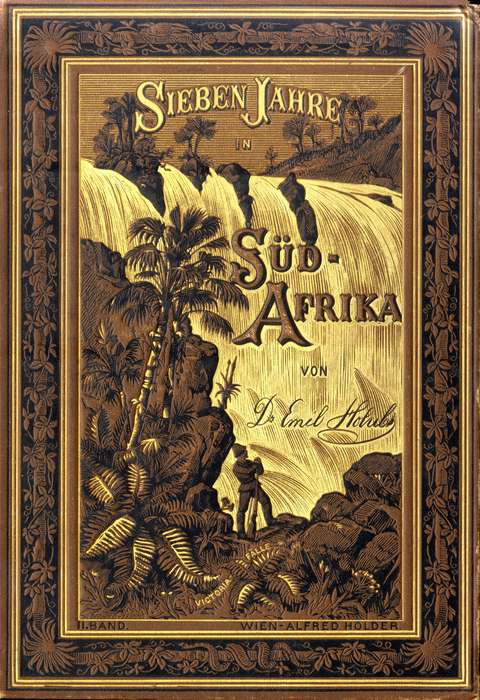
Title: Sieben Jahre in Süd-Afrika. Zweiter Band.
Author: Emil Holub
Release date: June 4, 2015 [eBook #49132]
Most recently updated: October 24, 2024
Language: German
Credits: Produced by Jens Sadowski and the Online Distributed
Proofreading Team at http://www.pgdp.net. This file was
produced from images generously made available by the
Bibliothèque nationale de France (BnF/Gallica) at
http://gallica.bnf.fr.
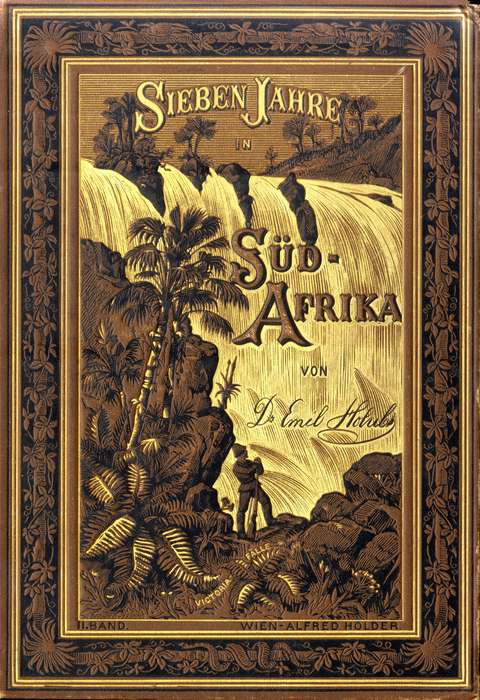
Sieben Jahre in Süd-Afrika
Zweiter Band.
Erlebnisse, Forschungen und Jagden
auf meinen Reisen von den Diamantenfeldern zum Zambesi (1872—1879)
Von
Dr. Emil Holub.
Mit 235 Original-Holzschnitten und vier Karten.
Zweiter Band.
Wien, 1881.
Alfred Hölder,
k. k. Hof- und Universitäts-Buchhändler,
Rothenthurerstraße 15.
Alle Rechte vorbehalten.
Druck von Friedrich Jasper in Wien.
I. Von den Diamantenfeldern an den Molapo.
Aufbruch von Dutoitspan. — Uebergang über den Vaal. — Korannagräber
im Hart-Riverthale. — Mamusa. — Wildgansjagd an Moffats
Salzsee. — Ein Nest des Königskranichs. — Ein Löwenabenteuer Taylor’s. — Molema’s
Town. — Barolongen-Hochzeit. — Beschwörungsmittel. — Eine
Gerichtssitzung. — Kalte Tage. — Das Malmanithal. — Weltevreeden-Farm
II. Von Jacobsdal nach Schoschong.
Jacobsdal. — Zeerust. — Ankunft in Linokana. — Schieferlager. — Ernteerträgnisse. — Die
Krokodile im Limpopo und seinen Nebenflüssen. — Erzlagerstätten
im Bushveldt. — Damara-Emigranten. — Die Löwenfurth
über den Marico. — Welsfang im Marico. — In Lebensgefahr. — Das
Buffadderthal. — Ankunft in Schoschong
III. Von Schoschong nach den großen Salzseen.
Geschichte der letzten Kämpfe zwischen Sekhomo und Khama. — Erosions-Erscheinungen
im Lualabette. — Die Maque-Ebene. — Frost. — Wilde
Strauße am Wagen. — Jagdverbot des Königs Khama. — Eland-Antilopen. — Die
ersten Palmen. — Wildpfade und Fall-Assagaie an den Nokane-Quellen. — Im
Gebiete der großen Salzseen. — Die Tsitani- und Karri-Karri-Pfanne. — Am
Tschaneng-Flusse. — Matabele am Wagen. — Die
Salzlager am Nataspruit. — Jagd auf Zulu-Hartebeeste. — Auf dem
Anstande auf Löwen. — Thierleben am Nataspruit
IV. Vom Nataspruit nach Tamasetse.
Die Salzlager im Nataspruit. — Ein Capitalschuß. — Von Löwen aufgeschreckt. — Das
sandige Lachenplateau. — Strauße am Wagen. — Nachtreise
bei Fackelschein. — Ein Löwenabenteuer. — Die Klamaklenjana-Quellen. — Vereitelte
Elephantenjagd. — Begegnung mit Elephantenjägern. — Die
Madenassana’s. — Gebräuche und Sitten derselben. — Der
Yoruha-Weiher und die Tamafopa-Quellen. — Nächtliches Thierleben im
Walde. — Eine verunglückte Löwenjagd. — Pit schläft auf dem Anstande
V. Von Tamasetse zum Tschobeflusse.
Henry’s Pan. — Leiden und Freuden der Elephantenjäger. — Eine Löwenjagd
des jungen Schmitt. — Makalaka’s. — Ein muthiges Weib. — Nächtlicher
Ueberfall durch einen Löwen. — Die südafrikanischen Löwenspecies. — Leben
und Gewohnheiten des Löwen. — Seine Angriffsmethoden. — Ankunft
in Panda ma Tenka. — Blockley. — Der Elfenbeinhandel
mit Sepopo. — Elandstiere. — Aerztliche Praxis an Henri’s Pan. — Thier-
und Pflanzenleben im Panda ma Tenka-Thale. — Bienenschwärme. — Westbeech’s
Handelsstation. — Saddler’s Pan. — Der Händler Y. — Im
Leschumo-Thale. — Gereizte Elephanten auf der Flucht durch den
Wald. — Am Ufer des Tschobe
VI. Im Tschobe- und Zambesithale.
Das Thal des Tschobe und seine Vegetation. — Signalisierung meiner
Ankunft. — Die ersten Boten aus dem Marutse-Reiche. — Landschaftsscenerie
an den Stromschnellen des Tschobe. — Begegnung mit Masupia’s. — Mein
Mulekau. — Geschichte der Matabele-Einfälle in das Reich Sekeletu’s. — Ein
Masupia-Grab. — Thierleben am Tschobe. — Makumba. — Begegnung
mit englischen Officieren in Impalera. — Die Hütten der
Masupia. — Der Schlangenhalsvogel. — Meine erste Bootfahrt auf dem
Zambesi. — Die Schilfrohrwälder an den Ufern des Zambesi und das
Thierleben in denselben. — Letschwe- und Puku-Antilopen. — Krokodile
und Flußpferde. — Ankunft in Alt-Schescheke. — Blockley’s Kraal
VII. Der erste Besuch im Marutse-Reiche.
Mein Empfang bei Sepopo. — Der Libeko. — Sepopo auf Schleichwegen. — Sepopo’s
Residenz. — Geschichte des Marutse-Mabunda-Reiches. — Die
Stämme des Reiches und ihre Wohnsitze. — Unterthanen-Verhältniß
derselben. — Die Sesuto-Sprache. — Portugiesische Händler am Hofe
Sepopo’s. — Sepopo ertheilt mir die Erlaubniß zur Bereisung seines
Landes und beschreibt mir den einzuschlagenden Weg. — Der Bau von
Neu-Schescheke. — Brand von Alt-Schescheke. — Culturstufe der Stämme
des Reiches. — Der Aberglaube und seine Opfer. — Thronfolge. — Machtbefugnisse
des Herrschers. — Das Bauwesen bei den Völkern des
Reiches. — Dreifache Bauart der Hütten. — Das Innere des königlichen
Gehöftes. — Der Kischitanz. — Sepopo’s Musikcapelle. — Die Musik-Instrumente
bei den Marutse-Mabunda. — Kriegstrommeln. — Die
Kischitänzer-Masken. — Rückfahrt nach Impalera. — Ankunft in Panda
ma Tenka. — Ein Löwenabenteuer
VIII. Ausflug zu den Victoriafällen.
Ankunft in Panda ma Tenka. — Neue Enttäuschungen. — Theunissen
verläßt mich. — Aufbruch nach den Fällen. — Jagd auf Orbecki-Gazellen. — Eine
Giraffenherde. — Die Süßwassertümpel in der Umgebung der
Victoriafälle. — Thier- und Pflanzenleben in denselben. — Ein schmerzenreicher
Gang. — Der erste Anblick der Fälle. — Unser Skerm. — Charakteristik
der Fälle. — Großartigkeit und Pracht derselben. — Höhe und
Breite der Fälle. — Die Inseln an der Fallkante. — Höhe der Dunstsäulen. — Die
Erscheinung der Fälle bei Sonnen-Auf- und Niedergang. — Die
Abflußrinne des Zambesi unterhalb der Fälle. — Felsenbildungen — Vegetation
und Thierleben an den Fällen. — Jagd auf Paviane. — Ein
interessantes Löwenabenteuer. — Die Manansa’s. — Schicksale und
Charakter derselben. — Ihre Sitten und Gebräuche. — Brautwerbung
und eheliches Leben bei denselben. — Todtenbestattung. — Rückkehr nach
Panda ma Tenka
IX. Zweiter Besuch im Marutse-Reiche.
Zweiter Aufbruch nach Impalera. — Die Krokodile im Zambesi und ihre
Gefährlichkeit. — Begräbnißfeier bei den Masupia’s. — Sepopo und seine
Frauen. — Reisepläne. — Baum- und Busch-Vegetation im Walde von
Schescheke. — Einzug einer Karawane von Tributpflichtigen. — Die
Marutse als Fischer. — Maschoku, der Scharfrichter Sepopo’s. — Schmiedewerkzeuge
der Marutse. — Der prophetische Tanz der Masupia’s. — Besuch
der Königinnen. — Der Fang des Krokodils. — Die Mankoë. — Die
Verwaltung des Marutse-Mabunda-Reiches. — Die Beamten-Hierarchie. — Eine
Elephantenjagd unter Sepopo’s Anführung. — Ausflüge in den
Wald von Schescheke und Büffeljagden in demselben. — Eine interessante
Löwenjagd. — Der Löwentanz der Marutse. — Die Maschukulumbe am
Hofe Sepopo’s. — Moquai, des Königs Tochter. — Hochzeitsfeier bei den
Marutse
X. Den Zambesi aufwärts.
Aufbruch von Schescheke. — Die Flottille der Königinnen. — Erstes
Nachtlager. — Marutse-Typen. — Mankoë. — Fruchtbarkeit des Zambesi-Thales. — Die
Stromschnellen am centralen Zambesi. — Die Mutschila-Aumsinga-Stromschnellen. — Schiffbruch
in denselben. — Sioma von
Löwen belagert. — Vom Fieber besinnungslos niedergeworfen. — Rückkehr
nach Schescheke
XI. Dritter Aufenthalt in Schescheke.
Condolenzbesuche des Königs und der Häuptlinge. — Eine neue Unthat
Sepopo’s. — Masarwa’s in Schescheke. — Ceremoniell bei den Mahlzeiten
an Sepopo’s Hof. — Mein erster Ausflug. — Der Fischfang im
Marutse-Reiche. — Sepopo erkrankt. — Wanderungen eines Arabers
durch Süd-Afrika. — Unterthanen-Verhältniß im Marutse-Reiche. — Charakterzüge
einzelner Stämme des Reiches. — Die Zukunft des Landes
XII. Die Culturstufe der Völker im Marutse-Reiche.
Religiöse Vorstellungen. — Lebensweise der Völker. — Ackerbau. — Erträgniß
desselben. — Preis der Feldfrüchte. — Consum. — Kleidung
der Männer und Frauen. — Die Stellung der Frau im Marutse-Reiche. — Erziehung
der Kinder. — Ehe. — Todtenbestattung. — Grabdenkmäler. — Das
Reisen im Lande. — Die Rechtspflege im Reiche. — Eine Hinrichtung. — Die
Doctoren Sepopo’s. — Aberglauben. — Zaubermittel. — Menschenopfer. — Industrie-Erzeugnisse
der Marutse. — Thongefäße. — Holzarbeiten. — Calebassen. — Flechtarbeiten. — Schneide-Werkzeuge. — Jagd-
und Kriegswaffen. — Textil-Industrie. — Canoebau. — Tabakspfeifen
und Schnupftabakdosen. — Toilette-Artikel. — Schmuckgegenstände
XIII. Aufenthalt im Leschumo-Thale.
Abfahrt von Schescheke. — Renitente Bootsleute. — Ein treffliches Schreckmittel. — Die
Fauna im Leschumo-Thale. — Diamond’s Jagdausflüge. —
Der Häuptling Moja. — Eine interessante Naturerscheinung. — Sepopo’s
Häscher. — Kapella’s Flucht aus Schescheke. — Schwere Gewitter. — Gährung
im Marutse-Reiche. — Sepopo’s Niedergang. — Aufbruch nach
Panda ma Tenka
XIV. Durch das Makalaka- und Westmatabele-Land.
Aufbruch nach Süden. — Vlakvarks. — Lager an den Klamaklenjana-Quellen. — Der
Händler Z. — Die Weiher von Tamasanka. — Die
Sibanani-Lichtung. — Reiches Thierleben. — Die Mambaschlange. — Ein
böses Gewissen. — Menon, der Chef der westlichen Makalaka. — Ein
Spion. — Menon hält über Z. Gericht. — Langfingrigkeit und Unreinlichkeit
der Makalaka. — Morulabäume. — Z. in Lebensgefahr. — Die
Ruinen von Rocky-Schascha. — Pittoreske Landschaftsscenerie am Rhamakoban-Flusse. — Tati. — Goldgräber. — Die
Familie Lotriet. — Matabele-Vorposten. — Geschichte
des Matabele-Reiches. — Africa als Löwenjäger. — La
Bengula’s Schwester. — Der Leopard im Schlafzimmer
Pit Jacobs
XV. Rückreise nach den Diamantenfeldern.
Ankunft in Schoschong. — Khama läßt Z. verfolgen und verurtheilt ihn. — Aufregende
Nachrichten aus der Colonie. — Aufbruch nach Süden. — Mochuri. — Der
Krieg der Bakhatla’s gegen die Bakwena. — Ich erstehe
zwei junge Löwen. — Ein Löwen-Abenteuer Van Viljoens. — Eberwald
besucht mich. — Jouberts See. — Houmans Vley. — Ankunft in Kimberley
XVI. Mein letzter Aufenthalt in den Diamantenfeldern.
Wiederaufnahme der ärztlichen Praxis. — Mein neues Heim und kleiner
Thiergarten in Bultfontein. — Ausstellung meiner Sammlungen im Varietiestheater
zu Kimberley. — Ausflug nach der Farm Wessels. — Die Gravirungen
der Buschmänner. — Hyänen- und Erdferkeljagden. — Meine
Broschüre über die Eingebornenfrage. — Irrige Auffassung derselben in
England. — Ernste Zeiten für die Colonie und Griqualand-West. — Mayor
Lanyon und Colonel Warren. — Aufbruch nach der Küste
XVII. Durch die Colonie zur Küste.
Abreise von Bultfontein. — Straußenzucht auf der Farm Ottersport. — Straußenzucht
im Allgemeinen. — Meine erste Vorlesung in Colesberg. — Cradock. — Ein
Unfall bei diesem Orte. — Der Zulu-Krieg. — Die Ursachen
der Mißerfolge in der Behandlung der südafrikanischen Eingebornen. — Meine
Artikel über den Zulu-Krieg. — Kampfweise der Zulu. — Grahamstown. — Reiche
paläontologische Funde. — Ankunft in Port
Elizabeth. — Eine Löwenjagd. — Ausflüge in die Umgebung. — Meine
marinen Sammlungen. — Meine Sammlungen in Gefahr. — Die letzten
Tage auf afrikanischem Boden. — Heimfahrt nach Europa, Projecte für
die Zukunft
| 1) | Die Roiwater-siekte |
| 2) | Chirurgische Erfahrungen |
| 3 u. 4) | Meine Behandlung des Fiebers |
| 5) | Zwei Züge von Kindesliebe bei den Eingebornen |
| 6) | Eine Löwenjagd Cowley’s |
| 7) | Originaltext einer Stelle aus meiner Broschüre: A few words on the Native Question |
| 8) | Die Dürre-Perioden in der Cap-Colonie |
| 9) | Die Straußenzucht in Süd-Afrika |
| 10) | Originaltext eines meiner Artikel über die Zulu’s |
| 11) | Die Maschona |
| 12) | Zweck und Ziel meiner nächsten Forschungsreise |
| Specialkarte | (Nr. 1) | des von Dr. Holub bereisten centralen Theiles von Ost-Bamangwato und West-Matabele. |
| " | (Nr. 2) | Die Victoriafälle des Zambesi. |
| " | (Nr. 3) | Dr. Holubs Bootfahrten im centralen Laufe des Zambesi von der Malumba-Bucht bis zum Nambwe-Katarakt (Süd-Barotse). |
| 1. | Titelbild zur dritten Reise in das Innere von Süd-Afrika |
| 2. | Batlapinen auf der Bläßbockjagd |
| 3. | Weiher bei Coetze’s Farm |
| 4. | Gräber unter den Kameeldornbäumen bei Mamusa |
| 5. | Wildgansschießen an Moffats Salzsee |
| 6. | Tauschhandel bei Konana |
| 7. | Rauchender Betschuana |
| 8. | Felsenpartie bei Molema’s Town |
| 9. | Pavianfelsen |
| 10. | Bootfontein |
| 11. | Newport-Farm |
| 12. | Welsfang im Marico |
| 13. | Im Sumpfe am Matebe-Flüßchen |
| 14. | An der Löwenfurth im Marico |
| 15. | Krokodile im Limpopo |
| 16. | Kampfesscene auf den Bamangwato-Höhen |
| 17. | Das Lualabett |
| 18. | Straußenheerde am Wagen |
| 19. | Jagd auf Eland-Antilopen durch Masarwa’s |
| 20. | Verfolgende Matabele |
| 21. | Jagd auf Zulu-Hartebeeste |
| 22. | Die Soa-Salzpfanne |
| 23. | Im Baume |
| 24. | Nachtreise bei Fackelschein |
| 25. | Von Löwen aufgescheucht |
| 26. | Pit, schläfst Du? |
| 27. | Heimkehrende Elephantenjäger |
| 28. | Ein muthiges Weib |
| 29. | Unterricht im Elephantenjagen |
| 30. | Nächtlicher Ueberfall durch einen Löwen |
| 31. | Elephantenheerde auf der Flucht |
| 32. | Bootfahrt im Zambesi |
| 33. | Impalera |
| 34. | Grab eines Masupia-Häuptlings |
| 35. | Am Tschobe-Ufer |
| 36. | Wildebene bei Blockley’s Kraal |
| 37. | Nilpferdjagd |
| 38. | Im Papyrusdickicht |
| 39. | Empfang bei Sepopo |
| 40. | Hafen von Schescheke |
| 41. | Uebersiedlung nach Neu-Schescheke |
| 42. | Musik-Instrumente der Marutse |
| 43. | Kischitanz |
| 44. | Kischitänzer-Maske |
| 45. | Am Ufer des Zambesi |
| 46. | Jagd auf Bushvaarks |
| 47. | Zusammentreffen mit Giraffen |
| 48. | Leben und Weben am Grunde der Süßwassertümpel |
| 49. | Die Victoriafälle |
| 50. | Der Löwe kommt |
| 51. | Jagd auf Sporngänse |
| 52. | König Sepopo |
| 53. | Kaïka, König Sepopo’s Tochter |
| 54. | Der prophetische Tanz der Masupia |
| 55. | Besuch der Königinnen |
| 56. | Meine Hütten in Neu- und Alt-Schescheke |
| 57. | Krokodilangel |
| 58. | Jagd auf Wasser-Antilopen |
| 59. | Büffeljagd |
| 60. | Löwenjagd bei Schescheke |
| 61. | Maschukulumbe an Sepopo’s Hofe |
| 62. | Sepopo’s Arzt |
| 63. | Mabunda. Makololo |
| 64. | Mankoë |
| 65. | Marutse-Typen |
| 66. | In den Manekango-Stromschnellen |
| 67. | Mambari. Matonga |
| 68. | Zambesi aufwärts |
| 69. | Verlust meines Bootes |
| 70. | Sioma von Löwen angegriffen |
| 71. | Fischotterjagd am Tschobeflusse |
| 72. | Masupia. Panda |
| 73. | Das Speeren der Fische |
| 74. | Gang durch Schescheke |
| 75. | Ertränken arbeitsunfähiger Personen |
| 76. | Sepopo’s Capellmeister |
| 77. | Korb aus Bast und Kalebassen-Korngefäße bei den Mabunda |
| 78. | Schöpflöffel und Kalebassen-Korngefäße bei den Mabunda |
| 79. | Ein Marutse-Elephantenjäger |
| 80. | Kalebassen für Honigbier und Korn bei den Marutse und Mabunda |
| 81. | Tabaks- und Dachapfeifen der Marutse und Mabunda |
| 82. | Dachapfeifen der Mabunda, Marutse und Masupia |
| 83. | Scene am Zambesiufer in Schescheke |
| 84. | Lager im Leschumo-Thale |
| 85. | Wana Wena, der neue König der Marutse |
| 86. | Ruinen von Rocky-Schascha |
| 87. | Ruinen von Tati |
| 88. | Begegnung mit einem Löwen am Tatiflusse |
| 89. | Der Leopard im Hause Pit Jacobs |
| 90. | Rückreise nach den Diamantenfeldern |
| 91. | Koranna-Gehöfte bei Mamusa |
| 92. | Platberg bei Rietfontein |
| 93. | Fingoknabe |
| 94. | Mein Haus in Bultfontein |
| 95. | Felsen-Gravirungen der Buschmänner |
| 96. | Grabstichel der Buschmänner |
| 97. | Jagd auf Erdferkel |
| 98. | Colonel Warren |
| 99. | Bella |
| 100. | Jacobsdaal im Jahre 1872 |
| 101. | Unfall bei Cradock |
| 102. | Kampfweise der Zulu |
| 103. | Masarwadorf |
| 104. | Fingodorf bei Port Elizabeth |
| 105. | Mainstreet in Port Elizabeth |
| 106. | Schlußvignette |
[Anmerkung zur Transkription: Die Errata wurden im nachfolgenden Text korrigiert.]
| Seite | 3 | Zeile | 6 | von | oben | lies: | Weltevreeden statt Weltufrede. |
| " | 27 | " | 17 | " | " | " | " |
| " | 111 | " | 1 | " | unten | " | 98 statt 28 Fuß. |
| " | 127 | " | 1 | " | oben | " | Manansa statt Masarwa. |
| " | 141 | (Illustrations-Unterschrift) lies: Grab eines Masupia-Häuptlings statt Masupia-Grab. | |||||
| " | 202 | Zeile | 3 | von | oben | lies: | Brauneisenstein statt Braunstein. |
| " | 249 | (Illustrations-Unterschrift) lies: Kaïka statt Moquai. | |||||
| " | 253 | Zeile | 6 | von | oben | lies: | Merops Nubicus statt Herops Nubicus. |
| " | 299 | " | 16 | " | " | " | Thari- statt Luchs-. |
| " | 341 | " | 15 | " | unten | " | nach dem Worte Matschuku: Tabak einzuschalten. |
| " | 395 | " | 17 | " | oben | " | Anthiae thoracicae statt Carabi venatores. |

Aufbruch von Dutoitspan. — Uebergang über den Vaal. — Korannagräber im Hart-Riverthale. — Mamusa. — Wildgansjagd am Moffat’s Salzsee. — Ein Nest des Königskranichs. — Ein Löwenabenteuer Taylor’s. — Molema’s Town. — Barolongen-Hochzeit. — Beschwörungsmittel. — Eine Gerichtssitzung. — Kalte Tage. — Das Malmanithal. — Weltevreeden-Farm.

Batlapinen auf der Bläßbockjagd.
Nach fast dreijährigem Aufenthalte auf dem heißen Boden des schwarzen Erdtheils, der Ruhmes- aber auch schweren Leidensstätte so vieler von froher Begeisterung für ihren Beruf erfüllter Männer, stand ich nun an der Schwelle meiner eigentlichen Aufgabe. Die verschiedensten Gefühle durchwogten meine Seele, konnte und durfte ich hoffen, das ferne Ziel zu erreichen, um dessentwillen ich die Heimat und meine Lieben verlassen hatte, war ich den Schwierigkeiten der geplanten Reise auch gewachsen? — Die gesammelten Erfahrungen auf meinen zwei vorhergegangenen Uebungs- und Recognoscirungs-Touren schienen mir diese Frage zu bejahen, ich hatte die verschiedenen Tücken und Gefahren der afrikanischen Natur, die zahllosen widrigen und störenden Zufälligkeiten im Verkehre mit den Eingebornen, ihre Behandlungsweise, die Tragweite und den Werth treuer und verläßlicher Begleiter und Diener kennen gelernt, und nach diesen Erfahrungen mich nach besten Kräften auf diese, meine dritte Reise, welche eine Forschungsreise im eigentlichen Sinne werden sollte, vorbereitet; — doch wo und wann ließ sich in Afrika der Erfolg selbst der ausdauerndsten und energischesten Bestrebungen beschränkter Menschenkraft mit Zuversicht vorherbestimmen!
Aus dem Widerstreite aller dieser Gedanken und Gefühle tauchte zuletzt das Bild des atlantischen Oceans bei Loanda auf und belebte meinen Muth, stärkte mein Vertrauen; in so manchen schwierigen Fällen war mir das Glück als treuer Bundesgenosse beigestanden, vielleicht lächelte es mir auch diesmal und half mir das Unberechenbare, an dem Forschungsreisen in Afrika so reich sind, überwinden.
* *
*
Am 2. März 1875 verließ ich Dutoitspan und begab mich vorerst zu einem Freunde nach Bultfontein, um hier bis zum 6. zu verweilen und den Rest meiner Geschäfte zu besorgen. Im Plane meiner eben anzutretenden Reise lag es, Süd-Central-Afrika zu erforschen und da ich deshalb kaum nach der Capcolonie zurückzukehren glaubte, hatte ich diesmal bei meinem Scheiden aus den Diamantenfeldern mehr und wichtigeres zu besorgen, als dies bei den zwei vorhergegangenen Versuchsreisen der Fall war.
Von Bultfontein am 6. aufbrechend legte ich etwa 11 Meilen zurück und hielt bei einer von einer sandigen, schon von den Diamantenfeldern aus sichtbaren Bodenerhebung umschlossenen Regenlache die erste Rast. Wir schliefen in dem tiefsandigen, auf einige Meilen hin den nach dem Transvaal-Gebiete führenden Weg begleitenden Mimosengehölze, dessen Durchzug jedem Gefährte so widerlich wird.
Am 7. passirte ich die beiden Farmen Rietfley und Keyle. Die erstere liegt auf einem stark salzhaltigen Grunde und unmittelbar vor dem auf einem nackten Felsenabhange liegenden unschönen Farmgebäude breitet sich einer der bekannten Salzseen aus. Zwischen dieser Farm und Keyle steht eine Lehmbaracke — eines der vielen Uebel jener Gegenden, eine Cantine. Der nächste Tagemarsch brachte uns an den Farmen Rietfontein und Pan-Place vorüber und wir schlugen unser Nachtlager auf Coetze’s Besitz auf. Auf den Grasebenen der ersten Farmen tummelten sich Springbockheerden, und als wir uns der zweiten, am Fuße des für Griqualand-West bedeutungsvollen und weithin sichtbaren Platberges gelegenen Farm näherten, erbeutete ich einiges Federwild, darunter ein Rebhuhn. Wir begegneten mehreren Haufen nothdürftig bekleideter Transvaal-Betschuana’s, die je von einem Weißen (Diamantengräber) angeführt, von diesem in ihrem Lande zum Diamantengraben geworben worden waren. Der mir interessanteste Punkt der bisherigen Reise war ein Sumpf an Coetze’s Farm. Ein rings von Schilf umsäumter, buchtenreicher und von kleinen Inseln bedeckter Weiher, der ein zahlreiches Wassergeflügel beherbergte, namentlich Wildenten, Bläßhühner und Taucher.
Als ich am Abend Mynheer Coetze besuchte und auf die vogelreichen Weiher zu sprechen kam, überraschte er mich mit der Antwort: »Ja, die Vögel brüten auch da und wir stören sie nicht, noch gestatten wir, daß dies Fremde thun, wir haben an den Thieren unsere Freude!« Mich erfreute diese Antwort sehr und ich hatte auch später Gelegenheit, öfters unter holländischen Farmern ähnlichen Gesinnungen zu begegnen.
Auf dem theilweise bewaldeten Gebiete dieses Farmers, das sich über Theile von Griqualand-West und des Oranje-Freistaates ausbreitet, findet sich unter anderem Hochwilde auch noch eine zahlreiche Heerde der gestreiften Gnu’s vor.
Zwei Tage später bewerkstelligten wir die recht mühselige Ueberfahrt über den Vaal bei Blignaut’s Pont. Einige Vogelbälge sowie zahlreiche Blattkäfer (Platycorynus) Arten wurden meine Beute an beiden Vaalufern. An der Ueberfuhr befand sich am diesseitigen Ufer ein Complex von windschiefen, allseitig gestützten Lehmhäuschen — ein Hotel darstellend — und am jenseitigen hie und da zerstreute Korannahütten, deren Bewohner Fährmannsdienste zu versehen hatten. Für die Ueberfahrt hatten wir an ihren Brodherrn 25 Shillinge zu bezahlen.
Nach einer in dem vom Regen stark aufgeweichten Boden beschwerlichen Fahrt gelangten wir am 10. in das dem Leser schon von früher her bekannte Transvaalstädtchen Christiana und zu der schon erwähnten Hallwaterfarm (fälschlich Monopotapa genannt), und erstanden von den hier weilenden Koranna’s (von Mamusa) unseren Bedarf an Kochsalz.
Am 12. schlug ich eine nördliche Richtung ein und passirte Strengfontein, Mynheer Webers Farm.[1] Auf der Weiterfahrt betrat ich ein schön begrastes Buschland, auf dessen Fläche ich mehrere Farmen gewahrte, und das von den Koranna’s, von Gassibone, von Mankuruana, sowie auch von der Transvaal-Regierung gleichzeitig beansprucht, factisch keinen Landesherrn besaß. Die Gehölze beherbergten Deuker, Hartebeest-Antilopen, gestreifte und schwarze Gnu’s, die Grasflächen Springbock- und Steenbock-Gazellen, Trappen und eine zahlreiche Vogelwelt kleinerer Art.
Wir zogen an einer kurz zuvor von den an den nahen Höhen umwohnenden Eingebornen eingeäscherte Farm (Drie- und Vierfontein genannt) vorbei und lagerten auf der etwas weiter ab liegenden Houmansvley. An der erstgenannten standen in der Nähe des Farmgebäudes einige Korannahütten, deren weibliche Insassen in ihrem Betragen im schroffsten Gegensatze zu zwei Batlapinenmädchen, die sich scheu zurückzogen, sich sehr zudringlich geberdeten. Nahe an Houmansvley liegt ein sumpfiger Weiher (Vley), in dem ich einige Wildenten, den grauen Reiher und langbeohrte Sumpfeulen (Otus Capensis) fand. Mit Houmansvley verließen wir die letzte der Farmen und betraten das Gebiet der Koranna’s von Mamusa.
Am Abend des 15. langten wir im Hart-Riverthale an. Bei der Abfahrt zum Flusse fuhren wir über einen hochbegrasten, von hundertjährigen Kameeldornbäumen bestandenen Abhang, in deren Schatten wir mehrere zum Theil noch erhaltene Batlapinen- und Korannagräber trafen. Das Ueberschreiten des Flusses wurde uns an diesem Tage durch die starke Strömung des oft vollkommen trockenen, gegenwärtig aber durch den letzten Regen bedeutend angeschwollenen Flusses unmöglich, auch war der Abhang eine zu anziehende Partie, als daß wir ihn so bald verlassen hätten können. Die zungenförmig von dem im Hintergrunde bewaldeten Hochplateau in das Hart-Riverthal hereinragende und steile Mamusahöhe lag uns — etwas zur Rechten, am rechten Hart-River, etwa 1200 Schritte entfernt — gegenüber.
Wir besuchten Mamusa und lagerten an dem kleinen Flüßchen »Prag«, unweit der unter dem östlichen Felsenabhange der Höhe erbauten Handelsstation. Mamusa, das noch vor wenigen Jahren einer der meist bevölkertsten Orte des Hottentotten-Elementes in Süd-Afrika bildete, war zur Zeit meines Besuches bis auf einige Sprößlinge des ergrauten Königs Maschou und ihrer Diener verlassen. Die Bewohner waren theils mit ihren Heerden auf die Weide gezogen, theils hatten sie die Stadt verlassen, um sich an den Nebenflüßchen der Mokara und des Konana, auf den nach Norden gegen den Molapo sich erstreckenden Wildebenen anzusiedeln. Dies kleine selbstständige Fürstenthum der Koranna’s von Mamusa ist eine Enclave in den südlichen Betschuana-Gebieten, doch sein Bestand für die Nachbarn nicht besonders segenbringend, da der häufige Contact zwischen dem Hottentotten- und dem Banthu-Elemente stets nur die Decadenz der Stämme der letzteren Familie zur Folge hatte.
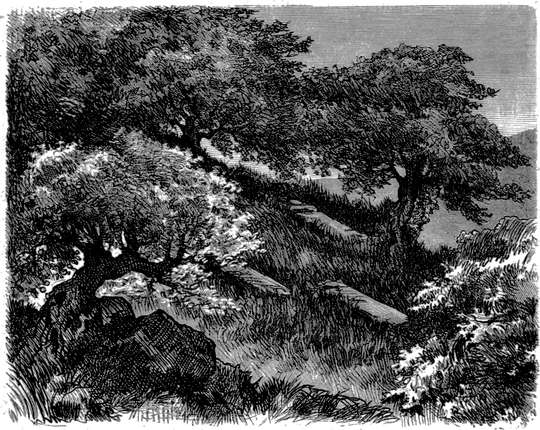
Gräber unter den Kameeldornbäumen bei Mamusa.
Bei dem Händler fand ich gefälliges Entgegenkommen. Herr Mergusson war ein Thierfreund und beschäftigte sich mit der Zähmung seines zahlreichen Wildgeflügels. Er zeigte mir mehrere meterhohe Stöße von Antilopen-, Gnu- und Zebrafellen, die er nach Bloemhof zum Verkaufe zu bringen gedachte. Er und sein Bruder hatten schon zweimal ihre Tauschhandelsreisen bis zum N’Gami-See ausgedehnt. Während meines Aufenthaltes im Weichbilde der Stadt hörte ich auch von jenen diebischen, auf meiner zweiten Reise in Musemanjana gemietheten Dienern.
Am 17. verließ ich Mamusa und langte Abends in dem südlichen Theile der grasreichen Quaggaebenen an, nachdem wir das bebuschte, hie und da durch Korannagehöfte belebte Hochland erstiegen hatten. Durch den Regen aufgeweicht, war die Wildebene theilweise in einen förmlichen Sumpfboden umgewandelt. An den wenigen trockeneren Partien wurden weißliche Pünktchen wahrnehmbar, die sich in der Nähe als Springbock-Gazellen entpuppten. Die schönen melodischen Töne der gekrönten Kraniche grüßten den Wanderer von allen Seiten und sie selbst — minder scheu als anderwärts — gestatteten ihm sogar die Pracht ihres Gewandes aus ziemlicher Nähe beobachten zu können. Das Gegacker der bespornten und der egyptischen Gänse lockte bald dahin, bald dorthin, während zahlreiche größere Ketten oder einzelne Pärchen von Wildenten über uns hin- und herschwärmten.
Die Fahrt der nächsten Tage bot uns vielfach Gelegenheit, unserer Jagdlust zu genügen und lohnte unsere Mühe durch ergiebige Beute, unter welcher sich ein Silberreiher, Regenpfeifer und Schnepfen befanden. An einem weiten, mit salzigem Wasser gefüllten See ließ ich unser Lager aufschlagen und beschloß hier einige Tage zu verweilen, da das reiche Thierleben für unseren Tisch, als auch für meine Sammlungen manch’ werthvolle Acquisition versprach. Schon mit frühester Stunde des nächsten Morgens brach ich in Begleitung Th.’s zur Jagd auf.
Da es in der Nacht geregnet hatte, war der Morgen recht kühl und vergnügt begrüßte ich die ersten Vorboten des Himmelgestirns, die sich vor mir in das Thal des Salzsee’s ergossen und sich in den Fluthen tausendfach widerspiegelten. Am jenseitigen Ufer entdeckten wir einen stattlichen Haufen des wunderlichsten der Stelzenvögel, des dunkelcarminrothen, braunschnäbligen Flamingo und nahebei graste eine Schaar von schwarzen Gänsen. Nach uns zu watete laut schreiend eine Doppelreihe der grauen Kraniche, während von einigen aus dem Gewässer hervorragenden Felsenblöcken aus, Fischreiher Rundschau hielten. Dazu schallte das schön klingende, langgezogene Mahem-Geschrei vom See herüber und zwischen den Gruppen der genannten größeren Vögel watschelte und schwamm eine Unzahl kleinerer Wasservögel, Enten und Bläßhühner. Ein Pfiff meines Gefährten riß mich aus diesen Betrachtungen und hieß mich auf der Hut sein; rasch einen Blick auf den See werfend sehe ich, wie sich eben eine Schaar Wildgänse aus dem Gewässer erhob. Schweren Schlages, doch ziemlich rasch, kommt es von Süden an mich herangebraust, denn mächtig verstehen es die dunkelbraunen Gänse, die Luft mit ihren bespornten Fittigen zu schlagen. Ein Doppelschuß bringt zwei der Thiere in die Binsen herab. Rasch wendet sich der Rest nach links, Th. zu und laut klagend eilt er nach den Grasebenen im Westen. Mit den beiden Schüssen war neues Leben unter die auf dem See ein Asyl suchenden, befiederten Schaaren gekommen. Die grauen Kraniche an unserem, die gekrönten am jenseitigen Ufer erhoben sich rasch aus der seichten (kaum zwei Fuß tiefen) Fluth; die Flamingo’s liefen hin und her, nur zeitweilig flog einer auf, um sich wiederum rasch niederzulassen — bis sie durch mein Erscheinen aufgeschreckt, laut schreiend aufflogen und kaum rabengroß scheinend, lange Zeit hindurch über dem See kreisten. Ihre Nachbarn, die schwarzen, grasenden Gänse suchten Schutz in den Fluthen, während sich Schaaren kleinerer Wasservögel aus den Binsendickichten des Ufers nach der Mitte des See’s flüchteten. Als wir einige Stunden später beim Frühstück saßen, bemerkten wir mit Staunen, daß sich am jenseitigen Ufer im Sattel zweier Höhen eine mindestens 250 Stück zählende Bläßbockheerde eingefunden, bei deren Anblick wir unser Mahl — leider vergeblich — im Stiche ließen. Als Ersatz gelang es mir, einen schönen grauen Kranich zu erbeuten. Auch Pit schoß an diesem Tage mehrmals Vögel an der Pfanne und überraschte mich Nachmittags mit der Nachricht, daß er an einer kleinen dichtbeschilften Lache ein Nest der Königskraniche gefunden habe.
Etwa 2000 Schritte nördlich von unserer Lagerstätte, hoch am Ufer des Moffat’schen See’s fand ich im Sumpfe eine kahle Stelle und in ihrer Mitte eine künstliche aus Binsen errichtete, 2½ Quadratmeter umfassende Insel, in deren Mitte sich eine Vertiefung — das Nest mit zwei faustgroßen, weißen, länglichen Eiern befand. Die eigentliche Nesthöhle hatte 30 Zoll Durchmesser und war etwa sechs Zoll tief.
An einem der nachmittägigen Ausflüge, als ich in einer Schlucht an dem Höhensattel lag — beobachtete ich einen schon auf der zweiten Reise wahrgenommenen Umstand, daß bei dem Aufsuchen der Tränke die Springbock-Gazellen die Pionniere bilden und die Bläßböcke und Gnu’s erst dann folgen, nachdem die ersteren die Annäherung gefahrlos gefunden haben.
Wir verließen am 23. das von mir Moffat’s Salzsee benannte Gewässer, dessen Ufer vorzügliche Schlupfwinkel des Canis mesomelas sind und zogen an einigen tiefen Weihern vorüber, in denen es von Bläßhühnern und Tauchern wimmelte. Auf einer naheliegenden bebuschten Höhe trafen wir Makalahari’s, welche damit beschäftigt waren, das Fleisch eines erlegten Bläßbockes in schmale Streifen zu schneiden; auch stießen wir auf eine Reihe von Fanggruben. Sie waren 1—1½ Meter breit und 8—15 Meter lang und gegenwärtig zum größten Theile ihrer ursprünglichen Tiefe mit Sand ausgefüllt. Abends passirten wir ein Gehölz, in welchem eine Batlapinen-Jagdgesellschaft (Mankurnana’s Leute) lagerte und uns bald im bittenden, bald im befehlenden Tone um Branntwein bestürmte. Am 25. wurden die Gebüsche dichter und das Wild, das am 24. an Zahl abgenommen, wieder häufiger. Eine etwa 400 Stück zählende Springbockheerde weidete vor uns, quer über den einspurigen, vom Grase überwucherten Weg, stob jedoch bei unserer Annäherung auseinander, Th. gelang es indeß, eine ausgewachsene Gais zu erlegen. Wir kamen nun in ein dichtes Buschfeld und das Land zeigte einen merklichen Abfall nach Nordwest, wir waren im Gebiete des Maretsane-Flüßchens angelangt. Wir passirten mehrere Regenschluchten und seichte, ziemlich breite Thäler mit üppiger Buschvegetation, von welchen ich eines Hartebeest-Thal nannte. Nachmittags langten wir im tiefen Thale des Maretsane-Flusses an; an dem rechten Abhange war ein Barolongen-Makalahari-Dorf erbaut, dessen Bewohner die Heerden von Molema’s Town hüteten. Das Thal selbst war stellenweise dicht bebuscht und schien mir reich an kleinen Wildgattungen, während die zwei bis acht Fuß tiefen Tümpel im Bette des Flusses, der hier mehr den Charakter eines Spruit besitzt, Fische des Orange-Rivers, Leguane, Krabben und zwei Entenarten beherbergten.
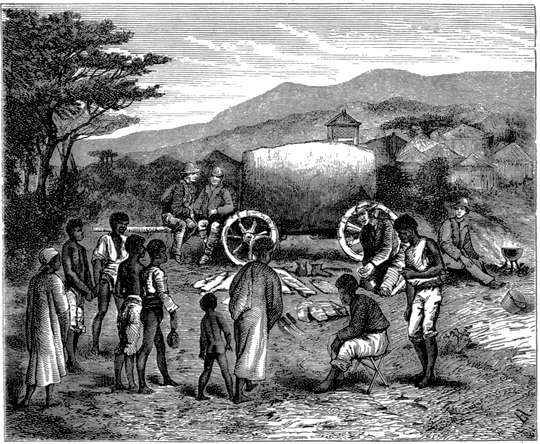
Tauschhandel bei Konana.
Bei der Schilderung meiner zweiten Reise in dieser Gegend erwähnte ich der sich im Unterlaufe der Flüßchen Konana, Maretsane und Setlagole aufhaltenden Löwen. Gegenwärtig kommen sie in nur sehr dürren Wintern, in denen das Wild die wasserarmen Partien des Kalahari-Buschlandes verläßt, nach den oberen Thalpartien dieser Spruits. Um so häufiger waren sie vor einigen Jahren, als hier das Wild noch in großen Rudeln weidete und auf den Quaggaflats Straußenheerden ebenso häufig waren, als es heutzutage die Gnu’s sind.
Ein Jäger Namens Wilhelm Taylor, den ich einige Tage nachdem ich Molema’s Town verlassen zum erstenmale und später noch zweimal an den Salzseen und den Klama-Klenjana-Quellen im nördlichen Theile des Bamangwatolandes traf, erzählte mir folgendes interessante, ihm zugestoßene Abenteuer.
»Im Jahre 1863 gab es noch so viele des werthvollsten der Riesenvögel an den obgenannten Flüßchen, daß häufig Partien von bis zu 20 Jägern die genannten Gegenden zwischen dem Hart-River und Molapo aufsuchten. Taylor jagte in jenem Jahre immer in Gesellschaft eines Holländers, der gegenwärtig am Malmanispruit residirt. Die Jäger kamen von Osten her und hielten an den Quellen des Maretsane Rast, vor Allem, um das Fleisch eines erlegten Zebra’s zu zerschneiden und zu trocknen. Obgleich sie an den beiden letzten Tagen keinen Löwen erblickten, trafen sie doch die nöthigen Vorsichtsmaßregeln, um sich gegen die Raubthiere zu schützen. Sie errichteten um den Wagen aus dürren Aesten eine leichte Umzäunung und banden die Zugthiere an die Räder des Wagens an. Das gewohnte Pfeifchen schmauchend, hatten sich Taylor und sein Genosse Abends unter den Wagen gelegt, während der Hottentotten-Diener am Bocke saß und Wache hielt. Die Unruhe, das starke Umherspähen desselben, fiel jedoch Taylor auf und zwang ihn, denselben über die Ursache seiner Unruhe zu fragen. Der Diener machte hierauf seinen Herrn auf einen Gegenstand aufmerksam, der wenige Schritte vor dem Zugtaue seit längerer Zeit herumschlich und den er für eine Hyäne hielt. Taylor beruhigte indeß den Diener, nachdem er scharf ausgelugt und meinte, es wäre nur ein vom Winde bewegter Busch. Kaum zu seinem Ruheplätzchen unter dem Wagen zurückgekehrt, hörte er schon den Ruf des Dieners: »Herr, es ist kein Busch, nein Herr, Du irrst Dich.« Taylor stand zum zweiten Male auf, betrachtete den Gegenstand, der sich nun genähert, etwas genauer und erkannte einen — Löwen, der wahrscheinlich durch das aufgehangene Zebrafleisch angelockt, den Wagen und dessen Insassen einer genauen Musterung zu unterziehen schien. Taylor ersuchte den Diener ihm aus dem Wagen sein Gewehr zu reichen, doch schon bei der ersten Bewegung, die der Bursche machte, stand der Löwe auf und kam direct an den Wagen heran, um sich etwa neun Schritte vor dem Feuer zwischen zwei Büschen niederzukauern. In demselben Momente aber als Taylor etwas zur Seite trat, um dem blendenden Feuerscheine auszuweichen, riß sein unvorsichtiger Gefährte dem Hottentotten das Gewehr aus der Hand, legte auf den Löwen an, schoß und fehlte. Sofort erhob sich das Raubthier und kam während die Weißen retirirten, rasch auf das Feuer los. Schon wähnten ihn die Jäger mit einem Satze innerhalb der Umzäunung zu sehen, als sich der an demselben Tage durch einen Schuß verwundete Hund, der unter dem Wagen lag, erhob und sich, seitlich über das Feuer springend, dem Löwen entgegenwarf. Der Löwe sprang erschrocken zurück und verschwand im Dunkeln, aber nur, um nach einigen Stunden in Begleitung mehrerer seiner Familie zurückzukehren und die Jäger förmlich zu belagern. Um nicht durch das Tödten oder Verwunden des einen die Uebrigen zum unmittelbaren Angriffe zu reizen, beschränkte sich Taylor darauf, die Thiere scharf zu beobachten und das Feuer in gleicher Mächtigkeit zu unterhalten. Gegen Morgen zogen die Löwen ab und die Jäger fanden das Gras förmlich niedergestampft. »You could’nt go so far as two yards without not to tap in to a lions-track,« meinte Taylor.
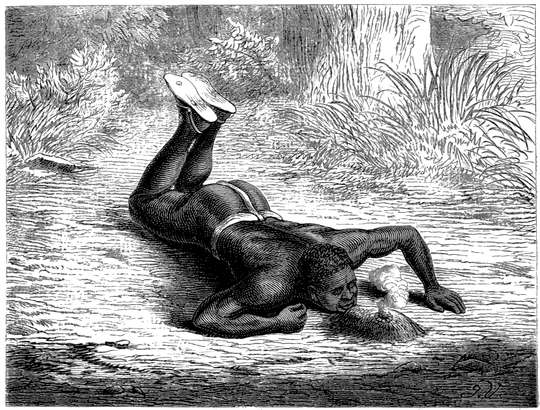
Rauchender Betschuana.
Am folgenden Tage begegneten wir, durch einen Mimosenwald ziehend, zweien Barolongen, welche mich auf die Nähe von Molema’s Town aufmerksam machten und mir mittheilten, daß König Montsua daselbst zu Besuch weile und in einem Vergiftungsprocesse den Vorsitz führe. Meinem ursprünglich gefaßten Plane entgegen, entschloß ich mich darauf wieder Molema’s Town zu besuchen und den König wie seinen Bruder Molema zu begrüßen.
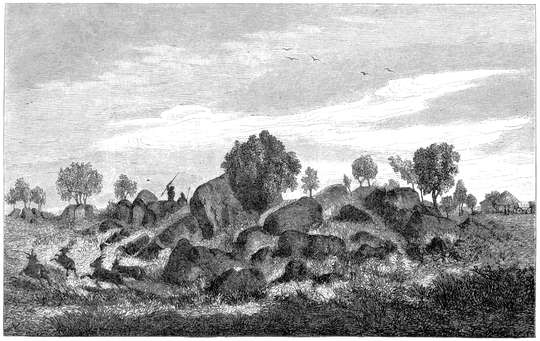
Felsenpartie bei Molema’s Town.
Am 28. März langte ich, das Thal des Lothlakane-Flüßchens, in dem König Montsua eine neue Residenz gründen wollte, hinabfahrend, in Molema’s Town an. Der Molapo floß etwas reichlicher als zur Zeit meines ersten Besuches: bald nachdem ich seine steinige Furth passirt, schlug ich auf derselben Stelle wie im Jahre 1873 das Lager auf. Mein erster Besuch galt Herrn Webb, dessen Wohnung nur noch baufälliger geworden, kaum mehr bewohnbar war. Mein Freund theilte mir mit, daß der König mit dem Unterhäuptling die Verhandlungen in dem erwähnten Vergiftungsprocesse leite.
Am 29. begab ich mich nach beendeter Gerichtssitzung zu Molema, um die Vornehmsten des Barolongen-Landes zu begrüßen. Ich traf den König sowie Molema und die anwesenden Häuptlinge auf der Erde, oder auf kleinen Holzstühlchen sitzend, beim Mahle. Der König gab seiner ungeheuchelten Freude Ausdruck, ebenso Molema und ich mußte ihnen wiederholt die Rechte reichen. Montsua begann sofort von meinen Moschanenger Curen zu sprechen und ersuchte mich ein oder zwei Tage hier zu verweilen. Nach einem kurzen Aufenthalte in Molema’s Höfchen begaben wir uns in das im europäischen Style aufgeführte Häuschen seines Sohnes, um Kaffee zu trinken, der in Blechbechern herumgereicht wurde. Molema litt noch immer an seinem Asthma, doch lief er rüstig umher und bat mich, ihm dieselbe Medicin wieder verabreichen zu wollen. Seine Erkenntlichkeit ging so weit, daß er mir zu zwei kräftigen Zugthieren verhalf, von denen mir sein Sohn Matjes eines für einen englischen Sattel abtrat.
Molema, ein Mann von mittlerer Statur, mager, ist durch eine Habichtsnase ausgezeichnet, welche mit dem durchdringenden etwas unstäten Augenpaare, dem Gesichtsausdruck etwas Scharfes verleiht. Er ist streng, doch gegen manche seiner Unterthanen, die blindlings seinen Willen thun, sehr nachsichtig, wovon mich auch das Urtheil in dem erwähnten Gerichtsprocesse überzeugte. Obgleich stets kränklich, ist er doch ein treuer und helfender Genosse seiner kranken Frau und trotz seines Alters sehr behend. Während einige seiner Söhne, sowie die wohlhabenderen Einwohner in der Stadt in europäischen Häuschen wohnen, bleibt Molema seinem herkömmlichen treu.
Am 29. hatte Herr Webb eine interessante Zeremonie auszuüben, nämlich drei Pärchen zu trauen, einer der neuen Ehegatten führte den auffallenden Namen »Er liegt im Bette«; diese und ähnliche Namen erhalten die Kinder der Betschuana’s im zarten Alter nach Eigenschaften, die ihrer Umgebung besonders auffallen. Als ich am Abend desselben Tages einen Spaziergang durch die Stadt machte, hörte ich aus einem der reinlicher ausstatteten Gehöfte einen anmuthigen vielstimmigen Gesang von Hymnen in der Setschuana-Sprache, der von vier Männern und zehn Frauen angestimmt wurde, womit die Hochzeitsfeier schloß.
Auf meinen häufigen Gängen durch die Stadt konnte ich beobachten, daß neben europäischen Kleidungsstücken namentlich Carossen aus den Fellen der grauen Wildkatze, des grauen Fuchses, der Deukergazelle und der Ziege getragen wurden. Knaben hatten in der Regel ein Ziegen- oder ein Schaffell über die Schulter geworfen, Mädchen trugen ein ähnliches, doch meist aus Gazellenhaut, und nebstdem aus gedrehten Lederstückchen gearbeitete Schürzen; einige der Knaben prangten sogar mit den Fellen junger Löwen.
Die Streitigkeiten zwischen der Regierung der Transvaal-Republik und den Barolongen schienen etwas nachgelassen zu haben, und dies, weil Montsua gedroht hatte, bei etwaigen Uebergriffen von Seite der Boers das englische Banner in seinen Dörfern aufzupflanzen.
Zwei Tage später erkrankte mein Gefährte T. schwer an der Ruhr, wahrscheinlich in Folge des seit mehr denn zwei Wochen anhaltenden Regenwetters, doch gelang es mir, ihn bald wieder herzustellen; am folgenden Tage kamen auch kranke Barolongen aus der Umgebung an den Wagen, um meine ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Da es sich an diesem Tage endlich etwas aufzuheitern begann, wurde es in der Umgebung der Stadt lebendig, das Thal des Molapo wiederhallte von dem Geschrei und Gesange der dunklen Frauen und Knaben, welche aus der Stadt ausgezogen waren, um die in die Kafirkorn- und Maisfelder einfallenden Schaaren der langschwänzigen Witwen, Feuerfinken und Webervögel zu verscheuchen. Die aus den Felsenritzen allerorten emportreibenden Kari- und Olivenbäume, die, wenn auch zuweilen niedrig, stets eine umfangreiche, wahrhaft prachtvolle Krone entwickelten, verliehen auf einer felsigen Erhebung in der Stadt emporwachsend, dem nach Norden von einer bewaldeten Bodenerhebung begrenzten Thale, einen dem Auge wohlthuenden Schmuck.
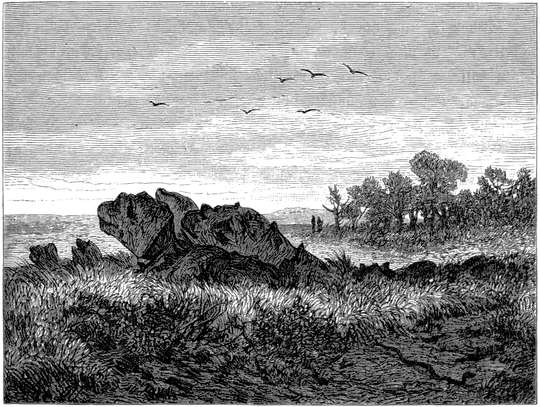
Pavianfelsen.
In Molema’s Town erfuhr ich, daß die Barolongen die getrockneten Blätter einer bestimmten Pflanzenart zu einem braunen Pulver rösten und dasselbe sowohl als Gift, wie auch als Beschwörungsmittel gebrauchen; so bedienen sie sich z. B. desselben, um mit dem zu Brei angerührten Pulver die höchsten Aehren eines Kornfeldes zu bekleben. Eine Berührung dieses Zaubermittels von Seite des Diebes würde dessen sofortigen Tod nach sich ziehen. In ähnlicher Weise sehen wir mit Hilfe desselben Materials, Striche, Wellenlinien etc. auf der Innenseite der Umzäunungen der Barolongen-Gehöfte angebracht, »um die Feinde des Haushaltes« fern zu halten. Als einige Tage vor meiner Ankunft einem der Bekehrten in Molema’s Town allnächtlich etwas Tabak aus seinem Gärtchen zu verschwinden pflegte, rieth Herr Webb dem Bestohlenen, einen in der Tabakpflanzung errichteten Pfahl mit Wagenfett zu übertünchen, und siehe da, der Dieb blieb aus.
Bevor ich noch am 12. April Molema’s Town verließ, erfuhr ich das Urtheil, welches König Montsua in dem bereits erwähnten Proceß gefällt hatte. Ich will hier die Episode schildern, um den Leser mit der Gerichtsbarkeit der Betschuana’s näher vertraut zu machen.
Ein ältlicher Barolonge hatte auf eine 15jährige Barolongen-Jungfrau (eine vaterlose Waise) in Molema’s Town sein Auge geworfen; da sie ihm jedoch nicht als Weib in seine Hütte folgen wollte, und er sie auch nicht kaufen konnte, sann er auf ein anderes Mittel, um seinen Wunsch erfüllt zu sehen. Er bot der Mutter des Mädchens seine Hand an, welche sie auch nicht verschmähte und nun, mit dem Mädchen seiner Neigung im selben Gehöfte wohnend, glaubte er ihre Zuneigung gewinnen zu können; allein da weder sein Aeußeres, noch seine Conversation, welche sich meist um Khomo (Vieh) und Mabele (Korn) drehte, bei dem Mädchen einen guten Eindruck hervorzurufen vermochten, nahm er seine Zuflucht zu einem Beschwörer. Das Mädchen sah wohl den Beweggrund dieser Heirat ein, und vermied alles, was ihrem Stiefvater als Zeichen der geringsten Gunst hätte erscheinen können. Als sie eines Tages zeitlich Morgens wie gewohnt, zur Feldarbeit ging, ward sie von ihrem Stiefvater eingeholt und es entspann sich nach ihrem eigenen Geständniß anderen Frauen gegenüber folgendes Gespräch. »Ich weiß, daß mich Dein Herz haßt.« Ein »E-Hē« belehrte ihn, daß er sich nicht irre. Vor Zorn zitternd, stieß der Alte seinen langen Stab heftig in den Boden und sagte. »Ich weiß es, es soll auch so bleiben, dann aber mußt Du mir versprechen, keinen anderen Mann zu nehmen.« Das Mädchen konnte sich eines lauten Auflachens nicht erwehren, und gab ihm frank und frei mit einem na-ja eine ebenso bestimmte abschlägige, wie zuvor eine bejahende Antwort. Mit vor Wuth entstellten Zügen eilte der alte Mann mit den Worten. »Du versprichst es nicht? dann vergifte ich Dich!« von dannen, während das Mädchen zu den Gärten am Flusse eilte und der dort arbeitenden Mutter und einer Nachbarin unter Schluchzen das Geschehene erzählte. Die Frauen suchten es der Gekränkten auszureden und meinten, es wäre alles nur ein Scherz, den sich der Stiefvater erlaubt hätte. Am selben Abend wurde sie, während sie ihr einfaches Mahl von gekochten Wassermelonen genoß, von ihrem Vater in’s Häuschen gerufen und unter einem Vorwande zu einer Nachbarin gesendet; von ihrem Gange zurückgekehrt, beendete sie ihr Mahl. Kurze Zeit darauf fing sie an über Unwohlsein zu klagen, Magenkrämpfe stellten sich ein, die sich so steigerten, daß sich die Arme laut schreiend auf der Erde rollte. Von den zur Hilfeleistung herbeigeeilten Nachbarn umringt, klagte sie, die Mutter an das ihr erzählte Zwiegespräch erinnernd, ihren Stiefvater laut der Vergiftung an. Gegen Mitternacht war sie eine Leiche und allgemein wurde ihr Stiefvater als der Mörder bezeichnet. Männer und Frauen, welche denselben Nachmittag den alten Mann Pflanzen am Flusse sammeln, andere, meist Nachbarsleute, die ihn Blätter und Zwiebeln im Höfchen kochen gesehen hatten, meldeten sich freiwillig zur Zeugenschaft.
Der Beschuldigte war Molema’s Leibeigener, ein Mann, der durch ein halbes Jahrhundert hindurch seinem Herrn treu gedient hatte; obgleich im Vorhinein entschlossen, ihn zu retten, sandte Molema sofort Boten an seinen Bruder, den König, nach Moschaneng, um ihm den Fall zu berichten. Montsua versprach selbst den Fall zu untersuchen. So kam es, daß er nur wenige Tage vor meiner Ankunft in Molema’s Town eingetroffen war und sofort die Leitung der Verhandlungen in die Hand nahm. Inzwischen befand sich der Beschuldigte auf freiem Fuße, machte seine gewohnten Spaziergänge, auf denen ihm Alles scheu auswich. Er hielt sich von Molema’s Weichherzigkeit überzeugt und glaubte sich ohne Mühe mit einigen Ochsen oder Kühen loskaufen zu können. Nach des Königs Ankunft in der Stadt, begann der Proceß und beschäftigte durch zwei volle Tage die hervorragendsten Häuptlinge der nördlichen, freien Barolongen. Nach jeder Sitzung (zwei am Tage) wurden die Anwesenden von Molema mit Bochobe (Mehlbrei) bewirthet.
Der Verurtheilte, dessen Schuld klar zu Tage lag und der von allen Anwesenden als schuldig befunden wurde, fand, wie er es gehofft, an dem Häuptling Molema den wärmsten Vertheidiger. Des Dieners Schuld anerkennend, um nicht seinen Bruder, den König, durch Widerspruch zu reizen, wußte doch Molema so viele Milderungsgründe anzuführen, daß der König angesichts der Haltung der Unterhäuptlinge von Molema’s Town und der Umgebung, sich erweichen ließ und von einer Verurtheilung zum Tode absah. Der König, dem schon die zweitägige Gerichtssitzung zu anstrengend vorkam und der es wohl zu verstehen schien, daß sein Bruder eine Gefälligkeit von ihm fordere, überließ demselben die Bemessung der Strafe. Molema bedeutete dem Verurtheilten sich sofort zu entfernen, um dem König den Proceß so rasch wie möglich vergessen zu machen und als dieser später einen Spaziergang durch die Stadt unternahm, ließ Molema den Schuldigen holen und sprach das Urtheil. Es war die gelindeste Strafe für ähnliche Vergehen: Der Beschuldigte mußte ein Rind an die nächsten Verwandten (in diesem Falle waren er und seine Frau die nächsten Verwandten) der Gemordeten als Blutsühne bezahlen.
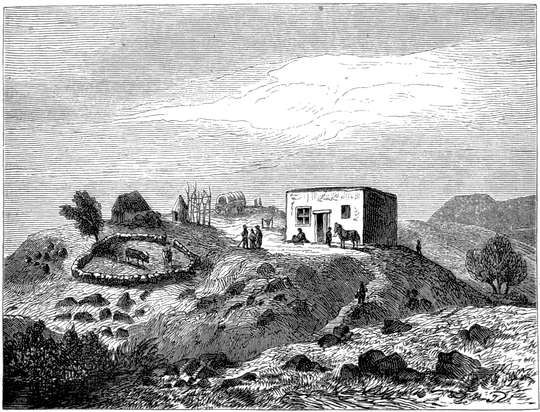
Newport-Farm.
Als ich mich am 2. zur Abreise rüstete und vor derselben noch einmal Herrn Webb besuchte, erschien plötzlich eine dunkle Gestalt in der schmalen Thüröffnung. Es war Montsua. Lächelnd kam er auf mich zugeschritten, faßte meine Rechte und drückte mir fünf englische Shillinge in die Linke, indem er mich bat, ihm einen Vorrath desselben Medicamentes zu bereiten, von dessen günstiger Wirkung an seinem Weibe er schon während meines ersten Besuches in Moschaneng sich überzeugt hatte.
Am Nachmittag des 2. April verließ ich die Stadt der oberen Barolongen und zog im Thal des Molapo aufwärts. Am folgenden Morgen passirte ich den letzten nach dieser Richtung hin bewohnten Kraal, über den als Unterhäuptling Linku (ein Schaf), der Bruder Molema’s gebietet. Der Morgen des 3. April war empfindlich kalt, ein eisiger Südostwind nöthigte uns, »Winterröcke« anzulegen. Auf der westlichsten, der sogenannten, zu dem Jacobsdaler Bezirk gehörenden Molapo-Farmen, Riet-Vley, deren Besitzer ein Boer Namens P. C. van Zyl[2] ist, hielten wir Rast.
Von hier ziehen sich die Farmen dicht aneinander liegend, bis an die Molapo-Quellen. Das Thal des Flusses erstreckt sich noch etwa 22 englische Meilen nach Osten, es behält zwar stromaufwärts seinen sumpfigen Charakter bei, doch wird es allmälig enger, seine Ufer hügelig, steil und bewaldet, und sind diese Partien nicht nur im Allgemeinen unter die anziehendsten der westlichen Transvaal-Grenze zu zählen, sondern auch für den Forscher, sei er nun Ornithologe, Entomologe, Botaniker oder Mineraloge, in jeder Beziehung des Besuches werth.
Die Wagenspur, der wir bisher gefolgt waren, führte an einer der letzten Farmen direct nach dem Baharutsen-Kraal Linokana, den ich jedoch über Jacobsdal und Zeerust zu besuchen gedachte. Ich zog jedoch am Abhange in der eingeschlagenen Richtung so weit, bis mich Baumdickichte nöthigten, an Mr. Taylors Farm (deren ich am Maretsane-Flusse gedachte), Oliv-wood-dry, der steilen Abhänge halber das Thal zu verlassen und die Hochebene wieder aufzusuchen. Oliv-wood-dry ist unstreitig eine der schönsten Farmen am oberen Molapo, sie besitzt einen guten Garten und eine der wasserreichsten Quellen, die den Molapo speisen, der Pflanzenwuchs der Thalsohle, vor den kalten Winden geschützt, bildet eine Oase auf dem westlichen Transvaal-Plateau. Um so dürftiger und eintöniger fand ich die Farm Bootfontein, auf welcher die Insassen derselben mehr zu vegetiren, denn zu arbeiten schienen.
Abends überschritten wir in dieser Gegend die Wasserscheide zwischen dem Oranje-River und dem Limpopo und übernachteten an den Quellen eines kleinen Spruit, den ich Burgerspruit benannte, und der ein linker Zufluß des Malmani ist. Im landschaftlich anziehenden Thale des Malmani, an dessen von üppiger Vegetation bedeckten Abhängen zahlreiche Farmen gelegen sind, trafen wir am nächsten Tage ein.
Am Morgen des 5. verließ ich das Malmanithal und zog an der Newport-Farm vorüber über das Hochplateau, eine mit niederen sauren Gräsern bewachsene Ebene, weiter nach Osten. Nach dieser Richtung hin und nach Nordost wurden zahlreiche Höhen, die Ausläufer des Marico-Höhennetzes, und zwar jene des Khama- oder Hieronymusthales sichtbar, die mit diesem eine der schönsten Partien des genannten südafrikanischen Höhencentrums bilden. Die Einsenkung zu dem Seitenthale, in das wir hinabfahren mußten, um zu dem Hauptthale zu gelangen, ist durch eine felsige Doppelhöhe gekennzeichnet, welche ich Rohlfsberg nannte, weiter nach abwärts fiel mir ein sattelförmiger Hügel auf, den ich Žižkasattel taufte. Die Abfahrt zum Thale war ziemlich beschwerlich, denn wir fuhren über steile Felsenplatten herab. Für die Mühen dieser Fahrt waren wir durch die Scenerie im Hieronymusthale reichlich entlohnt; die schönste Stelle bietet unstreitig die Partie an der Farm Büffels Huck, in deren Hintergrund sich die anziehenden Staarsattel-Höhen malerisch vom Horizonte abhoben. Abends hatten wir die Mündung des Hieronymusthales in jenes des kleinen Maricoflusses und die Farm Weltevreeden erreicht. Diese Farm gehörte einem der wohlhabendsten Boers des Marico-Districtes, einem Mynheer van Groonen, dessen Söhne durch längere Zeit Elephantenjäger gewesen und denen es ausnahmsweise gelungen war, sich damit ein Vermögen zu erwerben. Im Farmgarten sah ich eine junge Giraffe, eines der Beutestücke, die sie von einem Jagdausfluge heimgebracht hatten.
[1] Die Farm liegt östlich von dem Gebiete der unabhängigen Koranna’s.
[2] Ein Bruder des von mir erwähnten Damara-Emigranten.
Jacobsdal. — Zeerust. — Ankunft in Linokana. — Schieferlager. — Ernteerträgnisse. — Die Krokodile im Limpopo und seinen Nebenflüssen. — Erzlagerstätten im Bushveldt. — Damara-Emigranten. — Die Löwenfurth über den Marico. — Welsfang im Marico. — In Lebensgefahr. — Das Buffadderthal. — Ankunft in Schoschong.

Welsfang im Marico.
Von der Farm Weltufrede schon konnten wir das Städtchen Jacobsdal erblicken, einige wenige Gebäude an den Ufern eines Baches und ein nettes Kirchlein war alles, was damals dies werdende Städtchen des westlichen Transvaal-Gebietes aufzuweisen hatte. Von Jacobsdal änderten wir unsere Richtung in eine nördliche und nordöstliche, um nach Zeerust, dem wichtigsten Flecken des Marico-Districtes zu gelangen. Auf der Fahrt dahin passirten wir eine der ergiebigsten Farmen dieses Bezirks, jene des D. Bootha, an welcher der Malmani einen niederen, felsigen Höhenzug durchbricht, um sich dem Marico zuzuwenden.
Wir trafen am nächsten Tage in Zeerust ein, nachdem ich zuvor die das Städtchen beherrschenden Höhen besucht. Zeerust hat eine größere Ausdehnung als Jacobsdal und ein längerer Aufenthalt in der Umgebung des Städtchens wird dem Entomologen, Botaniker und Geologen reichlich seine Mühe lohnen.[3] Noch bevor wir am folgenden Tage das freundliche Linokana betraten, begegneten wir Rev. Jensen, der eben im Begriffe war, die Post aus dem Innern nach der Stadt zu bringen. Unser Zusammentreffen war ein herzliches und dankbaren Herzens nahm ich die Einladung an, während der nächsten 14 Tage sein Gast zu sein. Mir war diese Erholungszeit doppelt willkommen, denn sie bot mir nicht nur Gelegenheit, die Umgegend naturhistorisch zu erforschen, sondern war auch meinen Gefährten nöthig.
Die schönen großen eisenhaltigen Schieferlager, die wir in der Umgebung von Zeerust und Linokana vorfanden, würden in einer europäischen Stadt sehr gute Verwendung finden, doch werden sie auch von den Bewohnern des Marico-Districts bei ihren Bauten, namentlich ihren Einfriedigungen und Pflasterungen in Anwendung gebracht. Die Höhen von Zeerust waren mit dem Waggonbaum bewachsen, dessen Rinde zum Gerben verwendet wird.
Im Jahre 1875 wurden von den Baharutse in Linokana 800 Säcke Weizen (à 200 Pfund) gewonnen, und werden von Jahr zu Jahr immer größere Flächen Landes cultivirt. Die Baharutse bauen Mais, Sorghum, Melonen, Tabak etc. an, und bringen den Ueberschuß über ihren Bedarf nach dem Transvaal-Gebiete und den Diamantenfeldern zu Markte. Doch sind ihre Gehöfte minder fleißig und gut gearbeitet als jene der Barolongen. Die Baharutse haben ihr Ländchen an die Boer-Regierung abgetreten und sich nur das Gebiet einiger Farmen behalten.
Am 9. unternahm ich einen Ausflug zu den Quellen des Matebeflüßchens und auf die erzreichen Höhen der Umgebung. Die nächsten Tage waren theils der Bearbeitung meiner Routen-Aufnahmen, theils dem Besuche der Gärten und Pflanzungen und der Missionskirche gewidmet. Der Gottesdienst in der letzteren wurde mit dem Absingen einer Hymne eröffnet. Dann wurde das Evangelium vorgelesen, worauf abermals Gesang folgte, woran sich die Predigt des Missionärs anschloß. Der Eindruck des Gottesdienstes auf die auf ihren kleinen Holzstühlchen kauernden Neophiten war ein sichtlich guter. In seiner Einfachheit war dieser Gottesdienst erhebender als viele der mit Pomp celebrirten Feierlichkeiten in den Cathedralen der Großstädte.
Spät Abends am 15. kam der eingeborne Postbote von Molopolole an. Er hatte drei Tage gebraucht, um die Strecke zurückzulegen und blieb nun bis zum nächsten Tage hier, um die in Zeerust von Klerksdorp erwartete europäische Post wieder in’s Innere nach Molopolole zu bringen. Mich überraschte die letztere mit einem freundlichen Schreiben des allbekannten Geographen A. Petermann aus Gotha. Auch kam ein englischer Major aus dem Banquaketsen-Lande hier an, der das Land nach Edelmetallen durchforschte, er war im Begriffe nach Kolobeug und Molopolole zu reisen und erzählte mir und Rev. Jensen eine interessante Geschichte, die ihm und Capitän Finlason zugestoßen und ihn bewogen hatte, das nordöstliche Transvaal-Gebiet aufzusuchen.
Die regnerischen Tage, und an solchen war die Zeit meines Aufenthaltes in Linokana reich, brachte ich in der gastlichen Wohnung Rev. Jensens zu. Er benutzte diese Tage, um mir verschiedene, nützliche und interessante Mittheilungen zu machen und Erlebnisse auf seinen Missionsreisen zu erzählen. Unter anderen betätigte er die Thatsache, daß die Krokodile aus dem Limpopo unglaublich weit in dessen Nebenflüsse hinaufschwimmen und erzählte mir, daß er selbst vor einiger Zeit am Flüßchen Taung auf Krokodile stieß, welchen sein Hund bald zum Opfer gefallen wäre. Diese Stelle am Ufer des Taung, der ein Nebenfluß des Notuany ist und daher ein linker Zufluß des Limpopo, ist von dem letzteren zwei starke Tagreisen entfernt. Als noch Herr Wehrmann, ebenfalls ein Mitglied der Hermannsburger Missionsgesellschaft bei den Makhosi wohnte, lag nahe an seiner Wohnung ein kleiner Tümpel am Ufer des Kolobengspruit. Hier wurde eine Kuh an der Tränke von einem Krokodil im Spruit ertränkt.
Allnächtlich hörten wir den Gesang der Baharutse-Mädchen und Männer aus den umliegenden Stadtgebieten, denn die Baharutse lieben den Tanz. Einer der landschaftlich schönsten und des Besuches werthen Punkte in der Nähe von Linokana ist das Thal des Notuany etwa drei Meilen unterhalb seiner Vereinigung mit dem Matebe-Flüßchen. Felsige Bergabhänge hie und da von üppigen Triften und dichten Wäldern bedeckt, engen es ein und beherbergen zahlreiches Federwild, in den zahlreichen Schilfrohrdickichten des Matebe finden Wildkatzen bis zur Größe eines Leoparden die geeignetsten Schlupfwinkel und reiche Beute.
Am 23. verließ ich Linokana, überschritt den Notuany, an dem mir die halbzerfallene Brücke über denselben noch mehr Sorgen als auf der zweiten Reise verursachte und deren Passirung über zwei Stunden in Anspruch nahm.
In der Buysport-Schlucht, wo wir diesmal im Fischfang in den Tümpeln des Marupa-Flüßchens eine lohnende Beschäftigung fanden, verlebte ich einen angenehmen Tag; nicht minder ergiebig war unsere Jagdbeute. Die höher liegenden Tümpel sind fisch- und leguanreicher, als die nach der Oeffnung der Schlucht zu gelegenen, indem die höheren tiefer und mehr beschattet sind und daher weniger leicht austrocknen. Manche der den Fluß überschattenden Bäume (meist Weiden und Mimosen) waren bei einem Durchmesser von 4 Fuß, bis 60 Fuß hoch.
Am nächsten Tage, den 25. passirten wir die im Bushveldt liegenden Farmen Wit- und Sandfontein. Die Bewohner der ersteren rüsteten sich zu einem großen Jagdzug nach dem Innern, und hofften mich dort wieder zu finden. Zwarts Farm fand ich verlassen, der Eigenthümer war acht Tage zuvor nach denselben Gegenden abgegangen. Sein vorjähriger Jagdzug hatte ihm einige Strauße und Eland-Antilopen eingebracht. Von vorüberfahrenden Boers erfuhr ich, daß van Zyl, dem Damara-Emigranten, fortwährend neue Zuzügler aus dem Transvaal-Gebiete Gebiete an den Krokodil-River folgten und daß sich diese Emigranten bald hinreichend stark fühlen würden, um ihren Marsch nach Nordwesten fortzusetzen. Das linke Ufer des mittleren Krokodil-Riverlaufes zwischen dem Notuany und Sirorume war ihr Sammelplatz.

Im Sumpfe am Matebe-Flüßchen.
Am Nachmittag selben Tages langte ich auf Fouriers schon bekannter Farm Brackfontein an. Hier stieß ich auf zwei aus dem Jacobsdaler District kommende Boers, die mit ihren gebrechlichen Wägen, von einem elenden Gespann, Kühen und jungen Ochsen gezogen, auf die Jagd in’s »Innere« ausgingen. Das Arbeiten behagte ihnen nicht und so zogen sie das kostspielige Vergnügen des Elephantenjagens vor, um damit noch das wenige, das sie besaßen, einzubüßen und krank und mittellos in die Heimat zurückzukehren. Fourier zeigte mir Quarz, der reichliche Schwefelkies-Einschlüsse enthielt und theilte mir mit, daß er eine Stelle kenne, an welcher große Mengen dieses und eines anderen weniger glänzenden und mehr ockergelben Metalls zu finden sei, wollte mich aber durchaus nicht zu dem betreffenden Fundorte führen. Auch berichtete mir Fourier, daß die Batloka von Tschuni-Tschuni vier Wochen vor meiner Ankunft am Fuße der Dwarsberge einen Löwen erlegt hatten.
Ich verließ am Morgen des 28. die Farm und lagerte am Schweinfurth-Passe in den Dwarsbergen. Abends gelangten wir zu den in Felsen aufgegrabenen Quellen an den Ausläufern der Tschuni-Tschunihöhen, umfuhren am folgenden Tage die schon auf der letzten Reise besuchte Batlokastadt Tschuni-Tschuni, und lagerten, nachdem wir den Kessel an dem Betschuanaspruit durchzogen, am nördlichen Abhange der Ausläufer der Bertha-Höhe. Am Ufer des Betschuanaspruit beobachtete ich ein verlassenes Barwadorf, aus 15 Hütten bestehend, welche frei auf einer Wiese lagen und in Nachtmützen-Form aus je vier in ihren oberen Enden miteinander verbundenen, vier Fuß hohen Pfählen, sowie einigen über dieselben geworfenen Grasbündeln errichtet waren.

An der Löwenfurth im Marico.
Am Nachmittag des 30. langten wir am großen Marico an und lagerten an einer Stelle, an der eine Stromschnelle und zwei kleine Felseninseln das Uebersetzen des sonst der Krokodile halber nicht gefahrlos zu durchwatenden Stromes ermöglichten. Da mir die Stelle gefiel und das jenseitige Ufer wildreich war, entschloß ich mich, zwei oder drei Tage an der Furth zuzubringen. Etwa 100 Schritte unterhalb derselben wählte ich mir im jenseitigen Ufergehölze ein Plätzchen aus, an welchem ich mich auf den Anstand zu legen beschloß, und blieb auch trotz der Warnungen Pits dabei, der an der Furth frische Löwenspuren gefunden hatte. Zur Vorsicht versah ich den gewählten Platz mit einer niederen Hecke und bezog denselben nach Sonnenuntergang. Der Uebergang über den ziemlich reißenden Strom in der Dämmerung war beschwerlich und ermüdend.
Allmälig, und zwar je unangenehmer mir meine Lage mit der zunehmenden Dunkelheit erschien, desto mächtiger schlich sich in mein Denken eine lange zuvor nicht gleich innige Sehnsucht nach der Heimat und insbesondere nach meiner Mutter ein. Ich sah das Bild der treuen Pflegerin meiner Kindheit so treu vor mir, als stünde sie an meiner Seite. Diese spontan auftauchenden Gedanken und Vorstellungen erfüllten mich mit einer gewissen Bangigkeit. Wäre es nicht besser den Ort zu verlassen und zum Wagen zurückzukehren? Nein, mußte ich mir sagen, denn zur Stunde hatten die Krokodile bereits ihre Spaziergänge am Ufer begonnen, um die Stromschnellen zu umgehen.
Die Dunkelheit nahm indeß immer mehr zu, dichte Wolkenmassen hingen vom Himmel herab und ich kam zur Erkenntniß, daß mein Aufenthalt hier zwecklos und meine Lage keine beneidenswerthe war, ich konnte kaum auf zehn Schritte Entfernung Gegenstände unterscheiden, mein Gewehr bot mir daher keinen Schutz; das lange Jagdmesser war die einzige Waffe, auf die ich mich im Falle der Noth verlassen konnte. Krampfhaft faßte ich mein Messer mit der Rechten und hockte mich nieder. Ich trachtete mit dem Gesichte die Dunkelheit um mich zu ergründen und strengte das Auge an, doch ich sah nichts, nichts als tiefe Nacht um mich. Allmälig fieng es mir vor den Augen zu flimmern an, bläuliche Sterne schienen sich zu bilden und das Auge glaubte in ihnen das Bild der Mutter zu sehen. Diese wiederholte Vision versetzte mich in Aufregung, ich konnte das Gefühl, daß mir hier Gefahr drohe, nicht unterdrücken und beschloß das Wagniß zu unternehmen, in dieser Finsterniß zum Wagen zurückzukehren. Ich legte den einen Fuß auf die trockenen Aestchen und brach unter lautem Krachen durch, erhob mich jedoch wieder, faßte das Gewehr in die eine, das Messer in die andere Hand, um die Stelle zu verlassen. Doch was nützte mir das Gewehr im Gebüsch und in der Finsterniß — ich warf es zurück. In demselben Momente vernahm ich ein Kratzen und Scharren, vielleicht das einer Mangusta, doch deutlich davon unterscheidbar. Ich blieb stehen, der Laut wiederholt sich und schien von einem Brummen begleitet. War es ein Raubthier und so nahe, waren jene rostigen Gegenstände, die ich im Zwielicht in den Büschen drüben gesehen, auch in der That Löwen gewesen? Als ich die Hecke überschritten hatte, fühlte ich den Schlag des Herzens stürmischer werden. Mit dem Jagdmesser vor mir herumtastend, suchte ich den herabhängenden Aesten und den Baumstämmen auszuweichen. Nach jedem Schritte hielt ich einen Augenblick inne, um jedes etwa hörbare Geräusch möglichst deutlich und sofort aufnehmen und begreifen zu können. Ungeachtet der äußersten Vorsicht konnte ich es nicht verhindern, hie und da mit den Aesten in Collision zu gerathen; pochenden Herzens wartete ich dann mehr denn zwei Minuten, ob kein Geräusch ein anschleichendes Raubthier ankündige.
Es war nur eine kurze Strecke, die ich zurückzulegen hatte, nur 100 Schritte, doch nahm sie mir viel Zeit in Anspruch. Endlich langte ich, durch das Zischen des Wassers geleitet, an der Stelle an, wo die enge Regenrinne den Abstieg zum Flusse ermöglichte. In dieser herabgleitend, stand ich eine Minute später am Rande des Gewässers. Mit der gespanntesten Aufmerksamkeit setzte ich einen Fuß vor den andern und trachtete nach dem stärkeren oder schwächeren Brausen des Wassers vor mir die Furth zu erkennen; wie oft ich auch ausglitt und sogar der ganzen Länge nach in’s Wasser fiel, war ich doch immer wieder im Stande, mich rasch aufzurichten und die Richtung einzuhalten. So gelangte ich unter unsäglicher Mühe auf die erste der kleinen Inseln, ließ mich dann wieder in’s Wasser herab, durchschritt den engen Mittelarm, durch den die Hauptströmung zog, schwang mich auf die nächste Insel und gönnte mir hier einige Minuten Rast, bevor ich den Uebergang vollendete. In Schweiß gebadet, stieg ich zum dritten Male in das zischende Element herab und über die schlüpfrigen Steine balancirend, hatte ich endlich glücklich das diesseitige Ufer erreicht, ohne mit den Kinnladen der Ungeheuer Bekanntschaft gemacht zu haben. Obwohl ich noch nicht jeder Gefahr entronnen war, fühlte ich doch meine Brust bedeutend erleichtert, als ich den Fuß auf festen Boden setzte. Ich war so ermüdet, daß ich mich am Flußrande niedergesetzt hätte, wenn mich nicht der Gedanke, daß eben das unmittelbare Ufer an den Stromschnellen die von den Krokodilen zur Nachtszeit besuchteste Stelle ist, an der sie dann dem zur Tränke kommenden Wilde aufzulauern pflegten, davon abgeschreckt hätte. Ich war eben im Begriffe an den Büschen auf das hohe Ufer emporzuklimmen, als ich ein starkes Geräusch ober meinem Kopfe vernahm; im Aufstiege innehaltend, unterschied ich, wie dasselbe sich dem Flusse näherte. Ich kniete nieder und hielt mich am Stamme des Busches fest, um mich desto ruhiger verhalten und lauschen zu können. Wenige Minuten später erkannte ich die Ursache des Geräusches; es war eine Heerde der schönbehörnten Pallah-Antilopen, welche in den Fluthen unter mir ihren Durst stillen wollte. Ich erkannte sie an dem Anschlagen ihrer Hörner an die Büsche und dem eigentümlichen Brummen. Meine ganze Kraft aufbietend, zog ich mich an den überhängenden Aesten der Bäume auf den hohen Uferrand. Jetzt athmete ich freier auf, der Weg zum Wagen führte über eine Lichtung, auf diese eben heraustretend, schlug das Gekläffe der Hunde an mein Ohr, welche die Pallah’s gewittert hatten. Ein Pfiff brachte Niger in wenigen Momenten an meine Seite und bald darauf hatte ich den Wagen erreicht, um welchen lichterlohe Feuer brannten.
Am folgenden Tage besuchte ich gemeinschaftlich mit Pit den Rendezvousplatz und fand die Stelle, an der ich gelegen, sowie die nächste Umgebung von Löwenspuren bedeckt und die niedere Umzäunung aus trockenem Gezweige vollkommen zertreten. Der Aufenthalt an dieser Stelle kostete einem meiner Hunde in Folge des Stiches einer Fliege, welche schaarenweise die Thiere überfällt, und sich an Nase, Augen und Ohren festsaugt, das Leben.
Am 1. Mai unternahm ich mit Pit einen größeren Ausflug landeinwärts. Schon früher hatte ich gehört, daß man sich hie und da in der Colonie den Muth nimmt, in die geräumigen unterirdischen Hyänenbauten hineinzukriechen, um sich von der Anwesenheit des Raubthieres zu überzeugen. Ist die Hyäne »eingefahren« so wird in dem äußersten Theile ihres Baues aus gewissen Sträuchern ein Feuer angezündet, um das Thier auszuräuchern. Beim Entweichen wird sie erschossen oder mit Knitteln erschlagen. Ich machte nun auch mit Pit einen Versuch und forderte ihn bei einem Hyänenbau angelangt, auf, hineinzukriechen, und siehe da, er wiederholte auch hier, was er schon oft daheim gethan, diesmal leider ohne Erfolg, da der Ausräucherungsproceß nicht recht von Statten gehen wollte.
Am selben Tage trat ich die Weiterfahrt an und traf einige Meilen flußabwärts einen Elfenbeinhändler aus dem Matabelelande an, der im Auftrage des Königs der Matabele dem englischen Gouverneur in Griqualand (Kimberley) mittheilen sollte, daß ein weißer Forscher an der Ostgrenze seines Reiches unter den Maschona’s getödtet worden war.
Die überaus reiche Ausbeute des Tages, Vogelbälge, Reptilien, Insecten, Pflanzen und Mineralien bewog mich, mein Glück auch im Fischfange zu versuchen. Mit den nöthigen Werkzeugen ausgerüstet stand ich bald an dem hohen Flußufer und senkte meine Angel in die Fluth. Es gelang mir, mehrere Welse zu fangen, drei große, etwa sechs Pfund schwere Stücke vermochte ich nicht an’s Ufer zu schnellen, die Thiere brachen die Angel oder entschlüpften und fielen rasch über das steile Ufer in den Fluß zurück. Bei den Anstrengungen, die ich machte, um einen vierten zu landen, verlor ich das Gleichgewicht und fiel kopfüber das Ufer herab, blieb aber glücklicher Weise an den Dornen eines Wartebichi-Strauches hängen.
An den Perlhühnern am Marico beobachtete ich, daß sie sich überall da, wo Gebüsche bis an den Fluß herantraten, häufiger zeigten und daß sie ihre Bäume nicht vor dem Abtrocknen des schweren Morgenthaues verließen. Im Laufen leisten diese Geschöpfe Unglaubliches.
Gegen den Abend fuhren wir weiter und begegneten einer größeren Anzahl von Betschuana-Familien, dem Makhosistamme angehörend, welche nahe an den Ruinen von Kolobeng auf Seschele’s Gebiete wohnten. Sie waren aus ihren bisherigen Wohnsitzen ausgewandert und wollten sich an der Transvaal-Grenze am Fuße der Dwarsberge ansiedeln, da sie von Seschele zuviel geplagt wurden. Seschele bereitete sich vor, die Makhosi und die Bakhatla mit Waffenmacht zu überfallen, doch wurde dies den letzteren verrathen und sie trafen sogleich alle Vorkehrungen, um ihn gebührend zu empfangen, auf welche Nachricht hin aber Seschele von dem geplanten Ueberfalle abstand. Für den Reisenden und Händler, wie auch für die nachbarlichen Colonien ist es in jeder Hinsicht besser, wenn die Einheit der gegenwärtigen sechs Betschuana-Reiche aufrecht erhalten bleibt. Die Zersplitterung derselben in kleinere Staaten würde dieselben Nachtheile zur Folge haben, unter denen die europäischen Colonien und Reisende an der Ostküste nördlich der Delagoabai zu leiden hatten.
Am 4. beobachteten wir eine Wasserbockgaiß im hohen Grase des gegen seine Mündung leicht bewaldeten Maricothales. Th. beschlich das Thier ganz vortrefflich, doch das Unglück wollte, daß ihm die Patrone versagte und bevor ihm Pit eine zweite reichen konnte, hatte das Thier die Flucht ergriffen. Der Morgen war ausnahmsweise schön, doch hatten wir seit dem 2. täglich Fröste. Ich durchzog das bewaldete Dreieck zwischen dem unteren Marico und dem Limpopo, indem ich mich von dem ersteren entfernte, um ihm erst an seiner Mündung zu begegnen. Wir begegneten einem aus dem Westmatabele-Lande über 500 englische Meilen weit herkommenden Haufen Makalaka-Männer, welche zu Skeletten abgemagert nach den Diamantenfeldern zogen, um sich hier auf sechs Monate zu verdingen und sich ein Gewehr und Schußbedarf zu erwerben; leider konnten wir ihren Bitten um Fleisch nicht willfahren, da wir in den letzten Tagen kein Hochwild erlegt hatten.
Am folgenden Morgen fand ich mich am Ufer des Limpopo; da ich hier einige Tage zu verweilen gedachte, machten wir uns sofort daran, unseren Lagerplatz mit einer hohen Umzäunung aus Mimosenästen zu umgeben und die Zugthiere in Sicherheit zu bringen. Am Nachmittage unternahm ich mit Th. einen Ausflug am Marico-Ufer aufwärts und schoß zwei Meerkatzen und vier kleine Nachtaffen (Galakae), welche sich durch ein sehr feines seidenartiges Fell und ihre schönen großen Augen auszeichnen. Sie bringen in der Regel den Tag schlafend zu und beginnen erst mit der Nacht als wahre Sprungthiere das Leben in den Zweigen der Bäume in denen sie nach Motten und Insecten jagen, Beeren suchen, und den Gummisaft der Mimosen belecken. Mit den Krokodilen, welchen der Fluß seinen Namen verdankt, machte unser Diener am folgenden Tage Bekanntschaft. Mit Waschen am Ufer beschäftigt, tauchte plötzlich vor ihm ein dunkler Gegenstand aus der Fluth, bei dessen Anblicke ihm das Kleidungsstück entfiel und er es nur dadurch wieder gewann, daß er laut aufschreiend einen Stein dem nach dem eben versinkenden Gegenstande schnappenden Krokodile an den Kopf warf. Da ich den Limpopo etwas unterhalb der Vereinigung mit dem Marico blos etwa drei Fuß tief fand, versuchte ich es, den Strom an dieser Stelle zu überschreiten. Wir fällten mehrere große Mimosenstämme und bauten daraus ein Floß, doch das frische Mimosenholz war so schwer, daß es unter mir zwei Fuß tief einsank und als ich, das Floß im Stiche lassend, auf das Ufer zu springen im Begriffe war, hatte sich am gegenüber liegenden Floßende ein Krokodil angeklammert; diese unliebsame Erscheinung veranlaßte mich, vorläufig auf den Besuch des jenseitigen Ufers zu verzichten.
Am 7. verließen wir unsern Lagerplatz, zogen stromabwärts weiter und hatten auf der nächsten Strecke 15 enge und tiefe Regenschluchten zu überschreiten. Die Gegend war ein ununterbrochener Wald, in dem uns einige sehr schöne und umfangreiche Hardekoolebäume auffielen; das Land zur Linken gehörte Seschele, dem Bakwenakönig, das jenseitige der Transvaal-Republik.
Wir setzten an den folgenden Tagen die Reise fort und gelangten zur Mündung des Notuany, die Reise ging etwas langsam von statten, da das Thal des Limpopo und die an seinem Ufer befindlichen, höher liegenden und mit dem Strome nur bei Hochwasser communicirenden Sumpflachen mannigfache Gelegenheiten zur Jagd und zur Vermehrung meiner Sammlungen boten. Bevor wir noch den Notuany erreicht hatten, stießen wir auf das erste der beiden Lager, welche die Damara-Emigranten bezogen hatten, um sich zu ihrem Zuge nach Nordwesten zu sammeln. Das Lager bestand aus etwa 30 Wägen und eben so vielen Zelten. Große Vieh- und Schafheerden weideten von Bewaffneten beschützt ringsum. Die Leute saßen in Gruppen beisammen, die einen tranken den unentbehrlichen Kaffee, während andere emsig an der Completirung des Reisematerials arbeiteten. Mir fiel es auf, daß die meisten der Frauen schwarz gekleidet waren. Die Männer fragten uns, ob wir nicht einigen Boerwägen begegnet wären, und als wir es bejahten, daß wir zahlreiche Damara-Emigranten überholt hätten, da zeigte sich bei allen eine unverhohlene Freude, sie hofften, daß die Zeit nahe sei, wo sie hinreichend stark an Zahl, ihren Zug nach dem Damaralande antreten konnten, wobei sie hinzufügten, daß sie sich, im Falle ihnen von den Königen der östlichen und westlichen Bamangwato der Durchzug verwehrt würde, denselben erkämpfen wollten. Ich machte die Leute darauf aufmerksam, daß sie die trockenen, an Wasser so überaus armen Strecken des westlichen Theiles des nächst anliegenden Bamangwato-Reiches mit ihren zahlreichen Heerden kaum passiren könnten, oder dabei mindestens die Hälfte ihrer Thiere einbüßen würden. Doch sowohl hier als auch im zweiten Lager, in Schoschong und auf meiner Rückreise, auf welcher ich den Emigranten begegnete, war man gegen meine Vorstellungen taub und wollte von einer Umkehr nichts wissen, sie zeigten ein unbegrenztes Selbstvertrauen, besonders wenn man sie auf die Widerstandsfähigkeit der östlichen Bamangwato aufmerksam machte. Nach den Gründen ihrer Auswanderung befragt, klagten sie über die Regierung und die Person des Präsidenten, welcher ganz verkehrte Begriffe über die Auslegung gewisser Stellen in der Bibel hätte, während u. a. die Regierung bestrebt sei, Neuerungen einzuführen, die weder gut noch an der Zeit wären. Ihre Vorfahren südlich vom Oranje-River, sagten sie, waren grau geworden, ohne je mit solchen, mit großen Kosten verbundenen Neuerungen geplagt worden zu sein, deshalb wären auch jetzt diese nicht nöthig und dies um so weniger, als sie einen Zuzug von Fremden, namentlich von Engländern verursachten. Diese Neuerungen bezogen sich namentlich auf Verbesserungen, welche Präsident Burgers im Staate einzuführen bestrebt war, obgleich sie bei Weitem noch nicht die Abschaffung aller der Krebsschäden, an denen die Republik litt, erzielen konnten. Von allen diesen Neuerungen wurde mir das vom Präsidenten Burgers entworfene Eisenbahnproject, welches die Delagoabai mit der Transvaal-Republik verbinden sollte, als das abscheulichste bezeichnet.
Es ist wirklich staunenswerth und unglaublich, daß Menschen, die sich mühevoll ihren Besitz, ihre Farmen erkämpfen mußten, in Folge der oben angeführten Gründe und den Vorspiegelungen eines Mannes Glauben schenkend, ihre Heimatsstätte verließen, um eine Irrfahrt nach dem Innern anzutreten. Im Ganzen zählte der erste Trupp ohne Nachzügler etwa 70 Wägen. Sie wollten von den schönen Weideplätzen der Damara’s Besitz ergreifen und im Falle eines Widerstandes die Damara’s aus ihrem Lande vertreiben. Schon auf der Strecke Krokodil-River — Schoschong hatten sie sehr an Wassernoth zu leiden und so große Schwierigkeiten, ihre Heerden weiter zu bringen, daß sie, in Schoschong angekommen, entschlossen waren, nach dem Limpopo zurückzukehren, um hier so lange zu verharren, bis häufige Regen auf der Strecke Schoschong-Damaraland gefallen wären. Unter der Voraussetzung, daß die Boers das nöthige Land von den Damara’s käuflich erstehen wollten, versprachen ihnen der König Khama der östlichen Bamangwato’s, sowie jener der westlichen Bamangwato’s freien Durchzug durch ihre Gebiete. Als dem Ersteren jedoch die Nachricht zu Ohren kam, daß sie im Nothfalle zu den Waffen greifen würden, zog er sein Versprechen zurück, da er eine Invasion seines eigenen Landes befürchtete. Auf dieses hin erklärten die Boers offen, daß sie im Falle anhaltender Dürre das Königreich der Zulumatabele erobern, andernfalls aber sich mit Waffengewalt ihren Weg durch das Land der östlichen Bamangwato bahnen würden.

Krokodile im Limpopo.
Ich nahm mir damals, nach den Diamantenfeldern zurückgekehrt (im Jahre 1877), die Freiheit, mich der Sache öffentlich anzunehmen um dem Bamangwatostamm und seinem edlen Herrscher einen Vernichtungskampf und den Holländern schwere Kämpfe zu ersparen und schloß den ersten der diesbezüglichen in den »Diamond News« am 24. März veröffentlichten Artikel mit den Worten. »Es wäre absurd, wenn Leute wie diese Boers, welche weder im Stande waren, den Fortschritt in ihrem Mutterlande zu begreifen, noch fähig ihm zu folgen, vielmehr auf jede noch so nützliche Neuerung mit Verachtung herabblickten, einen neuen Staat gründen wollten.«[4]
Zwei Monate später nachdem ich dies geschrieben, erhielt ich die Nachricht, daß sich die Boers die Freundschaft Khamanes, der bei Seschele wohnte und Khama feindlich gesinnt war, dadurch zu sichern gedachten, daß sie ihn zum Könige der Bamangwato’s erheben wollten. Als ihnen dies nicht gelang, trachteten sie auch Matscheng, den Onkel Khama’s, in ähnlicher, aber auch vergeblicher Weise, gegen diesen als Bundesgenossen zu gewinnen.
Im Jahre 1876, namentlich aber 1877, hatte sich die Lage der am Limpopo der Entscheidung harrenden Damara-Emigranten bedeutend verschlechtert, die Leute sprachen nicht mehr von einem gewaltsam erzwungenen Durchzuge, im Gegentheile wollten sie jedem Kampfe ausweichen, denn viele von ihnen waren fieberkrank geworden. Als das Fieber in ihren Reihen immer mehr um sich griff, entschlossen sie sich zum Aufbruche, sie ließen von Khama nochmals den freien Durchzug fordern und zogen unterdessen statt nach Schoschong nach dem Mahalapsiflusse, um den König Khama irrezuführen. Inzwischen hatte sich Khama auf einen möglicher Weise bevorstehenden Kampf mit den Boers vorbereitet. Seine Leute mußten sich auf dem freien Raum vor der Stadt täglich in der Führung der Waffen einüben, während er die vom Limpopo abziehenden Boers mit zahlreichen Kundschaftern umgab, um sich über jede ihrer Bewegungen zu orientiren. Die Nachrichten, die er erhielt, bestärkten ihn immer mehr und mehr in der Ueberzeugung, daß ihm die Weißen in keiner Weise gewachsen seien. Manch’ anderer Eingebornenfürst Süd-Afrika’s hätte aus der schlimmen Lage derselben Nutzen geschöpft und wäre über die durch Krankheiten und Entbehrungen im Widerstande geschwächten, jedoch noch immer wohlhabenden Herdenbesitzer hergefallen. Khama jedoch sandte den Missionär Rev. Hephrun an den Mahalapsi, um sich über die hilflose Lage der Abenteurer zu vergewissern. Als ihm der Prediger nach seiner Rückkunft ihre Lage schilderte, gestattete ihnen Khama sofort freien Durchzug. Die Emigranten waren seit 1875 derart herabgekommen, daß sie nicht nur an keinen Kampf mit den Bamangwato’s denken konnten, sondern Khama selbst die Befürchtung hegte, daß sie kaum im Stande sein würden, in ihrem hilflosen Zustande den Zuga-River zu erreichen. Bald nachdem sie Schoschong verlassen und ihren Zug nach Nordwest angetreten hatten, mehrten sich täglich und stündlich ihre Mühsale. Der erste Theil der Strecke Schoschong — Zuga-River ist ein einziger tiefsandiger Wald (von den holländischen Jägern gewöhnlich das Durstland genannt) und besitzt nur fünf Wasserstellen, wie den Letlotsespruit, die Wasserlöcher von Kanne, Lothlakane, Nehokotsa etc., an denen man Thiere tränken kann. Die meisten dieser Stellen sind im Sande oder ausgetrockneten Flußbetten gegrabene Löcher, welche es kaum gestatten, ein Gespann Ochsen auf einmal zu tränken; Abends aufgegraben, liefern sie am nächsten Tage einige Eimer Wasser, woher sollten die Emigranten das nöthige Wasser für ihre nach Tausenden zählende Rinder- und Schafheerde nehmen. So geschah es, daß die Thiere durch Durst förmlich außer sich, truppweise davonliefen und die Boers in elendem Zustande am Zuga anlangten.
Die Noth an Dienern machte sich bei den Leuten sehr fühlbar, ich sah oft Kinder die Leitochsen führen und Frauen, hier die Gattin, dort die Tochter, die riesige Peitsche schwingen. Nach und nach durch Krankheit decimirt und nachdem sie etwa 50 Percent ihrer Habe eingebüßt, langten die Emigranten am N’gami-See an. Von da begann ein neuer beschwerlicher Zug durch das Land der westlichen Bamangwato. Eine kleine Anzahl von Familien, deren meiste Mitglieder am Fieber darniederlagen und zahlreiche Waisen erreichten das Damaraland. Während meines Aufenthaltes in London im Jahre 1880 erfuhr ich, daß die Ueberlebenden jener bedauernswerthen Leute von allen Mitteln derart entblößt ankamen, daß ihnen die englische Regierung durch freiwillige Gaben der opferwilligen, englischen und holländischen Bevölkerung der Capstadt und anderer südafrikanischer Städte, an Kleidung und Nahrung etc. unterstützt, mehrere Sendungen per Dampfer via Walfischbai zugemittelt hatte. So endete der Versuch jener starrköpfigen Menschen, die, sich gegen jeden Fortschritt auflehnend, aus Nationalhaß und Unwissenheit mit offenen Augen ihrem Verderben entgegen eilten.
Bevor ich noch den Notuany erreicht hatte, konnte ich wahrnehmen, daß das Wild, welches während meiner zweiten Reise die Ufer des Limpopo so dicht bevölkert hatte, durch das unausgesetzte Jagen von Seite der Emigranten decimirt war. Ich fand nur Hippopotamus- und in einem dichten Gebüsch einige Giraffenspuren und diese führten in einem engen Fußpfade zum Flusse herab; doch hatte ich keine Muße den Giraffen zu folgen und wollte sie auch den Boers nicht verrathen.
Auf einem dem Ufer entlang unternommenen Ausfluge schwebte ich in Lebensgefahr. Wir folgten einer größeren Kette Perlhühner, die Thiere liefen vor uns her, nur zeitweilig erhob sich eines, um sich nach uns umzusehen; so kamen wir auf eine unseren Weg kreuzende, über und über mit Gras überwucherte, etwa 12 Fuß tiefe und etwas breitere Regenschlucht, ich machte den mir unmittelbar folgenden Th. auf sie aufmerksam und stieg herab, um sie zu durchschreiten, mein Genosse hatte jedoch meine Warnung nicht gehört, sondern seine ganze Aufmerksamkeit auf die vor uns herlaufenden Perlhühner gerichtet und hielt den Sniderstutzen schußbereit in der Hand. Bei dem Sturze in die Tiefe der Schlucht fiel er nach vorne, wobei der Finger unwillkürlich den Drücker berührt haben mußte, denn die Kugel streifte meinen Nacken; zwei Centimeter mehr nach vorne gesenkt, hätte sie mir das Lebenslicht ausgeblasen.
Am Notuany schlug ich für einige Tage mein Lager auf, um mich der Durchforschung der nächsten Umgebung zu widmen. Mein erster Ausflug galt dem südlichen Winkel an der Mündung des letzteren Flusses in den Limpopo. Hier, im Schatten riesiger Mimosen, fand ich während meiner zweite Reise zahlreiches Hoch- und Niederwild, diesmal spähte ich lange vergebens nach Beute, bis endlich eine Gazelle aus dem hohen Ufergras vor mir aufsprang. Ein wohlgezielter Schuß aus dem nur mit Hasenschrot geladenen Gewehre hemmte für immer ihre zierlichen Sprünge. Einige in dem Walde wohnende Masarwa’s — Seschele’s Vasallen — brachten uns Pallahfelle zum Verkauf, die ich auch erstand.
Die Ufer am unteren Marico und dem Limpopo bestanden aus Granit, Gneis, grauem und röthlichem Sandstein, der letztere oft mit zahlreichen eingeschlossenen Kieseln und dann zuweilen recht groteske Hügelformen, wie eine am Ufer des letztgenannten Stromes den »Cardinalshut« bildend; stellenweise gesellt sich Grünstein und eisenhaltiger Kalkschiefer hinzu. Den ersten oberhalb seiner Mündung in den Limpopo in den Notuany einmündenden Spruit nannte ich Purkyne’s Spruit. Die stärksten unter den Mimosen, auf denen ich hie und da Geiernester bemerkte und die sonst der Aufenthalt zahlreicher Vogelarten (Bubo Vereauxii und maculosus, Psittacus, Coracias caudata und nuchalis etc. etc.) waren, hatten einen Umfang bis zu zehn Fuß.
Gegen meine zuerst gefaßte Absicht verließ ich den Notuany schon am 12. und zog das Limpopothal weiter abwärts. Da jedoch die Gegend meinen Sammlungen viele und schöne Acquisitionen versprach, hielt ich schon nach einer Tour von vier Meilen inne. Auf einem am 14. unternommenen Ausfluge vermehrte sich meine Sammlung um zwei Cercopithecus, einen Sciurus, zwei Perlhühner und zwei Francolinusbälge. An einem der erlegten Affen, einem ausgewachsenen Männchen, fielen mir einige krankhafte Auswüchse auf, die dem Thiere in Form von großen Geschwüren sein Dasein recht unangenehm gemacht haben mußten. Aus den Fluthen des Limpopo sah ich fast nach jeden 100 Schritten den Körper eines erwachsenen Krokodils auftauchen, und ebenso rasch verschwinden.
Am folgenden Tage verließ ich den Limpopo, um die bewaldeten, auf dem südlichen Abhange tiefsandigen, auf dem nördlichen felsigen Höhen zu überschreiten und in das Thal des Sirorume zu gelangen. Niger machte sich hier das Vergnügen, zwei über den Weg nach links laufende gefleckte Hyänen zu jagen, ohne die unbeholfenen Thiere einholen zu können. Gegen Mittag langten wir bei der schon erwähnten Lache auf dem Gipfel der Erhebung an und begannen am Nachmittage dieselbe gegen den Sirorume hinabzufahren. Die Benennung der nun erreichten Gegend als Buffadder-Gebiet zeigte sich auch diesmal richtig, unmittelbar am Wege fanden wir zwei zusammengerollte Schlangen, welche wir erlegten. Nach Trinkwasser fahndend, kam ich, einem schon früher benützten Masarwapfade folgend, zu einem etwa zehn Fuß tiefen, kleinen Loch, aus dem mir Wasser entgegenblinkte. Ich band meinen Hut an den Gewehrriemen, um das ersehnte Naß herauszuschöpfen; als meine Schöpfkanne beinahe den Wasserspiegel erreicht hatte, sah ich einen schimmernden Gegenstand theilweise am, theilweise über dem Wasser glänzen; den Gegenstand näher beobachtend, erkannte ich eine Buffadder, die sich vergebens bemühte, aus diesem Gefängnisse zu entschlüpfen. Ebenso häufig wie die Buffadderschlangen sind im Sirorumethale Leopardenspuren. Dichte Dorngebüsche, zerklüftete höhlenreiche Felsen an den Thalabhängen bieten hier dieser Wildkatze die gewünschten Schlupfwinkel.
Auf der Fahrt am nächsten Morgen fand ich am Sirorume einen Bamangwato-Posten. Sekhomo, der frühere Bamangwato-König, hielt hier keinen, da er nicht hinreichend Leute zur Verfügung hatte, darum sah auch zu jener Zeit Seschele diese Gegend als seinen Jagdgrund an. Die Gegend war von Giraffen, Kudu’s, Hartebeest- und Eland-Antilopen, sowie von Gazellen und Wildschweinen, doch auch zahlreich von Hyänen und Schakalen bevölkert.
Am 17. erreichte ich Khama’s Salzsee, an welchem ich die durstigen Zugthiere zu den Felsencisternen führen und tränken ließ. Von einigen herbeieilenden Bamangwato’s und Makalahari erhandelte ich einige Curiositäten, darunter auch ein Schlachtbeil. An meinem Wege fand ich Hornvipern (Giftschlangen), welche jedoch so gnädig sind, den ahnungslos sich ihnen nähernden Menschen durch ein lautes Pfauchen zu warnen. Gegen Abend kamen fünf Makalaka’s, wahre Hünengestalten, an den Wagen, um sich mir als Diener zu verdingen; da ich den Charakter dieses Stammes zu wohl kannte, ging ich auf ihr Ansuchen nicht ein.
Ich verließ am 19. Khama’s Salzsee und langte spät in der Nacht in Schoschong, der Residenz Khama’s, an; ich fand die Stadt sehr verändert. Nach seinem Siege hatte sie Khama angezündet, etwas mehr zusammengedrängt und näher der Mündung der Schoschonschlucht in das Franz Josefs-Thal erbaut, wodurch die Gehöfte der Weißen isolirt wurden. Das Wiedersehen mit Rev. Mackenzie war ein sehr herzliches, mein Freund lud mich wieder ein, für die Zeit meines Aufenthaltes, den ich auf 14 Tage bemessen hatte, sein Gast zu sein.
[4] Diese Boers dürfen keinesfalls mit ihren gebildeten Stammesgenossen in Süd-Afrika verwechselt werden.
Geschichte der letzten Kämpfe zwischen Sekhomo und Khama. — Erosions-Erscheinungen im Lualabette. — Die Maque-Ebene. — Frost. — Wilde Strauße am Wagen. — Jagdverbot des Königs Khama. — Eland-Antilopen. — Die ersten Palmen. — Wildpfade und Fall-Assagaien an den Nokane-Quellen. — Im Gebiete der großen Salzseen. — Die Tsitani- und Karri-Karri-Pfanne. — Am Tschaneng-Flusse. — Matabele am Wagen. — Die Salzlager am Nata-Spruit. — Jagd auf Zulu-Hartebeeste. — Auf dem Anstande auf Löwen. — Thierleben am Nata-Spruit.
Die Veränderungen im öffentlichen Leben und in den socialen Zuständen der Bamangwato’s seit meinem ersten Besuche der Stadt waren mir sofort aufgefallen. Damals war Sekhomo, das verkörperte Hinderniß jedweder Neuerungen, welche als Wohlthaten der Civilisation betrachtet werden können, ein unermüdlicher Priester in der Pflege heidnischer Gebräuche und Orgien, am Ruder; jetzt war es Khama, sein ältester Sohn, gerade das Gegentheil seines Vaters. Da mit Khama der größte Theil derer, die ihm in seine freiwillige Verbannung gefolgt waren, zurückkehrte, und da sich ihm die meisten der unter Sekhomo hier lebenden Bamangwato’s unterwarfen, zählte die Stadt gegenwärtig dreimal so viel Bewohner als zur Zeit meines ersten Besuches. Eine größere Ordnung und Sicherheit machte sich in Allem und Jedem bemerklich und mit dem Verbote des Branntwein-Verkaufes hatte Khama eines der wichtigen Beförderungsmittel des Müßigganges und des Unfriedens außer Wirkung gesetzt. Er war aber auch bestrebt, nach und nach allen den Sitten schädlichen, sowie den Geist umnachtenden heidnischen Gebräuchen Einhalt zu thun.
Am 21. besuchte ich mehrere kranke Eingeborne in der Stadt, darunter einen von Khama’s Kriegern, dem das eine Schienbein durch eine Kugel zersplittert worden war.[5] Ich besuchte Khama während meines Aufenthaltes in Gesellschaft des Herrn Mackenzie mehrmals, und hatte Gelegenheit, immer mehr und mehr den lobenswerthen Charakter dieses Mannes kennen zu lernen. Ausflüge in die nächste Umgegend, die Bearbeitung meiner Routen-Aufnahmen von Linokana nach Schoschong sowie die ärztliche Praxis, in welcher ich durch Herrn Mackenzie und Hephrun bei der Pflege der kranken Schwarzen unterstützt wurde, füllten die Tage meines Aufenthaltes aus. König Khama war so gütig, mir einen Diener aus dem Trosse seiner Leibdiener, einen Mann, der mich bis an den Zambesistrom begleiten sollte, zu versprechen. Dieser Eingeborne sollte auch, wenn ich nach der Westküste oder nach Norden weiterziehen sollte, meinen Wagen mit den bis an den Zambesi gesammelten Objecten nach Schoschong zurückbringen, als Lohn sollte ich dem Manne eine Muskete geben. Freund Mackenzie beschenkte mich mit zwei schönen, von den Maschona’s gearbeiteten Holztöpfen, Rev. Hephrun mit zwei Unzen Chinin.
Am 27. brachte mir Khama den versprochenen Diener und hielt ihm in meiner Gegenwart eine Rede, welche mit den folgenden Worten schloß. »Dein neuer Herr ist ein Mann, und daß er ein Njaka (Doctor) ist, das hab’ ich Dir schon erklärt.«
Auf meinen in Gesellschaft Rev. Mackenzie’s unternommenen Ausflügen zeigte mir dieser alle jene Stellen, welche in der Geschichte der Bamangwato’s durch die letzten Kämpfe zwischen Khama und Sekhomo Bedeutung erlangt hatten. Die folgenden Zeilen mögen meine gelegentlich der Schilderungen meines ersten Aufenthaltes in Schoschong angeführten Mitteilungen ergänzen. Ich erwähnte am Schlusse derselben, daß Khama Schoschong verlassen, und ihm der größte Theil der Bamangwato’s in diese freiwillige Verbannung an den Zuga-River gefolgt war, als jedoch Khama sah, daß das Fieber seine Leute in dem Sumpflande decimire, entschloß er sich, nach Schoschong zurückzukehren, und sich zu seinem Rechte zu verhelfen, wohl nicht heimlich seinen Vater und Bruder zu überfallen, sondern diesen offen sein Kommen anzuzeigen; er that dies auch und bezeichnete den Tag seiner Ankunft. Er drang von Nordwesten über die Bamangwatohöhen vor, um die die Stadt beherrschenden und die Schoschonschlucht bildenden Felsenabhänge zu gewinnen. Sekhomo hatte seine Leute getheilt, um mit der schwächeren Abtheilung die Stadt zu vertheidigen, während er die größere auf den Höhen postirte, um Khama an seinem Vorhaben zu hindern; durch den Zuzug der Bewohner der im oberen Thale des Schoschon gelegenen Makalakadörfer verstärkt, hatte Sekhomo eine Khama’s Truppen ebenbürtige Anzahl von Kriegern. So wie in den früheren Kämpfen bewiesen sich diese Makalaka’s, die sich aus dem Matabelelande hierher geflüchtet hatten, auch in diesem Kampfe äußerst unverläßlich und verrätherisch, sie waren diesmal Sekhomo’s wirkliche Bundesgenossen, allein sie hatten auch Khama, den ankommenden Königssohn, ihrer Hilfe und Freundschaft versichert und sandten ihm die Nachricht, daß sie ihn an der Schoschonkluft erwarten würden. Khama schlug die sich ihm entgegenstellenden Krieger Sekhomo’s so rasch, daß diese versprengt den Rückzug nach der Stadt nicht mehr einschlagen konnten, und da bald darauf der seinen Sieg möglichst rasch ausnützende Feldherr mit der Vorhut auf dem Plateau erschien, auf welchem die Makalaka’s Posto gefaßt hatten, glaubten diese, daß es ihm in dem Kampfe schlecht ergangen und er besiegt sei, und diese Richtung blos aus dem Grunde eingeschlagen habe, um den Versuch zu machen, sich der in der Schoschonkluft verborgenen Viehheerden zu bemächtigen. Während sich nun seine Leute vertrauensvoll den Makalaka’s näherten, eröffneten diese auf die Ankommenden ein heftiges Feuer. Dies machte die Bamangwato’s so wüthend, daß die der Vorhut rasch folgende Haupttruppe nur ein einziges Mal ihre Musketen auf sie feuerte, dann aber auf sie losstürzte, und die meisten mit dem Kolben erschlug.
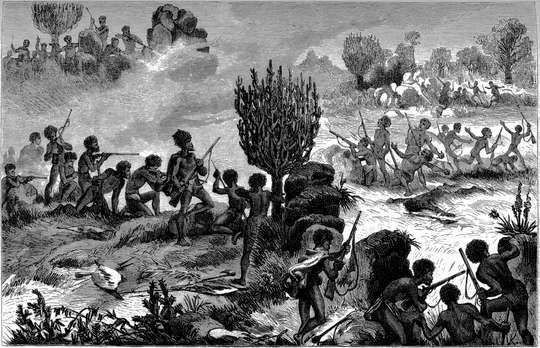
Kampfesscene auf den Bamangwatohöhen.
Ich ließ bei Herrn Mackenzie eine Kiste mit gesammelten Gegenständen zurück sowie Briefe, die er den Herrn Jensen nach Linokana abzusenden versprach, auch wollte er mir etwaige mit der Kaffernpost angekommene Briefe durch Eingeborene oder nach den Zambesi-Gegenden reisende Elfenbeinhändler nachsenden. Während meines Aufenthaltes in Schoschong langte hier eine Gesandtschaft, geführt von Kosi Lintschi, von Rechtswegen dem eigentlichen Bakwena-Thronerben an. Er kam im Namen Sekhomo’s, der sich zu Seschele geflüchtet, um von Khama Sekhomo’s Mutter zu erbitten, zu gleicher Zeit kam aus dem Matabele-Lande die Nachricht daß die Matabele-Zulus einen erfolgreichen Angriff auf die Maschonas ausgeführt hatten.
Herr Mackenzie hielt in einem von ihm selbst aufgeführten Gebäude neben seiner Wohnung durch fünf Stunden Schule, und zwar waren es schon Männer, »Seminaristen«, verschiedenen Betschuanastämmen angehörend, die er belehrte; einige dieser Männer hatten auch zwei Jahre später unter der Anleitung des Rev. Hebern eine Missionsstation auf Wunsch der Eingebornen-Bevölkerung am N’gami-See errichtet.
Hatten wir während unseres ersten Aufenthaltes in Schoschong über fortwährenden Regen, so hatten wir diesmal über anhaltende Dürre zu klagen, in Folge welcher meine Zugthiere etwas abgemagert waren. Am 4. Juni verließ ich Schoschong, um meine Reise nach dem Zambesi anzutreten. Im Franz Josefsthale aufwärts ziehend, schlugen wir am folgenden Tage eine nördliche Richtung ein und überschritten den Unicornpaß und gewannen, nachdem wir das Unicornthal passirt, die Hochebene. Die Scenerie im Unicornthale ist eine sehr anziehende, isolirte Felsenhügel, welche eine baumförmige, armleuchterförmig sich verzweigende Euphorbiacea in ziemlich dichten Beständen schmückt, verengen ab und zu das Thal. Vor wenigen Tagen hatte sich hier eine kleine Episode zugetragen, deren Lösung Khama zur Ehre gereichte; einem Elephantenjäger war durch die umwohnenden Bamangwato’s ein Zugthier entwendet worden, der Spur der Diebe folgend, war der nach Schoschong zurückkehrende Jäger im Stande, dem Könige den Wohnort der Diebe zu bezeichnen. Der König ließ diese vor sich bringen und befahl den Dieben, nicht allein den Schaden sofort zu ersetzen, sondern dem Bestohlenen für die erlittene Verzögerung der Reise zwei Ziegen zu übergeben.
Die Reise am 6. führte über ein tiefsandiges, waldiges Hochplateau, spät Abends gelangten wir zum Letlotsespruit und lagerten nahe an dem Falle dieses Spruit, der jedoch nur nach heftigem Regen sichtbar ist und dessen Wasser dann über die Granitblöcke herabstürzt; die anliegenden Höhen, von zahlreichem Niederwild belebt, zeigten in ihren obersten Lagen rothen Sandsteinschiefer, darunter Quarzit, schwarzen Kieselschiefer, und in den tiefsten Lagen Granit. Die Wasserlöcher von Kanne waren das Ziel des nächsten Tagesmarsches. In einem Halbbogen zur Rechten erheben sich mehr denn dreißig kegelförmige Höhenkuppen, welche die Bamangwato- mit den Serotlehöhen verbinden. In der Nähe dieser Wasserlöcher befand sich ein Viehposten, dessen Bewohner bei unserer Annäherung rasch ihr Vieh zum Wasser trieben, um es zu tränken, so daß wir keines mehr vorfanden und die Löcher neu ausgraben mußten. Am 8. gelangte ich bis zu dem Thale des Luala-Spruits, dessen Vegetation und nächste Umgebung ein anmuthiges Landschaftsbild gewährt. Besonderes Interesse erregen die Gebirgsformation und die Erosions-Erscheinungen im Flußbette. Hier waren es Grotten und Höhlen, dort Nischen, Bassins oder gothische Gewölbe, welche das Wasser, obwohl nur kurze Zeit hindurch im Jahre fließend, im Lualabette ausgewaschen hatte. An der sehr tiefen und schwierig passirbaren Furth traf ich zwei Elfenbeinhändler an, von welchen der eine, Herr Anderson, dem Namen nach als ein ehemaliger Gold-Digger bekannt war. Sie lagen seit einigen Tagen hier, um durch ihre Diener die Gegend bis an die Maque-Ebene, die ihnen als wasserlos geschildert wurde, auszukundschaften. Der Luala wie seine Nebenflüsse waren alle trocken und man mußte allmälig eine Stelle in dem humusreichen Bette ausgraben, um Wasser gewinnen zu können. Nach den Mittheilungen der von Herrn Anderson ausgesendeten Boten hatten wir zwei Tage und zwei Nächte zur nächsten Wasserstelle zurückzulegen, ich ließ deshalb mit Rücksicht darauf unsere Speisen für die nächsten zwei Tage hier zubereiten, um an Wasser zu sparen. Da sich Herr Anderson erbot, mir Gesellschaft zu leisten, so nahmen wir uns vor, die Reise bis an die Salzseen gemeinschaftlich zu machen.
Am 10. zog ich das Hauptthal des Flüßchens hinauf und gelangte Abends zu dem bewaldeten tiefsandigen Hochplateau, welches etwa 30 englische Meilen lang, einen Theil des südlichen Durstlandes bildet. Bei der Wasserlosigkeit der zu durchziehenden Gegend, empfahl es sich so rasch als möglich vorwärts zu kommen, weshalb wir auch bis in die finstere Nacht unsere Fahrt fortsetzten, einige Stunden ausruhten und mit anbrechender Morgendämmerung die Fahrt bis in die späten Vormittagsstunden fortsetzten. Nach einer fünf- bis sechsstündigen Rast während der heißesten Tageszeit brachen wir neuerdings auf. Diese Art und Weise des Reisens ist in den wasserarmen, tiefsandigen, bewaldeten Gegenden dringendst geboten. Das enge Weggeleise, der schlangenförmig sich hin- und herwindende Weg, die wasserarme Gegend und die Anstrengung der Zugthiere in dem tiefen Sande machen das Reisen zur heißen Tageszeit vollkommen unmöglich. Abends hatten wir die von Mapanibäumen bewachsene Tiefebene von Maque erreicht und fanden überall zahlreiche Spuren des gestreiften Gnus, der Zebras, der Giraffen, und selbst im Weggeleise äußerst zahlreiche Löwenspuren. Wir stießen auch auf einige Masarwa’s, welche uns jedoch ein einige Meilen zur Rechten vom Wege liegendes Sumpfwasser zu zeigen verweigerten, da sie die ihnen in diesem Falle drohende Züchtigung durch die Bamangwato’s fürchteten. Die gesammte Maque-Ebene, nach Westen von Tafelbergen begrenzt und nach Norden gegen das Salzseen-Bassin abfallend, ist ein einziger Humusboden, der in der nassen Jahreszeit gänzlich aufgeweicht, in der Trockenzeit durch seine Dürre das Reisen unendlich erschwert. Unter den Händen eines europäischen Landwirths würden die gegenwärtig noch Jagdgründe der Bamangwato’s bildenden Flächen dieser Ebene bald von Weizen- und Baumwollpflanzungen bedeckt sein.
Mit gänzlich erschöpften Zugthieren gelangten wir endlich am folgenden Abende zu den gesuchten Wasserlöchern, an denen bereits die Händler vor mir angekommen waren. Am folgenden Tage holte uns ein Bote des Königs Khama hier ein, welcher den Auftrag hatte, die Bamangwato-Gehöfte auf dieser Strecke zu besuchen und den Insassen derselben den Befehl des Königs bekannt zu geben, unter keiner Bedingung einem Jäger einen längeren als dreitägigen Aufenthalt an einem Gewässer zu gestatten. Dieser Befehl wurde durch die Handlungsweise der holländischen Jäger veranlaßt, welche in übermüthiger Weise alles Wild, dessen sie nur habhaft werden konnten, des Felles halber erlegten und das Fleisch den Geiern zum Fraße überließen. Obgleich wir keine Jäger waren, kam uns dieser Zwischenfall sehr ungelegen, da die Eingebornen uns für solche hielten und ihr Benehmen ziemlich unangenehm wurde. Die Stelle, an der wir eben gelagert hatten, war erst vor etwa zwei Monaten von den Boers verlassen worden, wir fanden auch den gabelförmigen Schleifschlitten, mit dem sie das geschossene Wild zu ihren Wägen herbeischleppten.
Nördlich der Maque-Ebene treten Boas häufiger auf, während sie in Natal keine Seltenheit sind und auf den Höhen der südlichen Betschuanaländer nur stellenweise und vereinzelt angetroffen werden. Mit dem Mapanibaum, dessen Blätter sich durch ihre Oelhaltigkeit, dessen Stamm sich durch die Porosität des Holzes und Brüchigkeit auszeichnet, treten in der Flora auch andere, den tropischen genäherte Pflanzenarten und Formen auf, doch ist die Winterkälte hier noch immer recht empfindlich, wenn auch nicht in dem Maße wie am Vaal- und Oranje-River, zudem liegt die Maque-Ebene etwa 1200 Fuß tiefer als jene Hochebene an den genannten Flüssen. Am Morgen des 14. waren die Löcher mit einer über 1 Cm. starken Eisdecke überspannt.
Am Nachmittage des 13., als ich eben einige hundert Schritte vom Wagen entfernt, in einem dichten Gebüsch eine Boa verfolgte, entstand am Wagen ein Geschrei, das mich zur Umkehr bewog. Ich fand Anderson in nicht geringer Aufregung. Ueber den Grund derselben befragt, theilte mir der Jäger mit, daß eben eine Heerde wilder Strauße im vollen Laufe auf die Lachen zur Tränke herangestürmt sei, daß die Thiere jedoch durch die Wägen erschreckt, sich in den nahen Mimosenwald geworfen hätten und nun von den Wagenlenkern und den übrigen Dienern verfolgt würden. — Nach einer halben Stunde kehrten diese abgehetzt und abgemüdet zurück, ohne einem Strauß auch nur auf Schußweite nahegekommen zu sein.
Den zum Wagen rückkehrenden Dienern folgte bald eine Schaar von Eingebornen nach und eröffneten eine überlaute Discussion mit uns. Sie erklärten, daß wir keine friedlichen Reisenden, sondern Jäger wie die Boers wären, die kein Wild verschonen, denn kaum hätten wir die Strauße gesehen, als wir ihnen auch schon nachstellten. Schließlich drängten sie zur baldigsten Abreise und wollten von einer Fristerstreckung nichts wissen.
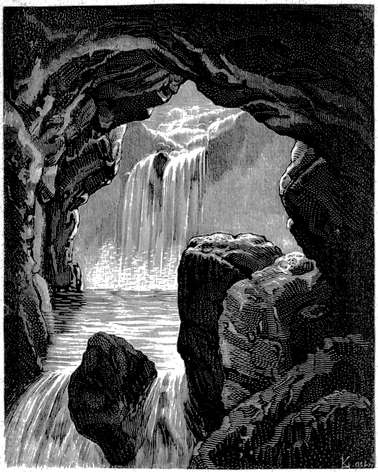
Das Lualabett.
An diesen Maque-Lachen hatten sich in den letzten Jahren vor meiner Ankunft einige interessante Löwenabenteuer zugetragen, von denen ich eines im weiteren Verlaufe meiner Reiseschilderung wiedergeben will. Wir verließen am folgenden Morgen die Lachen und zogen in Gesellschaft Andersons in nördlicher Richtung, in welcher eine von den Boers »Bergfontein« benannte Quelle in 65 bis 71 Meilen Entfernung liegen sollte. Hochbegraste und bebuschte Lichtungen wechselten auf dieser wasserlosen Strecke mit lichten Mapaniwäldern ab, zahlreiche den Weg kreuzende Spuren zeugten für den Wildreichthum der Gegend. Während des Marsches wurden wir von zahlreichen Eingebornen eingeholt, welche mit Assagaien bewaffnet (es waren Makalahari’s und Masarwa’s) auf die Elandsjagd ausgezogen waren.
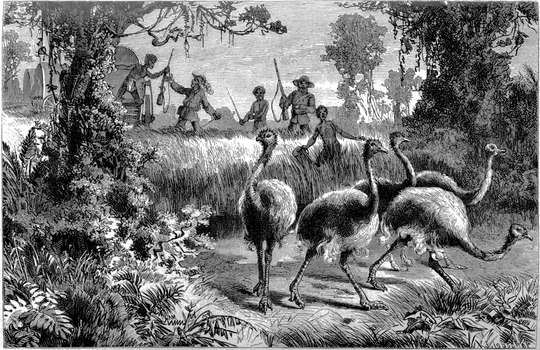
Straußenheerde am Wagen.
Von allen Antilopen ist das Eland die wohlgenährteste, namentlich die Stiere, deren Herz in einem bis zu 25 Pfund schweren Fettsack eingebettet ist, der sie an schneller Flucht hindert. Die Thiere werden so kurzathmig, daß sie von den behenden Masarwa’s im vollen Lauf eingeholt und gespeert werden. Die Nachfolgenden stoßen ihm die Assagaie von rechts und links in die Brusthöhle, um die Lungen oder das Herz zu verletzen. Berittene Jäger (Holländer und Engländer) jagen die Elande (auch die Giraffen) bis an den Wagen heran, um sie erst hier niederzuschießen und sich so den Transport des Fleisches und Felles zum Wagen zu ersparen. Nach den Berichten der Eingebornen und Jäger glaube ich, daß man ohne Schwierigkeiten das Eland zähmen und zum Tragen und Ziehen kleiner Lasten verwenden könnte.
Am selben Tage stießen wir auf zwei mit Musketen bewaffnete und von fünf Masarwa’s begleitete Bamangwato’s, welche zwei mit Fleisch beladene Ochsen vor sich hertrieben; jeder der Masarwa’s trug etwa 50 bis 60 Pfund Fleisch. Die Leute gingen nach Schoschong, um sich von Khama Verhaltungsmaßregeln geben zu lassen, da ein Theil der aus dem Reiche ob ihrer verrätherischen Handlungsweise verbannten Makalaka sich im nördlichen Bamangwato-Lande umhertrieb, von den Masarwa’s bedienen ließ und dieselben an jeder Dienstleistung für ihre Herren (die Bamangwato’s) hinderte.
Am 17. Früh gelangte ich nach Bergfontein, einer an einem bewaldeten Abhange liegenden, von den Eingebornen als jene des zur Regenzeit nach Norden fließenden Nokaneflüßchens angesehene Quelle. Der Abhang, ein zerklüftetes, dicht bebuschtes und von üppiger Vegetation bedecktes Hügelland ist der Abfall der Maque-Ebene zu den Lachen der großen Salzseen. Dicht bei einander stehende Fächerpalmen grüßen etwas abseits vom Ufer des Nokane-Spruit den vom Süden kommenden Wanderer und bereiten ihn, der noch nie die Wunder der tropischen Pflanzenwelt erschaut, auf jene vor; die Gebüsche und Bäume der ganzen Gegend hoch überragend, sind sie vielleicht die südlichsten Repräsentanten der Königin der Palmen im centralen Südafrika. Da sie eben reiche Früchte trugen, schoß ich mir einige herab, um sie meiner Sammlung einzuverleiben. Um die vier schlanken, von den schönsten Kronen geschmückten Stämme wucherte reichliches Palmengebüsch, welches aus den herabgefallenen Früchten emporgekeimt war. Schon an diesen waren die Blätter riesig groß und und begannen sich fächerförmig zu entfalten. In einem kahlen, seichten, doch breiten, über eine allmälig abfallende Felsenwand sich hinziehenden Spruitbette fand ich einen Strauch, der mich an die baobabartigen erinnerte. Der untere Theil des etwa 4 bis 5 Fuß hohen Strauches war unförmlich verdickt, bis zu 40 Zoll stark und fleischig, von einer gelblichen Rinde bedeckt, etwa 1 bis 1½ Fuß über dem Boden verengte er sich zu 2 bis 3 Zoll dünnen Aestchen, gleich Fortsätzen, die einer fleischigen, oberflächlichen Wurzel entsteigen. Manche dieser Stöcke waren mehrere Centner schwer und ich hoffe einen oder zwei das nächste Mal fortbringen zu können.
Von den am Maque und hier ansässigen Makalahari’s und Masarwa’s erstand ich einige aus Holz und Bein gefertigte Schmucksachen und Utensilien, die ich jedoch später durch einen Unfall einbüßte. Die einzelnen Höhen des Hügellandes sind dicht bewaldet, durch den Wald führen nur äußerst wenige Wege und dies meist Wildpfade nach der Nokanequelle. Diese wenigen Pfade macht sich nächtlich das Wild, aber auch die in der Nähe wohnenden Eingebornen zu Nutzen, indem sie vergiftete Fall-Assagaien über diesen Pfaden aufhängen. Rechts und links von dem betreffenden Baume wird das Gestrüpp flügelartig aufgeschüttet, um die in dem Pfade oder nahe an demselben schreitenden Kudu’s zum Einhalten desselben zu zwingen. Einen Fuß über dem Boden wird quer über den Pfad eine Grasschnur gezogen, welche an einem Holzpflöckchen, doch nur so lose befestigt ist, daß sie sich bei einem mäßigen Rucke von demselben loslöst. Am gegenüberliegenden Pfadrande stehen zwei Holzstäbchen, mit einem Querstäbchen verbunden. Die Schnur führt unter diesem hindurch und wird so in ihrer horizontalen Lage erhalten und dann empor zu den ersten über den Weg reichenden Queraste geführt, von dem sie mit dem Fallassagai beschwert, über dem Pfade und senkrecht über der darüber ausgespannten Schnur herabhängt. Die Waffe ist im Allgemeinen sehr roh gearbeitet und besteht aus einem drei bis vier Fuß langen, ungeglätteten, schweren und armdicken Holzstücke, in welches eine stumpfe, kaum zwölf Zoll lange, rostige mit Gift getränkte Eisenwaffe eingelassen ist. Die Waffe verwundet das Thier am Nacken nur leicht, das Gift wirkt rasch, trotzdem wird das Fleisch von den Eingebornen benützt indem sie das die Wunde umgebende Fleischstück ausschneiden. Die Pfade werden von den Jägern zu bestimmten Zeiten, in denen das Wild in den Wintermonaten häufiger das Wasser aufsucht, abgesucht, um so rasch wie möglich nach dem Eindringen der vergifteten Waffe der Beute habhaft zu werden. Andersons Genosse war bei der Verfolgung einiger Kudu’s auf einen solchen Pfad gerathen und in demselben fortgestürmt, als ihn sein ihm unmittelbar folgender Diener noch rechtzeitig auf die drohende Gefahr aufmerksam machte. Ich selbst fand mehrere Wege in der Nähe des Wassers in dieser Weise abgesperrt.
Am Nachmittage zog ich in Gemeinschaft mit den beiden Elfenbeinhändlern nach Norden bergabwärts, mehrmals den Nokane und später zwei andere trockene Spruits kreuzend. In dem dichten Grase der Thäler beobachtete ich ungewöhnlich entwickelte hohe Aloë-Pflanzen und zahlreiche Tigerschnecken.
Am 18. Früh langten wir am Südostufer eines Salzsees an, der den südlichsten (auf meiner Tour) von einer Unzahl von kleineren, und den kleinsten von drei riesigen Salzseen bildete. Diesen nach Westen unabsehbaren Salzsee durchschritt ich an seiner größten Ausdehnung von Süden nach Norden an seinem Ostufer in zwei Stunden. Er stellte eine gleichmäßig seichte, kaum zwei Fuß tiefe, weißlichgraue, von steifem Salzgras umrahmte und von dichtem Waldgebüsch umschlossene Fläche dar, welche kaum einmal im Jahre mit Wasser vollgefüllt ist. Um ihn herum, hauptsächlich jedoch im Bereiche des Grases befinden sich zahllose kleinere, ebenso seichte Salzlachen. Von allen Seiten strömen Regenflüsse nach heftigen Regengüssen ein, die jedoch in der Regel nicht bis in den Salzsee einmünden, sondern vertieft mit einem um drei bis sechs Fuß tieferem Bette nahe am Ufer desselben stagniren. Das von ihnen geführte Wasser tritt über und füllt in dieser Weise den See. Dieser südlichste Salzsee heißt Tsitani, ebenso der bedeutendste Fluß an seinem Ostufer und die Höhe zu unserer Linken, durch welche der Abfall des Hochplateaus nach dem Salzseebecken als zungenförmiger Ausläufer markant hervortrat. Ein großer Theil des Bodens am Grunde der Salzseen ist von einer Felsenplatte gebildet, die theils von dem durch die Regenzuflüsse angeschwemmten Erdreich überlagert ist, oder frei und nackt da liegt. Während der Aufnahme der Breite des Salzsees in seinem östlichen Theile, stieß ich auf eine Heerde gestreifter Gnu’s, leider ohne eines der Thiere habhaft werden zu können. An dem salzigen Gewässer des Flusses Tsitani (es fanden sich noch einige Lachen davon an seiner Mündung) traf ich ziemlich häufig Löffelreiher und Enten. Unter dem übrigen Wildgeflügel sah ich nach längerer Zeit Knurrhähne wieder.
Am folgenden Morgen beendete ich die Kartenskizze der Tsitani-Pfanne und schoß in den Bäumen des Ufers einen großen Uhu. Der Boden rings um die kleinen Salzpfannen ist namentlich an allen den geringen Senkungen sehr salzhaltig. Bleibt hier das Regenwasser auch nur kurze Zeit stehen, so wird schon die Vegetation in der Entwickelung gehemmt. In Folge der raschen und mächtigen Verdunstung bildet sich eine ½ bis 1 Zoll starke, 2 bis 6 Zoll vom Boden abstehende Kruste auf weite Flächen hin, welche bei dem Betreten unter jedem Schritt einbricht. Der Rand des Sees wird von kleinen Chalcedonen und Milchkieseln bedeckt, welche das Regenwasser herabschwemmt. Zur Zeit heftiger Winde wird das sich an dem Rande bildende Salz sowie der feine salzhaltige Boden der trockenen oberen Rasenfläche in hohen, weißlichgrauen Staubwolken aufgewirbelt.
Am 21. verließen wir gemeinschaftlich das Ufer der Tsitanipfanne, trennten uns jedoch bald darauf, da ich von den Eingebornen vernahm, daß weiterhin Wasser anzutreffen sei und ich es nicht für nöthig hielt, das Reisetempo der beiden Handelsleute einzuhalten. Wir trafen bei der nächsten Wasserstelle wieder, zwei Wochen später im Thale des Panda ma Tenka-Flüßchens zum zweiten Male und etwa ein Jahr später in Schoschong nochmals zusammen.
An der Salzpfanne bemerkte ich auch den ersten Baobab, eines der südlichsten Exemplare in der von mir eingeschlagenen Richtung (die zwei südlichsten im centralen Süd-Afrika wurden von Mauch im westlichen Transvaal-Gebiete am rechten Ufer des Limpopo angetroffen); er hatte bei 25 Fuß Höhe einen Umfang von 52 Fuß. Auf meinem Wege nach Norden hatte ich zuerst einige der beschriebenen kleineren, am Ostufer der Tsitani liegenden zahlreichen Salzpfannen, sowie den Tsitanifluß selbst zu überschreiten, dann hielt ich durch das Becken der großen Salzseen eine fast nördliche Richtung ein. Dichter Niederwald, in dem die Bäume zum großen Theile mehr oder weniger verkrüppelt waren, wechselten nun mit Wiesen ab, die mit saftigem Süßgras und einem reichen Blumenflor bewachsen waren. An den salzhaltigen Stellen und am unmittelbaren Rande der Pfannen und seichten Flüßchen und Bäche nahm die Vegetation einen stachlichen Charakter an. Springbock- und Deukergazellen, Zulu-Hartebeeste und gestreifte Gnu’s, nach den Spuren zu urtheilen auch Löwen, belebten die Scenerie an der Tsitanipfanne und in den umliegenden Wäldern.
Die Fahrt führte uns in den nächsten Tagen an einer Reihe von umfangreichen Bodenvertiefungen vorüber, deren Mitte von kleinen Salzseen eingenommen werden, ich zählte auf der Strecke bis zu unserem Nachtlager, dem ersten nach dem Verlassen der Tsitanipfanne, nicht weniger als 42. An einem derselben, dem kleinen Schoni-Salzsee hielten wir unsere Mittagsrast. Außer diesen Salzseen stießen wir auf Süßwasserlachen, die an ihrer Binsenumrahmung leicht zu erkennen sind.
Am Morgen des 22. stand ich am Ostufer eines den Tsitani an Größe weit übertreffenden, tiefer liegenden und von den Eingebornen Karri-Karri genannten Salzsees, dessen Ufer zahlreiche Baobabbäume schmückten. Von besonderem Interesse schien mir die geologische Formation am Ostufer des Karri-Karri, welcher ebenso wie der Tsitani-Salzsee ein ziemlich gleichschenkeliges Dreieck bildet, dessen Spitze nach Westen gekehrt ist und dessen Fläche von Osten nach Westen sich unabsehbar ausdehnt. Im Westen steht der Karri-Karri-Salzsee und der Tsitani- mit dem nördlicher gelegenen Soa-See durch den Zuga-River in Verbindung.
Masarwa’s, deren Unterschenkel an der Vorderfläche die bekannten rothen Krusten zeigten, boten uns die Früchte des Baobabs zum Kaufe an und begehrten für dieselben etwas Mais und Tabak. Drohender Regen trieb uns zur Eile an und gestattete uns nicht, länger an dem Ufer des Sees zu verweilen, welcher mir in naturhistorischer Hinsicht sehr reiche Ausbeute versprach.
Ich überschritt am Nordostende an einer der Hauptbuchten des See’s den Mokhotsifluß, dessen Gefälle nach Nordost gerichtet ist und der das überschüssige Wasser aus dem seichten See nach dieser Richtung hin abzuführen scheint. Der Weg führte während des nächsten Tages durch einen dichten Mapaniwald und später über einen trockenen, etwa 60 Fuß breiten, 10 bis 16 Fuß tiefen Fluß, der ein deutliches Gefälle nach Osten zeigte und von den Masarwa’s der mit hohen Bäumen bestandenen Ufer halber, Tschaneng oder der schöne Fluß genannt wird. Mit ihm parallel läuft ein Spruit (von den holländischen Jägern Mapanifontein genannt), in welchen zahlreiche Quellen münden und dadurch, daß auch der Tschaneng bei Hochwasser einen Theil seines Wassers an ihn abgibt, in seinen tieferen Partien das ganze Jahr hindurch Wasser führt. Ich bin der Ansicht, daß der Tschaneng ein Abflußarm des Zuga-River oder ein Abfluß der größten der drei Salzseen, der Soa ist, und sich in den Matloutse-River oder einen seiner Nebenflüsse ergießt. Auf der Fahrt nach dem Tschaneng erlegte ich einen auf der Jagd nach Eidechsen begriffenen großen Raubvogel (Buteo Jackal), welcher den Colonisten unter dem Namen Schakalvogel bekannt ist. Ich verließ den Tschaneng am Nachmittage des 23. und zog mit Anderson, der mich eingeholt hatte, einige Meilen gemeinschaftlich nach Norden. Wir zogen durch den Khori genannten Wald und an einem verlassenen Masarwadorfe nahe der Furth über den Tschaneng vorbei und erblickten in den Frühstunden des nächsten Tages den Spiegel eines dritten großen, Soa genannten Salzsees, in dessen Nähe wir holländischen Jägern begegneten, welche auf der Straußen- und Elephantenjagd begriffen waren.
Wir konnten Dank dem trockenen Wetter mehrere lange mit ein- und ausfließenden Spruits in Verbindung stehende Buchten der Soa, welche bei Regen unpassirbar sein mußten, übersetzen und übernachteten im Thale des sumpfigen Tsiriflüßchens, in dem ich bis zum 27. verblieb. Im nahen Walde fanden wir nahe an einem verlassenen Masarwadorfe in einigen im Flußbette des Momotsetlani (nach einer Baumart von den Masarwa’s so benannt) gegrabenen Löchern vortreffliches Trinkwasser. Ich unternahm während dieses Aufenthaltes mehrere Ausflüge in die Umgebung und erlegte auf einem solchen fünf Enten, zwei Perlhühner, die hier in zahlreichen Ketten anzutreffen sind, sowie einen braunen Storch, das erste Exemplar dieser Art, das ich bis zu diesem Tage in Süd-Afrika beobachtet.
Die Soa ist der größte, der in dem großen bis über den N’gami-See nach Westen sich hinziehenden, und durch den Tschaneng mit dem Limpopo-System zusammenhängenden Pfannenbecken liegenden Salzseen; gleich der Tsitani und Karri-Karri ist auch die Soa eine seichte, ein bis vier Fuß tiefe, weißlichgraue, nur kurze Zeit im Jahre theilweise, selten vollkommen gefüllte Pfanne. Es wäre sehr wichtig, durch ein ganzes Jahr in der trockenen wie in der nassen Jahreszeit dieses Salzseebecken zu beobachten, um dessen Verhältniß zum Zuga und zum N’gami-See studiren zu können; wenn dies bisher nicht geschah, so mag der Grund dieses Versäumnisses wohl darin liegen, daß das Reisen zur Regenzeit in dieser Gegend ungemein erschwert und nebstbei auch sehr gesundheitsschädlich ist. Daß der Zuga manchmal nach Westen und manchmal nach Osten fließt, läßt sich aus der ziemlich gleichen Höhe dieses großen central-süd-afrikanischen Beckens erklären. Ist der N’gami-See durch seine zahlreichen westlichen und nördlichen Zuflüsse gespeist, und sein flaches Becken gefüllt worden, so gibt er seinen Ueberschuß nach Osten durch den Zuga an die Pfannen ab, aus denen wieder derselbe durch den Tschaneng, deren natürlichen Abzugskanal, abfließt. Zeigt der N’gami-See niederes Wasser, so gibt der Zuga den Ueberschuß aus seinem tiefen Bette an ihn ab, da sich in ihm durch die reiche Beschilfung auch das Wasser längere Zeit zu halten vermag und er außerdem zahlreiche Quellen aufnimmt. Auch mag er zuweilen von dem überschüssigen Wasser der Westhälfte der Salzseen gespeist werden.
Am 27. Früh verließ ich den Tsiri und zog durch drei Stunden mit meinem Ochsengespann durch eine Unzahl von Buchten und kleinen Salzpfannen stets am Ufer des See’s hin. Erst gegen Mittag nahmen diese ab und wir betraten eine nach Norden unübersehbare, nach Westen durch den See und nach Osten durch ein Mapani-Gehölz begrenzte Grasebene, auf welcher sich allenthalben zahlreiches Wild in kleinen Rudeln herumtummelte. Hie und da sichtbare Schilfrohrdickichte ließen Süßwasser vermuthen, wir täuschten uns nicht und lagerten bald an einer solchen Lache. Von einem kleinen Ausfluge heimgekehrt und eben damit beschäftigt, meine letzthin gesammelten naturhistorischen Objecte zu ordnen, vernahm ich plötzlich zu meiner Linken das Hilfsgeschrei meines Dieners Meriko und als ich mich rasch am Wagenbrette emporrichtend nach ihm umsah, bot sich mir ein eigenthümlicher Anblick, eine Scene dar, wie ich sie vorher nie gesehen. Durch das hohe Gras kam Meriko herangerannt, und schrie in der Setschuana: »sie tödten mich, ich bin todt, sie tödten mich.« Er setzte wie ein flüchtiges Wild über die sich ihm stellenweise entgegenstellenden Zwergbüsche und hatte im Laufe sein aus Gras geflochtenes Hütchen und seine Khamacarosse verloren. Hinter ihm kamen, die nächsten etwa 150, die entferntesten 500 Schritte weit, andere laut schreiende und ihre Kiri’s hoch schwingende Eingeborne dahergestürmt. Endlich kommt Meriko zum Wagen herangekeucht, er umfaßt meine Füße und weist flehenden, verzweifelnden Blickes auf die ihm folgende Schaar, seine ersten Worte, die er zu stammeln vermochte, belehrten mich über die Scene. »Matabele, Herr, Matabele-Zulu wollen mich todtschlagen.«
Mir war es unerklärlich, wie sie hierher auf das Gebiet Khama’s gekommen waren und ich dachte schon, daß vielleicht ein Krieg zwischen beiden Nachbarstaaten ausgebrochen sei. Was beabsichtigen diese Männer? War das ein Angriff auf den Wagen und seine Insassen? Sie schienen mir, wie sie so gellend dahergesaust kamen, wahrhaft Wölfe in Menschengestalt zu sein. Von den Waffen Gebrauch zu machen, schien mir ein gefährliches Wagniß und zudem kannte ich nicht ihre eigentlichen Absichten. Ich mußte also das Weitere ruhig abwarten, nur Meriko wartete ihre Ankunft nicht ab, sondern sprang über die Deichsel und setzte nach der entgegengesetzten Seite seine Flucht fort, nur daß er nicht mehr schrie, um sich wahrscheinlich, wenn er die günstige Gelegenheit dazu ersah, in dem hohen Grase zu verbergen. Ich rief ihm zu, am Wagen zu bleiben, und daß die Löwen in dem vier Fuß hohen Grase gefährlicher als die Zulu’s seien, doch mein Mahnruf verhallt ungehört. In den anstürmenden Matabele sah er seinen sicheren Tod und diesem wollte er entrinnen. Endlich waren sie da, die berüchtigten Zulukrieger. Sie umringten den Wagen, schrieen und schwangen ihre Kiri’s. Das waren nicht die Vertreter eines Stammes, das war ein Gemisch verschiedener Stämme, »die gestohlenen Knaben der unter Moselikatse gemordeten und geplünderten Stämme,« welche zu Kriegern auferzogen, ebenso roh wie die zwei eigentlichen Zulu’s geworden waren, die sie anführten. Bis auf einen kleinen Lappen von Leder und Wollfranzen — einige trugen nur eine Kürbißschale oder ein cylindrisches Geflechte — nackt, waren sie beinahe sämmtlich mit einem aus schwarzen Straußenfedern oder anderen Wildhuhnfedern gearbeiteten ballonförmigen und auf der Stirnhöhe sitzenden Kopfschmucke versehen. Das wild rollende Auge gepaart mit dem Ausdrucke von ungewöhnlicher Rohheit in der Physiognomie, waren beredte Belege, daß sie einem kriegerischen Eingebornenstamme angehörten, der nur »gebieten« wollte und konnte. Die meisten der Anwesenden waren wohl schon Menschenschlächter gewesen, und dies nur einzig des Raubes halber. Der eine der beiden schwärzesten in der Schaar, die sich als Anführer kenntlich zu machen suchten, schwang sich auf die gestützte Deichsel und gab mir in einem gebrochenen Holländisch zu verstehen, daß sie die Krieger »La Bengulas« wären, daß sie gewohnt seien, auf ihren Streifzügen alle Diener der Weißen zu tödten, wenn man diese nicht loskaufe, deshalb seien sie gekommen, auch jenen Hund, der zu mir herangelaufen wäre, todtzuschlagen, wenn ich nicht sofort für ihn bezahlen würde. — »Bezahlen will ich nichts,« entgegnete ich, gute Miene zum bösen Spiele machend, »allein den Matabelekriegern will ich etwas schenken, wenn sie dann den Wagen verlassen.« Ich hoffte auf diese Art nicht nur allen möglichen Streitigkeiten und gefährlichen Situationen auszuweichen, sondern auch der allbekannten Stehlsucht der Matabele zuvorzukommen. Obwohl Th. und Pit unsere Utensilien mit Argusaugen bewachten, konnten sie es nicht verhindern, daß einer der Matabele besonderes Wohlgefallen an einem neben mir liegenden Messer fand, das er indeß, von mir in flagranti ertappt, wieder im Stiche ließ.
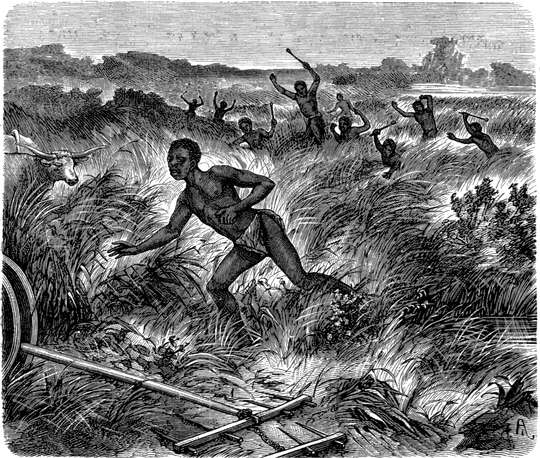
Verfolgende Matabele.
Der Zulu rief seinen Genossen, theilte ihm seine Meinung mit und dieser damit zufrieden, rief mit lautem Gekreisch alle die Anwesenden zusammen, um ihnen meinen Entschluß mitzutheilen. Die Nachricht wurde mit gleich heftigem Geschrei und Grinsen beantwortet. Nun hieß ich alle an der Deichsel antreten. Meine unerwarteten Gäste im Auge behaltend langte ich in den Wagen und holte einen Becher Schießpulver und ein Stück Blei (etwa zwei Pfund) hervor, womit ich die beiden Anführer beschenkte. »Lapiana«, rief der eine der Führer aus, er zeigte auf mein Sacktuch und ahmte die Bewegung des Zerreißens nach; dabei suchte er mir zu verstehen zu geben, daß solch eine Lapiana als Gurt um den Leib oder als Stirnverzierung, wie der mit Riemchen an dem Kopfe befestigte Vogelfedernschmuck getragen werden solle. Ich begriff nun seinen Wunsch und brachte zwei Meter Calico hervor, die ich in dünne Lappen riß und sie dann den Einzelnen reichte; dieselben wurden auch sofort in der angedeuteten Weise verwendet. Das Geschenk fand bei ihnen so sehr Gefallen, daß sie um weitere zwei Stücke für ihre Führer baten, welchem Ansuchen ich auch willfahrte, dann aber vom Wagen herabsprang und mich zu meinen Gefährten wendend, den lärmenden Gesellen den Rücken kehrte. Ihren Führern folgend, die langsam den Rückzug eröffneten und die Geschenke in der Luft schwangen, entfernte sich die Truppe und wir alle fühlten uns nun etwas weniger beengt als eine Stunde zuvor, da wir von dem schweißtriefenden Merico vernommen, welch’ ehrenvoller Besuch uns bevorstand. Manche der Matabele hatten von Th. Tabak für Salz eingetauscht.
Von Meriko erfuhr ich, daß wir uns bereits am Ufer des Nata, des wichtigsten Zuflusses der Soa befanden, und daß in seinem Bette leicht Salz zu gewinnen sei und daß die Matabele jährlich von ihren Königen oder von ihren Häuptlingen hierher gesendet werden, um Salz zu holen; unsere Matabele-Gäste waren eben auf einem solchen Zuge begriffen gewesen. Der Bamangwato-König weiß wohl von diesen Raubzügen, allein er hindert die Matabele nicht, die zuweilen den ihnen begegnenden Bamangwato’s die Waffen abnehmen und den Masarwa’s die Unterschenkelknochen entzweischlagen.[6]

Jagd auf Zulu-Hartebeeste.
Zur großen Beruhigung unseres wackeren Bamangwato-Dieners fuhren wir noch am selben Tage weiter nach Norden, nach dem Ufer des nahen Nataflusses. Das Wild nahm zu, größere Heerden von Springbockgazellen, die ich so weit im Norden nicht anzutreffen dachte, mehrere Trupps von Zulu-Hartebeesten, gestreiften Gnu’s, Straußen und Zebra’s wurden sichtbar. Meriko, der wieder vergnügt mit Niger neben dem Wagen einherlief, sprang zuweilen auf das Wagenbrett, um sich von dem Abzuge der Matabele zu versichern; bei Gelegenheit einer solchen Umschau bat er mich, in der Fahrt inne zu halten. Ich folgte der mir angegebenen Richtung, in welcher etwa 600 Schritte vom Wagen und zur Rechten im Grase, Meriko auf eine Heerde großer »Polocholo« (Wild), »Sesephy« (Zulu-Hartebeest) hinwies. Ich konnte mit bestem Willen nichts sehen, desto besser Pit und Th., die beide mehrere Stücke zählten. Rasch wurde Kriegsrath gehalten und die Verfolgung der Thiere in folgender Weise beschlossen: Ich sollte mich schußbereit halten, der Wagen jedoch die Fahrt fortsetzen, auf etwa 300 Schritte nahegekommen, sollte ich auf der den Thieren entgegengesetzten Seite (sie befanden sich etwa 200 Schritte vom Wege) vom Wagen gleiten und im Grase gegen die Thiere bis auf 150 Schritte anschleichen, aus welcher Entfernung ich dann, durch einen Hardekoolebaum gedeckt, feuern konnte. Es war nicht schwer, diesen Plan zur Ausführung zu bringen, und bald fand ich mich im Grase und kroch langsam vorwärts, während der Wagen die Fahrt fortsetzte.

Die Soa-Salzpfanne.
Bevor ich jedoch noch den schützenden Baum erreichte, machte mich ein Pfiff von Th. darauf aufmerksam, daß die Thiere durch den Wagen aufgescheucht worden wären und sich eben zur Flucht wandten. Um so rascher kroch ich nach dem Baume, spannte den Hahn und als ich eben vorschaue, erscheint eines der Thiere (der Führer) von einem zweiten Thiere gefolgt, etwa 150 Schritte im vollen Laufe in meinem Gesichtskreise. Ich lege auf das erste an und feuere. Meine Gefährten schreien laut auf und eilen, sich um Wagen und Gespann nicht weiter kümmernd, von den Hunden gefolgt, alle nach der Stelle, die eben das Wild eingenommen. Ich sehe vier Thiere flüchten und da ich nicht wußte, daß es fünf waren und der Pulverrauch den Führer der Heerde meinen Blicken entzog, staunte ich nicht wenig über meine Gefährten. Ich dachte zuerst an das Gespann, das die Leute im Stiche gelassen, doch der Weg war mit üppigem Gras überwuchert, das Gespann stand still und graste im Joche, so gut es ging. Ich eile den Uebrigen nach und wer beschreibt mein Erstaunen, als ich vor mir einen schönen Sesephy verendet liegen sehe. Sanct Hubertus war mir diesmal ungewöhnlich hold und verhalf mir zu einer ebenso schönen als wichtigen Acquisition.
Am Nata-Spruit angelangt, mußte ich, abgesehen von der verlockenden Gelegenheit, meine Sammlungen zu bereichern, den ermüdeten Zugthieren einige Tage Rast gönnen. Unsere nächste Sorge galt der Auffindung von Trinkwasser, im Flußbette selbst waren alle Lachen salzhaltig. Da uns jedoch zwei Tage zuvor von einem Masarwa die Möglichkeit, frisches Wasser im Bette des Nataflusses zu finden, in Aussicht gestellt wurde, folgten wir zwei dem Fluß aufwärts. Das Flußbett war 100 bis 150 Schritte breit, bis an 20 Fuß tief und schien nach Regengüssen bis an das Gras am oberen Rande gefüllt zu sein. Ein Freudenschrei Th.’s kündigte mir an, daß unser Suchen nicht vergebens war, es war ein glücklicher Fund, denn schon die nächste Lache zeigte wieder salzhaltiges Wasser.
An unserem Wege im Flußbette hatten zahllose Wildspuren gekreuzt, unter denen jene der an der Soa erwähnten Wildarten die häufigsten waren, doch fielen uns auch namentlich sehr zahlreiche, frische Löwenspuren auf. Der von Pit vorgeschlagene, von mir und Th. gutgeheißene, nur von Meriko wegen der nur zwei Stunden entfernt lagernden Matabele mißtrauisch betrachtete Lagerplatz ward sofort bezogen. Der zahlreichen frischen Löwenspuren halber hielt ich es für angemessen, die Zugthiere in unmittelbarer Nähe des Lagers zu halten und befahl dem mit einem Hinterlader bewaffneten Meriko Wache zu halten. Bald war auch die Umzäunung des Lagers fertig gestellt, welche diesmal hoch und breit gearbeitet war. Außerdem wurden vier Feuer errichtet und bis zur vollen Dunkelheit unterhalten, so daß sie durchwegs bis gegen 1 und 2 Uhr Nachts ungeschwächt fortbrannten.
Der arme Niger hatte schwere Arbeit und bewies sich vortrefflich. Jene vom königlichen Geblüte machten uns wiederholte Besuche, noch häufiger fanden sich die beiden Schakalarten, der Schabrackenschakal und der graue ein, auch die gefleckte und die braune Hyäne ließen sich vernehmen, schließlich »der lieben Thiere so viele,« daß ich von nichts als schönen Löwen- und Hyänenbälgen, die vor mir ausgestopft im lustigen Reigen tanzten, träumte. Schakalgekläffe in zwei Modulationen bildete die »Ouverture« zu jenem Concert, das Löwengebrüll den »dramatischen« Theil der Vorstellung, die mit dem unharmonischen Hyänengeheule gegen Morgen ihren Abschluß fand.
Am 28. unternahm ich mit Pit mehrere Ausflüge an beiden Nata-Ufern. Da die Partien stellenweise sehr dicht bebuscht waren und wir häufig den Fluß und die in denselben mündenden Regenschluchten zu passiren hatten, deckten wir uns gegenseitig gegen unerwartete Angriffe. Zahlreiche Löwenspuren von respectabler Größe nöthigten uns zur Vorsicht und scharfem Auslugen. Die längs des Flusses und so hoch oben am Ufer führenden Wildpfade, von welchem aus das Raubthier eine gute Uebersicht über das breite und von den Antilopen ob seines Salzgehaltes häufig besuchte Bett haben konnte, waren von zahllosen Löwenspuren bedeckt. Neben diesem Wildpfade einhergehend, kamen wir zu einem am Rande einer kleinen Regenschlucht stehenden, etwa 20 Fuß hohem Baume, der deutliche Spuren der Löwenklauen trug. Hier pflegten die in der Nachbarschaft hausenden Thiere ihre Klauen zu schärfen und auf den Hinterpfoten hockend die Vordertatzen an der Rinde zu wetzen. Der Baum, dessen Aeste etwas armleuchterförmig gestaltet waren, schien mir für den Anstand wie geschaffen. Schon vor Sonnenuntergang war ich von Pit und dem Hunde begleitet, zur Stelle, ich trachtete mir wo möglich die bequemste Lage zu wählen, da ich in derselben 10 bis 14 Stunden zubringen mußte. Ich drängte Pit zur raschen Rückkehr, damit er noch bei vollem Tageslicht den Wagen erreichen konnte. Sowie ich mich allein befand, besah ich mir die nächste Umgebung rings um mich her; zu meiner Rechten standen in einer Entfernung von 20 bis 30 Fuß höhere Bäume als jener, auf dem ich Posto gefaßt. Der Boden war stellenweise hoch, doch schütter begrast, so daß man überall den lichten Sand, welcher den interessanten Blätterkalk an den Salzseen bedeckt, durchschimmern sah. Unter mir befand sich eine runde Stelle, welche außer meinen Fußstapfen und denen des Dieners nur Löwenspuren zeigte. An meiner Linken führte eine mit dichtem und hohen Gras überwachsene, etwa 6 Fuß tiefe und 20 Fuß breite Regenmulde, welche in den nahen, kaum 20 Schritte entfernten Nataspruit mündete. Am jenseitigen Ufer stand ein dichtes Gehölz, durch welches einer der Löwenpfade führte, von diesen zweigte sich ein Nebenpfad zu meinem Baume ab. Da die Nächte äußerst kalt waren, welcher Temperaturfall nach der bedeutenden Tageshitze um so empfindlicher war, hielt ich es für angezeigt, mich an einem der stärksten Aeste festzubinden, um nicht vom Schlummer überrascht mit den Löwen unter mir in nähere und unliebsame Berührung zu kommen. Mein Sitz ließ sonst nichts zu wünschen übrig, ich saß bequem in einer dreifachen Astgabel.
Unterdessen war die goldene Scheibe allmälig am westlichen Horizonte untergegangen, nur ein glühend rother Streifen schimmerte hie und da durch das lichte Gezweige der höheren Baumkronen. Ohne es vorher zu ahnen, war es mir in dieser Nacht möglich, so manche Scene aus dem Thierleben beobachten zu können. Schon bei Sonnenuntergang ließen sich aus den Grasebenen die Zebrahengste hören, welche mit lautem Quag-ga, Quag-ga ihre Wachsamkeit über die unter ihrer Führung stehenden Heerden zu erkennen gaben. Der nächste Laut, der dann und wann von allen Richtungen her zu mir drang, war das klagende Gebelle der Schabrakenschakale, aus dem man das mißtönende Einzelgeheul ihres grauen Bruders gut unterscheiden konnte. Es war zu erwarten, daß das ausgehängte Wildfleisch seine Pflicht thun werde und sie dem Wagen einen Besuch abstatten würden, was auch geschah, denn das anfangs verschwommene Gebelle wurde immer deutlicher und deutlicher, so daß ich mir sogar gegen Mitternacht einbildete, die Zahl der Concertisten bestimmen zu können. Bei einbrechender Dunkelheit fesselte ein eigenthümliches Geräusch, eine Art Kratzen und Scharren, meine Aufmerksamkeit; es waren Scharrthiere, welche in dem sandigen Boden nach Würmern und Puppen fahndeten. Diese kleinen Raubthiere arbeiteten die ganze Nacht hindurch; so oft sich ein Geräusch in der nächsten Umgebung vernehmen ließ, stellten sie ihre Arbeit sofort ein.
Etwas später, gegen 10 Uhr, verließen die Gazellen und Antilopen ihre Weideplätze, um noch vor der gewöhnlichen Ausgangszeit der großen Raubthiere den salzhaltigen Schlamm im Bette des Nata zu belecken und in die freieren unbebuschten Partien, von woher sie gekommen, zurückkehren zu können. Der anmuthige Steenbock, einer der anmuthigsten unserer südafrikanischen Gazellen, kam bedächtig den Löwenpfad herangegangen. Hätte ich nicht zufällig hingeblickt, so hätte ich seine Annäherung gar nicht wahrgenommen; im Ganzen waren es drei Thiere, die ich erspähen konnte. Ein flüchtiger doch leiser Schritt, dem ein Moment Ruhe folgte, spornte meine Sehkraft zum Aeußersten an, doch konnte ich das Thier nicht erkennen. Abermals folgten einige flüchtige Sätze und dasselbe, gewiß eine größere Gazelle oder Antilope, verhielt sich ruhig, es wiederholte noch dreimal seine Sätze, um in der Zwischenzeit abermals zu lauschen.
Es mochte 10 Uhr sein, als eine Heerde von Thieren, nicht bedächtig und lauschend, doch langsam und in großer Zahl längs dem jenseitigen Ufer der Regenmulde herabstieg. Die Mündung dieser Mulde ermöglichte es den Thieren, bequem das kleine salzhaltige und einen Süßwasser-Tümpel enthaltende Flußbett zu erreichen. Die letzterwähnte Thierheerde war an einem besonderen Geräusche, das dem Anschlagen von Knitteln gegen die Baumstämme ähnelte, leicht zu erkennen. Es waren die durch ihr prachtvolles Geweih ausgezeichneten Kudu-Antilopen. Während ich diese Thiere noch später in dem Flußbette herumarbeiten hörte, näherte sich dem vom Flusse abwärts längs des Ufers führenden und die Regenmulde kreuzenden Wildpfade herab, ein kurzer etwas schwerer Tritt, und bald darauf gewahrte ich ein schwarzes, etwa kalbgroßes Thier, das ich als eine braune Hyäne erkannte. Das Thier ging langsam durch die Schlucht und schnupperte wiederholt beinahe bei jedem seiner Schritte, blieb dann auf einige Secunden stehen und fiel, auf das jenseitige Ufer der Mulde gelangt, sofort in ein rascheres Tempo ein.
Es schien mir, als sollte ich diese Nacht vergebens den König der Thiere erwarten. Als sich mir schließlich diese Befürchtung immer mehr aufdrängte, erscholl aus einer Entfernung von etwa 1000 Schritten das mir wohlbekannte, tiefe Gebrüll. Ich war jetzt sicher, daß das Thier seiner Gewohnheit gemäß den Pfad herunter und zu seinen Lieblingsbäumen kommen werde. Ich suchte nun meine Aufmerksamkeit von allem Anderen, namentlich von dem lauten Gebelle, mit dem meine beiden Hunde die an den Wagen drängenden Schakale abzuschrecken suchten, abzulenken. Mehr denn eine halbe Stunde verrann, bevor sich das Gebrüll des Löwen, diesmal in der Nähe, wiederholte. Nach etwa 15 weiteren Minuten vernehme ich den ersten Laut des herantrabenden Thieres, es kam näher und näher, doch deutlich nehme ich auch wahr, daß es nicht in seinem gewohnten Pfade am jenseitigen Mulden-Ufer, sondern mitten durch die hochbegraste Mulde selbst einherschritt.
Nach einigen raschen Schritten hielt das Thier inne, lauschte einen Moment, um sich wieder zu nähern. So war es bis auf 15 Schritte nahe gekommen — doch mir bei der in der Tiefe der Mulde herrschenden Dunkelheit und dem hohen Grase noch immer unsichtbar geblieben. Auf’s Gerathewohl in’s Gras zu feuern, hielt ich aus dem Grunde nicht gerathen, weil es den Löwen in die Flucht jagen konnte. Der Löwe mußte jetzt an dem Zweigpfade angelangt sein, der zu meinem Baume führte, er blieb jedoch volle 15 Minuten, in der Muldensohle, ohne sich zu rühren, er mußte mich wohl gewittert haben und schien sich für den Angriff oder die Flucht zu entscheiden. Da höre ich den Schritt wieder, dann eine Pause, um im nächsten Augenblicke zu hören, wie der Löwe einen Satz in das jenseitige Gebüsch machte und darinnen verschwand. Bald darauf belehrte mich Niger’s wüthendes Gebell, welche Richtung der Löwe genommen und ich bereute es, nicht gefeuert zu haben. An allen Gliedern steif, mußte ich nichtsdestoweniger auf meinem Posten ausharren, bis Pit und Niger bei Tagesanbruch sich bei mir eingefunden hatten.

Im Baume.
[6] Ich möchte auf diesen Umstand besonders Reisende aufmerksam machen, welche eingeborne Diener im Gefolge haben und diese Gegenden berühren sollten. Für sie ist es am angezeigtesten, sich vorher durch Kundschafter die Gewißheit zu verschaffen, ob die Ufer des Nata gefahrlos zu passiren sind.
Die Salzlager im Nataspruit. — Ein Capitalschuß. — Von Löwen aufgeschreckt. — Das sandige Lachenplateau. — Strauße am Wagen. — Nachtreise bei Fackelschein. — Ein Löwenabenteuer. — Die Klamaklenjana-Quellen. — Vereitelte Elephantenjagd. — Begegnung mit Elephantenjägern. — Die Madenassana’s. — Gebräuche und Sitten derselben. — Der Yoruha-Weiher und die Tamafopa-Quellen. — Nächtliches Thierleben im Walde. — Eine verunglückte Löwenjagd. — Pit schläft auf dem Anstande.
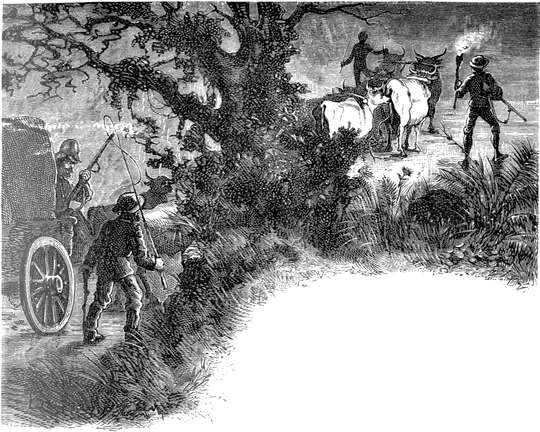
Nachtreise bei Fackelschein.
Am Vormittage des 29., nach jenem angenehmen Zeitvertreib, der im Löwenbaume durchlebten Nacht, unternahm ich einen Ausflug, um die Formation an den Nata-Ufern zu untersuchen. Zwei Riesenstörche (Sattelstorch-Species Mycteria senegalensis) zogen ihre weiten Kreise über den Fluß; mich rasch niederduckend, störte ich sie nicht beim Einfallen, beschlich sie dann und es gelang mir, einen für meine Sammlungen zu erbeuten. Die Thiere stellten den zahlreichen Fischen nach, welche sich in einer der flacheren Salzlachen des Flußbettes unter dem Gesteine zu verbergen suchten. Am Nachmittage machte ich einen längeren Ausflug durch die südliche Ebene, um nach der Matabelehorde zu sehen, und um die Stelle, an welcher sie das Salz zu gewinnen pflegten, näher zu untersuchen. Schon 1200 Schritte vom Wagen jagten wir eine Zebratruppe (von der dunklen Art) auf, welche in wilder Flucht dem Flusse zueilte, so rasch und in solcher Hast, daß ich schon die ganze Heerde über das steile Ufer herabstürzen zu sehen wähnte, als die Thiere ebenso plötzlich stille hielten und dann zur Rechten einbiegend, durch eine schmale Abflußrinne hinabgelangten. Es dröhnte laut auf und eine dichte Staubwolke erfüllte die Luft, als die Thiere das trockene Bett kreuzten, noch einige hundert Schritte hinübereilten, um dann an einer weniger steilen Stelle unfern meines Wagens auf das jenseitige Ufer emporzuklimmen. In der Ferne erschienen die Thiere größer als sie sind, ihre Hauptstärke liegt in dem gewaltigen Kopfe und dem Halse, und da sie sehr gut genährt sind, ist es nicht schwer, sie mit Pferden einzuholen. Die Masarwa und Makalahari nennen sie mit Rücksicht auf ihr Wiehern, das durch »Quag-ga«, wobei die erste Silbe bedeutend kürzer als die zweite klingt, deutlich wiedergegeben werden kann, Quaggas. Je näher ich dem Matabele-Lager kam, desto mehr Vorsicht hielt ich für nöthig, da ich jedoch auf der Ebene wenig Deckung fand, wandte ich mich nach Westen und kam hier in eine Flußvertiefung, die nach dem Nata zuführte, so daß ich selbe als einen Arm des unteren Nata ansehen möchte, der nach der Soa führt. Ich folgte ihm geraume Zeit, er hatte denselben Charakter wie der Nata und entschloß mich dann, durch das hohe Gras nach dem vermuthlichen Lager, d. h. bis auf eine englische Meile Entfernung von demselben anzuschleichen. Doch wie staunte ich, als dieser Arm nach einer Stunde Wegs, wobei wir rechts und links von uns Zulu-Hartebeest-Heerden beobachteten, nach Osten in der von mir angestrebten Richtung abbog und ich ihn verfolgend, das verlassene Matabele-Lager vor mir sah.
Ich stand an einigen mit rosa- und dunkelcarmin gefärbter, stark salzhaltiger Flüssigkeit gefüllten, ziemlich umfangreichen, in der Mitte des Bettes liegenden Lachen; rings war der Boden von weißlichem Salzniederschlage bedeckt, und zerstreute Salzstücke, schöne auf einer 1 bis 2 Zoll dicken harten Thonlage ruhende Krystalle, lagen überall umher, auch Pfähle, mit denen das Salz aus den Lachen herausgebrochen worden sein mochte. Die Matabele hatten also die Stelle schon verlassen, ich hatte die Störenfriede nicht mehr zu fürchten und konnte eine genaue Besichtigung der Lachen vornehmen. Bei normalem Winterwasserstand sind dieselben 1 bis 1½ Fuß tief, 30 bis 45 Fuß breit, 30 bis 900 Fuß lang. Der Niederschlag am Boden ist 1 bis 3 Zoll stark und verbindet die Ufer einige 6 bis 10 Zoll unter der Oberfläche der Flüssigkeit wie eine starke Eisdecke, schlägt man diese durch, so kommt man einige Zoll bis einen Fuß tiefer auf den eigentlichen Boden des Gewässers. Tritt man hinein, so glaubt man auf Nadelkrystallen zu stehen, und die Füße bedecken sich mit einem deutlich sichtbaren Niederschlage. Diese stark salzhaltigen Lachen sind weder von Vögeln noch anderen Thieren besucht.
Die schönen rosarothen Krystalle, mit denen jeder in die Lache geworfene Gegenstand bald inkrustirt und an der Salzdecke festgepicht wird, erblassen leider so wie sie der Lache entnommen werden. Wir schleppten mit, so viel wir konnten, und ich sandte am folgenden Tage Pit und Meriko zur selben Stelle, um Salz für unseren Gebrauch zu gewinnen. Um es von seinem Kalkgehalte zu befreien, wird das Salz gekocht und dann zerschlagen. Ich bediente mich seiner zum Einsalzen des Wildfleisches. Auf dem Heimwege von diesen Salzlachen (ich folgte dem Bette, indem sie liegen, bis in den Nata, es ist also ein von ihm abzweigender und sich wieder mit ihm vereinigender Arm) beobachtete ich die letzten Springbockheerden nach Norden und Heerden des gestreiften Gnu’s, das hier das schwarze Gnu vertritt, welches ich nicht nördlicher als über Schoschong zu beobachten Gelegenheit hatte.
Am 29. schoß mein Freund Th. eine Steinbockgazelle, auf der östlichen Grasebene, es war ein Capitalschuß auf 250 Meter. In der Nacht am 29. legte ich an mehreren Stellen mit Strichnin vergiftete Stücke Fleisch aus, um einige Schakalbälge zu gewinnen, am nächsten Morgen fand ich vier Cadaver dieser Thiere; das Fleisch des abgezogenen Thieres wird schon in der folgenden Nacht von seinen Genossen verspeist, und man wird dann in den nächsten Tagen jene, die an dem Mahle theilgenommen, todt in dem Gebüsche wiederfinden. Die Umgegend des unteren Nataflusses ist durch zahlreiche Baobabbäume, welche in dem salzhaltigen Boden ebenso gut gedeihen, wie im Humus, so wie durch dichtes Palmengebüsch ausgezeichnet.
Meine Sammlungen hatten nun schon derart an Umfang gewonnen, daß ich mich entschließen mußte, das bisher Gewonnene mit dem ersten, nach dem Süden zurückkehrenden Elfenbeinhändler oder Jäger zu Rev. Mackenzie nach Schoschong zu senden. Am 3. Juli verließ ich den Lagerplatz im Mimosengehölz, den ich trotz der nächtlichen Löwenbesuche liebgewonnen hatte und zog am linken Nata-Ufer den Fluß nach aufwärts. Der Weg führte am Rande der östlichen Ebene und war theilweise tiefsandig. Während unserer Fahrt sahen wir eine Heerde von Zebra’s in einer Entfernung von 500 Schritten grasen. Th. wollte seine Kunst als Schütze an den Thieren erproben, schlich sich auf 50 Schritte an und feuerte aus dem hohen Grase auf eines der Pferde. Der Schuß traf, das Thier fiel sofort nieder, sprang auf, lief noch etwa zehn Meter, fiel abermals nieder und verendete nach 15 Minuten. Wir eilten alle hinzu, Pit faßte unvorsichtiger Weise das Thier am Kopfe, doch dieses, obwohl in den letzten Zügen, biß nach ihm, ohne ihn glücklicher Weise zu erhaschen, andernfalls hätte der Diener eine tiefe Bißwunde davongetragen. Wir machten uns sofort an das Abhäuten der Beute und nahmen mit Ausnahme des Brust- und Halsfleisches, alles übrige mit, um Beltong zu bereiten. Etwa 2½ englische Meilen weiter fand ich in einem dichten Gehölze die geeignete Stelle zu einem neuen Lagerplatz, um hier vollends die Haut des Thieres zu präpariren.
Während Pit und Th. damit beschäftigt waren, das Fleisch der Zebrastute in Stücke zu schneiden, um es aufzuhängen, arbeitete ich an dem Felle und dem Schädel. Meriko wachte mit einer Muskete bei den grasenden Zugthieren. Am Nachmittag besah ich mir die nächste Umgebung und fand die Büsche dicht, den Baumwuchs spärlicher, doch stellenweise schöne Baobabbäume. Das Ufer des Nataspruits, in dem sich hie und da schöne bewaldete Inseln befanden, war hier hoch und steil und das Bett enthielt eine mehrere hundert Fuß lange und ziemlich tiefe Lache, welche von Wasserschildkröten und Fischen wimmelte. Doch auf sie hatten wir nicht viel Zeit zu verwenden, denn es schien mir geboten, bis Ende dieses Monats, wenn möglich, den Zambesi überschritten zu haben und bis zum December in das weniger ungesunde Hochland an seiner nördlichen Wasserscheide gelangt zu sein.
Da wir keine Löwenspuren bemerkten, errichteten wir eine ziemlich niedrige Umzäunung — es war uns bisher nicht bekannt, daß die Löwen oft Tagereisen weit Streifzüge von ihren gewohnten Schlupfwinkeln aus unternehmen; die Nacht war kalt, ein eisiger Südsüdwest-Wind hieß uns die Nähe des Feuers suchen und da die Nacht dunkel zu werden versprach, bereute ich es, keine höhere Umzäunung gemacht zu haben; ich vertröstete mich damit, daß das Zebrafell morgen trocken sein und ich den Ort verlassen konnte. Schon um 8 Uhr war die Finsterniß vollständig hereingebrochen, zeitweilig fielen Regentropfen und verkündeten im Vereine mit dem durch die Wipfel der niederen Bäume streichenden Winde eine unangenehme Nacht.
Plötzlich, so plötzlich, daß wir alle vor Schrecken aufsprangen, wurden wir durch das heftige Zusammenfahren und Gebrülle der Ochsen in der Umzäunung aufgeschreckt. Nur zu leicht konnten wir deutlich hören, daß einige derselben flüchtig geworden und beim Uebersetzen der meist aus trockenen Aesten errichteten Umzäunung in derselben eingebrochen waren. Um unsere Ueberraschung noch zu erhöhen, sprang Niger laut bellend nach den Gebüschen, während sich der kleinere Hund winselnd unter dem Wagen zu verbergen suchte. Wir drei am Feuer dachten natürlich, daß ein oder mehrere Löwen über den niederen Zaun in den Kraal eingedrungen waren, dies um so mehr, als wir die zurückgebliebenen Zugthiere sich in einen Klumpen aneinanderpressen sahen und uns ein ununterbrochenes, gedämpftes Blöken beunruhigte.
Von Th., der wenige Augenblicke vorher eben damit beschäftigt war, die Zugthiere etwas kürzer anzubinden, konnten wir, so weit uns der Feuerschein etwas in der Dunkelheit zu sehen gestattete, nichts erblicken. Während sich Meriko und Pit jeder mit einem Feuerbrand bewaffneten, sprang ich auf den Bock, um meinen Hinterlader zu ergreifen, und ließ die Diener ihre Leuchten hochhalten, um hinreichend Licht in den Kraal zu werfen. Ich konnte jedoch nichts von einem Löwen in demselben erblicken. »Theunissen, können Sie den Löwen sehen,« rief ich, doch statt einer bejahenden Antwort drang ein wimmerndes. »Helft mir, helft!« aus dem Knäuel der Zugthiere, aus deren Mitte sich zugleich das ängstliche Blöken vernehmen ließ. Wir sprangen herbei und fanden, daß die Zugthiere durch einige sich anschleichende Löwen in Aufregung versetzt, das in der Erde befestigte Ziehtau losgerissen und sich in der Verwirrung in dasselbe verwickelt hatten, wobei Th. und zwei Zugthiere niedergeworfen wurden, während andere zwei über die Umzäunung setzten.
Dank der Wachsamkeit Nigers hatten sich die Löwen zurückgezogen, und während wir Th., der glücklicher Weise unverletzt war, aus seiner unerquicklichen Lage befreiten, kehrten auch die beiden entlaufenen Zugthiere zum Wagen zurück. Ich ließ, nachdem die Thiere am Wagen entsprechend befestigt waren, rasch fünf Feuer um den Wagen und die Umzäunung anzünden, und unter ihrem Schutze fällten wir mehrere Mapanibäumchen und erhöhten damit die Umzäunung.
Erst am 5. konnte ich die Weiterfahrt, und zwar unter strömendem Regen antreten, der mir indeß diesmal willkommen war, da er den tiefen Sand compacter machte und den Zugthieren die Arbeit erleichterte. Ich passirte die durch tiefe Sandmassen ziemlich schwer passirbare Furth des Nataspruits und traf jenseits derselben auf einem verlassenen Jagdplatze die Reste eines Boerwagens. Von Wild beobachteten wir blos Deukergazellen, zwei gestreifte Gnu’s, einige Zebra’s und Perlhühner, von denen letzteren ich eines erlegte. Nachmittags traten wir aus den bewaldeten Partien heraus und zogen über eine hochbegraste Ebene, die stellenweise mit einzelnen Mapanibäumen oder kleinen Mapani- und Mimosengehölzen bestanden war. Obgleich ich sehr dagegen war, das Gespann in von Löwen bewohnten Gegenden Abends oder Nachts weiden zu lassen, war es diesmal nicht zu vermeiden; wir machten die Thiere frei und trachteten sie in der Nähe des Wagens zu halten. Doch kaum hatten sie etwa 150 Schritte weit sich entfernt, als sie durch ein Thier scheu geworden, in wilder Flucht nach rechts über die Ebene dahinjagten. Mit Hilfe des braven Nigers, der den Störenfried, eine Hyäne, rasch entdeckt und verfolgt hatte, gelang es Th. und Pit, die Thiere nach einer Weile wieder einzufangen. Die Nacht hindurch hatten wir das Vergnügen, ein von gefleckten Hyänen gegebenes Concert anzuhören.
Am 6. durchzogen wir Vormittags ein Terrain, das dem des vorigen Tages sehr ähnlich war, während wir am Nachmittage eine ausgedehnte wiesige, vom Niederwalde rings umschlossene Lichtung passirten, auf welcher sich zahlreiches Wild tummelte. Ein heftiger Regenguß spendete uns reichlich das ersehnte Trinkwasser, das uns der Boden nicht finden ließ. Wir sahen Strauße auf der Ebene, Deukergazellen, gestreifte Gnu’s und Löwen im Anschleichen der Zebra’s begriffen. Gegen Abend kamen wir an ein Gehölz, an welchem ich zu übernachten beschloß.
Am Abende des 8. Juli betraten wir einen Wald, der einen Theil des »sandigen Lachenplateaus« bildet und sich etwa 100 englische Meilen nach Norden erstreckt. Der Boden auf dieser Strecke ist mit Ausnahme einiger Lichtungen, welche Lachen aufweisen, tiefsandig und ist der westliche Theil des Gebietes, den Mohr das Land der »tausend Teiche« genannt hat. Ich belege mit diesem Namen nur jene Strecke, welche keinen merklichen Abfall zeigt und dem Regenwasser keinen Abfluß nach den Flüssen gestattet. Jene Lachen charakterisiren diese Gegend und werden zumeist (95 Percent derselben) nur vom Regen gespeist. Sie sind klein und dicht begrast und enthalten während 2 bis 8 Monaten reichliches Regenwasser. Nur eine verschwindend kleine Anzahl wird von Quellen gespeist und solche das ganze Jahr hindurch wasserhaltige Stellen sind von den Madenassa’s, die den wiesigen Niederwald bewohnen, benannt worden. Andere, die nur zeitweise im Jahre Wasser enthalten, haben von den holländischen und englischen Jägern und Elfenbeinhändlern Gelegenheitsnamen erhalten. Dieses Lachengebiet liegt zwischen der Soa und dem Nata (gegen Süden), den Zambesi-Zuflüssen nach Norden, dem Mababi-Veldt nach Westen und dem Nata- und Uguaj-River nach Osten. Es ist im Innern Süd-Afrika’s jenes Land, in welchem die riesigen Säugethiere, wie Elephanten, Nashorne, Giraffen noch häufiger zu finden sind, und von welchem aus sie sich dann nach Osten und Westen, sowie nach Norden über den Zambesi ausbreiten. Seiner Wasserarmuth in der Trockenzeit halber, ist es nicht nur mit großen Opfern zu passiren und nicht geringere fordert zuweilen im Beginne des Sommers vom October bis December eine aufsprossende Giftpflanze, die das Gras im Wachsthume überholt und den Ochsen sehr schädlich wird. Aus diesem Grunde wählen auch oft die Elfenbeinhändler, welche mit dem am Zambesi wohnenden Stämmen in Verkehr zu treten suchen, den sogenannten östlichen, d. h. einen durch Westmatabele und das Gebiet der Makalaka führenden Weg, doch hat auch dieser zahlreiche Schattenseiten und Nachtheile, welche namentlich in der Unzuverlässigkeit und Stehlsucht der Eingebornen auf dieser Strecke begründet sind.
Während der Fahrt am Nachmittage des 7., bevor wir noch in den dichten Wald einfuhren, und als wir eben die letzte Lichtung passirten, schrie Meriko, der vor den Ochsen einherging, auf, und wies mit der Hand nach links, indem er sich eines Ausdrucks bediente, den ich nicht verstehen konnte. Ich saß neben Th. am Bocke und war natürlich sehr begierig, den Grund der Aufregung meines in jeder Hinsicht hin braven Bamangwato-Dieners zu erfahren. Es waren zwei Strauße, die kaum 250 Schritte vom Wege entfernt, seine Aufmerksamkeit erregt hatten. Ich sah nur einen, der nahe an einem Gebüsche stand; nicht der Beute halber, die dem Könige der Bamangwato’s gehörte, sondern bloß des Jagdvergnügens halber sprang ich herab, um mich im hohen Grase anzuschleichen. Der zweite Strauß, den ich bisher nicht bemerkte, saß auf der Erde, lugte nur mit dem Kopfe über das Gras und ergriff bei meiner Annäherung sofort die Flucht, während mich einige Büsche am Gebrauche des Gewehres verhinderten. Als ich wieder freieres Terrain gewann, waren die Vögel eben im Begriffe, in einen Niederwald einzudringen und rannten so ziemlich auf einen und denselben Baum zu. Ich feuerte aus einer Entfernung von 450 Schritten und hörte die Kugel in den Stamm des Baumes einschlagen. Die größte Freude über den verunglückten Jagdversuch zeigte Meriko, weil ich das Eigenthum seines Herrn, des Königs Khama, nicht geschmälert hatte, und versprach, nach seiner Rückkehr nach Schoschong es dem Könige selbst zu berichten.
Da ich alles aufbieten wollte, um die erste der Quellen auf dem genannten Plateau noch an diesem Tage zu erreichen (wir hatten den Tag über kein Trinkwasser für die Zugthiere gefunden) blieb mir nichts übrig, als unsere Reise trotz mannigfacher Schwierigkeiten und Bedenken Nachts fortzusetzen. Voran lief Niger, selbst ohne erst dazu aufgemuntert worden zu sein, ihm folgte Pit mit einem Hinterlader, dann Meriko, der die Leitochsen am Riemen führte, mit einem tüchtigen Feuerbrande, Th. trieb die Ochsen, und ich saß am Bocke, das Gewehr schußgerecht in der Hand haltend, ein zweites lag hinter mir, um es nöthigenfalls dem neben mir schreitenden Th. sofort reichen zu können. Gegen 11 Uhr Nachts langte ich an der erwähnten Quelle an, welche den in den Wäldern ringsum wohnenden Madenassana’s unter dem Namen der südlichsten der Klamaklenjana-Quellen bekannt ist. Hier traf ich mehrere Elephantenjäger, denen ich einige Wochen zuvor, und andere, welchen ich an der Soa-Salzpfanne begegnet hatte, sie alle klagten über den Mißerfolg ihrer Jagd.
Ich will hier eines interessanten Löwenabenteuers gedenken, das sich einige Tage vor meiner Ankunft an der Stelle, an der mir, wie erwähnt, die Hyänen mein Gespann scheu gemacht hatten, zugetragen, und das mir den Tag nach meiner Ankunft an den genannten Quellen berichtet wurde. Die Herren Daniel Jakobs, ein Boer-Jäger, Frank, ein Engländer, der der Jagd halber diese Gegend aufsuchte, und Kurtin, ein Elfenbeinhändler, sind die Helden dieser Jagdepisode. Sie hatten eben ausgespannt, als ihnen die Diener die Nachricht brachten, daß eine Giraffenheerde einige Meilen vom Wege ab in Sicht sei. Da Herr Frank noch nie zuvor Giraffen in der freien Natur gesehen, verabredete man sich, ihm den ersten Schuß zu gönnen. Rasch wurden die Pferde gesattelt und man eilte dem Wilde entgegen. Obgleich dieses sofort die Flucht ergriff, wurde es doch schon nach kurzem Wettlauf eingeholt und Jakobs beeilte sich sofort vom Pferde herab eines der Thiere niederzuschießen. Die Gesellschaft sattelte ab und war eben damit beschäftigt, das Thier zu zerlegen, als einer der nachgeeilten Diener die Jäger auf eine andere, etwa 2000 Schritte entfernt grasende Giraffe aufmerksam machte. Man suchte auch diese auf und Herr Frank feuerte gleich zwei Schüsse ab, ohne ihr jedoch ein Leid anzuthun, dann schoß Kurtin und fehlte ebenfalls, Jakobs folgte als dritter und obgleich er das Thier förmlich mit seinem Pferde zusammenrannte und sein Doppelgewehr abschoß, entkam die gehetzte Giraffe unverwundet. Da er sah, daß die beiden anderen Jäger zurückgeblieben waren, wollte er schon dem Thiere die Freiheit schenken und von der Verfolgung ablassen, als es ihm einfiel, es mit dem Pferde zu überholen, zu wenden und in dieser Weise Herrn Frank noch eine Gelegenheit zum Schusse zu geben. Von neuem jagte er der Giraffe nach und hatte sie beinahe schon erreicht, als er unmittelbar vor sich, ein wenig zur Linken, eine sprungbereite Löwin im Grase liegen sah. Sich nach seinen Begleitern umkehrend, um sie herbeizurufen, sieht er, daß er an einer zweiten Löwin und einem Löwen vorbeigeritten war, ohne die Raubthiere vorher bemerkt zu haben. Aus dieser unangenehmen Lage suchte er sich dadurch zu befreien, daß er rasch nach rechts abbog, einige 30 Schritt in dieser Richtung hin galoppirte, dann auf den Löwen, der ihn mit seinen Blicken verfolgte, anschlug und feuerte. Er schoß zu hoch, verfehlte den Löwen und traf die Löwin in’s Schulterblatt. Darauf feuerte der herbeigerittene Kurtin zweimal und fehlte, ohne daß sich die Löwen in ihrer Ruhe stören ließen. Jakobs schoß nun zum zweitenmal und verwundete den Löwen schwer, so daß sich dieser in ein nahes Gebüsch zurückzog. »Da ich dachte, daß uns die beiden Löwinnen, die in das tiefe Gras so weit hineingekrochen waren, daß wir sie nicht sehen konnten, bekriechen, d. h. sich zum plötzlichen Sprunge bereit machen würden, gab ich,« so berichtete mir Daniel Jakobs, »den wohlmeinenden Rath, uns lieber eiligst zurückzuziehen, als den Kampf mit den Löwen fortzusetzen. Während unseres Rückzuges sahen wir beide Raubthiere, das eine stark hinkend, sich ebenfalls davonmachen. Alle diese Löwen gehören in den Bereich des Nataflusses und finden namentlich in dem stellenweise sechs bis sieben Fuß hohen Grase vortreffliche Schlupfwinkel.«
Die Klamaklenjana-Quellen bestehen (so weit sie nahe dem Wege liegen) aus vier von einander getrennten, sumpfigen Gewässern, daher rührt auch ihr Name »viermal hinter einander«; zwischen ihnen, sowie rechts und links im Walde, liegt eine Unzahl von während kürzerer oder längerer Zeit im Jahre gefüllter Regenlachen. Nahe an der ersten Quelle, die wir am Abend des 7. erreichten, zweigt sich ein von den holländischen Jägern geschaffenes Geleise nach dem Mababifelde ab. Hier stieß ich auf den Diener Andersons mit Namen Saul; er reiste in Gesellschaft eines Makalahari-Mannes, der vier Kinder mit sich führte, Saul hatte ihn am Nataspruit gefunden und ihn aufgefordert, sich ihm anzuschließen. Er war dessen sicher, daß sein Brodherr nichts dagegen einwenden werde und dies um so weniger, da er ihn bei der Straußenjagd verwenden wollte. »Ich weiß aber, daß Du kein guter Schütze bist, wie kannst Du Strauße erlegen?« frug ich Saul. — »Doch, Herr, ich treffe sie schon,« antwortete derselbe. Wenn ich sie jagen will, nehme ich einige Makalahari mit mir. Wir suchen hierauf die Spur der Strauße auf, und streben namentlich nach solchen, welche von einem Pärchen herrühren. Mir ist es hauptsächlich darum zu thun, daß ich das Nest der Thiere finde. Beim Neste angelangt, wird ein Loch in die Erde gegraben und hier verstecke ich mich, um den brütenden Thieren aufzulauern. Den ersten zum Neste eilenden Vogel erlege ich mit Leichtigkeit aus unmittelbarer Nähe, den zweiten dadurch, daß ich den Balg des ersteren auf einen Pfahl ziehe und diesen vor dem Neste aufstelle, wenn mich nicht der zweite Vogel schon bei dieser Arbeit überrascht, und sich auf Nimmerwiedersehen empfiehlt. Doch geschieht dies selten und auf diese Weise gelang es mir, schon viele Strauße sammt ihren Eiern zu erbeuten.«
An der südlichsten der Klamaklenjana-Quellen erfuhr ich die Bedeutung der hie und da von den Masarwa’s und Bamangwato’s genannten Flüsse. So z. B. bezeichnet Khori, das Land am Seitenflüßchen des Tschaneng, »eine Trappe« und der Mokhotsi »eine starke Strömung«.
Am 9. kehrte der Genosse Andersons von den nächsten Klamaklenjana-Quellen heim und berichtete, daß ein Boer in dem anliegenden Walde eine Elephantenkuh geschossen habe, welche Nachricht die an der Quelle lagernden Jäger in nicht geringe Aufregung brachte, allein diese steigerte sich noch nach der Rückkehr Theunissens von einem Ausfluge, den dieser in den Wald nach Osten unternommen, und auf dem er auf fünf flüchtige Elephanten gestoßen war. Er rief dem ihm unmittelbar folgenden Meriko zu, ihm rasch die Patronen zu reichen, und hätte hinreichend Zeit gehabt, ein Dutzend Schüsse abzufeuern, wenn nicht Meriko, um das dem Könige gegebene Versprechen, keine Elephanten zu schießen, zu halten, die Jagd dadurch vereitelt hätte, daß er beim Anblicke der flüchtenden Colosse das Weite suchte und Theunissen ohne Munition zurückließ.
Auch ich machte zwei Ausflüge tiefer in den Wald hinein und entdeckte Spuren von Giraffen, Harrisböcken, Kudu’s, Elephanten und Büffeln. Den Tag vor unserer Ankunft war eine Büffelheerde am Wasser beobachtet worden, doch hatte sie sich so zeitlich nach Mitternacht entfernt, daß sie die Jäger am Morgen nicht einholen konnten. Bevor ich noch die Quellen verließ, traf ich hier mit Mr. Taylor zusammen, er klagte auch über den Mißerfolg der Jagd. Einer der Jäger besuchte alljährig eine Stelle in der Umgegend, welche ihm reichliche Beute sicherte; mehrere tief im Walde wohnende Madenassana’s waren seine ausgiebigsten Helfer. Zwei andere Elephantenjäger, die dies vernommen, trachteten auch ihr Glück an derselben Stelle zu versuchen, ein Versuch, der indessen ihr gegenseitiges Freundschaftsbündniß nicht inniger gestaltete.
Am 10. verließ ich meinen Lagerplatz und langte nach einer zweistündigen Fahrt durch den tiefsandigen Niederwald an den nächsten Klamaklenjana-Quellen an. Ich traf hier einen Elephantenjäger mit Namen Mayer, sowie einen Holländer, Mynheer Herbst, an; etwas weiter ab, an einem zweiten Gewässer, einen anderen Holländer mit Namen Jakobs und den Elfenbeinhändler Mr. Kurtin, dessen ich bei der zuletzt beschriebenen Löwenjagd gedachte. Der Letztere theilte mir mit, daß er auf einem seiner ersten Züge in dieses Gebiet nicht weniger als 66 Ochsen durch die schon erwähnte von October bis December in diesen sandigen Niederwäldern aufsprossende Giftpflanze verloren hatte. Jakobs theilte mir einige seiner interessanten, sowie auch die nennenswerteren Löwenabenteuer Pit Jacobs, des zweitberühmtesten Elephantenjägers Süd-Afrika’s mit. Mayer und Herbst jagten in Compagnie, Herbst schoß hier eine Elephantenkuh und war noch immer ganz davon begeistert. Herr Mayer hatte einige Makalaka’s in Dienst genommen, welche auch mir einige Tage zuvor ihre Dienste angetragen hatten, da ich jedoch von diesem unter den Matabele’s wohnenden Banthustamme eine sehr schlechte Meinung habe und nebenbei die hier Betreffenden wahre Galgen-Physiognomien zur Schau trugen, rieth ich Herrn Mayer an, sie aus seinem Dienste zu entlassen. Er wollte nicht darauf eingehen und hatte es leider später zu bereuen. Denn als ich ihn sieben Monate später wieder traf, da hatte der arme und gute Mann, dem ich das Beste von Herzen wünschte, über zahllose Diebstähle zu klagen, welche die Makalaka-Diener verübt, und darnach verschwunden waren. Ich traf auch hier zum ersten Male die den Bamangwato’s unterthänigen Madenassana’s an; es ist ein schöner Menschenschlag, leider von ziemlich abstoßendem Gesichtsausdruck. Von Hautfarbe fast dunkelschwarz, sind es meist hohe Gestalten von starkem Knochenbau, namentlich die Männer. Um so mehr wunderte es mich, unter den Frauen förmlich zarte Geschöpfe zu finden. Die Madenassana’s haben ein stärkeres und längeres Wollhaar, welches besonders an den Schläfen und der Stirne oft bis einen Zoll tief herabhängt. Das Cranium ist dann in der Regel oft kurz behaart.
Besucht ein Bamangwato das sandige Lachenplateau, so sucht er gewöhnlich zuerst die Madenassana’s, die Helfer bei seinen Jagden auf, um für seinen König und sich Elfenbein zu erwerben. Diese wohnen aber in der Regel so versteckt in den dichten Partien der Wälder, daß die Jäger ihre Wohnungen kaum gewahr werden, wenn sie nicht von einem Madenassana selbst zu denselben geführt werden. Der Aelteste in einer solchen kleinen Niederlassung ist dann der kleine Stamm-Unterhäuptling; will man als Blaßgesicht Diener unter den Madenassana’s miethen, so ist es immer das beste, sich an den ältesten des Dörfchens zu wenden. Miethet man sie auf einige Monate, dann bezahlt man ihnen zwei bis vier Pfund Glasperlen, oder auch einige Wolldecken, doch zuweilen wird auch Schießpulver und Blei verlangt, auf die Dauer von sechs bis zehn Monaten begehrten sie eine Muskete.
Im Gegensatze zu vielen anderen Banthustämmen wird bei ihnen die unter einfachen Ceremonien vorgenommene Verehelichung respectirt und eheliche Treue bei ihnen ziemlich hoch gehalten. Während bei manchen Stämmen das Gefühl von Eifersucht nicht gekannt oder nur in einem schwachen Grade vorhanden ist, kann sie nach dem, was ich von meinen Berichterstattern über die Madenassana erfahren, bei ihnen selbst zu schweren Verbrechen führen. Der Stamm wurde mir als genügsam geschildert und auch als Diener sind sie besser als die Masarwa’s und Makalahari’s. Der weiten Entfernung ihrer Wohnplätze von Schoschong wegen — sie bewohnen den nordwestlichen Winkel des östlichen Bamangwato-Landes — und da sie nicht gleich den Masarwa’s über das Land zerstreut sind, ist ihr Verhältniß den Bamangwato’s gegenüber kein so drückend sklavisches wie das der Masarwa’s. Sie besitzen eigene Gewehre, und werden nur jährlich von einigen von dem Könige von Schoschong aus abgesandten Bamangwato’s aufgesucht, welche von ihnen die Abgaben einsammeln, oder sie zu Jagden verwenden. Im Jahre 1874 trafen drei Bamangwato’s einen kleinen Haufen der Madenassana’s im Dienste des Elephantenjägers Zwart an, sie forderten diese auf, den weißen Mann sofort zu verlassen und sich ihnen anzuschließen, was diese indeß verweigerten. Darauf ergriffen die Bamangwato’s die Frau des Aeltesten (des Anführers) und fingen sie zu schlagen an, um durch diese Züchtigung den Sinn der Vasallen zu bekehren, doch der Mann der Geschlagenen ergriff einen ihm zunächst liegenden Assagai, stürzte sich auf den Bamangwato und hätte auch den nächsten von ihnen durchbohrt, wenn diese nicht zu ihren Gewehren gegriffen und auf die Madenassana in Anschlag gebracht hätten.
Die Makalaka’s, deren ich kurz vorher erwähnte und von denen ich eine so geringe Meinung habe, trieben sich in den Jahren 1875 und 1876 recht zahlreich zwischen dem Nata und dem Zambesi herum. Es waren meist Flüchtlinge aus Schoschong, die ihrer verrätherischen Handlungsweise halber aus der unmittelbaren Nähe der erzürnten Bamangwato’s weichen mußten.
Am Nachmittage desselben Tages (des 11.) durchschritt ich, von meinem Diener Pit begleitet, den dichten Wald nach Nordost und traf ein Kudupärchen, das jedoch trotz seines Riesengehörns so rasch in den Büschen verschwand, daß wir keinen Schuß anbringen konnten. Diese Antilope liebt meist hügelige Dickichte oder bewaldete Höhen und nur dies kann es mir erklären, daß sie den Löwen, welche in Süd-Afrika besonders den Rand der Lichtungen lieben, seltener als viele andere Species zum Opfer fällt.
Am 12. verließ ich die zweiten (mittleren) Quellen und begab mich nach den nächsten und dritten, wohin der Jäger Jakobs und der Händler Kurtin schon vorher übersiedelt waren. An diesem Tage langte hier ein Elfenbeinhändler (ich will ihn X. nennen) an, welcher den König des Marutse-Reiches, Sepopo, auf welches ich lossteuerte, besucht hatte, er empfahl mich an seinen guten Freund Z., den ich weiter nordwärts am Panda ma Tenka-Flüßchen finden sollte. Ich ersuchte ihn, mir zwei Kisten gesammelter Gegenstände nach Schoschong zu befördern, was er auch versprach, ohne daß ich später je wieder etwas von denselben sah. Mr. Kurtin verkaufte an ihn zwei Falben (einen derselben hatte ich im Jahre 1874 in Schoschong von der Dickkopsickte geheilt) für 800 Pfund Elfenbein. Auf den beiden Wägen des Käufers waren circa 7000 Pfund Elfenbein geladen, davon waren 5000 Pfund von Sepopo eingehandelt, den Rest hatten die Diener des Händlers auf ihren Jagdzügen am südlichen Zambesi-Ufer, zwischen den Victoriafällen und der Tschobemündung erbeutet. X. berichtete auch, daß am Zambesi das Fieber gefährlich und die noch zu bereisende Gegend sehr wasserarm sei. X. war so gütig, mir den sechsten Theil einer geschlachteten Kuh zu senden, wofür ich mir erlaubte, ihn mit Medicamenten zu versorgen.
Nachmittags reiste ich ab und zog in einer west- bei nördlichem Richtung nach der nördlichsten der Klamaklenjana-Quellen; die durchreiste Waldpartie zeigte schöne Kameeldornbäume, Mimosen und ahornartige, doch auch Mochononobäume und Fächerpalmen-Gebüsche; durch eine ähnliche Gegend führte uns der Weg am 13., wobei wir unser Mittagslager bei den eben genannten Quellen aufschlugen. Ich zählte von den südlichsten bis zu den nördlichsten Quellen 25 nach heftigen Regen gefüllte Einsenkungen.
Auf einigen während der Fahrt durch den Wald unternommenen Abstechern erblickte ich Büffel, gestreifte Gnu’s, Zulu-Hartebeests und Zebra’s im Wechsel und zahlreiche Löwenspuren. An den nördlichsten Klamaklenjanaquellen mündet ein von den Elfenbeinhändlern aus Westmatabele gewählter Weg. Hier traf ich auch drei Elephantenjäger, die Herren Barber, Frank und Wilkinson, von denen sich der erstere als Jäger eines ausgezeichneten Rufes erfreut, ebenso wie seine hochgeehrte Mutter nicht allein eine ausgezeichnete Künstlerin, sondern auch eine äußert feine Beobachterin des Thierlebens ist, und über die Resultate ihrer Betrachtungen auch schon mehrere kleinere Schriften veröffentlicht hat. Mr. Barber zeigte mir sein Skizzenbuch, in dem er seine Jagdabenteuer künstlerisch wiedergab.
Ich übernachtete einige Meilen weiter nordwärts im Walde. Der Baumwuchs auf der am folgenden Tage zurückgelegten Strecke war ungleich besser entwickelt und erreichten mehrere Stämme bis 60 Fuß Höhe; sie gehörten einer Species an, welche von den Holländern die wilde, Syringa, von den Bamangwato’s »Motscha«, sowie eine andere, nicht minder häufige Art, die »Monati« genannt wird. An manchen der Büsche bemerkte ich zahlreiche rothblühende Orchideen.
Gegen Mittag erreichte ich einen in einer unbedeutenden Vertiefung liegenden Weiher, Yoruha, d. h. ein Sprung genannt, wo ich abermals den Jägern, die ich an den letzten Quellen getroffen, begegnete. Der Händler X. hatte ihnen diese Stelle als bleibenden Aufenthalt angerathen, weil seine Diener in den Yoruhawäldern eine Unzahl von Elephanten niedergestreckt hatten. Da nach den Spuren zu urtheilen eine Elephantenheerde an dem Yoruhawasser zwei Tage zuvor zur Tränke gekommen war, erwarteten die Jäger sie auch am heutigen Tage. Um keine Störung durch meine Hunde zu verursachen, ging ich weiter und langte früh am 15. an den Tamafopa-, d. h. den Skeleton-Quellen an. Etwa eine halbe englische Meile nordwärts davon, an einigen gewöhnlich das ganze Jahr hindurch wasserhaltigen Regenlachen entschloß ich mich, den Wagen tiefer in den Wald zu bringen und hier zwei oder drei Tage zu verbleiben, hauptsächlich um womöglich das Fell der Säbelantilope, der schönsten der südafrikanischen Antilopen, zu gewinnen. Auf einem Ausfluge nach dem Westen sah ich Steenbockgazellen und Zebra’s und kreuzte mehrmals von der vorhergehenden Nacht herrührende Spuren von Deukergazellen, Kudu’s, Giraffen, Büffeln und Elephanten, sowie von Schakalen, Hyänen, Leoparden und Löwen. Nach den zahlreichen Spuren, die ich an der größeren der beiden Regenlachen vorfand, zu schließen, mußte diese allnächtlich von einer großen Anzahl von Thieren, namentlich Zebra’s, Büffeln und Harrisböcken besucht werden und ich entschloß mich, hier eine Nacht auf dem Anstande zu liegen. Ich wählte mir diesmal Pit als Begleiter, der mir wohl eine recht amüsante Nacht bereitete, meinen beabsichtigten Zweck jedoch vereitelte. Bevor wir ausgingen, wurde um unseren Waagen eine entsprechende Umzäunung errichtet und Th. versprach jedwede Vorsicht zu gebrauchen, um einer etwaigen Löwenattaque würdig zu begegnen. Eine Stunde vor Sonnenuntergang machten wir uns auf den Weg, um die von mir gewählte Stelle zu besetzen. Der Leser stelle sich in einem hochbegrasten Walde eine stellenweise mit fünf Fuß hohem Riesengras bewachsene, etwa 400 Meter im Umfange messende und etwa 10 Fuß unter dem Niveau des Waldes liegende Lichtung vor, in deren Mitte sich eine kleine, grasbewachsene Regenlache, der Rest des Gewässers befand, das vor wenigen Monaten die ganze Einsenkung ausgefüllt haben mochte. Am westlichen Rande der Lichtung stand ein mächtiger Hardekoolbaum und in der Lichtung selbst, etwa 15 Schritte von dem letzteren, ein etwa 30 Fuß hoher Baum der Acacia detinens, unter diesem erhob sich, theilweise durch ihn gestützt, einer der riesigen Ameisenhügel, und da sich die Aeste des letztgenannten Baumes tief neigten, schien die Stelle zu unserem Anstande wie geschaffen. Wir sammelten einige Aestchen, die von dem Hardekoolbaume abgefallen waren, um damit eine kleine, kaum zwei Fuß hohe Brustwehr zu errichten. Zwischen uns und dem Grase ringsum befand sich eine etwa 2½ Meter breite kahle Stelle, die wir beide für sehr günstig hielten. Da Pit noch nie zuvor auf dem Anstande des Nachts gelegen hatte, frug ich ihn, ob er sich auch stark genug fühle, die ganze Nacht durchzuwachen, er beeilte sich, mich dessen zu versichern und so machten wir unsere Gewehre schußbereit; als wir mit unseren Vorbereitungen fertig waren, hatte eben die Sonnenscheibe den westlichen Horizont berührt. Einige der schönen geschwätzigen Glanzstaare, von ihren weiten Ausflügen zurückgekehrt, zwitscherten noch eine Weile lang in den Zweigen des Hardekoolbaumes, bevor sie in die alljährlich bewohnten Nester hineinschlüpften. Bevor es jedoch dunkel geworden war, verließen wir noch für einen Moment die schon eingenommene Stelle, um dem Rathe meines Dieners nachgebend, von dem Dornbaume über uns einige seiner dünnen, doch langen Aeste abzuschneiden, um die Umzäunung damit zu bedecken. Aus der Ferne ertönendes Schakalgekläffe belehrte uns darüber, daß die Zeit herangekommen, zu welcher das den Tag über weidende Wild dem Wasser näher komme und die von den nächtlichen Streifungen zurückkehrenden Raubthiere sich an ihre gewohnten Raubzüge machten.
Wir nahmen unsere frühere Stellung ein. Pit wählte seine gewohnte halbliegende, ich zog das Hocken vor, weil es mir für die Dauer noch das Angenehmste schien; wir sprachen Anfangs mit gedämpfter Stimme, jedoch hielt ich es für besser, auch davon abzulassen. Wir mochten eine halbe Stunde lang gelauscht haben, als ich vorsichtig aufstehend auslugte, doch konnte ich nichts sehen, und selbst über die Richtung, aus welcher ein eigentümlich gedämpfter Ton zu mir drang, konnte ich mich anfangs nicht orientiren, erkannte aber bald zu meiner Enttäuschung und Entrüstung, daß es Schnarchtöne waren, die sich dem weitgeöffneten Munde meines harmlos eingeschlafenen Dieners entrangen. Etwas unsanft geweckt, fühlte sich Pit über meine Beschuldigung bitter gekränkt und versprach den Anfechtungen Morpheus’ zu widerstehen — doch die Allgewalt des Schlafgottes besiegte schneller als ich es gedacht, den schwachen Willen des Schwarzen, dessen ganze Seligkeit eben der Schlaf war.
Gegen 10 Uhr, als das fahle Mondlicht über die Lichtung hinfluthete, vermengten sich seine melodischen Kehlkopftöne mit einem dumpfen Laut, wie wenn sich von Westen her ein Trupp Pferde dem Wasser nähern würde. Ich ergriff mein Gewehr und an den Mimosenstamm angelehnt, lugte ich zwischen diesem und dem an acht Fuß hohen Termitenhügel aus, der Laut wurde mit jeder Minute stärker und rührte unstreitig von Zebra’s her. Ich sollte auch nicht lange darüber im Zweifel bleiben, denn etwa eine Viertelstunde später, nachdem ich den Laut vernommen, erschienen auf der grell vom Lichte des Mondes beschienenen freien Stelle zwei Zebra’s, welche vorsichtig nach allen Seiten Rundschau hielten und beinahe nach jedem zweiten Schritte stehen blieben, um zu lauschen, wovon die sich aufrichtenden Ohren deutlich zeugten; nach wenigen Augenblicken kam die etwa 20 Stück zählende Heerde. Ich war unentschlossen, ob ich sofort feuern oder vielleicht zuvor noch Pit in die Gegenwart zurückrufen sollte, damit auch dieser zum Schuß käme. Die ganze Heerde stand nun auf der Lichtung ruhig wie eine aus Stein gemeißelte Gruppe. Die Betrachtung dieses schönen Bildes war mir kaum zwei Minuten lang vergönnt, denn aus der Tiefe unter mir drangen zwei das Gehör, den Geist und die Seele tief verletzende Mißtöne in die Stille der Nacht, laut genug, um von den kaum sieben Schritte entfernten Zebra’s gehört zu werden. Um die Thiere nicht vollends zu verscheuchen, weckte ich den Unverbesserlichen. Diesmal erhob er sich sofort, griff jedoch in seinem Schlaftaumel nach der niederen Umzäunung, welche mit Ausnahme der obersten Lage aus trockenen Zweigen bestehend, unter seinem Gewichte zusammenbrach, während ich nun rasch nach ihm griff, um ihn vor dem Falle zu schützen, damit er die Thiere nicht vollends vertreibe, wirft sich die Zebraheerde in Blitzesschnelle herum und war verschwunden, bevor ich noch an’s Feuern denken konnte.
Bald darauf schnarchte Pit lustig weiter. Mitternacht kam und nichts wollte sich hören lassen, doch gegen 1 Uhr, als sich der Mond wieder gesenkt hatte, vernahm ich ein Blöken von Nordwest her, welches sich der Lichtung zu nähern schien. Es war eine Büffelheerde, die Thiere hatten jedoch unsere Witterung bekommen und waren an der Lichtung vorübergegangen, und bei einer zweiten, die 500 Schritte nach Osten zu lag, eingekehrt. Ich wollte auch dieses vorüberziehende Wild zur Kenntniß meines wißbegierigen Dieners bringen und machte ihn auf das Brüllen und Blöken aufmerksam. »Kühe, Kühe und Kälber,« meinte er, »Th. hatte sie nicht fest gemacht.« Dann lehnte sich sein müder Oberkörper wieder zurück und bevor ich noch mein Lachen über seine Antwort unterdrückt, war er wieder eingeschlafen. Doch auch bei mir fing die Müdigkeit an, merklich ihre Rechte geltend zu machen, und ich versank in einen Halbschlummer, aus dem mich ein Geräusch, einem sich nähernden Sturmwind nicht unähnlich, emporriß.
Mehr denn 20 Minuten hindurch konnte ich über die Ursache desselben nicht klug werden, nicht eher, als bis ich dessen sicher war, daß es von einer der beiden ostwärts von uns liegenden Regenlachen herkam, und ein schnarrender trompetenartiger Ton mein lauschendes Ohr traf. Es war eine zahlreiche Elephantenheerde, welche sich in dem größeren, mit Gras reichlich durchwachsenen Gewässer gütlich that. Deutlich konnte man zwischen dem trompetenartigen Geschnurre das Plätschern der Riesenthiere im Wasser vernehmen. Durch diese Wahrnehmung aufgeregt, ergreife ich Pits Hand und ihn aufrüttelnd, deute ich auf das Geräusch hin. »Ja,« lallte er, »decken Sie sich nur zu, der Wind bläst heute gar stark«. Nach wiederholtem Rütteln gelang es endlich, dem blöden Schläfer die Situation begreiflich zu machen.
»Ich erinnere mich,« sagte ich, »an zwei kleinen Stellen trockenes Gras gesehen zu haben, wir stecken dies in Brand, der die Thiere erschrecken und uns einen Anblick bietet, wie wir ihn wohl nach jahrelangem Wandern im Innern Süd-Afrika’s nicht oft erleben werden.« Doch damit zeigte sich mein Heldenjüngling nicht zufrieden. »Doctor, haben Sie heute Früh die zahlreichen Löwenspuren gesehen, und dahin sollen wir gehen? Aus dem hohen Gras können uns die Löwen auf den Rücken springen, bevor wir uns nur umwenden können.« Der Mond neigte sich zum Untergange, die Nacht fing an sich zu verdunkeln und nachdem ich mir die Sache reiflich überlegt, beschloß ich diesmal dem Rathe meines Dieners nachzugeben. Wir lauschten noch eine Weile und dann entschlummerte Pit, doch es dauerte nicht lange und unwillkürlich folgte auch ich seinem Beispiele.
Wir mochten uns etwa eine halbe Stunde lang diesem Genusse hingegeben haben, als ich plötzlich durch ein unmittelbar vor dem Anstande hörbares Gebrülle zum Bewußtsein gebracht wurde, welches mich zum raschen Handeln nöthigte und mir die nächtliche Kühle vergessen ließ; es war das Gebrülle eines Löwen, dem ein schwächeres, mehr ein Brummen, jenes der Löwin folgte. Das Gebrüll wiederholte sich dann etwa 30 Schritte vor uns, worauf es sich zu nähern schien, ich kniete nieder und machte mich schußbereit, doch konnte ich der Dunkelheit halber nichts sehen, weshalb mir auch meine Lage etwas unangenehm vorkam, und dies um so mehr, als ich dessen sicher war, daß wir schon lange von den Raubthieren beobachtet wurden und meine Hände in Folge der Feuchtigkeit ziemlich starr geworden waren. Doch da liegt ja Pit, gewiß ein Retter in der Noth, doch konnte ich mich auf ihn verlassen?
Ich will zugeben, daß es ein etwas unsanfter Rippenstoß war, den ich ihm nun versetzte, denn rasch hob er sich empor und weil sich zufällig in diesem Augenblicke das Löwengebrülle wiederholte, war es nicht nöthig, Pit eine Erklärung dieses Lautes geben zu müssen. Er sprang sozusagen kerzengerade auf, und griff mit der Hand nach dem überhängenden Aste der Mimose. Auch die Raubthiere mußten das Geräusch vernommen haben, wir hörten, daß die Thiere näher kamen, nun schien mir auch zum zweiten Male des Dieners Wink vortrefflich, und der Baum eine rettende Insel werden zu wollen. Doch wie hinauf gelangen? Ich hatte eine von den schottischen Flachmützen, so wie ein Paar hohe Stiefel und einen bis an die Kniee reichenden Ueberzieher, so bewaffnet, war es vielleicht möglich, mir einen Weg nach Oben durch das dichte Netz der mit Doppeldornen versehenen Zweige zu bahnen, ich zog zum Ueberfluß den Ueberrock noch über den Kopf und ließ mich von Pit hinaufschieben, um desto leichter die Hindernisse zu bewältigen. Als ich den Fuß auf die ersten stärkeren Zweige setzte, zog ich Pit nach, der mir zu gleicher Zeit die Gewehre reichte. Trotzdem, daß wir endlich eine etwa drei Meter hohe Stelle über dem Boden eingenommen hatten, war es uns doch nicht möglich, ob der herrschenden Dunkelheit und des hohen Grases so viel von den Löwen zu erblicken, daß wir auf sie feuern konnten. Sie blieben brüllend im Hochgras der Lichtung hin und her rennend, bis gegen den Morgen, um welche Zeit sie in der Richtung, aus welcher die Büffel gekommen waren, verschwanden. Als wir nach ihrer freundlichen Entfernung auch zu unserer Abreise schritten, besuchten wir das jenseitige Wasser, aus dem indeß sowohl die Büffel als auch die Elephanten verschwunden waren. Hier fanden wir, daß wenigstens 30 Elephanten, darunter auch Kälber, dasselbe besucht hatten.
Da ich an den Thieren Beobachtungen anstellen wollte, so folgte ich ihnen mit Pit nach, nachdem wir zuvor am Wagen einen Morgenimbiß eingenommen und von Th. vernommen hatten, daß das Löwenpärchen auf einer freien Sandstelle kaum einen Steinwurf weit vom Lagerplatze gebrüllt habe. Doch gab ich die Verfolgung wieder auf, weil die Elephanten, nach den Spuren zu urtheilen, einen Vorsprung von mehreren Meilen hatten. Obgleich ich am selben Tage Tamafopa verlassen wollte, hatten mir doch die Elephanten in der vorigen Nacht das Herz so warm gemacht, daß ich noch einen Versuch allein unternahm, bei dem Gewässer, wo sie sich herumgetummelt hatten, auf dem Anstande zu liegen. Ich besah mir genau den Ort und wählte als den besten Observationspunkt einen etwa 50 Fuß hohen, dicken schönen Haardekoolbaum, an dem jedoch die niedrigsten Aeste so hoch begannen, daß es mich Wunder nahm, wie ich hinauf gelangen sollte. Endlich fand sich auch das Mittel hierzu, ich band acht Stück Ochsenriemen zusammen, nahm Pit und Meriko mit und ließ mich hinaufziehen. Oben machte ich es mir zurecht, so wie ich konnte, um das nächtliche Treiben bei dem Weiher so deutlich als möglich beobachten zu können. Leider war mein Harren ein vergebliches, es kam die Nacht, in diesem Theile der südafrikanischen Troppen von eigenthümlicher winterlicher Kühle und Schönheit, ich fror ganz entsetzlich. Gegen Mitternacht hörte ich zwar die herannahende Elephantenheerde, doch zugleich auch das wohlbekannte Knallen der afrikanischen Riesenpeitsche, und es währte nicht lange, daß das in den Büschen, von der Elephantenheerde verursachte Knacken, schwächer wurde und endlich, je näher der Wagen kam, gänzlich aufhörte. Wie ich später vernahm, war es der Elfenbeinhändler Kurtin, der nach dem Panda ma Tenka-Thale zog, um hier seinen mit einem Wagen vorausgesandten Bruder zu treffen.
Am 17. versuchte ich, ein Erdferkel (einen Termitenfresser) auszugraben. In der Nacht auf den 18. tödteten wir zwei Fahlschakale und zogen durch sehr tiefen Sand nach den Tamasetse- (d. h. sandiger Ort) Weihern, an denen ich bis zum nächsten Morgen verblieb. Da ein kalter Wind über die Lichtung, in der die Weiher liegen, herunter pfiff, zog ich meinen Wagen in’s Gehölz, um hier ein ruhigeres Nachtlager zu finden, und dies deshalb, weil ich bis zum 20. hier zu verweilen gedachte, um einer Säbelantilope habhaft zu werden. In der Nacht wurden wir plötzlich durch einen Aufschrei Meriko’s wachgerufen. Eine Schlange hatte sich auf seinem Unterleibe eingenistet. Leider war Meriko über diesen Besuch so erbittert, daß er das enteilende Thier schwer verletzte, bevor ich es für meine Sammlungen retten konnte.
In Folge der Anstrengungen der letzten Tage und der schlaflosen Nächte fühlte ich mich sehr unwohl, und war froh, mich an dem Lagerfeuer erwärmen zu können. Ich war eben mit der Durchsicht meines Tagebuches beschäftigt, als mich ein Aufschrei Th.’s dazu bewog, mich rasch umzusehen. Ich war, ohne das Thier gesehen zu haben, neben einer wahrscheinlich durch die Wärme des Feuers angelockten Buffadder gesessen. Wenige Secunden später war diese Schlange meinen Sammlungen einverleibt.
Henry’s-Pan. — Leiden und Freuden der Elephantenjäger. — Eine Löwenjagd des jungen Schmitt. — Makalaka’s. — Ein muthiges Weib. — Nächtlicher Ueberfall durch einen Löwen. — Die südafrikanischen Löwenspecies. — Leben und Gewohnheiten des Löwen. — Seine Angriffsmethoden. — Ankunft in Panda ma Tenka. — Blockley. — Der Elfenbeinhandel mit Sepopo. — Elandstiere. — Aerztliche Praxis am Henry’s Pan. — Thier- und Pflanzenleben im Panda ma Tenka-Thale. — Bienenschwärme. — Westbeech’s Handelsstation. — Saddler’s Pan. — Der Händler Y. — Im Leschumothale. — Gereizte Elephanten auf der Flucht durch den Wald. — Am Ufer des Tschobe.
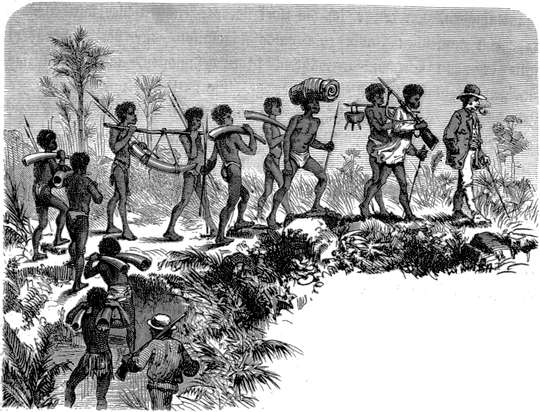
Heimkehrende Elephantenjäger.
Zeitlich Morgens verließ ich am 20. Juli mein Lager im Tamasetsewalde und zog in der wiesigen Einsenkung weiter nach Norden. Spät am Nachmittage holte uns zu Pferde ein ärmlich gekleideter holländischer, etwa 14 Jahre alter Knabe ein. Als ich ihn, nicht wenig erstaunt, über den Zweck der Reise befragte, erfuhr ich, daß seine Eltern in einer Hütte an der nächsten Lache wohnten, und daß ihn der Vater unter Begleitung von nur zwei Schwarzen mit einem Ochsenwagen nach dem entfernten Makalakalande gesendet habe, um Kaffirkorn gegen Glasperlen und Kattun einzutauschen.
Am folgenden Morgen langte ich an diesem Gewässer an, das nach dem Diener eines Jägers mit Namen Henry, der hier eine Giraffe erlegt hatte, Henrys-Pan genannt wurde. Ich fand hier drei Boerfamilien, drei holländische Jäger, Schmitt und die Gebrüder Lotriet. Der erstere lebte bereits in einer geräumigen Grashütte seit einem Monat hier und hatte Tags vor meiner Ankunft eine Säbelantilope erlegt. Als einer der erfahrenden Jäger bereicherte er meine Jagdskizzen mit einigen äußerst interessanten Löwenabenteuern und Scenen aus den Elephantenjagden, von denen ich die zwei überraschendsten hier mittheile.
Im laufenden Jahre (die halbe Jagdsaison war bereits vorüber) hatte er neun Elephanten, während seiner gesammten, nahezu zwanzigjährigen Jagdthätigkeit über 300 erlegt. Er hatte sich vor nicht langer Zeit mit der Witwe eines Jägers, der im Matabele-Lande gestorben war, durch einen der Herren Missionäre daselbst trauen lassen. Sein ältester Stiefsohn ist der Held der beiden folgenden Begebenheiten. Vor zwei Jahren lag Schmitt an der südlichsten Klamaklenjana-Quelle mit der Absicht, hier seinen Stiefsohn mit den Elephanten und ihrer Jagd vertraut zu machen. Als man eines Morgens gefunden, daß zahlreiche Elephanten eine der Quellen während der Nacht besucht, machte er sich gegen Mittag von seinem Sohne und dessen kleinem Leibdiener, einem Masarwa, begleitet auf den Weg, um der Spur der Thiere zu folgen. Kaum eine Stunde weit vom Wege entfernt, sah Schmitt, der beritten war, einen mächtigen männlichen Elephanten Siesta halten. Das wohl kranke Thier war hinter seinen Genossen zurückgeblieben. Schmitt wollte dem folgenden Knaben das Thier nicht eher zeigen, als bis sie auf 50 Schritte nahegekommen waren, worauf er sich mit ihnen dem Thiere behutsam und durch Büsche gedeckt näherte, dann hieß er sie nach der bekannten Weise das Thier »kehren«, d. h. sie hatten vor das Thier zu laufen, es durch einen Schrei zu wecken, und nach der Richtung, woher sie gekommen waren, oder nach einer anderen Seite hin zur Flucht zu bringen. Von der Beschaffenheit des Windes hängt es nun ab, auf welche Seite des flüchtenden Elephanten sich der Jäger zu stellen hat. Als jedoch die Nimrod-Aspiranten das Riesenthier erblickten, nahmen sie Reißaus. Schmitt wandte jedoch sein Pferd und jagte ihnen nach, löste seine Nilpferdpeitsche vom Sattel peitschte beide zu dem Elephanten, und befahl ihnen, aus einer Entfernung von 30 Schritten auf den Elephanten zu feuern. Beide Kugeln schlugen in die Fleischmasse der Schenkel ein. Der Jäger befiehlt seinem Gehilfen von Neuem zu laden, sprengt dann vor den Elephanten, der aufstürzend mit dem Rüssel, aus dem Winde die Stellung seiner Gegner zu ergründen sucht, um das Thier mit lautem Geschrei zu den Jägern zu treiben, allein das verwundete Thier machte dem Jäger einen Strich durch die Rechnung, denn es kehrte sich, sowie es den Reiter erblickte, gegen diesen und jagte ihm laut brüllend, mit hochgehobenem Rüssel nach. Der alte Jäger machte aber von seiner Flucht den besten Gebrauch, indem er nach einem seiner kleinen Genossen zusprengte, um das Thier auf die neuen Gegner aufmerksam zu machen. Obgleich der Elephant jetzt einen anderen Anblick darbot als zur Zeit seines Schlummers, wichen doch die kleinen Jäger, denen vielleicht noch von der vorhergehenden Züchtigung ein unangenehmes Gefühl zurückgeblieben war, nicht von ihrem Posten und sandten ihre beiden vierlöthigen Kugeln dem vorüber trabenden Thiere in das Ohr, so daß sein Tod vor Ablauf von zwei Minuten erfolgte.
Ein Jahr vorher hatte Pit, der Stiefsohn Schmitts, mit seinem kleinen Diener auf eigene Faust eine Elephantenkuh, einen Löwen, zwölf Giraffen, sechs Strauße, eine Säbel-Antilope geschossen und zahlreich waren seine Opfer unter den Zebra’s, Eland- und Kudu-Antilopen. Vor drei Jahren, als noch Pit ein Junge von 11 Jahren war, jagte sein Stiefvater im Matabele- und Maschona-Lande. Auf dem Heimwege begriffen, war er bis zu dem Ramakhobanflusse gelangt, wo er einige Tage auszuruhen gedachte. Hier ritt er mit seinem Sohne Pit aus, um frisches Fleisch für die Seinigen zu gewinnen. Eine Meile vom Wagen entfernt, wurden die Jäger von einem tiefen Brummen überrascht, welches aus einem Gebüsche vor ihnen zu kommen schien. Bevor sie sich noch genau überzeugen konnten, in welchem Gebüsche das ihnen dem Laute nach wohlbekannte Raubthier liege, stürzte dieses, eine ausgewachsene Löwin, mit fletschenden Zähnen auf die Jäger los. »Vater,« ruft Pit, »soll ich zuerst feuern oder willst Du den ersten Schuß haben?« Der alte Jäger, dem das Benehmen des Raubthieres ungewöhnlich vorkam, und da es so zornig schien, es irgend verwundet glaubte, behielt sich den letzten und entscheidenden Schuß vor. Darauf feuert Pit beide Schüsse seines kleinen Doppelgewehres auf das Raubthier ab, welches sich eben niedergelegt hatte, um auf seinen Vater den Sprung zu wagen, beide Kugeln trafen das Thier, in den Schädel über dem linken Ohre eindringend, daß es sofort zusammensank. Pit war, dem Befehle seines Vaters Folge leistend, vom Pferde herabgestiegen, und hatte den Zügel über den linken Arm geworfen, in stehender Stellung gefeuert. Bei der Untersuchung des Thieres fand sich, daß die Löwin unter einen der vergifteten Fall-Assagaie gerathen und am Rücken verwundet worden war.
Außer Schmitt befand sich noch ein Mann aus der Colonie an Henry’s Pan, der ebenfalls der Jagd halber hierher gezogen war und der an einem Epitelialkrebs des Unterkiefers litt. Die beiden Familien der Lotriet, die eine aus neun, die zweite aus drei Personen bestehend, waren sämmtlich am Fieber erkrankt. Zwei nothdürftig aus Zweigen und Gras errichtete Hütten, die weder gegen Regen, noch gegen die sengenden Sonnenstrahlen hinreichenden Schutz boten, waren der Aufenthalt der Armen. Hier lagen sie auf der Erde, hungernd und ohne jedwede Hilfe in einem erbarmungswerthen Zustande. Sie beschuldigten einen Händler, sie in diese Gegenden und bis zum Zambesi gelockt und sich ihrer dann auf schnöde Weise entledigt zu haben. Als ich später sechs andere Elfenbeinhändler darüber befragte, bestätigten mir diese nicht allein, was die beiden Lotriets freiwillig gebeichtet, sondern berichteten mir so viel über dieses Individuum, daß ich mich aus verschiedenen Gründen, namentlich aber, damit sich nicht Aehnliches wiederhole, genöthigt sah, die traurige Geschichte dieser Lotriets der Oeffentlichkeit zu übergeben. Ich that dies in den »Diamond News« unter dem Titel »Dark Deeds« und behalte mir weitere ähnliche Veröffentlichungen für später vor.
Die meisten der kranken Lotriets schwebten in Lebensgefahr, sie trugen nur zu deutlich an ihrem Körper die Spuren des Fiebers zur Schau und es fehlte ihnen nicht allein an Kleidungsstücken, sondern auch an den nöthigen Heilmitteln. Ich verabreichte ihnen diese, und erhielt von dem einen der Lotriets einen acht Pfund schweren Elephantenzahn dafür, dessen Werth jenem des verabreichten Chinins annähernd gleichkam. Drei Tage zuvor hatten die Leute für etwa sechs Unzen Ricinusöl (Castor oil) eine gleiche Entschädigung zahlen müssen.

Ein muthiges Weib.
Auf einem in die Nähe unternommenen Ausfluge hatte ich die Gelegenheit, Kudu-Antilopen in der Nähe beobachten zu können, leider hatte ich mich dabei in dem endlosen Walde verirrt, mit Hilfe der Sonne jedoch spät Nachmittags den Lagerplatz wiedergefunden. Auf einem anderen Ausfluge kam ich zu zahlreichen von einer Elephantenheerde gegrabenen Löchern. Sie waren meist kreisrund und hatten einen Durchmesser von 4 bis 6 Fuß und waren etwa 1 bis 1½ Fuß tief; hat der Elephant mit dem Tastorgan seines Rüssels die von ihm namentlich gesuchten Wurzeln und Knollen gefunden, so läßt er sich auf die Knie nieder, um die beliebte Nahrung mit den Stoßzähnen herauszugraben. Da jedoch die gesuchtesten solcher Pflanzen zumeist am Abhange von Felsenhügeln an und zwischen dem Gestein sich finden, zeigen die sich in diesen Gegenden aufhaltenden Elephanten an den Spitzen stark abgeschliffene Hauer; daher rührt auch die Ungleichheit der Elephantenzähne rücksichtlich ihrer Schwere welche Gewichts-Differenz oft vier Pfund erreicht.
Mein über die Makalaka’s gefälltes Urtheil fand ich hier wieder durch einige Berichte bestätigt. Ich will vorläufig einen derselben im Folgenden mittheilen. In der Abwesenheit ihres Gemahls hatten es zweimal Makalakadiener versucht, Frau Schmitt die Gewehre aus dem Wagen zu stehlen; in dem einen Falle hatte es das Weib des Jägers verhindert, in dem zweiten kam sie zu spät und hatte nur noch das Nachsehen; da sie jedoch um jeden Preis die beiden gestohlenen Gewehre wieder bekommen wollte, ergriff sie den im Wagen verborgen gewesenen Hinterlader ihres Mannes und eröffnete vom Bocke aus »Feuer« auf die flüchtigen Diebe, welche dasselbe mit ihren Musketen erwiderten, ohne jedoch die Frau zu verwunden.
Nur noch eine Reminiscenz aus dem Leben dieser einfachen Holländerin sei hier erzählt, bevor wir von Henry’s Pan scheiden. Vor vier Jahren, als sie noch an Mynheer van de Berg verheiratet war und mit ihm im wildreichen, allein ungesunden Maschonalande der Elephantenjagd halber verweilte, erkrankte er an demselben Fieber, wie jene, die ich an dem Gewässer getroffen. Drei Monate lag dieser schon darnieder; als sich keine Aussicht auf Besserung zeigte, lud sie ihn auf den Wagen, ergriff die Peitsche und trieb das lange Ochsengespann nach dem entfernten Matabelekraal, in welchem sich der Missionär Thompson aufhielt, um von diesem Hilfe zu erflehen. Doch schon drei Tage später starb ihr Mann, die Hilfe war zu spät gekommen. Im selben Jahre verehelichte sie sich mit Schmitt, der vor sieben Jahren am Ramakhoban-River seine erste Gemahlin an derselben Krankheit verloren hatte.
Am 23. schoß Schmitt im Walde einen Elandstier und zeigte mir den Talgsack, in dem sich das Herz befand; dieses Talgstück wog 29 Pfund. Als ich mich darüber wunderte, antwortete man mir, daß das durchaus nicht eines der schwersten sei; dieses Elandtalg hält in Bezug auf seine Qualität die Mitte zwischen Fett und Rindstalg. Ich suchte die beiden Lotriets von der Jagd abzuhalten, da sie fieberkrank waren, doch erhielt ich von beiden die leider nur zu begründete Antwort. »Herr, unsere Familien können doch nicht Hungers sterben.« Auch die beiden Lotriets vermehrten die Sammlung meiner Erzählungen von Löwenjagden durch einige interessante Episoden aus ihren vieljährigen Jagden im Bamangwato- und Matabele-Lande.
Zu meiner Genugthuung nahm ich bei allen den Kranken, mit Ausnahme jenes, der an Carcinoma litt, am 25. eine Besserung ihres Zustandes wahr, besonders an jenen, welche in Lebensgefahr schwebten; sie waren sämmtlich derselben entrückt. Der eine der beiden Lotriets beschrieb mir eine Stelle, an welcher beinahe täglich vier Strauße, darunter zwei Hähne, zu finden waren, ihnen selbst einige Stunden aufzulauern, hatten weder er noch sein Bruder die nöthige Kraft, und da er sich besser fühlte, wollte er mir seine Erkenntlichkeit in der Weise an den Tag legen, daß er mir die Jagdbeute verschaffen wollte; aus den bereits entwickelten Gründen konnte ich jedoch sein Anerbieten nicht annehmen.
In der Nacht vom 24. auf den 25. hatte ein Löwe auf die etwa eine Stunde weit entfernte Umzäunung, in welcher die Lotriets ihre Zugthiere hielten, einen Angriff gemacht, als der durch den Löwen in der Umzäunung wachgewordene Diener mit einem Feuerbrande aus seiner Grashütte heraussprang und den Löwen in die Flucht schlug.
Am 26. verließ ich Nachmittags Henry’s Pan und zog weiter in forcirten Tagemärschen nordwärts, um eine wasserlose Strecke möglichst bald überwunden zu haben. In der einförmigen Gegend — der Weg führte mehrere Tage durch tiefsandigen Wald — fiel uns ein Baobab auf, welcher unmittelbar über der Erde 98 Fuß 10 Zoll im Umfange hatte. Minder arm und eintönig als die Gegend war die Vogelwelt auf dieser Strecke: unter den Raubvögeln fielen mir namentlich die ziemlich häufig sichtbaren Buteo’s auf, unter den Nachtraubvögeln fand ich Zwergeulen, unter den Singvögeln waren zwei Pyrolarten und Fliegenschnapper bemerkenswerth, die Männchen der letzteren waren durch einen langen Schweif ausgezeichnet, auch überraschte mich die große Zahl der kleineren Sänger, ich traf hier mehr derselben an, als an manchen anderen Orten mit mannigfacher und üppiger Vegetation. Am zahlreichsten von allen waren jedoch die Würger vertreten, namentlich auffallend war eine große Species mit prachtvoll rothem Unterleib und Kehle, welche sich die niederen und dichtesten Gebüsche zum Aufenthalte gewählt. Gelbgeschnäbelte Tukane waren nicht selten zu erblicken, in großer Menge wieder die kleineren, langschwänzigen Wittwenarten, sowie die wiedehopfartigen und Bienenfresser. Meine Sammlungen wurden auch durch zahlreiche Pflanzen, besonders Samenarten und Früchte, Holzschwämme etc. vermehrt.
Am 30., nachdem wir den beträchtlichen Aufstieg auf das waldige Plateau bewältigt, gelangten wir auf eine hochbegraste, nach zwei Seiten von Wäldern umsäumte Ebene. Dieser Abhang des Plateaus zeichnete sich durch einige bisher von mir nicht beobachtete Thier- und Pflanzenspecies tropischen Charakters aus. Manche der Leguminosen (Bäume) fielen mir durch das eigentümliche Entleeren ihres Samens auf. In Folge der Sonnenhitze barsten die Samenschoten mit einem lauten Geräusche, wobei die Samen herumgestreut wurden. Tausende von kleinen Bienchen schwärmten in der Luft, verkrochen sich in die Haare, Kleider und belästigten Augen, Ohren und Nase. Seitdem wir den Nata-River verlassen hatten, waren wir langsam höher und höher gestiegen, nun schien es mir, daß wir den Culminationspunkt des Plateau’s erreicht hatten. Am Nachmittage fuhren wir zum ersten Male nach längerer Zeit an einigen unbedeutenden, Melaphyr und Quarzit aufweisenden, niederen Höhen entlang, an welchen sich namentlich der Baobab bemerkbar machte, die übrigen Bäume und Sträucher aber, wahrscheinlich ob des steinigen Bodens mehr oder weniger verkrüppelt erschienen. Am Abend langte ich endlich an dem längst ersehnten ersten Zuflusse des Zambesi an; es war nur ein Bächlein, welches nahe an unserem Lagerplatze seinen Ursprung nahm, doch bildete es stellenweise tiefe Tümpel, denen man, so verlockend sie auch zum Bade einluden, nicht trauen durfte, da sich in ihnen oft Krokodile aufhalten. Das Gras an den Lichtungen ringsum und in den Thälern war niedergebrannt, stellenweise brannten noch die Büsche, die wahrscheinlich durch Straußenjäger in Brand gesetzt worden waren, um rasch das frische Gras zum Keimen zu bringen und damit die Strauße an diese Orte zu fesseln. Von dem Deikha-Flüßchen ab, mehrere Thäler, deren Regenabflüsse nach den letzteren zuführten, sowie bewaldete Sand- und Felsenhügel am 31. überschreitend, gelangte ich am Abend in das obere Thal des Panda ma Tenka-Flüßchens, das eine Strecke lang nach Norden und später nach Nordwest floß, und nachdem es zahlreiche Regenzuflüsse, sowie Spruits und stets fließende Berggewässer aufgenommen, unterhalb der Victoriafälle in den Zambesi mündet. Ich fand am linken Abhange zum Flusse mehrere Wägen vor, denn die ebenerwähnte Stelle bildet, seitdem englische Händler mit den Zambesivölkern in Verkehr zu treten begonnen haben, das Rendezvous derselben und ebenso der Elephantenjäger. Hier hatte der Zambesihändler Westbeech eine Handelsstation errichtet, welche aus einem umzäunten, eine Hütte und ein viereckiges Lagerhäuschen enthaltenden Gehöfte bestand. Einige Zeit im Jahre verweilte der Händler selbst hier, in seiner Abwesenheit versahen seine Geschäftsführer Blockley und Bradshaw die Geschäfte. Kam er vom Süden mit neuen Waaren hieher, nachdem er Elfenbein nach den Diamantenfeldern geführt, so trat er von hier aus seine Handelszüge nach Schescheke und den Zambesi abwärts an.
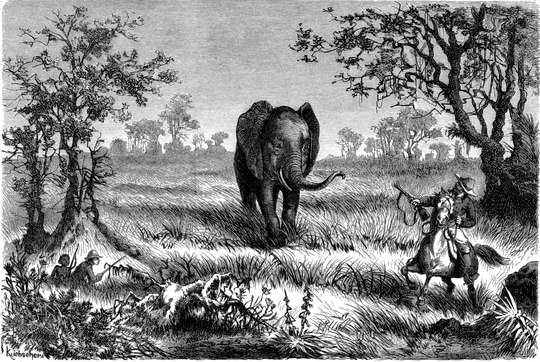
Unterricht im Elephantenjagen.
Ich traf in der Handelsstation Herrn Blockley an und in den Wägen Herrn Anderson, dessen ich schon erwähnt und der sich auch diesmal sehr freundlich zeigte. Als ich mich darüber wunderte, daß man hier so hohe Umzäunungen um die Wägen errichtet hatte, antwortete man mir: »Ja, aber die Löwen laufen auch hier wie die Hunde herum.« Der Weg war thatsächlich mit frischen Löwenspuren bedeckt. Die Löwenabenteuer, welche sich in der letzten Zeit in der unmittelbarsten Nähe der Station zugetragen, bilden einige der interessantesten, die ich meinen Tagebüchern einverleiben konnte. Ich will dem Leser eines derselben hier anführen und zwar jenes, bei welchen die schon an Henry’s Pan erwähnten Lotriets und zwar der ärmere der beiden Brüder und dessen zahlreiche Familie argen Schaden erlitten.
Am linken Ufer des Flüßchens, d. h. an dem zum wiesigen Thale herabführenden Waldabhange, einige hundert Schritte oberhalb der Handelsstation, standen im Mai 1875 fünf Wägen und ein zweirädriger Karren. Um die Zeit als sich dieses Abenteuer zutrug, waren die Besitzer der Wägen mit Ausnahme des A. Lotriet, der sich auf die Elephantenjagd begeben, anwesend. Obgleich man täglich Löwen in unmittelbarer Nähe oder auch weiter ab brüllen hörte, hatte sich doch keines der Raubthiere noch zu einem Angriff auf Menschen und Hausthiere erkühnt und dadurch die Lagerinsassen in vieler Hinsicht sorglos gemacht, wofür die äußerst primitive Umzäunung des Lagers sprach.
Auch der 15. Mai verlief ruhig und die ihm folgende Nacht schien den Bewohnern des Thales umsoweniger gefahrdrohend zu werden, als der Mond sein silbernes Licht so hell über Berg und Thal ergoß, daß sich die Objecte deutlich und in großer Ferne abhoben. Trotzdem unterließen es die Matabele-Diener auch in dieser Nacht nicht, wie sie es in dunklen Nächten zu thun gewohnt waren, zwei mächtige Feuer zu beiden Seiten ihrer Hütten anzuzünden. Die Weißen hielten nur ihre Bedürfnisse in den Wägen, sie selbst, mit Ausnahme Y.’s, schliefen in den Grashütten nebenan. In der Lotriet’schen Hütte hatten sich die kleineren Kinder bereits zur Ruhe gelegt, nur die Mutter und die älteste Tochter waren noch wach, sie saßen an der niedrigen Thüröffnung und blickten durch dieselbe in die mondscheinhelle Nacht hinaus. Da schien es der Frau, als ob sie auf einer der freien Stellen vor der Hütte einen dunklen Gegenstand sich bewegen gesehen hätte. Um besser sehen zu können, kroch die Beobachterin aus der Hütte und sah schärfer nach dem Gegenstande. Auch die Tochter lugte aus dem Innern hervor, doch beide konnten den sich nähernden Gegenstand nicht erkennen, nicht eher, als bis er auf eine größere, grell beschienene Lichtung herausgetreten war und sich nun beiden als ein Löwe erkennbar machte. Mit einem Schrei stürzte die Mutter nach dem Wagen zu und suchte in diesem Zuflucht, während die Tochter eine Matte gegen die Thüröffnung der Hütte preßte, um sie zu verschließen. In ihrer Angst vergaß die Frau alle Rettungsmaßregeln, unterließ es, die Matabele-Diener herbeizurufen, welche mit Feuerbränden den Löwen verscheuchen und das am Wagen angekoppelte Pferd retten konnten. Kaum war die Frau in denselben gelangt, so fühlte sie einen heftigen Ruck am Wagen, dem ein lautes Fauchen und ein zweiter Ruck folgte, mit dem sich, nach dem Hufschlag zu urtheilen, das Pferd von dem Wagen losgerissen zu haben schien. Die Frau spähte nun aus, und sah, wie sich das Pferd mit dem Löwen am Rücken weiter zu schleppen suchte. Nun schrie die Frau um Hilfe, als jedoch die muthigen Matabele aus ihrer Hütte hervorstürzten und zu den Bränden griffen, war das Pferd schon niedergestürzt. Der Löwe hatte es durch wiederholte Bisse in den Nacken getödtet. Bei dem Geschrei der Frau hatten auch alle ihre Kinder wie Mr. M. Schutz in den Wägen gesucht. Für Mr. Y. wäre es eine Kleinigkeit gewesen, von seinem Wagen aus die ihm zur Verfügung stehenden Hinterlader auf das Raubthier abzufeuern, doch er konnte sich nicht zu einer solchen Heldenthat ermannen und überließ es den unbewaffneten Matabele, mit dem Thiere fertig zu werden. Den Muthigen war das Glück hold und da einige ihrer Wurfgeschosse gut trafen, jagten sie das Thier in die Flucht.

Nächtlicher Ueberfall durch einen Löwen.
Man wußte mir nicht zu sagen, warum am folgenden Tage der Cadaver des Pferdes nicht entfernt worden war, er blieb liegen und am nächsten Abend wiederholte der Löwe seinen Besuch, um sich an dem Raube gütlich zu thun. Doch diesmal machte er schon vorhinein durch anhaltendes Gebrülle die Bewohner der drei Wägen auf seine Ankunft aufmerksam und da war der vorsichtige Mr. Y. der erste, welcher auf Rettung dachte. Der Ansicht, daß weder die Wägen, noch die Grashütte ihre Insassen vor den Klauen des Löwen schützen können, ließ er sich von seinen Matabele-Dienern einen Assagai reichen und sich in den nahen Mapanibaum emporheben, der sich über den Hütten seiner Diener erhob. Die übrigen Weißen suchten Schutz in ihren Wägen, während die Diener den Löwen abermals durch Feuerbrände zu verscheuchen suchten. Doch gelang es ihnen diesmal nicht, das Raubthier blieb, es hatte sich an die brennenden Wurfgeschosse gewöhnt, ja es sprang nach ihnen und die Schwarzen hatten keine Zeit, die Assagaien aus ihren Hütten zu holen, sondern nahmen eiligst Zuflucht hinter den Wägen ihrer Herren. Ihnen folgend passirte der Löwe den Mapanibaum, auf dem Y. thronte und der selig in dem Gedanken, daß der Löwe von seiner Anwesenheit keine Ahnung hatte, sich auch mäuschenstille verhielt. Nun feuerte Frau Lotriet ein Gewehr ab, das sie sich im Wagen zurechtgestellt und blind geladen hatte, um das Thier zu schrecken und es von jeden weiteren Angriffen auf die Hütten und Wägen abzubringen. Knurrend und sich nach seinen Feinden umblickend, zog sich der Angreifer zurück, was die Matabele wieder bewog, sofort aus ihrem Verstecke hervor nach den Feuern zu stürzen und Feuerbrände zu ergreifen.
Der unter lautem Geschrei unternommene Angriff hatte auch Erfolg, einige brennende Wurfgeschosse trafen den Löwen so gut, daß er aufsprang und verschwand, Arnold Lotriet fühlte sich sehr niederschlagen, als er von dem Verluste hörte, denn ein Pferd, das bereits die endemische Pneumonie überstanden, ist in allen tsetsefreien Gegenden ein wahrer Talisman.
Unter den südafrikanischen Löwen unterscheide ich drei Species, den gewöhnlichen vollmähnigen, wie wir ihn in der Berberei treffen, den mähnenlosen und den von den Holländern Krachtmanetje genannten, der sich durch ein kurzhaariges lichtes Fell, doch hauptsächlich durch eine kurze und nie über die Schulter reichende Mähne auszeichnet. Den Bondpoote-Löwen der Holländer habe ich als selbständige Species ausgegeben, da es sich ergab, daß vollmähnige Löwen in ihrer Jugend ebenso braun und schwärzlich gescheckt sind. Ich habe dies an einem Thiere, das ich mir hielt, beobachtet — so wie sich in den ersten zwei Jahren die schwarzen Flecken mehren, so verschwinden sie mit dem zunehmenden Alter des Thieres.
Die in Nord-Afrika lebenden gemeinen vollmähnigen Löwen sind in Süd-Afrika die seltensten, man findet sie nur hie und da zerstreut vor. Die mähnenlosen waren früher häufig am Molapo, jetzt findet man noch welche im Thale des zentralen Zambesi und des unteren Tschobe. Ich beobachtete, daß ihr Fell auffallend licht gefärbt ist. Die gewöhnlichste Art ist die bis zur Schulter bemähnte, in manchen Gegenden findet man eben nur diese vor, sie ist eine der häufigsten und bewohnt das Thal des Limpopo von der Mündung des Notuany abwärts, und sind ihre Vertreter im Alter von zwei bis vier Jahren besonders verwegen und gefährlich.
Im Allgemeinen ist der südafrikanische Löwe ein äußerst kluges und berechnendes Thier, er »denkt« viel. Den ihm gegenüber stehenden Feind, mag nun der Löwe der Angreifer oder der Angegriffene sein, sucht er zu »beurtheilen« und da wo er denselben überlegen findet, wird ihn selbst eine wiederholte Verwundung nicht zum Angriffe verleiten. Im Allgemeinen sucht er zu imponiren, zu schrecken, um sich seiner Beute leichter zu vergewissern. Einmal geschieht dies durch sein Brüllen, das andere Mal dadurch, daß er den Kopf hochgehoben langsam einherschreitend die Zähne fletscht, ein drittes Mal wieder, daß er in großen Sätzen herangesprungen kommt, oder auch, daß er im scharfen Trab sich nähert und dabei ruhig brummt. Da er die ganze Zeit hindurch, möge er in dieser oder in jener Weise seine Schreckmethode in Ausführung bringen, seinen Gegner stets scharf im Auge behält, entgeht ihm auch die leiseste Bewegung nicht; die ihm gegenüber beobachtete Bewegungslosigkeit ist das Beste, was man in einem solchen Augenblicke thun kann. Während eine Bewegung mit der Hand oder irgend welche andere den Löwen im Allgemeinen nicht herausfordert, so kann es doch geschehen, daß junge Löwen durch diese Bewegung gereizt werden und zum Angriff übergehen. Doch gibt es Umstände, wenn sie auch selten sind, bei welchen alte und erfahrene Löwen, die einen ihnen gewachsenen Gegner zu würdigen wissen, ohneweiters zum Angriffe übergehen. Solch’ einem Angriffe jedoch kann der Mensch leichter begegnen, da er in der Regel weniger vorsichtig und berechnet ist. Wir finden diese Angriffsweise bei Löwinnen, welche ihre Jungen bewachen, bei Thieren, welche lange gehungert haben und endlich bei solchen, die auf einer Hetzjagd oder von einer größeren Menschenmenge verfolgt werden. Sehr wichtig für den Menschen bleibt es immer, daß er den Löwen zuerst erblickt und beobachten kann; für den Neuling, daß er sich dabei an seinen Anblick gewöhnt, wenn dies auch nur einige Minuten währt, bevor der Kampf oder die gegenseitige Vorstellung beginnt. Selbst für einen erfahrenen Jäger wird es oft unangenehm, wenn sich Mensch und Thier zugleich erblicken, dann wird es oft schwierig, dem Löwen und seiner Taktik erfolgreich zu begegnen, d. h. ihm im selben und weiteren Momente zu »imponiren« suchen, wenn der Jäger nicht schon zuvor in der Lage war und die Gelegenheit ersah, dem Löwen eine tödtlich verletzende Kugel zuzusenden. Der schlimmste Fall für den Menschen ist jedoch jener, bei welchem der arme Käfersucher oder der Bewunderer der schönblüthigen Liliaceen im Eifer sich in seinem Lieblingsstudium ergeht und längere Zeit hindurch von dem Raubthiere beobachtet ist, dieses plötzlich hinter ihm aufbrüllt und im selben Momente vielleicht sich zum Sprunge anschickt. Während es, wenn auch seltene Fälle gibt, in denen Eingeborne beim Feuer oder unter anderen Verhältnissen von Löwen überrascht, mit heiler Haut davon kommen, ist kein Fall bekannt, in dem ein einzelner Mensch, der vor einem Löwen die Flucht ergriffen, nicht von diesem niedergeworfen worden wäre.
Löwen, die an das Aufblitzen und den Knall des Schusses gewöhnt sind, die häufig gejagt wurden und in deren Gebiete nur wenig Wild, oder nur solches vorhanden ist, dessen sie nicht habhaft werden können, sind stets muthiger und gefährlicher als jene, welche in wildreichen Gegenden wohnen und selten einen Menschen zu Gesicht bekommen. So sind in Süd-Afrika die Löwen am Maretsane- und Setlagole-Flusse berüchtigt und auch jene im Matabele-Lande verwegene Thiere. Kein Raubthier, mit Ausnahme des Fuchses, benimmt sich so listig wie der Löwe, wenn er sich einer schwer erreichbaren Beute bemächtigen will und entwickelt eine um so größere Schlauheit, in je größerer Zahl er seiner Beute nachspürt. Die Thiere versuchen sich in Treibjagden, doch theilen sie sich oft in der Verfolgung, indem ein Theil das Wild, auf das sie ihr Augenmerk gerichtet haben, beschleicht und nachdem ihm dieses gelungen, sich dem Wilde zeigt, um dieses nach der entgegengesetzten Seite zu scheuchen, in welcher der andere Theil im Hinterhalte auf dem Anstande liegt. Diese Verfolgungsmethode beobachten sie namentlich bei Thieren, welche sich durch rasche Flucht der ihnen drohenden Gefahr leicht entziehen können, ferner bei solchen, welche hoch über das Gras blicken und so den heranschleichenden Räuber, wenn er näher herangekommen, bemerken können, ferner auch bei solchen, deren Fleisch von ihnen besonders gesucht und jedem anderen vorgezogen wird. Zu diesem Wilde gehören in erster Reihe Pferde, Zebra, überhaupt Einhufer und Giraffen.
Kurz nach meiner ersten Ankunft in Panda ma Tenka in einem der kleinen Seitenthäler, deren ich auf meiner Fahrt nach der Gaschumaebene gedenken werde, wurden zwei Zebra’s in der letztgenannten Weise getödtet. Eine Zebratruppe graste in dem Thale, mehrere Löwen kamen das Thal heruntergelaufen. Nachdem sie eine Zeit lang den Pferden ihre Aufmerksamkeit geschenkt, verließen zwei ihre Genossen und liefen dem linken bewaldeten, das Thal begleitenden Höhenabhang entlang nach abwärts. Die übrigen hockten sich an der Stelle nieder, an welcher sie zuerst die Zebra’s erblickt hatten; die beiden ersten, die »Antreiber«, überholten das im Thale grasende Wild und schlichen sich, als sie etwa 200 Schritte unterhalb desselben gelangt waren, von der Höhe in’s Thal hinab. Doch dadurch kamen sie unter den Wind und die Zebra’s wurden auf sie aufmerksam, bevor sie noch nahe gekommen waren. Die letzteren zogen, sich häufig thalabwärts umsehend, im Schritt thalaufwärts. Die beiden ihnen folgenden Löwen hoben zeitweilig ihre Köpfe über das Gras, was, nachdem sie dies mehrmals wiederholt hatten, die Zebra’s zur schleunigen Flucht veranlaßte. So liefen die nichts ahnenden Thiere, die bewaldeten Erhebungen zur Rechten und Linken für gefährlich haltend, über die wiesige Thalsohle förmlich in den Rachen der Löwen. Diese hart an den Boden geschmiegt, holten zum todtbringenden Sprunge aus, als eben die Zebra’s an ihnen vorbei galoppirten. Zwei wurden das Opfer der Räuber, d. h. zwei der Löwen saßen im Sattel, und während der Rest der Zebra’s nach rechts und links auseinander stob und sich erst weiter oben im Thale vereinigte, um die Flucht fortzusetzen, widerhallte das Thal von dem Gebrülle der siegreichen Löwen. Als noch die Ebenen zwischen dem Hart-River und Molapo an Straußen reich waren, verloren die daselbst mit zahlreichen Pferden jagenden Jäger so manches derselben, ohne daß sie die Räuber je züchtigen konnten. Trotzdem daß die Pferde in der Nähe der Wägen gehalten wurden, wußten die Löwen in der Regel ihren Angriff zu einer solchen Zeit zu unternehmen, um welche an denselben tiefe Stille und Ruhe herrschte. Während mehrere Löwen sich im Umkreise von zwei bis drei englische Meilen in’s Gras niederduckten, machte sich einer daran, seinen Genossen die Pferde zuzujagen; nur selten geschah es, daß er bei dieser Gelegenheit von den Hunden am Wagen ausgewittert, es mit dem Leben büßte, in der Regel kam er unbehelligt mit seiner Beute davon. Das Thier schlich sich flach auf der Erde wie ein Reptil dahinkriechend, bis in die unmittelbare Nähe des Wagens, zwischen eines der Pferde und den Wagen, oder zwischen zwei Pferde, um auf diese Weise das eine Pferd durch sein Erscheinen aufzuscheuchen. Das erschreckte Pferd zog sich in den meisten Fällen nach der dem Löwen entgegengesetzten Seite zurück und dies war eben die Richtung, in welcher die Raubgenossen auf dem Anstande lagen. Diese Art des Angriffes ist die gewöhnlichere, wo das Terrain eine mit zwei bis drei Fuß hohem Gras bedeckte Ebene ist. Ich schließe vorläufig diese Charakterskizze des Löwen und werde später noch Gelegenheit finden, die Angriffsweise des Löwen auf die einzelnen Wildarten zu schildern.
Am Abend des Tages nach meiner Ankunft im Panda ma Tenka-Thale war ich mit Anderson zu Blockley zum Nachtimbiß geladen, da gab es Suppe aus Büffelfleisch und marinirte Stockfische, von Morton & Co. aus London präparirt. Von Blockley erfuhr ich, daß Westbeech schon vor neun Monaten die durch Rev. Mackenzie an ihn gesandte Nachricht von meiner Ankunft an Sepopo überbracht hatte und daß dieser mir die Erlaubniß willig ertheilt hatte, ihn besuchen zu dürfen, zu welcher der König die Worte hinzufügte, er höre gern, daß ich auf dieser meiner Reise seinen Elephanten nichts Uebles anthun wolle und selbst auch im gegentheiligen Falle ich ebenso willkommen als Monary sei. Unter dem Namen Monary aber ist im Marutse-Reiche Livingstone gekannt. Blockley hatte nicht allein in des Königs Residenz viele Monate zugebracht, sondern auch gleich Westbeech auf des Königs Einladung diesen in seinem Mutterlande, der Barotse, aufgesucht und ihm bei dieser Gelegenheit unter den größten Schwierigkeiten einen Wagen bis nach der Barotse gebracht.
Ich zog später in Gesellschaft Blockley’s nach Schescheke und habe außerdem längere Zeit in seiner Nähe zugebracht, sein Betragen mir gegenüber war jederzeit ein so freundliches, daß ich mich seiner nur mit dem Gefühle der tiefsten Dankbarkeit erinnere. In Panda ma Tenka traf ich auch eine Anzahl von Bakwena’s, geführt von einem königlichen Prinzen, welche Sepopo besuchen wollten; sie überbrachten ihm eine alte Mähre als Geschenk Seschele’s. Die Abgesandten Seschele’s erkannten mich sofort, ich aber nicht sie.
Da Herr Blockley schon am 2. zu Sepopo abreisen wollte, entschloß ich mich, ihn zu begleiten. Meinen Wagen wollte ich unter der Obhut Th.’s in Panda ma Tenka zurücklassen und Meriko sollte bis zu meiner Rückkunft die Ochsen hüten. Pit entschloß ich mich als einzigen Diener mit hinüber zu nehmen. Da die Zugthiere hier einen guten Preis hatten verkaufte ich drei der meinen, um mir Elfenbein an Stelle des zu Ende gegangenen Baargeldes zu verschaffen und war entschlossen, den Rest nur dann zu verkaufen, wenn mir von Sepopo selbst die Erlaubniß, die Nord-Zambesi-Gebiete durchforschen zu können, gegeben werden sollte. Ich verkaufte auch einen meiner Hinterlader an Herrn Blockley und erzielte einen guten Erlös, den ich zum Ankaufe von Thee, Kaffee, Zucker etc. verwendete.[7] Westbeech hatte bereits vor vier Jahren den Handel mit Sepopo eröffnet, seiner Fürsprache bei dem Könige hatten alle übrigen Händler es zu verdanken, wenn ihnen das Marutsereich offen stand, ihm selbst kam es vor Allem zu statten, daß er drei Eingebornen-Sprachen, und zwar das Sesuto, Setebele und Setschuana fließend sprach.
Am 2. August wollte ich Panda und Tenka verlassen, um mich mit Blockley nach dem Tschobe und zu Sepopo zu begeben, als zwei Manansa, deren ich noch bei der Beschreibung der Victoriafälle gedenken will, ankamen und meldeten, daß eine Truppe ihres Stammes mit Elfenbein herankäme. Blockley verschob auf diese Nachricht hin seine Abreise. Er hatte die Manansa mit Gewehren versehen, und nun theilten sie die Jagdbeute mit ihm, indem jeder der Eingebornen einen Zahn von jedem getödteten Dickhäuter in Anspruch nahm. Diese Theilung der Beute währte so lange, bis sich der Manansa so viel erworben, daß er sich ein Gewehr und Schießpulver kaufen konnte, worauf ihm dann der ganze Erlös zufiel, für welche er dann Kleidungsstücke, Messingdraht, Decken u. s. w. erstand. In dieser Weise hatten auch Halbcastmänner aus der Colonie, welche mit den Händlern als Wagentreiber in die Zambesi-Gegenden gekommen waren, so viel erworben, daß sie Wagen und Ochsen erstanden.
Trotz der Ausbreitung des Elfenbeinhandels und des Umstandes, daß hierbei Tausende und Tausende von Elfenbeinzähnen jahrelang durch die Hände der weißen Händler gingen, brachte derselbe diesen keinen materiellen Gewinn. Vor 20 Jahren, als noch südlich vom Zambesi Elephanten und Strauße sehr zahlreich waren, gab es nur wenige Jäger, denen es vortrefflich gut ging, deren Gewinn lockte von Jahr zu Jahr immer neue herbei, bis sich ihre Zahl um das vierzigfache gesteigert hatte und deren Erwerb eben so rasch als die Zahl der werthvollen Thiere abnehmen mußte. Was bei dem Walfischfang in den europäischen Nordmeeren zu Tage trat, d. i. dessen allmälige Erschöpfung, war auch bei dem Handel mit Elfenbein zu befürchten. Der Anbau von Weizen, Zucker, Baumwolle und Reis muß an die Stelle der Jagd treten, und nur der Handel mit den Erträgnissen des Ackerbaues wird von Jahr zu Jahr blühender sich gestalten können. Das Verbot der Betschuana-Könige, in ihren Gebieten Elephanten zu jagen, die Maßregeln, die der König der Matabele, La Bengula, in dieser Beziehung dictirte, hauptsächlich aber das Verbot der Waffenausfuhr nach Norden aus den südafrikanischen Colonien werden allmälig diese Wandlung anbahnen.
Am 3. September machten wir uns endlich auf den Weg. Blockley hatte einen Wagen mitgenommen, welcher die für Sepopo bestimmten Handelsgüter führte, derselbe sollte neun Meilen südlich von der Mündung des Tschobe in den Zambesi zurückgelassen werden, und die Waaren dann mittelst Träger bis an den Tschobe und den Zambesi fortgeschafft, um weiterhin mittelst Kähnen den Zambesi aufwärts nach der neuen Residenz des Marutse-Mambundakönigs befördert zu werden.
Wir passirten auf den ersten Meilen unserer Fahrt ein interessantes hügeliges Terrain, welches von zahlreichen nach Nordost und Ost in das Panda ma Tenka-Flüßchen fließenden Bächen und Spruits durchzogen war; die deren Thäler trennenden Hügel waren steinig und in der Regel stellenweise auch dicht mit Bäumen bestanden. Eine markante Stelle auf dieser Strecke bildete ein mächtiger über eines dieser Flüßchen sich erhebender Baobab, dessen Umgebung durch den Aufenthalt eines dunkel bemähnten, mächtigen Löwen, welcher den Jägern und Händlern schon viel Schaden angerichtet hatte, berüchtigt war.
Abends machten wir Halt, da eine bewaldete Bodenerhebung von West nach Ost vor uns hinzog, welche der Tsetsefliege zum Aufenthalte diente und der Zugthiere halber nur bei Nacht passirt werden konnte. Wir trafen an unserer Lagerstelle einen Halbeastjäger, der etwa 20 Meilen weiter Strauße gejagt hatte, und nach Panda ma Tenka zurückzukehren im Begriffe war, um von Blockley einige Waaren zu kaufen. Blockley und »Africa«, so hieß der Mann, verließen mich nun; ersterer hatte jedoch seinen Dienern den Auftrag gegeben, mit dem Wagen noch 30 Meilen weit die Reise fortzusetzen und dann auf ihn zu warten, er wollte so rasch als möglich nachkommen, um mit mir weiter zu reisen. Africa war mit einigen Leuten Sepopo’s am südlichen Tschobe-Ufer zusammengekommen, und diese hatten ihm die Nachricht überbracht, daß König Sepopo in Folge der schlechten Aufführung des Bakwena-Prinzen an seinem Hofe sehr erbittert sei.
Schon während der Fahrt hatte uns das Gebrülle eines Löwen begleitet, während der Rast kam es derart nahe, daß wir uns schußbereit halten und mächtige Feuer anzünden mußten. Die Nacht wurde so dunkel, daß wir kaum auf zehn Schritte vor uns sehen konnten. Wir passirten nach zwei Uhr den Tsetsewald und erreichten am folgenden Morgen eine rings vom Walde umsäumte Grasebene, Gaschuma genannt. Sie zeigte zahlreiche, ziemlich tiefe, von Wassergeflügel bewohnte Lachen, ich passirte sie später noch dreimal und jedesmal fand ich zahlreiches Wild an derselben. Diesmal waren es Zebra’s, Zulu-Hartebeeste und Harrisböcke. Zum ersten Male beobachtete ich auch hier die Orbecki-Gazellen.
Am Morgen fuhren wir weiter und über eine zweite Ebene, beide aus dem schönsten Humusboden bestehend, den man sich nur denken konnte und der es förmlich unmöglich macht, die Stelle in der Regenzeit zu passiren. Wir hielten wieder an einem Gehölze und an einer Regenlache, Saddler’s Pan genannt.
Nächsten Tages änderten wir unsere nördliche Richtung in eine nordwestliche und gelangten zu einer ausgetrockneten Lache, deren Ufer mehrere Fächerpalmen schmückten. Aehnliche Bäume, die sich durch ihre besondere Höhe auszeichneten und auf der Gaschuma-Ebene standen, waren, wie mir später Westbeech mittheilte, aus reinem Muthwillen von einem Händler oder Jäger gefällt worden.
Abends gelangten wir zu einer anderen, Schneemans-Pan genannten Regenlache. Hier hatten wir Blockley zu erwarten und ich benützte die Zeit, um von den am Wagen sich aufhaltenden Manansa’s über ihre Sitten und Gebräuche, sowie ihre Sprache Näheres zu erfahren. Ich erhielt diese gewünschten Aufschlüsse von einem Manansa, der als Kind mit einem Händler nach dem Süden gegangen war und sich hier an einen Farmer verdingt hatte, wobei ihm Gelegenheit geboten war, sich die holländische Sprache anzueignen. Ich verzeichnete 305 Worte und Phrasen der Manansa- oder Manandscha-Sprache (von den Jägern haben sie den Spitznamen Maschapatan erhalten).
An Schneemanns Weiher war ich nicht wenig überrascht, von dem Händler Y., dessen ich an Henrys-Pan gedacht, besucht zu werden. Ich konnte nicht umhin, ihm wegen seines Benehmens den Lotriets gegenüber Vorwürfe zu machen. Er war diesmal lebensgefährlich am Fieber erkrankt und ich rieth ihm, so rasch wie möglich nach Panda ma Tenka zurückzukehren und gab ihm einen Brief an Th. mit den nöthigen Recepten mit. Er hielt jedoch meine Warnung für übertrieben und überflüssig, verzögerte seine Abfahrt und starb bevor er noch Panda ma Tenka erreicht hatte. Während Blockley von der Rechtlichkeit der Marutse so viel zu erzählen wußte, berichtete Y. das Gegentheil davon. Ich forschte später nach dem Grunde dieser Differenz der Urtheile und fand, daß die Marutse und Masupia von Schescheke zuvor nicht diebisch gewesen, und es erst wurden, als der unglückliche Y. bei ihnen eingekehrt war. Er hatte alle seine Diener am südlichen Tschobe-Ufer Elephanten jagen lassen und behalf sich in Schescheke, wohin ihn der König Sepopo mit seinen Kähnen hatte bringen lassen, ohne Diener. So dachte er hier selbst, dort durch seine Diener, Elfenbein zu erbeuten. Doch er wurde fieberkrank und konnte sich von seinem Lager nicht rühren, ja kaum sprechen. Die Hütte, die er bewohnte, war abgetheilt, in der kleineren Abtheilung befand sich sein Lager, in der größeren, die er von seinem Lager übersehen konnte, waren seine Waaren unvorsichtiger Weise zur Schau ausgestellt. Dies reizte die Bewohner von Schescheke, sie besahen sich nicht wie das Jahr zuvor — seitdem ein englischer Händler vom Süden gekommen war — die Waaren von Außen, sondern drangen in die Hütte ein, betasteten die Gegenstände und als sie daran Niemand hinderte, nahmen sie so manches, später Vieles mit. Bei meinem späteren Besuche hatte ich viel über den diebischen Charakter mancher Bewohner Schescheke’s zu klagen.
Am 7., an welchem Tage ich Blockley erwartete, erkrankte ich an Kolik-Symptomen und dies nach dem Genusse von rothschaligen, rundlichen Bohnen; ich fand, daß der Farbstoff der Schale das schädliche Pigment sei, weshalb das erste Absudwasser, das sich violett färbt, abgegossen und frisches nachgegossen werden müsse, und beobachtete auch später, daß die Eingebornen eine ähnliche Procedur mit denselben vornehmen. Am Nachmittage stellten sich einige Manausa ein, die mir Talg zum Tausche anboten. Nachdem ein wohlgenährtes Eland erlegt ist, wird der Talg in einer thönernen Schale geschmolzen und in einem aus der Platoïdes desselben Thieres verfertigten Säckchen aufbewahrt. Unsere Diener brachten grünlich-braunen Honig, der von einer winzigen Biene herrührt und säuerlich schmeckt und dessen reichlicher Genuß die Sinne betäubt — er wirkt auch als ein Laxativ ohne Kolikschmerzen hervorzurufen. Die Erzeuger dieses Honigs besitzen keinen Stachel und nach der Beschreibung von Seite der Diener und der Masarwa’s hielt ich sie mit jenen Bienen, die uns in dem nördlichen Theile des sandigen Waldplateaus überfielen, für identisch.
Am 8. ziemlich Früh langte Blockley, von zwei Dienern begleitet, von Panda ma Tenka an, worauf wir uns auf den Weg machten, um in der Nacht das zweite und bis zum Zambesi reichende Tsetsegebiet bis zu der Leschumo-Haltstelle zurückzulegen. Wir erreichten das obere Leschumothal — eine enge, beiderseits von einer mäßigen, doch tiefsandigen bewaldeten Bodenerhebung umsäumte Wiesenfläche, nach Mitternacht. Der Wagen wurde hier zurückgelassen, die Zugthiere aber sofort wieder nach Schneemanns Pan zurückgetrieben, damit sie bei Tagesanbruch aus dem Bereiche des Tsetse-Gebietes waren.
Am 9. August sandte Herr Blockley eben einen Boten an Makumba, den Masupia-Häuptling (eines den Marutse unterthänigen, an der Mündung des Tschobe in den Zambesi wohnenden Stammes), um von diesem — der in Impalera, einem Dorfe am jenseitigen Tschobe-Ufer, wohnte — Träger zu erbitten, mit deren Hilfe die Güter bis an den Tschobe befördert werden sollten.
Wir zogen eine kurze Strecke das Leschumothal nach abwärts, es wurde sumpfig und felsig, aus dem dichten und hohen Ufergrase sprangen hie und da Rietbock-Gazellen auf, welche nach kurzem Laufe weiter abwärts ein ähnliches Versteck aufsuchten. Eine Stunde später verließen wir das Thal und wandten uns auf einem Pfade nach Nordwesten, um eine sandige, dichtbewaldete Bodenerhebung zu betreten. Am Abhange dieses »Sandbultes« fanden wir sehr zahlreiche Büffel und noch zahlreichere Elephantenspuren. Die Riesenthiere mußten in der verflossenen Nacht hier durchpassirt sein. Die Spuren, die in dem Sande kaum einen Zoll tiefe Eindrücke hinterlassen hatten, führten in einer Breite von 20 Schritten; die Heerde hatte offenbar Eile, denn die von ihnen durchzogene Strecke war mit zerknickten Stämmen, Aesten und Büschen besäet. Am häufigsten waren armdicke Stämmchen entwurzelt und schenkelstarke Bäume im unteren Drittel so gebrochen, daß der übrige Stamm noch an der Rinde oder an der Bruchstelle am Rumpfe hing. Doch gab es auch welche, die stärker und in der Mitte ihrer eigentlichen Stammeshöhe (4 bis 6 Fuß über dem Boden) vorkommen gebrochen waren, der Bruch war dann ein solcher, daß der zurückgebliebene stehende Baumstumpf (namentlich der gebrechlicheren Holzarten) nach unten oft bis zur Wurzel herab geborsten war. Sehr häufig waren die quer in die Bahn hineinragenden Aeste anderer Bäume herabgerissen worden und daß dies mit Riesenkraft geschah, konnte man daraus entnehmen, daß oft ein großes Rindenstück von dem Stamme mit herabhing oder mit dem Aste herabgerissen worden war.[8]
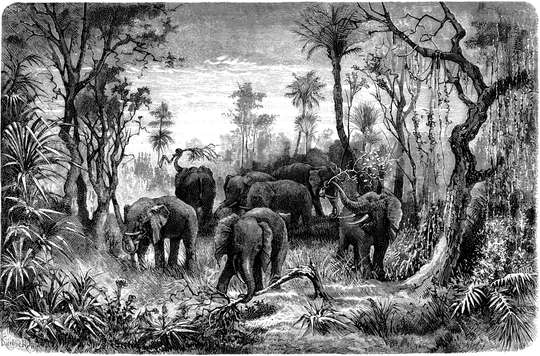
Elephantenheerde auf der Flucht.
Wir kamen in eine seichte in das Leschumothal führende Niederung, welche mit schönen Mimosenbäumen bewachsen war, deren Krone dem ermüdeten Wanderer den köstlichsten Schatten spendeten, nur hie und da vermochte der Sonnenstrahl die dichte Laubkrone zu durchdringen. Aus der Einsenkung ging es wieder hinauf in einen sandigen Wald, dessen Boden sich nach Nordwest etwas verflachte, um plötzlich gegen das Thal des Tschobe und Zambesi abzufallen. Unvergeßlich bleibt mir das Panorama, das sich meinen Blicken an jenem Tage bot, als ich plötzlich aus dem Walde heraustrat und in das Thal der beiden Ströme herabblickte.
So war ich doch an den Strom gelangt, von dem ich als Knabe so viel gelesen und geträumt hatte. Vor mir öffnete sich ein weites, nach rechts etwa drei Meilen breites, nach links in seiner größten Ausdehnung durch eine unabsehbare Ebene begrenztes Thal. An meiner Seite war es von dem bewaldeten felsigen Abhang des sandigen Hochplateaus beherrscht. Die Mitte dieses Thales nehmen zwei Inseln ein, das Land, welches den Zambesi und Tschobe nach ihrer theilweisen Vereinigung zwischen dieser und ihrer eigentlichen noch von einander scheidet. Die östliche, die »Prager« Insel ist einige hundert Schritte lang und etwas weniger breit, die zweite 2 Stunden lang und 1 bis 1½ Stunden breit. Die erste ist flach, die zweite zeigt bewaldete Felsenkuppen, von denen sich nur eine in der östlichen Hälfte, zahlreiche und meist zusammenhängende in der westlichen befinden. Am Fuße der östlichen liegt Impalera, Makumba’s Stadt, zur Zeit meines Besuches die »Wacht« des Marutse-Reiches nach Süden. Vor dieser Masupia-Niederlassung schimmert tief unter dem Beschauer und etwa eine Stunde von ihm entfernt, das von Schilfmassen besäumte an 300 Schritte breite Bett des Tschobestromes. Die Höhen auf der großen Impalera-Insel sind ein Verbindungsglied des Abfalls, der nach Westen zu bis an den Tschobe herantritt, ihn mit Felsenbänken durchzieht und so Stromschnellen bildet, dann sich zu den Impalera-Höhen erhebt, um nochmals nach Nordnordost den Zambesi mit Felsenrissen zu durchziehen, hier ähnliche doch bedeutendere Schnellen und Inseln zu bilden und sich mit dem, bei den Victoriafällen an das linke Zambesi-Ufer herantretenden felsigen Plateau-Abfall zu verbinden.
Das Thal war nach Westen nur durch den bläulichen, von dem röthlichen Glanz der untergehenden Sonne in seinen tieferen Partien in Feuerpracht schimmernden Horizont umsäumt. Die unbegrenzte Ferne hinter den unabsehbaren Schilfrohrdickichten war das Land, dem meine eigentliche Forschungsreise galt, dort wollte ich erringen, was ich seit meiner Kindheit erstrebt.
[7] Ein Pfund Thee kam hier auf 12, ein Pfund Kaffee auf 4, 1 Pfund Zucker auf 4 Shillinge zu stehen.
[8] Der beschränkte Raum gestattet es mir nicht, hier näher auf die Gewohnheiten und die Lebensweise der afrikanischen Elephanten einzugehen.
Das Thal des Tschobe und seine Vegetation. — Signalisirung meiner Ankunft. — Die ersten Boten aus dem Marutse-Reiche. — Landschaftscenerie an den Stromschnellen des Tschobe. — Begegnung mit Masupias. — Mein Mulekau. — Geschichte der Matabele-Einfälle in das Reich Sekeletu’s. — Ein Masupia-Grab. — Thierleben am Tschobe. — Makumba. — Begegnung mit englischen Officieren in Impalera. — Die Hütten der Masupia. — Der Schlangenhalsvogel. — Meine erste Bootfahrt auf dem Zambesi. — Die Schilfrohrwälder an den Ufern des Zambesi und das Thierleben in denselben. — Letschwe und Puku Antilopen. — Krokodile und Flußpferde. — Jagd auf Flußpferde. — Ankunft in Alt-Schescheke. — Blockley’s Kraal.

Bootfahrt im Zambesi.
Das Thal des Tschobe-Rivers ist gegen seine Mündung eine halbe bis drei englische Meilen breit, ähnlich auch das Thal des Zambesi, so weit es noch oberhalb der Victoriafälle die Tschobe-Victoriahöhen begleiten. Mit Ausnahme jener Stellen, an welchen die Felsenhöhen unmittelbar mit ihren Ausläufern herantreten, sind die Ufer beider Flüsse sandig, ähnlich wie die des Zugaflusses und der meisten Zuflüsse des schon erwähnten Hochlandbeckens des centralen Süd-Afrika; die felsigen Ufer, die, wie schon erwähnt, ober der Vereinigung beider Flüsse (am rechten Tschobe-Ufer einige Meilen weiter aufwärts als am linken Zambesi Ufer) beginnen, sind meist der Abfall eines tiefsandigen Plateaus. Auf dieser Strecke, sowie am Flusse abwärts fanden wir eine üppige tropische Vegetation, stromaufwärts nimmt sie, so weit als ich gelangen konnte, etwas ab. Beim Eintritte in das Thal fallen dem Besucher sofort neue Baum- und Buscharten auf. Die meisten tragen Früchte, welche, mit Ausnahme der bis zu zwei Fuß langen, armdicken, wurstförmigen des Moschunkulu, eines Giftbaumes, theils zu verschiedenen häuslichen Zwecken verwendet, theils genossen werden. Welche Wandlung die Vegetation im Zambesithale und auf dem angrenzenden Plateau im Vergleich zu den südlicher gelegenen Strecken im Innern Süd-Afrika’s erfährt, können wir schon aus der Thatsache ersehen, daß sich die Bewohner am centralen Zambesi (wohl um so mehr am unteren und oberen Zambesi) das ganze Jahr hindurch nur von Früchten ernähren können. Jeden Monat im Jahre finden wir irgend welche Frucht oder eßbare Samen zur Reife gediehen. Auch die Thierwelt ist reichhaltiger, darunter namentlich Vögel, Schlangen, Fische, Insecten, und unter diesen wieder besonders Schmetterlinge. Auch der Mensch ist in jenen Gebieten aus eigener Kraft höher entwickelt als die Bewohner der Gegenden südlich vom Zambesi.
An einer Uferstelle, welche durch eine kleine Bucht und durch einen prachtvollen Moschunkulubaum ausgezeichnet war und sich einige hundert Schritte oberhalb der am jenseitigen (linken) Ufer gelegenen Masupia-Niederlassung Impalera befand, ließ ich, da es der gewöhnliche Landungsplatz der den Strom übersetzenden Eingebornen war, einen Skerm und eine Grashütte errichten. Unterdessen schritt ich zum Flusse hinab und fand den Tschobe stellenweise 2 bis 300 Schritte breit und so tief, daß sein Gewässer tiefblau erschien. Die dicht beschilften Ufer gaben den zahlreichen Krokodilen Gelegenheit, ohne gesehen zu werden, stets auf der Lauer zu liegen und nicht weit ab auf der klaren Fluth wiegten und schaukelten zahlreiche Nyhmphaeaceen einer kleinblüthigen und nur wenige Blumenkronenblätter besitzenden Species.
Auf den Rath der mir von Blockley mitgegebenen Diener, welche schon mehrmals mit ihrem Herrn hier gewesen waren, feuerte ich einige Schüsse ab, um die Bewohner von Impalera von unserer Ankunft in Kenntniß zu setzen. Bald darauf kamen zwei Männer in einem etwa 8 Schuh langen, 14 Zoll breiten und 10 Zoll tiefgehenden, aus einem Baumstamme mit der Pallahaxt ausgehöhlten Kahne an unser Ufer. Es waren zwei dunkelbraune Gestalten, groß und stark gebaut, welche das primitive Bekleidungsstück der Banthufamilie Süd-Afrika’s in der geschmackvollsten Weise, die ich bis jetzt beobachtet habe, angelegt hatten. Sie trugen einen ledernen Leibgurt, um den bei dem einen drei ausgearbeitete Felle kleinerer Thiere, bei dem anderen ein etwa drei Meter langes Calicostück so geschlungen war, daß dieses eine vordere und hintere Schürze und einen die Lenden bedeckenden mittleren Theil bildete. Unstreitig sahen sie in diesem primitiven Anzuge schmucker aus als die Zulu, Makalaka, Betschuana, Colonial-Kaffern etc.
Ich gab ihnen ein Messer, um mich bei ihrem Häuptlinge Makumba anzumelden, zu gleicher Zeit erwähnten auch meine Diener, daß Dschorosiana (Georg), Maniniani (der kleine Georg, im Gegensatze zu Westbeech, der ob seiner Größe Dschorosiana Umutunja genannt wurde), im Leschumothale auf Träger harre, um des Königs Handelsgüter nach Impalera zu bringen; die Männer sollten jedoch auf ihrem Wege nach dem Leschumothale Korn bringen, welches Dschorosiana Maniniani mit Sipaga (kleinen Glasperlen), Talama (große Glasperlen) und Sisipa (2½ Meter Kattun) austauschen wolle. Während der Zeit unserer Besprechung hockten die beiden Männer auf der Erde und standen, nachdem der Manansa-Diener seine Rede beendet mit einem Autile intate (wir haben verstanden, Freund) auf, um sich mit den Worten Camaja koschi (wir sind im Begriffe zu gehen, Herr) von mir zu verabschieden. Früh am 11. unternahm ich einen Ausflug flußaufwärts und fand in dem Thale zahllose Spuren von Büffeln, Roen und Kudu’s, Wasserbock-Antilopen, Pallah-, Deuker- und Orbecki-Gazellen, Schakalen, Leoparden und Löwen. Auch sah ich zahlreiche Hyänenspuren und von den Felsenhügeln tönte unaufhörlich Paviangebelle in’s Thal herab, während mich in dem Palmengebüsch zahlreiche Affen zu einigen Schüssen verleiteten. Vom Wildgeflügel beobachtete ich zwei Francolinus-Arten, das Perlhuhn, von Sumpf- und Wassergeflügel den Scopus (Hammerkopf), drei Arten der Spornkibitze, Hoplopterus, Sattelstörche, (Mycteria Senegalensis, Shaw), mehrere Arten von Enten und eine Plectropterus-Art, Sporngänse, sowie eine Plotus- (Schlangenhalsvogel) und eine Kormoran-Art (Phalacrocorax),
Am anziehendsten fand ich den Tschobe an und über den Stromschnellen, welche sich etwa sechs Meilen oberhalb seiner Mündung und drei Meilen oberhalb unseres Landungsplatzes befanden. Oberhalb dieser Stromschnellen verbreiten sich in einer marschigen Gegend in einem wahren Riesenschilfwalde die Verbindungsarme mit dem Zambesi; es sind breite natürliche Canäle mit ruhig fließendem Wasser, welche ich mit dem Auge weit verfolgen konnte. An den Stromschnellen liegen sehr viele kleinere und größere Felseninseln, die theils kahl, theils mit Sand bedeckt und von welchen letzteren wieder einige mit Schilf, andere mit dichtem Gebüsch und Bäumen bewachsen sind. Da, wo zwischen zwei Felseninseln ein kleiner Wasserstrahl einen winzigen Verbindungsarm bildet, fand ich äußerst geschickte, aus Rohr gearbeitete, den in Mittel-Europa gebräuchlichen ähnlich geformte Fischreusen. Auf den Inseln war auch eine reiche Vogelwelt vertreten, namentlich Sumpfvögel, welche die höheren Felsenriffe sowie das sandige Ufer occupirt hatten und in den feuchteren Partien sich herumtummelten. Besonders reich schien mir der Fluß an Krokodilen zu sein während ich an den Schnellen, die ich Blockleyschnellen taufte, Wasserleguane bemerkte.
Als ich Abends zu unserem Lager zurückkehrte, traf ich 17 Masupia’s daselbst an, es waren prächtige Gestalten, welche ihre Haarwolle an der Craniumhöhe in kleine Zöpfchen geflochten trugen und ihre Haare auch sonst mit verschiedenem Schmucke, wie Haarbüschel verschiedener kleiner Raubthiere und Gazellen, Korallen und kurzen Glasperlenschnürchen zierten. Als besonderen Schmuck trugen sie Armringe, die bei einigen aus Thierhaut, bei anderen, offenbar wohlhabenderen, aus Elfenbein verfertigt waren. Ich erhandelte von diesen für Glasperlen und Kattun Alles, was sie mit sich gebracht hatten, Assagaie, Messer, Kafirkorn und Bohnen. Jener, dem ich gestern das Messer geschenkt, brachte mir heute einen aus Thon von den Frauen mit der Hand gearbeiteten und mit Butschuala (Kafirkorn-Bier) gefüllten Topf. Dadurch und ohne es zu ahnen, wurde ich sein Mulekau (d. h. ich konnte Alles, was sein Haus bot, beanspruchen). Dieses Mulekauthum ist einer der unglückseligsten Gebräuche des Marutsereiches, indem dadurch die bei den Völkern dieses Reiches in einem höheren Grade als bei den anderen Südafrikanischen Stämmen beobachtete eheliche Zuneigung früh untergraben wird. Da man auf Alles, in dem Hause des Mulekau Anspruch machen kann, sind auch die Frauen des Hauses davon nicht ausgenommen, und mein Mulekau wunderte sich nicht wenig, als ich einige Tage später, nach Impalera kommend, von seinem Anbote, mit Ausnahme von Fischen, Bier, Korn und einigen ethnographischen Gegenständen, keinen Gebrauch machen wollte.
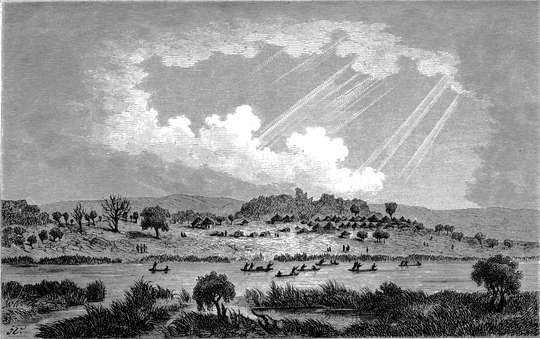
Impalera.
Die Anwesenden theilten mir durch den Manansa-Diener August mit, daß der Häuptling Makumba auf dem jenseitigen Zambesi-Ufer auf der Elephantenjagd weile und mich nicht eher sehen und grüßen dürfe, als die Antwort des Königs Sepopo auf mein Ansuchen in Impalera eingelangt sei. Aus diesem Grunde nahmen sie auch kein Geschenk für ihren Häuptling Makumba an. Die in Impalera sowie am Tschobe aufwärts und am Zambesi abwärts wohnenden Masupia haben den Strom zu überwachen und weder einem Weißen noch Farbigen ohne Wissen und Willen des Königs das Ueberschreiten des Flusses zu gestatten. Ihr Verhältniß zum Könige des Marutsereiches hatte mir später Makumba mit einigen Worten klar dargelegt. Ich bemerkte auch an ihnen, daß sie das »Mein und Dein« nicht sonderlich respectirten, ihre Gelüste aber bezähmten, wenn man sie bei ihren Besuchen im Lager scharf fixirte.
Am 12. erhielt ich zahlreiche Besuche von den Masupia’s von Impalera, sie frugen wiederholt meine Diener, von denen die Manansa der von den Masupia’s gesprochenen Makololosprache vollkommen mächtig waren, ob mein freundlicher Begleiter Dschorosiani Maniniani, Matabele-Diener im Leschumothale habe; sie hatten den Auftrag, keinen Weißen, selbst wenn er vom Könige die Erlaubniß zum Besuche des Reiches erhalten hätte, den Eintritt in das Reich zu gestatten. Wenn ich Matabele-Diener gehabt und trotzdem darauf bestanden hätte, das Marutse-Reich zu besuchen, hätte ich wie Stanley, d. h. mit Gewalt vorgehen müssen.
Die Matabele sind bei den Völkern des Marutsereiches so wie nördlich von Zambesi, doch auch von den östlich anwohnenden Maschonas so gehaßt, wie die mohammedanischen, schwarzen Sclavenjäger, die von der Ostküste ihre Raubzüge gegen die großen Seen Central-Afrika’s unternehmen, von den Bewohnern der Negerländer Central-Afrika’s. Als Begleiter hätten sie es mir ermöglicht, den afrikanischen Continent vom Süden nach Norden zu durchqueren, allein die mir nachfolgenden Weißen hätten es dafür büßen müssen. Zweimal hatten es die Matabele unter der Regierung des am centralen Zambesi herrschenden Königs Sekeletu versucht, ihre Raubzüge auch auf die nördlich vom Zambesi liegenden Gebiete auszudehnen, doch beide Versuche mißlangen. Einmal gelangten sie über die Stromschnellen, auf eine oberhalb der Victoriafälle liegende Insel, welche von den Batoka’s, einen an Sekeletu Tribut zahlenden Stamm, mit der Manzafrucht bebaut war. Da einige Tage später Hochwasser herabkam, war ihnen die Rückkehr abgeschnitten, sie gruben sich aus Nahrungsmangel die Manzawurzel aus dem Boden, und erlagen alle, da dieselbe nur im getrockneten Zustande genossen werden kann, im frischen jedoch giftige Eigenschaften besitzt, dem Genusse derselben. Bei einem zweiten Versuche wurde eine Truppe Matabele von einem Masupia auf eine Insel stromaufwärts übersetzt. Darauf entschuldigte sich der Mann, daß er von der Arbeit sehr ermüdet sei und zur Fortsetzung der Ueberfahrt den Beistand einiger Landsleute in Anspruch nehmen müsse. Ganz gegen ihre Gewohnheit schenkten die Matabele den Worten des Mannes vollen Glauben und ließen ihn ziehen. Der Masupia kehrte aber nicht wieder und hatte so die Feinde seines Landes in die Falle gelockt und sich weiter um sie nicht gekümmert. Auf der Insel gefangen, hatten die Zulus kein angenehmes Los. Da sie im Speeren der Fische nicht geübt waren, und den Fluß ob seiner vielen Krokodile nicht zu durchschwimmen wagten, auf der Insel aber mit Ausnahme einiger weniger Früchte, der Fächerpalme, nichts Genießbares vorfanden, war ihre Lage sehr schlimm und der Hunger so groß, daß sie ihre aus Ochsenhaut verfertigten Sandalen und Schilde im Wasser aufweichten, sie mit ihren Speeren zerschnitten und genossen. In Folge der Nahrungsnoth starben viele, der Rest wurde vom Könige Sekeletu, der inzwischen mit zahlreichen bemannten Kähnen von Linyanti herbeigeeilt war, ohne Schwierigkeiten überwältigt, gefangen genommen, und in der Barotse, dem Mutterlande der Marutse, welche damals seine Unterthanen waren, angesiedelt.
Während meines zweimaligen Besuches am Marutsehofe hatte ich Gelegenheit einige dieser nach Schescheke Tribut abführenden Matabele kennen zu lernen. Sie trugen zwar noch die bekannten, aus Federn gearbeiteten Kopfverzierungen, doch der kriegerische Geist der Zulus war aus ihnen gewichen, sie waren, wie mir König Sepopo mittheilte, ganz vorzügliche Ackerbauer geworden.
Einer von den schon erwähnten, mich am 12. besuchenden Masupia war ein grauwolliges Männchen, welches sich darauf viel einbildete, den verstorbenen König Sekeletu, unter dem das Makololo-Reich vernichtet wurde, bedient zu haben. Ich erstand an diesem Tage für dreiundeinhalb Meter gewöhnlichen Kattuns einen Ziegenbock, den man von Impalera herübergebracht hatte. Derselbe war in Folge des Stiches der Tsetsefliege auffallend klein. Als der Bock geschlachtet wurde, setzte sich mein Mulekau in der Erwartung eines Geschenkes neben demselben nieder, das heißt: er machte als neuer Freund seine Rechte geltend, deren eines es war, jederzeit wenn er mich zur Essenszeit besuchte, von mir Bewirthung fordern zu können. An diesem und am folgenden Tage zogen die Masupia, im Ganzen vierzig Mann, haufenweise zu Blockley nach dem Leschumo-Thale; sie brachten auf Verlangen Korn zum Verkauf, welches sie in etwa drei bis vier Liter fassenden, aus Kürbisschalen verfertigten Gefäßen, mittelst Tragstangen transportirten. Diese Gefäße waren mit Bast umflochten und mit solchem auch an den Tragstangen befestigt.
Diese Kürbisgefäße werden von allen südafrikanischen Stämmen zu den verschiedenartigsten Zwecken benützt. Die häufigste Verwendung finden sie aber im Marutse-Reiche und werden von dem Mambunda-Stamme mit eingebrannten Zeichnungen (Menschen und Thiere darstellend) verziert. Man gebraucht sie im Allgemeinen als Wassergefäße, wobei sie auch mit einem aus Riemen gearbeiteten Netze umspannt sind. Die Vasallenstämme der Betschuana, die Makalahari, Barwa, Masarwa und Madenassana, die keinen Ackerbau betreiben, bedienen sich zu solchen Zwecken der Straußeneier. Mittelgroße Kürbisschalen gebrauchen die meisten Banthu-Stämme als Gefäße zur Aufbewahrung fetter Substanzen. Der kleinsten bedienen sich namentlich die südlich von Zambesi wohnenden als Schnupftabaksdosen, und die plattgedrückten, sowie gleichmäßig weiten, cylindrischen werden zu Musikinstrumenten verwendet.
In der Nacht auf den 13. ließen sich zum erstenmale die Nilpferde mit ihrem dumpfen Brüllen hören. An diesem Tage kam ein Basuto, mit Namen April, der Blockley begleitet, um von Sepopo die Erlaubniß zu erhalten, Elephanten in dessen Gebiet jagen zu können, mit 18 Masupia, welche nach dem Leschumo-Thale Korn getragen hatten und nun mit Blockley’s Gütern beladen waren; sie trugen 50—60 Pfund per Mann. Blockley selbst hoffte noch am selben Abend im Tschobe-Thale eintreffen zu können.
Am 14. zeitlich Morgens unternahm ich einen Ausflug flußabwärts und stieß auf demselben auf verlassene Eingebornengehöfte der Masupia, welche sich nach der Zerstörung des südlich an die Victoria-Fälle angrenzenden Manansa-Reiches durch die Matabele — auf das jenseitige Tschobe- und Zambesi-Ufer geflüchtet hatten. Ich fand im Thale einige Gräber von Masupia-Häuptlingen. Es waren kahle, elliptische Stellen, auf denen Antilopenschädel und Elephantenhauer aufgepflanzt waren; die letzteren so angebracht, daß ihre Spitzen nach außen und unten hervorragten. Jene, die schon vor geraumer Zeit auf das Grab gepflanzt waren, trugen deutliche Spuren des Verwitterungs-Processes an sich, sie waren gebleicht, porös und zersplittert; mehr nach der Mitte des Grabes zu, doch nahe an diesen standen ein Paar besser erhaltene, wenn auch kleiner, 20—30 Pfd. schwere — doch auch viele von diesen waren schon durch die Einflüsse der Atmosphäre beschädigt, während die zuletzt gesetzten Milchzähne, daher werthlose Gaben waren. Sie wurden in aller letzter Zeit eingepflanzt, als die Marutse den Werth des Elfenbeins kennen gelernt, und der Herrscher, trotz dieses Actes der Pietät seiner Unterthanen, seine Revenuen nicht geschmälert sehen wollte.
Auf dem Heimwege fand ich längs des Flusses Sikomoren, von denen sich namentlich eine dadurch auszeichnete, daß der Stamm, sowie die Aeste mit Feigen — leider unreifen — ungemein dicht behangen waren. Am Nachmittage kam Blockley aus dem Leschumo-Thale und bezahlte jedem Masupia als Traglohn ¼ Pfund Glasperlen. Dabei wollten die Masupia’s die ihnen angebotenen blaßrothen Glasperlen nicht annehmen; sie begehrten kaiserblaue, indem sie betonten, daß sie für dieses Geld Assagaie kaufen wollten, und der Stamm, von dem sie diese Waffen zu kaufen gewohnt waren, gegenwärtig nur an den letzteren Glasperlen Gefallen finde.
Einen recht interessanten Anblick bot die Ueberfahrt der mit Blockley zurückkehrenden Kornverkäufer. Spät am Nachmittage stiegen sie in ihre Kähne, die etwa 20 an der Zahl in der nahen kleinen Bucht lagen und ruderten dem jenseitigen Ufer zu. Je nach der Größe des Canoes hatte dieses ein bis vier der dunklen Gestalten als Bemannung. Die meisten der engen, von 7 bis 16 Fuß langen Kähne waren mit den leeren Korngefäßen, einige mit Brennholz gefüllt, auch waren hie und da Fleischstücke von einer erlegten Büffelkuh zu sehen. Die letzten der Truppe waren fünf unserer Besucher, darunter auch mein Mulekau, er hatte einen der kleinsten, die anderen, einen der größeren Kähne zur Verfügung. Da er seine Kunst im Rudern glänzen lassen wollte, bemühte er sich, vor seinen vier Gefährten das jenseitige Ufer zu erreichen. Da auch die übrigen nicht zurückbleiben wollten, entspann sich vor meinen Augen eine originelle Regatta. Es gelang zwar meinem Mulekau, einen ziemlichen Vorsprung zu gewinnen, doch in der Mitte des Stromes verfing sich ein Windstoß in den Falten seines Kubu (Mantel) und trieb ihn mit seinem Kahn zurück, während seine Gefährten ihn nun leicht überholten. Eitelkeit hatte ihm diesmal die Siegespalme entrissen, indem er sich von Pit aus den von mir für zwei Schlachtbeile eingetauschten Calico (6 Meter) eine Kubu (Decke) zuschneiden ließ, die ihm verhängnißvoll geworden war.

Am Tschobe-Ufer.
Am 15. schiffte sich Blockley ein, ich selbst mußte noch hier auf die Antwort des Königs warten und benützte die Zeit bis dahin zu weiteren Ausflügen. Ich fand weitere zwei warme, salzhaltige Quellen und vermehrte meine Fischsammlung mit einigen von den Masupias in der Bucht und in den Flußdickichten gespeerten Fischen. Auch hier hatte ich wie am Limpopo wiederholt die Gelegenheit, Krokodile nach den, auf über dem Wasser hängenden Büschen und Röhrichten sitzenden Eis- und Sumpfvögeln schnappen und sich dabei bis zwei Fuß hoch mit dem Oberkörper aus dem Wasser emporheben zu sehen.

Wildebene bei Blockley’s Kraal.
Die Nacht vom 15. auf den 16. brachte ich am Flusse zu, indem ich das nächtliche Thierleben unmittelbar am Wasser beobachten wollte. Ich wählte mir eine etwas kahle Sandstelle aus, an der ich durch einige Binsen gegen den Fluß gedeckt, mit Hilfe des Mondlichtes ziemlich deutlich Alles um mich, namentlich die Gegenstände in dem Wasser der Lagune beobachten konnte. Gegen 11 Uhr kam eine Pallah-Heerde an das obere Ende der Lagune, der führende Renner mit einem tiefen Brüllton die Sicherheit des Ortes seinen Schützlingen meldend. — Das meiste Interesse flößte mir ein Pärchen der großen Fischotter ein, welches von dem Schilfrohrdickicht am jenseitigen Ufer der kleinen Bucht ausgehend, den seichten Rand derselben abjagte und im Fischfang weit mehr Geschick zeigte, als die zahlreich aus dem Wasser emporschnellenden Krokodile.
Die Thiere blieben etwa zwei Fuß vom Wasser entfernt, am Rande des Gewässers einige Momente stehen, dann sprangen sie vorwärts und liefen rasch durch einige der nächsten Binsen, indem sie mit den Schnauzen die Stellen um die Binsenwurzeln absuchten; kehrten hiernach wieder zurück und auf’s Ufer, um da die Beute zu verzehren, welche mir nur aus kleinen Fischen zu bestehen schien.
Am nächsten Tage machte ich einen größeren Ausflug flußaufwärts, doch war ich nicht im Stande, obgleich es eine interessante Hetzjagd war, weder einer der Roen-Antilopen oder Pallahgazellen, noch eines der zahlreichen Paviane habhaft zu werden; hingegen war es mir vergönnt, namentlich schöne große Eisvögel (Ceryle Maxima), ferner Bienenfänger und Kukuke zu beobachten. Nachmittags begrüßten mich am jenseitigen Ufer mehrere rasch aufeinander folgende Gewehrschüsse, es war das Rumela (der Gruß), welchen der Häuptling Makumba abfeuerte, um mir anzuzeigen, daß die zum Könige abgesandten Boten mit einer für mich befriedigenden Antwort von Schescheke angelangt waren. Der Sitte gemäß hatte ich darauf in ähnlicher Weise zu erwidern und benützte diesen Anlaß, um nach den Früchten des Maschungulubaumes zu schießen. Da es mir gelang, einige derselben zu spalten, andere zu durchbohren, hatte ich in den Augen der anwesenden Masupia’s sehr an Ansehen gewonnen. Bald darauf stießen zwei kleine Kähne vom jenseitigen Ufer ab, um mich hinüber zu bringen. Der untere Tschobe wie der Central-Zambesi sind tiefe Ströme (ich schätze ihre Tiefe auf 30 bis 40 Fuß), welche selbst größeren Dampfern freie Schifffahrt ermöglichen. Leider sind die schiffbaren Strecken nach je 50 bis 100 englischen Meilen durch Felsenbänke unterbrochen, welche Stromschnellen verursachen.
Am jenseitigen Ufer gelandet, wurde ich mit abermaligen Schüssen von Makumba begrüßt und hatte sie zu erwidern. Was mir beim Betreten des Masupiadorfes sofort auffiel, waren die aus Schilfrohr erbauten Hütten und Gehöfte. Die meisten waren nach dem System der Doppelbauten, wie ich sie bei Mosilili’s Ruinenstadt antraf, errichtet. Dieselben hatten einen Durchmesser von 9 Fuß, die äußeren einen solchen von 25 Fuß bei einer Höhe von 12 Fuß. Weder zuvor noch später beobachtete ich so hohe Schilfrohr-Umzäunungen wie in Impalera und bei einem Zweigstamme der Marutse. Das Schilfrohr war hier in seiner ganzen Höhe belassen, einestheils, um das Spiel der Winde abzuhalten, anderntheils, um dem andringenden Schwalle des Hochwassers in den Sommermonaten besser zu widerstehen und die Hütten zu schützen. Einige Hütten zeigten Backofenformen, bestanden aus einer Veranda und zwei Kammern und waren aus Schilfrohr und Gras aufgeführt.
In der Mitte der Niederlassung auf einem Rasenplatze stand eine Berathungshütte, d. h. eines jener kegelförmigen, auf einigen dünnen Pfählen ruhenden Strohdächer, und in diesen fiel mir besonders ein länglicher, hohler Gegenstand, eine Morupa (Trommel) auf, welche sich, wie ich später erfuhr, in den meisten Dörfern des Marutse- und Masupia-Reiches vorfindet. Das Trommelfell ist durchbohrt und ein Stäbchen durch die Oeffnung gesteckt, durch welches oben ein Querstäbchen läuft. Man entlockt dieser Trommel einen dem Knarren neuer Stiefel nicht unähnlichen Ton, und wird derselbe dadurch erzeugt, daß man das Stäbchen im Innern der 1½ Fuß langen röhrenförmigen Trommel mit der, mit einem befeuchteten Baobab-Baststücke umwickelten Hand schnell reibt. Die Trommel findet nur dann Verwendung, wenn die Insassen des Dorfes den siegreich von einer Löwen- oder Leopardenjagd Heimkehrenden entgegengehen, um sie mit Gesang und Tanz zu empfangen.
Ich wurde von Makumba, einem dunkelfarbigen Masupia von etwa 40 Jahren, freundlich empfangen und traf noch am selben Tage zwei englische Officiere, Captain McLoud und Fairly, sowie Herrn Cowley, welche von Natal der Jagd halber an den Zambesi gereist waren. Sie hatten auch deshalb Sepopo ersucht, sein Reich betreten zu dürfen. Der König sagte es zu, und die Herren waren, nachdem sie ihm ihre Geschenke überbracht, eben im Begriffe, nach Panda ma Tenka zu ihren Wägen zurückzukehren, um sich für die großen Jagden im Marutse-Reiche zu rüsten. Leider wurden sie bitter enttäuscht und trotz aller ihrer Opferwilligkeit von Sepopo nicht gut behandelt.
Captain McLoud erzählte mir, daß er einen Elephanten erlegt habe, dessen Hauer je hundert Pfund schwer waren. König Sepopo hatte sie in Empfang genommen und ihm nach seiner Rückkehr nach Schescheke zwei andere, die er selbst erbeutet, als Ersatz versprochen. Makumba hatte uns in einer seiner Wohnungen mit Butschuala (Kafirkornbier) bewirthet. Es wurde in großen Holztöpfen servirt und mit aus Kürbisschalen verfertigten Schöpflöffeln getrunken. Während des Gespräches machte Makumba, der seinem König treu ergeben war und später sogar sein Leben für ihn aufopferte, mich auf des Königs Eigentümlichkeiten aufmerksam, damit ich mein Betragen darnach einrichten konnte. Bevor ich Impalera verließ, machte ich wiederholt Gänge durch das Dorf und fand, daß man die Niederlassung in drei Gehöftgruppen eintheilen konnte. Die dem Flusse anliegende Gruppe zählte 135, jene gegen den einige hundert Schritte nach Norden zu liegenden Hügel, auf dem die Bewohner von Impalera sich bei Hochwasser zu flüchten pflegen, 25 und die westliche 32 Wohnungen. Die Frauen des Dorfes trugen keine Schürzen, wie wir sie in so mannigfacher Form bei den Betschuana’s finden, sondern bis an die Knie reichende aus gegerbtem Leder verfertigte Röckchen. Im Allgemeinen fand ich das Aussehen der Leute bedeutend besser, als das der Betschuana.
Makumba verließ noch am selben Tage Impalera, um sich nach seiner Residenz, welche am linken Zambesi-Ufer liegt, zu begeben. In Impalera wohnte nur eine seiner Frauen mit ihren Dienerinnen, um für den Häuptling das Feld zu bestellen, und ihn zu empfangen und zu bewirthen, so oft er Impalera mit seinem Besuche beehrte. Er kam diesmal, um mich in des Königs Namen zu bewirthen. Als ich ihm für seine Freundlichkeit dankend, ein Geschenk anbot, wies er dieses mit den Worten zurück. »Würde ich es thun, so hätte ich es mit meinem Leben zu büßen, wir dürfen von keinem Fremden, ob Schwarzer oder Weißer ein Geschenk annehmen, bevor nicht der König eines empfangen.«
Spät am Nachmittage des 17. brachen wir auf, um zu der Landungsstelle am Zambesi zu gelangen, welche in der Nähe eines großem Baobab gelegen, Makumba-Hafen genannt wird. Die Bootsleute errichtetem für mich und Blockley einen Skerm; hier verbrachte ich am Ufer des Riesenstromes, nach dem ich mich jahrelang gesehnt hatte, die erste Nacht zu. Die Makumba-Landungsstelle liegt unmittelbar an den schon erwähnten Stromschnellen des Zambesi, kaum vier englische Meilen oberhalb seiner Vereinigung mit dem Tschobe. Vor uns im Strome lagen die zahlreiche theils bewaldeten, theils beschilften Inseln. An einigen über die Stromschnellen hängenden kahlen Aesten saßen Schlangenhalsvögel, und an den hervorragenden braunen Felsenrissen hatten Kormorane Stellung genommen. Sie tauchten in die Fluth, ließen sich von dem Wasser nach abwärts tragen und fischten, mieden jedoch die von Krokodilen bewohnten Tiefen. Auffliegend, ließen sie sich wiederum an den Felsenblöcken nieder und breiteten ihre Flügel aus, um sie zu trocknen. Wir schossen mehren der Vögel, doch konnten wir uns nur zweier bemächtigen, die übrigen, wie ein von mir erlegter Schrei-Seeadler (Haliaëtus vocifer), wurden von dem Wasser fortgetragen und fielen den Krokodilen zur Beute. Während der Nacht ließen sich die Nilpferde in Intervallen von zehn zu zehn Minuten hören, doch blieben wir in Folge des mächtigen, gegen den Fluß zu angezündeten Feuers von einem Besuche der unwillkommenen Gäste verschont.
Am 18. unternahm ich nach Sonnenaufgang meine erste Bootfahrt auf dem Zambesi. In einem gebrechlichen, kaum 18 bis 20 Zoll breiten, aus einem Baumstamme ausgehöhlten Kahne, dessen Bord nur 2½ Zoll über das Wasser ragte, schaukelt sich der Reisende auf der klaren Fluth, die unter ihm schwärzlich-blau erscheint und von der großen Tiefe des Stromes spricht, während sie sich vor und hinter ihm als ein dunkelblaues Band hinzieht und die in allen Nüancen des Grün prangenden Inseln umschlingt. Zu unserer Rechten, etwa sechs Fuß über dem Strome, erhebt sich eine dichte Wand des riesigen Schilfrohrs, welche sich stellenweise meilenweit in’s Land hineinzieht. Hie und da gewahren wir förmliche Grotten in der ganzen Breite dieser Schilfrohrmassen, zu welchen Gänge — die Pfade der Nilpferde — führen, welche dieser riesige Dickhäuter benützt, um vom Flusse aus auf die Weide gelangen zu können. Zahlreiche schöne Winden mit rothen Blüthen schlängeln sich an den Schilfrohrstängeln empor und beleben in anmuthiger Weise die dunkle Wand des rauschenden Schilfwaldes. Zu unserer Rechten breitet sich eine morastige Schilfinsel aus, ringsum von den wunderlichen Formen der Papyrusstaude, wie mit einem spitzen Kragen umsäumt, die äußersten der Stauden, deren Stängel theilweise vom Wasser bespült werden, bewegen deutlich ihre Fiederköpfe, sie zittern und jene an der stärkeren Strömung schaukeln hin und her. An kleinen freien Stellen zwischen den phantastischen Gebilden der Papyrusstauden sieht das Auge hie und da plötzlich weiße, rothe, graue, oder schwarze Farbentöne durchschimmern und bevor wir uns noch dessen versehen, ist ein Silber-, Purpur- oder grauer Reiher aufgeflogen, während wir zahlreiche kleinere Arten des Reihers, der Dommel und anderer Sumpfvögel, an den etwas gebeugten Stängeln der Staude nach Fischchen auslugend, beobachten können.
Biegt man in einen der von den Bootsleuten seltener aufgesuchten Arme ein, so sieht man sich bald von Wildgänsen und Enten umschwärmt, während die Sandbänke von Klaffschnäblern, Strandläufern und drei Möwenarten wimmeln. Durch ihren langgezogenen Schrei ziehen die pärchenweise auf Bäumen oder an erhöhten Uferstellen sitzenden Schrei-Seeadler die Aufmerksamkeit des Reisenden auf sich; immer wieder tauchen neue und anziehende Erscheinungen aus der Thierwelt an dem Ufer des mächtigen Stromes auf. Zu der interessanten Uferscenerie, dem durch eine bunte vielstimmige Vogelwelt belebten Schilfrohrwald zu unserer Rechten und den Papyrusdickichten zu unserer Linken gesellt sich noch der Reiz, den die Fahrt in dem Canoe auf den Reisenden ausübt. Wir können uns kein malerischeres Bild denken, als die Bemannung der die Fluthen schnell durchschneidenden und doch schwer beladenen Kähne, die dunklen Gestalten der Marutse mit ihren langen Rudern und ihren aus gegerbten Fellen bestehenden, mit weißem und rothem Calico umwundenen, im Winde flatternden Schurzfellen. Der am Bootschnabel stehende Mann lenkt denselben. In einem Tempo werden die Ruder in’s Wasser getaucht und diese Bewegung zuweilen mit Gesang begleitet. Unmittelbar hinter dem vordersten Ruder sitzt der Reisende und hinter ihm haben in der Regel noch drei bis vier, doch zuweilen bis eilf weitere Bootsleute Posto gefaßt und führen stehend ihre Ruder. Die längsten der Kähne messen 22 Fuß.
Ich schätze die Breite des Flusses, je nachdem und in welcher Anzahl Inseln denselben verbreitern, auf 300 bis 1000 Meter. An vielen Stellen ist das Ufer unterwaschen und senkt sich unmittelbar zur Tiefe des Stromes. An den beschilften Stellen beträgt die Tiefe, acht Fuß vom Ufer entfernt, sechs Fuß, während dieselbe Tiefe an den mit Binsen bewachsenen Stellen erst in einer Entfernung von 20 Fuß beobachtet wird.
Nach einer dreistündigen Bootfahrt lichtete sich das rechte beschilfte und bewaldete Ufer zu einer in weiter Ferne von einem Gehölze begrenzten und von zahllosem Wilde belebten Grasebene, welche die Masupia und Marutse, Blockley zu Ehren Blockley’s-Kraal benannt haben. Hier verließ ich das Boot und ging dem Ufer entlang weiter. Nahe an dem Schilfwalde, häufiger noch am Rande des Laubwaldes, trieben sich Büffelheerden herum. Zum erstenmale beobachtete ich hier Letschwe- und Puku-Antilopen, welche in Heerden zu Hunderten auf den Grasebenen weideten. Die ersteren Thiere größer, die letzteren kleiner als die Bläßbock-Antilopen, waren durch ein gelblich-braunes (wie bei allen Wasserantilopen) dichtzottiges Fell und ein Paar nach vorwärts gekrümmter Hörner ausgezeichnet. Außerdem sah ich Trupps von Rietbockgazellen im hohen Grase hinter den Schilfrohrpartien. Nach dem Gehölze zu bemerkte ich zahllose Heerden von Zebra’s und kleinere 10 bis 20 Stück zählende Trupps des gestreiften Gnu.

Nilpferdjagd.
Wir fuhren stets nahe am Ufer und dies namentlich, um den tagsüber sich in der Strommitte aufhaltenden und nur zeitweilig an der Oberfläche auftauchenden Nilpferden auszuweichen. Hatten wir an manchen Stellen der Strömung halber den Fluß zu kreuzen, so wurde dies von den Bootsleuten so schnell wie möglich ausgeführt. Als wir das linke Ufer mit dem an der betreffenden Stelle von einer Papyrus-Insel gebildeten rechten, vertauschten und stromaufwärts dahin glitten, fiel es mir auf, daß die Leute plötzlich innehielten und der mir zunächst stehende Ruderer mir das Wort Kubu zuflüsterte. Ueber die Bedeutung dieses Wortes blieb ich nicht lange im Zweifel, denn mein freundlicher Nachbar wies auf eine etwa 200 Schritte entfernte Stelle im Strome vor uns, an welcher ein dunkler kurzer Klotz auftauchte und dem ein niedriger doppelter Wasserstrahl entstieg, bald darauf erschien auch ein zweiter. Es waren die Köpfe von Nilpferden. So wie die dunkle Masse unter dem Wasser verschwand, wurde äußerst leise und langsam vorwärts gerudert, und als wir mit der Stelle, wo die Thiere zuerst erschienen, in eine Linie gekommen waren, wurde wieder stille gehalten. Blockley und ich hielten unsere Gewehre schußbereit; zuerst erschienen diesmal die Köpfe zweier junger Thiere, dann der große Kopf des männlichen Thieres, dem jener eines weiblichen unmittelbar folgte. Von acht auf die beiden letzteren abgefeuerten Schüssen trafen zwei den Alten hinter das Ohr. Die Bootsleute behaupteten, daß das Thier tödtlich getroffen sei, und es mußte auch der Fall gewesen sein, denn obgleich wir noch eine Stunde lang gegen den Willen der Eingebornen, welche, wenn nicht mit den kleinsten ihrer Kähne und mit eigens dazu verfertigten Speeren ausgerüstet, aus der Nähe dieser Thiere so schnell wie möglich zu kommen trachten, auf derselben Stelle blieben, tauchten immer wieder nur drei Köpfe, nicht aber jener des Alten auf.
Unter den größeren Säugethieren Südafrika’s halte ich das Hippopotamus dem unbewaffneten Menschen gegenüber für das gefährlichste. In der freien Natur kennt und leidet das Thier nur jene Objecte in seiner Nähe, die es stets um sich sieht. Jeden ihm fremd erscheinenden Gegenstand behandelt es als einen seine Ruhe störenden Feind; trifft es bei seinem Ausgange oder Heimwege zum Flusse (in den Schilfrohrgrotten) ein solches Object, mag es nun ein Ochs, ein Pferd, ein Stachelschwein oder eine Kiste, ein angestrichener Holzblock, eine quer über gehängte Wolldecke oder gar ein menschliches Wesen sein, so stürzt es sofort darauf los, um sich den Weg frei zu machen. Geschieht es nun, daß der betreffende Gegenstand rasch entfernt wird oder daß sich das lebende Wesen in die Büsche zurückzieht, so geht das Nilpferd seines Weges ruhig weiter, es hat den Gegenstand, der seinen Stumpfsinn für einen Moment aufgeregt hat, vergessen.[9] Vor ihm findet der unbewaffnete Mensch, der doch so oft aus einer Begegnung mit dem Löwen und in der Mehrzahl der Fälle, aus einer solchen mit dem Leoparden, und Büffel (wenn er diese Thiere nicht gereizt) unbehelligt hervorgeht, keinen Pardon.
Wird von mehreren auf derselben Stelle im Flusse auftauchend Nilpferden eines verwundet, so kommen die Uebrigen seltener zur Oberfläche des Wassers, und war die Wunde eine tödtliche, so erscheint das leblose Thier eine Stunde nach seinem Tode an der Oberfläche und treibt mit den Wellen abwärts. In einem solchen Falle verstehen es die Völker des Marutse-Reiches sich auf leichte Weise des Kadavers zu bemächtigen. Ein an eine Grasschnur befestigter Stein wird über dem Cadaver geworfen, und indem man das freie Ende der Schnur in der Hand festhält, vermag man mit einem leisen Zuge der Hand den Coloß gegen das Ufer zu ziehen. Die Bewohner des Marutsereiches, vor Allem aber die längs dem Zambesi-Ufer wohnenden, Marutse, Masupia, Batoka und namentlich jedoch die letzteren, welche ob ihrer Geschicklichkeit im Jagen dieses Dickhäuters von den Marutsekönigen aus ihren am oberen Zambesi befindlichen Wohnsitzen geholt und längs dem Flusse in kleinen Dörfern angesiedelt wurden, um den königlichen Hof sowohl, wie die in den am Flusse grenzenden den Provinzen wohnenden Häuptlinge mit frischen und getrockneten Fischen und Nilpferdfleisch zu versorgen, sind passionirte Jäger des Thieres.
Diese Stämme haben die kleinsten ihrer Kähne, die kaum eine Person tragen und äußerst schwierig zu regieren sind, jedoch blitzschnelle Bewegungen zulassen, Mokoro tschi Kubu (Nilpferdkanoe) genannt. Zur Jagd bedienen sie sich besonders großer, mit einem einfachen Widerhaken versehener, langgestielter Assagaie, welche jedoch, da der Stiel aus weichem Holze gearbeitet ist, nicht schwerer als die gewöhnlichen kleineren Wurfspeere sind. Als ich später nach Schescheke kam, berichtete man mir einen höchst traurigen Fall, der sich im vorigen Jahre (1874) auf einer Sandbank in der Nähe dieser Stadt abgespielt hatte. Ein den Fluß herabfahrender Masupia bemerkte an der Sandbank ein schlafendes Nilpferd und hielt es für eine leichte Sache, dasselbe zu erlegen. So geräuschlos wie möglich heranrudernd, kam er in die unmittelbare Nähe des Thieres. Er steigt aus dem Boote, nähert sich dem Thiere und stößt ihm den Speer hinter die Schulter ein. Doch das Eisen erzeugte nur eine unbedeutende Wunde, indem es an einer Rippe abglitt. Bei dem Stoße erhob sich das Thier und wandte sich so rasch, daß der Mann nicht bei Seite und aus seinem Gesichtskreise springen konnte. Da er sich jedoch sofort von dem Thiere angegriffen sah, warf er sich flach auf die Erde, um sich unsichtbar zu machen. Doch er mußte diese Bewegung nicht behend genug ausgeführt haben, um selbst das stumpfsinnige Geschöpf zu täuschen, denn das Thier warf sich auf ihn und wollte den Mann zertreten. Als dieser sich wehrend den rechten Arm ausstreckte, fühlte er denselben auch zwischen den scharfen Hauern des Feindes und bis auf einen Hautlappen durchbissen. Der unwillkürliche Versuch, auch die linke Hand zur Abwehr auszustrecken, hatte eine völlige Amputation derselben zur Folge. Vorüberfahrende Fischer fanden den Verstümmelten in sterbendem Zustande.
Ich habe wiederholt Nilpferdfleisch genossen, doch konnte ich demselben keinen besonderen Geschmack abgewinnen. Als ein Leckerbissen wird die gelatinöse dicke Haut desselben gebraten betrachtet. Roh zugeschnitten, gibt sie gute Handhaben für Messer und kleinere Werkzeuge, da sie getrocknet zusammenschrumpft und den Eisentheil festhält.
Wird von den Masupia oder Marutse flußaufwärts oder abwärts bis zu zehn geographischen Meilen von Schescheke entfernt, ein Flußpferd erlegt, so wird beinahe in allen Fällen die Hälfte nach Schescheke dem Könige überbracht, dabei gilt der Brustkorb als Königsstück. In der Regel verläßt das Hippopotamus sein Element am Abend und geht auf die Weide, wobei es oft wählerisch ist und zuweilen grasend neun englische Meilen stromaufwärts streift, um bei Tagesgrauen den Heimweg nach dem Flusse anzutreten, d. h. die Stelle aufsucht, an der es am Tage im Flusse oder in der Lagune geweilt, und seine Anwesenheit durch wiederholtes Auftauchen und »Blasen« kundgibt. Zuweilen wurden die Flußpferde neun bis zehn englische Meilen weit vom Strome im Walde und dann meist schlafend angetroffen. Weniger beschwerlich ist die Jagd auf diese Thiere im östlichen und südlichen Matabele, sowie im Maschona-Land, wo sie im Süden vom Limpopo, im Norden vom Zambesi die Zuflüsse aufwärts verfolgen und sich in der Tangente derselben aufhalten. Matabele-Händler berichteten mir Fälle, in welchen Maschonas vor ihren Augen mit breitschneidigen Dolchen die Nilpferde im Wasser angriffen und auch bewältigten.
Die Nilpferde waren in früheren Jahren über ganz Südafrika verbreitet; die an den Felsenhöhen angetroffenen Gravirungen der Buschmänner beweisen, daß sie einst nicht nur die Flüsse, sondern auch die salzhaltigen Regenpfannen bevölkerten.
Man findet sie noch in den Flüssen Natals und in der Cap-Colonie berichtete man mir, daß sie noch am Unterlaufe einiger der Flüsse in Kaffraria vorgefunden werden. Im centralen Südafrika trifft man sie von Süden her zuerst im Limpopo an. Obgleich der Zambesi von Krokodilen wimmelt, und sie die Hauptursache waren, warum die Bootsleute so sehr die Nilpferde mieden, sahen wir doch kein einziges. Die Ufer bestanden aus Thon und Humus in abwechselnden 2 bis 18 Zoll starken Lagen, von einer torfähnlichen Masse aus den angeschwemmten und vermoderten Pflanzenresten gebildet. Hie und da, wo eine seichte Einsenkung aus der Grasebene zu unserer Rechten in eine Rinne endend, am Flusse ihren Abschluß fand, hatten die Masupia-Fischer ein bis zehn Fuß hohes Schilfrohrgitter errichtet und damit die Vertiefung gegen den Fluß zu abgesperrt. Wir machten etwa 3 bis 3½ englische Meilen per Stunde und kreuzten an dem ersten Tage zehnmal den Strom und dies theils um scharfen Biegungen desselben, theils um der starken Strömung auszuweichen. Während wir einen Ueberblick über die Grasebene zur Rechten (Blockley’s Kraal) mit all’ ihrem Wildreichthum bis an das sie begrenzende Gehölze genossen, war uns der Ausblick nach Süden und Westen durch hohes Schilfrohrdickicht vollkommen verwehrt. Diese lagunenreichen Dickichte zwischen dem unteren Tschobe und dem Zambesi sind ein wahrer Lieblingsaufenthalt der Elephanten und Nilpferde. Auf einer sandigen Insel, auf welcher wir eine verlassene Hütte trafen, schlugen wir unser Nachtlager auf. Während einige mit ihren Assagaien und Messern das Schilfrohr abschnitten, es zu Bündeln banden, gruben andere mit den gleichen Werkzeugen Löcher in den Sand, in welchen die zu Pfählen verbundenen Schilfbündel eingelassen wurden. Inzwischen hatten drei Kähne abgestoßen, um vom gegenüberliegenden Ufer getrocknetes Gras herbeizuschaffen und es auf die oben in ihren Wipfeln vereinigten Rohrbündel zu werfen. Die nachtmützenförmige etwa 4½ bis 6 Fuß hohe, 2 bis 2½ Fuß breite Hütte war von den Männern in unglaublich kurzer Zeit fertiggestellt.
Am folgenden Vormittage passirten wir am linken Ufer einen an seiner Mündung etwa 50 Meter breiten, an Krokodilen reichen Fluß Kascha oder Kaschteja (der von Livingstone gebrauchte Name Madschilla mußte bei den Makololo im Gebrauche gewesen sein). Schon einige hundert Schritte oberhalb der Mündung verengte sich der Fluß stellenweise bis zu 15 Meter; trotz der stellenweise geringen Tiefe (drei Fuß) wäre das Durchwaten desselben ein gefährliches Wagestück, denn die getrübte Fluth verräth die tückischen Insassen des Gewässers nur zu deutlich. Wir begegneten mehreren Kähnen mit Leuten aus Makumba’s Stadt, welche Elfenbein nach Schescheke zu Sepopo gebracht hatten und nun mit Schießmaterial und zwei Wolldecken als Gegengeschenk auf dem Heimweg waren. Nach einem erfrischenden Bade an einer seichten und ungefährlichen Stelle steuerten wir rüstig weiter, um noch vor Abend die neue Residenz zu erreichen. Die Nähe dieser tsetsefreien Niederlassung der Masupia verkündeten uns schon kleine Viehheerden, welche längs des Flusses und wohl bewacht weideten.
Alt-Schescheke lag etwa 1½ Meilen westlich von der Stelle, wo der Strom von Süden her eine plötzliche Wendung nach Osten macht, an einer Zambesi-Lagune. Der Marutse-Hof residirte von jeher in dem fruchtbaren und für die Viehzucht so wohlgeeigneten Mutterlande Barotse. Sepopo, zur Zeit meines Besuches König des Reiches, hatte sich viele Grausamkeiten unter seinem Stamme zu Schulden kommen lassen, weshalb er in der Barotse mißliebig wurde, seine Residenz verließ und sich in der zum größten Theile durch die Tsetse inficirten Masupia-Provinz niederließ. Ein zweiter Grund der Uebersiedlung war seine Unzufriedenheit mit den portugiesischen Elfenbeinhändlern von der Westküste, deren Waaren ihm im Vergleiche zu jenen Westbeech’s werthlos schienen, weshalb er bemüht war, seine neue Residenz den von Süden kommenden Händlern näher zu rücken.
Als wir uns der Residenz näherten, rieth Blockley an, unsere Ankunft mit einem Rumela anzuzeigen. Kaum waren die Salutschüsse verhallt, erschienen Menschengruppen unter den Bäumen und einige zwanzig Schüsse folgten sofort als Gegengruß; sie bewiesen, daß sich der König unter der Menge befand und selbst die Anlage der neuen Stadt leitete. Unter dem Geschrei der Menge, das uns nun entgegenscholl und welches die Bootsleute aneiferte, hatten wir eine Viertelstunde später das Ufer an den Bäumen erreicht und an eine Stelle, wo einige Kähne an’s Land gezogen waren, angelegt. Zur Audienz bei dem Herrscher am centralen Zambesi hatten wir in Gala zu erscheinen, meine Bestürzung war daher keine geringe, als zur Completirung des Anzuges mein Hut fehlte. Blockley ließ mir kaum Zeit, mein Gepäck zu durchsuchen, denn schon ertönten von den Bäumen her die Klänge der Myrimba.
Wie ich schon früher erwähnte, war mein Kommen dem Könige seit mehreren Monaten bekannt, er hatte sich wiederholt bei Westbeech und Blockley um mich erkundigt und geäußert: »Wenn doch der Njaka käme, der wie Monari (Livingstone) in seinem Reiche reisen wolle.« Deshalb sollte sich auch mein Empfang feierlicher gestalten, als er seit Livingstone den 15 Blaßgesichtern, die vor mir das königliche Antlitz Sepopo’s geschaut, bereitet worden war.
[9] Dies Alles beruht wohl auf der Gehirnquantität der Körpergröße des Thieres gegenüber.
Mein Empfang bei Sepopo. — Der Libeko. — Sepopo auf Schleichwegen. — Sepopo’s Residenz. — Geschichte des Marutse-Mabunda-Reiches. — Die Stämme des Reiches und ihre Wohnsitze. — Unterthanen-Verhältnisse derselben. — Die Sesuto-Sprache. — Portugiesische Händler am Hofe Sepopo’s. — Sepopo erteilt mir die Erlaubniß zur Bereisung seines Landes und beschreibt mir den einzuschlagenden Weg. — Der Bau von Neu-Schescheke. — Brand von Alt-Schescheke. — Culturstufe der Stämme des Reiches. — Der Aberglaube und seine Opfer. — Thronfolge. — Machtbefugnisse des Herrschers. — Das Bauwesen bei den Völkern des Reiches. — Dreifache Bauart der Hütten. — Das Innere des königlichen Gehöftes. — Der Kischitanz. — Sepopo’s Musikcapelle. — Die Musik-Instrumente bei den Marutse-Mabunda’s. — Kriegstrommel. — Die Kischitänzer-Masken. — Rückfahrt nach Impalera. — Ankunft in Panda ma Tenka. — Ein Löwenabenteuer.

Im Papyrusdickicht.
Ein Haufen sämmtlich mit den schon erwähnten ledernen und Kattunschürzen bekleideter Eingeborner meldete uns des Königs Anwesenheit. Morena Sepopo war uns thatsächlich sehr nahe, denn nach kaum 200 Schritten stand ich dem Könige gegenüber. In europäische Kleidung gehüllt, ein englisches mit einer weißen Straußfeder geschmücktes Hütchen am Kopfe kam er, ein Mann von circa 35 Jahren, leichten Schrittes mir entgegen. Sein Gesicht war breit, sein Ausdruck angenehm, die Augen groß und ihre anscheinende Gutmüthigkeit verrieth keineswegs den Tyrannen, der in ihm verkörpert war. Lächelnd streckte er mir seine Hand entgegen, begrüßte auch Blockley und würdigte sogar den Diener April eines Kopfnickens. Der König war von einigen seiner hervorragenden Würdenträger umgeben, von denen nur einer eine Hose, zwei andere Wolldecken über den Rücken geschnallt trugen, die übrigen unterschieden sich nur durch zahlreiche Bracelets von dem Haufen ringsum. Das in die Augen Springende des Zuges war die Musikcapelle des Königs. Neben dem Könige schritten zwei Myrimbaschläger, d. h. zwei Musiker, welche an einem Riemen ein Kalebaßpiano trugen und es mit zwei Schlägeln bearbeiteten. Neben diesen Männern, welche die haarsträubendsten Melodien hervorzauberten, schritten Tambours, welche riesige röhrenförmige Trommeln mit ihren Fingern schlugen und dazu sangen. Dann erst folgte der Troß. Der König führte uns unter eine der hohen Mimosen und hier kam ein europäisch gekleideter Mann hinzu, der mir als ein Betschuana vorgestellt wurde und seit drei Jahren an Sepopo’s Hofe als Dolmetsch lebte.
Jan Mahura hieß das pfiffige, corpulente Individuum, das auch sofort sein Amt übernahm, während sich Blockley allein sehr gut dem Könige und dem Volke ringsum verständlich machen konnte. Durch Mahura stellte sich mir der Herrscher mit den Worten: Kia Sepopo morena a Zambesi (ich, Sepopo, der Herrscher vom Zambesi) vor. Dann setzte er sich auf ein kleines Holzstühlchen nieder, das ihm ein Diener nachtrug und lud uns mit einer Handbewegung ein, uns auf die Erde niederzulassen. Als der König mein Zaudern bemerkte, seinem Winke Folge zu leisten, ließ er zwei ringförmige Grasbündel herbeiholen und sie als Sitze anweisen. Nun half kein Zögern und nolens volens mußte ich mich bequemen, mich mit meinem schwarzen Gala-Anzuge niederzusetzen. Wir hatten kaum unsere primitiven Sitze eingenommen, als Sepopo meinen Begleiter Blockley mit zahllosen Fragen bestürmte.
Da ich noch nie zuvor einer so lebendigen Auseinandersetzung in Sesuto-Serotse-Sprache beigewohnt, konnte ich dem Gespräch nicht folgen und wandte meine Aufmerksamkeit den Umsitzenden zu. Sie theilten sich eben, um einem gebeugten jungen Manne, der eine große Holzschüssel trug, Raum zu geben. Ein Herold verkündete sein Amt; kaum hatte er uns begrüßt, als sich ein Duft von Bratfischen verbreitete, der mir die Unverständlichkeit der Sprache erträglicher machte. Der Mann stellte die Schüssel auf den freien Raum zwischen dem Könige und uns. Derselbe griff sofort zu und reichte den Häuptlingen Kapella und Maschoku je einen Fisch, und nun erst, nachdem diese den halben Fisch bereits verzehrt hatten, und er sich versichert halten durfte, daß die Speise nicht vergiftet sei, bot er mir und Blockley je einen Fisch und bediente sich selbst. Unsere Finger mußten Messer und Gabel ersetzen, wobei uns der Herrscher eines über 5000 Quadratmeilen großen Reiches mit gutem Beispiele und nicht geringer Fertigkeit voranging. Trotz unseres sehr fühlbaren Hungers — wir hatten seit Früh nichts zu uns genommen — durften wir, um keinen Verstoß gegen die Landessitte zu begehen, nur den halben Fisch verspeisen, und mußten den Rest dem nächstansitzenden Häuptling reichen, dieser aß auch nur einige Bissen und gab den Rest seinem Nachbar. So wurde mit zehn Fischen die ganze Versammlung gespeist und selbst die Leibeigenen durften sich an den Köpfen der Fische delectiren.
Die Bewohner des Marutse-Reiches verstehen es vortrefflich, Fische zuzubereiten, dieselben werden theils im eigenen Thran geschmort, theils an der Sonne getrocknet und dann auf Kohlen gebraten. Diese in der erstgenannten Weise zubereiteten Arten sind jene von den Zambesi-Völkern Tschi-Mo, Tschi-Gatschinschi, Tschi-Maschona etc. genannten, während sie Raubfische mit Ausnahme des an den Lippen stark bewehrten Inquisi verschmähen. So sah ich sie selten den schildköpfigen Wels genießen, und zwar hauptsächlich deshalb, weil das Fleisch dieses in Süd-Afrika so gemeinen Thieres im Zambesi von einem Parasiten, einem spiralförmigen, ähnlich den Trichinen eingerollten, drei Zentimeter langen Wurme förmlich durchsetzt ist. Eine große Menge von Fischen wird an der Sonne getrocknet und monatelang aufbewahrt, in Körbe gepackt, nach Norden geschickt und damit Handel getrieben.
Nach beendetem Mahle brachten mehrere Diener einige mit Wasser gefüllte Holzschüsseln, mit deren Inhalte sich die nächste Umgebung (der innere Kreis) die Lippen netzen mußte. Das Wunderlichste war jedoch das zweite Reinigungsmittel, um sich von den Fettresten des Mahles zu befreien. Einer der Diener brachte auf einer kleinen Holzschale etwa 20 wallnußgroße, schmutziggrüne Kugeln. Der König und sein Hofstaat nahmen je eine — auch uns schob man die Schüssel zu — bestrichen und rieben sich die Hände ein und wuschen sie hierauf. Meine Neugierde, den Stoff dieser Kugeln zu untersuchen, erregte allgemeine Heiterkeit. Jan Mahura »übersetzte« mir die Worte des Königs. »Rieche Herr«, worauf ich über den seifenartigen Charakter der Kugeln keinen Zweifel mehr hatte. Wir Weißen griffen nun zu den Sacktüchern, um die Hände zu trocknen, während Sepopo ein Libeko, d. h. seinen Nasenlöffel, nahm und sich damit die Feuchtigkeit von den Fingern abschabte, bis sie trocken waren, dasselbe thaten auch die Häuptlinge und die ihnen zunächst Sitzenden, doch gab es welche in den hintersten Reihen, welche selbst einen Libeko ersparen wollten und sich einfach die Hände an dem reinen Kieselsande trocken abrieben.
Dieser Libeko ist ein bei den Banthustämmen gebräuchliches, eisernes flaches, 1 bis 4 Zentimeter breites, 4 bis 35 Zentimeter langes, an einer Gras- oder Glasperlenschnur oder einem Riemchen etc. getragenes Miniaturschäufelchen, welches die Stelle eines Sacktuches vertritt und dessen Gebrauch die Verbreiterung der Nasenflügel und die Verunstaltung des Gesichtes zur Folge hat. Da sich die Sonne schon zum Untergange neigte, brach der König, von uns und den spielenden und singenden Musikern gefolgt, auf. Er lenkte seine Schritte nach unserem Landungsplatze, wo er mit seinen Leuten drei der Kähne bestieg, um eine Lustfahrt zu unternehmen. Während der Fahrt ließ er tüchtig drauf losknallen, worauf die ihm Folgenden würdig erwidern mußten. Nach circa fünf Minuten verließen wir den Strom, bogen in eine Lagune ein und waren, eine westliche Zweiglagune aufsuchend, nach einer guten Viertelstunde an Ort und Stelle, am Landungsplatze von Alt-Schescheke angelangt. Kaum 20 Fuß über dem eigentlichen Thale, am Rande eines tiefsandigen Gehölzes, lag das an das alte Masupia-Dorf angebaute Schescheke, welches der König mit der neu angelegten Residenz vertauschen wollte. An der Landungsstelle lag das aus Holz und Schilf errichtete Gehöfte des Händlers Westbeech, worin er seine Waaren so lange aufbewahrte, bis sie Sepopo gegen Elfenbein ausgetauscht hatte. Im Hofraume des Gehöftes standen drei Hütten, eine von dem Koch des Elfenbeinhändlers bewohnt, eine als Küche und die dritte als Wohnhaus für die Diener verwendet. Hinter dem Häuschen, zwischen demselben und dem Zaune, stand eine vierte, etwa fünf Fuß hohe, zwei Meter im Durchmesser haltende Hütte, ähnlich jener der Koranna’s (brodlaibförmig) mit einem niedrigen Eingange, daß man nur nach Art der Vierfüßler hineingelangen konnte. Diese sollte mein Palast sein, meine Wohnung während des ersten Aufenthaltes in der Residenz eines mächtigen Königs.
Bevor ich sie bezog, wurde ich noch mit Blockley vom König zum Nachtmahle gerufen; er saß auf einem mit Zement gepflasterten Höfchen auf einer Matte. Zu seiner Linken nahmen wir auf einem ähnlichen Teppich Platz, während sich einige neben der Königin zu seiner Rechten niederließen. Es wurde gekochtes Elandfleisch auf Tellern servirt, auch fehlten Messer und Gabeln nicht, deren Gebrauch dem Marutse-Hofe von den von der Westküste kommenden Händlern beigebracht worden war. Als Zuspeise zum Fleisch reichte man Manza, einen durchscheinenden Mehlbrei, den ich später sehr nahrhaft fand.[10] Nach Tisch wurde ein dickbauchiges, in einem langen gekrümmten Halstheil endigendes Kürbißgefäß mit Impote (Honigbier) hereingebracht und dieses in Blechbechern und in den von Westbeech dem Könige geschenkten Gläsern credenzt. Der Mundschenk setzte sich, nachdem er in die Hände geklascht, auf den freien Raum zwischen dem Könige und das Volk und trank selbst den ersten Becher, dann nippte der König von dem nächsten und gab den Rest der Lieblingskönigin zu seiner Rechten, dann mir und Blockley; auch von den Häuptlingen wurden manche bedacht, doch nur uns wurde die Ehre des »Zunippens« zu Theil. Nach beendetem Trunke des Impote stand der König auf, zog seine Stiefel aus, reichte sie der Dienerin, die das Essen herbeigebracht, und begab sich dann in seine Wohnung, in welcher ich ihn am nächsten Morgen zu besuchen und mich beim Frühstück einzufinden versprach.
Ich schlief schon seit zwei Stunden auf meinem Kistenlager, als ich durch einen Lichtschimmer und ein Geräusch in dem kleinen Raume der vorderen Kammer des Waarenhäuschens erwachte. Ich sah nun Sepopo von seinen Leuten begleitet, unter den von Blockley mitgebrachten Waaren herumkramen und endlich eine Wagenlaterne, um die er schon am Tage den Händler vergebens angesucht, ergreifen, und sich dann schleunigst entfernen. Dies war jedenfalls eine originelle Art und Weise, wie sich der Marutse-Herrscher ihm gefallende Gegenstände zu verschaffen wußte.
Bevor ich noch die Erzählung meiner Erlebnisse am ersten in Schescheke zugebrachten Tage beschließe, will ich noch einer Episode erwähnen, die sich während des Impote-Trinkens zutrug. Es erschienen nämlich während desselben vier mit Elfenbein beladene Männer, legten ihre Last auf einen Haufen der in der Mitte der Umzäunung niedergelegten Elephantenzähne, knieten dann nieder und klatschten in die Hände, indem sie zugleich fünfmal mit der Stirne die Erde berührten und »Schangwe, Schangwe« riefen. Dann standen sie auf und setzten sich in die hinterste Reihe und blieben hier so lange ruhig sitzen, bis der König sein Mahl beendet. Sodann krochen sie, dazu aufgefordert, etwas näher und klatschten sowohl während als nach seiner Rede leise in die Hände und erzählten mit einem nicht endenwollenden Wortschwall die Jagd, auf welcher sie das Elfenbein erbeutet. Der König befahl ihnen am nächsten Tage wiederzukommen, um Schießbedarf und eine kleine Belohnung entgegenzunehmen. Das Elfenbein war als Krongut sein Eigenthum und die an die Unterthanen ausgegebenen Gewehre waren diesen nur geliehen, d. h. wurden stets als des Königs Eigenthum betrachtet und konnten jeden Augenblick zurückgefordert werden.
Bei den anderen Weißen, die den König besuchten, war es Sitte, das Geschenk, welches die Erlaubniß des Königs, das Land zu betreten, erwirken sollte, vom rechten Tschobe-Ufer aus, bevor man noch Impalera betreten, zuzusenden. Von mir wurde dies nicht gefordert, sondern ich überreichte mein Geschenk, welches in einem Snider-Hinterlader und 200 Patronen bestand, erst nach meiner Ankunft.
Während das Nachtmahl am vorhergehenden Abend vor der Hütte eingenommen, wurde das Frühstück in der Wohnung servirt. Die längliche einem acht Fuß hohen Giebeldache nicht unähnliche Grashütte war durch eine Scheidewand in zwei Hälften getheilt, in der vorderen Kammer, in welcher wir unser Frühstück einnahmen, waren die Wände mit Marutse-Waffen, riesigen Gewehren und auffallenden Kleidungsstücken darunter einer portugiesischen Dragoner-Uniform, und riesigen Elephantenzähnen geschmückt. Ich benützte die günstige Stimmung des Königs um mir von ihm Aufklärungen über die Geschichte der Marutse und seines Reiches geben zu lassen, und will im Folgenden diese Aufschlüsse, soweit sie mir später von Häuptlingen bestätigt wurden, wiedergeben.
Von Sebituani angeführt, war ein Zweigstamm der zwischen dem oberen Oranje- und oberen Vaal-River wohnenden Basuto nach Norden ausgewandert. Der Durchzug durch die Betschuana-Reiche wurde von denselben mit Gewalt erzwungen und nach der Unterjochung vieler am centralen Zambesi und unteren Tschobe, namentlich der östlichen Bamaschi und der Marutse ein an 2000 Quadratmeilen umfassendes Reich, das der Makololo gegründet, außerdem viele Völker des Ostens bis an den Kafuefluß tributpflichtig gemacht. Als jedoch schon unter dem folgenden Herrscher Sekeletu Zwistigkeiten unter den Makololo ausbrachen und sich diese zu offenem Parteikampfe steigerten, griffen die unterjochten Marutse zu den Waffen, warfen sich auf die zwischen dem Tschobe und Zambesi sich aufhaltenden Makololo und schlugen diesen ohnehin auch durch die Malariafieber decimirten Stamm in mehreren Gefechten, wobei die gesammte männliche Bevölkerung bis auf zwei Männer und die Knaben ausgerottet wurde. Von den südlich vom Tschobe wohnenden Makololo traf auch die etwa 2000 Köpfe zählende männliche Bevölkerung ein ähnliches Los. Wären sie am rechten Tschobe-Ufer geblieben, so hätte das Makololoreich bis heutigen Tags noch fortbestanden, so aber fürchteten sie die durch die Mabundas und andere unterjochten Völkerschaften verstärkten Marutse, verließen das Stromgebiet des Tschobe und wandten sich zu den westlichen Bamangwato, nach dem N’gami-See; sie wurden von dem Könige derselben, Letschuatabele, scheinbar freundlich aufgenommen, allein ihre Vernichtung war schon im Vorhinein beschlossen. Der Abgesandte des Königs begrüßte sie mit den Worten: »Wenn Ihr Freunde der Bathowana seid, dann lasset Eure Speere und Schlachtbeile draußen bei Euren Frauen und kommt als Freunde in die Stadt.« Das thaten auch die Makololo. Kaum waren sie aber im Berathungsraume angelangt, d. h. in die Kotla eingetreten, als die Bathowana den Eingang mit Aesten und Baumstämmen versperrten und die in der Umzäunung befindlichen Makololo bis auf den letzten Mann niedermetzelten. Mit den Frauen geschah dasselbe wie bei den Marutse, die Sieger theilten sie unter sich, der König wählte sich die schönsten, dann kamen die Häuptlinge an die Reihe und der Rest wurde vom Herrscher verschenkt. Seither finden wir unter den dunkelgefärbten Bathowana’s und den nördlich vom Zambesi wohnenden Völkern des Marutse-Reiches Frauen von braunem Teint, auf welche sich die dunklen Stämme nicht wenig einbilden, da sie das lichtere Colorit als eine Veredelung ihrer Race ansehen. Sepopo nahm nun das Land der Makololo mit Ausnahme des östlichen Bamaschi-Territoriums und ihres südlich vom Tschobe gelegenen Gebietes (aus Furcht vor den Matabele) in Besitz.
Nördlich von den Marutse erstreckte sich das Mabunda-Reich, welches von Königen aus der Herrscherfamilie der Marutse regiert wurde. Vor wenigen Jahren starb die Königin der Mabunda, welche auf ihrem Todtenbette Sepopo’s älteste Tochter Moquai zur Nachfolgerin ernannte. Da jedoch Moquai die Nachstellungen von Seite ihres Vaters befürchtete, übergab sie ihm die Regierung ihres Reiches, und so fand ich bei meinem Besuche nördlich vom Zambesi ein vereinigtes Marutse-Mabunda-(Mambunda-)Reich von Sepopo, dem directen Nachkommen der alten Königsfamilie der Marutse beherrscht.
Während des Frühstücks ließ er die wichtigsten Repräsentanten der 18 größeren, sich in 83 Zweigstämme theilenden Stämme herbeirufen, und stellte sie mir vor. Von den 18 größeren waren die meisten in Schescheke mit einem oder mehreren Häuptlingen in einer Zahl von 10 bis 500 vertreten. Die wichtigsten Stämme des Reiches sind: die Marutse, Mabunda (die beiden herrschenden), Masupia, Matonga, Makalaka, Mankoë, Mamboë, Manansa, Mabimbi, Bajezi, Bakalomo, Bamata, Banjoka, Basuto, Batoka, Livanga, Manenga, welche sich wiederum in folgende Zweigstämme theilen: Aimalio, Aitunga, Alumba, Aluschanga, Ambolela, Ambume, Amoodé, Angoko, Aquanga, Babuiko, Bahumokume, Bajaoma, Bajeji, Bakabololule, Bakalomi, Balea, Bolioa, Balobule, Balomokmeci, Bamakoma, Bamalingo, Bamata, Bamomba, Bamosima, Banamo, Bonoka, Baoë, Bapalesi, Baquanti, Basetuta, Basioma, Basimavotomo, Basuto, Batoka, Boemenda, Boo, Emafoa, Emunonoco, Jabia, Jamoë, Jëta, Kasabe, Katulama, Kombala, Liamba, Liamankua, Liato, Livanga, Linkamba, Loena, Lujana, Luketa, Luueku, Mabimbi, Mafumbe, Makalaka, östliche Nolianga, westliche Notulu, Malundasieeme, Mambalango, Mamboë, Mabunda, Mampakani, Manansa oder Manandscha, Mankoja = Mankoë, Manengo, Marutse, Maschoscha, Masupia, Matomo, Matonga oder Ma-beker, M’Banga, Milanka, M’Kanda = Makanda, M’Koma = Makoma, Moëna, Moëlopuma, Monojanda, Nambo, Nikalulunda, Ojukamonde, Salama, Sima, Wafi, Wassiwanda. Außer diesen schon seit beträchtlicher Zeit in dem Gebiete ansässigen Stämmen finden wir hie und da zerstreut angesiedelt: Matabele, Menons-Makalaka und Masarwa; die beiden letzteren sind als Flüchtlinge aus dem Süden über den Zambesi gekommen (die Masarwa, ein Vasallenstamm der Bamangwato und Menons-Makalaka, ein den Matabele tributpflichtiger Stamm).
Die Marutse bewohnen die fruchtbaren Thäler des Barotselandes zu beiden Seiten des herrlichen Zambesistromes, von Sekhose (Süd) an, stromaufwärts bis an 150 englische Meilen südlich von der Vereinigung des Kapombo mit dem Liba. Ich glaube, daß die Barotse der fruchtbarste Theil des Reiches ist und sich sowohl für die Viehzucht als für den Ackerbau vorzüglich eignet. Sie hat Ueberfluß an Wild und wildwachsenden, dem Menschen sehr nützlichen vegetabilischen Produkten, von denen Gummi elasticum eines der wichtigsten sein dürfte. Das Land besitzt viele bedeutende Städte und war früher der Wohnsitz der Königsfamilie. Die Mabunda’s umwohnen das Land der erstgenannten von Nordost und Ost, wobei jedoch die Hauptmasse des Landes östlich von der Barotse, am oberen Mittellauf der Flüsse Njoko (Noko), Lombe und Loi zu liegen kommt.
Die Mankoë haben einen Landstrich inne, der von Norden her an das Gebiet der Mabunda grenzt und seine größte Ausdehnung von West nach Ost hat, aber nicht auf das westliche Zambesi-Ufer hinübergreift. Die Mamboë wohnen nördlich von den letzteren am unteren Kapombo und Liba. Die Bamomba und Manengo leben im Weichbilde der Stadt Kavagola am oberen Zambesi. Die Masupia bewohnen das Land südöstlich der Barotse bis 30 englische Meilen unter der Tschobe-Zambesi-Vereinigung längs des Zambesi und an 50 englische Meilen den Tschobe stromaufwärts. Die Batoka wohnen östlich von den Masupia am linken Zambesi-Ufer bis etwa 30 englische Meilen unterhalb der Victoria-Fälle. Die Matonga sind Grenznachbarn der letzteren und theilweise der Masupia (von Norden her); die Hauptmasse lebt am Mittellaufe des Kaschteja- (Livingstone’s Madschila-) Flusses. Die westlichen Makalaka wohnen am unteren Kaschteja zwischen den Matonga und Masupia. Die östlichen Makalaka leben als östliche Nachbarn der Batoka den Zambesifluß abwärts, Wanke’s Kraal ist ihre größte Niederlassung. Die Lujana wohnen am Südufer des Zambesi, westlich von den Masupia’s. Die Wohnsitze der übrigen Stämme ziehen von den Lujana gegen die Südgrenze der Barotse, ferner nördlich von den Matonga, Makalaka und östlich von den Mamboë und Mankoë, doch auch in kleineren Gebieten, da, wo sich oft zwei der erwähnten größeren Stämme berühren, oder sie sind über das Gesammtreich zerstreut worden und bilden kleine Colonien im Lande der Makalaka, Mambunda, Marutse etc.
Die meisten der genannten Stämme sind wirkliche Unterthanen und werden mit Ausnahme der Marutse als Sklaven angesehen, nur ungefähr ein Viertheil sind Tributzahlende und dies meist Stämme des Ostens (Batoka, östliche Makalaka, Mabimbi etc.) Durch Sepopo’s Grausamkeiten sind viele Eingeborne aus dem Reiche nach Süden hin geflohen und da dem Tyrannen dadurch auch viele Schwierigkeiten in dem Centrum des Reiches erwuchsen, hat sich in den letzten Jahren das Tributverhältniß der an den Grenzen nach Nordost und Ost wohnenden Stämme bedeutend gelockert. Die den eigentlichen (wirklichen) Unterthanen auferlegten Steuern bestehen in Getreideabgaben (Kleinkorn, Kafirkorn, Mais); im Abliefern bestimmter Mengen getrockneter Früchte, Kürbisse, Tabak, Gummi elasticum, Matten, Canoës, Rudern, Waffen, Holzarbeiten (Töpfe, Schüsseln, Musikinstrumente), Thierhäuten, frischem und getrocknetem Fisch- und Nilpferdfleisch. Außerdem sind Elfenbein, Honig und das nahrhafte Manza Krongut und jeder sie verkaufende, resp. vertauschende Unterthan wird mit dem Tode bestraft. Die Tributzahler haben dem Marutse-Mabunda-Herrscher jährlich eine bestimmte Zahl Elfenbeinzähne (männlicher und weiblicher Elephanten) und Häute einer großen grauen und dunkelbraunen lang behaarten Lemurspecies abzuliefern.
Die herrschende Sprache im Gesammtreiche, ich möchte sagen, das Mittel des leichten Verständnisses zwischen den einzelnen Stämmen, ja ein wahres Bindeglied, ist die der vernichteten Makololo. Die Makololo haben sich viel schweres Unrecht zu Schulden kommen lassen, des Geschickes gerechter Arm hat sie ereilt, doch mit ihrem Verschwinden vom Schauplatze der Geschichte des centralen Süd-Afrika ist eine Versöhnungspalme emporgewachsen; ihre Sprache, das Sesuto ist geblieben, sie vererbte sich auf die Besieger, sie wurde diesen nothwendig, namentlich als durch Vergrößerung des Reiches (in Folge der Vereinigung mit dem Mabunda-Reiche) und engeren Verkehr mit den südlich vom Zambesi wohnenden Völkern sich mehr und mehr und ohne alles absichtliche Zuthun von Seite der Beherrscher, ein gemeinsamer, namentlich nach der letzteren Richtung hin leicht verständlicher Sprachlaut nothwendig erwies.
Welch’ eine große Hilfe für den Forscher, wenn er sich im Süden ohne Schwierigkeit die Sesutosprache zu eigen machen könnte. Die gegenwärtige Makololo-Sprache ist nicht mehr das reine Sesuto, sondern durch die Vermischung mit dem Serotse etwas corrumpirt; ein der Sesutosprache Mächtiger ist im Marutse-Mabunda-Reiche vollkommen sicher. Als ich den König über die Ausdehnung seines Reiches befragte, da meinte er, daß seine Leute 15 bis 20 Tagreisen zu gehen hätten, bevor sie die nördliche Grenze erreichen könnten; nach diesen mit ihm, seinen Häuptlingen, den Abgesandten der nördlich wohnenden Maschukulumbe und den portugiesischen Händlern gepflogenen Besprechungen und nachdem ich die Entfernungen nach Tagreisen in Meilen verwandelt, zog ich die Grenzlinien des Reiches, wie sie auf der Karte zu sehen sind. Die Grenze wird nach Norden und Osten von den Maschukulumbe, nach Südwest von den Bamaschi, nach Süden von den Bamangwato-Reichen und dem Matabelelande gebildet.
Sepopo’s Name bedeutet in der Serotse »einen Traum«, seine Mutter hieß Mangala. Die Vorstellung der in Schescheke anwesenden Häuptlinge und Würdenträger — darunter war auch Kapella, der Commandant der Truppen — schloß der König mit dem häßlichen Maschoku, dem Scharfrichter, einem riesigen Mabunda, und seinen zwei Schwiegersöhnen, welche zugleich seine Schwiegerväter waren. Er hatte nämlich von beiden letzteren je eine Tochter zur Frau genommen und ihnen dafür zwei seiner unmündigen Töchterchen als Frauen zugesagt.
Als er die gegenseitige Vorstellung schloß, näherten sich mit lauten Schangwe-Rufen drei Marutse seiner Hütte und brachten drei Büffelschwänze; der König hatte sie ausgeschickt, um mich und Blockley mit Fleisch zu versorgen. Bei dieser Vorstellung wurde Honigbier getrunken, worin Lunga, die schönste der Basutofrauen, Unglaubliches leistete. Bevor ich noch schied, zeigte mir der König seine beiden Leibärzte, welche ihn mit Zaubermitteln zu versehen haben, so oft er sich auf die Jagd begibt. Den Tag benützte ich, um mir die Stadt zu besehen, und am Abend fand ich mich wieder in dem königlichen Gehöfte ein. Am selben Abend kam auch Makumba von Impalera und brachte die betrübende Nachricht, daß der Händler Y., den ich an Schneemanns-Pfanne getroffen und ihm angerathen hatte, so schnell wie möglich nach Panda ma Tenka zu meinem Wagen zu reisen, gestorben sei, bevor er noch dahin gelangt war.
Vom 20. auf den 21. ereignete sich ein Intermezzo, welches die Harmonie zwischen mir und dem Könige etwas störte. In Folge der Generosität des Freundes Blockley ging es in unserem Höfchen wieder so lustig wie die Nacht zuvor her; es mochte wohl schon Mitternacht sein, bevor die in einen ausgezeichneten Humor versetzten schwarzen Damen und Herren die drei riesigen Biertöpfe geleert hatten. Als sie endlich vor Müdigkeit und in Folge des reichlichen Biergenusses in Schlummer verfielen, da waren es die Kalebaßpiano’s, welche mit ihren Tönen jeden Versuch zum Einschlummern illusorisch machten. Endlich lullten mich die sich wiederholenden Weisen in den wohlverdienten Schlaf ein, doch es währte nicht lange und ich wurde durch das Bellen eines Hundes wieder geweckt. Als ich meine Augen öffnete, schien es mir in der Hütte ungewöhnlich hell und doch hatte ich die Oeffnung mit einer Kiste geschlossen; nun bemerkte ich plötzlich einen dunklen Körper in der niedrigen, 2½ Fuß hohen Thüröffnung. Ein Eingeborner war eben im Begriffe, sich mit der rechten Hand der neben mir auf einer Kiste liegenden Kleider zu bemächtigen. Ich hatte außer einigen über mir hängenden Assagaien, die ich Tags zuvor erstanden, keine Waffe bei mir. Bevor ich noch zum Stoße ausholen konnte, war der Dieb aus der Oeffnung verschwunden, ich stürzte ihm nach, doch derselbe war in Begleitung eines Gehilfen, einen Stock und einen Fisch zurücklassend, zwischen den Hütten verschwunden. Dieses nächtliche Abenteuer regte mich so auf, daß ich für den Rest der Nacht das Auge nicht schließen konnte. Als ich am nächsten Morgen den König davon benachrichtigte, antwortete er mir ausweichend, und ich konnte bemerken, daß ihm an diesem Tage meine Begegnung nicht sonderlich freue. Doch ich ließ nicht ab und wollte, daß er die Sache untersuchen lasse. Ich nahm nun zu einer List Zuflucht, sandte einen von Blockley’s Dienern in die Stadt und ließ bekannt machen, daß ich einen Stock am Flusse gefunden hätte, und daß ich diesen Gegenstand gerne von seinem Besitzer erstehen würde. Ich ließ den Stock beschreiben und war begierig, ob die versprochenen Glasperlen den Dieb eruiren würden. Spät am Nachmittage fand sich ein ältliches Individuum ein, welches, als man ihm den Stock zeigte, auf diesen losstürzte und ihn als sein Eigenthum reclamirte. Nun erst, nachdem er auch den getrockneten Fisch als sein Eigenthum bekannte, führte ich ihn zum Könige, der eben beim Nachtmahle saß. Da jedoch ein Freund des Beschuldigten, der mit ihm gekommen war, rasch heim eilte, um das gestohlene Gut zu verstecken, so fanden die Abgesandten des Königs nichts in seiner Hütte und er wurde unschuldig erklärt. Als ich mich jedoch mit diesem Urtheilsspruch nicht zufrieden gab, meinte der König, daß er den Mann mir zu Liebe bestrafen wolle. Auf meine Frage, welche Strafe er über den Mann verhängen würde, antwortete er, daß ihm der Tod bestimmt sei. Damit konnte ich mich nun wieder keinesfalls einverstanden erklären und bat den König, den Mann auf freien Fuß setzen zu lassen, bemerkte jedoch dem Könige gegenüber, daß ich jeden nächtlichen Eindringling künftighin niederschießen werde. Sepopo meinte hierauf, daß dies das Beste wäre und theilte dies den zahlreich Versammelten sofort mit lauter Stimme mit.
Am Abend kamen Männer von der Barotse, darunter auch ein von Sekeletu gefangen genommener Matabele und brachten ihre Abgaben an Korn. Der König zeigte den Ankömmlingen das Innere seiner Hütte, auf das er nicht wenig stolz war. Nachdem ich am selben Tage durch Masangu, einem Würdenträger, den man vielleicht am richtigsten Arsenal-Verwalter nennen könnte, aufmerksam gemacht worden war, daß der König in Folge der durch den Diebstahl mir zugethanen Beleidigung geneigt wäre, mir Satisfaction zu geben, wollte ich die Gelegenheit benützen und den König formell um die Erlaubniß bitten, sein Reich bereisen zu dürfen. Gleich bei meiner Ankunft in dem Höfchen fiel mir unter den dreißig in tiefer Stille Hockenden ein Mann ob seiner äußerst demüthigen und unterwürfigen Stellung auf, die Verschmitztheit, die aus seinem Gesichte hervorleuchtete, brachte mir die Vermuthung bei, daß ich es nicht mit einem Eingebornen des Marutsereiches zu thun habe; nachdem ich ihn etwas näher fixirt, war ich dessen sicher, daß es ein Halbkast war. Als ich den günstigsten Moment für gekommen hielt, rückte ich mit meinem Ansuchen heraus; ich frug den König, ob er mein ihm durch Westbeech gestelltes Ansuchen kenne, und als er dies bejahte, erläuterte ich nun den Zweck meiner Reise.
Nachdem der König zugehört verhielt er sich einige Minuten ruhig, dann warf er die Frage auf: »Spricht der weiße Doctor die Serotse oder die Sesuto?« Ich antwortete verneinend. »Spricht der weiße Doctor die Sprache dieser beiden Männer,« und er wies auf zwei zu seiner Linken liegende Männer, von denen mir der eine als Halbkast und durch sein verdächtiges Aussehen so aufgefallen war. Als ich mich darauf erkundigte, was dies für Leute seien, antwortete mir der eben erwähnte, indem er seinen Hut lüftete mit demüthiger Stimme. »Wir sind portugiesische Händler von Matimbundu und gute Christen.« Das waren also die sogenannten Mambari, von denen ich schon so viel Unfreundliches vernommen. Der mir vom Könige als ein »großer Mann« und Doctor vorgestellte, hieß Sykendu. Als der Mann zu mir aufsah, war ich durch seinen gleißnerischen Blick in meiner erstgefaßten Meinung nur bestärkt. Als Sepopo vernahm, daß ich auch ihre Sprache nicht verstehe, meinte er, daß ich sie in Schescheke erlernen müßte, da mir diese Männer als Führer und Dolmetscher ausgezeichnete Dienste leisten könnten, und so hörte ich, daß den portugiesischen Händlern (ich lernte später noch mehrere kennen) von Loanda, Mossamedes und Benguela jene Gebiete, die wir bis jetzt zwischen der Westküste und dem Bangweolo-See und nach Osten bis an die Mündung des Kafueflusses als eine Terra incognita betrachten, in allen Details bekannt sind; sie kennen nicht allein die verschiedenen Eingebornenreiche und ihre Herrscher, sondern auch die Unterhäuptlinge und die Charakterzüge derselben. Sie kannten auch alle Höhenzüge und Flüsse, welche man auf einem Zuge durch diese Gebiete zu überschreiten hatte. Und doch hatten es diese Leute, ebensowohl als ihre weißen Collegen von der Westküste für gerathen gefunden, von diesen Kenntnissen zu schweigen, um nicht Handelsleute anderer Nationen nach den an Elfenbein und Gummi reichen Ländern zu locken. Ich ersuchte Sepopo um zwei Führer, doch bevor er noch antworten konnte, überraschte mich Sykendu mit einer Antwort. Seinen Hut abermals lüftend, beugte er den Kopf bis zur Erde und indem er ein lateinisches Kreuz schlug, machte er einen Schwur bei der Mutter des Heilandes, daß er und der neben ihm liegende Bruder die beiden besten Christen im Innern und deshalb auch die besten Führer wären. Dies war wohl die Antwort auf die mißtrauischen Blicke, mit denen ich die Männer zu betrachten mich nicht erwehren konnte. Abermals herrschte auf einige Minuten Stille, dann meinte Sepopo, es wäre gut, wenn ich mir vielleicht die Serotse oder die Sprache der Makololo aneignen würde. Er meinte, ich würde dann etwas verhüten, was Livingstone auf seinem Zuge durch das nördliche Mamboeland begegnet. Der Monary (Livingstone) konnte sich mit den Leuten nicht verständigen und deshalb dachten jene Häuptlinge, daß er ein Zauberer und mit dem Regen vom Himmel herabgefallen sei. Monary mußte jeden von ihnen mit einem Gewehre beschenken, um sie vom Gegentheile zu überzeugen. Sykendu warf sodann die Frage auf, ob der Engländer auch wisse, daß man ihre Führerdienste gut bezahlen müsse, worüber ihn Sepopo vollkommen beruhigte. Sykendu forderte vier 80 Pfund schwere Elephantenzähne als Führerlohn, ich bot jedoch nur vier solche zu 40 Pfund unter der Bedingung, daß diese von mir bei Sepopo deponirt würden und meinen Führern erst bei ihrer Rückkehr von Matimbundu, wohin sie mich zu bringen hatten, vom Könige auszufolgen wären. Als ich jedoch einige Monate später Schescheke verließ und mich auf meine Weiterreise begab, zog ich ohne die beiden Mambari, ich hatte sie nämlich in der Zwischenzeit als Sklavenhändler kennen gelernt und anderweitige Gründe gefunden, ihnen zu mißtrauen.
Als an jenem Abend die Sache mit den Mambari in’s Reine gebracht worden war, versprach Sepopo, mich mit Kähnen und Bootsleuten zu versehen, die Letzteren sollten mich bis nach der Barotse bringen, hier sollten diese von Marutse-Männern und in jeder weiteren Provinz bis in das Mamboëland durch neue Leute abgelöst werden. Die Mamboë jedoch hätten mich bis an’s große Wasser, d. h. das Meer zu begleiten, wofür ich einen jeden mit einer Muskete zu entlohnen gehabt hätte, während die mir blos auf kurze Strecken mitgegebenen Bootsleute mit Hemden oder Kattun bezahlt werden sollten. Außerdem versprach der König den am Flusse wohnenden Völkerschaften den Befehl zu ertheilen, mich und meine Gefährten mit den nöthigen Lebensmitteln zu versorgen. Er rieth mir zwar an, mich nach Norden gegen den See Bangweolo zu wenden, da ich dann mit Trägern reisen und Kähne ersparen würde, was für ihn angenehmer und für mich gefahrloser sein würde.
Wie oft bereute ich es später, seinem Rathe nicht gefolgt zu sein. Ich dachte der Wissenschaft mehr zu nützen, wenn ich den Zambesi bis an seine Quellen verfolgte und anderseits hoffte ich, daß mich die Bootfahrt weniger ermüden würde und ich meine Kräfte für die weitere große Landreise reserviren könnte.
Ich entschloß mich, so bald wie möglich in das Panda ma Tenka-Thal zurückzukehren, meine Angelegenheiten zu ordnen und mich dann wider nach Schescheke zurückzubegeben, um meine Reise nach dem Zambesi aufwärts fortzusetzen. Am 22. besuchte ich die nach Osten zu gelegene, zum Aufbau der neuen Stadt bestimmte Stelle; auf dem Wege dahin wie am Orte selbst bot sich mir ein höchst interessanter, pittoresker Anblick. Die Erbauung der neuen Stadt war im vollen Zuge, der Fluß wimmelte von Kähnen, in denen Männer Gras, Pfähle, Schilfrohr herbeizuschaffen bemüht waren. Da waren eben einige beladene Kähne im Begriffe den Fluß zu kreuzen, um sich ihrer Last an unserem Ufer zu entledigen, während andere eben abstießen, zahlreiche andere stromaufwärts und abwärts dahinglitten. Landeinwärts schleppten einzeln oder im Gänsemarsch einander folgende Männer und Frauen riesige vorne überhängende und hinten beinahe bis zur Erde reichende Grasbündel heran. Andere Haufen von Männern trugen an Pfählen riesige Thongefäße aus den königlichen Kornkammern, um sie in dem neu zu errichtenden königlichen Gehöfte zu placiren. Von Zeit zu Zeit begegnete ich einem »wandelnden Dache«. Ich sah vor mir eines der kugelförmigen Grasdächer sich in dem hohen Grase bewegen, oder ich wurde durch das plötzliche Erscheinen eines anderen aus meinen Träumereien gerissen. Nur bei näherer Untersuchung konnte ich die Locomobile dieser Dächer erkennen, schwarze Schenkel wurden in dem hohen Grase sichtbar, es waren jene der Träger, welche zu 10 bis 30 durch das hohe Gras schlichen. An der Vorderseite hatte man eine kleine Oeffnung angebracht, durch welche der leitende Träger herauslugte. Manche der Arbeiter zogen singend, andere tanzend dahin, wieder andere liefen in scharfem Trab an mir vorüber. Auch die Königinnen waren nicht müßig, ich sah welche im vollen Stolze ihrer Würde einherschreitend und von einem Trosse Grasbündel tragender Dienerinnen begleitet.
Einmal rief mich der Gruß: »Moro (Guten Morgen), Moro! Njaka Makoa (Doctor, Weißer) wach und als ich mich umkehrte, sah ich den Masupia-Häuptling Makumba mit einer Schaar seiner Leute an mir vorüberpassiren. In der Blockley’s Gehöfte von drei Seiten (nach Norden, Westen, Osten) umgebenden Stadt Alt-Schescheke waren zahlreiche Menschen mit dem Abbrechen der Rohrhütten und Häuschen und der Uebersiedelung ihres Eigenthums beschäftigt. Auch Blockley packte seine sieben Sachen zusammen, um sich einstweilen in Neu-Schescheke in einer für ihn auf Befehl des Königs errichteten Grashütte niederzulassen.
Ich war, nach Alt-Schescheke zurückgekehrt, eben mit meinem Tagebuche beschäftigt, als mich der wiederholte Ruf »Molelo, Molelo« (Feuer) emporriß und vor die Hütte trieb. Ich sah zwar nur ein brennendes Gehöft, doch dieses eine stand in der Mitte einiger hundert anderer aus trocknem Rohr errichteter, von der Sonnenhitze gedörrter, und deshalb rasch in ein Flammenmeer verwandelter Hütten. Ein starker Ostwind fachte die Flammen immer mehr an, an den nach dem Flusse zu mündenden Pfaden erschienen heulende und schreiende Frauen und Kinder. Dazwischen dröhnten die Detonationen der Schüsse aus den in den Hütten zurückgelassenen Gewehren. Die Kugeln schlugen bald hier bald dort ein und gefährdeten die Lage der den Brandplatz umgebenden Leute in hohem Grade. Sowie ich meine wenigen Sachen aus der Hütte herausgeschafft hatte, kam Blockley herbeigerannt. Er kam um Schaufeln zu holen, da sich am Waldesrande, an der dem Feuer entgegengesetzten Seite die Hütte befand, in welcher Westbeech sein, sowie das an Sepopo verkaufte Schießpulver aufbewahrt hatte. Es galt nun den Pulvervorrath so rasch als möglich aus der Hütte zu schaffen und es in dem feuchten Boden zu vergraben, da ein Waldbrand zu befürchten war. Nach Westen, etwa 30 Schritte weit, lag des Königs Pferdestall (aus Pfählen errichtet) und nach Osten eine kaum zwei Meter ab liegende Gruppe von Hütten, doch da sie beide von der Hauptmasse, die vor uns (nach Norden) im Feuer stand, circa fünfzehn Schritte entfernt waren, weniger gefährlich. Die meiste Gefahr drohte eben von vorne, wo zwei Rohrgehöfte aus der Masse hervortretend, unserer Schilfumzäunung auf fünf Meter Entfernung gegenüberstanden, sie war noch vom Feuer verschont geblieben. Wirkte auch der durch die Flammen sausende Wind mit dem tausendfachen Geknatter, das von dem Brande zahlloser Rohrschäfte herrührte, sowie die von der Sonne und von dem Feuer ausgehende Gluth sinnebetäubend, so verschuldeten es doch in erster Linie die sich entladenden Gewehre, daß sich die Reihen der Löschenden so stark lichteten, und ich fürchten mußte, im Augenblicke der höchsten Noth allein zu stehen. Ich hatte nur meinen Diener Pit und einen von Blockley’s Dienern bei mir, welche die wenigen Thon- und Kürbisgefäße, die uns zur Verfügung standen, am Flusse füllten und dabei noch die Hälfte davon im Eifer der Arbeit zerschlugen. Mein Beispiel eiferte bald mehrere Eingeborne zur Nachahmung an und so gelang es mir, der Verbreitung des Feuers eine Schranke zu setzen, nachdem ich die Rohrumzäunung unseres Gehöftes niedergerissen hatte.
Mehr als die Hälfte von Alt-Schescheke wurde durch diesen Brand zerstört; als Sepopo von der Baustelle von Neu-Schescheke aus das Feuer sah, machte er seinem Unmuth in einer für seine Umgebung recht fühlbaren Weise Luft. Er hieb auf sie mit dem Stocke los, bis er sich müde geschlagen. Freudig begrüßte ich den siegreich zurückkehrenden Blockley, dem es gelungen war, das Schießpulver zu retten und auch er gab seiner Freude Ausdruck, daß ich sein und Westbeechs Waarengehöfte gerettet hatte. Ich hatte keine Ahnung, daß ich selbst in der größten Gefahr schwebte, da in dem Gehöfte, dessen Rettung mir gelungen war, Blockley 700 Pfund Schießpulver in einer Kiste aufbewahrt hatte.
Am nächsten Tage kamen mehrere Kähne von der Barotse, welche der König zu meiner Verfügung stellte; er rieth mir, rasch zu meinem Wagen nach dem Panda ma Tenka-Thale zu eilen und mich bald wieder in Schescheke einzufinden. Ich blieb in Neu-Schescheke, nachdem ich zu Blockley übersiedelt war und das Häuschen in Alt-Schescheke verlassen hatte, bis zum 30. August. Die Zeit meines Aufenthaltes in der königlichen Residenz verwendete ich meist zur Vermehrung meiner ethnographischen Sammlungen und zum Studium der Gebräuche der hier so zahlreich versammelten Eingebornenstämme des Reiches, nebstbei zur Erlernung der Sesuto-Sprache. Da ich dem Versprechen des Königs zufolge den Weg nach der Westküste offen zu haben wähnte, schloß ich mit Blockley ein Geschäft ab, wobei er sich verpflichtete, meinen Wagen mit den Sammlungen nach Schoschong zu bringen, wo sie einstweilen deponirt werden sollten. Dafür verkaufte ich ihm, da er es außerdem sehr benöthigte, mein Gespann für Elfenbein und verschiedene Waaren, wie Calico, Glasperlen etc.
Ich will nun im Folgenden einige Züge aus dem Charakter der das Marutse-Mabunda-Reich bewohnenden Stämme anführen und mit der Erzählung einiger Begebenheiten in der Zeit vom 26. bis 30. August die Schilderung meines ersten Besuches bei Sepopo schließen.
Mit Ausnahme der östlich von den Matabele wohnenden Maschona ist kein Stamm in Südafrika so thatkräftig wie mehrere das Marutse-Mabunda-Reich bewohnenden Stämme und da die Producte ihrer Kunstfertigkeit reichlich im ganzen Lande verbreitet sind, fallen sie dem vergleichenden Ethnologen sofort in die Augen und sprechen für die relativ hohe Culturstufe der Stämme. Dieses Uebergewicht über die südafrikanischen Stämme wird aber noch schlagender, wenn wir ihre Geschicklichkeit im Canoefahren, Fischen etc., ins Auge fassen. Die Fertigkeit in der Production von Gegenständen aus Metall, Bein, Horn, Haut, Holz und ihre sonstigen Verrichtungen lassen auf eine nicht unbedeutende Stufe geistiger Fähigkeiten schließen. Sie lechzen nach jeder Belehrung und Unterweisung und begreifen leicht. Zur Vervollständigung der Parallele zwischen ihnen und den Stämmen südlich des Zambesi muß ich jedoch auch erwähnen, daß sie in moralischer Beziehung tiefer als die meisten der Eingebornenstämme Süd-Afrika’s stehen, doch ist diese Erscheinung durch den primitiven, urwüchsigen Zustand bedingt, in dem Wilde, wenn sie von der wohlthätig auf sie einwirkenden Außenwelt abgeschlossen sind, verbleiben und keineswegs ein erworbenes Laster, wie wir es bei der Hottentottenrace finden. Deßhalb glaube ich auch mit Rücksicht auf ihre geistigen Fähigkeiten, daß sich diese Schattenseite ihres Charakters allmälig heben lassen wird.
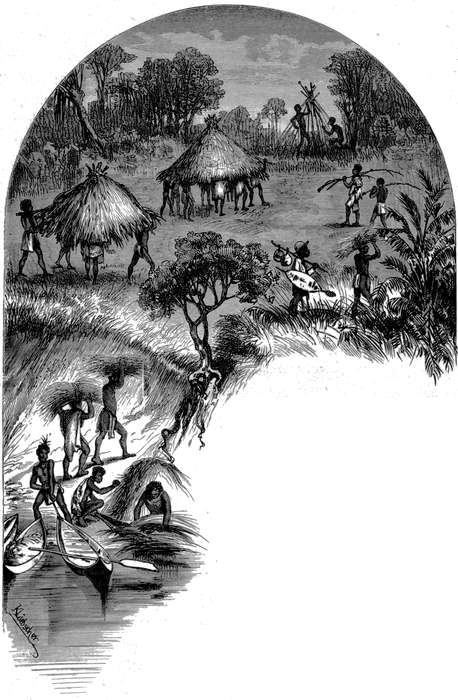
Uebersiedlung nach Neu-Schescheke.
Ein weiterer tief im Wesen und in der Tradition des Volkes begründeter Uebelstand ist der Hang zum Aberglauben, worin die Völker des Reiches die übrigen Süd-Afrika’s weit überragen und der durch die zahlreichen Menschen, die ihm zum Opfer fallen, noch verschärft wird. Unter allen anderen südafrikanischen Stämmen herrscht derselbe nur bei den Zulu’s und Matabele’s in ähnlich abschreckendem Maße. Da jedoch am Zambesi das Königshaus die Hauptschmiede des Zauberschwindels ist und die Könige ihre Grausamkeiten oft aus Aberglauben ausüben, somit von ihnen derselbe wissentlich bei den Unterthanen genährt und verbreitet wird, dieselben dann wegen der vielen aus diesen Untugenden des Königs und seiner Rathgeber hervorgehenden Schreckensthaten das Oberhaupt mit seinen Lehren vom Zauber und Aberglauben fürchten und hassen lernen, so wäre es am zentralen Zambesi mehr als irgendwo in Süd-Afrika lohnenswerth, diese abergläubischen Gebräuche, das wichtigste Hinderniß der Civilisation zu schwächen und zu beseitigen.
Der König der Marutse ist unumschränkter Herrscher und Besitzer des Landes und seiner Bewohner. Trotzdem aber streckt — mit Ausnahme Sepopo’s, dessen Regierung die eines Tyrannen war — der Herrscher nur selten seine Hand nach fremdem Eigenthume aus. Der jeweilige Herrscher oder die Herrscherin (die Frauen sind bei den Nord-Zambesistämmen als Regentinnen, weil sie weniger grausam als die Männer sind, beliebter) bestimmen ihren Thronfolger schon bei Lebzeiten. Derselbe kann Knabe oder Mädchen, muß aber stets einer Marutse-Mutter entsprossen sein. Bei den conservativen Betschuana’s gilt der erste männliche Sprosse der ersten Frau als Nachfolger und diese Bestimmung besitzt solche Rechtskraft, daß selbst im Falle eines frühzeitigen Ablebens des rechtmäßigen Königs, der erste Sohn, dem die verwitwete Königin das Leben gibt, der rechtmäßige Herrscher des Landes wird. Im Jahre 1875 bestimmte Sepopo, daß sein sechsjähriges Töchterchen die zukünftige Herrscherin des Marutse-Reiches werden solle, von Rechtswegen hätte Moquai, seine älteste Tochter, die rechtmäßige Thronfolgerin sein sollen, da sie jedoch als Königin der Mabunda’s einen großen Anhang im Lande hatte, schien sie ihm als Thronfolgerin zu gefährlich. Die erste Frau des Königs wird »Mutter des Reiches« genannt.
Der König gilt auch für den größten Zauberer und Heilkünstler und unter dem Deckmantel dieser bei den meisten Völkern so geachteten Künste wurden von Sepopo die schrecklichsten Verbrechen begangen, wobei er nach Herzenslust das Volk hinterlistig täuschte, trotzdem er selbst vom Unsinn vieler abergläubischer Gebräuche durchdrungen war.
Der jeweilige Herrscher des Marutse-Reiches besitzt sehr große Einnahmsquellen. Außer seinen ausgedehnten bebauten Ländereien, die theils von ganzen Colonien seiner dazu beorderten Unterthanen, theils von seinen vielen mit zahlreichem Gefolge versehenen Gemahlinnen bewirthschaftet werden, betragen die directen Abgaben, wie der eingezahlte Tribut ganz erstaunliche Mengen an allerlei Artikeln, welche ein Marutse-Fürst sich nur wünschen kann und repräsentiren einen bedeutenden Werth. Da Gummi elasticum wie auch Elfenbein, die ihm als Krongut abgeliefert werden müssen, die wichtigsten Tauschartikel bilden, so ist der Herrscher der eigentliche und erste Kaufmann des Landes. Er kauft oft Wagenladungen von Waaren im Werthe von 3—5000 £ St., verschenkt den größten Theil davon an seine nächste Umgebung oder an die ihn zufällig aus den entlegeneren Theilen des Reiches aufsuchenden Unterthanen, wobei jedoch die vertheilten Waffen, wie Gewehre etc. stets des Königs Eigenthum verbleiben. Trotzdem gelüstet es oft doch noch dem Könige nach einer schönen, einem der wohlhabenderen seiner Unterthanen angehörenden Rindviehheerde, die ihm seiner Auffassung nach zugehört, die er jedoch des guten Scheines halber nicht ohneweiters ausgeliefert haben will, sondern sich ihrer auf andere Weise bemächtigt, z. B. dadurch, daß er einfach den Besitzer des Hochverrathes, der Zauberei ober eines Mordes anklagt, verurtheilt und hinrichten läßt.
Der Herrscher kann das Leben nehmen wann und wie er will; er kann zu Sklaven machen wen und wie viele er will; er kann seine Hand nach der Frau eines Jeden ausstrecken, wenn diese sein Wohlgefallen erregt, wobei er einfach den Gemahl zur Seite schiebt und ihm eine andere Frau anbietet oder gibt; er kann ferner die Kinder den Eltern entreißen, wenn diese zu dieser oder jener Zauberei nothwendige Objecte bilden sollten. Die Regentinnen können sich nach Gefallen einen Gemahl wählen, ohne Rücksicht, ob der Mann schon durch eheliche Bande gebunden ist oder nicht. Der Regent besitzt immer das Schönste, was von den Nachbarvölkern, was von den Weißen ausgetauscht, oder was kunstvollst im Reiche selbst ausgearbeitet wurde. Hochverrath wäre es, wenn Jemand Schöneres oder Werthvolleres als der Herrscher besitzen würde. Oft bot ich den Leuten Geschenke an, die jedoch, wenn es ungewöhnlichere Objecte betraf, mit den Worten zurückgewiesen wurden: »Wir dürfen es nicht nehmen, wir wissen nicht, ob es Sepopo besitzt.«
Im Bauwesen überragen die Völker des Marutse-Mabunda-Reiches die meisten südlich vom Zambesi wohnenden Eingebornenstämme, den in diesem Fache Gewandtesten kommen sie gleich. Es gilt dies jedoch nur von den feste Wohnsitze innehabenden Stämmen, nicht aber von jenen, die sich blos periodisch der Ernte, der Fischerei oder der Jagd halber kurze Zeit an einem selbstgewählten oder ihnen vom Statthalter oder König angewiesenen Orte aufhalten. Solche periodische Wohnsitze finden wir namentlich an den Ufern der großen Flüsse, an östlichen und südlichen Waldabhängen und im Dickicht der Wälder, wo mitten in denselben ebene Lichtungen das Wild anlocken. Feste Wohnsitze sind über das ganze Land zerstreut; das Land der großen Städte ist aber die Barotse. Die Völker bauen im Allgemeinen gefällige, angenehme und gediegene Hütten und Häuser und — was sehr in die Wagschale fällt — sehr rasch. Es läßt sich leicht erkennen, daß es namentlich die Natur ist, in der die Völker leben, die ihnen das Baumaterial so reichlich und unter so geringer Mühe liefert und so das Bauen erleichtert, allein wir dürfen den Leuten auch einen gewissen Sinn, ein größeres Verständniß in dieser Fertigkeit nicht absprechen, die wir bei den meisten der südlich vom Zambesi wohnenden Stämme vermissen, denen ebenfalls von der Natur das Baumaterial in unmittelbarer Nähe und reichhaltig gespendet wird. Ich erwähnte bereits, in welch’ kurzer Zeit Neu-Schescheke aufgebaut wurde. Man kann nicht behaupten, daß die Hütten der Betschuana-, der Zulu-, Hottentotten-Race etc. mehr Schutz gegen das Feuer gewähren, als jene nördlich des Zambesi; hier jedoch wird der durch das Feuer verursachte Schaden so leicht und rasch ersetzt, daß das Unglück minder fühlbar wird.
Das Flußnetz des Marutse-Reiches mit seinen ausgedehnten, hoch und dicht bewachsenen Marschen bietet den Bewohnern reichliche, fruchtbare, wohlgelegene Ansiedlungsstellen und das Riesenwälder bildende Schilf ein vorzügliches Baumaterial, Holz zum Baugerüste, Lattenwerk, Bast, und daraus wie aus Palmenblätter geflochtene Seile und Taue, Nägel und Klammern, dichtes riesiges Gras als Eindeckungsmaterial, Sand und Thon zum Cement finden sich fast überall und wo es fehlt, kann es mit den raschen Booten in kurzer Zeit herbeigeschafft werden. Dabei hilft Einer dem Andern, wo es nöthig ist. Bezüglich ihrer Anlage sind die Städte so nahe als es die jährlichen Ueberschwemmungen gestatten, an die Flüsse angebaut und in der Regel von einem Kranze von Dörfern umgeben, in denen meistens Leibeigene wohnen, die für ihre Herren in der Stadt in deren nächster Umgebung Felder bestellen, Getreide anbauen oder auch Viehheerden hüten müssen. Außerdem sind die Städte bedeutend reiner gehalten als jene südlich des Zambesi, wozu, wie zur persönlichen Reinlichkeit, auch wieder der Ueberfluß an Wasser die Erklärung gibt.
Unter den verschiedenen Stämmen des Reiches fand ich die Marutse im Bauen praktischer als die von ihnen unterjochten und tributpflichtigen Stämme. Bei den Marutse beobachtete ich drei wesentlich von einander verschiedene Bauarten, und zwar: concentrische hohe, cylindrische und Langbauten. Die concentrische Bauart besteht aus zwei Häusern, von denen das eine, an Umfang kleinere, jedoch höhere, in ein weiteres, niedrigeres hineingebaut ist und beide von einem kegelförmigen Riesendache überdacht werden. Die Form des inneren Hauses ist die eines Kegelstutzens, es trägt ein eigenes kleines, gewölbtes, niederes Dach, die Form des äußeren Hauses ist eine cylindrische. Das gemeinschaftliche Dach reicht von der Spitze des Innenbaues ein bis zwei Meter über den Außenbau und wird an seiner Peripherie von einem Pfahlkranze gestützt, wodurch noch um den Außenbau eine schattige Veranda geschaffen wird. Den Bau dieser Häuser übernehmen die Frauen, jenes des Königs die Königinnen, nachdem ihnen ihre Männer, hier die Diener oder die dazu beorderten Unterthanen das nöthige Material herbeigeschafft, geebnet und mit Cement (aus Thon und Sand hergestellt) angeworfen haben. Die Baustellen haben gewöhnlich einen Umfang von 6 bis 12 Meter. Die Peripherie wird zu einer 30 bis 40 Centimeter tiefen, 10 bis 15 Centimeter breiten Furche vertieft und in diese lose Bündel von starkem, über vier Meter hohem Rohr eingelassen und die Furchen sodann ausgefüllt. Mittelst zwei bis vier Palmenblattstricken wird diese cylindrische Rohrmauer der Quere nach durchflochten, die Rohrstengel fest mit einander verbunden, wobei ich beobachtete, daß diese zum Durch-, Um- und Aneinanderflechten der Rohrbündel und Stengel benützten Querverbindungen nach oben zu kürzer werden, so daß statt einer cylindrischen eine kegelstutzförmige, etwa drei bis vier Meter hohe Rohrmauer entsteht, welcher Vorgang auch genau der Natur des Baumaterials entspricht.
In einer Höhe von drei bis vier Meter über dem cementirten Boden wird das Rohr gleichmäßig abgeschnitten und dann in allen Fällen die Außenseite, bisweilen auch die Innenfläche dieser Rohrwand cementirt. Nachdem dies vollendet, wird von Männern das niedere kegelförmige Rohrdach geflochten und von den Frauen einer enganschließenden Kappe gleich, dem Baue aufgesetzt und von außen cementirt. Mit einer in der Regel dem Hofeingange entgegen blickenden Thüröffnung von halb ovaler Gestalt, die man in die Rohrwand einschneidet und deren Rahmen man durch kunstvolles Cementgesimse ersetzt, vollendet man den Bau des concentrischen Hauses. Bei der Anlage des Außenbaues wird in ähnlicher Weise vorgegangen. Auch hier wird eine Furche gegraben, der Boden cementirt und Rohrbüschel, doch nur von 2⅔ bis 3⅓ Meter Höhe eingepflanzt, die etwa 30 Centimeter tief im Boden sitzen. Da diese Umfassungsmauer die Wucht des Hauptdaches zu tragen hat, wird die Rohrwand durch zahlreiche, eng aneinander oder höchstens 50 Centimeter von einander abstehende, ihr an Höhe gleichkommende oder sie um einige Centimeter überragende, der Rinde beraubte Pfähle gestützt. Die Außenfläche dieses äußeren Hauses ist stets, die Innenfläche zumeist cementirt, weshalb man kaum das leichte Baumaterial vermuthen würde. Genau mit der Oeffnung des Innenbaues correspondirend ist auch an dem Außenbaue die Thüre angebracht, bei allen größeren Bauten von Manneshöhe, 2½ Meter hoch und 80 Centimeter bis einen Meter breit. Ist der Außenbau (12 bis 24 Meter im Umfange) von den Frauen vollendet, so wird das Hauptdach von Männern geflochten und die Verandapfähle in einer Entfernung von 1 bis 1½ Meter von dem Außenbau eingerammt. Der Raum zwischen diesen Pfählen und dem Außenbau, d. h. das Trottoir der Veranda wird etwa 10 bis 20 Centimeter hoch aufgeschüttet und cementirt. Ist nun inzwischen das kegelförmige Riesendach fertiggestellt, so wird es dem Außenbau aufgesetzt, die schwierigste Procedur bei der gesammten Bauthätigkeit. In einem Tempo wird das Dach von 40 bis 60 Männern mittelst 3 bis 4½ Meter langen Pfählen von der Erde gehoben und auf die kürzeren Pfähle gestützt; nun verwechseln einige, nach und nach alle die kurzen Pfähle gegen die längeren und abermals wird das Dach in einem Tempo hoch aufgehoben, daß der Rand an einer Stelle auf der Dachspitze des Innenbaues ruht und dann mit Bedacht von der entgegengesetzten Seite weitergehoben, bis es über dem Dache des Innenbaues liegt. Das ungleichmäßig die Veranda überragende Rohr wird nun zugestutzt und von Männern wie Frauen das Dach mit dem trockenen, vorjährigen Ufergras gedeckt. Dabei wird zuerst das Dach mit einer 15 bis 30 Centimeter dicken Graslage regendicht überschüttet und mit Fächerpalmenstricken und Tauen netzartig umwunden, um es gegen den Wind widerstandsfähig zu machen.
Auf das Glätten des grauen Cementes und vor Allem auf den gesimsartigen Rahmen der inneren Thüre, auf welcher dünne Leisten auf das Feinste und symmetrisch ausgeführt sind, wird die größte Mühe verwendet. Der König besitzt in seinem Hofe drei solche in dem Winkel eines gleichschenkeligen Dreieckes stehende Häuser; zwei bis drei Königinnen je eines; die Würdenträger in der Regel eines bis zwei. Namentlich schön und gediegen sollen jedoch die königlichen Gebäude in der Barotse gearbeitet sein. Die Nebenhäuser der Königinnen sind nach Art der backofenförmigen Bauten der Masupia’s gearbeitet. Der königliche Hof besteht aus mehreren um die Gebäude des Regenten concentrisch angeordneten Häusergruppen.
Die königlichen Wohnhäuser sind von einer elliptischen Umzäunung umgeben und werden nach außen hin von zwei concentrischen Gehöftkreisen umfaßt, die je sechs bis acht Gehöfte zählen, welche von den Königinnen bewohnt werden, im weiteren Umkreise befindet sich sodann das königliche Vorrathshaus, das Küchen-Departement, die Hütte für die königliche Musikbande; im vierten äußersten Kreise stehen das im europäischen Style gehaltene Berathungshaus und die Hütten der Dienerinnen und Diener. Die Häuptlinge wohnen in einem weiten concentrischen Kreise um den Complex der königlichen Wohnungen, oder wenn sich, wie in Neu-Schescheke, die königlichen Gebäude an ein Gewässer lehnen, in einem Kreissegmente, wobei jedem Häuptlinge die Stelle, an der er sich in der Residenz niederlassen soll, genau ausgemessen ist. Den Hofeingang versperrt man bei Nacht, um die Raubthiere abzuhalten, mit einer aus Rohr gearbeiteten Thüre.
Eine zweite Bauart, hauptsächlich bei einem Zweigstamme der Marutse im Gebrauche, ist die cylindrische. Die in diesem Style aufgeführten Hütten sind cylindrisch und hoch, selten und dann nur an der Innenwand cementirt. Sie haben einen Durchmesser von 3 bis 4 Meter und sind mit einem 1 bis 1¼ Meter hohem Rohrdach gedeckt, welches an seiner Spitze verschiedene, aus Holzstücken, Gras- und Strohseilen verfertigte Verzierungen trägt.
Eine andere Bauart der Hütten bei den Marutse ist die giebeldachförmige, mit einem gewöhnlich in der Mitte angebrachten, der Hofthür zugekehrten niedrigen Eingang, an dessem Rahmen das Baumaterial, Schilfrohr oder Gras, vorspringende Kämme bildet, um den Regen abzuhalten und einen besseren Verschluß zu sichern. Die armförmigen, oben bogenartig in einander greifenden Rohrbündel sind durch zahlreiche, dünnere aus gleichem Material geformte Latten der Quere nach verbunden. Bei größeren Bauten wird der Giebel durch drei bis fünf Pfähle gestützt und durch Matten-Verschalung das Innere in zwei ungleiche Räume getheilt, von denen der kleinere als Empfangs-, der größere als Schlafraum benützt wird. Solcher Giebelbauten enthält ein größeres Gehöfte einen bis zwei, bei einem Wohlhabenden findet sich in der Regel noch eine Rundhütte als Kornkammer und bei einem Häuptlinge eine ähnliche als Berathungshaus. Der Hofraum ist von länglich-ovaler Form und das Hauptgebäude mit seiner Frontseite dem Eingange zugekehrt.
Von den in Schescheke lebenden Marutse wohnen zwei Drittel derselben in solchen Häusern unter dem Häuptlinge Maranzian. Die Mabunda’s haben den Langbau der Marutse im Gebrauch, nur sind ihre Hütten kürzer und breiter und haben einen flacheren First. Die Umzäunung ist eine viereckige und besteht aus ½ bis 2 Meter hohen Pfählen, die in einer Entfernung von ein bis zwei Meter in die Erde eingelassen sind, und einem sich an diese mittelst Querstangen stützenden Rohrzaun.

Musikinstrumente der Marutse.
Außer den genannten drei Häusern fand ich in dem königlichen Hofraume noch drei Hütten, welche mir auffielen, erstlich des Königs Apotheke und sein Badezimmer, eigentlich ein auf dünnen Pfählen ruhendes Strohdach mit einem Durchmesser von etwa drei Meter und mit einem fünf Fuß hohen Pfahle in der Mitte. Dieser Pfahl war mit kleinen Körbchen, Kalebassen, Säckchen, Antilopenhörnern, Knochen, Korallensträngen etc. behangen, unter denen die gefäßartigen Objecte heilende Kräuter, sowie Gifte, deren man sich zu den Hinrichtungen bediente, doch auch allerlei Zauberschwindel, Zauberinstrumente und Mittel aus Holz, Rohr, Vogel- und Thierknochen, Elephanten- und Nilpferd-Elfenbein, Fruchtschalen, Thierklauen, zu Pulver gebrannte Knochenstücke, ferner die Schuppen des Schuppenthieres und des Krokodils, Schlangenhaut, Tuch- und Wolllappen enthielten. Auch auf dem Boden der Hütte lagen solche Gegenstände in verschiedenen Gefäßen und an der Innenseite des Hüttendaches war ein Medicinkistchen aufgehangen, das ein portugiesischer Händler einst Sepopo verehrt hatte. Außerdem hingen einige Musikinstrumente in der Hütte und jeden Abend wurde eine riesige runde Holzschüssel hereingebracht, in der Sepopo sein Bad nahm. Vor derselben stand eine kleinere Hütte mit einem prismatischen Dache, in welcher verunstaltete Elephantenzähne, deren man zufällig auf der Jagd habhaft geworden war, sowie einige Gefäße mit allerlei Zaubermitteln lagen, deren sich der König auf der Jagd bediente. Hinter dem Empfangshause erhob sich ein ähnlich geformtes, bedeutend kleineres, prismatisches, auf einen Baumstamm gehobenes Dach, unter welchem eine Unzahl von Elephantenschwänzen als Trophäen dieser in der Nähe von Schescheke erlegten riesigen Dickhäuter, sowie eine Gruppe von Assagaien, die größten und bestgearbeiteten im ganzen Lande vor dem schädlichen Einflusse des Regens geschützt wurden. Zwischen dieser Hütte und der hohen Rohrumzäunung standen auf Holzgestellen und Stäbchen einige Gefäße (Kürbisschalen und Thon), in welcher zur Jagd benöthigte Zaubermittel aufbewahrt wurden. Bei meinen Gängen durch die Stadt fand ich in jedem Höfchen einen Baumast oder einen kleinen trockenen Stamm eingepflanzt, an dem die Kopfskelette der Antilopen sowie die Atlaswirbel der größten Säugethiere, die Jagdtrophäen des Herrn des Gehöftes, hingen und die von dessen Thatkraft Zeugniß geben sollten. Nach dem Tode des Mannes werden dann diese Trophäen auf sein Grab niedergelegt.
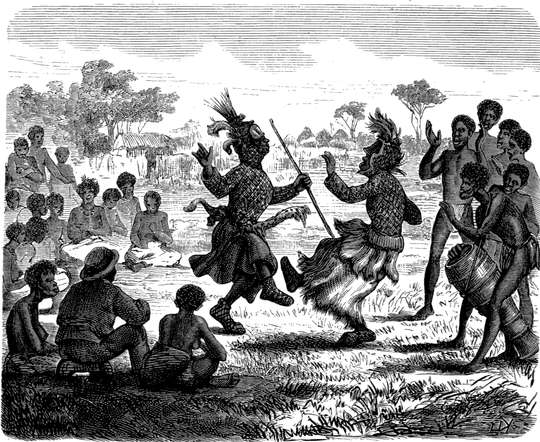
Kischitanz.
Am 26., als ich mich eben am Ufer des Flusses erging, warf sich ein Krokodil aus dem Wasser auf einen im Kahne stehenden Mann, der sich jedoch durch einen Sprung auf das sandige Ufer zu retten vermochte.
Von den Portugiesen, von dem Könige und seinen Häuptlingen, sowie von Blockley erfuhr ich, daß der Madschila-River ein ähnlich sandiges und bewaldetes Hochplateau wie jenes zwischen den Salzseen des centralen Süd-Afrika und dem Zambesi-Gebiete durchströme, bei den später unternommenen Ausflügen in dieser Richtung hin konnte ich jedoch bemerken, daß das Land größere, zum Ackerbau vorzüglich geeignete Lichtungen besaß, welche gegenwärtig zahlloses Wild beherbergten.

Kischitänzer-Maske.
Am 27. machte ich wiederholte Versuche, um vom Könige Kähne zu meiner Rückkehr nach Panda ma Tenka zu erlangen, wurde aber mit leeren Ausflüchten vertröstet. Tags zuvor hatte der König mir zu Ehren einen Mabunda-Tanz aufführen lassen. Die Idee dieses Tanzes ist eine verwerfliche, auch ist es vielleicht von Interesse zu wissen, daß die Schwarzen des Marutse-Reiches sich der in diesem Tanze enthaltenen Unschicklichkeit bewußt sind und deshalb nur maskirte Männer daran theilnehmen. Auffallend vorgeschritten erscheinen die Völker des Marutse-Mabunda-Reiches in ihren musikalischen Begriffen. In der Fertigkeit der Handhabung musikalischer Instrumente finden sie zwar Rivalen in den Stämmen an der Ostküste Süd-Afrika’s, die häufiger mit den Portugiesen in Berührung kamen, im Gesange sind ihnen die Matabele-Zulu überlegen. Im Marutse-Mabunda-Reiche fand ich zum ersten Male eine vom Könige zu seiner Unterhaltung und Verherrlichung gehaltene, aus einheimischen Künstlern recrutirte Musikbande. Sie besteht aus mehreren Tambours, welche längliche, röhren- und kegelstutzförmige einfache, sowie sanduhrartig geformte Doppeltrommeln mit ihren Hohlhandballen und Fingern bearbeiten; die Doppeltrommeln hängen an einem um den Nacken geworfenen Riemen, während die länglichen von den resp. Künstlern »geritten« werden. Die wichtigsten Instrumente der Capelle sind die Myrimbas (Kalebaßpianos), welche ähnlich den Doppeltrommeln getragen werden. Die Musikbande besteht aus 20 Mann, von denen jedoch nur sechs bis zehn jedesmal auftreten, damit eine hinreichende Anzahl für den Nachtdienst und als Reserve erübrigt wird. So treten auch die beiden königlichen Cithervirtuosen meist einzeln auf. Die Musikanten müssen auch Sänger sein, um in den freien Intervallen, oder bei den gedämpften Klängen der Instrumente mit schreiender Stimme des Königs Lob zu verkünden.
Die zum Dienst Befohlenen müssen sich jederzeit bereit halten, dem oder jenem ihnen vom Könige Bezeichneten vorzuspielen, sie haben den König bei seiner Ankunft in der Stadt zu empfangen, ihn auf seinen Ausgängen zu begleiten und müssen bei öffentlichen Tänzen, Hochzeiten etc., doch immer nur auf des Königs ausdrücklichen Befehl spielen. Außer den drei Trommelarten und zahlreichen Sylimbas (citherartigen Instrumenten) fand ich bei der königlichen Musikcapelle noch Streichinstrumente aus Fächerpalmenrippen, eiserne Glöckchen und eine klöppellose Doppelglocke, sowie aus Fruchtschalen verfertigte Schellen, ferner aus Elfenbein, Holz und Schilfrohr gearbeitete Pfeifchen. So werden die Streichinstrumente beim Elephantentanz, die Glocken beim Kischitanz, die Schellen bei den Hochzeits-Ceremonien verwendet; für den prophetischen Tanz der Masupia leiht der König flaschenförmig ausgehöhlte, durchlöcherte, mit trockenen Samen gefüllte, faustgroße Kürbisse, welche geschüttelt, schellenartige Laute erzeugen. Nur die aus Fruchtschalen bereiteten Schellen, einige Glöckchen und kurze Pfeifen sind in ähnlicher Form unter der Bevölkerung zu finden, häufiger das citherartige Instrument, doch meist in untergeordneter Gestalt; die größten und bestgearbeiteten besitzt der König, wie ihm überhaupt alle Capellen-Instrumente gehören, so daß es mir nicht gelingen konnte, diese zu den schönsten Handarbeiten im Marutse-Reiche gehörenden Objekte meinen Sammlungen einzuverleiben, dagegen erstand ich mehrere kleine citherartige Instrumente. Die Gemeinden, d. h. Niederlassungen, haben in der Regel bei den meisten Stämmen längliche kleine Trommeln, je eine, in der Berathungs- oder Gemeindehütte aufbewahrt, die bei besonderen Jagderfolgen, bei Vergnügungen, bei Bestattungen erschallen.
Die Weisen und Melodien der Marutse-Mabunda sind im Allgemeinen eintönig doch zahlreich und zeigen, daß einiger Unterricht in kurzer Zeit verhältnißmäßig guten Erfolg haben würde. Selbstverständlich ist hier die Musik nur ein mechanisches Bearbeiten der einzelnen Instrumente, nur bei den Citherspielern fand ich eine Ausnahme. Ich erwähne namentlich die beiden königlichen Citherkünstler, zwei Greise, die unstreitig mit Gefühl spielten. Sie sangen, d. h. summten dazu, doch ihre Stimme war genau den bald ruhig fließenden Accorden entsprechend gemessen, bei der sich allmälig zu Piano und Pianissimo dämpfenden Melodie zu einem flüsternden leisen Gesange gesunken, um wieder allmälig zu einem Forte überzugehen. Ich vermißte hier glücklicher Weise das mißtönende krächzende Einfallen, wodurch sich der plötzlich in ein schreckliches Fortissimo ausbrechende Gesang des Obertambours kennzeichnete.
Noch eines Musik-Instrumentes muß ich erwähnen, ich bedauere blos, daß ich es überhaupt nennen muß, und daß ich es im Marutse-Lande vorfand; es sind vier Kriegstrommeln, die nur zur Kriegszeit geschlagen, gewöhnlich im Berathungshause aufbewahrt werden. Der Wahnsinn des Aberglaubens machte sie zu grausigen Objecten, ihr rother Anstrich, die rothen Flecken am Trommelfelle, sind Blutzeichen; sie enthalten trockene Fleisch- und Knochenstücke, die, unschuldigen Kindern angesehener Eltern bei Lebzeiten abgeschnittenen Finger und Zehen, welche Amulete (Beschwörungsmittel) abgeben sollten, um dem neuerbauten Schescheke Krieg und Feuer, und dem Reiche räuberische Ueberfälle fern zu halten.
Im Gesange stehen die Bewohner des Marutse-Mabunda-Reiches höher als die Betschuana, in manchen Formen ebenbürtig der Zulu-Race, doch werden sie von diesen und den Matabele durch deren großartige Kriegs- und Todtengesänge übertroffen. Der oben erwähnte Tanz, den ich am 26. beobachtete, ist ein Landesgebrauch der Mabunda, wird Kischitanz genannt und nur auf des Königs Geheiß getanzt und hat geschlechtliche Aufregung zum Zwecke. Den Kischitanz tanzen zwei oder vier Männer, von denen je einer den Mann, der andere die Frau vorstellen soll; die große Röhrentrommel begleitet den Tanz; die Tänzer sind von einem Haufen junger Leute umgeben, die zu dem Trommelschlag singend in die Hände klatschen und aus deren Mitte zuerst einzeln, dann je zwei neue Tänzer hervorkommen und gegen den König gewendet, ihren körperverdrehenden Tanz beginnen. Ein Anlauf, ein Annähern von der einen, ein Zurückweichen von der anderen Seite etc. sind das Wesen und die gebräuchlichen Gesten des Tanzes. Die Costüme sind königliches Eigenthum, es war mir daher nicht möglich, sie zu erwerben.
Dasselbe besteht aus der eigentlichen Maske, dem Netzwerk und der Lendenumhüllung. Die Maske, von Knaben aus Thon und Kuhdünger modellirt, ist mit rothem Ocker und Kalk bemalt und ein ziemlich bedeutendes Product des Mabunda-Fleißes. Die Maske ist bedeutend größer als der Kopf, den sie nebst dem Halse vollkommen bedeckt und einer mit niedergeschlagenem Visir versehenen Helmhaube ähnelt. Für die Augen und den Mund, seltener für die Nase, sind kleine Spalten offen gelassen. Die scharf hervorragenden Züge der Maske sind den als Wasserspeier benützten Zerrgestalten ähnlich und die Maske am Cranium mit Buckeln versehen, am mittleren in der Regel als Schmuck Schwanzhaare des gestreiften Gnu, an den übrigen Federbüsche befestigt. An der Maskenhaube oder unter ihr so weit hinausreichend, daß der Halstheil bedeckt wird, sehen wir das Netzgewand, das aus einer langen geschlossenen, mit langen Aermeln und daran befestigten Netzhandschuhen, aus federspuldickem Bastnetzwerk gearbeiteten Jacke und aus ähnlichen hohen Strümpfen besteht. Von den Lenden bis zu den Knöcheln reicht eine in Falten gelegte Wolldecke oder Carosse, welche die die Frau vorstellende Maske trägt, über der letzteren wird noch je ein Thierfell vorne und hinten getragen. Bis auf einen um den Hals bandartig geschlungenen Strohwisch ähnelt die weibliche Maske der männlichen, die letztere zeigt auffallendere Haubenverzierungen. Am Stahlringe, der um die Hüften läuft, sind rückwärts einige Glöckchen befestigt, die bei der leisesten Körperbewegung erklingen. Der Kischitanz, der eine Unzahl von Zuschauern anlockt und zu dem Kinder nicht zugelassen werden, wird in Schescheke meist in vierzehntägigen Zwischenräumen aufgeführt.
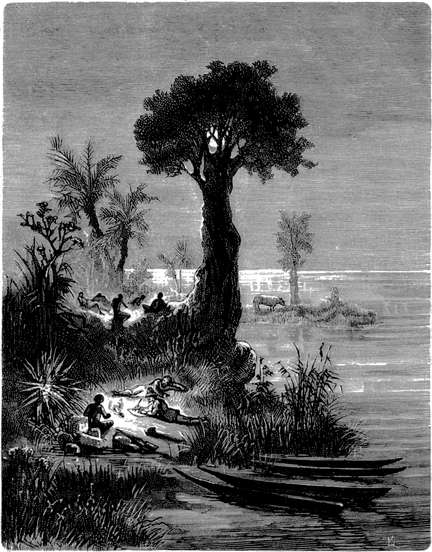
Am Ufer des Zambesi.
Am 27. bemerkte ich einige Leute des Alumba-Stammes, welche sich durch eine besondere Haarfrisur auszeichneten. Die einzelnen kleinen Knoten ihres wolligen Haares werden mit einem aus Fett und Brauneisenstein bestehenden Brei derart bestrichen, daß die Wolle vollkommen verhüllt wird und die 1 bis 2½ Zoll langen Haarknoten an dem herabhängenden Ende bedeutend verdickt erscheinen. In dieser Weise wird nur das Wollhaar am Scheitel behandelt, und zwar in etwa vier über einander liegenden Lagen. Einige der Marutse trugen am Halse Schuppen des Schuppenthieres und Reste einer Schildkrötenart, welche sie mit gutem Erfolg als blutstillendes Mittel gebrauchten. Auch zeigte man mir ein Stückchen Buschholz, an dem man bei Keuchhusten-Anfällen, kleine Kinder mit Erfolg saugen läßt.
Bei seinen Besuchen, die uns Sepopo abstattete, brachte er stets, von einem ganzen Trosse seiner Diener begleitet, bedeutende Mengen von Elfenbein, um von Blockley namentlich Gewehre und Schießpulver zu kaufen. Während des Nachtmahls stellten sich dann die Schützen ein, welche am folgenden Morgen zur Jagd befohlen waren; der König gab jedem circa einen Liter Schießpulver und merkte sich genau den Mann. Blockley klagte über die Forderungen Sepopo’s, die dieser an ihn stelle, besonders darüber, daß er nach jedem Kaufe ein bedeutendes Geschenk begehre. Westbeech hatte dies eingeführt und den König daran so gewöhnt, daß dieser nunmehr sich ohne Geschenk nicht zufrieden gab. Anfangs, da Westbeech der einzige Händler war, welcher seine Waaren am Zambesi feilbot und dies am rechten Tschobe-Ufer geschah, konnte er für seine Waaren jeden beliebigen Preis fordern und bekam ihn auch, als jedoch andere Händler, durch diesen Erfolg angelockt, nach Schescheke gingen, waren sie vollkommen in der Gewalt des Königs und da sie sich noch überdies überboten, klagten sie über den schlechten Ertrag des Handels.
Als ich am 28. den König besuchte und wir abermals über meine Reise sprachen (der König war in Folge eines Streites mit Blockley in schlechter Stimmung und ich trachtete ihn, indem ich ihm durch Mahura lustige Reisebegebnisse erzählte, wieder in guten Humor zu bringen), zeichnete er mir im Sande mit seinem Stöckchen meine Route durch sein Reich, zeichnete den Lauf des oberen Zambesi und seiner Nebenflüsse, daß mir förmlich das Herz vor Freude pochte. Den König freute das Interesse, das ich an seinen Mittheilungen nahm, er rief zwei vorübergehende Männer herbei. Es waren zwei Manengo vom oberen Zambesi, welche die mir bezeichnete Strecke mehrmals bereist hatten und vom Könige befragt, die eben von ihm beschriebene Route selbst bestimmen sollten. Und siehe da — ihre Erklärung stimmte mit der des Königs vollkommen überein.
Als ich Abends eben damit beschäftigt war, an meinem Tagebuche zu arbeiten, versuchte es Jemand, sich durch die Eingangsöffnung zu drängen. Es war eine Frau, die den Basuto-Diener April suchte. Ihr Mann hatte bei dem Brande Alles verloren und von April ein kleines Geschenk an Glasperlen erhalten, wofür er sein Mulekau wurde und nun dessen Frau während der Zeit seines Aufenthaltes in Schescheke als Gegengeschenk erhalten hatte.
Alles was Sepopo bei mir sah und ihm neu erschien, wollte er, wenn es ein ihm brauchbar dünkender Gegenstand war, besitzen, andernfalls aber wenigstens die Erklärung des Gegenstandes erhalten. So befragte er mich über meinen Compaß; um ihm die Wichtigkeit des Instrumentes zu zeigen, zeichnete ich die östliche Hemisphäre in den Sand, dann Afrika allein und darauf meine Route wie die verschiedenen, südlich vom Zambesi liegenden, unabhängigen Betschuana-Reiche.
Am Nachmittage besuchte ich das königliche Küchen-Departement, das mehrere Personen zählte und unter der Leitung einer Frau stand. Die riesigen Korngefäße ruhten auf Holzgestellen, in eigenen, aus Matten und Rohr erbauten Hütten. Im Allgemeinen war Alles sehr reinlich gehalten. Zur Zeit meines Besuches wurde eben — das Feuer wird stets im Höfchen auf einem niedrigen Heerde angemacht — von einem Diener Nilpferdfleisch in einem riesigen Topfe gekocht. Das Fleisch war ziemlich gar und wurde auf einer Holzschüssel servirt, dann aus dieser auf kleinere zertheilt und der Königin zugesendet.
Spät Abends kam ein Bote vom Panda ma Tenka-Thale mit der Nachricht, daß Westbeech mit dem Händler Francis von Schoschong daselbst angekommen sei. Da ich am nächsten Morgen die versprochenen Kähne zur Abreise zu erhalten hoffte, arbeitete ich bis gegen Morgen an den entworfenen Zeichnungen.
Früh am 29. wurde ich auch zu den Kähnen gerufen. Diese sollten mich bis zur Makumba-Landungsstelle bringen und dann hier liegen bleiben, um die von Westbeech zu erwartenden Waaren nach Schescheke zu bringen. Die Stromfahrt nach abwärts war nicht minder angenehm als die Fahrt zu Sepopo. Ich gab mich der Betrachtung der reichen Vogelwelt hin und hatte bald an den insbesondere durch einen verlängerten Unterkiefer ausgezeichneten, schwarzweiß-gescheckten Scheerenschnäbeln (Rhynchopsinae), den riesigen Marabus und den großen Eisvögeln mehr denn hinreichende Studienobjecte gefunden. Die Binsen waren mit Schnecken bedeckt und das Ufer von den Krabben förmlich durchlöchert. Ein Loch lag neben und über dem andern. Das Wasser war in den wenigen Tagen, seitdem ich den Strom aufwärts befahren hatte, um 18 Zoll gefallen.
Am nächsten Morgen, nachdem wir an der Bucht übernachtet, fuhren wir weiter, die Bootsleute thaten dabei ihr Möglichstes, rasch vorwärts zu kommen, und schätzte ich die Geschwindigkeit, mit der wir uns vorwärts bewegten auf vier bis fünf englische Meilen in der Stunde. Als ich nach Impalera gelangte, fand ich hier die Händler Westbeech und B. Francis, sowie einen Gehilfen des ersteren, welche eben im Begriffe waren, Sepopo begrüßen zu gehen. Sie hatten ihre Wägen in Panda ma Tenka zurückgelassen. Francis war diesmal wie auf allen seinen Handelszügen von seiner von Weißen wie Schwarzen hochgeschätzten Gemahlin begleitet. Er war mit zwei Wägen und einem entfernten Verwandten, Oppenshaw, als Gehilfen (Clerk) gekommen. Westbeech, der sich erst einige Monate zuvor mit einer Farmerstochter aus dem westlichen Transvaal-Gebiete verehelichte, kam in der Begleitung seiner jungen Frau, eines Gehilfen Buuren und eines Mannes mit Namen Walsh, der früher Soldat und dann Gefangenwärter in Hope-Town gewesen war und sich sehr gut auf das Abbalgen der Vögel verstand. Er sollte eben dieser Arbeit in den Zambesi-Gegenden obliegen und beide sich in den Ertrag theilen. Westbeech und Francis wollten von ihrem Besuche bei Sepopo rasch nach dem Panda ma Tenka-Thale zurückkehren und dann nach den Victoriafällen gehen, um dieses Naturwunder ihren Frauen zu zeigen.
Von den angekommenen Händlern erhielt ich meine Correspondenz, darunter willkommene Briefe aus der Heimat, aus den Diamantenfeldern (Griqualand-West), aus den Transvaaler Goldfeldern, auch 60 Zeitungen, deren freie Ränder mir später von großem Nutzen sein sollten; darunter ein Exemplar der »Diamond News« mit meinem ersten über die dritte Reise veröffentlichten Artikel. Meine Abreise war durch die Abwesenheit des Häuptlings Makumba verzögert worden. Das Uebersetzen über den Tschobe schien mir zwar leicht zu bewerkstelligen, allein ich brauchte ja Träger, um die in Schescheke gesammelten Objecte und das für den Verkauf von Ochsen von Blockley erhaltene Elfenbein nach dem Panda ma Tenka-Thale schaffen zu lassen. Die zweite Ueberfahrt über Tschobe verursachte mir viel Sorgen und Aerger. Mangel an Trägern und ein Boot, das ein faustgroßes Leck hatte, wodurch der Transport meiner Sammlungen sehr gefährdet wurde, hielten mich in steter Aufregung. Im Leschumothale angekommen, fand ich die schon erwähnten englischen Officiere, Mr. Loud und Fairly, die einen zweiten Besuch bei Sepopo machen wollten, sie gestatteten mir, mich ihres Wagens nach Panda ma Tenka zu bedienen. In der Nacht zum 3. wurde das Gespann geholt und ich verließ das Thal. Auf meinem Zuge nach der Gaschuma-Ebene beobachtete ich, daß das Abbrennen des Waldgrases eine Verminderung der Tsetse zur Folge hatte und das Gras bereits neu zu sproßen begann.
Am Mittag des 4. langten wir in der Gaschuma-Ebene an, welche, trotzdem sie wieder abgebrannt worden war, an den noch begrasten Stellen zahlreiches Wild beherbergte. Am Wagen befanden sich auch zwei den englischen Officieren gehörige Pferde, welche unglücklicher Weise gerade dem nachlässigsten ihrer Diener anvertraut waren. Ohne meinen Warnungen Gehör zu schenken, ritt derselbe am nächsten Morgen mit den Pferden voraus. Als wir uns der Baobabstelle näherten, befahl ich meinem Diener und dem Wagenlenker scharf auszuspähen, denn ich war dessen sicher, daß der bekannte Löwe dem störrigen Diener begegnet war. Da es noch nicht vollkommen Tag war, konnten wir nicht viel sehen, doch bemerkte der Wagenlenker den Gesuchten auf einem Baume stehend und blos ein Pferd des Capitän M. nahebei. Das geübte Auge des Hottentotten erkannte zu gleicher Zeit in den einige hundert Schritte entfernten Büschen zu unserer Rechten einen sich zurückziehenden Löwen. Mich auf den Bock stellend, spähte ich aus und sah auch bald darauf das Pferd einige Schritte links vom Wege mit ausgerissenen Eingeweiden daliegen. Einige kleine Wunden im Nacken zeigten, wie es der Löwe getödtet. Die Sache trug sich folgendermaßen zu. Ungefähr auf 300 Schritte dem schon erwähnten Baobab nahegekommen, wurde der Diener von dem Löwen angegriffen und bei der Verfolgung vom Pferde abgeworfen, während der Löwe, ohne sich um den Mann weiter zu kümmern, den Pferden nachsetzte. Hierbei trat dem Eisenschimmel des Herrn Fairly die herabgleitende Decke bei dem Fluchtversuche hindernd in den Weg, so daß das Thier eingeholt und niedergerissen wurde. Der Schwarze suchte seine Zuflucht in dem nächsten Mapanibaume, auf welchem er auch bis zur Annäherung unseres Wagens verblieb, während das zweite Pferd bis zu unserer Ankunft, etwa sechzig Schritte entfernt ruhig graste. Ich nahm mit den Dienern Verfolgung des Löwen auf, jedoch ohne Erfolg.
[10] Ich hoffe die Manzawurzel zu einem der Ausfuhrmittel aus dem Marutse-Reiche zu machen.
Ankunft in Panda ma Tenka. — Neue Enttäuschungen. — Theunissen verläßt mich. — Aufbruch nach den Fällen. — Jagd auf Orbecki-Gazellen. — Eine Giraffenheerde. — Die Süßwassertümpel in der Umgebung der Victoriafälle. — Thier- und Pflanzenleben in denselben. — Ein schmerzenreicher Gang. — Der erste Anblick der Fälle. — Unser Skerm. — Charakteristik der Fälle. — Großartigkeit und Pracht derselben. — Höhe und Breite der Fälle. — Die Inseln an der Fallkante. — Höhe der Dunstsäulen. — Die Erscheinung der Fälle bei Sonnen-Auf- und Niedergang. — Die Abflußrinne des Zambesi unterhalb der Fälle. — Felsenbildungen. — Vegetation und Thierleben an den Fällen. — Jagd auf Paviane. — Ein interessantes Löwenabenteuer. — Die Manansa’s. — Schicksale und Charakter derselben. — Ihre Sitten und Gebräuche. — Brautwerbung und eheliches Leben bei denselben. — Todtenbestattung. — Rückkehr nach Panda ma Tenka.

Jagd auf Bushvaarks.
In Panda ma Tenka angelangt, fand ich reges Leben in Westbeechs Pfahlumzäunung, mehrere Wägen waren eingetroffen, ein ganzer Troß von Dienern bewegte sich bunt durcheinander und dazwischen heulten und liefen nicht weniger als etwa 20 Hunde. Leider fand ich, daß der Regen in meinen Wagen gedrungen war und mir die aus Thierfellen bereiteten Kisten derartig beschädigt hatte, daß die meisten der in ihnen aufbewahrten Insecten, Pflanzen und Samen verdorben waren. Einige der bei meiner Abreise zurückgebliebenen Händler fand ich bedenklich am Fieber erkrankt. Während meiner Abwesenheit wurde einer der Diener Khama’s, des Bamangwato-Königs, der von diesem an den schon erwähnten Jäger Africa verdungen worden war, von einem Elephanten getödtet. Africa mußte später, als er nach Schoschong kam, als Entschädigung 50 £ St. zahlen.
Nach dem Besuche der Victoriafälle wollte Westbeech mit seinem Gehilfen Bauren einen dreimonatlichen Aufenthalt in Schescheke nehmen, Blockley sollte es indeß versuchen, mit Wanke, dem östlich von den Victoriafällen wohnenden Makalaka-Fürsten Handel zu treiben, während Bradshaw in Panda ma Tenka bleiben, die Oberaufsicht führen und von den Madenassana’s und Masarwa’s Elfenbein einhandeln sollte. Mein Gefährte Th. hatte vollauf zu thun, um für die am Wechselfieber erkrankten Elfenbeinhändler die nöthigen Medicamente zu bereiten. Während ich tagsüber Ausflüge unternahm und meine Vorbereitungen zur zweiten Zambesi-Reise traf, benützte ich die Nachtstunden zur Erledigung meiner Korrespondenz und Aufzeichnung meiner Erlebnisse.
Am 10. September kehrten Westbeech und Francis von Sepopo zurück und brachten je einen circa 50 Pfund schweren Elfenbeinzahn als Geschenk des Königs für ihre Frauen mit. Sie waren auf ihrer Rückfahrt auf mehr als 30 Krokodile und 5 Nilpferde gestoßen, wobei sie von einem der letzteren angegriffen wurden. Mein zweiter Aufenthalt in Panda ma Tenka brachte mir viele Sorgen und Enttäuschungen, meine Mühe, Diener und Träger zu finden, war leider vergeblich. Meine Enttäuschung erreichte den höchsten Grad, als ich von einem der Händler erfuhr, daß mein Gefährte Th. mit mir nicht weiter gehen und mich hier verlassen wolle, um nach dem Süden zurückzukehren; ich hatte mich auf ihn verlassen und seinethalben andere Offerten zurückgewiesen. Th. war mir die ganze Zeit bisher immer treu und willig beigestanden und ich konnte es kaum glauben, daß er mich in der gegenwärtigen entscheidenden Stunde meiner Reise, in welcher ich einen Freund so nöthig hatte, verlassen konnte, dieses Mißgeschick war indeß unabwendbar und wurde noch dadurch verschärft, daß Pit sich derart ungeberdig benahm, daß ich ihn entlassen mußte.
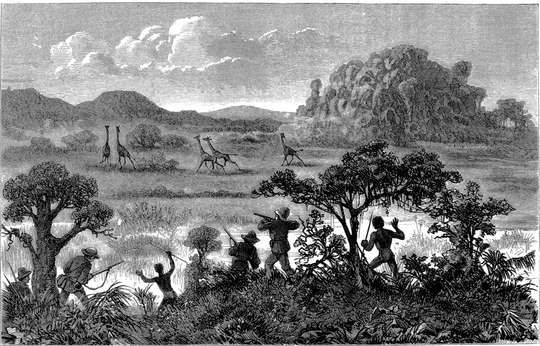
Zusammentreffen mit Giraffen.
Es war eine Wiederholung jener vielen Enttäuschungen am Vorabende der Ausführung einer lange gehegten Idee oder eines lange gefaßten Planes, wodurch ich mich plötzlich von meinem angestrebten Ziele weit zurückgeschleudert sah. Wo sollte ich Diener miethen, die mir auf meiner Weiterreise nach Nordwest als Träger dienen mußten? In dieser unangenehmen Lage, in einer Situation, in der ich, von meinen Leuten verlassen, selbst nicht im Stande war, in den Wäldern nach Osten die Eingebornendörfer aufzusuchen, um neue Diener zu miethen, wurden Westbeech und Francis meine Retter. Als die Beiden meine Noth erfuhren, versprachen sie mir unter den südlich von den Victoriafällen wohnenden Manansa oder den ihnen benachbarten Batoka’s Diener zu werben — doch unter der Bedingung, daß ich sie zu den Victoriafällen begleitete, wohin sie sich begeben wollten um »the splendid falls« ihren Frauen zu zeigen. Da half kein Zögern und ich ging. Es gelang mir noch zuvor einen Masupia-Mann, den ich »Elephant« taufte und der vom Zambesi hergekommen war, um bei einem Eingebornen oder weißen Jäger Arbeit zu suchen, zu miethen.
Es war eigentlich nicht meine Absicht, die Victoriafälle aufzusuchen (sie lagen etwa 50 englische Meilen rechts ab von meiner Reisetour), allein durch diese eigenthümlichen, unerwarteten Umstände gezwungen, mußte ich mich zu einem Besuche derselben entschließen. Heute schätze ich mich glücklich, der Aufforderung der beiden Händler Folge geleistet zu haben. Meinen Wagen der Aufsicht der Leute Westbeechs überlassend, machte ich mich mit den neuen Freunden auf den Weg. Wir fuhren in zwei Wägen bis zur Gaschuma-Ebene. Die Gegend zwischen der früheren Handelsstation am Panda ma Tenka-Flüßchen und Gaschuma ist für den Reisenden sehr anziehend. Wir gelangten gegen 3 Uhr Morgens zu den ersten Teichen der Gaschuma-Ebene. Die Richtung nach derselben war eine nordnordwestliche, während die Victoriafälle nordöstlich lagen, wir uns daher von der Gaschuma-Ebene nach Osten zu wenden und dann eine Ostnordost-Richtung einzuschlagen hatten.
Um die von der Tsetse inficirte Gegend zu den Victoriafällen durchziehen zu können, mußten die Wägen mit den Ochsen auf der Gaschuma-Ebene zurückgelassen werden und bedienten wir uns für die Weiterfahrt eines von sechs Langohren gezogenen Karrens. Die Reise-Gesellschaft bestand aus folgenden Personen: Westbeech und seine Frau, Francis und dessen Frau, Bauren, Oppenshaw, Walsh und mir, ferner vier Cap-Halfcastmännern, meinem Masupia-Diener und zwanzig Makalaka’s und Matabele’s. Diese benutzten wir als Träger, um unsere Nahrung, Kochgeschirre und Decken fortzuschaffen.
Auf der Gaschuma-Ebene, welche durch dichte Fächerpalmenbüsche und einige prachtvolle Fächerpalmen geschmückt ist, blieben wir bis zum 15., um eine tüchtige Umzäunung um unsere Wagen zu errichten, denn zahlreiche Löwenspuren nöthigten uns zur größten Vorsicht. Das Gras auf der Ebene war zum größten Theile niedergebrannt, nur hie und da zeigten sich noch dichtere Partien. Stellenweise fing neues Gras zu sprossen an und hier, kaum daß man sie wahrnehmen konnte, lagen flach auf der Erde paarweise oder zu Vieren die schönen, zierlichen Orbecki-Gazellen, die bei unserer Annäherung plötzlich aufsprangen und in Sätzen davon eilten, um sich in der Entfernung von einigen hundert Schritten nach uns umzusehen.
Ich und O. (F.’s Freund) hatten einige der Thiere verfolgt und waren so von der langsam sich vorwärts bewegenden Karawane abgekommen. Da jedoch unsere Verfolgung nutzlos war, wandten wir uns nach unseren Gefährten, hatten auch schon hundert Schritte nach dieser Richtung hin zurückgelegt, als kaum 30 Schritte vor uns blitzähnlich ein Orbecki-Pärchen aufsprang. Freund O. schießt auf das eine Thier, das kaum 50 Yards von uns entfernt stehen blieb und bricht ihm den einen Vorderlauf nahe am Knöchel, allein auf drei Füßen jagt das Thier in großen Sätzen weiter. Wir folgen, doch schon auf 200 Schritte Entfernung springt es wieder auf; wir schießen neuerdings und fehlen, erst ein dritter von mir abgefeuerter Schuß traf das in großen Sätzen flüchtende Thier in die Lenden. Es fiel im Sprunge und als wir es erreichten, war es verendet. Da kein Diener in der Nähe war, mußten wir es abwechselnd tragen, bis wir nach zweistündigem Marsche in der brennenden Hitze zu den tief im Walde lagernden Genossen stießen.
Nachmittag brachen wir auf und legten sechs Meilen, im Ganzen bisher dreizehn englische Meilen zurück. Diese Strecke war von der Gaschuma-Ebene und einem tiefsandigen Walde gebildet. Dann passirten wir vier Thäler und schlugen in dem bedeutendsten, dem fünften, unser Nachtlager auf. Diese Thäler waren seicht, die Spruits bis auf jene im vierten und fünften trocken, hochbegrast und vertieften sich nach Südost, wohin die Flüßchen sich wandten, um sich in den Panda ma Tenka-Fluß zu ergießen. In dem dritten Thale trafen wir eine Giraffenheerde an, die an uns in einer Entfernung von 600 Schritten thalabwärts vorbeipassirte. Auf der Strecke von der Gaschuma-Ebene bis zu unserem Nachtlager trafen wir folgende Wildarten, nebst frischen Spuren von Thieren, die kurz zuvor unsern Pfad gekreuzt haben mußten. Orbecki’s, Deuker-, Rietbock- und Steinbock-Gazellen, Wasser-Antilopen, Zulu-Hartebeests, Kudu’s, Giraffen, Büffel, Elephanten und Zebra’s.
Das Flüßchen, an dem wir übernachteten, hieß Tschetscheta. Dasselbe floß bald in dünnem Strahle über Steine, bald durch einen schilfigen Morast, um gleich darauf einen tiefen, klaren, breiten Tümpel zu bilden. Die Thäler waren alle hochbegrast, das Gras stellenweise bis fünf Fuß hoch und dicht, und der Boden humusreich. Diese klaren Tümpel der oberen Zuflüsse des Panda ma Tenka-River und einige, welche hoch oben liegen und von Krokodilen nicht erreicht werden können, gehören zu den interessantesten Punkten der hügeligen Umgebung der Victoriafälle. Ich habe manche Stunde, in der Betrachtung derselben versunken, hier durchträumt; das klare Wasser zeigt uns, daß der Tümpel von Krokodilen frei ist und darum lohnt es sich der Mühe, sich in das Gras auszustrecken und dem Leben und dem Bilde unter der schimmernden Oberfläche einige Betrachtung zu widmen.
Da wo hohes Gras diese Miniatur-Weiher umgibt, wäre es gefährlich, sich denselben ohne Vorsicht zu nähern, hohes Gras an Flüssen ist ein gesuchter Aufenthalt aller Katzenarten Süd-Afrika’s und deshalb ist es nöthig, erst einige Steine in das Gras vor sich zu werfen, um sich zu vergewissern, daß das Feld rein sei. Nachdem dies geschehen, nähern wir uns dem Tümpel. Nahe an unserem Lagerplatze lag ein vier Meter breiter, zwei Meter tiefer und zehn Meter langer Weiher, in den sich ein kaum zehn Zentimeter breiter Wasserstrahl ergoß, der Abfluß in ein Binsendickicht war etwas breiter.
Die Fluth war klar, man konnte leicht die Objecte am Grunde des Weihers erblicken. Wohl die Hälfte der krystallenen Fluth war von einem zarten, hier hell-, dort dunkelgrünen, die mannigfachsten und groteskesten Formen und Gestalten bildenden Algengewebe durchsetzt. Hier stieg es in Schichten empor, neben und übereinander gelagert, den zarten, theilweise oder halb durchsichtigen Wölkchen in den azurnen Höhen ähnlich, dort zur Linken, nahe dem Ausflusse bildete es ein dunkles Labyrinth von Grotten und Höhlen, während es sich zu unserer Rechten zu dem wunderlichen Gebilde einer Burgruine aufgethürmt hat. Deutlich sieht man den Bergsockel, dessen dichten Lagen ein hohes, viereckiges Prisma und ein dieses noch um einige Zoll überragender Cylinder, eine Warte ein Thurm entsteigt; beide Gebilde, mit einem beiläufigen Durchmesser von 12 Zoll sind in dem untersten Drittel ihrer Höhe mit einem Querarme verbunden, der in seiner unteren Hälfte durchbrochen erscheint, diese breite Spalte in dem zarten Algengewebe, durch die eben ein Fischchen schoß, glich einer gothischen Thoröffnung. Oben an dem prismatischen Wartthurme sonderten sich vom Pflanzengebilde einige wenige kurze, theilweise spitzige Fortsätze ab, welche arg beschädigten Zinnen täuschend ähnlich waren.
Vom Hintergrunde gegen des Weihers Mitte reicht ein dunkelgrüner, unter dem Wasser bedeutend umfangreicher erscheinender Säulenwald, die Stengel des über dem Wasser säuselnden Rohres. An einer freien Stelle in der Fluth vor uns, zwischen dem Ufer, an dem wir im Grase ausgestreckt, und den mannigfachen Gebilden der Algen, steigen drei spiralförmig gewundene Stengel einer großbluthigen Nymphaea empor, zwei tragen die bekannten flachen, großen und glänzenden Blätter, der dritte eine schöne hellblaue Blüthe. Wie ein funkelnder Stern liegt sie auf dem Krystallspiegel. Noch andere Algenformen (nebst jener erwähnten) entsteigen dem dunklen Grunde des Weihers, manche mit zersägten und lappigen Blättern, ähnlich denen verschiedener Farrenkräuterarten.
Anfangs scheinen uns diese Pflanzengebilde ruhig zu schlummern, doch gewöhnt sich das Auge an das Bild, so nimmt es eine leise Strömung wahr, welche in der klaren Fluth durch den Einfluß des dünnen Wasserstrahles von rechts her erzeugt wird — und die Folge davon? — Die Rohrsäulen vibriren, jetzt stärker, nach und nach schwächer, bis sich wieder eine rascher zu bewegen scheint. Und die Grotten, Höhlen und die wundersam geformten Ruinen der Algen? Jene rechts, namentlich die beiden senkrecht aufgetürmten Formen zittern deutlich und ununterbrochen, während sich die dem Abflusse nahen stark nach diesen neigen, als wenn sie Lust hätten, den scheidenden Tropfen nach dem nächsten Weiher zu folgen. Einige gelbblüthige Wasserpflanzen und jene gelappten Cryptogamen am Boden strecken sich, als würden sie sich sehnen, gleich der reichblätterigen Blume der Wasserrose, welche als erklärte Königin des kleinen Seereiches sich auf der spiegelnden Oberfläche hin- und herwiegt, auch die Höhe und mit ihr die letztere zu erreichen, um sich am Tage von den Sonnenstrahlen erwärmen und küssen, von den Schatten der Nacht kühlen und vom Morgenthau erfrischen zu lassen.
Das Bild im Weiher gestaltet sich für den Beschauer noch anziehender durch das Leben der Thierwelt, welcher das Gewässer zum bleibenden Aufenthalte dient. An der freiesten Stelle, um der Sicherheit halber Rundschau halten zu können, liegen mehrere dunkelgestreifte barsch(?)artige Fische, bis auf die leichten, kaum merkbaren Bewegungen ihrer Schwanzflossen unbeweglich. Zeitweilig tauchen aus den Grottenlabyrinthen der Algen etwa fußlange, langbebartete Welse auf, welche meist paarweise, bald neben, bald hinter einander schwimmend, sich necken und spielen. Doch was ist jener dunkle, gelblich marmorirte, querüber im Schilfwalde, auf dem gegenüberliegenden Ufer und, wie es scheint, unbeweglich liegende Gegenstand? Eine Schlange? — Nein, jetzt rührt es sich; das eine spitze Ende berührt die Wasseroberfläche, es ist ein Leguan, der auf die befloßten Bewohner des Weihers lauert. Und außerdem welch’ emsig Treiben der niederen Thierwelt! Kleinere und größere Wasserkäfer, Dytiscus- und Hydrophilus-Arten, sowie auch Wasserspinnen, die einen emsig sich emporrudernd, die anderen, schon mit dem hellschimmernden Luftbläschen versehen, wieder hinab eilend, um sich unter den Blättern der Wasserpflanzen, oder in dem Algengewebe zu verbergen. Gleich Seiltänzern klimmen ihre Larven und jene der Lybellen die Stengel der Seerosen auf und nieder, während jene der Uferfliegen mühsam kleine, puppenförmige Gehäuse nachschleppen.
Am nächsten Morgen ging es weiter; wir hatten zahlreiche Flüßchen und tiefe, von schwarzem Humusboden bedeckte und mit hohem Gras überwachsene Thäler zu überschreiten. Die Flüßchen flossen nach Südsüdwest, nach Süd, nach Südost und Ost und ergossen sich, wie ich denke, alle in den Panda ma Tenka-Fluß. Die Thäler waren theils durch felsige Höhen, theils durch sandige Wälder von einander getrennt. Wir trafen Kudu’s, Stein- und Wasserböcke, Bushvaarks und zahlreiche Elephantenspuren. Am Nachmittage kamen wir über einen hohen, tiefsandigen Wald in ein größeres und breiteres Thal, in das von beiden Seiten mehrere Seitenthäler einmündeten. Unser Nachtlager schlugen wir an einem stets fließenden Wasser auf, welches auch die sämmtlichen Gewässer, die aus den Seitenthälern in das Hauptthal münden, aufnimmt und von den hier früher wohnenden Manansa der Matopa-Fluß genannt wird. Auf zwei Drittel seines Laufes stellt der 5 bis 22 Fuß breite, 1 bis 4 Fuß tiefe Fluß einen Gebirgsfluß dar, dessen Bett sich gegen seine Mündung (unterhalb der Victoriafälle) verbreitert.
Am folgenden Morgen, den 17. September (1875), verließen wir zeitlich unser Lager, um noch am selben Tage die Victoriafälle zu erreichen. Mir war dieser und alle die ferneren Tage dieser Reise, bis zu meiner Heimkehr nach Panda ma Tenka, zu Leidenstagen geworden. Um meine Fußbekleidung für die fernere lange Reise zu schonen, hatte ich zu diesem Ausfluge mir von einem im Panda ma Tenka-Thale jagenden Händler ein Paar Schuhe gekauft; leider zerfielen dieselben schon am zweiten Tage und ich sah mich gezwungen, die lose anhängenden Stücke mit Riemchen an den Fuß zu binden. Dazu waren die durchwanderten Gegenden sehr dornenreich und steinig, und die Felsenplatten durch die heiße Sonne glühend geworden.
Schon am selben Morgen und zwar an einer Biegung des Matopa-Thales — es wendet sich plötzlich nach Osten — hörte ich deutlich ein dumpfes Gebrause, einem in weiter Ferne gleichmäßig rollenden Donner nicht unähnlich. Da ich meinen Gefährten voraus war — ich ging immer rascher, um mich dann auf einige Momente niedersetzen zu können, konnte ich es mir Anfangs nicht erklären, allein nach und nach schien es mir der erste Vorbote des berühmten Wasserfalles zu sein. Wir hatten mehrmals den Matopa-River und manchmal unter großen Schwierigkeiten zu überschreiten; ich ging voraus, denn meine Füße schmerzten mich sehr, und ich sehnte mich darnach, mich auf einige Stunden ausruhen zu können. An dem steilen, bewaldeten Abhange des linken Ufers beobachtete ich einige flüchtige Zebra’s, denen ich, soweit die Richtung ihrer Flucht mit meinem Ziele, den vor mir noch in ziemlicher Entfernung ober den Katarakten aufsteigenden Wasserdünsten, zusammenfiel, einige Stunden nachschlich, doch nicht rasch genug in den zum Matopa-Flüßchen führenden Schluchten folgen konnte. Je weiter ich ging, desto müder fühlte ich mich; spät am Nachmittag mußte ich die Sohlen der zerstückelten Schuhe tragen und trachtete barfuß die Fälle zu erreichen. Ich fühlte mich jeden Moment mehr und mehr abgemattet, da ich vom Morgen her nichts zu mir genommen hatte. Endlich gegen 4 Uhr langte ich, über eine tiefsandige Waldeshöhe eilend, bei dem Falle an. Mir durch die Gebüsche Bahn brechend, stand ich am Rande des Abgrundes, in den sich die Wässer stürzen. — Ich werde nie diesen Anblick vergessen.
Die Füße waren jedoch nicht mehr im Stande, die Körperlast zu tragen, und so mußte ich mich auch von dem herrlichen Anblick trennen und dem Ufer aufwärts folgend, einige Wildfrüchte zu erhaschen suchen. Ich schlich mehr, als ich ging und mußte mich an den Bäumen und Sträuchern festhalten, um nicht umzusinken, da endlich auf einem halbverdorrten Klapperbäumchen entdeckte ich eine Frucht. Ich wußte, daß sie ein süßes Fleisch barg, schlug sie mit einem Steine herab, zerschlug die dünne gelbliche Schale und leerte in wenigen Augenblicken den Inhalt, als mir der Same der Frucht auffiel, welcher jenem von Nux vomica täuschend ähnlich war. Einige Minuten nach dem Genusse der Frucht stellte sich auch wirklich heftiges Erbrechen ein und ich sank vollkommen ermüdet nieder. Mühselig kroch ich zu dem Ufer des Zambesi und schlürfte von dem klaren Wasser, das meine Lebenskräfte wachrief. Um meine Reisegefährten aufmerksam zu machen, feuerte ich einige Schüsse ab, erhielt aber keine Antwort. Nach einer halben Stunde fühlte ich mich wieder besser, und als ich etwa 50 Schritte gegen den Wald gegangen war, sah ich die ersten meiner Genossen aus diesem heraustreten. Zwischen drei laubreichen, breitkronigen Bäumen, etwa 500 Schritte vom Zambesi und 900 Schritte von dem Falle wurde nun ein »Skerm« errichtet.
Mit dem Betreten der von Büffeln, Elephanten, Löwen etc. bewohnten Districte drängt sich den zu Fuß Reisenden die Nothwendigkeit auf, allabendlich einen Skerm (Schirm, Schutz) anzulegen, innerhalb dessen er die Nacht unbelästigt zubringen kann. Je nach der Anzahl der Begleiter und Diener errichtet man einen bis drei solcher Skerme, welche, von halbmondförmiger Gestalt, aus in die Erde eingetriebenen, etwa sechs Fuß hohen und mit Zweigen durchflochtenen Pfählen bestehen. In dem zu zwei Drittel umzäumten Raume befindet sich das Nachtlager; die offene Seite wird durch ein oder mehrere Feuer geschützt, welche wie eine Secante die offenen Enden des Halbmondes verbinden. Abwechselnd muß einer der Diener die Nacht über wachen, um diese Feuer zu unterhalten. Unsere Diener machten vier Skerme, einen mit zwei Grashütten für die zwei Ehepaare, einen für uns Junggesellen, Mr. W., B., O. und mich, einen für die Capdiener (Halbcast), welche sich über die Zulu’s und Makalaka’s erhaben fühlend, mit diesen nicht einen und denselben Schlafraum theilen wollten, und einen für sich selbst. Unser Lagerplatz lag etwa in der Mitte des eigentlichen Zambesi-Thales, zwischen dem Flusse und der tiefsandigen, dichtbewaldeten Bodenerhebung, welche einigermaßen parallel als die Senke eines Hochplateaus und eines Hügelnetzes schon von der Tschobe-Mündung ab den Fluß stromabwärts begleitet. Längs des Flusses zieht sich ein dichtes Gebüsch von Saropalmen und zwischen diesem und jener Bodenerhebung liegt das eigentliche mit hohem Grase bewachsene, von dichtem Busch- und Baumwuchs bedeckte Thal, aus welchem die stolzen Fächerpalmen und mächtigen Baobabbäume dem Auge sofort auffallen. Wir hielten uns drei Tage in der Nähe der Fälle auf, und trotzdem ich durch meine wunden Füße viel zu leiden hatte, muß ich doch diesen Zeitraum als einen der mich befriedigendsten meines ganzen Aufenthaltes in Süd-Afrika bezeichnen. Ich halte die Victoriafälle des Zambesi für eine der großartigsten Erscheinungen auf der Erdoberfläche. Während wir an manchen Wasserfällen die Masse des niederstürzenden Wassers wie an dem Niagara, bei anderen die Höhe der senkrechten Wand, über die sich das Wasser in die Tiefe stürzt, bewundern, erregt bei den Victoriafällen nicht nur der in einer Unzahl von einzelnen Strahlen und Massen getheilte Fall des Wassers, sondern auch der Abfluß des herabgestürzten Wassers in einer engen, steilwandigen und tiefen Felsenschlucht, deren Breite sich zu der Strombreite oberhalb der Fälle etwa wie 1:13 verhält, unser Staunen und Entzücken.
Der von Westen nach Osten zu fließende Strom macht an den Fällen eine plötzliche Wendung nach Süden, so daß das Ufer an dem wir stehen zum westlichen, das gegenüberliegende zum östlichen wird. Da jedoch der Fluß unter denselben nicht in seiner vollen Breite abfließt, ist es dem Beschauer möglich, einen großen Theil des den Fällen gegenüber nicht bedeutend tiefer als diese liegenden südlichen Ufers als Standpunkt zu benützen, um mit dem Gesichte nach Norden gekehrt, die Victoriafälle betrachten zu können. Leider ist jedoch der unmittelbare Rand des Abgrundes, in den sich die Wasser stürzen, und der wie erwähnt, den Fällen gegenüberliegt, durch die stetig auf ihn fallenden Wasserdünste so glatt, daß man nicht bis unmittelbar an dieselben herantreten kann. Wir stehen nun etwa 100 bis 200 Schritte von einer klippenreichen, schwarzbraunen, an 400 Fuß hohen Felsenwand entfernt, ihre untere Begrenzung können wir nicht sehen; über ihre obere stürzen sich die Wasser des Zambesistromes. Mehrere durch üppige tropische Vegetation geschmückte Inseln, etwas über 100 Schritte vom westlichen Ufer entfernt, theilen den Fall gleich in seinem westlichsten Viertel, und auch weiterhin nach dem Ostufer ist er unmittelbar über dem Abgrunde, am Rande der Felsenwand gelegene kleinere und größere, jeder Vegetation baare, braune Felseninseln circa dreißigmal getheilt. Zu unserer Linken zwischen den bewachsenen Inseln und dem Westufer ist die Felsenwand niedrig, so daß das Wasser mit Wucht nach der Kante zueilt und hier in einem einzigen, wohl 100 Schritte breiten Schwall bogenförmig in die Tiefe stürzt. Zwischen diesem und den nächsten Strahl ist eine große Fläche der schwarzbraunen Felsenwand zu erblicken, welche auch überall, zwischen und hinter den dünnen oder auch breiten, lichten, weißerscheinenden und zur Tiefe schießenden oder senkrecht über die Felsenwand herabfallenden Strahlen zu sehen ist, und so einen dunklen Hintergrund gewährend, diese nur noch deutlicher und schöner hervorhebt.
Die einen sind so dünn, daß sie den Grund nicht erreichen, schon im oberen oder im unteren Drittel, manche in der Hälfte des Falles zerstäuben, um als Dunst emporzusteigen. Manche, etwa drei bis fünf Meter breit, erreichen den Abgrund — doch mit zerstäubenden und aufkräuselnden Rändern — dort wieder fällt ein breiter Strahl auf eine vorspringende Felsenzacke, daß er sich bricht und in Cascadenform zur Tiefe stürzt, am wichtigsten schien mir der vom linken Uferrande in die Tiefe schießende Wasserstrahl. Die Mannigfaltigkeit der fallenden Wasserstrahlen und Massen ist gewiß unerreicht.
Haben wir diesen durch einige Zeit unsere volle Aufmerksamkeit gewidmet, so ist es lohnend, den Blick zu erheben, bis er gegen Norden dem blauen Horizont begegnet. Im weiten Hintergrunde das herrliche Grün der Fächer- und Saropalmen, mit denen die in der Ferne über das Flußbett zerstreuten Inseln bewachsen sind, welches angenehm von dem lichten Azur der Höhen absticht, und neben und um diese Inseln die tiefblauen Ränder des Stromes, seine Fluthen, die noch so still, so langsam fließen, daß es scheint, als würden sie stille stehen, und folgen wir ihnen nach der Richtung, in welcher wir stehen, so sehen wir sie anfangs wenig, doch dann, je näher sie uns rücken, um so bewegter, bis sie einige Ketten quer über den Fluß sich hinziehender und größtentheils aus dem Wasser hervorragender Felsenblöcke erreichen, gegen diese anprallend zurückweichen, um sich nun zwischen den freien Lücken und Nischen mit vervielfachter Geschwindigkeit dem Abgrunde zu nähern, die schroffe Kante zu erreichen und dann brausend in die Tiefe zu stürzen. Besonders schön erscheinen die mit den Fächer- und Saropalmen und Palmengebüsch, mit Lianen und Aloëarten bewachsenen, über dem Abgrunde liegenden und von drei Seiten von den schäumenden Wogen umgebenen Inseln. Nachdem Livingstone diese Fälle — zu Ehren der Königin Victoria — »Victoriafälle« genannt hat, erlaubte ich mir, das hochinteressante, die Victoriafälle beiderseits umgebende Hügelland zu Ehren des Prinz-Gemahls »The Albert country« und die Inseln zu Ehren der königlichen Prinzen und Prinzessinnen mit deren Namen zu belegen.
Wenden wir uns zu dem südlichen und zugleich westlichen Ufer, an dem wir stehen, und zu jenem Abgrunde, der wie ein Felsentrog zwischen uns und den Fällen sich befindet und das herabstürzende Wasser aufnimmt. Unser Ufer, wie das gesammte unter den Fällen ist eine Felsenbank, die mit Humus und Thonerde bedeckt, einer besonders in der unmittelbaren Nähe der Fälle üppigen Vegetation Raum gewährt.
Indem wir an dem Rande des Abgrundes stehen, genießen wir den Schatten riesiger Sykomoren, Mimosen, etc. Diese Bäume, welche unsere schlanksten Pappeln an Höhe überragen, haben meist wohl eine erst im letzten Sechstel oder Achtel ihrer Höhe beginnende Krone, diese aber ist so dicht, daß man unter ihnen wie unter einem ausgespannten Schirm steht. Armdicke Lianen, schnurgerade oder in Spiralen emporsteigend, verbinden den Fuß des Baumes mit seinem Gipfel und bieten den Affen Gelegenheit, dem verborgenen Beobachter ihre Kletterkünste vorzuführen. Außer den hohen Bäumen sind es noch dichte Saro- und Fächerpalmen-Gebüsche und riesige Farrenkräuter, welche zur Ueppigkeit der Scenerie dieses Ufers so viel beitragen. Der Reisende schreitet bei einem Gange durch diese hochinteressanten Formen Floras über einen elastischen, schwellenden Teppich von kleinen Blumen und Moos, der von Feuchtigkeit durchtränkt ist, am Rande des Abgrundes aber, da, wo der nackte braune Felsen hervorblickt, sehen wir einzeln oder in Knäueln, kleine, erbsen- bis hühnereigroße, etwas plattgedrückte, rundliche, dunkelgrüne Algen lose dem Felsen aufliegen.
Diese Ueppigkeit der Vegetation ist zu gutem Theil auf die continuirlich von den Fällen herrührenden und auf die gegenüberliegenden Ufer herabfallenden, reichlichen Wasserdünste zurückzuführen. Unaufhörlich steigen längs der oberen Kante des Falles mit den einzelnen Fallstrahlen correspondirende Säulen von Wasserdünsten einige hundert Fuß hoch in die Lüfte, auf 50 englische Meilen weit sichtbar. Eben während unseres Betrachtens sind sie unmittelbar vor uns so dicht, daß sie die gegenüberliegende Stelle vollkommen verhüllen, doch schon im nächsten Augenblicke hat sie ein mäßiger Windhauch von Osten her nach Links zu gedrängt, nur eine dünne und durchscheinende Säule ist zurückgeblieben, welche wie ein Schleier mehrere der vor uns herabstürzenden Strahlen verhüllt und nun ein wahrhaft märchenhaftes Bild hinzaubert, denn auch das tiefe Blau der Fluth über dem Falle und jene herrlichen Inseln mit den Palmen erscheinen uns so fern gerückt und doch wieder so nah, wie in einen Nebelschleier gehüllt.
Von unvergleichlicher Schönheit und malerischem Reize sind diese Fälle bei Sonnen-Aufgang oder Niedergang, wenn kreisrunde, in den Dunstfäden erscheinende Regenbögen den Effect erhöhen. Das Aufsteigen der Dünste ist mit einem eigenthümlichen Zischen verbunden, und doch ist dies nur zeitweilig zu hören, wenn der Wind das Getöse aus dem Grunde der Felsenschlucht, das den Beschauer im wahren Sinne des Wortes betäubt, etwas abschwächt. Wie ich schon erwähnt, können wir von dem Südufer — dem besten Standpunkte des Beobachters — den Boden des Abgrundes nicht sehen (wohl von der westlichen Seite, wenn wir uns an den Rand einer bebuschten Schlucht durcharbeiten können), und darum wirkt das furchtbare Getöse, das von der Tiefe aus die Lüfte erfüllt und meilenweit wie das ununterbrochene Rollen des Donners vernommen wird, nur um so betäubender auf die menschlichen Sinne ein. Wir hören ein Brüllen und Zischen, zeitweise deutlich das eigentümliche Anschlagen stürzender Wassermassen an den harten Felsenklippen, der Felsenboden unter uns scheint zu zittern, als käme dies Getöse aus einer Höhle unter uns. Wenn wir in die Tiefe des Abgrundes hinabsehen könnten, es würde die Sinne befriedigen und das ängstliche Gefühl, das sich unwillkürlich unser bemächtigt, bannen, so aber kommt es uns vor, als stünden wir an einem Höllenkrater, in dem die Elemente, in einem Vernichtungskampf mit einander begriffen, rasen. Wie klein, wie machtlos und unansehnlich erscheint der Mensch gegen solch’ ein Product der Natur!

Die Victoriafälle.
Wir wandten uns nun nach der tieferen Felsenschlucht, durch welche die ganze Wassermasse des Stromes abfließt. Dieser Abfluß geschieht im Zickzack, und in folgender Richtung. Von dem Felsenthore (dem Ausfluß) etwa 300 Schritte weit ist die Richtung südlich, geht dann unter einem stumpfen Winkel plötzlich auf 1000 Schritte in eine westsüdwestliche über, welche nach einem scharfen Winkel auf 1100 Schritte in eine südöstliche umschlägt u. s. w. Wenn wir von dem Thore längs derselben hinschreiten — so weit es nämlich die einmündenden Schluchten, die wegen ihrer Steilheit umgangen werden müssen, gestatten — so bietet sich dem Auge, man möchte sagen alle 200 Schritte ein neues Bild der steilen, die Schlucht bildenden Felsenwände. Hier stehen sie senkrecht, schroff, als wären sie scharf abgemeißelt, hier erhebt sich eine braune bis schwärzliche Felsenmauer, dort wieder eine ähnliche dunkle Felsenwand, hie und da mit grünen und rothen Flecken, stellenweise marmorirt; Punkte, die sofort in’s Auge fallen und zu dem dunklen Hintergrund einen äußerst angenehmen Contrast bilden. Der Wind hat von dem hochliegenden Ufer lose Erdtheile herabgeweht, welche sich mit Aloësamen in den Felsenritzen eingenistet haben, diese fingen an zu sprossen — die Wurzeln klemmten sich in die feinen Ritzen — hefteten sich innig an den Felsen an und nun gediehen die Pflanzen in den vollständig mit Erde und vertrockneten Blatttheilen gefüllten Felsenspalten vortrefflich, wie ihre mächtigen Blüthenähren es beweisen. Der reife Samen wird in den Fluß hinabgeführt, um weit, weit von den Fällen, an dem Ufer desselben Stromes neue Keime auszuwerfen und das Ufer zu schmücken.
Manche Partien der Felsenwände neigen sich terrassenförmig zur Tiefe und erscheinen theils jeder Vegetation bar, theils an den oberen horizontalen Flächen mit Vegetation überwuchert. Doch an vielen Stellen und dies namentlich am westlichen Ufer, sehen wir eine üppige Baum- und Buschvegetation bis zur mittleren Höhe oder bis zum Strome selbst herunterreichen. Sie bekleidet die vielen nach abwärts führenden, doch sehr steilen Schluchten, welche dem Regenwasser der nächsten Umgebung zum Abfluß dienen. Manche vereinigen sich an ihrer Mündung zu einer einzigen. In dieser Weise wechseln die Bilder längs der langen Partien der Zickzacklinie. Die Ueberraschung ist noch größer, wenn wir die Formen der Wände im kurzen Zickzackscheitel betrachten.
Ich will blos drei solcher Punkte besonders hervorheben. Das rechte (westliche) Ufer der kurzen Strecke unter der Abflußöffnung ist ein senkrecht abfallender Felsen, der gegen die Fälle zu etwas zurücktritt und im Canal eine rundliche Bucht bildet, dann jedoch, nach Osten als scharfe Felsenwand hervortretend, die westliche Wand des engen Felsenthores bildet, welches den herabgestürzten und unten wieder vereinigten Gewässern des Zambesi den Abfluß gestattet. Das uns gegenüberliegende Ufer, die östliche Wand dieses Thores, wird von einer kegelstutzförmigen, nach hinten (Osten) mit dem Hinterlande zusammenhängenden Felsenhöhe gebildet, welche im unteren Drittel, jeder Vegetation baar, schroff abfällt, in den zwei oberen Dritteln jedoch mit prachtvoller, tropischer Vegetation ringsum überwuchert terrassenförmig aufsteigt und mit ihrer Umgebung, dem rechts und links gähnenden Abgrunde, dem brausenden dunkelblauen Strom an ihrem Fuße, einen gewaltigen Eindruck hervorruft. Als ich noch im Schauen dieser Felsenscenerie versunken dastand, tauchte in meinem Geiste ein nie geschautes, doch oft geträumtes Bild: die hängenden Gärten der Semiramis, auf.
An dem folgenden kurzen, die zweite und dritte Zickzacklinie verbindenden Arme finden wir einen ähnlich geformten, doch mehr schroffen aus aufgethürmten Blöcken bestehenden Felsen. Er ist von Norden, von Osten und Süden von dem tobenden Wasser umspült, doch gegen Westen von dem Hinterlande durch eine tiefe Schlucht getrennt. Hier auf dieser isolirten, wohl über 300 Fuß hohen Felsenkuppe war kein Blättchen, keine Spur von Vegetation zu sehen, Floras liebliche Kinder waren von dem unwirthlichen Felsen verbannt. Vergebens haben sich seit Tausenden von Jahren alle die Elemente gegen den Felsenriesen empört, der Blitz unzählige seiner vernichtenden Schläge an ihm zersplittert, Aeolus mit all’ seinen Genossen gegen ihn angerast und unten der grimmigste Feind alles Festen auf der Erde schäumend und tosend an seinem Sockel sich gebrochen. Er bezwang diesen und wies ihm die Bahn.
Wenden wir uns nun von den Wänden der Schlucht zu der Tiefe selbst, in der ein dunkelblauer Strahl pfeilschnell dahinschießt. Er scheint kaum ein Drittel so breit wie die Mündung der Schlucht (nach oben), mit furchtbarer Gewalt stößt und bricht er sich an der scharfen Wendung der gegenüberliegenden Felsenwand, daß er theilweise zurückgeworfen wird und zurückströmend in der Regel in einer Bucht seine Kraft zu sammeln sucht, um sich mit der nächsten Woge zu vereinigen und von Neuem seine Kraft an dem Felsen zu versuchen. Stellenweise ragen aus der Fluth Felsblöcke empor, an denen die reißend dahineilenden Wogen aufschlagen und sich theilen. An einigen der Ecken, an denen die Fluth unter einem scharfen Winkel eine verschiedene Richtung einschlägt, sehen wir gleichsam um den brausenden und schäumenden Strahl zu verspotten, scharfkantige, spitz zulaufende, bis mehrere Meter lange Vorsprünge der heftigsten Strömung entgegengerichtet, an denen sich auch die Kraft derselben bricht.
Tausende von Jahren tobt der dunkle Strom in der Tiefe, allein wir können kaum stellenweise eine merkliche Einwirkung wahrnehmen, die er auf diese unerschütterlichen Wände hervorgebracht haben mochte. Ich bedauere nur, daß es mir nicht möglich war, länger als drei Tage an den Victoriafällen zu verweilen. Um die Schlucht, ja das gesammte, hochinteressante Naturwunder kennen zu lernen, müßte man 1½ bis 2 Monate an den Fällen verweilen, die Inseln oberhalb des Falles und das gegenüberliegende Ufer besuchen. Außerdem bietet die Natur in der nächsten Umgebung der Fälle so viel Anziehendes, daß ich mit mir längst in’s Reine gekommen bin, bei meinem nächsten Besuche nach Muße hier verweilen zu wollen.
Während des dreitägigen Aufenthaltes, wobei mir leider der Zustand meiner Füße den Genuß dieses herrlichen Bildes beeinträchtigte, hatten ich und mein Diener eine interessante Begegnung mit einer sehr zahlreichen Pavianheerde. An der von mir »Pavianschlucht« genannten Felsenschlucht, welche als Regenabfluß der umliegenden Gegend zum Flusse führt und in ihren beiden Dritteln dicht mit Bäumen bestanden, im unteren jedoch kahl und steil ist, sah ich an der mir gegenüber liegenden Wand eine zahlreiche Pavianheerde. Ich wünschte einige Pavianschädel zu gewinnen und tödtete ein Thier, dessen Leiche jedoch in den Fluß herabkollerte, verwundete andere und brachte auch den rechten Flügel des Feindes zum Weichen, dagegen behauptete das Centrum seinen Platz, während der linke Flügel sogar agressiv vorging und mit Steinen zu werfen begann, so daß ich, nachdem ich unvorsichtiger Weise alle Patronen mit Ausnahme einer verschossen, mich mit meinem Begleiter durch die Flucht einem Handgemenge mit den erzürnten Affen entziehen mußte.
Die am jenseitigen Ufer unter dem Häuptling Mochuri wohnenden Bathoka’s kamen auf Kähnen herüber, um uns Ziegen, Kafirkorn, Bier und Bohnen zum Kaufe anzubieten. Ich traf später in Schescheke einen dieses Stammes, es war ein Unterhäuptling und Verwandter Mochuris, und Sepopo, in der Meinung, daß ich noch keinen Bathoka gesehen, stellte mir denselben vor. Ich erkannte ihn sofort wieder, doch dieser hütete sich, desgleichen zu thun, da er sich der Uebertretung des königlichen Verbotes, von den Weißen Gewehre zu kaufen, schuldig fühlte und höchstwahrscheinlich zum Tode verurtheilt worden wäre.
Während ich an der kartographischen Aufnahme der Fälle arbeitete, stieß ich mehrmals auf weidende Pallahheerden, den Capdienern gelang es, ein Thier zu erlegen. Dieses schöne Thier gehört zu den häufigsten der am Zambesi angetroffenen Wildarten.
Am 20., dem Vorabende unserer Abreise, hatten wir noch ein interessantes Löwenabenteuer zu bestehen, das glücklicher Weise einen recht humoristischen Abschluß fand. Einige Augenblicke, nachdem ich von einem meiner Ausflüge zu den Fällen zurückgekehrt war, kam auch Walsh von seiner gewohnten Vogeljagd zum Lagerplatze und berichtete, daß er etwa 1200 Meter vom Lagerplatze einen Löwen eben in dem Momente gesehen habe, als er eine hochbegraste Wiese überschreiten wollte, um zum Flusse zu gelangen. Sofort wurde Kriegsrath gehalten und die Jagd auf den Löwen beschlossen, nur das eine wollte mir nicht gefallen, daß sich auch die beiden Frauen bereit erklärten, uns zu begleiten. Frau Francis hob zu ihrer Rechtfertigung hervor, daß ihr Gemahl in ihrer Gegenwart schon mehrere Löwen erlegt habe, weshalb sie auch diesmal einer solch’ ergötzlichen Scene nicht fernbleiben wollte. Frau Westbeech wieder, welche erst einige Monate verheiratet war, wollte ihren Georg nicht allein in der Gefahr wissen.
Wie ich schon erwähnte, war das eigentliche Zambesithal in einer Entfernung von 100 Schritten bis auf mehrere Meilen hin von einer sandigen Bodenerhebung begrenzt. Das meist mit Bäumen dichtbestandene Thal hatte gegen den Fluß zu einige baumlose Wiesen, die unmittelbar am Flußufer von einem dichten, etwa zwei bis drei Meter breiten Saropalmengebüsch umsäumt waren. Walsh war eben im Begriffe, über eine solche, etwa 30 Meter breite Wiese zu schreiten, als nahe an einem Baume der Löwe aufsprang, und im gegenüber liegenden Palmgebüsche verschwand. Nahe an dem Baume stand ein etwa fünf Meter hohes Bäumchen, an welches sich ein pyramidenförmiger Termitenbau anlehnte. An der bezeichneten Stelle angelangt, formirten wir uns in vier Treffen, um dem Raubthiere mit Aussicht auf Erfolg an den Leib zu rücken. Im ersten Treffen (von rechts nach links) standen Westbeech, Francis, Walsh und ich, im zweiten Mr. O. und B. und zwei Capdiener, im dritten ebenfalls zwei solche und zwei mit Musketen bewaffnete Matabele, dann folgten die übrigen Diener, manche mit Assagaien, manche mit Kiri’s, manche blos mit Baumästen bewaffnet. Die drei ersten Treffen sollten gegen den Busch vorrücken, das vierte auf der etwas erhöhten Bodenstelle am Wiesenrande stehen bleiben und das Palmengebüsch auf das eifrigste beobachten, um uns verdächtige Bewegungen in demselben sogleich melden zu können. Wir waren nicht weit gekommen, als uns Frauenrufe zum Stillstand brachten. Die Damen fanden sich unter dem Baume nicht sicher genug und wollten auf den Termitenbau gehoben sein, wozu ihnen auch sofort ihre Männer verhalfen. Wir setzten hierauf langsam und bedächtig unseren Marsch über die hochbegraste Wiese fort. Wir waren nun ungefähr bis auf zwei Meter dem Busch nahegekommen, und da der Löwe noch immer kein Zeichen von sich gab, hob sich der Muth aller Angreifer, doch dieser Aufschwung nahm ein jähes Ende, denn plötzlich schallte uns aus dem Dickicht ein wildes Gebrüll entgegen, stark genug, um selbst dem beherztesten Jäger die Ueberzeugung beizubringen, daß es einen Unterschied zwischen einer Felis Leo und einer Felis domestica gebe. Wir waren dem Thiere so nahe, daß es Francis mit einem Sprunge erreichen und tödten konnte, bevor wir es an dessen Leiche erlegt hätten.
Die erste Folge des Gebrülles war, daß wir stille hielten, unverwandten Blickes schauten wir nach der verdächtigen Stelle, doch konnten wir nichts sehen. Nach einigen Secunden ertheilte einer der beherzten Jäger den Rath, an den Rückzug zu denken, welchen wir auch, ohne weiter daran gemahnt zu werden, antraten. Die Stelle, von welcher das Gebrülle zu kommen schien, fixirend, das Gewehr schußbereit, zogen wir uns zurück. Während des Rückzuges hatten sich die einzelnen Treffen etwas gelichtet, doch den größten Muth bewies das vierte, das wir erst nach einigem Suchen auf dem großen Baume gewahrten, wohin es sich geflüchtet hatte. Wir feuerten zahlreiche Schüsse in das Gebüsch ab, doch ohne Erfolg, darauf zündeten wir das trockene Gras an und trachteten auf diese Weise das Raubthier zum Verlassen seines Schlupfwinkels zu bewegen, doch das Geschick war uns an diesem Tage nicht hold, wir hatten heftigen Gegenwind und da brannte es nach der entgegengesetzten Richtung. Wieder waren es laute Rufe von Seite der Frauen, welche unsere Aufmerksamkeit erregten. Der Wind hatte den übelriechenden Rauch in einer dichten Wolke gegen das Bäumchen getrieben, in dessen Aeste die beiden Frauen, um sich noch sicherer zu fühlen, hinaufgestiegen waren, und diese förmlich mit dem Ersticken bedroht, da wurde Löwe und alles andere vergessen und man eilte den Damen zu Hilfe, die auch bald aus ihrer Lage befreit waren, und nach allen den Mißerfolgen dachten wir die Löwen leben zu lassen und heimzukehren; doch Westbeech, der als tollkühner Löwenjäger bekannt war, wollte sich in Gegenwart seiner Neuvermählten solch’ eine Gelegenheit nicht entgehen lassen, und machte den Vorschlag, das Palmengebüsch flußaufwärts zu durchstöbern. Um diesen Vorschlag auszuführen, hatten wir die Wiese in der Richtung zu durchschreiten, in der es Walsh am Morgen gethan hatte. Mit Ausnahme der Frau Westbeech betheiligten wir uns alle an diesem zweiten Jagdzuge. Diese wurde unter dem Schutze des vierten Treffens, der Matabele Diener, welche nicht wenig darauf stolz waren, die Gemahlin ihres Herrn beschützen zu können, zurückgelassen.

Der Löwe kommt.
Wir hatten glücklich die Wiese überschritten und suchten bereits in den Palmenbüschen, als uns ein herzzerreißendes Geschrei zur Stelle bannte; in demselben Augenblicke hatten wir uns alle umgewendet, und das Erstaunen mehrte sich, als wir keine Spur von Frau Westbeech mehr sahen. Der erste, der sich von seinem Schrecken erholte, war Westbeech, mit dem Gewehre in der Rechten, eilte er an uns vorüber, da sich jedoch das Angstgeschrei aus dem tiefen Grase der Wiese, die wir eben überschritten hatten, wiederholte, eilten wir ihm nach; doch wurden wir neuerdings für einen Moment aufgehalten, als der vor uns laufende Westbeech plötzlich mit einem Schreie verschwindet. In der Aufregung, die sich unser bemächtigt hatte, beachteten wir das überlaute Gelächter der herbeilenden Matabele nicht, Francis, der uns allen Voraus war, machte zwei Sätze nach vorne und in das von den Matabele angestimmte Gelächter einfallend, warf er das Gewehr bei Seite und sah in’s Gras, wir hörten nur noch seine Worte. »Bleibt zurück! Bleibt zurück!« Nach einige Secunden tauchte Westbeech vor ihm auf, beide liefen nun einige Schritte weiter, beugten sich nieder und nun erschien Frau Westbeech als die dritte im Bunde. Die Lösung dieses etwas räthselhaften Vorganges war bald gefunden. Die an dem Zambesi-Ufer wohnenden Manansa’s hatten, als sie noch keine Gewehre besaßen, um sich des Wildes leichter bemächtigen zu können, am Ufer des großen Stromes zahlreiche Fallgruben gegraben. Diese von jenen der bei den Betschuana’s üblichen abweichenden Gräben waren 10 bis 12 Fuß lang, 8 bis 10 Fuß tief, bei einer Breite von nur 18 bis 24 Zoll, dabei verengte sich die obere Oeffnung nach unten derart, daß jedes Thier bei den Versuchen sich zu befreien, nur immer tiefer einfiel und eingezwängt wurde. In eine solche war die arme Frau Westbeech am jenseitigen, der ihr zu Hilfe eilende Gemahl am diesseitigen Ende der Wiese gefallen. Frau Westbeech hatte sich, von einigen Hautabschürfungen abgesehen, glücklicher Weise nicht beschädigt, der Zwischenfall veranlaßte es jedoch, die Jagd aufzugeben und nach dem Skerm zurückzukehren. Als uns Abends die Bathoka wie gewöhnlich aufsuchten und wir sie fragten, ob es hier Löwen gebe, antwortete man uns, daß ihnen seit vielen Jahren ein Löwe bekannt sei, der sich in der Regel nicht weit von unserem Skerm aufzuhalten pflege, es wäre aber ein so an den Menschen gewöhntes Thier, daß sie selbst bei Nacht unbehelligt vor ihm vorbeigingen.
Bevor ich noch von den Victoriafällen scheide, will ich des Eingebornenstammes, der Manansa, gedenken, welchen man hie und da noch im Albertslande begegnet und der noch in den Dreißiger Jahren sein eigenes Reich besaß. Die Manansa bewohnen das Hügelland südlich von und um die Victoriafälle, ein Gebiet, welches den Bamangwato’s von rechtswegen zugehört, das jedoch von dem Matabele-Herrscher auch als das seine betrachtet wird und unter welcher Streitfrage Niemand mehr als die Bewohner dieses Striches zu leiden haben. Die Bamangwato’s nennen sie schlechtwegs Masarwa, während in Wirklichkeit die Manansa nichts mit den Letzteren gemein haben. Die Manansa bebauen kleine versteckte Thalpartien oder leben als Jäger hie und da, ohne bleibende Wohnsitze zu haben; werden sie von den Matabele hart bedrängt, so flüchten sie nach dem Westen auf das Bamangwato-Gebiet, und wenn von den Letzteren bedrängt, nach Osten auf jenes der Matabele; nur dann, wenn sie nicht mehr entkommen können — ergeben sie sich auf Gnade und Ungnade und erklären sich als gehorsame Unterthanen ihrer »Verfolger«. Man kann Albertland ein streitiges Gebiet zwischen den Bamangwato und Matabele nennen und dessen Bewohner nur als periodisch ansässige — so lang die Geißel über ihnen schwebt — Unterthanen und Bewohner des Bamangwato-Reiches betrachten, die in Wirklichkeit, wenn es auch die Bamangwato behaupten, reine Sklavendienste verrichten.
Bis zum Jahre 1838 war der Stamm der Manansa in einem selbstständigen Reiche vereinigt, das südlich bis an die westlichen Makalaka’s und den Ugwajfluß weit aufwärts, sowie zum Mittellauf des Kwebu-River reichte. — Dieses Königreich war von einem »Großen Häuptling« beherrscht, der bei dem Andrange der Matabele nachzugeben bemüht war.
Allein so wie Moselikatze (Tigerkatze hätte besser für ihn gepaßt) den Königreichen der Makalaka ein Ende gemacht und das große Reich der Maschona zur Hälfte zerstört, so wurde auch jenes der Manansa von ihm vernichtet. Den guten Worten des freundlichen, aufrichtigen Häuptlings wurde kein Glauben geschenkt und da die grausamen Matabele nicht gewohnt waren, für ihre Erpressungen gute Worte zu ernten, wurde er für verrätherisch gehalten; man witterte darin einen hinterlistigen Plan. Auch bei den Wilden glaubt der Schlechte in jedem guten Nebenmenschen nur Schlechtes zu finden — und da man sicher dachte, daß er einen Hinterhalt gelegt habe und nur durch die freundlichen Worte Zeit gewinnen wolle, um seine Männer zu sammeln, wurde er von den in Ueberzahl in sein Gehöfte und seine Stadt eingedrungenen Matabele zur Erde geworfen, sein Leib mit Assagaien aufgeschlitzt, das Herz herausgeschnitten, und mit den Worten: »Du hattest zwei Herzen, auch ein falsches, esse es«, ihm dieses an die noch zuckenden Lippen gepreßt.
Bei diesem Raubzuge der Matabele wurde dem Manansa-Reiche ein Ende gemacht, die Manansa zersplittert, alle Knaben von den Matabele mitgenommen, um zu Kriegern erzogen zu werden. Seitdem wiederholten die Matabele oft ihre Raubzüge, und die Reste der Manansa, wurden theils nach und nach vernichtet, theils flüchteten sie zu Sepopo, dem früheren Marutsekönig, theils zu Mochuri, dem Chef der Bathoka (nördlich von den Victoriafällen), sowie zu Wanke, dem Chef der nordöstlichen Makalaka (nördlich vom Zambesi und östlich von den Victoriafällen). Ich machte mehrere Versuche, zu erfahren, ob die Uebriggebliebenen einen Häuptling unter sich anerkennen, doch lange erfolglos, bis sich Jene, mit denen ich täglich verkehrte, überzeugt haben mußten, daß ich die Antwort mir in meinem »lungalo« (Buch) eintragen wollte, nicht aber um, wie sie wohl dachten, es dem Matabele-König zu verrathen, theilten sie mir mit, daß sie alle, wo überall sie zerstreut auch wohnen mochten, einen Chef verehrten, der östlich von Wanke’s Land ein kleines Gebiet von diesem Fürsten eingeräumt erhalten und hier die Reste des Stammes um sich gesammelt hatte. »Und warum geht Ihr nicht auch dahin, statt hier wie die Hunde herumgejagt zu werden?« Eigenthümlich — ähnlich wie im Süden, wo der Buschmann an seinen Felsen und Klüften mit seinem ganzen Sein hält — ist es auch hier die Liebe zu den bewaldeten Höhen und anmuthigen Thälern, welche die flüchtigen Manansa an die Scholle bindet, auf der sie das Licht der Welt erblickten. Jener Chef (Häuptling) ist der Sohn des von den Matabele ermordeten Königs.
Die Manansa haben viele Gebräuche, mit denen sie sich von anderen südafrikanischen Stämmen unterscheiden. Ich will einstweilen eines Gebrauches erwähnen, welcher vielleicht auch einem weiteren Leserkreis überraschend erscheinen dürfte. Wir ersehen daraus, daß das weibliche Geschlecht, ähnlich wie bei den Marutse und im großen Gegensatz zu der ungefälligen Behandlungsweise von Seite der Betschuana und zu jener abscheulichen bei den Matabele auch bei den Manansa geachtet wird. Wir wollen die Verlobung eines Manansa-Mannes besprechen. Hat ein solcher mit Wohlgefallen die Reize eines Mädchens seines Stammes beobachtet und erkannt, sie auch liebgewonnen (was unter den Betschuana und Zulu eine Seltenheit ist), so sendet er eine ihm wohlbekannte alte Frau zu ihr, welche für ihn die Brautwerbung versucht. Die Abgesandte gibt von dem Antragsteller das bestmögliche Bild, schildert seine Geschicklichkeit im Erwerben des njama (ñama) (des Fleisches, d. i. des Wildes), seine Gutmüthigkeit, zählt die vielen Felle auf, die sein Lager weich machen, und die Fruchtbarkeit des kleinen Grundstückes, das schon seine Mutter bebaut hatte.
Nun wird Familienrath gehalten; hier entscheidet nicht blos der Vater noch befiehlt er, sondern Mutter, Tochter und Vater erörtern den Gegenstand untereinander. Ist es ein Mann, welcher der Tochter gefällt, und wissen die Eltern nichts gegen ihn einzuwenden, so wird dem (während der Unterredung) vor der Thüre wartenden Weibe eine befriedigende Antwort ertheilt. »Der Antragsteller möge kommen,« was jedoch schon so viel bedeutet, daß ihn die Eltern als Schwiegersohn, die Tochter als Mann annimmt. Erscheint er nun in der Hütte und hat er seinen Gruß gesprochen, so muß er vorerst seiner Auserwählten ein Geschenk machen, das früher in dem reichen Felle einer Halbaffenspecies bestand, seitdem jedoch Glasperlen unter ihnen bekannt wurden, bietet er ihr eine handvoll kleiner, blauer Glasperlen an. Nur nachdem er dies gethan und es angenommen wurde, spricht ihn das Mädchen an, die von nun an seine Frau ist. Glücklicher Weise vermissen wir hier die Orgien, wie sie leider die heidnischen Verlobungs- und Trauungsfeste vieler südafrikanischer Völker charakterisiren. Der Vater, die Mutter, und hat die junge Frau erwachsene Geschwister, die in demselben Gehöfte wohnen, so mischen sich auch diese in ein Gespräch, das bis zur Tagesneige dauert. Am Abend entfernen sich die Eltern aus der Hütte, um eine der Nebenhütten im Höfchen zu beziehen, und thun dies je nach der Jahreszeit durch ein bis zwei Wochen. Täglich am Morgen verläßt der junge Mann seine Frau und geht seiner Arbeit nach, worauf erst die Eltern für den Tag ihr Besitzrecht wieder geltend machen. Für jede Gunstbezeugung von Seite der jungen Frau muß ihr der Augetraute stets eine handvoll Glasperlen bezahlen. Jeden Morgen nehmen Beide eine Waschung des Körpers mit lauem Wasser vor, welche Gefälligkeit auch wieder mit einem Geschenke beglichen wird. Nach ein oder zwei Wochen bringt der Schwiegersohn dem Vater ein Geschenk von vier Ziegenböcken und vier Mutterthieren, oder statt derselben acht Glasperlenschnüre (zwei Pfund Glasperlen).
Von diesem Tage an helfen die Eltern dem jungen Paare zwei Hütten bauen oder eine, je nachdem der Mann schon eine besaß oder nur bei seinen Eltern oder Freunden wohnte. Eheliche Treue wird sehr gewahrt, namentlich von Seite des Mannes, als unerhört wurde mir ein Treubruch bezeichnet, und dies führt uns zu einem wichtigen Punkt, in welchen die Manansa die »gebildeten Marutse« überflügeln, die mit ihrem abscheulichen »Mulekau«-Thum ihre eigenen Frauen zum Treubruche verleiten, sie oft gegen ihren Willen dazu zwingen. — Die bevorstehende Niederkunft einer Frau führt ihre alten Nachbarinnen in’s Haus. Das Erste, was sie thun, ist, die Waffe des Mannes, mag es ein Assagai oder ein Gewehr etc. sein, hinauszutragen und sie in eine andere seiner Hütten, sollte er jedoch (was selten der Fall) nur eine Hütte besitzen, in die Wohnung seines Nachbarn zu tragen, ebenso wie für den Ehemann ein unwiderrufliches Gebot ist, sich von eben dem Augenblicke aus der Hütte seines kranken Weibes zu entfernen. Erst am achten Tage nach der Geburt des Kindes, und nachdem Mutter und Kind mit warmem Wasser und die Hütte durch und durch gereinigt wurde, führen die alten Weiber den Mann wieder in sein Haus zurück, um seine Frau zu begrüßen und sein Kind zu sehen. — Diese Reinigungsproceduren, welch’ ein Gegensatz zu der Unreinlichkeit der Hottentotten-Race und der Makalaka’s! — Trotzdem, daß der Mann in’s Haus eingeführt wurde, darf er nicht darin wohnen, erst nach drei bis vier Wochen von dem Tage an gerechnet, an dem er sein Kind zuerst erblickte.
Tritt ein Todesfall ein, so wird die Person in der Abendstille in der Nähe des Gehöftes, und wenn es der Boden gestattet, in einer etwa fünf Fuß tiefen Grube beerdigt. Ein Erwachsener erhält einen Assagai in’s Grab und wird dabei in eine Carosse gehüllt. Die Beerdigung geht außer dem Gestöhne der weiblichen Angehörigen im Stillen vor sich. Stirbt ein Hausvater, so wird den Tag nach der eben genannten Ceremonie all’ sein Eigenthum zusammengetragen. Die Bewohner des Dorfes versammeln sich und nun tritt der älteste Sohn hervor, um von dem Eigenthum Besitz zu nehmen. Ist kein Angehöriger oder kein Sohn vorhanden, so wird von den Versammelten ein Mann zum Erben eingesetzt, meist ein Freund des Verstorbenen, und dieser hat dann den Namen desselben anzunehmen.
Die Manansa sind in der Regel von Mittelgröße und nicht stark gebaut, doch bereiten sie dem Forscher nicht geringe Schwierigkeiten, weil sie seit der Zerstückelung des Landes sich mit den ebenfalls flüchtigen Matonga und Masupia und nördlich vom Zambesi mit den Makalaka und Bathoka sehr vermischt haben. Schwarzbraun ist der Teint des Stammes, freundliche Augen, kleiner Kopf und große Lippen. — Als Verzierungen beobachtete ich bei ihnen jene der ärmeren Classen im Marutse-Reiche (doch war es wohl anders als noch ihr Reich bestand), Arm- und Fußringe aus Gnu- und Giraffenhaut, auch aus Eisendraht. Sie tragen höchst einfache Ohrringe aus besserem Material und als Kleidung in der Regel blos einen kaum handbreiten Lappen aus Calico oder aus wildwachsender Baumwolle bereitet, doch zuweilen ein kleines Fell über die Hüften geschlungen, die Frauen kurze Röckchen aus gegerbten Fellen. Als Diener dürften die Manansa allen übrigen südafrikanischen Stämmen vorzuziehen sein, ich fand sie sehr geschickt im Anschleichen des Wildes, dabei nicht überhitzig, sondern, was eben nöthig war, sehr vorsichtig, gefällig, ehrlicher als andere und vor Allem treuer.
Die Manansa werden von den mächtigeren, umwohnenden Stämmen, von den Marutse, Betschuana und Matabele, mit Verachtung angesehen und demgemäß behandelt. Sie sind die »Schildbürger« des nördlichen Süd-Afrika geworden. Was ihnen namentlich zur Last gelegt wird, ist ihre auffallende Gutmüthigkeit und Friedfertigkeit, zwei Tugenden, welche seitdem die Zulu-Matabele zwischen dem Limpopo und Zambesi der Rohheit und Herzlosigkeit Platz gemacht — als Untugenden, die erstere als ein gleißnerisches Betragen, die zweite als Feigheit angesehen werden. — Auch dies ist ein Werk des Vandalenthums der Matabele, nicht nur Mord und Raub, auch das Ersticken aller edleren Gefühle und Mißtrauen in jedes freundliche Wort, das da gesprochen, in jede gute Handlung, die begangen wird, waren eingezogen.
Werden sie verfolgt und ist Flucht nicht mehr möglich, so kehren die Manansa um und gehen mit gesenktem Assagai ihren Feinden entgegen. Bei dem Zusammentreffen legen sie die Waffen auf die Erde und hocken sich nieder. Wenn nun auch der Sturm ihrer Verfolger auf sie losbricht, sie bleiben ruhig. Als sie von einem (dem vorletzten) der Bamangwato-Könige Moschesch bedrängt wurden, beschwichtigten sie die Habsucht ihrer Verfolger mit Elfenbein. Moselikatze’s Krieger raubten die Knaben und auch viele Frauen; die Horden des gegenwärtigen Matabele-Despoten nehmen, was sie nur zu Gesichte bekommen, auch dann, wenn sie von La-Bengula einem Weißen als Begleiter nach den Victoriafällen mitgegeben werden — nur dann, wenn dem Könige in dem Weißen durch einen der in Gubulowajo wohnenden Missionäre ein Mann von Bedeutung vorgestellt wird, wie z. B. im Jahre 1875, als Major S. um Diener nach den Victoriafällen ersuchte, befiehlt der König den Begleitern, sich jedweden Mordens und Raubens zu enthalten, damit es der Weiße bei seiner Rückkehr der »großen weißen Königin« (Königin Victoria) nicht berichten könne.
Als ich einst einem Manansa, der periodisch sich bei einem Händler verdungen und sich so über das Geistesniveau seiner Landsleute geschwungen hatte, über die »Feigheit« seines Stammes fragte, antwortete er mir mit einem gutmüthigen Lächeln und Schütteln des Kopfes: »Furchtsame Pallahs sind wir nicht und auch von langer Zeit her nicht gewesen. Allein wir lieben das Leben in den Dörfern und das Jagen der Thiere, die wir in Gruben fangen, seltener die Waffe gebrauchend. Wir geben den blutliebenden Matabele unsere Elephantenzähne und zeigen ihnen, wenn sie es verlangen, die frischen Spuren der Elephanten, um ihrer noch mehr zu erlegen; allein wir wollen und mögen nicht kämpfen da wir nicht das Blut und das Tödten der Thiere, noch weniger der Menschen lieben.«
Nach dem Tode eines Königs versammeln sich die Männer und bringen den zum Nachfolger bestimmten Thronerben in des Königs Haus. Sie bringen eine Handvoll Sand und kleine Steinchen vom Zambesi und auch einen Hammer. »Hier ist die Allgewalt über das Land, das Wasser und das Eisen (Arbeit und die Waffen).« Dabei erinnern ihn die Häuptlinge und das Volk von dem Tage an, wo er König wurde, nie vom Fleische des Nilpferdes und des Rhinoceros zu essen, da diese Thiere »sehr bösartig« seien, und der König, der ihr Fleisch genieße, wild und böse werden könnte.
Das Albertland, im Süden von dem sandigen Lachenplateau begrenzt, im Westen bis zur Tschobe-Mündung reichend, und vom Zambesi durchströmt, gehört unstreitig zu den meist interessanten Partien des zentralen Süd-Afrika. Nicht allein durch das Naturphänomen der Victoriafälle von Wichtigkeit, bietet es dem Touristen eine Fülle anziehender, felsiger und bewaldeter Hügellandschaften und hochbegraster Thäler.
Der Geologe, Botaniker wie auch der Mineraloge werden gewiß nur befriedigt dieses Hügelland verlassen. Mit Ausnahme des Spring- und Bläßbockes und des schwarzen Gnu wird der Mammaliajäger die meisten größeren Quadrupeden, die Süd- und Central-Afrika charakterisiren, vorfinden; der Mineraloge findet reichliche Arbeit. Unter den niederen Thieren sind Reptilien zahlreich vertreten, Krokodile oft bis zu den entferntesten Partien der Bergflüsse anzutreffen, in denen theils Spuren am Ufer, theils das getrübte Wasser ihre Gegenwart verrathen. Von Insecten sind alle Geschlechter, namentlich aber die Lepidoptera durch viele neue Arten ausgezeichnet. Die Thäler besitzen einen so guten Boden, daß bei dem warmen Klima tropische Gewächse mit Vortheil angebaut werden könnten, nur muß vorerst die Tsetse-Frage gelöst sein und man Mittel gefunden haben, den sommerlichen Fiebern vorbeugen zu können.
Auf dem Rückzuge nach Panda ma Tenka schlugen wir eine etwas veränderte Richtung ein. Unsere Capdiener schossen am Matopa-Flusse ein Wildschwein und weiter aufwärts im selben Thale wurde unsere Colonne von einem Geschrei der voranschreitenden Diener alarmirt. Durch einen penetranten Geruch angezogen, waren unsere Schwarzen abseits in die Büsche eingedrungen und fanden hier einen männlichen Elephanten in Folge von Schußwunden verendet. Das Thier war stark von Löwen angefressen; diese hatten sich an die Lippen gemacht und das Fleisch an den Schußwunden aufgerissen. Die Diener konnten noch eines der davonschleichenden Raubthiere erblicken. W. und F., deren Diener das Elfenbein gefunden, nahmen es in Besitz, und die Diener schnitten die untersten Fußglieder ab, um sie zu unserem Aerger mitzunehmen. Der penetrante Geruch, der diesem Leckerbissen der Eingebornen entströmte, zwang uns endlich, auf dessen Entfernung zu dringen. Frisch zubereitet kommen sie den Bärentatzen gleich; die der schwartigen Sohle aufliegende Substanz und das Herz, also winzige Theile im Verhältniß zu seiner Größe, sind die Leckerbissen, die das Riesenthier dem Menschen bietet.
Der Rückweg mit den wunden Füßen war so beschwerlich, daß ich mich mit Noth weiter schleppte. Den größten Theil beider Strecken von der Gaschuma-Ebene bis zu den Fällen und zurück nach der Ebene, hatten auch die Damen zu Fuße zurückgelegt. Wir gelangten bis auf mich wohlbehalten in der Gaschuma-Ebene und einen Tag später, am 24. September, in Panda ma Tenka an. Hier traf ich zwei Matonga’s und einen Manansa, welche Arbeit suchten und die ich sofort miethete, während mir W. und F. mit ihren Leuten behilflich waren, meine zu einer so weiten Reise nöthigen, zahlreichen Gegenstände nach dem Leschumo-Thale zu schaffen.
Zweiter Aufbruch nach Impalera. — Die Krokodile im Zambesi und ihre Gefährlichkeit. — Begräbnißfeier bei den Masupias. — Sepopo und seine Frauen. — Reisepläne. — Baum- und Busch-Vegetation im Walde von Schescheke. — Einzug einer Karawane von Tributpflichtigen. — Die Marutse als Fischer. — Maschoku, der Scharfrichter Sepopo’s. — Schmiedewerkzeuge der Marutse. — Der prophetische Tanz der Masupia’s. — Besuch der Königinnen. — Der Fang des Krokodils. — Die Mankoë. — Die Verwaltung des Marutse-Mabunda-Reiches. — Die Beamten-Hierarchie. — Eine Elephantenjagd unter Sepopo’s Anführung. — Ausflüge in den Wald von Schescheke und Büffeljagden in demselben. — Eine interessante Löwenjagd. — Der Löwentanz der Marutse. — Die Maschukulumbe am Hofe Sepopo’s. — Moquai, des Königs Tochter. — Hochzeitsfeier bei den Marutse.

Jagd auf Sporngänse.
Am 24. September saß ich wieder in meinem Wagen in Panda ma Tenka, der Ausarbeitung meines Tagebuches obliegend. Ich fühlte mich äußerst mißmuthig und bedrückt; die physischen Schmerzen an meinen wunden Füßen verschärften noch diesen Zustand, aus welchen mich Niger, mein treuer und anhänglicher Begleiter herausriß, da er mich nach längerer Abwesenheit (ich hatte ihn bei dem letzten Ausfluge zu den Victoriafällen zurücklassen müssen) zu begrüßen kam. Es that mir wirklich leid, mich in der nächsten Zukunft von dem Hunde zu trennen, denn da ich ihn dem Gifte der Tsetsefliege nicht aussetzen wollte, gedachte ich ihn mit dem mir von dem Bamangwato-Könige mitgegebenen Diener Meriko nach Schoschong zu senden, wo er einstweilen bei meinem Freunde, Herrn Mackenzie, verbleiben sollte. Hätte ich damals geahnt, daß ich wieder nach dem Süden zurückkehren müsse und Niger nicht wieder sehen sollte, ich hätte das treue Thier nie von meiner Seite gelassen. Als ich Meriko den ausbedungenen Lohn bezahlte und ihn mit Lebensmitteln versehen hatte, machte er sich mit dem Hunde auf den Weg, und langte nach drei Wochen in Schoschong an. Leider war um diese Zeit mein Freund Mackenzie nicht anwesend und der Hund wurde einem Wagenlenker von Francis und Clark, der eben nach Grahamstown fuhr, mitgegeben. Trotz aller Mühe, die ich mir gab, das Thier wieder zu gewinnen, blieb es verschollen.
Meine Tauschartikel waren sehr herabgeschmolzen und so sah ich mich genöthigt, trotz der exorbitanten Preise von den anwesenden Elfenbeinhändlern Glaskorallen, Kattun und Wolldecken zu kaufen.[11]
Am 27. September erkrankte ich an Dysenterie, doch war der Anfall kein heftiger, und gelang es mir, mich bald wieder herzustellen. Während des Aufenthaltes in Panda ma Tenka lernte ich auch einen Mann aus der Umgegend von Grahamstown, Henry W., kennen, er war ein ausgezeichneter Jäger, doch konnte ich nicht umhin, es ihm sehr übel zu nehmen, daß er sich manchmal auf der Jagd arge Schlächtereien erlaubte. So gab er einst einen weiblichen Elephanten, der ihn verfolgte, nachdem er das Thier durch einen Schuß zum Falle gebracht, seinen Dienern preis, welche dasselbe durch mehr denn zwei Stunden mit ihren Assagaien marterten, bevor er seinen Qualen durch einen Schuß ein Ende machte.
Von Panda ma Tenka schrieb ich einen Brief an einige befreundete Großhändler in den Diamantenfeldern und Port Elizabeth, um hier einiges Interesse für den Handel mit Gummi elasticum zu wecken, das die Portugiesen aus dem Marutse-Reiche nach dem Westen ausführen.
An beiden folgenden Tagen hatten wir Regen und Sturm, nachdem in den letzten Monaten zuvor in diesen Gegenden kein Regen gefallen war. Am 30. September verließen wir Panda ma Tenka, um in gleicher Weise wie das erste Mal über die Gaschuma-Ebene nach dem Leschumo-Thale zu gelangen, mußten aber die Fahrt bald unterbrechen, da die Last des Karrens zu groß war und ich um einen zweiten Wagen nach Panda ma Tenka senden mußte. Derselbe kam erst am Nachmittage des 1. October an, wir zogen nun weiter und übernachteten an der Gaschuma-Ebene, auf welcher ebenso wie in Panda ma Tenka die Nacht zuvor ein Trupp Löwen die Zugthiere aus ihrer Umzäunung zu scheuchen bestrebt war. Obgleich meine vier Diener drei verschiedenen Stämmen angehörten und eben so viele Dialecte sprachen, einer die Sesupia, einer die Setonga und einer die Senanso, so verstanden sie doch alle die Sesuto-Serotse und ich hatte, mit ihnen plaudernd, Gelegenheit, neue Ausdrücke in der letztgenannten Sprache zu erlernen. Auf der Fahrt nach Saddlerspan versuchte es ein Diener Westbeechs, mit Namen Fabi, einigen in der Nähe grasenden Zulu-Hartebeests beizukommen und stieß dabei beinahe mit einem Löwen zusammen, der ebenfalls das Wild beschlich.
In der Nacht auf den 4. langten wir wohlbehalten im Leschumothale an. Schon am folgenden Tage sandte ich meine vier Diener nach dem Tschobethale. Da mir Westbeech auch seine acht Langohren, die wir mitgenommen hatten, zur Verfügung stellte, konnte ich den größten Theil meines Gepäckes absenden, und langte am 5. selbst dort an. Im Leschumothale hatte ich die beiden englischen Händler Brown und Kroß getroffen welche mich sehr freundlich aufnahmen und eben von einem vergeblichen Versuche, zu Sepopo gelangen zu können, in’s Leschumothal zurückgekehrt waren; sie hatten kurz vor meiner Ankunft zwei prächtige Löwen, darunter einen alten männlichen und unbemähnten erlegt.
Am Tage nach meiner Ankunft im Tschobethale erschienen hier sechzehn und am folgenden sechs weitere Bootsleute, die von Sepopo gesendet, Westbeech mit seinen Waaren und mich mit meinem Gepäcke nach Schescheke zu bringen hatten. Dem König war es namentlich um die Waaren des Händlers zu thun, da dieser bei seinem letzten Besuche eine Anzahl von Elephanten-Gewehren nach Panda ma Tenka gebracht zu haben vorgab und der König selbe schon mit Ungeduld erwartete. Der giftige Muschungulubaum war diesmal in voller Blüthe, die Blüthen groß, schön dunkel-carminroth. Ich wollte mich früh am 6. mit allen Waaren übersetzen lassen, allein ein heftiger Wind ließ es nicht zu, jedenfalls wäre es sehr gefährlich gewesen, die Bootfahrt zu unternehmen, da das Umkippen der Kähne für die Insassen derselben äußerst unangenehm ist und diese sehr oft den Krokodilen zum Opfer fallen. Ich war später in Schescheke selbst Augenzeuge solcher Unglücksfälle geworden.
Ich gedenke später ausführlicher über die Krokodile des zentralen Zambesi zu sprechen, will aber jetzt schon einer Tragödie gedenken, die sich vor Kurzem unweit der Landungsstelle am jenseitigen (Impalera-)Ufer abgespielt hatte. Ein Masupia-Mann war mit seinem Weibe und seinem Töchterchen längs des linken Tschobe-Ufers ausgefahren, um Schilfrohr für seine Behausung zu schneiden. Während dieser Beschäftigung schlug der Kahn in Folge eines Windstoßes um und seine drei Insassen fielen in’s Wasser. In Folge der eben an dieser Stelle herrschenden starken Strömung gelangten Mutter und Tochter wohlbehalten an eine Sandbank. Sie sahen eben, wie der Mann sich durch das Schilf dem Ufer zuarbeitete, schon hatte er dasselbe erfaßt und trachtete sich auf die etwa vier Fuß hohe, steile Wand emporzuschwingen; nach mehreren fruchtlosen Versuchen, wobei er in’s Wasser zurückfiel, gelang es ihm endlich, einen herabhängenden Buschzweig zu erfassen, so daß er sich auch im selben Augenblicke emporzuziehen vermochte, als der Freudenschrei seiner Angehörigen ihnen auf den Lippen erstarb. Im Schilfe zeigte sich plötzlich der unförmige Körper eines Krokodils. In dem Momente als der Mann sich emporziehen wollte, war das Krokodil ebenfalls emporgeschnellt und hatte einen seiner über dem Wasser hängenden Füße ergriffen und riß den Unglücklichen mit sich in die Fluth zurück. Das Geschrei der Frauen zog eine im Felde arbeitende Genossin herbei, die nach Impalera eilte, um die beiden Frauen noch vor dem Dunkelwerden zu retten, da sie sonst in der Nacht auf der Sandbank ein ähnliches Schicksal wie den Gatten und Vater ereilt hätte.

König Sepopo.
Am folgenden Morgen wurde meine Aufmerksamkeit durch wiederholte Gewehrschüsse wachgerufen; ich erfuhr auf meine Frage, was dieselben zu bedeuten hätten, daß man eben einen Masupia begrabe. Ungefähr 400 Schritte nördlich der Niederlassung liefen auf einem zwischen zwei Bäumen gelegenen Raume zwölf mit Gewehren bewaffnete Männer herum, welche ihre Gewehre abschossen und dazwischen heftig schrieen; unter einem der beiden Bäume saßen zehn Männer und Frauen Bier trinkend, unter dem linken Baume befand sich das bereits zugeworfene Grab. Die Masupia’s machen ihre Gräber sechs bis sieben Fuß tief und zwei Fuß breit. Der Verstorbene wird mit seiner Carosse und seinen Waffen, seiner Haue, begraben und ihm auch etwas Korn in’s Grab gelegt. Seine Freunde verbleiben den Tag über am Grabe, und ist der Mann wohlhabend, so wird neben dem Bier auch viel Fleisch von seinen geschlachteten Hausthieren verzehrt. Das Schießen, Schreien und Umherlaufen soll das Eindringen der bösen Geister in das frischaufgeworfene Grab verhüten. Als ich einen der Umstehenden über die Todesursache des Dahingeschiedenen fragte, hob dieser die Augen gegen das Firmament und meinte Molemo sei daran schuld. Am selben Tage brachten die Masupia’s Fleisch von einem Nilpferde, das sie erbeutet. Es war, wie sie meinten, ein junges Thier, doch hatte es bereits zehn Zoll lange Stoßzähne. Beim Transportiren meines Gepäcks nach der Makumba-Landungsstelle war mir Makumba’s Bruder, Ramusokotan, behilflich, ein Unterhäuptling, der einige Meilen stromaufwärts am linken Ufer des Tschobe wohnend, den unteren Flußlauf zu bewachen hat. Auf meinem Gange nach der benannten Landungsstelle stieß ich dreimal auf Pallahgazellen, zweimal so nahe, daß ich sie aus nächster Nähe beobachten konnte.
Ich fand das Wasser des Zambesi abermals gesunken, auf der Bootfahrt während des Vormittags entkam mein Boot nur durch ein Wunder der Wuth des einen der drei Nilpferde, denen Blockley auf unserer ersten Fahrt nach Schescheke den Führer mit zwei Schüssen geraubt hatte. Als wir an derselben Stelle diesmal ohne die Thiere zu beunruhigen, vorbeipassiren wollten, fühlten plötzlich Westbeechs Bootsleute mit ihren Rudern das Thier unter dem Kahne, doch entkamen sie glücklich, weil vielleicht die Berührung mit dem Ruder das Nilpferd etwas abgeschreckt hatte. Das Thier machte nun einen Stoß nach meinem (dem folgenden) Boote; doch die Bootsleute, gewarnt durch den Schrei und die pfeilschnelle Bewegung des vorderen Bootes, waren eben so schnell nachgefolgt, und so tauchte der unförmliche Kopf des Dickhäuters drei Meter hinter meinem Kahne auf.
In Schescheke angekommen, hätte ich in einer vom Könige errichteten Hütte wohnen können, ich zog jedoch das Anerbieten Westbeechs vor, mich in einer der Hütten, die in seinem Höfchen standen und in welchem inzwischen Blockley einen kleinen Pfahlbau als Waarenhäuschen errichtet hatte, niederzulassen. Als ich Sepopo aufsuchte, rief mir dieser entgegen, daß ich zu spät gekommen sei und er die für mich bestimmten Marutse-Männer nicht länger hätte auf mich warten lassen können. Am Nachmittage kam ich wieder und brachte dem Könige allerlei kleine Geschenke, wobei es den König recht ergötzlich stimmte, als ich mich selbst mit ihm in der Sesuto-Serotse zu verständigen suchte.
Gegen Abend rief mich Blockley aus der Hütte, um einen seltenen Anblick genießen zu können. Der König war von einem Besuche der sich in der Barotse aufhaltenden Königinnen und seiner Tochter Moaquai, der Mabunda-Königin, beehrt worden. Es waren etwa 40 Kähne, in manchen war die Mitte des Bootes für die königlichen Frauen mit je einer Matte überdeckt, um diese gegen die Gluth der Sonne und den Regen zu schützen, manche der Kähne hatten 13 Ruderer, die durchwegs stehend ihre Arbeit verrichteten. Andere Kähne waren mit riesigen Töpfen, Matten, Körben, theils mit den Bedürfnissen der Reisenden, theils mit den für den König bestimmten Geschenken beladen.
Am folgenden Tage besuchte ich Kapt. McLoud, Fairly und Kowly. Der König hatte sie in einer Rundhütte nahe dem königlichen Gehöfte einlogirt. Sie klagten, daß der König noch immer zaudere, die große Elephantenjagd, derentwegen sie zum zweiten Male herüber gekommen waren, abzuhalten. Auch besuchte ich mit Westbeech die Königinnen, welche von der Barotse gekommen waren und welche dieser während seines Aufenthaltes in der Barotse kennen gelernt hatte, unter ihnen befand sich Mokena, die Mutter des Landes. Ich lernte sechzehn Frauen Sepopo’s kennen, seine Lieblingsfrau war eine Makololo Namens Lunga, eine andere hieß Mafischwati, die Mutter Kaikas, der von Sepopo bestimmten Thronerbin; die vierte hieß Makaloe, die fünfte Uesi, die sechste Liapaleng, sodann folgte Makkapelo, durch welche im Jahre 1874 zwei Männer ihren Tod fanden; Mantaralucha, Manatwa, Sybamba, Kacindo. Als zwölfte nenne ich Molechy, die von Sepopo wegen Treulosigkeit beinahe ertränkt worden war, dasselbe geschah einer anderen mit Namen Sitau. Der Verführer wurde gewöhnlich den Scharfrichterknechten übergeben, um für den König Büffelfleisch zu holen, d. h. er wurde im Walde gespeert. Der König selbst bestrafte aber Sitau auf folgende Weise. Unter großem Zulauf der Bewohner Schescheke’s stieß er mit einigen Kähnen vom Lande gegen die Flußmitte ab, er selbst saß mit Sitau in einem Kahne. Mitten im Strome angelangt, band er ihr Hände und Füße, und tauchte sie dreimal so lange unter das Wasser, daß sie mit genauer Noth wieder zu sich gebracht werden konnte. Als sie zu sich kam, fragte er sie, wie ihr das Ertrinken gefalle, und drohte ihr, das nächste Mal sie einfach in den Fluß zu werfen. Die vierzehnte war Silala und zwei andere hatte er zweien seiner Häuptlinge zum Geschenk gemacht. Der eigentliche Thronfolger war vor zwei Jahren gestorben, er hieß Maritela und war ein Sohn Marischwati’s. Vor seinem Tode kam zufällig der Gouverneur der Barotse an sein Lager, und da das Kind über Durst klagte, willfahrte er seinem Begehr und reichte ihm einen Trunk aus einem in der Nähe stehenden Topfe. Zufällig starb der Knabe kurz darauf und der allgemein beliebte Gouverneur wurde von Sepopo angeklagt, sein Söhnchen vergiftet zu haben, zum Tode verurtheilt und vergiftet. Die ebenfalls aus der Barotse angekommene Tochter Moquay hatte sich mit einem der aus der allgemeinen Metzelei geretteten Makololo, Namens Manengo verheirathet. Der König berichtete mir während eines Besuches, den er mir abstattete, über den König der Makololo, daß dieser sehr elend zu Grunde ging, da sein Körper mit Geschwüren gänzlich bedeckt war. Nach seinem Tode begannen die Parteikämpfe unter seinem Stamme.
Eine weitere Konferenz mit Sepopo und den Portugiesen, die ich am 12. hatte, ließ schon dem Könige keine Ruhe, er belehrte mich, daß, wenn ich auf meiner Weiterreise von Schescheke mich nur zwei Tage lang in jeder Stadt der Barotse aufhalte, ich zwei Monate lang durch sein Reich in einem Kahne zu reisen hätte, bevor ich jenes des Iwan-Joe erreicht haben würde. Ich fände hier die Quellen des Zambesi und würde von da zwei Monate sieben Tage bis Matimbundu brauchen. Auch am 13. besuchten wir die neu angekommenen Königinnen und fanden, daß sie in hoher Achtung standen. Gruppen von Besuchern waren um sie gelagert und warteten ruhig ab, bis es ihnen gestattet wurde, die hohen Gäste ansprechen zu dürfen.
Am 14. wurden wir von einem Tänzer besucht, dessen Waden mit einigen aus Fruchtschalen gearbeiteten Schellen behangen waren. Sein Tanz war ein Springen und ein Schütteln des ganzen Körpers, um mit den Schellen großen Lärm zu erzeugen. Am Hofe Sepopo’s fand sich auch ein Mambari, der bei dem Könige Schneiderdienste verrichtete, er war auf einem nach Westen unternommenen Raubzuge der Marutse mit seinen Leuten irriger Weise gefangen genommen worden. Dieser Mambari war mit zwei seiner Genossen an einer nahen Quelle, als sie bei der Rückkehr eben zu der Metzelei ihrer Leute anlangten. Die beiden anderen ließ Sepopo wieder ziehen, nachdem er sie reichlich mit Vieh beschenkt, doch Kolintschintschi, der nunmehrige königliche Schneider, wurde am Hofe zurückgehalten.
Auf meinen Ausflügen in den Schescheke umgebenden Wald fand ich außer derselben Baum- und Buschflora wie in den Betschuana-Wäldern noch zahlreich mir neue Arten und manche mir schon von den Betschuana-Ländern her bekannte Species zur doppelten Höhe gediehen. An Vierfüßlern war die Gegend sehr reich und unter diesen fand sich eine mir noch unbekannte Art einer Hartebeest-Antilope mit platt gedrückten Hörnern. Sehr zahlreich war auch die Vogelwelt vertreten, unter anderen fand ich hier zum erstenmale den Bienenfänger (Merops Nubicus), einen grauen, mittelgroßen Tukan, den großen Plotus und zwei Spornkibitz-Arten, welche durch gelbliche Hautlappen an ihrem Gesichte ausgezeichnet waren.
Am 17. begegnete ich einer jener Karawanen, welche aus den entfernteren Theilen des Reiches Abgaben an den König bringen. Sie zählen zehn bis mehrere Dutzend Menschen. Die freiwillig von ihrer Heimat Scheidenden oder von ihren Häuptlingen Abgesandten kommen mit ihrem ganzen Haushalte, da sich in ihrer Abwesenheit Niemand um die Kinder bemühen würde. Die eben vorüberziehende Karawane zählte 30 Personen, voran schritten die Männer von ihren Frauen und diese wieder von den Kindern gefolgt, beim Einzuge in Schescheke ordneten sie sich der Größe nach. Den Zug eröffnete der Führer, welcher nur seine Waffen und eine eiserne Glocke trug, mit welcher er unaufhörlich läutete. Dann folgten die Abgaben tragenden Männer mit Elephantenzähnen und mit Manzawurzeln und einer kleinen Frucht gefüllten Körben beladen. Die Frauen trugen die Reise-Utensilien und die Nahrungsmittel.
Am 19. unternahm ich, Westbeech, B. und W., je zwei in einem Kahn eine Bootfahrt stromaufwärts, um in einer der Lagunen mit der Angel zu fischen. Es lagen mehrere größere und kleinere Kähne in der hafenartigen Bucht und wir trafen zweimal eine so gute Wahl, daß wir nach einigen Minuten zurückkehren und die Canoes wechseln mußten; im kleinsten konnten ich und Bauer kaum das Gleichgewicht erhalten. Auf diesem Ausfluge beobachtete ich auch das Fischen der Marutse und Masupia mittelst Netzen. Aus zwei mit je vier Bootsleuten bemannten Kähnen, welche je ein großes aus Bastschnüren geflochtenes, weitmaschiges Netz bargen, warfen die Fischer hier das Netz aus, wobei sie sich, je tiefer dasselbe einsank, desto mehr nach rechts und links den Ufern näherten; sie zogen dabei das Netz nach aufwärts, so daß in dem Momente, wo sich die Kähne berührten, auch das Netz sammt den gefangenen Fischen in beiden Kähnen lag. Die Fische wurden nun mit Kiri’s betäubt und an’s Land befördert. Auf unserer Heimfahrt waren wir Zeugen einer unangenehmen Prügelscene. Von den in unserer kleinen Bucht badenden Mädchen hatte eines dem andern einige Glasperlen gestohlen, dies wurde von den anderen bemerkt, welche nun sich auf die Diebin stürzten, sie mit Händen und mit Schilfrohrstücken so lange schlugen, bis sie auf die Knie fiel und schreiend und flehend die Hände aufhob; doch selbst als sich ihrer ein Mann annahm wurde die Züchtigung fortgesetzt und ihr endlich von der Beschädigten das kleine Lederröckchen vom Leibe gerissen.
Als ich Abends beim Könige zum Nachtmahle geladen war, spielte sich eine Scene ab, welcher leider ein Gebrauch im Marutse-Reiche, sowie die Grausamkeit Sepopo’s zu Grunde lagen. Eine Stunde mochte seit Sonnenuntergang verronnen sein; im königlichen Gehöfte ging es recht munter zu. Gewohnter Weise saß der König mit gekreuzten Füßen auf seiner Matte, ihm zur Rechten die zu seiner Unterhaltung an diesem Tage bestimmten Königinnen. Zu seiner Linken war mir und seinem Neffen und nunmehrigen Nachfolger eine ähnliche Matte als Teppich angeboten. Auf der freien Stelle zwischen uns und dem in einem Halbkreise sitzenden, zahlreich versammelten Volke hatte der königliche Mundschenk Matungulu seine gewöhnliche Stelle schon eingenommen und war eben damit beschäftigt, Honigbier auszuschenken. Der Honig wird von den Marutse-Königen als Krongut betrachtet und muß an diese abgegeben werden, der Verkauf desselben wird von dem Könige mit dem Tode bestraft. Tagtäglich gehen einige dazu bestimmte Männer aus, um mit Hilfe des Honigkukuks Honig zu sammeln und die königliche Küche zu versehen, manche kehren gleich, noch am selben Tage, manche jedoch erst nach einigen Tagen mit ihrer Beute zurück.
Der König hatte eben von dem ihm dargereichten Glase ein wenig genippt und den Rest seiner Lieblingskönigin Lunga gereicht, dabei, wie er dachte, einen Capitalwitz vorgebracht, den er, wie gewohnt, zuerst selbst belachte, welches Lachen der Etikette gemäß von der demüthig zusammengekauerten Umgebung desselben mit einem wahren Pferdegewieher beantwortet wurde. Dasselbe war noch nicht ausgeklungen, als eben wohl den so entstandenen Lärm benutzend, einer der Unterhäuptlinge aus der Menge zu dem Könige heranschlich und demselben ziemlich leise von kaum hörbarem Händeklatschen begleitet, Folgendes berichtete: »In meinem Dorfe lebt ein alter Mann, dessen Füße zu schwach sind, um das Polocholo (Wild) zu jagen. Schon vor langer Zeit hat es Njambe (Gott) gefallen, seine Weiber sterben zu lassen und ihm so die Möglichkeit benommen, sich mit Mabele (Korn) zu nähren; seine Verwandten leben, da er mit Dir, o König, nach Schescheke gekommen war, in der fernen Barotse, und so hat er Niemanden hier, der ihm Nahrung reichen könnte, noch ist er selbst im Stande, sich welche zu erwerben.« Während der Häuptling sprach, schenkte Sepopo seine Aufmerksamkeit einem Anderen ihm gegenüber sitzenden Manne und als der erstere geendet, gab er diesem mit einem Autile intate zu verstehen, daß er ihn begriffen, und der Ruf »Maschoku« zeigte dem Berichterstatter, daß er erhört wurde. Maschoku hieß Sepopo’s Scharfrichter und er wurde eben gerufen, um den Häuptling, sein Dorf, den König und die Nachbarn von der Gegenwart des alten Mannes zu befreien.
Während meines Aufenthaltes in Schescheke gab es im Marutse-Reiche keinen so gehaßten Menschen wie Maschoku, keinen gefürchteteren Namen als diesen. Dem Stamme nach ein Mabunda, war er in Folge seiner Tauglichkeit ein Werkzeug Sepopo’s und seiner Geschicklichkeit halber, mit der er sein furchtbares Amt versah, von dem Könige zum Häuptling erhoben worden. Mehr denn sechs Fuß lang, sehr stark gebaut, zeichnete er sich durch einen unförmlichen Kopf und sehr abstoßende Gesichtszüge aus, welche ihm meinerseits mit Rücksicht auf sein Amt den Namen die Mabunda-Hyäne zuzogen. Auf den Ruf des Königs kam Maschoku auf allen Vieren herangekrochen, ein unterwürfiges, listiges Lächeln, ein Grinsen, das von der Befriedigung, mit der er des Königs Rufe zu folgen schien, ließ den Menschen noch widerlicher erscheinen, als er es ohnehin schon war. Auch er klatschte in die Hände und horchte; vor dem Könige angekommen, senkte er den Kopf, um gespannt des Königs Befehl zu vernehmen. »Maschoku,« sprach der König, »kennst Du den Mann, von dem eben der Häuptling sprach? Trachte die Sache morgen Früh in Ordnung zu bringen.« Dann nickte der König seinem Günstling zu und nachdem er ihn noch mit einem Becher Impote ausgezeichnet, entließ er den Mann, welcher auf dieselbe Weise, wie er gekommen, zurückkroch. So war die Sache abgemacht und für neue Nahrung der Krokodile des Zambesi gesorgt worden. Der König machte seinem guten Humor noch in einigen Witzen Luft, zog sich hierauf in sein Schlafgemach zurück, während die Musikcapelle in ihrem vor den königlichen Wohnungen erbauten Häuschen die nächtliche Serenade executirte.
Wir wollen nun sehen, wie am folgenden Morgen dem Befehle des Königs Genüge geschah. Einige Stunden nach Tagesanbruch hatten sich vor der Grashütte des den Krokodilen geweihten überflüssigen Mannes fünf Männer eingefunden, aus denen sich die berüchtigte Gestalt der Mabunda-Hyäne auffällig hervorhob, der letztere beugte sich nun zu der kleinen Eingangsöffnung der Hütte herab, streckte seinen unförmlichen Arm aus, um das Opfer beim Fuße zu ergreifen. Der Greis versuchte es, sich zu erheben, doch seine Schwäche hinderte ihn daran; wie Espenlaub zitterte der gebrechliche Körper. Mit den Worten. »Fasset an, ihr Männer, je eher desto besser für Dich, Vater,« tröstete der Scharfrichter sein Opfer. Die Gehilfen des Scharfrichters schleppten nun den Mann zum Flusse. Schweigend schritt die Gruppe dahin; am Ufer angelangt, band Maschoku die Hände und Füße des Mannes und ließ ihn in das bereit gehaltene Canoe bringen. Das Boot stieß ab, und nach einigen Ruderschlägen waren die Mörder in der Mitte des Flusses angelangt; während nun der Gehilfe mit dem Ruder das Gleichgewicht des Bootes zu erhalten bestrebt war, ergriff der Scharfrichter sein Opfer mit fester Hand und tauchte es, unterstützt von einem Gehilfen unter Wasser. Gurgelnde Laute entstiegen der Tiefe und die Arme zuckten nach aufwärts, doch alles vergebens, an der Gewalt des eisernen Griffes Maschoku’s scheiterte auch der verzweifelt Rettungsversuch. Auch die Luftblasen, welche bisher noch an der Oberfläche der Fluth auftauchten, blieben aus, das Leben war aus dem Körper entwichen. Nun wurde der Körper in’s Boot gezogen und näher dem Ufer an einer Stelle, wo die königlichen Straßenreiniger den Unrath den Krokodilen vorzuwerfen pflegten, in die Tiefe versenkt. Dies die gewöhnliche Weise wie König Sepopo mit kranken, alleinstehenden und altersschwachen Leuten umzugehen pflegte. In Schescheke gab es mehr solcher Opfer als in anderen Theilen des Marutse-Reiches, weil sich hier Fremdlinge aus den verschiedenen Provinzen versammelten, um den König zu begrüßen. Unter manchen Herrschern jedoch, wie z. B. unter dem beim Volke im guten Angedenken stehenden Großvater Sepopo’s, wurde diesem Gebrauche nie gehuldigt, ebensowenig während der Regierung einer Königin.

Der prophetische Tanz der Masupia.
Am 20. besuchte ich Masangu, den schon erwähnten Häuptling, Vorstand der Metall-Handwerker in Sepopo’s Reich, der zugleich die Oberaufsicht über alle von dem Könige an seine Unterthanen abgegebenen Gewehre zu führen hatte. Er war eben mit dem Ausbessern eines Gewehres beschäftigt und bediente sich dabei seiner eigenen Instrumente; Hammer, Meißel, Zange und Blasbalg waren die best gearbeitsten ihrer Art, die ich bisher unter den Eingebornen Afrika’s angetroffen hatte. Er frug mich, ob ich schon die Masupia’s tanzen gesehen habe; als ich dies verneinte, machte er mich auf den Schall der aus den königlichen Gehöften ertönenden Langtrommeln aufmerksam und forderte mich auf, den Tanz der Masupia’s zu beobachten. Die Bewohner des Marutse-Reiches lieben den Tanz sehr, ich möchte sagen, daß jeder Stamm einen Specialtanz besitzt; mit den Betschuana’s haben sie den Pubertätstanz gemein, den die Mädchen feiern, wenn sie ihre Reife erlangt haben. Er wird Wochen lang und stets bis gegen Mitternacht ausgeführt, und dient auch dazu, um das Freundschaftsband unter den im Alter ziemlich gleichstehenden, in einer Ortschaft geborenen Mädchen inniger zu knüpfen. Der Tanz wird von Gesang und Castagnetten-Musik begleitet.
Andere Tänze sind der Trauungstanz, ferner der Elephantentanz, der zugleich mit dem größten Trinkgelage verbunden ist, bei welcher Gelegenheit ich auch den schädlichen Effect des Butschuala beobachten konnte. Die Fächerpalmen-Instrumente werden dabei rasch mit einem Rohrstäbchen gestrichen und mit den Stahlhandschuhen (klöppellosen Doppelglocken) der Tact dazu geschlagen. Ferner gibt es den Löwen- und Leopardentanz, welche nach glücklich ausgeführten Jagden von den heimkehrenden Jägern und den ihnen entgegenkommenden Dorfbewohnern ausgeführt werden. Wie an dem Elephantentanze, so betheiligt sich der König auch an dem Mokoro- oder Bootstanze.
Jener, den ich am 20. October in Schescheke beobachten konnte, war ein prophetischer Tanz und eine der vielen Gaukeleien, welche dem Stamme der Masupia’s eigenthümlich sind. Zwei Männer tanzten unter dem Schalle der größten Trommeln der königlichen Capelle und dem Gesange und Händeklatschen einiger dreißig sie eng umringender Landsleute vom frühen Morgen bis zum Sonnen-Niedergange, bis sie sozusagen besinnungslos niederstürzten; in diesem Momente mußten sie Worte ausstoßen welche sich auf das Vorhaben, eine große Jagd, Krieg oder Raubzug etc., bezogen, welches der König oder Statthalter auszuführen gesonnen war. Beinahe durchwegs lautet ihre Weissagung günstig und ein Geschenk von Glasperlen oder Kattun wird ihnen dafür zu Theil; straft der Zufall ihre Worte Lügen, so müssen sie sich aus dem Bereiche des erzürnten Hohen ferne halten, um nicht ein fühlbares Nachgeschenk zu erhalten. Masupia-Tänzer waren phantastisch mit Gnu- oder Zebraschwänzen am Kopfe, an den Armen und Hüften geschmückt und bildeten mit ihrem Tanze einen Uebergang zu den maskirten Tänzern. Der Tanz an sich selbst ist ein Hüpfen von einem Fuß auf den andern, unterbrochen von einem Sichausstrecken auf dem Boden, das plötzlich, oder so langsam mit kaum wahrnehmbarer Benützung der Gelenke geschieht, und mit einem Schütteln des Körpers und Kopfes, Verschieben des Kopfschmuckes etc. verbunden ist. Auch diese Tänzer benützen die Wadenschellen und einige kleine flaschenförmige, zu gleichen Zwecken gearbeitete Kürbisschalen. Zu Hause begehen die Masupia’s ähnliche Tänze mit Gaukeleien verbunden, welche sie oft geschickt einzufädeln wissen. So scheint es, als wenn sie sich während des Tanzes mehrmals tief in die Zunge schneiden und nach jedem Schnitt Blut hervorquellen würde; untersucht man aber die Zunge nach dem Tanze, so findet man sie nicht im Geringsten verletzt.
Abends kamen Boten von Dr. Bradshaw von Panda ma Tenka mit einem Briefe, worin wir mit der Nachricht überrascht wurden, daß der den Lesern schon von den Klamaklenjana-Quellen her bekannte Händler A. X., dem ich zwei Kistchen gesammelter Objecte nach Panda ma Tenka gesendet, am Nataflusse von Hyänen getödtet wurde. Der Mann hatte sein wenig glorreiches Leben damit zum Abschlusse gebracht, daß er einen seiner Diener wegen eines kleinen Vergehens niederschoß und in der Furcht, von den Genossen des ermordeten Dieners getödtet zu werden, im trunkenen Zustande seinen Wagen verließ und sich in den nahen Büschen verbarg. Die erschreckten Diener hörten sein Geschrei während der Nacht, doch wagten sie es nicht, ihm zu Hilfe zu eilen. Am nächsten Morgen sollen sie seine frisch abgenagten Gebeine und zu Fetzen zerrissenen Kleider gefunden haben. Zwei der Diener hatten sich, nachdem sie sich mit Nahrungsmitteln versehen auf den Weg nach dem Panda ma Tenka-Flüßchen gemacht, um hier den Compagnon des Verunglückten aufzusuchen und ihm den Unglücksfall zu berichten.
Am 21. setzte ich mein einige Tage zuvor angefangenes Studium der Fische fort, wobei ich diesmal meine Aufmerksamkeit dem auch im Zambesi vorkommenden schildköpfigen Wels (Glanis siluris) widmete. Ich erwähnte schon des Thieres und seiner Parasiten und will noch hinzufügen, daß mir seine Farbe hier dunkler erschien als die der südlicher vorkommenden Thiere. An Stellen, die uns von Krokodilen weniger dicht bewohnt zu sein schienen, warfen wir die Grundangel aus und in der Regel mit gutem Erfolg.
In der Nacht auf den 22. vernahm ich aus dem Dorfe des Häuptlings Ratau (dem westlichsten) Frauengeschrei und früh Morgens einige Gewehrschüsse. Das erstere bezeichnete das Ableben eines Marutse, das zweite, daß man ihn bestatte. Am 22. sandte der König einen Kahn, um Blockley und Bauren nach Impalera zu schaffen, damit der erstere den des Tauschhandels halber geplanten Ausflug nach dem Lande des Makalaka-Fürsten Wanke unternehmen könne. Die Sendung eines Kahnes für zwei Weiße und mehrere Diener wurde von Blockley als Beleidigung angesehen und diente nicht dazu, um das in letzterer Zeit durch das unfreundliche Auftreten von Seite Sepopo’s eingetretene Zerwürfniß zu mildern. Der König erschien diesmal von 120 der Seinen und seiner Capelle begleitet. Die Menschen füllten das kleine Höfchen vollständig, Sepopo wollte durch dieses imposante Auftreten den Händlern zu verstehen geben, daß sie vollkommen in seiner Gewalt seien.
Der König hatte sich kaum entfernt und ich war an die Ausführung einiger Zeichnungen geschritten, als zwölf Königinnen auf meine Hütte losstürzten. Sepopo hatte ihnen erzählt, daß ich unlängst ihn und Maschoku abgezeichnet, nun wollten sie sein und des Scharfrichters Bild sehen; da half kein Widerstreben und ich mußte mit der Zeichnung heraus, ja ich mußte ihnen auch zeigen, wie ich das Bild gezeichnet hatte, dabei wurde ich derart umlagert, daß mir das Athmen schwer wurde. Die eine wies auf das und frug die andere um jenes, während eine dritte nach dem Bleistifte griff und zwei andere wieder die Feinheit des Papieres bewunderten; die rückwärts Stehenden, die nicht viel sehen konnten, drängten hervor und zwei der Vordersten lehnten sich sans gène an meine Schultern und entfalteten dabei so viel Koketterie, wie ich sie nie an den schüchternen Betschuana- und Zulu-Frauen beobachten konnte. Da ich des Königs Eifersucht wohl kannte, hielt ich es für das Beste, einen der schwarzen Diener, der sich beim Eintreten der Frauen des Königs entfernen wollte, bleiben zu heißen. Nach einer halben Stunde verließen sie mich, um Westbeech in dem nebenan liegenden Waarenhäuschen anzubetteln. Nach ihrer Entfernung warf ich eine Matte gegen die Thüröffnung und ließ nur eine Spalte für das Licht offen, ich hoffte nun Ruhe zu haben, doch hatte ich die Neugierde der Töchter Eva’s nicht in Rechnung gebracht, denn kaum war dies geschehen, als abermals zwei Königinnen an der Thüre erschienen. Sie dachten mich wohl abwesend, denn aus den Worten der einen, »Sikurumela mo’ ndu, Njaka chajo« (der Deckel liegt an der Thüre, der Doctor ist abwesend), konnte ich ihre Enttäuschung entnehmen.
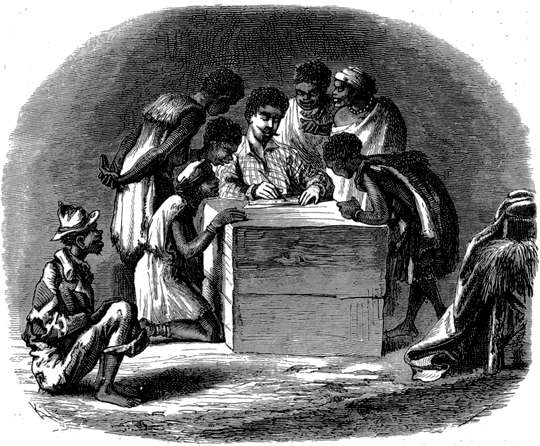
Besuch der Königinnen.
Von allen mir bis jetzt in Südafrika bekannten Eingebornenstämmen halte ich jene im Marutse-Reiche für die reinlichsten. Gerade an den am Flusse gelegenen größeren Ortschaften gibt es wenige sandige Untiefen; nichtsdestoweniger und trotz der Gefahr, welche den Badenden durch die zahlreichen Krokodile droht, lieben die Stämme des Marutse-Reiches das Bad. Ist das Ufer zu steil oder das Wasser zu tief, so wird das Wasser über den Kopf gegossen. Waschen ist ihnen eine Nothwendigkeit, sie reinigen sich selbst nach jedem Mahle Mund und Hände.
Am 23. machte ich einen Ausflug auf die angrenzende Wildebene (Blockley’s Kraal), wobei ich Gelegenheit fand, die Puku-, Letschwe- und Wasser-Antilopen beobachten zu können. Am Rande des Gehölzes (die Ueberschwemmungen des Zambesi setzen diese Ebenen bis an das Gehölz unter Wasser) beobachtete ich zahlreiche Felder der Eingebornen. Frauen und Kinder waren mit dem Umgraben, Männer mit dem Fällen der Bäume beschäftigt, um den Grundbesitz ihrer Herren (die auch sie ernährten) nach dem Gehölze hin auszudehnen. Heimkehrend fielen mir die an mehreren Stellen im Umkreise einiger schon errichteten Gehöfte erbauten Hütten auf, sie hatten eine Nachtmützenform und mußten in wenigen Stunden aus Gras und Schilfrohr errichtet worden sein. Sie waren für die Sklavinnen bestimmt und standen ohne alle Umzäunung da, damit ihr Eigenthümer leicht die Aus- und Eingehenden überblicken konnte.
Am 24. besuchte ich eine Hütte, in welcher einer der Mambari’s mit Hilfe der ihm von dem Masupia-Häuptling Masangu geliehenen Werkzeuge Schmiedearbeiten verrichtete. Einen Gehilfen Masangu’s fand ich damit beschäftigt, einige Hauen zu schärfen, und sah den von den Marutse verwendeten doppelten Blasebalg, welcher einen continuirlichen Luftstrom in das Feuer bließ. Dieser Blasebalg besteht aus drei Haupttheilen, einem hölzernen, theilweise mit Leder überzogenen, einem aus Horn verfertigten und einem thönernen Theile. Der hölzerne Theil ein Doppelgestell aus zwei mit Lederlappen bedeckten Rundschüsseln und je einer aus diesem parallel laufenden Holzröhre bestehend. Die Lederstücke sind in ihrer Mitte mit Stäbchen versehen, haben an der Seite je eine Oeffnung und werden abwechselnd gehoben oder gesenkt und auf diese Weise Luft eingelassen und ausgepreßt; diese wird abwechselnd in eine der hölzernen Röhren getrieben und tritt aus diesen in die aus den Hörnern der Säbel- oder Gemsbock-Antilope verfertigten. Die beiden Hornröhren sind kürzer als die hölzernen und stehen mit diesen in keinem festen Zusammenhange, sie laufen auch nicht mehr parallel zu einander, sondern sind an den vorderen Enden zu einander geneigt und münden in eine thönerne und diese unmittelbar auf den Feuerherd.
Mein Nachmittags-Spaziergang führte mich zum Flusse, an dem ich einen Haufen lebhaft gesticulirender Eingeborner antraf. Der Fluß hatte soeben die Leiche eines vor einigen Tagen von einem Krokodil beim Baden getödteten Mädchens an’s Land geschwemmt. Menschen, sowie größere Säugethiere werden von den Krokodilen ertränkt, da sie von dem Reptil nicht verschlungen werden können. Sowie das Krokodil durch das Aufhören der Zuckungen von der Widerstandslosigkeit seiner Beute überzeugt ist, öffnet es am Grunde des Wassers seine riesigen Kinnladen und läßt die Beute fallen. Das riesige Thier ist, außer es zerren zwei um das ertränkte Opfer, nicht im Stande, mit seinen Zähnen ein größeres Thier oder den Menschen als frischen Cadaver zu zerkleinern, es bleibt aber als Wächter bei dem Ertränkten liegen, bis der Verwesungsproceß beginnt und die Leiche, durch die Gase emporgehoben, zur Wasseroberfläche aufsteigt. Dann wird erst dieselbe zerstückelt und verschlungen. Hat jedoch ein Fisch oder sonst ein Gegenstand die Aufmerksamkeit des Thieres vom Fraße ab und auf sich gelenkt, und geschah dies während des Tages, so wird der gehobene Gegenstand vor der anbrechenden Dunkelheit nicht mehr berücksichtigt. Sepopo sowie seine Leute theilten mir mit, daß in keinem Theile seines Landes die Krokodile so schlimm und gefürchtet wären, als in der Umgegend von Schescheke. Kurz vor meiner Ankunft wurde ein Mann von denselben aus dem Boote herausgeholt, vor drei Tagen ein sechsjähriger badender Knabe erfaßt und während meines ferneren Aufenthaltes in Schescheke fanden mehr als dreißig Menschen ihren Tod durch diese räuberischen Saurier.
Kleine Krokodile werden zufällig im Netze mit Fischen, große erwachsene Thiere mittelst riesiger Angeln gefangen und getödtet. Die Construction dieser Fangvorrichtung ist sehr sinnreich ausgedacht und ausgeführt. Sie besteht aus einer eisernen Angel, mehreren dünnen Bastschnüren, einem Baststrick und einem Rohrbündel; eine eingehendere Beschreibung dürfte die folgende Skizze ersparen. Der den Angelhaken umhüllende Köder wird von einem Netze gehalten, mehrere vier bis 4½ Meter lange federspuldicke, sehr fest gedrehte Bastschnüre vermitteln die Verbindung zwischen dem Angelhaken und dem 3 bis 4½ Meter langen Basttau, welches an dem Rohrbündel befestigt ist.

Meine Hütten in Neu- und Alt-Schescheke.
Haben die Krokodile in Schescheke in kurzem Zeitraume nacheinander mehrere Opfer gefordert, so werden auf des Königs Geheiß die Krokodil-Angeln ausgelegt. Man legt das Rohrbündel auf das Ufer, den mit dem Köder (in Verwesung übergegangenes Hundefleisch)[12] versehenen Angelhaken auf drei Rohrstöckchen, so daß derselbe am Uferrande 1½ Meter über dem Wasserspiegel wie auf einem Stühlchen ruht. Wittert das riesige Reptil den Köder, so schwimmt es in seine Nähe und verhält sich hier ruhig bis zum Anbruche der Nacht. Sich aus dem Wasser emporschnellend, erfaßt es den Köder mit seinen riesigen Kinnladen und würgt ihn hinunter. Doch die vorstehenden Hakenspitzen verhindern dieß, wie auch das Schließen der Kinnladen, wodurch dann das einfließende Wasser in den Schlund und in die Luftröhre eindringen kann. Es stürzt damit in die Tiefe, nach und nach ermatten seine Anstrengungen, sich von der mit den Widerhaken im Schlunde festsitzenden Angel zu befreien und das Thier treibt stromabwärts. Von diesem Kampfe gibt das an der Wasseroberfläche schwimmende Rohrbündel treues Zeugniß. Nach einer halben bis einer Stunde hat der Saurier ausgerungen und wird vom Strome ab und an eine Sandbank oder gegen das Ufer getrieben, wobei das Rohrbündel den Fischern das geköderte Thier verräth. In Schescheke wurden zuweilen auf fünf aufgestellten Angeln zwei bis drei Krokodile in einer Nacht gefangen. Gespeert werden die Krokodile nur, wenn man die Geangelten noch lebend antrifft, oder wenn man ihnen zufällig beim Fischspeeren, auf der Nilpferd-, Elephanten- oder Otterjagd begegnet. Gleich den Fischnetzen sind auch die Krokodilangeln königliches Eigenthum. Als nach einigen Tagen die fünf Angeln ausgesetzt waren, fand ich mich zeitlich am Flußufer ein, um den Erfolg zu beobachten. Drei der Angeln waren verschwunden, dafür sah ich drei der größeren Kähne mit je zwei Bootsleuten bemannt, flußaufwärts nach Schescheke zusteuern. Ein jedes derselben barg ein riesiges Krokodil, in dessen Leibe ein Mensch füglich Platz finden konnte. Die Thiere wurden nun an’s Ufer geschleppt und einige von Sepopo’s Leuten machten sich daran, ihnen den Kopf abzuschneiden; die Augenlider und Luftwarzen, sowie einige Rückenkammschuppen wurden als Heil- und Zaubermittel dem Könige überbracht.
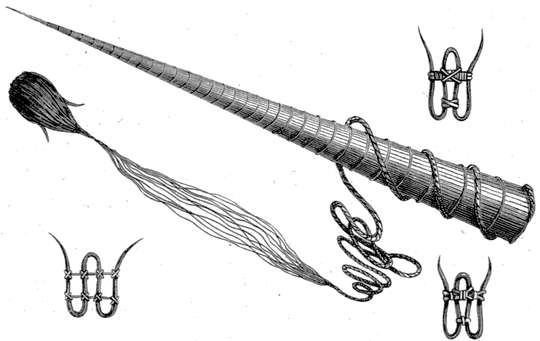
Krokodilangel.
Als ich eben daranging, die Leiche des vom Krokodile getödteten Mädchens beerdigen zu wollen, wurde ich von deren Verwandten mit den Worten daran verhindert: »Njambes Wille war es, daß sie das Krokodil tödtete, deßhalb muß sie auch dem Krokodile zur Beute werden.« Die Leiche wurde auch gegen Sonnenuntergang von den Krokodilen in die Tiefe gezerrt. An diesem Tage kam auch die Königin Lunga, um mir ihre vierzehnjährige Tochter, mit Namen Njama vorzustellen, sie war eben an Monalula, den ältesten Sohn Sepopo’s, einen Einfaltspinsel, verheiratet worden. Vor der Hochzeit wurde sie vier Wochen lang von ihrer Mutter sowie einigen anderen Königinnen in einem nahen Walde in einer Hütte einquartirt, wo sie die Zeit mit Fasten und Arbeiten zubringen mußte und von den Frauen in den Pflichten des Weibes unterrichtet wurde. Während dieser Zeit war ihr Wollhaar bis auf eine elliptische Stelle abgeschabt und mit Brauneisenstein eingerieben worden. Njama war eine Tochter des Makololo-Fürsten Sekeletu.
Am 25. fand ich auf einem Ausfluge im Walde ein Mankoë-Dorf. Die Leute, der schönste Menschenschlag im Marutse-Reiche, trugen bedeutend längeres Wollhaar, welches sie hoch aufkämmen, wodurch der Kopf wesentlich größer scheint. Sie waren nach Schescheke gekommen, um dem Könige bei dem bevorstehenden Elephanten-Jagdzug behilflich zu sein. Ich beobachtete bei ihnen nächst den Mabunda’s die schönsten Holz- und Hornschnitzereien, wenn diese Gegenstände auch nur Reise-Utensilien waren. Die Wohnungen dieser Leute bestanden in vier riesigen, zwei Meter hohen, zwei Meter breiten Längshütten, welche ein parallel laufendes Doppelhufeisen darstellten. Am Heimwege stieß ich auf mehrere Gräber der Masupia-Häuptlinge, welche mit Elfenbein geschmückt waren. Ferner fand ich Kalebassen, mit ihrer Oeffnung nach abwärts auf einem kleinen Termitenhügel ruhend, durch deren durchlöcherten Boden ein Stab eingeführt war, dieselben sollten mit dem in der Kalebasse befindlichen Knochenpulver nach der Ansicht der Marutse den Regen anziehen.
Im Laufe des Tages fand ich Gelegenheit, mir von Sepopo Aufklärungen über die Verwaltung des Landes und die Beamten-Hierarchie des Reiches geben zu lassen. Die letztere läßt sich in vier Kategorien scheiden, welche erstens am Hofe, zweitens in den verschiedenen Gebieten der einzelnen Stämme als Statthalter des Herrschers, Koschi, amtiren, drittens in Unterhäuptlinge, die diesen untergestellt als Kosana und Makosana das Amt eines Statthalters versehen, und viertens in Beamte, die sich nur mit der Person des Königs zu beschäftigen haben und im Range zwischen den beiden letztgenannten Classen stehen.
Zu den ersterwähnten Rangstellen gehören: a) der Höchst-Commandirende, zu Sepopo’s Zeiten war es ein Ehrenmann, mit Namen Kapella, ein dem König verwandter Marutse, der später von dem Letzteren zum Tode verurtheilt wurde; b) der Arsenal-Gouverneur, welcher das königliche Waffen- und Munitionslager unter sich hat, und im Auge behalten muß, wie viel und an wen die Gewehre vom Könige vertheilt werden. Unter Sepopo bekleideten zwei Masupia’s, Massangu und Ramakocan, diese Stelle; c) der Commandant der Leibgarde, der jedoch blos im Kriegsfalle seine Functionen ausübt; zu Sepopo’s Zeit war es dessen Cousin Monalula; d) der Commandant der jungen Krieger, die zur Kriegszeit eine besondere Heeresabtheilung bilden; unter Sepopo war es Sibendi.
In die zweite Rangklasse gehören die Statthalter, welche über die einzelnen von den verschiedenen bedeutenderen Stämmen bewohnten Provinzen gestellt sind und Civil- und militärische Gewalt in sich vereinigen. In Gebieten, wie in der Barotse, im Masupia-Mabunda-Lande, also in den umfangreicheren Provinzen, sind mehrere Chefs installirt und dann einem im Hauptorte der Provinz Residirenden unterstellt. Alle diese bisher genannten Würdenträger sind dem jedesmaligen Ober-Gouverneur der Barotse untergeordnet. Dieser Mann wird nach dem Regenten als die höchstgestellte Person betrachtet, unter Sepopo und auch nach seinem Tode bekleidete Ikambella diesen Posten.
In die dritte Rangclasse gehören die Unter-Häuptlinge, Vice-Statthalter, höhere und niedere Beamte über größere oder kleinere Städte und Dörfer, kleinere Landstriche und über Kolonien, welche ausschließlich für den König Viehzucht, Ackerbau, Jagd und Fischerei betreiben. Die Beaufsichtigung der regelmäßigen Ablieferung der dem Könige schuldigen Abgaben ist übrigens auch in allen anderen Provinzen eine hervorragende Amtspflicht der Beamten. Der größte Theil des Erträgnisses an Getreide wird an den Statthalter abgegeben, dieser sendet wieder den für den König bestimmten Theil dem Letzteren zu. Erlegen die Unterthanen ein Stück Wild oder schlachten Freie oder Sklaven, welche Vieh besitzen dürfen ein Stück davon, so wird das Bruststück an den Kosana, ist jedoch der Koschi im Orte oder auf der Jagd anwesend, an denselben, geschah es in des Königs Residenz oder in deren Nähe, an denselben als Königsstück abgegeben. Dies ist Gesetz. Die Unterhäuptlinge haben auch alle wichtigen Begebenheiten ihrem Koschi und dieser dem Regenten unverzüglich zu hinterbringen.
Die Würdenträger der letztgenannten Rangclasse bilden zum größeren Theile den »engen Rath des Königs« und stehen nach landläufigen Begriffen höher als die der dritten Rangclasse, thatsächlich aber sogar in des Herrschers Gunst höher als die Statthalter. In diese Kategorie gehören der Scharfrichter, zur Zeit Sepopo’s der bereits erwähnte Maschoku, fünf bis sechs Leibärzte, unter denen der alte Liva und sein Bruder besonders berüchtigt war, ferner des Königs Mundschenk, ein bis zwei Detective, der Aufseher, der in der Residenz stationirte Fischer und der oberste Kahnaufseher. Obgleich Sepopo die Verwaltung des Mabunda-Reiches seiner Tochter Moquai aus den Händen nahm, hatte sie doch, vom Volke als die eigentliche Herrscherin angesehen und geehrt, ihren eigenen Hofstaat, in welchem ihr Gemahl Manengo die höchste Stelle bekleidete, auch hatten sie einen Kanzler, einen Garde-Commandanten, die Statthalter ihres Reiches waren jedoch von Sepopo installirt worden. Außer den genannten Würdenträgern lernte ich noch die Häuptlinge Sambe, Premier der Königin Moquai, Nubiana, einen Marutse, ebenso Moquele und Mokoro, auch die beiden Masupia-Chefs Monamari und Simalumba kennen.
Sepopo umgab ein engerer und großer Rath. Der erstere war das »Werkzeug des Herrschers«, ein Haufe nicht minder grausamer Creaturen als der König es selbst war (unter Regentinnen ist er nicht vorhanden), der große Rath aber, der zum Theile aus Ehrenmännern besteht, war ziemlich machtlos und fristete unter Sepopo eine bloße Scheinexistenz, da die milden Urtheile der Mitglieder desselben, sowie sie dem Herrscher nicht zusagten, einfach ignorirt wurden, oder der engere Rath, der stets dem Könige gehorcht, zu den Berathungen zugezogen, wodurch der große Rath stets überstimmt wurde. Der große Rath bestand aus den Hof-Würdenträgern, aus Häuptlingen und Unterhäuptlingen, die zufällig die nächste Umgebung des Königs bewohnten. Obgleich Sepopo seinen Wohnsitz mehrmals wechselte, machte er doch die Erfahrung, daß ihm zwar anfangs die Mitglieder des großen Rathes zu Willen waren, später sich jedoch seinen Grausamkeiten, namentlich den zahlreichen Hinrichtungen der von ihm ob des geringsten Verdachtes schon des Hochverrates Angeklagten, widersetzten. Um den Widerstand des großen Rathes zu brechen, verfiel Sepopo auf den Gedanken, den großen Rath im Masupia-Lande, sowie die Häupter jenes der Barotse zum Tode zu verurtheilen, es war dies eine Gewaltmaßregel, welche nicht wenig seinen Sturz beschleunigte. Bei den Stämmen im Marutse-Reiche stand der große Rath in bedeutendem Ansehen, während man mit sklavischer Demuth zu dem engeren emporblickte.
Unter Sepopo’s Regierung führten zwei mumienartig aussehende Zauberdoctoren, der eben genannte Liva und sein Bruder, das Wort. Sie, welche schon mehreren Herrschern gedient hatten und eine mehr denn sechs Decennien dauernde Praxis hinter sich hatten, wußten dem mißtrauischen und äußerst abergläubischen Sinne Sepopo’s zu schmeicheln und ihn in seinem Aberglauben zu bestärken. So hatten sie sich in der Gunst der Stämme vom Vater auf den Sohn zu erhalten gewußt und waren weniger gehaßt denn gefürchtet, wenn sie auch oft die schrecklichsten Grausamkeiten anriethen. Wenn sich die Stämme nicht früher schon gegen Sepopo, diesen ungewöhnlichen Despoten erhoben, so beruht diese Schonung in dem Ansehen, das er als das Haupt des engen Rathes genoß und darin, daß er als ein Mann betrachtet wurde, der mit seinen Zaubermitteln leicht die gegen ihn ersonnenen Pläne entdecken und vereiteln konnte. Seine Grausamkeiten nahmen indeß an Häufigkeit zu. Die höchsten Beamten des Reiches waren vor ihm nicht mehr sicher, und doch wagte es Niemand, gegen ihn einen Assagai zu erheben. Da traf es sich, daß er öffentlich Zaubermittel ausstellte und dem Volke die Wirkung derselben erklärte, die jedoch ausblieb. Nun fielen den Leuten die Schuppen von den Augen, sie erkannten, daß die ganze Zaubermacht des Tyrannen Humbug sei, verloren die Furcht vor derselben und vertrieben ihn endlich.
Als ich am 26. mit Westbeech und einem Koschi über die Würdenträger des Marutse-Reiches sprach, theilte mir der erstere eine Episode aus dem Leben eines portugiesischen Händlers mit, welcher periodisch das Marutse-Reich zu besuchen pflegte. Ein nebenan stehender Häuptling warnte mich jedoch, vor dem Könige Anspielungen auf diese Episode zu machen, da es diesen immer in furchtbare Wuth versetze. Der genannte Händler, von den Eingebornen Intschau genannt, kam in der Regel mit hundert bis hundertzwanzig männlichen und zwanzig weiblichen Trägern nach der Barotse, er hielt einen förmlichen Hofstaat und trug seinen Reichthum an Prätiosen zur Schau, beschenkte auch den damals in der Barotse geladenen W., der ihm als Gegengeschenk ein Doppelgewehr übergab. Als nun Westbeech im Jahre 1874 Senhor Intschau in der Barotse traf, ordnete der König eine der großen Jagden an, wie sie jährlich während der Zambesi-Ueberschwemmungen abgehalten zu werden pflegen. Während derselben flüchten sich die Wasser-Antilopen des Zambesi-Thales (der Letschwe und Puku) in die überschwemmten, dem Flusse anliegenden Partien, was ihnen aber zum Verderben gereicht, da auf manchen Jagden bis zu vierzig Stück gespeert werden. Sie werden mit Kähnen gejagt und diese Jagden gestalten sich zu einem wahren Festtage der Marutse. Der König Sepopo hatte für seinen Gebrauch ein eigenes großes Boot, das eine Hütte trug, in welcher in den freien Augenblicken während der Jagd Bier getrunken wurde, welches die Städte und Dörfer, an denen man vorüberfuhr, liefern mußten. Jenes floßartige Riesenboot wurde von vierzig Bootsleuten gesteuert.[13]
Als sich nun Sepopo auf jene Jagd begab, lud er Westbeech ein, an derselben theilzunehmen, nicht aber den Portugiesen, worüber der letztere so erbittert war, daß er sich an dem Könige zu rächen beschloß. Wie schon erwähnt, standen in dem vom Könige allein bewohnten Gehöfte drei Häuser, jene in der Stadt Sola, die Sepopo damals bewohnte, waren namentlich solid ausgeführt. In Abwesenheit des Königs nahm sich nun Intschau die Freiheit, von dem königlichen Gehöfte Besitz zu ergreifen, wobei er dessen Schlafgemach in einen Düngerhaufen verwandelte. Die Bewohner von Sola hielten den Portugiesen im Besitze der königlichen Erlaubniß und berichteten dem Könige nicht eher die Invasion seines Gehöftes, als bis sie durch das Vorgehen des Fremden die königlichen Gebäude entehrt sahen. Als sie hörten, daß der König auf der Rückfahrt begriffen sei, reisten ihm die Solaner entgegen und berichteten ihm, was geschehen war. Der König wollte den Leuten nicht Glauben schenken und schickte einige Männer seiner Begleitung voraus, welche sich von der ihm angethanen Schmach überzeugen sollten. Die Abgesandten konnten nur die Aussagen der Solaner bestätigen, worauf der König Intschau auffordern ließ, Sola und sein Reich überhaupt sofort zu verlassen, welchem Befehle der Elfenbeinhändler auch wohlweislich nachkam.
Darauf berief der König den kleinen Rath. Seine Lieblinge, die vom Aberglauben umnachteten Rathgeber, hielten eine geheime Sitzung und kamen zu folgendem Beschlusse, den sie dem Könige und später auch dem Volke kundgaben. Sie sagten: »Intschau hätte nie eine solche Beleidigung gewagt, wenn er nicht im Besitze von sehr starken und ganz wundersamen Medicinen gewesen wäre. Der König dürfe daher nie mehr Sola und um so weniger seine Wohnung aufsuchen, es würde ihm, sowie auch seinen Unterthanen und dem ganzen Lande sehr großen Schaden bringen. Um all’ dies abzuwenden, hielten sie es für das Beste, daß die Einwohner Sola verlassen, daß sie wie der König all’ ihr Hab und Gut mit sich nehmen sollten und daß dann die Stadt dem Boden gleichgemacht, d. h. an allen Seiten angezündet, damit auf diese Weise die Gewalt der von den Portugiesen schon angewendeten oder noch hie und da verborgenen Medicinen und Zaubermittel vernichtet werde.« So geschah es auch.
Am 27. sollte endlich die lang besprochene Elephantenjagd abgehalten werden. Ein ungewöhnlich reges Leben herrschte schon mit dem ersten Morgengrauen in Schescheke. Das Königsgehöft war so mit Bewaffneten überfüllt, daß ich mich kaum durchdrängen konnte. Der König war eben im Begriffe, an dieselben Schießpulver und Kugeln auszufolgen. Ich eilte zu meinen englischen Freunden, um ihnen die Nachricht zu bringen, doch sie waren von einem Häuptlinge schon davon in Kenntniß gesetzt, ohne jedoch formell vom Könige dazu eingeladen worden zu sein, und rüsteten sich eben zur Jagd. Am lebhaftesten ging es zwischen dem königlichen Gehöfte und dem Flusse, sowie an demselben her, schreiend und lachend zogen und liefen einzelne zum Flusse herab, ich sah die Männer von Schescheke nie vorher so gesellig und dienstfertig einander begegnen. Es war wohl die Aufregung des Augenblickes, denn nur selten wurden solch’ große Jagden unternommen, man hatte sich schon seit Monaten dazu vorbereitet und ihr Reiz war um so höher, weil sie einestheils mehrmals aufgeschoben war und andererseits weil der König selbst mit drei Weißen sich an der Jagd betheiligen sollte. Am Ufer lagen Kahn an Kahn, auf dem jenseitigen hatte sich eine ganze Flottille eingefunden, deren Bemannung auf dem Sande campirte und jeden Augenblick abzustoßen bereit war. Auch den Fluß entlang zogen Schaaren, welche weiter abwärts an dem Flusse Kaschteja die herabkommende Flottille erwarten und von ihr auf das jenseitige Ufer übergesetzt werden sollten. Es waren meist Mankoë, Mabunda’s und die westlichen Makalaka’s, welche landeinwärts in Karawanen nach Schescheke gekommen waren. Am Ufer vor Schescheke hatte jeder Häuptling seine Leute geordnet, d. h. seine und die Kähne seiner Untergebenen waren an bestimmten Stellen aneinander gereiht und ihre Insassen harrten in denselben oder am Ufer, oder sie waren mit dem Einladen ihrer Karossen, Wassergefäße und Waffen beschäftigt, namentlich waren es ihre Gewehre, mit denen sie sich viel zu schaffen machten.

Jagd auf Wasser-Antilopen.
Schon war der König im Begriffe sein Gehöfte zu verlassen, als er von meinen englischen Freunden an sein ihnen so oft gegebenes Versprechen gemahnt wurde. Hier zeigte es sich nun deutlich, wie abscheulich der König an den Engländern gehandelt; trotzdem er sie so lange vertröstet und sie förmlich ausgesogen, hatten die Herren Alles willig gethan, um nur jedem seiner Wünsche nachzukommen, sie hatten kaum ordentliche Kleider mehr am Leibe, zweimal waren sie von Panda ma Tenka nach Schescheke nur dieser ihnen so angepriesenen Jagd halber herüber gekommen und nun trachtete Sepopo nochmals sie davon abzuhalten. Er that dies aus zwei Gründen, erstlich weil er gewohnt war, die erlegten Elephanten als seine Jagdbeute zu betrachten, wenn er auch selbst nicht einen einzigen erlegt hatte; es hieß immer, der König habe alle Elephanten geschossen, und dann, weil er die Neugierde der Weißen fürchtete, welche durch den Reichthum des Landes an Elephanten leicht zu öfteren Besuchen verleitet werden konnten. Von mehreren Häuptlingen gedrängt, gab er endlich nach und stellte den drei Jägern, sowie einem Händler mit Namen Dorehill, der den König schon ein Jahr zuvor besucht hatte, einen Kahn zur Verfügung.
Gegen Mittag reiste der König ab und die Flottille — am Ufer vor Schescheke standen allein etwa zweihundert Boote — setzte sich unter den Klängen von Sepopo’s Capelle in Bewegung. Ich bedaure nur, daß ich die Jagd selbst nicht mitmachen konnte, ohne des Königs Verdacht zu erregen, auf meiner Weiterreise durch sein Reich seine Elephanten belästigen zu wollen.
Die Abendstunden, welche ich nun in Gesellschaft W.’s zubrachte, benützte ich mit seiner Hilfe, um mit den Eingebornen über deren Sitten und Gebräuche zu sprechen und Erkundigungen einzuziehen. Während des Mahles am ersten Abende fand sich ein Marutse mit Namen Uana ca Njambe, d. i. Kind Gottes, ein, er hielt sich für sehr weise und wurde von Sepopo oft zu Rathe gezogen.
Am 29. blieb ich in unserem Gehöfte als Wächter zurück, während W. mit seinen Dienern auf die Jagd auszog, sie waren glücklicher als ich am Tage vorher, denn sie brachten einen Letschwebock heim, das arme Thier hatte nicht weniger als zehn Kugeln im Leibe. Ich glaube, daß keine Antilope so stark und mächtig entwickelte Halsmuskeln besitzt wie der Letschwe. Am 30. kamen mehrere Marutse in unser Gehöft, welche um die Stirne und Brust aus Schlangenhäuten gearbeitete Binden zu dem Zwecke trugen, um den Kopf- und Brustschmerz zu verscheuchen; sie belehrten mich, daß sie dieselben auch zur Abwehr des Hungers trugen, ähnlich wie dies die Makalaka’s mit Riemen und die Matabele mit Kattunstücken thun, indem sie sich damit den Unterleib zusammenschnüren. Am Abende kamen zwei Bootsleute von den vier auf die Elephantenjagd ausgezogenen Weißen, um ihnen Nahrung nachzuführen. Sie brachten die Nachricht, daß die Jagd bisher ohne Erfolg gewesen sei und am folgenden Morgen fortgesetzt werden solle. Nach einer Stunde kehrte Herr Dorehill und H. Cowley unerwartet zurück, sie schienen höchst enttäuscht und entrüstet. Sie waren mit Sepopo und den hervorragendsten seiner Leute in einem Schilfdickicht postirt, in welchem sie die zuerst von der Vorhut angetroffene Elephantenheerde erwarteten. Der König war unvorsichtig genug, schon aus einer Entfernung von sechzig Schritten zu feuern, so daß sich die Heerde sofort zur Flucht wandte, und nach allen Seiten in das Dickicht auseinanderstob. In des Königs Nähe lagen über achthundert Schützen und eben so zahlreich waren die Antreiber gewesen. Kaum daß sich die Elephanten zur Flucht wandten, feuerten nun alle ihre Gewehre auf diese los, viele legten dabei die Waffe gar nicht an die Wange an und so war es nicht zu verwundern, daß blos fünf Elephanten dabei getödtet wurden. Die beiden Jäger erzählten, daß sie sich zur Erde werfen mußten, um den Geschossen auszuweichen, denn die Kugeln flogen wie Hagel nach allen Seiten. Die ganze Masse der Antreiber benahm sich sehr ungeschickt und erzielte einen viel geringeren Erfolg, als ihn zwei Masarwa’s erreicht haben würden. Der König machte seiner Entrüstung über den Mißerfolg der Jagd in der gewohnten Weise Luft, indem er mit einem Stocke seine schwarzen Unterthanen so lange schlug, bis sein Arm erlahmte. Der König war mit allerlei Salben beschmiert auf die Jagd gegangen, welche Vorsichtsmaßregel er ein Molemo nannte, um sich leicht der Elephanten zu bemächtigen.
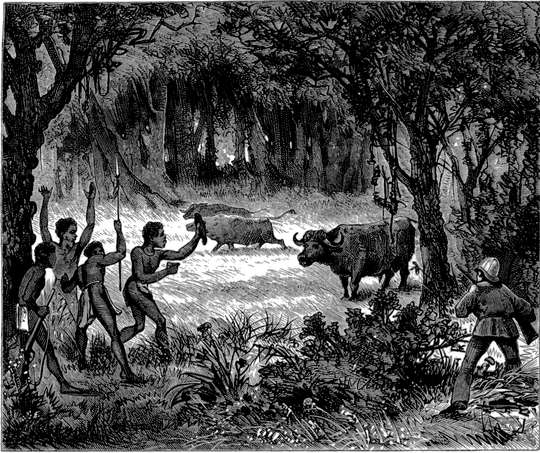
Büffeljagd.
Am 1. November machte ich einen größeren Ausflug nach dem Westen in den Schescheker Wald. Schon vor Sonnenaufgang passirte ich die Stelle, an welcher Alt-Schescheke gestanden und zog dann in westlicher Richtung weiter. Zu meiner Linken breitete sich das Thal des Zambesi, eine unabsehbare mit Bäumen und Schilfdickichten bewachsene Ebene aus, von zahlreichen hie und da bis Meilen langen, tiefen Flußarmen durchfurcht. Der Gehölzrand, an dem ich mich vorwärts bewegte, lag etwa zwanzig Fuß über dem Flußniveau. Manche der Lagunen erstreckten sich vom Flusse in nordwestlicher Richtung bis an das Gehölz, welches sie bis auf einige Meilen begleiteten, während sich der Fluß stellenweise bis drei Meilen von dem Gehölze entfernte. Etwa zehn Meilen von Schescheke ober einer der genannten Lagunen, erblickte ich zwei Schlangenhalsvögel. Diese Thiere bieten, auf einem kahlen, überhängendem Aste sitzend, einen eigentümlichen Anblick. Der niedrige gedrungene Körper und die kurzen Füße stehen in keiner Proportion zu dem dünnen langen Halse, der keinen Moment ruhig, meist schlangenförmige Bewegungen ausführt. Noch wunderlicher erscheint uns dieser Vogel, wenn wir ihn im Wasser schwimmen sehen, der gesammte Körper ist dann bis zur Hälfte des langen Halses in das Wasser eingesunken, nur das schmale mit einem sehr scharfen Schnabel versehene Köpfchen und die dünnste Halspartie ragt über das Wasser empor. Ich begegnete dem Plotus congensis in der östlichen Cap-Colonie und dann erst wieder am Zambesi. Es scheint kaum glaublich, daß das Thier seinen Hals derart erweitern kann, daß es handbreite Fische ohne besondere Beschwerden zu verschlucken vermag; es gelang mir, einige derselben zu erbeuten, obgleich sie in’s Wasser fielen und das Herausholen derselben mir und meinen vier Dienern der Krokodile halber, von welchen die Lagune wimmelte, etwas beschwerlich wurde. Weiter ziehend erlegte ich einen Francolinus nudicollis und nach einigen weiteren Schritten stießen wir auf frische Büffelspuren; diese führten vom Walde zum Flusse herab.
Wir folgten ihnen und kamen in den Wald zurück, dann an einem Eingebornendorfe vorüber und tiefer in den Wald hinein. Etwa drei Meilen vom Dorfe fanden wir neben den Spuren frische halbzerkaute Grashalme, die unsere Aufmerksamkeit auf das Aeußerste spannten weil wir uns die Thiere in unmittelbarer Nähe dachten. Der Niederwald von Schescheke ist in dieser Richtung zwar ziemlich dicht, doch sind die Bäume nicht hoch. Er umschließt viele hochbegraste Lichtungen und bildet gegen dieselben zu oft Gebüschdickichte von Unterholz welche das Vorwärtskommen äußerst erschweren.
Wir hatten nun in einer Partie des Waldes ganz frische Spuren bemerkt und bewegten uns mit größter Vorsicht vorwärts. Gebeugt gingen wir etwa drei Schritte von einander entfernt und musterten scharf die Umgebung. Tschukuru, der Matonga-Diener, war der erste, welcher den übrigen Dienern ein Halt gebot und sich vorbeugend, mir Wort »Narri« (Büffel) zuflüsterte. »Okaj (wo)?« frug ich, »kia hassibona narri (ich sehe keinen Büffel).« Tschukuru drückte leise an meine Schulter um mich zum Niederbengen zu bewegen, was die Anderen auch verstanden und sich je hinter einem Baume niederhockten. Der mir angegebenen Richtung folgend, sah ich etwa 120 Schritte vor mir einige dunkle auf der Erde liegende Körper, es waren vier Büffel, von welchen einer mit der Stirne zu mir gekehrt lag. Auf diesen legte ich nun an und feuerte. Wir erhoben uns sofort nach dem Schusse, um dessen Wirkung zu sehen; das in das Dickfleisch des Nackens getroffene Thier wälzte sich auf der Erde herum, doch im nächsten Momente sprang es wieder auf und mit ihm die Gefährten, die wir jedoch nicht deutlich zählen konnten, da sich die Büffel ziemlich dicht aneinander drängend zur Flucht gewendet hatten. Ich konnte nicht annehmen, daß das getroffene Thier schwer verwundet worden war.
Wir verfolgten die Thiere äußerst vorsichtig, denn mir sowohl wie den Dienern war die List eines erzürnten oder verwundeten Büffels wohlbekannt. Der Büffel vermag besser als das Nilpferd Feinde von fremden Gegenständen, die es nicht zu fürchten hat, zu unterscheiden und ist auch ungereizt dem unbewaffneten Menschen gegenüber ungefährlicher als das Hyppopotamus. Verwundet trachtet der Büffel bis zum letzten Momente seinem Gegner beizukommen, um ihn zu vernichten. Um dieses zu erreichen, befolgen die Thiere eine und dieselbe Methode, das Thier wendet sich zur Flucht und sucht sich hinter einem Gebüsch zu verstecken, um den folgenden Jäger zu erwarten, dann stürzt dasselbe hervor, um sich auf ihn zu werfen. Unglücksfälle solcher Art sind ziemlich häufig und selbst erfahrene Jäger, welche diese List des Thieres kannten, sind von dem südafrikanischen Büffel überlistet und schwer verwundet worden. In manchen Fällen begnügt sich dann das erzürnte Thier, mit gesenktem Kopfe auf diesen zu stürzen und ihn emporzuwerfen, was in der Regel eine Ausrenkung des Fußes oder einen Arm- oder Beinbruch zur Folge hat, doch manchmal macht das Thier auch von seinen Hufen Gebrauch und preßt den Körper des Niedergeworfenen mit den Hörnern zur Erde. So ist mir ein Fall, der sich am Limpopo ereignete, bekannt, in welchem ein Weißer und drei Schwarze getödtet und ein vierter Schwarzer von einem und demselben Büffelstier schwer verwundet wurde.
Zweihundert Schritte von der Stelle, an der wir die Stiere zuerst aufgejagt hatten, blieben dieselben stehen, und als wir uns näherten, konnten wir deutlich sehen, wie die vordersten unsere Witterung zu gewinnen suchten; als wir um fünfzig Schritte näher gekommen waren, wandten sie sich mit Ausnahme eines einzigen zur Flucht. Dieser folgte ihnen zuerst langsam einige Schritte nach und dann blieb er stehen, indem er sich hinter einem Baumstamme zu decken suchte. Ich hieß meine Begleiter stehen bleiben, um die Aufmerksamkeit der Thiere auf sich zu lenken, während ich tief gebeugt näher kroch, und dem Büffel eine Kugel in den Leib sandte; das Thier sank für einen Moment, erhob sich jedoch gleich wieder. Ich schlich abermals näher, indem ich mich unter dem Winde hielt, und von links, von der Seite her, dem Thiere aus fünfzig Schritte Entfernung eine Kugel zusandte. Dieser Schuß traf das Thier in die Brust und rasch folgte ein zweiter, der das linke Blatt durchbohrte, nach diesem Schusse wankte das Thier auf eine freiere Stelle, wo es in die Knie sank. Tanzend und singend liefen nun die Diener herbei. Ich aber sandte dem sterbenden Thiere aus einer Entfernung von zwanzig Schritten eine Kugel hinter das Ohr, worauf der Kopf zurückfiel, die mächtigen Füße sich ausstreckten und der Büffelstier unsere Beute war. Jetzt ließen sich die Diener nicht mehr halten und waren mit mehreren Sprüngen oben auf dem Cadaver, um es sich daselbst für einen Moment bequem zu machen. Ein großes Feuer wurde nun angezündet, und ein Stück des Büffelherzens am Feuer gebraten, dann ein Schenkelknochen herausgeschnitten und das Mark geröstet.
Gegen Abend verließ ich mit Narri die Stelle, um heimzukehren, während die übrigen Diener zurückblieben, um das Thier vollends zu zerlegen. Der wilden Thiere halber — Löwenspuren gab es in Menge und an dem Gehölzrande gegen die nächste Lagune zu Leopardenspuren — mußte das Fleisch auf einem Baume aufgehangen werden; da sich jedoch mit Einbruch der Nacht ein heftiges Gewitter entlud, waren sie nicht im Stande, Feuer anzumachen und mußten ebenfalls, auf dem Baume hockend die Nacht zubringen.
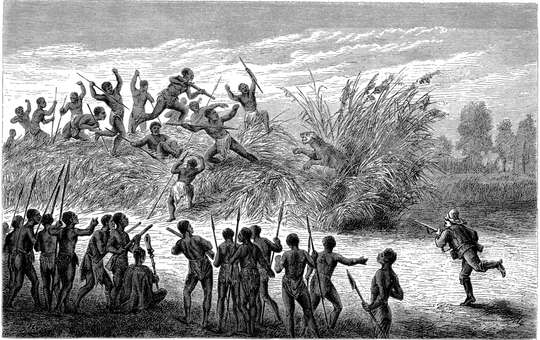
Löwenjagd bei Schescheke.
Als ich auf der Heimkehr eben die Stadt betrat, ward ein von zwei Fischern gelenktes, mit Fischen beladenes Boot von dem sich erhebenden Orkan umgeschlagen. Wunderbarer Weise gelangten beide unbeschädigt an’s Ufer dafür aber war der Fluß von einer Menge todter Fische bedeckt, welche die Strömung rasch dem Ufer zutrieb. Wie aus dem Boden gewachsen tauchten nun rechts und links am Ufer Jungen auf, welche es sich angelegen sein ließen, die ausgeworfene Beute sofort in Beschlag zu nehmen. Manche hatten schon ihr kleines von der Schulter herabgerissenes Ledermäntelchen vollgefüllt, als sich plötzlich unter ihnen eine wilde Bewegung bemerkbar machte und die mir zunächst Stehenden die Fische von sich warfen und die obere Uferpartie rasch zu gewinnen suchten. Der durch seine rothe Wolldecke gekennzeichnete Aufseher der Fischer nämlich war wie ein Raubvogel zwischen die beutelustige, am Strande versammelte männliche Jugend Schescheke’s eingefallen und ließ wacker den Stock auf dem Rücken der kleinen Freibeuter tanzen.
Am Morgen des 2. November war ich nicht wenig erstaunt, zahlreiche Bewaffnete nach dem im Westen der Stadt liegenden Walde eilen zu sehen; es konnte doch unmöglich ein Feind sein, dem es zu begegnen galt. Einige auf uns zuschreitende Männer lösten bald diesen Zweifel. Es waren Abgesandte, welche uns den Gruß ihres Häuptlings entboten und uns zu einer Löwenjagd einluden. Vier Löwen waren in des Königs Heerden eingefallen und hatten vier Rinder getödtet. Der von Westen fließende Zambesi machte etwa 150 Schritte oberhalb unseres Gehöftes eine plötzliche Wendung nach Norden, um sich nach einer kurzen Strecke unter einem rechten Winkel nach Osten zu wenden, und so Neu-Schescheke zu umspülen. An dem letzterwähnten scharfen Buge nach Osten zweigt sich eine Lagune nach Westen ab, welche sich in Arme theilt und an deren linkem nördlichen Ufer auf einer Halbinsel der Schauplatz der von den Löwen begangenen Unthat lag. Westbeech und Walsh fanden kein Vergnügen an der Jagd und lehnten die Einladung ab, Cowley und ich folgten derselben.
Cowley war ein angenehmer, achtzehnjähriger Jüngling mit einem rosigen Mädchengesicht; er war sehr zuvorkommend und hatte meiner Ansicht nach nur den einen Fehler, daß er um jeden Preis ein Gordon Cumming werden wollte. Auf einer Löwenjagd hätte er um ein Haar sein Leben eingebüßt; so jung er auch war, hatte er bereits zwei Löwen erlegt, ich fand nun seine Eile erklärlich, den dritten hinzuzufügen. Außer dem Häuptling waren etwa 170 Eingeborene anwesend, davon jedoch nur vier mit Gewehren bewaffnet. Später hatte ich Gelegenheit, zu beobachten, daß die Marutse nur in Fällen, wenn der Löwe ihnen einen Schaden zugefügt hat, mit einigem Muth auf denselben losgehen. Als ich nach einer halben Stunde um die Lagune bog, kam mir der ganze Troß entgegen, man folgte eben der größten der vier Löwenspuren, nachdem man noch zuvor die Hirten über den Vorgang befragt und den Thatbestand bis in’s kleinste Detail aufgenommen hatte. Da man es für unmöglich hielt, daß sich die Löwen so nahe an die Stadt wagen würden, wurden die königlichen Heerden auch in der Nacht auf einer freien Stelle gehalten, während die Hirten in kleinen gebrechlichen Grashütten schliefen.
Nachdem wir uns dem Zuge angeschlossen hatten, brach der ganze Haufe auf, einige Eingeborene, welche von zwei Hunden unterstützt wurden, verfolgten die Spur der Raubthiere. Dann kam Marancian in unserer Begleitung und hinter uns wälzte sich laut schreiend und gesticulirend der übrige Troß. Lange konnten wir indeß diese Marschordnung nicht beibehalten, sie war nur in unbebuschten Partien möglich, doch als die Spur durch Dorndickichte führte, durch welche kaum die Hunde durchschlüpfen konnten, suchte sich jeder durchzuarbeiten, so gut er konnte, dabei war es schwer möglich, sich schußbereit zu halten; noch unangenehmer war unsere Lage dort, wo die Spur durch ausgetrocknete, hochbeschilfte Vertiefungen führte. Indem wir nicht sofort des Thieres ansichtig wurden, sondern es erst nach einer mehr denn einstündigen Verfolgung erblickten, wuchs der Muth unserer schwarzen Begleiter, da sie der Meinung waren, daß der Löwe seiner Schuld bewußt, auf voller Flucht begriffen sei. Wir waren eben aus einer solchen Vertiefung auf eine mit Dornenbüschen bewachsene Düne gelangt, als die Hunde wüthend gegen eine zweite, unseren Weg kreuzende und in die erstgenannte einmündende beschilfte, etwa drei Meter tiefe und acht Meter breite Einsenkung lossprangen. Die Fährte war hier so frisch, daß das Raubthier sich eben verborgen haben mußte. Hier ließen wir den Troß der Eingebornen zurück und forderten sie auf, möglichst viel Lärm zu machen; ich umging die Terrainmulde an ihrem Beginne und stellte mich am gegenüberliegenden Rande schußbereit auf, während mein Begleiter seine Hunde in das Röhricht hetzte. Mehrere Eingeborne, darunter auch Marancian, hatten sich indeß zu mir gesellt.
Das Gebell der Hunde belehrte uns bald, daß das Raubthier uns umgangen und in unserem Rücken Posto gefaßt hatte. Da wir von dieser Seite dem Thiere nicht beikommen konnten, hoffte ich es von dem gegenüber und tiefer liegenden Rande des Röhrichtes zu erblicken und stieg deshalb nach abwärts, um es zu durchschreiten, wobei mir auch der ganze Schwarm der Schwarzen folgte. Wir standen nun etwa hundert Mann an der bezeichneten Stelle und suchten vergebens das Raubthier. Cowley hatte sich am linken Flügel aufgestellt, ich wählte mir die zum Schusse geeignetste Stelle, und zwar dem vermeintlichen Verstecke gegenüber. Da jedoch weder Schreien, noch das Werfen von Holzstücken und Assagaien irgend welchen Erfolg hatte, so ließ ich die noch immer nachströmenden Schwarzen die von mir erst wenige Augenblicke zuvor eingenommene Stelle, wo ich von dem Löwen umgangen worden war, dicht besetzen und mit ihren langgestielten Assagaien das Dickicht durchwühlen. Es war ein Höllenlärm, alle schrieen aus Leibeskräften und hielten ihre Wurfspeere zum Gebrauche bereit. Marancian stand etwa zwanzig Schritte vor mir, von seinen mit Gewehren bewaffneten Unterthanen umgeben. Je länger das Thier in seinem Verstecke verharrte, desto mehr wuchs der Muth der Angreifer. Plötzlich, wie das Aufleuchten eines Blitzes, wirft sich eine Löwin mit einem Satze aus dem Gebüsch in das Schilfdickicht vor uns und bevor noch die Wurfgeschosse sie erreichen konnten, erfolgte ein zweiter Satz, mit welchem die Löwin laut aufbrüllend fünfzehn Schritte rechts von mir mitten in die Doppelreihe der schwarzen Jäger sprang. Leider war es mir in diesem sonst günstigen Momente des dichten sich zwischen mir und dem Thiere befindlichen Menschenknäuels halber nicht möglich, das Gewehr abzufeuern. Die Löwin hatte die Menschen nieder- und auseinandergeworfen, ohne sie arg verletzt zu haben und war dann mit einem dritten Satze in einem überaus dichten, zwei Schritte hinter uns beginnenden, an zwölf Fuß hohem Dickichte verschwunden. Sofort wandten wir uns alle dem neuen Schlupfwinkel der Löwin zu. Marancian befahl seinen Leuten, das Schilfrohr niederzubrechen und das Raubthier nach der entgegengesetzten Seite zu drängen. Was uns alle befremdete, war das Verstummen der Hunde, sie waren inzwischen in das Dickicht eingedrungen und erst, als sich die Leute an das Brechen des Schilfrohres machten, hörten wir ihr von der Wiese herüberschallendes Gekläffe.
Wir eilten so schnell, als uns unsere Füße nur trugen, auf die Wiese und sahen die Löwin in weiten Sätzen dahinjagen und die Hunde unmittelbar auf ihren Fersen. Ich sah meinem armen Freunde den Verdruß an, seine früher eingenommene Stelle verlassen zu haben. Die Scene, die nun folgte, wäre wohl des Griffels eines Künstlers werth gewesen. Vergegenwärtigen wir uns eine nach Südwest und West von Schilfrohr-Dickichten, nach Norden von einem Gebüsch umsäumte, an 800 Meter lange und 600 bis 700 Meter breite, hochbegraste Wiesenfläche. Auf dieser als den vordersten Gegenstand der sich dahinbewegenden Gruppe die gelbliche, sich momentan über das hohe Gras emporschnellende Gestalt der flüchtenden Löwin, dann die kleineren, jedoch nur seltener sichtbaren der Hunde und dann der gesammte Troß der Verfolger, an zweihundert dunkle Menschengestalten, die einen trabend, die letzten raschen Schrittes folgend, die vordersten jedoch einander in schnellem Laufe überbietend. Die meisten bis auf die rothen, weißen, carrirten oder ledernen, braunen Schürzen, vollkommen entblößt, nur wenige mit über die Schulter geworfenen Karoßmäntelchen, die bei dem raschen Laufe und den hohen Sprüngen lustig im Winde flatterten. Die Einen schwingen die langen Waffen, die Anderen haben ihre Speere geschultert, und während die vorderste durch die Flucht der Löwin ermuthigte Schaar lautgellende Schreie ausstößt, beginnt die Nachhut die Melodie zum Löwentanz. Etwa 800 Meter von ihrem letzten Schlupfwinkel nahm die Löwin abermals in einem Schilfrohr-Dickicht von dreieckiger Form, im Umfange von siebzig Metern, ihre Zuflucht. Dieses Dickicht war an seiner nördlichen, langen Seite von einer zehn Fuß hohen, bebuschten Sanddüne begrenzt. Marancian faßte mit seinem Stabe von etwa sechzig Schwarzen circa acht Meter vor dem Röhricht Posto; ich etwa fünf Meter der Basis des schilfigen Dreieckes gegenüber (an seinem Ostrande). Cowley stand etwa dreißig Schritte hinter mir und hinter einem Busche auf der Düne, da er sich dachte, daß die Löwin von unten gedrängt, nach aufwärts längs der Düne zu entkommen trachten werde. Etwa zehn Eingeborne hatten sich zu meiner Seite postirt. Nun folgte die vielleicht interessanteste Episode dieses Abenteuers. Von Marancian theils durch Worte aufgemuntert, theils auch fühlbar mit seinem langen Stabe dazu angespornt, begannen die meisten der Jäger von seiner Seite her das Schilfrohr in der Mitte seiner Höhe zu brechen und sich darauf zu schwingen. Das Schilfdickicht vor mir verwandelte sich nach und nach in eine schwankende, dunkelgrüne, prasselnde, vier Fuß hohe Gerüstdecke, auf der sich vierzig schwarze Gehalten in einer so eigenthümlichen Weise herumtummelten, daß man trotz des Ernstes der Situation das Lachen nicht unterdrücken konnte. Dabei wurde geschrieen und mit der freien Hand gesticulirt, daß man eine Schlachtscene vor sich zu sehen glauben konnte. Bei allen den Bewegungen war es jedoch für die Leute äußerst schwierig, das Gleichgewicht auf der schwankenden Rohrdecke zu behaupten, hier fiel einer der Länge nach kopfüber, dort zwei nach rückwärts.
Die Scene änderte sich jeden Augenblick. Man hatte von der Spitze des Dreieckes begonnen und arbeitete gegen seine Basis, gegen uns zu, und hatte so allmälig das ganze Dickicht bis auf eine kleine Ecke (Dünenecke) niedergebrochen; die Löwin war unstreitig immer mehr zurückgewichen und wir mußten sie jeden Augenblick hervorstürzen sehen. Um so gespannter und aufgeregter schien alles, nur Marancian nicht, der noch immer auf seinem Platze in aller Gemüthsruhe saß. Plötzlich erschallt ein zorniges Brummen und aus dem noch ungebrochenem Schilfe stürzt die Löwin auf ihre Angreifer hervor. Von diesen feuert einer einen Schuß ab, die Kugel schlägt in den Sand zwischen die Leute zu meiner Rechten ein, die meisten der Braven auf der schwankenden Decke fallen aus Bestürzung zurück, ein guter Theil wird unsichtbar, von den Hintersten werfen einige die mächtigen Wurfspeere auf das Thier, welches nach dem Ausfalle sofort wieder in seinen Schlupfwinkel zurückkehrt und sich hier niederkauert, um einen rettenden Sprung auf die Düne zu wagen. In diesem Momente den Kopf des Thieres erblickend, springe ich heran und feuere aus einer Entfernung von zwei Metern, drei Speere fallen zu gleicher Zeit in das Dickicht ein und treffen das Raubthier, dessen Brummen aufgehört hat. Das Thier war todt, doch um sicherer zu sein, feuern ich und Cowley zu gleicher Zeit und zwanzig Speere senken sich noch überdies in den Körper der Löwin, bevor man sie herauszog. Nun kam jeder der Schwarzen herbei und einen Spruch murmelnd bohrte er seinen Assagai in den Leib des Thieres. Da die Löwen des Königs Ochsen getödtet hatten, mußte der Schädel des Thieres als ein Beschwörungsmittel dienen und über dem Viehkraal in Schescheke aufgehangen werden.
Ich kehrte mit Cowley heim, während unsere Trophäe am Nachmittage unter Sang und Klang zur Stadt gebracht wurde. Vier kräftige Männer trugen an zwei Pfählen (die Vorder- und Hintertatzen des Thieres waren zusammengebunden worden) die Löwin, so daß ihr Kopf beinahe auf der Erde schleifte. Bei ihrer Annäherung — es war beinahe um dieselbe Zeit, als meine Diener mit dem Büffelfleisch heimkehrten — zog ihnen der Rest der männlichen Bevölkerung entgegen. Man musizirte auf der schon erwähnten Löwentrommel und führte dabei den Löwentanz auf. Die Menge ordnete sich hierbei in zwei Gruppen, die Träger der Beute und die Jäger. Diese wurden von dem Würdenträger, der den Kampf geleitet, eröffnet; ihm folgten diejenigen Jäger, die dem Thiere am nächsten gestanden hatten, während sich in der Mitte der Menge der Musiker, ein Tambour, befand. Die Tänzer bildeten plötzlich aus der Gruppe nach rechts, links und vorne hinausrennende, mit Schild und Speer den Löwenkampf versinnlichende Jäger, die den regsten Antheil an der Jagd genommen hatten. Der Gesang der zweiten oder tanzenden Gruppe, der von der vorderen beantwortet wird, ist nicht so monoton wie bei anderen Gelegenheiten, wird jedoch durch die Töne des Instruments, die ihn begleiten, sehr verunglimpft.
Als der Körper des Thieres unter den beiden Mimosen niedergelegt wurde, untersuchten ich und Cowley die Wunden und fanden, daß mein erster Schuß die linke Schädelhälfte der Länge nach durchbohrt hatte. Nach dem Schusse lag die Löwin auf der Erde und von ihrem Gesichte war nur ein kleiner Theil unter den Augen sichtbar geworden. Dorthin drang meine zweite und auch Cowley’s Kugel ein; ich fand sie in dem zerschmetterten zweiten Halswirbel, während sich die kleine Bleipille meines Freundes an den scharfen unteren Schädelknochen in Atome zersplittert hatte.
Mit der Aufzeichnung dieser Löwenjagd war auch das mir von Westbeech geschenkte und aus seinem Tagebuche geschnittene Papier, das letzte, dessen ich überhaupt habhaft werden konnte, ausgegangen, ich nahm nun meine Zeitungen, die ich in Schoschong erhalten und zwischen denen ich Pflanzen zu pressen pflegte, zu Hilfe, schnitt die freien Ränder ab und klebte sie mit dem Gummi der Mimosen zu Blättern zusammen.
Am nächsten Tage beehrte mich Marancian mit seinem Besuche und wir sprachen mit W. über die Barotse, das Mutterland der Marutse. Marancian meinte, ich würde, da ich Alles unter den Leuten in Schescheke so beobachte und Häuser und all’ die Dinge in mein lungalo (Buch) eintrage, weit schönere Bauten und Dinge in den Städten der Barotse sehen und er machte mich namentlich auf die Denkmäler der Könige aufmerksam. Mich freute diese neue Aufmunterung zur Reise nach dem schon von Westbeech, dann eingehend vom Könige, von den Häuptlingen Rattau, Ramakocan, den Königinnen, Moquai und den Portugiesen besprochenen Lande. So kamen wir auch auf des Königs verstorbenen Thronfolger Maritella zu sprechen. Nach seinem Tode ließ der König das zur Stadt und ihrer Umgebung gehörende Vieh auf dem Grabe zusammentreiben und hier mehrere Stunden stehen, bis die Thiere durstig und hungrig geworden, Ihren Unmuth durch Gebrülle kundgaben. »Seht,« sprach der Herrscher, »auch die Thiere trauern um Maritella, mein Kind.«
An diesem Tage kehrte der König mit seinen Leuten von der großen Elephantenjagd zurück. Er war höchst unmuthig und mit dem Erfolge derselben in jeder Beziehung unzufrieden. Am 2. hatte man in den Sümpfen in der Nähe von Impalera über hundert Elephanten getroffen, jedoch nur vier davon erlegt. Nicht weniger als zehntausend Schüsse waren gegen die Thiere abgefeuert worden. Am Abend sah ich bei dem König die erbeuteten Hauer. Zwei à 60, sechs zwischen 25 und 30 Pfund Gewicht, vier kleine Kuhhauer und vier werthlose Zähne junger Thiere. Dabei waren die zwei größten durch die Kugeln arg beschädigt worden.
In der letzten Zeit war es in Schescheke recht empfindlich warm geworden, so daß man durchaus nicht mehr eine Jacke am Körper ertragen konnte. Um so schwüler war es in meiner fensterlosen Grashütte und wahrhaft unerträglich, wenn die über einen Fuß starke, nasse Graslage, die auf dem Schilfrohrgerippe lag, auszudünsten begann.
Am 7. machte ich einen abermaligen Ausflug, diesmal nach Nordost, es war die längste Fußreise, die ich je zu Stande gebracht, etwa 52 englische Meilen. Schon etwa um zwei Uhr hatte ich Schescheke verlassen, durchschritt den westlichen Theil von Blockley’s Kraal bis an den Kaschteja hin und verfolgte dann den Fluß aufwärts, indem ich vergeblich eine passende Uebergangsstelle suchte. Das Thal am unteren Laufe des eben genannten und schon mehrmals erwähnten linken Zambesi-Zuflusses ist flach, wiesig, von Niederwald umsäumt. Bis zum Kaschteja trafen wir Zebras, gestreifte Gnu’s, Letschwe- und Puku-Antilopen, Rietbock- und Steinbock-Gazellen, im Thale des Kaschteja den Orbecky und Rietbock in Heerden, eine Erscheinung, die weder ich noch ein anderer Jäger zuvor beobachtet hatte.
Die englischen Offiziere wollten am 8., höchst unzufrieden mit dem Aufenthalte in Schescheke, die Stadt verlassen, doch sie waren nicht im Stande, Kähne von Sepopo zu erhalten, um nach dem Tschobethal und Panda ma Tenka zurückkehren zu können. Auch am 9. schlug Sepopo ihre abermalige Bitte ab. Heute kehrte auch Blockley von Panda ma Tenka mit einer größeren Anzahl von Gewehren zurück; ich war froh, den freundlichen Mann, der mir so viele Dienstleistungen erwiesen, wiederzusehen, und machte mit ihm einen Besuch beim Könige, der mich wahrhaft beglückte, denn nunmehr sollte mein längst gehegter Wunsch in Erfüllung gehen. Der König war gesonnen, das mir gegebene Versprechen baldigst zu erfüllen. Er theilte uns mit, daß in nächster Zeit die von der Barotse zu Besuche gekommenen Königinnen sowie Moquai nach dem letzteren Lande zurückkehren würden, und daß ich in ihrer Gesellschaft reisen solle; ich konnte keine einflußreicheren Begleiter als jene von den Völkern so hochgeehrten Frauen haben.
Als ich gegen Mittag Sepopo zum zweiten Male besuchte, fand ich sein Gehöft mit Menschen gefüllt und als ich in das Haus eintrat, fragte mich der König, ob ich schon Maschukulumbe gesehen hätte, da ich es verneinte, nahm er mich bei der Hand, führte mich vor sechs auf der Erde hockende Menschen, die mir fremd und einer eingehenderen Betrachtung werth schienen. Sie waren von schwärzlicher Hautfarbe und hatten alle einen weiblichen Zug in ihrem Gesichte, die meisten eine Adlernase. Jener Zug rührte von der Bartlosigkeit der Gesichter, sowie davon her, daß ihre Oberlippe stark eingefallen war. Eine weitere Eigentümlichkeit der fremden Besucher war, daß sie mit Ausnahme ihres Scheitels alle behaarten Theile an ihrem Körper rasirt hatten, besonders auffallend war aber die Haarfrisur, welche sich auf ihrem Scheitel auftürmte. Sepopo berichtete mir, daß es Maschukulumbe seien, welche nach Osten und Norden die Grenznachbarn seines Reiches bilden. Vom Könige und mehreren Häuptlingen befragt, berichteten sie, daß die Stämme der Maschukulumbe unter folgenden Fürsten leben. Sialoba, Mokobela, Kajila, Wuengwa, Kasenga, Kaingo, Musanana, Similindi, Kasamo, Kanjambo und Nadschindu. Die Anwesenden waren Abgesandte, welche alljährlich mit Geschenken zur Begrüßung des Herrschers an den Marutse-Hof kommen und nach einigen Wochen mit Gegengeschenken heimkehren. In ihrem Lande gehen sie vollkommen nackt einher, nur die Frauen pflegen sich Eisenglöckchen an einem Riemen um den Leib zu hängen. Der Stolz der Maschukulumbe ist ihr Haar, es ist auch in der That sehenswerth. Auf der Höhe des Scheitels, fest mit dem Kopfe zusammenhängend, ruht ein kegel- oder kegelstutzförmiger, aus mehreren Lagen aufgebauter Chignon. Die einen Lagen sind aus horizontalen, die anderen aus verticalen, bei einem zweiten aus sich kreuzenden, bei dem anderen wiederum aus parallel laufenden, kunstvoll geflochtenen Zöpfchen gebildet und mit einer Gummilösung durchtränkt, so daß das Ganze als ein aus dem Haare des Trägers allein bereiteter Bau angesehen werden könnte; doch dem ist nicht so. Periodisch schabt der Maschukulumbe bis auf eine kreisrunde, bis fünfunddreißig Zentimeter im Umfange messende Cranium-Fläche das wollige Haar von seinem Körper ab. Auf die am Scheitel stehenbleibende Wolle wird nun der thurmartige Chignon aufgebaut; das durch das periodische Abschaben gewonnene Haar wird aufbewahrt, bis eine hinreichende Menge zur Verfügung steht; um diese jedoch in möglichst kurzer Zeit zu erlangen, erlaubt sich der Gemahl auch den Kopf etc. seiner Frauen, seiner Sklaven und die Köpfe aller der im Kriege erschlagenen Feinde abzuschaben, und das so gewonnene, für den Maschukulumbe unschätzbare Material mit Hilfe von Gummi mit seinem Eigenen zu verbinden, und dann in kleine Zöpfchen zu flechten. Die längste dieser Frisuren endete in einen 1.03 Meter langen Schweif. Sie war nach rechts geneigt, beugte sich der Mann nach vorne, so senkte sich auch der ganze Haarthurm. Diese Frisur hatte einen Umfang von sechsunddreißig Zentimeter, die anderen waren zwanzig bis dreißig Zentimeter hoch. Die Temporalmuskeln waren zu fingerdicken Strängen entwickelt, nur dadurch konnte der Kopf auch die große Last auf dem Cranium tragen. Die eingesunkenen Oberlippen waren durch das Aussprengen der oberen Schneidezähne bedingt, welcher Proceß bei den Maschukulumbe ähnlich wie die Boguera bei den Betschuana’s zur Zeit ihrer Mannbarkeit oder vor derselben, also in der Abhärtungsperiode des Knaben vorgenommen wird. In ähnlicher Weise brechen sich ein nördlich vom Zambesi wohnender Makalakastamm und die an seinen beiden Ufern wohnenden Matonga’s die oberen mittleren Schneidezähne und thun dies aus einem Motiv der Eitelkeit. Die Matonga-Frauen sind der Ansicht, daß nur Pferde mit allen Zähnen fressen, die Männer jedoch sollen kein Pferdegebiß haben.
Der König war an diesem Tage mit den Seinen beschäftigt, aus den Blattrippen der Saropalme ein Musikinstrument zu schneiden, die concave Fläche desselben wurde mit Ausnahme der Enden tief ausgefurcht und an der convexen, rückwärtigen Außenfläche zahlreiche zwei bis drei Millimeter breite seichte Furchen eingeschnitten, das Instrument wurde dann beim Elephantentanze mit einem Stäbchen gestrichen.
Westbeech, Dorehill und Cowley verließen am 10. Schescheke, um nach Panda ma Tenka zu gehen, während sich Sepopo noch immer weigerte, den beiden englischen Officieren, welche sehnlichst abzureisen wünschten, Kähne zur Verfügung zu stellen. Am 11. zog der König, von einem Haufen seiner Unterthanen begleitet, durch die Stadt und führte laut singend den Mokoro- oder Bootstanz auf. Unter den Klängen der Schiffermelodie wurde eine Bootfahrt versinnlicht. Der Vortänzer, hier der König, machte die Gesten des Bugruderers, der ihm folgende Schwarm, etwa siebzig seiner Unterthanen ahmten die Backbordmänner nach. Da ich die Hoffnung nicht aufgab, Sepopo werde die englischen Offiziere ziehen lassen, arbeitete ich neue Feuilletons für englische und heimische Blätter aus und übergab ihnen dieselben sowie meine Correspondenz zur freundlichen Weiterbeförderung. Sie waren schon im Begriffe in die Boote zu steigen, als sie abermals von Sepopo zurückgehalten wurden; endlich gab er nach. Da waren es aber die von den Engländern gemieteten Diener, welche sich die unfreundliche Behandlungsweise ihres Königs zum Muster nehmend, nicht minder unverschämt betrugen. Durch meine Intervention gelang es indeß, auch diese zur Vernunft zu bringen und den Officieren die Abreise zu ermöglichen. In den letzten Tagen hatte sich eine der Sommerplagen von Schescheke, die Mosquito’s, recht bemerkbar gemacht und ließen mich kaum zur Ruhe kommen.
Am 16. wurde abermals von den Marutse des notwendigen Köders halber eine Hetzjagd auf einen Hund unternommen, da eine Frau beim Baden wieder von den Krokodilen getödtet wurde. Auf meinem Rundgange durch die Stadt kam ich eben dazu, als ein Menschenschwarm nach dem Flusse hinstürzte; demselben folgend kam ich zu den zwei Mimosen, in deren Nähe eben zwei riesige Krokodile an’s Land gezogen wurden.
Seit einigen Tagen fiel jeden Nachmittag Regen und am frühen Morgen so reichlicher Thau, daß ein Ausgang vor zehn Uhr ein Morgenbad genannt werden konnte. In den meisten Partien war das Gras drei Fuß hoch.
Am 20. machte ich wieder einen Ausflug nach Nordost und schoß eine Steinbock-Gazelle, dabei war meine Ausbeute an Coleoptera äußerst reich. Am folgenden Tage machte ich einen größeren Ausflug nach Norden. Ich verließ Schescheke noch vor Tagesgrauen und kehrte gegen sechs Uhr Abends heim. Trotz des starken Thaues und der sonstigen Mühen fühlte ich mich durch neue Beobachtungen und die gewonnene Beute reichlich entlohnt. Ich fand manche Theile des Waldes mit einem hohen umfangreichen Busch, der von Tausenden großer weißer Blüthen bedeckt war, dicht bestanden. Diese Blüthen dufteten so herrlich, daß die Luft im Walde von einem starken, förmlich berauschenden Wohlgeruche geschwängert war. Auf einer der tief im Walde liegenden Lichtungen fand ich zwei zuvor noch nicht beobachtete Lilien, die eine zeigte eine schöne violette Blüthe; an der zweiten fand ich einen ockergelben Blattkäfer, an den jungen Trieben des Mutsetlabusches eine zweite rothblaugestreifte und zwei mir noch neue Rüsselkäfer-Arten. Am Heimwege erhaschte ich an zwei weißblühenden Büschen drei Arten kleiner Rosenkäfer und in einer ausgetrocknete hochbegrasten Bodeneinsenkung, die auf meiner zweiten Reise erwähnte, im Lande Seschele’s angetroffene Litta Spec.
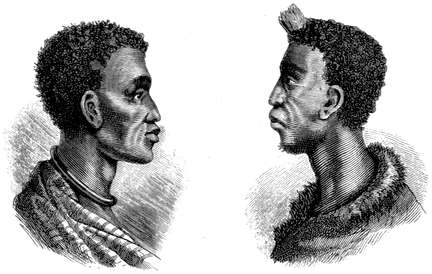
Mabunda. Makololo.
Abends erschien der König in unserem Gehöfte und lud mich und Walsh auf einen Becher Honigbier ein; während des Nachtmahls fertigte der König einen Proceß ab. In der Stadt hatte eine Schlägerei (ein sehr seltenes Ereigniß) stattgefunden, und ein Mann war dabei von seinen Genossen mit dem Widerhaken eines Assagai verwundet worden. Sepopo verurtheilte die Leute zur Zahlung eines Schmerzengeldes und als die Schuldigen (es waren Makalaka’s, welche am Kaschteja wohnen) ihre Insolvenz betheuerten, befahl er ihnen, dem Verwundeten eines ihrer Rinder zu geben, und durch zwei Monate in den königlichen Feldern den Königinnen bei der Ausübung ihrer Arbeiten behilflich zu sein. Am 23. kehrte Bauren über Impalera von Panda ma Tenka nach Schescheke zurück. Er berichtete, daß mein früherer Diener Pit von einem Büffel verwundet worden war und daß Westbeech auf seinem Wege nach Impalera einen Büffel erlegt habe. In Folge der letzten Regen hatten sich die Lachen und Senken in den Gehölzen gefüllt und das Wild sich von der am Zambesi anliegenden Wildebene Blockleyskraal in den Wald zurückgezogen. Am Nachmittage untersuchte ich die beiden Fischspecies Tschi-Mo und Tschi-Maschona, doch sollte ich den Tag nicht beschließen, ohne noch Zeuge einer unerquicklichen und bedauernswerten Scene zu sein, durch die ich die der Königin Moquai gezollte Achtung bedeutend geschmälert sah.
Da ich mich am 24. auf eine Büffeljagd begeben wollte, zog ich mich etwas zeitlicher in meine Hütte zurück. Es mochte etwa neun Uhr Abends sein, als ich ein lautes Weinen vom Flusse her vernahm. Anfangs achtete ich nicht darauf, doch bald wurde dasselbe von einem dumpfen Gebrause menschlicher Stimmen übertönt und erweckte meine Neugierde. Narri, einer meiner Diener, den ich abgesendet, um mich über die Ursache dieser Bewegung aufklären zu lassen, stürzte wenige Minuten später ganz außer Athem zu mir und berichtete, daß die Königin Moquai eben eine ihrer Dienerinnen ertränken lasse. Ich konnte eine solche Handlungsweise von Moquai nicht glauben und eilte zum Flusse, um mich zu überzeugen.
Mehrere Gruppen von zankenden und schreienden aber auch lachenden Menschen belagerten das Ufer, an welches man eben einen anscheinend leblosen Körper einer Sklavin trug. Auf dem Wege nach Moquai’s Wohnung, wohin man diese weiter schleppte, erfuhr ich auch den Sachverhalt. Das vor uns liegende Mädchen, das indessen wieder ihr Bewußtsein erlangt hatte, war eine Dienerin (Sklavin) Moquai’s. Tags zuvor hatte Moquai der Dienerin bekannt gemacht, daß sie ihr einen Mann, einen Mabunda, einen häßlichen Holzschneider, zum Gemahl bestimmt habe. Als Zeichen ihrer Unterwürfigkeit kreuzte die Sklavin ihre Hände über der Brust, doch brach sie im selben Momente in ein lautes Schluchzen aus, ein deutlicher Beweis, wie sehr ihre Gefühle der aufgedrungenen Wahl wiederstrebten. Darüber wurde die Königin so unwillig, daß sie ihre Magd sofort entließ. Moquai, die etwas Aehnliches noch nicht zuvor beobachtet, berief das Mädchen noch einmal vor sich. Als die Königin ihren Befehl wiederholte, wagte es die Sklavin zu widersprechen. Sie wollte ihrer Herrin treu dienen, von dem ihr aufgedrungenen Alten jedoch nichts wissen. Moquai fühlte sich durch diesen Widerstand beleidigt und erzürnt und ließ den Bräutigam rufen und bedeutete ihm, in der Stille der Nacht seine Braut an den Strom zu führen und sie so lange unter Wasser zu halten, bis sie beinahe erschöpft sei, sie dann herauszuziehen und im bewußtlosen Zustande in seine Hütte zu bringen, damit sie aus ihrem Todesschlummer als eine Mosari (eine verheiratete Frau) erwache.
Die Sonne stand schon hoch am Himmel, als am nächsten Morgen Gesang und Trommelschlag aus Moquai’s Gehöfte an mein Ohr schlugen. Vor der Hütte der Neuvermählten wurde der Hochzeitstanz aufgeführt. Ich sah zehn Männer, welche die Füße hoch emporhebend, sich langsam gehend und gleichzeitig vorwärts bewegend, eine elyptische Bahn beschrieben. In der Mitte der Tanzenden stand ein schreiender Sänger, der sich in entgegengesetzter Richtung drehte und mit einem Laubzweige den Tact angab. Die Tänzer waren sämmtlich mit Schürzen aus rauhgargearbeiteten Thierfellen bekleidet (meist Thari- und grauen Fuchsfellen). Manche hatten ihre Waden mit drei bis vier Reihen angefädelter, aus Fruchtschalen verfertigter Schellen behangen. Der Gesang des in der Mitte Hüpfenden wurde vom Schlage zweier Langtrommeln begleitet, vier andere Tänzer hockten auf der Erde, um die müde gewordenen abzulösen. Unter den Tanzenden drehten sich auch zwei kaum zehnjährige Knaben; später gesellten sich zahlreiche Vorübergehende hinzu; namentlich um sich nach dem Tanze an dem Kafirkornbier gütlich zu thun, das die Königin gespendet. Der Tanz dauerte nicht weniger als drei Tage. Zuweilen wiederholt der Kreis den Gesang im Chore, zog die Schultern an einander und führte in demselben Momente eine rasche Vorwärtsbewegung aus.
Als ich am Nachmittage von einem Ausfluge in das westliche Gehölz heimkehrte, lenkte ich meine Schritte nach der Hütte der Neuvermählten. Die Hütten der Leibeigenen ringsum waren im freudigsten Aufruhr; Alles lachte und scherzte und überall saßen und lagen Gruppen um die gefüllten Butschualatöpfe; der Trommelschlag rief viele Neugierige herbei, Alles war lustig und fröhlich, nur Eine, die Hauptperson schien wenig von alldem zu sehen und zu hören, den Kopf auf ihre Hände gestützt, saß sie auf der Erde vor ihrer Hütte; ihre Züge waren starr und das Auge blickte stier auf den nächsten Hüttenzaun.
Am 25. überraschte uns Sepopo und Moquai mit einer Serenade, der erstere hatte sechs, die letztere zwei Musikanten, zwei Myrimbas (Kürbisschalenpianos), und vier Morupas (Röhrentrommeln) im Gefolge; um den König nicht zu beleidigen, blieb ich den ganzen Tag daheim. Gegen Mittag des 26. kam Westbeech von Panda ma Tenka mit Gewehren für den König, auch erschienen zwei Portugiesen in Schescheke, von denen einer, obgleich sie sich beide Señhores nannten, so schwarz wie ein Mambari war, diesen Beinamen jedoch mit Verachtung zurückwies. Francis Roquette hieß der eine, und hatte nebst dunklen Frauen zwanzig Diener. Diese zeichneten sich dadurch aus, daß sie bis auf einen, einem Helmkamm gleichenden Haarkamm ihre Wolle vom Kopfe abgeschabt hatten. Am 27. beendeten meine Diener die ihnen aus Segeltuch zugeschnittenen Segeltuchsäcke, in denen mein Gepäck auf der Weiterreise befördert werden sollte. An diesem Tage wurde auch das im europäischen Style errichtete Berathungshaus fertig und die bisher in einem der königlichen Häuser aufbewahrten Kriegstrommeln darin untergebracht. Da ich deutlich sehen konnte, daß sich die Königinnen zum Aufbruch nach der Barotse rüsteten, traf auch ich meine Vorbereitungen, um jeden Augenblick abreisen zu können. Die beiden Portugiesen kamen vom Norden aus einem der Maschukulumbe-Länder, in welchen sie den größten Theil ihrer Waaren für Elfenbein ausgetauscht hatten, während sie den Rest derselben, Feuerstein-Musketen, grobes Schießpulver in Fäßchen, Blei, Eisenkugeln und Kattun nach Schescheke brachten. Am 1. December 1875 ging endlich mein sehnlichster Wunsch in Erfüllung, ich konnte die Weiterreise stromaufwärts antreten.
[11] Ich bezahlte für 30 Pfund blaue große Glasperlen, die schon um nächsten Tage in der Sonne zersprangen, 30 Pfund Elfenbein.
[12] Einer abergläubischen Ansicht zu Folge halten die Marutse in Verwesung gerathenes Hundefleisch als eine von den Krokodilen besonders gesuchte Lockspeise.
[13] Als sich später die Marutse gegen ihren Herrscher erhoben, eröffneten sie ihre Feindseligkeiten damit, daß sie dieses Riesenboot verbrannten.
Aufbruch von Schescheke. — Die Flottille der Königinnen. — Erstes Nachtlager. — Marutse-Typen. — Mankoë. — Fruchtbarkeit des Zambesi-Thales. — Die Stromschnellen an centralen Zambesi. — Die Mutschila-Aumsinga-Stromschnellen. — Schiffbruch in denselben. — Sioma von Löwen belagert. — Vom Fieber besinnungslos niedergeworfen. — Rückkehr nach Schescheke.

Mankoë.
Am Morgen des 1. December 1875 besuchte mich ein Marutse-Unterhäuptling und lud mich ein ihm zu folgen. Am Ufer des Zambesi angelangt, fand ich drei für mich bestimmte königliche Kähne, die indeß kaum für den Transport meines Gepäcks hinreichten, weshalb ich um einen vierten ersuchte, wobei meine Diener noch immer zu Lande am Ufer folgen mußten. Gegen Mittag verließen wir Schescheke und kamen ziemlich rasch vorwärts. Ich fand so zahlreiche Inseln und Buchten, daß ich es bedauern mußte, in Folge der herannahenden Fieberzeit rasch reisen zu müssen und nicht die nöthige Zeit zur Verfügung hatte, das Bett des Zambesi in seiner ganzen Breite mit seinen Inseln, Lagunen etc. in allen Details kartographisch aufnehmen zu können. Der Uferabhang, in dessem Sande sich eine 12 bis 24 Zoll starke, mit Thon untermischte Torfschichte bemerkbar machte, zeigte mir schon auf der ersten Strecke unserer Fahrt einige sammelnswerthe Pflanzen; doch konnte ich nicht daran denken, die Fahrt zu unterbrechen, da mir viel daran lag die Flottille der Königinnen, welche bereits Morgens Schescheke verlassen hatten, einzuholen. Gegen Abend kamen wir an Stellen, an denen zahlreiche vom Strome herabgeführte und im Grunde festsitzende Baumstämme die größte Vorsicht geboten; bei Sonnenuntergang hatten wir endlich die Landungsstelle der Flottille erreicht. Es war ein nackter, sandiger Uferabhang, doch beiderseits von Schilf und oben von Gebüschen gegen Wind geschützt. Während die weiblichen Dienerinnen zahlreiche Herdfeuer angezündet hatten und ihren Küchenarbeiten oblagen, führten mehrere Kähne das zum Baue der Hütten nöthige Schilfrohr herbei. Ich wollte an diesem gemeinsamen Lagerplatze übernachten, meine Bootsleute jedoch schlugen einen, noch einige Meilen entfernteren vor, und da ich damals ihre Finten nicht kannte, fügte ich mich; erst später erfuhr ich, daß sie sich möglichst bestrebten, nicht an demselben Orte, den sich die königliche Flottille zum Lagerplatze erwählt hatte, zu übernachten, damit mich die Königinnen gegen ihre Belästigungen nicht zu schützen vermochten. Spät am Abend langten wir endlich an der auserkorenen Lagerstelle an, es war eine wenige Hütten zählende Niederlassung von Mamboëfischern und Nilpferdjägern. Einige in den Ufersand eingetriebene Baumäste, auf denen Netze hingen, zahllose aufgesteckte Köpfe kleiner Krokodile und nicht minder zahlreiche herumliegende Welse wiesen deutlich auf ihr Gewerbe hin. Wir logirten uns in einer 2½ Meter hohen, drei Meter breiten und sechsundzwanzig Meter langen Grashütte ein. Während der Fahrt beobachtete ich zahlreiche Wasser- und Sumpfvögel, Staare, Finken, Eisvögel etc.
Als wir am nächsten Morgen eben im Begriffe waren, mit unserem Gepäck die Boote zu beladen, kam die königliche Flottille in Sicht, die wir nun erwarteten. Die Mamboë, die Bootsleiter der Königinnen, übergaben derselben ein Abends vorher geschlachtetes Rind und die Mutter des Landes, Mokena, war so gütig, mir ein Hinterviertel von dem geschlachteten Thiere zu überlassen. Meine Bootsleute mußten sich der königlichen Flottille anschließen und nun ging es rasch vorwärts. Die vielen, bald vor, bald hinter uns fahrenden, einander überholenden, den Fluß kreuzenden, dort wieder zwischen den Inseln rechts oder links einbiegenden stark bemannten Kähne boten, auf dem tiefblauen, von Mimosengebüschen und den Schilfrohrwalde umsäumten Strome ein wechselndes und sehr interessantes Bild, das ich gerne festgehalten hätte, wenn nicht die kartographische Aufnahme des Flusses jede Minute beansprucht haben würde. Einer am rechten Ufer erbauten Marutse-Niederlassung gegenüber hielten wir für eine halbe Stunde auf einer Sandbank, um den Bootsleuten, die sich sehr wacker hielten, einige Augenblicke Ruhe zu gönnen. Während diese gemüthlich ihre Dachapfeifen schmauchten, wurde von den königlichen Frauen ein kleiner Imbiß eingenommen, bei dem sie auch mich nicht vergaßen, indem mir eine der Königinnen, Mamangala, geröstete Fische übersandte. Flußscenerie und die Thierwelt blieben sich auch heute gleich.
Gegen Abend landeten wir an einer Stelle, an der schon früher von vorüberfahrenden Schiffern circa zwanzig Hütten errichtet worden waren. Es war auch die höchste Zeit, denn ein Gewitter war im Anzuge und es fing zu regnen an, bevor ich mein Gepäck an’s Ufer gebracht hatte; hier lag auch bereits das vierte Boot. Der Sturm dauerte bis gegen Mitternacht. Der Regen drang in die Hütten und ich mußte mit meinen Decken mein Gepäck zu sichern suchen. Auf einem Kistchen sitzend, entschlummert, glitt ich im Schlafe auf den Boden nieder und erwachte früh zu meinem Erstaunen in einer in der Hütte entstandenen Regenlache; die Folgen ließen nicht auf sich warten. Am folgenden Morgen gab ich dem Drängen meiner Bootsleute nach und unternahm einen Jagdausflug auf einer mit vier bis fünf Fuß hohem Grase bewachsenen, von zahlreichen Lagunen und beträchtlichen Sümpfen bedeckten Ebene, welche von dem Schescheker Walde umsäumt, sich nach Westen erstreckte und hie und da bewaldet war. Auf niedrigen Bodenerhebungen erblickte ich kleine Marutse-Dörfer, deren bedeutendstes Katonga hieß. Zur Zeit der Zambesi-Ueberschwemmungen steht die ganze Ebene bis zu diesen Dörfern unter Wasser.
Von dem leider erfolglosen Jagdausfluge zurückkehrend, fühlte ich plötzlich eine nie zuvor empfundene Müdigkeit über mich kommen, welche so zunahm, daß ich etwa eine halbe Wegstunde von unserem Lager entfernt außer Stande war, weiter zu gehen, und mich meine Diener dahin tragen mußten. Nach den Symptomen zu schließen, welche diese Müdigkeit begleiteten, hatte mich das Fieber überfallen. Meine Bootsleute waren sehr ungehalten darüber, daß ich ohne Beute zurückgekehrt war und ihnen die Bewohner von Katonga nicht hinreichend Bier und Korn gegeben hatten, ich war deshalb froh, daß sich der mir als Führer mitgegebene Unterhäuptling Sekele meiner annahm und die Leute zur Ruhe verwies. Während der Nacht verschwand eine der Dienerinnen der Fürstin Moquai. Diese ließ die Spur, die zum Wasser führte, verfolgen, und es zeigte sich, daß die Person einige Schritte flußabwärts an’s Land gestiegen war und die Richtung nach Schescheke eingeschlagen hatte; sofort wurden einige der Männer nachgesendet, welche die Flüchtige, die unlängst gegen ihren Willen verheiratete Sclavin, zurückbrachten.

Marutse-Typen.
Wir setzten am nächsten Morgen die Bootfahrt fort und liefen gegen Mittag in einen schmalen Flußraum ein, der von der nördlichsten mehrerer bewaldeter Inseln und dem linken Ufer gebildet wird. Ich erlaubte mir diese Inselgruppe die Rohlfs-Inseln zu benennen. Auf der Festlandseite des Flußarmes lag die westlichste Masupia-Niederlassung Sekhosi, in der schon seit vielen Decennien fleißig Ackerbau getrieben wurde, unter Anderem wurden hier auch Manza und Bohnen cultivirt. Gegenwärtig pflegen die Marutse nur so viel anzubauen, als sie zu ihrem Lebensbedarfe und ihren Abgaben benöthigen, nur die Masupia, Batoka und östlichen Makalaka bauen etwas mehr an und verkaufen den Ueberschuß den Händlern und Jägern aus dem Süden. Dabei cultiviren sie meist nur sandige Abhänge, Waldstellen um Termitenhaufen, während die fruchtbarsten marschigen Theile vollkommen brach liegen. Mit Rücksicht auf diese großen Strecken, die regelmäßige Bewässerung, die man diesen angedeihen lassen kann, das warme Klima etc., hat das Land eine große Zukunft. Die von den Flüssen entfernteren Binnengebiete bestehen aus einem oft meilenlange Wiesenstrecken einschließenden Urwald, so daß auch diese gute Felder abzugeben versprechen. Nöthigenfalls können auch die Flüsse, wie der Zambesi selbst, zur Bewässerung des Landes herangezogen werden. Die Stämme sind strebsam und arbeitsam; hat der Pflug in’s Land Eingang gefunden und ist es einmal vom Süden oder Osten dem allgemeinen Verkehr geöffnet, so wird das Marutse-Reich rasch aufblühen.
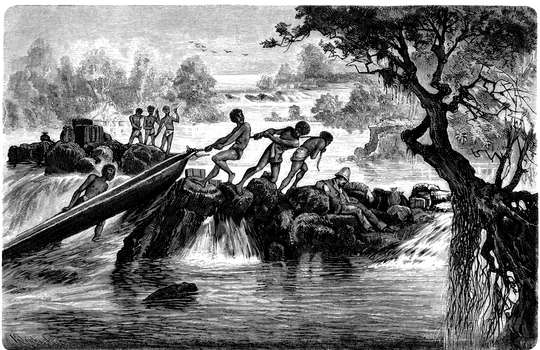
In den Manekango-Stromschnellen.
Ungefähr zwölf Meilen von Schescheke tritt ein Vorbote der die südliche Barotse durchziehenden und den Fluß nach abwärts begleitenden Höhenketten, der Wald von Schescheke, unmittelbar an’s Ufer. Schon östlich von Schescheke, etwa halben Weges zwischen den Makumba-Stromschnellen und der Mündung des Kaschteja-Flusses, auf welcher Strecke das Land sich allmälig nach Westen hob, vermißte ich die Saro- und und Fächerpalme, sowie die Papyrusstaude. Westlich von Sekhosi ist das Gefälle des Stromes ein bedeutendes, es beginnen hier auch die Süd-Barotse-Stromschnellen und Katarakte des zentralen Zambesi. Dieselben sind zumeist durch Felsenbänke gebildet, welche quer in einer geraden oder schrägen Richtung über den Fluß ziehen und gleichsam Verbindungsarme zwischen den beiden den Zambesi begleitenden Höhenketten darstellen. Durch diese Felsenriffe sind zahlreiche Inseln gebildet und je weiter ich kam, desto interessanter schien das Flußbett mit seinen vielen nackten, dunkelbraunen, doch auch nicht minder zahlreichen beschilften, oder stellenweise auch hochbewaldeten Inseln zu werden. Auf einer Strecke von vierzehn englischen Meilen zählte ich einen Katarakt und vierundvierzig Stromschnellen, die letzteren waren in der Weise gebildet, daß sich allmälig das aus einer einzigen Felsenplatte gebildete Flußbett neigte, oder daß sich dasselbe plötzlich stufenförmig senkte. Stellenweise waren es wieder Felsenblöcke, welche theils unter dem normalen Wasserstande liegend oder auch über denselben hervorragend die Stromschnellen verursachten, nur einmal beobachtete ich, daß eine Felsenbarrière durch den Fluß lief, welche hie und da Oeffnungen zeigte, durch welche sich das Wasser mit Wucht Bahn zu brechen suchte.

Mambari. Matonga.
Diese Schnellen wären mit den Marutse-Kähnen unpassirbar, wenn sie nicht von den Krokodilen gemieden würden. Die Abwesenheit der großen Saurier ermöglicht es den Schiffern, an solchen Stellen das Boot zu verlassen und den Kahn theils schiebend, theils ziehend das Hinderniß zu überwinden. An den schwierigeren Partien ist es jedoch nöthig, das Gepäck auf die aus dem Flusse hervorragenden Blöcke umzuladen und dann den leeren Kahn über die Stromschnellen zu bringen. Die erste dieser Stromschnellen die wir passirten, nennen die Eingebornen Katima Molelo, sie bestand mehreren Partien und wir waren im Stande, sie mit den Rudern an einer Stelle zu überwinden, während an den übrigen die Bootsleute aussteigen und die Kähne über die Felsenriffe ziehen mußten. Kaum über das Hinderniß gelangt, beeilten sie sich in das Boot zu springen, um den im tieferen Fahrwasser auf der Lauer liegenden Krokodilen zu entgehen. Die nächstbedeutendste Stromschnelle nach dieser, die wir am 5. zu passiren hatten, war jene von den Eingebornen Mutschila Aumsinga genannte, es ist die gefährlichste auf der Strecke Schescheke-Nambwe-Katarakt, sie ließ leider auch mir ihre Gefährlichkeit fühlen. Meine Krankheit hatte sich an diesem Tage verschlimmert, allein ich achtete darauf, daß mir selbst das Sitzen in dem Kahne beschwerlich wurde, indem es mit Gliederschmerzen verbunden war, dennoch ließ ich mich in meiner kartographischen Arbeit nicht stören.
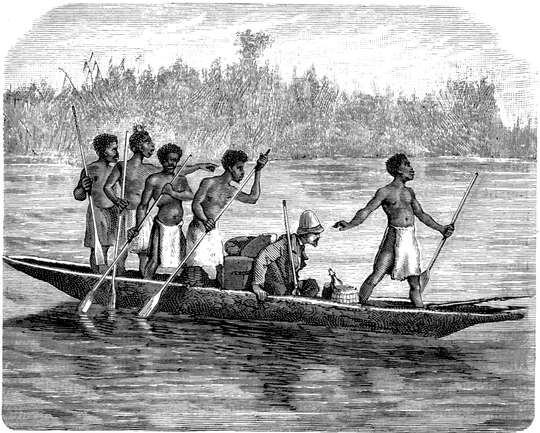
Zambesi aufwärts.
Die Mutschila-Aumsinga-Stromschnelle wird durch eine ziemlich bedeutende Neigung des felsigen Bettes, sowie zahlreiche unter dem Wasser liegende Felsenblöcke gebildet, doch die dem Schiffer drohende Gefahr rührt von einem anderen Umstande her. Zwischen einer bewaldeten Insel und dem linken Ufer gelegen, und nur etwa fünfzig Meter breit, zeigt sie zwei, durch einige an ihrem Beginn liegende Inseln bedingte Seitenströmungen, welche die Kraft des Schiffers erschöpfen, und dieß um so mehr, als sie an keiner Stelle so seicht ist, daß die Bootsleute den Kahn über die Schwelle ziehen könnten. Ein zweiter Uebelstand in meinem Falle war, daß die Kähne schwer beladen, aber nicht hinreichend bemannt waren. Meine Gewehre sowie meine Tagebücher, Glasperlen, Patronen, und die für die Häuptlinge und Könige bestimmten Geschenke befanden sich in meinem Boote, das an diesem Tage das dritte in der Reihenfolge war. Das zweite war jenes, welches mein Schießpulver, meine Medicamente, meine Provisionen und die in Schescheke gesammelten Insecten und Pflanzen führte (die übrigen gesammelten Gegenstände hatte ich Westbeech zur Weiterbeförderung nach Panda ma Tenka übergeben). Da ich sah, daß die Bemannung dieses Bootes nur mit genauer Noth der Strömung Widerstand leisten konnte, rief ich den Leuten zu, die vom Ufer überhängenden Bäume und Büsche zu ergreifen, um das Boot mindestens in seiner Stellung zu erhalten. Meine Zurufe wurden indeß vom Brausen der Strömung übertönt. Die Ruder gleiten von der Felsenplatte wie von einer Spiegelfläche ab, die ihnen allen wohlbekannte Gefahr verwirrt die Bootsleute, statt ihre Muskeln anzuspannen; regellos greifen ihre Ruder ein und damit war das Los des Bootes entschieden. Doch nein, es kann nicht möglich sein, so bitter und unversöhnlich kann ja des Geschickes Walten mir nicht entgegentreten. Meine Medicamente, die Nahrungsmittel, die Mühen so vieler Tage sollten vom Wasser verschlungen und mir verloren gehen? und eben jetzt, da ich an Fieber erkrankt, ihrer bedürftiger als je gewesen, und wo die Hoffnung und Möglichkeit, das Verlorene wieder zu erlangen, vollkommen fern gerückt war?
Meine Bootsleute wurden durch die verzweifelte Lage des vorderen Bootes verwirrt und die Strömung begann auch mit unserem Boote ihr Spiel. Doch wir waren dem Ufer nahe und rasch genug konnten die überhängenden Aeste ergriffen und das Boot gegen die Insel herangezogen werden. Das erste Boot aber war der Wucht der Strömung nachgebend, bald aus seiner zur Stromlinie parallellen Stellung gebracht und bot der Gewalt des Wassers seine Breitseite entgegen. »Helft doch!« schrie ich verzweifelt den Leuten in meinem Boote zu und war eben selbst im Begriffe in das Wasser zu springen, alles andere, selbst das heftige Fieber, unter dessen Einwirkung ich seit den letzten zwei Stunden so heftig transpirirte, daß die Kleider am Körper klebten, war unter den obwaltenden Umständen vergessen; meine Bootsleute hielten mich aber mit Gewalt zurück. Von der Strömung erfaßt, auf der einen Seite niedergepreßt, neigte sich das Boot, seine Lenker, denen bei dem verzweifelten Versuch, die Gewalt der Strömung zu überwinden, die Ruder gebrochen waren, verloren das Gleichgewicht und in demselben Momente schlug die erste Welle in das Boot, bald folgten eine zweite, eine dritte Welle und nun — ich traute meinen Augen nicht — schlug es um. Nach mehrfachen Anstrengungen, wobei meine und die folgenden Bootsleute treulich mithalfen, gelang es, das Boot wieder flott zu machen und einige Gegenstände zu retten.
Alle kühnen Hoffnungen, alle Pläne und Wünsche, der Traum vom atlantischen Ocean — alles war hier versunken. Mitleidslos zerstörte das Geschick in wenigen Augenblicken die siebenjährigen Vorbereitungen zur Ausführung meiner mir selbstgestellten Aufgabe. Angesichts dieses Unfalls, der alle früheren Enttäuschungen tausendfach überbot, mußte ich, vom Fieber niedergeworfen, auf die Fortsetzung der Reise, der alle meine Anstrengungen galten, verzichten. Und um das Maaß der bitteren Erfahrungen voll zu machen, sah ich auch die Früchte monatelanger Arbeit emsigen Sammelns vernichtet — kaum einen nennenswerten Bruchteil konnte ich retten.
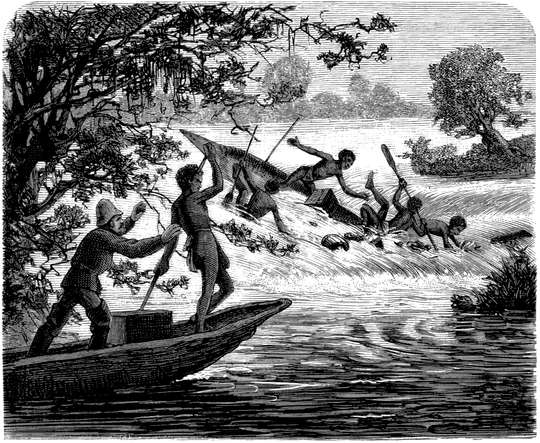
Verlust meines Bootes.
Nachdem wir das mir für die Dauer meines Lebens denkwürdige Mutschila-Aumsinga passirt hatten, landeten wir eine Stunde später am rechten Zambesi-Ufer unterhalb eines Mabunda-Dorfes mit Namen Sioma; die uns längs des linken Ufers folgenden Diener wurden herübergeholt, um so rasch wie möglich vor einbrechender Nacht ein Lager errichten zu können. Wir wurden jedoch von den Mabunda’s mit der Nachricht überrascht, daß die Gegend von Löwen nur wimmle und ihr Dorf sozusagen allnächtlich von diesen Raubthieren belagert sei. Mir schien diese Mittheilung nur ein Vorwand zu sein, uns zur Fortsetzung der Reise zu bewegen. Ich erstand von ihnen für Glasperlen Kafirkornbier, das ich meinen Bootsleuten als Gratification für die vielen Mühen, die sie an diesem Tage meinethalben hatten, verabreichte. Da ich mich durch die Mittheilung der Mabunda’s nicht abschrecken ließ und sie mit den Glasperlen günstiger gestimmt hatte, riethen sie uns, die Dächer einiger verlassenen am Flusse erbauten Hütten ab- und zusammenzutragen und diese kegelförmigen Grasbauten in Hufeisenform derart neben einander aufzustellen, daß ein Theil des Dachrandes (nach Außen) auf die Erde zu liegen komme, der andere dagegen auf kurzen Pfählen nach innen zu gestützt sei, so daß unser Lager sieben riesigen kegelförmigen Grasfallen nicht unähnlich war. Vor den Hütteneingängen ließ ich mehrere große Feuer anzünden.
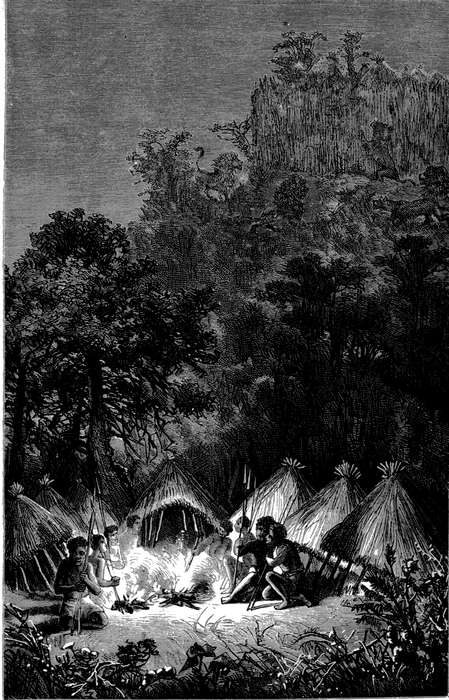
Sioma von Löwen angegriffen.
Während der unglückseligen Fahrt des heutigen Tages waren mir am Ufer des Stromes zwanzig bis vierzig Fuß hohe Bäume mit weißlicher Rinde aufgefallen, von deren Stamme zahllose Wurzeln, einem dichten Barte gleich und von den über das Wasser wuchernden Aesten in drei bis sechs Fuß langen, röthlich braunen Zotten herabhingen.
Am 5. regnete es den ganzen Tag hindurch, der Wind war am Nachmittage eisig kalt geworden und obgleich die Diener das offene, fallenartig niedergelegte Dach mit Matten zu verhängen suchten, so wurden diese vom Winde immer weggeblasen und ich unzählige Male in meiner heißen Fieberhitze von dem kalten Regenschauer plötzlich abgekühlt. Während ich fast regungslos auf dem aus Kisten errichteten Lager gebannt war — meine Krankheit hatte sich nur noch verschlimmert und ich konnte nur mit Hilfe der Diener meine Lage ändern — wurde ich Ohrenzeuge eines Gesprächs, welches von den letzteren, die mich schlafend wähnten, außerhalb der Hütte geführt wurde. Borili, einer der beiden Matonga’s gab seiner Schadenfreude lebhaften Ausdruck, daß der Njaka (Zauberer, Doctor) schwer erkrankt sei und suchte seine Genossen dazu zu verleiten, mit meinen Vorräthen das Weite zu suchen und auf das südliche Tschobe-Ufer zu flüchten. Da die anderen drei Diener sich ziemlich passiv verhielten, beschloß ich das Complot im Keime zu ersticken. Ich rief die Diener und während ich die anderen mit Glasperlen beschenkte, frug ich Borili, ob er noch immer ein Tlobolo (Gewehr) als Lohn zu erhalten gedenke. Auf seine rasche bejahende Antwort erwiderte ich mit Nein und hielt ihm vor, daß er kein guter Diener, sondern ein Dieb sei und drohte ihm im Wiederholungsfalle eines ähnlichen verrätherischen Versuches nach Schescheke zur Bestrafung zurückzusenden.
Abends ließ die Fieberhitze etwas nach, so daß ich mich von den Dienern von meinem Schmerzenslager herabheben und mich auf die Erde setzen ließ; mit dem Rücken gegen mein Lager gestützt, empfing ich einige Mabunda’s und erhandelte von ihnen einige Handarbeiten, schrieb an meinem Tagebuche und bereitete aus den noch geretteten, wenigen Medicamenten für einen der Bootsleute ein Brechmittel, der durch den zu reichen Genuß der Frucht eines Busches Ki-Mokononga bedenklich erkrankt war. Nach den Symptomen, unter denen derselbe erkrankte, sowie nach dem penetranten Geruche konnte ich schließen, daß das Fleisch dieser Frucht die Eigenschaften des Amigdalin und Dulceïn (Blausäure) vereinigt. Die Früchte waren 2½ bis 3½ Zentimeter lang, 1½ bis zwei Zentimeter dick, hatten einen länglichen Kern, ein gelbliches Fruchtfleisch und eine zähe Epidermis, sie schmeckten süßlich und nach bitteren Mandeln. Nachdem sich der Mann mehrmals erbrochen, fühlte er sich bedeutend besser und am nächsten Tage wieder ganz wohl.
Da das Fieber etwas nachgelassen, benützte ich die freien Augenblicke, um den von Sioma herabgekommenen Mabunda-Häuptling und meine Bootsleute sowie die beiden Führer über Land und Leute im Marutse-Reiche zu befragen. Den Hauptgegenstand unseres Gespräches bildeten die zwischen dem Zambesi und Tschobe wohnenden Stämme Livaga, Libele und Lujana, sowie die am zentralen Tschobe, welcher den Namen Lujana führt, wohnenden unabhängigen Bamaschi unter den drei Fürsten Kukonganena, Kukalelwa und Molombe.
In der folgenden Nacht wurden wir von der Wahrheit der Mittheilung der Mabunda’s überzeugt. Schon nach Sonnenuntergang fingen etwa 150 Schritte vor uns Löwen ein mehrstimmiges Concert an und ließen nicht ab, als bis der Tag zu grauen begann; oben im Dorfe aber schrieen die Leute die ganze Nacht hindurch und schlugen auch eine Trommel dazu, sie hatten mehrere Feuer innerhalb der ihr kleines Dörfchen umschließenden Umzäunung angezündet und trachteten auf alle mögliche Weise die Raubthiere abzuhalten. Meine Bootsleute saßen aber die ganze Nacht mit ihren langen Speeren vor ihren Hütten, auf deren Wände sich ihre Schatten abzeichneten. Glücklicherweise verging die Nacht, ohne daß es die Löwen gewagt hätten, uns einen Besuch abzustatten.
Am 6. fühlte ich mich wieder schlechter, so daß ich den ganzen Tag über liegen bleiben mußte und mich nur meinem Tage- und meinem Skizzenbuche widmen konnte. Die regnerische und kalte Witterung der nächsten Tage verschlechterte meinen Zustand immer mehr; obwohl glühend vor Fieberhitze, fröstelte ich unter dem Hauche des kalten Nordostwindes. Mit genauer Noth konnte ich schreiben. Ich suchte mir Muth einzuflößen, allein es scheiterte an der nackten Wirklichkeit. Der Kopf brannte wie Feuer, die Zeilen flimmerten mir vor den Augen und doch war das meine einzige Zuflucht.
Am 8. fuhren wir weiter, ich weigerte mich, die Rückfahrt nach Schescheke anzutreten, während der Fahrt jedoch verschlimmerte sich mein Zustand so sehr, daß ich Abends aus dem Boote an’s Land getragen werden mußte. Kaum in einer der von vorüberfahrenden Schiffern errichteten Grashütten untergebracht, stellte sich heftiges Erbrechen und ein ruhrartiger Anfall ein, welche mich so schwächten, daß ich den Morgen nicht mehr zu erleben fürchten mußte. Und doch hatten wir an diesem Tage die interessanteste Partie des Zambesi, die ich mit Ausnahme der Victoriafälle kennen gelernt habe, durchreist. Wir hatten nicht weniger als zweiundvierzig Stromschnellen zu passiren und waren bis zum südlichsten der Barotse-Katarakte gelangt.
Am 9. schleppten mich meine Diener zu einigen geräumigen Hütten über dem Katarakte (etwa 1000 Schritte weit) die für die Königin Moquai errichtet waren. Von den Stromschnellen waren die, von den Marutse Manekango, sowie die, Muniruola genannten, die gefährlichsten zu passiren. Die letzteren waren von einer förmlichen Felsenmauer gebildet, die achtundzwanzig Zoll über dem Wasser quer über den Fluß hinzog und durch welche sich das Wasser durch kleinere und größere Oeffnungen Bahn brach. Bei der heftigen Strömung mußten die Bootsleute die Kähne emporheben und an den engen Durchbruchsstellen durchzuziehen trachten, unterdessen legten mich die Bootsleute aus dem Kahne auf das Felsenriff. In den erwähnten Hütten hatte die Königin drei Tage lang auf mich gewartet, sie dachte, daß ich umgekehrt wäre und setzte die Heimreise fort, sandte aber am 9. von ihrer entfernten Landungsstelle ihren Gemahl Manengo zu mir. Nachmittags stellte sich heftiges Erbrechen und Athembeschwerden ein, ließen aber glücklicher Weise am nächsten Tage wieder nach und ich konnte einige Löffel Maizena zu mir nehmen.
An diesem Tage fuhr Inkambella, der Gouverneur der Barotse, nach Sepopo der bedeutendste Mann im Lande, stromabwärts vorbei. Abends trat abermals eine Verschlimmerung meines Zustandes ein und ich ließ die Bootsleute rufen, um mich mit ihnen über die Rückkehr nach Schescheke verständigen zu können; von meinen Dienern hörte ich indeß, daß diese bereits zwei Kähne unterhalb der Fälle in Bereitschaft hielten, meiner Weisung also schon zuvorgekommen waren. Als ich sie deshalb zur Rede stellte, erfuhr ich, daß ihnen König Sepopo einen geheimen Befehl ertheilt hatte, auf mich wohl Acht zu geben und mich wo möglich in seinem Reiche am Leben zu erhalten. Als Arzt hatte ich mir Achtung verschafft und der König, der mich deshalb als großen Zauberer ansah, wollte es verhüten, daß durch meinen Tod ein großes Unglück über das Land hereinbreche.
Am 11. luden mich die Bootsleute in einen der Kähne, meinen Diener Narri in den zweiten und steuerten bald darauf mit mir gegen Schescheke zu — nicht ohne vorher von mir Geschenke erpreßt zu haben. Zu gleicher Zeit stritten sie sich mit meinen Dienern, weil diese sie beim Diebstahle einiger meiner Gegenstände ertappt hatten.
Auf der Rückfahrt am 11. brannte die Sonne so heiß und der Durst quälte mich so sehr, daß ich, um nur etwas Kühlung zu finden, meine Hände aus dem Boote in’s Wasser herabhängen ließ. Die Bootsleute beeilten sich jedoch, mir sie wieder in den Schoß zu legen und warnten mich vor den zahlreichen Krokodilen. Abends übernachteten wir einige Meilen östlich von Katonga und langten am folgenden Tage in Schescheke an. Als ich von den Bootsleuten zu Westbeech gebracht wurde und mich in der Thüre aufstellte, erkannte mich dieser nicht wieder.
Condolenzbesuche des Königs und der Häuptlinge — Eine neue Unthat Sepopo’s. — Masarwa’s in Schescheke. — Ceremoniell bei den Mahlzeiten an Sepopo’s Hof. — Mein erster Ausflug. — Der Fischfang im Marutse-Reiche. — Sepopo erkrankt. — Wanderungen eines Arabers durch Süd-Afrika. — Unterthanen-Verhältniß im Marutse-Reiche. — Characterzüge einzelner Stämme des Reiches. — Die Zukunft des Landes.

Fischotterjagd am Tschobeflusse.
Nach Schescheke zurückgekehrt, war es meine Absicht, hier meine Genesung abzuwarten und die Reise dann fortzusetzen. Mein Zustand verschlechterte sich indeß wieder, und da eben die ungesunde Zeit eingetreten war, rieth mir Sepopo sowohl als Westbeech, die Stadt und das Marutse-Reich zu verlassen, nach dem Süden zurückzukehren und meine Reise erst nach meiner vollständigen Genesung wieder aufzunehmen. Meine bisherigen Erfahrungen sagten mir aber, daß die Befolgung dieses Rathes einem Entsagen aller und jeder Hoffnung, in nächster Zeit das Ziel zu erreichen, gleichkam.
Der König, sowie mehrere mir befreundete Häuptlinge kamen um mich zu sehen und drückten ihr Bedauern aus, obgleich mich die meisten versicherten, daß sie meine Erkrankung vorhergesehen; jeder sprach die Ansicht aus, daß ich zu spät Schescheke verlassen hatte, der König beschuldigte mich, daß ich mit meinem Besuche der Victoriafälle des Zambesi die erste günstige Gelegenheit, Schescheke verlassen zu können, versäumt habe, seine Unterthanen jedoch gaben ihm die Schuld, indem er mich von October bis December zurückgehalten habe, und mir vielleicht selbst damals die Kähne nicht zur Verfügung gestellt hätte, wenn er nicht wiederholt von Moquai deshalb bestürmt worden wäre.
Da die von mir bewohnte und von Blockley in Westbeech’s Gehöfte erbaute Hütte nach meiner Abreise eine andere Bestimmung erhalten hatte, nahm mich Westbeech in seinem Waarenhause freundlichst auf. Mit dem Könige selbst ging es stark herab; ich erwähnte, daß während meines Aufenthaltes am Njambwe-Katarakt der geachtetste Mann im ganzen Reich an mir vorüber nach Schescheke fuhr, um den König zu begrüßen. Es war mir auch bekannt, daß ihn Sepopo wegen seines Ansehens und seiner Beliebtheit bei dem Volke tief haßte. Da sich kein Unterthan seines Reiches zu einem Meuchelmord am Barotse-Gouverneur hergegeben hätte, klagte er ihn und die mit ihm von der Barotse zugleich herabgekommenen Häuptlinge des Hochverrates an, doch ohne Erfolg, denn dieselben wurden sofort freigesprochen. Bei dieser Gelegenheit war Westbeech und John Mahura gegenwärtig; wie tief Sepopo in Macht und Ansehen gesunken war, mag daraus hervorgehen, daß er sich während der Verhandlung von Mahura einen Narren und den größten Verräther an seinem Lande nennen ließ.
Am 13. kam der König wieder zu Besuche, indem er mit seinem Hofstaate, sich an dem Mokoro-Tanze belustigend, in das Höfchen hineingelangt war. Er nannte mich seinen Mulekau, und während sich Inkambella und seine Freunde zu mir setzten, trat der König zu Westbeech; die Gesellschaft Inkambella’s war ihm unerträglich geworden.
Am 14. gegen Abend stellten sich bei mir solche Brustschmerzen und Beklemmungen ein, daß ich mich auf der Erde wand und mich meine vier Diener kaum zu halten im Stande waren. Erst nachdem mir Westbeech etwas Ipecacuanha gereicht hatte, und ich mich darauf zweimal erbrochen hatte, wurde das Athmen etwas freier. Später während meiner sechzehnmonatlichen Krankheit wiederholten sich diese Anfälle noch mehrmals, bei deren Bekämpfung mir das oben erwähnte Mittel stets gute Dienste leistete.

Masupia. Panda.
Am 17. berichtete man mir, daß mein zuerst engagirter, portugiesischer Führer Sykendu zu gleicher Zeit mit mir Schescheke verlassen und sich das Zambesi-Thal entlang nach der Barotse gewendet hatte. Unter den Schwarzen, die er mit nach dem Westen nahm, und die er bei den zwischen der Küste und dem Innern Central-Afrikas wohnenden Stämmen gegen Gummi und Elfenbein auszutauschen pflegte, befanden sich auch zwei Mädchen, die er unmittelbar vor seiner Reise gekauft hatte. Eines der Mädchen entzog sich der nach der Westküste ziehenden Sklaven-Carawane heimlich durch die Flucht, sie wurde jedoch wieder eingefangen, mit ihrer Genossin in Ketten gelegt und weiterbefördert.
In den letzten Wochen waren die zahlreichen Völker Sepopo’s durch Vertreter eines neuen Stammes vermehrt worden. Es waren Masarwa’s, welche aus dem östlichen und weltlichen Bamangwato-Lande entflohen, Schutz bei Sepopo suchten und hier als äußerst geschickte Elephantenjäger mit offenen Armen empfangen wurden und ein bedeutend besseres Los als bei ihren früheren Herren zu erwarten hatten. Bei meinem späteren Besuche in dem königlichen Gehöfte machte mich oft der König auf diese Flüchtlinge aufmerksam. »Sieh, Njaka, sieh da die Masarwa’s;« ein andermal. »Hier sitzen Khama’s Unterthanen« u. s. w. Am selben Tage ging es Abends während des Impotegelages in dem königlichen Höfchen recht lebendig zu. Ein Mambari, der von Sekeletu, dem letzten Makololoherrscher zum Sklaven gemacht worden war, beklagte sich darüber, daß er nicht, gleich den anderen, frei gegeben wurde und begann einen Streit mit den Marutse, der in Tätlichkeiten auszuarten drohte.
Ich konnte mich noch immer nicht vom Lager erheben, den ganzen Tag mir allein überlassen, hatte ich Muße genug, über meinen Zustand nachzudenken und über das harte Walten des Geschickes zu klagen. Durch Boten, die von dem Panda ma Tenka-Flüßchen zum Tschobe gesendet wurden, sowie durch Masupia’s vom genannten Flusse erfuhren wir, daß meine englischen Freunde McLaud, Fairly, Cowley, Dorehill, ihre sämmtlichen Diener, sowie mein Diener Pit in Panda ma Tenka am Fieber schwer erkrankt waren.
Erst am 19. hatte sich mein Zustand so weit gebessert, daß ich mit Hilfe meiner Diener einen Gang durch das Gras um unser Gehöfte machen konnte. Um uns unseren Aufenthalt in Schescheke recht zu verleiden, gesellten sich zu den schon bestehenden Unannehmlichkeiten noch die Mosquitos, welche am Zambesi und am Zugariver eine wahre Landplage sind. Der Abend und die Nacht sind die Zeiten, zu denen diese kleinen blutdürstigen Insecten ihre wüthenden Angriffe auf Mensch und Thier unternehmen, selbst Wolldecken schützen vor den langen spitzen Saugrüsseln der Schnacken nicht. Das einzige Mittel, das uns einigermaßen gegen ihre Angriffe Schutz gewährte, bestand darin, daß wir von den Dienern drei bis vier Kuhdüngerhaufen in unserer Hütte anzünden ließen.
Den folgenden Tag begaben sich Walsh und Westbeech auf die Sporngansjagd und versahen unsere Küche mit frischem Fleischvorrath. Leider erlaubte es mein Zustand nicht, mich selbst an einer solchen Jagd zu betheiligen. Die Sporngänse wie die meisten Entenarten halten sich um diese Zeit des Jahres auf den freien Stellen in den Sümpfen auf, und man nähert sich ihnen mit Kähnen, indem man ihrem Gekaker folgend, durch das hohe Schilfrohr streichen muß. Am erfolgreichsten ist die Jagd bei mäßigem Winde, wobei das Sausen des Schilfes das durch das Boot verursachte Geräusch deckt. Als der König von den Jagderfolgen meines Freundes gehört hatte, kaufte er ihm eine größere Menge Schrot ab und sandte einige seiner Günstlinge auf die Jagd aus, und als ich einige Tage später beim Könige zu Besuche war, wurden einige der erbeuteten Gänse zum Frühstück servirt; aus der Zubereitung derselben konnte ich entnehmen, daß die Marutse gewohnt sind, ähnliches Wild zu erbeuten und zuzubereiten. Speisen in fester Form werden mit den Fingern, halbflüssige mit Holzlöffeln zum Munde geführt und die Mahlzeiten gewöhnlich in sitzender Stellung auf Stroh und Binsenmatten, sei es im Wohnhause oder vor dem Eingange desselben, eingenommen.
Zum königlichen Frühmahle werden stets einige seiner Frauen (Königinnen) und Kinder geladen, die sich gegen Sonnenaufgang (Osten) niederlassen, Fremde (Weiße) erhalten dieselbe Richtung angewiesen, während sie Abends zur Linken des Herrschers zu sitzen kommen. Die eingeladenen Würdenträger, wenn sie zufällig hinzukommen, lassen sich bei den im Hause eingenommenen Mahlzeiten zur Rechten vom Eingange und vom König, bei den im Freien eingenommenen zu seiner Linken und auf bloßer Erde nieder. Bei den Früh-Mahlzeiten im Hause gruppirte sich das stets zahlreich vertretene Volk um den Eingang des Hauses, bei den letzteren um den König, seine Gäste und die Gouverneure in einem Halbzirkel gegen den Hofeingang, so zwar, daß zwischen dem Könige und dem halbkreisförmigen Knäuel eine Stelle offen blieb, die von den das Mahl auftischenden Dienern, beim Mahlschluß von dem königlichen Mundschenk eingenommen wurde. Der König und der Hausherr überhaupt, wenn es ein höherer Würdenträger ist, sucht sich das beste Stück aus, er reicht sodann das Gericht der Lieblingsfrau und den anderen Königinnen, hierauf erst dem weißen Gaste (sind zwei anwesend, so müssen sie sich mit einem Gefäße behelfen) und zuletzt einem oder zweien der Würdenträger. Sind jedoch die Frauen nicht gegenwärtig, so erhalten die Würdenträger oder der Mundschenk die ersten Bissen.
Nach dem Frühstück wird Kafirkornbier genossen, gewöhnlich ein, beim Könige zwei bis drei riesige Töpfe voll. Das Bier wird aus langgestielten Kürbißlöffeln getrunken. Beim Könige wird außerdem noch Honigbier nach dem Frühstück, beim Nachtmahle ein bis drei wohlgefüllte Kalebassen desselben aufgetragen. Für das kredenzen derselben ist stets ein Mundschenk bestimmt, der zuerst das Getränk verkosten muß, bevor er es dem König reicht. Der König leert das erste Gefäß, nippt vom zweiten, um es einer der Frauen oder einem seiner kleinen Kinder zu reichen; dann thut er ein Gleiches dem weißen Besucher gegenüber. Vom Honigbier bekamen nur seine besonderen Günstlinge zu verkosten, meist Menschen, deren Dienst er den Tag über in Anspruch nahm oder es für den nächsten Tag beabsichtigt.
Da der Honig Krongut ist, wird das Honigbier nur in der königlichen Familie öffentlich, sonst nur im Geheimen getrunken, es wird, wie ich schon erwähnte, nicht aus reinem Honig, sondern aus den mit Wasser übergossenen und an einer der Sonne ausgesetzten Stelle acht bis zwölf Stunden in einer Kalebasse belassenen Honigwaben und dem unreinen Honig bereitet.
Am 24. wagte ich einen längeren Ausgang durch die Stadt, ich ging, wie ich es später zu meiner Hauptbeschäftigung in Schescheke machte, um gegen die nun leider nicht mehr benöthigten Ausrüstungs-Utensilien von den verschiedenen Schescheke bewohnenden Stämmen ethnographische Objekte einzutauschen. Unter den gesammelten Pflanzen fand ich ein Drittel mir schon bekannter Arten vor, zwei Dritttheile waren mir neu, von welchen wieder ein großer Theil vom unmittelbaren Ufer des Zambesi aus dem Zambesi-Hochlande herrührte.[14]
Die uns durch die Mosquitos bereiteten schlaflosen Abende benützte ich, um von Westbeech Näheres über die als Unterthanen der Matabele am Majtengwe wohnenden westlichen Südzambesi-Makalakas zu erfahren, die ich persönlich während meiner verschiedenen Besuche in Schoschong sowie durch die Berichte meines Freundes Mackenzie kennen gelernt hatte.
Am 25. fühlte sich der König derart unwohl, daß er den Weißen den Eintritt in sein Gehöft bis auf Weiteres verbot; es war das unstreitig das Werk Sykendu’s, dem es darum zu thun war, dem gesunkenen Handel seiner Partei wieder aufzuhelfen und die weißen Männer aus dem Süden möglichst zu verschwärzen und ihnen die Gunst Sepopo’s zu entziehen.
Täglich brachten uns die Fischer Sepopo’s Fische zum Kaufe. Die im Marutse-Reiche übliche Fischerei theile ich in Fisch- und Wasserreptilien-Fang ein. Im Fange gewisser Wasserreptilien haben einige, im Fischfange die sämmtlichen am Zambesi vom Kabompo bis weit über die Victoria-Katarakte östlich wohnenden Stämme eine ungewöhnliche Fertigkeit, sie übertreffen in dieser Hinsicht manche der Küstenbewohner (Eingeborne) und jene am N’gami-See, welche keine schlechten Fischer zu nennen sind. Nicht minder meisterhaft betreiben gewisse Stämme im Reiche, wie die Marutse und Mamboë’s den Fang der beiden großen Wasserreptilien, des Wasserleguans und des Krokodils. Die Fischerei verschafft den Bewohnern des Reiches einen nicht unbedeutenden Theil der Lebensbedürfnisse; die Fische, welche regelmäßige Steuer- und Tributabgaben bilden, sind auch Handelsartikel. Der Fischfang wird auf fünffache Art betrieben: 1. in Netzen, 2. in Reusen, 3. in niedrigen kleinen Dämmen, 4. durch Absperren kleinerer Lagunen mit weitmaschigen Rohrmatten und 5. mit Speeren. Von den fünf verschiedenen Fangweisen der Fische im Marutse-Reiche ist der Fang mit Netzen am großartigsten und reichlichst lohnend. Die Marutse arbeiten sehr gute, weite und engmaschige, mit Schwimmpflöckchen und Beschwermitteln versehene, fünfzehn bis fünfundzwanzig Meter breite Netze aus Bastfäden, die zu Federspul- und kleinfingerdicken Schnüren gedreht sind. Die Netze entsprechen ihrem Zwecke vollkommen, halten sich auch länger als man denken würde. Nach beendeten Fischzügen werden sie sorgsam gereinigt und getrocknet. Die Netze werden meist zum Fischen in den breiten und längeren Lagunen benützt, namentlich in solchen, die kein morastig-schilfiges Ufer haben. Die Mamboë, Marutse und Masupia sind als die besten Fischer im Reiche bekannt. Dieselben sind in Colonien längs dem Flusse angesiedelt, und bewohnen hier theils stabile, theils periodische Niederlassungen.
Die zweite Fangweise ist die in Reusen; diese wird zur Zeit des niedrigsten und des höchsten Wasserstandes, im letzteren Falle oft combinirt mit der dritten Fangweise, versucht. Im ersteren Falle stets an den Stromschnellen, wo die Wassermenge des Flusses durch zahlreiche Inseln getheilt, kleine, zwischen zwei Felsenblöcke eingeengte Strömchen bildet. Die Reusen sind auffallend schmal, etwa 1½ Meter lang, mit dreißig bis vierzig Zentimeter Querdurchmesser und in der Form unseren Reusen ähnlich. Sie sind aus starkem Rohr gearbeitet und werden dem Strome mit ihren Mündungen entgegengehalten.
Die dritte Fangart besteht in der Errichtung niedriger, aus dem durchweichten Boden der überschwemmten ebenen Partien der Thäler aufgeführter Ringdämme. Diese werden mit dem ersten Sinken des Flusses errichtet, welches so rasch erfolgt, daß man mit Leichtigkeit sich der Fische innerhalb der Dämme bemächtigen kann. Ich fand ähnliche Dammüberreste an ebenen Stellen in der Nachbarschaft der Dörfer und Städte. Der Inquisi wird in dieser Weise häufig erbeutet. Das trübe Wasser erleichtert das Gelingen des Fanges.
Die vierte Fangweise besteht im Absperren der Mündungen kleiner drei bis zehn Meter breiter, minder dicht oder gar nicht beschilfter Lagunen mit weitmaschigen, aus starkem Rohr gearbeiteten Matten. Diese Fangweise wird in den Monaten Mai, Juni, Juli und August zur Zeit des Sinkens des Wassers in der Regel mit gutem Erfolge angewendet. In ähnlicher Weise werden in den Fluß einmündende Regenmulden abgesperrt. Die fünfte Fangweise ist nächst dem Netzfang die anziehendste und beweist die große Geschicklichkeit, mit welcher die Zambesi-Bewohner die leichteren Wurf- und Stoßspeere zu handhaben wissen. Nebst den Fischen werden auch Leguane gespeert, als Speere bedient man sich einer Waffe, die zwischen einem Fischotter- und einem Fischassagai die Mitte hält. Die Scheide ist nur acht bis zehn Zentimeter lang, zierlich gearbeitet und vertritt die nagelförmige runde Spitze der letztgenannten Waffe, so, daß der übrige Theil vierkantig und fingerdick ist. Die vier Kanten sind von vier Reihen gekrümmter Widerhaken gebildet.
Der Unmuth Sepopo’s über seine Krankheit mehrte sich von Tag zu Tag, er wurde mißtrauisch, denn auch diesmal erblickte er in seiner Krankheit den Einfluß eines bösen Zaubers eines seiner Unterthanen und suchte durch eine Reihe von Hinrichtungen diesen Bann zu brechen. Die Stimmung Sepopo’s kam Vielen sehr gelegen, sie konnten sich nun auf die leichteste Weise ihrer Gegner oder Nebenbuhler entledigen, indem sie dieselben einfach des Hochverrates anklagten.
Da sich der Zustand Sepopo’s nicht besserte, ließ er am 27. Sykendu rufen und drohte, ihn hinrichten zu lassen, wenn nicht rasch eine günstige Aenderung eintreten würde. Sykendu versprach ihm rasche Hilfe, jedoch nur unter der Bedingung, daß Sepopo ihm ein schönes Makololo- oder Masupia-Weib übergebe. Der König, welcher bisher das wiederholt ausgesprochene Verlangen des Mambari unberücksichtigt ließ, erfüllte es nunmehr.
Am 30. besuchte mich der Häuptling Rattau; ich lenkte das Gespräch auf meine zukünftige Reise und er erzählte mir von einem Araber, welcher diese Reise einst unternommen hatte. Als ich nun Westbeech darüber befragte, berichtete mir dieser eine Episode, die ebenso abenteuerlich wie interessant genannt werden muß und die Zähigkeit des Arabers erkennen läßt. Ein Araber, der im Dienste des Sultans von Zanzibar stand, schiffte sich mit einem der englischen Dampfschiffe nach Capstadt ein. Hier lebte er eine Zeit lang unter den Malayen und als er von einem Weißen, den er darum befragt hatte, über die Richtung belehrt wurde, in der seine Heimat lag, nahm er sich vor, dahin zu wandern. Man bewilligte ihm die Ueberfahrt nach Port Elizabeth, von wo er sich nach den Diamantenfeldern wandte. Von hier wieder die Richtung nach Norden einschlagend, gelangte er mit dem Wagen eines Händlers bis Kuruman, und bei der ersten Gelegenheit, die sich ihm darbot, nach dem Marico-District, von da kam er irriger Weise wieder nach Kuruman zurück, um schon in kurzer Zeit darauf nach dem Marico-District zurückzukehren. Von Zeerust reiste er auf einem zufällig mit Lebensmitteln nach Schoschong fahrenden Wagen nach dem Lande der östlichen Bamangwato, woselbst er sich eine Zeit lang aufhielt, ohne jedoch das Anerbieten der Schoschonger Kaufleute, sich bei ihnen zu verdingen, anzunehmen.
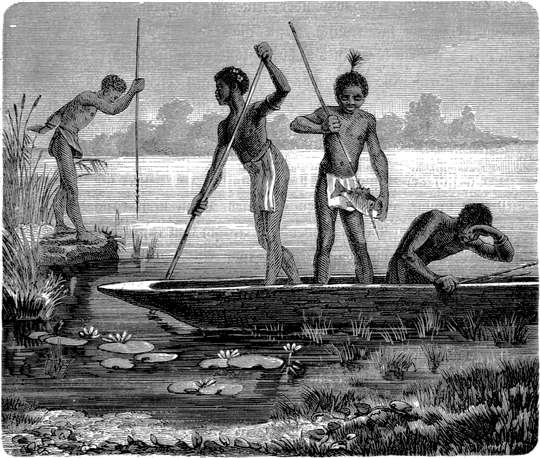
Das Speeren der Fische.
In ein dürftiges Gewand gehüllt, mit getrocknetem Fleisch und einem Kiri versehen, trat er, nachdem er sich den Weg nach Norden hatte beschreiben lassen, seine Weiterreise an. So kam er bis zum Nataflusse, hier fanden ihn Seschele’s Leute (welche von einem Jagdzuge zurückkehrten) in halbverhungertem Zustande, trugen ihm ihre Hilfe an und forderten ihn auf, mit ihnen nach dem Süden zurückzukehren. Er schlug jedoch ihr Anerbieten aus und zog weiter. In Folge Wassermangels wich er jedoch vom Wege ab, schlug eine östliche Richtung ein und irrte drei Tage lang umher, schlief in der Nacht auf Bäumen, bis er zuletzt unter einem derselben in bewußtlosem Zustande liegen blieb. Hier fanden ihn Matabele, nährten ihn bis er wieder zu Kräften kam und brachten ihn hierauf zu ihrem Könige La Bengula nach Gubuluwajo, woselbst er einige Zeit verweilte. Als er von Westbeech’s erstem Zuge zu Sepopo hörte, folgte er diesem, nachdem ihm der Matabele-König eine Strecke weit Führer mitgegeben. So kam er abermals zum Nataflusse, an dem er den Wagen des holländischen Jägers van Groonen antraf, jedoch ohne Aufenthalt weiter nach dem Zambesi zog. Jenseits des Saddler’schen Tümpels begegneten und berichteten ihm Westbeech’s Diener, daß der letztere am Tschobe weile. In Folge Wassermangels verließ er neuerdings seinen Pfad und traf einen Haufen Masarwa’s, die einen Kudu und ein Zebra erlegt hatten; von ihnen erhielt er Antilopenfleisch und ließ sich zu Westbeech führen. Dieser war nicht wenig erstaunt, diesen kaum bekleideten, und über und über von dem dornenvollen Wege mit Wunden bedeckten Menschen vor sich zu sehen. Am 9. September 1871 verließ der Araber Impalera, um sich mit Sepopo’s Leuten nach der Barotse, wo der König damals wohnte, einzuschiffen. Fünf Monate lang blieb er bei Sepopo, bis er sich erholt hatte; als er sich auf die Weiterreise begab, wurde er von einem Stamme, der weiter ab wohnte, wieder zu Sepopo zurückgebracht, verblieb hier einige Zeit und trat neuerdings seine Reise weiter nach Norden an. Man erfuhr nur noch, daß er nach einer der nördlichen Provinzen des Landes, nach dem Mankoë-Lande gelangt war und dann verschollen blieb.
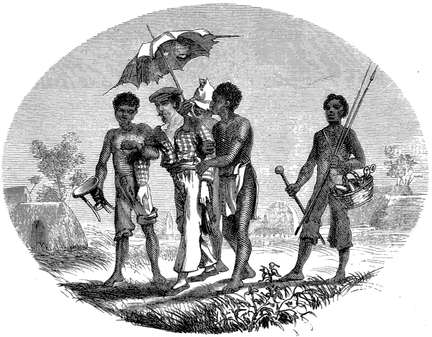
Gang durch Schescheke.
Am letzten Tage des Jahres 1875 brachten uns Masupia’s von Panda ma Tenka die traurige Nachricht, daß Cowley, der Begleiter der beiden englischen Officiere, welche zu Sepopo der Elephantenjagd halber gekommen waren, dem Fieber erleben sei, ferner daß die beiden Officiere in einem trostlosen Zustande von den Victoriafällen von ihren Dienern zurückgetragen wurden.
Am 2. Jänner 1876 erkrankte Westbeech an einer Entzündung der Kniehöhle, nachdem ihm seine Mittel nicht die gewünschte Linderung brachten, untersuchte ich die erkrankten Stellen und fand, daß beiderseits die Kniehöhle von zahllosen weißen Blasen bedeckt sei. Ich öffnete einige derselben und fand zu meinem Erstaunen, daß sie mit feinen äußerst scharf bewollten Pflanzenhärchen eines binsenartigen Grases gefüllt waren. Zu dem Könige, den ich seit meiner Rückkehr noch nicht besucht hatte, war in der letzten Zeit außer Sykendu, drei seiner Frauen und seinen Günstlingen Niemand zugelassen worden.[15]
Westbeech und auch die mich besuchenden Häuptlinge riethen mir meiner Gesundheit halber so bald als möglich Schescheke zu verlassen. So entschloß ich mich zur Rückkehr nach Panda ma Tenka. Jene Tage, an welchen mich mein Zustand ans Lager oder in der Hütte fesselten, benützte ich, um von den mich besuchenden Häuptlingen Erkundigungen über das sociale Leben im Marutse-Reiche einzuziehen. Ich gebe in Folgendem die Berichte derselben in der Hauptsache wieder.
Die wirklichen Unterthanen werden als Sklaven angesehen, wenn sie einem anderen Stamme als den der Marutse und Mabunda angehören und nicht vom Herrscher frei erklärt wurden. Die Marutse sind allgemein frei von Sklavendiensten, allein sie können nach begangenen Missethaten oder wenn sie des Königs Ungunst erregen und deshalb angeklagt und verurtheilt wurden, zu Sklavendiensten verhalten werden. Erhielt oder nahm ein Sklave eines anderen Stammes eine Marutse-Frau zur Gemahlin, so werden die Kinder, wenn der Vater nicht später frei erklärt wurde, als Sklaven angesehen und gehören demjenigen an, in dessen Leibeigenschaft der Vater stand. Der Preis für einen ausgewachsenen Sclaven belief sich in Schescheke auf ein Boot, eine Kuh oder zwei Baumwolldecken; im westlichen Theile des Reiches ist der Preis noch niedriger, in den nördlichen Partien wie am oberen Kaschteja-Flusse sind sie sogar für einige Glasperlenschnüre feil. Im Marutse-Reiche finden keine öffentlichen Sklavenmärkte statt, trotzdem können aber viele Sklaven in einem einzigen Dorfe erstanden werden. Leider sind es meist die Mambari, die so manchen Sklaven kaufen und verkaufen und damit gewiß den unwissenden Schwarzen kein gutes Beispiel geben. Diese Händler, die gleich mit ihren Gebetbüchern zur Hand sind, um sich vor Jeden, den sie als schreib- und lesekundig wähnen, als Christen zu bekennen, haben in Wirklichkeit nichts von christlicher Liebe und tragen nur Verwirrung statt Belehrung und Civilisation in die vom Aberglauben befangenen Gemüther der Völker am oberen und centralen Zambesi.
Ist ein Mann nicht gerade Leibsklave, so kann er, mit Erlaubniß seines Herrn, mehrere Frauen nehmen. Freie Frauen, die nicht wie Sklavinnen einfach als Geschenk gegeben oder verkauft werden, sind in ihrer Wahl frei. Schon die Vorliebe für weibliche Herrscher setzt eine größere Achtung für das weibliche Geschlecht voraus, größer, als wir sie bei den Betschuana’s finden, bei welchen sie Dienerinnen und Arbeiter, bei den Masarwa’s, bei denen sie Lastthiere sind und bei der Zulu-Race, bei welchen sie als Sklaven betrachtet und behandelt werden. Verschenkt der Regent oder ein Angesehener eine Frau, so geschieht dies meist als Gegengeschenk oder als Gunstbezeugung. Am 10. kam von Panda ma Tenka die höchst betrübende Nachricht, daß Westbeech’s Gehilfe Bauren dem Fieber erlegen sei. Am 11. erschien der Kommandant Capella in unserem Höfchen und brachte die Nachricht, daß der König sechs Kähne dem Elfenbeinhändler zur Verfügung gestellt habe, um sein Elfenbein nach Impalera zu schaffen. Der Letztere erklärte jedoch, er brauche zweimal so viel und könne jetzt noch nicht abgehen. Ich jedoch benützte diese Gelegenheit, um meine Sachen zu packen und die Rückreise anzutreten. Westbeech versprach, sich noch am selben Tage von Sepopo mehrere Kähne zu erbitten und mich drei Tage später einzuholen. Ich verließ mich darauf, traf keine Vorsorge, mir Nahrungsmittel zu verschaffen — nicht ahnend, daß durch Sepopo’s Hinterlist aus den drei Tagen fünf Wochen wurden, und ich noch die traurigste Zeit auf dieser dritten Reise erleben sollte. Im folgenden Capitel will ich Handel und Wandel, Sitten und Gebräuche der Stämme des weitläufigen Reiches schildern, hier sei es mir erlaubt, vor dem Scheiden von Schescheke noch einiger Charakterzüge der bedeutendsten das Marutse-Reich bewohnenden Stämme zu gedenken.
Kein Stamm des Marutse-Mabunda-Reiches ist so tapfer und muthig wie die südlich vom Zambesi wohnenden Zulu’s und Amaswazie’s. Von den Matabele findet sich eine Kolonie in der Barotse, während unter den übrigen zahlreichen Stämmen die Mamboë und Masupia zu den muthigsten zu rechnen sind. Mit Rücksicht auf Muth den wilden Thieren gegenüber sind die Masupia-Elephantenjäger unerschrocken, doch keiner der Stämme besitzt so tüchtige Löwenjäger wie es die Matabele sind. Nur in der Jagd des Nilpferdes und des Krokodils werden diese von einem der Zambesi-Stämme, den Mamboë’s übertroffen. Zu Trägern und schweren Arbeiten eignen sich die Mabunda und Mankoè. Die letzteren sind unstreitig der schönste und kräftigste Menschenschlag im vereinigten Königreiche. Als die feigsten werden die Manansa angesehen, ich selbst lernte sie nur als bewährte, keineswegs feige Diener kennen. Stolz ist unter den Eingebornen meist mit Muth gepaart, deshalb erreicht er bei den Matabele einen hohen Grad, während die Stämme des Marutse-Mambunda-Reiches ihn kaum kennen. Zwar lassen die Marutse es den übrigen Völkern deutlich und öfter fühlen, daß sie der herrschende Stamm seien, allein von eigentlichem Stolz und einem auf selbstbewußter Kraft und Machtstellung beruhenden Dünkel, wie ihn die Matabele und Zulu’s zur Schau tragen, bemerkt man hier zu Lande nichts, selbst die in der Barotse angesiedelten Matabele sind durch ihre friedliche Umgebung nach und nach zahme Löwen geworden. Deshalb ist auch das Verhältniß zwischen Herr und Sclave ein ziemlich befreundetes, ein viel freundlicheres, als bei allen südlich vom Zambesi wohnenden, Vasallen und Sklaven haltenden Stämmen. Bescheiden erscheinen namentlich die Mamboë und alle nördlich des Zambesi wohnenden Stämme, welche selten den Marutse-Hof besuchen. Im Allgemeinen ist die Bescheidenheit von Seite der Unterthanen den Kosana’s und Koschi’s und dem königlichen Hofe gegenüber eine an tiefste Unterwürfigkeit grenzende; wenn sich die Bewohner des Tschobe-Striches, ferner die Batoka, Matonga am Zambesi und die in und um Schescheke lebenden Marutse und Mabunda den Weißen gegenüber oft sehr arrogant betragen, so trägt wohl meist das Benehmen der Weißen selbst die Schuld daran. Diese Arroganz kann jedoch nicht als Stolz bezeichnet werden; denn ich beobachtete nur zu oft, daß ein dem anmaßenden Dünkel und der Frechheit entsprechendes scharfes, strenges Auftreten die Eingebornen einschüchterte.
Wie blind und treu die Untertanen gehorchen, zeigt das Verhältniß zu Sepopo. Was die Treue der Sklaven zu ihrem Gebieter betrifft, ist diese meist eine lobenswerthe, dafür kann man weniger von ehelicher Treue und Liebe sprechen. Ich bemerkte wohl, daß oft Zuneigung zur Ehe führte, diese aber in seltenen Fällen als bindend betrachtet wird, wofür schon das Mulekau-Unwesen spricht. Dasselbe ist ein Krebsschaden des ganzen Volkes, es zerstört jedes Eheglück und wirkt schon auf die heranwachsende Jugend so verderblich, daß diese sehr wenig von wirklicher Zuneigung in’s eheliche Leben hinüberbringt. Das Mulekauthum scheint namentlich den südwestlichen und westlichen Stämmen eigen gewesen zu sein, sich aber nach und nach über das ganze Reich ausgebreitet zu haben.
Was die elterliche und kindliche Zuneigung anbelangt, so beobachtete ich in der Regel blos die erstere, ja ich fand die Eltern oft sehr liebevoll und zärtlich schon herangewachsenen Sprossen gegenüber, allein in der Regel wird diese von den Kindern schlecht belohnt, wenn die Eltern altersschwach und gebrechlich werden. So wie ich die Stämme des Marutse-Mabunda-Reiches kennen lernte, würde ich es dem Reisenden nicht rathen, den ihm vom Könige mitgegebenen Dienern blindlings zu vertrauen. Der Reisende muß einen Chef oder einen sonst angesehenen Mann als Führer fordern, einen, der mit dem Kiri den Trägern und Bootsleuten gebietet, wenn sich diese widerspenstig zeigen, er muß schon im Vorhinein die gegenseitigen Pflichten und Rechte vom Könige genau feststellen lassen. Der Reisende darf nicht zu freigebig sein und die verschiedenen Stämme so behandeln, wie es ihre geistige Entwicklung und ihr Charakter erheischt. Güte hilft bei den Manansa und Mamboë, ein gemessenes etwas mehr zurückhaltendes Betragen bei den Marutse, Mankoë; unablässige Vorsicht ist den Masupia, Mabunda und Matonga gegenüber geboten. Ein ernstes, ich möchte sagen jedes Lächeln bannendes Benehmen muß man den Matabele zeigen, und vor den Makalaka’s Alles nagelfest halten. Den Herrscher behandle man mit großer Freundlichkeit und suche es geheim zu halten, wenn man sich mit ihm entzweit. Hilft Güte allein nicht und stellt der Regent immer unverschämtere Forderungen, so muß man sich ernst, gemessen und furchtlos zeigen und sich nicht zu übereilten, gewaltthätigen Schritten hinreißen lassen. Tapferkeit und Muth sind, wie schon erwähnt, nicht die Zierden der obgenannten Stämme, und darum ist ein entschlossenes, furchtloses Auftreten das beste Mittel, sich den Rückzug zu sichern, wenn man an weiteres Vordringen oder an die Verwirklichung anderweitiger Pläne nicht mehr denken kann.
Die Menschenopfer zu Zauberzwecken, die Art und Weise des Tödtens der Hausthiere, der Gebrauch der mit Widerhaken versehenen Wildassagaie etc. zeigen deutlich, daß der thierische Raub- und Vernichtungssinn eine der größten Schwächen der obgenannten Völker bilden. Haß und Falschheit sind äußerst selten, ich möchte nur die Makalaka’s der letzteren Untugend beschuldigen. Dankbarkeit den Weißen gegenüber ist unstreitig allen Stämmen eigen und in um so höheren Grade, je einfacher ihre Lebensweise und je weiter nach Norden, Nordosten oder Nordwesten dieselben von den Victoria-Katarakten und der Tschobe-Mündung wohnen. Eitelkeit besitzen alle wilden Stämme; derselben zu fröhnen, haben im Allgemeinen die Völker des Marutse-Mabunda-Reiches mehr Geschick und Sinn, als die meisten der südlich vom Zambesi wohnenden eingebornen Stämme. In moralischer Beziehung stehen sämmtliche Stämme des Reiches tief, doch ist diese Schattenseite ein Produkt des Urzustandes und nicht erworben, wie bei einigen Stämmen der Hottentotten-Race. Ich glaube, daß ein gutes Beispiel, Bekehrung, ein von den Weißen auf den Herrscher sanft ausgeübter Druck schon nach zwei Jahren eine äußerst befriedigende Umgestaltung bezwecken könnte. Es gehört jedoch dazu ein ernsteres Auftreten von Seite der Weißen und ein Mann als Herrscher, der mehr Ehrenhaftigkeit besitzen müßte, als ich es an Sepopo beobachtet habe. Erstlich müßten die Fremden das Anerbieten der Mulekau-Ehre zurückweisen. Sie gewinnen nicht allein mehr Achtung, sondern zeigen auch dadurch, daß solche Sitte in dem Lande der Weißen nicht allein ungebräuchlich, sondern auch verdammt ist.
Das System, nach welchen sich der König seine Gemahlinnen nimmt, indem er sie in der Regel gegen ihren Willen raubt, und deren sich dann viele, trotz aller Androhungen des Todes, der Untreue schuldig machen, muß auch erst gebrochen werden, bevor eine merkliche Besserung der Sitten im Gesammtreiche erzielt werden könnte. Die Frauen betrachten ohnehin die ehelichen Bande als sehr lose, selbst da, wo sie sich den Mann frei gewählt haben. Das Beispiel der Königinnen, die sich der Untreue schuldig gemacht, trägt sicherlich nicht dazu bei, der allgemeinen Unsittlichkeit zu steuern, und dies umsoweniger, als Sepopo selbst jeden ihm zu Gehör gekommenen Fall der Oeffentlichkeit preisgab.
Daß die wenigen Weißen und Eingebornen, die von Süden her das Marutse-Mabunda-Reich besuchen, schon einen gewissen indirekten Einfluß auf die Stämme des Zambesi ausgeübt haben, erhellt daraus, daß sich die Stämme schon, wenn auch noch sehr primitiv, bekleiden, während die nördlichen Nachbarn des Reiches, die Maschukulumbe, vollkommen nackt einhergehen.
Religiöse Vorstellungen. — Lebensweise der Völker. — Ackerbau. — Erträgniß desselben. — Preis der Feldfrüchte. — Consum. — Kleidung der Männer und Frauen. — Die Stellung der Frau im Marutse-Reiche. — Erziehung der Kinder. — Ehe. — Todtenbestattung. — Grabdenkmäler. — Das Reisen im Lande. — Die Rechtspflege im Reiche. — Eine Hinrichtung. — Die Doctoren Sepopo’s. — Aberglauben. — Zaubermittel. — Menschenopfer. — Industrie-Erzeugnisse der Marutse. — Thongefäße. — Holzarbeiten. — Calebassen. — Flechtarbeiten. — Schneide-Werkzeuge. — Jagd- und Kriegswaffen. — Textil-Industrie. — Canoebau. — Tabakspfeifen und Schnupftabakdosen. — Toilette-Artikel. — Schmuckgegenstände.
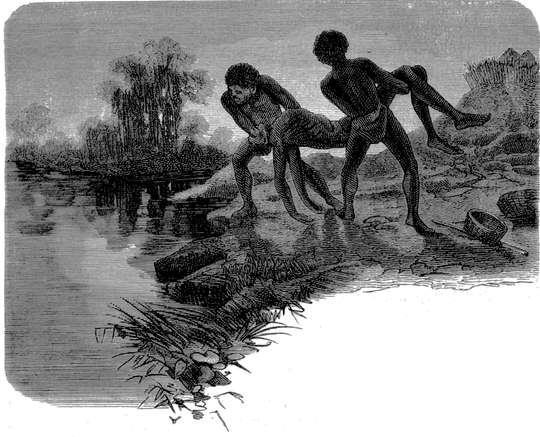
Ertränken arbeitsunfähiger Personen.
Ich erlaubte mir in den letzten Capiteln bei verschiedenen Gelegenheiten auf die mir interessant erscheinenden Gebräuche im Marutse-Reiche und auf viele Charakterzüge seiner Stämme hinzuweisen; ich will nun die Schilderung derselben im Folgenden vervollständigen und im nächsten Capitel zu meinen Reise-Erlebnissen zurückkehren.
Wie schon erwähnt, besaß die Banthu-Familie, bevor sie sich in die zahlreichen Stämme theilte, welchen wir gegenwärtig begegnen, den Glauben an einen mächtigen, unsichtbaren Gott; bei den Marutse hat sich dieser Glaube unter allen Banthu-Stämmen am reinsten erhalten. Man glaubt an ein unsichtbares allwissendes Wesen, welches genau das Thun eines Jeden beobachtet und mit jedem Menschen nach Belieben verfährt.
Man scheut sich sogar seinen Namen auszusprechen, und bedient in der Regel eines Ersatzwortes: »Molemo«, welches Wort jedoch umfangreichen Begriff in sich schließt und deshalb in seinem jedesmaligen Sinne leicht verwechselt werden kann. Molemo kann Gott, kann böse oder gute Geister, Heilmittel und auch Gifte, Zaubermittel Amulete etc. bezeichnen. Ihre richtige Benennung für das oben erwähnte allwissende Wesen ist »Ñambe« = Njambe. Beim Aussprechen dieses Wortes erheben sie ihre Augen gegen das Firmament, weisen mit der Hand dahin oder sie thun beides ohne Njambe auszusprechen. Ich beobachtete Viele, die es mit »Er da oben« oder »Er« umschrieben. Sie meinen, das mächtige Wesen lebe »mo-chorino«, d. h. im Blau des Firmamentes. Stirbt Jemand natürlichen Todes, so heißt es: »Njambe rief ihn hinweg«; unterliegt ein anderer im Kampfe mit seinem Nebenmenschen, mit wilden Thieren oder der Wuth der Elemente, so heißt es: »Es geschah auf Njambe’s Geheiß;« wird ein Verbrecher zum Tode verurtheilt, so wird dies als die gerechte von Njambe gesandte Strafe angesehen und der Schuldige, der davon überzeugt zu sein scheint, ergibt sich demüthig in sein Geschick, während der unschuldig Verurteilte (unter Sepopo gab es deren zahllose) wie die ihn begleitenden Freunde bis zum letzten Momente das größte Vertrauen in Njambe’s Allwissenheit setzend, auf seine Hilfe hoffen, die sich bei dem bei Hinrichtungen gebräuchlichen Giftgenusse im Erbrechen des Giftes äußern soll.
Die Völker des Marutse-Reiches glauben außerdem an unsichtbare gute und böse Geister und suchen letztere durch auf Pfähle aufgehangene Beschwörungsmittel von ihren Gehöften zu bannen oder sie mindestens zu besänftigen. Die Abwehr- und Besänftigungsmittel sind: Thier- und Menschenknochen, Nilpferdzähne, besondere Holzstücke, Baumrinden, Kürbißkalebassen etc., die in aus Bast, Gras oder Baumblättern geflochtenen sackförmigen Körbchen auf drei bis vier Fuß hohen Pfählen aufgehangen werden. Die meisten Völker des Marutse-Mabunda-Reiches glauben an ein Fortleben nach dem Tode, und so pflanzen z. B. die Masupia mächtige Elfenbeinzähne auf die Gräber ihrer Chefs. Es geschieht dies hauptsächlich, um den verstorbenen, Njambe näher gerückten Chef durch die Weihe der Zähne für seine Trennung von seinem Hab und Gut und von ihnen selbst zu beschwichtigen und sich seines nun doppelt mächtigen Schutzes zu vergewissern.
Außerdem, daß sie jedes Unheil bösen Geistern zuschreiben, glauben sie auch viele Unglücksfälle dem Uebelwollen, dem Zürnen eines verstorbenen Chefs zuschreiben zu müssen, die durch gewisse am Grabe vorgenommene Ceremonien besänftigt werden können. Erkrankt ein Mitglied der königlichen Familie, oder ein weiser Besucher in der Umgebung von königlichen Beerdigungsstätten, so wird der Erkrankte, wenn er sich der Gunst des königlichen Hauptes erfreut, an das Grab des Angesehensten gebracht, und hier verrichtet der Herrscher eine gebetartige Ceremonie in flehender und beschwörender Form, damit sich der Verstorbene des armen Dulders erbarme und ihn durch seine Fürsprache bei Njambe gesund mache.
Die Lebensweise der Stämme des vereinigten Marutse-Mabunda-Reiches ist im Allgemeinen nicht so einfach wie die ihrer südlich vom Zambesi wohnenden Bruderstämme. Der Boden lohnt die Mühe des Ackerbaues so reichlich, die Viehzucht gedeiht in zwei Dritttheilen des Reiches so vortrefflich, und das von der Tsetse inficirte Dritttheil ist derart von Wild überschwemmt, die Flüsse und ihre Lagunen fischreich und die Wälder, Büsche und Wiesen so reich an eßbaren Früchten, Samen und Wurzeln, daß die Eingebornen nicht, wie manche Betschuana-Stämme durch das Ausbleiben der Sommerregen von Hungersnoth heimgesucht werden. Die reichliche Wassermenge, der gute Boden und das warme Klima unterstützen Ackerbau und Viehzucht in der kräftigsten Weise.
Die Felder werden von den Frauen durch fleißiges Ausjäten rein gehalten, auf den meisten lange Furchen zum Wasserabfluß gezogen. Zur Zeit der herannahenden Reife errichtet man Wächterhütten, in denen Junge wie Erwachsene zuweilen Tag und Nacht die Felder bewachen. Beim Ausdreschen schüttet man die Aehren und Kolben auf große Carossen und Häute, auch auf Stroh- und Rohrmatten und schlägt mit Knütteln auf dieselben los. Ein bestimmter Theil der Ernte gehört den Frauen, welche darüber nach Gutdünken verfügen können. Dabei wissen sie ihr Eigenthum in Wort und That zu wahren und ihren Theil gut zu verkaufen; ich beobachtete sowohl bei meinen Unterhandlungen als bei dem Tauschgeschäft der Händler, daß wir nicht so leicht die gesuchte Waare von dem schönen Geschlechte erstehen konnten; selbst wenn Männer an Stelle ihrer Frauen die Waaren feilboten, forderten sie stets einen höheren Preis und sagten: »Die Frau fordert es, sonst muß ich das Korn wiederbringen.« Für ihren eigentlichen Bedarf, abgesehen von den Abgaben an den Chef und den König, baut sich eine Familie von etwa fünf Personen ein bis drei Grundstücke von je 2800 bis 3000 Quadratmeter Fläche. Da dieselben zu zwei Dritttheilen in den bewaldeten Theilen des Landes liegen, wird zuerst von den Männern und Jungen das Unterholz abgehauen, und die großen Bäume ihrer Aeste beraubt. Mir dem gewonnenen Holze wird das Feld umzäunt. Das Unterholz und das ausgejätete Unkraut wird hierauf in Brand gesteckt und mit der Asche das Feld gedüngt und nun die Saat gepflanzt. Diese Aussaatzeit begreift die Monate September und October in sich; zur Saat der Kürbisse, bohnenartigen Früchte, des Tabaks etc. wählt man die Zeit von Ende October bis Anfang December. Die zuletzt erwähnten Feldfrüchte werden zuerst und bei einem auffallend raschen Wachsthum oft schon im Jänner reif, die Kafirkornarten und der Mais im Februar, die Bohnen in beiden Monaten. Am häufigsten wird das gewöhnliche Kafirkorn angebaut, von dem ich zwei Arten, das rothe und das weiße unterscheide. Es gedeiht vorzüglich und liefert das Hauptcontingent der vegetabilischen Abgaben, sowie für den nach außen hin mit Feldfrüchten getriebenen Handel. Die beiden Arten stimmen vollkommen mit denen Süd-Afrikas überein.
Die dritte Kornart, die wir auch hie und da, doch selten in Süd-Afrika vorfinden, wird von den holländischen Jägern »Kleen-Korn«, von den Marutse »Rosa« genannt. Diese Art zeigt kleine, dem Vogelsamen (Hanfsamen) ähnliche Samen, welche fein gestoßen, ein schwarzes, zur Brodbereitung durch größere Bindekraft tauglicheres Mehl als die beiden sorghumartigen liefern. Es wird von den Marutse als feinere Mehlgattung angesehen und hat den zweifachen Werth der beiden anderen Gattungen.
Gleich häufig wird der Mais gepflanzt und gedeiht vortrefflich. Noch häufiger als Mais werden im Marutse-Reiche die kürbißartigen Früchte angebaut, darunter mehrere Arten Wassermelonen, eßbare Kürbisse und eine Unzahl Flaschen- etc. Kürbisse, die nur der äußeren Schalen halber gepflanzt werden. Ebenso häufig werden zwei Bohnengewächse, das eine mit kleineren farblosen, das andere mit etwas größeren, meist carminrothen oder violetten Bohnen gepflanzt. Sie bilden wie das Mabele (gewöhnliches Korn), die Rosa und der Imboni (Mais) einen Theil der Abgaben. Mit Nilpferdspeck oder Fleisch gekocht, bietet die Li-tu- und die Di-nau-a-Bohne ein Gericht, welches unsere heimische Art an gutem Geschmack übertrifft. Zu diesen Feldfrüchten müssen wir noch drei hinzufügen, von welchen die Manza und die Masoschwani (Arachis hypogaea, M’pinda der centralen Westküste) im Gesammtreiche, Baumwolle in den östlichen Landestheilen allein angebaut werden. Die drei letzteren verbürgen, daß auch Reiscultur mit Erfolg betrieben werden könnte. Die Arachis bildet einen Theil der Steuern und des Tributs, die Manza ist Krongut und wird im Gesammtertrage dem Hofe abgeliefert, während die Baumwolle von den östlichen Stämmen für den eigenen Bedarf gebaut und verwendet wird. Die Arachis wird in der Asche und in Schalen geröstet genossen, von den Europäern, welche den Zambesi besuchen, im Nothfalle geröstet und als Kaffeesurrogat verwendet. Die Manza wird zu feinem Mehl gestoßen und ohne Zuthat von Salz als Mehlbrei genossen.
Bezüglich der Baumwolle erwähne ich, daß sie zu guten starken Geweben verarbeitet wird. Weniger als Nahrungsmittel denn als durststillendes Mittel pflanzt man häufig um die Hütten und zerstreut zwischen Korn und Mais das gleich üppig und hoch aufwachsende Zuckerrohr (Imphi). Es ist dieselbe Art, welche man in ganz Süd-Afrika vorfindet und erreicht am centralen Zambesi ihre Süßreife im December bis Februar.
Der Preis der Feldfrüchte stellt sich wie folgt:
Zur Anpflanzung des Tabaks wählt man meist kleine, etwa 10—20 Quadratmeter umfassende Vertiefungen. Der Tabak wird getrocknet, zerkleinert, etwas befeuchtet und dann in den Kornstampfblöcken zu kegelförmigen und brodförmigen Ballen festgestoßen. Im Allgemeinen ist der Tabak, wie ihn die Unterthanen des Marutse-Herrschers anbauen, dichter gearbeitet, hält sich länger und ist bedeutend nicotinreicher als jener, den wir bei den südafrikanischen Eingebornenstämmen finden. Mit Rücksicht auf Boden, Klima und Bewässerungs-Möglichkeit bin ich der Meinung, daß nicht allein unsere Getreidearten, namentlich Weizen, sondern auch Reis, Baumwolle, in den östlichen Theilen auch Kaffee, nicht minder Wein und unsere sowohl als auch Südfrüchte ausgezeichnet gedeihen könnten.
Ziehen wir die Menge der consumirten Nahrungsmittel in Betracht, so finden wir, daß nebst Wildfleisch gewöhnliches Kafirkorn, Kleinkorn und Mais sowie Kürbisse in erster Linie stehen. Nach den Fischen folgt im Verhältniß der consumirten Mengen: saure Milch, süße Milch, Rind-, Ziegen- und Schaffleisch, etwa fünfundvierzig wilde Fruchtarten, zwei Bohnenarten, Erdnüsse, Hühner, Wildgeflügel, Manza, Honig etc. Das Fleisch wird meist in gut geschlossenen, irdenen Töpfen gekocht, oder auf Kohlen am und ohne Bratspieß geröstet. In der Fleischzubereitung übertreffen die Stämme jene südlich vom Zambesi, ich glaube, daß kein Einziger derselben so wohlschmeckende Fleischgerichte bereiten könnte, wie man sie in den besseren Häusern des Marutse-Reiches zu bereiten pflegt. Es wird den Reisenden um so mehr überraschen, wenn er bedenkt, wie sehr das Reich den Betschuana-Reichen gegenüber »verschlossen« genannt werden muß. Wildgeflügel wird gekocht oder gebraten, und mit den Kopffedern oder der Krone auf schön durchbrochenen Holzschüsseln servirt. Aus Aberglauben verschmähen manche Stämme gewisse Wildarten, bei einigen wurde z. B. die Pallah nicht beachtet, bei anderen die Eland-Antilope, bei manchen das Fleisch des Nilpferdes, während wieder manche Fleisch genossen, welches, wie das der Raubthiere, von den meisten südafrikanischen Eingebornen als ungenießbar betrachtet wird. Fleisch und Fische werden auch getrocknet und ohne jeden Einsalzungsproceß auf längere Zeit aufbewahrt. Die Kornarten werden gekocht oder in hölzernen Stampfblöcken zu Mehl gestoßen und aus demselben mit Milch oder Wasser ein Brei bereitet, Mais wird in grünem und trockenem Zustande gekocht und geröstet. Von Bohnen kochen die Stämme die genannten Arten und rösten die Erdnuß (Arachis). Die Kürbisse werden zerschnitten und gekocht, die Wassermelonen roh genossen oder gekocht. Wichtig ist die Zubereitung der Manza, deren Wurzel im grünen Zustande giftige Eigenschaften besitzt, im trockenen, fein pulverisirt, einen schmackhaften arrowrootartigen Brei liefert, der namentlich zu Fleischspeisen als eine passende Zuspeise gelten kann. Wilde Baum- und Buschfrüchte werden im frischen und getrockneten Zustande geröstet (am Feuer sowohl als an der Sonne) oder werden in Milch gekocht oder auch zerstoßen und in breiartigem Zustande genossen. Da die einzelnen Wildfrüchte zu verschiedenen Jahreszeiten reifen, so kann man füglich sagen, daß die Eingebornen im Marutse Reiche sich von diesem Nahrungsmittel allein das ganze Jahr hindurch nähren könnten.
Zur Würze der Speisen bedienen sich blos die Wohlhabenderen des Salzes, da dieses von weit her aus West und Südwest herbeigebracht wird. Von geistigen Getränken erzeugen sie aus Kafirkorn ein starkes und ein schwaches Bier, das erstere, das Lagerbier, wird Matimbe, das zweite Butschuala genannt; außerdem erzeugen sie süßliche Biere aus mehreren Wildfrüchten, so aus der Morulafrucht, das ciderartige, ferner das schon erwähnte Honigbier Impote. In der Regel halten Wohlhabende zwei Mahlzeiten, die erste 1½ oder zwei Stunden nach Sonnenaufgang, die zweite beim Sonnenuntergang, Bier wird nachgetrunken. Die ärmeren Classen halten nur eine nennenswerthe Mahlzeit und zwar am Abend.
Unstreitig sind die Völker im Marutse-Mabunda-Reiche in der Zubereitung ihrer Speisen auffallend reinlich und verwahren dieselben in reinen Holz- und Erdtöpfen, in Körben und Kalebassen. Auch waren die Marutse die ersten, bei denen ich Butter zubereiten sah; sie rauchen mehr Tabak als jene Stämme, zu denen er von den Weißen eingeführt wird. Mit dem Genuß von Rauch- und Schnupftaback wird schon in früher Jugend begonnen, dem letzteren huldigen alle, auch junge Mädchen nicht ausgenommen. Doch ist ihr Schnupftabak ein complicirterer als der im Süden gebrauchte, er enthält gestoßenen Tabak, Asche, getrocknete und gepulverte Nymphaeastengel und die Secretion aus der Drüse des Rhabdogale mustelina. Der Rauchtabak wird in brödchenförmigen Kuchen geformt, die durchlöchert an einer Schnur getragen werden.
Was die Pflege des Körpers betrifft, so halte ich von allen mir bis jetzt in Süd-Afrika bekannten dunklen Stämmen die das Marutse-Mabunda-Reich bewohnenden für die reinlichsten; sie baden häufig, selbst wenn dies auch in seichten Stellen und in den Lagunen der Krokodile halber sehr gefährlich ist.
Die Kleidung der Marutse ist trotz ihrer Einfachheit weit geschmackvoller als jene der meisten südafrikanischen Stämme. Statt der Riemenfranzen der Zulu-Race und den um die Lenden geschlungenen, kaum handbreiten Riemen der Betschuana, Makalaka etc. tragen die Männer in der Regel Leder- und Kattunschürzen, welche an einem Leibgurt, d. h. um denselben von vorne nach hinten geschlungen werden. Blos die Stämme, die häufiger das südliche Zambesi-Ufer besuchen, wie die Batoka, Makalaka, Manansa, Masupia, Marutse etc., d. h. jene, die oft mit den Weißen zusammenkommen, bedienen sich des Kattuns als Schürze. Gewöhnlich beanspruchen sie ein 2½ bis drei Meter langes Stück gewöhnlichen Kattuns, ohne auf Farbenunterschiede Gewicht zu legen. Können sie ein Stück von obiger Länge (eine Sitsiba) nicht erhalten, so trachten sie mindestens ein solches zu gewinnen, das vorne bis an die Knie reicht. Jene, welche Lederschürzen tragen, bedienen sich rauhgar gegerbter Felle kleiner Säugethiere, so die Marutse und Masupia solcher des Scopophorus und Cephalopus, welche längs des Randes mit eingeschnittenen rundlichen oder viereckigen Löchern versehen sind, die Kopftheile finden sich oben am Gürtel. Die Manansa benützen einen kleinen, kaum handbreiten Kattun-, Tuch- oder Lederlappen. Auch in ihren Carossen differiren die das Marutse-Reich bewohnenden Banthustämme bedeutend von den meisten südlich vom Zambesi wohnenden, zu dieser großen Völkerfamilie gehörenden Stämmen. Sie lieben die Kreisform, die einem spanischen Mäntelchen nicht unähnlich ist und bis zu den Hüften herabreicht. Auch sind Mäntelchen aus Letschwe- und Pukufellen im Gebrauch. Der Herrscher und einige seiner höchsten Würdenträger kleiden sich zuweilen in europäische Kleider, doch gehen sie auch oft blos mit der Schürze angethan einher oder sie hüllen sich, wie bei ungünstiger Witterung in eine Wolldecke ein. Der Leibgurt ist aus glattgar geerbtem Gnu- oder Gazellenleder, aus Elephantenhaut, aus der Haut des Wasserleguans, der Boa, Cobra und anderer Schlangen, oder auch aus Stroh- und Grasgeflecht verfertigt.
Was die Bekleidung der Kinder und Frauen betrifft, gehen kleine Mädchen bis zum vierten, Knaben bis zum sechsten und zehnten Jahre unbekleidet einher. Im vierten Jahre erhalten Mädchen ein Riemenschürzchen aus dünnen, bis fünfundzwanzig Centimeter langen, gedrehten, zuweilen mit Bronceringelchen geschmückten Riemen; vom zehnten Jahre an tragen sie in der Regel eine kleine an einem Riemen befestigte viereckige Lederschürze. Da sie jedoch meist schon in früher Jugend, lange vor ihrer Reife verlobt werden, so tragen viele zwei Schürzen, eine vordere kürzere und eine hintere längere. Verheiratete Frauen bedienen sich eines bis an die Knie herabreichenden, rauhgar gegerbten, mit den Haaren nach innen gekehrten, meist aus Rindsfell verfertigten Röckchens, das mit einem Doppelband (Riemen) an den Leib festgehalten wird. Die Außenseite des Röckchens ist mit einem röthlichbraunen, angenehm riechenden Rindenstoffe stark eingerieben. Säugende Frauen gehen oft ähnlich den Männern mit einem Letschwefellmantel angethan umher, der gewöhnlich über den Rücken geworfen, bei Annäherung von Fremden oder Besuchern über die Brust zugezogen wird.

Sepopo’s Capellmeister.
Bei ungünstigem Wetter tragen die Frauen, seltener die Männer, riesige bis auf die Knöchel reichende, kreisförmige, nach vorne geschlitzte, mit einer Rundöffnung für den Kopf versehene Carossen, die mit einem Riemen oder einer Holz- und Metallspange um den Hals festgehalten und gewöhnlich mit der Rechten zusammengehalten werden, so daß die sich ihrer Bedienenden gleichsam in einen gefalteten Lederkegel gehüllt erscheinen. Die Stämme gehen meist barfuß einher, was der im Lande überwiegende Sandboden leichter gestattet, als die meist dornenreichen Länderstrecken der südlich vom Zambesi wohnenden Stämme. Für größere Reisetouren bedienen sich die Bewohner des Marutse-Reiches meist aus rohem Büffel-, Gnu- und Rindvieh-Leder gearbeiteter Sandalen, die mit Riemchen zur großen Zehe über den Fußrücken und den Fersenhacken befestigt werden.
Einige der östlichen Tributstämme wie die Makalaka und Matonga, bereiten aus selbstgezogener Baumwolle Gewebe von Tuch- bis Deckengröße. Aehnliche werden auch aus Bast von den Maschona’s gearbeitet. Die kleineren Gewebestücke dienen als Schürzen meist für Männer; der deckenartigen bedient man sich im Hause; sie sind von viereckiger länglicher Form und auf den kurzen Seiten mit Franzen versehen; sie werden ein bis zwei Meter breit, 1½ bis 2½ Meter lang, die Franzen zehn bis vierzig Centimeter lang gearbeitet.
Die Stellung der Frauen im Marutse-Reiche ist eine bei Weitem bessere und würdigere als bei den südlich vom Zambesi wohnenden Stämmen. Hier bebauen zwar auch die Frauen die Felder und helfen im Häuserbau, allein die schwierigsten Beschäftigungen, wie Jagd, Fischerei, das Herbeischaffen der Baumaterialien fällt den Männern zu. Die älteren Leute fand ich meist in den Wäldern und auf den Feldern beschäftigt, im ersteren Falle Männer Wildfrüchte sammelnd, im letzteren Frauen die jüngeren unterweisend und die weniger beschwerlichen Arbeiten verrichtend. Die Söhne ärmerer Leute, sowie Sklavenknaben verrichten meist Hirtendienste allein oder unter der Leitung eines Erwachsenen; jene der Wohlhabenderen versuchen sich häufig in der Jagd, sei es mit dem Assagai oder dem Gewehr. Zur Erntezeit haben die Knaben auf dürftigen, die Felder überragenden Holzgerüsten die Feldfrüchte gegen Gazellen und Finken zu schützen, sowie bei der Annäherung von Antilopen, Büffeln und Elephanten die Dorfbewohner zu alarmiren.
Die Bewohner des Marutse-Reiches sind keine Langschläfer, sie gehen schon eine bis 1½ Stunden vor Sonnenaufgang an die Arbeit und legen sich spät zur Ruhe. Die Vergnügungen beginnen mit der Tagesneige und dies um so später, je niedriger die Personen gestellt sind. Man schläft zumeist auf Carossen, Fellen, Stroh oder Grasmatten; des Königs Lager bestand aus fünfundvierzig großen prächtigen, auf einander gelagerten Carossen und jede Nacht waren drei bis vier Königinnen, jede an einem Bettrande Platz nehmend, beordert, des Königs Schlummer zu bewachen.
Die Kinder werden den Frauen zur Erziehung überlassen, die Knaben entschlüpfen jedoch schon sehr zeitig dem wachenden Mutterauge und schließen sich mehr dem Vater an. Kinder eines Freien erhalten Sklavenkinder zu Genossen, zu Spielgefährten und zu ihrem künftigen Troß, und diese üben oft nicht geringen Einguß auf die heranwachsenden Herren aus, welche ihnen oft mit innigerer Zuneigung als ihren Rathgebern und Willensvollstreckern zugethan sind. Die Eltern sind meist so von ihren Kindern eingenommen, daß ich schon zwölfjährige Knaben ihre Väter beherrschen sah. Die Knaben werden frühzeitig im Waffengebrauch unterrichtet, und bauen sich frühzeitig ihre eigenen Hütten. Die Mädchen werden tüchtig zur Arbeit angehalten, während der Vater bezüglich des Unterhalts der Familie in dem aufwachenden Mädchen eine Helferin zu sehen gewohnt ist. Mädchen bis zum zehnten oder zwölften Jahre werden meist zum Wasserherbeischaffen und in der Haushaltung bechäftigt.
Die Heiraten werden mit lauten, zu einem gewissen Grade orgienartig ausartenden Festlichkeiten gefeiert, bei welchen, wie bei den Beerdigungen, der reichliche Genuß von Kafirkornbier und ein besonderer Tanz die hervorragendsten Momente bilden. Die Ehen werden in der Regel unmittelbar, nachdem die Mädchen ihre Reife erlangt haben, geschlossen, wenn die Kinder nicht schon im zartesten Kindesalter einander verlobt wurden. Oft geschieht es, daß ein angesehener Mann die erwachsene Tochter seines Freundes zur Frau begehrt, sein Wunsch vom Vater gebilligt und von der Tochter angenommen wird, worauf dann der neue Schwiegersohn, der gewöhnlich schon mehrere Frauen und Kinder besitzt, eines seiner kleinen Mädchen dem Schwiegervater verspricht, d. h. verlobt, was zu dem im Marutse-Mabunda-Reiche häufig anzutreffenden Verhältniß führt, daß der Schwiegersohn zum Schwiegervater wird. Sepopo war mehreren Koschi’s und Kosana’s gegenüber Schwiegersohn und Schwiegervater zugleich. Hat ein Mädchen ihre Reife erreicht, so werden sofort ihre Gespielinnen davon benachrichtigt, die sie dann täglich, acht Tage lang, spät am Abend aufsuchen und bis tief in die Nacht in ihrem Höfchen unter Castagnetten- und Gesangbegleitung einen Tanz aufführen, nachdem zuvor eines der Mädchen (bei einbrechender Dunkelheit) die Genossinnen durch lautes Jodeln zum Besuche aufgeboten hatte. Hat die Tochter eines Koschi oder des Königs, oder eines seiner nahen Verwandten ihre Reife erlangt und ist sie eine Verlobte, so wird sie von ihren nächsten verheirateten Verwandten in ein nahes Wald- oder Schilfdickicht geführt, wo sie eine Woche lang, nur von einer Sklavin bedient, ein abgeschiedenes Leben führen muß. Sie wird jedoch täglich von ihren Freundinnen (gegen Abend) aufgesucht, ihr Kopf mit Parfüm eingerieben und sie mit Ermahnungen und Zureden für den ehelichen Stand vorbereitet, um nach Ablauf der obgenannten Frist ihrem Gemahl übergeben zu werden. Die Hochzeiten werden mit Tänzen gefeiert, an denen sich jedoch blos das männliche Geschlecht betheiligt und die ich unter dem Namen Hochzeitstänze schon besprach. Solch’ ein Tanz dauert in der Regel, selbst bei Leibeigenen, zwei bis drei Tage und Nächte. Die Sklavenheiraten sind nichts anderes als die ausgeführten Befehle ihrer Herren, d. h. der Freie gibt seinem Leibeigenen eine seiner Sklavinnen zur Frau.
Das Wesen der Beerdigung im Marutse-Reiche bildet zu dem bei den Völkern südlich des Zambesi beobachteten einen schroffen Gegensatz. Während die Stämme des Marutse-Mabunda-Reiches ihre Todten unter Singen, Schreien, Musikbegleitung und Schießen beerdigen, thuen es ihre südlichen Nachbarn meist im Dunkel der Nacht, ganz nahe an ihren Gehöften zwischen diesen oder unter den Hecken, damit die Beerdigungsstelle womöglich verborgen bleibe. Die meisten Völker des Marutse-Mabunda-Reiches suchen ihre Beerdigungsstellen zu kennzeichnen. Im Reiche ist es Sitte, die Jagd-Trophäen aufzubewahren. Diese Jagd-Trophäen bestehen, wie schon erwähnt, in auf Pfählen aufgedeckten Kopfskeleten der Gazellen, Zebras etc. etc., während die Köpfe der großen Raubthiere, ähnlich der Sitte im Matabele-Lande, wo Löwenfelle an den König abgeliefert werden müssen, an den jeweiligen Statthalter, oder in des Königs Nähe an diesen abgegeben werden. Diese Kopfskelete werden auf dem Grabe des Jägers niedergelegt und oft Bäumchen um dasselbe in Ellipsenform gepflanzt, oder wenigstens trockene Aeste herumgelegt, um das Betreten der Stelle durch Thiere und die Entweihung des Grabes hintanzuhalten. Daß die meisten Stämme des Marutse-Reiches ihrem Bestattungswesen mehr Zeremonien widmen, fußt wohl in ihren Ideen, die sie über unsere Vergänglichkeit gefaßt und darin, daß sie an ein Fortleben nach dem Tode glauben.
Das Vollkommenste in der Form der Grabdenkzeichen findet man im Mutterlande des herrschenden Stammes, in der Barotse, wo für jedes der angesehenen verstorbenen Mitglieder der königlichen Familie ein Mausoleum errichtet wurde. Ich bedaure tief, daß ich auf dem Zuge nach Nordwest verhindert wurde, diese Grabdenkmäler zu besichtigen, meine Kenntniß derselben beschränkt sich auf die Berichte Sepopo’s, seiner Leute, der wichtigen in Schescheke lebenden Häuptlinge, sowie der beiden Elfenbeinhändler Westbeech und Blockley, welche die Barotse auf des Königs Geheiß im Jahre 1872 bis 1873 besucht hatten.
Besuchen die Unterthanen den König und kommen sie aus entlegenen Provinzen, so rufen sie beim Eintritt in den königlichen Hof ein mehrmaliges »Tau-tu-ña, Tau-tu-ña aus«, worauf sie sich abseits, nahe am Eingange niederhocken und stillschweigend warten, bis sie von einem Abgesandten des Königs angesprochen werden. Bisweilen werden sie von ihrem in Schescheke wohnenden Koschi, Kosana etc. eingeführt, der sich dann in kriechender Stellung nähernd, dem Könige ihre Ankunft meldet. Werden sie nun zum Herrscher gerufen, so nähern sie sich in demüthiger Weise auf allen Vieren kriechend, halten in einer Entfernung von vier bis sechs Schritten vor dem Gebieter inne, um so lange in die Hände zu klatschen, bis sie von ihm angesprochen werden. Bei mehreren übernimmt dies ihr Führer. Hat ihnen der Herrscher eine Rückantwort ertheilt, so ziehen sie sich, abermals laut klatschend, zurück, ihre Audienz ist vorüber. Solche, die aus der Nähe kommen, begrüßen den König mir »Schangwe-Schangwe«; gewöhnliche Grußformen sind: »Schangwe, Koschi« oder »Rume-la, Ra, Rumela Intate«; das erstere namentlich den Weißen gegenüber.
Was das Reisen im Marutse-Reiche betrifft, so reist man zu Lande mit Hilfe von Trägern, die man für die ganze Strecke miethet, oder von Stamm zu Stamm wechselt, was jedoch haarklein beim Könige ausbedungen werden muß. Für die Bewilligung der Träger gibt man dem Könige einen Hinterlader mit 200 Patronen oder drei Elephantengewehre (Vorderlader), jetzt Kleider etc. als Geschenk, diesem oder jenem Statthalter, dessen Provinz man durchzieht, ein schönes Kleidungsstück oder eine gute Wolldecke; als Bezahlung gibt man einem dortigen Diener für zwei Monat Arbeit eine Baumwollendecke oder drei Yards Kattun und ein Pfund schönblauer kleiner Glasperlen. Für die Zeit von sechs bis zwölf Monaten muß erst jeder Unterthan vom Herrscher die Erlaubniß einholen, um so lange eines Weißen Diener zu sein — außer es wird im Geheimen zwischen einem Koschi und seinem Sklaven abgemacht. Für zwölf Monate Dienst gab man am Zambesi eine Muskete und natürlich die Gesammtzeit hindurch die nöthige Nahrung, zuweilen ein Stückchen Tabak oder Dacha. Haben die Träger und Bootsleute einen strengen Ausseher über sich, so gehen sie rüstig vorwärts, sie begnügen sich mit einer täglichen Mahlzeit, einer halbstündigen und vier- bis fünfmaligen viertelstündigen Rast, um von Tagesanbruch bis vier oder fünf Uhr dem Marsche oder dem Rudern obzuliegen. Die freie Rastzeit wird benützt, um rasch ein Feuer anzuzünden — ein Feuerbrand wird stets mitgetragen — und ein Pfeifchen Dacha zu rauchen.
All’ dies bekommt jedoch einen anderen Anstrich, wenn man keinen guten Makosana als Aufseher hat, dann bereiten namentlich jene, die schon öfter mit den Weißen in Berührung kamen, dem Reisenden Unannehmlichkeiten und belästigen ihn nicht wenig, verzögern und hindern die Reise, wo sie können. Gibt man ihnen nach, wird es umso ärger. Das Gepäck wird meist auf dem Kopfe oder an einem über die Schulter gelegten Pfahle, schwere Gegenstände an einem langen Pfahle von zwei bis vier Männern getragen. Gewöhnlich legen die Träger drei englische Meilen in der Stunde zurück, in der Bootfahrt stromaufwärts 3½ bis 4½, stromabwärts 5½ bis sieben Meilen, wenn nicht Strömungen und Schnellen die Flußfahrt verzögern oder Flußpferde den Weg versperren.
Reisen die Eingebornen allein, so nehmen sie nie größere Quantitäten Nahrung mit sich, jene, die in den zweirudrigen Booten die Kornabgaben nach Schescheke bringen, haben die kleinen Fahrzeuge derartig überladen, daß sie darauf angewiesen sind, sich ihre Nahrung unterwegs zu verschaffen, sie nehmen sich höchstens einige Fische mit, sammeln wilde Früchte, und da sie in der Regel geräuschlos längs dem Ufer dahingleiten, sind sie im Stande, so manchen in dem Uferschilf und Gras schlummernden Vogel mit einem sicheren Wurfe des Thoboni-Stockes zu erlegen.
Ich will noch einer Begrüßungsform erwähnen, welche von Seite des Herrschers sowohl als von Seite der Koschi, Kosana und eines jeden Haus- und Hüttenherrn, dem fremden Besucher gegenüber beobachtet wird. Nachdem man einige Worte ausgetauscht (beim Herrscher, wenn die Ankömmlinge angesehene Personen sind), nimmt der Gastgeber aus seiner am Leibgurte oder an einem Riemchen um den Hals, an einem der Armringe oder auch an der Carosse befestigten Schnupftabakdose eine tüchtige Prise; oft wird ihr ganzer Inhalt auf die linke Hohlhand geschüttet, und nachdem sich der Eigentümer selbst daran gelabt, reicht er den Inhalt mit halb geschlossener Hand dem zunächst Begünstigten, dann noch zweien oder dreien der übrigen.
Die Rechtspflege im Marutse-Reiche hat in der That manche gute Seite, und vor Allem durch die Bildung des großen Rathes viel gewonnen. Leider hat diese durch den Geist des herrschenden Stammes und das Wohlwollen eines lange dahingeschiedenen guten Herrschers gestiftete Institution nach und nach durch despotischen Königswillen an Macht und Geltung eingebüßt, bis sie unter Nero-Sepopo den Todesstoß erlitt, so daß sich in den letzten Decennien die Rechtspflege im Marutse-Reiche, ich möchte sagen von Jahr zu Jahr verschlechterte. Altgewohnte Gebräuche, welchen Gesetzeskraft innewohnt, erben sich unter den eingebornen Stämmen treu fort und werden willig befolgt, und jeder Verstoß gegen ihre Rechtskraft, d. h. jede willkürliche Beschränkung derselben von Seite eines Herrschers sehr mißliebig aufgenommen; durch die Unterdrückung dieser Gewohnheitsgesetze hat sich Sepopo das Volk zuerst entfremdet. Die Rechte über das bewegliche und unbewegliche Eigenthum, mochte das erstere sowohl Personen als auch Habe in sich begreifen, die socialen Rechte der verschiedenen Stämme untereinander und zum herrschenden Stamm, der Unterthanen und Tributzahlenden zum Herrscher im Allgemeinen, die Thronfolge-Bestimmungen, Vertragsclauseln, die Strafgesetze etc., wurden von Sepopo theils abgeschafft, theils vollkommen nach seinem Gutdünken zugestutzt und neu formulirt; es ist jedoch sicher, daß unter Wana-Wena seinem Nachfolger der größte Theil der alten Marutse-Gesetze wieder zur Geltung gelangen wird.
Kleine Zwistigkeiten werden von den Makosana und Kosana, wichtigere von dem Statthalter geschlichtet; alle schwerer erscheinenden Verbrechen etc. müssen, wenn sie nicht in gar zu weiter Entfernung von der Residenz des Königs begangen, vor diesen und den großen Rath gebracht werden. Mord ist im Allgemeinen ein seltenes Verbrechen und wird mit gleicher Münze bestraft. In der Residenz des Königs werden die meisten Hinrichtungen im Lande vorgenommen, weil so viele Unbeliebte, Beneidete aus den Provinzen, des Hochverrathes angeklagt und nach der Residenz geschleppt werden. Sepopo nahm keine Rücksicht; jahrelange, treue ergebene Dienstleistung, selbst von Würdenträgern, enge Verwandschaftsbande mit dem Könige etc. konnten nicht schützen, wo sein Verdacht rege wurde; in einem solchen Falle war jedes Gesetz null und nichtig. Die Beschuldigung des Hochverrates, des Mordes, der Flucht aus dem Reiche, des Verkaufes von Elfenbein und Honig, des Diebstahles an königlichem Eigenthume, des Ehebruches mit einer der Königinnen begangen, der zufällige Tod eines Nächsten genügten, um vergiftet oder verbrannt zu werden. Raufereien, Verwundungen, leichter Diebstahl wurden mit schwerer Arbeit in den königlichen Feldern oder lebenslänglicher Sklaverei bestraft. Fühlte der König kein persönliches Interesse oder Uebelwollen, so wurde der Ausspruch dem großen Rathe übergeben, und stimmte dieser für den Tod, so wurde der Verurteilte dem Gottesurteile mit dem Giftbecher unterworfen.
Im Folgenden will ich es versuchen, die Vorbereitungen und das Ceremoniell eines solchen Gottesurtheiles, respective einer Hinrichtung zu schildern.
Ein glühender Lichtschimmer überfluthete die meilenweite, die neue Hauptstadt des Marutse-Reiches, Schescheke, im Osten begrenzende Ebene; in manchen Theilen der Stadt herrschte noch Stille, da die Bewohner sich bis tief in die Nacht bei Butschuala-Gelagen gütlich gethan hatten. In den Dörfern der Mabunda und Masupia’s war es dagegen bereits ziemlich rege, namentlich jedoch in den unmittelbar am Flußufer erbauten Mamboë-Dörfern. Die Mamboë, denen die Fischerei obliegt, pflegen sich nicht von den schimmernden Vorboten des goldenen Gestirns zur Arbeit aufmuntern zu lassen; kaum daß es graut, sind sie schon bei ihren Kähnen und Netzen, um sich in die nahen und entfernten Lagunen und Flußbuchten zu begeben, und die ihnen von dem königlichen Küchenmeister vorgeschriebene Anzahl von Fischen zu erbeuten. Das rege Treiben in der winzigen Bucht nahe an meiner Hütte, wo sie ihre Kähne zu bergen pflegten, hatte mich oft früh angelockt, und so stand ich auch heute und schaute ihrem Treiben zu. Als die Letzten abstießen, wandte ich mich nach meiner Hütte. Zwischen derselben und dem königlichen Häusercomplex lag ein etwa sechshundert Schritte breiter Streifen freien Landes, und über dieses hin bewegte sich ein Zug von etwa zwanzig Menschen. Diese hatten die Richtung nach dem Walde eingeschlagen, einen der Pfade wählend, der zwischen meiner Hütte und dem aus Schilfrohr erbauten Häuschen der portugiesischen Händler, durch die Marutse-Dörfer führte. Voran schritt ein Mann, der, jedem Bewohner von Schescheke nur zu wohl bekannt, als Vollstrecker der Grausamkeiten des Königs Sepopo, ein Schrecken im Marutse-Reiche geworden war. Es war Maschoku, die Mabundahyäne. Er war mit einem bis an die Knöchel reichenden, buntcarrirten Wollhemd bekleidet; ihm folgte ein Mann von mittleren Jahren und diesem zwei Greise, wahre wandelnde Mumien, die mit ihren fezartigen Kopfbedeckungen als des Königs Leibärzte und die Hauptredner in dem unmenschlichen engeren Rathe, der dem Könige zur Seite stand, allgemein bekannt waren. Hinter denselben schritten vier mit Assagaien bewaffnete junge Männer. Den Zug schlossen zwei Gruppen von etwa acht Personen, in der ersteren bemerkte ich ein Weib und zwei Kinder. Die Leute bewegten sich, wie es schien, in einer gedrückten Stimmung, während die letzte Gruppe schreiend und lärmend einherzog. Als ich diesem Zuge nachsah, hörte ich hinter mir ein leise geflüstertes »camaja mo mositu, ku umubulaja mona mo!« (Die gehen in den Wald, um jenen Mann zu tödten.) Es war ein Knabe aus Schescheke, der mir für Glasperlen Fische zum Verkaufe brachte und die Gruppe bemerkte, die meine Aufmerksamkeit erregt hatte.
Der zur Hinrichtung Geschleppte war von einigen Nachbarn, die auf seine reiche Ernte neidisch waren, des Hochverrathes angeklagt und von dem Könige gegen den Ausspruch des hohen Rathes zum Tode verurtheilt worden. Der König war unpäßlich geworden, und die Krankheit wurde auf gewisse Zaubereien geschoben, die jener begangen haben sollte.
An der Hinrichtungsstelle angekommen, riß der Scharfrichter dem Verurtheilten seine Lederschürze vom Leibe, zerbrach die aus Elfenbein und Holz gearbeiteten Armringe, während seine vier bewaffneten Helfer nach den nahen Büschen griffen, um dem Armen aus grünen Buschzweigen eine Schürze um die Hüften zu flechten. In der Mitte der kleinen Lichtung standen zwei, drei Fuß von einander abgehende und fünf Fuß über den Boden ragende rauhe Pfähle, welche im unteren Drittel und an ihren freien Enden mit je einem Querholze verbunden waren. Hie und da sehen wir einen Aschenhaufen, aus dem einzelne halbverbrannte Menschenknochen hervorragen.
Maschoku faßte den Verurteilten bei der Hand, führte ihn zu dem Joche, ließ ihn auf das untere Querholz niedersetzen und hieß ihn mit den Händen die Pfähle erfassen. Einer seiner Begleiter brachte eine kleine Kürbißflasche, ein anderer eine hölzerne Schale. Der Scharfrichter goß aus der ersteren eine dunkle Flüssigkeit, ein Decoct von giftigen Kräutern in die Schale, welches er selbst am vorhergehenden Abend von dem Könige zu diesem Zwecke erhalten hatte; er reichte die Schale dem Manne hin und gebot ihm zu trinken. Kaum hat der Aermste getrunken, so stürzten jene, welche gesenkten Hauptes und klagend dem Manne zur Hinrichtung gefolgt waren, auf diesen zu und brachen in lautes Wehklagen aus. »Mein Mann, mein Bruder, mein Vater, Freund, Freund!« riefen sie durcheinander. »Fürchte Dich nicht, Du sollst nicht sterben, Du bist ein guter Mann, Du hast nie Böses gethan; böse Menschen, die nach Deinem Mabele (Korn) und nach Deinem Khomo (Vieh) trachteten, haben schlechte Worte gesprochen, und deshalb hat man Dich hierhergeschleppt; Du hast nie Böses gegen den König im Sinne gehabt, so wirst Du auch nicht sterben. Njambe, der gute und schlechte Herzen kennt, sieht auch Deine Unschuld und wird Dich das Molemo (Gift) erbrechen lassen.« So reden die Freunde des Verurtheilten; sie streicheln und liebkosen ihn. Wie sie etwas in ihrem Eifer nachlassen, treten die Ankläger heran, jene, welche beim Zuge die Nachhut bildeten. Mit geballten Fäusten drohen sie dem am Schaffot Sitzenden, die ärgsten Verwünschungen gegen ihn ausstoßend. »Du Verräther, Du schlechter Mensch, schwarz ist Dein Herz, Du wolltest den König tödten! Schlechte Medicinen hast Du in seine Behausung geworfen, die ihm die Krankheit in dieselbe brachten, allein wir haben Deine Schlechtigkeit gesehen, wir sagten es dem Könige, und nun sollst Du dafür sterben. Siehst Du das Feuerchen da, was eben unsere Brüder angezündet haben, sieh’, das wollen wir groß machen und dann Deine Gebeine, die Knochen eines schlechten Hochverräthers, daran rösten und verbrennen!« Und abermals drohen sie mit den Fäusten und speien ihn an.
Nach den alten Marutse-Gesetzen muß jeder Verurtheilte eine Schale Gift trinken. Fällt er nach dem Genusse des Giftes besinnungslos zur Erde, so wird er für schuldig erklärt und sofort verbrannt. Wenn im Gegentheile der Verurtheilte das Gift erbricht, so wird er für unschuldig erklärt, allerdings kein wohltuendes Begnadigungsmittel, da nach dem Genusse des Giftes eine Blutzersetzung eintritt, welche Ausschläge und Siechthum und nach vielen Leiden, einige Jahre später den Tod zur Folge hat. Der König Sepopo, der die meisten Gesetze und Gebräuche seines Landes umstieß, berücksichtigte auch diesen nicht und gab oft im Geheimen dem Scharfrichter den Auftrag, die Verurteilten auf jeden Fall zu tödten.
So geschah es, daß, als der König von der Barotse nach Schescheke übersiedelte, er von seinem Mutterlande des Tsetse-Gürtels halber, der die Umgegend von Schescheke umspannt, keine Rinder für seinen Bedarf nach der neuen Residenz mitnehmen konnte. In Schescheke lebte aber unter mehreren Häuptlingen Einer, der große Heerden besaß; auf ihn fiel sofort des Königs Augenmerk und damit war auch das Los des Aermsten entschieden. Er wurde angeklagt und verurtheilt, doch das Gift hatte keine Wirkung. Da fand sich ein zweiter Sklave, der den Häuptling des Hochverrathes beschuldigte, und als auch die zweite Verurtheilung nichts half, folgte eine dritte, schließlich wurde er so lange mit dem Vorderkörper in’s Feuer gehalten, bis er seinen Geist aufgab.
Nachdem ich Schescheke verlassen, wurde auch die Frau des Häuptlings Mokoro, zum Tode verurtheilt. Sie war als unschuldig erklärt worden, der Scharfrichter aber theilte ihr mit, daß ihm der König den Befehl ertheilt, sie am folgenden Tage zu verbrennen. Um solch’ einem Tode zu entgehen, warf sie sich in den Fluß und wurde sofort von einem Krokodile ergriffen, doch von diesem längere Zeit hin- und hergezerrt, bevor das Thier mit ihr in die Tiefe versank und das grause Schauspiel ein Ende fand.
Nachdem sich die Ankläger müde gescholten, traten die beiden alten Medizinmänner heran, nahmen den Verurtheilten von dem Gestell und drehten ihn mehrmals im Kreise herum, sie thaten dies, um, wie sie sagen, das Gift besser im Körper wirken zu lassen. Kaum hatten sie ihn wieder seine frühere Stellung einnehmen lassen, näherten sich ihm wieder seine Freunde. »Freund, entledige Dich doch des schädlichen Stoffes, den Du getrunken, brich ihn aus, damit Du diesen bösen Menschen und dem Könige zeigst, daß Du unschuldig bist!« Freunde und Kläger wechseln so ab, bis das Gift betäubend oder wie ein Brechmittel zu wirken beginnt. In dem vorliegenden Falle wirkte es betäubend; etwa eine halbe Stunde, nachdem er das Gift zu sich genommen, fiel der Verurtheilte besinnungslos zur Erde. Bevor dies jedoch geschah, hatten schon einige seiner Ankläger ein kleines Feuer angezündet, auf welches sie bei ihren Spottreden hinwiesen. Kaum war der Verurtheilte zur Erde gefallen, erfaßten ihn die Diener des Scharfrichters und schleppten ihn zu dem Feuer. Vergebens rangen seine Angehörigen die Hände; mitleidslos ward er mit dem Kopfe in das kleine Feuer gehalten, so daß er mit halbverbranntem Gesichte, bevor noch das Feuer zur Flamme angefacht war, erstickte. Dann erst wurde trockenes Reisig herbeigetragen und eine Art Scheiterhaufen errichtet, auf welchem der Körper gänzlich verbrannt wurde.
Laut klagend und jammernd zogen die Angehörigen des Verurtheilten heim. In der Stadt verstummten sie, um nicht des Königs Mißfallen zu erregen. Sehr Viele trachteten sich, sowie sie nur eine Ahnung von einer etwaigen Vorladung erhielten, durch Flucht nach dem Süden über die beiden Ströme zu retten. Andere tödteten sich selbst, als sie sahen, daß sie trotz ihrer durch das Erbrechen des Giftes erwiesenen Unschuld, doch wieder angeklagt und verbrannt werden sollten. Die auf der Flucht Ergriffenen wurden theils von den Verfolgern niedergestoßen, theils wieder nach Schescheke zur Hinrichtung eingebracht. Verurtheilte, freiwillig Heimgekehrte und auf die Fürbitte der Weißen oder eines fremden, Sepopo befreundeten Eingebornenfürsten gestützt, um Nachsicht Flehende wurden bei ihrer Ankunft in Schescheke wohl begnadigt, allein wenige Tage darauf wieder verurtheilt.
Bei Diebstählen bestrafte der König oder der Würdenträger nur wenn der Schuldige der That geständig oder wenn er von mehreren Zeugen überwiesen war. Im Allgemeinen wird von der Obrigkeit nicht viel gethan, um des Diebes habhaft zu werden. »Bringe ihn und beweise, daß er Dich bestohlen hat, ich werde ihn schon empfindlich züchtigen,« heißt es zumeist.
Ich erwähnte bereits, das zwei vom Könige begnadigte Verbrecher in der Residenz, die Reinigung der Stadt zu besorgen hatten; bevor noch die Bewohner von Schescheke erwachen, sind diese Beiden schon auf ihren Füßen und walten ihres Amtes. Dabei ereignete es sich nun mehrmals im Jahre, daß menschliche Leichen an den Pfaden und in den Straßen lagen; auf Sepopo’s Geheiß, der jeden Todten, die Mitglieder des königlichen Hofes ausgenommen, als Unrath ansah, mußten dieselben gleich dem Kehricht behandelt werden.
Von nennenswerter Heilkunde fand ich in dem Marutse-Reiche mehr vor als in allen übrigen mir bekannten südafrikanischen Eingebornenländern. Diese Heilkunde bildete die Basis, auf der die schon öfters erwähnten Doctoren, die Mitglieder des engeren Rathes, ihr Wissen und Ansehen, späterhin ihre Zaubereien stützen konnten. Mehrere vegetabilische Heilmittel und Gifte kennend, suchten sie weiter in der Heilkunde nachzugrübeln, geriethen aber nur zu leicht, geleitet und durchdrungen von dem volksthümlichen Aberglauben in das verderbliche, den Geist umnachtende Chaos der Beschwörungsformeln.
Ich beobachtete, daß sie sich auf die Behandlung von Dysenterie, Fieberanfällen, Husten, Lungenkatarrh, Stillung von Blutungen und Schlangenbissen wohl verstehen. In der Regel werden jedoch die Arzneien mit vielen Zeremonien verabreicht, um eben den Kranken glauben zu machen, daß letztere den Löwenantheil an der Kur haben. Oertliche Blut-Entziehungen mit Metall-, Horn- und Knochenmessern bewirkt, und das Blut mit Hornsaugröhren ausgesogen, fand ich — wie unter den Betschuana’s — gemein und gewöhnlich an den Schläfen Wangen, Oberarmen, der Brust und den Schultern applicirt. Es soll Schmerzen an diesen Körpertheilen mildern, — wie ich bemerken konnte, meinte man hiemit Neuralgien sowohl als Entzündungsschmerzen der betreffenden oder der Nachbarorgane. — Die Vegetabilien werden zumeist getrocknet und dann im pulverisirten Zustande oder als Decoct, oder aber der bei ihrer Verbrennung erzielte Rauch und ihre Asche als Heilmittel gebraucht. Von thierischen Stoffen gebraucht man Knochenstaub, gebranntes Knochenpulver, die Schuppen des Schuppenthieres, die, Riechstoffe enthaltenden Drüsen gewisser Säugethiere und thierische Excremente etc. etc. Einen wesentlichen Unterschied zwischen den Heilkünstlern des Mabunda-Reiches und denen der meisten Betschuana’s, fand ich in dem äußeren Auftreten derselben; mit Ausnahme des hohen Alters kennzeichnen sich die Ersteren durch keine besonderen Abzeichen. Ebenso scheint die Doctorswürde im Mabunda-Reiche nicht erblich zu sein, während dies bei den Betschuana’s der Fall ist.
Der Aberglaube ist eine der bedauernswerten Erscheinungen, welche der geistigen Entwickelung der südafrikanischen Eingebornen im Wege stehen. Es war vor Allem Sepopo, der sich von seinen Unterthanen als Zauberer gefürchtet und groß zu machen verstand und sich endlich so tief in die Gaukelei hineinlebte, daß er selbst daran glaubte, wodurch es ihm möglich wurde, sich trotz seiner nichtswürdigen Grausamkeiten so lange am Throne zu behaupten. Die abergläubischen Lehren hatten durch die greisen Doctoren ein nicht geringes Ansehen beim Volke erlangt, dessen Zweifel oft durch die gewonnene Ueberzeugung der Heilkraft der als Heilmittel von den Aerzten gebrauchten vegetabilischen Producte, sowie in Hinblick auf die geheiligte Person des Königs geschwächt oder benommen wurden. Der Zaubermittel gibt es eine Legion; ich will blos einige anführen.
Beim Beginne eines Krieges, nach der Erbauung einer Stadt und bei anderen wichtigen Gelegenheiten, bei Landplagen etc. wurden bestimmte Theile des menschlichen Körpers geopfert, d. h. bei Lebzeiten vom menschlichen Körper abgetrennt und an bestimmten Orten in erlesenen Gefäßen aufbewahrt.
Aus Büffelfett gearbeitete Armringe und Brustbänder sollen gewisse Krankheiten bannen und gegen menschliche Nachstellungen schützen. Das Herzfett der Hausthiere, auf Stäbchen in Kreuzform befestigt und bei Nachtzeit vor die Hütten der aus dem Reiche Geflohenen eingepflanzt, soll auf die Flüchtlinge höchst verderbend einwirken, daß sie auf der Flucht die Sinne verlieren, und wie im trunkenen Zustande zu ihrer Niederlassung zurückkehren, um ihre gerechte Strafe zu erleiden. Das Pulver verschiedener gebrannter Knochen von Säugethieren, Vögeln, Amphibien am Körper getragen, wird verkauft, um schnellfüßig zu werden, das verfolgte Wild in seinem Laufe zu lähmen und dem Jäger reiche Beute zu sichern. Es wird theils in Säckchen auf dem Leibe getragen, theils in an den Armen und Beinen geführte Einschnitte eingerieben. Weitere Zauberkraft enthaltende Mittel sind all’ die pharmaceutischen Präparate, die der Weiße an die Eingebornen verabreicht, seltene Thierfelle, wie das des großen schwarzen Lemur, anormale Bildungen in der Färbung kleiner Säugethiere, Ausschnitte aus dem Kamme der Schwanzflossen des Krokodils, seine Augen und die Luftlöcher; Hörner des Cephalopus Hemprichii und des Scopophorus Urebi, seltene Glasperlen, auffallende pathologische Haar-, Horn- und Knochenbildungen von Thieren; Säckchen, genäht aus der Haut der Boa, Leib- und Brustgurte aus Schlangen-, Erd- und Wasserleguanhaut verfertigt, kleine Muscheln, die an Stirn- und Halsbändern, an Armringen und Leibbinden festgenäht, getragen werden. Die letzteren, sowie andere Kalkproducte von Seethieren haben die Portugiesen eingeführt und damit im Allgemeinen einen regen Handel getrieben.
Diese Amulete und Zaubermittel werden, wenn nicht am Körper getragen, auf geheimen oder nur dem Hausherrn bekannten Orten aufbewahrt gehalten. Der König hat hinter seinem Empfangshause längs der Hofumzäunung eine Reihe von bemalten Thontöpfen und Kalebassen stehen, die sämmtlich abergläubische Mittel enthalten. Außerdem hat der König eine eigene Hütte für seinen medicinischen Besitz und die zahlreichen Amulete erbaut; bei Sepopo stand sie zwischen seinem Empfangs- und dem Waarenhaus. Zu den offenen, Zaubermittel enthaltenden, Behältern gehören: aus Bast, Gras und Stroh verfertigte Säcke und Körbe, kleinere und größere, schwarz gebrannte, einfach gehaltene und gekerbte Holzschüsseln, große, roh gearbeitete Holzschüsseln, Töpfe und Schalen aus ungebranntem oder auch gebranntem Thon, gewöhnlich mit dunklen Glasur-Zeichnungen bedeckt und zuweilen auf Gestellen, Holzfüßen, Baumstämmchen aufgestellt, oder auf Pfählen aufgehangen; ferner Kalebassen, die dann gewöhnlich unter Miniaturdächern aufgestellt werden.
Zu den geschlossenen gehören kleine Makenkekörbe, Miniaturkörbchen aus Fächerpalmblättern gearbeitet, kleine sanduhrförmige, mit Pfröpfen (aus Holz) versehene, Schnupftabakdosen ähnliche Kalebassen, zugepfropfte Hörner kleiner Gazellenarten, mit Linien und Kreisen (Einkerbungen, Eingravierungen) bedeckte kleine Ziegenbockhörner und nett geschnitzte, in Pulverhornform gehaltene Hörner größerer Antilopen (Harrisbock, Gemsbock, Roen-Antilope etc.); sämmtliche sind mit Hängschnüren versehen. Ferner beobachtete ich solche, die sorgsam aus Holz, Rohr, Vögel- und Thierknochen, Nilpferd- und Elephanten-Elfenbein, aus Fruchtschalen, Thierklauen zu Dosen geschnitzt, oder aus Thierfellen und aus der Haut innerer thierischer Organe (Eingeweide, Blase etc.), aus Tuch- und Wolllappen zu Säckchen genäht sind. Im Allgemeinen verwendet man im Marutse-Reiche auf diese Artikel eine bedeutende Sorgfalt, und Sepopo’s Medicin- und Gifthütte allein würde, in ein europäisches Museum transferirt, eine interessante ethnographische Sammlung abgeben. Leider ist es für den Sammler nicht leicht, sich mehrere solcher Objekte durch Tausch anzueignen; die Eingebornen wollen sich der in denselben enthaltenen Zaubermittel halber nicht von ihnen trennen.
Das Ausschütten von Flüssigkeiten vor der Hof- oder Hausthüre wird als ein Zauberversuch zum Schaden des Hausherrn oder Desjenigen angesehen, der unvorsichtiger Weise über die nasse Stelle hinwegschreitet. Unwohlsein wird in der Regel als die Folge von Zauberei oder gefährlichem Uebelwollen angesehen. Meine Arbeiten und meine den Kranken geleistete Hilfe hatten mich im Marutse-Reiche zu einem großen Zauberer gestempelt, und hatten nur das eine Gute, daß ich von allen mehr als andere Weiße gefürchtet wurde. Die meisten Geheimmittel sind den Zauberern (Doctoren), dem König und dem Scharfrichter bekannt und werden verhältnißmäßig theuer verkauft.
Bisweilen wurden zwei und mehrere Sitzungen abgehalten, um sich über dies oder jenes unmenschliche Mittel zu einigen. Personen, die dem Rathe mißtrauten, einzelne nachdenkende Köpfe, wurden nur zu leicht aus der blindlings gehorchenden und unterwürfigen Menge herausgefunden, des Hochverrathes oder anderer nicht begangener Verbrechen angeklagt bei Seite geschafft.
Ich hatte bereits Gelegenheit zu erwähnen, daß von Sepopo zu manchen abergläubischen Zwecken Menschenopfer verwendet wurden. Dieselben sind kein landesüblicher Gebrauch, sondern waren dem Könige von dem engeren Rathe empfohlen worden. Während meines ersten Aufenthaltes begann er, wie ich bereits erwähnt, Neu-Schescheke zu bauen. Um die neue vor einem ähnlichen Schicksale wie es die alte Residenz traf zu bewahren, wurde eine Sitzung des engeren Rathes abgehalten und die Schrecklichen beschlossen, dem Knaben eines Häuptlings die Finger und die Zehen abzuhauen und diese in der Kriegstrommel aufzubewahren. Trotz der Geheimhaltung dieses Beschlusses wurde die Absicht des engeren Rathes einem Häuptlinge verrathen, der die Nachricht allen seinen Freunden mittheilte, doch nicht schnell genug und ohne Verdacht zu erregen. Gegen Ende des Monats September, als Blockley allein in Schescheke zurück geblieben war, konnte man allnächtlich in dem Walde von Schescheke Menschengruppen begegnen, welche nach den tieferen Waldpartien zueilten, es waren die Vertrauten dieses oder jenes Häuptlings, welche dessen Knaben aus dem Bereiche des Tyrannen zu bringen suchten, ohne daß der König oder der Scharfrichter eine Ahnung davon hatten, daß man ihre Pläne zu durchkreuzen suche.
Am bestimmten Tage schickte Maschoku seine Diener in der Stadt umher, um sie die Häuptlingsgehöfte ausspioniren zu lassen, in welchen man sich am leichtesten eines Knaben bemächtigen konnte. Alle bis auf einen kehrten unverrichteter Weise zurück, sie fanden die Gehöfte förmlich kinderleer, nur der eine wollte einen Knaben im Hofraume seines Vaters spielen gesehen haben. Als dies der Scharfrichter dem Könige hinterbracht hatte, befahl er dem Vater des Knaben sofort für die Bedachung eines noch unvollendeten königlichen Baues das nöthige Gras und Schilf zu holen, alles andere nahm Maschoku auf sich. Als ihn seine Diener benachrichtigten, daß der Chef abgereist sei, berief dieser den erwähnten Diener und gab ihm die nöthigen Instructionen, um das Opfer auch glücklich in das Gehöft des Königs zu bringen. Hier war eine größere Menschenmenge versammelt, welche lautlos dasaß; der König schien unmuthig und deshalb wagte es Niemand, ein Wort zu sprechen.
Um diese Zeit erschien in dem Höfchen des Häuptlings, der sein Gehöft verlassen, um für den König das nöthige Schilfrohr zu holen, ein Mabunda-Mann, der Abgesandte des Scharfrichters, setzte sich nahe an der Umzäunung nieder und wartete bis ihm eine der Hausfrauen mit dem Willkommgruß »Rumela« ansprach und theilte derselben nur mit, daß der Kosana, der eben mit seinem Kahne abstoßen wolle, ihn mit dem Auftrage hiehersende, ihm sein kleines Söhnchen zu bringen. Die Mutter befiehlt dem Kinde, dem Manne zu folgen und dieses fügt sich willig dem Gebote. Dieser schlägt aber die Richtung nach den königlichen Gehöften ein, wo er mit seinem Erscheinen plötzlich die darin herrschende Stille unterbricht. Aus seinem Hinbrüten durch Maschoku wachgerufen, wirft der König einen Blick auf den Knaben und steht dann von den Anwesenden gefolgt auf. Man nimmt nun den Knaben in die Mitte, der durch die stillschweigende Menge eingeschüchtert, sich willenlos fortschleppen läßt. Die königliche Capelle beginnt hierauf ihre monotonen Weisen und begleitet den König. Zum Flusse ging es wohl und dies mochte den Knaben etwas ruhiger stimmen, doch ein plötzlicher Schrei einer Häuptlingsfrau, deren Gehöfte man passirte, flößte dem Kinde Furcht und Schrecken ein. Die Frau kannte das Schicksal des Opfers, das man eben zur Schlachtbank führte.
Am Flusse angekommen, besteigt die etwa siebzig Köpfe zählende Menge sämmtliche am Ufer liegende Boote und fährt nach dem jenseitigen Ufer; die Tambours folgen, während die Myrimba’s zurückbleiben. Am jenseitigen Ufer; angekommen, läßt sich Sepopo auf ein Stühlchen nieder, der Scharfrichter, seine Knechte und die Mitglieder des engeren Rathes bilden einen Kreis, die Tambours und die anderen Musiker stellen sich rings umher, damit das Volk von Schescheke die grausame That nicht sehe. Der Knabe, durch alle die schweigsamen Männer erschreckt, folgt nur zögernd. Nun nickt der König mit dem Kopfe und im selben Momente wird der Knabe zur Erde geworfen, das erschrockene Kind beginnt laut zu schreien, aber den Tambours wurde zugleich das Zeichen gegeben, und laut schallen die Trommeln, um das Geschrei des Kindes zu übertönen. Der Widerstand des hilflosen Kindes ist von den Henkersknechten bald überwältigt, und nun gehen die alten Doctoren an’s Werk und schneiden dem Opfer Finger um Finger, Zehe um Zehe vom Körper. Trotz des lauten Trommelschlages vernimmt die Menge am diesseitigen Ufer einige Worte des sterbenden Knaben. »Ra, Ra came, Ra Ra« (Vater, mein Vater), zeitweilig wird das Wort: »Umu umu bulaja« (sie tödten mich) hörbar; obwohl die Menschenmenge sich mit jedem Augenblicke mehrt, und alle begreifen, daß Sepopo eine neue Grausamkeit begeht, wagt es Niemand, an die Rettung des armen Knaben zu denken.
Nachdem sich die Doctoren der genannten Gliedmaßen bemächtigt haben, wird dem Leben des Knaben sofort ein Ende gemacht, d. h. das Opfer wird erwürgt und mit einem Kiri erschlagen. Nach vollbrachtem Werke werden die Boote wieder bestiegen, ganz zufällig scheinen diese in der Mitte des Fluges einen Knäuel zu bilden, in Wirklichkeit aber nur, um den Körper des Knaben unbemerkt in den Fluß gleiten zu lassen. Während die Boote etwas flußabwärts an den königlichen Gehöften anlegen, folgt ihnen eine jammernde Frau am Ufer nach, watet, die Krokodile und den Zorn des Tyrannen nicht achtend, in das Wasser und fordert laut ihr Kind, ihren Muschemani zurück. Der König steigt ruhig aus, was weiß er von Mutterfreude und Mutterschmerz, ihm folgen die Seinen, und bald sitzt man bei einigen Töpfen Butschuala, während die alten Doctoren die getrennten Finger und Zehen in einer der Kriegstrommeln verbergen.
Diese Alarm-, Kriegs-, Schlachttrommeln sind ebenfalls königliches Eigenthum, von welchen stets drei bis vier vorhanden und im großen Berathungshause aufbewahrt sind, sie werden nur bei Ueberfällen der Residenz, beim Ausmarsch in den Krieg, beim Ausbruch revolutionärer Emeuten u. s. w. geschlagen. Ich vermuthe, daß diese Trommeln mit ähnlichen Schlägeln wie die Kalebaß-Piano’s oder mit kleinen Kiris bearbeitet werden. Der Holztheil der Trommel ist mit rothem Ocker bemalt, die Füße sind klein, der Henkel gleich der Lederumreifung aus ungegerbten Rindsfellen gearbeitet. Diese Trommeln haben dreißig bis fünfzig Centimeter im Durchmesser und vierzig bis fünfzig Zentimeter Höhe.
Als ich nach meinem zweiten Besuche nach Schescheke zurückgekehrt war, berichteten mir zwei der Häuptlinge von Schescheke diese Episode, am ausführlichsten that es Blockley, denn unser Gehöft lag dem Thatorte gegenüber.
Noch bevor ich den Zambesi überschritt, hörte ich die industrielle Thätigkeit der Völker Sepopo’s rühmen. Unter den Süd-Zambesi-Stämmen behaupten die Maschona den ersten Rang. Da ich das Maschona-Land nicht besuchen konnte und nur nach den mir zugekommenen oder gezeigten Handarbeiten urtheilen mußte, mag mein Ausspruch nicht jenes Gewicht besitzen, das ich wünschen würde, doch kann ich mich dahin aussprechen, daß es Stämme im vereinigten Marutse-Mabunda-Reiche gibt, welche in gewissen Branchen der Industrie die Maschona übertreffen.
Unter den Küchenutensilien stehen die aus Thon verfertigten Gefäße obenan. Manche haben Vasenform, andere sind durch die angebrachten dunkleren und helleren Verzierungen, die am Halse oder Mantelkragen angebracht sind, und andere dadurch wieder ausgezeichnet, daß sie geglättet, förmlich von einer Glasur überzogen zu sein scheinen. Am Boden fand ich nie Zeichnungen vor, auch vermißte ich Henkel. Die als Getreide-Speicher benützten Thongefäße haben Riesendimensionen und Urnenform. Diese Riesengefäße sind roher als die vorgenannten gearbeitet und ohne Ausnahme aus ungebranntem Thon. Die Gefäße sind nach oben mit einem tellerförmigen Thondeckel geschlossen und zeigen an der vorderen Seite unmittelbar über dem Boden eine halbkreisförmige, meist handbreite Oeffnung, die mit einer beweglichen Platte von Innen verschlossen ist. Diese Platte trägt einen horizontal sitzenden Stiel, mit dessen Hilfe die Oeffnung nach Belieben geschlossen werden kann. Diese Riesengefäße sind so schwer, daß ich, wie an den königlichen, sechzehn Männer keuchend schleppen sah, beim Transport werden sie auf Pfählen getragen. Die Thongefäße sind meist nur Arbeit der Frauen, während die Holzgefäße von Männern, und zwar meist von Mabunda’s gearbeitet werden. Die ersteren werden zur Aufbewahrung und Zubereitung von Kafirkornbier, zur Aufbewahrung von Milch, Wasser und zum Kochen benützt. Sämmtliche Holzgefäße sind innen und außen mit Eiseninstrumenten tiefschwarz eingebrannt und dies ist so gleichmäßig und vorsichtig ausgeführt, daß man sie aus Ebenholz verfertigt halten würde. Die meisten derselben sind mit erhabenen, symmetrischen, um den Rand, Hals und Mantelkragen laufenden Schnitzereien und manche mit durchgebohrten, abgeflachten Buckeln als Henkeln versehen; jeder Holztopf ist mit einem geschnitzten Deckel versehen.
Nächst den Thongefäßen sind die aus Holz verfertigten Gefäße zahlreich und nicht minder mannigfach vertreten. Unter diesen gehören die Vorlegschüsseln für klein gehackte Fleischsorten zu den edelsten Holzschnitzereien der Mabunda, zu den besten Holzarbeiten in der Abtheilung der Küchenutensilien. Im Allgemeinen sind die Holztöpfe von cylindrischer oder Kegelstutz-Form mit abgerundetem Boden. Sie dienen zur Aufbewahrung von Mehl, Bohnen, kleinen Früchten und Bier. Den Uebergang von den Holztöpfen zu den zahlreichen Varietäten der Holzschüsseln bilden die mit Ausgußmulden versehenen Napfschüsseln.
Die eigentlichen Holzschüsseln sind entweder Rundschüsseln oder ovale; die letzteren wieder schiffchenförmige oder schalenförmige. Die ersteren der ovalen Gattung sind die früher erwähnten, schön gearbeiteten Fleisch- und Vorlegeschüsseln, sie trafen durchwegs einen horizontal-vorstehenden, durchbrochen geschnitzten Rand, sind henkellos und tiefschwarz von Farbe. Ich fand sie in der Regel im Hause der Angesehenen, doch die schönsten in des Königs Besitz. Die länglich-schalenförmigen gehören zu den größten Holzschüsseln, die riesigsten fand ich bei den Matabele. Sie sind von doppelter bis dreifacher Größe der obgenannten und stets mit zwei ordentlichen Henkeln an den Enden des größten Durchmessers versehen. Sie dienen zum Auftischen von groben Fleischstücken für eine größere Anzahl von Personen und sind oft an ihrer ganzen Mantelfläche mit symmetrischen oder unsymmetrischen, ein bis drei Centimeter erhabenen Arabesken-Schnitzereien bedeckt. Ich glaube, daß den Maschona die Palme in dieser Arbeit gebührt. Von Rundschüsseln finden wir mehrere Varietäten vor; alle haben mehr oder weniger hervorragende Henkelbuckel und in der Regel eine gewölbte, nur in seltenen Fällen eine ebene, thalergroße Bodenfläche, der Rand ist meist gekerbt. Sie fehlen in keiner Haushaltung, da ihr Gebrauch ein allseitiger ist, und sie als Milch- und Oelgefäße und zur Aufbewahrung fetter Substanzen dienen.

Ein Marutse-Elephantenjäger.
Die getrockneten Fruchtschalen verschiedener Kürbißarten werden sehr häufig zu Gefäßen verarbeitet. Vor Allem dienen diese Kalebassen als Wasserbehälter sowohl im Hause als auch auf Reisen, da ihnen das geringe Eigengewicht zu statten kommt. Sie bieten noch mannigfachere Formen als die eben genannten Gefäßarten, die einestheils schon von der Natur mannigfach gegeben sind, anderntheils künstlich hergestellt werden. Für den öfteren Gebrauch sind sie gelblich, bräunlich, rothbräunlich, schmutzig- bis dunkelbraun oder ziegelroth polirt und oft mit einem Bast- oder Grasstricknetz umsponnen; jene zu seltenerem Gebrauche sind oft mit eingebrannten Zeichnungen versehen. Auf das Einbrennen der Zeichnungen verstehen sich namentlich die Mabunda, und dies insbesondere mit Rücksicht auf die Figuren. Ich beobachtete einfache und verschlungene Arabesken, Abbildungen von Menschen, Säugethieren, Vögeln, Amphibien, Fischen und Insecten; ferner von Hütten, allerlei Geräthschaften, namentlich Waffen, Rudern, Kähnen, Pfeifen; außerdem von Bäumen, Sonne und Mond; doch auch Jagdscenen auf dem Lande und zu Wasser und Schlachtscenen, von denen mir besonders zwei auffielen, welche die Eroberung einer befestigten Stadt versinnlichen sollten, und wobei die gegenwärtig bei diesen Völkern vermißten steinernen Brustwehren deutlich aufgezeichnet waren. Im Allgemeinen bekunden diese eingebrannten Zeichnungen großen Eifer und eine ziemliche Fertigkeit, sowie einigen für Wilde anerkennenswerthen Kunstsinn, obgleich ich sie nicht den Kunstproben gleichstellen könnte, wie sie die besseren Höhlengemälde der Buschmänner vor Augen führen. Im Allgemeinen nehmen die mit eingebrannten Zeichnungen versehenen Kürbißgefäße einen ehrenvollen Rang in der Industrie der Stämme am centralen Zambesi ein und übertreffen wesentlich die ähnlichen Erzeugnisse der südlich von diesem Flusse wohnenden Stämme. Die zu den Kalebassen nöthigen Kürbisse werden theils auf den Maisfeldern, theils um die Hütten und Häuser angebaut.
Die kleinsten Kalebassen werden zu Schnupftabakdosen, jedoch nicht so häufig verwendet, wie bei den Betschuana. Auch an Löffeln fand ich die schönsten Formen im Marutse-Reiche. Die großen Schöpflöffel werden aus langhalsigen gebogenen, am unteren Ende plötzlich verdickten Kürbissen verfertigt; sie sind nicht selten mit eingebrannten Zeichnungen geschmückt, ihre Farbe meist gelb, bräunlich oder rothbraun. Die zweite Art der Löffel sind Holzlöffel, und zwar gibt es große, bis sechzig Centimeter lange, zum Auftischen von Mehlbrei, eingedickter Milch, gekochter Früchte etc. und kleinere, deren man sich bei Tisch bedient. Unter den Holzlöffeln ragen jene der Mabunda’s durch die mühevolle Arbeit sowie die eingebrannten Zeichnungen nicht nur im Marutse-Reiche, sondern in ganz Afrika hervor. Zum Zerstampfen von Korn fand ich hölzerne, pokalartig aus einem Holzstück verfertigte Blöcke und Mörser. Ferner findet man aus breiten Holzspänen gearbeitete Kornschüsseln zum Sieben des gestampften Getreides.
Die Flechtarbeiten machen den Bewohnern des Marutse-Mabunda-Reiches alle Ehre. Zu den einfachsten gehören kugelförmige, aus Gras sowie ebenso einfach aus Baobabrinde verfertigte Kornsäcke (fünfzig bis siebzig Zentimeter lang und dreißig bis fünfzig breit), ferner eine dritte Art aus Rohr und den Stengeln staudenartiger Gewächse oder Fächerpalmblätter gearbeitet; diese sind größer und dienen zum Transport getrockneter Fische und nuß- bis faustgroßer Früchte. Auch die aus fingerdicken, geflochtenen Bastfasern genetzten und Garnsäcke werden von den meisten Stämmen gleich rasch und gediegen gearbeitet.
Die einfachste Art der Körbe besteht aus einer cylindrischen, nach unten abgeschlossenen und an der Mündung mit einem hölzernen oder aus einem Riemen verfertigten Henkel versehenen Röhre, welche aus einer, unserer rothen Birkenrinde ähnlichen Rinde gearbeitet und mit Bast zusammengenäht wird. Sie dienen meist zum Sammeln der Früchte. Flechtarbeiten im engeren Sinne des Wortes sind die Makuluani-Körbe, d. h. Körbe, die aus lancettförmigen Blatttheilen der Fächerpalme verfertigt werden. Sie sind sehr gediegen gearbeitet und entsprechen vollkommen dem Zwecke, mit ihrem dicht schließenden Deckel und dichten festen Gewebe als Verschlußkästchen oder Truhen zu dienen. Sie haben eine gefällige, jedoch in zahlreichen Exemplaren nicht ein einziges Mal übereinstimmende Form. Die in der Barotse angesiedelten Matabele arbeiten Körbe aus Gras und Stroh so fein, dicht und gediegen, daß sie ein vollkommen wasserdichtes, zum Biertrinken benütztes Gefäß vorstellen.
Zu der best gearbeiteten Flechtarbeit wie zu den besten Handarbeiten der Marutse-Mabunda-Reiche überhaupt gehören unstreitig die beiden in der Barotse von den Marutse-Stämmen gearbeiteten Arten der Makenke-Körbe. Sie werden aus einem verhältnißmäßig schwierig zu bearbeitenden Material, den Wurzelfasern eines ahornartigen Strauches, des Mosura, verfertigt. Man unterscheidet zwei Arten: die eine ist stets deckellos und wird beinahe immer in einer und derselben Form und Größe geflochten, die zweite ist mit einem dichten, falzförmig eingreifenden Deckel versehen und zeigt die größte Verschiedenheit in Bezug auf Form und Umfang. Im künstlerischen Werthe stehen sich beide gleich. Ich sah kein einziges Exemplar ohne Verzierung durch eingeflochtene, schwarz gebrannte oder dunkelgefärbte Fasern (Strähne) hergestellte Zeichnungen. Dies Alles macht diese Körbe selbst in der Barotse beachtenswert, in den anderen Theilen des Reiches bekommt man sie kaum zu Gesicht; ja es hatte große Schwierigkeiten, in Schescheke, am Hofe des Marutse-Herrschers, einige zu erstehen.
Die im Haushalte und von den Männern bei ihrer täglichen Beschäftigung gebrauchten Messer sind scheidenlos und bestehen aus einer dünnen, scharf zugespitzten, oft an der Schneidekante ausgebogenen oder im Ganzen sichelförmig gebogenen Eisenklinge, die fest in einen kürzeren, mit Leguan- oder Schlangenhaut überzogenen Griff eingefügt ist. Unter den Waffen unterscheide ich Wurf-, Stoß-, Hieb-, Schneide-, Schlag- und Schutzwaffen. Zu den ersteren gehören gewisse Arten der Assagaie und Stöcke; zu den zweiten andere Arten von Assagaie und Dolche; zur dritten Kategorie Schlachtbeile; zur vierten Messer, Dolche; zur fünften Stöcke und Kiri’s und zu der letzten Kategorie Schild und Stock.
Die Assagaie zeigen durchwegs gefällige Form, gute Arbeit, sind sinnig den verschiedenen Zwecken entsprechend erdacht und repräsentiren die besten Producte dieser Art, die ich bis jetzt in Südafrika zu beobachten Gelegenheit hatte. Ihre Assagaie stehen weit über denen der Betschuana und Makalaka. Von den verschiedenen Arten derselben erwähne ich die Häuptlings-Assagaie; sie gelten als waffenartige Abzeichen höherer Würdenträger, gehören zu den kräftigsten, aber auch selteneren Waffen. Sie sind 1½ bis zwei Meter lang, wovon ein Dritttheil auf den Eisentheil kommt; der Stiel ist der stärkste unter allen nördlich vom Zambesi bekannten Hand-Assagaien und gewöhnlich an seinem oberen, noch häufiger in der Mitte und am unteren Ende ausgeschnitten, zuweilen auch mit eingekerbten Linien, Ringen etc. verziert.
Der Hand-Assagai dient zur Bewaffnung der Rechten im Handgemenge und ist eine furchtbare Waffe, namentlich in der Hand der Matabele. Er zeichnet sich durch eine zur Hälfte ausgeschliffene Längsleiste an der Schneidefläche, durch einen starken, mit erhabenen Ringen versehenen Hals und einen kurzen festen Stiel aus, dessen unteres Ende durch ein fingerdickes Eisenband beschwert ist.
Der lange Schlacht-Assagai ist das Gegentheil des vorher genannten; er ist leicht, mit langem Stiel versehen und dient als Wurfwaffe. Er wird 1¾ bis 2¼ Meter lang gearbeitet, die Schneide ist einfach, der Hals von mäßiger Länge.
Im Gebrauche sind ferner kurze und lange Jagd-Assagaie, deren Hals mit einseitigen oder beiderseitigen Widerhaken versehen ist; der Hauptunterschied liegt darin, daß die Schneide, d. h. das Eisenblatt nach abwärts harpunenartig ausläuft oder die gewöhnliche Speerform zeigt.
In Bezug auf die Gebrauchsweise werden die letzteren in solche für kleine und mittelgroße Gazellen und kleine Raubthiere, und solche für starkes Hochwild, wie Büffel, Zebra, Gnu, Nashorn und große Raubthiere, Pardel, Löwe etc. eingetheilt.
Der eigentliche Krokodilspeer gehört zu den längsten Assagaien und zeichnet sich durch die Anheftungsstellen der Widerhaken aus, von denen er nur vier zählt. Die Schärfe gleicht jener der früher beschriebenen, der Hals zeigt an der Uebergangsstelle an der Schneide beiderseitig einen Widerhaken und ein gleiches da, wo er in den Stiel einläuft, doch hier sind dieselben nach aufwärts gekehrt.
Im Gebrauche stehen weiters zwei Arten von Wurf-Assagaien, deren man sich zur Erlegung der zahlreichen Ottern bedient. Die Schneide, ähnlich der des vorigen, ist zehn bis zwanzig Centimeter lang, schmal, sehr scharf und ziemlich stark. Der Leguan-Assagai ähnelt in Allem dem Schlachtassagai, nur daß seine Schneide um die Hälfte kleiner ist.
Der Fisch-Assagai entbehrt der lanzenartigen Schneide und ähnelt einem mit einer vierkantigen, ungezähnten, nur am Ende abgerundeten Spitze versehenen Leguan-Assagai. Die Widerhäkchen an den Kanten sind besonders scharf seitwärts und etwas nach aufwärts gekrümmt und zeigen vortreffliche Arbeit. Derselbe entspricht vollkommen seinem Zwecke und gehört zu den häufigsten Assagai-Formen im Reiche.
Der Nilpferd-Assagai ist der längst gestielte und einer der einfachsten, der Stiel ist zwei bis drei Meter lang und nur bei dieser Waffe aus weichem Holz verfertigt.
Die dreizehnte der wichtigen Assagai-Formen ist der Elephanten-Assagai. Derselbe ist ganz aus Eisen verfertigt, an seinem unteren Stabende verdickt oder breiter gearbeitet und in seiner Mitte mit einem kurzen ledernen Ueberzug versehen.
Die Fallgruben-Assagaie sind die am einfachsten gearbeiteten; sie werden in Fallgruben mit den Stielen eingegraben und mit den Schneiden nach aufwärts gestellt, um gelegentlich bei der Jagd auf Wasser-Antilopen verwendet zu werden.
Die Stoßwaffen schließe ich mit den Mabunda-Dolchen, welche unstreitig zu den niedlichsten Waffen des Marutse-Mabunda-Reiches gehören. Während die Bamangwato-Dolche nicht zu verachtende, jene der Matabele gefürchtete Waffen genannt werden müssen, zeichnen sich die im Marutse-Reiche durch ihre zierliche und lobenswerthe Arbeit aus. Das Auffallendste an ihnen sind die durchbrochenen, mehr oder weniger in der Form einer flachen Saturnuslampe gearbeiteten Scheiden. Dieselben wie die Griffe sind aus hartem Holz gearbeitet, mit Schnitzereien besäet und durch Einbrennen so gut geschwärzt, daß man bei dem ersten Anblick Ebenholz als Material vermuthen würde. Die Klinge ist aus minder gutem Eisen, sowie minder gut als die Assagaie, Schlachtbeile etc. gearbeitet, dafür ist jedoch große Mühe auf eingeschlagene Zierrathen verwendet, welche zumeist die breiten Flächen, der dünnen Klinge bedecken. Diese Zierrathen bestehen in Arabesken, symmetrischen Figuren, Menschen- und Thiergestalten.
Die Wurfstöcke sind 1 bis 1½ Meter lang, finger- und doppelfingerstark und in der Regel an einem Ende etwas verdickt.
Die Schlachtbeile zeigen, den Stämmen des Reiches entsprechend, eine sehr mannigfache Form. Sie übertreffen jene der südlich vom Zambesi wohnenden Stämme meist durch ihre gefällige Form, ihre Leichtigkeit, sowie durch die gute Eisen- als auch die gewählte Holzarbeit am Stiele. Während ich bei den Betschuana’s, Kaffern, Makalaka’s und den Matabele die dünnen Tomahawk-Klingen nie fest im Stiele sitzen sah, können diese nicht fester in den Stiel eingefügt werden. Dieser ist aus hartem Holz verfertigt, mit eingebrannten Zeichnungen versehen, einfach, doch entsprechend geformt, das Ganze leicht, geschmeidig wie eine Spielerei in der Hand eines Erwachsenen, und doch eine tüchtige Waffe im Handgemenge.
Die gewählteren Formen der Messer, die zumeist zum Holzschneiden und sonstigem Gebrauch, in seltenen Fällen zur Vertheidigung benützt werden, übertreffen die gewöhnlichen Küchenmesser an Länge und feiner Arbeit. Die sanft sichelförmig gekrümmte Klinge hat einen auffallend starken Rücken und zeigt oft eingeschlagene Zierrathen mannigfacher Art. Sie sitzt tief im plattgedrückten, oft recht anmuthig geschnitzten, bisweilen durchbrochenen und dunkelbraun polirten Stiele.
Die Kiri’s sind kurze rundliche, an einem Ende dick-kugelförmig angeschwollene Stöcke. Im Marutse-Reiche werden sie aus verschiedenen harten Holzarten und aus der Waffe des Nashorn’s gearbeitet; die aus dem ersteren Material sind mannigfacher, die kugelförmige Anschwellung des oberen Endes hühnerei- bis faustgroß, oft ausgeschnitzt, der Stock vierzig bis siebzig Centimeter lang, mit einem Stärke-Durchmesser von zwei bis vier Centimeter, oft polirt, das untere Ende gespitzt, abgerundet oder scharf abgestutzt, seltener mit einem Eisenreifchen versehen.
Zu den Schutzwaffen gehören vor Allem die Schilde, in deren Verfertigung die Stämme des Marutse-Reiches keine so hervorragende Stellung einnehmen als die südlich vom Zambesi wohnenden Eingebornenvölker. Ihre Schilde gleichen denen der Betschuana, sind größer als jene der Zulu-Race und der Masarwa und meist aus schwarzweiß-gescheckter Rindshaut verfertigt.
Ich schließe die Besprechung der Schutzwaffen und der Waffen im Allgemeinen mit den zur Abwehr üblichen Langstöcken; diese sind 1¾ bis 2½ Meter lang, 1 bis 1½ Centimeter stark (im Durchmesser) und meistens an beiden Enden mit spiralgewundenen Eisenreifchen versehen.
Zur Zeit meines Aufenthaltes im Marutse-Reiche bezifferte sich die Zahl der von Westen und Süden eingeführten Gewehre auf 500 Feuerstein-Musketen, 1500 gewöhnliche Percussions-Musketen, 80 Percussions-Gewehre auf Elephanten, 150 Rifles, 30 Percussions-Doppelgewehre aller Art, 10 Hinterlader und 3 Revolver. Nach meiner Abreise wurden sehr viele und zwar die besseren Gewehre von den Aufständischen in den Zambesi geworfen und da seitdem nur eine unbedeutende Anzahl neu erstanden wurde, so mag sich die gegenwärtige Zahl der Schußwaffen auf eilf- bis zwölfhundert belaufen.

Kalebassen für Honigbier und Korn bei den Marutse und Mabunda.
Die Bekleidungs-Industrie steht bei den Völkern des Marutse-Reiches nicht auf jener Stufe, welche andere Industriezweige einnehmen. Wohl ist der Schnitt an den Carossen und übrigen Kleidungsstücken ein gewählterer und zweckentsprechenderer, allein die Fertigkeit, gleichfarbige Felle, so anzureihen, daß die Farben selbst in sanfteren Nuancen ohne das Auge zu beleidigen zu einander passen, ja oft so geschickt zusammenzustellen, daß man sie beim Ansehen der behaarten Fläche gar nicht als Felle verschiedenartiger Thiere beurtheilen würde; ferner die Kunst, beschädigte Stellen an den Fellen (Schußlöcher, Bißwunden) mit genau entsprechend gefärbten und lang behaarten Einsätzen so auszubessern, daß dies in der Regel nur beim Ansehen der haarlosen Fläche erkannt wird, ist ihnen nicht eigen.
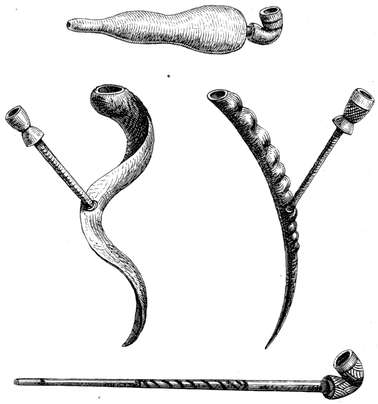
Tabaks- und Dachapfeifen der Marutse und Mabunda.
Während der Betschuana zu Bekleidungsstücken oder um einen guten Verkaufsartikel zu gewinnen, nur gleichartige Thiere ihrer Felle beraubt, ja, wo er z. B. viele Felle einer Art sammelt, dieselben in lichtere und dunklere, in dicht- und spärlich behaarte, oft sogar noch in große und kleine sortirt, und nur die in der Farbe, Behaarung und Größe einheitlichen Felle zu einer Carosse verarbeitet, finden wir im Marutse-Reiche zumeist die Felle verschiedener Thiere unsymmetrisch in einer Carosse zusammengeworfen, von Farben-Nuancen und Größen-Verhältnissen gar nicht zu reden. Auch vermißte ich an ihren Carossen die aus den Fellabfällen (wie Füße, Schwänze etc.) bei den Betschuana verfertigten Fransen und Umsäumungen werthvoller Stücke. In der Näharbeit, die mit der Ahle und gefaserter Thiersehne ausgeführt wird, stehen sich die Stämme nördlich und südlich des Zambesi gleich.
Bezüglich der Bearbeitung der Felle habe ich Folgendes beobachtet: die glattgar zu bearbeitenden, zu Schürzen, Sandalen, Riemen, Säcken etc. verwendeten Felle werden befeuchtet und einige Zeit hindurch eingerollt gehalten, dann die Haare mit der Hand oder mit einem stumpfen Messer abgekratzt und das Fell mit dieser Fläche nach abwärts gekehrt, auf einer glattgescheuerten Stelle ausgespannt und mit Holznägeln längs des Randes an den Boden befestigt. Mit Hilfe eines keilförmigen, vertical in einen daumendicken Stab eingelassenen Eisens oder eines Schabbeilchens »Pala« genannt, an schwächeren, an dicken Fellen mit Hilfe von zehn bis zwanzig in ein Bündel zusammengebundenen, zehn bis fünfzehn Zentimeter langen vierkantigen und scharfspitzigen Nägeln wird die Innenseite des Felles von allen noch etwa ihr anhaftenden Fleischresten, Sehnenfasern etc. freigeschabt, das Fell beiderseits mit fettigen oder öligen Substanzen gut eingerieben und der Proceß damit geschlossen, daß zwei bis sechs Männer in hockender Stellung im Tacte und unter Gesang, das Fell mit ihren Händen pressen, Stelle an Stelle an einander reiben, bis sich das Fell trocken und geschmeidig anfühlt.
Die schon früher erwähnten baumwollenen Tücher und Decken sind eine der besten industriellen Arbeiten des Marutse-Reiches. Das Gewebe ist ein gutes, d. h. ein festes und durchaus nicht grobes zu nennen, ja es zeigt sogar etwas Kunstfleiß, da wir oft dunklere Streifen symmetrisch in das hellere Gewebe eingewoben finden.
Das Ackergeräthe ist zwar sehr einfach, da wir es eigentlich nur in einer Grabhacke vertreten finden; allein dieser einzige Gegenstand übertrifft an Brauchbarkeit beinahe alle südlich vom Zambesi angewendeten Geräthe. Das Eisen am gewöhnlichen Holzbeil ist ungewöhnlich stark, ähnelt in Form einigermaßen dem Schlachtbeile und ist zuweilen mit erhabenen, ausgefeilten Zierrathen im Längendurchmesser versehen. Der Stiel ist 50 Centimeter lang, stark und gerade. Zum Aushöhlen der Canoë’s und Töpfe, zur Bereitung von brettförmigen Holzstücken bedient man sich der Beile, die in Form mit der »Pala« übereinstimmen, in der Größe je nach dem Gebrauchszwecke variiren. Auffallend gut fand ich Eisen an den Hämmern, welche an Brauchbarkeit jene der Betschuana weit übertreffen. Meißelartige Geräthe für weiches Material wie für Metall, sind klein oder größer, von viereckiger oder rundlicher Nagelform.
Bohrinstrumente werden mit Hilfe von mit Fidelbögen getriebenen Drehwalzen, in welche sie eingesetzt werden, gehandhabt. Hieher gehören auch uns nachgeahmte spiralförmig gearbeitete Kugelzieher, Schrauben etc., die wieder mit eigens gestalteten Feilen erzeugt werden. Zangen sind zwar sehr primitiver Natur, doch entsprechen sie ihrem Zwecke vollkommen. Nägel erzeugt man in der mannigfachsten Form und bedient sich dabei wie bei den Schmied- und Schlosserarbeiten überhaupt eines einfachen Ambosses.
An Rudern fand ich drei Arten vor: lange, kurze und Jagdruder; die letzteren sind ausschließliches Eigenthum des Königs und bilden mit dem größten Theile der beiden anderen Arten Tribut-Artikel. Die langen sind drei, die kurzen zwei Meter lang und stets aus hartem, astlosem Holze gearbeitet. Sie sind an ihrem breiteren Ende schmäler als die kurzen und hier gerade abgeschnitten, die kurzen schiffchenförmig in eine Spitze zulaufend, beide mit eingebrannten Zeichnungen und Schnitzereien, doch nicht so häufig wie bei den Jagdrudern versehen. Diese letzteren sind an ihrem unteren Ende gabelförmig gespalten, über der Spaltspitze geht quer eine Drahtklammer durch den Ruderstock, um das Bersten zu verhindern. Die Jagdruder sind in der Regel drei Meter lang und werden bei den während der Zambesi-Ueberschwemmungen unternommenen Letschwe- und Puku-Jagden gebraucht.
Die Tabakspfeifen sind in doppelter Form gearbeitet, die einfachere ist in der westlichen Hälfte des Reiches, die zweite im Süden vorherrschend. Die erstere ähnelt im Allgemeinen den türkischen Pfeifen und besteht aus einem einfachen bis einen Meter langen, daumendicken, geraden, zuweilen mit eingebrannten Zeichnungen versehenen Rohrstück und einem aus gebranntem Thon gearbeiteten, meist schwärzlichen oder grauen, mit eingebrannten Linien, Kreisen, Arabesken bedeckten, verhältnismäßig kleinen Pfeifenkopfe. Die zweite Form der Tabakspfeifen ist im Stiele abweichend, der aus einer länglichen, oft eingeschnürten Calebasse verfertigt ist; das obere, dünne Kalebaß-Ende dient als Mundstück. Auf kurzen Ausgängen vergißt der Eingeborne nie seine Tabakspfeife, namentlich dann nicht, wenn er in Gesellschaft des Weißen reist. Der Tabak wird in kleinen Tuch-, Calico-, meist jedoch Lederlappen an der Carosse oder am Gurte befestigt.
Als unzertrennlicher Genosse auf längeren Reisen gilt jedoch die Dachapfeife, die in ihrem Wasserbehälter eine große Mannigfaltigkeit zeigt. Dacha — sind die getrockneten Blätter einer Hanf-Art, die in ganz Süd-Afrika von den Eingebornen um ihre Behausung gepflanzt, als ein leicht berauschendes Mittel durch eine Wasserpfeife geraucht wird. Die Dachapfeifen bestehen aus drei Theilen, dem Kopfe, einem Rohrstab und dem das Wasser enthaltenden Horn, durch das der Rauch gezogen wird, wobei der Raucher mit dem Munde die breite Oeffnung umfaßt und so den Rauch anzieht. Dies erzeugt einen Hustenreiz und je heftiger derselbe, desto höher hält der Eingeborne den Genuß.
Obgleich wir Schnupftabakdosen bei allen südafrikanischen Eingebornen sowohl als eigene Fabrikate als auch in von den Weißen erhandelten Stücken zahlreich vertreten finden, so habe ich doch in keinem Eingebornen-Reiche eine solche Auswahl eigener Arbeit in diesem Artikel gefunden wie bei den Marutse. Man verwendet zu Tabakdosen Elfenbein- und Nilpferdhauer, Säugethier- und Vogelknochen (Röhrenknochen); Geweihhorn, Nashorn; Thierklauen; die Haut von Schlangen, Leguanen; Leder (Säckchen), Holz in mannigfacher Form; Rohr; Fruchtschalen von Kürbissen; Fruchtschalen kleiner, rundlicher oder länglicher Busch- und Baumfrüchte; Rinde und endlich von den Weißen eingeführte Metalldosen.
Die Dosen aus Elfenbein sind im Allgemeinen mit kleinen, ringförmigen eingebrannten Zeichnungen versehen und werden an Glasperlen-, Bast- oder Riemenschnüren befestigt, am Gurte oder an den Armringen getragen. Ich fand sie nur bei den Wohlhabenderen im Gebrauche. An Gestalt ihnen nächstverwandt sind die aus dem Horn des Rhinoceros verfertigten Schnupfdosen; beide Arten Dosen haben nur eine kleine Halsöffnung, während die Betschuana’s noch eine zweite Oeffnung an der Basis anbringen.
Die aus Rohr und Vogelknochen gearbeiteten gehören zu den einfachsten und werden meist von Knaben und Mädchen gebraucht. Die aus den Hörnern von Hausthieren und Wild geschnitzten sind von einfacher Form, oft jedoch durch Schnitzereien verziert, am häufigsten bei den Makalaka’s anzutreffen. Die gewöhnlichste Form haben jene aus Fruchtschalen, während andere zu drei bis fünf an einem Riemchen hängend, meist von Frauen an ihren Carossen befestigt werden; außerdem trachten die schwarzen Schönen diese kleinsten der Tabakdosen dunkel zu poliren, wodurch sie recht nett und glänzend schwarz, dunkelviolett oder bräunlichviolett erscheinen. Die meisten Schnitzereien und eingebrannten Zeichnungen verwendet man an den hölzernen, doch scheinen diese mehr den ärmeren Stämmen, wie den Mamboë’s, Manansa etc. eigen zu sein, die sich auch in vielen Fällen einfacher Tuch- und Lederläppchen bedienen. Ist eine Dachapfeife für einen reisenden Bewohner des Marutse-Reiches unentbehrlich, nimmt er bei kleineren Ausgängen einen Kiri, Stock etc. mit, so muß seine Tabakdose sein treuester Gefährte bei Tag und Nacht, beim Ruhen und Arbeiten, bei seinen kurzen Besuchen und langen Reisen genannt werden.
Als Schmucksachen gelten Gegenstände, die nebenbei einem anderen Zwecke dienen, wie Amulete, Kapseln, Schnupftabakdosen, Dosen für Heil- und Beschwörungsmittel und am Körper getragen werden. Das Material zu denselben liefern Metalle, massive und Röhrenknochen, Elfenbein, Zähne verschiedener Thierarten, ebenso Hautstücke und hornige Bestandtheile, Hörner, Krallen, Klauen und Schuppen größerer Amphibien, Schildkrötenplatten, Schuppen vom Schuppenthiere etc., Federn, Muschelschalen, Talg, Holz, Gras, Bast, Rohr, Früchte, Fruchtschalen und Samen.
Unter den aus Metall erzeugten Toilette-Gegenständen fand ich Ringe (Fingerringe), Armbänder, Fuß- und Wadenringe, sowie unbedeutende kleine Ohrringe aus Eisen, Kupfer und Messing; Gold vermißte ich vollständig. Die Eisen- und Kupfersachen waren theils aus eigenen Schmelzhütten hervorgegangen, theils waren sie aus von den Weißen erkauftem Eisen- und Kupferdraht, die messingenen nur aus dem von den Weißen erstandenen Messingdraht gearbeitet. Die eingeführten Toilette-Artikel werden sehr selten in ihrer ursprünglichen Form benützt, sondern ihr Material zumeist umgeschmolzen und dem Landesgebrauch entsprechend umgearbeitet. Unter den aus eingeführtem Metalle erzeugten Objecten stehen die fingerdicken und von den Frauen der Wohlhabenderen, z. B. von den Königinnen, zu zwei bis acht auf einem Fuße getragenen Fußringe im größten Ansehen. Ringe aller Art (Fuß-, Armringe etc.) aus heimischem Eisen und erhandeltem Eisendraht werden meist von den niederen Ständen getragen; ihre Menge ist jedoch geringer als jene der aus Messing verfertigten, am seltensten sind Armringe aus Kupfer. Gewöhnlich trägt man einen bis zwei, die Frauen der Koschi und Kosana zwei bis drei, selten vier je an einem Fuße. Da der Herrscher den besten und stärksten Draht selbst kauft, den Unterthanen nur die weniger gute Sorte zu erstehen möglich ist, so finden sich auch die meisten und ansehnlichsten metallenen Schmuckringe in der Residenz und in der Barotse, sowie im Makalaka- und Matonga-Lande (Tributzahler) und nehmen nach dem Norden und Nordosten des Reiches rasch ab, wo sie einigermaßen durch aus selbstgewonnenem Eisendraht verfertigte Objecte vertreten werden. Die einfachen, aus dünnem Messing-, Kupfer- oder Eisendraht gearbeiteten unansehnlichen Ohrringe weichen nur unbedeutend von denen der Betschuana’s ab.
Mannigfach sind die aus Bein, namentlich aus Elfenbein verfertigten Artikel; die wichtigsten sind jedoch die fingerdicken Arm- und Fußringe. Die Elfenbeinringe werden gedrechselt, passen genau den Stellen an, an denen sie getragen werden, sind stets fein, ich möchte sagen fehlerfrei gearbeitet, und wenn sie auch der Schnitzereien und eingebrannt Zierrathen entbehren, eine elegante Arbeit. Es kostete mich auch nicht geringe Mühe, einiger dieser Objecte habhaft zu werden. Außer den Bracelets verfertigt man aus Elfenbein allerlei kleine, längliche Kapseln, cylindrische Stäbchen, Plättchen mit eingebrannten Ringelchen und Linien, die man durchbohrt und mittelst feiner Bastschnüre in das Haar befestigt. Ziemlich häufig finden wir Haarnadeln vertreten, die gleich den vorigen Gegenständen auch aus den Röhrenknochen der Thiere und häufig aus Nilpferd-Elfenbein verfertigt, in ihrer oberen, stärkeren Hälfte mit eingebrannten Zeichnungen und Schnitzereien verziert werden. Mannigfach sind die kleinen Schmuckgegenstände, die aus Holzstäbchen und Plättchen, Fasern und kleinen Gazellenhörnern oder aus den Spitzen der Hörner größerer Thiere gearbeitet werden. Meist werden sie mittelst Baststrängen an das wollige Haar befestigt oder an Schnürchen gefädelt und als Bracelets getragen. Man sieht Miniaturstäbchen, cylindrische oder kleine Kegelchen, Zöpfchen etc. Als unerreichtes Product der Holzschnitzerei unter den südafrikanischen Stämmen, können die dünnen, anmuthig geschnitzten, langzähnigen Haarkämme der Marutse gelten.
Sklaven verfertigen sich Arm- und Fußringe, sowie Bracelets und sogar Halsringe aus ungegerbten Gnu-, Zebra- und Büffelfellen, die Masarwa erzeugen die Stirnbänder aus Zebra-Mähnen. In allen Fällen wird die Haarseite nach Außen getragen. Vielerlei Zierrath wird auch aus den feinen wie gröberen Haaren und aus den Borsten der Säugethiere verfertigt. Aus den feineren Haaren, sowie den steifen Widerrist-Haaren arbeitet man Büschelchen, Fransen, Quasten, kreisrunde Scheiben, einfache oder zwei bis drei aufeinander ruhend, von einem Durchmesser von drei bis fünfzehn Zentimeter, ferner Ballen und Wülste, an welche man Riemen befestigt, um sie beim Tanzen um das Kinn zu binden. Die meisten dieser Schmuckgegenstände werden mit Riemchen und Strängen versehen und zur Ausschmückung des Kopfhaares benützt. An diese Formen schließe ich den Kopfputz aus Vogelfedern an. Viele schmücken ihr Haupt mit zwei bis drei schönen Einzelnfedern. Diese Federbüsche werden bei der Ankunft in des Herrschers Residenz, ferner bei Tänzen, Jagdausflügen und während eines Raubzuges oder Krieges aufgesetzt. Bei den Matabele bilden sie einen wesentlichen Theil des Nationalschmuckes und ich erwarb einen, der größere Dimensionen aufwies, als der Kopf des Trägers.
Aus Gras, feinen Holzfasern, Bast und Stroh, werden nette Armbänder etc. geflochten, bei weitem kunstvoller von den Stämmen des Marutse-Reiches, als sie sich z. B. bei den Menons und Makalaka’s südlich vom Zambesi vorfinden, wo diese Industrie doch ziemlich im Schwunge ist. Der Masupia- und Marutse-Knabe ist schon in der Wahl des Grases vorsichtig; es muß nur bestimmten Grasarten angehören, zu bestimmter Zeit gesammelt und entsprechend zubereitet werden, um in dem einen Falle eine stechend gelbe, im andern eine carminrothe Farbe zu zeigen, dann wird auch die Flechtarbeit sorgsam ausgeführt — all’ dies kümmert die Makalaka-Knaben wenig, wenn sie auch so manche Stunde der Grasflechterei für Schmuck- und Haushaltungszwecke widmen.
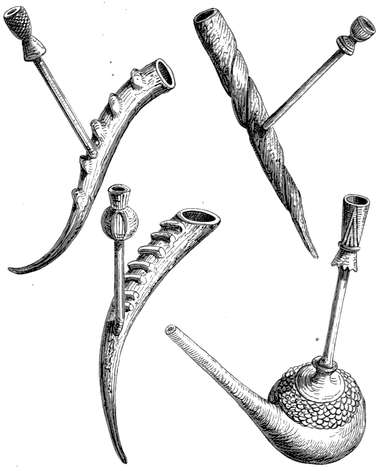
Dachapfeifen der Mabunda, Marutse und Masupia.
Die Säugethier- und Vögelklauen werden aufgefädelt als Bracelets getragen oder je zwei an einer Schnur aufgefädelt, an der Hinterhauptwolle befestigt. Von kleinen Wasserschildkröten bedient man sich der Gesammtschalen, um von diesen eine in der Scheitelhöhe oder drei in Reihenfolge auf der Längsmittellinie des Kopfes zu befestigen. Kleine Muscheln, wie sie die Portugiesen von der Westküste bringen, kleine runde Tarsus- und Carpusknöchelchen, dunkel bis glänzend schwarz polirt, Samen und kleine hartschalige Früchte werden an Roßhaar- und Gras-Schnürchen gefädelt, und als Bracelets, als Fußringe und als Haarschmuck getragen.
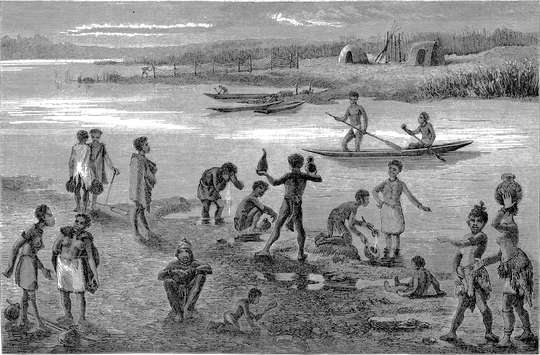
Scene am Zambesiufer in Schescheke.
Die von den Händlern eingeführten Toilette-Artikel (insbesondere Glasperlen) cursiren als Geldmünzen, dabei herrscht bei diesem oder jenem Stamme der Geschmack für bestimmte Farben vor; manche, wie z. B. die hell- und dunkelvioletten, gelben und blaßrothen, werden gar nicht beachtet. Die gesuchtesten sind die himmel- und dunkelblauen, dann folgen zinnober- und rostrothe, weiße, schwarze, grüne, sämmtlich klein mit einem Längendurchmesser von etwa 1½ Millimeter. Unter den mittelgroßen (Längendurchmesser etwa drei bis vier Millimeter) strebt man meistens nach den hellblauen, rostrothen, und unter den großen (sechs Millimeter bis einen Centimeter im Längendurchmesser) nach den mehrfach gefärbten (mehrere Farben in einer Perle), weißgefleckt auf schwarzem, dunkelviolettem Grunde, hauptsächlich aber nach schwefelgelben und grünen. Die Form der Glasperlen ist den Stämmen gleichgiltig.
Wäre man noch so krank nach einer Reise im Marutse-Reiche, und hätte man noch so viele Träger nothwendig, man wird mit einem genügenden Vorrathe schöner blauer Glasperlen nie an Mangel leiden; weder Herrscher, Koschi und Unterthan, weder Frau und Kind, noch Freier und Sklave könnten dieser Verlockung widerstehen.
Die Ueberlegenheit der Völker des Marutse-Reiches über jene südlich des Zambesi in der Verwendung dieser Schmuckgegenstände besteht darin, daß die Glasperlen in richtiger Menge und geschmackvoll in Ringen, Strängen etc. über den Körper vertheilt werden; in richtiger Menge, d. h. über Glieder und Rumpf so vertheilt, daß sie den Körper nicht belasten, nicht überladen, was wir z. B. in Bezug auf die unteren Extremitäten bei den Bakwena’s, Bamangwato’s etc. und bezüglich der Arme, des Halses und Rumpfes bei den Menon’s, Makalaka’s südlich vom Zambesi beobachten können.
Als Anhang zu den Toilette-Artikeln will ich noch einige Worte über die Behandlung des Kopfhaares folgen lassen. Daß die meisten Stämme auch auf die Pflege des Kopfhaares viel Sorgfalt verwenden, konnte ich wiederholt beobachten, ja ich fand sogar sehr viele, die sich regelmäßig kämmten, während andere, wie z. B. der Stamm der Mankoë, von Natur aus ein längliches Wollhaar besitzend, dieses wie aufgepudert tragen, was diesem stattlichen Menschenschlage zur Zierde gereicht. Manche der Marutse flechten ihr kurzes Wollhaar in Zöpfchen, je zwei bis vier Stränge zu einem Zopfe vereinigend. Ich vermißte bei den Stämmen des Reiches, sowohl das bei den Betschuana übliche Betünchen der Haare mit Eisenstein, als auch die Ring- und Kronenfrisur der Zulu’s.
Spielsachen bestehen meist in Thongebilden, in deren Erzeugung sich die aufwachsende Jugend recht geschickt zeigt. Die zumeist gearbeiteten Figuren stellen Kischi-Tänzer in ihren Verzerrungen, Männer als Jäger und Reiter, gehörnte Thiere, ferner Elephanten, Nashorn und Nilpferde dar. Meist wird dazu dunkler Thon gewählt, und die menschlichen Figuren fünf bis zwölf Centimeter hoch, die thierischen fünf bis zehn Centimeter hoch und fünf bis zwölf Centimeter lang, gemodelt. Andere Spielsachen werden aus Holz ebenfalls in Figurenform geschnitzt, dies meist von den Mabunda’s, oder mit Figuren versehene Holzlöffel und Stücke den Kindern zum Spielen gegeben.
Matten finden sich in großer Mannigfaltigkeit vor, einfach, aber nett und mühevoll gearbeitet, oft mit dunkleren einfachen Bändern oder auch mit Figuren von gleichem Material durchflochten, zuweilen sind diese eingeflochtenen Zeichnungen von schwarzer, rother etc., von der gelblichen Matte gefällig abstechender Farbe. Sie sind verschieden geformt und werden zu verschiedenen Zwecken gebraucht, je nachdem sie aus Binsen, Gras, Stroh oder Rohr verfertigt sind.
Von den hölzernen Kopfkissen sieht man sowohl primitive als gut gearbeitete Exemplare; vorwiegend traf ich gefällige aus hartem Holz gearbeitete Stücke. Die hölzernen Stühlchen sind in der Regel kurz, zwanzig bis dreißig Centimeter hoch, zehn bis fünfzehn Centimeter im Breitedurchmesser, stellen durchbrochen geschnitzte, seltener solide, dann aber primitiv gearbeitete Holzcylinder dar, deren obere Fläche seicht ausgehöhlt ist. Die durchbrochene Schnitzerei des Stockes ist säulchenförmig, die Säulchen parallel zur Höhe laufend. Ein solcher wird hohen Personen bei allen Ausgängen stets von einem Diener nachgetragen.
Als vierten in diese Kategorie gehörenden Gegenstand muß ich noch die Fliegenwedel nennen. Sie bestehen aus zwei Theilen, dem Stiele und dem Wedel; der Stiel wird aus Holz, Rohr, Nilpferd-, Nashorn- und Büffelleder, in selteneren Fällen aus Gazellenhorn und dem Horn des Rhinoceros, der Wedel aus langen Widerristhaaren der Thiere, aus Mähnen und Roßhaar, aus den buschigen Schwänzen der hundeähnlichen Raubthiere und aus Federn gearbeitet. Am häufigsten sind jene aus Ochsen-, Gnu- und Schakalschwänzen. Der Wedel ist entweder in den Stiel eingelassen oder über denselben mittelst Bastfäden, Grasschnüren, Roßhaar, Thiersehnen etc. daran befestigt, der Stiel in der Mehrzahl der Fälle geschnitzt, mit eingebrannten Zeichnungen versehen, oder mit breiten Messing- und Kupferringen, mit aus Messing- und Kupferdraht und aus steiferem Roßhaar geflochtenen Ringen, oder aber mit Binden aus Schlangen- und Leguanhaut umspannt.
Abfahrt von Schescheke. — Renitente Bootsleute. — Ein treffliches Schreckmittel. — Die Fauna im Leschumo-Thale. — Diamond’s Jagdausflüge. — Der Häuptling Moja. — Eine interessante Naturerscheinung. — Sepopo’s Häscher. — Kapella’s Flucht aus Schescheke. — Schwere Gewitter. — Gährung im Marutse-Reiche. — Sepopo’s Niedergang. — Aufbruch nach Panda ma Tenka.
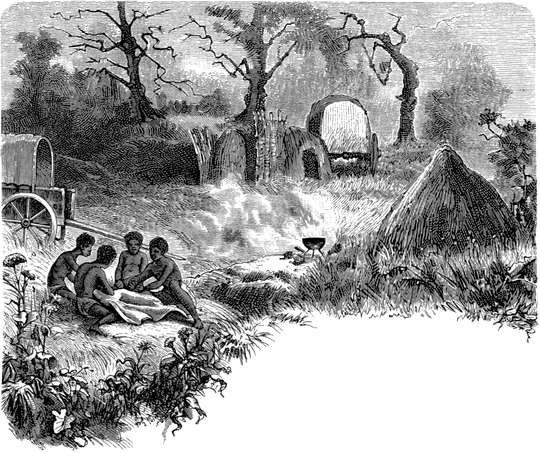
Lager im Leschumo-Thale.
Wie ich bereits am Schlusse des eilften Kapitels erwähnt, mußte ich, wenn auch mit innerstem Widerstreben, Schescheke verlassen, da ein längerer Aufenthalt daselbst mein Leben ernstlich gefährdet hätte. Nach einer Fahrt von einigen Stunden hielten die Bootsleute, die wohl wußten, daß ich Sepopo auf immer verlassen habe und sich deshalb um mich wenig kümmerten, an einigen Masupiahütten an. Ich ließ mich aus dem Boote heben und zu der nächsten Hütte führen. Sie war nur provisorisch von Masupia-Fischern errichtet worden, um die nöthige Abgabe an Fischen in den marschigen Lagunen ringsum zu erwerben. Ich erstand fünf Fische, gab jedem Diener einen und ließ einen für mich rösten.
Schon Nachmittags bemerkte ich, daß sich die Bootsleute unter keiner Bedingung kräftiger in ihre Ruder zu legen bemühten, und als wollte mich das Schicksal zu all’ den Mühen des Tages verspotten, hatten die Bootsleute eine Stelle für unser Nachtlager gewählt, welche nicht unwirthlicher und ungesünder sein konnte. Es war dies an einer kleinen hochbeschilften Insel unmittelbar vor einem Sumpfe, auf welcher sich zwei elende, periodisch von den Masupia-Fischern bewohnte Hütten befanden. Da mein Boot das letzte war, hatten die ersteren von den Hütten Besitz genommen, und es blieb meinen Dienern nichts übrig, als für mich eine Hütte zu erbauen. In 2½ Stunden war diese fertig, als sie hierauf mit Hilfe der Bootsleute mein Gepäck aus den Booten heraus und in die Grashütte geschafft hatten, zeigte es sich, daß diese zu klein, namentlich zu niedrig errichtet worden war und daß man mich eben mit Mühe hinein zerren und auf die Kisten zu legen vermochte. Mein Gesicht berührte das Gras des Hüttendaches, welches noch vom vorigen Jahre vom Hochwasser auf die Insel angeschwemmt, hier ringsum gesammelt worden war; es war feucht und ein widerlicher Geruch entströmte demselben, der sich mit der Ausdünstung des Sumpfes vermengte. An Schlaf war unter diesen Verhältnissen nicht zu denken. Mein Bootunglück, die mißlungene Weiterreise und zahllose andere folternde Gedanken ließen mich eine höchst unerquickliche Nacht verleben. Die Nilpferde, wie auch die Riesenreiher ließen sich mehrmals hören, die einzigen Laute, welche die Stille der Nacht unterbrachen. Vor Mitternacht tauchten mehrere kleine Wolken auf, die sich sehr schnell vermehrten und bald darauf den Himmel so verdunkelten, daß ich auch nicht ein einziges Sternlein mehr erblicken konnte. Mein durch die Krankheit ohnehin angegriffenes Gemüth empfand die zunehmende Schwüle in der Atmosphäre um so schwerer.
Nach Sonnenaufgang verließen wir die Stelle, um unsere Fahrt flußabwärts wieder aufzunehmen. Die Art und Weise, in der die Bootsleute die Kähne luden, und sich während der Fahrt benahmen, mahnten mich, auf Aergeres gefaßt zu sein. Je mehr ich auf rasche Fahrt drang, desto langsamer ging diese von statten, ja als sich ein leichter Wind erhob, landeten die Männer auf einer Sandbank und wollten sich nicht von der Stelle rühren; die Androhung der von Sepopo zu erwartenden Strafe hatte keinen Erfolg. Ich versprach Glasperlen, ich drohte, meine Diener schimpften, doch alles vergeblich. Die Leute fingen an zu lachen, die einen legten sich auf den Sand, um zu schlafen, die anderen, um sich an meiner Schwäche und Hilflosigkeit zu ergötzen. Als ich sah, daß alle meine Versuche erfolglos blieben, nahm ich meine Zuflucht zu einem Schreckmittel, um mir bei diesen Menschen Respect zu verschaffen. Ich saß am Bug des einen Kahnes, als es mir einfiel, den an die Musketen gewöhnten Marutse meinen Hinterlader zu zeigen. Ich ließ mehrmals das Gewehr in der Sonne blinzeln, wählte mir einen einzeln aus dem Wasser hervorragenden Rohrhalm, der sich auf einem freien Raume zwischen zwei Gruppen der widerspänstigen Bootsleute erhob und feuerte drei Schüsse auf denselben ab. Der erste Schuß traf, die wirklichen und die sich verstellenden Schläfer sprangen auf die Beine, rasch darauf fiel der zweite Schuß und schlug nahe seinem Ziele ein, worauf die Leute in ihre Boote sprangen, und als zufällig die dritte Kugel den übrig gebliebenen Stumpf rasirte, hatten die ersten Kähne schon abgestoßen und meine Bootsleute hinderten mich am abermaligen Gebrauche des Carabiners.
»Es saust zu viel in den Ohren, Herr! Wenn Du schießen willst, dann bringen wir Dich nach Impalera, und dort findest Du auch viel Polocholo (Wild).« Schon drei Stunden nachher landeten wir unter dem Makumba-Baobab. Der Himmel hatte sich aufgeklärt und von den bewaldeten Hügeln der Impalera-Insel wehte uns eine frische Brise entgegen, die auf mich wie ein erfrischender Labetrunk wirkte. Ich erhob meinen Carabiner, um einige der über mir hängenden Baobabfrüchte herabzuschießen. Während die Bootsleute die Kähne entluden, eilten meine Diener in den Wald, um Früchte für mich zu sammeln. Zu meinem freudigen Staunen traf ich Blockley hier an, er war eben im Begriffe, mit Gütern nach Schescheke zu gehen.
Am 13. gelang es mir, für sechs Meter Calico einen Miniatur-Ziegenbock und eine größere Quantität Korn sowie siebenundzwanzig lebendige Finken (verschiedener Art) zu erstehen, welch’ letztere ich leider schon am folgenden Morgen bis auf drei einbüßte. Als ich Morgens nach den Thieren sah, fand ich alle bis auf drei todt, sie waren von einer rostrothen Termite, die zu Tausenden in den Käfig gedrungen war, getödtet worden. Ich hatte diese Termitenart früher nie beobachtet; der Kopf war beinahe von der halben Körperlänge und die Fänge so stark, daß sie sich wie eine Zecke einbeißen konnten.
Am 14., an dem Tage, an welchem Blockley nach Schescheke gehen und ich nach Süden reisen wollte, kamen Masupia-Schiffer von der genannten Stadt und riethen meinen Bootsleuten sowie den Bewohnern von Impalera ab, Blockley nach Schescheke zu bringen, da der König sein Herz gegen Dschorosiana Umutunja verschlossen habe.
Am 15. setzte ich über den Tschobe und hatte das dreifache an Fährgeld zu bezahlen, um das Marutse-Reich verlassen zu dürfen. Da ich um keinen Preis im sumpfigen Tschobe-Thale übernachten wollte, sandte ich meine Diener mit einem Theile des Gepäcks sofort nach dem Leschumo-Thale ab, wo Blockley zwei leere Wagen stehen hatte, um mich in diesen bis zu Westbeech’s Ankunft einzulogiren. Ob meiner Schwäche jedoch konnte ich nicht sofort folgen, und als sich endlich einige Masupia’s von Impalera einfanden, um mich und den Rest meines Gepäckes nach dem genannten Orte zu tragen, brach ein Gewitter über das Thal herein, welches mich die Nacht in der elenden Grashütte zuzubringen nöthigte, in welcher der wenige Tage zuvor in Panda ma Tenka verstorbene Bauren zuerst erkrankt war. Wir machten uns gegen Mittag des nächsten Tages wieder auf den Leidensweg und erreichten das nur drei Stunden entfernte Leschumo-Thal erst nach zwölf für mich qualvollen Stunden. Ich mußte von hundert zu hundert Schritte stets einige Minuten innehalten, dabei triefte der Körper dennoch von Schweiß. Die Anstrengungen dieses Marsches zwangen mich am nächsten Tage zur vollsten Ruhe.
Am 17. fühlte ich mich etwas leidlicher, doch wurde meine Absicht, in der nächsten Nähe des Wagens zu botanisiren, durch ein heftiges, den ganzen Tag hindurch währendes Gewitter vereitelt. Ich hatte schon während der letzten drei Tage auf Westbeech’s Ankunft gehofft, sein Nichterscheinen vermehrte meine Aufregung, da mein kleiner, auf drei Tage berechneter Vorrath an Salz, Zucker und Thee zu Ende war. Zu meiner freudigen Ueberraschung kehrte der Diener Elephant von einem Gange durch den Wald mit reichlichem Honig zurück. Meine Hände und meine Stirne waren seit der am Tschobe-Ufer zugebrachten Nacht von besonders bissigen Mosquito’s zerstochen worden und jede dieser kleinen Verwundungen hatte sich zu einer Eiterpustel verwandelt, deren Spuren ich noch monatelang trug. In all’ diesem Ungemach freute mich die erlangte Ueberzeugung, daß ich zuverlässige und arbeitsame Diener besaß. Ich bedauerte nur, daß ich sie nicht dazu bewegen konnte, sich meines Hinterladers zu bedienen und etwas Wild für mich zu schießen, sie verstanden es nicht und fürchteten sich zugleich, von demselben Gebrauch zu machen. Mit ihren Assagaien war es ihnen nicht möglich, das Wild in dem sandigen Walde, durch den sich das Leschumo-Thal schlängelt, zu erlegen, denn dieses Wild bestand meistens in flüchtigen Gazellen, Büffeln, Nashorn und Elephanten. Zwei Nächte zuvor hatte eine größere Elephantenheerde das Thal einige Schritte unterhalb der Wägen gekreuzt.
Am 19. ließ ich mich in der nächsten Umgebung des Wagens herumführen und sammelte mit Hilfe meiner Diener Pflanzen und Insecten. Meine letzten zwei Bücher, welche ich aus dem Schiffbruche meiner Habe gerettet hatte, wurden nun als Pflanzenpressen benützt. Da sie nur Octavformat hatten, sah ich mich genöthigt, die Pflanzen zu zerlegen, um sie später wieder zusammen zu setzen. Ich widmete den Kindern Flora’s ein eigenes Tagebuch, in welchem ich von den meisten gesammelten Pflanzen nebst anderen Notizen, die Namen, die sie von den Masupia-Dienern oder den Manansa- und Matonga-Gehilfen erhielten, verzeichnete. Pflanzen und Pflanzentheile, die ich nicht pressen oder trocknen konnte, wurden abgezeichnet (dies gilt besonders von Schwämmen und Pilzen, an denen das Leschumo-Thal sehr reich war) und die Skizzen während der schlaflosen Nächte weiter ausgeführt. Die Insecten wurden in eine mir von Westbeech geschenkte weithalsige, mit einigen Papierstreifen gefüllte Picklesflasche gethan und diese mehrmals in das kochende Wasser in meinem Kaffeekessel eingetaucht, wodurch die Thiere getödtet wurden.
Die häufigsten unter den im Leschumo-Thale erworbenen Insecten waren Käfer, Heuschrecken und Wanzen, besonders fielen mir die artenreichen Lepidoptera auf, die ich zweimal zu sammeln versuchte. Leider mißglückte dieses Bestreben, eine Ratte, welche im Wagen zwischen den Gepäcksstücken hinreichende Schlupfwinkel gefunden haben mußte, zerstörte die angelegten Sammlungen, und ich fand jedesmal die Schmetterlinge bis auf die Stecknadeln aufgezehrt. Unter den Käfern waren die häufigsten Laufkäfer (Cicindela, Mantichora granulata, Carabus) Scarabaniden, Blattkäfer, Rüsselkäfer und Klopfkäfer (Psammodes). Die letztere Gattung findet man in zahllosen Varietäten, und fielen sie selbst den für solche Thiere unempfänglichen holländischen Farmern auf. Sie besitzen einen dicken, walzen- und herzförmigen Hinterleib, welchen sie heben, um mit ihm in Zwischenräumen von drei bis zehn Secunden einen leisen Schlag gegen die Erde oder den Zimmerboden, auf dem sie sich zufällig befinden, auszuführen. Sie »klopfen«, wie die Holländer meinen und rufen einer den andern heran. Viel Vergnügen machte mir im Leschumo-Thale die Beobachtung der Mantichorae und Anthiae thoracicae; diese leben paarweise in selbst aufgescharrten, bis einen Fuß tiefen oder in verlassenen Erdlöchern. Die selbst aufgescharrten sind höchstens 2½ Centimeter hoch, dagegen vier bis sechs Centimeter breit, und es wunderte mich oft, wie die Thiere diese Gänge im losen Sande graben konnten. Die Thierchen waren den ganzen Tag auf den Beinchen, sie unterscheiden sich von anderen großen Carabiden in ihrer Bewegung namentlich dadurch, daß sie sehr oft stille und auf ihren hohen Beinen ziemlich hoch stehen, man mochte sagen, förmlich Rundschau halten. Den Holländern sind sie durch eine Eigenschaft, welche sich dem Neuling, wie es auch mir einige Jahre zuvor geschah, schmerzlich fühlbar macht, aufgefallen. Trachtet man, diesen Käfer zu fangen, und ist man im Begriffe, denselben, mit dem Hinterleibe nach sich gekehrt, in die Sammelflasche unterzubringen, so spritzt das Thier eine Ladung ätzenden Saftes aus, welcher, da man beim Fange der Insecten meist gebeugt ist, in der Regel das Gesicht und oft die Augen trifft.
Da ich mich am 6. etwas besser fühlte und ein von der Jagd zurückkehrender Diener Westbeechs, »Diamond«, mit einigen Manansa bei den Wägen eingekehrt war, so unternahm ich, auf einen Diener gestützt einen kleinen auf sechs englische Meilen sich erstreckenden Ausflug. Es war mir namentlich darum zu thun, Vogelbälge zu erbeuten, da ich jedoch den Thieren weder nachlaufen noch sie beschleichen konnte, erbeutete ich nur einen gabelschwänzigen schwarzen Würger; um so reicher war die Ausbeute an Pflanzen und Insecten. Im Ganzen hatte mir mein Aufenthalt im Leschumo-Thale gegen dreitausend der ersteren und etwas über fünfhundert der letzteren eingetragen. Auf dem eben genannten Ausfluge stieß ich auf Eisenschmelzöfen, sie waren bis zu einem Meter breit, zwei Meter lang, niedrig und aus gebrannten Miniaturbacksteinen ausgeführt, und mochten wohl vor vierzig bis sechzig Jahren von einem der den Marutse unterthänigen Völkern gebaut worden sein, die vor der Gründung des Räuberstaates der Zulu-Matabele am südlichen Zambesi-Ufer wohnten.
Am 21. kamen Masupia von Impalera und brachten Korn, welches sie mir zum Kaufe anboten. Nachmittags kehrte der Jäger Diamond von einem Jagdausfluge heim; seine Diener trugen das Fleisch einer Büffelkuh, die er am Morgen erlegt hatte. Auch er klagte über die Unarten der Büffelstiere, welche namentlich im Sommer in Folge der dichtbelaubten Gebüsche des Waldes schwierig zu jagen sind. Der Genuß des Büffelfleisches verschlechterte meine Krankheit, da meine Verdauung durch die lange Entbehrung jeder Fleischnahrung sehr geschwächt war. Um so größer war die Freude der Diener über die erwünschte Abwechslung im täglichen Menu. Diamond erzählte mir bei dieser Gelegenheit die Jagdabenteuer Pit’s (meines früheren Dieners). Derselbe hatte vor einiger Zeit zwei Rhinocerosse erlegt und kehrte nach diesem glücklichen Jagdereignisse zu seinen Genossen (er war mit einer Truppe von Westbeech’s Leuten ausgezogen) zurück, um Träger zu holen; als er jedoch zehn Stunden später wieder an Ort und Stelle anlangte, fand er nichts als Knochen vor. Zufällig im Walde streifende Madenassana hatten die erlegten Thiere aufgefunden, und nachdem sie ein herrliches Mahl gehalten, die besten Stücke mitgenommen, während der Rest von Hyänen und Schakalen verzehrt worden war.
Meine Hoffnung, daß das höher liegende Thal des Leschumo-Flüßchens sich gesünder erweisen werde als das Tschobe-Thal, war eine trügerische. Stundenlang war dasselbe am Morgen von dichtem Nebel erfüllt, die Ausdünstung an manchen Tagen, namentlich nach heftigem Regen, höchst unangenehm; am unwohlsten fühlte ich mich in den frühen Morgenstunden, gegen Mittag besserte sich wohl mein Befinden, doch zitterte ich unter dem Einflusse auch des unbedeutendsten Windhauches, so daß ich auch an den heißesten Tagen in den Monaten Jänner, Februar und März nur mit einem schweren Mentschikoff und einem zweiten Ueberrock angethan, meinem Sammeleifer gerecht werden konnte.
Am 23. fand sich eine Truppe von Marutse-Männern bei mir ein, die zu meiner Verwunderung vom Süden kamen. Es war Moja, ein Häuptling und Bruder des Kommandanten Kapella, der von Sepopo ein Jahr zuvor zum Tode verurtheilt wurde, mit seinen Leuten. Sepopo fand nämlich eines Morgens eine Flüssigkeit vor seiner Thüre ausgegossen; er sah dies als Zauberei an und die Feinde Moja’s beschuldigten diesen der That. Da sich der König zufällig um diese Zeit unwohl fühlte, war er von der Schuld Moja’s überzeugt, und so wurde auch dieser verurtheilt; allein Moja zog es vor, sich durch Flucht dem Giftbecher und dem Feuertode zu entziehen, und flüchtete nach Süden zum Könige der östlichen Bamangwato nach Schoschong. Dieser nahm ihn freundlich auf und begriff auch wohl des armen Mannes Heimweh; da er annahm, daß Sepopo ihm eher glauben würde, sandte er Moja mit einem eigenhändigen Begleitschreiben, in welchem die Unschuld des Marutse-Häuptlings nachgewiesen war, zurück. Ich zweifelte daran, daß Sepopo Moja verzeihen würde, und rieth ihm ab, heimzukehren, doch dieser konnte der Sehnsucht nicht widerstehen, seine Frauen, Kinder und seine Heimat wiederzusehen.
Am 24. sandte ich zwei meiner Diener nach dem Zambesi, um die am jenseitigen Ufer wohnenden Masupia’s herüber rufen zu lassen und diese zu bewegen, womöglich Manza, einen Ziegenbock und Kafirkorn nach Leschumo-Thale zu bringen; leider verfehlten die Ausgesandten den Weg und ich sah mich gezwungen, am folgenden Tage zwei andere Diener senden. In den nächsten Tagen kamen Masupia’s von Impalera mit Korn, wobei es mir gelang, einige interessante ethnographische Objecte und einen riesigen Stoßzahn eines Nilpferdes zu erwerben.
Am Abend des 24. beobachtete ich eine äußerst interessante Erscheinung am Himmel. Die Sonne war eben im Untergange begriffen, über ihr und im Süden je ein schmaler Streifen des blauen Firmamentes sichtbar, während am östlichen Horizont ein Gewitter zog, aus dem zahlreiche Blitze niederfuhren. Als eben nur noch ein Segment der Sonne sichtbar war, erschien auf der gegenüberliegenden Stelle etwa fünfundvierzig Grad über dem östlichen Horizont eine feurige Röthe, welche die obere Hälfte eines Regenbogens zu decken schien, so daß nur sein nördlicher Schenkel in Ostnordost, der südliche in Südost zu sehen war. Mit dem vollständigen Untergang der Sonne erblaßte diese Röthe und verschwand dreißig Secunden später, während nun der ganze Regenbogen sichtbar wurde, wobei sich das Roth desselben intensiver zu färben begann, bis endlich ein sehr intensives und prachtvolles Carmin die anderen Regenbogenfarben im Zeitraume von einer Minute vollkommen deckte. Drei Minuten später erblaßte das Roth, um aber nach wenigen Secunden wieder am östlichen Horizont bis zu einer Höhe von etwa zehn Grad über demselben, von den schweren Regenwolken im Hintergrunde sich deutlich abhebend, zwischen den Regenbogenschenkeln zu erscheinen. Nach circa vier Minuten erblaßte die Röthe und die Regenbogenschenkel und eine halbe Stunde später hatte sich das Dunkel der Nacht über das Leschumo-Thal gelagert.
Am 25. erkrankten zwei meiner und einige der Diener Diamond’s an Kehlkopfkatarrh; eine verabreichte Dosis Brechmittel hatte sofortige Besserung zur Folge. Die äußerst ungünstige Witterung hatte auch in meinem Zustande wiederholte Rückfälle zur Folge, deren Heftigkeit ich wohl bald mildern konnte, welche aber stets ein Schwächegefühl zurückließen, das mich völlig arbeitsunfähig machte.
Wenige Tage darauf erkrankten zwei Diener Diamond’s an Typhus. In diese trüben Tage brachte die Jagd einige Abwechslung; auf einer solchen war es dem bereits erwähnten Basuto April gelungen, einen feisten Büffelstier zu erlegen, dessen Fleisch ins Lager geschleppt wurde. Die folgende Nacht gab es nun ein förmliches Fest, es wurde gesungen und getanzt und selbst die kranken Schwarzen sogen gierig an den halbgerösteten Fleischstücken, nachdem sie selbe nicht zu schlucken vermochten.
Am 2. Februar kehrte Diamond von einem zweitägigen Ausfluge an den Zambesi zurück; er war in den dichten Waldpartien, die sich zum unteren Laufe des Leschumo-Flüßchens erstrecken, auf eine Elephantentruppe gestoßen und unter sie gerathen, was ihn so einschüchterte, daß er auch nicht einen Schuß auf dieselben abzufeuern wagte.
Aus Impalera kam mir die Nachricht zu, daß ein Theil von Westbeech’s Elfenbein dahingeschafft worden war, und so konnte ich hoffen, daß Westbeech bald im Leschumo-Thale eintreffen werde. Mir war dies um so erwünschter, da ich mich unmöglich länger mit der dürftigen Kafirkornkost fortbringen konnte. Am 7. kam ein Trupp von etwa dreißig Marutse an, welche als Häscher von Sepopo ausgesendet waren, um — zu meinem grenzenlosen Erstaunen — Moja und Kapella einzufangen; ich vernahm auch, daß die Mehrzahl der in Schescheke und im Masupia-Lande wohnenden Häuptlinge, die den großen Rath bildeten, die vom Könige wegen Hochverrathes etc. Beschuldigten schuldlos sprachen, und sich den häufigen Hinrichtungen widersetzten. Sepopo wollte sich mit einem Schlage dieser Männer entledigen und verurtheilte zwölf der bedeutendsten Häuptlinge zum Tode, darunter Inkambella, Marancian, auch Kapella und Moja. Moja war erst wenige Tage zuvor, wie schon erwähnt, mit einem Briefe Khama’s in Schescheke angelangt; wie mir Westbeech später mittheilte, gab es bei der Ankunft Moja’s einen förmlichen Aufruhr in Schescheke; es war noch nie geschehen, daß ein zum Tode Verurtheilter nach Schescheke zurückgekehrt war. Westbeech, der gerade in seinem Höfchen beschäftigt war, wurde plötzlich in aller Hast zum Könige entboten, er fand den Hofraum Sepopo’s mit Leuten überfüllt. Der König reichte ihm aber sofort einen Brief, der in der Setschuana-Sprache geschrieben und von Khama, dem Könige der östlichen Bamangwato’s unterzeichnet war. Westbeech wurde ersucht, den Inhalt mitzutheilen, Sepopo fühlte sich durch denselben sehr geschmeichelt, ließ sofort von Westbeech einen Brief an Khama schreiben, daß er ihm zu Liebe Moja pardonnire, doch am selben Abend noch gab er Maschoku den Befehl, am folgenden Morgen jene zwölf, darunter auch Moja und Kapella hinzurichten; Maschoku aber, der sich fürchtete, so viele der einflußreichsten Männer zu tödten, erschien in der Nacht an der Hütte Kapella’s und warnte ihn. »Kapella, Du bist verurtheilt, morgen zu sterben!« Kapella wußte genug, weckte seine beiden Frauen und einen in der Hütte nebenan schlafenden Bruder Moja’s, sowie drei seiner zuverlässigsten Diener und seinen jüngsten Knaben und machte sich sofort auf den Weg. Am Flußufer suchte er Westbeech auf und berichtete diesem den Vorfall. Westbeech, der immer in solchen Fällen ein gutes Herz offenbarte, versorgte ihn mit Schießbedarf und anderen Reise-Utensilien.
Kapella nahm zu den zwei nächsten Kähnen seine Zuflucht und rasch glitten die Flüchtlinge stromabwärts im Dunkel der Nacht dahin. Nach Mitternacht waren sie schon circa zwanzig Meilen von Schescheke entfernt, hier ließen sie die Boote flußabwärts treiben und schlugen sich in die schilfigen Moore am Südufer des Zambesi, um die Niederlassung der Masupia’s zu erreichen, welche oberhalb Impalera am Tschobe gelegen, unter der Gerechtsame des Bruders des Masupia-Häuptlings Makumba, eines sehr warmen Anhängers Sepopo’s stand. Hier hofften sie so zeitlich anzukommen, daß sie sich noch vor dem Erwachen der Masupia’s einiger ihrer Boote zur Ueberfahrt über den Tschobe bedienen konnten. Der Gang in den Pfaden, dem hohen Schilf entlang, war im Dunkel der Nacht aus sehr vielen Gründen ein äußerst gefahrvoller und Kapella hätte ihn nie gewagt, wenn es nicht um sein eigenes und das Leben der Seinen gegangen wäre. Alles ging nach Wunsch und die Flüchtlinge langten kurze Zeit nach Tagesanbruch bei der genannten Niederlassung an. Trotzdem waren schon zwei der Masupia’s bei den Booten beschäftigt; bei dem plötzlichen Erscheinen der bewaffneten Gruppe, in welchen sie wohl Flüchtlinge aus Schescheke ahnen mochten, ergriffen die Männer die Flucht, um im Dorfe Lärm zu schlagen, versenkten jedoch, bevor man es ihnen wehren konnte, die beiden Boote. Die Flüchtlinge machten sich sofort an die Arbeit, die kleinen Kähne aus der seichten Bucht an’s Land zu ziehen, sie vom Wasser zu entleeren, und dann so rasch als möglich über den Tschobe zu setzen, was ihnen auch gelang.
Obgleich die beiden Männer ihren Häuptling davon benachrichtigten und Kapella’s Namen nannten, fand es dieser, da er den Commandanten als einen guten Schützen kannte und sich auch nicht zum Häscher hergeben wollte, für angezeigt, die Sache erst morgen zu überlegen; seinen Leuten gegenüber meinte er, daß man das Ganze wohl erwägen müsse, es wurden die Aeltesten des Dorfes zusammengerufen und ihnen die Sache auseinandergelegt. Unterdessen waren viele Stunden verflossen, so daß die Flüchtlinge einen bedeutenden Vorsprung erreicht hatten, als die Verfolger, jene erwähnten Marutse, im Leschumo-Thale erschienen, um nach Kapella und den Seinen zu fahnden. Diese Truppe zog erst in der Nacht auf den 8. wieder ab, sie hatten von ihrem Hauptquartier im Leschumo-Thale aus den Wald ringsum durchsucht.

Wana Wena, der neue König der Marutse.
Westbeechs dunkler Jäger Diamond, der abermals am 6. ausgegangen war, kehrte am folgenden Tage schwerbeladen heim, d. h. seine Diener keuchten unter den Rumpfstücken eines Büffelstieres. Nahe an der Stelle wo er ihn erlegt, ließ er sich von seinen Dienern eine Grashütte errichten, um darin zu übernachten. In der Nacht hörte er nun, daß Raubthiere sich um das Fleisch zu zerren schienen; der alte Diamond war indeß durch häufigen Branntweingenuß nicht mehr der Elephantenjäger früherer Tage und so hielt er sich sicherer in der Hütte. Morgens fand er, daß sich drei Löwen an den Eingeweiden des Thieres gütlich gethan hatten.
In der Nacht auf den 11. kam plötzlich Diamond an den Wagen und berichtete, daß zwei Marutse-Männer mit dem Auftrage angekommen wären, Kapella und Moja einzufangen und sie zu tödten, falls sie in unserem Lager sich versteckt halten sollten. Diese Mittheilung brachte mich derart in Aufregung, daß ich den beiden Marutse durch Diamond befehlen ließ, sich sofort zu entfernen. Zu spät erfuhr ich leider den Irrthum Diamonds, welcher der Sirotsesprache nicht besonders mächtig war. Wie hätte ich es auch ahnen können, da ich die Leute nicht sah, daß mir Diamond gerade das Gegentheil von dem berichte, was ihm die Leute mitgetheilt hatten. Statt Sepopo’s Häscher zu sein, waren es Kapella’s Diener, welche von ihrem Herrn abgesandt waren, um Fleisch von mir zu erbitten.
Der 12. war ein geräuschvoller Tag für das Leschumo-Thal. Vor- und Nachmittag kamen mehrere Masupia-Trupps von Impalera mit Elfenbein und ein Diener Westbeechs mit dem Auftrage von Letzterem, nach Panda ma Tenka zu gehen und Zugthiere für die beiden Wägen zu holen. In der Nacht auf den 14. schlief ich etwas besser und hoffte deshalb etwas zeitlicher aufstehen zu können. Nachdem mich mein Diener Narri nothdürftig angekleidet, setzte ich mich auf den Bock, um die frische, wenn auch ungesunde Morgenluft einzuathmen. Der Gedanke, daß mich Westbeech bald erlösen werde, hatte meine Lebensgeister etwas aufgefrischt. Narri, der eben mit dem Kochen des Kafirkornkaffee’s beschäftigt war, trat heran, und machte mich auf den Laut menschlicher Stimmen aufmerksam, welche aus ziemlicher Entfernung thalabwärts hörbar wurden. Ich rief die Diener herbei, ließ sie lauschen und sie erkannten singende Masupia’s, welche von Impalera mit Westbeechs Elfenbein beladen sich uns näherten. Die drei anderen Diener waren schon wieder zum Feuer zurückgetreten, nur Narri stand noch bei mir, als sich plötzlich etwa dreißig Schritte vor uns eine dunkle Mannesgestalt, ein unbewaffneter Schwarzer erhob und auf mich zusprang. »Irre ich mich, trügt mich das geschwächte Gesicht? Ist es möglich? Doch nein, ich täusche mich. Wie käme mein Freund Kapella, der Commandant des Marutse-Heeres, in diesem Zustande hieher? Doch ja, es ist Kapella, nicht mehr der Führer der Marutse-Schaaren, sondern der Flüchtling.« Ich wollte vom Wagen herabspringen und seine Hände fassen, doch ich hatte nicht die Kraft dazu. Inzwischen hatte er mich erreicht und am Arme ergriffen. »Intate (Freund), ich bin hungrig, stehe mir bei, drüben im Gehölze hungert meine Frau und meine Kinder,« dann unterbrach er sich plötzlich und horchte auf den Gesang der herannahenden Masupia’s, welche jeden Augenblick an der nächsten Waldesecke erscheinen mußten. Die gutmüthigen Züge verzerrten sich in diesem Momente zur Unkenntlichkeit, Todesangst sprach aus ihnen. Ich weiß nicht, ob die Aufregung in dem Momente es ermöglichte, oder das Mitgefühl der Angst mich so stark machte, ich ergriff einen etwa zwei Eimer Korn enthaltenden Sack, der hinter mir im Wagen lag und warf ihn dem Manne in die Arme. Kapella winkte mir mit der Hand, beugte sich nieder und schlich, von den Masupia’s ungesehen, durch das hohe Gras nach dem nahen Walde.
Am 15. zog das schwerste Gewitter, das ich bisher in Afrika beobachtet, über das Leschumo-Thal dahin, es kam so plötzlich, daß meine Diener rasch Sand und Erde auf die Feuer werfen mußten, um die Grashütten vor Brand zu schützen. Der darauf folgende, noch immer vom Sturmwind begleitete Regenschauer drang durch die Wagendecke, so daß ich mit meinen Decken und Reserve-Kleidungstücken die Sammlungen vor einer abermaligen Beschädigung schützen mußte. Das Wagendach schwankte hin und her und die Gewalt des Orkans schüttelte den Wagen, als wäre dieses formidable afrikanische Transportgebäude ein Spielzeug gewesen. Die eine der Grashütten war durch den Orkan umgeworfen, und die andere, in welcher sich die Diener geborgen, eingedrückt worden. Dank dem leichten Materiale desselben hatte ihnen dieser Unfall nicht viel Leid zugefügt. Gegen Abend mußten sich die Diener wieder daran machen, zwei neue Hütten zu errichten, eine für sich und eine für mein Gepäck, da ich den Wagen für Westbeechs Elfenbein frei machen mußte.
Am 16. langte Westbeech im Leschumo-Thale an. Er beklagte sich über die ihm von Sepopo nach meiner Abreise widerfahrene Behandlung und entschloß sich, nicht mehr nach Schescheke zu gehen, sondern die Waaren nur in’s Tschobethal zu bringen und sie hier auszutauschen. Er gab mir die gewünschten Aufschlüsse über die letzten Vorgänge in Schescheke und theilte mir mit, daß die Idee eines Aufstandes und der Vertreibung des Königs bei den Marutse-Mabunda-Häuptlingen immer mehr festen Fuß gefaßt hätte; dazu kam noch folgender Umstand, der dem Könige in den Augen der Untergebenen sehr schadete. Als er nämlich am Tage nach der Flucht Kapella’s die Nachricht davon erhielt, gerieth er so in Zorn, daß er, wie in der Regel, mit dem Kiri auf seine Umgebung losschlug, dann aber rief er laut, daß er ein Zaubermittel bereiten wolle, welches unwiderruflich die Flüchtlinge zurückbringen werde, dasselbe müsse auf sie derartig einwirken, daß sie die Sinne verlieren und in diesem Zustande nach Schescheke zurückkehren müßten, um sich von Maschoku tödten zu lassen. Er ließ einen Ochsen schlachten und sich den Talg vom Herzen überbringen, dann wurden etwa drei Fuß lange Stäbchen herbeigeschafft und dieselben einen Fuß tief vor der Hüttenthüre der Entflohenen in den Boden eingeladen. Diese Stäbchen wurden darauf an ihrem oberen Ende etwas gespalten und ein Stückchen Talg aufgelegt. Es war das erste Mal, daß sich Sepopo so offen vor seinem Volke über seine Zaubermittel und deren Wirkung aussprach, so daß sich nun auch zum ersten Male die Bewohner von Schescheke von diesem Humbug zu überzeugen Gelegenheit hatten.
Die Portugiesen waren von Sepopo noch immer nicht für ihre Waaren bezahlt worden, er vertröstete sie von Woche zu Woche. Auch berichtete mir Westbeech, daß der Dolmetsch Sepopo’s, Jan Mahura, und sein Bruder am nächsten Tage im Leschumo-Thal eintreffen würden, da sie ihres Lebens nicht mehr sicher waren, und der erstere von dem Könige für seine fünfjährigen Dolmetscherdienste eben seinen Lohn erhalten hatte. Westbeech war gezwungen, noch Güter in Schescheke zurückzulassen, auch sollte sein Koch Fabi, ein Halbcast aus der Colonie, nicht mit nach dem Süden ziehen, weil die ihm vom Könige geschenkte Frau, Asserat, mitzugehen sich weigerte.
Am 17., als bereits das gesammte Elfenbein (11080 Pfund) von Schescheke nach dem Leschumo-Thal gebracht worden war, erkrankte mein Diener Elephant an einer Entzündung des Schleimbeutels unter dem Knie, einem Uebel, welches unter den Masupia’s und Matonga’s häufig angetroffen, Tschi Kana Mirumbe genannt, und mit warmen aus Bohnenmehl bereiteten Umschlägen geheilt wird.
Als am 19. Masupia-Männer vom Zambesi und Tschobe Korn, Mais und Kürbisse zum Verkaufe brachten, boten sie den erhaltenen Kaufpreis dem Bruder des Jan Mahura an, welcher ihnen dafür Elephanten-Medicin, d. h. eine solche, die sie in den Stand setzen sollte, Elephanten ohne Schwierigkeit zu tödten, verabreichen mußte. Jan Mahura machte ihnen zu diesem Behufe an den Armen und den Schenkeln seichte und lange Längseinschnitte und rieb ihnen in dieselbe ein schwärzliches Pulver ein, welches die gewünschte Wirkung äußern sollte.
In der Nacht vom 19. auf den 20. waren die Wagen gepackt, nach Mitternacht trafen die Zugthiere ein und wir verließen das Leschumo-Thal, um weiter nach Panda ma Tenka zu ziehen.
Aufbruch nach Süden. — Vlakvark’s. — Lager an den Klamaklenjana-Quellen. — Der Händler Z. — Die Weiher von Tamasanka. — Die Sibanani-Lichtung. — Reiches Thierleben. — Die Mambaschlange. — Ein böses Gewissen. — Menon, der Chef der westlichen Makalaka. — Ein Spion. — Menon hält über Z. Gericht. — Langfingerigkeit und Unreinlichkeit der Makalaka. — Morulabäume. — Z. in Lebensgefahr. — Die Ruinen von Rocky-Schascha. — Pittoreske Landschaftscenerie am Rhamakobanflusse. — Tati. — Goldgräber. — Die Familie Lotriet. — Matabele-Vorposten. — Geschichte des Matabele-Reiches. — Afrika als Löwenjäger. — La Bengula’s Schwester. — Der Leopard im Schlafzimmer Pit Jacob’s.
Südostwärts reisend, gelangten wir noch am selben Tage bis zu Schneemann’s Weiher, wo wir bis zum Abend verblieben. Die Reise durch den Wald, zeitig am Morgen war insoferne angenehm, als der Wald förmlich vom Dufte der schönen weißen, fünfblättrigen Blüthen des Mopondostrauches erfüllt war. Abends brachen wir wieder auf und fuhren die Nacht hindurch, bis wir zu Mittag des nächsten Tages am Rande der Gaschuma-Ebene anlangten; hier mußten wir rasten, da die Regengüsse der letzten Tage die Wiesenlichtungen in Sümpfe verwandelt hatten. Das Gras auf den Ebenen war stellenweise sechs bis sieben Fuß hoch und wurde von den Eingebornen Matimbe genannt. Des hohen Grases wegen sahen wir auch sehr wenig Wild. Während unseres Aufenthaltes an der oberwähnten Stelle kamen sechs Marutse von Schescheke, die uns nachgegangen waren, und brachten meine Büffelhörner, die Westbeech in Schescheke mitzunehmen vergessen, sowie einen fünfundzwanzig Pfund schweren Elephantenzahn mit. Die Leute folgten dem Wagen bis Panda ma Tenka unter dem Vorwande, Zündhölzchen für Sepopo zu erstehen, eigentlich aber in der Absicht, sich zu überzeugen, ob sich Kapella, der Flüchtling, unserem Wagen anschließen würde. Kapella, dem ich nach jenem schon erwähnten denkwürdigen Morgen des 14. Jänner täglich theils aus meinem, theils aus Westbeechs Kornproviant versorgte, hatte bei der Ankunft des Elfenbeinhändlers von Schescheke den Leschumo-Wald verlassen, und war bis zu den Gewässern der Gaschuma-Ebene vorausgegangen. Hier trafen wir ihn mit den Seinen und mit Moja, und unter den Dienern des Flüchtlings erkannte ich einen, der sich während meiner letzten Fahrt von Schescheke nach Impalera durch sein unverschämtes Auftreten hervorgethan hatte. Da die ganze Gesellschaft seit dem Verlassen des Leschumo-Thales kein Wild erlegt hatte, war die Ueberraschung, die uns Bradshaw von Panda ma Tenka aus durch das Zusenden eines Ziegenbockes bereitete, recht erfreulich.
In der folgenden Nacht verließen wir das Tsetsegebiet und gelangten, nachdem wir noch stundenlang mit dem schwer beladenen Wagen an einem der vielen Zuflüsse des Panda ma Tenka-Flüßchens aufgehalten worden waren, noch am selben Tage nach der gleichnamigen Niederlassung. Mein früherer Diener Pit, sowie Bradshaw waren durch das Fieber förmlich zu Skeleten abgemagert.
Am 23. theilte mir Westbeech die unangenehme Nachricht mit, daß seine Zugthiere durch die Tsetse decimirt und er nicht im Stande sei, der bei dem Verkaufe meiner Zugthiere eingegangene Verpflichtung, meinen Wagen nach dem Süden zu bringen, nachzukommen, er ersuchte mich, mein Gepäck auf einem der mit Elfenbein beladenen Wägen unterzubringen. Am 24. kam der Elfenbeinhändler Saddler von Schoschong an, er berichtete von der Strenge, mit welcher König Khama gegen die Einfuhr von Branntwein auftrete und äußerte sich, daß die Leute in Schoschong sich sehr wundern würden, mich zu sehen, da man mich nicht wieder im Süden erwartete.
Am 27. war ich endlich mit dem Packen meiner Sammlungen fertig geworden und so benützte ich gleich den Nachmittag, um sie zu vermehren. Ich erstand auch von Bradshaw eine Sammlung von 1300 Käfern für 20 £ St., dann für Elfenbein, zur Completirung der Sammlungen 40 Vogelbälge von demselben und 63 von Walsh. Am Nachmittage des 28. verließen wir das Thal, und obgleich mir Westbeech auch auf der Rückreise nach Schoschong viele Gefälligkeiten erwies, so wurde mir das Reisen in einem fremden Wagen unangenehm, da meinem Sammeleifer durch den Raummangel bald Halt geboten war. Ich konnte an Orten nur Stunden verweilen, wo ich eine Woche hindurch die lohnendste Arbeit gefunden hätte. Ich gewann dabei die Ueberzeugung, daß Westmatabele allein Jahre lang einen Forscher ununterbrochen beschäftigen könnte.
Als wir am 28. das Panda ma Tenka-Thal hinaufzogen, jagten unsere Hunde zwei Exemplare der Vlakvark-Species auf. Es gab eine Hetzjagd, welche zwanzig Minuten währte und wobei Schwarze und Weiße, die einen mit Gewehren, die anderen mit Assagaien bewaffnet, dem Wilde nachjagten. Obgleich das Vlakvark unter den Wildschweinen die drohendsten Hauer besitzt, ist es doch unserem europäischen Wildschwein gegenüber eine feige Creatur; es besitzt eine staunenswerth dünne Haut, sowie einen weißen Backenbart im Gesichte. Die folgende Nacht hatte ich abermals wenig Rast, denn in Folge der Fahrt über die steinigen Bodenerhebungen zwischen dem Panda ma Tenka- und dem Dejkha-Flüßchen waren die gepackten Sachen so hin- und hergeworfen worden, daß ich Alles neu ordnen mußte. Auf der Fahrt des nächsten Tages, auf der letzten der großen Graslichtungen, welche das sandige Lachenplateau vom Zambesi-Gebiete auf der bereisten Strecke trennt, entdeckte ich, daß alle Wildpfade von zahlreichen wilden Straußenheerden zum »Wechsel« benützt wurden. Wäre ich in meinem Wagen gereist, so hätte ich mich für die nächsten achtundvierzig Stunden in eines der nahen Gehölze gelagert, um diese Thiere nach Herzenslust beobachten zu können.
Am 3. gelangten wir zu Henry’s Pan, jeden Augenblick, den der Wagen hielt, benützend, fand ich auf dieser, sowie auf der Gesammtstrecke bis Schoschong hin so viel Sammelnswerthes, daß ich nur täglich bei der Arbeit sowie während der Fahrt und in der Nacht bei dem Recapituliren des Erlebten stets über den Zeitmangel und das rasche Reisen klagen mußte. Am 3. beobachtete ich Giraffenspuren im Geleise vor uns, es mochten wenigstens zwanzig Thiere gewesen sein, welche hier ihren Weg genommen hatten. Am nächsten Tage erreichten wir die Lachen von Tamasetse und erstaunten nicht wenig, einen Reiter uns entgegenkommen zu sehen; wir erkannten in ihm den Compagnon des dem Leser schon bekannten Elfenbeinhändlers Anderson. Dieser hatte sich zurückgezogen, während der Erstere mit seinen Dienern hier und um Tamasetse herum Strauße jagte. Dieser Mann, mir Namen Webster, theilte mir mit, daß er mit noch zwei Weißen, Herrn Z. und Mayer, den ich dem Leser schon bei der Reise nach Norden an der zweiten Klamaklenjana-Quelle vorgeführt, in der Nähe lagere. Herr Z., ein früherer Händler, hatte diesmal aus einem ganz besonderen Grunde diese Gegenden ausgesucht. Die zoologische Gesellschaft in London hatte nämlich für ein Junges der weißen (grauen) Rhinoceros-Art einen Preis von 500 £ St. loco Capstadt ausgeschrieben und nach diesen gelüstete es dem ehemaligen Händler. Da dieser Abenteurer sich womöglich geringe Auslagen bereiten wollte, hatte er solche Tauschartikel mitgenommen, die im Innern Afrika’s mit geringer Mühe 500 Percent Reingewinn abwarfen. Im Maschona-Lande wäre es ihm am ehesten gelungen, der gesuchten Species habhaft zu werden, doch eines Vergehens wegen, dessen er sich bei einem früheren Besuche des Landes schuldig gemacht, wagte er es nicht wieder, offen das Matabele-Land zu betreten, um von dem Matabele-König den Durchzug nach dem Maschona-Lande zu erbitten. Als er auf seiner Reise gegen den Zambesi nach Schoschong kam, hatte der König Khama erfahren, daß er Brantwein am Wagen als Tauschartikel führe und gebot ihm, sofort nach dem Süden zurückzukehren. Z. wollte sein Ziel nicht so leichten Kaufes aufgeben, angesichts der Haltung Khama’s versprach er zu den am Limpopo weilenden Damara-Emigranten zu gehen und hier das Feuerwasser abzusetzen, doch dies war nur eine List. Er schlug die Richtung nach dem Limpopo, d. h. nach Südsüdost ein, wandte sich jedoch bald nachher vom Wege ab, kehrte in einem spitzen Winkel nach Norden zurück und verfolgte diese eingeschlagene Richtung bis zur Höhe von Schoschong. Das bereiste Land war hie und da bebuscht, was ihm wohl zu statten kam und als er diesen Punkt erreicht, verbarg er hier seine Branntweinfässer und ging denselben Weg zurück, bis er wieder nach Schoschong kam und dem Könige seinen leeren Wagen zeigte. Dieser glaubte dem Manne, obgleich er sich über die rasche Erledigung der ganzen Angelegenheit wunderte.
Z. schlug eine östliche Richtung ein, bis er das erwähnte Versteck erreicht hatte, lud hier die verbotene Fracht wieder auf und zog nach Westmatabele, um nun nach Nordwest, in das sandige Lachenplateau einzubiegen; da er jedoch in Westmatabele den ihm begegnenden Zulu’s den Grund seines Besuches mitzutheilen gezwungen war, so nannte er sich Capitän Y., der die Victoriafälle des Zambesi zu sehen wünsche, und hiezu La Bengula um Erlaubniß bitte. Er suchte dies durch Boten, die er nach Gubuluwajo zum Könige sandte, zu erreichen, durchzog dann Westmatabele und das Makalaka-Land und gelangte nach dem sandigen Lachenplateau, wo er mehrere Monate zubrachte, während welcher Zeit er seine vier Pferde, die er der Jagd halber mitgenommen, verlor. Während dieser Fahrten brachte er bis auf vier Flaschen Spiritus den ganzen Inhalt seiner Fässer an den Mann. Inzwischen wurde Khama durch die herumstreifenden Bamangwato’s sowie die hie und da postirten Masarwa und Madenassana das Thun des Z. berichtet, auch ließ er nachforschen und der Branntweinschmuggel des Letzteren lag klar zu Tage. Auch Z. blieb dies nicht unbekannt, und er fürchtete, daß ihm der Weg nach dem Süden abgeschnitten sei, und in die Hände Khama’s zu fallen, welcher ihm zur Strafe das Gefährt wegnehmen könnte. La Bengula, den Zulu-König, fürchtete er aber noch mehr. In dieser für ihn ziemlich peinlichen Lage — es war ihm indessen auch klar geworden, daß er ein weißes Nashornkalb nicht erwerben könne — konnte ihm die Ankunft unserer Truppe in Tamasetse nur sehr willkommen sein.
Niemand begrüßte denn auch unsere Ankunft freudiger als Z. Wie hatte sich der arme Mayer verändert? Das böse Fieber hatte ihn in wenigen Wochen siech und so elend gemacht, daß ich ihn mit Noth wiedererkennen konnte. Z. fragte mich um Rath für seine fieberkranken Diener. Ich erwiderte, daß ich selbst am Fieber krank, nicht einen Gran von den nöthigen Medicamenten besitze. Das letzte was ich von Bradshaw gekauft, hatte ich Pit, dem einen Wagentreiber und Sohn Jan Mahura’s gereicht. Doch rieth ich Z. an, um den Dienern das lästige Gefühl der Müdigkeit in den Schenkeln zu beheben, Branntwein in die Muskulatur derselben einreiben zu lassen. »Ich habe keinen Branntwein mehr, doch es sind noch vier Flaschen mit Spiritus im Wagen, ich werde diese verwenden.« Doch Z. hatte mit dem Samaritanerwerk keine Eile, er mischte den Inhalt der vier Flaschen mit Wasser und verkaufte den so gebrauten Branntwein an die Mitreisenden für 33 £ St., und als mein armer Freund von dem furchtbaren Genusse umnachtet, nicht mehr seiner Herr war, verkaufte er ihm Wagen und Ochsen, um sie nicht an König Khama zu verlieren. Ich will die unangenehmen Auftritte übergehen, die sich damals während des Aufenthaltes an den Tamasetse-Lachen vor mir entrollten. Z. ging nun nach dem Süden als Gast meines Freundes und in dem tröstlichen Bewußtsein, wenn auch keinen Preis gewonnen, so doch keinen erheblichen Verlust erlitten zu haben.
Am 7. verließen wir Tamasetse und zogen über die Wässer von Tamafopa und Yoruah nach den nördlichsten der Klamaklenjana-Quellen, von welchem sich ein Geleise nach Südost nach dem Makalaka-Lande abzweigt. Hatte ich während unseres Aufenthaltes auf Tamasetse über das Unheil zu klagen, das Z. mit seinem Brantwein angerichtet, so war dies auf der Weiterreise nur noch mehr der Fall. Westbeechs Wagenlenker (an dem Wagen, in dem ich fuhr) war und blieb betrunken, was zur Folge hatte, daß das Gefährt mehrmals daran war, umzuschlagen, zuweilen sah ich mich gezwungen, selbst die Peitsche in die Hand zu nehmen, was meinen Zustand wieder verschlimmerte.
Am 8. gelangten wir zu dem Yoruah-Weiher. Da Bradshaw hier einen Rückfall erlitt, auch zwei andere Wagenlenker, namentlich Diamond, krank wurden, blieben wir hier 1½ Tage, die ich so gut es anging zur Vermehrung meiner Bälgesammlung benützte. Z. erkrankte an Dysenterie, mein Diener Elephant unter ähnlichen Umständen und zwei andere Diener Westbeechs am Fieber. Am 12. gelangten wir zu den Klamaklenjana-Quellen und fuhren von da noch am Abend ab. Ich fand diesmal das Lachenplateau auffallend wildarm und erkannte auch bald den Grund dieser Erscheinung. Die zahllosen weitab im Walde liegenden Lachen hatten sich mit Regenwasser gefüllt, und so war das Wild nicht an die wenigen Quellenweiher gebunden, sondern konnte sich beliebig weit vom Geleise zurückziehen. Am Nachmittage wurde ich vom Fieberschauer niedergeworfen und hatte noch in der Nacht eine arge Beschädigung meiner Sammlungen zu erfahren. Der betrunkene Wagenlenker war einem vorragenden Aste nicht ausgewichen, der die senkrechten Stützsäulen der linken Dachseite rasirte, dabei in den Wagen drang und hier die in den letzten fünf Tagen gesammelten Coleoptera sowie einige ethnographische Objecte theils arg beschädigte, theils vollkommen unbrauchbar machte.
Am 13. gelangten wir nach einer sehr beschwerlichen Tour durch einen tiefsandigen, dichten Niederwald, und nachdem in der Nacht ein Trupp von Nashorne und Elephanten unsere Route gekreuzt hatte, nach einer mit Wassertümpeln versehenen Lichtung, Tamasanka genannt. Die Weiher von Tamasanka trocknen nie aus, ihr Wasser ist rein und beginnt, zwei bis drei Tage im Gefäß ruhig belassen, sich zu verdicken. Westbeech hatte dies erprobt, während mir leider die nöthige Zeit dazu fehlte, denn wir verließen den Ort schon am folgenden Tage. Auf der Nachmittagsfahrt beobachtete ich zum ersten Mal eine Finkenart, die Paradieswitte (Vidua Paradisea), die an der Westküste häufig anzutreffen ist. Auch fand ich auf der Strecke vom Tamasetse Fliegenschnapper, Pirole, kleine grünlich-gescheckte Spechte und die Vidua regia. Im Allgemeinen zeigten sich im sandigen Pool-Plateau alle die Strecken, welche größere Lichtungen enthielten, reicher an Vertretern der Vogelwelt, als die dicht bewaldeten Partien, in welchen man nur kleine, von Regenlachen ausgefüllte Lichtungen antrifft.
Die Weiterfahrt am 15. und 16. wurde etwas mühevoll, da die Wagenspur von Gras vollkommen überwachsen war und wir uns den Weg erst suchen mußten. Unsere Diener fanden am ersten Tage den halb abgenagten Cadaver einer Giraffe, die wohl von Löwen getödtet sein mußte und delectirten sich nicht wenig an der so leicht gewonnenen Beute. Am 16. betraten wir eine von Mapanibäumen bewachsene Ebene, ein Seitenstück zu jener von Maque, welche von schönen und sehr fischreichen Weihern bedeckt war und von den Eingebornen Sibanani-Lichtung genannt wird. Sie bildet den südöstlichen Theil des sandigen Lacheplateaus und gehört den östlichen Bamangwato und den Matabele an. Der Landstrich war unter Moselikatze bis in die Fünfziger Jahre im ausschließlichen Besitz der Matabele, es war ihr westlichster Punkt nach dieser Richtung hin. Die Wachposten wurden jedoch seither eingezogen, da sie steten Löwen-Anfällen ausgesetzt waren und die ihrer Obsorge anvertrauten Viehheerden nicht mehr schützen konnten. Der Wald in der Sibanani-Lichtung ist nur am Rande der Weiher dicht, welche mir in dem ursprünglichen Bette eines Flusses, dessen Wasser schon vor mehreren Jahrhunderten versiegt sein mögen, zu liegen schienen.
Der geringeren Dichte des Waldes halber ist die Sibanani-Lichtung für die Jäger von besonderem Interesse; alle Wildarten, von der Deukergazelle bis zum Elephanten, sind hier anzutreffen. Der Ornithologe findet die Vögel des sandigen Lachenplateaus mit interessanten Formen von Sumpf- und Schwimmvögeln in Menge vor. In Folge dessen sind auch Tag- wie Nacht-Raubvögel in vielen Species vertreten, an den zahlreichen feuchten Partien erstreckt sich ein wahrer Blumenteppich, der Tummelplatz der zahlreichen Colibris und Bienenfänger, während man an den das Wasser überhängenden Aesten bald den kleinen, oben azurblauen und durch einen Schopf ausgezeichneten Alcedo Cristata, bald eine zweite Art, den Halcyon Swansonii, doch auch den weißschwarz-gescheckten Ceryle Rudis erspäht. Ich will noch des Riesenreihers (Ardea Goliath), und des schönsten aller Gänschen, der Nettapus Madagascariensis gedenken, blos zwölf bis vierzehn Zoll lang erscheint das Thierchen, oben glänzend schwarzgrün, unten weißlich mit Ausnahme der Brust und Seiten, welche sich rostfärbig präsentiren, die Wangen, Stirn und die Kehle sind weiß, der Kopf dunkelschwarzgrün, welche Farbe sich bis nach dem Halse hinzieht und hier beiderseits einen hellgrünen Fleck umsäumt.
Zwei Umstände machen indeß den Aufenthalt an dem Sibanani-Weiher weniger angenehm, als ihn der Forscher sonst unter den obgenannten Umständen finden würde. Es ist erstlich gegen das Ende des Sommers die ungesunde Ausdünstung einiger der seichteren Weiher und zweitens die gelbe Mambaschlange, von der ich schon berichtete, daß sie in der Regel in dem dichten Geäste zweier, einen Wildpfad überhängenden Bäume auf der Lauer liegt. Westbeech berichtete mir, daß in trockenen Wintern die fischreichen Weiher so wasserarm werden, daß man die Fische, unter denen ein Glanis am häufigsten vorkommt, mit den Händen fangen könne. Hier hörte ich auch zum ersten Mal wieder nach vielen Monaten den Silberschakal (Canis mesomelas) und ich fand meine Vermuthung, daß die Sibanani-Lichtung eine der tiefsten Partien des sandigen Lachenplateaus sei, auch dadurch bestätigt, daß ich zahlreiche Pflanzenspecies mit denen des Salzseebeckens identisch fand. Ich konnte erst wieder hier, seitdem ich die Zambesi-Zuflüsse verlassen, schöne Fächerpalmen-Gebüsche beobachten. Die Mitreisenden machten sich, von ihren Dienern begleitet, an die nächst anliegenden Weiher, um unseren Tisch mit Wildgeflügel zu versorgen, leider mit geringem Erfolge. Im Winter soll es hier noch bedeutend mehr Wild geben, allein schon gegenwärtig fand ich zahlreiche frische Wildspuren, welche unseren Weg kreuzten und unter welchen ich auch jene des schwarzen Nashorns bemerkte.
Am 18. brachen wir wieder auf und gelangten nach einem längeren Marsche in das Thal des Nataflusses, zogen das Thal entlang, und überschritten ihn sodann. Der Fluß hat hier den Charakter eines sandigen, nur stellenweise kleine Lachen enthaltenden Spruits. An seinen Ufern, welche mit sechs bis sieben Fuß hohem Grase dicht bewachsen waren, fanden sich stellenweise tiefe, zur Zeit der Ueberschwemmungen gefüllte Lachen, ein Charakteristicon vieler südafrikanischer Flüsse, namentlich aber des Limpopo-Systems. Am Nachmittage ging es weiter nach Südost, dem Makalaka-Lande zu; unser Weg führte durch einen dichten Mapaniwald. Da Westbeech der erste war, der vor vier Jahren diese Route befuhr, die nun vom Makalaka-Lande über den Majtenque und Nata das Matabele-Land mit den Tschobe-Zambesi-Gegenden verbindet, so erlaubte ich mir, das genannte Geleise »The Westbeech Road« zu nennen. Am Abend gelangten wir auf eine mehrseitig von Gehölzen begrenzte Grasebene, in der sich der aus dem Makalaka-Lande fließende Majtenque-River im Boden verlieren soll.
Am 19. hatten wir sehr viele tiefe, wenn auch schmale, trockene Regenmulden zu passiren, welche zu dem genannten Flusse führen, der gegen seine Mündung schmäler und seichter erscheint und dessen Ufer von Fanggruben förmlich durchwühlt sind. Der Majtenque ist ein sandiger Fluß, der hunderte von Bergflüßchen aufnimmt, die jedoch nur äußerst kurze Zeit hindurch fließen, so daß nicht immer dieser Abfluß seine Mündung erreicht, sondern sich namentlich in dem letzten Drittel seines breiten Inselbettes verliert. Der größte Theil seines Gebietes liegt in dem schönen Gebirgslande, welches von den westlichen (Menons) Makalaka’s bewohnt wird. Da sich der Zustand Westbeechs nicht besserte, übernahm ich ihn in meine Behandlung. Am 20. erkrankte auch Dr. Bradshaw an Dysenterie. Wir zogen den ganzen Tag das Thal aufwärts am rechten Ufer des Flusses dahin. Seitdem wir das Panda ma Tenka-Thal verlassen hatten, gab es sehr warme Tage, namentlich die Spät-Nachmittage waren ungemein schwül, dagegen waren die Nächte kalt. Am Vormittage des 21. überschritten wir den Majtenque. Kurz zuvor zeigte man mir einen hohen Mapanibaum, unter welchem einer der Makalaka-Häuptlinge begraben liegt. Der Baum war hohl und genoß noch aus einem zweiten Grunde einen gewissen Grad von Verehrung. Die Makalaka’s glaubten, daß in ihm, doch weniger oft wie in einer der Felsenhöhlen in ihrem Gebirge, ihr Morimo oder der unsichtbare Gott wohne und während sie alljährig in die Felsenhöhle Geschenke brachten, warfen Vorübergehende als Zeichen der Hochachtung ihre Armspangen etc. in die Höhlung des genannten Baumes.
Je weiter wir zogen, desto merklicher erhob sich das Land. Kleine Granithügel erhoben sich vor uns, ohne uns indeß die Aussicht auf die Kuppen der eigentlichen Makalaka-Höhen im Hintergrunde zu benehmen. Bei dem ersten namhafteren Hügel trennte sich Westbeech, um mit Bradshaw, Menon, den Makalaka-Häuptling aufzusuchen und von diesem einige Begleiter nach dem Matabele-Lande zu erhalten, in dessen westlichster Provinz wir uns eben befanden. Westbeech ging seinen in der Residenz des Matabele-Königs wohnenden Compagnon Philips aufsuchen, um ihn, der gemeinschaftlichen Abrechnung halber, zur Reise nach Schoschong zu bewegen. Da Westbeech wegen seiner Gunst beim Könige unter den Makalaka’s geachtet war, entsprach man seinem Ansuchen sofort. Abends erschien auch Menon, um den Elfenbeinhändler mit seinem Gegenbesuche zu beehren. Seitdem wir im Majtenque-Thal nach aufwärts zu reisen begannen, zeigte Z. eine auffallende Unruhe, sowohl während der Fahrt als auch während der Raststunden war er stets wie auf der Wache, er lugte nach allen Seiten aus und glaubte stets Makalaka’s zu sehen. Oft stand er neben mir mit verstörten Zügen am Bocke. »Haben Sie den Schrei gehört, der eben durch den Wald drang? Sahen Sie nicht eben einen Makalaka hinter jenen Dornenbäumen verschwinden?« Da ihm Westbeech seine betrügerische Handlungsweise vorhielt, und man ihm überhaupt von Seite meiner Reisegefährten nicht freundlich entgegenkam, flüchtete er sich zu mir. Saßen wir in der Nacht am Feuer, so war er in der Regel an meiner Seite. Doch litt es ihn nicht lange an einer Stelle, wiederholt stand er auf, und suchte mit seinem unsteten Blick das Dunkel zu durchdringen. Der Zug in das Makalaka-Land schien Z. mit wahrer Furcht zu erfüllen, dies veranlaßte mich, nach dem Grunde seines Betragens zu fahnden. »Ja,« meinte er, nachdem er mir lange genug, ausweichend geantwortet, »so ein kleiner Zufall hat sich während meines Besuches im Innern ereignet; als wir von einer Elephantenjagd heimkehrten und auf einen Pfad im Walde entlang gingen, einer hinter dem Andern folgend, entlud sich ganz zufällig das Gewehr eines meiner Diener, und einer der Leute Menon’s wurde dabei getödtet; es kann nun leicht geschehen, daß Menon denkt, ich habe den Makalaka erschossen.«
Als er nun hörte, daß wir uns nahe an Menon’s Dorfe befanden, erreichte seine Unruhe den höchsten Grad. Er folgte den Wägen und war nicht eher zu sehen, als bis Menon von seinem abendlichen Besuche wieder heimgekehrt war. Menon ist von Mittelgröße, etwa fünfzig Jahre alt, hager, ein Tartüffe ohne Gleichen, mit ihm fanden sich zugleich einige Makalaka’s ein, von denen keiner ein ehrliches Gesicht hatte. Diese von mir — um sie von den nördlich vom Zambesi wohnenden Bruderstämmen zu unterscheiden — die Süd-Zambesi und westlichen, nach ihrem Häuptlinge Menon’s genannten Makalaka sind mit ihren südlichen Brüdern seit dem Jahre 1837 Unterthanen der Matabele-Zulu geworden. Sie waren friedliche Ackerbauer und Viehzüchter, sind gegenwärtig das erstere nur mehr in einem geringen Grade geblieben und nebstbei die unzuverlässigsten Leute und die größten Diebe in Südafrika. All’ dies haben ihre Herren, die Zulu-Matabele auf ihrem Gewissen.
Während seine Begleiter sich an’s Feuer niederhockten, blieb Menon in eine schäbige Gepardcarosse gehüllt, stehen, um uns einen nach dem andern zu mustern. Er schien von dieser Revue nicht befriedigt zu sein und suchte nach Z., denn der Unfall war ihm von den Z. entlaufenen Genossen des Erschossenen berichtet und er zugleich von der Anwesenheit des weißen Mannes, der uns am Nataflusse traf, durch einen seiner Spione unterrichtet worden. Seinem Unmuthe darüber machte er dadurch Luft, daß er von mir und Walsh, die wir zum erstenmale sein Land betraten, einen Durchzugszoll begehrte. Da außer Westbeech Niemand die Makalaka-Sprache verstand, und dieser uns ruhig zu bleiben bedeutete, ohne von Menon Notiz zu nehmen, so ließ dieser auch von seiner Bettelei ab, ja in wenigen Minuten hatte sich das Blatt gewendet. Von Westbeech an die Pflichten der Gastfreundschaft gemahnt, versprach Menon eine Ziege zu senden. Er entschuldigte sich, daß er kein Rind senden könne, da die Matabele seine gesammten Rinder geraubt hätten. Diese Gefälligkeit Menon’s wurde von unserer Seite durch Geschenke an Blei und Schießpulver erwidert, welche auch freundlichst entgegengenommen wurden. Als sich der Häuptling verabschiedet hatte, war nur noch einer seiner Leute zurückgeblieben, anscheinend eine untergeordnete Creatur, die sich am Feuer der Diener niederließ. Mir fiel der Mann durch sein scheues Benehmen auf, und ich beobachtete ihn um so schärfer. Anscheinend sich wärmend, warf der Mann oft den Kopf nach den einzelnen Wägen zurück. Bei einer dieser Bewegungen hielt er den Kopf längere Zeit vom Feuer abgewandt, um darauf das letztere in auffallender Weise zu schüren. Was konnte er gesehen haben? Ich blicke mich um, einige Schritte hinter mir stand Z.; nun war mir auch das ganze Benehmen des als Spion zurückgelassenen Makalaka’s klar. Z.’s Züge waren mehr denn je verstört. Nachdem ich mein Erstaunen über sein Fernbleiben geäußert, entschuldigte er sich damit, daß er sich in einen Busch niedergelegt und dabei eingeschlafen und erst vor Kurzem erwacht sei. »Menon war hier am Wagen, hat wohl nach mir gefragt?« Auf die Anspielung auf den ihm widerfahrenen sogenannten Unfall brauste er auf und schalt Menon einen Lügner.
Der Makalaka am Feuer, der von Z. nicht beachtet worden war, da er für einen unserer Diener gehalten werden konnte, hatte das Gespräch belauscht, erhob sich unauffällig und entfernte sich. »Seht, das war einer von Menon’s Spionen!« sagte ich. Z. sprang auf, ballte die Faust, doch dem Manne nachzusetzen, fehlte ihm der Muth. Wir begaben uns zur Ruhe, jeder in seinen Wagen. Nochmals nahm ich wahr, wie mein Nachbar ängstlich nach dem Feuer auslugte, er mochte wohl einen Ueberfall befürchten.
Während seines Besuches hatte Menon sechs Begleiter bei sich, von welchen zwei mit Assagaien und vier mit Kiris bewaffnet waren, einzelne Makalaka’s trugen auch Musketen; unter den Frauen trugen einige kurze, über und über mit weißen und violetten Glasperlen geschmückte Lederröckchen. Ich erstand von ihnen einige Handarbeiten, welche jedoch weniger gut als die unbedeutenderen Produkte der Betschuana gearbeitet waren. Die bereiste Strecke im Majtenque-Thale, scheint, für die Zukunft ein Eldorado versprechen zu wollen; die bewaldeten Höhen ein vortreffliches Weideland zu liefern. Für einen Botaniker und Ornithologen ist die Reise durch das Makalaka-Land eine wahre Herzensfreude; leider ist sein Forschen in Folge des Charakters des Eingebornenstammes ununterbrochen behindert und in hohem Maße beschränkt.
Am 22. ging es weiter, nachdem Westbeech mit einem berittenen Diener und einigen Makalaka’s zu Fuß die Reise nach Osten nach der Hauptstadt des Landes Gubuluwajo angetreten. Wir anderen legten nur drei Meilen zurück und hielten unter einem Morulabaume Rast, um hier Korn und Melonen zu erhandeln, und womöglich auch die versprochene Ziege von Menon zu erwarten. Wir fanden unter dem Baume schon die Makalaka’s versammelt. Von den Aeltesten in einem Kreise umgeben, harrte bereits Menon unser. Das Ganze sollte den Anstrich einer Feierlichkeit haben, thatsächlich aber war es eine Gerichtssitzung, wobei unserem Begleiter Z. die Rolle des Angeklagten zufiel. Menon hatte Z. mit Mahura als Dolmetsch vorladen lassen, und die Verhandlung wurde in der Setschuana geführt. Das Interessanteste daran war wohl die Begründung des Urtheils von Seite Menon’s. Er sagte: »Ob er von den Weißen erschossen wurde oder nicht, ob Dein Gewehr, da Du hinter ihm schrittest, zufällig losging oder nicht — das ist Alles gleichgiltig, Du mußt seiner Frau und seinen Angehörigen zahlen und mir auch, da ich dadurch einen meiner Arbeiter, d. h. Unterthanen eingebüßt habe.«
Z., dem es im Kreise der Makalaka etwas zu unheimlich wurde — er zitterte, daß er kaum sprechen konnte, und sein Gesicht war glühendroth — betheuerte seine Unschuld in geläufiger Rede, Mahura fand kaum Zeit, ihm zu antworten und sprach endlich, da er nur zu deutlich sah, daß sich sein Client selbst schadete, nach seinem Gutdünken und mit solchem Erfolge, daß Menon trotz des Wehklagens von Seite der Verwandten des Getödteten die Zahlung respective Verabreichung eines färbigen Wollhemdes, einer Wolldecke und sieben Sacktüchern an Stelle der ursprünglich bestimmten Muskete, Schießbedarf und Wolldecken festsetzte. Der erstgenannte Gegenstand fiel ihm als »Schiedsrichter« zu. Nachdem dieser erlauchte Gesetzgeber das Hemd empfangen, verabschiedete er sich, doch kam er bald wieder, denn die Verwandten machten Z. die Hölle heiß, sie beschimpften ihn, nannten ihn Mörder und warfen ihm die Decke und Sacktücher vor die Füße. Menon suchte zu schlichten, da trat jedoch wieder Mahura als rettender Engel dazwischen, indem er Z. zuflüsterte: »Reiche die zurückgewiesenen Artikel dem Häuptling als Geschenk, er nimmt sie an und Du hast Dir einen tüchtigen Bundesgenossen geschaffen.« Z. folgte; Menon nahm die Sachen an, blies sich auf, um den Seinen noch mehr zu imponiren und die Sache war beglichen.
So geschickt im Marutse-Reiche die Masupia als Gaukler sind, so sind es die Makalaka als Langfinger. Mir ist ein Fall von einem Elfenbeinhändler bekannt, der den Leser wohl interessiren könnte. Ein Händler kaufte von Makalaka’s einen Elephantenzahn und legte diesen in seinen Wagen. Es währte nicht lange, und die Makalaka’s brachten einen zweiten, doch konnte der Mann diesen nicht mehr so leicht erstehen, der gefordert Preis war so hoch, daß er ihn nicht nehmen wollte, worauf die Verkäufer den Zahn zur Erde warfen und den Händler einluden, sich von dem großen Gewichte desselben zu überzeugen. Dieser that es und unterdessen wurde ihm der erste Zahn aus dem rückwärtigen Theile des Wagens gestohlen. Endlich gaben die Verkäufer nach und dies um so mehr, weil sie den Weißen auf einen dritten Zahn aufmerksam machten, den eben einige von der Seite herbeitrugen. Sie schienen es eilig zu haben und so kaufte der Händler auch den dritten. Nach dem Kaufe verschwanden die Makalaka’s auffallend rasch im Walde. Unser Mann, der mit dem Gewinne bei dem Kaufe zufrieden war, wollte sich nun die Waare noch einmal besehen. Doch zu seinem Schrecken war der Zahn verschwunden und auch die Makalaka’s — der Händler hatte drei Stück Elfenbein gekauft und nur zwei erhalten.
Der Verkauf von Elfenbein geschieht jedoch nur im Geheimen, da die Makalaka’s alles Erbeutete an den Makalaka-König abliefern müssen. Die Makalaka’s nähern sich dem Reisenden gewöhnlich in Haufen, während die Einen ihn zu beschäftigen suchen, trachten die Andern ihr diebisches Handwerk auszuführen; man kann sagen, daß alles, was nicht mit Ketten und Schrauben an den Wagen befestigt ist, während der Reise durch dieses Territorium von seinen sauberen Insassen gestohlen wird. Sie lernten dies von den Matabele, oder wurden von denselben dazu angestiftet und gezwungen. Es ist nöthig, sich stets diese Langfinger einige Schritte vom Leibe zu halten und auf jeder Wagenseite wenigstens einen Diener als Wache aufzustellen, diesem auch wohl einzuschärfen, sich mit den Makalaka’s in kein Gespräch einzulassen. Wird in dieser Weise den Leuten keine Gelegenheit zum Stehlen gegeben oder sie in flagranti ertappt und zur Rede gestellt, so kann man sich für einige Zeit vor weiteren Angriffen und Belästigungen sicher fühlen, denn die verunglückten Diebe gehen heim und berichten, daß der Weiße eine gute Medicin habe (Beschwörungsmittel mit dem er den Diebstahl wahrnimmt), und daß es nichts nütze, etwas zu nehmen, er sehe Alles, auch wenn er beschäftigt sei.
Nebst dem genannten Laster sind die Südzambesi-Makalaka’s und namentlich die südlichen und westlichen (d. i. die unter dem Matabele-Scepter stehenden), noch durch eine nicht zu beschreibende, beispiellose Unreinlichkeit berüchtigt. Ich glaube, daß sich die meisten Leute im Makalakalande, mit Ausnahme jener die als Diener unter den Weißen gelebt, Jahre lang nicht waschen; ich sah Frauen mit Glasperlensträngen im Gewichte von mehreren Pfunden behangen und belastet und ich mußte annehmen, daß die untersten dieser Rosenkränze am Leibe klebten. Seitdem die Matabele die Herren der Makalaka’s geworden, ist auch das Bauwesen unter dem letztgenannten Stamme so in Verfall gekommen, daß die meisten ihrer kleinen Dörfer ruinenartig aussehen. Die einzige Tugend der Makalaka’s ist neben der Arbeitsamkeit eines guten Theiles dieses mehr denn decimirten Volkes dessen strenge Sittlichkeit, welche unter allen anderen südafrikanischen Stämmen nicht ihres Gleichen findet.
Nachmittags zogen wir weiter durch einen Niederwald, aus dem überall um uns zwanzig bis siebzig Fuß hohe, pyramidenförmige, kegel- und kegelstutzförmige Granithügel, zuweilen aneinander gereiht emporstiegen. Je weiter wir am Ufer des Majtenque nach aufwärts zogen, desto höher, anmuthiger und großartiger gestaltete sich diese Scenerie, hie und da im Walde machten sich die schon mehrmals erwähnten Morulabäume bemerkbar, welche mit einem Zaune, der etwa drei bis vier Meter von dem Stamme abstand, umgeben waren, da sie eben reife Früchte trugen. Diese fielen ab und um zu verhüten, daß sie nicht vom Wilde verzehrt wurden, hatte man die Stämme umzäunt. Jede Familie hatte je nach der Einwohnerzahl des Dorfes einen oder mehrere Bäume als ihr Eigenthum erklärt. Aus dem Fruchtfleische wird ein Bier zubereitet, welches ciderartig schmeckt und auch der in eine harte Schale eingeschlossene Kern wird benützt (ich glaube, daß er zerstoßen und das gewonnene Mehl zu Brei bereitet wird).
Auf unserem Marsche näherten wir uns mehrmals dem Majtenque, oft bot sein Thal eine höchst anmuthige Scenerie. Während der Fahrt am 22. war ich Zeuge eines Beweises rührender Kindesliebe bei einem Schwarzen, der seiner hochbetagten Mutter begegnete. Von Diamond erfuhr ich gleichfalls eine Episode aus seinem bewegten Leben, die mir den Beweis lieferte, daß trotz des sonst verwilderten Zustandes der Eingebornen bessere Regungen in der Brust manches unter ihnen leben und für ihre Empfänglichkeit für Civilisation sprechen.[16] Nachmittags lagerten wir in der Nähe mehrerer Dörfer und hörten hier, daß wenige Tage vor unserer Ankunft eine Truppe von Matabele-Kriegern Menon und die westlichen Dörfer am Majtenque abgesucht hatte, um Knaben als Tribut zu fordern und mit ihnen das jüngste Regiment zu completiren. Menon hatte dies verweigert, und nun glaubte man allgemein, daß ihm diese Verweigerung das Leben kosten werde, denn obgleich die Makalaka’s viele Gewehre besaßen, so reichte doch ein Regiment der Zulu-Matabele hin, die in kleinen Dörfern zerstreut wohnenden Makalaka’s zu vernichten. In dieser Weise war es Moselikatze und seinen vierzig Kriegern möglich, seit dem Jahre 1837 ein Reich zu gründen, das gegenwärtig über 20000 Krieger zählt, doch geschah es zumeist unter Anwendung der rohesten Gewalt, nachdem die Väter getödtet und die Mütter geraubt worden waren.
Auch am folgenden Tage führte der Weg zwischen zahllosen Granitkuppen hindurch, jede tausend Schritte bot sich dem Auge ein neues anmuthiges Bild dar. An unserem ersten Ausspannplatze trafen wir einen Unterhäuptling mit Namen Henry, einen alten Bekannten Westbeechs, von dem Bradshaw für letzteren und seine Diener Sorghum, Mais und Melonen erstand. Henry hielt seine Leute in ziemlicher Ordnung, so daß wir wenigstens in seiner Gegenwart nicht erheblich belästigt wurden. Doch wurde unser Aufenthalt durch das plötzliche Erscheinen eines jener zahlreichen, die Makalaka’s erstickenden Blutsauger, eines Matabele-Kriegers gestört. »Halloh, Ihr Weißen, Ihr habt Sepopo’s Leute mit Euch als Diener. Wenn Ihr nicht zahlt, tödte ich sie Alle, einen nach dem Andern,« rief er uns zu. Um seinen Worten den nöthigen Nachdruck zu geben, schwang er mit der Rechten einen mächtigen Kiri, mit der Linken sein Gewehr. Trotzdem er mir einmal mit dem Kiri bis unter die Nase kam und ich in mir das Blut kochen fühlte, blieb ich ruhig. Da zog der tapfere Kämpe ab und die Makalaka ringsum belachten seine eitle Prahlerei aus vollem Halse. Nun kam er an Walsh und Bradshaw, doch da sich diese an ihren Gewehren zu schaffen machten, nahm er dies als eine Herausforderung an und geberdete sich noch wüthender, bis jene auf ihn losgingen, worauf er sich von dem ununterbrochenen Gelächter der Umsitzenden begleitet, zurückzog.
Auf der Nachmittagsfahrt eröffneten sich uns neue Gebirgsscenerien, die Höhen mit denselben schönen armleuchterförmigen Wolfsmilchbaume bewachsen, wie ich ihn an den Bamangwato-Bergen beobachtet. Die Felder, die wir sahen, waren von beträchtlichem Umfange, ebenso die Gehöfte, welche umzäunt waren und an deren hervorragenden Punkten die Wohnungen des Besitzers standen. Die Umzäunung zeigte von achtzig zu achtzig Meter eine einfache hölzerne Schlagfalle und bildete im Ganzen noch ein Ueberbleibsel dessen, was die zahllosen Makalaka-Dörfer und Gehöfte vor dem Einzuge der Matabele in die Matopo-Gebirge gewesen waren.
Das am Morgen durchzogene Dorf Henry’s hieß Katheme; Abends langten wir an einem zweiten Dorfe mit Namen Bosi-mapani an, und am folgenden Tage erreichten wir eine andere der zahlreichen Niederlassungen der Makalaka’s. Hier waren wir, obgleich eine halbe Meile weit von der Niederlassung im Walde ausspannend, bald von einigen kleinen Trupps, zusammen an sechzig Köpfe zählend, belagert. Man bot uns eine Ziege und zwei Schafe zum Kaufe an. Bradshaw kaufte sie; leider waren in diesem Momente die Diener bei den Wägen postirt und mußten diese im Auge behalten, damit uns nichts gestohlen werde. Einer seiner Diener hatte Mühe, die im Walde etwa fünfzig Schritte vor uns gehenden Thiere heranzuteiben. Bevor er sie noch erreicht hatte, stoben die drei Stücke wie auf ein gegebenes Kommando auseinander. Die Thiere gehörten verschiedenen Heerden an. Diese werden von Hirtenjungen geführt, welche ihre Thiere mit Pfeifen lenken. Kaum waren die Thiere verkauft, als auch schon der Plan der Verkäufer fertig war, dieselben ebenso rasch wieder an sich zu bringen. Sie hatten zu diesem Zwecke die drei Hirtenjungen herbeigerufen, die auf ein gegebenes Zeichen jeder seine eigene Weise anstimmte und die Ziegen weglockten. Der ausgesandte Junge lief einem der Schafe nach und holte es ein, doch bevor er es zurückbrachte und festknüpfte, war das andere und die Ziege entlaufen. Nun wurden mit Androhung La Bengula’s die Makalaka’s, nachdem sie noch Westbeech’s Taschenmesser mit sich genommen, zur Heimkehr gezwungen. Die Thiere aber waren und blieben verschwunden.
Am 25. hatten wir uns vom Flusse Majtenque etwas entfernt, so daß die meisten Kuppen uns zur Linken zu liegen kamen. Größere und ganze Höhenrücken erhoben sich jedoch am südlichen Horizont in der Richtung unserer Fahrt. Die öfteren Besuche der Matabele-Krieger an unserem Wagen schienen auf Z. einen unangenehmen Eindruck auszuüben. Er scheute sie noch mehr als die Makalaka und kroch gewöhnlich in seinen Wagen, so wie sich einer der Zulukrieger sehen ließ. Ohne von den Matabele erkannt worden zu sein, wäre er doch während unserer diesmaligen Mittagsrast von zwei Matabele erschlagen worden, wenn Bradshaw und ich ihm im rechten Augenblicke nicht beigestanden wären und sich später ein herzugekommener alter Matabele in’s Mittel gelegt hätte. Die beiden Friedensstörer waren zwei Matabele-Jünglinge, welche den Kopf mit dem bekannten Federschmucke geziert, ihre Hüften von Günsterkatzen-Schwänzen umhüllt, an den Wagen um eine Lapiana (Lappen) zu betteln gekommen waren. Z. hatte einen kleinen Hund, der dem einen der beiden Matabele bellend entgegensprang. Dieser holte sogleich aus und hätte auf ein Haar dem kleinen Thiere den Kopf zerschmettert und fuhr auch sofort, als Z. die Hand schirmend über das Thier ausstreckte, denselben barsch an, womit der Streit begann. Dem leicht erregbaren weißen Manne stieg die Zornesröthe in’s Gesicht und er antwortete nicht allein im heftigen Tone, sondern ließ sich zu einer drohenden Handbewegung hinreißen. Dies war aber eben, was die beiden Strolche wünschten, denn im selben Momente hob der eine seinen Kiri zum Schlage nach dem Kopfe des Händlers und wurde nur durch unser Dazwischentreten von der Ausführung seines Vorhabens abgehalten. Da wir jedoch die mitgenommenen Gewehre wieder in den Wagen zurücklegten, fingen jene wieder zu schimpfen an und schlugen ihre Kiris wuthschäumend gegen den Boden. Durch den Lärm angelockt, erschien bald darauf ein alter Matabele-Krieger, dessen Kopf die bekannte Auszeichnung seines Standes, der mit einem Haarkreise verwachsene Lederring, zierte. Von Z. über den Vorfall unterrichtet, ergriff er einen Zweig und schlug damit auf die beiden Angreifer, ähnlich wie man zwei kleine Jungen züchtigen würde, worauf sich die beiden Jünglinge grollend zurückzogen.
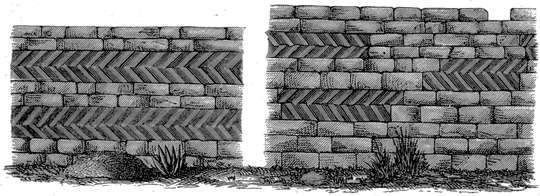
Ruinen von Tati.
Am Nachmittage gelangten wir zu dem aus etwa fünfzehn Hütten bestehenden Makalaka-Dorfe Kambusa genannt. Es gehörte Jantschi an, den Westbeech wohl kannte und von dem wir keine Belästigung zu fürchten hatten. Sein Gehöft hatte eine doppelte Umzäunung. Eine aus Pfählen erbaute Umfriedung der Wohnungen und eine aus Dornengebüsch für die das Gehöfte in einem Kreise umgebenden Felder. Mit Kambusa schieden wir von den Makalaka-Dörfern und hatten nur noch eine kurze Strecke durch die gegenwärtige Makalaka-Provinz des Matabele-Landes zu reisen, während sich noch vor fünfundvierzig Jahren das Makalakagebiet um hundert englische Meilen südlicher erstreckte. Gegen Abend überschritten wir die gegenwärtige Grenze. Diamond machte mich auf ein etwa sechshundert Schritte vom Wege, am Ufer des Flüßchens Aschangana stehendes Gebüsch aufmerksam, unter welchem ein Weißer begraben lag. Es war Mr. Oats, ein Engländer, welcher der Jagd halber in diese Gegend gekommen war, am Fieber erkrankte und starb. Bradshaw und Diamond reisten mit ihm zu gleicher Zeit nach dem Süden; da er jedoch im Makalaka-Lande starb, so durfte er hier nicht beerdigt werden, sondern erst an der Grenze. Im Jahre 1874 errichtete des Verstorbenen Bruder hier einen Grabstein.
Bevor wir Jantsche verließen, versorgte ich mich auf einige Tage mit Wassermelonen, die ich für Glasperlen erstand. Zu den Feldfrüchten, welche die Makalaka’s bauen, gehören zwei Species der Wassermelonen, welche sehr zuckerhältig sind.
Am 26. März überschritten wir zwei Flüßchen, bevor wir den ebenfalls quer unsere Richtung schneidenden Matloutsi kreuzten. Während der Fahrt der letzten Tage durch das Makalaka-Land hatten wir siebzehn Regenflüßchen überschritten, welche Zuflüsse des Majtenque waren und nach meiner Meinung kaum den zehnten Theil der Zuflüsse desselben darstellten. Die durchreiste Strecke bot die schönsten Scenerien, die ich auf meiner eiligen Reise durch das Makalaka-Land beobachten konnte. Die Formation des Bodens bestand meist aus Granit mit starken Quarzadern durchschossen, an vielen Stellen von einem dunkelschieferblauen Glimmerschiefer in verticalen, horizontalen und schiefen Lagen bedeckt. An der Spitze der Höhen waren diese Schichten meist in schiefen Lagen in einem Winkel von siebzig Grad und südwestlich streichend gelagert. Das Interessanteste jedoch, was ich auf der durchreisten Strecke beobachten konnte, waren die steil sich aus hochbegrasten stellenweise bebuschten Auen erhebenden, oder kegelförmige Höhen krönenden pittoresken Granitmassen. Den Formen entsprechend, erlaubte ich mir, einzelne mit folgenden Namen zu belegen: Eine am Matloutsi »die Mütze«, an dem nächsten Spruit (nach Süden zu) »die beiden Spatzen«, eine jenseits des folgenden Spruit »die Keule« und zwei zur Rechten vom Geleise »den Schweber« und »die Pyramide«, wobei der letzteren die Palme gebührt. Diese Scenerie im Vorlande gaben mir eine annähernde Vorstellung der landschaftlichen Reize des eigentlichen Berglandes vom Oberlaufe der Limpopo-Zuflüsse Matloutsi, Schascha, Tati und Rhamakoban. Da ich die beiden Schaschaflüsse erst am folgenden Tag überschritt, war es mir klar geworden, daß der Tschaneng in den Matloutsi oder einen seiner Nebenflüsse münden müsse. Die Gegend schien sehr wildreich zu sein, doch bei weitem nicht mehr in dem Grade als vor wenigen Jahren. Das häufigste Wild waren Pallah, Zuluhartebeeste, Harris-Antilopen und Tigerpferde.
Als wir Abends am rechten Ufer des wegen seines Bettes von den Eingebornen die felsige Schascha genannten Flusses ausspannten, und ich einen freien Augenblick benützend, einen Ausflug gegen Osten unternahm, fand ich an einem der vielen kuppenförmig aufsteigenden Granithügel eine Ruine, einen jener Anhaltspunkte für die Geschichte der früheren Bewohner des centralen Süd-Afrika. Der befestigte Felsenhügel war isolirt und einer der niedrigsten ringsum, die Befestigung bestand aus Granitziegeln, welche ohne jedes Bindemittel auf einander ruhten. Die Ruine stellte eine etwa die Mitte der kleinen Felsenkuppe einschließende Mauer dar, welche jedoch theilweise von schroff aufsteigenden Felsenblöcken gebildet wurde, so zwar, daß die künstliche Mauer an manchen Stellen zwanzig Centimeter, an anderen bis zwei Meter hoch und dreißig bis fünfzig Centimeter stark war. Der Eingang befand sich gegen Norden, die Mauer trat hier beiderseits vor und bildete einen förmlichen Gang. Die Granitziegel waren flach, zehn bis fünfundzwanzig Centimeter lang, acht bis fünfzehn hoch und sechs bis fünfundzwanzig breit, ihre obere und untere Fläche trapezförmig. Doch glaube ich sicher zu sein, daß von den früheren periodischen oder stabilen Bewohnern dieser Miniaturfeste (der Umfang mochte etwa hundertdreißig Meter sein) auf der Mauer eine Umwallung aus Holz oder Dornenästen errichtet worden war. Da ich mich gezwungen sah, schon nach zweieinhalbstündigem Aufenthalte wieder aufzubrechen, konnte ich keine Nachgrabungen anstellen, welche mir die nöthigen Aufschlüsse darüber gegeben hätten. Wir überschritten noch an diesem Tage den felsigen Schascha, mußten jedoch der eingetretenen Dämmerung halber sehr bald am jenseitigen (linken) Ufer unser Nachtlager aufschlagen.
Am 27. zogen wir, nachdem wir den sandigen Schascha überschritten, der sich mit dem felsigen verbindet und nachdem wir zwölf Zuflüsse des ersteren gekreuzt, bis zu dem Punkte, wo wir den sandigen in seinem Oberlaufe zum letzten Male berührten. Namentlich an dieser Stelle bot sich uns eine der schönsten Scenerien des Westmatabele-Landes dar. Der Reichthum der Pflanzenformen in dieser Gegend war in jeder Beziehung überraschend; da hier auch zahllose kleinere und größere, verschiedenen Arten angehörende Euphorbiaceen-Stämme im vermoderten Zustande den Boden der bewaldeten Höhenabhänge bedeckten, so fanden sich in ihren Höhlungen zahlreiche Scolopender und zwei Scorpion-Arten, auch Eidechsen und zahlreiche Insecten. Glücklicherweise hatte sich während meiner Reise durch das Makalaka-Land kein Fieberrückfall einstellt, und obwohl immer kränklich, konnte ich doch die meinen Sammeleifer anregenden Gelegenheiten benützen. Die kurzen flußauf- und abwärts unternommenen Ausflüge waren sehr lohnend. Hier war das Felsenbett sandig, dort wieder eine einzige Ebene oder gewölbte Granitplatte, welche stellenweise ein natürliches, tiefes oder seichtes Becken oder Rinnen einschloß, durch welche sich ein dünner Strahl seinen Weg nach dem Süden bahnte, um sich nach und nach in sumpfigen und sandigen Partien des Flußbettes zu verlieren. Wir überschritten nun den Tatifluß, dessen tiefsandiges breites Bett und sehr steile Ufer uns nicht geringe Schwierigkeiten bereitete.
Am 29. kamen wir in das Thal des Rhamakoban-Flusses, an dessen rechtem Ufer wir dahinzogen, wir überschritten weiterhin drei Regenzuflüsse des Tatiflusses, sowie vierzehn, die nach heftigem Regen dem Rhamakoban zueilten. Das Land am Rhamakoban-River ist seines Wildreichthums wegen unter den Elephantenjägern wohl bekannt; Giraffen, Tigerpferde, Roen-Antilopen, graue Pallah’s, Harris-Antilopen, Gnu’s, Löwen, Hyänen und Trappen gehören zu den häufigsten Wildorten und unter den größeren sind Nashorne und Strauße keine Seltenheit. Auch am 30. reisten wir so eilig wie am vorhergehenden Tage, da Bradshaw, der nach dem Abgange Westbeech’s die Leitung aller Wägen übernommen, über Mangel an Korn, Mehl, Thee, Zucker und Salz klagte und sich beeilte, die Handelsstation am Tatiflusse so bald als möglich zu erreichen. Nach Ueberschreitung von acht rechtsseitigen Zuflüssen des Rhamakoban, verfolgten wir das Thal desselben und verließen es erst am Nachmittage, um das zwischen demselben und dem Tatiflusse gelegene Hochland zu durchziehen. Auch auf dieser Strecke konnte ich anziehende Felsenformationen beobachten, welche ich der Reihe nach (von Norden nach Süden) »den Altar«, »die Gedenktafeln« und die »weißen Marksteine« nannte. In den letzten Tagen war der Mapanibaum wieder häufiger aufgetreten, und die am Nachmittage durchreiste Strecke bestand eigentlich aus einem einzigen, durch größere und kleinere Lichtungen unterbrochenen Mapaniwalde. Nahe an den weißen Marksteinen mündete der nach dem centralen Matabele-Land führende Weg in unser Geleise.
Am 31. langten wir an den Ufern des Tati an und erblickten am Abhange der niederen Tatihöhen einige im europäischen Style ausgeführte Gebäude, von welchen indeß nur zwei bewohnt waren. Das eine hatte der Elephantenjäger Pit Jacobs, das zweite der schottische Elfenbeinhändler Brown inne. Noch vor wenigen Jahren ging es hier sehr lebendig zu. Goldsucher aus allen Welttheilen waren zusammengeströmt, um des edelsten der Metalle habhaft zu werden, doch sie fanden statt Alluvial-, Quarzgold, was ihre Erwartungen bedeutend herabstimmte und schon nach kurzer Zeit ihre Reihen beträchtlich lichtete. Compagnien übernahmen nun die Arbeit, doch auch sie ließen nach und nach vom Betriebe ab, als sich ihre Maschinerien unzulänglich erwiesen. Die Hauptschuld am Mißerfolge war wohl die bedeutende Entfernung von der Küste, da selbst die einfachste Maschine nur mit dem fünf- und sechsfachen Kostenaufwande ihres Werthes hierhergebracht werden konnte.
Man fand sieben Unzen Gold auf eine Tonne Quarz, doch man theilte mir auch mit, daß stellenweise bis zu vierundzwanzig Unzen aus einer Tonne gewonnen wurden. Herr Brown, der ein Tauschgeschäft hatte, fungirte zugleich als Agent der aufgelösten Kompagnie, da noch einiges von dem Eigenthume derselben zurückgeblieben war. Im Thale des Tatiflusses, eine kurze Strecke unterhalb der Besitzung, fand ich noch die Ueberreste der Dampfmaschine, mit der man den Quarz zerkleinert hatte. Das goldhaltige Gestein wurde von einer eine Gehstunde weit landeinwärts am linken Ufer liegenden Stelle geholt, und als eben die seichten Goldgruben sich mit Wasser zu füllen begannen, fehlte es an einer zweiten Dampfmaschine, um sie zu entleeren, weshalb die Arbeit aufgegeben wurde. Bei unserer Ankunft war Herr Brown nicht anwesend, sondern auf einem Besuch in Gubuluwajo, um daselbst durch den Missionär Herrn Thompson mit Fräulein Jacobs getraut zu werden. Wir fanden jedoch bei seinem Geschäftsführer eine freundliche Aufnahme und hatten hier die Rückkehr Westbeech’s zu erwarten.
Außer den genannten Personen war ich nicht wenig erstaunt, die bei der Reise nach Norden am Henryspan angetroffenen Lotriet-Familien in einigen Grashütten wohnend, wiederzufinden. Alle aus dem Bamangwato-Lande im Allgemeinen von Süden nach dem Matabele-Lande fahrenden Wägen haben in Tati zu halten und sich mit einem neuen Gespann zu versehen. Die Matabele-Händler halten sich schon immer eines bereit, um nicht unnütz aufgehalten zu werden. Diese Maßregel war von dem Könige erlassen worden, um das Einschleppen der Roiwatter-Krankheit zu verhüten. Die Matabele besaßen einst eine große Anzahl von Viehheerden, welche größtenteils den umwohnenden Völkern geraubt waren, doch die vom Süden eingeschleppte Lungenseuche hatte unter den Thieren schrecklich aufgeräumt.
In Tati liegt immer eine Truppe Matabele-Männer, welche das Land nach Südosten zu bewachen haben; zur Zeit meiner Ankunft waren die Leute darauf erpicht, zufällig eintreffende Weiße nach Möglichkeit zu quälen und den von den Diamantenfeldern mit Gewehren heimkehrenden Makalaka’s, nachdem sie die Ankommenden aufgefangen und durchgeprügelt hatten, die Gewehre und den Schießbedarf in des Königs Namen abzunehmen.
Das Matabele-Königreich war zur Zeit meines ersten Besuches das zweitmächtigste Eingebornenreich südlich vom Zambesi, gegenwärtig nach der Niederwerfung der südlichen Zulu’s ist das Reich der nördlichen, d. h. der Matabele als das mächtigste anzusehen. Es hat eine Längenausdehnung von etwa achtzig bis neunzig, eine Breite von fünfzig bis sechzig geographische Meilen. Nach Mackenzie war der Gründer dieses weitläufigen Reiches ein Sohn Matschobane’s, eines Zulu-Häuptlings in Natal. Als Tschaka, der mächtigste der Zulu-Häuptlinge, seine Nachbarn unterjochte, wurde auch Moselikatze gefangen. Auf einem Raubzuge begriffen, den er im Auftrage Tschaka’s unternahm, welcher seinen Muth kennen gelernt hatte, wandte er sich mit den geraubten Heerden nach dem Herzen der jetzigen Transvaal-Colonie, unterjochte die Bakhatla-, Baharutse- und andere Betschuana-Stämme und ließ sich in dem am Marico und seinen Zuflüssen liegenden Höhenlande nieder. Hier wurde er von dem Griquachef Berend-Berend angegriffen, der nicht nur abgewiesen, sondern auf’s Haupt geschlagen wurde. Damit war aber nur der Reigen der gegen ihn gerichteten Angriffe eröffnet, es tauchten immer wieder neue Feinde auf. Zuerst waren es zwei Zulu-Heerhaufen, welche von Tschaka und einer von dessen Nachfolger Dingan dem Flüchtigen, doch erfolglos, nachgesendet wurden. Dann waren es die dem Transvaal-Gebiete sich nähernden Boers, welche, den gefährlichen Nachbar wohl erkennend, seiner los werden und das schöne Land am Marico erobern wollten. Sie griffen im Jahre 1836 unter Gert Maric Moselikatze am Fuße einer Höhe in dem genannten Territorium an; der Kampf endete mit einer vollständigen Niederlage des Zulu-Häuptlings, worauf Moselikatze mit dem Reste seiner Leute, unter denen sich nur vierzig Ringköpfe (eigentliche Krieger) befanden, das Land verließ und die Länder verwüstend, gegen den Zambesi zog, um jenseits dieses Stromes ein neues Reich zu gründen. Doch was Menschenhand nicht vermocht hatte, that die kleine Tsetsefliege, sie warf den Zuluwolf zurück. Dieser fiel nun erst über ein, dann über ein zweites Makalaka-Dorf und nach und nach über die einzelnen Makalaka-Königreiche, dann über jene der Manansa etc. her. In der Stille der Nacht überfiel er die Dörfer der Ackerbauer, steckte sie in Brand, tödtete die herausstürzenden Männer und raubte die Frauen, Kinder und Viehheerden; in dieser Weise wuchs seine Macht, und so schuf er ein neues Zulu-Reich in Süd-Afrika. Die geraubten Knaben wurden den Kriegern zum Unterrichte im Kriegsdienste anvertraut, jene, die schon Waffen zu tragen vermochten, sofort eingereiht. Die Frauen wurden den Kriegern geliehen, die Heerden wurden königliches Eigenthum und diente zur Erhaltung der anfangs in Rotten, später in Regimenter eingereihten Krieger. Als jedoch Moselikatze bemerkte, daß seine Krieger die ihnen zugewiesenen Makalaka-Frauen nicht als Beute behandelten, sondern milde gegen sie auftraten, fürchtete er ihre Verweichlichung und ordnete eine Schlächterei der seinem Zwecke gefährlich scheinenden Frauen an. Die Krieger folgten auch den Befehlen und schlugen ohne Ausnahme ihre neuen Frauen todt. Jährlich unternahm der König Raubzüge in die benachbarten Länder und Tausende von Unschuldigen wurden auf diese Weise geschlachtet. Denn außer den Männern wurden auch die arbeitsunfähigen Greise und die Frauen, Säuglinge und überhaupt kleine Kinder getödtet.
Ich will es versuchen, im Folgenden das Regiment der Matabele-Zulu in kurzen Zügen zu schildern; außer meinen eigenen Beobachtungen stütze ich mich auf die eingehenden Forschungen meines Freundes Mackenzie, sowie auf die mir von den beiden Elfenbeinhändlern Westbeech und Philipps mitgeteilten Berichte. Das Regiment der Zulu-Matabele ist in jeder Beziehung militärischer Despotismus, demselben unterliegt Alles, Mensch, Thier und jedes Atom des Landes. Ueber die einzelnen Heeres-Abtheilungen sind Häuptlinge gestellt und diesen unterstehen abermals Unterhäuptlinge, welche Officiersrang einnehmen, während jener des Induna etwa einem Regiments-Inhaber gleichkommt. Die Krieger führen blindlings die ihnen gegebenen Befehle aus, dagegen buhlen die Unterhäuptlinge und Häuptlinge um die Gunst des Königs und wenn dies nicht durch hervorragende Thaten im Kampfe möglich ist, so suchen sie sich durch Verleumdung gegenseitig beim Könige zu verschwärzen. Der König hat mehrere Scharfrichter, welche im Dunkel der Nacht ihre blutige Arbeit zu verrichten haben. Da die Matabele-Krieger allabendlich nebst Fleisch auch Kafirkornbier erhalten und darauf in der Regel in einen festen Schlummer fallen, wird es dem Scharfrichter oder dem sogenannten Messer des Königs leicht, an die Arbeit zu gehen.

Begegnung mit einem Löwen am Tatifluße.
Ich will nur eines Beispiels aus Mackenzie’s Erfahrung hier erwähnen. Der Tapferste der Tapferen in Moselikatze’s Heer war Monjebe, einer seiner ersten Häuptlinge, doch weil er seiner Tugenden halber oft vom König mit Geschenken ausgezeichnet war, blickten die übrigen Induna’s neiderfüllt auf den Günstling und ließen nicht ab, ihn fortwährend beim Könige der Zauberei und Verschwörung anzuklagen. Anstatt Monjebe zur Verantwortung zu ziehen, hielt Moselikatze das Ganze geheim, lieh leider endlich sein Ohr den Verleumdern und gab ihnen auch das Recht, Monjebe zu tödten. Am folgenden Morgen waren von dem Gehöfte des letzteren nichts mehr als einige rauchende Pfähle zu erblicken. Als mein Freund Mackenzie im Jahre 1863 das Matabele-Land besuchte, traf er nur einige Zulukrieger. Die Männer in der »Blüthe« waren Betschuana, welche Moselikatze als Knaben während seines Aufenthaltes im Transvaal-Territorium und auf seinen Zügen geraubt oder als Abgabe erpreßt hatte. Die jungen Regimenter bestanden meist aus Makalaka- und Maschona-Jünglingen.
Im Frieden haben die Knaben die Heerden zu hüten, kommen sie heim, so müssen sie sich im Gebrauche der Waffen üben. Diese Leibesbewegung stählt und kräftigt ihren Körper derart, daß man einen Masarwa aus dem Kalahari-Bushveldt und einen der unter den Matabele aufwuchs, nicht als Männer eines Stammes ansehen würde. Die Matabele-Krieger leben in Baraken, ein Bild der Häuslichkeit ist nirgends zu sehen. Nur den Häuptlingen, und in Ausnahmsfällen einem Krieger ist es gestattet, das ihm als Beute übergebene geraubte Mädchen als seine Frau, nicht als seine Sklavin zu betrachten, obgleich beide wohl das gleiche Los tragen. Der König hinderte die einzelnen Stämme nicht, den ihnen zukommenden abergläubischen Gebräuchen getreu zu bleiben, erlaubte aber auch nicht, daß einer seiner Leute Christ werde. Das Matabele-Land wurde zuerst von Missionären aufgesucht, dann folgten Elfenbeinhändler; sie kauften von diesen wohl Gewehre und Schießbedarf, aber keine Kleidung.
Jahr für Jahr begehen die Matabele, bevor sie auf ihre Raubzüge ausziehen, den der Gottheit geweihten Tanz Pina ea Morimo. Zu diesem finden sich die Krieger in voller Kleidung auf dem Paradeplatze ein, Kopf, Brust und Hüften mit einem aus schwarzen Straußfedern verfertigten Gewande geschmückt. Den versammelten Kriegern wird ein schwarzer Stier vorgeführt und dieser so lange gejagt und gehetzt, bis er von Schweiß und Schaum bedeckt, wie gelähmt, niederstürzt. Nun wird dem Thiere das Schulterblatt mit einigen künstlich geführten Schnitten sammt der Muskulatur ausgeschält und an einem kleinen Feuerchen zwei bis drei Minuten lang geröstet, das Fleisch in kleine Stückchen geschnitten und in diesem halbrohen Zustande von den heranstürzenden Kriegern verschlungen. Der Genuß desselben soll sie besonders stark und tapfer machen.
Rings um die Niederlassung der Weißen am Tatiflusse erheben sich kleine Hügel, welche theils aus Eisenglimmerschiefer, Quarz und Granit bestehen und theils einzelne Höhenkuppen, theils den Abfall des Rhamakoban-Tatiflusses bilden. Ich unternahm Ausflüge nach allen Richtungen hin, doch hieß man mich die größte Vorsicht gebrauchen, da es in der Umgebung von Löwen wimmeln sollte.
Am 30. besuchte ich zuerst die beiden von den Weißen bewohnten Wohnungen. Pit Jacobs, der holländische Jäger, war, von seinem Sohne begleitet, auf Elephantenjagd ausgezogen. Gegen Abend suchte ich das rechte Flußufer aus und erbeutete dabei einige Virivas colius. Am folgenden Tage besuchte ich die umliegenden Höhen und fand, daß man überall bis zu fünfzig Fuß tief Minen gegraben hatte, um Goldadern auf die Spur zu kommen. Auf dem nördlichen Hügel, der mit dem Tati-Abhang in Verbindung stand, fand ich Ruinen in Form einer Mauer, auf der höheren Kuppe eine kleinere Umwallung, auf der niedrigeren eine dreimal umfangreichere. Die erstere war 1 bis 1½, die letztere 1½ bis 2 Meter hoch und beiderseits 1 bis 1¼ Meter breit und ohne jeglichen Cement aus Eisenglimmerschieferziegeln errichtet. Während die Innenseite der Mauer immer gleichförmig aus drei bis zehn Centimeter starken, zehn bis fünfzig Centimeter langen und zehn bis zwanzig Centimeter breiten viereckigen Platten errichtet war, fand ich an der Außenseite der Mauer, daß hier wohl der Verzierung halber zwei Reihen kleinerer schief und dachziegelförmig gegen einander gelegte Platten einander unter einem rechten Winkel deckten (siehe das vorstehende Bild). Beide Umwallungen haben einen Eingang von Norden, bei der größeren war dieser Eingang dadurch geschützt, daß der rechte Mauerflügel nach außen vortrat und daß vom linken eine gerade Mauer nach Innen zu gegen die Mitte der Umwallung lief. Im Allgemeinen waren diese Ruinen den am Schascha-River vorgefundenen ähnlich geformt und mochten wohl von einem Stamme der Goldgewinnung halber errichtet worden sein. Auch hier hoffe ich auf der nächsten Reise Nachgrabungen anzustellen und zu entscheiden, ob sie von den im Osten lebenden Maschona’s oder von den Bewohnern Monopotapa’s errichtet wurden. Abends besuchte ich den zurückgekehrten, zweitgrößten Elephantenjäger Süd-Afrika´s Pit Jacobs und hörte gespannt seinen Mittheilungen aus seiner fünfundzwanzigjährigen Jägerlaufbahn zu.
Am Vormittag des 2. April besuchte ich auch den Verweser des Herrn Brown, um den Ankauf einiger Utensilien zu besorgen. Wir waren eben mit den letzteren beschäftigt, als ein Schwarzer mit dem Rufe hereinstürzte: »Löwen, Löwen unter der Heerde!« Obgleich an mehreren Stellen im Innern Löwen sehr zahlreich sind, so ist mir doch keine bekannt, an welcher dieses gewaltige Raubthier so kühn und verwegen auftreten würde, als in der Umgebung der Tati-Station. Als noch die Goldgräber hier arbeiteten, hatten sie von den Thieren sehr viel zu leiden. Hier geschah es damals, daß die Löwen über einen zwei Meter hohen und an seiner Basis ebenso breiten aus Dornästen erbauten Kraalzaun setzten, um die Zugthiere darin zu erwürgen. Sehr oft fanden Jacobs und Brown, daß Löwen in der Nacht zwischen ihren Wohnungen sich herumgetummelt hatten. Als der Minenbetrieb hier noch im Gange war, wurde eines Morgens einer der schwarzen Arbeiter, als er eben aus seiner Hütte treten wollte, um Brennholz für die Dampfmaschine zu sammeln, von einem Löwen angegriffen, und des Mannes Leben nur durch den Umstand gerettet, daß der Angreifer ein altes Thier mit stumpfen Zähnen war.
Während meines Aufenthaltes in der Tati-Station wurde eine Löwin in meiner Gegenwart erlegt. Am Tage als wir abreisten, wurden sieben Löwen am Wege vor uns gesehen. Acht Tage nach meiner Abreise schoß Pit Jacobs einen männlichen Löwen und wenige Tage darauf holte sich ein Löwe in der Nacht Herrn Brown’s Pferd aus dem Stalle, der, weil in einer Pfahlumzäunung erbaut, nach dem Wohngebäude zu offen war. Diese Vorfälle mögen dem Leser eine Idee von der Dreistigkeit und Keckheit der Löwen in Tati geben.
Nach der von dem Schwarzen erhaltenen Nachricht waren wir sofort bereit, das in die Heerde eingebrochene Raubthier zu züchtigen. Ich lief zu unserem etwa vierhundert Schritte vom Flusse abseits liegenden Lager, um mich mit meinem Snyder und Patronen zu versorgen. Als Bradshaw von dem Vorfalle hörte, schloß er sich mir mit seinem Vorderlader (einem Doppelgewehre) an, mit dem er wahre Wunder wirkte. Den mit Ruinen gekrönten Hügel zur Linken lassend, bewegten wir uns, das linke Ufer entlang, thalaufwärts. Dieses war nur etwa zwei- bis dreihundert Schritte breit, von bebuschten Höhen zur Rechten umsäumt, stellenweise bebuscht, dagegen unmittelbar am Flusse in einer Breite von etwa hundert Meter ziemlich dicht mit Mimosen bestanden. Außer mir und Bradshaw und einigen zwanzig mittelmäßig bewaffneten Schwarzen betheiligten sich noch ein Sohn Pit Jacobs’ und der ausgezeichnete Halbkastjäger Africa, die beiden letzteren zu Pferde, an der Verfolgung. Während des Marsches berichtete uns der Diener, daß der Angriff des Raubthieres auf die Heerde an einem erst gestern im sandigen Bette des Flusses gegrabenen Tränkloche geschah. Das Flußbett war hier etwa hundert Schritte breit, etwa dreißig Schritte von unserem Ufer erhob sich in demselben eine kleine dichtbebuschte Insel, zwischen ihr und unserem Ufer die genannte Lache. Als sich nun die Heerde zur Tränke versammelt hatte, stürzte plötzlich von jener Insel eine Löwin auf dieselbe, die Thiere flohen an’s Ufer und die Löwin zerbiß, einer Kuh nachsetzend (ganz gegen die sonstige Gewohnheit der Löwen), dieser die Fußgelenke, so daß sie ihr Opfer zum Falle brachte. Dies geschah unter einem Mimosenbaume, auf welchem bei dem ersten Erscheinen des Löwen der eine der beiden unbewaffneten Hirten Zuflucht genommen hatte; sein Hund aber blieb in der Nähe des Baumes und umkreiste laut bellend das Raubthier. Dem Hundegebelle folgend, kamen wir auf eine kleine, unmittelbar am Flusse gelegene Lichtung, und sahen den Kopf eines Rindes über das Gras herausragen. Africa hatte jedoch schon vom Pferde aus das Raubthier erblickt, und bevor wir uns dessen versahen, donnerte seine Elephantenbüchse. Nun erst sah ich wie eben der Kopf der hinter der Kuh in dem Grase hockenden Löwin in dasselbe zurücksank. Der Schütze hatte dem Raubthiere die Wirbelsäule am Epistropheus zerschmettert. Unmittelbar nach dem Schusse war der die Löwin in ihrem Fraße so beunruhigende und schon durch andere Vorfälle den Weißen von Tati so wohl bekannte Hund auf die Löwin losgesprungen und hatte ihr, sie an dem einen Ohre fassend, den Kopf zurückgerissen. Dann stürzten die Matabele auf die Löwin und hieben auf das todte Thier los. Ohne die Kuh getötet zu haben, hatte die Löwin derselben oben neben dem Kreuze ein Loch in den Leib gebissen und verzehrte die mit ihren Klauen herausgerissenen Eingeweide. Wir befreiten sofort das arme Thier von seinen Leiden und Africa verehrte mir das Fell des Raubthieres.[17]
Seitdem ich Africa am Tschobe begegnet, war er seiner Straußen- und Elephantenjagden halber von Khama des Landes verwiesen worden und nun nach Tati gekommen, um gegen Bezahlung von La Bengula die Erlaubniß zur Straußenjagd zu erhalten. Meine Zeit bis zum 7. benützte ich hauptsächlich zur geologischen Untersuchung der nächsten Umgebung, sowie zur Aufzeichnung der interessantesten Jagderlebnisse von Pit Jacobs und Bradshaws und eines dritten zugereisten Boerjägers. Am 6. besuchte der Sohn Africa’s seine Eltern, er brachte das Fleisch eines Kudu für dieselben mit, und hieß uns alle sehr vorsichtig sein, da er an seinem zwei Stunden entfernten Lager allnächtlich von Löwen beunruhigt wurde. Am folgenden Tage kam von Süden her über Schoschong ein Elfenbeinhändler, der, in seinem Geschäfte äußerst tüchtig, alles andere nicht zu beachten schien. Er klagte über Wassermangel zwischen Schoschong und Tati und über die Häufigkeit der Löwen auf dieser Strecke.
Westbeech und sein Compagnon Philipp, sowie ein anderer Elfenbeinhändler F. und Herr Brown mit seiner jungen Frau kamen am nächsten Tage von Gubulowajo zurück. Der erstere brachte eine von La Bengula mit einem † unterzeichnete Vollmacht, Elephantenjäger gegen Begleichung eines gesalzenen Pferdes in seinem westlichen Territorium jagen lassen zu dürfen. Herr Brown sowie der zugereiste Elfenbeinhändler theilten mir sehr interessante Einzelheiten über die Grausamkeiten der Matabele mit. La Bengula besitzt eine Schwester, eine sehr wohlbeleibte Person, welche einigen Einfluß auf den König ausübt. Als ihr einst W. vorwarf, warum sie sich keinen Gemahl wähle, gab sie ihm den Bescheid, sie sei zu corpulent, um gehen zu können, und da außer dem Könige Niemand im Lande einen Wagen besitze, müsse sie auf einen Ehegemahl verzichten. So oft ich an diesen Händler denke, muß ich stets bedauern, daß er seine Gunst, deren er sich von Seite La Bengula’s erfreute, nicht zu allgemeinem Nutzen geltend machte, daß er sich Sepopo gegenüber zu nachgiebig zeigte und so dessen Gunst, und durch mancherlei andere Umstände jene Khama’s verscherzte.
Sein zwölfjähriger Aufenthalt unter jenen Stämmen hatte ihn zum Meister ihrer Sprachen gemacht. Während seines letzten Besuches besuchte er den König La Bengula, als diesem eben sein Mahl auf einer Schüssel, die selten oder nie gescheuert wird, vorgelegt wurde. Ohne dazu aufgefordert worden zu sein, half sich W. sofort und reichte einige Stücke seinen Genossen, die mit ihm gekommen waren (mit Ausnahme zweier Missionäre wohnten stets einige Elfenbeinhändler im Umkreise der königlichen Stadt), worauf die umsitzenden Induna’s zu murren begannen. »Georg,« hieß es, »behandelt den König wie sein Kind.« »Wie kannst Du ihm das Fleisch nehmen?« W.’s Antwort. »Habe ich nicht Moselikatzes Wagen getrieben und so den König herumgeführt? War er da nicht mir anvertraut? War er nicht mein Kind? Ist nicht da La Bengula sein Sohn auch mein Kind?« schien die Murrenden sehr zu befriedigen, denn sie klatschten in die Hände. — Ich fragte den Masupia-Diener, den Westbeech mit nach Gubuluwajo genommen, ob die Matabele-Frauen schön seien. »Nein, Herr, sie haben kein hinteres Schurzfell, noch sind sie tätowirt.« Auf die wohlgeformten Gestalten und die angenehm sein sollenden Züge nahm der seiner Heimat ungetreue Sohn keine Rücksicht.
Bevor ich von Tati scheide, will ich noch eines eigentümlichen Abenteuers gedenken, welches sich im Februar des Jahres 1876 im Hause des Jägers Pit Jacobs zutrug. Um diese Zeit war der alte Jäger mit seinen Söhnen und einer seiner beiden Töchter auf der Elephantenjagd im südlichen Matabele-Lande beschäftigt. Die Frau war nur mit der zweiten an Herrn Brown verlobten Tochter, zwei kleinen Söhnchen und einem Masarwa-Diener zurückgeblieben.
Ueber die Höhen am Tatiflusse hatte sich bereits das Dunkel der Nacht ausgebreitet, und die Bewohner der Station schliefen bereits, nur aus der halboffenen Thür (aus einer unteren und oberen Hälfte bestehend) und der dieser entgegenliegenden Fensteröffnung der Wohnung Jacobs schimmerte ein schwacher Lichtschein. Das Haus des holländischen Jägers bestand aus einem sogenannten Hartebeest-Bau, d. h. aus vier, aus dünnen Baumpfählen errichteten, mit rother Ziegelerde überschmierten, mit einem aus Pfählen und Gras gebildeten Giebeldache überdeckten, dünnen Wänden. Eine aus dem ersteren Material verfertigte Scheidewand theilte den inneren beschränkten Raum in einen größeren, das Wohn-, Empfangs-, Eß-, Wasch- und Arbeitszimmer, und in einen kleineren, das Familien-Schlafzimmer. In dem ersteren lief eine Holzbank der Mauer entlang und nur an der südlichen Wand nahe der Thüre stand ein einfacher Holztisch, und unter der Fensteröffnung, welche man mit einem Brette zu schließen pflegte, eine Nähmaschine, ein Geschenk des Herrn Brown an seine Braut. Da wo die Bänke nicht hinreichten, einen ganzen Wandsitz zu bilden, füllten Kleiderkisten diese Lücke aus. Der zweite Raum hatte nur zwei nennenswerthe Objecte, zwei rohgezimmerte Bettstätten, eine der Eingangsöffnung gegenüber, welche die Scheidewand an der Fensteröffnung durchbrach und eine unmittelbar an der letzteren anliegend.
Um die Zeit des zu berichtenden Vorfalls war Herr B. bei seiner Verlobten noch zu Besuch. Der Diener war längst in seiner Hütte entschlummert, welche dem Hausthore gegenüber stand, die Mutter war mit den Kindern zur Ruhe gegangen. Sie lag mit dem kleineren, dreijährigen Knäblein auf dem Lager dem Eingange gegenüber, der zweite Knabe schlief auf dem anderen Bettgestelle. Während die Kinder schliefen, mischte sich die Mutter zeitweilig in das Gespräch ihrer in der vorderen Kammer sitzenden, verlobten Tochter. Um das Bild noch zu vervollständigen, muß ich noch hinzufügen, daß sich das Hauskätzchen am offenen Fenster einen außergewöhnlichen Sitz gewählt hatte. — Zur selben Zeit wurde die Niederlassung durch den Besuch eines hungrigen Leoparden beehrt, welcher nach mehrtägiger erfolgloser Jagd in den Büschen die Niederlassung aufgesucht hatte. Hier wurde Viehkraal nach Viehkraal umgangen, doch die Dornzäune schienen zu hoch für seinen Muth und so wagte er sich an die menschlichen Wohnungen heran, um doch wenigstens einige Hühner zu erbeuten. Auf diesem stillen Umzuge hatte er auch die Stätte von Pit Jacobs häuslichem Glücke umkreist. Der Leopard erblickte die Katze und den etwas mageren Bissen in der Noth immerhin des Angriffs werth haltend, wagte er, sich näher schleichend, den Sprung. Kätzchen sind jedoch kluge Thiere, und jenes hatte seinen Feind noch rechtzeitig erspäht, denn im selben Augenblicke als er aufsprang, setzte es herunter und verbarg sich unter der Nähmaschine, das Raubthier jedoch war mit einem Satze in der Mitte des Zimmers, zum nicht geringen Entsetzen der beiden Verlobten, sowie zu seinem eigenen Schrecken. Von dem lauten Aufschrei der beiden begrüßt, sowie von dem flackernden Lichte der in einer Wagenlaterne ihr ephemeres Dasein fristenden Kerze geblendet, geräth das Thier außer Fassung und sinnt auf Flucht und ein Versteck. Der Leopard erhebt sich brummend, blickt sich um und wirft sich dann in den dunklen Abgrund, der ihm als Eingang zu dem Schlafzimmer entgegengähnt, worüber die beiden so unangenehm Ueberraschten neuerdings aufschrieen, denn da drinnen lag ja die wehrlose Mutter mit den beiden Kindern. Frau Jacobs sah ein Thier in ihre Schlafkammer setzen und sich unter ihr Bett verstecken; sie fragt, was es wäre, jene wollen sie beruhigen und sagen es sei blos ein Hund. »Ja, wenn es nur ein Hund ist, warum schreit Ihr denn so fürchterlich.« In der Meinung, daß es vielleicht eine Hyäne sei, springt die Frau auf, ergreift das neben ihr liegende Kind und eilt, das zweite vollkommen vergessend, in die vordere Kammer. Als die Beiden sie ohne das zweite Kind in der Kammer erscheinen sehen und die Mutter in sie dringt, den Namen des Thieres zu nennen, gestehen diese ein, daß es kein Hund oder Pantherkatze sondern ein Leopard sei. Nun brach die Mutter in Wehklagen aus, sie wollte hineinstürzen und ihr Kind holen. Mit aller Macht mußte sie zurückgehalten werden aber um so mehr drang sie hierauf auf die Tödtung des Raubthieres.

Der Leopard im Hause Pit Jacobs.
Nachdem die Aufregung Aller sich etwas gelegt hatte, sann man auf die Mittel, das Thier zu bekämpfen. Auf der Schlafzimmerseite der Scheidewand hingen einige geladene Elephantengewehre, doch in der allgemeinen Angst und Bestürzung hatte man diese vollkommen außer Acht gelassen. Ein großes Küchenmesser war die einzige Waffe, welche zur Hand war, da fiel jedoch der Frau Jacobs der in der Hütte schlafende Masarwa ein, dessen, wenn auch höchst primitiver Assagai bessere Dienste leisten konnte. Bald war auch der Gewünschte mit seiner Waffe zur Stelle und so bewaffnet nahm Brown den Kampf mit dem Leoparden auf. B. sollte im gebeugten Zustande mit der Waffe in der Hand und gefolgt von seiner Braut dem Thiere den Garaus machen; um jedoch auch in der That dieses Heldenstück auszuführen, war Licht nöthig; hier half Miß Jacobs, indem sie die Laterne hochhielt. Sowie der erste Lichtschimmer auf den Leoparden gefallen war, fauchte dieser vernehmbar und sprang mit einem Satze aus seinem Verstecke auf das gegenüber stehende unbeleuchtete Lager, auf welchem der fünfjährige Jacobs trotz des Geschreies der Frauen ruhig weiterschlief. Dies war die Ursache eines neuen Geschreies von Seite der Frauen, denn alle wähnten das Kind, wenn nicht schon todt, so doch dem sicheren Verderben preisgegeben. Doch keines von beiden war der Fall. Das Raubthier mußte unmittelbar vor oder hinter den Knaben gesprungen sein, ohne die geringste Notiz von ihm zu nehmen, denn der Knabe schlief weiter und war erstaunt, am nächsten Morgen die aufregende Scene erzählen zu hören.
Der Leopard saß auf seinen Hinterfüßen und fauchte zähnefletschend die Eindringlinge an. Abermals stellten sich die Angreifer in eine Schlachtlinie und vorwärts ging es in die Schlafkammer. Um mit ihrem Rathe nötigenfalls beizustehen und ihrem Verlobten den Schauplatz besser zu beleuchten, lehnte sich Fräulein Jacobs, die Laterne vor ihn hinhaltend, über Herrn Brown, und damit ihre Kinder im wichtigen Momente nicht verzagen und sie das Ganze sehen könne, lehnte sich auch Frau Jacobs an ihre Tochter, so daß Brown unter der Last förmlich zusammenbrach. Wie vermochte er unter diesen Verhältnissen mit Sicherheit einen tödtlichen Stoß gegen das Thier zu führen. Es darf uns daher nicht wundern, daß er kaum die Haut des Thieres durchbohrt hatte. Allein kaum war dies geschehen, als der Leopard auf seine Gegner lossprang. Im nächsten Momente als sein Assagai abglitt, fühlte Herr B. die Tatzen des Thieres auf seinem Kopfe und Nacken. Die nächste Wirkung dieses Sprunges war, daß Herr Brown von Tochter und Mutter und dem neugierigen, sich gleichfalls an Frau Jacobs anlehnenden schwarzen Diener beschwert, dem auf ihm lastenden Gesammtgewichte nachgeben mußte und mit dem Leoparden zu Boden stürzte. Der Stütze beraubt, folgten auch in der Gefahr getreu, Fräulein und Frau Jacobs, sowie der Masarwa ihm nach. Dies war wohl die glücklichste, wenn auch für die Betheiligten in jenem Momente unangenehme Lösung der Situation. Es wäre nun vielleicht Einem oder dem Andern schlecht ergangen, wenn das Raubthier nicht selbst durch den Wechsel seines Standpunktes erschreckt worden wäre. Der Leopard fühlte sich plötzlich auf einem zuckenden, in holländischer, englischer sowie in der Sesarwa-Sprache schreienden Knäuel und da mit dem Falle des Herrn Brown auch die Laterne ausgelöscht war, kam es selbst dem Leoparden in der Dunkelheit unheimlich vor und anstatt zu beißen und zu kratzen, machte er einen Satz durch die Thüre in das Wohnzimmer und von da durch die Ausgangsthüre, deren obere Hälfte nicht geschlossen war, ins Freie. Nach und nach entwirrte sich auch der Menschenknäuel und nachdem Licht herbeigeschafft war, rief das ganze an komischen Momenten reiche Erlebniß, das unter Umständen tragisch enden konnte, allgemeine Heiterkeit hervor.
Am 10. April verließen wir die Tati-Station und fuhren durch ein bewaldetes Hügelland bis zum Schaschaflusse, einem Sand-River, der unter anderen zahlreichen Nebenflüssen gleichen Charakters auch den Tatifluß aufnimmt. Nahe an der Stelle wo wir hielten, fand ich an der Mündung eines trockenen Regenspruits in den trockenen Schaschafluß, eine kleine aber tiefe Lache, welche Krokodile beherbergte.
Am Morgen des 12. überschritten wir den Matloutsi- und den Seribe-Fluß, sowie seit dem wir Tati verlassen, zehn Zuflüsse des Schascha, Matloutsi und Seribe, am folgenden Tage vier weitere Spruits. Der Weg war abermals äußerst beschwerlich und voller Felsblöcke. Wir blieben den Tag über am Matloutsi-Flusse, welcher theilweise die östliche Grenze zwischen dem Matabele- und Bamangwato-Reiche bildet. (Früher war es der Tatifluß.) Großes Interesse bot eine doppelte Reihe von Hügeln, deren Form bald kegelförmig war, bald wieder förmlichen Hexaëdern glich. Wir überschritten am nächsten, einem sehr heißen Tage Morgens den Kutse-Khani und den Lothlakhane-Fluß und lagerten am Ufer eines dritten mit Namen Goque. Da wir vor uns eine weite, wasserlose Strecke hatten, wurden hier die Zugthiere mehrmals getränkt. Der Weg führte nunmehr an der Kette der Serule-Höhen vorüber und über drei Regenspruits und späterhin an den Serule-River, den wir gegen Mittag überschritten, gegen Süden und Südosten erhob sich der Höhenzug der Tschopoberge, deren höchste Kuppen am Nord- und Südende liegen.
Am 16. erreichten wir das Thal des Palatschwe-Flusses und überschritten am selben Tage auch das Thal des Lotsaneflusses. Ich glaube, daß sich beide Flüsse am Fuße der Tschopo-Höhen vereinigen und am nördlichen Abhange derselben ihren Lauf gemeinsam fortsetzen. Die Lotsane Furth, eine der schwierigsten auf dem Wege von oder nach dem Matabele-Lande, war einige Jahre zuvor bei den Elfenbeinhändlern und Elephantenjägern durch zahlreiche und äußerst kecke Löwen berüchtigt.
Am 17. betraten wir ein Hochland, in welches zahlreiche Regenlachen eingebettet waren, von denen jedoch nur drei im Winter wasserhaltig sind und deren zweite Lemones-Pfanne genannt wurde. An den beiden letzteren fanden wir Bamangwato-Viehposten. Ich muß noch erwähnen, daß wir von Tati ab eine Matabele-Begleitung erhalten hatten, welche Z. nicht geringen Kummer und Sorgen einflößte. An der letzten Lache, Tschakani genannt, schlugen wir unser Nachtlager auf; hier erfuhren wir, daß Setschele die in seinem Lande wohnenden Bakhatla bekriege. Da wir kein Wild erlegen konnten und unsere von Tati mitgenommenen Lebensmittel zur Neige gegangen waren, wurde eines der Reserve-Zugthiere geschlachtet. Wir überschritten hierauf den Tawani und kamen in der Nacht bis an das Ufer des sandigen Mahalapsi-Flusses.
Am frühen Morgen hatten wir den östlichen Fuß der Bamangwato-Höhen erreicht und zogen nun nach Schoschong. Ein Theil des Trupps blieb zurück, da es hieß, daß in Schoschong das Gras durch die anhaltende Dürre förmlich abgebrannt sei und die Quellen des Schoschon so wenig Wasser lieferten, daß sie kaum den Bedarf der Bewohner deckten. Nachdem uns Z. verlassen, welcher aus Furcht vor Khama die Richtung nach dem Limpopo zu den Damara-Emigranten einschlug, zogen wir das Franz Josefsthal aufwärts und erreichten nach einigen Stunden Schoschong.
Ankunft in Schoschong. — Khama läßt Z. verfolgen und verurtheilt ihn. — Aufregende Nachrichten aus der Colonie. — Aufbruch nach Süden. — Mochuri. — Der Krieg der Bakhatla’s gegen die Bakwena. — Ich erstehe zwei junge Löwen. — Ein Löwen-Abenteuer Van Viljoens. — Eberwald besucht mich. — Jouberts See. — Houmans Vley. — Ankunft in Kimberley.
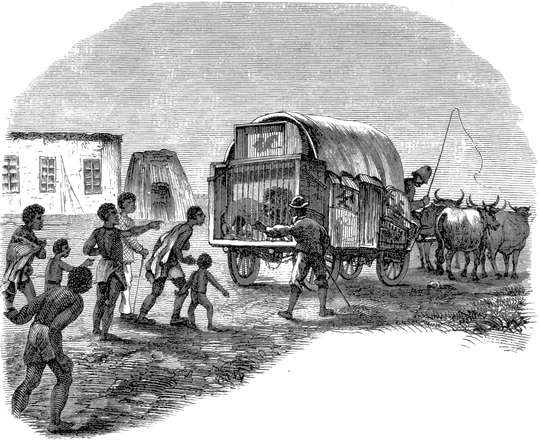
Rückreise nach den Diamantenfeldern.
Von meinem guten Freunde Mackenzie auf das Herzlichste aufgenommen, mußte ich abermals sein Gast sein; um meine Erholung zu beschleunigen, lud er mich ein, so lange bei ihm zu verweilen, als er selbst noch in Schoschong verblieb. Seiner Gastfreundschaft, sowie der bei Herrn Jensen in Linokana genossenen danke ich zum größten Theile meine Genesung. Als ich wieder zum ersten Male ein Stück ordentlich zubereitetes Brod genießen konnte, kam ich mir wie ein mächtiger Herrscher vor, der jede seiner Launen zu befriedigen vermag.
Als ich am Tage meiner Ankunft mit Westbeech Khama besuchte, überraschte er den letzteren mit der Frage nach Z. Khama war davon genau unterrichtet, daß er mit uns gereist war und da half Westbeech keine Widerrede, er mußte gestehen, daß Z. Früh Morgens den Wagen verlassen habe. Am selben Nachmittage noch sandte der König bewaffnete Mannschaft aus, um Z. einzubringen, doch diese kehrten spät am Abend unverrichteter Dinge zurück, worauf der König Berittene aussandte, um die Gegend bis gegen den Khama-Salzsee durchforschen zu lassen.
Am Morgen des 22. kehrten sie mit dem Flüchtigen zurück, beim Durchstreifen des Bushveldts waren sie von dem Scheine eines kleinen Feuers angezogen worden, sie ließen ihre Pferde zurück und näherten sich so leise, daß Z. ohne von seinem Revolver Gebrauch machen zu können überwältigt wurde. Zum Könige gebracht, zeigte sich Z. über seine Gefangennehmung sehr aufgebracht. Der König aber hielt ihm sein Vergehen vor und verurtheilte ihn zu einer Geldbuße von 100 £ St. und als sich der Verurtheilte entschuldigte, daß er diese Summe nicht besäße, antwortete Khama, »ich weiß wohl, daß Du Dein Gespann sammt Wagen an W. verkauft hast, er muß für Dich bezahlen, da er noch das Geld schuldet.«
Die mitgekommenen Matabele brachten einen Brief La Bengula’s an Khama, welcher diesen einlud, gemeinschaftlich an den Präsidenten der Transvaal-Republik und Sir Henry Bartle, den Gouverneur der Cap-Colonie, die Bitte zu richten dem Vordringen der Damara-Emigranten Einhalt zu gebieten. Am 22. wurden zwei Händlergehilfen von dem Könige in öffentlicher Sitzung zu je 10 £ St. Strafe verurtheilt, weil sie vor ihren außerhalb der Stadt liegenden Gehöften in betrunkenem Zustande aufgefunden wurden. »Wenn Ihr Euch schon nicht enthalten könnt,« sagte Khama, »so thut es innerhalb Euerer Wohnungen oder Wägen, um nicht meinen Leuten ein böses Beispiel zu geben.«
Am 24. reisten meine Gefährten nach dem Süden ab, während ich mit Westbeech’s Wagen, den er vor der Hand nicht benöthigte, nachdem er das Elfenbein daraus entnommen, in Schoschong im Hause meines Freundes Mackenzie zurückblieb. Am 25. und 26. fühlte ich mich leidlich wohl und hielt im Hofraume Revue über meine Sammlungen, von welcher der von einem Jagdzuge am Limpopo zurückkehrende Kapitän G. ganz entzückt zu sein schien. Es freute mich, mit dem Könige bereits ohne Dolmetscher in der Setschuana plaudern zu können. In den Abendstunden verzeichnete ich meine Erlebnisse, während mir Rev. Mackenzie wieder Interessantes über die Gebräuche der Bamangwato’s mittheilte.
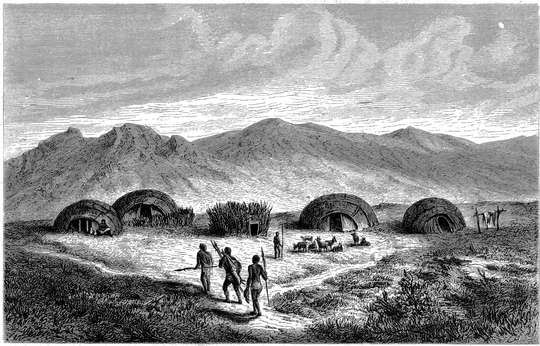
Koranna-Gehöfte bei Mamusa.
Am 4. kam der Elfenbeinhändler Shelten vom N’gami-See an und berichtete von der Gefangennahme des Damara-Emigrantenführers Van Zyl durch die Damara’s, sowie daß eine Horde der Makololo, die sich aus der früheren Niedermetzelung des Stammes gerettet und heimlich am Tschobe aufhielt, von den westlichen Bamangwato’s vernichtet worden sei. Da ich mich am 10. etwas wohler fühlte, bestieg ich das Plateau auf welchem der entscheidende Kampf zwischen Sekhomo und seinen Verbündeten, den Makalaka’s einerseits und Khama andererseits stattfand. Ich fand nur ein einziges der vorgefundenen Skelete der Makalaka’s für meine Sammlungen brauchbar.
Am 13. kam durch die eingebornen Postboten die Nachricht, daß in der Transvaal-Provinz zwischen den Boers und dem Eingebornen-Häuptling Sekokuni Krieg ausgebrochen sei. Von Khama aufgefordert, übernahm ich bis zum Ende meines Aufenthaltes in Schoschong die Behandlung der sich meldenden kranken Eingebornen, wobei mir die beiden Herrn Missionäre getreulich beistanden und auch die nöthigen Medicamente lieferten.[18] Am 15. sandte ich einen Bericht an Lord Derby, dem Minister für auswärtige Angelegenheiten Großbritanniens, über die Sklaverei im Marutse-Reiche. In den folgenden Tagen kamen häufige Nachrichten von den Grausamkeiten, welche von den beiden im Lande Seschele’s kriegführenden Theilen, den Bakwena’s und Bakhatla’s, ausgeübt worden waren. Anfangs waren die Bakwena’s, dann die Bakhatla’s zum Angriff übergegangen.
Am 24. wurde in Schoschong die Boguera an den Mädchen vorgenommen, wie Khama mir versicherte, zum letzten Male. In den ersten Tagen des Juni begann Freund Mackenzie Vorbereitungen zu seiner Uebersiedlung nach Kuruman, wohin er berufen worden war, um ein größeres Seminar zu gründen. So weit meine schwachen Kräfte hinreichten, suchte ich ihm bei seinen Arbeiten zu helfen. Doch die Krankenbesuche während der heißen Zeit verschlechterten meinen Zustand und ich sah mich gezwungen, Khama zu ersuchen, mir ein Pferd zur Verfügung zu stellen, was er auch that. Während dieses Aufenthaltes in Schoschong erfuhr ich, daß Matscheng und andere Betschuana-Häuptlinge am rechten Limpopo-Ufer wohnten, ohne die Oberhoheit der Transvaal-Republik anzuerkennen und der Limpopo deshalb nicht als Nordgrenze dieses Landes angesehen werden könne. Am 13. kam die Nachricht, daß die Bakhatla bei ihrem Angriffe auf Molopolole, die Hauptstadt der Bakwena’s, geschlagen worden waren. Im Kampfe hatten die Hinterlader der letzteren den Ausschlag gegeben.
Am 21. verließen wir Schoschong; unsere Karawane bestand aus sieben Wägen. Außer mir und Herrn Makenzie reisten auch Herr Hephrun und die beiden Missionäre Thompson und Helm aus dem Matabele-Lande mit, denn die Herren hatten in Molopolole eine Conferenz abzuhalten. An Khama’s Salzsee wurden wir noch durch einen Abschiedsbesuch des Königs Khama beehrt, er konnte nicht umhin, noch einmal meinem Freunde Mackenzie, dem Manne, dem er so viel zu verdanken hatte, die Hand zu drücken. Bei dieser Gelegenheit fand er mehrere Wägen eines Händlers vor, der durch sein Land nach dem Matabele-Lande ziehen wollte. Khama gestattete dies jedoch nicht und zwang den Mann zur Rückkehr nach dem Süden, weil derselbe ein Jahr zuvor gegen des Königs Willen im Lande Branntwein verkauft hatte.
Wegen Wassermangel war unser weiterer Zug bis an den Limpopo recht beschwerlich, statt ihn wie gewöhnlich zu kreuzen, umfuhren wir den Sirorume, um dem erwähnten tiefsandigen Wald an diesem Flusse auszuweichen. Kurze Zeit zuvor hatte im Flußthal ein Löwe in der Nacht das Pferd des Jägers Dracke getödtet, wobei einer der schwarzen Diener einen Ochsen für das Raubthier ansah und diesen auch glücklich erlegte. Abends am 23. kamen wir an der Notuany-Mündung an und blieben bis zum 26.; ich lernte hier auch den Afrikareisenden, Kapitän Grandy kennen, der nach dem Matabele-Lande reiste und später dem Fieber erlag.
Wir zogen nun das Limpopo-Thal aufwärts, die Geleise, welche nur einige Male, das letzte Mal wohl vor Jahren, befahren worden sein mochten, waren äußerst schlecht, theilweise tiefsandig, meistens felsig. Am 1. und 2. lagerten wir an einer jener Lachen, welche, wie schon erwähnt, am Ufer des Notuany gelegen, von Quellen sowohl wie von dem ausgetretenen Flusse gespeist werden und selbst dann noch wasserhaltig bleiben, nachdem der Fluß schon längst ausgetrocknet ist. Die angetroffene Lache war zwanzig Meter breit, hundertfünfzig lang und enthielt zahlreiche Fische. Da an einem der Wägen des Herrn Mackenzie ein Rad gebrochen war, begab sich Rev. Hephrun nach der nahen Stadt der westlichen Bakhatla, Mochuri, um von zwei daselbst wohnenden Händlern ein Rad zu entlehnen. Als wir am 3. Mochuri erreichten, hörten wir, daß die Bakhatla Tags zuvor von ihrem Kriegszuge gegen die Bakwena’s heimgekehrt waren. Sie hatten sich unbemerkt der Hauptstadt Molopolole genähert und nachdem sie sechzehn Makalahari-Hirten getödtet, sich der Heerden bemächtigt und alle Angriffe der Bakwena’s, die Heerden wieder zu gewinnen, zurückgeschlagen. Da erst erstand der König der Bakwena’s von den Händlern einige Hinterlader und mit Hilfe derselben war es endlich den Bakwena’s gelungen, so viele Bakhatla niederzuschießen, daß diese die geraubten Heerden aufgeben mußten. Von den gefallenen Bakhatla’s waren nur zehn todt, die übrigen verwundet, allein von den Verwundeten nur vier heimgekehrt, die übrigen waren nach Bakwena-Sitte, trotzdem sie einen christlichen König hatten (Seschele), niedergemetzelt worden. Die Bakhatla’s klagten, daß die Bakwena’s einige ihrer Viehposten überfallen, die Hirten getödtet und ihren Frauen Hände und Füße abgeschlagen hatten.
Die Stadt der Bakhatla’s schien mir die reinlichste Betschuana-Stadt, die ich bisher besucht hatte. Der Stamm der Bakhatla’s war früher im Transvaal-Gebiete ansässig, verließ jedoch das Land nach der Besitznahme desselben durch die Boers zum großen Theile und siedelte sich nun unter zwei Häuptlingen als östliche und westliche Bakhatla im Lande Seschele’s an. Dieser forderte nun von ihnen wie von den Makhosi und den Batloka Tribut, den sie verweigerten. Mochuri breitet sich an einer Sattelhöhe aus, der Ort ist von einem hohen Dornzaune umgeben, die Gehöfte sind äußerst rein gehalten und gut cementirt. Bis zum Jahre 1876 waren die Bakhatla unter den centralen Betschuana’s der einzige Stamm, welcher sich mit Tabakbau beschäftigte und dessen Erträgnisse in den Handel brachte. Eine ihrer Hauptbeschäftigungen außer dem Ackerbau ist die Gerberei und Bearbeitung des Leders zu verschiedenen Artikeln. Die Mehrzahl des Stammes spricht holländisch.
Ich erstand hier von den Häuptlingen durch Vermittlung Rev. Mackenzie’s zwei junge Löwen und verließ hierauf Mochuri, um weiter nach dem Süden, gegen Tschuni-Tschuni, zu ziehen, während sich meine Freunde, die Missionäre, nach Molopolole wandten. Ich schied schweren Herzens von ihnen, denn beide waren mir stets wahre Freunde gewesen. Von Mochuri gelangt man nach einer zwölfstündigen Fahrt nach Molopolole (etwa dreißig englische Meilen). Nachdem ich das bewaldete Thal des Notuany verlassen, durchfuhr ich in südöstlicher Richtung eine große Ebene, welche in Folge ihres Salzgrundes nur spärlich mit Gras bewachsen war. Am 4. meine Reise fortsetzend, langte ich Nachmittags in Tschuni-Tschuni an. Hier herrschte solche Trockenheit, daß man über dreißig Fuß tiefe Löcher im Felsengrunde der Spruits graben mußte, um auf Wasser zu stoßen. Ich hielt mich deshalb nicht lange auf und zog weiter. Während einer Rast am nördlichen Abhange der Dwarsberge entsprangen mir meine jungen Löwen. Es währte mehr als zwei Stunden, bis ich und meine Diener, zerkratzt und mit zerbissenen Händen die Thiere eingefangen hatten.
Am 6. erreichte ich das dem Leser schon bekannte Brackfontein und schlug von hier statt der südwestlichen über Buysport eine südliche Richtung ein um nach Linokana zu gelangen, wobei ich auf die Farm Leuvfontein zusteuernd, das Bushveldt von Norden nach Süden durchzog. Auf diesem Marsche bemerkte ich, daß das Morupa-Flüßchen von Buysport sich in einigen seichten Einsenkungen verlor und nur nach sehr heftigen Regengüssen über die Grasflächen strömend den großen Marico erreicht. In diesem Thale nahe an der Farm Leuvfontein am Nordabhange des östlichen Höhenzuges, über welche der Buysport-Paß führt, trug sich vor einigen Jahren ein Löwenabenteuer zu, welches ich noch wegen seiner Originalität und weil es dem schon mehrmals erwähnten Van Viljoen, einem der berühmtesten Löwenjäger zustieß, im Folgenden wiedergeben will.
Im Jahre 1858 unternahm Mynheer Jan van Viljoen mit seinem ältesten Sohne und einem Holländer mit Namen Engelbrecht eine Reise in das Bushveldt. Man hatte die Stelle, an der gegenwärtig Leuvfontein liegt, verlassen, und war eben daran, das untere Morupa-Thal zu kreuzen. Die drei Jäger ritten voraus, denn die Wägen bewegten sich äußerst langsam vorwärts. Eine unmittelbar vor ihnen den Weg kreuzende Pallahheerde verleitete Viljoen sein Jagdglück zu erproben und so verließ er seine Gefährten und wandte sich rechts in die Büsche. Sich auf hundertfünfzig Schritte den Thieren behutsam nähernd, ersieht der Jäger eine gute Gelegenheit, einen tüchtigen Pallahbock aufs Korn zu nehmen; während er eben anlegt, scheint es ihm, als ob er von links her einen auftauchenden Schatten wahrnehmen würde. In dem Momente als er sich umsieht, fühlt er sich von einem Löwen erfaßt und sein Gesicht in des Löwen Rachen. Tiefe Narben im Gesichte zeugen noch heute für das starke Gebiß des Räubers. Er war durch den Sprung des mächtigen Raubthieres vom Pferde herabgerissen worden, allein kaum lag er auf dem Boden, als ihn der Löwe losließ und bald den vor sich daliegenden und ihn anstierenden Menschen, bald das ruhig stehende und an die vierfüßigen Räuber ziemlich gewöhnte Pferd betrachtete. In Folge des Falles Viljoen’s, war der Sattelgurt gerissen und der Sattel hing nun an den Hinterfüßen des Pferdes, das vom gestürzten Reiter etwa vier Meter entfernt war. Nachdem sich der Löwe eine Zeit lang Roß und Reiter betrachtet, schnappte er plötzlich nach der Brust desselben, um ihn davonzutragen, doch Viljoen war eben so rasch und versuchte mir seinem rechten Arme die Brust zu decken, während er mit seiner linken Hand den Löwen an seinem linken Ohre festhielt. Das Raubthier erfaßte nun mit seiner unteren Kinnlade den Arm, mit der oberen die Brust. In diesem für Viljoen so verhängnisvollen Momente wurde das Pferd sein Lebensretter. Den Sattel an seinen Hinterfüßen als unnütze Last fühlend, schlug dasselbe aus, so daß der Sattel aufflog und die Bügel klingend aneinanderschlugen. Da läßt der Löwe den Jäger fahren und stiert das Pferd an, das nun zum zweiten Male ausschlägt, wodurch der Schwanzriemen reißt und der Sattel gegen den Löwen und Jäger herabkollert. Dies schien selbst dem verwegenen Räuber zu viel. Mit einigen Sätzen sprang er zur Seite und stellte sich etwa zehn Meter weit beobachtend auf. Viljoen erhebt sich sofort und ergreift sein nebenan liegendes Gewehr. Doch beim Anlegen fühlt er einen heftigen Schmerz im Munde. Der Jäger denkt, der Löwe hätte seine Kinnlade zerbissen, und da er fürchtet, daß ihm in diesem Zustande das Abfeuern des geladenen Vierpfünders eine nicht geringere Verwundung als des Löwen Biß eintragen würde, entschloß er sich, nur im äußersten Nothfalle davon Gebrauch zu machen. Von einer nahen Höhe herabkommende Baharutse, welche die gefährliche Situation leicht begriffen, zwangen indessen den Löwen durch lautes Geschrei zur Flucht. Verwundert sahen Viljoen’s Gefährten diesen über und über mit Blut besudelt sich ihnen nähern.
Sechsundzwanzig Tage lang lag der Jäger in Folge seiner Brust- und Armwunden darnieder, bevor er sein Lager verlassen konnte. In derselben Nacht tödtete der Löwe einen von Moilo’s Hirten, der in einem nahen Gehölze wohnte. In Folge der letzteren Unthat wurde er am folgenden Morgen von einem großen Haufen der Baharutse verfolgt, aufgesucht und erschossen. Es war ein ausgewachsener Krachmanetje.
Am 8. erreichte ich Linokana und wurde hier von Herrn Jensen auf das Freundlichste angenommen. Viel Freude bereitete mir der Besuch meines werten Freundes Eberwald, der meinethalben von den fernen Leydenburger Goldfeldern hierhergekommen war, um mich zu begrüßen. Während meines Aufenthaltes in Moilo, wo er Herrn Jensens freundliche Aufnahme mit der Pflege, die er dessen Gärten angedeihen ließ, entgalt, war er mir sehr behilflich, und reiste auch später mit mir nach dem Süden. Der Häuptling Moilo war gestorben und sein Neffe Kopani von Moschaneng, der der Transvaal-Regierung unterstehende Häuptling der Baharutse, Chef von Moilo geworden. Den Tag nach meiner Ankunft, als eben ein geräumiger Käfig für mein Löwenpärchen fertigstellt war, verendete die Löwin.
Im Osten der Republik wüthete der Kampf, wobei sich die Weißen im Nachtheile befanden. Allenthalben im Marico-District wie in der ganzen Republik wurden Leute, Vieh und Wägen conscribirt, wogegen die Ackerbauer sehr murrten.
Am 5. August langte Herr Mackenzie auf seinem Marsche nach Kuruman hier an, auch Herr Williams kam von Molopolole, um mich wegen seiner Gesundheit zu consultiren. Am 6. entlohnte ich meine vier Zambesi-Diener To, Narri, Burilli und Tschukuru, damit sie nach dem Zambesi zurückkehren konnten und um mich ihrer Hilfe auch auf dem nächsten Zuge zu versichern, gab ich mehr als ihnen gebührte. Durch Herrn Wehrmann, einen unter den östlichen Bakhatla’s wohnenden Missionär, erfuhr ich, daß ihre Stadt zwei Stunden westlich vom großen Marico am nördlichen Abhange gelegen, Melorane, und der Häuptling der westlichen Bakhatla’s Linsch heiße und ein Sohn Khamanani’s sei. Bevor noch meine Diener nach dem Norden abgingen, benützte ich meine geringe Kenntniß der Senansa und der Sesuto-Serotse-Sprache, um einiges über die Setonga (zwei meiner Diener waren Matonga’s) zu erfahren.
Um mir zur Rückreise nach den Diamantenfeldern einiges Geld zu erwerben, übernahm ich die Behandlung von Kranken. Unter meinen Patienten befand sich auch ein Händler K., der durch Westbeech’s eminente Rosselenkerkunst aus dem Wagen geworfen worden war und sich arg beschädigt hatte. Auch der holländische, allgemein beliebte Prediger de Vries befand sich unter meinen Kranken, dessen Heilung mir unter der holländischen Bevölkerung des Districtes viele Freunde erwarb. Am 19. September erhielt ich von Lord Derby eine freundliche Antwort auf den ihm von Schoschong aus gesendeten Bericht über die Sklaverei im Marutse-Reiche. Am 24. verließ ich Linokana, schlug von hier nach Mamusa den kürzesten Weg ein und berührte Ooisthuizens erzreiche Farm sowie den südlichen Theil der westlichen Grenze des Marico-Districtes; der Weg auf dieser Strecke bereitete uns ob seiner felsigen Beschaffenheit ungemeine Schwierigkeiten.
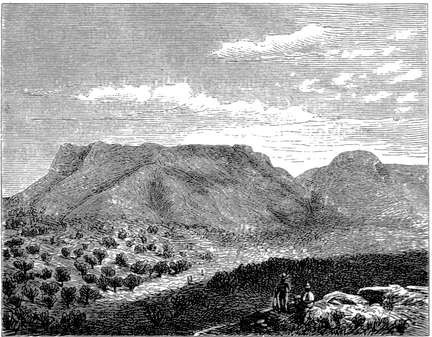
Platberg bei Rietfontein.
Bei meinen kleinen Ausflügen in der Umgegend der Farm Dornplace am Molapo fand ich auch den vom Eigentümer desselben erwähnten Felsensee (Joubert-See), wohl der kleinste in Süd-Afrika, der in einem tiefen, etwa hundert Meter langen und etwa über fünfzig Meter breiten Felsenloche liegt; fünf Meter vom Ufer betrug die Wassertiefe circa zweiundvierzig Meter. Laut Angabe des Farm-Eigenthümers stand das Wasser in der Regenzeit bis zu 1½ Meter höher; derselbe glaubte auch, daß der See mit dem nahe vorbeifließenden, doch tiefer liegenden Molapo communicire. Ich denke, daß die unteren Felsen aus dem harten grauen Kalkstein bestehen und der kleine Felsensee am Grunde zahlreiche Grotten und Höhlen besitze und auch aus diesen gespeist wird. Die steilen Felsenwände waren von hellrostbraunen großen Klippschliefern, Felsentauben, Staaren und zahlreichen Bienen bevölkert. Herr Joubert bereicherte meine Jagdnotizen mit mehreren sehr interessanten Jagdbegebenheiten, darunter drei Löwenjagden. In früheren Zeiten schienen Löwen, namentlich die mähnenlose Art sich äußerst zahlreich am Molapo aufgehalten zu haben. Herr Joubert sowie andere Farmer des Molapo-Thales klagten über die Krebsschäden der Transvaal-Republik und gaben mir mit Joubert, dem Feldcornet an der Spitze, die Vollmacht, bei der englischen Regierung die Annexion des Molapo-Thales zu beantragen. Sie klagten namentlich über die willkürliche Handhabung der Gesetze, sowie, daß die Republik sie gegen die Barolongen nicht zu schützen vermöge, nachdem sie zuvor Concessionen zum Farmankauf und zum Ankauf von Landgebieten ertheile, welche nicht ihr, sondern den Barolongen angehören.
Am 30. aufbrechend, gelangte ich nach einer kurzen Fahrt zu der von mehreren Familien bewohnten Farm Rietvley, spät Nachmittags nach Poolfontein. Früher eine Farm, ist es jetzt eine Niederlassung von Barolongen unter dem Häuptling Matlabe; der Stamm wurde aus der Umgegend von Potschefstroom hieher angesiedelt. Hier war auch Herr Hansen als Mitglied der Hermannsburger Mission thätig, doch gehörte der größte Theil der Bevölkerung dem wesleyanischen Bekenntniß an. Eine in dieser Gegend zu Tage kommende Quelle entspringt aus einem der tiefen Löcher des harten grauen Kalksteines, in der Umgegend stieß ich auch auf einen tiefen kleinen Felsenweiher, der sich durch eine schwimmende Grasinsel auszeichnete.
Noch am selben Abend verließ ich die Barolongen (Stamm der Ba-Rapulanen), welche fleißig den Ackerbau betreiben. Die Reise in den folgenden Tagen bis an den Harts-River, den wir eine Tagreise oberhalb Mamusa überschritten, führte durch die wildreichen Quagga-Ebenen. Das Gras war niedrig, die Gegend ziemlich trocken und in Folge dessen das Wild, das sich in wasser- und grasreichere Gegenden zurückgezogen, seltener. Die Quellen des Maretsane-Flusses berührend, fand ich die seichte Thalvertiefung ziemlich reich an Niederwald. Am 1. langte ich bei einem großen Salzsee an, der ähnlich wie der Moffat-See von Wassergeflügel reichlich belebt war. Leider erkrankte ich hier abermals am Fieber und so war ich hier sowohl am Kalverts- wie an einem nahen zweiten, dem Helmor-Salzsee in der Jagd nicht besonders glücklich.
Am 4. November weiterziehend, besuchte ich den Harm-Salzsee, an dessen Ufer einige Boers in äußerst ärmlichen Verhältnissen von der Jagd und vom Salzgewinne lebten; an den folgenden Tagten passirte ich den Mackenzie- und Livingstone-Salzsee und langte nach einer mehrstündigen Fahrt über sumpfartig aufgeweichtem Boden bei einem von hohen Binsen umsäumten Weiher an, in dessen Mitte ein tiefes Felsenloch zu liegen schien. Als wir uns der Stelle näherten, wurden wir förmlich von dem Geschrei betäubt, das uns von seinen befiederten Bewohnern tausendstimmig entgegenschallte. Ich glaube, es ist der einzige seiner Art auf den Ebenen des Harts-River und Molapo. Wir schlugen in zwei verlassenen holländischen Jagdhütten, um welche ringsum ein wahres Golgatha von Antilopen- und Gnu-Knochen errichtet war, unser Nachtlager auf. Ich bedauerte, daß mir zur gründlichen Untersuchung des Sumpfes ein Kahn fehlte. Außer den mannigfachsten Sumpf- und Wasservögeln waren es namentlich Finken, welche im Uferschilfe hausten; ein seltenes Schauspiel brachte der Abend tausende und tausende von Schwalben kamen von ihrer Tagesjagd von den unabsehbaren Ebenen herangeschwärmt, um daselbst zu übernachten.
Am 9. überschritten wir zum ersten Mal den Harts-River, der durch Regen angeschwollen, die Durchfahrt nicht wenig gefährdete. Den Harts-River entlang ziehend, erreichten wir am 10. Mamusa und am folgenden Tage Houmans-Vley. Während des Marsches fing ich einen mächtigen Landleguan. Ich wurde von dem Farmer S. F. Houman freundlich aufgenommen; derselbe machte mich auf einige Pavian-Skelete aufmerksam, welche auf dem Abhange zum Harts-River lagen und erzählte mir folgende Jagdbegebenheit. Er war vor einigen Wochen von vier Hunden gefolgt, ausgeritten, um einige vermißte Schafe aufzusuchen. Als er heimkehrend sich etwa auf zwei Meilen seinem Hause genähert hatte, traf er eine dreißig Stück zählende Pavianheerde an. Trotz der Müdigkeit jagten die Hunde sofort auf dieselben los, doch wurden sie von diesen übel zugerichtet. Während sich die meisten Affen auf Bäume flüchteten und so die Hunde zerstreuten, warfen sich einige der größeren Thiere zu gleicher Zeit auf je einen Hund. Der unbewaffnete Farmer sprengte nun mit dem Pferde auf die Affen ein und trennte das stärkste Männchen von der Truppe. Auf dieses hetzte er seine muthigen vier Hunde, doch der Affe warf sich dem vordersten so geschickt entgegen, daß er ihm mit seinem furchtbaren Gebiß die Kehle ausriß. Im nächsten Momente hatte der zweite Angreifer ein gleiches Schicksal erlitten und beide Hunde waren wenige Augenblicke später verendet, die beiden anderen, noch jungen Hunde suchten unter dem Pferde Schutz. Aufgebracht über den Verlust der Hunde eilte der Farmer heim, bewaffnete sich und erlegte sechs Paviane.
Bevor ich noch von meinem Gastfreunde schied, theilte er mir noch etwas über seine Abstammung mit. Sein Vater stammte aus Mecklenburg, wo er durch Unvorsichtigkeit den Tod zweier seinem Vater angehörenden Rennpferde verschuldete. Aus Furcht vor der Strafe verließ er mit einem Kaufmannsschiffe die Heimat, kam in Capstadt an und siedelte sich später hier an.
Am 14. verließ ich die Farm und zog weiter südlich und südwestlich nach der Hallwater-Farm, welche ich von zahlreichen Koranna’s bevölkert fand. Je näher ich den Diamantenfeldern kam, desto trüber wurde meine Stimmung. Ich hatte kaum 2 £ St. im Vermögen, dagegen eine Schuld von 120 £ St. an Herrn Jensen zu bezahlen, ohne daß ich je hoffen konnte aus dem Verkaufe von Wagen und Ochsen diesen Betrag herauszuschlagen, da solche in Diamantenfeldern billiger als in der Transvaal-Republik erstanden werden können.
Am 20. langte ich in Christiana an und machte hier die interessante Bekanntschaft eines Händlers mit Namen Sanders, der an der tropischen Westküste Afrika’s gereist war. Das Vaal-Riverthal nach abwärts ziehend, stellte sich am 23. bei mir ein neuer heftiger Fieberanfall ein und krank erreichte ich am 26. Kimberley.
[18] Von den achtzig Kranken waren mehr als siebzig mit Lues behaftet.
Wiederaufnahme der ärztlichen Praxis. — Mein neues Heim und kleiner Thiergarten in Bultfontein. — Ausstellung meiner Sammlung im Varieties-Theater zu Kimberley. — Ausflug nach der Farm Wessels. — Die Gravirungen der Buschmänner. — Hyänen- und Erdferkeljagden. — Meine Broschüre über die Eingebornenfrage. — Irrige Auffassung derselben in England. — Ernste Zeiten für die Colonie und Griqualand-West. — Major Lanyon und Colonel Warren. — Aufbruch nach der Küste.

Fingoknabe.
Von allen Mitteln entblößt, traf ich zum vierten Male in den Diamantenfeldern ein. Nach einundzwanzigmonatlicher Abwesenheit von denselben konnte ich mir die Schwierigkeiten nicht verhehlen, welche sich mir bei der Wiederaufnahme meiner ärztlichen Praxis entgegenstellten, ich war neuerdings fast fremd geworden und doch bot mir die Praxis die einzige Gelegenheit, meinen Verpflichtungen nachzukommen. Unwillkürlich regte sich in mir der Wunsch zur Herstellung meiner erschütterten Gesundheit in die Heimat zurückzukehren. Der Gedanke, das mir selbst gestellte Problem nicht gelöst zu haben, verbannte jedoch denselben vorläufig aus meiner Seele. In dieser drückenden Lage entschloß ich mich schon einige Tage nach meiner Ankunft eine Ausstellung der gesammelten naturhistorischen und ethnographischen Objecte zu veranstalten, um mit dem Ertrage derselben später die Heimreise antreten zu können. Da ich Herrn Werner von meiner Ankunft in Kenntniß gesetzt hatte, fand sich dieser schon am ersten Tage außerhalb Kimberley bei mir ein und lieh mir unaufgefordert eine Geldsumme, welche es mir gestattete, die geplante Ausstellung in’s Werk zu setzen. Ich zog deshalb mit meinem Wagen nach Bultfontein, wo ich einfacher und zurückgezogener leben konnte. Zudem fand sich gerade ein einsames Häuschen in der Nachbarschaft meines Freundes, der, obwohl jetzt verarmt, mir doch in meiner Krankheit treue Pflege angedeihen ließ. Die gemiethete Wohnung bestand in einem aus Lehm ausgeführten viereckigen Zimmer, hatte einen einfachen Lehmboden und war mit Zinkblech gedeckt, welche Bedachung den Aufenthalt namentlich im Sommer recht unerträglich machte.
Hier hatte ich nun meine Sammlungen untergebracht und wohnte mit meinem Freunde Eberwald, welcher mir die ganze Zeit treu zur Seite stand und unter meiner Aufsicht die Medicamente für meine Patienten bereitete. Das Geschick war mir hold, schneller als ich es je zu hoffen gewagt, vermehrte sich meine Praxis und hob meinen Muth; mit einiger Beruhigung konnte ich in die nächste Zukunft blicken. Vor meinem Häuschen standen die Ruinen einer dachlosen Küche, in dieselbe stellte ich den mit Herrn Eberwald zu Anfang des Jahres 1877 gearbeiteten großen Löwenbehälter, während ich im Umkreise derselben die Höfchen, Behälter und Käfige für meine vierfüßigen Thiere und Vögel errichtete. Leute, die aus der Colonie, aus dem Oranje-Freistaate aus dem Transvaal-Gebiete etc. nach den Diamantenfeldern kamen, verfehlten nicht, meine zahmen Thiere (die meisten waren vollkommen gezähmt) anzusehen und brachten mir bei späteren Besuchen andere seltene Thiere mit.
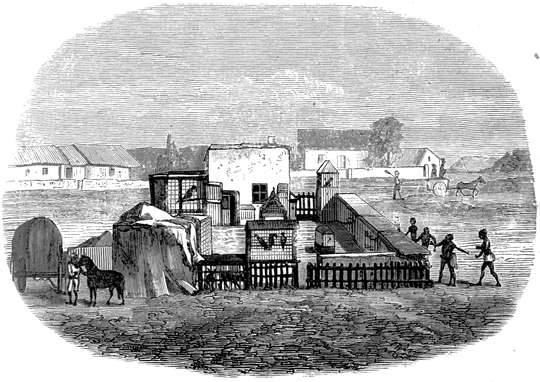
Mein Haus in Bultfontein.
Als sich im Jahre 1878 meine Praxis bedeutend vermehrt und Freund Eberwald, mein Apotheker, alle Hände vollauf zu thun hatte, wurde die Pflege der Thiere zwei Schwarzen übergeben, welche es leider an Sorge und Nahrung fehlen ließen. Durch die Einflüsse der Witterung kamen manche der Behälter, welche ich so groß wie möglich und der Lebensweise der Thiere angemessen, construirt hatte, zu Schaden. Einzelne Thiere entwichen und wurden von der umwohnenden, freien schwarzen Bevölkerung erschlagen und verzehrt, andere wieder nicht richtig gepflegt und so hatte ich, bevor ich die Diamantenfelder verlassen konnte, mehr als zwei Drittel meiner Pfleglinge verloren. Um die großen, bald pyramiden-, bald thurmähnlich geformten Käfige für kleinere Vögel hatte ich Epheu und Lianen gepflanzt, so daß die armen Gefangenen im natürlichen Laubschatten gegen die senkrechten Strahlen der afrikanischen Sonne geschützt, munter umhersprangen und sangen. Der beschränkte Raum gestattet es mir nicht, meine zweijährigen Beobachtungen an meinen Gefangenen hier mitzutheilen, ich muß mich mit der Specification derselben begnügen. Vor Allem muß ich meines Löwen erwähnen, der mir ungewöhnlich anhänglich war, obwohl ich ihn der Besuche halber im Käfige halten mußte. Oft steckte er seine Vorderpfoten aus dem Käfige, um mich zu umarmen und gab mir seine Anhänglichkeit durch Liebkosungen zu erkennen. Ich refusirte ein Offert von 100 £. St., als er fünf Monate alt war und verlor ihn später, nachdem er mich das Doppelte gekostet. Als ich vierzehn Tage behufs Gewinnung der Felsgravuren der Buschmänner im Oranje-Freistaate weilte, wurde sein Käfig nicht gut gereinigt und ich erkannte leider seine Todesursache zu spät. Er erlag einer Amoniämie. Wenn er während seiner Krankheit mich zufällig auf meinem Mosco vom Krankenbesuche heimkehrend, erblickte, sprang er so plötzlich und unerwartet auf, daß die Besucher meines kleinen Thiergartens auseinander stoben, während er sich schon an die weit von einander abgehenden Gitterstäbe schmiegte, um sich von mir streicheln zu lassen.
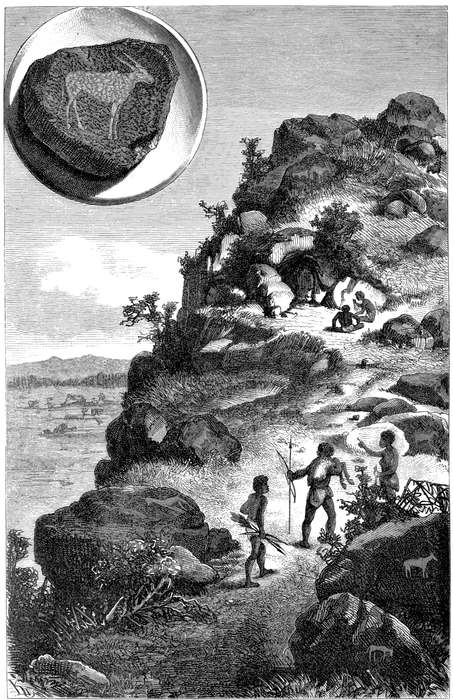
Felsen-Gravirungen der Buschmänner.
Ich hatte Schakale, die wiederholt wegliefen und wiederum zurückkehrten, Springhasen, die sich wie Säuglinge hätscheln ließen, doch sie alle konnten mir nicht den Verlust meines jungen Löwen »Prinz« ersetzen. Als es mit ihm schon stark bergab ging und er nicht mehr aufrecht stehen konnte, schleppte er sich, sowie er nur meine Stimme hörte, gegen das Gitter hin. Ich hatte in meinem Thiergarten weiters Meerkatzen und Paviane, Igel, Rohrrüßler, einen Caracal, Mangusten, das schwarz-weiß gestreifte Wiesel, Schabrakenschakale, Wolfshyänen, Springhasen, Berghasen und Erdeichhörnchen, gestreifte und Blindmäuse, Schuppenthiere, Steenbock-, Deuker- und Springbockgazellen und einen Klippschliefer etc., von Vögeln nenne ich drei braune südafrikanische Adler, einen Schopfadler, zwei Arten von Gabelweihen, Rothfalken, sowie Sperberarten, ferner Schlangenadler, braune und schwarze Aasgeier (Gyps socialis), zwei Arten Uhu’s, Ohreulen, Papageien, Mandelkrähen, schwarze und weißgescheckte Krähen, Kernbeißer und insectenfressende Singvögel, einen Tukan, Fischreiher, verschiedene Wildgänse, einen Pelikan, einen Schlangenhalsvogel u. a. m.
Im Jänner des Jahres 1877 war ich, wie schon erwähnt, im Stande, im Varieties-Theater in Kimberley eine Ausstellung meiner Sammlungen zu veranstalten. Ich muß gestehen, daß mir diese Ausstellung, so viele Freunde sie mir auch schuf, materiell keinen Nutzen brachte, im Gegentheile mich in Schulden stürzte und ich gezwungen war, um mir die Mittel zur Rückkehr nach Europa zu verschaffen, neuerdings meine ärztliche Praxis aufzunehmen und die Gesammtersparnisse des Jahres 1877 auf Tilgung meiner Verpflichtungen zu verwenden.
Obgleich die Diamanten wieder im Preise gesunken, waren doch der anhaltenden Dürre halber Cerealien theurer wie je; daher war es mir willkommen, ein tüchtiges Roß als Reitthier zu erwerben, welches mir dieselben Dienste leistete, als drei oder vier Pferde im Jahre 1873. Die zunehmende Praxis im Jahre 1878 hatte meine Gesundheit — denn ich bin bis jetzt noch immer kränklich gewesen — nicht gebessert, so daß ich in der Zeit, zu welcher sich alle meine Patienten bis auf zwei Kinder bedeutend wohler fühlten, die Diamantenfelder verließ, und mich für kurze Zeit auf eine der Farmen in dem nahen Freistaate begab, wo ich von dem Besitzer, Herrn Wessels, freundlich aufgenommen und mir ein Haus zur Verfügung gestellt wurde. Auf dem Gebiete dieser Farm fand ich die schon vor mir von dem Geologen Georg Stow und Kapitän Warren besichtigten Gravirungen der Buschmänner, welche diese auf Bergeshöhen anbrachten.
Im Aussterben begriffen, bewohnen die Reste dieses Stammes einzelne Theile der Cap-Colonie und haben bis heutigen Tages den Einflüssen der Civilisation sich zu entziehen gewußt. Einst bewohnten sie felsige Höhen und die Höhlen an den schroffen Abhängen derselben in der Cap-Colonie und im Oranje-Freistaat. Sie scheinen die ältesten Bewohner Süd-Afrika’s zu sein und ein Theil derselben sich mit den vom Norden andrängenden Banthu-Familien zu den Masarwa’s, ein anderer Theil mit den noch früher aus Nordnordosten einwandernden Hottentoten verschmolzen zu haben.
Von ihren Felsenhöhlen erspähen sie das Wild auf den Ebenen und jagen es mit Bogen und Pfeil. Auf so tiefer intellectueller Stufe sie auch standen, vermochten sie es, die Felswände der von ihnen bewohnten Höhen mit Ockermalereien — Thiere, Schildkröten, Leguane, Schlangen und Thierkämpfe, sowie Kämpfe mit den sie bedrängenden Banthu’s, die Gestirne und andere in die Augen fallende Objecte darstellend — zu verzieren. Als das Wild nach und nach von den eingewanderten Europäern erlegt worden war, stiegen die Buschmänner von ihren Höhen herab, um die Heerden der Weißen zu erbeuten, welches Vorgehen einen gegen sie eröffneten Vernichtungskampf zur Folge hatte. Der wahre Buschmann (es gibt zu viele Mischlinge) liebt seine Felsenhöhen leidenschaftlich, und hat er sich auch als Diener vermiethet, oder ist er, wie in früheren Zeiten, dazu gezwungen worden, so entflieht er bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit, stiehlt ein Schaf und eilt seinen Höhen zu. Fälle treuen Ausharrens bei ihren Dienstherren sind selten. War man bisher gewohnt, dem Buschmann eine der tiefsten Stufen im Menschengeschlechte einzuräumen, so wird man diese Meinung aufgeben, sobald man seine Arbeiten näher kennen gelernt hat.
Kein Stamm in Süd-Afrika bis tief nach Central-Afrika hat so viel und wahre Kunstfertigkeit in der Bearbeitung des Gesteins entwickelt, als der Buschmann. Seine Geräthe sind sowohl aus Holz, Bein und der Schale des Straußenei’s als auch aus Stein gearbeitet. Seine Langweile hat er sich mit Steinausmeißelungen vertrieben, die abermals mit Steininstrumenten ausgeführt wurden und mit diesen seine ureinfachsten Wohnsitze verherrlicht, seinen Kunstsinn bewiesen und sich Denkmäler gesetzt, die Alles überdauern werden, was die übrigen hier lebenden Stämme der beiden anderen südafrikanischen Völkerfamilien, der Hottentoten und Banthu, geleistet haben.

Grabstichel.
Die Zeichnungen in ihren Höhlenwohnungen sind mit verschiedenfärbigem Ocker, meist auf Sandstein ausgeführt. Der Geologe Stow hat diesen Arbeiten besondere Aufmerksamkeit gewidmet und zahlreiche Copien derselben verfertigt. Ich hoffe auf meiner nächsten Forschungsreise nach Afrika die größten Exemplare derselben zu erlangen, die von den Höhen herabzubefördern mir diesmal aus Mangel an nöthigem Werkzeuge und Arbeitskräften unmöglich war.
Die gesammten Buschmann-Curiositäten zerfallen in zwei Classen, und zwar in Utensilien und Steinausmeißelungen. Zu den ersteren gehören: Dreieckige, pfeilspitzartige Kieselschiefer etc., mit denen die Contourlinien der Zeichnungen eingravirt und sonstige Hausarbeiten verfertigt wurden, ferner Beschwersteine, welche an das obere Ende eines unten angekohlten, zugespitzten 1½ bis 3 Fuß langen Stockes angeheftet, mit dessen Hilfe eßbare Wurzeln ausgegraben oder wasserhaltige Stellen aufgescharrt wurden. Oft findet man Steine mit nur theilweise ausgeführter Höhlung, welche mit Hilfe eines Sandschmirgels und eines anderen Gesteinstückes herzustellen versucht wurde. Was die Steingravirungen anbetrifft, so sind diese an vielen Höhen blos in geradlinigen oder in unzusammenhängenden schiefen Strichen ////// dargestellte Objecte, an anderen jedoch vollkommen ausgemeißelt. Solche Stücke gehören zu den Besten ihrer Art und ich glaube, daß die von mir mitgebrachten achtzehn Gravirungen bis zum heutigen Tage Unica in Europa sind.
Von den aus Herrn Wessel’s Farm mitgebrachten Stücken sind namentlich folgende als gute Arbeiten hervorzuheben: Oberkörper eines Buschmann’s; Buschmannsfrau eine Last tragend; Linke Sohle eines erwachsenen Buschmann’s; Strauß mit Reiter; Strauß von einem Nashorn gestoßen; Roibock-Gazellen; Eland-Antilopen; Buntbock-Antilope; Kopf einer Gemsbock-Antilope; ein Gnu; ein Rind; ein Schakal eine Gazelle jagend.
Während meines Aufenthaltes auf dieser Farm im westlichen Gebirge des Oranje-Freistaates gelang es mir, eine große Anzahl von Insecten, Vogelbälgen und Pflanzen, zu erwerben und bevor ich noch die gastliche Stätte verließ, nahm ich, von den umwohnenden Farmern dazu eingeladen, an zwei interessanten Jagdausflügen Theil. Beide wurden von einer größeren Anzahl von Berittenen und Eingebornen zu Fuß mit einer Meute unternommen, und galten der Verfolgung der gestreiften Hyänen und Erdhöhlen-Thiere. Mein Hauptzweck dabei war, womöglich lebende Stachelschweine, Springhasen und Erdferkel zu erjagen. Die erste dieser Jagden wurde bei Tage unternommen; wir umstellten zu Pferde eine Felsenhöhe und sandten die Treiber mit den Hunden hinauf, leider vergeblich, denn die Hyänen hatten sich schon geflüchtet.
Die Gegend, in welcher die zweite Jagd abgehalten werden sollte, wurde von großen bebuschten und mit zahllosen brodlaibförmigen Termitenhügeln bedeckten Grasebenen gebildet, welche ringsum, namentlich aber von Osten, von mit Gebüsch bestandenen Felsenhöhen umsäumt waren. Jeder der an der Jagd theilnehmenden Farmer hatte einige Hunde mitgebracht, welche die Spur der ihre Höhlen verlassenden Nachtthiere aufnehmen sollten. Die von meinen Freunden für unseren Ausflug gewählte Nacht war unstreitig eine der reinsten und schönsten Mondscheinnächte, die ich in Afrika erlebte. Da ich den Tag über entferntere Höhen der Gravirungen der Buschmänner halber besichtigt hatte und auch am folgenden Tage einen längeren Ausflug unternehmen wollte, ließ ich meinen Rappen daheim und ritt ein mir von meinem Gastfreunde geliehenes Pferd, das an die Gegend gewöhnt, mir bessere Dienste zu leisten versprach. Endlich wurde das Zeichen zum Aufbruch gegeben und die Hundemeute zur Aufnahme der Spur angefeuert. Wir mochten etwa sieben Minuten hingaloppirt haben, als zu unserer Rechten am Fuße der Höhe das Hundegeheul vernehmbar wurde. Mit einem lauten »Hurrah!« spornten wir die Pferde an und aufwärts ging es durch das niedere Gestrüpp, wobei wir unseren Rennern die Zügel schlaff anliegen ließen, da wir die vor uns im Grase zerstreut liegenden Felsenblöcke nicht sehen konnten und das Ausweichen ihnen überlassen mußten. Wir sahen vor uns einen sich wälzenden Hundeknäuel, in dessen Mitte zeitweilig etwas Weißliches aufglitzerte. Es war ein Stachelschwein, das die Hunde förmlich zerrissen hatten. Unter den Säugethieren hat die Natur, abgesehen von dem Stachelkleide, diese Thierspecies mit einer so gebrechlichen Haut versehen, daß ein Raubthier beim Gebrauche seiner Fänge das Thier zu zerfleischen im Stande ist. Kaum zur Stelle, waren wir herabgesprungen und hieben auf die Hunde los, doch es war zu spät, und so fiel das Stachelschwein den eiligen Basuto’s als Beute zu. Ein ähnliches Schicksal hatten zwei andere Stachelschweine, ein Springhase und ein schwarzweiß gestreifter Mäusehund (das südafrikanische Stinkthier).
Einer frischen Spur folgend, waren die Hunde nach der Attaque auf den Mäusehund in einem Bogen nach der Höhe zurückgegangen und stießen auf ein Erdferkel (Orycteropus capensis). Von den Hunden gehetzt, trachtete sich dieses in ein Erdloch einzugraben und hatte dies schon theilweise ausgeführt, als wir zur Stelle gelangten. Trotz der vereinten Anstrengungen unserer schwarzen Diener entkam das Erdferkel nach seinem Baue, nachdem es die bei der Ausgrabung beschäftigten Männer wie Bälle bei Seite geworfen hatte. Unter den Zahnarmen ist unstreitig das Erdferkel das stärkste Thier. Seiner Gestalt nach länglich, walzenförmig, besitzt es lange, mächtige Nägel an seinen Scharrhänden, deren Muskulatur einzig in ihrer Art genannt werden darf. Dem länglichen, walzenförmigen Körper ist der fleischige, keilförmige Schwanz eine besondere Stütze. Im Nothfalle gebraucht ihn das Thier zur Vertheidigung, sonst meist auf der Flucht, wenn es in weiten Sätzen enteilt. Auch bedient es sich seiner, wenn es in hockender Stellung die Termitenhaufen ausgräbt, denn es ist einer der größten südafrikanischen Termitenfresser. Es besitzt eine sehr dicke, beborstete Haut, welcher Schakalfänge wenig anhaben können; außerdem ein Paar lange Lauscher, welche ihm sehr zu statten kommen. In der Colonie bedient man sich der Haut, um daraus die kurzen, gedrehten Doppelriemen (Strappen) zu verfertigen, die man den Zugthieren anlegt. Außer ihm stellen unter den Vierfüßlern den Termiten namentlich das kurzschwänzige Schuppenthier, die Wolfshyäne, die Mangusten und unter den Vögeln besonders die Kiebitze nach.
Nachdem wir so den eigentlichen Zweck unserer Jagd nicht erreicht hatten, gaben wir jeden anderen Versuch auf und ritten langsam heim. Auf diesen Mißerfolg hin trachteten ich, sowie meine Freunde, einiger lebender Thiere habhaft zu werden. Es gelang mir auch, zahlreiche Vögel zu gewinnen, von denen jedoch die meisten, und darunter namentlich die Siedelsperlinge, zu Grunde gingen. Auf einem von dieser Farm aus unternommenen Ausfluge erspähte ich in einem Neste der letztgenannten eine an fünf Fuß lange Cobra. Es gelang mir jedoch nicht eher das Thier zu erlegen, als bis es viele der auffliegenden alten Vögel getödtet, und eine Menge der Jungen und Eier verschlungen hatte.
Die Zeit meines letzten Aufenthaltes in den Diamantenfeldern in den Jahren 1877—78 war, namentlich aber das letztere, für Süd-Afrika von großer Bedeutung. Ich erinnere den Leser an den Krieg, den die Colonie mit den an ihrer östlichen Grenze, sowie Griqualand-West mit den westlich wohnenden Stämmen zu führen hatten, Kriege, welche das Vorspiel zu dem Kampfe mit den Zulu’s bildeten. Auch erwähne ich der Einverleibung der Transvaal-Republik in den Verband englischer Colonien. Meine unmaßgebliche Meinung geht dahin, daß diese Ereignisse für den ganzen südlichen Theil Afrika’s von größter Bedeutung waren, namentlich rücksichtlich der Lösung der Eingebornenfrage.
Ich erlaubte mir im April des Jahres 1877 meine Ansicht über diesen Gegenstand in einer kleinen, sechzehn Seiten zählenden Broschüre: »A few words on the Native Question« niederzulegen, und da so manches, was ich in derselben besprach, seither in Erfüllung ging, will ich hier einiges daraus dem Leser vorführen. Die Behandlung und Lösung der Eingebornen-Frage, welche einen Vergleich mit den Verhältnissen in Süd-Afrika anzustellen mich angeregt, anderseits die ehrenvolle Aufforderung hervorragender Männer in Süd-Afrika gaben mir Veranlassung, meine Ansichten in jener Broschüre darzulegen. Die Ereignisse der letzten Jahre bis zum Zulukriege zeigen uns wohl, daß England in Südafrika, wenn auch in anderer Weise als in Nordamerika, größere Erfolge als andere Colonisatoren auf dem Festlande Afrika’s errungen hat. Im Allgemeinen war die Behandlungsweise eine ähnliche; allein das Eingebornen-Element ist in seinem Charakter von jenem Nordamerika’s verschieden, weshalb eine gleiche Behandlung desselben unmöglich Erfolg versprechen konnte, umsomehr, da es namentlich zwei Vorurtheile gab, welche die europäischen Colonisten beherrschten. Das erste derselben sah in den Eingebornen trotz ihrer angewohnten Laster die unschuldig Bedrückten; das zweite im Gegensatze hiezu erblickte in den Schwarzen den Weißen inferiore, kaum menschlich zu nennende Creaturen. Jene, welche eine gemäßigtere Ansicht hatten, waren sowohl der Zahl als ihrem Einflusse nach die Schwächsten und meist praktisch denkende Menschen, welche als jahrelange Nachbarn in das Leben der Eingebornen leicht Einblick nehmen konnten.
Als ich im Jahre 1875 jene Broschüre schrieb, war mir das Letztere nicht bekannt, ich fand erst später, daß meine Idee mit jener vieler erfahrener Colonisten übereinstimmte; sie gewann auch später die Oberhand und wurde zur Staatsraison. Es gibt in Süd-Afrika Eingebornenstämme, welche gegenwärtig in ihrer geistigen Beziehung, in ihrer Auffassung etc. einem gewöhnlich entwickelten Kinde aus unserer Mitte von etwa fünf bis sechs Jahren nicht unähnlich sind. Spezielle Charakter-Eigenthümlichkeiten einzelner Eingebornenstämme erklären uns ihre mindere oder höhere Culturstufe ähnlich wie Geistes- und Gemüthsanlagen die Kinder einer europäischen civilisirten Familie untereinander unterscheiden. Gutmütigkeit als Charakterzug bei dem einen, Sinn für Industrie bei einem zweiten, Hang zum Diebstahle oder Raubsucht bei anderen Stämmen finden wohl theilweise in der größeren oder geringeren Gehirnmasse ihre Erklärung. Die Hottentotten, Griqua’s und Koranna’s können wir füglich mit Kindern vergleichen, welche sich willenlos von ihren Gespielen leiten lassen und namentlich nach allem Glitzernden haschen. Eben deshalb wäre es verfehlt, den südafrikanischen Eingebornen ohneweiters die Rechte eines Gebildeten einzuräumen, selbst dann, wenn diese auf mechanischem Wege sich Lese- und Schreibkenntnisse erworben haben. Von größtem Werthe scheint es mir, ihnen in einer leicht verständlichen, leicht ausführbaren Weise die richtigen Begriffe der Arbeit, den Bau der Wohnung, die Pflege und Ernährung des Körpers, den Feldbau, die Viehzucht, beizubringen und sie dabei zu unterweisen, wie sie ihren Nebenmenschen, ihren ungebildeten Stammesbrüdern, andererseits dem Weißen gegenüber sich betragen sollen.
Einer der furchtbarsten Feinde der Civilisation war bis jetzt noch der Aberglaube. Ich bin der Ansicht, daß wir denselben auf keine andere Weise erfolgreich bekämpfen können, als indem wir die Eingebornen Süd-Afrika’s sich ihre Lebensbedürfnisse ohne Inanspruchnahme des vermeintlichen Einflusses der Zauberer, Fetische und Regenbeschwörer gewinnen lehren.
Ich erlaubte mir, die Regierung darauf aufmerksam zu machen, daß den südafrikanischen Schwarzen eine andere Zukunft bevorstehe, als den Indianern Nordamerikas und daß man aus diesem Grunde gewisse Krebsschäden, welche jene decimirten, von ihnen fernhalten müsse. Zu solchen Maßregeln gehört die Beschränkung oder die vollkommene Sistirung des Branntwein-Verkaufes an die Schwarzen in den Kolonien, sowie das strenge Verbot, das Feuerwasser nach den nachbarlichen, unabhängigen Eingebornenländern einzuführen. Einige der Stämme kamen uns schon jetzt hilfreich entgegen, indem bei ihnen die Einfuhr sowie der Verkauf des Feuerwassers nicht gestattet ist, und ich fühle mich glücklich, sagen zu können, daß gegenwärtig dieses Verbot wenigstens in einem Theile Afrikas gewiß zum Vortheile der dunklen Bevölkerung wie des weißen Mannes selbst zur Geltung gekommen ist. Ferner erlaubte ich mir, darauf hinzuweisen, daß sowohl die Regierung, als auch der einzelne Weiße im Umgange mit den verschiedenen Stämmen den Charakter derselben, sowie jenen der Häuptlinge wohl berücksichtigen müsse, ferner, daß die Ansuchen gewisser Eingebornenherrscher um Einverleibung ihres Gebietes in den Verband englischer Colonien äußerst vorsichtig aufzunehmen sind.
Was ich darüber in meiner Broschüre erwähnte, hat sich später in Bezug auf den Batlapinen-Fürsten Mankuruan, den Bakwena-König Seschele, ferner an den Damara’s und an Khama, dem Bamangwato-Fürsten, als richtig erwiesen; ich glaube auch daß meine Schilderung des Zulu-Charakters eine getreue war. Ich bin längst von der Ansicht abgekommen, daß, nachdem die Zulu-Macht gebrochen worden, Großbritannien seinen Colonialbesitz in Süd-Afrika weiter ausdehnen solle. Ich glaube, daß der stabile Aufenthalt eines oder mehrerer Vertreter (Commissaire) an den Höfen, sowie Handels- und Colonisations-Verträge mit den einzelnen und mächtigeren Eingebornenkönigen des centralen Süd-Afrika und des südlichen Central-Afrika für die endliche Erschließung des Erdtheils die besten Erfolge versprechen, jedoch unter der Voraussetzung, daß Gewehre und Munition als Handelsartikel ausgeschlossen bleiben.
In Europa war bisher die irrige Ansicht verbreitet, daß die Engländer in Süd-Afrika alles Land gierig verschlingen, dessen sie nur habhaft werden können. Die Gegner und Kritiker der englischen Colonialpolitik in Süd-Afrika scheinen jedoch nicht zu wissen, daß in den meisten Fällen die betreffenden Landstriche den Engländern formell von den verschiedenen Eingebornenherrschern angeboten wurden. Vor meiner dritten Reise schwärmte ich sehr für die rasche Eröffnung einer Handelsstraße nach Central-Afrika und dachte damals, es sei dies nicht anders erreichbar, als indem das Gesammtgebiet zwischen dem Vaal und dem Zambesi dem englischen Scepter unterworfen würde. Seither haben sich meine Ansichten über diese englische Machtvergrößerung geändert und ich weiß nun genau, daß Großbritannien die Annexion mehrerer spontan angebotener Eingebornengebiete ausschlug. Meine Broschüre war damals, eben am Vorabende mehrerer solcher Landabtretungs-Anbote von Seite mehrerer Eingebornenfürsten, geschrieben worden, und darum glaubte ich die Regierung darauf aufmerksam machen zu müssen, die größtmögliche Vorsicht dabei zu beobachten.
So heißt es in derselben: »Da sehen wir Mankuruan, den Batlapinen-König und einen der Batlapinen-Stämme, da den Barolongen-König Montsua u. A. vor uns. Sie gestehen, daß sie uns angehören wollen, bevor wir sie jedoch in den Verband unserer Unterthanen aufnehmen, stellen wir einige Fragen. »Ist es Euer eigener Wille, Ihr Könige, oder seid Ihr die Abgesandten Eures Volkes? Oder ist es die Ueberzeugung, zu der Ihr beide gekommen seid? Warum wollt Ihr Unterthanen der Königin werden? Beruht dies auf innigen Freundschaftsgefühlen den Makoa’s gegenüber, die Ihr Englishmans nennt? Oder ist dies weniger oder gar nicht der Fall und geschieht es, weil Ihr Euch vor dem anderen Stamme der Weißen, den Boers, zurückgesetzt fühlt, oder sie hasset oder fürchtet? Ihr sucht vielleicht unsere Freundschaft, weil Ihr von einem Nachbarstamme angefeindet werdet? Es mag jedoch auch sein, daß es zwei Herrscher in Eurem Reiche gibt und einer dadurch, daß er der englischen Regierung seinen Antheil, in Wirklichkeit jedoch das ganze Land anbietet, in dieser Weise die Oberherrschaft über seinen Nebenbuhler zu erringen sucht?
Haben wir auf diese Weise die Wahrheit über das Ebengesagte erfahren, so ist es nöthig, sich den Charakter des anbietenden Eingebornenfürsten und die Kulturstufe seines Stammes in allen Details klar zu machen und darnach zu handeln. So gestanden die vorerwähnten Damara zwei Jahre nach der Annexion ihres Gebietes ein, daß sie der letztgenannte der erwähnten Gründe bewogen hätte, die Oberherrschaft Großbritanniens anzusuchen.«[19]
Ich erwähnte, daß zur Zeit meines letzten Aufenthaltes in den Diamantenfeldern der Krieg mit den Colonial-Kaffern ausbrach, daß Griqualand-West, unsere Colonie, von ähnlichen Unglücksfällen heimgesucht wurde, daß jedoch in beiden Kriegen das Recht bald den Sieg davontrug. Wenn der Krieg in Griqualand-West, einem kleinen Ländchen mit wenigen Weißen, so rasch und mit so geringen Menschenverlusten und Unkosten glorreich zu Ende geführt wurde, so ist dies den beiden Umständen zu verdanken, daß der Colonie ein erprobter Militär als Gouverneur vorstand und die Diamantenfelder von beherzten unerschrockenen Männern bewohnt wurden. Ja, dies zeigte sich namentlich in der Geschichte dieser Provinz. Die Ereignisse und ihr Verlauf in den letzten drei Jahren mögen schlagende Beweise für diese Behauptung sein. Ich meine hier namentlich den Krieg, welchen diese Colonie mit den Griqua’s, Masarwa’s und Batlapinen und ihren Häuptlingen Mora, Donker-Maglas etc. zu bestehen hatte. Diese Eingebornen-Elemente, die zu denen gehören, welche gegen die Tugenden des weißen Mannes taub geblieben sind, waren durch andere unreine Elemente, aus dem Colonialkriege entwichene Rebellen, weggelaufene farbige Diener etc. verstärkt, von Westen her, von Kuruman und den Langbergen über die ihnen zunächst wohnenden Ansiedler plötzlich hergefallen, hatten sie getödtet und ihre Häuser geplündert, Unthaten, die eben zum Kriege führten. Die schwarzen Räuber rechneten namentlich darauf, daß Griqualand-West von der in einen Kaffernkrieg verwickelten Colonie keine Hilfskräfte erlangen und von Schutzmannschaft entblößt sei, sowie daß sich die Tausende der in den Diamantenfeldern arbeitenden Eingebornen im geeigneten Augenblicke erheben und so die Hauptader der Provinz in Schach haltend, diese durch das Niederbrennen der Gebäude und Ermordung der Bewohner auf lange hin vernichten, sich selbst jedoch und die Anstifter des Krieges mit der daselbst gewonnenen Beute widerstandsfähiger machen könnten, während sie selbst, die wahren Urheber, nach Gutdünken die Road-side hotels und stores (an den Feldwegen liegende Einkehrhäuser und Gehöfte), sowie die Farmen plündern würden.
Die Lage von Griqualand-West war damals gewiß eine kritische, ich selbst Zeuge der höchst gefährlichen Situation, in der sich damals die Weißen befanden. Zum Glück für Alle waren es beherzte Männer, welche nach dem Säuberungsprocesse in den Diamantenfeldern zurückgeblieben waren, glücklicherweise stand an der Spitze der Regierung ein Mann, der rasch die Situation überblickend, sich zurechtfand (der frühere Gouverneur Major Lanyon) und der in Colonel Warren, seinem Nachfolger im Commando und den gegenwärtigen Gouverneur der Provinz den richtigen Mann fand, der sich von keiner Gefahr einschüchtern ließ und rasch die besten Verfügungen traf. So hatten sie Alle, wahrhaft Uebermenschliches leistend, Griqualand-West befestigt, hatten ihre Frauen und Kinder vor einem schmählichen Untergange bewahrt und dem Weißen Achtung verschafft, ohne welche es diesen unmöglich wäre, mit den Farbigen im Frieden und Einklang zu leben.
Major Lanyon erließ einen Aufruf, in welchem er die Bewohner der Central-Diggings zur Verteidigung ihres neuen Heimatlandes anspornte und in wenigen Tagen waren über sechshundert wehrfähige Männer beisammen, welche sich bereit erklärten, ihr Blut für ihre Freunde und ihr neues Heim zu opfern. Von diesen waren etwa zweihundert Volontärs, die übrigen junge Leute, die sich unter sie aufnehmen ließen, oder Diamantengräber, die zu einem bürgerlichen Freiwilligen-Corps zusammentraten. Rasch wurden Pferde eingekauft und die Leute, ich möchte sagen Tag und Nacht gedrillt (einexercirt), wobei meist von früheren, als Diamantengräber, Diamantenkäufer oder in anderer Lebensstellung situirten Offizieren die nöthige Unterweisung ertheilt wurde. Durch etwa vierhundert Basuto’s (Betschuana’s vom Calcedon, reiche, Ackerbau treibende Eingeborne) verstärkt, zogen sie gegen den gemeinschaftlichen Feind, der bei einem Raubversuche überrascht, in seine Berge (Langberge und ihre Ausläufer) zurückgeworfen wurde. Es entspann sich nun ein Guerillakrieg. Hatte man einen felsigen, schon von Natur aus befestigten, mit Steinwällen durch die Eingebornen noch unzugänglicher gemachten Felsenberg erstürmt, so zog sich der Feind auf einen zweiten, und so weiter — Hügel auf Hügel mußte gestürmt und erobert werden und Colonel Warren bewies, daß er Feldherrntalent besitze und die Männer der Diggings, daß sie es verstehen »how to do their duty!«
Mit dem Ertrage meiner zunehmenden Praxis glaubte ich, etwa im December desselben Jahres, die Diamantenfelder mit Europa vertauschen zu können, doch konnte ich diesen meinen Vorsatz meines umfangreichen Gepäckes und der noch zahlreicheren lebenden Thiere halber nicht sobald ausführen. Die Fracht für die ersten beiden Sendungen, d. h. die während der ersten und zweiten Reise gesammelten naturhistorischen und ethnographischen Objecte hatte großmüthiger Weise Herr Naprstek in Prag beglichen. Auf meiner Rückreise hatte mir derselbe gütige Freund 20, die geographische Gesellschaft zu Wien 40 £ St. gesendet, welche Beträge jedoch kaum hinreichten, um mir einen Wagen, dessen ich zum Transport meiner lebenden Thiere nach der Seeküste bedurfte, anzuschaffen. Es war meine Absicht, nicht vor December die Rückreise durch die Kolonie anzutreten. Ich hoffte mir bis dahin nicht allein den noch fehlenden Betrag, sondern auch eine eventuell nöthige Reservesumme zu verdienen, um den Oranje-Freistaat und die Ostprovinz der Cap-Colonie zu einer Zeit zu durchreisen, zu welcher ich mit Sicherheit auf gute Weide für meine Zugthiere rechnen durfte. Ich hatte einundzwanzig Kisten mit den Sammlungen durch einen Transportrider (Miethswagen) nach Port Elizabeth vorausgesendet, wo sie von dem österreichischen Viceconsul, Herrn Allenberg, in seinem Waarenhause bis zu meiner Ankunft in Port Elizabeth aufbewahrt wurden. Ich selbst sträubte mich aber, mit einem Miethwagen zu reisen, weil ich die Rückreise durch den Oranje-Freistaat und die Colonie womöglich zu geognostischen und paläontologischen Studien benützen und nicht ein Sklave des Kutschers sein wollte.

Colonel Warren.
Ich gab meinen Vorsatz, im Dezember 1878 abzureisen, auf, da mich die Zusendung von 220 Pfund St. — 1000 fl. als hochherziges Geschenk Seiner Majestät des Kaisers, 60 Pfund St. vom böhmischen Landesausschusse und 200 fl. vom Vereine »Svatobor«, sowie ein Darlehen von 1000 fl. welches mir eine Gönnerin gewährte, — in den Stand setzten, sechs Monate früher die Diamantenfelder zu verlassen. Leider trafen mich auf der Rückreise von den Diamantenfeldern nach Port Elizabeth eine Reihe von Unfällen, welche einen großen Theil meiner zur Reise bestimmten Mittel verschlangen, so daß ich mich genöthigt sah, mich in Cradock niederzulassen und von Neuem als Arzt zu prakticiren. Im Monate August 1878 verließ ich endlich die Diamantenfelder und miethete als Wagenlenker einen früheren Diener eines mir bekannten Kaufmannes in Kimberley, außerdem nahm ich noch drei Kinder auf die Reise nach dem Süden mit mir.
Unter meinen Bekannten und Patienten in den Diamantenfeldern hatte sich namentlich ein Freund, mein unmittelbarer Nachbar in Bultfontein, durch seine Zuvorkommenheit hervorgethan. Ich dachte ihm nun meine Erkenntlichkeit dadurch am besten zu beweisen, daß ich einen seiner Knaben mit mir nahm und ihm die Oberaufsicht über die lebenden Thiere überließ, wobei ihn anfangs der braune Wagenlenker, später in der Colonie ein Fingo, in der Verrichtung der gröberen Arbeiten unterstützen sollte. Dafür versprach ich seinen Eltern, wenn er sich gefügig und brav verhalten würde, ihn in meiner Heimat erziehen zu lassen. Damit er mir jedoch während der Reise nicht zur Last falle und ich ungehindert meinen Forschungen nachgehen könne, gaben ihm seine Eltern eine kleine Betschuana-Dienerin, Bella, mit, welche ihm in seinen Arbeiten an die Hand gehen sollte.
Das dritte Kind war der dreizehnjährige Sohn eines Holländers mit Namen Schneemann, dessen Familie ich mehrere Wochen hindurch behandelt hatte und welcher mir aus Dankbarkeit öfter bei meinen Arbeiten half und mir sein ältestes Kind unter der Bedingung, ihn zum gebildeten Menschen zu erziehen, als Bedienten mitgab. Der arme Schneemann, ein biederer Charakter, war einer jener vom Mißgeschick Heimgesuchten, welche statt des erhofften Glückes und Reichthumes in den Diamantenfeldern Elend, Kummer und Sorgen einheimsten. Philipp, so hieß der Knabe, nahm es auf sich, das Gespann zu führen. Bevor ich noch die Meeresküste erreichte, sah ich mich in Cradock genöthigt, den erstgenannten Knaben seiner Nachlässigkeit halber heim zu senden. Auch Philipp Schneemann konnte dem Heimweh nicht widerstehen und so wurde er in Cradock seinem inzwischen in den Bürgersdorfer District übersiedelten Vater übergeben.
Von den Diamantenfeldern scheidend, kann ich nicht umhin, mit dankbarem Herzen meinen einstigen Patienten für ihr stets freundliches Entgegenkommen und ihre mir so vielfach erwiesenen Gefälligkeiten zu danken, sowie meinen besonderen Dank für die rege Teilnahme, den aufrichtigen Rath und die mir so oft erwiesenen Freundschaftsdienste den Herren: J. Wernherr, Alfonse Loewy, Ch. Hartley, R. Murray, Anthony Davison, Gebrüder Peizer, Stransky und Durack, Wessels und Söhne, R. M. Scholz, McKay, Burkner, Rothschild, Vries, den Familien der Herren A. Kerr, Pinkney, Proksch, Fuchs, Scholtz, Stow, Bult, Ch. Sonnenberg, Ch. Roberts; den Redactionen des »Independent«, der »Diamond News«, des »Diamondfield Advertisers«, sowie der nicht mehr bestehenden »Mining Gazette« und des »Diamondfield« auszusprechen. Desgleichen fühle ich mich veranlaßt, Fräulein Mathilde Proksch, gegenwärtig Vorsteherin eines »Young Ladies Institute« in Leydenburg, für ihre uneigennützige Fürsorge bei Durchsicht der in den englischen südafrikanischen Zeitungen veröffentlichten Artikel auf das Herzlichste zu danken.
[19] Vgl. den englischen Originaltext Anhang 7.
Abreise von Bultfontein. — Straußenzucht auf der Farm Ottersport. — Straußenzucht im Allgemeinen. — Meine erste Vorlesung in Colesberg. — Cradock. — Ein Unfall bei diesem Orte. — Der Zulu-Krieg. — Die Ursachen der Mißerfolge in der Behandlung der südafrikanischen Eingeborenen. — Meine Artikel über den Zulukrieg. — Kampfweise der Zulu. — Grahamstown. — Reiche paläontologische Funde. — Ankunft in Port Elizabeth. — Eine Löwenjagd. — Ausflüge in die Umgebung. — Meine marinen Sammlungen. — Meine Sammlungen in Gefahr. — Die letzten Tage auf afrikanischem Boden. — Heimfahrt nach Europa, Projecte für die Zukunft.

Bella.
Meine Rückreise von den Diamantenfeldern nach der Meeresküste erlitt eine längere Unterbrechung in Cradock, auch in Port Elizabeth und in der Capstadt war ich zu längerem Aufenthalt veranlaßt.
Mich nach Süden wendend, überschritt ich den Modder-River, dessen tiefes Bett uns während der Durchfahrt viele Schwierigkeiten entgegensetzte. Der Modder-River bildet tiefe, äußerst fischreiche Lachen. Sein Thal ist eigentlich eine tiefe, in den Laterit ausgewühlte Regenschlucht. Die steilen, mit dichtem Gebüsch und Bäumen bewachsenen Abhänge bieten zahlreichen Vögeln Schutz und Aufenthalt. Eine der wenigen anziehenden Scenerien an diesem Flusse ist jene an seiner Vereinigung mit dem Rietflusse. Stellenweise sind auch seine Uferwände, wie die des ebengenannten Zuflusses, schlammig (daher der Name Modder- oder Schlammfluß), Stellen wo so manch’ ermüdetes Zugthier der von den Colonialhäfen mit langen Gespannen nach den Diamantenfeldern ziehenden Fuhrleute einsinkend, sein Ende fand.
Ich berührte auf dieser Reise Jacobsdaal, welches seit meinem ersten Besuche im Jahre 1872 ansehnlich zugenommen hatte, und wandte mich dann gegen das Städtchen Philippolis. Auf dem Wege dahin passirte ich auch das Riet-River-Hotel. Die frühere Canwaß- und Eisenblechconstruction war nun zu einem massiven Steinhaus umgebaut worden und ich staunte nicht wenig, als mich der Hotelier mit den Worten begrüßte: »Waren Sie nicht vor sechs Jahren mit den Herren Michaelis und Rabinowitz in einem Karren hier eingekehrt?«
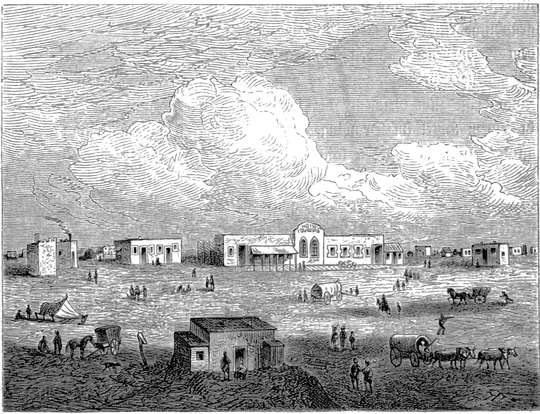
Jacobsdaal im Jahre 1872.
Auf der Farm Kalke fand ich einige Oolithgesteine und Fossilien, letztere nach Süden hin an Häufigkeit stetig zunehmend. Das einförmige, trostlose Landschaftsbild bewies mir, daß ich mich den Strichen näherte, welche seit Jahr und Tag unter großer Dürre zu leiden hatten. Die Gegend ringsum konnte im wahren Sinne des Wortes verbrannt, verdorrt genannt werden, man sah nicht einen grünen Halm; das Braun der Felsen und der Erde war der überwiegende Farbenton, welchen das Auge gewahrte.[20] Mein Aufenthalt in Philippolis gestaltete sich durch den Verkehr mit den Großhändlern Schultze, den Gebrüdern Liefmann, dem Postmeister Försterlein, Dr. Knobel und Dr. Igel zu einem sehr angenehmen. Sie unternahmen mit mir mehrere Ausflüge, deren naturhistorische und ethnographische Ausbeute meinen Sammlungen sehr zu Statten kam. Unter dem Erworbenen fanden sich mehrere lebende Vögel sowie eine ausgewachsene Springbockgais und von Herrn Schultze erhielt ich eine schöne Quarzdruse zum Geschenk, die ich bei meiner Durchreise im Jahre 1872 in seinem Hotel im Drawing-Room bemerkt, allein damals aus Mangel an Mitteln nicht erstehen konnte, sowie von Herrn Försterlein ein äußerst interessantes, ethnographisches Specimen. Es war ein Talisman in einem kleinen, vier Zentimeter langen, zwei Zentimeter breiten, acht Millimeter starken, an einem Ende schmäleren, schwarzen Holztäfelchen und einem in das breiteste Enddrittel eingesetzten Bergkrystallstückchen bestehend und dem Geber von einem ihm zum Danke verpflichteten Basuto-Doctor geschenkt worden. Als es von Herrn Försterlein zufällig einigen Basuto’s gezeigt wurde, sprachen ihn diese darum an und machten ihm verschiedene Kaufsofferte. Das bedeutendste davon bestand in zwei feisten Rindern.
Auf dem Weitermarsche nach Süden war ich einige Tage auf der Farm Ottersport des Herrn Schultze zu Gast, auf welcher ich die erste Gelegenheit hatte, zahme Strauße zu beobachten. Die letzteren werden gegenwärtig in Südafrika, namentlich in der Cap-Colonie und dem Oranje-Freistaate in solcher Anzahl gezüchtet, daß man schon im Jahre 1879 über hunderttausend Thiere zählte. Der aus dieser Zucht gewonnene Ertrag ersetzt weitaus den Verlust, der durch die stete Abnahme des Handels mit Federn der wilden Strauße entsteht. Dem Ei entschlüpft, hat das Küchlein einen Werth von 5 £ St., halb erwachsene Vögel werden mit zwanzig bis fünfzig, Brütende bis zu 150 £ St. bezahlt. Die Straußvogelzucht wird namentlich in jenen Gegenden betrieben, in welchen die Schaf und Rinderzucht minder einträglich ist.
Das größte Hinderniß, mit dem die Straußenzüchter zu kämpfen haben, sind eigenthümlicher Weise Parasiten. Wohl an fünf bis zu fünfundzwanzig Percent der gezüchteten Thiere sterben in Folge von Band- und riesigen Palisadenwürmern, von denen eine kleine Species der ersteren sich zu tausenden und tausenden im Körper des Thieres vorfindet, die letzteren, welche oft bis Meterlänge erreichen, die Musculatur des Vogels durchfressen, ohne selbst das Herz zu verschonen. Uebrigens nehmen die Parasiten oft schon von dem Ei des Straußes Besitz, bevor die Verhärtung der Außenhaut desselben stattgefunden hat; ich entnehme dies aus dem Berichte einer englischen Zeitung aus Süd-Afrika, welcher mir vor einigen Tagen zukam und erzählte, daß man Straußeneier mit Würmern gefüllt vorfand.[21]
Nachdem ich den Oranje-River an der Furth des Herrn Roß überschritten hatte, erreichte ich Colesberg. Ich fand in demselben eine so freundliche Aufnahme, daß ich aus Dankbarkeit nicht umhin konnte, einer Einladung zu einem Vortrage Folge zu leisten; es war der erste, zu dem ich mich erkühnte. Der Erfolg desselben veranlaßt mich, auch in anderen Städten der Kolonie für die Eröffnung Central-Afrika’s nach dem Süden zu plaidiren. Namentlich verpflichteten mich hier die Herren Prediger sowohl, als auch die Aerzte der Stadt und die Herren Abrahamson, Knobel, Leviseur, Mader, Weekley. (Redacteur des Colesberg Advertisers) zu lebhaftem Danke. Mit Herrn Knobel besuchte ich den Colesberg, der nicht allein in geognostischer und paläontologischer Beziehung interessant ist sondern auch dem Botaniker durch seine reiche Flora, dem Zoologen durch das Vorkommen zahlreicher Berghasen, Klipschliefer, etc., Tag und Nacht-Raubvögel, Höhlenstaare und Tauben, zahlreicher Schlangen und Eidechsen, Kerbthiere und auch Arachniden reichlich den Aufstieg lohnt.
Von hier wandte ich mich nach Cradock; doch wählte ich der Unfruchtbarkeit der Gegend halber nicht die kürzeste Route, sondern ging westlich über Middleburg, da ich hier wenigstens an einer Stelle Futter für die Zugthiere zu finden hoffte. Ich wandte mich zunächst nach Kuilfontein, der Farm des Herrn Murray, wo Herr Knobel versteinerte Rippen eines Thieres in einer Mauer gefunden hatte. Mit Erlaubniß des Besitzers riß ich die Mauer nieder und fand prachtvolle, in harten Sandstein eingeschlossene Skelettheile von Sauriern vor und zwar waren es hauptsächlich die Dicynodon-Species, sowie Eidechsen und krokodilartige Thiere, außerdem fand ich eine fossile Flora in weißlichem Sandstein, welche den, namentlich in der östlichen Capcolonie-Provinz häufiger auftretenden Dicynodon-Schichten aufliegt. Ich blieb hier neun Tage lang und wäre wohl, mit Rücksicht auf das gastliche Entgegenkommen von Seite des Besitzers und der reich entlohnenden paläontologischen Funde, noch länger geblieben, wenn nicht die Dürre der Gegend, die selbst dem Besitzer zu der enormen Auslage des Futterkaufens für einen Theil seiner Hausthiere und das Absenden des anderen in eine grasreiche Gegend des Oranje-Freistaates gezwungen hatte, mich bewogen hätte, den Colesberger District so bald wie thunlich zu verlassen.
Ich machte in Begleitung meines freundlichen Wirthes mehrere Ausflüge in die Umgegend und traf stellenweise Thonschieferlagen mit kleinen Muscheln und Schneckenschalen, sowie Spuren riesiger Eidechsen — wahrscheinlich der Dicynodon-Art? An Wild trafen wir blos Springböcke, Trappen, Knurrhähne, Rebhühner, Wildtauben und Wildenten. Ich erwarb in Kuilfontein drei Fischreiher, welche, ziemlich zahm, alljährig in den Weiden an der Quelle zu nisten pflegen. Meine weitere Reise bis nach Cradock war der herrschenden Dürre halber ein wahrer Leidensweg.
Auf der Newport-Farm fand ich einige hübsche Fossilien, darunter Abdrücke von eidechsenartigen Thieren. Auch hier wurde ich äußerst freundlich aufgenommen und bedaure nur, daß ich der an mich ergangenen Einladung, eine Jagd auf Berggazellen um die Thiere beobachten zu können und eine reichlich lohnende Angelpartie mitzumachen, nicht Folge leisten konnte. Die Newport-Farm-Scenerie ist unstreitig eine der anziehendsten im Middleburger District und ich hoffe hier mit Erfolg auf meiner nächsten Reise einen photographischen Apparat verwenden zu können.
Auch in Middleburg hielt ich, hiezu aufgefordert, einen Vortrag über meine Reisen und fand die liebenswürdigste Aufnahme bei den Bewohnern des Städtchens. Ich bin namentlich den Herren Veidling, Heathcoth und Dr. Moore, welch’ letzterer später auch meine Praxis in Cradock übernahm, zu Dank verpflichtet. Auch in der nächsten Umgebung von Middleburg fand ich ein reiches Dicynodon-Lager und bedaure nur, daß die graslose Strecke ringsum mir einen längeren Aufenthalt nicht erlaubte. Da ich seitdem aus den mitgebrachten Fossilien erkannt, daß dieses Lager auch Fischspecies aufweist, will ich auf meiner nächsten Forschungsreise durch die südafrikanischen Colonien dem Orte meine vollste Aufmerksamkeit widmen.
In Cradock angekommen, war es meine Absicht, meinen erschöpften Zugthieren, von welchen leider einige in Folge des Futtermangels zu Grunde gegangen waren, einige Tage Rast zu gönnen, doch sah ich mich bald genöthigt, daselbst einige Monate zu verweilen, um meine bisher erlittenen Verluste durch den Ertrag der ärztlichen Praxis zu decken. In meiner mißlichen Lage war mir das herzliche Entgegenkommen der Bewohner Cradocks ein wahrer Trost und ich fühle mich namentlich den Familien Grey, Greaves, Green, Gillfillan, Smolmann, Armstrong, Turkington, Leigh, Cawood, Woodland, Rice, Wolters, Rawstone und Gardener, sowie den Herren Brown, Rudd, McLoud zu tiefem Danke verpflichtet. Auch den Herren Mynheeren van Rensburg und Marais, sowie Mr. Forster von der Gillfillan-Brücke gedenke ich hier in freundlicher Erinnerung.
Zur Zeit meines Aufenthaltes in Cradock war der Fish-River mehrmals böser Laune. Ich war anfangs noch nicht dessen sicher, ob ich mich auf einige Monate in der Stadt niederlassen und praktiziren sollte und wohnte in meiner Arche etwa eine halbe Meile oberhalb der Stadt am jenseitigen (rechten) Flußufer. Da ich jedoch schon über zwanzig Patienten zu behandeln hatte, so ritt ich täglich mehrmals mit meinem Mosco nach der Stadt. Ich hatte auf meinem Wege zur Brücke zwei meist trockene Rinnsale zu passiren. Diese zwei etwa vier Meter tiefen, vom Wasser ausgespülten Mulden bildeten, wie man mir mittheilte, nur sehr selten und dann höchstens nur auf einige Stunden, meist nach sehr heftigen Platzregen im westlichen Gebirge (Cradock liegt in einem wahren Bergnetze) fließende Gewässer. Etwa 1½ Monate nach meiner Ankunft im Weichbilde der Stadt fiel durch mehrere Tage (nach mehr denn vierzehnmonatlicher schrecklicher Dürre in der Cap-Colonie) unausgesetzt Regen, in Folge dessen der Hauptfluß anschwoll und auch jene Rinnsale sich mit gelblicher, andere mit röthlicher, breiartiger flüssiger Masse füllten. Ich war schon früh zur Stadt gerufen worden, konnte jedoch des zahlreichen Krankenbesuches am Wagen halber, erst Nachmittags dahineilen und als ich zu dem zweiten, sonst immer trockenen Zuflusse des zu meiner Rechten etwa dreißig Schritte ab brausenden und schäumenden Fish-Rivers kam, fand ich etwa dreißig Menschen am diesseitigen Ufer, die sich nicht hinüberwagten — es waren meist Wäscherinnen, welche Früh die Stadt verlassen hatten, um ihrer Beschäftigung an den etwa 1½ englische Meilen flußaufwärts liegenden schwefelhaltigen warmen Quellen nachzugehen, nun aber nicht heimkehren konnten. Hätte ich meinen Krankenbesuch in der Stadt nicht für sehr dringend gehalten, wäre ich wieder zum Wagen zurückgeritten, da ich jedoch nach dem früh mir vom Krankenbette zugekommenen Bulletin eine Verschlimmerung befürchtete, entschloß ich mich, den zischenden Strudel vor mir zu durchreiten. Der röthliche dicke Schwall war etwa acht bis neun Meter breit und schien mir an der günstigsten Stelle 1½ Meter tief, leider hatte das Wasser unmittelbar unter dieser Stelle ein Loch ausgehöhlt und bildete hier einen etwa drei Meter hohen Katarakt, über welchen es laut schäumend sich mit den tosenden Wellen des Fish-Rivers vereinigte. Ich kannte mein Pferd und vertraute ihm meine Sicherheit an, selbst bestrebt, ihm seine anscheinend schwere Arbeit zu erleichtern.
Bei den zwei ersten Schritten fühlte ich den Körper des Thieres erzittern, ich munterte es auf, rasch bewegte es sich vorwärts; um es von dem Loche zur Linken abzuhalten, hielt ich mehr nach der entgegengesetzten Richtung, wo leider die Strömung zu stark war und das Thier zum Falle brachte; doch waren noch unsere Köpfe über Wasser. Bevor wir uns noch dem Katarakte genähert, hatte Mosco sich von selbst emporgerafft und suchte mit einem Satze das jenseitige Ufer zu gewinnen — seine Absicht mißlang, er fiel auf die Vorderknie — doch zum zweiten Male raffte er sich auf, sein Körper zitterte so sehr, daß ich nicht mehr mit ihm das Ufer lebend zu erreichen dachte, jeden Moment wähnte ich ihn mit mir in die schäumende Tiefe zur Linken fortgespült — da, ohne angespornt zu werden, noch ein Versuch — ein zweiter Satz und die Vorderhufe hatten sich in den Lehmboden des jenseitigen Ufers eingegraben, nur einige Secunden verharrte Mosko in dieser Stellung, ein anderer Satz brachte ihn vollends auf’s Trockene. Wir waren gerettet!
Während meines Aufenthaltes in Cradock war ich so sehr durch meine Praxis in Anspruch genommen, daß ich meine seit dem Verlassen der Diamantenfelder aufgenommenen paläontologischen Forschungen aufgeben mußte. Ich hatte stets sechzig, zuweilen bis achtzig Personen auf der Krankenliste und konnte nur selten aufs Land fahren, da mich meine Stadt-Kranken zu sehr beschäftigten; Herr Kidger sen., der Inhaber eines Geschäftes, war so gütig, mich mit einigen Dicynodon-Resten zu beschenken.
In die Zeit meines Aufenthaltes in Cradock fällt auch die wichtigste Episode, die sich in Süd-Afrika während der letzten fünfundzwanzig Jahre abgespielt hatte — der Zulu-Krieg. Für den Culturfortschritt in Süd-Afrika war der Zulu-Krieg eine Notwendigkeit, doch darf man sich nicht der Ansicht hinneigen, daß ihn Sir Bartle Frere eigenmächtig hervorrief, und die englische Regierung in Südafrika ohne die trifrigsten Gründe zu den Waffen griff. Das Vorgehen Sir Bartle Frere’s war einer der weisesten Schritte, die er, sowie überhaupt ein Staatsmann, auf dem afrikanischen Kontinente thun konnte. Er sah die Gefahr, die den Kolonien von dem Zulu-Lande drohte, er wußte von Ketschwajo’s Vorbereitungen und kannte die allgemeine Kampflust, mit welcher die Zulu-Krieger Ketschwajo’s nach einem Zusammenstoße mit den Weißen lechzten. Bald waren es die Colonisten in Natal, bald die Grenzbewohner der südöstlichen Districte der Transvaal-Colonie, die über die Anmaßungen der Zulu’s zu klagen hatten. In den letztverflossenen Decennien hatten in beiden Ländern zahllose Flüchtlinge aus dem Zulu-Lande Schutz vor den maßlosen Grausamkeiten ihres Königs und der Induna’s gesucht und gefunden.
Hätte die englische Regierung in Afrika nicht zuerst zu den Waffen gegriffen, so wären die Zulu’s wie eine blutgierige Meute Hunde über Natal hereingebrochen, und in einer Woche hätten durch diesen Ueberfall zwanzig- bis dreißigtausend Menschen ihr Leben eingebüßt. Ketschwajo hatte es längst darauf abgesehen. Der dem Zulu-Herrscher eigene Stolz, das sichere Vertrauen, das er auf die Unerschrockenheit und Tapferkeit, sowie die anderen Eingebornenstämmen gegenüber verhältnißmäßig große Anzahl seiner Krieger setzte, machten ihn siegesbewußt, lullten den Tyrannen, dessen Vorbereitungsmanöver oft Hunderte von Menschenleben kosteten, in den großen Traum ein, Herr von Natal zu werden. Dieser Schlag hätte aber einen furchtbareren noch im Gefolge gehabt: die Erhebung der meisten südafrikanischen Stämme gegen alle Weißen.
Wenn es in Süd-Afrika einige, in England jedoch zahlreiche Menschen gibt, welche den Zulu-Krieg pro ipso als eine der größten Ungerechtigkeiten ansehen, deren sich die englische Regierung in Süd-Afrika schuldig gemacht, so beruht diese irrige Ansicht auf einem vollkommenen Mißverständniß des Eingebornen-Charakters im Allgemeinen und des Zulu-Charakters im Besonderen. Die Vertreter der ebenerwähnten Ansicht sind meist Menschen, welche mit den Eingebornen nie in Berührung kamen oder nie Gelegenheit hatten, die ungeheuchelte, nackte Handlungsweise der Zulu’s kennen zu lernen, die schließlich von einem Vorurtheil befangen, stets und in Vorhinein in jedem Schwarzen einen armen, bedrückten, gequälten und von den Weißen zurückgesetzten Menschen sehen.
Als ich nach meiner Rückkehr von Afrika in England hochstehenden Personen gegenüber, welche in verschiedenen Welttheilen durch Jahrzehnte beschäftigt waren, den südafrikanischen Eingebornen eine erfreuliche Zukunft in Aussicht stellte, staunte man überall. Man war von der allgemeinen, bisher geltenden Idee des Aussterbens der schwarzen Race und ihres Verdrängtwerdens von Seite der Weißen durchdrungen und glaubte in dem Zulu-Kriege nur eine Bestätigung dieser Ansicht zu finden. Wenn die Behandlung der Schwarzen von Seite der Weißen in vielen Weltgegenden bisher zumeist Mißerfolge aufwies, so beruhten dieselben erstlich auf einer irrigen Auffassung der Natur und Stellung des Eingebornen. Er wurde entweder als ein untergeordnetes, kaum menschliches Wesen angesehen und dann übel behandelt, oder er, das ungebildete Kind, wurde belehrt, daß er seinem Lehrmeister und weißen Herrn vollkommen gleich stehe. Da der Schwarze diese Identität nicht begreifen konnte, und er, der ungebildete Unmündige, sich nun plötzlich als Gebildeter betragen, das Kind den Erwachsenen spielen sollte, kam ein offener Widerspruch zu Tage, dessen unmittelbare Folge ein schwerer Mißgriff des Weißen war; in Folge dieser irrigen Auffassung gab man dem Kinde ferner seine eigene vorzügliche Waffe in die Hand, welches nun nichts Eiligeres zu thun hatte, als die vermeintliche Ebenbürtigkeit dem weißen Manne gegenüber geltend zu machen und gegen ihn die Waffe zu gebrauchen. Ein weiterer, sich nur allzubald rächender Fehler war drittens die Einfuhr und der Verkauf alkoholhältiger Getränke, viertens die Einschleppung von ansteckenden Krankheiten, und endlich fünftens, daß sich die zu dem Verkehr mit den Eingebornen von dieser oder jener Regierung bestimmten Personen (Commissäre etc.) als untauglich und ihres Amtes unwürdig zeigten, und zwar dadurch, daß sie namentlich vor Allem ihre persönlichen und die Vortheile ihrer Nächsten und weniger das Wohl der Eingebornen im Auge hatten.
Was die beiden ersteren Punkte mit Rücksicht auf Süd-Afrika betrifft, so glaube ich schon im vorigen Capitel darauf hingewiesen zu haben, daß man gegenwärtig glücklicher Weise in das richtige Fahrwasser »how to deal with the natives« eingelenkt habe. Der letzterwähnte Punkt kann in Süd-Afrika gar nicht zur Sprache kommen. Die Berichte der Commissäre of the native-affairs können nur zu leicht einer Prüfung unterzogen werden. Für den geringsten Mißbrauch ihrer Amtsgewalt würde eine sofortige strenge Bestrafung auf dem Fuße folgen. Bezüglich des dritten Punktes sehen wir das Unglaubliche in Süd-Afrika möglich geworden, daß Eingebornenfürsten dem Verkaufe des Feuerwassers steuern und daß auch einige der Colonial-Regierungen die Ausfuhr desselben nach den unabhängigen Eingebornenreichen verboten oder eingeschränkt haben.
Eine glückliche Lösung der Zulu-Frage, welche bei diesem kriegerischen Volke nur mit Waffengewalt zu Stande kommen konnte, war für Süd-Afrika von derselben Bedeutung, als eine solche der orientalischen Frage für manche Staaten Europa’s. Ein mehrjähriger Aufenthalt unter verschiedenen Stämmen und mein Wirkungskreis als Arzt, bot mir hinreichende Gelegenheit, so manche Ansicht derselben kennen zu lernen und über die wirklichen Verhältnisse der einzelnen Stämme unter einander, ihre Beziehungen zu den Engländern und Holländern Erfahrungen zu sammeln, welche mich wenigstens theilweise zu der Veröffentlichung der dem Leser schon bekannten Broschüre, sowie einer Reihe von Artikeln veranlaßten
Auf der Heimreise durch die Kolonie begriffen, ersah ich (der Leser möge dies Geständniß entschuldigen) daß mir meine Zulubriefe, meine Reisen wie auch meine Ausstellung in Kimberley zahlreiche Freunde erwarben. Der erste dieser Artikel, welchen ich vor dem Ausbruche des Krieges schrieb und in welchem ich unter Anderem die Kampfweise der Zulu’s und die Gefahr, welche für Afrika von Seite dieser Barbaren bevorstand, schilderte, verspätete sich in Folge lebensgefährlicher Erkrankung des Redacteurs des »Eastern Star« und erschien, von mir telegraphisch urgirt, zufällig am selben Tage, an welchem die Nachricht von der Niederlage der englischen Truppen bei Isandula die Cap-Colonie erreichte; derselbe war vor dem Ausbruche des Krieges am 16. Jänner abgesendet worden. Ich erlaube mir im Folgenden einige Citate aus demselben anzuführen:
»Gibt es gegenwärtig etwas Wichtigeres, Gefahrdrohenderes auf dem politischen Horizont Süd-Afrika’s als jene dunkle Wolke im Osten, als die Zulu-Frage? Schwarz, dicht geballt, blitzgeschwängert ist diese Gewitterwolke, die ungebundene Masse eines der rohesten Eingebornen-Elemente, welche unseren Blick in die Zukunft trübt und seit Jahren den Frieden und die Wohlfahrt Süd-Afrika’s bedroht.
Dort — nördlich vom Tugelaflusse hängt das Damokles-Schwert über Deinem Haupte, Süd-Afrika. Und dieses Schwert und jene Wolke? Ein blutdürstiger Tyrann, dessen Macht auf Tausenden und abermals Tausenden entmenschter, ihm wie eine Rotte wilder Wölfe in sklavischer Unterwürfigkeit blindlings folgender Creaturen beruht. Doch wie ist es denn möglich, daß solch’ ein Wütherich so viele Jahre und in einer solchen Weise die Civilisation hier um uns beeinträchtigen konnte, daß der Weiße jeden Moment die drohende Meute über sich hereinzubrechen befürchten mußte? Hast du denn geschlummert, britischer Löwe, daß du dir für die beispiellose Sanftmuth, die du so oft den Zulu’s gegenüber bewiesen, so lange solch’ eine schmähliche Stellung dem Zulutyrannen gegenüber gefallen lassen mußtest? Ja, dort nördlich von der Tugela, in dem schrecklichsten durch einen Eingebornenfürsten geschaffenen Gefängnisse harrt der gordische Knoten Süd-Afrika’s seiner Lösung.
Bei der Betrachtung dieser von Osten her verderbendrohenden Wolke haben wir jedoch nicht allein das Furchtbare des ihr entströmenden Ungewitters zu fürchten, sondern noch einen zweiten Umstand. Es ist das Verhältniß zu den übrigen Wolken und Wölkchen, die auf dem Horizonte über uns schweben. Obgleich Feinde des Zulustammes — ja ihn hassend — verbindet doch den letzteren mit den meisten der südafrikanischen Eingebornenstämme ein Gedanke, der von der Natur eingeimpfte, aus einem allseitigen Neid hervorgegangene, trotz der wohlwollenden Behandlung unter dem Gouverneur Sir Henry Barkly durch ein Gefühl einer irrthümlichen Zurücksetzung gestärkte Haß der dunklen Racen den Weißen gegenüber.
Von der größten Wichtigkeit ist es nun für uns, zu wissen, ob sich jene kleinen Wolken, die meisten bedeutenden Stämme, beim Losbrechen jenes Unwetters mit den Zulu’s vereinigen werden oder nicht. Farbige, die sich seit Jahren und Jahren zwischen den Weißen bewegten, die als Diener, Aufseher etc. seit Decennien in des weißen Mannes Diensten standen, Menschen, deren Dörfer um unsere Ansiedelungen liegen, und friedliche Nachbarn geworden waren, Farbige, die, ob Bastard-Buschmänner, Hottentotten oder Banthu’s, den Zulu als einen Erbfeind haßten, welche von demselben wiederholt bekriegt, von ihm Schreckliches erleiden mußten — lächelten zufrieden in sich hinein, so oft sie von dem arroganten Auftreten Ketschwajo’s hörten, freuten sich im Stillen, daß doch ein schwarzer Bruder (in Wirklichkeit ihr größter Feind) dem Weißen Trotz und Hohn bot und zu bieten im Stande war. »Ja, die Zulumacht, die Macht des blutdürstigen Ketschwajo, ist eine hohe Mauer, ist ein Felsen, über den das Bleichgesicht nicht klimmen, den es nicht bezwingen kann.« Einen weiteren Beweis der Zulumacht glaubten sie auch darin zu erblicken, daß die meisten der Wächter des Weißen — die schwarzen Policemen — Zulumänner aus Natal, Flüchtlinge aus Ketschwajo’s Gebiete waren. In keinem Eingebornenlande Süd-Afrika’s ist eine solche Rohheit und Unmenschlichkeit, ist eine solche Barbarei zu beobachten, solch thierische Wuth manifestirt, wie in Ketschwajo’s Land. Ja, wir sehen, daß selbst der regierende Stamm, die Zulu’s selbst, auf die furchtbarste Weise von ihrem Tyrannen mißhandelt werden, ebenso barbarisch wie die Eingebornen es sind, sich ebenso sklavisch den Befehlen des Tyrannen unterwerfen und ihre Mitmenschen abschlachten, um vielleicht bald darauf selbst abgewürgt zu werden. Muth und Unerschrockenheit sind die einzigen Tugenden, die wir den Zulu’s zuerkennen müssen, doch da dieser Charakterzug nur zur Stärkung der Macht eines Tyrannen und des Plünderns halber zur Geltung kommt, büßt er das Lobenswerte ein und wird zur entfesselten thierischen Wuth, mit der sich der Tiger auf sein Opfer wirft. Bald in dieser, bald in jener Weise haben sich unsere Brüder in Natal Drohungen und Erniedrigungen von Seite des Zulu-Fürsten gefallen lassen. Jede der ihnen angethanen Schmähungen war eine Schmähung für uns Alle, und es sind nun Tausende und Tausende, die gegenwärtig von der südlichen Meeresküste bis zu dem nördlichen Bogen des Limpopo, von der Mündung des Oranje-Rivers bis zur Tugela-Mündung welche, — die Einen ein Ende dieser Anmaßungen mit geballter Faust fordern, die Anderen aus der Tiefe ihres Herzens darum flehen.
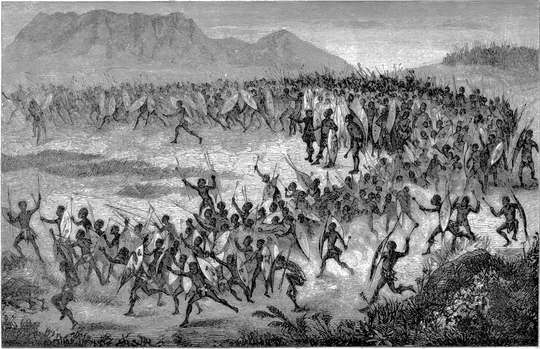
Kampfweise der Zulu.
Jene von uns, die da glauben, daß die vom Zululande drohende Gefahr in der Cap-Colonie, Griqualand-West u. s. w. weniger zu fürchten sei, huldigen einer irrigen Auffassung. Das Zulu-Land ist ein Vulcan, von dem ganz Süd-Afrika Verderben droht. Die Unzufriedenheit unter den Eingebornenstämmen wird vom Zulu-Lande aus stets angefacht und genährt, nur wir, die wir seit Jahren unter diesen Stämmen wohnen und uns die Mühe nehmen, uns in den Charakter dieser Eingebornen einen Einblick zu verschaffen, fühlen es, daß wir auf einem Vulcan stehen, dessen Ausbruch nördlich von der Tugela zu suchen ist und dessen Lava-Erguß das gesammte Süd-Afrika zu überschwemmen droht. Die niedrigsten den südafrikanischen Eingebornen eigenen Laster finden im Zulu-Lande ihre Pflege. Haben die Colonisten noch nicht das Zischen vernommen, mit dem die Lava aus dem Zulu-Krater entströmt? Für jene, die es nicht vernommen, mag es in Folgendem wieder klingen.
Ich hoffe, es gibt keinen unter uns, der dies nicht glaubt, aber wenn einige dieser unglücklichen Mitbrüder noch existiren sollten, laßt sie hingehen und sie, wenn auch nur kurze Zeit, am Ufer des Tugela wohnen. Fragt sie bei ihrer Rückkehr! Ihr würdet in den früheren Freunden Hasser der Zulu wiederfinden.
Wem tönt nicht der übliche Spruch der Zulu’s in den Ohren. »Blaßgesichter, Ihr wähnt Euch Indunas (Häuptlinge)? Glaubt Ihr dafür geschaffen zu sein, zu befehlen, daß wir Eure Gesetze befolgen, die wir hassen, Gebote, die Ihr gut und schön nennt? Ihr wollt uns arbeiten lehren? Wir haben diese Schmach (arbeiten zu müssen) nie über uns ergehen lassen, außer wenn uns des Königs Gebot hieß menschliche Schädel zu brechen. Haß und Tod für Euch. Wir verachten Alles, was Ihr für uns gethan, uns geschenkt habt. Schwachheit war es, nichts als elende Schwachheit, Großmuth nennt Ihr es — thut es nach Belieben, wir nicht!« Jene, welche sich zu Vertheidigern der Zulu’s aufwerfen, mögen sich diesen Gedanken, der alle Ketschwajo-Zulu’s beseelt und von ihnen ausging, einprägen.
Ist die Zulu-Frage mit den Waffen glücklich gelöst, dann steht uns eine frohe Zukunft bevor! Colonisten, ich bin kein Freund von Kriegen, nicht vielleicht, weil es mir an persönlichem Muthe gebricht, sondern der armen Opfer willen, die ein Krieg erheischt. Wenn sich mir nicht diese aus Thatsachen durch mehrere Jahre geschöpfte Ueberzeugung aufgedrungen hätte, ich würde nie diesen Krieg als eine Nothwendigkeit angesehen haben.
Außer Ketschwajo’s Zulu-Reiche finden wir noch ein zweites, ein nördliches, das Matabele-Reich des La Bengula. Nur von vierzig wahren Zulu-Kriegern und einigen ihrer Sklaven gegründet, hat es sich seit 1837 zu einem großen Reiche emporgearbeitet, und seine räuberischen Horden haben sich noch nicht müde gemordet, denn das Matabele-Reich ist im steten Wachsen begriffen.
Wäre das südliche Zulu-Land seit Jahren und Decennien nicht von allen Seiten eng und straff umspannt worden, ein Gleiches hätte sich, und nur noch in höherem Grade wie bei den Matabele, zugetragen; es hätte sich durch Raub und Mord nach drei Seiten ausgedehnt. Während das zweite Zulu-Reich im friedlichen von arbeitsamen und friedliebenden Stämmen bewohnten Makalaka-Reiche gegründet wurde und sich so leicht im Sinne eines Raubstaates ausdehnen konnte, wird Ketschwajo’s südliches Zulu-Reich im Süden von Natal, im Westen vom Oranje-Freistaat und der Transvaal-Republik, im Norden von den kriegerischen Amaswazies, sowie im Osten vom Meere umsäumt und dadurch noch eine zeitlang in Schach gehalten. Mit dem Anwachsen der Bevölkerung jedoch regte und bäumte sich das Zulu-Element so zusehends, daß es immer arroganter und drohender erschien und schon seit Jahren an einen Kampf mit der weißen Race dachte. Die blutigen Manöver Ketschwajo’s beweisen hinlänglich, was das Zulu-Volk und sein Herrscher vorhatten. Die Wirthschaft der Zulu sehen wir nur zu deutlich an den Matabele, deren Geschichte klar vor unseren Blicken daliegt.«[22]
Diesem Artikel folgten andere, in welchen ich über die Kampfweise der Zulu’s berichtete und deren Inhalt auch später durch die Nachrichten vom Schlachtfelde bestätigt wurde. In unbegrenztem Stolze und Selbstbewußtsein hält sich der Zulu nicht nur für den tapfersten Eingebornen Süd-Afrika’s, sondern auch dem Weißen, seinen Waffen und seiner Kriegsführung überlegen. Seine Kampfbegierde kommt seiner Tapferkeit gleich und erklärt die rasche und mächtige Ausbreitung der Zulu-Herrschaft. Ich möchte sie beinahe als das kriegerischeste und kampfmuthigste unter den uncivilisirten Völkern bezeichnen. Wir beobachten an ihnen nicht allein Muth und Tapferkeit, sondern auch einen hervorragenden Sinn für Strategie. Bei ihrem Angriffe nützen sie alle Vortheile des Terrains aus, hohe Grasfelder, Regenmulden, dichtes Gestrüppe etc., dichte Nebel, sowie die nächtliche Zeit, um dem Feinde so nahe als möglich zu kommen. Doch thun sie dies nicht, wie die Colonial-Kafferstämme, um sich zu decken, sondern einzig und allein, um den Feind zu überraschen. Ist dies jedoch nicht möglich, so gehen sie über eine unbebuschte Grasebene auf den Feind los, ohne Rücksicht darauf, ob sie sich dabei Stunden lang einem continuirlichen Gewehrfeuer aussetzen müssen. Dadurch unterscheiden sie sich in ihrer Kampfweise im Allgemeinen von den Colonial-Kaffern, Hottentotten und ihren Bastarden. Die ersteren greifen in der Regel im offenen Kampfe an, doch ziehen sie sich nach der ersten Niederlage sofort auf ihre bebuschten Höhen und den Niederwald zurück und setzen von hier aus den Guerillakrieg fort. Die Hottentotten etc. scheuen den offenen Kampf und ihnen ist im Allgemeinen nur die letztere Kampfweise eigen. Die Zulu’s hingegen zeigen eine Todesverachtung, wie sie sonst bei keinen afrikanischen Farbigen vorkommt.
Kopf, Brust und Füße mit thierischen Haaren, Hautstücken, Schwänzen oder Federn phantastisch geschmückt, eilen die Zulu’s unter gellendem Jauchzen oder dem Absingen eines ihrer kriegerischen Lieder, ungeachtet des Kugelregens und der ihnen entgegenblitzenden Bajonette gegen den Feind vor. Während ihres Sturmlaufes trachten sie sich mit ihrem Schilde zu decken, und indem die Linke, die den Schild hält, zugleich einen Wurf- und zwei kurze Assagaie festhält, schwingt die Rechte einen Wurfassagai, mit dem der Mann in der Regel auf eine Entfernung von sechzig Schritten zu treffen weiß. Auf dreißig Schritte dem Feinde genähert, schleudert er den zweiten und ergreift, ununterbrochen heranstürmend, seine kurzen Assagaie, um sie im Handgemenge als Waffen zu benützen. Dabei geschieht es oft, daß die Zulu-Krieger, um freier auslegen und arbeiten zu können, den Schaft des kurzen Assagai’s abbrechen, um mit dem Eisentheile wie mit einem Dolche weiter zu kämpfen.
Mit Vorliebe schieben sie die beiden Flügel ihrer Angriffscolonnen armartig vor, welche sie die Hörner ihrer Armee nennen. Während nun das Centrum den Feind direct angreift, suchen die beiden Flügel im weiten Bogen die feindliche Armee zu umgehen und zuerst ihren Nachtrab, dann ihre Flanken anzugreifen. Da dem Centrum die schwierigste Aufgabe obliegt, so ist dieses nicht allein aus den Kerntruppen gebildet, sondern es hat auch eine Reserve von gleicher Stärke hinter sich. Siegt das Centrum, so wird die Ausnützung des errungenen Erfolges dem Reservecorps überlassen, dessen Aufgabe es ist, die Gefangenen auszurauben und die Verwundeten niederzumetzeln. Sind es Weiße, mit denen die Zulu’s kämpfen, so werden diese in der Regel entkleidet, und nicht selten geschieht es, daß dem Feinde der Unterleib aufgeschlitzt, oder die Leichen verstümmelt werden.
Der mir zugemessene Raum gestattet es nicht, hier die Einzelheiten des Zulu-Krieges vorzuführen. Dem Leser sind wohl die englischen Mißerfolge wie die Siege bekannt, und die ersteren unstreitig den Umständen zuzuschreiben, daß man erstens die Zulu-Kampfweise irrthümlich mit jener der Colonial-Kaffern für identisch hielt, ferner daß man die Zulu-Macht unterschätzend, mit zu geringen Streitkräften in den Krieg zog (nicht Sir Bartle Frere’s Schuld, der um mehrere Regimenter Verstärkung ansuchte), und daß man endlich sowohl bei dem Auskundschaften einer Gegend, wie bei dem Weitermarsche nicht die gehörige Vorsicht gebrauchte. Der Mißerfolg der englischen Waffen im Anfange des Krieges wurde durch die folgenden glänzenden Siege rühmlichst wettgemacht und der Feldherr wie die Befehlshaber der einzelnen selbstständig operirenden Colonnen, die Officiere wie die Mannschaft, haben die erlittenen Scharten nicht allein ausgewetzt, sondern auch im Kampfe mit dem kriegerischsten der Eingebornenvölker Afrikas und auf einem höchst ungünstigen, felsigen und hochbegrasten Terrain neuen Ruhm erfochten. Der Sieg bei Ulundi und nicht Wolseley’s Thaten hatten den Krieg zum Abschlusse gebracht. Und ich halte es für vorzeitig, daß die britische Regierung in London vor der Beendigung des Krieges Sir Bartle Frere den Machtspruch in dieser Angelegenheit entzog und Lord Chelmsford abberief. Denn ich denke, daß in Folge dessen die Friedensverträge mit den Zulu’s nicht in entsprechender Weise abgeschlossen worden sind, um einen dauernden Frieden mit dem Eingebornen-Element in Süd-Afrika zu erzielen.
Die Richtigkeit dieser Behauptung können wir aus den allerletzten uns in diesem Monate (October 1880), aus Süd-Afrika zugekommenen Nachrichten über die Erhebung eines Theiles der Basuto’s gegen die Cap-Colonial-Regierung bezüglich des Disarmament (Waffenauslieferung) beobachten. Wäre der Friede mit den Zulu’s im Sinne der in den südafrikanischen Kolonien bei weitem vorwiegenden Meinung abgeschlossen worden, hätten sich gegenwärtig die Basuto’s aus dem oberwähnten Grunde nicht aufgelehnt. Allein die wohlwollende Meinung von Seite der englischen Colonial-Regierung in London, die sich in den Vertragsschlüssen mit den Zulu-Häuptlingen nach der Beendigung des Krieges kundgab, wurde von den übrigen Eingebornenstämmen Süd-Afrika’s (den freilebenden, wie den unter der Oberhoheit der Weißen stehenden) nicht als eine wohlwollende Handlung, sondern als der Ausdruck von Schwäche angesehen.
Die Absicht, mit der das Ministerium Sprigg die Waffen-Auslieferung begründet, und bei einigen Stämmen schon erfolgreich durchgeführt hat, beruht hauptsächlich: erstlich auf der Idee eines dauernden südafrikanischen Friedens, zweitens einer friedlichen Lösung der Eingebornenfrage, und zwar sollen dadurch, daß man den Eingebornen die Feuerwaffen abkauft und ihnen keine weiteren verkauft, kriegerische Stämme, sowie jene, welche trotz ihrer sonst friedlichen Gesinnungen sich nach und nach durch den Erwerb der Feuerwaffen zu kriegerischen heranbilden, zu friedlichen Ackerbauern und Viehzüchtern erzogen werden. Es sollte eine langsame doch wohlerwogene stufenförmige Erziehung ganzer Stämme durchgeführt werden; hat man diese erreicht, so könnte die Regierung später gewiß einzelnen Jagdfreunden unter den Eingebornen ohne Gefahr Gewehr-Licenzen (Jagdkarten) ertheilen.

Masarwadorf.
Auf meiner Heimfahrt nach Europa traf ich zufällig mit General Lord Chelmsford und seinem Stabe zusammen. Bei dem ersten Zusammentreffen dankte mir derselbe für die Aufrichtigkeit, mit der ich meiner Ueberzeugung im Verlaufe des Krieges Ausdruck gegeben hatte. In der Begleitung Lord Chelmfords fand sich auch der ihm zugetheilte General der Cavallerie Sir Elevyn Wood, der in der englischen Armee durch seine persönliche Tapferkeit sich einen rühmlichen Namen erworben hat. Er wunderte sich nicht wenig, als ich ihm Telegramme vorwies (unter anderen jenes, in welchen mir sein Sieg über die Zulu’s bei Kambula berichtet wurde) aus denen er entnehmen konnte, daß ich während des Krieges in direkter telegraphischer Verbindung mit Natal stand.
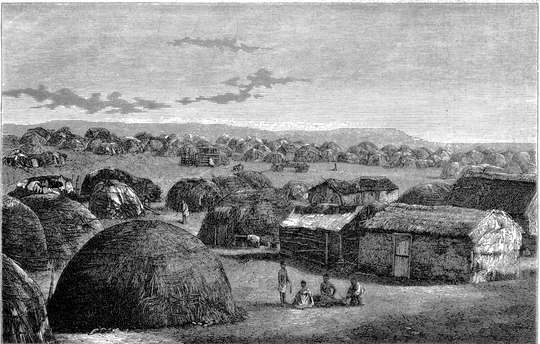
Fingodorf bei Port Elizabeth.
Ich muß gestehen, daß sich seit jener Zeit das Band, welches mich an Süd-Afrika so innig fesselte, nicht gelockert hat, selbst nicht nach der erfolgten Ankunft in Europa; trotz der Verleumdungen der Elfenbeinhändler Westbeech und Andersen in einem afrikanischen Blatte, die mich ebenso wie dieses Blatt selbst während meines Aufenthaltes in Afrika nicht genug zu rühmen wußten. Hingegen freute es mich lebhaft, meine Thätigkeit von den bedeutendsten Blättern Süd-Afrika’s gerecht und unparteiisch beurtheilt zu sehen. Ich werde immer das innigste Interesse an dem Fortschritte der südafrikanischen Colonie nehmen und stets des mir von Seite der englischen wie holländischen Colonisten bewiesenen Entgegenkommens eingedenk sein.
Als ich mir die nöthigen Mittel zur Weiterreise erworben hatte, verließ ich noch vor der Beendigung des Zulu-Krieges Cradock, um mich über Grahamstown nach Port Elizabeth zu begeben. In der ersteren Stadt angekommen, miethete ich mir eine Wohnung in Bathurstreet, in deren Hofe ich mein Pferd sowie die meisten der lebenden Thiere frei herumlaufen lassen konnte. Mein Aufenthalt in Grahamstown wurde mir namentlich durch die Herren Redakteure des »Easter Star«, Mr. Sheffield, Mr. Slater B. A. und »Mail« Mr. Crocott, sowie dem Herrn Very Rev. Dean Williams, Med. Dr. Williamson und Dr. E. Atherstone zu einem sehr angenehmen gemacht. Zu großem Danke bin ich aber auch dem Herrn Bischof Ricards, Hon. Cawood, der Familie Francis, die ich in Schoschong im Bamangwato-Lande getroffen, den Familien der Rev. Walton, Wood und Barton, Herrn Tidmarsh, dem Herrn Glanville, Curator des Museums, und Anderen verpflichtet. Hier erhielt ich auch manche interessante naturhistorische Objecte, darunter einen lebenden Luchs von dem Very Rev. Herrn Dean Williams und einige Trylobiten von Herrn Glanville zum Geschenke. Auch sammelte ich Mineralien, eine Anzahl exotischer Gewächse, wobei mir Herr Tidmarsh aus dem botanischen Garten äußerst zuvorkommend an die Hand ging. Außerdem gelang es mir auch, zahlreiche lebende Vögel zu erwerben, von denen ich jedoch drei Viertheile am Tage meiner Reise nach Port Elizabeth einbüßte. Wir hatten so eisigen Regen, daß die meisten Thiere trotz guter Verwahrung dem Unwetter erlagen, bevor wir die nur wenige Stunden entfernte Eisenbahnstation erreicht hatten.[23]
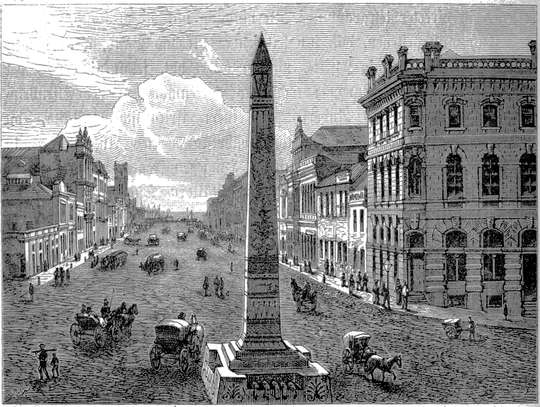
Mainstreet in Port Elizabeth.
Am Abend desselben Tages langte ich in Port Elizabeth an. Mit Freuden begrüßte ich nach so vielen Jahren wieder das Meer und nahm mir vor, ihm während meines Aufenthaltes die größte Aufmerksamkeit zu widmen. Fast täglich während meines sechswöchentlichen Aufenthaltes ritt ich zeitig früh nach dem Cap Recif oder weiter hinaus, zuweilen auch nach der Mündung des Zwartkops-Rivers, um an seinem Gestade zu sammeln. Ich hielt in Port Elizabeth einige Vorlesungen. Für eine derselben wurden mir von der Chamber of Commerce 60 £ St. verehrt. Ich fand hier allseitig eine freundliche Aufnahme, besonders von Seite der Redactionen des »Eastern Telegraph«, und des »Eastern Herald«. In meinem Sammeleifer standen mir namentlich die Herren Vermold, Holland und Halok sowie der frühere österreichische Consul Allenberg bei. Herr Holland, dessen Frau Gemahlin eine Künstlerin ist und mit Vorliebe das Studium der Botanik der südafrikanischen Flora betreibt, machte mich auf die Haufen von thierischen Knochen und Conchilienschalen aufmerksam, welche an gewissen Stellen am Meeresufer förmlich hügelweise von den früheren Bewohnern dieses Gebietes bei ihrem Mahle angehäuft worden waren. Da ich von diesen Funden erst bei meinem Scheiden aus Süd-Afrika Kenntniß erhielt, konnte ich nicht entscheiden, ob sie etwa von den Buschmännern herrühren. Ist dies nicht der Fall, so müssen diese Mahlreste von einem in Süd-Afrika ausgestorbenen Stamme aufgehäuft worden sein. Ich fand in Port Elizabeth meine schon vor einem Jahre dahin abgesandten Sammlungen in vierundzwanzig Kisten in gutem Zustande vor und brachte neues Material hinzu, welches mit dem in Port Elizabeth gewonnenen im Ganzen siebenundvierzig Kisten füllte; in Capstadt wurden zwei weitere Kisten hinzugefügt.
Bevor ich von Süd-Afrika scheide, erlaube ich mir aus meinem Tagebuche eine der interessantesten Löwenjagden Van Viljoens, eines der bedeutendsten südafrikanischen Elephantenjäger den Lesern mitzutheilen. Das an das Matabele-Reich grenzende Maschona-Land wurde seines Wildreichthums halber, und da sie vom Matabele-Könige specielle Erlaubniß zu seinem Besuche erhielten, wiederholt von den beiden Jägern Viljoen und Pit Jacobs der Elephantenjagd halber aufgesucht. Während eines solchen weiten Jagdausfluges machten beide Jäger mehrmals mit Löwen nähere Bekanntschaft, eine dieser Begegnungen will ich im Folgenden zu schildern versuchen.
Van Viljoen jagte diesmal in Gemeinschaft mit seinem Sohne Jan, beide waren von ihren Frauen begleitet und jene Jan’s hatte ihre beiden Kinder, von welchen das jüngere noch ein Säugling war, bei sich. Die Jäger hatten ihren Lagerplatz gewechselt und lagen mit ihren Wägen nahe an einem von der giftigen Tsetse bewohnten und deshalb für ihre Zug- und Reitthiere unzugänglichem Territorium. Die Frauen im Lager zurücklassend, pflegten die Jäger dann von ihren Dienern begleitet, zu Fuß weit in das Tsetsegebiet zu dringen, um den sich mehr und mehr vor dem Feuerrohr zurückziehenden Elephanten tagelang zu folgen. Die neue Lagerstelle wurde öfters, sowohl während ihrer Abwesenheit, als nach ihrer Rückkehr — wie es schien — von einem und demselben äußerst dreisten Löwen heimgesucht. Das erste Mal geschah dies an einem Morgen. Der werdende Tag hatte die Dämmerung weit nach Westen verdrängt. Im Lager der Jäger schien noch alles im tiefen Schlafe begraben. Man gönnte sich eben etwas mehr Ruhe, wenn die Herren abwesend waren. In der aus Mapanizweigen errichteten Umzäunung standen die beiden Riesenwägen, in denen die Weißen ihre Vorräthe bargen, während sich ihre Familien in zwei nothdürftig aus Schilfrohr und Geäste errichteten, mit Gras überdachten und mit Lehm übertünchten, an die Umzäunung angebauten Hütten einquartirt hatten. Es ist ein Charakterzug des jagenden Boers, daß er auf seinen Jagdzügen in der Wildniß stets ein solch’ elendes Hartebeest-Häuschen dem Wagen, der selbst einer großen Familie hinreichenden Raum bietet, vorzieht. Nahe an der ersten Umzäunung befand sich eine weniger umfangreiche aber höhere, aus Dornbüschen errichtete, welche als Viehkraal diente.
Endlich wird die Stille im Lager unterbrochen. Die kleine Matte, welche die winzige Eingangsöffnung einer der drei an den Kraal angebauten kegelformigen, von den Matabele-Dienern bewohnten Grashütten schloß, wird durch einen nackten schwarzen Arm von innen bei Seite geschoben, und ein kräftiger Zulu, dunkel wie die Kohle, zwängt sich durch, um sich sofort zu dem vor der Hütte im Erlöschen begriffenen Feuer zu beugen und es anfachend, neu auflodern zu machen. Bald folgen ihm zwei Gefährten, der erste aber holt sich aus der Hütte zwei Assagaie, spießt auf den einen ein Stück Fleisch, und nachdem er auch einen Feuerbrand erfaßt, um sich dasselbe einige Stunden später auf der Weide zu braten, öffnet er den Viehkraal, um die Rinder an sich vorbeipassiren zu lassen. Diese die gewohnte Richtung einschlagend, bewegen sich allmälig dem nahen Dickichte zu. Der bewaffnete Hirte folgt, ein Lied seiner Heimat vor sich hinsummend. Doch kaum zweihundert Meter vom Lager entfernt, werden die Ochsen durch den plötzlichen Ueberfall von Seite eines Löwen aus ihrer Lethargie gerissen und einer aus ihrer Mitte angegriffen; der auf diese höchst unsanfte Weise in seinem Gesange unterbrochene Matabele verlor indeß keinen Augenblick die Fassung, denn kaum hatte der Löwe mit seiner rechten Tatze den Ochsen am Maul erfaßt, um in der gewohnten Manier beim Angriffe auf Rinder, diesem den Athem zu benehmen, die andere in die linke Schulter eingeschlagen und sich in die Kehle verbissen, sauste schon der Assagai des Hirten durch die Luft — leider war es ein zu leichter Speer, — den rechten Vorderarmknochen des Raubthieres treffend, prallte dieser hier wie von einer Steinplatte ab und fiel in’s Gras.
Der Wurf sowohl, wie das Geschrei des Mannes, das auch von den zu Hilfe herbeieilenden Gefährten kräftig aufgenommen wurde, thaten das ihrige um das Raubthier zu verscheuchen. Die Matabele brachten sofort die Zugthiere zurück in den Kraal, einer lieh sich von der Frau Jan’s ein Gewehr, während die anderen ihre Speere und Schilde ergriffen und machten sich hierauf in corpore an die Verfolgung des Löwen. Sie nahmen die Spur auf, doch überzeugten sie sich bald, daß er sich mit gewaltigen Sätzen weit in die Büsche zurückgezogen hatte. Heimgekehrt, brachten sie die Zugthiere wieder auf die Weide um sie diesmal vereint, den ganzen Tag über zu bewachen. Man war auf eine Wiederkehr des Raubthieres gefaßt, doch es verging ein Tag nach den anderen, ohne daß man den Löwen zu Gesicht bekommen hätte, obwohl allnächtliches Brüllen seine Nähe verrieth.
Am zwanzigsten Tage nach jenem Zwischenfalle kehrten die weißen Jäger in ihr Lager zurück. Ohne ihnen Zeit zu lassen, ihre eigenen Erlebnisse zu berichten, wurden sie sofort von den Frauen von dem Gebahren des frechen Eindringlings in Kenntniß gesetzt, und genau der Handlungsweise des holländischen Jägers entsprechend, machten sich die Jäger noch am selben Tage an die Verfolgung des Raubthieres, indeß ohne Erfolg, trotzdem sie durch mehrere Tage mit dem ganzen Trosse ihrer Diener (fünfzehn Matabele) die Büsche und Dickichte abpürschten. Da man auch in der Nacht sein Gebrüll seltener vernahm, glaubte man, daß sich das Thier gänzlich aus der Gegend zurückgezogen hatte.
Acht Tage nach ihrer Rückkehr von der Elephantenjagd verließ der alte Jäger mit seiner Frau den Lagerplatz, um den König der Matabele, La Bengula zu, besuchen. Zwei Tage später verließ auch sein Sohn die Stelle, um neuerdings eine Elephantenjagd im Tsetse-Distrikt zu unternehmen. Genau sieben Tage später machte sich der Löwe an dem Lagerplatze wieder bemerkbar, in welchem diesmal nur die junge Frau mit ihren beiden Kindern und abseits in der Grashütte ein Matabele zurückgeblieben waren. Für die Frau, die sich — warum ist mir nicht erklärlich — in der Lehmhütte sicherer als in dem von einem Gestrüppzaune umgebenen Wagen hielt, schien diesmal das zeitiger als je zuvor schon bei Sonnenuntergang hörbare Gebrüll des Löwen eine schlechte Vorbedeutung zu sein. Um sie noch trüber zu stimmen, war die Nacht sehr dunkel und für einen etwaigen Ueberfall von Seite des Löwen wie geschaffen. »Nachdem ich mich,« so berichtet Frau Van Viljoen, vergewissert, daß der Viehkraal wohl verwahrt sei, und der Diener die Feuer um denselben angezündet hatte, begab ich mich etwas früher als gewöhnlich in das Hartebeest-Häuschen. Das Löwengebrüll war abermals und bedeutend näher als das erstemal, hörbar geworden; denken Sie jedoch nicht, daß es mich in Angst versetzt hätte, — das Weib eines holländischen Jägers ist an die Wildniß gewöhnt und hat nicht einmal, sondern oft reißenden Thieren in das grimmige Auge zu schauen. Sie ist nicht gewohnt zu fliehen, auch nicht, wenn diebische oder raubsüchtige Schwarze sie bedrohen. Die Waffe in der Hand weiß sie sich wohl zu vertheidigen, und doch, ich weiß es mir nicht zu erklären, — in jener Nacht fühlte ich mich erregt, fühlte etwas wie einen heftigen Schlag unter meiner linken Brust, ich fühlte dies immer wieder, so oft ich auf meine beiden auf der Erde in Carossen eingehüllten und schlafenden Kinder herabblickte; mehrmals erhob ich mich mit der Absicht Licht zu machen, doch wie durfte ich dies thun. Der durch die zahllosen Ritzen nach Außen dringende Schein mußte ja den Räuber nur auf uns in der Hütte aufmerksam machen und ihm auch die geringe Widerstandsfähigkeit der Hütte vor den Angriffen seiner Tatzen verrathen. Ich fühlte mich derart beengt, daß ich mich erheben mußte, die Luft schien mir drückend schwül, so lange ich auf dem Boden saß. Ich stand auf, doch kaum hatte ich mich erhoben, so zog es mich wieder herab zu den Kleinen, ich konnte sie in dem Dunkel nicht sehen, und dies machte mich noch ängstlicher. Wie befriedigt fühlte ich mich, als ich mich zu ihnen herabbeugend, — sie ruhig athmen hörte. Inzwischen hatte sich das Löwengebrülle wiederholt, das Thier mußte schon auf zweihundert Schritte nahe gekommen sein.
Dunkel, aber eben so ruhig wie schwarz war die Nacht, deutlich hörte ich die Bewegungen der Zugthiere in der sie schützenden Umzäunung, auch das Prasseln der an mehreren Stellen um dieselbe brennenden Feuer entging mir nicht, manchmal däuchte es mir, als würde ich den Schlag meines Herzens hören, so stille und ruhig war es um mich selbst. Leider war kein einziges Gewehr am Lagerplatze zurückgelassen worden, und so hatte ich im Nothfalle keine Waffe, um mich zu vertheidigen. Da sich mehr denn eine Stunde kein Löwengebrüll weiter hören ließ, fühlte ich mich etwas beruhigter; ich suchte rasch zu vergessen, was mich eben betrübt, und lauschte mit um so größerer Befriedigung, ja mit ganzem Herzen den Athemzügen der Kleinen. Doch, ich weiß es mir nicht zu erklären, wie es kam, eben dieser ruhige, glückliche Schlummer meiner Kinder, machte mich von Neuem unruhig. Wie, wenn er doch gestört werden sollte, gestört und mit Gefahr für ihre Sicherheit? Ich fühlte mich unglücklicher denn je. Sollten sich meine trüben Ahnungen erfüllen? Ich mochte mich mehr denn eine Stunde mit diesem Gedanken abgequält haben als dieselben nur zu schnell in Erfüllung zu gehen schienen.
Zuerst wurde ein deutlicher Lärm, ein Zusammenrennen der Rinder im Kraale hörbar. Wenige Augenblicke später ein schwerer Tritt. Sollte wirklich das Thier uns gewittert haben und sich an uns heranmachen? Ich lauschte an den Thürritzen, so wie ich jedoch, den schweren Tritt sich wieder nähern hörte, flog ich zu den Kindern. Der Säugling athmet rascher, hatte ich ihn unvorsichtiger Weise berührt? Ich mußte ihn in die Arme nehmen, sein Köpfchen an meine Brust pressen, auf dem Lager schien er mir weit, riesig weit entfernt zu sein. Ich suchte es mit meinem Hauch, mit meinen Küssen zu beruhigen, bis sich der rasche, schwere Athem zu meiner Beruhigung gelegt hatte. Da »Trab«, »Trab«, der schwere Tritt des Löwen wieder hörbar, näher der Hütte als zuvor. Dann, Herr, bevor ich mich dessen versah hörte ich, das Raubthier an der Hüttenwand, es hatte den Kopf gegen eine der breiten, tiefer liegenden Ritzen gepreßt und zwar mit einer Kraft, daß der lose Mörtel von der Innenwand herabfiel. Mit lauten, schlürfenden Athemzügen, schnupperte es durch die Fugen, vergewisserte es sich von unserer Anwesenheit.
Hatte ich in meiner Unruhe das Kind zu sehr an mich gepreßt, ich weiß es nicht, doch es fing an zu weinen. Werden Sie nicht unmuthig, Herr, warum runzeln Sie die Stirn? Konnte ich dafür, daß ich das Kind zu fest an mich zog? Ich war wohl dasselbe holländische Weib geblieben, allein ich war wehrlos und in einer finsteren Nacht einem wüthenden Feinde preisgegeben, den ich nicht einmal sehen konnte. Ich beugte mich nieder zu dem zweiten Kinde und hob es empor, und dieses durch das Weinen des Säuglings geweckt, fing nun nicht minder heftig zu weinen an. Was sollte ich thun? Wie sollte ich die Kinder beruhigen? Verzweiflungsvoll warf ich mich vorwärts, daß die brennende Stirne das Grasdach berührte, und preßte die beiden Kinder fest an mich. Ich konnte mich kaum der Thränen erwehren, aber bemeisterte mich mit fast übermenschlicher Gewalt, das Weib eines Boerjägers durfte nicht schluchzen.« Einige Tage später als sie das Erlebte ihrem Manne zu erzählen begann, suchte das so lange gefolterte mütterliche Gefühl in einem heftigen Schluchzen Erleichterung.
»Ich wollte an dem feuchten Grase meine brennende Stirne kühlen, allein um das Maß meines Schmerzes voll zu machen, dringt plötzlich durch all die Fugen und Ritzen unserer gebrechlichen Nußschale ein sinn- und ohrbetäubendes Gebrüll ein. Die dünnen, nichtigen Wände, die Luft um uns schienen zu zittern. Sie kennen es wohl, haben es doch vielmals in der Wildniß vernommen, dieses eigene Gebrüll! Wie aus der heiseren Kehle eines rachsüchtigen Riesen herausgestoßen! Die dumpfen Brülllaute zuerst rasch einander folgend, dann langsamer, in kürzeren Pausen und weniger deutlich, bis sie in einem dumpfen Stöhnen ihren Abschluß finden. Jeden Moment glaubte ich die Wand eingedrückt, und den grünlichen Schein der furchtbaren Augen zu sehen. Ich konnte mich kaum mehr aufrecht halten und fühlte meine Kraft schwinden. Doch Dank dem Herrn, er hielt Wache über uns; der Löwe versuchte noch mehrmals sein Manöver, uns durch sein Gebrüll aus der Hütte zu scheuchen. Doch es gelang ihm nicht. Um so erfolgreicher war sein Versuch an dem Viehkraal, die Ochsen brachen durch die Umzäunung aus den Dornbüschen, der Löwe griff eines der Thiere an und tödtete es nahe an unserer Wohnung. Deutlich hörte ich das Stöhnen des armen Rindes und das zornige Brummen des Löwen, der mehrmals während der Nacht den Cadaver verließ und unsere Wohnung umkreiste, ohne jedoch wieder so nahe anzukommen, wie er es das erstemal gethan.«
Nach seiner Rückkehr nahm Jan van Viljoen neuerdings die Verfolgung des räuberischen Eindringlings auf, die des hohen Graswuchses auf den Ebenen und in den Thälern des Maschona-Landes halber, bei weitem mehr Vorsicht erfordert und gefährlicher ist, als in den Betschuana-Ländern. Doch auch diesmal war seine Mühe erfolglos. Fünf Tage später kehrte der alte Herr mit seiner Frau von dem am Matabele-Hofe abstatteten Besuche zurück. Er war von einem andern holländischen Jäger Namens Grief begleitet.
Am selben Nachmittage als die Jäger sich zu einem kleinen Nachmittags-Schläfchen niedergelegt hatten, wurden sie durch die Diener wach gerufen, welche die aus dem Matabele-Lande mitgebrachten Pferde, deren Bewachung ihnen oblag, herantrieben und die Nachricht brachten, daß ein und wahrscheinlich der nämliche Löwe einen vergeblichen Versuch gemacht habe sich eines der Reitthiere zu bemächtigen. Die Jäger sattelten sofort ihre Pferde, nahmen mehrere Matabele-Diener mit sich und eilten der Stelle zu, an welcher man das Raubthier wahrgenommen hatte. Der alte Herr van Viljoen nahm es auf sich, das Ufer des nahen Umaweja-Flusses hinabzureiten, während sein Sohn und Grief das seichte Flußbett durchritten, um das jenseitige Ufer abzusuchen. Kaum hier angelangt, wurden sie von einem der Matabele auf den unter einem Busche liegenden Löwen aufmerksam gemacht.
Er lag etwa hundert Meter von dem Flusse entfernt. So wie er uns erblickte machte er sich auf und davon. Nein — so sagte ich zu mir, berichtete mir Jan Viljoen, diesmal darfst du uns nicht entkommen, und dem Pferde die Zügel lassend, holte ich aus, hatte auch bald meinen Wunsch erreicht und das Raubthier, welches sich zeitweilig mit seinen Sätzen über das Gras erhob überholt. Schon sechzig Schritte vor ihm machte ich plötzlich gegen dasselbe Front und es gelang mir, es durch einen lauten Schrei und eine drohende Handbewegung auf einen Moment zum Stillstand zu bringen. Diesen Augenblick benutzte der uns nachgaloppirende Grief um von seinem Pferde aus auf den Löwen zu feuern. Die Kugel traf das Thier, das scheinbar todt zusammensank. Sofort eilten unter lautem Geschrei die Matabele-Diener herbei, um der Gewohnheit gemäß ihre Speere in den Cadaver zu tauchen. Doch — im selben Momente als sie demselben nahe kommen, springt der todtgeglaubte Löwe auf und macht sich sprungbereit. Nur zwei der Schwarzen hielten Stand. Als sie sich jedoch von ihren Genossen verlassen sahen, dachten auch sie an den Rückzug, denn sie konnten in dem hohen Grase die Bewegungen des Löwen nicht verfolgen.
Sobald jedoch der Löwe auch diese Beiden fliehen sah, sprang er ihnen nach. Der Verfolgte wurde zum Verfolger. Die Reiter, die ihn todt wähnten, hatten ihre Pferde gewendet und ritten eben langsam dem Lagerplatze zu, als ihnen durch das Hilfegeschrei der Matabele Halt geboten wurde. Im selben Momente hatten sie die Pferde herumgeworfen und eilten den beiden hart Bedrängten zu Hilfe. Doch sie kamen zu spät und konnten es nicht mehr verhüten, daß der Löwe einen der beiden Letzten ereilte, ihn zu Boden riß und Schenkel und Schultern zerfleischte. Jan van Viljoen war der erste zur Stelle, er war unmittelbar an das Raubthier herangeritten, sprang aus dem Sattel und sandte dem ihn anstarrenden Löwen die Kugel in das Ohr, daß er nach rechts überschlug und neben seinem Opfer niederfiel. Dieses jedoch, im Glauben der Löwe geberde sich scheintodt wie das erste Mal, sprang auf und suchte das Weite, um jedoch schon zwanzig Schritte weiter in Folge des starken Blutverlustes besinnungslos niederzustürzen. Drei Monate lag der Arme krank, bevor seine vielen Wunden heilten. Der Löwe gehörte der Krachmanetje-Art an und war der letzte, den Jan van Viljoen erlegte.
Mit Herrn Allenberg und Vermold machte ich mehrere Ausflüge nach dem Zwartkop- und Zondaags-River, auf welchen ich äußerst zahlreiche, der Juraformation angehörende Fossilien sammelte. Ich wollte meine Sammlungen sowie die Käfige mit den lebenden Thieren[24] mit dem Dampfschiff Arab der Union Steam Ship Company absenden und hatte auch die Befrachtung des Kutters, welcher die Colli von den Waarenhäusern bis an das etwa eine halbe Meile von der Küste vor Anker liegende Schiff bringen sollte, beaufsichtigt, und verließ den letzteren, als Alles vorsichtig in demselben niedergelegt worden war. Ich begab mich dann in die Stadt, um meine Abschiedsbesuche zu machen, denn ich wollte mit demselben Dampfschiffe bis Capstadt fahren, hier vierzehn Tage verbleiben, um mich dann auf dem Dampfer German einzuschiffen. Zur See zurückgekehrt, fand ich meine Colli am Meeresufer aufgethürmt; als man nämlich mittelst eines Taues den Kutter durch die Brandung zu ziehen suchte, war das letztere gerissen und der Kutter an’s Land zurückgeworfen worden, wobei das Wasser in das Fahrzeug gedrungen war. Es war ein Wunder, daß es nicht an der hölzernen Landungsbrücke zerschellte und ich so die Arbeit der letzten vier Jahre nicht eingebüßt hatte. Da es nun nicht mehr möglich war, mein Gepäck noch vor der am selben Nachmittage zu erfolgenden Abfahrt des Arab an Bord desselben zu bringen, überließ ich es der Obhut des neuernannten österreichischen Consuls für Port Elizabeth, Herrn von Mosenthal, eines ebenso gefälligen als hochgebildeten Mannes, welcher mir außerdem während meines Aufenthaltes in Port Elizabeth äußerst zuvorkommend begegnete und einer der wärmsten Vertheidiger der Interessen Oesterreichs im Auslande ist.
Als ich mich vierzehn Tage später in Capstadt einschiffte, fand ich meine Gepäckstücke in der besten Art und durch einen besonderen Bretterverschlag geschützt auf dem German untergebracht, wofür ich besonders den Herren Mosenthal, Allenberg, Vermold und dem zweiten Offizier des German zu danken habe. Am dritten Tage, nachdem wir Port Elizabeth verließen, landeten wir in Capstadt, wo ich ein nicht minder herzliches Entgegenkommen als in Port Elizabeth fand. Ich hielt hier mehrere Vorlesungen, darunter eine in der philosophischen Gesellschaft, die mich ein Jahr zuvor zum correspondirenden Mitgliede gewählt hatte. Ich machte in Capstadt die ehrenwerthe Bekanntschaft Sr. Excellenz des Statthalters der Cap-Colonie, Sir Bartle Frere, eines der hervorragenden englischen Politiker und Geographen, ferner einiger Edelleute, welche seinen Stab bilden, darunter des Sohnes des Lords Hathurton, Herrn Litleton, ferner der Minister der Cap-Colonie, vieler der hervorragendsten Mitglieder beider Häuser des Cap-Parlaments, sowie des berühmten Astronomen Prof. Gill, des Custos des südafrikanischen Museums, Herrn R. Trimen, des Landesgeologen Dunn, des Geologen Shaw, des Botanikers Bolus, der Redacteure der »Cape-Times«, Argus »Standard Mail« und der »Lantern«, sowie des »Uitenhaager Blattes«, Herrn Bidwell — sämmtlich Herren, die sich mit Wärme meines Vorsatzes bezüglich der Erforschung des centralen Süd-Afrika und einer Eröffnung Central-Afrika’s nach dem Süden angenommen hatten. Von den Mitgliedern des Parlaments wurde mir die hohe Ehre erwiesen, daß am Tage meiner Abreise von Capstadt durch Hon. Brown im Hause der Antrag gestellt wurde, daß sich das Gouvernement der Cap-Colonie meine Dienste zum Zwecke neuer Forschungen im Gebiete zwischen dem Vaal und Zambesi sichern solle. Die Regierung jedoch ersuchte, wie ich später erfuhr, den geehrten Herrn Antragsteller, meiner Rückkehr nach Europa halber, den Antrag zurückzuziehen.
In Capstadt wurden mir neuerdings 40 £ St. verehrt, welche mir sehr willkommen waren, da ich durch den verlängerten Aufenthalt in Grahamstown und in Port Elizabeth von der in Cradock erworbenen, zur Heimkehr bestimmten Summe manches Pfund eingebüßt hatte. Die Hälfte der in Capstadt verlebten Zeit brachte ich am Meeresufer zu und hier bildeten Fische und Schwämme meine Ausbeute, während mich die Algoa-Bai namentlich mit Cephalopoden, Muscheln, Schnecken, Seeraupen und Algen, die Umgegend mit Pflanzen und Fossilien versehen hatte.
Das in Süd-Afrika, meist während meiner drei Reisen gesammelte ethnographische und naturhistorische Material besteht in etwa 30900 Exemplaren, von denen ich über 12500 Exemplare in dem mir von dem hohen k. k. Handelsministerium gütigst überlassenen Pavillon des Amateurs in Wien vom Beginne des Mai bis Ende October 1880 ausgestellt habe. In dieser Sammlung befanden sich über 1300 ethnographische Objecte, welche ich unter den Buschmännern, Hottentotten, den Fingo, Gaika, Galeka, Pondo, den südlichen und nördlichen (Matabele) Zulu’s, den Basuto’s, den Betschuana-Stämmen (Batlapinen, Barolongen, Banquaketse, Makhosi, Manupi, Baharutse, Bakhatla, Bakwena, Ost- und West-Bamangwato), den südlichen und nördlichen Makalaka, Maschona,[25] Manansa, Matonga, Masupia, Marutse, Mabunda, Mankoë, einige Stücke von den Bewohnern von St. Helena und Madeira erworben habe, sowie einige von den Colonisten verfertigte Arbeiten. Die naturwissenschaftliche Abtheilung enthält eine Sammlung von Fellen, welche zum Ausstopfen bestimmt sind, zu welchem Zwecke nach dem Tode der betreffenden Thiere, an deren Körper die nöthigen Messungen vorgenommen wurden und 41 Schädelskelete vorlagen. Außerdem 14 kleinere Thiere in Spiritus aufbewahrt. Ferner 71 lose Felle, 62 anatomische Präparate, 10 pathologische Objecte, 134 Hörnerpaare von Gazellen, Antilopen, Gnu’s, Büffeln etc. Von Vogelbälgen wurden ausgestellt, und zwar von mir präparirt, 271 Bälge; vom Elephantenjäger Bradshaw erstand ich 62; 69 waren von Mr. Walsh gegen Elfenbein eingetauscht; 42 von Mr. X. aus der Transvaal-Colonie und 20 kaufte ich dem Taxidermist des südafrikanischen Museums in Capstadt ab.[26] Ferner von Vögeln 11 anatomische Präparate, 4 pathologische Präparate, 23 Nester, 89 Eier und eine Gruppe von 57 in 8 Rahmen geordnete Straußenfedern.
An Reptilien: 25 Schildkröten (2 anatomische Präparate); 256 Eidechsen, (2 anatomische Präparate;)[27] 87 Schlangen (10 anatomische Präparate); 45 Lurche. Ferner: 69 Fische (4 anatomische Präparate); 35 Eier verschiedener Haifischarten. An Gliederthieren waren 2256 ausgestellt.
An Insecten wurden vom Jahre 1872 bis 1878 über 18000 gesammelt, 1300 von dem Elephantenjäger Dr. Bradshaw gegen Elfenbein eingetauscht. In der Ausstellung befanden sich 2056 Exemplare, und zwar 1744 Käfer, 4 Raupen, 25 Wespen, 1 Termitenkönigin, 162 Heuschrecken, 62 Wanzen, 19 Schaben, 39 Insectenbauten.[28] An Zecken waren 8, Krustenthieren 33, Spinnen 51, Spinnennestern 8, Scorpionen 36, Scolopendern 40, Julus 20, Würmern 4 Arten ausgestellt.
Von Weichthieren 782, darunter 9 Cephalopoden und 3 Cephalopodengehäuse, 148 Schnecken, 26 Muscheln, 43 Patellae, 26 Seeraupen, zusammen 243 Exemplare, sämmtlich in Spiritus aufbewahrt. Einsiedlerkrebse 10, Gehäuse von Schnecken 370; von Muscheln 100; von Patellae 70; zusammen 540 Exemplare.[29] Von den niederen Ordnungen der Seethiere befanden sich in der Ausstellung 933, darunter 37 Seeigel, 15 Seesterne, 7 Quallen. Von Meeres-Polypen: 31 Corallenbildungen von St. Helena, 336 aus der Algoa-Bai, 3 aus der Tafel-Bai, 365 Schwämme aus der Algoa- und Tafel-Bai, 59 Schwämme in Spiritus und 7 aus der Tafel-Bai, zusammen 801 Exemplare;[30] schließlich 73 verschiedene niedere Meeresthiere.
Von den 1138 ausgestellten Versteinerungen habe ich etwa 60 Stück von den Herren Dr. Reed in Colesberg, Murray in Kuilfontein, Kidger in Cradock und Cook in Port Elizabeth zum Geschenk erhalten, die übrigen selbst gesammelt. Ferner befanden sich in der Ausstellung 1130 getrocknete Meeres-Algen, 364 Früchte und Samen, Holzarten, Schwämme etc., 3328 getrocknete Pflanzen im Herbarium, wovon ich 64 Exemplare zum Geschenk erhielt. An Mineralien waren 720 Handstücke ausgestellt.[31]
Nach siebenjähriger Abwesenheit von der Heimat konnte ich nicht länger die Sehnsucht bemeistern, meine Lieben und Freunde in Europa wiederzusehen. Allmälig entschwand die Küste bei Green Point und später die Kuppe des Tafelberges meinen Blicken. Der Ocean, dessen Beute ich vor sieben Jahren bald geworden wäre, bot diesmal ein Bild beglückenden Friedens und bewahrte mir auch seine Gunst, bis mein Fuß wieder europäischen Boden betreten hatte.
Am 5. August 1879 nahm ich an Bord des Dampfers German von Süd-Afrika Abschied. Meine Sammlungen wurden in einigen Partien heimgesendet. Die größte Sendung, circa fünfzig Kisten, brachte ich selbst mit. Von den mitgebrachten lebenden Thieren übergab ich den Caracal, zwei braune Adler und den Schlangenadler der zoologischen Gesellschaft zu London. Die übrigen nahm ich mit nach Oesterreich. Seine kaiserliche Hoheit Kronprinz Rudolph geruhte die Kronenkraniche huldvollst entgegenzunehmen, den Pavian, ein äußerst zahmes Exemplar, und einen der grauen südafrikanischen Kraniche übergab ich der Stadtvertretung von Prag für den Stadtpark, den dunkelbraunen Aasgeier und einen der langarmigen Zanzibar-Affen der Physiokratischen Gesellschaft.
In London erhielt ich während meines mehrwöchentlichen Aufenthaltes abermals Beweise von Hochherzigkeit einiger englischen Familien, welche es mir ermöglichten, meine Sammlungen nach der Heimat befördern zu lassen. Namentlich fühle ich mich Herrn Littleton, Sohn des Lord Hathurton, welcher mir 100 £ St. zur Verfügung stellte, und der Direction der Union Steam Ship Company, welche mir die ganzen Frachtspesen von Capstadt bis Southampton nachließ, zu größtem Danke verpflichtet.
In meiner Seele wurzelt der feste Vorsatz, so bald als thunlich wieder zurückzukehren, um meine Forschungen fortzusetzen, erstens um gewisse interessante Punkte, die ich nur vorübergehend besuchen konnte,[32] einer näheren Besichtigung zu unterziehen, zweitens um auf die in den letzten sieben Jahren gemachten Erfahrungen bauend, die Forschungen von Süd-Afrika nach Central-Afrika auszudehnen.[33]

[22] Vergl. den Auszug aus dem englischen Originaltexte im Anhange 10.
[23] Gegenwärtig ist die Eisenbahnstrecke bis Grahamstown ausgebaut.
[24] Zu meinem größten Leidwesen gestatteten es mir die Verhältnisse nicht, meinen treuen Mosco mit in die Heimat zu nehmen.
[26] Etwa 50 von den erstgenannten vier Sammlern und einige von Herrn Brown in Tati gekaufte wurden theils verschenkt, theils nach der Ausstellung in Kimberley mit anderen Gegenständen verkauft, um das Deficit der Ausstellung zu decken; etwa 60 Vogelbälge wurden in Prag zurückgelassen.
[27] Eine gleiche Anzahl letzterer ging in Folge Mangels an genügend starkem Weingeiste in Süd-Afrika zu Grunde.
[28] Die Insecten sind von Herrn Dr. Rickerle in Prag gespießt und zum großen Theile bestimmt worden.
[29] Etwa 300 Duplicate nicht eingerechnet.
[30] Etwa 500 Duplicate nicht eingerechnet. Davon sind 50 Exemplare gekauft, die übrigen selbst gesammelt.
[31] 400 Stück nicht mit eingerechnet, von denen ich viele in letzter Zeit schleifen ließ und welche sich als Onyxe von besonderer Schönheit und an Nickelmetall reiche Jaspisgeschiebe erwiesen haben.
[32] Siehe den Hinweis in Anhange zum ersten und zweiten Bande
1) Die Roiwater-siekte, welche die Zugthiere in Natal und den angrenzenden Freistaat- und Transvaal-Partien in manchen Jahren decimirt, tritt meist zur Zeit der Grasreife auf und besteht wohl in einer acuten, doch auch chronischen Entzündung der inneren Harnorgane, zuweilen auch mit Ruhr verbunden. Blutharnen ist eines der gewöhnlichsten Symptome. Die erkrankten Thiere scheinen große Schmerzen zu leiden, denn viele blöken mit hoch emporgehobenem Kopfe, manche drehen sich dabei im Kreise herum. Die Thiere erkranken am Orte selbst, wo sie den Krankheitsstoff (gewisse Pflanzen) in sich aufgenommen, oder auch acht bis zehn Tage später, nachdem sie bereits die betreffenden Gegenden verlassen haben. Bei manchen hat es den Anschein, als ob sie das Uebel in einer gelinden Form überstanden hätten und da soll man sofort die Thiere von der Arbeit nehmen und sie womöglich in gegen kalte Winde geschützten Partien bis zur vollen Genesung halten. Beläßt man sie jedoch im Joche und hat man zur selben Zeit unter kaltem Regen zu leiden, so erkranken die Thiere unter den gefährlichsten Symptomen und die Fälle enden dann meist tödtlich. Als bestes Heilmittel bezeichnete man mir fünfzehn bis zwanzig Tropfen mit Wasser verdünntes Chlorodyn, welche den Thieren von fünf zu fünf Stunden eingeflößt werden.
2) Bei der Untersuchung der Wunde des Kriegers in Schoschong fand ich mehrere eiternde Wundkanäle, welche dafür sprachen, daß der Knochen oben und unten abgefault war. Ich entschloß mich die losen Fragmente zu entfernen und da der Kranke eine Erweiterung der Wundkanäle mittelst eines Messers nicht gestatten wollte, erreichte ich den beabsichtigten Zweck durch ein mehrmaliges Abbrennen mit Lapis, da es jedoch nicht möglich war, das untenliegende, über acht Zoll lange Knochenstück auf diesem Wege zu entfernen, lieh ich mir von Herrn Mackenzie eine Blechscheere, führte ihre Spitzen in den Wundkanal ein, zwickte den todten Knochen durch und extrahirte ihn wie alle übrigen in Mangel eines anderen Instrumentes mit einer Mahlzahnzange. Ich entfernte etwa fünfundzwanzig Knochenstücke und fand dann mit der Sonde die Wundkanäle, welche durch Kugelsplitter entstanden waren. Nun war es mir möglich, an der Hinterseite des Unterschenkels durch frische Einschnitte Fragmente zu entfernen. Mittelst eines wohl noch nie zu einem solchen Zwecke gebrauchten Meißels schabte ich die vordere, ebenfalls etwas cariös gewordene Fläche der Fibula rein und reinigte die erkrankten Stellen mit adstringentia. Als ich den Mann zwölf Monate später wieder sah, hatten sich die beiden Enden des Schienbeines durch neue Knochenmasse vereinigt und der Mann, der sich zuweilen beim Gehen auf einen Stock stützte, hatte blos einen etwas verbreiterten Schienbeinknochen.
3 u. 4) Waren die Kopfschmerzen und der Blutandrang zum Kopfe zu heftig geworden, so half ich mir durch das Auflegen von starkem Senfpflaster auf den Hals, in Folge dessen der Kopf profus zu schwitzen begann und die beklemmenden Zustände nachließen. Während der sechzehn Monate, welche Zeit hindurch ich an Fieber litt, machte ich in verschiedenen Perioden zusammengefaßt, nur ungefähr durch zwei Monate von kleinen, nie zwei Gran übersteigenden (meist eingranigen) Chinindosen Gebrauch. Von bestem Erfolge erwiesen sich starke Schweiße, welche anfänglich wohl schwächten, jedoch die Athembeschwerden, die Kopf- und Nackenschmerzen, sowie das Gliederreißen und das dumpfe Gefühl der Schwere in den Oberschenkeln behoben.
5) Während der Fahrt durch das Makalaka-Land folgte ein Makalaka-Diener Bradshaw’s mit Namen Mapani unserem Wagen. In einer der dichteren Partien des Waldes sah ich eines Tages einen alten und einen jungen Mann im Grase liegen von welchen der Jüngere Mapani plötzlich anrief. Dieser hatte die Beiden kaum bemerkt, als er im nächsten Augenblicke zu ihnen hinsprang, seinen Hut vom Kopfe riß und dem alten Manne (seinem Vater) zu Füßen lag und unter einem mehrmaligen »Rumela« zwei eiserne Hauen aneinanderschlug. Als er sich wieder erhoben hatte, sah ich zum ersten Male Thränen in den Augen eines erwachsenen Schwarzen. Als wir später hielten suchte Mapani eine Greisin auf, welche mit vieler Mühe etwa fünfzig Pfund Korn für ihn gebracht hatte. Es war die Mutter des Makalaka-Dieners.
Eine andere Episode erzählte mir Diamond, der in den letzten zwölf Jahren bald als Diener, Koch oder Wagenlenker, Händler und Jäger auf ihren Zügen durch Süd-Afrika begleitete und später Gelegenheit gefunden hatte, selbstständig sein Glück als Jäger zu versuchen. Er schoß während dieser seiner Laufbahn so viel Elephanten, daß er sich für den Erlös einen Farmbesitz im Griqualande hätte kaufen können, wenn nicht das Feuerwasser gewesen wäre. Arm, siech und altersschwach, in Folge des allzuhäufigen Genusses, war er zuletzt nicht mehr fähig, Elephanten zu jagen und so arm, daß er nicht einmal das Gewehr, mit dem er schoß, sein nennen konnte. Doch gab es Momente in seinem Leben, wo ihm, einem Opfer der Trunksucht, bei dem Anblicke der stillen Häuslichkeit eines Andern das Gewissen erwachte und sich hören ließ. Mit dem Vorsatze sich zu bessern, kam er einmal nach der Colonie und es fand sich auch ein braunes Griquaweib, welches seine Frau wurde. Willig überließ er ihr die Zügel der Regierung, ohne dabei den Kürzeren zu ziehen, denn nie war mit ihm ein Brodherr so zufrieden, wie jener, bei dem er als verheirateter Mann diente. Dieser war ein Händler und zog durch das Makalaka-Land nach dem Zambesi. Bevor noch Diamond das letztere betreten hatte, war er Vater geworden, was den gebesserten Charakter des Mannes nur noch stetiger zu machen schien. Es gab um jene Zeit viel Regen im Makalaka-Lande, der von dem Stamme hochbegrüßt, eine reiche Ernte versprach, den Reisenden jedoch große Schwierigkeiten bereitete und das Fortkommen auf dem durchweichten Boden sehr erschwerte. Dieses Regenwetter machte das braune Weib und ihr Kind kränklich und als sie an einer kleinen Lichte, nahe an Menons Dorfe lagerten, hatte die Krankheit des Säuglings in bedenklicher Weise zugenommen. Wir passirten eben diese Lichtung. Diamond saß neben mir am Bocke und wendete sich plötzlich mit den Worten zu mir: »Seht, Herr,« und er wies mit der Peitsche nach der Mitte der Lichte zu, wo üppiges Gras hochaufgesprossen war, »dort liegt mein Kind begraben!« Als er während seines früheren Aufenthaltes auf dieser Lichte gegen den Abend des zweiten Tages mit seinen Zugthieren von der Weide heimkehrte, kam ihm seine Frau entgegen, »Diamond,« sagte sie, »unser Kind ist todt.« Den Schmerzausbruch meines Weibes hinderte ich mit einer raschen Handbewegung und mit den Worten: »Weib, sei still und zeige kein trübes Gesicht, merkt es einer der Makalaka’s, so dürfen wir unser Kind nicht begraben,« denn von irgend einem abergläubischen Motiv beherrscht, gestatten es die Makalaka’s nicht, daß ein Fremder weder schwarz noch weiß, in dem von ihnen bewohnten Territorium begraben werde. Stirbt einer unglücklicher Weise im Gebiete des Majtenque-Flusses, so muß er bis an die Landesgrenze geschafft und hier erst bestattet werden; dies wußte Diamond wohl und da er in Folge der schlechten Wege wohl nicht in den nächsten vierzehn Tagen so weit gelangen konnte, mußte auf jeden Fall der Tod des Kindes geheim gehalten und dasselbe im Dunkel der Nacht bestattet werden. Diamond entschloß sich, seinem Herrn den Todesfall geheim zu halten. Seinen Gefährten gegenüber zwang sich Diamond, so wie es ihm nur thunlich war, vergnügt zu erscheinen, und um einigen Makalaka’s, die eben bei ihm zu Gaste waren, den bitteren Verlust nicht ahnen zu lassen. Als sich endlich die Makalaka entfernt hatten, schlich sich Diamond in das nächste Gebüsch, um sich auch zu vergewissern, daß sie gegangen waren, kehrte dann rasch zu der neben ihrem todten Kinde anscheinend schlafenden Frau zurück. »Nimm das Kleine mit Dir in den Wagen und hülle es in ein Tuch, lasse es im Wagen und ruhe etwas auf den Decken unter demselben aus. Das Weib that wie ihr geheißen, während sich Diamond mit dem Gespann zu schaffen machte. Er brachte die am vorderen Ende befestigten Zugthiere an die mittleren heran, um sie ganz gegen seine Gewohnheit hier zu befestigen und als er dies gethan, legte er sich anscheinend zur Ruhe nieder, in Wirklichkeit aber um zu wachen. So hatte er einige Stunden in dieser Weise zugebracht, dann stand er auf und brachte die sämmtlichen in der Mitte befestigten Ochsen nach vorne, rief dann sein Weib und beide machten sich daran, die reichlich angehäuften thierischen Excremente an einer Stelle, die ihnen für ein Grab ihres Kindes hinreichend groß zu sein schien, bei Seite zu schaffen, gruben ein seichtes Loch und legten die Leiche hinein. Den letzten Liebesdienst erwies seinem Kinde Diamond allein. Er konnte seiner Frau das Schluchzen nicht verwehren, und da er sich fürchtete, daß dasselbe ihr Thun verrathen könnte, sandte er sie zu ihrem Lager zurück, während er das kleine Grab schloß, mit den Excrementen der Thiere die Stelle bedeckte und hierauf die Zugthiere abermals dicht gedrängt um dieselbe befestigte und erst gegen Morgen auf ihre gewöhnlichen Posten zurückstellte. Die Makalaka’s merkten nichts von der Bestattung, doch der mehrtägige Aufenthalt auf der Stelle war eine trübe Zeit für das Hottentottenweib. »Und seit jener Zeit,« fuhr Diamond fort, »ging es wieder bergab mit mir, die Frau kränkelte mehr und mehr und es dauerte nur wenige Wochen und ich hatte auch für sie ein Loch zu graben. Seit ihrem Tode kam der Brandy wieder über mich und ich bin der Diamond von früher geworden und werde auch so bleiben, bis man auch mir irgendwo unter einem alten Dornbaum ein Loch gräbt.«
6) Ich erwähnte bereits, daß Herr Cowley, der jugendliche Jäger, mit aller Macht ein Gordon Cumin zu werden bestrebt war und zu diesem Ehrgeiz durch den Erfolg seiner ersten Löwenjagd, auf welcher er eine ausgewachsene Löwin erlegte, angespornt wurde. Ein fernerer Grund dieses Bestrebens mag wohl auch der Umstand gewesen sein, daß seine ihm an Erfahrung unstreitig überlegenen Jagdgefährten, die beiden schon erwähnten englischen Officiere, weder das Glück noch Gelegenheit hatten, eines der königlichen Thiere zu erlegen. Unter der großen Zahl von etwa vierzig Löwen-, Elephanten- und Straußenjägern sowie Elfenbeinhändlern, welche auf ihren Zügen zufällig mit Löwen zusammenkamen und sie zu bekämpfen hatten, ist mir nur mein seliger Freund Cowley bekannt, der an einen Eingebornenfürsten im südlichen Afrika die Anfrage stellte: »Morena (König), bezeichne mir eine Stelle in Deinem Reiche, wo ich mit Sicherheit Löwen antreffen und erlegen kann!« Da Cowley auch, nachdem der Fürst seinem Begehren entsprochen, seine Absicht zur Ausführung brachte, kann ihm Niemand Muth und Entschlossenheit absprechen, doch ihn vielleicht mit selbem Rechte einer Tollkühnheit zeihen, und dies um so mehr, als er auf diesem, seinem zweiten Jagdzuge beinahe sein Leben eingebüßt hätte.
Auf der Reise von Süden nach Norden wird der Reisende in den nördlichen Betschuanaländern und nördlich am Zambesi so häufig — er selbst sowohl auf seinen Jagdausflügen, wie seine Diener beim Wasserholen und Hüten etc., die Zugthiere beim Grasen, oder sein Lagerplatz in der Nacht, oder auch zuweilen das Eigenthum des Stammes, bei dem er sich zufällig aufhält — von Löwen angegriffen, daß es dann seine Ehre und Pflicht fordert, ja daß es oft die Nothwendigkeit erheischt, sein, oder das Leben seiner Umgebung zu schirmen und mit dem stärksten der südafrikanischen Raubthiere anzubinden. So ist ihm mehr denn hinreichende Gelegenheit geboten, seinen eigenen Muth, sein sicheres Auge und festen Arm zu erproben. So oft ich mich an Cowley erinnere, kann ich mich eines wehmüthigen Gefühles nicht erwehren. Noch immer sehe ich den frischen Jüngling vor mir mit dem blühenden Gesicht, sehe ihn, wie männlich er alle Strapazen eines südafrikanischen Interior-hunters ertrug und dann quält der Gedanke mich umsomehr, daß dieser von Gesundheit strotzende Organismus in wenigen Tagen dem Malaria-Fieber erliegen mußte. Am Abhange der bewaldeten Höhen, die sich am Oberlaufe des Panda ma Tenka-Flüßchens zu dem wiesigen Thale des letzteren herabneigen, einige hundert Schritte über der Handelsstation gleichen Namens, hat man den Löwenjäger begraben. Ein Steinhaufen, mit dem man das Grab beschwerte, um Hyänen und Schakale davon abzuhalten, bezeichnet die Ruhestätte des jungen Jägers.
Es war am 3. September des Jahres 1875, als Cowley während des abendlichen Methgelages (womit täglich das Nachtmahl am Marutse-Hofe in Schescheke schloß) an den König Sepopo die erwähnte Frage richtete und sich von dem Könige das Geleit einiger Marutse- oder Masupia-Männer erbat, welche ihn an eine von Löwen häufig besuchte Stelle bringen sollten. Auf diese Anfrage hin brach Sepopo in ein lautes Gelächter aus. »Ein Kind hat eben geredet, bist ja noch zu jung, um Löwen zu tödten! Makoa (Weißer), ich versichere Dich, die Löwen verstehen es zu beißen.« Da jedoch Cowley durch den Dolmetscher Jan Mahura auf seinem Ansuchen bestand, berief der König aus dem ringsum hockenden Halbkreise vier Männer zu sich, und bezeichnete ihnen das linke Ufer des stromabwärts einige Meilen unterhalb Schescheke in den Zambesi von Norden her einmündenden Kaschteja-Flusses als die Stelle, an welcher der weiße Jäger zweifellos Löwen antreffen könnte. Am folgenden Vormittage stieß man von Schescheke in einem kleinen Kahne ab, steuerte flußabwärts und gelangte nach drei Stunden an die Mündung des vom Könige genannten Flusses. Dieser scheidet die schon mehrmals genannte, sich im Osten an Schescheke anlehnende, Blockley’s Kraal genannte Wildebene in eine kleinere westliche und eine sehr ausgedehnte östliche Partie. Kaum gelandet, schoß Cowley, zur vollen Befriedigung seiner Geleitsmänner eine aus dem hohen Ufergras aufspringende, feiste Rietbock-Gazelle. Da sich durch den Schuß jedoch das sichtbare, ringsum grasende Wild zurückzog, bestimmte Cowley den folgenden Tag zur Jagd.
Am folgenden Morgen verließ die Jagdgesellschaft schon bei anbrechender Dämmerung das Lager und ging das linke Kaschteja-Ufer entlang. Ein dunkler in der Entfernung auftauchender Gegenstand, den die Eingebornen für einen Löwen hielten, entpuppte sich als ein gestreiftes Gnu. Als man so fruchtlos mehrere Meilen weit gegangen war, kehrten die Jäger in einem weiten Bogen nach rechts über die Wildebene zu ihrem Lagerplatze an der Kaschteja-Mündung zurück; da jedoch die sonst drückende Tageshitze durch die am Himmel hängenden, dichten Wolkenmassen gemildert war, versuchte Cowley sein Glück zum zweiten Male, nachdem er einen Imbiß zu sich genommen. Man ging abermals das Kaschteja-Ufer entlang, doch weiter landeinwärts als man es am Vormittage gethan und es hatte den Anschein, als ob die Jäger mehr Glück haben sollten, denn schon zu Beginn ihres Streifzuges trafen sie zahlreiche Heerden von Zebra’s und gestreiften Gnu’s, doch Cowley war entschlossen, seine Waffe nur an einem Mitgliede der königlichen Familie zu erproben. Man ließ das Wild zur Rechten und verwandte die vollste Aufmerksamkeit meist auf das hohe Ufergras, in welchem man mit Sicherheit die Raubthiere vermuthen konnte. Und abermals waren es die Schwarzen, welche den Weißen auf einen etwa vierhundert Schritte entfernten Gegenstand aufmerksam machten. Als man näher herantrat, erhob sich eine Löwin. Nachdem sie einige Secunden die herannahenden Menschen angeglotzt, machte sie kehrt und zog sich langsamen Schrittes zurück. Cowley sandte einen der Schwarzen der Stelle zu, wo das Raubthier gelegen und machte sich mit den zwei anderen (der vierte war am Lagerplatze zurückgelassen worden) an die Verfolgung der Löwin. Raschen Schrittes vorwärts eilend, hatte er sich derselben bis auf zweihundert Schritte genähert, als sie sich gegen ihn umwendend, stehen blieb. Der Jäger benützte diesen Augenblick zum Feuern und sandte in rascher Aufeinanderfolge zwei Kugeln dem Raubthiere entgegen. Beide Schüsse gingen fehl. Der Löwin erschien jedoch das Pfeifen der Kugeln zu mißfallen und laut knurrend peitschte sie mit ihrem Schweife den Boden. Für einen Augenblick legte sie sich nieder und kam dann aufspringend in gerader Richtung auf die Menschen los. Cowley kniete nieder und schoß auf eine Entfernung von hundertfünfzig Meter, fehlte aber wieder. Um so rascher bewegte sich die Löwin vorwärts. Die beiden hinter dem Jäger stehenden Schwarzen überließen diesen seinem Geschicke und liefen, laute Verwünschungen dem sich nähernden Raubthier entgegenrufend, auf und davon. Cowley warf sich vollends zur Erde, suchte sich hinter einem kaum 2½ Fuß hohen, brodlaibförmigen Termitenhügel zu decken und feuerte von hier aus seinen dritten Schuß auf eine Entfernung von dreißig Meter. Die Kugel traf das Thier mit einer solchen Wucht am vorderen Schulterblattrand, daß es zurückgeworfen, auf seine Hinterfüße fiel. Aufbrüllend schnappte es nach der Wunde und sprang nun in großen Sätzen heran, glücklicher Weise jedoch nur die fliehenden Schwarzen beachtend, wobei sie Cowley vollkommen übersehen haben mußte. Um nun die Aufmerksamkeit des Thieres nicht auf sich zu lenken, hütete sich der Jäger, sein Gewehr zu laden, sondern verhielt sich ganz ruhig. Die Löwin, die nun das Tempo ihrer Schritte etwas gemäßigt hatte, passirte zu seiner Rechten in einer Entfernung von drei Schritten; erst als sie etwa sieben weitere Schritte gethan hatte, lud er sein Gewehr wieder und warf sich so behutsam wie möglich um den Termitenhügel herum, um mit dem an dem Insectenbau fest angelegten Hinterlader einen fünften Schuß zu wagen. Er lag noch nicht vollkommen geschützt, als die Löwin seine Bewegung wahrnehmend, zurückschaut, ihn jedoch abermals übersieht. So wie sich das Raubthier wieder den Dienern zuwendet, feuert Cowley. Die Kugel traf die Löwin hinter und etwas unter das rechte Ohr, so daß sie auch im selben Momente zusammenbrach. Trotzdem gab ihr Cowley einen zweiten Schuß, um sich von ihrer Unschädlichkeit zu versichern. Es war ein beinahe ausgewachsenes Thier, dessen Fell mir der werdende Cuming zeigte, und auf welches er nicht wenig stolz war. Niemand war aber über den Erfolg Cowley’s mehr erstaunt als König Sepopo.
7) We see before us Mankoroane and a part of the Batlapins and Montsiwe the Barolongchief and others! They say they wish to be annexed. Our first question, when accepting the offer, should be: »Is it the wish of the chiefs or their subjects? Do the people as well as the chiefs ask for it?« Our second question would then be: Why do you ask for annexation? Is it because of your great attachment to the Makoa (white men) called »Englishmen«, or is it because you are disregarded, or imagine yourself to be so by the other white race called the »Dutchmen« or perhaps because you are oppressed by one of the neighbouring tribes?—or is it that the Chief is particularly annexious to gain the title of Chief Paramount, if two dispute for it?« When we hear impartial judgment passed on this, then we already know something about the character of the chief and his people. However, we must endeavour to gain true information about the manner of life and the intellectual abilities of the tribe.
8) Die Dürre war leider für einen Theil des Oranje-Freistaates und große Landstriche der Cap-Colonie so verderblich, daß sehr viele Farmer verarmten und die meisten derselben, auf deren Boden seit Jahr und Tag kein Tropfen Regen gefallen war, sowie die den Transport von der Küste nach dem Innern mit Ochsengespannen vermittelnden Fuhrleute sehr schwere Verluste erlitten. Leider sind diese Dürren in jenen Gegenden Süd-Afrika’s periodisch wiederkehrend und werden wohl erst in einigen Decennien in gewissen Strichen durch den Aufbau von Riesendämmen behoben werden können. Manche Strecken der Cap-Colonie wurden theilweise auch in diesem wie im vorhergehenden Jahre von einer mehr denn zwölfmonatlichen Regenlosigkeit heimgesucht, welche den Viehstand mancher Grundbesitzer mehr als decimirte; so verlor ein Herr Ch. von viertausend Stück Vieh über dreitausend.
9) Wenn ich nicht irre, nahm die Straußenzucht im Oranje-Freistaate ihren Anfang, wurde aber bald bis auf einzelne Versuche fallen gelassen. Hingegen erfreute sie sich in der Cap-Colonie der besten Pflege, so zwar, daß sie hier beinahe zur Vollkommenheit gedieh und nunmehr aus derselben zahme Strauße in größerer Anzahl nach der Republik gebracht wurden, um hier von Neuem, und wie ich höre mit Erfolg, gezüchtet zu werden. Manche der Züchter verlegen sich auf den Incubator (ein hölzerner Kasten), in dem durch künstliche Wärme — meist mit Hilfe erwärmten Wassers — den Straußeneiern die nöthige Brutwärme zugeführt wird; andere ziehen den natürlichen Brutproceß vor. Einige stellen die den Eiern entschlüpften Küchlein unter die Obhut schwarzer Diener, ohne sie weiter mit Brutvögeln in Berührung zu bringen, während eine kleinere Zahl die zur Welt gekommenen Jungen den Aeltern anvertraut. Im Allgemeinen scheint das letztere System bessere Erfolge als das erstere zu versprechen, doch ist es nicht für Jeden durchführbar, da es in jeder Beziehung hin kostspieliger ist. Während man sonst die Küchlein verschiedenen Alters in beschränkten, die halberwachsenen und erwachsenen Vögel in mehr oder minder umfangreichen Umzäunungen hält und weiden läßt und man die letzteren (halberwachsenen und alten Vögel) in aus Pfählen und vier- bis sechsfachen starken, horizontal und in einem Abstande von zwölf bis achtzehn Zoll gezogenen Drähten gebildeten Umzäunungen mit ziemlicher Sicherheit erhalten kann, muß man im ersteren Falle über große und mit einer dichten und hohen Umzäunung begrenzte Räume gebieten können. Die Federn zahmer Strauße werden nie so schön, wie jene der wilden. Letztere werden immer werthvoller bleiben, sowie sie gegenwärtig immer seltener in den Handel kommen. Darum wäre die schon mehrmals ausgesprochene Idee bezüglich der Zähmung der Strauße von Seite jener Eingebornenstämme Süd-Afrika’s, respective der Betschuana und Matabele, in deren Ländern sich diese nützlichen Vögel noch im wilden Zustande vorfinden, einiger Beachtung werth, umsomehr als die von ihnen bevölkerten Strecken meist mit Niederwald bedeckt sind, welcher leicht auf mehrere Meilen hin umzäunt werden könnte. In großen Räumen sich selbst überlassen, und nur selten aufgesucht, werden sie sich an den Anblick des Menschen gewöhnen, werden solche Strauße unstreitig ein den wilden Vögeln vollkommen gleiches oder nahezu gleichkommendes Gefieder erhalten. Je größer auch der Raum, in dem sich eine Straußenheerde bewegen kann, desto weniger Gefahr droht ihr durch die Entozoa-Parasiten, welche die häufigste Todesursache unter zahmen Straußen bilden. In mehreren Städten der Cap-Colonie, wie in Port Elizabeth, Grahamstown und Cradock werden allwöchentlich am Samstag Straußenfedernmärkte abgehalten, auf welchen auch lebende Thiere zur öffentlichen Versteigerung gelangen. Ich entnehme einem zu Anfang October aus Süd-Afrika erhaltenen Briefe, daß in Folge der starken Vermehrung der Strauße der Preis derselben seit kurzer Zeit sehr gesunken ist. Brutvögel, von denen fünf Paar feilgeboten waren, wurden mit 100 bis 125, ein erwachsenes aber nicht brütendes Paar (vier Paare) mit 35 bis 50, zwei einzelne Hähne mit je 35 und zwölf junge Vögel mit 17 £. St. 17 Sh. das Stück veräußert. Ein interessanter Fall wird von Herrn Johnsohn von Witteklip berichtet, er hatte ein paar Brutvögel, welche, nachdem sie Eier gelegt, dieselben sofort im Stiche ließen. Herr J. legte acht Eier davon in einen Incubator. Nach dreiundvierzig Tagen kamen lebende Küchlein zur Welt, doch alle so schwach und elend, daß sie schon wenige Stunden darauf zu Grunde gingen. Die meisten waren Mißgeburten, eines der Thiere hatte mit Ausnahme der Fußknochen keinen Knochen im Körper. In der Zwischenzeit legten die alten Vögel abermals zahlreiche Eier, ohne sich wieder um dieselben kümmern zu wollen. Bei gleichem Vorgehen mit diesen Eiern wurde wieder kein Resultat erzielt. Die Küchlein waren abermals Mißgestalten, es befand sich ein Cyclop darunter und ein Thier, das nur einen Oberschnabel hatte.
10) »Is there anything at present more treatening for us on our South African horizon than the cloud of the Zulu question? Dark, thick, bearing numerous most pernicious flashes, mercilless as they can only be, bursting from an untamed savage element, this cloud darkens our hopes of future peace and prosperity. It threatens daily and hourly, more and more with its numerous layers, the thousands who blindly, slavishly, and furiously, like a pack of wild dogs, listen to and follow Cetyvayo’s dread comands.
There, north of the Tugela, there is the sword of Damocles suspended over thee, South Africa. But behold, not suspended by a mighty Sovereign or a wise man, who thought to teach a King to give account of every moment of his life, but by a blood-thirsty, savage king guilty of the shedding of the innocent blood of thousands of human beings! Shocking! How has such a creature ever dared to suspend a hanging peril over South African men? Were thou slumbering, mighty Britannia’s fearless symbol? Could the British Lion so long endure such acts of offence? There, north of the Tugela, in the horrid prison of native liberty, the Gordian knot avails its solver.
But there was still another cause which made the already threatening cloud to appear yet more dangerous. It was the juxtaposition of this cloud to the remaining ones, here and there obscuring the horizon. Too often driven by the same boisterus gale,—they are thrown together and when united, they change the peaceful blue sky into a fire-spitting volcano. A blue azure sheet the symbol of heavenly peace converted into a volcano threatening peril and destruction.
The seat of the greatest insolence in our South African Continent, the seat of the roughest savageness, an image of habitual, animal-like expression of rage and fury, the seat of the lowest degradation of the human race, where members of the governing tribe are misdealt with a great deal worse than many of the species ingratae of our animals, than the unclean animals of ancient ages—the Empire of lies and thefts, the conglomeration of all the vices a savage can boast of—yes, our South African viper nest lies there north of the Tugela! Courage is the only virtue we could attribute to them (the Zulu’s) if it would be exhibited, and used for brave acts, but if it is exercised only to strengthen the power of a tyrannical monster, for the sake of murdering and plundering, the virtue is misused, and no more a virtue than the expression of the animal fury of a »tiger of trade«, or by the cries of his digestive organs! Year after year, insult after insult, has been offered to, and commited on, the Natal colonists! Are they not our brethren, united with us under Her Most Gracious Majesty’s Sovereignty? The insults are offerd, to us as well as to them. Every righteous man who has the welfare of his fellow-subjects in view, every one from the Cape of Good Hope up to the northern Transvaal boundary from the mouth of the Oranje River to the Indian Ocean, must feel that degradation in all the depths of his heart, must feel himself struck by every one of those shamefull blows, and cannot retain one with a clenched fist, to demand another with feelings of awe to pray for a stop to these odious deeds.
A great mistake is made, if any one of us (may be of those to whom I have referred above) thinks that the danger in store is only for those living in Natal and the Transvaal colony. We must look upon the matter just if we were insulted and attacked ourselves. The Zulu crater throws its fire high over the whole of South Africa; the burning lava spreads over all its countries, Zululand being the concentration of all the possible dissatisfaction of South Africa! All those of our unfortunate native tribes who seek and have sought their heathen welfare by overthrowing, and overwhelming the race of the whites, look with true desire towards this volcano in our north eastern corner; sigh in thought, sigh in words, and most secretly through messengers they sent into Cetywayo’s laager. There the last outburst of all the lowest savage vices seeks its protection, finds its nursery and hopes for its salvation. Into the boiling mass of the volcano we see from all directions, streams of sulphuric fluid flowing. There united with the vaporous mass, the »Zulu life« burst forth in one gush of seeting, destroying, hissing lava. And the hiss is repeated every moment, every day by that native mind in Cetywajo Kingdom. etc. etc.
11) Die Maschona, welche einst mehrere Reiche in Süd-Afrika bildeten, wurden zum großen Theile von den Matabele vernichtet, welche noch alljährig Raubzüge in ihre Gebiete, die sich von Osten an das Zulu-Reich anschließen, unternehmen. In der Regel gelingen den Matabele diese Raubzüge und sie bringen außer Frauen, Knaben und Kindern auch verschiedene Industrie-Erzeugnisse heim, welche deutlich die Kunstfertigkeit des bedrückten Stammes zeigen.[34] Ihre Gebiete sind sehr fruchtbar, leider aber auch sehr ungesund. Die Elfenbeinhändler berichteten mir, daß die Maschona’s ihre Hütten hoch über dem Boden und wo es möglich ist, an den Vorsprüngen steil abfallender Felsen- und Höhenwände erbauen, und zwar einestheils aus Gesundheitsrücksichten, andererseits um ihre Gehöfte leichter in Vertheidigungszustand setzen zu können.
Die Stämme bauen Reis an, der sich durch ein größeres, röthlich gefärbtes Korn auszeichnet. Sie bearbeiten mit Erfolg Metalle und machen im Gegensatze zu anderen südafrikanischen Stämmen mit Ausnahme der Buschmänner und Masarwa’s von Bogen und Pfeil Gebrauch. Vortrefflich müssen ihre aus Baumbast und anderen vegetabilischen Flechtstoffen bereiteten Gewebe, beachtenswerth ihre Waffen und Musik-Instrumente genannt werden. Sie wurden in der Regel von Osten und Südosten her von den portugiesischen Händlern von der Ostküste aufgesucht, während Moselikatze sowohl wie La Bengula den englischen Elfenbeinhändlern, aus Furcht, daß diese den Maschona’s zu Gewehren verhelfen würden, den Eingang in das Gebiet der letzteren erschwerten oder vollkommen zu verbieten pflegten. — Das Maschona-Land ist reich an Quarz, Alluvial-Gold und sehr reich an Wild.
12) Meine nächste gegen Schluß dieses oder zu Beginn des kommenden Jahres anzutretende Reise soll den Charakter einer wissenschaftlichen Forschungsreise an sich tragen, auf welcher ich nicht nur den rein geographischen, sondern auch allen verwandten Disziplinen meine Thätigkeit und vollste Aufmerksamkeit widmen will. Das nächste Reiseziel bilden die Cap-Colonie und die ihr im Osten angrenzenden Kafferngebiete, deren partielle Durchforschung in paläontologischer, botanischer und ethnologischer Hinsicht während eines Zeitraumes von circa vier Monaten ich mir zur Aufgabe stelle und deren Resultate (Sammlungen) von mir sofort nach der Heimat gesendet werden sollen. Das gesammelte naturhistorische und ethnographische Materiale soll gleich dem auf meinen bisherigen Reisen zusammengebrachten von Fachgelehrten wissenschaftlich bereitet, vaterländischen Museen, Instituten, Schulen etc. überwiesen werden.
Indem ich noch vor meiner Reise durch einschlägige Studien und Uebungen meine Kenntnisse in den einzelnen wissenschaftlichen Fächern nach besten Kräften vervollständigen will, hoffe ich unter Hinweis auf die bereits vorliegenden Resultate meiner ersten drei Reisen die mir erwachsende Aufgabe zum Nutzen der Wissenschaft zu bewältigen.
Das Hauptziel meiner nächsten Reise ist in geographischer Hinsicht die Durchquerung des afrikanischen Kontinents von Süd nach Nord. Nachdem ich auf der Strecke zwischen dem Vaal und Zambesi die bisherigen unsicheren Positionsbestimmungen durch verläßliche und genaue ersetzt, ist es meine Absicht, das Stammland der Marutse (die Barotse) mit besonderer Berücksichtigung der dortigen Königsgräber sodann das ganze Gebiet zwischen diesem Lande und dem Kafueflusse in geographischer, naturhistorischer und ethnographischer Hinsicht zu durchforschen und die bis dahin erzielten Sammlungen von den Victoriafällen aus nach Süden zur Weiterbeförderung nach der Heimat zu senden.
In rein nördlicher Richtung meine Reise fortsetzend, will ich die Wasserscheide zwischen dem Zambesi- und Congo-System (Bangweolo-See) erforschen und den Lauf des Kongo bis zu seiner großen Biegung nach Westen verfolgen. Gestatten es die Verhältnisse und Zustände, so will ich von hier ab in nordnordwestlicher Richtung weiter vordringen und bei dieser Gelegenheit das letzte der großen hydrographischen Probleme Afrika’s, die Frage nach dem Unterlaufe des Uëlle zu lösen und weiterhin Darfur durchziehend, Aegypten zu erreichen suchen. Sollten unüberwindliche Hindernisse mir die volle Ausführung meines Reiseplanes verwehren, so ist es meine Absicht, mich nach der Ostküste zu wenden.
Ich will schließlich besonders betonen, daß es mir nicht um eine bloße Durchquerung Afrikas zu thun ist, sondern daß ich Schritt für Schritt das durchreiste Gebiet durchforschen und wenn mir dies gelingen sollte, mit den möglichst vollständigen Sammlungen bereichert, nach drei Jahren heimzukehren gedenke.
[34] Im Laufe des Jahres 1880 kam mir die Nachricht zu, daß 12000 Matabele-Krieger von den vereinigten Maschona’s geschlagen wurden.
Special Karte
(No. 1.)
des von Dr. Holub bereisten
centralen Theiles
von
Ost Bamangwato
und
West Matabele.
Nach Compass Aufnahmen. Juli 1875, u. März u. April 1876.
Maßstab 1:500000
Kartog. lith. Inst. v. G. Freytag Wien
Verlag v. Alfred Hölder, k. k. Hof- u. Universitäts-Buchhändler in Wien.
Druck v. Jos. Eberle & Co. Wien
Special Karte No. 2.
Die Victoriafälle
des
Zambesi
nach Compassaufnahmen von
Dr. Emil Holub.
Maaßstab 1:7000.
Kartogr. lith. Anst. v. G. Freytag, Wien.
Verlag v. Alfred Hölder k. k. Hof- u. Universitäts-Buchhändler in Wien.
Druck v. Jos. Eberle & Co. Wien.
Special Karte
(No. 3)
Dr. Holub’s Bootfahrten im
centralen Laufe
des
Zambesi
von der Makumba Bucht
bis zum Nambwe Katarakt.
(Süd Barotse)
Nach Compass-Aufnahmen vom August 1875 bis Februar 1876.
Maßstab 1:180000.
Kartogr. lith. Anst. v. G. Freytag, Wien.
Verlag v. Alfred Hölder, k. k. Hof- u. Universitäts-Buchhändler in Wien.
Druck v. Jos. Eberle & Co. Wien.
Anmerkungen zur Transkription
Fußnoten wurden am Ende des jeweiligen Kapitels gesammelt.
Der Originaltext ist in Fraktur gesetzt. Im Original g e s p e r r t hervorgehobener Text wurde in einem anderen Schriftstil markiert. Textstellen, die im Original in Antiqua gesetzt sind, wurden in einer anderen Schriftart markiert.
Die variierende und inkonsistente Schreibweise des Originals wurde weitgehend beibehalten. Lediglich die am Buchanfang aufgeführten Errata und offensichtliche Druckfehler wurden korigiert wie hier aufgeführt (vorher/nachher):