Title: China und Japan: Erlebnisse, Studien, Beobachtungen
Author: Ernst von Hesse-Wartegg
Release date: January 13, 2019 [eBook #58686]
Language: German
Credits: Produced by the Online Distributed Proofreading Team at
http://www.pgdp.net (This file was produced from images
generously made available by The Internet Archive)
Anmerkungen zur Transkription
Der vorliegende Text wurde anhand der 1900 erschienenen Buchausgabe so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und altertümliche Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original unverändert; fremdsprachliche Zitate wurden nicht korrigiert. Umlaute in Großbuchstaben wurden in ihrer Umschreibung dargestellt (Ae, Oe und Ue). Fußnoten wurden an das Ende des jeweiligen Kapitels verschoben.
Ausdrücke in chinesischer und japanischer Sprache wurden in einer Transliteration in lateinischer Schrift wiedergegeben. Diese Übertraung wurde vom Verfasser nicht immer konsistent durchgeführt, dennoch wurden abweichende Schreibweisen wie im Original beibehalten.
In der Buchversion wurde für den Begriff ‚et cetera‘ die tironische Note für ‚et‘ verwendet, welche allerdings mit vielen Schriftarten nicht dargestellt werden kann. Aus diesem Grund wurde in der elektronischen Version von der Abkürzung ‚etc.‘ Gebrauch gemacht.
Einige Seitenzahlen des Inhaltsverzeichnisses wurden vom Bearbeiter richtiggestellt. In mehreren Bildunterschriften finden sich Angaben zur natürlichen Größe der abgebildeten Gegenstände. Diese beziehen sich ausschließlich auf die gedruckte Originalversion, da Bildgrößen auf unterschiedlichen Wiedergabegeräten zum Teil stark variieren können. Fußnoten wurden an das Ende des jeweiligen Kapitels verschoben.
Passagen in Antiquaschrift werden im vorliegenden Text kursiv dargestellt. Abhängig von der im jeweiligen Lesegerät installierten Schriftart können die im Original gesperrt gedruckten Passagen gesperrt, in serifenloser Schrift, oder aber sowohl serifenlos als auch gesperrt erscheinen.
China und Japan.
Erlebnisse, Studien, Beobachtungen
von
Ernst v. Hesse-Wartegg.
Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage.
Mit 61 Vollbildern, 212 in den Text gedruckten Abbildungen und einer Generalkarte von Ostasien.
Verlagsbuchhandlung von J. J. Weber in Leipzig. 1900.
Alle Rechte vorbehalten.
Ein Buch, das „China und Japan” betitelt ist, bedarf eigentlich keines Vorwortes. Der Titel allein besagt, daß es sich um eine wenig bekannte, in jeder Hinsicht eigenartige Welt handelt, die erst in neuester Zeit der Allgemeinheit erschlossen werden soll. Je mehr man von ihr erfährt, in desto höherem Maße interessiert man sich für sie, mit desto größerer Aufmerksamkeit wird jedes neue Buch darüber gelesen.
Leider ist die deutsche Litteratur in Bezug auf die beiden großen Reiche Ostasiens keineswegs reich zu nennen. Sie besitzt darüber bedeutende umfangreiche Quellenwerke, aber der Preis derselben oder die Art der Darstellung ist nicht für die Allgemeinheit geschaffen. Auch sind in den letzten Jahrzehnten eine Anzahl Reisewerke erschienen, mit der Schilderung persönlicher Erlebnisse und Einzelheiten, die nur beschränkte Kreise zu befriedigen vermögen; an leicht faßlichen, charakteristischen Darstellungen der ostasiatischen Monarchien mit ihren Städten und Naturwundern, ihren Bewohnern und deren Kultur fehlt es aber, und doch werden solche Bücher von den Gebildeten aller Stände gerade jetzt gesucht, wo sich die Beziehungen mit Ostasien in jeder Hinsicht immer inniger gestalten. Mehr als je zuvor hegt man den Wunsch, die Wahrheit zu erfahren über das Wesen der ostasiatischen Kultur und über die Gefahren, mit welcher das ostasiatische Gespenst nach der Meinung vieler unsere christliche Welt bedrohen soll.
„Völker Europas, hütet eure heiligsten Güter!” So lautet der Mahnruf, der vor kurzer Zeit von höchster Seite erlassen wurde, und die Völker Europas suchen die Begründung dieses Mahnrufs in dem Erwachen und Erstarken der Völker Ostasiens.
Wird die Erschließung von China und Japan dem europäischen Handel, der Industrie, dem allgemeinen Wohlstand Vorteile bringen, oder wird sie einen schrecklichen Wettbewerb zur Folge haben, verderbenbringend für unsere christliche Welt?
Mit diesen Fragen vor Augen habe ich auf meiner jüngsten Reise um die Welt in den Monarchien Ostasiens länger als beabsichtigt verweilt und zu ihrer Beantwortung nach Material gesucht. Ich gebe in dem vorliegenden Werke nicht nur meine eigenen Erfahrungen und Anschauungen, sondern faßte auch jene zahlreicher anderer Persönlichkeiten zusammen, die seit vielen Jahren in den verschiedensten Berufszweigen in Ostasien thätig sind, aber nicht die Zeit, den Wunsch oder das Vermögen haben, ihre reichen Erfahrungen in einheitlichen, abgerundeten Darstellungen zu Papier zu bringen. Frühere große Weltreisen und ihre Schilderung haben mir vielleicht zu größerer Fertigkeit, geübterem, schärferem Blick für das verholfen, was dem europäischen Leser von besonderem Interesse ist. Nur wer die Kultur anderer Länder und Weltteile kennen und aus sich selbst herauszugehen gelernt hat, kann überall den richtigen Maßstab anlegen. Andere werden gewöhnlich einseitig nach der von ihrer Jugend an gewöhnten Elle messen, vieles minderwertig, verzwickt und verrückt halten, was nicht nach dieser heimatlichen Elle paßt. Und weil die Kultur der Ostasiaten von der unsrigen so sehr abweicht und so selten einsichtige, unabhängige Schilderer fand, ist der Begriff „Chinesisch” bei uns zur landläufigen Bezeichnung für alles Groteske geworden. Daher kommt auch das allgemeine Aufsehen, um nicht zu sagen Erschrecken, als in neuester Zeit solch unabhängige Schilderungen über die wahre Kultur, den wahren Charakter, das wahre Können der Ostasiaten erschienen sind.
Gestützt auf das in Ostasien gesammelte Material habe ich in den letzten zwei Jahren manche der nachstehenden Kapitel in verschiedenen großen Zeitschriften veröffentlicht, und die Thatsache, daß diese Arbeiten von zahlreichen, mitunter von Hunderten anderer Blätter Deutschlands nachgedruckt und in fremde Sprachen übersetzt worden sind, liefert den Beweis, daß sie gerade das enthalten, was man in Europa zu erfahren wünscht. Dieser Erfolg hat mich ermutigt, den eingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen und China und Japan in allgemein faßlichen charakteristischen Darstellungen zu schildern, soweit es dem Einzelnen überhaupt möglich ist. Das Ergebnis ist das vorliegende Buch.
1897.
Ernst v. Hesse-Wartegg.
Mehr noch als im Jahre des Erscheinens der ersten Auflage hat das in den vorstehenden Zeilen Gesagte seine Richtigkeit. Ostasien tritt immer mehr in den Vordergrund der allgemeinen Aufmerksamkeit, immer mehr kommt man in Europa zur Erkenntnis der gegenwärtigen Bedeutung der ostasiatischen Reiche, die sich noch mit jedem Jahre steigern wird. Das große China wird endlich aus seiner mehrtausendjährigen Erstarrung aufgerüttelt und der Erschließung durch Europa entgegengeführt; Japan hat einen weiteren Schritt vorwärts gethan in seiner hochinteressanten Umwandlung zu einem modernen Reich mit abendländischer Kultur und droht ein gefahrvoller Rivale auf den ostasiatischen Märkten zu werden; Rußland tritt durch die Besiedelung Ostsibiriens und den Bau der transsibirischen Eisenbahn als neue gebietende Macht in Ostasien auf; das alte ohnmächtige Korea wird wie ein Spielball zwischen den drei Großmächten umhergeworfen. Durch diese Umwälzungen im fernen Osten werden auch die Beziehungen Europas mit jenen Ländern in andere Bahnen gelenkt, der europäischen Industrie werden neue, trotz des japanischen Wettbewerbs sich immer mehr erweiternde Absatzgebiete erschlossen, dem europäischen Handel wie dem Touristenverkehr winkt ein gewaltiger Aufschwung in naher Zeit.
Ueberzeugt von der Wichtigkeit des chinesischen Marktes und von dem Ringen unter den Industriestaaten des Erdballs, das in Bälde um diesen Markt platzgreifen wird, habe ich seit Jahren getrachtet, die Aufmerksamkeit aller Kreise im Deutschen Reich durch zahlreiche Aufsätze und öffentliche Vorträge auf Ostasien zu lenken und ein kräftiges Eintreten zur Wahrung der großen und berechtigten deutschen Interessen dort herbeizuführen. Dieses Streben ist auch an vielen Stellen der ersten Auflage des vorliegenden Werkes zum Ausdruck gebracht worden, mit gleichzeitiger Betonung der Wichtigkeit eines eigenen deutschen Hafens in China und der Absendung eigener Handelsexpeditionen zum Studium der Märkte.
Früher als allgemein erwartet wurde, sind diese Wünsche zur Erfüllung gekommen. Deutschland hat sich eine Eingangspforte in das chinesische Reich, einen Stützpunkt für die Entwickelung seiner kommerziellen und politischen Interessen in Ostasien geschaffen, mit einem Hafen, auf welchen ich bereits in der ersten Auflage dieses Werkes, lange vor der Besitzergreifung, hingewiesen habe.
Um diesen Hafen und sein Hinterland näher kennen zu lernen und zu schildern, unternahm ich unmittelbar nach der Besetzung Kiautschous eine neue Reise in das deutsche Gebiet und von dort kreuz und quer durch Schantung und die angrenzenden Provinzen nach Peking. Die Ergebnisse dieser Reise, welche ursprünglich in dem 1900 erschienenen Werke „Schantung und Deutsch-China” (Leipzig, J. J. Webers Verlag, Preis 14 Mark) niedergelegt wurden, sind kurz zusammengefaßt mit in die vorliegende Auflage aufgenommen und bis auf die Gegenwart ergänzt worden. Aber auch sonst hat das vorliegende Werk vielfache Aenderungen und Ergänzungen erfahren, wie schon aus der Vermehrung des Inhalts um hundert Textseiten, 17 Vollbilder und 90 in den Text gedruckten Abbildungen hervorgeht.
Während der genannten Reise von 1898, sowie auf einer darauffolgenden, im Jahre 1900 unternommenen Reise war ich überall bedacht, alles Wissenswerte über das hochinteressante Leben, Thun und Treiben der Bevölkerung, über die Regierung, Kaufleute und Industrielle zu erfahren, Handel und Gewerbe, Landwirtschaft, Bergbau, Landesprodukte, sowie auch die landschaftlichen Schönheiten und kulturellen Merkwürdigkeiten der geschilderten Länder im touristischen Sinne kennen zu lernen, so daß ich hoffe, daß „China und Japan” auch in der vorliegenden Auflage zur allgemeinen Belehrung und Unterhaltung, dem Geschäftsmann zum Nutzen, dem Touristen zur Führung dienen wird.
1900.
Ernst v. Hesse-Wartegg.
Erster Teil: China.
Zweiter Teil: Japan.
Als wir, von dem sonnigen heißen Hinterindien kommend, nach mehrtägiger Seefahrt in den Hafen von Hongkong dampften, war der erste Eindruck dieses vielgerühmten englischen Emporiums von Ostasien keineswegs ein angenehmer. Der Morgen war feucht und kalt, die See unruhig, ein dichter Wolkenschleier verhüllte die Spitzen der zweitausend bis viertausend Fuß hohen Berge, welche die Bucht von Hongkong einschließen, und wir sahen davon nichts weiter als die massigen, mehrere Stockwerke hohen Granitpaläste, die sich amphitheatralisch die steilen Anhöhen emporziehen, und die weite windgepeitschte Wasserfläche, auf welcher sich unzählige Ozeandampfer, Dschunken und Sampans schaukelten. Etwa einen halben Kilometer von den Ufern gingen wir vor Anker, und sofort war unser Schiff von einer Menge von kleinen chinesischen Booten umschwärmt, deren halbnackte Insassen uns laut schreiend und lärmend ihre Dienste anboten. Wären sie nicht gewesen, wir hätten uns ebensogut in Portsmouth oder Plymouth glauben können, so durchaus englisch erschien uns Hongkong an diesem nebeligen Morgen. Während wir noch unschlüssig waren, uns bei so bewegter See den kleinen Chinesenbooten anzuvertrauen, und uns über den recht fühlbaren Mangel von Anlegebrücken in einem so großen Welthafen wunderten, kam glücklicherweise für uns wenige Passagiere eine kleine Dampfbarkasse angefahren, die uns nach viertelstündiger Fahrt ans Land brachte.
Hier, rings um Peddar Street Wharf, erschien uns Hongkong noch viel englischer, als vom Wasser gesehen. Vor uns eine gerade Straße, zu beiden Seiten von hohen englischen Geschäftshäusern eingefaßt, links an der Ecke ein riesiges englisches Hotel, das uns aufnehmen sollte, rechts eine englische Postoffice, in der Mitte, am Kreuzungspunkt einer zweiten, natürlich Queens Street genannten Straße, ein[S. 4] plumper, englischer Glockenturm; über den Kaufläden nur englische Aufschriften: English Pharmacy, English Book Store, Public House, Drinking Bar, Gin, Brandy, England for ever!
Brr! Welche Enttäuschung! Wir hatten auf den Sundainseln, in Malakka, Siam, Kambodscha, in der malerischen fremdartigen Pracht der Malayenwelt geschwelgt, wir hatten uns schon so sehr auf China gefreut und von Pagoden und Buddhatempeln geträumt. Statt dessen wurden wir durch diese englische Provinzstadt in die nüchterne, schmutzige Alltagswelt zurückversetzt. Im Hongkonghotel gab es schlechte englische Küche, in den weiten Korridoren liefen die Ratten umher, und die Mehrzahl der Zimmer war unbewohnt. Nicht viel besser war der Eindruck, den wir auf unsern ersten Gängen zu jenen Geschäftshäusern erhielten, an welche wir Empfehlungsbriefe abzugeben hatten, englische und deutsche. Im Gegensatz zu dem herzlichen, gastfreien Empfang in Singapore, Colombo, Bangkok, Batavia etc. war die Aufnahme durch die deutschen Kaufherren von Hongkong frostig, von Einladungen, Einführung im Klub u. dergl. gar nicht zu sprechen. Aber die Briefe mußten doch abgegeben werden. Wir waren nun frei und konnten uns nach Herzenslust das, was Hongkong an Interessantem bietet, ansehen.
Da fanden wir denn doch, daß in Hongkong geradezu alles interessant ist. Hongkong ist die Eingangspforte in das gewaltige chinesische Reich, die englisch geschriebene Vorrede zu jenem mit sieben Siegeln verschlossenen Buche, China geheißen, und die beste Einführung in dasselbe. Gleichzeitig ist es aber eine der großartigsten Schöpfungen englischen Unternehmungsgeistes, der hier auf dieser kahlen Granitinsel binnen fünf Jahrzehnten einen der wichtigsten Handelshäfen der Welt geschaffen hat. Noch leben hier chinesische Fischer, welche sich des Tages erinnern, als das erste englische Schiff an ihrer einsamen, gottvergessenen Felseninsel anlegte. Das war im Jahre 1845. Heute ist diese Insel ein wahres Paradies, und an ihrer Nordseite zieht sich in einer Länge von etwa sechs Kilometern eine Großstadt von 300000 Einwohnern hin, während das zwanzig Quadratkilometer große Wasserbecken vor ihr in jedem Jahre 20000 Schiffe mit acht bis neun Millionen Tonnen Gehalt beherbergt. Täglich kommen fünfzig Schiffe, täglich verlassen ebensoviele den Hafen, nach allen Ländern der Alten und Neuen Welt bestimmt, und der Handel, der in dieser kleinsten aller englischen Kolonien getrieben wird, erreicht in jedem Jahre beinahe tausend Millionen Mark!
Man kommt in Hongkong aus der Verwunderung nicht heraus, teils über die unglaublichen Leistungen der Handvoll Engländer, welche hier ansässig sind, teils über die fremdartige chinesische Kulturwelt, die sie rings umgiebt und durch ihre Masse anscheinend zu erdrücken droht, während sie thatsächlich mit Leichtigkeit durch diese Handvoll Engländer gelenkt und beherrscht wird. Nur auf dem kleinen, eingangs erwähnten Teil von Hongkong, rings um Peddar Street, tritt der englische[S. 6] Provinzialstadtcharakter so unangenehm auf. Die schwere, massige Bauart der Häuser, der Gegensatz zu den luftigen, verandenumgebenen Bungalows von Singapore oder Colombo, hat seine Begründung. Hongkong liegt leider mitten im schlimmsten Taifungebiet, und diese furchtbaren Stürme würden leichtere Häuser, Veranden, Dächer und dergleichen spielend fortreißen. Die Stadt hat das schon mehrfach erfahren. Im Jahre 1874 wurden durch einen Taifun während einer halben Stunde über tausend Häuser vollständig zerstört, und Tausende von Menschen verloren dabei ihr Leben. Deshalb diese steinernen Arkaden an Stelle der luftigen Veranden, deshalb die schweren eisernen oder hölzernen Läden an den Fenstern, die sofort geschlossen werden, wenn von dem Taifunobservatorium auf der gegenüberliegenden Halbinsel Kowloon als Warnungssignal die drei gefürchteten Kanonenschüsse ertönen.
Von meinen Fenstern im fünften Stock des Hongkonghotels zeigte sich am Morgen nach meiner Ankunft Hongkong, seinem Rufe entsprechend, in viel freundlicherer, großartigerer Weise. Die helle, warme Sonne überstrahlte die weite Bucht, die mit Tausenden von Schiffen aller Art, von den winzigen Pantoffelbooten bis zu den größten Ozeandampfern besäet war und sich belebter zeigte als irgend einer der Welthäfen, die ich auf meinen fünfundzwanzigjährigen Reisen durch alle Kontinente gesehen habe. Gegen Norden, jenseit der etwa zwei Seemeilen breiten Bucht, auf dem chinesischen Festlande, leuchteten in einer langen Linie die weißen Warenhäuser, Kasernen und Hongs von Kowloon, umgeben von einem Kranz üppiger Gärten, und über diese erheben sich kahle, steile, zerklüftete Höhen von eigentümlicher roter Färbung, schon zu China gehörig. Zu meinen Füßen lag die Stadt Hongkong oder, wie sie eigentlich heißt, Viktoria. Der 600 Meter hohe, steile Berg, an dessen Fuß sie liegt, hat ihr nicht viel Platz zur Ausbreitung gelassen, und so ziehen sich nur zwei oder drei lange Straßen dem Meeresufer, hier Praya genannt, entlang, zu beiden Seiten mit mehrstöckigen Granithäusern besetzt, die im untersten Stockwerk Arkaden für die Fußgänger besitzen. Zahlreiche Querstraßen führen von der Praya den Berg hinan und verlieren sich dort in dem Grün prachtvoller Gärten mit subtropischer Vegetation. Palmen mit schön geschwungenen Wedeln, Bananen mit ihren mächtigen Blättern, hohe Araukarien, Kakteen und Agaven der verschiedensten Art zeigen sich dort, und inmitten dieser zaubervollen Flora erheben sich stattliche Villen und Paläste, Kirchen mit hohen Türmen. Ganz oben an der Spitze des Peak grüßt von einem hohen Mastbaum die stolze britische Flagge herab. Fürwahr, wenige Häfen der Erde können sich an Schönheit und Großartigkeit mit Hongkong messen, vielleicht Rio de Janeiro, San Francisco, Neapel allein. In seiner Anlage erinnerte mich Hongkong ein wenig an Genua, der Hafen mit seinem stolzen Peak dagegen an Gibraltar; Kowloon ist sein Algeciras. Und ist nicht Hongkong in der That das Gibraltar von China? Wie der Dschebel al Tarik, so[S. 7] ist auch der Peak, der mit seinen Vorbergen und kleinen vorgelagerten Inselchen die Einfahrt nach dem Süden des chinesischen Reiches beherrscht, mit kanonengespickten Festungswerken versehen, und überdies steht eine eigene Flotte im Dienste von Hongkong, während in den drei großen Kasernen einige tausend Mann englischer Linientruppen untergebracht sind. Welch hohen Wert England auf diesen äußersten gegen Osten vorgeschobenen Posten seines Weltreiches legt, geht aus der Thatsache hervor, daß es gegen zwanzig Millionen Mark zu seiner Befestigung verwendet hat; überdies trägt die aus wenigen tausend Europäern bestehende Kolonie jährlich über drei Millionen Mark zu Verteidigungszwecken bei. Unter dem Schutze der Kanonen und Bajonette von Hongkong hat sich nicht nur der englische Handel, sondern auch jener der andern europäischen Staaten, vor allem der deutsche, so mächtig entwickelt, und wir müssen England dafür dankbar sein; denn ohne Hongkong hätte sich dieser deutsche Handel, der hier jenem Englands an Umfang zunächst steht, niemals so ausbreiten können. Die englische Flagge hat auch den deutschen Kaufmann beschützt. Die Engländer haben nicht nur für sich, sondern auch für die andern Nationen die Kastanien aus dem chinesischen Feuer geholt. Ja mehr noch, die Chinesen selbst sind ihnen dankbar; denn nahe an 300000 bezopfte Söhne des Reiches der Mitte haben hier auf dem winzigen Stück englischen Bodens Zuflucht, Sicherheit, Rechtsschutz, Lebensunterhalt, ja Reichtum gefunden. Der großen Mehrzahl nach sind sie loyale Unterthanen der Königin Viktoria geworden, und der Geburtstag dieser Herrscherin wird von den Chinesen in Hongkong ebenso festlich gefeiert wie von den Engländern.
Die Chinesen bilden auch den weitaus größten und merkwürdigsten Teil der Bevölkerung der Kolonie, die sonst auch zahlreiche Angehörige aller Nationen Europas, dann Amerikaner, Malayen, Japaner, Indier, Araber etc. aufweist. Alle die asiatischen Bürger von Hongkong haben dabei ihre eigentümlichen malerischen Trachten beibehalten, so daß man bei einem Spaziergang durch die Hauptstraße, die Queen Street, sozusagen eine lebende Völkerkarte studieren kann. Nur die Peddar Street ist spezifisch englisch; verläßt man aber das Hongkonghotel durch den nach der Queen Street führenden Ausgang, so ist man sofort in dem denkbar internationalsten Verkehr: Parsis mit ihren schwarzen gestickten Cereviskäppchen, Malayen mit ihren schürzenartigen Sarongs, Araber im weißen Burnus, Japaner in ihren Kimonoschlafröcken, Indier mit mächtigen Turbanen. Ein Teil der Polizisten von Hongkong besteht aus baumlangen Indiern, und die europäischen Kolonisten der Stadt unterhalten zu ihrem persönlichen Schutz ein Regiment von Sikhs, die wohl englische Uniform tragen, aber die hohe, brennrote Zuckerhutmütze beibehalten haben; dazwischen englische Soldaten und schottische Hochländer mit nackten Knieen und karrierten Jacken, Matrosen von den Kriegsschiffen aller möglichen Nationen. Man[S. 8] hört die verschiedensten Sprachen sprechen, sieht die verschiedensten Begrüßungsarten, aber der äußere Rahmen, die Straßen, Häuser, städtischen Einrichtungen sind durchaus englisch, was die Seltsamkeit des Eindrucks noch erhöht.
Selbst die Chinesen wohnen in mehrstöckigen Häusern. Man braucht in der Queen Street von dem Glockenturm nur wenige hundert Schritt nach Osten oder nach Westen zu gehen, um mitten in die Chinesenviertel zu kommen. In dem englischen Teil dieser interessanten Völkerstraße sieht man die Chinesen nur als Compradores (Angestellte) in den verschiedenen Geschäftshäusern, hie und da auch einen vornehmen Laden, von Chinesen gehalten, und seine Insassen zeigen durch ihre seidene Kleidung, gute Beschuhung und die unfehlbare Brille auf der Nase, daß sie den wohlhabendern Ständen angehören. Sonst sieht man hier nur Kulis im Dienste der Weißen, Lastträger, Straßenkehrer, Rickshaw Boys und Sänftenträger. Wagenverkehr ist in den steil ansteigenden Straßen Hongkongs unmöglich; ebenso unmöglich wäre er in den wenigen ebenen Straßen wegen des unglaublichen Völkergetümmels, das dort tagsüber herrscht. Er wird durch die japanische Rickshaw, den zweiräderigen, von einem Kuli gezogenen Handwagen ersetzt; an den Straßenecken stehen deren immer eine Anzahl in langen Reihen. Kaum zeigt sich ein Europäer vor seiner Hausthür, so wird er sofort von den wild aussehenden, im Sommer halbnackten Rickshaw-Kulis umringt, die ihre Dienste anbieten, fünf Cents, etwa zwölf Pfennig, für die halbe Stunde. Vertraut man sich wirklich einem dieser menschlichen Zugtiere an und hat ihm die Bestimmung zugerufen, so saust es auch schon pfeilschnell mit dem kleinen Handwagen von dannen. Es fährt seinen Passagier straßenauf straßenab und bleibt endlich vor irgend einem beliebigen Hause stehen, das möglicherweise von dem gewünschten Ziel eine Stunde weit entfernt ist. Die Hongkong besuchenden Fremden wissen eben nicht, daß die meisten dieser Kulis nicht ein Wörtchen Englisch verstehen und daran gewöhnt sind, daß man sie mit dem Spazierstöckchen rechts oder links berührend, in stummer Weise etwa ähnlich zu lenken pflegt wie Pferde durch die Zügel. Man kann sich auch dadurch helfen, daß man in irgend einen Kaufladen tritt und den Inhaber bittet, dem Rickshaw-Kuli auf Chinesisch das Ziel zu nennen. Wird dies unterlassen, so fährt der Kuli seinen Passagier planlos oft stundenlang spazieren.
Besser sind die Tragstühle, welche von den Europäern Hongkongs mit Vorliebe benutzt werden; jede Familie, jedes Handlungshaus oder Hotel besitzt einen eigenen „Marstall” von Kulis und mehrere Tragstühle, die mitunter sehr kostbar ausgestattet sind. Die Kulis tragen eigene Uniformen; bald sind es blaue Hemden und Beinkleider mit weißen Rändern, bald weiße mit roten Rändern, bald verschiedene Ornamente, Kreise, Quadrate, Monogramme, welche die Tragstuhleigentümer auf Brust und Rücken der Kuli-Uniformen aufnähen lassen. Je wohlhabender oder angesehener die Bürger, desto größer ist die Zahl ihrer Chairkulis; gewöhnlich aber werden[S. 9] die Stühle von zwei bis vier Kulis getragen. Die an den Straßenecken zum beliebigen Vermieten stehenden Stühle werden von zwei Kulis bedient. Die Europäer von Hongkong haben diese Art der Fortbewegung wohl den Chinesen abgesehen. In Canton und allen anderen Städten bedienen sich die Civilmandarine und wohlhabenderen Chinesen, besonders die Frauen, stets eigentümlicher verschlossener Sänften, die auf drei bis vier Meter langen Bambusstangen ruhen. An Stelle der geschlossenen Sänften treten in Hongkong offene Armstühle aus Rattangeflecht, mit einer kleinen an Seilen hängenden Fußbank darunter. Man setzt sich in den Stuhl, die Kulis heben die Tragstangen auf ihre Schultern, und fort geht es in leichtem, raschem Schritt, für 20 Cents (etwa 45 Pfennig) die Stunde. Die Menschen sind hier billiger als die Tiere. Sie erleichtern den Verkehr ungemein, denn in den heißen Sommermonaten ist das Gehen, überhaupt jede Körperbewegung mit großer Anstrengung und Schweißerguß verbunden. Dieser Hitze entsprechend ist auch die Kleidung der Europäer, Herren wie Damen, von Ende Mai bis Mitte September durchweg schneeweiß, und nur im Winter, der zuweilen recht empfindlich kalt sein kann, werden dunkele Kleider getragen. Im Jahre 1892 beispielsweise waren die Abhänge des, wie bemerkt, etwa 600 Meter hohen Peak bis auf die Hälfte herab mit Schnee und Eis bedeckt, dagegen gewährt das breite Plateau auf seinem Gipfel im Sommer stets kühlen, frischen Aufenthalt, und es ist auch dort oben und an den Abhängen eine ganze Stadt prächtiger Villen und Hotels mit Gärten entstanden, welche von dem hier herrschenden Wohlstand und der Leichtigkeit des Erwerbs Zeugnis ablegen. Eine Drahtseilbahn nach schweizerischem Muster verbindet die Geschäftsstadt unten mit diesen Residential Suburbs, in welchen die Familien der Geschäftsleute, hohen Beamten und Offiziere wohnen. Täglich fuhr ich mit dieser durch die schönsten Parkanlagen führenden Bahn hinauf, um der Einladung eines englischen Kaufherrn oder des kommandierenden Generals Folge zu leisten, bis wir schließlich in das reizende Haus des Chefs der größten Handelsfirma von China, Messrs. Butterfield & Swire, übersiedelten. Von dort oben genießt man einen Rundblick über Land und Meer, einzig in seiner Art, und das Bild, welches der mit Tausenden von hellerleuchteten Schiffen und Booten bedeckte Hafen tief unter mir, sowie die Straßen der Stadt mit ihren langen Reihen vielfarbiger riesiger Lampions darboten, wird mir zeitlebens unvergeßlich bleiben. Welche Großstadt von 300000 Einwohnern besäße auch auf der einen Seite einen solchen Hafen, auf der andern einen so gewaltigen Berg?
Interessant ist es auch zuweilen, auf den gut gepflegten Wegen zu Fuß nach Hongkong herabzusteigen, an Palästen vorüber, welche die Europäer mit chinesischem Gelde sich hier errichtet haben, und durch üppige Gärten, von denen jene des Gouverneurs und des Militärbefehlshabers wohl die schönsten sind. In ihrer Mitte erheben sich die durch Pracht und Eleganz gleich ausgezeichneten Residenzen dieser[S. 10] beiden Beamten, das Government House und das Headquarter House. Anschließend an sie breitet sich auf einer Terrasse der entzückende Botanical Garden aus, eine öffentliche Parkanlage, wie geschaffen für den Sammelplatz der vornehmen Welt. An ihrer Statt begegnete ich auf meinen Spaziergängen gewöhnlich nur Fremden, welche sich diesen aus dem nackten Granitboden gezauberten Feengarten ansehen wollten. Sonst bleiben diese von chinesischen Gärtnern mit Liebe und peinlichster Sorgfalt gepflegten Anlagen nur blassen, schwachen Kindern von Weißen oder Mischlingen überlassen, die unter der Obhut chinesischer oder indischer Wärterinnen hier mit Steinchen oder Federball spielten. Höchstens daß zuweilen chinesische Damen der bessern Stände mit ihren verkrüppelten, Ziegenhufen nicht unähnlichen Füßchen hier im Schatten herrlicher Koniferen mühsam einherhumpeln. Die „Fashionables” der Kolonie aber meiden den Botanischen Garten und versammeln sich dafür an bestimmten Tagen auf den neben der City Hall, dem anspruchsvollen Rathause, gelegenen Cricket Grounds, um unter den Klängen einer Militärmusik den Cricketmatch anzusehen. Von den Deutschen behauptet man, daß, wenn ihrer zwei irgendwo in Afrika oder Asien zusammenkommen, sie sofort einen Gesangverein gründen. Dasselbe kann man von den Engländern in Bezug auf Cricket sagen. Auf dem Hongkonger Cricket Ground, dem einzigen ebenen Platz der Stadt, wird von den merkantilen Gentlemen der Kolonie im Verein mit den Offizieren Cricket mit einem Eifer gespielt, als wären sie auf den Grounds von St. John’s Wood oder im Hurlingham Club. Unter großen Feldschirmen sitzen die Damen in den elegantesten Toiletten und sehen stundenlang dem Spiele zu oder nehmen in dem reizenden Pavillon der Grounds Erfrischungen, ein Bild, das man wohl in London zu sehen gewohnt ist, das aber hier in China geradezu befremdet. Beliebte Ausflüge der fashionablen Welt sind auch die mit ungeheuren Kosten aus den Granitfelsen gesprengten und mit Koniferen beschatteten Wege, die nach dem Happy Valley mit seinen Friedhöfen und dem Pferderennplatz führen. Dort hinauf, auf den Kennedy Road oder Bowen Road, lassen sich die Damen nachmittags in ihren eleganten, in der kühleren Jahreszeit mit Pelzen und Teppichen bedeckten Chairs tragen; dort, in den reizenden Parkanlagen, bringen sie Stunden mit Lektüre oder Geplauder zu, während ihre uniformierten Kulis in der Nähe auf dem Rasen lagern. Am Ende dieser beiden Roads liegt das breiteste Thal der Insel, das Happy Valley, wohl in Erinnerung an die geflügelten Worte so benannt, welche Solon an den Krösus richtete: Nemo ante mortem beatus. Fürwahr, die Friedhöfe von Hongkong sind die schönsten Plätzchen der ganzen Insel, die schönsten auch, die ich in China gesehen habe. Bambushecken, mit Stämmen, die bis über fünfundzwanzig Meter emporschießen, umgeben diese Ruhestätten der Toten. Jede Religion besitzt hier ihren eigenen Friedhof. Der erste ist jener der Mohammedaner, dann folgt der mit besonderer Sorgfalt gepflegte der Katholiken, prachtvolle Monumente ent[S. 12]haltend, dann jener der Protestanten, der größte von allen; in einiger Entfernung schließt sich daran der Friedhof der Parsen, dann jener der Hindu, und schließlich der jüdische, während der Friedhof der Chinesen auf der entgegengesetzten Seite sich die Anhöhe hinaufzieht. Mit Ausnahme des letztgenannten zeigen sich diese Ruhestätten eher wie wohlgepflegte, schattige Parks, eine Fortsetzung der Palmenhaine des vor ihnen gelegenen Rennplatzes, auf dem zur Zeit der Wettrennen (mit chinesischen Ponies) ein ähnliches großstädtisches Leben herrscht wie in unseren europäischen Hauptstädten.
Eine breite Fahrstraße führt von dort längs des Hafens nach Hongkong zurück, auf der Landseite mit Fabriken, Maschinenwerkstätten und Kasernen besetzt. Hier liegt das Militärspital, umgeben von einem Garten, anschließend daran das Marinearsenal, weiter der große, palastartige Bau, welcher die Offizierswohnungen enthält. Jedes irgendwie verfügbare Plätzchen ist von stattlichen Bauten eingenommen, die auch einer europäischen Großstadt Ehre machen würden. Da sich aber Hongkong von Jahr zu Jahr mit Riesenschritten weiter entwickelt, so ist man eben daran, dem Hafen längs des ganzen Ufers von Hongkong einen breiten Landstreifen abzugewinnen. Vor dem Hongkonghotel ist dies bereits geschehen, und dort erhebt sich eine große Statue zu Ehren der Königin Viktoria, für die man sonst gar kein Plätzchen mehr gefunden hätte.
Ja, die guten Europäer, die auf diesem Stück chinesischen Bodens eine neue Heimat gefunden haben, verstehen es zu leben und das, was ihnen durch die große Entfernung von ihrem europäischen Mutterlande abgeht, durch eigene Schöpfungen reichlich zu ersetzen. Ihre Einkünfte sind groß und werden leicht verdient. Die Geschäftsstunden beginnen spät am Tage und sind um fünf Uhr abends wieder vorüber; nur an „Steamer Days”, d. h. an den Tagen der ein- und auslaufenden Postdampfer ist die Arbeit anhaltender. Die Europäer sind die Herren der Insel. Alle körperlichen Verrichtungen werden ihnen durch Kulis, Diener, Aufwärter chinesischer Rasse abgenommen, und selbst dem ärmsten Irländer würde es hier nicht im Traum einfallen, irgend eine Dienerstelle zu bekleiden, wäre es auch beim Gouverneur. Die Europäer haben ihre Klubs, ihre Vereine, Gesellschaften, Konzerthallen und Theater, in welchem zuweilen Wandertruppen ihre Vorstellungen geben, und in den unteren Räumen des Rathauses haben sie sogar ein reichhaltiges Museum von chinesischen Merkwürdigkeiten gegründet.
Auf den Weltreisenden wird das europäische Hongkong weniger Anziehungskraft ausüben als das chinesische. Die ganze chinesische Kultur in allen ihren höchst merkwürdigen Phasen und Einzelheiten zeigt sich ihm hier, ohne daß er zu reisen oder auf seine europäische Bequemlichkeit zu verzichten braucht. In den Kaufläden der Queen Street findet er alle Produkte Chinas in Hülle und Fülle; er kann die schönsten Porzellane, die kostbarsten Silberarbeiten, Holzschnitzereien, Stoffe und[S. 13] Stickereien erwerben, er kann das chinesische Post- und Bankwesen, die Opium- und Spielhöllen, Theater, Vergnügungen kennen lernen; er wird chinesische Hochzeitszüge, Prozessionen, Leichenbegängnisse, Festlichkeiten sehen, ohne daß er sein Hotelfenster zu verlassen braucht. Und wandert er wirklich durch das Gewirr der engsten, schmutzigsten Gäßchen, die Zufluchtsstätten des schlimmsten Gesindels, so kann er es in vollkommener Sicherheit thun; denn überall befinden sich europäische, indische und chinesische Polizisten, die, bei Tag mit Stöcken, zur Nachtzeit mit Gewehren bewaffnet, für seine Sicherheit sorgen. Die Chinesen wissen dies wohl und fügen sich, ja sie werden von den jungen Hongkonger Herrchen in ihrem Uebermut häufig mit Roheit behandelt, ohne sich darüber aufzuhalten. Ich habe mehrfach gesehen, wie diese Europäer, darunter leider auch Deutsche, Chinesen ohne alle Ursache, vielleicht nur weil sie nicht schnell genug aus dem Wege gingen, mit Püffen, Stockschlägen und Fußtritten bearbeiteten. Freilich ist Hongkong auch der Sammelplatz sehr böser Elemente, die Zufluchtsstätte des Gesindels von Canton, Swatau, Futschau und anderer Häfen. Die chinesischen Wohnungen in den hohen europäischen Häusern, welche die mitunter kaum zwei Meter breiten Gäßchen einfassen, starren vor Schmutz; in den Gäßchen selbst ist übelriechender Unrat aufgehäuft, und die gräßlichste Verkommenheit, das größte Elend, treten einem entgegen. Die Kolonialregierung hat dort vieles versäumt und ist viel zu nachsichtig vorgegangen; gerade während meiner Anwesenheit in Hongkong bildete dieses Chinesenviertel einen dankbaren Herd für die furchtbare Beulenpest, die, von Canton ausgehend, sich über das südliche China verbreitete. Aehnlich wie es in der vornehmen, glänzenden Hauptstadt des englischen Weltreiches, in London, Stadtteile giebt, die als eine Schmach europäischer Kultur bezeichnet werden können, ebenso zeigt sich neben dem stolzen, glänzenden europäischen Hongkong das chinesische als eine wahre Brutstätte des Lasters, mit Spelunken, Spielhöllen und Orten der größten Verworfenheit, die leider von den Matrosen der europäischen Schiffe nur zu häufig aufgesucht werden. Im Jahre 1894 konnte die Verwaltung der Kolonie der Beulenpest, die in diesem Stadtviertel wütet, nicht anders Herr werden, als indem sie einen Teil einäschern, einen anderen vollständig neu umbauen ließ. Aber diese Maßregeln hätten vorher, nicht nachher ergriffen werden müssen. Durch die Sorglosigkeit und den Leichtsinn der europäischen Stadtverwaltung hat der Handel Hongkongs zeitweilig sehr gelitten. Ueber 80000 Chinesen flüchteten sich während der Epidemie aus der verpesteten Stadt; viele Tausende wurden dahingerafft. In diesem Chinesenviertel umherwandernd, wunderte ich mich, wie die Söhne des Reiches der Mitte gerade einem solchen Orte den Namen „wohlriechendes Wasser” gegeben haben konnten; denn das ist die Bedeutung des Wortes Hiang Kiang. Der Name Hongkong ist nur der Cantoner Dialekt dafür, und diesen haben die Europäer angenommen.
In Hongkong wurde mir der Besuch von Macao von jedem Menschen, mit dem ich darüber sprach, abgeraten. Macao sei heute ein altes, dem vollständigen Verfalle rasch entgegeneilendes Nest ohne irgendwelches Interesse. Was in Macao zu sehen wäre, würde man viel besser in Hongkong selbst, oder in der berühmten Zweimillionenstadt Canton sehen, und jeder Tag, den man Macao widme, sei ein verlorener Tag. Hongkong hatte eine Zeit lang gute Ursache, auf die alte Portugiesenstadt an der Mündung des Perlflusses eifersüchtig zu sein, damals, als es selbst noch in den Kinderschuhen steckte, während Macao der größte und herrschende fremde Hafen von China war. Aber diese Zeiten sind vorüber, und die guten Hongkonger sollten den von ihrer Größe gefallenen Rivalen ein freundlicheres Andenken bewahren. Es thut besonders den Chinesen gegenüber nicht gut, wenn Europäer verschiedener Nationen so schlimm voneinander sprechen, wie es die Bewohner Hongkongs von jenen Macaos thun. Dieser Zwiespalt und diese kleinlichen Eifersüchteleien waren schon vor dreihundert Jahren die Ursache, daß sich die Chinesen die unangenehme streitsüchtige Gesellschaft verbaten und sich gegen alle Europäer ohne Unterschied der Nation absperrten. Ohne sie wäre China vielleicht schon seit Jahrhunderten geöffnet und dem europäischen Verkehr ergeben.
Ich ließ mich von den Hongkongern nicht abhalten, Macao doch einen Besuch zu machen, denn Macao ist nicht allein eine Stadt von größtem historischen Interesse, sondern hat auch heute noch unableugbare Bedeutung. Wohin mich meine Reisen in Ostasien auch führen mochten, von Singapore und Batavia bis nach dem nördlichen Japan und Korea, überall traf ich Portugiesen aus Macao als Geschäftsleute an. Sie waren nicht immer reine Portugiesen, sondern vielfach[S. 15] vermischt mit chinesischem, arabischem, malayischem, japanischem Blut, eine merkwürdig abenteuerliche, unstäte, leidenschaftliche Mischlingsgesellschaft, aber man nennt sie in Ostasien doch allgemein, wenn auch mit Unrecht, Portugiesen und giebt Macao als ihre Heimat an.
Macao wurde schon im Jahre 1557 von den Portugiesen gegründet, die, damals auf ihrer kommerziellen Höhe stehend, den Handel nicht nur mit China, sondern mit der ganzen ostasiatischen Welt beherrschten. Durch die Schaffung eines festen Stützpunktes in China waren ihnen die Mittel in die Hand gegeben, diese Herrschaft auch in späteren Zeiten aufrecht zu erhalten. Aber sie haben es nicht verstanden. In ihrem Uebermut, in der Leichtigkeit, mit welcher sie damals große Vermögen erwerben konnten, in dem Bewußtsein ihrer militärischen Kraft gegenüber den ostasiatischen Völkern ließen sie sich zu unvernünftigen Bedrückungen, Roheiten und willkürlichen, ungerechten Schritten verleiten. Als die Holländer und Engländer in Ostasien erschienen, wurden mit diesen Händel angefangen, statt einig mit ihnen vorzugehen, wie es heute geschieht, und diese unkluge, abenteuerliche Politik hat dem europäischen Handel einen Schaden zugefügt, der in seinem Umfang ganz unberechenbar ist. Ist Macao die Wiege dieses Handels zwischen Europa und Ostasien, so ist es auch gleichzeitig sein Grab, und die heutige verfallene Portugiesenstadt im Süden Chinas zeigt in ihren verlassenen Warenhäusern und vereinsamten Palästen die Grabsteine ihrer einstigen Größe. Hongkong und Canton haben die Erbschaft angetreten. Die Tausende von Schiffen, welche jährlich in die weite Bucht des Perlflusses einlaufen, dampfen an Macao vorüber, um ihre Schätze in dem englischen Emporium abzuladen, das auf der östlichen Seite dieser Bucht, Macao gegenüber, liegt. Mit Macao wird nur noch spärlicher Verkehr unterhalten. Täglich läuft ein kleiner Dampfer von Hongkong in mehreren Stunden nach der Portugiesenstadt, um am nächsten Tage nach Hongkong zurückzukehren. Leicht könnte der Ausflug in einem Tage gemacht werden, wenn nicht zwischen den Schiffskapitänen und den Hotels von Macao ein zärtliches Einvernehmen bestände, durch welches die Besucher dieser portugiesischen Kolonie veranlaßt werden, dort eine Nacht zuzubringen. Aber diese gewährt ihnen dafür Gelegenheit, eine der interessantesten Eigenheiten Macaos kennen zu lernen, nämlich die zahlreichen Spielhöllen. Sie haben Macao zu dem Namen „das Monte Carlo von Ostasien”, dem berüchtigten Baccaratspiel zu dem Namen „Macao”, den Dampfern zu dem Spitznamen „Gambling Steamers” und, last not least, der Verwaltung von Macao zu der reichsten Einnahme verholfen.
Wenn man sich nach zuweilen recht stürmischer Fahrt zwischen zahlreichen Dampfern, chinesischen Dschunken und Fischerbooten hindurch Macao nähert, so gewährt diese Stadt einen ungemein malerischen, um nicht zu sagen großartigen Anblick. Amphitheatralisch ziehen sich die Häuser, überhöht von zahlreichen Kirchen und Türmen,[S. 16] eine sanfte Anhöhe empor, gegen die Küste zu von einer Palastreihe begrenzt, wie sie wohl keine andere Stadt Chinas aufzuweisen hat. An beiden Enden von alten Festungswerken beschützt, zieht sich diese Praya grande anderthalb Kilometer dem Meeresstrand entlang, das Regierungsgebäude, das Rathaus und andere öffentliche Gebäude enthaltend. Leider können die Passagiere größerer Dampfer das herrliche Panorama der Stadt mit ihrem Kranz grüner Berge dahinter nur aus der Ferne bewundern, denn der Hafen versandet immer mehr und ist nur kleinen Dampfern, sowie Dschunken zugänglich. Die großen Ostasiendampfer müssen sechs bis acht Kilometer weit draußen in der Bucht vor Anker gehen, und mit der schlechten Verwaltung und der Konkurrenz von Hongkong hat wohl auch dieser Umstand am meisten zu dem Verfall von Macao beigetragen.
Dieser Verfall zeigt sich dem Besucher der Stadt nicht so sehr in den Gebäuden, als in der Stille und Geschäftslosigkeit, die in den engen, durchaus südeuropäischen Gäßchen herrscht. „La Cidade do Santo Nome de Deos en China” heißt die Stadt im Portugiesischen, und sie trägt auch ganz den portugiesischen Charakter mit ihren vielen Klöstern und Kirchen, von denen die schönste, im Jahre 1835 durch eine Feuersbrunst eingeäschert, leider heute nur noch eine traurige Ruine ist. Der Name „die Stadt des heiligen Namens Gottes in China” hat leider auf die Bevölkerung keinen besonders günstigen Einfluß gehabt. Ihrem Leben und Treiben nach zu urteilen, scheint sie vielmehr dem Chinesengötzen Ama zu huldigen, dessen Standbild früher auf dem Platze stand; aus diesem Namen Ama, im Verein mit dem chinesischen Kao (Hafen) entstand Ama-Kao, später verkürzt zu „Macao”. Und doch kann sich dieses verkommene Nest, der letzte Rest der früheren portugiesischen Weltherrschaft, rühmen, einen der größten Gotteskämpfer, den kühnsten und eifrigsten Missionar Asiens, den heiligen Franz Xaver, in seinen Mauern beherbergt zu haben. Er starb auch hier, auf einer kleinen Insel nahebei, im Jahre 1552, ein Zeitgenosse des berühmten Dichters der Lusiade, Camoens, der hier in den Jahren 1550 und 1560 zusammen achtzehn Monate zugebracht hat. Mit Andacht stand ich vor dem bescheidenen Denkmal, das die Portugiesen ihrem größten Dichter hier errichtet haben, bei der Grotte, in die er sich zurückzuziehen pflegte, um seinen Träumen, seinen Dichtungen nachzuhängen. Was würde er, der in der Machtperiode seines Vaterlandes gelebt, heute zu Macao sagen, in welchem zu seiner Zeit der Keim zur Beherrschung von China geschlummert hat! Und wie Portugal China verloren hat, so hat es auch mit diesem größten Reiche der Erde das zweitgrößte der Erde, nämlich Indien, verloren. Was Macao in China, das ist Goa in Indien, auch nur ein Denkmal der Unfähigkeit und Habsucht der früheren portugiesischen Machthaber.
Die malerischen Anhöhen hinter der Stadt emporsteigend, konnte ich die eigentümliche Lage dieser winzigen Kolonie wahrnehmen. Sie erinnerte mich lebhaft an Gibraltar, das den Spaniern gerade so auf der Nase sitzt wie Macao den Chinesen,[S. 17] nur daß die Anhöhen des letzteren sich nicht entfernt mit dem Felsen des Dschebel al Tarik vergleichen lassen. Auch Macao liegt auf einer langen, nach Süden laufenden Halbinsel, die nur durch einen flachen, sandigen Landstreifen von fünfundsiebzig Meter Breite mit dem chinesischen Hinterlande zusammenhängt. Jenseits davon gewahrte ich die Mauern der chinesischen Stadt Tschingan, das die Portugiesen in Casabranca umgetauft haben. Wie groß aber der portugiesische Landbesitz in Wirklichkeit ist, können sie selbst nicht sagen. Sie haben wohl vor lauter Sklavenverkäufen und Spielen in den chinesischen Spielhöllen während der dreiundeinhalb Jahrhunderte ihres Hierseins noch keine Zeit dazu gefunden. Sie behaupten, ihre Kolonie sei einunddreißig Quadratkilometer groß, ein Zehntel von Schaumburg-Lippe, aber die Chinesen geben ihnen nicht einmal das, ja bis zum Jahre 1887 ließen die bezopften Söhne des Himmels überhaupt keine Ansprüche der Portugiesen zu. Ich erkundigte mich über die eigentlichen Besitzverhältnisse in dem monumentalen Regierungsgebäude auf der Praya. Der überaus höfliche Secretario geral do Governo e Secretario de Legaçao (die Portugiesen lieben lange Titel) widersprach den Angaben der meisten Reisewerke, daß Macao gar keine portugiesische Kolonie sei. Bis 1887 hätten die Portugiesen allerdings dem Kaiser von China eine jährliche Miete von 500 Taëls für die Halbinsel gezahlt. In dem Vertrage des genannten Jahres aber wurde der wirkliche Besitz den Portugiesen zuerkannt. Sie haben, um das zu erreichen, dreihundertfünfzig Jahre gebraucht. Kann man sich da über den Rückgang ihres einstigen Weltreiches wundern?
Die heute noch in Macao lebenden Portugiesen, etwa 5000, sind, wie bemerkt, mit wenigen Ausnahmen Mischlinge, denen man die chinesische oder malayische Mutter an den Schlitzaugen und der dunkeln Hautfarbe sofort ansieht. Keine andere Nation Europas hat ein so erstaunliches Anpassungsvermögen, was mit anderen Worten heißt, keine hat sich für die weibliche Hälfte der dunkelhäutigen Menschenrassen so empfänglich gezeigt, so wenig kaukasischen Rassenstolz entwickelt. Ich habe diese Wahrnehmung in Afrika, in Indien, auf den Sundainseln, in Malakka etc. gemacht und sah sie nun auch in China bestätigt.
Wovon die Portugiesen in Macao leben, ist schwer zu sagen. Während in Hongkong und Canton der denkbar regste Handel und Verkehr herrscht, ist es in Macao still, und das ganze noch vorhandene Geschäftsleben liegt in den Händen der 60000 Chinesen, welche das weitaus bedeutendste, lebenskräftigste und wohlhabendste Element in dieser europäischen Kolonie bilden. Das Streben jedes Portugiesen in Macao scheint es zu sein, in irgend einem andern Hafen Ostasiens Unterkunft und Beschäftigung zu finden, oder in Macao selbst irgend eine Regierungsstelle zu ergattern. Es ist gar nicht zu glauben, welches Beamtenheer hier erforderlich ist, um die einunddreißig Quadratkilometer Landes zu verwalten. Das Sprichwort „Viele Köche versalzen die Suppe” hat sich hier glänzend bewährt.
An die europäische Stadt schließt sich jene der Chinesen an, eben so schmutzig, lärmend, belebt wie das Chinesenviertel in Hongkong, aber die Elemente, die sich hier zusammengefunden haben, sind zum Teil noch verlotterter als dort. In früheren Jahrzehnten steckten die chinesischen Kaufleute hier unter einer Decke mit den portugiesischen in Bezug auf den schmachvollen Menschenhandel, der hier getrieben wurde. Harmlose Chinesen wurden unter allerhand falschen Vorspiegelungen angeworben, auch durch Piraten gewaltsam abgefaßt und als Sklaven nach Peru, Kalifornien oder Mexiko verkauft. Eine halbe Million Seelen fielen den Portugiesen so zum Opfer, bevor die chinesische Regierung die Einstellung dieses Kulihandels erwirken konnte. Damit ging die leichteste und ergiebigste Einnahmequelle den Portugiesen verloren, und so warfen sie sich denn im Verein mit ihren chinesischen Freunden auf das Lotteriewesen, das bei einem so spiellustigen Volke, wie die Chinesen, günstigen Boden finden mußte. Wie früher durch den Kulihandel, so wurden nun durch die Lotterie im wahren Sinne des Wortes spielend ungeheure Vermögen erworben, und auch die portugiesische Regierung gewann durch die Abgaben jährlich Millionen. Um das Geld im Lande zu erhalten, hob die chinesische Regierung das Lotterieverbot in China auf, die in Macao befindlichen Lotteriegesellschaften fanden in neugegründeten Anstalten dieser Art in Canton gewaltige Konkurrenten, und damit versiegte auch diese unlautere Einnahmequelle. Statt der früheren Millionen giebt sie heute der Regierung nur etwa 200000 Mark jährlich. Nun warfen sich die guten Bewohner von Macao, dieser Freistätte des Lasters, auf den Opiumschmuggel. Die Chinesen konnten demselben nicht anders beikommen als durch die Gründung einer neuen Zollstation auf der benachbarten Insel Lappa, und so blieben den Portugiesen nur jene Geschäftchen, welche in Macao selbst betrieben werden können, wo sie die Hand der chinesischen Regierung nicht erreichen kann: die Spielhöllen mit Baccarat und dem chinesischen Fan-Tanspiel, das der portugiesischen Regierung immer noch eine jährliche Einnahme von etwa 600000 Mark abwirft. Während die Kaufleute anderer europäischer Nationen in China ihr Augenmerk auf die kommerziellen Bedürfnisse der Chinesen richten, spekulieren die Portugiesen, wie man sieht, hauptsächlich auf deren Laster und Leidenschaften; kein Wunder, daß sie sich unter Chinesen wie Europäern in Asien keiner besonderen Achtung erfreuen.
In den beiden vorzüglichen Hotels von Macao, dem „Boa vista” und dem auf der Praya Grande (der Strandpromenade) gelegenen Hingkeehotel findet der Besucher immer Führer, welche ihn auf seinen Spaziergängen durch die Chinesenstadt begleiten und die hauptsächlichsten Spielhöllen zeigen. So elegant und einladend, wie jene des europäischen Macao, Monte Carlo, sind sie keineswegs, aber dennoch trifft man in ihnen neben Chinesen auch viele Europäer, Portugiesen wie junge englische Clerks, welche auf den „Gambling Steamers” von Hongkong herüber[S. 19]kommen, um ihr Glück zu versuchen. Aus Neugierde setzte ich selbst auch einigemale auf Fan-Tan und — gewann. Die Einrichtung des Fan-Tantisches ist sehr einfach. Die Spieler setzen sich an die mit 1, 2, 3, 4 bezeichneten Seiten des Tisches und legen ihren Einsatz auf eine derselben. In der Mitte wird ein Haufe von kleinen Münzen oder auch Bohnen, Steinchen etc. zusammengeworfen und mit einer Metallschüssel bedeckt. Sind die Einsätze gemacht, so hebt der Bankhalter die Schüssel ab und zählt den Münzen- (oder Bohnen-)haufen, indem er immer vier und vier davon abstreift. Bleiben eine, zwei oder drei Münzen übrig, so haben jene Einsätze gewonnen, welche auf die mit 1, 2 oder 3 bezeichnete Tischseite gelegt wurden. Bleibt kein Stück übrig, war also die Münzenmenge durch vier teilbar, so streicht der Bankhalter alle Einsätze ein. Es kann aber auch auf alle vier Seiten gesetzt werden, und der Bankhalter zieht einen Teil des Gewinstes für sich ein.
Ein anderes Spiel, das die portugiesische Regierung als Monopol einer Gesellschaft abgetreten hat und aus dem sie eine Einnahme von etwa zweihunderttausend Mark jährlich bezieht, ist das Pak-kap-piu. Die ersten achtzig Schriftzeichen, welche in dem Schulbuche der Chinesen „Die tausend Schriftzeichen Klassiker” enthalten sind, befinden sich auf Papierstreifen aufgedruckt, welche unter die Spieler verteilt werden. Der Bankhalter verkauft nun Karten, welche, auf die Papierstreifen aufgelegt, gerade zehn der achtzig verschiedenen Schriftzeichen bedecken. Bei dem Spiele, an welchem ich in einer der Spielhöllen teilnahm, kostete jede Karte hundert Reis (Macao besitzt die portugiesische Goldwährung). Ich legte meine Karte auf die ersten zehn Schriftzeichen. Der Bankhalter zog nun aus einer verdeckten Schüssel zwanzig Täfelchen und legte sie vor sich auf den Tisch, so daß alle Mitspielenden sie sehen konnten. Jedes Täfelchen enthielt ein Zeichen. Mein Führer hob nun meine Karte auf und sah nach, welche dieser zwanzig gewinnenden Zeichen unter meiner Karte waren. Er zählte deren drei. Ich hatte meinen Einsatz verloren. Hätte meine Karte deren sechs bedeckt, so wäre mir ein Gewinst von hundert Reis zugefallen; bei sieben Schriftzeichen zweihundert, bei allen zehn etwa zehntausend.
Diese beiden Spiele waren in den Spielhöllen, die ich besuchte, die beliebtesten. Aber es wurden deren noch Dutzende andere gespielt, mit Würfeln, Dominos, Bambusstäbchen und den fingerlangen kleinen chinesischen Spielkarten, deren es zwei verschiedene Arten giebt. Ein Spiel mit Dominopunkten auf den Karten zählt deren 32, ein anderes, Ngau-pai genannt und schon seit Jahrtausenden bekannt, besitzt in jedem Päckchen 36 Karten und dürfte wohl das älteste Kartenspiel der Welt sein.
Indessen, weder in Macao noch sonst irgendwo in dem großen Reiche der Mitte beschränken die Chinesen ihre außerordentliche Spielwut auf die Spielhöllen allein. Alt und jung, Männer wie Frauen, reich und arm bis zu dem elendesten Kuli, alles ist von frühester Jugend an dem Spiel ergeben. Man sieht die Chinesen in[S. 20] den Häusern, in den Kaufläden, in Theehäusern, ja selbst in den Vorhöfen ihrer Götzentempel, auf Schiffen und in den Straßen spielen. Jede Gelegenheit wird dazu benützt. Bei meiner Wanderung durch den ungemein reichhaltigen Fruchtmarkt von Macao bemerkte ich ein halbes Dutzend langbezopfter Söhne des Himmels um einen Fruchthändler versammelt, der unter spannender Aufmerksamkeit seiner Zuseher eine Apfelsine schälte. Sorgfältig zerteilte er sie und zählte dann die in ihr befindlichen Samenkörner. Als er das Resultat laut ausrief, wechselten die sechs zusehenden Chinesen Geldmünzen untereinander. Ich konnte mir den Grund nicht erklären. Mein Führer erzählte nun, die sechs Chinesen hätten untereinander auf die Zahl der Samenkörner in der ersten besten Orange gewettet.
Giebt es auf dem Erdball einen Fluß, auf welchem sich ebenso interessantes, reges, malerisches Leben zeigt wie auf dem Perlfluß? Ich kenne ihn nicht. Man könnte die Themse erwähnen und den Hudson bei Neuyork, aber die breiten Rücken dieser Ströme tragen hauptsächlich gewaltige Ozean- und Flußdampfer, Dampffähren, Schleppschiffe und moderne Segler. Sie sind nur Wasserstraßen, dem Verkehr gewidmet, nicht dem Leben. Leben zeigen wohl der Ganges, Nil, Irawaddi und der Menam, allein lange nicht in dem gleichen Maße wie der Perlfluß, besonders auf der achtzig Seemeilen langen Strecke zwischen dem größten Handelsemporium und der größten Stadt des himmlischen Reiches, zwischen Hongkong und Canton. Dort lebt ein großer Teil der Bevölkerung geradezu auf dem Wasser, und während die modernen Dampfer, welche die Europäer auch auf diesem urchinesischen Fluß verkehren lassen, nur dem Transport von Waren und Passagieren dienen, wohnen auf dem Perlfluß Hunderttausende von Menschen. Auf der breiten Wasserfläche dieses trüben, schlammigen, reißenden Flusses werden sie geboren, verbringen sie ihr Leben und sterben; aus seinen Fluten ziehen sie ihre Nahrung, ihren Lebensunterhalt. Sie sind menschliche Amphibien, denen das Leben auf dem trockenen Festlande kaum erträglich scheint, und die sich nur auf ihren Sampans, Fischerbooten und schwimmenden Häusern wohlbefinden.
Man mag in dem ungeheuren chinesischen Reiche reisen, wohin man will, nirgends wird sich die chinesische Eigenart malerischer zeigen als auf dem Cantonflusse und auf dem Wege dahin. In letzter Zeit wird viel von einer Eisenbahn zwischen Hongkong und Canton gesprochen, vielleicht wird man schon in wenigen Jahren[S. 22] das Dampfroß durch die gesegneten Reisgefilde am Kwantung eilen sehen. Aber wer immer in Zukunft Canton besucht, möge die Flußfahrt dahin unternehmen, wenn er das alte China kennen lernen will. Prächtige große Dampfer von mehreren tausend Tonnen Gehalt vermitteln den Verkehr zwischen den beiden so wichtigen Städten. Als ich eines Morgens nach einer raschen Fahrt in der Jinrickishaw durch das schmutzige Chinesenviertel in Hongkong den Dampfer Hankau bestieg, der mich nach Canton bringen sollte, glaubte ich mich auf einem der schwimmenden Passagierpaläste des Hudson zu befinden, so groß und prächtig sind die Dampfer der Hongkong-Canton- und Macao-Dampfergesellschaft. Auch die Einrichtung dieser blendend weißen Schiffe mit ihren geräumigen, eleganten Salons, ihrem Hurricandeck und ihren schönen Kabinen erinnerte mich an die Hudsondampfer. Nur besitzen sie eine bedenkliche Zuthat, die den amerikanischen Flußdampfern fehlt. In einem an den Salon grenzenden Raume prangte ein kleines Arsenal von Schieß-, Stich- und Hiebwaffen, zum Zugreifen bereit, und als mich ein chinesischer Steward mit lang herabhängendem Zopfe in meine Kabine führte, bemerkte ich in dieser, unmittelbar über meinem Bett, einen haarscharf geschliffenen Säbel und einen geladenen Revolver. Vor den zum Zwischendeck führenden Thüren hielten bewaffnete Matrosen Wache und ließen keinen der tausend oder noch mehr chinesischen Passagiere, welche dort unten zusammengepfercht waren, auf das Oberdeck.
Warum diese Sicherheitsmaßregeln? Sie scheinen heute vielleicht überflüssig, aber in früheren Jahren kam es häufig vor, daß sich chinesische Seeräuber als Passagiere auf die Dampfer einschmuggelten und, sobald diese das Insellabyrinth vor der Mündung des Perlflusses erreicht hatten, den Kapitän, die europäischen Offiziere und Passagiere überfielen, um sie auszurauben. Noch vor einigen Jahren ereignete sich dies auf einem solchen Dampfer, und bald nachdem ich Canton wieder verlassen hatte, berichteten die Tagesblätter aus Hongkong von dem Ueberfall eines chinesischen Schiffes durch Piraten in jenen Gewässern. Sie ermordeten die ganze Schiffsmannschaft und führten das Schiff nach einer unbewohnten Insel, wo sie den Anstrich desselben änderten und es für weitere Piratenzüge benützten. In völliger Sicherheit ist man auch heute noch nicht, trotz der englischen Kriegsfahrzeuge und der kuriosen chinesischen Kanonenboote, welche den Patrouillendienst auf dem Perlfluß versehen. Deshalb wird der Wachtdienst auf den Passagierschiffen sehr streng gehandhabt; eine Anzahl Matrosen mit Revolvern und Säbeln sind stets in Bereitschaft, und neben diesen Waffen giebt es noch andere, nicht minder gefährliche. Der Ingenieur unseres Dampfers zeigte mir gerade gegenüber der Eisenthüre, welche zum Zwischendeck führt, die Mündung eines Schlauches, der mit dem Dampfkessel in Verbindung steht. Im Falle von Meuterei braucht der wachthabende Matrose nur einen Hahn zu öffnen, um die ganze bezopfte Gesellschaft mit heißem Dampf abzubrühen.
Während wir, den herrlichen Hafen von Hongkong verlassend, in das Labyrinth kahler, brauner Felseninseln steuerten, welche der eigentlichen Mündung des Perlflusses, der Boca Tigris, vorgelagert sind, besah ich mir die Einrichtung des Dampfers. In den Räumen der ersten Kajüte gleicht alles, wie gesagt, den Hudsondampfern. Eine Eisenthür führt nach der auf demselben Verdeck befindlichen zweiten Kajüte, welche für die Chinesen der besseren Stände bestimmt ist, und an diese schließt sich eine Kajüte für die chinesischen Damen. In der vornehmen Welt Chinas herrscht in Bezug auf das weibliche Geschlecht eine ähnliche Abschließung wie bei den Mohammedanern, nur daß sich die Chinesinnen niemals verschleiern.
Das Zwischendeck ist für die Chinesen der untern Stände bestimmt. Der ganze verfügbare Raum war mit Zopfträgern angefüllt, die auf mitgebrachten Decken oder Strohmatten lagen oder auf ihren Kisten und Kasten und Kleiderbündeln hockten, denn das Zwischendeck der chinesischen Dampfer besitzt keine Einrichtungsstücke, und jeder Passagier muß für seine Bequemlichkeit so gut als möglich selbst Sorge tragen. Die meisten hatten ihre Tabaks- oder Opiumpfeife im Munde und gaben sich Karten- oder Dominospiel hin; selbst die bettelarmen, halbnackten Kulis, die vielleicht nichts ihr Eigen nannten als das zerlumpte, bis zu den Knieen reichende Beinkleid, ihr einziges Kleidungsstück, und ein paar Sapeken (Kupfermünzen im Wert von einem viertel Pfennig), kauerten gruppenweise auf den kahlen Dielen und frönten dem Spiel. Verkäufer von allerhand Eßwaren, gekochtem Reis, kleinen getrockneten Fischen, Seegras, übelriechenden Eiern und sonstigen abschreckend aussehenden Dingen zogen von Gruppe zu Gruppe, andere verkauften kochendes Wasser für die Theebereitung; hier ließen sich blinde Musiker mit ihren Gesängen, Pfeifen und Gongschlägen hören, dort lauschten Gruppen von Kulis den Märchen und Räubergeschichten von gewerbsmäßigen Erzählern. Auch zahlreiche Frauen befanden sich unter den Passagieren. Die Chinesen sind ein sehr reiselustiges Volk, und der Prozentsatz jener, welche sich auf der Wanderschaft befinden, ist vielleicht größer als bei manchem europäischen Volke. Mütter mit ihren Kindern, junge Mädchen, arme Bootsfrauen und Kuliweiber lagen rauchend, spielend oder mit allerhand Arbeiten beschäftigt auf ihren Binsenmatten. Viele schliefen. Als Kopfkissen dienten ihnen eigentümliche hohle Porzellankästchen in der Form und Größe unserer Bauziegel. Die Atmosphäre in diesen Räumen war trotz der weitgeöffneten Luken geradezu unerträglich. Die kleinen Papierfächer, welche jeder Chinese mit sich führt, waren unausgesetzt in Bewegung; aber der Gestank der Lebensmittel, alten Kleider und Matten, die Ausdünstung von mehr als tausend Menschen, der eigentümliche odeur de Chine, der jedem Gegenstand in diesem Lande anhaftet, konnten weder von den Fächern noch von der stark durchziehenden Seeluft verscheucht werden.
Trotz des ungemein interessanten Anblicks, den die bunt zusammengewürfelte Menge gewährte, eilte ich deshalb bald auf das Verdeck zurück. Wir waren bei[S. 24] den hohen steilen Felsen der Boca Tigris angekommen und fuhren zwischen den starken Batterien hindurch, welche die Chinesen hier zur Verteidigung von Canton durch deutsche Ingenieure haben anlegen lassen. Auch weiterhin zeigen alle Berge, alle Inseln, alle den Fluß eindämmenden Felsen Befestigungen, aber nur solche nach chinesischem Muster. Hohe, blendend weiße Mauern ziehen sich vom Flusse die Anhöhe hinauf und auf der andern Seite wieder herunter. Im Innern dieser so umschlossenen weiten kahlen Räume ist nichts zu sehen als ein oder zwei gemauerte Häuser, welche die Anhöhen krönen, und Steintreppen, welche vom Flusse zu ihnen emporführen. Kanonen, Erdwerke, Waffen, Mannschaften schienen diesen chinesischen Festungen zu fehlen. Die einzigen Anzeichen, daß sich dort Mannschaften befinden mußten, waren zahllose dreieckige Flaggen, weiß mit roten chinesischen Schriftzeichen in der Mitte, oder rot mit weißen Schriftzeichen; zu Hunderten wehten sie auf den Mauern und Gebäuden. Man sagte mir, es würde heute ein hoher Mandarin zur Untersuchung der Festungswerke erwartet, und deshalb der Fahnenschmuck. Ja, wenn die Chinesen mit Flaggen allein Krieg führen könnten!
Weiter stromaufwärts verflachen sich die Ufer, und jedes irgendwie verwendbare Stückchen Land wurde durch die fleißige Hand der Zopfträger in Reisfelder verwandelt. Splitternackt, nur mit großen Strohhüten auf den Köpfen, stehen sie in dem Schlamm und versetzen jedes einzelne der Hunderttausende von zarten Reispflänzlein in schnurgerade Reihen. Selbst die Schlammbänke, welche der reißende Strom hie und da mitten in seinem Bett aufgeworfen hat, zeigen solche Paddy-(Reis-)felder. Wohl äußert sich die Meeresflut bis hinauf nach Canton und hat dort noch ein Spiel von über einen Meter, aber das Salzwasser selbst dringt nicht viel weiter als bis zu der Boca Tigris, und es ist nur die Anstauung des schlammigen Süßwassers, welche weiter oben das Flutenspiel mitmacht. Die weiten, sumpfigen Ebenen werden durch Erddämme eingefaßt, welche mit Lichee und Bananen bepflanzt sind. Nur vereinzelt gewahrt man in diesen Gegenden Palmen. Wären diese zahlreicher vorhanden, die Dörfer zu beiden Seiten des Flusses würden mit ihren düstern, dunklen Schlammmauern an die Fellachendörfer des Nilthales erinnern. An Stelle der Minarets treten hier die eigentümlichen vielstöckigen Pagoden, an Stelle der Moscheen nicht etwa Buddhatempel, sondern die festen viereckigen Steintürme der Pfandhäuser, deren es wohl in jedem Dorfe eins oder mehrere giebt. Sie sind nächst den Pagoden die höchsten und solidesten Bauten in China. Auffällig ist es, daß auch in den Dörfern alle Häuser mit gebrannten Hohlziegeln eingedeckt sind, und daß die Dörfer durchweg parallel zu der Flußrichtung stehen; die abergläubischen Chinesen thun dies aus Furcht vor den bösen Geistern, welche, unsichtbar für sie, in der Richtung des Flusses durch die Lüfte jagen und ihrer Meinung nach durch quergestellte Dächer aufgehalten würden. Im Gegensatz zu der Armseligkeit der Dörfer steht die ungemein sorgfältige Bebauung[S. 25] der sie umgebenden Ländereien. Sie verraten die Jahrtausende alte Kultur, der sie durch die arbeitsamen Chinesen unterworfen wurden. Jede irgendwie verwendbare Erdscholle ist bebaut; neben den Reisfeldern gewahrt man Gemüsegärten, Orangen- und Obstpflanzungen, hie und da erheben sich gewaltige Schattenbäume, und zwischen ihnen hindurch sieht man noch in weiter Ferne Segelboote dahinziehen, wie in Holland. Der Fluß ist in viele Seitenarme gespalten, und je nach ihrer Bestimmung stromauf- oder -abwärts benutzen die chinesischen Fahrzeuge die Flutströmungen im Hauptfluß oder in kleinen Nebenarmen. Ja, diese chinesischen Schiffe! Jedes einzelne verdient in Europa in irgend einem Museum aufgestellt zu werden. Gewiß waren es nicht die Phönizier, sondern die Chinesen, welche die Segelschiffahrt erfunden haben, denn schon vor Jahrtausenden war dieselbe sehr entwickelt. Chinesische Fahrzeuge besuchten die verschiedenen Länder der ostasiatischen und australischen Welt, und wenn sie auch im Laufe der Zeit erheblich verbessert worden sind, so heimeln sie den Reisenden, der ihnen hier auf dem Perlfluß begegnet, doch an, wie die kuriosen Fahrzeuge der alten Portugiesen und Holländer aus der Zeit der großen Entdeckungsreisen. Gegen sie erscheinen die Karavellen des Kolumbus noch modern. Und dabei haben sie sich in China vielleicht in demselben Verhältnis vermehrt wie die riesige Bevölkerung, denn die zahlreichen Flüsse, Seen und Kanäle des großen Landes, wo immer man auch hinkommen mag, sind mit ihnen bedeckt, zu Tausenden und Abertausenden drängen sie sich in den Häfen, an den Kanalschleusen, in den Marktstädten zusammen, zu Tausenden schwimmen sie auch hier auf dem Perlfluß.
Am zahlreichsten sind wohl die Fischerboote, dem ungeheuren Fischreichtum dieses merkwürdigen Flusses entsprechend. Fischerboote überall, in der Mitte des Stromes verankert, in den zahlreichen Buchten oder längs der schlammigen, schilfbedeckten Ufer, mit Netzen, Angeln und Kormoranen, diesen eigentümlichen Vögeln, welche sich die Chinesen ganz unterthan gemacht haben und die mit unendlicher Geduld den lieben Tag lang die Fische aus den Fluten für ihre Herren hervorholen.
An verschiedenen Stellen ist der Fluß von den Chinesen zur Verteidigung gegen die Franzosen und Engländer gesperrt worden. Sie trieben in kleinen Abständen starke Pfähle in den Grund quer über den Fluß und ließen nur schmale, leicht zu verteidigende Durchfahrten für die Schiffe frei. Diese schwarzen, über die Wasserfläche hervorlugenden Pfähle sind für den Fischfang wie geschaffen; die Angriffe der weißen Barbaren waren doch für etwas gut. Ungeheure kohlschwarze Netze hängen an diesen Pfählen, und während die letzteren den Schiffen den Durchzug versperren, thun die ersteren dies in Bezug auf die Fische. Stromabwärts schaukeln sich, durch Seite an die Pfähle befestigt, zahllose aneinandergekettete Sampans, plumpe offene Boote, mit den Fischern darin. Diese haben ihren Opfern, den Fischen, die Art der Fortbewegung im Wasser abgelauscht, denn statt Ruder nach[S. 26] unserer Art zu benützen, hängt ein einziges großes Ruder über den Hinterteil des Bootes ins Wasser und wird durch die Bootsleute hin und her bewegt, ähnlich wie der Fisch seine Schwanzflossen braucht. Hunderte anderer Boote liegen in den Buchten verankert, die schwarzen Netze zum Trocknen auf den Masten aufgehängt.
Nächst zahlreich sind auf dem Perlfluß die kuriosen chinesischen schwimmenden Wohnhäuser, die, aus der Ferne gesehen, das Aussehen schwimmender Pantoffel haben und auch Pantoffelboote genannt werden. Zehntausende dieser Boote bedecken den Fluß, andere Zehntausende liegen in Canton an den Ufern verankert, mit einer Bevölkerung, die nach Hunderttausenden zählt. Jedes dieser Boote beherbergt eine, mitunter auch mehrere Familien. Der hintere Teil des Pantoffelbootes ist offen und dient für die Ruderer. Unter ihnen sind die Vorratsräume für Lebensmittel, Getränke, allerhand Hausrat, lebende Schweine, Enten, Gänse und gar häufig auch Kinder. Sind die Eltern an der Arbeit, oder werden Passagiere mit dem Boote befördert, so wird die kleine unangenehme, störende Gesellschaft einfach in diese dunkeln Vorratsräume gesteckt. Das Vorderteil des Bootes ist durch ein tonnenartiges, nach hinten offenes Gewölbe eingedeckt, aus Reifen bestehend, die mit Brettern oder Leinwand überzogen sind. Unter dem Gewölbe befinden sich lange Bänke, welche der Bootsfamilie tagsüber als Sitze, zur Nachtzeit als Betten dienen. Der Fluß ist die Welt, in welcher diese Leute leben. Unaufhörlich kreuzen sie mit ihren Fahrzeugen hin und her, vollständig unbekümmert um die großen Dschunken und europäischen Dampfer, welchen sie häufig den Weg versperren. Die Steuerleute müssen die Dampfpfeife unaufhörlich ertönen lassen, um diese Boote zu warnen, und an den Flußsperren, wo sich Hunderte von Booten an den kaum vierzig Meter breiten Durchlässen zusammendrängen, werden gar häufig einzelne umgerannt. Sie scheinen aber geradezu mit Absicht das Fahrwasser der Dampfer aufzusuchen und fahren auf zwei, drei Schritte Entfernung vor dem scharfen Bug vorbei, in beständiger Lebensgefahr. Wie mir der Kapitän des „Hankau” erzählte, betrachten sie dieses Passieren des Dampferbuges in ihrem Aberglauben als glückbringend. Was mir gelegentlich meiner ersten Fahrt auf dem Perlflusse auffiel, waren die roten Leinwandlappen und roten Papierstreifen, welche jedes einzelne Boot, jede Dschunke auf den Masten, am Bug und an den Seiten zeigte. Vorn auf der Spitze jedes Schiffes brannten außerdem Joß-sticks (Räucherkerzen) in großen Mengen, und wer immer ein Gong besaß, schlug wie besessen unaufhörlich darauf los. Durch diese abergläubischen Mittel wollten die Bootsinsassen die bösen Geister bannen. In Canton und den umliegenden Ortschaften wütete gerade die sibirische Beulenpest. Tausende fielen dieser schrecklichen Plage täglich zum Opfer, und die Chinesen kennen kein anderes Mittel, ihr entgegenzutreten, als daß sie die bösen Pestgeister auf die genannte Art verscheuchen.
Zwischen den Sampans und Fischerbooten schwimmen Hunderte von Dschunken den Fluß auf und ab, große plumpe Kästen mit hohem Bug und noch viel höherem Stern, mit bunten Farben überschmiert und an den Seiten mit grotesken Fratzen bemalt. Die Seitenwände dieser Fahrzeuge laufen gegen das Steuer zu nicht zusammen wie bei unseren Schiffen, sondern verlängern sich geradlinig um etwa einen Meter oder noch mehr über das Steuer hinaus. In diesem so gebildeten Schlitz steckt das Steuerruder mit einer Reihe vertikaler Einschnitte, durch welche beim Steuern das Wasser durchschießt. Auf dem plumpen, bunt bewimpelten Mast sitzt gewöhnlich nur ein großes Segel, nicht aus Stoff, sondern aus einer Binsenmatte bestehend, die mit fächerartigen Rippen versehen ist. Wird das Segel entfaltet, so öffnet es sich mit divergierenden Rippen ähnlich wie ein Fächer, dem der Knopf abgeschnitten wurde. Die zahlreichen Löcher und aufgesetzten Flecke zeugen nicht nur von dem Alter dieser Mattensegel, sondern auch von den Stürmen, welche die Boote in den chinesischen Gewässern, besonders zur Teifunzeit, zu überstehen haben. Der Bug mancher Dschunke zeigt eine grotesk geschnitzte scheußliche Fratze, bei allen Dschunken aber sitzen nahe dem Bug zwei ungeheure runde Fischaugen, welche den Schiffskörpern das Aussehen scheußlicher Seeungetüme verleihen. Als ich einen Chinesen in Canton über den Zweck dieser aufgemalten Augen befragte, meinte er in der merkwürdigen Verkehrssprache zwischen Europäern und Chinesen im fernen Osten, dem Pidgen-English: „No got eye, no can see; no can see, no can go” (hat kein Auge, kann nicht sehen; kann nicht sehen, kann nicht gehen).
Viele von den Dschunken, in chinesischer Sprache Tschuank genannt, sind für den Passagierverkehr zwischen Canton und den Küstenstädten, sowie Formosa, Hainan, ja Singapore und den Sundainseln bestimmt; andere liegen nur dem Frachtenverkehr oder dem hier in großartigem Maßstabe betriebenen Schmuggel ob. Zu seiner Verhinderung besitzt die Zollbehörde eine Anzahl von Kanonenbooten, welche sich durch besondere Schnelligkeit auszeichnen und deren Befehlshaber Europäer sind. Aber auch die Chinesen haben auf dem Perlflusse eine Menge von Kanonenbooten, hauptsächlich gegen die Seeräuber bestimmt, auf die sie nach Thunlichkeit Jagd machen. Diese Kanonenboote sind nichts weiter als gewöhnliche Dschunken mit einer Kanone auf dem Stern und einer Bemannung von etwa einem Dutzend Soldaten. Die großen rotweißen Flaggen auf der Mastspitze künden den Schmugglern schon von weitem die chinesische Hermandad an, so daß sie beizeiten Reißaus nehmen können.
Aus dem Perlfluß verkehren gegen sechzig verschiedene Arten von Dschunken. Viele von ihnen, besonders die Privatfahrzeuge reicher Chinesen, sind mit prachtvollen Schnitzereien und Vergoldungen geschnitzt und sehr rein gehalten. Nichts kann malerischer sein als diese kurios geschwungenen, stets wie zu einer Hochzeit mit Wimpeln und bunten Flaggen geschmückten großen Schiffe, die nirgends als nur[S. 28] in China zu sehen sind und eine der größten Merkwürdigkeiten dieses Landes bilden. Für den Passagierverkehr zwischen Hongkong und Canton, auch weiter stromaufwärts bis Shaoking, dienen unter anderen eigentümliche Fahrzeuge, welche die Europäer spottweise „chinesische Dampfer” nennen. Eben kam uns eines derselben entgegengefahren, und es hätte nicht viel gefehlt, so wären wir mit ihm zusammengestoßen. Der Form nach war dieses Schiff den europäischen Dampfern ähnlich, nur besaß es statt der Schaufelräder an den Seiten ein einziges Schaufelrad auf dem Stern, ähnlich den berüchtigten Stern-wheelers auf dem Ohio und Mississippi, die ich auf meinen amerikanischen Reisen so häufig zu benutzen gezwungen war. Aber statt durch eine Dampfmaschine, wurde dieses Schaufelrad durch Menschenarbeit in Drehung versetzt. Vor dem Schaufelrad befand sich nämlich unter dem Verdeck ein großes Tretrad, und auf diesem steigen unaufhörlich, in Schweiß gebadet, etwa zwei Dutzend halbnackter Kulis einher. In früheren Jahren führten manche dieser „Dampfer”, um die Täuschung für die chinesischen Passagiere noch vollständiger zu machen, mittdecks einen hohen schwarzen Schornstein, unter dem ein Feuer aus feuchtem Holz unterhalten wurde, damit der aus dem Schornstein qualmende Rauch recht weit sichtbar war. In neuerer Zeit sind die Schornsteine verschwunden, aber die Treträder sind geblieben, fürwahr eine billige Triebkraft, denn jeder Passagier, der sich dazu hergiebt, das Rad zu treten, hat freie Fahrt. Dabei melden sich stets doppelt und dreifach so viele Passagiere, als der Schiffseigentümer zur Fortbewegung des Schiffes braucht.
Die einzige Station, bei der wir auf dem Wege nach Canton anhielten, war das alte Whampoa, früher der Handelshafen der Riesenstadt Canton, denn bis hierher konnten die großen Seeschiffe vordringen. Auf den benachbarten Anhöhen erheben sich zwei alte, vierstöckige Pagoden, die sich in der herrlichen Umgebung dieses einstigen Welthafens sehr malerisch ausnehmen und die Wahrzeichen Whampoas bilden. Aber Glanz und Reichtum sind längst dahin, und an Stelle der einstigen reichen Hafenstadt befindet sich ein elendes chinesisches Fischerdorf, von den Zollbeamten spottweise die „Bambusstadt” genannt. Die einstigen Docks und Reparaturwerkstätten der Europäern wurden an die chinesische Regierung verkauft, welche sie zur Ausbesserung und Ausrüstung ihrer Kanonen- und Torpedoboote eingerichtet hat. Auch eine Marineschule befindet sich hier.
Während unser Dampfer in der Mitte des Stromes anhielt und einige Boote den Passagierwechsel bewerkstelligten, wurde mein Augenmerk durch ein höchst malerisches Schauspiel gefesselt. Von Canton her kam auf dem Flusse eine Flottille von etwa einem Dutzend Booten herabgeschwommen; war es denn chinesische Fastnacht? Aus der Ferne betrachtet, erschienen mir diese Boote wie aus einem kölnischen Karnevalsumzug herausgerissen. In phantastischen Farben prangend, über und über mit Fahnen, dreieckigen und viereckigen Bannern, bunten Wimpeln und roten[S. 29] Papierstreifen geschmückt, zeigte jedes Boot eine andere mehr oder minder verzwickte Form. Am glänzendsten und reichsten erschien das erste Boot, auf dessen Mast die gelbe kaiserliche Fahne mit dem blauen Drachen wehte. Unter seltsamen Musikklängen und lärmenden Gongschlägen zog es an uns vorüber. Soldaten mit blauen Kitteln und roten Kreisen auf Brust und Rücken standen auf dem Verdeck, und unter einem bunten Baldachin saß rauchend ein hoher Mandarin. Dieses offizielle Mandarinboot wurde von einer Anzahl Kanonenboote und Dschunken begleitet, die alle ähnlichen Flaggenschmuck zeigten. Wie mir der chinesische Comprador unseres Dampfers mitteilte, war der Mandarin der auf einer Inspektionsreise begriffene Provinzbefehlshaber. Aber selbst diese phantastischen Züge werden zu gewissen Zeiten weitaus übertroffen, wenn in den größern Städten und vor allem in Canton das Fest der Drachenboote abgehalten wird, eine Art Wasserkarneval, der aus dem dritten Jahrhundert vor Christo stammt und sich seit zwei Jahrtausenden alljährlich wiederholt. Gerade während meines Aufenthaltes in Canton wurde zur Verscheuchung der sibirischen Pest von dem Provinzstatthalter ein solches Fest anbefohlen. Die phantastische Ausschmückung dieser zwanzig bis dreißig Meter langen, in Drachenform gebauten Boote spottet jeder Beschreibung. Unter dem furchtbarsten Lärmen, Gongschlagen, Schreien und Singen, mit Feuerwerk und bengalischen Lichtern schießen diese von fünfzig bis sechzig Rudern fortbewegten Boote zwischen den Tausenden von Sampans und Pantoffelbooten, die ebenfalls mit Laternen bedeckt sind, auf und nieder, und häufig kommt es bei den Wettfahrten zu ernsten Unglücksfällen.
Bald nachdem wir Whampoa verlassen hatten, passierten wir die letzte Strombarriere, unter fortwährender Gefahr, einige der immer zahlreicher werdenden Boote umzurennen, und endlich gewahrte ich in der Ferne zwischen den zahllosen Masten dieses belebtesten Flusses der Erde das Häusermeer der Zweimillionenstadt Canton, überragt von dem höchsten Gebäude derselben, von der katholischen Kathedrale mit ihren zwei Türmen. Unwillkürlich wurden meine Blicke von dem aufregenden, malerischen Flußschauspiele abgezogen, und staunend mußte ich immer wieder diese Wahrzeichen des Christentums betrachten, welche inmitten dieser fremden, heidnischen Welt uns so packend an die ferne christliche Kultur gemahnten.
Zu den beiden Seiten des ungemein belebten Flusses erhebt sich die Riesenstadt; ihr Häusermeer dehnt sich von den Ufern viele Kilometer in die Ebene aus, zieht sich an den Bergwänden im Westen empor und schwindet endlich zwischen den Bäumen des ungemein fruchtbaren, reich bebauten Landes. Aber vergeblich sucht unser Auge nach hervorragenden architektonischen Werken, nach Tempeln und Palästen und Türmen; chinesische Städte kennen diesen Schmuck nicht. Ver[S. 31]einzelt hebt sich eine mehrstöckige alte Pagode über das Meer der einförmigen, grauen, gleichhohen Hausdächer; hie und da ragen feste viereckige Türme, aus Grauziegeln gebaut, empor, wie die Türme von Ritterburgen, aber sie sind nichts weiter als Pfandhäuser, die in China eine gar wichtige Rolle spielen; das einzige wirklich bemerkenswerte Gebäude dieser urchinesischen Millionenstadt, das wir schon auf viele Meilen Entfernung wahrgenommen hatten, geradezu das Wahrzeichen Cantons bildend, ist die schon erwähnte gotische Kirche mit zwei hohen Türmen, die Kirche des katholischen Bischofs von Canton.
Der Ruf unserer Dampfpfeife hatte Hunderte von Sampans in unsere Fahrbahn gelockt, nur mit schwerer Mühe war es möglich, den Dampfer zwischen ihnen hindurch an die Werft zu führen. Wir hatten mehrere hundert chinesische Reisende an Bord, und die Lenker der Sampans umdrängten in mehrfachen Reihen das Schiff, um Passagiere zu ergattern. Unter diesem Getümmel und Geschrei ans Land gehen zu wollen, wäre eitles Bemühen für uns Europäer gewesen; so sahen wir denn eine Stunde lang dem tollen Treiben zu unseren Füßen zu. Die Mehrzahl der Sampans waren von Frauen und Mädchen gelenkt. In blauen, weiten, bis an die halben Waden reichenden Beinkleidern, ein dunkelblaues Hemd mit weiten Aermeln darübergeworfen, ohne Kopfbedeckung und ohne Schuhe, führten sie mit kräftigem Arm das Ruder der schweren Boote. Diese sind ihre Wohnung und gleichzeitig ihr einziges Erwerbsmittel. Die Boote selbst sind vorne und hinten mit einem Deck versehen, auf welchem die Ruderer stehen und sich zwischen den anderen Booten geschickt hindurchzwängen, indem sie Ruder, Kenterstangen und ihre Hände benutzen. In der Mitte jedes Bootes befinden sich ein Paar Bänke, durch ein rundes Holzdach gegen Sonne und Regen geschützt. Dies ist der Sitz für die Passagiere und zur Nachtzeit die Schlafstätte der Bootsleute. Vorne auf dem Bug wird gewaschen und gearbeitet, hinten gekocht und gegessen. Tagsüber rudern sie auf dem breiten, gelben Perlstrom umher auf der Suche nach Arbeit, am Abend ankern sie irgendwo an den Ufern zwischen Tausenden anderen ähnlichen Booten und pflegen der Ruhe. So geht es Tag für Tag, Jahr für Jahr von ihrer Kindheit bis zu ihrem Tode. Selten, wenn überhaupt, kommen sie über die Stadtmauern von Canton hinaus.
Die Ankunft der großen Hongkongdampfer giebt ihnen mehr Arbeit, als sie sonst finden würden; deshalb der Zudrang dieser Hunderte von Booten, deshalb dieses Schreien und Stoßen und Drängen und Hasten, daß uns angst und bange wurde. Endlich, nach langem Warten, war der letzte Chinese, das letzte seiner Gepäckstücke, Kopfkissen und Strohmatten (denn auch solche nimmt der Chinese stets mit auf die Reise) in den Sampans untergebracht, und es kam nun die Reihe an uns. Schon längst hatte sich eines der Bootsweiber uns angeschlossen, ein strammes, einäugiges Weib, das gar nicht übel englisch sprach und uns die Karte des[S. 32] Shameenhotels überbrachte. Der Kapitän des Schiffes, ein Mann, der seit dreißig Jahren in China weilt, hatte sie als durchaus zuverlässig empfohlen; Susan, so lautet ihr Spitzname, hat wohl den größten Teil der europäischen Touristen seit vielen Jahren in ihrem Sampan nach dem Hotel gebracht. In ihrem Buche hatten die meisten ihren Namen eingetragen, darunter berühmte Persönlichkeiten; sie kannte jedermann in Canton, und jeder kannte sie. Ihr Mann faulenzte in der Stadt und schmauchte Opium, sie arbeitete Tag und Nacht und hatte sich trotz der Lumperei ihres Gatten ein Vermögen von mehreren tausend Dollars zusammengescharrt. Mit kräftigen Armen hob sie unsere schweren Koffer auf die Schulter und beförderte sie behutsam auf ihren Sampan. Dann führte sie uns über die schmalen schwankenden Bretter in das Boot und ruderte uns zwischen Tausenden von Booten in den Kanal zur Landungstreppe des Shameenhotels. Ueberall sahen wir, daß diese Sampans nur von Weibern gelenkt und bedient wurden; selbst kleine Mädchen, kaum mehr als sechs bis acht Jahre alt, ruderten schon fleißig und machten sich auf den kleinen schwankenden Booten nützlich.
Das Shameenhotel liegt auf der kleinen flachen Insel im Cantonfluß, welche die Chinesen den Engländern und Franzosen als Niederlassung für ihre Kaufleute und Konsulate vor etwa zwei Jahrzehnten abgetreten haben. Tausende von Jahren bis zu dieser Abtretung war die Insel nichts weiter als eine wüste Sandbank im Herzen der chinesischen Millionenstadt. Zwei Jahrzehnte hatten genügt, um darauf eine der schönsten und reinlichsten Europäerstädte Asiens hervorzuzaubern. In ihrer Art ist sie vielleicht ebenso merkwürdig wie Canton selbst. In dem elenden, schmutzigen, aller Beschreibung spottenden Straßengewirr der Chinesenstadt ist es natürlicherweise Europäern geradezu unmöglich, zu wohnen; dafür bauten sie sich auf Shameen schöne einstöckige Häuser, die sich mit jenen unserer modernen europäischen Villenviertel vergleichen lassen. In langen Reihen stehen sie da, umgeben von kleinen wohlgepflegten Gärten, manche von ihnen überhöht von Masten, auf welchen die Flaggen der verschiedenen Konsulate flattern. Unter den mehreren hundert Einwohnern sind die meisten europäischen Nationen vertreten. Am zahlreichsten findet man Engländer und Deutsche, die hier große Ausfuhrgeschäfte besitzen. Die Stadt untersteht weder den Chinesen noch irgend einer europäischen Nation, sie ist eine Republik für sich, und zwar eine der internationalsten Art und im vollsten Sinne des Wortes unabhängig. Sie hat ihr Theater, ihren Klub, ihren philharmonischen Verein, ihre Parks, ihre Gärten, ihren Lawn-Tennis-Ground, aber keinen einzigen Kaufladen nach europäischer Art, sie hat auch keine Straße. Ein Stadtrat, aus Mitgliedern der verschiedenen Nationen gewählt, besorgt die Verwaltung. Shameen hat seine eigene Polizei, Wasserleitung, Feuerwehr, alles in vortrefflicher Verfassung, ein Muster für das benachbarte Canton, das heute noch regiert wird und so aussieht wie vor tausend Jahren. Die Bewohner Shameens,[S. 33] mitten in dem Mongolenreiche lebend, abgeschnitten von der Außenwelt, sind dabei doch ganz vergnügt; ihren Bedarf an Lebensmitteln etc. beziehen sie teils aus Canton, teils aus einem Warenlager, das nach Art der Konsumvereine eingerichtet ist, und Straßen brauchen sie nicht, weil man im ganzen südlichen China keine Wagen kennt. Das einzige Verkehrsmittel in Shameen, ebenso wie in Canton sind Tragstühle.
Die Insel ist wie eine Festung gegen die Chinesenstadt abgesperrt. Auf der einen Seite bespült sie der breite Cantonstrom, wo gewöhnlich ein paar europäische Dampfer, darunter häufig solche mit deutscher Flagge, vor Anker liegen, auf der anderen Seite trennt sie ein Kanal mit senkrechten Steinufern von Canton. Die beiden darüber führenden Brücken sind durch starke Eisengitter abgesperrt und von dem Shameener Polizeikorps, wie von chinesischen Soldaten bewacht, als würde man jeden Augenblick einen Ueberfall von seiten der Mongolen befürchten.
Diese Ueberfälle waren in früheren Jahren thatsächlich gar nicht selten. Noch in den achtziger Jahren drang der tolle Pöbel Cantons nach Shameen und brannte einen Teil der europäischen Stadt nieder. Die Konsuln schilderten mir die Bevölkerung Cantons als die gefährlichste von China: leicht aufbrausend, fanatisch und von Fremdenhaß erfüllt. Ueberall wurde ich zur Vorsicht gemahnt, selbst in Shameen, obwohl man dort weniger Furcht vor den Cantonesen hat als anderswo. Thatsächlich brachte ich Tage auf der Wanderung durch die entlegensten Viertel Cantons zu, nur begleitet von einem englisch sprechenden Chinesen, Namens Ah-Kham, aber nirgends begegnete ich der geringsten Feindseligkeit. Die Leute, von denen manche vielleicht noch niemals einen Europäer gesehen hatten, betrachteten mich neugierig, aber sie erwiderten freundlich meinen Gruß. Ich trat, ohne irgendwie gehindert zu werden, in Buddhatempel und Gefängnisse, in Kaufläden und Privathäuser, und das Bangen, das ich während der ersten halben Stunde in dem engen Gäßchenlabyrinth der so übel beleumundeten Stadt unwillkürlich empfand, wich allmählich dem Gefühl vollständiger Sicherheit.
Die Chinesen behaupten, die größte Stadt ihres Reiches sei Canton. Es wird wohl auch so sein, obwohl diese abergläubischen Leute nie eine Volkszählung gemacht haben. Sie meinen, das wäre schlechtes Joß, das heißt, es brächte Unglück. Die Angaben, nach einer allgemeinen Schätzung, schwanken zwischen einer Million und zweieinhalb Millionen. Es kommt ja auch gar nicht darauf an. Haben sie doch in ihrem Reiche mehr Einwohner als das ganze große englische Kolonialreich, Rußland, die Vereinigten Staaten und ein paar europäische Königreiche zusammengenommen. Manche ihrer Provinzen zählen zwanzig bis dreißig Millionen, eine ganze Menge von Städten, die man in Europa nicht einmal dem Namen nach kennt, haben eine bis anderthalb Millionen Einwohner, Canton aber ist die größte darunter.
Es ist wohl auch die sehenswerteste, nicht etwa wegen architektonischer Bauten, großstädtischer Anlagen, Schulen, Museen, Fabriken etc. Derlei Dinge besitzen chinesische Städte überhaupt nicht. Im chinesischen Reiche giebt es, nicht einmal den Kaiserpalast in Peking ausgenommen, kein einziges Gebäude, das sich an Größe und Pracht mit irgend einem unserer modernen Miethäuser messen könnte; die Tempel sind größtenteils armselige, schmucklose Bauten, in deren Höfen Unkraut wächst. Die Privathäuser der Reichen sind unscheinbar. Die große Prüfungshalle für staatliche Beamte in Canton gleicht einer Ruine, Museen existieren nicht, außer man betrachtet die Städte selbst als solche, Fabriken kennt man nicht, und in ganz Canton giebt es noch keine Dampfmaschine, keinen Betrieb durch Wasserkraft, kein Gas, keine Elektrizität. Canton ist ebenso wie alle anderen Städte Chinas heute noch so, wie es vor fünfhundert, vor tausend, vor zweitausend und mehr Jahren war, mit derselben Kultur, denselben Gebräuchen und Sitten und Manufakturen, nur ist es größer geworden. Es ist gewachsen, nicht fortgeschritten. Vor viertausend Jahren hatte es schon ähnliche Münzen wie heute, und was es zur Zeit Christi geschaffen und gethan, schafft und thut es heute noch, das ewige Einerlei, kein Fortschritt, kein Rückschritt; China blickt nicht in die Zukunft, es kennt nur seine Gegenwart und besser noch als diese seine Vergangenheit.
Und weil von all den sogenannten Sehenswürdigkeiten in Canton nichts vorhanden ist, wird es von unseren modernen Globe-trotters gemieden, und die Mutigsten unter ihnen widmen ihm höchstens einen Tag. Von den Hunderten Touristen, die es jährlich besuchen, bleiben nicht zehn Prozent länger als einen, nicht zwei Prozent länger als zwei Tage. Und doch ist Canton eine Stadt, die selbst bei monatelangem Aufenthalte immer etwas Neues bietet, denn nirgends ist das Volksleben anregender, interessanter, merkwürdiger, seltsamer. Nirgends kann man einen tieferen Einblick bekommen in das fremdartige Wesen der mongolischen Welt, die heute noch größer als die kaukasische und dabei so total verschieden von dieser ist, daß die beiden nichts miteinander gemein haben als die Geburt, das Leben, das Sterben. China liegt nur in einem anderen Kontinent, es scheint, als läge es auf einem anderen Planeten.
Schon an der Brücke, die von Shameen nach Canton führt, zeigt sich diese fremde Welt. Chinesische Soldaten kauern hier rauchend oder Opium schmauchend auf den Strohmatten in ihrer Wachtstube. Vor dieser sind große, mit bunten Fratzen bemalte Schilder aufgestellt, im Innern stehen dreispitzige Lanzen, lange, nur mit zwei Händen zu gebrauchende Schwerter, Büchsen mit trichterförmiger Mündung, Gewehre mit Feuersteinschlössern, kurze doppelte Säbel in einer Scheide, rote und weiße Fahnen mit fremdartigen chinesischen Schriftzeichen. Die Soldaten tragen keine besondere Uniform, nur ist ihr blaues Hemd mit roten Borten besetzt, und auf einem weißen runden Schilde auf der Brust zeigen sich in schwarzer[S. 35] Schrift Nummer und Gattung ihres Regiments. Auf ihren langbezopften Schädeln tragen sie einen tellerförmigen, spitz auslaufenden Hut, an den Füßen Sandalen. Bei jeder Wachtablösung wird an einer großen alten Kesseltrommel ein Heidenlärm gemacht, und vier Chinesen bringen aus den etwa zwei Meter langen Tuben langgezogene einförmige Klagetöne hervor. Europäer werden durch das Brückengitter eingelassen, Chinesen nicht.
Die schönen, wohlgepflegten Wege Shameens hören mit einem Male auf, sobald man das jenseitige Kanalufer erreicht, und binnen wenigen Minuten ist man mitten in dem seltsamen Gewirr schmaler Gäßchen, welche Canton bilden. Unter den tausenden Gäßchen giebt es nur wenige, in welchen man mit ausgestreckten Armen nicht beide Seiten berühren könnte. Stundenlang durchirrte ich dieses Labyrinth, ohne irgend ein System in dasselbe bringen zu können, ohne zu wissen, wo ich mich befand, wohin mich wenden. Die Gassen sind alle geradlinig, manche über ein Kilometer lang, mit unzähligen Seitengassen, gerade so weit, gerade so aussehend wie die andern, ohne irgend welchen Anhaltspunkt, um sich zurechtzufinden. Offene Plätze, Boulevards, Kanäle, Gärten giebt es keine. Ebenso fehlt es an irgendwelchen auffälligen Gebäuden. Die Hunderttausende von Häusern, die hier dicht aneinander gedrängt stehen, sind alle gleich gebaut und annähernd von gleicher Größe. Graue, harte Ziegel sind bei allen das Material; die Ecksteine an den Eingängen sind Granit, die Dächer überall mit gebrannten Hohlziegeln bedeckt, die durch Mörtel fest miteinander verbunden sind. Schornsteine und Kamine sind nirgends zu sehen. Die Mehrzahl der Häuser besitzt nur ein Stockwerk, und dieses ist ganz von einem einzigen Raume erfüllt, der sich nach der Straße hin öffnet und von dieser Luft und Licht empfängt. Fenster giebt es keine. Die Häuser im Innern der Stadt tragen noch ein zweites, viel niedrigeres Stockwerk, durch eine steile Leiter oder ebensolche Holztreppe mit dem unteren verbunden. Nur einige chinesische Speisehäuser, Theater und Gasthöfe sind größer, höher, geräumiger, aber auch sie haben keine Fenster und Thüren. Die Thüröffnung nach der Straße hin hat die ganze Breite des Hauses, und soll sie zur Nachtzeit geschlossen werden, so werden vertikale starke Pfosten, eine Art Gitter bildend, in die Thüröffnung eingesetzt und durch Querbalken festgehalten. Nur Privathäuser besitzen Thüren nach unserer Art. In den Geschäftsstraßen der inneren Stadt giebt es nur wenige solche; je weiter man aber hinauskommt, desto häufiger werden die Privathäuser, desto stiller demgemäß auch die Straßen. Die Thüren, zu denen gewöhnlich einige Stufen emporführen, stehen offen, doch erhebt sich auf etwa ein Meter Entfernung hinter ihnen eine Holzwand, welche das Innere des Hauses den Blicken der Vorübergehenden entzieht. Auf diesen Holzwänden prangen gewöhnlich in bunten Farben die grotesken Bilder zweier Götzen, der Schutzpatrone des Hauses, auf den Steinstufen der Thüre kauern ein paar Weiber, auf der Bank vor der Bretterwand ruhen ein paar[S. 36] chinesische Diener. Trat ich, ungehindert durch diese Pförtner, in den Hofraum, so fand ich in den meisten Häusern neben der Thür eine Anzahl alter dreispitziger Lanzen, Schwerter und alter Feuerstein- oder Luntengewehre aufgestellt. Von dem Hofraum aus öffnen sich die Thüren nach dem Labyrinth der Wohnungen, Pavillons, Ahnenhallen, Tempel, Gärtchen und Bassins, welche die Wohnung der reichen Chinesen und ihrer Familien bilden. Nach außen sind diese großen Räume von einer hohen grauen, fensterlosen Mauer umschlossen, eine Art Stadt und Festung für sich. Unmittelbar daranstoßend sind wieder die labyrinthartigen Gäßchen, in denen jedes Haus ein Kaufladen ist, dessen entlegenste Winkel man von außen sehen könnte, wäre hinreichend Licht vorhanden. Aber hier herrscht ewige Dämmerung. Ueber die Hausdächer sind quer über die Straße Matten und Bretter gelegt, und von diesen hängen Tausende der eigentümlichen chinesischen Firmentafeln und Schilder herab, so tief, daß man sie mit erhobener Hand anfassen könnte. Drei bis fünf Meter lang, prangen sie in den buntesten Farben und sind mit den eigentümlichen malerischen Schriftzeichen in Gold oder Schwarz oder anderen Farben bedeckt. Horizontale Firmenschilder kennt man in China einfach deshalb wenig, weil nicht in horizontaler, sondern in vertikaler Richtung geschrieben wird. Jeder der lose herabbaumelnden Tafeln entspricht nur der eine Kaufladen, der sich in je einem Hause befindet und immer das ganze untere Stockwerk desselben einnimmt. In Canton giebt es Hunderte von Straßen, in welchen jedes Haus einen Kaufladen besitzt, und zwar einer dem andern so dicht sich anschließend, daß nur das Mauerwerk sie voneinander trennt. Gewöhnlich haben sich bestimmte Industrien in bestimmten Gassen angesiedelt, die dann auch entsprechend benannt sind. Die Geldwechsler, Goldarbeiter, Kuriositätenhändler, Schuh-, Kleider-, Schnittwaren- und Papierhändler, die Fächerarbeiter, Holzschnitzer, Möbeltischler, Messingarbeiter etc. haben alle ihre eigenen Gäßchen, in denen sie nicht nur ihre fertigen Waren zur Schau gestellt haben, sondern auch vor den Augen der Passanten an neuen Waren arbeiten. Die elegantesten Kaufläden, in verhältnismäßig etwas weiteren Gassen gelegen, zeigen den einzigen in ganz Canton wahrnehmbaren Luxus, ja diese Kaufläden mit ihrer Ausstattung würden auch in europäischen Städten Aufsehen erregen. Herrliche Holzschnitzereien, geschichtliche Ereignisse darstellend, oder vorzügliche Nachahmungen verschiedener Blumen, Bäume und Schlingpflanzen, reich vergoldet, schmücken den Eingang; sie hängen an den Seiten des inneren Raumes und bilden im Hintergrunde desselben einen altarartigen Aufbau, dessen Mittelstück gewöhnlich ein bunt gemaltes, groteskes Bild des Kriegsgottes in goldenem Rahmen bildet. Vor diesem Götzen brennen Oellampen und sind einige Sträuße von Papierblumen aufgehängt. Unter[S. 37] dem Altar oder an den Seiten des Kaufladens im Hintergrunde sitzt der Eigentümer an einem kleinen, mit Holzschnitzereien gezierten Tischchen, auf dem sich gewöhnlich die Geschäftsbücher, dann eine Wage zum Abwägen des Geldes und ein Rechenbrett befinden. Ohne Wage würde der Händler betrogen werden, denn in Canton herrscht in Bezug auf das Bargeld eine ähnliche Sitte wie in England mit den Banknoten. Dort werden die letzteren von den jeweiligen Eigentümern unterschrieben, in Canton erhält jeder Silberdollar von dem jeweiligen Besitzer seinen Stempel aufgeprägt. Deshalb bekommen die meisten Dollars, die man in Canton erhält, durch das Abstempeln die Form kleiner, halbrunder Schalen, ja vielen fehlt sogar der Boden; ich habe zahlreiche Dollars gesehen, die nur aus dem äußeren Kranz bestanden. Der ganze mittlere Teil war herausgeschlagen und lag in kleinen und größeren Stücken in den Geldschüsseln der Kaufleute. Wird einem Kaufmanne als Bezahlung für die gekaufte Ware ein Dollar dargereicht, so prüft er ihn gewöhnlich zuerst nach dem Metallklange, dann nach seinem Gewicht, und das Fehlende muß von dem Käufer ersetzt werden.
Das Rechenbrett ist jedem chinesischen Kaufmann oder Händler geradezu unentbehrlich, die allereinfachsten Zählungen werden an den schwarzen Kugeln des Rechenbrettes ausgeführt, und beim Durchschreiten der Gäßchen hört man fortwährend ihr Geklapper. Europäische Kaufleute in China gewöhnen sich auch bald an ihren Gebrauch, bis sie ihnen schließlich unentbehrlich werden. Wo immer der Chinese sich ansiedelt, verwendet er auch sein Rechenbrett. Ich fand es in den Chinesenvierteln in San Francisco, Lima, Batavia, Portland, Singapore bei jedem einzelnen chinesischen Kaufmann. Alle Kaufläden stehen nach der Straße zu weit offen; jedermann kann nach Belieben eintreten, kaufen oder nicht kaufen. Der Chinese wird jedem Besucher seine Waren mit großer Geduld vorlegen und ebenso geduldig an dem Preise festhalten, obschon er schließlich doch gerade so nachgiebig wird, wie die Korallenhändler von Neapel. Die Kaufläden scheinen gewissermaßen Teile der Gäßchen selbst zu bilden. Bei dem ungemein regen Verkehr, der sich tagsüber in diesen bewegt, würden sich Menschen, Tragstühle, Lasten aller Art binnen wenigen Minuten ineinander festkeilen, wenn nicht die Kaufläden den Menschen Gelegenheit gäben, einzutreten und auszuweichen; freilich wird dadurch so mancher Laden besudelt; der Inhalt manches Unratgefäßes, manches Tragkorbes, deren zwei gewöhnlich mittels langer Stangen auf den Schultern der Träger befördert werden, ergießt[S. 38] sich in den schönen Juwelier- oder Modeladen, aber die Menschen sind daran gewöhnt. Die Ladenbesitzer haben von den Bettlern viel zu leiden; diese ziehen nicht mit offener Hand bittend von Laden zu Laden, sondern führen allerhand Ohrenmartern mit sich, um dadurch eine Gabe zu erzwingen. Hier läutet eine Frau, ein Kind auf dem Rücken, eine große Glocke mit schrillem, durchdringendem Klange, sie tritt in einen Laden und läutet dem Besitzer so lange die Ohren voll, bis er sich zu einer Gabe entschließt, dann zieht sie zu seinem Nachbar. Ein strammer junger Bursche, der aus weiß Gott welchem Grunde Bettler geworden, geht von Laden zu Laden und schlägt in jedem zwei harte, glatte Hölzer aneinander, wie riesige Castagnetten, ein Dritter klappert mit Eisenstücken, ein Vierter schlägt zwei Porzellanscherben aneinander; denn ohne Lärm scheint es kein Betteln zu geben.
Ohne Lärm giebt es auch keine Straße in Canton. In den dämmerigen engen Gäßchen, so eng, wie man bei uns nicht einmal Hauseingänge macht, herrscht tagsüber ein furchtbares Lärmen, Schreien, Klopfen, Trommeln, kurz alle erdenklichen Geräusche. Nur die vielen Hunde, diese Abfallräumer von Canton, sind stumm. Die Gäßchen sind alle wohlgepflastert, aber mit schrecklichem Schmutz und fürchterlichen Gerüchen erfüllt, zumal man in Canton keine Kloaken und keine Wasserleitung kennt; schmutziges Gesindel, Bettler, Aussätzige durchwandern die Gäßchen; Lasten aller Art, Flüssigkeiten, Warenballen, Düngerkörbe, Möbel, alles Erdenkliche wird auf den Schultern der Kulis durch dieses dämmerige Labyrinth hindurchgezwängt, so daß der Fußgänger kaum jemals ohne Beschmutzung und Besudelung seiner Kleider nach Hause zurückkehrt. Ich trug in Canton stets Leinenanzüge, die ich nach jedesmaligem Gebrauch zweimal waschen ließ. Die Chinesen der besseren Stände, Mandarinen, Offiziere, Frauen, zeigen sich niemals in diesen, dreiviertel von Canton bildenden Stadtteilen. Haben sie dort zu thun, so lassen sie sich in geschlossenen, mit schwarzer Wachsleinwand überzogenen Tragstühlen auf dem Rücken von zwei, drei oder vier Kulis tragen. Nun können sich diese nur durch Geschrei den Weg bahnen; ebenso schreien die ambulanten Gemüse-, Fisch-, Fleisch- und Fruchthändler, die Lastenträger; die Bettler machen mit ihren Bettelwerkzeugen einen furchtbaren Lärm; in den Läden wird geklopft, gesägt, gehämmert, oder als merkwürdiger Zeitvertreib das Gong geschlagen, die Kesseltrommel gerührt, kurz es herrscht der furchtbarste Lärm, das regste Menschengewühl. Alles Erdenkliche geschieht auf offener Straße oder in den Kaufläden vor den Augen der Vorübergehenden. Geheimnisse können in den Geschäftsvierteln Cantons nicht gehütet werden. Jeder Einzelne kann sehen, wie und was der andere ißt, wie er sich an- und auskleidet, wie er schläft und wie er sich wäscht, wenn er dies bei dem häufig höchst empfindlichen Wassermangel überhaupt thut. In den Kaufläden sitzen oder liegen die Menschen gewöhnlich nur mit kurzen dunkelblauen Hosen bekleidet; viele tragen allerdings eine Art dunkelblaues Hemd, bei ebensovielen aber ist der Oberkörper[S. 39] bis zu den Lenden nackt; es war mir überraschend, bei den meisten eine ähnlich weiße Hautfarbe zu finden, wie bei den anglo-sächsischen Rassen in Europa. Die gelbe Hautfarbe der Mongolen scheint hier bloße Mythe zu sein; war sie bei den Kulis überhaupt vorhanden, so war sie nur eine Wirkung der Sonne, denn die Schenkel und andere, gewöhnlich durch Kleidungsstücke bedeckte Körperteile waren weiß. Ihre ganze Sorgfalt verwenden sie nicht auf die Kleidung, sondern auf ihren Haarschmuck. In jedem Gäßchen sah ich gewiß stets zwei oder drei ambulante Barbiere, welche die Schädel bis zu dem Scheitelzopfe kahl rasierten, Nasen und Ohren ausputzten und mit kleinen Zangen die Härchen abklippten. Am Morgen besteht der gewöhnliche Zeitvertreib der Chinesen darin, daß sie sich gegenseitig ihre mitunter bis an die Hüften reichenden langen rabenschwarzen Scheitelhaare kämmen und zu Zöpfen flechten, deren Ende durch bis zum Boden reichende Seidenschnüre verlängert wird. Das in den Bazars verkehrende Volk trägt keine Hüte, nur die Wohlhabenden tragen Schuhe oder Sandalen, alle aber haben ihren Fächer, den sie, wenn sie ihn nicht gerade zum Fächeln oder als Sonnenschirm benutzen, in den Nacken gesteckt tragen.
Vom Frauenleben bekommt man in dem Gassenlabyrinth der inneren Stadt nichts zu sehen. Alle Industrien, der ganze Handel, der ganze Verkehr liegt in den Händen der Männer, nur in den Korbflechtereien fand ich Weiber beschäftigt. Selbst die Fächer und die herrlichen Cantoner Seidenstickereien, vielleicht die schönsten der Erde, werden von Männern hergestellt. Dafür haben die Frauen, wie erwähnt, den ganzen großartigen Bootverkehr in den Händen. Maschinen, mechanische Betriebe etc. sind in Canton gänzlich unbekannt. Die Industrien sind ausschließlich Hausindustrien. Es gewährte mir das größte Interesse, die Chinesen an der Arbeit zu sehen. Mit ungeheurer Geduld, mit staunenswertem Geschick und mit großer Kraft arbeiteten sie unter meinen Augen all die schönen Erzeugnisse, für welche Canton in ganz China und auch im Auslande berühmt ist. Nicht nur Seidenstickereien und Fächer, Juwelen und getriebene Silberarbeiten, auch Bronzen, Porzellan, Kleider, Schuhe, Ziselier- und Emailarbeiten gehen unter ihren Händen ohne Zuhilfenahme unserer Instrumente mit erstaunlicher Präzision hervor.
Oeffentliche Fisch-, Gemüse- und Fleischmärkte, wie sie unsere Markthallen bergen, hat Canton nicht; jede Straße besitzt an ihrer Stelle Kaufläden, und sie sind die Hauptursache der fürchterlichen Gerüche, welche die Stadt verpesten; die Cantonesen nehmen es mit ihrer Küche bekanntlich nicht sehr genau.
Die elenden Gerüche verleiden dem Besucher den Aufenthalt in Canton gar sehr, zumal, wie gesagt, auch nicht ein einziges freies Plätzchen Erholung gewährt. Ganz Canton besteht aus einem einzigen Labyrinth winziger Gäßchen, denen man wie mit Absicht Luft und Licht und Wasser zu entziehen scheint. Selbstverständlich mangelt es abends an Beleuchtung. Deshalb ist jeder Cantonese gehalten, eine[S. 40] brennende Laterne mit sich zu führen, wenn er des Abends ausgeht. Uebrigens verläßt er sein Haus oder seine Straße nur in den dringendsten Fällen, denn nach Sonnenuntergang wird jede einzelne Straße an beiden Enden durch eiserne Gitter oder feste Thore abgesperrt, und Nachtwächter, mit Lanzen versehen, übernehmen den Wachtdienst. Sie tragen Trommeln und Triangel und machen damit zeitweilig Lärm, um zu erkennen zu geben, daß sie nicht schlafen. Die Tatarenstadt, in welcher sich die Residenz des Vizekönigs, des Generals und der Gerichtsbehörden befindet, ist überdies noch mit einer eigenen Mauer umgeben, und um die ganze Stadt ziehen sich feste Ringmauern und Wälle, auf denen Hunderte alter, unbrauchbarer Geschütze stehen. Diese Mauern sind die bedeutendsten Bauten Cantons, denn was die Stadt an Tempeln, Palästen und Pagoden aufzuweisen hat, ist im Verhältnis zu ihrer Größe kaum der Rede wert. Canton ist die größte Stadt Chinas; viel eher könnte sie das größte Dorf des himmlischen Reiches genannt werden.
Während meines ersten Aufenthaltes in Hongkong waren Gerüchte von dem Ausbruch einer pestartigen Krankheit in der größten Stadt des himmlischen Reiches aufgetaucht, und bei meiner Ankunft in Canton fand ich diese Gerüchte leider nur zu sehr bestätigt. Seit einem halben Jahre hatte es dort fast gar nicht geregnet; Schmutz und Unrat, diese sprichwörtlichen Merkmale chinesischer Städte, hatten sich in dem engen scheußlichen Straßengewirre während dieser Zeit angesammelt und verpesteten die Luft derart, daß man sich über die vielen Menschenopfer kaum zu wundern brauchte.
Schon die plumpen, schweren chinesischen Dschunken und die kleineren Sampans, die den Strom bevölkern, zeigten, daß sich in Canton etwas Außergewöhnliches abspielen müsse; statt der zwei kleinen roten Joßpapierchen, welche die Chinesen zur Beschwörung der bösen Geister gewöhnlich an den Stern ihrer Schiffe kleben, prangten dort ein halbes Dutzend oder noch mehr; rote Papierstreifen mit allerhand Inschriften in Gold und Schwarz klebten auch auf den aus zusammengenähten Matten bestehenden Segeln, am Bug und an den Seiten. Joßstäbchen brannten dutzendweise auf den Schiffen und sandten kleine leichte Rauchwölkchen empor; wie Kleingewehrfeuer knatterten die vielen Fire-Cracker, die auf dem Flusse und an den Ufern verpufft wurden, und mehr als sonst fuhren Sampans und Ruderboote, von Chinesenfrauen gelenkt, dicht vor dem Bug unseres Dampfers vorbei.
Mehr als die zahlreichen burgartigen Pfandhäuser und Tempeldächer der Riesenstadt verriet die drückende stinkende Atmosphäre, daß wir uns Canton näherten. Stoßweise führte sie uns der Wind als Grüße aus der Peststadt entgegen. Die ersten dieser Nasenstüber jagten uns Schrecken ein, allein nun war nicht mehr zu helfen.
In dem recht gut gehaltenen Shameenhotel wurde mir die tröstliche Auskunft zu teil, daß in der europäischen „Konzession” noch kein Pestfall vorgekommen sei und daß Europäer von der tückischen Krankheit überhaupt nicht viel zu befürchten hätten, indessen man riet mir doch zur größten Vorsicht. Mit Mühe überredete ich einen die englische Sprache radebrechenden Chinesen, Ah-Kam, mich in das enge, schwüle, düstere Straßengewirr zu begleiten, das sich jenseits des Kanals auf der weiten Ebene des Perlflusses ausbreitet. Schon nachdem wir ein Viertelstündchen durch das Labyrinth Cantons gewandert waren, konnte ich das Wüten der Epidemie wohl verstehen.
Nicht nur die verpestete Luft, die Anhäufung faulender organischer Stoffe und der Genuß schlechten Wassers waren die Ursachen der Pest. Eine Publikation des Gouverneurs von Canton ließ noch auf eine andere Ursache schließen: den Genuß verseuchter Tiere. Ich ließ mir aus den chinesischen Tagesblättern Cantons folgende[S. 42] Notiz übersetzen: „Da die Ratten die ersten Opfer der Seuche waren, so ließ der Mandarin des Distrikts des westlichen Thors, Lo Ching, zehn Cash (etwa zwei Pfennig) als Prämie für jede ihm vorgelegte tote Ratte ausschreiben. In den ersten vier Tagen wurden ihm 2600 tote Ratten gebracht, von denen 1400 in der To-postraße allein aufgelesen wurden. Der Mandarin ließ sie zusammen vergraben”.
Ebenso ließ der Stadtpräfekt in einer Proklamation Ende April das Schlachten von Schweinen verbieten, und am Tage meiner ersten Wanderung durch Canton wurde eine zweite Proklamation an die Straßenecken geklebt, derzufolge der Fischfang in Zukunft verboten wurde. Es geschah dies hauptsächlich, um das Verkaufen verseuchter oder toter Schweine und Fische zu verhindern.
Wer mit chinesischen Sitten und Gebräuchen nicht vertraut ist, konnte indessen beim Durchwandern der Stadt nicht viel von der herrschenden Epidemie wahrnehmen; zunächst ist das Bild der Gäßchen mit ihren zahllosen Kaufläden, mit ihrer eigentümlichen Bevölkerung, mit den fremdartigen Sitten und Gebräuchen etc. so ungemein fesselnd und interessant, wenn auch abstoßend, daß ihr Besucher geradezu überwältigt wird. Freilich sah er möglicherweise manchen Leichenzug an sich vorbeikommen, oder er erblickte in diesem oder jenem Hause durch die weitoffenen Thüren einen Leichnam mit weißem Laken bedeckt, heulende Trauerweiber auf den Matten zu seinen Füßen kauernd. Aber der Straßenverkehr zeigte sich im großen ganzen ebenso wie zu normalen Zeiten. Indessen die Pest nahm immer mehr überhand, die Bevölkerung wurde immer ängstlicher, denn es starben an manchem Tage an tausend Menschen, es fehlte an Särgen, und ich sah selbst viele Leichen, die, nur mit einem Tuche bedeckt, auf Matten nach den Friedhöfen außerhalb der Stadt getragen wurden. Die meisten waren innerhalb weniger Stunden oder doch innerhalb eines Tages gestorben. Zuerst fühlten sie heftiges Fieber mit hoher Körpertemperatur, Kopfschmerz und Durst; dann stellte sich Bewußtlosigkeit ein, und gleichzeitig mit dieser entstanden am Halse, in den Achselhöhlen und an den Lenden große, harte, schmerzhafte Beulen von schwarzer Färbung, schließlich färbte sich der ganze Körper schwarz. Der Tod trat dann längstens binnen einem Tage ein. In einer verhältnismäßig geringen Zahl von Fällen zieht sich die Krankheit mehrere Tage hin, und dann ist Hoffnung auf Genesung vorhanden. Doch erfuhr ich im Hospitale der achtzehnten Straße in Canton von den chinesischen Aerzten, daß durchschnittlich von je drei Fällen zwei tödlich verlaufen. Sie versicherten, die Beulenpest sei nicht ansteckend und trete nur bei Menschen auf, die unter ähnlich elenden sanitären Umständen lebten. Das beruhigte mich so weit, daß ich meine Wanderungen durch Canton mehrere Tage lang fortsetzte. Indessen fand ich nach meiner Rückkehr nach Hongkong in der dortigen „Preß” eine Korrespondenz aus Canton, worin es heißt: „Die Pest ist nicht nur jenen gefährlich, welche in der Stadt wohnen, sondern auch fremden Besuchern. Wir vernehmen von Chinesen,[S. 43] daß mehrere Fremde starben, während sie im Tragsessel durch die Stadt getragen wurden”. Gut, daß ich dies in Canton selbst nicht erfahren hatte.
Und doch war es auch ohne diese Kenntnis unheimlich genug in Canton. Wohl der Bravste mag erschrecken, wenn er einen so mörderischen Gast in seiner Nähe weiß, unsichtbar und deshalb nicht anders zu bekämpfen als durch die Flucht. Durch diese wäre mir aber ein hochinteressanter Einblick in das innerste Denken und Fühlen der Chinesen entzogen worden, und so wiederholte ich meine Besuche, jedesmal mehrere Stunden mitten unter diesem seltsamen Volk im Innersten ihrer Hauptstadt verweilend. Ich hatte viel von ihrem Haß gegen Europäer, von ihren thätlichen Angriffen auf diese, von der Zahl der Diebesbanden und Einbrecher in Canton gehört. Wie lange ist es denn her, daß der Pöbel selbst Shameen erstürmte und eine Anzahl der europäischen Häuser niederbrannte? Ich selbst habe von diesem Haß nicht das geringste wahrgenommen. War es nur der furchtbare, alle Vorstellungen übersteigende Aberglaube der Chinesen, der mich vor Haß schützte? Standen sie unter dem alles andere übertäubenden Einfluß der Seuche in ihrer Stadt, der sibirischen Pest? Wie viele Opfer diese gefordert hat, konnte ich aus vielen kleinen Anzeichen erkennen, die sonst von Besuchern unbeachtet bleiben, weil sie ihnen unbekannt sind. Die Chinesen trauern dadurch, daß sie während sieben Wochen nach dem Tode ihres Verwandten ihr Kopf- und Barthaar wachsen lassen, daß sie statt des schwarzen Schwänzchens in ihren Zopf ein weißes oder blaues flechten; daß sie statt schwarzer Schuhe weiße oder blaue tragen; daß Frauen und Mädchen während der Trauerzeit kein Messer, keinen Löffel, keines der kleinen Eßstäbchen beim Essen benutzen, sondern mit den Fingern essen; an den Häusern der Verstorbenen werden die beiden großen roten Papierlaternen, die an jedem Chinesenhause vor dem Eingange baumeln, durch weiße ersetzt; die Thüren der Häuser, in denen sich eben Verstorbene befinden, werden geschlossen und brennende Kerzen auf die Schwelle gesteckt. Wie viele dieser und anderer kleinen Merkmale sah ich doch, die mir mehr sagten, als es die Aerzte oder städtischen Mandarine konnten!
Die berühmten Cantoner flower boats, die Blumenboote mit den Restaurants und den gepuderten und geschmückten Mädchen, standen am Abend leer, denn niemand wollte, niemand konnte in so drückenden Zeiten sich vergnügen; das glänzende, reiche, lärmende Flußleben Cantons zur Nachtzeit hatte sich in Totenstille verwandelt, als hätten die Tausende von Sampans und Dschunken gar keine Bevölkerung. Hörte ich auf meinen nächtlichen Flußfahrten auf dem Hausboot des Shameenhotels irgendwo lärmende Trommeln und Trompeten und fire crackers, so rührten sie vom Drachen- oder vom Löwentanz her, womit die Chinesen die bösen Geister aus ihren Häusern treiben wollen; kehrte ich spät nachts in mein Hotel zurück, so sah ich von meinen Fenstern aus jenseits des Kanals phantastische Prozessionen,[S. 45] bei dem flackernden Schein der Fackeln gewahrte ich scheußliche große Fratzen, buntbemalte Drachenköpfe mit mehrere Meter langen Schwänzen, die von darunter steckenden fanatischen Chinesen fortbewegt wurden; andere, mit dreispitzigen Gabeln und Zangen versehen, tanzten um sie herum; riesige Kupferpauken wurden hinter ihnen einhergetragen und heftig darauf losgeschlagen; fast die ganze Nacht hindurch währte das Kleingewehrfeuer der fire crackers und das Abschießen von allerhand Feuerwaffen, alles nur zur Vertreibung der bösen Geister; vom Schlafen war unter solchen Umständen keine Rede, zumal Shameen eines der verrufensten Mückennester Chinas ist. Hie und da erhellte ein greller Feuerschein meine Stube, und blickte ich durch die Fenster, so sah ich, wie die langbezopften Chinesen in den Kanalbooten unter mir Joßpapiere, d. h. große, mit allerhand Beschwörungsformeln bemalte Papierbogen verbrannten. Waren sie verglüht, war wieder nächtliches Dunkel an Stelle des roten Scheines getreten, dann sah ich auf den Booten Tausende winziger rotglühender Punkte, von den glimmenden Joßstäbchen herrührend, die massenweise auf den Booten angebracht waren. Wie gern hätte ich eine nächtliche Wanderung durch die Straßen der Stadt angetreten, die vor mir lag wie ein Vulkankrater, in dem es bald hier bald dort aufflammte und krachte und polterte. Allein jede Straße Cantons ist zur Nachtzeit verbarrikadiert; an beiden Enden werden die Thorgitter versperrt, und die nächtlichen Straßenwächter mit dem Schlüssel am Gürtel lassen niemanden durch; wanderte ich dann am frühen Morgen durch die feuchten, übelriechenden, unheimlichen Gäßchen, dann sah ich den Boden mit roten Papierfetzen bedeckt, die Ueberreste der während der Nacht verbrannten Joßpapiere und Feuerwerkskörper. In jedem Gäßchen befindet sich ein kleiner Altar, an welchem Joßstäbchen glimmten; außer diesem gemeinschaftlichen Altar besitzt jedes Haus der inneren Stadt Cantons seinen eigenen Altar auf der Gassenseite neben dem Haupteingange. Auf jedem einzelnen glimmten einige Joßstäbchen, auf jedem Arbeitstische der Handwerker, auf jedem Verkaufstische der Kaufläden standen Sandbüchsen mit diesen wohlriechenden, leichten Rauch entwickelnden Glimmstengeln. Die Menschen eilten rasch und scheu dahin, wenige Weiber, fast durchwegs Männer; jeder einzelne hatte an seiner dunkelblauen Bluse vorn ein kleines Säckchen mit Amuletten hängen; jeder trug ein ähnliches Säckchen, mit riechender Substanz gefüllt, in der Hand und hielt es an die Nase; oder er trug statt des Säckchens einen Rosenkranz oder ein Stück Sandelholz. In jedem Gäßchen hockten Chinesenjungen an den Häusern, dabei Beschwörungsmittel feilbietend, und die Verkäufer von Joßpapieren machten ausgezeichnete Geschäfte. Alles eilte so schnell wie möglich durch die verpesteten Gäßchen, nur die Kolonien aussätziger Weiber behielten ihre angestammten Plätze bei, zeigten ihre wunden, aussätzigen oder gänzlich abgestorbenen Gliedmaßen und bettelten um Almosen. Zuweilen stieß ich auf die lärmenden Drachenprozessionen, gefolgt von Banden verlotterter Chinesen, Tamtam und Pauken[S. 46] schlagend oder kleine Holzstäbchen aneinander klappernd; oder es huschte ein Leichenzug rasch vorbei, Musikanten voraus, dann der Tote, dann der prächtige Tragstuhl mit der Ahnentafel des Verstorbenen, einige Anverwandte dahinter. In den Buddhatempeln wurde überall von den zahlreichen Priestern gebetet; gefühl- und gedankenlos murmelten sie stehend ihre Gebete zu den großen vergoldeten Götzen empor, die grotesk mit verschränkten Beinen auf den Altären sitzen. Der Stadtpräfekt hatte diese allgemeinen Gebete angeordnet, um den Dämon aus der Stadt zu treiben, und den Göttern wurden außerdem reiche Sühnopfer dargebracht. Eine andere Verordnung der Regierung befahl, daß die langen grotesken Ruderboote der alljährlichen Drachenfeste, die gewöhnlich nach der Festzeit in den Schlamm des Perlflusses versenkt werden, wieder auszugraben seien, um damit Rundfahrten auf dem Flusse zu unternehmen, denn ihnen wird besondere Kraft zur Teufelsvertreibung zugeschrieben. So begannen denn gerade während meines Besuches der Stadt die Fahrten dieser Drachenboote im Distrikt des Ostthores, ohne selbstverständlich irgendwie zu helfen. Aber das merkwürdigste Mittel zur Vertreibung der Pest erfand doch die Regierung, ein Mittel, das selbst in den Annalen des himmlischen Reiches nur selten vorkommt und ein grelles Streiflicht auf den Aberglauben und die Geisterfurcht der Chinesen wirft. Das chinesische Jahr ist nicht wie das christliche ein festes Jahr. Die Monate werden nach dem Monde gemessen, und in jedem dritten Jahre wird willkürlich nach irgend einem der zwölf Monde ein dreizehnter Monat eingeschoben. Der Jahreswechsel jedoch richtet sich nach der Sonne. Neujahr fällt jedesmal auf den ersten Neumond, nachdem die Sonne in das Sternbild des Aquarius eingetreten ist, also nach unserer Zeit auf bestimmte Tage zwischen dem 21. Januar und 19. Februar. Im Jahre 1893 fiel das chinesische Neujahr beispielsweise auf den 17. Februar; nun ist der Neujahrstag in China das größte Fest des ganzen Jahres und wird überall in der lärmendsten Weise gefeiert, alle Schulden müssen vor dem Neujahrstage getilgt werden, es wird den Göttern geopfert und von den Wahrsagern das Glück des neuen Jahres erforscht. Da nun das Jahr 1894 bisher einen so unglücklichen Verlauf hatte, so erließ die Regierung eine Proklamation, derzufolge der erste Tag des bevorstehenden vierten Monats als neuer Neujahrstag allgemein gefeiert werden müsse, um die übrigen Monate des Jahres in ein glückliches Jahr zu verwandeln. Der Erlaß ist vom 2. Mai christlicher Zeitrechnung datiert und in den englischen Blättern Hongkongs vom 4. Mai 1894 zu lesen. Aber die Leute starben trotz des dekretierten neuen Jahreswechsels, ja die sibirische Pest griff immer mehr um sich, das benachbarte Hongkong wurde zu einem ihrer Hauptherde, und von dort wurde sie durch die Schiffe im Laufe der Jahre nach Afrika, Australien, Indien und sogar bis ans Mittelmeer verschleppt. Nur den strengen sanitären Maßnahmen ist es zu danken, daß man nicht auch in Europa die Bekanntschaft dieser schrecklichen Epidemie gemacht hat.
Wer jemals irgendwelche Gefängnisse in China gesehen oder dort Gerichtssitzungen beigewohnt hat, der wird es gewiß begreiflich finden, daß die Zopfträger des Reiches der Mitte nur in seltenen Fällen Schutz und Recht bei ihren Mandarinen suchen. Nicht daß die mit geringen Veränderungen seit Jahrtausenden bestehenden Gesetze etwa ungerecht oder unklar wären. Im Gegenteil. Kenner, wie beispielsweise die europäischen Beisitzer bei den gemischten Gerichten in Shanghai oder Tientsin, versicherten mir, sie wären vortrefflich, und die Gesetzbücher seien zutreffender, klarer und kürzer abgefaßt als jene so mancher europäischen Staaten. Es ist nur ihre Handhabung von seiten der Mandarine, die Bestechlichkeit und Nachlässigkeit der Beamten, die Grausamkeit der Foltern und Strafen, welche den Chinesen einen heillosen Respekt vor den Gerichten einflößen und sie nur in Fällen der äußersten Notwendigkeit bei diesen Schutz suchen lassen. Auch dann bedarf es immer noch eines gut gespickten Geldbeutels und großen Einflusses, um[S. 48] das gewünschte Ziel zu erreichen. Fast hat es den Anschein, als sei die ganze Rechtspflege mit Absicht darauf zugespitzt, die Chinesen auf den gütlichen Ausgleich ihrer Streitigkeiten hinzuweisen. Der Kaiser Kang-Hi äußerte sich darüber folgendermaßen: „Es ist gut, daß die Menschen sich vor den Gerichten fürchten. Ich wünsche, daß jene, welche sich an die Richter wenden, ohne Mitleid behandelt werden. Mögen sich doch alle guten Bürger untereinander wie Brüder vertragen und Streitfälle dem Urteil der Greise und Ortsvorsteher vorlegen. Was die Streitsüchtigen, die Eigensinnigen und die Unverbesserlichen betrifft, so sollen sie nur von den Beamten zerschmettert werden. Das ist das einzige ihnen zukommende Recht”.
In diesen Kaiserworten werden die Rechtsbegriffe Chinas, wie sie noch heute obwalten, in kürzester und treffendster Weise gekennzeichnet. Thatsächlich werden in dem ganzen großen Reiche kleinere Streitfälle immer zuerst den Häuptern der Familie vorgelegt, welche ihr Urteil nach uralten Traditionen und Gebräuchen fällen. Ist doch das Familienleben wie das ganze Staatswesen Chinas nach patriarchalischen Grundsätzen geregelt, der Ortsvorsteher ist der Vater aller Einwohner, der Provinzgouverneur der Vater aller seiner Untergebenen, der Kaiser aber der Vater aller Chinesen. Derselbe Geist erfüllt auch die Rechtspflege. Das chinesische Gericht kennt keine Rechtsgelehrten, keine Advokaten und Staatsanwälte. Der Mandarin des Ortes, des Distriktes oder der Provinz ist der alleinige Richter, nur das Recht über Leben und Tod liegt in den Händen des Kaisers.
Bei den vielen Obliegenheiten des Mandarins gebricht es ihm selbstverständlich an Zeit, den verschiedenen Streitfällen, die ihm vorgelegt werden, besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Das summarische Verfahren, mit welchem die Mandarine selbst bei wichtigen Fällen vorgehen, erinnerte mich lebhaft an ähnliches, das ich in verschiedenen anderen Ländern, hauptsächlich in Marokko, Tunis und in dem fernen Korea gesehen habe. Geradeso wie dort, giebt es auch hier kein langes Prozessieren, Vertagen der Verhandlungen, Hinausschleppen durch allerhand Kniffe der Anwälte, keine Geschworenen, Beisitzer u. dergl. Der Fall wird vorgetragen, und ist die Zeugenvernehmung vorüber, so erfolgen Urteilsspruch und Strafe auf der Stelle. Dann kommt der nächste Fall an die Reihe, und so geht es fort, bis der Mandarin die Sitzung abbricht.
Dabei ist das ganze Rechtsverfahren öffentlich. Es spielt sich sozusagen auf der Straße ab, und der Besucher chinesischer Städte hat auf seinen Wanderungen fast täglich Gelegenheit, etwas davon zu sehen, seien es Gefängnisse oder Bestrafungen, Gerichtssitzungen oder Foltern. Je größer die Stadt, desto häufiger sind diese keineswegs immer willkommenen Gelegenheiten. Schon am ersten Tage meines Aufenthaltes in Canton sah ich eine öffentliche Bestrafung. In der Nähe des Yamens (Residenz) des Tatarengenerals wurde meine Aufmerksamkeit durch laute[S. 49] Gongschläge auf einen seltsamen Aufzug gelenkt, wie er wohl in keinem anderen Lande der Welt vorkommen dürfte. Hinter dem Gongschläger, einem Polizisten, schritt ein Mensch einher, dessen Hände hinter seinem Rücken zusammengebunden waren. In seinen heftig blutenden Ohrläppchen steckten etwa dreißig Centimeter lange Stäbchen, und an diesen waren Papierstreifen, mit Schriftzeichen bedeckt, aufgeklebt. Hinter ihm marschierten zwei Soldaten der Wache. Auf meine Frage antwortete mir der mich begleitende Dolmetscher, dies wäre ein Dieb. „Auf den Papierchen”, so fuhr er fort, „stehen sein Name, seine Verbrechen und die Bestrafung. Ich lese eben, daß er zu fünfzig Stockstreichen verurteilt wurde. Wahrscheinlich führen sie ihn jetzt vor den Mandarin. Wollen Sie zusehen?” Wir schlossen uns dem Menschenhaufen an, der dem Zuge folgte. Bald waren wir vor dem Gerichtshofe angelangt. Soldaten hielten das bezopfte Gesindel an dem Eingange zurück, während wir uns durch ein „Kumscha” von einigen Sapeken den Einlaß erkauften. Der Kumscha ist in China dasselbe, was in Europa die Eintrittskarte, im ganzen Orient aber der Bakschisch ist. Kaum hatten die Gerichtswachen ihren Kumscha in der Hand, so stand uns alles offen. Wir befanden uns in einem Hofraum, auf drei Seiten mit Gefängnissen besetzt; durch einen Thorbogen gelangten wir in einen zweiten Gefängnishof, in dessen Hintergrund sich der nach dem Hofe offene Gerichtssaal befand.
Dorthin wurde auch der Dieb geführt. Im Hintergrunde saß hinter einem langen Tische der Mandarin, große runde Augengläser auf der Nase, den chinesischen Beamtenhut mit Knopf und Roßschweif auf dem bezopften Haupte. An kleinen Tischchen zu beiden Seiten saßen Beamte, die mit Pinseln allerhand Schriftzeichen auf Papierstreifen malten. Gerichtsschergen mit ruderartigen Stäben in der Hand standen im Hintergrunde. Die Wände waren mit Papierbogen, ähnlich den japanischen Kakemonos, behangen, und mein Dolmetscher erklärte mir, die großen Schriftzeichen auf denselben bedeuteten die Ehrentitel, Würden und Aemter des Mandarins, sowie allerhand auf die Gerichtspflege bezugnehmende Sprüche.
Beim Eintritt wurden dem Diebe die Handfesseln abgenommen, und er warf sich vor dem Mandarin auf die Knie, mit der Stirn auf den Boden schlagend. Nach einigen Worten des Mandarins wurde er von den Schergen auf eine lange, niedere Bank gelegt, seine Beinkleider wurden bis zu den Knien heruntergeschoben, so daß seine Schenkel entblößt waren, dann faßte ihn ein Scherge beim Haarzopfe, ein anderer bei den Füßen. Auf ein Zeichen des Mandarins trat der Strafvollstrecker auf ihn zu und begann mit einem dünnen Streifen Bambusholz auf den oberen Teil der Schenkel loszuschlagen. Wie der Dolmetscher mir sagte, giebt es zwei verschiedene Arten von Schlägern, nicht etwa Ruten oder Stöcke, wie bei den Bastonnaden, die ich im Orient gesehen habe, sondern dünne, ungemein zähe und elastische Streifen, aus armdicken Bambusrohren herausgespalten, die einen handbreit und etwa meterlang, die anderen schmäler und kürzer.
Die Streiche fielen in außerordentlich rascher Folge, und das Geräusch der kurzen, trockenen Schläge, das in eigentümlichem Tonfall stattfindende Zählen derselben, das Stöhnen des unter jedem Schlage zuckenden Verurteilten vertrieben uns bald aus dem schwülen Raume. Wie ich nachher erfuhr, werden für größere Vergehen bis zu dreihundert Streiche verabfolgt. Gewöhnlich haben aber schon hundert Streiche ernste Verletzungen zur Folge, und wenn es immer möglich, wird der Verurteilte selbst oder durch seine Freunde die Hand des Schergen „schmieren”, um eine zartere Behandlung oder ein „Verzählen” während der Bestrafung zu erwirken. Thatsächlich sah ich später in Tschingkiang eine ähnliche Exekution. Der Schuldige schrie, als stecke er auf dem Spieß, aber dennoch bemerkte ich, daß ein großer Teil der Streiche auf die Bank, statt auf die Schenkel auffiel. Gerade dann war das Geschrei des Delinquenten am stärksten.
Ist die Bestechung der Richter und Schergen aus verschiedenen Ursachen nicht durchzuführen, oder will der Schuldige der entehrenden Strafe überhaupt entgehen, so wird er an seiner Statt einen Prügelknaben anwerben, der für ihn die Strafe empfängt. Aber nicht nur diesen Bastonnaden, auch Gefängnisstrafen, ja sogar der Erdrosselung oder Enthauptung kann der Verurteilte sich dadurch entziehen, daß er Stellvertreter anwirbt. Es giebt in China viele Tausende armer Teufel, deren trauriger Lebensberuf und Erwerb es ist, sich für andere prügeln und einsperren zu lassen, was ja mitunter im europäischen Zeitungswesen auch vorkommen soll.[S. 51] Mit der Zeit werden die in Mitleidenschaft gezogenen Körperteile derart hart und unempfindlich, daß die Sache für die berufsmäßigen Prügelknaben gar nicht so schlimm ist. Häufig kommt es aber, wie gesagt, auch vor, daß sich sogar Menschen finden, die sich aus Not und Verzweiflung köpfen lassen, um mit dem Lösegelde, das sie mit ihrem Leben bezahlen, ihre Familien, ihre Kinder vor Elend und Verhungern zu erretten. Diese Stellvertretung ist in China allgemein gebräuchlich und gesetzlich erlaubt. So werden beispielsweise Frauen selten wirklich bestraft, denn ihre Männer und Kinder geben sich zur Erduldung der Strafe her. Körperliche Züchtigung von Frauen findet gewöhnlich dadurch statt, daß die Streiche mit einem Stück zähem elastischen Leder auf Lippen und Backen der Betreffenden verabfolgt werden. Den meisten von ihnen wäre wohl die früher geschilderte Bastonnade lieber.
Die chinesischen Gefängnisse sind nicht etwa hohe, feste Gebäude mit vergitterten Fenstern und starken Umfassungsmauern, wie bei uns, sondern ebenerdige Räumlichkeiten, die sich auf viereckige Höfe öffnen. Das Entspringen der Sträflinge wird dadurch verhindert, daß gewöhnlich eine Hand und ein Fuß derselben aneinander gekettet werden. Außerdem sind alle Straßen in der Umgebung der Gefängnisse scharf bewacht. Beim Verlassen des Cantoner Gerichtshofes wurden wir von den freundlich grinsenden Gefangenwärtern, die sich natürlich ihren Kumscha erobern wollten, eingeladen, die anstoßenden Gefängnisse in Augenschein zu nehmen. Sie sind gar nicht so schlimm, als man erwarten sollte. Freilich fehlt es in den einzelnen, für etwa acht bis zwölf Gefangene bestimmten Räumen an jeglicher Einrichtung; sie schlafen auf Matten auf dem Boden und kochen sich ihren Reis auf offenen Herden im Hofe. Schmutz und Gestank sind auch nicht schlimmer als in den elenden Kuliwohnungen in Hongkong, dieser vielgepriesenen Kolonie der Engländer. Dafür sind aber die Sträflinge selbst, wenigstens ihrem Aussehen nach, das schlimmste, zerlumpteste Gesindel, das mir jemals vorgekommen ist. Schmutzstarrend, mit zerzaustem, wirr herabfallendem Haar, ausgehungert, mit Ungeziefer bedeckt, drängten sich die Gefangenen um uns, ungestüm ihren Kumscha fordernd, und angewidert beeilten wir uns davonzukommen. Die Gefängniswärter ließen uns indessen nicht so leicht aus den Händen. Wir mußten noch das Gefängnis der zum Tode Verurteilten in Augenschein nehmen, und niemals werde ich den entsetzlichen Anblick dieser Dutzende von Leuten vergessen, die in dem dunkeln, modrigen, von scheußlichen Gerüchen erfüllten Raume ihrem Tode entgegensahen: Piraten, Vatermörder, Straßenräuber, wahre Bestien, nicht nur ihren Verbrechen, sondern auch ihrem Aussehen und Benehmen nach. Hyänen in Menschengestalt, ihre schmutzstarrenden, mit Aussatz bedeckten Körper notdürftig in faulende Kleiderfetzen gehüllt; mit entsetzlichem Geheul erhoben sich diese Elenden bei unserem Eintritt von dem feuchten, unflätigen Boden und stürzten mit wirrem Haar und stierem[S. 52] Blick auf uns zu, um ein paar Kupfermünzen zu erhaschen. Erleichtert atmeten wir auf, als die geschlossene Thüre uns wieder von ihnen trennte. Welches Elend! welches Schicksal! Monatelang müssen sie hier warten, bis die Bestätigung ihres Todesurteils von Peking herabkommt, denn nur bei Aufständen, im Kriegsfalle oder bei außergewöhnlichen Verbrechen hat der Provinzgouverneur das Recht über Leben und Tod. Sonst gelangen alle Todesurteile, und es sind deren Tausende in jedem Jahre, vor den Kaiser, der sie gewöhnlich im Herbst zu prüfen pflegt. Um die Namen derjenigen, denen er das Leben schenkt, zieht er mit seinem roten Pinsel (der Kaiser schreibt nur mit solchen) einen Kreis. Die anderen verfallen dem Henker. Sind die Dokumente von Peking eingetroffen, so wird mit der Vollstreckung des Urteils nicht länger gezögert. Der Weg der Unglücklichen zum Richtplatz ist nicht lang. Sie werden in neue Kleider gesteckt und ohne weiteres geköpft oder erdrosselt.
Als wir das Gefängnis verließen, führte mich der Dolmetscher nach dem berüchtigten Töpfermarkt nahebei, dessen Boden mit dem Blute so vieler Tausende von Unglücklichen gedüngt ist. Eigentliche Richtplätze giebt es in China nicht. In Peking werden die Hinrichtungen öffentlich in der Nähe des Gemüsemarktes, in Canton auf dem Töpfermarkt vollzogen. Die Töpfer unterbrechen eben für einige Stunden die Arbeit, ein Plätzchen wird von Töpfen und Gefäßen aller Art freigemacht, und sind die Verurteilten hingerichtet, so wird die Arbeit wieder aufgenommen. Das Erdrosseln gilt als die weniger schmachvolle Art der Hinrichtung und ist den Verurteilten auch insofern lieber (der Tod selbst ist dem stoischen Chinesen durchaus nicht schrecklich), als er im Jenseits so seine Glieder beisammen behält. Der Geköpfte aber kommt ohne Kopf zu seinen Ahnen ins Jenseits, und wie können die Opfergebete seiner Nachkommen ihn finden, wenn sein Körper nicht zu erkennen ist! Deshalb werden die Verwandten oder Freunde des Geköpften, denen der entseelte Körper zur Beerdigung übergeben wird, den Kopf gewöhnlich wieder an den Rumpf befestigen. Dem Verurteilten gilt es als die schlimmste Verschärfung seiner Strafe, wenn ihm angekündigt wird, daß sein Kopf nach der Hinrichtung noch als warnendes Beispiel ausgestellt, also vom Körper getrennt bleiben soll.
Auf dem Töpfermarkt zeigte mein Führer mir ein Kreuz, auf welchem kurz zuvor ein Verbrecher gefoltert worden war, und daneben lag ein mit einer kleinen Strohmatte bedeckter Gegenstand. Als der Führer diese Matte wegzog, zeigte sich meinen entsetzten Blicken ein blutiger Menschenkopf, der von einer Hinrichtung herrührte. Nahebei lag ein etwa fußhoher, mit Blutspuren und zahlreichen tiefen Einschnitten versehener Holzklotz. Weil die zum Tode Verurteilten freiknieend enthauptet werden, so konnte ich mir die Bestimmung des Holzklotzes nicht erklären. Da erwähnte der Führer nur das Wort Lei-tschei und machte mit der Rechten die Bewegung des Zerhackens. Nun entsann ich mich, in Hongkong auf einer grauenvollen Photographie denselben[S. 53] Holzklotz bemerkt zu haben. Lei-tschei ist die gesetzliche Todesart für Elternmörder und besteht darin, daß der Verurteilte, wie die Vorschrift lautet, vor der Enthauptung in tausend Stücke zerhackt wird. Die Scharfrichter beginnen mit dem Abhauen der Weichteile ... doch, man möge mir die Schilderung dieser entsetzlichen Grausamkeit ersparen. Genug, das Lei-tschei wird jetzt noch alljährlich in Dutzenden von Fällen angewendet.
Die drei genannten Todesarten, das Erdrosseln, Köpfen und Zerstückeln, sind noch nicht die schlimmsten. Sind sie auch die allein gesetzlichen, so giebt es noch viel grausamere, wenn auch nicht so blutige. In der großen Stadt Futschau wird der ausländische Stadtteil durch die berühmte Wan-schan-Kian, die Brücke der zehntausend Alter, mit dem chinesischen Stadtteil verbunden. Mitten unter den vielen Kramladen und Kaufständen, welche die Ränder der Brücke einnehmen, und über welchen häufig genug auf langen Stangen die Köpfe enthaupteter Verbrecher prangen, sieht der Spaziergänger zuweilen einen Käfig aus Bambusstäben, in welchem irgend ein Verbrecher unter den glühendsten Sonnenstrahlen schmachtet. Zwei den Hals umschließende Querbretter halten den Kopf so hoch, daß die Fußspitzen des aufrecht stehenden Unglücklichen kaum den Boden berühren. Papierstreifen, auf den Käfig geklebt, verkünden den Vorübergehenden sein Verbrechen. So bleibt er tagelang ausgestellt, bis endlich der Tod ihn von dieser langsamen Folter befreit. Aehnliche Käfige sah ich nachher bei meinen Reisen durch das Innere von China beinahe in allen Städten, gewöhnlich auf den belebtesten Verkehrspunkten, an Brücken, vor den Yamen der Mandarine und vor den Stadtthoren.
Aber noch mehr. Als in den siebziger Jahren die furchtbarste Hungersnot in den nördlichen Provinzen herrschte, blieb Tausenden der darbenden Landleute nichts übrig als der Kannibalismus, und die Feder sträubt sich, die entsetzlichen Vorkommnisse niederzuschreiben, die der Geschichte angehören. Wurden derlei Unmenschen auf der That ertappt, so wurden sie in Tientsin in Käfigen an den Pranger gestellt und mußten verhungern; andere wurden lebendig an die Stadtmauern gepflöckt, und eine Anzahl Frauen, welche des Kannibalismus an ihren eigenen Kindern überwiesen wurden, ließen die Mandarine lebendig begraben.
In Kowloon, der Hongkong auf dem Festlande gegenüberliegenden Chinesenstadt, wurde mir die Stelle gezeigt, wo vor einigen Jahren fünfzehn Piraten, welche ein europäisches Schiff überfallen und die Mannschaft getötet hatten, summarisch geköpft wurden. Vertreter der europäischen Konsulate in Hongkong waren dabei zugegen, und ich erwarb in Hongkong Photographien dieser Exekution, welche die letztere in verschiedenen Momenten darstellen.
Die Köpfe waren mit erstaunlicher Sicherheit von den Körpern getrennt worden; kein einziger der letzteren zeigte die geringste Verletzung. Wie mir Chinesen erzählten, wird die Enthauptung selten vom Scharfrichter selbst, sondern gewöhnlich von einem Sträfling vollzogen, der sich vorher an Gurken für sein schauerliches Amt einübt. Er ist wohl zu derartigen Vorstudien gezwungen, denn trennt er das Haupt nicht auf den ersten Strich, so darf er keinen zweiten ausführen, sondern muß die Trennung durch Sägen vollenden.
Hat der chinesische Provinzmandarin auch nicht das Recht über Leben und Tod der Verbrecher, so hat er auf andere Weise die Mittel hierzu doch in seiner Hand.[S. 55] In China besteht nämlich heute noch die gesetzliche Folter. Kein Verbrecher darf verurteilt werden, ohne daß er sein Verbrechen selbst eingestanden hat, selbst wenn die Beweise erdrückend wären. Erst wenn er sein Geständnis selbst unterschrieben hat, und häufig genug unterschreibt auch der Unschuldige ein solches, um der Tortur zu entgehen, wird ihm die Strafe zugemessen. Die Foltern selbst, obschon grausam genug, sind lange nicht so entsetzlich wie jene, welche in früheren Zeiten in Europa gebräuchlich waren, und von denen in manchen unserer alten Burgen und in den Museen heute noch die Folterwerkzeuge Zeugnis ablegen.
Die gebräuchlichsten Foltern in China sind eine Art von Hand- und Fußschrauben, Knien auf Ketten, auf Glassplittern gemischt mit Salz und andere. Das Entsetzliche der Sache liegt hauptsächlich darin, daß nicht nur der Angeklagte, sondern auch Kläger und Zeugen häufig der Folter unterworfen werden, um weitere Geständnisse von ihnen zu erpressen. Ist der Drang der Geschäfte zu groß, so werden die Beschuldigten mit den Zeugen zusammen ins Gefängnis geworfen, bis der Mandarin Zeit hat, den Fall zu prüfen; und das allein erklärt schon die heilige Scheu der Chinesen vor dem Gesetz. Stirbt jemand an den Folgen dieser entsetzlichen Behandlung, so wird die Sache möglichst vertuscht; auch lassen die Mandarine mit sich reden, und gewöhnlich bekommt von zwei streitenden Parteien diejenige recht, welche den Mandarin durch Schmieren beeinflußt hat. Diese Bestechlichkeit der Richter ist in China geradezu sprichwörtlich und erklärt auch die bedeutenden Einkünfte der[S. 56]selben, sowie das Streben der chinesischen Litteraten, Beamtenposten zu ergattern. Freilich wird der Willkür der Mandarine teils durch die Furcht vor ihren Vorgesetzten, teils durch die öffentliche Meinung ein wirksamer Hemmschuh angelegt. Wird das Treiben eines Mandarins der Bevölkerung zu bunt, so wird er, besonders häufig in den Inlandstädten, von den Stadtältesten höflich eingeladen, die Stadt zu verlassen. Man stellt ihm die Sänfte vor die Thür, veranlaßt ihn sie zu besteigen und trägt ihn vor die Stadtthore. In solchen Fällen behält die Bevölkerung gewöhnlich recht, und der Provinzgouverneur oder die Zentralregierung ernennt einen anderen Mandarin auf den freigewordenen Posten.
Häufiger noch als die Bastonnade kommt in China die Strafe des Kangtragens zur Anwendung. Auf meinen Wanderungen in chinesischen Städten fand ich fast überall derartige unglückliche Kangträger, besonders zahlreich in den Gefängnissen selbst. Der Kang besteht ans zwei Brettern, welche, an den Innenseiten mit Ausschnitten für den Hals versehen, dem Verurteilten als eine Art Halskrause angelegt und durch Ketten oder Riegel miteinander verbunden werden. Diese Halsbretter, etwa sechzig bis achtzig Centimeter im Geviert und bis zu zwei Finger dick, bleiben[S. 57] dem Sträfling während der ganzen Strafdauer, von ein bis drei Monaten. Sie wären an und für sich, obschon bis zu fünfzehn oder zwanzig Kilogramm wiegend, gar nicht so schrecklich. Die Schwere der Strafe kann man sich erst vorstellen, wenn man erfährt, daß der Kang Tag und Nacht auf dem Nacken des Unglücklichen ruht, daß er sich also niemals niederlegen kann, sondern stehend oder sitzend schlafen muß. Ebensowenig kann er seine Hände zum Kopfe führen oder Nahrung zu sich nehmen und muß also durch mitleidige Vorübergehende oder Freunde gefüttert werden. Auf die Bretter geklebte Papierstreifen enthalten seinen Namen, das Verbrechen und die Dauer der Strafe.
In manchen Werken über China wird behauptet, daß Frauen zum Tragen des Kangs niemals verurteilt würden. Ich habe aber selbst weibliche Kangträger gesehen und auch Photographien erworben, welche nicht nur einzelne, sondern auch drei Frauen zusammen in einem Kang mit drei Halslöchern steckend darstellen. Wie stark das weibliche Geschlecht unter den Gefangenen oder sonstigen Verurteilten in China vertreten ist, konnte ich trotz eifriger Nachfragen ebensowenig erfahren, wie die Zahl der letzteren überhaupt. Ja in den Gefängnissen der größten Städte konnte man mir nicht einmal die Zahl der Gefangenen während eines Jahres angeben. Mit der Statistik ist es in China schlecht bestellt, aber doch kann es keinem Zweifel unterliegen, daß die Zahl der Gerichtsfälle in dem Reiche der Mitte verhältnismäßig bedeutend geringer ist, ja vielleicht kaum die Hälfte jener in zivilisierten Ländern beträgt. Der Wunsch des Kaisers Kang-Hi in Bezug auf die Rechtspflege in China ist also in Erfüllung gegangen.
An den Sehenswürdigkeiten chinesischer Städte, an Tempeln, Pagoden und Ehrenpforten, hat sich der Europäer gewöhnlich bald satt gesehen, denn der großen Mehrzahl nach sind sie von einem ewigen Einerlei. Kam ich im Reiche der Mitte in eine mir noch unbekannte Stadt, so bangte mir gewöhnlich schon vor dem Confuciustempel oder der Pagode, die ich besichtigen sollte. Was wirklich interessant wäre, wie die Kaiserpaläste und Ahnentempel in Peking, ist nicht zugänglich, und wo diese Kaiserpaläste und Tempel wirklich zugänglich wären, wie in Nangking, sind nur noch traurige Ruinen davon übrig.
Weit interessanter als diese Bauten in den chinesischen Städten ist das Leben und Treiben ihrer Einwohner, darunter vor allem die chinesische Industrie. Gewöhnlich ließ ich mich von einem Dolmetscher zuerst in die Geschäftsstraßen führen, wenn die engen, dunklen, feuchten Gäßchen der meisten Städte den Namen Geschäftsstraßen überhaupt verdienten. Allerdings war ich selbst dort viel mehr der Gegenstand der Neugierde, als es die Chinesen für mich waren. Solange ich mich mitten durch das rege Gewühl und Gedränge fortbewegte, beschränkte sich mein[S. 59] neugieriges Gefolge gewöhnlich auf etwa ein Dutzend Personen; blieb ich irgendwo stehen, so verdoppelte sich der mich umdrängende Menschenhaufe, und begann ich gar durch meinen Dolmetscher zu fragen oder zu feilschen, dann schrieen die bezopften Straßenjungen vor lauter Verwunderung und lockten noch die Menschen aus den Seitengäßchen herbei. In der ersten Zeit war mir diese schmutzige, zerlumpte Gesellschaft in hohem Grade lästig, aber später gewöhnte ich mich daran. Bei solchen Gelegenheiten kam mir immer der erste Chinese in den Sinn, den ich als kleiner Junge in Europa gesehen habe. War ich ihm dort etwa nicht ebenfalls nachgelaufen? Wurde er nicht durch böse Gassenjungen geneckt und beim Zopfe gezupft und ausgelacht? Jetzt zahlten seine Landsleute mir diese Neugierde zurück.
In Canton kümmern sie sich um die Europäer wenig mehr. Canton, diese größte Stadt des Reiches der Mitte, ist an Europäer schon seit dreihundert Jahren gewöhnt, man sieht ihrer dort viel mehr als in anderen Städten Chinas, und das Gefolge beschränkt sich gewöhnlich nur auf ein halbes Dutzend Menschen, die man sich hier auch leichter vom Leibe halten kann. Dazu ist Canton das Paris, oder ich möchte lieber sagen das Neuyork von China, Peking ist sein Washington. Canton ist der Hauptsitz der chinesischen Industrie; Hunderttausende sind dort mit der Anfertigung von Waren beschäftigt, die auf zahllosen Dschunken und Kanalbooten, auf dem Rücken von Mauleseln oder Lastträgern durch das ganze Reich geführt werden; in Canton sind die geschicktesten Arbeiter, die reichsten Kaufleute, die schönsten Läden, und wohin ich auch kam, nach Städten in Nord und Süd, in den Industrievierteln fand ich mit geringen Abweichungen doch nur den Abklatsch des industriellen Lebens von Canton. Es ist in dieser Hinsicht die erste Hauptstadt Chinas, alles andere Provinz.
Gerade wie es in vielen Städten Europas der Fall ist, so sind auch in den chinesischen Städten die einzelnen Industrien gewöhnlich in bestimmten Quartieren zu finden; hier eine Gasse, vielleicht ein bis zwei Kilometer lang, gefüllt mit Goldarbeiterläden, die sich dicht aneinander reihen, so daß ich oft gar nicht wußte, ob ein Schaukasten zu dem einen oder dem anderen Laden gehörte; bog ich um eine Straßenecke, so befand ich mich vielleicht im Viertel der Fächerfabrikanten, in der nächsten Straße in jenem der Möbeltischler, und so ging es weiter.
Ein Haus gleicht dort dem andern: das untere Stockwerk wird ganz von dem Geschäft eingenommen, das von der einen Hauswand zur anderen offen steht, um das in den düsteren Gäßchen an und für sich spärliche Licht einzulassen; im oberen Stockwerk sind die Wohnungen, und vor jedem Hause baumeln die roten, gelben, goldenen oder schwarzen langen Schilder herab, ein Wald von Schildern, der jeden Ausblick verhindert, das Sonnenlicht ausschließt und die Gäßchen selbst in ewige Dämmerung hüllt, während die Schilder darüber glitzern und glänzen. Man denke sich nur sämtliche Firmentafeln des Wiener Grabens oder der Berliner Friedrichstraße, statt an den Häusern befestigt, vor denselben von Stangen der Länge nach herunterbaumeln! Unten in den Gäßchen ein ewiges Gewoge und Getriebe, ein Lärmen, Schreien, Stoßen und Drängen, ein Hin- und Herzerren, Schieben und Drücken von Zehntausenden bartloser, langbezopfter, halbnackter Gestalten, alle auf der Jagd nach Erwerb, alle im Kampf ums Dasein. Rechts und links in den kleinen finsteren Gewölben aber wird gehämmert und geklopft, gesägt und gefeilt, ohne Unterlaß vom Morgengrauen bis zur anbrechenden Dunkelheit. Ueberall wird so emsig gearbeitet, als gälte es, Bestellungen auszuführen, die unbedingt am Abend fertig sein müssen. Welcher Fleiß! Welche Unermüdlichkeit des Schaffens!
In diesen Industrievierteln Cantons wie anderer chinesischer Städte sah ich niemals die Menschen rasten und ruhen, ausgenommen, sie lagen still und tot unter dem weißen Leinentuche, aufgebahrt in denselben Läden, in denen sie ihr ganzes Leben in Arbeit verbracht hatten. Aber in den Läden ringsum wurde dabei doch rastlos geschafft, obschon niemand wußte, ob nicht die Arbeit unter seinen Händen die letzte war, ob nicht der tückische Tod sich ihn als nächstes Opfer ausersehen hatte. Wanderte ich durch diese Straßen, Kampfer im Munde und ein mit Kampfergeist getränktes Taschentuch vor der Nase, so vergaß ich über dieser Emsigkeit des Schaffens selbst die furchtbaren Verhältnisse, die eben in Canton herrschten. Ich war der einzige Spaziergänger, der einzige Müßiggänger unter all diesen Zehntausenden und hätte mich selbst hinsetzen mögen, um mitzuthun. Betrachte ich heute die Dutzende von Sachen, die ich auf meinen Spaziergängen in den chinesischen Städten erworben habe, dann sehe ich im Geiste auch die Arbeiter vor mir, die sie verfertigten, diese halbnackten, schweißtriefenden, emsigen Gestalten, wie sie stumm, ihrer Arbeit vollständig hingegeben, auf dem feuchten Boden kauern, und der höchst eigentümliche Geruch, der all den Industriestädten Chinas eigen ist, haftet auch meinen Fächern und Stickereien, Stoffen und Gerätschaften noch heute an. Entfalte ich eine der herrlichen Stickereien, so ist bald mein ganzes Zimmer mit diesem berauschenden modrigen Duft geschwängert, ein Gemenge von Opium-, von Sandelholz- und Theegeruch. Er ist unangenehm, bedrückend, ich möchte sagen furchteinflößend. Er erinnert an Grüfte. Es sind ja[S. 61] in der That Grüfte, in denen die großen Massen der Chinesen arbeiten, und auch ihre Arbeit ist furchteinflößend. Wie, wenn diese Hunderte von Millionen fleißiger Menschen ihre althergebrachten Werkzeuge fortwürfen und zu unseren modernen Arbeitswaffen, zu unseren Maschinen, griffen? Wie, wenn ein industrieller Li-Hung-Tschang den rastlosen Fleiß, die Fertigkeit dieser größten Arbeiterarmee der Welt gegen die unserige, europäische, ins Feld führte und in China Hunderte von Fabriken, von Hochöfen und Gießereien schaffen sollte? Was würde dann aus uns?
Dieses Gedankens konnte ich mich niemals erwehren, wenn ich die Chinesen bei der Arbeit sah, und als Europäer, als Weißer, dankte ich im stillen der Vorsehung, daß sie den Chinesen wohl Fleiß, Enthaltsamkeit, Kraft, Geschicklichkeit, aber keinen Fortschrittsgeist gegeben hat. Wie vor Tausenden von Jahren, so arbeiten sie heute noch mit den gleichen rohen Werkzeugen, und ich kaufte mir in China dieselben Fläschchen, die man unter den Pyramiden in den Gräbern der alten Aegypter gefunden hat, Artikel, welche die Chinesen damals in alle Welt versandten, bis andere Völker, andere Kulturen des Abendlandes als ihre Konkurrenten auftraten und sie vom Markt verdrängten. Aber droht die mongolische Flut nicht von neuem über das Abendland hereinzubrechen?
Nicht so bald! Der konservative Zug der Chinesen, die Achtung vor dem Althergebrachten schützt uns noch für lange Zeit vor ihnen. Kennen sie doch die Europäer schon seit Jahrhunderten und ihre Werkzeuge, ihre Maschinen, ihre praktischen Arbeitseinrichtungen schon seit Jahrzehnten. Die weißen Barbaren brachten ihnen bequeme Arbeitswaffen, einfach, leicht, der doppelten Leistung fähig, aber die Mongolen ließen sie unbeachtet und arbeiteten mit den alten plumpen, schweren Werkzeugen weiter, dabei möglicherweise besser, sorgfältiger als wir mit unserer praktischen Schulung und unseren praktischen Werkzeugen. Man sehe sich nur ihre Bronzen, ihre Holzschnitzereien, ihre Lackwaren, Porzellane, Möbel an! Jeder Artikel ist das Werk einer einzigen Familie, vielleicht eines einzigen Arbeiters, denn Arbeitsteilung kennt der Chinese nicht. Sang Ting oder Han Tschang hat möglicherweise die Form für seine Bronze selbst modelliert, die Metallmischung und den Guß vorgenommen; er hat selbst mit dem Stichel die einzelnen Figuren ciseliert und emailliert, vergoldet und vollendet. Sang Ching macht nicht etwa nur die Holzarbeit eines Möbels. Er webt die Stoffe, macht die Stoffmuster, das Gerippe des Möbels, schnitzt kunstvolle Verzierungen, lackiert und tapeziert selbst. Mag man über die bizarren Formen dieser uns fremdartig berührenden Erzeugnisse lächeln, jedes Stück hat doch einen gewissen Charakter und zeigt etwas Individuelles. Maschinen wurden schon vor fünfzig Jahren eingeführt, und die Engländer boten alles Erdenkliche auf, sie unter die Leute zu bringen, aber die Chinesen nahmen nur solche an, welche kraftspendend waren, andere jedoch, welche die Handarbeit[S. 62] selbst übernehmen und vollkommener verrichten, wie z. B. die Nähmaschinen, wiesen sie zurück. Tausend Fächer, einander so gleich wie ein Ei dem anderen, werden Stück für Stück, Blatt für Blatt von einem einzigen Arbeiter geschnitzt, gebunden, gemalt und verkauft. Reichen bei größeren Arbeiten die Hände nicht aus, so werden die Füße, die Zehen zu Hilfe genommen, und mancher Chinese leistet mit seinen Zehen Besseres als mancher Weiße mit seinen Händen. Sie haben ein erstaunliches Geschick; jeder einzelne ist ein Meister Hämmerlein. In manchen chinesischen Dörfern fand ich keinerlei Kaufläden, und als ich mich erkundigte, wo denn die Menschen ihre Stoffe, Schuhe, Gerätschaften hernähmen, hieß es, sie verfertigten sie selbst. In Bauernhäusern fand ich uralte Webstühle, vor den Häusern saßen Frauen, die Kleider nähten, hockten Männer, die Sandalen flochten. Ist etwas zu besorgen, wozu ihnen die Werkzeuge fehlen, so rufen sie irgend einen der wandernden Handwerker. Schmiede, Flickschneider, Schuster, Barbiere, Gewerbtreibende aller Art wandern von Ort zu Ort, gerade so, wie ich es auch in Korea getroffen habe und wie es bei uns die Scherenschleifer thun. Wo sie Arbeit finden, wird Halt gemacht, das Ränzlein ausgepackt und gearbeitet. Auf dem Wege von Zikawei nach Sutschan begegnete ich einem Schmied, der eben im Begriffe war, seine ambulante Schmiede einzurichten, um einige Flickarbeiten zu besorgen. Statt wie bei uns die Ränzchen auf dem Rücken zu tragen, oder einen Handwagen mit sich zu führen, schieben die chinesischen Handwerker ihre Siebensachen auf einem unförmlichen Schubkarren vor sich her, oder sie verteilen sie in zwei flache Körbe und hängen diese an die beiden Enden eines mannslangen, armdicken Bambusrohres, das sie auf den Schultern oder auf dem Nacken tragen. So befördern sie meilenweit Lasten, welche wir nicht hundert Schritte weit tragen würden, ohne erschöpft zu sein. Mein guter Schmied hatte an dem einen Ende des Bambusrohres einen Blasbalg hängen, an dem ein unförmiges Stück Eisen, sein Amboß, festgebunden war. Am anderen Ende hing ein schwerer Korb mit alten Eisenstücken, Werkzeugen und einem Kohlensack. Darüber thronte eine Pfanne und ein irdener Topf. Während ich meinen Tiffin (Gabelfrühstück) einnahm und ein wenig ruhte, beobachtete ich seine Thätigkcit. Er legte den Amboß auf einen Stein, den er zuvor mit etwas feuchter Erde bedeckt hatte, holte die Pfanne hervor, die er mit Kohlen füllte, fügte durch eine Oeffnung in der ersteren den Blasbalg ein und begann das Feuer anzufachen. Dann füllte er den Topf in dem nahen Kanal mit Wasser, und nun sah ich erst, daß er im Begriff war, zuerst seine Mahlzeit zu kochen, denn er warf eine Handvoll gepreßtes Seegras in den Topf, dazu eine Menge gekochten Reis. Mit einem Appetit, als wäre es Trüffelragout, verschlang er dann dieses Gemengsel, und derselbe Topf diente ihm später zum Abkühlen der Eisenstücke und Gerätschaften, die ihm von den Einwohnern zur Ausbesserung gebracht wurden.
In den Städten halten sich diese wandernden Künstler länger auf; sie bleiben stunden-, auch tagelang an irgend einer Mauer hocken und warten auf Kundschaft. In Tschinkiang am Jangtsekiang wohnte ich einer ergötzlichen Szene bei. Es war gerade großer Festtag, die Feier irgend eines Provinzheiligen, und in der Stadt drängten sich viele Tausende von Landleuten aus der ganzen Provinz. Ein zerlumpter, struppiger Mongole kam durch die Hauptstraße gewandert und kauerte vor einem an der Schattenseite im Freien thätigen Barbier nieder. Bevor er sich seinen Schädel kahl rasieren ließ, zog er seine blaue Aermeljacke aus und warf sie einer wandernden Flickschneiderin zu, die vor seinen Augen mitten auf der Straße die Schäden ausbesserte. Da kam ein Flickschuster mit seinem Schnappsack herbeigelaufen, und wie in England die Bootblack- (d. h. Stiefelwichs-) Jungen, so wies auch dieser mongolische Crispinusjünger beharrlich auf die Schäden an den Filzschuhen des Chinesen. Nach längerem Geschrei und Geplapper schienen die beiden handelseinig; der Schuster zog dem Chinesen die Schuhe ab, setzte sich neben das Flickweib und begann nun seinerseits, Lederflecke auf die Löcher der Fußbekleidung zu setzen.
Leder findet in China bei weitem nicht die ausgebreitete Verwendung wie bei anderen Völkern. Lederschuhe sieht man fast gar nicht, denn die Fußbekleidung der ärmeren Klassen besteht aus Strohsandalen, jene der bemittelteren aus Seide, mit Filzsohlen.
In gar manchen Industrien sind uns die Chinesen wie gesagt trotz ihrer primitiven Werkzeuge ebenbürtig, wenn nicht überlegen. Ihre Silberarbeiten sind bewundernswert; einzelne Arbeiter modellieren, schmieden und vergolden die herrlichsten Vasen, Prunkbecher, Blumenhalter mit Hunderten von getriebenen Figürchen, kaum ein oder zwei Centimeter groß, aber so zart gearbeitet, daß man die Gesichtszüge und den Faltenwurf der Gewänder daran unterscheiden kann; dann werden diese Arbeiten von denselben Künstlern noch ciseliert.
Noch zarter und künstlerischer sind die herrlichen Stickereien. Viele Tausende von Männern und Frauen sind in Canton mit Stickarbeiten beschäftigt, die auch in großen Mengen nach Europa ausgeführt werden und hier willige Abnehmer finden. Monatelang wird manchmal an einem Stück gearbeitet; die Blumen, Vögel, Schmetterlinge werden ihnen nicht vorgezeichnet; sie arbeiten direkt nach dem Muster auf der Seide und führen bestimmte Stickereien auf beiden Seiten derselben aus, wobei sie die Enden der Fäden so geschickt verarbeiten und verstecken, daß man sie nicht entdecken kann. Die schönsten Muster werden in Seidenstoffe auf ganz einfachen Webstühlen eingewebt. Mit den Geheimnissen der Färberei sind sie, obwohl sie von der Chemie als Wissenschaft keine Ahnung haben, wohl vertraut, und die von ihnen gefärbten Stoffe halten die Farben besser als diejenigen, die sie von Europa geliefert bekommen. In der Zartheit und Genauigkeit von Holz-, Elfenbein- und Steinskulpturen stehen sie unerreicht da. Mit großer Findigkeit[S. 64] benutzen sie z. B. in geädertem Marmor die dunklen Adern, in Astholz die Astknoten für die Zwecke ihrer Arbeit; aus einer knorrigen Wurzel schneiden sie im Handumdrehen einen langbärtigen Götzen, aus einem vielkantigen Speckstein einen grotesken Alten, wobei ihnen die Auswüchse und Vorsprünge des Materials eher förderlich als hinderlich sind. An Häuserfronten, Thüren, Wänden, Möbeln bringen sie derlei Skulpturen an, wo sich nur Platz bietet, schneiden, polieren, vergolden und bemalen sie mit großer Kunst, aber sie verstehen es nicht, den Figuren die richtigen Verhältnisse, landschaftlichen Darstellungen die Perspektive zu geben. Das zeigt sich auch bei ihren Malereien. In Canton fand ich Tausende mit dem Bemalen des sogenannten Reispapiers beschäftigt, eine Eigenart der chinesischen Industrie. Dieses vermeintliche Reispapier, zart, blendend weiß, sehr gebrechlich und federleicht, ist keineswegs Papier, sondern das Mark einer Abart des Brotfruchtbaumes, das sehr sorgfältig abgelöst und dann mit dünnen, breiten Messern in ganz dünne Scheiben geschnitten wird. Auf diese Scheiben malen die Chinesen mit Wasserfarben alle möglichen Bildchen aus dem Volks- und Familienleben, Porträts, Landschaften, aber sie haben es nicht gelernt, den Bildern Schatten zu geben, ja in einem Porträt wird beispielsweise die Schattierung als Fehler angesehen; bei Darstellungen von Landschaften denken sie sich dieselben nicht von einem einzigen Standort aus gesehen, sondern sie verändern denselben jeweilig und malen also eine entfernt stehende Person ebensogroß und mit ganz denselben Einzelheiten, wie eine nahestehende, nur stellen sie die letztere tiefer, die entfernt stehende höher im Bilde.
In der Mehrzahl der Städte, selbst der kleinsten, werden Seidenstoffe gewebt, aber nirgends befindet sich eine Fabrik in unserem Sinne des Wortes; die Seide wird in einzelnen Familien verarbeitet, deren wertvollste Habe ihr unförmiger Webstuhl bildet. Und doch verstehen diese armen, unwissenden Mongolen bessere Seidenstoffe zu machen als wir. Die Worte Seide (Setum), Satin, Senshaw, die heute in der ganzen Welt eingebürgert sind, stammen aus dem Chinesischen, wo sie Sse, Ssetum und Ss’inscha heißen. In Nanking ließ ich mich in die berühmte kaiserliche Seidenfabrik führen, wo die Seide für den kaiserlichen Hof in Peking, sowie für die Ahnen- und Götzenopfer angefertigt wird, gewaltige Mengen, denn in Peking werden für Opferzwecke jährlich dreißigtausend Stück Seide allein verbrannt. Statt einer Fabrik fand ich dort eine Reihe schmutzstarrender dunkler Räume und in jedem einen plumpen, vorsündflutlichen Webstuhl; aber auf diesen entstanden allmählich unter meinen Augen die herrlichsten Damastbrokate, welche am chinesischen Kaiserhofe die Bewunderung der Gesandten in so hohem Grade erregen.
Welche Künstler die Chinesen in Bezug auf das Porzellan sind, ist ja bekannt; von China kam die Porzellanfabrikation auch nach Korea und von dort nach Japan, wo man heute vielleicht noch zarteres Porzellan macht wie in dem eigentlichen Mutterlande desselben.
Ob es wohl bekannt ist, daß der Name Porzellan nicht aus diesem letzteren, sondern aus dem Portugiesischen stammt? Als die Portugiesen vor drei Jahrhunderten die zarten durchscheinenden gebrechlichen Theetassen zum erstenmal sahen, hielten sie das Material für geschliffene Perlmuttermuscheln, im Portugiesischen Porcellana genannt, und dieser Name blieb dem Porzellan in den meisten Ländern und Sprachen bis auf den heutigen Tag.
Papier war ihnen schon im ersten Jahrhundert vor Christo bekannt, aber gerade so wie damals machen sie es heute noch aus Bambusfasern, die sie in einem großen Mörser zerstampfen und mit etwas Baumwollfaser mischen. Sie selbst betrachten das koreanische Papier als das beste, und bis auf die jüngste Zeit bestand ein Teil des Tributs, welchen Korea an den Kaiser von China zu zahlen hatte, in Papier. Aus derselben Zeit stammt die Erfindung der Tusche, die sie immer noch aus denselben Stoffen, Oel-, Kohlen- und Fichtenholzruß (also nicht etwa aus dem Tintenfisch, wie es in Europa vielfach angenommen wird), erzeugen. Vielfach wurde von seiten der Europäer in China versucht, besonders bei Artikeln, welche nach Europa ausgeführt werden, den Chinesen billigere Erzeugungsmethoden beizubringen, aber sie bleiben mit rührender Beharrlichkeit bei ihren althergebrachten Methoden, wie sie möglicherweise schon zur Zeit des Confucius gebräuchlich waren. Fast könnte man daran verzweifeln, daß sie sich in ihren Industrien überhaupt aufrütteln lassen, wenn nicht die wohlfeilen europäischen Produkte die chinesischen unterbieten und deshalb immer mehr und mehr Eingang finden würden.
Der Chinese ist viel zu sehr Rechenmeister und Handelsmann, um sich auch dann auf seine Ueberlieferungen zu steifen, wenn es ihm an den Geldbeutel geht; einzelne Artikel hat er schon aufgegeben, um sie durch europäische zu ersetzen, andere europäische hat er selbst zu erzeugen begonnen. So z. B. machen die Chinesen wohl schon seit langer Zeit Nähnadeln, aber jede einzelne wird mit der Hand gefeilt und gebohrt und ist deshalb nicht nur kostspielig, sondern auch so plump, daß sie sich mit unseren spottbilligen Nadeln gar nicht vergleichen lassen. Bekanntlich werden unsere Nadeln in kleine schwarze Paketchen gepackt. Die guten chinesischen Damen stießen sich anfänglich an der schwarzen Unglücksfarbe des Packpapiers und meinten, wenn die Nadeln in rotes Papier gepackt wären, würden sie sie doch versuchen. Natürlich beeilten sich die Birminghamer, ihre zarten Produkte für den chinesischen Markt in schönes rotes Papier zu hüllen, und jetzt haben sich die Chinesen so sehr an die billigen europäischen Nadeln gewöhnt, daß sie auch schwarze Packungen annehmen. Der chinesischen Nadelindustrie aber ist der Garaus gemacht. In den entfernten Provinzen des Innern schmieden sich die Bauern ihre Nadeln freilich noch immer selbst. Auch den Nutzen von Glas haben sie einsehen gelernt, das sie bis zum Verkehr mit den Europäern gar nicht gekannt haben. Ihre Fensterscheiben waren Papierbogen, ihre Spiegel aus Metall. Allmählich lernten[S. 66] sie das Schmelzen des Glases, und Tausende von Tonnen Glasscherben und alten Flaschen wurden jährlich nach China exportiert; jetzt verstehen sie es schon, den Kies selbst zu schmelzen und Glasscheiben zu erzeugen, so daß die Ausfuhr von Glasscheiben nach China vollständig aufgehört hat. Aber Spiegel können sie noch immer nicht erzeugen, dafür schleifen sie ihre runden Metallspiegel so glänzend, daß dieselben wirklich Ersatz für die Glasspiegel bilden.
Auch Brillen fanden bei den Zopfträgern willigen Eingang, aber während sie viele aus Europa einführen lassen, machen sie die Linsen und Horneinfassungen auch schon selbst; je größer die Linsen, je dicker die Rahmen, desto besser, denn es gehört in China zum guten Ton, große Brillen zu tragen. Die Mandarine, Beamten, wohlhabenden Geschäftsleute und die Compradores (Zahlmeister) der europäischen Kaufleute tragen gewöhnlich unförmig große Augengläser mit Krystallscheiben darin, welche ihr halbes Gesicht bedecken. Unsere europäischen Linsen können sie nicht gebrauchen, weil diese ihrer Ansicht nach viel zu klein sind. Deshalb bestehen in China einige Schleifereien solcher Linsen, und da ihr Glas zu unrein ist, verwenden sie nur Krystall und schleifen die Linsen so lange, bis sie den betreffenden Augen entsprechen. Auf meiner Reise den Jangtsekiang aufwärts legte unser Schiff auch in Wuhu an. Während eines Spazierganges dort begegneten wir einem meinem Begleiter bekannten Chinesen, der eben zum Sekretär des Tao-Tais (Präfekten) ernannt worden war. Durch unseren Dolmetscher ließ er uns mitteilen, er wäre eben im Begriff, zum Optikus zu gehen, um sich Brillen für seine schwachen Augen schleifen zu lassen. Offenbar schämte er sich vor uns, als Beamter noch keine Brille zu tragen. Thatsächlich sahen wir ihn bei einem Brillenmacher halten, und als wir zwei Stunden später zufällig wieder vorbeikamen, rief er uns lächelnd zu, die Linsen wären nun für sein Auge passend geschliffen. Der Neugierde halber blickte ich durch diese riesigen kreisrunden Gläser; sie waren flach wie Fensterscheiben.
Aus dem ganzen industriellen Leben der Chinesen konnte ich erkennen, daß sie mit Zähigkeit an ihren althergebrachten Werkzeugen und Herstellungsarten festhalten und ungemein schwer dazu gebracht werden können, sich die unsrigen anzueignen. Selbst im Auslande, wie z. B. in Kalifornien, wo sie doch mitten unter den Amerikanern leben und arbeiten, haben sie ihre altchinesischen Handwerksmethoden beibehalten; sie lassen sich ihren ganzen Bedarf an Kleidern, Gerätschaften, Werkzeugen aus China bringen, statt die praktischen, billigen amerikanischen Artikel anzuschaffen. Nur Artikel, die sie vor der Berührung mit den Europäern nicht besaßen, nehmen sie willig an, vorausgesetzt, daß ihnen deren Nützlichkeit einleuchtet. So war es gar nicht schwer, den Gebrauch von Petroleum und damit auch Petroleumlampen bei ihnen einzuführen, aber die letzteren machen sie jetzt in Canton schon selbst und verschicken sie jährlich nach vielen Tausenden ins Innere. Ebenso[S. 67] unbekannt war ihnen unsere Eisenindustrie mit ihren großen Gießereien, ihren gewaltigen Stahlwerken, Maschinen aller Art. Es dauerte gar nicht lange, so besaß die Regierung an verschiedenen Orten Arsenale und Maschinenwerkstätten, geleitet von Europäern, die sie aber allmählich durch eingeborene Ingenieure und Mechaniker zu ersetzen bestrebt sind. Augenblicklich sind sie daran, den Eisenbahnbau von Europäern zu studieren, um seinerzeit ihre Eisenbahnen selber bauen zu können.
Trotz der großen Erfindungen, welche die Geschichte den Chinesen des Altertums zuschreibt, sind die heutigen Bewohner Chinas kein erfindungsreiches Volk; dafür ist ihr Nachahmungsvermögen ungewöhnlich stark ausgeprägt. Haben sie einmal europäische Gegenstände, von deren Nützlichkeit sie überzeugt sind, und werden sie durch Europäer in die Geheimnisse ihrer Herstellung eingeweiht, so ist es ihnen ein leichtes, selbständig zum Nachteil der europäischen Industrien weiter zu schaffen.
In Hongkong, Shanghai, Singapore und anderen Großstädten Ostasiens ist die Kleinindustrie fast ganz in die Hände der Chinesen übergegangen, denn der Europäer kann mit ihnen nicht konkurrieren. Der Bedarf an Kleidern und Schuhwerk für die dort ansässigen Europäer wird größtenteils von Chinesen geliefert, die sich auch in diesen Sachen als sehr flinke, verläßliche und äußerst anspruchslose Arbeiter erweisen. Für neue Kleider, Wäsche oder Schuhe Maß zu nehmen, ist nicht ihre[S. 68] Sache; aber sobald ich ihnen ein europäisches Kleidungsstück als Muster mitgab, verfertigten sie danach in der kürzesten Zeit genau das gleiche Kleidungsstück zu erstaunlich billigen Preisen. Ganze Anzüge aus guten europäischen Stoffen wurden mir in Shanghai und Singapore für zehn bis zwölf Silberdollars (nach dem gegenwärtigen Werte zwanzig bis fünfundzwanzig Mark) binnen vierundzwanzig Stunden geliefert. Nur muß in kleineren Orten darauf Bedacht genommen werden, diesen bezopften Kleiderkünstlern nicht etwa geflickte Kleider als Muster mitzugeben, weil das neue Kleidungsstück dann gewiß den gleichen Flickschaden an der gleichen Stelle zeigen würde.
Wie in den mohammedanischen Ländern, braucht man auch in China die Kinderschulen nicht lange zu suchen; schon aus der Ferne künden sie sich durch einen Heidenlärm an, und es ist geradezu erstaunlich, welches Geschrei die kleinen kahlrasierten sechs- bis achtjährigen Rangen entwickeln können. Gewöhnlich sitzen ihrer nicht mehr als zwanzig bis dreißig in einer Schule, aber man könnte glauben, sie wären von der zehnfachen Zahl, so kräftig sind ihre Lungen. Vom frühen Morgen bis nach Sonnenuntergang schreien sie sich ihre Kehlen aus, Tag für Tag, Monat für Monat, ohne sonntägliche Unterbrechung, ohne Ferienzeit, denn diese schönste Zeit der europäischen Schuljugend ist in China unbekannt. Zu Neujahr ist Schulanfang, und kurz vor dem nächsten Neujahr geht der Kursus zu Ende, um nach den Festlichkeiten neuerdings zu beginnen. So geht es drei, sechs, zehn Jahre lang, je nach der Schulbildung, welche die chinesischen Eltern ihren Söhnen zukommen lassen wollen. Ihren Söhnen allein, denn die Töchter sind im Reiche der Mitte von der Schulbildung ausgeschlossen. Sie gehören in das Haus, nicht ins Leben, und selten begegnet man einer Chinesin, die geläufig lesen und schreiben kann.
Bei meinen Spaziergängen durch Canton wollte ich auch diese chinesischen Kinderschulen kennen lernen, allein der Besuch eines Europäers hätte wohl Lehrer wie Schüler befangen gemacht. So trachtete ich, Gelegenheit zu erhalten, sie unbemerkt zu beobachten. Gegenüber einem der vielen gemauerten, mehrstöckigen Pfandhäuser, welche das Häusermeer der Zweimillionenstadt überragen, befand sich ein kleines, einstöckiges Häuschen. Das untere Stockwerk wurde von einem Kastenverfertiger eingenommen, der den ganzen lieben Tag an seinen Kisten und Kasten hämmerte. Das obere Stockwerk hatte er an einen Privatlehrer vermietet, der etwa zwanzig schlitzäugige Söhnchen des Himmels in den Lehren des Confucius unterrichtete. Mein Dolmetscher hatte von dem Pfandhausbesitzer die Erlaubnis für mich erwirkt, einen Vormittag im ersten Stock seines festen, turmartigen Gebäudes zubringen zu[S. 70] dürfen. Ich schloß die schweren Holzläden des der Schule gerade gegenüberliegenden Fensters und stellte mich an das Guckloch. Das Schulzimmer war nur etwa ein Meter von mir entfernt, und ich konnte es ganz übersehen.
Der Mentor war bereits am Werk: ein alter Mann mit ungeheurer Brille auf der Nase, über welche er beim Lesen hinwegguckte. Alle Lehrer, die ich später in anderen Städten zu sehen bekam, trugen Brillen, nicht etwa ihrer schlechten Augen wegen, sondern als Zeichen ihrer Gelehrsamkeit und größeren Autorität. Neben meinem Lehrer stand ein kleines Tischchen, auf dem sich ein langes elastisches Bambusröhrchen befand. Der Zweck desselben ist bekannt. Auch in Europa weiß es jeder Schuljunge. In einer Ecke der hinteren Wand stand etwa ein Meter hoch vom Boden ein spannenlanges Holztäfelchen, mit einigen chinesischen Schriftzügen bedeckt, wie mir mein Dolmetscher erklärte, zu Ehren des Confucius. In der anderen Ecke bemerkte ich eine scheußliche Fratze auf Papier gemalt, den Gott der Schulweisheit darstellend. Vor beiden standen mit Sand gefüllte Töpfe, in denen einige Räucherkerzchen glimmten. Der Rest der Schulstube wurde von etwa zwei Dutzend kleinen Tischchen und Stühlen für die Schüler eingenommen; die Jungen standen in Reihen vor dem Lehrer und schrieen laut die Sätze nach, die er ihnen aus einem kleinen Buche vorsagte. Dabei schlenkerten sie mit den Händen und tanzten von einem Fuße auf den andern, daß die langen Scheitelzöpfchen ihrer sonst kahlrasierten Schädel wie Uhrenpendel hin- und herbaumelten. In einer Hand trug jeder ein kleines rotes Zettelchen, mit einigen Schriftzeichen bedeckt, auf welche mitunter ein Blick geworfen wurde. Von Zeit zu Zeit kehrte die ganze bezopfte Gesellschaft zu ihren Sitzen zurück, augenscheinlich um das eben vom Lehrer Gehörte auswendig zu lernen. In sitzender Stellung konnten die Jungen nicht so gut mit den Beinen strampeln und die Arme bewegen, dafür schüttelten sie die Köpfe oder wiegten den Oberkörper hin und her und schrieen dabei nach Leibeskräften ihre Lektion herunter. Das verhinderte den bebrillten Lehrer aber nicht, allmählich einzuschlummern. Zuerst schien es, als würde er in dem vor ihm auf dem Schoße liegenden Büchelchen lesen; dann begann er mit dem Kopfe zu nicken, wie eine chinesische Porzellanfigur mit beweglichem Kopf, und endlich schlief er ganz fest, trotz des Gebrülles rings um ihn. Mitten während der Schulstunde trat ein verspäteter Schüler ein, was die anderen zu noch stärkerem Schreien veranlaßte. Der Lehrer erwachte. Zornig blickte er auf den kleinen putzigen Nachzügler, der schüchtern vor das Bild des Weisheitsgottes trat und sich davor auf die Knie werfend mit der Stirn den Boden berührte; dann bezeigte er dem Confuciustäfelchen und schließlich auch dem Lehrer die gleiche Verehrung. Aber dieser nahm den Jungen sehr ungnädig auf. Ihn bei den Kleidern packend, legte er ihn über seine Knie und drosch mit dem Bambusrohr recht unbarmherzig auf ihn los. Die anderen Schüler wagten es gar nicht, aufzublicken. Hatte einer von ihnen[S. 71] seine Lektion erlernt, so trat er vor den Lehrer, reichte ihm das rote Zettelchen und plapperte dann den Inhalt herunter, aber nicht mit der Vorderseite dem Lehrer zugewandt, wie bei uns, sondern mit der Kehrseite. Bei den Chinesen ist eben alles umgekehrt.
Die letzte Schulstunde wurde dem Schreiben gewidmet. Jeder Schüler hatte vor sich auf dem Tische ein kleines Schreibheft aus dünnem, durchscheinendem Papier, eine Tuschschale, ein Stückchen Tusche und einen Haarpinsel mit Bambusstiel. Der Lehrer verteilte kleine Schreibunterlagen mit einigen chinesischen Schriftzeichen; diese wurden unter das letzte Blatt des Heftes geschoben (die Chinesen schreiben bekanntlich von oben nach unten, von hinten nach vorn), und jeder Schüler malte nun mit schwarzer Tusche die durch das dünne Papier sichtbaren Schriftzeichen mit ziemlicher Gewandtheit nach, ohne daß sie dabei ihren Arm auf den Tisch legten, sondern ganz frei hielten. War eine Seite damit bedeckt, so wurde die Uebung auf der zweiten von neuem begonnen, während der Lehrer von Schüler zu Schüler schritt und die Reihenfolge der einzelnen auszuführenden Striche erklärte. Jedes der zahllosen Schriftzeichen der chinesischen Sprache besteht nämlich aus verschiedenen Strichen, viele darunter haben deren sogar dreißig oder mehr, und die unrichtige Stellung auch nur eines einzigen Striches würde den Sinn des ganzen Zeichens verändern. Ebenso ist es auch nicht einerlei, ob man das Zeichen von oben oder unten oder in der Mitte zu malen beginnt; der unrichtige Anfang erschwert das Malen des ganzen Zeichens, ähnlich wie es bei unserer Schrift der Fall ist, wenn wir ein Wort mit einem Buchstaben in der Mitte zu schreiben beginnen würden. Etwas nach zehn Uhr vormittags wurde der Unterricht für eine Stunde unterbrochen, die Jungen packten ihre Siebensachen zusammen und gingen[S. 72] nach Hause, nicht lärmend und schreiend und lachend, wie zuweilen unsere Schüler, sondern ernst und gravitätisch. Wieder die verkehrte Welt!
Die Schulstube war nun leer, und mein Dolmetscher führte mich hinüber. Die Tische und Sitze waren nicht beschmutzt, bekritzelt und zerschnitten, wie jene unserer Schulen, sondern von makelloser Reinheit. Auf dem Tische des Lehrers lag das Buch, aus welchem er seine Weisheit schöpfte, dasselbe Buch, das ich später in Shanghai, in Nanking und anderen Städten Chinas überall in Verwendung finden sollte und das den Chinesen seit tausend Jahren unverändert von Generation zu Generation als Urquell ihres Wissens dient. Ein Zeitgenosse Karls des Großen war sein Verfasser. Mit einer gewissen Ehrfurcht nahm ich das Buch zur Hand. In der chinesischen Schrift giebt es bekanntlich keine Buchstaben, sondern jedes Wort, jeder Begriff hat sein eigenes Zeichen. Immerhin ist es befremdend, daß die Tausende von Millionen chinesischer Schulkinder, welche seit dem neunten Jahrhundert nach diesem Lehrbuche unterrichtet worden sind, als ersten Anfang, unserem ABC entsprechend, gleich die philosophischen Lehren des Confucius eingetrichtert bekommen haben. Der erste Satz dieses Sant-tsz-king genannten Lehrbuches lautet nämlich folgendermaßen:
Da stand es in den eigentümlichen, verzwickten Hieroglyphen, jedes Zeichen eine Art Rösselsprung mit Strichlein und Punkten, dick und dünn, keilförmig oder gebogen, mit Quadrätchen und Dreiecken dazwischen, ohne irgendwelche Anleitung zur Erforschung des Rätsels, ein Dutzend Rösselsprungfiguren in vertikalen Reihen untereinander. Mein Dolmetscher sagte mir den Inhalt her, ohne die Zeichen auch nur anzusehen, denn ebenso wie jeder andere Chinese, vom Kaiser bis zum letzten Handwerker, hatte auch er als Kind dieses ABC des chinesischen Unterrichtswesens auswendig lernen müssen. Die Uebersetzung lautete:
Dann folgen gelehrte, tiefsinnige Sätze über die Notwendigkeit der Kindererziehung und die Art, wie sie erfolgen soll, endlich einige Fundamentallehren, z. B.:
„Es giebt drei Mächte — Himmel, Erde, Mensch.
Es giebt drei Lichter — Sonne, Mond und Sterne.
Es giebt drei Bande — zwischen Fürst und Beamten: Gerechtigkeit, zwischen Sohn und Vater: Liebe — zwischen Mann und Weib: Eintracht.
Menschlichkeit, Gerechtigkeit, — Anstand, Weisheit, Wahrheit:
diese fünf Kardinaltugenden muß man beachten.
Reis, Hirse, Hülsenfrüchte, Weizen, Roggen und Gerste —
sind sechs Lebensmittel, mit denen die Menschen sich ernähren.
Gegenseitige Liebe zwischen Vater und Sohn, Eintracht zwischen Mann
und Weib, vom älteren Bruder Güte, vom jüngeren Bruder Achtung;
Ordnung zwischen älteren und jüngeren Leuten, Freundschaft zwischen
Gefährten, vom Fürsten Rücksicht und vom Minister Treue:
diese Pflichten sind allen Menschen auferlegt”.
Dieser Art sind die Sätze, welche alle chinesischen Jungen auswendig zu lernen haben, ohne auch nur ein Wort davon wirklich zu verstehen, denn sie sind in der alten klassischen Sprache der Chinesen verfaßt, die von den vielen Dialekten, wie sie heute in dem ungeheuren Lande gesprochen werden, mitunter ebenso verschieden ist, wie etwa Lateinisch vom Deutschen. Der Unterricht der Chinesen beginnt also etwa ebenso, als würde man unseren des ABC unkundigen Schülern einen lateinischen Klassiker, etwa Cicero, in die Hände geben und z. B. mit dem Satz beginnen:
wobei man ihnen sagt, wie die einzelnen Wörter ausgesprochen werden. Aehnlich hat es ja wirklich der Dichter des Verlorenen Paradieses, der blinde Milton gethan, der sich von seinen Töchtern lateinisch vorlesen ließ, ohne daß sie selbst ein Wort davon verstanden; aber sie kannten doch zum mindesten die Buchstaben und ihre Zusammensetzung zu Wörtern; nach der chinesischen Lehrmethode aber müssen die Kinder das Wort nicht nach den einzelnen Schriftzeichen, aus denen es besteht, sondern nach seinem allgemeinen Aussehen erkennen und die Aussprache wissen, ohne auch nur von einem den Sinn, die Bedeutung zu verstehen. Wie geplagt müßte ein europäischer Schriftsetzer sein, der, ohne jemals ein chinesisches Schriftzeichen gesehen zu haben, ein chinesisches Buch in Typen setzen sollte! Aber er wäre noch glücklich zu preisen im Vergleich zu den jugendlichen Söhnen des Reiches der Mitte, welche außerdem noch die Aussprache jedes dieser Tausende und Abertausende von Schriftzeichen kennen müssen.
Tausende und Abertausende von Zeichen! Mit jenen des San-tsz-king ist es nämlich lange nicht abgethan. Denn auf dieses erste Lehrbuch folgt ein zweites mit ähnlichem Inhalt und tausend Wortzeichen, von denen nicht zwei in Aussprache oder Bedeutung einander gleich sind. Das Buch stammt aus dem Jahre 550 nach Christi Geburt, also aus der Zeit der Langobardenzüge über die Alpen. Und haben die chinesischen Jungen auch dieses von Anfang bis zu Ende auswendig gelernt, so müssen sie dasselbe mit den vier Büchern und fünf Klassikern thun, welche die großen Schätze der chinesischen Litteratur enthalten.
Der dritte Band der fünf Klassiker, Lun-yü, enthält die wichtigsten Gespräche von Confucius und darunter auch das in Deutschland so viel gebrauchte Sprichwort: „Was du nicht willst, das man dir thut, das thue auch den anderen nicht”.
In diesen sogenannten neun heiligen Büchern befinden sich 4601 verschiedene Wortzeichen, von denen manche, wie gesagt, bis zu dreißig verschieden gestellte[S. 75] Striche, Punkte, Keile enthalten, wobei die falsche Stellung eines einzigen den Sinn des ganzen Zeichens ändert. Die chinesische Schriftsprache enthält im ganzen gegen 200000 verschiedene Wortzeichen, von denen jedoch die größte Zahl veraltet ist. Das große Wörterbuch von Kang-hyi enthält 44449 der gebräuchlichsten.
Erst wenn die Jungen eines dieser Bücher nach dem anderen auswendig gelernt haben, erfolgt die Erklärung des Sinnes durch den Lehrer, wobei gewöhnlich die Kommentare von Tschu-fu-tze benützt werden, welche zur Zeit der Kreuzzüge geschrieben wurden. Das ist das Um und Auf des Wissens, welches der chinesischen Jugend beigebracht wird. Mathematik, Geographie, Geschichte, Religion, ihre eigene Umgangssprache, irgend welche praktische Wissenschaften sind dem chinesischen Lehrplan absolut unbekannt, und selbst Leute, welche von den Chinesen als die größten Gelehrten angesehen werden, haben häufig nicht die leiseste Ahnung von der Lage der Kontinente, geschweige denn der einzelnen Länder. Alles, was jenseits der Grenzen des himmlischen Reichs liegt, heißt einfach Barbarei, und nur die Mandarine, welche in den offenen Häfen Dienst thun, kennen die Bedeutung, wenn auch nicht die Lage von Deutschland, England, Rußland. In all diesen Dingen, welche bei uns jedem Schuljungen der ABC-Klassen geläufig sind, herrscht eine ebensolche Unkenntnis wie etwa bei unseren ABC-Schülern über Confucius. In China giebt es keinen staatlichen Unterricht, keine Staats- oder städtischen Schulen, Schulzwang, Schulklassen, Diplome, Schulferien und Prüfungen, ausgenommen die allgemeinen Wettprüfungen für die Beamtenstellen. Aber dennoch hat jede Stadt, jedes Dorf eine bestimmte Anzahl von Privatschulen, welche gewöhnlich von durchgefallenen Prüfungskandidaten für Beamtenposten unterhalten werden. Sie erheben von den Schülern ein jährliches Schulgeld von zwei bis fünf Taels (etwa sechs bis fünfzehn Mark), was ihnen bei einer Schülerzahl von zwanzig bis vierzig ein spärliches Jahreseinkommen von hundert bis hundertundfünfzig Taels, oft auch weniger, gewährt, also ein ähnliches Schullehrerelend wie in Ländern, die uns näher liegen. In größeren Städten kommt es häufig vor, daß die wohlhabenderen Einwohner einer Straße oder eines Stadtviertels sich zusammenthun und einen eigenen Lehrer zum Unterricht für ihre Kinder nehmen, zuweilen geschieht dies auch von einzelnen reichen Familien allein, oder von kaufmännischen Zünften, welche gewöhnlich einen Raum ihres Zunfthauses oder Klubs für Schulzwecke einrichten. Auch die in China sehr ausgebreitete Wohlthätigkeit hat viele Schulen geschaffen, aber der Unterricht ist in allen derselbe. Auch in den höheren Schulen, welche in manchen Großstädten, wie z. B. in Canton, Shanghai, Tientsin, in den letzten Jahrzehnten entstanden sind, giebt es keine anderen Lehrbücher; die wichtigste Fertigkeit, die dort gelehrt wird, ist der elegante Stil, die Dichtkunst und Korrespondenz; bei der letzteren kommt es aber nicht darauf an, eigene Gedanken leicht und klar niederzuschreiben, sondern die größtmögliche Zahl stereotyper Wendungen und Floskeln[S. 76] auswendig zu lernen, in welchen der Schreiber sich und seine Familie möglichst herabzusetzen, die Person des Adressaten in den übertriebensten Ausdrücken herauszustreichen sucht. Auch die neugegründeten Hochschulen und Universitäten in Peking, Tientsin, Nanking sind keineswegs als solche aufzufassen, doch gehen sie weiter als die gewöhnlichen chinesischen Schulen und zeigen Mathematik, Geographie, Geschichte und vor allem moderne Sprachen unter ihren Lehrfächern. Soll ein Junge in Arithmetik, in verschiedenen Künsten und Fertigkeiten ausgebildet werden, so wird er nach mehrjährigem Besuch einer der oben geschilderten Schulen zu einem Handelsmann oder Gewerbetreibenden in die Lehre gegeben. Was er ins Leben an Kenntnissen mitbringt, sind Lesen und Schreiben, aber auch das nur in beschränktem Maße, das desto größer wird, eine je größere Zahl von Jahren er in einer Schule Unterricht genossen hat. Die unteren Stände begnügen sich damit, ihre Jungen zwei, drei Jahre in die Schule zu schicken, Gärtner, Bootsleute, Kulis, Lastträger thun auch das nicht. Im allgemeinen kann man annehmen, daß etwa dreißig Prozent mindestens ihren Namen schreiben und die einfachsten Aufschriften, Firmenschilder und dergleichen lesen können, etwa zehn bis zwanzig Prozent, je nach der Provinz, können einfache Briefe schreiben, und nur vielleicht fünf Prozent beherrschen die Sprache und Litteratur einigermaßen. Sie genießen dafür aber auch bei ihren Mitbürgern das größte Ansehen.
Nach dem Buch der Gebräuche, das seit vielen Jahrhunderten von den Chinesen nach Thunlichkeit befolgt wird, soll der Knabe im siebenten Lebensjahr die Kardinalpunkte des Wissens und das Zählen lernen; aber es darf ihm nicht gestattet werden, auf derselben Matte (mit den Eltern) zu sitzen, oder an demselben Tische zu essen; im achten Jahre muß ihm gelehrt werden, Näherstehende zu bedienen und anderen vor sich selbst den Vorrang zu lassen; mit zehn Jahren muß der Knabe zu Privatlehrern in die Schule geschickt werden und dort Tag und Nacht bleiben, um Arithmetik und Schreiben zu lernen; er muß dort einfache Kleider tragen und sich anständig, aufrichtig und zweckentsprechend benehmen. Mit dreizehn Jahren soll der Knabe sich mit Musik und Dichtkunst befassen; mit fünfzehn Bogenschießen und militärische Künste lernen. Dann ist er mit zwanzig Jahren so weit, um als Mann ins Leben zu treten und noch mehr Anstandsregeln zu lernen, sowie seinen Kindes- und Geschwisterpflichten treu nachzukommen; mit dreißig Jahren soll er heiraten und die Leitung von Geschäften übernehmen; mit vierzig Jahren kann er in den Staatsdienst eintreten, und wenn der Landesfürst seine Regierungspflichten mit Weisheit erfüllt, soll er ihm treu dienen, sonst nicht. Mit fünfzig Jahren kann er zum Rang eines Ministers erhoben werden, und mit siebzig Jahren muß er sich ins Privatleben zurückziehen.
Diese Vorschriften lesen sich sehr schön, aber mit ihrer Ausführung kann es natürlich nicht sehr genau genommen werden. Immerhin steht der Lebenslauf der[S. 77] Chinesen trotz der einseitigen Schulbildung auf einer viel höheren Stufe, als es gewöhnlich angenommen wird. Dank ihrer guten und strengen häuslichen Erziehung und ihrer Beobachtungsgabe lernen sie zu Hause von praktischen Dingen vielleicht ebensoviel wie in den Schulen von den alten Klassikern, und das Auswendiglernen der letzteren stärkt ihr Gedächtnis in hervorragender Weise. Welch große Fähigkeiten in der jungen Welt Chinas schlummern und nur geweckt zu werden brauchen, zeigt der überraschende Erfolg und das rasche Vorwärtskommen jener, welche in den vielen christlichen Missionsschulen Chinas, in den von Europäern geleiteten Schulen in den offenen Vertragshäfen, dann in jenen der ostasiatischen Kolonien erzogen werden. Ich habe deren in Shanghai, Hongkong, Batavia und vor allem in Singapore besucht, und die Lehrer waren des Lobes voll über die Lernbegierde und das verhältnismäßig rasche Auffassungsvermögen der chinesischen Schüler. Am meisten Gelegenheit, dies zu beobachten, bietet wohl das großartig angelegte, reich ausgestattete Raffle’s Institute in Singapore, wo ich selbst mehrere Tage in den verschiedenen Klassen unter mehreren Hunderten chinesischer Schüler zubrachte. Junge Chinesen, welche in europäischen oder amerikanischen Lehranstalten ausgebildet wurden, haben ihre Lehrer in Erstaunen gesetzt und bei den Prüfungen die besten Studenten der kaukasischen Rasse in mancher Hinsicht übertroffen.
In den ersten Tagen meines Aufenthalts in Canton machte ich die Bekanntschaft eines der reichsten und vornehmsten Kaufherren der chinesischen Millionenstadt und stattete ihm in seinem aus Dutzenden von Hallen und Häusern bestehenden Heim meinen Besuch ab. Kaum war ich wieder in mein Hotel, auf der Insel Shameen gelegen, zurückgekehrt, so fand sich auch schon ein langbezopfter Bote mit einem großen roten Papierblatt bei mir ein, auf welchem einige chinesische Hieroglyphen verzeichnet waren. Mein Dragoman las: „Am sechsten Tage des Mai wird ein bescheidenes Fest das Licht deiner Gunst erwarten. Grüße von T. T.” — also eine Dinereinladung, wie ich sie gewünscht hatte. Nur war die Stunde nicht angegeben. Mein Dolmetscher erklärte mir, diese würde später mitgeteilt werden. Am Morgen des sechsten Mai erschien in der That wieder ein Diener mit einer zweiten roten Karte, auf welcher die Speisestunde, sieben Uhr abends, angegeben war.
Als ich eine halbe Stunde früher im Begriff stand, meine Sänfte zu besteigen, erschien ein Abgesandter meines Gastgebers, um mich nach dessen Haus zu geleiten. Am Eingange zu seiner mit einer hohen grauen Ziegelmauer umschlossenen Wohnung empfing mich der Wirt in eigener Person mit einer tiefen Verbeugung, indem er gleichzeitig die zusammengeballten Hände zur Stirn erhob. Er war in einen langen Talar von schwerer Seide gekleidet und trug auf seinem bezopften Haupte den schildförmigen Tatarenhut mit langer roter Seidenquaste. In seinem Empfangssalon, geschmückt mit herrlichen Ebenholzschnitzereien, Lampions und Vasen mit künstlichen Blumen, befanden sich bereits einige chinesische Gäste, sowie ein junger Engländer, der mit mir auf demselben Schiffe nach Canton gekommen war. Wir wurden allen Anwesenden vorgestellt, und diese beeilten sich, die gewöhnliche Frage an uns zu richten, welches denn unser „ehrenwertes” Alter wäre. Vor mir, dem Vierziger, machten die Zopfträger tiefere Verbeugungen als vor dem viel jüngeren Engländer. Natürlich mußten auch wir uns nach dem ehrenwerten Alter der Chinesen erkundigen. Mr. Clark, mein Engländer, schien überrascht, als unser Gastherr ihm sein Alter als Sechziger nannte, und auf die Frage nach der Ursache seines Staunens ließ Clark ihm sagen, er sähe viel jünger aus, er hätte ihn nicht für so alt gehalten. Konsternation auf allen Gesichtern. Diese europäische Höflichkeitsäußerung zog hier entschieden nicht, Clark hätte besser gethan, ihm zu sagen, daß er ihn für einen Achtziger hielte. Während es in Ländern, die uns Europäern[S. 79] näher liegen, Sitte sein soll, daß besonders die Damen von ihrem Alter einige Jährchen abzwacken, hören es die Chinesen sehr gern, wenn man ihnen ein paar Jahre mehr giebt.
Sieben Uhr. Schon hatten wir auf Damengesellschaft verzichtet, als plötzlich aus dem benachbarten Raum sechs höchst elegant gekleidete junge Damen trippelten, mit Füßchen kaum so lang wie mein Zeigefinger, mit Perlenschnüren und Schmetterlingen in dem glattgekämmten, glänzend pomadisierten Haar, weißgeschminkten Gesichtern und brennroten Lippen, reizende kleine Wesen, deren Erscheinen sofort alle Gesichter aufheiterte. Hinter ihnen schritten ebensoviele noch jüngere Mädchen in einfacherer Kleidung einher, die an der Thür stehen blieben. Jede hielt eine Wasserpfeife und eine glimmende Lunte in der Hand. Sie waren die Dienerinnen der Damen.
Der Ausdruck Dame ist hier nicht recht gewählt, denn die Frauen der Chinesen sind bei den Mahlzeiten, an denen andere Männer, ob Chinesen oder Europäer, teilnehmen, niemals zugegen. Da aber die Bewohner des Reiches der Mitte sich bei solchen Festlichkeiten auch gern unterhalten, so ziehen sie an Stelle ihrer Frauen öffentliche Sängerinnen bei, von jener Sorte, die nach unseren Anschauungen den Namen Dame nicht verdienen. Nicht etwa, daß sich die anwesenden Chinesinnen irgend welche Freiheiten in der Toilette oder im Benehmen gestattet hätten. Beileibe nicht. Ihre langen, blauseidenen Gewänder, über und über mit den köstlichsten Stickereien bedeckt, reichten vom Halse bis an die Knöchel, und niemals würde sich bei solchen Gelegenheiten auch die Schlimmste dieser „Blumen” nur halb so viel Toilettefreiheiten erlauben wie unsere Damen der Gesellschaft. Die sechs Blumen unserer Tafelrunde gebärdeten sich sittsam und bescheiden, und als endlich der Gastherr uns einlud, den Speisesaal zu betreten, trippelten sie alle zusammen uns Männern nach. In China würde es für Verrücktheit oder gar Unverschämtheit angesehen, wollte man einer Dame den Arm reichen, um sie zu Tisch zu führen.
Der Speisesaal war ein geräumiges, hohes Gemach, dessen eine Wand ganz aus kuriosen, durchbrochenen Ebenholzschnitzereien bestand, mit runden, weiten Oeffnungen, durch die wir den schönen Garten und Lotosteich des Gastherrn sehen konnten. Die Tafel stand der gegenüberliegenden Seite etwas näher und war zickzackförmig angeordnet; die Sitze befanden sich aber nur an der äußeren Langseite, sowie an den Stirnen, während die innere Langseite frei blieb. Den chinesischen Gastmahlzeiten pflegen nämlich Vorstellungen von Sängerinnen, Zauberkünstlern und dergleichen zu folgen, und eine vollständige Besetzung der Tafel würde den Ausblick auf dieselben verhindern. Große farbige Laternen hingen an Seidenschnüren von der Decke; die Wände bedeckten lange Papierstreifen mit Inschriften und Sinnsprüchen, und rings um den Saal waren kleine Ebenholztischchen aufgestellt mit ebensolchen, schön geschnitzten Stühlen zu beiden Seiten. Auf einem dieser Tischchen stand ein großer Kohlenbehälter mit einem Kessel darüber für den Wein, ein anderer größerer Tisch diente als Serviertisch, dicht besetzt mit Schalen, Schüsseln und Täßchen.
Es war köstlich anzusehen, unter welchen Verbeugungen und Zeremonien die Gäste Platz nahmen. Der Hausherr hatte mir den Ehrenplatz zu seiner Linken angewiesen; die Höflichkeit erfordert es, zu warten, bis der Gastgeber Platz genommen hat, er aber lud seinerseits wieder die anderen Teilnehmer zum Sitzen ein, und es vergingen einige Minuten, ehe die Verbeugungen ihr Ende erreichten. Mir zur Linken hatte eine der kleinen Dämchen Platz genommen, die fortwährend kicherte und mit ihren Kolleginnen Bemerkungen austauschte, die wohl uns Fremde betrafen. Der Tisch war über und über mit Speisen und Blumen bedeckt; große Schüsseln mit Enten, Schinken, Gemüsen und Früchten, und über jede Schüssel waren noch Blumen gestreut. Die herrlichen Blumenvasen, Schüsseln, kleinen Thee- und Wein[S. 81]täßchen, die vor jedem Gaste standen, waren aus feinstem Porzellan. Zu meinem Schrecken bemerkte ich, daß neben meinem Tellerchen nicht Messer und Gabel, sondern nur Chop Sticks lagen. Weiß der geneigte Leser, was Chop Sticks sind? Die Chinesen ebenso wie die Japaner essen nur mit zwei etwa zwanzig Centimeter langen Stäbchen, die den Netznadeln unserer Damen so ziemlich gleichen. Gewöhnlich sind sie aus Holz geschnitzt, in diesem Falle waren sie aus Elfenbein und hatten überdies noch hübsch ciselierte silberne Köpfe. Aber was nützte mir das kostbare Material, da ich auf ihren Gebrauch noch nicht eingedrillt war? Die Chinesen nehmen zwei Sticks in eine Hand, derart, daß der Mittelfinger zwischen ihnen liegt, und handhaben sie so geschickt, daß sie selbst einzelne Reiskörner damit aufnehmen können. So haben sie es schon vor Jahrtausenden gethan, während unsere Vorfahren noch im siebzehnten Jahrhundert mit den Fingern aßen und keine Teller kannten. Wem kommt nicht die Verordnung der großen Kaiserin Maria Theresia in den Sinn, in welcher sie den Offizieren verbot, an der Hoftafel mit den Fingern zu essen, oder sich die Nase am Rockärmel abzuwischen? Und doch machte ich diesmal den Chinesen im stillen einen Vorwurf daraus, daß sie noch keine Gabeln besaßen, denn wie sollte ich denn all die guten Dinge essen? Sollte ich wie Ludwig XIII. von Frankreich auch die Finger gebrauchen? Die Antwort gab mir mein Gastherr selbst, indem er zu Beginn der Mahlzeit seinen kleinen Porzellanbecher mit warmem Reiswein, Samschu, d. h. dreimal gebrannt, zur Hand nahm und erklärte, er hätte auf meinen Wunsch dieses Gastmahl veranstaltet, um mir Gelegenheit zu geben, die chinesische Küche kennen zu lernen. Dazu gehörten auch die Chop Sticks. Er hoffe, ich werde dieselben noch recht häufig in seinem Hause gebrauchen. Darauf leerte er sein Schälchen Wein, und sich gegen mich verneigend drehte er das Schälchen in seiner Hand um. In ähnlicher Weise zeigten mir auch die anderen Gäste ihre geleerten Samschuschälchen, und ich mußte selbstverständlich das gleiche thun. Der Geschmack des Weines war wie lauwarmer scharfer Sherry.
Neben meinem winzigen Tellerchen lag glücklicherweise noch ein Löffel von Porzellan und Silber, in seiner Form einem kleinen Kochlöffel nicht unähnlich; an Stelle der Serviette hatte jeder Gast einige bedruckte Papierblättchen, wie sie durch die Japaner auch in Europa bekannt geworden sind, nur kleiner, denn sie dienen nicht als Serviette, sondern zum Abwischen der Eßstäbchen, die während der Mahlzeit nicht gewechselt werden. Die schmutzigen Papierchen werden einfach unter den Tisch geworfen. Vor jedem Gast stand überdies ein kleines silbernes Schälchen für Gewürze und ein zweites aus schönem blauen Porzellan für Soya, eine Gewürzsauce, die bei den wenigsten Mahlzeiten fehlt.
Ich hatte schon gefürchtet, daß die schönen Schinken und Gänse, die vor uns in so leckerer Weise den Tisch zierten, die Mahlzeit bilden würden; gefürchtet deshalb, weil ich ja kein Messer zum Zerschneiden der Speisen hatte. Ich wurde aber[S. 82] eines Besseren belehrt, als die Diener jedem einzelnen Gaste aus der Küche kommende Speisen, schon in winzige Stückchen zerschnitten, in kleinen Porzellanschälchen vorsetzten. Was diese Fleischstückchen wirklich waren, konnte ich wegen der dicken verschiedenfarbigen Saucen, in denen sie schwammen, nicht ausfinden. Vergeblich bemühte ich mich, mit Hilfe meiner Stäbchen einzelne Stückchen herauszufischen, zum höchsten Gaudium der kleinen Mädchen, bis sich endlich mein Gastgeber erbarmte und ein Stückchen mit den von ihm benutzten Stäbchen aus seiner Schale nahm und mir in den Mund schob; er that dies nicht sowohl um mir zu helfen, sondern weil dies bei den Chinesen auch als besondere Auszeichnung gilt. Es war nicht gerade appetitlich, aber „in Rome, one must do as the Romans do”. Der Geschmack war süßlich, ölig und so widerwärtig, daß ich den Ehrenbissen am liebsten wieder von mir gegeben hätte. Aber wie konnte ich die Gastfreundschaft so verletzen! Also herunter damit. Hätte ich nur ein Gläschen Wasser gehabt! Mit Verlangen blickte ich auf die schönen Orangen und Leitschis und Mangos, die vor mir aufgetürmt waren, dabei war ich hungrig wie ein Wolf und konnte es doch nicht über mich bringen, einen zweiten Bissen hinunterzuwürgen. Vielleicht brachte der nächste Gang, der uns etwa vorgesetzt wurde, etwas Besseres. Abermals Fleischstückchen, abermals Sauce, aber so sehr mit Knoblauch versetzt, daß ich mich mit einem geschickt erwischten Bissen begnügte. Ich hoffte über diesen zweiten Gang dadurch hinwegzukommen, daß ich recht lange mit meinen Stäbchen herumfischte. Ja, wenn nur meine holde Nachbarin nicht gewesen wäre! Kichernd beobachtete sie meine Versuche, dann erbarmte sie sich meiner, der ich dieses Erbarmen gar nicht wollte. Sie nahm ein Stückchen aus ihrer Schale und schob es mir in den Mund. So wurde ich auch während der folgenden Gänge bald von rechts, bald von links gefüttert, mein Schälchen Reiswein wurde immer wieder halbgeleert weggenommen und durch ein neues, gefülltes ersetzt. Nun bemerkte ich erst, auf welche Weise dies geschah: Auf einem Seitentischchen standen zwei Weingefäße in heißer Kohlenasche. Die halbgeleerten Schalen wurden bei jedem Gange vom Tische genommen und die Reste in das eine Gefäß zusammengegossen; dann wurden die Schalen aus dem anderen wieder gefüllt. War dieses leer geschöpft, so holte sich der Mundschenk den Wein aus dem anderen Gefäß, in welchem die zusammengeschütteten Reste mittlerweile wieder warm geworden waren.
Neun Uhr. Immer noch wurden neue Gerichte aufgetragen, es mochte wohl der zwölfte oder vierzehnte Gang dieses Banketts sein, und gar keine Aussicht auf ein baldiges Ende. Die Geschichte war recht langweilig. Mein Nachbar zur Rechten schob mir unter höflichen Verneigungen immer neue Bissen in den Mund, meine Nachbarin zur Linken kicherte fröhlich weiter und trank mir zu. Die anderen Gäste begannen ihre Befriedigung über die gebotenen Leckerbissen in einer Sprache zum Ausdruck zu bringen, zu der man keine chinesische Grammatik braucht, biedere,[S. 83] kräftige Naturlaute, die so recht von Herzen zu kommen schienen. Es war aber auch gar nicht anders möglich auf die vielen Zwiebeln, Knoblauch, die verschiedenen Oele, Fette, Wurzeln, Gemüse, Kräuter, Suppen, Leckereien, Präserven, Saucen, Fleisch- und Fischstückchen und den warmen Wein. Meine Odaliske bestand fest darauf, mit mir zu konversieren. Sie fragte mich die allermerkwürdigsten Dinge, die von ihrem Nachbar zur Linken, meinem Dolmetscher, in erbärmliches Englisch übertragen wurden. Ich suchte meine Antworten durch Kopfnicken und Zeichen aller Art auszudrücken, um nicht meinen Dolmetscher durch englische Antworten in Verlegenheit zu bringen. Sprach ich wirklich mit ihm, so lachten die Dämchen alle laut auf und schrieen yes, yes, was es nur Platz hatte. Clark benutzte fortwährend das Taschentuch, um die in seinen Mund geschobenen Bissen auf unmerkliche Weise zu beseitigen. Sein ganzes Diner mußte unter dem Tische liegen.
Die Hitze, der odeur chinois, der in dem Raume herrschte, der warme Wein, die Gerüche der Speisen hatten den Aufenthalt für uns zwei Kaukasier geradezu unerträglich gemacht, und wir ermunterten uns gegenseitig durch Zeichen, den Tisch für einige Augenblick zu verlassen. Der Gastherr schien diese Zeichen zu verstehen, denn er selbst stand nun auf und sprach unter einer Verbeugung gegen mich einige Worte, auf welche die ganze Gesellschaft sich von den Sitzen erhob. Endlich! Erleichtert sprangen wir auf unter dem Eindruck, die Sache wäre beendigt. Zeremoniös kam aber der Dolmetscher auf mich zu, um mir zu sagen, der Hausherr wünsche uns Gelegenheit zu geben, die jungen Damen, ausgezeichnete Sängerinnen Cantons, zu hören und ein paar Pfeifen Tobak zu rauchen; dann würden wir das Diner fortsetzen. Welcher Schrecken! Es stand uns also noch eine zweite Auflage Knoblauch und Zwiebel, Oel und Fett bevor! Wir begaben uns in den anstoßenden Raum, wo die Dienerinnen der Dämchen uns die eigentümlichen[S. 84] Wasserpfeifen der Chinesen zu rauchen gaben und langbezopfte Aufwärter schön servierten. Jeder von uns erhielt ein kleines Theetäßchen ohne Henkel, aber wie eben in China alles verkehrt ist, so stand auch das Täßchen nicht auf der Untertasse, sondern die letztere lag umgekehrt auf dem Täßchen und deckte dasselbe zu. Die Aufwärter hoben diesen Deckel auf, schütteten einige graue Theeblätter in das Täßchen, gossen kochendes Wasser darüber und legten die Untertasse wieder auf. Wollten die Gäste den Thee trinken, so faßten sie die heiße Tasse so, daß sie mit den Fingern gleichzeitig die obenliegende Untertasse ganz wenig zurückschoben und so festhielten. Durch den offenen Spalt wurde der Thee mit einem Male ausgeschlürft, während die Theeblätter durch den Deckel zurückgehalten wurden. Sahne und Zucker werden in China zum Thee nicht verwendet, bei der vorzüglichen Qualität der Theeblätter durchaus kein Nachteil.
Als die Sängerinnen ihre monotonen, fortwährend zwischen Dur und Moll einherschwebenden Gesänge unter Guitarrebegleitung abgeleiert hatten, ließ der Gastherr einen chinesischen Taschenspieler seine in der That merkwürdigen Kunststückchen ausführen. Die Abwechselung war uns sehr willkommen, denn das pehng, pehng, pit, pit, pit des Guitarregezupfes war nicht länger zu ertragen. Gern hätten wir uns nach den Vorführungen des Taschenspielers verabschiedet, um dem zweiten Teil des Diners zu entgehen, aber der Gastherr ließ uns durch den Dolmetscher sagen, er hätte gerade für dieses zweite Diner einige chinesische Delikatessen, Schwalbennestsuppe und Haifischflossen, zubereiten lassen, und so folgten wir denn wieder der bezopften Gesellschaft in den Speisesaal. Es war zehn Uhr, und während der ganzen folgenden Stunde wurden uns wieder ein Dutzend Gänge der verschiedensten Art vorgesetzt: Entenzungen, Schweinsmaul, Garnelen mit Knoblauch und Zucker zubereitet, kleine Fischchen mit eingemachten Fichtenzäpfchen, geröstete Lilienwurzeln, Fischhirn mit Pilzen und anderes. Wo das Englisch meines Dolmetschers zur Erklärung der Speisen nicht ausreichte, zeichnete er mir die betreffenden Dinger auf eine Papierserviette. Eine fade schmeckende Speise, die wie Kalbskopf nach Schildkrötenart zubereitet aussah, wurde mir endlich als die berühmten Schwalbennester bezeichnet; beim nächsten Gang bekamen wir in kleinen Schälchen eine schwärzliche Gallerte vorgesetzt, in welcher dunkelrote Eidotter staken; die Gallerte, von der ich ein Stück mit einem Stäbchen aufspießte, schmeckte uns doch so sehr nach Schwefelwasserstoffgas, daß ich mich desselben sofort wieder entledigte; mein Nachbar zog erstaunt die Augenbrauen in die Höhe, der Dolmetscher machte ein wichtiges Gesicht und meinte: „vely good, that vely old egg” „sehr gut, das sehr altes Ei” (ich schreibe vely und nicht very, weil der Chinese das r nicht aussprechen kann und statt r stets l anwendet). Sehr altes Ei! Ich erfuhr die Zubereitung dieser Eier aus einem chinesischen Kochbuch. Vielleicht ist sie unseren Köchinnen von Nutzen: Aus Holzasche, Kalk, Salz, Wasser und einigen aromatischen Kräutern wird ein dicker Brei[S. 85] bereitet, in welchen die frisch gelegten Eier gelegt und darin unter hermetischem Verschluß vierzig Tage lang aufbewahrt werden. Dann sind sie schon genießbar, aber je länger sie liegen bleiben, desto besser werden sie nach chinesischen Begriffen, gerade so wie unsere Weine, und ein mehrere Jahre altes Ei ist das Nonplusultra einer Delikatesse. Solche Eier waren es, die wir vorgesetzt bekamen!
Indessen, es ist doch alles Geschmacksache auf unserer Erde. Ich forderte meinen Dolmetscher auf, mir die Bemerkungen meines Gastfreundes mitzuteilen, und er antwortete, der letztere hätte gehört, die Europäer äßen Käse aus Milch von Kühen, Eseln und Schafen zubereitet. Sie ließen diese Käse auch so lange liegen, bis sie schimmlig würden und noch viel schlimmer stänken als diese Eier; wie es denn käme, daß wir gerade die alten Eier schlecht fänden. Ich mußte ihm darauf meine Antwort schuldig bleiben.
Nach einigen Suppen, mit wohlriechenden Oelen versetzt und gekochten Nudeln darin, kam eine Speise, die aus dünnen, weichen Knorpeln zubereitet schien und[S. 86] gar nicht so schlimm mundete. Das waren die berühmten Haifischflossen, von denen nicht etwa das Fleisch, sondern nur die weichgekochten Gräten gegessen werden. Die Pausen zwischen den einzelnen Gängen stillten die anscheinend noch immer hungrigen Gäste damit aus, daß sie fortwährend getrocknete Melonenkerne knabberten, die in kleinen Schüsselchen vor ihnen standen, ebenso wie man bei englischen Mahlzeiten mit Salz gebrannte Mandeln knabbert. Eine Speise, die bei großen Banketten in China gewöhnlich auf den Tisch kommt, Fisch in Ricinusöl gebacken, fehlte glücklicherweise diesmal, daß sie aber thatsächlich serviert wird, geht aus den übereinstimmenden Mitteilungen der Chinareisenden hervor. Ich habe vier Jahre später in Tsiho, an der Südgrenze von Petschili, am Hoangho, auch Kuchen vorgesetzt bekommen, die in Ricinusöl gebacken waren[1].
Auch bei diesem Diner bewahrheitete sich das Sprichwort: „Das Letzte ist das Beste”. Es kam in Gestalt einer dampfenden Schüssel gekochten Reises, der uns vorzüglich mundete. Damit war die Mahlzeit beendet. Es war elf Uhr geworden, und wir verabschiedeten uns mit herzlichem „Tschin-Tschin” (Heil, Heil!) von unserem Gastgeber und den übrigen Anwesenden. In unser Hotel zurückgekehrt, ließen wir uns noch eine Flasche Bier und ein Stück Roquefortkäse gut munden, denselben Käse, den die Chinesen so sehr verschmähen, und der bei uns als Delikatesse gilt. Andere Länder, andere Sitten.
Wie ich nachher auch in anderen Städten erfuhr, spielen sich die Festmahlzeiten der Chinesen, auch jene der Regierungsmandarine in Peking, in ähnlicher Weise ab wie das geschilderte. Speisen sie allein oder doch nur in Gesellschaft näherer Freunde, so sind die Mahlzeiten selbstverständlich viel einfacher, ja, es giebt selbst in Ostasien kaum eine Nation, die genügsamer und einfacher wäre wie eben die Chinesen. Nur die Wohlhabenden und die Mandarine gestatten sich zuweilen den Luxus eines derartig großartigen Banketts, dessen Speisen unter gewöhnlichen Verhältnissen hinreichen würden, das Menü für einen ganzen Monat zu füllen.
[1] Siehe Hesse-Wartegg, „Schantung und Deutsch-China”, Leipzig, J. J. Webers Verlag, 1900.
Wem kämen beim Lesen der vorstehenden Ueberschrift nicht Ratten, Mäuse, Katzen und Regenwürmer in den Sinn? Wer hat nicht schon gehört, daß diese und andere Dinge zu den Leibspeisen der bezopften Söhne des Reiches der Mitte zählten? Als ich zuerst meinen Fuß auf chinesischen Boden setzte, graute mir vor den verschiedenen Leckerbissen, die ich im Laufe meiner Reisen möglicherweise vorgesetzt bekommen würde, und ich nahm mir fest vor, kein Ragout, keine Fleischspeise mit kleinen Knochen, und wenn sie noch so lecker aussähe, zu genießen. Als ich China verließ, war mein Widerwille gegen die Küche der Chinesen verschwunden, nicht etwa, weil ich mich an die Regenwurm- und Rattenragouts gewöhnt hatte, sondern einfach deshalb, weil ich selbst in den Hütten der Landleute statt der genannten ekelhaften Dinge ganz schmackhafte Mahlzeiten zu genießen bekam.
Freilich ist es nicht zu leugnen, daß der zerlumpte Pöbel in den chinesischen Großstädten, besonders in Canton und Swatow, nicht nur Ratten und Hunde, sondern auch noch andere, viel unappetitlichere Tiere mit Wohlgefallen verzehrt, aber man möge ja nicht glauben, daß dieselben etwa auf den Mittagstisch der besseren Stände oder gar der Mandarine kämen. Was wird in unsern europäischen Großstädten nicht alles verzehrt! Haben wir nicht auch Gasthäuser, in denen Pferdefleisch und, unter wohlgewürzter Wildbretsauce verborgen, schmackhafte Katzenragouts verkauft werden? Essen wir etwa nicht auch Schnecken, Austern, Seespinnen, Tintenfische, faulen Käse, Aale und Krebse geradezu als Delikatessen? Wer mit solchen Genüssen einverstanden ist, den sollte es gar nicht wunder nehmen, daß der weniger verwöhnte Gaumen der Chinesen auch an Schlangen, fettgemästeten Hunden und mürbegebackenen Seidenwürmern Gefallen findet.
Der Chinese verzehrt eben alles, was da kreucht und fleugt, und in dieser Hinsicht steht das vielgerühmte Kulturvolk der Japaner auch nicht viel über ihm. Ich erinnere mich, auf dem Wege von Nikko nach Chuzendschi im Innern von Japan in einem Gasthause eingekehrt zu sein, an dessen Balkendecke seltsame Dinge, Cigarrenbündeln nicht unähnlich, herabhingen. Als ich eines dieser Bündel zur Hand nahm, bemerkte ich, daß es braungeschmorte Eidechsen waren. Gegessen habe ich sie freilich nicht, aber sie können ebenso schmackhaft sein wie Schnecken. Daß auch die Chinesen Eidechsen essen, habe ich nicht erfahren, dafür haben sie in ihren Mahlzeiten aber doch mehr Abwechselung als irgend ein anderes Volk der Erde. Würden sie zur Bereitung ihrer Speisen nicht so viel schlechtes Oel, zuweilen sogar Ricinusöl, dann große Mengen von Zwiebel und Knoblauch verwenden, so könnte sich der Europäer mit der chinesischen Küche, wenigstens bei den besseren Klassen, ganz einverstanden erklären. Die Chinesen sind geborene Köche, selbst der geringste Land[S. 88]arbeiter ist im stande, schmackhafte Speisen zuzubereiten, und die Küche ist keineswegs ausschließlich in den Händen der Frauen.
Im Vergleich mit den Europäern genießen die Chinesen viel weniger Fleisch; während Gemüse bei uns die Beilagen zu den Fleischspeisen bilden, sind bei den Chinesen die Gemüse die Hauptgerichte, und Fleisch oder Fische bilden nur die Beilagen. Das weitaus wichtigste Lebensmittel im Reiche der Mitte gerade so wie in Japan und in anderen Ländern Ostasiens ist der Reis, derart, daß „eine Mahlzeit einnehmen” im Chinesischen Tschi fan, Reis essen, heißt. Begegnen zwei Chinesen einander, so sind die einleitenden Worte ihrer Unterhaltung „tschi kno fan”, d. h. „haben Sie Reis gegessen?” Ebenso wie wir uns gegenseitig mit „Wie geht es Ihnen?” und „Haben Sie gut geruht?” begrüßen. Auch bei den Mahlzeiten der Mandarine oder bei Festbanketten ist Reis die pièce de résistance und wird stets am Ende der oft aus dreißig bis vierzig Gängen bestehenden Mahlzeit aufgetragen. So viel andere Dinge die Teilnehmer von den Schwalbennestern an bis zu den Haifischflossen und Bambussprossen heruntergewürgt haben, niemals verschmähen sie diese letzte Speise, den Reis.
Der Reis wird in Ostasien in vorzüglicher Weise zubereitet, und die Europäer gewöhnen sich so leicht an ihn, daß er in den meisten Häusern und auf den Ostasiendampfern täglich auf den Tisch kommt. Die Zubereitung ist von der in Europa gebräuchlichen verschieden. Um die Hülsen der Reiskörner zu brechen, werden sie im Innern Chinas mittels hölzerner Hämmer in ebensolchen großen Mörsern gestampft; dann werden sie in einer irdenen Schüssel mit rauhem Boden umhergerieben, um die noch anhaftenden Hülsenteile zu entfernen. Ist der Reis gereinigt, so wird er nicht wie bei uns in Wasser gekocht, sondern in ein Sieb aus Bambusgeflecht gethan, das auf einen halb mit Wasser gefüllten Topf gestellt wird. Der Dampf des kochenden Wassers erweicht die Körner, kocht sie aber nicht zu einem Brei, wie es bei uns häufig geschieht. Gewöhnlich wird in demselben Wasser gleichzeitig auch Fleisch gekocht, während auf das erste Sieb ein zweites mit Gemüsen, ein drittes mit Nudeln, vielleicht auch ein viertes mit Popos, das heißt Fleischklößchen, getürmt wird. Der Dampf durchzieht die Siebe und kocht alle Speisen der Mahlzeit gleichzeitig. Der Reis ersetzt auch das Brot, das der Chinese nicht kennt. Wohl bereitet er aus Mehl und Wasser Teig, aber er läßt diesen nicht backen, sondern in Form unserer Knödel oder Dampfnudeln abdampfen. Buchweizen, Mais und Gerste werden wohl zu Mehl zerrieben, aber auch in Körnerform gekocht zu verschiedenen Speisen verarbeitet.
Neben Reis genießen die Chinesen unzählige andere Feldfrüchte, Gemüse, Bambussprossen, selbst den gewöhnlichen Seetang, von welchen ungeheure Quantitäten, besonders zwischen den japanischen Inseln und der koreanischen Küste, aus dem Wasser gefischt und nach China gebracht werden. Ich begegnete in den chinesischen[S. 89] Gewässern mehrfach ganzen Dschunkenflottillen, die mit Seetang gefüllt waren. Wichtiger noch als dieses sind die Bohnen, besonders im nördlichen China, dann Erbsen, die in allen möglichen Arten gezogen und zubereitet werden. Alle unsere Gemüse, von Kohl und Salat bis zu Sellerie und Spinat, leider auch Zwiebeln und Knoblauch, sind in ganz China zu finden und sind an Größe und Geschmack mit den unserigen gar nicht zu vergleichen. Im Norden Chinas kommen auch Kartoffeln vor, im Süden tritt an ihre Stelle die süße Kartoffel. Unzählige andere Vegetabilien, Wasserpflanzen, Wurzeln, Blätter, Stengel, manche von absonderlichem Aussehen und Geschmack, finden sich auf den Märkten von Canton, Swatow und Tientsin, ja, man kann ruhig sagen, daß der Chinese, wenn er wolle, jeden Tag im Jahre ein anderes Gemüse auf seinem Tisch haben könnte.
Aehnlich bunt ist die Liste der Fleischspeisen, die aber, wie gesagt, nicht den Hauptbestandteil, sondern, namentlich bei der ärmeren Klasse, eine Zugabe der Mahlzeit bilden. Während bei uns das Rind die wichtigsten Fleischspeisen liefert, ist dieses in China am seltensten und wird für Nahrungszwecke überhaupt gar nicht gezüchtet. Rinder ebenso wie Büffel sind zu nützliche Tiere, um geschlachtet zu werden, auch mag die buddhistische Religionslehre, welche sich dagegen wendet, mit in Betracht kommen. Wenigstens kommt es bei Ueberschwemmungen und Trockenheit häufig vor, daß von seiten der Behörden das Schlachten dieser Tiere gänzlich verboten wird, um die zürnenden Götter zu versöhnen. Auch Ziegen- und Hammelfleisch wird von den Chinesen selten gegessen, obschon in der Mongolei ausgezeichnete Fettschwanzhammel gezogen werden. Pferdefleisch, im Norden auch Kamelfleisch, kommt auf den Märkten häufiger vor, aber die in ganz China und Tibet bis nach der Mandschurei beliebteste Fleischspeise liefert das Schwein. In manchen Sprachen des südlichen China wird sogar unter dem Worte Fleisch überhaupt nur Schweinefleisch verstanden. „Schwein” heißt im Chinesischen geradeso wie „Herr”, nämlich Tschu, womit aber keinerlei Anspielung gemacht werden soll. Selbst die ärmsten Familien halten wenigstens eines dieser Tiere. Auf dem Perlfluß habe ich Dschunken und Flöße gesehen, auf denen Schweine gehalten wurden, die frei herumliefen und von den Abfällen der schwimmenden Haushaltung gefüttert wurden. In den Märkten der großen Städte fand ich sie braunglänzend, fettstrotzend in Reihen von Hunderten aufgehängt; oder sie waren schon zerlegt, und ihre kleinen wohlschmeckenden Schinken, über den Fleischhandlungen oder an den Bambusstangen wandernder Händler aufgehängt, wurden zum Kauf aufgeboten. Seltsamer war es schon, wenn ich auf meinen Spaziergängen in Canton Händlern begegnete, die in ihren an Bambusstangen aufgehängten Holzkäfigen junge Katzen oder junge, fette Möpse einhertrugen. Zuweilen blieb ein Käufer davor stehen, nahm ein Hündchen heraus und befühlte und bezwickte die heulenden Tiere gerade so, wie es unsere Köchinnen mit den Gänsen thun, wenn sie sich von der Fleischmenge überzeugen wollen. Diese wohlschmeckenden[S. 90] Möpschen werden, wie die Straßburger Gänse, eigens gefüttert, nur daß neben Mais vornehmlich Reis dabei die wichtigste Rolle spielt. Ich besuchte in Canton ein Hunde- und Katzenrestaurant, fand dort aber nur Gäste aus den ärmsten Volksklassen. Ueber der Thüre hängen neben den genannten schon geschlachteten Tieren auch ganze Stränge von getrockneten oder braungeräucherten fetten Ratten, die aber auch nur von den Aermsten der Armen gegessen werden und keineswegs, wie man in Europa glaubt, zu den beliebtesten Lebensmitteln der Chinesen gehören. Sprach ich mit Mandarinen oder wohlhabenden Kaufleuten darüber, so schienen sie von dem Gedanken, Ratten oder Mäuse zu essen, gerade so angewidert wie wir Europäer. Mit „Tête de chien à la vinaigrette” oder „dogs tail soup” schienen sie sich eher befreunden zu können. Warum auch nicht? Die zarten, mit Reis gemästeten Hündchen müssen mindestens so schmackhaft sein wie die von ekelhaftem Futter lebenden Schweine.
Geflügel wird von den Chinesen massenhaft gegessen, vornehmlich Gänse und Enten. Auf der Fahrt von Hongkong nach Canton und weiter stromaufwärts begegnete ich zahlreichen Booten, deren Insassen sich ausschließlich mit dem Brüten und Mästen der Gänse befaßten. Diese guten Gaben Gottes werden in China fast ausschließlich in künstlichen Brutanstalten ausgebrütet, deren es auch an den Ufern der vielen Arme des Perlflusses unzählige giebt. Nach etwa vierwöchentlichem Lagern in den gleichmäßig erwärmten Körben kriechen die jungen Tierchen aus der Schale, und die Gänseboote fahren nun langsam den Fluß entlang, um die Tiere an günstigen Stellen der schlammigen Ufer zur Fütterung ans Land zu lassen. Bei einbrechender Dunkelheit kehren sie regelmäßig wieder auf die Boote zurück. Im nördlichen China, zum Beispiel in Tientsin und Peking, werden vornehmlich Enten gezüchtet, die fast die Größe und das Gewicht der Gänse erreichen und von den Chinesen äußerst schmackhaft gebraten werden. Auch die meisten anderen Arten unseres Geflügels, Wildenten, Rebhühner, Wachteln, Schnepfen, Fasane, Reisvögel kommen in den hochkultivierten Ebenen Chinas massenhaft vor und werden von den Einwohnern entweder in Netzen gefangen oder mit uralten Büchsen mit Eisenschrot geschossen.
Wie wir, so essen auch die Chinesen Froschschenkel. Die Tiefebenen rings um die großen Flüsse strotzen von Fröschen. die auf eigentümliche Weise gefangen werden. Auf einem Spaziergange gegen Whampoa zu gewahrte ich einen Chinesen, der in dem schilfigen Uferschlamme umherwatete und seine Angel nicht ins Wasser, sondern in das Gras warf. Als ich ihm näher kam, bemerkte ich, daß an dem Ende der Leine ein winziges munteres Fröschlein zappelte, um dessen Leib die zarte Leine festgebunden war. Geschickt warf der Fischer das Tierchen in das dichte saftige Gras der Reispflanzung, dem Lieblingsaufenthalt der dicken, alten, fettgemästeten Frösche. Kaum wurde das Köderfröschlein von einem solchen alten[S. 91] Quaker bemerkt, so sprang er mit einem Satze darauf los und verschlang es. In demselben Momente zog aber auch der Angler die Angelleine ein, packte den alten Frosch mit einer Hand, das Ende der Leine mit der anderen und zog langsam den verschlungenen Köder wieder aus dem Magen des Tieres heraus. Der Frosch wurde in einen Korb gesteckt, das zappelnde Köderfröschlein aber neuerdings ausgeworfen. Auf diese Weise verloren in dem Viertelstündchen, während dessen ich den Fang beobachtete, etwa ein halbes Dutzend fetter Quaker nicht nur ihr Frühstück, sondern gleichzeitig auch Freiheit und Leben.
Nirgends in der Welt dürften die Flüsse, Seen, Tümpel fischreicher sein als in China, nirgends dürfte auf Fische und Amphibien aller Art eifriger Jagd gemacht werden. Die Flüsse sind, mit Ausnahme schmaler Fahrstraßen für die Schiffe, ganz mit Netzen und Netzstangen bedeckt; in jedem Tümpel, sogar in den Reisfeldern, werden Fische gezüchtet, und in den Städten des Südens sah ich sogar in den Straßen Bassins und Kübel, in welchen Salme oder Karpfen gemästet wurden, Tiere, zuweilen so dick und fett, daß sie sich in den engen Behältern gar nicht umwenden konnten. In anderen Bottichen lagen lebende Aale und Wasserschlangen in allen möglichen Größen und Farben, denn auch die Wasserschlangen werden von den Chinesen gerne gegessen und hauptsächlich für die Zubereitung schmackhafter Suppen benützt. In Amoy werden meterlange braune Schlangen mit ihren Köpfen an Bambusstangen aufgehängt und so feilgeboten. Das Recht des Fischens ist freigegeben, und da es die bequemste Art von Erwerb bildet, sind Flüsse und Seen gewöhnlich mit Fischern übervölkert, die in jeder erdenklichen Weise auf die Wasserbewohner Jagd machen. Sie stechen sie geschickt mit Speeren, fangen sie mit Angeln, Netzen, holen sie mit Rechen aus dem Schlamm, locken sie in Fallen oder lassen sie durch Kormorane fangen. Diese Art des Fischens ist für den Europäer wohl die interessanteste, und in China sowohl wie in Japan sah ich den flinken klugen Tieren mitunter stundenlang zu, wie sie auf das Kommando des Fischers von den Booten ins Wasser glitten und nach einigen Minuten, zuweilen auch nach längerer Zeit, wieder auftauchend, auf das Boot zurückkehrten. Der Schnabelkropf war gewöhnlich mit Fischen oder Aalen gefüllt, die sie hintereinander wieder ausspieen und dafür von dem Fischer mit einem Stück Fisch belohnt wurden. Damit sie ihre Beute nicht selbst verschlingen und die Fischer das leere Nachsehen haben, tragen diese pelikanartigen, häßlichen Vögel ein Hanfseil um den Hals, so eng geschnürt, daß sie nur kleine Fischchen verschlingen können, nicht aber größere. Von frühester Jugend an abgerichtet, folgen sie ihrem Beruf mit größtem Eifer. Die eigentümlichste Art des Fischens ist wohl in Hankau, am oberen Jangtsekiang. Die (durchwegs chinesischen) Matrosen der Jangtsedampfer verhelfen sich, wenn sie dort im Hafen lagern, zu guter Fischkost dadurch, daß sie eine etwa zwei Fuß große eiserne Kochschüssel, die sonst zum Abkochen von Reis verwendet wird, an[S. 92] der Innenseite mit Fett beschmieren und das Gefäß dann horizontal mittels Stricken ins Wasser hinablassen. Ziehen sie die Schüssel nach einer Stunde wieder heraus, so ist sie bis zur Hälfte mit kleinen, breitlingartigen Fischchen gefüllt. Das Fett zieht diese Fische massenhaft an, bis sie sich allmählich in der Schüssel und im Wasser rings um dieselbe in dichten Schwärmen drängen. Bei dem raschen Herausziehen der Schüssel können die untersten wegen der über ihnen befindlichen Fischmengen nicht entschlüpfen und fallen den Matrosen zum Opfer.
Bei den Apachen und Pueblo-Indianern Arizonas fand ich als Lieblingsspeise aus gerösteten und gestampften Heuschrecken zubereitete Kuchen. Diese Speise wird auch von den Chinesen gerne gegessen; viel lieber haben sie freilich geröstete Seidenwürmer, die in großen Mengen verspeist werden. Williams behauptet in seinem ausgezeichneten Werke über China, daß sie auch Regenwürmer äßen. Die Chinesen, bei denen ich mich hierüber erkundigte, leugneten es entschieden, während sie von den Seidenwürmern als Leckerbissen sprachen. Zu diesen letzteren zählen in China vor allem die vielgenannten Schwalbennester, dann Haifischflossen, Tripang (Seewalze) und Fischmagen, nur sind die Schwalbennester so kostspielig, daß sie auf den Tisch der Reichen beschränkt bleiben. Für einen Teller Schwalbennestsuppe bedarf es für etwa sechs Mark Nester. Es ist bekannt, daß diese Schwalbennester von den Sundainseln, hauptsächlich von Java stammen, nicht bekannt dürfte es indessen sein, daß in Canton allein jährlich über acht Millionen Nester eingeführt werden. Im Innern des Landes wird das Kilogramm Schwalbennester mit fünfzig bis hundert Mark bezahlt. Der Grund dieser hohen Preise dürfte weniger darin liegen, daß die Chinesen die Nester als wohlschmeckende Delikatesse betrachten, sondern vielmehr in dem Umstande, daß man dem Genuß der seltsamen Speise besonderen Einfluß auf den Körper zuschreibt. Aus demselben Grunde werden auch die ekelhaften lederartigen Seewalzen und die Haifischflossen gegessen.
Die chinesischen Schwalbennester sind von der Größe einer kleinen Damenhand und bestehen der Hauptsache nach aus dem Speichel der Schwalben, der mit Federn und Seegrasfasern vermengt ist, die sorgfältig entfernt werden. Ihre Zubereitung fand ich in einem chinesischen Kochbuch folgendermaßen angegeben:
„Entferne sorgfältig alle Federn. Koche die Nester in Suppe oder Wasser, bis sie weich und von der Farbe des Nephrytsteines (gründlichweiß und durchscheinend) sind. Lege sie auf eine Lage Taubeneier, bedecke sie mit Schinkenschnitten und koche sie nochmals. Liebst du sie süß, so füge kandierten Zucker bei. Bereite sie sorgfältig und ohne Oel. Habe acht, daß sie lange kochen, denn ißt du sie, bevor sie weich sind, so bekommst du Durchfall.”
Haifischflossen werden von den Chinesen ebenfalls massenhaft gegessen, und in dem südlichen Hafen Koreas, in Fusan, fand ich eine große Kolonie von Japanern, die sich fast ausschließlich mit dem Haifischfang beschäftigten. Die zuckenden Leich[S. 93]name der vielen getöteten Haifische boten keineswegs einen appetitlichen Anblick, denn die kleinen flinken Japaner sprangen zwischen ihnen umher und hieben den noch lebenden Tieren die Flossen und den Schwanz ab. Das chinesische Kochbuch giebt folgende Zubereitung von Haifischflossen an:
„Lege sie in einen Kochtopf, füge Holzasche bei und koche sie mehrmals ab. Dann kratze sorgfältig die Haut ab. Entfernt sie sich nicht leicht, koche abermals und kratze wieder. Koche nochmals, schabe das Fleisch ab und behalte die Floßfedern. Koche diese nochmals und thue sie hierauf in Quellwasser, das du mehrmals wechseln mußt, damit der kalkige Geschmack verschwinde. Dann thue die Floßfedern in die Suppe, lasse sie mehrmals aufkochen, bis sie weich sind. Dann füge der Suppe Krebsfleisch und ein wenig Schinken bei und esse.”
Die Schilderung ist so deutlich, daß jede Köchin danach Haifischsuppe zubereiten kann. Die beste Bezugsquelle für Haifischflossen ist Cheng Ming & Co. in Canton.
Einfacher als die Speisen der Chinesen, von denen hier nur die gebräuchlichsten und merkwürdigsten angeführt wurden, sind ihre Getränke. Wasser trinken sie nur wenig; an seine Stelle tritt überall der Thee, aber ohne Zucker und Milch, da sie Milch ebenso wie Butter verschmähen. Nur in der Mandschurei wird schmutzige, schlechtschmeckende Butter und Käse bereitet, auch zuweilen Milch getrunken.
Geistigen Getränken huldigt der Chinese nur wenig; nie habe ich in China einen Betrunkenen gesehen. Wohl haben sie viele und schmackhafte Weinreben, allein die Zubereitung von Wein ist ihnen nicht bekannt. Dafür machen sie Soki, eine Art Reisbranntwein, und bei keinem Festmahl fehlt Samschui, das ist warmer Reiswein. Bei den Mandarinen hat neuestens sogar in den Inlandstädten ein ihnen früher unbekanntes Getränk Eingang gefunden, dem sie recht gerne zusprechen, und das chinesisch Hsiang-pin, d. h. wohlriechender Trank für Gäste, heißt. Wir in Europa haben dafür einen anderen Namen. Er lautet: Champagner.
Wer von Hongkong nach dem großen Handelsemporium des Jangtsekiang, nach Shanghai will, thut gut daran, zu dem Zwecke einen der großen Palastdampfer des Norddeutschen Lloyds zu benützen, denn je schneller er die Reise ausführt, desto besser ist es für ihn, und die Lloydschiffe nehmen gewöhnlich in keinem der fünf offenen Häfen zwischen Hongkong und Shanghai Aufenthalt, sondern fahren direkt nach dem letztgenannten Reiseziele. Wohl befindet sich unter den fünf Vertragshäfen, die man passiert, Futschau, eine der großen Städte Chinas mit einer Million Einwohnern, aber wer Canton gesehen hat, dem wird Futschau, ausgenommen die herrlichen Landschaften am Minfluß und die weitere hochmalerische Umgebung, nur wenig Interessantes bieten. Die südlich von Futschau gelegenen zwei Vertragshäfen Swatow und Amoy sind des Besuches kaum wert. Beide werden selbst von den Chinesen als sehr schmutzige Städte angesehen, auch ist die Bevölkerung den Europäern durchaus nicht besonders freundlich gesinnt, was seinen triftigen Grund hat: bald nach der Eröffnung dieser Häfen gaben sich die Europäer, welche sich dort ansiedelten, einem schmachvollen Kulihandel hin, ähnlich wie es früher die Portugiesen in Macao thaten. In den letzten Jahren hat die Feindseligkeit der Chinesen wohl etwas nachgelassen, aber die Zahl der in den beiden Städten residierenden Europäer hat doch nicht in ähnlichem Maße zugenommen wie in den anderen Häfen und dürfte zusammen etwa 350 betragen, die zahlreichen chinesischen Zollbeamten und Missionäre mit eingeschlossen.
Aehnliches kann auch von den beiden nördlich von Futschau gelegenen Vertragshäfen Wentschou und Ningpo gesagt werden; beide Häfen leiden unter der erdrückenden Nachbarschaft von Shanghai, und der europäische Handel will nicht recht vorwärts; vielleicht teilweise auch deshalb, weil die Schiffahrt in diesen Gewässern bis hinauf nach Shanghai recht gefährlich ist.
Spät am Abend kam ich in Shanghai an und fuhr durch die glänzend erleuchteten, mit modernen Palästen besetzten Straßen nach dem Astor House, einem neuen eleganten Hotel ersten Ranges. Dort überreichte man mir eine Einladung zu der St. Georges Celebration, die gerade heute Abend um neun Uhr in Chang-Su-Ho’s Garten stattfinden sollte. Die Einladung war auf schönes Papier mit Goldbuchstaben gedruckt und mit bekannten, geachteten Namen unterzeichnet. Rasch warf ich mich in Toilette und war ein halbes Stündchen später an der Pforte eines Gartens, an der eine Reihe glänzender Equipagen ihre Insassen entlud. Damen in reichen Abendtoiletten, begleitet von tadellos gekleideten Gentlemen, eilten scherzend und schäkernd dem Inneren des Gartens zu, von wo Tausende von Lampions und Lichtern mir entgegenstrahlten. Triumphbogen aus tropischen Gewächsen und[S. 95] unbekannten Blumen wölbten sich über dem wohlgepflegten Wege; aus allen Bäumen und Bosketts glühten verschiedenfarbige Lichter, und in der Mitte einer weiten Rasenfläche erhob sich ein großer Tempel, ganz aus chinesischen Laternen zusammengesetzt, ein feenhafter Anblick. Ein schöner dunkler See mit einer dreißig Meter hohen Pagode in der Mitte trennte diesen Tempel von einer Reihe von Gebäuden, Tribünen, Schaubuden und Cafés, die, in ein Lichtmeer getaucht, Tausende von Menschen beherbergten, Menschen, wie ich sie bei den großen Gartenfesten von London und Paris zu sehen gewohnt war, alle in großer Toilette, alle von weltmännischen, ungezwungenen Manieren, alle einander kennend und begrüßend. Nur ich war fremd und kannte nicht eine Seele. Ueberrascht von diesem seltsamen und unerwarteten Anblick mengte ich mich in das Gewühl und beobachtete die einzelnen Gruppen. Niemals und nirgends habe ich auf einem so kleinen Raum innerhalb weniger Minuten so viele Sprachen sprechen hören. Zwischen dem Anzünden und Fertigrauchen einer Cigarette vernahm ich in den einzelnen Gruppen Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Dänisch, Portugiesisch, am meisten aber Englisch und Deutsch, gutes Hamburger Deutsch. Vermengten sich diese Gruppen untereinander, dann sprangen die Sprechenden von einer zur andern Sprache über, mit einer Leichtigkeit, die einfach überraschte. Wo war ich denn? War der Garten, in dem ich mich eben befand und der mit Entzücken das Band, das mich an die Heimat fesselt, wieder strammer anzog, war dies China? Wo waren denn die Chinesen? Im Schatten der Bäume und der Bosketts, hinter den Häusern huschten sie umher als dienende Geister, brennende Lampions zu löschen, verlöschende Lichter durch neue zu ersetzen, Stühle zu tragen, Paletots und seidene zarte Damenmäntel zu halten. War dies China, das Reich der Mitte, den Europäern versperrt, beherrscht von einem Kaiser, welcher der[S. 96] Sohn des Himmels ist, und verwaltet von zugeknöpften, mißtrauischen, finsteren Mandarinen?
In den Cafés und Schaubuden ging es gar lustig her. Allerhand Allotria standen auf dem ellenlangen Programm, und die in knisternde Seide gehüllte, juwelengeschmückte Damenwelt eilte von einer Bude zur andern, um Konzerte und Dramen und Ballett- und Zaubervorstellungen mitzumachen, alles das veranstaltet durch Gentlemen-Amateurs. Und als diese Produktionen im Freien zu Ende waren, strömte alles in einen großen, säulengeschmückten, glänzend erleuchteten Tanzsaal, wo ein ausgezeichnetes Orchester lustige Weisen spielte und sich die eleganten Pärchen im Kreise drehten und über den glatten Parkettboden flogen. War das China?
Am nächsten Morgen an das Fenster meines Hotelzimmers tretend, hatte ich einen überraschenden Anblick: ein mächtiger Strom, wohl eine halbe englische Meile breit und bedeckt mit Dutzenden von großen Ozeandampfern, Kriegsschiffen, Leichtern und Booten. Die auf den Masken lustig flatternden Flaggen zeigten alle Farben in allen möglichen Zusammenstellungen: Engländer, Oesterreicher, Belgier, Franzosen, Dänen, Spanier, dazwischen die blaue Flagge der englischen Naval Reserve, der rote Ball in weißem Felde der Japaner, der chinesische blaue Drache auf gelbem Felde, aber am zahlreichsten das Schwarz-Weiß-Rot der deutschen Handelsflotte. Die größten und stolzesten Schiffe, die hier auf dem breiten gelben Strom vor Anker lagen, waren deutsche, darunter der gewaltige Koloß „Preußen” des Norddeutschen Lloyds, mit dem ich selbst von Süden heraufgekommen war. Ein schöner Park mit wohlgepflegten Blumenbeeten und schattigen Baumgruppen zog sich von meinem Hotel dem linken Stromufer entlang südwärts, auf der Landseite eingefaßt von großen Steinpalästen mit Balkonen und Arkaden, mit Gittern und monumentalen Thorbogen davor. Von den Dächern erwiderten Flaggen aller Nationen die Grüße der fremden Schiffe; soweit ich nur sehen konnte, boten sich mir Bilder großartigen Lebens und Verkehrs, wie sie nur noch in den Handelsemporien unseres eignen alten Kontinents zu finden sind, und dieses Leben und dieser Verkehr trugen dabei auch das Gepräge unserer eigenen Kultur. War das China?
Diese europäische Großstadt an der Pforte des Jangtsekiang, des mächtigsten Stromes von Asien und der Hauptverkehrsader des chinesischen Reiches, ist eine der merkwürdigsten Schöpfungen unseres Zeitalters. Rings umgeben von mongolischer Kultur, Tausende von Meilen östlich von Europa, ebensoviele Tausende von Meilen westlich von Amerika ist es der entlegenste Außenposten unseres die Welt beherrschenden Handels, unserer Industrien, nicht etwa eine künstlich genährte und gehegte Kolonie, sondern eine Hochburg, welche die furchtlosen Kaufherren der letzten Generation selbst dem Mongolenkoloß abgezwungen, groß und stark gemacht haben. Man hat Shanghai das „Paris von Ostasien” genannt, und ein solches ist es in der That.
Im Vergleich zu Shanghai treten alle anderen europäischen Städte Ostasiens in den Hintergrund, Singapore, Penang, Hongkong, Batavia, Manila, Yokohama, Kobe, Nagasaki. Manche darunter sind schöner, größer, behaglicher, keine aber hat einen ähnlich entwickelten Handels- und Schiffsverkehr, eine so aufgeweckte liberale, energische, vergnügungslustige Bevölkerung.
Es sind freilich weder architektonische Wunder noch großartige Schöpfungen nach unseren Begriffen, die man hier zu sehen bekommt, denn man darf ja nicht vergessen, daß Shanghai in China liegt. Aber die Menschen, die aus allen Ländern und Weltteilen hierher in das flache, sumpfige, ungesunde Tiefland an der Mündung des Jangtse verschlagen wurden, haben sich ihre neue Heimat, dieses europäisch-chinesische Babel, überraschend schön und behaglich und zweckmäßig eingerichtet.
Ueberraschend, das ist das rechte Wort. Ich hatte mir die Handelsmetropole Chinas als eine lebhafte, lärmende Geschäftsstadt mit großen Warenlagern und Quais und Schiffsbureaus, mit chinesischen Arbeitern und chinesischem Schmutz vorgestellt, etwa so wie Hongkong. Als ich aber meine erste Promenade auf dem Bund von Shanghai machte, fühlte ich mich eher in einem europäischen Badeort, etwa einem nordischen Nizza, so elegant, so vornehm und durchaus europäisch zeigt sich Shanghai von der Flußseite her. Auf etwa zwei Kilometer zieht sich dieser Bund dem Ufer entlang, eine von hohen Laubbäumen beschattete, vorzüglich gehaltene Straße mit schönen Fahrwegen auf beiden Seiten. Der Raum zwischen dieser Straße und dem Flußufer wird durch weite Rasenflächen, Baumgruppen und den vorerwähnten Stadtpark eingenommen, während auf der anderen Seite, die Fronten gegen den Fluß gewendet, die Paläste des Handels sich erheben. Würden nicht an den Thoren auf kleinen Schildern die Namen solcher Weltfirmen wie Butterfield & Swire, Jardine Matthison & Co., Siemssen & Co., Melchers & Co., Sassoon & Co., Deutsch-asiatische Bank, Hongkong- und Shanghaibank und andere zu lesen sein, man würde in jedem einzelnen dieser langen Reihe von Palästen viel eher vornehme Privatresidenzen vermuten, so schön und behaglich erscheinen sie, so wohlgepflegt sind die kleinen ihnen vorgelagerten Gärtchen, so absolut gar nichts sieht man von den wenig ansprechenden Einzelheiten des Großhandels. Ich bin während meines ersten vierzehntägigen Aufenthaltes in Shanghai den Bund mehrmals täglich auf- und abgewandert, aber niemals sah ich auch nur einen Warenballen, einen Dockarbeiter, einen Frachtwagen in dieser merkwürdigen Straße. Und doch wechseln hier im Jahre Hunderttausende von Tonnen Waren die Hände, werden von hier in jeder Woche zahlreiche Dampfer nach Indien, Japan, den Philippinen und Sundainseln, nach Europa und Amerika, nach dem nördlichen China, Korea, Ostsibirien und den Jangtse aufwärts tausend Meilen weit bis nahe nach Tibet expediert. Alles geht hier merkwürdig still und glatt vor sich; in den großen Geschäftsbureaus herrscht ein vornehmer Ton, eine gewisse weltmännische Eleganz, grundverschieden[S. 98] von den Verhältnissen, an die man zu Hause gewöhnt wurde. Im Verkehr mit den Geschäftsleuten erhält man den Eindruck, als hätte man es mit lauter wohlhabenden, wohlsituierten Gentlemen zu thun, welche das Geschäft eben nur als Sport betreiben. Obschon Shanghai nicht nur der Waren-, sondern auch Geldmittelpunkt von China ist, und eine stattliche Zahl von Banken hier ihren Sitz haben, giebt es doch keine Börse. Der ganze Börsenverkehr wird einfach beim Mittagscocktail an der Bar des Shanghaiklubs abgewickelt. Vor zehn Uhr morgens sind nur wenige Geschäftsbureaus geöffnet; mittags erscheinen vor den meisten elegante Equipagen, welche die Herren Prinzipale nach Hause oder in einen der Klubs bringen; nachmittags wird wieder zwei bis drei Stunden gearbeitet, und das Tagwerk ist vollbracht, wenigstens was das Geschäft betrifft. Ich hatte gehofft, den Kleinhandel und etwas von dem großen Warenverkehr Shanghais in den vom Bund landeinwärts führenden Seitenstraßen zu sehen, aber auch dort ist wenig davon zu merken. Diese Seitenstraßen sind auf über hundert Meter nur Fortsetzungen des Bunds, und darüber hinaus beginnt der chinesische Stadtteil, jedoch keineswegs mit dem ekelerregenden Hongkonger Schmutz. Die Straßen behalten auch im chinesischen Viertel ihre beträchtliche Breite und auffällige Reinlichkeit, und hat man das Chinesenviertel durchfahren, so gelangt man wieder in hübsche, wohlgepflegte, schattige Avenuen, wo halb verborgen in großen schattigen Gärten hübsche moderne Villen stehen. Nur in der eigentlichen, mit einer Ringmauer umgebenen Chinesenstadt und teilweise auch in der französischen Konzession sieht man die engen und schmutzigen Gäßchen, welche jede Stadt Chinas kennzeichnen. Wer das chinesische Shanghai sehen will, muß sich dort hinein bemühen, denn in der europäischen Stadt ist davon fast gar nichts vorhanden. Chinesen sieht man hier nur als Kutscher, Rickshaw Boys und als Angestellte oder Diener in den Handlungshäusern. Die japanische Rickshaw, eigentlich Jinrickshaw, hat sich auch in Shanghai eingebürgert, und ich glaube, es sind davon nicht weniger als tausend vorhanden, kleine zweiräderige, einsitzige Wägelchen, zwischen deren Deichseln statt Pferden kräftige, dickwadige Chinesen laufen. Noch ein anderes merkwürdiges Vehikel verirrt sich zuweilen aus der Chinesenstadt auf den Bund: ein Schubkarren mit einem großen Rad und Sitzen auf beiden Seiten desselben. Für wenige Pfennige gönnen sich die Chinesen auf derlei Schubkarren das Vergnügen des Fahrens. Sie setzen sich auf eine der beiden Sitzbänke, und der kräftige Kuli schiebt sie rasch, wie eine Ladung Steine, nach ihrem Bestimmungsort. Zuweilen werden diese Schubkarren auch von zwei Passagieren, gewöhnlich Frauen, gleichzeitig benutzt, und man muß über die Kraft der Kulis staunen. Hat ein chinesischer Diener irgend ein Gepäckstück zu befördern, ein Bauer ein Schwein auf den Markt zu führen, eine Mutter ihr krankes Kind nach dem Hospital zu bringen, flugs wird ein Schubkarren requiriert, Gepäckstück, Schwein oder Kind auf die eine Seite angebunden, auf der andern Seite selbst Platz genommen[S. 99] und fort geht es im Laufschritt nach dem Ziele. Von Europäern werden diese Schubkarren niemals benutzt, und selbst die in Japan so beliebte Jinrickshaw scheint bei der eleganten Welt Shanghais etwas verpönt zu sein. Damen benutzen sie selten, dagegen sind die Rickshaws bei den Chinesinnen beliebt. Eines Tages sah ich zwei derselben in einer Rickshaw sitzen, und sie näher betrachtend, gewahrte ich zu meiner Ueberraschung an ihnen blondes, in langen Zöpfen herabfallendes Haar, blaue Augen, kaukasische Gesichtszüge. Blonde Chinesinnen! Aber das ethnologische Wunder wurde mir bald erklärt. Die Fräuleins der schwedisch-protestantischen Mission halten es für ihre Zwecke entsprechender, sich in chinesische Gewänder zu kleiden. Ich sah deren später noch andere in den Uferstädten des Jangtsekiang. Auch die Missionare tragen fast ausschließlich die chinesische Tracht.
In den Banken, Geschäftsbureaus, in den Haushaltungen, Gärten, in der Küche und Kinderstube besteht die dienende Welt nur aus Chinesen, und ich glaube nicht, daß in ganz Shanghai ein halbes Dutzend weißer Diener, wenn überhaupt so viele, zu finden sind. Die Kaukasier sind dort nur Gentlemen und Ladies, die Chinesen im Verkehr mit ihnen nur Untergeordnete, treu, zuverlässig, ehrlich, aufmerksam, still und emsig, so daß den Europäern dank ihnen das Leben in Shanghai wirklich leicht gemacht ist. Häusliche Verrichtungen kennen sie gar nicht. Von den Einkäufen für die Küche bis zum Hausreinigen und Stiefelputzen wird alles in der glattesten Weise durch die Chinesen besorgt, welche Kassierer, Stubenmädchen, Köchinnen, Hausdiener, Kutscher, mit einem Worte alles sind. Die Europäer haben deshalb sehr viel Zeit und überdies alle erdenklichen Gelegenheiten, diese Zeit in der angenehmsten Weise totzuschlagen. Selbst in europäischen Großstädten dürfte es nicht mehr Klubs, Gesellschaften, Vergnügungen aller Art geben, und man kommt im Winter und Frühjahr aus diesem Taumel fast gar nicht heraus. Shanghai hat davon vielleicht sogar ein bißchen zu viel, und es würde den jungen Herren besser bekommen, wenn sie von ihren in neuerer Zeit durchaus nicht mehr übermäßig hohen Bezügen etwas zurücklegen würden, statt sie auf Equipagen, Reitpferde, Klubs und Jagden zu verwenden.
An der Spitze der Gesellschaft stehen die Konsularvertreter und Gerichtsbeamten der europäischen Mächte, da ja die europäischen Bewohner Shanghais den chinesischen Gerichten selbstverständlich nicht unterstehen, sondern ihre eigenen Konsulargerichte haben. Die Konsulate Deutschlands, Englands und Frankreichs sind in wahren Palästen untergebracht, und die betreffenden Vertreter üben die Repräsentation mit sehr viel Takt und Eleganz. Die Generalkonsuln Englands und Frankreichs sind gleichzeitig die obersten Behörden Shanghais. England wie Frankreich erhielten nämlich vor einigen Jahrzehnten die Handvoll chinesischer Erde, auf welcher Shanghai steht, als Konzession. Auch die Vereinigten Staaten ergatterten sich eine solche; sie ist aber längst mit der englischen Konzession vereinigt und hat keine[S. 100] selbständige Munizipalität mehr wie diese oder die französische. Ein kleiner Kanal bildet die geographische Grenze zwischen beiden, eine gesellschaftliche giebt es aber längst nicht mehr, denn viele französische Ansiedler, müde der Nörgeleien ihres konsularischen Diktators, sind nach der englischen Konzession ausgewandert, kleinere englische Kaufleute traten auf französischen Boden über, und die ganze Fremdengesellschaft bildet in Shanghai eine einzige Happy Family, wo von Rassenhaß und Nationalitätenhader nichts zu sehen ist. Wohl giebt es einen deutschen, englischen und französischen Klub, der erstere einer der schönsten und gastfreiesten Ostasiens, allein bei Festlichkeiten, Soireen, Musikabenden und dergleichen wird die Gesellschaft geladen ohne Unterschied der Nationen. Kurz vor meiner Ankunft in Shanghai fanden auf dem herrlichen Rennplatz zur Seite des Bubbling Well Road große Wettrennen statt, an denen sich ganz Shanghai beteiligte. Wenige Tage später veranstaltete die Société dramatique française in dem hübschen kleinen Lyceumtheater ganz reizende Amateurvorstellungen in französischer Sprache, zu denen die Deutschen ebensogut geladen waren wie die Engländer; und in Erwiderung des englischen St. George- und des französischen Thalia-Abends gaben wieder einige Tage später die Deutschen eine glänzende Soiree zu Ehren einer eben durchreisenden Künstlerin von Weltruf, bei welcher die großen Säle des Konkordiaklubs mit einer ähnlich internationalen Gesellschaft dicht gefüllt waren und Champagner in Strömen floß. So geht es auch auf den Jagden, Konzerten, auf dem Lawntennisboden, wie bei den Regatten auf dem Wusungstrome zu.
Es ist ein wahres Glück, daß sich die Menschen hier so gut vertragen, denn Organisation auf staatlicher Grundlage ist keine vorhanden, und kein Mensch kann sagen, wem Shanghai eigentlich gehört. Das Zollwesen ist chinesisch, die Munizipien sind englisch und französisch, und an Postämtern giebt es ein deutsches, französisches, englisches, japanisches, chinesisches und Shanghaipostamt für den Lokalverkehr, sechs verschiedene Postämter, jedes mit seinen eigenen Postbeamten und Postwertzeichen. Die Chinesen haben in Shanghai ihr eigenes Militär und nahe der Stadt auch ein großes, vortreffliches Arsenal. Die Polizei des europäischen Stadtteils ist größtenteils auch chinesisch, untersteht aber den Munizipien und hat mit den chinesischen Behörden nichts zu thun. Neben den etwa dreihundert chinesischen Polizisten giebt es aber auch fünfzig europäische und fünfzig indische. Dieses seltsame Gemengsel hält die Ordnung in Shanghai in ausgezeichneter Weise aufrecht, und kommen größere Unruhen vor, bedrohen Rebellen die Stadt, wie es vor einem Vierteljahrhundert geschah, so lassen die Bewohner Shanghais ihre eigene Armee aufmarschieren. Diese besteht aus drei europäischen Freiwilligenkorps, nämlich einer Schwadron Kavallerie, einer Feldbatterie und drei Kompagnien Infanterie, durchweg von Bürgern Shanghais gebildet. Verschiedene Telegraphengesellschaften verbinden diese Stadt mit der Außenwelt, und die Kaufleute lesen morgens beim[S. 101] Frühstückstisch in den vortrefflichen englischen Zeitungen Drahtberichte aus London, Paris, Berlin, Neuyork. Shanghai hat vier englische Tageszeitungen, von denen die North China Daily News die beste ist, dann mehrere Wochenblätter, unter denen der deutsche, vorzüglich redigierte Ostasiatische Lloyd besonders rühmend hervorgehoben zu werden verdient.
Nun sage man noch, Shanghai sei keine europäische Großstadt! Europäisch im wahren Sinne des Wortes. Denn die Chinesen mit ihrer Viertelmillion Seelen leben für sich und vermengen sich, ausgenommen durch die dienende Klasse, niemals mit den Europäern. Ist es nicht wunderbar, daß diese letzteren, so verschiedenen Rassen, Nationen, Gesellschaftsklassen und Berufsarten angehörend, eine so große, schöne Stadt gründen konnten und so einträchtig darin leben? Man wird gewiß fragen, wie viele europäische Einwohner Shanghai besitze. Die Antwort wird vielleicht mehr Staunen erregen als alles andere: nicht mehr und nicht weniger als irgendeine unserer hauptstädtischen großen Infanteriekasernen: sechstausend, das ist alles. Am stärksten sind, wie überall, die Engländer vertreten, und ihnen zunächst kommen nicht nur an Zahl, sondern auch an Einfluß, Wohlstand, Handel und in gesellschaftlicher Hinsicht die Deutschen.
Dabei geht es in geschäftlicher Hinsicht in Shanghai mit Riesenschritten vorwärts. Die Stadt entwickelt sich zusehends, sowohl was die europäische wie die chinesische Bevölkerung anbetrifft. Zwischen 1870 und 1880 nahm die europäische Einwohnerzahl ab, während sie in den fünf auf 1880 folgenden Jahren um fünfzig Prozent wieder zunahm und sich seit 1885 sogar verdoppelte und heute, wie gesagt, sechstausend Seelen erreicht hat. Unter diesen sind über 2000 Engländer, 450 Deutsche, 380 Amerikaner und nur 300 Franzosen, dann 800 sogenannte Portugiesen, größtenteils Mischlinge aus Macao. Der Dampferverkehr erreicht jährlich etwa 6000 Schiffe mit acht Millionen Tonnen, der Wert des Handels tausend Millionen Mark.
Auch in industrieller Hinsicht wächst Shanghai seit dem Frieden von Shimonoseki, hauptsächlich deshalb, weil den Chinesen die freie Einfuhr von Maschinen in die Vertragshäfen abgezwungen wurde. Im Jahre 1896 allein entstanden in Shanghai vierundzwanzig neue Seidenfilaturen, an denen sich auch Chinesen mit bedeutendem Kapital beteiligten. Die Erschließung des Stromgebietes des oberen Jangtsekiang, der nicht mehr zu hemmende Handelsverkehr mit den Provinzen des Innern sichern Shanghai einen glänzenden Aufschwung, der durch Kriege und Unruhen nur zeitweise unterbrochen werden kann.
Seit einigen Jahren ist auch das Deutsche Reich Besitzer kleiner Landstrecken in den Vertragshäfen Hankau und Tientsin geworden. Deutschland folgte mit dieser Landerwerbung dem Beispiel Englands, Frankreichs, Nordamerikas und Portugals, welche Staaten schon seit Jahrzehnten in verschiedenen Teilen Chinas, hauptsächlich in der Nähe der offenen Häfen Konzessionen, d. h. Gebietsabtretungen von seiten Chinas erlangt haben, deren älteste an der Mündung des Cantonflusses gelegen sind: Hongkong und Macao. Freilich zählt die ganze Insel Hongkong mit ihrer Hauptstadt Victoria nur achtzig Quadratkilometer, Macao nur zwölf Quadratkilometer Grundfläche, eine Messerspitze voll im Vergleich zu den elf Millionen Quadratkilometern des chinesischen Landbesitzes; allein diese beiden Gebiete wurden England und Portugal unbedingt abgetreten und bilden eigene, von China vollständig unabhängige Kolonien unter europäischer Verwaltung.
Abgesehen von Hongkong und Macao sind jedoch in der Mehrzahl der drei Dutzend den Europäern geöffneten Häfen europäische Settlements, d. h. Ansiedelungen, zu finden, deren Grund und Boden entweder von der chinesischen Regierung an die eine oder andere auswärtige Macht bedingungslos abgetreten, oder gegen Zahlung einer Miete für neunundneunzig Jahre verpachtet wurde; in einigen Häfen verständigten sich die europäischen Ansiedler mit den chinesischen Ortsbehörden bezüglich der käuflichen Erwerbung einer Landstrecke für ihre Wohnungen und Geschäftshäuser, in anderen Häfen, wie z. B. in Futschau, giebt es überhaupt kein eigenes europäisches Settlement, sondern die Europäer wohnen zerstreut mitten unter den Chinesen.
Praktisch, wie die Engländer in allen Kolonialsachen sind, und eingedenk der Thatsache, daß fünfundsechzig Prozent des ganzen chinesischen Außenhandels in ihren Händen liegen, waren sie auch diejenigen, welche sich gleich zu Anbeginn die weitestgehenden Vorteile zu sichern wußten, und die weitaus große Mehrzahl der fremdländischen Ansiedelungen in China befinden sich auf englischen Konzessionen. Ihnen zunächst kommen die Franzosen mit ihren Konzessionen in Shanghai, Canton, Hankau, Tientsin. Allein die Franzosen haben es nicht verstanden, ihre durch blutige Kriege in China erworbenen Vorteile auszunützen. Die fremden Kaufleute verschiedener Nationen, vor allem die Deutschen, zogen es vor, sich in den englischen Konzessionen anzusiedeln, und selbst die Mehrzahl der französischen Kaufleute entzog sich der Willkür und dem Absolutismus ihrer eigenen Behörden, so daß beispielsweise von den in Shanghai ansässigen Franzosen die größere Zahl in der englischen, nicht in der französischen Konzession wohnt. In Hankau wohnt auf der dortigen französischen Konzession überhaupt nur der Konsul, und in Tientsin hat sich der französische Konsul als Leiter der dortigen Konzession seines Landes durch[S. 103] Eigenmächtigkeiten aller Art so unliebsam gemacht, daß gerade sie und die fortwährenden Reibungen mit den Engländern und Deutschen die Hauptveranlassung zu der Errichtung einer eigenen deutschen Konzession waren.
In den Verträgen der europäischen Mächte mit China ist von diesen Landschenkungen nicht die Rede; die Mächte haben sich nur das Recht der unbehinderten Ansiedlung und des freien Handels ihrer Unterthanen in den offenen Häfen, sowie das Recht der freien Religionsübung und des Reisens durch alle Gebiete Chinas gesichert. Reisende in China bedürfen nur eines von ihrem Konsul ausgestellten und von den chinesischen Behörden visierten Reisepasses; auf etwa vierzig Kilometer rings um die offenen Häfen und für die Dauer von fünf Tagen sind Reisepässe nicht erforderlich; die Chinesen sind also in dieser Hinsicht viel liberaler, als es die Japaner bis 1898 waren, in deren Land Europäer nur mit gebundener Marschroute reisen durften. Die größte Zahl der offenen Häfen Chinas verdanken wir England; fünf weitere wurden durch die Verträge mit Frankreich dem europäischen Verkehr eröffnet, und in dem Vertrag zwischen Preußen und China vom Jahre 1861 erscheinen die wichtigen Häfen Hankau, Tschin-kiang und Kiu-kiang als offene Häfen. Während aber England und Frankreich als Folge dieser Verträge von den Chinesen territoriale Konzessionen erwarben, wurde dies von Preußen in den drei letztgenannten Häfen unterlassen, und die Landerwerbung Deutschlands in Tientsin war überhaupt seine erste in China.
Schon aus dem Gesagten geht hervor, daß die Konzessionen der verschiedenen Mächte in den Vertragshäfen nicht ausschließlich nur den eigenen Unterthanen als Wohnort dienen; ja diese ein bis drei Quadratkilometer großen Gebiete sind nicht einmal den Konsularbehörden dieser Mächte unterstellt, sondern bilden sozusagen kleine Republiken, die gegebenenfalls unter dem Schutze aller Mächte stehen. Aehnlich lagen die Verhältnisse bis 1898 auch in den fünf Vertragshäfen Japans, und diese Republiken sind eine Eigenart Ostasiens, wie sie sonst auf dem Erdball nicht wieder vorkommt. In Ostasien hören die Engländer oder Deutschen dem Chinesen oder Japaner gegenüber auf, Engländer oder Deutsche zu sein; sie, sowie die Amerikaner, Franzosen und Angehörige anderer Nationen, sind glücklicherweise einfach Kaukasier, oder, wie sie von den Chinesen genannt werden, Barbaren. Freilich hat sich England im Vertrag von Tientsin 1858 ausdrücklich ausbedungen, daß kein englischer Beamter oder Unterthan mit dem Worte Barbar bezeichnet werden dürfe, indessen wird dieses Wort doch noch immer, und zwar täglich, von den Chinesen gebraucht.
Das hervorragendste Beispiel dieser europäischen Republiken in China ist Shanghai; dort besaßen ursprünglich die Engländer, Amerikaner und Franzosen eigene streng abgegrenzte Konzessionen, allein die Bevölkerung dieser Fremdenstadt ist so international, und die Interessen sind dabei so gemeinsam, daß die Amerikaner und Engländer ihre Hoheitsrechte aufgaben und die ganze Verwaltung der Bevölkerung[S. 104] selbst überließen, diese gleichzeitig unter den Schutz aller in Peking vertretenen Mächte, d. h. deren Gesandten, stellend. Nur die Franzosen beteiligten sich nicht daran, sondern behielten ihre eigene, unter dem Generalkonsul stehende Verwaltung, obschon, wie gesagt, der größte Teil der französischen Kaufleute außerhalb der französischen Konzession wohnt. Jeder Kaufmann, der eine bestimmte jährliche Steuer zahlt, ist in dieser Republik Shanghai stimm- und wahlberechtigt. In jedem Jahre wird eine öffentliche Versammlung einberufen, welche die Mitglieder des Stadtrats zu erwählen hat. Dieser aus neun Räten und einem Sekretär bestehende Stadtrat ist die oberste, und man könnte beinahe sagen, souveräne Behörde der Republik. Da die Engländer und Deutschen in Shanghai am zahlreichsten sind, so sind sie auch im Stadtrat am stärksten vertreten, obschon es ebensogut vorkommen könnte, daß dort die Franzosen oder Portugiesen die Majorität besäßen. Es handelt sich glücklicherweise in Shanghai nicht um Nationalitäten, ebensowenig giebt es Parteiwesen und Opposition; die tüchtigsten und angesehensten Bürger werden gewählt und wiedergewählt, solange sie ihre Schuldigkeit thun. Unter dem Stadtrat (Municipal Council) stehen die Steuerbeamten, das Ingenieur- und Vermessungsamt, die Sanitäts- und Polizeibehörden, die Feuerwehr und das Freiwilligenkorps. Die einzelnen Komitees des Stadtrats überwachen diese Einrichtungen und legen jährlich in einer allgemeinen öffentlichen Versammlung den Bürgern der Republik Rechenschaft ab, ähnlich wie es in einzelnen Kantonen der Schweiz, z. B. in Unterwalden und Appenzell, der Fall ist.
Während die inneren Angelegenheiten dieser Republik, wie diejenigen von Hankau, Canton, Tientsin, in den Händen der Bürger selbst liegen, werden die äußeren Angelegenheiten, vornehmlich der Verkehr mit den Chinesen, durch die Konsuln vermittelt. Die chinesischen Behörden haben innerhalb der europäischen, genau abgegrenzten Ansiedelungen keine Rechte; sie dürfen sie nicht militärisch besetzen lassen, auch von den dortigen Einwohnern, selbst wenn sie Chinesen wären, keine Steuer erheben. Deshalb dienen die Settlements auch zahlreichen Chinesen als Asyl, wo sie, unbelästigt von den Mandarinen, in Frieden leben und schaffen können. So wohnen innerhalb der Grenzen des europäischen Settlements in Shanghai (abgesehen von der französischen Konzession) allein 260000 Chinesen, im Vergleich zu 75000 im Jahre 1870. Sie stehen in allen Dingen unter der europäischen Verwaltung der Settlements, und nur die Rechtspflege über sie wird von einem chinesischen Mandarin gehandhabt, dem aber abwechselnd ein Assessor des europäischen Konsulargerichts zur Seite steht, der thatsächlich der Richter ist. Die europäischen und amerikanischen Bewohner der Settlements sind exterritorial, gerade so, wie es die fremdländischen Gesandten in unseren Staaten sind; in Bezug auf die Rechtspflege stehen sie unter ihren Konsuln, denen Gerichtsassessoren beigegeben sind. Die Europäer können aber auch außerhalb der Konzessionen irgendwo in den Städten[S. 105] oder auf dem Lande Grund und Boden erwerben oder ihrem Beruf nachgehen und bleiben dennoch unter der Gerichtsbarkeit ihrer Konsuln. Chinesische Behörden dürfen sie nicht aburteilen, sondern müssen sie den betreffenden Konsuln abliefern. Bei Rechtsstreitigkeiten zwischen Europäern und Chinesen treten gemischte Gerichte in Thätigkeit.
Die Konzessionen sind nicht etwa für ewige Zeiten auf den ursprünglich bestimmten Flächenraum beschränkt. Sind die vorhandenen Bauplätze vergeben, so daß neue Ankömmlinge keinen Grund und Boden mehr finden, sollen Gärten, Spielplätze, Fabrikanlagen geschaffen werden, so erwerben die Betreffenden durch Kauf die ihnen passenden, an die Konzession grenzenden Strecken, die Kaufbriefe werden von den chinesischen und europäischen Behörden bestätigt und in dem betreffenden Konsulate aufbewahrt. Das erworbene Land aber wird in die Fremdenkonzession einverleibt. Die Zentralregierung in Peking, selbst die Provinzbehörden haben damit nichts zu thun; in den meisten Fällen genügt die Bestätigung durch die Ortsbehörden.
Auch in Häfen, wo nur englische Konzessionen bestehen, bilden die dort lebenden Europäer der verschiedensten Nationen eine kleine Republik für sich, nur daß die Maßnahmen des Municipal Council, wie Steuerauflagen, Wege- und Hafeneinrichtungen, polizeiliche Anordnungen, der Bestätigung des Konsuls bedürfen. Ähnlich sind auch die neuen German Settlements in Tientsin und Hankau eingerichtet worden.
Man braucht im Reiche der Mitte gar nicht weit zu wandern, um zur Erkenntnis zu kommen, daß neben Thee die Seidenzucht die wichtigste Industrie und die einträglichste Erwerbsquelle der Zopfträger bildet. Millionen der chinesischen Landbevölkerung, Männer, Frauen und Kinder, beschäftigen sich hauptsächlich mit der Zucht der Seidenraupen, Millionen mit Spinnen und Weben der Seidenstoffe, und wollte man die Geldsummen nennen, welche die fleißigen Bauern der mittleren Provinzen im Laufe des letzten Jahrhunderts allein durch diese kleinen unscheinbaren weißen Würmer verdient haben, man müßte zu Milliarden greifen. Werden doch alljährlich allein nach Europa und Amerika Seide und Seidenwaren im Werte von etwa zweihundert Millionen Mark ausgeführt, und diese bilden nur einen Bruchteil der Unmassen Seide, welche die Chinesen für Kleidung und Opferzwecke jährlich selbst verbrauchen. In Peking allein werden von dem Sohne des Himmels und den kaiserlichen Prinzen jährlich Tausende von Stücken der kostbarsten Seidenstoffe im Werte von Hunderttausenden verbrannt, um den Göttern und den eigenen Ahnen wohlgefällig zu sein. Quadratmeilen Landes könnten mit den von fleißigen Händen angefertigten Seidenstoffen bedeckt werden, und alle diese Massen rühren von der kleinen Seidenraupe her. Kein Wunder, daß die Chinesen diesen Tierchen die größte Sorgfalt, die aufmerksamste Pflege angedeihen lassen und sie mit solcher Auszeichnung, ja Ehrfurcht behandeln, als wären es lauter Mandarine mit roten Hutknöpfen. Gerade so wie die Mandarine ihre eigenen strengumschlossenen und bewachten Yamen (Amtslokale) haben, so besitzen auch die Seidenraupen ihre eigenen Häuser, fern von jedem Straßenverkehr, von jedem Lärm gelegen, geschützt gegen Zug und Wind, gegen Kälte und übergroßes Licht. Die Chinesen, die sie zu pflegen haben, essen keinen Knoblauch und keine Zwiebel, weil den Tierchen der Geruch unangenehm sein soll; sie kleiden sich viel reinlicher und waschen sich vor[S. 107] dem Eintritt in das Raupenhaus die Hände; innerhalb des Hauses aber ist Singen, Pfeifen, lautes Sprechen streng verboten. Wenn überhaupt gesprochen wird, so darf dies nur im Flüsterton geschehen. Wie beneidete ich häufig die Seidenraupen um ihre köstliche Nachtruhe! Was herrschte in den chinesischen Städten, die ich besuchte, für ein Höllenlärm! Schreien, Schießen, Gongschlagen, Trompeten die ganze Nacht hindurch! Wir Menschen mußten leiden, und diese kleinen Dingerchen, die ja nur unsertwegen überhaupt gezüchtet werden, können ruhig schlafen! Was wurde ich bei meinen Wanderungen durch die Chinesenstädte von zerlumpten, aussätzigen, verkrüppelten Bettlern belästigt, und ich mußte es geduldig ertragen. Wehe aber diesen Bettlern, wenn sie sich einem Raupenhause auch nur nähern sollten! Mit Stöcken werden sie davongejagt. Selbst kerngesunde Menschen dürfen ein derartiges Heiligtum nur betreten, wenn sie sich mit Wasser, in dem Maulbeerblätter liegen, besprenkelt haben. Wo das Wasser fehlen sollte, müssen sie vor dem Eintritt Sand auf ihr Haupt streuen, ähnlich den Mohammedanern, denen es auch gestattet ist, ihre Waschungen vor dem Gebet statt mit Wasser mit Sand vorzunehmen. Man könnte glauben, die Seidenraupe sei der Gott der Chinesen. In ihren Tempeln verkehren sie mit derselben Gleichgültigkeit wie auf der Straße; sie wickeln sogar Geschäfte dort ab und spielen in den Tempelhöfen Theater. Die Raupenhäuser aber sind geheiligt; niemand darf sie während der Trauerzeit um einen Anverwandten betreten, und auch Frauen, die einen Zuwachs in ihrer Familie erwarten, sind von dem Besuche ausgeschlossen.
Diese Gebräuche sind durch Jahrtausende geheiligt, wie so viele andere in dem blumigen Reiche der Mitte. China ist ja die eigentliche Heimat der Seidenraupe, von wo sie ihren Weg nach anderen Ländern Ostasiens und nach Europa genommen hat. Die Gattin des Kaisers Huang-Li war es, die im 26. Jahrhundert vor Christi Geburt als erste die Seidenraupe nährte und mit ihren zarten Fingern die Seidenfäden von den Cocons haspelte. Sie wird darum auch in ganz China unter dem Namen Yuen-fi als Göttin der Seide hoch verehrt.
In Peking ist ihr ein innerhalb der verbotenen Kaiserstadt gelegener Tempel geweiht, und dort werden ihr alljährlich einmal von der ersten Kaiserin (der Sohn des Himmels hat deren nämlich zwei) und ihrem ganzen Hofstaate Opfergaben dargebracht. In feierlichem Aufzuge begeben sie sich nach dem Yuen-fi-Tempel. In dem Tempelgarten angelangt, schneiden sie eigenhändig Blätter von den Maulbeerbäumen, wozu die Kaiserin eine goldene Schere verwendet, während die Hofdamen solche aus Silber haben. Mit diesen Blättern füttern sie die Seidenraupen im Innern des Tempels; dann werden ihnen von den Priestern Cocons dargereicht, von denen die hohen Damen die Seide abwickeln. Ob es ihnen gelingt, die zarten Fäden wirklich unversehrt auf die Spule zu bringen, ist zweifelhaft, denn diese Arbeit erfordert ungemein viel Übung; aber sie geben wenigstens dem Lande ein[S. 108] gutes Beispiel, das auch überall befolgt wird. Das Coconfest gehört zu den großen Feiertagen des chinesischen Jahres, und wie in Peking, so wird es auch in den Provinzen von den Mandarinen und den Beamten in feierlichster Weise begangen.
Indessen, die gute Yuen-fi und ihre Schützlinge, die Seidenraupen, werden erst seit ein paar hundert Jahren so sehr verehrt. Als im Jahre 1260, unter der Yuandynastie, Baumwolle von Indien her in China eingeführt wurde, verdrängte diese durch ihre Wohlfeilheit die Seide immer mehr. Die Seidenindustrie verfiel, und zu Beginn des siebzehnten Jahrhunderts wurde noch gerade so viel Seide erzeugt, als der kaiserliche Hof für seine Opferfeste und die Mandarine für ihre Kleidung bedurften. Erst die Europäer waren es, die die Seidenzucht in China wieder zu Ansehen brachten, denn die europäischen Damen fanden bekanntlich an den kostbaren, reizenden Seidenstoffen besonderen Gefallen, und da der Bedarf von den europäischen Seidenzüchtereien nicht befriedigt werden konnte, so bestellten die europäischen Händler Seidenstoffe in China.
Die Industrie entwickelte sich immer mehr, die vielen Millionen Silber, welche die Europäer den Chinesen für ihre Seide bezahlten, brachten erneuten Wohlstand unter die letzteren, so daß sie sich bald selbst wieder in kostbare Seidenstoffe kleideten. Statt der Kaiserin Yuen-fi sollten also die Chinesen eigentlich die europäischen Damen als Göttinnen verehren und in ihren Tempeln Bildnisse von Europäerinnen aufstellen, die sich an Liebreiz und Schönheit gewiß mit der vorsündflutlichen Kaiserin messen können und denen auch von Rechts wegen der Dank der Zopfträger gebührt. Jetzt wird Seide wieder in allen Provinzen des eigentlichen Chinas, vornehmlich in Schantung, ja sogar in der fernen Mandschurei hergestellt, und auf meiner Reise nach Korea fand ich, daß die Seidenkultur auch dort Eingang gefunden hat. Die beste chinesische Seide aber wird in der Provinz Tschekiang hergestellt, und die Hauptstadt derselben, Hangtschou, ist gleichzeitig das Lyon von China, die Metropole der Seidenindustrie.
Man darf aber nicht etwa glauben, es gäbe in China große Maulbeerplantagen, Massenkultur in Seidenraupen, Spinnereien und Webereien mit Dampfbetrieb. Die chinesische Industrie bewegt sich in anderen Bahnen. Gerade so, wie zur Zeit der Gattin des Kaisers Huang-Li, liegt auch heute noch die ganze Seidenzucht in den Händen der Bauern. Der Arbeitsteilung, Vereinfachung der Arbeit durch Maschinen, Neuerungen und Verbesserungen ist der Chinese schwer zugänglich. Wie unsere Bauern ihre eigenen Kartoffeln und gelben Rüben in ihren Gärtchen pflanzen, so pflanzt auch jeder Bauer in Tschekiang seinen Reis und Thee und zieht seine Seidenraupen, die letzteren nicht etwa allein der Seide, sondern auch der Nahrung wegen. Sind nämlich die Cocons abgebrüht und die Seidenfäden abgewickelt, so werden die Larven den Cocons entnommen und als Leckerbissen verzehrt.
Da nun für die Raupenzucht Maulbeerbäume unerläßlich sind, so findet man deren auch auf den meisten kleinen Landgütern, wo immer nur ein Plätzchen vorhanden ist, auf dem weder Reis noch Thee gepflanzt werden kann. Es giebt aber auch zahlreiche größere Maulbeerpflanzungen, in die die jungen Bäumchen gewöhnlich im Dezember in Abständen von etwa zwei Meter voneinander gepflanzt werden. Man läßt sie nicht zu Bäumen emporwachsen wie bei uns, sondern schneidet sie bis auf fünfzig Centimeter Höhe, und dieses fortwährende Beschneiden giebt ihnen ein Aussehen, wie es beiläufig unsere Weidenbäume zeigen, mit dicken Knollen am oberen Ende des Stammes, an dem zahlreiche Schößlinge hervorsprießen. Die Bäume werden fünfzig bis sechzig Jahre alt, und würde man sie wachsen lassen wie die wilden Maulbeerbäume, so besäßen sie in diesem Alter eine Höhe von zwanzig bis fünfundzwanzig Meter.
Für die Zucht der Seidenraupe werden natürlicherweise nur die größten und vollkommensten Cocons verwendet. Schon am ersten Tage, nachdem der weibliche Falter sich durch die seidene Hülle des Cocons gebohrt und das Licht der Welt erblickt hat, legt er gewöhnlich mit musterhafter Pünktlichkeit die Eier. Man setzt ihn für diesen Zweck auf einen großen Bogen groben Papiers, in den nördlichen, kälteren Provinzen wohl auch auf ein Stück Stoff, und auf diesem sieht man bald gegen fünfhundert winzige Eierchen. Diese Papierbogen oder Stoffe werden nun sorgfältig in reines Wasser getaucht und auf horizontale Bambusstangen zum Trocknen aufgehängt. Dort bleiben sie den Sommer und Herbst über bis zum Dezember und werden dann in ein reines, staubfreies, sonniges Zimmer auf den Boden gelegt. Im Februar werden die Eierbogen nochmals dadurch gewaschen, daß man sie eine Zeit lang mit lauwarmem Wasser übergießt; dies geschieht teilweise auch, um ein möglichst gleichzeitiges Auskriechen der Raupen zu erzielen. In manchen Gegenden bewahren die Chinesinnen die Eierbogen an ihrem Körper, um den Eiern die natürliche gleichmäßige Wärme zu teil werden zu lassen, oder sie legen sie auch zwischen die Untertücher ihrer Betten.
Naht die Zeit des Auskriechens der Würmer, so werden die Papierbogen auf reine Bambusmatten gelegt und diese in Fächer eingeschoben, die sich ringsum an den Wänden des Raupenhauses hinziehen. Diese Fächer sind ebenfalls aus Bambus angefertigt, weil Bambus geruchlos ist und die Raupen nach der Meinung der Chinesen Gerüche nicht vertragen können. Wenn nur die guten Zopfträger diese vortreffliche Eigenschaft ebenfalls besäßen! Das Reisen in China und der Aufenthalt in den Städten wäre dann unendlich viel angenehmer.
Es ist erstaunlich, welche Mengen an Maulbeerblättern die neu ausgekrochenen Würmchen vertilgen können. Sie sind kaum ein viertel Centimeter lang und von der Dicke eines Menschenhaares, aber dabei fressen sie sich in die saftigen grünen Blättchen hinein, daß es eine wahre Freude ist. Ursprünglich sind sie von schwarzer[S. 110] Farbe; während der zweiunddreißig Tage ihres Raupendaseins werden sie aber immer heller, bis sie schließlich eine schmutzigweiße Farbe zeigen und die Länge eines kleinen Fingers erreicht haben. Ihre einzige Lebensaufgabe scheint es zu sein, möglichst viel zu fressen, und die Chinesen behaupten, daß sie in einem Tage zwanzigmal ihr eigenes Gewicht an Maulbeerblättern verzehren. Alle fünf Tage setzen sie mit ihrem Fraß aus und geben sich dem Schlafe hin, während dessen sie sich häuten. Am zweiunddreißigsten Tage werden in den Raupenhäusern lose Strohbündel aufgehängt und auf jedes derselben sechzig bis siebzig Raupen gesetzt. Die Strohhalme geben ihnen den Halt, um sich einzuspinnen, und nach fünf Tagen haben sie sich aus den zartesten Seidenfäden ihren Sarkophag gesponnen. Ließe man sie darin ruhig schlafen, so würden sie am zehnten Tage als Schmetterlinge ihre Auferstehung feiern.
Dies ist natürlich keineswegs die Absicht der Seidenzüchter. Kaum sind die Cocons fertig gesponnen, so werden sie von den Strohhalmen abgelöst, auf Bambusmatten gelegt und der Hitze von Holzkohlenfeuern ausgesetzt, welche die Puppen tötet. Nun werden die Cocons in heißes Wasser gelegt, um die Seide zu lockern, und die Fäden mittels primitiver Mittel abgewickelt. Nur in Shanghai, Macao,[S. 111] Canton und Tschifu haben bisher europäische Filaturmaschinen zum Aufwinden der Coconfäden Anwendung gefunden. Wären diese in China ebenso allgemein eingeführt wie in Europa oder in Japan, das auch hierin die Europäer nachgeahmt hat, so würde die chinesische Seide noch viel mehr begehrt werden und größeren Wert besitzen, als jetzt, aber wem gelänge es, die Chinesen dazu zu bringen? Sie sind all diesen, von den europäischen Barbaren stammenden Neuerungen abhold, und wie ihre Großväter und Väter, so arbeiten auch sie heute noch in der althergebrachten Weise. Ich habe Bauernhäuser besucht, deren Inwohner nicht nur die Maulbeerbäume auf ihrem Grund und Boden pflegten und Seidenwürmer großzogen, die Weiber wickelten auch die Seide von den Cocons, spannen die Fäden und webten die Stoffe auf den ursprünglichen Webstühlen, die vielleicht seit Jahrhunderten schon in ihren Familien sich von einer Generation auf die andere vererbt haben.
Dabei sind die Stoffe fester, dauerhafter als jene, die auf europäischen Maschinen angefertigt werden, allein die letzteren sehen hübscher und gefälliger aus, und deshalb wetteifern sie mit chinesischen Stoffen in China selbst. Es giebt in dem ganzen großen Vaterlande der Seide heute noch keine einzige von Chinesen geleitete Seidenfabrik nach europäischem Muster. Selbst die kaiserliche Seidenfabrik in Nanking, die ich auf meiner Fahrt den Jangtsekiang aufwärts besuchte, hat noch keinen Dampfbetrieb, und die schweren herrlichen Brokate für die kaiserliche Familie, welche in Peking das Entzücken der europäischen Gesandten erwecken, werden auf den plumpen chinesischen Webstühlen gerade so wie um Christi Geburt hergestellt.
Aber es giebt doch eine Stadt in dem großen Reiche, wo man wirklich von einer großartigen, ausgebreiteten Seidenindustrie sprechen kann, wo gegen hunderttausend Menschen jahraus jahrein Stoffe weben, während in der Umgebung dieser Stadt noch eine gleich große Zahl von Arbeitern ihren Lebensunterhalt durch die Seidenweberei verdienen. Es ist Hangtschou. Obschon nur zwei Tagereisen von Ningpo, einem der großen Vertragshäfen Chinas entfernt, und leicht zu erreichen, wird es von Europäern nur selten besucht. Und das mit Unrecht, denn Hangtschou, die Hauptstadt der Provinz Tschekiang, ist eine der bedeutendsten und interessantesten Städte des Reiches der Mitte, bei den Chinesen hochberühmt seit undenklichen Zeiten. Sogar in Europa erlangte Hangtschou während einiger Zeit eine gewisse Berühmtheit, die es den überschwänglichen Schilderungen des großen Weltfahrers Marco Polo verdankte. „Sie hat hundert Meilen in der Runde”, so schreibt er, „und hundertsechzigtausend Häuser; dazu dreitausend Bäder, zwölftausend steinerne Brücken, jede einzelne bewacht von zehn Soldaten, und so hoch, um ganze Flotten durchzulassen; jede der zwölf Handwerksgesellschaften besitzt zwölftausend Häuser.” Nirgends hat Marco Polo etwas gesehen, wie diese „edelste der Städte, die großartigste und schönste der Welt”. Aber auch andere spätere Reisende,[S. 112] darunter der arabische Ahasverus Ibn Batuta, schwärmen von Hangtschou in ähnlicher Ueberschwänglichkeit. Die Chinesen sagen: „Um glücklich zu sein, muß man in Sutschou geboren sein und in Hangtschou leben”, und ein ähnliches Sprichwort der Zopfträger lautet: „Der Himmel über uns, Sutschou und Hangtschou auf Erden”.
Thatsächlich war Hangtschou schon zu Beginn der christlichen Zeitrechnung eine große Stadt und von 1127 bis 1278 die Hauptstadt des chinesischen Reiches mit zwei Millionen Einwohnern. Heute entspricht es freilich weder seiner eigenen Vergangenheit, noch den begeisterten Schilderungen der früheren Reisenden, aber es ist dennoch eine der sehenswertesten Städte von China. Wer es besucht, darf allerdings auf Dampferfahrten, Hotels und andere europäische Bequemlichkeiten, wie sie heute sogar schon tausend Kilometer den Jangtsekiang aufwärts im Herzen von China zu treffen sind, keinen Anspruch machen. Er muß von Ningpo aus in einem chinesischen Kanalboot die Reise unternehmen, will er nicht auf kantigen Maultierrücken und elenden holperigen Wegen landeinwärts reiten und in einem chinesischen Hotel übernachten, was auch nicht gerade zu den Annehmlichkeiten des Lebens zählt. Hangtschou liegt am Nordufer des breiten Tsientangflusses, nahe seiner Mündung in die Bucht von Hangtschou. Der Fluß wird auf Fährbooten übersetzt, welche jedermann, vom Mandarin erster Klasse bis zum letzten Bettler, zur freien Verfügung stehen. Diese Fährboote sind eine Eigentümlichkeit Hangtschous, ein Beispiel chinesischer Wohlthätigkeit. Bei dem ungeheuren Verkehr zwischen der immer noch eine Viertelmillion Einwohner zählenden Provinzialhauptstadt und ihrem großen Seehafen Ningpo würde eine geringe Abgabe den Inhabern der Fährboote, ob nun Regierung oder Privatunternehmer, reiche Einnahmen verschaffen, Hunderttausende von Taels jährlich. Allein die vornehmen Herren von Hangtschou, die Gilden und reichen Kaufleute dieser Stadt, sowie von Ningpo schossen ein beträchtliches Kapital zusammen, aus dessen Zinsen etwa dreißig Dschunken unterhalten und zur kostenfreien Verfügung der Reisenden gestellt werden.
Schon an dem seiner wilden Springfluten wegen berüchtigten Fluß zeigt sich Hangtschou viel großartiger als so manche andere noch volkreichere Chinesenstadt. Mächtige Mauern und Wälle mit hohen kanonengespickten Thoren umgeben die Stadt, und über diese ragen zahlreiche Pagoden und Tempel empor, schöner, prächtiger, höher als irgendwo in China. Sie sind die einzigen Ueberreste aus der nunmehr viele Jahrhunderte zurückliegenden Glanzzeit der Stadt. Damals lagen sie in der Mitte derselben, heute aber erheben sich viele in den Reisfeldern und Maulbeerpflanzungen der Umgebung, weit außerhalb der jetzigen Ringmauern. Wie die früheren, weit ausgedehnteren Ringmauern, so sind auch viele Tausende von Häusern und Palästen der Zeit zum Opfer gefallen. Die Chinesen bauen aber nicht wie die Griechen, die Römer und Aegypter es gethan, aus Stein, sondern aus Lehm, und nur für die wenigsten Bauten, hauptsächlich Pagoden und Ehren[S. 113]pforten, verwenden sie Quadern. Welch herrliche alte Städte würde China sonst besitzen! Was könnte es im Reiche der Mitte für Roms und Athens geben! Am verderblichsten war für die Größe und Blüte von Hangtschou der furchtbare Aufstand der Taipings um die Mitte des Jahrhunderts, und heute noch sind die trostlosen Spuren dieses verderblichsten aller Bürgerkriege selbst in der inneren Stadt nicht verwischt.
Die Chinesen errichten beim Häuserbau eben nur die Grundmauern bis auf etwa einen Meter über dem Erdboden aus Ziegeln oder Stein. Der Rest der Mauern wird aus gestampftem Lehm oder Erde errichtet und darüber aus Balken der Dachstuhl gebaut. Solche Mauern können heftigen Regengüssen und sonstigen Witterungseinflüssen natürlich nicht lange standhalten. Aehnlich wurden auch die Stadtmauern hergestellt. So dräuend sie auch aussehen mögen, sie sind aus Lehm aufgeworfen und nur äußerlich mit einer Lage von Steinen bekleidet, die aber nicht mit Mörtel aneinander gefügt werden. Die zahlreichen alten Tempel, Pagoden, Kaiserpaläste, Lusthäuser und Befestigungstürme, die heute im Umkreis von mehreren Kilometern um die jetzige Stadt in Feldern und Sümpfen liegen, liefern wie gesagt den Beweis, daß Hangtschou einstens vielleicht die überschwänglichen Lobpreisungen Marco Polos und des Ibn Batuta verdient hat. Auf den Inseln des großen Sees Si-Hu im Westen der Stadt erheben sich inmitten üppiger Vegetation derartige verfallene Bauten, deren leichte, elegante Architektur noch heute erkennbar ist. An den Ufern des Tsientangflusses steht die mächtige aus dem zwölften Jahrhundert stammende Pagode der sechs Harmonien, und an der Nordseite des Si-Hu die schlanke, vor nahezu einem Jahrtausend gebaute Pao-Schupagode. Der gewaltigste Bau ist jedoch wohl die ganz aus gebrannten Ziegeln hergestellte Lui-Fung-Ta, d. h. die Pagode des donnernden Felsens, gegen siebzig Meter hoch und aus dem zehnten Jahrhundert stammend.
Indessen Hangtschou geht dank seiner Seidenindustrie neuer Blüte entgegen und hat sich in den letzten Jahrzehnten abermals weit über seine jetzigen Ringmauern ausgedehnt, so daß zwischen den Stadtthoren und dem Tsientangfluß eine neue volkreiche Vorstadt entstanden ist. Wenige Städte Chinas zeigen in ihren geraden, verhältnismäßig breiten Straßen so lebhaften Verkehr; die Kaufläden, die nach den verschiedenen Industrien und Warengattungen beisammen liegen, sind schöner, größer, reichhaltiger, die Menschen sind besser gekleidet, und über der ganzen Stadt liegt ein Anstrich von Wohlstand, denn Hangtschou wird von vielen reichgewordenen Mandarinen und Kaufleuten, von Litteraten und Industriellen bewohnt. Ganze Quartiere werden von den Seidenwebern und Spinnern eingenommen, die Tag für Tag ohne Unterbrechung ihrem Gewerbe nachkommen und sich nur an acht oder zehn Tagen im Jahre, während des Neujahrsfestes, Ruhe gönnen. Gerade so wie in Canton werden auch hier in den kleinen Häusern Pongeeseide, Kopftücher, Stück[S. 114]seide und Brokate in vorzüglichen Gattungen hergestellt, aber während Canton sehr viel für die Ausfuhr nach Europa arbeitet, wird der größte Teil der Erzeugnisse von Hangtschou im Inlande abgesetzt, und die ganze Ausfuhr der Provinz Tschekiang beläuft sich nur auf etwa 400 Pikuls (25000 Kilogramm) im Werte von einer Viertelmillion Taels.
Am meisten Seide wird aus Hankou, im Herzen Chinas am Jangtsekiang gelegen, ausgeführt und ihr Wert erreicht jährlich gegen vierundzwanzig Millionen Mark; beiläufig ebensoviel exportiert Canton; dann folgen der Reihe nach Tschifu und Itschang. Im Jahre 1891 erreichte die Ausfuhr chinesischer Seide nach Europa zweihunderttausend Pikuls, im Jahre 1893 belief sich der Wert der Seidenausfuhr aus siebenunddreißig Millionen Taels oder etwa hundertundvierzig Millionen Mark.
In den nördlichen Provinzen, sowie in der Mandschurei werden die Seidenwürmer nicht allein mit Maulbeerblättern, sondern auch mit Eichenlaub großgezogen. Man läßt die Würmer auf den Bäumen, wo sie sich selbst nähren, und sie bleiben ohne Pflege und ohne Schutz, bis sie sich eingesponnen haben. Die Frühjahrscocons werden nicht eingeheimst; man läßt die die Falter auskriechen, und erst die Herbstcocons bilden die Ernte. In diesen nördlichen Provinzen ebenso wie im Stromgebiete des Jangtsekiang sind die Krankheiten der Seidenraupen, welche in Frankreich und Italien so große Verheerungen unter ihnen anrichten, unbekannt, dagegen sind sie in Tschekiang schon aufgetreten. Trotzdem liefert China unzweifelhaft auch heute noch die beste Rohseide, und sollten die Chinesen endlich die bewährten europäischen Erzeugungsmethoden annehmen, so würde es ihnen leicht werden, den japanischen Wettbewerb aus dem Felde zu schlagen und ihre jetzt schon so großen Einnahmen zu verdoppeln.
Am ersten Tage meines Aufenthaltes in Canton gewahrte ich in dem Straßengewirr dieser größten Stadt des Reiches der Mitte an einer Straßenbiegung eine junge Chinesin, ihrer Kleidung nach zu schließen, den besseren Ständen angehörig. Auf ihren winzigen Füßchen trippelte sie unbeholfen, auf einen Schirm gestützt, einher, ein seltsames Wesen mit bemaltem Gesicht und üppigem schwarzen Haar, in welchem einige natürliche Blumen steckten.
Die Chinesen, die ihr begegneten, blickten sie spöttisch an, einige riefen ihr mir unverständliche Worte zu, andere verhöhnten sie durch Gebärden. Die Chinesin aber ließ alle Vorübergehenden unbeachtet.
Das zarte Geschöpf interessierte mich, denn ihr unschuldsvoller Gesichtsausdruck und ihre Scheu sagten mir, daß sie unmöglich eine Jüngerin Aphrodites sein könne. Mein Dolmetscher, den ich darüber befragte, bestätigte meine Vermutung. „So geht es den Frauen immer”, fügte er hinzu, „wenn sie sich ohne Begleitung auf die Straße wagen. Anständige Frauen sollen bei uns das Haus nicht verlassen, und thun sie es, so lassen sie sich in geschlossenen Sänften tragen, oder sie nehmen Begleiterinnen mit.”
„Aber die vielen Frauen, die wir hier in den Straßen sehen”, frug ich weiter, „bleiben doch unbeachtet? Kein Mensch scheint sich um sie zu kümmern.”
„Weil sie arm sind, nur Arbeiterinnen und Frauen aus dem Volke. Aber Damen dürfen sich so nicht sehen lassen: das ist gegen die Sitte.”
Thatsächlich fand ich während meiner folgenden Reisen und Aufenthalte in größeren Städten diese Bemerkungen bestätigt. Der Gegenstand war so interessant, daß ich überall trachtete, so viel als möglich darüber zu erfahren. Auf vielen früheren Reisen hatte ich beobachtet, daß nichts so richtig auf den Kulturzustand eines Volkes schließen läßt, als die Stellung der Frau. In China ist diese Stellung nicht so tief, als es den Anschein hat. Die Mißachtung der Frau ist nur äußerlich und durch althergebrachte Formen eingeimpft. In Wirklichkeit spielt sie vielleicht eine ebenso wichtige, wenn nicht wichtigere Rolle und ist geachteter und einflußreicher als bei so manchem anderen Volke, dessen Kulturzustand für höher angesehen[S. 116] wird als jener der Chinesen. Der Fremde, der länger in China weilt, wundert sich in der ersten Zeit, den Chinesen niemals in der Gesellschaft ihrer Frauen und Töchter zu begegnen. Empfängt der Chinese zu Hause, so bleiben die weiblichen Mitglieder seiner Familie unsichtbar; giebt er Diners, so nehmen nur Männer, zuweilen auch Courtisanen daran teil, niemals die Frauen; besucht er das Theater, so werden die Frauen in einer abgesonderten, den Männern unzugänglichen Galerie Platz nehmen; fährt er an einem besonderen Festtage spazieren, so geschieht dies ausschließlich nur in Gesellschaft von Männern; die Frauen fahren in einem anderen Wagen und zu anderer Zeit aus. Bei Familienfesten, Hochzeiten und dergleichen bewirtet der Hausvater die Männer, seine Gattin die Frauen. Ja, es ist unter den Chinesen sogar ein Verstoß gegen die gute Sitte, nach dem Befinden der Frau überhaupt nur zu fragen, geschweige denn ihr einen Besuch abzustatten oder die (stets rote) Visitenkarte bei ihr zu hinterlassen. Im gesellschaftlichen Verkehr werden die Frauen vollständig ignoriert, als wären sie gar nicht vorhanden, obschon die Chinesen unter sich ein sehr ceremoniöses, höfliches Volk sind. Das einzige weibliche Wesen, das im Gespräch unter Bekannten beachtet wird, ist die Mutter. In einem fremden Hause erkundigt sich der Besucher nach dem Alter und dem Befinden aller männlichen Bewohner. Er fragt nicht: „Wie geht es Deinem Vater?” sondern in wörtlicher Uebersetzung: „Ausgezeichneter Bejahrter, welches ehrenwerte Alter?” d. h. „wie alt ist Dein Vater?” Der Vater des Hausherrn wird von Besuchern als der ausgezeichnete Ehrenwerte oder der ehrwürdige große Fürst bezeichnet; der Sohn nennt seinen Vater Majestät der Familie oder Fürst der Familie; der verstorbene Vater heißt der frühere Fürst. Will aber ein Gast der Mutter des Hausherrn (niemals der Frau) seine Aufmerksamkeit bezeugen, so sagt er: „Ausgezeichnete Langlebigkeit Halle bezeuge für mich Wunsch Ruhe”. Die drei ersten Worte deuten die Wohnung der Mutter an. Spricht ein Chinese mit einem näheren Bekannten von dessen Frau, so nennt er sie die ehrenwerte Dame oder Deine Bevorzugte; spricht er aber von seiner eigenen Frau, so bezeichnet er sie mit den Worten „tsien nui”, d. h. die Geringe der inneren Gemächer oder auch die Närrische der Familie. Selten dringt ein Fremder bis in die Frauengemächer seines Gastfreundes.
Unter solchen Umständen ist es ungemein schwierig, aus eigener Anschauung etwas über das Leben und die Stellung der Frauen in der besseren Gesellschaft der Chinesen zu erfahren; der Fremde wird sie im Theater, im Wagen oder in der Sänfte, dann bei festlichen Aufzügen oder in Tempeln sehen können, aber er kann nicht mit ihnen sprechen; die einzigen Auskünfte über sie kann er nur von Dolmetschern, von katholischen Missionären, welche vermöge ihres Berufes in das Familienleben der Chinesen näheren Einblick erhalten, und endlich von aufgeklärten, an den Umgang mit Europäern gewöhnten Chinesen selbst erhalten, wie es deren in den Hafenstädten, besonders in Shanghai, viele giebt. Ich habe diese Quellen[S. 118] nach Thunlichkeit benutzt und mir überdies die bezüglichen Stellen des in ganz China anerkannten Buchs der Gebräuche übersetzen lassen; einen tiefen Einblick in das Frauen- und Familienleben gewährt überdies ein äußerst interessantes Buch eines neueren chinesischen Schriftstellers, Luhtschau, genannt der weibliche Lehrmeister. In seiner Vorrede sagt er von den Frauen:
„Im Gespräch soll eine Frau nicht dreist und geschwätzig sein, sondern streng sich danach halten, was recht ist; ob sie ihrem Gatten einen Rat erteilt, oder ihm Vorwürfe macht, oder ihre Kinder unterrichtet, sie muß immer die Etikette beobachten, ihre Erfahrungen unterwürfig vorbringen.... Das Betragen der Frau soll streng, ernst und nüchtern sein, sich aber doch den verschiedenen Gelegenheiten anpassen, z. B. im Bedienen ihrer Eltern, im Empfangen oder Begrüßen ihres Gatten, beim Aufstehen oder Niedersetzen. Wenn in gesegneten Umständen oder in Trauer, oder bei der Flucht vor dem Kriege, soll sie durchaus anständig sein. Die wichtigsten Beschäftigungen eines Weibes sind die Zucht des Seidenwurmes und das Weben von Stoffen; die Zubereitung und das Austeilen der Speisen für die Haushaltung, dann das Vorbereiten der Opfergegenstände; danach können Studien und Lektüre die Zeit ausfüllen.”
Dieser Abschnitt aus dem Werke Luhtschaus sagt in wenigen Worten sehr viel, und was die Hauptsache ist, seine Vorschriften werden von der großen Menge der Frauen Chinas streng eingehalten. Es kann kaum sittsamere, keuschere und tugendhaftere Frauen geben, als es die Chinesinnen sind, sittsam im Betragen wie in der Kleidung. Im Gegensatz zu den Japanerinnen zeigt sich die Chinesin unter allen Verhältnissen stets vollkommen bekleidet, von der Fußspitze bis zum Halse; selbst unter den untersten Ständen, unter den Bootsleuten Cantons oder den Theearbeiterinnen Hankaus, bleiben höchstens die Füße und Unterarme unbekleidet.
Wie kleidet sich die Chinesin? Das ist gewiß für europäische Damen ein sehr interessantes Kapitel, zumal jetzt, wo die Schöpfer der Damenmoden wohl ihr ganzes Erfindungstalent aufgebraucht haben, wo die ganze Geschichte der Mode von der Jetztzeit bis zum Altertum und vom Altertum bis zur Jetztzeit mehrmals durchprobiert, wo alles bisher Erdachte schon mehrmals hervorgeholt, eingeführt und wieder abgesetzt wurde, wo nichts mehr übrig bleibt, als zu den Moden der letzten Jahre zurückzugreifen; denn mit jedem Jahre, mit jeder Saison wechseln die Damenmoden zum Schrecken aller Gatten und Familienväter. Wo kann man noch etwas Neues, nicht Dagewesenes hervorholen? Die Toiletten der Negerinnen und Indianerinnen sind selbstverständlich ausgeschlossen, die Gewänder der Bewohnerinnen Indiens und Japans entsprechen nicht dem europäischen Geschmack, also vielleicht China? Ich glaube nicht, daß unsere Damen an der Tracht der Chinesinnen besonderen Gefallen finden dürften, ebensowenig wie die letzteren an unseren Moden Gefallen gefunden haben. Beträgt die Bevölkerung Chinas wirklich[S. 119] vierhundert Millionen, so giebt es dort beiläufig zweihundert Millionen Evatöchter, also um vierzig Millionen mehr als in ganz Europa. Aber unter diesen zweihundert Millionen hat es bisher keine gegeben, welche die Tracht der europäischen Damen angenommen hätte, ja, ich habe in China keine einzige Chinesin gesehen, die auch nur ein Hütchen, ein Stiefelchen, einen Handschuh oder Strümpfe nach europäischem Muster getragen hätte. Ein ähnliches Beharren an althergebrachten Trachten, eine ähnliche Standhaftigkeit habe ich bisher bei keinem Volke angetroffen. Auf meinen Reisen sah ich zahlreiche Negerinnen, Indianerinnen, Mulattinnen, Frauen der Indier, Javaner, Malayen, Siamesen, Japaner, Birmaner, selbst der Araber in europäischen Frauentrachten. Noch zahlreicher waren jene, welche wenigstens einzelne Kleidungsstücke, vor allem Strümpfe, Schuhe und Hüte angenommen haben. Nicht daß diese europäischen Kleidungsstücke ihrem Aussehen zuträglich gewesen wären, im Gegenteile, bei keiner einzigen von den Tausenden des bunten Völkergemisches, das mir vorschwebt, hat ein europäisches Kleidungsstück je eine Erhöhung ihrer weiblichen Reize, eine Verschönerung ihres Aussehens zur Folge gehabt. Anderseits kann merkwürdigerweise die Europäerin, besonders jene der germanischen Rassen, die Tracht irgend einer anderen Rasse, ausgenommen der Negerinnen und Indianerinnen, die, sagen wir, zu geringfügig ist, anlegen, sie wird dadurch an eigentümlichem Reiz nur gewinnen. Nur eine Frauentracht macht darin eine Ausnahme: gerade jene der Chinesin, die unschönste, die ich unter den Frauentrachten der einzelnen fremden Völker kennen gelernt habe. Von den Chinesinnen werden die Erfinder der europäischen Damenmoden wohl kaum jemals etwas holen. In einer Hinsicht ist dies sehr bedauerlich, und diese ist die Beharrlichkeit, mit welcher die Chinesinnen an der althergebrachten Tracht festhalten. Wie ihre Urgroßmütter, so kleiden sie sich auch heute noch, und so werden sich voraussichtlich auch ihre Enkelinnen kleiden. Die Chinesin hat so wenigstens Gelegenheit, ihre Kleidungsstücke auszutragen, sie braucht sie nicht nach einjährigem Gebrauch wieder beiseite zu legen. Sie kann ihren Geist, ihre Mittel, ihre Zeit nützlicheren Dingen zuwenden als der leidigen Mode.
Im ganzen großen Weltreiche herrscht eine merkwürdige Gleichheit der Frauentracht, wie sie sonst in so ausgesprochener Weise nirgends vorkommt. Von der Mandschurei bis Tonkin, von Tibet bis ans Gelbe Meer zeigt der Schnitt der Kleider bei hoch und niedrig nur geringe Unterschiede. Am einfachsten sind wohl die armen Frauen jener Hunderttausende gekleidet, welche in Canton auf dem Perlflusse leben. Ihre Armut, ihr Elend gestattet ihnen keine anderen Kleidungsstücke als ein blaues bis über die Knie reichendes Oberhemd, an der Seite zugeknöpft, und ein Paar blaue Beinkleider aus Baumwollstoff, die bis nahe an die Knöchel reichen. Sie kennen keine regelrechte Kopfbekleidung, und ihre Füße sind nackt. Ebensowenig kennen sie Unterwäsche. Die einzige Koketterie, die sie entfalten, betrifft[S. 120] die gewöhnlich sorgfältige Haarfrisur, welche sie noch mit natürlichen Blumen schmücken; aber die Chinesin flicht ihre Haare nicht in Zöpfe, sondern kämmt sie glatt von der Stirn nach hinten und steckt sie dort, bandartig zusammengeklebt und verschlungen, mit einer langen Stecknadel fest. Jede trägt überdies Ohrgehänge aus milchgrünem Nephritstein (Jade), und jene, welche sich durch Arbeit mühsam einige Mark zusammensparen, legen diese gewöhnlich noch in einem ebensolchen Armring aus einem Stück an. Reichen ihre Mittel nicht dafür aus, so kaufen sie sich wenigstens Ohr- und Armringe aus grünlich-milchigem Glas.
Andere Kleidungsstücke als das Baumwollhemd und die Beinkleider kennen die Frauen und Mädchen der niederen Stände nicht; auch die Feldarbeiterinnen der südlichen Provinzen tragen sie Tag und Nacht. Bei brennender Sonnenhitze schützen sie ihren Kopf durch große Strohhüte, und dann sind sie aus einiger Entfernung von den Männern kaum zu unterscheiden, besonders wenn diese ihren langen Zopf nicht über den Rücken fallend, sondern um den Kopf gewunden tragen. In China, diesem Lande der verkehrten Welt, wo unsere Kultur auf den Kopf gestellt ist, tragen die Männer Zöpfe, nicht die Frauen.
Je höher man in der gesellschaftlichen Rangstufe der Chinesen aufwärts steigt, desto zahlreicher werden die Kleidungsstücke der Frauen. Jene, denen man in den Straßen Cantons, Swataus, Futschaus begegnet, tragen Sandalen oder Schuhe. Ihre Füße und Knöchel sind mit weißen Baumwollstreifen umwunden, welche zuweilen das untere Ende der Beinkleider umfassen. An ihren großen oder vielmehr natürlichen Füßen erkennt man, daß sie umherziehende Tagelöhnerinnen sind, die sich ihren Verdienst heute hier, morgen dort durch saure Arbeit erwerben. Die nächst höhere Stufe, die Frauen der Handwerker und kleinen Händler, sind durch reichlichere Kleidungsstücke und bessere Schuhe erkenntlich, die bei den Chinesen beider Geschlechter niemals aus Leder, sondern stets aus Stoff mit dicken Filzsohlen ohne Absätze bestehen. Gewöhnlich ist die Farbe der Schuhe schwarz. Sind sie blau, so befindet sich ihr Träger in leichter Trauer, sind die Schuhe und mit ihnen auch die Kleidungsstücke weiß, so befindet sich ihr Träger in tiefer Trauer. Nur die Unterkleider sind unter gewöhnlichen Verhältnissen weiß, und der Besitzer derselben zeigt dadurch allein schon, daß er dem Mittelstande angehört. Eine Frau aus diesen Ständen läßt sich schon aus der Ferne als solche durch ihren beschwerlichen, unbeholfenen Gang erkennen, der sich ausnimmt, als ginge sie auf kurzen Stelzen einher. Nähert man sich ihr, so gewahrt man auch die Ursache dieses eigentümlichen Ganges, denn die Füße zeigen sich wie schmale Ponyhufe, mit weißen Baumwollstreifen umwunden und in winzigen Schuhen steckend, die, kaum eine Spanne lang, mit bunten Zieraten und Stickereien versehen sind.
Viele Reisende, die auf ihrer Jagd um den Erdenglobus flüchtig durch Canton oder Shanghai wanderten, berichten, die Unsitte der Verkrüppelung der Füße sei im[S. 121] Abnehmen begriffen. Sie haben eben nur Frauen der untersten Stände gesehen, bei welchen die Fußverkrüppelung überhaupt nicht vorkommt. Aber bei den Frauen der mittleren und höheren Stände findet sie heute gerade so statt wie vor Jahrhunderten. Ja auf meinen Reisen durch die nördlichen Provinzen, vornehmlich in Schantung, habe ich selbst auf den Feldern, in den ärmsten Dörfern keine einzige Frau, kein Mädchen von über zwölf Jahren gesehen, deren Füße nicht verkrüppelt gewesen wären. Je höher die gesellschaftliche Stufe, welcher die Frau angehört, desto mehr werden auch ihre Füße von früher Jugend auf eingezwängt, desto kleiner erscheinen die Füßchen, ja ich habe in China neue sowohl wie getragene Schuhe erworben, die neun bis zwölf Centimeter lang sind. Als ich in einem Schuhladen in Hongkong zum erstenmale derlei Schuhe erblickte, hielt ich sie für solche von zwei- oder dreijährigen Kindern, bis ich erwachsene Frauen mit solchen Schuhen einhertrippeln sah. Hätte man mir dergleichen in Europa erzählt, ich hätte es für unglaublich gehalten. Die winzigen schmalen Füßchen in den hübschen, bunten Seidenschuhen nehmen sich ungemein zierlich und kokett aus, besonders wenn die Damen sitzen oder stehen. Gehen sie, so kann man sich der Gedanken an die Qualen, die sie ausstehen müssen, nicht erwehren, aber hat man Gelegenheit, einen nackten derartigen Fuß zu sehen, dann wird man von Entsetzen erfaßt. Im chinesischen Hospitale von Hongkong zeigte mir der (europäische) Arzt vom Dienste die Füße einer kranken Frau. Die vier kleineren Zehen waren unter der Fußsohle eingebogen, und ihre Nägel erschienen in die Sohle eingewachsen. Die Ferse war nach vorn gezwängt, derart, daß der Abstand zwischen dem fleischlosen Fersenknochen und der Spitze der großen Zehe kaum zwölf Centimeter betrug; und die Wadenknochen waren vollständig fleischlos, nur mit der runzeligen, roten Haut bedeckt.
Das ist chinesische Frauenschönheit, auf welche die Männer den größten Wert legen; das sind Reize, welche die chinesische Braut besitzen muß, wenn sie überhaupt einen Mann finden will. Von einer Abnahme dieses entsetzlichen Gebrauches in China habe ich nirgends etwas vernommen, auf dem Lande wie in der Stadt sind die Kin-lien, d. h. goldenen Lilien (so heißen die verkrüppelten Füße bei den Chinesen), nach wie vor ein Schönheitszeichen, und nur in Hangtschou habe ich erfahren, daß viele dortige Männer in ihren Heiratskontrakten die goldenen Lilien nicht mehr erwähnen, daß sie also die verkrüppelten Füße der Braut nicht mehr vorschreiben. Ich habe mit vielen Chinesen über diese entsetzlichen Martern, welche die armen Frauen ausstehen müssen, gesprochen, aber die meisten lächelten und meinten statt jeder weiteren Antwort, es wäre eben Sitte. Ein aufgeklärter Kaufmann in Shanghai stellte statt aller Antwort die Gegenfrage auf: „Verkrüppeln denn Ihre europäischen Damen nicht auch ihre Füße, verkrüppeln sie nicht ihre Körper, indem sie dieselben ebenso zusammenzwängen wie unsere Frauen ihre Füße?”
In dieser Hinsicht sind die Frauen der Tataren und Mandschuren viel besser daran. Die Fußverkrüppelung kommt bei ihnen nicht vor, es genügt ihnen, ihre an und für sich sehr kleinen, wohlgeformten Füßchen in zierliche Pantöffelchen zu stecken, und sie finden doch ihren Mann. Da die herrschende Kaiserdynastie einem Mandschurengeschlechte entstammt, so besitzt auch die Kaiserin von China keine verkrüppelten Füße, und am ganzen Kaiserhof ist diese Unsitte unbekannt.
Bei den Chinesen ist sie einfach Modesache, deren Entstehung noch von niemand erklärt worden ist. Uebrigens können sich viele fashionable Damen Chinas trotz ihrer Hemmschuhe erstaunlich gut fortbewegen. Freilich sah ich einmal in Nanking eine Dame, die vor ihrem Hause von einer Dienerin aus der Sänfte gehoben und auf ihrem Rücken in das Innere getragen wurde, gerade so wie die Fellachenweiber ihre Kinder auf dem Rücken tragen. In Chinkiang sah ich mehrere Sklavinnen, die ihre reich geputzten Herrinnen in derselben Weise über die Straße in ein Freundeshaus trugen. Die Damen hatten ihre Arme um den Nacken der Trägerinnen geschlungen, und die letzteren hielten ihre Lasten wieder dadurch, daß sie, mit ihren Händen nach rückwärts greifend, die Schenkel der Damen unterstützten. Die goldenen Lilien waren unter den Kleidern auf beiden Seiten der Sklavinnen sichtbar. Gesprächsweise erwähnte ich dies einem im Innern von China wirkenden Missionar gegenüber. Dieser, seit einer Reihe von Jahren dort thätig und mit dem Leben der Chinesen eng vertraut, erzählte mir seinerseits, er habe schon viele Chinesinnen kennen gelernt, die ungeachtet ihrer verkrüppelten Füße ohne Schmerz beträchtliche Strecken weit gehen konnten. Eine derselben war jeden Sonntag von ihrer mehrere Kilometer weiten Wohnung zum Gottesdienst in die Kirche gekommen und wieder zu Fuß heimgekehrt. Viele Hausfrauen haben bei ihren häuslichen Verrichtungen in den zumeist sehr geräumigen Homes mit ausgedehnten Gärten und Höfen täglich recht viel zu gehen, so daß der Einwand, die verkrüppelten Füße hinderten am Gehen, keineswegs richtig ist. Auf meinen späteren Inlandreisen sah ich Chinesinnen, mit ihren verkrüppelten Füßchen in Seidenschuhen steckend, auf den Feldern arbeiten; ja, als ich den heiligen Berg Taischan, sechstausend Fuß hoch, bestieg, thaten Dutzende von Frauen, darunter Greisinnen, das gleiche mit ihren winzigen Krüppelfüßchen.
Die Toilette der vornehmen Chinesinnen ist in Schnitt und Farbe jener der niederen Stände ähnlich, aber mit farbigem Besatz und den prächtigsten Stickereien reich verziert. Die Aermel sind weiter und länger, so daß bei herabfallenden Armen sogar die Hand davon bedeckt wird. Ein steifes Nackenband mit Stickereien hält den Faltenwurf in Ordnung, und auf der Brust sind dieselben Stickereien von Bären, Drachen, Reihern, Pfauen und dergleichen zu sehen, welche ihr Gatte je nach seinem Mandarinsrange tragen darf. Ueber dem Beinkleid tragen die vornehmen Damen Chinas noch einen langen blauen Rock, der bis an die Füße reicht und an den Hüften festgehalten wird. Das gestickte blaue Oberhemd fällt über diesen Rock bis nahe an das Knie herab. Jede Seite des Unterrockes zeigt sechs senkrechte Doppelfalten, und auf die Vorder- und Rückseite sind viereckige Stücke aus den schwersten Seidenstoffen aufgenäht, welche die herrlichsten und zartesten Stickereien tragen, Arbeiten, die unsere Damen in helles Entzücken versetzen würden. Sie, sowie der Kopfputz und die Füße bilden den Stolz der chinesischen Frauenwelt. Auf Schmucksachen, ausgenommen Ohrgehänge und Armspangen aus Halbedelsteinen, Perlen oder Edelmetall, wird kein besonderer Wert gelegt. Hüte sind auch bei vornehmen Damen unbekannt; ebensowenig tragen sie Kopftücher oder Schleier. Der Kopf ist stets unbedeckt und unverhüllt. Nur wenn Mandarinsfrauen zu Festlichkeiten an den Kaiserhof befohlen werden, erfordert die ungemein strenge Etikette, daß sie dieselben Hüte mit denselben Rangabzeichen tragen wie ihre Männer.
Viele Damen finden Gefallen daran, die Fingernägel des dritten und vierten, zuweilen auch des kleinen Fingers der linken Hand ein paar Centimeter lang wachsen zu lassen. Im Hause werden die Nägel durch zierlich ornamentierte Fingerhüte aus Gold oder Silber geschützt, die nach unten zu offen sind. Es blieb mir unverständlich, auf welche Weise die chinesischen Damen Hände und Gesicht waschen konnten, auf welche Weise sie auch ihre Zeit verbrachten, denn Handarbeiten mit[S. 124] derartigen Krallen sind ausgeschlossen, und mit dem Romanlesen ist es im Reich der Mitte schlimm bestellt.
Die kostbaren Juwelen werden von den Damen im Haar getragen. Ueberhaupt gefiel mir an ihnen der Kopfputz am besten, denn die Gesichter sind gewöhnlich mit einer dicken Schicht Puder bedeckt, über welche die Damen noch eine ebenso dicke Schicht von Rot legen, das bis an die Augenbrauen reicht. Sie suchen diese Malerei auch keineswegs zu verbergen, sie ist ehrlich, offen und dick aufgetragen, und gewiß kann sich niemand rühmen, eine chinesische Dame jemals zum Erröten gebracht zu haben. Die Augenbrauen werden zuweilen ausgezupft oder abrasiert, stets aber mit Holzkohle derart nachgezeichnet, daß sie etwa die Form des Mondes an den ersten Tagen nach Neumond besitzen. Was Wunder, daß mir unter solchen Umständen das Haar am besten gefiel? Auch hier werden falsche Haare zu Hilfe genommen, ganz so, wie es bei Damen, die unseren Rassen näher stehen, zuweilen auch der Fall sein soll. Nur ist es den Chinesinnen leichter, die Haarfarbe des Chignons zu treffen, denn sie sind durchweg rabenschwarz. Eine blonde oder rote Chinesin würde vielleicht größeres Aufsehen erregen als die siamesischen Zwillinge. Junge Mädchen tragen das Haar lang herabfallend. Frauen verleihen ihrem gewöhnlich sehr üppigen Haarwuchs erhöhten Glanz dadurch, daß sie es in harzigen Flüssigkeiten baden und sorgfältig kämmen. Haarbürsten sind den orientalischen Völkern unbekannt.
Durch Zufall sah ich einmal mit Hilfe des Feldstechers der Haartoilette einer Dame zu, eine gewiß verzeihliche Indiskretion, wenn man bedenkt, daß ich sie nur in ethnographischem Interesse, und um die Europäerinnen vielleicht etwas Neues zu lehren, beging. Die blatternarbige Schöne saß auf ihren Fersen auf dem Boden. Sie kämmte ihr reiches Haar von der Stirne glatt zurück und hob es etwas vom Kopfe dadurch, daß sie einen Finger darunter hielt. Dann wurde der flache Haarstrang am Scheitel nach vorn umgebogen, so daß er eine Schleife bildete, und mit einer Nadel festgesteckt. In ähnlicher Weise bildete sie mit dem Seitenhaar Schleifen, die weit vom Kopfe abstanden, und steckte sie am Scheitel mit Nadeln fest. Dann schmückte sie das Haar mit Juwelen und Blumen, von denen die hübscheste in ein kleines schmales Gefäß gesteckt wurde, das sie in dem Haar verbarg.
In den mittleren Provinzen Chinas wird das Haar von rückwärts nach aufwärts gekämmt und in einem hohen, vom Kopfe abstehenden Bogen nach vorn geführt, wo es festgesteckt wird. Ein chinesischer Poet besingt eine Schöne mit folgenden Worten: „Wangen wie die Mandelblüte, Lippen wie die Pfirsischblüte, den Leib wie ein Weidenblatt, Augen, so munter wie in der Sonne glitzerndes Wassergekräusel, und Füße wie die Lotosblume.”
Würden unsere Damen die Lage ihrer Schwestern bei den anderen Völkerrassen aus eigener Anschauung kennen lernen, so würden sie uns wahrscheinlich größeren Dank wissen für die gewiß beneidenswerte Stellung, welche wir ihnen, wir wollen es zugeben, auch mit vollem Rechte eingeräumt haben. Die Chinesen vergleichen beispielsweise die Stellung der Frau zum Manne wie jene der Erde zum Himmel, wobei der letztere selbstverständlich durch das starke Geschlecht dargestellt wird. Die Geschlechter sind in dem uralten Reiche der Mitte keineswegs gleichberechtigt wie bei uns. Der Chinese huldigt der Frauenschönheit und Frauentugend nicht wie wir, er besingt und umschwärmt sie nicht, Frauenwünsche und Frauenlaunen sind ihm nicht Befehle, die Ritterlichkeit und Höflichkeit, mit welcher unseren Damen, wie sie meinen, noch viel zu wenig begegnet wird, ist den Chinesen vollständig unbekannt. Der Mann herrscht dort, die Frau dient, dem Manne allein gehört das öffentliche Leben, die Frau bleibt im Hause, der Mann genießt vollständige Freiheit, die Frau ist dem Willen des Mannes unterworfen. Sie tritt überhaupt nicht an die Oeffentlichkeit und wird im großen ganzen als ein geringeres Wesen angesehen. Die Geburt eines Sohnes ist ein Freudenfest im Hause und in der ganzen Familie des Chinesen; die Geburt einer Tochter wird kaum berücksichtigt. Fragt man einen Chinesen, ob er Kinder besitze, so wird er das nur auf die Söhne beziehen und die Töchter gar nicht mit nennen, ja, es ist Thatsache, daß Tausende von neugeborenen Mädchen jährlich ermordet werden. Armut und übergroßer Kindersegen sind die Hauptursachen dieses verbrecherischen Gebrauchs. Von den Eltern selbst wird der Kindermord selten begangen; das Kind wird gewöhnlich der Hebamme übergeben oder vielleicht an einer Polizeistation oder an dem Kreuzungspunkt von[S. 126] Straßen weggelegt. Wird es gefunden, bevor es dem Hunger oder den Unbilden der Witterung unterlegen ist, so wird es einem der vielen in den Städten bestehenden Waisenhäuser übergeben und dort großgezogen. Die Regierung hat den Kindermord in mehreren kaiserlichen Edikten verdammt und mit Strafe belegt; er ist auch in den meisten Gegenden nicht so häufig, wie es angenommen wird, nur in Schantung und Honan scheint er überhand genommen zu haben. Uneheliche Kinder werden stets beseitigt. Auch bei Knaben kommt es zuweilen vor, besonders wenn sie mit Gebrechen behaftet sind, oder wenn die abergläubigen Eltern der Meinung sind, daß das Kind von bösen Geistern besessen ist. So wurde mir in Tsining am Kaiserkanal erzählt, daß kürzlich ein Knäblein in das dortige Waisenhaus gebracht wurde, das auf der Brust von Raben ganz zerhackt war. Ein christlicher Chinese soll es vor den Stadtmauern gefunden haben. In Tsining und Tsautschou-fu kommt das Weglegen von neugeborenen Töchtern besonders in Zeiten von Hungersnot sehr häufig vor. Gewöhnlich werden die armen Wesen schon im Elternhause getötet, die Leichen aber über die Stadtmauer geworfen, wo sie von Hunden und Raben gefressen werden. Ein chinesisches Sprichwort sagt: Igo guinia pango örr, d. h. „eine Tochter ein halber Sohn”, und wenn in einer Familie der Reihe nach mehrere Töchter geboren werden, so wird häufig auch in den besseren Ständen eine Tochter geopfert, in der Hoffnung, daß bei der Seelenwanderung ihre Seele doch in den Körper eines Knaben kommen dürfte.
In den meisten Großstädten befinden sich eigene Kindertürme, gemauerte Behälter, in welche die Leichen neugeborener Kinder geworfen werden, um die Beerdigungskosten zu ersparen. Aber es ist unrichtig, daß sie zur Aufnahme lebender weggelegter Kinder dienen.
In vielen Familien gleicht das Leben der Mädchen und Frauen, natürlich nur nach europäischen Begriffen, einem langsamen Hinsterben, denn sie sind an das Haus gefesselt, keine Frau darf es ohne Bewilligung ihres Gatten verlassen, und thut sie es, so kann der Mann sie einem anderen Manne als Konkubine verkaufen. Man hat mir von vielen Frauen erzählt, welche das Haus jahrelang nicht verlassen haben. Freilich darf man sich unter den Häusern der Reicheren nicht etwa solche wie die unserigen vorstellen. In China wohnen ganze Familien, oder vielmehr Familiengruppen, mit zahlreichen Männern, Frauen, Kindern und Sklavinnen in einem ausgedehnten Häuserkomplex mit Gärten und Lotosteichen, Lusthäuschen, Hallen und Tempelchen, alles von einer hohen Mauer umschlossen, aber über diese Mauer hinaus gelangen die Frauen nur selten. Sie haben ihre eigenen Häuser und Gemächer, und schon als Kinder von sechs bis sieben Jahren werden sie von ihren Brüdern und Vettern, mit einem Worte, von den Männern so viel als möglich abgesondert. Selbst in den Räumen der ärmeren Klassen dürfen Knaben und Mädchen nicht auf denselben Matten sitzen oder gemeinschaftlich ihre Mahlzeiten[S. 127] einnehmen. Ja, einem alten chinesischen Gebrauch zufolge sollen Frauenkleider mit jenen der Männer nicht auf denselben Nagel gehängt werden; Frauen sollen nicht an denselben Stellen baden, an welchen sich Männer zu baden pflegen; die Frau darf auch nicht mit dem Manne essen. Zuerst stillt er seinen Hunger, dann kommt die Frau. In den untersten Volksschichten können diese Gebote natürlich nicht eingehalten werden, aber in den höheren Ständen werden sie streng beachtet.
Erreicht das Mädchen ein Alter von dreizehn bis fünfzehn Jahren, so wird sie von den Eltern verlobt, ja sehr häufig findet diese Verlobung schon statt, wenn die Kinder kaum das fünfte oder sechste Jahr erreicht haben. Von einer selbständigen Wahl ihrer Gatten ist natürlich niemals die Rede. Nur in seltenen Fällen hat das Mädchen der besseren Stände Gelegenheit, andere Männer wenigstens flüchtig zu sehen, aber selbst wenn zwei junge Leutchen auf solche Art Zuneigung zu einander fassen sollten, müssen die Eltern ihre Zustimmung geben. Ein chinesisches Sprichwort sagt darüber: T’schü t’schi yu ho, pi ku fu mo, d. h. „will man ein Weib freien, so muß man sich an die Eltern wenden”. Die Eltern sind die unumschränkten Gebieter über ihre Kinder; diese werden niemals zu Rate gezogen, und nur von Seite der Männer darf eine Heiratsaufforderung ergehen, niemals von den Mädchen. Papa und Mama des zukünftigen Ehemannes, selbst wenn er erst acht oder zehn Jahre alt sein sollte, lassen durch eigene Heiratsvermittler in den verschiedenen, ihnen im Range annähernd gleichen Familien nach einem passenden Mädchen Umschau halten. Ohne Heiratsvermittler giebt es in China keine Heirat. Der Chinese sagt: Tien schang wu yün pu hsia yü, ti hsia wu mei pu t’scheng t’schin, „wie der Himmel ohne Wolken keinen Regen spenden kann, so kann auch keine Heirat stattfinden ohne Heiratsvermittler”, wobei diese Vermittler meistens pfiffige, alte Weiber sind.
Die beiden Familien erkundigen sich eingehend nach den beiderseitigen Verhältnissen, und sind diese befriedigend, so wird die Summe festgestellt, welche die Eltern des angehenden Ehemannes den Eltern der Braut zu zahlen haben, denn die Ehe in China ist im Grunde nichts weiter als der Ankauf einer Frau. Unrichtige Angaben dürfen dabei nicht gemacht werden, sonst erhält der schuldige Papa vom Gerichte hundert Stockstreiche verabreicht, und die Geschenke, welche der Braut beim Abschluß der Verlobung gemacht werden, müssen zurückgeschickt werden. Auch darf kein Zwang eintreten. Sollte es sich herausstellen, daß jemand die Tochter eines freien Mannes zur Ehe mit seinem Sohne oder einem sonstigen Anverwandten gegen den Willen ihrer Eltern oder Vormünder veranlaßt hat, so wird er gerichtlich erdrosselt. Die Tochter wird aber niemals nach ihren Wünschen gefragt, obschon die chinesischen Mädchen doch auch Herzen haben. Ihre Pflicht ist es, den Eltern zu folgen und sich fürs Leben an jenen zu ketten, den die Eltern für sie angenommen haben, mag auch das Herz dabei zu Grunde gehen. Deshalb kommen auch in China Liebes[S. 128]tragödien gar nicht selten vor. Will die junge Braut sich der Ehe mit einem ihr verhaßten Manne entziehen, so bleibt ihr nichts übrig, als Selbstmord zu begehen.
Sind die Erkundigungen, wie gesagt, befriedigend ausgefallen und die Verträge unterzeichnet, so sendet der Bräutigam seiner ihm gänzlich unbekannten Braut Verlobungsgeschenke, unter denen sich als wichtigstes häufig dieses nützliche, aber keineswegs besonders angesehene Haustier, eine Gans befindet. Die Gans gilt in China wie in Korea als das Symbol der ehelichen Treue. Mit der Annahme der Gans ist das Mädchen verlobt, obschon sie je nach ihrem Alter häufig noch Jahre warten muß, ehe ihr das zweifelhafte Glück zu teil wird, Frau zu werden. Was immer in manchen Werken über China behauptet werden mag, es kommt doch nur selten vor, daß Männer unter zwanzig Jahren, Mädchen unter fünfzehn Jahren wirklich heiraten.
Man kann sich die Gefühle eines solchen eben aufblühenden jungen Mädchens vorstellen, wenn sie den chinesischen Verlobungsring, die Gans, erhält. Sie hat keine Ahnung von dem Aussehen und Charakter des Menschen, mit dem sie für ihr ganzes Leben verbunden werden soll. Von ihren Eltern und Brüdern oder gar von Bekannten kann sie darüber wenig erfahren; denn vom Tage ihrer Verlobung an wird sie noch strenger gehalten als zuvor. Sie darf mit Fremden gar nicht verkehren, und sollten ihre Eltern Besuche erhalten, so muß sie sich aus dem Raume entfernen.
Wie ihre kleinen Füßchen, die goldenen Lilien, so werden auch ihre Gefühle, ihr ganzes inneres Wesen und Sein absichtlich verkrüppelt, und es wäre unverständlich, wie chinesische Mädchen unter solchen Umständen noch fröhlich sein, lachen und scherzen können, wüßten wir nicht, daß sie eben keine Ahnung von den glücklichen Verhältnissen haben, unter denen ihre kaukasischen Schwestern in Europa und Nordamerika leben. Ihr Horizont reicht nicht weiter als die Mauern ihres Heims, ihre Urteilsfähigkeit ist eingedämmt durch die althergebrachten Formen und Sitten, ihre Lektüre, wenn sie lesen gelernt haben, beschränkt sich auf langweilige Klassiker, Theaterstücke und chinesische Erzählungen, denn Bücher über Länderkunde, Geschichte und dergleichen giebt es nur wenige.
Am Tage der Ehe wird sie von einem Freunde ihres Gatten abgeholt, in eine rote Sänfte eingesperrt und so nach ihrem zukünftigen Heim getragen. Aber ihre Stellung bleibt nach wie vor die gleiche, denn sie erhält keinen eigenen Hausstand. Als Mädchen war sie die unterwürfige Dienerin ihrer Eltern und älteren Brüder, als Frau ist sie die Dienerin ihrer Schwiegereltern und ihres Gatten. Der Verkehr mit dem Elternhause hört auf, die Eltern ihres Gatten sind nun ihre Eltern, und selbst wenn ihr Gatte sterben sollte, so bleibt sie in der Familie desselben und darf zu ihren eigenen Eltern nicht zurückkehren. Dies ist sogar der Fall, wenn der Tod ihres Verlobten vor der Heirat erfolgen sollte. Ein derartiges[S. 129] Los ist gewiß nicht beneidenswert. Sie gelangt mitten unter Fremde, die ihr nicht immer mit Liebe begegnen, ohne Murren muß sie die Befehle ihrer neuen Mutter, der Herrin des Hauses, ausführen, sie selbst hat nichts zu sagen, ja sie findet mit Beschwerden bei ihrem Manne kaum irgendwelche Unterstützung, denn als erstes Gebot im chinesischen Familienleben gilt die Unterwerfung gegenüber den Eltern. Zeigt die junge Frau Unwillen oder Trotz, so kann sie von ihrem Manne geschlagen werden. Hilfe findet sie nirgends. Nur durch sklavische Befolgung ihrer Pflichten, durch Demut und Unterwürfigkeit kann sie sich allmählich die Neigung ihrer neuen Verwandten erwerben; wird ihr aber ein Sohn geboren, so ist ihre Stellung gesichert, sie wird fortan mit Achtung und Liebe behandelt. Während des ersten Monats nach der Geburt ihres Kindes ist sie das Opfer einer Menge eigentümlicher Gebräuche. Mutter, Vater, ja ihr eigener Gatte meidet das Gemach, in dem die Kranke liegt. Niemand als ihre Dienerin darf es betreten, und ein großer Strauß von Immergrün, über der Thür aufgehängt, warnt alle Besucher vor dem Eintritt. Ja die letzteren dürfen sogar ihre großen roten Visitenkarten nicht abgeben. Alle Personen, die mit ihr in demselben Hause wohnen, selbst Fremde, die das Haus während dieses ersten Monats betreten sollten, werden unrein und dürfen beispielsweise bis nach Ablauf des Monats keinen Tempel betreten. Stirbt die unglückliche Mutter während dieser Zeit, so hat sie im Fegefeuer bestimmte Strafen auszustehen, bis sie aus demselben durch besonders vorgeschriebene Tempelopfer befreit wird.
Ist das junge Wesen, dem sie das Leben gegeben hat, ein Mädchen, so wird die Stellung der jungen Frau womöglich noch ungünstiger, denn nicht nur, daß sie in der Achtung ihrer Eltern und Verwandten sinkt, ihr Gatte wird sich auch bald, wenn es seine Mittel erlauben, nach einer zweiten Gattin, oder vielmehr nach einer Konkubine umsehen. Die chinesischen Gesetze erkennen freilich nur eine Frau, und zwar die erste, als die rechtmäßige an, allein sie gestatten es dem Manne, so viele Konkubinen in sein Haus aufzunehmen, als er ernähren kann oder will. Diese Art der Vielweiberei kommt hauptsächlich bei den wohlhabenden Kaufleuten und Mandarinen vor, in den ärmeren Klassen nur selten. Dennoch sind mir auch hier derartige Fälle vorgekommen. Meine Bootsfrau in Canton, ein energisches, sparsames, flinkes Wesen, erzählte mir selbst, daß ihr Gatte sich eine Konkubine im Hause hielte, und beklagte nur das schwere von ihr sauer erworbene Geld, welches er ihr für diesen Zweck abpreßte. Ruderte sie mich mit ihren starken Armen auf dem breiten Strom umher, dann kam ihr Gespräch immer wieder auf ihren verlumpten Mann zurück und auf seine zweite Frau, die sie im Hause dulden mußte. Aus jedem Worte sprach ihre Eifersucht. Sind die Chinesinnen denn keine Frauen? Mein Dolmetscher in Canton besaß drei Frauen, jener in Chinkiang zwei. Durch Zufall begegneten wir diesen letzteren in der Straße, häßliche, ärmlich gekleidete[S. 130] Wesen: die eine war in einer Seidenzucht beschäftigt, die andere verkaufte den chinesischen Bootsleuten im Hafen Eßwaren. Wie ich mir nachher von einem Zollbeamten sagen ließ, hatte der gute Lin Tun Fung seine zweite Frau nur ins Haus genommen, weil er durch ihre Thätigkeit seine Einnahmen vermehrte.
So gefügig und duldsam die chinesische Frau auch sein mag, eine Nebenbuhlerin im Hause muß ihr doch arge Seelenschmerzen bereiten, denn nicht selten kommt es vor, daß sie durch allerhand kleine Mittelchen trachtet, ihre Schwester oder sonst eine Anverwandte ihrer eigenen Familie mit ihrem Manne zusammenzubringen, damit er sie als Konkubine wähle. Mehrere Konkubinen sind weniger schlimm als eine einzige. Um die Ruhe seines Hausstandes zu sichern, weist der Gatte der zweiten Gattin gewöhnlich eine eigene Haushaltung an, denn ein chinesisches Sprichwort sagt: „Ein Schlüssel macht keinen Lärm, zwei Schlüssel verursachen Gerassel”. Auch wenn die erste Frau ihm Söhne geboren haben sollte, nimmt der Chinese gerne noch eine zweite Frau; besonders Schiffer, Boots- und Handelsleute, die viel auf Reisen gehen, und wohlhabendere Beamte, welche die Bäder besuchen wollen. Seine erste Frau kann er nicht mitnehmen, weil ihr die Leitung der Hausgeschäfte obliegt, als Reisefrau nimmt er die zweite mit.
Der Ausdruck zweite oder dritte Frau ist nicht in diesem Sinne zu verstehen, denn nur die erste ist wirklich seine legitime Frau, und bei ihren Lebzeiten darf er keine zweite heiraten, er darf auch keine solche an die Stelle der ersten setzen, also ihre Stellungen in seinem Haushalte vertauschen. Die Nebenfrauen sind nur Konkubinen und unterstehen der wirklichen Gattin; sie werden auch nicht mit demselben Ceremoniell wie die letztere geheiratet, sondern einfach ihren Eltern abgekauft, und dabei kann der Gatte wenigstens dem Zuge seines Herzens folgen, lieben und in sein Haus aufnehmen, wen er will.
Die Nebenfrauen eines Chinesen sind, wie bemerkt, der Autorität der ersten Frau unterworfen. Diese allein hat im Hause zu befehlen, und das ist vielleicht die einzige Genugthuung, die ihr nach ihrer Demütigung durch den Gatten bleibt. Mädchen der besseren Stände werden auch für Nebenfrauen nicht hergegeben; gewöhnlich entstammen sie den armen Volksklassen, sind möglicherweise Sklavinnen oder sogar Dienerinnen aus dem eigenen Hausstande. Ihre Kinder müssen sie aber der ersten Frau abtreten, welche die Mutter aller Kinder ihres Gatten wird und mit diesem allein über ihre Eheschließung und alle andern Verhältnisse zu verfügen hat. Die wirklichen Mütter dürfen keine Einsprache erheben.
In Arbeit, Erziehung der Kinder und Verwaltung des Hausstandes vergehen die Jahre, und je älter sie wird, desto mehr steigt ihr Ansehen. War ihr Gatte der älteste Sohn der Familie, und sterben seine Eltern, so hat sie die höchste Stellung in der Familie erreicht, ist umgeben und hochgeachtet von den Frauen der jüngeren Brüder, ihren Kindern und Enkeln, die alle unter ihrer Leitung in demselben Häuser[S. 131]komplex wohnen. Stirbt ihr Gatte aber noch bei Lebzeiten seiner Eltern, und solange sie jung ist, so gilt es nicht für anständig, wenn sie sich einen zweiten Gatten nimmt, und die Fälle einer Wiederverheiratung kommen bei Witwen von Beamten niemals, bei solchen der höheren Stände nur selten vor. Aber ein chinesisches Sprichwort sagt: t’ieu yan hsia, niang yan tschia, wu fa k’o tschy,[S. 132] d. h. will der Himmel regnen und deine Mutter wieder heiraten, so kann sie nichts daran verhindern. Um die althergebrachten Sitten zu wahren und angesehenen Familien die Schande zu ersparen, eine Witwe ihres Hauses in ein anderes Haus übertreten zu sehen, werden standhafte Witwen in China auf eigentümliche Weise belohnt. Ich habe in chinesischen Städten und Dörfern häufig freistehende Thorbogen aus Stein, mit Inschriften bedeckt, wahrgenommen. Ursprünglich dachte ich, sie wären Triumphbogen, zum Andenken an kriegerische Thaten oder tapfere Generale aufgeführt. Aber diese tapferen Generale sind in diesem Falle gewöhnlich standhafte Witwen oder besonders brave Töchter gewesen. Ich kann mit meinem bescheidenen Europäerverstand freilich nicht begreifen, wie es bei einer Witwe besonderer Standhaftigkeit bedarf, nach den gewöhnlich sehr traurigen Erfahrungen der ersten Ehe dem Ansturm neuer Freier zu widerstehen. Aber in China scheint die Sache doch anders aufgefaßt zu werden, denn dieser tapfere Widerstand wird dem Distriktstaotai gemeldet, dieser macht einen Bericht an den Provinzgouverneur, und der letztere sendet ihn sogar an den Kaiser in Peking. Ich fand zuweilen in der Pekinger Staatszeitung Edikte, mit welchen Seine Majestät anordnet, daß der Witwe X. X. oder der braven Tochter Y. Y. in ihrem Heimatsorte ein Triumphbogen zu errichten sei. Wieder die verkehrte Welt. Bei uns sind es große Staatsmänner und Kriegshelden, welchen solche Ehren erwiesen werden, in China Mädchen und Witwen.
Stirbt die gesetzliche Frau eines Mannes, so darf er sich wieder verheiraten oder eine seiner Konkubinen zur ersten Frau erheben, die mit zunehmendem Alter endlich die Herrschaft über den ganzen Familienclan erhält. Ja, sollte sie in dieser höchsten Familienstellung ihren Gatten verlieren, so tritt nicht etwa der älteste Sohn an dessen Stelle als Leiter der Familie, sondern die Mutter bleibt es in unumschränkter Weise bis zu ihrem Tode. Der Chinese sagt, seine legitime Frau sei wie der Mond, die Konkubinen wie die Sterne, und alle drehen sich in ihrem Laufe um die Sonne, den Mann.
Die chinesischen Ehen sind nicht etwa unauflöslich. Die Gesetze nennen sieben Gründe für die Ehescheidung, welche die gesellschaftlichen Verhältnisse des Reiches der Mitte grell beleuchten. Sie sind: Ehebruch, Unfruchtbarkeit, Eifersucht, Ungehorsam, Diebstahl, Aussatz und Geschwätzigkeit. Auch kann die Scheidung auf gegenseitiges Einverständnis erfolgen. Sollte der Mann bei Ehebruch seiner Frau die Scheidung nicht verlangen, so setzt er sich der Bestrafung durch Stockstreiche aus; sollte sie während seiner Abwesenheit eine neue Ehe eingehen, so wird sie erdrosselt; nur wenn diese Abwesenheit drei Jahre dauert, kann sie nach Anmeldung bei den Gerichten ihre Freiheit erlangen.
Die armen Frauen der höheren Stände haben es kaum viel besser als jene der indischen Zenanas oder der arabischen Harems, und beinahe könnte man sagen, daß die Frauen der untersten Stände Chinas ein günstigeres Los haben, als ihre[S. 133] reichgekleideten, geputzten und geschmückten Schwestern. Sie sind wenigstens nicht an das Haus gefesselt, sie genießen einigermaßen Freiheit. Besonders in Canton und den südlichen Provinzen sah ich sie allen möglichen Berufen nachgehen. Schneiderinnen kauern an den Straßenecken, um Kleider zu flicken; Dienerinnen durchwandern die Gäßchen, um Einkäufe oder Besorgungen für ihre Herrin zu machen; auf dem Flusse und im Hafen verkehren die Frauen ungezwungen, durch keine gesellschaftlichen Formen eingeengt, mit den chinesischen oder fremden Männern. Die ärmsten der Frauen ziehen durch das Gewirre von Gäßchen der Städte, um allerhand Abfälle und Unrat für ihre Schweine zu sammeln. Draußen auf dem Lande sind sie in den Seidenzüchtereien oder auf den Reisfeldern thätig; sie schneiden Gras oder suchen auf den Bergabfällen nach Wurzeln, Zweigen und sonstigem Brennmaterial; Hunderte pflücken Theeblätter an den sich meilenweit hinziehenden kleinen Stauden; überall sind es kräftige, gut gebaute Gestalten, weit größer und stärker als ihre Schwestern in Japan oder Hinterindien. Weiter gegen Norden, in der Umgegend von Swatau oder Amoy, sind sie schon viel seltener; auch am Jangtsekiang und Kaiserkanal genießen sie lange nicht die gleichen Freiheiten wie in Canton.
Das auffälligste Merkmal eines Chinesen ist wohl sein Haarzopf. Ohne Zopf kein Chinese; er ist ihr größter Stolz und der hervorragendste Gegenstand ihrer Eitelkeit, sowie das Streben jedes Chinesenjungen, dem der Zopf erst in seinem zwölften bis vierzehnten Jahre zu tragen gestattet ist. Der Kaiser trägt ihn ebensogut wie der letzte Lastenträger, der tapfere Reitergeneral ebensogut wie der Apotheker, und nur eine Berufsklasse ist davon ausgenommen: die Priester, deren Schädel spiegelglatt rasiert sind. Diese Rattenschwänze entlocken den Europäern unwillkürlich ein Lächeln, aber sie bedenken nicht, daß unsere eigenen europäischen Feldtruppen bis zu Anfang des vorigen Jahrhunderts, die englischen Seeleute sogar noch bis zur letzten Generation, ebenfalls Haarzöpfe getragen haben. Allerdings waren die letzteren nicht so lang wie bei den Chinesen, dafür aber waren sie weiß gepudert und erhielten sich gerade beim Militär am längsten, während in China nahezu die ganze männliche Bevölkerung diese bis unter das Knie herabfallenden Haarzöpfe trägt. Die Mädchen haben in China nur bis zu ihrer Verlobung einen über den Rücken fallenden Haarzopf. Bis gegen die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts trugen die Chinesen ihr Haar ähnlich wie wir, und erst von der Vertreibung der angestammten Mingdynastie durch die Mandschuren stammt die Sitte, das Scheitelhaar zu einem Zopf zu flechten. Die Mandschuren waren Zopfträger, und kaum hatten sie die Herrschaft über das gewaltige Chinesenreich an sich gerissen, so machten sie den Zopf zum Zeichen der Unterwerfung. Jeder Chinese mußte sich seinen Schädel mit Ausnahme des Scheitelhaares kahl rasieren und das letztere in einen Zopf flechten lassen. Die Barbiere im ganzen weiten Reiche wurden mit der Ausführung dieser kaiserlichen Verordnung betraut. Mit dem Rasiermesser in der einen und dem Schwert in der andern Hand durchzogen sie ihre Distrikte, und den Chinesen blieb die Wahl, ihr Kopfhaar oder ihren ganzen Kopf zu opfern. Die große Mehrzahl entschloß sich natürlich zu der weniger schmerzlichen Operation. Immerhin kam es zu vielen Aufständen gegen diese drakonische Maßregel, zumal die Barbiere damals wie bis auf die jüngste Zeit den geächteten Ständen angehörten und nicht gut kaiserliche Beamte sein konnten. Deshalb kam der erste Mandschukaiser, einer der größten Herrscher, die China jemals gehabt hat, auf einen anderen, friedlicheren Ausweg: er verordnete, daß Verbrecher, Sträflinge und die Angehörigen der geächteten Volksklassen keinen Haarzopf tragen dürfen. Dadurch machte er den Zopf zum Wahrzeichen der[S. 135] Ehrbarkeit und des guten Bürgertums, der Widerstand hörte auf, und bald konnte man sich keinen Chinesen mehr ohne Zopf denken.
Uebrigens stammt aus jener Zeit ein charakteristisches Barbierzeichen, das seinen Weg auch durch ganz Nordamerika, zum Teil auch nach Europa gefunden hat. Den Besuchern der Neuen Welt wird es aufgefallen sein, daß die dortigen Barbiere vor ihren Läden kurze, dicke, bemalte Stangen als Abzeichen ihres Berufes errichten, und bis auf den heutigen Tag hat man vergeblich nach dem Ursprung dieser Sitte geforscht. Für den Kenner chinesischer Verhältnisse dürfte es indes zweifellos sein, daß dieser Ursprung in China zu suchen ist. Wie heute, so war auch schon vor Jahrhunderten das Abzeichen kaiserlicher Beamter eine oder eine Anzahl hoher Stangen vor ihren Wohnungen. Der Distriktsgouverneur hat deren z. B. zwei, der[S. 136] Provinzgouverneur vier vor seinem Amte stehen. Nun waren die Barbiere, als sie mit dem Abrasieren der Chinesenschädel von seiten der ersten Mandschuregierung betraut wurden, gewissermaßen kaiserliche Beamte und errichteten vor ihren Häusern den Beamtenpfahl. Diejenigen, die mit ihren Werkzeugwägelchen oder Schubkarren im Lande umherzogen, brachten diesen Pfahl, allerdings von geringerer Länge, an den Fuhrwerken an, und wie ich auf meinen Reisen selbst wahrgenommen habe, ist dies noch heute in China allgemein Sitte. Als die Chinesen ihre Wanderung übers Meer nach Amerika antraten und sich dort ansiedelten, war das Barbierhandwerk dasjenige, dem sich die Einwanderer am liebsten zuwandten; sie errichteten auch in Amerika ihre Barbierpfähle, und von ihnen nahmen die meisten Barbiere dieses Abzeichen an, das bald allgemein wurde. Den Chinesen ist die schönste Zierde des Mannes, der Bart, vorenthalten; erst im späteren Alter erscheinen um den Mund und an den Backen vereinzelte struppige Haare, die dann ihr größter Stolz sind und sorgfältig gepflegt werden. Sonst zeigen sich Haare nur auf etwaigen Gesichtswarzen, und auch diesen wenden die Chinesen besondere Pflege zu. Was ihnen die Natur im Gesicht versagt hat, ersetzte sie durch überreichen Haarwuchs am Hinterkopf, ein Haarwuchs, der stets tiefschwarz ist. Der kleinen Chinesenbrut wird der Schädel bis zum Alter von zwölf oder vierzehn Jahren in eigentümlicher Weise rasiert. Hier und dort, über den Ohren, am Scheitel, am Nacken werden einzelne kleine Haarbüschel stehen gelassen, so daß diese possierlichen Jungen aussehen, als würde die Natur ihnen gleich an sechs oder mehr Stellen Zöpfe wachsen lassen. Erst nachdem die Knaben das genannte Alter erreicht haben, wird der Schädel ganz glattrasiert und nur das Scheitelhaar stehen gelassen. Natürlicherweise wird dies erst nach Jahren lang genug, um daraus einen Zopf zu flechten. Im Mannesalter reicht das natürliche Scheitelhaar der Chinesen bis auf etwa den halben Rücken, bei manchen erreicht es sogar eine Länge von einem Meter und noch mehr, stets aber muß durch künstliche Mittel nachgeholfen werden, um dem Zopf die erforderliche Länge bis zu den Fußknöcheln zu geben. In das natürliche Haar wird gewöhnlich noch ein Strang Menschen- oder Pferdehaar eingeflochten, der am Nacken dicke, fest- und glattgeflochtene Zopf wird nach abwärts immer dünner, und etwa in der Nähe des Sitzteils besteht er nur noch aus einem Geflecht von Seidenschnüren von schwarzer oder roter Farbe mit einer Seidenquaste am Ende.
Sind die Chinesen in Trauer um ihre Eltern oder nahe Verwandte, so dürfen sie ihr Kopfhaar während der Dauer von sieben Wochen weder in Zöpfe flechten noch schneiden lassen, noch dürfen sie es kämmen. Stirbt der Kaiser, so gilt diese Vorschrift für alle Chinesen während der Dauer von hundert Tagen, und man kann sich unter solchen Umständen das wüste Aussehen dieser Millionen von Menschen leicht ausmalen, eine Nation von Struwelpetern. Die armen Barbiere haben[S. 137] während dieser Zeit gegen ihren Willen Ferien, und viele nagen am Hungertuche. Gewiß wird in dem ungeheuern Reiche niemand für Gesundheit und Langlebigkeit des Landesvaters eifriger beten, als es diese Ritter des Rasiermessers thun.
Ist die erste Zeit der tiefen Trauer verstrichen, so flechten die Chinesen in ihr hinteres Anhängsel statt der schwarzen Seidenschnüre weiße, weil Weiß die Farbe ihrer Trauer ist. Leute, die viel zu reisen oder in den Straßen der Städte zu thun haben, verwenden statt weißer auch blaue Schnüre, die den Schmutz weniger zeigen. Um das Beschmutzen möglichst zu verhindern, wird der Haarzopf auch auf Reisen oder bei schmutzigen Arbeiten, wie auf Flußbooten, beim Lastentragen, mehrmals um das Hinterhaupt gewickelt und festgesteckt. Bei der Annäherung von Höhergestellten oder im Verkehr mit diesen muß der Zopf losgebunden werden, denn ihn auf dem Kopfe zu behalten, wäre ein ebensogroßes Vergehen gegen die gute Sitte, als würde bei uns jemand den Hut aufbehalten oder Besucher in Hemdärmeln empfangen. Auf nichts verwenden die Chinesen bei ihrer Toilette größere Sorgfalt als auf ihren Zopf, nicht nur in ihrem eigenen Lande, sondern auch in ganz Ostasien überhaupt, ja selbst in Amerika. Ich habe auf meinen Reisen Zehntausende Chinesen gesehen, die den ärmeren Volksklassen angehörten und weder viel Kleidungsstücke, noch Nahrung, noch Wohnung besaßen, allein der Haarzopf war selbst bei diesen armen Teufeln in schönster Ordnung. Es kann einem Chinesen keine größere Schmach angethan werden, als wenn ihm der Zopf abgeschnitten wird. Mit abergläubischer Sorgfalt behüten sie ihn, und als vor einigen Jahren die Vegetarianersekte (Geheimbündler, die den Sturz der fremden Mandschudynastie anstreben) dem von dieser eingeführten Haarzopf den Krieg erklärten, als in unheimlicher Weise den Chinesen auf der Straße, im Theater, im Theehause, überall wo nur möglich, die Zöpfe abfielen, da herrschte die größte Erregung im Lande. Die Behörden befahlen der Bevölkerung, am Abend das Haus zu hüten, sowie Thüren und Fenster sorgfältig zu verschließen, ja, manche Stadtbehörden befahlen durch Maueranschläge allerhand Zaubermittel zur Beschützung des Zopfes. So verordnete z. B. der Taotai (Bürgermeister) von Peking als unfehlbares Mittel, in die Zöpfe einen roten und einen gelben Faden einzuflechten. In Hangtschau fand der Magistrat ein noch viel besseres Mittel. Drei verschlungene chinesische Schriftzeichen werden mit schwarzer Tinte auf gelbe Papierschnitzel dreimal niedergeschrieben. Eins der letzteren wird verbrannt und die Asche mit einer Tasse Thee getrunken, eins wird in den Haarzopf eingeflochten, und das dritte wird über die Hausthür geklebt. Bei solchen Gelegenheiten hat gewöhnlich zuerst die weiße Bevölkerung zu leiden; der Verdacht, mit den bösen Geistern in Verbindung zu stehen, fällt zunächst auf Missionare, Kaufleute, Reisende, und der geringste Anlaß, ein unbedachtes Wort, eine verdächtige Gebärde reicht hin, die Wut des abergläubischen Volkes auf die Weißen zu lenken. Also Respekt vor dem chinesischen Zopf!
Von den großen volkreichen Handelsstädten, welche an den Ufern des mächtigen Jangtsekiang liegen, und der Mehrzahl nach dem fremden Handelsverkehr geöffnet sind, ist Tschinkiang für den Reisenden am leichtesten erreichbar. Von Shanghai, der Metropole des ganzen Jangtsethales und wichtigstem Hafen desselben, fahren nahezu täglich große, bequeme Passagierdampfer stromaufwärts nach Hankau und berühren auf ihrer durchschnittlich fünf- bis sechstägigen Fahrt alle größeren Hafenstädte, darunter Tschinkiang.
Wir waren um Mitternacht von Shanghai abgefahren, und am frühen Nachmittag des folgenden Tages sahen wir in weiter Ferne die malerischen Wahrzeichen von Tschinkiang aus der vom gelben schlammigen Strom durchzogenen sumpfigen Ebene hervorragen: die wie eine riesige Halbkugel von achtzig Meter Höhe geformte Silberinsel mit ihrem Adjutanten, dem kleineren bewaldeten Federfelsen, beide mit kurios geformten Tempeln und Pagoden bedeckt. Kaum hatte unser Dampfer sie umfahren, so sahen wir am südlichen Ufer des Stromes die große Stadt vor uns liegen, zu beiden Seiten von bebauten Hügeln eingefaßt, die wie natürliche Wachttürme aus dem tiefen Sumpflande aufsteigen. Beide Hügel sind von geschichtlichem Interesse. Auf dem einen, uns näherliegenden, zeigt sich inmitten von grünen Parkanlagen das größte und imposanteste Gebäude von Tschinkiang,[S. 139] nicht etwa ein Tempel, eine Pagode oder Ahnenhallen, sondern das im europäischen Stil gebaute englische Konsulat. Im Jahre 1889 befand sich dasselbe in einem anderen Gebäude, als der hier stets unruhige, leicht erregbare Pöbel der Stadt ohne irgend welche Veranlassung einen Angriff auf das Konsulat unternahm und mit vielen anderen europäischen Häusern auch dieses Gebäude niederbrannte. Als Genugthuung den Engländern gegenüber mußten die Chinesen auf dem bewaldeten Hügel ein neues Konsulatsgebäude errichten. Auch der jenseits der Stadt, stromaufwärts gelegene Uferhügel erinnert die Chinesen an ihre vielen Kämpfe mit ihren besten Freunden, den Engländern. Dieser Hügel, die Goldene Insel genannt, lag noch im Jahre 1842 mitten im Fluß, und an der Südseite war die englische Flotte verankert, während die Landtruppen zu Lande jene Siege erkämpften, welche zu dem Friedensvertrag von Nanking führten. Diese einstige Insel ist längst mit dem Festlande innig verwachsen, ja sogar an ihrer Nordseite haben die Anschwemmungen des Jangtsekiang schon einen breiten Landstreifen geschaffen.
Zwischen beiden Hügeln sahen wir das Häusermeer von Tschinkiang in buntem, malerischem Flaggenschmuck prangen. Jedes Haus, jeder Tempel, die Masten der Tausende von Frachtbooten, welche sich im großen Kanal und an den Ufern des Jangtsekiang zusammendrängten, sogar die Bäume zeigten rote und weiße Flaggen; die ganze Bevölkerung schien auf den Beinen zu sein, und von der breiten, dem Jangtseufer entlang laufenden Bundstraße drang entsetzliches Lärmen und Schreien zu uns herüber. Der Comprador unseres Dampfers, selbst ein langbezopfter Chinese, klärte mich auf meine Frage darüber auf. Heute wäre gerade das Tiu-Tiufest, zu welchem gewöhnlich viele Tausende aus dem Innern des Landes hier zusammenzuströmen pflegten, und es sei an solchen Tagen nicht rätlich, sich zu weit in die Stadt hineinzuwagen. Allein gerade dieses heidnische Fest reizte meine Neugierde. Der Ingenieur des Dampfers erklärte sich bereit, mich zu begleiten, wir schlangen die Feldstecher um die Schultern, steckten Revolver ein und machten uns auf den Weg.
Wegen der Unterwaschung der Flußufer, wie sie auf dem ganzen unteren Jangtsekiang vorkommen, können die Dampfer auch hier nicht direkt an dieselben anlegen, sondern an eigene Hulks, alte abgetakelte Schiffskörper, die in der Nähe des Ufers fest verankert und mit dem letzteren durch Brücken verbunden sind. Jede der drei großen Dampfergesellschaften des Jangtse hat ihren eigenen Hulk, und der ganze Uferraum zwischen denselben ist mit zahllosen Dschunken, Segelbooten, Sampans, Frachtschiffen und Kanonenbooten dicht gefüllt. Tschinkiang ist ja nicht nur ein großer Verkehrshafen und Handelsplatz des Jangtsethales, es liegt auch im Mittelpunkte eines Netzes von Kanälen, deren größter, der Kaiserkanal, gerade hier den Jangtse kreuzt. An diesem Kreuzungspunkte der beiden wichtigsten Wasserstraßen von China mußte eine große und reiche Stadt entstehen, trotz der schweren Kata[S. 140]strophen, welche sie während des letzten halben Jahrhunderts zu überstehen hatte. Im Jahre 1842 wurde sie nach langer Verteidigung von den Engländern gestürmt und eingenommen, aber die rothaarigen Barbaren fanden innerhalb der Ringmauern zu ihrem Entsetzen nichts als Leichen vor. Die Verteidiger, größtenteils Mandschuren, hatten zuerst alle Weiber und Kinder, dann sich selbst getötet, um ja nicht in die Hände des von ihnen so sehr gehaßten Feindes zu fallen. Dreizehn Jahre später hatte die Stadt durch Zuwanderer wieder sehr gewonnen, als die furchtbaren Horden der Taiping sie einnahmen und teilweise zerstörten, und weitere vier Jahre später, im Jahre 1859, fiel sie in die Hände der kaiserlichen Truppen, die hier ebenso wütend hausten, wie in dem benachbarten Nanking. Die ganze Bevölkerung wurde niedergemetzelt, die Stadt bis auf die Ringmauern und einige Straßen dem Erdboden gleichgemacht. Noch im Jahre 1894 sah ich dort Ruinen, welche aus jener Zeit herrührten.
Aber alles das waren nur zeitweilige Hindernisse für den Aufschwung von Tschinkiang, das heute wieder an zweihunderttausend Einwohner zählt und innerhalb des von den Ringmauern umschlossenen Vierecks gar keinen Platz mehr hat. Es hat sich über die Stadtmauern ausgedehnt, und gerade in den westlich entstandenen Vorstädten ist der Sitz des Handels, des hauptsächlichsten Verkehrs und Reichtums der Stadt, während der östliche Teil ganz dem großartigen Leben und Verkehr auf dem Yunhokanal untergeordnet ist. An die westliche Vorstadt stoßen gegen die Landseite zu ärmere Quartiere, die sich bis zu den sanften von Festungswerken gekrönten Höhen hinter der Stadt hinanziehen und in weit ausgedehnten Friedhöfen mit kleinen, konischen, grünen Grabhügeln endigen.
Die Fremdenkonzession liegt dicht an den Ufern des Jangtsekiang. Obschon in derselben alles in allem genommen nur siebzig Europäer wohnen, haben sie doch einen hübschen mit steinernen Warenhäusern und schmucken Villen besetzten Bund (d. h. Uferstraße) geschaffen, der ebenso wie die nächstliegenden Seitenstraßen wohl gepflastert, beleuchtet und mit üppigen schattenspendenden Bäumen besetzt ist. Von dem chinesischen Ueberfall im Jahre 1889, bei welchem die Hälfte aller Häuser der Konzession zerstört wurde, ist keine Spur mehr wahrzunehmen. Die Handvoll Europäer, welche hier neben und mitten unter zweihunderttausend Chinesen wohnen, haben ihre eigene städtische Verwaltung, ihre Feuerwehr, Polizei, zwei Kirchen und einen Klub. Es fehlt ihnen nur noch eine tägliche Zeitung, aber auch sie wird kommen.
Wir fanden die Mehrzahl der europäischen Bewohner von Tschinkiang im Garten des Zollkommissärs versammelt. Die gegen den Bund gelegene Ecke der hohen festen Gartenmauer war mit Erde zu einer Art Terrasse angefüllt worden, und von dieser beobachteten die europäischen Damen des Orts (etwa ein halbes Dutzend) in völliger Sicherheit die Vorgänge auf der Straße, zumal eine Reihe[S. 141] von Polizisten mit langen mehrzackigen Lanzen, Säbeln und ballschlägerartigen, rot gestrichenen Holzkeulen hier Wache standen. Der mich begleitende Schiffsingenieur und ich waren die einzigen Europäer in den Straßen.
War schon auf dem Bund das Brüllen und Stoßen, Lärmen, Schreien, Gestikulieren, Tamtamschlagen und Musizieren der Chinesen zum Davonlaufen, so wurde es in der eigentlichen Chinesenstadt noch weitaus überboten, denn alle Augenblicke fuhren uns auch noch die massenhaft zum Knallen gebrachten Feuerfrösche (Fire-Crackers) zwischen die Beine, die Mehrzahl der sich drängenden und umherstoßenden Chinesen trugen brennende Joßkerzen, rasselten mit langen auf die Erde fallenden Ketten oder schlugen mit eisernen Pilgerstöcken heftig auf den Boden. Jedes einzelne Haus, fast ohne irgend welche Ausnahme, war mit rotweißen Fahnen bunt ausstaffiert, vor jedem Hause, selbst dem ärmlichsten, war ein Altar errichtet, oder doch wenigstens ein mit einem Tuch bedeckter Tisch aufgestellt. In der Mitte des Altars oder Tisches standen überall Sandbüchsen mit glimmenden Räucherkerzchen, und zu beiden Seiten derselben steckten brennende Kerzen aus rotgefärbtem Wachs in zinnernen Leuchtern. In den Straßen gewahrte ich nur Männer und Knaben, keine Frauen. Ihnen blieben die Häuser überlassen, und sie nutzten diese Gelegenheit, das seltsame Schauspiel zu betrachten, auch gehörig aus. In den Fenstern, auf Balkonen, Hausdächern und Gartenmauern standen oder saßen sie in ihren kostbarsten Festkleidern, hauptsächlich von blauer Farbe, seltener grün, schwarz oder weiß, aber keine einzige von den Tausenden, die ich sah, war rot oder gelb gekleidet. Ihre mitunter recht hübschen Gesichter waren mit Puder- oder Schminkeschichten überzogen, in der äußerst sorgfältigen Haarfrisur steckte allerhand Schmuck, vom billigsten Flittergold und Papierrosen bei den Armen bis zu kostbaren Perlschnüren und großen Jade(Nephrit-)steinen bei den Reichen. Die letzteren waren überdies durch ihre winzigen, nicht viel mehr als daumengroßen Füßchen kenntlich, die sie kokett zwischen den Balkongittern hervorstreckten.
Was das Gewimmel und das Getöse in den Straßen zu bedeuten hatte, war mir nicht recht klar. Jeder schien den Festtag des heidnischen Schutzpatrons von Tschinkiang in seiner eignen Weise feiern zu wollen. Die reichen Kaufleute der Stadt hatten große Summen dazu beigesteuert, und aus der Provinz waren viele Tausende, darunter das schlimmste Gesindel, hierhergekommen, um sich einen guten Tag zu machen. Sie wurden noch durch Tausende von Bootsleuten von der Flotte des großen Kanals verstärkt.
In langen malerischen Prozessionen zogen sie durch das enge Straßengewirre der Stadt. Viele von ihnen waren in phantastischer Vermummung, in langen hellroten Talaren mit hohen zuckerhutförmigen Hüten, von denen lange Fasanenfedern wagerecht abstanden; andere mit goldenem und silbernem Flitterwerk bedeckt, wieder andere hatten den Oberkörper ganz unbekleidet, und ihre Köpfe steckten in[S. 142] scheußlichen Tierfratzen; alle aber trugen groteske Waffen, Dreizack, flammende Schwerter, Morgensterne, Lanzen oder Pilgerstäbe mit rasselnden Ketten umwickelt.
Hier und da wurden den Prozessionen bunt aufgeputzte Kinder vorangetragen, die auf drei bis vier Meter hohen Stangen saßen und auf die Papierrosen in ihren Haaren und ihre glänzende Goldflitterkleidung nicht wenig stolz schienen. In jeder Prozession wurden prachtvolle Sänften umhergetragen, mit Vergoldungen und Schnitzereien bedeckt, manche sogar aus getriebenem Silber. Durch die Glasfenster gewahrte ich im Inneren aus Holz geschnitzte, langbärtige Fratzen. Die zahlreichen Fahnen, Sonnenschirme und Inschriftentafeln, die wie ein wandelnder Wald jeder Prozession vorangetragen wurden, zeigten die Namen der einzelnen Zünfte und Gilden der Stadt. Zwischen den einzelnen Umzügen wogte zerlumptes halbnacktes Gesindel auf und nieder, von den berittenen Soldaten mühsam in Ordnung gehalten. Zahlreiche Bettler, die Stirnen seltsamerweise mit weißem Papier verklebt, warfen sich uns auf den Knien entgegen, so daß wir kaum vorwärts kommen konnten. Gleichzeitig kam von einer Seitenstraße ein phantastischer Karnevalszug des Wegs, lärmend, heulend und waffenschwingend, als wären sie alle eben dem Tollhaus entwichen. Zwischen ihnen befanden sich einzelne Reiter. Wir konnten weder vor- noch rückwärts. Der Zug, mehrere hundert Menschen umfassend, hatte uns bald umringt, ich wurde von meinem Gefährten getrennt, und als ich den Versuch machte, ihm nachzueilen, versperrten mir die Reiter durch die Pferdekruppen den Weg. Gleichzeitig begann ein wilder Geselle mit langem zerzausten Haar und Kettenstäben in den Händen auf mich loszuschreien und schien die übrigen auf mich zu hetzen, denn ich bemerkte, wie sich die Gesichter verfinsterten und drohend überall die bewaffneten Hände erhoben. Schließlich spie der wilde Geselle mich an und trachtete mich über den Haufen zu werfen. Da war guter Rat teuer. Ich war allein inmitten vieler Tausende fanatischer Chinesen, deren leichte Erregbarkeit durch die Aufstände und Abschlachtungen in früheren Jahren hinreichend bekannt war, und ein Nachgeben, einen Augenblick des Zögerns hätte ich möglicherweise mit meinem Leben bezahlen müssen. Rasch entschlossen griff ich nach meinem Revolver, den ich in der rechten Rocktasche trug. Auf dem Wege dahin streifte meine Hand das Etui mit meinem Fernglase; ich weiß nicht wie es kam, einer plötzlichen Eingebung gehorchend, zog ich statt des Revolvers mein Fernglas hervor und hielt es an mein Auge. Verwunderung malte sich auf den Gesichtern der Umstehenden, das Geschrei und Geheul verstummte, und derselbe wilde Hallunke, der mich eben zuvor hatte niederschlagen wollen, riß mir das Glas aus der Hand. Kaum hatte er es an sein Auge gesetzt, so begann er zu lachen und die ihn Umgebenden der Reihe nach zu betrachten. Sein Erstaunen mußte die Neugierde der anderen in hohem Grade erwecken, denn ein Reiter entriß nun ihm mein Glas, und kaum hatte er lachend durch dasselbe geblickt, so wanderte es[S. 143] zu seinem Nachbar. Seine Ausrufungen versetzten die Zopfträger in große Heiterkeit. Alle lachten, und ich glaubte am besten zu thun, indem ich mitlachte. Mein Glas war nun in den Händen eines Mannes, der an der Ecke eines seitwärts führenden engen Gäßchens stand. Ich zwängte mich zu ihm durch, nahm ihm lachend das Glas aus der Hand, und ohne mich umzublicken, verschwand ich in dem Gäßchen, das gerade weit genug war, um einen Menschen durchzulassen. Durch dasselbe hatte sich auch mein Begleiter geflüchtet, und zu meiner Freude erwartete er mich am anderen Ende dieses finsteren Durchgangs.
Wir hatten nun genug von den Festlichkeiten der Provinzheiligen und wanderten aus der Stadt hinaus, die sanfte Anhöhe empor, die von einem Fort mit merkwürdigen Pagodendächern gekrönt wird. Auf den Umfassungsmauern steckten Hunderte von kleinen dreieckigen Fahnen in Rot und Weiß. Der Weg führte durch eine ausgedehnte Nekropole mit Tausenden und Abertausenden von kleinen Grabhügeln, hier und dort unterbrochen von kleinen Rasenflächen und Baumgruppen. Unter einer der letzteren gewahrten wir auf einer Steinbank sitzend vier Chinesinnen, die in den Anblick des wunderbar schönen Jangtsekiangthales versunken schienen, das sich zu unseren Füßen auf viele Meilen stromauf- und -abwärts ausdehnte. Als wir ihnen näher kamen, bemerkten wir erst, daß diese vermeintlichen Chinesinnen hellblonde Haare und blaue Augen hatten, dabei so große Füße, wie sie eine Tochter des Reiches der Mitte noch niemals besessen haben mag. Die vier Damen waren Angestellte irgend einer schwedischen Mission, die hier oben unter dem Schutz des Forts ein Missionshaus besaß. Neben diesem, und auch auf dem jenseitigen Abhang der Anhöhe im Freien zerstreut, liegen noch einige andere Missionshäuser, hauptsächlich amerikanischen Sekten angehörend. Die Missionäre leben hier mit ihren Frauen recht lauschig und behaglich und geben den Chinesen die verschiedenen Arten und Wege an, auf welchen sie als Christen selig werden können. Da giebt es eine Amerikan-Baptist-Mission, Amerikan-Methodist-Episkopal-Mission, Amerikan-Southern-Presbyterian-Mission, China-Inland-Mission, aber sie alle zusammengenommen mit ihren Dutzenden von Missionären und deren Frauen und ihren reichen Mitteln haben nicht ein Viertel des Erfolges aufzuweisen, den die beiden katholischen Padres französischer Nation hier mit ihren bescheidenen Mitteln erzielt haben. Wenn diese vielen amerikanischen Missionäre wenigstens für die Europäer von irgend welchem Nutzen wären! Wie wünschenswert wäre es z. B., wenn in den Spitälern der Missionen kranke Europäer Aufnahme fänden. Leider ist dies nicht der Fall; Europäer werden abgewiesen und nur kranke Chinesen aufgenommen.
Das Fort auf der Anhöhe schien mir von den Hunden besser bewacht als von den Soldaten. Während die ersteren bei unserem Kommen Lärm schlugen, blieben die letzteren, große Damenstrohhüte auf den bezopften Köpfen, ruhig auf dem grünen Rasen liegen und schielten nur mit halboffenen Augen zu uns herüber. Als ich[S. 144] Miene machte, das Thor zu durchschreiten, sprang einer der Soldaten auf und verwehrte uns den Eintritt. Nur wenn wir einen Erlaubnisschein vom Mandarin besäßen, dürften wir in das Innere des Forts. Indessen wir wurden durch die wunderbare Aussicht auf den Jangtsekiang reichlich für diese Enttäuschung entschädigt. Von hier oben konnten wir deutlich die früheren Ufer des ewig wechselnden Stromes verfolgen. Bald reißt er von einem Ufer ganze Morgen, ja Quadratkilometer Landes ab, um sie am jenseitigen anzusetzen, bald bricht er sich eine neue Laufbahn durch die üppigen Gersten- und Roggenfelder, bald läßt er Inseln aus seinem Bett verschwinden, bald weiter abwärts neue entstehen. Mit dem Fernglas musterten wir das jenseitige Ufer des gewaltigen Gelben Stromes, wo sich noch zur Mitte des 19. Jahrhunderts die große Stadt Koatschen befunden hat, eines der wichtigsten Salzdepots von ganz China, und zeitweilig waren zu ihren Füßen im Fluß gegen zweitausend Salzboote und Dschunken verankert. Wir konnten davon nichts mehr wahrnehmen als einzelne elende Hütten, mitten im Morast steckend. Der Jangtsekiang hat die Stadt verschlungen. Auch das einst so berühmte Jangtschau hat seine frühere Bedeutung gänzlich eingebüßt. Jangtschau liegt nur einige zwanzig Kilometer von Tschinkiang an der Nordseite des Jangtsekiang und war in früheren Zeiten die Hauptstadt des Jangreiches. Vor sechshundert Jahren, lange bevor irgend ein Europäer den Fuß auf chinesischen Boden setzte, besaß Jangtschau einen europäischen Gouverneur, keinen anderen als Marco Polo, der drei Jahre hier residierte.
Aus jener Zeit ist wohl weder dort, noch in Tschinkiang etwas übrig, nicht einmal die alten Pagoden der Goldenen Insel dürften dieses Alter besitzen. Als wir von unserem Ausflug zurückgekehrt waren, ließen wir uns nach diesem Heiligtum der Buddhistenwelt rudern, wo kolossale Buddhastatuen, umgeben von solchen seiner Apostel und Gelehrten, der Anbetung durch die andächtigen Zopfträger harren, aber das Leben und Treiben auf dem Bund, der Hauptstraße der Fremdenansiedelung. interessierte uns mehr, und stundenlang hätte ich dem Treiben in den offenen Eßbuden, rings um die ambulanten Küchen, bei den Spieltischen, Frucht- und Eierhändlern zusehen können, wenn nicht der furchtbare, ohrenbetäubende Lärm gewesen wäre. Die Chinesen scheinen nichts thun zu können, ohne dabei aus vollem Halse zu schreien; selbst die Lastenträger schreien bei jedem Schritt ihr ha-ho desto kräftiger, je größer die Last, die sie zu tragen haben, als ob sie die Arbeit mit Geschrei allein verrichten könnten. Vom frühen Morgen bis zum Einbruch der Nacht aus Tausenden von Kehlen ohne Unterbrechung ha-ho schreien zu hören ist begreiflicherweise kein Vergnügen für die europäischen Bewohner der Konzession. Vor einigen Jahren wandten sie sich deshalb an den Taotai von Tschinkiang mit dem Ersuchen, das Schreien zu verbieten. Das geschah auch, aber am folgenden Tage schrieen die Kulis ihr ha-ho vielleicht nur noch kräftiger, und dabei ist es bis heute geblieben.
Eine Stunde nach Mitternacht hielt der große, nach Hankau bestimmte Jangtsekiangdampfer mitten auf dem breiten Strom, und der langbezopfte chinesische Steward bedeutete mir, ich wäre in Nanking angekommen. Vom Verdeck aus sah ich von dieser Weltstadt, deren Bevölkerung Millionen zählte, dieser einstigen Hauptstadt des größten Reiches der Erde, nichts weiter als eine gewaltige Ringmauer. Der Vollmond beschien die einsamen Ufer des Stromes. Kein Schiff, nicht einmal eines der vielen chinesischen Kanonenboote, welche auf dem Jangtsekiang den Polizeidienst versehen, deutete die Einfahrt in den Hafen an; nur zwei niedrige ärmliche Gebäude standen dort dicht am Stromufer, und von diesem stieß eben ein kleiner, von ein paar Kulis gelenkter Sampan ab, um mich abzuholen. Ein paar Minuten später saß ich darin, und während meine chinesischen Bootsleute mit kräftiger Hand durch die Fluten des hier reißenden Stromes dem Lande zuruderten, verschwand der große Dampfer in der Richtung gegen Hankau.
Es war ein Glück, daß die englischen Professoren der Marineschule in Nanking von meinem Kommen unterrichtet waren und mir eine Sänfte mit vier Trägern entgegengesandt hatten, sonst hätte ich wohl im Freien außerhalb der Stadtmauern übernachten müssen. Raschen Schrittes trugen mich die Kulis durch die elende Hüttenstadt, welche den Hafen von Nanking bildet. An dem Kanal angelangt, welcher dieses verkommene Nest mitten durchschneidet, mußten die Bootsleute der[S. 146] Fähre durch kräftige Hiebe aus dem Schlaf geweckt werden. Was sind die Chinesen doch für ausgezeichnete Schläfer! Der Kanal war über und über mit Pantoffelbooten bedeckt, deren jedes einer Familie als Wohnung dient. Obschon nun Hunderte von Hunden bei unserem Kommen wütenden Lärm schlugen, ließ sich doch niemand aus dem Schlafe wecken. Nur aus einem der Boote drangen leise Gongschläge zu mir herüber. Einer der Insassen mochte wohl im Sterben liegen, und die aufmerksamen Verwandten trachteten durch diese Gongmusik die bösen Geister zu vertreiben.
Jenseits des Kanals trugen mich die schweißtriefenden, stinkenden Kulis abermals eine Viertelstunde lang durch eine öde, verlassene Gegend, ehe wir an die ungeheuren Stadtmauern von Nanking gelangten. In dem bleichen Mondlichte zeigten sich diese noch viel gewaltiger, als sie wirklich sind. Auf viele Meilen zogen sie sich zu beiden Seiten unseres Weges in die Ferne, aus großen Quadern bestehend und vortrefflich erhalten, noch immer eines der größten Werke, welche Menschenhände geschaffen haben. Sie umgeben die alte Kaiserstadt in einem Umkreise von vierunddreißig Kilometern und erreichen bei einer Stärke von acht bis vierzehn Metern eine Höhe von fünfzehn bis dreißig Metern. Im ganzen genommen, enthalten sie nicht weniger als sieben Millionen Kubikmeter Mauerwerk und dreißig Millionen Kubikmeter Erde, also das Sechzehnfache der größten Pyramide Aegyptens. Hunderttausende von Menschen müssen jahrelang an diesem ungeheuren Werke gearbeitet haben, und die Mauer hat auch den Jahrhunderten, die seit ihrer Erbauung verflossen sind, ebenso wie den vielen Kriegen und Belagerungen getrotzt, deren letzte zur Zeit der Taipingrevolution die furchtbarste war. Nur nach langer Mühe gelang es den kaiserlichen Truppen im Jahre 1864, eine Bresche in dieses gewaltige Werk zu schießen. Sie wurde seither wieder ausgebessert. Der Vizekönig der Provinz verwendete dafür, sowie für die Erneuerung der Thortürme mit den schön geschwungenen Dächern eine Million Mark, eine Geldsumme, welche mit größerem Nutzen in der Stadt selbst hätte verausgabt werden können. Das ungeheure Thor, durch welches unser Weg in die Stadt führte, war fest verschlossen. Lange mußten meine Kulis mit den Tragstangen der Sänfte pochen, ehe die inneren Querbalken losgelöst wurden und der eine Thorflügel sich so weit öffnete, um uns durchzulassen. Ein Soldat in Pantoffeln und ohne irgend welche Bewaffnung sah mich mit schlaftrunkenen Augen an, richtete aber weder eine Frage an meine Begleiter, noch verlangte er mir meinen Reisepaß ab. Und das zu einer Zeit, als die Japaner sich mit allen Kräften zu dem großen Kriege rüsteten, der einige Monate später wirklich ausbrechen sollte.
Jenseits des vielleicht hundert Meter langen gewölbten Thorweges, der unter den Mauern und Wällen der Stadt in das Innere derselben führte, mußten meine Kulis noch eine geraume Zeit wandern, ehe wir das Thor der Marineschule,[S. 147] meiner Behausung, erreichen. Die Straßen waren wohl mit gutem Pflaster versehen, allein die Häuser zu beiden Seiten waren nur erbärmliche Lehmhütten, ähnlich wie ich sie in den ärmsten chinesischen Dörfern gesehen habe. Die einzigen Menschen, denen wir auf unserem nächtlichen Marsche begegneten, waren Nachtwächter, die schläfrig durch die einsamen Straßen wanderten und bei jedem Schritt mit ihrem eisernen Speer auf den Boden schlugen, oder mit Zinken und Trommeln etwaigen Dieben und Einbrechern ihr Nahen verkündeten. In der Wachtstube gegenüber der Marineschule lagen zehn Soldaten schlafend auf ihrem harten Holzlager ausgestreckt. Bei unserem Kommen wurde von einem dieser Vaterlandsverteidiger kräftig eine Trommel gerührt, in der ganzen Stadt, nah und fern, antworteten Dutzende von Trommeln. Trotz dieses laut durch die Nacht hallenden Wachtrufes rührten sich die schlafenden Soldaten nicht. Wozu auch? Sie sind ja längst an diesen nächtlichen Lärm gewöhnt. Als ich eine Stunde später selbst in dem ganz modernen europäischen Hause der Marineschule zur Ruhe gegangen war, dauerte das Trommeln noch fort. Alle Augenblicke wurde ich durch Trommeln aus dem Schlafe geweckt; aber mit der Zeit gewöhnte auch ich mich daran. In allen chinesischen Städten wird zur Nachtzeit fortwährend getrommelt, Gong geschlagen, Tuba geblasen, und ohne diesen Lärm müßte es den Hunderten von Millionen schlafender Chinesen ganz unheimlich vorkommen.
Als ich am nächsten Morgen meinen ersten Spazierritt durch Nanking unternahm, wunderte ich mich, warum der Vicekönig, der in einem bescheidenen Yamen seine Residenz aufgeschlagen hat, für die Ausbesserung der Stadtmauern so viel Geld ausgegeben haben konnte. Wo war denn eigentlich das vielgerühmte Nanking? Ich war innerhalb der Stadtmauern, aber die Stadt selbst suchte ich stundenlang auf- und niederreitend vergeblich. Reis-, Gerste- und Roggenfelder bedeckten weite Flächen, andere waren von wüstem Sumpfland eingenommen, wieder andere bedeckte dicht wucherndes Gestrüpp und Wald. Hie und da zwischen den Feldern erhoben sich elende Strohhütten, in welchen armselige Weiber ihren Hausrat besorgten, während die Männer die Wasserbüffel bewachten, die in den Feldern den Pflug zogen. Weiterhin führte mich mein Weg durch Trümmerfelder von Quadratkilometern Ausdehnung, bedeckt mit Steintrümmern und Schutthaufen, zwischen denen das Unkraut üppig emporschoß. Wohl hatte ich von den furchtbaren Verwüstungen gehört, die der große Taipingkrieg in den sechziger Jahren in seinem Gefolge hatte, allein so entsetzlich, wie ich sie nun in Wirklichkeit fand, hätte ich dieselben nicht für möglich gehalten. Sollte denn von all den Tausenden von Palästen, Tempeln, öffentlichen Gebäuden, Pagoden, welche die Millionenstadt in früherer Zeit besessen hat, wirklich nichts mehr übrig geblieben sein? Wo war die Purpurstadt, wo der Kaiserpalast, in dem die Kaiser der Mingdynastie residiert haben, wo der Palast des letzten Taipingkaisers? Ich ließ mir die Tatarenstadt[S. 148] zeigen, die, von einer eigenen Ringmauer umschlossen, im östlichen Teil von Nanking gelegen ist. Auch dort nichts als Steintrümmer, ähnlich jenen des Dschebel Mokattam in Kairo oder denen von Karthago, wo ich vor Jahren umhergewandert, nur noch trostloser, weil sie frischer waren, aus der neuesten Zeit stammten. Ich hatte wenigstens Ruinen erwartet, wie sie Paris in seinen Tuilerien, seinem Staatsratsgebäude, seinem Hôtel de ville besessen hat, und als ich auf dem weißen Steingeröll umherreitend endlich meinen Begleiter nach dem Kaiserpalast fragte, antwortete er mir, ich befände mich eben auf der Stelle, wo er sich vor der Taipingrevolution befunden hätte. Und die Ruinen? Das Steingeröll, über das mein Pferd einherstolperte! Nicht ein Stein liegt dort auf dem anderen. Nanking ist nicht mehr. Es wurde während der Revolution einfach zu Staub zermalmt, vom Erdboden weggewischt, wie man Staub vom Spiegel wischt. Kein Erdbeben, kein Brand, keine Ueberschwemmung hätte hier schlimmere Verwüstungen anrichten können als die Hand von Menschen während der Revolution. Ich befand mich in Tokio, als ein Erdbeben viertausend Häuser zerstörte oder beschädigte. Ich habe Chicago bald nach dem großen Brande gesehen, der es großenteils vernichtete, und St. Cloud in Minnesota nach dem furchtbaren Tornado, der es in Trümmer geblasen hat. Nirgends war die Vernichtung auch nur annähernd so vollständig wie hier, wo nichts als weiße Trümmerfelder die Stelle anzeigen, wo noch Mitte dieses Jahrhunderts eine der größten, ältesten und volkreichsten Städte unseres Erdballes gestanden hat. Innerhalb der Mauern von Nanking hat sich in der That eines der merkwürdigsten, leider nur zu wenig bekannten Ereignisse der Weltgeschichte abgespielt. Hier war es, wo der berüchtigte Hong-Sin-Tsien, ursprünglich ein armer Schullehrer, durch seine Ueberzeugung und Thatkraft sich zu einem gewaltigen Heerführer emporgeschwungen und schließlich während elf Jahren als Kaiser über die Hälfte des chinesischen Reiches herrschend, der Dynastie in Peking so starren Widerstand entgegengesetzt hat. Seine Armeen waren überall erfolgreich, überall wurden die kaiserlichen Heere durch die Taiping geschlagen, und eine Zeit lang glaubten die Chinesen selbst an die Intervention des Himmels zu Gunsten des Friedenskaisers in Nanking. Aber als die Kaiserlichen endlich die Europäer um Hilfe anriefen, war es mit der sagenhaften Unüberwindlichkeit vorbei. Unter ihren Heerführern waren überdies Zwistigkeiten ausgebrochen; viele kämpften auf eigene Faust, etliche fielen in den Schlachten, andere gingen mit ihren Mannschaften zu den Kaiserlichen über. Müde von den Bedrückungen, dem Sengen, Rauben und Morden der umherziehenden Taipingbanden fielen ganze Provinzen von dem Rebellenkaiser ab, und diesem blieb schließlich von seinem großen Reiche nichts weiter als seine Residenzstadt Nanking. Lange Zeit hielt er sich dort, hauptsächlich geschützt durch die gewaltigen Ringmauern. Am 30. Juni 1864 gelang es endlich der Artillerie des kaiserlichen Belagerungsheeres, in diese Mauern eine Bresche zu[S. 149] schießen, und damit war der weitere Widerstand der Rebellen ein erfolgloses Bemühen. Aber die letzteren ahnten wohl, welch schreckliches Schicksal ihnen schließlich bevorstand, und deshalb entschlossen sie sich, lieber auszuharren, als sich zu ergeben. Nur der Rebellenkaiser selbst verlor den Mut. Schon lange war sein Geist durch die rasch aufeinanderfolgenden Schläge getrübt worden, und als er noch die Nachricht von dem Fall der großen Ringmauer erhielt, nahm er sich durch Gift das Leben. Seine Generale riefen nun seinen Sohn zum Kaiser aus, und der sechzehnjährige Jüngling übernahm den Befehl über die Verteidigungstruppen. Achtzehn Tage hielten sich die Rebellen noch gegen die Kaiserlichen. Am 19. Juli 1864 aber drangen die letzteren durch die Bresche in die Stadt. Ein treuer Diener von Hong-Siu-Tsien rettete den jungen Rebellenkaiser dadurch, daß er ihm sein eigenes Pferd gab, allein ebenso wie sein Retter, fiel schließlich auch der Kaiser in die Hände der siegreichen Belagerer und wurde enthauptet.
Beim Lesen des offiziellen Berichts über die Einnahme von Nanking stehen einem vor Entsetzen die Haare zu Berge. Nicht weniger als hunderttausend Menschen wurden innerhalb dreier Tage niedergemetzelt, viele Tausende starben in der durch so viele verwesende Leichname verpesteten Stadt. Alles wurde zerstört und verwüstet, die ganze Stadt mit unbeschreiblicher Wut dem Erdboden gleichgemacht. Selbst der Leichnam des verstorbenen Hong-Siu-Tsien wurde nicht verschont. Die Kaiserlichen fanden sein Grab; sie rissen der verwesenden Leiche die Haut vom Körper, warfen seine Gliedmaßen den Hunden vor und ließen seinen Kopf auf einer Stange steckend durch die aufrührerischen Provinzen tragen. So endete die Rebellion der Tschang-Mao, vielleicht die schrecklichste und blutigste aller Zeiten. Nankings Ruinen sind nicht die einzigen. Im ganzen Jangtsekiangthale und in den südlich davon gelegenen Provinzen blieb wohl keine Stadt verschont. Jahrzehnte werden noch vergehen, ehe sich die Bevölkerung der verwüsteten Provinzen, über hundertfünfzig Millionen, von den furchtbaren Verheerungen der Taiping erholt haben wird, Nanking aber ist wohl auf Jahrhunderte hinaus gebrochen. Die Regierung ließ allerdings aus den umliegenden Provinzen Ansiedler kommen, sie unterstützte die Wiederaufnahme der einst so berühmten Industrien, der Seidenspinnerei, der Fabrikation des unter dem Namen Nanking bekannten Baumwollstoffes, der Porzellanmanufaktur; sie ließ außerhalb der Mauer ein Arsenal errichten, und die Stadt soll heute chinesischen Berichten zufolge wieder eine Viertelmillion Einwohner haben. Ich glaube es nicht. Nach meiner Schätzung können die wenigen Straßen, die hier und dort auf dem weiten Trümmerfelde wieder entstanden sind, kaum mehr als hunderttausend Menschen enthalten. Sie wohnen in ärmlichen Häusern, zum größten Teil aus den Trümmern der zerstörten Stadt erbaut, und Handel und Wandel sind nur ein Schatten dessen, was er früher, und wie er heute in benachbarten Städten, in Shanghai, Tschingkiang, Wuhu herrscht. Armut und[S. 150] Aberglaube überall. In den elenden Kaufläden hängen lange Schnüre von Shoes, d. h. Silberbarren, aber aus Silberpapier angefertigt, welche die Chinesen an den Gräbern ihrer Verstorbenen oder in den Tempeln ihren Götzen opfern. Vor den Thoren der wenigen besseren Häuser stehen kurze hohe Wände mit allerhand Fratzen bemalt, um die bösen Geister zu bannen. Als ich nach meinem ersten Spazierritt in die Marineschule zurückkehrte, fiel mir auf, daß das Hauptthor nicht in derselben Linie mit der Umfassungsmauer war, sondern schief stand. Als ich die Professoren, meine Gastfreunde, darüber befragte, erklärten sie mir, daß auch beim Bau dieses europäischen Hauses, wie bei jenem der chinesischen Häuser, Gelehrte und Wahrsager zu Rate gezogen wurden, um die günstigste Lage gegenüber den guten und bösen Geistern zu bestimmen. Sie erklärten, das Thor müsse genau nach Süden gerichtet sein, und deshalb die schiefe Lage desselben. Nun vergingen sich die europäischen Professoren beim Bau des Hauses insofern, als sie es ein Stockwerk hoch aufführen ließen. Darob großes Geschrei unter den Chinesen, die es nicht zugeben wollten, daß dieses Haus höher sein sollte als jenes des obersten Leiters der Schule, eines chinesischen Generals. Glücklicherweise stand dasselbe aber auf einem Hügel. Die Professoren erklärten nun ihrerseits, sie hätten alle Rücksichten für ihren Vorgesetzten beobachtet, denn das Dach ihres neuen Hauses wäre thatsächlich tiefer gelegen als jenes des chinesischen Generalshauses. Die Gelehrten überzeugten sich durch Augenschein von der Richtigkeit dieser Behauptung, und das Haus blieb stehen. Sonst hätte gewiß das erste Stockwerk wieder abgetragen werden müssen.
Die verhältnismäßige Neuheit der Häuser in den über die ungeheure Fläche zerstreuten Stadtteilen läßt diese auch reinlicher erscheinen als andere chinesische Städte; die Leute, großenteils im Dienste der Provinzialregierung stehend, die hier ihren Sitz hat, und überdies durch die vielen christlichen Missionen beeinflußt, sehen auch reinlicher und besser gekleidet aus; die Straßen sind breiter, und vor den zahlreichen ärmlichen Kaufläden befinden sich, durch Holzgitter eingefaßt, kleine Vorplätze mit Sitzbänken, welche den Inhabern und Käufern tagsüber als Aufenthalt dienen. Die großen Entfernungen erschweren natürlich den Verkehr; an Stelle der Schubkarren, welche in Shanghai, Tschinkiang, Tschifu und anderen Städten des Nordens zur Beförderung von Menschen und Lasten dienen und von kräftigen Kulis geschoben werden, verwenden die Bewohner Nankings größtenteils Esel, die im Vergleich zu den elenden, mageren Tieren, die man in Italien und der Levante sieht, viel kräftiger und besser genährt sind. Kein Wunder! Befinden sich doch innerhalb der Ringmauern dieser merkwürdigen Stadt ganze Quadratmeilen von Feldern und futterreichen Wiesen, die vielleicht vier Fünftel des ganzen Raumes einnehmen. Nur auf einem Fünftel erheben sich die Anfänge der neuen Stadt. Die christlichen Missionshäuser sind hier zahlreicher als die Götzentempel,[S. 151] deren es in dieser alten Kaiserstadt nur drei giebt. Auch sie wurden erst nach dem Taipingkriege neu erbaut. Der schönste ist wohl der aus mehreren Höfen und Hallen bestehende Confuciustempel, der friedlich zwischen jenen der Buddhisten und Taoisten in der Nähe der französischen katholischen Mission gelegen ist. Kein Priester oder fanatischer Anbeter des großen chinesischen Weltweisen verwehrt dem europäischen Besucher den Eingang, und mit Muße kann man die mit schöngeschwungenen Schiffsschnabeldächern gedeckten Hallen durchwandern. Während in dem Taoistentempel scheußliche langbärtige Götzenbilder aufgestellt sind, prangt hier nur eine große Tafel mit dem Namen des unsterblichen Confucius in goldenen Lettern, umgeben von ähnlichen Tafeln mit den Namen seiner Apostel.
Auf einem Hügel im Mittelpunkte Nankings erhebt sich eine hölzerne Pagode mit einer ungeheuren Bronzeglocke, die ähnlich wie die japanischen durch einen horizontal schwingenden Holzbalken, der sich außerhalb befindet, geläutet wird. Als ich zu diesem von allen Teilen der Stadt sichtbaren Glockenturm emporritt, warfen sich mir eine Menge Bettler entgegen. Schon in der Ferne sanken sie mitten in der Straße auf ihre Knie und schlugen mit ihrer Stirne auf den Boden, so daß ich Mühe hatte, mein Pferd zwischen ihnen hindurchzulenken. Nahe der Pagode gewahrte ich mehrere Missionsanstalten und auch die Mauern eines chinesischen Militärforts mit zahlreichen Schießscharten, aus denen die Mündungen gewaltiger Kanonen hervorlugten. Als ich diese näher betrachtete, sah ich erst, daß die Schießscharten sowohl wie die Kanonenrohre auf die Mauern gemalt waren! Im Innern des Forts exerzierten chinesische Truppen mit Bogen und Pfeilen, sowie langen dreieckigen Lanzen. Nur wenige Abteilungen waren mit Schießgewehren bewaffnet, und diese Soldaten wurden einige Monate später den japanischen Heeren mit ihren modernen Hinterladern entgegengestellt!
Die größte Sehenswürdigkeit Nankings befindet sich im Osten der Stadt, außerhalb der Ringmauer: das Mausoleum der berühmten Kaiser der Mingdynastie. Eines Morgens ritt ich, begleitet von Professor Hearson der Marineschule, dort hinaus. Da der Weg uns durch Sümpfe und Reisfelder geführt hätte, galoppierten wir auf der oberen Fläche der ungeheuren Stadtmauer bis zum Taipingthor, etwa zehn Kilometer weit von unserer Wohnung gelegen, und gelangten durch dieses ins Freie. In dem kühlen, dunkeln Thortunnel kauerten Hunderte von Chinesen an den Wänden und rauchten oder spielten Domino, geschützt gegen die brennende Sonnenhitze. Draußen vor dem Thore breitete sich ein großer, sumpfiger See aus, und jenseits desselben auf einer kahlen, hügeligen Fläche gewahrte ich die ungeheuren Steinfiguren, welche gerade so wie bei den Kaisergräbern von Peking zu den Minggräbern führen. Die Anlage dieser Gräber ist sehr merkwürdig. Angelehnt an die Bergketten im Norden, erhebt sich ein etwa sechzig Meter hoher, dicht bewaldeter Hügel, und vor diesem liegt ein Tempel, von einer hohen Mauer aus rotgebrannten[S. 152] Ziegeln eingeschlossen. Die Tempeldecke wird durch eine Säule getragen, die auf einer ungeheuren steinernen Schildkröte, etwa vier Meter lang und drei Meter breit, steht. Von diesem Grabtempel führt in südlicher Richtung eine etwa fünfhundert Meter breite Avenue bis zu zwei hohen Steinsäulen, wo sie sich im rechten Winkel nach Osten wendet und bei einer auf einem Hügel stehenden offenen Tempelhalle, etwa ein Kilometer von den Steinsäulen entfernt, endet. Der erste, nach Süden gerichtete Teil der Avenue ist zu beiden Seiten mit ungeheuren Steinfiguren alter Kaiser besetzt, der nach Osten gerichtete Teil dagegen enthält ebenso ungeheure Tierfiguren, durchwegs aus Steinmonolithen gemeißelt, deren Größe mich an jene von Oberägypten und Nubien erinnerte. Diese Tierfiguren stehen mit den Köpfen einander zugewendet an den Seiten der etwa zehn Meter breiten Straße in Abständen von etwa dreißig Meter voneinander. Das erste, den Steinsäulen zunächst stehende Tierpaar sind, wenigstens dem Aussehen nach, zwei ungeheure aufrechtstehende Tapire, das nächste Paar sind ebenfalls Tapire, jedoch in liegender Stellung; ihnen folgen zwei aufrechtstehende, dann zwei liegende Löwen; dann aufrechte und liegende Elefanten; an sie schließen sich ebensolche Doppelpaare von Kamelen, Pferden und dergleichen bis an die Tempelhalle. Die Figuren sind ziemlich gut ausgeführt, etwa vier Meter hoch und von entsprechender Länge, nur haben die chinesischen Bildhauer es mit der Anatomie der Tiere nicht besonders genau genommen. So z. B. sind die Vorderfüße der liegenden Elefanten mit den Knieen nicht nach vorwärts, wie bei den Pferden, angefertigt, sondern mit den Knieen nach rückwärts, so daß die Füße dieselbe Stellung zeigen wie bei liegenden Löwen. Auf den Rücken der aufrechten Elefanten bemerkte ich eine Menge kleiner Steinchen, was wieder mit einem abergläubischen Gebrauch der Chinesen zusammenhängt. Professor Hearson erklärte mir, Zopfträger, welche im Begriff stehen, zu heiraten, pilgern zuvor zu einem dieser Elefanten und werfen ein Steinchen auf seinen Rücken. Bleibt dasselbe oben liegen, so wird die Ehe innerhalb eines Jahres durch einen Sohn gesegnet werden. Fällt aber das Steinchen herab, so wird der Zopfträger Vater einer Tochter. Um dieses Unglück in den Augen der Chinesen zu verhindern, wird die Ehe mitunter auf ein Jahr hinausgeschoben, oder findet sie doch statt, so macht der Ehemann von seinen Rechten bis zum folgenden Jahre keinen Gebrauch und wiederholt dann seine Anfrage bei dem Elefantenorakel. Vielleicht wird dann durch einen Zauberer oder Wahrsager künstlich nachgeholfen, um das gewünschte Ziel zu erreichen.
Die Chinesen lieben das Theater gerade so sehr, wenn nicht sogar mehr, als Europäer. Auf meinen Reisen im Reiche der Mitte habe ich in allen Städten, ja in vielen Dörfern Theater angetroffen, und der Besuch derselben würde den Neid jedes europäischen Theaterdirektors erweckt haben. Alle waren stets zum Erdrücken gefüllt, und geschlossene Theater, oder solche mit schlechtem Besuch sind in China unbekannt. Die dortigen Theater sind eben etwas anders eingerichtet als die unsrigen, und nur ihr Ursprung dürfte derselbe sein. Seltsamerweise hatten die Chinesen in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung noch keine Theater. Seltsamerweise deshalb, weil ja sonst die meisten Einrichtungen der Zopfträger in die Zeit vor Christi Geburt, einzelne sogar in die Zeit vor der Erbauung der Pyramiden zurückgreifen. Musik war ihnen wohlbekannt, das Theater aber wurde ihnen erst durch die von Westen in China einfallenden Völkerschaften von unseren gemeinschaftlichen Lehrmeistern des Theaterspiels, den Griechen, überbracht. Die erste glaubwürdige Nachricht über das Theater in China stammt aus dem Ende des siebenten Jahrhunderts. Damals regierte über das große Reich ein sehr vergnügungslustiger Herr, der Kaiser Tang Ming Huang. Er fand Gefallen an der Musik und an der von den westlichen Völkern ausgeübten Schauspielerei und suchte sie in seinem Lande dadurch zu verbreiten, daß er an seinem Hofe eine eigene Musik- und Theaterschule errichtete. Die Hunderte junger Mädchen, die er in dieser Schule ausbilden ließ, erregten begreiflicherweise sein Wohlgefallen; er schuf für sie ein eigenes Pensionat des demoiselles, das in einem großen Obstgarten mit Birnbäumen stand, und die jungen, chinesischen Misses führten deshalb unter den dem Gebrauch von Beinamen sehr ergebenen Chinesen die Bezeichnung „Die Birnbaumschülerinnen Seiner Majestät”. Noch heute heißen die chinesischen Schauspieler die Brüder aus dem Birnbaumgarten. Schwestern giebt es leider keine mehr, und damit haben die chinesischen Theater, wenigstens nach unserm Geschmack, ihren größten Reiz verloren. Eine Bühne ohne Schauspielerinnen, Sängerinnen, Tänzerinnen wäre bei uns wohl undenkbar. Die Chinesen würden diese angenehmen Persönlichkeiten gewiß auch sehr gerne wieder auf den Brettern, welche die chinesische Welt bedeuten, sehen und bewundern, aber sie dürfen nicht. Ein kaiserliches Edikt hat es ihnen verboten. Die Theaterdamen waren in China wahrscheinlich ebenso verführerisch wie anderswo. Eine derselben hatte dem Kaiser Yung Tsching, der zu Anfang des vorigen Jahrhunderts das Szepter führte, den Kopf so verdreht, daß er ihr sogar Herz und Hand anbot und sie unter jene nach Tausenden zählende Damengesellschaft aufnahm, welche mit ihm auf dem vielsitzigen chinesischen Herrscherthron saßen. Die Frucht war ein Sohn, der im Jahre 1736 unter dem Namen Kien Lung seinem Vater als[S. 154] Kaiser des Reiches der Mitte folgte, einer der weisesten und gerechtesten, welche die chinesische Geschichte kennt. Im ersten Jahre seiner sechzigjährigen Regierung veranlaßte ihn seine Mutter, um an ihren einstigen Beruf nicht mehr erinnert zu werden, das Auftreten von Frauen auf der Bühne zu verbieten. Er willfahrte nicht nur ihrem Wunsche, sondern ging sogar noch weiter. Die Gefahren kennend, welche auch mitunter von seiten männlicher Bühnenmitglieder zarten Frauenherzen drohen, verbot er auch Männern die Mitwirkung auf der Bühne, und seither befindet sich der Schauspielerstand ausschließlich in den Händen der Eunuchen. Aber glücklicherweise nur bei Hof. Die Schauspieler, aus welchen sich die wandernden Truppen von China zusammensetzen, erfreuen sich, wenigstens der Form nach, der vollen Mannbarkeit, selbst wenn sie in Frauenkleidern stecken und weibliche Rollen spielen.
Ständige Theatergesellschaften giebt es in China nur bei Hofe; alle anderen sind umherziehende Banden, die bald hier bald dort ihre Vorstellungen geben, je nachdem in den Ortschaften Märkte, religiöse oder weltliche Feste abgehalten werden. Ebensowenig giebt es in China Theatergebäude nach europäischem Muster. Allerdings bestehen solche in Hongkong und Shanghai; auch in Canton und einigen anderen Städten hat man die Zweckmäßigkeit derselben eingesehen, und Kapitalisten haben Theater erbaut, die sie an wandernde Truppen vermieten. Allein im Innern des ungeheuren Landes fehlen sie vollständig. Kommt eine Gesellschaft mit ihren Kisten und Kasten in eine Ortschaft, so wird von einer eigenen Klasse von Handwerkern in aller Eile ein Theater gebaut. Binnen ein, zwei Tagen ist es fertig. Hohe starke Bambusstangen bilden das Gerippe; Bühne, Dach und Ankleidezimmer werden durch Bretter hergestellt, die mit Rattanseilen (einer Art spanischem Rohr) an die Bambusstangen festgebunden werden. Nägel kommen selten zur Verwendung. Dann wird ein ähnliches Flugdach vor der Bühne errichtet, unter dem sich die Stühle für die besser zahlenden Zuschauer befinden, der Rest der Zuschauer steht rings um die Bühne unter freiem Himmel. Zieht die Truppe nach einigen Tagen oder Wochen wieder ab, so wird das Theater wieder auseinandergebunden und für die nächste Gesellschaft aufbewahrt.
Ich habe derlei Theater auch in großen Städten gesehen, selbst in der größten, in Canton. Dort wollten gerade die Priester ein religiöses Fest begehen, und um die Götter zu ehren und sie versöhnlich zu stimmen, wurden auch Theatervorstellungen auf das Programm genommen. Die Priester sammelten unter den wohlhabenden Einwohnern freiwillige Beiträge, die sie dadurch öffentlich quittierten, daß sie die Beträge der Spenden und die Namen der Geber auf rote Zettel schrieben und diese dann an die Tempelwände klebten. Sobald die erforderliche Summe beisammen war, ließen sie eine Truppe anwerben und im inneren Tempelhofe ein Theater bauen, mit der Bühne dem Tempel zugewendet, damit die bemalten und vergoldeten Götterfiguren, die grimassenschneidend auf ihren Altären hockten, doch auch die Vor[S. 155]gänge auf der Bühne wirklich sehen konnten, und während mehrerer Tage wurde unter kolossalem Andrang des Publikums Theater gespielt. Um ihre Einnahmen noch zu vermehren, vermieteten die Priester den übrigen freien Raum der Tempelhöfe für Garküchen, Spielhöllen und noch viel schlimmere Zwecke, ad maiorem dei gloriam. Der Zweck heiligt die Mittel.
Die Gesellschaften werden aber auch von reichen Privatleuten häufig angeworben, um in ihren Häusern vor der weiblichen Welt, deren Erscheinen in öffentlichen Theatern gegen die gute Sitte verstoßen würde, Vorstellungen zu geben. Auch Hochzeiten, Geburtstage und dergleichen werden mit Theatervorstellungen gefeiert, wobei aber die Gastgeber Sorge tragen, daß kein zu vertraulicher Verkehr mit den Schauspielern stattfindet, denn diese gehören in China zu den geächteten Ständen und sind mit ihren Nachkommen bis ins dritte Glied von allen Beamtenposten ausgeschlossen.
Die Theatervorstellungen beginnen gewöhnlich am Morgen und dauern bis zur einbrechenden Dunkelheit. Nachtleben giebt es in chinesischen Städten keines, die Thore, ja selbst einzelne Stadtviertel und Straßen werden für jeden Verkehr abgesperrt, und die chinesischen Theaterbesucher könnten gar nicht nach Hause gelangen. Eine Ausnahme machen freilich die Theater in den großen, den Fremden geöffneten Hafenstädten. Dort sind die Sing Song, d. h. in chinesischem Patois Theater, ebenso abends geöffnet wie die englischen Sing Song. Ebenso habe ich sie auch in San Francisco, Singapore abends geöffnet gefunden. Es ist aber ein gewaltiger Irrtum, zu glauben, daß die chinesischen Theaterstücke, wie es vielfach von flüchtigen Globe trotters dargestellt wurde, tage- und wochenlang ohne Unterbrechung dauern. Die Chinesen haben ebenso ihre ein- und mehraktigen Stücke wie wir, nur ist bei ihnen der Vorhang und demnach das Fallen des Vorhangs unbekannt, ein Stück folgt fast ohne Unterbrechung auf das andere, und will sich irgend ein reicher Herr unter den Zusehern ein bestimmtes Theaterstück vorspielen lassen, so braucht er es nur zu verlangen und dafür einige Taels zu bezahlen.
Fast alle Theaterstücke der Chinesen werden durch Musik begleitet, fast in allen kommen Gesänge vor. So sehr ich mir während vieler Besuche in den verschiedensten Theatern Mühe gab, in dem furchtbaren Lärm, den die auf der Bühne selbst kauernden Gongschläger, Lautenbläser und Violinenkratzer unausgesetzt machten, irgend eine Methode, Rhythmus, Melodie zu finden, ist es mir doch niemals gelungen, und als ich einmal in Shanghai einen der englischen Sprache mächtigen Chinesen darüber befragte, so antwortete er mir lächelnd, es sei ihm mit der europäischen Musik, die er gehört, gerade so gegangen. Wir können uns Gesang nicht ohne Melodie denken, und wenn wir sprechen, geschieht es in der gleichen Tonart. Die Chinesen sprechen, indem sie jedem Worte einen anderen Ton geben, also nach unseren Begriffen in singender Weise, dafür sind aber ihre Gesänge monoton. Wir[S. 156] können die letzteren mit unseren Musikzeichen nur annähernd wiedergeben, denn statt acht Töne enthält die chinesische Musik nur sieben. Dabei kennen sie kein Piano, keine der Modulationen, welche unserer Musik den großen Reiz verleihen; sie singen mit näselnder Stimme, gewöhnlich so laut, wie sie nur können, und doch sagt Confucius von der Musik, sie sei die „Essence der Harmonie, welche zwischen Himmel, Erde und den Menschen herrscht”. Die Chinesen lieben die Musik über alle Maßen; sie haben ihre Musikgesellschaften, ihre Musikkorps, und keine Festlichkeit, keine Prozession, kein Gottesdienst, kein Hochzeitszug oder Begräbnis ist ohne Musik. Sie sind darin die Deutschen des Orients. Ein großer Prozentsatz der Chinesen beiderlei Geschlechts kann irgend ein Instrument spielen; sie haben die Musik schon vor nahezu fünftausend Jahren, zur Zeit des Kaisers Fu-hsi gekannt und sind auch die eigentlichen Erfinder der Orgel, auf chinesisch Scheng; sie besitzen eine große Zahl der verschiedensten Instrumente, darunter sogar solche aus Stein. Bei einer solchen Leidenschaft für die Musik ist es begreiflich, daß dieselbe auch im Theater nicht fehlen darf, ja ein großer Teil der Besucher kommt nur ihretwegen, denn vom gesprochenen Text ist bei den mit voller Kraft geschrieenen Fisteltönen, deren sich die chinesischen Schauspieler befleißigen, doch nur wenig zu verstehen. Die Mehrzahl der chinesischen Dramen sind übrigens den Zuhörern bekannt; sie stammen aus verschiedenen Jahrhunderten, behandeln die militärischen Großthaten, die Feldzüge, Schlachten, Hofereignisse, aber nur bis zur Erhebung der jetzt herrschenden Kaiserdynastie auf den Thron; seitherige Ereignisse dürfen nicht auf der Bühne behandelt werden, und da die Schauspieler ihre Rollen nicht aus Büchern, sondern der Tradition nach von Generation zu Generation lernen, gewähren ihre Darbietungen einen tiefen, höchst interessanten Einblick in Leben und Sitten der Chinesen in früheren Jahrhunderten. Von der Gegenwart darf nur das bürgerliche und Familienleben behandelt werden, nach Art unserer Volksstücke, und ich habe gerade aus diesen durch aufmerksames Beobachten und durch die Erklärungen des Dolmetschers sehr viele Züge aus dem Leben dieses merkwürdigen Volkes gelernt, die mir sonst gewiß entgangen wären.
Die Bühneneinrichtung der chinesischen Theater ist etwa von derselben lächerlichen Einfachheit, wie unsere Bühnen sie zur Zeit Shakespeares zeigten. Im Hintergrund befindet sich irgend eine bemalte Leinwand, durch welche zwei Thüren nach dem Schauspielerzimmer führen; aus diesem stürzen die Mimen mit grotesk bemalten Gesichtern und in ebenso grotesken Anzügen heraus, schreien ihre Rolle herunter und verschwinden wieder in den Thüren; dabei lärmt und tobt die Musik ununterbrochen. Die Musiker sitzen auf einer Seite der Bühne im Hintergrunde, und anscheinend besteht zwischen ihrem Getöse und dem Gesang der Schauspieler gar kein Zusammenhang. Ein paar Stühle, Kisten und Kasten, auf der Bühne aufgestellt, vervollständigen die Einrichtung, und je nach Bedarf werden diese szenischen[S. 157] Hilfsmittel während der Handlung von den Angestellten umhergetragen, aufeinandergetürmt. Es wird dabei vorausgesetzt, daß diese letzteren dem Publikum unsichtbar sind. Ueberhaupt wird die Phantasie der Zuschauer in etwas übermäßiger Weise in Anspruch genommen. Ich entsinne mich, in Canton eine Schauspielerin, d. h. einen als Dame verkleideten Schauspieler gesehen zu haben, der mühselig eine aus Stühlen und Kisten gebildete Pyramide erklomm. Sie sollte einen Berg darstellen, und die Handbewegungen und Wendungen der Dame zeigten an, daß sie sich durch einen Wald den Weg bahnte. Bei einer anderen Gelegenheit legten sich sechs Kerle übereinander auf die Mitte der Bühne. Von zwei Seiten stürzten phantastisch vermummte Krieger aufeinander, eine Partei rollte die daliegenden Kerle beiseite und wurde dann mit der anderen handgemein. Mein Dolmetscher erklärte mir, die sechs Kerle hätten eine Festungsmauer dargestellt. Ein anderes Mal sprang ein Krieger, indem er die Bewegung des Reitens machte, quer über die Bühne von einer Seite zur anderen und schien dort an eine unsichtbare Person einen Brief abzugeben. Wie ich erfuhr, war dies ein reitender Bote, der von einer handelnden Person im Stücke nach der Mongolei gesandt wurde. Damit aber das Publikum die Sache auch verstände, erklärte der Bote, als er mit seinem Briefe auf der Seite der Bühne dastand, er sei nun in der Mongolei angekommen und erfülle gerade seine Mission. Gewöhnlich erscheinen mit den handelnden Personen auch die guten und bösen Geister, denn ohne Geister geschieht bei diesem abergläubigen Volke überhaupt nichts. Statt aus der Hinterthür kommen diese aber ihrem überirdischen Charakter entsprechend aus Versenkungen. Einmal bemerkte ich, während drei groteske Gestalten ihre Szene darstellten, den Kopf eines solchen Geistes aus einer Versenkung erscheinen. Aber weiter schien er trotz aller Anstrengungen nicht emporkommen zu können. Deshalb schrie er den Schauspielern zu, sie möchten ihm doch helfen. Sofort sprangen sie auf ihn zu und zerrten ihn aus seinem Loche. Kaum war er auf den Beinen, so stellte er sich in Positur, und die Schauspieler machten alle Zeichen des Erschreckens.
So lächerlich diese Dinge mir auch vorkamen, die Tausende, die um mich herum saßen und ihre Kürbiskerne kauten, die gewöhnliche Beschäftigung der Theaterbesucher, behielten ihren ruhigen Ernst und folgten mit Spannung der Handlung. Bei besonders packenden Szenen drückten sie ihre Bewunderung nicht durch Händeklatschen aus, sondern durch laute Rufe, wie: Hau Hau, Ei, Hai, Wau, Buh, Jah und dergleichen. Die reine Menagerie. Uebrigens sollen sich die chinesischen Dramen auch nach unseren Begriffen durch schöne Sprache und geradezu klassischen Aufbau auszeichnen, und Sir John Davis, vielleicht der beste Kenner des chinesischen Theaters, äußert sich voll Entzücken über einzelne Tragödien, die er auch ins Englische übersetzt hat. Was wenigstens mir und wohl allen Besuchern Chinas große Bewunderung einflößte, war die vollkommene Art, wie die Schauspieler sich[S. 158] als Frauen verkleideten und die weiblichen Bewegungen und Sprache wiedergaben, sowie die ganz erstaunliche Pracht der Kostüme. Selbst Schmiertruppen in Dörfern haben deren eine beträchtliche Zahl, und es muß eine gewaltige Summe Geldes in diesen kostbaren Helmen, Federn, Waffen, Goldbrokaten und Seidenstickereien stecken.
Die Schauspieler sehen es gar nicht ungern, wenn man ihnen in ihren Ankleidezimmern einen Besuch abstattet, und sie zeigten mir mit Befriedigung und Stolz auf ihren Gesichtern alle ihre Kostbarkeiten. Sie rekrutieren sich der Mehrzahl nach aus den ärmsten Volksklassen. Kinder werden zu Theaterdirektoren in die Lehre gegeben, viele werden von armen Eltern sogar an sie verkauft. Während der ersten drei Jahre müssen sie Handlangerdienste versehen und Rollen lernen, indem sie den älteren Schauspielern zuhören und von diesen auch Unterricht empfangen. Aus Büchern lernen sie, wie bemerkt, nicht, und so kommt es auch, daß durch die Willkürlichkeiten und Extempora der Schauspieler dieselben Stücke von den verschiedenen Truppen verschieden gegeben werden. Die einmal erlernten Rollen vergessen sie niemals wieder. Jedes der zwanzig bis dreißig Stücke, die eine Theatertruppe in ihrem Repertoire haben dürfte, kann ohne Probe zu jeder Zeit gespielt werden. Souffleure, Inspizienten, Regisseure sind auf der chinesischen Bühne unbekannte Pflanzen.
Die chinesischen Schauspieler bilden eine eigene Zunft und haben gerade so ihre lokalen Vereinigungen wie ihre europäischen Kollegen; ihren Direktoren gegenüber besitzen sie aber viel größere Unabhängigkeit und Gewalt als die letzteren. Sie haben sogar ihren eigenen Schutzgott, einen fratzenhaft aussehenden Götzen, dem sie Opfer darbringen und den sie in jedem Jahre durch große Festlichkeiten günstig zu stimmen suchen, eine Art chinesischer Generalintendant.
Von den vielen Millionen Menschen, welche täglich mit Wohlbehagen ihren Thee schlürfen, haben wohl noch die wenigsten darüber nachgedacht, woher die kleinen braunen Blättchen am Grunde ihrer Theekanne eigentlich stammen. Ob aus Indien oder Ceylon oder China, ob er Oolong oder Pekko oder Souchong heißt, ist der großen Mehrzahl der Theetrinker ziemlich gleich. In Hotels oder Kaffeehäusern wird einfach eine Portion Thee verlangt, bei den vornehmen Five o’clock teas erhält man die Schälchen mit dem mehr oder minder köstlichen Naß vorgesetzt, ohne daß man sich weiter darum kümmern würde. Wenn nur die rechte Menge Zucker und Sahne dabei ist! Ohne diese beiden Dinge kein Thee.
Wie anders ist es im wahren Heimatslande des letzteren, in China! Es würde dort, wo für Hunderte von Millionen Menschen der Thee nicht nur das wichtigste, sondern man könnte füglich sagen, das einzige Getränk bildet, niemandem einfallen, auch nur ein einziges Stückchen Zucker beizufügen, die Sahne aber ist dem Chinesen ganz unbekannt. Sie trinken überhaupt keine Milch, und die Kühe werden nicht gemolken. Nur in Tibet wird dem Thee Grütze und Mehl zugesetzt und so eine Art dicke Suppe bereitet.
In den ersten Tagen meines Aufenthaltes in China konnte ich mich an den nach chinesischer Art zubereiteten Thee gar nicht gewöhnen. Machte ich bei Chinesen Besuche oder besorgte ich Einkäufe, so wurde mir stets ein Täßchen Thee vorgesetzt. Ein bezopfter, mandeläugiger Mongole brachte die Täßchen herbei, legte einige Theeblätter hinein, goß kochendes Wasser darauf und deckte dann jedes Täßchen mit der umgekehrten Untertasse zu. Nach einigen Minuten nahm mein Gastgeber gewöhnlich seine Tasse in die Rechte, schob mit dem Zeigefinger derselben Hand die Untertasse ein wenig zurück, um beim Trinken die Theeblätter nicht in den Mund[S. 160] zu bekommen, und schlürfte dann mit Wohlbehagen die gelblich-grüne klare Flüssigkeit. Bei meinem ersten ungeschickten Versuche entschlüpfte die Untertasse meinen Fingern und zerbrach, ich verbrannte mir die Hand und Zunge und fand den Thee dazu auch noch abscheulich. Bei den folgenden Versuchen ging es schon besser, und nach einer Woche begriff ich vollkommen, daß man Thee nach Chinesenart trinken muß. Dann ist er ein wahres Labsal. Wenn die Chinesen so wenig geistige Getränke genießen und unseren Wein, unser Bier gar nicht kennen, so mag dies großenteils den erquickenden, belebenden Eigenschaften ihres ausgezeichneten Thees zuzuschreiben sein. Dasselbe kann von den Indiern und Japanern gesagt werden. Beide Völker übernahmen den Thee von den Chinesen und sind auch in Bezug auf den Theebau ihre größten Wettbewerber geworden. Ungeheure Mengen indischen und japanischen Thees gelangen heute auf den Weltmarkt, in England und seinen Kolonieen trinkt man fast ausschließlich nur indischen, in Amerika großenteils japanischen Thee, aber der beste bleibt doch der chinesische.
In der Umgebung von Canton bekam ich keine Theepflanzung zu sehen, denn Thee wird in China erst weiter nördlich, hauptsächlich im Stromgebiet des Jangtsekiang gebaut. Bei Ningpo, einem der den Europäern geöffneten Häfen, gedeiht er am besten, und dort war es auch eine meiner ersten Unternehmungen, die Theepflanzungen der Umgebung zu besuchen. Es war Anfang Mai, und wie bei uns, so ist auch dieser Monat in China der schönste. In den Reisfeldern unten am Flusse prangten die kleinen Pflänzlein im herrlichsten Grün; weiter oben am Fuß der Berghänge stand das Getreide schon kniehoch, vermengt mit Mohnblumen und rotblühendem Klee; und die Berge bis hinauf zu den Gipfeln zeigten den wunderbarsten Azalienschmuck. Hier und da, in der Umgebung der weitverstreuten kleinen Bauernhöfe, erhoben sich Gruppen mächtiger Weiden- und Kampferbäume mit ihren dunkelgrünen buschigen Kronen. Dickstämmige Wistarias, diese schönsten und beharrlichsten aller Schlingpflanzen, wanden sich an den Baumstämmen empor, ihre Zweige umklammerten die Zweige der Bäume, und zwischen deren Laub prangten ihre lila Blütentrauben in ungezählten, erdrückenden Massen.
Der Gesang von Drosseln erfüllte die Luft ganz so wie bei uns, und die warme Frühlingssonne beschien ein so herrliches Landschaftsbild, wie ich es in China gar nicht erwartet hätte. Ihre Strahlen spiegelten sich tausendfach in den scharf umgrenzten Wasserflächen der Reisfelder wieder und glitzerten in dem Flusse, dessen Ufer die üppigste Vegetation zeigte. In den kleinen, von wohlgepflegten Gemüsegärten umgebenen Dörfchen und Höfen, die ich auf meiner Wanderung passierte, zeigten sich nur wenige Menschen. Die ganze Bevölkerung war draußen auf den Feldern bei der Arbeit.
Nach etwa zweistündigem Marsche erreichte ich ein größeres Dorf, und jenseits desselben zogen sich auf weite Strecken die ersten Theepflanzungen hin, durchwegs[S. 161] kleine Felder mit den eigentümlichen, hagedornartigen Theesträuchern bedeckt. Man war eben an der ersten Ernte, und auf dem Wege hinauf begegnete ich zahlreichen Landleuten, welche, meinen Gruß mit freundlichem Tschin-tschin erwidernd, die frischgepflückten Blättchen in großen Körben heimtrugen, Männer, Frauen und Kinder, alle gleich gekleidet. Sie trugen ein dunkelblaues, loses Baumwollhemd mit weiten Aermeln und ebensolche Beinkleider, die bis etwas unter die Knie reichten. Die Männer hatten auf ihren mehrfach gewundenen Haarzöpfen große Strohhüte sitzen, Frauen und Mädchen aber trugen ihr üppiges schwarzes Haar sorgfältig gekämmt und mit frischen Blumen geschmückt. Hier war es auch, wo ich zum erstenmale wirklich hübsche schlankgewachsene Chinesinnen sah. Ihre Gesichter waren gebräunt und nicht wie jene ihrer Schwestern in den Städten bepudert und bemalt; ihre unteren Gliedmaßen und ihre nackten Unterarme zeigten runde pralle Formen. Paarweise trippelten sie einher, auf ihren Schultern Bambusstäbe tragend, von denen die schweren Körbe, mit Theeblättern gefüllt, herabhingen. Kamen sie an mir vorbei, so schlugen sie verschämt die Augen nieder und wandten ihre Gesichter mit verlegenem Lächeln ab. In den Pflanzungen selbst ließen sie sich durch mein Kommen nicht in ihrer Arbeit stören. Emsig streiften sie mit ihren kleinen Händchen die Blätter von den Zweigen und warfen sie in die Körbe auf ihrem Rücken. Hunderte von Mädchen, ja selbst Kinder von fünf oder sechs Jahren, waren so mit dem Einheimsen der Blätter beschäftigt, denn in einer Woche mußte die Ernte beendigt sein. Sie ist ja die beste und kostbarste der drei oder höchstens vier Ernten, welche der Theestrauch jährlich liefert. Die Blättchen sind Ende April und Anfang Mai fleischiger, wohlriechender als die nachfolgenden und zeigen eine zarte weiße Behaarung, welche wahrscheinlich der Grund war, warum man in Europa den Thee dieser Ernte irrtümlich als Blütenthee bezeichnet. Die Blüten selbst werden nicht zur Theebereitung verwendet. Sie sitzen auf den Spitzen der buschigen, etwa meterhohen Sträucher und sind weißlich, geschmack- und geruchlos. Im Herbst entwickelt sich die Frucht, eine Kapsel mit drei kleinen Bohnen, aus welchen die Sträucher gezogen werden.
Mit dem Abstreifen der frischen grünen Blätter ist die Arbeit des Theebaues nicht etwa beendet. Freilich erfordert der Theestrauch keine besondere Düngung oder Bearbeitung des Bodens; lehmiger und sandhaltiger Boden, dazu Sonnenlicht und eine hinreichende Menge Regen ist alles, was erforderlich ist. Aber dennoch hat der Theebauer den größten Teil des Jahres mit seiner Pflanzung zu thun. Aus den Samenkörnern werden zuerst Sprößlinge gezogen und diese, sobald sie einige Monate alt sind, in die Pflanzungen selbst versetzt, wo sie in langen Reihen mit etwa anderthalb Meter breiten Abständen voneinander stehen. Zwischen sie werden noch allerhand Gemüse gepflanzt. Nach dem zweiten Jahre pflegt man in manchen Gegenden (der Thee ist in dem ganzen, zwei Millionen Quadratkilometer[S. 162] umfassenden Stromgebiet des Jangtsekiang verbreitet) die Blätter schon zu pflücken, doch ist die Pflanze erst im sechsten Jahre ausgewachsen und liefert dann bis zu ihrem achtzehnten oder zwanzigsten Jahre zwei bis vier Ernten jährlich. Läßt man die Stauden wachsen, so erreichen sie drei bis fünf Meter Höhe; sie müssen also jährlich beschnitten werden, um das Pflücken der Blätter zu erleichtern.
Dieses Pflücken kann nur an warmen, sonnigen Tagen erfolgen, und deshalb beeilten sich die Mädchen und Kinder so sehr, als ich zwischen ihnen durch die Pflanzungen wanderte. Wie mir mein Dolmetscher erzählte, waren sie schon seit Morgengrauen an der Arbeit. Kaum gönnten sie sich Zeit, um ihren gekochten Reis und ihr Gemüse zu verzehren; dann arbeiteten sie sich wieder ihre kleinen Händchen blutig und blickten mitunter ängstlich auf, um zu sehen, ob nicht Wolken im Anzuge wären, deren Entladung ihre Ernte verderben würde. War ein Korb mit den glänzenden fleischigen Blättchen gefüllt, dann sprang wohl ein Mädchen darauf und stampfte die Blätter mit ihren nackten Füßen fester zusammen, und konnte nichts mehr hineingepreßt werden, so wurde rasch ein Bambusstock durch die Handhabe gezogen, die Last auf die Schultern gehoben, und fort gings in raschem Getrippel hinab zum Farmhause.
Unten in den verstreuten Höfen und kleinen Dörfchen sind Männer und Frauen mit der Zubereitung der Theeblätter beschäftigt, und bricht die Dämmerung an, dann eilt alles aus den Pflanzungen hinab, um bis Mitternacht die Blätter zu dörren. Ein paar Stunden Schlaf nur sind den jungen Arbeiterinnen gegönnt, dann springen sie wieder zurück in die Pflanzung, und das Tagewerk beginnt von neuem. Ihre einzigen Werkzeuge sind ihre Hände und Füße. Sobald ein Korb Blätter in die Farmhäuser gelangt, so machen sich Frauen und Kinder darüber her, um geschickt die alten und gelben Blätter daraus zu entfernen, die guten Blätter aber auf luftige Bambusgeflechte zu werfen, wo sie bald welken und weich werden, so daß sie mit der flachen Hand leicht zu rollen sind. Diese Arbeit dauert so lange, bis sich an den Blättern rötliche Flecken zeigen. Das Rollen der Blätter heißt im Chinesischen kung-fu, woraus die europäischen Handelsleute Kongu oder Kongo machten. Der als Kongo bezeichnete Thee stammt also nicht etwa vom Kongo, sondern heißt so viel als gerollter Thee.
Nun werden die Blätter in baumwollene Säckchen gestopft und diese in durchlöcherte Kisten oder Fässer geworfen. Dann springen die Arbeiter hinein und treten und kneten die Säckchen, ähnlich wie die Italiener und Spanier die Weintrauben, so lange, als aus den Oeffnungen noch der Saft der Blätter, eine klebrige, ölige Flüssigkeit, herausläuft. Auf diese Weise wird ein großer Teil des bitteren Tanningehaltes entfernt und das Gewicht der Blätter auf etwa ein Viertel verringert.
Nun sind die Blätter für das Feuern reif. Dies geschieht in manchen Gegenden von den Theebauern selbst, oder sie verkaufen die Blätter, nachdem diese einige Stunden[S. 163] in Körben einer leichten Gärung ausgesetzt wurden, den Händlern der großen chinesischen Theekaufleute. Diese ziehen Ende April und Anfang Mai durch die Theedistrikte und kaufen den Bauern ihre Ernten ab. Großer Grundbesitz ist in China eine Seltenheit. Jeder Bauer hat ein kleines Stückchen Land, höchstens einige Morgen groß, auf dem er seinen Thee, Reis, Getreide, Bohnen und Gemüse selbst zieht. Den Ueberschuß verkauft er an die Händler. Diese senden den Thee nach ihren Hongs oder Warenhäusern, und dort erfolgt die weitere Zubereitung. Die Blätter werden von halbnackten Chinesen auf heiße Eisenpfannen geworfen und dort unter fortwährendem Umrühren erhitzt; dann breitet man sie auf große Bambusrohrtische aus und drückt nochmals durch Kneten mit der Hand die vorhandene Feuchtigkeit aus. Dieses Erhitzen, Rollen und Trocknen wird mehrmals wiederholt, bis die Blätter vollständig gedörrt sind und eine dunkle Farbe angenommen haben. Blätter verschiedener Ernten werden in den Hongs auch gemischt; dann werden ihnen auch, um verschiedene Theesorten zu erzeugen, mancherlei wohlriechende Blüten zugesetzt, und der grüne Thee wird überdies noch einer Behandlung mit Preußischblau und Gipsmehl unterworfen, um ihm eine schönere Färbung zu geben.
Alles das ist sehr leicht niedergeschrieben, aber wir europäischen Theetrinker machen uns kaum eine Vorstellung von der unendlichen Sorgfalt und Zartheit, welche diese Zubereitungen erfordern. Wohl stehen den Zopfträgern des Reiches der Mitte jahrhundertelange Erfahrungen zu Gebote, aber doch bleibt die Theeindustrie die schwierigste aller chinesischen Industrien. Durch Generationen hat sie sich ohne irgend welche Neuerungen fortvererbt, und gerade so wie die Urgroßväter, so machen auch die Enkel ihre Theearten nach denselben Vorschriften. Indier wie Japaner verwenden praktische, vorzüglich arbeitende Maschinen, größere Länderstrecken sind durch Gesellschaften oder einzelne zu einem Betrieb vereinigt worden, und der Wettbewerb dieser beiden Länder bedroht den chinesischen Theemarkt in der empfindlichsten Weise, allein die Zopfträger sind viel zu konservativ, um sich dadurch aus ihrem alten Gleise heben zu lassen. Bei ihnen macht der Schaden nicht klug. Die Preise sind durch die Indier und Japaner so sehr herabgedrückt worden, daß es sich bei aller Sparsamkeit und Enthaltsamkeit kaum mehr lohnt, Thee zu bauen. Und hier zeigt sich eine der Eigentümlichkeiten der Chinesen, ihr negativer Geist. Statt es den anderen Völkern durch Annahme von Maschinen, durch vereinigten Betrieb, durch Arbeitsteilung gleichzuthun, leben sie einfach noch enthaltsamer und widmen ihren Produkten stets dieselbe zeitraubende und kostspielige Bearbeitung.
Ihr einziger Bundesgenosse im Kampf mit den anderen Theebauern ist die ausgezeichnete Qualität ihres Thees. Oolong, Souchong und Pekko beherrschen noch immer den Markt auf dem europäischen Kontinent, hauptsächlich in Rußland. Die genannten drei Namen sind nicht etwa solche von Städten oder Theedistrikten. Oolong heißt in der chinesischen Sprache schwarzer Drache und ist eine Art[S. 164] schwarzen Thees, Souchong heißt kleine Pflanze und Pekko weißer Flaum nach dem Flaum, welchen die Blätter der ersten und besten Ernte zeigen.
In Europa herrscht immer noch ziemlich allgemein die Ansicht, daß schwarzer und grüner Thee aus zwei verschiedenen Pflanzen hergestellt wird und daß besonders Indien und Ceylon die Heimat des schwarzen, China und Japan die Heimat des grünen Thees seien. Das ist ein Irrtum. Beide Sorten werden aus demselben Thee hergestellt. Grüner Thee wird einfach weniger gebrannt als schwarzer.
Aus den Händen der chinesischen Theehändler gelangt der Thee in die Hongs der europäischen Kaufleute in den großen Hafenorten, wo er für den Transport nochmals getrocknet und in Kisten, die mit Blei gefüttert sind, verpackt wird. Von den hundertzwanzig Millionen Kilo Thee, welche in der letzten Zeit jährlich aus China ausgeführt wurden, stammen etwa dreieinhalb Millionen Kilo aus Kiukiang am Jangtsekiang, gegen je zwei Millionen aus Ningpo und Tamsui, dem Haupthafen von Formosa, je eine halbe Million aus Lappa und Canton, eine Viertel[S. 165]million aus Amoy, aber der große Haupthafen des chinesischen Thees, ja die Metropole des Thees überhaupt ist immer noch Hankau, von wo jährlich über hundert Millionen Kilo nach aller Welt verschifft werden.
Den wenigsten ist Hankau, eine der wichtigsten und größten Städte des Reiches der Mitte, auch nur dem Namen nach bekannt. Es liegt tausend Kilometer den Jangtsekiang aufwärts im Herzen von China, im Mittelpunkte des größten Theedistriktes und hat wohl mit den es umlagernden Städten eine Bevölkerung von anderthalb Millionen.
Als ich meine Reise von Shanghai den gewaltigen Strom aufwärts unternahm, waren meine Mitpassagiere durchwegs nach Hankau gebucht. Die Warenballen, die auf den Docks in Shanghai verladen wurden, gingen nach Hankau, alles sprach nur von Hankau. Was Shanghai für das ganze chinesische Reich ist, das ist Hankau für das Innere desselben; Shanghai liegt am Anfang, Hankau am Ende des Dampferverkehrs auf dem chinesischen Riesenstrom. Wohl gehen heute deutsche Dampfer noch einige hundert Kilometer weiter aufwärts nach Itschang, allein für die großen transozeanischen Dampfer, die Kriegsschiffe und die zahlreichen Passagierdampfer des Jangtsekiang ist Hankau die Endstation. Die Stadt liegt am linken Ufer des großen Hanflusses, der, aus dem Hochlande von Schansi kommend, sich hier in den Jangtsekiang ergießt. Jenseits Hankau, am rechten Hanufer, liegt die alte Chinesenstadt Hanyang, und beiden gegenüber, am Südufer des Jangtsekiang, liegt die befestigte Hauptstadt der Provinz Hupei, Wutschang. Sie erinnerten mich in Bezug auf ihre Lage lebhaft an die Metropole der neuen Welt, an Neuyork mit seinen Schwesterstädten Brooklyn und Jersey City. Aber während dort eine gewaltige Brücke und Dampffähren den Verkehr herstellen, während Tausende von Dampfern und Segelschiffen den breiten Strom durchfurchen und der Verkehr ein betäubender, alles überwältigender ist, bekümmert sich in dem Städtetrio des Jangtsekiang keine Stadt um die andere. Jenseits des ungeheuren, meilenbreiten Stromes zeigen sich von Wutschang nur die Festungsmauern, hinter denen die Stadt selbst liegt, und ähnlich scheint auch der Unternehmungsgeist der Chinesen mit einer hohen, unbezwingbaren Mauer umgeben zu sein. Hanyang, einst viel bedeutender als Hankau, ist ein elendes, schmutziges Nest, in dem einige hunderttausend Zopfträger ihr freudloses Dasein fristen und das nichts von Interesse für den Fremden bietet, es sei denn der pagodengekrönte Hügel, der sich hinter der Stadt mit ihren geraden, meilenlangen Straßen auf etwa hundert Meter über den Fluß erhebt. Von dort genießt man eine herrliche Aussicht auf die beiden Ströme und die drei Städte an ihrem Zusammenfluß. Das Häusermeer von Hankau mit seinen niedrigen, unendlich einförmigen Ziegeldächern zeigt ebenfalls nur geringe Abwechselungen. Gegen Norden schließt es eine hohe Mauer von den Reisfeldern der Umgegend ab, und in der Mitte erheben sich einige citronengelbe Porzellandächer, die der Residenz des Tao[S. 166]tais oder Distriktsgouverneurs angehören. An den Ufern der mächtigen, gelben, trüben Wasserfläche des Jangtsekiang wird das trostlose Stadtbild Hankaus von einem langgestreckten Park mit hohen Bäumen begrenzt, zwischen deren Kronen ein paar größere Häuser hervorlugen. Dort ist die europäische Konzession, die Residenz der Handvoll Europäer, die Hankau zu dem gemacht haben, was es heute ist, zur Metropole des Theehandels.
Und kommt man in diese kleine europäische Niederlassung, so sieht man von dem großen Geschäftsverkehr erst recht nichts. Die Häuser sind geräumige, einstöckige Villen mit breiten Veranden und Galerien im Stile der indischen Bungalows, etwa wie in den vornehmen Stadtteilen von Bombay und Singapore, umgeben von gutgepflegten Gärten. Parkanlagen trennen sie von dem steinernen Uferkai des Jangtsekiang, auf dessen Fluten nahebei ein paar Hulks liegen; sie sind die Anlegestellen für die gewaltigen schneeweißen Flußdampfer, die mich in Größe und Einrichtung ganz an die gleichen Hudson- und Mississippidampfer erinnerten. Weiter draußen im Strome liegen ein paar Ozeandampfer vor Anker. Zwischen den hübschen Privatresidenzen zeigen sich zwei Klubhäuser und zwei Kirchen, weiter gegen Osten ein Kloster, und daran schließt sich ein großer Rennplatz für die Wettrennen, welche die Handvoll Europäer sogar im Herzen von China veranstalten. Der Rennplatz[S. 167] ist eigentlich der Boden der französischen Konzession, während die Wohnungen der Europäer, hauptsächlich Russen, Engländer und Deutsche, auf der englischen Konzession stehen. Da sich bisher aber kein Franzose in Hankau angesiedelt hat, steht dort nur das französische Konsulat. Hinter dieser eigentümlichen Europäerstadt erheben sich ein paar Theefabriken, und an diese schließt sich das schmutzige, übelriechende Straßengewirr der Chinesenstadt. Das ist Hankau.
Nach diesem Fleckchen europäischer Erde im Innern Chinas werden die ungezählten Tonnen Thee aus dem Stromgebiet des Jangtsekiang zusammengeschleppt. Sie kommen auf den Rücken von chinesischen Kulis, auf Maultieren, auf grotesken Dschunken und Booten und auf großen europäischen Dampfern. Dorthin reisen im Frühjahr die Theehändler und Tscharsiehs (Theekoster) von Europa, von Singapore und Shanghai; täglich kommen Dampfer an, täglich lichten andere ihre Anker für ferne Ziele. Während weniger Wochen in jedem Frühjahr herrscht in Hankau fieberhafte Thätigkeit. Europäische Handelsherren und ihre Agenten, Koster und Spekulanten, chinesische Compradores (Geschäftsleiter), Schroffs (Geldzähler), Kommis und Kulis arbeiten dann von früher Morgendämmerung bis in die Nacht hinein. Das geht so, wie gesagt, während einiger Wochen im Jahre, etwa von Anfang Mai bis Anfang Juni. Dann wird es wieder still in Hankau.
Warum diese Eile? Warum diese angespannte Thätigkeit während so kurzer Zeit? Die wichtigste Theeernte des Jahres tritt eben dann ein, und die einzelnen europäischen Theehäuser trachten natürlicherweise, die besten Sorten zu den niedrigsten Preisen einzukaufen. Dazu muß aber jede Kiste, jeder Sack geprüft werden, und diese Prüfung ist die wichtigste Sache des ganzen Theehandels, denn von dem Urteil des Prüfers oder Tscharsieh hängen mitunter sehr hohe Summen ab. Tausende von Kisten werden der Reihe nach von flinken Kulis geöffnet, die Farbe und Qualität der Blätter geprüft. Dann wird jeder Kiste eine Probe entnommen, aus welcher in kleinen Schälchen Thee bereitet wird.
Während draußen die Kulis lärmen und schreien, sich stoßen und drängen, Kisten öffnen und vernageln, geht es in den dämmerigen Prüfungsräumen still und feierlich her. Mit derselben Genauigkeit, mit welcher die Apotheker bei der Mischung von giftigen Arzneien verfahren, werden die einzelnen Proben abgewogen, die Schälchen gereinigt, das Kochen des Wassers und die Dauer des Ziehens auf Sekunden nach Sanduhren beobachtet, dann schlürft der Tscharsieh einen Schluck durch die Zähne in den Mund, und nach diesem einzigen Schluck fällt die Entscheidung. Ein Zögern, Nachdenken, nochmaliges Prüfen ist nicht gestattet. Nun prüft ein Tscharsieh mitunter hundertundfünfzig bis zweihundert Theesorten an einem Morgen, und man kann sich denken, welche Verantwortlichkeit auf dem heiklen Gaumen dieser Theekoster ruht!
Der größte Teil der Theemengen, welche in Hankau von den chinesischen Kaufleuten erworben werden, geht mittels Dampfer direkt oder über Shanghai nach[S. 168] Europa, teilweise auch über den Stillen Ozean und die Kanadische Pacificbahn, um in Montreal oder Neuyork auf transatlantische Dampfer übergeladen zu werden. Die großen Theekaufleute Englands ziehen es vor, ihren Thee über den Stillen Ozean und Kanada nach Europa zu verschiffen, weil der Transport durch die Singaporestraße und den Indischen Ozean den Thee der Gefahr des Schwitzens, also einer Art Gärung aussetzt, die dem Geschmack der wertvollen Theeladung natürlich nicht förderlich wäre.
Die Prüfung der zweiten und dritten Theeernte, welche weniger kostbare Theesorten liefert, erfolgt gewöhnlich durch lokale Tscharsiehs in Hankau oder Shanghai.
Während des Rollens und Brennens des Thees sowie während des Transportes auf den elenden Straßen wird eine große Menge von Blättern zerbröckelt oder zu Staub zerrieben. Diese Abfälle werden sorgfältig gesammelt und in den vorerwähnten Hankauer Fabriken zur Bereitung des Ziegelthees verwendet. Bei uns ist Ziegelthee nahezu unbekannt, in Rußland und Sibirien aber gehört er neben dem Karawanenthee zu den beliebtesten Sorten. Die steinharten Täfelchen des Ziegelthees werden in Sibirien, wo es zuweilen im Geldverkehr an kleinen Münzen fehlt, sogar an deren Stelle ausgegeben und ziemlich allgemein als Zahlung angenommen.
In den großen, dunklen, staub- und dampferfüllten Räumen der Fabriken stehen zahllose Fässer mit feinem Theestaub oder Blätterabfällen, welche sorgfältig zerkleinert und durch Siebe geschüttelt werden. Hunderte von halbnackten, schweißtriefenden Kulis, den langen Scheitelzopf um ihre kahl rasierten Schädel gewunden, wiegen dieses gelbliche Theemehl in Partien von je einem Kilogramm und füllen damit kleine Säckchen aus Baumwollstoff, andere werfen diese Säckchen in große durchlöcherte Metallcylinder, wo sie mit heißem Dampf durchtränkt werden. Von Zeit zu Zeit beugt ein Chinese seinen Oberkörper über den dampferfüllten Cylinder, holt die Theesäckchen wieder heraus und trägt sie zu der Preßmaschine, wo sie in ziegelartige Formen gepreßt werden. Unter diesen Preßmaschinen darf man sich aber nicht etwa solche aus Eisen und Stahl vorstellen, wie sie bei uns in Verwendung stehen. Ein langer Bambusstamm ist mit einem Ende in einem Scharnier befestigt; nahe diesem trägt er an der unteren Seite einen in die Ziegelform genau passenden Stempel. Ist die Form mit einem Theesäckchen gefüllt, so springt ein Chinese mit seinem vollen Körpergewicht auf das andere Ende des Bambusstammes, und während dieses sich senkt, legen sich noch ein paar andere Kulis darüber. Dann wird der Bambusstamm wieder gehoben, der steinhart gepreßte Theeziegel herausgenommen und ein anderes Theesäckchen in die Form geworfen. Die fertigen Ziegel, etwa von der Form und Größe unserer gewöhnlichen Dachziegel, nur von nahezu schwarzer Farbe, werden noch getrocknet, in Papier geschlagen und sind nun zum Transport durch die Karawane fertig.
In Europa wird ziemlich allgemein angenommen, daß der Karawanenthee wirklich auf Kamelrücken den viele tausend Kilometer weiten Weg nach Rußland zurücklegt. Das ist aber ein Irrtum. Von der ganzen ungeheuren Strecke wird nur ein verhältnismäßig kleiner Teil wirklich auf Kamelrücken zurückgelegt. Der gesamte produzierte Ziegelthee wird zunächst den Jangtsekiang abwärts nach Shanghai verschifft. Von dort geht ein kleiner Teil zu Schiff nach Tientsin und Peking, wird dort auf Kamele verladen und von diesen karawanenweise quer durch die Mongolei nach Kiachta in Sibirien gebracht. Von dort gehen die Ladungen zu Wasser nach Irkutsk am Baikalsee. Die größte Menge des Karawanenthees wird von Shanghai nach Nikolajewsk an der Mündung des Amur in das Ochotskische Meer verschifft und dort auf die Amurdampfer verladen, unter denen sich auch einige deutsche Dampfer befinden. Diese bringen den Thee den Amur und Schilka aufwärts nach Strjetensk. Von hier aus übernehmen Karawanen den weiteren Transport landeinwärts über Tschita nach Werchne-Udinsk am Selengafluß, von wo wieder Dampferverbindung mit Irkutsk jenseits des Baikalsees besteht. Erst hier beginnt der eigentliche Karawanentransport quer durch Sibirien nach Tomsk. Dort wird der Thee wieder auf Dampfer verladen, die ihn über Tobolsk nach Tjumen führen, von wo die Eisenbahnlinie über Jekaterinenburg nach Perm benützt wird. Dann geht er in Dampfern die Kama abwärts, die Wolga aufwärts nach Nischni-Nowgorod und von da mittels Eisenbahn endlich nach Moskau.
Wie kann sich denn der verwickelte Transport von so wohlfeilen Theesorten über so ungeheure Strecken überhaupt lohnen? Warum werden gerade die besseren Theesorten durch Dampfer von Hankau direkt nach Odessa gesandt und nicht die wohlfeileren? Der Seetransport von Hankau nach Odessa ist ja unverhältnismäßig billiger als der Landweg nach Sibirien. Der Grund liegt in den russischen Einfuhrzöllen. In Odessa beträgt er gerade das Doppelte von jenem an der Amurmündung, und so kommt es, daß der Thee trotz der größeren Transportkosten auf dem Landweg in Moskau selbst immer noch billiger ist, als würde er über Odessa kommen. Auf dem letzteren Wege kommt das Kilogramm Thee einschließlich Transport und Zoll auf etwa drei Mark, auf dem Land- oder Karawanenwege nur auf zweieinhalb Mark zu stehen. Darin liegt der eigentliche Grund des Karawanentransportes, und die herrschenden Ansichten über die Güte des Karawanenthees, eben weil er zu Land befördert wurde, gehören in das Reich der Fabel. Nur ein kleiner Teil der besten Theesorten wird durch Karawanen nach Rußland befördert. Die Hauptmenge kommt zu Wasser nach Europa.
Hankau ist unzweifelhaft der wichtigste Handelsmittelpunkt im Innern von China, eine der größten Städte des Reiches der Mitte, an der größten Verkehrsstraße des letzteren, an dem Jangtsekiang gelegen. Etwa tausend Kilometer von der Mündung dieses mächtigen Stromes aufwärts mündet der von Norden herkommende Hanfluß in den Jangtsekiang, und rings um diese Mündung liegen die schon im vorigen Kapitel erwähnten drei Städte, welche irrtümlicherweise zu dem Begriff Hankau zusammengefaßt werden. Stellt man sich den Zusammenlauf der Flüsse etwa wie ein umgekehrtes T (⟂) vor, so bildet der Horizontalstrich den Jangtsekiang, der Vertikalstrich den Hanfluß. In der linken Ecke liegt die Stadt Hanyang, in der rechten Hankau, und beiden gegenüber auf dem südlichen Ufer des Jangtsekiang, also auf der unteren Seite des Horizontalstriches, die große Stadt Wutschang, die Hauptstadt der Provinz Hupei und bis vor kurzem Residenz des aufgeklärten und europäerfreundlichen Vicekönigs Tschang-tschi-Tung. An Einwohnerzahl ist Wutschang die größte des Städtetrios, aber der Handelsverkehr steht nicht im Einklang mit dieser Größe, was teilweise auf die steilen, für Hafenanlagen und dergleichen[S. 171] ungünstigen Ufer und die festen hohen Mauern zurückzuführen ist, welche Wutschang umgeben und direkt von den Ufern emporsteigen, ähnlich wie es auch in Nanking der Fall ist. Diese Mauern verbergen auch die Stadt fast vollständig, und man sieht von ihr vom Flusse aus nur einige Pagoden, darunter die berühmte Hoang holin, d. h. die Pagode vom gelben Kranich, eine der bemerkenswertesten und seltsamsten von ganz China, weshalb ihre Abbildung in geographischen Werken auch häufig zu sehen ist und auch auf den Briefmarken des europäischen Postamtes in Hankau vorkommt. Wutschang ist hauptsächlich Militärstadt und Festung. Von Europäern wohnen innerhalb ihrer Mauern nur einige Missionare; der Handel mit europäischen Waren für Wutschang sowohl wie für das angrenzende Gebiet gegen Süden zu liegt in den Händen von chinesischen Kaufleuten, und der lokale Flußverkehr zwischen Wutschang und den am gegenüberliegenden Ufer des Jangtsekiang gelegenen Städten Hankau und Hanyang ist sehr gering. Ebenso gering ist auch jener über den Hanfluß zwischen den beiden letztgenannten Städten, obschon alle drei zusammen eine Einwohnerzahl von etwa anderthalb Millionen Seelen besitzen dürften. Anderswo wären bei einer so großen Menschenansammlung gewiß längst Dampffähren für den Lokalverkehr eingerichtet worden, und es ist zu verwundern, daß Tschang-tschi-Tung diese nicht auf eigene Rechnung laufen läßt. Nächst dem Vicekönig von Tschili, Li-Hung-Tschang, ist der frühere Vicekönig von Hupei der unternehmendste aller Provinzgouverneure. Er hat in Wutschang selbst große Baumwollspinnereien und Eisenwerke anlegen und zu den etwas weiter flußabwärts befindlichen Eisengruben eine Eisenbahn bauen lassen. Bis zum Jahre 1894 lag die Leitung dieser Unternehmungen in den Händen eines deutschen Ingenieurs.
Gerade so wie Wutschang ist auch Hankau mit einer Umfassungsmauer umgeben, eine der Dutzendstädte des chinesischen Inlandes ohne besondere Sehenswürdigkeiten, ja man könnte sagen, ohne besondere Bedeutung, denn die letztere beschränkt sich auf die wenigen Schollen Landes außerhalb der Chinesenstadt an den Ufern des Jangtsekiang, wo die Europäer ihre Wohnsitze aufgeschlagen haben. Die Engländer und Franzosen starteten im Wettlauf um den Handel des Jangtsekiangthales ziemlich gleichzeitig, aber während sich auf der englischen Konzession schöne Bungalows (Wohnhäuser indischen Stils), Godowns (Warenlager), Klubs, Kirchen und dergleichen erheben und dem Bund, d. h. der längs dem Jangtsekiang angelegten Uferstraße, ein so großstädtisches Aussehen geben, wie es in Ostasien nur der Bund in Shanghai besitzt, ist die französische Konzession öde und verlassen. Nur der französische Konsul hat dort, wie bereits bemerkt, seinen Wohnsitz und mag aus lauter Langeweile seine Fingernägel benagen, denn französische Geschäftsleute giebt es in Hankau keine. Wären sie vorhanden, so würden sie wahrscheinlich ebenso wie jene in Shanghai und Canton fürsorglich die französische Konzession meiden und in der englischen ihre Wohnsitze aufschlagen.
Zu der englischen und französischen Konzession ist im Jahre 1895 nun auch eine deutsche gekommen, allerdings etwas spät, aber sie ist nun vorhanden, was in Anbetracht der großen Wichtigkeit Hankaus für den deutschen Handel die Hauptsache ist. Sie hätte schon vor mehr als drei Jahrzehnten erfolgen sollen, denn es war Preußen, welches sich in seinem 1861 mit China abgeschlossenen und 1863 ratifizierten Vertrage die Eröffnung Hankaus für den fremden Handel ausbedungen hat. Leider ist dieser handelspolitische Erfolg damals nicht weiter ausgebeutet worden. Die Engländer und nächst ihnen die Franzosen ließen sich bald nach der Oeffnung des Hafens von der chinesischen Regierung kleine Landstrecken längs der Ufer des Jangtsekiang in Hankau abtreten, und die sieben dort ansässigen deutschen Firmen sind seither bei den Engländern zu Gast. Nun hat Deutschland das Versäumte nachgeholt, und die deutsche Konzession im Herzen Chinas kann nur auf das freudigste begrüßt werden. Sie erstreckt sich auf etwas über einen Kilometer längs der Uferfront und hat den allerdings nicht sehr großen Umfang von etwa sechsundvierzig Hektar.
Was Shanghai für das ganze Jangtsekiangthal ist, das ist Hankau für den oberen Teil desselben und für die angrenzenden mittleren Provinzen, ja, eine beträchtliche Zahl von Seeschiffen berührt den Hafen von Shanghai, Wusung, kaum, sondern fährt direkt nach Hankau, klariert, nimmt Ladung und fährt wieder direkt nach Europa, hauptsächlich nach England und Odessa zurück. Große Kriegsschiffe erscheinen häufig vor Hankau. Der Jangtsekiang ist aber für größere Dampfer noch um sechshundertvierzig Kilometer weiter stromaufwärts bis nach Itschang schiffbar, und kleinere Dampfer können sogar bis nach Tschungking, das noch einmal soweit stromaufwärts liegt, vordringen.
1887 liefen in Itschang 24 englische und 31 chinesische Dampfer, von Hankau kommend, ein. 1896 war diese Zahl auf 46 englische und 43 chinesische gestiegen, und der Tonnengehalt erreichte 63000 Tonnen. Der Wert der Waren betrug, soweit er überhaupt bekannt wurde, etwa 50 Millionen Mark, dürfte aber in Wirklichkeit viel höher gewesen sein. Davon waren mehr als die Hälfte für Tschungking bestimmt. Indessen sind Tschungking sowohl wie Itschang ausschließlich nur Dependenzen von Hankau. Welchen Handelsverkehr die etwa hundert dort angesiedelten Europäer zu bewältigen haben, geht aus den großen, stets steigenden Ein- und Ausfuhrwerten hervor. 1887 beliefen sich die Einfuhrwerte zusammen auf 120 Millionen Mark, die Ausfuhrwerte auf 92 Millionen; im Jahre 1896 hatten die Einfuhrwerte den englischen Konsularberichten zufolge etwa 140 Millionen Mark, die Ausfuhrwerte über 70 Millionen Mark erreicht, zusammen also 210 Millionen Mark, während der Gesamtwert des Handels nach mir vorliegenden Privatnachrichten 300 Millionen Mark überstiegen haben dürfte. Diese Zahlen beweisen die Wichtigkeit Hankaus für den deutschen Handel und die Notwendigkeit, diesem Emporium des Jangtsekiang noch größere Aufmerksamkeit zuzuwenden als bisher. Die Einrichtung eines deutschen Settlements wird dazu wohl das Ihrige beitragen. An den deutschen Industriellen und Exporteuren liegt es, auch ihrerseits mehr Unternehmungsgeist zu zeigen und womöglich eigene erfahrene Leute zum Studium des chinesischen Inlandmarktes nach Hankau zu senden, wie es mehrere französische Handelskammern gethan haben. Die Regierung hat die Bresche geschaffen, den Weg geebnet; jetzt liegt es an den Interessenten selbst, das Weitere zu thun. Der Norddeutsche Lloyd unterhält einen zweiwöchentlichen Dampferverkehr mit Shanghai, und im Anschluss an diese Prachtdampfer laufen nunmehr auch deutsche Dampfer auf dem Jangtse.
Die wichtigsten Ausfuhren Hankaus sind in erster Linie Thee im Werte von nahezu 100 Millionen Mark. Ein deutscher Theehändler, Herr Theodor aus London, hat im Jahre 1894 allein für etwa 4 Millionen Mark Thee aufgekauft und nach Europa verschifft. Nächst Thee kommen Tabak, Seide, Medizinalwaren, Baumöl, Hanf, Häute, Wachs, Galläpfel und Reis. Die wichtigsten Einfuhren Hankaus sind:
| Baumwollwaren (Schirtings und Baumwollgarne) im Werte von etwa | 30 | Mill. | Mark |
| Wollwaren im Werte von | 4 | „ | „ |
| Metallwaren „ „ „ | 3 | „ | „ |
| Opium „ „ „ | 7 | „ | „ |
| Zucker „ „ „ | 7 | „ | „ |
| Petroleum „ „ „ | 5 | „ | „ |
| Farbwaren „ „ „ | 1½ | „ | „ |
| ferner Fensterglas, Nadeln, Schirme und dergleichen. | |||
Dieser große Warenverkehr bewegte sich bisher hauptsächlich auf englischen Schiffen; denn von der gesamten Schiffahrtsbewegung Hankaus im Jahre 1896, etwa 1400 Schiffe mit 1½ Millionen Tonnen, waren über 1000 englische, 400 chinesische, etwa 38 norwegische und nur 10 deutsche. Frankreich ist an dem Handel von Hankau, wo es, wie gesagt, ein eigenes Settlement besitzt, gar nicht beteiligt.
Diese Verhältnisse werden sich nunmehr gewiß bald zu Gunsten Deutschlands ändern, und man möge ja rechtzeitig die erforderlichen Schritte thun, damit ein noch größerer Anteil an dem Handel gesichert werden kann; denn Hankau ist dazu ausersehen, der Mittelpunkt des chinesischen Eisenbahnnetzes zu werden. Die einleitenden Schritte zur Erbauung der chinesischen Zentralbahn Peking-Hankau sind bereits geschehen, und die Weiterführung derselben von Hankau nach Canton steht nicht mehr in weiter Ferne.
Für deutsche Kaufleute bietet Hankau günstigeren Boden zur Ansiedelung und Errichtung von Agenturen als irgend eine andere offene Stadt Chinas, Shanghai und vielleicht Tientsin ausgenommen. Die Fahrt von Shanghai nach Hankau auf prächtigen Flußdampfern erfordert vier Tage, und fast täglich kommen und gehen Dampfer, so daß die Verbindung mit der Außenwelt und mit Europa sehr günstig ist. Das Leben in Hankau ist ganz ansprechend, das Klima ähnlich dem unserigen, nur ist es im Sommer während einiger Wochen heißer und feuchter. An Vergnügungen ist dort eher zu viel als zu wenig vorhanden; es bestehen zwei Klubs mit vielen Zeitungen, Billards und Spielsälen, Cricket, Lawntennis, Jagden, Ruder-, Yacht- und sonstige Sportvereine. Im Winter werden Bälle, im Frühjahr Pferderennen und Football matches veranstaltet. Es fehlt nicht an Aerzten, an Kaufläden für den nötigen Hausbedarf, und die beiden katholischen Missionen haben eigene Hospitäler, von denen eins eine Abteilung für Europäer besitzt.
Die chinesische Bevölkerung wird zuweilen ein wenig unangenehm, und es ist schon zu ziemlich ernsten Unruhen und Aufständen gegen die Europäer gekommen, doch pflegt im Strome vor den europäischen Ansiedelungen irgend ein englisches, deutsches oder sonstiges Kriegsschiff zu liegen, das im Notfalle die ganze fremde Bevölkerung leicht aufnehmen kann. Ueberdies wissen die Europäer sich sehr gut zu verteidigen. Sie haben zu diesem Zweck ein eigenes, mit Gewehren, Kanonen,[S. 175] Hieb- und Stichwaffen versehenes Arsenal, dazu spanische Reiter zur Absperrung der Zugänge. Gelegentlich der Unruhen im Jahre 1891 erließ der englische Konsul am 19. Juni an die Europäer Hankaus eine Proklamation, die zur Charakterisierung der dortigen Zustände und als Kuriosum hier wörtlich wiedergegeben werden mag, denn ein ähnliches Schriftstück ist wohl in der Geschichte selten vorgekommen.
I. Das Verteidigungskomitee von Hankau hat die Hongs (d. h. Warenhäuser) der Herren Moltschanoff, Petschatnoff u. Cie. und der Herren Jardine, Matheson u. Cie. als die beiden Zufluchtsstätten bestimmt, wohin im Falle von Alarmierung alle Frauen und Kinder sofort gebracht werden sollen. Dies soll von den Familienvätern persönlich besorgt werden.
Alarmsignale. Bei Tage: drei rasch aufeinanderfolgende Kanonenschüsse. Bei Nacht: außerdem Raketen und blaue Signalfeuer.
II. Der unterzeichnete Konsul hat keine Nachricht, der zufolge in absehbarer Zeit ein Angriff auf die Europäer beabsichtigt wird. Wir haben im Strome zwei Kanonenboote liegen, die uns beschützen würden.
Der Unterzeichnete hat volles Vertrauen in den Willen und in die Macht der (chinesischen) Behörden, Aufstände zu unterdrücken. Dem Unterzeichneten ist es aus seiner dreißigjährigen Erfahrung in China bekannt, daß geheime Gesellschaften hier immer bestanden haben, allein sie sind seiner Ansicht nach heute weniger gefährlich als früher, und auch in den Gesinnungen der chinesischen Beamten gegen uns ist eine Wendung zum Bessern bemerkbar.
Der Unterzeichnete unterstützt alle von den Europäern unternommenen Vorkehrungen zur Verteidigung;... er besitzt in Bezug auf das Verhalten des chinesischen Pöbels gewisse Erfahrungen; Aufstände des letzteren können durch einige resolute Männer, welche gemeinsam und unter einheitlicher Leitung sofort auftreten, leicht unterdrückt werden.
Der kgl. großbritannische Konsul: C. T. Gardner, m. p.
Aehnlich wie die jüngsten Städte der Neuen Welt, so zeigen auch die uralten Städte des chinesischen Reiches in ihrem Aussehen wie in ihrer Anlage große Einförmigkeit. Was von den ersteren gilt, kann auch von den letzteren gelten: hat man eine gesehen, so hat man alle gesehen.
Wer in China erwartet, ähnliche Sehenswürdigkeiten zu finden, wie die Städte Europas sie in ihren Kirchen, Palästen, Museen, Gärten, Theatern, Denkmälern, Fabrikanlagen besitzen, würde in ärgster Weise enttäuscht werden. Die erste Chinesenstadt, welche der Europäer besucht, sei es Canton oder Tientsin oder Tschifu, wird ihn durch die eigenartige Bauart der Häuser, die alten Ringmauern und Thore, die hohen Pagoden und vor allem durch das seltsame bewegte Volksleben fesseln, das sich in den bunten, kuriosen Straßen abspielt. Aber in der nächsten Stadt, die er berühren sollte, wird er dieselben Ringmauern, dieselben Pagoden, dieselben Häuser und Straßen wiederfinden, und so wiederholt sich dies in dem ganzen Reiche mit geringen Abwechslungen. Selbst die beiden berühmten Hauptstädte Chinas, Peking und Nanking, bilden keine Ausnahmen. Es ist wie bei einem Regiment Soldaten: die Individuen sind verschieden, die Uniform ist dieselbe. Und dabei ist diese Uniform, das Aeußere der chinesischen Städte, bei weitem nicht so malerisch, so fesselnd, so altertümlich, wie beispielsweise irgend eine Stadt unserer schönen, sonnigen Mittelmeerküsten.
Wer eine chinesische Inlandstadt besuchen will, die nicht gerade an dem mächtigen Jangtsekiang liegt, der muß entweder ein plumpes, von Chinesen geleitetes Boot mieten, oder den Weg dahin auf Maultierrücken zurücklegen, denn mit Ausnahme des genannten Stromes herrscht auf keinem Fluß Chinas für größere Strecken Dampferverkehr; Eisenbahnen sind vorläufig unbekannt, und da es in China nur sehr wenige fahrbare Straßen giebt, ist auch der Reisewagen als Transportmittel ausgeschlossen. Wo er vorhanden ist, wie etwa zwischen Tientsin und Peking, wird es sich der Reisende wohl dreimal überlegen, ehe er sich zu einem derartigen Marterkasten entschließt. Weder die Unsicherheit, noch die Unkenntnis der ungemein schwierigen Sprache, noch die Kosten bilden so bedeutende Hindernisse für Reisen[S. 177] in China, wie der Mangel an Verkehrswegen. Die Unsicherheit ist nicht so groß, als man bei uns annimmt, keineswegs größer, als in vielen anderen von Europäern gern bereisten Ländern; die Schwierigkeit der Verständigung mit den Chinesen wird durch die Anwerbung eines Dolmetschers umgangen, ja ein solcher ist geradezu eine unbedingte Notwendigkeit; und was die Reisekosten betrifft, so sind sie sehr gering, kaum die Hälfte, unter Umständen sogar ein Viertel jener, an welche man in Europa gewöhnt ist.
Gerade wie es bei uns im Mittelalter der Fall war, ist die weitaus größte Zahl der chinesischen Städte mit festen Ringmauern umgeben, deren Thore bei einbrechender Dunkelheit gesperrt und erst nach Sonnenaufgang wieder geöffnet werden. Ist die Sonne hinter dem Horizont verschwunden, so wird in der Regel von den Militärwachen an den Stadtthoren eine rote Kerze entzündet, und ist der letzte Rest derselben verbrannt und die Flamme erloschen, so werden die mächtigen, mit Eisen beschlagenen Thorflügel geschlossen, ein gewaltiger Querbalken durch die an den Flügeln und in den Mauern angebrachten eisernen Lager geschoben und ein schweres Schloß vorgehängt. In vielen Städten, besonders zur Zeit von Krieg oder Unruhen, werden die Thore unter keinen Umständen zur Nachtzeit geöffnet, selbst nicht für irgend einen Mandarin mit dreiäugiger Pfauenfeder. Sollte ein kaiserlicher Postläufer, an seinem gelben Fähnchen und dem Schellengeklingel kenntlich, verspätet eintreffen, so wird er vielleicht in einem herabgelassenen Korbe längs der Stadtmauer emporgezogen. Der Reisende muß sich also darauf gefaßt machen, inmitten von allerlei Gesindel vor den Stadtthoren im Freien zu übernachten, will er nicht in irgend einer der elenden, schmutzstarrenden, übelriechenden Spelunken einkehren, deren es gewöhnlich vor den Thoren mehrere giebt. In Söul entging ich der Sache dadurch, daß ich einfach an einer schadhaften Stelle über die hohe Mauer hinwegkletterte, eine Turnübung, der sich dort schon sehr oft auch die Gesandten fremder Mächte unterziehen mußten. Einen chinesischen Paß wird wohl jeder Reisende mit sich führen, obwohl er nur selten abverlangt wird. Man ist in dieser Hinsicht in China viel weniger streng als in manchem Lande Europas.
In den meisten chinesischen Städten bildet die Ringmauer das bedeutendste und interessanteste Bauwerk. Zehn bis fünfzehn Meter hoch, umgiebt diese mit Granitquadern bekleidete Mauer die ganze Stadt, und nur die wenigen Pagoden ragen darüber empor, die einzigen Gebäude, welcher man bei der Annäherung an die Stadt gewahr wird. Den oberen Rand der Mauer entlang zieht sich eine Parapetmauer mit Schießscharten, aus denen möglicherweise die Mündungen von alten eisernen Geschützen hervorlugen. Vor der Mauer befinden sich gewöhnlich tiefe, breite Gräben, stellenweise mit stagnierendem Wasser oder übelriechenden Abfällen angefüllt; denn die Chinesen haben in ihren Städten noch keine Kanalisierung oder Rieselfelder nach europäischem Muster, sondern lassen den Unrat ihrer Häuser von Kulis in Bottichen[S. 178] vor die Stadtmauern tragen, falls sie ihn nicht anderweitig verwerten. In Peking beispielsweise dient dieser Unrat zum Besprengen und Niederschlagen des Staubes in den Straßen.
Am stärksten und dräuendsten erscheinen die Stadtmauern in der Nähe der Thore, ansehnlicher als wohl in irgend einer Festung Europas, vielleicht die alten Sarazenenmauern im südlichen Spanien ausgenommen. Die Wachthäuser sind auf die Thore aufgesetzt und gewähren mit ihren geschwungenen doppelten Dächern, ihren Schießscharten und Kanonen einen ungemein malerischen Anblick. Hat man das Thor durchschritten, so gelangt man in einen kleinen Festungshof, hinter dem sich mitunter noch ein zweites, ebenso hohes, starkes Thor erhebt. Treppen führen zur Festungsmauer empor, die oben gewöhnlich mit Steinen gepflastert ist und eine Breite von drei bis fünf Meter besitzt. Aber so drohend und unbezwingbar diese chinesischen Ringmauern von außen auf den ersten Blick aussehen mögen, so verwahrlost und verfallen zeigen sie sich bei näherer Besichtigung. Die Parapetmauern liegen in den meisten Städten in Ruinen, die Granitbekleidung der Hauptmauer ist an vielen Stellen abgefallen und läßt erkennen, daß der gewaltige Bau nur aus aufgeschütteter Erde besteht. Die Kanonen sind überall verrostet, vollständig unbrauchbar und liegen vielleicht sogar ohne Lafetten in dem üppig emporwuchernden Unkraut. Längs der ganzen, über fünfzig Kilometer langen Stadtmauer von Nanking sah ich überhaupt kein einziges Geschütz, und von den Hunderten eiserner Kanonen auf den Mauern Cantons, der größten Stadt des Reiches der Mitte, fand ich nicht eine, bei welcher ein Schuß nicht größere Gefahren für die Verteidiger als für die Angreifer mit sich bringen würde. Die dräuenden Kanonenmündungen über den Stadtthoren von Peking sind überhaupt nur auf die schwarzen Holzläden der Schießscharten aufgemalt. Ueberall herrscht Verwahrlosung und Verfall; die Thorwachen, in zerlumpte Uniformen gehüllt, lungern schläfrig an den Thoren, Lanzen, Flaggen, Schwerter und Schilde, in den seltsamsten Formen, verrostet und unbrauchbar, hängen hinter ihnen an der Wand. Dringt die Kunde von irgend welchen Unruhen in die Stadt, wird ein neuer Gouverneur ernannt oder eine Inspektion von seiten irgend eines hohen Generals angekündigt, dann wird über Hals und Kopf alles notdürftig ausgebessert und übertüncht, und dabei bleibt es bis zu dem nächsten derartigen Anlaß. In einer Hinsicht sind diese Mauern aber doch von Nutzen für die Städte: sie sind die beliebtesten, wenn nicht einzigen Spaziergänge für den besseren Teil der Bevölkerung. An warmen Sommerabenden kann man dort oben Hunderte lustwandeln sehen, Gelehrte und Litteraten, Kaufleute und junge Stutzer in ihren langen blauen Gewändern, gewöhnlich mit einem kleinen Käfig in der Linken, in dem irgend ein Singvogel oder eine Wachtel umherhüpft. Was die Schoßhündchen bei uns, das sind die Vögel bei den Chinesen.
Außerhalb der Stadtthore breiten sich bei vielen Städten Vorstädte aus, in deren elenden Lehmhütten die ärmeren Klassen der Bevölkerung wohnen und in deren Straßen es gewöhnlich lebhafter zugeht als in der Stadt selbst. Ein fortwährendes Schreien und Lärmen, Drücken, Stoßen, Hin- und Herlaufen, Klopfen und Hämmern, Feilschen und Zanken von zerplumptem, schmutzigem Gesindel, das tagsüber fast ausschließlich auf der Straße lebt. Selbst die Frauen scheinen es zu verschmähen, im Innern der schmutzstarrenden Lehmhütten zu verweilen. In manchen Städten ist um diese Vorstädte noch eine zweite Ringmauer angelegt worden, und man hat zwei Thore zu durchschreiten, ehe man in die innere Stadt gelangt. Auch in dieser ist das Leben und Treiben lebhaft, wenn auch ruhiger und vornehmer als draußen in den Vorstädten. Das Straßennetz der chinesischen Städte ist im allgemeinen regelmäßiger angelegt als jenes der alten europäischen; die Straßen schneiden sich in rechten Winkeln, über Flüsse und Kanäle führen zahlreiche, gewöhnlich sehr steile Brücken, um den Schiffen die Durchfahrt zu gestatten, und wäre alles wirklich so, wie es von den Erbauern der Stadt und den Behörden vorgesehen wurde, dann wäre der Aufenthalt dort gar nicht unangenehm. Aber leider teilen die Chinesen eine charakteristische Eigenschaft mit den meisten anderen Völkern des Orients, bis ans Mittelmeer: städtische Anlagen, Häuser, Tempel, Paläste, einmal hergestellt, werden nur in den seltensten Fällen wieder ausgebessert und bleiben in der Regel bis zum gänzlichen Zerfall sich selbst überlassen. Ueberdies verwenden die Chinesen nur für ihre Pagoden, für kaiserliche Paläste, einzelne Tempel und Ehrenpforten Stein als Baumaterial, ihre Häuser bauen sie zum größten Teil aus Holz und Lehm, im besten Fall aus ungebrannten Ziegeln. In Hangtschau, Sutschau, Ningpo, Tschinkiang und vielen anderen Städten werden wohl die Grundmauern bis auf etwa einen Meter Höhe über dem Erdboden aus Stein oder Ziegeln ausgeführt. Dann werden von diesen Mauern aufwärts vertikale Bretterverschalungen errichtet, so hoch als das höchstens ein Stockwerk hohe Haus werden soll, und zwischen die beiden Bretterwände wird nun auf die Grundmauern feuchte Erde und Lehm geschüttet. Dieser wird fest gestampft, und sobald er trocken ist, werden die Bretterwände entfernt. Auf die Lehmmauern werden nun die Dachbalken befestigt, das Dach mit gebrannten Hohlziegeln eingedeckt, und das Haus ist fertig. Die Fenster werden mit Papier verklebt, doch kann man in den Städten, besonders längs der Küste, schon sehr viele Fenster mit Glasscheiben finden. Oefen giebt es keine. Im Süden bedarf es deren nicht, im Gebiet des Jangtsekiang wärmen sich die Leute im Winter wie im mohammedanischen Orient an Holzkohlenbecken, und im Norden bis nach Korea wird der Rauch des Küchenfeuers unter den Fußboden geleitet, der auf diese Weise erwärmt wird. Besitzt das Haus über dem Erdgeschoß noch ein Stockwerk, so enthält das obere Stockwerk gewöhnlich die Wohnräume, zu denen man mittels einer steilen, leiterartigen Holztreppe gelangt.
Daß derartige Häuser den Unbilden der Witterung und der Zeit nicht lange Widerstand leisten können, ist wohl einleuchtend. Deshalb findet man in chinesischen Städten so zahlreiche Ruinen und Schutthaufen, und daher kommt es auch, daß in diesem ältesten Kulturlande der Welt keine Denkmäler aus früheren Jahrtausenden zu finden sind, wie sie selbst in jenen Ländern heute noch bestehen, welche längst der Geschichte angehören: Babylonien, Assyrien, Altgriechenland und Altägypten. Dort ist die Kultur vergangen, und nur die steinernen Kolossalbauten legen Zeugenschaft ab von dem einstigen Glanze; hier ist die Kultur geblieben, aber die steinernen Denkmäler fehlen. Was davon vorhanden ist, Pagoden aus Stein oder Ziegeln, Ehrenpforten, Festungsmauern und dergleichen, reicht zum größten Teil nicht weiter zurück als in das achte oder neunte Jahrhundert und geht sicher dem gänzlichen Verfall entgegen. Handel und Verkehr konzentrieren sich auf einige wenige Hauptstraßen, wenn man die engen, drei bis vier Meter breiten Gäßchen überhaupt mit diesem Namen bezeichnen kann. In den Städten des Nordens sind die Straßen breiter und für den Wagenverkehr berechnet, die Kaufläden finden sich zumeist nach den einzelnen Geschäftszweigen beisammen; hier die Goldschmiede, daneben vielleicht Buch- oder Papierläden, dort Hutläden, Verkäufer von Kleidern, Fächern, Matten, Möbeln und dergleichen, ähnlich wie es früher auch in vielen Teilen Europas der Fall war. In den Seitenstraßen geht es viel ruhiger zu, und am stillsten ist es in den Bezirken, wo sich die Yamen der Behörden und die mit hohen Mauern umgebenen Wohnungen der Reichen befinden. Innerhalb dieses Viertels oder anstoßend an dasselbe befindet sich in den meisten Provinzhauptstädten noch eine eigene mit Mauern umgebene Stadt, welche die Wohnungen der Mandschukrieger enthält, die sogenannte Tatarenstadt.
Aehnlich wie die mohammedanischen Städte, so zeichnen sich auch die chinesischen vor allem durch Schmutz und Unrat aus. Wohl sind in vielen Kloaken vorhanden, die in der Mitte der Hauptstraßen angelegt und mit Steinplatten bedeckt worden sind; wohl laufen auch an den Häusern entlang schmale Abzugsgräben, aber es ist niemand da, der die Pflasterung, niemand, der die Kloaken in Ordnung hält, und so kommt es, daß sich beides, Pflaster und Kloaken, längst friedfertig vereinigt haben, daß man in Kloaken fällt, wenn man auf lockere Steine tritt, und in den Unratspfützen, in welche man häufig durch den ungemein lebhaften Verkehr gedrängt wird, über Steine stolpert. Hier und dort haben sich die Kloaken einen Ausweg nach den Wasserkanälen gesucht, und in diesen waschen die sorgsamen Hausfrauen am Morgen Reis und Gemüse für ihre Mahlzeiten. In den Häusern der Reichen geht es wohl besser zu. In den chinesischen Städten, wo alle Berufszweige zu Zünften vereinigt sind, selbst die Lastträger, Barbiere und Bettler, giebt es auch eine Zunft der Kanalräumer. Für geringes Geld holen sie täglich den Unrat aus den Häusern derjenigen, die sie bezahlen, und tragen ihn in Kübeln, die von wage[S. 182]rechten Schulterstangen herabhängen, vor die Stadtthore oder auf offene Plätze neben den Hauptstraßen, um ihn dort in der Sonne trocknen zu lassen. Welche Gerüche unter solchen Umständen die chinesischen Städte erfüllen, läßt sich eher ahnen als sagen.
Von passender Unterkunft für europäische Reisende kann natürlich keine Rede sein; freilich giebt es in allen Städten chinesische Hotels, aber gewiß würde jeder lieber in unseren Kuhställen die Nacht zubringen als in diesen elenden, von Schmutz, Unrat und Ungeziefer erfüllten Löchern, die, gewöhnlich im ersten Stockwerk gelegen, nichts weiter enthalten als Schlafbretter an den Wänden, ähnlich den Schiffskojen, die man überdies noch mit chinesischen Reisenden teilen muß. Ueber diese Bretter sind schmutzige Matten gebreitet, im Winter vielleicht noch schmutzigere Wolldecken. Von Bequemlichkeiten für die Toilette, Auskleiden und dergleichen ist nichts vorhanden. Die fensterlosen Räume sind mit den widerwärtigsten Gerüchen geschwängert, in denen Opiumrauch den Grundton angiebt; in den unteren Räumen herrscht die Nacht über Lärmen, Schreien und Gepolter; hat es sich vielleicht zeitweilig gelegt, dann kommt man wegen des unaufhörlichen Gebells der Hunde oder dem Geknabber der Ratten nicht zur Ruhe, und steht man bei Tagesanbruch auf, so ist vielleicht der Reisesack mit Geld und Gut verschwunden. Glücklicherweise befinden sich heute schon in den meisten Städten christliche Missionen mit europäischen Missionaren, und dorthin pflegen sich die Reisenden zunächst zu wenden, um deren Gastfreundschaft in Anspruch zu nehmen.
Nächst den mehrstöckigen Pagoden und Buddhatempeln sind in den verschiedenen Provinzstädten wohl die Yamen der Regierungsbehörden die anspruchsvollsten Bauten. Den Yamen des obersten Mandarins, gewöhnlich vom Range eines Taotai, kennzeichnen zwei hohe Flaggenmasten vor dem Haupteingange; residiert in der Stadt ein Provinzgouverneur, so stehen vor seinem Yamen vier derartige Flaggenstangen, und die Dächer seiner Wohnung sind mit gelben Glasurziegeln bekleidet, ähnlich wie der Kaiserpalast in Peking. Auch in Bezug auf die Yamen herrscht in China große Einförmigkeit. Wer jemals einen dieser Häuserkomplexe betreten hat, der findet sich ohne Führer in allen zurecht. Während in den alten Städten Europas häufig genug die Aemter in verschiedenen, voneinander recht weit entfernten Gebäuden untergebracht sind, liegen sie in den chinesischen Städten alle innerhalb der Yamenmauer beisammen: Stadtwache, Gefängnis, Gerichtssaal, Polizei, Kasse und endlich die Wohnungen der Beamten. Die einzelnen Gebäude sind rechtwinkelig zu einander angelegt und umschließen mehrere viereckige Höfe, deren innerster gewöhnlich die Privatwohnung des Taotai selbst enthält.
Der Vorhof der Yamen dient den ärmeren Volksklassen zum Aufenthalt, den Kindern zum Spielplatz. Obwohl die Chinesen vor dem Regierungsvertreter einen Heidenrespekt haben, trocknen sie doch in dem Vorhof seines Palastes ihren Reis[S. 183] oder ihre schmutzige Wäsche oder geben sich verschiedenen Arbeiten hin. Von diesem Platze führen drei, stets nach Süden gerichtete Pforten in das Innere. Die mittlere, größte Pforte wird nur bei besonders festlichen Anlässen geöffnet; auf ihre schweren, schwarzen Thorflügel sind zwei riesengroße Fratzen gemalt, welche die bösen Geister abwehren sollen. Die Pforte zur Linken ist ebenfalls geschlossen und öffnet sich nur, um die zum Tode verurteilten Verbrecher hinauszulassen. Die Pforte zur Rechten ist die gewöhnliche Eingangspforte. Ueber alle drei erhebt sich ein kleines Ziegeldach, an dem große Holztafeln mit den Würden und Titeln des höchsten Mandarins in Goldlettern befestigt sind. An der Innenseite des Eingangs hängt eine große Trommel, für jene bestimmt, die den Mandarin um Schutz und Recht anrufen wollen. Sobald der Mandarin die Trommel hört, ist er verpflichtet, die[S. 184] Hilfesuchenden sofort zu vernehmen und ihnen Genugthuung zu gewähren. Ich fand diese Trommeln auch im Norden Chinas und selbst in den Städten Koreas. Allein gewiß werden sich nur sehr wenige rühmen können, den Klang der Trommeln jemals gehört zu haben, nicht etwa, weil sich in China niemand über Unrecht zu beschweren hätte, sondern vielmehr deshalb, weil die Chinesen dank der Willkür und Habsucht der Mandarine stets trachten, ihre Differenzen auf irgendwelche andere Art auszutragen, ehe sie sich den Mandarinen in die Hände geben.
Von den ebenerdigen Gebäuden mit vorspringenden Ziegeldächern, die den ersten Hof umschließen, ist jenes zur Linken das Gefängnis, jenes zur Rechten das Wachthaus, auf dessen Wand gewöhnlich eine ganze antike Waffensammlung prangt: zweischneidige oder doppelte Schwerter von verschiedenen Formen, Lanzen, Dreizacke, Schilde, Fahnen und dergleichen, selten Feuerwaffen. Das der Pforte gegenüberliegende Gebäude ist eine Art Säulenhalle mit einer nach dem zweiten Hof führenden, gewöhnlich verschlossenen Pforte. Hier werden die Gerichtssitzungen abgehalten; an dem in einer Ecke aufgehängten Gong schlagen die Wachen zur Nachtzeit die Stunden an.
Jenseits der Gerichtshalle liegt ein zweiter Hof, dessen Seitengebäude die Bureaus der Sekretäre enthalten, während das Mittelgebäude von dem großen Empfangssaal des Mandarins eingenommen wird. Die Wände sind mit schönen Ebenholzschnitzereien, Zeichnungen und Inschriften bedeckt, von der Decke hängen Lampions herab, und an der hinteren Saalwand liegt eine etwa zwei Fuß hohe Estrade mit einem kleinen Theetischchen und einigen roten Kissen, der gewöhnliche Sitz für den Mandarin und seine Besucher; an den Seitenwänden stehen abwechselnd kleine geschnitzte Tscha-ki (Theetischchen) und ebensolche Armstühle. Durch zwei Seitenthüren steht diese Empfangshalle mit den Privatgemächern des Mandarins in Verbindung, die sich in den um einen dritten Hof angeordneten Gebäuden befinden.
Die Yamenbeamten sind nur die Vertreter der kaiserlichen Regierung, von dieser bestellt, nicht etwa städtische Beamte. Die Stadtverwaltung wird ähnlich wie bei uns von der Bürgerschaft gewählt, und nur das Tatarenviertel der einzelnen Städte untersteht direkt den kaiserlichen Behörden. Je nach der Größe der einzelnen Städte sind diese in eine verschiedene Zahl von Stadtvierteln eingeteilt, deren jedes etwa sechzig bis hundert Familien umfaßt. Man darf sich aber diese Familien nicht etwa so vorstellen wie bei uns. Häufig gehören mehrere hundert Personen zu einer Familie und wohnen in eigenen ummauerten Häusergruppen beisammen: Großeltern, Eltern, Kinder und Kindeskinder, vielleicht zwanzig bis vierzig Familien derselben Abstammung. Die Aeltesten jeder dieser Familiengruppen, chinesisch Kia-tschang, bilden eine Art Stadtrat und wählen unter sich einen Aeltesten oder Pao-tsching. Dieser ernennt die verschiedenen Beamten seines Viertels und hat die Bestimmungen des Stadtrates bezüglich der Reinigung, Aufsicht und Sicherheit in[S. 185] seinem Gebiet auszuführen. Für die gemeinschaftlichen Interessen aller Stadtviertel wählen die Stadträte der letzteren eigene Vertreter, und über diesen steht endlich der Regierungsmandarin oder Taotai.
Man darf nicht etwa glauben, daß diese Mandarine überall mit ihren Erpressungen und Bedrückungen leichtes Spiel haben. Ganz wie ich es in den koreanischen Städten gefunden habe, so geht es auch in China zu, das ja doch nichts weiter als ein großes Korea ist. Treiben es die Mandarine zu arg, so werden sie von der Stadtbevölkerung einfach vor die Thüre gesetzt, ohne daß der Provinzgouverneur oder gar die Pekinger Regierung dagegen Einspruch erheben würde. Ist die Stadtbevölkerung dagegen mit der Verwaltung des Taotai zufrieden, so wird die Dankbarkeit ihm gegenüber auf recht eigentümliche Weise zum Ausdruck gebracht. Am Ende seiner Dienstzeit begeben sich die Mitglieder des Stadtrats nach dem Yamen und bitten den Mandarin in ihrer blumenreichen Sprache, der Stadt doch ein Paar seiner Stiefel zu schenken. Gewährt er diese ihn besonders ehrende Bitte, so werden die Stiefel in feierlicher Prozession mit Musik und Fahnen nach dem südlichen Stadtthor getragen und dort an der Decke aufgehängt, wo sie bleiben, bis sie in Stücke fallen.
Aber nicht nur der Stadtrat, auch das niedere Volk versammelt sich häufig, um über öffentliche Angelegenheiten zu beraten, und als Versammlungsort dienen in den Städten eigene Beratungshallen mit großen Höfen, wo auch die wandernden Theatertruppen ihre Buden aufzuschlagen pflegen, Hahnen- und Wachtelkämpfe stattfinden. Die unteren, ungemein abergläubischen Volksklassen sind von Agitatoren leicht aufzuwiegeln, besonders wenn irgendwo in einer Stadt das Feng-schui verletzt wurde. Feng-schui heißt wörtlich Wind-Wasser, bedeutet aber den Schutz gegen die bösen Geister, die in China überall in der Luft wie im Innern der Erde herumziehen und fortwährend bestrebt sind, den Chinesen Unheil anzuthun. Die glückliche Seite ist die südliche, und deshalb stehen auch alle offiziellen Gebäude in China mit den Hauptfronten nach Süden; vor den Thoren zu Privathäusern werden eigene freistehende Mauern errichtet, um die bösen Geister abzuhalten. Kein Gebäude darf höher sein als das andere, es sei denn eine Pagode oder ein Tempel, und[S. 186] die Fremden, besonders die Missionare, müssen bei dem Bau ihrer Häuser alle möglichen Finten anwenden, um die Chinesen zu beruhigen. Selbst Flaggenmaste und Telegraphenstangen zerstören das Feng-schui. Die Mehrzahl der Unruhen und Aufstände gegen die Missionare hat diesen einfältigen Aberglauben zur Ursache. In Ningpo bestand der amerikanische Konsul darauf, einen hohen Flaggenmast vor seiner Wohnung zu errichten, und da er seinen Willen, gestützt auf die Kriegsschiffe, durchsetzte, errichteten die Chinesen nahebei einen noch höheren Mast, auf den sie als Gegenwirkung eine kleine teuflische Fratze setzten. Lange, gerade Kanäle findet man in chinesischen Städten selten, denn in solch breiten Avenuen könnten die bösen Geister zu leicht verkehren; wo solche Kanäle sind, werden sie durch künstliche Inseln durchbrochen, oder durch zahlreiche, verschieden hohe Brücken überspannt. Die geraden Straßen der Stadt würden den bösen Geistern auch ungehinderten Durchzug gewähren, deshalb werden die Firmentafeln vor die Häuser in die Straße gehängt, wodurch die Teufelchen natürlich abgelenkt werden.
Ebensowenig wie Wasserleitung und Kanalisierung giebt es in den chinesischen Städten Straßenbeleuchtung. Bis neun oder zehn Uhr abends geht es in den Geschäftsstraßen recht lebhaft zu, und die kleinen Oellämpchen in den weit geöffneten Kaufbuden werfen auch auf die Straßen hinreichend Licht. Aber dann werden die Thore geschlossen, die hölzernen Läden der Kaufbuden geräuschvoll zugeschlagen, die Lampen ausgelöscht, und es herrscht überall Dunkelheit und Ruhe. Nur hier und dort an Straßenkreuzungen oder an Brückenaufgängen flackern armselige Lichter, die entweder durch gemeinschaftliche Beiträge der Straßenbewohner oder durch die Freigebigkeit einzelner unterhalten werden. Verspätete Passanten, die nach Hause eilen, tragen stets Handlaternen, um auf den elenden Wegen nicht zu stolpern oder in Löcher zu stürzen. Gegen Mitternacht hört alles Leben in den Straßen auf, man hört nur den Schritt der Wachen und das Aufstoßen ihres Bambus- oder Eisenstabes auf das Pflaster; alle zwei Minuten schlagen sie auch noch kräftig auf einen Gong, um zu zeigen, daß sie wachen. Nichts konnte mich zur Nachtzeit mehr ärgern als diese dumpfen, feierlichen Schläge, die mich jedesmal aus dem Schlafe weckten. Schreitet ein einsamer Wanderer durch die Straßen, erweckt er zufällig einen Hund, so bellen bald Hunderte oder gar Tausende dieser Bestien und machen während einer halben Stunde einen derartigen Heidenlärm, daß von Schlafen keine Rede sein kann.
Gegen Diebe und Einbrecher gewähren die Wachleute natürlich keinen Schutz, weil sie ja ihr Nahen selbst durch ihre lärmenden Schritte und Stockschläge verkünden. Häufig folgen ihnen aber ein paar hundert Schritte hinderdrein andere, ruhig einherschleichende Wachleute, und diesen gelingt es nicht selten, Einbrecher auf frischer That zu ertappen.
Zwei oder drei Stunden nach Mitternacht beginnen die zahlreichen Hähne zu krähen, endlich bricht die Dämmerung an, und bald erwacht die Stadt aus ihrem Schlafe; das Gepolter mit Thüren und Fensterläden ertönt von neuem; die niedrigen Schornsteine beginnen zu rauchen, die Einwohner kochen ihren Morgenreis und bereiten sich zu neuem Tagewerk vor. So viele Arme es in den chinesischen Städten auch geben mag, ihre Mahlzeiten, Reis, Gemüse, Fische haben auch die Bettler, ausgenommen zur Zeit von Hungersnot. Die Glücksgüter sind in China lange nicht so ungleich verteilt wie bei uns, und herrscht in dem Reiche der Mitte auch nicht so protziger Reichtum und Luxus, so giebt es dafür auch nicht so viel offenes und verstecktes Elend.
Schon in der im Jahre 1896 verfaßten ersten Auflage dieses Buches habe ich auf den Hafen von Kiautschou verwiesen und im Kapitel über die europäischen Handelshäfen in China bemerkt: „Die Zahl, das Ansehen und der Handel der Deutschen in Ostasien sind so groß, daß auch in anderen Häfen deutsche Landerwerbungen sehr wünschenswert wären, wenn man sich nicht entschließt, einen eigenen Hafen von der chinesischen Zentralregierung zu erwerben. Niemals war die Gelegenheit dazu günstiger als jetzt.” — Ich ahnte damals nicht, daß dieser gewiß allgemein geteilte Wunsch so bald in Erfüllung gehen sollte. Wenige Monate nach der Besitzergreifung Tsingtaus durch das Deutsche Reich traf ich dort ein, um den Hafen und das Hinterland, das bis dahin von keinem Europäer in allen seinen Teilen bereist worden war, kennen zu lernen.
Als wir zwischen den kleinen Felseninseln, die Kiautschou vorgelagert sind, gewissermaßen den Portierlogen des neuen Deutsch-China, hindurchfuhren, wies der Kapitän unseres Schiffes auf ein langes felsiges Vorgebirge, das von Süden her weit vorspringt und das er mit Kap Evelyne bezeichnete. Diesem gegenüber, aber weit landeinwärts, verläuft eine zweite langgestreckte Halbinsel im Meere, gegen Osten an eine Gruppe von mächtigen, schwarzen Bergen anschließend, von denen bis zur Besetzung des Gebietes durch die Deutschen nur der höchste, der bis auf elfhundert Meter in die Wolken ragende Lauschan, einen Namen besaß. Seither sind auch die anderen Berge mit Namen belegt worden. Dem Lauschan zunächst liegt der Prinz-Heinrichberg mit feinen an die Mythen bei Schwyz gemahnenden Spitzen; dann folgt der Kaiserstuhl, und noch näher an die Einfahrt zur Kiautschoubucht der Diederichsberg, dann als Wahrzeichen und Signalpunkt der Bucht der teilweise bewaldete Kegel des Truppelberges, genannt nach dem wackeren damaligen Kommandanten in Kiautschou, Kapitän Truppel.
Ich kann nicht sagen, daß mich der Anblick dieses Hafens besonders fesselte. Die Berge, und selbst die zwischen ihnen liegenden Thäler, zeigten nur wenige Spuren von Grün, auf dem zackigen Grat des schwarzen, düsteren Lauschangebirges lag Schnee, und von Besiedlung, von Dörfern, Städten und Gärten war nicht das geringste zu sehen. Und doch ist Schantung eine der reichsten, fruchtbarsten, am dichtesten besiedelten Provinzen Chinas.
Erst als wir der Küste der nördlichen Halbinsel ganz nahe waren und die Ankerkette rasselnd in dem hellgrünen Seewasser verschwand, lenkte der Kapitän unser Augenmerk auf eine Anzahl niedriger Lehmmauern, die sich von der graugelben Umgebung kaum abhoben und nur durch die schwarzen Dächer kenntlicher gemacht wurden. Das ist der Sitz der deutschen Regierung, das ist Tsingtau, der Hafen von Kiautschou. Ich richtete mein Fernglas auf diese öde Häuserguppe. Nahe dem sandigen Meeresstrande breitete sie sich aus, rings umgeben von Militärlagern, über denen schwarz-weiß-rote Flaggen wehten. Das nächste Lager oder Fort, wenn man will, liegt unmittelbar am Meere, und von dort streckt sich eine lange, eiserne Brücke in die See, der Landungsplatz von Tsingtau.
Bald war unser Dampfer umschwärmt von kleinen weißen Dampfpinassen, bemannt mit fröhlichen, frisch aussehenden deutschen Matrosen, welche die Post für die verschiedenen Schiffe abzuholen hatten. Die Frachten und Passagiere wurden in einer chinesischen Dschunke an die Landungsbrücke gebracht, die noch aus der Chinesenzeit stammt, gerade so wie alle Militärlager und die meisten von der deutschen Regierung besetzten Gebäude. In den wenigen Wintermonaten, die seit der ersten Landung der deutschen Truppen verstrichen waren, ist wohl sehr viel gearbeitet worden, aber ein chinesisches Küstendorf kann nicht so ohne weiteres in eine deutsche Hafenstadt verwandelt werden. In Deutschland war der Name Tsingtau bis zu meiner Abreise Anfang Februar 1898 ganz unbekannt, und Kiautschou war in aller Mund. Nach Kiautschou wurden die Postkarten aller Kolonialenthusiasten gerichtet, nach Kiautschou die Briefe von zahlreichen Briefmarkensammlern, die sich chinesische Briefmarken mit dem Poststempel Kiautschou erbaten. Kiautschou liegt aber etwa fünfzig Kilometer landeinwärts und ist von der See aus ganz unzugänglich, ja es ist überhaupt nur ganz vorübergehend von den deutschen Truppen besetzt worden. Tsingtau ist, wie gesagt, nur ein kleines Fischerdörfchen, aber es ist für die Schiffahrt und die künftigen Hafenanlagen so günstig gelegen, daß es von den Behörden auch zum Sitz der Regierung ausersehen worden ist. Kiautschou hat in Deutschland den Rahm abgeschöpft und ist ganz unverdienterweise zu einer Berühmtheit gelangt, die eigentlich Tsingtau zufallen sollte.
Von der Landungsbrücke führte ein Fußweg an dem von deutschen Soldaten besetzten Brückenfort vorüber, dem sandigen Meeresstrande entlang, nach dem Dörfchen, als dessen erstes Gebäude sich ein ganz ansprechender, hübsch gebauter Götzentempel präsentiert. Zwei hohe Flaggenstöcke ragen über die mit wunderlichen Steinfiguren geschmückten Dächer der verschiedenen Tempelbauten hinaus. Diese letzteren sind[S. 190] auch die größten des ganzen Ortes, denn zum Namen des Gouverneurs schreitend, sah ich zu beiden Zeiten der engen Hauptstraße nur kleine niedrige Chinesenhäuser mit winzigen, papierbekleideten Fensterchen. Glas war in dieses entlegene Nest von Schantung noch ebensowenig gedrungen wie Seife. Hunderte von den langbezopften Söhnen des Reiches der Mitte drängten sich in dieser Straße zwischen den ärmlichen Kaufläden, alle in der gleichen charakteristischen Kleidung: blaue Baumwolljacken, blaue Beinkleider. Im Sommer tragen sie nur diese, im Winter werden Jacken und Beinkleider mit Baumwolle gefüttert. Wird es kälter, so legen sie darüber noch eine zweite dick wattierte Jacke an und häufig noch eine dritte[S. 191] und vierte, so daß manche von ihnen aussehen wie wandelnde Baumwollballen zumal die Aermel wie bei Zwangsjacken um einen halben Fuß länger sind, als die Arme. Daß von einem Wechsel der Kleider während des Winters keine Rede sein kann, sah ich auf den ersten Blick, und auch meine Nase konnte diese Wahrnehmung machen. Zwischen den Kaufläden kauerten ambulante Händler mit ihren nichtigen Waren, Nägeln, Streichhölzern, Tabak in Papierbeutelchen, Pfeifen, Erdnüssen, Kuchen. Hier und da war an der Häuserfront auch ein Kochherd gebaut, mit einem kleinen Schutzdach darüber, und darauf wurde in riesigen Töpfen der Tschau-Tschau, das Mittagmahl, zubereitet.
Von der Marktstraße zweigt sich zur Rechten eine zweite, breitere ab, und diese war augenscheinlich das vorläufige Europäerviertel des Ortes. Freilich zeigte auch diese Straße nur langgestreckte, ebenerdige Chinesenhäuser mit Steinmauern, Papier[S. 192]fenstern und Strohdächern, aber der frische Anstrich, die neu eingesetzten Hausthüren und vor allem die große Reinlichkeit, die überall herrschte, bewiesen, daß hier unmöglich Chinesen wohnen könnten. In der That trugen zwei der Häuser die Namen der zwei einzigen deutschen Handelsherren, welche sich bisher hier angesiedelt hatten: Schwarzkopf & Co. aus Hongkong und Sietas & Co. aus Tschifu. Ihnen gegenüber trägt ein Haus die Bezeichnung „Kaiserlich Deutsche Post”. Ein paar Schritte weiter öffnet sich ein großer Platz, auf welchem sich der Yamen des Gouverneurs von Tsingtau erhebt, ganz so eingerichtet, wie alle Yamen der chinesischen Mandarine. Dem von einem Militärposten besetzten Haupteingang gegenüber erhebt sich eine hohe Schutzwand gegen die bösen Geister, sowie der große Flaggenstock, auf dem heute die weiße Kriegsflagge mit dem schwarzen Kreuz weht. Ins Innere des Yamens tretend, gelangte ich zunächst in einen geräumigen Hof, von ansprechenden chinesischen Häusern umschlossen, in welchem sich die Bureaus und Wohnungen der Offiziere des Stabes befanden. Hier sollte auch ich Unterkunft finden, denn von Hotels oder Logierhäusern war zur Zeit meines Eintreffens, Mitte März, noch keine Spur vorhanden, und erst später ging man daran, das frühere chinesische Zollhaus zu einem Absteigequartier für Fremde einzurichten. Ein breiter Durchgang in dem Mittelhause führt in einen zweiten Hof, ebenfalls von chinesischen Gebäuden mit schön geschwungenen Dächern und Veranden aus geschnitztem Holz eingefaßt. Das mittlere und größte Haus enthält die nur aus zwei Räumen bestehende Wohnung des Gouverneurs, und die beiden Zimmer, die für den bevorstehenden Besuch des Prinzen Heinrich eingerichtet wurden. Bureaus nehmen die anderen Gebäude vollständig ein, ja es mußten noch die dahinter befindlichen Kasernen der längst verschwundenen chinesischen Soldaten dafür eingerichtet werden.
Dieses Einrichten der Kasernen und Wohnhäuser, das Reinigen der Straßen und Plätze des Dorfes, die Verbesserung der Wege, Brücken, Flußläufe, Dämme und dergleichen war die größte Aufgabe, welche die wackeren deutschen Truppen während der bisher verflossenen kalten Wintermonate auszuführen hatten. Der chinesische Bauer und der chinesische Soldat sind keineswegs für ihre Reinlichkeit berühmt, und andere Bewohner besaß Tsingtau überhaupt nicht. Polnische Dörfer hätten in Tsingtau vor der deutschen Besetzung als Muster von Reinlichkeit angesehen werden können, und daß auch die chinesische Regierung für ihre Unterthanen nur sehr wenig thut, ist sattsam bekannt. Um diese Mistgrube von Deutsch-China zu reinigen, wurden allerdings die bezopften Kulis, deren man habhaft werden konnte,[S. 193] in den Dienst gepreßt, allein die Matrosen von den Kriegsschiffen und die Soldaten des Marine-Infanteriebataillons mußten fleißig mithelfen. Ihr Fleiß, ihre Ausdauer, und die Freudigkeit, mit der Offiziere sowohl wie Mannschaften sich an das ungewohnte, und man kann wohl sagen, unwürdige Werk machten, verdienen alle Bewunderung. Wohl gab es in Tsingtau das Gouverneursyamen und die fünf großen mit Lehmmauern umgebenen Militärlager, in deren ebenerdigen Gebäuden das chinesische Militär bis zur Besetzung wohnte, ja dieselben waren sogar in einem besseren Zustande, als ich sie sonst bei früheren Reisen im chinesischen Reiche angetroffen hatte. General Tschang, der arme Befehlshaber von Tsingtau, war für chinesische Verhältnisse ein ganz ausgezeichneter Offizier. Zur Zeit des chinesisch-japanischen Krieges sollte Tsingtau in einen festen chinesischen Kriegshafen umgewandelt werden, und Tschang hatte rings um den Ort der ganzen Seeküste entlang Mauern aufführen, die festen Militärlager anlegen und alles in, allerdings chinesischen, Verteidigungszustand setzen lassen, so daß die Deutschen bei ihrer Besetzung des Ortes viel vorgearbeitet fanden. Wollten aber deutsche Soldaten die chinesischen Kasernen beziehen, so mußten diese doch von Grund aus neu gereinigt, verbessert, neu eingerichtet werden. Wo die Maurer, Schlosser, Zimmerleute und dergleichen finden? Da wurde denn der Offizier zum Maurerpolier, der Soldat zum Handwerker, und statt mit Gewehr und Säbel, mußten sie mit Kelle und Hobel arbeiten, aber das Gewehr doch stets zur Seite. Nur der umsichtigen Leitung, der Ordnung, Disciplin, Anspruchslosigkeit und dem guten Mute, der alle beseelte, gelang das anscheinend Unmögliche. Nach der harten Tagesarbeit kamen die Entbehrungen der Nacht. Betten gab es natürlicherweise nicht, desgleichen waren keine Oefen zum Wärmen der eisig kalten, dunklen Räume, keine Glasscheiben für die papierüberklebten Fenster, keine Küchen vorhanden; die armen Leute mußten in Hängematten schlafen, Offiziere wohnten zu zweien und dreien in engen, dunklen, feuchten Räumen, speisten wie im Felde vor dem Feinde, entbehrten der notwendigsten Bequemlichkeiten und mußten dabei auch noch den anstrengenden Garnisonsdienst versehen.
Das Ergebnis dieser harten Arbeit zeigte sich schon nach wenigen Monaten. Die Kasernen, die ganzen Militärlager wurden zu Mustern von Sauberkeit; ganz Tsingtau wurde gesäubert, die Straßen wurden beleuchtet, ein in einem chinesischen Dorfe unerhörtes Ereignis; die Häuser wurden mit Nummern versehen, an den Straßen[S. 194]ecken sah man Tafeln mit Benennungen wie Marktstraße, Bankgasse, Yamenplatz, Paroleplatz und andere. Die Wege waren ausgebessert, zwischen dem Yamen und den verschiedenen, Tsingtau umgebenden Militärlagern herrschte Telephonverbindung, auf dem hohen Truppelberg, der sich über Tsingtau erhebt, befand sich bereits eine Signalstation, in den Straßen sah man zwischen dem lebhaften Chinesengedränge schon Polizisten, überall herrschte Ordnung, und die Grundlage für eine gesicherte Weiterentwickelung der jungen Hauptstadt von Deutsch-China war gelegt. Auch die vorläufigen Untersuchungen über den neuen deutschen Kriegshafen und über das zukünftige Handelsemporium wurden beendet. Die Offiziere der Kriegsschiffe, welche jenseits der Halbinsel Tsingtau in der Bucht von Kiautschou ankern, haben die Untersuchungen durchgeführt und gefunden, daß dieser Hafen längs der Nordküste der Halbinsel von Tsingtau, an der Bucht von Kiautschou angelegt werden müsse, denn dort befindet sich ein etwa zehn Kilometer langer, einen Kilometer breiter Streifen tiefen, sicheren Fahrwassers, der durch die fortschreitende Anfüllung und Verseichtung der Bucht erst nach Jahrhunderten gefährdet werden dürfte.
Von dem hohen Erdwalle des Höhenlagers, das nahe der Spitze der Halbinsel Tsingtau liegt, gewann ich den ersten Ueberblick über die ganze zukünftige Anlage[S. 195] und kam zu der Ueberzeugung, daß die Zeiten gewiß nicht fern sind, wo an Stelle der sandigen Gerstenfelder, die sich zwischen dem heutigen Tsingtau und dem Hafen in der Bucht ausdehnten, eine blühende deutsche Handelsstadt sich erheben wird, mit allen modernen Einrichtungen, wo elektrische Bahnen zwischen beiden Küsten verkehren und der Hafen mit Schiffen aller Flaggen gefüllt sein wird. Vor meinem geistigen Auge sah ich an Stelle der Götzentempel christliche Kirchen stehen und längs des sandigen Meeresstrandes, der die Bucht von Kiautschou umfaßt, Eisenbahnzüge laufen, welche die Schätze der Provinz zum Hafen, die deutschen Industrieprodukte aber nach der Provinz bringen sollten. Seit Jahren war ich in den Zeitungen und durch zahlreiche öffentliche Vorträge für diese Erwerbung eingetreten, und jetzt, da ich sie gesehen, war ich mehr als jemals überzeugt, daß sie dem deutschen Handel zum Segen gereichen würde. In Hongkong und Shanghai lagen die Verhältnisse in den Anfangszeiten viel ungünstiger als in Tsingtau, und es hat Jahre gebraucht, bis auch nur der Keim zu den Weltstädten von heute gelegt war. Hongkong wurde im Jahre 1841 als offener Hafen erklärt, aber erst fünf Jahre später, 1846, war der Grund für die neu zu bauende Stadt trockengelegt und überhaupt bewohnbar. Die Verhältnisse waren dort überaus ungünstig, Malaria und Fieber wüteten so fürchterlich, daß ein Regiment Soldaten binnen einem Jahre über zweihundert Mann verlor. Ja der erste Gouverneur, Sir John Davis, empfahl der englischen Regierung auf Grundlage mehrjähriger Erfahrungen sogar, die Kolonie ganz aufzugeben. Und trotz dieser scheinbar kaum zu überwindenden ungünstigen Verhältnisse ist Hongkong heute ein Welthafen von der größten Bedeutung.
Mit Shanghai erging es bei seiner Gründung nicht viel besser wie mit dem letztern. Am 17. November 1843 als offener Hafen erklärt, bedurfte es mehrerer Jahre, um die Sümpfe trocken zu legen und die Flußläufe zu regulieren. Während der ersten zwei Jahre wurden nur fünf Häuser gebaut, und 1849, sechs Jahre nach der Eröffnung, hatten sich in Shanghai erst 25 Firmen niedergelassen mit 100 Europäern, darunter sieben Frauen; Futschou, 1842 eröffnet, brauchte sogar zehn Jahre, bis es einigen Handel bekam. Zur Zeit meines ersten Besuches war Tsingtau freilich noch ein ganz merkwürdiger Ort. An fünftausend deutsche Männer wohnten hier, aber keine einzige deutsche Frau, und seit Monaten hatten diese fünftausend ein weibliches Wesen ihrer Rasse überhaupt gar nicht gesehen. Keiner der fünftausend war über fünfzig, keiner unter zwanzig Jahre alt, es gab keine Greise, keine Kinder. In den Straßen war niemals ein Wagen gefahren, in den Ansiedelungen hat niemals ein Hotel oder eine Wirtschaft unserer Art bestanden. Bürgermeister, Richter, Militärkommandant, Landrat, alles war der Gouverneur in eigner Person, und Zivilbeamte gab es noch keinen einzigen. Niemals hat es unter so viel Männern so viel Ordnung, Gemeinsinn, Arbeitseifer und dabei so wenig Erwerbssinn und Eigennutz gegeben. Ich habe auf meinen Reisen, hauptsächlich in den jungen Minenstädten der Felsengebirge, Ansiedelungen gesehen mit einer Bevölkerung, die auch nur aus Männern bestand. Aber wie anders waren die Verhältnisse hier und dort!
Das regierte Element bilden hier die Chinesen. Als die rotbärtigen Teufel mit ihren blinkenden Waffen landeten, gab es in Tsingtau nur einige hundert Einwohner, vier Monate später waren ihrer ebensoviele tausend, und die Einwohnerschaft hat sich seither wohl verzehnfacht. Ein Winter hatte schon genügt, um dieser armen elenden Bevölkerung verhältnismäßigen Wohlstand zu geben, und so viel Geld wie jetzt haben sie in ihrem Leben gar nicht gesehen. Früher erhielten sie dreißig bis vierzig Cash, das heißt sechs bis acht Pfennige am Tage, heute wohl das sechsfache. Es hat sich in der ganzen Gegend herumgesprochen, daß die Deutschen nicht stehlen und bedrücken, wie es die chinesischen Soldaten gethan haben, sondern daß sie alles bar bezahlen. Arbeit gab es sofort in Hülle und Fülle, und täglich kamen Dschunken mit Waren, täglich lange Züge von Schubkarren. Diese letzteren sind die Equipagen, Lastwagen, Karren, das wichtigste Beförderungsmittel der ganzen Provinz. Für diesen Zuzug mußten Quartiere gebaut werden, überall entstanden neue Häuser, überall wurde gemauert, gezimmert, gehämmert. Und diese Thätigkeit wurde seit meinem Besuche, man könnte sagen, von Tag zu Tag immer lebhafter. Jedes Schiff brachte neue Ansiedler, Kaufleute, Unternehmer, Beamte, Missionare; dazu massenhaft Waren, Baumaterial, Maschinen, Bestandteile für industrielle Unternehmungen aller Art. Unter vorzüglicher Leitung wurde in kürzester Zeit ein praktischer Stadtplan entworfen und seine Ausführung[S. 197] sofort in Angriff genommen. Hunderte von Chinesen arbeiteten an dem Unterbau der breiten Prinz-Heinrichstraße, welche von dem Haupttempel parallel mit der Meeresküste nach dem Brückenlager führt, und an der dieser entlang laufenden Kaiser-Wilhelmstraße; zusehends entstanden die Bismarck-, Tirpitzstraße mit zweckmäßigen Kanalanlagen; es wurde eine Wasserleitung angelegt, der Bau eines Wellenbrechers im Hafen, von Regierungsgebäuden und Beamtenwohnungen begonnen; das Material dazu gewann man aus Steinbrüchen, nach welchen Eisenbahngeleise gelegt wurden. Neben der Bauthätigkeit der Regierung entwickelte sich auch jene von Privatunternehmern mit gleicher Lebhaftigkeit, und heute, drei Jahre nach der Besitzergreifung Tsingtaus, steht an Stelle des elenden Chinesendorfes eine freundliche, anspruchsvolle geschäftige deutsche Stadt mit Hotels, Banken, großen Warenhäusern, Fabriken und industriellen Anlagen der verschiedensten Art; dazu junge Gartenanlagen, Privathäuser, Villen, im ganzen ein Gemeinwesen, wie es in solcher Raschheit und verhältnismäßiger Vollkommenheit in China noch niemals geschaffen worden ist. Das geht auch aus dem Jahresberichte der kaiserlich-chinesischen Zollbehörde vom Jahre 1899 hervor, in welchem gesagt wird: „Die neue Hafenstadt Tsingtau, früher ein ärmliches Fischerdorf, welches auf dem Wasser- wie Landwege sehr viel weiter als die andern Dschunkenhäfen der Bucht von den Hauptmärkten des Inlandes entfernt, keinerlei kommerzielle Bedeutung besaß, ist auf dem besten Wege, in baldigster Zeit eine in vielen Beziehungen mit den schönsten Städten des Ostens rivalisierende moderne Stadt zu werden. Ausgedehnte Kanalisations- und breite Straßenanlagen werden aus dem Felsen gesprengt; elektrisches Licht und Telephonanlagen, Wasserwerke und[S. 198] Anforstungen werden schnell gefördert, bequeme Wohnungen, komfortable Hotels, Bureaus und Werkstätten sind überall im Entstehen. Die früheren chinesischen Häuser sind aufgekauft und die Bewohner in eine gefällig angelegte Musterstadt verpflanzt worden in der Nähe des nördlichen Innenhafens. Auf diese Weise, getrennt von einer unter gesunden Bedingungen untergebrachten chinesischen Bevölkerung, mit vorzüglichen sanitären Anlagen, dazu beglückt mit einem herrlichen Klima, milder als Tschifu im Winter und ebenso kühl im Sommer, mit vortrefflichen Seebädern und luftigen Bergzügen, wie geschaffen für Sommerfrischen, in unmittelbarer Nähe, bietet Tsingtau die beste Gewähr, sich zu einem der ersten klimatischen Erholungsorte des Ostens zu entwickeln.
Als Handelshafen erscheint die Zukunft des Hafens von Tsingtau in gleicher Weise vielversprechend. Seine augenblicklichen Nachteile, ungeschützte Ankerplätze und das Fehlen von Quais, ein Umstand, der Umladen in Leichter, Zeitverlust und Unkosten für Schiffe wie Ladung verursacht, sowie das Fehlen guter ins Hinterland führender Straßen, werden bald der Vergangenheit angehören. Die neuen Häfen mit Anlegestellen für die Schiffe, Geleisen, Güterspeichern und allen modernen Einrichtungen sind schon im Bau begriffen; der kleinere, für Küstenfahrer geeignet, wird voraussichtlich Ende 1900 fertiggestellt sein, während der andere, für die größten Schiffe zugänglich, noch mehrere Jahre bis zu seiner Vollendung bedarf. Die gleichfalls in der Ausführung stehende Eisenbahn wird Tsingtau zum Ausgangspunkte nehmen und den Hafen mit Kiautschou und den andern bedeutenden Städten der reichen und nordwestlichen Distrikte der Provinz in Verbindung bringen und die Haupt-Kohlen-, Seiden- und Strohgeflecht-Distrikte durchschneiden.”
Die Umgegend von Tsingtau ist weitaus nicht so reizlos, wie sie sich vom Schiffe aus zeigt und wie sie vielfach geschildert wird. Zwischen den einzelnen Küstendörfern ist jedes irgendwie verwendbare Stückchen Land sorgfältig von den fleißigen Chinesen geackert und bebaut, rings um die Dörfer und in diesen selbst erheben sich zahlreiche Obstbäume; über den kegelartigen Erdhügeln der Toten stehen Föhren und Pinien, und der Baumwuchs würde noch stattlicher sein, wenn es den Bewohnern nicht vollständig an Brennmaterial fehlen würde. Die Chinesen lieben die Natur, sie umgeben ihre Heimstätten und die Heimstätten ihrer Toten mit Baum- und Blütenschmuck, aber der Selbsterhaltungstrieb ist stärker. Um die Bäume zu schützen, brennen sie trockene Gräser, die sie mit den Wurzeln ausreißen, sie fällen nicht die Föhren, sondern schneiden die grünen Nadeläste ab, und jeder abgestorbene Baum wird durch die Pflanzung eines neuen ersetzt. Dabei liegen reiche Kohlenschätze nur hundertfünfzig Kilometer nördlich von ihnen. Die Eisenbahn, welche jetzt schon von deutschen Ingenieuren gebaut wird, wird auch in dieser Hinsicht segenbringend sein.

Gesamtansicht von Tsingtau.
Gesamtansicht von Tsingtau.
1. Tsingtau mit dem Yamen des Gouverneurs im Vordergrunde.
2. Gegenwärtiger Handelshafen.
3. Gegenwärtige Landungsbrücke.
4. Stellung der Kriegsschiffe (hinter der Landzunge).
5. Der Truppelberg.
6. Das obere Dorf.

Gesamtansicht von Tsingtau
(linker Teil)
1. Tsingtau mit dem Yamen des Gouverneurs im Vordergrunde.
2. Gegenwärtiger Handelshafen.
3. Gegenwärtige Landungsbrücke.
4. Stellung der Kriegsschiffe (hinter der Landzunge).
Draußen im deutschen Gebiete und auf den entlegenen Außenposten an den Grenzen von Deutsch-China halten junge Offiziere mit kleinen Abteilungen Ruhe und Ordnung aufrecht. Sie wohnen in den mehr als bescheidenen Bauernhäusern der Chinesen, kaum viel besser als die Chinesen selbst, auf Stunden in der Runde[S. 200] nur von solchen umgeben. Aber der Aufenthalt auf dem Lande entbehrt nicht eines gewissen Reizes, besonders wenn der nahende Frühling alles verklärt, wo die Sonne wärmer scheint und wo auch schon wie traute Grüße aus der fernen Heimat die lieblichen Veilchen zu blühen beginnen. Ich habe das ganze große Gebiet kreuz und quer durchzogen und war dabei nicht so sehr überrascht von der Sorgfalt, mit welcher Obstgärten und Felder gepflegt und gehütet werden, denn ich kannte den Fleiß des chinesischen Landmannes von früheren Reisen. Was meine Verwunderung in viel höherem Grade erregte, war die Dichtigkeit der Bevölkerung, die große Zahl von Dörfern, die innerhalb Deutsch-Chinas liegen und die zusammen wohl an siebzigtausend Einwohner zählen mögen. Es ist keineswegs ein wertloses Stück Land, das deutsche Missionare ihrem Vaterlande mit ihrem Blute erkauft haben, denn es kann diese ganze Bevölkerung nähren. Auf den elenden Fußwegen zwischen den Feldern, an ausgewaschenen Flußläufen und gefahrvollen Schluchten entlang reitend, gewahrte ich überall junge Gerste, Bohnen, Erdnüsse, süße Kartoffeln; in den Obstgärten stehen in langen Reihen Birnbäume, sorgfältig beschnitten und mit abgeschälter Rinde, um die Bäume gegen Insekten zu schützen; in den Dörfern sah ich über die steinernen Umfassungsmauern der Häuser mitunter Bambusstauden, Myrten und Lorberbäume, Pinien, ja sogar große blühende Kamelienbäume. Am Eingang jedes Dorfes erhebt sich ein Götzentempel, gewöhnlich von alten, hohen Bäumen überschattet; in den Straßen wurde überall fleißig gearbeitet, an Stelle der Mistjauchen unserer Dörfer liegt der Dünger, mit zerkleinerten Bauziegeln vermischt, im Hinterhause und wird mit rührender Sorgfalt und Sparsamkeit auf die Felder verteilt. An freien Stellen befinden sich in jedem Dorfe Mahlmühlen, aus großen flachen Steinen bestehend, auf denen sich eine schwere Steinwalze, gewöhnlich durch Eselchen gezogen, im Kreise wälzt. Frauen bringen die schweren Säcke herbei,[S. 201] verteilen die Körner auf der Mühle, treiben das Eselchen an und verbringen die Zwischenzeit noch mit Nähen und Flicken. Bei der Annäherung eines Europäers wenden sie ihr Gesicht ab oder laufen davon, so schnell ihre winzigen Füßchen sie nur tragen können. Ich war überrascht, wie sehr die Qual der Fußverkrüppelung in diesem Gebiete verbreitet ist. Unter den Tausenden von Frauen, die ich zu Gesicht bekam, besaß keine einzige ihre natürlichen Füße. Selbst wenn sie auf den Feldern arbeiteten, oder Lasten trugen, steckten ihre Füßchen in den kaum spannenlangen gestickten Seidenschuhchen. Sonst ist ihre Kleidung jener der Männer ähnlich, nur daß sie an Stelle der blauen oder weißen Beinkleider solche von knallroter Farbe tragen. Die Knaben tragen schon von etwa zehn Jahren an den langen Zopf, der mit Hilfe von eingeflochtenen Schnüren bis nahe an den Boden herabbaumelt; die Frauen stecken ihre prächtigen, rabenschwarzen Haare mit Silbernadeln auf dem Kopfe fest.
Auch an landschaftlichen Schönheiten ist das deutsche Gebiet reich; auf der tiefblauen, weiten Fläche der Kiautschoubucht liegen kleine und große Inseln; die letzteren, mit Dörfern und Tempeln bedeckt, sind gut bebaut, vor allem Potato-Island und die Tschiposaninsel. Etwa in der Mitte des Gebietes erhebt sich der mächtige schwarze Woschan, mit seinem östlichen malerischen Ausläufer, dem bewaldeten Prinz-Heinrichberg. Die Grenze gegen das chinesische Gebiet aber bildet der lange scharfgezackte Gebirgszug des Lauschan, dem einer meiner letzten Ausflüge galt. Aus dem ungemein lieblichen, wohlbebauten Connythale mit seinen Dörfern, Tempeln und Friedhöfen erhebt sich seine gewaltige Masse, überragt von himmelanstrebenden Felsnadeln und Spitzen. Die Besteigung dieses mit ungeheuren Trümmern besäten, vollständig vegetationslosen Gebirgszuges war nicht gerade ein Genuß, aber wir wurden doch belohnt durch den Anblick des reizenden Thales von Jia-kung-tiën,[S. 202] mit dem gleichnamigen Kloster, das zwischen Bambusstauden, Myrten- und Lorberbäumen halb verborgen daliegt. Die freundlichen Taoistenmönche zeigen als ihren größten Stolz einen wunderbaren Kamelienbaum von etwa sechs Metern Höhe und anderthalb Metern Stammesumfang.
Je mehr ich von dem neuesten und gleichzeitig entferntesten Besitz des Deutschen Reiches zu sehen bekam, desto mehr stieg meine Dankbarkeit für diejenigen, die ihn dem deutschen Volke gegeben haben, denn ich bin überzeugt, daß er mit jedem Jahre an Wert gewinnen und dem deutschen Handel, wie der deutschen Industrie Segen bringen wird.
Mit Tsingtau hat das Deutsche Reich nur eine Pforte zu dem großen unbekannten Hinterlande erreicht, und dieses, nicht Tsingtau, ist für den deutschen Handel in China von der größten Wichtigkeit. Von diesem Hinterlande und seiner Eröffnung wird es abhängen, ob der neue Hafen an der chinesischen Küste eine Bedeutung erlangen wird, die über jene einer Kohlenstation und eines Stützpunktes für die deutsche Flotte hinausgeht, und die Errichtung von Faktoreien, größeren Hafenanlagen, Leuchttürmen, Befestigungen rechtfertigt.
Wo immer man auf dem Erdball Umschau halten mag, wird man große blühende Handelshäfen ausschließlich nur dort finden, wo schiffbare Wasserstraßen nach einem[S. 204] fruchtbaren, dicht bewohnten Hinterlande führen, oder wo die Bodenverhältnisse die Anlage von Eisenbahnen, dieses wichtigsten Ersatzes für Wasserstraßen, möglich machen.
Wie sind nun diese Verhältnisse im Hinterlande von Deutsch-China bestellt? Was liegt dahinter? Worauf stützt man die Hoffnungen auf eine gedeihliche Entwickelung des Keimes, den die deutschen Blaujacken an der fernen Küste von Schantung gepflanzt haben? Wer kennt dieses Schantung aus eigner Anschauung? Was bisher davon ins Abendland gedrungen ist, beruht großenteils auf Hörensagen. Seitdem der große Venetianer Marco Polo im dreizehnten Jahrhundert das ferne Cathai bereist und mit seiner wundersamen Mär von dem chinesischen Riesenreiche die Alte Welt in Erstaunen gesetzt hat, haben nur ein paar englische Reisende, hauptsächlich Missionare, verschiedene Teile von Schantung besucht; ein Deutscher ist vor dreißig Jahren ihren Pfaden gefolgt, allein hauptsächlich mit wissenschaftlichen Zielen vor Augen. Was sie berichtet haben, und was die in dieser Hinsicht unzuverlässigen Chinesen über Schantung erzählen, bildete bis zu diesem Jahre die Grundlage unseres Wissens. Was dort für den Handel zu holen ist, welche Aussichten sich für einen Hafen an der Küste darbieten, hat uns noch niemand, gestützt auf eigne Anschauung, erzählt. In dieser Hinsicht, wie auch in Bezug auf die Geographie und Ethnographie des Landes, ist Schantung großenteils noch eine terra incognita.
Und doch sind die wenigsten Gebiete des großen asiatischen Kontinents interessanter und würden eine so ergiebige Ausbeute für den Reisenden darbieten, als gerade Schantung; denn abgesehen von den mineralischen Schätzen, die dort unter der Erde schlummern, abgesehen von dem eigenartigen Thun und Lassen der Bewohner dieses Landes zwischen dem mächtigen Gelben Strom und dem großen Kaiserkanal, liegt ja dort, am Südfuße der malerischen Berge des mittleren Schantung, das heilige Land von China. Dort liegt die Geburtsstätte des großen Religionsstifters der Chinesen, Confucius, sowie die seiner Apostel Mencius, Tse-Tse und anderer. Dort liegen heute noch, wohlbehütet von ihren Nachkommen, die Gräber dieser Weisen; und in einer Großstadt, Yentschou-fu, werden ihre Lehren studiert, erklärt und über das ganze Land verbreitet; unweit davon erhebt sich der sagenhafte heilige Berg von China, der Taishan, mit seinen zahllosen Tempeln, Opferaltären und kaiserlichen Denkmälern, zu Füßen des Taishan aber liegt das Mekka von China, die große Pilgerstadt Taingan.
All das bot mir mehr als hinreichende Veranlassung, von dem deutschen Hafen Tsingtau aus die Reise kreuz und quer durch die Provinz Schantung, ein Gebiet so groß wie Süddeutschland, einschließlich der Reichslande, zu unternehmen. Von meinen früheren Reisen in dem großen Reiche der Mitte wußte ich, daß es galt Abschied zu nehmen von all den Bequemlichkeiten des modernen Reiselebens und[S. 205] von allem Verkehr mit der Außenwelt. In China ist der Reisende auf sich selbst und seine eignen Hilfsmittel angewiesen, und da in Tsingtau der Handelsverkehr noch ein Ding der Zukunft ist, hatte ich mir den erforderlichen Reisebedarf, bis herab zu Kochgeschirren und Bettzeug, von Shanghai aus besorgt.
An einem kalten, stürmischen, regnerischen Märztage verließ ich, begleitet von meinen chinesischen Dienern und Photographen, Tsingtau in einer elenden Dschunke, um über die weite Bucht von Kiautschou nach der Stadt dieses Namens zu segeln. Eine andere Verbindung besteht heute mit Kiautschou nicht, wollte ich nicht zu Pferd über Land um die große Meeresbucht herum nach meinem in wenigen Monaten so berühmt gewordenen Ziele reiten. Die Stadt war auch schon früher einmal, vor Jahrhunderten, berühmt, als die Meeresbucht in ihrer nördlichen Hälfte noch nicht so verschlammt war wie jetzt. Dutzendemale fuhr die kleine, von fünf blöden Zopfträgern bemannte Dschunke auf den Schlammboden auf; die einströmende Flut erst führte sie weiter in einen kaum vier Schritte weiten Kanal, um in der Nähe eines elenden Chinesendorfes, Tapautau, ganz stecken zu bleiben. Auf meine tags zuvor an den Mandarin von Kiautschou gerichtete Bitte standen dort drei, mit mageren Gäulen bespannte zweirädrige Karren bereit, und derartige Karren, mit einem Reitpferd für mich, bildeten die Transportmittel meiner Karawane während der ganzen, zwei Monate langen Reise.
Die einst so blühende Hafenstadt Kiautschou liegt heute mehrere Wegstunden von der Meeresbucht entfernt, auf trockenem Lande, und nichts ist unrichtiger, als in Bezug auf Kiautschou von einer Hafenstadt zu sprechen. Der Name Kiautschou als Bezeichnung für den deutschen Besitz in China sollte überhaupt aus allen Zeitungen wie aus der Leute Mund verbannt und dafür Tsingtau gesetzt werden. Tsingtau ist ja der deutsche Hafen, von Kiautschou zulande anderthalb Tagereisen entfernt. Statt Tsingtau Kiautschou zu nennen, ist gerade so, als würde man in Deutschland statt der deutschen Stadt Emden das holländische Groningen nennen. Kiautschou steht ja trotz seiner kurzen Besetzung durch die deutschen Marinesoldaten im Jahre 1897 vollständig unter dem steinernen Scepter des „Sohnes des Himmels”, und ein bezopfter alter Mandarin, namens Lo, führt dort in seinem Namen die Regierung. Wohl liegt Kiautschou in der Zone des sogenannten „deutschen Einflusses”, und keine wichtigere Regierungsmaßnahme kann dort ohne Einwilligung der Deutschen getroffen werden, allein Stadt und Gebiet sind unanfechtbar chinesisch.
Obschon Kiautschou nach europäischen Begriffen kaum mehr als ein stattlicher, mit hohen Ringmauern umgebener Marktflecken ist, wird es von den Chinesen doch noch immer als eine bedeutende Stadt betrachtet, was schon ihr Name „tschou[S. 206]” besagt. Die Städte erster Größe heißen in China „fu”, wie z. B. die Hauptstadt von Schantung Tsinanfu heißt, Städte zweiter Größe heißen „tschou”, wie Kiautschou, Tsinningtschou, jene dritter Größe, oder Kreisstädte, heißen „hsien”, wie Weihsien, Poschanhsien. Nicht ohne eine gewisse Erregung ritt ich durch das Stadtthor ein, auf welchem eine Zeitlang die deutsche Flagge geweht hat; Abgesandte des Mandarins erwarteten mich hier, um mich durch die von weiten grünen Feldern und schattigen Friedhöfen unterbrochenen elenden Vorstädte nach der inneren Stadt zu führen. Bald hatten wir die mächtige innere Ringmauer erreicht. Jenseits des vollständig unbewachten Thores gelangten wir in ein Gewirr von engen Gassen, eingefaßt von ebenerdigen Häuschen. Vor einem derselben wurde Halt gemacht. Durch die weitgeöffneten Flügelthüren erblickte ich einen Hof, in dessen Hintergrund sich eine Lehmhütte mit Strohdach erhob. Das war mein „Hotel”, das zur Zeit der deutschen Besatzung auch als Hauptquartier der Marinetruppen gedient hat. Eine wackelige Thür, von innen durch hölzerne Querriegel notdürftig verschließbar, führte in einen dunklen Raum, der als einzige Möbel einen Tisch und zwei Stühle besaß. Zu beiden Seiten befanden sich kleine Kabinette mit Holzpritschen; der Fußboden bestand aus festgestampftem feuchten Lehm, die kleinen Fensterchen waren mit dünnem zerrissenen Papier überzogen, von Heizeinrichtungen, Betten, Waschgefäßen und dergleichen keine Spur. All das muß der Reisende in China, wenn er auf etwas Bequemlichkeit Anspruch macht, mit sich führen, und meine Diener hatten während meiner Irrfahrten durch die Provinz mit dem Ein- und Auspacken all der Gerätschaften täglich vollauf zu thun; denn ebenso wie dieses „Hotel”, so sind auch alle anderen in Schantung, nur daß die Mehrzahl bei weitem nicht so reinlich und verhältnismäßig so frei von Ungeziefer waren, wie dieses historische deutsche Hauptquartier in Kiautschou.
Da ich mit offiziellen Empfehlungsschreiben seitens der chinesischen Regierung reiste, so meldete sich bald nach meinem Eintreffen ein Yamenbeamter, der mir die große rote Visitenkarte des Präfekten überbrachte. Chinesische Etikette erfordert es, daß man die eigne Visitenkarte, mit Namen und Titeln in chinesischen Schriftzeichen, durch den Beamten zurücksendet und sich bei dem Stadtmandarin zum Besuch anmeldet. Der erste Besuch, den ich Seiner Ehren, dem Präfekten Lo machte, war nicht ohne Interesse. Allein mit Bedauern denke ich heute an die kostbare Zeit zurück, die in jeder einzelnen der vielen Städte und Marktflecken in Schantung mit den Besuchen und dem Empfang der Gegenbesuche seitens der Mandarine verloren ging. Jeden zweiten oder dritten Tag kam ich in eine Stadt, und statt mich sofort an die Besichtigung derselben machen zu können, mußte ich die ersten zwei oder drei Stunden derlei gesellschaftlichen Erfordernissen opfern. Wie der bezopfte alte Lo, so empfingen mich auch alle anderen Mandarine in vollem Staatskleide, umgeben von ihren Sekretären, Beamten und Ehrengarden, in[S. 207] der Haupthalle ihres Yamens. Die drei großen Höfe, die ich dabei zu durchschreiten hatte, waren gewöhnlich von vielen Hunderten Neugierigen gefüllt, von denen der größte Teil einen Europäer überhaupt zum erstenmal erblickte. In der Haupthalle angelangt, führten die Anwesenden vor mir den Kautau aus, indem sie sich mit vor der Stirn gefalteten Händen bis nahe dem Boden verbeugten. Dann führte mich der Mandarin zu einem der beiden im Hintergrund befindlichen Stühle, nahm aus den Händen eines Dieners eine Tasse Thee und stellte sie auf das zwischen den Stühlen stehende Tischchen. Dann erst nahm er Platz und die Unterhaltung begann mit Hilfe meines Dolmetschers. Leider verlangt es die Höflichkeit, nicht früher aufzubrechen, bis der Mandarin seine Theetasse zum Munde führt, und das dauerte mitunter sehr lange, denn ebenso begierig wie ich es war, die Verhältnisse in Schantung kennen zu lernen, ebenso begierig waren auch die Mandarine, etwas über Deutschland zu erfahren, das sie ja nur dem Namen nach kennen. Geographie wird in den chinesischen Schulen nicht gelernt.
Kaum war ich nach diesen Besuchen nach Hause zurückgekehrt, so ließen sich die Mandarine, in mancher Stadt drei oder vier hintereinander, zum Gegenbesuch anmelden. Den Vortrab bildeten Soldaten und Yamendiener, die zuweilen die großen phantastischen Paradewaffen trugen, dann kam die von vier Dienern getragene, von einem großen roten Zeremonienschirm beschattete Sänfte, in welcher der betreffende Mandarin saß, und die Kautaus, Theezeremonien und langweiligen, überall ziemlich gleichen Gespräche begannen von neuem, bis ich durch das Erheben meiner Theetasse das Zeichen zum Aufbruch gab.
Kiautschou hat von seiner einstigen Größe noch recht viel Reichtum und Industrie bewahrt, auch der Handel mit dem Inlande ist noch ziemlich rege. Die Stadt besitzt reizende Tempel und zahlreiche Steindenkmäler in Gestalt von Ehrenpforten, in den Geschäftsstraßen reiht sich Laden an Laden, in denen die fleißigen Zopfträger unter den Augen der Passanten Pfeifen drechseln, hübsche Messingwaren, Leuchter, Opiumlämpchen und dergleichen herstellen, Tapeten mit chinesischen Ornamenten bedrucken, spinnen, weben, nageln, hämmern, vom frühen Morgen bis in die Nacht hinein. Ja, ich fand in wenigen Städten so viel Industrie wie hier, und die Stadt wird durch die geplante Eisenbahn von Tsingtau nach der Hauptstadt Tsinanfu gewiß viel gewinnen, denn was Schantung vor allem anderen braucht, sind Schienenwege. Als ich nach zweitägigem Aufenthalte mit meiner umfangreichen Karawane aufbrach, um durch die große Ebene nördlich von Kiautschou nach Weihsien zu reisen, bekam ich den ersten Vorgeschmack der gegenwärtigen Verkehrsrouten. Die einzelnen Dörfer und Städte in der ganzen Provinz sind nicht etwa durch Straßen oder auch nur Landwege miteinander verbunden, die irgendwie von den Mandarinen unterhalten werden, sondern Karren, Reiter, Fußgänger schlagen einfach die nächste Richtung nach ihrem Ziele ein, und ihren Spuren[S. 208] folgen die Nachkommenden, so daß allmählich eine breite, tief ausgefahrene Route in dem weichen Alluvialboden entsteht, im trockenen Herbst und Frühjahr mit knietiefem, feinem Staub bedeckt, im Winter festgefroren, in der sommerlichen Regenzeit mit knietiefem Wasser angefüllt. Selbst die wichtigsten Verkehrsstraßen, wie jene zwischen dem einzigen Handelshafen von Schantung, Tschifu, nach der Hauptstadt, und die große, vom Jangtsekiang quer durch Schantung nach Peking führende sogenannte Kaiserstraße sind nicht viel besser, so daß man sich die Annehmlichkeiten des Reisens in der deutschen Provinz von China leicht ausmalen kann. Ermattet, ausgehungert, mit fingerdickem Staub bedeckt, kam ich nach den langen Tagemärschen in mein Nachtquartier, und in den Dorfherbergen war zuweilen das Wasser so schmutzig und übelriechend, daß ich ein paar Flaschen Apollinariswasser opfern mußte, um mich zu reinigen. Die große Mehrzahl der Mandarine und fast alle Kaufleute, die ich sprach, begrüßen die kommende Eisenbahn als einen Segen, und daß dem Bau dieser Eisenbahn keine übergroßen technischen Schwierigkeiten entgegenstehen, konnte ich überall erkennen. Von Kiautschou dehnt sich eine ungeheure, fast durch gar keine Erhebung unterbrochene Ebene in nördlicher Richtung quer durch Schantung und die Provinz Petschili bis nach Peking aus; die auf den meisten Karten verzeichneten Gebirge sind dort nicht vorhanden und erheben[S. 209] sich nur im mittleren Teile von Schantung, so daß sie von der nach der Hauptstadt Tsinanfu geplanten Eisenbahn, ohne einen Umweg zu machen, umfahren werden können. Die Mehrzahl der auf den Karten verzeichneten größeren Flüsse sind einen großen Teil des Jahres über wasserlos und erfordern keine schwierigen Brückenbauten. Auch bezüglich der zu erwartenden Einnahmen braucht man sich keinerlei Sorgen hinzugeben. Ich war auf der Reise nach der Hauptstadt überrascht von der großen Zahl volkreicher Städte und Dörfer; nach jeder halben Wegstunde stieß ich auf ein Dorf von mehreren hundert Einwohnern; häufig sah ich in meiner Sehweite im Umkreis Dutzende von Dörfern, durch die hohen Weiden und Eschen, welche ihren Hauptschmuck bilden, leicht erkennbar, von wirklichem Elend bekam ich nichts zu sehen. Und wenn in manchen Jahren der große Uebelthäter von China, der Hoangho, ungeheure Länderstrecken überschwemmt, wenn in verschiedenen Gebieten heftige Regengüsse oder anhaltende Dürre die Ernte vernichten, so ist dafür in anderen Gebieten der Ertrag der Ländereien an Weizen, Hirse, Bohnen, Reis und anderen Früchten so groß, daß der stellenweise entstehenden Hungersnot gesteuert werden könnte, wenn nur Transportwege vorhanden wären, um den Ueberfluß eines Gebietes nach dem notleidenden anderen schaffen zu können. Aber diese Transportmittel sind der Hauptsache nach Schubkarren, welche von Kulis gelenkt werden. All die zahlreichen Produkte der ungemein fruchtbaren und dichtbevölkerten Provinz, Kohle, Eisen, Lebensmittel, Seide, Wolle, Stoffe, Glas- und Töpferwaren, werden auf Schubkarren verfrachtet, und selbst der Passagierverkehr bedient sich hauptsächlich dieser primitiven Fuhrwerke.
Merkwürdigerweise bedienen sich die Schubkarrenkulis um Schantung zur Beförderung ihres Fahrzeugs auch der Segel. Vor dem Karren stecken zu beiden Seiten des Rades mannshohe Segelstangen, und zwischen diesen hissen die Kulis bei günstigem Winde blaue oder graue Segel. Unter diesen Umständen spricht es ungemein für den natürlichen Reichtum der Provinz, sowie für den Fleiß, die Nüchternheit und Sparsamkeit ihrer Bewohner, daß so viele Millionen ihr Auskommen finden können und daß in einer Reihe von Städten so große Wohlhabenheit herrscht. In Weihsien, Tsingtschoufu, Tsinanfu, Tsinin und anderen Städten giebt es eine ganze Anzahl von Millionären, ja die Hauptstadt der Provinz dürfte zu den reichsten Städten Chinas gezählt werden können. Freilich bekommt nur der aufmerksame Reisende davon etwas zu sehen, denn ebensowenig wie in anderen Provinzen besitzen auch die Städte Schantungs irgend welche Paläste: die Reichen verbergen ihre Wohnungen, ihre Wohlhabenheit hinter hohen Mauern, und die einzigen ansehnlichen Bauten, die man zu sehen bekommt, sind vor allem die mächtigen, von kuriosen Türmchen und Pagoden gekrönten Ringmauern, welche alle Städte und auch zahlreiche Marktflecken umgeben, sowie die vielen, Buddha oder Confucius geweihten Tempel, die sich gewöhnlich inmitten schattiger Cedern-[S. 210] und Fichtenhaine erheben. Sie bilden die einzigen Sehenswürdigkeiten nach unseren Begriffen, denn Monumente, Museen, Theater, große Fabrikanlagen und dergleichen gibt es in Schantung ebensowenig wie in dem ganzen übrigen China. Die Theater werden von den im Lande umherziehenden Wandertruppen jedesmal auf Marktplätzen oder in Tempelhöfen eigens aus Bambusrohren errichtet und nach Beendigung ihres „Gastspiels” wieder abgebrochen. Fabriken giebt es nicht; alles, sogar die Kohlenminen, Glasbläsereien und Töpfereien der großen Industriestadt Poschan sind gewissermaßen Hausindustrie, und die einzigen Dampfmaschinen der ganzen an fünfunddreißig Millionen Einwohner zählenden Provinz befinden sich in dem Arsenal von Tsinanfu.
Für den Mangel an sogenannten Sehenswürdigkeiten wurde ich aber durch das Leben und Treiben der Bewohner in den Städten wie auf dem Lande mehr als entschädigt, denn die Provinz hat noch keine Beziehungen zu der Außenwelt, alles hat sich in malerischer Ursprünglichkeit erhalten, und deshalb war für mich jede Stadt, jedes Dorf eine Art Museum. Weihsien mit seinen großen Märkten,[S. 211] Tsingtschoufu mit den herrlichen Buddhatempeln und interessanten mohammedanischen Moscheen, Lintschi mit seinen mehrtausendjährigen Altertümern, das industriereiche Poschan, dann Tschangschan, Tschangkin und vor allem die gegen vierhunderttausend Einwohner zählende Hauptstadt boten mir eine Reihe von Bildern, wie sie sich dem Reisenden in China selten zeigen. Dazu reiste ich in der schönsten Jahreszeit, im Frühling, und das Klima ist jenem von Mitteleuropa ähnlich, wenn auch die Sommer heißer und an den Küsten viel feuchter sind als bei uns. Die Chinesen sind große Freunde der Natur, sie haben sich für die Anlage ihrer Städte die malerischsten Punkte ausgesucht, und auch die grüne Landschaft besitzt hier großen Reiz; fehlen auch in ganz Schantung die Wälder, so sind doch alle Ortschaften von großen Obstgärten umgeben, und in den Feldern erheben sich überall dunkle Cypressen- und Cedernhaine, in deren Schatten unter mannshohen Erdhügeln die Toten ruhen auf ewig, denn nur in den seltensten Fällen rührt der Chinese an den Gräbern seiner Vorfahren. Schantung besitzt aber auch Königsgräber in der Gestalt hoher Pyramiden, von deren Vorhandensein man im Abendlande bisher nichts wußte. Jenseits von Putang, westlich von Tsingtschoufu ragen sie aus dem grünen Meer der wallenden Felder empor, noch mysteriöser als jene des Landes der Pharaonen. Obschon die Zeit viel von der ganzen Anlage verwischt hat, konnte ich doch erkennen, daß dieser Friedhof einer Königsdynastie einst großartig gewesen sein muß, großartiger vielleicht als jene der Ming, die ich bei Peking und bei Nanking gesehen habe. Der ganze Komplex umfaßt etwa einen Quadratkilometer und ist durchschnittlich drei bis vier Meter über die Ebene erhaben. Nach den aus großen Quadern aufgeführten, stellenweise noch erhaltenen Umfassungsmauern und der ganzen Terrainbildung zu urteilen, muß dieses ausgedehnte Plateau künstlich aufgeführt worden sein, eine übermenschliche Arbeit. Fünf große und mehrere kleine Pyramiden liegen nördlich des Weges, sechs große südlich desselben. Die Höhe der großen Pyramiden, vom Plateau aus gerechnet, schwankt zwischen vierzig und sechzig Meter; die höchsten sind jene, die sich von dem Dorfe in südwestlicher Richtung in einer Reihe gegen einen hohen Kalkfelsen hinziehen, auf dessen Spitze sich eine Anzahl Tempel, Opferhallen und Steindenkmäler erheben.
Wie alle Gräber in Schantung, so sind auch diese Königsgräber nur aus Erde aufgeführt, und es wundert mich nur, daß die Form ihrer Terrassen und Stufen so gut erhalten ist. Selbst die Wände sind glatt und vom Regen nur wenig angegriffen. Dort wo dies der Fall ist, stellte sich die Anfüllung als ein Gemenge von Lehm und Schutt mit zahlreichen Scherben dar. Die Wände jedoch bestehen[S. 212] aus festgeknetetem und gestampftem Lehm. Jede Pyramide hat eine breite Stufenterrasse von zweihundert bis vierhundert Schritt Umfang und zwanzig bis dreißig Meter Höhe, und auf dem Plateau dieses massigen Unterbaues erhebt sich, umgeben von steinernen Inschriftstafeln, eine kleinere Stufenpyramide. Die nördlichste Pyramide besitzt keine derartige Terrasse, sondern steigt vom Boden in fünf mächtigen, gleichmäßigen Stufen empor, so daß sie mich in ihrem ganzen Aussehen lebhaft an die berühmte Stufenpyramide von Sakkara erinnerte. Leider ist es unmöglich, Näheres über das Alter und die Bestimmung dieser Pyramiden zu erfahren, denn der erste Kaiser der Tsindynastie, dieser Napoleon Chinas, dem es gelungen war, all die Fürstentümer und Königreiche zu unterwerfen und unter sein Scepter zu bringen, ließ auch alle Geschichtswerke und Archive der verschiedenen kleinen Dynastien verbrennen.
Der interessanteste Teil von Schantung ist jedoch das Bergland südlich von Tsinanfu; nach all den offiziellen Besuchen, Mahlzeiten und gesellschaftlichen Zerstreuungen chinesischer Art, wie sie der Aufenthalt in der von vielen Mandarinen bewohnten Provinzhauptstadt mit sich brachte, war ich froh, wieder mit meiner Karawane hinauszuziehen in die Natur, um das heilige Land von China kennen[S. 213] zu lernen. Ein Ritt von anderthalb Tagen brachte mich nach dem Mekka von China, nach der viertausend Jahre alten Stadt Taingan. Schon aus weiter Ferne sah ich das Wahrzeichen des heiligen Landes, den mächtigen, beinahe zweitausend Meter hohen Taishan in die Wolken ragen. Mit Spannung ritt ich durch das Thor der hohen Stadtmauer in Taingan ein, denn hier mußte ich doch endlich Altertümer, Denkmäler aus der längst vergangenen großen Zeit Chinas finden, die ich auf meinen bisherigen Reisen in diesem ältesten Kulturlande des Erdballes vergeblich gesucht hatte. Die tausendjährigen Städte besitzen keine Burgen, alte Mauern, malerische Ruinen, wie sie sich in allen Ländern des Abendlandes darbieten, nun war ich in einer der ältesten Städte der Erde, die aus der Zeit der ägyptischen Pyramidenbauer stammt. Aber auch hier wurde ich grausam enttäuscht. Ruinen sah ich wohl, Ruinen von großen Vorstädten und ganzen Stadtvierteln, doch stammen sie nicht aus alten Zeiten, sondern sind die traurigen Ueberreste, welche die wütenden Rebellen aus dem Taipingkriege hier zurückgelassen haben. Dieser Krieg aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts war vielleicht der größte, blutigste, grausamste aller Zeiten, denn ganze Provinzen von der Ausdehnung europäischer Reiche wurden verwüstet, zwanzig Millionen Menschen getötet. An wenigen Stellen wütete er so furchtbar wie hier, denn siebenmal drangen die Rebellen im Laufe der Kriegsjahre in Taingan ein, plünderten und zerstörten, was sie konnten, und das heutige Taingan ist nicht viel besser, nicht interessanter als irgend eine andere Stadt der Provinz. Nur der große Taishantempel, der mit seinem von tausendjährigen Cedern und Cypressen erfüllten Park fast die ganze nördliche Hälfte der Stadt einnimmt, ist von den Taiping verschont geblieben. Dieser Tempel ist das Ziel von vielen Tausenden von Pilgern, die in jedem Jahre aus allen Teilen des chinesischen Reiches hier zusammenströmen, um der „heiligen Mutter des Taishan” zu opfern und ihren Segen zu erflehen. Als ich, begleitet von einigen Soldaten, den Tempelpark betrat, waren gerade an die zehntausend Pilger hier versammelt, von denen die Mehrzahl noch niemals einen Europäer gesehen haben mochte. Natürlicherweise war ich bald von Neugierigen umringt, und als ich gar mit Hilfe meines Photographen den Apparat aufstellte, um die großen Tempelbauten, die uralten Denkmäler und die Menschenmenge selbst aufzunehmen, schienen die abergläubigen Zopfträger zu fürchten, ich wolle sie verzaubern. Ein derartiges dreibeiniges Ding mit glänzenden Metall- und Glasplatten hatten sie ja in ihrem Leben noch nicht gesehen. Bald begann es Steine auf mich zu hageln, und einige Mutige machten Miene, auf mich loszuschlagen. Da erhob ich erzürnt meinen Stock, und in demselben Augenblicke zerstob die Menge vor mir. Meine Soldaten griffen nun ihrerseits ein und trieben die Tausende wie eine Herde Schafe vor sich her, den Ausgängen zu. Binnen wenigen Minuten war der Platz gesäubert, die Thore wurden geschlossen, und ich konnte unbeirrt meine Aufnahmen machen.
Der Taishantempel von Taingan gehört zu den größten Tempeln von ganz Ostasien; der Provinzgouverneur hatte dem Mandarin von Taingan den Befehl zukommen lassen, den sonst nur einmal im Jahre geöffneten Tempel für mich aufschließen zu lassen, und ich war wohl der erste Europäer, der Gelegenheit hatte, ihn in allen seinen Teilen zu besichtigen und Aufnahmen zu machen. Mehr als die auf einem Thron sitzende, kunstvoll geschnitzte und vergoldete Figur der heiligen Mutter bewunderte ich die herrlichen Malereien, welche die Tempelwände bedecken und die, aus dem siebzehnten Jahrhundert stammend, wohl zu dem Schönsten gehören, was die chinesische Kunst hervorgebracht hat. In einer Reihe von Wandgemälden ist hier die Besteigung des Taishan durch den ersten Kaiser der gegenwärtigen Dynastie dargestellt, und in Bezug auf Farbenreichtum, Perspektive, Gruppierung der zahlreichen Figuren habe ich auch in Japan nichts Schöneres gesehen.
Nachdem die Pilger der heiligen Mutter im Taishantempel geopfert haben, unternehmen sie gewöhnlich zu Fuß den Aufstieg auf den gewaltigen Granitberg, dessen Gipfel, etwa fünfundzwanzig Kilometer von Taingan entfernt, der höchste des ganzen Berglandes von Schantung ist. Am zweiten Morgen nach meinem Eintreffen in Taingan zog auch ich, begleitet von meinem Photographen, durch das Nordthor der Stadt, um die sechstausend Stufen, welche von dem ersten Drittel der Höhe zum Gipfel führen, emporzuklettern; und mittags stand ich mitten zwischen den zahlreichen großen Tempeln, welche das oberste Plateau des heiligen Berges krönen. Meinen Leuten die photographischen Aufnahmen überlassend, pilgerte ich zwischen kostbaren Bronzedenkmälern und ungeheuren Steintafeln, welche verschiedene Kaiser hier gestiftet haben, zu dem heiligsten der Tempel, jenem der heiligen Mutter: sie thront auf einem rotlackierten Holzaltar, in kostbare, mit herrlichen Stickereien geschmückte Seidengewänder gehüllt; vor ihr aber ist der Boden des weiten Tempelraumes meterhoch mit Münzen bedeckt, den Opfergaben der Pilger. Auch Silberstücke von verschiedener Größe liegen zwischen den Millionen[S. 215] von Kupfermünzen, die in jedem Jahr einmal von einem Abgesandten des Provinzgouverneurs hinausgeschafft werden. Den größten Teil der zusammen immerhin mehrere hunderttausend Mark betragenden Gaben erhält die Kaiserinmutter in Peking, ein zweiter Teil fließt in die Taschen des Mandarins, den Rest erhalten die Mönche der zahlreichen Klöster, welche sich auf dem Taishan befinden.
Zwei Tagereisen südlich von Taingan liegt das berühmte Kiufu, die Vaterstadt von Confucius, und auch hier war es mir vergönnt, als der erste Europäer den stets verschlossenen Tempel des Heiligen zu betreten. Dank meiner Empfehlungen sandte der Herzog Confucius, der direkte Nachkomme des großen Religionsstifters in der sechsundsiebzigsten Generation, seine Kammerherren und fünfzig Mann seiner grotesk uniformierten Leibgarde, um mich zu empfangen und in den Tempel zu geleiten, der wie jener von Taingan in einem großen Park mit mehrtausendjährigen Bäumen gelegen ist, den Taingantempel jedoch an Größe und Pracht weitaus übertrifft. Ich habe auch in Peking, ja selbst an den heiligen Stätten des Jyeyasu in Japan nichts Schöneres gesehen. Die Denkmäler, Ehrenpforten, Nebengebäude, Pavillons und Kioske strotzen von kunstvollen Holzschnitzereien, Skulpturen und Vergoldungen, am schönsten aber präsentiert sich der ungeheure Tempel selbst in seiner erhabenen Einfachheit. Er erhebt sich auf einer weiten, von Balustraden aus weißem Marmor umschlossenen Terrasse, die etwa mannshoch über dem Parkgrund gelegen ist. Zahlreiche weiße Marmorsäulen, Monolithen, mit köstlichen Skulpturen bedeckt, stehen vor der etwa achtzig Meter langen Fassade und tragen die Architraven des ungeheuren zweistöckigen Daches, das ganz mit Porzellanziegeln von gelber Farbe, der Farbe des Kaisers, eingedeckt ist. Der ganze Tempel besitzt kein Fenster, und in dem weiten inneren Raume ist es so dunkel, daß eine photographische Aufnahme unmöglich war. Mächtige viereckige Säulen tragen das Dach; an den Wänden hängen mehrere Meter lange, mit breiten geschnitzten Goldrahmen umfaßte Inschriftstafeln, Widmungen der Kaiser verschiedener Dynastien. In der Mitte des Raumes erhebt sich eine Art Heiligenschrein aus rotlackiertem Holz mit vergoldeten Skulpturen, und in diesem Schrein sah ich die überlebensgroße Statue des Confucius mit seiner Ahnentafel davor, nach dem Glauben der Chinesen der Sitz seines Geistes. Eine Reihe von Opfertischen vor diesem Schrein tragen zahlreiche Bronzegefäße, Urnen, Behälter für Räucherkerzen, Statuen und dergleichen, Geschenke verschiedener Kaiser während der letzten zweitausend Jahre. Manche dieser uralten Gefäße stammen aus dem persönlichen Besitz des alten Confucius, eine Reihe von seinen Manuskripten und Gegenständen des täglichen Gebrauchs aber sind in der Familie von Vater auf Sohn durch die Jahrtausende bis heute erhalten geblieben und befinden sich in dem Palast des gegenwärtigen Herzogs. Das Wohnhaus des Confucius ist verschwunden, aber eine Ceder, die er selbst gepflanzt hat, steht heute noch in dem Tempelpark.
Auch Vater und Mutter des Confucius, sowie seinen Söhnen, Enkeln und Aposteln sind in diesem Parke eigene Tempel geweiht, umgeben von steinernen oder bronzenen Gedenktafeln verschiedener Kaiser. Das Grab des Religionsstifters befindet sich etwa zwei Kilometer außerhalb der Stadt. Eine Avenue, von tausendjährigen Baumriesen besetzt, führt hinaus zu dieser Stätte, wo, umgeben von etwa zwanzigtausend Gräbern seiner Nachkommen, der Heilige ruht. Ein Erdhügel von etwa zwölf Meter Höhe bedeckt seine sterbliche Hülle, und davor steht ein einfacher Grabstein mit seinem Namen. Auch seine nächsten Nachkommen sind hier begraben, und in jedem Jahre versammeln sich die heutigen Träger des Namens Confucius, oder vielmehr Kung-tse, wie er im Chinesischen heißt, um in einer eignen Opferhalle dem großen Toten zu opfern. Dasselbe geschieht auch in dem Confuciustempel der Vaterstadt Kiufu unter Verbrennung von Opfern, Zeremonientänzen und Mahlzeiten, bei denen dem Geiste des Verstorbenen von dem jetzigen Herzog Speisen und Getränke vorgesetzt werden. Wohl zwei Drittel der etwa 18000 Einwohner zählenden Stadt sind Nachkommen des Confucius und führen seinen Namen; die Begräbnisstätte außerhalb der Stadtmauer ist seit 2400 Jahren benutzt worden, und wie damals, so lassen sich auch heute noch alle Angehörigen des Stammes Confucius hier beerdigen, selbst wenn sie tausend Kilometer weit von Kiufu das Zeitliche gesegnet haben sollten. Wenn immer die Mittel vorhanden sind, werden ihre Leichen hierher transportiert.
Merkwürdigerweise ist Kiufu, dieses Jerusalem von China, kein Wallfahrtsort wie Taingan; nur selten kommen fromme Confucianer hierher, und noch weniger wird das etwa vierzig Kilometer weiter südlich gelegene Tsiuhsien besucht, die Geburtsstadt des größten Apostels der Confuciuslehre, Mencius. Ich fand Tsiuhsien noch ärmlicher und verfallener als Kiufu; bei meinem Einzug lief die ganze zerlumpte Bevölkerung hinter mir her, und es herrschte in der Stadt große Aufregung, so daß mir und meinen Begleitern von seiten des Mandarins nahegelegt wurde, möglichst bald weiterzureisen. Der Ahnentempel und die Grabstätte des Mencius ähneln jenen seines großen Lehrmeisters, nur sind sie kleiner, einfacher, und während die Tempel des Confucius vorzüglich erhalten sind, gehen jene des Mencius dem Verfall entgegen. Die direkten Nachkommen des Mung-tse, dies ist sein chinesischer Name, kümmern sich wenig darum. Die ganze Familie ist verlottert, und ihr Haupt verdient keineswegs die in der Familie erbliche Würde eines Mitglieds der berühmten Pekinger Hanlin-Akademie.
Von Tsiuhsien nahm ich den Weg in westlicher Richtung nach der Gelehrtenstadt Yentschoufu, dem Sitz des kommandierenden Generals von Schantung und einer der schönsten Städte der Provinz. Bischof Anzer, der Leiter der deutschen katholischen Mission von Südschantung, die in Tsining am Kaiserkanal ihren Hauptsitz hat, ließ hier eine Zweigmission einrichten. Wie in Tsining, in Tsaut[S. 218]schoufu und anderen Orten, wo die Missionare ihre Thätigkeit entfalten, waren sie auch hier bis zum letzten Jahre unaufhörlichen Verfolgungen ausgesetzt, die bekanntlich in der Ermordung der beiden Missionare Nieß und Henle ihren Höhepunkt fanden. Wie das heilige Grab des Confucius, so besuchte ich auch von Tsining aus die Gräber der beiden Märtyrer, die vorläufig, bis hinreichend freiwillige Beiträge zur Errichtung würdiger Denkmäler einlaufen, auch nur Erdhügel nach chinesischer Art sind. Für die Deutschen besitzen diese Gräber ungleich höhere Wichtigkeit als jene der chinesischen Heiligen, denn die, welche unter diesen Erdhügeln ruhen, waren die direkte Ursache, daß Deutschland sich heute einen Hafen in China und, was mehr ist, den Handel einer großen Provinz gesichert hat, der mit der Zeit viele Millionen eintragen wird. Des bin ich heute, nachdem ich das ganze Gebiet durchwandert, gewiß.
In einigen Jahren werden deutsche Eisenbahnen durch die bisher fast unbekannten Gegenden führen und sie dem deutschen Handel, der deutschen Kultur eröffnen zum Segen ihrer selbst und zum Nutzen ihrer Erschließer.
[2] Näheres über Schantung und seine Merkwürdigkeiten, über die Stromgebiete des Hoangho und Kaiserkanals, sowie über die Provinz Petschili in Hesse-Wartegg, Schantung und Deutsch-China, Leipzig, J. J. Weber. Preis 14 Mark.
Der große Wasserweg, welcher von Süd nach Nord quer durch das chinesische Reich führend, die südlichen Provinzen desselben mit Tientsin und Peking verbindet, ist trotz seines gegenwärtigen Verfalls immer noch eine der wichtigsten Verkehrsstraßen des Kontinents, ja, man könnte ruhig behaupten, nächst dem Jangtsekiang und der transsibirischen Eisenbahn die wichtigste. Auf den wenigsten Wasserstraßen des Erdballs dürften sich so viele Schiffe befinden wie auf dem Kaiserkanal. Nach Zehntausenden zählen die Fahrzeuge, welche das durchschnittlich etwa fünfzig Meter breite Bett des Kanals auf seinem über siebzehnhundert Kilometer langen Laufe von Hangtschau bis Tungtschau (bei Peking) bedecken. Gelegentlich meines Besuches von Tschinkiang und Yangtschau, am Ausgangspunkte des Kanals und des Jangtsekiang, sah ich selbst viele Tausende von Frachtbooten, welche auf einer Strecke von vielleicht zwanzig Kilometer mit nur geringen Unterbrechungen dicht aufeinander folgten und manchmal kilometerlange Ketten bildeten. Noch immer wird der Tributreis auf dem Kanal nach Peking befördert, noch immer herrscht auf dieser Wasserstraße ein ungeheurer Warenverkehr, und hat dieser in den siebziger Jahren vielleicht eine Verminderung erfahren, so ist er seit den letzten drei bis vier Jahren entschieden wieder im Steigen begriffen und wird vielleicht in ebensovielen Jahren denselben Verkehr aufweisen wie zuvor.
Der Anblick, den diese vielen Tausende bei den Schleusen von Tschinkiang zusammengedrängten Fahrzeuge darboten, wird mir zeitlebens unvergeßlich bleiben. Der ganze breite Kanal war von einem Ufer zum andern mit ihnen buchstäblich bedeckt, überhöht von einem Wald von buntbewimpelten Masten, zwischen denen sich hier und da die Flaggen der Mandarinboote und Kriegsfahrzeuge zeigten. Jedes Fahrzeug war von einer Unzahl Menschen bewohnt, welche die vier bis fünf Monate dauernde Fahrt nach Peking und die ebensolange Rückfahrt nach dem Süden des Reiches mitmachten. Jedes der schwerbeladenen Boote besaß auf dem Bug zwei Anker mit je vier Armen und zwischen den über den Stern des Bootes hinausragenden Seitenwänden ein Steuerruder, das je nach der verschiedenen Wassertiefe im Kanal gehoben und gesenkt werden kann. An den Seiten der Boote befanden sich buntbemalte Leeboards (Schwertbretter), welche die Chinesen ähnlich wie die Holländer zur Sicherung der Fahrt bei seitlichen Winden herablassen. Viele Boote waren mit grotesken Fratzen und Ornamenten bemalt, der Bug zeigte sehr hübsche Schnitzereien, und hinter denselben zwei riesige gemalte Fischaugen, denn die Chinesen meinen, daß auch die Boote solcher Augen bedürfen, um ihren richtigen Weg finden zu können. Die Mehrzahl der Boote hatten eine Ladung von 200 bis 400 Pikul (12000 bis 24000 Kilogramm) Reis, außerdem aber noch verschiedene andere Waren, denn die Frachten der Boote, welche den kaiserlichen Tributreis nach Peking bringen, sind von allen Zöllen und Abgaben während der ganzen Reise befreit. Der Besitzer jedes Bootes erhält überdies von der kaiserlichen Regierung eine Vergütung von 800 Cash (etwa 2 Mark) für den Transport jedes Pikul Reis, im ganzen also 400 bis 800 Mark für die acht- bis zehnmonatliche Reise, und von dieser Summe muß er die Löhne und den Unterhalt seiner Leute, den Transport durch die vielen Schleusen und alle sonstigen Ausgaben bestreiten. Die Summe ist nicht so gering, wenn man die Lebensverhältnisse in China in Betracht zieht. Ich fand in den beiden genannten Kanalstädten Hunderte von Privatbooten verschiedener Größe, manche recht bequem eingerichtet, welche mir von den Eigentümern für etwa zwei Mark fünfzig Pfennig für den Tag angeboten wurden, und von dieser Summe bestreitet der Lao-pan (Kapitän) sämtliche Ausgaben, sogar die Nahrung des Passagiers. Auch zahlreiche Omnibusboote verkehren auf dem Kanal, und die Reisekosten betragen einen Cash, d. h. etwa einen viertel Pfennig pro Li (575 Meter). Das Reisen in China ist ungemein billig. Will man statt der langsamen, einförmigen, durch Aufenthalte an den Schleusen und in den Städten unterbrochenen Kanalfahrt lieber auf dem Landwege von Tschinkiang nach Peking reisen, was je nach der Jahreszeit zwei bis drei Wochen Zeit erfordert, so kostet ein zweiräderiger Karren, mit zwei Maultieren bespannt, etwa fünfunddreißig Taels (d. h. neunzig bis hundert Mark). Dafür werden dem Reisenden auf dem über tausend Kilometer langen Wege auch noch luxuriöse[S. 221] Mahlzeiten, sogenannte San-su-san-hoen, geliefert, deren jede aus sechs Gängen besteht.
Viel schneller kommen auf dem großen Kanal freilich die Mandarinboote vorwärts, denn diesen müssen die gewöhnlichen Frachtboote Platz machen, und sie werden auch zur Nachtzeit durch Schleusen gelassen, was bei den gewöhnlichen Booten nicht gestattet ist. Die Boote der höheren Mandarine, vom Taotai aufwärts, dürfen sogar von Dampfschaluppen gezogen werden. Diese Mandarinboote sind wahre schwimmende Paläste, wenigstens nach chinesischen Begriffen, mit schönen Schnitzereien, Vergoldungen, Wimpeln, Flaggen, Ehrenschildern und dergleichen geschmückt und auch im Innern sehr bequem eingerichtet. Zu ihrer Sicherheit werden sie zuweilen auch noch von Kanonenbooten begleitet, deren es auf dem Kanal und den von ihm durchschnittenen Seen des Schmuggels und Piratenwesens wegen zahlreiche giebt. Durch ihre Wachsamkeit ist das Reisen auf dem Kanal ziemlich sicher. Uebernachtet man auf einem, längs der Kanalufer verankerten Boote, so sind bald eigene Wächter, sogenannte Ta-keng zur Stelle, welche für wenige Sapeken die Nachtwache auf dem Verdeck übernehmen und alle halbe Stunden durch heftige Gongschläge ihre Wachsamkeit anzeigen. Bei Tag aber ist der Kanal viel zu belebt, als daß Piraten einen Angriff wagen würden.
Woher der große Kanal den in europäischen Werken gewöhnlich gebrauchten Namen „Kaiserkanal” bekommen hat, ist nicht recht erklärlich. In China ist dieser Name unbekannt. Dort heißt er Yun-ho, d. h. „Fluß für Transporte” oder Yun-liang-ho, d. h. „Fluß für Tributtransporte”. Dabei ist der Name „Fluß” viel richtiger als Kanal, denn der Yun-ho ist kein Kanal im europäischen Sinne. Er wurde auch nicht von einem Ingenieur entworfen und ausgeführt, sondern ist das Werk mehrerer Dynastien, welche Jahrhunderte lang daran arbeiten ließen, bis er seine heutige Gestalt angenommen hat. In dem letzten Jahrhundert diente er hauptsächlich für den Transport des Reistributes, welchen die südlichen Provinzen zu liefern haben. In dem kaiserlichen Jahrbuch fand ich, daß der Kiangnan jährlich einen Tribut von 1430000 Pikul (90000 Tonnen) Reis nach Peking abführen muß, wozu vier- bis fünftausend Boote, in 65 Flottillen geteilt, erforderlich sind. Tschekiang hat 670000 Pikul, Kiangsi 800000, Honan 220000, Schantung 350000 Pikul Reis zu liefern. Aber diese ungeheuren Massen werden in Wirklichkeit fast niemals aufgebracht. Eine Million Pikul im ganzen genommen, dürfte der Wahrheit näher liegen, immerhin eine Menge, für deren Transport vier- bis fünftausend Boote erforderlich sind.
Der Yun-ho ist selbst auf kleineren Landkarten Chinas durch eine lange Linie bezeichnet, welche von Hangtschau in der Provinz Tschekiang ausgehend, in hauptsächlich nördlicher Richtung den Jangtsekiang und Hoangho überschreitend, nach Tientsin beziehentlich Peking führt. Bei seiner Anlage wurden in geschickter Weise alte[S. 223] Flußläufe, Seen, Thalniederungen benutzt, was wohl die augenblickliche Arbeit erleichterte, den Kanal dafür aber den Ueberschwemmungen durch die ungeheuren Ströme, welche er durchkreuzt, aussetzt. Noch in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts wurde er durch die Gewässer des Jangtsekiang gespeist, und die Strömung war gegen Norden gerichtet; seitdem aber der furchtbare Hoangho in den fünfziger Jahren seinen alten südöstlichen Lauf aufgab, und statt seine Schlammfluten dem Gelben Meer zuzuführen, dieselben durch ein neu gegrabenes Bett in den Golf von Petschili münden ließ, haben sich auch die Verhältnisse im Transportkanal gründlich verändert. Die jährlichen Ueberschwemmungen des nahezu 4500 Kilometer langen, ungemein wasserreichen Hoangho lassen auf dem ausgedehnten Inundationsgebiet erhebliche Schichten von Schlamm und Erde zurück, und auch das Flußbett wird durch diese Ablagerungen so beträchtlich erhöht, daß die Uferbewohner ihre Ortschaften und Felder nur durch die entsprechende fortwährende Erhöhung der Uferdämme schützen können. Neben diesen Ablagerungen fand, nach den Angaben von M. Bickmore im Journal der asiatischen Gesellschaft, auch eine allmähliche Hebung der westlich von der Halbinsel Schantung gelegenen Länderstriche von innen heraus statt, und diese Umstände brachten naturgemäß beträchtliche Veränderungen in dem Flußsystem zwischen Hoangho und Jangtsekiang mit sich.
Heute ist es nicht mehr der letztere, welcher den Transportkanal speist, und die Strömung in demselben ist auch nicht mehr nach Norden gerichtet, sondern der Kanal erhält sein Speisewasser aus dem großen, den Hungtsesee durchfließenden Hoaiho; ja, der Kanal bildet gewissermaßen die Fortsetzung dieses Flusses und führt seine Wassermassen in nördlicher und südlicher Richtung ab. Nun ist der Wasserstand in dem Hoaiho und damit auch in dem ausgedehnten Hungtsesee sehr heftigen und plötzlichen Schwankungen unterworfen, für welche das durch hohe steinerne Uferdämme eingefaßte Kanalbett nicht ausreicht. Das Gebiet westlich des Kanals, eine weite, wasserreiche Ebene, liegt höher als das Kanalbett, das Gebiet östlich desselben bis zur Meeresküste liegt tiefer als das Kanalbett. Der östliche Kanaldamm ragt etwa sechs bis acht Meter über diesen, Hiaho genannten Landstrich empor, der nichts weiter als ein ungeheurer Polder von der Ausdehnung des Königreichs Holland ist. Wie dort, mußte auch das Hiahogebiet gegen die Meeresfluten durch Dämme geschützt werden; wie dort, wird es von zahlreichen Speise- und Abzugskanälen durchzogen und bildet eines der ertragreichsten Reisgebiete nicht nur Chinas, sondern vielleicht von ganz Asien. Noch in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts befand sich hier die Mündung des Hoangho, und das ausgedehnte Tiefland war alljährlich schrecklichen Ueberschwemmungen ausgesetzt. Seither hat er sich nach Norden gewendet, und die Bewohner sind herzlich froh, daß sie den unangenehmen Gesellen losgeworden sind. Allein sie wären aus dem Regen in die Traufe gekommen, wenn die Kanalbehörden nicht recht sinnreiche Einrichtungen[S. 224] getroffen hätten, um das Hiahotiefland gegen die Wassermassen des Hoaiho zu schützen und die letzteren für die Reiskulturen des Tieflandes dienstbar zu machen. Sie legten dazu an verschiedenen Stellen in dem östlichen Kanaldamm Abzugsschleusen verschiedener Art und Größe an, deren kleinste Art Tong genannt wird. Diese Tong sind Oeffnungen von einem Meter ins Geviert, welche in entsprechender Höhe durch den östlichen Kanaldamm führen, um das Ueberschußwasser des Kanals in die Speisekanäle des Hiaholandes abzulassen. Sie bleiben stets geöffnet.
An gewissen Stellen zwischen den Tong sind größere Schleusen, sogenannte Tscha, im östlichen Uferdamme angebracht. Die Wände dieser bis nahe an den Kanalboden reichenden Oeffnungen sind mit Steinen und Zement bekleidet und besitzen vertikale Coulissen, welche zur Aufnahme schwerer Holzbalken dienen, die horizontal aufeinandergelegt werden. Reichen die Tong nicht aus, um das überschüssige Kanalwasser abzuleiten, so werden je nach der Menge desselben ein, zwei oder mehr dieser horizontalen Balken aus den Tscha genommen, und das Ueberschußwasser ergießt sich in brausendem Falle in die Abzugskanäle, welche durch das Hiahotiefland nach dem Gelben Meere führen. Im Mai und Juni, wenn der aus den Bergen von Honan kommende Hoaiho durch die schmelzenden Eis- und Schneemassen erheblich geschwollen ist, reichen die Tong und Tschas nicht mehr aus, um das im Kanal sich sammelnde Ueberschußwasser abzuführen, und dann liegt die Gefahr nahe, daß selbst der Kanaldamm durchbrochen und damit der ganze Kanal auf lange Strecken vernichtet wird. Um dies zu verhindern, haben die chinesischen Ingenieure an gewissen Stellen des östlichen Kanaldammes sogenannte Pa angelegt. Dazu wurde auf Strecken von achtzig bis hundertzwanzig Meter Länge der östliche Kanaldamm bis nahe an den Boden durchschnitten und durch einen leichten Aufbau aus kleinen Steinen, mit Erde vermischt, ersetzt, der durch Reisigfaschinen zusammengehalten wird. Steigt das Wasser im Kanal durch die Anschwellungen des Hoaiho in gefahrdrohender Weise, so werden in diesen Pa nur ein oder zwei mittlere Reisigfaschinen entfernt; das Wasser bricht sich nun leicht eine Bahn durch die so entstandene Oeffnung und erweitert sie durch seine eigene Kraft. Ist das Ueberschußwasser durch die Abzugskanäle des Hiaholandes abgelaufen, so werden die Pa erneuert, und der Kanal ist wieder hergestellt.
Verkehrsunterbrechungen finden im Kanal besonders im Norden recht häufig statt. In manchen trockenen Sommern sinkt der Wasserspiegel für einige Wochen, so daß auf kilometerlange Strecken die Wassertiefe nur zwei bis drei Fuß beträgt und viele Boote stecken bleiben. In kalten Wintern friert der Kanal zuweilen auch für ein bis zwei Wochen zu, im Winter 1893 war er sogar drei Wochen lang durch eine dicke Eisdecke geschlossen; aber im Frühjahr und Herbst kann man im Kanal kilometerlange Reihen von Frachtbooten sehen, die mit langen Seilen durch die Bootsmannschaften langsam vorwärts gezogen werden. Männer, Frauen, Kinder,[S. 225] alles hilft ziehen, von Tagesanbruch bis gegen neun Uhr abends, und die Wege auf beiden Kanaldämmen zeigen zuweilen ununterbrochene Reihen von im Gänsemarsch hintereinander einherzottelnden Chinesen. Liegen an den Kanalufern Boote vor Anker, über welche das Zugseil der hohen Maste wegen nicht gezogen werden kann, so springt die ganze Gesellschaft an Bord und rudert die Boote vorwärts, bis die Bahn wieder frei ist. Dasselbe findet auch auf einer mehrere Kilometer langen Strecke im Tschao-pe-ten statt, in welchem die Kanaldämme unterbrochen sind. Bei günstigen Winden werden die Segel aufgezogen, und die Bootsmannschaften können ruhen.
Die schwerste Arbeit auf der einförmigen langen Reise durch den Kanal erfordert das Passieren der Schleusen, deren es Dutzende giebt. In der Provinz Kiangsu allein sind deren vier, aber nicht Schleusen nach europäischer Art, sondern das Passieren von einem Niveau zum andern erfolgt auf steilen Rampen, über welche das durch Steinmauern eingezwängte Wasser herabschießt. Auf diesen Mauern zu beiden Seiten der Rampen sind hölzerne Winden (Gangspille) nach Art der Pferdegöpel angebracht. Nähert sich ein Frachtboot einer Schleuse, so sind auch bald achtzig bis hundert Kulis zur Stelle, mit deren Führer der Besitzer des Bootes sich bezüglich des Preises einigen muß. Gewöhnlich beträgt er 1000 bis 2000 Cash. Dann wird das Boot an die Seile der Winden festgebunden, die Kulis stellen sich an die langen hölzernen Arme der Winden, und unter furchtbarem Schreien und Lärmen wird das Boot langsam die Rampe emporgezogen, bis es sich auf dem höhern Wasserspiegel befindet. Während dessen beten und opfern die Bootseigentümer den Kanalgöttern. Das Passieren von einem höhern Wasserspiegel zu einem tiefern geht leichter vor sich und kostet dementsprechend auch weniger.
Auch durch die zahlreichen Zollstationen werden die Boote, besonders jene der Missionare und Geschäftsreisenden, in ihrer Fahrt erheblich aufgehalten. Alle acht bis zehn Kilometer trifft man auf ein Zollamt, dessen Einnahmen entweder den kaiserlichen Kassen oder lokalen Mandarinen zufließen, und bei jedem Zollamt müssen sich die Boote die Untersuchung durch die Zollbeamten gefallen lassen. Nur die Boote des kaiserlichen Reistributs und jene der Mandarine dürfen die Zollämter ungehindert passieren, ja bei hohen Mandarinen müssen sich die Zollbeamten in ihre Staatskleider werfen und den Reisenden durch den Kautau ihre Ehrfurcht bezeigen.
Damit den lokalen Mandarinen ja keine Einnahmen entgehen, wird der Kanal bei mancher Zollstation zur Nachtzeit durch ein Holzgitter gesperrt und erst bei Tagesanbruch wieder geöffnet. Am großartigsten sind die Ansammlungen von Frachtbooten in Hangtschau am Südende und in Tungtschau am Nordende des Kanals, ferner in Tschinkiang und Tientsin. Man kann dort häufig viele Tausende von Booten versammelt sehen, die so dicht aneinander liegen, daß man den Kanal mit[S. 226]unter trockenen Fußes, von einem Boot auf das andere springend, übersetzen kann. Von verschiedenen chinesischen Transportgesellschaften wurden seit Jahren Versuche gemacht, die Erlaubnis zur Einführung von Schleppdampfern zu erlangen, die den Verkehr ungemein erleichtern würden. Allein sie scheiterten an dem Widerstand der Regierung, die vielleicht nicht so sehr den Neuerungen widerstrebt, als das Auswaschen und Zerfallen der Kanaldämme durch den heftigen Wellenschlag befürchtet. Die Instandhaltung des Kanals verschlingt in jedem Jahre ohnehin schon ungeheure Summen, und ihn für den Dampferverkehr einzurichten, dürfte bei den gegenwärtigen Verhältnissen eine Unmöglichkeit sein.
Obschon der Kaiserkanal den weitaus wichtigsten Verkehrsweg zwischen dem Süden und Norden Chinas bildet, ist er seltsamerweise von europäischen Reisenden nur streckenweise befahren worden, ja ich glaube nicht, daß einer von ihnen jemals den ganzen Weg von Hangtschou, dem südlichen Anfangspunkte des Kanals, und Peking, eine Strecke von über achtzehnhundert Kilometern, zurückgelegt hat.
Nachdem ich den südlichen Teil des Kaiserkanals auf früheren Reisen kennen gelernt hatte, bot sich mir im Jahre 1898 Gelegenheit, auch die nördliche, gegen fünfhundert Kilometer lange Strecke, zwischen der Nordgrenze Schantungs und Peking, zu bereisen. Auch hier könnte ich meine Vorgänger an den Fingern einer Hand abzählen, und wie mir der Kapitän meines Schiffes selbst mitteilte, war ich der erste Europäer, den er überhaupt gesehen, einzelne Missionare ausgenommen. Eine solche Reise ist keineswegs mit besonderen Annehmlichkeiten verknüpft. Schon beim Aufstehen von dem erbärmlichen Nachtlager auf der Dschunke beginnen die Schwierigkeiten mit dem Waschen. Wohl fuhr ich auf einem wasserreichen Kanal einher, aber sein Wasser ist womöglich noch ärger mit Erde und allerhand Unrat geschwängert als jenes des großen Hoangho, den ich kurz zuvor befahren hatte. Schwimmen doch auf seinem schmalen Bette zwischen Tschingkiang und Tientsin Hunderttausende von Booten, während des Sommers und Herbstes dürften über eine Million Menschen auf ihm wohnen, und der Kanal nimmt den ganzen Unrat auf. Der schlammige Kanalgrund wird durch die zum Vorwärtsstoßen der Boote benutzten Stangen fortwährend aufgerührt, so daß sich das Wasser im Glase vollständig undurchsichtig zeigt. Ich hätte es nicht mit dem Mikroskop untersuchen mögen. Und doch ist dieses Kanalwasser das einzig vorhandene im Umkreis von vielen Kilometern; die Landleute benutzen es zum Bewässern ihrer Felder, die Bewohner der vielen, längs des Kanals liegenden Städte und Dörfer zum Trinken, ja es soll nach der Aussage der Missionare, die ich in den Städten sprach, sogar sehr gesund sein, wenn sich die darin schwimmenden Schlammteilchen durch mehrstündiges Stehen auf dem Boden abgelagert haben. Filter fand ich nirgends in Verwendung. Ich ließ mir gewöhnlich am Abend mehrere Gefäße vollschöpfen, und des Morgens war das Wasser hinreichend klar geworden, um wenigstens zum[S. 227] Waschen benutzt zu werden. Zu meinem Thee hatte ich mir aus den Gebirgen von Mittel-Schantung Quellwasser, in geleerte Apollinarisflaschen gefüllt, mitgenommen. Wohl giebt es auch in dem ganzen Gebiete zwischen dem Kaiserkanal und den Küsten des Golfes von Petschili zahlreiche Quellen, aber das Wasser ist überall erdig, in vielen Orten auch übelriechend und ungesund, so daß die Einwohner das Kanalwasser als ein wahres Labsal zu betrachten scheinen. Es ist wenigstens fließendes Wasser. Die vielen Flußläufe, die auf den Landkarten dieses Gebietes verzeichnet sind, haben den größten Teil des Jahres über keinen Tropfen Wasser oder existieren überhaupt nicht. Der wichtigste dieser Flußläufe ist der Lao-Huang-Ho, nämlich das Flußbett des Hoangho vor etwa tausend Jahren. Im Grunde genommen sind auch alle anderen Flußläufe südlich und nördlich davon, bis an den Peiho, nichts anderes als alte Flußläufe des Hoangho, der in seiner Unbeständigkeit sich bald hierhin, bald dorthin wandte, ja man könnte füglich behaupten, daß an den ganzen Küsten des Gelben Meeres von Tientsin bis an die Mündung des Jangtsekiang keine Strecke von hundert Kilometern liegt, wo der Hoangho nicht einmal seine Mündung gehabt hätte. Nun haben sich aus früheren Zeiten die einmal angegebenen Flußläufe auf den Landkarten erhalten und sind auch in die neueste Wäbersche Karte aufgenommen worden, so daß dieses Gebiet aussieht, als sei es von wasserreichen Flüssen durchzogen, während das gerade Gegenteil der Fall ist.
Die Städte und Dörfer, die ich passierte, liegen zum Teil in Ruinen. Auf der ganzen Strecke zwischen dem Hoangho und Tientsin befindet sich keine Schleuse, keine Brücke, erst in der Nähe der Millionenstadt Tientsin sah ich wieder Zeichen ähnlicher Wohlhabenheit wie in der Provinz Schantung; der Verkehr auf dem Kanal wurde immer lebhafter, immer gefährlicher. Aber geschickt manövrierten Kapitän und Mannschaften zwischen den zahlreichen Booten hindurch, obschon sie nach der fünf Tage und fünf Nächte dauernden, fast ununterbrochenen Fahrt todmüde waren. Die Kulis standen mit langen Enterhaken bewaffnet auf dem Bug, und wollten Schiffe ihrem Geschrei nicht weichen, so benützten sie rücksichtslos die langen Stangen, ja sie hakten sie in die fremden Boote ein, um das unsere rascher vorwärts zu ziehen, ohne daß die Insassen derselben Protest erhoben hätten. Meine in roten Uniformjacken steckenden Geleitsoldaten und die Flagge auf meinem Boote mochten sie glauben machen, es befände sich ein hoher Mandarin an Bord, und Mandarine erfreuen sich auf Reisen der umfassendsten Privilegien.
An den Ufern mehrten sich die Ansiedlungen, Dörfer, Städte, ja ich gewahrte mitten in dem Gewirre von Häusern, Tempeln mit kurios geschwungenen Dächern und mehrstöckigen Pagoden schon große Fabriken mit rauchenden Schornsteinen, das sicherste Zeichen europäischer Kultur und der Nähe einer europäischen Niederlassung. Der Kanal war hier an sechzig bis achtzig Meter breit, und hatte schon[S. 228] auf der bisher zurückgelegten Strecke der ungemein lebhafte Verkehr mein Staunen erweckt, so überstieg derselbe hier in der Nähe von Tientsin alles, was ich in China bisher gesehen. Es war im Grunde genommen begreiflich, denn der Kanal ist ja eine große Verkehrsroute, ähnlich wie eine unserer Haupteisenbahnlinien. Auf diesen sehen wir vielleicht alle Viertelstunden Züge laufen, aber die Größe des Verkehrs lernen wir erst in den Bahnhöfen der Hauptstationen kennen. Tientsin ist eine derartige Hauptstation des Kaiserkanals, sogar die wichtigste und größte desselben auf seinem ganzen achtzehnhundert Kilometer langen Wege von Hangtschou bis Tungtschou bei Peking. Bei einer nach Hunderttausenden zählenden Menge von Fahrzeugen kann man sich leicht vorstellen, was das heißt. Schon einige Kilometer vor Tientsin war der Kanal von diesen Booten buchstäblich bedeckt; lange Reihen davon lagen dicht neben- und ineinander, vielleicht fünfzig oder noch mehr der Breite nach von Ufer zu Ufer, und das Fortkommen wurde so schwierig, daß meine Bootsleute das Segel einziehen und, sich mit Händen und Füßen gegen die umliegenden Boote stemmend, den Weg für mein Fahrzeug bahnen mußten.
Es dauerte mehrere Stunden, ehe wir wirklich nach der Millionenstadt Tientsin gelangten. Obschon ich diese zweitgrößte Stadt des Reiches der Mitte von früher kannte, sah ich doch erst diesmal den am meisten malerischen, eigenartigsten Teil derselben, jenen, in welchem sich der großartigste Verkehr von ganz China konzentriert. Vom Verdecke meines Bootes sah ich das Häusermeer dieser großen Handelsmetropole mit ihren bis in den Kanal gebauten Warenlagern. Auf beiden Ufern drängten sich Hunderttausende geschäftiger Menschen mit Lasten beladen, Lasten ziehend, Karren führend, im Karren sitzend, zu Pferd oder Maultier oder in Sänften getragen; in den engen Straßen wälzte sich diese Menschenmasse, absonderlich, bunt, lärmend, gestikulierend, auf und nieder. Buntbemalte Mauern, Pagoden, Tempel, Ehrenpforten, Mandarinsyamen mit hohen Flaggenstangen, Tausende von bemalten oder vergoldeten Aushängeschildern in den Straßen, Farbe, Leben, Bewegung, Lärm überall, am meisten aber auf dem Kanale selbst, wo sich Zehntausende von Booten drängten, Boote in allen Farben, mit grotesken Ornamenten bemalt, mit roten Beschwörungszettelchen beklebt; auf dem Bug glotzten ungeheure Fischaugen, auf den Masten wehten lustig bunte Wimpel, am Steuer flatterten allerhand Flaggen mit eigentümlichen großen Schriftzeichen, und auf jedem Verdeck arbeiteten, schrieen Dutzende von Menschen. Die Boote waren so dicht nebeneinander, daß ich bequem, von einem zum andern springend, ans Festland hätte gelangen können. Wo diese Boote wohl herkamen? Wo sie hinwollten? Was sie für Lasten, für Waren haben mochten? Die Menschen, die sie bemannten, waren in ihrem Aussehen verschieden, sie sprachen verschiedene Sprachen, stammten aus den verschiedensten Teilen dieses ungeheuren, einen halben Kontinent umfassenden Reiches, aber es waren doch durchweg Chinesen, nicht ein einziger Angehöriger einer fremden Nation befand[S. 229] sich unter ihnen, nur ich allein. Selbst in Canton oder Peking oder Shanghai habe ich keinen so großartigen, so erdrückenden Eindruck des ungeheuren Handels und Wandels der Chinesen bekommen wie hier, während der Stunden, die ich mit meinem Boote auf dem Kaiserkanal in Tientsin zubrachte.
Mit unglaublichen Anstrengungen hatten wir endlich die große Brücke erreicht, welche die beiden Stadthälften miteinander verbindet, und auf welcher täglich Hunderttausende von Menschen, Wagen, Karren, Pferden, Maultieren, Kamelen verkehren; doch ist diese Brücke vielleicht die elendeste irgend einer Großstadt des Reiches. Auf unförmigen Pontons liegen lose Querbalken, zerfahren, holperig, mit Löchern und fußbreiten Spalten, ohne Geländer gegen das Wasser, so daß nicht selten Passanten, ja Wagen und Pferde darüber hinausgedrückt werden und in den Kanal stürzen.
Mein Kapitän meinte, hier müßte ich landen, denn die Brücke könnte nicht geöffnet werden. Das Landen und Ausladen meiner Gepäckstücke war aber inmitten dieses Wirrwarrs zu Wasser und zu Lande eine Unmöglichkeit. Ich sandte also meinen Boy mit meinem Reisepaß zum Brückenmandarin mit der Bitte, die Brücke öffnen zu lassen. Eine halbe Stunde verrann, dann erhielt die Brückenmannschaft den Befehl, mein Boot durchzulassen. Gongschläge warnten die Passanten. Wie besessen stürzten noch alle, die auf der Brücke waren, hinüber und herüber, die Kutscher hieben auf ihre Pferde ein, daß die Karren aus den holperigen Balken fußhoch emporsprangen. Die Sänftenträger rannten, was sie konnten, und selbst als die Brücke schon ein, zwei Schritte weit geöffnet war, sprangen noch die guten Leutchen über den Spalt. Endlich war der Raum breit genug, um durchzufahren. Jenseits aber war das Gedränge der Boote womöglich noch dichter, und ich sah gar keine Aussicht, durchzukommen. Da nahte sich mir, von Boot zu Boot springend, ein junger Mandarin, das bezopfte Haupt von einem Tellerhute mit weißem Knopfe bedeckt, in der Rechten eine Waffe wie eine lange Cirkuspeitsche. Der Peitschenstiel war ein dickes Bambusrohr, so lang wie eine Angelrute, und daran hing ein mehrere Meter langer, mehrfach geknoteter Strick. Nachdem er vor mir den Kautau gemacht, stellte er sich auf den Bug meines Bootes und übernahm die Führung desselben auf so eigentümliche und geschickte Art, daß ich ihn wahrhaftig bewunderte. Er schrie nicht und gestikulierte nicht, ganz gegen alle Chinesenart. Er gebrauchte nur seine Peitsche. Mit raschem Blick hatte er die Sachlage übersehen und wußte genau, auf welchem Wege er mich durch das Labyrinth von Booten in freies Fahrwasser bringen konnte. Dazu mußten die Boote, die fünf, sechs Reihen breit vor uns lagen, Platz machen. Er sprang zunächst über mehrere hinweg und ließ dann seine Peitsche sprechen. Mit unglaublicher Sicherheit fiel das Peitschenende auf den Rücken des betreffenden Kapitäns, und kaum hatte dieser den Schlag empfangen und, sich umwendend, den Mandarin erkannt, als er auch schon sein Boot weiter[S. 230]führte, um dem nächsten Platz zu machen. Abermals spielte die Peitsche, das zweite Boot wurde in den vom ersten geräumten Platz gedreht, und so ging es fort, bis wir um eine Bootslänge vorwärts konnten. Dann wiederholte sich die Taktik des Mandarins bei der nächsten Reihe, dann bei der dritten, und eine halbe Stunde später waren wir im freien Fahrwasser. Nun machte der Mandarin wieder seinen Kautau, nahm von mir einen Vierteldollar Trinkgeld dankbar entgegen und ließ sich, auf das nächste Boot springend, von diesem ans Ufer rudern.
Ich war in Tientsin. Zu meiner Linken erhob sich der Yamen des Vicekönigs von Petschili, während so langer Jahre die Residenz von Li-Hung-Tschang, und ein paar hundert Schritte weiter sah ich die neuerstandene französische Kirche mit ihren Türmen und kaiserlichen Schutztafeln, im Jahre 1897 aus den Trümmern jener Kirche wieder erbaut, die vor einunddreißig Jahren von fanatischen Chinesen geplündert und verbrannt worden war. Eine Stunde später legte mein Boot am Bund der europäischen Ansiedelung, dem Astor Hotel gegenüber, an, meine Irrfahrten im chinesischen Lande waren vorüber, ich befand mich wieder unter Europäern.
Von Tientsin wird im Abendlande vielfach als von einer Seestadt, dem Hafen Pekings und der Hauptstadt der Provinz Petschili, gesprochen; aber alle drei Bezeichnungen sind nur in beschränktem Grade richtig. Tientsin ist keine Seestadt, sondern liegt etwa fünfzig Kilometer vom Meere entfernt; es ist wohl in mancher Hinsicht der Vorhafen von Peking, hat aber die Hauptstadt des Reiches der Mitte an Bedeutung und Größe weitaus überflügelt. Während man Peking als eine Millionenstadt anzusehen pflegt, besitzt es thatsächlich kaum eine halbe Million Einwohner; dagegen hat Tientsin deren weit über eine Million und ist nach Canton die bevölkertste Stadt von China, in seinem Verhältnis zu Peking etwa ähnlich wie Amsterdam oder Rotterdam zum Haag; Tientsin ist auch nicht die Hauptstadt der Provinz Petschili, diese ist das kleine Paoting-fu. Der Umstand, daß der letzte Vicekönig der Provinz, Li-Hung-Tschang, den größten Teil des Jahres in Tientsin zu verweilen pflegte, mag die Ursache dieses Irrtums sein.
Tientsin, zu deutsch Himmelsfurt, ist im Grunde genommen eine Inlandstadt, rings umgeben von weiten, vollkommen flachen Niederungen, in denen man vergeblich einen Felsen oder auch nur einen Stein suchen würde. Auf Hunderte Kilometer nach Nord und Süd ist das Land Alluvialboden, die Anschwemmung des von Nordwesten kommenden, wasserreichen Peihoflusses, zu deutsch „Fluß des Nordens”, dessen Schlamm- und Erdmassen mit der Zeit die Westhälfte des Golfs von Petschili ausfüllen werden. Schon jetzt wird die Schiffahrt in dem Golf durch zahlreiche Untiefen erschwert, und die Barre, welche der Peihofluß vor seiner Mündung aufgeworfen hat, macht es den Dampfern unmöglich, zur Ebbe in den Fluß einzufahren. Richten die Seedampfer ihre Abfahrtszeit von Shanghai oder Tschifu nicht so ein, daß sie zur Flutzeit die Peihomündung erreichen, so müssen sie vor der Barre liegen bleiben, und oft sehen die Passagiere der ankommenden Dampfer dort ein Dutzend oder mehr Schiffe vor Anker liegen.
Haben die Lotsen die Dampfer glücklich über die Barre geführt, so dauert es immer noch einen Tag Flußfahrt, um Tientsin zu erreichen, denn obschon die geradlinige Entfernung von dieser Handelshauptstadt des nördlichen China nur etwa[S. 232] fünfzig Kilometer beträgt, muß das Schiff doch auf seiner Fahrt den vielen Flußwindungen folgen, welche diese Entfernung mehr als verdoppeln. Diese Flußfahrt ist wohl eine der eintönigsten, die man unternehmen kann, an jene auf dem unteren Mississippi zwischen dem Golf von Mexico und New-Orleans erinnernd. Ganz wie dort, befindet sich auch hier an den schlammigen Mündungen ein elendes Dorf, die Wohnungen der Lotsen und Fischer enthaltend, das in der neuesten Geschichte Chinas so berühmt gewordene Taku, zu deutsch Große Mündung. Von der Schiffsbrücke gewahrt man in der Ferne die langen Linien der Takuforts, welche auf Veranlassung Li-Hung-Tschangs zum Teil von deutschen Ingenieuren erbaut und mit deutschen Geschützen armiert worden sind. Je weiter der Dampfer stromaufwärts dringt, desto zahlreicher werden die menschlichen Ansiedelungen, elende Dörfer mit strohgedeckten Lehmhütten, deren Farbe von jener der weiten staubbedeckten Ebene kaum absticht. Soweit man sehen kann, kein Baum, kein Strauch; Grabhügel sind streckenweise die einzigen Erhebungen über dem Boden, Gräber, Tausende und Abertausende an der Zahl, einzeln oder gruppenweise beisammen, wahre Totenstädte. An manchen Stellen werden sie von hohen, schmutzigweißen Salzpyramiden oder Ziegelbrennereien überragt.
An den Ufern des schmutziggelben, etwa ein Kilometer breiten Stromes tummeln sich zwischen zahllosen schwarzen Schweinen nackte Kinder umher und baden sich in der Brandung, welche der Dampfer aufwirft. In der Umgebung der Dörfer arbeiten fleißige Mongolen in den Getreide- und Reisfeldern. Mit einem ungeheuern Strohhut als einziger Bekleidung, versetzen sie die zarten Reispflanzen, graben oder schöpfen Wasser aus dem Fluß; an manchen Uferstellen knarren und quietschen Wasserräder, von Büffeln getrieben, auf deren Rücken kleine Chinesen hocken; hier und da wird das Wasser auch von Windmühlen emporgehoben, die aber nicht, wie die unserigen, ihre Segel auf senkrechten, sondern auf wagerechten Flügeln tragen und aussehen wie riesige Haspelräder. Armut und Elend, wohin man blickt. Selbst die zahlreichen Dschunken, welche den Fluß bevölkern, sehen ärmlich und schmutzig aus im Vergleich zu jenen von Canton und Futschau.
Nur mühsam kommen die großen Dampfer in dem vielgewundenen Strome vorwärts. Zuweilen fahren sie beim Ausweichen anderer mit dem Bug in ein Reisfeld und können nicht weiter vorwärts; dann müssen die chinesischen Schiffskulis ans Land, um mit Seilen und Stangen das Schiff wieder in den Strom zu bringen. Die Passagiere auf dem Verdeck haben fortwährend ihre Plätze zu wechseln, wollen sie sich gegen die Sonnenglut schützen; bald scheint die Sonne von rechts, bald von links, bald von hinten oder vorn, so stark sind die Flußkrümmungen, denen das Schiff folgen muß. Sie bringen die Passagiere fortwährend aus der Orientierung. Ortschaften, die man auf der einen Seite gesehen hat, gewahrt man bald darauf[S. 234] auf der andern; dieselben Schiffe sieht man bald nach Westen, bald nach Osten dampfen, und dabei hat es den Anschein, als führen sie auf dem trockenen Lande, denn vom Flusse selbst hat man seiner Krümmungen wegen gewöhnlich nur ein kurzes Stück vor sich.
Diese Tiefebene wäre ein reich gesegneter, fruchtbarer Länderstrich, würde sie nicht so häufig von furchtbaren Ueberschwemmungen, abwechselnd mit anhaltender Dürre, heimgesucht werden. Die Verwüstungen, welche die Elemente hier zeitweilig anrichten, spotten der Beschreibung.
Unter solchen Verhältnissen darf der Reisende über die Armut und das Elend, welches auf der Tiefebene zwischen Taku und Tientsin ihm überall entgegentritt, nicht überrascht sein. Im Gegenteil, es ist zu staunen, daß die Bevölkerung innerhalb der letzten Jahre mit so großem Fleiß wieder die Kulturen hergestellt, die Dörfer wieder aufgebaut hat. Die Zahl der letzteren mehrt sich, je näher man an Tientsin herankommt. Auch die Vegetation wird üppiger, man gewahrt sogar den lange auf weiten Strecken vermißten Baumwuchs. Gegen Nordwesten erscheinen[S. 235] die zahlreichen rauchenden Schornsteine und Gebäude des von Li-Hung-Tschang geschaffenen Arsenals, und bald darauf geht der Dampfer vor der Fremdenstadt am Tientsin vor Anker.
Engländer, Deutsche und Amerikaner, im ganzen kaum tausend Seelen, haben hier und am Südufer des etwa 120 Meter breiten Stromes ein kleines, reizendes Städtchen geschaffen. Mit seinen geraden, von Bäumen beschatteten Straßen und hübschen einstöckigen Häusern in modernem Baustil ließe dasselbe ganz vergessen, daß man sich nicht in Europa, sondern im nördlichen China befindet, wenn nicht auf dem schattigen Bund und an dem davorliegenden Flußufer Tausende langbezopfter Chinesen schreiend und stoßend sich drängen würden, beladen mit Kisten und Säcken, Lasten aller Art, die aus den Schiffen auf den Bund getragen und dort bergehoch aufgetürmt werden. Tientsin ist ja der Hauptstapelplatz und Hauptmarkt des ganzen chinesischen Nordostens, und dabei ist die Geschäftszeit auf neun Monate im Jahre beschränkt. Von Mitte Dezember bis Mitte März ist der Fluß, die große Verkehrsstraße, von welcher Tientsin lebt, gewöhnlich durch Eis gesperrt, und obschon die Chinesen auch dann noch Waren mittels Segelschlitten flußauf und flußab befördern, reicht dieser Transport über das Eis doch lange nicht hin, um den gewaltigen Warenverkehr zu bewältigen. Immer höher werden die Warenberge auf dem Bund; jenseits des Flusses, auf dem Nordufer, gewahrt man noch höhere Berge von Getreide- und Reisfässern, Theekisten, dazu große Pyramiden von Salz, das gerade in der Umgebung von Tientsin massenhaft gewonnen wird und ein Monopol der chinesischen Staatsregierung bildet. Neben diesen Artikeln bilden die Hauptausfuhr Tientsins: Bohnen, Strohgeflechte, Erbsen, Datteln, Kamelhaar, Schafwolle und dergleichen, während die Haupteinfuhrartikel Opium, Baumwollstoffe, Fensterglas, Zucker, Stahl- und Eisenwaren, endlich Papier sind. Der Handel, hauptsächlich in den Händen englischer und deutscher Firmen liegend, ist in den letzten Jahren sehr bedeutend gestiegen, und Tientsin ist heute die dritte Handels- und Hafenstadt Chinas, nur von Hankau und Shanghai übertroffen.
In der Fremdenkonzession von Tientsin, von den Chinesen „Tze-ku-lin”, d. h. Bambusgebüsch, genannt, waren nach dem letzten Bericht des chinesischen Zolldirektors 16 englische, 15 deutsche, 5 französische und je 3 amerikanische, japanische und russische Firmen ansässig, mit 852 Europäern, darunter 380 Engländer, 200 Amerikaner und 60 Deutsche. Gerade so wie Shanghai, besitzt auch Tientsin auf seiner Konzession mehrere Klubs (darunter einen deutschen), Kirchen, Hotels, Konsulate, Kaufläden, und das gesellige Leben ist ein sehr reges. Die dort erscheinende Wochenschrift Peking and Tientsin Times ist eines der besten fremdsprachlichen Blätter von China.
Etwa drei Kilometer oberhalb der Fremdenkonzession oder dem Settlement, wie es die Europäer nennen, dehnt sich an beiden Ufern des Peiho die Chinesenstadt[S. 236] Tientsin aus. Die innere Stadt ist ebenso wie die meisten andern Städte mit einer Ringmauer umgeben, über welche hinaus sich in den letzten Jahrzehnten mehrere große Vorstädte entwickelt haben, volkreicher, belebter und geschäftiger als die innere Stadt. Um diese Vorstädte und das fremde Settlement wurde in den siebziger Jahren noch eine zweite Erdmauer und ein breiter tiefer Wassergraben gezogen in einem Umfang von über dreißig Kilometern. Etwa im Stadtmittelpunkte von der Südseite her mündet der Große Kanal, der allerdings durch die Seeschiffahrt und langjährige Vernachlässigung von seiner früheren Bedeutung etwas verloren hat, aber immerhin noch in hervorragender Weise zur Warenbeförderung benutzt wird.
Für die Fremden, welche schon andere chinesische Städte kennen gelernt haben, bietet die Millionenstadt Tientsin nur sehr wenig von Interesse. An Sehenswürdigkeiten nach unseren Begriffen hat sie kaum irgend etwas aufzuweisen. Sie besitzt keine großen Tempel, Pagoden, Plätze, Paläste; die Wohnungen der Reichen sind gewöhnlich von hohen Mauern umschlossen und auch vom Yamen des früheren mächtigen Vicekönigs ist nichts zu sehen als die große, von Soldaten bewachte Pforte. Selbst wem vergönnt war, in das Innere des Yamens zu dringen und von Li-Hung-Tschang empfangen zu werden, wird außer der gewaltigen Persönlichkeit des letzteren wenig bleibende Eindrücke mit sich genommen haben. Wie alle anderen Yamen in den Provinzhauptstädten enthält auch jenes von Tientsin mehrere Höfe mit ebenerdigen Gebäuden, die sich keineswegs durch ihre Architektur oder durch besondere Reinlichkeit auszeichnen. Nur hat der Vicekönig, seiner Vorliebe für fremdländische Einrichtungen entsprechend, zwei oder drei Räumlichkeiten neben seiner Privatwohnung europäisch möblieren lassen.
Das einzige, wodurch sich Tientsin vor anderen chinesischen Städten, besonders den südlichen auszeichnet, sind seine breiten Straßen und das ungemein rege Leben, das sich in ihnen zeigt. Ich habe dasselbe bereits im vorstehenden Kapitel geschildert. Nirgends, weder in Shanghai noch in Canton, noch in Hankau wird man einen derart lebhaften Verkehr finden wie hier, in der Stadt sowohl wie auf dem Flusse.[S. 237] Auf dem letzteren drängen sich die alten malerischen Dschunken, chinesische Kanonenboote, Schleppdampfer, Ruderboote so sehr, daß sie mitunter das Flußbett vollständig bedecken und man des Wassers kaum ansichtig wird. Und trotz der großen Breite der Straßen kann man sich oft nur mit Mühe zwischen den Menschen, Kamelen, Maultieren, Eseln, Lastwagen und Schubkarren Bahn brechen. Wohin der Weg auch führen mag, überall dasselbe rege, lärmende Leben, derselbe Verkehr. Die ganze Bevölkerung scheint tagsüber auf der Straße zu sein und dringenden Geschäften nachzujagen, als wären sie lauter Börsenspieler, bei denen in Minuten Tausende auf dem Spiele stehen. Im Gegensatz zu den engen Gäßchen der zweiten Millionenstadt Chinas, Canton, welche einen anderen Verkehr als zu Fuß oder in der Sänfte gar nicht ermöglichen, wird hier viel auf Maultieren und Eseln geritten, und an den Straßenecken stehen tagsüber lange Reihen dieser Tiere, gesattelt und auf Kunden harrend, wie in unseren Städten die Droschken. Auch die japanische Rickshaw, der zweiräderige, von Kulis gezogene Handwagen, hat hier schon ebenso wie in Shanghai ihren Einzug gefeiert, aber für die unteren Volksklassen der Chinesen ist doch der Schubkarren noch immer das beliebteste Beförderungsmittel geblieben, weil es das wohlfeilste ist. Die Chinesen benutzen diese Schubkarren[S. 238] nicht nur für Personenverkehr, sondern auch zum Transport kleinerer Lasten, der Hauptfrachtenverkehr aber wird durch die Kamele und zweiräderigen Lastkarren vermittelt, beides Erscheinungen, die in den südlich gelegenen Städten und selbst noch in Shanghai unbekannt sind. Sie bringen einige Abwechselung in die sonst große Eintönigkeit des chinesischen Straßenverkehrs, der, wie bemerkt, in solcher Lebhaftigkeit nicht nur in China, sondern auch in ganz Asien nur an wenigen Orten angetroffen wird.
Mitten in Tientsin, an den Ufern des breiten, lebhaften Stromes, erhebt sich seit Ende der neunziger Jahre wieder die katholische Kathedrale, welche in dem berüchtigten Aufstand des Jahres 1870 von fanatischem Pöbel am 21. Juni zerstört worden war. Mit ihr wurden damals das französische Konsulat und das Kloster der Lazaristen verbrannt, die Priester, Nonnen und eine Anzahl anderer Europäer wurden in grausamster Weise ermordet. Die chinesische Regierung wurde veranlaßt, den Hinterbliebenen eine Entschädigung von zwei Millionen Taels zu zahlen und die zerstörten Gebäude wieder zu errichten, aber es hat beinahe drei Jahrzehnte gebraucht, bis diese Gebäude vollendet waren. Heute erheben sich vor der imposanten Kathedrale auf einer gemauerten Plattform noch zwei offene Pavillons, welche steinerne kaiserliche Schutztafeln bergen, zur Verhinderung ähnlicher Angriffe[S. 239] seitens des fremdenfeindlichen Pöbels. Von dem vielgerühmten Wirken des langjährigen Vicekönigs von Tschihli, Li-Hung-Tschang, sieht man in Tientsin ebenso wie in der Provinz nur wenig. Er hat seine Thätigkeit hauptsächlich der Einrichtung von Verteidigungsmitteln zugewendet, wohl in Vorahnung des Krieges mit den Japanern; er hat die Kriegsmarine von China geschaffen, die Festungswerke an der Mündung des Peiho und weiter stromaufwärts anlegen lassen, das Arsenal gebaut, eine Kriegsschule, sogar ein Hospital gegründet; während früher der Frachtenverkehr zur See zum weitaus größten Teile durch Schiffe unter fremdländischen Flaggen vermittelt wurde, ist es ihm zu danken, daß eine chinesische Dampfergesellschaft, die China Merchant Company, fast ebensoviele Frachten Tientsins befördert wie die englischen Schiffe; Li hat auch die Telegraphenverbindung mit Peking und anderen Inlandstädten, ferner die Eisenbahn nach den Kai-ping-Kohlenminen zu stande gebracht. Aber für die Hebung des Wohlstandes im Volke ist nur wenig geschehen. Vielleicht besaß er die Macht und die Mittel nicht, um jene Werke zu schaffen, die Tientsin, Peking und der ganzen Provinz vor allem andern not thun: die Eisenbahn nach Peking, die Vertiefung und Ausbesserung des immer mehr verfallenden großen Kanals, dieser einzigen Landverkehrsroute mit dem Süden, dann die Entwässerung der Provinz, die Regulierung des Peihoflusses.
Die großen Katastrophen, welchen der Wohlstand der Provinz zum Opfer gefallen ist, hätten doch zur Lehre dienen sollen, daß vor allem für ein Kanalsystem zur Entwässerung der Tiefebenen zu sorgen war. Millionen und Millionen Menschen waren durch die Ueberschwemmungen jahrelang brot- und erwerbslos geworden; statt viele Millionen Goldes zum bloßen Lebensunterhalt dieser Menschenmassen zu opfern, hätte man diese Arbeitskräfte zur Herstellung der erforderlichen Kanalisierung heranziehen sollen; sie wären zu spottbilligen Preisen zu haben gewesen. Nicht für den Krieg allein war zu sorgen, sondern auch für den Frieden, für den Handel, und dieser ist durch das allmähliche Verseichten des Peiho unendlich bedroht. Aehnliche Verhältnisse lagen vor zwei Jahrzehnten an der Mündung des Mississippi vor; ganz wie der Peiho zeigte sein Stromlauf vielfache Windungen, und seiner Mündung lag eine Schlammbank vor. Wenige Millionen Dollars haben hingereicht, die störendsten Flußkrümmungen im Unterlaufe abzuschneiden, den Flußlauf dadurch zu verkürzen, das Gefälle zu vergrößern und so zu ermöglichen, daß in derselben Zeit eine erheblich größere Wassermenge abfließt; so wurde die Ueberschwemmungsgefahr für die Uferländer des Mississippi verringert. Statt die Barre an der Mündung dieses Stromes mühsam auszubaggern, hat sie Kapitän Eads durch den Strom selbst wegreißen lassen, indem er bis nahe an die Barre die reißenden Wassermassen des Mississippi durch weit über die Meeresküste hinausreichende künstliche Dämme zusammenhielt. Aehnliches hätte mit erheblich geringeren Kosten auch am Peiho geschehen können; nicht nur von der Ueberschwemmung von 1889[S. 240] wäre das Land verschont geblieben, auch die elenden Schiffahrtsverhältnisse wären dadurch wenigstens zum großen Teile beseitigt worden. Erst dem jetzigen Nachfolger Lis bleibt es vorbehalten, die Eisenbahn nach Peking zu bauen, und die Reise nach der nur hundertzwölf Kilometer entfernten Reichshauptstadt, die bisher mühsam in zwei Tagen zurückgelegt werden konnte, beansprucht jetzt kaum vier Stunden. Aber die Regulierung des Peiho und des ganzen Flußnetzes steht noch in weitem Felde. Erfolgt sie einmal, so wird Tientsin einen weiteren und noch größeren Aufschwung erfahren als seit seiner Eröffnung für den Fremdenverkehr im Jahre 1858.
Es dürfte auf dem Erdball kaum eine Stadt mit größerem Namen geben, die diesen letzteren so wenig rechtfertigen würde wie Peking. Alle Illusionen werden dort schon am ersten Tage unter erstickendem schwarzen Staube begraben oder in stinkenden Pfützen ertränkt, und je größer die Sehnsucht war, nach der Hauptstadt des Mongolenreiches zu kommen, desto größer ist gewöhnlich schon nach eintägigem Aufenthalt die Sehnsucht, Peking wieder zu verlassen. In keiner Weltstadt wird das „man war dort gewesen” teurer erkauft, von keiner ist die Erinnerung weniger befriedigend. China ist ja bekannt als ein Land voller Widersprüche, aber der auffälligste derselben ist vielleicht Peking selbst. Durchzieht man im Geiste die Welt, so wird man finden, daß die Hauptstädte aller Länder ein Zehntel bis ein Dreißigstel der Gesamtbevölkerung derselben enthalten. Peking aber, dessen Einwohnerzahl man sich in Europa noch vor gar nicht langer Zeit mit jener Londons wetteifernd dachte, hat wenig mehr als eine halbe Million Einwohner, ein Achthundertstel der Gesamteinwohnerzahl des Reiches. Peking ist die Residenz eines Kaisers, der den Namen „Sohn des Himmels” und „Bruder der Sonne” führt und unumschränkter Beherrscher des größten und ältesten Reiches der Erde ist, eines Reiches, das schon vor Jahrtausenden hohe Kultur besaß, also zu einer Zeit, als wir Europäer überhaupt noch kein menschenwürdiges Dasein hatten. Sehen wir anderswo Länder von Jahrtausende alter Geschichte, so strotzen sie von Denkmälern hoher Kunst, die wir mit Staunen betrachten. Aber vergeblich sieht man sich in[S. 242] der Hauptstadt des ältesten aller Länder, in Peking, nach solchen um; es gleicht eher der Hauptstadt eines Nomadenvolkes, das seine Zelte aus Holz und Ziegel erbaut hat. Von der Pracht und Herrlichkeit des ältesten Kaiserthrones dieses Erdballs sind nur wenige Spuren zu sehen.
Wie die meisten Hauptstädte geistig und schöpferisch die Mittelpunkte der einzelnen Reiche sind, von denen das ganze Leben derselben ausstrahlt, der Verkehr pulsiert, der Kreislauf der Regierungsmaschine ausgeht, so sind sie auch in geographischer Hinsicht im Herzen ihrer Länder gelegen, oder sie entwickelten sich an günstigen Verkehrspunkten, an großen Stromläufen, an Meereshäfen. Die Hauptstadt des Mongolenreiches aber liegt am Nordostende des letzteren, an keinem Flusse, an keinem Meere, sondern in einer staubigen, wenig fruchtbaren, Ueberschwemmungen ausgesetzten Ebene, und vergeblich fragt man sich, warum diese Hauptstadt gerade dort angelegt worden ist. Begegnen wir in unserem Leben etwas Unbegreiflichem, Widersinnigem, so bezeichnen wir es mit Recht als chinesisch. Am allerersten[S. 243] läßt sich das auf Peking selbst anwenden. Wer Indien, Siam, Birma, Kambodscha gesehen hat, der erwartet in der Residenz des größten asiatischen Reiches Paläste, große Tempel, Pagoden ähnlicher Art wie dort. Ja, diese Erwartungen werden noch bestärkt, wenn man Tungtschau, die letzte Etappe auf der Flußreise von Tientsin nach Peking, oder mit der Eisenbahn kommend, die weit außerhalb der Ringmauern gelegene Bahnstation verlassen hat und sich auf den aller Beschreibung spottenden, mit fußhohem Staub bedeckten oder vor Schlamm grundlosen Wegen den ungeheuren Mauern nähert, welche die Hauptstadt des Chinesenreiches umschließen. Fünfzehn Meter hoch, verstärkt durch mächtige, gemauerte Bastionen, erhebt sich dieses Bollwerk über die weite, niedrige, von Gärten und Feldern eingenommene Umgebung. Auf Tausende von Metern kann man es verfolgen, bis es in dräuenden, mehrere Stockwerke hohen Ecktürmen sein Ende erreicht. Der Weg führt zu einem weiten Flügelthor, von einem mächtigen Aufbau mit dreifachem, geschwungenem Dach gekrönt. Je mehr wir uns der Mauer, hinter welcher Peking liegt, nähern, desto reger wird der Verkehr. Wie um den Eingang zu einem ungeheuren Bienenkorbe drängt sich hier alles Leben zusammen, Tausende von Fußgängern, Lastträgern, Reitern auf Mauleseln und Kamelen, Sänften, getragen von vier und sechs Trägern, ganze Karawanen von Kamelen, mit schweren Lasten beladen, alles schreiend, gestikulierend, stoßend, drängend, und wir wundern uns, wie all diese Massen in dem finsteren, tunnelartigen Thorwege Platz finden können. Noch größer aber ist die Verwunderung darüber, daß von all den Tausenden Mongolen an den Thoren der Hauptstadt eines dem Europäer feindlich gesinnten Reiches unter gewöhnlichen Umständen kein einziger den reisenden Fremdlingen auch nur durch Blicke oder Gesten irgend welche Feindschaft zeigt. Wir sind mitten in dem Gedränge von Fußgängern und Reitern und Lasttieren, aber während sie einander drücken und stoßen, machen sie dem Europäer freundlich Platz. Die Soldaten der Thorwache verlangen keinen Reisepaß, unbehindert gelangen wir durch das finstere Thor und sind in Peking. Lasse man doch ein paar reisende Chinesen durch die Vorstädte unserer europäischen Metropolen einziehen! Wie würde der Janhagel sie umdrängen, begaffen und belästigen!
Peking ist eine der ältesten Städte der Welt. In den chinesischen Annalen erscheint sie unter dem Namen Ki schon im zwölften Jahrhundert vor Christi Geburt; aber erst Kublai-Chan, der Enkel des großen Mongolenführers Dschingis-Chan, gab ihr ihre heutige Gestalt und Ausdehnung. Marco Polo, der berühmte Venezianer, schilderte sie, als sie noch den Namen Kambalik führte. Den Namen Peking oder vielmehr Bedsching (Residenz des Nordens) erhielt sie erst im Jahre 1409, als sie zur Hauptstadt des chinesischen Reiches erhoben wurde. Die Chinesen selbst nennen Peking einfach Kingtscheng, d. h. die Residenz, auf den chinesischen Landkarten aber ist sie als Tschun-tien-fu bezeichnet. Die gewaltigen Ringmauern und[S. 245] Türme, mit denen sie heute umgeben ist, wurden in der ersten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts erbaut. Als die siegreichen Mandschu sich ein Jahrhundert später Pekings bemächtigten, setzten sie sich in der nördlichen Hälfte fest, ihr Anführer, der Gründer der noch heute regierenden Dynastie, bezog die alten Paläste der Mongolenfürsten und relegierte die Chinesen in die südliche Hälfte der Stadt.
Mit dem Betreten der Hauptstadt beginnt die Enttäuschung, die mit jedem Schritte, mit jeder Stunde des Aufenthaltes sich steigert. Wo ist auch nur die Stadt? Auf weite Strecken Staub und Sümpfe, hier und da ein elendes Chinesenhäuschen, keine Straßen, keine Paläste, keine Pagoden, ganz wie ich es in der alten Hauptstadt des Reiches, in Nanking, gefunden habe. Erst nach langem, ermüdendem Ritt über die elendesten Wege beginnt das Gewirr schmutziger, mit niedrigen Häuschen besetzter Straßen, dicht gedrängt mit ebenso schmutzigen, ärmlichen Leuten. Auch wenn die zweite, die Chinesenstadt von der Tatarenstadt trennende Mauer passiert ist, es wird nicht besser; wir sind endlich in der Straße der Gesandtschaften, ohne daß ihr Aussehen es irgendwie, höchstens durch die Flaggenstangen über den niedrigen Thoreingängen, verriete. Auch das einzige Hotel der Reichshauptstadt Chinas befindet sich hier, kaum bescheidenen Ansprüchen genügend. Und diese schmutzstarrenden Straßen, diese armseligen Mauern und ärmlichen Kaufläden bilden Peking? Sollte es doch nicht irgendwo bessere Stadtteile mit Palästen und schönen Tempeln, mit reinlichen Straßen und Plätzen geben?
Die große Umfassungsmauer, die wir bei unserem Einzuge bewundert haben, ist in Peking wie in jeder anderen Stadt Chinas gleichzeitig das bedeutendste Bauwerk. In der Größe und Mächtigkeit ihrer Ringmauern sind die Chinesen wohl unübertroffen. Hier am Fuße der Ausläufer des mongolischen Hochlandes umschließen sie in einem länglichen Rechteck gegen fünfundsechzig Quadratkilometer Landes, etwa die gleiche Fläche wie Berlin, aber da die Bevölkerung Pekings kaum ein Drittel jener von Berlin erreicht, so ist es begreiflich, daß weite Strecken innerhalb der Ringmauern von Feldern und wüsten, unbebauten Ländereien eingenommen sind, in denen man sich ganz leicht irgendwo in der Mongolei, weit von Peking entfernt, denken könnte. Nur die mittleren Teile des großen Rechtecks sind wirklich mit Häusern und Straßen besetzt.
Das Merkwürdigste der letzteren ist wohl ihre Regelmäßigkeit. Ich kenne in der Alten und Neuen Welt wenige Städte, die so abgezirkelt wären, wie Peking. Unsere alten Städte zeigen ein Gewirr krummer, enger Gäßchen, als hätten ihre Gründer mit Absicht die gerade Linie vermieden. Selbst die neuesten Städteschöpfungen in den amerikanischen Prairien, die wohl einen regelmäßigen, schachbrettartigen Straßenplan haben, dehnen sich nach verschiedenen Richtungen der Prairie ungleich aus. Peking, das doch ebenfalls eine uralte Stadt ist, besitzt zunächst die genau rechteckige Umfassungsmauer der Tatarenstadt, an welche sich südlich eine ebenso regel[S. 246]mäßige Umfassungsmauer um die Chinesenstadt anschließt. Innerhalb beider Städte sind die Straßen nach Schachbrettform angelegt, nur sind jene der Chinesenstadt enger. In der Tatarenstadt sind manche Straßen wahre Boulevards, bis zu dreißig Metern Breite.
Die Umfassungsmauer der Tatarenstadt sperrt diese auch gegen die Chinesenstadt ab, ein merkwürdiges Wechselspiel! In alter Zeit erbauten die Chinesen unweit Peking die berühmte Große Mauer gegen die Tataren, und hier in der Hauptstadt Chinas erbauten die Tataren eine große Mauer gegen die Chinesen!
Das regelmäßige Straßennetz der Tatarenstadt, die entschieden die schönere von beiden ist, wird auf eigentümliche Art unterbrochen. Gewiß hat jeder in japanischen Bazars schon die viereckigen Schachteln gesehen, in denen man beim Abheben des Deckels kleinere Schachteln findet, die wieder kleinere einschließen. Aehnlich liegt innerhalb der Tatarenstadt eine zweite, mit der äußeren parallele Umfassungsmauer, welche die offizielle Kaiserstadt umschließt, und innerhalb dieser zweiten Mauer zieht sich parallel zu dieser eine dritte Mauer hin, ein Rechteck umfassend, welches die allen Europäern und Chinesen vollständig unzugängliche eigentliche Palaststadt des Kaisers und seines Hofes enthält. Drei ummauerte Städte sind auf diese Weise ineinandergeschachtelt, und an die äußerste, größte, schließt sich die durch Thore verbundene Chinesenstadt an.
Wie von den Städten, so gilt das Einschachteln und Ummauern auch von den Wohnsitzen der Prinzen, der Mandarine und militärischen Würdenträger, von den[S. 247] verschiedenen Regierungsämtern und den Yamen. Während wir unseren Gebäuden nach der Straßenseite zu die schönsten und imposantesten Formen geben, während wir sie mehrere Stockwerke hoch aufbauen, mit Türmen, Erkern und Balkonen versehen, ist in Peking, wie überhaupt in ganz China, das gerade Gegenteil der Fall. In der Tatarenstadt wandert man in den breiten, staubigen, sonnigen Avenuen zwischen niedrigen, grauen Mauern einher, die hier und da von freistehenden Thorbogen unterbrochen sind, unter deren Ziegeldächern sich in vergoldeten Lettern die Ueberschriften der verschiedenen Aemter befinden. Von den Gebäuden selbst sieht man höchstens einige mit blauen und grünen Glasurziegeln bedeckte, kurios geschwungene Dächer über die äußeren Umfassungsmauern hervorragen. Anders in der Chinesenstadt. Dort bieten die Straßen einen malerischen, belebteren Anblick dar, denn der Verkehr ist in den viel engeren Straßen auf einen kleineren Raum eingeschränkt, die Häuser enthalten überall Kaufläden der verschiedensten Art, und vor diesen sind noch in der Mitte der Straße lange Reihen von Kaufbuden aufgestellt, zwischen denen sich die Tausende und Abertausende langbezopfter Chinesen drängen. Nur hier bekommt der Fremde ähnliches Leben, ähnlichen Verkehr zu sehen wie in den anderen Hauptstädten Chinas, in Canton, Hankau, Tientsin, sofern es ihm der aller Beschreibung spottende Zustand der Straßen überhaupt gestattet. Während in unseren Ländern den Hauptstädten gewöhnlich die größte Sorgfalt gewidmet wird, ist in China das Umgekehrte der Fall. Kaum eine andere Großstadt des weiten Reiches dürfte einen ähnlichen Schmutz und Unrat zeigen wie Peking. In früheren Zeiten mag es wohl anders gewesen sein, denn noch jetzt zeigen die Straßen Spuren einstiger sorgfältiger Pflasterung. Aber in China wird selten etwas ausgebessert. Einmal gebaut, bleiben die Bauten oder Straßen sich selbst überlassen, bis sie allmählich gänzlich verfallen. Ursprünglich waren die Straßen auf eigentümliche Weise angelegt. Während wir beispielsweise die an den Straßenseiten entlang laufenden Trottoirs erhöhen und den mittleren Teil der Straße tiefer legen, ist in Peking der mittlere Fahrweg für Wagen, Reiter und Sänften erhöht, und die Seitenwege längs der Hausmauern sind tief. Freilich ist durch den regen Verkehr der Unterschied zwischen Fahr- und Fußweg an vielen Stellen verwischt worden; die Pflasterung bot den Chinesen einen bequemen Steinbruch dar, aus welchem sie sich das Baumaterial für ihre Häuser holten, und stellenweise liegt der mittlere Straßenteil sogar tiefer. Die Tausende von Fuhrwerken, Kamelen und Maultieren haben im Laufe der Jahrhunderte den Straßenboden aufgewühlt, und mit Ausnahme der sommerlichen Regenmonate sind die Straßen mit fußtiefem schwarzen Staub bedeckt. Durch den lebhaften Verkehr fortwährend aufgewirbelt, erfüllt dieser Staub die Atmosphäre, legt sich auf Hausdächer, dringt in die Kaufläden, lagert in dicken Schichten auf den Waren, Lebensmitteln und den Verkäufern, schwärzt die zuweilen schön bemalten und mit Vergoldungen geschmückten Häuserfronten, eine furchtbare,[S. 248] ekelerregende Plage, wenn man in Betracht zieht, auf welche Weise der Staub entstanden ist. Aller Unrat von Tieren und Menschen wird auf die Straße geworfen und bleibt dort liegen. Tausende und Abertausende von Lastträgern, Kutschern, Kamel- und Maultiertreibern entleeren sich täglich auf der Straße, und ertönen zur Zeit des Sonnenunterganges vor den Thoren die Gongschläge als Signal der Thorsperre, so erscheinen gewöhnlich gleichzeitig vor den Hausthüren Knechte, um dem mit dem scheußlichsten Unrat geschwängerten Staube auf eine originelle Weise noch weiteren Unrat zuzuführen. Wasser ist nämlich in Peking, das natürlich keine Wasserleitung besitzt, ein kostbarer Artikel. Wasserträger durchziehen die Straßen und verkaufen den Kübel für einige Sapeken. Ebensowenig besitzen die Häuser eigene Kloaken. Die guten Bewohner der Reichshauptstadt töten also zwei Fliegen mit einem Schlage dadurch, daß sie die flüssigen Abfälle der Häuser zum Begießen[S. 249] der Straßen verwenden. Die Knechte schöpfen den Unrat mit großen Schaufellöffeln aus den Kübeln und schleudern ihn möglichst weit über die Straße, ähnlich wie unsere Bauern ihre Felder zu düngen pflegen. Dadurch wird allerdings der Staub für ein Stündchen, gerade zur schönen, kühlen Abendzeit, gelöscht, aber in Peking wird sich dann gewiß jeder aus naheliegenden Gründen hüten, sein Haus zu verlassen.
Kommen dagegen, besonders im Juli und August, die gewöhnlich sehr heftigen Regengüsse, dann ist Peking ein einziger stagnierender Sumpf, aus welchem nur die Häuser und stellenweise der mittlere Fahrweg hervorragen. Für Fußgänger ist dann selbstverständlich der Verkehr ganz unmöglich, aber auch für Reiter und die Insassen von Sänften ist er mitunter lebensgefährlich. Der Schlamm verdeckt die zahlreichen Untiefen, und stolpern Reittiere oder die zuweilen bis über die Knie im Schlamme watenden Sänftenträger, dann purzeln gewöhnlich auch die in kostbare Gewänder gehüllten Mandarine in die stinkende Jauche. Von den beiden Uebeln, Staub und Schlamm, ist der Staub immer noch das kleinere.
Der Kaiser hat von diesen elenden, verlotterten Zuständen seiner Hauptstadt kaum eine Ahnung. Selten verläßt er die verbotene Stadt seiner Paläste, um sich nach irgend einem der großen Tempel zu Gebeten und Opfern tragen zu lassen, und dieses große Ereignis wird gewöhnlich vorher in der Regierungszeitung bekanntgemacht. Dann wird von seiten der Stadtbehörden über Hals und Kopf an der Ausbesserung jener Straßen gearbeitet, durch welche der kaiserliche Zug seinen Weg nehmen soll; der mittlere erhöhte Fahrweg wird mit gelbem Sand bestreut, die Löcher werden ausgefüllt, die Jahrmarktsbuden zu beiden Seiten geschlossen, und wo sich besonders unflätige Stellen in den Häuserreihen zeigen, werden große gelbe Tücher vorgespannt, damit ihr Anblick den kaiserlichen Augen entzogen bleibt. Auch sonst werden alle Fenster und Thüren der Häuser geschlossen, die Straßen aber für jeden anderen Verkehr abgesperrt, und während es bei uns unstatthaft ist, den Souveränen den Rücken zuzuwenden, ist dies bei den Chinesen Vorschrift.
Ja, wenn doch der Kaiser einmal unvermutet den Befehl geben würde, einen andern als den so vorbereiteten Weg einzuschlagen! Aber ebenso, wie die Chinesen Sklaven des Kaisers sind, so ist der Kaiser wieder Sklave der Traditionen und der strengen Hofetikette. Eine derartige Willensäußerung von seiten eines chinesischen Kaisers ist kaum jemals vorgekommen, wie es auch unter den verschiedenen Söhnen des Himmels niemals einen Harun al Raschid gegeben hat.
Recht drollig sind die Namen mancher Straßen der Hauptstadt. Eine Straße in der Nähe der Gesandtschaften heißt die „Straße der glücklichen Spatzen” von den zahlreichen, frechen Sperlingen, die in Peking gerade so ihr Unwesen treiben wie bei uns und im Verein mit Hunden, Raben und Tauben die einzigen Straßenreiniger sind. Eine Straße heißt Barbarenstraße (unter welchem Namen die Europäer in China bekannt sind), andere führen die Namen Affen, Gehorsam, Steinerner Tiger[S. 250] oder Unermeßbar große Straße; die verkehrsreichste und lärmendste aller Verkehrsadern aber heißt sonderbarerweise die Straße ewiger Ruhe. Sackgassen werden in China tote genannt, im Gegensatz, zu den anderen, die lebende heißen. Auch die Paläste und Tempel haben eigentümliche Namen. Der Palast des Kaisers heißt der friedliche Palast des Himmels, jener der Kaiserin der Palast der irdischen Ruhe, ein Confuciustempel heißt die Halle gespannter geistiger Uebung, und einzelne Thore führen die Namen wie: das Große Reine oder das Thor des ewigen Friedens, oder endlich das Thor der standhaften Unschuld.
Die Paläste der verbotenen Stadt bekommt der gewöhnliche Sterbliche niemals zu sehen, außer er wäre kaiserlicher Prinz, Tatarengeneral oder mandschurischer Eunuch. Selbst den Gesandten der Großmächte wurde niemals der Anblick des eigentlichen Kaiserpalastes zu teil. Gelegentlich des Neujahrsfestes wurden sie vor einigen Jahren zum erstenmal innerhalb der Umfassungsmauern des Palastes empfangen, aber auch nur in einer freistehenden, von der eigentlichen Kaiserresidenz entfernten Halle. Mandschurische Palastwachen halten jeden Unbefugten an den Thoren zurück, doch ist wenigstens die äußere oder zweite Kaiserstadt den Europäern geöffnet. Ein großer Teil derselben wird von den schattigen Anlagen des kaiserlichen Parkes eingenommen mit seinem künstlichen See, über welchen mit Statuen geschmückte hohe Marmorbrücken führen, mit seinen künstlich aufgeworfenen, tempelgekrönten Hügeln, mit Yamen und offiziellen Bauten verschiedener Art, durch ihre grünen Dächer kenntlich.
Die orangegelben Porzellandächer, welche über die roten Mauern der verbotenen oder Purpurstadt emporragen, sind jene der kaiserlichen Paläste. Die meisten anderen Hausdächer Pekings bestehen aus grauen Hohlziegeln. Das auswärtige Amt, Tsung-Li-Yamen genannt, und die ausländischen Gesandtschaften sind in ehemaligen Prinzen- oder Mandarinenresidenzen untergebracht, und wer das behagliche Innere einer solchen kennen lernen will, braucht nur eines dieser Gesandtschaftspalais mit seinen vielen Gebäuden, seinen Höfen und Gärten zu besuchen. An Sehenswürdigkeiten in unserem Sinne besitzt Peking nur wenig. Mit Ausnahme der Tempel des Himmels und der Erde am Südende der Chinesenstadt, der alten Jesuitensternwarte, der vielen Pagoden, marmornen Thore und Brücken ist in der Hauptstadt des Chinesenreiches nicht viel zu sehen. Den besten Ueberblick über die Stadt erhält man, wenn man einen Turm der katholischen Kirche besteigt oder aus der breiten äußeren Stadtmauer spazieren geht. Dort ist man wenigstens gegen den furchtbaren Staub und das Gedränge des schmutzigen Volkes geschützt, und dorthin flüchten sich auch an schönen Tagen die Mandarine zu einem Spaziergang; statt Hündchen mit sich zu führen, tragen sie vielleicht auf einem Stöckchen einen Jagdfalken, Kanarienvogel oder eine Wachtel. Von hier oben aus gesehen zeigt sich Peking viel freundlicher, denn die hohen Mauern, mit welchen die Mandarinenwohnungen umschlossen sind, verbergen diese vollständig, während man von den Stadtmauern wenigstens zwischen den Baumkronen der vielen grünen Gärten die Dächer der Häuser zu Gesicht bekommt. Jede größere Residenz hat ihren Garten, und das am meisten ins Auge fallende Objekt inmitten dieser Gartenstadt bleibt immer das Gelb der kaiserlichen Porzellandächer, so daß ein witziger Franzose einmal sagte, von der Stadtmauer aus gesehen zeige sich Peking wie eine plat d’épinard aux oeufs, eine Spinatschüssel mit einem Eidotter in der Mitte.
Bei weitem interessanter als der äußere Rahmen ist das Leben und Treiben, das sich in demselben abspielt. Von dem offiziellen Leben der Kaiserstadt bekommt man[S. 252] allerdings nur wenig zu sehen: Mandarine mit verschiedenen ihrem Rang entsprechenden Stickereien auf Brust und Rücken zu Maultier und begleitet von einem Troß von Dienern oder in Sänften, die, je nach dem Range ihres Insassen, von zwei, vier oder sechs Trägern getragen werden; mandschurische Bannersoldaten und Yamenläufer, Angestellte der Regierungsbureaus. Die Straßen der Tatarenstadt zeigen sonst nur wenig Leben, denn die Chinesen, die eigentlichen Träger des Handels und Verkehrs, dürfen in derselben nicht wohnen, und alle Theater, Freudenhäuser, Opium- und Theehäuser sind hier verboten.
Desto lebhafter ist das Leben und Treiben in der Chinesenstadt. Auf den Fahrwegen in der Mitte der Straßen drängt sich das Volk, wandert von Bude zu Bude, kauft und verkauft, schreit, lärmt, gestikuliert, lebhafter als in der Toledo von Neapel. Endlose Reihen der kleinen, zweiräderigen Maultierwägelchen fahren auf und nieder, alle Augenblicke stockt der Verkehr; auf den Fisch-, Fleisch-, Pelz-, Porzellan- und Gemüsemärkten ein fortwährendes Gedränge, hier und da auch eine öffentliche, grausenerregende Hinrichtung; unter viereckigen Sonnenschirmen gehen[S. 253] ambulante Handwerker, Barbiere, Restaurateure und dergleichen ihren Geschäften nach; zwischen ihnen, besonders aber an der Bettlerbrücke, kauern zahllose Bettler, zum Teil entsetzlich verstümmelt, Blinde, Lahme, Aussätzige, mit offenen Wunden bedeckt, und flehen unter fortwährendem Kumscha- Kumscharufen um Almosen. Als Rahmen dieses ungemein belebten, farbenreichen, seltsamen Bildes dienen die vielen Kuriositätenläden, Konditoreien, Restaurants, Kramläden aller Art; schlanke Pfeiler, von denen verschiedenfarbige lange Holzschilder, mit allerhand Inschriften in großen Goldbuchstaben bedeckt, herabhängen, überragen die einstöckigen kleinen Häuschen. Niedliche, mit geschnitzten Balustraden versehene Galerien ziehen sich unter den Dächern des ersten Stockwerkes hin, und die Häuserfronten, besonders jene der Konditoreien, sind über und über mit vergoldeten Schnitzereien bedeckt, die allerdings von dem schrecklichen Staub geschwärzt sind.
Hier und dort werden auf freien Plätzen von den vergnügungssüchtigen Zopfträgern allerhand Tierkämpfe veranstaltet; nicht nur Hähne, auch Tauben, Wachteln, ja sogar Grillen werden dazu verwendet, und mit gespannter Aufmerksamkeit folgen die Wettenden dem Kampfe der winzigen Tierchen. Leben, Lärmen, Bewegung, Verkehr überall, dazu Staub, Schmutz, Gedränge, Gestank und furchtbare Hitze, die im Winter ebensogroßer Kälte Platz macht. Ebenso still und schläfrig, wie es in der Tatarenstadt zugeht, ebenso lärmend und bewegt ist es in der Chinesenstadt: in den Chinesen steckt das Leben, der Erwerb, der Reichtum, und dennoch sind die Tataren die Herren der Stadt und des ganzen Landes.
An Sehenswürdigkeiten besitzt Peking außerhalb seiner Mauern viel mehr als innerhalb. Einige Wegstunden nördlich von Peking erheben sich die Ausläufer des mongolischen Hochlandes, und verborgen zwischen den stellenweise bewaldeten Abhängen liegen zahllose Klöster, Pagoden, Grabstätten, Tempel; dort liegen auch die kaiserlichen Sommerpaläste und ausgedehnten Parks. Dorthin flüchten sich während der heißen Zeit die fremden Vertreter und Missionare und gehen allerhand Sport nach; noch weiter gegen Norden liegen die bekannten Kaisergräber der Mingdynastie, und den Abschluß der belebten, reich bebauten und bevölkerten Landschaft bildet die ungeheure chinesische Mauer mit ihren gewaltigen Türmen und Thoren. Sie allein übertrifft die gehegten Erwartungen, alles andere in und um Peking bleibt weit hinter denselben zurück, und mit leichtem Herzen verläßt man die weit über das verdiente Maß berühmte, aber immerhin hochinteressante Kaiserresidenz des Chinesenreiches.
Chinesische Schachfiguren.
Kwang-Su, der Sohn des Himmels, der Herr der zehntausend Jahre, kam, wie man sich in Peking ziemlich allgemein erzählt, durch ein Verbrechen auf den Drachenthron, eine interessante und doch kaum bekannte Geschichte. Sein Vorgänger, der junge Kaiser Tung-Chih, starb im Januar 1875 an den Blattern, trotzdem seine Aerzte für über tausend Taels (viertausend Mark) Joßpapierchen verbrennen ließen, um den Segen des Himmels auf ihn herabzuflehen und den in ihm steckenden Teufel zu vertreiben. Tung-Chih hinterließ eine junge hübsche Witwe, Ah-Lu-Té, deren Zustand einen nachgeborenen Thronerben erwarten ließ. Dann wäre Ah-Lu-Té als Kaiserin-Mutter während der jungen Jahre ihres Sohnes Regentin geworden, und die beiden bisherigen Regentinnen, die Witwen des 1861 verstorbenen Kaisers Hien-föng, hätten abdanken müssen. Das paßte ihnen natürlicherweise keineswegs, und so nahmen sie denn, wie man sich in Peking erzählt, zu einem Pülverchen Zuflucht, das die junge Nebenbuhlerin gleich nach dem Tode des Kaisers aus dem Wege räumte. Die beiden alten Damen beriefen sofort die mandschurischen Prinzen zu einem Familienrate und ließen den kaum mehr als drei Jahre alten Prinzen Tsai-tjen, den Sohn des Prinzen Chun, als Thronerben erklären. Es war Mitternacht, als die Wahl erfolgte, aber die Kaiserinnen mußten doch ihr Bedenken über die Gesetzlichkeit dieses kleinen Staatsstreiches à la chinois haben, denn ohne eine Minute Zeit zu verlieren, ließen sie das schlafende Kind wecken und in den Beratungssaal bringen. Dort empfing der arme heulende Junge die Huldigung der Prinzen und wurde unter dem Namen Kwang-Su, d. h. erhabene Nachfolge, zum Kaiser ausgerufen. In der Pekinger Staatszeitung aber erschien die Nachricht, der verstorbene Kaiser hätte ihn selbst zu seinem Thronerben ernannt.
Natürlich konnte der den Windeln kaum entwachsene Knabe das gewaltige Staatsschiff noch nicht lenken, und so blieben die beiden alten Witwen an der Spitze der Regierung um zu schalten und zu walten, wie es ihnen beliebte. Im Jahre 1881 starb die Kaiserin des östlichen Zimmers, Tung-Tai-Hau, und die Kaiserin des westlichen Zimmers, Si-Tai-Hau, führte die Zügel der Regierung bis Anfang März 1889, d. h. bis zur Mündigkeitserklärung des regierenden Kaisers ganz allein. Seither trägt sie den Titel Kaiserin-Exregentin, aber in Wirklichkeit ist sie immer noch allmächtig und führt den Kaiser am Gängelbande.
Das kleine Söhnchen des Himmels durfte sich seiner Kindheit nicht lange erfreuen. Schon einige Monate nach seiner Erwählung zum Kaiser wurde ein Shi-foo oder Hofmeister für ihn ernannt, und die Pekinger Staatszeitung verkündete auch die Namen der für die Erziehung und Ausbildung des Knaben bestimmten Lehrer. Das astronomische Amt, dem die Feststellung der günstigsten Tage für alle kaiser[S. 256]lichen Unternehmungen obliegt, bestimmte den 14. Mai 1876 für den Beginn des Unterrichtes. An diesem Tage erschien der kleine Kwang-Su, geführt von seinem Vater, zum erstenmal im Schulzimmer. Dort lagen die gelahrten Männer, die ihm angemessene und zweckmäßige Lehren zu erteilen hatten, auf den Knieen und empfingen ihren Schüler, Gebete murmelnd und mit der Stirne den Boden berührend. Kwang-Su überreichte ihnen nun eine Schrift, worin er sie bat, ihn in der chinesischen Weisheit zu unterrichten, und damit begann die Studienzeit des Kaisers, die ohne Unterbrechung bis zu seiner Verheiratung, d. h. bis zu seinem fünfzehnten Lebensjahre währte. Von Schuleschwänzen, Spielen und Unterhalten war bei dem jungen Kwang-Su keine Rede, und wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er gewiß lieber den Kaiser aufgesteckt und wäre Prinz geblieben. Seine tägliche Beschäftigung, sein Verhalten gegenüber den Lehrern, das ganze Zeremoniell ihres Empfanges und ihrer Verabschiedung nach empfangener Lektion ist auf das strengste geregelt. Schon um drei oder vier Uhr morgens begann der Unterricht, zunächst in chinesischer Sprache und Litteratur; dann folgten mandschurische und mongolische Lektionen, der Unterricht in den verschiedenen chinesischen Dialekten, Reiten, Fechten, Turnen, Bogenschießen. Dies ging so mit kurzen Unterbrechungen für die Mahlzeiten den ganzen Tag fort, und mit Sonnenuntergang mußte der Kleine ins Bett, um am nächsten Morgen mit Sonnenaufgang wieder seine chinesischen Lektionen zu empfangen. Die starren Lehrer verstanden keinen Spaß. Nutzten die Ermahnungen nichts, so wurde das Bambusstäbchen zu Hilfe genommen. Da man aber den Sohn des Himmels nicht wie einen gewöhnlichen Sterblichen durchbläuen kann, so wurde ein anderer Junge für ihn geprügelt. Dieser Prügelknabe, in chinesischer Sprache Hahachutze, war von gleichem Alter wie der Kaiser und hatte alle Stockschläge, die eigentlich für die kaiserlichen Weichteile bestimmt waren, zu empfangen. Der Kaiser mußte dabei zusehen. In ähnlicher Weise hatten früher auch europäische Monarchen ihre Prügelknaben, z. B. Heinrich IV. von Frankreich, Edward VI. und Edward VII. von England, ja während der Regierung mancher Souveräne giebt es heute noch Prügelknaben, Minister genannt.
Im Jahre 1889 vollendete Kwang-Su sein fünfzehntes Lebensjahr. Schon vorher wurde von der Kaiserin-Regentin eine passende Braut für ihn ausgesucht, und die Staatszeitung vom 28. Oktober 1888 enthält darüber folgendes kaiserliche Edikt:
„Seitdem der Kaiser in aller Ehrfurcht das Erbe seiner Vorfahren angetreten hat, ist er allmählich zum Manne gereift, und es geziemt sich nun, daß eine Person von hervorragenden Eigenschaften als seine Gemahlin ausgewählt werde, damit sie ihn in den Pflichten des Palastes und in seinen tugendhaften Bestrebungen unterstütze. Die Wahl ist auf Yeh-ho-na-la gefallen. Sie ist die Tochter des stellvertretenden Bannergenerals Kwei-Hsiang, eine tugendhafte Jungfrau von angenehmem Aeußeren und Vorzügen. Wir befehlen, daß sie zur Kaiserin erhoben werde.”
Damit aber der Kaiser nicht unvertraut mit den ehelichen Pflichten seine neue Gemahlin heimführe, wurde ihm schon ein Jahr vorher eine Lehrmeisterin beigegeben. Diese Fei wird stets unter den hübschesten Töchtern der mandschurischen Bannerleute ausgesucht und muß ein Jahr älter als der Kaiser, also fünfzehn Jahre alt sein. Von wem diese ihrerseits die ehelichen Pflichten lernt, wird in dem Zeremonienbuche nicht gesagt.
Unmittelbar nach der Vermählung des Kaisers erfolgte seine Thronbesteigung. Eine Krönung giebt es an den orientalischen Höfen nicht, ebensowenig, wie es Kronen giebt. Zunächst wurden kaiserliche Prinzen in großem Aufzuge nach den Tempeln des Himmels und der Erde, sowie nach der kaiserlichen Ahnenhalle gesandt, um dort die Thronbesteigung des Kaisers zu verkünden. Am folgenden Tage stattete der Kaiser, begleitet von allen Prinzen und dem ganzen prächtigen Gefolge der abtretenden Kaiserin-Regentin einen Besuch ab, und am 4. März erfolgte der feierliche Regierungsantritt unter großartigem Zeremoniell, an welchem der ganze Hof mit seinen Tausenden von Würdenträgern und Garden teilnahm. Die Feierlichkeiten fanden jedoch durchwegs innerhalb der Mauern der Palaststadt statt, und von den Hunderten von Millionen chinesischer Unterthanen war nicht ein einziger Zeuge derselben. Selbst bis heute haben nur die höchsten Würdenträger des Reiches und einige der ausländischen Gesandten den Kaiser von Angesicht zu Angesicht gesehen. Bei der Thronbesteigung aber waren auch diese nicht zugegen, und was man davon erfuhr, entstammt dem in der Regierungszeitung veröffentlichten Zeremoniell.
Sobald die kaiserlichen Astrologen vom Chien-ching-Thore der Palaststadt aus verkündeten, daß der günstige Augenblick für den Regierungsantritt gekommen sei, verließ der Kaiser, in seine mit Drachen bestickten Galagewänder gekleidet, seine Gemächer und bestieg eine Prachtsänfte, in welcher er zu der Chung-ho-Halle getragen wurde. Dort nahm er die Huldigung der Beamten und Bannerleute des inneren Palastes entgegen und begab sich nun in seiner Sänfte nach der eigentlichen Thronhalle (Tai-ho), vor welcher ihn sein ganzer Hofstaat unter den Klängen der Musik empfing. Dem Eingange zunächst standen die Prinzen und höchsten Staatsbeamten; dann kamen zehn Palastgardisten mit vergoldeten Helmen und mit Pantherschweifen verzierten Hellebarden; ferner zehn Palastgardisten mit Gürtelschwertern; Beamte des Zeremonienamtes; fünf kaiserliche Elefanten, unzählige Banner- und Standartenträger, Garden, Musikkorps. Während die ganze Gesellschaft sich zur Erde warf, betrat der Kaiser die Halle und bestieg den in der Mitte stehenden Thron, eine hohe Plattform, auf welcher sich ein breiter Stuhl mit hoher Rückenlehne befand. Auf diesen Thronstuhl ließ sich der Kaiser nach mandschurischer Art mit untergeschlagenen Beinen nieder. Die Musik verstummte, und die Beamten des Zeremonienamtes führten der Majestät nun die kaiserlichen Prinzen, die mongolischen Fürsten, den hohen Adel und die Würdenträger des großen Reiches zur Huldigung[S. 258] vor den Thron. Auf ein Zeichen des Zeremonienmeisters knieten alle nieder, und der Reichsherold befahl nun die Urkunde der Regierungsübernahme zu verlesen. Damit war die Thronbesteigung vorüber, und der Kaiser kehrte als Herrscher über China nach seinem Palaste zurück.
Nur durch die seltenen Empfänge der ausländischen Gesandten sind Berichte über das eigentümliche, aber stets würdevolle Zeremoniell am chinesischen Kaiserhofe durch europäische Augenzeugen in die Oeffentlichkeit gelangt. So empfing der Kaiser gelegentlich des 60. Geburtstages der Kaiserin-Exregentin die Gesandten, um die Glückwünsche ihrer Souveräne in Empfang zu nehmen.
Der Schauplatz des feierlichen Staatsaktes war einem ostasiatischen Blatte zufolge diesmal das Wenhuatien (d. h. Halle der Blüten der Litteratur), ein älteres Gebäude von mäßiger Größe im südöstlichen Teile des Palastes. Dasselbe dient zur Abhaltung einer litterarischen Feierlichkeit im zweiten Monat jeden Jahres, bei welcher dem Kaiser von einigen hervorragenden Mitgliedern der Hanlinakademie Vorträge über die Klassiker gehalten werden. Der Eingang für die fremden Vertreter und ihre Begleiter fand durch das Tunghuamen (das östliche Blumenthor) statt, die einzige Oeffnung in der Ostmauer des inneren Palastes. Dort wurden die Sänften zurückgelassen, und man begab sich zu Fuß durch den weiten ummauerten Hofraum, an den Spalier bildenden Palastgarden vorbei, nach dem Chuanhsintien (Halle der Offenbarung der Herzensgüte), einem kleineren dreigeteilten Gebäude, in welchem den mythischen Kaisern und alten Weisen einstmals Opfer dargebracht wurden und das in diesem Falle als Wartesaal für die Gesandten diente. Die letzteren wurden hier durch die Prinzen und Minister des Tsungli-Yamens empfangen, um dann nach kurzem Aufenthalt durch das Wenhuamen (Thor der Blüten der Litteratur) nach einer Reihe offenbar für den Zweck besonders hergerichteter blauer Zelte geleitet zu werden, die dicht neben dem Wenhuatien lagen und in denen für jede Gesandtschaft ein besonderer Raum hergestellt war.
Von hier aus begaben sich die Vertreter mit ihrem Gefolge nach dem Audienzsaal, bis zu der äußeren Freitreppe desselben durch zwei Palastbeamte, vor den Thron durch zwei Minister des Tsungli-Yamens geleitet. Zwanzig Minuten vor zwölf Uhr wurde der Aelteste des diplomatischen Korps, der Gesandte der Vereinigten Staaten, geladen, die übrigen folgten der Amtsdauer nach. Das Weitere spielte sich dann in ähnlicher Weise ab, wie bei früheren Audienzen: der Gesandte näherte sich mit seinen Begleitern unter drei Verbeugungen der Estrade, auf welcher der Kaiser saß und zu der mehrere Stufen emporführten, hielt darauf eine kurze Ansprache, in der er des feierlichen Ereignisses gedachte, und überreichte, nachdem dieselbe von dem betreffenden Gesandtschaftsdolmetscher ins Chinesische, von dem zur Seite des Kaisers stehenden Prinzen Kung bezw. Ching (beide wechselten bei den einzelnen Gesandten ab) ins Mandschurische übertragen war, das Glückwunschschreiben[S. 259] seines Souveräns bezw. Präsidenten in die Hände des ihm entgegenkommenden Prinzen, der es auf den mit gelber Seide behangenen Tisch vor den Kaiser legte.
Das vom deutschen Kaiser gesandte Glückwunschschreiben bestand in buchförmig zusammengelegten Pergamentblättern, auf denen der Text in mehreren Farben kunstvoll ausgeführt war und die durch zwei massive, mit weißem Leder überzogene und mit reicher Goldverzierung sowie dem kaiserlichen Namenszuge geschmückte Deckel zusammengehalten wurden. Das Ganze, ein vornehmes Kunstwerk, das allgemeine Bewunderung erregte, lag in einem eleganten Holzkasten, auf dem ebenfalls ein großes W mit der Kaiserkrone angebracht war.
Der Monarch neigte das Haupt beim Empfang, sprach dann in vernehmlichem Tone zu dem links neben ihm knieenden Prinzen einige Sätze, in denen er seiner Genugthuung und Freude Ausdruck gab, dieser wiederholte die Worte, nachdem er die Estrade verlassen, dem Dolmetscher auf Chinesisch, der letztere in seiner Landessprache dem Gesandten. Damit war die Audienz beendet, und der Gesandte verließ, abermals unter Verbeugungen und in derselben Weise geleitet wie vorher, die Empfangshalle.
Das orientalische Zeremoniell machte sich hierbei in bedeutsamer Weise geltend: das Wenhuatien hat in seiner Südwand drei Eingänge, zu denen drei steinerne Freitreppen emporführen; solange nun der Gesandte Träger des kaiserlichen Schreibens war, überließ man ihm den vornehmsten Zugang, d. h. die große mit einem Teppich belegte Mitteltreppe und die Mittelthüre, die sonst nur von dem Kaiser benutzt wird; der Ausgang fand dagegen durch die linke Seitenthüre statt.
Dem ganzen Vorgang ließ sich eine majestätische Würde nicht absprechen. Der Kaiser saß, wie bemerkt, auf einer Estrade an einem mit gelber Seide behangenen Tische; hinter ihm befanden sich die üblichen Paraphernalien: der Wandschirm, die Pfauenwedel; zur Rechten standen zwei Prinzen des kaiserlichen Hauses, zur Linken der Prinz von Kechin und Prinz Kung bezw. Prinz Ching. In der Halle selbst bildeten schwerttragende Garden zu beiden Seiten Spalier, dahinter standen Eunuchen und Palastbeamte. Das bei weitem Interessanteste in der ganzen Scene war natürlich die Person des mit Zobelpelz und Staatsmütze angethanen jugendlichen Monarchen. Die ungewöhnlich großen, glänzenden schwarzen Augen gaben dem zarten, fast kindlichen Gesichte ein ungemein sympathisches Aussehen, das auch durch die von einem kürzlich überstandenen Fieberanfall herrührende Blässe durchaus nicht beeinträchtigt wurde.
Beim Heraustreten aus der Halle bot sich dem Auge ein malerisches Bild. Zu beiden Seiten, d. h. nach Ost und West, von der nach Süden zu führenden Freitreppe zog sich in weit ausholendem Bogen die lange Reihe der Palastgarden entlang, davor und dahinter bewegten sich Scharen von Beamten in ihren langen Tuniken mit den buntgestickten viereckigen Rangabzeichen auf Brust und Rücken.[S. 260] Bei aller Geschäftigkeit war keine eilige oder überstürzende Bewegung zu beobachten, alles ging, dem chinesischen Amtscharakter entsprechend, feierlich und würdevoll zu. Wandte man sich nach rechts, so erblickte man am Ende des weiten Platzes die hohe, mit gelbglasierten Ziegeln gedeckte Mauer, welche die lange Reihe der Mittelhallen des Palastes einschließt; am Südende derselben gewahrte man das dreiteilige Tsoyimen (Linkes Thor der Rechtlichkeit), und jenseits davon, weit darüber hinausragend, erhob sich der mächtige Bau der Taihohalle, das durch seine architektonischen Verhältnisse am meisten hervorragende Gebäude der Kaiserstadt. Das Ganze wirkte, wie jede chinesische Anlage, weniger durch die Einzelausführung als vielmehr durch das Kolossale der Ausdehnung und das Würdevolle der Gruppierung.
In diplomatischen Kreisen wurde es entschieden mit Genugthuung begrüßt, daß der chinesische Hof sich endlich entschlossen hat, den mit so ängstlicher Sorgfalt gehüteten inneren Palast den fremden Vertretern zu öffnen und so eine endgültige Lösung der langwierigen Audienzfrage herbeizuführen. Wie schwer ihm dies geworden sein mag, haben die jahrelangen Verhandlungen zur Genüge dargethan.
Die Hauptpflichten des Kaisers von China bestehen darin, seinen Vorfahren zu opfern, seiner Stieftante, der alten Kaiserin-Exregentin, alle fünf Tage einen Besuch zu machen, in den Tempeln des Himmels und der Erde zu beten und den Großwürdenträgern Audienz zu erteilen, in denen alle laufenden Regierungsgeschäfte erledigt werden. Nach den Mitteilungen, die ich von Pekinger Diplomaten erhielt, soll der Kaiser viel intelligenter und energischer sein als seine Vorgänger. Dem Aussehen nach ist er klein, mager, bartlos, mit einem unverhältnismäßig großen Kopf; doch machte er auf die wenigen europäischen Gesandten, die ihn zu Gesicht bekommen haben, einen sehr günstigen Eindruck. Daß er auch bestrebt ist, sich über die Grenzen der Purpurstadt hinaus zu informieren, geht aus vielen Thatsachen hervor. Er hat das Studium der englischen Sprache begonnen, er liest die ihm zur Sanktionierung vorgelegten Berichte, und wo er Bestechlichkeit oder Nachlässigkeit der Beamten wittert, läßt er sofort von den Censoren genaue Untersuchungen einleiten. Vor einigen Jahren wurde die ganze chinesische Welt durch die Nachricht überrascht, daß der Kaiser selbst die Prüfung der Zöglinge der Pekinger Hanlinakademie vorgenommen hätte, ein unerhörtes Ereignis. Diese Akademie ist die höchste litterarische Anstalt Chinas. Ihre Mitglieder sind hohe Würdenträger, Mandarine, Gesandte und dergleichen, und aus ihnen rekrutieren sich nach erfolgreich bestandenen Prüfungen die Examinatoren in den Provinzen, sowie die Lehrer für den kaiserlichen Thronfolger, wie für die kaiserlichen Kinder überhaupt. Seine Majestät ist zwar bisher trotz seiner zehnjährigen Ehe mit so vielen Gemahlinnen noch nicht mit Nachkommenschaft gesegnet worden, aber die Lehrer für eine solche sind schon da. Nun hat sich die in ganz China so ausgebreitete Bestechlichkeit sogar bis an diese Hanlinakademie herangewagt, und die Beamten, welche die so[S. 261] wichtigen und einträglichen Examinatorenstellen erlangen wollen, liefern mit ihren schriftlichen Prüfungsarbeiten gleichzeitig eine mehr oder minder hohe Geldsumme ab. Wie eine Bombe fiel nun unter die Prüfungskommission der Befehl des Kaisers, die schriftlichen Arbeiten der Aspiranten ihm vorzulegen. Bei der Durchsicht stürzte er die Rangliste von unterst zu oberst; sechs Beamte, welche die Kommission an die letzte Stelle gesetzt hatte, erlangten die höchsten Ehren, andere, welche in die erste Klasse aufgenommen worden waren, wurden in die dritte oder vierte gestellt, einige sogar ganz abgewiesen. Unter den Aspiranten befand sich auch Tsui-Kuo-Yin, der frühere chinesische Gesandte in den Vereinigten Staaten, ein angesehener, ehrwürdiger Mandarin zweiter Klasse und Lehrer des kaiserlichen Thronfolgers. Seine Arbeit schien den Kaiser nicht befriedigt zu haben, denn es wurde ihm sein Mandarinknopf zweiter Klasse und sein Rang als Lehrer entzogen.
Auch sonst zeigt der Kaiser große Selbständigkeit; das Köpfen oder Degradieren der Generale während des Krieges mit Japan erfolgte direkt auf seinen Befehl; entgegen der Mehrzahl seiner Mandarine dringt er auf die Organisation seiner Armee nach europäischem Muster, und überlebt seine Dynastie die jetzige heftige Erschütterung, so dürften bald bessere Zeiten für China kommen, vorausgesetzt, daß er nicht durch irgend ein Pülverchen vorher aus dem Leben geschafft wird. Seine Hofschranzen, Eunuchen und mandschurischen Bannerleute sind natürlich bestrebt, ihn möglichst von dem direkten Verkehr mit der Außenwelt fernzuhalten und alles durch ihre habgierigen, stets offenen Hände zu leiten. Selbst Audienzen bei dem Sohne des Himmels müssen in vielen Fällen durch hohe Summen erkauft werden; Pfauenfedern, Mandarinknöpfe und sonstige Auszeichnungen sind ziemlich offen im Markt, kurz, alles ist demjenigen erreichbar, der zahlen kann. Zu diesen elenden Verhältnissen in der unmittelbaren Umgebung des Kaisers haben wohl auch die vielen Prinzen beigetragen, von denen nur die wenigsten standesgemäße Bezüge haben. Andere haben wohl Zutritt zu den obersten Aemtern und damit auch Einfluß, aber dafür keine Bezüge, und so lassen sie sich häufig ihren Einfluß bezahlen. Viele befinden sich in ganz untergeordneten Stellungen, ja sogar als Diener in den Gesandtschaften und bei Fremden, aber sie gehören doch zu dem kaiserlichen Clan, dessen Oberhaupt der Kaiser ist und der seine eigene Verwaltung und seine eigene Gerichtsbarkeit besitzt.
Die ganze prinzliche Gesellschaft ist in zwei Gruppen eingeteilt, deren erste, die Tsung-schih, nur die direkten Nachkommen des Gründers der Dynastie und ersten Kaisers umfaßt. Sie sind dadurch kenntlich, daß sie einen gelben Gürtel tragen. Die zweite, Gioro genannte Gruppe, umfaßt alle Abkömmlinge der Nebenlinien, und ihre Mitglieder tragen einen roten Gürtel. Die Gesamtzahl der männlichen Mitglieder des kaiserlichen Clans dürfte etwa sechstausend betragen; ein eigenes Familienamt in Mukden, der Hauptstadt der Mandschurei, verwaltet die Archive[S. 262] und kontrolliert die Ansprüche jedes Prinzen. Die ganze Gesellschaft ist je nach ihrer näheren oder entfernteren Verwandtschaft mit dem Kaiser in zwölf verschiedene Grade eingeteilt. Die Prinzen erster Klasse heißen Tsin Wang, d. h. Prinzen von Geblüt, und beziehen aus der kaiserlichen Schatulle eine jährliche Apanage von etwa 35000 Mark, Seidenstoffe, Lebensmittel, und verfügen außerdem über eine Hofhaltung von 350 Personen; Prinzen zweiter Klasse, Kiun Wang, d. h. Söhne der Prinzen erster Klasse, haben die Hälfte der genannten Einkünfte und Hofhaltung; Prinzen dritter Klasse, Beile, ein Drittel, solche vierter Klasse, Beitse, ein Viertel, und so fort bis herab zu der letzten Klasse, deren Mitglieder nur etwa zwölf Mark monatlich und einige Rationen erhalten. Etwa 500 Mark werden ihnen bei ihrer Verheiratung und eine ähnliche Summe für Beerdigungskosten bei etwaigen Todesfällen in ihrer Familie gewährt. Natürlich können sie damit ihr Auskommen nicht finden, und so nehmen sie zu allerhand unerlaubten Mitteln Zuflucht, um zu Geld zu kommen. Ja, Wells Williams erzählt in seinem ausgezeichneten Buche The middle Kingdom, daß sie nicht selten ihre Frauen zu Tode mißhandeln, um nur so oft als möglich die Beerdigungs- und Hochzeitskosten zu erhalten.
Von der Pracht der orientalischen Höfe, besonders der indischen und javanischen, ist in China nur sehr wenig zu sehen. Die goldstrotzenden, glänzenden Uniformen, Ordensketten und Sterne fehlen gänzlich, die langen weiten Gewänder sind wohl aus reichen schweren Seidenstoffen, aber mit Ausnahme der Brustplatten, welche die Abzeichen des Ranges bilden, schmucklos und in dunklen Farben. Der Kaiser verläßt seinen Palast nur, um sich nach einem Tempel zu begeben oder die Kaiserin-Exregentin zu besuchen. Einige hundert berittener Garden, dann die gelbe kaiserliche Sänfte, dann wieder einige hundert Garden mit Bogen und Pfeilen bewaffnet, das ist alles. Die rot-weiß-blau gekleideten Sänftenträger dürfen während der ganzen Promenade nicht miteinander sprechen, nicht spucken oder sich räuspern; gewahren die Garden irgend einen Neugierigen, so machen sie ihn durch wohlgezielte Pfeile darauf aufmerksam, daß der Anblick des kaiserlichen Zuges verboten ist.
Die Ausgänge nach den verschiedenen Tempeln, die Ahnenopfer und Besuche bei der Kaiserin-Mutter bilden beinahe die einzige Abwechselung in dem einförmigen, arbeitsvollen Leben des jungen Kaisers. Zuweilen läßt er sich auch in dem prachtvollen Park der verbotenen Stadt spazieren fahren. Festlichkeiten, Theater- und Tanzvorstellungen kommen nur selten vor, und auch zu diesen werden nur einige der nächststehenden Prinzen und Minister geladen, niemals Frauen. Gewöhnlich werden die Vorstellungen am folgenden Tage für die Kaiserinnen und Damen des Hofes wiederholt, und dann sind wieder die Herren abwesend.
Von den Chinesen, Tataren und Mandschuren in Peking ist über das höchst eigentümliche Frauenleben am Kaiserhofe nichts zu erfahren. Selbst die kaiserlichen Prinzen haben keinen Zutritt zu den kaiserlichen Gemächern. Die wenigen Festlichkeiten, die zuweilen bei Hofe gegeben werden, haben eigene, von den Kaiserpalästen getrennte freistehende Hallen zum Schauplatz, und auch dort kommen die Prinzen mit den Haremsdamen nicht in Berührung, weil bei diesen Festlichkeiten die Damen fehlen. Manchmal giebt die Kaiserin-Exregentin dem Kaiser und seinem Hofe Bankette oder Empfänge. Dann ist sie wohl selbst mit einer Anzahl ihrer Hofdamen zugegen, sitzt auf ihrem Throne und läßt sich von dem Kaiser und den Prinzen die höchsten Ehrenbezeugungen erweisen. Bei Banketten beläuft sich die Zahl dieser demütigen Kautaus, die der Kaiser auszuführen hat, auf sechsunddreißig. Aber auch zu der Kaiserin-Witwe werden nur Männer geladen.
Unter solchen Verhältnissen ist es ungemein schwierig, in das Leben und Treiben am Kaiserhofe zu Peking einzudringen.
Während meines Aufenthaltes in Peking gelang es mir indessen durch Zufall, Einblick zu erhalten in das große Zeremonienbuch, das Hwui Tien. In zweihundert dicken Bänden sind die genauesten Vorschriften für das ganze Thun und Lassen des Kaisers, der Prinzen und der Damen des Kaiserhofes verzeichnet, und besonders der achtundvierzigste Band ist voll des merkwürdigsten Zeremoniells. Daß dieses auch heute noch im vollsten Umfange gebräuchlich ist, geht aus den Mitteilungen der Pekinger Zeitung hervor, und diese beiden Publikationen gestatten es doch, sich eine richtige Vorstellung von dem Leben in dem chinesischen Olymp zu machen, selbst wenn es auch hinter den roten Mauern und unter den gelben Porzellandächern der Kaiserpaläste dem Auge des Sterblichen verborgen bleibt.
Der kaiserliche Hof mit seinen vielen Tausenden von Beamten, Eunuchen, Garden, Haremsdamen und Sklavinnen bildet ein kleines Reich für sich, mit eigenen Ministerien, eigener Gerichtsbarkeit, eigenen Finanzen, und der ganze Apparat ist gewiß viel größer als der Regierungsapparat so manchen europäischen Staates. Das Oberhofmeisteramt, hier Nuiwu Fu genannt, hat eine Anzahl von Ministern und Mandarinen, denen wieder sieben verschiedene Abteilungen untergeordnet sind. Die erste Abteilung besorgt das selbst für die chinesischen Olympbewohner Unentbehrlichste: die Verpflegung. Auch darüber enthält das Zeremonienbuch die genauesten Vorschriften, und es ist interessant, die Mengen von Lebensmitteln zu erfahren, die dem Kaiser vom Verpflegungsamte angewiesen werden. Täglich, so heißt es in den Vorschriften, sind Seiner Majestät vorzusetzen: 15 Kilogramm Fleisch in einer Schüssel und 3½ Kilogramm Fleisch zu einer Suppe zusammengekocht; 1 Kilo[S. 264]gramm Schweinefett und ebensoviel Butter; zwei Schafe, zwei Enten und zwei Hühner oder anderes Geflügel und 75 Pakete Thee. Die Kaiserin erhält 10½ Kilogramm Fleisch auf Tellern, 6½ Kilogramm Fleisch mit Gemüsen zusammengekocht, eine Ente, ein Huhn oder anderes Geflügel, 12 Krüge mit Wasser und 10 Pakete Thee. Die Eunuchen, Hofdamen, Konkubinen und Dienerinnen erhalten täglich ebenso genau vorgeschriebene Rationen, deren kleinste aber immer noch aus 500 Gramm Fleisch und einem Paket Thee besteht.
Die zweite Abteilung des Hausministeriums ist der nächstwichtigen Sache, der persönlichen Sicherheit des Kaisers und seines Hofes, gewidmet und besorgt die Leibwachen, die Verteidigung des Palastes und die Garden, die den Kaiser auf Reisen begleiten. Diese Leibwachen belaufen sich zu gewöhnlichen Zeiten auf etwa sieben- bis achthundert Mann und gehören dem sogenannten Gelben Banner an, das sich durchweg aus Mandschuren zusammensetzt. Sie tragen bei Festlichkeiten prächtige seidene Uniformen, reich vergoldete Metallhelme mit dem fünfklauigen kaiserlichen Drachen geschmückt, sind aber nur mit Hellebarden und Schwertern bewaffnet. Einzelne Abteilungen der Garden tragen auch Pfeil und Bogen, aber während ich selbst im Palasthofe des Königs von Korea Gatlingkanonen sah, gab es in der purpurnen Stadt Pekings bis auf die jüngste Zeit keine Feuerwaffen.
Die dritte Abteilung der kaiserlichen Hofhaltung überwacht das Zeremoniell zwischen den einzelnen Mitgliedern der kaiserlichen Familie; die Herolde und Eunuchen dieses Amtes regulieren den Aufzug aller Haremsdamen, wenn sie zur Huldigung vor den Kaiser befohlen werden, sie stellen die Gefolge und die Ehrenwachen, die den Kaiser bei seinen Ausgängen begleiten, und versehen den Dienst bei allen Festlichkeiten und Audienzen. Interessanter ist die vierte Abteilung, denn ihren Beamten liegt die Auswahl der Damen für den kaiserlichen Harem ob, und weil diese Damen die größten Unkosten der ganzen Hofhaltung verursachen, ist dieser Abteilung auch die Einziehung der Steuern und kaiserlichen Revenüen übertragen. Die fünfte Abteilung hat die kaiserlichen Paläste und Gärten unter sich, besorgt alle Neubauten und Reparaturen und reinigt die Straßen der Hauptstadt, falls der Kaiser oder irgend ein Mitglied seiner nächsten Verwandtschaft Ausgänge unternimmt. Obschon sie niemals den Fuß wirklich auf den Boden setzen, sondern stets in Sänften getragen werden oder reiten, müssen doch alle Wege, die sie passieren, mit gelbem Sand bestreut werden. Für den Kaiser ist eine bestimmte Menge Sand vorgeschrieben, für die Prinzen je nach ihrem Range weniger. Die sechste Abteilung verwaltet die kaiserlichen Stallungen, Meiereien und Herden, und die siebente Abteilung hat die Gerichtsbarkeit über die Bewohner der kaiserlichen Stadt unter sich.
Am interessantesten sind unzweifelhaft die Befugnisse der vierten Abteilung, die sich mit dem Harem des Kaisers befaßt. Die Beamten dieser Abteilung sind selbst[S. 265]verständlich der großen Mehrzahl nach Eunuchen. Sie bleiben ihr Lebenlang unverheiratet und lassen sich nicht einmal auf Liebesabenteuer ein. Der männliche Artikel „der” wird ihnen nur aus Höflichkeit beigelegt. Sie tragen die Kleidung der Männer, aber keine Bärte. Ihre Zahl beträgt nicht weniger als dreitausend. Die für den Nachwuchs erforderlichen Leute sind nicht so leicht aufzutreiben, denn die Operationen der Eunuchentaufe sind keine Kleinigkeit. Man erwirbt deshalb gewöhnlich passende Knaben von ihren Eltern oder Anverwandten gegen Zahlung, überdies aber besteht seit 1829 ein Gesetz, demzufolge die Söhne aller wegen Familienmordes hingerichteten Verbrecher den kaiserlichen Haremsbehörden auszufolgen sind. Von diesen werden sie zu Eunuchen verwandelt, ob sie wollen oder nicht.
Dem Namen nach ist allerdings die Kaiserin-Mutter die Herrin über das ganze Heer der kaiserlichen Haremsdamen, in Wirklichkeit aber muß auch sie sich den Verordnungen der vierten Abteilung fügen. Wie viele Frauen der Kaiser im Laufe seiner kurzen Regierungszeit geehelicht hat, weiß er wohl selbst nicht. Auf ein Dutzend mehr oder weniger kommt es ja auch gar nicht an. Gesetzlich bestimmt sind ihm neben der Kaiserin noch neun Frauen zweiten Ranges, siebenundzwanzig dritten Ranges und einundachtzig Beischläferinnen verschiedener Klassen; nach welchen Verdiensten diese Damen in die Klassen eingeteilt werden, ist selbst in dem dicken Zeremonienbuche nicht enthalten, eine bedauernswerte Unterlassung. Es wäre wohl gegen das Ansehen des Sohnes des Himmels, jeweilig nur einer einzigen Gattin Herz und Hand anzutragen, und deshalb werden ihm immer gleich neun Frauen auf einmal zugeführt. Dazu wird alle drei Jahre im kaiserlichen Palaste eine große Mädchenparade abgehalten, wozu die Offiziere der mandschurischen Banner ihre sämtlichen im Alter zwischen zwölf und sechzehn Jahren stehenden Töchter ausrücken lassen müssen. Der Kaiser, begleitet von der Kaiserin-Mutter, hält die Revue ab und wählt die ihm zusagenden Mädchen aus. Sie bleiben nun bis zum vollendeten fünfundzwanzigsten Lebensjahr Beischläferinnen des Kaisers. Hierauf werden sie wieder in Gnaden entlassen, diejenigen ausgenommen, die mit kaiserlicher Nachkommenschaft gesegnet wurden. Diese können dann je nach ihren Verdiensten die ganze Stufenleiter durch die verschiedenen Klassen durchlaufen, ja sogar bis zur Kaiserin erster Klasse vorrücken. Auf hohen Rang und gesellschaftliche Stellung der Familie wird verzichtet. Jede Korporalstochter kann Kaiserin werden. Die Mutter des Kaisers Hien-fu, der von 1850 bis 1861 regierte, war ein blutarmes, den untersten Ständen angehöriges Mädchen und verkaufte in dem schmutzigen Gassengewirr Pekings Obst. Ihre außergewöhnliche Schönheit erweckte die Aufmerksamkeit des ersten Ministers, und ohne weitere Umstände wurde sie in den kaiserlichen Harem aufgenommen.
Der augenblicklich regierende Kaiser Kwang-Su bestieg am 4. März 1889 im Alter von fünfzehn Jahren den Drachenthron. Einem alten Gesetze zufolge mußte[S. 266] der Kaiser jedoch vor seiner Thronbesteigung in den Ehestand treten, und die Vermählung fand am 26. Februar desselben Jahres unter allerhand höchst eigentümlichen Gebräuchen und Zeremonien statt. Schon 1888 fand im Kaiserpalast zu Peking die erste Mädchenparade statt; Tausende von jungen, hübschen Backfischchen im Alter von zwölf bis sechzehn Jahren kamen, begleitet von ihren Vätern, durchwegs Mandschuren, angerückt, und die Kaiserin-Regentin traf die erste Auswahl. Einige Tage später wurden die gewählten Kandidatinnen einer zweiten, engern Wahl unterzogen. Diese wurden nun genau registriert und nach ihrer Heimat mit dem Bedeuten zurückgeschickt, daß sie sich für die dritte, entscheidende Wahl bereithalten möchten.
Am 28. Oktober 1888 wurde diese anbefohlen. Die dreißig jungen Mädchen wurden zunächst im kaiserlichen Palast festlich bewirtet; der Kaiser unterhielt sich mit ihnen und teilte dann der Kaiserin-Regentin seine Wünsche mit. Am 8. November 1888 wurde endlich in der Pekinger Staatszeitung verkündet, daß Yeh-ho-na-la, eine Maid von hoher Tugend, ansprechendem Aeußeren und geziemendem Benehmen, die Tochter eines mit der Kaiserin-Regentin verwandten Mandschugenerals, zur Gemahlin des Kaisers erwählt worden sei. Die Hochzeit konnte aber erst drei Monate später stattfinden, denn sie erforderte sehr umfassende, zeitraubende und kostspielige Vorbereitungen. Dem Volke wurde hierfür eine Hochzeitssteuer im Betrage von zwei Millionen Taels, also etwa acht Millionen Mark auferlegt, die Gesamtkosten der Hochzeitsfeier beliefen sich jedoch auf nicht weniger als siebeneinhalb Millionen Taels. Außerdem mußten die Provinzen noch eine Menge von Lebensmitteln, Kleiderstoffen und Material liefern; darunter auch die berühmte, die Manneskraft fördernde Ginsengwurzel und das Holz für die Särge des Kaiserpaares.
Die feierliche Verlobung fand am 4. Dezember 1888 durch ein großes Bankett statt, woran aber nur Frauen teilnahmen, während die Männer, darunter ein kaiserlicher Prinz, der Stellvertreter des Kaisers, in einem andern Raum bankettierten. Schon bei dieser Gelegenheit erhielten die Braut und ihr Vater kostbare Geschenke, die aber durch die eigentlichen Hochzeitsgeschenke weit in den Schatten gestellt wurden. Ein kaiserlicher Abgesandter überbrachte am 4. Januar 1889 in feierlichem Aufzuge folgende Geschenke: 200 Unzen Gold, 10000 Taels in Silber, ein Theegeschirr mit Kannen und Tassen aus massivem Golde, zwei silberne Waschbecken, 1000 Stück der kostbarsten Seide, 20 mongolische Reitpferde, vollständig gesattelt und gezäumt, und 40 Packpferde ohne Ausrüstung. Die Eltern der Braut erhielten ähnlich wertvolle Geschenke, ja selbst die andern Mitglieder der Familie und die Dienerschaft wurden reich bedacht.
Für den 26. Februar 1889 war die Hochzeit anbefohlen worden, und zwei Tage vorher sandte der Kaiser einen Prinzen nach den Tempeln des Himmels und der Erde, um den Göttern zu opfern, sowie nach dem kaiserlichen Ahnentempel, um[S. 267] den Vorfahren die bevorstehende Vermählung zu verkünden. Es geschah dies dadurch, daß diese Trauungsanzeige auf eine Atlasrolle geschrieben und diese vor den Altären der Ahnen verbrannt wurde. Am Hochzeitstag versammelte sich der ganze, aus Tausenden von Personen bestehende Hof, alle in kostbare neue Seidengewänder gekleidet und mit ihren Rangabzeichen, goldenen Phönixen, Mandarinknöpfen, Pfauenfedern und dergleichen versehen, in der großen Thronhalle (Taiho) des Palastes, wo auf zwei mit gelber Seide überdeckten Tischen die Insignien der Kaiserin, d. h. eine goldene Tafel mit der darauf gravierten Vermählungsurkunde und ein goldenes Siegel bereit lagen. Vor dem Thron wurde das goldene kaiserliche Scepter niedergelegt. Inzwischen beobachteten die kaiserlichen Astrologen unter allerhand Hokuspokus ihre astronomischen Instrumente und verkündeten endlich, daß der günstige, d. h. der den Geistern genehme Zeitpunkt für die Vermählung gekommen sei. Darauf begab sich der Kaiser in seinem mit goldenen Drachen bestickten Staatskleid in einer gelbseidenen Sänfte nach der Thronhalle, nahm dort den Kniefall des Hofes entgegen und besichtigte die Insignien der Kaiserin, alles unter dem großartigsten, bis in die geringsten Einzelheiten geregelten Zeremoniell. Während die Anwesenden kniend, mit der Stirn auf dem Boden, dalagen, verlas ein Zeremonienmeister die Trauungsurkunde: „Seine Majestät der Kaiser hat von Ihrer Majestät der Kaiserin-Regentin ein Edikt erhalten, demzufolge Yeh-ho-na-la, die Tochter des Bannergenerals Kwei-Hsiang, zur Kaiserin erwählt worden ist. Dem Uns ergangenen Befehl gemäß soll die Investierung der Kaiserin mit dem Scepter vorgenommen werden.”
Nun wurde dem mit der Investierung der Kaiserin betrauten kaiserlichen Prinzen das Scepter übergeben. Unter den Klängen der Tatarenmusik begab sich der Kaiser wieder in seinen Palast zurück, das goldene Siegel und die Vermählungstafel aber wurden in kostbare, ungemein reich geschmückte Drachensänften gelegt, um die sich nun der Festzug, der Prinz mit dem Scepter an der Spitze, gruppierte. Hinter den kolossalen Drachensänften wurde der gelbseidene kaiserliche Sonnenschirm einhergetragen; es folgten Minister, Mandarine, unzählige Schirm-, Fahnen- und Bannerträger und endlich die Eunuchensippe mit den Gewändern der Kaiserin in eigenen, prachtvoll vergoldeten Sänften. Vor dem Palast der Braut empfingen der Vater und die männlichen Anverwandten den Zug; die Eunuchen trugen die Insignien und das Kaiserscepter in die Gemächer der Braut, die vor diesen Zeichen ihrer künftigen Würde niederkniete und die vorgeschriebene Zahl von Kautaus machte. Zuvor hatte sie jedoch unter Beihilfe zahlloser weiblicher Zeremonienmeister, Herolde und Hofdamen das Hochzeitskostüm angelegt, das gewiß die Damen interessieren dürfte, zumal es meines Wissens in Europa noch nicht geschildert wurde. Das Kleid war von dunkelblauer, schwerer Seide mit goldenen, eingestickten Drachen und breiten Goldborten an den Aermeln und dem unteren Saume; auf der Vorderseite des Kleides prangten in Goldstickerei die chinesischen Schriftzeichen Wau-fu und[S. 268] Wau-scheu, d. h. immerwährendes Glück und langes Leben. Unterkleider und Schuhe waren von gelber Seide. Die Halsgeschmeide der Kaiserin, hauptsächlich aus Perlen, Diamanten, Türkisen und Korallen zusammengesetzt, sollen nach den Mitteilungen der Shanghaier Blätter einen fabelhaften Wert besitzen. Das Taschentuch war aus grüner Seide, reich gestickt und mit juwelenbesetzten Quasten und gelben Bändern geschmückt. Das wichtigste und kostbarste Stück war jedoch der Kopfputz, eine Mütze aus rotem Samt mit auf die Schulter fallendem Besatz von Zobelpelz, gelb gefüttert und durch diamantenbesetzte Samtbänder festgehalten. Auf der Mitte der Kappe erhob sich ein goldener Phönix, umgeben von einer Anzahl der kostbarsten Perlen. Rings um diesen Schmuck waren an der Kappe nach hinten andere goldene Phönixe befestigt, jeder mit achtundzwanzig großen Perlen besetzt, und auf der Hinterseite der Kappe saß ein goldener Fasan, dessen langer juwelenbesetzter Schweif über das Zobelfell fiel.
In diesem Aufzuge erschien die Braut vor den Eunuchen, die ihr nun das kaiserliche Edikt vorlasen und die an dem gleichen Nachmittag stattfindende Abholung nach dem Kaiserpalast verkündeten. Die Trauungstafel und das Siegel blieben bei ihr, das Scepter aber wurde wieder unter dem weitschweifigsten Zeremoniell dem vor der Brautwohnung harrenden Prinzen übergeben, der es dem Kaiser wieder zurückbrachte. Nachmittags besuchte der Kaiser mit seinem ganzen Hofstaate die Kaiserin-Regentin und gab hierauf in der Taihohalle feierlich unter Trompetengeschmetter und Trommelschlag den Befehl, die junge Kaiserin abzuholen. Sofort wurde der Hochzeitszug wieder mit dem Prinzen an der Spitze gebildet, aber diesmal fungierte an Stelle der Drachenstühle eine Phönixsänfte, mit gelbem Damast ausgeschlagen und von sechzehn Trägern getragen, denen die kaiserliche Palastgarde in ihren pompösen Uniformen mit goldenen Helmen und Pantherfellen folgte.
In dem Palast der Braut hatten sich mittlerweile die kaiserlichen Prinzessinnen, Hofdamen, Frauen der Minister und höchsten Mandarine versammelt. Beim Eintreffen des Zuges überreichten die Prinzessinnen der tiefverschleierten Braut einen Apfel und durchräucherten den Phönixstuhl mit tibetanischem Weihrauch. Nun nahm die Braut allein darin Platz, Trauungstafel und Siegel wurden in die dafür bestimmten Drachenstühle gelegt, und begleitet von dem großartigen, glänzenden Gefolge begab sich die Braut zu dem Palast des Kaisers, diesmal schon beschattet von dem hohen kaiserlichen Sonnenschirm mit sieben eingestickten Phönixen. An dem Außenthore mußten den Vorschriften gemäß alle Sänften zurückbleiben und nur jene mit der Kaiserin wurde bis an die Eingangspforte des Palastes getragen. Dort mußten die Sänftenträger und Eunuchen mit abgewendeten Gesichtern zurücktreten, die Palastgarden aber hinter einem hohen Schirm sich verbergen, um zu verhindern, daß sie die Kaiserin erblickten. Unter Beihilfe der Prinzessinnen verließ die Kaiserin nun die Sänfte und erhielt in der Vorhalle des Palastes abermals einen Apfel[S. 269] sowie ein großes, mit Perlen und Goldstücken gefülltes Gefäß. Langsam durchschritt sie den Korridor zu dem Brautgemach, vor dem der Kaiser, ihr Gemahl, sie erwartete. Zu seinen Füßen lag ein Sattel, daneben standen Pfeil und Bogen. Als der Kaiser seine Braut gewahr wurde, schoß er einen Pfeil tief in den Sattel, trat dann auf die junge Kaiserin zu und schlug ihren Schleier zurück. Zwei Prinzessinnen führten sie nun in das Brautgemach und luden sie ein, auf dem Brautbette Platz zu nehmen. Der Kaiser setzte sich neben sie, und mit ineinander verschlungenen Armen tranken sie nun den von den Prinzessinnen dargereichten Wein. Hierauf genossen sie eine Suppe, die Brühe des langen Lebens genannt, und einen aus allerhand mysteriösen Kräutern und Wurzeln gemachten Brei, „die Mehlspeise der Söhne und Enkel”. Die Prinzessinnen bildeten bei dieser feierlichen stummen Mahlzeit die Bedienung. Dann machten sie das Brautbett zurecht, legten an die vier Ecken desselben vier mit Nephritstein (Jade) eingelegte Scepter und zogen sich zurück. In der offiziellen Pekinger Zeitung, die den ganzen Hergang in der größten Ausführlichkeit schilderte, ist leider nicht erwähnt, ob die kaiserliche Braut ihre Phönixe und Fasanen auf dem Kopf behielt. Es heißt darin nur, daß die Prinzessinnen am nächsten Morgen um drei Uhr wieder erschienen, um das Kaiserpaar zu wecken. Eine halbe Stunde später begaben sich die Neuvermählten nach dem Hwa-Huang-Tempel, um dort ihre Gebete zu verrichten, und hierauf nach dem Chieng-Ching-Palaste, wo sie sich vor den Gedenktafeln der kaiserlichen Ahnen neunmal zu Boden warfen. Nach einem kurzen Höflichkeitsbesuch bei der Kaiserinmutter kehrten sie nach dem Kaiserpalast zurück. Hier mußte die junge Kaiserin neunmal vor ihrem Gatten die Knie beugen und gelegentlich dieser Turnübung dem Kaiser ihr Nephritscepter überreichen. Dafür reichte ihr der Kaiser sein eigenes Scepter. Nun war die Zeit für den Empfang der Nebenkaiserinnen und des ganzen Harems mit Gefolge und Dienerschaft gekommen. Alle, selbst die Nebenkaiserinnen, mußten vor der jungen Herrin den Kautau ausführen.
Glücklicherweise wird nur die Hochzeit mit der ersten Kaiserin mit so großem Pomp und Aufwand gefeiert, sonst käme der Kaiser sein Leben lang aus den Heiratszeremonien gar nicht heraus. Mit den Neben- und Aushilfskaiserinnen wird nicht viel Aufhebens gemacht. Die Pekinger Zeitung verkündet einfach ihre Ernennung, ebenso wie die Ernennung einer Anzahl von Beischläferinnen verschiedener Grade. Sie haben alle ihre eigenen Wohnungen, ihre Dienerschaft und Eunuchen, und der Kaiser macht bei ihnen nach Belieben die Runde. In dieser Beziehung werden ihm von dem Zeremonienmeister keine Vorschriften gemacht, dafür hält dieser unter den Beischläferinnen strenge Ordnung, und sollten sich die Haremsdamen irgend welche Vergehen zu schulden kommen lassen, so werden sie zuweilen streng bestraft. So z. B. veröffentlichte die Pekinger Staatszeitung im Jahre 1895 folgendes Edikt:
„Ich, der Kaiser, habe folgende von mir getroffene Verfügung der allergnädigsten Kaiserin-Exregentin mitgeteilt: Unser Hof hat seine Familientraditionen und Vorschriften, die streng und vernünftig sind. Dem Hofharem gebührt es nicht, sich in Sachen der Staatsverwaltung einzumischen. Die Frauen zweiten Ranges, Zfin und Tscheshen, haben ihre bisherige Bescheidenheit aufgegeben. Sie haben sich dem Prunke ergeben und wenden sich wiederholt an Se. Majestät mit Bitten und Anliegen, ihm viel Sorge verursachend. Das darf nicht weiter vorkommen. Denn wenn man sie nicht warnt, so steht zu befürchten, daß die Frauen des Kaisers von allen Seiten mit Bitten und Intriguen bestürmt werden, während diese Intriguen doch nur eine Leiter zu allerlei Betrug sind. Deshalb sind die Frauen Zfin und Tscheshen zu degradieren und solches zur öffentlichen Kenntnis zu bringen. Jetzt wird Ruhe und Stille im Innern des Palais einkehren. So geschehe es.”
Noch strenger ist vom kaiserlichen Hausministerium unter den Eunuchen aufgeräumt worden, deren es in kaiserlichen Diensten wohl dreitausend giebt. Da sie sich in der unmittelbaren Umgebung des Kaisers befinden, so ist auch ihr Einfluß auf denselben bedeutend, und sie lassen sich in Anbetracht ihrer unverantwortlichen Stellung häufig zu allerhand Gesetzlosigkeiten verleiten. Jeden Monat veröffentlicht die Staatszeitung Edikte, denen zufolge verschiedene Eunuchen geköpft oder in die Verbannung gesandt worden sind.
Der Thronfolger wird in China unter den Kindern der verschiedenen Beischläferinnen ganz nach Gutdünken des Kaisers erwählt; die Töchter des Kaisers aber werden an hohe mandschurische Generale oder mongolische Fürsten verheiratet, nur dürfen die letztern ihren hochgeborenen Gemahlinnen gegenüber keinerlei eheliche Rechte ausüben, müssen also sozusagen Eunuchen spielen. Sollten sie sich vielleicht doch zu unerlaubten Beziehungen zu ihren eigenen Frauen verleiten lassen, so werden sie streng bestraft. Der Kaiser Taokwang ließ einem solchen kecken Gatten achtzig Stockschläge verabfolgen.
Die Pekinger Regierungszeitung vom 29. Juni 1895 brachte folgendes Edikt des Kaisers: „In den letzten Wochen ist im Bereiche der Hauptstadt viel Regen gefallen, und noch immer ist der Himmel mit Wolken bedeckt, so daß zu befürchten steht, es könnte durch zu viel Regen die Ernte geschädigt werden. Wir sind auf das tiefste besorgt, und es erscheint geziemend, um günstiges Wetter zu flehen. Wir werden uns deshalb am 1. Juli nach Takao-tien zum Opfern begeben und die himmlische Macht bitten, Regen und Sonnenschein, alles zur rechten Zeit, zu gewähren, auf daß man beruhigt der Ernte entgegensehen könne.”
Am 30. Juni erschien in der Regierungszeitung folgende Nachricht: „Der Kaiser wird sich morgen früh drei Uhr zum Opfern nach Takao-tien begeben.”
Aehnliche Edikte und Nachrichten finden sich in der genannten Zeitung nahezu jede Woche. Bald opfert der Kaiser in der Ahnenhalle, bald im Tempel des Himmels oder in jenem der Erde. Die Opferzeit ist gewöhnlich ungemein früh, zwischen drei und fünf Uhr morgens, zuweilen sogar mitten in der Nacht.
Wenn in diesen Edikten von Priestern niemals gesprochen wird, sondern immer nur vom Kaiser, so hat dies seinen Grund darin, daß er selbst der Stellvertreter der chinesischen Gottheit auf Erden ist, eine Art Hoherpriester mit dem Zopfe. Wie in biblischen Zeiten König und Oberpriester häufig in einer Person vereinigt waren, so ist es in China bis auf den heutigen Tag geblieben. Ja noch mehr: der Kaiser ist der Sohn des Himmels, seine Vorfahren auf dem Drachenthrone weilen als Geister in der Gesellschaft der himmlischen Mächte, und er selbst fährt bei seinem Ableben auf einem goldenen Drachen zum Himmel. Sein Geist lebt dort fort und beeinflußt das Leben der Hinterbliebenen in derselben Weise, wie das seine von seinen eigenen Vorfahren beeinflußt wurde. Aus diesem Glauben entwickelte sich der Ahnenkultus, der in China und besonders am Kaiserhofe kaum weiter getrieben werden kann. Innerhalb der verbotenen Purpurstadt im Herzen Pekings befindet sich ein großer kaiserlicher Ahnentempel, und auch in den anderen, dem Himmel, der Erde, der Sonne und dem Monde geweihten Tempeln Pekings sind die kleinen Ahnentafeln der verstorbenen Kaiser aufgestellt. In dem Tai-miau, d. h. dem Großen Tempel, neben dem Kaiserpalast, befinden sich außer den Ahnentafeln der Kaiser auch jene der Kaiserinnen aus den letzten zehn Generationen, einfache Holztäfelchen, auf welchen die Namen und Titel der Verstorbenen verzeichnet sind und die in vergoldeten Holzkästchen auf langen Tischen stehen. Anschließend an den kaiserlichen Ahnentempel befindet sich an der Ostseite eine Halle für die Ahnentafeln der kaiserlichen Prinzen, an der Westseite eine zweite für die Tafeln verdienter Staatsmänner, Feldherren und andere, also eine Art chinesischer[S. 272] Ruhmeshalle, jedoch ohne irgend welchen anderen Schmuck, ohne Statuen oder dergleichen.
In diesem Tai-miau bankettiert der Kaiser unmittelbar nach seiner Thronbesteigung mit seinen kaiserlichen Vorgängern, denn die Opfer, welche diesen dargebracht werden, denken sich die Chinesen als Festmahle. Sobald der Kaiser in großem Ornat die Halle betreten hat, werden vor die Ahnentafeln jedes einzelnen Kaiserpaares die Opfer gesetzt, und zwar vor jede Tafel drei Becher Wein, zwei Schüsseln Suppe, ein kleines Tischchen und ein Stuhl, auf welchem passende Kleider für den unsichtbaren Vorfahren liegen. Jeder Kaiser erhält außerdem noch zwei Stücke kostbaren Seidenstoff. Auf langen Tischen vor jedem Kaiserpaare werden auch noch zwischen Weihrauchfässern und glimmenden Räucherkerzchen je ein geschlachtetes Schwein, ein Rind und ein Schaf gelegt. Hierauf tritt der Kaiser allein in die Mitte der Halle, wirft sich auf die Knie, und mit der Stirne den Boden berührend ruft er der Reihe nach alle seine Vorfahren mit ihren Namen und Titeln an, eine zeitraubende Affaire, wenn man bedenkt, daß diese Titel aus je zwölf bis zwanzig Wörtern bestehen. Dann bittet er sie, diese Opfergaben als Ausdruck seiner Fürsorge und Verehrung entgegenzunehmen. Der Kaiser liest dieses Gebet von einer kleinen gelben Holztafel ab, die er sodann unter den Klängen eines mongolischen Musikkorps und dem Gesang von Chorsängern den Zeremonienmeistern übergiebt. Beamte raffen nun die Seidenstoffe zusammen und tragen sie in feierlichem Aufzuge zu einem großen offenen Altare, wo sie in Gemeinschaft mit der Gebettafel verbrannt werden.
Hierauf folgt eine höchst eigentümliche Zeremonie, die lebhaft an ähnliche Zeremonien im altjüdischen und christlichen Gottesdienste erinnert. Ein hoher Tempelbeamter reicht dem Kaiser einen Becher mit dem Wein des Segens dar. Bevor er ihn empfängt, kniet er dreimal nieder und berührt jedesmal mit der Stirne dreimal den Boden. Hat er den Becher geleert, so wird ihm das Fleisch des Segens auf einer Schüssel dargereicht, wobei er dieselbe Anzahl von Kautaus auszuführen hat. Im Laufe dieses Opferdienstes hat er im ganzen achtzehnmal niederzuknien und die Stirne vierundfünzigmal auf die kalten Steinplatten zu senken, eine recht anstrengende Turnübung, die von allen anwesenden Prinzen und Würdenträgern ebenfalls ausgeführt werden muß.
Der wichtigste Tempel Pekings, in welchem der Kaiser selbst als Hoherpriester den Opferdienst versieht, ist der berühmte Tempel des Himmels. In der Chinesenstadt, anschließend an die starken, hohen Umfassungsmauern Pekings, befinden sich zwei große, mehrere Quadratkilometer umfassende Tempelhaine, eigentlich schattige, mit prachtvollen alten Bäumen besetzte Parks, auf deren grünen Matten die Opfertiere, Rinder, Schafe und andere, grasen. Hohe, blaßrote Mauern umschließen diese weiten Plätze des Friedens, und nur wenigen Fremden ist es vergönnt, in das Innere einzudringen. Der westliche Park enthält den Tempel des Ackerbaues, der[S. 273] östliche den viel größeren und wichtigeren Tian-niau, d. h. den Tempel des Himmels. Bevor die augenblicklich regierende Dynastie auf den Thron gelangte, war der Tempel des Ackerbaues eigentlich der Tempel der Erde. Aber im Jahre 1531 entschieden die Schriftgelehrten, daß dieser Tempel der Erde außerhalb der Stadtmauern liegen müsse, und es wurde deshalb nördlich der Tatarenstadt ein Park von etwa dreihundert Morgen angelegt, in dessen Mitte sich der Tempel oder vielmehr der Altar der Erde erhebt.
Während des größten Teiles des Jahres sind die heiligen Tempelhaine einsam und verlassen, die stillsten Plätzchen des weiten chinesischen Reiches. Aber dreimal im Jahre, zur Zeit der Sommer- und Wintersolstitien und zu Beginn des Frühlings, drängen sich unter den schattigen Bäumen rings um den Altar des Himmels die Großen des Reiches in ihrer ganzen Pracht. Der Kaiser, die Prinzen, Mandarine und Generale sind dann hier versammelt, begleitet von Musikern, Chorsängern, Tempeldienern und Tänzern, von Leibgarden und Palastsoldaten, ein ungemein seltsames, großartiges Bild. Der Kaiser verläßt schon am Tage vorher bei Sonnenuntergang seinen Palast, um im feierlichsten Aufzuge durch die frischgescheuerten, mit gelbem Sand bestreuten Straßen seiner Hauptstadt nach dem Tempel zu pilgern. Aus Ehrfurcht vor der geheiligten Person des Monarchen müssen sämtliche Thüren und Fenster der Häuser geschlossen werden, keine Seele, weder Chinese noch Europäer, darf sich zeigen. Durch diese verödeten Straßen rollt der von einem Elefanten gezogene gelbe Staatswagen, in welchem der Kaiser sitzt. Nicht weniger als zweitausend Hofbeamte, Mandarine, Eunuchen und Garden, mit zahllosen Bannern, Ehrentafeln und Ehrenschirmen begleiten den Monarchen. Im Tempelhain angelangt, besichtigt der Kaiser zunächst die Opfertiere und begiebt sich hierauf in die Halle des Fastens und der Buße, während sein Gefolge sich außen unter den Bäumen auf den Rasen lagert. Kein Laut unterbricht die nächtliche Stille, denn der Kaiser liegt mehrere Stunden in der dunklen Halle auf den Knieen, im Gebet versunken. Hierauf wird der Kaiser in ein Staatszelt geführt, wo er unter großem Zeremoniell die Händewaschung vornimmt und die langen blauseidenen Gewänder als Oberpriester anlegt; nun beginnt der Zug zu dem Opferaltar. Voran schreiten Bannerträger, dann 235 Musiker in blauseidenen Talaren und eine gleiche Zahl von Tänzern, welche während des Marsches langsame, feierliche Tanzbewegungen ausführen. Hierauf kommt der Kaiser, gefolgt von allen Prinzen und hohen Würdenträgern, viele Hunderte an der Zahl.
Mittlerweile ist an der heiligen Opferstätte selbst alles vorbereitet worden. Innerhalb einer zweiten Ringmauer erhebt sich auf einer Marmorterrasse der mächtige runde Tempel des Himmels mit drei hohen, sich verengenden Stockwerken und himmelblauen Porzellandächern. Hehre Einfachheit kennzeichnet das Innere. Vergoldete Holzsäulen tragen die Dächer, und an der Nordseite, dem Eingang gegen[S. 274]über, stehen auf reich geschnitzten, rot lackierten Tischen die einfachen Täfelchen des Shang-te, das heißt des „obersten Herrn des Himmels, der Erde und aller Dinge”, sowie der acht verstorbenen Kaiser der regierenden Dynastie. Aus diesem Tempel werden die mit blauem Seidenstoff umhüllten Täfelchen nach dem heiligen Altar des Himmels getragen, auf welchem das kaiserliche Opferfest stattfinden soll.
Dieser Altar, eine der heiligsten Stätten des chinesischen Reiches, befindet sich nahebei in einem dichten Cypressenhaine. Umgeben von ehrwürdigen alten Bäumen, erhebt sich hier ein aus blendend weißen, kreisrunden Marmorterrassen bestehender Aufbau, zu dessen oberster Plattform vier breite Treppen von je neun Stufen emporführen. Die Terrassen, ebenso wie die Treppen sind von skulpturengeschmückten Marmorbalustraden umgeben, in denen Drachen- und Phönixmotive die Hauptrolle spielen. In der Mitte des obersten, mit weißem Marmor belegten Plateaus erhebt sich ein großer Marmorblock für den Kaiser, und darüber wird ein die ganze Fläche einnehmender Baldachin gespannt. Bei dem flackernden Schein zahlreicher Fackeln stellen nun die in lange, hellblaue Gewänder gehüllten Diener die Kaisertäfelchen auf die oberste Plattform; auf die nächsttiefere Terrasse werden die Täfelchen der Sonne, des Großen Bären, der fünf Planeten, der achtundzwanzig Konstellationen und ein letztes Täfelchen für die übrigen Sterne aufgestellt. Diesen gegenüber, auf der entgegengesetzten Seite der zweiten Terrasse, werden die Täfelchen für Mond, Wind, Regen, Wolken und Donner auf kleine Tischchen gestellt, so daß also der oberste Gott Shang-te nach chinesischen Begriffen von allen Himmelskörpern umgeben ist.
Vor jedes Täfelchen werden auf langen Tischen Räucherpfannen für Weihrauch gestellt und allmählich auch die Kerzen und Räucherstäbchen entzündet. Während der ganze Cypressenhain durch die brennenden Fackeln erleuchtet wird, flimmern auf der weißen Marmorpyramide, den aztekischen Teocalli nicht unähnlich, Tausende und Abertausende kleiner Lichtchen. Bei ihrem Scheine werden nun vor jedem Täfelchen die Opfergaben aufgetürmt: zwölf Stück der schwersten blauen Seide vor Shang-te, je drei Stück weißer Seide vor jedem Kaiser, dann zusammen siebzehn Stück roter, gelber, blauer, schwarzer und weißer Seide für die übrigen Täfelchen, die, wie gesagt, nichts weiter als etwa fußhohe, zwei Zoll breite, aufrechtstehende Holzplättchen sind, auf welchen die Namen der genannten Himmelskörper stehen. Sobald die Kunde von dem Anmarsch des kaiserlichen Zuges hierher gelangt, werden die Opfermahlzeiten aufgetragen: Shang-te ein geschlachtetes Kalb, den Sternen ein Stier, ein Schaf und ein Schwein. Vor jedes Täfelchen werden drei Schalen Reiswein aufgestellt und dann in acht Reihen achtundzwanzig mit allerhand Lebensmitteln und Früchten gefüllte Schüsseln gesetzt. Manche derselben enthalten Suppe mit Rind- und Schweinefleischschnitten, andere wieder Pökelfleisch mit Vermicelli, wieder andere Hasen- oder Rehfleisch, geräucherten oder gesalzenen Fisch,[S. 275] Bambussprossen, Petersilie, gekochten Reis, Hirse, Zwiebelblüten verschiedener Art, ja selbst Gewürze, wie Salz und Pfeffer, werden bei dieser Göttermahlzeit nicht vergessen. Chorgesang und Musik verkünden das Nahen des kaiserlichen Zuges. Bald ist der ganze Rasenplatz mit Tausenden von Menschen angefüllt; die Prinzen und Würdenträger steigen auf die beiden untersten Terrassen, während der Kaiser allein langsam zur obersten Plattform emporsteigt und dort vor dem Täfelchen des Shang-te sich dreimal zur Erde wirft und neunmal mit der Stirne den Boden berührt. Dasselbe wird hierauf von allen Anwesenden ausgeführt.
Nun schweigt die Musik, Totenstille herrscht ringsherum. Der Kaiser aber hebt ein prachtvolles Stück blauen Nephritsteines (Jade), das Symbol des Himmels, mit beiden Händen zu der Tafel des Shang-te empor, als sichtbares Zeichen des Opfers. Aus der Ferne erhebt sich die Stimme eines Sängers, der eine Opferhymne singt, und währenddessen wird von Dienern das Opferkalb des Shang-te mit heißer Suppe besprengt. Zunächst wird vom Kaiser von einem blauen Gebetstäfelchen ein Gebet abgelesen, in welchem der Segen des Himmels und die Gunst der verstorbenen Kaiser herabgefleht wird. Das Musikkorps spielt nun eine Hymne, während welcher die Tänzer langsam quadrillenartige Figuren ausführen. Bei dem flackernden Fackelscheine, inmitten der dunkeln Waldbäume, mit dem klaren Sternenhimmel darüber, müssen diese malerischen Gruppen, umgeben von Tausenden in prächtige Gewänder gehüllten Prinzen und Würdenträgern, ein ungemein feierliches, fremdartiges Bild darbieten, das leider niemals dem Auge eines Europäers sichtbar wird. Wer erinnert sich aber bei der Vorstellung dieser Scene nicht an die Schilderungen der biblischen Opferfeste, an Melchisedek und das jüdische Paschal? Seit Tausenden von Jahren werden die chinesischen Opferfeste in genau derselben, streng geregelten Weise ausgeführt, und wie sie nach Westen bis an das Mittelmeer gelangt sind, dürften sie auch ihren Weg nach Osten zu den Azteken genommen haben, deren Opferfeste mit den chinesischen bedeutende Aehnlichkeiten besaßen. In Ost und West sind sie verschwunden, nur an der Quelle selbst, in China, haben sie sich bis auf den heutigen Tag erhalten.
Abermals schweigt die Musik, und die nächtliche Stille wird durch eine mysteriöse Stimme unterbrochen, welche die Worte singt: „Reicht den Becher des Segens und das Fleisch des Segens dar”. Hohe Würdenträger bieten nun beides in feierlicher Weise dem Kaiser dar, welcher vor und nach dem Einnehmen dreimalige Kautaus vor den Täfelchen ausführt. Unter den Klängen einer Jubelhymne werden diese Täfelchen wieder nach dem Tempel zurückgetragen, die Seidenstücke, Opfertiere und Speisen aber dem Feuer übergeben, um durch die Verbrennung thatsächlich zu den Geistern zu gelangen, für welche sie bestimmt sind. In feierlichem Zuge werden die Opfergegenstände über den nur durch Fackeln erleuchteten Tempelhain auf den Verbrennungsplatz getragen. In einer Ecke nahe der Um[S. 276]fassungsmauer erhebt sich ein etwa drei Meter hoher offener Feuerherd aus grünem Porzellan, und neben diesem stehen acht kleinere Kamine aus Mauerwerk, in welche runde Eisenschüsseln von etwa einem Meter Durchmesser eingelassen sind. Auf die in allen Herden glimmenden Holzkohlen werden nun die Opfer gelegt, jene für Shang-te auf den grünen Porzellanherd, jene für die Kaiser auf die eisernen Herde, und während die kostbarsten Seidenstücke, das Fleisch und die Gemüse in Rauch aufgehen, kehrt der Kaiser von seinem Opfergange nach dem Palast zurück. Wenn die Sterne am Firmament erblassen und der erste schwache Schimmer des anbrechenden Tages am Horizont erscheint, liegt der große Park des Himmelstempels wieder still und verlassen da, kaum daß noch leichter Rauch sich über den verbrannten Opfern kräuselt.
Neben diesen großen Opferfesten findet alljährlich auf dem Himmelsaltar noch ein anderer höchst eigenartiger Götterdienst statt. Nicht in den reichen kaiserlichen Gewändern, sondern in grobe Sackleinwand gehüllt schreitet der Kaiser von der Halle der Buße zu dem Himmelsaltar. Oben angelangt, verliest er die Namen aller Verbrecher, an welchen während des abgelaufenen Jahres das Todesurteil vollstreckt wurde, und fleht zum Himmel um Gnade für jene, welche möglicherweise an dem ihnen zugeschriebenen Verbrechen schuldlos waren.
Aehnlich den Opferfesten im Tempel des Himmels sind jene im Tempel der Erde, nur daß hier nicht den Himmelskörpern, sondern den Erdgeistern geopfert wird, jenen der vier großen Meere, der vier großen Flüsse Chinas und der vierzehn höchsten Berge; auch hier werden die Täfelchen der verstorbenen Kaiser neben jenen der Erdgeister aufgestellt; aber nur die für die Kaiser bestimmten Opfergaben werden verbrannt, die Opfer für die Erdgeister werden tief in die Erde vergraben, um auf diese Weise wirklich ihre Bestimmung zu erreichen.
Manche religiöse Zeremonien am chinesischen Kaiserhofe stammen aus undenklichen Zeiten. Die Anbetung der Sonne und des Mondes in den ihnen geweihten Tempeln ist noch ein bis auf den heutigen Tag erhaltenes Ueberbleibsel der ältesten Religionen; manche andere Zeremonie, wie z. B. das Ackerbaufest, reicht in dieselbe Zeitperiode zurück, in welcher die ägyptischen Pyramiden erbaut wurden. Vor viertausend Jahren regierte beispielsweise in China der Kaiser Shun. Er wendete dem Ackerbau besondere Aufmerksamkeit zu und eröffnete in jedem Frühjahr selbst die Feldarbeit, indem er mit einem Pfluge Furchen zog. Ganz wie vor viertausend Jahren geschieht dies noch heute in dem großen Tempelhain für Agrikultur, der sich neben jenem des Himmels längs der Südmauer Pekings hinzieht. An einem bestimmten Tage im Frühjahr erscheint der Kaiser mit den kaiserlichen Prinzen und dem gesamten Hofstaate, um zunächst den Göttern zu opfern, oder vielmehr in symbolischer Weise mit ihnen ein Festmahl zu begehen. Nach den nötigen Kautaus vertauschen der Kaiser und die Prinzen ihre prächtigen Gewänder mit der Tracht der Landleute und begeben sich auf ein nahes Feld, wo sie mit gelb lackierten Pflügen, an welche Büffel gespannt sind, neun Furchen ziehen. Hinter den Pflügen schreiten Mandarinen einher, welche den Samen ausstreuen. Während der ganzen Zeit tragen Chorsänger und Musikkorps Hymnen zum Lobe des Ackerbaues vor.
Wie um reichen Erntesegen, muß der Kaiser auch, wie eingangs erwähnt, um den erforderlichen Regen, oder wenn es zu viel regnet, um Trockenheit zum Himmel flehen. Zunächst werden Präfekten oder Gouverneure nach den verschiedenen Tempeln entsendet; werden ihre Gebete nicht erhört, so beordert der Kaiser Prinzen seiner Familie dahin, schließlich geht er selbst opfern und beten, unter der Voraussetzung, daß ein Kaiser nicht nur auf Erden, sondern auch im chinesischen Olymp mehr Einfluß hat als ein gewöhnlicher Sterblicher. So verkündete der Kaiser beispielsweise in der Pekinger Zeitung vom 8. Juli 1894 folgendes:
„Da seit dem ersten Drittel des vorigen Monats in der Hauptstadt und Umgebung reichlich Regen gefallen war und das Wetter sich nicht aufklärte, so begaben Wir Uns zum Opfern und Beten nach Ta-Kao-Tien. Danach blieb der Himmel immer bewölkt und der Regen hört nicht auf. Mit ängstlicher Erwartung sehnen Wir einen Umschwung der Witterung herbei und finden es deshalb angemessen, von neuem darum zu flehen. Wir haben den 10. Juli dazu erwählt, um Uns in Eigener Person nach Ta-Kao-Tien zu begeben. Nach dem Tempel Shih-Ying-Kung beordern Wir den Prinzen dritter Klasse Tsai-Ying, nach Chao-Hsien den Prinzen vierter Klasse Po-lun und nach Niang-ho mian den Herzog Tsitse, um insgesamt an dem genannten Tage zu opfern und um gutes Wetter zu bitten.”
Da sich so einflußreiche Persönlichkeiten bei dem chinesischen Jupiter Pluvius verwendeten und ihm so großartige Opfermahlzeiten gaben, konnte er nicht anders, als sich erweichen lassen. Schon tags darauf trat schönes, trockenes Wetter ein.
Gegen Süden, Westen und Osten breiten sich um die berühmte Kaiserstadt weite Tiefebenen aus, mit Schnee bedeckt im Winter, staubgefüllt und reizlos im Frühjahr und Herbst, gewöhnlich auf weite Strecken überschwemmt im Sommer. Der Peiho und seine zahlreichen Nebenflüsse nehmen durch diese langweilige Ebene ihren vielgewundenen Lauf; nichts zeigt hier die Nähe einer Großstadt, der Hauptstadt des volkreichsten Reiches der Erde an. Anders ist es aber, wenn man Peking durch das Nordthor verläßt. In weitem Halbkreis wird das Weichbild der Stadt hier von einem Kranz kühner, ungemein malerischer Gebirge umzogen, die sich bis weit in die Mongolei hinein ausdehnen, das beliebteste Jagdrevier des chinesischen Kaiserhofes; der reizendste Sommeraufenthalt für die chinesischen Großen, die fremden Gesandten und europäischen Einwohner Pekings, welche der heißen Jahreszeit entfliehen wollen. Schon unmittelbar nachdem man die schmutzige, volkreiche Nordvorstadt durchritten hat (Spaziergänge bieten in Anbetracht der elenden Wege keinen Genuß), stößt man auf Spuren der tausendjährigen fremdartigen Kultur, welche sich[S. 279] dieses herrliche Stück Land unterworfen hat. Ueberall liegen inmitten ausgedehnter Parks Sommerhäuser und Villen in chinesischem Stil, dazu zahlreiche malerische Tempel, Klöster und vor allem Schlösser des Kaiserhofes und der Prinzen. Auf den Bergspitzen erheben sich hohe vielstöckige Pagoden, und wo immer ein schöner Aussichtspunkt, ein schattiger Wald vorhanden ist, trägt er gewiß einen Tempel oder ein Kloster. Die Mönche sind gerne bereit, ihre Wohnungen mietweise den fremden Teufeln zu überlassen, und sicher werden alle fremden Diplomaten, alle Europäer, welche längere Zeit in Peking verweilt haben, den Sommeraufenthalt in den Bergen als die schönste Erinnerung ihrer ganzen Chinareise bewahren. Kommt die heiße Jahreszeit, dann flüchtet alles in diese prächtige Umgebung, vor allem der kaiserliche Hof, der in den Vorbergen eine der herrlichsten Residenzen besitzt, die ich in Asien gesehen habe, den berühmten Wan-schu-schan, d. h. den Berg der zehntausend Zeitalter.
Der Ausflug von Peking nach Wan-schu-schan ist einer der wenigen in dem ganzen elf Millionen Quadratkilometer großen Reiche, auf welchem man nicht in Gefahr kommt, den Hals zu brechen. Der Weg, der nach Wan-schu-schan führt, wird ja vom Kaiser benutzt und ist demnach in vorzüglichem Zustande. Die Straße führt einem breiten, mit hohen Schattenbäumen bepflanzten Kanal entlang, welcher das Ueberschußwasser des Sees von Wan-schu-schan nach Peking führt, um damit die Bassins, Kanäle und Seen der dortigen Kaiserstadt zu speisen. Einen so angenehmen Ritt wie diesen habe ich auf allen meinen Reisen durch China noch nicht unternommen. Von hundert zu hundert Metern stehen zu den Seiten des Weges gemauerte Wachthäuser für die Mandschurenwachen, welche darauf zu sehen haben, daß zur Zeit der kaiserlichen Reisen kein Fremder den Weg benutzt. Vor dem Eingang zu jedem Wachthause stehen auf Gestellen sechs Lanzen mit roten Pferdehaarbüscheln, und zu den Seiten erheben sich Galgen mit darübergelegten Schnüren, die aber nicht etwa zum Aufhängen der eingefangenen Menschen, sondern nach eingebrochener Dunkelheit zum Aufhängen von Papierlaternen dienen.
Die einzelnen Farmhäuser und Dörfchen, die Tempel, Brücken, Gartenmauern, Landsitze und dergleichen, die sich in der Nähe des Weges befinden, sind in so vorzüglichem Zustande der Erhaltung und von solcher Sauberkeit, daß man sich irgendwo in der Welt, nur nicht in China, diesem Lande der Ruinen und Verwahrlosung, glauben könnte. Es sind Potemkinsche Dörfer, wohl bestimmt, den Kaiser über den wahren Zustand seines ungeheuren Reiches hinwegzutäuschen, denn gerade die Umgebung Pekings ist ein Ruinenfeld, wie es in solcher Ausdehnung und Großartigkeit nur wenige seines Gleichen hat. Ich sah das wieder, als ich von dem Wege ablenkte, um noch dem großen Tempel von Wu-ta-sse einen kurzen Besuch zu machen. Dieses herrliche Denkmal, welches Kaiser Yung-lo vor nahe fünf Jahrhunderten zu Ehren Buddhas mit ungeheuren Kosten errichten ließ, ist dem Verfall[S. 281] nahe, die großen kaiserlichen Gedenktafeln vor dem Tempel sind umgefallen, die riesigen, zwei Meter langen Steinschildkröten, auf denen sie standen, sind mit Erde und Schutt bedeckt, die Dächer der Tempelgebäude sind eingestürzt, und in den Ruinen wohnen in Lumpen gehüllte, verlotterte Priester, die mir für wenige Cents die letzten buddhistischen Gebettafeln verkauften. Das Denkmal selbst, ein monumentaler Steinbau, mit Hunderten von Buddhafiguren bedeckt, trägt auf seiner oberen Terrasse noch immer die wunderlichen fünf Pagoden, doch ist die Treppe, die zu denselben hinaufführt, eingestürzt und nicht mehr benutzbar. Weiterhin, auf Meilen rechts und links vom Wege, nichts als Ruinen. Die herrlichsten und kostbarsten Tempel, einst Zierden des chinesischen Reiches und Schatzkästlein chinesischer Kunst, sind verfallen, überwuchert, verlassen, wie die Ruinen von Uxmal und Palenke, die ich vor Jahren besuchte. Schöne Bronzegefäße, Opferschalen, Glocken liegen halb im Erdreich vergraben auf den Feldern, und niemand kümmert sich um sie. Welch herrliches Bild des Friedens, der Kultur und des Wohlstandes muß dieses Land einstens dargeboten haben! Aber die Chinesen haben es nicht verstanden, es gegen die Einfälle der Feinde zu verteidigen. Die letzten waren die schrecklichen Horden der aufständischen Taiping, und was diese noch in einer Anwandlung von Ehrfurcht verschont hatten, wurde von noch schlimmeren Vandalen, von den Soldaten Frankreichs und Englands zerstört, verbrannt, geplündert. Dieser chinesische Krieg wird immer ein Schandfleck in der Geschichte dieser beiden Völker bleiben. Es wäre genug gewesen, die Chinesen zu bezwingen und den Kaiser zu Paaren zu treiben, es war aber ein Verbrechen, diese entzückenden Paläste und Tempel, diese Sommersitze, Brücken, Denkmäler, Gräber aus mutwilliger Zerstörungswut zu vernichten.
Auf den Kaiserweg zurückgekehrt, kam ich etwa auf der halben Entfernung zwischen Peking und Wan-schu-schan auf einen kaiserlichen Tempel, in welchem der Kaiser, der abwechselnd zu Pferde oder in der Sänfte reist, abzusteigen pflegt, um dort Thee zu nehmen. Jenseits des Kanals gewahrte ich eine große Zahl niedriger Gebäude, von einer Lehmmauer umgeben, die sich wohl einen Kilometer weit den Kanal entlang hinzieht: das Lager mehrerer tausend mandschurischer Bannertruppen, die gerade in ihren bunten malerischen Trachten am Exerzieren waren. Bald darauf stieß ich auf das von einem hölzernen Paifong (Ehrenpforte) überhöhte Eingangsthor des Parkes von Wan-schu-schan, der selbstverständlich jedem Fremden, ob Europäer oder Chinese, verschlossen ist. Eine hohe, viele Kilometer lange Ziegelmauer umgiebt den ganzen großen Sommersitz; die Wachthäuser für die mandschurischen Soldaten mehren sich, und neben den daran stehenden langen Lanzen sah ich noch bei jedem Wachthause ebensoviele Stangen stehen, die an ihrer Spitze scharfe Haken trugen. Diese Instrumente sind dazu bestimmt, Neugierige, welche vielleicht die Mauer erklimmen sollten, bei den Hosen zu fassen und wieder herunterzuzerren.
Nach langem Ritt gelangte ich in das Mandschurendorf Wan-schu-schan, zu Füßen des gleichnamigen Berges, eine Art mandschurisches Paradedorf. Wäre doch ganz China so rein, so wohlhabend, so nett wie dieses Dorf! Und wie leicht wäre dies bei einer halbwegs guten Regierung möglich! War es doch vor Zeiten so, als gute Kaiser mit ehrlichen Beamten über das Reich der Mitte herrschten. In der Mitte des Dorfes befindet sich ein großer, von Wachthäusern und davor stehenden spanischen Reitern eingefaßter Platz, und dieser führt direkt zur monumentalen Haupteingangspforte des kaiserlichen Sommersitzes, von zwei ungeheuren Bronzelöwen bewacht. Hunderte von neugierigen Mandschuren und Chinesen umdrängten mich, als ich, in der Mitte des Platzes stehen bleibend, erstaunt mein Fernglas auf die großartigen Paläste richtete, die sich hinter der Umfassungsmauer auf den Bergabhängen erheben, allein niemand wagte ein Schimpfwort oder einen Steinwurf.
War es mir auch nicht vergönnt, das Innere des herrlichen Sommersitzes zu betreten, weil die kaiserliche Familie eben hier weilte, so sah ich ihn doch in allen seinen Einzelheiten von meinem Standorte hier und dann von einem im Norden sich erhebenden bewaldeten Hügel. Ich habe in China und Japan, in Siam und Indien und anderen Ländern des asiatischen Kontinents keine so eigenartige Palastgruppe gesehen wie jene, welche sich meinem Auge auf dem Berge der zehntausend Zeitalter entrollte. Die Sage, die chinesische Kunst sei im Verfall, wird hier zu Schanden. Als letzter Ausläufer des Hsi-schan (Westgebirges) erhebt sich hier ein steiler Berg, auf der Südseite von einem großen See bespülte steinerne Balustraden mit Statuen, Obelisken und bronzenen Tiergestalten umfassen die spiegelklare Wasserfläche, aus der stellenweise die großen Blätter der Lotospflanze hervorragen. Die reizendsten Pavillons mit zierlichen, kurios geschwungenen Porzellandächern erheben sich an den Ufern, auf der Landseite von Gartenanlagen eingefaßt, hinter denen sich die mächtigen Cypressen und Kiefern eines großen schattigen Parks erheben. Zwei Inselchen unterbrechen den Seespiegel, durch herrliche weiße Marmorbrücken miteinander verbunden; auf einem dieser Inselchen erhebt sich ein großer Tempel mit einer hohen Pagode von mehreren Stockwerken. Zu ihren Füßen ruht auf dem Wasser eine mächtige weiße Dschunke mit einem zweistöckigen Gebäude darauf. Bei näherer Besichtigung ergiebt sich, daß dieses seltsame Fahrzeug vom Seegrunde aus ganz aus weißem Marmor gebaut ist, ein Lieblingsaufenthalt der Kaiserin-Mutter, welche diesen Sommersitz mit dem Kaiser zu teilen pflegt, um ihn so besser unter den Augen und sicherer unter dem Daumen zu haben, denn nicht der Kaiser, sondern diese merkwürdige Frau ist die eigentliche Lenkerin der Geschicke von China.
Noch merkwürdiger, großartiger als der See und die unzähligen in dem weiten ihn umgebenden Park verstreuten Gloriettes, Wohnhäuser, Ehrenpforten, Tempelchen und dergleichen sind die Paläste, welche sich auf dem steilen Berge selbst erheben. Vom Seeufer steigt zunächst eine ungeheure Steinterrasse empor mit vertikalen[S. 284] vielleicht dreißig bis vierzig Meter hohen Wänden, und auf der weiten oberen Plattform steht eine großartige Pagode mit vier schön geschwungenen Dächern aus orangegelbem Porzellan übereinander, gekrönt von einem goldenen Knauf. Die Pagodenwände selbst sind mit grünen Porzellanziegeln bekleidet und auf das reichste ornamentiert. Zu beiden Seiten dieses merkwürdigen Bauwerks bedecken die Anhöhe Tempelchen, Wohnhäuser, Kioske ohne Zahl, durch breite Treppenfluchten miteinander verbunden; zwischen ihnen erheben sich im Schatten mächtiger, knorriger Kiefern Bronzepagoden, Urnen, Vasen von hohem Wert.
Ein Weg führt zu einem breiten Felsenvorsprung an der Südseite des Berges. Auf diesem zeigte sich mir ein geräumiges, luftiges Wohnhaus, mit dreiteiligem grauen Ziegeldach, das auf dicken rotlackierten Pfeilern ruht und weit über die Wohnräume hinwegreicht, so eine breite Veranda bildend. Auf der Terrasse davor erheben sich große Fichten, und unter einer derselben gewahrte ich einen roten Armstuhl mit einem kleinen Tischchen daneben. Dieses Haus wurde mir als das gewöhnliche Wohnhaus des Kaisers bezeichnet, und auf der Terrasse davor soll er den größten Teil seiner Zeit zubringen. Auf meine Frage nach dem Wohnhause der Kaiserin-Mutter wurde mir die Antwort zu teil, daß diese ihren Aufenthaltsort häufig wechsle, bald in diesem, bald in jenem der vielen innerhalb der Umfassungsmauer zerstreuten Gebäude wohne.
Von der kaiserlichen Villa führt ein breiter sonniger, anscheinend zementierter Weg auf den Gipfel des Berges, und dieser wird von der eigentlichen offiziellen Kaiserresidenz gekrönt, ein Palast mit Rundbogenfenstern und ebensolchen Pforten, ganz mit orangegelben glänzenden Porzellanziegeln bekleidet, die in dem Sonnenlichte wie Edelsteine glitzerten. Eben als ich mein Fernglas darauf richtete, erschien auf dem kahlen Wege davor ein farbenreicher Zug von Menschen, dessen Mittelpunkt eine in Gelb gekleidete sitzende Gestalt bildete, über die ein großer roter Sonnenschirm einhergetragen wurde. Von unten herauf näherte sich diesem Zuge ein zweiter, ebenso zahlreicher, aus welchem eine rotgekleidete Gestalt hervortrat, als beide Menschengruppen voreinander Halt machten. Das Volk rings um mich bezeichnete mir die letztere als den Kaiser, die gelbe Gestalt als jene der Kaiserin-Mutter.
Wie alle anderen Kaiserpaläste und Prinzensitze in der Umgebung von Peking, vor allem wie der feenhafte nur einen Kilometer von Wan-schu-schan entfernte Sommerpalast mit seinem ausgedehnten herrlichen Park, so war auch Wan-schu-schan im Jahre 1860 von den französisch-englischen Truppen verbrannt und zerstört worden. Die Kaiserin-Mutter ließ diesen Sommersitz jedoch in den letzten Jahren neu erbauen, und hier war es, wo Prinz Heinrich als erster Prinz eines souveränen Hauses von dem Sohne des Himmels empfangen wurde.
Von den vielen Reisenden, die China besuchen, gehen nur wenige über Shanghai hinaus, nach Peking, und von den wenigen, die Peking besuchen, unternimmt höchstens ein Zehntel den Ausflug zur Großen Mauer, weil sie von dieser das eigentlich Imposante, die dreitausenddreihundert Kilometer Länge, doch nicht sehen können, sondern nur ein Stückchen, und dann, weil die Reise keineswegs eine Vergnügungstour genannt werden kann. Es ist nicht jedermanns Sache, eine Woche auf hartem Maultierrücken durch Steinwüsten und über kahle Gebirge zu reiten, in elenden schmutzigen Chinesenspelunken zu übernachten und sonnenverbrannt, ermüdet, wenn überhaupt mit gesunden Gliedern, nach Peking zurückzukehren, nur um eine Mauer gesehen zu haben. Wer sich aber diesen Strapazen wirklich unterzieht, der wird reichlich dafür entschädigt, nicht der chinesischen Mauer wegen, sondern weil er auf dieser Reise das Leben und Treiben der Chinesen im Inlande kennen lernt, ein ungemein malerisches und landschaftlich großartiges Stück China sieht und an der Großen Mauer selbst noch einen Blick in die Mongolei werfen kann, unter die Nachkommen der Horden des Dschingis-Chan und Kublai-Chan.
Schon das Leben auf der großen Heerstraße zwischen Peking und der Großen Mauer gewährt das größte Interesse, denn auf dieser Straße findet der Warenaustausch statt zwischen dem chinesischen Reiche, der Mongolei und Sibirien. Als ich, begleitet von meinem chinesischen Dolmetscher, auf einem Eselchen Peking verließ, um mich nordwärts gegen die Mongolei zu wenden, hatte ich schon im Stadtthore Mühe, überhaupt durchzukommen, denn nach Tausenden zählen die Kamele, die, schwerbepackt mit allerhand Waren, täglich hier ankommen oder ihren Rückweg nach dem fernen Sibirien antreten. Auf dem viertägigen Ritt nach Nankou, am Südabhange der mongolischen Berge, begegnete ich zahlreichen Karawanen, gewöhnlich mit sechs bis acht, aber auch zwanzig und dreißig Kamelen im Gänsemarsch hintereinander, geführt von breitgesichtigen schlitzäugigen Mongolen. Die Kamele bilden heute noch das wichtigste Transportmittel auf dieser Weltverkehrsroute; sie bringen Thee im Werte von vielen Millionen, chinesische Seidenstoffe, Kleidungsstücke, Stickereien, Industrieprodukte aller Art nach Norden und kehren mit Kohle, Kamelhaar, Häuten, Kalk, Soda, Papier und dergleichen von dort wieder nach Peking zurück. Neben den Kamelkarawanen begegnete ich auch solchen von Maultieren, aber verhältnismäßig nur wenigen Fuhrwerken, vornehmlich plumpen, schweren Ochsenkarren. In verschiedenen Werken über China habe ich gelesen, der elende Zustand dieser Weltverkehrsroute ließe einen Wagenverkehr überhaupt nicht zu, und die Strecke von Nankou über das Gebirge nach Kalgan an der Großen Mauer wäre selbst für Reiter auf Maultieren nur mit Lebensgefahr zu passieren. Das[S. 286] war bis vor einem Jahrzehnt wirklich der Fall. Seither sind aber, ein in China unerhörtes Ereignis, die Wege ausgebessert worden, und man kann heute von Peking bis in die Mongolei fahren. Freilich nicht in Equipagen, sondern nur in zweirädrigen federlosen Karren, die dem Reisenden beim Fahren die Knochen aus dem Leibe rütteln, und kommt man zu einer besonders steilen oder der massenhaft umherliegenden Felstrümmer wegen unpassierbaren Strecke, so werden die Räder abgezogen und der Karrenkasten mittels Stangen zwischen zwei hintereinandermarschierenden Maultieren aufgehängt. Wird der Weg wieder besser, dann wird diese sonderbare Sänfte, im Chinesischen Schen-tse genannt, durch das Anstecken der Räder wieder in ein Fuhrwerk verwandelt.
Je weiter ich mich auf meinem Ritt von Peking entfernte, desto kahler und trostloser wurde die weite Ebene. Rings um Peking ist sie wohl bebaut und mit zahlreichen Dörfern, Gärten, Lustschlössern der Prinzen und Großen, Tempeln, Pagoden und Parkanlagen besetzt. Nachdem ich aber um Mittagszeit auf einer schönen Marmorbrücke den wilden Bergstrom Schaho übersetzt hatte, wurde die Gegend einsamer, unfruchtbarer, denn die vielen Wildbäche, welche zur Regenzeit ihre Fluten und Geröllmassen aus den nahen mongolischen Bergen herabwälzen, verheeren dieses Gebiet in jedem Jahre. Das ungemein malerische, vielgezackte Gebirge umschließt die Ebene in einem weiten Halbkreis; nirgends zeigt sich eine Bresche, ein Paß, um hinüberzugelangen auf die mongolische Seite. Erst kurz vor Nankou entdeckte ich den Weg, der dem Pei-Scha-ho, einem kleinen, zeitweilig aber sehr wasserreichen Bergstrom entlang in das Gebirge emporführt. Am Austritt dieses Flusses in die Ebene liegt Nankou, das mein erstes Reiseziel war.
Nankou ist ein kleines Chinesennest, eigentlich nur aus einer einzigen breiten Straße bestehend, in welcher jedes zweite Haus eine Karawanserei für die Kamel-, Maultier- und Pferdekarawanen ist. Hier drängt sich des Abends der ganze Verkehr der sibirischen Route zusammen, um am folgenden Morgen den letzten Tagesmarsch nach Peking zurückzulegen oder auf dem Wege nach Norden den schwierigen Aufstieg durch den Nankoupaß nach der Großen Mauer zu unternehmen. Eine andere Verkehrsroute zwischen der Mongolei und China giebt es auf Hunderte von Kilometern nicht, denn wäre auch die Große Mauer nicht da, so würden doch die weg- und steglosen steilen Gebirge jeden Verkehr unmöglich machen. Binnen wenigen Jahren dürfte es wohl anders werden, denn eine Eisenbahn zwischen Peking und Sibirien durch die Mongolei ist geradezu unvermeidlich, und die langsam, aber stetig und sicher vordringenden Russen haben die Konzession zur Erbauung dieser Bahn bereits erhalten. Vorläufig aber laufen alle Verkehrsrouten nach Norden hier zusammen, ebenso wie all die Verkehrsrouten von Sibirien und der Mongolei aus den verschiedensten Weltgegenden an dem Nordende des Passes oder vielmehr an jenem Thore der Großen Mauer zusammenlaufen, welches bei Kalgan in der Mongolei liegt.
Diese ungemein wichtige Lage von Nankou haben die Chinesen schon vor vielen Jahrhunderten erkannt; sie haben nicht nur Nankou mit einer hohen und starken, von Türmen flankierten Ringmauer umgeben, sondern auch ähnliche Mauern als Thalsperren links und rechts der Berge emporgeführt. Unseren modernen Geschützen würden diese Riesenmauern, welche bereits einen Teil der gegen die Mongoleninvasion errichteten großen Mauer bilden, freilich nicht lange stand halten, aber in früheren Zeiten leisteten sie gegen die nur mit Bogen und Pfeil, Lanze und Schwert bewaffneten Reiterscharen vorzügliche Dienste.
Als ich nach einer elenden, in einer lärmenden Chinesenspelunke verbrachten Nacht bei Sonnenaufgang wieder weiter ritt, passierte ich noch zwei andere derartige Paßsperren, ehe ich die Höhe des Gebirges und damit auch die Große Mauer selbst erreichte. Oder doch wenigstens das, was man als diese eigentlich bezeichnen sollte, denn obschon nur sozusagen ein Vorwerk derselben, ist sie doch viel höher, mächtiger und besser erhalten als die noch zwei Tagereisen weiter nordwestlich vorbeiführende Große Mauer.
Der Eindruck, den das gewaltige Bauwerk beim ersten Anblick hervorruft, wird noch dadurch erhöht, daß der zu ihr emporführende Weg in einem von steilen Felsen eingefaßten finsteren Engpaß läuft, so schmal, daß der Weg neben dem Wildbache, der am Grunde der Schlucht braust, kaum Platz findet. Ist die etwa sechshundert Meter über dem Meere gelegene Paßhöhe erstiegen, so steht man vor dem berühmten Pa-ta-ling, dem Thore, das hier durch die Mauer führt und von einem mächtigen Wachturm überhöht wird. Eine Rampe führt zu der Mauer empor und, auf dieser stehend, konnte ich erst die ungeheure Mächtigkeit und Ausdehnung derselben erkennen. Wie die meisten Stadtmauern in China, besteht auch diese Grenzsperre gegen die Mongolei aus einem Erdwall, der zu beiden Seiten bis hinauf mit mächtigen Granitquadern belegt ist, so fest und genau aufeinander gefügt, daß sich auch heute noch, viele Jahrhunderte nach der Erbauung, nur wenige Lücken zeigen. Dieser Wall, in einer unteren Breite von etwa achtzehn Metern und einer Höhe von elf Metern, ist oben mit Steinen oder gebrannten Ziegeln gepflastert und hat zwischen den Parapetmauern oder Brustwehren, mit denen er auf beiden Seiten seiner ganzen ungeheuren Länge nach eingefaßt wird, eine Breite von fünf bis sieben Meter.
Die Brustwehren sind aus halbmeterlangen, fußbreiten Ziegeln aufgeführt und besitzen auf etwa anderthalb Fuß Höhe vom Boden Schießscharten für Handfeuerwaffen, während zwischen den gewaltigen, drei Meter voneinander entfernten Zinnen die Geschütze eingeführt wurden. Von den letzteren liegen noch Dutzende ohne Laffetten, verrostet, auf dem Wall umher, denn die Große Mauer wird ihrer ganzen Ausdehnung nach nicht mehr bewacht, und auch die von hundertfünfzig zu hundertfünfzig Meter sich über die Mauer erhebenden gra[S. 289]nitenen Wachthürme sind verlassen, Schlupfwinkel für Fledermäuse und allerhand Ungeziefer.
Von meinem hohen Standpunkte aus konnte ich die Mauer auf viele Meilen weit verfolgen; wie eine ungeheure, zu Stein gewordene Schlange führt sie unabsehbar nach Ost und West die steilen Berge hinauf auf schwindelnde Höhen, in tiefe Thäler hinab, ohne die mindeste Rücksicht auf die Bodenverhältnisse. Kein Berg ist zu hoch, kein Thal zu tief, kein Fluß zu breit. Alles wird von diesem Riesenwerke überwunden. Jeder Granitblock, jeder der zentnerschweren Ziegel mußte aus beträchtlichen Entfernungen durch unwirtliches, unbewohntes Gebiet herbeigeschleppt und dann erst noch auf steile, mitunter fast unzugängliche Höhen getragen werden. Und wie viele Granitblöcke, wie viele Ziegel waren für diese dreitausenddreihundert Kilometer lange Mauer erforderlich! Auf einer früheren Reise hatte ich den ersten Anfang der Großen Mauer bei Schanhaikwan im Gelben Meere gesehen, und wie hier, so setzte mich auch dort ihre Massenfestigkeit, die Höhe und Stärke ihrer Türme, die weit ins Meer vorgeschobene Endbastion in Erstaunen. Um für diese Endbastion das Fundament zu schaffen, wurden große Schiffe mit Eisenstücken und Granitblöcken gefüllt und versenkt. An manchen Stellen ist die Mauer höher und stärker, an manchen schwächer, streckenweise nur ein einfacher Erdwall, aber hier, bei Pa-ta-lin, an der Hauptroute zwischen der Mongolei und China, ist sie durchwegs in verhältnismäßig vorzüglichem Zustand und selbst auf den wolkenumzogenen Berggipfeln durch feste Wachtürme verstärkt.
Und diese Mauer, die ich über den Gebirgskamm in unabsehbare Fernen hinziehen sah, die Steppen der Mongolei und die kahlen Berghänge Chinas zu ihren Füßen, ist, wie gesagt, nur die zweite, innere Mauer, im siebenten Jahrhundert aufgeführt und unter der Mingdynastie vor vierhundert Jahren erneuert. Bei ihrer Erbauung wurden über eine Million Menschen an die chinesische Grenze befohlen, um an dem Riesenwerk zu arbeiten. Die innere Mauer zweigt sich von der äußeren nordöstlich von Peking ab und vereinigt sich mit ihr wieder im Westen der Provinz Schansi, nahe dem mächtigen Hoanghostrom.
Die eigentliche Große Mauer, oder wie sie von den Chinesen genannt wird, Wan-li-tschang-tscheng, das heißt das zehntausend Li lange Bollwerk, liegt auf dem Wege von Nankou nach Sibirien um zwei kleine Tagereisen weiter, unmittelbar an der großen Handelsstadt Tschan-kia-kao, dem Kalgan der Russen, in der Mongolei und zieht vom Gelben Meere bis in die Wüste Gobi im Westen des Reiches. Sie wurde unter dem Kaiser Tschi-Hwangti im Jahre 214 vor Christi Geburt als Schutz gegen die wiederholten Einfälle der Mongolen begonnen und im Laufe der Zeiten wiederholt erneuert, ausgebessert und verstärkt.
Ihre Gesamtlänge beträgt dreitausenddreihundert Kilometer, also wie etwa die Entfernung vom Ural nach Spanien. Wie der Jesuitenpater de Mendoza erzählt, sandte[S. 290] der Kaiser, „um sothanes wunderbahres Werck zu verfertigen, das dritte Theil seiner Unterthanen, und bißweilen von fünff Mann zween dahin; und obgleich die Einwohner einer jeden Landschafft an denen Oertern, so ihren Häusern am nächsten, blieben und arbeiteten, sturben doch nichtsdestoweniger fast alle Diejenigen, welche dahingingen, entweder vor Langwierigkeit der Reyse, oder vom Unterschiede der Lufft, so in diesen Ländern ist.”
Peter de Gojern, der 1655 bis 1657 die Gesandtschaft der Ostindischen Gesellschaft zum großen Tatarenchan, d. h. dem Stammvater der jetzt regierenden chinesischen Kaiserdynastie, nach Peking begleitete, sagt in seiner 1666 in Amsterdam erschienenen Reisebeschreibung:
„Den Baw dieses wundergrossen Wercks ließ der Kayser aufführen nicht so sehr zur Scheide Wandt zwischen dem Sinischen und Tartarischen Reiche, als zum hochnöthigen Mittel hinfüro dem Einfall der Tarter zu wahren und solche mächtige Feinde allerdings aus dem Reiche zu halten. Er ließ eine solche Zahl Menschen daran arbeiten, daß das gantze Werck innerhalb fünff Jahren fertig und vollzogen ward.”
„Denn da nam dieser Kayser auß jedweden zehen Männern durchs gantze China drey, und zuletzt auß jeden fünffen zween heraus, welche täglich an der Mawr arbeiten und ein gewisses Stücke davon fertig schaffen musten. Das gantze Werck ward von Kiesel- und andern Steinen auffgeführt, und dermassen dicht und fest gemawret, daß man nicht die geringste Spalte oder Ritze daran finden konnte. Ja es hatte der Kayser ein gar strenges Gebot publiciret, daß, wo in einigem Winckel oder Fugen des Wercks sich ein Nagel hineinschlagen liesse, derjenige, so am selbigen Stücke gearbeitet, ein Fenster im Galgen geben solte.”
Ein Wort des Kaisers hatte genügt, Millionen von Menschen in Bewegung zu setzen; Millionen verließen ihre Heimat, ihre Familien, um nach der Nordgrenze des ungeheuren Reiches zu ziehen und dort unter den größten Entbehrungen jahrelang zu arbeiten. Hunderttausende büßten ihr Leben ein, von irgend welchem Lohn, irgend welcher Entschädigung für diese Opfer war nicht die Rede, und doch opferten sie sich, weil es der Kaiser befohlen. Aehnliches, wenn auch in unvergleichlich kleinerem Maßstabe, ist bei der Herstellung des Suezkanals erfolgt, aber es ist sehr fraglich, ob sich ein gleiches Zusammentreiben von Menschen noch einmal ausführen ließe. In China indessen gilt das Kaiserwort im Ernstfalle noch immer für allmächtig. Noch heute richten sich trotz aller Mißwirtschaft, trotz Elend, Zerfall und Aufständen doch noch alle Blicke nach Peking. Ich habe das im chinesischen Reiche überall wahrgenommen, und wenn auch das Vertrauen in den Bestand und in die Widerstandskraft des chinesischen Volkes durch den letzten Krieg mit Japan erheblich erschüttert worden ist, so scheint es mir doch sehr gefehlt, diese Widerstandskraft zu unterschätzen. Droht wirklich ernste Gefahr für den Bestand[S. 291] des Reiches und dringt davon die Ueberzeugung in die Massen des Volkes, dann dürfte China nicht so leicht zu besiegen sein, wie es durch die Japaner geschehen ist.
Dafür wird aber die friedliche Eroberung desto sicherer stattfinden, soweit es den Handel, den Verkehr, die Erschließung des Landes betrifft, und gegen diese wird auch die chinesische Mauer nicht standhalten. Die einstigen tapferen Mongolen, welche unter Dschingis-Chan das Reich überfluteten, ziehen heute als friedliche Kameltreiber durch die Mauer nach China; ihre Fürsten sind Vasallen des Kaisers und kommen zeitweilig nach Peking, um dort ihren Tribut zu entrichten.
Nicht die Mongolen drohen dem chinesischen Reiche, sondern das Volk, das nördlich an sie grenzt: die Russen. Gegen sie giebt es keine chinesische Mauer, und durch denselben Engpaß von Nankou, durch welchen heute der ganze Verkehr zwischen China und Sibirien auf Kamel- und Maultierrücken stattfindet, wird binnen einem Jahrzehnt die Lokomotive dampfen.
Die Umgangsformen sind bei den Chinesen vielleicht strengeren Regeln unterworfen als bei irgend einem anderen Volke, nur kommen sie in einer der unsrigen ganz entgegengesetzten Weise zum Ausdruck. Empfängt beispielsweise ein Chinese Besucher in seinem Hause, so nimmt er dazu seinen Hut nicht ab, sondern setzt ihn auf; er schüttelt bei der Begrüßung nicht die Hände des Besuchers, sondern seine eigenen Hände, und er weist dem Gaste nicht die rechte, sondern die linke Seite als Ehrenplatz zu. Es wäre ein schlimmer Verstoß gegen die Etikette, wollte der Gast sich nach dem Befinden der Damen erkundigen oder den Wunsch ausdrücken, ihnen vorgestellt zu werden. Die Damen bleiben unsichtbar, selbst bei Mahlzeiten, und statt ihrer werden Frauen von zweifelhaftem Ruf zugezogen. Die Tafel wird nicht mit einem weißen Tischtuch bedeckt, wie bei uns, denn weiß ist bei den Chinesen die Farbe der Trauer. Während der Mahlzeit werden nicht kalte, sondern warme Getränke aufgetragen; die Reihenfolge der Speisen ist die umgekehrte der unsrigen. Der Chinese hat nicht den Wunsch, möglichst jung, sondern möglichst alt auszusehen, und es ist die größte Schmeichelei, einen jungen Mann zu seinem ehrwürdigen Aeußeren zu beglückwünschen. Wir schneiden unsere Kopfhaare kurz, der Chinese verlängert sie noch künstlich durch Seidenschnüre; wir sind stolz auf unsere Bärte, der Chinese vertilgt bis zu seinem fünfundvierzigsten Jahre sorgfältig alle Bartspuren. Die Chinesin schnürt sich nicht den Leib, sondern die Füße; geht sie aus, so setzt sie nicht einen Hut auf, sondern entfernt jede Kopfbedeckung und zeigt das Gesicht unverschleiert. Der Chinese trägt keinen Spazierstock, sondern einen Fächer, statt sich auf seinen Spaziergängen von einem Hund begleiten zu lassen, trägt er einen Käfig mit einem Vogel; und reitet er, so hält er die Zügel nicht in der linken, sondern in der rechten Hand. Er schreibt nicht mit der Feder, sondern mit einem Pinsel, und zwar von oben nach unten, von rechts nach links, von hinten nach vorn; Randbemerkungen macht er nicht unten, sondern oben, Nachschriften stehen dort, wo bei uns der Anfang ist, und datiert er einen Brief, so schreibt er zuerst das Jahr, dann den Monat, dann den Tag. Spricht er jemanden an, so nennt er den Namen zuerst, den Titel nachher, und sagt nicht: „Guten Morgen, Herr Fischer”, sondern „Fischer Herr, Tschin-Tschin”. Der Chinese kann die schlimmsten Schimpfwörter an den Kopf geworfen bekommen, er wird darüber vielleicht lachen; tritt ihm aber zufällig jemand auf die kleine Zehe, was wir unter gegenseitigen Höflichkeitsformen weiter unbeachtet lassen, so vergeht er vor Zorn und prügelt sich vielleicht sogar. Stirbt sein Sohn, ein Ereignis, worüber wir jammern und wehklagen, so lacht der Chinese, solange er unter Leuten ist, darüber. Alle diese und tausenderlei andere Einzelheiten in den Umgangsformen sind in China[S. 293] durch uralte Ueberlieferungen geheiligt, ja sie werden durch ein eigenes Staatsministerium bis ins kleinste festgestellt. Dieses Ministerium, eine der sechs großen Zentralbehörden in Peking, führt den Titel Li-Pu, etwa Amt der Gebräuche und Zeremonien. Der Hof, die Festtage, der administrative und militärische Organismus, die Geburten, Hochzeiten, Leichenbegängnisse, Trauer, Götter- und Ahnenverehrung, die Ehren und Würden, Uniformen, Trachten, Sommer- und Winterkleidung, die Art der Begrüßung, Gehen, Fahren, Reiten, mit einem Worte das ganze Leben des Chinesen von seiner Geburt bis zu seinem Tode, ja sogar darüber hinaus, ist dem Li-Pu untergeordnet, und seine Vorschriften werden von jedem Bewohner des Reichs der Mitte genau beobachtet.
Das Li-Pu ist in eine Anzahl von Aemtern eingeteilt, deren jedes seine besondere Bestimmung hat und seine Weisheit aus einem uralten Werke, dem Buch der Gebräuche schöpft, das nicht weniger als zweihundert Bände umfaßt. Einem dieser Aemter ist auch der Ahnenkultus untergeordnet mit den Vorschriften für die Verehrung der verstorbenen Kaiser, Generale, Staatsmänner und Gelehrten, der Geistermahlzeiten, Ahnenopfer und dergleichen. Ein anderes Amt, das Amt des Gastes und des Wirtes genannt, regelt den Verkehr mit den fremden Gesandtschaften und tributpflichtigen Fürsten; ihm sind die Dolmetscher und die chinesischen Gesandtschaften im Auslande in Bezug auf die Einzelheiten der Ausrüstung und Reise untergeordnet. Sogar die Musik hat ein eigenes Kaiserliches Musikamt mit einer großen Anzahl von Beamten, welche die Aufgabe haben, „die Grundsätze der Harmonie und Melodie zu erforschen, Musikstücke zu komponieren und Instrumente anzufertigen, um diese Musikstücke aufzuführen”. Die Chinesen sind wohl das einzige Volk des Erdballs, das ein eigenes Musikamt besitzt und so viel offizielle Musik macht. Selbst die Regeln des Tanzes sind von dem Ministerium der Gebräuche vorgeschrieben, denn, so sagt Confucius, „in Wirklichkeit ist nichts ohne seine bestimmten Zeremonien”.
Der Chinese kann sich nicht einmal nach Belieben sein Haus bauen. Er hat in der Anlage des Hauses, in der Richtung der Front, ja sogar in Bezug auf die Höhe bestimmte Vorschriften zu beobachten. Er darf es nicht höher bauen als das nächste Haus eines ihm im Range Höherstehenden, und neben den Gesetzen, welche die Lebenden ihm zur Befolgung auferlegen, darf er auch das Recht der Toten nicht verletzen. Den bösen Geistern, die Himmel und Erde bevölkern, muß er aus dem Wege gehen, oder wie es in China heißt, das Feng-Schui beobachten. Auf Schritt und Tritt, in seinem ganzen Thun und Lassen ist er durch Vorschriften und alte Traditionen eingeengt, besonders dann, wenn er in den kaiserlichen Dienst getreten ist. Auch der gewöhnliche Bürger muß sich dem Li-Pu willenlos unterwerfen. Die Farbe, Stoffgattung und der Zuschnitt der Kleider, die Anzahl der Knöpfe, die Hüte, die Farbe der Sänften, Sänftenstangen, ja sogar die Regen- und[S. 294] Sonnenschirme haben ihre bestimmte Bedeutung. Der chinesische Beamte darf nicht nach Belieben ein wärmeres Kleidungsstück anlegen oder es mit irgend einem beliebigen Pelz verbrämen lassen. Er mag in den kalten Provinzen des Nordens frieren, er mag bei der Annäherung des Sommers in dem tropischen Süden schwitzen, Sommerkleidung oder Pelz muß er anbehalten, solange nicht von Peking der Tag bezeichnet wird, an welchem Seine Majestät der Kaiser seinen Sommer- oder Winterhut aufgesetzt hat. An diesem Tage wechseln auch sämtliche Mandarine ihre Kleidung. Ist es Sommer geworden, so werden die Pelze, die aufgestülpten schwarzen Seidenhüte und die kleinen niedlichen Handöfchen, die jeder Beamte bis dahin zu tragen hat, eingepackt und mit seidenen Gewändern, leichten Bambushüten und Fächern vertauscht. Generalgouverneur, Tatarengeneral oder Minister können sich wohl in den Provinzen den Luxus von sechs oder mehr Sänftenträgern erlauben, in Peking aber dürfen ihre Sänften nur von vier Trägern getragen werden. Würdenträger geringeren Grades haben in Peking Anspruch auf zwei, außerhalb der Hauptstadt auf vier Sänftenträger; noch geringere dürfen sich in Peking der Sänfte nicht bedienen, können aber reiten. Zieht ein hoher Würdenträger diese Art der Fortbewegung vor, so muß er von zehn Stalldienern begleitet werden, von denen zwei vor ihm, acht hinter ihm einherschreiten. Je nach dem Range sinkt diese Anzahl der Begleiter auf sechs, vier und zwei herab, und Beamte des geringsten Grades haben nur einen Begleiter, wobei aber auch noch eine strenge Unterscheidung darin liegt, ob der Begleiter vor dem Reiter oder hinter ihm einherschreitet.
Die gelbe Farbe darf nur von Mitgliedern des kaiserlichen Hofes oder von solchen Würdenträgern getragen werden, denen diese Auszeichnung besonders verliehen wird. Die eigentlichen Rangabzeichen sind die roten, weißen, blauen oder metallfarbenen Knöpfe auf den Hüten und die viereckigen, reich gestickten Schilder auf Brust und Rücken. Zeigen diese Schilder einen in Gold gestickten Storch, so sind die Träger Beamte des höchsten Ranges, zeigen sie einen Drachen mit vier Klauen an den Füßen, so sind die Träger Edelleute. Als besondere Auszeichnung dürfen manche von diesen einen Drachen mit fünf Klauen tragen. Näht sich jemand die fünfte Klaue auf, ohne die Berechtigung dazu zu haben, so wird er durch hundert Stockschläge bestraft und muß einen Monat den schrecklichen Holzkragen, Kang genannt, tragen. Nur gewisse privilegierte Klassen dürfen sich in Seide kleiden; wenn ein Bürger in die Stickereien seiner Kleider Goldfäden einflechten[S. 295] oder es wagen sollte, statt schwarzer Tuchschuhe solche aus Seide zu tragen, so wird er ebenfalls streng bestraft. Das gilt nicht allein von den Männern. Auch die Frauen sind diesen strengen Kleidungsvorschriften unterworfen, so daß man die Gattin eines Mandarins dritter Klasse beispielsweise von einer solchen vierter Klasse, die Beamtenfrau von der Offiziersfrau und von einer gewöhnlichen Bürgersfrau sofort unterscheiden kann.
Die Chinesin kann sich nicht nach Belieben in Samt und Seide hüllen, Sonnenschirme, Spitzen, Federn von Qualität und Farbe tragen, wie ihre Mittel es erlauben oder wie ihr es am besten steht. Es wäre gewiß den gesellschaftlichen und Vermögensverhältnissen in anderen Ländern sehr zuträglich, wenn man dort ebenfalls einige Vorschriften ähnlicher Art machte. Außerhalb Chinas ist die Dame Mode souverän, in China nur der Kaiser.
Wie die Kleidung, so ist auch die Begrüßung bei den Chinesen strengen Regeln unterworfen. Europäische Reisende in China haben die gegenseitige Begrüßung der Chinesen unter dem Sammelnamen Kautau zusammengefaßt. Der Kautau besteht darin, daß man mit geschlossenen Beinen in die Knie fällt und mit der Stirn den Boden einmal berührt. Aber diese Begrüßung gebührt nicht jedermann. Der Li-Pu unterscheidet acht verschiedene Arten der Begrüßung. Die gewöhnlichste besteht darin, daß man die beiden zu Fäusten geballten Hände vor der Brust aneinanderhält. Das ist der Kung-schau. Die nächst höhere Begrüßung, Tso-yih genannt, besteht neben der eben beschriebenen noch in einer Verbeugung. Bei der dritten, Ta-tsien, hockt der Grüßende nieder, als ob er in die Knie fallen wollte; bei der vierten, Kwei genannt, fällt er wirklich auf die Knie. Erst die fünfte Begrüßung ist der einfache Kautau. Die sechste Art der Begrüßung besteht aus diesem Kautau, aber mit dreimaligem Aufschlagen der Stirne auf den Boden. Deshalb auch ihr Name San-kau, d. h. dreimal aufschlagen. Die siebente Begrüßung Lu-kau besteht aus zwei San-kaus und die achte und ehrfurchtsvollste Begrüßung aus drei San-kaus. Bei dieser, San-kwei-kin-kau genannt, muß also der Grüßende dreimal niederknien und jedesmal die Stirne dreimal auf den Boden schlagen. Dieser Gruß[S. 296] gebührt jedoch nur den höchsten Göttern und dem Kaiser, dem Vertreter dieser Götter auf Erden. Manchen Göttern wird nur die siebente oder sechste Begrüßung zu teil.
Die Kaiser der gegenwärtigen Dynastie haben bisher auf diese Begrüßungsart ungemein streng gehalten, und sie bildete auch den Gegenstand eines ernsten diplomatischen Zwischenfalles, als im Jahre 1873 der Empfang der Gesandten durch den Kaiser erörtert wurde. Das Li-Pu bestand darauf, daß auch die Gesandten der Großmächte vor dem Beherrscher des Reiches der Mitte sich dreimal niederwerfen und mit der Stirn den Boden neunmal berühren sollten. Die Gesandten weigerten sich natürlich, diese erniedrigende und keineswegs graziöse Begrüßung auszuführen, und erklärten sich nur bereit, dem Kaiser dieselben Ehren zu erweisen wie ihren eigenen, dem Kaiser im Range gleichstehenden Souveränen. Die Verhandlungen wurden während sechs Monaten fast täglich geführt, bis endlich den Diplomaten die Geduld riß und der amerikanische Gesandte erklärte, die diplomatischen Beziehungen abzubrechen und von seiner Regierung Instruktionen abzuwarten, welche dem Ernst der Situation entsprechen würden. Daraufhin gab der Kaiser gnädigst nach und begnügte sich mit drei tiefen Verbeugungen der Gesandten. Eine andere Schwierigkeit bildeten die harmlosen schwachen Degen, die zur diplomatischen Uniform gehören. In Gegenwart des Kaisers dürfen keinerlei Waffen getragen werden, und es dauerte lange, ehe die bezopften Zeremonienmeister der verbotenen Mode nachgaben.
Ebensowenig dürfen in Gegenwart des Kaisers Augengläser und Zwicker getragen werden. Nun war einer der Vertreter so kurzsichtig, daß er ohne Gläser vollständig hilflos war. Die Chinesen beschlossen, daraus keine diplomatische Frage zu machen, sondern an die Gutherzigkeit des betreffenden Gesandten zu appellieren. Er gab wirklich nach und wurde von zwei Kollegen in die Audienzhalle des Kaisers geführt.
Augengläser dürfen in China auch im gewöhnlichen Leben vor im Range höherstehenden Personen nicht getragen werden. Selbst der Kurzsichtige muß sie abnehmen, wenn er vor einen Mandarin tritt, und sollte beispielsweise bei Gerichtsverhandlungen ein Kurzsichtiger in die Lage kommen, etwas lesen zu müssen, so muß erst die Erlaubnis des Richters zum Aufsetzen der Augengläser eingeholt werden. Augengläser bilden überhaupt in China das Zeichen von höherem Ansehen und Würde. Sobald ein Litterat irgend eine Mandarinstelle erhält, wird es gewiß sein erstes sein, sich ein paar Augengläser anzuschaffen, selbst wenn er sich des besten Sehvermögens erfreuen sollte.
Jedem Mandarin des Zivil- oder Militärstandes gebührt je nach seinem Range eine der vorstehenden Begrüßungsarten. Begegnet ein niedriger Mandarin auf der Straße einem höheren, so muß er vom Pferde oder aus der Sänfte steigen, um diese Begrüßung vorschriftsmäßig auszuführen. Mandarine desselben Ranges thun[S. 297] dasselbe, ja sie überbieten sich sogar, um einander zuvorzukommen. Man kann sich leicht vorstellen, welcher Zeitverlust und welche Umstände mit so zeremoniösen Begrüßungen auf offener Straße verbunden sind, und deshalb trachten Mandarine, wenn sie einander aus der Ferne ansichtig werden, auszuweichen, oder sie ziehen die Vorhänge ihrer Sänften zu und thun, als bemerkten sie einander gar nicht. Das Volk hat sich vor den Mandarinen, wenn sie im Dienste sind oder zu Gericht sitzen, auf die Knie zu werfen. Nur die Greise machen darin eine Ausnahme. Selbst grauhaarige Sträflinge werden gewöhnlich von den Richtern aufgefordert, sich zu erheben. Diese im Auslande leider so wenig gekannte Achtung vor dem Alter hat in China für viele Ausländer schon sehr schlimme Folgen gehabt. Vor einer Reihe von Jahren begegneten sechs junge Engländer in der Nähe eines Vertragshafens einem alten Manne, der eine schwere Last auf dem Rücken trug. Nach chinesischer Etikette würde jedermann, ob aus den niedrigsten oder höchsten Ständen, einem Greise ausweichen, selbst wenn er keine Bürde trüge. Der Weg war schmal und die Engländer bestanden darauf, daß der Alte ihnen Platz mache. Als er sich weigerte, schlugen sie ihn und stießen ihn endlich in den Sumpf zur Seite des Weges. Diese That sollte ihnen übel bekommen. Die erzürnten Bewohner des Dorfes, zu welchem der Alte gehörte, machten sich zur Verfolgung der Engländer auf und töteten sie insgesamt.
Auch bei Besuchen beobachten die Chinesen ein eigentümliches Zeremoniell. Der Besucher wird sich in seiner Sänfte nicht bis an das Thor tragen lassen, sondern seinen der Sänfte stets vorausschreitenden Visitenkartenträger mit seiner gewöhnlich etwa fünfundzwanzig Centimeter langen roten Visitenkarte zu dem Bewohner des betreffenden Hauses voraussenden. Ist der Besucher in Trauer, so sind seine Visitenkarten von weißer Farbe, und die Schriftzeichen sind blau. Will der Hausbewohner den Besucher nicht empfangen, so verleugnet er nicht seine Gegenwart, wie es in anderen Ländern zu geschehen pflegt, sondern sein Thorhüter wird dem Visitenkartenträger sagen: „Dein Herr braucht sich nicht zu bemühen”. Darauf wird die Karte dort gelassen. Wird der Besuch angenommen, so begiebt sich der Hausherr bis zum Eingang, um den Besucher zu empfangen und ihn selbst unter vielen Verbeugungen in die inneren Räume zu führen. Vorher wird er aber seinen offiziellen Zeremonienhut aufsetzen. Die größeren Häuser und die Yamen (Dienstwohnungen) der Mandarine haben gewöhnlich drei Eingänge. Der mittlere Eingang wird nur Besuchern von gleichem oder höherem Range als der Hausherr geöffnet. Auch diese Frage hat in China schon viele Ungelegenheiten gemacht. In Canton z. B. unterhielten die europäischen Konsuln viele Jahre lang keinen persönlichen Verkehr mit dem Vizekönig, weil dieser sich weigerte, ihnen die mittlere Ehrenpforte zu öffnen. Allerdings standen die Konsuln im Range tief unter dem Vizekönig, allein sie waren die Vertreter ihrer Regierungen und unterließen lieber den Verkehr mit[S. 298] dem Vizekönig gänzlich, als sich durch eine Seitenpforte zu ihm zu begeben; nach langen diplomatischen Verhandlungen setzten sie aber ihren Willen durch.
Sobald der Hausherr seinem Gast den (stets erhöhten) Ehrensitz zu seiner Linken angewiesen hat, werden Thee und Pfeifen aufgetragen. Der Besucher ist nicht verpflichtet, irgend etwas zu genießen, außer wenn der Hausherr ihm als besonderen Beweis seiner Achtung eine Tasse Thee selbst darreicht. Er wird dies niemals mit einer Hand, sondern immer mit beiden Händen thun, indem er sich von seinem Sitze erhebt, und in derselben Weise muß der Besucher die Tasse Thee auch in Empfang nehmen. Bei offiziellen Besuchen zwischen Mandarinen und europäischen Beamten wird der dargebotene Thee erst am Schlusse des Besuches getrunken. Berührt der Hausherr im Laufe der Unterhaltung seine Tasse, so ist dies das stillschweigende Zeichen, daß er die Unterhaltung beendet zu sehen wünscht.
Auch in den einzelnen Redeformen beobachtet der Chinese gewisse feste Regeln, und eine ungezwungene Unterhaltung wie bei uns ist im Reiche der Mitte absolut unbekannt. Ja und Nein werden immer in der sonderbarsten Weise umschrieben, denn es wird in China beispielsweise als schlimmer Verstoß gegen die gute Sitte angesehen, jemandem etwas direkt durch ein Nein abzuschlagen. Seit Jahrhunderten sind die einzelnen Fragen und Antworten bei Besuchen in bestimmte Formen krystallisiert, mit solchen bombastischen Floskeln verziert, so mit Komplimenten ausgeschmückt, daß sie in der wörtlichen Uebersetzung geradezu unverständlich sind. Drückt beispielsweise der Besucher sein Bedauern darüber aus, daß er den Hausherrn so lange nicht gesehen hat, so wird dieser nach den bestehenden Formeln antworten: „Wir beanspruchen die Mühe Ihrer ehrenwerten Schritte zu empfangen; ist die Person in der Sänfte wohl?[S. 299]” was soviel heißt als „Ich danke für Ihren Besuch und hoffe, Sie befinden sich wohl”. Gewöhnlich sendet der Hausherr nach den einleitenden Höflichkeitsbezeugungen nach seinen Söhnen, die beim Eintreten den Kautau vor dem Besucher ausführen. Studiert einer der Söhne, so wird vom Besucher die Hoffnung ausgesprochen, daß er „den Wohlgeruch der Bücher fortführen”, d. h. den litterarischen Ruf der Familie aufrechterhalten wird. Je höher der Besucher die Anwesenden preist, desto verächtlicher wird der Hausherr von seinen Angehörigen sprechen, denn es gehört zur guten Sitte, alles Fremde in den Himmel zu erheben, alles Eigene herunterzusetzen; aber immer in der für Ausländer so schwer verständlichen Umschreibung. Die Frage: „Erfreut sich der ehrenwerte große Mann des Glückes?” will sagen „Befindet sich Ihr Vater wohl?” Fragt der Besucher: „Wie viele würdige junge Herren (Söhne) haben Sie?” so antwortet der Vater, wenn er beispielsweise nur einen Sohn haben sollte: „Mein Los ist armselig, ich habe nur einen kleinen Käfer”. In ähnlichen Formen bewegen sich auch die Gespräche von Fremden, die einander begegnen, selbst wenn sie Bettler sein sollten. So z. B.:
„Wie lautet Ihr ehrenwerter Name?”
„Der erbärmliche Name Ihres minderen Bruders ist Ming.”
„Was ist Ihre erhabene Langlebigkeit?”
„Sehr gering. Nur elende siebzig Jahre.”
„Wo befindet sich Ihr edler Palast?”
„Das Schmutzloch, in welchem ich mich verberge, ist in X.”
„Wie viele würdige junge Herren (oder wie viele „kostbare Pakete”) haben Sie?”
„Nur drei dumme kleine Schweinchen.”
Unter Gleichgestellten ist es ein Verstoß gegen die Etikette, sie bei ihrem Namen zu nennen, selbst wenn sie die besten Freunde oder sogar Brüder sein sollten. Sie sprechen einander als Ehrwürdiger älterer Bruder oder Ehrwürdiger jüngerer Bruder an. Der älteste Sohn einer Familie Namens Ming wird als der große Ming bezeichnet, der zweite Sohn als Ming Nummer zwei, der dritte als Ming Nummer drei und im Verkehr mit Gleichgestellten werden sie von diesen mit Ehrwürdiger großer Ming, oder Ehrwürdiger Ming Nummer zwei und so fort angesprochen. Nur der Höhergestellte hat das Recht, sie bei ihrem wirklichen Namen zu nennen.
So ist das ganze Leben der Chinesen eingeengt durch ein bis in die kleinsten Einzelheiten gehendes Zeremoniell, auf das mit der größten Fürsorge geachtet wird. Der Europäer, der glaubt, sich im Verkehr mit Chinesen darüber hinwegsetzen zu können, wird niemals etwas ausrichten, denn die Chinesen messen den Charakter und die Stellung eines Mannes hauptsächlich nach diesen in unseren Augen nichtigen Einzelheiten. Ich habe das auf meinen Reisen im Innern Chinas und bei meinen Mandarinbesuchen fast täglich beobachtet. Der frühere amerikanische Gesandte in Peking, Chester Holcombe, erzählt darüber einige interessante Beispiele. Einmal[S. 300] sandte er einen Konsul nach einer Provinzialhauptstadt, um dort eine Angelegenheit mit dem Gouverneur zu schlichten. Eine halbe Stunde nach seiner Ankunft in der betreffenden Stadt ritt der Konsul, noch in seinen Reisekleidern, zu dem Yamen des Gouverneurs und klopfte mit seiner Peitsche an die große Thür. Der erschreckte Thorhüter nahm seine Karte ab und brachte sie dem Gouverneur, aber dieser weigerte sich, den Konsul zu empfangen. Während einer Woche ließ er sich täglich beim Gouverneur anmelden, täglich wurde er abgewiesen, und schließlich mußte er unverrichteter Dinge die beschwerliche, wochenlange Rückreise nach Peking antreten. Auf dem Wege wurde er in einer Stadt von dem Pöbel auch noch thätlich insultiert. Die fragliche Angelegenheit, die durch ein höfliches Auftreten des Konsuls ohne weiteres hätte geregelt werden können, zog sich drei Jahre lang hin, und schließlich mußte sich der Gesandte selbst bequemen, nach der betreffenden Provinzialstadt zu reisen. Mit allen Einzelheiten der chinesischen Etikette vertraut, wurde er von dem Gouverneur mit ausgesuchter Höflichkeit empfangen, und die Sache wurde in der ersten Unterredung beigelegt.
Einmal hatte Holcombe eine Konferenz mit den chinesischen Ministern im Auswärtigen Amte in Peking. Als ich eintraf, so erzählt er, waren zwei von ihnen bereits anwesend. Wir bekomplimentierten einander gegenseitig geraume Zeit an der Thüre, bevor wir eintraten, und wieder eine geraume Zeit, ehe wir an dem großen runden Tische im Konferenzzimmer unsere Plätze einnehmen konnten. Während unserer Beratungen kamen nacheinander fünf andere Minister. Jedesmal stürzten die anwesenden Minister wieder aus der Thüre, verbeugten sich unzähligemal voreinander, ohne daß einer den Vortritt annehmen wollte, und schließlich kämpften sie wieder unter den tiefsten Verbeugungen um den untersten Sitz am Tische, so daß während der Konferenz die Teilnehmer fünfmal ihre Plätze wechselten.
Der Chinese wird selten im Verkehr mit seinen Landsleuten oder mit Ausländern absichtlich eine unangenehme oder anstößige Bemerkung fallen lassen. Ist er unzufrieden, so sagt er es nicht gerade heraus, sondern überläßt es dem Zuhörer, die wirkliche Ursache herauszufinden, während er ihm irgend eine erfundene Geschichte erzählt. Er will seinen Zweck erreichen, aber auf eine, wie er glaubt, angenehmere Weise. Erscheint beispielsweise einem chinesischen Diener sein Lohn zu gering, so wird er sich nicht beschweren. Seiner Ansicht nach wäre dies äußerst unhöflich. Er wird also sofort seinen Vater krank werden oder einen Verwandten sterben lassen, um damit seinen Austritt aus dem Dienst zu entschuldigen. Ist sein Dienstherr ein Ausländer, der mit den chinesischen Gebräuchen noch nicht vertraut ist, so wird er die Angaben des Dieners vielleicht als bare Münze nehmen und den Diener wirklich entlassen. Aber hat er die Chinesen durch langen Verkehr mit ihnen kennen gelernt, so wird er trachten, durch einen anderen Diener den wahren Grund herauszufinden und ihn zu berücksichtigen, stets aber wird er sich dabei den[S. 301] Anschein geben, als schenkte er den Ausflüchten seines Dieners vollen Glauben, um diesen nicht auf einer Lüge zu ertappen.
In der Absicht, unangenehme Wahrheiten, ihre wirklichen Gefühle und Beweggründe zu verbergen, werden die Chinesen zu allen nur erdenklichen Mitteln und Wendungen Zuflucht nehmen. Hoch oder niedrig, verlieren sie selten ihren Gleichmut, und nur in ihrem Hause den vertrautesten Freunden gegenüber legen sie die eisernen Fesseln der Etikette ab und lassen ihren Gefühlen freien Lauf. Diese Sitte von Unterdrückung und falscher Auslegung ihrer innersten Gedanken hat, wie Holcombe sehr richtig sagt, in der Außenwelt den Eindruck hervorgerufen, daß die Chinesen ein kaltblütiges, gleichgültiges Volk ohne Nerven seien. Aber in Wirklichkeit sind sie äußerst empfindlich, stolz und leidenschaftlich. Nichts bringt die Chinesen so sehr außer Fassung und verwirrt sie, wie die geraden und schroffen Manieren der westlichen Völker, hauptsächlich der Engländer und Amerikaner, und deshalb verschanzen sie sich gerade diesen gegenüber hinter ihrer starren Etikette, während sie dem höflichen, bescheidenen und geduldigen Deutschen größere Offenheit und größeres Vertrauen entgegenbringen.
Nach der letzten großen Schlacht zwischen den Chinesen und Japanern brachten die Blätter die Drahtmeldung aus China, daß dem Vizekönig von Tschihli (in Europa unter dem Namen Petschili besser bekannt) zur Strafe für die Niederlage seiner Truppen ein Pfauenauge unterdrückt worden sei.
Diese Nachricht dürfte der großen Mehrzahl der Leser unverständlich geblieben sein, denn selbst die in China lebenden Europäer sind mit chinesischen Orden und Ehrenzeichen nicht vertraut, die zuweilen in den absonderlichsten Formen verliehen werden. Orden nach europäischen Begriffen besitzen die Chinesen überhaupt nicht. Allerdings wurden während der Kriege, welche die Chinesen in den letzten Jahrzehnten gegen Engländer, Franzosen und die eigenen Rebellen auszufechten hatten, an die im chinesischen Heere dienenden Europäer Orden und Medaillen verliehen, doch waren diese letzteren nur willkommene Behelfe der Vizekönige und wurden von der chinesischen Zentralregierung nicht anerkannt. Erst am neunzehnten Tage des zwölften Monats des siebenten Jahres Kuangsi (am 7. Februar 1882) stiftete der Kaiser des himmlischen Reiches einen Orden, Shuanglung-Pao-Sing, zu deutsch den Orden des doppelten Drachen, doch auch dieser wird nur an verdiente Ausländer verliehen. So z. B. befanden sich unter den ersten mit dem Großkreuz dekorierten Ausländern der Direktor der chinesischen Zollämter Sir Robert Hart und der von der Chartumer Katastrophe her bekannte englische General Gordon, der sich in der chinesischen Expedition gegen die Taiping ausgezeichnet hatte. Allein Chinesen erhalten weder Orden noch Medaillen. Die gebräuchlichste Belohnung für Zivil- und Militärdienste ist die Erhebung zu einer höheren Rangstufe der Mandarine oder, wie sie in China heißen, Kwun. Mandarin ist keineswegs ein chinesisches, sondern ein vom portugiesischen Mandar, Befehlen, abstammendes Wort, das nur in der lingua franca Ostasiens, dem pidgin English, gebräuchlich ist.
Die Chinesen haben neun Klassen von Mandarinen, deren jede für Militär und Zivil besondere Abzeichen besitzt, durchwegs Tiere, die auf einem etwa einen Quadratfuß großen viereckigen Tuchschild mit farbiger Seide aufgestickt sind. Diese Schilder werden von den Mandarinen auf Brust und Rücken getragen, und an ihnen erkennen die Chinesen ihre Beamten, die Soldaten ihre Offiziere. Die Tiere sind die folgenden:
Außer diesen Brustschildern ist auch die Art der Leibgürtel genau festgesetzt, so z. B. tragen die Mandarine erster Klasse rote Gürtel mit Schnallen aus Jade (Nephrit) und Rubinen, jene der letzten Klasse Schnallen aus Büffelhorn.
Zu den Abzeichen der Mandarine gehören auch die Knöpfe oder vielmehr nußgroßen runden Kugeln auf der Spitze der chinesischen Hüte. Bei den Mandarinen erster Klasse sind die Kugeln Rubinen, bei jenen der zweiten Klasse Korallen, die Knöpfe der Mandarine dritter und vierter Klasse sind blau, und zwar durchsichtig blau (Saphir) und undurchsichtig (Lapis Lazuli); bei der fünften und sechsten Klasse weiß, durchsichtig (Krystall) und undurchsichtig (Marmor). Sollen Mandarine für leichtere Vergehen bestraft werden, so wird ihnen für eine bestimmte Zeit der Knopf entzogen.
Neben diesen mit dem Rang verbundenen Abzeichen giebt es in China auch außerordentliche Auszeichnungen, von denen die höchste die gelbe Reitjacke ist (im Chinesischen Ma-Kwa), ein gelbseidener Rock, der jedoch nur auf Reisen, im Felde und bei Hofe getragen wird. Sir Robert Hart und von den Chinesen der berühmte Vizekönig von Tschili, Li-Hung-Tschang, sind die bekanntesten Inhaber der gelben Reitjacke. Für ganz besondere Leistungen wird auch die gelbe Flagge verliehen, ein kleines gelbseidenes Fähnchen, das der Inhaber in seiner Rechten trägt. Der Besitz des Fähnchens führt das souveräne Recht von Leben und Tod mit sich und es wird deshalb nur äußerst selten verliehen. In ganz China dürften kaum mehr als sechs Würdenträger die gelbe Flagge besitzen.
Häufiger wird die Pfauen- oder Krähenfeder verliehen. Die so Ausgezeichneten tragen die Feder auf dem Hute hinten nach abwärts geneigt. Prinzen und den höchsten Würdenträgern werden die Pfauenfedern mit drei Augen verliehen, geringeren Beamten nur solche mit zwei Augen, und Federn mit einem Auge sind sogar für geringes Geld käuflich. Li-Hung-Tschang konnte in Anbetracht seines hohen Ranges keine schlimmere Strafe widerfahren als die 1894 erlassene Verfügung, daß er eine Zeit lang nur zwei Augen auf seiner Pfauenfeder tragen durfte.
Krähenfedern werden nur Soldaten der kaiserlichen Garde verliehen. Sie können aber auch die Pfauenfeder erhalten. So z. B. bringt der Titel Baturu die Pfauenfeder mit sich. Ein Baturu ist in der chinesischen Armee etwa dasselbe,[S. 304] was der Ritter der Ehrenlegion in der französischen Armee, nur trägt der chinesische Baturu statt des Kreuzes am roten Bändchen die Pfauenfeder und erhält einen passenden Titel, z. B. der Tapfere oder der Großmütige, mit dem auch höhere Bezüge verbunden sind. Bisher wurde nur ein Europäer, der General Mesny (ein Franzose), Baturu.
Noch seltsamer als die eben erwähnten sind einige andere Auszeichnungen der Chinesen, z. B. das Recht, die Schwertscheide mit der gelben Rinde der Robinia pygmaea, einer Akazienart, überziehen zu lassen, oder das Recht, beim Reiten rote Zügel zu führen. Li-Hung-Tschang ist auch Inhaber dieser Auszeichnungen.
Zivilmandarinen wird als besondere Belohnung gestattet, die Tragstangen ihrer Tragstühle rot überziehen zu lassen. Mandarine gehen niemals zu Fuß aus, sondern reiten oder lassen sich in Tragstühlen tragen. Es wäre eine Entwürdigung für einen Mandarin, zu Fuß oder ohne entsprechende Begleitung von Dienern und Sekretären auf der Straße zu erscheinen.
Zu den zahlreichen Orden chinesischer Art, die der frühere Vizekönig von Tschili besitzt, gehört auch der Zobelorden, wenn diese Bezeichnung erlaubt ist. Das Tragen von Zobelfellen erfordert in China die kaiserliche Bewilligung, und die Kaiserin[S. 305]witwe sandte Li-Hung-Tschang selbst als Geburtstagsgeschenk die für einen Mantel erforderliche Zahl von Zobelfellen.
In der offiziellen Pekinger Zeitung war vor einigen Jahren von einer noch seltsameren Auszeichnung zu lesen, die damit zusammenhängt, daß es in China keinen Erbadel nach unserer Art giebt. Sir Robert Hart, der früher erwähnte chinesische Zolldirektor, hatte durch seine vortrefflichen Maßnahmen die Einnahmen des Reiches beträchtlich vermehrt, und der Kaiser erließ deshalb folgende Verordnung: „Dem Generaldirektor wird ein Stück Seide verliehen, worauf die Namen seiner drei nächsten Vorfahren in fünf verschiedenen Farben aufgestickt sind. Diese Auszeichnung betrachten Wir (der Kaiser) höher als die gelbe Reitjacke.”
Und bald darauf enthielt die Pekinger Zeitung einen kaiserlichen Erlaß, demzufolge der Kaiser den drei nächsten Vorfahren des Sir Robert Hart die Kappenknöpfe ersten Ranges verlieh. Glückliche Vorfahren! Sir Robert Hart wäre es lieber gewesen, seine Nachkommen so ausgezeichnet zu sehen, aber, so argumentieren die chinesischen Staatsmänner, was haben die Nachkommen des Sir Robert zu seinen Erfolgen beigetragen? Waren die Vorfahren daran nicht viel mehr beteiligt?
Der chinesische Adel ist mit dem europäischen in keiner Weise zu vergleichen und könnte eher als eine Art amtlicher Würden angesehen werden. Er wird ausschließlich nur für militärische Verdienste verliehen und besteht aus neun Klassen, von denen die obersten fünf beiläufig unseren Herzögen, Markgrafen, Grafen, Vizegrafen (Vicomtes) und Baronen entsprechen. Ihre chinesischen Namen sind Kung, Hau, Puk, Tß und Nam. Jede Klasse ist wieder in verschiedene Unterabteilungen geteilt, je nach den Leistungen, für welche der Adel verliehen worden ist. Die oberen Adelstitel sind nur während einer bestimmten Anzahl von Generationen in der Familie erblich, z. B. sechsundzwanzig in der ersten (Herzog), und nur eine in der achten Adelsklasse, so daß die Adelsfamilien nach einer bestimmten Zeit allmählich erlöschen. Den erblichen Adel in europäischem Sinne besitzen in China nur die direkten Nachkommen von Confucius und Koxinga (der Eroberer von Formosa), sowie die acht von den alten Mandschurenfürsten abstammenden Familien.
Würde alles das, was in der letzten Zeit über das chinesische Mandarinentum geschrieben wurde, der Wahrheit entsprechen, so müßte man als die erste und wichtigste Maßregel für die Reorganisierung des chinesischen Staatswesens dem Kaiser empfehlen, alle Mandarine ohne weiteres aufzuhängen. In Europa gilt der Mandarin als das Urbild von Bestechlichkeit, Faulheit und Niedertracht, und alles, was diesen Namen führt, wird mehr oder weniger als ein korruptes Beamtengesindel angesehen, das den Ruin des chinesischen Reiches herbeiführen muß.
Wäre dem wirklich so, dann müßte es längst kein China mehr geben, denn wie das Mandarinentum heute besteht, so hat es schon vor Jahrtausenden bestanden, und China ist doch während dieser Jahrtausende das größte und volkreichste Reich der Erde geblieben, mit großen Reichtümern und ausgebreitetem Handel, mit einer[S. 307] hohen Kultur eigener Art und bedeutenden sittlichen Eigenschaften, welche jener mancher anderer Völker um ein bedeutendes überragen. Das chinesische Mandarinentum kann deshalb nicht so schlecht sein wie sein Ruf und ist es auch nicht.
In China sind Adel- und Kastengeist, sowie die bevorzugten Klassen nicht so ausgeprägt, das Volk ist wahrhaft demokratisch, und jedem, der die Fähigkeiten und Kenntnisse besitzt, stehen alle Stellen bis zu den höchsten Ministerstellen in der unmittelbaren Umgebung des Kaisers offen. Die Bedingung dafür ist fleißiges Studium der Klassiker, eine schöne Handschrift, guter Stil, Gewandtheit in Aufsätzen, die Kenntnis der alten Lehren des Confucius, dessen Geist das chinesische Staatswesen heute noch regiert. Für alle Beamtenposten werden derartige litterarische Prüfungen ausgeschrieben; die einen in den lokalen Distrikten, die anderen in den Provinzhauptstädten, wieder andere in Peking, ja unter den Augen des Kaisers selbst. Wer diese Prüfungen besteht, erhält dadurch die Befähigung, Beamter zu werden, und je besser er sich seiner Aufgaben entledigt hat, desto größer ist seine Aussicht, wirklich einen Posten zu erhalten. Die Zahl der Beamten ist nämlich im Verhältnis zu jenen, die sich dafür vorbereiten, eine sehr geringe und entspricht auch nicht entfernt den Bedürfnissen des Landes. Im Vergleich zu dem großen Beamtenstand der europäischen Staaten ist derjenige Chinas wie zehn zu eins, das ganze Riesenreich wird alles in allem von 2100 Mandarinen verwaltet; dabei ist der chinesische Beamtenstand der angesehenste und begehrteste aller Stände und steht auch hoch über dem Militär. Finden z. B. Festlichkeiten statt, an welchen die Zivil- und Militärmandarine teilnehmen, so gebührt den ersteren der Ehrenplatz an der Ostseite, den letzteren jener an der Westseite.
Schon die bestehenden Vorschriften über die Besetzung der Mandarinenposten zeigen, in welchen Ehren sie gehalten werden. So dürfen sich z. B. Chinesen, welche von den geächteten Ständen, also von Barbieren, Schauspielern, Schifferknechten und[S. 308] dergleichen abstammen, und selbst wenn ihre Ahnen in der dritten Generation eines dieser Gewerbe betrieben haben sollten, nicht Mandarine werden und auch nicht an den öffentlichen Prüfungen teilnehmen. Das führte in Hankau zu einem ergötzlichen Vorfall, der bezeichnend ist für die chinesischen Sitten. Unter den Bewerbern um die militärischen Prüfungen befand sich ein junger Mann, der durch seine außergewöhnlichen Kenntnisse und Fertigkeiten den Neid der Mitbewerber erweckte; um ihn zu beseitigen, wurde den Examinatoren die Anzeige gemacht, daß der Großvater des Betreffenden, wie es der Wahrheit entsprach, Barbier gewesen sei. Daraufhin wurde der unglückliche Kandidat aus den Listen gestrichen und ihm anbefohlen, die Stadt sofort zu verlassen. Aber die Barbiere von Hankau erhielten Kunde davon, und diese brachte sie so aus der Fassung, daß sie beschlossen zu streiken. In Hankau und dem benachbarten Hanyang legten dreitausend bezopfte Figaros ihre Waffen, die Rasiermesser, nieder; auf der halben Million Chinesenschädel der beiden Städte wuchsen die Haarstoppeln immer länger, die Scheitelzöpfe wurden immer zerzauster, kein Barbier rührte sich. Selbst der Befehl der Behörden an die Figaros, ihr Handwerk wieder aufzunehmen, blieb unbeachtet. So wurde denn das Militär beauftragt, die Ritter vom Rasiermesser abzufassen und in den Yamen zu bringen. Dort zwang man sie unter Androhung der Bastonnade, jeden um den gewohnten Preis zu rasieren, und der Vorhof des Yamens war eine Zeitlang eine ungeheure Barbierstube. Allein da die Mehrzahl der Barbiere ausgerissen war oder sich versteckt hatte, blieben immer noch Hunderttausende von Chinesenschädeln in trauriger Verfassung. Auch die Zerstörung der Wohnungen der entflohenen Barbiere durch das Militär konnte die letzteren nicht zur Reue bewegen, ja noch mehr, die Barbiere der benachbarten Provinzhauptstadt Wutschang schlossen sich dem Streik ihrer Brüder an. Allmählich kamen aber Barbiere aus den anderen Provinzstädten nach Hankau, und die Sache endete schließlich damit, das sich auch die Figaros der letzteren Stadt fügten und die Berechtigung der Ausschließung ihres Standeskollegen von den Prüfungen anerkannten.
Kein Chinese darf in seinem heimatlichen Distrikte Beamter werden; um Begünstigungen vorzubeugen, darf er auch keine Verwandten unter seine Untergebenen aufnehmen, und selbst in verschiedenen Distrikten derselben Provinz dürfen Vettern nicht gleichzeitig Beamtenposten einnehmen. Zur Aufrechterhaltung der Unparteilichkeit dürfen Beamte keine Frau heiraten, die unter ihrem amtlichen Wirkungskreise steht, ja sie dürfen in gerichtlichen Streitfragen zwischen zwei Parteien keine Entscheidung fällen, wenn sie durch ihre Frauen mit einer der Parteien im Verwandtschaftsverhältnis stehen sollten. Ehen mit Tänzerinnen, Schauspielerinnen und Sängerinnen sind nicht nur ihnen, sondern auch ihren Söhnen untersagt, und gehören sie dem erblichen Adel an, so darf selbst ein Enkel keine solchen Ehen eingehen, ohne dadurch in eine tiefere Adelsklasse versetzt zu werden.
Die höchste Reichsbehörde, etwa das, was im Deutschen Reiche das Reichskanzleramt, ist das Großsekretariat, aus vier Großsekretären bestehend, doch sind die Befugnisse desselben und sein Einfluß geringer als jene der Mitglieder des Tschun-Tschi-Tschu, zu deutsch Reichsrat. Dieser setzt sich aus fünf Mandarinen erster Klasse zusammen, gewöhnlich aus einem kaiserlichen Prinzen als Präsidenten an ihrer Spitze, durchwegs hochbetagten Herren, denen es gewiß recht schwer fallen muß, häufig um drei Uhr morgens in Gegenwart des Kaisers über die Regierungsangelegenheiten des Reiches zu beraten. Vom Reichsrate gelangen die letzteren an eines der sechs Ministerien oder, falls es sich um Angelegenheiten handelt, welche das Ausland betreffen, an das in den letzten Jahren so berühmt gewordene Tsung-li-Yamen, welchem viele Jahre lang das chinesische „Mädchen für alles”, Prinz Kung, als Präsident vorstand.
Ebenso wie die Wohnungen der Prinzen und Mandarine (von Palästen kann man bei ebenerdigen, einfachen Gebäuden nicht sprechen), ebenso wie die Ministerien und anderen Regierungsgebäude, so ist auch das Tsung-li-Yamen von einer jener hohen, kahlen Mauern umgeben, welche der Tatarenstadt von Peking ein so einförmiges, düsteres Aussehen verleihen. Ueber dem mit verschiedenen Ziegeldächern eingedeckten Haupteingang stehen auf einer Tafel vier große vergoldete Schriftzeichen, welche, in unsere Sprache übertragen, lauten: „Reich der Mitte, Ausland, Friede, Glück”, was etwa bedeuten soll: „Chinesisches Amt zur Herstellung friedlicher und glücklicher Beziehungen mit dem Ausland”. Von diesen friedlichen und glücklichen Beziehungen haben die Chinesen bisher freilich nicht viel zu verspüren bekommen. Ihre Schuld ist es keineswegs. Das Um und Auf der chinesischen Wünsche in Bezug auf das Ausland ist, in Ruhe gelassen zu werden, und wollte man die vier Worte: „Reich der Mitte, Ausland, Friede, Glück” in chinesischen Sinne auslegen, so müßte man über die Thüren des Tsung-li-Yamens schreiben: „Ausland, lasse das Reich der Mitte in Frieden, dann ist es glücklich”. Seitdem die Europäer nach China gekommen sind, ist die Regierung aus Kriegen,[S. 310] Verlegenheiten, Zahlungen, Verlusten an Macht, Ansehen, Land und Volk nicht herausgekommen, und man kann es den Chinesen wahrhaftig nicht übelnehmen, wenn sie den Europäer mit nicht gerade freundlichen Blicken betrachten, und wenn die Herren des Tsung-li-Yamens bestrebt sind, die Europäer hinzuhalten. Denn es ist ja eine ausgemachte Sache für sie, daß niemals ein Europäer kommt, um zu geben, sondern immer nur, um zu nehmen. Die Gesandten der Mächte wollen Entschädigungen, Gebietsabtretungen, die Kaufleute Konzessionen, Kaufabschlüsse, die Missionare gar werfen durch die christliche Lehre, die mit dem ganzen Gesellschaftsleben, dem Ahnenkultus und der Religion der Chinesen in schroffstem Widerspruch steht, das ganze Gefüge über den Haufen und wirken mit ihren Lehren, wie ein Chinese sich drastisch ausdrückte, wie Sauerteig. Die zehn Mitglieder des Tsung-li-Yamens haben für ihre Unterhandlungen mit den Ausländern diese Halle eingerichtet, bei deren Betreten die letzteren mit zweierlei Gepäck ausgerüstet sein müssen, entweder mit Geduld oder mit Kanonen. Wer Kanonen zu seiner Verfügung hat, kommt besser fort.
Hinter dem Eingange öffnen sich dem Besucher des Yamens eine Reihe von einfachen, aber reinlichen und geschmackvoll ausgestatteten Hallen, deren letzte in einem hübschen wohlgepflegten Garten endigt. Ein kleiner Raum mit einem rundem Tisch und verzwickten chinesischen Stühlen aus schwarzem Holz dient als gewöhnliches Empfangszimmer für fremdländische Gesandte, wobei stets drei Mitglieder des Tsung-li-Yamens mit einer Schar von Sekretären und Dienern gegenwärtig sind. An den Wänden hängen an Stelle von Bildern oder Landkarten die in China allgemein gebräuchlichen langen Papierstreifen mit allerlei Weisheitssprüchen. Der erste derselben lautet: „Zu lernen ist sehr verdienstvoll”, der zweite: „Wenn der Thee halb angebrüht ist, entsteigt ihm das Aroma”, der dritte: „Wei schan tsui luh”, was etwa bedeutet: „Gut zu thun ist das höchste Glück”. Den ersten Spruch mögen die Herren des Tsung-li-Yamens wohl beherzigen, denn solange sie nicht wissen, das es neben Frankreich, England und Rußland auch noch andere Reiche in Europa giebt, taugen sie für ihren Beruf nicht viel. Bis vor kurzem unterstanden dem Yamen folgende Aemter: eine englische Abteilung mit sechs Beamten, eine französische mit sieben, eine russische mit sechs, eine amerikanische Abteilung mit sechs Beamten, schließlich eine Abteilung für Seeverteidigung. Es wird wohl nicht lange dauern, bis noch eine deutsche Abteilung hinzukommt.
Ebenso wie die Ministerien sind auch die Mehrzahl der fremdländischen Gesandtschaften in chinesischen Häusern, ursprünglich Wohnungen von Prinzen oder hohen Mandarinen, untergebracht, und sie unterscheiden sich von den übrigen einförmigen Gebäuden nur durch die Flaggenmasten, die über die Thore ragen. Der Verkehr zwischen den Gesandten und den chinesischen Mandarinen beschränkt sich auf das Allernotwendigste. Selten erfolgen gegenseitige Besuche, noch seltener erscheint[S. 311] irgend ein Mitglied des Tsung-li-Yamens zu einer Soiree oder einem Diner, aus Furcht, von den anderen als fremdenfreundlich angesehen zu werden. Ueber das ganze Thun und Lassen selbst der höchsten Mandarine wacht das Zensorenamt mit zahllosen Beamten, und jeder Mandarin hat in den Archiven dieses Amtes seine Konduitenliste. Selbst der Kaiser untersteht den Zensoren. Als Kuang-Su zum erstenmal nach seiner Thronbesteigung seine Ahnenopfer darbrachte, übergab ihm ein Zensor eine Schrift, in welcher er dem Kaiser das Recht absprach, diese Ahnenopfer vorzunehmen, da er nicht direkter Sprosse der letzten Kaiser, sondern nur ein Neffe des vorletzten Kaisers sei. Dann nahm er sich vor den Augen des Kaisers das Leben, weil er es gewagt, die Handlungen des Kaisers zu bemängeln. So ist das ganze Leben an dem merkwürdigen Hofe, so ist die Regierung des chinesischen Reiches ein seltsames Gemisch von gut und schlecht, ein Zwiespalt von Vorwärtsschreiten und Beharren bei dem Althergebrachten, ein Gegensatz von Patriotismus und kleinlichem Intriguenspiel, von Uneigennützigkeit und schlimmster Habgier. Die Wasser sind getrübt, und die Europäer fischen nach Herzenslust darin. An jeder Angel zappelt eine Eisenbahn, ein Hafen, eine Provinz.
Die chinesischen Mandarine sind in neun Rangklassen eingeteilt, die sich durch bestimmte Vorrechte, Gehaltsbezüge und äußerlich durch bestimmte Abzeichen, hauptsächlich durch die eigroßen Rangknöpfe auf den Hüten und die gestickten Tierwappen auf Brust und Rücken ihrer Gewänder unterscheiden. Das ganze Beamtentum als Stand führt in China den Namen Pe-kuan, d. h. die hundert Obliegenheiten, die Mandarine der höchsten Klassen heißen Tai-fu, jene der niederen Kuang-fu. Der Name Mandarin ist portugiesischen Ursprungs und unter den Chinesen unbekannt. Die nominellen staatlichen Bezüge der Ministerbeamten sind anscheinend gar nicht so gering, ja viel bedeutender als jene der europäischen Staaten. So bezieht z. B. der Vizekönig einer Provinz 20000 Taels (nach dem gegenwärtigen Kurse entspricht ein Tael im Werte etwa 3 Mark); der Gouverneur 16000, der Provinzschatzmeister 9000, der Provinzrichter 6000, ein Präfekt 3000, ein Distriktmagistrat zwischen 2000 und 800 Taels; ein Provinzkommandant 4000, ein General 2400, ein Oberst 1300 Taels und so abwärts bis zu dem niedrigsten Beamten, der etwa 130 Taels im Jahre erhält. Wenn diese Bezüge wirklich nur für die Person des Betreffenden bestimmt wären, dann könnten die Mandarine vortrefflich auskommen und hätten es kaum nötig, zu Nebenverdiensten Zuflucht zu nehmen. Allein gewöhnlich kommen sie erst nach einer mehrere Jahre langen Wartezeit auf ihren Posten, und da es für Personen mit litterarischen Graden nicht standesgemäß ist, sich irgend welchem Handels- oder Arbeitsberuf hinzugeben, müssen sie auf ihre zukünftigen Bezüge hin Schulden machen. Haben sie endlich den Posten, so können sie ihn den bestehenden Vorschriften nach nur drei Jahre lang behalten. Um die Beamten nämlich so unabhängig als möglich von Familien- und Freundschafts[S. 312]einflüssen zu erhalten, werden sie alle drei Jahre auf andere Posten versetzt, und selbst solange sie in einer Stadt bleiben, können sie ihren Gehalt nicht ausschließlich für ihre Bedürfnisse verwenden, sondern müssen davon auch noch ein Heer von Sekretären, Schreibern und Dienern füttern, welche vom Staate nicht bezahlt werden und von den Chinesen nicht mit Unrecht die Bezeichnung Klauen ihrer Vorgesetzten erhalten haben. Der Mandarin ist in seinem Distrikte nicht nur der Vertreter der Regierung, er ist gleichzeitig Polizeibeamter, Richter, Steuereinnehmer, Standesbeamter und Notar, und in seiner Hand vereinigen sich alle Verwaltungszweige. Seine Hauptpflichten sind es, Ruhe und Ordnung zu erhalten, die Steuern einzutreiben und darauf acht zu haben, daß er von den Spionen der Regierung, den Zensoren oder vom Volke selbst seinen Vorgesetzten nicht wegen Mißbrauchs seines Amtes angezeigt wird. Gelingt ihm dies, so kann er nach Ablauf der dreijährigen Amtszeit Beförderung gewärtigen. Er kann auch dem Volk mehr Steuern abnehmen, als dieses zu zahlen verpflichtet ist, und die Chinesen lassen sich das auch ganz gerne gefallen. Sie wissen ja, daß Widerstand gegen die Regierungsvertreter immer Geld kostet und zu zeitraubenden Untersuchungen, zu weiteren Bedrückungen, möglicherweise zu Aufständen führt, wodurch sie viel größere Verluste erleiden würden, als es die rechtswidrige Steuereintreibung verursacht. Der Mandarin seinerseits wird dieses Spiel auch nicht zu weit führen, denn wird er bei seinem Vorgesetzten angeklagt, so muß er diesem vielleicht eine viel größere Geldstrafe zahlen, als sein ganzer dem Volke abgenommener Gewinn ausmacht. Sollte er dann immer noch seine Erpressungen fortsetzen, so kann es vorkommen, daß die Bevölkerung seines Wirkungskreises ihn eines Tages in feierlichem Aufzuge mit einer Sänfte aus dem Yamen abholt und vor die Stadtthore trägt. In solchen Fällen giebt die Regierung, der es vor allem um den lieben Frieden zu thun ist, gewöhnlich dem Volke recht und ernennt einen anderen Mandarin an die Stelle des verjagten. Ebenso wie das Volk eine maßvolle Uebervorteilung durch die Mandarine duldet, ebenso geschieht dies auch von seiten der Regierung, die sehr wohl weiß, daß der Mandarin mit seinem Gehalte nicht auskommen kann, und die direkt und indirekt aus den Erpressungen ihrer Beamten Nutzen zieht. Direkt dadurch, daß sie die Einzahlung eines größeren Steuerbetrages von den Beamten erwarten kann, indirekt dadurch, daß auch die Hände der höheren Mandarine von den unteren geschmiert werden. W. Holcombe erzählt, ein chinesischer hoher Diplomat habe ihm selbst mitgeteilt, er könne in Peking nur dann eine Audienz erlangen, wenn er dieselbe mit gewichtigen Geschenken bezahle. Bei seiner ersten Audienz bei einem Prinzen des kaiserlichen Hauses brachte sein Sekretär hundert Unzen Silber mit, welche er an der Pforte dem Hausoffizier des Prinzen übergab. Derselbe Gewährsmann sah einmal bei einem hervorragenden Pekinger Juwelier hundert lackierte, mit Seide überzogene Servierbretter, von denen jedes zehn kleinere[S. 313] Abteilungen enthielt, bestimmt zur Aufnahme von Silberbarren von je zehn Unzen Gewicht. Die Servierbretter waren von einem hohen Mandarin bestellt worden, der dieselben mit zehntausend Unzen Silber füllen und einem kaiserlichen Prinzen zum Geschenk machen wollte. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft, und mit Geld läßt sich eben auch in China viel erreichen, selbst Mandarinstellen.
Daß Titel, Würden, Pfauenfedern und derlei Auszeichnungen im himmlischen Reiche ebenso käuflich sind wie anderswo, wird niemand wundernehmen. Auch die Chinesen sind eitel, und es giebt eine ganze Menge reicher Leute, welchen der Kaiser den Mandarinsrang als Belohnung dafür verliehen hat, daß sie in Zeiten der Bedrängnis große Summen für Brücken, Dammbauten oder gemeinnützige Zwecke opferten. Solche Ehren geben dem Träger gewisse Vorrechte und als äußeres Abzeichen den vielbegehrten Mandarinknopf auf dem Hut (also das Knopflochbändchen ins Chinesische übersetzt); doch ist damit nicht etwa das Recht, wirkliche Aemter zu bekleiden, verknüpft.
Indessen kann man in China auch Aemter für Geld kaufen. Von mancher Seite ist dies bestritten worden, und der vorgenannte amerikanische Diplomat behauptet, er hätte während seines mehrjährigen Aufenthaltes in China niemals einen Mandarin in offiziöser Stellung getroffen, der diese durch Kauf erlangt hätte, niemals auch nur von einem solchen gehört, ausgenommen Leute vom Range eines Dorfpolizisten.
Demgegenüber ist es mir wohl erlaubt, ein Edikt des Kaisers von China anzuführen, das in der offiziellen Pekinger Staatszeitung vom 6. Juli 1894 veröffentlicht wurde. Dasselbe lautet: „Der Lektor im Hanlin yuan, Wen-ting schi, bemerkt in einer Eingabe, daß der Verkauf von Aemtern keine althergebrachte Einrichtung sei, und bittet, denselben zu Gunsten einer geordneten Staatsverwaltung ganz einzustellen. Wenn die Staatsverwaltung den Aemterverkauf zuließ, so war dies ursprünglich eine der äußersten Geldnot entspringende Maßregel. In der letzten Zeit nimmt jedoch der Aemterverkauf dermaßen überhand, daß Verwirrungen im Beamtenkorps entstehen und allerlei Mißstände eintreten müssen. Der Taotai und der Präfekt sollen für das Wohl der Bevölkerung Sorge tragen. Wie können aber Leute, die nichts von Amtsgeschäften verstehen und sich mit Geld ein Amt[S. 314] erkauft haben, ihren Posten genügend ausfüllen? Das Finanzministerium soll deswegen zunächst den Verkauf von Taotai- und Präfektenposten gänzlich einstellen. Wegen der anderen kleineren Aemter möge die genannte Behörde gleichfalls in Erwägung ziehen, wie dem Verkauf derselben passend Einhalt gethan werden kann, und darüber ausführlich berichten.”
Obschon es in China, wie schon aus diesem kaiserlichen Edikt hervorgeht, eine ganze Menge derartiger durch Stellenkauf auf ihre Posten gelangten Mandarine giebt, so machen auch diese vielen Schwalben immer noch keinen Sommer aus. Ein ostasiatisches Blatt bemerkt darüber ganz richtig: „Das hohe Ideal, das einst in Bezug auf die Staatsverwaltung bestand, ist gesunken und verdunkelt durch zahlreiche Fehler und Flecken; dessenungeachtet besteht zweifellos ein Ideal. Sobald man beispielsweise einen Bezirksrichter findet, der seiner Pflicht getreu nachkommt, wird er durch das Volk geehrt, und der Kaiser drückt ihm seine Anerkennung aus. Die Strafen, welche die Pekinger Staatszeitung beständig verkündet, legen auch einen Beweis für die Bemühungen der Regierung ab, das System rein und wirksam zu erhalten. Wie es in der Natur der Religionssysteme liegt, daß sich mit der Zeit in dieselben Mißbräuche und unnötiges Zeremoniell einschleichen, so nimmt auch ein verwickeltes System des Beamtentums allmählich ein gekünsteltes Gewand an und verliert den Lebensatem, der es bei seiner Entstehung beseelt hat.”
„Man darf also die zweifellos bestehenden Mißstände keineswegs verallgemeinern. Unter den Beamten findet man zahlreiche Personen von großer Lauterkeit des Charakters, Talent und Energie; tüchtige, ehrliche, auf das Volk bedachte Männer füllen die Mehrzahl der Posten aus, obgleich sie in Gegenständen Prüfungen bestehen müssen, welche die moderne Wissenschaft verlacht. Die Massen des Volkes erfreuen sich eines guten Teils persönlicher Freiheit; der bescheidene Chinese, obgleich übersteuert, wird nicht so bedrückt, wie wir dies in manchen Ländern des Westens sehen. Es giebt unter den letzteren solche, die für zivilisiert gehalten werden, in denen aber die Mißwirtschaft viel größer ist als im Reiche der Mitte.”
Wer die Verhältnisse in China aus eigener Anschauung kennen gelernt hat, wird derselben Meinung sein. Anders steht es mit der Ausführbarkeit der europäischen Finanzverwaltung im Reiche der Mitte. In den offenen Hafenstädten und in den Distrikten längs des Jangtsekiang wäre sie heute schon wohl möglich, aber im Innern des Landes ist die Zeit dafür noch nicht gekommen. Die Massen des Volkes müssen die Ueberzeugung gewinnen, daß sie in Bezug auf ihre Taschen unter europäischer Steuerverwaltung besser fahren, und das dürfte doch noch viele Jahre Zeit erfordern.
Ein höheres Ziel, als litterarische Ehren und Würden zu erlangen, giebt es in China nicht, und gerade so wie vor anderthalbtausend Jahren führt auch heute noch nur ein Weg zu diesem Ziele: die Wettprüfung. Niemand, der eine solche Prüfung nicht bestanden hat, kann, wenigstens dem Wortlaut des Gesetzes nach, Mandarin, Beamter, Minister, Gesandter werden. Und selbst falls er einen solchen Posten nicht erreichen sollte, bleibt er doch der angesehenste Mann in seinem Orte, er ist vor dem Gerichte von Körperstrafen befreit, er braucht vor dem Richter nicht zu knien und mit der Stirne die Erde zu berühren wie das gewöhnliche Volk, und gerade so wie der Edelmann in Europa über der Thür seines Palastes das Wappen seiner Väter anbringt, so hängt derjenige, der in China die Prüfungen überstanden hat, eine große Tafel mit seinem von ihm selbst erworbenen litterarischen Titel über seine Hausthür.
Gymnasien, Universitäten, Kollegs, überhaupt Unterrichtsanstalten wie in Europa, sind in China nur in wenigen Hauptstädten in sehr beschränkter Zahl vorhanden und überdies Schöpfungen der neuesten Zeit. Im Inlande treten an ihre Stelle Privatschulen. In diesen werden die Kinder vom zarten Alter an in die Lehren des Confucius und Mencius eingeweiht, dort lernen sie ein paar tausend chinesischer Schriftzeichen lesen und auf Papier malen, dort führt sie der Privatlehrer in die Feinheiten des chinesischen Stils und die chinesische Kalligraphie ein. Geographie, Geschichte, Religion, praktische Wissenschaften sind unbekannte Unterrichtsgegenstände. Eine höhere chinesische Schule ist etwa mit einem europäischen Gymnasium vergleichbar, in welchem vom ersten bis zum letzten Jahre nichts anderes gelehrt würde als die griechischen Klassiker in der Ursprache. Derjenige, der sie am besten auswendig herzusagen und zu erklären weiß, wird in den Staatsdienst aufgenommen.
Glaubt ein Chinese, daß er die vor Tausenden von Jahren geschriebenen Sieben heiligen Bücher hinreichend meistert, so kann er sich zu den öffentlichen Prüfungen melden, welche zweimal in je drei Jahren in der Hauptstadt seines Distriktes abgehalten werden. Alt und jung wird zugelassen, und es kommt häufig vor, daß Großvater, Vater und Sohn gleichzeitig als Prüfungskandidaten in den Wettkampf treten. Die von der Provinzregierung ernannten Examinatoren prüfen die schriftlichen Arbeiten. Diejenigen Kandidaten, welche die besten Arbeiten geliefert haben, gewöhnlich ein Zehntel der ganzen Zahl, erhalten den vielbegehrten Knopf auf ihren Hut und den offiziellen Titel Siu-tz-ai, d. h. Knospendes Genie.
Aber das ist nur die erste und niedrigste Stufe zum chinesischen Parnaß, eine notwendige Vorbedingung, um als Kandidat zu den Prüfungen in der Provinzhauptstadt zugelassen zu werden, welche alle drei Jahre einmal, gewöhnlich im September, abgehalten werden. Die Examinatoren sind Mitglieder der Hanlinakademie in Peking, dieser chinesischen Akademie der Wissenschaften, und werden vom Kaiser ernannt. Außerdem wohnen der Vicegouverneur der Provinz und die hervorragendsten Mandarine denselben bei.
Den Besuchern der chinesischen Provinzhauptstädte, vor allem der Städte Canton, Hangtschau und Nanking, werden gewöhnlich die großen Prüfungshallen gezeigt, in welchen diese Wettprüfungen stattfinden. Woher der Name Prüfungshalle stammt, kann ich mir nicht recht erklären, denn als ich, geführt von meinem Dragoman, jene von Canton betrat, glaubte ich mich eher in einem Viehpark zu befinden, wie ich sie rings um die großen Schlachthäuser von Chicago gesehen habe, als in dem Versammlungsort der Gelehrtenwelt der Provinz Kwantung: eine ebene, mit Gras und Unkraut überwucherte Fläche von etwa sechzehn Morgen Ausdehnung, eingeschlossen von einer hohen alten Mauer. Ein breiter, schlecht gepflasterter Weg führt von einem Thore quer über diesen Platz zu dem gegenüberliegenden Thore und teilt ihn in zwei gleiche Hälften. Von diesem Mittelweg zweigen sich auf[S. 317] beiden Seiten in Abständen von etwa fünf zu fünf Schritten niedrige, stallartige Gebäude ab, welche bis an die Umfassungsmauer reichen. Die Breite dieser sonderbaren langen Gebäude beträgt kaum drei Schritte, die restlichen zwei Schritte entfallen auf die engen Gänge oder Gäßchen zwischen ihnen. Auf der einen Seite zeigt jedes Gebäude etwa hundert kleine Thüröffnungen, die andere wird durch eine kahle Mauer gebildet, die weder Fenster noch Thüren hat. Von einer Halle ist nichts zu sehen. Verwundert erkundigte ich mich nach dem Zweck dieser anscheinenden Stallungen. Mein Dragoman ließ mich durch eine der vielen kleinen Thüröffnungen treten. Ich befand mich in einem kahlen, gemauerten Raume, der das Aussehen und die Größe zwischen einem Schilderhaus und einem Schweinestall haben mochte. Thüre, Fenster, Einrichtung waren nicht vorhanden. Nahe beim Thüreingang und an der gegenüberliegenden Mauer bemerkte ich horizontale Einschnitte. Der Boden starrte vor Schmutz, und bei meinem Eintritt raschelten Eidechsen davon. Kellerasseln und anderes Ungeziefer verschwanden in den Rissen und Sprüngen der Mauer. Genau so sahen auch alle anderen dieser kerkerartigen Räume aus. Jeder zeigte über der Thüröffnung eine Nummer, und ebenso trug auch jedes Gäßchen eine Bezeichnung.
Als wir dieses Labyrinth von Tausenden von Kammern durchschritten hatten, gelangten wir durch das jenseitige Thor in einen kleineren Hof, in welchem sich einige andere niedrige Gebäude, aber mit größeren Räumlichkeiten, befanden. Das war alles. Nirgends war eine Spur von Leben. All diese Räume waren öde und verlassen. Nur an der großen Eingangspforte lungerten einige Wächter und Soldaten umher.
Aber wie anders ist das Bild dieser Prüfungshalle alle drei Jahre während der Septemberprüfungen! Fünfzehn- bis zwanzigtausend Menschen, vielleicht noch mehr, drängen sich dann innerhalb der Umfassungsmauern zusammen, und die Aufmerksamkeit der ganzen Provinz mit ihren dreißig Millionen Einwohnern konzentriert sich hier, wie es etwa in England zur Zeit der großen Rennen auf der berühmten Epsomdown bei Derby oder zur Zeit der Stiergefechte auf der Plaza de Toros in Sevilla der Fall ist. Schon eine Woche vorher treffen aus allen Teilen der Provinz die Prüfungskandidaten mit ihren Familien und Freunden in Canton ein, und nachdem sie in den chinesischen Hotels oder bei Privaten Unterkunft gefunden haben, melden sie sich mit ihren Legitimationen bei der Prüfungskommission, welche in den Gebäuden des vorerwähnten kleineren Hofes ihr Hauptquartier aufgeschlagen hat und dort während des ganzen Prüfungsmonats wohnen bleibt. Die kaiserlichen Kommissare, hohe Mandarine, Hunderte von Beamten, Schreibern, Sekretären, Soldaten und Wächtern beleben die öden Räume und bereiten alles für die Prüfungen vor, zu denen sich gewöhnlich acht- bis zwölftausend Kandidaten zu melden pflegen, mitunter viel mehr, als die Prüfungshalle[S. 318] Platz besitzt. Der weite Raum wird gereinigt, und auch die kleinen vorgeschilderten Zellen, deren es in der Cantoner Prüfungshalle 8653 giebt, werden gekehrt und für die Aufnahme der Kandidaten einfach dadurch vorbereitet, daß man in die Mauereinschnitte zwei fußbreite Bretter einschiebt; das eine derselben dient als Tisch, das andere als Sitz.
Am frühen Morgen des festgesetzten Tages drängen sich die Prüfungskandidaten, begleitet von ihren Verwandten, Freunden und Dienern vor dem Hauptthore der Halle zusammen, alle sind mit Kleidungsstücken, Decken, Lebensmitteln, Kochgeschirren, Theetöpfen und sonstigem Hausrat schwer beladen, denn die Kandidaten bleiben während der nächsten neun Tage in den winzigen Prüfungszellen wohnen und dürfen nur die dritte und die sechste Nacht außerhalb der streng bewachten Prüfungshalle zubringen. Niemand darf sie in das Innere derselben begleiten. Am Thore nehmen sie von ihren Begleitern Abschied und treten, bepackt mit ihrem Hausrat, einzeln durch das Thor. Hier werden sie von Beamten der Prüfungskommission genau untersucht, ob sie nicht etwa kleine Taschenausgaben der Klassiker oder sonst irgendwelche verbotene Gegenstände mit sich führen, und haben sie diese Untersuchung bestanden, so melden sie sich bei den Mandarinen. Von diesen erhält jeder Kandidat einige gestempelte Papierbogen, auf welchen sein Name und seine Nummer der ihm zugewiesenen Zelle verzeichnet stehen. Mit Spannung erwarten sie die kleinen roten Zettelchen, welche in der Prüfungshalle selbst gedruckt werden und die Themata enthalten, über welche sie binnen zwei Tagen drei Arbeiten und ein Gedicht verfassen müssen. Keine Arbeit darf mehr als vierhundert und weniger als dreihundert Schriftzeichen enthalten, und etwaige Aenderungen oder Randnoten dürfen zusammengenommen weitere hundert Schriftzeichen nicht übersteigen.
Sind diese Arbeiten abgeliefert, so können die Kandidaten unbehelligt die Halle für eine Nacht verlassen. Bei ihrer Rückkehr werden sie abermals untersucht, und man weist ihnen neue Zellen an, wo sie die zweite Serie von fünf Arbeiten über klassische Gegenstände zu schreiben haben. Die dritte Serie, für welche abermals drei Tage Zeit gelassen werden, besteht aus fünf Arbeiten über Gegenstände, deren Auswahl dem kaiserlichen Examinator überlassen bleibt und die in den letzten Jahrzehnten zuweilen auch moderne Fragen, etwa über Staatswissenschaften, die Geographie der Provinz oder des Reiches, oder Mathematik, umfassen. Sind auch diese Arbeiten abgeliefert, so ist die Prüfung vorüber, die Kandidaten können ihre Zellengefängnisse verlassen. Aber es vergehen mehrere Wochen, ehe sie das Ergebnis der Prüfung erfahren. Jedes der bei der Prüfungskommission eingelaufenen Schriftstücke, mitunter bis zu dreißigtausend an der Zahl, muß ja vorher sorgfältig geprüft werden, und diese Prüfung geht, zur Vermeidung von Unterschleifen oder Bevorzugung, mit der größten Strenge vor sich. Zunächst werden über die Namen der Kandidaten auf den einzelnen Arbeiten Papierstreifen geklebt und diese mit Nummern[S. 319] bezeichnet, so daß den Examinatoren die Verfasser der Arbeiten unbekannt bleiben. Dann werden alle die vielen Tausende von Schriftstücken mit roter Tinte abgeschrieben, eine dritte Klasse von Beamten unterzieht sie der ersten Prüfung und wählt die besten aller Arbeiten aus. Nur diese werden den kaiserlichen Examinatoren selbst vorgelegt. Immerhin sind dies noch zehn Prozent, also zwei- bis dreitausend Schriftstücke, von etwa achthundert bis tausend Kandidaten. Nun sind jeder Provinz nur eine bestimmte Anzahl von litterarischen Graden, in Kwantung z. B. nur siebzig bis achtzig, zugewiesen, und den kaiserlichen Examinatoren liegt es ob, unter den nahezu tausend besseren Kandidaten siebzig bis achtzig auszuwählen, deren Arbeiten die vorzüglichsten waren. Auch damit sind die Vorsichtsmaßregeln gegen Unterschleife nicht zu Ende, denn ein kaiserlicher Zensor hat die Arbeiten der von den Examinatoren zur Erteilung von Graden vorgeschlagenen Kandidaten durchzusehen und ihnen die Bestätigung zu erteilen.
Wie mir indessen von chinesischen Litteraten selbst eingestanden wurde, kommen bei diesen Prüfungen trotz aller Strenge dennoch Unterschleife vor; Bücher werden eingeschmuggelt, Thorhüter bestochen, andere Kandidaten verfassen die Arbeiten ihrer Kollegen. Dagegen lassen sich die Examinatoren nicht so leicht zu Unregelmäßigkeiten herbei, denn solche werden mit der größten Schärfe bestraft. In der Mitte der sechziger Jahre wurde beispielsweise ein kaiserlicher Examinator, Mandarin ersten Ranges und Großsekretär des Reiches, weil er seinen Neffen begünstigt hatte, enthauptet. Im Herbst 1894 versuchte es ein reicher Chinese aus der Provinz Tschekiang, den Examinator durch Zuwendung einer Summe von zehntausend Taels zu bestechen. Der letztere erstattete Anzeige, und der Chinese wurde zum Tode verurteilt.
In anderen Provinzstädten ist der Zudrang zu den Wettprüfungen zuweilen noch stärker als in Canton. So z. B. mußten vor einigen Jahren in Hangtschau, dessen Prüfungshalle zehntausend Zellen enthält, in den engen Gäßchen dazwischen noch über tausend Sänften aufgestellt werden, um alle Kandidaten unterzubringen. Man sollte meinen, den siebzig bis achtzig Glücklichen, welchen es von all den Tausenden allein beschieden ist, mit litterarischen Graden aus den Prüfungen hervorzugehen, stände zum mindesten das große Los bevor. Welch große Kosten, welch mühsame Reisen, welche Arbeiten und Entbehrungen sind mit derlei Prüfungen verbunden! Der Aufenthalt in den kleinen Zellen ist bei heißem Wetter geradezu unerträglich, und so mancher alte oder schwache Mann, der als Kandidat die Prüfungshalle betritt, verläßt sie nicht mehr lebend. Gar nicht selten sind die Fälle, daß besonders Greise an Erschöpfung sterben, und da es gegen die Vorschriften wäre, die Thore der Halle während der Prüfungen zu öffnen, so werden Oeffnungen in die Umfassungsmauer gebrochen und die Leichname der Unglücklichen herausgeschafft. Ein großer Prozentsatz der Kandidaten giebt sich auch mit der einmaligen Prüfung[S. 320] nicht zufrieden. Beharrlich melden sie sich ein zweites, drittes Mal, ja noch öfter, und vielleicht ist es ihnen endlich vergönnt, als Greise die Prüfung zu bestehen, d. h. damit den Titel Chü-dschin, d. h. beförderter Mann zu erringen. Und ist dies wirklich geschehen, so werden Eilboten zu Land oder Wasser nach dem Heimatsort gesandt, um das Glück zu verkünden, welches diesem letzteren zu teil geworden ist. Die Familie des neugebackenen Chü-dschin veranstaltet große Freudenfeste, sie läßt an den Straßenecken große rote Plakate anschlagen und alle Freunde und Bekannten durch eigene gedruckte Anzeigen von der erfolgten Ernennung in Kenntnis setzen. Ueber die eigene Hausthür aber wird eine große Tafel mit den Worten Beförderter Mann aufgehängt. Wohlhabende errichten häufig sogar steinerne Triumphbögen zu Ehren eines glücklichen Prüfungskandidaten.
Und was hat der Kandidat dadurch in Wirklichkeit erreicht? Nicht etwa einen einträglichen fetten Mandarinsposten, irgend welche besondere Würden oder Auszeichnungen, sondern einfach die Möglichkeit, mit der Zeit, vielleicht nach vielen Jahren, irgend eine bescheidene Staatsstellung zu erreichen.
Wer schneller und sicherer zu einer solchen gelangen will, muß sich noch zu einer dritten Art von Prüfungen melden, welche alle drei Jahre einmal, gewöhnlich in dem auf die Provinzprüfungen folgenden Frühjahr in der Reichshauptstadt selbst stattfinden. Auch in Peking ist die Prüfungshalle nicht viel besser als in den Provinzhauptstädten, doch sind die Kandidaten die Gäste des Kaisers, und während sie dreimal drei Tage mit je einer mittägigen Unterbrechung in den Prüfungszellen schmachten, erhalten sie aus den Küchen, welche bei jedem Zellengäßchen eingerichtet werden, reichliche Lebensmittel. Aber die Kosten der weiten, mitunter monatelangen und beschwerlichen Reise müssen sie selbst bestreiten. Haben sie keine Mittel dazu, so wird ihnen möglicherweise ein reiches Bankhaus dieselben vorstrecken, und sind sie einmal Mandarin geworden, so müssen sie diese Darlehen mit reichen Zinsen zurückerstatten. Auch in Peking vollziehen sich die Prüfungen in ähnlicher Weise wie in den Provinzhauptstädten, nur sind sie entsprechend schwieriger, die Aufgaben über klassische und philosophische Themata müssen glänzend gelöst werden, die Gedichte fehlerfrei sein. Durchschnittlich melden sich zu jeder Prüfung vierzehntausend Kandidaten aus allen Provinzen, und nur ein Zehntel davon können den vielumworbenen Grad eines Tsen-tse, d. h. fertiger Gelehrter, etwa unserem Doktorgrad entsprechend, erreichen. Jede Provinz hat je nach ihrer Einwohnerzahl Anspruch auf eine bestimmte Zahl von Tsen-tse-Stellen, und diejenigen Kandidaten, welche diesen Grad erlangt haben, werden gewöhnlich nach kurzer Zeit zu Mandarinen befördert und erhalten eine Regierungsanstellung. Wer von den Tsen-tse anstrebt, noch höhere litterarische Ehren zu erreichen, muß sich einer vierten Prüfung unterziehen. Diese wird in der verbotenen Stadt sogar unter den Augen des Kaisers selbst abgehalten, und die Glücklichen, welche diese schwierigste aller Prüfungen[S. 321] bestehen, werden Mitglieder der Hanlinakademie und führen den stolzen Titel Poeten und Historiker des kaiserlichen Hofes. Die besten von diesen werden nach einer formellen Prüfung vor dem Kaiser zu Tschuang-yuen, d. h. etwa poeta laureatus, ernannt und haben damit Anspruch auf den Posten eines kaiserlichen Examinators oder auf andere hohe Würden.
Wie man sieht, ist das Mandarinentum in China nicht ganz so schlecht wie sein Ruf. Die vielbegehrten Posten müssen mit großen Mühen und durch jahrelanges Studium erworben werden und kommen nicht etwa durch Günstlingswesen, hohe Verwandtschaften oder mächtige Freunde zur Besetzung, wie es in manchen, uns viel näher liegenden Ländern zuweilen geschieht. Wohl kommen sehr viele Unterschleife vor, im ganzen und großen aber hat sich das System der Wettprüfungen durch anderthalb Jahrtausende verhältnismäßig rein erhalten und läßt die Chinesen in einem ganz anderen, günstigeren Lichte erscheinen, als es gewöhnlich geschieht. Nur ist es zu bedauern, daß diese Kenntnisse sich nicht auf nützlichere Gebiete erstrecken als die vergilbten, veralteten Klassiker Chinas.
Von allen jenen, die China und die Chinesen durch vieljährige Beziehungen kennen, von Missionaren, Kaufleuten, Diplomaten, werden die geheimen Gesellschaften des Reiches der Mitte als die Hauptursachen der Christenmetzeleien und überhaupt als die Urheber der traurigen Zustände in den chinesischen Städten bezeichnet. Sie sind durchwegs politischen Charakters, und bei allen ist der Grundzug Fremdenhaß. Gelänge es der Pekinger Regierung, diese Geheimbünde zu brechen und zu vernichten, dann könnte an eine Wiedererwachung des Reiches gedacht werden; dann wäre es möglich, eine kaiserliche Armee zu schaffen und den Missionsanstalten sicheren Schutz angedeihen zu lassen; solange diese Geheimbünde aber fortbestehen, niemals. Den besten Beweis dafür bilden die englischen Kolonien in Malakka und die holländischen Kolonien in der Sundasee. Solange man dort der chinesischen Geheimbünde[S. 323] nicht habhaft werden konnte, waren Aufstände, blutige Kämpfe, Verbrechen an der Tagesordnung; erst seit den strengen Maßregeln gegen die Geheimbünde sind Ruhe und Ordnung eingetreten. Dasselbe gilt auch von Hongkong.
Gerade in diesen Kolonien, wo die oberste Gewalt in den Händen der Europäer liegt, war es möglich, einen Einblick in das Wesen dieser chinesischen geheimen Gesellschaften zu erhalten und daraus auf ihre Macht und Ausbreitung in China selbst zu schließen. Im Reiche der Mitte gehört die Ausforschung dieser nach Hunderten zählenden Gesellschaften beinahe zu den Unmöglichkeiten; wird doch Verrat an den Chinesen selbst durch den Tod bestraft; wie erst würde es den Europäern ergehen, welche gegen die Geheimbünde vorgehen wollten! Die erste Nachricht von ihrem Bestehen war in einem Buch des bekannten Sinologen Doktor Milne enthalten, das im Jahre 1825 unter dem Titel Some accounts of a Secret Society in China erschien und die größte dieser Gesellschaften, die Tien-ti-hwey, behandelte. Das Buch erregte die Aufmerksamkeit eines Dolmetschers im Dienste der niederländischen Kolonialregierung, Namens Gustav Schlegel. Gelegentlich einer Haussuchung bei einem des Diebstahls beschuldigten Chinesen in Padang (Sumatra) wurden eine Anzahl Bücher und Dokumente vorgefunden, die Schlegel zur Uebersetzung zugewiesen wurden, und in ihnen fand er die Bestätigung der Angaben Milnes, sowie die Thatsache, daß sich in Padang eine Loge der großen Tien-ti-Gesellschaft befand. Gestützt auf das reiche in seinen Händen befindliche Material, veröffentlichte er 1867 sein berühmtes Buch The Thian-Ti Hwei or Hung League. Einige Jahre nachher gewann der Protektor der Chinesen in Singapore, Mr. W. A. Pickering, so viel Einfluß auf die Hung-Gesellschaft, daß sie ihn zu ihren geheimen Sitzungen zuließ. Er vervollständigte die Kenntnisse, die bis dahin über das Wesen und den Umfang der Gesellschaft in die Oeffentlichkeit gedrungen waren.
In ihrem Katechismus heißt es: „Seit der Erschaffung der Welt besitzen wir den Namen Hung”.... „Ying und Yang, Himmel und Erde zusammen, erzeugten die Söhne von Hung, in Myriaden vereinigt.” Wirkliche Beweise ihres Bestehens stammen jedoch erst aus dem siebzehnten Jahrhundert, d. h. seit der Vertreibung der angestammten Kaiserdynastie durch die Tataren. Damals war ihr Wahlspruch: „Gehorche dem Himmel und thue recht”; und dieser Wahlspruch steht auch heute noch auf jeder Seite ihrer Bücher und Veröffentlichungen; thatsächlich aber ist ihr Wahlspruch: „Hoan Tscheng, Hok Beng”, d. h. „Vertreibe die Tataren und setze die Mings wieder ein”. Im Dialekt, wie er in der Provinz Fokien gesprochen wird, heißt Tscheng die Mandschudynastie und Beng die Mingdynastie. Neben dem Namen Tien-ti-Hwey wird von den Chinesen auch Sam-hap, d. h. Triad (oder Dreiheit, Dreieinigkeit) als offizieller Name des Geheimbundes anerkannt wegen der Vereinigung der drei Begriffe Himmel, Erde, Mensch. Gestützt darauf strebt der Geheimbund die Beteiligung aller Chinesen an, und um dieses Ziel zu erreichen,[S. 324] sind alle Mittel erlaubt. Jede Loge (und es giebt deren wohl in jeder Stadt Chinas) besitzt eine Anzahl von Tai-ma, d. h. Werbern. Sobald sie aus irgend einem Grunde die Mitgliedschaft eines bestimmten Chinesen für wünschenswert erachten, erhält er auf geheimnisvolle Weise einen geschriebenen Befehl, sich zu der angegebenen Zeit an einem genau bezeichneten Orte einzufinden. Hat der Betreffende nicht den Wunsch, der Triad oder, wie sie auch heißt, der Hung-Gesellschaft beizutreten, so wird er seinen Wohnsitz aufgeben und sich unter anderem Namen in einem entfernten Orte verbergen, denn Widerstand wäre vergeblich. Frederick Boyle, der sich mit dem Wesen der Hung-Gesellschaft eingehend befaßt hat, sagt darüber: „Irgend einen Racheakt, sei es körperliche Züchtigung oder eine falsche Anklage bei den Gerichten, zu welcher sich auch falsche Zeugen finden, hat der Betreffende dann gewiß zu erwarten, wenn ihm nicht noch Schlimmeres passiert. Zuweilen wird der Betreffende bei passender Gelegenheit von den Tai-ma überfallen und gefesselt nach der Loge geschleppt oder durch List in eine Falle gelockt.”
Als Versammlungsorte der Hung-Mitglieder werden überall die geheimsten und entlegensten Schlupfwinkel ausgesucht; in Canton und Singapore liegen sie zwischen Sümpfen und Dschungeln, und die Zugänge werden durch Bewaffnete bewacht. Pickering erzählt, daß mehr als einmal Fremde, die den Geheimspruch als Erkennungszeichen nicht zitieren konnten, auf der Stelle getötet wurden. Nach diesen Logenplätzen werden nun die Novizen geführt und dort einem ebenso umfangreichen wie haarsträubenden Zeremoniell unterworfen, ehe sie als Mitglieder aufgenommen werden. Es würde wohl einen stattlichen Band füllen, sollte der ganze Hokuspokus mit seinen Einzelheiten geschildert werden. Nachdem der Novize nahezu die ganze Nacht in Angst und Pein allen möglichen Prozeduren unterworfen wurde, gelangt er endlich vor den Thron des Meisters und liegt dort in weiße Gewänder gekleidet, mit aufgelöstem Haar und offener Brust auf dem Rücken, während acht Räte spitze Schwerter nach seiner Brust richten. Dort hat er zu schwören, daß er seine ganze Familie als tot betrachte und keine irdischen Beziehungen und Verpflichtungen mehr anerkenne. Dann muß er einige Tropfen seines Blutes in einen mit Wein gefüllten Becher fallen lassen, und nachdem er diesen geleert, wird er als Novize in den Bund aufgenommen, um bei späteren Versammlungen noch weiteren Prüfungen unterworfen zu werden.
Die Hung-Gesellschaft besitzt keinen obersten Meister, sondern sie wird von den fünf Großlogen der Provinzen Fokien, Kwangtung, Yüman, Hunan und Tschekiang geleitet. Alle anderen Logen, auch jene in den Kolonien, dann in Amerika und Australien sind irgend einer der fünf Großlogen unterthan, und ihre Mitgliederzahl muß mehrere Millionen erreichen. In Singapore beispielsweise war sie im Jahre 1887 nahezu so zahlreich wie die ganze chinesische Bevölkerung. Alle Mitglieder sind durch die strengsten Gesetze und Androhung furchtbarer Strafen zu[S. 325] Gehorsam und Einhaltung der Vorschriften des Tien-ti verpflichtet. Der vierunddreißigste der sechsunddreißig Grundartikel verbietet ihnen, um nur das Wichtigste hervorzuheben, bei grausamer Todesstrafe, unter keiner Bedingung sich an die bestehenden Gerichte, Behörden oder Polizei zu wenden. Der fünfunddreißigste Artikel setzt ebenfalls die Todesstrafe darauf, wenn ein Mitglied irgendwie vor Gericht Zeugenschaft ablegt, außer es ist falsche Zeugenschaft auf Befehl der Logenleiter. Die ganze Gerichtsbarkeit aller Mitglieder der Loge liegt dem Meister ob. Man kann sich unter diesen Umständen den ungeheuren Einfluß und die Bedeutung der Hung-Gesellschaft in China leicht vorstellen. Sie bildet gewissermaßen einen Staat im Staate, viel stärker, besser organisiert und einflußreicher als dieser selbst, und wie Boyle sagt: „die verkommenste, blutdürstigste und bedrückendste Gesellschaft, welche die Weltgeschichte kennt”. Schlegel sagt: „Die Hung-Gesellschaft hat überall, wohin sie kam, Bürgerkrieg und Mord im Gefolge gehabt”, und Milne sagt: „Die Mitglieder schützen einander gegen das Gesetz, verbergen ihre Verbrechen und helfen ihren Brüdern, sich der Hand der Gerechtigkeit zu entziehen”. Pickering äußert sich folgendermaßen: „Die Tien-ti ist eine Vereinigung, um die Interessen ihrer Mitglieder gegen die Gesetze aufrechtzuerhalten und Reichtümer zu sammeln, indem sie den Freudenhäusern, Spielhöllen und dergleichen unrechtmäßig Tribut auferlegen”. Der Polizeiinspektor von Singapore berichtet: „Sie sind eine ständige Gefahr für den Frieden der Kolonie”. Sie üben überall eine Schreckensherrschaft aus, und die Mandarinen sind dagegen machtlos, denn irgendwelche Unternehmungen gegen sie werden durch Tortur, Mord, Brand oder durch falsche Anklagen gerächt, für welch letztere sich immer, wenn nötig, tausend falsche Zeugen finden.
Die Logenleiter beuten in vielen Fällen ihre Macht zu ihren eigenen Zwecken aus und gelangen so zu großem Reichtum. Tschang-Ah-Kwi, einer der Vorsteher der Loge zu Penang, wurde vor einigen Jahren wegen Mordes angeklagt, und man fand, daß er ein Vermögen von 40 Millionen Mark besaß. Sein Spießgeselle Tschin-Ah-Yam erfreute sich eines nahezu ebensogroßen Vermögens. Das Obergericht in Singapore verurteilte den Distrikt-Großmeister der Hungs, Namens Khu-Tan-Tek, vor kurzem zum Tode, und er erklärte, man würde nicht den Mut haben, ihn hinzurichten. Thatsächlich wurde ihm das Leben geschenkt, wie man sagt, weil man sich vor der Rache der Hung-Mitglieder fürchtete. In China selbst wäre es bisher natürlich vergebliche Mühe gewesen, gegen die Hungs vorzugehen. Der beste Beweis ist ja der große Taipingkrieg, der auf Veranlassung der Hung-Gesellschaft entfacht wurde und den China erst durch die Hilfe der Europäer zu Ende führen konnte, nachdem die volkreichsten Provinzen in Wüsten, die blühendsten Städte in rauchende Trümmerhaufen verwandelt worden waren. In früheren Zeiten schritt die chinesische Regierung wohl energisch gegen die Hungs ein. So wurden in Canton an einem Tage allein dreitausend von ihnen enthauptet, und gelegentlich[S. 326] der Unruhen in Peking im Jahre 1817 wurden zehntausend in die dortigen Gefängnisse geworfen, wo sie verschmachteten. Allein die Hungs sind eine lernäische Schlange und der Kaiser von China leider kein Herakles.
Dagegen wurde in den europäischen Kolonien in Ostasien die Unterdrückung der Hung-Gesellschaft mit mehr oder minder Erfolg durchgeführt. Die Hungs sind die Ursache, daß sich der Sultan des unabhängigen Malayenstaates Perak unter den Schutz Englands stellen mußte, denn er konnte mit seiner Macht gegen die fünfzigtausend Hungs in seinem Staate nicht ankämpfen. In Niederländisch-Indien und in den Philippinnen machte man zuerst in furchtbarer Weise Bekanntschaft mit den Hungs, und dem Morden, Plündern und Rauben wurde dadurch wenigstens teilweise Einhalt gethan, daß man auf die Verleitung zum Eintritt in den Geheimbund die Todesstrafe setzte. Ebenso wurden über jene Chinesen, in deren Besitz man Flaggen, Bücher oder Abzeichen der Hung-Gesellschaft fand, die schwersten Strafen verhängt. Die ganze mongolische Bevölkerung wurde strenger Kontrolle unterworfen, indem man ihnen eigene Quartiere anwies, außerhalb welcher sie nicht wohnen durften. Die Quartiere wurden in Bezirke abgeteilt und eigenen Beamten und Polizisten unterstellt, die für die Bevölkerung verantwortlich waren. In jeder Straße oder Abteilung einer solchen waren eigene Wachleute, die jeden Einwohner persönlich kannten und dafür zu sorgen hatten, daß niemand nach einer bestimmten Sperrstunde ohne triftigen Grund seine Wohnung verließ. Allein auch diese strenge Maßregeln konnten die geheimen Gesellschaften nicht unterdrücken, wie die äußerst bewegte Geschichte der spanischen und niederländischen Kolonien hinlänglich beweist. Wie oft wurde Manila von den Hungs und anderen Geheimbündlern geplündert und besetzt! Wie oft war es notwendig, mit der ganzen Garnison gegen sie vorzugehen! Ebenso war Bandjermassin auf Borneo die Stätte blutiger Kämpfe, so daß die niederländisch-indische Regierung sich entschloß, alle Mitglieder der Hungs und alle verdächtigen Chinesen aus ihrem Gebiet zu verweisen. Zehn Jahre später schrieb aber Schlegel: „Es ist unmöglich gewesen, die Hungs aus ihren Wohnsitzen gänzlich zu vertreiben. Sie bestehen heute noch an allen Orten”. Die vielen Tausende, welche Niederländisch-Indien wirklich verließen, wandten sich nach dem Sultanat von Sarawak im Nordwesten Borneos, und Rajah Brook konnte sich gegen dieses Raubgesindel nicht anders helfen, als indem er zehntausend der eingeborenen Dayaks anwarb und gegen die Chinesen zu Felde zog. So wurden sie vernichtet.
Merkwürdigerweise wurden die Geheimgesellschaften trotz all dieser traurigen Erfahrungen, trotz der großen Unsicherheit in Singapore und Penang, trotz der vielen Raubanfälle, Kämpfe und Morde in diesen englischen Kolonien am längsten geduldet, bis endlich der Aufstand von 40000 bewaffneten Chinesen im Jahre 1876 auch hier energische Maßregeln nach sich zog. Statt aber ihre Unterdrückung an[S. 327]zuordnen, beschränkte sich das englische Kolonialamt auf ihre Registrierung und Beaufsichtigung. Erst 1888, nachdem die Zustände unerträglich geworden waren und die englischen Beamten in ihrem Leben bedroht wurden, beschloß man die gänzliche Ausrottung der Geheimbünde, die auch thatsächlich gelungen sein soll. Auf wie lange, ist eine andere Frage.
Nächst der Tien-ti-Gesellschaft ist der gefürchtetste, mächtigste und verbreitetste Geheimbund Chinas die Wu-wei-kian, zu deutsch „Thue nichts”, jener Bund, welchem das jüngste Hinmorden der christlichen Missionare 1895 zugeschrieben wird und dessen Mitglieder von den Europäern Vegetarianer genannt werden. In früheren Zeiten führte der Bund den Namen „weißer Lotos”, und 1724 erließ der Kaiser Yung-Tsching gegen ihn ein Edikt, demzufolge alle Mitglieder vogelfrei erklärt wurden. H. F. Balfour hat sich während seines langjährigen Aufenthaltes in Shanghai eingehend mit den Vegetarianern beschäftigt, die diesen Namen deshalb führen, weil ihnen der Genuß von Fleischspeisen verboten ist. Ursprünglich durften sie keine farbigen Kleider tragen, keine spitzigen Waffen oder Werkzeuge benutzen (thatsächlich waren die Wunden der jüngst ermordeten Missionare durchweg Hiebwunden) und kein Vermögen besitzen. Beim Eintritt in den Bund müssen sie jetzt noch ihre ganze Habe dem Bund abtreten und behalten nur die Nutznießung, solange sie leben. Die Mehrzahl der Bündler gehören den wohlhabenderen Ständen an, und der Bund, der im Gegensatz zu dem Tien-ti einem einzigen Oberhaupt oder Großmeister untersteht, soll demnach auch ungeheure Reichtümer besitzen. Zu Beginn des Jahrhunderts beschlossen die Vegetarianer die Vernichtung der Kaiserdynastie in Peking. Der Plan wurde entdeckt, und der Kaiser Kia-King dekretierte die Ausrottung der Vegetarianer im ganzen Reiche. Sie zogen sich unter ihrem Großmeister Fang-Yung-Tschen nach ihrem Hauptquartier Nanking zurück und hielten monatelang der Belagerung durch die Kaiserlichen stand. Endlich fiel Nanking, der Vicekönig ließ Tausende köpfen und gewährte nur jenen Gnade, die sich entschließen würden, Fleisch zu essen, um dadurch ihre Unterwerfung und Lossagung von dem Geheimbunde auszudrücken. Thatsächlich unterwarfen sich sehr viele, allein keiner davon blieb lange am Leben. Sie wurden als Renegaten von den übriggebliebenen Geheimbündlern ermordet.
Statt unterdrückt und vernichtet zu sein, wechselten die Mitglieder der Gesellschaft den Namen derselben vom „weißen Lotos” in „Thue nichts” und sind heute zahlreicher und gefürchteter als je zuvor. Der Grund davon liegt darin, daß die Wu-wei-kian auf den Aberglauben des Volkes wirken. Die Chinesen halten sie für Magiker, im Bund mit diabolischen Mächten. Balfour sagt darüber: „Gebildete Chinesen haben mir allen Ernstes versichert, daß die Wu-wei-kian aus Papier Vögel ausschneiden und diesen mittels eines Zaubermittels Leben einflößen. Sie können auch ihren Atem unglaublich lange Zeit anhalten, bis sie im Gesichte schwarz[S. 328] werden und alles Leben in ihnen erloschen zu sein scheint. Während dieser Zeit verläßt die Seele ihren Leib, um allerhand Auskünfte einzuholen; sobald sie zurückkehrt, gelangen die Wu-wei-kian wieder zum Leben”.
Das Hauptstreben der Gesellschaft ist wie bei den Hungs ebenfalls gegen die Fremdherrschaft, also gegen die Mandschuren gerichtet. Allein sie gehen in ihrem Grundsatz „China für die Chinesen” noch weiter und stehen allen Europäern und allen europäischen Religionen, demnach zunächst den Missionaren, feindlich gegenüber. Eine ganze Menge der Morde und Angriffe auf Missionshäuser in den letzten Jahrzehnten werden ihnen in die Schuhe geschoben, ebenso wie sie auch direkt der jüngsten Greuelthaten beschuldigt werden.
Die drittgrößte Geheimgesellschaft ist die Ko-Lao-Wai oder „Gesellschaft des älteren Bruders”. Als der letztere wird die frühere Kaiserdynastie Tang angesehen, und das Streben der Gesellschaft ist es, an die Stelle der Mandschuren die Nachkommen der Tang zu setzen. Das Hauptquartier der Ko-Lao sind die mittleren Provinzen Chinas, Hunan und Honan, und die Mitglieder des Bundes bestehen hauptsächlich aus Soldaten. Boyle sagt über sie: „Nach allen Berichten sind sie eine tollkühne und gewissenlose Bande, die in den mittleren Provinzen des Reiches einen großen Teil der Missethäter und Vagabunden zu ihren Mitgliedern zählt”, und Balfour sagt: „Es ist gar nicht zu bezweifeln, daß, wenn einer ihrer alten Generale die Fahne des Aufruhrs entrollen würde, binnen kürzester Zeit hunderttausend Mann um ihn geschart wären”. Nach Briefen, die ich während meines Aufenthalts in China erhielt, wird dem Einfluß dieser Ko-Lao großenteils der Mißerfolg der chinesischen Waffen im Feldzuge gegen Japan zugeschrieben. Die Regimenter, welche zahlreiche Ko-Lao in ihren Reihen hatten oder ganz aus solchen bestanden, weigerten sich zu kämpfen oder liefen ganz davon in der Hoffnung, daß durch die Niederlagen die Mandschudynastie gestürzt würde und damit ihre Hoffnungen auf die Tangdynastie größere Aussicht auf Erfüllung hätten.
Auch die Mohammedaner, deren Zahl in China zwanzig bis fünfundzwanzig Millionen erreicht, haben ihren eigenen großen Geheimbund, Hwuy-Hwuy-Jin genannt. Novizen werden dadurch gereinigt, daß man sie zunächst tüchtig durchbläut und ihnen dann Seifenwasser zu trinken giebt, was die Nachwirkung des bei den Taoisten so beliebten und bei den Mohammedanern verpönten Schweinefleisches paralysieren soll. Die unzähligen anderen Geheimgesellschaften Chinas sind viel kleiner und mehr auf gewisse Provinzen oder Städte beschränkt, gerade wie bei unserer eigenen Vereinsmeierei. Auf die sozialen und politischen Zustände des Reiches üben sie keinen nennenswerten Einfluß aus. Ob der große Mohammedaneraufstand des Jahres 1895 in den Provinzen Schensi und Kansu auf den Einfluß der Geheimbünde zurückzuführen ist, kann nicht gesagt werden. Die Aufständischen waren hauptsächlich von religiösem Fanatismus und blindem Chinesenhaß erfüllte[S. 329] Banden, die hier schon seit Jahrhunderten einen Rassenkrieg gegen die Ungläubigen führen; mit diesem Namen nämlich werden die Chinesen von den Mohammedanern bezeichnet. Die letzteren, obschon ähnlich gekleidet wie die Chinesen und allen Gebräuchen derselben, selbst dem Zopftragen und dem Verkrüppeln der Füße bei den Frauen unterworfen, sind doch anderer Rasse, denn sie stammen aus dem fernen Turkestan und wurden vor einem Jahrtausend von den Kaisern der Tangdynastie nach Kansu gerufen, um dieses gegen die Einfälle der Tibetaner zu schützen. Sie erhielten dafür die Bewilligung, sich in Kansu und Schensi anzusiedeln, verbreiteten sich aber auch auf die Nachbarprovinzen, vornehmlich nach Schantung, und zählen heute zusammen etwa zwanzig Millionen. Sie leben mitten unter den Chinesen, vermengen sich aber niemals mit diesen und sind ihnen auch seit jeher feindlichgesinnt geblieben. Auch die Mohammedaner haben ihre Geheimgesellschaft, deren Streben es ist, die beiden Provinzen ganz von Chinesen zu befreien und ein unabhängiges mohammedanisches Reich zu gründen. Teilweise ist auch religiöser[S. 330] Fanatismus ein Grund des Hasses gegen die Chinesen, denn diese haben ihnen wohl die Ausübung ihrer Religion gestattet, aber die Moscheen im Reiche der Mitte dürfen über den Pforten keinen Halbmond und keine Bezeichnung als Moscheen tragen; im Innern der Moscheen sind überdies auf Anordnung der chinesischen Behörden Statuen des Confucius und die Ahnentafeln der chinesischen Kaiser aufgestellt, die von den Mohammedanern verehrt werden müssen. Das, zusammen mit dem Rassenhaß und den Bedrückungen durch die Mandarine, läßt die Gärung unter den Mohammedanern nicht zur Ruhe kommen.
Bald nach dem chinesisch-japanischen Kriege und vielleicht als Folge desselben und der dabei zu Tage getretenen Ohnmacht der Mandschuregierung entstand auch in Schantung ein Geheimbund, Tjiu-dschung-tsau, allem Anschein nach dasselbe wie die weiße Lotosgesellschaft, nur unter anderem Namen. Die Geheimbündler verbreiteten unter den Chinesen den Glauben, daß sie unverwundbar seien; dadurch gewannen sie so großen Einfluß, daß sogar die Mandarinen sich ihrer bedienten, um dem Räuberunwesen zu steuern, wenn ihre Militärmacht nicht ausreichte. Allmählich wurden aber die Geheimbündler selbst zu Räubern, ein Schrecken für Südschantung, so daß die Provinzregierung endlich reguläre Truppen gegen sie aussandte. Schon im ersten Kampfe mit den Provinztruppen fiel eine ganze Menge der Unverwundbaren unter den Schwertstreichen; die Gefangenen wurden von den Ortsmandarinen in die Holzkäfige gesteckt, wie sie in den Höfen jedes Yamens in Schantung stehen, und in diesen Käfigen am Halse aufgehängt. Nach zwei bis drei Tagen fanden die Unverwundbaren so ihren jämmerlichen Tod. Die Seifenblase war geplatzt, mit den Tji-dschung-tsau war es schon in den Sommermonaten 1895 vorbei.
Aber die Chinesen sind leichtgläubige Leute, und dazu ist die Unzufriedenheit mit der Regierung wie mit dem stetigen Fortschreiten der Europäer so groß, daß es bald zu einem neuen Geheimbunde kam, der wohl ganz wie der letzte auch nur ein Auswuchs der Sekte der Weißen Lotos sein dürfte, nur unter einem anderen Namen. Dieser Name ist eben Ta-tau-hui oder Gesellschaft der Großen Messer. Warum Große Messer, weiß ich nicht, denn ihre Waffe ist ebenfalls nur eine lange, schmale zweischneidige Lanze, im Chinesischen Piau-djiang genannt. Ich sah eine derartige erbeutete Waffe bei einem der Mandarine von Tsinan-fu.
Auch die Ta-tau-hui geben sich als unverwundbar aus, und ihr Schutzmittel sind ebenfalls Papierzettel mit allerhand Zauberformeln. Sie haben auch früher, als sie von der Regierung noch nicht so verfolgt wurden, in ähnlicher Weise Waffenübungen veranstaltet wie die Tji-dschun-tsau. Ihr Streben ist dasselbe: Vertreibung der Mandschuregierung, Vertreibung der Europäer. Hauptsächlich zu dem Zweck, um der Regierung Knüppel zwischen die Beine zu werfen, haben sie im Jahre 1895 über zwanzig Bethäuser der katholischen Mission von Südschantung[S. 331] niedergebrannt. China mußte schon damals der Mission einen Schadenersatz von 10000 Tiau (1 Tiau etwa 1 Mark 60 Pfennig) leisten. Die Provinzregierung wurde angewiesen, die Ta-tau-hui zu vertreiben, und in der That zog der jetzige Nien-Tai (Provinzialrichter) von Schantung, welcher damals Yü-ta-dschen (Mandarin) von Tsau-tschau-fu war, an der Spitze von Regierungstruppen persönlich gegen die Großen Messer ins Feld. Die letzteren wurden versprengt, dreißig von ihnen gefangen und in der Stadt Schain-hsien hingerichtet. Unter den Hingerichteten befand sich auch ein Anführer der Großen Messer, Namens Liu-schö-dsau. Aber das eigentliche Haupt, der schon genannte Tschan-tsia-dschi, flüchtete über die Grenze nach Honan und konnte bis heute nicht festgenommen werden. Ich habe selbst die Proklamation angeschlagen gesehen, in welcher die Regierung den Betrag von 1000 Taels auf seinen Kopf setzt.
Dieses strenge Vorgehen für die an den Missionen verübten Unthaten erbitterte die Großen Messer natürlich noch mehr. Bald darauf wurden in Kü-ye die beiden unglücklichen Missionare Nieß und Henle ermordet und so viele andere Schandthaten verübt, daß auch von Peking auf die Beschwerden des Missionsleiters die strengsten Befehle zur Unterdrückung der Großen Messer kamen. Die Provinztruppen schlugen die Horden auch in mehreren blutigen Gefechten, und der Gouverneur berichtete nach Peking, der Geheimbund bestände nicht mehr. Das war in der That der Fall, denn um der Verfolgung durch die Regierung zu entgehen, organisierten sich die Mitglieder wieder zu einem neuen Bunde unter anderem Namen, jenem der Boxer. Aber der Zweck all dieser Gesellschaften ist, wie die Ereignisse gezeigt haben, stets der gleiche: Vertreibung der Fremden, China für die Chinesen.
Wie in so vielen andern Dingen, so zeigt die chinesische Kultur auch in Bezug auf das Zeitungswesen die größten Widersprüche. Während Europa nur noch wenige Kleinstädte besitzt, die nicht ihre eigene Tageszeitung aufzuweisen hätten, wohnen zwischen dem Himalaya und der sibirischen Grenze gegen vierhundert Millionen Menschen, denen der Begriff Zeitung in unserm Sinne noch vollständig unbekannt ist. Und doch wären alle Grundbedingungen dafür in China massenhaft vorhanden. Die Chinesen sind ja die Erfinder des Papiers, der Druckerschwärze, des Buchdrucks, ja der Zeitungen selbst. Schon vor dreizehnhundert Jahren schnitten sie ihre Schriftzeichen in Holzplatten und druckten ganze Werke. Vor achthundert Jahren, im Jahre 1040, erfanden sie die beweglichen Drucktypen, und während wir in Europa die Zeitung als eine Errungenschaft der neuesten Zeit ansehen, besaßen die Chinesen deren eine schon vor elfhundert Jahren, denn chinesische Werke aus der Zeit der Dynastie Tang, zwischen den Jahren 713 und 741, erwähnen bereits die Pekinger Staatszeitung. Sie ist also um viele Jahrhunderte die älteste Zeitung der Welt, mit seltener Pünktlichkeit durch Generationen hindurch Tag für Tag erscheinend.
Zu einer Tageszeitung im Inlande haben es aber die Hunderte von Millionen Zopfträgern bis auf die jüngste Zeit nicht gebracht, obschon es weder an schriftstellerischen Talenten, noch an Lesern, noch an Stoff mangelt. Und an Neugierde fehlt es wahrscheinlich ebensowenig, wenn man den großartigen Stadtklatsch in Betracht zieht, der durch Hausierer, Barbiere, Dienerschaft von Straße zu Straße verbreitet wird und stets willfährige Zuhörer findet. Oder ist vielleicht die Regierung daran schuld, die mit eiserner Faust alle Zeitungsunternehmungen niederhält, Redakteure verfolgt und einsperrt, wie es bei uns, sagen wir vor dem Jahre 1848, der Fall war? Nicht im mindesten. Das mittelalterliche China ist im Gegensatz zu manchem unserer modernen Kulturstaaten das Paradies der Preßfreiheit. Jeder kann drucken und veröffentlichen, was er will. Es giebt kein Preßgesetz, keine Bürgschaft, keinen Zeitungsstempel, keine Zensur, keine Beschlagnahme. Litteratur, besonders die klassische, wird in China hochgeschätzt. Die Litteraten gehören zu den angesehensten Ständen, und von der Bevölkerung ist vielleicht ein gleicher Prozentsatz des Lesens kundig wie unter den Völkern von Südeuropa. Dennoch hat sich China bis auf die jüngste Zeit mit der einzigen Pekinger Zeitung begnügt.
Diese Pekinger Zeitung, im Chinesischen „Tzing pao”, ist in Bezug auf ihre Redaktion, ihr Aussehen und ihre Verbreitung ein Unikum. Der Text beschränkt sich auf Hofnachrichten und die Veröffentlichung von kaiserlichen Erlassen, Ernennungen, Gesetzen und Strafen. Alle Dokumente der ganzen Regierungsmaschine dieses größten Reiches der Welt gelangen in den großen Staatsrat, und dieser verfügt, welche Dokumente veröffentlicht werden sollen. Abschriften derselben werden dann dem Geheimen Rat übergeben, von welchem täglich ein Mandarin den Dienst im kaiserlichen Palast versieht. Dem Geheimen Rat liegt es ob, die Dekrete, Diplome, Urteile und dergleichen an ihre Bestimmung gelangen zu lassen, und dazu werden sie der Generalpostdirektion, einer Abteilung des Kriegsministeriums, übergeben, die sie durch eigene Kuriere nach den verschiedenen Provinzen entsendet, denn ein geregeltes Postwesen nach europäischem Muster ist ja in China unbekannt. Gleichzeitig mit den Beamten der Postdirektion finden sich im Geheimen Rate täglich auch Beamte der Ministerien und die Redakteure der Pekinger Zeitung ein, um von den verschiedenen Dokumenten Abschriften anzufertigen. Die Druckerei der Pekinger Zeitung, ein halbamtliches Unternehmen, untersteht der Oberaufsicht der Postdirektion; sie hat darauf zu achten, daß der Wortlaut der amtlichen Bekanntmachungen nicht geändert oder gekürzt werde; sie erhält auch täglich eine für die verschiedenen Behörden der Hauptstadt wie der Provinzen bestimmte Anzahl Abdrücke, die sie gleichzeitig mit den anderen Dokumenten durch die Kuriere versendet.
Man wird sich möglicherweise über den Ausdruck Zeitungsdruckerei wundern, denn bisher wurde ziemlich allgemein angenommen, daß die Pekinger Zeitung täglich in der erforderlichen Anzahl von Exemplaren geschrieben wird. Dies ist ein Irrtum. Die wirklich offizielle Pekinger Zeitung wird gedruckt, gerade so wie unsere Regierungszeitungen, und es besteht in Peking hierfür eine eigene Druckerei mit Setzern und Pressen, nur erfolgt der Zeitungsdruck dort nicht so einfach und rasch wie bei uns. Es vergehen immer einige Tage, bis eine Ausgabe der Zeitung hergestellt ist. Man muß sich eben vor Augen halten, daß unsere Setzer im ganzen mit ein paar Dutzend Buchstaben zu arbeiten haben, die in Kästen vor ihnen liegen, ja bei den neuen amerikanischen und deutschen Setz- oder Zeilengießmaschinen fallen sogar diese Setzkästen fort, und die Setzer arbeiten wie an einer Schreibmaschine. In der chinesischen Sprache giebt es statt einzelner Buchstaben ebensoviele Tausende verschiedener Zeichen; jedes Wort oder doch jede Silbe hat ihr eigenes Zeichen, und dementsprechend giebt es in chinesischen Druckereien auch ganze Katakomben gefüllt mit Tausenden von Kästchen, jedes mit anderen Typen. Die größte Druckerei, die ich in China zu besuchen Gelegenheit hatte, war jene der katholischen Mission in Zikaway, am Sutschaukanal gelegen. Ich wanderte dort lange Gänge, zu beiden Seiten mit derartigen Kästen besetzt, auf und ab. In jedem lagen verschiedene Typen, nicht etwa die winzigen Metallstäbchen, die so leicht zu handhaben[S. 334] sind, sondern Holzstücke von etwa einem Quadratcentimeter Durchschnitt für die gewöhnlichen Typen. Unsere Buchstaben sind einfach in der Form und leicht zu erkennen. Die chinesischen Zeichen aber bestehen der Mehrzahl nach aus zwanzig bis dreißig verschiedenen Strichlein, kunterbunt durcheinander gezogen, mit Auswüchsen, Quadrätchen, Punkten und Kreislinien, daß einem europäischen Setzer die Haare zu Berge stehen würden, hätte er es auch nur mit sechsundzwanzig derlei Zeichen zu thun. Und die Chinesen haben deren mindestens ebensoviele Tausende. Dabei sind mitunter Dutzende dieser schwer zu unterscheidenden Hieroglyphen nur durch ganz kleine Strichlein oder Punkte voneinander unterschieden. Welche Freude für den Setzer und erst recht für den Korrektor! Ein chinesischer Setzer müßte, wollte er sich aus den langen Galerien die Typen selbst zusammenholen, so viel umherlaufen wie ein Briefträger; er hat deshalb gewöhnlich einige Laufburschen zu seiner Verfügung, welche ihm die verschiedenen Typen, deren er bedarf, aussuchen.
Unter solchen Umständen darf es nicht wundernehmen, daß der Satz chinesischer Handschriften so viele Zeit beansprucht. Aber auch der Druck geht ähnlich langsam vor sich. Die Papierblätter der Pekinger Zeitung, neunzehn Centimeter hoch und zwanzig Centimeter breit, liegen neben dem Drucker, der den Satz in einem Holzrahmen vor sich stehen hat. Zunächst nimmt er mittels einer breiten Bürste, einem umgekehrten Blumenstrauß nicht unähnlich, etwas Druckerschwärze aus einem muldenartigen Gefäß und schwärzt die Typen. Dann legt er sorgfältig ein Blättchen darauf und fährt mit einem kleinen harten Handkissen darüber. Damit ist ein Blatt einer Zeitung fertiggedruckt, denn weder bei chinesischen noch bei japanischen Büchern wird die Rückseite bedruckt. Die Blätter werden mit dem Druck nach außen einmal gefaltet und an den offenen Seiten zusammengeheftet. Würde man ein chinesisches Buch aufschneiden, so ergäben sich nach je zwei bedruckten Seiten immer zwei leere.
Ein solches Buch ist nun auch jedes Exemplar der offiziellen Pekinger Zeitung, denn der Inhalt verteilt sich auf zehn bis zwanzig und noch mehr Blätter, je nach der Menge des Textes. Sind alle Blätter in der geschilderten Weise gedruckt worden, so werden sie gefaltet und zusammengeheftet dadurch, daß man sie etwa einen Centimeter vom Rückenrand durchlocht, Bindfäden aus gedrehtem Papier durchzieht und diese zusammenknüpft. Ueber die Bindfäden aus Papier darf man sich nicht wundern, denn das chinesische Papier ist aus viel zäheren Stoffen angefertigt als das unserige. In Korea fand ich sogar aus Papier gedrehte Seile und Schnüre allgemein im Gebrauch.
Jedes Exemplar der Pekinger Zeitung wird nun mit einem Umschlag von gelbem Papier versehen, denn gelb ist die Farbe des Kaisers; dann wird noch auf der hintersten Seite des Umschlags in roter Farbe der Name Tsing-pao, d. h. Hauptstadtzeitung aufgedruckt, und damit ist die Zeitung zur Ausgabe bereit. Eigene[S. 335] Kuriere der Postbehörde übernehmen die Pakete und laufen damit durch die Straßen Pekings, um sie den einzelnen Mandarinen, Gesandtschaften und sonstigen Abonnenten zu überbringen. Auf die Zeitung kann nämlich auch um den geringen Preis von beiläufig einer deutschen Reichsmark für den Monat abonniert werden.
Davon machen auch eigene halbamtliche Druckereien in jeder Provinzhauptstadt Gebrauch. Kaum ist der Kurier aus Peking mit den Regierungsdepeschen und den Zeitungsnummern im Yamen des Generalgouverneurs oder Vizekönigs eingetroffen, so kommt ein Zeitungsexemplar nach der Druckerei, um dort für die Abonnenten und Behörden der Provinz nochmals vervielfältigt zu werden.
Der ganze geschilderte Vorgang nimmt wie gesagt mehrere Tage in Anspruch. Nun liegt es aber im Interesse der Behörden und Gesandtschaften, so rasch als möglich in den Besitz der einzigen offiziellen Regierungsnachrichten zu kommen, und deshalb werden mit stillschweigendem Einverständnis der Postverwaltung in Peking noch zwei andere Ausgaben der Zeitung veranstaltet. Bei der einen, „T’schang peun”, d. h. lange Zeitung (weil das Format etwas länger ist), wird der Text der Dekrete auf Wachsplatten rasch eingeschnitten und von diesen der Druck veranstaltet; für die zweite „Sie’-peun”, d. h. geschriebene Zeitung, wird der Inhalt der Dokumente von Schreibern rasch in der erforderlichen Anzahl von Exemplaren abgeschrieben. Sie besteht aus einem einfachen Blatt Papier ohne Umschlag. Diese Ausgabe kommt gewöhnlich einige Tage früher als die gedruckte zur Verteilung und kostet, ihrer Herstellungsweise entsprechend, erheblich mehr, d. h. etwa 24 Reichsmark monatlich.
Nehmen wir einmal eines der gelben offiziellen Zeitungshefte zur Hand. Natürlich müssen wir, wie bei arabischen und jüdischen Büchern, von rückwärts beginnen. Jede Seite wird durch violette Linien in sieben vertikale, etwas über einen Centimeter breite Rubriken geteilt, und in jeder Rubrik stehen vierzehn Zeichen, die aber nicht am oberen Rande, sondern etwa fünf Centimeter weiter unten beginnen. Auf jeder Seite bleibt dieser obere Raum als Ausdruck der Achtung für die kaiserlichen Dekrete und Nachrichten frei, gerade so wie wir es in unseren Briefen an Hochgestellte zu thun pflegen.
Die erste Rubrik der ersten Seite, nach unserer Lesart also die letzte, enthält das Datum: Tag, Monat und Regierungsjahr des Kaisers; die zweite die Inhaltsangabe (mu-lu). Dann folgen auf dem Rest der ersten und zuweilen auch der zweiten Seite Hof- und Palastnachrichten. Jeder Ausgang des Kaisers, jedes Gebet, jeder Besuch wird genau mit allen Einzelheiten des Zeremoniells, der Kleidung und des Gefolges verzeichnet. Die dritte Seite enthält den Garnisonsbefehl, d. h. den Stand und die Dienstleistungen der verschiedenen Tatarenbanner von Peking. Auf den folgenden Seiten befinden sich die Edikte des Kaisers, dann die Ernennungen und Verfügungen auf Grund von Meldungen der Zensoren und Provinzgouverneure, schließlich Meldungen aus den verschiedenen Provinzen und Vorkommnisse in Peking,[S. 336] kaiserliche, militärische oder polizeiliche Strafen und dergleichen. Eine eigentümliche Einrichtung der Pekinger Zeitung ist es, daß die Verfügungen des Kaisers gewöhnlich einige Tage früher veröffentlicht werden als die Berichte der Gouverneure, auf welche hin sie getroffen wurden, denn die chinesische Hofetikette schreibt vor, daß die kaiserlichen Worte stets allen andern vorgehen.
Im ganzen und großen ist also die Pekinger Zeitung etwa unseren offiziellen Regierungszeitungen ähnlich, allein man würde sich gewaltig irren, wollte man annehmen, ihr Inhalt wäre auch ähnlich langweilig. Im Gegenteil, die Lektüre derselben oder vielmehr die Uebersetzung ist für den Europäer, welcher Hof und Regierung, Leben und Sitten in China kennen lernen will, eine unerschöpfliche Quelle des Wissens, und ich gestehe offen, ich verdanke dieser Lektüre mehr Nachrichten, Fingerzeige, Aufschlüsse als allen dickbändigen Reisewerken über China. Ich bin zuerst in Siam auf diese offiziellen Veröffentlichungen aufmerksam gemacht worden, und während meiner folgenden Reisen in China, Korea und Japan war es stets meine erste Sorge, möglichst viele Nummern der Regierungszeitungen durchzustudieren. Sie sind die einzigen Bädeker jener Länder. Das ganze China, von Peking bis in die fernsten Grenzländer, vom kaiserlichen Hofleben bis herab zu dem Treiben der Wegelagerer und Seeräuber entrollte sich in diesen kleinen, mit Hieroglyphen gefüllten Blättchen vor meinen Augen: Militär und Marine, Gerichtspflege, Tempelopfer und Ahnenverehrung, Beamtenwesen, Agrikultur, Industrie, Aberglauben und Volksgebräuche, und fürwahr, es könnte kein besseres Buch über China geschrieben werden, als wenn man einen Jahrgang der Pekinger Zeitung übersetzen und durch Erklärungen ergänzen würde.
Das, was man in anderen Ländern gewöhnlich als offizielles Vertuschungssystem bezeichnet, kennen die Chinesen nicht. Ich war auf das höchste erstaunt, als ich in der Pekinger Zeitung alle Missethaten der höchsten Mandarine, Ministerialbeamten, Tatarengenerale ganz offen geschildert fand. Ja sogar Anklagen gegen die Kaiserin-Exregentin, gegen die Kaiserinnen und Prinzen von seiten der Zensoren finden in der Tsing-pao Aufnahme, dazu die Strafen, welche der Kaiser auf Grundlage von Berichten zu erteilen für gut fand. Wo wäre ein ähnliches Vorgehen in europäischen Staaten denkbar?
Die Erklärung dieses merkwürdigen sozialen Phänomens liegt darin, daß es in China keine innere Politik, keine politischen Parteien, keinen Sozialismus und Anarchismus giebt; daß man in China keine absolute, keine despotische Regierung, sondern im wahren Sinne des Wortes nur ein Patriarchat kennt. Die Chinesen werden wie eine Familie betrachtet, deren Patriarch der Kaiser ist, und vor diesem giebt es kein hoch und niedrig, alle werden nach demselben Recht und Gesetz behandelt.
In den dem europäischen Handel geöffneten Vertragshäfen entstanden in den letzten Jahren auch einige chinesische Tageszeitungen, aber sie wurden ursprünglich[S. 337] nicht durch Chinesen, sondern durch Engländer gegründet. In diesen Vertragshäfen spielt das Zeitungswesen eine bedeutende Rolle. Obschon beispielsweise Shanghai nur etwa 6000 europäische Einwohner zählt, hat es fünf Tageszeitungen, davon vier in englischer und eine in französischer Sprache erscheinend, ferner mehrere Wochenblätter, darunter ein deutsches: Der ostasiatische Lloyd, das einzige deutsche Blatt in ganz Asien. Hongkong mit seinen 10000 Europäern besitzt drei englische Tages- und zwei Wochenblätter, Tientsin, Amoy und Futschau je eine Tageszeitung, obschon die europäischen Kolonien dieser Städte kaum einige hundert Einwohner zählen. In der portugiesischen Kolonie Macao giebt es noch einige portugiesische Blätter. Als nun die Herausgeber einiger dieser europäischer Zeitungen das rege Interesse sahen, welches ihre Veröffentlichungen auch unter den englisch sprechenden Chinesen fanden, versuchten sie die Herausgabe chinesischer Tagesblätter, welche gleichzeitig mit den englischen erschienen, und der Erfolg war derartig, daß in den letzten Jahren eine ganze Reihe chinesischer Blätter entstanden. So erscheint in der Redaktion der China Mail in Hongkong die chinesische Wa T’ziat Pao, in jener der Daily Preß die chinesische Tschung Ngoi San Pao. Die größte chinesische Tageszeitung aber wird von der Redaktion der North China Daily News in Shanghai hergestellt und heißt Tschen-Pao (Shanghai-Neuigkeiten); ja die unternehmenden Herausgeber dieser Blätter veröffentlichen seit einiger Zeit sogar ein illustriertes Wochenblatt in chinesischer Sprache, Hu-Pao (litterarische Neuigkeiten), und machen damit vortreffliche Geschäfte. In Tientsin kommt gleichzeitig mit der dortigen Times der Tsche-Pao (etwa die chinesischen Worte für Times) heraus, und in der größten Stadt Chinas, in Canton, gab vor zwölf Jahren der damalige Vizekönig Tschang-Tschi-Tong selbst die Veranlassung zur Gründung einer chinesischen Tageszeitung, zu deren Redakteur er einen seiner Sekretäre ernannte. Diese Zeitung, Kwang-Pao (Neuigkeiten der Provinz Kwangtung), wurde von dem Nachfolger des Vizekönigs eine Zeitlang unterdrückt, erscheint aber jetzt wieder unter dem Namen Tschung si dsche Pao (Tagesneuigkeiten aus China und dem Westen). Ist es nicht bezeichnend für die Zustände in dem Jahrtausende alten Reiche der Mitte, daß der Vizekönig einer der größten Provinzen desselben zum Zeitungsgründer wird? Friedlich und freundschaftlich verträgt sich dieses vizekönigliche Blatt mit seinem einzigen Cantoner Rivalen, dem Ling nam dsche Pao, zu deutsch Tägliche Nachrichten von Ling nam. Canton hieß nämlich in früheren Zeiten Ling nam. Auch in dem durch den Frieden von Shimonoseki eröffneten Hafen Sutschau wurde 1897 eine neue, dreimal monatlich erscheinende Zeitung gegründet, welche den Namen Schiwu Pao, d. h. etwa „die Zeiten”, führt. Ihre Druckerei beschäftigt sich auch mit der Uebersetzung und Herausgabe von nützlichen europäischen Büchern.
Damit sind wohl alle Zeitungen des Vierhundertmillionen-Reiches erschöpft, ein halbes Dutzend von je drei- bis sechstausend Auflage, das Shanghaier Tschen-[S. 338]Pao ausgenommen, das täglich in einer Auflage von zwölftausend Exemplaren gedruckt wird. Aber neben diesen Blättern wirkt schon seit Jahren noch ein anderes, halbwöchentliches Blatt, das an Auflage alle zusammen übertreffen dürfte und bis in die entferntesten Provinzen des Reiches, ja nach Tibet und der Mongolei geht, überall gelesen, überall beachtet wird und ganz im stillen den größten Einfluß unter allen periodischen Veröffentlichungen Chinas ausüben dürfte, ein Blatt, besser gedruckt und von vornehmerem Aussehen als alle anderen, die Pekinger Zeitung nicht ausgenommen. Es führt den Titel Y-wen-lu und wird von den Priestern der katholischen Mission in Zikawei bei Shanghai herausgegeben. In meisterhafter Weise verstehen es die chinesischen Redakteure, katholische Priester, das Volk zu belehren, Auszüge aus der Pekinger Zeitung wie aus den europäischen Blättern zu bringen, dazu gediegene Artikel über Europa und seine Errungenschaften, aber gleichzeitig wird auch für die katholische Religion Propaganda gemacht, und es ist nicht zum geringsten diesem Blatte zuzuschreiben, wenn die katholische Kirche heute in China weit über eine Million Anhänger besitzt.
Die chinesischen Tagesblätter sind in Aussehen und Einteilung nicht etwa das, was wir in Europa als chinesisch zu bezeichnen pflegen, exotisch, eigentümlich, verzwickt, verschnörkelt, denn sie sind ja nicht der chinesischen Kultur entsprungen, sondern der europäischen und wurden nur der chinesischen angepaßt. Der Mehrzahl nach besitzen sie etwa das Format der deutschen Gartenlaube und haben vier Blätter, bei denen auch die Innenseiten bedruckt sind, gerade so wie bei unseren Zeitungen. Auch die Einteilung ist ganz dieselbe, nur umgedreht; dort, wo bei uns die Anzeigen stehen, also auf der letzten Seite, befinden sich Titel und Leitartikel, und das was bei uns die erste Seite ist, ist bei den chinesischen Blättern die letzte, ganz gefüllt mit Reklamen. Da sage man noch, die chinesische Kultur sei seit Jahrtausenden stehengeblieben! Reklamen von Geheimmittelchen, Pillen und Pülverchen, von Schneidern und Schustern, von Theatern und Vergnügungen, Verlustanzeigen, Land-, Häuserverkäufe und dergleichen. Manche dieser Anzeigen sind sogar schon mit kleinen Bilderchen illustriert, um die Aufmerksamkeit besser anzuziehen. Und all diese Dinge findet man nicht nur auf einer Seite. Nein, bei den meisten Blättern sind vier ganze Seiten, also die Hälfte der Ausgabe, mit Anzeigen gefüllt, deren Lektüre einen tiefen Einblick in das wirkliche Volksleben und den Volkscharakter der Chinesen gewährt. Zeigt die Pekinger Zeitung den Hof, das offizielle China und jene Ereignisse, welche zur Kenntnis und Behandlung von seiten der Regierung kommen, so führen die Reklameseiten der lokalen Blätter den Fremden in den chinesischen Kleinverkehr, in die Details des städtischen Lebens ein und zeigen, daß dieses Volk in den Fremdenstädten im großen und ganzen gerade so lebt wie wir Europäer, nur ins Chinesische übertragen.
Besehen wir uns die letzten, d. h. also die ersten Seiten der chinesischen Zeitungen. Der Kopf ist ganz wie bei unseren Blättern; der Titel recht groß, daneben in kleineren Zeichen die Stellen, wo man in der Hauptstadt wie in den Provinzen abonnieren kann, darunter das chinesische Datum. Der Preis einer Nummer ist durchschnittlich etwa fünf bis sechs Sapeken, beiläufig anderthalb Pfennig. Dann folgen vortrefflich geschriebene Leitartikel über in- und ausländische Dinge, und die chinesischen Redakteure nehmen gar keinen Anstand, der Regierung allerhand gutgemeinte Ratschläge zu geben. Die zweite Seite enthält Auszüge aus der Pekinger Zeitung, Ernennungen, kaiserliche Edikte, welche sich die Zeitungen von ihren hauptstädtischen Korrespondenten, die es auch in China schon giebt, telegraphieren lassen. Daran schließen sich Uebersetzungen der Reuterschen Depeschen über die wichtigsten Ereignisse der westlichen Welt, denn Reuter hat auch in Ostasien seine Abonnenten. Den interessantesten Teil der chinesischen Zeitungen bilden indessen die letzten Textseiten: Lokalnachrichten, Feuilleton, kleine Korrespondenzen aus der Provinz, Personalsachen, Gerichtspflege. Wie man sieht, haben sich die chinesischen Ritter der Feder oder vielmehr des Pinsels, denn man schreibt in China mit einem Pinsel, die europäischen Zeitungsredaktionen ganz zum Vorbilde genommen. Nun kommen in den englischen Blättern, aus welchen sie einen großen Teil ihrer Weisheit schöpfen, eine ganze Menge von Begriffen und Dingen vor, für welche es begreiflicherweise keine chinesischen Wörter giebt, wie z. B. Telephon, Telegraph. Statt lange Umschreibungen zu gebrauchen, nehmen sie ähnlich klingende chinesische Wörter zu Hilfe, die an und für sich ganz andere Dinge bedeuten, was anfänglich dem chinesischen Leser recht chinesisch vorkommen mag. In ihrer Art sind sie wie unsere Bilderrätsel. So z. B. wird das Wort Ultimatum von den chinesischen Redakteuren durch die Zeichen U-li-ma-tung gebildet, Telephon aus den drei Zeichen to-li-fung, und status quo aus ße-ta-tu-ko. Ebenso schwierig ist es für sie, in den Anzeigen europäischer Kaufleute deren Namen zu schreiben. Deshalb besitzt jedes europäische Haus einen eigenen chinesischen Namen, so z. B. heißt Ehlers E-li-si, Golding Go-ting, Morrison Ma-li-sun, Wolf Wa-fu, Wilkinson Way-king-sun. Nur Meier oder Mayer giebt es wie allüberall auf unserm Erdball, auch sogar in China, Meyer bleibt Meyer, wohin er kommt, nur wird der Name im Chinesischen Mei-ier geschrieben.
Trotz all dieser Anpassungen der chinesischen Redakteure an ihre englischen Vorbilder in Ostasien zeigt sich in ihren Berichten doch ein naiver Geist, Aberglauben und Leichtgläubigkeit, die dem Leser unwillkürlich ein Lächeln entlocken. Beim Lesen der einfältigen Lokalberichte und Korrespondenzen aus der Provinz fiel mir die merkwürdige Uebereinstimmung mit ähnlichen Berichten auf, wie sie bei uns noch im letzten Jahrhundert häufig zu lesen waren und allgemein Glauben fanden. Die Geschichte wiederholt sich eben, und man kann die einzelnen Phasen unserer eigenen[S. 340] Kulturentwickelung heute noch in fernen Ländern bei anderen Völkern wiederfinden, unser Altertum, unser Mittelalter, unsere neuere Zeit. Das habe ich auf meinen Reisen in allen Weltteilen in tausenderlei Einzelheiten gesehen, das fand ich, wie gesagt, auch in der chinesischen Presse. Ich erwähne hier nur einige den Cantoner Blättern entnommene Nachrichten, z. B. vom 8. Mai 1894:
„Eine Jungfrau hatte in einem Rocke unvorsichtigerweise eine Nadel stecken lassen, die ihr beim Ankleiden in die Haut drang. Ratlos standen die herbeigerufenen chinesischen Aerzte, ohne Mittel, zu helfen und den Schmerz zu lindern. Da rief ihr Bruder einen Freund herbei, der sich auf dergleichen verstand. Er legte dem Mädchen ein mit geheimen Zeichen beschriebenes Papier auf die Brust, und am folgenden Tage kam die Nadel richtig zum Vorschein, so daß sie entfernt werden konnte.”
9. Mai: „In Schuntak kamen bei einem starken Regenguß zwei Fischlein vom Himmel nieder. Sie sahen so lieblich aus, daß die Bevölkerung sie nicht zu speisen wagte. Sie wurden deshalb sorgfältig in den Fluß gesetzt, wo sie lustig davonschwammen.”
10. Mai: „In der Pu-Tschi-Tschiaostraße mietete jemand ein Haus und machte bekannt, daß er von den Heiligen zum Erlöser der leidenden Menschheit bestimmt sei. Er fand starken Zuspruch, besonders von Frauen. Da thaten sich die Nachbarn zusammen und jagten ihn davon.”
11. Mai: „In einem Gebäude des Panyü-Ritters wuchs vor einigen Tagen ein Bambus hervor, der in einem Vormittag die Höhe von sieben Fuß erreichte, das Dach durchbrach und in drei Tagen siebzig Fuß hoch war. Es giebt Leute, die das wunder finden, obschon eigentlich nichts natürlicher ist. Der Boden ist dort schwefelhaltig, und Schwefel ist bekannt wegen seiner Expansivkraft.”
Derartige Mitteilungen fand ich in jeder Zeitungsnummer, zuweilen auf derselben Seite mit Reuterdepeschen. Das alte und das moderne China begegnen sich in diesen Blättern, aber es wird gar nicht mehr so lange dauern, bis die Bewohner der Hauptstädte derlei naive Nachrichten gar nicht mehr lesen werden. Dafür werden sie größere Aufmerksamkeit den Bank- und Verkehrsnachrichten, den Wechsel- und Aktienkursen zuwenden, die von Jahr zu Jahr in den wenigen bestehenden Blättern immer mehr Platz einnehmen. Der Keim für den neuen Kurs ist auch in China gelegt, und in zwei Jahrzehnten dürfte jede größere Stadt des Reiches der Mitte ihre Zeitung besitzen.
So sehr der Außenhandel Chinas in den letzten Jahrzehnten auch gestiegen ist, so bildet er noch heute nur einen kleinen Prozentsatz des Binnenhandels dieses ungeheuren, an Größe den ganzen europäischen Kontinent weit übertreffenden Reiches. China ist so überaus reich an Naturprodukten aller Art, daß es bis auf die jüngste Zeit ausländische Produkte kaum gebraucht hat; die Produkte des Südens gehen nach dem Norden, jene des Nordens nach dem Süden. Im ganzen Reiche findet der regste Austausch der eigenen Erzeugnisse statt. Die Flüsse, Kanäle, Straßen, Pfade sind jahraus jahrein mit Frachtladungen bevölkert, und wohl kein einziges Reich der Erde dürfte einen so großen Binnenhandel besitzen wie China.
Dabei hat China noch immer keine von jenen Erleichterungen des Verkehrs, die wir heute bei uns als unerläßlich für den letzteren ansehen: wenige Eisenbahnen, nur teilweise geregeltes Postwesen und kein Münzwesen. Während in allen zivilisierten Staaten der Erde Banknoten, Gold- oder Silbermünzen den Handel vermitteln, giebt es in dem chinesischen Reiche keine solchen; nicht Gold und Silber, sondern Kupfer ist der Standard, und was die Banknoten betrifft, die von den Chinesen erfunden wurden und deren Einführung in den Handelsverkehr schon der alte Marco Polo auf seinen Reisen in China vor sechshundert Jahren gepriesen hat, so sind sogar diese in dem Reiche der Mitte außer Kurs gekommen und nur noch in größeren Städten in lokalem Gebrauch. Statt Pfund Sterling, Dollars, Napoleons, Mark und Gulden giebt es in China nur kleine durchlochte Kupferscheiben als gesetzliche Münze; sie sind es, die dem Tausende von Millionen Mark erreichenden Geschäftsverkehr als Grundlage dienen.
Auf welche Weise geschieht dies nun? Wie können die Kaufleute in Canton und Formosa mit jenen in der Mandschurei oder in Tibet auf Tausende von Kilometern Entfernung den Geschäftsverkehr unterhalten? Wie können sie selbst in[S. 342] den einzelnen Provinzen oder Städten ihre Waren bezahlen, wollen sie es nicht mit ganzen Maultierladungen von Kupfer thun?
Und doch sind diese Kupfermünzen, wie gesagt, die einzigen Münzen des Reiches und waren es schon vor Jahrtausenden. In Mittel-Schantung fand ich Münzen, die zweitausend Jahre alt waren, und im chinesischen Museum zu Hongkong habe ich Kupfermünzen gesehen, die viereinhalb Jahrtausende alt waren. Münzen, nicht von runder Form, sondern viereckige Scheiben mit einem Loch am obern und zwei fingerartigen Ansätzen am untern Rande; die aufgeprägten Schriftzeichen besagten, daß sie im Jahre 2800 vor Christi Geburt unter der Dynastie Wuti zirkulierten; andere Münzen von ähnlicher Form stammen aus der Zeit der Hia-Dynastie, also zweitausend Jahre vor Christi Geburt. Ich selbst besitze chinesische Münzen in der Form und Größe unserer Rasiermesserklingen, die über zweitausend Jahre alt sind, andere runde von etwa sechs Centimeter Durchmesser stammen aus den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung und besitzen schon die viereckige Durchlochung in der Mitte, welche alle chinesischen Kupfermünzen ohne Ausnahme noch heute zeigen. Ohne Loch keine Münze. Wie ist es nun möglich, daß diese Münzen bei so ungeheuren Summen, um die es sich zuweilen handelt, als Zahlungsmittel dienen?
Nun war freilich in der letzten Zeit in europäischen Blättern viel von den chinesischen Taels zu lesen, in denen Zahlungen geleistet werden und welche nach ihrem Kurse beiläufig drei Reichsmark entsprechen; auch der Briefmarkensammler findet auf den von der chinesischen Zollbehörde herausgegebenen Briefmarken als Wertangabe einen, zwei oder drei Candarins, und fragt er, was der Candarin für einen Wert besitzt, so wird ihm zur Antwort, daß zehn Sapeken oder, wie sie im Chinesischen heißen, Li, einen Candarin ausmachen; allein Taels, Candarins und Li sind nur fiktive Werte, als Münzen bestehen sie nicht, ebensowenig wie heute die englischen Guineen. Der Tael ist einfach eine chinesische Unze reines Silber, und soll eine bestimmte Summe in Silber bezahlt werden, so wird die beiläufige Menge von einem Silberbarren abgeschlagen, das Zuviel abgeschnitten oder das Fehlende durch kleine Stückchen ergänzt. Auch wird das Silber in sogenannte Shoes von der Form einer Badewanne im Gewichte von 5, 10, 20 oder mehr Taels gegossen. Die wirkliche Münze des Kleinverkehrs in ganz China ist der Cash, und etwa 1350 bis 1450 dieser Cash bilden einen Tael. Es befinden sich nämlich unter den Cash so viele falsche oder schlecht geprägte, abgegriffene Münzen, daß nicht einmal die gesetzliche Zahl von 1350 eingehalten wird, sondern je nach der Güte der Münzen 1350 bis 1450 Cash dazu gehören, um einen Tael zu machen. Wie die Kupfermünzen, so haben auch die Taels selbst nicht im ganzen Lande den gleichen Wert. Am wertvollsten ist wohl der Haikwan-Tael, in welchem die Zollabgaben geleistet werden. Daneben hat jede Provinz ihren eigenen Tael, und will ein Kaufmann in Shanghai etwa 100 Taels nach Hankau oder Tientsin[S. 344] oder Nütschwang remittieren, so gelten diese 100 Taels in Hankau vielleicht 101, in Tientsin 98, in Nütschwang 103 Taels, bei beständig wechselndem Kurs.
In Canton sind die Taels überhaupt abgeschafft, und die gesetzliche Münzeinheit ist seit einigen Jahren der Canton-Silberdollar. Der Vizekönig der Provinz Kwantung hat nämlich vor mehreren Jahren in Canton eine Münze mit europäischen Prägemaschinen und unter europäischer Leitung errichten lassen, eine der großartigsten Münzstätten der Erde, deren Graveure, Arbeiter aber durchaus Chinesen sind. Dort kommen nun seit 1890 gut geprägte ganze, halbe und fünftel Dollars zur Ausgabe, welche trotzdem, daß sie keine Durchlochungen in der Mitte zeigen, von der dortigen Bevölkerung allgemein angenommen werden. Auf der Rückseite dieser Canton-Dollars, welche im Wert dem japanischen Yen und dem mexikanischen Dollar ziemlich gleich sind, befindet sich das chinesische Wappentier, der mehrfach gewundene Drache, und die Umschrift in englischer Sprache: Kwantung Province nebst der Wertangabe, die aber nicht auf den Dollar, sondern auf den Tael Bezug hat. So zum Beispiel heißt es auf dem Dollarstück nicht etwa Ein Dollar, sondern 7 mace und 2 Candarins. Auf den silbernen Zehn- und Fünf-Centstücken, die ebenfalls zur Ausgabe gelangten, heißt es 72 resp. 36 Candarins. Wohl hat der Canton-Dollar 100 Cents gerade wie der mexikanische, aber es wird nicht nach Cents, sondern nach Cash gerechnet, von denen 972 auf den Dollar gehen. Diese Cash der Cantoner Münze, heute in China die beliebtesten, zeigen auf ihrer runden Scheibe von 2½ Centimeter Durchmesser chinesische Bezeichnungen, die soviel als „Gangbare Münze” bedeuten. In der Mitte sind sie gerade so durchlocht wie die Cash in anderen Provinzen.
Dieser Wirrwarr von Münzen wird in den offenen Häfen, hauptsächlich in Canton, Shanghai, Tientsin und Futschau, noch durch die vielen ausländischen Münzen erhöht, Singapore-, Hongkong- und mexikanische Dollars, dann japanische Yen, spanische und portugiesische Münzen, alle von verschiedener Silbergüte und demzufolge von verschiedenem Wert. Wenn sie nur alle echt wären! Aber in wenigen Ländern habe ich eine so große Zahl schlechter oder falscher Münzen angetroffen wie in den chinesischen Hafenstädten. Im Inlande oder in den nicht geöffneten Häfen kommen Silbermünzen überhaupt nicht vor. In Shanghai und Hongkong nehmen die chinesischen Großkaufleute oder jene, die mit Europäern in[S. 345] regem Verkehr stehen, die Banknoten der Hongkong and Shanghai Banking Corporation ohne weiteres an. Diese große Bank, unter deren Direktoren sich mehrere Deutsche befinden, besitzt in den größten Städten Ostasiens, von Singapore bis Yokohama, Filialen, und ihre Banknoten sind bei den Europäern Ostasiens überall im Verkehr. Aber obschon sie auf fünf, zehn und mehr Silberdollar lauten, ist ihr Wert in den verschiedenen Städten doch verschieden. So wechselte ich beispielsweise in Singapore englisches Geld in ostasiatische Dollarbanknoten ein und erhielt dank der großen Silberentwertung für jeden Goldsovereign statt 5 Dollar 9½ bis 9¾ Dollar. Man bedeutete mir, daß die Singapore-Banknoten der Hongkong- und Shanghai-Bank in Shanghai ebenfalls kursierten. In Shanghai mußte ich jedoch, als ich die Singapore-Banknoten bei dieser gleichen Bank in Shanghai-Banknoten einwechselte, fünf Prozent des Wertes bezahlen.
Meine erste Erfahrung mit chinesischem Geld in China selbst machte ich in Canton. Ich hatte mir von Hongkong einige hundert Silberdollars mitgenommen, da man mir sagte, Banknoten würden in Canton von den Chinesen nicht angenommen. Bei meinen ersten Einkäufen in Cantoner Juwelierläden bemerkte ich auf jedem Tische eine kleine Wage. Sobald ich meine Silberdollars auf den Tisch gelegt hatte, nahm der Händler die Münzen in eine Hand und legte der Reihe nach jede einzelne auf den aufrecht gehaltenen Zeigefinger der anderen Hand; dann schlug er mit einer zweiten Münze leicht an die erste an, und befriedigte ihn der Silberklang, so ließ er die erste Münze in den Schoß gleiten, legte die zweite auf den Finger und schlug mit der dritten auf die zweite. So ging dies fort, bis alle Münzen geprüft waren. Zwei hatte er ausgeschieden, für die ich ihm andere geben mußte. Damit war aber die Prüfung noch nicht beendigt. Die ganze Menge wurde auf die Wage gelegt, gewogen, und da sich eine Differenz von etwa einem halben Dollar herausstellte, mußte ich ihm auch noch diesen bezahlen. In den anderen Kaufläden ging es mir ebenso, und bei meiner Abfahrt von Canton hatte ich eine ganze Menge zurückgewiesener, schlechter Dollars in der Tasche.
In den großen Bankhäusern von Hongkong und Shanghai bewunderte ich die unglaubliche Fertigkeit, mit welcher die Schroffs (chinesische Unterbeamten) die einzelnen Dollars nach ihrer Güte prüfen. Die Banken Ostasiens, darunter mehrere deutsche, haben nämlich wohl Europäer als Leiter, Kassierer, Korrespondenten und Buchführer, welche die eigentlichen Bankgeschäfte führen, allein Banknoten und klingende Münze sind ausschließlich unter der Obhut der Chinesen. Die langbezopften, bartlosen, mitunter recht ausgemästeten Gestalten, mit ungeheuren kreisrunden Brillen auf der Nase, haben in den Bankhäusern eigene Lokale, wo auf Zähltischen Massen von Banknoten und Geldrollen liegen, wo schwere Kisten, mit Silberdollars gefüllt, bis zu Manneshöhe aufgetürmt stehen und Haufen von Silberbarren auf den Fußböden liegen, oft Hunderttausende von Dollars im Wert. Wird Silbergeld[S. 346] eingezahlt, so übernehmen die Schroffs die Rollen und prüfen jeden einzelnen Dollar, indem sie ihn äußerst geschickt mit den Fingern der einen Hand emporschnellen und mit der anderen auffangen, und jede, deren Klang den Schroff nicht befriedigt, wird zurückgewiesen. Dann werden diese minderwertigen Dollars eigens berechnet, die anderen, um ihr Gewicht zu prüfen, gewogen, und der Eigentümer erhält eine Anweisung an die europäischen Bankbeamten für die entsprechende Summe, die ihm von diesen in einem Check oder, wenn er Banknoten will, von Chinesen in solchen ausbezahlt wird.
Der oberste Beamte der chinesischen Angestellten, selbst ein Chinese, heißt Komprador. Derartige Kompradores besitzt gewiß jede europäische Firma in China, von Hongkong hinauf bis nach Nintschuang, Hankau oder Tschunking, im Innern des Landes, nahe der tibetanischen Grenze. Ohne Komprador wäre der Verkehr mit den Chinesen überhaupt nicht möglich. Alle Kompradores sprechen das eigentümliche, in ganz Ostasien gebräuchliche Pidschen-Englisch, und in dieser, selbst dem englisch sprechenden Fremden ziemlich unverständlichen Sprache verkehrt der ostasiatische Kaufmann mit dem Komprador, der seinerseits den ganzen Bargeldverkehr seines Kaufmanns leitet, das Bargeld in seinen Händen hat und seine Bücher in chinesischer Sprache führt. Die Kompradores erlegen bei ihrem Eintritt in das Geschäft eine Bürgschaft, aber auch ohne diese würden sie das Vertrauen ihrer Firma selten mißbrauchen, ja ihre Ehrlichkeit ist im gewissen Sinne sprichwörtlich. Nicht nur der europäische Kaufmann in China, auch der Privatmann hält sich einen Komprador, der alle Geldgeschäfte seines Herrn unter sich hat. Der Europäer führt gewöhnlich überhaupt kein Geld bei sich, höchstens einige kupferne Cash, um sie gelegentlich einem Bettler zu geben. Bei Einkäufen irgendwelcher Art, auf den Märkten, in Kaufläden, Gasthöfen und Klubs werden alle Rechnungen mit „Chits” bezahlt.
Der Chit (sprich Tschitt) ist ein leeres Blatt Papier von etwa zehn Centimeter ins Geviert, mit der Firma des Eigentümers als Kopf. Gewöhnlich sind deren fünfzig oder hundert zu einem Block zusammengeklebt. Kauft der europäische Kaufmann einen Anzug oder ein Buch oder irgend einen Gegenstand, so wird der Verkäufer den Betrag auf ein Blatt des „Chitbook” schreiben, und der Käufer unterzeichnet es. Will der Europäer in irgend einem Gasthofe oder Klub ein Glas Wein oder eine Flasche Sekt trinken, so wird ihm der Kellner (stets ein Chinese) das Chitbook vorlegen. Der Konsument schreibt den Betrag mit Bleistift darauf, setzt seinen Namen darunter und entfernt sich. Selbst mir, dem Fremden, der in jeder Stadt höchstens ein paar Wochen weilte, wurde nicht Barzahlung abgefordert, sondern einfach das Chitbook vorgelegt. Diese Papierblättchen werden von den Handelsleuten in bestimmten Zeiträumen den Firmen nach gesondert und dann von dem eigenen Komprador den Kompradores der betreffenden Firmen zur Zahlung[S. 347] unterbreitet. Meine eigenen Chits wurden den Kompradores des Hotels, wo ich eben wohnte, gesandt, und diese bezahlten die Beträge ohne weitere Frage. Zahlte ich in größeren Kaufläden mit einer Banknote, auf die ich einen Betrag herauszubekommen hatte, so erhielt ich von dem Verkäufer einen Chit für den Komprador des Geschäftes, der irgendwo in der Ecke hinter seinem Zahltische saß, und dieser zahlte mir den Betrag gegen Abgabe des Chits. Will eine Hausfrau bare Münze haben, so wendet sie sich nicht an ihren Gatten, sondern giebt ihrem Komprador einen Chit, und dieser zahlt ihr den darauf verzeichneten Betrag in bar. Niemand in diesen Großstädten Chinas hat Bargeld in der Tasche, nur der Komprador hat es stets. Er ist die lebendige Geldlade. Er kassiert Beiträge ein, zahlt sie aus, führt Ueberschüsse an die Bank ab und legt zeitweise die Bücher seinem Brotherrn zur Prüfung vor. Das ist alles, was dieser mit Geld überhaupt zu thun hat.
Unter den Chinesen dagegen ist im Lokalverkehr, ausgenommen bei größeren Beträgen, nur Barzahlung gebräuchlich, und deshalb hat auch jeder Kaufmann seine Goldwage und seinen Probierstein für Silber neben sich auf dem Kauftisch stehen, um die Münzen nach ihrer Güte zu prüfen. Goldmünzen hat es in China niemals gegeben und giebt es auch heute nicht. Gold ist in China überhaupt selten zu sehen. Empfängt der chinesische Kaufmann einen Silberdollar in Zahlung, und findet er ihn gut, so prägt er sofort seinen Stempel darauf, den sogenannten „Chop”, und hat er keinen, so drückt er den Farbenstempel auf oder malt seine Unterschrift in roter Farbe auf den Dollar. Als ich das erste Mal in Hongkong Banknoten in Silberdollars umwechselte, erhielt ich in Papier gewickelte Münzenrollen, die ihrer Länge nach zu schließen, den doppelten Betrag enthalten mußten. Ich fürchtete, der betreffende Schroff hätte sich zu seinem Nachteil geirrt, und öffnete die Rolle, um nachzuzählen. Als ich die Dollarmünzen vor mir sah, war auch die verdächtige Länge der Rollen erklärt. Von den hundert Dollars, welche sich in jeder Rolle befanden, waren nicht zehn unversehrt. Alle anderen zeigten mehrere tiefe Eindrücke von chinesischen Firmennamen, jeder etwa zweimal so groß als die Stempelzeichen auf unseren Silber- oder Goldwaren. Bei einzelnen war von der Prägung gar nichts mehr zu sehen, und durch diese Dutzende, ja vielleicht Hunderte von Stempeln waren aus den flachen Münzen silberne Hohlgefäße geworden im Verhältnis so tief wie unsere flachen Theeschalen. Nur die Randprägung war noch erkenntlich und besagte, daß diese Silberschalen einst Münzen waren. Diese Hohlprägungen also waren die Ursache, daß die Geldrollen eine so ungewöhnliche Länge zeigten.
Aber nicht genug damit. In manchen Kaufläden und Wechselstuben Cantons fand ich auf den Tischen kleine Körbe, gefüllt mit kleinen Silberstückchen und Silberringen, und als ich sie näher besah, entpuppten sich die Ringe als die Ränder von Silberdollars, welche so viele Stempel empfangen hatten, daß endlich Stück für Stück aus der Mitte herausgefallen und nur der äußere Rand der Münze übrig[S. 348] geblieben war. Die einzelnen Silberstückchen im Korbe aber waren derartige Teile der Dollars. Auch sie sind noch gangbare Münzen. Sie werden einfach abgewogen, und ihr Wert wird nach dem Gewicht berechnet.
Wie die Wage und der Probierstein, so ist dem chinesischen Kaufmann noch ein dritter Gegenstand für den geschäftlichen Verkehr absolut unentbehrlich, nämlich das Rechenbrett. Ohne Rechenbrett ist der Chinese einfach hilflos und nicht im stande, die kleinsten Rechenexempel auszuführen. Bei jeder gewöhnlichen Addierung, sagen wir, um 5, 7 und 11 zusammenzuzählen, nimmt er das Rechenbrett zu Hilfe und fingert darauf herum, wie auf den Saiten einer Zither. Das Rechenbrett, im Chinesischen Swampan genannt, besteht aus einem Rahmen von der Größe eines Papierbogens, zwischen den eine Anzahl paralleler Stäbchen eingesetzt sind. Diese sind durch ein Querstäbchen in zwei Teile geteilt. Auf der einen Hälfte jedes Stäbchens stecken je fünf kleine Holzkugeln, auf der anderen je zwei. Jede der fünf Kugeln zählt eins, jede der zwei Kugeln fünf. Will der Chinese zählen, so schiebt er zunächst alle Kugeln an die Rahmenwände zurück. Um dann beispielsweise sechs und acht zusammenzuzählen schiebt er eine einzelne der fünf Kugeln und eine der zwei Kugeln desselben Stäbchens gegen den mittleren Teilstab zusammen und hat so sechs; dann schiebt er, um acht dazu zu bekommen, drei weitere Einserkugeln desselben Stäbchens und die zweite Fünferkugel zusammen; zwei Fünfer bilden aber eine Zehn; diese werden durch die auf dem nächsten Stäbchen zur Linken sitzenden Kugeln dargestellt; er schiebt also wieder beide Fünferkugeln an die Wand zurück, dafür eine Zehnerkugel vor und hat so zehn und vier, also vierzehn. Die Kugeln des zweitnächsten Stäbchens stellen die Hunderte, jene des drittnächsten die Tausende dar. Ich habe nicht nur in China und Japan, sondern in allen ausländischen Kolonien der Chinesen, in Siam, Singapore, Japan, Korea, Nord- und Südamerika in jedem einzelnen chinesischen Kaufladen ausnahmslos derlei Rechenbretter gefunden, und die Chinesen hängen mit einem gewissen Aberglauben an ihnen. Werden beispielsweise in Canton morgens die Kaufläden geöffnet, so ist es das erste Werk der Händler, ihren Swampan zur Hand zu nehmen und allmählich immer heftiger zu schütteln, daß die Kugeln lärmend aneinander klappern. Das bringt ihrer Meinung nach gute Geschäfte mit sich.
Im Straßenverkehr der chinesischen Städte spielen die Cashwechsler eine große Rolle. In den Geschäftsstraßen kauern sie zuweilen dutzendweise längs der Häuser, vor sich ein Tischchen mit Haufen von Kupfermünzen, neben sich einen Korb mit einigen zwanzig oder dreißig Strängen von Cash, ihr ganzes Arbeitskapital. Es war mir immer ein Wunder, wie diese langbezopften Leutchen ihr Leben fristen konnten, denn ihr ganzes Barkapital würde einem Europäer mit bescheidenen Bedürfnissen nicht länger als eine Woche genügen. Und diese Wechsler leben damit nicht nur Jahr aus Jahr ein, sie verdienen sich auch noch ganz hübsche[S. 349] Sümmchen. Hat einer der vielen ambulanten Frucht- oder Gemüsehändler, Barbiere, Restaurateure einen Sack voll kupferner Cash verdient, so tauscht er sich diese losen Münzen gegen die entsprechende Anzahl Cashstränge, sogenannte Tiao, ein. Er leert seinen Geldschrank vor dem Wechsler, und dieser untersucht und zählt die Mengen großer und kleiner, alter und neuer, guter und schlechter Kupfermünzen, wie sie eben in dem täglichen Verkehr in ganz China durch so und so viele Hände wandern. Nach längerem Feilschen werden Händler und Wechsler einig, und der letztere giebt dem ersteren für den vollen Münzenhaufen schön zusammengebundene Geldwürste, aus einiger Entfernung betrachtet, einem Pärchen Frankfurter nicht unähnlich.
Jede Wurst, von je 30 Centimeter Länge, enthält etwa 250 durchlochte Bronzemünzen; das Gewicht des Wurstpaares beträgt durchschnittlich 2 Kilo, und der Wert beläuft sich auf etwa 1 Mark 20 Pfennig. Da es im Innern Chinas häufig schwer fällt, Silberbarren gegen derartige Bronzemünzen umzutauschen, so mußte ich auf meinen Reisen, um nicht in Zahlungsverlegenheiten zu kommen, gewöhnlich 30 bis 40 Tiao, also 60 bis 80 Kilo Münzen mit mir führen, und meine Geldbörse war ein zweispänniger Reisekarren.
Während die Zölle und Steuern in Taels bezahlt werden, entsprechen die Cashstränge aber nicht den Taels, sondern t’scha-pu-to (beiläufig) eher dem Dollar. In China ist alles t’scha-pu-to, sogar das Geld. Um einen Strang zu machen, sucht der Wechsler aus seinen Münzhaufen zuerst zehn Säulen von je 100 Cash zusammen, wobei er aber auch eine gewisse Anzahl schlechter, durch Falschmünzer zur Verbreitung gelangter Cash einschmuggelt. In jedem Strange werden sich immerhin 30 bis 50 derartig minderwertige Cash befinden, und darin liegt das Geheimnis des Verdienstes der Wechsler. Dann dreht er ein Hanfseil fest zusammen, macht einen Knoten in der Mitte und fädelt nun 100 Cash auf den Strang; hierauf wird ein kleiner Knoten gemacht, abermals eine Säule von 100 Cash aufgefädelt, bis der Strang zehn derartige Abteilungen von je 100 Cash enthält. Er wird nun fest zu einem Kranz zusammengebunden und repräsentiert t’scha-pu-to einen Dollar spanischer, japanischer, mexikanischer oder Hongkonger Münze. Aber die letzte Abteilung enthält nicht 100, sondern 74 Cash. 20 werden abgezogen, weil es so Sitte ist, und die übrigen 6 Cash sind für den Hanfstrick. Der Wechsler hat also von jedem Dollar 26 Cash offiziell, außerdem etwa 30 bis 50 andere, da er schlechte Cash eingeschmuggelt hat, und überdies läßt er sich für diesen Strang von dem Kunden nicht 1000, sondern vielleicht 1050 bis 1070 Cash zahlen unter dem Vorwande, daß sich unter dessen Münzen eine große Anzahl schlechter Cash befänden. Er mag also bei jedem Strang bis zu 100 Cash verdienen, d. h. bei jedem Dollar ein Zehntel. Verkauft er im Tage 10 bis 20 Dollar, so hat er sich ein für einen Chinesen recht annehmbares Sümmchen verdient. Deshalb also die vielen Wechsler in den Straßen.
Die nächsthöhere Klasse der chinesischen Bankiers sitzt schon in eigenen Läden, die mit dem Gott des Handels, einer abscheulichen bärtigen Puppe, mit phantastischen Gewändern angethan, geschmückt sind. Der Gott des Handels muß ja Glück bringen. In den Geschäften Cantons sind diese Fratzen in Nischen nahe der Decke im Hintergrund des Ladens aufgestellt, und eine brennende Lampe davor soll den bezopften Götzen wach erhalten. Vorn, gegen die Straße zu, befindet sich der Ladentisch mit Silberwage, Rechenbrett und einigen Körben für das Silber, denn diese Klasse von Bankiers hat mit Kupfermünzen wenig mehr zu thun. Sie haben, wie alle anderen Berufszweige, auch ihre eigenen Vereinigungen oder Klubs mit gedruckten Vorschriften, die bei schweren Geldstrafen genau befolgt werden müssen. In ihnen wird z. B. den einzelnen Mitgliedern vorgeschrieben, dieselben Zinsen und Gebühren zu berechnen und einander nicht zu unterbieten.
Die Hauptgeschäfte dieser kleinen Bankiers sind denen ihrer
europäischen Kollegen nicht unähnlich, nur berechnen sie für Darlehen,
Wechsel, Checks und dergleichen erheblich mehr als die letzteren.
Ein fester Zinsfuß besteht selbstverständlich in China nicht, und
die Zinsen richten sich beispielsweise bei Darlehen ausschließlich
nach der Stellung desjenigen, der ein Darlehen aufnimmt. Genießt er
Ansehen und guten Ruf, so braucht er „nur” ½ bis ¾ Prozent im Monat
zu bezahlen, oder 8 bis 10 Prozent im Jahre. Papiere, Schuldscheine
und ähnliches werden nicht verlangt. Das Wort des Betreffenden oder
höchstens noch eines Bürgen genügt. Andere, weniger „gute” Kunden haben
12 bis 14, ja noch mehr Prozente zu bezahlen. Die Bankiers nehmen
auch Depositen an, für welche sie etwa die Hälfte der Darlehnszinsen
bezahlen. Sind die Geschäftsleute vertrauenswürdig, so können sie
auch mehr ziehen, als ihr Guthaben ausmacht, je mehr, desto besser,
weil sie ja hohe Zinsen dafür zu zahlen haben. Vertrauen spielt in
China vielleicht noch eine größere Rolle als bei uns, und entschieden
wird dort viel weniger geschrieben. Geldanweisungen oder Wechsel
werden ziemlich allgemein, wenigstens in den Provinzen, in denen sie
ausgestellt wurden, als Zahlung angenommen und gehen durch verschiedene
Hände. Die Chinesen haben eigentümlicherweise dreierlei Schreibarten
für Ziffern. Wie wir etwa die arabischen und römischen Ziffern haben,
so besitzen sie für den gewöhnlichen Gebrauch recht einfache Ziffern,
z. B. für eins 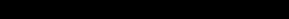 , zwei
, zwei 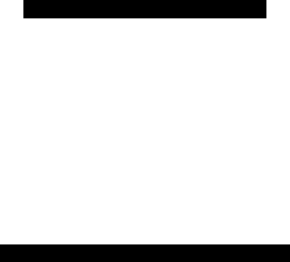 ,
drei
,
drei 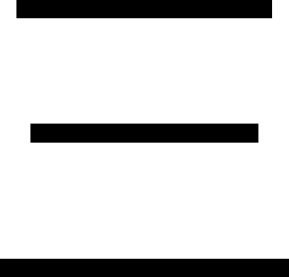 , zehn
, zehn
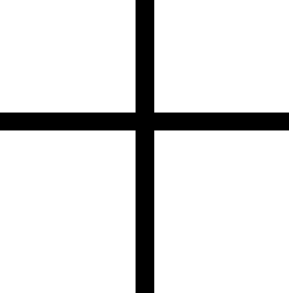 und so fort; hundert, tausend
und zehntausend setzen sie aber nicht wie wir aus den Grundzahlen
zusammen, sondern sie besitzen eigene Zeichen dafür, denn sie haben
keine Null. Für Wechsel und Checks verwenden sie viel kompliziertere
Schriftzeichen, und eine dritte noch schwierigere Art dient für
bedeutende Summen, Urkunden und dergleichen.
und so fort; hundert, tausend
und zehntausend setzen sie aber nicht wie wir aus den Grundzahlen
zusammen, sondern sie besitzen eigene Zeichen dafür, denn sie haben
keine Null. Für Wechsel und Checks verwenden sie viel kompliziertere
Schriftzeichen, und eine dritte noch schwierigere Art dient für
bedeutende Summen, Urkunden und dergleichen.
Ein chinesischer Wechsel besteht aus einem Streifen zähen Papiers, auf welchem allerhand schwarze, rote und blaue Schriftzeichen aufgemalt und aufgestempelt sind. In Blau prangt der Name des Bankiers und das Datum, in Schwarz jener des[S. 351] Ausstellers und der Betrag, in Rot werden die Unterschriften jener gemacht, durch deren Hände der Wechsel geht. Die Bankfirma drückt, bevor sie den Wechsel aus ihrem Buche reißt, ihren Stempel derart auf, daß die eine Hälfte auf den Wechsel, die andere auf den entsprechenden Coupon fällt, und von diesem Stempel und dem Namen oder der Stellung der Firma hängt auch der Wert des Wechsels ab. Die Provision für den Bankier beläuft sich auf 3 bis 4 Prozent.
In verschiedenen Städten haben die kleineren Bankiers das Recht, Banknoten auszugeben, ohne irgendwelche staatliche Kontrolle, aber sie sind doch gehalten, wenigstens die Hälfte des Wertes ihrer im Umlauf befindlichen Banknoten in Bargeld zu besitzen. Die kleinste Banknote lautet auf 400 Cash (nach dem gegenwärtigen Kurse beiläufig eine Mark), die höchste auf 500 Tiao. Für falsche Banknoten sind die Bankhäuser nicht haftbar.
Am wichtigsten sind für den Europäer die großen chinesischen Banken, deren sich in jeder Stadt mehrere befinden, und die auch mit den europäischen Banken der offenen Häfen in regem Geschäftsverkehr stehen. Das Kapital dieser Banken wird entweder von den Firmeninhabern[S. 352] selbst aufgebracht, oder es beteiligen sich große Kaufleute und Aktionäre daran, ganz wie bei uns. In den offiziellen Berichten der Zollbehörden an die Zentralstelle in Peking fand ich das Kapital der Mehrzahl dieser „großen” Banken durchschnittlich mit 20000 bis 150000 Taels angegeben; das größte Kapital besitzen mehrere Canton-Banken mit 500000 Dollars. Leider hat die Zollbehörde in Shanghai in den letzten bis auf 1880 zurückreichenden Berichten unterlassen, von den dortigen Banken zu sprechen, denn Shanghai ist unzweifelhaft der wichtigste Handelsmittelpunkt des chinesischen Reiches, dasselbe, was die Londoner „City” für England und seine Kolonien ist. Es wäre möglich, daß in Shanghai eine oder die andere chinesische Bank ein Kapital besitzt, das eine Million und mehr erreicht.
Von diesen „großen” Banken sind in den verschiedenen Hafenstädten die Haikwanbanken die wichtigsten, denn diese befassen sich mit den Einzahlungen der Zölle an die Zollämter und der Absendung der Zolleinnahmen nach Peking resp. Tientsin. Die Zölle dürfen nicht in gewöhnlichen Provinz-Taels, sondern nur in vollwertigen, gesetzlich bestimmten Taels einbezahlt werden, und daher auch der Name Haikwan tael, der in der letzten Zeit in den europäischen Zeitungen häufig zu lesen war. In den Europäern nicht geöffneten Städten nehmen diejenigen Banken die erste Stelle ein, welche die Steuern, Likin, Abgaben für Opium und Salz einkassieren, die Beamtenbesoldungen ausbezahlen und die Einnahmen der einzelnen Distrikte nach Peking remittieren. Diese Banken sind nicht etwa Staatsbanken. Gewisse, das Vertrauen des Gouverneurs oder Taotais genießende Bankhäuser werden eben mit den Regierungsgeschäften betraut. Möglicherweise haben sie sich diese Stellung durch Bestechung der Beamten erworben, oder die letzteren beteiligen sich an dem Gewinn. Da sie das größte Ansehen genießen, werden ihnen häufig auch die Gelder von kaufmännischen oder Wohlthätigkeitsgesellschaften, Waisenhäusern und Spitälern zur Verwaltung gegeben. Sie zahlen für Depositen weniger Zinsen und sind überhaupt konservativer als die gewöhnlichen Banken. Ihnen zunächst im Ansehen und Vertrauen kommen die sogenannten Schansibanken. Sie führen diesen Namen deshalb, weil ihre Leiter durchwegs aus der Provinz Schansi im Norden Chinas stammen; auch ihre Angestellten sind größtenteils aus der gleichen Provinz, womöglich sogar aus demselben Orte. Die Hauptsitze dieser Schansibanken befinden sich in den größten Städten Chinas, und von dort werden in kleineren Städten und Hafenplätzen Zweigbanken gegründet. Wie groß das Vertrauen ist, das man diesen Schansileuten entgegenbringt, geht aus der Thatsache hervor, daß die Zweighäuser häufig ohne irgend welches Kapital gegründet werden. Kaum hat die Bank ihre Thüren geöffnet, so erhält sie schon Depositen, mit denen sie ihr Geschäft betreibt.
Jede der genannten Banken besitzt einen Beamtenstand von sechs bis zwölf, ja bis zu zwanzig Leuten, welche feste Summen monatlich beziehen und außerdem noch an dem Gewinn der Bank beteiligt sind. Eine Ausnahme machen die Schansi[S. 353]banken. Wird ein Beamter in irgend einem Zweighause im Innern des Landes angestellt, so geschieht dies gewöhnlich auf die Dauer von drei Jahren, während welcher Zeit die Familie des Betreffenden als Pfand unter der Aufsicht des Haupthauses bleibt und von diesem allen Lebensbedarf erhält, der genau verrechnet wird. Auch der Beamte erhält während der drei Jahre keinen Gehalt, er entnimmt den Bankgeldern alles, was er für Nahrung, Wohnung, Kleidung, für Repräsentationskosten, Bankette und dergleichen bedarf, und bucht jeden Betrag unter den Bankausgaben. Unterbeamte erhalten ihren Bedarf an Kleidung, Nahrung und dergleichen von dem Bankchef. Während der ganzen Dienstzeit dürfen sie mit ihren Familien nur durch das Hauptbankhaus verkehren, d. h. ihre Briefe an die Familie werden zuerst von den Chefs gelesen, bevor sie in die Hände der Familie gelangen. Nach Ablauf der drei Jahre werden sie von anderen Beamten abgelöst und kehren mit ihren Büchern nach dem Hauptsitz der Bank zurück. Dort werden die letzteren geprüft, und hat sich neben ehrlicher Verwaltung der Gelder auch noch ein ansehnlicher Gewinn gezeigt, so erhalten die Beamten eine bedeutende Summe als Belohnung und dürfen zu ihren Familien zurückkehren. Werden Unterschleife entdeckt, so müssen sich die Betreffenden vor dem Gericht verantworten und werden gegebenenfalls eingesperrt.
Diese großen Banken haben es hauptsächlich mit der Regierung, mit reichen Kaufleuten, Zöllen, Salz- und Opiumsteuern, Likin (Wegezöllen) und anderem zu thun. In den Hafenstädten sind das Hauptzahlungsmittel mexikanische, japanische, spanische, Hongkong- und Canton-Dollars, selbst den Jangtsekiang aufwärts bis nach Tschunking werden sie überall als Zahlung angenommen. So z. B. ist in Wuhu der Carolus oder spanische Dollar allgemein eingeführt, und es sind davon auch in der ganzen Provinz über eine Million verbreitet. Im Innern des Landes aber sind es nicht Münzen, sondern Silberbarren, mit denen Zahlungen geleistet werden. Ihrer dem chinesischen Schuh nicht unähnlichen Form nach werden diese Barren allgemein mit dem englischen Namen Shoe bezeichnet. Der gewöhnliche Shoe hat einen Wert von 50 Taels, es giebt aber auch solche von 20, 10 und 5 Taels, welche wohl die kleinsten sind. Im Chinesischen heißt dieses ungeprägte Silber Sycee (Seisieh). Um Fälschungen der Barren zu vermeiden, bestehen in den größeren Städten eigene Probierämter oder Kung-ku, die aber keineswegs Staatsämter sind, sondern von den Bankhäusern und großen Geschäftsfirmen unterhalten werden. Für die Prüfung und Bestimmung eines Shoes von 50 Taels wird eine Gebühr von 50 Cash bezahlt. Da sich Silber auf dem Probierstein je nach dem Silbergehalt mehr oder weniger entfärbt, so werden die Shoes nach der Farbe (im Chinesischen Se) geprüft, und man sagt „der Shoe hat 97 oder 98 Farbe”. Sobald der gewöhnlich sehr hohe Silbergehalt bestimmt ist, wird der Shoe gewogen, und das Probieramt schreibt mit roter Farbe den Inhalt und den Wert des Barrens[S. 354] in Taels auf denselben. Diese Bestimmung wird von den Handelsleuten selten in Zweifel gezogen und gewöhnlich in gutem Glauben angenommen.
Die Banken beschäftigen sich nicht nur mit der Verwaltung, Verzinsung und Versendung von Geldern, sie gewähren auch Darlehen, bezahlen für Kaufleute die Steuern und Abgaben, und ein höchst seltsames Geschäft ist das Spekulieren in Beamtenstellen. Hat einer oder der andere gelehrte Chinese seine Prüfungen gut bestanden, so hat er Anwartschaft auf irgend einen Beamtenposten, den er nach Monaten oder nach Jahren in Peking wirklich erhält. Während dieser Wartezeit werden ihm von Banken, selbst von den Schansibanken, Vorschüsse geleistet, ja bei der elenden Mandarinwirtschaft und der Käuflichkeit der Stellen schießen die Banken die Gelder zum Ankauf einer Stellung vor, senden sie nach Peking, und das Diplom, die Amtsinsignien und dergleichen werden auch nicht dem Beamten, sondern der Bank zugesandt, welche sie dem neuen Regierungsangestellten aushändigt. Die Bank zieht dann die Vorschüsse von dem Gehalt der Beamten ratenweise ab. Der Geldverkehr zwischen den einzelnen Städten wird gewöhnlich durch Wechsel besorgt, und die Banken haben eigene, ich möchte sagen lokale Handlungsreisende, die von Zeit zu Zeit oder auch täglich in den großen Geschäftshäusern vorsprechen, um sich auf dem Laufenden zu erhalten. Sind beispielsweise von vier verschiedenen Häusern in Futschau Gelder an ebensoviele Häuser in Ningpo zu senden, so werden die Banken die Gesamtsumme an ein europäisches Bankhaus in Futschau einzahlen, welches dafür einen Wechsel an ein europäisches Haus in Ningpo sendet. Gleichzeitig benachrichtigt die chinesische Bank in Futschau ihren Korrespondenten in Ningpo, daß der an sie gelangende Wechsel in vier einzelnen Beträgen an die vier bestimmten Handelshäuser zu zahlen sei. Kommt es vor, daß Kaufleute in Ningpo bestimmte Summen an chinesische Kaufleute in Futschau zu zahlen haben, so verständigen sich die Banken, und es wird nur die Differenz übermittelt, also etwa das Prinzip unserer „Clearing Houses”, aber par distance.
Der Mittelpunkt dieses clearing für ganz China ist jedoch unzweifelhaft nicht Canton oder Hongkong, sondern Shanghai. Die Bankhäuser in Shanghai haben allerorts ihre Korrespondenten, und der größte Teil des Geld- und Wechselverkehrs spielt sich dort ab. All dies zeigt entschieden ein großes gegenseitiges Vertrauen, eine Ehrlichkeit und Anständigkeit des Geschäftsverkehrs, von welcher man in Europa bisher viel zu wenig Kenntnis hatte, und beweist, daß man die Chinesen in dieser Hinsicht auch viel zu sehr unterschätzt, wie man bisher gewohnt war, die Japaner zu überschätzen. Die geschilderten Verhältnisse zerstören auch gründlich die immer noch in vielen Kreisen bestehende Annahme, China besitze kein Geld, keinen Geschäftsverkehr, das Land wäre seit Jahrtausenden erstarrt und verlottert.
Der Umstand, daß in den Briefmarkenalbums nur chinesische Zollbriefmarken, aber keine eigentlichen Reichspostmarken vorkommen, hat in Europa die Meinung aufkommen lassen, China besitze überhaupt kein Postwesen. Das mag richtig sein, wenn man sich darunter das moderne Postwesen nach Stephanschem Muster vorstellt, mit seinen regelmäßigen Versendungs- und Lieferzeiten, mit Briefmarken, Postkarten und internationalen Einrichtungen. Man würde aber gewaltig fehlgehen, wollte man annehmen, daß es in dem großen Reiche der Mitte überhaupt keine Post gäbe. Im Gegenteil. Briefe, Pakete und Gelder können in China heute von einem Ende des viele Millionen Quadratkilometer großen Landes zum andern befördert werden, und diese Sendungen gelangen mit erstaunlicher Sicherheit in die Hände der Adressaten. Städte und Dörfer aller achtzehn Provinzen sind durch die chinesische Post erreichbar, und unsere europäischen Kaufleute können mit dem Dalai Lama von Tibet oder dem Vizekönig der Mandschurei beinahe ebenso einfach korrespondieren, als wäre China ein Glied des Weltpostvereins.
Dabei sind die postalischen Einrichtungen Chinas nicht etwa Errungenschaften der Neuzeit, den Europäern abgelauscht, wie es beispielsweise in Japan der Fall ist. Das chinesische Postwesen ist das älteste des Erdballs, älter als jenes der Aegypter und Chaldäer, ebenso wie ja auch die chinesische Schriftsprache die älteste ist. Schon vor fünftausend Jahren haben die Chinesen Briefe geschrieben und durch ihre Post befördern lassen. Vor einem Jahrtausend besaßen sie schon ihre Regierungszeitung, die durch Postboten an ihre Abonnenten bestellt wurde, und da sage man, die Chinesen hätten keine Post! Marco Polo hat in seinen Werken die erste Schilderung dieser Post entworfen, und hätten die Europäer damals (etwa im dreizehnten Jahrhundert) mehr Unternehmungsgeist besessen, es wäre, gestützt auf die Ausführungen Marco Polos, vielleicht schon zu jener Zeit unserm Kontinent ein Thurn und Taxis erstanden.
Erst im siebzehnten Jahrhundert gelangte das Postwesen in Europa auf dieselbe Stufe, auf der es in China schon zu Anfang der christlichen Zeitrechnung war. Seither ist es den Chinesen freilich in ungeahnter Weise vorausgeeilt, während es bei den letztern beinahe auf derselben Stufe wie zur Zeit Christi stehen geblieben ist. Bis vor wenigen Jahren verschloß sich ja China sogar dem Telegraphen.
Ohne ein eigenes Postwesen wäre es den Chinesen gar nicht möglich gewesen, ihr ungeheures Reich von einer Hauptstadt aus zu regieren. Deshalb stand schon vor Jahrtausenden und besteht heute noch ein eigener Kurierdienst, der in Peking seinen Mittelpunkt hat und dort dem Kriegsministerium untersteht. In einem der Yamen des letztern stehen beständig Kuriere und Pferde bereit, um die kaiserlichen[S. 356] Dekrete und die Pekinger Zeitung an die Vizekönige der einzelnen Provinzen zu bringen, und es werden davon in jeder Woche eine bestimmte Zahl nach verschiedenen Richtungen versendet. Die Kuriere nach der Mandschurei und nach dem nördlichen Tibet sind gewöhnlich beritten, während jene nach dem Süden die mitunter über zweitausend Kilometer weiten Strecken zu Fuß zurücklegen. Wie rasch diese Kurierpost funktioniert, geht beispielsweise aus der Thatsache hervor, daß den kaiserlichen Beamten für die Reise von Peking nach Canton, eine Strecke von etwa zweitausend Kilometern, drei Monate eingeräumt werden, während die Postläufer gehalten sind, diese Strecke in zwölf Tagen zurückzulegen. Es entfallen also auf jeden Tag gegen hundertsiebzig Kilometer. Gewöhnliche offizielle Dokumente werden mit einer Schnelligkeit von zweihundert Li (etwa hundertzehn Kilometer) pro Tag befördert; Dokumente, welche mit der Bezeichnung „Eilig” versehen sind, müssen mit der Schnelligkeit von zweihundertzwanzig Kilometern, und solche, welche den Vermerk „Sehr Eilig” tragen, mit der Schnelligkeit von vierhundert Kilometern im Tag befördert werden. Während der Taipingrevolution versahen die Reichspostboten zeitweise den Dienst mit einer durchschnittlichen Schnelligkeit von zwanzig Kilometern in der Stunde.
Freilich werden zu kaiserlichen Postläufern nur die größten und stärksten Männer ausgesucht, und sie heißen im Chinesischen auch Tschien-fu, d. h. starke Männer, oder Tsien-li-ma, d. h. Tausendpferd. In ihrer Kleidung unterscheiden sie sich nur wenig von dem chinesischen Landvolk: lose blaue Jacken mit langen, weiten Aermeln, kurze, bis über die Knie reichende Beinkleider und einen schwarzen Hut, der in Form und Größe einer umgestürzten Schüssel ähnelt. Die Waden sind nackt, und die Füße sind mit leichten Strohsandalen bekleidet. In der Rechten halten die Läufer einen papiernen Sonnenschirm, in der Linken eine Papierlaterne, deren Licht nach Eintritt der Dunkelheit angezündet wird. Die Depeschen, Zeitungen und Pakete sind in Oelpapier eingeschlagen und gewöhnlich in einem Rückenkorb aus Bambusgeflecht untergebracht, der durch ein um die Brust geschlungenes Tuch festgehalten wird. An diesem letztern baumelt eine kleine Glocke oder Schelle, das Abzeichen der Postläufer. Obschon die zu tragende Last zuweilen vierzig bis fünfzig Kilogramm beträgt, ist die gewöhnliche Gangart der Postläufer der Laufschritt. Tag und Nacht, bei glühender Hitze oder grimmiger Kälte traben sie auf den elenden Wegen leicht einher, oft mehrere Stunden ohne Unterbrechung. Unterkunft und Nahrung erhalten sie in den einzelnen Ortschaften, die sie berühren, von den Behörden, doch gilt es den Läufern als Regel, sich niemals zu sättigen, sondern lieber öfter, dafür aber nur eine geringe Menge Speisen zu sich zu nehmen. Charakteristisch für die Sicherheitszustände in China ist es, daß die Postläufer keine Waffen tragen. Nur in unruhigen Zeiten werden ihnen ein oder mehrere Geleitsmänner mitgegeben, ebenso kräftig und ausdauernd, wie sie selbst sind. Diese[S. 357] Tschien-fu haben eine eigentümliche Art, sich auf Kämpfe mit etwaigen Straßenräubern einzuüben. In einem hohen Raume werden an langen, von der Decke hängenden Seilen schwere Sandsäcke befestigt. Der Uebende stellt sich in der Mitte zwischen denselben auf und versetzt der Reihe nach jedem Sacke einen kräftigen Stoß, bis sie sich alle in schwingender Bewegung befinden. Die Aufgabe des Uebenden besteht nun darin, die schweren Säcke fortwährend in Schwingung zu erhalten und darauf zu sehen, daß kein Sack ihn von hinten trifft oder gar umwirft. Sollte das geschehen, so wird der Betreffende zum Geleitsdienst nicht mehr zugelassen. Man glaubt gar nicht, welche Behendigkeit und Kraft es von dem Uebenden erfordert, sich diese von allen Seiten auf ihn eindringenden Sandsäcke vom Leibe zu halten, und die chinesischen Straßenräuber haben auch gewöhnlich vor den Geleitsmännern der Post einen heiligen Respekt.
Ein chinesischer Brief (ein Viertel der natürlichen Größe).
Für die reitenden Boten sind auf bestimmte Entfernungen Pferdewechsel vorhanden, und die Beförderung der Postsäcke erfolgt in ähnlicher Weise, wie sie beispielsweise in den Vereinigten Staaten noch in den sechziger Jahren, vor der Eröffnung der Pacific-Eisenbahnen, stattfand. Dort waren es Privatunternehmer, die bekannte, noch heute blühende Firma Wells Fargo Expreß, welche die Briefbeförderung zwischen dem Mississippithal und Kalifornien besorgten, und noch in den siebziger Jahren bin ich in Arizona diesen Postreitern mitunter selbst begegnet.
Obschon die Läufer der chinesischen Regierungspost nur mit offiziellen Depeschen Peking verlassen, werden ihnen auf ihrem Wege nach den entfernten Provinzhauptstädten doch auch viele Privatbriefe zur Besorgung übergeben, ein recht einträglicher Nebenverdienst, wenn man bedenkt, daß die Beförderung eines Briefes, je nach der Strecke, zwei- bis vierhundert oder selbst noch mehr Cash, d. h. vierzig bis achtzig Pfennig kostet.
Aber der eigentliche nichtamtliche Postverkehr Chinas wird durch private Postunternehmungen besorgt, deren es in jeder größeren Stadt eine beträchtliche Anzahl giebt. Es spricht nicht wenig für die Ehrlichkeit und Gewissenhaftigkeit der Geschäftsleute, daß diese privaten Postanstalten unter keinerlei Regierungsaufsicht stehen, keine Bürgschaften zu hinterlegen haben und mitunter nur unbedeutendes Betriebskapital besitzen; dennoch werden ihnen häufig von Kaufleuten beträchtliche Geldwerte zur Beförderung übergeben. Obschon nun diese Beförderung gewöhnlich durch einfache, arme Postläufer erfolgt und die Briefe mitunter mehrmals die Hände wechseln, kommen Verluste doch nur selten vor. Tragen die Angestellten der betreffenden Firmen die Schuld an dem Verlust, so wird derselbe von den Firmen voll ersetzt.
Jede dieser Privatposten besitzt in den verschiedenen Städten eigene Agenten, und wo sich eine Agentur für jeden einzelnen Unternehmer nicht lohnen würde, bestellen mehrere einen gemeinschaftlichen Agenten, welcher dafür an ihre Gesamtheit jährlich eine Art Miete zu entrichten hat. Was er während des Jahres über diese Summe an Beförderungsgebühren einnimmt, ist sein Verdienst. Wird die Summe aber nicht erreicht, so wird ihm der Unterschied von den Postanstalten ersetzt.
Die Chinesen schreiben viel mehr Briefe, als man anzunehmen geneigt wäre, und der ungeheure Geschäftsverkehr im Inland macht die große Zahl von Briefen und dementsprechend auch die große Zahl von privaten Postämtern begreiflich. Dennoch ist der Verdienst der letzteren wegen der Zersplitterung des Postdienstes und der doppelten oder dreifachen Besetzung desselben Postens nur gering. Würde die Regierung das ganze Postwesen in eigene Verwaltung nehmen und in ähnlicher Weise einrichten, wie es heute wohl in allen Staaten des Erdballs geschieht, so könnten sehr beträchtliche Einnahmen erzielt werden.
Die Chinesen schreiben ihre Briefe gewöhnlich auf kleine, weiche, gelbliche Papierbogen, die durch rote Striche in vertikale, fingerbreite Spalten geteilt sind. Jede[S. 359] Spalte enthält eine Zeile der eigentümlichen, von oben nach unten und von rechts nach links geschriebenen Schriftzeichen.
Der Brief wird in einen geklebten Umschlag von länglicher Form gesteckt, der der Länge nach mit einem zweifingerbreiten Streifen von roter Farbe, der Glücksfarbe, bedruckt ist. Auf diesen wird die Adresse geschrieben und der nun fertige Brief auf eines der Postämter getragen. Briefmarken sind in den chinesischen Privatpostämtern unbekannt. Der Beamte erkundigt sich, ob der Briefschreiber die Beförderung ganz oder teilweise bezahlen oder die Bezahlung dem Adressaten überlassen will, und pinselt dementsprechend einen Vermerk auf den Briefumschlag: „Weingeld (d. h. Postgebühr) bezahlt”, oder „Weingeld nach dem Tarif”, oder „so und so viel Cash bezahlt, Rest einzufordern”. Nur wenn der Brief Banknoten, Wechsel und dergleichen enthalten sollte, wird die Beförderungsgebühr von dem Absender bezahlt, und er erhält dafür einen Empfangsschein, auf Grund dessen er im Fall des Briefverlustes die volle Wertsumme vom Postamte einfordern kann. Bei solchen Wertsendungen sind je nach der Entfernung des Bestimmungsortes für je hundert Taels ein halber bis anderthalb Tael Versicherungsgebühr zu bezahlen.
Wohl giebt es bei den meisten Privatpostämtern Chinas, und es sind deren Tausende, feste Tarife; je größer die Entfernung, desto höher die Bestellungsgebühr; das Briefgewicht ist dabei Nebensache. Deshalb kommt es auch in den verschiedenen Großstädten täglich vor, daß eine Anzahl Briefschreiber ihre für dieselbe Stadt bestimmten Briefe in einen einzigen Umschlag zusammenthun, wodurch je nach der Zahl der Briefe ein oder mehrere Taels an Postgebühr erspart werden. Am Bestimmungsorte übernimmt es dann der Adressat, die anderen beigeschlossenen Briefe an ihre Adressen abzuliefern oder nochmals der Post zur Beförderung zu geben. So beträgt beispielsweise die Gebühr für einen Brief von Tschunking am oberen Jangtsekiang nach Hankau, eine Entfernung von 3000 Li, 60 Cash, im Hankauer Lokalverkehr jedoch nur 5 Cash; werden zwanzig Briefe nach Hankau befördert, so würden sie einzeln 60 Cash, zusammen 1200 Cash, d. h. nahezu einen Tael kosten. In einem Umschlag vereinigt, kosten sie nur 60 Cash, und dazu in Hankau selbst je 5 Cash, d. i. 100 Cash Bestellungsgebühr. Statt 1200 Cash haben also die Empfänger zusammen nur 160 Cash zu bezahlen.
Uebrigens gelten die Tarifsätze der Postämter nur für Fremde und Privatleute, die nur selten Briefe absenden. Die Inhaber der Postämter lassen mit sich reden. Je geringer ihr Ansehen und ihre Stellung, desto wohlfeiler ist die Beförderung; haben die Postämter es mit großen Hongs, d. h. Geschäftshäusern zu thun, die viele Briefe absenden, so gehen sie mit ihrem Tarif auf zwei Drittel oder die Hälfte herunter; ja sie befördern die Briefe der Angestellten dieser Häuser ganz frei, d. h. stempeln diese Briefe „Weingeld bezahlt” und lassen an den Abgangstagen ihrer Postläufer die Briefe von den einzelnen Hongs durch ihre Angestellten selbst abholen.
Beim Eintreffen der Kuriere senden die Postanstalten die Briefe den verschiedenen Adressaten ins Haus und ziehen dabei die Gebühren ein. Die großen Geschäftshäuser haben aber gewöhnlich bei ihren Postämtern eine laufende Rechnung und zahlen die Briefgebühren ein- oder zweimal jährlich.
In den Großstädten haben sich die meisten größeren Postunternehmungen untereinander bezüglich der Absendung ihrer Läufer nach anderen wichtigen Städten geeinigt, d. h. einen sogenannten Pool abgeschlossen, demzufolge jeden Tag oder jeden zweiten, dritten, vierten Tag, je nach Erfordernis, der Läufer einer anderen Postanstalt abgeht und die Briefe sämtlicher Postanstalten mitnimmt. Da jeder Brief die zu bezahlende Summe und den Namen der Postanstalt zeigt, so ist die Abrechnung ziemlich leicht. Dank dieser Vereinigung der Postämter lohnt es sich nunmehr auch, zeitweilig Kuriere nach entfernteren, unbedeutenden Städten abzusenden, so daß heute thatsächlich in ganz China von diesen Postanstalten Briefe bestellt werden. Der Kurier erhält von seinem Absender den Auftrag, den betreffenden Brief auf seinem Wege in dem dem Bestimmungsort nächstgelegenen Wirtshause abzugeben. Der Wirt verwahrt den Brief, bis ein nach demselben Dorfe ziehender Maultiertreiber oder Lastträger bei ihm vorkommt, und übergiebt ihn diesem zur Weiterbeförderung. Gewöhnlich sind diese Leute froh, sich durch solche Gelegenheiten ein paar Cash zu verdienen, und geben die Briefe gewissenhaft ab.
Dort, wo zwischen verschiedenen Städten Dampferverkehr herrscht, werden die Briefsäcke den Compradores, d. h. Zahlmeister, der Dampfer zur Beförderung anvertraut, und diese beziehen dafür von den Postämtern gewisse Summen, die entweder für jeden Postsack oder jährlich bezahlt werden. An den verschiedenen Bestimmungsorten der Postsäcke erwarten die Agenten der Postämter die Ankunft des Dampfers und nehmen die Säcke zur Verteilung oder Weitersendung der Briefe in Empfang. In ähnlicher Weise wird sogar auch der Briefverkehr zwischen China und den zahlreichen chinesischen Kolonien in Ostasien, in Singapore, Siam, Tonking, Saigon, den Philippinen besorgt. Die Chinesen gehen so viel wie möglich den europäischen Postämtern aus dem Wege, besonders wenn es sich um Beförderung von Geldsummen handelt. Gerade die Chinesen in den Kolonien senden sehr viel Geld nach ihrem Heimatsland, wohin sie ja gewöhnlich bei zunehmendem Alter selbst zurückkehren.
Auf Flüssen, die einen Dampferverkehr besitzen, werden die Postboten gewöhnlich nur stromabwärts in eigenen Segel- und Ruderbooten nach ihrem Bestimmungsort gesandt; der Verkehr stromaufwärts erfolgt zu Land mittels Läufern. Am besten wird der ganze Postdienst dieser Art aus der Schilderung des Verkehrs auf der wichtigsten Verkehrslinie Chinas, dem Jangtsekiang, erhellen. Der entfernteste dieser Flußhäfen ist Tschungking am oberen Jangtsekiang, in der Luftlinie nur vierhundertdreißig Kilometer von der tibetanischen Grenze entfernt, ein[S. 361]tausendfünfhundert Kilometer von Peking und etwa ebensoweit von Shanghai. Die wirkliche Entfernung dürfte zweitausend Kilometer übersteigen.
Tschungking besitzt sechzehn Postämter, von welchen sich drei mit dem Brief-, Geld- und Paketverkehr mit den stromabwärts gelegenen Städten bis Shanghai befassen, während dreizehn den Postverkehr im ganzen westlichen und südwestlichen China besorgen. Neun von ihnen besorgen auch die Beförderung von Waren, Gepäck und Reisenden (mittels Sänften und Tragstühlen) nach der Mehrzahl der dortigen Städte. Alle dreizehn Postämter bilden eine Art Postverein, denn sie berechnen die gleichen Gebühren und senden ihre Läufer, gewöhnlich drei- bis neunmal im Monat, gemeinschaftlich aus. Von diesen Läufern werden nicht weniger als 48 der wichtigsten Städte und Märkte der Provinz Szetschuan regelmäßig bedient, ferner fünf Städte in der 1000 Kilometer entfernten Provinz Schensi, zwei Städte in Kansu, zwei in Kweitschau und drei in Yünnan, zusammen also 60 Städte, in welchen die Postämter von Tschungking eigene Agenturen unterhalten. Im Bedarfsfalle werden nach den verschiedenen Städten noch Extraposten abgesandt, deren Zahl monatlich im Durchschnitt sechs erreicht.
Die drei mit den Flußhäfen des Jangtsekiang verkehrenden Postämter benutzen zur Beförderung der Briefe und Pakete sogenannte Post-Wasserhände, d. h. kleine, von einem, höchstens zwei Mann gelenkte Segel- und Ruderboote, in welchen die Kuriere und Poststücke untergebracht werden. Die Briefpakete werden in Oelpapier gewickelt, dann in wasserdichte Säcke gepackt und mit Schnüren an die Ruder des Bootes gebunden, damit im Falle eines Schiffbruchs diese Ruder als eine Art Rettungsgürtel dienen und die Briefsäcke nicht verloren gehen. Ein Brief von Tschungking nach Hankau kostet 60 Cash, ein Paket etwa 300 Cash für je 500 Gramm Gewicht, ein Wechsel von 1000 Taels nach Hankau 1000 Cash (also 1⁄10 Prozent), worin die Versicherungsgebühr eingeschlossen ist. Die drei Postämter lassen gemeinschaftlich alle fünf Tage ein Postboot nach Hankau abgehen, und ebenso häufig wird die Post von Hankau nach Tschungking gesandt. Extraposten kommen jetzt, da Tschungking bereits eine Telegraphenverbindung mit dem chinesischen Netz besitzt, auf dieser Linie nur noch selten vor.
Die Postboote sind länger und leichter gebaut als die gewöhnlichen Flußboote; der Bootsmann sitzt am Hinterteile des Schiffes und rudert mit den nackten Füßen, wobei die große Zehe etwa wie der Daumen arbeitet; mit der Rechten handhabt er das Steuerruder. Gleichzeitig wird, wenn irgend möglich, auch das Segel benutzt; dennoch war die kürzeste Zeit, in welcher ein Postboot von Tschungking Hankau erreicht hat, bisher elf Tage, stromaufwärts würde es selbstverständlich noch viel länger dauern; deshalb werden die Postboote, sobald sie Itschang oder Hankau erreicht haben, für 3000 bis 4000 Cash verkauft und Bootsleute, wie Kuriere kehren zu Land nach Tschungking zurück, wobei sie gleichzeitig die Hankauer Post mitnehmen.
Auf der Reise von Tschungking den Jangtsekiang abwärts ist der nächste offene Flußhafen Itschang, gleichzeitig der Endpunkt der Dampferfahrt. Dort befinden sich nur drei Agenturen von Hankauer Postämtern, die aber Briefe und Wertsendungen nach allen größeren Orten Chinas annehmen. Der wichtigste Verkehrsmittelpunkt des Jangtsekiangthales ist die etwa sieben Tagereisen weiter stromabwärts gelegene Stadt Hankau, die Metropole des chinesischen Theehandels, mit etwa einer Million Einwohner. Hier befinden sich nicht weniger als siebenundzwanzig verschiedene Postunternehmungen, von denen fünfzehn ihre Poststücke mit Dampfern, zwölf mit Landboten versenden. Briefe von hier nach Shanghai oder Ningpo kosten 80 Cash, nach Canton 100 Cash, nach Peking oder Tientsin 200 Cash, und die Postanstalten arbeiten so vorzüglich, daß selbst bei der Beförderung auf Fluß- und Kanalbooten Verluste selten vorkommen. So sandte beispielsweise, wie der Zolldirektor von Hankau berichtet, die Postanstalt Hotschang in den letzten fünfzehn Jahren 4200 Postboote aus, von denen nur drei ihre Postsäcke verloren haben.
Die Post des nächsten Posthafens Kiukiang wird durch vierzehn Agenturen von Hankauer oder Shanghaier Postanstalten besorgt, und mehrere Agenturen ruhen in den Händen einer einzigen Chinesenfirma. Auch hier arbeiten die verschiedenen Postämter zusammen und senden gemeinschaftlich einzelne Kuriere mit den Postsäcken nach verschiedenen Städten. So wird beispielsweise an allen Tagen des Monats, welche die Ziffern 1, 4 und 7 enthalten (also am 1., 4., 7., 11., 14., 17., 21., 24. und 27.), die Post nach den Städten des Südens, an allen Tagen, welche die Ziffern 2, 5 und 8 enthalten, nach den Städten des Nordens befördert. Der weiter stromabwärts gelegene offene Hafen Wuhu ebenso wie das nur zwei Tagereisen von Shanghai entfernte Tschinkiang liegen bereits gänzlich innerhalb der Interessensphäre der großen Postanstalten Shanghais, der Hauptstadt des Jangtsekianggebietes.
Neben den privaten Posten und dem oben bezeichneten Kurierdienst für Regierungsdepeschen besteht in China seit einer Reihe von Jahren noch eine Art halboffizielle Post, die von dem ausgezeichneten Leiter der chinesischen Zollämter, Sir Robert Hart, ins Leben gerufen wurde und wohl den bescheidenen Anfang für die nunmehr zur Einführung gelangende chinesische Reichspost bilden dürfte. Ursprünglich war dieser Postdienst nur für den Verkehr der Zollämter bestimmt, allein er hat sich so sehr bewährt, daß die in den Vertragshäfen residierenden Europäer ihre für das Innere Chinas, für Peking und Korea bestimmten Briefschaften hauptsächlich nur der Zollpost anvertrauen. Dieselbe ist ganz nach europäischem Muster organisiert, und die Beförderung geschieht im Sommer durch Dampfer, da ja die Vertragshäfen mit wenigen Ausnahmen Dampferverbindung mit Shanghai und demzufolge auch mit Korea und Tientsin, dem Hafen von Peking, besitzen. Da im Winter die Häfen des Gelben Meeres während mehrerer Monate durch Eis geschlossen[S. 363] sind, erfolgt der Postdienst dann durch Kuriere, und zwar zwischen Peking und Tientsin täglich, zwischen Tientsin und Nintschwang in der Mandschurei einmal wöchentlich, und zwischen Tientsin und den südlicheren Häfen Tschinkiang, Tschifu (d. h. also auch Shanghai) dreimal wöchentlich.
Außerdem geht von Shanghai bei jedesmaliger Ankunft der europäischen und amerikanischen Postdampfer noch eine Extrapost mit den für die Regierung und die ausländischen Gesandtschaften bestimmten Briefschaften über Land nach Peking ab. Diese Extraposten legen die Strecke Shanghai-Peking in zwölf Tagen zurück. Die Zollpostämter besitzen für die Freimachung der Briefe eigene Postwertzeichen, welche in der Mitte den chinesischen Drachen zeigen und am Rande die Wertangabe in englischer Sprache, ein, zwei oder drei Candarins, tragen. Die chinesischen Briefmarken haben jedoch nur für den chinesischen und koreanischen Verkehr Gültigkeit. Sollen Briefe z. B. von Peking oder Söul mittels der Zollpost nach Europa gesandt werden, so wird auf dieselben der Wert der Briefmarken für die Sendung nach Shanghai, also drei Candarins, aufgeklebt und außerdem noch der Wert in so vielen englischen Briefmarken, als für die Sendung nach Europa oder Amerika erforderlich ist. In Shanghai wird von seiten der Zollpost die entsprechende deutsche, englische oder französische Briefmarke dazugeklebt, je nachdem die Briefe mit deutschen, englischen oder französischen Postschiffen nach Europa abgehen.
Für den lokalen Briefverkehr in Shanghai, Hankau, Ningpo, Tschifu und Tschinkiang haben die europäischen Verwaltungen dieser Vertragshäfen eigene Briefmarken zur Einführung gebracht, und dieselben werden auch zur Freimachung der Briefe für andere Vertragshäfen benutzt. Die Behörden machen mit diesen Briefmarken vortreffliche Geschäfte, weniger durch die Lebhaftigkeit des Briefverkehrs als durch den Absatz, den sie bei europäischen Briefmarkensammlern finden.
Wie man aus den vorstehenden Ausführungen sieht, ist China ganz im Gegensatz zu den herrschenden Anschauungen viel mehr mit postalen Einrichtungen versehen, als es wünschenswert ist, ja in keinem Lande der Welt giebt es so vielerlei Postanstalten als gerade in China. Shanghai allein besitzt beispielsweise außer den sechs früher schon erwähnten staatlichen Postämtern noch gegen dreißig Privatposten für den Inlandverkehr.
Im Lauf der letzten Jahre hat es der Leiter des chinesischen Zollwesens, Sir Robert Hart, zu Wege gebracht, an vielen Hauptverkehrsrouten eine kaiserliche Post einzuführen. Er bediente sich dazu der Zollbeamten sowie einzelner Privatpostanstalten, und der ganze Apparat arbeitet so vortrefflich, daß bald das ganze Chinesische Reich kaiserliche Postämter besitzen dürfte.
China hat wohl europäisches Kriegsmaterial erworben, aber der militärische Geist ist derselbe geblieben, wie er vor drei Jahrhunderten zur Zeit der Eroberung Chinas durch die Mandschus war. Die europäischen Instruktionsoffiziere fanden in China nicht etwa als Lehrmeister von Strategie und Taktik, sondern einfach als Drillsergeanten Verwendung. Vor drei Jahrhunderten hatte sich die Kriegskunst der Mandschus in so ausgezeichneter Weise bewährt, daß sie das größte Kaiserreich Asiens unterjochten und auf den Thron der gestürzten Kaiserdynastie einen Mandschurengeneral setzen konnten; warum und wozu sollte diese bewährte Kriegskunst geändert werden? Sie ebenso wie die ganze Heeresorganisation wurden also bisher mit fast abergläubischer Konsequenz beibehalten; da aber die Chinesen einsahen, daß ihre Soldaten mit Bogen und Pfeil gegen die modernen Schießwaffen der Europäer nicht aufkommen konnten, drückten sie einem Teil ihrer Streiter an Stelle des Bogens Hinterladergewehre in die Hände und schafften Kruppsche Kanonen an. Daß die Verschiedenheit der Waffen auch eine Aenderung der Taktik mit sich bringt, daran haben sie bisher nicht gedacht, obschon sie während ihrer Kriege gegen die Engländer, Franzosen und Japaner gewiß hinlänglich Gelegenheit bekamen, dies zu beobachten.
Mit rührender Treue halten die Söhne des Himmels an ihren alten Ueberlieferungen fest und stehen den Erfindungen der Yan-kwei-tse, ausländischen Teufel (das ist die gebräuchliche Bezeichnung der Chinesen für die Europäer) fast mit Verachtung gegenüber. Ich sah dies schon in der ersten Woche meines Aufenthalts in China, als ich von Hongkong den Perlfluß aufwärts nach Canton fuhr. Canton, die größte Stadt des himmlischen Reiches, gleichzeitig eines der wichtigsten und reichsten Handelsemporien Chinas, ist mit hohen, gewaltigen Mauern umgeben, und auch die Inseln, sowie die Höhen längs der Flußufer sind von steinernen[S. 365] Festungswerken gekrönt. Doch bestehen diese aus nichts weiter als festen Mauern, die einen weiten Platz umschließen, in deren Mitte sich die ebenfalls aus Stein erbauten Kasernen erheben. Natürlich war es bei der Expedition gegen Canton den Franzosen ein leichtes, diese Mauern zusammenzuschießen, Canton einzunehmen und dasselbe zwei Jahre lang besetzt zu halten. Dies hätte den Chinesen doch zeigen müssen, daß derlei Forts nicht nur kein Verteidigungsmittel sind, sondern daß die Steinmauern beim Aufschlagen der feindlichen Geschosse durch die umhergestreuten Trümmer den Verteidigern noch gefährlicher werden. Man hätte erwarten sollen, daß die Chinesen nach dem Abzuge der Franzosen moderne Forts anlegen würden. Statt dessen hatten sie nichts Eiligeres zu thun, als die noch unbesetzten Höhen längs des Perlflusses mit ganz denselben Steinmauern zu umgeben, wie sie die bisherigen Forts zeigten. Diese Mauern krönen nicht etwa den Gipfel oder das oberste Plateau der Höhen, sondern umschließen deren Fuß, ziehen sich allenfalls auch in den Thälern oder auf den Bergkämmen aufwärts, aber stets so, als wollten die Erbauer geflissentlich das ganze Innere des Forts den feindlichen Kugeln bloßstellen. In den Schießscharten dieser Forts stecken wohl mitunter moderne Geschütze, von Krupp oder Armstrong geliefert, in Canton selbst jedoch fand ich auf den Ringmauern nicht ein einziges modernes Geschütz, sondern nichts als verrostete, vollständig unbrauchbare Kanonen aus früheren Jahr[S. 366]hunderten, auf zerfallenen Holzlafetten ruhend oder einfach im hohen Grase schlummernd.
Die Garnison Cantons besteht aus den Soldaten der alten Mandschu- und Tatarenfamilien, die mit Weib und Kind in der mit einer besonderen Mauer umgebenen Tatarenstadt wohnen. Auf den freien Plätzen dort, sowie außerhalb der Stadtmauer sah ich diese Soldaten exerzieren. Die einen hatten moderne Mauser- oder Winchestergewehre, die anderen Bogen und Pfeil, wieder andere lange dreispitzige Lanzen, Schilde und Schwerter.
Dieselben Festungswerke, dieselben Soldaten fand ich später am Jangtsekiang, ja selbst in den Hafenstädten am Golf von Tschihli, welche doch die Hauptstadt des Reiches, Peking, vor feindlichen Angriffen beschützen sollen. Der wichtigste dieser Häfen ist nächst Tientsin das auf der Halbinsel Schantung gelegene Tschifu. Diese Wichtigkeit wurde in den letzten Jahren sogar von den Chinesen anerkannt, und sie beschlossen, dort neue Forts zu erbauen. Dem Hafen sind zwei Inseln vorgelagert, welche den Zugang vollständig beherrschen. Statt dort wurden die Forts, natürlich wieder nach der alten Schablone, auf dem Festlande weiter einwärts errichtet. Sachverständige schlugen die Hände über den Köpfen zusammen. Endlich wurde der Tatarengeneral der Provinz über die Gründe dieser sonderbaren Art der Küstenbefestigung befragt. „Ja”, antwortete dieser, „wohin soll sich denn im Fall der Einnahme der Forts die Besatzung zurückziehen, wenn diese Forts auf den Inseln angelegt würden?”
In Nanking, der alten Hauptstadt des himmlischen Reiches, wollte ich das dort befindliche Arsenal besuchen. Allein es wurde nicht gestattet. Doch erfuhr ich, daß alle früher dort bediensteten Europäer vor einigen Jahren entlassen wurden. Die ganze Erzeugung von Gewehren, Kanonen, Hieb- und Stichwaffen wird von den Chinesen geleitet. Die Garnison von Nanking hat dieselben Stadtteile inne wie vor dreihundert Jahren, und die Waffen sind, wie ich es bei dem Exerzieren der Truppen selbst sah, auch dieselben geblieben: Lanzen und Schwerter, Bogen und Pfeil. Nur ein kleiner Teil der Truppen ist mit Schießgewehren bewaffnet.
Der Vicekönig von Wutschang am Jangtsekiang hat einen der am Strome gelegenen befestigten Lager vor einigen Jahren hundert Hinterladergewehre mit je hundert Patronen gesandt mit dem Auftrage, Schießübungen anzustellen. Bei der Inspektion durch den Mandschugeneral im darauffolgenden Jahre rückten die Truppen wieder mit Bogen und Pfeil aus. Als nach dem Verbleib der Gewehre gefragt wurde, antwortete der Lagerkommandant, daß er sie weggegeben hätte, als die Munition verschossen war.
Pekinger Diplomaten erzählten mir, die Hälfte der dortigen Garnison hätte ihre Gewehre in den Pfandhäusern, und in den Provinzen käme es häufig vor, daß die Soldaten ihre modernen Hinterladergewehre gegen alte Feuersteinflinten sehr gern umtauschen, da sie mit diesen besser umzugehen wüßten.
Daß übrigens auch die kaiserliche Regierung in Peking keinen allzugroßen Wert auf die moderne Bewaffnung legt, geht aus einem Bericht der kaiserlichen Regierungszeitung hervor, der in der Ausgabe vom 24. Juni 1894 enthalten ist, also schon zur Zeit, als der Krieg mit Japan nahezu Gewißheit geworden war. Er lautet:
„Der Vize-Generalleutnant Ya er chien hatte in einem früheren Berichte eine Vermehrung der Ausrüstung seiner in Tscheng-tu stationierten Bannertruppen mit ausländischen Gewehren beantragt. Die hierfür erforderlichen Geldmittel sollten den Ueberschüssen der Opiumsteuer entnommen werden. Der Bannergeneral Kung schon, sowie der Generalgouverneur der Provinz Szechuan (dessen Hauptstadt Tscheng-tu ist) wurden seinerzeit zur Begutachtung dieses Antrages aufgefordert.
Nach den nunmehr eingereichten Berichten derselben sind die Steuerüberschüsse nicht groß genug für die verlangte militärische Ausrüstung; dieselben müssen auch für Notstandsjahre reserviert bleiben.
Deshalb wird dem Vize-Generalleutnant seine Bitte abgeschlagen. Wenn die zum Schutze des Landes bestimmten Bannertruppen in der vorgeschriebenen militärischen Uebung verharren, so braucht an ihrer Bewaffnung (aus Lanzen, Bogen und Pfeilen) nichts geändert zu werden und bleibt die Tüchtigkeit der Soldaten gesichert. Der Bannergeneral und seine untergebenen Offiziere sollen deshalb mit erhöhtem Eifer die militärische Ausbildung der Truppen betreiben, von welcher die Leistungsfähigkeit im Felde abhängt.”
In demselben Edikt befindet sich auch noch folgender Paragraph:
„Der obenerwähnte Generalleutnant ist mit einem übermäßigen Gefolge von siebzehn Offizieren und Soldaten nach Peking gekommen und soll die Reisekosten eigenmächtig den für den Unterhalt der Truppen bestimmten Fonds entnommen haben. Diese Verwendung öffentlicher Gelder zu Privatzwecken läßt sich aus den von sämtlichen Hauptleuten unter Siegel eingelieferten Dokumenten erweisen. Der Generalleutnant soll über diesen Punkt genauen Bericht erstatten.”
Am folgenden Tage, den 25. Juni 1894, enthält die Pekinger Staatszeitung folgendes Edikt:
„Im Januar hatte das Kriegsministerium Uns gebeten, an alle Provinzen den Befehl zur schleunigen Aufstellung einer Truppenliste zu erteilen, um eine genaue Zusammenstellung der verfügbaren Armeen machen zu können. Dieser Befehl wurde allen Generalgouverneuren und Gouverneuren erteilt und ihnen eine Frist von drei Monaten gestellt.
Da diese Frist abgelaufen ist, so möge das Kriegsministerium die Aufstellung besorgen, gegen die säumigen Beamten jedoch Strafe beantragen.”
Der Zufall spielte mir Auszüge aus den offiziellen Truppenlisten in die Hände, und gestützt darauf, sowie auf die Erkundigungen, die ich in verschiedenen Garnisonen einzog, fand ich das Heerwesen Chinas heute im großen und ganzen ebenso, wie[S. 368] es vor dreihundert Jahren geschildert wurde. Die ganze Organisation des Heeres ist zu interessant, zu originell, um nicht näher besprochen zu werden.
Vor allem ist es auffällig, daß die Hauptmasse des chinesischen Heeres nicht dem Kaiser untersteht und in seinem Namen angeworben und unterhalten wird, sondern daß jeder Vizekönig der achtzehn Provinzen Chinas seine eigenen, von den benachbarten Heeren völlig unabhängigen Truppen besitzt. In dieser Hinsicht haben die chinesischen Vizekönige fast ebenso souveräne Rechte wie früher die einzelnen deutschen Fürsten. Der eine Vizekönig verwendet mehr Sorgfalt auf die Uniformierung und Bewaffnung seines Heeres, der andere weniger; die Vizekönige der mit Fremden mehr in Berührung kommenden Küstenprovinzen haben schlagfertigere und besser gedrillte Truppen als jene des Inlandes, wo die Heere mitunter sehr vernachlässigt werden. Doch ist jedem Vizekönig die Truppenzahl, die er unterhalten muß, vorgeschrieben, und die Zentralregierung kann von ihm die Beistellung irgend eines beliebigen Teiles derselben oder des ganzen Heeres verlangen. So wurden beispielsweise bei Ausbruch des letzten Krieges die ersten 15000 Mann von den Vizekönigen der drei nördlichen Küstenprovinzen auf Befehl des Kaisers beigestellt. Das kleinste Heer besitzt die Provinz Anhuei im Inlande mit 8700 Mann, das größte die Küstenprovinz Kwangtung mit 70000 Mann. Die anderen Provinzen besitzen Heere von 20000 bis 60000, Tschihli, die früher von Li-Hung-Tschang regierte wichtigste Provinz des Reiches, 42000 Mann. Die Gesamtsumme dieser Provinzialtruppen oder, wie sie in China heißen, der Truppen des grünen Banners, beläuft sich auf 650000 Mann. Ihr Sold ist ebenso verschieden wie ihre Bewaffnung und ihre Einteilung. Während beispielsweise die Ausgaben für die Armee Li-Hung-Tschangs im Jahre über 1½ Millionen Taels betragen, erreichen jene der um 8000 Mann stärkeren Armee Kiangfus kaum 1 Million Taels. Die Gesamtausgaben der Provinzen für die 650000 Mann betragen 14½ Millionen Taels oder etwa 60 Millionen Mark. Diese Ausgaben müssen jedoch bei der Zentralregierung verrechnet werden, ebenso ist es diese letztere, welche auf Grundlage der eingereichten Vorschläge sämtliche Offiziere ernennt. Die[S. 369] Truppen des grünen Banners besaßen nach den erwähnten Tabellen des Kriegsministeriums in Peking folgende Offiziere: 16 Generale, 64 Generalleutnants, 280 Oberste, 373 Oberstleutnants, 425 Majore, 825 Hauptleute, 1650 Leutnants und 3500 Fähnriche, im ganzen also etwa 7100 Offiziere. Dies dürfte wohl die geringste Offizierszahl in irgend einem Heere sein, denn beispielsweise besitzt Frankreich bei einer der chinesischen Truppenzahl nahezu gleichen Friedensstärke mehr als die vierfache Zahl von Offizieren, nämlich 28555. Italien besitzt bei einem Drittel der obigen Friedensstärke die doppelte Zahl von Offizieren.
Die Truppen der einzelnen Provinzen sind nicht in Regimenter und Bataillone eingeteilt, sondern liegen in Abteilungen verschiedenster Stärke in Städten, Forts oder in einzelnen Lagern. Jede Provinz ist in eine gewisse Zahl militärischer Distrikte unter dem Befehl eines Obersten eingeteilt, und in jedem Distrikt befinden sich mehrere Lager. In den Städten versehen die Garnisonen gleichzeitig den Polizeidienst, denn Polizei im europäischen Sinne giebt es in China nicht. In den Lagern, besonders wenn diese auf dem Lande gelegen sind, hat der Soldat nicht viel zu thun. Ausgenommen zur Zeit der Manöver oder bei Inspektionen durch die Kommandierenden, beschäftigt er sich mit Ackerbau, Gartenzucht oder allerhand Gewerben. Gewöhnlich ist er auch noch verheiratet und hat Weib und Kind bei sich.
In jeder Provinz giebt es einen Mandschu- oder Tatarengeneral, der unabhängig von dem Provinzgouverneur seine (kaiserlichen) Mandschutruppen befehligt und direkt der Zentralregierung untersteht, außerdem noch einen General der Provinztruppen. Der kommandierende General von Schantung hat sein Hauptquartier nicht in der Kaiserstadt, sondern in Yentschou-fu, wo ich Gelegenheit bekam, Tieng-min-leh, dies sein Name, kennen zu lernen. Er erwies mir nämlich die Ehre seines Besuches. Ihm voraus trabte seine berittene Leibgarde, mit kurzen Schwertern bewaffnet, dann kamen die Träger der Zeremonienschirme und fantastisch geformten, auf langen Stangen sitzenden Zeremonienwaffen, endlich der Karren des Generals, umgeben von zwölf Schwertträgern. Militärmandarine bedienen sich bei Ausgängen oder Besuchen gewöhnlich eines zweiräderigen Maultierkarrens, Zivilmandarine der Sänfte. Der alte Herr war von einer Liebenswürdigkeit, wie ich sie noch bei keinem Mandarin angetroffen hatte. Er blieb eine halbe Stunde bei mir sitzen, sprach unter anderm von Napoleon III. und Moltke, dessen Schriften, ins Chinesische übersetzt, sich in seiner Bibliothek befänden. Er erwähnte auch, er hätte in den chinesischen Zeitungen Shanghais und Pekings von meiner Reise gelesen, sowie von meiner publizistischen Thätigkeit zu Gunsten Chinas während des japanischen Krieges, und ich könne in China überall des freundlichsten Empfanges sicher sein. Er sei ein großer Freund der Deutschen, hätte von diesen viel gelernt und ließe auch seine Truppen nach deutschem Muster drillen. Wie diese aussehen, ist aus[S. 370] den Abbildungen dieses Kapitels zu entnehmen. Im ganzen mochte er in seinem Lager einige hundert Mann haben.
Der Sold der Soldaten des grünen Banners ist äußerst gering und beträgt kaum mehr als zwanzig bis dreißig Pfennige für den Tag, wovon er sich beköstigen und uniformieren muß, vorausgesetzt, daß ihm der Sold überhaupt regelmäßig bezahlt wird. Gewöhnlich halten die Offiziere kleinere Beträge zurück und geben sie den Soldaten dafür an Festtagen oder zum neuen Jahre. Eine feste Dienstzeit giebt es in China nicht, ebensowenig eine allgemeine Wehrpflicht. Es giebt keine Pension, keine Alterszulagen, keine ärztliche Pflege, keine Armeeverpflegung, jeder muß sich selbst nach Belieben verpflegen, nähren und kleiden. Die Uniform der Provinzialtruppen besteht aus einer blauen Bluse mit rotem oder weißem Besatz, auf deren Brust- und Rückenteil in einem etwa zwanzig Centimeter großen, weißgeränderten Kreise die Provinz und das Lager, in welchem der Mann steht, in chinesischen Lettern verzeichnet sind. Die leinenen Beinkleider, gewöhnlich von blauer Farbe, stecken in den kurzen Schäften der aus Filz verfertigten Stiefeln, und auf dem Kopfe sitzt ein tellerartiger Tatarenhut aus Bambusgeflecht, bei manchen Truppen mit einem roten Roßschweif geschmückt. Im Polizeidienst besteht die Bewaffnung der Soldaten aus einer kurzen, ein-, zwei- oder dreispitzigen Lanze, zuweilen auch aus einem Doppelschwert mit zwei Klingen in einer Scheide.[S. 371] Auf dem Lande, außer Dienst, oder in den Lagern sind die Soldaten gar nicht bewaffnet.
Die Rekrutierung erfolgt am Werbetische, und trotz des erbärmlichen Soldes ist der Andrang doch immer stärker als der Bedarf. Ich sah eine derartige Rekrutierung in Nanking. Auf dem freien Platze vor dem Hause eines der höheren Offiziere war ein Zelt aufgeschlagen, in welchem sich einige Offiziere befanden. Ein paar Soldaten, mit Lanzen bewaffnet, hielten die sich herandrängenden Bewerber und das Volk in Ordnung. Vor dem Zelte lag ein etwa sechs Fuß langer Bambusstock auf dem Boden mit runden Steinen im Gewicht von zusammen hundert Catties (etwa 65 Kilogramm), an den Enden des Stabes gleichmäßig verteilt. Die Soldaten ließen die bis zur Hüfte entblößten Applikanten der Reihe nach vortreten. Die Offiziere warfen ein paar prüfende Blicke auf sie, dann wurde ihnen befohlen, den Bambusstock mit beiden Händen bis über den Kopf emporzuheben. Bestanden sie diese Kraftprobe, so wurde ihr Name in ein Register eingetragen und ihnen geheißen, im Lager vorzusprechen. Dort erhielten sie einiges Handgeld, kaum viel mehr als einer Mark entsprechend, und blauen Stoff, um ihre Uniform daraus nähen zu lassen. Damit waren sie kaiserliche Soldaten.
Für diejenigen, welche auf Offiziersstellen Anspruch machen, sind unter der gegenwärtigen Regierung ähnliche Prüfungen eingeführt worden wie für den Zivildienst, und den erfolgreichen Kandidaten werden je nach der Art, wie sie die Prüfung bestehen, auch dieselben Titel, Siu-tsai, Kü-jin und Tsin-sz, verliehen. Für den letzten (höchsten) Grad erfolgt die Prüfung in Peking. Man darf jedoch nicht glauben, daß die Offizierskandidaten wie jene für die Beamtenstellen auf ihre litterarischen Kenntnisse hin oder gar in Taktik und Strategie, Befestigungs- und Ingenieurkunst geprüft werden. Das wird von einem chinesischen Offizier nicht verlangt. Dafür müssen die Kandidaten gewandte Reiter, Fechter und Ringkämpfer sein; nicht die geistige, sondern die Muskelkraft giebt den Ausschlag, und die besten Noten erhalten jene, welche sich überdies als Bogenschützen bewähren. Dazu wird auf dem militärischen Uebungsplatze ein dreißig bis fünfzig Centimeter tiefer gradliniger Graben von etwa einem halben Kilometer Länge und hinreichender Breite gegraben, daß ein Pferd in demselben galoppieren kann. Auf etwa fünfzig bis sechzig Meter Entfernung von dem Graben sind Scheiben aufgestellt, mit Zwischenräumen von etwa fünf Meter voneinander. Der Kandidat, mit Bogen und Pfeilen bewaffnet, hat zu Pferd zu steigen und, während dieses den Graben entlang galoppiert, Pfeile nach den Scheiben abzuschießen. Treffen diese Pfeile das Schwarze, so wird von den Wächtern der Gong angeschlagen, um die Examinatoren davon in Kenntnis zu setzen. Noch 1898 hatte ich selbst in Yentschou-fu, im Innern von Schantung, Gelegenheit, eine derartige Prüfung zu sehen.
Mit dem erfolgreichen Bestehen der Prüfung wird jedoch der Kandidat noch lange nicht Offizier. Dazu muß er entweder viel Geld oder viele Freunde haben. In einem Aufsatz über das Offizierskorps, der in der ersten Zeitung Shanghais, der Daily News erschien, heißt es in dieser Hinsicht: „Irgendwelche wissenschaftliche Ansprüche werden an den Offizier nicht gestellt; die höheren Offiziersstellen werden verkauft, die niedrigeren an Freunde und Verwandte gegeben. Die wenigsten haben eine Ahnung vom praktischen Militärdienst, und es kommt vor, daß die höchsten Kommandostellen der Armee von gänzlich Unwissenden eingenommen werden.”
Deshalb ist der Soldatenstand in China auch keineswegs angesehen, ja man blickt auf ihn verächtlich herab. Die Offizierschargen stehen nicht im gleichen Rang mit den entsprechenden Chargen des Zivildienstes, sondern um einen Grad tiefer. Als in den neunziger Jahren zwei deutsche Instruktionsoffiziere mit dem Einexerzieren der Infanterie der Provinz Tschihli betraut wurden, nahmen auch die Offiziere an den einfachsten Exerzitien teil, gerade so wie die Soldaten. Bald hatten die deutschen Offiziere den Chinesen deutsche Strammheit beigebracht, und diese führten alle Evolutionen vortrefflich aus. Nun wurden von den so gedrillten Bataillonen Unteroffiziere als Drillmeister zu den anderen Truppenkörpern kommandiert, ja die Vicekönige anderer Provinzen erbaten sich solche, und der Einfluß der deutschen Offiziere ist heute in den meisten Provinzialarmeen wahrzunehmen. In einigen dieser letzteren giebt es vortreffliche Truppenkörper, die selbst europäischen Ansprüchen genügen dürften, vor allem in den Armeen von Kwangtung und Tschihli, welch letzterer Li-Hung-Tschang besondere Sorgfalt zuwendete. Die Infanterie ist dort mit dem deutschen Infanteriegewehr bewaffnet, gut geschult und schlagfertig. Noch besser soll, nach dem Urteil von Fachleuten, die Artillerie sein, aus dem begreiflichen Grunde, weil die alten chinesischen Armeen keine Artillerie besaßen, deshalb auch keine althergebrachten Gebräuche und Vorschriften umzustoßen waren. Das ganze Geschützwesen mußte von Grund auf neu gelernt werden, und die deutschen Instruktoren haben in dieser Hinsicht die größten Erfolge aufzuweisen; die Feldgeschütze wurden hauptsächlich von Krupp geliefert, und das Material befindet sich im Gegensatz zu dem Festungsmaterial in bester Ordnung.
Schlimmer ist es in den Provinzialarmeen um die Kavallerie bestellt. China wird niemals eine solche im europäischen Sinne besitzen können, denn vor allem hat es keine Pferde. Die mongolischen Ponies sind wohl kräftig und ausdauernd, besonders auf langen Märschen, aber viel zu klein und leicht. Alle zehn Jahre wird das Material erneuert, dadurch, daß der Vicekönig dem Kommandierenden gewisse Summen zum Ankauf neuer Pferde anweist, oder selbst Remontekommissionen nach der Mongolei entsendet. Den einzelnen Lagerkommandanten wird für den Unterhalt der Pferde das Geld monatlich angewiesen. In Tschihli beträgt dasselbe[S. 373] vierzehn Mark per Pferd und Monat. Die Reiter sind mit Winchester-Karabinern bewaffnet.
In den anderen Provinzen ist es um die Kavallerie ebenso schlecht bestellt wie um die Infanterie, doch soll es in der Mandschurei eine zwischen 40000 und 50000 Mann zählende Armee von Reitern geben. In den Garnisonen der Küstenprovinzen ist davon nichts zu sehen. Wären die 650000 Mann der Armee des grünen Banners wirklich gut geschult und vor allem wirklich vorhanden, so würde dies eine höchst respektable Macht vorstellen. Allein allgemein erzählt man sich, daß die Kommandanten vieler Lager im Inland die vorgeschriebene Truppenzahl nur auf dem Papier besäßen. Das Geld für den Sold und Unterhalt wird eingesteckt. Steht eine Inspektion bevor, so werden schnell Rekruten in der erforderlichen Zahl angeworben, in Uniformen gesteckt und gedrillt. Ist diese Inspektion vorüber, so werden sie wieder entlassen.
Neben dem grünen Banner besteht in China noch die alte Mandschuarmee in ganz derselben Organisation wie vor dreihundert Jahren, zur Zeit der Eroberung Chinas durch die Mandschus. Damals teilte ihr Führer, der nachherige Kaiser Tien-ming, seine Horden in vier Banner, das rote, gelbe, blaue und weiße. Als im Laufe des Krieges zahlreiche Mongolen und abtrünnige Chinesen seinem Heere zuströmten, organisierte er diese in vier weitere Banner mit denselben Farben, nur mit verschiedenfarbigen Rändern. Nach der Gründung des großchinesischen Reiches genügten diese acht Banner für den Dienst nicht mehr, und es wurden neben denselben noch acht weitere Mongolenbanner und acht Chinesenbanner organisiert, die noch bis auf den heutigen Tag bestehen, nominell in einer Gesamtstärke von 105000 Mann. Die stärksten Banner sind jene der Mandschus mit je 85 Kompagnien von je 80 bis 90 Mann; die Mongolenbanner sind durchschnittlich nur 28 Kompagnien, die Chinesenbanner 33 Kompagnien stark. Zusammen besitzen die mandschurischen Banner 678, die mongolischen 221, die chinesischen 266 Kompagnien, im ganzen also sind 1165 Kompagnien Bannertruppen verfügbar, welche von der kaiserlichen Zentralregierung in Peking unterhalten werden und jährlich 16 Millionen Taels, d. h. etwa 64 Millionen Mark erfordern. Mit den Truppen des grünen Banners zusammen beträgt das militärische Budget Chinas demnach 30½ Millionen Taels, und die Bevölkerung Chinas auf 400 Millionen angenommen, entfällt auf den Kopf eine jährliche Militärsteuer von etwa 35 Pfennigen.
Die vierundzwanzig Banner bilden zum Unterschiede von den Provinzialarmeen die eigentliche kaiserliche Armee. In Wirklichkeit aus Leibeigenen bestehend, vom Throne bezahlt und seit Generationen von Vater auf Sohn militärpflichtig, bilden sie die wahren Stützen des Kaiserthrones und der Dynastie in dem von dieser unterworfenen chinesischen Reiche. Die Bannersoldaten sind es, welche den Garnisons- und Polizeidienst in den Großstädten versehen. Doch sind sie dort nicht wie europäische Truppen in Kasernen untergebracht, sondern sie bewohnen in jeder Stadt eigene, mit Mauern umgebene und abgeschlossene Stadtviertel, die sogenannte Tatarenstadt. Dort hausen sie mit Weib und Kind in eigenen Häuschen, jeder Soldat für sich; in der Mitte der Tatarenstadt erhebt sich gewöhnlich der Yamen des Tatarengenerals, unter welchem diese Bannertruppen sowohl wie die Provinzialtruppen stehen. Die Bannertruppen sind über das ganze Reich, je nach der Größe und Zahl der Städte, verteilt, manche Provinzen, wie z. B. Kiangsi, Hunan, Yünnan und Kueitschau, besitzen deren gar keine, andere Provinzen, wie z. B. die Mandschurei, besitzen nur Bannertruppen. Am zahlreichsten sind sie in der Hauptstadt Peking selbst. Dort stehen außer den 4000 Mann der kaiserlichen Leibgarde etwa 15000 Mann der verschiedenen Banner. Je nach ihrer Farbe garnisonieren sie in verschiedenen Stadtteilen: das rote Banner im Süden, das weiße im Westen, das blaue im Norden und die Truppen des grünen Banners (Chinesen) im[S. 375] Osten. Die eigentliche Kaiserstadt wird von den Truppen des gelben Banners bewacht.
Daß die kaiserliche Regierung es mit dieser Bewachung wie überhaupt mit der Disziplin der Pekinger Bannertruppen recht ernst nimmt, geht aus der Regierungszeitung vom 1. April 1894 hervor, deren Bericht ich hier folgen lasse, weil er auch auf die Bestrafungsarten in der Armee einiges Licht wirft. In der Nähe der Stadtthore hatte sich verdächtiges Gesindel herumgetrieben und war zum Teil sogar in die Stadt gedrungen. Dies gelangte zur Kenntnis der Regierung, und diese verordnete Folgendes: „Der Kommandeur der Gardeabteilung des geränderten weißen Banners, Kochin, welcher an dem betreffenden Tage die Wache hatte, wird seiner sämtlichen Aemter entsetzt; aus besonderer Gnade wird ihm aber sein Rangknopf (auf dem Hut) und der Posten eines dienstthuenden Gardeoffiziers zweiter Klasse geschenkt. Der Oberst desselben Banners, ferner vier Gardeoffiziere (namentlich angeführt) sind auf der Stelle zu entlassen. Dem Brigadegeneral des linken Flügels, Shan-yin, und jenem des rechten Flügels, Chang-liu, werden ihre amtlichen Einkünfte während eines Jahres, ferner dem Prinzen Tsai-yina und dem General des mongolischen rotgeränderten Banners ihre amtlichen Einkünfte während drei Monaten entzogen. Die Mannschaften, welche an dem betreffenden Tage die Wache hatten, sind zu prügeln und zu entlassen. Beachtet dies mit Zittern.”
Die Uniform der Bannertruppen weicht von jener der Provinztruppen einigermaßen ab. Sie besteht aus einer bis über die Knie reichenden, nachthemdartigen weißen Tunika, über welcher eine ärmellose Jacke von der Farbe der betreffenden Banner getragen wird. Von derselben Farbe sind die Beinkleider, von denen jedoch nicht viel zu sehen ist, da sie in den kurzen Schäften der Filzstiefeln stecken. Der Hut ist mit zwei Eichhörnchenschwänzen geschmückt. Auf ihren kleinen, kräftigen Ponies sitzend und zu Kompagnien vereinigt, sehen diese Tatarentruppen ungemein malerisch aus. Ueber die farbenreichen Uniformen erhebt sich in jeder Kompagnie ein großes Banner, umgeben von zahlreichen kleineren Fähnchen, welche die Soldaten in eigenen Schäften auf dem Rücken tragen. Die Pfeilköcher sind über die Schultern gehängt, die Säbel aber hängen nicht am Gürtel der Reiter, sondern stecken horizontal auf der linken Seite des Pferdes unter dem Sattel, der Griff voraus. In der Rechten halten die Reiter die Zügel, in der Linken den Bogen. Zur vollkommenen Ausrüstung gehören überdies Tabakspfeife, Fächer und der mit scheußlichen Fratzen bemalte runde Schild.
Allerdings dürfen diese Truppen einem europäisch geschulten und bewaffneten Feinde gegenüber weitaus im Nachteil sein. Indessen müssen die ungeheuren Fortschritte in Betracht gezogen werden, die in den letzten zwei Jahrzehnten in Bezug auf die Ausbildung mancher Truppenkörper gemacht wurden. Neben Abteilungen, die heute noch ebenso sind wie vor hundert Jahren, giebt es andere, die voll[S. 376]ständig nach modernen Mustern ausgerüstet und einexerziert sind und die auch, wie die letzten Kriege gezeigt haben, an Tapferkeit manchen europäischen Truppen nicht nachstehen. Von der ganzen verfügbaren Armee, mit den mongolischen und tibetanischen Truppen etwa eine Million, dürften vielleicht nur 50000 Mann den Anforderungen der modernen Kriegskunst entsprechen. Die Armee Li-Hung-Tschangs allein besteht, mit den Bannerleuten zusammen, aus etwa 50000 Mann gut geschulter Truppen mit über 500 Geschützen, von denen etwa die Hälfte moderne Hinterlader sind. Dank dem Einfluß des genannten Vicekönigs von Tschihli sind seit dem letzten Franzosenkrieg in Tientsin, Nanking und anderen Städten von europäischen Fachleuten geleitete Militärschulen und Arsenale angelegt worden, von denen jene von Shanghai und Futschau wohl die bedeutendsten sind. In Bezug auf Ingenieurwesen, Verpflegung, Sanitätswesen ist es bisher noch beim alten geblieben, doch tritt dafür wieder ein anderer wichtiger Umstand in den Vordergrund: die Ausdauer, Furchtlosigkeit und überraschende Mäßigkeit der chinesischen Soldaten. Hätten sie auch noch Disziplin, China würde es mit irgend einem Feinde aufnehmen können. Aber gerade diese fehlt dem chinesischen Soldaten vollständig, und sie kann ihm auch nicht so rasch beigebracht werden.
Die ziemlich verbreitete Ansicht, die Missionen in China stammten erst aus neuerer Zeit und fielen beiläufig mit der Eröffnung chinesischer Häfen für den europäischen Handel zusammen, ist irrig. In China wurde das Christentum schon viel früher gepredigt als in so manchem europäischen Lande. Der Tradition nach soll sogar der Apostel Thomas nach China gekommen sein. Sicher ist es, daß die Nestorianer dieses große Reich zum Felde ihrer Missionsthätigkeit ausersehen haben und schon in den ersten Jahren des sechsten Jahrhunderts, etwa um das Jahr 505, dorthin gelangten. Williams sagt in seinem großen Werke über China u. a.: „Eines der interessantesten alten Denkmäler in China, und gleichzeitig die älteste christliche Inschrift in Asien, rührt von den Nestorianern her und stammt[S. 378] aus dem Jahre 781”. Diese Inschrift wurde 1625 in Schang-an, einer Stadt der Provinz Schensi, entdeckt und beschreibt die Ankunft der christlichen Missionare, sowie den Schutz, den die chinesischen Kaiser der neuen Lehre während anderthalb Jahrhunderten angedeihen ließen. Ein Priester, Olopun, wurde im Jahre 635 vom Kaiser in seinem Palaste empfangen, und in dem gleichen Jahre wurde ein kaiserliches Edikt erlassen, das mit dem Satze schließt: „Laßt den neuen Glauben freien Lauf nehmen durch das ganze Reich”. Nachfolgende Herrscher schützten die christliche Religion, und Klöster erhoben sich bald in hundert Städten. Zu Ende des achten und in der ersten Hälfte des neunten Jahrhunderts wetteiferten die buddhistischen Missionare mit den Christen. Im Jahre 841 gelang es der Sekte der Taoisten, den Kaiser zu bewegen, ein Edikt gegen den Buddhismus zu erlassen, und mit diesem litt auch das Christentum. Kirchen und Klöster wurden zerstört, und die Nestorianer konnten sich von diesem Schlage nicht mehr ganz erholen. Wohl erwähnt Marco Polo noch christliche Kirchen in China, allein es wird bezweifelt, daß sie aus der Zeit der Nestorianer stammten. Doch gelang es im Jahre 1307 dem Pater Johannes von Monte Corvino in Peking, oder wie es damals hieß, Khanbalik, festen Fuß zu fassen. Papst Clement V. ernannte ihn zum Erzbischof von Peking, und als solcher wirkte er beinahe zwei Jahrzehnte lang. Sein einziger europäischer Gefährte war ein Deutscher, Bruder Arnold von Köln. Als bald darauf die mongolische Dynastie gestürzt wurde, fand auch die neubegründete Mission ein Ende.
Drei Jahrhunderte nach Marco Polo, in den Jahren 1579 und 1581, erreichten die ersten römisch-katholischen Missionare, die Jesuiten Michael Ruggiero und Matteo Ricci, das chinesische Reich. Von Canton wanderte Ricci nordwärts bis nach Nanking, wo er 1610 starb. Der Kaiser empfing ihn freundlich, und unter seinem Schutz bekehrte Ricci eine beträchtliche Anzahl vornehmer Chinesen zum Christentum; die Tochter eines von ihnen, in der Geschichte unter dem Namen Candida bekannt, erbaute 39 Kirchen, ließ auf ihre Kosten 130 Bücher drucken und sandte zahlreiche eingeborene Missionare in die Provinzen, um den neuen Glauben zu predigen. Bald folgten den ersten Jesuitenvätern eine Anzahl anderer, darunter die berühmten Adam Schaal, Verbiest, Regis, die unter dem Schutz des letzten Kaisers der Mingdynastie, sowie unter den beiden ersten Kaisern der neuen Mandschudynastie Hervorragendes leisteten. Das astronomische Observatorium in Peking, eine Kanonengießerei und eine Anzahl großer geographischer Werke über China legen davon noch heute Zeugnis ab. Unter dem mächtigen Schutz des Hofes und der Regierung machte der Katholizismus in China überaus rasche Fortschritte, bis es aus Anlaß religiöser Fragen zum Zwiespalt zwischen dem Kaiser und den dem Papst gehorchenden Missionaren kam. Den Chinesen leuchtete es nicht ein, daß sie einer außerhalb Chinas residierenden höheren Autorität als jener ihres eigenen[S. 379] Kaisers gehorchen sollten, und 1724 wurde ein Edikt erlassen, wodurch die Verbreitung des katholischen Glaubens in China verboten wurde. Alle Missionare, ausgenommen einige in Peking thätige Gelehrte, wurden des Landes verwiesen. Viele folgten dem Befehl, andere blieben im geheimen und befestigten die Uebergetretenen in ihrem neuen Glauben. Bis zum Jahre 1842 machte der Katholizismus nur geringe Fortschritte. In diesem Jahre jedoch wurde das Christentum in China durch die Verträge mit den europäischen Mächten gestattet; zahlreiche Missionare trafen bald darauf wieder in China ein, und heute giebt es unter den Chinesen weit über eine Million Katholiken. Die in Hongkong erscheinende katholische Zeitschrift „The Roman Catholic Register” gab vor kurzem folgende Statistik der katholischen Missionen in China: 41 Bischöfe, 664 europäische und 559 chinesische Priester; gegen 2000 niedere und 34 höhere Schulen; 34 Klöster, 3000 Kirchen und Kapellen und 1092818 Bekehrte. Es kommt also auf je 400 Chinesen ein Katholik. Neben den Schulen sind in vielen der über alle Provinzen Chinas verbreiteten Missionen auch Hospitäler und Waisenhäuser errichtet worden, die nicht wenig zur Bekehrung der Chinesen beitragen. Am wirksamsten ist jedoch immer noch die Propaganda vermittelst Zeitschriften, Büchern und Flugblättern in chinesischer Sprache geblieben; diese stammen hauptsächlich aus der großen Druckerei der Jesuitenmission in Zikawei, wohl die bedeutendste Druckerei in ganz China.
Von den acht in dem Reiche der Mitte thätigen katholischen Missionen sind jene des Pariser Seminars die zahlreichsten, mit zehn Vikariaten, gegen 250 christlichen Missionaren und gegen 175000 Christen. Erst dann kommt der seit 1660 in China thätige Jesuitenorden mit zwei Vikariaten, 130 Missionaren und etwa 140000 Christen. Dann schließen sich an die Lazaristen, Franziskaner und Dominikaner, deren Mission aus dem Ende des siebzehnten Jahrhunderts stammen; ferner das belgische Seminar, das Mailänder Seminar seit der Mitte dieses Jahrhunderts und endlich der Augustinerorden, der 1879 eine Mission errichtete. Als letzte kam im Jahre 1887 die deutsche katholische Mission von Südschantung, die binnen kurzer Zeit sehr große Erfolge erzielt hat. Bemerkenswert ist es, daß die beiden Kathedralen von Canton und Peking zu den größten Bauten dieser Städte gehören und daß die katholischen Missionare vielfach die Kleidung der Chinesen und sogar den langen chinesischen Haarzopf annehmen.
Der gewiß überraschende Erfolg der katholischen Missionen wäre nach der Ansicht zahlreicher Katholiken in Ostasien noch großartiger, wenn Frankreich sich nicht so auffällig als der alleinige und rechtmäßige Beschützer aller Katholiken in Asien, vor allem in China, aufspielen würde. Die Sache hat viel zu sehr einen politischen Beigeschmack, und die Chinesen, die von den Franzosen schon wiederholt bekriegt worden sind, fürchten, daß die Franzosen diesen Schutz über die Katholiken nur als Deckmantel für politische Zwecke benützen. Ich habe das von einflußreichen Chinesen[S. 380] selbst wiederholt aussprechen hören, und sie trauen der Aufrichtigkeit der Franzosen in dieser Sache um so weniger, als sie erfahren haben, mit welchem Eifer die Franzosen in Frankreich selbst gegen alle katholischen Institute vorgehen. Viel lieber sehen sie hinter Katholiken in China den Papst als die Franzosen stehen, und es geschah wohl, um ihrem Einfluß möglichst vorzubeugen, daß sie sich herbeiließen, einen päpstlichen Delegaten in Peking zu empfangen. Gleichzeitig wurde aber von der obersten Stelle das sogenannte Duldungsedikt erlassen, worin den Chinesen, die zum Christentum übertreten, wiederholt eingeschärft wird, daß sie dadurch nicht aufhören, Chinesen zu sein, und als solche unter dem Schutz der eigenen Regierung stehen, der allein sie Gehorsam schuldig sind. Von den vorgenannten Bischöfen, oder wie sie in China heißen, apostolischen Vikaren, sind die weitaus große Mehrzahl auch Franzosen, und zwar Jesuiten, Lazaristen oder Priester der schon 1663 gegründeten Gesellschaft der Missions etrangères in Paris, neun Vikare sind Italiener, der Rest verteilt sich auf Spanier und Belgier. Als im Jahre 1887 die deutsche (Steyler) Mission in Südschantung gegründet wurde, ist dort auch ein deutscher Vikar, Bischof von Anzer thätig, und eine der ersten Maßnahmen dieses eifrigen Mannes war es, seine Mission unter deutschen Schutz zu stellen. Alle anderen katholischen Missionen in China stehen auch heute noch unter französischem Schutz.
Der erste protestantische Missionar, der China besuchte, war Doktor Robert Morrison im Jahre 1807, und er blieb bis auf den heutigen Tag auch der verdienstvollste. Damals war der Fremdenhaß in China so stark, daß er an ein Bekehrungswerk nicht denken konnte; dafür unternahm er die Herausgabe eines großen chinesischen Wörterbuchs und die Uebersetzung der ganzen Bibel ins Chinesische, Werke, die seinen Namen für alle Sinologen unsterblich machen. Nach dem Vertrag von Nanking 1842, in welchem Hongkong an England abgetreten und fünf Häfen den Europäern geöffnet wurden, kamen eine Anzahl protestantischer Missionare nach China und begannen ihre Bekehrungsthätigkeit. Damals gab es nur sehr wenige chinesische Protestanten, kaum einige Dutzend. Seither wurde das Reisen im ganzen Reiche freigegeben, andere Häfen wurden eröffnet, den Missionaren der ständige Aufenthalt und die Errichtung von Kirchen, Schulen und Spitälern in einer Reihe von Inlandstädten gestattet. Heute giebt es nach der offiziellen Statistik im ganzen 40 verschiedene protestantische Missionsgesellschaften, die in fast allen Provinzen Chinas thätig sind und ein Personal von 1300 Europäern (darunter 700 Frauen) und 1657 chinesischen Missionaren besitzen. Während die katholischen Missionare europäischer Abstammung größtenteils der französischen Nation angehören, sind die protestantischen zumeist Engländer und Amerikaner, dann auch Deutsche und Schweden. Die Zahl der zum Protestantismus bekehrten Chinesen, Methodisten, Baptisten, Lutheraner, Presbyterianer und dergleichen beträgt im ganzen etwa 50000.[S. 381] Berücksichtigt man die große Zahl der Missionare und die Zeit, die ihnen zur Verfügung stand, so entfällt auf die Thätigkeit jedes protestantischen Missionars nicht viel mehr als jährlich eine bekehrte Seele.
Die Ursachen dieser spärlichen Resultate zu beleuchten, ist hier nicht der Platz. Wer darüber näheres zu erfahren wünscht, lese die Werke der, nebenbei bemerkt, protestantischen Reisenden Cummings, Williams, Moules, Knollys, Spencers, Percivals, Exners und anderer. Die darin enthaltenen Ausführungen lassen es sehr wünschenswert erscheinen, daß das ganze System der protestantischen Missionen eine gründliche Umgestaltung erfahren möge, sollen die ungeheuren Summen, die für Missionszwecke in China geopfert werden, wirklich wenigstens einigermaßen Nutzen bringen.
Der frühere kaiserliche Gesandte in China, Herr v. Brandt, sagt darüber: „Manche Widersprüche würden sich bei gemäßigterem Vorgehen der Missionare vielleicht vermeiden oder ausgleichen lassen, aber wie der Zelotismus der Bettelorden im siebzehnten Jahrhundert das klug begonnene Werk der Jesuiten zerstörte, so tritt jetzt der Fanatismus protestantischer Eiferer einer Annäherung hindernd in den Weg; es kann nur gewünscht werden, daß das zwanzigste Jahrhundert nicht einen Rückschlag zeitigen möge, wie das siebzehnte ihn gesehen.”
Rühmenswerte Ausnahmen bilden nach dem allgemeinen Urteil, das man in China zu hören bekommt, die vier deutschen protestantischen Missionen, die seit 1847 thätige Rheinische Missionsgesellschaft, die Berliner Gesellschaft zur Beförderung evangelischer Missionen, der Allgemeine evangelische Missionsverein und der Berliner Frauen-Missionsverein für China. Die drei erstgenannten Missionsgesellschaften, von denen die Berliner die größte und erfolgreichste ist, haben zusammen etwa 1500 bis 1800 chinesische Gemeindemitglieder aufzuweisen.
Herr v. Brandt sagt über die Missionen weiter: „Versucht man die Thätigkeit der katholischen und protestantischen Missionen nach ihrer erzieherischen Thätigkeit zu charakterisieren, so findet man, daß die ersteren mehr Wert auf praktische, die letzteren auf geistige Erfolge zu legen scheinen. Selbstverständlich besitzen beide besondere Schulen und Institute für die Ausbildung der für den Priesterstand bestimmten Chinesen, aber während in den Waisenhäusern und großen Schulen der katholischen Missionen die Knaben mehr für die praktischen Zwecke des Lebens vorgebildet und zu Handwerkern erzogen und die Mädchen in allen für die künftige Hausfrau erforderlichen Gegenständen unterrichtet werden, da die Erfahrung gelehrt hat, daß eine christliche Frau selbst in einer heidnischen Familie einen oft zur Bekehrung derselben führenden Einfluß auszuüben im stande ist, scheinen die protestantischen Missionen größeren Wert auf eine wissenschaftliche Ausbildung zu legen. Man könnte das eine als das System des Labora et ora, das andere als das des Ora et labora bezeichnen.”
Wurde von den englischen und amerikanischen Missionen bisher irgendwo ein thatsächlicher, wenn auch verhältnismäßig nur geringer Erfolg erzielt, so ist vor allem die Provinz Fukien zu nennen, und hier, ebenso wie auch in den andern Provinzen, hauptsächlich unter der Landbevölkerung, nicht in den Städten. So hat beispielsweise die bedeutendste und hervorragendste der protestantischen Missionsgesellschaften in China, die Christian Society in Shanghai, wo sie eine große Missionsanstalt besitzt, während vierzigjähriger Thätigkeit im ganzen 33 Bekehrungen erzielt. Arthur Moule, einer der angesehensten protestantischen Missionare in China, sagt in seinem Buche New China and old, daß in dem Hauptsitze der Church Missionary Society, also in der großen Stadt Futschau, nach elfjähriger angestrengter Thätigkeit die Zahl der Christen sehr gering und fast gar kein Fortschritt wahrzunehmen sei.
Knollys erzählt in seinem Buche English life in China, er sei einem Missionar begegnet, der während zwölf Jahren in China thätig war. Auf die Frage, wieviel Bekehrungen er in dieser Zeit vorgenommen hätte, nannte ihm der Missionar drei.
Ich selbst habe in Taingan-fu, im Herzen von Schantung, aus dem Munde des vielleicht ältesten Missionars, Dr. Crawford, einem Baptisten, vernommen, daß er in seiner sechsundvierzigjährigen Thätigkeit noch keine wahre Bekehrung zu seiner Glaubenssekte aufzuweisen hätte.
In Peking übertrug ein protestantischer Missionar während seiner zeitweiligen Abwesenheit die Besorgung der Kirche und des Gottesdienstes einem chinesischen Christen, an dessen vollständiger Bekehrung er dank siebenjähriger Erfahrung mit ihm nicht zweifeln konnte. Als der Missionar nach Peking zurückkehrte, erfuhr er, daß sein Stellvertreter in der Kirche eine Spielhölle etabliert habe. Mir selbst erzählte ein Prediger der christlichen Missionsgesellschaft, einmal seine Bekehrten dabei angetroffen zu haben, wie sie ihre buddhistischen Götzen verehrten und nach lang anhaltender Dürre um Regen baten. Als er sie darüber zurechtwies, antworteten sie ihm: „Dein Gott hat uns nicht geholfen, wir versuchen es jetzt mit unsern Göttern”. Wiederholt hörte ich von Missionaren die Ansicht aussprechen, daß sich Chinesen aus Spekulation dem Christentum zuwenden, indem sie sagen: „Buddha Gott ist gut, christlicher Gott auch gut, zwei Stück Gott noch besser”. Eine große Zahl Chinesen zeigen sich wenigstens äußerlich dem Christentum nicht abgeneigt, weil sie dann Gelegenheit haben, kostenfrei die Missionsschulen zu besuchen, die englische Sprache, Lesen, Schreiben und andere praktische Kenntnisse sich anzueignen. Sind sie damit fertig, so legen sie das Christentum wieder ab.
Aus diesen Beispielen, denen unzählige andere beigefügt werden könnten, ist zu ersehen, daß die Chinesen für das Christentum im allgemeinen bisher keine große Empfänglichkeit gezeigt haben, ja sie stehen den Missionaren, wie überhaupt allen Fremden, feindlicher gegenüber als jemals zuvor. Das beweisen die wiederholten[S. 384] Angriffe auf die Missionen, die Zerstörung von Kirchen, Wohnhäusern und Schulen, die Verfolgung und Niedermetzelung von Missionaren in fast allen Provinzen des weiten Reiches. Aber man braucht daraus nicht zu folgern, daß die Missionare den Chinesen besonders viel verhaßter sind als die übrigen Fremden. Haben die Missionare zunächst unter dieser Fremdenverfolgung zu leiden, so ist es vornehmlich deshalb, weil sie größtenteils mitten im Inlande zerstreut, fern von den offenen Häfen vollständig schutzlos leben und daher feindlichen Angriffen zu jeder Zeit ausgesetzt sind, während die große Zahl anderer Fremder in den offenen Häfen, die dort zeitweilig vorhandenen Kriegsschiffe und die regen Beziehungen mit Nachbarhäfen solche Angriffe viel schwieriger machen.
Der Schutz der Fremden in China ist eine der schwierigsten Aufgaben, welche die Mächte dort zu lösen haben, um so mehr, als es bisher der Zentralregierung in vielen Fällen thatsächlich an der Kraft und Möglichkeit gefehlt hat, den Fremdenschutz selbst durchzuführen. In Bezug auf die Missionare handelt es sich dabei nicht allein um das religiöse Moment. Was man von dem Vorgehen, der Gesittung und dem Wesen einzelner Gruppen von Missionaren auch halten mag, es darf nicht vergessen werden, daß die Missionare in China, gerade so wie anderwärts, nicht nur die Pioniere des Christentums, sondern auch die Pioniere europäischer Kultur und europäischen Handels sind. Wo die Missionen festen Fuß gefaßt haben, da werden die Chinesen mit europäischem Wesen vertraut, da ist es auch leichter, Handelsposten zu gründen, und zu dem idealen kommt mit der Zeit materieller Gewinn. Mit den Missionen stehen oder fallen die Hoffnungen, friedlichen Eingang in das Reich der Mitte zu erzielen. Schon deshalb verdienen und bedürfen die christlichen Missionen ohne Unterschied des Glaubens den weitgehendsten Schutz der Mächte. Mit Parlamentieren kommt man bei den Chinesen nicht vorwärts, eine Kanonenmündung flößt ihnen größeren Respekt ein als alle Gesandten zusammengenommen.
Seit 1891 sind in China, besonders im Stromgebiet des Jangtsekiang, Dutzende von Missionen zerstört und zahlreiche Missionare ermordet worden; diese Gewaltthaten vermehrten sich noch seit dem Abschluß des chinesisch-japanischen Krieges und erreichten ihren Höhepunkt in dem Ausbruch des Aufstandes in der Provinz Fukien, ja es hat den Anschein, als ob der Feldzug gegen die Missionen in einer Reihe von Provinzen systematisch betrieben würde.
Die englischen Blätter von Shanghai, Tientsin und Hongkong enthalten seit Jahren fast in jeder Woche Berichte über Christenverfolgungen, die sich nicht allein auf die europäischen Missionen beschränken, sondern auch gegen die chinesischen Christen gerichtet sind. Besonders hat man es dabei auf ansässige Missionare und ihre Niederlassungen in größeren Städten abgesehen, also gerade dort, wo sich Behörden und Garnisonen befinden.
Als hervorragendstes Beispiel der letzten Jahre können die Gewaltthaten in der Provinz Szetschuen im oberen Stromgebiet des Jangtsekiang an der tibetanischen Grenze gelten. Dort waren seit Jahren etwa dreißig katholische und protestantische Missionen thätig, mit eigenen Kirchen, Kapellen, Hospitälern und Schulen und über zweihundert Missionaren. In der Hauptstadt von Szetschuen, Tscheng-tu, befanden sich elf Missionen, und die katholische Mission war gleichzeitig der Sitz des Bischofs Dunand. Seit dem letzten Maitage des Jahres 1895 sind diese Missionen vom Erdboden verschwunden, mit ihnen wurden auch andere Missionen in den Provinzstädten zerstört, die Missionare angegriffen, verwundet und gewaltsam vertrieben. Der eigentliche Anstifter war kein anderer als der damalige Vicekönig der Provinz, Li-ping-Tschang, ein fanatischer Fremdenhasser. Während seiner neunjährigen Regierung hat er der Verbreitung des Christentums und europäischer Ideen unaufhörlich Schwierigkeiten in den Weg gelegt, und seinem Widerstand ist es zuzuschreiben, daß der obere Jangtsekiang für die Dampfschiffahrt so lange Zeit nicht freigegeben wurde.
Auch in Schansi, Yünnan, Hunan und Kiangsi gärt es fortwährend unter den Christenfeinden, und was Schantung betrifft, so fanden die Christenverfolgungen nach der Ermordung der deutschen Missionare Nieß und Henle nur eine zeitweilige Unterbrechung durch das energische Auftreten der Deutschen. Wagt man es nicht, den Europäern selbst entgegenzutreten, so wird die einheimische Bevölkerung gegen den Christenglauben aufgehetzt und die Wut der Leute auf die chinesischen Christen gelenkt. Auffällig war es bei all den Angriffen auf die christlichen Missionen, daß sie in verschiedenen Provinzen fast gleichzeitig vorfielen, und daß nach jeder Greuelthat die Telegraphenleitungen zwischen den betreffenden Provinzen und Peking oder Shanghai unterbrochen wurden. Erst nachdem den Ministern in Peking von seiten der fremden Vertreter energisch zu Leibe gegangen worden, waren die Telegraphen rasch wieder in Ordnung. Ebenso auffällig ist es, daß die Edikte zur Beschützung des Christentums, zur Bestrafung von Gouverneuren und Beamten, welche diese Beschützung unterlassen hatten, zur Auszahlung von Schadenersatz und dergleichen sehr selten in die Pekinger Regierungszeitung kommen. Man hat die Regierung deshalb stark in Verdacht, daß sie gegenüber den fremden Vertretern ein doppeltes Spiel treibt und indirekt die Ausschreitungen gegen Christentum und Fremdlinge duldet. Von seiten vieler Mandarine geschieht dies, wie allgemein anerkannt, ziemlich offen.
Der Grund davon liegt teils darin, daß die Mandarine fürchten, durch das Ueberhandnehmen der christlichen Kultur und des fremden Einflusses ihren Halt am Volk zu verlieren, teils darin, daß sie sich dem Fremdenhaß der Geheimbündler nicht offen gegenüberstellen wollen; wissen sie doch, daß ein Widerstand der geheimen Hunggesellschaft oder den Vegetarianern gegenüber die schlimmsten Folgen für sie[S. 386] selbst hätte. Deshalb hüten sie sich auch, selbst wenn ihnen die wahren Missethäter bekannt wären, sich an ihnen zu vergreifen. Um den Befehlen der Pekinger Regierung und den Anforderungen der fremden Vertreter Genüge zu thun, werden ein paar ganz unschuldige Menschen oder im letzten Fall ein paar Sträflinge aus den Gefängnissen um einen Kopf kürzer gemacht, die als Schadenersatz erforderlichen Summen vom Volke erpreßt, und die Sache ist erledigt. So ist es während der letzten Jahrzehnte gegangen, so wird es auch in Zukunft gehen, wenn nicht von seiten der Mächte ganz andere Schritte unternommen werden als bisher. Es genügt nicht, daß die Chinesen für jede zerstörte Mission, für den Kopf jedes ermordeten Missionars eine bestimmte Summe zu zahlen haben; es geht nicht, daß die Schuldigen straflos ausgehen und ein paar Unschuldige dafür ins Gras beißen. Es handelt sich nicht allein um das Leben des Missionars als einzelnen Menschen, das durch eine gewisse Summe gewissermaßen erkauft werden kann. Den Mandarinen würde dies dann immer ein, allerdings kostspieliger, Spaß bleiben, aber immerhin ein Spaß, den sie sich mit irgend einem Missionar heute oder morgen erlauben dürften. In Peking allein ist diesen elenden Verhältnissen durch Proteste der Vertreter und energisches Einschreiten derselben nicht abzuhelfen. Da die Regierung, wie gesagt, nicht immer die Macht oder Mittel hat, die Verbrecher exemplarisch zu bestrafen, so kann dies nur durch die Mächte geschehen.
Der Jangtsekiang, diese Hanptverkehrsroute Chinas, ist bis über Tschungking, also bis nahe an die tibetanische Grenze für kleinere Dampfer schiffbar, im Jahre 1899 wurde sogar eine deutsche Dampferlinie auf dieser Wasserstraße eingerichtet, und zeitweilig fahren auch englische, französische und deutsche Kriegsschiffe bis Hankau. Nützen die Proteste der Mächte zum Schutze der Missionare nichts, dann brauchen sich die Mächte auch nicht um etwaige Proteste der Chinesen gegen ein Vordringen der Kriegsschiffe bis Itschang und Tschungking zu scheren. Und wurden ägyptische, tunesische und marokkanische Häfen bombardiert, so braucht man vor den chinesischen nicht stille zu halten. Die Chinesen müssen vor dem Europäer Respekt bekommen und durch Schaden erfahren, daß er und sein Eigentum durch Kanonen geschützt wird. Allgemein wird in ganz China, ja in ganz Ostasien, ein gemeinschaftliches Auftreten der Mächte gefordert und die Flußpolizei auf dem Jangtse verlangt. Wäre in Tschungking ein Kanonenboot vor Anker gelegen, so hätten es sich die Chinesen wohl kaum einfallen lassen, die Missionen in Tscheng-tu anzugreifen, und wären nur hundert europäische Marinesoldaten von Futschau landeinwärts marschiert, mit dem Brennen und Morden in den Fukien-Missionen wäre sofort eingehalten worden. Einen ernstlichen Widerstand hätten die mit Bogen, Pfeilen und Feuersteingewehren bewaffneten chinesischen Soldaten in den Provinzen des Innern gewiß nicht geleistet. Allgemein wird auch ein kräftiges Einschreiten in Peking zur endlichen Anlage von Eisenbahnen verlangt, die vor allem andern[S. 387] der Zentralregierung in Peking selbst vom allergrößten Nutzen wäre. Nur mit Eisenbahnen kann das Land regiert werden, durch Eisenbahnen können Aufstände im Keime rasch unterdrückt, die Zentralgewalt des Kaisers befestigt werden. Diese Erfahrungen wurden ja in einer Anzahl anderer Länder gemacht, zuletzt in Mexiko. Vor der Aera der Eisenbahnen verging kein Jahr ohne Pronunciamento, ohne Revolution. Seitdem das Eisenbahnnetz von Amerikanern hergestellt wurde, reicht der Arm der Zentralregierung bis in entfernte Winkel des Aztekenreiches. Dasselbe würde in China geschehen, dann erst wären die Mandarine sofort am Kragen zu fassen, dann Ordnung im Lande zu erhalten. Last, not least würden die Eisenbahnen die ungeheuren Schätze Chinas eröffnen, den Missionen und Handelsleuten und damit dem europäischen Handelsverkehr und Export Schutz und Förderung gewähren. Kräftiges, gemeinsames Auftreten in Peking, Kriegsschiffe auf den Flüssen und in Tientsin würden den Widerstand der starren Mandarine wohl brechen. Freilich kosten derlei Expeditionen Geld, allein die Summen sind verschwindend im Verhältnis zu dem Nutzen, welcher Europa durch die Eröffnung des chinesischen Reiches in den Schoß fiele. Vor einigen Jahrzehnten, im Jahre 1853, waren es die amerikanischen Kriegsschiffe, welche, mit ihrem wackern Commodore Perry an der Spitze, auf dieselbe Weise die Eröffnung von Japan erzwangen. Wenige Schiffe mit ein paar hundert Mann haben dazu hingereicht, der Welt ein großes asiatisches Reich zu erschließen. Haben wir seither keine Fortschritte gemacht? Haben die vereinten Großmächte nicht die Mittel und die Kraft, dieselbe Prozedur mit China vorzunehmen? Ist kein Perry mehr da? Mit christlicher Liebe allein ist noch kein orientalisches Reich den Europäern geöffnet worden. Immer und überall mußte die Gewalt mitsprechen. Die alten, erstarrten, den Fremden trotzenden Mächte sind wie Austern. Man muß sie mit Gewalt öffnen, dann sind sie tot und können von den Europäern verspeist werden.
Um sich eine Vorstellung von den Schwierigkeiten des Reisens in China zu machen, muß man sich zunächst vor Augen halten, daß es im ganzen chinesischen Reiche keine Straßen, keine fahrbaren Wege nach unseren Begriffen giebt. Wohl sind in früheren Jahrhunderten (man könnte von Jahrtausenden sprechen) einzelne sogenannte Kaiserstraßen angelegt worden, die in den ersten Jahrzehnten ihres Bestehens besser gebaut waren als unsere Chausseen. Dieser Straßenbau erfolgte aber in vielen Fällen nicht etwa, um den Bedürfnissen des Verkehrs zu entsprechen, sondern nur auf Routen, welche die Kaiser des Reiches zu bereisen beabsichtigten. Als beispielsweise die Residenz von Peking nach Nanking und ein paar Jahrhunderte später wieder von Nanking nach Peking verlegt wurde, baute man zwischen diesen beiden Städten quer durch die Provinzen Kiangsu, Schantung und Petschili eine vorzügliche Straße, deren Spuren ich vom Jangtsekiang nach Norden an verschiedenen Stellen begegnet bin. So z. B. in der Nähe von Yangtschou, der früheren Hauptstadt des längst vergangenen Yangreiches, in welcher vor mehr als siebenhundert Jahren der berühmte Venetianer Marco Polo drei Jahre lang Gouverneur war. Dann wieder in verschiedenen Teilen von Westschantung, wo mir stellenweise die großen, durch eine Art Zement miteinander verbundenen Steinquader die Richtung der einstigen Kaiserstraße anzeigten. In China werden, wie schon früher erwähnt, Pagoden und Tempel, Wohnhäuser, Straßen und Brücken selten ausgebessert; einmal gebaut, bleiben sie sich selbst überlassen. Geschieht es zeitweilig doch, dann sind es weniger die Mandarine, die dafür Geld opfern, sondern die Bürger der an der Verkehrsroute liegenden Ortschaften, die es als wohlthätiges Werk betrachten und gewöhnlich an den Brücken oder Wegstrecken, welche sie auf ihre Kosten ausbessern lassen, womöglich schon vor der Ausbesserung eine Steintafel aufstellen, auf welcher in großen Lettern ihre Namen und ihre That verewigt sind. Nur wenn ein Provinzgouverneur oder gar der Kaiser (was freilich schon jahrzehntelang nicht mehr geschehen ist) eine Reise durch ein bestimmtes Gebiet unternehmen soll, dann werden die Wege durch die Mandarine in die schönste Ordnung gebracht. Alle zehn Jahre reist beispielsweise der Kaiser oder ein Prinz als sein Stellvertreter von der Hauptstadt durch Petschili und die chinesische Mandschurei nach Mukden, um dort nach altem Herkommen an den Gräbern seiner Vorfahren zu opfern. Ungeheure Summen werden dann angewendet, um den elenden Weg mit Steinen zu pflastern, alle Unebenheiten auszufüllen und das ganze Straßenbett mit gelbem Sand zu überschütten. Alle Dörfer und Städte längs der ganzen Strecke werden bis auf den letzten Heller gebrandschatzt. Von sieben zu sieben Kilometern werden längs der Straße Pavillons als Rastorte errichtet und mit den[S. 389] kostbarsten Seidenstoffen und Stickereien ausgeschmückt. Selbst wenn der Kaiser nicht in eigener Person die Wallfahrt unternimmt, sondern an seiner Statt nur sein Bildnis nach Mukden schickt, muß dies geschehen. Auf der jüngsten Flucht des Kaiserhofes von Peking nach dem Westen waren die Straßen gewiß in schönster Ordnung. Der Telegraph mußte spielen, Meldereiter wurden vorausgesandt, um den Mandarinen das hohe Glück zu verkünden, daß die Kaiserin in nächster Zeit passieren würde, und die Mandarine preßten die Bevölkerung in den Dienst, um die Wege in aller Eile herzurichten. Leider finden aber diese Reisen des Kaiserhofes und der hohen Excellenzen nur zu selten statt, und deshalb spotten die Wege in den meisten Gegenden jeder Beschreibung. Stieß ich bei meinen Fahrten auf Teile der Kaiserstraßen, dann wich ich ihnen sorgfältig aus und zog mit meiner Karawane gewöhnlich rechts oder links in die Felder, denn die alten Granitquader haben sich an vielen Stellen gesenkt, ein Block steht einen Fuß unter, der nächste oder zweitnächste um einen Fuß über dem anderen. Streckenweise fehlten sie ganz, und tiefe Löcher traten an ihre Stelle. Diese Straße zu benutzen, hätte meinen federlosen Karren wohl die Räder und Achsen, meinen Zugtieren die Beine gekostet. Und doch haben Straßen das chinesische Reich durchzogen, als die ägyptischen Pyramiden noch nicht gebaut waren. Kaiser Hwang-Li, der eigentliche Gründer des Reiches war es, der zuerst im Jahre 2640 vor Christi Geburt, also vor etwa viereinhalb Jahrtausenden, gepflasterte Straßen nach allen Großstädten anlegen ließ. Wäre seinem Beispiel doch nur von einigen seiner Nachfolger gefolgt worden!
Im nördlichen Teile Chinas sind Landwege (Straßen kann man diese über Stock und Stein führenden Routen nicht nennen) viel häufiger als südlich des Jangtsekiang, denn im Norden giebt es viel weniger Flüsse und Kanäle. Wären solche vorhanden, dann gäbe es keine Landwege, denn der Chinese benutzt, wo immer möglich, nur Wasserwege. Selbst Großstädte sind untereinander nur durch solche, für Karren kaum benutzbare Wege miteinander verbunden, und ein europäischer Reisewagen könnte auf keiner Straße in China zehn Kilometer zurücklegen, ohne daß die Achsen brechen würden. Am besten sind die Wege auf ebenem Boden und in den Alluvialgebieten von Westschantung und Petschili. Dort giebt es keine Steine; wo in der Nähe von Städten die Wege mit Steinen gepflastert waren, sind die letzteren längst von der Bevölkerung zum Hausbau weggenommen worden, was dem Reisenden keineswegs unangenehm ist, denn, wie bemerkt, haben die chinesischen Reisekarren keine Federn. Der Wagenkasten, einem großen, nach vorne offenen Reisekoffer ähnlich, sitzt direkt auf der schweren Holzachse zwischen den beiden Rädern, und man kann sich lebhaft vorstellen, welche Reiseeindrücke man auf holperigen Steinstraßen von unten hinauf erhält, zumal der Wagenkasten keine Sitze hat. Der Reisende kriecht von der Gabeldeichsel aus auf allen Vieren in den Karren und nimmt direkt auf dem nackten Holzboden Platz.
Wo keine Straßenpflasterung vorhanden ist, sind die zwischen den Feldern sich dahinschlängelnden, viel gewundenen Wege in der trockenen Jahreszeit natürlich mit knietiefem Staub, in der nassen Jahreszeit mit eben so tiefem dünnflüssigen Kot gefüllt, man fährt also ziemlich weich dahin, hat aber dafür nach einer Stunde Fahrt eine fingerdicke Schicht Staub oder Straßenkot auf dem Leibe und den Augen, Nase und Lunge damit halb verklebt. Stellenweise sind längs der großen Verkehrsrouten schattige Bäume vorhanden, die einzige Labsal während der ermüdenden, anstrengenden Reisen. In bevölkerten Gegenden reist man im allgemeinen ziemlich sicher, in einsameren wird der Reisende nur zu häufig von Räubern angehalten, besonders im Hochsommer, wenn der Sorghum auf den Feldern zu beiden Seiten des Weges zu Manneshöhe gewachsen ist und die Wegelagerer vollständig gedeckt sind und ohne jede Gefahr für sich ihrem einträglichen Beruf nachkommen können. Der fremde Reisende, welcher das Glück hat, einen kaiserlichen Reisepaß zu erhalten und überdies an die hohen Mandarine empfohlen ist, erhält gewöhnlich von den Mandarinen der Ortschaften, die er passiert, eine Anzahl Soldaten als Schutz, aber ich verließ mich wenig auf meine überdies nur mit Stöcken oder alten ungeladenen Pistolen bewaffnete Begleitmannschaft, sondern hielt meinen Revolver schußbereit. In einsameren Gegenden, sowie auf den sogenannten kaiserlichen Hauptrouten sind die Wege durch eine Art Landjäger bewacht, oder sollen es wenigstens sein. Auf Hunderten von Kilometern, die ich diese Straßen entlang gewandert bin, sah ich trotz dem vielen Raubgesindel, das die Gegend dort unsicher machte, nicht einen einzigen Soldaten; doch sagte man mir, die Wachthäuser, die sich alle zwei Kilometer neben der Straße erheben, wären zur Nachtzeit von mehreren Soldaten besetzt. Wozu, ist mir nicht klar geworden, denn der Chinese reist zur Nachtzeit nicht, es ist also auch niemand zu beschützen. Diese Wachthäuser sind eine charakteristische Beigabe der Kaiserstraßen. In den Ueberschwemmungsgebieten des Hoangho stehen sie auf drei bis fünf Meter hohen Erdpyramiden und zeigen nach der Straßenseite eine von einer Mauer umsäumte Veranda, in anderen Gegenden stehen sie in gleicher Höhe mit dem Straßenboden, und von ihren Ecken laufen diagonal zwei mannshohe, mehrere Meter lange Lehmwände aus, wie Schutzleder für Pferdeaugen. Ihren Zweck konnte ich nicht erfahren. Die weißgestrichenen Mauern tragen in riesigen schwarzen Schriftzeichen die Bezeichnung „Wachthaus für Straßenpolizei”. Das Innere dieser Häuschen ist jeder Einrichtung bar, nicht einmal Strohmatten liegen auf dem Boden, dafür zeigen sich gewöhnlich viele Beweise, daß diese Regierungsbauten von den Passanten für Zwecke benutzt werden, zu denen man gewöhnlich die Einsamkeit und Dunkelheit aufsucht.
Wo Flüsse und Bäche zu überschreiten sind, giebt es an den Kaiserstraßen überall Brücken, die meisten aus Steinquadern mit riesigen Pfeilern erbaut, aber mit so holperigem steinernen Pflaster auf dem Brückenbett, daß die Reisenden zur Sicherung[S. 391] der Körperteile, auf denen sie sitzen, die federlosen Karren zu verlassen pflegen. Viele Brücken sind eingestürzt, und neben den Ruinen hat irgend ein unternehmender Chinese aus Bambusstangen und Reisstroh eine fliegende Brücke angelegt, für deren Passierung er von dem Reisenden einen kleinen Betrag erhebt. Freilich senkt sich diese Brücke zuweilen bis in das Wasser, oder ein schwerer Karren bricht mit den Rädern durch das Strohbett, aber wer hinüber will, muß sich eben dieser Gefahr aussetzen. Sind die Flüsse tief genug, dann treten an die Stelle solcher Brücken Fährboote. Auf großen Verkehrsrouten machen die Eigentümer derselben vortreffliche Geschäfte, und zuweilen fand ich an beiden Ufern Dutzende von Karren, Hunderte von Reisenden mit Pferden und Maultieren auf die Beförderung an das jenseitige Ufer wartend. Sobald ich aber mit meiner, nur einem hohen Mandarin gebührenden Begleitmannschaft erschien, mußte alles Platz machen, und ich hatte den Vorzug, mit der ganzen Reisekarawane allein sofort übergesetzt zu werden, ohne daß man eine Zahlung von mir begehrte. Ich leistete sie indessen doch in allen Fällen. Mandarine sind nämlich in China die größten Freiberger. Sie haben überall den Vortritt, und alle Verkehrseinrichtungen, sogar der Aufenthalt in den Mandarinsyamen der verschiedenen Städte, in denen sie übernachten, sind frei, während der Ortsmandarin verpflichtet ist, sie und ihr Gefolge zu verpflegen. Natürlich thun sie das auch nicht aus eigener Tasche, sondern das Volk muß herhalten.
Die gewöhnlichen Reisenden werden auf die verschiedensten Arten ausgebeutet. So traf ich beispielsweise an dem Westschantung durchfließenden Tawönho, über welchen mein Weg mich nach dem Kaiserkanal führte, keine Brücke und keine Fährboote, sondern nur eine Furt. Am Ufer lagerten einige zwanzig junge Burschen, welche ein Geschäft daraus machen, für einige Kupfermünzen Zahlung die Reisenden durch die gelben trüben Fluten zu führen. Damit ihnen dieser Verdienst nicht entgehe, graben sie an verschiedenen Stellen des Flußbettes unter dem Wasser tiefe Löcher und lassen nur eine schmale, ihnen allein bekannte Furt frei. Würde es einem Reisenden einfallen, den Fluß ohne ihre Führung zu durchschreiten, so ist zwei gegen eins zu wetten, daß er in eines dieser Löcher fällt, und dann muß er erst recht die Hilfe der Burschen in Anspruch nehmen, um für zehnfache Zahlung seinen Karren wieder herauszuziehen.
Ueber den ganzen Unterlauf des Hoangho giebt es keine einzige Brücke. Die letzte Brücke befindet sich bei der alten Kaiserstadt Kaifung.
Angenehmer als auf den Kaiserstraßen reist man auf den gewöhnlichen Landwegen, welche die nördlichen Provinzen durchziehen, aber wohlverstanden nur im Frühjahr und Herbst, denn zu anderen Zeiten stehen diese Wege unter Wasser oder sind mit knietiefem Staub bedeckt. Sie sind wenigstens nicht gepflastert und weisen auch nicht so viele Verkehrsstockungen durch Kamel- und Karrenkarawanen auf, die sich[S. 392] gewöhnlich den Hauptspaß machen, mitten auf den Straßen ihre Rasten zu halten. Ehe die Karren, Waren, schlafenden Tiere und Menschen aus dem Wege geräumt sind, vergeht geraume Zeit. Schlimm werden die Reiseverhältnisse, wenn man die Provinzen Anhuei, Kiangsu und Ostschantung verläßt und am unteren Hoangho das ungeheure Lößgebiet betritt, welches, stellenweise schon in Westschantung auftretend, den größten Teil von Schensi, Schansi und Honan umfaßt, ja auch noch viele Tausende Quadratkilometer der westlichen Mongolei einnimmt. Ich stieß auf die ersten Lößmassen am Nordostfuß der Gebirge von Mittelschantung. Karrenräder und Pferdehufe reißen den trockenen, aus feinstem Sand und Erdteilchen bestehenden Boden auf, und der Wind trägt die gelockerte, staubige Schicht fort; kommen Regengüsse, so fließt das Wasser durch den tiefen Wegeinschnitt ab und wäscht diesen noch tiefer. Wird das während Jahrtausenden fortgesetzt, wie es in China der Fall war, so wird aus dem ursprünglich im gleichen Niveau mit der Ebene liegenden Wege eine enge tiefe Schlucht mit senkrechten Wänden auf beiden Seiten. Die Dörfer, Felder, Gärten sind oben, die Wege fünf, zehn, zwanzig und mehr Meter tief unter ihnen. Wo die Lößschichten nicht so stark und die Wege demgemäß nicht so tief eingesunken sind, pflegen Fußgänger diesen, auch noch mit knietiefem, gelbem Staub gefüllten Wegschluchten auszuweichen und oben den Rand derselben entlang zu wandern. Schubkarren, Maultierkarren und Reiter aber müssen durch diese Schluchten, die mitunter viele Kilometer lang sind und nur wenige Unterbrechungen oder Erweiterungen zeigen. Dabei sind die Wegschluchten mit ihren senkrecht aufstrebenden kahlen Lößwänden unten kaum zwei Meter breit. Kommen zwei Karren in entgegengesetzter Richtung gefahren oder auch nur Lastschubkarren, so können sie einander nicht ausweichen. Hier lernte ich zum erstenmal den Wert meiner sonst wenig nützenden Soldatenbegleitung recht kennen; denn kamen wir zu einer derartigen Wegschlucht, so ritt einer der Soldaten rasch voraus, um die etwa entgegenkommenden Karren vor dem Einfahren in die Schlucht zu warnen. Mitunter kam aber dieser bezopfte Vortrab zu spät, eine ganze Kolonne von Lastkarren war bereits eingefahren, und dann galt es für uns, in diesen backofenheißen, staubigen, sonnigen, trockenen Schluchten zu warten, bis die Kutscher ihre Zugtiere ausgespannt, mit unsäglicher Mühe und Gefahr aus den senkrechten Wänden eine kleine Höhlung gegraben hatten, um die Tiere zurückführen und hinten wieder an die Karren spannen zu können. Nun konnten sie die Karren wieder aus der Schlucht heraus bis zur nächsten Ausweichestelle führen, und der Weg war für meine Karawane frei. Keiner wagte es, darüber sich aufzuhalten; sobald sie die nur durch ihre roten oder blauen Kittel erkennbaren, zuweilen ganz unbewaffneten Soldaten gewahrten, gehorchten sie ohne Widerrede.
Um diese höchst beschwerlichen und zeitraubenden Unterbrechungen zu verhindern, pflegen die Kutscher beim Einfahren in die Schluchten mit ihren langen Peitschen[S. 393] zu knallen und laute, langgezogene Warnungsrufe erschallen zu lassen. Mitunter hören sie einander auch deutlich, aber einer hofft auf die Nachgiebigkeit des anderen, beide fahren darauf los, bis sie einander auf der Nase sitzen. Dann geht das Geschimpfe und das Geschrei los, aber was macht’s? Die Chinesen haben ja Zeit, und kommen sie nicht heute ans Ziel, so doch morgen.
Viel tiefer eingeschnitten sind die Wege in Schansi und Honan, und dabei sind sie viele Tausende von Kilometern die einzigen Verkehrsrouten. In den senkrechten Lößwänden, zwischen denen man über sich nur einen schmalen Himmelsstreifen wahrnimmt, giebt es sogar Wohnungen der Landleute, Hotels, Tempel und Götzenschreine. Die Leute graben sich lange Galerien, die sie als Wohnzimmer, Küchen und Vorratskammern einrichten, die Reisenden müssen in ähnlichen Höhlen einkehren, die sie mit ihren Dienern und Zugtieren teilen. In manchen Gebieten haben die Lößablagerungen, welche ein Flußthal, und damit auch eine Stadt, von dem nächsten Flußthal mit dem Reiseziele trennen, Hunderte von Kilometern Ausdehnung, und einmal in der Wegschlucht, kann man nicht wieder heraus, ausgenommen auf steilen Pfaden, die sich gewöhnlich am Zusammenfluß zweier Schluchten die senkrechten Lößwände hinanschlängeln. Man kann unter diesen Umständen begreifen, warum einflußreiche Mandarine schon lange darauf hinwirken, die Kaiserresidenz von dem für Europäer leicht erreichbaren Peking mitten in die Lößgebiete nach dem alten Singanfu zu verlegen. Dort wäre die Regierung der Beeinflussung durch europäische Kriegsschiffe und Kanonen entrückt, dorthin kann niemals ein europäisches Heer gelangen, und die Mandarine könnten nach Belieben schalten und walten. Engpässe wie die Lößwege von Schansi und Honan habe ich nur noch im nördlichen Arizona gefunden. Eine geringe Anzahl Leute genügt, um auch der stärksten Armee den Durchgang zu wehren, und aus diesem Grunde allein schon wäre es einem Heere unmöglich, auf der Route durch Schansi und Honan gegen Singanfu vorzugehen.
Während sich der ungemein lebhafte Verkehr zwischen den großen Städten und Handelsmittelpunkten nördlich des Jangtsekiangs auf den geschilderten Landwegen abwickelt, findet der weitaus größte Verkehr in den südlich des Jangtsekiangs gelegenen Provinzen auf dem Wasser statt. Der Chinese benützt Flüsse und Kanäle in viel größerem Maße, als es in Europa der Fall ist. Schon Kaiser Hwang-ti, unter dessen Regierung die Chinesen, lange vor den Phöniziern, zum erstenmal die offene See befuhren, ließ vor 4500 Jahren ein ausgebreitetes Netz von Kanälen anlegen, und dieses wurde im Laufe der Zeiten vervollständigt, wo immer sich nur eine Gelegenheit darbot. Im Süden des Reiches, vornehmlich in Kwangtung, sind die Flüsse die Hauptstraßen, und Straßen auf dem Festlande wurden dort nicht als Verbindungen zwischen Handelszentren, sondern zwischen zwei nicht durch Kanäle zu verbindenden Wasserstraßen angelegt. Das südliche China ähnelt mit seinen Wasserstraßen Holland. Diese gewöhnlich nur kurzen Landwege sind im Süden in[S. 394] viel besserer Verfassung als im Norden, und selbst Pfade im Hinterlande sind zuweilen mit großen Granitplatten gepflastert, die durch eine Art Zement miteinander verbunden sind. Am auffälligsten zeigt sich das Gewirr von Kanälen dem Reisenden im südlichen Kiangsu und in Tschekiang, im Gebiet der großen Handelsstädte Sutschau und Hangtschau. Fast der gesamte Handels- und Personenverkehr spielt sich auf den Kanälen und Flüssen ab. Ist die Wasserreise auch zeitraubender, so ist sie doch unvergleichlich wohlfeiler als der Landverkehr, und das ist ein Umstand, der bei den vielen Eisenbahnprojekten eine viel viel zu wenig berücksichtigte Rolle spielt. Gewinnsüchtige Unternehmer in Europa haben für den Süden Chinas ein ganzes Netz von Eisenbahnen ausgeheckt, aber sie sollten die Sache doch eingehender prüfen, ehe sie das europäische Kapital zur Beteiligung einladen. Bei einem so ausgebreiteten Kanalverkehr ist der Unterschied in den Transportkosten zwischen Eisenbahn und Wasser ein so gewaltiger, daß er für die Chinesen die Vorteile einer schnelleren Beförderung weitaus aufwiegt. Ueberdies wären über dieses Netzwerk von Kanälen so viele Brücken zu bauen, in dem weichen Boden so kostspielige Fundierungen vorzunehmen, daß die Kapitalsanlage in vielen Fällen kaum eine entsprechende Verzinsung finden würde. Deshalb ist unter anderen auch Hongkong mit der Zweimillionenstadt Canton noch durch keine Eisenbahn verbunden.
Anders liegen die Verhältnisse im Norden, vornehmlich in Schantung und Petschili, und dementsprechend sind auch die meisten, ja fast einzigen Bahnen bisher nur in diesen Provinzen zur Ausführung gekommen. In Schantung giebt es so gut wie keine Wasserwege, der sehr bedeutende Verkehr steht im Zeichen des Schubkarrens und Packesels, und dort werden sich die im Bau begriffenen Eisenbahnen, zunächst jene von Tsingtau nach Tsinanfu, vortrefflich lohnen. Dabei kommt ihnen der Umstand zu statten, daß es sozusagen dort, wie bemerkt, gar keine Straßen giebt und die Mandarine sich im allgemeinen um die Verkehrswege nicht im mindesten kümmern. Freilich ist ungeachtet der elenden Verkehrsverhältnisse das Reisen in Schantung doch sehr wohlfeil. Warentransporte kosten durchschnittlich für je 100 Li und 100 Kattie (= 1 Pikul = 60½ Kilogramm) 50 bis 70 Pfennig. So z. B. kostet der Transport von Tsinanfu nach Peking, etwa 1000 Li (nahe an 500 Kilometer), 5 Mark für den Pikul. Die Kosten eines Karrens oder einer der in Ostschantung gebräuchlichen, von Maultieren getragenen Sänften, Schen-tze genannt, belaufen sich für den Tag auf 3 Mark, und damit kann der Reisende täglich 60 bis 70 Kilometer zurücklegen. Werden auf den neuen Bahnen in Schantung dieselben Fahrpreise gerechnet wie in Deutschland, etwa 6 Pfennig der Kilometer in zweiter Klasse und 4 Pfennig in dritter Klasse, so würden sich die Transportkosten bei einer Tagesreise von etwa 400 Kilometer auf 24 resp. 16 Mark stellen. Die Reise im Karren würde auf derselben Strecke etwa 20 Mark kosten, aber eine Woche Zeit in Anspruch nehmen, so daß die Chinesen wohl die Eisenbahn vorziehen würden.
Im ganzen sind bis heute in China gegen 450 Kilometer Eisenbahnen in Betrieb. Die längste ist die von Tientsin über Tongschan und Tongku nach Schanhaikwan an der großen Mauer führende Bahn mit 214 englischen Meilen. Eine zweite Bahn läuft von Taku über Tientsin nach Peking, eine dritte von 80 englischen Meilen Länge von Peking nach Pautingfu. Die Fahrgeschwindigkeit beträgt auf diesen Bahnen nur 20 englische Meilen in der Stunde. Sonst giebt es in China nur noch die Bahn von Woosung nach Shanghai und eine kurze Kohlenbahn am Jangtsekiang. Die Bahn von Peking nach Pautingfu soll von einer belgischen Gesellschaft durch Schansi nach Kaifung und von dort nach Hankau verlängert werden. Kommt sie zu stande, dann öffnen die glänzenden Stahlschienen wie mit einer Lanzette das Herz des chinesischen Reiches, dann ist Honan und damit auch Singanfu leicht erreichbar, in Berührung mit der abendländischen Welt. Aber bis dahin wird noch eine lange, sehr lange Zeit vergehen. Die Chinesen werden noch viele Jahre fortfahren, ihre bisherigen Verkehrsmittel anzuwenden, und ob sie die Eisenbahn durch Schansi und Honan, wenn sie einmal gebaut ist, auch so rasch benutzen werden, ist noch fraglich.
In Honan, wo ähnlich wie in Schantung der Transport vielfach mit Schubkarren erfolgt, kostet ein solcher mit einem Mann 50 bis 80 Pfennig, bei einer täglichen Durchschnittsfahrt von 30 Kilometer; ein Ochsenwagen, der dieselbe Strecke zurücklegt, kostet je nach der Beschaffenheit der Straße 2 bis 3 Mark täglich. Der Preis eines mit zwei Maultieren bespannten Karrens vom Jangtsekiang bis Peking kostet einschließlich der Unterkunft und Mahlzeiten 70 bis 80 Mark. Die etwa 1000 Kilometer lange Strecke wird in zwei bis drei Wochen zurückgelegt. Bei diesen Verhältnissen ist es zweifelhaft, ob eine Bahn in Honan, die unverhältnismäßig hohe Baukosten erfordert, auf einer gesunden finanziellen Grundlage stehen wird.
Angesichts der neuesten Unruhen in China, der ewigen Gefahr, in der die Fremden dort leben, der großen Opfer an Menschen und Geld, der kostspieligen militärischen Expeditionen, welche die Beziehungen Europas mit dem Reiche der Mitte zur Folge gehabt haben und voraussichtlich noch in Zukunft haben werden, hört man die Frage: Hat der Handel mit China überhaupt eine so große Bedeutung, daß er diese Opfer rechtfertigt; wäre es nicht besser, sich anderen Gebieten zuzuwenden und deren Erschließung anzustreben?
Wie groß ist dieser Handel? Im Jahre 1898 belief sich im Gesamtwert die Ein- und Ausfuhr, soweit die in den Vertragshäfen bestehenden Zollbehörden ihn kontrollieren, auf etwa elfhundert Millionen Mark. Diese Summe erscheint nicht groß, wenn man bedenkt, daß der Außenhandel des kleinen Belgien einen Wert von über zweiundzwanzighundert Millionen besitzt, also das Doppelte des Außenhandels von China. Selbst Argentinien hat trotz seiner Jugend als Staat bereits einen Außenhandel von nahezu tausend Millionen Mark. In einer Reihe anderer Staaten entwickeln sich die Handelsbeziehungen mit Europa ruhig, ohne besondere Schwierigkeiten, ohne jedwede Opfer und militärische Expeditionen. Warum, so hört man fragen, sollen also die Steuerzahler wegen des verhältnismäßig geringen Handels so tief in den Säckel greifen?
Und dennoch geschieht dies seitens fast aller Seemächte. Neben dem Deutschen Reiche sind bei den letzten Unruhen England, Frankreich, Oesterreich-Ungarn, Italien, Rußland, Holland, selbst das kleine Belgien an der Expedition gegen China beteiligt gewesen, dazu die Vereinigten Staaten und Japan. Freilich stand dabei zunächst die Aufgabe im Vordergrunde: Bestrafung des Bruchs des Völkerrechts durch die[S. 397] Mißhandlung der Gesandten seitens der chinesischen Machthaber, man könnte besser sagen, der chinesischen Ohnmachtshaber, Sühne für die vielen Menschenleben, die schweren Verluste an Hab und Gut der fremden Einwohner. Aber dabei wurden doch auch geschäftliche Interessen verfolgt, und man dachte auch an den Nutzen, welchen die Expedition nach dem Friedensschluß für die verschiedenen Mächte bringen soll.
Ebenso sicher, wie die endliche Niederwerfung Chinas durch die verbündeten Streitkräfte, ist es auch, daß eine Aufteilung Chinas in absehbarer Zeit nicht stattfinden wird. Im Gegenteile, statt als Kriegsbeute verschiedene Provinzen und Länderstriche einzuheimsen, haben die Mächte alles Interesse daran, das chinesische Reich intakt zu erhalten und ihm eine feste, starke Regierung zu geben, sogar unter der Leitung eines Kaisers aus der gegenwärtig herrschenden Dynastie. Ganz abgesehen von der Eifersucht unter den Mächten bei einer Aufteilung und der Unmöglichkeit einer Einigung über die von jeder Macht beanspruchten Gebiete, hat man sich gewiß schon in jedem Kabinette gefragt, auf welche Weise und zu welchem Zwecke die verschiedenen Provinzen des aufgeteilten Vierhundertmillionenreiches von den Mächten regiert und verwaltet werden sollten. Es ist ja hinlänglich bekannt, welchen Aufwand an Geld, Beamten, Militär, Schiffen und dergleichen schon ein Landgebiet von der Größe einiger hundert Quadratkilometer, etwa wie Deutsch-China, erfordert. Wie viele Hunderte Millionen, Zehntausende von Soldaten, Hunderte von Beamten würde erst die Verwaltung einer ganzen Provinz bedürfen! Es handelt sich bei den chinesischen Provinzen um Ländergebiete so groß wie Preußen oder ganz Süddeutschland, mit Einwohnerzahlen von zwanzig bis vierzig Millionen. Selbst wenn solche Gebiete an die erobernden Reiche angrenzen würden, wie etwa Nordchina an Sibirien, würden solche Bissen in Anbetracht der heterogenen feindlichen Bevölkerung nicht zu verdauen sein. Wie erst, wenn man die ungeheure Entfernung Chinas von den mitteleuropäischen Reichen in Betracht zieht! Der Krieg der Amerikaner gegen das im Vergleich mit den Chinesen verschwindend kleine Völkchen der Philippiner, der Frankreichs gegen Tonkin und Englands gegen die handvoll Boeren sprechen deutlicher, als es alle Argumente vermögen.
Und selbst wenn eine solche Verwaltung unter der Anspannung aller Kräfte doch eingerichtet würde, so würde die Frage entstehen: wozu? Was ist der Nutzen, den ein solch unsinniges Wagnis hätte? Die Erschließung der betreffenden Provinz? Die Hebung der Kaufkraft ihrer Bevölkerung? Die Schaffung eines neuen Absatzgebietes? Würde das letztere wirklich ausschließlich der Industrie der betreffenden Kolonialmacht zu gute kommen, dann wäre dies zum wenigsten etwas Greifbares, obschon viele Jahrzehnte der Aufwand unverhältnismäßig größer sein würde als der Ertrag. Das Spiel wäre die Kerzen nicht wert, die man dabei verbrennt. Aber das ausschließliche Recht der kommerziellen Ausbeutung einer Provinz würde von[S. 398] anderen Mächten niemals zugestanden werden. Mehrere haben mit Säbelgerassel erklärt, unter allen Umständen an der Politik der offenen Thür festzuhalten. Gleiches Recht, gleiche Handelsfreiheit für alle Mächte ist ihre Politik in Bezug auf den chinesischen Markt, und eine Macht, welcher es gelingen sollte, eine Provinz als Kriegsbeute zu ergattern, würde dann einfach nur anderen Mächten, zunächst den Japanern und Amerikanern, die Kastanien aus dem Feuer holen. Wohl ist heute und wohl auf Jahrzehnte hinaus England am chinesischen Handel am meisten beteiligt, aber der Handelsverkehr Japans und Amerikas mit China geht mit Riesenschritten vorwärts; sie haben heute schon alle anderen Mächte, England ausgenommen, überholt, und dank ihrer günstigen geographischen Lage, geringen Frachtsätzen und anderen Umständen wird in Zukunft unzweifelhaft ihnen der Hauptanteil am chinesischen Handel zufallen. Provinzen auf Kosten europäischer Steuerzahler zu erschließen, oder gar die Verwaltung selbst zu übernehmen, hieße also, den genannten großen Handelsrivalen in die Hände arbeiten.
Ueber diese Fragen ist man in den europäischen Kabinetten wohl schon längst im klaren. Es giebt in China keine Provinzen zu holen, keine Kolonien zu gründen, und doch besteht unter allen Industriemächten ein wahrer Wetteifer in Bezug auf China.
Der Grund und Endzweck dieser Bestrebungen ist der Handel, nicht wie er heute ist, denn schon eingangs wurde angeführt, daß er im ganzen nur die Summe von elfhundert Millionen erreicht, sondern der Handel Chinas, wie er sich in Zukunft gestalten wird. Er ist bisher deshalb nicht bedeutender gewesen, weil zunächst nur eine kleine Anzahl von Häfen dem Außenhandel geöffnet waren und es von den wenigsten derselben Verkehrswege nach dem Hinterlande giebt. Europäische Waren konnten demnach nur kleinen Gebieten zu entsprechenden Preisen zugängig gemacht werden. Die Chinesen machen sich diese, wenn sie von ihrem Nutzen überzeugt sind, zu eigen. Aber sie hegen für die europäischen Errungenschaften, Maschinen, Dampfschiffe, Eisenbahnen und dergleichen ebensowenig Bewunderung wie für deren Erfinder und Erzeuger. Es ist ihnen im Laufe der Jahrhunderte von den benachbarten kleineren Völkern viel zu viel Weihrauch gestreut worden, sie werden von ihrer Kindheit an viel zu sehr in dem Glauben ihrer eigenen Unübertrefflichkeit erhalten, als daß sie den Europäern höhere Achtung schenken sollten als etwa dem Zauberkünstler, über dessen Kunststückchen sie staunen. Gerade so wie wir unsere europäische Kultur für die beste halten, so halten die Chinesen die ihrige für die beste, und ebensowenig wie wir die unserige mit der chinesischen vertauschen würden, ebensowenig würden sie die ihrige für die europäische aufgeben. Ein kleines bewegliches Volk wie die Japaner, mit großem Verkehr und ausgebreiteter Schiffahrt, war leichter zu überzeugen, aber auch sie nahmen von den Europäern nur jene Dinge an, deren praktischer Nutzen ihnen sofort ins Auge sprang, alles andere[S. 399] ließen sie links liegen. Es kann keinen größeren Irrtum geben als zu glauben, die Japaner hätten die europäische Kultur angenommen. Dazu gehört unsern Begriffen nach die christliche Religion und Moral. Die Japaner sind aber in diesen ethischen Beziehungen ganz dieselben geblieben, die sie vor der großen Umwälzung waren. Für Christentum und christliche Moral sind sie unendlich viel weniger zugänglich als die Chinesen, was die beiderseitigen Erfolge der Missionen auch beweisen.
Die Chinesen werden ähnlich wie die Japaner zu Werke gehen, nur unendlich viel langsamer; auch sie werden alle europäischen Erzeugnisse und Einrichtungen annehmen, sobald sie ihre Nützlichkeit einsehen lernen. Das beweist die ganze Entwickelung des chinesischen Handels mit Europa. Aber die große Masse der Chinesen kennt mit Ausnahme leicht zu transportierender kleiner Massenartikel die europäischen Produkte überhaupt noch nicht. Würden sie den Chinesen vor Augen geführt werden, so würden sie auch bald ausgedehnte Märkte dort finden, denn die Chinesen sind zu praktische Menschen, zu vorzügliche Geschäftsleute, um den Wert eines Artikels nicht sofort zu erkennen. Was bisher an europäischen und amerikanischen Waren eingeführt wurde, kommt also nicht ganz China zu gute, sondern nur kleineren Gebieten in der Umgebung von offenen Häfen und längs der Wasserstraßen.
Um nur einige Beispiele hervorzuheben: Ich habe noch am Hoangho Leute gefunden, die ihre Kleider mit selbstgeschmiedeten und gefeilten Nähnadeln nähten; mit Staunen betrachteten sie die glänzenden Näh- und Stecknadeln, die ich ihnen zeigte. Den Mandarinen im Binnenlande konnte ich kein willkommeneres Geschenk machen als ein Notizbuch mit Bleistift. Gewöhnt, ausschließlich mit Pinsel und Tusche zu schreiben, kennen sie auch die Stahlfeder noch nicht, die sich für die Niederschrift chinesischer Schriftzeichen auch gar nicht eignet, und wenn ich des Abends in einer Dorfherberge meine Reisenotizen machte, umdrängten mich gewöhnlich Dutzende staunender Chinesen, um dem raschen Lauf meiner Feder auf dem Papier zu folgen. Bleistifte aber eignen sich für die chinesische Schrift, und die Mandarine konnten sich nicht genug wundern, daß ein Stift auch ohne Tusche chinesische Schriftzeichen auf dem Papier hervorbringen kann. Die Verwunderung stieg jedoch aufs höchste, wenn ich den Bleistift umdrehte und mit dem am anderen Ende befindlichen Radiergummi die Schriftzeichen wieder wegputzte. In Städten und Dörfern war ich ein wanderndes Museum. Die Leute hatten wohl schon zuweilen Weiße gesehen, denn die Missionare sind bereits in die meisten Gegenden des Innern vorgedrungen, tragen aber fast ausschließlich chinesische Tracht. Weiße in Europäertracht, wie ich sie trug, waren ihnen noch fremd. Sie befühlten neugierig meine Kleider und Stiefel, besahen Hut und Regenschirm, verwunderten sich in Orten, wo Feuer noch immer mit Feuerstein und Stahl gemacht wird, über meine Zündhölzchen und noch mehr über den in Papier gewickelten Tabak, d. h.[S. 400] Cigaretten, die sogar viele Mandarine noch nicht kannten. Auf den großen inneren Märkten fand ich gerade so wenig europäische Artikel wie auf unseren Märkten chinesische, und wo sie sich dort oder hier vorfinden, werden sie als Kuriosa, nicht als praktische Waren für den allgemeinen Nutzgebrauch betrachtet. Eisenwerkzeuge, Lampen, Gerätschaften werden immer noch zum weitaus größten Teil von den Chinesen selbst gemacht, ebenso Kleiderstoffe und alle möglichen Gebrauchsartikel. Sie kennen eben die praktischen Erzeugnisse des Abendlandes, wie gesagt, nur in beschränkten Bezirken ihres ungeheuren Landes. Wird dieses aber durch Eisenbahnen und freien Verkehr, ungehinderte Ansiedelung seitens europäischer Kaufleute, dann Abschaffung der Inlandszölle den Europäern wirklich erschlossen, wie es früher oder später doch geschehen wird und muß, dann wird der Absatz all dieser Artikel nach vielen Millionen berechnet werden müssen.
Gerade in diesen Massenartikeln ist aber die deutsche Industrie groß. Jetzt schon werden davon nach den wenigen geöffneten Häfen, von denen vielleicht nur ein Zehntel bis ein Zwanzigstel der chinesischen Bevölkerung erreicht wird, große Massen ausgeführt. Wie erst, wenn es sich um ein Absatzgebiet handelt, das auf seinen elf Millionen Quadratkilometer Fläche vierhundert Millionen Einwohner zählt! Die Chinesen brennen heute noch größtenteils Oel in irdenen Lampen; und doch sind Petroleum und Petroleumlampen bereits wichtige Einfuhrartikel. Eine einzelne Lampe hat freilich wenig Wert, handelt es sich aber darum, achtzig Millionen Haushaltungen, so viel wie ganz Europa zählt, mit Lampen zu versehen, dann gewinnt dieser Artikel eine ganz andere Bedeutung. Ebenso geht es mit den meisten anderen Artikeln.
Um dafür einen Markt zu gewinnen, müssen die Leute auch die Mittel haben, alle diese Dinge wirklich zu kaufen. China ist nun thatsächlich ein Land, das viel größere Mittel und damit Kaufkraft besitzt, als man gewöhnlich annimmt. Statt daß die Kaufkraft Chinas erschöpft wäre, könnte man das gerade Gegenteil behaupten. Niemand würde es beispielsweise einfallen, China mit Ländern wie Siam oder Marokko zu vergleichen, und doch ist der auswärtige Handel dieser letzteren im Verhältnis bedeutend größer als jener Chinas. In Siam entfallen etwa 23 Mark jährlich auf den Kopf, in Marokko ungefähr 9 Mark 50 Pfennige, in China nur 3 Mark. Im Jahre 1874 entfielen vom auswärtigen Handel nur 1 Mark 50 Pfennige auf den Kopf. Es ist also eine Steigerung auf das Doppelte innerhalb eines Vierteljahrhunderts zu verzeichnen. Ist es anzunehmen, daß China als einziges Reich der Erde dabei stehen bleiben und nicht weiter fortschreiten wird?
Freilich sind die großen Massen der Chinesen arm, und in Zeiten von Ueberschwemmungen oder Dürre leben Millionen Menschen im größten Elend. In viel größerem Maße ist dies in Indien der Fall. Land und Bevölkerung sind dort viel ärmer als in China, dabei auch nur halb so groß, und doch ist der auswärtige[S. 401] Handel von Jahr zu Jahr gestiegen, bis er heute an dreieinhalb Milliarden Mark erreicht hat, mehr als das Dreifache von China. Man hat eben die Hilfsquellen Indiens entwickelt und dem Lande Eisenbahnen, moderne Verkehrsmittel gegeben. In China sind alle Bedingungen für den blühendsten Handel, für den reichsten Absatz an Waren aller Art vorhanden, das Land verfügt selbst über ganz bedeutendes Großkapital, und Geld ist nach Hunderten von Millionen Mark im Verkehr. Der einheimische, chinesische Binnenhandel besitzt ungeachtet der primitiven Verkehrsmittel, der Dschunken auf dem Wasser, Kamele, Maultiere und Schubkarren auf dem Lande einen Umfang, von dem man sich kaum eine Vorstellung machen kann. In Schantung allein sind mehrere hunderttausend Kulis als Schubkarrenführer beschäftigt und Jahr aus Jahr ein mit Frachten unterwegs. Flüsse und Kanäle wimmeln von Fahrzeugen, Frachtbooten aller Art. In den Großstädten, darunter viele mit Hunderttausenden von Einwohnern, Orte, die man in Europa kaum dem Namen nach kennt, herrscht Wohlstand und Reichtum, giebt es ausgebreitete Industrien, Bankhäuser, Großkaufleute, Postämter, Verkehrsanstalten, alles natürlich nach chinesischem Schnitt. Ich habe all dies in meinem Buche „Schantung und Deutsch-China” (Verlag von J. J. Weber, Leipzig) mit allen wissenswerten Einzelheiten geschildert.
Indessen, diese schon vorhandene Kaufkraft kann noch verdoppelt, verdreifacht werden, wenn es einmal dazu kommt, die geradezu unerschöpflichen Hilfsquellen, welche noch im Schoße der Erde schlummern, zu öffnen. Welche Massen von Gold bergen die Höhen der Mandschurei und die „goldenen Hügel” nördlich von Peking, die aus verschiedenen Gründen nur zum Teil und das auch nur auf die primitivste Art von den Chinesen ausgebeutet werden! Welche Silbermengen bergen Schantung, Schansi, Tschili, Honan, und doch sind die Mehrzahl der Silberlager noch gar nicht eröffnet! Aber wichtiger als Gold und Silber sind die schwarzen Diamanten, die Kohlen. Schansi, diese ungemein wichtige, an die deutsche Interessensphäre Schantung grenzende Provinz hat in seinem südlichen, an den Hoangho grenzenden Teil Kohlenlager, wo über sechshundert Millionen Tonnen der besten Anthrazitkohle der Ausbeute harren. Dort, ebenso wie in ungeheuren Kohlenlagern des benachbarten Honan liegen zwischen den Kohlenschichten solche von vortrefflichem Eisenerz. Dasselbe gilt, wenn auch in geringerem Umfange, von Schantung, und in allen diesen Gebieten wird wohl Kohle schon gewonnen, hat sich auch eine sehr beträchtliche Eisenindustrie schon entwickelt, aber alles mit den primitivsten Mitteln und bedrückt durch die beutesüchtigen Mandarine.
Welcher Ausdehnung sind ferner die Thee- und Seidenkultur in China noch fähig! Und vor allem unter europäischer Anweisung die Industrie, wenn man in Rechnung zieht, welche Millionen fleißiger, flinker, genügsamer Arbeiter den Chinesen zur Verfügung stehen! Werden diese in dem ungeheuren Reiche schlummernden[S. 402] Schätze und Kräfte geweckt, dann wird es kein größeres und dankbareres Absatzgebiet auf Erden geben als China. Dieses wird den Industrieländern der Alten und Neuen Welt stets erhalten bleiben. Vielfach kommt zwar die Befürchtung zum Ausdruck, China könnte das alte Europa einmal, wenn es zu modernem Leben und Schaffen erwacht ist, erdrücken. Diese Befürchtung ist unbegründet. Zunächst wird es noch vieler Jahrzehnte bedürfen, ehe an einen wirksamen Wettbewerb Chinas ernstlich gedacht werden kann; während Europa diese ganze Zwischenzeit vor sich hat, entwickeln sich auch hier die Industrien immer mehr, es entstehen immer neue Industriezweige, neue Artikel, in welchen die europäischen Industrieländer den Chinesen voraus bleiben werden. Der zeitliche Abstand, um welchen China in seiner Entwicklung hinter Europa zurückgeblieben ist, kann nicht leicht ausgeglichen werden. Weder China noch Japan wird Europa bei den hier fortwährend auftauchenden neuen Erfindungen einholen können, sie werden in dieser Hinsicht für absehbare Zeit von Europa abhängig bleiben.
Aus dem Gesagten kann man ersehen, daß der Handel Chinas noch tief in den Kinderschuhen steckt, aber er schreitet doch rasch voran, und wenn alle Mächte sich so sehr um China bemühen, so geschieht es, um sich bei Zeiten einen Platz dort zu sichern. Im Jahre 1766 haben 23 fremde Schiffe hingereicht, den auswärtigen Handel Chinas zu bewältigen; im Jahre 1830 waren schon 150 Schiffe dazu erforderlich; im Jahre 1898 erreichte der Schiffsverkehr in den chinesischen Häfen die Riesenzahl von 43000 Dampfern und 9000 Segelschiffen mit zusammen 34 Millionen Tonnen Gehalt. Vor einem halben Jahrhundert war der Wert des Außenhandels weniger als hundert Millionen Mark. Heute hat er elfhundert Millionen erreicht, d. h. soweit er auf europäischen Schiffen und in den dreißig offenen Vertragshäfen sich abwickelt. Welche Unmassen ausländischer Waren in den anderen Häfen des Reiches und in den 21000 chinesischen Schiffen mit acht Millionen Tonnen Gehalt dazu kommen, entzieht sich der Beurteilung; der Gesamtwert des Außenhandels kann aber jährlich nicht geringer sein als anderthalb Milliarden Mark.
Wohl kann dieser Außenhandel in dem einen oder anderen Jahre durch außergewöhnliche Ursachen, wie Kriege oder geschäftliche Krisen in Europa, durch Währungsschwankungen oder vor allem durch Kriege, Revolutionen und dergleichen in China selbst zeitweilig eine Verminderung erfahren; er wird aber im ganzen und großen stetig zunehmen, und diese Weiterentwicklung zu hemmen, haben weder die reaktionären Mandarine, noch die Regierung die Macht. Ein Blick in die Vergangenheit eröffnet dem Auge auch die Zukunft. Wie lagen die Verhältnisse in China noch vor sechs Jahrzehnten, zur Zeit des berühmten Opiumkrieges? Das Innere Chinas war jedem Europäer verschlossen, und in den wenigen Häfen, in denen sie sich aufhalten durften, waren sie den strengsten, mitunter schmachvollen Beschränkungen unterworfen.
Wäre es damals jemandem eingefallen, zu prophezeien, daß fünfzig Jahre später europäische Großstädte auf chinesischem Boden stehen würden, daß die Flüsse von europäischen Dampfern befahren, Eisenbahnen, Telegraphen das Land durchziehen würden, man hätte ihn für verrückt gehalten. Die Wirklichkeit von heute übertrifft sogar solche Prophezeiungen; dreißig seiner größten und wichtigsten Häfen sind europäischen Kaufleuten und Ansiedlern erschlossen, aus Shanghai und Hongkong sind europäische Großstädte geworden, in denen man mit derselben Sicherheit und Bequemlichkeit wohnt, als lägen sie in Europa. Telegraphenlinien verbinden die Hauptstadt mit den Provinzen, Kabel die Inseln mit dem Festlande; zwischen Tientsin und Shanghaikwan, Tientsin und Peking, Shanghai und Woosung u. s. w. verkehren Eisenbahnzüge. Die einzelnen Küstenpunkte von Tongkin bis hinauf in die Mandschurei sind durch regelmäßige Dampferlinien unter fremden Flaggen miteinander verbunden; auf den Hauptflüssen verkehren europäische Dampfer, und die Hauptwasserstraße des chinesischen Reiches, der Jangtsekiang, ist eine Hanptverkehrsstraße des europäischen Handels geworden bis hinauf gegen die tibetanischen Grenzdistrikte für Handelsschiffe aller Flaggen, vornehmlich auch der deutschen Flagge. Das so lange verschlossene sagenhafte Peking ist heute der Sitz der europäischen Gesandten, die mit den höchsten Beamten des Riesenreiches verkehren und von dem Kaiser in seinem eigenen Palaste empfangen werden. In Peking befinden sich Kirchen, Klöster, Schulen und Universitäten, die letztern chinesische Unternehmungen, aber mit europäischen Lehrkräften. Die Armee hat europäische Instruktoren, moderne Arsenale stehen unter europäischer Leitung, ebenso der ganze Telegraphen-, Post- und Zolldienst mit Beamten, welchen die höchsten chinesischen Auszeichnungen verliehen worden sind. Wer hätte das vor dreißig oder vierzig Jahren zu hoffen gewagt?
Die Wirren der letzten Zeit sind vorübergehend, die Kugel ist einmal ins Rollen gekommen und, wie gesagt, nicht mehr aufzuhalten. Der Aufstand gegen die Fremden und ihre Kultur, welche sie dem alten China bringen wollen, scheint wie ein letztes Aufraffen der Reaktionäre, der alten Partei der Mandarine und Litteraten, der Geheimgesellschaften und des von ihnen abhängigen Gesindels, zusammen immer noch bedeutend genug, daß die schwache Regierung sich ihnen nicht wiedersetzen konnte. Ihnen gegenüber steht aber eine ganz bedeutende Partei von aufgeklärten Leuten, welche in den offenen Häfen oder in Singapore, Hongkong, Batavia moderne Bildung und Kultur kennen gelernt haben, dann der ganze großenteils vom Auslande abhängige Kaufmannstand in den Handelsstädten. Dazu kommen auch zahlreiche Mandarine und ein großer Teil des gebildeten Teils des Volkes. Wenn diese nicht offen für die Erschließung des Reiches eintreten, so ist es teils aus Furcht vor der Regierung einerseits, die ihre Absichten niemals klar und offen zum Ausdruck bringt, und vor den Geheimgesellschaften anderseits, welche fremdenfreundlichen[S. 404] Mandarinen gleich mit dem Mordstahl zu Leibe gehen. Ich habe in den verschiedenen Städten des Innern mit Hunderten von Mandarinen und anderen aufgeklärten gebildeten Leuten gesprochen und aus ihren Aeußerungen diesen Eindruck gewonnen. Dazu kommt noch bei ihnen die Furcht, daß durch die Eröffnung des Reiches die politische Selbständigkeit desselben verloren gehen könnte. So gern sie die europäischen Industrien verwerten möchten, sie haben doch eine ganz ausgesprochene Vaterlandsliebe, die in dem Grundsatz gipfelt: „China für die Chinesen”. Ich hatte Gelegenheit, Einblick zu bekommen in die Berichte, welche seitens der Zentralregierung von den Provinzgouverneuren über die projektierten Eisenbahnen eingeholt wurden. In diesen Berichten kommen Aeußerungen vor, wie: „Zum Bau der Bahnen können wir chinesisches Material benutzen, zur Ausführung von Arbeiten können Leute aus unserem Volke herangezogen werden. Die Gehälter der etwa in Dienst zu stellenden Europäer würden doch nur einen beschränkten Betrag ausmachen” .... „Das nötige Eisenbahnmaterial vom Auslande zu beziehen, wäre zu umständlich und kostspielig. Unser Eisen ist für Schienen ganz geeignet. Wenn sie auch vielleicht teurer zu stehen kämen, so wären sie doch unsere Landeserzeugnisse”.... „Nur für die erste Strecke würde ich empfehlen, Eisenmaterial aus dem Auslande zu beziehen, bis die Hochöfen und Hüttenwerke für die Fabrikation unserer Schienen fertig sind. Dann sollte lediglich einheimisches Eisen verwendet werden, damit die Entwicklung des Eisenbahnnetzes unserer eigenen Industrie zum Vorteil gereiche”.... „Wir sollten für den Eisenbahnbau keine ausländischen Gelder aufnehmen, sondern ebenso wie die chinesische Dampfergesellschaft dreißig Millionen Taels im Inlande aufgebracht hat, eine inländische Anleihe aufnehmen. Eurer Majestät möchte ich das allerunterthänigste Gesuch unterbreiten, alle Anträge, die fremde Anleihen bezwecken, kurzweg abzulehnen, um das Unwesen der ausländischen Banken und Geschäftsvermittler, dieses Ratten- und Heuschreckenungeziefers, das uns aufzehrt, zu vermeiden”... „Wollen wir Bahnen bauen, so müssen wir uns die Erbauer aus unserem eigenen Volke durch Schulen und ausländische Lehrer selbst heranziehen”.... „Wir wollen fremdes Kapital und fremde Arbeit von unseren Eisenbahnunternehmungen ausschließen”....
In diesen Gutachten sprechen die Provinzgouverneure auch die Ueberzeugung aus, daß die Eisenbahnen dem Handel und Wohlstand der Chinesen förderlich sein und überdies die Ausländer von diesem Handel verdrängen werden. Das zeigen unter anderen folgende Stellen in den Berichten: „Der Handel, der jetzt auf fremden Schiffen erfolgt, würde wieder den Landweg einschlagen und den Fremden den Gewinn wegnehmen zu gunsten unserer Bevölkerung. Wenn aber den Fremden kein Gewinn mehr bei uns in Aussicht steht, so werden sie die Sache bald aufgeben und nach Hause zurückkehren”... „Eure Majestät würden durch die Eisenbahnen und die durch sie wachsende Ausfuhr chinesischer Erzeugnisse den Staat und[S. 405] die Nation auf eine sichere Grundlage stellen und nicht den fremden Händlern ein Mittel zum Wettbewerb und zu größerem Gewinn verschaffen”... „Eisenbahnen fördern den Handel, die Maschinen, die Industrie; durch sie wird man die Erzeugnisse des Landes aus entfernten Gegenden zu versenden im stande sein. Die Eisenbahnen sollen uns helfen, durch Eröffnung der verschlossenen Quellen unserer Reichtümer die Verluste wieder gut zu machen, welche wir durch die Ausfuhr unseres Kapitals erlitten haben.”
Wie man sieht, wird in diesen Berichten der Fremdenhaß, welcher die Chinesen kennzeichnet, auch durch die höchsten Reichsbeamten in offizieller Weise zum Ausdruck gebracht. Fremdenhaß ist die bisherige Richtschnur der ganzen Beziehungen Chinas zum Auslande gewesen; nur in geringem Grade bei der Landbevölkerung vorhanden, steigt er mit den höheren Gesellschaftsklassen und wird zum Fanatismus bei den Litteraten, sowie bei der Mehrzahl der Machthaber. Er liegt auch den ganzen jüngsten Unruhen zu Grunde und ist, wenn man die Sache mit kaltem Blute betrachtet, begreiflich. Man denke sich doch in einem europäischen Reiche die wichtigsten Häfen in chinesischem Besitz und den dortigen Welthandel in chinesischen Händen; man denke sich chinesische Dampfer auf den europäischen Hauptströmen, Eisenbahnen, industrielle Anlagen mit chinesischem Kapital gebaut, durch Chinesen verwaltet, in den Hauptstädten chinesische Missionare, den unteren Volksklassen von Buddha und Confucius erzählend, und alles das unter dem Schutze chinesischer Gesandten in den Hauptstädten der europäischen Reiche, mit chinesischen Kanonen und Kriegsschiffen an den Grenzen, welche alle Begehren der Gesandten unterstützen. Gewiß würde sich der Haß gegen die chinesischen Eindringlinge ganz gewaltig regen, und man würde alles einsetzen, um sie wieder hinauszuwerfen. Nun dünken sich die Chinesen auf einer viel höheren Kulturstufe, als die der Europäer; sie sind stolz auf ihre uralte Zivilisation, die sich Jahrtausende lang bewährt und alle anderen überdauert habe. In ihrem Dünkel betrachten sie die Fremdlinge als ebenso „minderwertige” Wesen, wie wir die Chinesen betrachten, und hegen ihnen gegenüber denselben Haß, den wir gegen sie empfinden würden, wenn sie unsere Heimatländer kommerziell ausbeuten würden.
Indessen, diese Gefühle der Chinesen können nicht geschont werden, zumal sie selbst mit Europa und Amerika in den mannigfaltigsten Verkehr getreten sind. China muß entwickelt, erschlossen werden, und dazu ist es nötig, daß China die erdrückende Macht Europas und die große Ueberlegenheit seiner Kultur noch eingehender kennen und fühlen lernt. Es giebt China gegenüber kein Zurück mehr, sondern nur ein Vorwärts. China wird militärisch niedergezwungen werden, wie schon mehrmals zuvor. Ist das geschehen, dann soll wieder Friede herrschen. Damit aber die alten Fehler der Friedensabschlüsse mit China vermieden werden, ist es erforderlich, daß genügende Macht auch in Zukunft über die Erfüllung der[S. 406] Friedensbedingungen wache. Eine der vornehmsten der letzteren wird es sein müssen, daß Angehörige aller Nationen ungehindert in China verkehren dürfen; es soll keine „Vertragshäfen” mehr geben; jede Stadt soll offen sein; Flüsse und Kanäle müssen frei sein für die Schiffahrt der Flaggen aller Länder; es sollen keine „Interessensphären” für verschiedene Staaten mehr geschaffen werden; ganz China soll eine Interessensphäre sein für die ganze Welt und damit auch für sich selbst. Es darf nicht geduldet werden, daß beispielsweise ausschließliche Absichten Englands auf das ganze Jangtsekiangthal, das Rückgrat des chinesischen Reiches, zur Ausführung kommen. Hongkong, Macao, Tsingtau und andere bestehende feste Besitzungen fremder Mächte werden als solche bestehen bleiben, neue aber sollen nicht dazu kommen.
Wieviel von diesen Wünschen zur Durchführung kommen kann, steht dahin. Es wird dies mehr von den Mächten, als von China abhängen, am meisten von England, das schon jetzt bestrebt ist, eine Sonderstellung einzunehmen und seine eigenen Ziele zu verfolgen. Die größten Gewinner aber werden jene Mächte sein, welche als jüngste auf der chinesischen Bildfläche erschienen sind, Amerika und Japan. Alle Konzessionen Chinas kommen zunächst diesen beiden Mächten zu gute; ihr Einfluß und ihr Handel sind, wie bemerkt, in den letzten Jahren rascher gestiegen als die irgend welcher anderer Staaten. Das bringt ihre geographische Lage und ihre Entwickelung mit sich und kann nicht geändert werden. Von den europäischen Mächten ist am chinesischen Handel nächst England das Deutsche Reich am meisten beteiligt. Hoffentlich wird der Friede diese Beziehungen zwischen Deutschland und China zu noch einträglicheren machen!
Fräulein Chrysanthemum, diese eigenartige, possierliche Schönheit aus dem fernsten Osten, hat vor etwa dreißig Jahren in Europa ihren Einzug gehalten, einen Einzug, der einem Triumphzuge glich durch den ganzen Kontinent. Europa fand Gefallen an ihrem bepuderten und bemalten Rokokogesichtchen, an ihren feinen, geschlitzten schwarzen Augen mit den hochgezogenen Brauen, an ihrem kirschrot geschminkten, stets lächelnden Munde, an ihren drolligen Stellungen und Bewegungen. Sie trug faltenreiche, bunte, blumengestickte Kleider, und ihr reiches, glänzendschwarzes Haar schmückten papierene Schmetterlinge. Ihrem Köpfchen diente gewöhnlich ein großer, bunter japanischer Papierschirm als Folie, wie ein Heiligenschein, aber ein solcher für die Heiligen der fremden Götterwelt.
Eine so frische, anmutige, naiv-natürliche Erscheinung hatte das alte Europa schon lange nicht mehr gesehen. Sie war neu und kam sozusagen über Nacht in die Mode. Man brachte sie auf die Operettenbühne und das Puppentheater, man malte sie auf Fächer, Vasen und Wandschirme, man modellierte sie in Porzellan[S. 410] und Bronze, man schnitt sie aus Holz, und heute ist sie in Millionen von Exemplaren in ganz Europa zu finden, von Spanien bis Rußland, von Norwegen bis Griechenland, in Herrscherpalästen wie in bescheidenen Wohnungen. Keine Primadonna hat sich jemals solchen Ruhmes erfreut wie dieses kleine, putzige, drollige Fräulein Chrysanthemum.
Sie stammt aus Japan und mußte von dort wohl auswandern und sich eine neue Heimat suchen, denn in ihrem Vaterlande ist sie in den letzten Jahrzehnten allmählich aus der Mode gekommen. Sie hat dort lange genug regiert, Jahrtausende lang. Und während sie Japan verlassen mußte, um so vielen Menschen bei uns in Europa die Köpfe zu verdrehen, hat in ihrer alten Heimat eine andere Dame ihren Platz eingenommen und verdreht den Japanern die Köpfe: Prinzessin Mode aus Paris oder Wien oder sonst welchem Geburtsort, in seidenen, tief ausgeschnittenen Schleppkleidern, mit Puffenärmeln und Handschuhen, mit gewaltigen Hüten und seidenen Strümpfen. Der Hof und die elegante Welt im Lande des Sonnenaufgangs frönen nunmehr dieser abendländischen Prinzessin Mode. Fräulein Chrysanthemum aber ist dort leider verschwunden; nur in der Provinz hält sie noch Hof, und unter jenen Städten, die ihr bis auf den heutigen Tag die Treue am meisten bewahrt haben, ist Nagasaki.
Nagasaki ist die südlichste große Hafenstadt des japanischen Inselreiches und dabei wohl auch die entzückendste. Nirgends paßt Fräulein Chrysanthemum besser hinein; die eine erscheint für die andere wie geschaffen, sie ergänzen sich gegenseitig, und deshalb sind sie einander wohl auch so lange treu geblieben.
Wer von dem ungeheuren, düsteren chinesischen Reiche nach Japan fährt, der kommt in Nagasaki mitten in eine neue Welt hinein, in die Welt der Feen. Die Landschaften, die sich dem Reisenden bei der Einfahrt in den tief eingeschnittenen Fjord von Nagasaki zeigen, sind von klassischer Schönheit, ideale olympische Landschaften, die man sich nur von den griechischen Göttern oder von den Schwestern von Fräulein Chrysanthemum bevölkert denken kann. Der Name Fjord erinnert an die kalten, nackten Meereseinschnitte des nebeligen Norwegens mit ihren Schneeflocken und Gletschern und ihren düsteren menschlichen Ansiedelungen in den Thälern; der Fjord von Nagasaki ist das gerade Gegenteil davon. Während dort die Natur majestätisch, allgewaltig, drohend und erdrückend auftritt, schmiegt sie sich hier lieblich und zärtlich an den tiefblauen, klaren, stillen Wasserspiegel, der sich meilenweit ins Herz der Insel Kiuschiu, einem wahren Phäakenlande, hineinzieht. Prächtige Felspartien, sanft ansteigende Berge mit üppigstem Baumwuchs, zierliche, reinliche Dörfchen an den Ufern; Gärten ringsum, daran anschließend wohlgepflegte Reisfelder, so zierlich und schön gehalten, als dienten sie den japanischen Phäaken, ihren Bewohnern, nur als Spielerei; hier und dort ragen Felseninseln aus der blauen Wasserfläche hoch empor, malerisch in der Form, mit kühnen Nadeln und Spitzen,[S. 411] und jede derselben gekrönt von ebenso malerischen Fichten oder hochaufstrebenden Kryptomerien; blühende Schlinggewächse klettern an den gelben Felsmauern empor und spiegeln sich in der glatten Wasserfläche ebenso treu und natürlich wieder; aus dem Grün blickt hier und dort ein Tempelchen hervor, und auf den Felsen erheben sich brennrote Pagoden. Dutzende dieser Inselchen sind in den Fjord hineingestreut, und zwischen ihnen ziehen still und traumhaft die malerisch geschwungenen Boote mit blendend weißen Segeln wie Schwäne einher. Nirgends in der weiten Welt habe ich so ideal schöne Landschaften gesehen wie hier rings um das japanische Inselreich. Fast erscheint es wie eine Profanation, daß die schnaubenden, schwarzen, Kohlenrauch pustenden Dampferkolosse mitten durch diese Feenwelt fahren, daß prosaische stählerne Schiffsschrauben die blauen Wasserfluten aufwühlen, daß noch viel prosaischere Matter-of-fact-Menschen in die Heimat von Fräulein Chrysanthemum hineingedampft kommen.
Dort, ganz im Hintergrunde des Fjords, eingesattelt zwischen den hohen, bewaldeten, tempelgekrönten Bergen liegt diese Heimat, Nagasaki.
Die Dämmerung ist angebrochen, die grauen, einförmigen Dächer der niedrigen, zierlichen Holzhäuschen der Stadt sind kaum von dem Grün der Bäume zu unterscheiden. Bald erscheinen rings um den Hafen Lichter, rot, blau, weiß, in allen möglichen Farben der Papierlampions; sie werden immer zahlreicher und flimmern endlich in vielen Tausenden in den Straßen vor den Häusern, an den offenen Veranden auf; sie ziehen sich die umliegenden Anhöhen hoch hinauf bis zu den Tempeln; aus der Ferne dringen die Klänge der Samisen schwach zu uns herüber, dazwischen Gelächter und Gesang, wie von dem fröhlichen Treiben eines sommernächtlichen Gartenfestes.
Früh morgens werde ich durch ähnlichen Gesang, ähnliches Gelächter aus meinen Träumen geweckt, in denen zierliche Musmis und Tänzerinnen im Gewande Chrysanthemums die wichtigste Rolle gespielt haben. Durch das kleine runde Fensterchen meiner Schiffskabine blickte lächelnd Chrysanthemum selbst herein. Ja, das ist sie! Dieselben schalkhaften Schlitzaugen, derselbe rosige Mund. Aber welcher Anzug, welche Gestalt! Und wie kam sie nur an meine Kabinenluke, die doch gewiß mehr als sechs Meter über dem Wasserspiegel erhaben ist? Nun sehe ich es; ein großes, plumpes Kohlenboot, mit Kohlen schwer beladen, liegt an der Seite unseres Schiffes, und einige hohe, bis aufs untere Verdeck reichende Leitern sind an das Schiff angelehnt worden. Auf den Sprossen dieser Leitern sitzen von oben bis unten lauter Chrysanthemen und gucken neugierig durch die Kabinenluken. Sie sind alle gleich gekleidet: nicht in die schönen, vielfarbigen, faltenreichen Kimonos, sondern sie tragen enganliegende, bis etwas über die Knie reichende Hosen und lose, vorne nur notdürftig schließende Jacken aus dunkelblauem Stoff, ohne irgendwelche Unterkleider. Die Füße sind nackt, dafür umhüllen buntgestreifte Kopftücher den Kopf und lassen[S. 412] nur die hübschen, frischen, freundlichen Gesichtchen frei. Ein Kohlenschiff nach dem andern legt sich an unsere Seite, ganze Reihen von Leitern stehen nun nebeneinander, viele Dutzende von kleinen putzigen, prallen japanischen Mädchen sitzen auf den Sprossen, alle lächeln, schäkern und schwatzen miteinander. Die älteste mag kaum siebzehn, achtzehn Jahre zählen. Unten in den Kohlenschiffen werden endlich große Körbe mit Steinkohlen gefüllt und den Mädchen, die zu unterst auf der Leiter stehen, gereicht. Diese heben sie über ihre Köpfchen zu den nächsten Sprossen empor, und so passieren sie von Hand zu Hand, bis sie auf das Verdeck kommen. Dort nehmen andere Mädchen die Körbe in Empfang, schütten den Inhalt in den Kohlenschacht und schleudern die leeren Körbe mit kräftigem Schwung auf die Kohlenschiffe zurück. Der Kohlenstaub bedeckt sie bald vom Kopf bis zum Fuß, schwärzt die Gesichter, die winzigen Händchen und die Brüste, denn sie haben der Hitze wegen die Jäckchen geöffnet. Darunter erkennt man nicht einmal mehr das stereotype Lächeln, und gar bald sehen sie aus wie kleine, kohlschwarze Teufelchen. Man sollte es kaum für möglich halten! Diese zarten, blutjungen Geschöpfchen, die höchstens zum Guitarrezupfen, zu Spiel und Tanz geboren scheinen, sind in diesem Lande der Phäaken Lastenträger, Kohlenarbeiter!
Um den Bug unseres Riesenschiffes tummeln sich dicht neben und zwischen den rußigen, schmutzigen Kohlenbarken hindurch blendend weiße, so rein gescheuerte Sampans (Ruderboote) herum, daß man glauben könnte, sie wären alle erst vor einer Stunde aus den Werkstätten gekommen. Halbnackte Japaner mit bronzefarbigen, sehnigen Gliedern handhaben sie geschickt und führen die Passagiere des Dampfers ans Land. Ein langes Ruder ist am Steuer befestigt, und mit diesem machen sie ähnliche Bewegungen wie der Fisch mit seinen Schwanzflossen. Die Japaner haben bei ihren kleinen Fahrzeugen die Kunst der Fortbewegung den Fischen abgelauscht. Vor mir dehnt sich auf der Ostseite der weiten paradiesischen Bucht eine lange Reihe einstöckiger Häuser in europäischem Stil aus, die das europäische Settlement von Nagasaki bilden. Dieser reizende Hafen gehört nämlich mit vier anderen zu den für Europäer offenen Häfen des japanischen Reiches, und auf dem wenige Hektare großen Flächenraum, den die Japaner den Weißen zur Verfügung gestellt haben, dürfen sie ihre Häuser bauen, ihren Geschäften nachgehen. Nagasaki ist der älteste dieser Häfen, denn schon vor beinahe dreihundert Jahren hatten die damaligen Herren der Ozeane, die Holländer, die Bewilligung erhalten, hier ein Settlement zu gründen. Davon ist freilich nichts mehr vorhanden. Die den Hafen entlang laufende Bundstraße hat nur moderne, bescheidene Häuser aufzuweisen, ebenso ihre Parallelstraße landeinwärts und die Verbindungsgassen, in denen die Chinesen ihre Wohnungen aufgeschlagen haben. Kaum hundert Europäer, die Konsuln der fremden Mächte mit eingerechnet, wohnen hier, aber doch haben sie ihren eigenen Klub mit Billard-, Spiel- und Lesesälen, wo man sich irgendwo[S. 413] im Herzen von Europa, nur nicht in Japan fühlen könnte. Weiter südlich gegen das Meer zu liegt, versteckt zwischen üppigen Gartenanlagen, ein bescheidenes Hotel, dessen Name Bellevue durch die wunderbare Aussicht auf das japanische Nagasaki sehr wohl begründet ist.
An der Landungsstelle erwarten ganze Batterien von Rickshaws die ankommenden Reisenden. Weiß der Leser, was eine Rickshaw ist? Wahrscheinlich nicht, sonst hätte er sie schon längst in Europa zur Einführung gebracht. Die Rickshaw ist das bequemste, angenehmste, schnellste und billigste Fuhrwerk, das je zur Beförderung der Menschen erschaffen wurde. Helios hätte in keinem bequemeren zur Sonne, der Teufel in keinem luftigeren zur Hölle fahren können. Die Rickshaw ist eine offene, niedrige Viktoria ohne Kutschersitz, auf zwei Rädern und für einen Menschen Raum gewährend, der sie mit derselben Leichtigkeit besteigt, als wolle er sich in einen Armstuhl setzen. Vorn ist eine Gabeldeichsel angebracht. Ein japanischer Kuli stellt sich dazwischen, hebt die Deichsel mit den Händen auf und galoppiert mit der Rickshaw und ihrem Insassen davon. Der gewöhnliche Fahrpreis für eine Fahrt ist zehn bis zwanzig Pfennige, und die Miete für einen halben Tag von sechs Stunden beläuft sich auf fünfzig Pfennige (fünfundzwanzig Sen). Deshalb fällt es in Japan auch keinem Europäer ein zu gehen. Die Rickshaw ist ihr allgemeines Beförderungsmittel. Jede Rickshaw und jeder dazugehörige Kuli hat seine Nummer, gerade so wie unsere Droschken, und alle stehen unter polizeilicher Kontrolle.
Nummer 415 ist leider nicht zu sehen. Ich hätte gar zu gerne Nummer 415 gewählt, denn wer Pierre Lotis Madame Chrysanthème gelesen hat, der weiß, daß 415 Pierre Lotis Schwager war. Indessen Nummer vier hat eben so kräftige Lungen und eben so kräftige Beine. Kaum sitze ich in seiner Rickshaw, so läuft er auch schon im Galopp von dannen. Die Frühlingshitze ist groß, und auf die Gefahr hin, von einem schlitzäugigen Polizisten eingesteckt zu werden, hat sich Nummer vier seiner zwei Kleidungsstücke, ähnlich wie sie die vorgeschilderten Kohlenjungfrauen tragen, entledigt. Um den Anstand einigermaßen zu wahren, thut er es seinen Rickshawkollegen gleich und legt um den Leib einen weißen Leinwandstreifen, so groß wie eine weiße Ballkravatte. Sein muskelreicher Rücken glänzt von Schweiß wie polierte Bronze; das Wasser läuft ihm von den Schultern und Beinen herunter, er keucht und pustet, aber die Beine tragen ihn und seinen Wagen und mich federleicht den Bund entlang nach dem alten japanischen Stadtteil, dem eigentlichen Nagasaki.
Der erste Eindruck, den die langen, engen Gäßchen mit den bescheidenen, einstöckigen Häuschen jetzt in den späten Vormittagsstunden machen, ist enttäuschend. Straßen auf, Straßen ab dasselbe ewige Einerlei; gutes, mit peinlicher Sorgfalt reingehaltenes Pflaster, mit dem Trottoir nicht längs der Häuser, sondern in der[S. 414] Mitte der Straße; Matten- und Leinwanddächer schützen die langen Reihen von Kaufläden gegen die brennende Sonnenhitze; die Kaufläden nehmen die ganzen Häuserfronten ein, die weder Thüren noch Fenster haben; der ganze verfügbare Raum ist mit Waren der verschiedensten Gattung belegt, hier kostbare Bronzen und Porzellane, dort Rüstungen, Schwerter und Helme, daran anstoßend Papierwaren, Lampions, Schmetterlinge, Drachen; dann wieder Seidenwaren oder allerhand Artikel aus Schildpatt, eine der Hauptindustrien von Nagasaki. Ebensowenig wie nach vorne, haben die hölzernen Häuschen nach hinten eine Mauer; während ich durch die Straßen fliege, kann ich das Innere der Häuser von einem Ende zum andern sehen; alles ist offen, auf den ungemein reinlichen Strohmatten des erhöhten Fußbodens kauern schläfrige Japaner, Männlein und Weiblein, der Hitze wegen in tiefem Negligé, und rauchen ihre winzigen Pfeifchen, mit Köpfen, die kaum groß genug sind, um unseren zartesten Damen als Fingerhut zu dienen; oder sie schlafen, auf die Matten hingestreckt, einen Holzklotz als Kissen unter dem Kopf; oder sie hocken auf ihren Waden, die beliebteste Stellung, und schlürfen Thee aus winzigen Täßchen, den Theetopf vor sich auf dem Boden. Mitten durch die Häuser durch gewahre ich hier und dort ein winziges Gärtchen mit kurios gebogenen und verschlungenen Fichten, mit Wassertümpeln und winzigen Brücken darüber; auf den tischgroßen Rasenflächen stehen allerhand Bronze- und Steinfiguren, die reine Spielerei, denn viele der Gärtchen nehmen nicht mehr Raum ein als eines unserer europäischen Wohnzimmer. Plätze, Squares, öffentliche Gärten giebt es in dem alten Nagasaki keine; alles ist uralt, klein, niedlich und, was mich seltsam, aber angenehm berührte, durchaus japanisch. Von der Modernisierung des alten Japan, die sich dem Besucher von Yokohama, Osaka, Tokio und anderen Städten so unangenehm aufdrängt, sind in Nagasaki nur wenige Spuren zu sehen, und doch war gerade dieser Hafen den Kaukasiern schon über zwei Jahrhunderte geöffnet, als die anderen jedem Europäer noch hermetisch verschlossen waren. Damals, im alten Japan, war Nagasaki der moderne, europäische Hafen; jetzt im modernen, europäischen Japan ist Nagasaki derjenige, der am meisten Alt-Japan bewahrt hat. Nirgends sieht man in den Kaufläden so gute, alte Prachtstücke der japanischen Kunst wie hier; nirgends so echtes und schönes Satsuma- und Hizenporzellan; alte Seidenstoffe und Stickereien, Rüstungen und Bronzen. Man könnte sein Vermögen opfern, um all diese entzückenden Produkte einer fremdartigen Kunst zusammenzukaufen; trete ich in einen Kaufladen, flugs liegen die Händler, Vater, Mutter und Tochter, vor mir auf allen Vieren und berühren aus lauter Artigkeit mit der Stirn den Boden, und während der Papa die kostbarsten Stücke aus Schachteln und Papier, Baumwolle und Seidentüchern herauswickelt, um sie mir zu zeigen, bereitet ein Fräulein Chrysanthemum, seine Tochter, mit ihren zarten Fingerchen Thee und überreicht mir kniend eine Tasse. Dabei ist sie so niedlich[S. 415] und hübsch und lächelt so einschmeichelnd kokett, daß man viel eher vor ihr auf die Knie fallen möchte.
Am jenseitigen Ende der eigenartigen alten Stadt mit ihren schnurgeraden, sich rechtwinklig schneidenden Straßen, die wohl noch selten, wenn überhaupt jemals, von einem Lastwagen oder einer Equipage befahren worden sind, zieht sich die Vorstadt Dschudschendschi die reich mit alten Kampferbäumen besetzten Höhen empor. Dort, in einem der niedlichen Häuschen mit den offenen Veranden und den hübschen Gärten mit blühenden Wisterias, hat auch Pierre Loti mit seiner Frau Chrysanthème gewohnt; welches der Häuschen es wohl sein mag? Gegen die Meeresbucht zu sind die Berghänge mit Tausenden von Grabdenkmälern, alten, mit Farnkraut und Myrten überwucherten Steinen bedeckt, und zwischen beiden führt eine wundervolle Treppenanlage mit gewaltigen steinernen Thorbogen die Anhöhen empor zu dem berühmten Osuwatempel, einem der schönsten Shintotempel Japans. Nummer vier macht vor der Riesentreppe Halt, wischt sich mit den Händen den triefenden Schweiß von den Gliedern und ladet mich ein, den Tempel zu besuchen.
Es ist eher eine ganze Reihe von Tempeln, die dort oben inmitten eines Waldes von kolossalsten Kampferbäumen und Kryptomerien vor langer, langer Zeit errichtet wurden: kleine, einfache Holzhäuser mit schweren, grauen, bemoosten Dächern und weiten, von Galerien umgebenen Vorhöfen, in denen fromme Daimios im Laufe der Jahrhunderte Opferlaternen, steinerne Wasserbecken, Drachen- und Götzengestalten, ja sogar ein bronzenes Pferd haben aufstellen lassen. Das letztere ist eine Berühmtheit Japans, wohl wegen seiner für dortige Verhältnisse selten schönen Ausführung. Pierre Loti behauptete, es wäre aus Jade (Nephritstein), indessen sein reizendes Buch Madame Chrysanthème ist so voll von Unrichtigkeiten, daß man ihm auch wohl das steinerne Pferd hingehen lassen muß. Nur seine Chrysanthème, diese Gattin auf Zeit, hat er richtig geschildert, dann auch die Tänzerinnen und Sängerinnen.
Bei jedem Treppenabsatz haben die Japaner hier Tempelchen und Shintoschreine errichtet; über jedem Thor sind die charakteristischen Neujahrs-Hanfseile gespannt, mit langen, herabhängenden Papierfetzen, zur Abwehr der bösen Geister. Die Treppe scheint gar kein Ende zu nehmen. Weißgekleidete Priester mit kahlgeschorenen Schädeln huschen in den Gängen auf und nieder, verschwinden hinter weißen Vorhängen; andere halten eben unter allerhand geheimnisvollem Zeremoniell ihren Götterdienst; wieder andere ruhen in den Nischen und Seitengebäuden und schmauchen ihre Pfeifchen, deren Rauch sich mit jenem der Weihrauchhölzchen vermengt, die in ungezählten Mengen vor den bronzenen, steinernen und hölzernen Götzenbildern brennen.
Zur Linken führt ein Thor nach einem großen schattigen Garten. Welche Ueberraschung! Unter den riesigen Kampferbäumen stehen hier eine Anzahl Theehäuser,[S. 416] und vor jedem derselben laden uns buntgekleidete Musmis mit freundlichem Lächeln zum Besuch ein, Musmis in roten, blauen und rosenfarbigen Kimonos, mit Blumen besäet, Blumen auch in dem üppigen schwarzen Haar, den Samisen, die japanische Guitarre, in der Hand, und treten wir ein, flugs werfen sie sich zu Boden und harren der Befehle. Dann bringen sie, immer lächelnd, Stuhl und Tischchen herbei, es folgen Aschenbehälter mit glühenden Kohlen, dann die zierlichsten kleinen Porzellanschüsselchen mit den seltsamsten Eßbarkeiten. Sie drücken einem in reizend naiver Weise die japanischen Chop-Sticks (Eßhölzchen) in die Hand und lachen über unsere Ungeschicklichkeit. Drei, vier, fünf von diesen zierlichen Geschöpfchen kauern rings um mich auf dem Boden und befühlen meine Kleider, zupfen an meiner Uhrkette, nötigen mich zu essen und zu trinken. Ob ich nicht möchte, daß sie tanzten? Gewiß. Sofort wird der Samisku herbeigeholt, und während eine an den Saiten zupft, tanzen die anderen die eigentümlichen japanischen Tänze, den Manzai, Kisku und Ogurayama, tanzen sie mit den Händen, den Hüften, den Köpfchen und Knieen, nur nicht mit den Füßen. Dabei sehen sie so reizend aus, so verführerisch, so jung, vierzehn, fünfzehn Jahre, daß man nicht französischer Seeoffizier zu sein braucht, um sich in diese Chrysanthèmes zu vergucken. Und reißt man sich endlich los von den kleinen Zauberinnen, dann fallen sie nieder auf alle Viere und berühren ganz demütig mit der Stirne den Boden. Sayonara, Sayonara!
Am andern Tage trete ich den Rückweg nach der Stadt an, und unten angekommen zeigt sich mir in den Seitenstraßen der Vorstädte vereinzelt das seltsame, kaum glaubliche Schauspiel, das Pierre Loti in der Heimat von Fräulein Chrysanthème so oft gesehen hat:
„Zwischen fünf und sechs Uhr nachmittags ist jedes lebende Wesen nackt; Kinder, junge Leute, alte Männer, alte Frauen, alles sitzt in einem Bottich irgendwelcher Art und badet. Und das findet wo immer statt, in den Gärten, in den Höfen, in den Kaufläden, selbst auf der Thürschwelle, so daß die Unterhaltung mit den Nachbarn auf der anderen Seite der Straße leichter vor sich gehen kann. In dieser Situation werden Besucher empfangen, und die Badenden verlassen ohne das geringste Zögern die Badewanne, um dem Besucher einen Sitz anzubieten oder mit ihm einige liebenswürdige Redensarten zu wechseln. Indessen, weder die jungen Mädchen noch die alten Frauen gewinnen etwas durch dieses ursprüngliche Auftreten. Eine japanische Frau ohne ihren langen Kimono und ihren breiten, anspruchsvollen Obi (Leibbinde) ist nichts als ein winziges, gelbes Wesen mit krummen Beinen und flacher, formloser Brust; keine Spur bleibt zurück von ihren künstlichen kleinen Reizen, die gleichzeitig mit ihrer Kleidung verschwunden sind.”
Die Wahrheit dieser Bemerkung hat gewiß jeder empfunden, der die Japanerinnen im Bade gesehen hat, und gesehen hat sie jeder Japanbesucher, auch wenn er sie nicht gesucht hat, ja selbst, wenn er getrachtet hätte, ihnen auszuweichen, denn sie[S. 417] sind, wie gesagt, morgens und abends überall zu sehen. Wie beim Schmetterling, so sind es auch bei den Chrysanthèmes von Japan nur die Flügel, die Kleider, welche sie so reizend machen.
Ob denn das Urbild von Madame Chrysanthème, der japanischen Gattin Pierre Lotis, auch eine solche Enttäuschung für ihn war? Mein Schiff fuhr erst spät abends weiter, ich hatte also noch hinlänglich Zeit, ihr meinen Besuch abzustatten. Aber wie sie finden? Ueber den Bund schlendernd, kehrte ich bei dem Konsul einer großen, uns nahestehenden Kontinentalmacht ein, um mich nach ihr zu erkundigen. War sie seit dem Erscheinen von Pierre Lotis Buch zu einer Weltberühmtheit geworden, so wird man sie doch in Nagasaki noch viel besser kennen. Der Konsul war nicht zu Hause, und sein Sekretär hatte gar keine Ahnung von Pierre Loti und kannte weder das Buch noch die Heldin desselben. Vielleicht konnte ich beim französischen Konsul Auskunft in dieser Angelegenheit erhalten. Ich kletterte zwischen schönen, tropischen Gärten hinauf zu dessen Wohnung. Loti? Madame Chrysanthème? Er zuckte die Achseln. „Bedaure. Unbekannt.” Wie sollte er jeden Marineoffizier kennen, der in Nagasaki herumspaziert! Es kommen so viele französische Kriegsschiffe hierher. Gewöhnlich steigen sie bei Madame L., der Besitzerin des Hotels Bellevue, ab.
Das Hotel ist ganz nahe, und ich hatte doch die Absicht dort zu essen. Madame L. ist die dritte Witwe eines französischen Journalisten, der vor einigen Jahren in Tokio eine Zeitung, Courrier du Japan, gegründet hat. Nach einigen Nummern starb die Zeitung, gerade so wie ihr Gründer, an der Auszehrung. Seither warf sich die Witwe auf das Hotelwesen und darbt nicht mehr. Beim Kaffee, den ich auf der Hotelterrasse an ihrem Tisch einnehme, frage ich sie nach Pierre Loti und Madame Chrysanthème. Sie lacht auf. „Mais Monsieur, c’est un farceur! Er war in Nagasaki, hat aber weder Haus noch Frau hier gehabt. Das ist ja alles erdichtet! Er hat bei mir gewohnt und gegessen.” „Und Madame Chrysanthème?” fragte ich weiter. „Quand à ça”, antwortete sie mir, „es giebt Tausende hier. Sie brauchen nur zu pfeifen, und sie kommen. Aber Pierre Loti hat niemals mit einer solchen zusammengewohnt. Das einzige Wahre in seinem Buche ist seine Beschreibung von Nagasaki und seine Bemerkung, daß das vermeintliche Bronzepferd im Osuvatempel aus Jadestein ist.”
Ich empfahl mich und kehrte enttäuscht auf mein Schiff zurück. Ein paar Stunden vorher hatte ich selbst vor dem Bronzepferde gestanden und mich, mit dem Taschenmesser daran kratzend, überzeugt, daß das Pferd aus Bronze sei. Ob die Geschichte mit Pierre Loti, welche mir die Besitzerin des Hotels erzählt hat, ebenso unrichtig ist wie jene mit dem steinernen Pferd?
Wenn ich mir die vielen Länder, die ich in den verschiedenen Weltteilen gesehen habe, vor Augen zaubere, so kann ich doch keines finden, das sich an leidenschaftlichem Reiz, an idyllischer Schönheit mit dem Paradiese von Ostasien, mit Japan, vergleichen ließe, und in diesem letztern ist wieder die Inlandsee das Schönste.
Man denke sich den vielgerühmten Lago Maggiore mit Palanza und seinen Borromëischen Inseln hundertmal vergrößert, dann hat man ein annäherndes Bild der Inlandsee. Kein anderer Erdenstrich könnte den Vergleich mit ihr aushalten, und selbst der Lago Maggiore ist lange nicht so lieblich und zugleich großartig. Der großen Hauptinsel des japanischen Reiches, Hondo, sind gegen Südosten drei andere große Inseln vorgelagert, Kiuschiu, Schikoku und Awadschi, und zwischen ihnen breitet sich eine Wasserfläche von etwa 350 Kilometern Länge und zehn bis fünfzig Kilometern Breite aus, die mit der ungeheuren Wasserwüste des Stillen Ozeans nur durch schmale Straßen verbunden ist. Diese von den vier genannten Inseln umschlossene Wasserfläche ist die Inlandsee.
Auf meiner Dampferfahrt von Nagasaki nach dem in der letzten Zeit vielgenannten Schimonoseki bildeten einige Reisebeschreibungen über Japan meine Lektüre, und unwillkürlich mußte ich über die Ueberschwänglichkeit lächeln, mit welcher die Schönheiten der Inlandsee, deren Portierloge sozusagen Schimonoseki bildet, darin gepriesen werden. Allein die Wirklichkeit übertrifft thatsächlich alle Schilderungen. Schimonoseki selbst hat daran freilich keinen Anteil; ein kleines, bescheidenes Städtchen, der Hauptsache nach nur aus einer Straße bestehend, die sich auf zwei Kilometer längs des Nordufers der schmalen Meerenge hinzieht. Der Mastenwald von unzähligen Segelbooten entzog es unserem Anblick, so daß ich den Aufenthalt unseres Dampfers in der gegenüberliegenden großen, schwarzen Kohlenstation Modschi benutzte, um auf einer der flinken Dampfschaluppen, welche den Verkehr zwischen beiden Ufern der Meerenge besorgen, nach dem Städtchen zu fahren. Vor den Holzhäuschen und rings um die Warenhäuser herrschte reges Leben. Schimonoseki ist von der europäischen Kultur noch vollständig unberührt geblieben, und ganz wie vor der großen Revolution kleiden sich und leben die Einwohner auch noch heute. Selten wird es von Europäern besucht, kaum daß ein halbes Dutzend von Touristen in jedem Jahre in einem der kleinen urjapanischen Gasthöfe absteigt. Hinter dem Orte, die waldgekrönten Anhöhen hinauf, ist jedes Fleckchen Landes von den fleißigen Japanern bebaut worden, und auf beiden Seiten der Meeresküste bilden die zahlreichen, mit Kanonen besetzten Festungswerke die einzige Unterbrechung.
Die Schimonosekistraße mit ihren hohen, malerischen Uferbergen und der hier stets heftigen Flutströmung erinnerte mich lebhaft an den Rhein, etwa bei Bingen. Die[S. 419] Breite ist auch nicht viel größer, nur sind die Krümmungen stärker, so daß die großen Seedampfer mit besonderer Sorgfalt gelenkt werden müssen. Nach kurzer Fahrt treten die Ufer zurück, und wir befanden uns in dem am wenigsten schönen Teil des Binnenmeeres, der weiten, tiefblauen, spiegelglatten Suwo-Nada. Aber schon nach zweistündiger Fahrt sahen wir vor uns eine Anzahl von Inseln aus der Seefläche emporsteigen, und während der nächsten zwanzig Stunden kamen wir aus dem großartigen Insellabyrinth der Inlandsee gar nicht mehr heraus. Tausende und Abertausende von Inseln bedecken hier die Wasserfläche, Inseln in jeder Größe, bis zu kleinen, kaum einige Meter hohen Felsen, alle in so malerischen Formen und in so entzückender Gruppierung, daß man bei der Betrachtung dieser idealschönen Scenen in Bewunderung schwelgt. Die Passagiere unseres Dampfers blieben den ganzen Tag über auf Deck; vergeblich wurde der Gong zu den Mahlzeiten geläutet, und selbst als nach der entzückendsten, ewig wechselnden Beleuchtung die Sonne untergegangen war und schließlich Mond und Sterne auf dem Firmament erschienen, konnten sich nur die wenigsten entschließen, die Kojen aufzusuchen. An manchen Stellen befand sich unser Dampfer in einem Seekessel von zehn bis zwanzig Kilometer Durchmesser, auf allen Seiten von Land eingeschlossen, und nirgends war eine Durchfahrt zu entdecken. Hohe Bergketten erhoben sich kulissenförmig hintereinander, manche bewaldet, manche mit steilen, kühnen Vulkanspitzen; die weite Seefläche wurde von zahllosen Segelbooten durchfurcht, alle in alten malerischen Formen mit blendend weißen, viereckigen Segeln; ruhig wie Schwäne glitten sie einher und näherten sich unserem gewaltigen Dampfer; dann konnten wir auch die peinliche Reinlichkeit dieser nicht wie die Chinesenboote bemalten, sondern weiß gescheuerten Schiffe bewundern, deren Insassen ein geradezu ideales Leben von Ruhe und Behaglichkeit führen mochten. Zwischen den hoch aus dem Wasser ragenden Bootenden erhob sich auf den meisten eine kleine Kabine mit Wänden aus Bambusgeflecht, und im Innern lagerten die Insassen, ganze Familien, anscheinend unbekümmert um den häßlichen, schwarzen Rauch pustenden, lärmenden Riesendampfer, der die olympische Ruhe und Erhabenheit dieser einzig schönen Natur so rücksichtslos störte.
Auf solche scheinbar vollständig landumschlossene Seen folgten enge, von hohen Felseninseln eingefaßte Meerengen, die durch ihr heftiges, schäumendes Flutenspiel reißenden Bergflüssen glichen, und waren sie, nicht ganz ohne Gefahr für den Dampfer, passiert, so traten uns wieder die entzückendsten Inselgruppen vor Augen; die aus den blauen Fluten emporsteigenden Anhöhen waren bis hoch hinauf durch die fleißigen Inselbewohner in Terrassen geteilt worden, um die Bebauung zu ermöglichen; auf jeder Insel zeigten sich diese parallelen Terrassenlinien, während in den lauschigen, saftiggrünen Thälern, halb versteckt zwischen schattigen Hainen, die reinlichen Häuschen der Einwohner lagen. Zuweilen fuhren wir so nahe an ihnen[S. 420] vorbei, daß wir mit aller Deutlichkeit die Einzelheiten ihrer bescheidenen Haushaltungen wahrnehmen konnten; oder den Strand entlang zogen sich größere Städte hin mit Tempeln und Pagoden und regem Schiffsverkehr. Tempelchen und Heiligenschreine mit zahlreichen hochroten Opferthoren thronten auch auf den kleinsten Felseninselchen, gewöhnlich einzelne von ungemein malerischen, phantastisch geformten Fichten, deren lange, bis ins Wasser reichende Aeste von dem durch unseren Dampfer aufgeworfenen Wellenspiel bewegt wurden. Ueber dem ganzen entzückenden, stets wechselnden Bilde lag solcher Friede, solch Wohlbehagen, daß man am liebsten gleich hier ausgestiegen wäre, um inmitten dieses glücklichen Inselvölkchens den Rest seiner Tage zu verleben. Manchmal erinnerten mich gewisse Strecken dieses Binnenmeeres an die Azoren, an die schönen Sandwichinseln, Tausende von Kilometern weiter östlich, mitten im Großen Ozean gelegen; dann wieder an die Thousand Islands im St. Lorenzostrom, die ich so oft durchfahren hatte, oder an den herrlichen träumerischen Puget Sound im fernen Washington-Territorium. Wie die noch heute von Indianern bewohnten stillen Waldinseln dieser amerikanischen Inlandsee mochten die Inseln, an denen wir vorüberglitten, vor urdenklicher Zeit ausgesehen haben. Seit Jahrtausenden aber sind sie schon der Kultur unterworfen, und gerade diese Vereinigung von verständnisvoller Kultur und idealer Natur ist es, welche das Inlandmeer so reizvoll macht. Manche dieser Tausende von Inseln sind heilige Stätten der Japaner, so die Insel Miyadschima in der Nähe der großen Stadt Hiroschima. Ein einziger herrlicher Park mit riesenhaften, uralten Kryptomerien umgiebt die wunderbaren Tempel, denn an diese Baumriesen darf die Axt nicht angelegt werden; mitten unter den Pilgern ziehen die flüchtigen Waldbewohner, die Hirsche, umher und lassen sich mit der Hand füttern; nach einer uralten Vorschrift dürfen auf dieser heiligen Insel keine Geburten und keine Todesfälle vorkommen. Erwartet man solche Ereignisse, so werden die Betreffenden ans Festland geschickt.
Zu schnell vergingen uns Passagieren der Tag und die Nacht, und am nächsten Morgen sahen wir mit Bedauern das Ziel unserer Reise, gleichzeitig das Ende des Binnenmeeres, die weiße Stadt Kobe vor unseren Augen am Horizont auftauchen. Aber glücklicherweise wird dem Weltwanderer durch japanische Dampfer Gelegenheit geboten, die Inseln der Inlandsee zu besuchen und länger auf ihnen zu verweilen. Freilich sind diese Dampfer nicht solche europäischer Art. Nur der Schiffskörper und die Maschinen sind europäisch, alles Uebrige ist japanisch; der Reisende muß sich mit der recht frugalen japanischen Kost zufriedengeben, und will er seine Kabine betreten, so muß er sich zuvor seines Schuhwerks entledigen, gerade so, als würde er ein japanisches Haus besuchen. Aber wie gerne opfert man die gewohnte Bequemlichkeit, um diesen ostasiatischen Lago Maggiore zu besuchen und einige Wochen ungetrübten Glückes inmitten der entzückendsten Inselwelt des Erdballes zu verleben!
Obschon Kobe, nächst Yokohama der größte und besuchteste Seehafen des Mikadoreiches, ebenfalls zu den angenehmsten Orten des letzteren gehört, wirkte die Landung hier doch ernüchternd auf uns, als wären wir aus dem Olymp herabgestiegen mitten unter das prosaische, geschäftige europäische Erdenwallen. Kobe ist nämlich in der That nichts weiter als ein Stückchen Europa, an den Strand der größten Japaninsel Hondo versetzt. Freilich ein schönes Stück Europa, etwa ein Stück der Riviera, Mentone oder Bordighera. Eine schöne breite Straße mit Baumalleen und grünen Rasenflächen legt sich um die stets mit Hunderten von Dampfern und Segelfahrzeugen belebte Bucht, an der Landseite mit blendend weißen stattlichen Gebäuden besetzt, in deren Mitte stets die schwarz-weiß-rote Flagge auf dem deutschen Konsulate flattert. Am südlichen Ende dieser Häuserreihe ragt eine von einem Leuchtturm überhöhte Landzunge weit in die Bucht; sie wurde durch die Schlamm- und Steinmassen des zuweilen sehr wasserreichen Minatogawaflusses aufgeworfen, der hier an seiner Mündung die Grenze zwischen Kobe und der japanischen Zwillingsstadt Hiogo bildet. Indessen von einer Grenze zwischen beiden kann hier eigentlich nicht gesprochen werden, denn beide Städte sind durch ihre Interessen, durch ihren geschäftlichen Verkehr längst miteinander vereinigt, und die Ufer zu beiden Seiten des Minatogawaflusses, welche einst die Städte voneinander trennten, sind heute in reizende Parkanlagen verwandelt, ein beliebter Spaziergang der Europäer sowohl wie der Japaner.
Kobe ist ein Beispiel des in seiner Art geradezu amerikanischen Städtewachstums, das auch mehrere andere Orte Japans seit der großen Revolution aufzuweisen haben. Erst vor etwa vierzig Jahren kam der erste europäische Ansiedler nach dem öden Landstrich östlich des kleinen Städtchens Hiogo, den die Japaner für eine europäische Kolonie bestimmt hatten, und heute zählen Hiogo und Kobe zusammengenommen gegen zweihunderttausend Einwohner. Wie Yokohama, so hat auch Kobe seine englischen und deutschen Klubs, große vorzügliche Hotels ganz nach europäischer Art, Vereine, Gesellschaften und einen sehr bedeutenden Handel. Die Straßen Kobes übertreffen sogar jene von Yokohama an Breite und Reinlichkeit. Inmitten des seinem Aussehen nach lebhaft an den europäischen Süden gemahnenden Städtchens befand sich zur japanischen Zeit ein öder Fleck, der Richtplatz von Hiogo. Das Blut Hunderter von Opfern des Schlachtbeils hat den Boden hier gedüngt; an den Ecken des Platzes erhoben sich die hohen Stangen, auf welche die abgeschlagenen Köpfe, eine Beute für Geier, gesteckt wurden. Heute ist dieser Fleck in einen reizenden kleinen Park verwandelt, hinter welchem sich die Kobe umgebenden Anhöhen hinauf eine europäische Villenstadt befindet, die Wohnungen der Geschäftsleute, welche unten am Strande ihre Bureaus und Warenlager haben. Wer diese anmutige, belebte Hafenstadt durchwandert und sie mit ähnlichen Städten in Europa vergleicht, der würde ihre Einwohnerzahl auf mindestens mehrere tausend schätzen. Und doch[S. 422] erreicht sie in Wirklichkeit nicht einmal achthundert, die Frauen und Kinder eingeschlossen. Man würde es nicht für möglich halten. Während meiner Anwesenheit fand in der hübschen Konzerthalle der Stadt ein Konzert statt; das Auditorium war mit Damen in den elegantesten Toiletten und Herren im Frack und weißer Binde vollständig gefüllt, als stände die Halle in Wien oder Berlin und nicht bei den Antipoden; ein ganz annehmbares städtisches Orchester begleitete die fremden Künstler, und das Publikum beklatschte Brahms und Schumann mit Enthusiasmus. Wie tagsüber in den Straßen, so herrschte auch abends in den Klubs reges Leben; besonders wenn fremde Kriegsschiffe im Hafen liegen, was sehr häufig vorkommt, geht es in diesen eleganten Lokalen sehr munter zu. Mein Zimmer im Oriental Hotel ging gerade auf den benachbarten deutschen Klub, und ich kann von diesem fröhlichen Treiben recht viel erzählen. Vor drei Uhr morgens konnte ich keine Nacht die Augen schließen; die Handvoll biederer Germanen machte auf der Klubterrasse bei schäumendem Münchener Faßbier genug Lärm für einen großstädtischen Turnvereinsabend. Die meisten Europäer, die nicht als Regierungsvertreter oder Missionare hier wohnen, sind Importeure, Seiden- und Theehändler. Mit Interesse besuchte ich eines der großen Thee-godowns, wo Hunderte von Japanerinnen bei kärglichem Tagelohn die Theeblätter in heißen Pfannen rösten; mit offenen Jacken, die Brust und Arme entblößt, stehen sie vom frühen Morgen bis nach Sonnenuntergang an ihren Röstöfen und wenden mit den Händen die schmutziggrünen Blätter, die hauptsächlich in Nordamerika guten Absatz finden.
Das Schönste von Kobe ist seine Umgebung. Unmittelbar hinter der Stadt steigen eine Reihe von Bergen auf mehrere hundert Meter vom Meere empor, darunter sogar ein Bismarcksberg, wegen der drei einsamen, schlankstämmigen Bäume, die auf seinem kahlen Scheitel stehen, so genannt; diese Berge entlang ziehen sich prächtige Spaziergänge und führen zu schattigen Wäldern, Aussichtspunkten, Tempeln und Theehäusern. Der anmutigste Spaziergang ist wohl jener zu den berühmten Wasserfällen von Nunobiki, in deren Nähe man häufig große Affen herumklettern sieht. An den Wasserfällen spielt sich, besonders an Festtagen, ein gutes Stück japanischen, recht ursprünglichen Lebens ab. In den Tümpeln zu Füßen der Fälle baden sich nackte Männlein und Weiblein zusammen in rührender Ungeniertheit, in den Theehäusern tanzen die Maikos und singen die Geishas bei unvermeidlichem Samisengezupfe. Kaum wurden die Mädchen meiner oder irgend eines anderen Europäers gewahr, so ging der monotone Singsang los. Man hat die Mädchen hundertmal tanzen gesehen, das Pin-Pin der japanischen Guitarre tausendmal gehört, aber man läßt es doch immer wieder über sich ergehen. Japan ist eben das Land des Gesanges und des Tanzes.
Die Größe und Bedeutung des modernen Japan im Welthandel, die Leichtigkeit, mit der es sich im Laufe der letzten drei Jahrzehnte der europäischen Kultur erschlossen und die europäischen Industrien angenommen hat, lassen die Ansicht gerechtfertigt erscheinen, daß auch die wenigen europäischen Handelsstädte in Japan in rascher Zunahme begriffen seien. Aber die Zahl der in Japan ansässigen Europäer, welche auch in der besten Zeit kaum viertausend erreicht haben dürfte, hat in den letzten Jahren, besonders nach dem neuen Vertrag mit den europäischen Mächten, welcher die Europäer in Japan in unerhörter Weise den japanischen Gerichten unterstellt, eher ab- als zugenommen. Im ganzen waren in Japan bis 1898 sieben Städte den Europäern geöffnet, d. h. in sieben Städten wurden ihnen eigene, streng begrenzte Quartiere für Wohnsitze angewiesen, und die dort ansässigen Weißen, zum größten Teil Engländer und Amerikaner, verteilen sich bis auf die jüngste Zeit in folgender Weise:
Unter diesen etwas über 4000 Ausländern befinden sich 2100 Engländer, 1000 Amerikaner, 600 Deutsche und 500 Franzosen.
Wenn man berücksichtigt, daß mehr als die Hälfte dieser Ausländer christliche Missionare sind und daß von den übrigen 2000 wieder mehrere hundert im diplomatischen Dienst ihrer Heimatsländer oder im Dienst der japanischen Regierung stehen, so bleiben im ganzen etwa tausend Europäer, welche in Japan als Kaufleute thätig sind.
Das wichtigste Emporium des europäischen Handels mit Japan und gleichzeitig die größte europäische Ansiedelung im Reiche des Mikado ist Yokohama. Die großen Dampfergesellschaften, welche den Verkehr zwischen Europa, Ostasien und Amerika mit Japan vermitteln, darunter auch der Norddeutsche Lloyd, lassen ihre Schiffe hier anlaufen. Yokohama ist das große Thor nicht nur für den ausländischen Warenverkehr und die Touristenwelt, sondern auch für die Japaner selbst: es ist der Hafen der Reichshauptstadt Tokio und durch seine große Nähe beinahe nur ein Vorort der letztern. In gesellschaftlicher Hinsicht bilden Yokohama und Tokio nur eine Stadt. An größern Festlichkeiten in der einen Stadt nehmen die Europäer der andern gewöhnlich teil, und zwischen beiden herrscht das ganze Jahr über reger Verkehr.
Wer auf einem der großen Passagierdampfer des Norddeutschen Lloyds von China aus oder mit den Prachtschiffen der kanadischen Pacificgesellschaft von[S. 424] Nordamerika aus sich dem Hafen von Yokohama nähert, der wird von dem europäischen Leben dort vor der Hand nichts gewahr. Beim Anblick der malerischen Pracht der Seeküsten dieses ostasiatischen Inselparadieses, der Fremdartigkeit des Schiffsverkehrs auf der tiefblauen, mit zahlreichen, seltsamen Eilanden gespickten Meeresfläche glaubt er sich nach der langen einförmigen Seefahrt eher einem anderen Planeten zu nähern, als dessen erstes Wahrzeichen er bei klarem Wetter den wunderbaren Schneekegel des heiligen Berges der Japaner, des Fudschiyama, erblickt. Scharf hebt sich die den größten Teil des Jahres mit Schnee bedeckte Vulkanspitze von dem italienischen Himmel ab, der mich in seiner Eigenart und Majestät an einen anderen Bergriesen in der westlichen Hemisphäre erinnerte, an den gewaltigen Orizaba in Mexiko. Wie dieser, so weist auch der Fudschiyama mit seinem Schneekegel den Seefahrern leuchtend den Weg. Bald nachdem er über dem Horizont erschienen, zeigt sich gegen Osten ein zweiter mächtiger Vulkan, der stets qualmende Oschima auf der Vriesinsel. Dann kommen die ungemein malerischen Küsten der Bai von Tokio in Sicht, der Dampfer kreuzt die Mississippibucht mit ihren steilen, bewaldeten, malerisch geformten Felsen und geht endlich im Angesicht von Yokohama mitten zwischen Hunderten von Schiffen aller Art, von den größten fremdländischen Kriegsdampfern bis zu den winzigen japanischen Sampans, etwa einen Kilometer weit vom Lande vor Anker. Wie das Theaterschiff im dritten Akt von Meyerbeers „Afrikanerin”, ist auch unser Dampfer bald von fremdartigem, dunkelhäutigem Volke erobert, das aber nicht gekommen ist, um den friedfertigen Seefahrern den Garaus zu machen, sondern mit freundlichem Grinsen in der höflichsten Weise den Kulis Adressen von Hotels, Schneidern, Schustern und Kuriositätenhandlungen zu überreichen. Die drei vornehmsten Hotels von Yokohama holen glücklicherweise die Passagiere in eigenen Dampfbarkassen ab, und ihre Angestellten überheben sie der Sorge um ihr Reisegepäck. Auf der ganz europäisch eingerichteten Landungspier stehen wie bei uns die Droschken, Dutzende von Kurumas, bequeme einsitzige Fauteuils auf Rädern, bereit, und ein Kuli, der Kutscher und zweibeiniges Zugtier zugleich ist, bringt uns in raschem Lauf auf einer durchaus europäischen Straße nach dem ebenso europäischen Grand Hotel.
Was den Reisenden in Yokohama gewiß zunächst auffällt, ist die Abwesenheit von all den unangenehmen, lärmenden und schmutzigen Zuthaten unserer europäischen Häfen. Nirgends die hohen, düstern Warenhäuser, die rauchenden und pustenden Lokomotiven, kreischenden Dampfkräne, Schienengeleise, Frachtwagen, schmutzigen Hafenstraßen mit ihrem internationalen Verkehr, ihren Matrosenkneipen und Kramläden. Yokohama zeigt sich von der See aus eher wie eines unserer fashionablen Seebäder, Ostende oder Norderney, als wäre es gar nicht eine der wichtigsten Hafenstädte und Warenzentren eines großen Kontinents, sondern nur eine Villeggiatur wohlhabender Europäer, die sich hier wie etwa an der Riviera[S. 425] der herrlichen Natur und des gesellschaftlichen Lebens erfreuen wollen. Tausende von Globetrottern und Weltreisenden, vergnügungssüchtigen reichen Amerikanern und Engländern ziehen hier das ganze Jahr über aus und ein; Hunderte von europäischen Ansiedlern in Ostasien, hauptsächlich aus Shanghai, Hongkong, ja aus Bangkok und Singapore bringen den Sommer mit ihren Familien in Japan zu, und Yokohama ist der wichtigste Landungsplatz, der Verteilungspunkt all dieses fashionablen Verkehrs.
Dabei ist diese europäische Stadt im Reiche des Mikado eine ganz neue Gründung; noch vor etwa vierzig Jahren war der Name Yokohama höchstens einigen Diplomaten bekannt, als das damalige elende Fischerdörfchen von ein paar hundert Einwohnern von der japanischen Regierung den Europäern für eine Ansiedelung zugewiesen wurde. Damals hätte gewiß niemand vorausgesagt, daß nach vier Jahrzehnten dieses Fischerdorf zu einer Großstadt von nahe 200000 Einwohnern und einem Welthafen von ein paar Millionen Tonnen, mit einem Warenverkehr im Werte von etwa hundertfünfzig Millionen Yen herangewachsen sein könnte.
Yokohama liegt auf einer nur wenige Meter über dem Meeresspiegel sich erhebenden, vollständig flachen Insel, auf der Ostseite bespült von den Wellen der Bai von Tokio, auf den übrigen drei Seiten durch Schiffahrtskanäle vom Lande getrennt. Diese etwa zwei Kilometer lange und einen Kilometer breite Insel wird durch einen mit schönen europäischen Gebäuden besetzten und mit Gartenanlagen geschmückten Boulevard in zwei Hälften geteilt. Die nördliche Hälfte wird von der japanischen, die südliche von der europäischen Stadt eingenommen.
Man wäre nun geneigt zu glauben, daß die im Laufe der Jahre hierher verschlagenen Europäer von der so sympathischen, so ansprechenden und malerischen Kultur der Japaner, die sie selbst so sehr rühmen, etwas angenommen haben würden. Jeder nach Japan kommende Tourist hat das Verlangen, dies zu thun, und erkennt gerne die großen Vorteile an, welche sie in mancher Hinsicht des Lebens gegenüber der nüchternen, geschäftigen, europäischen besitzt. Aber die ersten Ansiedler waren eben Engländer. John Bull bleibt überall derselbe, ob er an den Ufern der Themse oder bei den Antipoden wohnt. Seine Zivilisation ist ihm so fest an den Leib gewachsen wie seine Beine, und er trägt sie überall mit hin. Die Engländer haben das Werk begonnen, die anderen Nationen sind ihnen gefolgt, und so ist hier eine durchaus europäische Stadt entstanden, mit geraden, wohlgepflasterten und erleuchteten Straßen, mit steinernen Häusern im europäischen Stile, mit Kaufläden, Buchhandlungen, Banken, Apotheken; mit vornehmen Hotels, Klubhäusern, Kirchen, Zeitungsbureaus, daß man sich ebensogut in Plymouth oder Penzance wähnen könnte, wären im Straßenverkehr nicht die japanischen Diener, Arbeiter und Bettler so zahlreich.
Neben dem vorgenannten, Nipon o dori genannten Boulevard mit dem großen Postamte und mehreren anspruchsvollen Konsulatsgebäuden ist die schönste Straße Yokohamas der Bund, eine schnurgerade, mit Bäumen bepflanzte Avenue, die sich wie die Promenade des Anglais in Nizza längs des Meerufers einen Kilometer weit hinzieht und nur auf der Landseite von Häusern besetzt ist. Aber hier, ebenso wie in den hinter dem Bund befindlichen Straßen, befinden sich nur die Hotels, Klubs, Konsulate und Geschäftshäuser. Doch ist die City, das geschäftliche Viertel von Yokohama, nur tagsüber belebt. Die meisten Europäer wohnen auf dem Bluff, südlich der Insel von Yokohama auf dem Festlande von Nipon. Dort erhebt sich steil aus dem Meere ein etwa fünfzig Meter hohes Plateau mit einer entzückenden Rundsicht auf die weite Meeresbucht, die sie umfassenden malerischen Küsten und die entfernten Bergketten des zentralen Japans mit dem alles überragenden Fudschiyama. Wer den steilen, mit japanischen Kuriositätenlagern und Kaufläden besetzten Weg zu dem Bluff emporklettert, befindet sich in wenigen Minuten in einer reizenden Villenstadt, einem kleinen Homburg, ebenso durchaus europäisch wie die Geschäftsstadt zu ihren Füßen. Jede der hübschen, in modernem Baustil errichteten Villen ist von einem Garten umgeben, in welchem die reiche japanische Flora, von eingeborenen Kunstgärtnern gepflegt, zu geradezu großartiger Entfaltung gelangt ist, vor allem in dem weitläufigen, öffentlichen Park, dem Bluff Garden, hinter welchem man sogar einen Wettrennplatz wie jenen in Goodwood oder Epsom gewahr wird. Verborgen zwischen majestätischen Kampferbäumen und japanischen Kiefern liegen hier oben auch das deutsche und englische Hospital, der Friedhof und eine Anzahl Missionsanstalten. Ebenso wie die City unter dem Bluff, enthält auch die Villenstadt auf dem Bluff etwa 300 Häuser mit ebensovielen Gärten. Hier leben die Kaufherren von Yokohama mit ihren Familien in entzückenden Homes, behaglich in ganz europäischem Stil eingerichtet, aber mit durchweg japanischer oder chinesischer Dienerschaft. Ist der Erwerb in Yokohama auch lange nicht so bedeutend wie in Shanghai oder Hongkong, so ist dafür auch das Leben billiger; die Chinesen sind die ehrlichsten und treuesten Diener, die Japaner die freundlichsten, dabei auch ganz vortreffliche Köche, so daß es in Yokohama den europäischen Hausfrauen bei weitem nicht so schwer ist, die Haushaltung zu besorgen, wie in Europa und auch der Junggeselle in seinem eigenen Heim ein sehr behagliches Dasein führen kann. In diesen Haushaltungen geht es zuweilen recht lustig her; es werden Gesellschaften, Tänze, Diners veranstaltet, und für die Vorbereitungen läßt man die japanischen, ungemein findigen Diener Sorge tragen. Sie stehen mit ihren Kollegen in anderen Häusern in Verbindung; fehlt es an Fleisch oder Fischen, so wird das Fehlende von diesen Kollegen entlehnt, und nicht selten kommt es vor, daß ein Kaufherr, bei einem anderen zu Gaste geladen, seine eigenen Bestecke, Teller und Schüsseln zu seiner Ueberraschung auf dem fremden Tische findet.
Recht eigentümlich ist in Yokohama, ebenso wie in Kobe, die Numerierung der Häuser. Wohl führen die Hauptstraßen auch Namen, und die einzelnen Geschäftshäuser haben ihre kleinen Firmentafeln, aber die Häuser sind nicht nach Straßen, sondern insgesamt je nach der Reihenfolge ihrer Erbauung numeriert, so daß es sowohl in der City wie auch auf dem Bluff nur gegen dreihundert Nummern giebt, wobei z. B. auf dem Bluff neben Nummer 99 Nummer 251, gegenüber Nummer 115, 186 und 165 liegen. Wo immer möglich, hat man in den Straßen die Nummern fortlaufend gehalten; denn sie spielen in Yokohama eine viel größere Rolle als in europäischen Städten. Da die Boten, Kuruma-Kulis, Briefträger nur ganz selten die europäischen Schriften lesen und auch die europäischen Namen nur schwer aussprechen können, so wird im öffentlichen Verkehr ein Geschäft gewöhnlich nur mit seiner Nummer bezeichnet. Die Kaufleute drucken auf ihren Briefbogen und Visitenkarten ihre Nummer ebenso bei wie ihre Kabeladresse, aber sonst weder Straße noch Haus. Bei den Kuruma-Boys, Dienst- und Geschäftsleuten heißen die Europäer einfach Gentleman Nummer 3 oder Lady Nummer 10. Einen anderen Namen kennen sie nicht.
Wie die Lebensmittel, so sind auch die Fahrgelegenheiten in Yokohama sehr wohlfeil; die Mehrzahl der Europäer haben ihre eigene Kuruma, die mit dem Lohn und Unterhalt des Kuli monatlich etwa zehn Yen, also ungefähr fünfundzwanzig Mark kostet; Privatequipagen mit Kutscher und Pferd kosten nur etwa hundert Mark monatlich, und deshalb wird auch von den Fahrgelegenheiten ungemein viel Gebrauch gemacht. Das gesellschaftliche Leben unter dem Häuflein der Europäer und Amerikaner der verschiedensten Nationen ist sehr rege; die Geschäftszeit beschränkt sich auf einige Stunden täglich, und auch diese werden nur an Steamer Days, wenn die einlaufenden Dampfer die Post bringen und abholen, streng eingehalten. Die Abende werden im Bekanntenkreise oder in den beiden Klubs zugebracht; zuweilen giebt es Konzerte und Theatervorstellungen von Wandertruppen, und fehlen diese, so hat doch Yokohama seine Gesang-, Orchester-, Cricket-, Renn- und Segelvereine, gerade so wie irgend eine Stadt Europas, obwohl die ganze verfügbare Bevölkerung kaum tausend Seelen umfaßt. Sogar ein städtisches Orchester von japanischen uniformierten Musikern ist vorhanden, und an den Abenden, an welchen dieses Orchester in dem Garten vor dem Grand Hotel Tafelmusik macht, herrscht in den Speisesälen dieses Hotels ein so elegantes und bewegtes Leben wie in den vornehmen Restaurants von Piccadilly, die Damen in großer Abendtoilette, die Herren in Schwarz mit weißer Halsbinde.
Dieses in Bezug auf Eleganz vielleicht sogar ein bißchen zu weit getriebene Gesellschaftsleben wäre in geistiger Hinsicht reger und angenehmer, wenn die Europäer nicht in so viele geschlossene Gesellschaften gespalten wären. So haben vor allem die sehr zahlreichen amerikanisch-protestantischen Missionare und ihre Frauen[S. 428] mit der kaufmännischen und diplomatischen Gesellschaft fast so gut wie gar keinen Verkehr. Ebenso sind die Engländer von den Amerikanern getrennt, beide wieder von den deutschen, und nur bei großen Anlässen, wie bei Wettrennen, Yachtfahrten, Konzerten und dergleichen trifft man sie vereinigt.
Japaner fehlen in der europäischen Gesellschaft vollständig. Die Japaner haben ihren eigenen Stadtteil und leben dort gerade so wie in irgend einer anderen japanischen Provinzstadt. Nur haben sie durch die fortwährende Berührung mit Europäern doch schon, was ihre Trachten anbelangt, einzelne abendländische Kleidungsstücke, Hüte, Schuhe oder Regenschirme angenommen, sie haben im Verkehr mit den rücksichtslosen, häufig roh auftretenden englischen und amerikanischen Touristen viel von ihrer Höflichkeit eingebüßt, und auch die Bazare haben sich diesem, von den ansässigen Europäern nicht mit Unrecht gehaßten Globetrotterverkehr angepaßt. Wohl sind die Kaufläden ungemein zahlreich, aber sie enthalten doch nur auf den Globetrottergeschmack berechnete Artikel, und feine, altjapanische Kunstsachen oder Antiquitäten wird man nur selten finden. Dennoch gehören die beiden Hauptstraßen des japanischen Stadtteiles, Benten-dori und Hondscho-dori, zu den belebtesten und sehenswertesten von ganz Japan. Die berühmte Isezakicho, die breiteste und belebteste Straße Yokohamas mit ihren fünf großen Theatern, ihren Schießbuden, Akrobaten und Märchenerzählern, mit ihren feinen japanischen Restaurants und Theehäusern, ein beliebter origineller Spaziergang für die Fremden und wohlbekannt bei den Einheimischen, ist im Sommer 1899 einem verheerenden Brande zum Opfer gefallen. Die schönen großen Bazare sind bis auf den Grund zerstört, weit schweifte der Blick auf dem öden Trümmerfeld vom Bahnhof bis zur griechischen Kirche, wo wenige Stunden vorher hohe Häuser standen und viele Tausende von Menschen ihr Heim besaßen. Verbrannt sind auch die Hauptpolizeistation, die große Yoshidaschule, die Musaschibank, Backsteinbauten, die der Gluthitze keinen Widerstand zu leisten vermochten.
Von den anderen Häusern sind, da sie nur aus Holz gebaut waren, der steinerne Kochherd und die Dachziegel übrig geblieben. Auf jedem Platze, wo ein Haus gestanden, wird bei einem Brande gewöhnlich von der Polizei eine Tafel mit dem Namen des Besitzers angebracht, damit derselbe im Schutte nach Gegenständen suchen kann, die die Hitze überdauert haben sollten. Binnen wenigen Stunden wurden 3300 Häuser vom Feuer verzehrt, viele Menschenleben sind verloren gegangen, und der materielle Schaden erreichte viele Millionen.
Glücklicherweise sind wenigstens die anderen Stadtteile Yokohamas, welche ebenfalls bedroht waren, verschont geblieben. Das japanische Yokohama wird von den Europäern eher unterschätzt, denn obschon ich fast alle größeren Städte des Mikadoreiches besucht habe, fand ich in Yokohama doch sehr Sehenswertes, vor allem in der stets belebten Theaterstraße mit ihren unzähligen Schaubuden, Theehäusern,[S. 429] Theatern, Vergnügungen der verschiedensten Art. Dazu ist die Umgebung Yokohamas von fast paradiesischer Schönheit; auf viele Meilen in der Runde gleicht die Landschaft einem wohlgepflegten Herrschaftsgarten mit den entzückendsten Tempelchen und Tempelhainen, mit reizenden, ungemein reinlichen Dörfchen, in denen die Bevölkerung auch noch in paradiesischer Einfachheit lebt; Kamakura mit seiner berühmten kolossalen Bronzestatue des Buddha und seinen alten Tempeln, Enoshima mit seinen Seebädern, Atami mit seinem heißen Hochsee und weiterhin die Gebirgsregion von Hakone mit dem gleichnamigen See und dem fashionabelsten Bade- und Sommeraufenthaltsort der Europäer in Ostasien, Myanoshita. Wie man sieht, leben die Handvoll abendländischer Pioniere im fernen Japan ganz behaglich und entbehren nur wenig von den Genüssen und Annehmlichkeiten unserer europäischen Städte; sie haben sogar ihre eigenen Zeitungen. In diesem Oertchen, das an Einwohnern nicht mehr besitzt als irgend eines unserer größern Dörfer, erscheinen nicht weniger als vier Tagesblätter, durchwegs in englischer Sprache. Obschon die Deutschen an Zahl den Engländern und Amerikanern zunächst stehen, haben sie bis jetzt doch noch keine eigene Zeitung, dafür besteht eine englische Wochenschrift, die Eastern World, welche, von einem Deutschen, Herrn Schröder, herausgegeben, die deutschen Interessen in Japan geschickt und kraftvoll vertritt, zuweilen auch deutsche Aufsätze bringt. Wie die vier englischen Tagesblätter bei einer Auflage von sechzig bis einigen hundert Exemplaren bestehen können, dürfte den meisten Zeitungsleuten Europas wohl ein Rätsel sein, vielleicht ist es auch ihren eigenen Redakteuren ein Rätsel. Dabei sind diese Blätter ganz vortrefflich geschrieben und gedruckt und enthalten täglich die wichtigsten telegraphischen Nachrichten aus Europa. Heute untersteht die europäische Einwohnerschaft leider der japanischen Verwaltung und bildet nicht mehr eine jener eigenartigen Republiken, deren Häupter sich aus den Konsuln und angesehenen Kaufleuten zusammensetzen, wie die chinesischen Vertragshäfen. Die stolzen englischen Kaufherren, die deutschen Reserveoffiziere, die anmaßenden Yankees, dazu die den vornehmsten Ständen angehörigen Touristen aller Herren Länder, ob Minister oder General, sind heute den kleinen schlitzäugigen häßlichen Japanern unterworfen, und leider beuten diese ihre souveräne Stellung, welche ihnen in, man kann wohl sagen, unbesonnener Weise, gewährt worden ist, zum Nachteil der Europäer aus. Die Gerichtspflege läßt sehr viel zu wünschen übrig, und die Klagen über erlittenes Unrecht werden immer zahlreicher. Wieder war es England, das, um seinen gewinnsüchtigen Kaufleuten Handelsvorteile zu sichern, seinen kaukasischen Rassenstolz vor der gelben Rasse gebeugt hat. Auch bezüglich des Zoll- und Postwesens enthalten die Zeitungen seit Jahren fortwährende Klagen über die Unzuverlässigkeit der japanischen Merkure. Selbst die offizielle Regierungszeitung, die Japan Mail, hat sich diesen Klagen angeschlossen.
Japan wird gerne das England oder Frankreich von Asien genannt, aber seine Hauptstadt Tokio ist nicht das Paris von Asien. Unter den zahlreichen Reisenden, welche die Hauptstadt des Mikadoreiches in den seit ihrer Eröffnung vergangenen vier Jahrzehnten besucht haben, dürfte es nur recht wenige geben, die von dieser frühern Residenzstadt der Schogune und jetzigen Kaiserstadt nicht sehr enttäuscht gewesen sind. Tokio ist wohl in Bezug auf seine Ausdehnung und Bevölkerungszahl mit Paris zu vergleichen; aber seiner Einförmigkeit nach ist es ein asiatisches Philadelphia, seiner Unfertigkeit nach ein asiatisches Chicago, vielleicht die häßlichste und ärmlichste aller Millionenstädte des Erdballs. Man kommt gewöhnlich mit großen Erwartungen nach Tokio, das als der vornehmste Sitz des europäischen Wissens und der europäischen Kultur in Asien gilt. Bis zu einem[S. 431] gewissen Grade ist das auch richtig, allein nehme man die paar Dutzend europäischer Monumentalbauten und Villen fort, welche innerhalb der letzten zehn Jahre hier an den Ufern des Sumidagawa entstanden sind, so bleibt von dem vielgerühmten Tokio, der Hauptstadt des Ostens, nicht viel mehr übrig als ein ungeheures Dorf. Vergeblich sucht man hier irgend welche der glänzenden, fremdartigen Prachtbauten, wie sie die alten Großstädte Indiens oder die Hauptstädte von Persien, Aegypten, Siam, Birma, selbst einzelne chinesische in so großer Zahl besitzen. Tokio ist nicht einmal die schönste und interessanteste Stadt des eigenen Landes. Was die Lage und Umgebung anbelangt, habe ich Nagasaki viel malerischer gefunden, die frühere Hauptstadt des Mikadoreiches, Kioto, viel interessanter; Kioto besitzt auch großartigere japanische Paläste, Nikko schönere Tempel, Nagoya schönere Straßen, Osaka mehr Leben und Industrie. Tokio ist nur die volkreichste der japanischen Städte, dazu die besuchteste und bekannteste, die Residenz des Kaisers, der Sitz der Regierung. In seiner Anlage und Bauart aber wirkt es sehr ernüchternd. Es ist keine japanische Stadt mehr und noch nicht eine europäische, in einem keineswegs malerischen Uebergangsstadium begriffen, das, wenn einmal vorüber, aus dem einstigen urjapanischen Sitz der Schogune eine alltägliche Stadt geschaffen haben wird, wie etwa Minneapolis oder Omaha oder sonst eine Stadt des amerikanischen Westens. Allerdings nur dem äußern Rahmen nach, denn glücklicherweise steckt in dem japanischen Volke ein gesunder Sinn, der sich der von oben kommenden Europäisierung mit Erfolg widersetzt. Gerade dieses harte Aufeinanderprallen der beiden einander so fremden Kulturen, der europäischen und japanischen, macht Tokio augenblicklich interessant[S. 432] und sehenswert. Welche von diesen Kulturen die Oberhand gewinnen wird? Vorläufig ist es nicht zu sagen. Der Druck von oben ist stark; die Regierung arbeitet mit den ihr zu Gebote stehenden, bedeutenden Mitteln; die Großen und Reichen des Landes folgen ihr zum Teil aus Klugheit, zum Teil aus Neigung oder Ueberzeugung. Aber auf das Leben und Treiben des Volkes haben sie glücklicherweise noch keinen maßgebenden Einfluß gewonnen, die Japaner sind im großen und ganzen in der Provinz wie in der Hauptstadt, was Sitten und Trachten anbelangt, dieselben geblieben, wie sie vor der Europamanie der Regierung gewesen sind, und so zeigt denn Tokio als einzige Stadt des Mikadoreiches japanisches Leben im europäischen Rahmen, heute und wohl auch noch für viele Jahre hinaus. Tokio liegt an der Mündung des Sumidagawa, die weite, seichte Bucht von Yeddo und seine sumpfigen Ufer gestatten aber den großen Seeschiffen die Annäherung nicht. Der Seehafen von Tokio ist das einige Kilometer weiter südlich gelegene Yokohama, mit dem es eine Eisenbahn nach europäischem Muster verbindet. Von dem Sumidagawa führt ein breiter Kanal in das Hügelland, auf welchem das Häusermeer von Tokio sich befindet, und windet sich in zwei nahezu vollständigen Spiralen um den Stadtmittelpunkt. Die innere Spirale umschließt die Paläste und Gärten der kaiserlichen Residenz, die äußere jene Stadtviertel, in denen sich die hauptsächlichsten Regierungsgebäude, Gesandtschaften, Paläste und Villen der vornehmen Welt befinden, und jenseits dieser äußern Spirale, mit dem Sumidagawa und der Meeresbucht durch zahlreiche Kanäle verbunden, dehnen sich die großen, ärmlichen Dörfer aus, die allmählich miteinander verschmolzen und in das Weichbild von Tokio einbezogen wurden. Die Japaner bauten sich diese Dörfer und Wohnsitze in den weiten Thälern, die sich zwischen dem Kranz der das einstige Yeddo umgebenden Hügel befinden; die letzteren selbst blieben größtenteils von der Ueberbauung verschont und tragen heute noch den alten, herrlichen Waldschmuck. Sie bilden die Parke und Tempelhaine, den Stolz und die schönste Zierde von Tokio. Wenn der alte Hodscho Udschitsuma, der im Jahre 1524 hier auf dem sumpfigen Boden zwischen den vereinzelten, kleinen Dörfern eine Festung angelegt hat, etwa noch einmal zum Leben käme, wie würde er sich wundern, rings um diese Festung eine der größten Städte des Erdballs zu sehen, noch mehr aber darüber, daß an derselben Stelle, wo einst sein Wohnhaus stand, heute der Mikado selbst residiert! Die Macht und der Besitz der Hodschos wurde durch den ersten Schogun Jjejassu gebrochen, der die kleine Festung Yeddo im Jahre 1598 zu seiner Residenz machte. Aber auch das hätte Yeddo nicht zu so großem Wachstum und solcher Blüte verholfen, wenn die Schogune nicht die Feudalfürsten des Landes verpflichtet hätten, in ihrer unmittelbaren Umgebung einen Teil des Jahres zuzubringen. Uneinig untereinander, zu schwach, um der Macht der Schogune aus dem reichen Hause der Tokogawa zu widerstehen, mußten diese Daimios rings um die befestigte Residenz der Schogune[S. 433] eigene Wohnsitze für sich und ihr Gefolge bauen, und so entstanden zwischen dem innern und äußern Festungskanal die Jaschiki von über dreihundert Daimios. Jeder dieser Daimios zog jährlich mit einer Gefolgschaft von zahlreichen Samurai, mitunter mehreren Tausenden, über die Hauptstraße des Reiches, den Tokeido, nach Yeddo, ein Herold schritt diesen prunkvollen Zügen voran und rief dem Volke, mit dem Fächer winkend, die Worte zu: „Schita-ni-Oru”, „nieder auf die Knie!” In der Residenzstadt der Schogune angelangt, bezogen sie mit ihren Familien und stattlichen Heerscharen die Jaschiki, und sollten sie auf Geheiß der Schogune in den Krieg ziehen, so mußten sie dem Schogun als Geisel ihre Familien zurücklassen.
Diese Ansammlung des gesamten Adels des Landes in Yeddo ließ die Stadt immer größer und volkreicher werden, und als endlich nach blutigen Kämpfen die Macht der Schogune gebrochen und Yeddo unter dem Namen Tokio zur kaiserlichen Haupt- und Residenzstadt proklamiert wurde, nahm sie einen noch viel größeren Aufschwung, der noch lange nicht seinen Höhepunkt erreicht hat. Aber dies geschah auf Kosten des malerischen Reizes des alten Yeddo, von dem heute nur wenig mehr übrig ist. Zwei Jahrzehnte haben genügt, es von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Wer heute von Yokohama mit der Eisenbahn nach Tokio reist, der trifft nach etwa einstündiger Fahrt auf einem modernen, europäischen Bahnhofe ein, wie etwa in Leipzig, nur daß an Stelle der Droschken lange Reihen von Rickshaws, von japanischen Kulis gezogene Handwägelchen, die Reisenden erwarten. Auch diese Rickshaws sind bereits europäisiert. Die Kulis tragen blaue Jacken, enganliegende Beinkleider und runde Hüte, die Rickshaws selbst zeigen Nummern wie unsere Droschken. Ein Portier in europäischer Uniform besorgt das Gepäck. Man rollt durch breite Straßen, in denen sich Geschäfte mit europäischen Firmentafeln und europäischen Waren befinden, und gelangt endlich zu einem von einem Garten umgebenen europäischen Hotel, dem Imperial, auf japanisch Taikoku Hoteru genannt, das ebensogut in Wiesbaden oder Trouville stehen könnte und dort erst recht die eleganteste und modernste aller Fremdenkarawansereien sein würde. Sogar die freundlichen, hübschen, kleinen Nesans, die in Japan allgemein die Hotelbedienung besorgen, sind der modernen Kultur geopfert worden, und an ihre Stelle sind Kellner getreten. Man schläft in vollständig europäischen Zimmern mit elektrischer Beleuchtung, speist in einem glänzenden Speisesaal nach europäischer Küche und zahlt für Wohnung und Beköstigung, alles einbegriffen, zwölf bis sechzehn Mark für den Tag. Von den Fenstern dieses vornehmsten Hotels nicht nur von Tokio, sondern von ganz Japan, sieht man auch nicht viel mehr, als man etwa in dem Auditorium Hotel in Chicago sehen würde, weite unbebaute Flächen mit einem Dutzend großer, drei- bis vierstöckiger Paläste darüber verstreut, einsame Straßenanlagen, die noch der Häuser harren, und lange Reihen hoher Telegraphenstangen, über die Hunderte von Drähten gespannt sind. Ich zählte deren an manchen Stellen gegen fünfhundert.[S. 434] Selbst auf einer ersten Rundfahrt, die gewöhnlich den Kaiserpalast und die Gesandtschaftsgebäude zum Ziele hat, wird man vergeblich japanisches Wesen, japanische Eigenart suchen. Die breiten, wohlgehaltenen Straßen sind mit Gaslaternen versehen, hie und da gewahrt man eine europäische Villa, von einem Gärtchen umgeben, die Wohnung irgend eines japanischen Prinzen oder irgend eines ausländischen Gesandten; an den Straßenecken stehen kleine, höfliche Polizisten in europäischen Uniformen, möglicherweise mit Brillen auf der Nase; die Menschen, denen man begegnet, tragen zum großen Teil ähnliche Kleider wie wir, die Wagen, Equipagen, das Militär, alles wie in Europa. Die Brücken über die Kanäle und Wallgräben könnten ebensogut über die Spree führen, und als ich bei einer späteren Gelegenheit zur Vorstellung beim Mikado in den Kaiserpalast kam, fand ich auch dort einzelne europäisch eingerichtete Räume, wie in irgend einem Herrscherpalast der Alten Welt. In der Nähe meines Hotels befand sich ein Klub, der Rokumei-Kwan, ähnlich eingerichtet wie St. James oder Grosvenor, mit Billard-, Lese- und Spielsälen, in denen japanische Herrchen in eleganten Pariser Kleidern französisch parlierten oder ihre Whistpartie spielten. Nur eins gemahnt den europäischen Spaziergänger hier daran, daß er sich auf demselben Boden befindet, wo früher die Schogune geherrscht und die Daimios gewohnt haben: die geradezu kyklopischen Festungsmauern, welche die Residenz des Kaisers umgeben. Gewaltigere Bollwerke haben wenige Festungen der Erde aufzuweisen. Dreißig bis vierzig Meter hoch und etwas konkav nach innen gebogen, werden diese Mauern aus lose aufeinandergelegten ungeheuren Quadern gebildet, so groß, daß man sich wundern muß, wie die kleinen japanischen Männlein[S. 435] im stande waren, sie ohne irgend welche Maschine oder unsere modernen europäischen Hilfsmittel in solcher Massenhaftigkeit aufeinander zu türmen. Diese Mauern entlang zieht sich ein fünfzig bis sechzig Meter breiter und stellenweise ebensotiefer Wallgraben hin, an dessen Herstellung Hunderttausende von Menschen jahrelang beschäftigt gewesen sein müssen. Der Wasserspiegel in den Gräben ist zur Sommerszeit mit blühenden Lotospflanzen bedeckt, und auf den Wällen darüber erheben sich ungeheure alte Pinien in phantastischen Formen, mit langen, bis an den Erdboden reichenden Aesten. Während meines Aufenthaltes in Tokio waren diese so malerisch beschatteten Wälle mein liebster Spaziergang. Selten begegnete ich dort einem Menschen, selten sah ich auch in den Straßen jenseits irgend welchen Verkehr, mit Ausnahme eines Nachmittags, als man die Leiche des verstorbenen englischen Gesandten unter großem Pomp und stattlicher Militärbegleitung zu Grabe trug.
Ist das wirklich die Stadt, die vor dreißig Jahren in den Werken von Sir Rutherford Alcock und Lawrence Oliphant so malerisch geschildert wurde? Tokio ist ihnen dann weit vorangeeilt, und was vor dreißig, nein, vor zehn Jahren darüber geschrieben wurde, ist heute nicht mehr richtig. Wo sind die Scenen, welche Alcock folgendermaßen beschreibt:
„Etwa alle hundert Schritte durchschreiten wir ein Thor, das die Japaner schließen, wenn zur Nachtzeit ein Diebesalarm gegeben wird oder bei Tage Unruhen sich ereignen, während eine elende Stadtwache in einem Wachthause nahebei untergebracht ist, die für die Ruhe in ihrem Viertel verantwortlich und stets wachsam sein muß. Sobald wir eines dieser Thore passieren, stürzen die Wachleute aus ihrem Häuschen heraus, mit langen Stangen bewaffnet, an deren oberen Enden eiserne Ringe hängen. Sie schlagen diese Stangen heftig auf den Boden auf, daß die Ringe klirren, und das sehen sie als eine uns zu leistende Ehrenbezeugung an.”
Aehnliches habe ich wohl auf meinen Reisen in China und Korea gefunden, aber in Tokio? Ebensogut hätte ich es in Chicago suchen können.
Und Oliphant, der in den sechziger Jahren Tokio besuchte, schreibt: „Die einzelnen Straßen sind durch zahllose Thore abgesperrt, und von einem Thore zum andern werden wir von einer neugierigen Menschenmenge verfolgt. Sobald wir ein Thor passiert haben, wird es geschlossen, und der Menschenhaufe bleibt hinter uns, um, an die Gitter gedrückt, uns mit neugierigen Blicken zu verfolgen, während sich um uns ein neuer Menschenhaufe sammelt, der uns bis zum nächsten Thore begleitet. Alle in die Hauptstraße mündenden Seitenstraßen sind hier durch quer darübergezogene Seile abgesperrt, und niemand versucht es, sie zu übersteigen oder unten durchzuschlüpfen.”
Wo sind diese Seile, diese Thore heute? Wo die neugierigen Menschenmassen? Ich bin durch die entferntesten Stadtteile von Tokio gewandert, kein Mensch kümmerte sich um mich.
Und die Jaschiki? Die Hunderte von Daimioschlössern, die in einem weiten Kreise das Schloß des Schoguns umgaben? Sie sind der modernen Aera zum Opfer gefallen. Einige Jahre haben hingereicht, um sie niederzureißen und eben jene weite, einsame Fläche zu schaffen, auf der sich die geschilderten Anfänge des europäischen Tokio erheben. Diese Fläche, mehrere Quadratkilometer umfassend, zieht sich in einem breiten Ringe um die kaiserliche Palastumwallung und erinnerte mich in mehr als einer Hinsicht an jene, die in vielen Städten Europas, vornehmlich in Wien, durch die Schleifung der Festungswälle und Glacis entstanden sind. Hier und dort, verborgen hinter den großen Neubauten in europäischem Stil, sind wohl noch einige Jaschiki der Daimio stehen geblieben. Eins dieser seltsamen Schlösser des alten Japan steht noch hinter dem Imperialhotel. Seinem Aussehen nach hätte ich es für eine Stallung gehalten, und thatsächlich dienen die noch vorhandenen Jaschiki als Kasernen und Stallungen für die moderne japanische Reiterei. Nur sind die alten Daimiowappen abgenommen und durch die Chrysanthemumrosette, die das kaiserliche Wappen bildet, ersetzt worden. Man darf sich unter den Jaschiki nicht etwa Schlösser und Burgen mit festen Mauern, Türmen, Erkern und Balkonen vorstellen, wie sie der Adel und auch die Patrizier in unseren Städten, hauptsächlich in jenen Italiens und Spaniens, besessen haben. Die Japaner haben nur auf ihre Tempel und Pagoden besondere architektonische Kunst verwendet, ihre Wohnhäuser waren und sind heute noch mehr als bescheiden, ebenerdige hölzerne Bauten, die nicht eine einzige feste Mauer besitzen, sondern im Grunde genommen aus nichts weiter als einem auf hölzernen Pfählen ruhenden Dache bestehen. Die Wände werden durch hölzerne Latten oder Papierrahmen gebildet. Die langen, niedrigen Außengebäude der Jaschiki dienten früher den Zweischwertermännern, d. h. der bewaffneten Gefolgschaft ihrer Daimios als Wohnungen und haben wohl das Aussehen, als wären sie aus Mauerwerk aufgeführt. Aber sie bestehen auch nur aus Holz mit leichtem Mörtelbewurf. In ihren Residenzen besaßen die Daimios wohl große, mehrstöckige Schlösser, nicht aber in der Hauptstadt.
Deshalb zeigen auch die wirklichen japanischen Stadtviertel, die außerhalb der ringförmigen Kanäle liegen, das Aussehen von Dörfern. Gegen dreimalhunderttausend Häuschen stehen hier auf dem weiten, an Ausdehnung Paris gleichkommenden Plane in einem unentwirrbaren Netze von Gassen und Gäßchen; nur die neuen Stadtteile, die auf dem rings um die Mündung des Sumidagawa dem Meere abgerungenen Sumpfboden entstanden sind, zeigen die schachbrettartige Straßenanlage der amerikanischen Städte. Dort befindet sich auch das Fremdenviertel, Tsukidschi, mit seinen wenigen Kaufleuten, vielen Missionaren und Kirchen. In dem freien europäischen Japan war es nämlich den Europäern bis 1898 ebensowenig erlaubt, frei umherzureisen, wie frei zu wohnen; nur jene, die im Dienste der japanischen Regierung standen, hatten den Vorzug, in Tokio wohnen zu dürfen; alle anderen Europäer wurden in das Tsukidschi verwiesen. Wir haben es in Europa in früheren Jahrhunderten mit den Juden so gemacht und machen es augenblicklich noch hier und da so mit den Zigeunern. Und die europäischen Großmächte ließen es geschehen, daß die gelben schlitzäugigen Mongolen die Angehörigen der stolzesten Rassen des Erdballs in gleicher Weise behandelten! Ist es denn zu verwundern, daß dieses sehr überschätzte Japanervolk vor Dünkel bersten könnte?
In das einförmige, ärmliche Straßengewirr von Tokio ist in den letzten Jahren etwas Ordnung gebracht worden. Den japanischen „Haußmanns” bleibt das Niederlegen ganzer Quartiere und das Durchbrechen neuer Straßen und Avenuen erspart. Diese Arbeit wird durch die zahlreichen verheerenden Schadenfeuer besorgt, die alle Jahre bald hier, bald dort ausbrechen und gleich einige tausend Häuser verzehren. Ich selbst war in Tokio Zeuge einer Feuersbrunst, die über tausend Häuser einäscherte, ohne daß darüber viel Aufhebens gemacht worden wäre. Die leichtgebauten Holz- und Papierhäuser brennen ja wie Streichholzschachteln, und ist irgendwo ein[S. 438] Brand entstanden, so denkt die Feuerwehr gar nicht daran, ihn zu löschen, sondern durch das Niederreißen der umstehenden Häuser nur einzuschränken. „Die Blume von Yeddo ist das Feuer”, sagt ein altes japanisches Sprichwort, und die Bewohner von Tokio sind von Tag zu Tag nicht ihrer Häuser sicher. Viele besitzen in der That die wenigen Balken und Dachgerippe für neue Häuser in Reserve. Brennt ihnen ihr Haus zusammen, so haben sie am folgenden Abend schon ihr neues Haus wieder aufgebaut.
Jedesmal, wenn eine Feuersbrunst ein paar Straßen oder ein Stadtviertel verheert hat, sind die Stadtbehörden zur Stelle und regulieren oder verbreitern das Straßennetz, so daß es heute doch schon einige gerade, breite Hauptstraßen giebt, durch welche sogar Pferdebahnen gelegt worden sind. Die interessantesten und belebtesten Straßen Tokios sind wohl die Ginza und Nakadori, interessant, weil sich in ihnen ein Geschäftsladen an den andern reiht, voll japanischer Produkte, Kuriositäten und Antiquitäten. Bei den Japanern herrscht noch großenteils die Sitte, daß die einzelnen Geschäftszweige in bestimmten Straßen oder Distrikten untergebracht sind, gerade so wie bei den Chinesen; aber in diesen Industrie- und Handelsvierteln sind die Häuser auch nicht größer oder stattlicher, nur haben die Japaner der Feuersgefahr insofern Rechnung tragen gelernt, daß sie kostbarere Waren in gemauerten Häuschen mit schweren Ziegeldächern und eisernen Fensterläden unterbringen.
Dieses einförmige, öde, farblose und armselige Häusermeer von Tokio wird an vielen Stellen durch kleine Hügel mit üppigem Baumwuchs unterbrochen, und zwischen den Bäumen versteckt schlummert irgend ein kleines, verschiedenen Gottheiten geweihtes Tempelchen. Was aber Tokio vor allen anderen Städten Japans auszeichnet, sind seine beiden prachtvollen Parks, der Schiba und der Uyeno, mit ihren ungeheuren, alten Kryptomerien und Kiefern, ihren langen Alleen von Aepfelbäumen,[S. 439] ihren lauschigen Tempelhainen und Lotosteichen. Die wunderbaren Tempel mit ihren nicht zu beschreibenden Einzelheiten von Ausschmückung und Einrichtung enthalten nicht nur die Gräber der Schogune, sie enthalten auch das Grab der altjapanischen Kunst. Wohl hat Tokio dafür moderne Hochschulen, Hospitäler, Bibliotheken, Museen, Arsenale, Fabriken erhalten, mit denen sich die Japaner heute brüsten, aber all das sind fremde Errungenschaften, die sie sich angeeignet haben. Ihr altangestammtes Eigentum, ihre Schöpfung, das Ergebnis ihrer Liebe und ihres Verständnisses für die Natur war ihre Kunst, die so herrliche Blüten getrieben hat; diese haben die Japaner ohne eine Thräne des Bedauerns geopfert, im Austausch für die modernen Wissenschaften der alten Welt hergegeben. Wer diese Tempelhaine durchwandert, die hohen, eigentümlichen Thorbogen durchschreitet, die langen Reihen steinerner und bronzener Opferlaternen passiert, von alten Daimios dem Andenken der Schogune gewidmet, und endlich die heiligen Grabtempel und den Göttern geweihten Hallen betritt, der empfindet neben rückhaltsloser Bewunderung auch jenes tiefe Bedauern für das Dahinschwinden einer großen Kultur, für welche der moderne Japaner kein Verständnis, kein Gefühl zu haben scheint.
Aber es giebt in Tokio noch ein Stück unverfälschten Japans, das die gütige Vorsehung auch noch recht lange zur Freude aller morgen- und abendländischen Besucher erhalten möge: jenseits des herrlichen Uyenoparks, zu Füßen der von gewaltigen Kryptomerien gekrönten Hügel dehnt sich jene eigentümliche Ausgeburt japanischer Sitten, die Yoschiwara mit ihren der Venus gewidmeten Freudenhäusern aus, und dicht daran schließt sich das Quartier von Asakusa, das sehenswerteste der ganzen Hauptstadt des Mikadoreiches. Ein vielstöckiger Steinturm, der schon so manches verheerende Erdbeben überstanden hat, bildet das Wahrzeichen von Asakusa, wenn nicht von Tokio selbst. Rings um diesen Turm liegen in großen Hainen die stattlichsten Tempel der Stadt, der Hongwanji und der der Gnadengöttin Kwannon geweihte Buddhistentempel von Sensodschi. An diesen merkwürdigen Gebäuden mit ihren absonderlichen Göttergestalten, Inschriften, Bildern und zahllosen Andächtigen hat sich der Ansturm der amerikanischen Baptisten-, Methodisten-, Unitarier-, Presbyterianer- und sonstigen Missionare doch gebrochen, ebenso wie der Ansturm der fanatischen Umstürzler mit ihren europäischen Reformen. Rings um diese Tempel liegt der Wurstlprater von Tokio mit zahllosen Schaubuden, Theehäusern, Theatern, Verkaufsständen, stets belebt, besonders aber an den zahlreichen Festtagen, wenn viele Tausende grotesk geputzter Japaner mit ihren Frauen, mit Musmis und Kindern dort hinauspilgern und Volksfeste abhalten, die in ihrer Eigenart dem Europäer entschieden interessanter sind als der Abklatsch europäischer Universitäten, Arsenale, Pferdebahnen und Gasanstalten, mit denen die modernen Japaner gerade dem Europäer gegenüber so gerne prunken.
Mit dem alten Japanerreich stand in den letzten beiden Jahrzehnten auch Mutsu Hito, der Beherrscher desselben, im Vordergrunde des Interesses. Der Sturz des Schogunats, die Wiedereinsetzung der alten Kaiserdynastie an die Spitze der Regierung, die Einführung europäischer Kultur, die Errichtung einer modernen Armee und Flotte, die Konstitution, mit einem Worte, die ganze wunderbare, in der Geschichte beispiellos dastehende Verwandlung Japans aus einem alten despotischen Feudalstaate in ein modernes Reich mit westlicher Zivilisation wird in Europa ziemlich allgemein der eigensten Initiative des japanischen Herrschers zugeschrieben. Wäre dies richtig, so müßte Mutsu Hito nicht nur als der weitaus bedeutendste der hundertzweiundzwanzig Kaiser seiner Dynastie sein, er wäre auch eine der bedeutendsten Erscheinungen der ganzen Geschichte, und es ist deshalb wohl begründet, sich mit dieser Erscheinung näher zu befassen. Schon der Umstand allein, daß er als der hundertdreiundzwanzigste seiner Familie auf dem gleichen Throne sitzt und daß sein Stammbaum bis auf das Jahr 660 v. Chr., also auf über 2600 Jahre zurückreicht, macht ihn zu einer interessanten Persönlichkeit. Ihm gegenübergestellt wären ja die Häupter unserer ältesten Herrscherfamilien Europas geradezu Parvenus, denn ihr Stammbaum reicht höchstens auf tausend Jahre zurück.
Bei näherer Betrachtung gestaltet sich die Sache freilich etwas anders. In Japan nahm man es mit der Thronfolge lange nicht so genau wie in den europäischen Herrscherfamilien. Der Thronfolger wurde nach Belieben aus der Menge der mit Konkubinen gezeugten Söhne auserwählt, zuweilen wurden Frauen auf den Kaiserthron gesetzt, ja es wurden häufig Söhne aus anderen dem Throne nahestehenden Adelsfamilien von verschiedenen Kaisern adoptiert und zu Thronfolgern gemacht.[S. 441] Eine direkte Thronfolge vom Vater auf den Sohn kam in der japanischen Geschichte nur selten vor. In den ersten Jahrhunderten der Dynastie, welche Jimmu Tenno, den Sohn des Himmels, als ihren Stammvater nennt, waren die Kaiser auch thatsächlich Herrscher; später gelangten Familien aus der nächsten Umgebung der Kaiserfamilie zu Einfluß und Macht, sie rissen allmählich die ganze Regierung an sich, und die Kaiser selbst waren kaum viel mehr als willenlose Puppen, die von den wirklichen Regenten nach Belieben gewöhnlich als Kinder auf den Thron gesetzt und wieder verjagt wurden, sobald sie das Mannesalter erreicht und den Usurpatoren gefährlich werden konnten. So waren beispielsweise unter dem Mikado Go-Nijo (1302–1308) nicht weniger als fünf Mikados gleichzeitig am Leben; nämlich er selbst, der von seinem siebzehnten bis zum dreiundzwanzigsten Jahre auf dem Throne saß; dann seine vier Vorgänger: Go-Fukakusa, der schon in seinem vierten Jahre Kaiser wurde und in seinem siebzehnten abdankte, d. h. abdanken mußte; dann Kameyama, Kaiser von seinem elften bis zum sechsundzwanzigsten Jahre; Go-Uda, Kaiser von seinem achten bis zum einundzwanzigsten Jahre, und der fünfte Kaiser, Fuschimi, schien den Ministern gar nicht zu passen, denn in seinem dreiundzwanzigsten Lebensjahre zum Kaiser gemacht, mußte er schon in demselben Jahre abdanken. Wie man sieht, wechselte man im alten Japan die Kaiser ähnlich wie heute in manchen europäischen Staaten die Minister. Nur war das Verhältnis umgekehrt. Nicht der Hund wedelte den Schwanz, der Schwanz wedelte den Hund.
Als die letzte Schogunfamilie, die berühmten Tokugawa, die Macht in den Händen hatte, wurde den Kaisern wohl alle Achtung und Verehrung zu teil, die ihnen gebührte, allein von der Regierung waren sie vollständig ausgeschlossen, ja sie waren kaum besser als Gefangene, die nicht einmal, wie das Sprichwort sagt, einen goldenen Käfig hatten. Dank der kaiserlichen Gnade war es mir gestattet, in der früheren Hauptstadt des Reiches, in Kioto, die Paläste zu besichtigen, die den Vorgängern des Kaisers und in seinen jungen Jahren auch noch dem regierenden Kaiser als Wohnung angewiesen waren. In den weitläufigen, einförmigen Holzgebäuden mit ihren breiten Veranden und papierenen Zimmerwänden sah ich noch viel weniger Pracht als in dem Palaste ihrer Unterthanen, der Schogune. Dort wohnten und lebten die Kaiser vollständig abgeschlossen von der Außenwelt, vollständig unsichtbar und in gänzlicher Unkenntnis der Größe und Eigenart ihres Reiches. Nur in den seltensten Fällen kamen sie über die Palastmauern heraus, und auch das nur in fest verschlossenen und verhängten Wagen. Von ihrem Regierungsantritte bis zu ihrem Tode bildeten ihre Frauen und ihre Hofhaltung den einzigen Verkehr. Nur die Kuge und die Daimios, also der höchste Adel des Landes, wurden in seltenen Fällen in den Thronsaal zugelassen, um dem Sohne des Himmels ihre Glückwünsche darzubringen oder ihre Ehrfurcht zu bezeugen. Sie lagen an einem Ende des Saales auf den Knieen, mit dem Gesichte auf dem Boden, während der Kaiser auf[S. 442] dem Throne am anderen Ende des Saales saß. Und welcher Thron! Ein Zelt von der Größe und dem beiläufigen Aussehen unserer kleinsten Feldzelte, aus weißem Seidenstoff angefertigt. Im Innern desselben liegt auf dem Holzboden eine Matratze, und auf dieser saß der Kaiser mit verschränkten Beinen. Während der Audienz wurde auch noch ein dichter Vorhang herabgelassen, damit kein Sterblicher das geheiligte Antlitz des Sohnes des Himmels erblicke.
Auch noch der regierende Kaiser empfing seine Fürsten auf diese Weise, und wer vor einem Vierteljahrhundert gesagt hätte, derselbe Kaiser würde auf einer Landesausstellung in Tokio angesichts vieler Tausende seiner Unterthanen selbst die Preise verteilen, mit der Kaiserin an seiner Seite ein neugeschaffenes Parlament eröffnen oder in seinem modernen europäischen Palaste Diners und Garden parties geben, der wäre in Japan als verrückt eingesperrt worden.
Die Sache erscheint in der That unglaublich und liest sich wie ein phantastisches japanisches Märchen. Am unglaublichsten aber erscheint es, daß Kaiser Mutsu Hito, der bis zu seinem sechzehnten Lebensjahre nur wenige fremde Menschen zu Gesicht bekommen hat, der in seinem siebzehnten Jahre zum erstenmal seinen Palast verließ, zum erstenmal grüne Reisfelder und bewaldete Berge, Dörfer und Städte mit seinen eigenen Augen gesehen hat, daß dieser Kaiser einige Jahre später bereits eine Armee nach europäischem Muster schuf, europäische Kultur und Kleidung für seine Unterthanen dekretierte und 1889 sogar seinem Lande eine Konstitution nach europäischem Muster gab.
Alle diese Errungenschaften werden in Europa ziemlich allgemein der persönlichen Thatkraft und Einsicht des Kaisers zugeschrieben, aber mit wie wenig Recht, kann man bei einigem Nachdenken schon aus dem Gesagten erkennen. Zu den herrschenden irrtümlichen Ansichten haben wohl die Begriffe beigetragen, die wir Europäer von unseren Herrschern haben. In Europa sind die letzteren Persönlichkeiten mit ausgesprochener Individualität, in Japan aber ist der Mikado, wie Chamberlain ganz richtig sagt, einfach der Kaiser. Er hat nicht einmal einen Namen, der von seinen Unterthanen ausgesprochen werden darf. Nach seinem Tode wird er unter dem Namen Meji, d. h. Aufklärung, bekannt sein, den er seiner Regierungszeit gegeben hat. Alle Verordnungen, alle Maßnahmen, Neuerungen werden allerdings vom Kaiser dekretiert, allein er ist keineswegs auch der Schöpfer derselben. Es wäre ja auch ganz unmöglich, daß der Kaiser, der beispielsweise in seinem Leben noch niemals das offene Meer gesehen hat und niemals auf einem Schiffe war, eine Kriegsflotte nach europäischem Muster aus eigenem Antrieb schaffen sollte; oder daß er, der niemals einen anderen Soldaten gesehen als etwa die Samurai (Zweischwertermänner) seiner Eskorte auf der Reise nach Tokio, deutsche Stabsoffiziere nach Japan berufen sollte, um seine moderne Armee Taktik und Strategie zu lehren. Aber ein großes Verdienst um sein Land und Volk, gleichzeitig auch um[S. 443] den Triumph unserer europäischen Kultur hat sich der Kaiser unzweifelhaft erworben: das, thatkräftige, kluge, weitsehende Männer seiner Umgebung gewähren zu lassen, ihnen Vertrauen zu schenken und sie auf ihren Posten selbst dann noch zu belassen, als sie seine kaiserlichen Vorrechte beschnitten, ja ihn veranlaßten, von seiner Gottähnlichkeit herabzusteigen unter die Menschen und selbst Mensch zu werden. Dazu gehört viel Seelengröße, viel Einsicht und Klugheit, Eigenschaften, die bei orientalischen Herrschern bei ähnlichen Anlässen nur äußerst selten zu finden sind. Statt wie es sonst zu geschehen pflegt, dem Strome der öffentlichen Meinung nachzugeben, ist er als erster mit seinem Beispiel vorangegangen, er hat befohlen und hat als erster diesen Befehlen Folge geleistet. Wo der Kaiser sich der Notwendigkeit beugt und die tausendjährige eigenartige Kultur seines Landes opfert, um neue, ihm und seinem Volke durchaus fremde, anfänglich unsympathische europäische Kulturfesseln anzulegen, da mußten seine Unterthanen ihm folgen. Die Gebildeten und Klugen der letzteren thaten dies aus eigener Ueberzeugung, die weitaus größte Masse gehorchte eben dem Gebote ihres Kaisers, gegen den von alters her ein Widerstand, eine Auflehnung undenkbar ist. Nur diese allgewaltige Autorität, diese halbgöttliche Stellung, welche der Kaiser aus der früheren Zeit mit hinübernahm bis zur Einführung der konstitutionellen Verfassung, konnte die ungeheuren Umwälzungen möglich machen, welche die Männer der Regierung beschlossen hatten. Wie in Deutschland und Italien, so muß man in dem neugeeinigten Japan neben dem Herrscher auch diese seine Ratgeber nennen, vor allen anderen Graf Ito, den Bismarck von Japan,[S. 444] dann Yamagata, Inouye, Yamada, Aoki, die beiden Saigo, Kuroda, Mutsu, Oyama, Okubo, Yoshida und Terashima. Sie sind die eigentlichen Schöpfer des neuen, ich möchte sagen abendländischen Japan, Männer, beseelt von glühender Vaterlandsliebe und Loyalität, dabei durch und durch ehrenhaft und selbstlos. Nicht sich wollten sie heben, sondern nur ihr Vaterland. Glücklich ein Land, das solche Männer hat!
Der Kaiser wurde am 3. November 1852 geboren und gelangte nach dem Tode seines Vaters am 13. Februar 1866 auf den Thron. Zwei Jahre später, am 9. Februar 1868, vermählte er sich mit Haruko, der dritten Tochter des Kuge (Fürsten) Ichijo Tadaka, am 28. Mai 1850 geboren, somit um zwei Jahre älter als der Kaiser. Am 15. April 1868 verließ das Kaiserpaar die alte Hauptstadt Japans, um die Residenz nach Yeddo zu verlegen, das bald darauf in Tokio, d. h. östliche Hauptstadt, umgetauft wurde. Als der bekannte amerikanische Staatsmann Seward auf einer Reise um die Welt 1871 Japan besuchte, empfing ihn der Kaiser noch in der altjapanischen Kaisertracht, die keineswegs als schön bezeichnet werden konnte: lange, steife Seidengewänder, die den Körper mit Ausnahme der Hände vollständig verhüllten, und auf dem Kopfe eine eigentümliche, schwarze Roßhaarkappe mit einem linealförmigen Aufsatz, der sich von der hinteren Seite der letzteren vertikal etwa einen halben Meter über das Haupt erhob. Der Kaiser sprach kein Wort und würdigte Seward überhaupt mit keinem Blicke. Seine Fragen und Bemerkungen waren auf einzeln bereitgehaltenen Papierbogen niedergeschrieben, die ein Hofbeamter dem Kaiser unterbreitete und dann ablas. Damit war die Audienz beendet.
Einige Monate später vertauschte der Kaiser das traditionelle japanische Kaisergewand mit einer militärischen Uniform nach französischem Schnitt, und seither hat er sich niemals mehr öffentlich in japanischen Gewändern gezeigt. Auf kaiserlichen Befehl mußte der ganze Hof moderne europäische Kleider anlegen, und von der Kaiserin herab bis zum letzten Hofbediensteten darf bei Hof seither niemand mehr in der angestammten Landestracht erscheinen. Mit einem Federzug wurde dem alten Japan, wenigstens den Aeußerlichkeiten nach, ein Ende bereitet.
Ueberhaupt stürzte man sich mit wahrem Feuereifer auf die Umgestaltung des ganzen Hofes, der Regierungsmaschine, ja selbst der Hauptstadt nach europäischen Vorbildern. Prinz Komatsu verweilte während mehrerer Jahre in den Hauptstädten Europas, um die Verhältnisse an den dortigen Höfen zu studieren; der Hofmarschall Sannomiya Yoshitane wurde an den Kaiserhof in Wien gesandt, um bei dem dortigen Oberhofmeisteramte das ganze altspanische Zeremoniell in allen seinen Einzelheiten kennen zu lernen, und nach Japan zurückgekehrt, wurde er damit betraut, dieselben nicht etwa ins Japanische zu übertragen, beziehungsweise den Verhältnissen in Tokio anzupassen, sondern ganz genau so wie in Wien einzuführen. Nicht der Schuh wurde geändert, um für den Fuß zu passen, der Fuß wurde in den schlechtsitzenden Schuh gezwängt.
Damit verlor aber der japanische Kaiserhof seinen eigentümlichen hohen Reiz, seinen ganzen Charakter und die Romantik, die ihn seit so langer Zeit umschwebt hat. So sehr man die Japaner zu ihren Unternehmungen der letzten Jahrzehnte beglückwünschen muß, von allen Europäern und Amerikanern, ja gewiß auch von der Mehrzahl der Japaner selbst wird das Aufgeben der Nationaltracht verdammt. Die alte Kaiserinwitwe beharrte bis auf den heutigen Tag fest an der angestammten Kleidung und mit ihr ein großes Kontingent Japaner der höchsten Stände. Bei allen Gelegenheiten, ausgenommen bei Hoffestlichkeiten, legen sie mit Vorliebe die reizenden, faltenreichen Gewänder an, die sie in ihrer Jugend getragen, denn sie wissen wohl, daß sie ihren sprichwörtlichen Liebreiz, ihre unsagbare Anmut nur in diesen Gewändern besitzen. Hoffentlich ist es zur Rückkehr zu den alten Trachten nicht zu spät, hoffentlich werden die japanischen Machthaber, welche in anderen Dingen so bewunderswerte Weisheit und Diskretion gezeigt haben, die Unzweckmäßigkeit dieser Toilettenreform noch einsehen und die europäischen Modefesseln, die sie ihren eigenen Landsleuten angelegt haben, selbst sprengen. Die europäischen Moden haben nämlich in Japan bei weitem nicht den Eingang gefunden, den man in Europa ziemlich allgemein annimmt. Nur diejenigen, welche durch ihre Stellung bei Hofe oder bei den Regierungsbehörden dazu gezwungen sind, tragen europäische Kleider. Dazu kommen vielleicht noch Mitglieder aristokratischer Familien, Studenten und Modenarren, welche Europa bereist haben. Alles in allem genommen, dürften sie aber bei einer Gesamtbevölkerung von 41 Millionen nicht viel mehr als den vierhundertsten Teil ausmachen. Ich besuchte eine Reihe von Städten, wo ich keinen einzigen europäisch gekleideten Japaner antraf, ja es giebt in Japan noch zahlreiche Ortschaften, wo man einen solchen überhaupt noch niemals gesehen hat.
Selbst dem Kaiser scheint die den Japanern ziemlich willkürlich aufgepfropfte Europäermode unsympathisch zu sein, denn sobald er seine staatlichen Funktionen beendigt hat, zieht er den Europäer aus und den Japaner an. Bei Audienzen, Festlichkeiten und Ausfahrten trägt er gewöhnlich die Uniform eines japanischen Generals, die ihm viel besser steht als so manchem seiner Offiziere.
Bei einer Privataudienz, zu der ich die Ehre hatte befohlen zu werden, hatte ich die gewünschte Gelegenheit, den Kaiser eine Zeit lang in nächster Nähe zu sehen. Das ganze mit der Audienz verbundene Zeremoniell erinnerte mich lebhaft an jenes bei großen europäischen Höfen. Am Eingang zum Palast wurde ich durch Kammerherren empfangen, die europäische Uniform mit Degen und Federhut trugen. Die Dienerschaft war in europäischer Livree, dunkelblauem Frack mit gelben Aufschlägen, welche das kaiserliche Wappen, die sechzehnblätterige Chrysanthemumblüte, eingestickt zeigen, roten Westen, dunkelblauen Kniehosen und weißen Strümpfen. Ich kann nicht sagen, daß diese Livree den kleinen, dunkelhäutigen, schlitzäugigen Japanern[S. 446] mit ihrem struppigen Haar besonders gut stand. Dafür zeigten sich die Kammerherren, dann der Zeremonienmeister und Hofmarschall Sannomiya, denen ich nun vorgestellt wurde, als vollendete europäische Gentlemen. Ihrem Typus, Auftreten und Benehmen nach hätte ich sie für Spanier oder Italiener gehalten, wenn ich ihnen irgendwo in Europa begegnet wäre. Sie sprachen mit fließender Leichtigkeit französisch, englisch und deutsch, und ganz besondere Gewandtheit zeigte der Adoptivsohn des Grafen Ito, der einige Jahre in Halberstadt die Schulen besucht hat. Der hochgebildete junge Mann, ein vollendeter Aristokrat, geht einer ähnlich glänzenden Carriere entgegen wie sein berühmter Vater, einer der Schöpfer des modernen Japan.
Der Saal, in dem wir uns befanden, war ganz europäisch möbliert. Auf einem Tische lagen vier Einschreibebücher für die beiden Majestäten, je eines für Europäer und Japaner.
Nach etwa halbstündigem Warten wurde ich durch lange hohe Korridore in den Audienzsaal geführt, wo gewöhnlich fremde Gesandte ihre Antrittsaudienz haben und ihre Beglaubigungsschreiben überreichen. Mit Ausnahme des herrlichen kassetierten Plafonds, mit Malereien und einem kleinen Thronstuhl in der Mitte, zeigte dieser Saal keinerlei Schmuck, auch keine Möbel. Ueber den spiegelglatten Parkettboden war ein moderner Teppich gebreitet. Zur Linken führte eine Thüre mit großen Spiegelscheiben auf einen Korridor, welcher den Audienzsaal mit den Privatgemächern des Kaisers verband; die Thüre zur Rechten führte nach dem großen Thronsaal.
Auf der Seite, welche wir einnahmen, öffnete sich der Audienzsaal auf einen wunderbar schönen Garten mit Fontänen, felsigen Wasserbecken und Grasmatten, welche durch Gruppen von bronzenen Störchen geschmückt wurden. Dieselben waren weiß übermalt und zeigten so natürliche Stellungen, daß ich sie im ersten Augenblick für lebende Störche hielt.
Ob dem Kaiser ein Zeremonienmeister voranschritt, ob er angemeldet wurde, wüßte ich nicht zu sagen. Er stand plötzlich vor mir. Ich kann es nicht verhehlen, daß ich im ersten Augenblick befangen, überwältigt war. Keine Persönlichkeit der Gegenwart hat eine so wunderbare Geschichte, keine kann auf eine so lange Reihe von Ahnen zurückblicken, die in das graue Altertum hinaufreicht, sechshundert Jahre vor Christi Geburt! Ich befand mich vor dem Inhaber eines Thrones, auf welchem hunderteinundzwanzig seiner Vorfahren gesessen haben und deren Stammvater seine Gewalt von den Göttern selbst empfangen haben soll.
Der Kaiser ist für einen Japaner ein großer, stattlicher, hochaufgerichteter Mann, mit fahlem gelblichen Gesichte, aus welchem große, schwarze, stechende Augen blicken; das Kopfhaar ist länger, als es die Japaner zu tragen pflegen, dicht und struppig; die Nase ist fleischig, Schnurr- und Vollbart sind dünn, mit langen, steifen Haaren; die Thränendrüsen treten auffallend stark hervor. Man kann nicht behaupten, der Kaiser sei ein schöner Mann, allein das wenig ansprechende Aeußere wird durch[S. 447] seinen hoheitsvollen Ausdruck und eine gewisse Unnahbarkeit, die sein Wesen zeigt, aufgewogen. Unter den vielen Tausenden von Japanern, denen ich auf monatelangen Reisen in dem Inselreiche begegnet bin, habe ich keinen von interessanterem, charakteristischerem Aussehen gefunden, und wenn man sich vor Augen hält, daß der Kaiser der Repräsentant einer Familie ist, die seit zweieinhalb Jahrtausenden nicht über einen enggezogenen Kreis herausgekommen ist, so muß man in ihm den reinsten Typus des Japaners sehen.
Der Kaiser trug eine Uniform, die jener der französischen Artillerieoffiziere ähnelt, aus schwarzem Tuch mit ebensolchen Seidenborten. Auf der rechten Brust prangte der Stern seines Chrysanthemumordens und zwei kleinere Ritterkreuze. Nachdem ich durch den Zeremonienmeister vorgestellt worden war, richtete der Kaiser mehrere Fragen an mich, die sich auf meine Reisen, hauptsächlich auf jene nach Korea, bezogen. Er sprach japanisch, mit leiser Stimme, und seine Worte wurden von einem Dolmetscher ins Französische übertragen. Meine Antworten und Ausführungen wurden dem Kaiser wieder japanisch mitgeteilt, der jeden Satz mit heftig ausgestoßenem „hei, hei”, etwa „ja, ja” oder „ich begreife” beantwortete. Während der ganzen Unterredung blickte der Kaiser niemandem in die Augen; er hielt sich steif und unbeweglich wie eine Statue und reichte auch beim Abschiede niemandem die Hand.
Unter den vorgeschriebenen drei Verbeugungen entfernten wir uns nun, rückwärts schreitend, aus dem Saale. Im Korridor teilte mir Hofmarschall Sannomiya mit, der Kaiser hätte ihm aus eigenem Antriebe Befehl gegeben, mir die Räumlichkeiten des Palastes zu zeigen. Geführt von diesem äußerst liebenswürdigen, weltmännisch gebildeten Würdenträger nahm ich nun während der folgenden Stunde die Palasträume in Augenschein, und es hätte gewiß noch viel längerer Zeit bedurft, um die prachtvollen Kunstwerke der Japaner, die hier die Säle schmücken, nach Gebühr zu bewundern.
Die Empfangsräume zeigen eine äußerst glückliche Verbindung zwischen europäischem und japanischem Stil; der Palast selbst besteht aus einer Reihe ebenerdiger, aneinanderstoßender Gebäude, deren jedes sein eigenes Dach, seine eigenen Veranden und Korridore besitzt und nur je einen großen Saal enthält. Alle diese Gebäude sind aus Holz aufgeführt, aber statt der verschiebbaren Papierwände, welche die japanischen Wohnhäuser besitzen, zeigen die Säle feste Wände, mit den herrlichsten Seidenbrokaten bekleidet; die Plafonds sind gerade so wie jene der Kaiserpaläste in Kioto kassetiert und mit Vergoldungen und Malereien geschmückt.
Die ersten Räume, die wir besuchten, waren drei Speisesäle von verschiedener Größe, ganz so eingerichtet wie jene in europäischen Palästen. In dem größten dieser Säle, für mehrere hundert Personen Raum bietend, werden dreimal jährlich große Tiffins d. h. Dejeuners gegeben, die aber nicht, wie es in manchen Büchern zu lesen ist, stets in europäischer Weise aufgetragen werden, sondern den daran teilnehmenden[S. 448] Diplomaten zuweilen durch ihre japanischen Eigentümlichkeiten recht unbequem sind. Auf einer kürzeren, an die Privatgemächer des Kaisers stoßenden Seite steht eine kürzere Tafel, von welcher drei längere Tafeln der Länge nach durch den Saal laufen. An der kürzeren Tafel sitzt der Kaiser, während an den langen Tafeln, aber immer nur auf einer Seite, das diplomatische Korps, die Minister und Generale Platz nehmen, so daß sie kein Gegenüber haben. Die Mahlzeiten finden um elf Uhr morgens statt; Teller, Gläser und dergleichen sind nach europäischen Mustern und zeigen an den Rändern die Wappenblume des Kaisers; an Stelle der Bestecke liegen jedoch japanische Eßstäbchen, mit denen sich so mancher Diplomat vergeblich abmüht, ein Stückchen Speise zu erwischen.
An einem kleinen Nebentischchen in der Nähe des Kaisers sitzt ganz allein der geistliche Chef des kaiserlichen Hauses, der Leiter der religiösen Shintozeremonien und des kaiserlichen Ahnenkultus, gewöhnlich ein Prinz der Kaiserfamilie. In der letzten Zeit lag diese Würde in den Händen des Prinzen Takuhito, aus dem Hause Arisugawa no-miya. Bei Besuchen europäischer Prinzen wie z. B. des Zarewitsch oder des österreichischen Thronerben im Jahre 1893 finden derlei Mahlzeiten gewöhnlich in einem der kleineren Speisesäle statt.
Der große Gesellschaftssaal nahebei ist ganz im europäischen Stil eingerichtet und enthält fast ausschließlich deutsche Möbel. In der Mitte des Saales befinden sich zwei runde Divans, über welchen sich auf Holzpiedestalen zwei große Bronzen Augsburger Fabrikats erheben, Kämpfe von reitenden Figuren mit Löwen und Bären darstellend. In den Ecken stehen europäische Sofas mit kleinen Tischchen davor, zwischen den Fenstern Sèvresvasen und französische Bronzen. Sie würden überall, nur nicht im japanischen Kaiserpalaste zur Bewunderung einladen. Ein vollständig neuer Zweig der japanischen Kunstindustrie, der mir bisher unbekannt war, wird durch zwei Wandgobelins nach französischem Muster repräsentiert. Die Japaner haben die Gobelinmanufaktur in Frankreich vor mehreren Jahren erlernt, und die beiden im Kaiserpalaste aufgehängten Prachtstücke zeigen, wie weit es die Japaner auch darin in der kürzesten Zeit gebracht haben. Weniger schön ist der anstoßende Musiksaal eingerichtet, und die schweren Brokatvorhänge an den hohen Fenstern, die Brokatbekleidung der Wände, die Teppiche auf dem Parkettboden, die vielen Divans sind auch nicht dazu angethan, die Bestimmung dieses Saales zu fördern. In einer Ecke steht ein großer Konzertflügel. Die schönen Vasen, Bronzen und Emailgegenstände, darunter ein wunderbar emaillierter Hahn in natürlicher Größe, stehen merkwürdigerweise auf deutschen Sockeln billigster Arbeit, plump in der Form, schlecht lackiert und vergoldet. Warum man an ihrer Stelle nicht solche japanischen Ursprunges mit dem schönen Gold- oder Rotlack verwendet hat?
Am imposantesten von allen Räumen des Palastes ist der große Thronsaal, den wir nun betreten, ein gewaltig großer hoher Raum, dessen Wand- und Deckenschmuck[S. 449] ein wahrer Triumph der japanischen Kunstindustrie ist. Von der Decke hängen zwei Glaslüster mit unzähligen elektrischen Lämpchen, die aber selten angezündet werden, da man sich in dem hölzernen Gebäude sehr vor Schadenfeuern fürchtet. Deshalb giebt es in dem Palaste auch keine Kamine, und die im Winter recht notwendige Erwärmung wird durch Luftheizung besorgt. Auf einer niedrigen, teppichbedeckten Estrade an einer Langseite des Saales stehen zwei gleich große, in Deutschland angefertigte Thronstühle für die beiden Majestäten unter einem hohen faltenreichen Sammetbaldachin. An Stelle der Kronen, welche in europäischen Herrscherpalästen Baldachin und Thronstühle schmücken, sind hier überall sechzehnblätterige goldene Chrysanthemumblüten, sowie drei Blätter und drei Blüten der Kiripflanze (Paulownia Imperialis) verwendet. Während die ersteren das Staatswappen bilden, ist die letztere seit undenklichen Zeiten das Familienwappen der Mikados von Japan. Obschon sonst die europäischen Höfe in allen Dingen genau nachgeahmt worden sind, hat man doch, ich möchte sagen glücklicherweise, vor den erhabensten Insignien des europäischen Herrschertums, Krone, Szepter und Reichsapfel, Halt gemacht. Es giebt in Japan keine Krone, ebensowenig wie in China und Korea. Erst die Herrscher der an China grenzenden hinterindischen Reiche, dann jene Zentralasiens tragen Kronen. Die größte Sammlung der letzteren habe ich im Kreml zu Moskau gesehen, die schönsten und kostbarsten jedoch in der Hauptstadt von Siam. Die Insignien der japanischen Kaiserwürde sind auch in der neuen Aera dieselben geblieben, die sie in früheren Zeiten waren, das heilige Schwert des Mikado Uda aus dem neunten Jahrhundert und der heilige Spiegel, das Sinnbild der Tonno. Der letztere wurde dem Stammvater der Kaiserdynastie von seiner Mutter, der Sonnengöttin, mit auf die Erde gegeben, und seit jener Zeit blieb dieses kostbare Kleinod in dem Besitz der Familie.
In dem Thronsaale finden am Neujahrstage, am Geburtstage des Kaisers und bei außergewöhnlichen Anlässen große Empfänge statt. Die Majestäten stehen auf der Estrade vor den Thronen, rechts von ihnen neben der Estrade die kaiserlichen Prinzen, links die Prinzessinnen; die Gesandten, Minister, Generale und sonstigen hohen Würdenträger defilieren in der in Europa, vornehmlich am spanischen Königs[S. 450]hofe üblichen Weise, während das kaiserliche Musikkorps die Mikadohymne spielt, dieselbe Hymne, die Japan schon vor dem Sturz des römischen Reiches und vor der Regierungszeit Karls des Großen besessen hat.
Aber während bei diesen Festlichkeiten von der alten Pracht des feudalen Japan absolut nichts mehr zu sehen ist, während die Prinzen in moderne Uniformen, die Prinzessinnen in Pariser Toiletten gekleidet sind und unter den Hunderten von Anwesenden auch nicht einer das japanische Nationalgewand trägt, hat sich hinter den Kulissen dieses modernen Kaiserhofes ein ganz erkleckliches Stück des Alten erhalten. An den genannten Festtagen pflegt der Kaiser schon um zwei Uhr morgens aufzustehen und unter allerhand Zeremoniell ein Bad zu nehmen; dann werden ihm die altjapanischen Kaisergewänder angethan, und so begiebt er sich, begleitet von seinem engeren Hofstaate, zu dem Shintotempel innerhalb der Mauern des kaiserlichen Palastes; der Hofstaat bleibt vor dem Tempel auf den Knien liegen, während der Kaiser allein eintritt und eine Andacht vor den Tafeln seiner göttlichen Ahnen verrichtet. Dann erst wird das alte Japan abgelegt, das moderne angezogen, und der Kaiser hält die Gratulationscour und die Truppenrevue ab.
Ebenso durchaus altjapanisch ist auch die gewöhnliche Lebensweise des Kaisers. Seine Privatgemächer zeigen nichts von europäischer Einrichtung. Ein langer, kahler Korridor führt von dem eben geschilderten Kaiserpalast zu einer inmitten von prachtvollen Gärten gelegenen Gruppe niedriger Häuser, und hier bewohnt der Kaiser drei Gemächer. Nach unseren europäischen Begriffen würde man dort wahre Schatzkästlein japanischer Kunst erwarten, mit glänzendem Goldlack, herrlichen Bronzen, Vasen und Porzellannippes. Statt dessen ist in diesen aus unscheinbaren Papierwänden gebildeten Räumen alles kahl. Kein Stuhl, kein Bett, nichts von den Bequemlichkeiten des Europäers ist vorhanden. Der Boden ist mit geflochtenen Matten belegt, und der Beherrscher des japanischen Reiches schläft auf einer harten Matratze. Nicht einmal unsere europäischen Badeeinrichtungen sind hier eingeführt worden, und gerade so wie der geringste seiner Unterthanen badet der Kaiser in einem hölzernen Bottich.
Auch die Kaiserin bewohnt hier drei ähnliche Gemächer, und nahebei waren für den Thronfolger bis zu seiner 1900 erfolgten Vermählung einige Zimmer reserviert, welche er bewohnt, wenn er das Kaiserpaar besucht. Jedes der vielen kaiserlichen Kinder von verschiedenen Müttern hat nämlich eine eigene Hofhaltung. Sie werden von ihrer frühesten Jugend auf verschiedenen Familien im Lande zur Pflege und Erziehung gegeben, wachsen in diesen auf, und je älter sie werden, desto größer wird ihr Hofstaat. Zeitweilig werden sie zum Besuch des Kaiserpaares in den Palast gebracht. Die Kaiserin selbst ist kinderlos geblieben. Dem Kaiser ist es freigestellt, sich so viele Gattinnen beizulegen, als er wünscht, allein nur eine, Haruko, hat den Rang einer Kaiserin und wohnt im kaiserlichen Palast an seiner Seite.
Der Kaiser pflegt sich gegen Mitternacht zur Ruhe zu begeben und zwischen sechs und sieben Uhr aufzustehen. Bald darauf empfängt er die Minister und unterschreibt die ihm vorgelegten Dokumente. Die Zeit bis zu den Mahlzeiten, die er um elf Uhr vormittags und sieben Uhr abends in Gemeinschaft mit der Kaiserin einnimmt, verbringt er mit Reiten, Bogenschießen und allerhand Sport. In den achtziger Jahren bewog man ihn zum Studium der englischen und französischen Sprache, allein er gab die Sache bald wieder auf und versteht auch jetzt noch keine europäische Sprache.
Innerhalb der weiten Parkanlagen, die, inmitten von Tokio gelegen, von einer dreifachen festen Mauer und dreifachen tiefen Wassergräben umgeben sind, befinden sich auch einige Hofämter, sowie die Wohnungen der kaiserlichen Dienerschaft und der Hofdamen. Jede derselben besitzt ihr eigenes Haus und selbständige Haushaltung und Küche. Sie kommen als Kinder im Alter von zehn bis elf Jahren an den Hof und werden dort in aller Abgeschiedenheit großgezogen und mit den Pflichten gegen den Kaiser, sowie dem ganzen weitläufigen Zeremoniell vertraut gemacht. Früher wurden zu Hofdamen nur Töchter von Kuges und Daimios gewählt, seit einigen Jahren wird diese Ehre jedoch auch Töchtern der Samuraiklasse (niederer Militäradel) zu teil.
Seinem Volke zeigt sich der Kaiser ausschließlich als europäischer Herrscher, in europäischer Uniform und mit den Bändern oder Sternen von Orden, die natürlich bei der Europäisierung des Reiches ebenfalls eingeführt werden mußten und auch dieselbe Einteilung zeigen wie die europäischen Orden. In ihrer Ausführung sind sie bunt und unschön. Der höchste derselben ist der Chrysanthemumorden, der nur an Mitglieder von Herrscherfamilien verliehen wird. Im Range nächststehend ist der Sonnen- oder Paulowniaorden, so genannt, weil die Insignien derselben den Sonnenspiegel, umrahmt von den Blättern der vorerwähnten Paulowniapflanze zeigen. Dasselbe gilt indessen auch von dem dritten Orden, jenem der aufgehenden Sonne, der in acht Klassen eingeteilt wird. Geringere Orden sind jener des Spiegels oder des geheiligten Schatzes, der Verdienstorden der goldenen Weihe (Militärorden), dann der Kronenorden, ein Damenorden, dessen Kleinod einen Blumentopf mit Blumen und den goldenen Vogel Hoo zeigt. Die Japaner haben an wenig Dingen so rasch Geschmack gefunden wie an den Orden. Bei seinen Ausfahrten benutzt der Kaiser gewöhnlich einen reich vergoldeten Staatswagen mit Spiegelscheiben, in dem er allein zu sitzen pflegt. Im Februar 1889 geschah es zum erstenmal, daß der Kaiser auch seine Gemahlin in dem gleichen Wagen mitfahren ließ, ein in den Annalen des japanischen Hofes unerhörtes Ereignis, gleichzeitig die indirekte Anerkennung der Ebenbürtigkeit der Kaiserin. Dem kaiserlichen Wagen pflegen Polizeibeamte, dann drei Ulanen vorauszureiten, deren einer, in der Mitte der Straße, die Lanze aufrecht hält, während die zwei an den Straßenseiten reitenden Ulanen[S. 453] die Lanze gefällt halten. Auch den Schluß des kaiserlichen Zuges bilden drei Ulanen, die jedoch die Lanzen mit der Spitze nach hinten halten. Unmittelbar vor dem Wagen reiten unter Anführung eines Generaladjutanten einige Offiziere, von denen einer die goldene Kaiserstandarte mit der Chrysanthemumblume trägt. Das Volk verhält sich beim Anblick des Kaisers stumm und wagt gar nicht, zu ihm emporzusehen. In einigen Gegenden des Landes herrscht der Glaube, daß es Unglück und Tod mit sich bringen würde, das Antlitz des Mikado zu sehen. Dem Wagen des Kaisers folgen stets einige andere mit der Suite.
Stünde die Person des Kaisers in Japan nicht so göttergleich, so hoch erhaben über jedes irdische Getriebe, sie würde gewiß, wenn möglich, noch an Volkstümlichkeit gewinnen durch die Gattin des Mikado, die Kaiserin Frühling (Haruko). Geboren in Kioto als die dritte Tochter eines Kuge (Prinzen), wurde sie in den strengen, starren Grundsätzen des alten Japan erzogen; sie lernte die chinesischen Klassiker, die japanische Dichtkunst, das Samisen- und Kotospiel (Guitarre und Lyra), Nähen und Sticken. Nach ihrer Vermählung mit dem Kaiser ließ sie sich der früheren japanischen Sitte gemäß die Zähne schwärzen und die Augenbrauen abrasieren. Seit der Europäisierung des Landes kam glücklicherweise diese Sitte außer Gebrauch, und[S. 454] heute ist diese edle Frau mit dem schönen Namen der modernisierte Typus einer japanischen Aristokratin, klein, schwächlich, mit wunderbar kleinen Händchen und langem, schmalem Gesicht. Wohl wenigen dürfte das Aufgeben der malerischen Frauentracht des alten Japan und das Annehmen von Schuhen und Korsett, steifen Röcken und großen Hüten nach europäischer Mode schwerer gefallen sein, wenigen steht diese moderne Tracht auch ungünstiger als der Kaiserin. Heute kann ein europäischer Besucher des Landes dies kaum mehr beurteilen, aber wer Gelegenheit gehabt hat, eines der großen Gartenfeste am Kaiserhofe vor und nach 1885 mitzumachen, der wird diese Wandlung vom Schönen zum Häßlichen schmerzlich empfinden. Alljährlich werden zwei dieser Feste gegeben, eines im Frühjahr während der Blütezeit der Kirschen, eines im Herbst, wenn die Nationalblumen der Japaner, die Chrysanthemen, in ihrer unbeschreiblichen Blütenpracht stehen. Tausende und Abertausende dieser Blumen, in allen erdenklichen Farben und Größen bis zu jener unserer Sonnenrose, stehen in den breiten Avenuen des kaiserlichen Parkes unter langen Mattendächern; manche Pflanzen tragen nur eine einzige Blüte, manche Dutzende, ja geschützt durch seidene Zelte kann man dort einzelne Pflanzen mit zwei- bis vierhundert Blüten sehen.
Wer könnte die bezaubernde Anmut und Schönheit der japanischen Damen, ihre zarte, faltenreiche Kleidung, den Reichtum und die Zeichnung der Stoffe schildern, wie sie damals vor 1885 sich zeigten! In den Avenuen und auf den weich besandeten Plätzen des Parkes harrten diese reizenden Gestalten der Majestäten, bewundert von den Gesandten, den Würdenträgern und sonstigen geladenen Europäern. Und nun erst die Kaiserin selbst, mit ihrem zahlreichen Gefolge von Prinzessinnen und Hofdamen, die in langer Prozession langsam die Zelte entlang wandelten. Die Tracht der Kaiserin bestand damals aus weiten, faltenreichen Hakama (Beinkleidern) aus dem schwersten, scharlachroten Damast, einem Ziban (Unterkleide) und einem Kimono (eine Art Schlafrock) von lila Seide mit eingestickten Wistaria und Chrysanthemumblüten. Um den Hals war ein vielfarbiges Seidentuch geschlungen. Das reiche, schwarze Haar umrahmte in einem breiten Zopf das Gesicht und fiel[S. 455] hinten bis zu den Hüften herab; stellenweise waren in das Haar kleine Stückchen von weißem Reispapier eingebunden wie bei den Shintopriesterinnen. Ueber der hohen Stirn prangte ein kleiner, goldener Phönix, in Japan wie in China das Abzeichen des Herrschers. In der einen Hand trug sie einen vielfarbigen Sonnenschirm, in der anderen einen hölzernen, bemalten Fächer mit schweren, lang herabfallenden Seidenschnüren.
Die Prinzessinnen und Damen des Gefolges trugen ähnliche Kostüme aus den herrlichsten Gold- und Silberbrokaten, wie man sie in Europa nur an den alten Priestergewändern findet. Der Aufzug dieser seltsamen farbenreichen, glitzernden Gestalten inmitten einer wahren Wildnis von Chrysanthemumblüten muß traumhaft gewesen sein.
Bei dem nächsten Kirschblütenfeste war all diese Herrlichkeit vorbei. Die Pariser Moden waren im Winter in Japan eingezogen und hatten den weiblichen Schmetterlingen Japans ihre Flügel abgeschnitten. Aber das ging nicht so leicht von statten, als es gesagt ist. Welche profane Schneiderin der Rue de la paix hätte die geheiligte Person der Kaiserin mit ihren Händen berühren und ihr die Kleider anpassen können? Lange sträubte sich die Kaiserin, lange wußte man keinen Ausweg. Endlich entschloß sich die kluge Gräfin Ito, Gattin des ersten Ministers und die Leiterin der europäischen Mode in Japan, als Probiermamsell für die Kaiserin zu dienen, und seither sieht man die Kaiserin nur mehr in europäischen Kleidern, die allerdings aus japanischen Stoffen angefertigt werden. Ihr mußten alle Damen des Hofes notwendigerweise folgen. Die herrlichsten alten Kimonos, die zartesten Stickereien, die reichsten Goldbrokate und schwersten Stoffe wurden geopfert, um dafür moderne Hüte und Schuhe und Pariser Kleider zu kaufen, und heute ist ein Gartenfest bei Hofe oder ein Ball beim ersten Minister nahezu eben so langweilig und einförmig wie in Europa. Die Wandlung hat der japanischen Aristokratie, die nach dem Sturz des Schoguns ohnehin schon den größten Teil des angestammten Vermögens auf den Altar des Vaterlandes legen mußte, große Kosten verursacht, von denen sie sich nur schwer erholt. Selbst das Kaiserhaus ist mit irdischen Gütern nicht überreich gesegnet. Das Familienvermögen ist gering, und die jährliche Zivilliste beläuft sich nur auf drei Millionen Yen (etwa sechs Millionen Mark).
Auch von diesen opfert die Kaiserin ihren Anteil für allerhand wohlthätige Anstalten, deren eifrigste Schöpferin und Förderin sie ist. Der eigene Kindersegen blieb ihr vorenthalten, dafür trachtet sie im schönsten Sinne des Wortes die Mutter ihres Volkes zu sein. Das Hospital des Roten Kreuzes und die Adelsschule erfreuen sich ihrer besonderen Fürsorge. Häufig sieht man die Kaiserin im Frühling durch die Straßen Tokios fahren, um diesen Anstalten Besuche abzustatten, die gewöhnlich mehrere Stunden währen. Mit engelgleicher Geduld hört sie den französischen und englischen Prüfungen der Schulkinder zu, obschon sie selbst kein[S. 456] Wort dieser Sprachen versteht. Sie ermuntert und beschenkt die Schüler, unterhält sich mit den Lehrern und verläßt selten eine Schule, ohne den Damen des Lehrerpersonals das gewöhnliche kaiserliche Geschenk, eine Rolle japanischen Seidenstoffes, zurückzulassen. Bei ihren Ausfahrten in einem prächtigen Galawagen wird sie gewöhnlich von zahlreichem Gefolge begleitet. Eine seltsame, wohl nur Japan eigentümliche Einrichtung ist es, daß der kaiserliche Wagen, sobald die Kaiserin denselben, am Bestimmungsorte angelangt, verlassen hat, von Dienern während des Wartens sorgfältig gewaschen und mit einer grünen Seidendecke verhüllt wird.
Hoffestlichkeiten finden außer den geschilderten nur wenige statt. Der Kaiser scheint an denselben keinen besonderen Gefallen zu finden. Zuweilen werden jedoch ihm zu Ehren von den anderen Mitgliedern der kaiserlichen Familie oder von den zehn Fürstenfamilien des Landes Festlichkeiten veranstaltet, denen das Kaiserpaar gerne beiwohnt.
Der Thronfolger Prinz Joschihito Harunomiya, ein Sohn des Kaisers und der Frau Yanagiwara, im Jahre 1879 geboren, wird als sehr aufgeweckt, energisch und ehrgeizig geschildert. Er erhielt seine Erziehung in der ganz nach europäischen Vorbildern geleiteten Adelsschule, und sollte seine schwächliche Gesundheit ihm je gestatten, den Thron seiner Väter zu besteigen, so dürften noch weitere europäische Reformen in Japan zu gewärtigen sein. Soweit das japanische Staatshandbuch es angiebt, ist er heute der einzige lebende Sohn des Kaisers, aber das Aussterben der kaiserlichen Familie ist deshalb keineswegs zu befürchten, denn es bestehen neben dieser noch neun Nebenlinien, deren Häupter kaiserliche Prinzen sind und Zivillisten in der Höhe von zehn- bis dreißigtausend Yen beziehen.
Im heutigen Japan ist von dem alten Glanze der Kugefamilien, von der Pracht der Daimios, wie sie in früheren Werken über das Inselreich des Mikado geschildert werden, gar nichts mehr zu finden. Mit dem Jahre 1871 fand die Feudalherrschaft in Japan, welche achthundert Jahre lang gewährt hatte, ihr Ende. Ein Federstrich ließ sie verschwinden, als wäre sie nichts weiter gewesen als Staub, im Laufe der Jahrhunderte angesammelt. Der uralte Hofadel ebenso wie die Duodezfürsten des Landes gaben in vielen Fällen ganz freiwillig ihre Länder, ihre Güter, Reichtümer und Einkünfte auf und wurden getreue Unterthanen ihres seit sechsundzwanzig Jahrhunderten regierenden Herrscherhauses. Keine Klasse der Bevölkerung nahm die Reformen, welche der Kaiser dekretierte, williger an als gerade der Adel, und keine hat sich so rasch in die europäischen Sitten und Gebräuche, wie sie heute wenigstens äußerlich am japanischen Kaiserhofe bestehen, eingewöhnt.
Welche Opfer dieser uralte Adel des Reiches dem Vaterlande gebracht hat, kann man ihrer wahren Größe nach erst beurteilen, wenn man den Einfluß und die Machtstellung der einzelnen Familien in früheren Zeiten kennen gelernt hat. Wohl kaum irgend ein Adelsgeschlecht Europas kann auf so zahlreiche Ahnen zurücksehen wie eine ganze Reihe der japanischen Kugefamilien, von denen einzelne ihre Abstammung bis in das sechste Jahrhundert vor Christi Geburt zurückführen. Die berühmteste Adelsfamilie Japans, die Fujiwara, stammen beispielsweise von einem Diener des Großvaters von Jimmu Tenno, dem Gründer der japanischen Kaiserdynastie, ab und sind seit mehr als 2600 Jahren mit den Geschicken der japanischen Nation auf das innigste verflochten. Andere, wie die Sugawara, die Taira und Minamoto, wenn auch viel jünger als die Fujiwara (zu deutsch Glycinenfeld), sind doch älter als alle europäischen Herrscherfamilien, und ihre Ahnen nahmen fast durchgehends die höchsten Stellen im Reiche ein. Von den heute noch bestehenden 155 Kugefamilien leiten 95 mehr oder minder direkt ihre Abstammung von den Fujiwaras ab, alle aber sind mit der Kaiserfamilie verwandt, und eine große Zahl dieser Familien des Hofadels haben kaiserliche Prinzen zu ihren Stammvätern. Gewöhnlich waren es Söhne des Kaisers mit Konkubinen, welche eigene Namen annahmen und eigene Familien gründeten; ihre Söhne erhielten dank ihrer innigen Verbindung mit dem Kaiserhause einträgliche Aemter, und fast in jeder Familie ist eines oder das andere erblich geblieben. Die Mehrzahl der Aemter hatten die Fujiwara an sich gerissen, und sie verstanden auch, dieselben jahrhundertelang in ihrem Besitze zu erhalten. Im siebenten Jahrhundert waren sogar alle Hofämter und die Mehrzahl der Gouverneur[S. 458]stellen in den Provinzen in ihren Händen. Gerade so wie ich es in meinem Buche „Korea” bezüglich der mächtigen Familie der Min geschildert habe, bildeten auch die Fujiwara einen undurchdringlichen Ring um den Mikado, der nichts weiter als ihr willenloses Werkzeug war. Wie die Min in Korea gewohnt sind, aus den Reihen ihrer Töchter eine Gattin für den König auszusuchen, um dadurch ihren Einfluß auf diesen zu sichern, so waren auch in Japan Jahrhunderte hindurch die Kaiserinnen stets Töchter des Hauses Fujiwara, und noch die in Tokio residierende Witwe des verstorbenen und Mutter des regierenden Kaisers entstammt diesem allmächtigen Hause. Wie Parasiten wanden sie sich um den Herrscherstamm und saugten an seinem Safte, sich selbst stärkend, indem sie ihn schwächten. So ging allmählich die ganze Macht der Mikados in die Hände des Hofadels über; den Kreisen der letzteren entstammten die Schogune bis auf die letzte Zeit, und sie, nicht die Kaiser, waren die eigentlichen Regenten und Herren des Landes.
Neben diesen Kuge oder dem Hofadel bildete sich in den Provinzen von Japan, sowie bei uns, allmählich ein Landadel heraus. Wohlhabendere Bauernfamilien vermehrten ihren Grundbesitz durch Erbschaft und Heiraten, ihre Stellung und ihr Ansehen aber durch einzelne tapfere Familienmitglieder; die fortwährenden Räubereien veranlaßten minder zahlreiche, minder wohlhabende Familien, bei ihren reichen und mächtigeren Nachbarn Schutz zu suchen; Aufstände und Unruhen in verschiedenen Teilen des Reiches zwangen die Regierung, diese Familien zur Unterdrückung derselben in Anspruch zu nehmen, und zu Beginn des siebenten Jahrhunderts wurden ihnen für ihre Dienste kaiserliche Vorrechte zu teil, sie erhielten Beamtenposten in der Provinz oder an den Grenzen des Reiches. Die Kaiserin Suiko erließ im Jahre 603 ein Dekret, demzufolge jedem Beamtenposten eine entsprechende Adelsstellung gebühre, und so entwickelten sich allmählich in den Provinzen adelige Familien, die an der Spitze ganzer Distrikte oder Clans standen, wie es noch heute beispielsweise in Schottland der Fall ist. Die Häupter dieser Familien sind die Daimios, zu deutsch „große Namen”, deren es bei dem Zusammensturz des alten Feudalsystems in den siebziger Jahren etwa dreihundert gab.
Nachdem diese Daimiofamilien in ihren Distrikten sich einmal zu den reichsten und mächtigsten emporgeschwungen hatten und der Ball ins Rollen gekommen war, stieg diese Macht je nach der Größe ihres Distriktes, nach der Energie, mit der sie auftraten, oder durch Zufall, so daß sie bald zu einer Art Souveränität gelangten. Damals war dies um so leichter, als es keine Verkehrswege gab und die Zentralregierung am Hofe des Mikado selbst viel zu schwach war, um dem Weitergreifen der Daimioherrschaft einen Damm entgegenzusetzen. Die Kuge blieben freilich die höchste Aristokratie des Landes, Legitimisten, könnte man sagen; die Daimios aber waren die reichsten und mächtigsten, und viele von ihnen besaßen in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts ungeheure Einkünfte. Ihr Rang wurde je[S. 459] nach der Größe der letzteren bemessen. So hatte beispielsweise der reichste Daimio, jener von Kaga, eine jährliche Einnahme von einer Million Koku Reis (nahezu zwei Millionen Hektoliter), während sich die niedrigsten Daimios auf Einkünfte von zehntausend Koku Reis (etwa achtzehntausend Hektoliter) standen. Die Macht der Daimios wurde im achten Jahrhundert noch durch eine Verordnung des Hofes vergrößert, derzufolge alle wohlhabenderen Bauern, welche im Waffenführen, Bogenschießen, Reiten bewandert waren, eine Art Miliz im ganzen Lande bilden sollten, unter Anführung der Daimios. Diese Maßregel war eine der wichtigsten in der ganzen Geschichte des Mikadoreiches, denn sie teilte die Bevölkerung in zwei große Klassen, die Ackerbauer und die Soldaten. Griffin sagt in seinem Werke „The Mikados Empire” sehr richtig: „Dabei wurde ein Teil des Volkes auf eine Lebensweise geführt, in welcher Reisen, Abenteuer, soldatische Tugenden, Ehre und Ritterlichkeit eine bedeutende Rolle spielten, und damit wurde die beste Klasse der Männer von Japan, die Samurai, geschaffen. Die Samurai haben jahrhundertelang das Waffenwesen, Ritterlichkeit, Patriotismus und Intelligenz des japanischen Reiches nahezu monopolisiert. Sie sind die Männer, welche stets bereit waren zu lernen und denen die großen Reformen des modernen Japan, das Aufheben des Feudalwesens, die Niederwerfung des Schogunats und die Wiederherstellung der einstigen Macht der Kaiser zuzuschreiben sind. Ihr Geist ist es, welcher Japan heute regiert; ihre Söhne sind es, die in Europa die Zivilisation des Abendlandes studieren; die Samurai sind die Seele der Nation.”
Jeder Daimio hatte eine mehr oder minder große Zahl von Samurai (Zweischwertermännern) unter seinem Befehl; sie teilten sich in zwei Klassen: Schizuko oder Samurai höheren Grades, deren es in Japan nach Aufhebung der Feudalherrschaft etwa 260000 gab, und Sotsu oder Samurai niederen Grades in einer Gesamtzahl von 167000. Die mächtigsten Daimios mit der größten Zahl und tüchtigsten Klasse von Samurai waren jene von Satsuma, Chosu, Tosa und Hizen; von ihnen gingen auch hauptsächlich die Ideen aus, welche zu den großen Umwälzungen der letzten Jahrzehnte führten, und Männer aus diesen Clans oder Stämmen haben auch heute die Zügel der Regierung in ihren Händen. Die Träger der Namen Ito, Yamagata, Yamada, Inouye und Aoki sind frühere Samurai von Chosu, die beiden Saigos, Terashima, Yoshida, Oyama, Kuroda sind frühere Samurai von Satsuma, welchem Clan überdies nahezu die ganze Seemacht Japans angehört.
Wie am Hofe des Mikado die Kuge allmählich die Gewalt an sich rissen, so erging es auch an den kleinen Höfen der Daimios, wo die Samurai die Rolle der Kuge übernahmen und die Gewalt der Daimios in ihre Hände bekamen. Die ganze Regierung des Clans, die Verwaltung des Landes wurde durch die Samurai besorgt, die Daimios hatten sich um die Regierungsgeschäfte gar nicht zu kümmern;[S. 460] sie wohnten mit ihren Familien in ihren prachtvollen Schlössern auf dem Lande oder in der Nähe ihrer Hauptstädte und vertändelten ihre Zeit weniger mit Waffenübungen als mit allerhand Spielereien, Theezeremoniell, Poesien, Aufführungen von alten Theaterstücken, Tänzen und Gesängen; allerdings unterstützten sie die schönen Künste, und die herrlichen Porzellane, Bronzen, Waffen, Metallarbeiten, Stoffe und Stickereien, die heute in unseren Museen so große Bewunderung erregen, wurden zum größten Teile auf Bestellung der Daimios ausgeführt. Aber auf der anderen Seite war dieses weichliche, thatenlose Leben nicht dazu angethan, den Daimios ihre frühere Energie, ihren Thatendienst zu erhalten, und was ihre Frauen anbelangt, so waren sie nicht viel mehr als Puppen. In den Schlössern der Daimios gab es weder die geistige Thätigkeit, welche an dem Hofe des Mikado herrschte, noch die Pflichten und Arbeiten der Samuraifrauen, so daß das Leben der Daimiofrau vielleicht, wie Alice Bacon in ihrem reizenden Büchlein über die japanischen Frauen sagt, langweiliger und zweckloser war als das irgendwelcher Frauen des Landes. Umgeben von endlosen Vorschriften der Etikette, ohne die Anregung, die von physischer Arbeit oder intellektueller Thätigkeit kommt, vegetierten diese Frauen mehr, als daß sie lebten. Kein Wunder, daß die Daimios unter der Herrschaft der Schogune aus dem Hause Tokugawa geistig wie physisch degeneriert waren, denn in dem Leben der Frauen gab es absolut nichts, was sie befähigt hätte, Gattinnen und Mütter starker Männer zu sein. Zart, niedlich, gekünstelt, geschickt in allerhand kleinen Nichtigkeiten, aber unfähig, selbständig aufzutreten, waren sie wohl vornehme Damen in jeder Weise, mit Instinkten von Ehre und Noblesse von ihrer frühesten Kindheit an, aber diese Jahre von Absperrung, von Unterwürfigkeit seitens ihrer Hunderte von Dienern, von fortwährendem Unterricht in den Pflichten, Würden und Zeremonien ihrer Stellung zeigen sich heute in auffälliger Weise an diesen Geschöpfen. Alice Bacon sagt über sie: „Es fehlt ihnen an Kraft, Ehrgeiz, an Klarheit des Denkens, während die Nation der Japaner diese Eigenschaften im höchsten Grade besitzt; dafür haben sie aber seltenen Anstand, reizvolles Benehmen, starkes Ehrgefühl und Rassenstolz, gepaart mit persönlicher Bescheidenheit, die nahezu Unterwürfigkeit erreicht.” Alice Bacon kennt sie genau, denn sie war einige Jahre lang Lehrerin in der seit anderthalb Jahrzehnten bestehenden Adelsschule in Tokio, wo die Söhne und Töchter der Aristokratie ganz nach europäischen Vorbildern ihre Erziehung genießen.
Während der letzten Generationen waren die Daimios durch ihr weichliches, üppiges Leben so weit herabgekommen, daß die Schogune der Dynastie Tokugawa leichtes Spiel mit ihnen hatten. Um sie besser im Zaume zu halten und etwaigen Unternehmungen zu Gunsten der Wiederherstellung der Kaisergewalt vorzubeugen, zwangen die Schogune sie, in der Hauptstadt Tokio Paläste zu bauen und während einer Hälfte des Jahres dort, in der unmittelbaren Umgebung der Schogune, zu[S. 461] wohnen. Aeußerlich wurden ihnen alle erdenklichen Ehren zu teil, aber in Wahrheit waren sie der Mehrzahl nach machtlose Puppen der Schogune. Griffin sagt über sie: „Rang-, Ehren- und Titelsucht ist die hervorragendste Leidenschaft der Japaner. Die reichsten Daimios opferten große Summen und ließen alle Einflüsse in Kioto spielen, um nur einen neuen Titel zu erhalten.” Titel und Orden spielen deshalb auch im modernen Japan eine wichtige Rolle, und selbst posthume Titel werden heute verliehen.
Von dieser Kuge- und Daimiowirtschaft ist in Tokio, wenigstens was die Aeußerlichkeiten betrifft, heute alles verschwunden; verschwunden sind auch die geräumigen Paläste des Adels, die sich noch vor zwanzig Jahren in weitem Kreise rings um die feste, mit Mauern und Wällen umgebene Residenz der Schogune hinzogen und eine Adelsstadt, ein Faubourg St. Germain, bildeten, wie es in dieser Art wohl auf Erden nicht wiederzufinden war. An der Stelle des Schogunpalastes innerhalb der Ringmauern steht heute der moderne Palast des Kaisers; auf den Trümmern der niedergerissenen Adelspaläste erheben sich kolossale moderne Bauten, Ministerien, Schulen, Universitätsgebäude, oder die weiten Grundflächen wurden zur Anlage von Parks und Gärten verwendet. Nur wenige jener Paläste sind der Zerstörungswut des modernen Japan entgangen, und an ihnen kann man erkennen, wie die Daimios in ihnen gewohnt haben. In den langen niedrigen Außengebäuden, welche viereckige Höfe bilden, wohnten die Samurai, die ihre Herren auf den Reisen nach der Hauptstadt zu begleiten pflegten, und in den inneren Gebäuden, einfach, kahl, niedrig, mit papierüberzogenen Holzrahmen als Wänden, wohnten die Daimios. Ihre Wappenblumen sind von den Thoren verschwunden, und an ihrer Stelle zeigt sich dort das Wappen des Kaisers, die Chrysanthemumblüte; an Stelle der Samurai hausen in diesen Räumen japanische Kavallerie und Artillerie modernen Musters. Ebenso sind die stolzen, vielstöckigen, eigentümlichen Stammburgen und Schlösser in den Provinzen in Kasernen umgewandelt worden. Die Familien selbst wohnen teils in altjapanischen Häusern, teils in modernen englischen Villen, je nachdem es ihre Mittel gestatten, denn der größte Teil ihrer Einkünfte wurde ihnen bei der Aufhebung der Feudalherrschaft ebenso entzogen wie ihre Länder. Sie wurden viel gründlicher mediatisiert, als es in Europa seinerzeit geschah. Es war auch bei diesen verweichlichten, mittellosen Herren leichter durchzuführen, zumal einige wirklich groß angelegte, patriotische Daimios selbst den Anstoß dazu gaben. Jene von Satsuma, Choshiu, Tosa und Hizen richteten eine Eingabe an den Thron, in welcher sie ihre Ländereien nicht als Privatbesitz, sondern als Eigentum der Krone bezeichneten und sich bereit erklärten, dieselben zusammen mit den Registern des ganzen Clans dem Kaiser zur Verfügung zu stellen. Die kleineren Daimios wußten nun, daß auch die Tage ihrer Herrschaft gezählt seien und Widerstand vergeblich wäre. Im September 1871 erschien ein kaiserliches Edikt, welches alle[S. 462] Daimios des Landes nach Tokio berief und ihnen befahl, sich ins Privatleben zurückzuziehen. In ihren Schlössern, in den weiten Hallen ihrer Vorfahren, nahmen sie Abschied von ihren Samurai und begaben sich, von einigen Dienern begleitet, nach der Hauptstadt. Ihre ehemaligen Fürstentümer wurden in Provinzen geteilt und unter Präfekten gestellt. Mit der Feudalherrschaft in Japan war es voraussichtlich für immer vorbei.
Selbst ihren alten angestammten Namen büßten sie vielfach ein. Die Bezeichnungen Kuge und Daimio wurden fortdekretiert und an ihrer Stelle eine neue Rangordnung des Adels eingeführt, ganz nach europäischem Muster. Es wurden Fürsten, Marquis, Grafen, Vizegrafen und Barone geschaffen und die früheren Daimios je nach ihrem alten Rang und Reichtum dieser oder jener Klasse zugeteilt. Sogar Samurais, die sich um die moderne Bewegung Verdienste erworben hatten, wurden diese neuen Adelstitel verliehen. Aber die alten Kuge konnten sich auch in dem neuen Gewande nicht dazu bequemen, die Daimios und geadelten Samurais, obschon sie vielleicht denselben Adelstitel besaßen, als ebenbürtig zu betrachten; die Hofkreise Japans sind in ähnliche Fraktionen und Cliquen gespalten wie die Aristokratie Frankreichs. Auch in dem Reiche des Mikado giebt es ein Faubourg St. Germain und ein Faubourg St. Honoré, bei allen aber dreht es sich hauptsächlich um die Gunst des Kaisers.
Der heutige Adel von Japan zählt 10 Fürsten, 25 Marquis, 80 Grafen, 352 Vicomtes und 98 Barone. Von den 10 Fürsten sind die 5 alten Gosekke, d. h. die höchststehenden der früheren 155 Kugefamilien, nämlich die Ichijo- (denen die regierende Kaiserin entstammt), Kujo-, Takatsukasa-, Nijo- und Konoyefamilien; ihnen wurden 1883 noch die Häuser Sanyo, Iwakura, Shimadzu, Mori und Tokugawa beigesellt, und diese zehn Familien genießen das Privilegium, daß aus ihren Töchtern die Braut des Kaisers oder des Thronfolgers gewählt wird.
Der Kaiser verkehrt auch in den Häusern der Fürsten, und vor einigen Jahren waren es gerade die Tokugawa, welche dem Souverän in ihrem Palaste eine große Festlichkeit im altjapanischen Stile gaben. Bei dem Preisfechten und der Novorstellung (eine Art lyrischen Dramas) kamen dieselben Gesichtsmasken und unschätzbaren Kostüme zur Verwendung, die in der Familie der Tokugawa seit Jahrhunderten im Gebrauch waren. Uralter Sitte gemäß wurden dem Kaiser bei seinem Besuche ein kostbares Schwert und ein Festgedicht in einem Kästchen aus Goldlack überreicht. Der Kaiser nahm diese Geschenke aus den Händen des Gastgebers entgegen, eines Mannes, dessen Vater Keiki der letzte der Schogune war. Dieser, ein Rebell gegen die kaiserliche Gewalt, lebt heute vergessen, ohne jeden Anhang und ohne politische Absichten und Hoffnungen, auf einem kleinen Landgute in der Nähe von Shidzuoka, während sein Sohn sich mit der gegenwärtigen Regierung vollständig ausgesöhnt hat und sich der Gunst des Kaisers erfreut.[S. 463] Den heutigen Marquis und Grafen und Vicomtes würde man es gewiß nicht ansehen, daß sie vor dreißig Jahren noch in den alten Daimiokostümen, begleitet von einer Anzahl Zweischwertermännern und zahllosem, malerischem Gefolge, auf dem Tokaido oder anderen Straßen des Landes einherzogen, kleine Souveräne mit Hofstaaten und großen Einkünften. Schmächtige, bewegliche, ungemein höfliche Männer, kleiden sie sich nach der neuesten Mode und sehen so elegant aus, als wären sie ihr Leben lang nicht über Piccadilly oder St. James hinausgekommen. Sie fahren in modernen Equipagen umher, reiten, spielen Lawn Tennis und unterhalten sich mit den ausländischen Diplomaten in französischer, deutscher oder englischer Sprache über allerhand europäische Dinge. In ihrem Adelsklub, dem Rokumeikwan, lesen sie die Times oder Kreuzzeitung, spielen Billard wie Franzosen und Poker wie Yankees; dazwischen machen sie Damen den Hof, besuchen Afternoon Teas und lassen sich bei Wohlthätigkeitsbazars ausplündern. Der vornehme Prinz Shimadzu von heute ist kein anderer als der einstige Daimio von Satsuma; der Marquis Maeda, bekannt wegen seines Reichtumes und Schwager eines kaiserlichen Prinzen, ist der frühere Daimio von Kaga. Sein Palast hat den Bauten der neuen Universität Platz gemacht, seine früheren Jahreseinkünfte von nahe zwei Millionen Hektoliter Reis fließen in die kaiserlichen Kassen, aber er hat doch genug übrig behalten, um überall, auch in Europa, als reicher Mann zu gelten.
Aber noch auffälliger ist die Wandlung, die mit den früheren Kuge- und Daimiodamen vor sich gegangen ist. Die zarten, bemalten Geschöpfchen mit den glattrasierten Augenbrauen und geschwärzten Zähnen, mit den buntfarbigen Kimonos und schweren Holzpantoffeln, die ihr ganzes Leben auf den Schlössern ihrer Väter verträumten, sind heute Pariser Modedamen mit modernsten Toiletten und Brillantenschmuck; sie haben sich die Augenbrauen wieder wachsen lassen, ihre Zähne sind wieder weiß geworden, und wären sie nicht so schlitzäugig und von gelblichem Teint, man könnte sie für vornehme Europäerinnen halten. Während sie früher vom Hauswesen, von Gesellschaften und dergleichen gar nichts wußten, sind manche heute die Leiter ihrer Hauswesen in großen Palästen oder Villen, ganz nach abendländischem Muster, und erfüllen ihre vielen Pflichten mit einer Gewandtheit, die Staunen erweckt. Selbst ans Reiten und Fahren haben sie sich gewöhnt. In Tokio besteht unter dem Schutze der Kaiserin, die selbst eine passionierte Reiterin ist, eine Damenreitschule, wo sich die jungen Aristokratinnen auf vortrefflichen Pferden, Mischlingen von japanischen und ungarischen Tieren, herumtummeln.
Nichts spricht so sehr für das Nachahmungs- und Anschmiegungstalent der Japaner als die Schnelligkeit, mit welcher selbst ihre Frauen ihre ganze Kultur und Anschauungsweise verändert haben. Sie legten das alte Japanertum anscheinend mit ebensowenig Schwierigkeit und Bedauern ab wie ein Paar getragene Handschuhe, aber nur anscheinend, denn ihre Anstrengungen mit den neuen, fremden[S. 464] Sprachen, Kleidern und Etikettevorschriften waren geradezu heroisch. Die Mütter studierten Sprachen und Sitten gleichzeitig mit ihren Töchtern bei denselben Lehrerinnen, und die Frauen der japanischen Diplomaten, wie zum Beispiel die Prinzessin Komatsu, welche einige Jahre in Europa gelebt hat, gaben der vornehmen Gesellschaft Japans nach ihrer Rückkehr dorthin Unterricht in abendländischer Etikette und Lebensart. Viel haben dazu auch einige europäische an Japaner verheiratete Damen beigetragen, in erster Linie Madame Sannomiya, die englische Gattin des japanischen Hofmarschalls dieses Namens. Zwei Japanerinnen, den vornehmsten Hofkreisen angehörig, haben das bekannte Vassar Kollege in Nordamerika mit Erfolg absolviert, und die Anschauungen, die sie von dort nach Japan mitgebracht haben, wirkten auf die dortige Gesellschaft wie Sauerteig. Die eleganteste und schönste der modernen Damen des Hofes ist wohl die Marquise Nabeshima, die Gattin des Oberzeremonienmeisters und reichsten Pairs von Japan.
Wie Paris und Wien, so hat auch Tokio seine gesellschaftliche Wintersaison, die gewöhnlich vom Oktober bis Mai, d. h. bis zum Eintritt der heißen Jahreszeit dauert, und während dieser Saison geht der soziale Eiertanz noch viel peinlicher und zeremoniöser vor sich als in den großen Residenzen Europas. Staats-, Diners- und sonstige Visiten müssen genau innerhalb einer gewissen Zeit gemacht werden, und der Europäer, der eine Wintersaison in der Gesellschaft von Tokio zubringt, kommt vor Visitenkartenabgabe kaum zum Atemholen. Und fügen muß er sich, will er nicht aus den Gesellschaftslisten gestrichen werden. Sogar das Tanzen nach europäischer Mode hat die junge Welt Japans schon erlernt, und auf den zahlreichen Bällen bei den Ministern, Hofwürdenträgern und Gesandten tanzen die schlitzäugigen Komtessen und Baronessen mit einer Präzision, gehen durch die Figuren der Quadrille und der Lanciers mit einer Kenntnis der Details wie alte pommersche Grenadiere auf dem Exerzierplatz. Wehe dem Europäer, der da irgend einen falschen Schritt macht! Er wird nicht durch Scherze oder huldvolles Lächeln, sondern im Gegenteil, durch tiefen Ernst zurechtgewiesen und könnte vor Scham über die Kenntnis seiner Tänzerinnen unter den Parkettboden versinken. In den Tänzen auf japanischen Bällen wird der Europäer zumeist nur militärischen Drill finden, und es ist kaum anzunehmen, daß die japanischen Damen besonderen Gefallen daran haben. Aber es ist eben europäische Sitte, und ihr muß gefolgt werden. Die Festlichkeiten am Kaiserhofe beschränken sich auf einige Staatsbankette an besonderen Festtagen und auf zwei Garden parties, bei welchen die Majestäten zu erscheinen pflegen. Dagegen giebt der Premierminister gewöhnlich am Vorabend des kaiserlichen Geburtsfestes einen Staatsball, und ihm folgt kurze Zeit darauf der Gouverneur von Tokio mit einem zweiten. Auch in den Gesandtschaften der europäischen Großmächte finden zahlreiche Festlichkeiten, Soirées dansantes, Diners und Garden parties statt, dann bei den Prinzen und Mitgliedern der hohen[S. 465] Aristokratie. Nur mit musikalischen Unterhaltungen war es bisher sehr schlecht bestellt. Neben diesen europäischen Kreisen giebt es in Tokio jedoch immer noch altjapanische Kreise, ja dieselben nehmen in der letzten Zeit eher zu als ab. Sie stellen sich die Erhaltung ererbter Sitten und Gebräuche zur Aufgabe, pflegen die alte Musik und das alte Theater und stellen sich auch in der Kleiderreform auf die Seite der feudalen Trachten. Die glänzenden, goldstrotzenden und gestickten Daimiokostüme sowie die Waffen haben sie wohl abgelegt, aber der nationale Kimono und der Obi sind in diesen Kreisen des legitimistischen Adels alleinherrschend. Daß sie diesem Adel angehören, lernt der Europäer schon nach kurzem Aufenthalte erkennen, denn die Japaner beiderlei Geschlechts tragen auf den Kimonos ihr Familienwappen aufgestickt. Gewöhnlich sieht man rückwärts auf dem Kragen, dann auf beiden Aermeln und auf der Brust weiße Kreise in der Größe unserer Damenuhren und innerhalb dieser Kreise weißgestickte Figuren, Blätter und Blüten verschiedener Pflanzen, Schmetterlinge, Vögel. Dies sind die alten Daimiowappen, an ihnen erkennt man die Angehörigen der Tokugawa, der Satsuma, Fujiwara und anderer großer Familien. Selbst die Samurai tragen derartige Wappen als das einzige, was die europäische Kultur von dem alten Japan noch nicht weggeschwemmt hat. In mancher Hinsicht ist dies bedauerlich. Eine Verbindung der altjapanischen mit der modernen europäischen Kultur wäre gewiß zweckentsprechender gewesen und hätte auch bei den Japanern selbst größeren Beifall gefunden.
Das Studium der Frauen (und welches Studium wäre interessanter?) fällt dem Reisenden in Japan viel weniger schwer als in den meisten anderen Ländern des Orients. In der Heimat des Islam werden die Frauen verborgen und streng gehütet, so daß kein fremdes Männerauge sie erblicken kann; in Indien stecken sie in ihren Zenanas, in China hausen jene der besseren Klassen hinter den hohen Umfassungsmauern ihrer weitläufigen Familienwohnungen, in Korea bedecken sie bei der Annäherung eines fremden Mannes die Gesichter oder fliehen. Der Reisende kann also dort gewöhnlich nur die eine, die männliche Hälfte der Bevölkerung in ihrem Thun und Lassen genauer kennen lernen. Anders in Japan. Den Bewohnern des großen asiatischen Inselreiches sind Harems oder Zenanas unbekannt, und die Frauen werden in der Freiheit ihrer Bewegung viel weniger beschränkt. Keine Kopftücher oder Schleier verhüllen ihre Gesichter, ja statt des Verbergens ihrer reizenden, liebenswürdigen Persönlichkeit findet oft das gerade Gegenteil statt, eher ein Zuviel als ein Zuwenig. Die Sprache ist bei weitem nicht so schwierig als jene anderer Völker, und auch in Bezug auf den Verkehr mit den Ausländern werden ihnen ebensowenig Beschränkungen auferlegt als wie mit ihren eigenen Landsleuten des starken Geschlechts. Selbst für denjenigen, der sich nicht die Mühe[S. 467] giebt, die klangvolle, sympathische Sprache der Japaner zu studieren, offenbart sich das Frauenleben bis in viele seiner interessantesten Einzelheiten. Nicht etwa deshalb, weil sich die Japaner in Bezug auf ihre Frauen, oder gar diese selbst, großer Mitteilsamkeit befleißigten. Im Gegenteil. Sie sind darin gerade so schweigsam wie andere orientalische Völker, aber dafür tritt das Familienleben in Japan in vieler Hinsicht ganz offen zu Tage. Im Straßenleben, bei Festlichkeiten, in Theehäusern und Theatern, in Hotels, auf Reisen spielen die Frauen eine fast ebensogroße Rolle wie die Männer, und wer Japan im Sommer besucht, dem gewähren die tagsüber offenen Häuser mit ihren Gärtchen und Höfen einen tiefen Einblick in das häusliche Leben. Die Japaner thun gut daran, denn gerade ihre Frauen verleihen diesem herrlichen Lande den größten Reiz. Gewiß wird jeder Reisende, der einige Monate in Japan verweilt hat, von den Frauen schwärmen, sein Entzücken steigert sich, je länger er dort verweilt.
Eine Reihe von liebenswürdigen Bildern der Erinnerung zieht vor meinen Augen vorüber, während ich diese Zeilen schreibe. Vornehme Damen mit langen schmalen Gesichtern und schwarzen schönen Augen, angethan mit den kostbarsten Seidengewändern, gefolgt von kleinen bescheidenen Dienerinnen; festlich geputzte Mädchen in farbenreichen, blumengestickten Kimonos, den bunten Sonnenschirm in der einen, den einem Schmetterling gleichenden Fächer in der anderen Hand, die Gesichter weiß gepudert, die schwarzen Augen munter und kokett in die Welt blickend, ein ewiges Lächeln um ihre rot geschminkten Lippen; fleißige Frauen in dunkelblauen Schlafröcken beim Kochen, Nähen und Waschen; auf den Feldern andere, die mit hochgeschürztem Kleid bis über die Knie im Schlamm stehend und im höchsten Sonnenbrand sorgsam ein Reispflänzlein um das andere pflanzen, stundenlang ohne Unterlaß; reizende junge Mädchen mit vollen blühenden Gesichtern und üppigen Formen, die, in enge Röckchen und Hosen gekleidet, rittlings auf schwer bepackten Pferden sitzen und sie geschickt über gefahrvolle Bergpfade lenken, die zierlichste Kavallerie, die man sich denken kann; freundliche aufmerksame Dienerinnen in den Hotels, die sich bei meinem Kommen und Gehen ehrfurchtsvoll auf den Boden werfen und ihn mit ihren weißen Stirnen berühren; Damen, kleine Tabakspfeifchen im Munde, in Theaterlogen auf ihren Fersen hockend, Aug’ und Ohr für die grotesken Vorgänge auf der Bühne; einschmeichelnde, putzige, hübsche Wesen, die mir in den Theehäusern die winzigen Schälchen mit Thee und Sake kredenzen und dann mit Samisenspiel und anmutigem Tanz die Zeit vertreiben: Frauen überall, daß man darüber fast die Männer vergessen könnte. Nirgends in Asien erscheinen sie so sehr als die bessere Hälfte wie hier, aber nirgends wird dies auch von den Männern so wenig gewürdigt. Und doch sind sie zeitlebens bestrebt, nur den Männern zu dienen, ihnen zu gefallen, das Leben zu erleichtern und zu verschönern, willig sich selbst dabei aufopfernd. Hier sind die lieblichsten Babies, die muntersten[S. 468] Kinder, die zärtlichsten Töchter, die liebendsten Frauen, die besten Mütter, die man in Ostasien vielleicht finden kann.
Es ist die verkehrte Welt. In Europa würde man derartige Frauen auf den Händen tragen, sie verzärteln und lieben, und hier in ihrer Heimat werden sie von der männlichen Welt mit Geringschätzung als untergeordnete Wesen behandelt, und ihre Aufopferung wird als etwas ganz Selbstverständliches hingenommen. Niemals gab es in Japan einen Werther, einen Toggenburg, einen Romeo, niemals hat ein Japaner einer schönen Frau zuliebe ritterliche Thaten begangen, ein Turnier ausgefochten oder gar sein Leben eingebüßt. Schillers Lied vom „Handschuh” muß dem Japaner einfach lächerlich erscheinen. In Japan giebt es keinen Ritter Delorges, und das edle Fräulein Kunigunde hätte sich wohl selbst hinabbemühen müssen unter die Löwen und Leoparden, um ihren Handschuh zu holen. Entfällt einem Japaner Fächer oder Pfeife, so wird sich seine Frau eifrig bücken, um den Gegenstand vom Boden aufzuheben. Nicht den Damen wird der Vortritt gelassen, sondern den Männern; Place aux Messieurs ist dort die Parole.
Allerdings wird der Frau von den überaus zuvorkommenden und höflichen Japanern ein gewisser Grad von Höflichkeit gezeigt; die Tochter des Hauses wird von ihrer eigenen Familie O Jo Sama, d. h. junge Dame, genannt, und spricht man von der Hausfrau, so wird ihrem Namen stets O, d. h. ehrenwerte, vorgesetzt. Das will aber nicht viel sagen, denn auch die Kulis werden mit ehrenwert angesprochen. In seinem Buche über Japan erzählt Dr. Kleist, sein europäischer Nachbar habe einen Hund besessen, der auf den nicht ungewöhnlichen Namen Meyer hörte. Riefen ihn die japanischen Diener, so setzten sie jedesmal O vor, also etwa „ehrenwerter Herr Meyer!”
Hat die japanische Frau ihre demütigende Stellung vielleicht selbst verschuldet? Betrachten wir sie näher. Ein ungemein zierliches, reizvolles Wesen von kleiner[S. 469] Gestalt, mit winzigen Händen und Füßen und sorgfältig frisiertem, rabenschwarzem Haar, ihre Augen sind die einer Madonna, ihr Herz das eines Kindes; ihr Lächeln, als würde sie ewig ihren Geliebten vor Augen haben, ihr Benehmen unsagbar einnehmend und höflich; ihr Gesicht nach europäischen Begriffen entschieden hübsch. Die Hautfarbe ist jene der Andalusierin, soweit man die Hautfarbe bei den Damen beider Rassen unter der dicken Puderschicht überhaupt entdecken kann. Sie spricht mit sympathischer, leiser, einschmeichelnder Stimme, und aus ihrem Alter macht sie kein Geheimnis. Im Munde sitzen kleine, regelmäßige weiße Zähne, die sie nach der Verheiratung schwarz färbt, damit sie keinem Manne mehr gefalle. Vergebliches Bemühen, denn bei geschlossenem Munde ist sie gerade so hübsch. Und die Japanerinnen können den Mund geschlossen halten. Sie wissen, daß die Geschwätzigkeit eine der sieben Ursachen der Ehescheidung bildet. Das ganze Persönchen steckt in einem an den Hüften zusammengebundenen Schlafrock von verschiedenen Farben. Setzt sich die Japanerin, so kniet sie zuvor nieder und legt ihren Körper auf ihre Fersen zurück. Liegt sie, so dient ein Holzklotz als ihr Nackenkissen, damit ihre sorgfältige Frisur nicht zu Schaden komme; geht sie, so thut sie das mit einwärts gewandten Füßen, wie die Enten, und neigt den Körper vor, als müsse sie bei jedem Schritt vornüberfallen. Begegnen ihr Bekannte, so verneigt sie sich mehrere Male zeremoniös zur Erde, als wären es lauter Könige, und ihr ganzer gesellschaftlicher Verkehr wird durch die strengste Etikette geregelt; sie trinkt nicht, spielt wenig, dafür raucht sie gerne bei jeder Gelegenheit ihr Pfeifchen, das sie immer nebst Tabaksbeutel und Zündhölzchen in den Aermelsäcken ihres schlafrockartigen Kimono trägt. Reinlichkeit ist eine ihrer schönsten Tugenden; um ihr zu frönen, opfert sie gerne eine andere Tugend, die Schamhaftigkeit. Sie nimmt täglich ein oder mehrere Bäder in oder außer dem Hause, allein oder in Gesellschaft, und zeigt dabei in ihrer naiven Unschuld aller Welt, wie sie gewachsen ist. Sie ist aber entsetzt über die tief ausgeschnittenen Ballkleider unserer Damen. Nur keine verführerischen Halbheiten! Entweder sie ist ganz bekleidet, oder, wo es die Umstände erfordern, wirft sie den Kimono ab und kleidet sich nur in ihren natürlichen Liebreiz, der ihr aber lange nicht so gut steht wie der Kimono. Auch in der heißen Jahreszeit, in ihrem Hause oder bei der Arbeit im Freien, befreit sie häufig ihren Oberkörper von aller Gewandung.
Besonders anregende Unterhaltung, geistige Genüsse, kann man von ihr nicht erwarten, denn sie lernt in ihrer Jugend wohl Singen, Tanzen, Samisen (die japanische Guitarre) spielen, sie lernt notdürftig lesen und schreiben und das Hauswesen führen. Dafür versüßt sie den Männern das Leben durch ihren Liebreiz, ihre Engelsgeduld, ihre Sanftmut und Unterwürfigkeit. Sie versteht es vortrefflich, einen Blumenstrauß in künstlerischer Weise zu binden und ihrem Gatten die Kleider zu flicken. Sie zieht ihre Kinder groß, liebt und verzärtelt sie und verbringt ihr[S. 470] eigenes Leben in Arbeit und Enttäuschungen. Ihre glücklichste Zeit ist ihre Kindheit. Einmal verheiratet, kann sie einen dicken Strich durch ihren Kalender machen. Mit vierzehn, sechzehn Jahren beginnt ihr Ehejoch, das sie schwer durchs ganze Leben trägt.
Der Schlüssel zu ihrem ganzen Charakter ist Unterwürfigkeit, Gehorsam. Als Mädchen schuldet sie diesen dem Vater, als Gattin dem Manne, als Witwe ihrem ältesten Sohne. Was immer ihr befohlen wird, hat sie auszuführen, und sie wird einen ihr unsympathischen Gatten nehmen, ohne zu murren. Zieht sie als Hausfrau in die Wohnung ihres Gatten, so ist es nicht, um an seiner Seite dem Hause vorzustehen. Sind ihre Schwiegereltern am Leben, so wird sie sofort deren Dienerin, und selbst ihr eigener Gatte wird sie gegen die Nergeleien ihrer Schwiegermutter nicht schützen können. Alice Bacon ruft in ihrem hübschen Buche über die japanischen Frauen mit Recht aus: „Glücklich die Frau, deren Schwiegereltern nicht mehr am Leben sind!” Das Unglück ihres Gatten gereicht ihr zum Vorteil, denn statt zwei Herren hat sie dann nur einem zu dienen.
Allerdings liegt ihr dann allein die Leitung des ganzen Hauswesens ob, aber nicht als die ebenbürtige Gattin des Mannes, sondern als seine erste Dienerin. Sie erscheint im öffentlichen Leben selten an seiner Seite; auch zu Hause sitzt sie nicht an seinem Tische. Er nimmt die Mahlzeiten allein ein, sie hat ihn dabei zu bedienen. Seine Wünsche sind ihre Befehle, die sie willig und freundlich ausführen muß. Sie muß nicht nur seine Kleider nähen und waschen, sie muß ihm selbst[S. 471] beim An- und Auskleiden behilflich sein; ja häufig setzt sie sogar einen gewissen Stolz darauf, mit eigener Hand Dienste zu leisten, welche sonst der Dienerschaft obliegen. Selbst die Kaiserin ist von diesen Pflichten des persönlichen Dienstes nicht befreit, sondern muß den Kaiser, ihren Gatten, auf verschiedene Weise bedienen.
Wie strenge es mit ihren Pflichten genommen wird, geht aus einem weit verbreiteten Werke des japanischen Moralisten Kaibara hervor. Darin heißt es: „Niemals darf die junge Frau sich gegen die Befehle ihrer Schwiegereltern auflehnen; in jedem Punkte muß sie dieselben befragen und ihnen gehorchen; selbst wenn sie von diesen gehaßt oder beschimpft würde, hat sie zu schweigen. Sie darf nicht selbstsüchtig zuerst an ihre Eltern denken. Jenen ihres Gatten, dann ihren Schwägern und Schwägerinnen gebührt zunächst ihre Achtung, denn die letzteren sind die Geschwister ihres Gatten. Eine Frau soll zu ihrem Gatten emporsehen, als wäre er der Himmel selbst, und niemals soll sie ermüden, ihrem Gatten in allen Dingen zu folgen, um so der himmlischen Züchtigung zu entgehen. Möge sie niemals von Eifersucht auch nur träumen; sie kann sich dadurch ihren Gatten nur noch mehr entfremden und sich in seinen Augen unerträglich machen. Am Morgen muß sie früh aufstehen, am Abend spät zu Bett gehen. Statt in der Muße des Tages zu schlafen, soll sie ihre Haushaltung besorgen und nimmer müde werden zu weben, zu nähen und zu spinnen. Sie darf nicht zu viel Thee und Wein trinken, noch zu vielen Vergnügungen nachgehen. Sie darf sich durch Medien oder Wahrsagerinnen nicht verleiten lassen, in unehrerbietige Vertraulichkeit mit den Göttern zu verfallen, und soll nicht fortwährend mit Beten beschäftigt sein. Wenn sie ihre Pflichten als ein menschliches Wesen zufriedenstellend erfüllt, braucht sie überhaupt nicht zu beten und wird sich doch des göttlichen Schutzes erfreuen. Väter”, so endet Kaibara seine Ausführungen, „lehrt eure Töchter diese Maximen schon von ihrer frühesten Kindheit an!”
Daß diese Mahnungen von den Eltern thatsächlich befolgt werden, zeigen ihre Töchter durch ihr ganzes dornenvolles Leben, und es ist nur erstaunlich, mit welcher Anmut, welcher demutsvollen Hingebung die Frauen die größten Erniedrigungen ertragen. Sie bleiben Kinder so lange, bis sie selbst Mütter werden, und dann wenden sie ihre ganze Liebe, ihr ganzes Leben ihren eigenen Kindern zu, deren Sklaven sie sozusagen werden. Niemals verschwindet das Lächeln von ihren Lippen: ein kindliches Lächeln, solange sie unter der Mutter Obhut sind, ein naiv-fröhliches Lächeln als Mädchen, ein bitteres Lächeln als Frauen. Aber daß es in Gegenwart ihres Gatten von ihren Lippen schwinden würde? Nein. Während mehrmonatlicher Reisen in Japan habe ich viele Tausende von Frauen in allen Lebenslagen gesehen, aber niemals sah ich eine im Zorn, niemals hörte ich eine Frau laut sprechen oder schelten, niemals ein Gezänk mit Männern oder anderen Frauen. Sie wissen, daß die Männer ihre unumschränkten Herren sind und von diesen nur so lange geduldet[S. 472] werden, als sie ihnen gehorchen und angenehm sind. Eifersuchtsscenen, Ungehorsam, Zänkerei, Geschwätzigkeit sind hinreichende Gründe, um sie aus dem Hause zu jagen. Der geringste Anlaß kann als Scheidungsgrund gelten, und sie müssen dann unter Zurücklassung ihrer Kinder enttäuscht und unglücklich in ihr Vaterhaus zurückkehren, ohne von ihren geschiedenen Gatten auch nur den geringsten Beitrag zu ihrem ferneren Lebensunterhalt zu bekommen. Sie fallen dann wieder ihren Eltern und Brüdern zur Last, denn eigenes Vermögen besitzen Japanerinnen niemals. Nur die Söhne sind erbberechtigt, und ist kein eigener Sohn vorhanden, so wird ein fremder adoptiert. Die Frauen besitzen nichts als ihre Kleider und einige Hausgerätschaften. Erwerbszweige stehen ihnen keine offen; was bleibt ihnen also übrig als zu leiden und zu dulden?
Wenn all ihre Mühen und Plagen für ihre Gatten von diesen nur durch Liebe und Zärtlichkeit vergolten würden! Aber ebensowenig wie von ihnen erwartet wird, daß sie den Gatten, denen sie von ihren Eltern gegeben werden, Liebe entgegenbringen, ebensowenig werden sie auch von ihren Gatten wirklich geliebt. Professor Chamberlain, der seit mehr als zwanzig Jahren in Japan weilt, gesteht in seinem Werke Things japanese, er hätte in dieser langen Zeit nur von einer einzigen Liebesheirat gehört, und dabei hatten die beiden jungen Leute ihre Erziehung auch noch in Amerika genossen. Sehr häufig kommt es allerdings vor, daß zwischen den Gatten eine gewisse Neigung herrscht, allein diese ist weit entfernt von Liebe in unserem europäischen Sinne.
Und doch erscheinen diese kleinen, herzigen, zärtlichen Wesen, die hübschesten Mädchen, die geduldigsten Frauen, die aufopferndsten Mütter wie für die Liebe geschaffen. Ist es nicht wie ein Fluch, daß der Himmel diesem intelligenten und zivilisierten Volke das herrlichste aller Gefühle, unsere Liebe, versagt hat? Sogar der Kuß ist ihnen unbekannt. Er erscheint ihnen als etwas Tierisches.
Wenn die Frauen noch wenigstens in ihrem Hause mit Gatten und den Kindern ihr Leben lang allein bleiben würden! Aber bald nach der Geburt des ersten Kindes entfremdet sich ihnen der Gatte nur zu häufig, und sie müssen es geduldig ertragen, daß er eine zweite Frau, vielleicht auch eine dritte, ins Haus nimmt, sie müssen lächeln, während er diesen seine Zärtlichkeit zuwendet, sie müssen schweigen, wenn er sie fürderhin nicht mehr beachtet. Ihr ganzes Wesen sollte sich dagegen aufbäumen, aber die Japanerin hat von frühester Jugend an dulden und leiden gelernt, und sie leidet auch nicht in dem gleichen Maße, wie unsere Frauen, eben deshalb, weil sie die wahre Liebe nicht kennt.
Wenn vorhin davon die Rede war, daß den Frauen Japans keine selbständigen Erwerbsquellen offen stehen, so müssen doch einige Ausnahmen gemacht werden, die hauptsächlich für die Frauen der unteren Volksklassen gelten. Sehr zahlreich sind die Dienerinnen in Privathäusern, Hotels und Theehäusern, sowie jene, welche[S. 473] Terpsichore ihr Talent, und wenn auch das nicht, so doch ihre Jugend weihen. Wer hat nicht schon von den reizenden Gaishamädchen gehört, welche mit Musik und Tanz die geselligen Abende der Japaner erheitern? Aber auch diese finden trotz ihres losen Lebenswandels zuweilen einen Mann, ja die Gaishas heiraten sogar in die höchsten Stände ein und werden ehrbare Hausfrauen, die ihre Männer durch ihren Witz und ihr Talent viel länger zu fesseln verstehen als viele andere Frauen.
Die glücklichsten Frauen sind in Japan doch jene der ärmsten Volksklassen, und vornehmlich auf dem Lande. Die Männer haben nicht die Mittel, sich Nebenfrauen zu nehmen, und Not kennt kein Gebot. Gemeinschaftlich begeben sich Mann und Frau zur Arbeit, gemeinschaftlich wird gegessen, sie teilen Freud und Leid miteinander, und die Frau ist mitunter, statt Dienerin zu sein, selbst der herrschende Geist der ärmlichen Haushaltung. Bei dem geringen Ansehen, das die Frauen in Japan genießen, und bei der großen Freiheit der Männer, ihrer Herren, ist es ein wahrer Segen, daß die Japaner im allgemeinen so höflich, zuvorkommend und ruhig sind, selbst bis in die unteren Stände. Welches elende Los wäre den Frauen beschieden, wenn in den ersteren ebensoviel Roheit, Rücksichtslosigkeit und Flegelei herrschen würde wie in Ländern, die dem unserigen viel, viel näher liegen!
Einer der Hauptreize der Japanerin liegt wohl unbestreitbar in ihrer Toilette. Nicht in jener, die durch eine der unsinnigsten Verordnungen des neuen Japan aus unserer alten westlichen Welt auch in dem fernen Lande des Sonnenaufgangs teilweise zur Einführung kam, sondern in jener Toilette, die die Japanerin seit undenklichen Zeiten bis auf die Gegenwart beibehalten hat. In Japan sind die Toiletten glücklicherweise nicht so sehr den Launen der Prinzessin Mode unterworfen wie anderswo. Dort hat man niemals etwas von Krinolinen, von Puffenärmeln und Culs de Paris gehört, der Schwerpunkt der Damentoiletten springt nicht in jedem Jahre, in jeder Saison von oben nach unten, von hinten nach vorn. Die japanischen Damen tragen keine mit ausgestopften Vögeln, Flügeln von Käfern, Federn und anderen barbarischen Zuthaten geschmückten Hüte; sie durchlöchern sich ihre Ohrläppchen nicht, um sie mit schwerem Geschmeide aus Edelmetall und Steinen zu beschweren; sie schnüren ihre zarten Füßchen nicht in enge, drückende Schuhe, und was den Stahl- und Fischgrätenpanzer anbelangt, mit welchem die Damen anderer Länder ihre Leiber umspannen, um sich, nach dem Ausspruch eines chinesischen Mandarins, das Aussehen von Wespen zu geben, so sind ihnen dieselben vollkommen unverständlich.
Die Toilette der Japanerin ist, was ihre Zusammensetzung und ihren Zuschnitt betrifft, von klassischer Einfachheit; sie erinnert am ehesten an jene der Griechin aus der klassischen Zeit und ist vielleicht ebenso alt wie diese. Aber dabei ist sie im ganzen genommen schöner, denn zu den langen, faltenreichen Gewändern treten noch die Feinheit und Kostbarkeit der Stoffe und vor allem die herrlichen Farben, an denen sich das künstlerische Auge niemals sattsehen kann. Wer jemals in Tokio oder in der alten Hauptstadt von Dai Nipon, in Kioto, eines der zahlreichen Volksfeste mitgemacht hat, den wird neben der Anmut und Lieblichkeit der japanischen Frauen nichts so sehr in Entzücken versetzt haben wie diese zarten, duftigen, farbenreichen Trachten, die den Volksmassen, aus der Ferne gesehen, das Aussehen lebendiger Blumenbeete geben, umflattert von den herrlichsten Schmetterlingen. Den Flügeln der letzteren, den Farben der ersteren mögen die Japaner bei ihrem einträchtigen Zusammenwirken mit der sie umgebenden herrlichen Natur, ja ihrem vollständigen Aufgehen in derselben ihre Toiletten abgelauscht haben. Wie Blüten um den Stengel, wie die Flügel an den Schmetterlingen liegen diese reizenden bunten Trachten auf der Japanerin, und beinahe könnte man sagen, nur diese verleihen ihr jenen eigenen, seltsamen Reiz; ohne sie erscheint auch die Japanerin wie der Schmetterling ohne Flügel, denn sie ist im Gegensatz zu ihrer europäischen Schwester keineswegs von besonderer Körperschönheit.
Kein Wunder, daß die Japanerin auf ihre Toilette vielleicht noch mehr Wert legt als die Europäerin. Aber sie thut es naiver, unbewußter als besonders jene Erscheinungen des Fin de siècle, welche ein geistreicher Franzose mit dem Namen Demi-Vierges bezeichnet hat. Die Japanerin schmückt sich, um sich und den anderen zu gefallen, aber mit derselben Harmlosigkeit entkleidet sie sich auch dieses Schmuckes und zeigt sich, wie die Natur sie erschaffen hat. Badet sie, so thut sie es offen und findet jedes Kleidungsstück vollständig für überflüssig; ist sie zu Hause, so wird sie, der heißen Sommerzeit entsprechend, die langen Kimonos abwerfen und vielleicht nur einen Lendenschurz anbehalten; sie macht kein Geheimnis aus ihren Schönheitsmittelchen, aus Puder und Schminken, aus Pomaden und dergleichen; die Häuser, vornehmlich in den Landstädten und Dörfern, sind weit geöffnet, die Holz- und Papierwände sind zur Seite geschoben, um der Luft möglichst freien Durchzug zu gestatten, und das ganze Hauswesen, bis zu den hintersten Räumlichkeiten, liegt dem Auge des Spaziergängers offen da. Kein Wunder, daß der Reisende, vielleicht ohne es zu wollen, in die ganze weibliche Intimität der japanischen Haushaltung eindringen kann und alles dort tausendmal unbehindert sieht, was ihm im Abendlande immer streng verborgen bleibt. Er lernt die Japanerin nicht nur im Theater, im Theehause und auf Festlichkeiten kennen; er sieht sie bei ihren häuslichen Verrichtungen, bei der Toilette, ja selbst im Bade, und es kann ihm in den volkstümlichen Badeorten Japans, wie z. B. in Ikao, selbst begegnen, daß er bei seinem[S. 476] eigenen Bade von einigen reizenden Nymphen überrascht wird, die, ohne sich in ihrer Naivität das geringste dabei zu denken, das Bad mit ihm teilen. Mit Ausnahme der Hauptstadt baden beide Geschlechter in ganz Japan gemeinsam in öffentlichen Bädern, und eben der Umstand, daß sie von frühester Jugend daran ebenso gewöhnt sind, wie es vor ihnen ihre Väter und Großväter waren, läßt ihnen das Befremden der Europäer darüber ganz unverständlich erscheinen.
Der Schnitt der japanischen Damenkleider ist bei hoch und niedrig, bei arm und reich, bei jung und alt, im ganzen Lande der gleiche, und überall sind auch die Kleidungsstücke dieselben. Die kleinen drei- bis fünfjährigen Püppchen, die mit ihren rasierten Schädeln auf den Veranden, vor den Häusern oder auf der Straße ihren fröhlichen Schabernack treiben, sind gerade so gekleidet wie ihre Großmama. Der einzige Unterschied liegt in der Gattung und Farbe der Stoffe. Wie die Aristokratin der vornehmsten Fürstenfamilie zottelt auch das Mädchen aus dem Volke auf plumpen, schweren Holzsandalen einher, und ebensowenig wie die letztere trägt auch die erstere jemals eine Kopfbedeckung, es sei denn im Winter bei kaltem Wetter. Dann wird bei Ausgängen eine Art Kapuze über den Kopf gezogen.
Beginnt die Japanerin der mittleren und oberen Stände ihre Toilette, so wird sie zuerst den Yumodschi, ein weißes Tuch von der Form und Breite unserer Handtücher, aber von der doppelten Länge, um die Hüften winden und dann einen ziemlich knapp sitzenden Bademantel aus zartem, hellfarbigem Seidenkrepp mit weiten Aermeln, den sogenannten Dschiban, anziehen. Dieses reizende, den ganzen Körper bis zu den Füßen leicht verhüllende Kleidungsstück vertritt bei den Töchtern Nipons unsere Hemden. Im Winter wird darüber noch ein zweites wollenes Unterkleid, Schitagi genannt, getragen, im Sommer aber folgt auf den Dschiban gleich der Kimono, das äußere Kleid. Alle drei, Dschiban, Schitagi und Kimono, sind ganz von demselben Zuschnitt und passen so genau in- und aufeinander wie die bekannten japanischen Schachteln. Der Kimono ist aber stets aus viel kostbarerem Stoff als die Unterkleider, und auf ihn wird von der Japanerin viel mehr Sorgfalt verwendet; denn an der Farbe, an dem Stoff und an der Ausschmückung desselben erkennt man die gesellschaftliche Stellung, ja selbst das Alter der Trägerin. Zu Hause werden einfache Kimonos aus gewöhnlichen Stoffen getragen, für Ausgänge und Festlichkeiten solche aus Seide oder Seidenkrepp, und für besondere Feierlichkeiten dienen Kimonos aus den kostbarsten, schwersten Brokatstoffen, in so herrlichen Mustern, mit so zarten und dabei reichen Stickereien, wie sie in Europa höchstens für die Prunkgewänder von Kirchenfürsten Verwendung finden. Wer in den achtziger Jahren das Glück gehabt hat, einer Festlichkeit bei Hofe beizuwohnen, etwa wie den berühmten Chrysanthemumfesten in den kaiserlichen Gärten, dem wird dasselbe wie ein Feenmärchen in der Erinnerung schweben. Inmitten des entzückendsten Blumenflors, wo Zehntausende der herrlichsten Chrysanthemen in allen erdenklichen[S. 477] Farben im Sonnenlichte prangten, wogten Hunderte japanischer Damen, selbst blumengleich, auf und nieder, und ihre lang wallenden Kleider wetteiferten mit den Blumen an Farbenreichtum; nur verging jener der letzteren mit den kalten Wintertagen, während die Gewänder der japanischen Aristokratie für die Ewigkeit gewebt zu sein scheinen. Von Generation zu Generation wurden diese Gewänder fortererbt bis auf den heutigen Tag, wo eine kalte, herzlose Verordnung der japanischen Regierung sie fortdekretiert hat, um sie durch die reizlosen Trachten der Europäerin zu ersetzen. Die Prachtkimonos, in Farbe und Zeichnung wahre Gedichte, wanderten zu den Händlern und durch diese in die Museen und Privatsammlungen Europas, wo sie heute das Entzücken aller Kunstfreunde erregen. Jede vornehme Japanerin besaß eine ganze Auswahl solcher Prunkgewänder für jede Jahreszeit. Standen die Pfirsich- und Kirschbäume in Blüte, dann trug sie einen Kimono über und über mit den gleichen Blüten gestickt; kam die Zeit der Chrysanthemen, dann vertauschte sie dieses Gewand mit einem anderen, welches in zartester Seidenstickerei nur Chrysanthemen zeigte, und so wechselten die Gewänder der Frauen, dieser menschlichen Blüten, je nach den Blütezeiten in der japanischen Flora. Aber nur bei Gesellschaften und festlichen Anlässen wurden und werden vielfach heute noch diese Gewänder getragen. Im gewöhnlichen Leben und auf der Straße sind die Kimonos der Damen viel einfacher, leichter, ruhiger in der Farbe, ohne Blumen und Stickereien. Die einzige Ausschmückung, welche diese Straßenkimonos zeigen, sind die auf dem Nacken und den Aermeln in weißer Farbe aufgestickten Wappen der Trägerin.
Nur die Kinder werden auch im gewöhnlichen Leben in die buntesten Kleider gesteckt; in allen Farben des Regenbogens prangen ihre Kimonos, geschmückt mit großen, auffälligen Stickereien. Je älter das Kind, desto zarter werden die Farben, desto kleiner die Muster, und die jungen Damen tragen nur einfarbige helle Kimonos, zumeist zart rosenrot, lichtblau, lila oder taubengrau, das heute die fashionable Farbe zu sein scheint. Je älter die Dame, desto dunkler wird die Nuance des Kimono, ohne jemals ganz schwarz zu werden.
Aber es giebt doch eine Klasse von Frauen, welche sich darin gefallen, auch im gewöhnlichen Leben die geschilderten reichen Trachten zu tragen, ja jene der vornehmen Welt darin zu überbieten: die Sängerinnen und Tänzerinnen, jene leichtlebigen originellen Geschöpfe, welche bei den Japanern eine so große Rolle spielen.
Der Kimono wird um den Leib durch ein breites Band, den Obi, zusammengehalten, und auf dieses Band verwenden die Japanerinnen aller Stände die größte Sorgfalt. Der Obi ist ihr größter Stolz, ihr Reichtum. Der Reisende, welcher in den ersten Tagen seines Aufenthaltes in Japan auf der Straße oder im Eisenbahnwagen, in Theehäusern oder im Theater Japanerinnen sieht, wird von diesem Kleidungsstück nicht sonderlich erbaut sein, denn wie eine wattierte Leibbinde, stets von dunklerer Farbe als der Kimono, umgürtet der Obi den zarten Leib der[S. 479] Japanerin, um sich rückwärts zu einem Cul de Paris aufzubauschen, der mit einem großen Kopfkissen verzweifelte Aehnlichkeit hat. Wären die Obis weiche, schmale Schärpen, wie sie die Männer in Japan um ihren Kimono tragen, das Aussehen der Japanerin würde dadurch entschieden gewinnen. Der Obi ist ein drei bis vier Meter langes und etwa einen Meter breites, viereckiges Stück Stoff, aber stets von der schwersten Seide und so kostbar, wie ihn die Trägerin nur erschwingen kann. Es giebt Obis, welche Hunderte von Mark kosten, und gewöhnlich ist der Preis dieses Gürtelbandes höher als jener aller anderen Kleidungsstücke, welche die Japanerin trägt, zusammengenommen. Um den Obi anzulegen, ist immer die Hilfe einer zweiten Person erforderlich, und es scheint in der That eine wahre Kunst zu sein, den Obi zu knüpfen. Zunächst wird über die langen, faltenreichen Kleider eine Schärpe aus Krepp, der Hoso-Obi, gebunden, dann wird der Obi der Länge nach zu einer etwa fußbreiten Schärpe zusammengefaltet und mit der Faltung nach oben der Japanerin zwei- bis dreimal um den Leib gewunden. Die Enden werden rückwärts in kunstvoller Weise zu einer riesigen Masche gebunden, und diese zwölf bis fünfzehn Lagen des ungemein schweren, dicken Stoffes bilden eben das eigenartige Kissen, das die Japanerin unter ihrem Rücken trägt. Um seinerseits wieder den Obi zu halten, wird darüber ein elastisches dünnes Seidenband mit kleinen kunstvollen Goldschließen an den Enden, das Obi-dome, gebunden. In den Falten des Obi verbirgt die Japanerin eine ganze Menge kleiner Artikelchen, die sie stets bei sich zu tragen pflegt, und was im Obi nicht Platz findet, wird in die weiten, sackartig herabfallenden Aermel des Kimono gesteckt. Da sind zunächst die kleinen, weichen Papierchen, welche die Japanerin statt des Taschentuches zu benutzen pflegt; ferner Pfeife, Tabaksbeutel und Zündholzschachtel, denn die Töchter Japans sind eingefleischte Raucherinnen und ziehen alle Augenblicke die winzigen Pfeifchen mit den fingerhutgroßen Köpfen und bleistiftlangen Stielen hervor, um sich diesem Genuß hinzugeben. Dann kommen allerhand Toilettenartikel, Kamm, Nadeln, Puderbüchse, Schminkkästchen, Schwärzestifte für die Augenbrauen, ein kleines Spiegelchen und schließlich der unentbehrliche, allgegenwärtige kleine Papierfächer.
Noch häßlicher als der Obi erscheint dem Europäer die Fußbekleidung der Japanerin. Diese zarten, ätherischen, reizenden Geschöpfchen gehen ihr ganzes Leben[S. 480] lang auf schweren Holzschuhen einher. Schon in den ersten Jahren ihrer Kindheit werden ihre winzigen Füßchen in zolldicke Holzsandalen gesteckt, die durch Lederstreifen an den Füßen festgehalten werden, und ein anderes Schuhwerk bleibt ihnen bis zu ihrem Tode unbekannt. Die Japanerin trägt keine Strümpfe. Ihre Waden bleiben nackt, und gehen sie im warmen Sommer in den Straßen oder den schattenreichen städtischen Parks spazieren, dann legen sie wohl auch ihre Kimonos über den Arm und zeigen mit rührender Unverfrorenheit ihre Beine. Aber auch bei herabfallenden Kimonos öffnen sich diese Gewänder beim Gehen und enthüllen die Beine mehr oder weniger bei jedem Schritte. An Stelle der Strümpfe trägt die Japanerin ganz kurze, etwa bis über die Fußknöchel reichende Leinen- oder Seidensocken mit einer Abteilung für die große Zehe und fester Sohle aus dickem Baumwollstoff. In ihren Häusern, im Theater, in Tempeln und Theehäusern gehen die Japanerinnen nur in diesen Socken einher, und die Holzsandalen bleiben vor der Thüre stehen. Treten sie auf die Straße, so schlüpfen sie mit ihren Füßen wieder in die schweren Klötze und schleifen damit mühsam und mit gebeugten Knien, vornüber geneigt, einher. Stehend oder sitzend ist die junge Japanerin von unsagbarem Reiz, der aber sofort verschwindet, wenn sie auf der Straße einherschlürft.
Man geht in Europa fehl, wenn man glaubt, die Verordnung der japanischen Regierung hätte im Volke irgendwelche Wirkung gehabt und das alte Japan hätte seine bisherigen malerischen Trachten modernen Kleidern, Miedern, Federhüten und Stöckelschuhen geopfert. Ausschließlich bei Hofe werden diese Produkte der europäischen Modeknechtschaft getragen, und die in solcher Maskerade erscheinenden Damen mögen wohl als abschreckendes Beispiel für all ihre nicht hoffähigen Schwestern gedient haben, denn, der Vorsehung sei es gedankt, man begegnet in Japan, wohin man auch reisen mag, in Städten und Dörfern, bei hoch und niedrig, nur japanischen Toiletten. Statt dieselben durch europäische ersetzt zu sehen, müßte man eigentlich herzlich wünschen, daß der japanische Kimono, aber ohne Obi und Holzsandalen, im Abendlande Einführung fände.
Dem europäischen Besucher Japans muß das ganze, ferne, schöne Inselreich wie ein einziger großer Kindergarten vorkommen. Alles scheint sich dort um die liebe, kleine, herzige Welt zu drehen. Die Häuser sind so klein und nett und zierlich, die Gerätschaften darin erinnern an Spielzeuge, die Gärtchen rings herum mit ihren kurios beschnittenen und verkrümmten Bäumchen, ihren winzigen Rasenflächen, Wassertümpeln, Miniaturbrücken und Tempelchen sehen aus, als wären sie für Puppen und nicht für Menschen geschaffen worden. In Japan sind eben auch die Erwachsenen in vielen Beziehungen Kinder. Man kann dort wohl sagen, wo die Kindheit anfängt, aber nicht, wo sie aufhört. Es ist das reine Kinderparadies.
Kinder bilden die einzige Sehnsucht des neuvermählten Ehepaares und, sind sie einmal vorhanden, dessen größten Stolz, ja dessen wichtigsten Besitz. Der Vater arbeitet nicht bis zu seinem Greisenalter, um die Kinder zu ernähren. Die Kinder sind es, die den Vater ernähren. Ist sein Haar grau geworden, so pflegt er sich von seinen Geschäften zurückzuziehen und überläßt die weitere Sorge, ja überhaupt seine ganze Habe, seinem ältesten Sohne. Er selbst verbringt den Rest seines Lebens in Ruhe und Behaglichkeit. Japanische Eltern blicken nicht mit Sorge in die Zukunft, denn sie wissen und können in allen Fällen darauf zählen, daß das Uebermaß von Liebe und Zärtlichkeit, das sie ihren Kindern zu teil werden lassen, von diesen reichlich vergolten wird, daß sie bis zu ihrem Tode von ihren Nachkommen gepflegt, geliebt und geachtet werden. Der größte Segen der Japaner ist ihr Kindersegen.
Die Ankunft eines Kindchens wird mit Freude begrüßt, besonders wenn der neue Ankömmling auf Erden männlichen Geschlechts ist, denn nur ein Sohn kann Namen und Besitz der Familie erben. Sofort werden Verwandte und nähere Freunde durch eigene Boten von dem großen Ereignis in Kenntnis gesetzt, und bald darauf stellt sich ein Strom von Besuchern in dem glücklichen Hause ein, um die Eltern zu beglückwünschen und das junge Wesen in Augenschein zu nehmen. Freude auf allen Gesichtern, nur nicht bei dem kleinen Weltbürger, der von Hand zu Hand gereicht wird und dem die Welt in den ersten Wochen seines Daseins recht unbehaglich vorkommen mag. Die Geschenke, die er erhält, kann er ja nicht nach ihrem Werte schätzen, und Geschenke erhält er in Hülle und Fülle. Bald sind es Kleidungsstücke oder Stoffe verschiedener Art, bald Spielzeug oder Lebensmittel, hauptsächlich Eier. Alle Geschenke sind niedlich in Papier verpackt und mit rotem Bindfaden zusammengebunden. An diesem hängt, in einem winzigen Paketchen aus rotem Papier, ein Stückchen Fisch, Noski genannt, der bei den abergläubischen Japanern als glückbringend gilt.
Am siebenten Tage nach der Geburt des Kindes wird ihm von seinem Vater oder einem Freunde der Familie ein Name gegeben, gewöhnlich der Vatername, etwas verändert, oder der Name eines Vorfahren. Ist das Kind ein Mädchen, so wird es nach irgend einer hübschen Naturerscheinung benannt, wie Frühling, Sonnenschein oder Gold, Apfelblüte, Chrysanthemum, Lilie und so fort.
Der neue Ankömmling und sein Name wird in dem Verwaltungsamte des Distriktes registriert, darauf folgt ein Festmahl von Reis mit roten Bohnen, und die Taufe ist vollzogen. Ein wichtiger Akt an diesem Tage ist auch das Rasieren des Kindesschädels. Das zarte, flaumige Kopfhaar verfällt dem Rasiermesser mit Ausnahme eines kleinen Schöpfchens am Scheitel. Je nach der Laune der zärtlichen Mama bleiben auf dem Schädel ihres jüngsten Sprößlings auch mehrere derartige Schöpfchen oder ein schmaler Kranz oder sonstige willkürliche Haarfiguren[S. 483] stehen, die den japanischen Kindern ein ungemein possierliches Aussehen geben. Erst wenn sie alt genug sind, um die Schule zu besuchen, läßt man ihnen die Haare stehen.
Dreißig Tage nach der Geburt erhalten die Kleinen ihre religiöse Weihe dadurch, daß sie in großer Familienprozession in einen Shintotempel getragen und dort unter den besonderen Schutz eines der Götter gestellt werden. An diesem Tage pflegen die glücklichen Eltern auch die vielen Geschenke, die ihrem Jüngsten bei der Geburt dargebracht wurden, zu erwidern, indem sie jedem Geber etwas Reiskuchen oder Eier oder sonst dergleichen senden, begleitet von einem höflichen Dankschreiben. Wenn man bedenkt, daß besonders in den besseren Ständen mitunter hundert oder noch mehr Geschenke einlaufen, so kann man sich die Mühen der jungen Mutter wohl vorstellen. Die Kuchen werden gewöhnlich in lackierten Holzkästchen gesendet, die aber durch den Ueberbringer wieder zurückgestellt werden müssen, wobei sich die Empfänger hüten, die Kästchen zu reinigen. Das würde Unglück über das Kind bringen.
Damit ist das ganze Zeremoniell, das mit dem Inslebentreten des Kindes verbunden ist, beendet, und es kann sich nun unbehindert seines Daseins freuen. Bei kaltem Wetter bleibt es hübsch zu Hause auf den reinlichen, weichen Matten der Wohnzimmer; Möbel giebt es in den japanischen Häusern keine, an denen es sich Löcher in den Kopf stoßen könnte; es giebt keine Glasschränke und Etageren mit allerhand Porzellan und Nippsachen, die es zerbrechen könnte; selbst die Wände des Zimmers bestehen aus weichem, auf Holzrahmen gespanntem Papier, und das größte Unglück, das die Kinder anstiften könnten, wäre, ihre Finger durch das[S. 484] Papier zu stoßen. Auch die Kleider können sie sich kaum beschmutzen, im Sommer tragen sie überhaupt keine, nicht das geringste Feigenblättchen. Werden sie hungrig, so nähren sie sich an dem Born der Natur, und die Muttermilch bleibt ihre hauptsächlichste Nahrung bis zum Alter von zwei bis drei Jahren.
In den besseren Ständen und in den Familien der Kuges (Fürsten) und Daimios (Adeligen) werden die Kinder in Kleider gesteckt, die ganz denselben Schnitt zeigen wie jene der Erwachsenen. Es kann nichts Possierlicheres geben als die liliputanischen Herrchen und Dämchen mit ihren glattrasierten Schädeln und den langen faltenreichen Gewändern, wenn sie, gerade so wie die Alten, tiefe Verbeugungen vor einander machen oder, kaum zwei bis drei Jahre alt, schon am Familientische teilnehmen und statt des Kinderlöffels schon die Reisstäbchen (Chop sticks) handhaben. Ankleiden können sie sich freilich noch nicht selbst, das besorgt Mama oder die ältere Schwester. Der nationale Kimono wird auf dem Boden ausgebreitet und das Kleine daraufgelegt. Dann werden ihm die Aermel auf die Aermchen gezogen, der Kimono über den kleinen Körper gefaltet und mit einer Schärpe zusammengebunden. Gewöhnlich trägt das Kind um den Hals auch ein kleines Messingschildchen mit Namen und Adresse, damit es nicht verloren gehen kann; zum besonderen Schutz gegen Unglücksfälle trägt es am Gürtel ein Kintschaku, d. h. ein Beutelchen aus kostbarem Stoff, in dem sich irgend ein Zaubermittelchen befindet. Bei kaltem Wetter werden zwei oder drei Kimonos ineinandergesteckt, und ihre Länge schützt Füßchen und Händchen.
In den armen Familien (und bei weitem die Mehrzahl der Japaner ist arm) kann man den jungen Sprößlingen nicht diese Pflege angedeihen lassen. Sie bleiben nackt oder bekommen höchstens einen Kimono. Mama hat viel zu viel im Hause, im Garten oder auf den Feldern zu thun, als daß sie sich viel mit ihrem Kindchen beschäftigen könnte; allein lassen kann sie es auch nicht, und so bindet sie es mit langen Bändern auf ihren Rücken. Ist aber ein älteres Schwesterchen da, selbst wenn es nur sechs oder sieben Jahre alt sein sollte, so wird das Kleine dem Schwesterchen aufgesattelt, und Mama kann ungehindert ihren Arbeiten nachgehen. Wo immer ich in Japan hinkam, in Städten und Dörfern, auf den Feldern wie in den Straßen, selten sah ich ein junges Mägdlein zwischen sieben und fünfzehn Jahren, das nicht ein Kindchen auf seinem Rücken getragen hätte, und der Kopf des kleinen Wesens ragte darüber hervor wie das Tüpfelchen über dem i. Es findet sehr bald Gefallen an dieser reitenden Stellung, guckt fröhlich über die Schultern des Schwesterchens in die Welt und bleibt dort Tag für Tag, Woche für Woche, bis es endlich selbst zappeln und gehen gelernt hat. Und ist es erst fünf, sechs Jahr alt geworden, so ist vielleicht wieder ein junges Brüderchen oder Schwesterchen zur Welt gekommen, dem es nun seinerseits den Rücken leihen muß.
Wie das Kleine, so gewöhnt sich auch die jugendliche Trägerin ganz unbewußt an diese Last und tummelt sich vor den Häusern herum, spielt mit den Nachbarkindern oder arbeitet, als wäre ihr das Kindchen angewachsen wie ein Höcker. Stundenlang trägt sie dasselbe umher, und wird dieses schläfrig, so schläft es ein, ohne sich durch das Schütteln beim Laufen und Herumspringen hindern zu lassen; die Händchen fallen schlaff herunter, das Köpfchen baumelt hin und her, fällt zurück oder auf die Seite, daß ich oft fürchtete, jetzt müßte das Genick brechen; aber das Kind schlief ruhig weiter. Daß ein Kindchen der Trägerin entfallen würde, kommt äußerst selten vor; wie ein gewandter Naturreiter auf seinem Pferde, so klammert es sich mit den gespreizten Beinchen an die Seiten der Trägerin, die thun und lassen kann, was sie will, es bleibt fest im Sattel. Wird es hungrig, so setzt sich die Trägerin neben Mama oder vielleicht auf deren Schoß, das Kleine dreht sich herum und nährt sich an Mamas Brust, ohne daß die letztere es zu halten braucht. Und wie fröhlich, wie still und wohlerzogen sind diese Kinder! Selten habe ich ein japanisches Kind weinen gesehen, niemals schreien gehört; niemals nahm ich schlechtes, ausgelassenes Benehmen wahr; niemals Prügeleien unter Jungen, niemals eine Bestrafung durch die Eltern. Werden sie irgendwie ungebührlich, so droht Mama oder Papa mit dem Oni, dem roten Teufel, der die Kinder holen wird. Der rote Teufel ist ihr größter Schrecken, und man kann sich vorstellen, welches Entsetzen das Kommen eines rothaarigen, rotbärtigen Deutschen etwa unter den Kindern eines Dorfes hervorruft. Sie zerstieben, laufen und verstecken sich in alle Schlupfwinkel.
Himmelbetten und Wiegen nach europäischem Muster giebt es in Japan nicht. Das Kleine wird fleißig gebadet, noch dazu in fast brühend heißem Wasser, was ihm aber nicht zu schaden scheint. Arme Leute, die keine eigenen Bäder besitzen, nehmen das Kindchen in die öffentlichen Bäder, wo sie in Gemeinschaft mit anderen Eltern und Kindern ohne irgend welche Scheu in dasselbe Bassin steigen.
Diese Bäder, der beständige Aufenthalt in der freien Luft, die unfreiwillige Bewegung, welche die Kinder auf dem Rücken ihrer Geschwister machen, scheinen ihrer Gesundheit sehr zuträglich zu sein. Die Sterblichkeit unter den japanischen Kindern ist geringer als bei uns, und die einzige ziemlich allgemeine Krankheit ist ein Hautausschlag auf den Köpfen und Nacken, der aber bald schwindet. Ist er überstanden, dann sehen die Kinder so gesund, kräftig und pausbackig aus wie Posaunenengel, eine wahre Freude für Eltern und Freunde, die das Kind bewundern, die feisten, harten Glieder befühlen und ihm eine glänzende Zukunft prophezeihen. Welches Kind ist denn überhaupt in den Augen seiner Eltern nicht das schönste und klügste, das es jemals gegeben hat!
Allmählich lernt das Kleine auch ein wenig sprechen, lange bevor ihm das freie Gehen gelingt. Die japanische Sprache ist so klangvoll, einfach und leicht zu erlernen, wenigstens was die notwendigsten Ausdrücke betrifft. Auch bei dem japanischen Kindchen sind die ersten Ausdrücke mama, tata, bebe, nur bedeuten sie ganz andere Dinge als bei uns. Mama heißt Nahrung, Essen, Trinken; bebe heißt Kleid, tata Socken; mit dem Worte ija wird nein, ich mag es nicht, es ist mir unangenehm bezeichnet. Das Kind lernt nun auch das Gehen, zuerst im Hause, dann außerhalb, in dem Gärtchen, das die meisten japanischen Familien hinter ihren Holzhäusern besitzen, oder auf der Straße, die ja selten von Fuhrwerken befahren wird und so besonders in Dörfern den gewöhnlichen Tummelplatz der Kinder bildet. Ist das Gehen im Hause gelungen, so wird dem Kinde der Gebrauch der geta oder stelzenartigen Holzpantoffel gelehrt, und es ist staunenswert, mit welcher Leichtigkeit es sich an diese plumpe, schwere Fußbekleidung gewöhnt, damit läuft, springt und den tollsten Schabernack treibt.
Die Eltern verfolgen die Entwickelung ihrer Kinder mit der liebevollsten Zärtlichkeit, ja die Liebe zwischen Eltern und Kindern ist vielleicht die einzige, wahre Liebe, welche die Japaner kennen. Sie bewachen und lehren die Kleinen und strafen sie kaum jemals. Aberglaube hat damit sehr viel zu thun. Wenn Blattern oder epidemische Kinderkrankheiten im Orte wüten, dann schreibt der sorgsame Papa über seine Hausthüre, die Kinder wären nicht zu Hause, damit die bösen Geister sich gar nicht bemühen, die Schwelle zu überschreiten. Vor Lügen werden die[S. 487] Kinder dadurch gewarnt, daß man ihnen sagt, der böse Oni würde ihnen die Zunge ausreißen.
Den Knaben wird gewöhnlich viel größere Freiheit gestattet als den Mädchen. Der Knabe wird ja von selbst seinen Weg machen; er ist der Erbe und Nachfolger des Vaters, dessen Handwerk er erlernt und dem so viele andere Berufszweige offen stehen. Anders das Mädchen. Es muß lernen, einen Mann zu gewinnen und nach der Verheiratung ihn für immer zu fesseln. Es darf keinen eigenen Willen haben, darf weder Unzufriedenheit noch Zorn, Heftigkeit oder Schmerz äußern; alle diese Gefühle muß es lernen unter freundlichem Lächeln, unter höflichen unterwürfigen Manieren und mit einer gewissen Koketterie zu verbergen; es muß lernen, sich selbst anziehend und den anderen das Leben angenehm und behaglich zu machen.
Glücklicherweise wird dem Töchterchen dies alles in zartester Weise und vielleicht ganz unbewußt beigebracht. Sie ist ja der Liebling im Hause. Die Eltern und Brüder behandeln sie mit Liebe und Zärtlichkeit, die Diener mit Achtung.
Allmählich werden ihr auch die häuslichen Verrichtungen sozusagen spielend beigebracht. Sie sind in japanischen Haushaltungen nicht so bedeutend wie bei uns, denn die einfachen, einstöckigen Häuschen haben, wie gesagt, fast gar keine Möbel, Nippsachen, Bilder, Spiegel, Teppiche, Fenster und dergleichen. Die Zimmer sind kahle Räume mit mattenbedecktem Boden, die Wände Papierrahmen, und die Reinhaltung derselben sowie der Engawa, d. h. der rings um das Haus laufenden Galerie, ist ziemlich leicht. Die Schlafstätten beschränken sich auf einfache Matratzen, die abends auf den Fußboden gelegt und morgens, wieder zusammengerollt, in einem Schrank aufbewahrt werden, und was die Mahlzeiten anbelangt, so brauchen sich die japanischen Mädchen nicht mit der höheren Kochkunst abzumühen, verschiedene Suppen, Braten und Mehlspeisen zubereiten zu lernen, in die Geheimnisse der Tunken und Konserven einzudringen, denn alle diese kulinarischen Genüsse wird auch der verwöhnteste Gatte nicht von ihr verlangen. Morgens Reis, mittags Reis, abends Reis, dazu getrocknete Fische und einfach gekochte Gemüse, das sind die Gerichte des täglichen Speisezettels. Es giebt auch keine Spitzen und feine Wäsche zu reinigen, keine Balltoiletten nach neuester Mode anzufertigen, keine Hüte zu schmücken; die einzige Fertigkeit, welche die jungen Mädchen in Japan brauchen, ist das Nähen; ihr schlafrockartiger Kimono und das Unterröckchen, das sie tragen, bedürfen keiner Modistin und Damenschneiderin; sie nähen ihre Kleidungsstücke selbst, und sind diese schmutzig, dann werden sie zertrennt und in kaltem Wasser ohne Seife gewaschen. Das Plätteisen ist den Japanern unbekannt. Nach jeder Wäsche werden die Kleidungsstücke neu genäht. Strümpfe und Schuhe in unserem Sinne werden von den Japanerinnen ebensowenig getragen wie Hüte. Ihre einzige Kopfbedeckung ist die allerdings sehr sorgfältige, mit Nadeln und Blumen geschmückte Haarfrisur, und[S. 488] diese wird alle Wochen einmal von eigenen Haarkünstlerinnen gegen ganz geringes Entgelt sorgfältig aufgebaut.
Die geistige Erziehung hat bis auf das letzte Jahrzehnt viel weniger Zeit erfordert als das Anlernen verschiedener Nichtigkeiten, die aber im Lande des Mikado eine große Rolle spielen. Die jungen Mädchen werden sorgfältig in die Geheimnisse der zeremoniellen Theebereitung (Tscha no yu) eingeweiht, sie lernen das umfangreiche Zeremoniell der Begrüßung und Bewirtung der Gäste, das Zusammenstellen und Binden von Blumensträußen, Samisen (Guitarre) spielen und in besseren Familien wohl auch verschiedene alte Tänze und Pantomimen zur Unterhaltung ihrer Eltern und etwaiger Gäste. Im Alter von sechs bis zehn Jahren besuchen sie irgend eine Privatschule, wo ihnen das Lesen und Schreiben der chinesischen und japanischen Schriftzeichen, chinesische Litteratur, japanische Dichtkunst und Geschichte beigebracht werden. Arithmetik, Geographie, Weltgeschichte und all die anderen Wissenschaften unserer Schulen werden den japanischen Kindern erst seit etwa einem Jahrzehnt bis zu einem gewissen Grade gelehrt; zuerst aber müssen sie dem chinesisch-japanischen Schulgang folgen. Es ist keine geringe Aufgabe für die armen jungen Wesen, nachdem sie mühsam die ungemein schwierige Schriftsprache der Mongolen und das Malen der Tausende von Hieroglyphen mit Pinsel und Tusche erlernt haben, die letzteren mit Feder und Tinte zu vertauschen und Englisch, Deutsch oder Französisch zu lernen; statt mit untergeschlagenen Beinen auf dem Boden zu hocken, auf Schulbänken zu sitzen, an Schultischen zu schreiben; und diese Schulfrage gehört in Japan noch immer zu den ungelösten, ja vielleicht unlösbaren Fragen. In Tokio, Yokohama und anderen Städten, in denen die europäische Kultur einigermaßen Fortschritte gemacht hat, war es mir ein befremdender Anblick, an Stelle der reizenden, buntgekleideten und geschmückten Miniaturjapaner diese kleine Welt in europäischer Kleidung mit Schulbüchern unter dem Arm zu sehen, ganz so wie bei uns. Den Eltern bereitet diese von der Regierung dekretierte europäische Erziehung und Kleidung ihrer Kinder schwere Sorgen und Kosten. Für die Jungen sind die Vorteile der neuen Erziehung noch leichter zu erkennen, bei den Mädchen aber wird die letztere einen vollständigen Umschwung in ihrem ganzen[S. 489] Leben und damit auch einen Umschwung der Kultur und Lebensweise des ganzen Volkes mit sich bringen. Ob aber die sittliche Grundlage für die letztere wirklich vorhanden ist?
Augenblicklich muß man noch im verneinenden Sinne antworten, denn die japanischen Kinder genießen keinerlei Religionsunterricht, das Christentum macht nur ungemein langsame Fortschritte, und die Moral nach unseren Begriffen steht bei den Japanern auf einer verhältnismäßig sehr niedrigen Stufe. Unsere Ansichten über die Tugend und Keuschheit, über die Liebe, Liebeswerben und Sittsamkeit sind der großen Mehrzahl des Volkes überhaupt unverständlich, und es muß gerechtes Erstaunen erwecken, daß die japanische Jugend trotzdem einen so hohen Grad kindlicher Naivität besitzt.
Und dabei bleiben Knaben und Mädchen in Japan länger Kinder als bei uns; sie sind sich keines Unrechts bewußt und freuen sich ihrer Kindheit, freuen sich an niedlichen, unschuldigen Spielen, freuen sich an Puppen und Märchen und Festlichkeiten, an denen es gerade in Japan eine übergroße Zahl giebt. Schon in ihrer frühesten Jugend lernen sie die Arithmetik, indem sie an den Fingern abzählen, wieviel Tage es noch bis zu dem nächsten Matsuri (Volksfest) sind. Zu Neujahr, an den buddhistischen oder nationalen oder häuslichen Festtagen werden sie in die denkbar buntesten Kleider gesteckt und wie Püppchen geputzt; die Mädchen pudern und bemalen ihre Gesichter, schwärzen die Augenbrauen, schminken die Lippen, gerade so, ja eher noch mehr als die Alten, und es kann keinen lustigeren Anblick geben als an solchen Festtagen die zu den Tempeln führenden Straßen und die Tempelhöfe selbst, wo Hunderte von Buden mit allerhand bunten und sinnreichen Spielwaren errichtet sind, zwischen denen dieses kleine Puppenvolk, begleitet von den Eltern, sich drängt, alles betrachtet, alles kauft und sich freut, so daß auch der ärgste Kinderfeind sich mit freuen muß. Jede Stadt Japans ist eine Art Nürnberg oder Sonneberg; in jeder Straße findet man Spielzeuge aller Art, und die Spielwarenindustrie ist eine der bedeutendsten des ganzen Landes.
Das größte Fest der Mädchen ist das Puppenfest, das am dritten Tage des dritten Monats abgehalten wird, und es giebt an diesem Tage wohl wenige Häuser im Reiche des Mikado, wo nicht sämtliche Puppen aus den Truhen hervorgeholt, sorgfältig herausgeputzt, gekleidet und auf Gestelle gesetzt werden, zur Freude der jungen Welt. In den Häusern des Adels kommen dabei zuweilen Hunderte von Puppen zum Vorschein, die zum Teil alte Familienerbstücke sind und gewöhnlich den Kaiser, die Kaiserin, das Gefolge und den Adel in Prachtgewändern darstellen. Die kleinen Mädchen dürfen dann den Puppen in winzigen Geschirren die Speisen kochen und auf ebenso winzigen Tischchen vorsetzen, sie spazieren führen, an- und auskleiden. An den öffentlichen Feiertagen freuen sich die Kleinen mit den Großen; sie spielen auf der Straße fast dieselben Spiele wie unsere Kinder: Ball, Drachen[S. 490] und Federball; im Winter, wenn es kalt ist, hocken sie um den Hibatschi (offenes Holzkohlenbecken) in der Mitte des Wohnzimmers, spielen Karten oder lassen sich von Großmama oder der Tante (O Ba San) die reizenden japanischen Märchen erzählen.
Für die Jungen ist das größte Fest das Flaggenfest am fünften Tage des fünften Monats; in jeder Familie, welche Söhne besitzt, werden an diesem Tage papierne Fische von ungeheurer Größe auf Bambusstangen gebunden und diese am Hause aufgestellt. Der Wind bläst die Papierfische wie Luftballons auf, und dann sieht man über dem Häusermeer der Städte Zehntausende derartiger Fische schweben. Die Jungen aber ziehen, womöglich als Soldaten oder Samurai (Zweischwertermänner) gekleidet, bunte Flaggen in der Hand, umher und stopfen sich mit Süßigkeiten voll. Große Freudentage sind es jedesmal, wenn die Eltern ihre Kinder mit in das Theater nehmen, Freudentage im wahren Sinne des Wortes, denn die Familien pflegen morgens ins Theater zu gehen und es erst spät abends zu verlassen. Die Kinder hören andächtig den geschichtlichen Darstellungen zu, und was daran häßlich und gemein ist, thut ihrer Ehrfurcht vor den Eltern keinen Abbruch. Nichts dürfte dem europäischen Besucher japanischer Inselstädte mehr auffallen als dieser schönste Zug des japanischen Charakters. Er wird so weit getrieben, daß sich alle Kinder und Diener eines Hauses jedesmal auf die Knie werfen und mit der Stirne den Boden berühren, wenn ihre Eltern ausgehen oder nach Hause kommen; nirgends ist Gehorsam so sehr die erste Kindespflicht wie in Japan, und in dieser Hinsicht könnten sich die Kinder in andern Ländern die Japaner zum Beispiel nehmen.
Für die junge, unverheiratete Japanerin ist die Zeit, welche sie in ihrem Elternhause zubringt, wohl die glücklichste. Eltern und Geschwister hängen mit großer Zärtlichkeit und Liebe an ihr und erfüllen nach Thunlichkeit alle ihre Wünsche; sie freut sich ihrer Kindheit und genießt bis zu ihrer Vermählung zwischen dem vierzehnten und siebzehnten Jahre weit größere Freiheiten als die Töchter anderer Völker. Man kann es diesen kleinen, munteren, bemalten und bepuderten Püppchen in ihren bunten Kleidern auf den ersten Blick auch ansehen, daß sie glücklich sind. Ein ewiges Lächeln schwebt um ihre rotbemalten Lippen, freundlich blicken ihre schwarzen, großen Augen in die Welt, und mögen sie auch schon längst in die Geheimnisse des Ehelebens eingeweiht worden sein, sie sind doch Kinder geblieben, die sich mit ihren jüngeren Geschwistern an allerhand Spielen erfreuen.
All diese Freuden und diese kindliche Selbständigkeit müssen sie aufgeben, sobald sie heiraten. Wenn sie sich nur ihre zukünftigen Gatten selbst auswählen dürften! Wenn es ihnen nur gestattet würde, ihre Herzen zu Rate zu ziehen, umworben und in unserem Sinne geliebt zu werden! Aber das Liebesleben unserer Völker ist den Japanern unbekannt.
Hat das junge Mädchen das genannte heiratsfähige Alter erreicht, so trachten die Eltern, sie sobald als möglich unter die Haube zu bringen. Aber die einleitenden[S. 492] Schritte werden selten von der Familie des Mädchens unternommen. In der Regel wendet sich der heiratslustige junge Mann an einen schon verehelichten Freund, der unter den jungen Musmis seiner Bekanntschaft Umschau hält; hat er eine gefunden, die ihm für seinen Freund passend erscheint, so trägt er die Sache ihren Eltern vor. Diese erkundigen sich nun ihrerseits nach den Verhältnissen des jungen Mannes, und sind sie geneigt, ihm ihre Tochter zu geben, so wird gewöhnlich im Hause des Vermittlers oder bei einer Theegesellschaft oder bei einer Theatre party eine Begegnung der jungen Leute zu stande gebracht. Des jungen Mädchens Wille wird dabei nicht besonders berücksichtigt, und es scheint ihr auch gar nicht so sehr daran gelegen zu sein. Sie weiß, daß sie der Ehe ebensowenig entgehen kann wie dem Tode, und so kann es sich ihr dabei hauptsächlich nur darum handeln, von allen Uebeln das kleinste zu wählen, d. h. einen Mann zu finden, gegen den sie nicht gerade Abneigung empfindet. Wärmere Gefühle, Sympathie oder gar Liebe werden von ihr nicht erwartet. Hat auch der Freier nichts Besonderes an ihr auszusetzen, so wird die Sache gleich in Ordnung gebracht. Er hat ja nicht viel dabei zu verlieren, da er sie nach ein paar Monaten Probezeit ohne weiteres ihren Eltern wieder zurückschicken kann. Zum Zeichen seines Einverständnisses sendet er seiner Zukünftigen gewöhnlich ein Stück Seidenstoff, das die Stelle des Verlobungsringes vertritt. Die Familie des Mädchens dagegen sendet ihm ein ähnliches Stück Stoff für einen Kimono. Nun wird mit Brautstand und Hochzeitsvorbereitungen nicht mehr viel Zeit verloren. Die Freunde des Bräutigams lassen sich bei Wahrsagern einen glücklichen Tag für die Hochzeit nennen, und am Abend dieses Tages begiebt sich die Braut in das Haus ihres Bräutigams.
Religiöse oder gesetzliche Förmlichkeiten sind bei japanischen Heiraten nicht erforderlich. Der ganze Vorgang ist nicht viel mehr als die Uebersiedelung des Mädchens aus ihrem Elternhause in jenes des jungen Mannes. Ihre Kleider, ein Schreibtischchen, ihr Arbeitskorb, das Kästchen mit ihren Schminken und Pomaden, dann zwei Eßtischchen und ein paar Teller aus lackiertem Holz bilden die gewöhnliche Aussteuer. Je wohlhabender die Familie, desto größer ist die Last ihrer Kleider, und häufig kommt es vor, daß junge Mädchen davon mehr in die Ehe bringen, als sie für ihr ganzes Leben brauchen. Auch ihre persönliche Dienerin, wenn sie solche besitzen, pflegt ihnen in das neue Haus zu folgen.
Am Abend des Hochzeitstages kleidet sich die Braut ganz in Weiß, in Japan die Farbe der Trauer, zum Zeichen, daß sie für ihre eigene Familie gestorben ist. Sobald sie das Elternhaus verlassen hat, wird dieses sorgfältig gekehrt, und in früheren Zeiten wurde vor demselben auch ein Feuer entzündet, Gebräuche, welche anzeigen, daß ein Leichnam aus dem Hause entfernt wurde. Sobald die Braut, begleitet von dem Heiratsvermittler und seiner Frau, im Hause des Bräutigams eingetroffen ist, vertauscht sie die weißen Kleider mit anderen, prunkvolleren, und[S. 493] begiebt sich in das Gemach des Bräutigams. Eine junge Freundin reicht dann eine mit Sake (Reiswein) gefüllte Schale abwechselnd der Braut und dem Bräutigam zum Trinken. Nach dreimaligem Nippen wird eine zweite, dann eine dritte Schale in derselben Weise dargeboten, und dieses dreimalige Darreichen der Weinschalen besiegelt den Ehebund. Bei wenigen Völkern der Erde vollzieht sich die Heirat einfacher und poesieloser wie hier.
In einem Nebengemache haben sich mittlerweile die Familien und Freunde des jungen Paares zu einem Festmahle versammelt, bei dem es gewöhnlich recht lustig zugeht. Die Familien und der Hausstand des Bräutigams sind in fröhlicher Stimmung, denn alle, bis zum letzten Diener und Stallknecht, werden von der Familie der Braut mit Geschenken bedacht; auch ist es in Japan gerade so wie bei uns Sitte, daß die geladenen Freunde des jungen Ehepaares diesem Geschenke, gewöhnlich Hausgerätschaften oder Kleiderstoffe, darbringen. Edelsteine und Schmucksachen sind ausgeschlossen, da die Japanerinnen keine tragen. Gewöhnlich bleibt die lustige Hochzeitsgesellschaft bei allerhand Leckereien und Reiswein bis spät in die Nacht hinein versammelt; Tänzerinnen und Sängerinnen tragen unter Begleitung von Samisen und Kotospiel das Ihrige zur Unterhaltung der Gäste bei, und haben sich diese endlich entfernt, so wird das Brautpaar von einem jungen Mädchen in das Brautgemach geführt; dort müssen Braut und Bräutigam nochmals je dreimal an drei Sakeschalen nippen, aber diesmal werden die Schalen dem Bräutigam zuerst gereicht. Nun sind die jungen Leute Mann und Weib, und die einzige Förmlichkeit, die noch erfüllt werden muß, ist eine schriftliche Anzeige des Vaters der Braut an die Polizeibehörde seines Stadtteils, daß seine Tochter aufgehört hat, bei ihm zu wohnen und in das Haus ihres Gatten übergesiedelt ist. Das letztere ist nicht immer ein eigenes Haus, das die jungen Leute allein bewohnen. Die Ehen werden in Japan gewöhnlich so früh geschlossen, daß der Gatte häufig noch gar keinen eigenen Erwerb oder irgend eine Stellung hat und deshalb im Hause seines Vaters wohnt. Die Braut ist dann einfach ein neues Mitglied der Familie, und dieser allein ist sie Ehrfurcht und Gehorsam schuldig.
Am dritten Tage nach der Heirat findet ein festlicher Empfang im Hause der Eltern der Braut statt, zu welchem alle Freunde der letzteren geladen werden. Gewöhnlich werden bei dieser Gelegenheit die an die Familie des Bräutigams gesandten Geschenke von dieser erwidert. Auch die jungen Eheleute sind durch uralten Gebrauch gehalten, zwei oder drei Monate später ein größeres Fest zu geben, entweder ein Festmahl oder eine Garden party, zu welchem der ganze Bekanntenkreis eingeladen wird. Für viele ist dieses Fest die erste Kunde von der vollzogenen Vermählung, denn Verlobungs- oder Vermählungskarten werden in Japan nicht ausgegeben. Die ganze Angelegenheit besitzt ja bei weitem nicht die Wichtigkeit wie bei uns. Die Frau wird in Japan nur als die erste Dienerin des[S. 494] Mannes angesehen, und ob es diese oder jene ist, die er heiratet, bleibt sich ziemlich gleich. Standes- und Familienrücksichten giebt es nur in beschränktem Maße, und besondere Veränderungen treten ja durch die Heirat nicht ein. Der Mann bleibt derselbe, ob Junggeselle oder Ehegatte; er hat keinerlei neue Pflichten, keinerlei Beschränkungen und kann thun und lassen, was er will. Er kann seine Abende außer dem Hause zubringen, wo er will, er kann andere Mädchen als Konkubinen in sein Haus aufnehmen, Liebe und Treue wird von ihm nicht erwartet. Seine Frau hat ihm in jeder Hinsicht zu gehorchen, hat alles ruhig und freundlich hinzunehmen, ihn zu pflegen, seine Mahlzeiten zu bereiten, seine Kleider zu nähen, sein Haus in Ordnung zu halten: sie ist mit einem Worte nicht viel mehr als eine Dienerin im Hause eines unserer Junggesellen, nur mit dem Unterschiede, daß sie bei uns ihren Monatslohn erhält und freiwillig ihren Dienst kündigen kann, wann sie will, während die japanische Frau diesen Dienst bis zu ihrem Tode versehen muß, ja, als Zeichen, daß sie gewillt ist, dies zu thun und keine Absicht hat, ihren Herrn zu wechseln, verunstaltet sie freiwillig ihr Aeußeres dadurch, daß sie sich die Zähne schwarz färbt und ihre Augenbrauen abrasiert. In den Großstädten verliert sich dieser Gebrauch immer mehr, in den Provinzstädten und Dörfern aber fand ich noch viele junge Frauen mit kohlschwarzen Gebissen.
Die geschilderten Gebräuche werden bei der europäischen Leserin kein geringes Entsetzen erwecken, und gewiß wird sie ihre japanischen Schwestern herzlich bedauern, hauptsächlich darüber, daß sie sich ohne Liebeswerbung, ohne Brautjungfern und gar erst ohne Hochzeitsreise in das anscheinend denkbar unglücklichste Ehejoch begeben müssen. Doch bei den untersten Volksklassen der Japaner liegen die Verhältnisse noch schlimmer. Die Arbeiter, Rickshawkulis, Hausdiener ersparen sich sogar die Festmahlzeiten und das zeremoniöse Saketrinken. Sie vermählen sich mit einer Frau, wenn es ihnen eben paßt, und vertauschen sie wieder mit einer anderen, mit ebensowenig Umständen, wie wir etwa unsere Kleider wechseln. Gar mancher in Japan wohnende Europäer wird beim Nachhausekommen durch die Anzeige seines Boy oder Betto (Pferdeknecht) überrascht, daß er sich eben vermählt habe. Einige Monate später ist er vielleicht wieder Junggeselle, und kommt ihm wieder einmal die Lust zu heiraten an, flugs bringt er sich eine neue Frau ins Haus, die ihm seine Kleider flickt, seine Mahlzeiten bereitet und ihn meistens viel besser bedient als er seinen Herrn.
Je höher man auf der gesellschaftlichen Stufenleiter emporsteigt, desto seltener begegnet man dem Wechsel der Frauen, oder, um ein in Europa geläufigeres Wort zu gebrauchen, den Ehescheidungen. Immerhin entfällt sogar in den von europäischer Kultur angehauchten Hauptstädten des Landes auf je drei Vermählungen eine Scheidung, und dieses Verhältnis würde sich vielleicht noch weiter ausgleichen, wenn in den wohlhabenderen Ständen nicht Umstände obwalten würden, welche die[S. 495] Scheidung überflüssig machen. Es sind nicht etwa ethische Momente, nicht größere Achtung oder Liebe für die eigene Frau, sondern es wird dort eben wegen der zahlreichen Japaner, welche die europäischen Verhältnisse kennen, immer weniger gern gesehen, daß man die Frau ohne weiteres aus dem Hause jagt. Ueberdies stammen die Frauen der höheren Stände doch aus besseren Familien, und man will sich durch eine nicht wohlbegründete Scheidung diese letzteren nicht zu Feinden machen. Deshalb behält man sie wohl im Hause, aber verheiratet sich dennoch mit einer Konkubine, vielleicht auch mit zwei oder noch mehr, je nach der Neigung oder den Mitteln. Möglicherweise wohnen diese Dämchen auch noch mit der legitimen Gattin in demselben Hause zusammen, und ihre Kinder wachsen gemeinschaftlich auf.
Man kann sich unter solchen Umständen die Lage der armen Frau wohl vorstellen, die all dies geduldig und lächelnd ertragen muß. Jeder Widerstand ihrerseits wäre vergeblich. Die Scheidung würde dann doch erfolgen, und sie müsste unter Zurücklassung ihrer Kinder in ihr väterliches Haus zurückkehren. Dazu ist die Liebe der japanischen Frauen zu ihren Kindern doch zu groß. In neuerer Zeit hat die Konkubinenwirtschaft in den besseren Ständen allerdings erheblich abgenommen, aber Professor Chamberlain von der kaiserlichen Universität in Tokio, vielleicht der beste Kenner des modernen Japan, sagt in seinem 1891 in Yokohama erschienenen Buche über Japan doch noch folgendes: „Warum sollte sich ein Mann überhaupt die Mühe geben, sich von einer ihm unsympathischen Frau scheiden zu lassen, wenn irgend eine Frau, die immer eine viel zu untergeordnete Stellung einnimmt, als daß sie ihm ernstlich lästig wäre, und wenn die Gesellschaft nichts dagegen hat, daß er sich irgendwelche Anzahl von Konkubinen hält?”
Derselbe Verfasser sagt weiter: „Die Scheidungsgründe in Japan sind: Ungehorsam, Unfruchtbarkeit, Lasterhaftigkeit, Eifersucht, Aussatz oder andere unheilbare Krankheiten, Geschwätzigkeit und Hang zum Stehlen, mit einem Worte, ein Mann kann seine Frau los werden, wenn immer er ihrer müde wird.”
Eine geistreiche Französin hat einmal gesagt: „Fille, on nous supprime; femme, on nous opprime” (als Mädchen unterdrückt man uns, als Frauen bedrückt man uns), aber in Japan giebt man sich dazu nicht einmal die Mühe. Der Mann hat zu befehlen, die Frau hat zu gehorchen; der Mann hat alle Rechte und Freiheiten, die Frau hat gar keine; der Mann ist der Herr der Schöpfung, die Frau ist ein untergeordnetes Wesen; und wenn sie irgendwelchen Einfluß in ernsten Dingen auf den Mann ausübt, so hat sie diesen Einfluß nicht sich selbst, sondern den Männern ihrer eigenen Familie, also ihrem Vater, ihren Brüdern zu verdanken, auf welche ihr Gatte Rücksicht nehmen muß, bevor er zum äußersten schreitet.
Als Beispiel dafür kann ein Fall gelten, der vor nicht langer Zeit in Tokio vorkam: Ein junger verheirateter Adeliger verliebte sich, im japanischen Sinne, auf dem Lande in ein junges Mädchen. Er brachte sie nach Tokio, nahm ihr eine Wohnung und vernachlässigte seine Frau. Die Schwiegermama entdeckte bald die Liaison, schrie Zeter und Mordio, die Zeitungen nahmen Notiz davon, und seine Freunde fürchteten, er würde am Ende seine offizielle Stellung bei der Regierung verlieren. Sie legten sich ins Mittel, und zwischen Mann und Frau, Schwiegermama und Konkubine wurde ein allseitig befriedigender Pakt geschlossen. Der Mann kündigte seiner Liebe die Wohnung, Frau und Schwiegermutter versprachen, keinen weiteren Lärm zu schlagen, das Mädchen kehrte zu ihren Eltern zurück, aber unter der Bedingung, daß sie den jungen Mann allmonatlich während mehrerer Tage in seinem Hause besuchen dürfe. Derlei Rücksichten werden aber, wohlverstanden, nur in den höheren Gesellschaftskreisen genommen. Selbst die Japan Mail, das von der Regierung subventionierte Organ, enthält in einer seiner Nummern folgenden Passus: „Streng genommen, wird Polygamie in Japan heute nicht getrieben. Thatsächlich war sie niemals legal, denn das Gesetz erkennt nur eine Frau an. Aber in vielen ehrbaren Haushaltungen giebt es eine Konkubine, vielleicht zwei oder selbst drei, neben der Hausfrau, ein elender Zustand, erniedrigend, unglücklich und mittelalterlich. Zur Ehre des Beamtenstandes, des Adels und der hervorragendsten Handelsherren muß es gesagt werden, daß dort mit wenigen Ausnahmen die Konkubinenwirtschaft nicht länger getrieben wird; ob aber die öffentliche Meinung reif genug ist, dieselbe als verbrecherisch zu verdammen, können wir nicht sagen.”
Indessen kommen in Japan Fälle vor, wo auch das Mädchen sich einen Gatten wählen kann. Giebt es in einer Familie beispielsweise keine Söhne, sondern nur Töchter, so wird dies von dem Vater als ein großes Unglück angesehen. Es ist niemand da, der seinen Namen, sein Geschäft erben kann, niemand, der die Ahnenopfer bringen kann, denn nur Männer können zu ihren Vorfahren beten und ihnen Opfer darbringen. Deshalb wird der Vater bestrebt sein, unter den jungen Männern seiner Bekanntschaft einen passenden Gatten für seine Aelteste auszuwählen, und dann wird auch diese zu Rate gezogen, ob ihr Zukünftiger auch hübsch und liebenswürdig genug sei. Ist sie einverstanden, so wird geheiratet. Der Mann muß aber dann ganz dieselbe traurige Rolle spielen wie sonst die Frau. Er muß seinen Namen ablegen und jenen der Familie seiner Braut annehmen, er muß in das Haus der letzteren ziehen und hübsch stille halten, sonst wird er gerade so davongejagt wie eine Frau. Natürlich geben sich zu solchen Geschäften nur arme Junggesellen her, denn „c’est alors Madame, qui porte les pantalons”.
Zwei Jahrzehnte lang waren Tokio, die Hauptstadt, und Yokohama, der Haupthafen des Mikadoreiches, von den furchtbarsten Schrecken der Elemente, von den Erdbeben, verschont geblieben. Der große Fudschiyama, dieser zum Teil mit ewigem Schnee bedeckte Riesenvulkan, schlummert seit Generationen, und die Reisenden, die von den beiden Städten aus mit stummer Bewunderung den herrlichsten aller Berge Japans betrachten, denken fast gar nicht mehr an die Möglichkeit eines Ausbruches. Für die letzte Juniwoche 1894 hatte ich eine Partie auf den Fudschi in Aussicht genommen, denn nachdem ich vor Jahren auf der Spitze des höchsten Vulkans Nordamerikas, des Popokatepetl, gestanden, war es ein begreiflicher Wunsch, auch den höchsten Vulkan Ostasiens zu besteigen. Da kam die Kunde, daß die schlummernden Geister des heiligen Fudschiyama sich wieder zu regen begonnen hätten; in seinem nördlichen Zwillingsberge, dem Asamayama, brodelte und grollte es fürchterlich, und aus seinem großen Krater stürzten gewaltige Lavamassen hervor. Desto interessanter dürfte die Besteigung werden, dachte ich mir, und fuhr von Tokio nach Yokohama, um die Vorbereitungen für meinen Ausflug zu treffen.
Der Tag war furchtbar heiß; drückende Schwüle lag über den weiten Reisfeldern der Tokiobucht; der Himmel zeigte bleierne Färbung, und mit Sehnsucht erwarteten wir Passagiere einen Regenguß. In Yokohama angekommen, fand ich unter den Gästen des Grand Hotel dasselbe Unbehagen, das ich selbst empfand; das Tiffin (Gabelfrühstück) wurde kaum genossen, und wir zogen uns gegen zwei Uhr nachmittags in unsere Zimmer zurück. Kaum hatte ich mich auf das Ruhebett geworfen, als plötzlich die Möbel rings um mich zu tanzen begannen; die Kommode fiel um, die Wände und der Fußboden krachten und schwankten wie auf bewegter See. Ein furchtbares Poltern und Dröhnen ließ mich vermuten, es wäre irgend ein Pulvermagazin in die Luft geflogen; als ich aber, zum Fenster hinausblickend, die Kamine von den Hausdächern fallen und diese selbst einstürzen sah, da wußte ich sofort den wahren Grund dieser Erscheinung. Hatte ich doch schon ein heftiges Erdbeben in Venezuela durchgemacht. Mit einem Satze war ich zur Thüre hinaus und eilte über die krachenden Treppen zwischen den heftig schwankenden Mauern hinab ins Freie an den Meeresstrand; Dachziegel, Mörtelstücke, Trümmer der Gesimse fielen rings um mich zu Boden. Das noch vor wenigen Minuten spiegelglatte Meer war wild aufgeregt und sandte hohe Brandungswellen den Strand empor; die schweren Dampfer und Kriegsschiffe draußen schaukelten heftig; eine ungeheure Rauch- und Staubwolke erhob sich über dem Weichbilde der Stadt, und man konnte sich bei dem schwankenden Boden kaum aufrecht erhalten. Während solcher Katastrophen ist es schwer, Beobachtungen zu machen; ich erinnere mich nur an[S. 498] das furchtbare unterirdische Dröhnen, an die einstürzenden Schornsteine und Dächer, das Rasseln der Fenster und das Abstürzen großer Felstrümmer von den Klippen des nahen Bluff; ich weiß nur, daß rings um mich Damen ohnmächtig auf dem Boden lagen, daß die Einwohnerschaft der Häuser längs der ganzen Straße des Bundes entsetzt aus ihren vier Mauern hinaus ins Freie stürzte, daß die Häuser ebenso schwankten wie die Schiffe draußen in der Bucht.
Wie lange die schreckliche Katastrophe währte, wußten wir nicht; erst nachträglich erfuhren wir, daß die Erschütterungen viereinhalb Minuten gedauert hatten. Endlich beruhigte sich der Boden, aber die wenigsten Menschen waren zu bewegen, in ihre Häuser zurückzukehren, da sie eine Wiederholung des Erdbebens befürchteten. Ich hatte keine Zeit zu verlieren, denn mit Bangen dachte ich an meine in Tokio weilenden Lieben. Ueber die Schuttmassen zwischen den geborstenen Wänden hinweg eilte ich nach meinem Zimmer, um meine Effekten zusammenzupacken, und ließ mich in einer Jinrickshaw nach dem Bahnhof führen. Dort erfuhr ich, daß infolge des Erdbebens der nächste Zug erst in einer Stunde abgelassen würde, und so benutzte ich diese letztere zu einer Rundfahrt durch die Stadt. Schuttmassen lagen in den Straßen, größtenteils von der abgeworfenen Bedachung, dem Maueranwurf und den Schornsteinen der Häuser herrührend; manche Häuser waren ganz eingestürzt, andere drohten einzufallen, und eine große Zahl zeigte weitklaffende Risse und Sprünge in den Mauern; bei einer Theefabrik waren Polizisten und Feuerwehrleute beschäftigt, Trümmer fortzuräumen, unter denen gegen dreißig Menschen begraben waren; auf Strohmatten oder notdürftig zusammengebundenen Tragbahren wurden Verwundete fortgetragen. Viele Dächer waren von den einstürzenden gemauerten Schornsteinen durchschlagen worden und zeigten große Löcher; im Straßenboden waren hier und dort klaffende Risse bemerkbar; in den Bazars, hauptsächlich in den vielen Läden mit den schönen japanischen Porzellan- und Emailwaren hatte das Erdbeben furchtbaren Schaden angerichtet; die prächtigsten, kostbarsten Sachen lagen zertrümmert auf der Erde.
Die meisten Schäden zeigten die Häuser in den europäischen Quartieren, da sie größtenteils aus Mauerwerk bestehen und ein Stockwerk hoch sind; die japanischen Häuser sind zumeist ebenerdig und aus Holz gebaut, aber während sie auf diese Weise von dem Erdbeben mehr verschont blieben, hatte doch am Tage zuvor eine andere furchtbare Katastrophe unter ihnen gewütet; nicht weniger als tausend Häuser waren einer großen Feuersbrunst zum Opfer gefallen, und noch rauchten die schwarzen verkohlten Reste dieses zerstörten japanischen Stadtviertels.
Rechtzeitig kehrte ich nach der Eisenbahnstation zurück, um den Zug nach Tokio zu benutzen. Während der einstündigen Fahrt sah ich überall Spuren des Erdbebens, eingestürzte Mauern und Häuser, beschädigte Dächer, umgestürzte Toris (Tempelthore) und Statuen. Auf dem Wege von der Schimbaschistation in Tokio[S. 499] nach dem dortigen Imperial Hotel sah ich, daß das Erdbeben hier noch heftiger gewesen sein mußte als in Yokohama, denn noch viel mehr Häuser waren beschädigt, besonders in dem Stadtviertel der Europäer; fast jedes zweite Dach hatte gelitten; die Schornsteine waren überall eingestürzt, die Mauern waren geborsten, der Mörtelanwurf abgefallen, viele Häuser ganz zertrümmert; von den das kaiserliche Palais umgebenden Festungswällen war die aus großen Quadern bestehende Bekleidung auf Strecken von fünfzig Metern abgefallen. Endlich war ich am Imperial Hotel angelangt, und glücklicherweise war unter den Gästen kein Unglücksfall zu beklagen. Dagegen bot der prachtvolle Bau selbst einen schrecklichen Anblick dar. Das große Einfahrtsthor war eingestürzt und lag nebst dem Eisengitter in Trümmern auf dem Boden; die Kamine waren abgestürzt und hatten große Löcher in das Dach geschlagen; die Mauern zeigten durchgehends klaffende Sprünge; mehrere Angestellte waren durch herabfallende Mauerstücke verwundet worden; in den Salons und Wohnzimmern waren Möbel umgestürzt, Bilder, Spiegel, Vasen und Statuen herabgefallen und zertrümmert. Die benachbarten Häuser waren schwer beschädigt und mußten zum Teil ganz abgetragen werden.
Merkwürdigerweise war das kaiserliche Palais durch das Erdbeben nur wenig betroffen, und das Kaiserpaar war mit dem bloßen Schrecken davongekommen; die Paläste der kaiserlichen Prinzen waren teilweise arg beschädigt. In den Straßen waren die Japaner schon überall beschäftigt, die Schuttmassen fortzuräumen, die Verschütteten auszugraben und die Schäden auszubessern. Doch gewärtigte man eine Wiederholung des Erdbebens. Um neun Uhr abends wurde auch ein zweiter Stoß, jedoch von geringerer Heftigkeit, empfunden. Am folgenden Tage hatte sich die allgemeine Furcht etwas gelegt, aber wie wohlbegründet sie war, geht aus der Statistik der Unglücksfälle hervor, welche die japanischen Morgenzeitungen auf Grund der eingelaufenen Meldungen veröffentlichten. In Tokio allein wurden innerhalb der viereinhalb Minuten des Erdbebens 36 Menschen getötet, über 300 verwundet; die Zahl der beschädigten Häuser erreichte 3720, der umgestürzten Mauern 162, der Schornsteine 289, der Risse im Erdboden 96. Seltsamerweise beschränkte sich das Erdbeben auf den zentralen Teil Japans zwischen Yokohama und Tokio; in den entfernteren Städten wurden die Erdstöße nur ganz leicht verspürt und verursachten nur geringe Unglücksfälle. Die Vulkane zeigten während des Erdbebens keine erhöhte Thätigkeit.
Dafür sind sie in den letzten Jahren wieder desto thätiger gewesen, vor allen anderen hatte der schreckliche Bandaisan im Norden Japans im Juli 1900 einen heftigen Ausbruch, dem mehrere hundert Menschen zum Opfer fielen. Nur der höchste Vulkan Japans, der berühmte heilige Fujiyama, hat seit Jahrhunderten bis auf den heutigen Tag seine erhabene Ruhe bewahrt.
Frauen auf der japanischen Bühne! Das ist die wichtigste Neuigkeit, die eben aus dem fernen Lande des Sonnenaufganges zu uns herüberdringt. Frauen als Schauspielerinnen und Tänzerinnen auf den Brettern, welche in Japan, wie bei uns, die Welt bedeuten! Die Kaiserin von Japan hat selbst die Initiative dazu ergriffen, ihren weiblichen Unterthanen diesen neuesten Beruf zu eröffnen, und in Zukunft wird es im Reiche des Mikado auch weibliche Sterne am Theaterhimmel geben. Bisher haben wohl die reizenden Musmis von Japan die dramatische und lyrische Kunst eifrig gepflegt, allein es war ihnen nicht gestattet, im Verein mit ihren männlichen Kollegen öffentlich aufzutreten. Bei uns gefallen sich die Theaterdamen von stattlichem Wuchs darin, in Hosenrollen aufzutreten, in Japan aber, diesem Lande der verkehrten Welt, gefallen sich die schönsten Männer darin, in Unterröcken zu spielen. Alle Weiberrollen, nicht nur die alten, wurden von geschminkten Jünglingen gespielt, ja sogar das japanische Ballett zählte bisher nur männliche Ballerinen. Warum? Wieder die verkehrte Welt: weil es gegen den Anstand und die gute Sitte verstoßen hätte, Mädchen neben jungen Männern öffentlich auftreten zu sehen. Die Japaner haben eben eigentümliche Begriffe von Anstand. Während die kleinen hübschen Mädchen im Alter von zwölf bis achtzehn Jahren, die Frauen im Alter von achtzehn bis dreißig Jahren, die Großmamas im Alter von dreißig bis wer weiß wie viel Jahren ihre Bäder häufig öffentlich auf der Straße nehmen, während die Damen in den fashionabeln Badeorten Ikao oder Karuizawa mit der größten Ungeniertheit im Verein mit fremden Männern in demselben kleinen Baderaum stecken, ohne irgend etwas Schlimmes davon zu denken, dürfen sie in voller Bekleidung auf der japanischen Bühne nicht neben und mit Männern auftreten. Im vergangenen Jahre hat eine amerikanische Sängerin von Weltruf, welche Japan als die erste Primadonna überhaupt besuchte[3], die dortigen Hofkreise auf das Widersinnige dieser Anstandsregeln aufmerksam gemacht und die hohe Stellung erklärt, welche die Frauen der europäischen Bühne nicht nur auf dieser, sondern vielfach auch im gesellschaftlichen Leben einnehmen. In ihrem Streben, es den Europäern auf allen möglichen Gebieten gleichzuthun, haben sie sich nun, gestützt auf diese und andere Berichte, auch die Reform des Theaterwesens zur Aufgabe gestellt, und sie beginnen damit, daß sie den Japanerinnen die Thüre zum Hinterpförtchen der Theater, zum Bühneneingang, öffnen.
Glücklicherweise ist dies eine der wenigen Neuerungen in der japanischen Kultur, die mit dem ganzen Wesen derselben verträglich ist, ja ihrer malerischen Eigentümlichkeit ein neues, glänzendes und erhaltendes Element zuführt. Im übrigen[S. 501] haben die Japaner ja leider aus europäischen Fräcken und Schleppkleidern, Vatermördern und Beinkleidern ein großes Leichentuch für ihre eigene, so ungemein malerische Kultur zusammengenäht. Wer diese letztere in ihrer ganzen Eigenheit, und so wie sie vor Jahrhunderten war, sehen will, muß japanische Theater besuchen. Dort hat sie ihre letzte Zufluchtsstätte gefunden, dort wird sie auch noch von den hochkonservativen aristokratischen Elementen erhalten.
Das japanische Theater ist gar nicht so alt, als man bei einer für asiatische Verhältnisse gewiß hohen und viele Jahrhunderte alten Zivilisation anzunehmen geneigt wäre. Es entwickelte sich aus den religiösen Gesängen und Tänzen, mit denen die buddhistischen Priester in früheren Zeiten ihren Tempeldienst zu begleiten pflegten und wie ich sie noch gelegentlich meiner eigenen Reise in den berühmten Tempeln von Nikko und Nara vorfand. In ähnlicher Weise haben ja auch die alten Griechen und Römer ihre Götter gefeiert, und dieser Kultus hat sich sogar nach Spanien verpflanzt, wo der Ostertanz der Pagen in der Kathedrale von Sevilla ein Ueberbleibsel des heidnischen Götterdienstes sein dürfte. Die großen Feudalfürsten des alten Japan ließen derlei Tänze und Gesänge an ihren Höfen zur Aufführung bringen; allmählich legten sie den ersteren andere Handlungen unter, die sie fast ausschließlich der japanischen Geschichte oder der Märchenwelt entnahmen, und so entstand, dabei immer weltlicher werdend, das japanische Theater von heute. Doch war es nur das gewöhnliche Volk, das an diesen öffentlichen Darstellungen in öffentlichen, auch an die alten Tempel gemahnenden Theatern Gefallen fand. Die Daimios (Fürsten) hielten an den alten Traditionen fest und unterstützen sie auch noch heute. In Tokio hatte ich Gelegenheit, mancher der traditionellen Privatvorstellungen von alten No-Spielen beizuwohnen, die nur vor geladenen Gästen der Aristokratie stattfinden und in denen Schauspieler auftreten, die ihre Kunst gerade so wie ihre herrlichen, kostbaren Kostüme von ihren Vätern und Vorvätern geerbt haben. Manche dieser Schauspielerfamilien haben einen theatralischen Stammbaum von sechs bis zehn Generationen aufzuweisen. Sie allein werden gesellschaftlich geachtet und anerkannt. Die Schauspieler der gewöhnlichen öffentlichen Theater aber waren bisher ebenso geächtet wie bei uns noch zur Zeit der alten Neuberin. Sie wurden geradezu der Klasse der „Eta” (Gesetzlose, Vogelfreie) beigezählt, und noch heute würde es in Japan keinem Aristokraten, Offizier oder Beamten in den Sinn kommen, eines der öffentlichen Theater zu betreten. Nur bei außergewöhnlichen Gelegenheiten, etwa wenn der Lewinsky von Japan, Danjuro, auftritt, oder bei Wohlthätigkeitsvorstellungen erscheinen sie, aber auch nur in zwei oder drei der vornehmsten Theater der Hauptstadt. Der Mikado hat noch niemals ein Theater besucht, und die einzigen Vorstellungen, die er gesehen hat, sind alte klassische No-Stücke, die in seinem Palast aufgeführt werden.
Das gewöhnliche Volk in Japan liebt die Theater über alle Maßen, ja ich kenne unter den Völkern der Erde keines, das mit solcher Begeisterung dem Theater ergeben wäre. Jede größere Stadt hat ihre Theater; Tokio, Kioto und Osaka haben deren eine ganze Anzahl, und wer das japanische Volksleben kennen lernen will, darf den Besuch der Theater, sowie die gewöhnlich ungemein belebten Straßen, in denen sie gelegen sind, mit ihren Theehäusern und Tingeltangeln aller Art nicht versäumen. Man muß sich aber unter den japanischen Theatern nicht etwa solche nach europäischem Muster vorstellen. Für den Japaner, der Europa besucht, dürfte es kaum eine größere Ueberraschung geben, als wenn er die glänzenden Räume unserer hauptstädtischen Opernhäuser betritt. Unsere bescheidensten Provinztheater sind immer noch eleganter und vornehmer in Bezug auf die Ausstattung sowohl wie auf die Masse der Besucher als die schönsten japanischen Theater. Der Mehrzahl nach sind sie große, leichtgebaute Bretterbuden, deren Zuschauerraum für drei- bis fünfhundert Personen Platz bieten dürfte. Vor dem Eingange stehen gewöhnlich acht bis zehn Meter lange Bambusstangen, gegen die Straße zu geneigt, wie riesige Angelruten, und an diesen hängen blaue und rote, mit bunten Inschriften bedeckte Leinwandstreifen. Die amerikanische Reklame mit ihren großen, bunt bemalten Affichen hat auch schon in Japan ihren Einzug gefeiert, die Theaterfronten sind gewöhnlich mit derlei Papierbogen ganz verklebt. An das Theater schließen sich in der Regel zierliche Theehäuser mit halbverdeckten, lampiongeschmückten Balkonen und Galerien an. Die Theaterstraßen der japanischen Großstädte bestehen gewöhnlich nur aus derartigen Theehäusern, Theatern und Schaubuden, in denen allerhand Zauber, ähnlich dem Wiener Wurstlprater oder der Pariser Foire de Neuilly, gegen ein paar Pfennige Eintrittsgeld zu sehen ist. Vom frühen Morgen bis in die Nacht hinein herrscht in diesen Straßen reges Leben, denn die Theater Japans sind nicht nur des Abends geöffnet, die Vorstellungen dauern den ganzen Tag über, und die Japaner, die sie besuchen wollen, nehmen Kind und Kegel, ihre ganze Familie mit und bleiben den ganzen Tag im Theater. Andere kommen nur für eine oder mehrere Stunden, um die wichtigsten Scenen oder die beliebtesten Schauspieler zu sehen. Wird ein neues Stück aufgeführt, so spricht es sich bald in der Stadt herum, welche Stunde die sehenswertesten Akte vorkommen, und dann sind die Theater gewöhnlich zum Erdrücken gefüllt. Die vielen Theehäuser mit ihren Kellnerinnen und Gaishamädchen (Sängerinnen) tragen dazu bei, einen dichten Menschenstrom durch die Theaterstraßen zu leiten, so daß dort der Wagen- und Rickshawverkehr verboten ist. Die Theaterbesucher müssen auch bei schlechtem Wetter ihre Rickshaws schon an der Straßenecke verlassen und den Weg zum Theater zu Fuß zurücklegen.
Wohl befinden sich neben den einzelnen Theatern oder am Haupteingange derselben auf der Straße Billetverkäufer, welche den Passanten gegen Erlag weniger[S. 503] Cash ein mit Schriftzeichen bedecktes Holzplättchen einhändigen; allein der Japaner, der für seine ganze Familie Platz haben will, muß sich denselben tags vorher, bei Zugstücken sogar schon mehrere Tage vorher sichern. Gewöhnlich vereinigt sich der Theaterbesitzer mit dem Besitzer des benachbarten Theehauses; dieser ist häufig sein Geldgeber und Kassierer, verkauft die Theaterplätze gegen einen gewissen Prozentsatz und liefert den Theaterbesuchern Speisen und Getränke. Wären die Theater nicht schon an den großen Angelruten kenntlich, die sozusagen die Besucher von der Straße fischen, so würden die Hunderte von Sandalen und Strohschuhen vor den Theatergebäuden dieselben schon als solche kennzeichnen. Keinem Japaner würde es einfallen, mit seinen Sandalen das Innere eines Theaters zu betreten, ebensowenig wie einen Tempel, einen Kaufladen oder sein eigenes Wohnhaus. Vor den Theatern stehen lange Gestelle, auf denen in mehreren Reihen die ganze Theaterfront entlang die plumpen, mit Stelzenstöckchen versehenen Holzsandalen oder Strohschuhe paarweise aufgehängt sind. Am Eingang zieht der Besucher die Füße aus seinen Sandalen und erhält für dieselben von dem Garderobier eine entsprechende Nummer, auf einem kleinen Holzklotz verzeichnet.
Das Innere der japanischen Theater ist von jenem der unserigen vollständig verschieden. Wohl giebt es eine Bühne mit Vorhang, allein Seitenkulissen, Rampenlichter, Souffleurkasten, Schnürboden und dergleichen fehlen. Dafür verlängert sich die Bühne auf beiden Seiten in den Zuschauerraum hinein, und diese etwa zwei Meter breiten, mannshohen Podien laufen, das Parkett zwischen sich einschließend, bis an die hintere Wand des Zuschauerraumes. Von dort gelangen die Schauspieler durch eigene, dem Publikum nicht zugängliche Korridore wieder auf die Bühne zurück. Die Mehrzahl der Theater besitzt über dem Parkett noch eine Galerie, und diese ist gerade so wie das erstere ganz in Logen eingeteilt. Nur der kleine Raum hinter den Logen bis zur Wand zeigt eine Reihe von Sitzbänken für die geringsten Klassen des Theaterpublikums, und in manchen Theatern ist wohl eine, von den übrigen Logen gesonderte Abteilung für europäische Besucher mit Stühlen zum Sitzen versehen. Sonst giebt es in den Theatern keine Sitze, denn das Publikum kauert auf dem Boden. Das ganze Parkett ist bis zu der Rampe durch zwei Fuß hohe Bretterwände in viereckige Räume von etwa vier Quadratmetern Fläche eingeteilt, und diese schachbrettartigen Felder sind die Logen. Wird jemandem eine Loge in der Mitte des Parketts zugewiesen, so muß er über die Abteilungsbretter und durch eine Reihe anderer Logen steigen, um zu der seinigen zu gelangen. Dort angekommen, ist er für den Tag ausschließlicher Besitzer des vollständig kahlen Kastens. Will er Sitzmatten, Ecktischchen, Kohlen- und Aschenkästchen, so muß er sie von den Angestellten eigens entlehnen und erhält für jeden gezahlten Betrag eine entsprechende Quittung, die auf Verlangen der Kontrolleure vorgewiesen werden muß, denn sonst wird der Betrag nochmals abverlangt.[S. 504] Gewöhnlich versammeln sich die Teilnehmer einer Theatre party oder einzelne Familien, welche Logen reserviert haben, in den Morgenstunden im Theater und je vier nehmen in einer Loge auf den Bambusmatten des Bodens Platz. In den Zwischenakten kommen die Kellner und Kellnerinnen des Theehauses, um nach ihren Wünschen zu fragen, Thee, Süßigkeiten, Früchte oder die bestellten Mahlzeiten zu bringen. Ueberdies befinden sich im Theater selbst, nahe dem Eingange, Stände mit Früchten, Tabak, Backwerk und Getränken aller Art, so daß die Besucher tagsüber das Theater gar nicht zu verlassen brauchen. Für die eigenen Familiendiener wird kein Eintrittsgeld berechnet; häufig legen diese oder das Theehaus alle Beträge aus, und am Schlusse der Vorstellung wird die Rechnung überreicht, die in den besseren Theatern für eine Familie von vier Personen etwa folgendermaßen lautet:
So bleiben denn die Theaterbesucher den ganzen Tag über im Theater, und für den Fremden bilden die einzelnen Logen mit ihren Insassen ebensoviele Schaubühnen, durch die er das Leben und Treiben der Japaner viel besser kennen lernt als auf der wirklichen Bühne. Die Mehrzahl der Besucher sind gewöhnlich Frauen und Mädchen. Mit ihren Kindern, mit Kopfkissen, Päckchen, Papiertüten, Pfeifen, Tabaksbeuteln, Theekannen treffen sie im Theater ein und machen es sich in ihrer Loge bequem. Die Kinder werden vor ihnen auf den Boden gebettet, der Aschenbehälter mit den glimmenden Kohlen steht zwischen ihnen, sie stecken sich ihre winzigen Pfeifchen an und kauern auf den Boden nieder. In dieser für Europäer unbequemen und ermüdenden Stellung verharren sie stundenlang; es war mir in Japan immer ein Rätsel, wie die zarten Frauen und Mädchen ihre Kniebeuge so lange aushalten konnten. Zeitweilig strecken sie sich ganz auf die Matten nieder, legen den Arm unter den Kopf und schlafen. Oder sie geben den schreienden Kindern in recht ungenierter Weise die Brust, rauchen dabei ihr Pfeifchen, knabbern an Zuckersachen, schlürfen Thee und fächeln sich Kühlung zu. Jeder Japanerin ebenso wie jedem Japaner sind Fächer und Pfeifchen ganz unentbehrliche Dinge; einer oder der andere dieser Gegenstände ist stets in ihren Händen.
Während der Vorstellung lauschen die Theaterbesucher andächtig den Ausführungen der Schauspieler, wälzen sich vor Lachen über den geringsten Scherz, vergießen Thränen bei jeder ernsten Scene, schaudern und gruseln bei Hinrichtungen und Selbstmorden, die auf der japanischen Bühne eine große Rolle spielen und mit allen blutigen Einzelheiten ungemein realistisch dargestellt werden. Fällt der Vorhang, dann geht der Lärm los. Die Hälfte der Anwesenden erhebt sich und eilt, über die Logenwände kletternd, zwischen den Insassen der Logen hindurch dem Ausgange oder den Büffettbuden zu; anderseits erscheinen wieder ein paar Dutzend Aufwärter oder Theehausmädchen, welche dampfende Schüsseln und Theetöpfe durch die verschiedenen Logen tragen; die Kinder klettern aus einer Loge in die andere, oder wohl gar auf die Bühne hinauf und tummeln sich dort lachend und schäkernd herum; mitunter steigen ganze Familien auf die Bühne, um vor dem Vorhang ihre Mahlzeiten einzunehmen; die in den Logen Zurückgebliebenen müssen sich in acht nehmen, daß ihnen nicht ihre Zehen abgetreten werden; ich mußte häufig ebensosehr die Geduld wie die Höflichkeit bewundern, mit der die japanischen Damen alle diese fremden Menschen, Besucher, Aufwärter, Kinder in ihren Logen und mitten zwischen sich hindurch umhersteigen ließen. Nicht ein finsteres Gesicht, nicht eine Gebärde des Unwillens oder der Ungeduld; lächelnd verneigen sie sich vor den Kellnern, lächelnd spielen sie mit den fremden Kindern, lächeln müssen sie bei allen Gelegenheiten. Dort zieht eine hübsche Musme aus den Aermeln ihres vorne offenen, den Busen entblößenden Kimono ein kleines Spiegelchen hervor, kramt aus den Tiefen der sackartigen Aermel Kamm, Puderbüchse, Lippenschminke und sonstige Toiletteartikel hervor und hantiert angesichts der ganzen Versammlung mit diesen Dingerchen. Allmählich kehren die Theatergäste wieder auf ihre Plätze zurück, von der Bühne ertönen drei dumpfe Schläge, ähnlich jenen, mit welchen auf den französischen Theatern der Beginn angezeigt wird; der Vorhang wird in die Höhe oder nach den Seiten zurückgezogen, und der nächste Akt beginnt.
Von Akten kann eigentlich keine Rede sein, ebensowenig wie von Tragödien, Lustspielen und Dramen nach europäischem Muster. Die Darstellungen, welche, wie bemerkt, morgens beginnen und spät abends endigen, beziehen sich gewöhnlich auf geschichtliche Ereignisse oder sind Märchen, Sagen und Romanen der alten Japaner entnommen. Auch giebt es keine eigene Theaterlitteratur. Als ich in Tokio einmal durch meinen Dolmetsch den Theaterunternehmer nach dem Verfasser des eben zur Ausführung gelangenden Stückes fragte, that er sehr verwundert und wußte nicht, was er antworten sollte. Erst als ich ihm meine Frage näher erklärte, erfuhr ich von ihm, daß an den japanischen Theaterstücken Direktor, Schauspieler, Theatermaler, Maschinisten, ja selbst das Publikum mitarbeiten. Irgend ein Märchen, eine Erzählung oder eine in den Zeitungen berichtete Begebenheit wird zum Vorwurf genommen, die Schauspieler arbeiten ihre Rollen selbst aus, jeder gute Einfall, der[S. 506] von irgendwelcher Seite kommen mag, wird bereitwilligst verwendet, und so entsteht allmählich das Stück, das aber während der ersten sechs oder acht Aufführungen täglich verändert und verbessert wird. Selbst später noch extemporieren die Schauspieler ganz nach Belieben, Scenen werden versetzt oder ganz weggelassen, und nur bei historischen Begebenheiten befleißigt man sich möglichster Treue in den geringsten Einzelheiten.
Mit Ausnahme von einigen der vornehmsten Theater, vor allem des Shintomiza-Theaters in Tokio, sind die scenischen Einrichtungen noch ganz so primitiv wie zu Shakespeares Zeiten in Europa, ja, wie sie Shakespeare selbst in seinem Sommernachtstraum verspottet hat. Für Interieurs bleibt die Bühne vollständig kahl. Eine Mauer mit einem Thor wird dadurch angezeigt, daß man in der Mitte der Bühne ein Thor aufstellt, und es bleibt der Einbildung des Publikums überlassen, sich zu beiden Seiten die hohe Mauer dazu zu denken. Die Schauspieler dürfen nur das Thor benutzen und nicht wissen, was jenseits desselben vorgeht; Theehäuser werden dargestellt, indem man ein paar Lampions mit der Inschrift „Theehaus” auf den Boden steckt. Gärten werden durch natürliche Pflanzen dargestellt. In den ersten Theatern Tokios hat man neben einer Menge anderer europäischer Einrichtungen auch schon gemalte Dekorationen, elektrische Beleuchtung und dergleichen angenommen, und besonders in dem vorerwähnten Shintomiza-Theater werden ganz hübsche scenische Effekte erzielt. Sonst beschränkt sich der theatralische Pomp fast ausschließlich auf die Kostüme der Schauspieler, deren Garderobe viele historische Waffen, Rüstungen, Mäntel und dergleichen von bedeutendem Wert enthält. Häufig bekommen beliebte Schauspieler derlei Gegenstände von aristokratischen Familien zum Geschenk. Die Schauspieler haben aber auch bessere Gelegenheit als bei uns, diese Prachtgegenstände aus nächster Nähe bewundern zu lassen, denn sie treten nicht nur auf der Bühne selbst auf, sondern benutzen zu ihrem Kommen und Abgehen die vorgenannten Estraden, auf denen sie langsam und feierlich mitten durch das Publikum schreiten. Zudem ist es gang und gäbe, den Schauspielern in ihren Ankleidezimmern Besuche abzustatten, wobei man ihnen gewöhnlich allerhand kleine Geschenke überreicht. Auch noch auf andere Weise kommen sie in die Lage, kleine Privatmuseen anzulegen oder sich durch Geldgeschenke zu bereichern, denn beliebte Schauspieler werden in Japan vom Publikum noch viel mehr verhätschelt als bei uns. Die beiden durch das Auditorium führenden Estraden heißen Hans mischi, d. h. „blumige Wege”, weil man den Lieblingen des Publikums dort vor ihrem Auftreten Blumen streut. Haben sie das Publikum zu besonderer Begeisterung hingerissen, so wird diese häufig in ähnlicher Weise zum Ausdruck gebracht, wie ich es bei den Stiergefechten in Spanien gesehen habe. Hüte, Schirme, Fächer, Pfeifen, Toiletteartikel aller Art werden dem abgehenden Schauspieler von zarten Händen zugeworfen, gerade wie einem siegreichen Torero, und diese Gegenstände werden dann in seiner[S. 507] Garderobe von den Eigentümern durch Bargeld oder andere Gegenstände wieder eingelöst.
Ob die Schauspieler diese Huldigungen nach unseren europäischen Begriffen verdienen, ist eine andere Frage. Der Mehrzahl der europäischen Besucher kommen diese Vorstellungen ungemein gekünstelt, unnatürlich und langweilig vor. Der ersten Vorstellung in einem japanischen Theater wohnt man gewöhnlich mit Interesse bei, aber damit ist der Reiz des Neuen und Ungewöhnten erschöpft, und wenige lassen sich verleiten, eine zweite zu besuchen. Nach meinen eigenen Erfahrungen halte ich das für unrichtig, denn erst, wenn man sich durch mehrmaligen Besuch an die Eigentümlichkeiten der dramatischen Kunst in Japan gewöhnt hat, kann man die Vorzüge der Darstellung beurteilen. Die Tradition scheint von den darstellenden Künstlern in Japan zu verlangen, daß sie auf der Bühne das Gegenteil des Natürlichen thun; ihre Bewegungen, ihre Kleidung, ihre Sprache, ihr Thun und Lassen sind eher Zerrbilder der Wirklichkeit, aber auch darin liegt eine Kunst, die gelernt werden muß. In Bezug auf das Mienenspiel und den Gesichtsausdruck leisten die japanischen Schauspieler mitunter Großartiges, und da es bis vor wenigen Jahren in den hauptstädtischen Theatern an Rampenlichtern gefehlt hat, ließen sich die Schauspieler während der Handlung auf der Bühne durch schwarzgekleidete Diener begleiten, welche Lampions trugen, die an der Spitze von Bambusstäben hingen und den Schauspielern vor die Nase gehalten wurden, damit ihr Gebärdenspiel im wahren Sinne des Wortes in das richtige Licht gesetzt werde. Neben den Schauspielern befinden sich übrigens immer Diener auf der Bühne, um ihnen die Kostüme und die Frisur während der Handlung zurecht zu zupfen, Gerätschaften herbeizutragen, die Scenerie zu versetzen und dergleichen. Es wird dabei stillschweigend angenommen, daß diese Diener für das Publikum unsichtbar sind. Der Souffleur befindet sich ebenfalls auf der Bühne; zuweilen sitzt er an einem Tischchen an der Seite und erzählt mit unnatürlicher Stimme den Lauf der Handlung, oder preist die Kunst der Schauspieler oder singt, begleitet von einem Orchester, das in einem Bambuskäfig zu Rechten der Bühne auf dem Boden hockt und im Trommeln, Guitarrezupfen, Pauken- und Lärmschlagen Großartiges leistet. Am meisten pflegt sich dabei ein Musiker auszuzeichnen, der zwei kurze Holzstäbe in mehr oder minder rascher Folge aneinanderschlägt, je nachdem es die Handlung verlangt.
Während die Japaner sich mit diesen und anderen Einrichtungen an die Seltsamkeiten des Theaterwesens anlehnen, wie ich es in China, Siam und Java kennen gelernt habe, sind sie in einer Hinsicht sogar den Europäern vorangeeilt. Vor einigen Jahren besuchte ich in Neuyork das Madison Square-Theater und sah dort eine eben erfundene Einrichtung, welche es gestattete, auf offener Scene einen vollständigen Dekorationswechsel in weniger als einer Minute auszuführen. Unterhalb der eigentlichen Bühne befand sich eine zweite gleich große. Während auf der[S. 508] ersteren gespielt wurde, setzten die Bühnenarbeiter auf der zweiten unteren die nächstfolgende Scene. Auf ein gegebenes Zeichen wurde eine sinnreiche Maschinerie in Thätigkeit gesetzt. Die obere Bühne verschwand im Schnürboden, die untere trat an ihre Stelle, ein Zwischenakt war erspart. Diese amerikanische Erfindung war in Japan schon längst im allgemeinen Gebrauch, nur daß die beiden Bühnen nicht übereinander, sondern hintereinander liegen. Durch eine einfache Vorrichtung wird der ganze Bühnenapparat, ähnlich wie die Drehscheibe bei Eisenbahnen, um eine vertikale Achse gedreht, die vordere Bühne kommt nach hinten, die hintere mit ganz verschiedener Scene nach vorne, und das Spiel wird ohne Unterbrechung fortgesetzt.
Die Annahme europäischer Sitten und Gebräuche in so vielen Berufszweigen ist auch nicht ohne Einfluß auf das Theater geblieben. Man verlangt Darstellungen, die dem modernen Leben entnommen sind, man verkürzt ihre Dauer und verwendet immer mehr die freien Abendstunden für den Theaterbesuch. In Tokio hat man begonnen, unsere modernen Theatereinrichtungen anzunehmen, und nun sollen, wie eingangs erwähnt, auch die Frauen als Darsteller zugelassen werden. Um den Theaterbesuch so rege als möglich zu gestalten, werden an jedem Tage eine Anzahl kleinerer Stücke aufgeführt, und zwar pflegen die Direktoren zwischen historischen Darstellungen und Tragödien Possen und Balletvorstellungen einzuschieben. Die Billets können für jedes einzelne Stück gelöst werden, ähnlich wie es in den Zarzuela-Theatern in Spanien der Fall ist. Nur Oper und Operette fehlen in Japan noch gänzlich, und es wird kaum innerhalb eines Menschenalters dazu kommen, daß die Japaner an unserer Vokalmusik Geschmack finden. Die einzigen lyrischen Dramen, welche die Japaner kennen, sind die aus der klassischen Zeit stammenden No-Darstellungen, und diese sind noch viel einförmiger und langweiliger als die gewöhnlichen japanischen Theaterstücke. Immerhin sollten die Japaner ihrer Kaiserin dafür Dank wissen, daß sie dem Theater durch die Zulassung von Frauen neue Abwechselung und neue Anziehungskraft gegeben hat.
[3] Minnie Hauk.
In rascher Folge kommen die Kurumas, gezogen von flinken, strammbeinigen Kulis, angefahren und entladen ihre Insassen, europäische Diplomaten und Offiziere, japanische Minister, Aristokraten und Beamte, reizende buntgekleidete Musmis, Frauen in jedem Alter, alle in das japanische Nationalgewand, den Kimono, gehüllt, alle mit Blumen und schönen Nadeln im Haar, den Fächer in der einen, den bunten Sonnenschirm in der andern Hand. Vor dem Eingang zu dem Shintomiza-Theater, dem vornehmsten von Tokio, ein Gedränge wie selten. Aber obschon Hunderte derselben Pforte zustreben, giebt es doch kein Drücken und Stoßen; mit der größten Höflichkeit machen die kleinen japanischen Menschlein einander Platz, verneigen sich tief voreinander, lächeln und entschuldigen sich mit vielen Worten. Man sieht, es ist die vornehme Welt der Hauptstadt, die sich heute hier Rendezvous gegeben hat. Unter Bücklingen überreichen die eleganten Damen dem Garderobier ihre Strohsandalen und Holzschuhe, nehmen unter Bücklingen dafür ihre hölzerne Garderobenummer in Empfang und betreten in ihren weißen Strümpfen das Innere des Theaters, um in den einzelnen Logen auf dem Boden Platz zu nehmen. Auch wir haben uns schon vor einigen Tagen eine Loge gesichert.
Die Vorstellung hat schon längst begonnen; wenn wir, und mit uns so zahlreiche Japaner der besten Stände, erst jetzt unsere Plätze einnehmen, so geschieht es deshalb, weil für diese Nachmittagsstunden das Auftreten des berühmtesten Schauspielers Japans, Danjuro, angekündigt war. Die ganzen, frühmorgens beginnenden, spät abends endigenden Vorstellungen mitzumachen, ist nur die Sache der mittleren und unteren Volksklassen Japans, für diese beginnen die tagelangen Aufführungen niemals früh genug und hören niemals spät genug auf. Glücklicherweise wird es nach den ersten Vorstellungen bald bekannt, um welche Stunde die besten Kräfte auftreten, die aufregendsten Scenen stattfinden, und dann pflegen die Theater zum Erdrücken gefüllt zu sein. Rechts und links von uns in den Balkonlogen, unter uns in den viereckigen Logenabteilungen des Parketts sitzen die Besucher, der größeren Zahl nach dem weiblichen Geschlecht angehörend, ausgestreckt auf dem Boden oder den Knien liegend, hocken in den verschiedensten Stellungen, essend, trinkend, rauchend; die verschiedenfarbigen, faltenreichen Gewänder, die Blumen in den Haaren, die Hunderte bunter, fortwährend bewegter Fächer vereinigen sich zu einem fremdartigen, malerischen Bilde. Aller Augen sind unverwandt auf die Bühne gerichtet, und mit der gespanntesten Aufmerksamkeit sehen sie den Scenen zu, die sie möglicherweise schon hundertmal gesehen haben und an denen dieses liebenswürdigste und genügsamste Theaterpublikum aller Länder immer wieder neuen Gefallen findet.
Dort oben auf der Bühne wird eben eines der Paradestücke Danjuros aufgeführt. Er selbst spielt gerade einen bejahrten Daimio aus der alten ritterlichen Zeit des japanischen Reiches; in die prachtvollsten goldgestickten Gewänder gehüllt, sitzt er starr und stumm auf dem Boden und kümmert sich nicht um die beiden Frauen, die, ebenfalls in herrlichen Kostümen, neben ihm kauern. Sie schluchzen und jammern und klagen, Thränen rollen über ihre Wangen und benetzen einen Gegenstand, den sie einander abwechselnd reichen und mit dem Ausdruck des höchsten Schmerzes an ihre Brust drücken. Bei genauerer Betrachtung sehe ich zu meinem Entsetzen, daß dies ein blutender Menschenkopf ist. „Mein Sohn, mein armer Sohn!” klagt fortwährend die ältere der beiden Frauen. „Mein Gatte!” ruft schluchzend die andere. Der Daimio zwischen beiden verzieht aber keine Muskel seines Gesichts. Kalt und teilnahmlos läßt er den Blick über das blutende Haupt seines einzigen Sohnes gleiten, des letzten Sprossen seiner Familie, der im Kampfe gegen die Armee des Mikado gefallen war. Auf ein stummes Zeichen von ihm entfernen sich die beiden Frauen.
Nun erhebt sich der Greis mühsam vom Boden und wendet sich langsam herum, um zu sehen, ob er wirklich allein sei. Niemand ist da, um Zeuge seines Schmerzes zu sein. Er atmet hoch auf und wirft sich plötzlich mit einer unnachahmlichen Gebärde der Verzweiflung über den am Boden liegenden Kopf. Sein ganzer Körper zittert, sein Greisengesicht ist in Thränen gebadet, während er das blutende Haupt mit dem wirren Haar und den verglasten Augen mit beiden Händen erfaßt und weit von sich haltend lange betrachtet; dann drückt er es an seine Brust und seine Wangen, verharrt eine Zeit lang in dieser Stellung und sinkt plötzlich wie leblos zu Boden, während das Haupt aus seinen Händen kollert.
Allmählich kehrt das Leben in den Körper des Greises zurück, er erhebt sich, seine Augen blicken teilnahmlos und verwundert umher, als suchte er sich die letzten Momente ins Gedächtnis zurückzurufen, dann zeigt eine schmerzliche Verzerrung seiner Gesichtsmuskeln, daß er das Bewußtsein seines entsetzlichen Unglücks wiedererlangt hat. Ein tiefer Seufzer entflieht seiner Brust, sein Gesichtsausdruck wird ruhiger, ja es hat den Anschein, als wäre es auch mit seiner Trauer vorbei. Nun zieht er langsam sein Schwert aus der Scheide und legt es neben sich auf den Boden; sorgfältig, bedächtig löst er Stück für Stück von seiner Kriegerrüstung; dann öffnet er die seidenen Untergewänder, läßt sich auf den Boden nieder, nimmt das Schwert und schlitzt sich damit den Leib auf. Das Blut entquillt der klaffenden Wunde, der entseelte Körper fällt zusammen, der alte Daimio hat Harakiri begangen.
Damit schließt das erste Stück, an welchem Danjuro teilnimmt, der Vorhang fällt, und erleichtert atmen alle auf. Nun begreife ich den Ruhm des japanischen Salvini, der seit nahezu fünfzig Jahren die Japaner entzückt und begeistert, gerade so[S. 511] wie vor ihm sein Vater, sein Großvater und so fort bis zurück in die neunte Generation vor ihm, eine ganze Dynastie von Danjuros, ein Schauspieleradel, der auf neun Ahnen zurückblicken kann. Mit dem Leben haben diese letzteren ihm auch ihre hohe Kunst eingeflößt, sie haben ihn in die Traditionen des alten klassischen Schauspiels eingeweiht; von Vater auf Sohn sind die Sitten und Gebräuche der ritterlichen Feudalzeit bis aus die Gegenwart herabgekommen und mit ihnen auch die alten Kostüme und Trachten, die Danjuro als die kostbarsten Erbstücke bewahrt und verehrt. In ihm ist das alte Japan verkörpert, und die Japaner, die ihn sehen, sehen in ihm ihre eigenen Vorfahren.
Nach kurzer Pause hebt sich der Vorhang wieder, und Danjuro, den wir eben als alten Ritter bewundert haben, erscheint jetzt als alte Frau. Mit staunenswerter Kunst hat er sein Gesicht in ein aristokratisches Frauengesicht verwandelt und trägt das Frauenkostüm mit so viel Anmut, daß man schwören könnte, eine Frau vor sich zu haben. Sie beweint und beklagt den Tod ihres Gatten; ihr Sohn steht vor ihr, schmerzerfüllt über den Verlust des Vaters und entschlossen, sich selbst den Tod zu geben. Doch seine Mutter ruft ihm mit bewundernswertem Pathos die Worte zu: „Hab ich dich dafür mit meiner Brust genährt? Ist das in der That mein Sohn, der sterben will, ohne den Tod seines Vaters gerächt zu haben?”
Der alte Liebling der Japaner interessierte mich in so hohem Grade, daß ich mit Freuden den Antrag meines Dolmetschers annahm, das nächste Stück auf der Bühne zuzubringen und den Künstler persönlich kennen zu lernen. Aber gerade so wie in manchen anderen Ländern ist auch in Japan der Künstler vor den Kulissen ein anderer als hinter den Kulissen, und Danjuro ist ein ebenso eitler Geck wie viele seiner Kollegen in den uns näher liegenden Ländern. Ja er treibt es mit seinem Ruhme noch viel ärger. Ihn auf der Bühne oder in seinem Zimmer zu besuchen, ist nämlich nicht etwa eine Auszeichnung, sondern ein einfaches Geldgeschäft. Wie man zahlt, um in das Theater zu gehen, so zahlt man in Japan noch einmal, um die Lieblingsschauspieler des Landes in ihrem Toilettenzimmer zu sehen und von ihnen empfangen zu werden. Eine ganze Menge von Bewunderern umstanden den Eingang zu Danjuros Garderobe, und sein japanischer Impresario war gerade damit beschäftigt, ihnen gegen Erlag eines mehr oder minder großen Lösegeldes ihre Hüte und sonstigen Toilettegegenstände, die sie dem Schauspieler in ihrem Enthusiasmus zugeschleudert hatten, wieder zurückzugeben. Andere hatten Einlaß in das Heiligtum gefunden, und es war ergötzlich, die tiefen Verbeugungen und Huldigungen zu sehen, mit denen sie Danjuro begrüßten. Er selbst nahm diese mit anscheinend gleichgültiger Miene als etwas Selbstverständliches entgegen. Allmählich wurde er freundlicher, und als ihm einer seiner Verehrer vermutlich eine besondere Schmeichelei gesagt hatte, ließ er sich so weit herab, ihn mit einer Nadel aus seinem Haare zu[S. 512] beschenken; einigen Damen schrieb er seinen Namen in schwungvollen Zügen auf den dargereichten Fächer, und schließlich bereitete er sogar eigenhändig Thee zu und reichte den Damen die kleinen gefüllten Schälchen dar.
Die Zeit verrann, die Besucher verließen die Bühne, und Danjuro mußte daran denken, seine Toilette für das nächste Stück zu machen. Von seinem Zimmerchen oberhalb der Bühne konnte er diese ganz übersehen, und wie eine eigensinnige Primadonna begann er nun seine Anordnungen herunterzuschreien; nichts schien ihm recht zu sein; nervös ließ er sich dabei von drei oder vier unterthänigen Dienern die Kleider ausziehen, schließlich nahm er vor einem großen Spiegel auf dem Boden Platz, um sein Gesicht zu bemalen. Er sollte zunächst als japanische Tänzerin auftreten, und mit erstaunlicher Geschicklichkeit schuf er sich mit einer wachsartigen Salbe eine andere Nase, malte sich neue Augenbrauen, ließ sich Haar und Chignon zurechtrichten und schließlich die wunderbarsten Kleider anlegen, die in großen Bambuskörben verwahrt waren. Danjuros Garderobe hat nicht wenig zu seinem Ruhme beigetragen. Er besitzt viele Dutzende der kostbarsten alten Kleider aus Brokaten und anderen Stoffen, die in Bezug auf Qualität, Form und Zeichnung geradezu einzig sind. Viele sind seit Generationen Erbstücke in seiner Familie, nicht nur Theaterkleider, sondern wirkliche Rüstungen und Hofkleider alter Fürsten, die seinen Vorfahren zum Geschenk gemacht wurden und deshalb neben dem reellen auch historischen Wert besitzen. Seine Waffen, Pfeifen, Fächer, Ornamente aller Art sind wahre Prachtstücke, und mit Stolz zeigt er sie zuweilen selbst seinen Günstlingen oder Schülern. Vor einigen Jahren wurde ein Teil dieser Garderobe gestohlen. Die ganze Polizei von Tokio wurde aufgeboten, und nach langen Nachforschungen gelangte man wieder in den Besitz der gestohlenen Stücke. Als sie aber Danjuro gebracht wurden, wies er sie stolz zurück; niemals, so äußerte er sich, würde er wieder Kleidungsstücke anlegen, die durch die Hand von Dieben entweiht worden wären.
Der alte Mime hatte die Vorstellung so lange aufgehalten, bis er mit seiner Toilette fertig war, dafür war auch die Verwandlung in eine jugendliche Tänzerin so vollkommen, daß ich Danjuro in dieser niemals wiedererkannt hätte. Wir eilten nach unserer Loge zurück. Eben geht der Vorhang, ein Geschenk des Königs Kalakaua von Hawai, in die Höhe; ein halbes Dutzend Trommler erscheinen, gekleidet in die herrlichsten, blumenbestickten Seidengewänder, Trommeln in der Form von riesigen Sandgläsern auf dem Rücken, und kauern im Hintergrunde der Bühne auf dem Boden nieder. Ihnen folgen ebensoviele Musiker mit dem nationalen Musikinstrument der Japaner, dem Samisen, einer Art Guitarre. Die Trommler schlagen auf ihre Felle, die Guitarrespieler zupfen an ihren Samisensaiten, und Danjuro erscheint in geradezu traumhaft schönen, überreichen Gewändern, feenhaft leicht und graziös, das Vorbild eines japanischen Gaishamädchens. In der Mitte[S. 513] der Bühne angekommen, führt der Greis, den wir schon als Daimio und als alte Frau bewundert hatten, die berühmtesten Tänze der losen Gaishamädchen auf, wobei es seinem hohen Alter allerdings sehr zu statten kam, daß die japanischen Ballerinen ihre Tänze mit allen Teilen des Körpers, nur nicht mit den Beinen ausführen, und daß diese letzteren den Blicken des Publikums verborgen bleiben. Während unsere Ballettdamen in Bezug auf die Dekolletierung die äußersten Grenzen des Möglichen zu erreichen trachten, suchen ihre japanischen Kolleginnen im Gegenteil so viel der kostbarsten Stoffe als nur möglich auf sich zu häufen und jeden Körperteil, mit Ausnahme des Gesichtes, der Hände und der Fußspitzen zu verbergen, die verkehrte Welt. Ein geistreicher Mann hat einmal ganz richtig gesagt: „La décense commence, où finit la beauté!” Das gilt aber nur für Europäerinnen; ihre japanischen Schwestern haben das Wort „décence” nicht in ihrem Dictionnaire, denn dieselben Gaishamädchen, die bei ihren Tänzen ein ganzes japanisches Modemagazin auf ihr winziges Körperchen laden, baden vielleicht in ihrem Heimatdorfe auf offener Straße ohne das geringste Feigenblatt.
Danjuro tanzt ein Viertelstündchen lang; dann springt ein schwarzgekleideter Theaterdiener vor und hält eine Decke mit ausgestreckten Armen derart vor den Tänzer, daß dieser den Blicken des Publikums verborgen bleibt. Andere Diener mit schweren Kleidern auf den Armen erscheinen, und auf der Bühne, während Trommelschlag, Samisengezupfe und der miauende Gesang eines verborgenen Chors ertönen, wechselt Danjuro seine Toilette. In dieser, womöglich noch schöneren, führt er einen zweiten Tanz auf, ebenso graziös, aber ebenso monoton wie der erste. Ein dritter und vierter folgt, und schließlich kommt der Knalleffekt, das Auftreten der Damen Fukiko und Dschisuko, der Töchter Danjuros, als Tänzerinnen in Gemeinschaft mit ihrem Vater. Für die anwesenden Japaner mögen sie bewundernswerten Reiz und jugendliche Anmut in noch höherem Grade besitzen als der Vater, uns Europäern sind diese feinen Unterschiede nicht ganz verständlich. Unseren Begriffen nach erreicht niemand den alten Danjuro in Gesichtsausdruck, in der Klarheit und Deutlichkeit der Sprache, bei der jede einzelne Silbe, jeder Laut seine Bedeutung hat und die so manchem unserer europäischen Mimen als Muster dienen könnte, schließlich auch in der Pracht der Kostüme, sowie in der Leichtigkeit und Natürlichkeit, mit welcher Danjuro sie trägt.
Der alte Knabe nimmt in dem Shintomiza-Theater natürlich die erste Stellung ein, und seine festen Bezüge sind die höchsten, die je einem japanischen Schauspieler gezahlt wurden, dreitausend Yen, etwa sechstausend Mark jährlich. Was mögen unsere Salvinis und Rossis, die solche Summen für einen einzigen Abend erhalten, dazu sagen? Freilich tritt Danjuro auch in anderen Theatern Tokios und der Provinzstädte auf und verdient sich mit derlei Gastvorstellungen, mit Geschenken und Unterricht vielleicht noch ebensoviel. Die jüngeren Schauspieler spielen jahre[S. 514]lang ohne irgendwelche Bezüge in seiner Gesellschaft, nur um von dem großen Meister zu lernen, ja sie zahlen für den Vorzug, mit ihm auftreten zu können. Durch sie erhält sich auch auf der japanischen Bühne die alte Ueberlieferung, auf die man im Reiche des Mikado noch immer große Stücke hält, trotz des modernen Realismus, dessen Hauch mit der europäischen Kultur auch zu diesen Antipoden gekommen ist und das japanische Theater zu beeinflussen beginnt.
In seinem Privatleben ist Danjuro ein japanischer Gentleman, dessen Hauptleidenschaft das Angeln ist. Danjuro ist übrigens nur ein Theatername, der sich aus dem sechzehnten Jahrhundert von Vater auf Sohn bis zum heutigen Träger vererbt hat. In Japan führen nämlich merkwürdigerweise Maler, Schriftsteller und Schauspieler ebenso angenommene Namen wie bei uns. Seinen Freunden ist Danjuro unter seinem wirklichen Namen Horikoschi Schu bekannt.
Danjuro ist indessen nicht der einzige Repräsentant aus alten japanischen Theaterfamilien; allerdings hat keiner eine so große Zahl von Theaterahnen aufzuweisen wie er, aber doch giebt es einige Schauspieler, in deren Adern Jahrhunderte altes blaues Komödiantenblut rollt. So ist der nächst Danjuro beliebteste Schauspieler Genoske der vierte seines Namens. Auch Sodansche, ein Vetter Danjuros, hat mehrere Ahnen, aber dennoch werden selbst diese Schauspieler von der guten Gesellschaft in Japan gemieden und stehen in einer Art sozialem Bann, gerade so wie unsere eigenen Thaliajünger noch im vorigen Jahrhundert. Mit den modernen Anschauungen, die heute in Japan herrschen und immer mehr um sich greifen, dürften auch die Vorurteile gegen die Schauspieler allmählich verschwinden; mit ihnen wird aber auch die altjapanische klassische Bühnenkunst verschwinden, deren hervorragendster Vertreter heute noch der alte Danjuro ist.
In früheren Zeiten brachte die japanische Litteratur manches Schöne zum Vorschein; aber man würde weit vom Ziele schießen, wollte man annehmen, sie hätte sich jemals auf der gleichen Stufe mit der japanischen Kunst und Kunstindustrie befunden. Wohl reicht sie zurück in jene Zeiten, als wir Germanen noch Barbaren waren, und hat Werke aufzuweisen, wie das Koschiki, das aus dem Jahre 712, und das Nihondschi (japanische Chronik), das aus dem Jahre 720 stammt, aber die Romandichtung hat sich niemals auf besondere Höhe emporgeschwungen, und man würde gar nicht fehlgehen, den Roman von Tamenaga Schunsui „Treu bis in den Tod” nach unseren Begriffen als den besten zu bezeichnen, welchen die japanische Litteratur besitzt. Er ist auch in Japan selbst der populärste. Die ersten Dichtungen stammen aus dem elften Jahrhundert, und merkwürdigerweise waren ihre Verfasser auch in den folgenden Jahrhunderten bis auf die neuere Zeit hauptsächlich Damen. Griffis sagt darüber: „Im Mittelalter war es ein Hauptzeitvertreib der Hofgesellschaft, Gedichte zu schreiben und vorzutragen. Der Kaiser selbst ehrte eine Dame oft dadurch, daß er ihr ein Thema für ein Gedicht angab, und ein glücklicher Gedanke, eine wohlklingende Stanze oder ein hübscher Vortrag genügten, die betreffende Dame zur Ehrendame des Hofes,[S. 516] zur kaiserlichen Konkubine, ja selbst zur Kaiserin zu machen. Ein anderes Vergnügen bestand darin, Geschichten zu schreiben und vorzulesen, und so entstanden die Monogataris, aus welchen wir das Hofleben Japans im zehnten und elften Jahrhundert kennen lernen; die Edelleute und Edelfrauen der damaligen Zeit treten vor uns in all ihrer Frivolität, aber auch mit all der Eleganz ihres damaligen, in so aristokratischen Kreisen sich bewegenden Daseins.” Wir lernen aus diesen Schriften ihr Denken, ihre Liebeständeleien, ihre ewigen Mondlichtschwärmereien kennen, ebensogut wie die Gesellschaften, die sie veranstalteten, und die Kleider, die sie bei solchen Gelegenheiten trugen. Das erste aus jener romantischen Zeit stammende Buch ist ein Märchen, Taketori monogatari, d. h. Die Erzählung vom Bambusflechter, in welcher die Abenteuer eines Mädchens geschildert werden, das aus dem Monde nach unserer Erde verbannt wurde. Das bedeutendste und berühmteste Buch jener Zeit ist das Gendschi monogatari, von Murasaki Schikibu, der Tochter des Daimio von Etschizen, im Jahre 1004 verfaßt. Die schönste und reinste Sprache soll in ihren Dichtungen eine Konkubine des Kaisers, Sei Schonagan, besessen haben, die ebenfalls im elften Jahrhundert lebte. Die Männer schrieben damals und auch noch in den späteren Jahrhunderten nicht das reine Japanisch, sondern gebrauchten zahlreiche chinesische Ausdrücke, wie wir in unserem Mittelalter Griechisch und Lateinisch gebrauchten. China war das Griechenland von Ostasien; von dort stammten Wissen, Religion, Künste und Litteratur; nur die Frauen pflegten die reine japanische Sprache; einer der besten Kenner der japanischen Litteratur, W. G. Aston, sagt darüber: „In der Geschichte der Litteratur steht die Thatsache einzig da, daß der größte Teil der besten litterarischen Leistungen einer Nation aus der besten Epoche das Werk von Frauen ist.”
Nach der Wiedereinsetzung des Mikado in die weltliche Gewalt war es das Bestreben der leitenden Staatsmänner, die alten Traditionen wieder aufzufrischen; einmal in jedem Jahre, gewöhnlich im Januar, wird ein Thema zur poetischen Bearbeitung ausgeschrieben, und die ganze Nation kann an diesem Preisdichten teilnehmen. Auch der Kaiser, die Kaiserin und die höchsten Würdenträger senden ihre Arbeiten ein, die durchweg aus einunddreißig Silben in fünf Zeilen zu bestehen haben. 1889 war das Thema: Gebet für die Dynastie in einem Shintotempel, 1890 war es: Patriotische Glückwünsche, 1891: Die Langlebigkeit des grünen Bambus und dergleichen. Der bekannteste und gelesenste Novellist Japans ist wohl Bakin (1767 bis 1848), dem die japanische Litteratur nicht weniger als zweihundertneunzig Werke verdankt, darunter solche mit Dutzenden von Bänden. Das bedeutendste Werk dieses fruchtbaren Dichters ist Hakkenden, d. h. Die Geschichte von acht Hunden, in hundertundsechs Bänden. Eines der hübschesten von Bakins Büchern heißt „Die Gefangenen der Liebe” und wurde ganz kürzlich von einem Amerikaner, Edward Grey, ins Englische übersetzt. Glücklicherweise hat der Ueber[S. 517]setzer die Eigentümlichkeiten der japanischen Ausdrucksweise so viel wie möglich beibehalten, vor allem die steifen Höflichkeitsformeln, die sich so anhören, als ginge die Sprache auf Stelzen. In den „Gefangenen der Liebe” handelt es sich um zwei Samurai, die gegen die Ehre gesündigt haben, und um einen Jägersmann, der sich gegen die Religion vergangen hat, und nicht nur diese drei Personen, auch ihre Kinder werden dafür vom Zorn des Himmels verfolgt. Der Jäger hatte dadurch, daß er wie ein Priester betete, den heiligen Hirsch von fünf Farben in den Bereich seines Bogens gelockt und durch einen gutgezielten Pfeil getötet. Die beiden Samurai aber hatten ihren Daimio, Nitta Yoschisada, als dieser mit einem schwachen Gefolge von einem dreitausend Streiter zählenden Feind angegriffen wurde, nicht verteidigt, sondern waren feige geflohen.
Der ältere Samurai, Ritter Itara Tarago Takeyasu, trat in den Dienst eines anderen Daimio und heiratete Haschibusa, die Maitresse eines heruntergekommenen Priesters Namens Saikei, welcher der Sohn des obenerwähnten Jägers ist. Haschibusa vergiftet ihren Gatten zufällig dadurch, daß sie eine Eidechse in den Brunnen fallen läßt, aus dem der Samurai seinen Theetopf füllt. Der jüngere Bruder des Samurai, Ritter Itara Schiro-Schiro-Takeakira, schwört Rache, und in der Meinung, in der Dunkelheit den Priester Saikei vor sich zu haben, schlägt er der Witwe seines Bruders, Haschibusa, den Kopf ab. Er wird wegen Mordes angeklagt und begeht Harakiri.
Die Frau des Jägers stirbt an demselben Tage, an welchem der Jäger mit dem toten Hirsch von fünf Farben heimkehrt, und neun Jahre später stirbt er selbst an Wasserscheu. Ebenso ereilte seinen Sohn ein unnatürlicher Tod, und jeder, in dessen Besitz das Hirschfell gelangt, geht elend zu Grunde. Nach vielen Abenteuern wird auch Saikei, der Sohn des Jägers, von Taye, der Tochter des jüngeren Samurai, ermordet, und die Geschichte hat damit ihr Ende.
Bakin hat in seine Erzählung auch übernatürliche Elemente eingeflochten. Saikei hat einmal den Donner aus den Aesten eines Baumes befreit, in welche sich dieser verfahren hatte. Dafür schützt ihn die Frau des Donners eine Zeitlang vor den Verfolgungen der Taye; ja sie läßt ihn sogar während einer zeitweiligen Erlahmung des Donners dessen Platz in den Wolken einnehmen.
Sehr naiv sind die vielen Randbemerkungen, welche Bakin seiner Erzählung beifügt. So sagt er vom Donner ganz ernstlich: „Die Erde ist voll von Schwefel und Salpeter, die in Form von Dunst emporsteigen und oben sich vereinigend zu Dampf werden, der die Eigenschaften von Schießpulver hat. Wenn dieser Dampf sich der Sonnenhitze zu sehr nähert, so entzündet er sich plötzlich, und die Explosion wird in der ganzen Welt gehört.”
An einer anderen Stelle, wo er von Mord und Totschlag seiner Romanhelden erzählt, sagt er in einer Randnote: „Es ist manchmal schwer, die Sucht, Böses zu[S. 518] stiften, zu beherrschen, aber wenn Du Dich (Leser) nur ernstlich bestrebst, gut zu sein, so wird es schon gelingen. Ich wünsche sehr, daß dies geschähe. Bakin.”
Nächst Bakin und Tamenaga Schunsui wird wohl Schippenscha Ikku der geistvollste moderne Romanschreiber sein; seine Dichtung Hiza Kurige zählt zu den ersten Meisterwerken der japanischen Litteratur. Ikku schildert darin mit sehr viel Humor die Abenteuer zweier armer Schlucker, welche zu Fuß den weiten Weg auf dem Tokaido von Kioto nach Tokio zurücklegen.
Im ganzen und großen ist die Romanlitteratur Japans lange nicht so reichhaltig, als man in Europa anzunehmen scheint, und nur die wenigsten Werke sind für Europäer wirklich ansprechende Lektüre. Unter ihnen nimmt gerade der eben in deutscher Uebersetzung erschienene Roman von Tamenaga Schunsui, wie gesagt, die erste Stelle ein, weil er auf den erhebendsten Ereignissen der japanischen Geschichte fußt, und die Japaner können von Glück sagen, daß sie gerade mit diesem Roman in der europäischen Leserwelt debütierten. Der weitaus größte Teil der japanischen Romane sind eher Ammenmärchen oder abenteuerliche Geschichten für Schuljungen. Basil Hall Chamberlain, Professor an der kaiserlichen Universität von Tokio und auch von den Japanern als der beste Kenner ihrer Litteratur angesehen, sagt darüber den Japanern ins Gesicht: „Es finden sich in ihren Erzählungen manche hübsche und geistreiche Stellen; sie sind auch von großem Werte für Philologen, Archäologen, Geschichtsforscher, aber vieles, was die Japaner in ihrer Litteratur am höchsten schätzen, ist nach europäischem Geschmacke unausstehlich fade und nichtssagend. Die Romane sind ebenso langweilig wie die Geschichtswerke, und viel zu langatmig.” An einer anderen Stelle sagt Chamberlain gerade von dem Meister des japanischen Romans, von Bakin: „‚Wie unnachahmlich!‘ rufen die Japaner entzückt von Hakkenden, einem Roman, den jeder gelesen und wiedergelesen hat, bis er ihn beinahe auswendig kennt. ‚Wie ausgezeichnet!‘ Ausgezeichnet, ja, antwortet der Europäer, ausgezeichnet zum Einschlafen, mit seinen langweiligen Schilderungen unmöglicher Abenteuer, die sich durch hundertundsechs Bände winden. Die japanische Litteratur ist ohne Genius, ohne Gedanken, ohne Logik, Tiefe und Breite, ohne Vielseitigkeit.”
Das ist das Urteil jenes Gelehrten, der in seiner Stellung am ersten berufen ist, ein solches zu fällen. Die Japan-Enthusiasten, die alles in den Himmel erheben, was aus Japan kommt, was Japan thut und Japan läßt, können aber auch andere anerkannte Autoritäten zu Rate ziehen, sie werden überall das gleiche Urteil finden, Satow, Griffis, Aston und so fort. Vielleicht werden diese Enthusiasten erwidern, daß die moderne japanische Litteratur seit der Restauration des Mikado zu größeren Hoffnungen berechtigte. Chamberlains Urteil ist in dieser Hinsicht geradezu vernichtend. In seinen Things japanese, ein Buch, das 1891 in Yokohama erschienen ist, heißt es darüber in sehr bemerkenswerter Weise:
„Die Eröffnung des Landes (der europäischen Kultur) hat der eigentlichen japanischen Litteratur den Todesstoß versetzt. Wohl verlassen die Presse jährlich Tausende von Büchern und Broschüren, also vielleicht mehr als jemals zuvor. Aber die Mehrzahl davon sind Uebersetzungen europäischer Werke oder Bücher, von europäischen Ideen beeinflußt. Das ist auch natürlich und ganz in Ordnung. In jedem Wissenszweig wird von der gegenwärtigen Schule europäisierter Autoren, wie Fukuzawa, Nischi Schu, Kato Hiroyuki, Toyama Masakazu und anderen ungemein viel den Japanern zugänglich gemacht. Aber natürlicherweise interessieren diese Uebersetzungen, Umschreibungen und Nachahmungen den europäischen Leser, dem die Originalwerke zur Verfügung stehen, viel weniger als die japanischen Bücher des alten Regime. Selbst die japanische Romanschreiberei geht nun nach europäischem Muster von statten. Nicht nur Methoden werden im Bausch und Bogen angenommen, sondern ganze Geschichten, und die europäischen Namen werden in japanische umgewandelt, z. B. Schmidt in Schimidu, Elisa in O Riza und andere. Europäische lokale Verhältnisse werden den japanischen Verhältnissen angepaßt.... Wir würden gerne zehntausend gegen eins wetten, daß nicht ein einziger Leser dieses Buches (Things japanese) jemals den Helden des volkstümlichsten Romans erraten würde, das unter dem gegenwärtigen Herrscher erschienen ist. Er ist Epaminondas. Das fragliche Werk nimmt sich unter dem Titel Keikoku Bidan das ganze Feld der thebanischen Politik zum Vorwurf. Ein Grund der ungeheuren Verbreitung des Werkes ist wohl der, daß nicht wenige Stellen des Inhalts ohne viel Schwierigkeit auf die moderne japanische Politik gedeutet werden können. Der Verfasser, Yano Fumio, hat sich aus dem Ertrag des Buches ein schönes Haus gebaut und eine Reise nach Europa unternommen.”
„Eine andere erfolgreiche Novelle, Kaschin no Kigu, beginnt im Kapitol zu Washington, wo ein Japaner seinem Begleiter die amerikanische Unabhängigkeitserklärung vorliest. Die Karlisten, die schlimmen Engländer, welche die Aegypter ihres eingeborenen Helden Arabi Pascha beraubten, alles das erscheint in kaleidoskopartiger Mannigfaltigkeit in diesem Werke, das, merkwürdig genug, im klassischen chinesischen Stil geschrieben ist.”
So weit Professor Chamberlain. Freilich wäre es doch möglich, daß gerade wegen der so weitgehenden, um nicht zu sagen, ausartenden Europäisierung der japanischen Litteratur eine Gegenströmung zum Vorschein käme, wie ich sie in Japan in Bezug auf Kleidung, Manieren, Kunst, Theater vielfach bemerkt habe. Es bestehen jetzt schon eine Anzahl Vereine zur Pflege der alten Traditionen, zur Erhaltung des geschichtlichen vormärzlichen Japan, wenn man so sagen darf. Aber es ist doch eine eigene Sache, wenn eine Litteratur wie eine Treibhauspflanze künstlich gepflegt und erhalten werden muß. Der innere Wert, die auf dem Leben und Treiben des Volkes ruhende Grundlage, Kraft und Saft, fehlen gewöhnlich[S. 520] derartigen Erzeugnissen, und wird schwerlich mehr in Japan ein zweiter Sumschin, ein zweiter Bakin kommen. Kommt er aber, so wird auch sein Geist, gerade so wie er selbst, europäische Formen zeigen.
Zum Schlusse noch ein Wort über die japanischen Bücher. Bei Romanen und Novellen, Märchen und alten Geschichtswerken wird auch heute noch die alte Form angewendet; die Papierbogen, lange Streifen, werden nur auf einer Seite bedruckt und dann in dem Format unserer Bücher so zusammengefaltet, daß die bedruckten Seiten die Außen-, die leeren die Innenseiten bilden. Dann werden diese gefalteten Bogen mit Bindfaden zusammengeheftet, und ein dünner Umschlag wird darübergeklebt. Würde man die Blätter aufschneiden, so würden auf diese Weise immer zwei bedruckte und zwei leere Seiten einander folgen. Aber die Blätter der japanischen Bücher werden nicht aufgeschnitten. Umschläge und Text sind sehr häufig in künstlerischer Weise mit farbigen Bildern ausgestattet. Die Seiten sind nicht numeriert, und wie bei arabischen und chinesischen Werken befindet sich der Titel auf der letzten Seite. Das Papier ist viel leichter, fester und weicher als jenes der europäischen Druckwerke. In neuester Zeit ist weiches, geripptes Papier für Märchenbücher und ähnliche Druckwerke sehr beliebt geworden. Die eigentümlichen, crêpeartigen Rippen werden dadurch hergestellt, daß die bereits gedruckten Bogen über Bambusstäbe gepreßt werden, deren Faserzeichnung das Papier dadurch annimmt.
Die wissenschaftlichen Werke, Uebersetzungen europäischer Werke und auch manche einheimische werden in den letzten Jahren ganz so gedruckt und gebunden wie die europäischen Originale: steifer Deckel und Leinwandrücken mit Golddruck.
Ueberraschend schnell hat sich in Japan das Zeitungswesen entwickelt. Im Jahre 1864 wurde das erste Blatt in japanischer Sprache gegründet und hatte in der ersten Zeit mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen. Dennoch entstanden bis zum Jahre 1874 weitere zehn Zeitungen, die indessen nicht regelmäßig erschienen und keine selbständigen Nachrichten, sondern nur Uebersetzungen aus den englischen Tagesblättern brachten. Redakteur und Herausgeber, Nachrichtensammler, Drucker und Austräger waren in einer Person vereinigt. Erst nach der Revolution, mit dem Beginn der neuen Aera, entwickelte sich das Zeitungswesen und umfaßt heute 600 regelmäßig erscheinende Blätter. Tokio allein hat über zwanzig Tagesblätter mit zusammen einer Viertelmillion Auflage, ferner 130 Wochen- und Monatsschriften mit zusammen einer halben Million Auflage.
Unter den bedeutenden einheimischen Tageszeitungen steht der offiziöse Nitschi Nitschi Schimbum (Die neuesten Nachrichten) an der Spitze. Er beschäftigt über hundertundfünfzig Personen, darunter einen Chef-, einen politischen, fünf Hilfsredakteure, zwölf Berichterstatter, zwei Stenographen, nur vier Setzer, deren jeder allerdings mehrere Gehilfen hat, dagegen zwölf Drucker. Wie bei fast allen[S. 521] japanischen Blättern bildet auch bei diesem das Reportertum den wundesten Punkt. Da die Reporter nach der Zeile bezahlt werden, und zwar sehr schlecht, so besteht der größte Teil der von ihnen berichteten Neuigkeiten aus Gebilden der eigenen Phantasie. Trotzdem verdienen sie durchschnittlich nur vierzig Mark monatlich. Sehr hervorragend sind unter den hauptstädtischen Zeitungen ferner der radikale Dschidschi Schimpo (Unsere Zeit) und der Hotschi Schimbun, das Organ des Grafen Okuma. Der Dschidschi Schimpo hat die Besonderheit, fortwährend große Reformpläne vorzubringen, die sich auf dem Papier sehr gut ausnehmen, denen es aber an Berührungspunkten mit dem praktischen Leben fehlt.
Großes Ansehen genießen auch der liberale Mainitschi Schimbun (Tägliche Neuigkeiten), der Herrn Nüma gehört, dem Vorsitzenden des Parlaments, dann der ebenfalls freisinnige Tschoja Schimbun (Amts- und Volksnachrichten), der konservative Tokio Dempo (Jedoer Telegraph), welcher als das Organ des früheren Handelsministers Generals Tami gilt, endlich der radikale, von einem japanischen Mitglied des britischen Barreaus redigierte Koran Schimpo (Oeffentliche Meinung), das Sprachrohr des Chauvinisten Grafen Itagaki und des Grafen Goto, eines strebsamen Politikers, der sich seit längerer Zeit vergeblich bemüht, die Führerschaft der radikalen Opposition zu erhalten. Uebrigens decken sich die Ausdrücke liberal, radikal, freisinnig in ihrer Anwendung auf japanische Zeitungen und Politiker vorläufig noch nicht mit dem, was man in Europa unter denselben versteht, denn einstweilen hat der blutjunge Parlamentarismus des Mikadolandes noch nicht zur endgültigen Bildung von bestimmten Parteien geführt.
Die Zensur ist zwar abgeschafft, aber die Presse hat, wie in Rußland, nicht wenig von den Behörden zu leiden. In einem Saale des Polizeigebäudes von Tokio sitzen zahlreiche Beamte, denen die Aufgabe obliegt, sämtliche einheimische Preßorgane nach Erscheinen auf Gesetzwidrigkeiten hin zu prüfen. Hat einer der mit Schere und Rotstift bewaffneten Herren etwas Verdächtiges erspäht, so legt er es seinem Chef vor, der seinerseits mit der Regierung sich ins Einvernehmen setzt. Wird es höhern Orts gewünscht, so ladet man den betreffenden Redakteur höflichst ein, bei der Polizei zu erscheinen, wo er dann ohne Umschweife die freundliche Mitteilung erhält, sein geschätztes Blatt sei auf so und so viele Tage und Wochen verboten. Nicht immer bleibt es bei dem Verbote, häufig kommt es auch zur gerichtlichen Verurteilung, zu Gefängnis. Um sich dieser Unannehmlichkeit zu entziehen, stellen viele Redakteure, was ja auch anderswo vorkommen soll, Strohmänner an, die gegen geringe Bezahlung und in Anbetracht eines beneidenswerten Müßigganges den Verantwortlichen spielen.

Scene aus dem Kriege
Japans gegen China:
Fünf japanische Pioniere schlagen über hundert
chinesische Soldaten in die Flucht.
Es mag sein, daß sich die Japaner, als sie den tollkühnen Entschluß faßten, den chinesischen Koloß zu bekriegen, nicht ihre eigenen Erfahrungen vor Augen hielten, sondern jene der Franzosen und Engländer, die dasselbe Wagnis noch unter viel ungünstigeren Umständen und mit noch viel geringeren Mitteln ausführten. Zehntausend Franzosen und Engländer waren vor etwa vier Jahrzehnten im stande, selbst Peking einzunehmen und den Chinesen in ihrer eigenen Hauptstadt den Frieden zu diktieren. In ihrem Dünkel hielten die Japaner ihre Truppen thatsächlich jenen der europäischen Mächte für gleichwertig, und möglicherweise sagten sie sich, wenn so geringe Truppenmengen aus so großen Entfernungen derartige Erfolge zu erzielen vermochten, so konnte der Sieg der so viel größeren Armee ihres, China so nahe gelegenen Heimatlandes nicht ausbleiben.
In der That haben die Japaner in der Organisierung und Ausbildung ihrer kleinen Armee Staunenswertes geleistet, ja, wer die japanischen Truppen auf dem Exerzierplatz oder auf dem Manöverfeld gesehen hat, dem muß es geradezu unglaublich erscheinen, daß dieselben Leute, die heute so stramm und nach allen Regeln europäischer Kriegskunst exerzieren, noch vor fünfunddreißig Jahren in mittelalterlichen Rüstungen steckten, daß sie an Stelle von modernen Hinterladergewehren und gezogenen Feldgeschützen mit Bogen und Pfeil bewaffnet waren.
Die Zustände in Japan waren damals jenen ähnlich, die in Deutschland vor der Erfindung des Schießpulvers herrschten. Das Land war in den Händen der[S. 523] feudalen Edelleute, die in ihren Ritterburgen saßen und ihre eigenen Fähnlein von Knappen und gerüsteten Kriegsleuten, die Samurai, unterhielten. Jeder dieser Daimios war ein kleiner, nahezu unabhängiger Fürst, der Kaiser aber war machtlos. Heute ist er der Herrscher, die Daimios sind mediatisiert, ihre Staaten sind in Dai Nipon, d. h. Großjapan, aufgegangen, ihre Armeen aufgelöst, und die alten Samurai stecken in Uniformen nach europäischem Muster.
Wenn man heute in Japan einer, wenn auch kleinen, so doch vollständig modernen Armee begegnet, die innerhalb der letzten zwanzig Jahre geschaffen wurde, wenn man erfährt, daß ihre Bewaffnung und Ausrüstung im Lande gefertigt und dort große Arsenale, Schiffbauwerkstätten, Militärschulen und Akademien sozusagen aus dem Boden gestampft wurden, so muß dies bei dem militärischen Fachmanne gerechtes Erstaunen, wenn nicht Bewunderung erwecken. Aber die Leistung ist in Wirklichkeit noch großartiger, als sie für den ersten Augenblick erscheint; denn die Soldaten hatten nicht etwa wie unsere Rekruten den Zivilrock aus- und den Militärrock anzuziehen. Sie mußten, figürlich gesprochen, die altjapanische Zivilisation ausziehen und in die moderne europäische Zivilisation hineinschlüpfen, denn das moderne Soldatentum ist mit den alten Sitten und Trachten der Japaner vollständig unverträglich. Bei den alten Samurai und Daimios war der asiatische, streng ausgesprochene Kastengeist seit vielen Generationen in Fleisch und Blut übergegangen. In die moderne Armee eintretend, fanden sich viele Samurai plötzlich ihren einstigen Untergebenen untergeordnet. Anscheinend war dies ein geradezu unübersteigbares Hindernis für die Disziplin des Heeres. Die übergroße, für europäische Augen geradezu lächerliche Höflichkeit der alten Zeit ist bis auf den heutigen Tag in Japan allgemein wahrnehmbar.
Unter Männern verschiedener, nie gleicher Stellung herrscht ein fortwährendes Verbeugen und Komplimentieren, der Untergebene wirft sich vor dem Höheren bei Besuchen in seinem Hause auf die Knie und berührt mit der Stirn den Boden. Gestern that er es noch und heute, nachdem er den Soldatenrock angezogen, soll er stramm und steif vor demselben Höheren dastehen und möglicherweise ihm scharf ins Auge blicken. Gestern bestand seine einzige Kleidung in einem losen, an den Hüften umgürteten Schlafrock, dem Kimono, und einem Paar Schlappschuhen oder Strohpantoffeln. Hals und Brust, Arme und Beine waren bloß. Heute hat er die stramme Militäruniform zu tragen mit dem beengenden Halskragen und den vielen, ihm vollständig ungewohnten, ja sogar unbekannten Knöpfen; statt des leichten Strohhutes muß er den schweren Tschako, statt des kleinen Fächers das Gewehr, statt der Strohpantoffel die schlimmsten Marterinstrumente der Japaner, Röhrenstiefel, anziehen, in denen er sich fühlen muß wie in den spanischen Stiefeln der Inquisition.
Gestern schlüpfte er beim Betreten eines Hauses aus seinen Strohpantoffeln und betrat die schönen reinen, teppichgleichen Matten mit bloßen Füßen oder in[S. 524] Strümpfen. Heute wird nun gerade das Gegenteil von dem Soldat gewordenen Japaner verlangt: er darf seine Stiefel nicht ausziehen, wenn er Wohnräume betritt. Gestern waren ihm Tische und Stühle unbekannte Dinge. Er saß und lag und aß auf dem Boden. Heute muß er auf Betten liegen, auf Stühlen sitzen, an Tischen seine Mahlzeiten einnehmen.
Diese wenigen Beispiele genügen, um zu zeigen, daß der Japaner beim Eintritt in die Armee seine ganze bisherige Lebensweise, ja sein Japanertum aufgeben muß, und es kann der japanischen Armee deshalb kein größeres Kompliment gemacht werden, als wenn gesagt wird, daß sie sich diesen ihr fremden, steifen, ja geradezu abstoßenden Vorschriften ohne Murren fügte und daß Insubordination nur selten vorkommt. Wie ich von europäischen Offizieren in Japan erfuhr, sind in den Kasernen gar keine Arrestlokale vorhanden; die wenigen, die hie und da zu finden sind, stehen meistens leer. Die Leute gewöhnen sich überraschend schnell an die europäisch-militärische Erziehung, sie lernen rasch und sehen in den reinlich gehaltenen, gut sitzenden Uniformen ganz martialisch aus.
Diese Thatsachen sind viel überraschender als das Vorhandensein der europäischen Militäreinrichtungen selbst. Die letzteren wurden einfach mit affenartiger Leichtigkeit und Genauigkeit Europa abgelernt. Die Japaner schickten zahlreiche Offiziere und Techniker nach Europa, wo ihnen mit etwas zu weit gehender Liebenswürdigkeit Thüren und Thore geöffnet wurden; sie beriefen Offiziere aus den europäischen Armeen, Ingenieure und Werkleute aus den europäischen Arsenalen, erwarben europäische Waffen, Gewehre, Geschütze, Ausrüstungsgegenstände, Maschinen und dergleichen, aber diese letzteren wurden nicht etwa in der erforderlichen Zahl bezogen, sondern nur als Modelle, um darnach andere in Japan selbst herzustellen. Die Europäer zeigten ihnen das Wie, und als die Japaner ihnen alles genau abgeguckt hatten, gab man den Europäern den Laufpaß. Selbst mit den Patenten wurde weitgehender Mißbrauch getrieben; man veränderte nur irgend einen Bestandteil und gab dann den betreffenden Gegenstand als eigene Erfindung aus. So z. B. ist die Infanterie mit Hinterladergewehren System Murata bewaffnet, die nichts anderes sind als französische Grasgewehre, von dem findigen japanischen Oberst Murata etwas verändert. Dank diesem recht fragwürdigen Vorgehen findet man heute in Tokio ein Arsenal, das vollständig den europäischen Waffenfabriken nachgemacht ist, und das von den Japanern mit so viel Stolz gezeigte Arsenal in Osaka ist im ganzen wie in allen Details eine verkleinerte Kopie des Arsenals von Woolwich; dieselbe Einteilung, dieselben Maschinen, dieselbe Arbeit, nur daß sich die guten Japaner aus anderen Arsenalen die modernsten Erfindungen und Verbesserungen absahen oder vielmehr abstahlen und in Osaka zur Anwendung brachten. Der Europäer aber, der diese Kriegswerkstätten, diese Militärschulen und Akademien, diese Kasernen und militärischen Einrichtungen besichtigt, wird von den stolzen[S. 525] Japanern mit dem Zaunpfahl eingeladen, alles rückhaltlos zu bewundern, und sie sind höchst ungehalten, wenn man ihnen vorwirft, daß das alles andere, nur nicht japanisch ist. Dank der Nachsicht und dem Entgegenkommen der europäischen Militärbehörden ist es den Japanern gelungen, diese letzteren und damit auch die europäischen Industrien über den Löffel zu barbieren. Mit diesen geborgten Einrichtungen haben die Japaner nun ein vortreffliches Heer geschaffen, das auf allgemeiner Wehrpflicht fußt. Vom siebzehnten bis zum vierzigsten Lebensjahre ist jeder Japaner auf Grund der 1889 etwas umgeänderten Militärgesetze des Jahres 1872 wehrpflichtig. Die Armee besteht aus dem stehenden Heere, der ersten Reserve, der zweiten Reserve und der Territorialarmee. In dem stehenden Heere beträgt die Dienstzeit drei Jahre, in der ersten und zweiten Reserve vier Jahre und in der Territorialarmee fünf Jahre. Die letztere wird nur im Kriegsfalle einberufen, die erste und zweite Reserve nur während sechzig Tagen im Jahre.
Nun beträgt die festgesetzte Friedensstärke der Armee auf dem Papier etwa 70000, in Wirklichkeit aber nur 40000 Mann. Bei einer Bevölkerung von 41 Millionen Seelen werden jedoch im Jahre über 200000 junge Leute dienstpflichtig. Was geschieht mit den Ueberzähligen?
Vor allem wurde das System der Einjährig-Freiwilligen ganz nach deutschem Muster eingeführt; ferner werden vom aktiven Militärdienst ausgenommen: Personen, die unter 4 Fuß 11½ Zoll groß sind, und das scheidet bei der kleinen Körperstatur der Japaner schon einen ganz beträchtlichen Prozentsatz der Rekruten aus.
Ebenso sind vom aktiven Dienste befreit: Familienhäupter, Priester, Lehrer und Schüler der von der Regierung anerkannten Bildungsanstalten, Aerzte und Regierungsbeamte, deren Dienst nicht von Stellvertretern besorgt werden kann; einer von zwei gleichzeitig einberufenen Brüdern oder ein Mann, dessen Bruder dient oder der einen Bruder im aktiven Dienste verloren hat.
Diese Ausnahmen erreichen im Jahre durchschnittlich vierzig Prozent der Stellungspflichtigen, da aber noch immer nahezu dreimal so viel Rekruten als erforderlich zur Verfügung bleiben, so wird eine durch das Los bestimmte Anzahl nur für ein Jahr dem aktiven Dienste einverleibt und dann in die erste Reserve versetzt.
Der Oberstkommandierende der Armee ist der Kaiser, dem als Generalstabschef der Marquis Oyama zur Seite steht und der gewissermaßen als Armeechef anzusehen ist. Die Organisation und Verwaltung der Armee untersteht dem Kriegsministerium. Die stehende Armee ist in 12 Divisionen eingeteilt, deren Hauptquartier in verschiedenen Hauptstädten des Inselreiches liegt. Jede Division besteht aus 2 Infanteriebrigaden, 1 Kavallerie- und einem Feldartillerie-Regiment, dann je 1 Genie- und Trainbataillon; jede Brigade aus 2 Infanterieregimentern zu 3 Bataillonen mit je 4 Kompagnien. Ein Infanterieregiment besteht aus 1 Oberst oder Oberstleutnant, 4 Majoren (von denen einer im Stabe), 1 Adjutanten, 12 Haupt[S. 526]leuten als Kompagniechefs, 27 Leutnants, von denen je 2 in einer Kompagnie und 3 im Stabe, 25 Fähnrichen, 15 Feldwebeln, 82 Gunso oder Obersergeanten, 48 Sergeanten, 192 Korporalen, 432 Soldaten erster und 816 Soldaten zweiter Klasse. Hierzu kommen 65 Nichtkombattanten, darunter Zahlmeister, Aerzte, Krankenpfleger, Rüstmeister, Handwerker und dergleichen und 14 Pferde, zusammen also 1720 Mann und 14 Pferde.
Im Kriege wird das Regiment auf 2880 Mann gebracht.
Ein Kavallerieregiment besteht aus 3 Schwadronen mit je 159 Offizieren und Soldaten und 135 Pferden, in Kriegsstärke mit 189 Mann und 145 Pferden. Die Artillerie ist in Brigaden zu je 2 Batterien mit 4 Geschützen eingeteilt, und jede Brigade besteht in Kriegsstärke aus 10 Offizieren und 326 Mann mit 12 Geschützen und 258 Pferden.
Im Kriege kommen zu den einzelnen Divisionen noch 1 Pionierkompagnie mit Brückenequipagen und dergleichen, ferner je 1 Sanitäts- und Feldtelegraphenabteilung; ein Pferdedepot, Munitions- und Verpflegungskolonnen, endlich eine Anzahl Ambulanzen. Die Truppenergänzung geschieht durch 24 über das ganze Land verteilte Depotsbataillone der aktiven und 12 der Territorialarmee. Die letztere stellt im Kriege 12 Infanterieregimenter, ebensoviele Kavalleriepeletons und Geniekompagnien mit der entsprechenden Menge der anderen Waffengattungen.
Die Kriegsstärke der japanischen Armee mit Ausschluß der Territorialarmee wird von den Japanern wie folgt angegeben:
davon Stabsoffiziere 450, Oberoffiziere 3360, Unteroffiziere 10391; die Zahl der Feldgeschütze ist 252.
In den vorstehenden Zahlen dürfte dem militärischen Fachmanne wohl die geradezu verschwindend kleine Kavallerie am auffälligsten sein. Allerdings ist dieselbe, wie ich höre, in den letzten Jahren auf über 3000 Mann gebracht worden, doch beträgt sie im Verhältnis auch dann nur ein Zehntel der Kavallerie in den europäischen Heeren. Erklärlich wäre dieses Mißverhältnis im Falle eines feindlichen Angriffes auf Japan, da das Land größtenteils aus Gebirgen und sumpfigen Reisfeldern besteht, Kavallerie also nicht entfernt in ähnlichem Maße verwendet werden kann wie in Europa. Für einen auswärtigen Krieg aber, wie der jüngste in China,[S. 527] ist die japanische Kavallerie absolut unzulänglich, einer der größten Nachteile, unter denen die Japaner zu leiden gehabt haben.
Soweit eine Reiterei in Japan vorhanden ist, wird sie von europäischen Fachleuten günstig beurteilt. Die Reiter sind nett uniformiert, sehen gut aus, sitzen stramm auf den kleinen, aber kräftigen Pferden und exerzieren gut. Auffällig ist hier, wie auch bei den anderen Waffengattungen, die geringe Verwendung von Trompetensignalen; die Kommandos werden hauptsächlich durch Säbelsignale gegeben; außer dem Säbel führen die Reiter der Gardekavallerie Lanzen, jene der Linie Muratakarabiner.
Die Pferde werden mit vier Jahren in den Dienst gestellt und durchschnittlich mit sechzehn Jahren ausgeschieden. Der Kaufpreis beträgt etwa 280 Mark. Seit neuester Zeit ist das deutsche Hufeisen als Beschlag eingeführt, auch erhalten die Pferde jetzt im Stalle Streu, während sie bisher auf dem nackten Holzboden standen, aber nicht mit dem Kopfe gegen die Stallwände, sondern, wie ich es auch in China und Korea wahrgenommen, mit dem Kopfe gegen den mittleren Durchgang, resp. nach außen gewendet, wodurch sie entschieden mehr Luft und Licht genießen als europäische Pferde. Die Stallungen sind auch viel höher und breiter, die Abteilungen viel geräumiger als in Europa.
Die Infanterie wird von Fachleuten ebenfalls sehr gelobt; obschon in Statur viel kleiner als europäische Soldaten, sehen die Leute doch stramm und kriegerisch aus, halten sich und marschieren gut, führen Bewegungen mit Sicherheit und Verständnis aus und handhaben ihre Waffen auf dem Exerzierplatz wie bei Schießübungen überraschend gut. Auffällig ist es, daß sie beim Bajonettfechten, ebenso wie die Reiter beim Säbelfechten, Ausfälle oder Paraden mit Schreien begleiten. Der Dienst wird sehr streng gehandhabt, entschieden strenger als in manchen europäischen Armeen, und die Leute dürfen nur zweimal in der Woche die Kaserne verlassen. Dafür ist in diesen Kasernen alles mögliche geschehen, um die Soldaten bequem unterzubringen. Die Schlafsäle, gewöhnlich für zwanzig bis dreißig Mann bestimmt, sind hoch, luftig, licht, geräumig, mit erträglichen Betten und Kopfbrettern und hinreichend Tischen und Bänken, alles von peinlichster Sauberkeit. Jede Kaserne ohne Ausnahme hat Krankenzimmer und eigene große Badehäuser mit heißem und kaltem Wasser, wo die Soldaten nach Belieben täglich zwei- oder dreimal baden können, ein Luxus, der bei uns nur den wenigsten vergönnt ist. Auch die Küche ist von besonderer Sauberkeit, allerdings keine außerordentliche Leistung, wenn man die überaus einfache Kost der japanischen Soldaten berücksichtigt. Fleischspeisen erhalten sie überhaupt nicht, ebensowenig Brot in unserm Sinne als tägliche Nahrung. An ihre Stelle treten dreimal am Tage gekochter Reis mit etwas Gemüse, die großen weißen Rettiche, Daikon genannt, und allenfalls zur Abwechslung Bohnen oder getrocknete Fische. Ihre Löhnung, nach allen Abzügen etwa[S. 528] zwei Yen (nach dem heutigen Kurse ungefähr vier Mark), wird ihnen monatlich ausbezahlt.
Von allen Waffengattungen wird die Artillerie am meisten gelobt. Ein englischer Artilleriemajor, namens Henry Knollys, erlaubt sich in seinem Buche „Life in Japan” folgendes, von englischem Dünkel diktiertes Urteil über dieselbe: „Sie ist in keiner Hinsicht auch nur annähernd so gut wie die englische Artillerie, aber soweit die Beurteilung in Friedenszeiten überhaupt möglich ist, werden die japanischen Feldbatterien im Vergleich mit jenen Frankreichs, Belgiens oder Deutschlands nicht zurückzustehen brauchen.” Ihre Geschütze sind 7½-Centimeter-Hinterlader aus der Uchatiusschen Stahlbronze im Arsenal von Osaka hergestellt und mit je sechs Pferden bespannt. Die Geschütze sind nicht aus blankem Metall, sondern mit japanischem Lack überzogen. Als Bedienungsmannschaft sind für jedes Geschütz fünf Kanoniere und ein berittener Unteroffizier vorhanden.
Das Offizierkorps der Japaner verdient alles Lob; viele Offiziere haben in europäischen Armeen gedient und sprechen eine der drei europäischen Hauptsprachen, wie ich es selbst unter den Offizieren der in Korea stehenden Division erfahren habe. Diese Division war die erste, welche seit der Neuorganisierung der japanischen Armee auf den Kriegsfuß gebracht wurde, und ich fand all das auf dem Papier verzeichnete Material thatsächlich vorhanden. Die Pioniere führten ihr ganzes Brückenmaterial mit sich, eine Telegraphenabteilung legte während meines Rittes von der Hauptstadt Söul nach Chemulpo den Feldtelegraphen, auf dem Wege fand ich Munitions- und Sanitätskolonnen, die Batterien hatten ihre sechs Geschütze und ihren ganzen vorgeschriebenen Bestand, das ganze Korps machte überhaupt einen vortrefflichen Eindruck.
Deshalb ist auch die Armee in Japan, im Gegensatz zu China, sehr beliebt und geachtet. Von seiten wohlhabender Bürger geschieht schon im Frieden vieles, um das Los der Vaterlandsverteidiger zu verbessern, aber während des Krieges mit Korea war es geradezu rührend, welche Massen von Tabak, Sake (Reiswein), Nahrungsmitteln aller Art sowie Geldbeiträge den Soldaten von Japan aus zugesandt wurden.
Eines wichtigen Zweiges des Militärwesens muß hier noch gedacht werden: der Krankenpflege. Bei dem chinesischen Heere besteht eine solche als selbständige Organisation überhaupt nicht. Die Chinesen haben weder Militärärzte noch irgend welche Einrichtungen, um die Verwundeten von den Schlachtfeldern zu holen und zu pflegen. Im jüngsten Kriege nahmen sich die gesunden Kameraden ihrer gefallenen Brüder nach Thunlichkeit an; allein das Los der großen Mehrzahl der verwundeten Chinesen war der elendeste Tod, sofern ihnen nicht von den Japanern oder von europäischen Missionsärzten Beistand geleistet wurde. Ebensowenig kennen die koreanischen Soldaten unser Sanitätswesen, wie es ja überhaupt in ganz Korea[S. 529] keine Aerzte giebt, die auf diesen Namen überhaupt Anspruch erheben könnten. Nur die zahlreichen katholischen Missionare in Korea sind immer bestrebt gewesen, neben dem Seelenheil auch für das leibliche Wohl der Koreaner nach Kräften zu sorgen, und ihren ärztlichen Kenntnissen sind zum großen Teil ihre bisherigen überraschenden Erfolge zuzuschreiben. Auch einige andere Missionen haben Hospitäler in einzelnen Städten errichtet, und in erster Linie ist hier jenes des anglikanischen Bischofs Corfe in Söul hervorzuheben. Bischof Corfe war früher Seelsorger bei der englischen Kriegsmarine und Kaplan des Admirals Herzog von Edinburg. Dank dieser Stellung gelang es ihm, unter den englischen Seeoffizieren hinreichend Kapital zu sammeln, um in Söul eine englische Mission mit einem größeren Hospital einzurichten. In dieser vortrefflichen, von zwei europäischen Aerzten geleiteten Anstalt sah ich 1894 gegen zwanzig koreanische Soldaten, die auf der Expedition gegen die Rebellen des Togakuto verwundet worden waren. Sie erzählten mir von dem entsetzlichen Elend auf den koreanischen Schlachtfeldern, wo die Verwundeten hilflos verschmachteten, falls sie nicht von den Siegern verstümmelt wurden.
Es ist eine der vornehmsten zivilisatorischen Errungenschaften der Japaner, daß sie ihr Augenmerk nicht nur auf die in der Schlachtlinie kämpfenden, sondern auch auf die verwundeten Soldaten richteten, und mehr als mit den Hinterladerkanonen und dem preußischen Drill haben sie durch die Organisierung der Krankenpflege ihren Platz unter den Kulturstaaten gesichert.
Die Japaner besitzen nicht nur ein vorzügliches militärärztliches Korps mit Aerzten, die sich auf europäischen Universitäten ihr Diplom geholt haben, sondern sie besitzen auch eine Gesellschaft vom Roten Kreuz. Erst im Jahre 1877 mit etwa 20 Mitgliedern gegründet, zählt sie deren heute über 28000 und besitzt ein Jahreseinkommen von etwa 70000 Yen, ungefähr 150000 Mark, mit einem Reservefond von nahe einer Million Mark.
Der große Aufstand von 1877 in der Provinz Satsuma bot die Veranlassung zur Gründung dieser Gesellschaft. Vicomte Sano, der jetzige Präsident der Gesellschaft, war auch ihr Gründer, und seinem unermüdlichen Wirken, verbunden mit dem Beistand, den ihm die beiden Barone Siebold, Söhne des berühmten Japanschilderers, liehen, ist das heutige Blühen der Gesellschaft zu danken. Der Mikado und seine Gattin nahmen sich des jungen Unternehmens eifrig an; ihre Beiträge allein erreichten bisher eine Million Mark, und sie stellten die Gesellschaft unter ihren kaiserlichen Schutz. Vicomte Sano konnte sich kein besseres Vorbild für die Organisation seines Werkes nehmen als die von Baron Mundy gegründete Wiener Freiwillige Rettungsgesellschaft. Wie dort, so beschränkt sich auch in Japan die Krankenpflege nicht auf den Krieg. Die häufigen Erdbeben geben genug Veranlassung für segensreiche Thätigkeit im Frieden. So wurden bei dem großen Erdbeben im Oktober 1891 in den Provinzen Owari und Mino allein über 7000 Personen[S. 530] getötet und 11600 Personen verwundet. Sofort wurden Aerzte und Pfleger nach den zerstörten Orten gesandt und über 2000 Personen in Pflege genommen.
In demselben Jahre wurde in Tokio ein großes, ganz von den Mitteln der Gesellschaft erbautes Hospital eröffnet, für welches das Universitätshospital von Heidelberg als Muster diente. Alle Einrichtungen des Hospitals wurden in Tokio kopiert und als Chefarzt Dr. Hashimoto, der Chefarzt der japanischen Reservetruppen, erwählt.
Kaum war die Kriegserklärung gegen China erlassen, so meldeten sich sofort freiwillige Krankenpfleger in großer Zahl, die, in Kolonnen organisiert und mit allem nötigen Material ausgerüstet, der Armee nach Korea folgten.
Die Krankenpflege bei den Japanern in Korea und China war großenteils in ihren Händen, und in rühmenswerter Weise beschränkten sie ihre Thätigkeit nicht auf ihre Landsleute, sondern nahmen auch verwundete Chinesen auf.
Im Jahre 1886 trat die Gesellschaft durch Vermittelung der japanischen Regierung der Genfer Konvention bei und nahm auch trotz der heidnischen Religion ihrer Mitglieder merkwürdigerweise das christliche Abzeichen derselben an, das rote Kreuz im weißen Felde, das nun sogar auf den Schlachtfeldern des fernen Ostens seine segensreiche Thätigkeit entfaltet hat.
Von all den Sehenswürdigkeiten, welche die Hauptstadt des Mikadoreiches dem fremdländischen Touristen bietet, ist keine so interessant und reizvoll wie das Volksleben in den Straßen, Winter und Sommer, Tag für Tag, von Sonnenaufgang bis in die zehnte oder elfte Abendstunde, ein Museum eigener Art, das uns ganz Japan, arm und reich, hoch und niedrig, in allen Ständen und Berufsarten, auf die bequemste und anziehendste Weise vor Augen führt: am frühen Morgen bei der Toilette, vormittags im geschäftlichen Verkehr, nachmittags auf der Promenade, abends bei den Vergnügungen.
Schon um sechs Uhr morgens stehen vor dem Hotel die eigentümlichen, japanischen Droschken, die von flinken, strammbeinigen Burschen gezogenen Kurumas, und trat ich um diese frühe Stunde auf die Straße, so begrüßte mich gewiß mein gewöhnlicher Kurumaja, den Hut in der Hand, mit den Worten: „Sukoschi o aruki irraschai?” (Herablassen, eine kleine ehrenwerte Spazierfahrt machen?) Ihn abzulehnen hätte mir nicht viel genützt, denn ein paar andere wären mir mit ihren Handwägelchen gefolgt, straßenauf und -ab, bis ich mich doch entschlossen hätte, einen davon für meine Spazierfahrt zu mieten.
Die Japaner sind keine Frühaufsteher. Um sechs Uhr morgens sind die Straßen noch menschenleer, die Häuser größtenteils geschlossen, und nur hier und da sieht man Weiber, welche die Straßen vor ihren Häusern kehren. Die japanische Polizei ist sehr streng, und jede Vernachlässigung wird empfindlich gestraft. Die Straßen der Hauptstadt haben ja keine Trottoirs; sie sind auch nicht so notwendig wie in europäischen Städten, denn in Tokio giebt es fast gar keinen Wagenverkehr. Alle Welt geht zu Fuß oder fährt in den kleinen Kurumas, deren Zahl in der Hauptstadt allein vierzigtausend übersteigt. Deshalb sind die Straßen auch leicht rein[S. 532]zuhalten. Was die Hauseigentümer nicht zusammenkehren lassen, wird von den zahlreichen Hühnern vertilgt, die um diese Stunde für kurze Zeit aus ihren Käfigen gelassen werden. An den Straßenecken stehen schläfrige Polizisten in ihren europäischen Uniformen; Kulis mit langen, schmalen Bottichen auf dem Rücken eilen geschäftig von Haus zu Haus, um den Unrat des vorhergehenden Tages einzusammeln und auf die Felder vor der Stadt zu tragen, ein gar kostbarer Schatz, denn nur durch diesen ist der Ertrag der japanischen Kulturen so reichlich. In den ärmeren Quartieren bezahlen die Bewohner mancher Häuser mit dem Unrat allein ihren Mietzins. Diese sorgfältige Verwendung der städtischen Abfälle hat freilich auch ihren Nachteil. Tokio besitzt noch immer keine Wasserleitung, die Ziehbrunnen in den Straßen reichen für den Wasserbedarf nicht hin, und in den ärmeren Quartieren muß man zu den Flüssen und Bächen Zuflucht nehmen, welche durch die auf dem Lande allgemein übliche, künstliche Bewässerung einen Teil dieser Abfälle wieder in die Stadt führen, eine der Hauptursachen der Cholera- und Typhusepidemien.
Bald erscheinen in den Straßen auch Landbewohner und Fischer, die den Ertrag ihrer Felder resp. ihres nächtlichen Fanges auf den Markt bringen. Manche tragen ihre Lasten auf dem Rücken, andere haben sie auf Handwägelchen verladen, zuweilen sieht man auch einzelne von Pferden oder Ochsen gezogene Wagen, aber der hauptsächlichste Frachtenverkehr erfolgt doch auf Schultern und Rücken der fleißigen, arbeitsfreudigen Kulis.
Allmählich werden auch die Häuser geöffnet. Mit lautem Rasseln und Knarren werden die Amado (hölzerne Sturmwände), die zur Nachtzeit rings um die Veranden der Häuser aufgestellt werden, beiseite geschoben, und während meiner langsamen Fahrt erhalte ich gar manchen Einblick in die intimen Verrichtungen des japanischen Hauswesens. Hier lagert eine Familie auf den weichen, reinlichen Matten und nimmt das Frühstück ein. Eltern und Kinder hocken im Kreise um die mit blendend weißem dampfenden Reis gefüllten Schüsseln und schlürfen aus zarten winzigen Täßchen heißen Thee. Dort liegt ein Japaner noch auf der Matratze und schmaucht sein Morgenpfeifchen, während die weiblichen Wesen seines Hausstandes waschen und fegen und kochen. Im Nebenhause breitet ein Kuriositätenhändler seine Schätze zum Verkaufe aus, ohne sich um seine Nachbarinnen zu kümmern, die eben in einem großen hölzernen Bottich ohne irgendwelche Bekleidung ihr Morgenbad nehmen. In einem anderen Hause kauert ein junges Mädchen, bis zu den Hüften unbekleidet, vor einem Spiegel, pudert ihr hübsches Gesichtchen und schminkt ihre Lippen so ungeniert, als wäre sie zwischen vier Wänden eingeschlossen. In demselben Raume macht vielleicht ein Japaner seine einfache Toilette. Seit der Europäisierung des Landes tragen die Japaner ihre alten, sorgfältigen Haartrachten nicht mehr; ihre Zöpfchen fielen der Schere des Friseurs[S. 533] zum Opfer, und die bürstenartigen Haarstoppeln folgen dem Kamme doch nicht. Bärte werden in Japan vornehmlich nur von den Beamten, den Aristokraten und Gelehrten getragen; die Männer des Volkes aber rasieren ihre Gesichter vollständig glatt. Ist diese Arbeit besorgt, so wird der lange, schlafrockartige Kimono angezogen, die Füße werden mit weißen oder blauen Leinensocken bekleidet, und die Toilette ist gemacht.
Die Straßen füllen sich immer mehr, hauptsächlich mit Männern, die in ihre Geschäfte eilen oder auf den Märkten Einkäufe besorgen. Reis, Fische und Gemüse bilden die Hauptnahrung der Japaner. Fleisch wird nur wenig gegessen, an seine Stelle treten die Fische, die in unzähligen Arten auf den interessanten, belebten Fischmärkten zum Verkauf dargeboten werden, und merkwürdigerweise sind es auch hier nur Männer, die ihren täglichen Hausbedarf einkaufen. Alles spielt sich in größter Ruhe ab, Käufer und Verkäufer verneigen sich ehrfurchtsvoll voreinander, und Szenen, wie sie sich auf unseren europäischen Fischmärkten abspielen, sind in Japan ebenso undenkbar wie die unflätigen Flüche, die man bei uns zu hören bekommt. Die japanische Sprache kennt keine Flüche.
Noch größer sind die Höflichkeitsbezeugungen in den Häusern oder auf der Straße, wenn Bekannte einander begegnen. Die große Mehrzahl der Japaner geht noch immer barhäuptig umher; nur Soldaten, Beamte, Studenten oder elegante Dandys tragen Kopfbedeckungen, und bei diesen besteht der Gruß im Salutieren oder ehrerbietigen Abnehmen der Hüte unter mehrfachen tiefen Verbeugungen. Bei Altjapanern wirken die Begrüßungen, selbst in den unteren Ständen, auf den europäischen Beschauer geradezu komisch. Bei einem besseren Zustande der Straßen würden sie wohl voreinander niederknien. So beschränken sie sich bei der Begegnung darauf, stehen zu bleiben und halbwegs in die Knie zu sinken. In dieser Stellung machen sie mehrere tiefe Verbeugungen voreinander, während sie mit den Händen auf ihren Schenkeln mehrmals auf- und niederfahren und bei geöffneten Lippen, aber geschlossenen Zähnen die Luft mehreremale laut hörbar einziehen. So bleiben sie eine geraume Zeit einander gegenüber, bis sich endlich der eine entschließt, seinen Weg fortzusetzen. Er wird stets als der Unhöflichere von beiden betrachtet, außer wenn seine Rangstellung ein höhere sein sollte.
In der gegenwärtigen Uebergangsperiode von Alt- zu Neujapan bekommt man in den Straßen Tokios zuweilen eine ergötzliche Mischung von Volkstrachten zu sehen. Das konservative Element bilden in Japan ebenso wie anderwärts die Frauen. Während monatelanger Reisen im Mikadoreiche habe ich Japanerinnen in europäischer Kleidung niemals auf der Straße, niemals in Theehäusern und Theatern und nur vereinzelt in vornehmen Gesellschaften in der Hauptstadt gesehen. Selbst einzelne Kleidungsstücke, wie Hüte, Schuhe, Strümpfe und dergleichen,[S. 534] haben bei den Japanerinnen noch nicht Eingang gefunden; auf der Straße wie im Hause kleiden sie sich glücklicherweise noch durchwegs japanisch, tragen ihre Kimonos und Obis, fächeln sich mit Papierfächern, rauchen ihre winzigen Pfeifchen, schneuzen sich mit Papierläppchen. Nur ein europäischer Artikel hat Gnade vor ihren Augen gefunden: an Stelle der reizenden Sonnenschirme aus Bambus und buntgeblümtem Papier tragen sie heute schon vielfach unsere unschönen Regenschirme mit dunklem Stoffüberzug. Bei den Orientalinnen fing die europäische Kultur von unten an; in Algier, Tunis, Aegypten, Kleinasien haben die Schönen willig ihre Pantöffelchen mit europäischen Schuhen und Strümpfen vertauscht; bei den Japanerinnen kommt der europäische Segen in Gestalt des Regenschirmes von oben, während sie mit Eigensinn an ihren unschönen, etwas über die Knöchel reichenden Socken und an den schweren, plumpen Holzsandalen, den Getas, festhalten. Auf diesen ein bis zwei Zoll hohen Holzklötzen schlürfen sie mit geknickten Knien und vorwärts geneigtem Oberkörper einher, und wenn die Frauen im Straßenleben Tokios dennoch die reizvollsten Erscheinungen sind, so verdanken sie dies nur ihren lieblichen, freundlichen Gesichtchen und den bunten, langen, faltenreichen Gewändern. Madame de Staël hat in Bezug auf die Europäerinnen sehr richtig bemerkt: „Es ist ihnen schwer, schön zu tanzen, schwerer, schön zu gehen, am schwersten, schön zu stehen.” Den Japanerinnen ist es schwer, schön zu stehen, schwerer, schön zu gehen, und tanzen nach unseren Begriffen können sie gar nicht.
Auch unter den Männern, denen man in den Straßen Tokios begegnet, sieht man nur wenige in europäischer Tracht. Hier reitet wohl ein Offizier in europäischer Uniform einher, stets begleitet von einer Ordonnanz; die Polizisten und Postboten tragen Uniformen, die Beamten, Aerzte, Professoren, Edelleute, Angestellte des Hofes und einzelne Elegants, die Europa besucht oder dort studiert haben, tragen europäische Kleidung. Aber sonst sind die Japaner ihrer alten Tracht treu geblieben. Dem Fortschritt huldigen viele von ihnen höchstens insofern, als sie zu ihren langen Kimonoschlafröcken europäische runde Hüte oder Seidencylinder tragen, was ihr Aussehen keineswegs malerisch macht. Man denke sich nur in einer europäischen Stadt einen Spaziergänger mit Brille, Cylinderhut, Regenschirm und plumpen[S. 535] Holzpantoffeln, den Körper in einen langen, dunkeln Schlafrock gehüllt, der beim Gehen auseinanderschlagend die nackten Beine des Spaziergängers zeigt! Und solche Gestalten sieht man in den Straßen Tokios zu Tausenden. Noch grotesker ist ihr Anblick bei Regenwetter. Um ihren Kimono nicht zu beschmutzen, heben sie denselben zuweilen bis an die Hüften empor und schlürfen in nackten Beinen umher. Dasselbe thun aber auch die japanischen Frauen und Mädchen mit rührender Ungeniertheit.
Dem Reinen ist alles rein. Das dachten wohl auch die vierzigtausend strammen jungen Burschen, die behende die Kurumas durch die Straßen Tokios ziehen, als ihnen durch die Behörden eine Uniform dekretiert wurde. Bis dahin schienen sie schon reich gekleidet, wenn sie sich ein paar hübsche farbige Figuren auf ihre Bronzehaut auftättowieren ließen. Nun müssen sie aber Uniformen tragen. In Europa dürften sie auch in diesen wegen zu großer Nacktheit eingesteckt werden, aber für japanische Verhältnisse sind sie mehr als genügend bekleidet. Dunkelblaue, strammanliegende Kniehosen bedecken ihre Hüften und Schenkel, ein vorne offenes Jäckchen aus grobem, dunkelblauem Baumwollstoffe den Oberkörper. Auf ihrem[S. 536] Kopfe sitzt ein mächtiger, pilzförmiger Strohhut, auf der Außenseite mit weißem Stoff überzogen, und an ihren Füßen stecken Strohsandalen. Jeder Kurumaj hat überdies auf dem Rücken seines Jäckchens die Nummer seines Handwägelchens aufgenäht. Aehnlich sind auch die Post- und Telegraphenboten uniformiert, nur daß sie außerdem noch weiße gestrickte Handschuhe tragen. Die Kulis, die im Hafen oder an den Ufern des stets mit Booten und Frachtschiffen bedeckten Sumidaflusses arbeiten, ersparen sich auch die Kniehosen. Das vorne offene Jäckchen und ein weißes Lendenband, nicht viel breiter als unsere Kravattenschleifen, bilden ihre einzige Bekleidung.
Die Studierenden der Universität, ja selbst die Schuljungen von Tokio tragen heute der Mehrzahl nach europäische Kleidung, und es befremdet den Touristen nicht wenig, inmitten des fremdartigen, bunten Straßenverkehrs die schlitzäugigen kleinen Japaner statt im Kimono in Beinkleidern und Stiefeln einherwandern zu sehen, die große Schultasche oder ein Paket Schulbücher unter dem Arme. Die kleinen Mädchen dagegen halten gerade so wie ihre Mütter an der reizenden Nationaltracht fest, und unter all den weiblichen Gestalten, die mit dem Fortschreiten des Tages immer zahlreicher im Straßenleben auftreten, sind die Mädchen die lieblichsten. Gewöhnlich tragen sie schon im Alter von sechs oder acht Jahren ein jüngeres Schwesterchen oder Brüderchen, das die Kunst des Gehens noch nicht erlernt hat, auf ihre zarten Rücken gebunden, lassen sich aber dadurch in ihren munteren Spielen keineswegs hindern. Die Abwesenheit von Straßenschmutz und Wagenverkehr erlaubt es ihnen, sich vor ihrem väterlichen Hause umherzutreiben. Zuweilen rollen am späten Vormittage doch einzelne Equipagen von Prinzen oder Gesandten durch die Hauptstraßen, aber gewöhnlich läuft den Pferden ein flinkbeiniger Diener nach Art der ägyptischen Sais voraus und verhindert durch seine Warnungsrufe Unglücksfälle.
Immer lebhafter wird das Leben in den Straßen, und gegen Mittag scheint es, als ob sich die ganze Bevölkerung Tokios auf den Beinen befinde; Priester in ihren eigentümlichen Gewändern erscheinen, hier und dort zieht irgend eine Tempelprozession oder ein Leichenbegängnis mit bunten, glänzenden Schaustücken und Ornamenten einher, ohne daß diese von seiten der Passanten besondere Beachtung fänden. Die vielen Kaufläden, die in manchen Hauptstraßen in kilometerlangen Reihen dicht aufeinander folgen und ihren ganzen Kram, Toiletteartikel für Damen, Fächer, Spielzeuge für Kinder, Porzellane, Geschirre, Pantoffeln, Papierlaternen und dergleichen auf der Straßenseite ausgebreitet haben, sind mit Käufern und Käuferinnen gefüllt, und der ganze Verkehr zwischen diesen Tausenden, das ganze Geschäftsleben spielt sich in so leichter, ungezwungener, man möchte sagen spielender Weise ab, als gäbe es in dem fernen Mikadoreiche überhaupt gar keinen Kampf ums Dasein, als wären alle Einwohner Kapitalisten, die behaglich von ihren[S. 537] Renten leben und die Geschäfte nur so nebenbei, zum Zeitvertreib, führen, ohne Absicht auf Gewinn. Die leichte, fröhliche Lebensart der Japaner, der Hang zu Vergnügungen, Spielen, Leckereien zeigt sich auch durch die zahlreichen ambulanten Händler, mit denen die Straßen gefüllt sind, Tag für Tag, Woche für Woche, als wäre jeder Tag des Jahres ein Matsuri (Festtag). Um sie besser kennen zu lernen, verlasse ich meine Kuruma und wandere zu Fuß durch die sich dicht drängende Menschenmenge. Aber sofort werde ich von anderen Kurumaja erspäht, und mehrere umringen mich mit derselben Zudringlichkeit wie die Eseltreiber in der Muski von Kairo oder die Vetturini von Neapel. „Riksha? Danna? O ide nasai? Irraschaimas no desaka?” „Wollen Sie eine Rickshaw, Herr? Wollen Sie nicht fahren? Wollen Sie nicht ehrenwerten Platz nehmen?” Und wenn ich versuche, sie abzuschütteln, entschuldigen sie sich: „Sore kara O mi aschi de ikimas.” „Sie wollen also vorwärts schreiten mit den ehrenwerten Beinen?” Alles ist in Japan ehrenwert. Ueberall hört man die gebräuchlichsten Begrüßungen: „Ohaio”, oder „Yo o ide nafaimaschta”, oder „Sajonara” und „Irraschai”, von allen Seiten werden einem verschiedene Waren, Leckereien, geschabtes Eis oder Limonaden angeboten, stets in freundlichster Weise. Hier der Modschi-Yaki (Briefverbrenner), mit seinen süßen Kuchen, welche die Form von allerhand Schriftzeichen, Tieren, Ornamenten und dergleichen zeigen. Neben ihm der Ameya oder Gallertenmann, der den Kindern für einen Pfennig mittels eines Röhrchens aus Gerstenbrei allerhand Figuren bläst; an einer vom Verkehr verschonten Ecke kauert ein Wahrsager, ein Tuch vor sich gebreitet, auf dem er mittels fünfzig kleiner Stäbchen und sechs roten und schwarzen Holzwürfeln allen, die es wünschen, für ein paar Pfennige ihre Zukunft vorhersagt; dort lenkt ein ambulanter Verkäufer von klebrigen Bohnenkuchen mit Gong und Schellengeklirre die Aufmerksamkeit auf sich, während ein blinder Amma (Masseur) dies mittels eines Pfeifchens thut; für wenige Pfennige ist er bereit, irgend jemandem, ob Mann oder Frau oder Kind, die Glieder durchzukneten. Hier schreitet gravitätisch ein bebrillter Arzt einher, gefolgt von einem Jungen, der ihm den Arzneikasten und Mörser trägt; dazwischen schleicht scheu ein zerlumpter Eta (ein Paria) umher; oder ein Kami-Kudsuhiroi (Lumpensammler) sammelt mit seinem Bambushaken Papierstückchen oder Kleiderfetzen; oder ein Spatzenfänger stiehlt sich vorsichtig, mit einem klebrigen Bambusstocke bewaffnet, den Hausdächern entlang und fängt mit erstaunlicher Geschicklichkeit die ahnungslosen frechen Vöglein. Vor den Tempeleingängen drängen sich Schaubuden, Verkaufsstände mit Spielwaren für Kinder, buntgeschmückten Haarnadeln für Mädchen, Toiletteartikeln, Früchten und Leckereien; zwischen ihnen kauert, umringt von Bewunderern, ein Künstler, mit Säckchen verschieden gefärbten Sandes versehen, aus denen er abwechselnd eine Handvoll nimmt und damit allerhand Landschaften, Figuren, Ornamente und dergleichen auf den Boden streut. Die Tempel selbst werden eifrig besucht, vornehmlich[S. 538] von Frauen und Mädchen. Sie waschen zunächst an dem Tempelbrunnen ihre Hände, dann schreiten sie langsam an die Stufen, die zum Götzenschreine emporführen, und machen die Gottheit dadurch auf sich aufmerksam, daß sie den vom Dache hängenden Glockenzug stark anziehen; erschallt die Glocke oder der Gong, so klatschen sie laut ihre Hände zusammen und sagen mit gebeugtem Oberkörper ihr Gebet her. Darauf verkünden sie durch abermaliges Händeklatschen der Gottheit, daß sie fertig sind, werfen einige Kupfermünzen vor den Altar oder in eine danebenstehende Holzkiste für die Priester und gehen ihres Weges.
In der Mittagsstunde leeren sich die Straßen, und zur Sommerzeit erscheinen sie zwischen zwei und vier Uhr nachmittags wie ausgestorben, höchstens daß bei großer Hitze Frauen oder Kinder die Straße vor ihren Häusern mit Wasser besprengen, oder daß dies von seiten der Stadt mittels großer Wasserkarren geschieht. Drei oder vier Mann schöpfen das Wasser aus den offenen Bottichen mittels Kübeln, die an Stangen befestigt sind, und schleudern es kräftig über die Straße; vor vielen Kaufläden hängen große, blaue oder schwarze Tücher vom Dache bis zum Straßenboden, um die Sonnenstrahlen abzuhalten. Die Hausbewohner geben sich der Siesta hin, schlafen, schlürfen ihren Thee oder rauchen ein paar Pfeifchen. Später, gegen fünf Uhr, wird der Straßenverkehr wieder lebhafter, die Leute besuchen vielleicht Theehäuser oder die vielen Sakebuden, die an dem vorgehängten Fichtenzweige und den großen, grell bemalten Sakebottichen sofort kenntlich sind. Die beste Gattung Reiswein zeigt auf dem Bottich eine große gemalte Blume, Hanazakari, die zweite die Schriftzeichen Muso-itschi, d. h. von keinem übertroffen, eine dritte hat eine große Päonie aufgemalt. In den letzten Jahren hat die Einführung von Eismaschinen eine ganze Menge von Eisbuden entstehen lassen, in denen geschabtes Eis mit Fruchtwässern versetzt feilgeboten wird, eine rasch beliebt gewordene Leckerei bei den unteren Volksklassen. Tausende wandern auch zu dieser Stunde nach dem nächsten Badehause, um trotz der Hitze ein heißes Bad zu nehmen. Tokio besitzt über tausend öffentliche Badehäuser, in denen durchschnittlich täglich dreihunderttausend Bäder genommen werden, ganz abgesehen von den Furodo oder Hausbädern, von denen sich in jedem besseren Hause eins befindet und von den Bewohnern täglich mehrmals benutzt wird. Man braucht in diese Badehäuser gar nicht einzutreten, um das Treiben im Innern wahrzunehmen, denn die Wände der Badehäuser bestehen vielfach aus Latten, zwischen denen man durchblicken kann. Männer, Weiber, Kinder treten scharenweise ein, zahlen am Eingange einige Pfennige, bewahren ihre Kleider in Kästchen an den Wänden auf und steigen splitternackt in das mit heißem Wasser gefüllte Bassin, das nur durch ein Seil oder eine Bambusstange in zwei Hälften für die beiden Geschlechter geteilt ist. Manche Frauen hocken auf den ins Wasser führenden Stufen, manche Fräulein stehen, nur in ihre Haut gekleidet, lachend und plaudernd am Rande des Bassins, wieder[S. 539] andere trocknen sich in höchst naiver Weise ab. Die ganze Gesellschaft benimmt sich dabei so ungeniert, als ob sie im Theater oder Theehause wäre. Solche Theehäuser sind in der That mit manchen Bädern verbunden, und in den kleinen abgeschlossenen Räumen ruht sich vielleicht nach dem Bade ein junges Pärchen auf weichen Matten aus.
Ist der Abend angebrochen, so erscheint wieder alles in den Straßen; Tausende pilgern hinaus unter die gewaltigen, uralten Fichten des Shiba- oder Uyenoparkes und lagern sich auf den Rasen oder in die Theehäuser, die rings um die Lotosteiche oder an den Ufern des Sumidagawa massenhaft stehen, andere mieten Vergnügungsboote, gehen in Theater oder Klubs, um Tanz und Gesang der zahllosen Gaishamädchen zu bewundern; in den Straßen leuchten allmählich lange Reihen von buntfarbigen Lampions auf, aus vielen Häusern ertönt Gesang und Samisenspiel, überall ist Leben und Fröhlichkeit, als gäbe es bei diesem leichten Phäakenvölkchen gar keinen Ernst, keine Arbeit und als wäre die ganze Hauptstadt des Mikadoreiches nichts als ein ungeheurer Badeort in der Hochsaison. Den Ernst des Lebens unter den Japanern lernt der Fremde im Straßenverkehr nur kennen, wenn eines der häufigen Erdbeben den Boden der Stadt erschüttert, Schornsteine, Dächer, ganze Häuser einstürzen und die Bevölkerung erschreckt auf die Straße eilt. Oder wenn sich am dunkeln Nachthimmel glühendrot die Blumen von Yeddo, die Flammenzungen von Schadenfeuern zeigen. In jedem Stadtviertel wird der Besucher Tokios hohe Pfähle mit Glocken und Leitern finden, an deren Spitze Wachtleute beständig nach verdächtigem Rauch oder Flammen Umschau halten. Bemerken sie dergleichen, dann verkünden sie durch eine bestimmte Anzahl von Glockenschlägen das Quartier, in dem Feuer ausgebrochen ist, und sofort entsteht unter der heiteren, sorglosen Bevölkerung lebhafte Bewegung. Hastig eilt alles nach Hause, die Bewohner des bedrohten Stadtteiles laufen oder fahren in Kurumas so rasch als möglich in ihre Quartiere, um ihre Siebensachen in Sicherheit zu bringen. Die kleinen, aus dürrem Holz, Strohmatten und Papierwänden bestehenden Häuschen flammen ja bei dem geringsten Anlaß wie Zunder auf, und an eine Rettung des Hauses oder der nächsten Nachbarhäuser ist gar nicht zu denken. Tokio ist schon vielmals durch Feuer zerstört worden, und in jedem Jahre, ja in jedem Monate werden Hunderte oder Tausende von Häusern eingeäschert. Kein Wunder, daß bei solchen Anlässen die ganze Stadt in furchtbarer Aufregung ist, die freiwilligen Feuerwehrgesellschaften mit ihren phantastischen Bannern und glänzenden Helmen rasch nach der Brandstelle eilen und selbst in entfernteren Straßengevierten das entsetzte Volk mit fieberhafter Schnelligkeit den ganzen Hausrat zusammenrafft, um ihn nach einem sicheren Stadtteil zu tragen. Die ungemein einfache Einrichtung der Häuser erleichtert dies. Die Mädchen rollen eiligst die dünnen Matratzen, Strohmatten und Kleidungsstücke zusammen, die Frauen werfen[S. 540] ihre Koch- und Eßgeschirre in einen Korb, die Männer heben die verschiebbaren Holz- und Papierwände aus den Fugen, und ein kleiner Handkarren nimmt die ganze Einrichtung auf. Nur das Dach und die Pfähle, auf welchen es ruht, bleiben zurück und werden ein Raub der Flammen, wenn es der Feuerwehr nicht gelingt, rings um die Brandstätte einen Kranz von diesen leeren Häusern rasch niederzureißen.
Manchmal steht ein hohes, außerordentlich massiv aussehendes Gebäude beinahe unversehrt da, eine Kura, d. h. ein feuerfestes Haus aus etwa vierzig Centimeter dicken Lehmwänden, worin der wohlhabendere Japaner seine wertvollen Sachen aufzubewahren pflegt. Diese weiß polierten Häuser, die trotz dem Material, aus dem sie gebaut werden, äußerlich sehr geschmackvoll aussehen, werden äußerst sorgfältig aus Lehm und Bambusflechtwerk errichtet. Die Bauzeit dauert ein bis zwei Jahre, da von den vielen Lehmschichten die unteren immer vollständig trocken sein müssen, bevor eine weitere darüber aufgetragen werden kann. Das Dach besteht aus dicht gefügten, schweren Ziegeln. In Feuersgefahr werden die dicken Läden und Thüren, deren staffelförmige Ränder ineinander greifen, geschlossen und die Ritzen derselben von besonders dazu Angestellten mit immer bereitstehendem Lehm zugeschmiert. Die Kura wird dann gleichsam versiegelt, indem der Schließende die Schriftcharaktere seines Namens auf Thüre und Fenster in den Lehm gräbt, und sie darf erst nach Beendigung des Brandes im Beisein einer Urkundsperson geöffnet werden. So ist in Japan bei Feuersgefahr alles sorgsam organisiert, sowohl das Verhalten des Einzelnen, wie das der Gesamtheit, da dieses Volk seit alters mit elementaren Gewalten wie Feuer, Erdbeben und Wassersnot zu rechnen gewohnt ist. Unter der Shogunherrschaft mußten die Lehensfürsten und die höchsten Staatsbeamten in voller Rüstung zu Pferde auf dem Brandplatze erscheinen und den Kampf mit dem Elemente leiten. Jetzt ist die Feuerwehr vollständig nach europäischem Muster eingerichtet.
Sonderbar ist das Verhalten der Ueberlebenden, die Familie oder Eigentum, oder beides verloren haben. Kein herzzerreißendes Klagen, kein Zeichen überquellender Verzweiflung, sondern nur stumme Resignation in das Unabänderliche sieht man auf allen Gesichtern. Ein so großer Gemütsmensch der Japaner sonst ist, Aeußerungen seelischen Schmerzes weiß er zu unterdrücken.
Wer Japan jemals im Sommer besucht hat, wird es begreiflich finden, daß die Europäer die Hauptstadt ebenso wie die Hafenstädte des Inselreiches, wenn immer möglich, fliehen, um auf den hohen Bergketten der japanischen Hauptinsel Hondo Kühlung zu suchen. In dieser ostasiatischen Schweiz sind es vor allem zwei Distrikte, die von den Europäern nicht nur Japans, sondern von ganz Ostasien bevorzugt werden: Nikko, im Norden der Hauptstadt Tokio, und Hakone, im Süden derselben gelegen. Die Japaner sind sich der Schönheit ihres Heimatlandes wohl bewußt, und stolz, wie sie sind, bestrebt, sich und ihr Inselreich den Bleich[S. 542]gesichtern des Abendlandes in möglichst günstigem Lichte zu zeigen, haben sie alles Erdenkliche gethan, um die schönsten Gebirgspartien Japans leicht zugänglich zu machen. Der europäische Unternehmungsgeist, der sich sonst in Asien überall zeigt, auf Ceylon und Java, in Indien und China, hat damit in Japan nichts zu thun gehabt. Mit japanischem Gelde und durch japanische Ingenieure wurden Eisenbahnen, Brücken, Straßen, Pferdebahnen, Fußwege angelegt, Hotels und Badeanstalten nach europäischem Muster eingerichtet, so daß man heute die prächtigsten Gegenden der asiatischen Schweiz, vor allem den Distrikt von Hakone, mit ähnlicher Bequemlichkeit besuchen kann wie Grindelwald.
Von dem trotz der Nähe des Meeres heißen, sonnenverbrannten Yokohama brachte mich eine mehrstündige Eisenbahnfahrt nach Kozu. Dieses ist ein kleines, ärmliches Städtchen nahe der Mündung des steinigen Sakawagawa in das Meer gelegen und würde wohl kaum jemals einen europäischen Reisenden zum Aufenthalt verlocken, wenn es nicht die Pforte zu dem herrlichen Bergdistrikt von Hakone wäre.
Während die altberühmte Hauptstraße des Landes, der Tokaido, von Kozu aus quer in den Bergdistrikt von Hakone hineinlenkt, muß die Eisenbahn ihm ausweichen; sie führt in einem weiten, hufeisenförmigen Bogen um ihn herum und erreicht erst auf der anderen Seite bei Numazu wieder das Meer. Den Tokaido entlang, der noch vor drei Jahrzehnten den Feudalfürsten des Landes mit ihrem malerischen Gefolge als Reiseweg diente, führt heute eine Pferdebahn mit schlechten Wagen, von elenden Kleppern gezogen, und diese bestiegen wir nun, um uns bis Yumoto an den Fuß der bewaldeten Berge führen zu lassen. Japanische Landleute, Kulis, barfuß bis zu den Schultern, dazwischen reizende Musmis in bunten Kimonos und alte Weiber mit Bündeln und Körben bildeten unsere Reisegefährten. Untereinander befleißigen sie sich der größten Höflichkeit, aber uns Europäern gegenüber zeigten sie nur vornehme Verachtung, im besten Falle Gleichgültigkeit. Waren ihnen doch in den letzten Jahren so viele anglo-amerikanische Flegel in den Weg gekommen, die ihren Gruß mit Grobheiten erwiderten, ihre Höflichkeit laut belachten und sich als so ungezogene Bengel benahmen, daß man den Insulanern ihren Abscheu vor der ganzen abendländischen Touristenwelt gar nicht verübeln kann.
In Odawara, wo sich der Pferdebahnstation gegenüber die gewaltigen Ringmauern einer zerstörten Feudalburg erheben, wurde kurzer Halt gemacht, dann ging es zwischen den wohlgepflegten, sorgsam bewässerten Reisfeldern auf hohem Damme weiter über das steinige, breite Bett des Hayagawa nach Yumoto.
Hier wurden wir europäischen Passagiere von Dutzenden halbnackter Kulis umringt, die uns ihre Rickshaws zur Weiterfahrt in die Berge hinauf anboten. In langen Batterien waren die leichten zweiräderigen Wägelchen aufgefahren; ohne daß man es wehren konnte, wurde das Gepäck auf die Rickshaws verladen, und mit derselben Zudringlichkeit, wenn auch mit größerer Höflichkeit wie die Beduinen an[S. 543] den ägyptischen Pyramiden, ließen uns die Kulis nicht los, bis jeder von uns eine Rickshaw mit zwei oder drei strammbeinigen bronzenen Gesellen angeworben hatte. Der eine stellte sich zwischen die Gabeldeichsel und erfaßte diese, ein zweiter vor ihm schlang sich eine Zugleine über die Schulter, und während dieses menschliche Tandemgespann unter lautem Hallo anzog, schob ein dritter von rückwärts nach. So durcheilte die ganze Karawane von mehreren Dutzend Rickshaws das Dorf, reizend eingenistet an den steilen Ufern der Schlucht, aus welcher der wasserreiche Hayagawa, ein Abfluß des herrlichen Bergsees von Hakone, hervorbraust. Die heftigen Regengüsse des Sommers hatten kurz zuvor die Brücke weggerissen, und notdürftig waren einige Bretter und Balken zu einem halsbrecherischen Steg gezimmert worden, über den uns die Kulis geschickt hinüberhalfen. Jenseits der Schlucht bestiegen wir andere bereitstehende Rickshaws, und nun ging es auf breiter, aber von Regenbächen zerrissener, steiniger Straße steil aufwärts in die Berge. Zur Rechten tief unter uns schäumte der Strom, zur Linken erhoben sich steile, stellenweise überhängende Bergwände, mit der üppigsten Vegetation überwuchert. Die herrlichsten Blüten, große japanische Lilien, die bei uns als Topfpflanzen sorgsam gepflegt werden, bedeckten die Abhänge nach vielen Tausenden; überall rauschten Bäche, in Kaskaden über Stock und Stein hüpfend, herab, dem Hayagawa zu. An manchen Stellen hatte der Regen Bergstürze zur Folge gehabt, durch welche die Regierung mit Mühe einen Weg bahnen ließ; in vielfachen scharfen Windungen, tiefe, finstere Schluchten entlang führte die Straße aus der nicht viel über dem Meeresspiegel liegenden Ebene aufwärts nach der entzückenden Bergidylle Miyanoshita, die fünfhundert Meter hoch zwischen der grünen Felspyramide Myojogatake und dem bewaldeten Sengenyama eingeschachtelt ist. Ich mußte die Ausdauer meiner flinken Kulis bewundern, die auf dem ganzen einstündigen Wege nur einmal anhielten, um sich an einer Quelle Kopf und Schultern zu baden und mehrere Holzbecher voll Wasser zu trinken. Der Schweiß rann in Strömen über den bronzenen Rücken und an den muskulösen Beinen hinab; schon kurz oberhalb Yumoto hatten sie sich ihrer Leinenjacken entledigt, sie ausgewunden wie ein Stück ausgespülter Wäsche und zum Trocknen über die Deichselstangen gehängt. Mit Bewunderung, gemischt mit Neid, betrachteten wir zarter veranlagten Europäer den prächtigen Körperbau dieser Bergbewohner.
Miyanoshita besteht aus zwei kleinen, urjapanischen Dörfchen, zwischen denen sich auf einem mit europäischen Gartenanlagen geschmückten Plateau das stattliche Fuji-ya-Hotel erhebt; etwas weiter unterhalb, am oberen Rande der steilen Hayagawaschlucht, befindet sich ein zweites Hotel von europäischem Aussehen, Nara-ya genannt, das aber der Hauptsache nach vornehmen Japanern zum Aufenthalt dient. Gerade während meines ersten Besuches von Miyanoshita weilten hier zwei putzige kaiserliche Prinzchen, Söhne Seiner Majestät und irgendwelcher japa[S. 544]nischen Komtesse oder Baronesse; sie besaßen einen aus zahlreichen Personen bestehenden Hofstaat, und unternahmen sie ihre täglichen Spaziergänge, so wurden sie von einem ganzen Schwarm von Höflingen und Polizisten begleitet.
Auch das Fuji-ya-Hotel, eines der besten von ganz Ostasien, ist zur Hälfte nach japanischer Art eingerichtet, das heißt an das im Schweizer Villenstil erbaute, ganz europäisch eingerichtete Haupthaus lehnen sich die Flügel, so leicht und zart wie schwedische Streichholzschachteln. Die einzelnen Schlafräume haben wohl Betten und sonstigen abendländischen Hausrat, die Wände aber sind nach japanischem Muster nur verschiebbare Holzrahmen, mit weißem Papier überzogen, ohne Fenster, ohne Thüren, nur von einer langen Holzveranda umgeben, von der man in die Schlafräume gelangt, indem man die Papierrahmen auseinanderschiebt. Ein weggeworfenes brennendes Zündhölzchen, unvorsichtiges Handhaben des Kerzenstockes würde das ganze Hotel wie einen Haufen trockener Holzspäne aufflammen lassen. Dafür spüren die europäischen und japanischen Gäste dieses Kartenhauses nur wenig von den häufigen Erdbeben, dieser schrecklichsten Landplage Japans. Während wir im Haupthause mehrmals durch die Erschütterungen, die das Gebäude in allen Fugen krachen und die Einrichtungsstücke herumtanzen ließen, aus unserer Ruhe geschreckt wurden, waren diese Erdbeben in den japanischen Anbauten kaum wahrnehmbar.
Wenn mich inmitten des vornehmen europäischen Lebens, das sich im Fuji-ya-Hotel abspielte, irgend etwas daran gemahnte, daß ich mich nicht in einer schweizerischen Gebirgskarawanserei, sondern viele Tausende Kilometer davon entfernt bei den Antipoden befand, so waren es die kleinen, freundlich lächelnden Nesans, die in den Wohnzimmern und im Speisesaale die Bedienung besorgten; hübsche Mädchen mit sorgfältig frisiertem Haar, in buntfarbige Kimonos gekleidet. Auf den reingescheuerten Matten der Korridore und Säle wackelten sie in Socken lautlos einher, die Zehen nach einwärts gerichtet wie Enten. Außer good morning, good night und thank you verstanden sie keine Silbe einer europäischen Sprache, und wer nicht japanisch sprach, mußte sich durch Zeichen mit ihnen verständigen. Die Speisekarten bei den Mahlzeiten trugen neben den englischen Namen arabische und japanische Nummern, ebenso die Weinkarten, und begehrte man gewisse Speisen und Getränke, so brauchte man nur auf die dabeistehenden japanischen Nummern zu zeigen, um das Gewünschte zu erhalten. Sonst waren Auseinandersetzungen mit ihnen nicht nötig; sie kannten ihre Pflicht, die Betten waren stets in Ordnung, und auf ihnen lagen allabendlich die Hotel-Ukatas sorgfältig ausgebreitet zum Gebrauch. Diese Ukatas sind eine Art Kimono, die Japaner wie Europäer als Schlafrock oder Bademantel benutzen und vom Hotel gerade so geliefert werden wie Handtücher und Bettwäsche. Morgens früh schlüpften die Hotelgäste aus ihren Betten in die Ukatas und eilten durch die langen Korridore hinab zu dem weitläufigen Badehaus, das aber, glücklicherweise für die Damen, keine gemeinschaftlichen Bassins besaß wie das[S. 545] benachbarte Nara-ya-Hotel und wie alle anderen japanischen Hotels und Badeorte des Landes. Dafür giebt es im Fuji-ya-Hotel lange Reihen geräumiger Badezimmer mit in den Fußboden versenkten großen Holzwannen, in denen bequem zwei oder drei Menschen zusammen baden könnten. Aus Bambusrohren kann man nach Belieben kaltes und warmes Wasser zuströmen lassen. Daran ist kein Mangel, denn hinter dem Badehause pritschelt und rieselt es in zahllosen Bächlein den Abhang herab. Diese Bäder gewähren so großen Genuß, daß die europäischen Gäste es den Japanern nachmachen und sich täglich durch zwei, drei Bäder erfrischen, nur werden sie von ihnen nicht so heiß genommen wie von den Japanern, die ein seltsames Wohlgefallen daran finden, sich mit heißem Wasser krebsrot brühen zu lassen.
Miyanoshita ist reich an den herrlichsten Spaziergängen, und ohne seine europäische Bequemlichkeit aufzugeben, hat man nirgends im Mikadoreiche so gute Gelegenheit, das japanische Dorf- und Landleben kennen zu lernen wie hier. Der ganze Distrikt ist eine entzückende Idylle, ein Olymp in Wirklichkeit, mit zufriedenen, höflichen, stillen, arbeitsamen Menschen, die aus der sie umgebenden herrlichen Natur einen Garten gemacht haben. Arm wie Kirchenmäuse, hegen sie doch anscheinend keinen Neid gegen die europäischen Protzen, die sie den Sommer über in ihrem Bergparadiese stören, vielleicht haben sie einsehen gelernt, daß ihr friedliches Landleben, ihre Beschäftigung, ihre bequeme Kleidung, ihre einfache Gemüse- und Fischnahrung immer noch vorzuziehen ist der tollen geschäftlichen Jagd, der Unruhe und Genußsucht dieser fleischfressenden Ungetüme John Bull, Onkel Sam und Bruder Sauerkraut. Das japanische Dorf Miyanoshita hat dem europäischen Badeort Miyanoshita nur insofern Rechnung getragen, als in dem reizenden Theehause thalaufwärts Tische und Bänke für die Badegäste angelegt wurden und zum Thee auch Löffel und europäisches Backwerk serviert werden. In der Mitte des reizenden kleinen Theehausgartens befindet sich ein Teich mit Tausenden von Goldfischen, so zahm, daß sie Biskuit aus der Hand schnappen.
Die Missionare, Diplomaten, Kaufleute, Touristen, die sich hier in den Bergen des Herzens von Japan allsommerlich aus allen Erdteilen und Ländern zusammenfinden, kann man nur des Morgens und Abends im Speisesaale vereint sehen. Tagsüber ist das große Hotel wie ausgestorben. Nach dem Frühstück werden verschiedene Wanderungen ins Gebirge angetreten. Die freundlichen japanischen Hauswirte in tadelloser europäischer Toilette lassen den Wanderern ihren Lunch auf japanische Weise in frisch gehobelte kleine Kästchen packen, vor der Thüre stehen Dutzende von sehnigen jungen Kulis mit ihren Rickshaws, Kagos oder europäischen Tragstühlen, dazu höfliche Führer, und man kann wochenlang täglich auf anderen Wegen die Umgebung durchstreifen, um mit jedem Tage entzückter von diesem herrlichsten aller außereuropäischen Länder nach Miyanoshita zurückzukehren. Der Reihe nach besuchte ich die reizenden Gebirgsdörfer Kiga, Dogashima, Miagino, badete in[S. 546] gemischter japanischer Herren- und Damengesellschaft in den Schwefelquellen des Badeortes Kodschigoku, bestieg den Sengenyama und den Myojogatake, um den wunderbaren Ausblick auf die japanischen Meeresküsten mit der vorgelagerten Vulkaninsel Oschima zu genießen und auf der entgegengesetzten Seite die stolzen Formen des Fudschiyama zu bewundern. Einige Tage später stand ich auch während eines wütenden Taifuns auf der etwa viertausendzweihundert Meter über dem Meere gelegenen Spitze dieses höchsten Bergriesen Ostasiens und blickte in den furchtbaren, mit Rauch und Schwefeldämpfen gefüllten Krater hinab.
Aber der reizendste Tagesausflug von Miyanoshita ist doch jener nach dem idyllischen Bergsee von Hakone. In bequemen Stühlen ruhend, die von je vier kräftigen Kulis mittels langer elastischer Bambusstangen auf den Schultern getragen wurden, brachen wir frühmorgens auf, um zunächst in dem etwa fünfhundert Meter weiter oben im Gebirge gelegenen Schwefelbad Ashinoyu Halt zu machen. Das Matsuzakahotel, halb in europäischem Stil geführt, war gerade so gefüllt wie alle anderen mit Hunderten von rheumatischen Japanern beiderlei Geschlechts, die in den heißen Quellen dieser vulkanischen Regionen Heilung suchten, aber für Europäer muß ein längerer Aufenthalt in diesem Ashinoyu entsetzlich sein. Der Ort liegt auf einem vollständig kahlen, trostlosen Plateau und ist den halben Sommer über in dichten Nebel gehüllt, während die Schwefelquellen die ganze Gegend durchstänkern und die umliegenden Sümpfe giftige Dämpfe aushauchen. So brachen wir denn nach kurzer Rast wieder auf, um auf öden Bergwegen zwischen den gewaltigen Kegeln des Kamiyama und des zweispitzigen Futagoyama (Zwillingsberg) hinabzuwandern zu dem Hakonesee.
Auf der ganzen Strecke begegneten wir keiner menschlichen Seele; ausgebrannte Kraterkegel ragen überall aus der baumlosen Hochebene hervor, hier und dort liegen kleine, bläulich-grüne Seen, nirgends ein Haus oder auch nur ein Flugdach; in dieser Einsamkeit haben buddhistische Heilige sich durch Bildwerke, in die Felswand gegraben, verewigt. Wie man in ganz Japan überall auf Weg und Steg kleinen Steindenkmälern und Götzenstatuen begegnet, so schlummern auch hier Dutzende in dem hohen, dürren Grase, darunter auch der riesige Dschizo, eines der Meisterwerke japanischer Bildnerkunst.
Endlich sahen wir einen Teil des blauen, stillen Hakonesees zu unseren Füßen liegen und hatten bald wieder die von ungeheuren Kryptomerien beschattete Tokaidostraße erreicht. Auf dieser hier noch vortrefflich erhaltenen, mit großen Steinen gepflasterten wichtigsten Heerstraße des alten Japan weiterwandernd, erreichten wir gegen Mittag das idyllische Dörfchen Moto-Hakone, am südlichen Ende des Sees gelegen, und einen halben Kilometer davon entfernt ein japanisches Theehaus, Tsudschi-ya. Mit seiner Vorderseite in den See hineingebaut, öffnen sich die durch Papierwände in einzelne Zimmerchen geteilten Veranden auf die weite, von Bergen[S. 547] umsäumte Wasserfläche, in deren Hintergrund der gewaltige Fujiyama emporragt. Zur Rechten erhebt sich auf einer schmalen, in den See vorspringenden Landzunge ein kaiserliches Schloß, das im Sommer zeitweilig Mitgliedern der Herrscherfamilie zum Aufenthalt dient. Auf der Theehausveranda nahmen wir unseren Imbiß ein, aufgetragen durch ein liebliches, junges Mädchen, das uns zum Andenken auch noch kleine Porzellannippsachen zusteckte, wohl als Erwiderung auf das reichliche Trinkgeld, das sie sich mehr durch ihr freundliches Wesen als durch besonders rasche Bedienung erworben hatte.
Als wir aufbrachen, um das bereitstehende Ruderboot zu besteigen, kam ein gewaltiger Platzregen niedergeprasselt, der unsere weißen Leinenanzüge und die Unterkleider bald bis auf die Haut durchnäßte. Das Boot war mit Wasser derart gefüllt, daß wir auf unseren Stühlen Platz nehmen und die Beine hochhalten mußten, während zwei von unseren Kulis fortwährend mit den Kübeln das Wasser ausschöpften. Das ähnlich wie unser Baedeker rot gebundene Murraysche Handbuch von Japan hatte ich zum Schutz gegen die Nässe unter meinen Sitz geschoben. Da der Führer ein baldiges Aufhören des Regengusses prophezeite und wir doch abends wieder nach Miyanoshita zurückkehren mußten, machten wir gute Miene zum bösen Spiel und ließen uns über den See nach dem Nordende desselben rudern.
Von den Ufern, die an malerischer Pracht mit den Gestaden der italienischen Riviera wetteifern, bekamen wir nur einzelne Stellen zu sehen. Nach zweistündigem, angestrengtem Rudern erreichten wir die Stelle, wo wir aussteigen mußten, um über die sogenannte Große Hölle den Rückweg anzutreten. Unsere Kulis hoben uns mit den Stühlen aus dem Boot und trugen uns, bis an die Hüften im Wasser watend, unter fortwährendem, strömendem Regen ans Ufer. Als ich dort meinen Tragstuhl verließ, um die steile Anhöhe des Kamuri zu Fuß emporzuklettern, brachen plötzlich meine Reisegefährten, Europäer wie Japaner, in schallendes Gelächter aus. Der rote Murray war in der Regenlache, die sich unter meinem Sitz gebildet hatte, vollständig durchnäßt worden und hatte meine weißleinenen Beinkleider gerade an ihrer bescheidensten Stelle knallrot gefärbt.
Auf halsbrecherischen Pfaden, an den Seiten schwindelnder Abgründe, führte unser Weg in das Thal von Miyanoshita zurück, und die Höllengegend, die wir zu durchwandern hatten, wird uns durch ihre großartige Wildheit und Einsamkeit wohl zeitlebens in Erinnerung bleiben. Heiße Schwefeldämpfe dringen überall aus dem weichen Kalk- und Schwefelboden, in dem unsere Füße stellenweise bis an die Knöchel versanken; das Wasser, das aus zahlreichen Quellen hervorsprudelt, ist ebenso heiß wie die nackten Felsen, die sie umgeben; dichte Nebelwolken raubten uns den Ausblick, warme Schwefelwasserstoffgase den Atem; an manchen Stellen brannte uns der Boden unter den Füßen, an anderen mußten wir über gewaltige Steintrümmer uns den Weg bahnen, und das bei unausgesetztem, strömendem Regen.[S. 548] Erst gegen Abend, als wir das lachende, grüne Thal der Hayagawa erreicht hatten, kam die Sonne wieder zum Vorschein.
Gerade diese Verschiedenheit der Landschafts- und Kulturbilder macht Miyanoshita zu dem entzückendsten Aufenthalt, den man sich denken kann, und wäre es in Europa gelegen, es würde gewiß zu unseren besuchtesten Wallfahrtsorten der Sommertouristen zählen.
Nach mehrwöchentlichem Verweilen in dieser Bergregion des mittleren Japan brachen wir endlich, nicht ohne Bedauern, auf, um nach der alten Hauptstadt des Reiches, nach Kioto, zu fahren. Auf dem Wege dahin blieben wir noch einige Tage in dem interessanten Nagoya, das, auf der großen Eisenbahnlinie Tokio-Kioto gelegen, doch noch von europäischen Einflüssen verschont geblieben ist und neben echt japanischem Leben auch noch großartige Tempel, reichgefüllte Antiquitätenläden und vor allem sein stolzes Daimioschloß besitzt. Dieses letztere, ein mehrstöckiger Bau in Pyramidenform, wird von den berühmten zwei goldenen Delphinen gekrönt, von denen einer auf der Weltausstellung in Wien allgemeine Bewunderung erregt hat. Das alte Schloß, einst die Residenz der mächtigen Fürsten von Owari, enthält in seinem Innern nicht viel Sehenswertes mehr, denn die Zerstörungswut der Staatsbehörden, der in den ersten Jahren der gegenwärtigen Regierung so viele Herrlichkeiten des alten Japan zum Opfer gefallen sind, hat auch dieses großartige Denkmal der Feudalzeit nicht verschont. Nur in seinem Aeußern ist es so geblieben, wie es in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts war.
Von Nagoya führte uns der Weg, teilweise in Rickshaws, teilweise im Eisenbahnwagen, durch die gesegneten Gefilde des ehemaligen Fürstentums Owari über Gifu an die Gestade des großen Biwasees und schließlich nach Kioto.
Der österreichische Thronerbe Erzherzog Franz Ferdinand sagt in seinem spannenden Werke über die von ihm unternommene Weltreise mit vollem Recht: „Was dem Katholiken Rom, dem Russen Moskau, dem Mohammedaner Mekka, dem Buddhisten Kandy, das ist Kioto dem Japaner.”
Damit soll freilich nicht auch gesagt sein, daß Kioto sich irgendwie mit Kandy, Mekka, Moskau oder gar mit Rom vergleichen lasse. Wer von der alten Hauptstadt des Mikadoreiches eine Art Rom erwartet, wird bei seinem Besuche dieser Hauptstadt gründlich enttäuscht. Kioto ist keine Stadt von Palästen, von Kunstwerken, Denkmälern, Museen, von großstädtischem Leben und Reichtum, wie Moskau oder Rom. Es besitzt davon im vollen Sinne des Wortes nichts, und würde irgend einer der zahllosen Adelspaläste der ewigen Stadt, irgend eine ihrer Kirchen nach Kioto verpflanzt werden, sie würden die größten und vornehmsten Bauten dieses japanischen Rom bilden; ja ich zweifle, ob die hundertfünfzigtausend Häuser von Kioto zusammengenommen hinreichend Mauerwerk enthalten, um damit nur einen einzigen römischen Palast bauen zu können.
Kioto ist eine hölzerne Hüttenstadt, gerade so wie der Hauptsache nach Tokio, wie Nagoya, Nagasaki und alle anderen Städte des japanischen Inselreiches, nicht schöner, nicht reicher, nicht großartiger; aber es ist dennoch die interessanteste Stadt. Warum, lernt der Reisende schon nach einem Aufenthalte von mehreren Tagen kennen, besonders wenn er zuvor die anderen Städte Japans besucht hat.
Die Landkarte zur Hand. Dort, wo die größte Insel des Mikadoreiches die schmalste Stelle zeigt, beiläufig im Mittelpunkt des ganzen japanischen Archipels, liegt der malerische Biwasee, an Größe etwa den Genfersee erreichend. Westlich von diesem See liegt in einem von hohen Bergen umschlossenen Thalkessel das alte Kioto. Für eine Kaiserresidenz war die Lage gut gewählt, und thatsächlich lebten und starben hier seit beinahe einem Jahrtausend eine lange Reihe von Kaisern,[S. 550] ungesehen von ihrem Volke, eingeschlossen in einen von hohen Mauern umgebenen Palast aus Holz und Papier. Erst die große Revolution sprengte vor etwa fünfunddreißig Jahren die Fesseln, mit denen die allmächtigen Vizekaiser, die Schogune, ihre kaiserlichen Puppen auf dem Throne umfangen hielten. Im Triumph wurde der Kaiser, dieser Nachkomme der Sonnengöttin, nach der neuen Residenzstadt Tokio, dem alten Yeddo, geführt, Japan warf sich der europäischen Kultur in die Arme und ließ Kioto zurück, wie ein ausgekrochener Schmetterling sein dünnes, vertrocknetes Puppengehäuse zurückläßt. Der ganze Schwarm der Kuge, dieses japanischen Hofadels, der Daimios, das schmetterlingsgleiche, glänzende Gefolge des Kaiserhofes zog mit dem Mikado nach seiner neuen Hauptstadt, und statt mit einem Rom ist Kioto eher mit einer unserer verlassenen Fürstenresidenzen zu vergleichen.
Schon während der seither verflossenen drei Jahrzehnte hat es von seiner früheren Bevölkerung etwa ein Drittel eingebüßt und besitzt heute nur noch gegen dreihunderttausend Einwohner. Aber das ist nur der Anfang von seinem Ende; die gegenwärtige Hauptstadt zieht viel von dem Glanz und Reichtum, das benachbarte Osaka viel von Industrie und Handel an sich; die verarmte Bevölkerung sucht anderswo besseren Erwerb, und es wird Kioto vielleicht ähnlich, wenn auch nicht ganz so gehen wie den japanischen Kaiserresidenzen vor Kioto und wie jenen in anderen Ländern; es wird eine Stadt bleiben von historischen Erinnerungen.
Schade darum, denn die Lage dieser urjapanischen Stadt ist entzückend. Ihre schnurgeraden, nach amerikanischer Schachbrettmanier angelegten Straßen liegen zu beiden Seiten des Kamoflusses (Kamogawa) ausgebreitet, in einer weiten, ovalen Mulde von der Form eines alten, ausgebrannten Kraters. Aber an die Stelle der starren Lava sind üppige Gärten getreten, das weite, graue, einförmige Häusermeer wird hier und dort doch von schattigen Tempelhainen, von Gartenanlagen und Squares unterbrochen und von den silbernen Bändern mehrerer Flußläufe durchzogen. Die sanften Abhänge der Kioto umgebenden Berge sind mit schönen Gärten bedeckt, zwischen denen zahlreiche Klöster, Tempel, Heiligenschreine und Pagoden hervorlugen, und die Länderstriche der ferneren Umgebung sind von den üppigsten Kulturen eingenommen, denn diese zentralen Provinzen von Japan, in deren Mitte Kioto liegt, sind die fruchtbarsten des ganzen Reiches.
Auch die neue Eisenbahn von Osaka nach Kioto hat kein neues Leben in die alte Stadt gebracht, und die moderne halbeuropäische Kultur, deren Einfluß man an vielen Dingen in Tokio und anderen Städten gewahrt, hat Kioto vollständig unberührt gelassen.
Als ich, von der ganz europäischen Hafenstadt Kobe kommend, in Kioto eintrat, brachte mich ein Kuli in einem der bequemen Rollstühle, diesen japanischen Droschken, durch gerade, einsame Straßen nach einem zweistöckigen Hotel, dem Kiotohotel.[S. 551] Es ist heute noch das einzige europäische Gebäude der Stadt, ganz modern gehalten, wie irgend ein Hotel in Europa. Trat ich aber aus dieser abendländischen Touristenoase auf die Straße, so befand ich mich mitten im urjapanischen Leben. Unabsehbare Reihen kleiner, höchstens ein Stockwerk hoher Holzhäuschen, nach der Straßenseite weit geöffnet; hier und da Kaufläden mit Büchern, japanischen Nippsachen oder Antiquitäten, oder ein Tempel mit mehreren Thorbogen und schöngeschwungenem Dach. Die Straßen ungepflastert, aber doch sehr reinlich gehalten; bei Tage nur wenig Verkehr, am Abend schlecht erleuchtet und noch einsamer. Meilenweit auf und ab, überall dasselbe. Die vollständig in europäische Tracht gekleideten Japaner, die Männer ebensogut wie die Frauen und kleinen possierlichen Mädchen, blieben stehen, um den Fremdling mit neugierigen Blicken zu betrachten; die Kinder liefen mir nach oder bildeten einen Kreis um mich, wenn ich bei irgend einem Kaufladen anhielt. Dem äußeren Rahmen nach präsentierten sich die einzelnen Stadtviertel Kiotos wie ebensoviele Dörfer des Berner Oberlandes, die ähnliche braune, mit Veranden geschmückte Holzhäuser zeigen. Denkt man sich irgend eines dieser Stadtviertel nach der Schweiz, etwa in das Emmenthal, versetzt, so könnte es ganz gut als ein Berner Dorf gelten, nur würde das dichte Beisammenstehen der Häuser und die Regelmäßigkeit und Reinlichkeit der Straßen Verwunderung erregen.
Der Zauber von Kioto, ebenso wie der anderen Städte Japans, liegt nicht in den Aeußerlichkeiten, die mehr als bescheiden sind, sondern in dem Leben und Treiben seiner Einwohner, in Sitten, Trachten und Festlichkeiten. Ueberdies birgt das äußerlich so einförmige Straßengewirre in seinen unscheinbaren Häuschen dasjenige, was wir an der japanischen Kultur am meisten bewundern und um was wir die Japaner geradezu beneiden könnten: ihre Kunst und Kunstindustrie. Am Hofe des Kaisers und seiner Großen ist sie in früheren Jahrhunderten großgezogen worden, die Künstler standen ihr ganzes Leben lang im Solde der Fürsten, und ihr Streben war es nicht, wie jener in anderen Ländern, möglichst rasch zu Ansehen und Reichtum zu kommen, sondern Kunstwerke zu schaffen, diesen ihre Individualität aufzuprägen. Arbeitsteilung war diesen Künstlern unbekannt. Jedes ihrer Werke wurde von ihnen entworfen und vom Anfang bis zur gänzlichen Vollendung allein ausgeführt. Die Zeit, die sie dazu bedurften, war nebensächlich, und häufig ist es vorgekommen, daß Künstler an einem einzigen Kunstwerk ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben. Da kam die Revolution. Der Kaiser und die Fürsten zogen von Kioto fort, aber viele Künstler blieben in der alten Hauptstadt zurück. In den kleinen Werkstätten, die sich durch keine Schilder oder äußere Zeichen dem Fremden offenbaren, wird fleißig nach den alten Grundsätzen weitergearbeitet, nur geschieht dies jetzt nicht mehr für die bisherigen Ernährer und Förderer dieser Künstler, die Fürsten, sondern für den allgemeinen Markt. Das konservative Element ist in diesen Künstlerfamilien[S. 552] zu stark, und die Zeit, die seit der Revolution verstrichen ist, war zu kurz, als daß sie sich den modernen Verhältnissen hätten anpassen können, wie es leider in Tokio, in Osaka und anderen japanischen Städten der Fall ist. Dazu ist in Kioto die künstlerische Atmosphäre noch dieselbe geblieben; zahlreiche Fürsten und Große entäußerten sich ihrer Kunstschätze, als die Regierung ihre Länder und Einkünfte konfiszierte, und obschon der größte Teil dieser Kunstschätze nach dem Abendlande gewandert ist und heute in Museen und Privatsammlungen die Bewunderung aller Kenner erweckt, ist doch noch vieles gerade in Kioto zurückgeblieben, das den dortigen Künstlern zum Vorbilde und zur Grundlage für andere Kunstwerke dient. So gewährt es dem Fremden das größte Interesse, diese bescheidenen Künstlerateliers zu besuchen und zu sehen, wie die entzückenden Bronze- und Emailsachen, Porzellane, Lackwaren, Malereien, Stickereien, Brokate und Seidenstoffe aus den fertigen Händen mit so ungemein einfachen Mitteln hervorgehen. Tagelang wanderte ich von einem zum anderen; überall wurde ich mit der altjapanischen, in den Hafenstädten leider auch allzurasch schwindenden Höflichkeit aufgenommen; überall wurde mir mit großem Zeremoniell von zarten Mädchenhänden Thee vorgesetzt, und nach langer Unterhaltung ließen sich die Künstler vielleicht herbei, ihre schönsten, in Kisten auf das sorgfältigste verpackten Kunstwerke zu zeigen. Ebensogroßes Interesse gewährte es mir, in den zahllosen Antiquitäten- und Kuriositätenläden der, Mandschudschidori genannten, Straße umherzustöbern, wo sich neben ganz modernen, auf den europäischen Touristenmarkt berechneten Waren doch noch eine ganze Menge altjapanischer Kunstwerke vorfindet. Uebrigens braucht man sich in Kioto gar nicht in die verschiedenen Läden zu bemühen. Die Bevölkerung ist einesteils durch die geschilderten Umstände verarmt, anderseits hat sie mit der den Japanern eigentümlichen Findigkeit und Schlauheit den Marktwert der alten Kunstprodukte rasch herausgefunden, und teils aus Not, teils aus hochentwickelter Gewinnsucht suchen die Händler oder auch Private die abendländischen Besucher der Stadt selbst auf.
Schon bei meiner Ankunft am Bahnhofe wurden mir von einer Schar von Agenten Visitenkarten, Zirkulare, Preiskurante, Einladungen und dergleichen überreicht oder in meine Rickshaw geworfen oder in meine Gepäckstücke gesteckt. Auf meinem Zimmer fand ich derlei Adressen zu Dutzenden hinter dem Spiegel steckend oder auf dem Tische ausgebreitet, und kaum hatte ich mit meiner Toilette begonnen, so klopften der Reihe nach ein halbes Dutzend von Kellnern, Stubenmädchen, Agenten, ja selbst kleine zierliche Nesans an meine Thüre, um mir Adressen zu überreichen oder gar eine Menge von Kunstgegenständen verschiedenen Werts, in Tücher gewickelt, vorzulegen. Wollte ich ausgehen, so erwarteten mich diese ambulanten Verkäufer an jedem Treppenabsatze, an jeder Korridorecke; kam ich nach Hause, so stand schon wieder eine ganze Anzahl von ihnen mit Paketen und Rollen und Bündeln da,[S. 553] und ich konnte mich ihrer nicht anders entledigen, als indem ich wirklich einige der reizenden, aber dabei recht teuren Sächelchen erstand. Damit hatte ich aber nur Oel ins Feuer gegossen. Mit staunenswerter Schnelligkeit mußte sich die Nachricht von meinen Einkäufen in Kioto verbreitet haben, denn am Tage darauf wurde ich in meinem Hotel von der doppelten Zahl dieser Verkäufer belagert. Bei aller Zudringlichkeit waren sie von einer Höflichkeit und Ehrerbietung, als wäre ich ein König gewesen. Um ihre Waren kennen zu lernen, ließ ich sie mir doch im Rauchzimmer des Hotels vorlegen. Einem nach dem andern wurde Audienz erteilt. Den ersten hoffte ich los zu werden, indem ich ihm die Hälfte seiner Forderung anbot. Flugs nahm er mich beim Worte, und ohne es zu wollen, war ich um ein japanisches Kunstwerk reicher, um vierzig Mark ärmer geworden. Dem zweiten bot ich ein Viertel seines Preises, und zu meinem Schrecken wurde auch das angenommen. Dem dritten war die Summe, die ich ihm anbot, doch zu gering. Damit hatte ich nun mein Mittelchen gefunden. Ich bot den anderen ein Zehntel ihres Preises, und das schreckte sie derart ab, daß sie mich schließlich nicht weiter belästigten.
In den Kaufläden selbst ließen sich die Händler selten etwas herunterhandeln, besonders in den großen Seiden-, Brokat-, Samt- und Bronzeläden, welche die wichtigsten und schönsten Produkte der Kunstindustrie von Kioto enthalten. Ueberall die größte Höflichkeit, überall Thee, überall warfen sich die Verkäuferinnen vor mir nieder, aber sie blieben fest bei ihren Preisen, die in der Regel das Doppelte von dem betrugen, was den eingeborenen Japanern abgefordert wird. Hier ein ergötzliches Beispiel dieser Beutelschneiderei, der man in Japan überall ausgesetzt ist: Auf meinem ersten Spaziergange nach meiner Landung in Yokohama fand ich in einem Curio Shop (Kuriositätenladen) ein reizendes Glockenspiel, das in ähnlichen Läden in Paris zu fünfzig Francs feilgeboten wird, mit zwanzig Mark bezeichnet. Natürlich erwarb ich es sofort, ohne zu handeln. In Tokio wurde mir dasselbe Kunstwerk um fünfzehn Mark angeboten, und da es wirklich hübsch war, kaufte ich auch dieses Exemplar. Zu meiner Ueberraschung wickelte einer der Händler, die mich in Kioto bestürmten, einmal noch ein solches Glockenspiel aus seinem Bündel. Ich bot ihm die Hälfte meines letzten Kaufpreises, also siebeneinhalb Mark, und ohne ein weiteres Wort war der Handel abgeschlossen. Als ich eine Woche später nach dem Birmingham von Japan, nach Osaka, kam, besuchte ich auch das dortige Gewerbemuseum, und eines der ersten Objekte, das mir auffiel, war mein Glockenspiel. Preis zwei Mark. Nun kaufte ich dieses erst recht und noch ein zweites dazu, denn mit solchen Geschenken, die in Paris einen Kaufpreis von fünfzig Francs besitzen, konnte ich doch nach meiner Rückkehr bei meinen Freunden Effekt machen. Hoffentlich liest keiner von ihnen dieses Bekenntnis.
Eine Kaiserstadt wie Kioto, welche in ihren (Holz- und Papier-) Mauern eine Reihe von fünfzig Kaisern beherbergt hat und beinahe ein Jahrtausend lang die[S. 554] Hauptstadt von Japan gewesen ist, mußte doch noch die Paläste dieser Kaiser und seines hohen Adels haben, wenn auch diese selbst vor einigen Jahrzehnten fortgezogen sind. In Nagoya, in Fukuyama, in Okayama hatte ich die großen, ungemein malerischen Burgen der alten Landesherren bewundert, welche die modernisierten Vandalen trotz ihrer blinden Zerstörungswut gegen alles Altjapanische noch haben stehen lassen: pyramidenförmige, mehrstöckige Pagoden, umgeben von gewaltigen Ringmauern und Gräben. Wie herrlich mußten also die Paläste der Kaiser selbst sein! In Tokio wird auch viel Wesens davon gemacht, und die Erlaubnis zum Besuche der Kaiserschlösser von Kioto mußte ich mir durch die Gesandtschaft bei der Regierung selbst erwirken. Mit diesen Besuchspässen in japanischer Schrift, reich mit viereckigen roten Stempeln versehen, fuhr ich eines Tages zunächst nach dem im Nordosten von Kioto gelegenen, Goscho genannten Kaiserpalast. Eine hohe Mauer mit sechs Thoren schließt denselben gegen die Außenwelt ab. Durch das Mi-Daidokoro Gamon, d. h. „das Thor der erhabenen Küche”, tretend, befand ich mich in einem öden, weiten Hofe, auf dem sich noch vor dreißig Jahren die Paläste der Kuge, d. h. der mit dem Kaiserhause verwandten Fürsten, befunden haben. Sie fielen der „Revolution von oben” zum Opfer. Ein Hofbediensteter empfing mich unter tiefen Bücklingen und führte mich in ein Bureau, wo mein Besuchspaß durchgesehen und mein Name in ein Buch eingetragen wurde. Hierauf begaben wir uns durch große, mit Bäumen bepflanzte Höfe zu einem kahlen, ebenerdigen, mit breiten Veranden umgebenen Gebäude, in dem ich die „erhabene Küche” oder die Wohnungen der Dienerschaft vermutete. Es war aber der Kaiserpalast selbst. Ich mußte meine Beschuhung mit weichen Hausschuhen vertauschen, deren Sohlen aus einem Stück Seidensamt bestanden, eine Vorsicht, die ich begreiflich fand, als ich die wie ein Pianodeckel polierten oder mit den zartesten Strohmatten bedeckten Fußböden der Korridore und Wohnräume betrat. Mit einer gewissen Ehrfurcht durchschritt ich die weiten Korridore, deren Wände aus gehobelten Holzrahmen, mit weißem Papier überzogen, bestanden, denn ich war ja im Begriff, die Empfangs- und Thronsäle der ältesten Kaiserdynastie der Welt zu betreten. Welche Schätze, welch erhabene Kunstwerke mochten hier in dem vornehmsten Palaste dieses Landes der Kunst aufgespeichert sein, wie freute ich mich auf die mir bevorstehende Augenweide! Mein Führer schob eine Papierwand zurück und hieß mich eintreten. Ein weiter, niedriger Raum mit einer etwa kniehohen Estrade an einem Ende. Auf der Estrade erhob sich ein niedriges Zelt aus vergilbter, weißer Seide, mit schwarzen Bändern behängt. Sonst war nicht das geringste Möbel zu sehen. Mit leisen Worten teilte mir der Führer mit, dies sei der Thronsaal und das Zelt der Thron des Kaisers. Wieder wurde eine Papierwand beiseitegeschoben, ein zweiter papierener Raum ohne irgend welche Einrichtung, der Empfangssaal; ein dritter Papierraum ohne Möbel, das Speisezimmer; ein vierter das Schlafzimmer; nichts als Papierwände, weiche,[S. 555] geflochtene Fußbodenmatten und sehr schön geschnitzte, reich bemalte Holzdecken. Voilà tout. So gab es etwa dreißig, vierzig derartige Räume, nur zeigten manche von ihnen künstlerische Wandmalereien, Bäume und allerhand Tiere mit viel Geschmack und Genauigkeit gemalt, sonst aber kein Bett, keinen Tisch, keine Vase oder Bronze, keine Blume. In einem Saale waren die Wände mit Malereien bedeckt, die Fächer darstellten, alle von solchem Geschmack, solcher Harmonie der Farben und Formen, daß ich mich kaum davon trennen konnte. Aehnliche Gefühle wie die, welche mich jetzt bewegten, hatte ich empfunden, als ich in Sakkara und Biban el Meluk in Aegypten die Königsgräber besuchte. Auch dort sind die leeren Räume mit ähnlich frischen Wandmalereien geschmückt. Aber wie dort, so schien es mir auch hier, als lägen Jahrtausende zwischen den Menschen, die zur Zeit ihrer Erbauung gelebt haben, und der Gegenwart. Und ist nicht auch dieser Papierpalast ein Königsgrab? Ist er nicht das Grab des alten Japan, das unvergleichlich viel anziehender, interessanter, malerischer war in seinen Menschen und ihrer Kultur als das nach europäischer Art gestiefelte und gespornte Japan von heute? Schöner, großartiger, individueller ist der nicht weit vom Kaiserpalast gelegene Palast der Schogune, Nidscho genannt. Die militärische Macht dieser einstigen Vicekönige äußert sich noch heute durch die festen Mauern mit pagodenartigen Ecktürmen, die ihn umgeben. Das Reisehandbuch nennt den Nidschopalast einen Traum von goldener Schönheit, womit wahrscheinlich die reichen Vergoldungen der Decken und Tragbalken der einzelnen Räume gemeint sind. Die Räume sind größer und höher, die Malereien kräftiger und kühner, einzelne in der That von besonderer Schönheit. Das Ganze zeigt größeren Reichtum, größere Vornehmheit. Geradezu blendend ist der goldstrotzende Audienzsaal der Schogune, und leicht konnte ich mir im Geiste das imposante Bild vergegenwärtigen, als diese nun in Staub liegenden großen Herren die in den prächtigsten Kostümen prangenden Feudalfürsten des Landes empfingen, ein Bild, das in solchem Glanz und solcher Fremdartigkeit wohl nirgends erreicht worden ist. Aber wo ist das alles heute? An einem Tage wurde es fortdekretiert, und nichts ist davon übrig geblieben als dieser Schogunpalast, die trotz ihrer Leere immer noch imponierende Hülle.
Viel interessanter als diese beiden Paläste sind die zahllosen Buddha- und Shintotempel, welche Kioto beherbergt, nicht weniger als dreitausend an der Zahl mit achttausend Priestern. In dieser Hinsicht ist Kioto wirklich ein Rom, ja es hat sogar seinen Papst in der Person des Großbonzen der Schinsekte, dessen Haupttempel der prächtige Higaschi-Hongwanschi ist. Tage verbrachte ich mit dem Besuche der verschiedenen Tempel, mit ihren Tausenden und Abertausenden von Buddhastatuen groß und klein, mit ihren bronzenen Göttern und Göttinnen, ihren Opferschreinen und habgierigen, recht unheiligen Priestern. Selten traf ich in diesen Tempeln andächtige Männer; die Hauptbesucher waren Frauen, und wie opferwillig[S. 556] diese den Göttern gegenüber noch heute sind, sah ich bei dem Bau des vorerwähnten Higaschi-Hongwanschi.
Zahlreiche Arbeiter waren noch mit der Fertigstellung dieses Riesengebäudes, eines der größten von Japan, beschäftigt, und in einer Ecke des Bauhofes lagen zwei mannshohe Rollen von armdicken schwarzen Tauen. Als ich näher trat, bemerkte ich, daß sie aus Haaren geflochten waren. Mein Führer erzählte mir nun, daß die gewöhnlichen Taue durchwegs zu schwach waren, um die ungeheuren Dachbalken dieses mächtigen Baues beim Emporziehen zu tragen, und ihr Reißen hatte mehrere Unglücksfälle zur Folge. Da weissagte ein Priester, daß nur Taue aus Frauenhaaren stark genug sein würden, die Arbeit zu ermöglichen. Und siehe, Tausende von Frauen opferten ihren Haarwuchs, mehr als erforderlich war. Wo gäbe es im Abendlande Frauen, die sich zu einem solchen Opfer entschließen würden? Hat es nicht seine Berechtigung, wenn alle Reisenden das Lob der Japanerinnen singen?
Mehr als irgendwo lernt man in den Tempeln von Kioto das innere Leben der Japaner kennen, ihre Geistesrichtung, ihren Aberglauben. Dabei enthalten sie aber auch ungezählte Merkwürdigkeiten, deren bloße Anführung allein schon ein Buch füllen würde. Und wie am Tage die Tempel, so gewähren zur Nachtzeit die zahllosen Theehäuser des Gion einen tiefen Einblick in die Sitten der Japaner. Gion ist das Quartier der Leichtlebigkeit, oder soll man sagen Leichtliebigkeit? Die Theehäuser sind ihrem Aeußeren nach bei weitem nicht so groß, reich und einladend wie die Yoshiwara von Tokio oder Yokohama, ärmliche, niedrige Häuschen, vor deren Thüren abends große weiße Papierlaternen mit recht verfänglichen Inschriften brennen. Aber im Innern geht es dafür desto toller zu. Aber auch im Freien kann man dieses eigentümlich muntere, lose Treiben kennen lernen, besonders im Sommer, wenn der Kamogawa ausgetrocknet ist und das Völkchen von Kioto es sich in dem weiten steinigen Flußbette bequem macht. Oder an den zahllosen Festtagen des Jahres, wenn die ganze Bevölkerung mit buntem Festschmuck in den Straßen ist. Dann erst sieht man, daß Kioto noch lebt und daß die Bevölkerung ebenso sorglos, ebenso urjapanisch ist wie zur Zeit der Schogune.
Japan ist das Land der Feste, wie kein zweites auf Erden. In jeder Woche finden in diesem gesegneten Inselreiche des fernen Ostens Festlichkeiten statt, nicht nur solche, wie wir sie haben: Neujahr, Kaisers Geburtstag und dergleichen, sondern Blumenfeste, Kinderfeste, Erntefeste, Fluß- und Waldfeste, vor allem aber religiöse Feste ohne Zahl. Die ganze Bevölkerung, hoch und niedrig, beteiligt sich daran. Die Häuser, Straßen, Gärten, Plätze und Tempel sind im Festschmuck, ebenso wie das Volk, das mit Kind und Kegel hinauszieht ins Freie. Landet ein Fremder an solchen Festtagen in Japan, er könnte sich auf irgend einem anderen Planeten denken, so fremd, so eigenartig sind die ungemein lebhaften, farbenreichen Bilder, die sich ihm überall darbieten, heute noch gerade so wie vor Jahrhunderten, denn was von der europäischen Kultur an Aeußerlichkeiten in Japan angenommen wurde, beschränkt sich auf die kleinsten Kreise und spielt in dem großen, alles beherrschenden Volksleben gar keine Rolle.
Am zahlreichsten sind im japanischen Kalender, wie schon gesagt, die religiösen Festlichkeiten, solche der Buddha- und Shintoreligion, ohne daß sich das niedere Volk in seiner Unwissenheit und dabei auch Gleichgültigkeit in religiösen Dingen eine Vorstellung von der eigentlichen Bedeutung dieser Feste macht. Genug, daß es ein Matsuri, ein Fest ist, und Gelegenheit bietet, sich zu unterhalten, den Tag über im Freien zuzubringen, die schönsten Kleider anzulegen, mit Verwandten und Bekannten zu zechen.
Nur eines dieser Feste wird vom Volke im ganzen Lande verstanden, das Fest der Toten, oder wie wir es nennen würden, Allerseelen.
Wohl ist von der modernen Staatsregierung in Japan offiziell wieder die altangestammte Religion der Japaner, der Shintoismus, im Lande eingeführt worden, aber das Volk steckt doch noch ganz im buddhistischen Glauben, der viele Jahrhunderte lang bis zur gegenwärtigen Restauration der herrschende war. Nach diesem Glauben kommen im August jeden Jahres die Seelen der Verstorbenen für drei Tage wieder auf die Erde, besuchen ihre Familien, Heimstätten und Lieblingsplätze, um am Abend des dritten Tages wieder ins Jenseits zurückzukehren.
Diese Geister müssen nach der Meinung des Volkes festlich bewirtet werden, und deshalb wird das Totenfest im ganzen Lande wie kein zweites gefeiert, besonders in der alten Hauptstadt Kioto.
Als ich Mitte August von einer längeren Reise wieder nach Kioto zurückkehrte, zeigte sich mir diese sonst verhältnismäßig einförmige Stadt in geradezu feenhafter Farbenpracht. Straßen auf, Straßen ab, nichts als bunte Fahnen, Flaggen, Festons; an den Häuserfronten in meilenlangen Reihen bunte Lampions in jeder Größe[S. 558] und Form, auf jeder Hausterrasse Blumen, Reisig, Papierguirlanden, besonders reich an solchen Häusern, in denen sich im abgelaufenen Jahre ein Todesfall ereignet hatte.
Blickte ich in diese dünnen Holzhäuschen mit zurückgeschobenen Papierwänden, dann sah ich vor den kleinen Familienaltären, welche dem Andenken der Toten geweiht sind, glimmende Weihrauchkerzen, deren leichter Rauch sich in dünnen Fäden emporschlängelte, und zwischen ihnen kleine Porzellanschälchen mit Reis und Reiswein, als Speise und Trank für die Toten. In den vornehmsten Yaschiki (Palästen) der Großen wie in den ärmsten Hütten, im Hintergrunde der Kaufläden, in Werkstätten, überall werden die Seelen der Verstorbenen auf diese seltsame Weise bewirtet, ohne daß dabei von Andacht oder Trauer etwas wahrzunehmen wäre. In den Straßen drängten sich die Menschen in ihren malerischen langen Festkleidern: Männer in dunklen, schlafrockartigen Kimonos, Frauen mit bunten Sonnenschirmen und Fächern, Mädchen mit hellfarbigen Kleidern und roten Unterröcken, alle gepudert und geschminkt, daß ihre Gesichter wie Puppenlarven aussahen; kleine putzige Kinderchen tummelten sich in großer Zahl zwischen den Erwachsenen herum, womöglich noch bunter gekleidet als die letzteren.
Wenn immer ich in meinem zweiräderigen Wägelchen, der Rickshaw, sitzend um irgend eine Ecke bog und in eine neue Straße einlenkte, dann bot dieselbe in ihrer Gesamtheit ein seltsam prächtiges Bild dar. Die Sonnenstrahlen leuchteten auf diesen Unmassen von roten, gelben, blauen, grünen Sonnenschirmen, auf diesen Tausenden von ebenso bunten Schlafröcken, die sich auf- und abbewegten, spielten auf den Blumensträußen und Fächern, die sich in unzähligen Händen befanden. Diese farbenreiche Menschenmenge wogte zwischen den bunten Häuserreihen einher, wie ein ungeheures Blumenbeet in Bewegung. Und fuhr ich dann mitten durch dieses Gewühl, dann bemerkte ich nur fröhliche Gesichter; die Alten blickten vergnügt umher, die Mädchen, diese lieben kleinen, reizenden Musmis, kicherten, die putzigen Kinder lachten, sprangen und tanzten, als gälte es irgend ein besonderes Freudenfest zu feiern, nicht ein Trauerfest für die Toten.
Das Ziel der meisten waren die Friedhöfe. Dort zwischen den langen Reihen von gleichförmigen niederen Grabsteinen standen bei jedem einzelnen Grabe Bambusstöcke, in deren Oeffnungen frische Blumen steckten. Die fröhliche Menge zeigte nicht die geringste Ehrfurcht oder Scheu vor den letzten Ruhestätten ihrer Toten. Lachend und scherzend stiegen sie über diese hinweg, erneuerten hier und dort die Blumen, banden bunte Lampions an die Stöcke oder stellten Oellämpchen auf die Grabsteine, denn heute Abend, dem dritten des Totenfestes, sollten die Seelen der Verstorbenen wieder zurückgeleuchtet werden in das dunkle Jenseits.
Kaum brach die Dämmerung an, so leuchtete es auf den Friedhöfen wie in den Straßen und Häusern überall auf, anfänglich nur schwach, später in grellen[S. 559] Farben. Hunderttausende von Papierlampions brannten längs der Häuser, die mit ihren Papierwänden im Grunde genommen selbst wie ungeheure Lampions erschienen. Dazu kamen die Lampions, welche die Menschen in den Straßen umhertrugen, auf langen Stöcken über ihren Köpfen, oder in den Händen, oder zu beiden Seiten der geräuschlos umherrollenden zahlreichen Handwägelchen. Das ganze Gewühl hatte etwas Seltsames, Phantastisches an sich: die Abwesenheit von Wagen und Pferden in den Straßen, das eigentümliche Geräusch der auf dem Straßenboden einherschlürfenden Holzpantoffeln, die von den roten oder blauen oder gelben Lampions in dieselben Farben getauchten Gestalten mit den fremdartigen Gesichtszügen, die weißen, bemalten Larvengesichter der Frauen: es schien mir, als wären all diese Wesen die Verkörperung jener Seelen, welche, aus dem Jenseits herabgekommen, heute noch in Kioto weilten, auf der Rückwanderung begriffen nach ihrem unbekannten Seelenheim, nach dem Nirwana, als wäre Kioto aus einer Stadt von Lebenden heute in eine Stadt der Geister ihrer Vorfahren verwandelt.
Ich fühlte mich beinahe unheimlich inmitten dieser Tausende und Abertausende, unter denen ich der einzige Europäer war, und ich ließ mich nach dem Kiotohotel zurückführen, um von den Fenstern meines im obersten Stockwerk gelegenen Zimmers den Gesamteindruck der Stadt zu genießen. Als ich dort eintrat, gewahrte ich auf dem schwarzen Felsen, der sich wie ein Turm im Osten der Stadt hinter Maruyama erhebt, einen Lichtschein. Wie die Flamme einer ungeheuren Fackel schwankte der ferne Lichtschein den steilen Abhang des Daimondschiyama entlang; dann erschien ein zweiter, ein dritter, dann Dutzende und Dutzende, bald hier, bald dort, Irrlichtern gleich, gespensterhaft, hoch empor, wie leuchtende Flammenwege, die ins Jenseits führen. All diese Flammen, flackernd, vom Winde bewegt, bald erlöschend, bald wieder aufleuchtend, verbanden sich allmählich zu Linien, die einander begegneten, einander kreuzten, und schließlich stand das chinesische Schriftzeichen Dai, einem verschlungenen A nicht unähnlich, in ungeheuren Flammenlinien auf dem hohen Berge.
Und während sich dort diese Flammenschrift formte, erstrahlten auf diesem und jenem Berge in der Dunkelheit andere Riesenflammen, nicht willkürlich und formlos, sondern bestimmte Umrisse annehmend, Linien, wie erstarrte Blitze, Dschunken, Pagoden, Schriftzeichen, Thorbogen und dergleichen. Ganz im Westen, wahrscheinlich auf den schwarzen Flanken des Araschiyama, erschien ein derartiger japanischer Thorbogen, ein Torii, wie ihn die Japaner nennen, von ganz ungeheuren Dimensionen, mit turmhohen brennenden Pfeilern und Querbalken, so lang wie Brücken. Wohin ich mich auch wenden mochte, gigantische, gespensterhafte Feuerzeichen überall, auf allen Höhen rings um die tief in einem weiten Thalkessel lagernde Stadt, und in den Straßen dieser letzteren selbst Myriaden bunter Lichter in langen Linien, mit anderen, die dazwischen einherjagten, als wären es wirklich die Seelen der Ver[S. 560]storbenen, die jenen flammenden Himmelszeichen, jenem feurigen Thorbogen zueilten. Darüber die finstere, kohlschwarze, sternenlose Nacht.
Als sich mein Auge an dieses seltsame Meer von Flammen und Lichtern gewöhnt hatte, bemerkte ich erst, daß ringsum auf den Hausdächern, auf Tempeln und Pagoden dunkle, schweigsame Gestalten standen, wie die sterblichen Hüllen jener irrlichtgleichen Seelen, die dort unten in den Straßen weilten. Als aber erst das große Flammenthor in seinen ganzen Umrissen brannte, als das Dai-Zeichen riesengroß durch die Nacht leuchtete, da erhob sich von diesen Gestalten auf den Dächern, den Bewunderern des feenhaften, höllischen Schauspiels, lautes Jubelgeschrei, das sich in den Straßen unten fortpflanzte, der Enthusiasmus der lebhaften, leicht beweglichen Volksmengen war entfacht und machte sich durch donnernde Rufe Luft.
Nach einer halben Stunde begannen die vielen Feuerscheine zu verblassen, allmählich zu erlöschen, die langen Reihen zerfielen wieder in einzelne Flammen, aus dem hellen Leuchten wurde dunkelrote Glut, wie die an Vulkanseiten hängende Lava, und dann erlosch auch diese, nur hier und da kleine Flämmchen, kleine flackernde, im dichten Rauch leuchtende Pünktchen zurücklassend, als wären die Heerscharen des Jenseits nunmehr zurückgekehrt und hätten nur noch einzelne Verspätete auf dem Wege zurückgelassen.
Dann ward es wieder dunkle Nacht, aber noch für lange nachher blieben diese glühenden Zeichen in meinen Augen, wie man das Bild der Sonnenscheibe, in die man geblickt, noch weiter sieht, selbst wenn man das Auge schließt.
Fürwahr, die feisten, faulen, spekulativen Buddhistenpriester kennen ihr Volk und verstehen es, das Interesse an ihrem Tempelzauber im Volke lebendig zu erhalten. Jahrhunderte hindurch haben die Mönche der Klöster auf den Kioto umgebenden Bergen die einfache, harmlose Bevölkerung ihrer Dörfer zu bewegen vermocht, das ganze Jahr über Holz zusammenzutragen und es auf den Berghängen in die bestimmten Linien jeder Flammenfigur niederzulegen. Welche Holzmassen herbeigeschleppt werden müssen, geht schon daraus hervor, daß jede der längeren Linien des Schriftzeichens Dai sich über eine Strecke von zweidrittel Kilometer hinzieht.
Ich stieg nun wieder in das Straßengewirr herab und folgte dem bewegten Menschenstrom, der sich dem breiten Bett des Kamogawa zuwälzte. Der Kamogawa, in der trockenen Jahreszeit nur ein wasserloses, steiniges Flußbett mitten im Herzen von Kioto, ist der eigentliche Hauptplatz der Stadt, der Mittelpunkt des geselligen Verkehrs und der Vergnügungen. Diesmal zog sich in seiner Mitte noch ein ziemlich beträchtlicher Wasserstreifen hin, so daß sich die fröhlichen Volksmassen den Vergnügungen zu Wasser und zu Lande hingeben konnten. Als ich aus der langen, menschenerfüllten Sandschoristraße heraus und auf die große Kamogawabrücke kam, blieb ich, geblendet von dem Anblick des Flußbettes, unwillkürlich stehen. Es erschien mir wie ein ungeheurer Ballsaal, in welchem eben ein tolles Maskenfest[S. 561] gefeiert wurde, lebhafter, farbenreicher, glänzender, großartiger als jene des Abendlandes zur Zeit des Karnevals. An den beiderseitigen Flußufern zogen sich fast ununterbrochene Reihen von Theehäusern, Restaurants, Schaubuden, Theatern hin, alle nach der Flußseite mehr oder weniger offen und von zahllosen farbigen Lampions erleuchtet. Derartige Buden waren auch im Flußbett selbst errichtet, fast bedeckt mit Lampions, und zwischen diesen Buden und jenen der Ufer spannten sich Bögen von Lampions; Lampionketten zogen sich auf dem Wasserlauf selbst entlang, umkränzten die offenen Bühnen der Tänzerinnen, Schauspieler und Zauberkünstler, baumelten auf den zahlreichen Vergnügungsbooten im Flusse, oder bewegten sich, getragen von den Spaziergängern, zwischen der Budenstadt auf und ab, Leben, Farbe, Licht, Bewegung, Gelächter, Gesang, Musik überall, und das einen Kilometer weit stromauf und -abwärts. Aber das war nicht alles. Langsam schritt ich über die Brücke und gelangte nun in die eigentliche Vergnügungsstraße der „heiligen” Stadt der Japaner, nach der Teramadschidori, in der jedes Haus nur dem Vergnügen gewidmet ist. Die Straße ist mit Bambusmatten, über Gerüste ausgebreitet, eingedeckt, und von dieser Decke, ebenso wie von den einzelnen Häusern hängen so zahlreiche Petroleumlampen, Glas- und Papierlampions, daß die Straße gewöhnlich taghell erleuchtet ist. Große Transparente preisen die Vorstellungen der Theater, der Geishamädchen, Sängerinnen, Tänzerinnen an und locken schon zu gewöhnlichen Zeiten das leichtlebige Volk von Kioto scharenweise herbei. Wie erst heute am Bon Matsuri, am Seelenfeste! Jeder Raum, jedes Theehaus, jedes Plätzchen im Flußbett selbst war mit fröhlichen Menschen gefüllt, die sich gütlich thaten und dabei den Darstellungen der Künstler lauschten. Keine Stadt Japans hat so schöne Geishamädchen, so ausgezeichnete Tänzerinnen, so fertige Akrobaten und Zauberkünstler; und sie alle, Tausende an der Zahl, gaben heute das Beste, das sie vermochten. Die Japaner sind Freunde von Picknicks; einzelne Familien hatten sich zusammengethan, um den Abend unter freiem Himmel im Flußbett drunten zu verleben, sie hatten Geishamädchen angeworben, um für sie zu musizieren und zu tanzen. Ueberall gab es heute derartige malerische Gruppen. Im Kreise kauerten die Familien mit ihren festlich geschmückten Kindern (selbst die kleinsten müssen bei solchen Gelegenheiten dabei sein) auf dem Boden, aßen mit ihren Eßstäbchen Süßigkeiten, Reiskuchen und eingemachte Früchte, tranken dazu Sake (Reiswein) oder rauchten ihre winzigen Pfeifchen; zwischen ihnen hockten blutjunge, phantastisch geputzte kleine Mädchen mit der japanischen Guitarre, Flöte und Trommel, und während sie musizierten, tanzten die berühmten Geishas von Kioto den Bonodori, einen religiösen, hauptsächlich in Posen und Körperschwenkungen bestehenden Tanz, der buddhistischen Ursprungs sein soll. Solche Bilder wiederholten sich im Flußbette unzähligemale, hier und dort tanzten auch die Zuseher, einen Kreis bildend, mit den Geishamädchen um die Wette.[S. 562] Ueberall Gesang, überall Guitarregeklimper, Trommelschlag, Gläserklang, Gelächter, Bewegung.
Die reizenden japanischen Mädchen in ihren malerischen Festgewändern, Schmetterlinge und Blumen im Haare, promenierten dazwischen Arm in Arm, auf und nieder, scherzten mit den Bekannten, bewarfen die auf dem Fluß einherziehenden Boote mit Blumen; Kinder umringten die ambulanten Verkäufer von Süßigkeiten, bewunderten die Fertigkeit der Taschenspieler und lachten über die mitunter recht obscönen Scherze der Märchenerzähler. Unter all diesen Zehntausenden befand sich nicht ein einziger Europäer, nicht einmal ein europäisch gekleideter Japaner, es war ein urjapanisches, urheidnisches Fest, und wer Gelegenheit gehabt hat, dieses oder irgend ein anderes Fest, selbst in den für Europäer offenen Städten Japans mit anzusehen, der wird von der vermeintlichen „europäischen” Kultur der Japaner einen sonderbaren Begriff bekommen. Steckt die europäische Kultur etwa allein in Eisenbahnen und Kanonen? Gehören nicht auch das Christentum und die Moral dazu?
Aber unter all den Japanern, die sich auf dem breiten Flußbette des Kamogawa gütlich thaten, befand sich wohl kein einziger Christ, von der Moral gar nicht zu sprechen. Wohl waren die losen, leichtfertigen Geishamädchen von ihren bemalten hübschen Köpfchen an bis zu den Fußspitzen bekleidet, aber in ihren Tänzen trieben sie mitunter die Unmoralität auf das äußerste, vor den Augen ganzer Familien, vor den Augen junger Mädchen, vor Kindern! Und diese blickten naiv, aufmerksam über jede Obscönität lächelnd auf solche Darstellungen! Es steckt in diesem merkwürdigen Volk doch noch ein gutes Stück Barbarentums, und so schön, so malerisch und glänzend ihre Festlichkeiten auch sein mögen, so sehr auch Europäer davon geblendet werden, es kommt doch dabei die ungeheure Kluft zum Vorschein, die uns christliche Bewohner des Abendlandes von diesen heidnischen Orientalen heute und noch auf lange Zeit hinaus trennt.
Lustige Weiber in der That! Lustig und dabei neckisch, kokett, hübsch und zärtlich, reizende Wesen, wie geschaffen, dem Manne das Leben zu versüßen. Fragt man einen Weltfahrer, welches Land ihm vor allen am besten gefallen hat, so wird er gewiß zur Antwort geben: Japan; und fragt man ihn, was ihm in Japan am besten gefallen hat, so ist die gewöhnliche Auskunft: die Japanerinnen.
Das beste dabei ist, daß er in neun Fällen unter zehn die wirklichen Japanerinnen gar nicht kennen gelernt, vielleicht gar nicht gesehen hat. Wie die Frauen der besseren Stände bei den meisten orientalischen Völkern, so bleiben diese auch in Japan dem öffentlichen Leben fern; selten erscheinen sie auf der Straße, selten bei gesellschaftlichen Anlässen, und jene, mit denen der Europäer in Japan in Berührung kommt, sind höchstens die Frauen der Minister, des Adels und der Hofwürdenträger; aber diese haben in den meisten Fällen dem alten Japan Adieu gesagt und sich dem neuen europäisierten Japan angeschlossen, prangen in Federhüten, Miedern und Stöckelschuhen, sprechen fremde Sprachen und tanzen Walzer und Quadrille. Der Europäer, der Japan bereist, und mag er sich auch Jahre in diesem herrlichen Lande aufhalten, lernt gewöhnlich nur die Frauen aus dem Volke kennen, die Verkäuferinnen und Ladenmädchen, die Wirtinnen und Kellnerinnen in den Theehäusern,[S. 564] die Sängerinnen, Tänzerinnen und andere. Wird er von irgend einem Japaner der besseren Stände zum Diner oder Thee geladen, so geschieht dies in der Regel nicht in dem Wohnhause des Japaners, sondern in irgend einem Theehause, und an die Stelle der Hausfrau mit ihren Töchtern treten Mädchen, die um so und soviel die Stunde gemietet werden, um den Gästen die Honneurs zu machen und durch Witz, Munterkeit, Gesang und Tanz die Zeit zu vertreiben. Die Japanerinnen sollten diesen kleinen, zierlichen Demoiselles zu Dank verpflichtet sein, denn wer weiß, ob sich die Frauenwelt von Dai-Nipon in Europa eines so liebenswürdigen Rufes erfreuen würde, wenn sie dem reisenden Europäer in allen ihren Ständen und Gesellschaftsklassen gerade so zugänglich wäre wie jene von, sagen wir, Amerika. Vielleicht wäre dieser Ruf auch nicht so, wie er ist, wenn die Japaner es den Europäern gleichthun und zu den Verrichtungen in Kaufläden, in Hotels und Theehäusern Damen von gesetztem Alter, ehrbare, gesittete Hausfrauen, ungeschlachte Dienstboten aus den Dörfern herbeiziehen würden. Was dem europäischen Reisenden in den ihm offenstehenden Lokalen entgegentritt, sind durchwegs niedliche, junge Mädchen im Alter von zehn bis siebzehn, höchstens zwanzig Jahren, so zart und hübsch und appetitlich wie Meißner Porzellanfigürchen, denen die gütige Vorsehung Seele und Leben eingeflößt hat. Ganz Japan sieht in seinen Provinzhotels und Theehäusern aus wie ein großes Mädchenpensionat, und es müßte schon ein ganz verzweifelt hoffnungsloses Exemplar von vertrocknetem Gelehrten sein, das in so reizend schäkernder, naiv spielender Umgebung nicht außer Rand und Band geriete. Kommt man da in irgend ein Provinzialhotel, so trippeln geschäftig drei, vier, fünf kleine possierliche Jüngferchen herbei und werfen sich vor dem Fremdling nieder. Mit unnachahmlicher Grazie sinken sie auf ihre Knie, legen ihre Körperchen zurück, so daß sie auf ihren Waden sitzen, und machen dann ihre Verbeugung so tief, daß sie mit ihrem Näschen beinahe den Boden berühren. Welch beneidenswerte Gelenkigkeit! Dann raffen sie sich wieder auf, nehmen dem Gaste mit reizendem Lächeln seine Gepäckstücke und Siebensachen ab und rücken ein weiches Kissen zurecht, auf dem er Platz nehmen muß. Flink wirft sich wieder ein Jüngferchen vor seine Füße auf den Boden und löst ihm die Schuhe von den Füßen. Man ist ganz beschämt. Solch zarte winzige Händchen und so schwere, plumpe, schmutzige Stiefeln! Aber da hilft kein Sträuben. Kichernd und schelmisch führen sie dann den Fremden auf die glänzenden, blank geputzten Matten oder auf einem Holzfußboden, so schön wie ein Klavierdeckel, weiter, schieben einige Holzrahmen mit weißem Papier überspannt zu einem Viereck zusammen, so daß ein Kämmerchen daraus entsteht, und man ist auf seinem Zimmer. Natürlich keine Thüre, keine Nummer, kein Schloß und Riegel, keine Fenster. Die spanischen Wände werden alle Augenblicke von den kleinen, stets lächelnden Mädchen auseinandergeschoben. Fräulein Sonnenschein trägt einen Kimono, dieses bequeme Universalkleidungsstück Japans, Fräulein Mohn[S. 565]blüte bereitet das Nachtlager, Fräulein Frühling richtet das Bad zurecht und hilft einem beim Auskleiden. Nein, so eine Naivität! Odysseus ist auf seiner Insel nicht so herrlich aufgehoben gewesen wie der Reisende in Japan. Man dünkt sich wie der einzige Mann in einem Reiche voll hübscher, junger Frauen. Ist man nach dem Bade in seinen Kimono geschlüpft, so wird die ehrenwerte Mahlzeit aufgetragen. Ein Fräulein trägt den ehrenwerten Tobakomon mit dem Hibatschi herbei, d. h. ein Kästchen mit glimmender Kohle und einem Aschenbecher, denn es wird vorausgesetzt, daß jedermann Raucher ist. Dann wird ein winziges, niedriges Tischchen herbeigetragen mit allerhand japanischen Leckerbissen und dem unfehlbaren Tscha, d. h. Thee. Tische, Stühle, Fauteuils nach unserer Art sind natürlich nicht vorhanden; dafür giebt es schwellende Kissen auf dem Boden, und man muß lernen auf seinen Waden zu hocken. Geräuschlos schlüpfen die kleinen Musmis aus und ein, richten die blendend weißen Eßstäbchen zurecht, gießen aus Porzellanflaschen warmen Reiswein in die Schalen und machen sich in jeder erdenklichen Art nützlich. Man kann nichts thun, ohne eine Musmi an seiner Seite zu haben, selbst in dringenden Fällen, wo man allein sein will. Sie sind wie Peter Schlemihls Schatten fortwährend auf unseren Fersen. Ob man ehrenwerte Musik hören will? Natürlich. Arigato, danke. Sofort treten ein paar kleine liebliche Mädchen vor, eine hübscher, putziger als die andere. Sie kauern sich an der Papierwand gegenüber auf die Fersen, nehmen den Samisen, d. h. die japanische Guitarre, oder den Koto (eine Art Zither) zur Hand und zupfen ohne Unterlaß an den Saiten herum. Ob man einen ehrenwerten Tanz sehen will? Gewiß. Eine oder zwei Tänzerinnen huschen herein, phantastisch aufgeputzt in reichen, goldstrotzenden Gewändern und tanzen.
Nacht. Man hat sich endlich, ganz verwirrt von dem liebreizenden Empfang, auf die harte Matratze zwischen den vier Papierwänden hingestreckt und muß sich wahrhaftig in die Beine zwicken, um zu sehen, ob man nicht träumt, ob dieses Schlaraffenleben Wirklichkeit ist. Draußen auf der Veranda brennt ein Licht in einem farbigen Lampion; aus der Ferne hört man Gesang und frohes Gelächter, dazu überall das Gezupfe auf den Samisen; zuweilen huscht ein Schatten an den durchscheinenden Papierwänden vorbei. Wer nur in den Nebenräumen schlafen mag? Man braucht ja bloß die Wände auseinanderzuschieben, nur ein klein wenig, ja nicht einmal das. Das Papier ist ja leicht mit dem Finger zu durchstechen. Richtig, da ist es schon. Andere haben denselben Gedanken gehabt. Ein leichtes Geräusch am zerreißenden Papier, ein einziges Fingerchen hat sich den Weg in unser Schlafgemach gebrochen, verschwindet, und in der Oeffnung erscheint ein schwarzes, glänzendes, neugieriges Auge. Kracks. Noch ein zweites Loch, ein zweites Auge. Was doch die Japanerinnen neugierig sind! Auf einer Seite im Nebenraume ein leichtes Seufzen, ein Klopfen, wie wenn ein Kapellmeister seinem Orchester[S. 566] abklopft. Leichter Tabakgeruch dringt zwischen den Spalten in unser Gemach. Wir sind aber auch neugierig. Wer da wohl drinnen sein mag? Mit dem Taschenmesser wird mäuschenstill ganz unten am Boden ein Loch durchs Papier geschnitten, da hockt ein Musmi in recht, recht leichter Kleidung vor ihrer Matratze und schmaucht noch vor dem Schlafengehen ein winziges Pfeifchen, nicht größer als ein Bleistift mit einem aufgesetztem Fingerhütchen. Ein, zwei tiefe Züge, dann klopft sie das Pfeifchen an dem Hibatschi wieder aus und steckt eine Kleinigkeit Tabak, den sie zwischen den Fingern zu einer Erbse gedreht hat, in den Fingerhut. So raucht sie fünf, sechs Pfeifchen, legt sich dann auf die Matratze, schiebt sich den kleinen, ziegelgroßen Holzklotz, der ihr als Kopfkissen dient, vorsichtig unter den Nacken, damit ja ihre sorgfältige Haarfrisur nicht in Unordnung gerät, und zieht eine dicke, geblümte Decke über das winzige Körperchen. Gute Nacht! Ob sie wohl ahnt, daß neben ihr ein Europäer weilt? Ob sie seinen Seufzer gehört hat? Alle Japanerinnen sind doch nicht neugierig. Sie schläft.
Am Morgen wieder dieselbe Geschichte. In Japan kennt man kein Anklopfen an die Thüre, kein Hereinrufen. Man mag gerade bei den privatesten Toilette-Angelegenheiten sein, die Papierwände werden auseinandergeschoben, frei und mit dem freundlich warmen Sonnenlichte dringt auch Fräulein Frühling wieder lächelnd ein. Das Bad ist bereit, der Frühstücksthee u. s. w. Während dieser Zeit werden die Matratzen wieder zusammengerollt und fortgetragen, die Effekten und Toilettesachen eingepackt, die Papierwände auseinandergeschoben, der Boden geputzt und geglättet wie ein Spiegel, nicht ein Stäubchen ist zu sehen. Mittags gemeinschaftliche Mahlzeit mit Japanern und Japanerinnen; der Tschau (d. h. die Speisen) werden in der Mitte des Raumes auf kleinen Tischchen aufgetragen, alles unter fortwährenden, tiefen, zeremoniösen Verbeugungen, als wären die Gäste lauter Könige.
Der große, niedrige Raum ist nach allen Seiten offen; vorne blickt man auf die Straße, hinten auf ein Gärtchen mit sorgfältig besandeten Wegen, grünem Rasen und kurios geschnittenen Bäumchen. In der Mitte, gerade vor der japanischen Table-d’hôte-Gesellschaft, ist ein kleiner Wassertümpel mit klarem Wasser, von künstlichen Felsen umgeben. Während wir essen, kommt da ein Japaner durch den Garten geschritten, wirft seinen Kimono ab und steigt splitternackt, gerade wie er erschaffen, in die kühle Flut. Nachdem er einigemale untergetaucht, kommt er wieder ans Land, stellt sich angesichts der Frauen und Mädchen und der kleinen, vierzehn- bis sechzehnjährigen Musmis hin und reibt sich mit Tüchern die Nässe vom Leibe. Welches Ach und Shoking, welcher Anlaß zu Ohnmachtsanfällen und welcher Aufwand an Riechfläschchen, Taschentüchern und dergleichen gäbe es doch in Europa! Hier kümmert sich kein Mensch um ihn; man sieht ihn gerade so, wie man die Bäume und den Himmel sieht, aber niemandes Blicke bleiben länger auf ihm haften; kein Augenpaar wird züchtig errötend niedergeschlagen. Und als er sich endlich zu[S. 567] uns setzt, um seinerseits das Tiffin (Vormittagsmahl) einzunehmen, geschieht dies unter gegenseitigen zeremoniösen Verbeugungen.
Wir wollen das Hotel verlassen. Vor dem erhöhten Fußboden der weiten Halle, die das Hotel eigentlich bildet, stehen zwischen Dutzenden von Getas, d. h. japanischen Holzpantoffeln, auch unsere Schuhe. Diensteifrig eilen die kleinen Mägdlein wieder herbei, um uns beim Anziehen derselben behilflich zu sein, und als wir uns zum Fortgehen wenden, fallen sie wieder auf die Erde. Sayonara, Sayonara tönt es von ihren ewig lächelnden Lippen.
Diese Musmis sind nur die bescheidensten weiblichen Wesen, mit denen der Europäer in Japan in Berührung kommt. Die nächst höhere Klasse sind die Maikos und Geishas. Während bei uns bekanntlich alle Frauen uns das Leben versüßen und angenehm machen, giebt es in Japan dafür professionelle Versüßerinnen in der Gestalt zahlloser Tänzerinnen und Sängerinnen, die jede Stadt ohne Ausnahme aufzuweisen hat. Tokio und Kioto, die neue und alte Hauptstadt von Dai-Nipon, allen voran, was ihre Zahl anbetrifft, aber jene, welche die größte Künstlerschaft besitzen und im Lande am berühmtesten sind, wird man in Osaka und Nagoya finden. Sie sind nicht etwa bestimmten Theehäusern, Theatern, Klubs oder Vergnügungslokalen zugeteilt wie unsere Volkssängerinnen, Dämchen des Corps de Ballet, Soubretten und dergleichen, sie bilden auch keine Gesellschaften oder Wandertruppen, die in Variététheatern, Cafés chantants oder Tingeltangeln ihre Kunst zum besten geben, sondern wohnen in der ganzen Stadt verteilt bei ihren Lehrmeistern oder Eltern und lassen sich für ein, zwei Stunden zu bestimmten Festlichkeiten oder Anlässen anwerben. Die jüngsten unter ihnen sind gewöhnlich die Maikos (Tänzerinnen), und erst, nachdem diese einige Jahre durch ihren Tanz die vergnügungslustige Männerwelt entzückt haben, werden sie Gaishas (Sängerinnen). Als solche bleiben sie bis zu ihrem zwanzigsten oder fünfundzwanzigsten Lebensjahre en vogue, um dann allmählich anderen, jüngeren Platz zu machen und zu verschwinden. Sie sind eine Eigenart von Japan. Ich habe ähnliche, wenn auch nicht so reizvolle, professionelle Gesellschaftsdamen nur noch in Korea und China getroffen, sonst nirgends auf dem Erdkreis. Ohne sie kann man sich Japan nicht gut denken. Während die Musmis in den Hotels und Theehäusern nur für die persönliche Bequemlichkeit der Besucher Sorge tragen, erheitern die Maikos sie durch ihren Tanz und ihre dramatischen Darstellungen, die Geishas aber vertreiben ihnen durch ihren Witz, ihren Gesang und ihre klassische Bildung in der angenehmsten Weise die Zeit. Als reizende Zugabe besitzen alle drei Klassen, Musmis, Maikos und Geishas, stets Jugend und Schönheit.
Eine Geisha nach europäischen Begriffen, wie sie etwa in der Operette dieses Namens während der letzten Jahre dem Theaterpublikum vorgeführt wurde, ist nicht dasselbe, was eine Geisha in ihrem schönen Heimatlande Japan ist. Ja, ich möchte sagen, sie haben miteinander nichts gemein als den Namen. Wie wäre es auch möglich, auf einer europäischen Bühne diese reizenden, kleinen Zierpüppchen darzustellen, die in Japan das Leben der Männer versüßen, ihnen die Abende in der angenehmsten Weise vertreiben, bei ihren Mahlzeiten die Gattinnen ersetzen, überhaupt als der Inbegriff von Schönheit, Anmut, Jugend, Geist und Witz gelten! Sollten unsere Geishas auf der Bühne wirklich ihren lieblichen japanischen Vorbildern entsprechen, dann dürfte zunächst keine von ihnen größer sein als die kleinste unserer Soubretten, keine älter als zwanzig Jahre, keine schwerer wiegen als das leichteste Schneiderlein. Die winzigen Dämchen unserer Bühnenwelt, die in Jugend und Gestalt an die Geishas von Japan erinnern könnten, sind unsere kleinen Ballettratten, ehe sie noch aus dem Uebungssaal heraus auf die Bühne getreten sind. Aber auch nur in Aussehen und Gestalt; alles andere, was die kleinen Dämchen unserer Ballettschulen erst lernen müssen, um ihren heiteren Beruf vor und hinter den Kulissen mit Grazie zu erfüllen, haben ihre Schwestern in Japan längst hinter[S. 569] sich. Wo denkt eine Sängerin des Abendlandes daran, vor dem achtzehnten oder zwanzigsten Jahre in die Oeffentlichkeit zu treten? In Japan denkt sie in einem solchen Alter bereits daran, sich zurückzuziehen. Und während unsere Geishas nur die vorgeschriebene Musik zu singen, die vorgeschriebenen Dialoge zu deklamieren haben, muß die japanische Geisha durch schlagfertigen Witz glänzen, tändeln, spielen, kokettieren, wie es in keinem Codex vorgeschrieben ist und wie es nur ihr süßes, leichtfertiges Naturell eingiebt. Ja nicht einmal in Bezug auf die Liebe, und was drum und dran hängt, gleichen einander die beiden Geishas. Die Sprache der Liebe ist universell und überall verständlich, heißt es. In Europa, ja, aber nicht in Ostasien. Die europäische Geisha ist der wirklichen wahren Liebe fähig, mit der größten Hingebung, die japanische wohl der größten Hingebung, aber nicht der wahren Liebe. Sie haben seltsame Herzchen, diese kleinen Geishapuppen von Japan, nicht größer und nicht kleiner als die unserer Theaterdamen, aber es ist nichts drin, es ist wie eine leere Börse. Werden Münzen hineingethan, dann klingt es. Und bekommt das kleine Geishamädchen Geld, dann singt es. So ein Geldbeutelherz kennt deshalb auch keine Leidenschaft, außer die bezahlte, und auch diese ist anders als im Abendlande. Was liegt bei uns nicht alles in einem verstohlenen Händedruck, in einem einzigen Blick! Die kleine Geisha von Tokio und Kioto kann man anblicken und anzwinkern und drücken, so kräftig man will, sie versteht kein Deutsch. Sie versteht auch keinen Kuß, und will irgend ein europäischer Schnurrbart mit ihren Lippen in Berührung kommen, dann glaubt sie, es soll ihr das Rot ihrer Lippenschminke abgebürstet werden. Da giebt es kein Geplänkel, kein Liebesgirren, sie kennt keine Halbheiten. Nichts oder alles, gewöhnlich alles.
In der Operette wird auf diese Unkenntnis des Kusses bei den Japanern auch in dem bekannten reizenden Duett Rücksicht genommen, aber dabei umarmen einander doch die Geisha und ihr europäischer Liebhaber, als wäre dies in Japan gerade so selbstverständlich wie anderswo. Die Japaner umarmen einander aber ebensowenig, wie sie einander küssen oder die Hände schütteln. In der ganzen japanischen Litteratur, weder in Prosa noch in Gedichten, findet sich irgend eine Anspielung auf dergleichen, selbst wo die heißeste Liebe der Gegenstand ist. Wenn Mann und Frau, Eltern und Kinder, Braut und Bräutigam, nach jahrelanger Trennung einander wiedersehen, kommt es zu keinem derartigen Erguß ihrer Liebe und Freude.
Die Liebe kommt auch nicht durch Worte zum Ausdruck, wie es in der Operette fortwährend geschieht. In der japanischen Sprache giebt es keine Wörter wie Liebchen, Schätzchen, Täubchen und dergleichen, an denen die europäischen Sprachen so reich sind. Nicht einmal der Ton der Stimme wird weicher und zärtlicher, wenn zwei Liebende, Liebende nach japanischer Art, beisammen sind.
Ich habe in einer berühmten japanischen Ballade, Schuntokumaru mit Namen, die ebenso bekannt und beliebt in jeder Haushaltung ist wie bei uns etwa die[S. 570] Liebesgedichte unserer größten Poeten, einen höchst seltsamen Zärtlichkeitserguß gefunden. Es handelt sich um zwei Liebende, die, durch ein grausames Geschick getrennt, das ganze Reich auf der Suche nacheinander durchwandern und sich endlich im Kiomidzutempel unerwartet wiederfinden. Welcher Dichter würde die zwei Liebenden nicht in der Ekstase des höchsten Glückes mit thränenüberströmtem Antlitz aufeinanderstürzen und ein paar Minuten lang sich umarmen und küssen lassen, wenn nicht die Geliebte selbst vor lauter Erregung ohnmächtig wird oder gar tot zu Boden stürzt? In der japanischen Ballade gucken die Liebenden einander stumm an, dann hocken sie sich auf ihre Waden und streicheln einander ein wenig.
Wenn aber die Liebe in Japan mit dem ganzen Zärtlichkeitskalender so unbekannt ist, wie kommt es dann, daß alle Europäer, die nach Japan kommen, von den kleinen Geishamädchen so entzückt sind? In der Operette hat man diesen Mangel an Liebesergüssen durch solche nach europäischer Art ersetzt, und sie präsentieren sich auch auf der Bühne im japanischen Gewande recht niedlich, aber japanisch sind sie nicht. Durch was wirkt dann die japanische Geisha?
Auf den Japaner wirkt sie durch ihren Geist, ihren Witz, ihre litterarischen Kenntnisse, durch Musik und Gesang. Dem Europäer sind Geist und Witz unverständlich, weil er nur in seltenen Fällen die Sprache hinreichend beherrscht; die Musik, welche die Geisha auf der japanischen Guitarre abzupft, ist für ihn entsetzlich langweilig und unschön, und was ihren Gesang betrifft, so könnte man dabei weinen. Ein solches Genäsel und Gemiaue, auch von der schönsten Geisha auf einer europäischen Bühne zum Vortrag gebracht, würde wie die erbärmlichste Katzenmusik wirken. Was den Europäer besticht, das sind also gewiß nicht ihre angelernten Kenntnisse, sondern nur ihre natürlichen Gaben, nämlich Jugend, Zartheit, Anmut. Wenn sie auch nicht hübsch sein sollte, besitzt sie doch eine gewisse Anziehungskraft. Sie macht einen um so tieferen Eindruck auf ihn, als er in Japan mit anderen Frauen selbst bei längerem Aufenthalt nur sehr selten zusammenkommt. Der Japaner hält seine Frauen, seine Töchter im Hintergrund; besucht man ein japanisches Haus, so wird man nur von Männern empfangen, und wird man mit diesen nach häufigerem Verkehr intimer, so kommt es wohl vor, daß auch die Frau, vielleicht sogar die Tochter bei der Begrüßung einmal vorgestellt wird. Aber die Frauen ziehen sich nach einigen Worten wieder zurück und erscheinen nur bei der Verabschiedung, um sich vor dem Besucher auf alle Viere zu werfen. Eine längere Unterhaltung ist ganz ausgeschlossen, und wollte man einer Frau irgendwelche Komplimente über ihre Schönheit oder über die Pracht ihrer Kleider machen, so würde dies sehr übel aufgenommen werden.
Uebrigens würden Unterhaltungen sehr ernüchternd und enttäuschend sein, denn die japanischen Frauen der besseren Stände waren bis vor kurzem und sind in den[S. 571] Provinzen, fern von den der europäischen Kultur eroberten Hauptstädten, auch heute noch von der Oeffentlichkeit ausgeschlossen. Sie werden geboren, lernen in ihrer Kindheit neben den Pflichten ihres Hauswesens höchstens noch Blumen binden, sticken, den Zeremonienthee bereiten; sie heiraten, verblühen mit fünfundzwanzig Jahren und sterben als treue, hingebungsvolle Hausfrauen und gute Mütter, aber ihre Geistesgaben wurden nicht entwickelt, sie besitzen keinerlei Kenntnisse und können deshalb weder in der Gesellschaft durch Konversation glänzen, noch zu Hause in dieser Hinsicht die Männer befriedigen.
Diesen Mangel ersetzen in Japan die Geishas. Sie sind Unterhalter, Zeitvertreiber von Beruf, gegen Bezahlung von so und so viel für die Stunde, den Tag oder Abend. Will sich ein Japaner nach vollbrachter Tagesarbeit durch Kurzweil den Abend vertreiben, so läßt er eine Geisha kommen; will er Freunden ein Souper geben, so nehmen daran nicht die Frauen und Töchter seines Hauses, oder jene seiner Gäste teil, sondern er mietet eine Anzahl Geishas mit ihren Dienerinnen und bringt den Abend mit der ganzen Gesellschaft in einem Theehause zu. Die kleinen, zierlichen Musmis (Kellnerinnen) des Theehauses empfangen an der Pforte, auf alle Viere ausgestreckt, die Gäste und führen sie in den Speisesaal; sind Europäer dabei, so lösen sie mit ihren zarten Fingerchen die Schuhe von deren Füßen; hockt die ganze Gesellschaft endlich in dem stuhl- und tischlosen Raume längs der kahlen Wände auf ihren Waden, so bringen die Musmis die Speisen und Getränke herein, setzen sie den Gästen auf winzigen Tischchen vor, tragen die gebrauchten Tellerchen und Schüsselchen wieder fort und besorgen mit einem Worte die gewöhnliche Bedienung. Dann aber treten die kleinen jungen Maikos (Tänzerinnen) und endlich die Geishas auf. Sie zupfen an ihren Guitarren und singen, sie führen fremdartige dramatische Tänze oder Szenen aus historischen Dramen auf, für europäischen Geschmack ebenso steif und unnatürlich, wie es ihr Gesang und ihr Guitarrengezupfe sind. In den langen Zwischenakten aber mischen sich diese bezahlten Vergnügungsdemoiselles unter die Gäste, setzen sich zu ihnen, kredenzen ihnen die gefüllten Reisweinschalen und schäkern und scherzen mit ihnen, indem sie ihren Geist, ihre übersprudelnde Fröhlichkeit, ihren Witz und ihre Schönheit glänzen lassen. Nicht etwa die Schönheit, wie sie bei unseren kurzgeschürzten Ballerinen und Café-chantant-Sängerinnen gewöhnlich in solcher Fülle zur Parade kommt. Keine entblößten Arme und Nacken, keine in Seidenschuhen steckenden Füßchen oder von Seide umspannte Gliedmaßen, nur die bemalten, gepuderten Gesichtchen sind bei den japanischen Geishas sichtbar. Ihre Körperchen sind ganz in die langen, goldgestickten, schlafrockartigen Kimonos gehüllt, und kommen bei rascheren Bewegungen auch die Glieder zum Vorschein, so üben diese dünnen Aermchen, diese krummen nackten Beinchen, diese in plumpen, kurzen Wollsocken steckenden Füße, die noch dazu mit den Zehen nach einwärts gedreht sind, eher das Gegenteil von Reiz aus.
Die weiten, faltenreichen Kleider gehören zum Tanz, ja wie mit ihren Körpern tanzen die Geishas auch mit ihren Kleidern und wissen diese mit unglaublicher Geschicklichkeit in die schönsten Falten zu werfen, ihnen sozusagen Leben und jenen Ausdruck einzuflößen, wie er zu der darstellenden Situation am besten paßt.
So vergeht der Abend, ein Teil der Nacht, und bricht die reisweinfröhliche Gesellschaft endlich auf, so wird dem Gastgeber die Rechnung überreicht, ein Stück Papier, einen halben Fuß breit und vielleicht zwei bis drei Fuß lang, mit allen gelieferten Genüssen haarklein spezifiziert. Nichts wird dabei vergessen, und solche Rechnungen sind zuweilen recht pikant, erreichen auch bei größeren Festlichkeiten Summen bis 300 und 400 Mark. Dazu werden auch den Geishas selbst noch beträchtliche Geschenke gemacht. Die Dämchen werfen sich dann vor den Anwesenden ehrfurchtsvoll nieder, senken ihre Näschen bis auf den Boden und entfernen sich, um in ihren Rickshaws nach Hause zu fahren.
Am nächsten Abend sind sie in irgend einem anderen Theehause für ähnliche Unterhaltungen engagiert, und so geht es bei den professionellen Schönheiten von Japan Tag für Tag, auch Wochen und Monde, einige Jahre lang. Dann ist wohl ihre Kunst sehr groß, aber ihre Jugend, ihre Schönheit ist vorüber, und haben sie nicht in ihrer kurzen Laufbahn einen Ehemann ergattert, so ziehen sie sich ins Privatleben zurück und bilden andere kleine Mädchen in den Geishakünsten aus. Ehemänner ergattern? Gewiß, noch dazu gar nicht selten. Die Japaner üben in Betreff des moralischen Vorlebens dieser kleinen Dämchen viel größere Nachsicht als die Abendländer. Orangenblüten und Myrtenkränze werden bei japanischen Hochzeiten überhaupt nicht getragen. Die Japaner suchen sich ihre Weiber aus, wie sie ihnen passen. Es ist nicht viel dabei riskiert, und das bekannte orientalische Sprichwort, von dem dreimal überlegen, ehe man sich ein Weib nimmt, ist in Japan unverständlich. Der Gatte kann sie ja nach ein paar Monaten Probezeit wieder zurücksenden. Eine Geisha ist unter solchen Verhältnissen eine recht begehrenswerte Braut. Statt daß sie jeden Tag für so und so viel die Stunde für jemand anderen singt und die Guitarre zupft, singt und zupft sie dann nur für ihren Gatten. Sie unterhält ihn mit den angelernten Künsten, in denen sie durch jahrelange Uebung in den verschiedensten Theehäusern zur Meisterschaft gelangt ist, und er ist zufrieden. Zudem ist nicht etwa jede Geisha notwendigerweise eine Sünderin. Wohl singen die Geishamädchen in einem bekannten Liede von sich selbst:
Aber trotz dieser vielsagenden Generalbeichte giebt es doch eine ganze Menge unter ihnen, die nicht jedem Liebeshauch folgen, und so ist es begreiflich, daß manche,[S. 573] die heute noch bei einem Herrenabend im Klub getanzt und gesungen hat, morgen Frau General oder Frau Minister ist. Dann kommt ihre Schauspielerkunst ihr erst recht zu statten.
Ist eine Geisha nach mehrjähriger Dienstleistung so verblüht, daß niemand mehr anbeißen will, dann zieht sie sich aus der Oeffentlichkeit zurück und wird, wie gesagt, Lehrerin anderer kleiner Mädchen. An solchen herrscht in dem mit Kindern reich gesegneten Japan kein Mangel. Wo viele Töchter im Hause sind, da ist es schwer, sie alle an den Mann zu bringen, andere Berufsarten in Aemtern oder im Geschäftsleben stehen der jungen Japanerin nicht offen, und so bleibt den Eltern nichts übrig, als ihre hübschesten und talentvollsten Mädchen Geishas werden zu lassen, wenn sie dieselben nicht gar für ebenso tief stehende Zwecke verkaufen. Gefällt die kleine, sieben- bis achtjährige Musmi einem Unternehmer, so zahlt er ihren Eltern eine gewisse Summe Geldes und läßt sie auf seine Kosten zur Geisha ausbilden. Damit beginnt für die kleinen Mädchen eine recht harte Zeit, denn es dauert Jahre eifriger Arbeit, um die traditionellen Tänze, Gesänge, Dichtungen, Mimik und dann die beliebtesten Instrumente, Samisen und Koto, zu erlernen. Dazu kommen noch viele andere Künste, von denen man im Abendlande gar keine Ahnung hat. So z. B. das ungemein schwierige und umständliche Zeremoniell des Tschano-yu, das heißt, der klassischen Theebereitung, die Kunst des Blumenbindens, Taschenspieler- und Kartenkünste, vor allem andern die Kunst, den Mann zu bezaubern und zu fesseln. In Kioto, der alten Hauptstadt von Japan, die neben der jetzigen Hauptstadt Tokio die schönsten und berühmtesten Geishas besitzt, giebt es eine eigene große Tanzschule, aber der Besuch derselben war für mich nicht von solchem Interesse, wie jener der kleinen Geishaschulen, an welchen Kioto reich ist.
Es ist nicht leicht, Zutritt zu diesen Kunstetablissements zu erhalten, und es bedurfte dazu langen Parlamentierens und beträchtlicher Geldgeschenke für die Direktricen. Eines Morgens meldete mein Dragoman, der die Verhandlungen geleitet hatte, daß ich nunmehr die Schule von Madame Silbermond besuchen könne. Auf dem Wege dahin riet er mir, auch verschiedene Leckereien und Bonbons für die kleinen Mädchen mitzubringen, um sie freundlicher zu stimmen. So kaufte ich denn ein paar Papiersäcke voll Süßigkeiten, die in Japan für ein Spottgeld zu haben sind. Schwer beladen kamen wir vor das ebenerdige Lattenhäuschen, in welchem Madame Silbermond wohnte. Monotones Samisengezupfe drang durch die papierüberklebten Fenster. Mein Dragoman hielt es für angemessen, meinen Besuch vorher anzukündigen. Gleich darauf kam er wieder heraus und lud mich ein, näher zu treten. Kaum war die Thüre hinter mir wieder geschlossen worden, so erschienen drei blutjunge hübsche Mädchen in bunten Kimonos (sie waren wegen der großen Sommerhitze nur lose über die sonst nackten Körperchen geworfen), warfen sich vor mir auf den Boden, indem sie mit der Stirne fast den Boden[S. 574] berührten, und machten sich dann kichernd daran, mir die Schuhe von den Füßen zu ziehen. Dann nahmen sie mich bei den Händen und führten mich wie einen Blinden zu dem Tanzsaal, dessen eine Papierwand eben zurückgeschoben wurde. Der mit zarten geflochtenen Reisstrohmatten bedeckte Fußboden befand sich etwa kniehoch über dem Thorweg. Die kleinen Mädchen kletterten flink hinauf und versuchten, mir unter fortwährendem Gekicher emporzuhelfen, als hätte ich, der ich mir unter diesen winzigen Dingerchen wie Gulliver vorkam, das allein nicht thun können. Im Hintergrunde des niedrigen, vollständig kahlen Raums erhob sich eine fusshohe Bühne, auf welcher etwa ein Dutzend junger Mädchen standen, vor ihnen auf den Matten des Saales Madame Silbermond. Kaum erblickten sie mich, so warfen sich alle vor mir mit feierlich ernsten Mienen zu Boden und verharrten, den Kopf beinahe zwischen den Beinen, minutenlang in dieser Stellung, wie wir es etwa in der Kirche bei irgend einer besonders heiligen Handlung thun. Natürlich mußte ich ebenfalls auf alle Viere sinken, was bei den engen europäischen Kleidungsstücken nicht ganz gefahrlos für dieselben ist. Endlich zog mich mein Dragoman am Rockschoße, als Zeichen, mich zu erheben. Schon mehrmals hatte die Direktrice, den Kopf ein wenig nach mir wendend, herübergeschielt, um zu sehen, ob ich noch auf allen Vieren lag, und sich dann sofort wieder zusammengeduckt. Als sie nun gewahrten, daß ich mich auf meine Knie erhob, thaten alle das Gleiche. Ich mußte nun auf das Geheiß des Dragomans mich nach dem Befinden der Hausfrau erkundigen; daraufhin wieder allgemeines Aufdenbodensinken, dann nach dem Befinden ihrer Eltern, wieder auf alle Viere, dann stellte die Dame selbst die gewöhnlichen Höflichkeitsfragen, und jedesmal galt es für alle Anwesenden, zusammenzuklappen wie Taschenmesserklingen. Endlich war die Begrüßung vorüber, die Theatermama und ihre possierlichen Jüngferchen blieben nun aufrecht auf ihren Waden hocken, und ich mußte dasselbe thun, denn die japanische Hauseinrichtung kennt keinen Stuhl, kein Fauteuil oder Sofa, nur brachten zwei Mädchen ein paar dünne Kissen herbei und schoben sie unter mich. Mein Dragoman hatte inzwischen die Papiertüten mit den Süßigkeiten den kleinen Mädchen überreicht, und obschon sie danach schielten und wohl für ihr Leben gerne davon genascht hätten, verbot es doch die gute Sitte, ihr Vorhaben auszuführen.
Das älteste der Mädchen mochte sechzehn Jahre zählen; ein liebes Kind, mit süßem Gesichtchen, kauerte sie in europäischer Weise, also auf dem richtigen Fleck ihres Körperchens sitzend, mit aufgezogenen Beinchen an der Wand. Die anderen standen im Alter von sieben bis fünfzehn Jahren, ihre Gesichtchen waren mit Puder bedeckt, Wangen und Lippen rot geschminkt, und auf der Unterlippe auch noch drei goldene Punkte aufgemalt. Sie trugen bunte, zum Teil sehr reich gestickte, aus kostbaren Stoffen bestehende Kimonos, und da ich mich wunderte, wie so winzige Mädchen aus armen Familien schon zu so kostbaren Kleidern kämen (diese pflegen[S. 575] sich doch erst die vollendeten Geishas schenken zu lassen), erzählte die Theatermama, unter den Mädchen befänden sich auch solche wohlhabender Eltern, die ihre Kinder nur für den Tanz- und Gesangsunterricht zur Schule sendeten, damit sie zu Hause sich produzierten. Sie hätten zu Ehren des fremden Besuchers ihre Zeremonienkleider angethan. Die wirklichen Geishaschülerinnen seien ihr von Unternehmern in Pension gegeben worden und zahlten ihr wöchentlich zwei Dollars (vier Mark) dafür. Aber sie hätten außerdem der Regierung eine Taxe von einem halben Dollar monatlich für jede Schülerin zu entrichten. Sobald diese in die Oeffentlichkeit tritt, steigt diese Monatstaxe auf einen Dollar.
Nun begannen die Tänze. Der Reihe nach führten die herzigen Kinder in aller Unschuld die gewagtesten und schwierigsten Tänze auf, immer zwei bis vier Kinder zusammen. Die japanischen Tänze sind nicht solche wie unsere Ballett- oder Ballsaaltänze; die letzteren kennt der Japaner überhaupt nicht, und wenige Errungenschaften der europäischen Kultur kommen ihm lächerlicher, sinnloser und den Anstand verletzender vor wie Walzer oder Polka. Noch toller findet er das Umherhüpfen der Ballettmädchen in kurzen, tief ausgeschnittenen Kleidern, die Schaustellung der Glieder, den Zehentanz. Die Maikomädchen sind bei ihren Tänzen stets bis zu den Zehenspitzen bekleidet, und die Tänze selbst stellen gewöhnlich irgend ein Ereignis in der Geschichte oder eine Handlung im Leben dar, wenn von Tänzen im rechten Sinne des Wortes überhaupt gesprochen werden kann. Es sind vielmehr Posen, Bewegungen mit dem Oberkörper und den Händen, unterstützt und verständlich gemacht durch die ungemein ausdrucksvolle Kunst der Fächersprache.
Ich war deshalb sehr verwundert, als zum Schluß die beiden ältesten Mädchen, trotz ihrer Jugend schon vollständig erblüht, eine veritable Tarantella zum besten gaben. Mit erstaunlicher Leichtigkeit trippelten die Füßchen über den Boden, drehten sich die frischen zarten Körper im Kreise, daß die Kimonos fast wagerecht von ihnen abstanden; dazu schüttelten die Mädchen wie toll die Köpfe und klatschten in die Händchen. Dann warfen sie sich plötzlich auf die Hände nieder, stellten sich auf den Kopf und streckten die Beine in die Höhe.
„Das ist der Manzai,” sagte stolz Madame Silbermond, als die Tänzerinnen wieder auf ihren Füßen standen. „Gefällt er Ihnen?” Als ich meiner Bewunderung Ausdruck gab, fügte sie bei: „Das ist der einzige europäische Tanz, den ich meine ehrenwerten Schülerinnen lehre.”
Irgend ein europäischer Spaßvogel wird sich wohl in Kioto den Jux erlaubt haben, diese Schlußpose, als zum abendländischen Tanze gehörig, gezeigt zu haben, und nun wird sie in den Geishaschulen von Kioto eingeübt.
Aber nicht nur darin zeigt sich der Einfluß der Europäer. Er ist schon so groß geworden, daß er sogar die ganze Existenz der Geishamädchen bedroht. Durch die Einführung von Mädchenschulen, durch die Erschließung anderer Berufsarten für[S. 576] das zarte Geschlecht und endlich durch den Wandel in Bezug auf die moralischen Anschauungen der Japaner dürften die Geishas, wie sie heute bestehen, immer seltener werden. Wer weiß, ob dann nicht auch noch unsere Cafés chantants und unser Ballett im Lande der aufgehenden Sonne zur Einführung gelangen.
Miß Alice Bacon, die jahrelang als Erzieherin in vornehmen Häusern Japans geweilt und einen tiefen Einblick in das japanische Frauenleben gewonnen hat, sagt von den Gaishas: „Die Gaisha ist nicht notwendigerweise schlecht, aber in ihrem Leben ist sie so großen Versuchungen ausgesetzt, daß auf eine ehrbare Gaisha viele kommen, die auf Abwege geraten und schließlich tief unter das Niveau der Ehrbarkeit sinken. Aber sie sind so verführerisch, glänzend und geistreich, daß viele von ihnen von Männern in angesehenen Stellungen zu Frauen genommen wurden und heute an der Spitze der vornehmsten Haushaltungen stehen...” Einer der größten Bewunderer Japans, Sir Edwin Arnold, zollt den lustigen Weibern von Dai Nipon alle Anerkennung, sagt aber in Bezug auf ihre Moral in seinem Buche „Japanese ways and thoughts” folgendes: „In Japan hat der Buddhismus die irdische Liebe in Mißachtung gebracht, die Lehren des Confucius haben sie noch weiter herabgesetzt, und der ideallosen Natur der Männer dient sie nur als Zeitvertreib und Vergnügen. Die japanischen Frauen haben der Theorie nach diese beschränkte Ansicht über die geschlechtlichen Beziehungen angenommen und für viele Zeitalter die Treue des Gemüts höher gestellt als die Reinheit ihres Körpers...”
„Ohne Zweifel ist es in den besseren Ständen die Regel, daß die Töchter bis zu ihrer Verheiratung sorgfältig erzogen und bewacht werden sollen, aber diese jungen Mädchen sprechen von den Musmis und Gaishas und Freudenmädchen in so freier Weise, daß man sofort den Unterschied zwischen den Anschauungen der Japaner und Europäer über die Beziehungen der beiden Geschlechter erkennt. Japan ist ein Land, wo es nicht nur ganz gewöhnlich ist, daß ein Mädchen sich für ihre Eltern zu öffentlichem Gebrauch verkauft, sondern wo sie für diese That eher bewundert und gelobt als geschmäht wird.”
Wo sie selbst eine so vielsagende Generalbeichte ablegen, braucht man sich kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Douglas Sladen sagt in seinem Buche „The Japs at home” folgendes über sie: „Ist eine Geisha geschickt, scherzhaft, gutmütig, vor allem aber schön, so erwirbt sie sich bald einen Ruf in der Stadt. Die jungen japanischen Stutzer hören es gerne, wenn man sie mit ihr neckt; ihre Engagementsliste ist auf Tage hinaus besetzt, man kann sie nur auf ein Stündchen zu Gesicht bekommen. Juwelen erscheinen auf ihren Fingern, Perlen in ihrem Haar, sie wird stolz, merkwürdige, vielsagende Blitze schießen zuweilen aus ihren Augen, eines Tages ist sie verschwunden. Wir werden zu einem großen Festgelage geladen, sie ist nicht da. Wir fragen bei ihren Freunden nach, niemand hat sie gesehen. Nun wissen wir, daß sie am Ziele ihres Strebens angelangt ist. Irgend ein reicher[S. 577] Herr hat sich so sehr in sie verliebt, daß er sie für sich allein haben will, und deshalb hat er sie aus den Händen ihres Herrn losgekauft. Sie folgt ihrem neuen Herrn in sein Haus, auf Zeit oder für immer, und sie, die in ihrer Jugend so zahlreichen Männern den Kopf verdreht hat, wird eine ehrenwerte Frau Oberst so und so, oder Frau Minister X.”
Wie häufig kommt es vor, daß Eltern ihre Töchter für eine kurze Zeit an Europäer verheiraten und den klingenden Lohn dafür einstreichen! Wer hat nicht Pierre Lotis reizendes Buch „Madame Chrysanthème” gelesen? Und wie Pierre Loti mit seinem kleinen Frauchen, so ist es vielen anderen Lotis in Japan ergangen, die Scheidungen sind dort so leicht gemacht! Aber sind die Europäer, die sich auf diesem nicht mehr ungewöhnlichen Wege zu einer zeitweiligen Lebensgefährtin verhelfen, nicht ebenso sittenlos wie die lustigen Weiber von Dai Nipon? Wie, wenn eines Tages als Gegenstück zu dem Buche „Madame Chrysanthème par Pierre Loti” ein Buch erschiene: „Pierre Loti par Madame Chrysanthème”? Ob die kleine, liebliche Japanerin nicht auch allerhand recht ergötzliche Einzelheiten über ihren Ehemann auf Zeit erzählen könnte?
Ja, noch mehr. Wie, wenn es einem Japaner einfallen würde, ein Buch zu schreiben über die europäischen Dames Chrysanthèmes, wie sie sich bei den Rennen in Longchamps, im Bois de Boulogne, auf dem Seebadstrande von Ostende und Trouville, in den Kasinos von Aix les Bains und Monte Carlo zeigen? Derartige Parallelen kann man in Japan nicht überall in öffentlichen Gesellschaften oder auf der Straße finden. Dort sind sie fein sorgsam in eigenen Quartieren untergebracht. Das größte und glänzendste ist in Tokio die vielberühmte Yoshiwara. Auf meinen Spaziergängen durch die japanische Kaiserstadt kam ich einmal zu einer weiten Pforte, von Polizisten bewacht. Jenseits gewahrte ich einen breiten, mit prächtigen Blumenbeeten und Springbrunnen geschmückten Boulevard, zu beiden Seiten mit großartigen, mehrstöckigen Palästen besetzt, den schönsten, die ich in ganz Japan gesehen. Etwa die Paläste des Hofes, der Regierung und des Adels, des Faubourg St. Germain von Tokio? Ich trat ein. Ueberall vornehme Stille. Die Häuser zeigten in den verschiedenen Stockwerken breite Veranden, mit Guirlanden und farbigen Lampions geschmückt; die Jalousien waren zugezogen, dafür standen die Hausthüren weit geöffnet, und im Innern gewahrte ich schöne Höfe und zierliche Gärtchen; Diener fegten die Straßen, Gärtner besorgten die Blumen und kurios geschnittene Bäume in den Anlagen. Und als ich einen des Weges kommenden, europäisch gekleideten Japaner darüber befragte, sagte er mir, ich befände mich in der Yoshiwara. Ich müßte aber abends kommen, um das Leben hier zu sehen. Der Abend fand mich wieder hier, aber wie verändert war das Aussehen dieser Straßen mit ihren Dutzenden von Palästen! Tausende von Lichtern brannten in vielfarbigen Lampions, in den Straßen wogten Menschenmengen lachend, scherzend[S. 578] auf und nieder; die Paläste waren weit geöffnet, hell erleuchtet; Samisen und Koto, Gesang und Gelächter drang aus ihnen, und unten in den Parterreräumen der Häuser prangte die weibliche Einwohnerschaft in ihren glänzendsten Gewändern. Statt durch Wände und Fenster waren diese Räume nach der Straße zu durch starke Gitter abgeschlossen, gerade wie wir sie in unseren Menagerien vor den Käfigen der Tiger und Löwen sehen; der mit Matten und Teppichen bedeckte Fußboden lag etwa zwei Fuß höher als die Straße, und auf ihm kauerten die Schogi, d. h. die Mädchen, die von ihren Eltern an die Besitzer dieser Kaschi-Saschiki genannten Häuser verkauft worden waren. In jedem Hause etwa dreißig bis vierzig, im ganzen vielleicht zweitausend. Manche von ihnen waren recht hübsch, nur zeigten ihre Gesichter dicke Schichten von Puder und Schminke, und in ihren sorgfältigen Haarfrisuren steckten Dutzende kostbarer, langer Nadeln. Der Obi, diese breite, aus schweren Brokaten bestehende Leibbinde, die in der japanischen Damentoilette das Mieder ersetzt, war mit der Schleife nicht rückwärts gebunden, sondern vorn, und das allein sagte, daß diese Dämchen Schogi waren, d. h. dem niedrigsten Stande der lustigen Weiber von Dai Nipon angehörten. Einer Regierungsvorschrift zufolge dürfen die Schogi nämlich ihren Obi nicht hinten binden. Es wäre ein langes Kapitel zu schreiben über die nach unseren Begriffen unendlich traurigen Verhältnisse, wie sie in den Yoshiwaras von Tokio, Kioto und den anderen Städten herrschen, aber — jeder Leser wird dieses „aber” verstehen.
Im Straßenleben der japanischen Großstädte waren mir besonders zur Zeit der Volksfeste vereinzelte Riesengestalten aufgefallen, die sich gegenüber den sonst so kleinen, unscheinbaren, schmächtigen Japanern nicht nur durch ihren hohen Körperwuchs, sondern auch durch ihre Fettleibigkeit, verbunden mit staunenswerter Muskelentwickelung, auszeichneten. Sie wurden mir als jene berühmten professionellen Ringer bezeichnet, die im Volksleben Japans eine ähnlich hervorragende Rolle spielen, wie etwa die Gladiatoren im alten Rom, oder die Stierkämpfer in Spanien, oder die Faustkämpfer in England und Amerika.
In der großen Feudalzeit Japans im fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert war jedes Mitglied der damaligen vornehmen Kriegerkaste, der Samurai, ein Meister in allerlei athletischem Sport, vornehmlich im Fechten und Ringen. Aber ähnlich wie im Abendlande sind diese die Muskelkraft hebenden, den Körper stählenden Uebungen der modernen Zeit zum Opfer gefallen, und selbst das Ringen wird nur mehr von den genannten professionellen Ringkämpfern oder Sumotori ausgeübt, die eine eigene Gilde mit strengen Gesetzen und Vorschriften ihrer Kunst bilden.
Würde sie nicht ihre äußere Erscheinung sofort kenntlich machen, so würde ein Blick auf ihre Haartracht genügen, um sie als Mitglieder der Ringkämpfergilde zu stempeln. Aehnlich wie die Stierkämpfer in Spanien ihr Haar zu einem über den Nacken fallenden kurzen Zopf flechten, so fassen die Sumotori ihr langes Scheitelhaar zu einer dicken Strähne zusammen, die sie mittels papierenen Schnüren nach vorn auf den Scheitel leiten. Diese Haartracht war früher auch im japanischen Volke allgemein, und noch während meiner Reise im Inneren Japans fand ich viele ältere Männer mit solchen Zöpfen, jedoch mit dem Unterschiede, daß sie ihr Haupthaar bis zum Scheitel abrasiert hatten.
Wird in Japan irgendwo ein größeres Volksfest gefeiert, so müssen auch Ringkämpfer dabei sein, und weder die Theater noch die Akrobaten, Zauberkünstler u. dergl. ziehen durch ihre Vorführungen eine so große Menge von Zusehern an wie die Sumotori. Je größer das Fest, desto zahlreicher sind die Ringkämpfer, und in Tokio, Kioto oder Osaka kommt es zuweilen vor, daß zwanzig bis dreißig Paare von Sumotori miteinander kämpfen, so daß die Vorstellungen einen ganzen Tag über währen. Aber es giebt kein geduldigeres Theaterpublikum als die Japaner. Je länger eine Vorstellung dauert, desto lieber ist es ihnen. Mit Kind und Kegel ziehen sie des Morgens ins Theater, nehmen ihre Lebensmittel für den Tag mit, machen es sich auf den Strohmatten des Zuschauerraumes bequem, trinken, essen, schlafen mitunter, die Mütter stillen ihre Kinder und rauchen gerade so wie die Männer oder jungen Mädchen ihr Tabakspfeifchen.
Die Ringkämpfer veranstalten nur selten ihre Vorstellungen selbst. Gewöhnlich sind es eigene Unternehmer, welche sie für bestimmte Summen anwerben, das Theater bauen und dafür die Eintrittsgelder der stets massenhaft zuströmenden Besucher einstecken. Je größer die Erfolge eines Sumotori sind, desto mehr wird er begehrt, desto besser bezahlt. Sie leben deshalb von ihrer ersten Jugend an ausschließlich für ihren Beruf. Zeichnet sich in irgend einer Familie ein Knabe durch außergewöhnliche Kraft und hohen Körperwuchs aus, so bestimmt ihn sein Vater vielleicht zum Sumotori und giebt ihn bei einem solchen in die Lehre. Hat er sich in allen Fertigkeiten seines Berufes ausgebildet, so tritt er in die Gilde ein, indem er sich verpflichtet, genau nach deren Vorschriften zu leben. Dazu gehören neben dem Gelübde der Keuschheit zunächst solche bezüglich seiner Kunst, dann aber auch unzählige andere, die sogar seine Nahrung betreffen. Wie mir einer der Sumotori, dessen Bekanntschaft ich in Kioto machte, erzählte, besteht seine tägliche Hauptnahrung aus sehr weichgekochtem Reis, und nur ausnahmsweise aus Fleischspeisen, ein Beweis, daß die Fleischnahrung für Muskelkraft keineswegs erforderlich ist. Mit vierzig Jahren ist die Laufbahn der Ringer zu Ende; sie erhalten dann aus der Kasse der Gilde eine Pension, müssen aber dafür ihre Nachfolger in den Fertigkeiten ihres Berufes ausbilden.
Eigene Theater oder Arenen für die Ringkämpfer giebt es in Japan nicht. Soll ein Ringkampf stattfinden, so werden an geeigneten Orten, in Kioto z. B. in dem weiten trockenen Flußbett des Kamogawaflusses, oder in Tokio nahe dem berüchtigten Ekointempel in der Vorstadt jenseits des Sumidaflusses eigene Schaubuden nach Art unserer Cirkuszelte errichtet, nur daß an Stelle der Leinwand geflochtene Strohmatten verwendet werden. Ein derartiges Zelt, Sumo genannt, ist schon aus der Ferne durch seine eigentümliche Zufahrt zu erkennen. Zu beiden Seiten derselben stehen Reihen gegeneinander geneigter haushoher Bambusstangen, und von diesen hängen sechs bis acht Meter lange, meterbreite Streifen roten, blauen oder gelben Zeuges, die mit großen Schriftzeichen bedeckt sind, herab. Vor dem Eingange selbst erhebt sich ein hohes Bambusgerüst, auf welchem ein Paukenschläger möglichst großen Lärm macht. In der Nähe sind die Ehrengaben des Publikums für die Sieger zur Schau gestellt. Der wohlhabende Japaner spielt sich gern auf den Kunstmäcen heraus, und wie im Abendlande den Künstlern Blumen und Kränze gespendet werden, so giebt es hier Ehrenflaggen, Kleiderstoffe, vor allem aber Fäßchen Reiswein. Gewöhnlich werden auch die Namen der Ringkämpfer durch große Anschläge bekannt gemacht. Je berühmter der Sumotori, in desto größeren Schriftzeichen prangt sein Name, ganz wie bei uns.
Am Eingang erhält man gegen Erlag eines viertel oder halben Dollars die Eintrittskarte in Gestalt eines mit Schriftzeichen bedeckten Holztäfelchens, das von den Aufwärtern im Innern wieder abgenommen wird. Japaner müssen am Eingang[S. 581] auch ihre Holzschuhe ablegen, ähnlich wie wir die Hüte und Schirme ablegen, denn im Innern ist der Boden mit feinen Filzmatten bedeckt, und diese Matten mit den schweren Holzschuhen zu betreten, wie sie selbst die vornehmsten Damen in Japan tragen, wäre ebenso undenkbar, als wenn wir beim Besuch eines Privathauses auf den Möbeln des Empfangszimmers umhertrampeln würden. Auf eigenen Gestellen stehen hier Hunderte und Aberhunderte von Holzschuhen in langen Reihen, und man kann sich das Gedränge wohl vorstellen, wenn nach beendeter Vorstellung die ganze bestrumpfte Gesellschaft ihre Schuhe sucht.
Im Innern des Zeltes befindet sich zur Rechten des kleinen Vorraumes die Künstlergarderobe. Hier kauern oder liegen auf Matten ausgestreckt die Sumotori, feste, fleischige Gestalten mit riesenhaften Gliedmassen, gewöhnlich vollständig unbekleidet; flinke Aufwärter kämmen ihre Haare, binden die Zöpfe fest, reiben ihre Glieder oder legen das einzige Gewand der Sumotori beim Kampfe, eine seidene Schärpe um deren Leib. Diese breite, ausnehmend feste Schärpe ist gewöhnlich von blauer Farbe und mit langen Fransen besetzt. Sie wird mehreremale um die Hüften gewunden und dann zwischen den nackten Beinen durchgezogen.
Um den inneren, gewöhnlich viereckigen Zuschauerraum zieht sich eine etwa brusthohe Galerie, welche die teuersten Sitzplätze enthält. Als ich mich in Osaka gelegentlich eines derartigen Ringkampfes auf diese Galerie begeben wollte, fand ich nirgends einen Aufgang, und ich war schon im Begriffe, mit Zuhilfenahme von Händen und Füßen hinaufzuturnen, als ein Aufwärter mit einer kurzen Leiter herbeieilte. Nachdem er mir meine hölzerne Eintrittskarte abgenommen, lehnte er die Leiter an die Galerie, und als ich oben war, nahm er sie wieder mit sich fort. Ich konnte mich des Gedankens an die furchtbaren Schrecken nicht enthalten, wenn hier bei dem fortwährenden Tabakrauchen und Ausklopfen der noch glühenden Asche aus den Pfeifen Feuerlärm entstehen sollte, aber daran wird wohl von den Japanern nicht gedacht. Die Hauptsache ist, daß durch das Fortnehmen der Leiter die Einschmuggelei billetloser Leute verhindert wird. Will jemand während der Vorstellung herunter, so ruft er durch Händeklatschen den Aufwärter herbei.
Wie auf der Galerie, so ist auch in dem Zuschauerraum unten gewöhnlich jedes Plätzchen von Neugierigen besetzt. In der Mitte dieses Raumes, rings umgeben vom Publikum, erhebt sich eine Bühne von vielleicht drei Meter Durchmesser, und diese bildet die eigentliche Kampfarena. An den Ecken erheben sich hohe Bambuspfosten, ein Leinwanddach tragend. Der Boden der Arena ist mit Erde bedeckt und ringsum mit Reisstrohbündeln eingefaßt.
Die Leitung des Kampfes obliegt einem Giozi, d. h. einem mit allen Regeln des Ringkampfes vertrauten Richter, der in seinen jungen Jahren selbst ein Sumotori war. In altjapanische bunte Gewänder gehüllt, das Abzeichen seiner Würde, ein fächerartiges mit Schnüren und Quasten behängtes Tutschiwa in der[S. 582] Hand, betritt er feierlichen Schrittes die Bühne, klappert mit zwei Holzstücken, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu erwecken, und verkündet nun mit schreiender Fistelstimme die Namen der zunächst auftretenden Kämpfer. Gewöhnlich sind es die jüngeren, minder erfahrenen Ringer, welche den Anfang machen. Der Anblick der beiden fetten, mit Ausnahme der Hüften vollständig nackten Gestalten gewährt keinen besonderen Liebreiz. Sie schlürfen zunächst aus den bereitstehenden Gefäßen etwas Wasser und gießen es über ihren Körper; dann nehmen sie eine Prise Salz in den Mund, reißen von den aufgehängten Papierpäckchen einige Blatt herunter, um sich die Hände abzuwischen, und stellen sich dann einander gegenüber, den Kampfrichter zur Seite, in Positur. Dazu müssen die Beine so weit wie möglich gespreizt werden, dann hocken sie auf ihre Waden nieder, indem sie mit den flachen Händen ein paarmal auf ihre Schenkel klatschen, und stemmen schließlich die ausgestreckten Arme mit dem Handrücken nach unten auf den Boden. Kaum sind sie in dieser keineswegs malerischen Stellung, so stoßen sie fast gleichzeitig einen Schrei aus, springen, wie von einer unsichtbaren Feder emporgeschnellt, empor und werfen sich mit vollster Wucht gegeneinander.
Bei diesen Kämpfen handelt es sich darum, den Gegner nach den genau vorgeschriebenen Regeln des Ringens zum Fall zu bringen. Stoßen, Schlagen, Boxen, dann gewisse Finten, wie das Unterstellen eines Beines u. dergl., sind auf das strengste verboten und kommen auch niemals oder doch nur höchst selten, vielleicht seitens eines aufgeregten jungen Kämpfers vor, mit dem Ergebnis, daß der Kampf sofort unterbrochen und er von der Arena ausgeschlossen wird. Die Mitglieder der Sumotorigilde aber sind in der traditionellen Kampfweise so eingeübt, daß sie nur diese zur Anwendung bringen. Als ich dieselbe bei verschiedenen Ringkämpfen kennen lernte, fiel mir ihre große Aehnlichkeit mit den bekannten Schwingfesten auf, welche jeden Sommer in den Hochthälern der Schweiz dutzendweise abgehalten werden. Hier sind es nicht professionelle Ringer oder, wie sie von den Schweizern genannt werden, Schwinger, sondern zumeist die Hirten von den Almen, dann Turner und Schwingamateure aus den Städten. Auch hier gilt es als vornehmste Aufgabe, den Gegner hoch zu heben und über den eigenen Kopf nach rückwärts zu werfen, daß er auf den Rücken zu liegen kommt. Die Schweizer Schwinger tragen an Stelle der Gürtelbänder aus festen Stoffen angefertigte Schwinghosen, bei welchen sie sich gegenseitig fassen. Die japanischen Ringer dagegen suchen das Erfassen ihres Gürtels seitens des Gegners nach Thunlichkeit zu verhindern. Ihre Gesetze sind bei der Gleichheit der Aufgaben viel strenger als bei den Schweizer Schwingern. Der Boden darf nur mit den Fußsohlen berührt werden. Niederknieen, Aufstützen mit Händen oder Ellbogen gelten als Niederlage, ebenso das Austreten aus dem nur acht oder zehn Quadratmeter großen Kampfplatze. Die Kampfrichter verfolgen den Verlauf des Kampfes auf das genaueste, ermuntern die[S. 583] Ringer durch Zurufe, warnen sie, wenn sie gegen die Regeln verstoßen oder sich den Strohbündeln nähern, welche den Kampfplatz umgeben. Wenn auch nur die Zehenspitzen eines Ringers die Grenze überschreiten, gilt er als besiegt.
Bei der Vorstellung, die ich in Osaka, dem japanischen Birmingham, anzusehen Gelegenheit hatte, traf ich gerade ein, als die besten und berühmtesten Ringer die Arena betraten, und die Aufmerksamkeit der Kopf an Kopf gedrängten Zuseher war derart, daß man den Eintritt eines Europäers gar nicht beachtete. Tausende von Augen waren ausschließlich auf die beiden feisten Riesengestalten gerichtet; die Frauen vergaßen das Essen, die Männer das Rauchen, selbst die Kinder blieben stumm und blickten neugierig nach der Arena. In dem ganzen weiten Raume nicht der geringste Laut, nicht die geringste Bewegung, als wäre die ganze fremdartige Versammlung erstarrt. Aber ein kurzer, mir ganz unverständlich gebliebener Handgriff einer der Ringer war das Signal zu donnerndem Applaus, in welchen alle wie auf Kommando gleichzeitig einstimmten. Von da an nahm die Erregung der Massen sichtlich zu; die Ringer hielten einander fest umschlungen, der Schweiß lief von ihren feisten Gliedern, die Adern waren zum Bersten geschwollen, ihr kurzer stoßweißer Atem war bis zu mir herüber hörbar, und doch rührten sie sich minutenlang nicht; eine kurze, kaum sichtbare Bewegung von vielleicht Handbreite hatte abermals enthusiastische Beifallssalven zur Folge, die eben so plötzlich, wie sie losbrachen, wieder verstummten. Jeder Versuch des einen Ringers, über den andern den geringsten Vorteil zu erringen, wurde von diesem sofort pariert; schließlich schien der eine plötzlich nachzugeben, der andere fiel durch das plötzliche Aufhören des Widerstandes nach vorne, und sein Gegner benützte diese Blöße blitzschnell, um mit Kopf und Schultern unter den Leib seines Widersachers zu fahren und diesen mit einem stierartigen Aufschnellen über sich hinüberzuschleudern, daß er auf allen Vieren auf der Arena landete.
Das Tosen und Schreien und Johlen der nun ganz außer Rand und Band geratenen Volksmenge war unbeschreiblich. Die sonst so ruhigen, höflichen Japaner sind bei solchen Veranlassungen ungemein leicht erregbar; Hüte, Tücher, Fächer, Pfeifen, Tabaksbeutel flogen in einem wahren Regen auf die Arena dem sich nach allen Seiten tief verbeugenden Sieger zu. Sie wurden von den Aufwärtern sorgfältig eingesammelt; denn diese handgreiflichen Beweise der Anerkennung werden nach beendeter Vorstellung von ihren Eigentümern wieder gegen eine mehr oder minder hohe Geldsumme oder andere Geschenke eingelöst. Alles das kommt dem siegreichen Ringkämpfer zu gute.
In neuester Zeit ist die körperliche Ausbildung der japanischen Jugend wieder aufgenommen worden, und in den Schulen wird überall fleißig nach abendländischem Muster geturnt.
Eine der ersten abendländischen Einrichtungen, die das moderne Japan unmittelbar nach der großen Revolution zur Einführung brachte, waren die Eisenbahnen. Heute ist die Mehrzahl der japanischen Städte durch Schienenwege miteinander verbunden, und die Hauptmasse des Verkehrs in diesem dichtbevölkerten Lande hat sich ihnen zugewendet. Der Reisende in Japan ist überrascht, mit welcher Schnelligkeit die Japaner sich mit diesem abendländischen Verkehrsmittel vertraut gemacht haben. Der ganze Eisenbahnbau, die Verwaltung und Verkehrsleitung ruhen ausschließlich in japanischen Händen, Japaner verfertigen die Waggons, zum Teil auch die Schienen und das andere Material, Japaner entwerfen und bauen neue Linien, dienen als Schaffner und Lokomotivführer, und unter den ganzen, viele Tausende umspannenden Personal wird man nicht einen einzigen Europäer finden.
Wie in allen anderen abendländischen Dingen, so gingen die schlauen Bewohner des Mikadoreiches auch hier zu Werke: sie ließen sich von europäischen Ingenieuren zunächst eine die Hauptstadt des Landes, Tokio, mit dem Haupthafen, Yokohama, verbindende Eisenbahn bauen. Im Jahre 1870 begonnen, wurde diese 27 Kilometer lange Bahn 1872 dem Verkehr übergeben, und sie diente seither als Muster für die Herstellung jenes ziemlich ausgedehnten Eisenbahnnetzes, das sich über die Hauptinsel Nipon ausbreitet. Die europäischen Ingenieure hatten ihre Schuldigkeit gethan, indem sie den Japanern zeigten, wie man es macht, und wurden entlassen. Alle anderen Bahnen wurden von den japanischen Ingenieuren der ersten Musterbahn nachgebaut, und sie unterscheiden sich deshalb nur wenig von den europäischen Bahnen. Stationshäuser, Oberbau, Rollmaterial, Signaleinrichtungen sind im wesentlichen dieselben wie bei uns.
Immerhin ist man auf Reisen in Japan überrascht, die Eisenbahnen so vorzüglich funktionieren zu sehen, als wären sie schon seit vielen Jahrzehnten im Betriebe, nur nehmen sie es mit den Fahrzeiten nicht sehr genau. Rufen sie „tadeima” oder „suguni”, etwa „höchste Zeit”, so dauert es gewöhnlich noch eine geraume Weile, bis abgefahren wird, Zugverspätungen sind also natürlich. Dabei haben sich die Japaner keineswegs in ihrem Thun und Lassen den Bahnen angepaßt, sondern umgekehrt, sie haben sich dieselben dienstbar gemacht, ohne auch nur das Geringste von ihrer nationalen Eigenart, von ihrem Leben und ihren Sitten aufzugeben. Auf meiner ersten Bahnfahrt im Reiche des Mikado, von Yokohama nach Tokio, brachte mich ein japanischer Kuli in einer Kuruma, diesem bequemen Fauteuil auf Rädern, nach einer Eisenbahnstation, die ebensogut in Halle oder Weimar hätte stehen können, nur daß hier, wie überhaupt auf den japanischen Stationen, die Restaurationslokale[S. 585] fehlen. An den Schaltern der drei Klassen standen Japaner, um ihre Fahrkarten zu lösen, und die Beamten sprechen auch hinreichend englisch, um sich mit europäischen Reisenden zu verständigen. Nur mußte ich, bevor ich meine Karte erhielt, einem Polizeiagenten in Uniform meinen japanischen Reisepaß vorweisen. Wäre in meinem Paß die Stadt Tokio nicht angeführt gewesen, so wäre mir auch keine Fahrkarte verkauft worden.
Bis zur Abfahrt des Zuges verteilten sich die Passagiere in den Wartesälen der drei Klassen, die ähnlich eingerichtet sind wie bei uns, mit Tischen, Stühlen und Bänken längs den Wänden. Im Wartesaale zweiter Klasse lagen sogar die wichtigsten Tagesblätter der Hauptstadt zur Lektüre auf. Männer, Frauen und Kinder, alle in ihren ursprünglichen Nationaltrachten, machten es sich auf den ihnen ungewohnten Sitzen so bequem, wie sie nur konnten; statt mit herabhängenden Beinen dazusitzen wie Europäer, streiften viele ihre plumpen Holzsandalen von den Füßen, zogen die Beine herauf und setzten sich in gewohnter Weise auf ihre Fersen. Die mehr als große Ungezwungenheit der Japaner in Bezug auf ihre Sitten konnte ich selbst hier, in dieser von zahlreichen Europäern bewohnten und von ihnen am meisten beeinflußten Stadt an einem ergötzlichen Beispiele wahrnehmen. Mitten zwischen den Frauen und Mädchen im Wartesaal zweiter Klasse saß ein älterer Japaner, der von der unangenehmen Landplage Japans, den kleinen hüpfenden Menschenjägern, ein wenig gepeinigt zu werden schien. Ohne sich um die Anwesenden im geringsten zu kümmern, entledigte er sich seines Kimono, dann seines Unterkleides und stand nun in nicht viel umfassenderer Bekleidung da als der, in der er erschaffen wurde. Nach aufmerksamer Betrachtung seiner Gliedmaßen schüttelte er seine Kleidungsstücke (Heiliger Florian, schütz’ mein Haus und zünd’ die anderen an!) sorgfältig aus, zog sie wieder an und nahm ruhig Platz.
Auf dem Gepäckbureau werden Gepäckstücke in ähnlicher Weise angenommen und eingeschrieben wie bei uns, nur daß die Empfangsscheine den Bestimmungsort und die Nummer in japanischer Schrift tragen. Als die Abfahrtszeit des Zuges gekommen war, wurden die Fahrsteige geöffnet, und die ganze Menge von Passagieren, mehrere Hunderte an der Zahl, begab sich in den bereitstehenden Zug. Nur wenige Passagiere trugen europäische Kleidung und ebensolche Schuhe; von ihnen wurde die erste Wagenklasse bevorzugt; zahlreicher waren jene, die zu ihrem dunklen, schlafrockartigen Kimono einen europäischen Hut oder weißen Sonnenhelm, dann Schuhe und Regenschirme europäischer Mache trugen; die Halbjapaner benutzten größtenteils die zweite Wagenklasse, während die große Masse der durchwegs japanisch gekleideten Passagiere in der dritten Klasse Platz nahmen. Diese Unterscheidung habe ich später auf meinen Reisen durch das ganze Land gefunden. Nur in den seltensten Fällen traf ich in der ersten Klasse einen Japaner in Nationaltracht; auch dann war er in europäischer Kleidung in den Wagen gestiegen und hatte erst[S. 586] hier den abendländischen Rock mit dem bequemen Kimono vertauscht, ohne Rücksicht auf die anderen Passagiere.
Auf derlei, gelinde gesagt, Ungeniertheiten muß man sich bei Eisenbahnreisen in Japan ebenso gefaßt machen wie in den Städten und Dörfern, nur sind sie reisenden Europäerinnen auf den Eisenbahnen peinlicher, weil sie sich, in Waggons eingeschlossen, dem nicht durch schleunige Flucht entziehen können. Von den Waggons erster Klasse sind wohl manche in verschiedene Abteilungen geteilt, viele andere aber, ebenso wie die Waggons zweiter Klasse, bilden nur einen einzigen Raum mit an den Wänden entlanglaufenden Sitzbänken und einem freien Platz in der Mitte, wo sich gewöhnlich ein Tischchen mit Eiswasser befindet. Die Waggons dritter Klasse haben wohl Abteilungen, aber die Teilwände reichen nur etwa zum halben Rücken der sitzenden Passagiere. Manche Abteilungen in den besseren Wagenklassen zeigen in japanischer und englischer Sprache die Bezeichnung „Nichtraucher”, doch bleibt sie in diesem Lande, wo Männer und Frauen ohne Ausnahme Raucher sind und stets ihre kleinen Pfeifchen bei sich führen, unbeachtet. An Reinlichkeit und Bequemlichkeit läßt nur die erste Wagenklasse nichts zu wünschen übrig, aber in dieser bekommt der Reisende wieder nichts von dem eigentümlichen und hochinteressanten Volksleben zu sehen, das sich in der zweiten und dritten Klasse abspielt. Auf meinen Reisen wählte ich deshalb gewöhnlich die zweite Klasse, und bei Tag und Nacht blieb meine Aufmerksamkeit zwischen den herrlichen Landschaftsbildern, an denen wir vorbeiflogen, und dem Leben und Treiben meiner japanischen Mitreisenden geteilt. Schlafwagen und Restaurations- oder Büffettwagen sind, nebenbei bemerkt, in Japan noch unbekannt.
Die Japaner pflegen für größere Reisen ihre Hauskleider, Reisedecken, Lebensmittel und dergleichen mitzubringen, und sobald sie den Waggon mit höflichen Verneigungen gegen die Mitreisenden betreten haben, machen sie es sich auf den langen schmalen Sitzen so bequem als möglich. Die Straßenkimonos werden mit dem leichten, aus hellem Stoff angefertigten Hauskleide vertauscht, was bei dem Umstande, daß die Japaner keine Unterwäsche tragen, zu ähnlichen Schaustellungen führt, als wollten wir in unseren gefüllten Waggons das Unterhemd wechseln; fortschrittliche Japaner, bei denen die europäische Kultur, von unten beginnend, sich bereits durch moderne Schuhe oder Stiefel äußert, streifen diese gewöhnlich ab und bleiben während der ganzen Fahrt in Socken; bei besonders heißem Wetter schlagen die Reisenden beiderlei Geschlechts ihre Kimonos zurück und fächeln mit den stets in ihren Händen befindlichen Papierfächern ihren nackten Beinen Kühlung zu. Ueberfällt die reisenden Kinderchen etwa ein natürliches Bedürfnis, so befriedigen sie dasselbe mitunter, besonders in der dritten Wagenklasse, auf dem Fußboden des Waggons. Reisetaschen und Koffer nach unserer Art haben im Reiche des Mikado erst spärlich Eingang gefunden; der Japaner der unteren Stände packt seine Sieben[S. 587]sachen gewöhnlich in ein buntes Taschentuch, das er vorläufig nur zu diesem Zwecke gebraucht; für jenen, zu dem wir es verwenden, bedient er sich kleiner Papierchen. Hat eine Japanerin in irgend einem der europäischen Kaufläden von Tokio oder Yokohama wirklich eine lederne Reisetasche erstanden, so wickelt sie auch diese sorgfältig in ein buntes Taschentuch und trägt sie wie ein Bündel. Ohne Bündel keine Reisende. Kleidungsstücke und dergleichen bringen die Japaner gewöhnlich in Yanagigori, kurzweg Kori genannt, unter. Diese Kori bestehen aus zwei länglichen Körben, die mit der Oeffnung gegeneinander zusammengeschoben und mit Stricken gebunden werden. Sie haben gegenüber unseren Reisekoffern den Vorteil, daß sie sich dem Inhalt anschmiegen und desto weiter auseinandergezogen werden können, je umfangreicher ihr Inhalt ist. Auch die in Japan wohnenden Europäer benutzen auf ihren Reisen gewöhnlich diese praktischen Kori, und aus Leder hergestellt, sowie mit Schlössern versehen, würde sich ihre Einführung in Europa sehr empfehlen.
Für diejenigen Reisenden, die sich ihren Mundbedarf nicht von Hause mitgebracht haben, werden auf den einzelnen größeren Stationen überall Lebensmittel, Kuchen, Eier, Früchte, ja ganze Mahlzeiten feilgeboten. Dazu dienen Schachteln in der Größe und Form unserer Cigarrenschachteln aus neuem weißen Holz, sogenannte Bento, die wenige Sen kosten. Beim Oeffnen der Umhüllung findet man zunächst eine kleine Papierserviette, dann einen Holzspan, der als Löffel dient, und zwei Eßstäbchen, zusammen von der Stärke und Länge eines Bleistiftes, die zum Zeichen ihrer Jungfräulichkeit nur zu zwei Dritteilen ihrer Länge auseinandergespalten sind. Unter ihnen zeigen sich die Leckerbissen der japanischen Mahlzeit: auf der einen Seite der Schachtel allerhand gekochte Wurzeln, eingemachte Früchte, rohe oder gesalzene Fischchen, aber niemals Fleisch, auf der anderen Seite köstlicher, blendend weißer Reis. Die Eßstäbchen dienen als Messer und Gabel, die Schachtel als Teller; dazu werden auf den Stationen Flaschen mit gutem japanischen Bier, Limonade und zur Kühlung dieser Getränke Eisstücke feilgeboten. Das gebräuchlichste Getränk ist aber doch Thee geblieben. Kleine Jungen verkaufen ganz reizende Theetöpfe mit heißem Theeaufguß und kleinen Schälchen dazu für drei bis vier Sen, alles inbegriffen, und kommt der Eisenbahnzug nach mehrstündiger Fahrt an eine größere Station, so ist es gewöhnlich die erste Aufgabe der mit der Reinigung der Waggons beauftragten Stationsdiener, die Dutzende von Theetöpfen und Schälchen zu entfernen, die sich während der Reise angesammelt haben. Die Töpfe finden aber zuweilen auch eine andere Verwendung, wie ich auf einer Reise von Tokio nach Osaka in Gesellschaft mehrerer europäischer Damen und einer Anzahl Japaner wahrzunehmen Gelegenheit hatte. Einer der letzteren hatte eben zwei Täßchen Thee geschlürft und den Theetopf unter den Sitz gestellt, als er Gelegenheit bekam, ein im Waggon vorhandenes Seitenlokal zu benutzen. Statt sich dorthin zu bemühen, holte er gemächlich den Theetopf wieder hervor und warf ihn nach vollbrachter[S. 588] That im kühnen Schwunge zum Waggonfenster hinaus. Derselbe Mann aber entfernte sich, an seinem Ziele angelangt, unter den ehrerbietigsten Verbeugungen vor uns aus dem Waggon, ein Beweis, daß er von der Unziemlichkeit seines früheren Betragens keine Ahnung hatte.
Europäer durften sich in Japan bis 1898 auch auf den Eisenbahnen keineswegs frei bewegen, für jede Reise bedurften sie eines von der Regierung ausgestellten Reisepasses in japanischer Sprache, in dem die einzelnen Orte, wo die Reisenden Aufenthalt nehmen wollten, genau angegeben waren. An jeder Eisenbahnstation, ja in jedem noch so kleinen Orte wachte die luchsäugige japanische Polizei mit der größten Strenge über die Reisenden, und wie eingangs erwähnt, kein Europäer durfte sich ein Eisenbahnbillet lösen, ohne daß sein Reisepaß vorher von einem Polizisten geprüft worden wäre. Wurde er in einem Orte angetroffen, der in seinem Passe nicht erwähnt war, so konnte er sich empfindlichen Unannehmlichkeiten aussetzen. Wie in dem gestrengen Rußland konnte er ohne Paß in keinem Hotel Aufnahme finden. Durch diese Paßschwierigkeiten wäre im Sommer 1894 meine Reise von Japan nach Korea bald zu Wasser geworden. Der letzte Passagierdampfer, der vor dem chinesisch-japanischen Kriege überhaupt nach dem „Lande der Morgenruhe” abgelassen wurde, sollte an einem bestimmten Tage den Hafen von Kobe verlassen, und mein Reisepaß war in Myanoshita, wo ich mich gerade befand, noch nicht eingetroffen. Um den Dampfer nicht zu versäumen, nahm ich zu einer List meine Zuflucht. Eine Kuruma, gezogen von zwei flinken Burschen, brachte mich und mein Reisegepäck, in dem sich unter anderem ein vollständiger japanischer Anzug befand, am Abend des letzten Tages aus dem Gebirge nach der Eisenbahnstation Kodzu. In dem Theehause der Station gegenüber nahm ich einen Imbiß ein, den ich mit einem reichlichen Dschadai (Trinkgeld) bezahlte, und ersuchte dabei eins der kleinen, mich bedienenden Nesanmädchen, mir eine Fahrkarte nach Kobe zu lösen. Durch einen glücklichen Zufall war der Polizist am Schalter gerade nicht anwesend, und sie brachte mir das ersehnte Stückchen Pappendeckel. In der Dunkelheit stahl ich mich nun in ein Bambusgestrüpp nahebei, streifte rasch meine Oberkleider ab, warf mich in einen Kimono, band ein rotes Kopftuch um, setzte eine große dunkle Brille auf und verbarg meine europäischen Kleider in dem Reisesack. So wartete ich das Herannahen des Zuges ab, und als er in die Station eingefahren war, sprang ich, so schnell es die schweren Holzpantoffeln erlaubten, mit einem Tuche vor dem Munde, als hätte ich Zahnschmerzen, zwischen Polizisten und Bahnbeamten hindurch in den Zug. Während der nächtlichen Fahrt erschien glücklicherweise nur ein Jünger der heiligen Hermandad in meinem Waggon, wo ich mich auf eine Bank ausgestreckt schlafend stellte. Meine Vermummung und die Dunkelheit halfen mir über diese Gefahr hinweg, und glücklich kam ich in Kobe, einem den Europäern geöffneten Hafen an, wo man sich über meine japanische[S. 589] Tracht nicht wenig ergötzte. Das Schiff war erreicht, der Reisepaß aber kam, wie ich nachträglich erfuhr, erst zwei Tage nach meiner Abreise in Myanoshita an.
Mit ihren Eisenbahnen machen die Japaner vortreffliche Geschäfte. Nach den offiziellen Mitteilungen vom Jahre 1896 hat das Eisenbahnnetz eine Länge von etwa 3000 Kilometern erreicht. Das ist vorderhand nicht viel, denn Japan hat dieselbe Größe wie ganz Norddeutschland mit Ausschluß der thüringischen Staaten und dabei eine Einwohnerzahl von 42 Millionen, also um 9 Millionen mehr als Norddeutschland. Während dieses nun ein Bahnnetz von über 30000 Kilometern Länge besitzt, hat dasselbe in Japan nicht viel mehr als ein Zehntel dieser Länge im Betrieb. Dafür sind augenblicklich noch weitere 1500 Kilometer im Bau begriffen. Während des Jahres 1895 hat die Regierung 26 temporäre Baubewilligungen im Gesamtumfange von 1350 Kilometern mit einem Kapital von 40 Millionen Yen erteilt, dazu 5 permanente mit 390 Kilometern und 10½ Millionen Kapital. Die Spurweite der japanischen Bahnen ist geringer als jene der europäischen und beträgt nur, die Schienen einbegriffen, 1 Meter 15 Centimeter, weshalb die Geschwindigkeit der Schnellzüge zu wünschen übrig läßt. Dafür sind auch die Fahrpreise geringer, denn sie betragen für den Kilometer nur etwa 6 Pfennig in der ersten, 4 Pfennig in der zweiten und 2 Pfennig in der dritten Klasse. Mit Ausnahme der kurzen Strecken zwischen Kobe und Osaka, sowie zwischen Tokio und Yokohama sind alle japanischen Bahnen eingleisig.
Unter staatlicher Verwaltung standen 1895 880 Kilometer mit 127 Stationen und 3000 Waggons, die Einnahmen beliefen sich auf 7¼ Millionen Yen, die Ausgaben auf 4 Millionen, so daß bei einem Anlagekapital von 40 Millionen Yen die Verzinsung etwa 8 Prozent beträgt; im Jahre 1891 belief sie sich nur auf 6 Prozent.
80 Millionen Yen sind in den Eisenbahnlinien der Privatgesellschaften angelegt, die Ende 1895 eine Gesamtlänge von 2300 Kilometern mit 273 Lokomotiven und 5000 Waggons besaßen. Ihre Einnahmen beliefen sich auf 8¾ Millionen, die Ausgaben auf 4 Millionen, und da von dem Kapital nur 60 Millionen eingezahlt sind, so ergiebt sich bei einem Reingewinn von 5¾ Millionen eine recht ansehnliche Dividende.
Die Zahl der Passagiere belief sich 1895 auf nahezu 22 Millionen, von denen 20½ Millionen die dritte Fahrklasse benutzten und 750000 die zweite; nur 50000 fuhren in der ersten Klasse, der Rest entfällt auf Dienstreisende.
Durch Unfälle wurden 135 Passagiere getötet und 38 verwundet.
Im Jahre 1898 war die Länge der Staatsbahnlinien 1065 Kilometer, der Privatbahnen 3682 Kilometer, zusammen also 4747 Kilometer.
Ebenso wie Dampfeisenbahnen sind in den letzten Jahren auch zahlreiche Pferdebahnen in Japan gebaut worden, in Städten sowohl wie auf dem Lande, ja die Japaner sind sogar noch einen Schritt weiter gegangen und können sich einer Eisen[S. 590]bahn rühmen, wie sie auf dem weiten Erdenkreis wohl kaum ihresgleichen hat. Als ich im Sommer 1894 auf meinen Fahrten längs der herrlichen Bucht von Odawara, südlich von Yokohama, das Bad von Atami mit seinem berühmten intermittierenden Geiser besuchte, legte ich den Weg dahin noch in der Rickshaw zurück. Seither sind spekulative Köpfe auf den Gedanken gekommen, eine Rickshaw-Eisenbahn anzulegen mit menschlichen Lokomotoren. Statt der von einem Kuli gezogenen Handwägelchen laufen auf dieser Bahn viersitzige Wagen, von zwei Kulis gezogen. Ich glaube, es besteht in Japan bereits ein Tierschutzverein. Ob es nicht zweckmäßig wäre, auch einen Menschenschutzverein zu gründen? Die Steigungen auf dieser Kulibahn sind derart bedeutend, daß sie von den armen Zugmenschen kaum bewältigt werden können, besonders wenn statt vier sogar sechs Passagiere in dem Wägelchen Platz nehmen; ebensowenig können die Kulis beim Herabfahren den ins rasche Rollen gekommenen Wagen zurückhalten, und es ist in der kurzen Zeit des Bestehens dieser Kulibahn schon häufig zu Unglücksfällen gekommen.
Die Aufhäufung des Verkehrs durch die Eisenbahnen hat natürlicherweise die alten Verkehrsstraßen Japans vereinsamt, aber wer Land und Leute kennen lernen will, muß dieselben doch noch benutzen. Die älteste dieser Straßen, die berühmte Nakasendostraße, läuft von Kioto mitten durch die Insel Nipon in östlicher Richtung; eine zweite führt von der alten Reichshauptstadt nach Norden, eine dritte in nordöstlicher Richtung nach der heiligen Tempelstadt Nikko, aber während der letzten Jahrzehnte vor der Einführung der Eisenbahnen war die belebteste Verkehrsstraße der Tokaido, zwischen Kioto und Yeddo, die Hauptroute der alten Feudalfürsten mit ihrem zahlreichen, oft nach Tausenden zählenden Gefolge auf ihrem jährlichen Huldigungszuge an den Hof des Schoguns. Der Verkehr auf dieser wichtigsten Route Japans wurde an Lebhaftigkeit von keiner Straße in den Großstädten übertroffen, und selbst heute noch wird der Tokaido täglich von Tausenden benutzt, die zu Fuß, zu Wagen, in der Rickshaw oder in der japanischen Sänfte, dem Kago, längere Reisen unternehmen. Leider verwendet die unter dem Zeichen des Dampfverkehrs stehende japanische Regierung auf die Straßen nur wenig Sorgfalt. Häufige Ueberschwemmungen und Erdbeben richten in jedem Jahre immer größere Verheerungen an, und stellenweise sind diese Verkehrswege kaum passierbar. Noch vor zwei Jahrzehnten waren sie durch die herrlichsten uralten Kryptomerien beschattet, und auf manchen Strecken, wie bei Nikko und an dem See von Hakone, hatte ich noch Gelegenheit, in meiner Rickshaw zwischen langen Reihen dieser wunderbaren Bäume einherzufahren, die mich in ihrer stolzen Höhe und Eigenart lebhaft an die berühmten Sequojas im Distrikt von Yosemite in Kalifornien erinnerten. In ihrem Streben nach vermeintlich europäischer Kultur begannen die Japaner auch hier mit rücksichtsloser Hand diese majestätischen Ueberreste des alten Japan zu vernichten; auf Meilen wurden die Bäume niedergeschlagen, um Platz zu machen für die Tele[S. 591]graphenstangen, und erst der Einspruch der Diplomaten und das Geschrei der ausländischen Zeitungen brachte die offiziellen Vandalen zur Besinnung. Die meisten Straßen Japans sind so schlecht unterhalten, vom Wasser so zerrissen und bei Regenwetter so bodenlos wie die chinesischen; nur stellenweise ist der Verkehr mittels Rickshaws möglich, und deshalb hat sich auch noch so lange der entsetzliche Marterkasten der Japanreisenden früherer Zeit, der Kago, erhalten. Der Kago wird hauptsächlich noch von Frauen benutzt, und es nahm mich beim Anblick derselben stets wunder, wie so zarte Wesen tagelang in diesem elendesten aller Tragstühle verweilen konnten: ein Sitzbrett, nicht viel größer als das unserer Armstühle, vorn und hinten mit Stricken an einer von Kulis getragenen Bambusstange aufgehängt, bildet den Kago. Auf diesem Sitze hockt der Reisende auf seinen Waden, denn der Kago ist zu niedrig, um auf der zum Sitzen bestimmten Partie des menschlichen Körpers zu ruhen und die Beine herabfallen zu lassen, auch zu kurz, um die Beine ausstrecken zu können.
Dabei ist infolge der kleinen Statur der Japaner der Raum zwischen Sitzbrett und Tragstange so niedrig, daß nur kleine Frauchen ihren Kopf hochtragen können; ich selbst konnte ihn nicht heben, ohne an die Tragstange anzustoßen. Zur Linderung der Marter wird freilich ein Kissen auf den Sitz gebreitet und an der Bambusstange ein horizontales Schutzdach aus Stoff gegen Sonne und Regen befestigt, aber eine Marter bleibt es dennoch, im Kago zu reisen. Deshalb wurden in den letzten Jahren hauptsächlich für die europäischen Reisenden die Tragstühle eingeführt, wie sie in China, meistens in Hongkong, gebräuchlich sind. Sie bestehen aus einem bequemen Armstuhl aus Strohgeflecht mit einer an Seilen hängenden Fußbank; statt von einer Bambusstange herabzuhängen wie der Kago, ist an jeder Seite des Tragstuhls etwa in der Höhe des Sitzes eine mehrere Meter lange elastische Bambusstange angebracht, deren Enden auf den Schultern von zwei bis vier Kulis ruhen.
Bei Rickshaw, Kago und Tragstuhl ist es erstaunlich, welche Kraft und Ausdauer die sehnigen Kulis entwickeln; noch erstaunlicher die Geringfügigkeit des Lohnes, mit dem sie sich zufrieden geben. Allerdings sind ihre Bedürfnisse mehr als bescheiden; sie schlafen in den ärmlichsten Hütten oder unter den längs des Tokaido und Nakasendo stellenweise errichteten Flugdächern; sie nähren sich von Reis und Gemüsen, und was ihre Kleidung betrifft, so besteht sie im Inlande, entfernt von der polizeilichen Ueberwachung der Städte, im Sommer immer noch aus der weißen Kravatte, die sie sich um die Lenden binden. Nur auf den belebtesten Verkehrswegen tragen sie dazu noch eine blaue, vorn offene Jacke und gestatten sich zuweilen auch den Luxus von enganliegenden Kniehosen. Derartiger Kulis dürfte es im Reiche des Sonnenaufgangs gegen zwei Millionen geben.
Der große Krieg zwischen China und Japan hat die Aufmerksamkeit Europas in höherem Maße als bisher auf Ostasien gelenkt, und vielfach sind die großen Gefahren besprochen, die der europäischen Industrie durch den Wettbewerb der Länder Ostasiens, vor allem Japans, drohen. Japan ist in den letzten Jahrzehnten in vielen Industriezweigen selbständig geworden, ja es tritt auf den ostasiatischen Märkten, sogar auch in Europa, mit seinen Industrieerzeugnissen erfolgreich auf.
Wo ist nun in dem fernen Inselreiche der Sitz der so jungen und doch so gewaltigen Industrie? Sind es einzelne Gebiete oder Städte, oder entwickelt sich das ganze Japan allmählich zu einem kleinen ostasiatischen Westfalen? Der Reisende in Japan erlangt darüber bald Klarheit. Während sich auf Reisen in Europa die Nähe größerer Städte gewöhnlich durch die mit Rauch geschwängerte Atmosphäre, durch Kirchtürme, hohe Schornsteine und große Fabrikgebäude kundgiebt, sieht man in Japan die Städte erst, wenn man sich beinahe in ihnen befindet. Ein Kranz von Gärten und hohen Bäumen entzieht die niedrigen, einstöckigen Gebäude dem Anblick, und die Atmosphäre der Städte ist ebenso klar und durchsichtig, der Himmel ebenso blau wie auf dem Lande. Die Japaner verwenden eben zur Feuerung hauptsächlich nur Holzkohlen. Schornsteine sind dazu nicht nötig,[S. 593] ja den Städten des südlichen Japan sind solche bisher glücklicherweise noch unbekannte Dinge geblieben.
Das Erstaunen des Japanreisenden ist deshalb groß, wenn er auf seiner Fahrt längs der Ostküste von Yokohama nach Kobe, etwa eine Stunde vor dieser Hafenstadt, im Osten die Atmosphäre mit dichtem Rauch geschwängert sieht, als ob dort gerade irgend eine Ortschaft vom Feuer verzehrt würde. Beim Näherkommen gewahrt er in der weiten Ebene eine große Zahl von umfangreichen Fabrikanlagen mit roten, mehrstöckigen, vielfensterigen Gebäuden und Dutzenden hoch über sie emporragenden Schornsteinen, ein Anblick, an den er wohl in den Industriebezirken von Sachsen oder Westfalen gewöhnt ist, der hier aber sein Befremden erweckt. Bald darauf fährt er in eine rauchige, finstere, belebte Eisenbahnstation ein, und der japanische Schaffner ruft Osaka.
Osaka, das japanische Birmingham, das neugeschaffene Emporium der ebenso neuen japanischen Industrie, die größte Fabrikstadt von Ostasien. Gleichzeitig ist dieses Osaka (sprich Ohsakka) die zweitgrößte Stadt des Landes, an Einwohnerzahl, Bedeutung und Reichtum nur von Tokio übertroffen. Vor dem Stationsgebäude drängen sich zwischen Tausenden von geschäftigen Menschen Hunderte von Kurumas, diese kleinen, zweiräderigen, von flinken, strammen Burschen gezogenen Handwagen. Ich springe in eine dieser Kurumas, rufe dem Kuli die Worte „Yadya Dschiyutai” zu und befinde mich nach einer raschen Fahrt von zehn Minuten durch die ungemein belebten Straßen Osakas in dem einzigen, halbwegs europäisch eingerichteten Hotel dieser japanischen Großstadt.
Das Dschiyutaihotel steht im Verein mit einigen anderen Gebäuden auf einer langen, schmalen, mit hübschen Parkanlagen bedeckten Insel inmitten des Yodogawaflusses, der hier etwa die Breite des Rheins bei Köln besitzt. Diese, Nakanoshima genannte Insel ist mit den Stadtteilen an beiden Ufern durch eine breite, stets dicht mit Menschen besetzte Brücke verbunden; auf dem Strom fahren zahllose Dampfer, Frachtboote und Sampans auf und nieder; die Ufer sind dicht mit malerischen, mehrstöckigen Holzhäusern eingefaßt, die mit ihren Fronten auf Piloten im Wasser stehen und in jedem Stockwerk eine mit Blumen, Lampions und Flaggen geschmückte, weit in den Fluß ragende, offene Veranda zeigen. Ueberall, in den Häusern, auf den Veranden, auf der Brücke und im Flusse herrscht das regste Leben. Menschen, wohin das Auge blickt, durchweg Japaner, anscheinend ganz unbeeinflußt durch die europäische Kultur. Während meines mehrtägigen Aufenthaltes in Osaka begegnete ich keinem einzigen Europäer. Es gab wohl in früheren Jahren viele hier, als die Japaner zur Anlage und Einrichtung ihrer Fabriken europäischer Fachleute bedurften. Sobald diese jedoch ihre Schuldigkeit gethan und die Japaner in die Geheimnisse ihrer Kunst eingeweiht hatten, wurden sie von den letzteren wieder entlassen. Heute werden all die großen Fabriken, die im Laufe der letzten zwei[S. 594] Jahrzehnte auf diesem urjapanischen Boden entstanden sind, fast ausschließlich von Japanern geleitet; sie sind mit japanischem Gelde errichtet worden, die europäischen oder asiatischen Rohprodukte, die sie benötigen, werden mit europäischen Maschinen ausschließlich von Japanern verarbeitet, kommen durch japanische Handelshäuser auf den Markt, werden bei japanischen Gesellschaften gegen Schäden versichert und endlich auf japanischen Dampfern nach den verschiedenen Häfen, aber auch nach China, Indien, Australien, ja selbst nach Europa verschifft. Kürzlich hat eine große japanische Dampfergesellschaft, die Nipon Yusen Kaisha, eine regelmäßige Dampferlinie über den Stillen Ozean nach Amerika und eine zweite durch den Suezkanal nach Europa eingerichtet, und die massenhaften Fabrikprodukte von Osaka gelangen in Europa auf den Markt, ohne daß der Europäer irgend etwas daran verdient.
Doch, wo sind die Fabriken des so rasch berühmt gewordenen Birmingham von Ostasien? Rings um den breiten Fluß und selbst im Innern der Stadt giebt es keine, und wer ähnliche Frachtwagen und andere Fuhrwerke, Maschinen, Schienengeleise, Quais mit schwarzen Drehkränen, gehandhabt von rußigen Arbeitern, erwartet, wie sie sich in den Fabrikstädten Europas zeigen, der wird hier angenehm enttäuscht. Auf dem Flusse, in den zahlreichen Kanälen, in den Straßen der inneren Stadt bis hinauf zur altjapanischen Frohnfeste ist das Bild von Osaka urjapanisch, und weder Tokio noch Kioto, noch irgend eine andere von Fremden besuchte Großstadt ist von der europäischen Kultur so unbeeinflußt geblieben wie Osaka. Tokio läßt sich von der Regierung, figürlich gesprochen, allmählich ins Europäische übersetzen, ebenso Yokohama, Kobe, Hiogo, teilweise sogar Kioto und Nagasaki. Osaka dagegen hat die europäische Kultur ins Japanische übersetzt; es hat sich von derselben alles angeeignet, dessen es bedarf, hat es aber dem japanischen Wesen angepaßt und ist in dem Aussehen seiner Straßen und Häuser und der Menschen, die in ihnen wohnen und verkehren, anscheinend mit zäher Absichtlichkeit urjapanisch geblieben. Ich habe auf meinen Reisen durch Japan keine Stadt gesehen, in der sich das japanische Leben und Treiben unverfälschter und dabei lebhafter zeigte, auch in dieser Hinsicht keine interessantere und sehenswertere Stadt gefunden als eben Osaka. Man sollte glauben, daß die großartigen europäischen Industrien, die sich hier in so kurzer Zeit entwickelt haben, auch auf das Leben, die Kleidung und das ganze Wesen der Einwohner nicht ohne Einfluß geblieben sein könnten. Keine Spur davon. Im Gegenteil. Nirgends ist von altjapanischer Eigenart mehr wahrzunehmen als gerade hier. Nirgends ist der alte Aberglaube, der Götzendienst, das Prozessionswesen ausgeprägter; nirgends werden die vielen Matsuri (Volksfeste) ursprünglicher gefeiert; nirgends giebt es bewegteres Leben in den Theehäusern und Theatern; die Geishamädchen von Osaka sind in ganz Japan als die hübschesten und fähigsten anerkannt, und in Osaka wird am besten nach altjapanischer Weise getanzt, gesungen und musiziert.
Die Stadt liegt auf beiden Ufern des breiten, vom Biwasee kommenden Yodogawaflusses und ist von alters her der Hafen der früheren Landeshauptstadt Kioto, mit der sie durch eine Eisenbahn und mehrere Dampferlinien auf dem Yodogawa verbunden ist. Aber Osaka kann heute nicht mehr als Hafen gelten, denn es ist etwa zwei bis drei Kilometer von der schlammigen Mündung dieses Flusses in die seichte Osakabucht entfernt, und Seedampfer können hier gar nicht herankommen. Osaka gegenüber, auf der Westseite der etwa fünfzehn Kilometer breiten Bucht, liegen die Zwillingsstädte Hiogo und Kobe, und diese bilden ihrerseits den Hafen von Osaka; von dort gelangen all die Erzeugnisse der letzteren Stadt zur Verschiffung, und wie in der Zeit vor der Revolution die Stadt Kioto den Hafen Osaka geschaffen hat, so hat nach der Revolution die Stadt Osaka den Hafen Kobe geschaffen und zu großer Blüte gebracht. Dieses Kobe ist eine europäische Stadt mit abendländischen Straßen und Häusern, mit Konsulaten, Theatern, Konzerthallen, Klubs nach europäischer Art, noch mehr als Yokohama, und vielleicht auch bestimmt, in nicht zu ferner Zeit dieses zu überflügeln; Osaka aber ist, wie gesagt, japanisch geblieben.
Das merkt man sofort, wenn man in einer Kuruma durch die Straßen dieser reizenden Stadt fährt. Sie ist ganz nach amerikanischer Schachbrettart angelegt; die breiten, geradlinigen Straßen schneiden sich in rechten Winkeln und werden von einer großen Zahl von ebenso geradlinigen Kanälen gekreuzt, über die gewölbte, hölzerne Brücken führen. Es sind also sozusagen zwei Städte übereinander; eine Stadt von Kanälen, zwischen denen sich nicht weniger als dreieinhalbtausend Brücken befinden.
Welche von diesen beiden Städten interessanter ist?
Bei Tag wohl die Stadt auf dem Lande mit ihrem ungemein regen Leben und Treiben und ihren unzähligen Kaufläden, die sich in den meisten Straßen auf Kilometer dicht aneinanderreihen, als ob jede einzelne der 162000 Familien der Stadt einen Kaufladen besäße. Durch die im Juli 1896 erfolgte Einverleibung von 28 umliegenden Städten und Dörfern in Osaka hat sie an Bevölkerungszahl um 125000 zugenommen und ist heute eine Stadt von 752000 Einwohnern, übertrifft also Birmingham um 300000 Seelen, und überall, Straßen auf, Straßen ab sind weitgeöffnete Läden, so daß man beim Spazierengehen nicht nur die vor den Läden an der Straße aufgestapelten Waren, sondern auch die in denselben herrschende Thätigkeit wahrnehmen kann. Osaka ist ja nicht nur Markt-, sondern auch Fabrikstadt; dabei nicht nur von europäischen Waren, sondern auch die größte Fabrikstadt nach japanischer Art. Draußen an der Straße der Handel, drinnen in den Läden die Industrie. Diese ist, was die spezifisch japanischen Produkte anbelangt, Kleinindustrie geblieben. Jede Familie arbeitet in den kleinen, niedrigen, aber nach vorne und hinten offenen und deshalb luftigen Läden für sich oder höchstens mit[S. 596] Zuhilfenahme von einem oder mehreren Arbeitern. Hier sieht man die fleißigen, kleinen Japaner, im warmen Sommer mit entblößtem Oberkörper, mit ihren Händen und häufig auch mit den Füßen arbeiten. Hier sieht man, wie die kleinen, zierlichen Fächer gemalt, wie ihre Bambusrippen gespalten und zusammengefügt werden, ein kleiner Artikel, der aber nach Hunderten von Millionen in alle Welt gerade von Osaka ausgeführt wird und Millionen in die Taschen der Einwohner bringt. Hier sieht man das Flechten der zarten, hübschen Strohmatten, die Herstellung des Indigo zum Färben der in den Fabriken angefertigten Stoffe, das Weben der herrlichen Seidenstoffe und golddurchwirkten Brokate, das Zusammensetzen der bekannten Sonnenschirme aus Bambus und Papier, das Verfertigen der kleinen, hölzernen Nippsachen, Kästchen und Schachteln, die von verschiedenen Größen, aber derselben Form, so genau ineinander passen; die Fabrikation der Millionen von Puppen, Kinderspielzeugen aller Art, der Bronzefigürchen, Schälchen und hunderterlei anderer wohlfeiler Artikel, die in den europäischen Bazars sich so wunderhübsch ausnehmen, unsere Bewunderung erregen, unsere Kauflust reizen. Stundenlang mußte ich in diesen interessanten Quartieren der japanischen Kleinindustrie verweilen, bald hier, bald dort, und staunen über die unglaubliche Geschicklichkeit, ebenso wie über die einfachen Mittel der japanischen Handwerker. In der Zartheit und Genauigkeit ihrer Arbeit stehen sie unter allen Nationen unübertroffen da oder können es wenigstens, wenn sie wollen. Infolge des ungeheuren Absatzes, den diese japanischen Nippes in Europa und Amerika gefunden haben, ist die Nachfrage nach diesen, größtenteils aus Osaka stammenden Artikeln so lebhaft geworden, daß die Kleinindustrie mit Arbeit überhäuft ist, und da der Nachwuchs an Arbeitern nicht genügt, ihre Arbeitskraft aber bei vierzehn- bis sechzehnstündiger Arbeitszeit nicht höher angespannt werden kann, so ist in den letzten Jahren ein bedauerlicher Schlendrian in der Herstellung eingetreten. Osaka ist eine Art japanisches Chicago, mit seiner Jagd nach dem Gelde. Verdiene Geld, verdiene es ehrlich, und kannst du es nicht, so verdiene es doch.
Nur eine beschränkte Zahl von Kunstgewerben hat sich noch zum Teil von dieser Leichtfertigkeit freigehalten, darunter die Herstellung feiner Bronzewaren und feiner Porzellansachen. In den Kuriositätenläden von Yokohama und Kobe wurden mir häufig reizende Artikel dieser Art vorgelegt. Bronzen mit eingesetzten oder aufgehämmerten Figuren, Ornamenten, eingelegtem, ungemein zartem Email, in den herrlichsten Formen, in der zartesten Ausführung. Oder entzückende kleine Vasen, Schalen, Tassen, Aschebehälter aus feinstem Porzellan, bedeckt mit Malereien von einer Feinheit, Kleinheit und Farbenpracht, die in Europa unerreicht ist. Man nannte mir als Erzeuger dieser Waren Firmen aus Osaka mit weitberühmten Namen. Als ich diese Firmen aufsuchte, um die Erzeugungsart dieser kleinen Kunstwerke kennen zu lernen, fand ich sie auch nur in bescheidenen kleinen Holzhäuschen, aber sie[S. 597] hatten keine offenen Kaufläden wie ihre minderwertigen Kollegen. An den verschlossenen Häusern, die man ebensogut für Privathäuser hätte halten können, waren keine Schilder oder Firmentafeln, ja selbst als ich Einlaß gefunden hatte, sah ich auch im Innern keine Schaustücke ausgestellt. Erst nach längerer Unterhaltung und nachdem ich den von zarten Mädchenhänden dargereichten Thee geschlürft, wurden die Kästen geöffnet, aus Baumwolle und Papier die kleinen Kunstgegenstände ausgewickelt und mir mit großem Zeremoniell, etwa wie der kostbarste Brillantschmuck, dargereicht. Und als ich die Frage stellte, wo das Atelier sich befände, wies man mich eine steile, enge Holztreppe hinauf in das erste Stockwerk, wo ein paar junge Arbeiter auf dem Fußboden saßen und an den kleinen Porzellanvasen und -schalen herumpinselten. Das war die ganze weitberühmte Fabrik. In Europa wäre ein Porzellanmaler von solcher Kunst und Fähigkeit mindestens ein Professor, in einem schönen Atelier sitzend und mit ansehnlichem Gehalt. Hier sind die Künstler junge bescheidene Burschen, die sechzehn Stunden den Tag arbeiten, halbnackt auf ihren Fersen hocken und als Tagelohn einen Yen, etwa zwei Mark, erhalten. Wenige werden besser bezahlt, während die weitaus größte Mehrzahl von Arbeitern, die in dem Kleingewerbe von Osaka Verwendung finden, nicht mehr als vierzig bis fünfzig Pfennig den Tag verdienen. Und derartiger Arbeiter giebt es in Osaka über sechzigtausend. Die besten Mechaniker erhalten einen Tagelohn von etwa zwei Mark, Sticker, Aufseher, Maler, Holzschnitzer eine Mark, Fabrikarbeiter durchschnittlich vierzig bis fünfzig Pfennig, Tagelöhner siebzig Pfennig. Noch viel geringere Arbeitslöhne erhalten die Arbeiterinnen. Am höchsten werden die Stickerinnen und Malerinnen bezahlt. Sie erhalten etwa vierzig Pfennig täglich; ihnen zunächst kommen Aufseherinnen und die ausgezeichnetsten Arbeiterinnen in den verschiedenen Industriezweigen mit etwa dreißig Pfennig, gewöhnliche Arbeiterinnen in den Fabriken mit zwanzig Pfennig und schließlich die Lehrmädchen mit zehn bis dreizehn Pfennig täglichem Arbeitslohn. Wie man sieht, betragen also die Arbeitslöhne in Japan im großen und ganzen nur ein Viertel bis ein Fünftel der europäischen Löhne, und wenn man berücksichtigt, daß Japan in Bezug auf Asien etwa ähnlich gelegen ist wie England in Bezug auf Europa, daß es mit den verschiedenen Ländern und Häfen der asiatischen Welt durch eigene japanische Dampferlinien in Verbindung steht und daß die Entfernung dieser Länder von Japan nur ein Drittel bis ein Fünftel ihrer Entfernung von Europa beträgt, an Fracht und Versicherungskosten demnach ungemein viel erspart wird, so hat man die Erklärung für den Aufschwung von Japan als Industriestaat und die Bedrohung der asiatischen Märkte durch die japanische Industrie.
Am auffälligsten wird sich das dem Japanreisenden in Osaka zeigen. Die einheimische Bevölkerung hat für die Bewältigung der industriellen Aufgaben hier längst nicht mehr hingereicht, und aus allen Provinzen strömt die Landbevölkerung hier[S. 598] zusammen, um Arbeit zu finden, die in der Stadt immer noch besser bezahlt wird wie auf dem Lande, gerade so wie es in den europäischen Industrieländern der Fall ist. In den letzten Jahren sind ganz neue Stadtteile entstanden, und die leichten, ärmlichen Häuschen sind schon vermietet, ehe sie fertig dastehen. Die Baugründe sind in diesem industriellen Emporium im Preise auf nahezu das Dreifache jener der Landeshauptstadt Tokio gestiegen, dementsprechend sind auch die Mieten und der Schischikin höher. Jeder, der ein Haus mieten will, muß dem Besitzer, bevor er das Haus bezieht, eine bestimmte Summe als eine Art Garantie zahlen, und diese wird Schischikin genannt. Brennt das Haus nieder, so fällt der Schischikin dem Hausbesitzer ganz zu, jedenfalls erhält er aber beim Ablauf der Miete zwanzig Prozent dieses Garantiebetrages, und bei den ärmlichen Verhältnissen der Japaner muß es Verwunderung erwecken, daß sie überhaupt im stande sind, den Schischikin zu erlegen. Der größte Zuzug nach Osaka kommt aus der westlich davon gelegenen Provinz Hiroschima, hauptsächlich Nachkommen der von den japanischen Eroberern unterworfenen Ureinwohner des Landes, der Ainos, ein friedfertiges, fleißiges, anspruchsloses Völkchen, das auch das Hauptkontingent für die japanischen Arbeiterkolonien in Australien, Neukaledonien, Hawai u. s. w. geliefert hat. Tausende von armen jungen Mädchen im zarten Alter von acht bis zwölf Jahren finden in den Fabriken von Osaka Beschäftigung, und viele Fabrikbesitzer haben für diese jungen, unselbständigen Arbeiterinnen eigene Kasernen angelegt, in welchen sie essen, schlafen, ja mitunter sogar im Lesen und Schreiben unterrichtet werden. Von ihrem kärglichen Tagelohn von durchschnittlich zwölf Pfennig müssen sie etwa neun Pfennig für Kost und Wohnung abgeben. Bei ihrem Anwerben erhalten sie einige Mark für Kleidung und überdies die Reisekosten nach Osaka, dafür müssen sie sich auf die Dauer von drei Jahren an die Fabrik verpflichten; der Ueberschuß von ihren Löhnen wird in eigenen Sparkassen angelegt und ihnen nach Ablauf ihrer Arbeitszeit bar ausbezahlt. Die erste Fabrik, die diese Einrichtung traf, war die große Kanegafudschi-Spinnerei in Tokio, welche über zweitausend solcher kleiner Mädchen beschäftigt.
Aber wo sind diese großen Fabriken von Osaka? In dem Straßengewirre dieser großen Stadt sind sie nicht zu sehen. Sie liegen größtenteils außerhalb, an den schmutzigen, übelriechenden Kanälen, gewaltige, ganz europäische Bauten, nach den modernsten Mustern angelegt und mit den besten europäischen Maschinen eingerichtet, von denen viele auch von Deutschland bezogen worden sind. Die beiden größten Etablissements stehen unter dem Betriebe der Regierung: das Arsenal und die Münze. Nach dem Urteil hervorragender Fachleute können sich beide mit den besten Etablissements dieser Art in Europa messen. Der österreichische Thronfolger, Erzherzog Franz Ferdinand, sagt in seinem ausgezeichneten Weltreise-Tagebuche folgendes über das Arsenal: „Die Kürze der Zeit, in welcher Japan vermocht hat, sich mit[S. 599] allen einschlägigen europäischen Einrichtungen vertraut zu machen, nimmt geradezu wunder. Das Arsenal ist mit Maschinen modernster Konstruktion ausgerüstet, so daß die Geschützrohre, welche in rohem Zustande aus der Gießerei kommen, binnen kürzester Zeit fertiggestellt werden. In mehreren umfangreichen Hallen wird die Geschoßerzeugung in großem Stile betrieben; selbstverständlich fehlt es auch nicht an den erforderlichen Nebeneinrichtungen, Reparaturwerkstätten, Tischlereien, Wagenbauereien und Sattlereien. Das Arsenal übernimmt gegenwärtig auch schon Lieferungen für das Ausland; so wurden gerade jetzt einige Gebirgsgeschütze für die portugiesische Regierung hergestellt.”
Ebenso wie das Arsenal wird auch die kaiserliche Münze, eine der größten und vollkommensten der Erde, durchaus von Japanern geleitet. Mit erstaunlichem Nachahmungstalent haben die kleinen, freundlichen, zuvorkommenden Japaner auf ihren europäischen Studienreisen die Geheimnisse unserer Erzeugungsmethoden auf geraden oder krummen Wegen kennen und nachahmen gelernt, und nach Hause zurückgekehrt war es ihr erstes, dieselben Anlagen herzustellen und einzurichten, um sich von den europäischen Märkten zu befreien. Dasselbe gilt von den großen Baumwollspinnereien, in denen Hunderttausende von Spindeln schwirren und aus australischer, indischer, ja selbst ägyptischer Baumwolle Garne herstellen, die in ganz Ostasien, sogar in Indien, allmählich die europäischen Produkte verdrängen. Aehnliches gilt von Webereien, Bierbrauereien, Lederfabriken, Glasbrennereien. Auf meinen Spaziergängen durch Osaka stieß ich sogar auf Fabriken von europäischen Regenschirmen, für welche die Stahlrippen aus Deutschland kommen, von Seifen, Zahnbürsten, Schuhen, ja sogar von Taschenuhren. Allerdings arbeitet die Uhrenfabrik heute noch, nach mehrjährigem Bestande, mit Verlust, aber es wird nicht lange dauern, bis sie ebensolche Erfolge aufzuweisen haben wird wie die Fabriken schwedischer Streichhölzchen, die heute schon die ganze, früher sehr bedeutende Einfuhr dieser Artikel aus Europa in Ostasien verdrängt haben.
Die Regierung unterstützt diese Entwickelung der einheimischen Industrie mit allen Kräften und lehnt sich dabei vollständig an die den Europäern haarklein abgelauschten Methoden an. So fand ich mitten in der Stadt ein großartiges Handelsmuseum, wie es leider selbst in vielen europäischen Großstädten noch fehlt. Jede japanische Stadt hat ein derartiges, Hakurankwei genanntes Museum, aber von allen, die ich gesehen habe, ist jenes von Osaka das vollständigste. Gegen Erlag eines Eintrittsgeldes von wenigen Pfennigen trat ich in einen großen, mit Baumanlagen und Blumenbeeten geschmückten Ausstellungspark mit einer Anzahl von Gebäuden, ganz wie irgend eine europäische Industrieausstellung, nur daß jene von Osaka permanent ist. In den Gebäuden sind all die hunderterlei Industrien der Stadt systematisch geordnet; die Produkte sind mit vielem Geschick übersichtlich aufgestellt; jeder einzelne Artikel, selbst der kleinste, zeigt auf einem kleinen Zettelchen den Preis und kann[S. 600] gleich an Ort und Stelle erworben und mitgenommen werden. Am Abend ist der Park mit elektrischem Licht hell erleuchtet, eine Militärmusik konzertiert, und Tausende von Japanern besuchen diese Ausstellung, als ob Ausstellung, elektrisches Licht, Wiener Walzer und dergleichen hier etwas ganz Selbstverständliches, Altbekanntes und nicht durchaus fremde, erst vor wenigen Jahren hier aufgepfropfte Kulturblüten wären.
Ebenso wie der Industrie haben sich die Japaner auch der europäischen Militärkunst bemächtigt und sie in Osaka nach dem alten dräuenden Fort verlegt, das auf einer Anhöhe im Osten der Stadt, hoch über dem wasserreichen, reißenden Yodogawastrom, thront. Der große japanische Feldherr Hideyoschi ließ es im Jahre 1583 erbauen, und sein Palast im Innern dieser starken Feste war der großartigste und kostbarste, den Japan je besessen hat. Der erste Schogun aus der Familie Tokugawa, der berühmte Iyeyasu, nahm es 1615, und seither blieb es im Besitz der mächtigen Schogune bis zum Jahre 1858. Hier wurde der letzte Schogun mit dem Reste seines Heeres von den Truppen des Mikado bedrängt, und am 22. Februar des genannten Jahres fiel auch dieses japanische Gaeta. Der Schogun flüchtete sich auf ein amerikanisches Kriegsschiff, seine Anhänger steckten den kostbaren Palast, den größten Stolz der japanischen Kunst, in Brand, und die Flammen, die ihn verzehrten, wurden zum Grabe des altjapanischen Feudalsystems, gleichzeitig aber zur Wiege der neuen Kaiserherrschaft und der modernen Aera.
Heute enthält die Festung die Kasernen und Offiziersquartiere einer japanischen Division. Zwischen den Wachen durch die Eingangsthore schreitend betrachtete ich mit Staunen die gewaltigen Mauern, welche Hideyoschi vor dreihundert Jahren hier hat aufführen lassen. Steinblöcke von sechs bis sieben Metern Länge, in einem Gewichte von weit über hundert Tonnen, an Massenhaftigkeit mit den Steinkolossen von Baalbeck und Karnack wetteifernd, liegen hier zu ungeheuren Mauern aufgetürmt, und wie dort, so mußte ich mich auch hier wundern, wie es den alten Japanern mit ihren ursprünglichen Mitteln, ohne Kenntnis unserer Mechanik, möglich war, diese Blöcke hierherzubringen und aufeinanderzulegen. Dieselben sind übrigens auch bei den Japanern Gegenstände der Bewunderung, und jeder einzelne hat seinen eigenen Namen. An den Ecken erheben sich heute noch auf diesen Mauern die eigentümlichen altjapanischen Wachthäuser mit mehreren Dächern übereinander, sonst aber ist alles dem modernen Militärwesen entsprechend eingerichtet worden. Wo immer möglich, scheint es das Streben der japanischen Regierung zu sein, Altjapan zu zerstören und die Kultur gewaltsam der abendländischen anzupassen. Aber im Volke mit seinen Sitten, seiner Religion und seinen Trachten ist alles beim alten geblieben.
Als wir zwei, Herr Josef Schittenhelm aus Wien und ich, die Höhen des steilen Otometogepasses erklommen hatten, zeigte sich unser Reiseziel, der gewaltige Fujiyama (sprich Fudschiyama) in seiner ganzen Majestät. Scharf heben sich seine chokoladebraunen Flanken und seine schneebedeckte Spitze von dem klaren, blauen japanischen Himmel ab, ganz so wie er auf Millionen von Abbildungen zu sehen ist, aber wie er sich den Sommer über in Wirklichkeit nur selten zeigt. Gewöhnlich ist sein Haupt in dichte Wolken gehüllt, und viele Reisende haben während ihres wochenlangen Aufenthaltes im Mikadoreiche den heiligen Berg der Japaner überhaupt nicht zu Gesicht bekommen. Als kleiner Junge hatte ich den spitzen Vulkankegel auf einem japanischen Papierfächer abgebildet gesehen; später auf Porzellanvasen, auf Tellern, in drolligen japanischen Bilderbüchern, in Gold auf Bronze- und Silbergefäßen getrieben, kurz auf all den unzähligen Sächelchen, mit welchen die Japaner unseren Markt überschwemmen. Ist doch der Fudschi das Wahrzeichen der Japaner, eine Art Gottheit, die Verkörperung der Konohamasaku ya hime, d. h. der Prinzessin, welche die Knospen der Bäume zu Blüten entwickelt. Wo hätte ich jemals gedacht, daß ich diesen herrlichsten aller Berge in Wirklichkeit sehen würde! Und nun sollte ich morgen auf seiner Spitze stehen!
Eigentlich ein unsinniges Unternehmen, eine zwecklose, mühsame, aufreibende Spielerei. Die Besteigung des Fudschi gilt den Japanern als Sühne für ihre Sünden, viele Tausende von Pilgern strömen im Sommer aus allen Teilen des Reiches herbei, und es bestehen, besonders unter der Landbevölkerung, zahlreiche Pilgervereine, deren Mitglieder einen kleinen Jahresbeitrag leisten, um in jedem Jahre abwechselnd einer Anzahl von Pilgern die Wallfahrt zum Fudschisan zu ermöglichen. Aber unsere christliche Religion kennt keine Bergbesteigungen als Buße für unsere Sünden. Indessen, zehn Jahre vorher hatte ich auf der Spitze des Popocatepetl, des höchsten Berges von Nordamerika gestanden, und es reizte mich, nun auch auf dem höchsten Berge von Ostasien zu stehen.
Unsere Kulis trugen uns im raschen Lauf durch eine wahrhaft paradiesische Landschaft herab nach Gotemba, an den Fuß des Fudschi. Wir saßen in Tragstühlen, die ganz bequem sind, solange man sich in Ruhe befindet. Werden aber die langen Tragstangen aus elastischem Bambusrohr auf die Schultern der Kulis gehoben und schlagen dieselben eine raschere Gangart an, dann wird man in grausamer Weise durchgeschüttelt. Bei jedem Schritte wird man aus dem Stuhl emporgeschnellt und fällt so unsanft auf den harten Rohrsitz zurück, daß wir ganz zerschlagen in Gotemba, einem an der großen Tokaidobahn gelegenen Dörfchen, eintrafen. In einem Theehause, bedient von zierlichen Nesanmädchen, nahmen wir unseren Mittagsimbiß, ver[S. 602]abschiedeten unsere Kulis und machten uns nach kurzer Rast wieder auf den Weg nach Subashiri. Mein Reisegefährte wollte um keinen Preis mehr einen Tragstuhl besteigen. Den ungefähr sechs Kilometer auf harter Lava aufwärts führenden Weg zu Fuß zurückzulegen wollte uns in Anbetracht der uns bevorstehenden ermüdenden Bergbesteigung auch nicht zusagen, und so mieteten wir den einzigen Wagen, der in Gotemba zu haben war, ein elender Kasten, bespannt mit einem müden Klepper. Wir waren damit aus dem Regen in die Traufe gekommen, denn die Fahrstraße zwischen Gotemba und Subashiri erwies sich als eine der elendesten, die ich jemals befahren habe, voll tiefer Schlammlöcher, Steintrümmer und Lavablöcke, so daß wir während dieser denkwürdigen Fahrt noch schlimmer durchgeschüttelt wurden als vorher in den Tragstühlen. Subashiri ist eines der interessantesten Dörfchen von Japan. Die große Pilgerzeit hatte begonnen, und gewiß mochten an zweitausend Pilger in den zahlreichen Hotels und Theehäusern weilen, aus denen der Ort besteht. Während wir auf der Terrasse des Yone-yama-Theehauses ruhten, kamen und gingen ununterbrochen Pilgerzüge von sechs, acht, zwanzig, dreißig Personen, alt und jung, reich und arm, aber ausschließlich nur Männer, keine Frauen, denn das Betreten des heiligen Berges ist den Frauen verboten. Alle die Pilger, die an uns vorbeizogen, waren gleich gekleidet: weiße Jacken, weiße, enganliegende Beinkleider, weiße Socken, Strohsandalen an den Füßen, ungeheure Strohhüte auf den Köpfen; um die Schultern hatte jeder eine etwa quadratmetergroße Strohmatte geschlungen, die als Schutz gegen Regen, Sonne und Kälte, zur Nachtzeit auch noch als Lagerstätte dient. In seiner Rechten trug jeder Pilger einen langen Stab wie unsere Bergstöcke, in der Linken aber eine Glocke, mit welcher fortwährend gebimmelt wurde. Auf den Veranden, in den nach allen Seiten offenen Häusern waren Pilger, die einen ruhten, die anderen spielten oder rauchten oder machten in höchst rücksichtsloser Weise ihre Toilette. Auf dem mattenbedeckten Fußboden unseres Theehauses wurde eben von der Hotelgesellschaft die Abendmahlzeit eingenommen. Japanische Herren und Damen, darunter ganz junge Mädchen, hockten im Kreise auf ihren Waden und handhabten geschickt ihre Eßstäbchen, indem sie Reis in ihren Mund schaufelten und ab und zu aus einer in der Mitte stehenden großen Schüssel ein Stückchen Fisch oder Wurzel abgabelten.
Der schlaue Hotelwirt wollte wahrscheinlich von uns das Geld für ein Nachtquartier verdienen, denn er riet uns sehr ab, noch heute abend den Aufstieg auf den Fudschi zu wagen. Das Wetter würde schlecht werden, es wären auch keine Pferde mehr da, um uns durch die Lava- und Schuttfelder nach Umagaishi, der letzten für Reiter zugänglichen Station des heiligen Berges zu bringen und dergleichen mehr. Als wir aber dennoch darauf bestanden und es mir gelungen war, ein paar Reitpferde aufzutreiben, hetzte er uns die Polizei auf den Hals. Mit wichtiger Miene wurden uns die Pässe abverlangt, da sie aber von der Regierung[S. 603] in Tokio ausgestellt und vollständig in Ordnung waren, belästigten uns die uniformierten Gesetzeshüter nicht weiter, vertrieben sogar noch die zahllosen Kinder, die uns in einem großen Kreise stehend begafften.
Gegen sieben Uhr abends saßen wir auf unseren schlecht gesattelten Kleppern und galoppierten durch die malerische Hauptstraße des Dorfes der gewaltigen, dunkeln Masse des Vulkans zu, der sich gerade vor uns in unsagbarer Majestät erhob. Das ganze Dorf zeigte das lebhafteste Jahrmarktsleben; in langen Reihen waren vor den Häusern Verkaufsstände von Süßigkeiten, Erfrischungen, kleinen Andenken an den Fudschi und dergleichen aufgeschlagen, von jedem einzelnen Hause wehten bunte Flaggen und Handtücher, welche die Pilger mitführen und an verschiedenen Orten zur Erinnerung an ihre Wallfahrt abstempeln lassen. In der Mitte der breiten Hauptstraße floß rauschend ein wasserreicher Bach dem Sakagagawa zu, und an seinen Ufern waren unzählige winzige Wasserräder und mechanische Spielzeuge aufgestellt, teils zum Ergötzen der Kinder, teils um die kleinen Apparate anzutreiben, die zur Verscheuchung der Fliegen über den Verkaufsständen von Obst und Süßigkeiten angebracht waren.
Blutrot war die Sonne untergegangen, und das bleiche Mondlicht leuchtete uns nun auf dem Wege, der durch öde Schutthaufen und dunkelbraune Lavafelder emporführt. Nach etwa zweistündigem Ritt betraten wir einen finsteren, hochstämmigen Wald und mußten unsere Pferde stramm am Zügel halten und uns von den Kulis den Weg mit Fackeln erleuchten lassen, um nicht durch die aus dem Boden ragenden Baumstümpfe und Wurzeln selbst zum Fall zu kommen. Mein Reisegefährte ärgerte sich weidlich über mein verrücktes Beginnen, den Fudschi, statt wie die anderen Menschen am helllichten Tage, zur Nachtzeit zu besteigen, wo man sich in der Finsternis Hals und Beine brechen kann. Aber ich wußte, wir würden bald wieder aus dem dunkeln Walde in den hellen Mondschein kommen, und dann war die Kraxelei doch entschieden angenehmer als bei der im Sommer furchtbar drückenden Sonnenhitze. Ich beabsichtigte so hoch als möglich emporzuklettern, den Rest der Nacht in einer der Schutzhütten zuzubringen und am nächsten Morgen die Besteigung zu vollenden. Bei dem ewig wechselnden Wetter konnte man ja nicht wissen, ob der ganze Berg nicht schon in einigen Stunden in dichten Nebel gehüllt sein würde, und dann wäre unsere ganze Reise vergeblich gewesen.
Mitten im finsteren Walde erblickten wir bald Lichter und hörten das Geklingel von Pilgerglocken. Wir hatten Umagaishi erreicht, ein ärmliches Theehaus mit anstoßendem Flugdach, unter dem auf langen Holzpritschen wohl ein halbes Hundert Pilger, die eben vom Fudschi herabgekommen waren, ausruhten. Die zahlreichen, weißgekleideten Gestalten, die hier in allen möglichen Stellungen umherlagen, nahmen sich in dieser Waldeinsamkeit beim flackernden Scheine brennender Kieferspäne gespenster[S. 604]haft genug aus. Sie beachteten uns kaum, als wir angeritten kamen und nach einem Schluck Thee den Weg wieder fortsetzten.
Dagegen protestierten aber unsere Kulis. „Umagaishi” heißt wörtlich „Pferd zurücksenden”, d. h. es war der Ort, wo die Pilger gewöhnlich vom Pferde steigen, um die Bergtour zu Fuß fortzusetzen. Ich hatte aber gehört, daß der Weg noch zwei Kilometer weiter für Pferde gut passierbar wäre, und um unsere Kräfte zu schonen, nahm ich meinem Kuli die Fackel aus der Hand und drückte mein Pferd vorwärts. Mein Begleiter folgte, und obschon wir manche halsbrecherischen Stellen zu passieren hatten, kamen wir doch, vielleicht als die ersten, die es je unternommen, zu Pferd in der Station Tschudschikiba an. Hier ließen wir die Pferde mit der Weisung zurück, am nächsten Abend nach Sonnenuntergang wieder zur Stelle zu sein. Nachdem wir das Gitter eines Tempelhofes passiert hatten, erwarben wir hier von einem alten Priester Alpenstöcke, und unsere Kulis legten einen ganzen Vorrat von Strohsandalen an, es dürften wohl zwanzig Paare gewesen sein. Ich glaubte, sie kauften dieselben auf die Bestellung irgend eines Wächters der Schutzhütten weiter oben, und ließ sie gewähren.
Anfänglich ging es ganz bequem vorwärts; der Wald wechselte mit Moorland und Grasflächen ab, und erst als wir auf etwa zweitausend Meter Höhe angekommen waren, wurde der Baumwuchs dünner, die Fichten wurden kleiner, verkrüppelter, und schließlich sahen wir nur noch stellenweise knorrige Zwerglärchen und stacheliges Gestrüpp, an dem wir unsere Kleider zerrissen. Der Mond leuchtete uns aber getreulich aufwärts. Trotz der vielen Tausende von Pilgern, die seit Jahrhunderten alljährlich die Bußpromenade auf den Fudschi unternehmen, hört der Weg oberhalb des zweiten Tausend Meter gänzlich auf, und wir kletterten teils auf harten Lava- und Basaltfelsen aufwärts, teils wateten wir durch vulkanische Asche und Sand, die bei jedem Schritte nachgaben. Wie die Japaner glauben, wird der von den Pilgern auf diese Art thalabwärts geschobene Sand zur Nachtzeit von überirdischen Mächten wieder auf den Berg hinaufgetragen. Wir bekamen aber nichts davon zu sehen.
Zur Erleichterung des Aufstiegs sind auf verschiedenen Seiten des ungeheuren Berges Reihen von Schutzhütten angelegt worden. Auf der Seite von Subashiri befinden sich deren zehn, in Entfernungen von etwa je einem Kilometer und Höhenunterschieden von je dreihundert Meter. Bald nachdem wir auf unserem schweigsamen nächtlichen Marsche die erste Hütte passiert hatten, wurde es empfindlich kälter, Wolken zogen gespensterhaft die Bergflanken über uns entlang und verhüllten den Mond, der Wind wurde heftiger und artete schließlich in einen so furchtbaren Orkan aus, daß wir mit Mühe und Not die zweite Schutzhütte erreichten. Wir wären ohne unsere Kulis wohl an ihr vorbeigeschritten, denn sie besteht nur aus einem in die Lavamassen gegrabenen kleinen Absatz, der durch niedrige Mauern,[S. 605] aus Lavablöcken aufgeführt, geschützt ist. Rohe Baumstämme, mit Felstrümmern beschwert, bildeten das Dach, und die einzige, gleichzeitig als Thür und Fenster dienende Oeffnung war durch Balken und Pfosten verrammelt. Auf unser Klopfen wurde geöffnet, und wir befanden uns in einem niedrigen, mit Dielen belegten Raum, in dessen Mitte auf dem nackten Felsboden ein Holzfeuer eben verglühte. Bei dem Schein einer rauchenden Petroleumlampe sahen wir, daß über dem Herde ein großer Kessel hing; Dutzende von Pilgern lagen auf ihren Strohmatten schlafend umher, während andere bei der heißen Asche des Herdes kauerten, um sich zu wärmen. Als wir eintraten, erhob sich der Wirt dieses „Hotels zu den vier Winden”, um uns stillschweigend in einem Winkel ein Nachtlager zu bereiten, denn bei dem furchtbaren Sturm, der selbst durch die Ritzen und Löcher unseres Schutzhauses pfiff, war ein Weiterklettern lebensgefährlich.
Er holte einige dünne, gefütterte Wolldecken hervor, breitete sie auf dem Boden aus und reichte uns noch vor dem Schlafengehen einen Kessel mit heißem Thee. Wir wickelten uns in unsere Mäntel, und todmüde, wie wir waren, hätten wir sofort in tiefen Schlaf versinken sollen, wenn — ja wenn!
Japan ist das Paradies der Flöhe, und selbst in vornehmen Hotels, wie in jenen am Miyanoshita, quälen sie den müden Wanderer in grausamer Weise. In den japanischen Hotels und Theehäusern aber sind sie eine entsetzliche Plage. Deshalb wollte ich auch das Nachtlager in Subashiri vermeiden, fiel aber desto trauriger hier herein. Kein Klima scheint ihnen zu kalt, kein Berg zu hoch, keine Entfernung zu groß, keine Person zu heilig. Mit wahrhaft republikanischer Gleichheit und Brüderlichkeit machen sie sich an alles, was lebt und eine Haut zu durchbeißen, rotes Blut zum Anzapfen hat. Ob diese verteufelten Miniaturgemsen durch Extrakuriere von unserem Kommen unterrichtet wurden, ob sie unsere Ankunft gerochen hatten, ich weiß es nicht; fünf Minuten, nachdem wir unsere müden Glieder ausgestreckt hatten, ging der Teufel los: ein Beißen und Jucken und Krabbeln, daß es nicht mehr auszuhalten war. Auf diese Legion von Quälgeistern Jagd zu machen, wäre wohl vergebliche Mühe gewesen; wenn sie nur immer ruhig sitzen geblieben wären! Aber nachdem wir zwanzig Stunden lang in der Eisenbahn und in Karren gefahren, geritten und gegangen und in Tragstühlen und Rickshaws durchgerüttelt worden waren, außerdem von der scheußlichen Kälte durchfrorene Finger hatten, war unsere Treffsicherheit auch dahin. Indessen, wir wollten unser Blut so teuer wie möglich verkaufen. Daß der ungleiche Kampf gegen diese blutdürstige Brut uns bevorstand, wußte ich und hatte mich mit Penny Royal-Oel versehen. Das bißchen Einreiben des Körpers, das wir vorher schon unternommen hatten, war nutzlos gewesen; so wurden denn die ganzen Flaschen in die Unterwäsche ausgegossen. Nun gab es eine Stunde Ruhe, und müde, wie wir waren, schliefen wir doch ein. Als wir aber um vier Uhr aufwachten, um unseren[S. 606] Weg fortzusetzen, waren unsere Körper doch mit roten Punkten wie besäet. Die Biester hatten während unserer Nachtruhe diese Tättowierung vorgenommen.
Es regnete und stürmte draußen noch immer so fürchterlich, daß wir beschlossen, noch zwei Stunden länger im Schutze dieses Flohstalles zu bleiben. Aber um sechs Uhr war das Wetter gerade so, auch um acht Uhr, zehn Uhr. Es wurde Mittag, und schon fürchteten wir, es würde uns ebenso ergehen wie vielen anderen, die zwei bis drei Tage bei schlechtem Thee und gekochtem Reis da oben in der Lavawüste zubringen mußten, da hellte sich das Wetter auf. Der Wind blies noch so kräftig, daß wir uns draußen kaum aufrecht halten konnten und mein Gefährte schon die Absicht aussprach, unverrichteter Dinge kehrt zu machen. Aber nein. Wir waren so weit gekommen, nun mußten wir hinauf. Also vorwärts! Es ging langsam, beschwerlich, aber es ging. Wir erreichten die dritte, vierte, fünfte Schutzhütte, dann die sechste, siebente und achte. Mein Reisegefährte war aber am Ende seiner Kräfte. Ich trat ihm meine Kulis ab, sie schlangen einen Gurt um seinen Leib und zogen, drei andere schoben von rückwärts, und so kam er mir allmählich nach, nicht ohne sich in jeder der Schutzhütten durch den mitgebrachten Cognac zu erfrischen.
In diesen Höhlen fanden wir überall müde Pilger, viele Flöhe, teure Rechnungen, aber nur wenig Trank und Speise, höchstens Reis, getrocknete Fische und Maccaroni, die in langen Schnüren an den Wänden mitten zwischen den blauen und roten Handtüchern hingen, die fromme Pilger zur Erinnerung zurückgelassen hatten. Jedes Tuch trug den Namen eines Pilgers. Die Wände, Stützbalken, selbst die Decken waren mit diesen seltsamen Visitenkarten austapeziert, viele hatten nur Papierstreifen mit ihren Namen zurückgelassen, und unter den letzteren las ich auch manchen englischen und amerikanischen Namen.
Je höher wir emporkamen, desto häufiger und größer wurden die Schneefelder in den Furchen, die in den obersten Kegel des Berges eingerissen sind, und dieser Schnee verschwindet das ganze Jahr über nicht. Zwischen den Furchen ziehen sich steile Grate aus harter, nackter Lava herab, und einen solchen benutzten wir zu unserem Aufstieg. Der scharfe Wechsel der Temperaturen hat diese Lavamassen vielfach gespalten, und dadurch fanden unsere Füße beim Aufwärtsklettern einigen Halt.
Bei der sechsten Schutzhütte schon hatten wir die kalte, dichte Wolkenschicht durchschritten, die den Berg wie mit Baumwolle umwickelt hielt, und der mächtige Gipfel lag klar vor uns, so nahe, daß wir hofften, ihn binnen einer halben Stunde zu erreichen. Aber wir waren nun schon drei Stunden geklettert, und je höher wir stiegen, desto höher schien auch der Berg zu werden. Zu unserer Linken, also mehr gegen die Südseite des Berges, befand sich zwischen zwei Lavagraten eine ungeheure Halde von Schutt und loser Asche, wie ich sie in solcher Ausdehnung nirgends[S. 607] gesehen habe. Vom Gipfel des Berges zieht sie sich viele Kilometer weit abwärts bis zu dem Waldkranz, der den Fudschi dort auf etwa anderthalbtausend Meter Höhe besäumt, und über diese Halde sahen wir Dutzende von Pilgern, auf ihre Bergstöcke gestützt, den Abstieg unternehmen, in raschem Laufe, bei jedem Schritt um vielleicht ebensoviel durch den hohen Schutt abwärts sinkend.
Endlich, gegen fünf Uhr abends, standen wir am Fuße einer ungeheuren Treppe, deren Stufen in die ungemein steile, glatte Lavawand gehauen sind, um den Aufstieg zum Gipfel überhaupt möglich zu machen. Mühsam, als wären unsere Beine von Blei, zogen wir dieselben von Stufe zu Stufe aufwärts, und recht erschöpft betraten wir gegen sechs Uhr abends den Rand des Kraters.
Auf dem schmalen Plateau zwischen dem äußeren Bergumfange und dem Krater selbst, der etwa einen größten Durchmesser von einem Kilometer haben mag, stehen einige aus Lavablöcken erbaute Häuschen, bewohnt von Priestern und Schenkwirten, die allerhand Erfrischungen und Erinnerungen an den heiligen Berg feilbieten. Eines der Häuschen ist zu einem kleinen Tempel eingerichtet, und an seinem Eingang setzten wir uns nieder, um ein halbes Stündchen zu ruhen und den Rest unserer Flasche Kokawein zu trinken. In den Cordilleren Südamerikas hatte ich zuerst die erfrischende Wirkung der Kokablätter kennen gelernt, und seither begleitet mich der Kokawein bei allen Bergbesteigungen.
Meinen Begleiter konnte ich zu einer Promenade um den Krater herum oder gar auf die etwa hundert Meter tiefe Sohle desselben nicht bewegen. Wollten wir die Nacht nicht oben zubringen, so mußten wir den Rückmarsch sofort wieder antreten. Ich eilte deshalb allein auf der schmäler werdenden Kante aufwärts zu dem kleinen Pavillon, der an der höchsten Spitze des Kraterrandes steht, und blickte von dort in den dampfenden, nebelerfüllten Kessel, dessen Wände aus zerklüfteten, phantastisch aufeinandergetürmten Lavablöcken bestehen. Aus manchen Ritzen und Oeffnungen schießt pfeifend heißer Dampf hervor, ein Zeichen, daß der höchste Vulkan Ostasiens nur schlummert. Wie, wenn er gerade jetzt aus seinem zweihundertjährigen Schlafe erwachen würde? Der Anblick wäre gewiß großartig, aber ich hätte mich dafür doch sehr bedankt. Der Gedanke an diese Möglichkeit machte mich grausen.
Mein Führer hielt mich davon ab, in den Krater hinabzusteigen, denn es wäre die höchste Zeit, den Rückmarsch anzutreten. Von den Priestern des Tempelchens ließen wir uns noch den Stempel des Fudschigipfels auf unsere Bergstöcke einbrennen, warfen noch einen Blick um uns und den Berg hinab zu der Wolkenschicht, die uns die Aussicht auf das Land und Meer zu unseren Füßen entzog, und machten uns wieder auf den Weg. Als wir den Fuß der steilen Felsentreppe erreicht hatten, bestanden die Führer darauf, uns Strohsandalen über die Schuhe zu binden und mir noch drei andere Paare mitzugeben, da ich gewöhnlich unserer Karawane voraneilte. Statt dann den glatten Lavagrat abwärts zu gleiten, auf[S. 608] dem wir emporgestiegen waren, schwenkten wir rechts ab auf die unabsehbare Schutthalde, unsere Füße versanken bis über die Knöchel in den losen, scharfen Sand, den der Krater in früheren Zeiten in so unglaublichen Mengen ausgeworfen hatte, und unsere Schuhe wären gewiß schon in der ersten halben Stunde zerschnitten gewesen, würden wir sie nicht durch die Strohsandalen geschützt haben. Das also war der Grund, warum die Führer sich gleich mit zwei Dutzend Exemplaren davon versehen hatten. Während des Abstiegs mußten wir sie wiederholt wechseln, denn nach je einer halben Stunde hingen sie wie Fetzen um unsere Füße. Die ganze Halde war besäet mit diesen Sandalenresten, und man hätte aus ihnen allein einen kleinen Fudschiyama aufbauen können. Man denke nur: in jedem Jahre wird der heilige Berg von vielleicht dreißigtausend Pilgern bestiegen, die mindestens an hundertfünfzigtausend Sandalenpaare verbrauchen, und das geht nun schon seit Jahrhunderten vor sich!
Wir flogen nur so die Halde hinab. Zehn Stunden hatten wir gebraucht, um auf den Gipfel zu kommen, und in weniger als drei Stunden waren wir, halb springend, halb in dem losen Sand abwärts gleitend, wieder unten am Waldessaume. Mittlerweile war es stockfinster geworden, und beim Scheine von Fackeln mußten wir uns den Weg durch den Wald abwärts bahnen nach unserem Ausgangspunkte Umagaishi, das wir etwa um zehn Uhr nachts erreichten. Die Pferde standen bereit, aber wir blieben doch ein Stündchen zwischen todmüden japanischen Pilgern auf den Bänken ausgestreckt, um ein wenig neue Kräfte zu sammeln. Waren wir doch seit vierzig Stunden unterwegs! Wir wären gerne die ganze Nacht hier geblieben, aber die Furcht vor der entsetzlichen Flohplage trieb uns bald weiter. Lieber die Nacht zu Pferde zubringen, als sich noch einmal diesen blutdürstigen kleinen Raubtieren aussetzen. Mein Begleiter wurde halbtot in den Sattel gehoben, als er aber zu Pferde saß, kam er wieder zu sich, und wir trabten lustig Subashiri zu. Dort wagte ich nicht, abzusteigen und Rast zu halten, denn mein armer Reisegefährte wäre diesmal kaum wieder in den Sattel gekommen. So ritten wir denn durch die stillen, toten Straßen des Dorfes und kamen glücklich um vier Uhr morgens in Gotemba wieder an, rechtzeitig, um den Frühzug nach Kozu zu besteigen. Von dort waren wir um neun Uhr morgens wieder in dem entzückenden Badeorte Miyanoshita bei unseren Lieben. Sie waren hocherfreut, uns wiederzusehen, denn während wir auf dem Fudschiyama waren, hatte unten ein furchtbarer Taifun gewütet, der eine Menge Schiffe vernichtet, eine Anzahl Dörfer arg mitgenommen und auch sonst im Lande großen Schaden angerichtet hatte. Diesem Taifun waren wir oben auf der Spitze des höchsten Berges Ostasiens wohl entgangen, aber doch würde ich lieber einen Taifun durchmachen, als nochmals den Fudschiyama besteigen.
Kein Land des Erdballes ist so vulkanisch wie das aus dreitausendachthundertundfünfzig Inseln und Inselchen bestehende japanische Kaiserreich. Eine ganze Reihe von Vulkanen sind dort noch heute thätig, und alle paar Jahre dringen Berichte von den schrecklichen Verheerungen zu uns, welche die Ausbrüche dieser Vulkane oder die Erdbeben dort anzurichten pflegen. Aber, bringen die Vulkane Zerstörung mit sich, so gewähren die Mineralquellen, die brühend heiß ihren Hexenkesseln entspringen, dafür wieder Heilung für viele körperliche Leiden. Japan ist ungemein reich an derartigen Quellen, die Eisen, Schwefel, Arsenik, Salz und Soda enthalten, und rings um diese Quellen sind zahlreiche Badeorte entstanden, die seit vielen Jahrhunderten von den Japanern aufgesucht werden: Unzen in der Nähe von Nagasaki, Kusatsu und Yumoto bei der altberühmten japanischen Tempelstadt Nikko, Miyanoshita, das fashionabelste und den Europäern bekannteste Bad in dem Distrikt des heiligen Berges Fudschiyama, und endlich Ikao mitten in den Gebirgen der Insel Nipon.
Ikao liegt nicht auf der großen Heerstraße der Globetrotter und ist noch nicht so besucht und verdorben von vergnügungssüchtigen Engländern und Amerikanern; noch keine Fahrstraße oder Eisenbahn führt hinauf zu den segenspendenden, heißen Quellen, und wer einen unverfälschten, stark besuchten, dabei interessanten und an Vergnügungen reichen Badeort der Japaner kennen lernen will, der reise nach Ikao, dem Karlsbad von Japan.
Nach meinen Erlebnissen in dem Lande der Morgenruhe, Korea, aus dem ich eben kam, durfte ich mir eine kleine Erholungsreise wohl gestatten. Schon die Fahrt nach der Ikao nächstgelegenen Eisenbahnstation, der Stadt Takasaki, gehört zu den schönsten, die man unternehmen kann. Das nördlich der Reichshauptstadt gelegene Land, das man im bequemen Eisenbahnwaggon während dreier Stunden durcheilt, gleicht einem herrlichen Garten. Jede Erdscholle ist von den fleißigen Japanern der Kultur unterworfen worden; die kleinen Felder und Obstgärten, die schattigen Haine, hohen Bambushecken, die Wege und Stege sind mit solcher Sorgfalt gepflegt, als ob ihre Besitzer lauter reiche Herren wären, die sich dem Ackerbau und der Gärtnerei nur aus nobler Passion hingeben. Dabei paßt in dieser geradezu idealen Landschaft alles zusammen, wie wenn ein geschickter Landschaftsgärtner, irgend ein[S. 610] japanischer Pückler-Muskau, die Hügel hätte künstlich aufführen und mit mächtigen Bäumen bepflanzen lassen; als ob er auf die verschiedenen Nuancen des Grün Rücksicht genommen und hier die hellen Bambusstauden, dort die dunkleren Kampferbäume, noch weiter die hohen dunklen Kryptomerien und kurios geformten Fichten nur wegen der Farbenzusammenstellung und des malerischen landschaftlichen Aufbaues, nicht aus Nützlichkeitsgründen gepflanzt hätte. Die höchsten Bäume sieht man auf den kleinen Hügeln, die sich hier und dort aus der weiten, mit rauschenden Bächen und Flüssen reich bewässerten Ebene erheben, und aus ihrem dunklen Grün leuchtet irgend ein Tempelchen oder eine Pagode hervor, zu denen lange Avenuen emporführen, gebildet von lauter Torii. Zwei, drei Dutzend dieser eigentümlich geschwungenen, hellrot angestrichenen Thorbogen stehen hier bei manchem Tempelchen hintereinander. Dieser weiten, schönen Landschaft dienen bewaldete Bergketten als Hintergrund, drei, vier, fünf hinter- und übereinander, wie Theaterkulissen, hier und da noch überhöht von steilen Vulkankegeln, die zwei- bis dreitausend Meter hoch in den blauen japanischen Himmel ragen.
Takasaki, ein liebliches, belebtes Städtchen, harmoniert heute vortrefflich mit seiner Umgebung und bildete bei der Annäherung meines Zuges den farbenreichen Mittelpunkt dieser olympischen Landschaft. Es war gerade Festtag, und Straßen auf, Straßen ab sah ich nichts als Triumphbögen aus Reisig und Blumen gebaut, Blumenguirlanden von Haus zu Haus, dazu unzählige, vielfarbige Lampions, und auf den Dächern wehte ein Wald von rot-weißen japanischen Flaggen. Jeder Lastwagen, jede Rickshaw, sogar die Waggons der Pferdebahn, die Takasaki durchzieht, waren mit Lampions behangen. In den Straßen aber wogte das buntgeputzte Volk wie Schmetterlinge in einem ungeheuren Blumenbeet. So fröhlich und zerstreut sie auch waren, die Anwesenheit eines Europäers mitten unter ihnen fesselte doch ihre Aufmerksamkeit, und bald war ich von neugierigen Knaben und Mädchen umringt. Sie sahen mich verwundert, aber dabei ganz zutraulich an, betupften meine Kleider und Handschuhe und brachen in schallendes Gelächter aus, als ich in japanischer Sprache versuchte, meine Weiterfahrt auf der Pferdebahn zu arrangieren. Eine solche führt nämlich von Takasaki noch nun etwa fünfundzwanzig Kilometer weiter in die Berge hinein, bis nach Shibukawa, ganz so eingerichtet wie unsere europäischen Pferdebahnen. Dieselben Wagen, dieselben europäisch uniformierten Kutscher und Schaffner; nur gehen sie mit ihren Pferden menschlicher um als ihre abendländischen Kollegen, lassen keine Ueberfüllung der Wagen zu und jede halbe Stunde wird angehalten, um den Pferden mit kaltem Wasser Maul und Bauch zu begießen.
Ich weiß nicht, ob während der Fahrt die Verwunderung der Japaner über mich oder meine Verwunderung über die Japaner größer war. Die Pferdchen krochen mit einer Langsamkeit einher, die uns gegenseitig hinreichend Muße zu Beobachtungen gab. Die meinigen waren gewiß interessanter. Es war Abend, und[S. 611] die große Sommerhitze ließ die keineswegs schüchternen japanischen Männlein und Weiblein in ihren nach allen Seiten offenen Häuschen in buchstäblich adamitischem Kostüm verweilen. In manchen Höfen nahmen die Familien gerade in engen Holzbottichen ihre Bäder oder promenierten nach dem Bade ohne irgendwelche Bekleidung auf und nieder, um sich an der Luft abzutrocknen. Je weiter auf unserer Fahrt der Abend fortschritt, um so deutlicher konnte ich die einzelnen häuslichen Verrichtungen in den Häusern, an denen wir vorbeifuhren, wahrnehmen. Auf die badenden Familien folgten solche, die gerade ihr Abendbrot, den unfehlbaren Reis, mit hölzernen Stäbchen in den Mund schaufelten, dann andere, die auf dem erhöhten Fußboden ihrer Häuser Strohmatten oder dünne Matratzen für ihr Nachtlager zurechtmachten, und schließlich schlafende Familien, Männer, Weiber, Kinder, alle beisammen, splitternackt, nur durch ein weites, an der Decke hängendes Mückennetz von der bösen Außenwelt geschieden.
Gegen zehn Uhr abends kam der Pferdebahnwagen, den ich für mich und meine europäischen Begleiter gemietet hatte, in Shibukawa, einem kleinen ärmlichen Dorfe, an. Große Aufregung unter den Einwohnern. Sie sprangen in ihrer mehr als leichten Nachttoilette von ihren Lagern, um zu sehen, was es gäbe, denn der Besitzer des der Station gegenüberliegenden Theehauses wollte durchaus, wir sollten bei ihm übernachten. Der Weg nach Ikao wäre zu schlecht für eine Weiterfahrt in der Dunkelheit, und er besäße vortreffliche Nachtlager und dazu hübsche junge Nesan, um uns den Schlaf zu versüßen. Aber ich bestand darauf, weiter zu fahren, es schien ja der Mond, und die Nesanmädchen übten keine Anziehungskraft auf uns aus. Nach langem Hin- und Herreden war der ziemlich hohe Preis für die Rickshaws vereinbart. Wir setzten uns in die kleinen leichten Wägelchen, vor jedes traten vier japanische Kulis mit muskulösen Beinen, und fort ging’s in die Berge hinauf nach Ikao. Ein paar Papierlaternen, von den Kulis getragen, erleuchteten spärlich den wirklich erbärmlichen, holperigen Weg.
Nach zweistündiger Fahrt krochen unsere Kulis unter Aechzen und Stöhnen den letzten Abhang empor nach unserem Ziele, von dem ich vorläufig nichts gewahrte als eine Menge von mattscheinenden Lampions gerade vor uns, mitten auf dem Wege. Als wir dieselben erreicht hatten, sah ich, daß sie von etwa zwei Dutzend Menschen getragen wurden, die sich vor uns ehrfurchtsvollst, wie es wohlerzogenen Japanern geziemt, auf alle Vier warfen: der Hotelbesitzer, die Kulis, die kleinen lieblichen Stubenmädchen, mit einem Worte, das ganze Personal des Murumatsuhotels. In diesem hatten wir Zimmer bestellt, da es in dem vortrefflichen Murrayschen Handbuch für Japanreisende (einen Baedeker giebt es wunderbarerweise noch nicht) als „europäisches Hotel” bezeichnet steht.
Dieses europäische Hotel befand sich ganz in der Nähe, das erste Haus des berühmten Badeortes. In der Dunkelheit konnten wir nur sehen, daß es ein Stock[S. 612]werk hoch war und im Erdgeschoß etwas wie einen Speisesaal und ein Billardzimmer besaß. Als wir aber von den hübschen Nesan die steile Treppe in das obere Geschoß emporgeführt wurden, entpuppte sich das europäische Hotel als ein echt japanisches, denn an Stelle von Schlafzimmern bestand das Geschoß aus einem großen, mit feinen Matten bedeckten Raume, der durch verschiebbare Papierwände in kleine Schlafabteilungen eingeteilt war. Zwei von diesen, mit dünnem, durchsichtigem Papier überzogenen Holzrahmen wurden auseinandergeschoben, und ich befand mich in meinem Schlafzimmer. Europäisch war nur die Bettstelle, der Waschtisch und ein Stuhl, die einzigen Einrichtungsstücke, die sich innerhalb der vier Papierwände befanden. Die kleine Nesan, ein allerliebstes Mädchen, machte sich um meine Person zu schaffen und schien nur unwillig den Versuch, mich in mehr oder minder angenehmer Weise in den Schlummer zu wiegen, aufzugeben. Ich schob meine Wände hinter ihr zusammen und war allein. Auf einer Seite trennte mich ein derartiger weißer Papierbogen von einer Schläferin, wie ich aus dem leichten Atemholen vermutete, auf der anderen ein zweiter Papierbogen unzweifelhaft von einem Manne. Sein sägeartiges Schnarchen verriet es. Das in Europa allerprobte Mittel, die Stiefel an die Wand zu werfen, ging nicht gut an, denn sie wären möglicherweise durch das Papier dem Schnarcher an den Kopf geflogen. Ich versuchte es also mit dem jedenfalls zarteren Mittel, dem Pfeifen, und das hatte den gewünschten Erfolg. Aber noch eine Stunde lang war es unmöglich, zur Ruhe zu kommen, denn die kleinsten Toilettengeräusche meiner Reisegefährten waren selbst aus den entfernteren Schlafabteilungen vernehmbar. Am nächsten Morgen wurde ich durch die kleinen Stubenmädchen geweckt, die einfach die Papierwände auseinanderschoben und sich in meinem Zimmer unter fortwährendem Lächeln und steten Verbeugungen allerhand zu thun machten, mich sogar hinabbegleiteten in den Badepavillon, der ziemlich offen dicht an der Straße lag. Schlösser, Riegel, Vorhänge, Badeanzüge und Schwimmhosen sind in den japanischen Badelokalen unbekannt, und wer baden will, muß eben fremde Gesellschaft mit in den Kauf nehmen.
Im Speisesaal gab es wenigstens Teller und Gläser, Messer und Gabeln, Tische für die Speisen, Stühle zum Sitzen und deshalb wohl der Name „europäisches Hotel”. Sogar ein Fremdenbuch war vorhanden, dem ich entnahm, daß das Hotel in den letzten drei Jahren auch von drei Deutschen besucht worden war.
Die Aussicht von der Veranda unserer etwa neunhundert Meter über dem Meere auf einem Bergvorsprung gelegenen Wohnung war entzückend; wahre Schweizerlandschaften entrollten sich vor meinen Augen, und nur die Schneeberge fehlten, um die Erinnerung an die Alpenländer vollständig zu machen. Zur Linken zieht eine dicht bewaldete Schlucht die Berge hinab bis in die Ebene, und auf dem jenseitigen Plateau gewahrte ich ein prachtvolles japanisches Schloß, ähnlich den[S. 613] Schlössern des Kaiserhauses oder der Schogune in Nikko oder Kioto, umgeben von wunderbaren Gartenanlagen. Das moderne Japan hat eben in den letzten zwei Jahrzehnten Leute mit noch größeren Mitteln geschaffen, und das Feenschloß von Ikao gehört dem Präsidenten der größten japanischen Dampfergesellschaft, der Nipon Yusen Keisha. Ikao selbst zieht sich von dem Murumatsuhotel, dem sich noch einige Dutzende japanischer Hotels auf dem Plateau anschließen, an der diesseitigen Schluchtwand steil den Berg hinab, und die Hauptstraße des Ortes besteht dementsprechend aus einer breiten, steilen, etwa einen Kilometer langen Treppe, zu deren Seiten sich die mehrstöckigen Holzhäuser erheben. Jedes Haus ein Hotel, jedes Hotel mit einem Bad oder Theehaus. Um das zu sehen, brauchte ich meine Veranda gar nicht zu verlassen, denn um mich herum in allen Gebäuden, allen Stockwerken waren die Papierwände, Thüren, Veranden weit geöffnet, so daß ich mitten durch bis in die jenseitigen Gebäude blicken konnte. Die Insassen betrachteten wohl mit neugierigen Augen den fremden Europäer, ließen sich aber nicht im mindesten in ihren Verrichtungen stören. Angekleidet oder ausgekleidet, beim Samisenspielen, Essen, Trinken, Arbeiten, Lesen, bei der Haartoilette oder bei noch viel intimeren Angelegenheiten zeigten sie auch nicht eine Spur von Scheu, als ob ich etwa ein Schoßhündchen oder ein Kanarienvogel gewesen wäre. Ich hätte gern irgend eine zimperliche alte Jungfer aus Deutschland unversehens im Fluge hierher zaubern mögen, um in einem dieser japanischen Hotels zu wohnen und mit den Japanern eine Badekur durchzumachen. Sie wäre wohl aus ihrer ersten Ohnmacht kaum wieder erwacht. Das wäre indessen auch unseren Badekommissären und der löblichen Sittenpolizei passiert, wenn sie mich auf meinem ersten Spaziergang durch Ikao hinab und wieder hinauf begleitet hätten. Die uralten, mehrstöckigen Häuser mit ihren vielen Veranden, Erkern, Treppen, Vorsprüngen, ihren hübschen Blumen, Lampions und Fähnchen an den Fronten und den bunten Bazars mit allerlei nichtigen Kleinigkeiten unten an der Straße nehmen sich ungemein malerisch aus, erinnern sogar entfernt an die vom Wetter schwarzbraun gefärbten Schweizer Chalets im Berner Oberland. Aber welch seltsames Leben und Treiben auf der Straße und in den Gärtchen und Bädern hinter ihnen! Unsere bildlichen Darstellungen des ersten Menschenpaares zeigen bei diesem entschieden umfassendere Bekleidung, als die verschiedenen Männlein und Weiblein hier in und außer dem Bade trugen. Nicht ein Läppchen in der Größe einer Briefmarke war an ihnen zu sehen.
Das stark schwefel- und eisenhaltige Wasser sprudelt in einer Wärme von 45 Grad Celsius aus einer Quelle hervor und wird dampfend und rauchend durch ein Netz von Bambusrohren den Abhang hinab in die einzelnen Bassins geleitet, die hinter und unter den Häusern liegen. Von der großen, die Straße bildenden Steintreppe führt bei jedem Hause ein Gang nach dem zugehörigen Bad, und in diesen nach allen Seiten offenen Bassins ergötzt sich die Badegesellschaft, Greise und junge[S. 614] Männer, alte Mütterchen und ehrbare Jüngferchen, alle durcheinander, den ganzen Tag über. Nach japanischen Baderegeln werden von den Kurgästen gewöhnlich mehrere dieser heißen Bäder täglich genommen, und viele geben sich gar nicht die Mühe, zwischen den einzelnen Bädern Toilette zu machen. Haben sie ein Bad genommen, so setzen sie sich auf die vor den Häusern an der Straßenseite befindlichen Bänke oder kauern splitternackt, wie sie sind, in der Sonne auf dem Boden, rauchen ihr Pfeifchen, mustern die Passanten, spielen Karten oder Domino. Dann geht es schwupps! wieder ins Bad, und nach ein paar Wochen ist die Kur vorüber. Im Bade selbst empfangen die Damen Besucher, begrüßen einander in ehrfurchtsvollster Weise mit tiefen Verbeugungen, schäkern und lachen in der ungezwungensten Weise der Welt, wie etwa beim Karlsbader Schloßbrunnen. Trat ich in irgend einen dieser Baderäume, so warf mir die ganze fröhliche Gesellschaft wohl neugierige Blicke zu, ließ sich aber sonst gar nicht stören; die jungen Damen blieben in recht verfänglichen Stellungen auf den Holzstufen hocken, rieben sich ihre Glieder, schwammen munter in den Bassins herum, oder lagen im Wasser auf dem Rücken; einzelne, die wohl aus den geöffneten Häfen stammen und die Abneigung der Europäer gegen derartige Schaustellungen kennen mochten, hielten aller[S. 615]dings ihre Hände ähnlich wie die reizvolle Venus im Kapitol, das war aber auch alles.
Die Japaner besuchen Ikao gewöhnlich in der Sommersaison, ganz wie wir unsere Bäder, und bringen nicht nur ihre Familien mit Kind und Kegel, sondern auch ihr Bettzeug, Wäsche, Geschirre und dergleichen, dazu auch zu ihrer Erheiterung Gaishamädchen mit, je nach ihren Mitteln und Neigungen. Die Hotels sind in drei Klassen eingeteilt; die Preise in den Hotels erster Klasse für Zimmer und Nahrung betragen pro Person und Tag etwas über eine Mark. Freilich kennt die japanische Küche keine Fleischspeisen, und die Hotelgäste erhalten morgens nur Reis und etwa Bohnensuppe, mittags wieder Reis mit frischem oder gesalzenem Fisch, dazu Gemüse, Wurzeln, Mehlspeise und Früchte, abends natürlich wieder Reis, Fischsuppe und dergleichen. Dazwischen Thee à discrétion. Die Preise in den Hotels zweiter Klasse belaufen sich auf etwa achtzig Pfennige, in jenen dritter Klasse auf etwa fünfzig bis sechzig Pfennige, alles inbegriffen. Die Bäder sind dazu in allen Hotels frei, und nur wer in den Hotels erster Klasse ein Einzelbad nehmen will, muß dafür eine kleine Vergütung entrichten.
Die Umgebung von Ikao ist reich an herrlichen Spaziergängen; vor allen zu erwähnen ist jener den rauschenden, mit heißem ockergelben Wasser gefüllten Yusawabach entlang, stromaufwärts nach dem Badeorte Yumoto, oder der nach dem idyllischen Harunasee oder auf den steilen, aber aussichtsreichen Vulkankegel des Somayama. Noch besuchter sind die für skrophulöse Personen besonders heilkräftigen Bäder von Kusatsu, eine Tagereise von Ikao mitten in der herrlichen Gebirgsregion des zentralen Japan gelegen, mit nahezu siedeheißen Eisen-, Arsenik- und Schwefelquellen. Selbst die Japaner, die sich so gern im Wasser krebsrot brühen lassen, verläßt der Mut, wenn sie vor den dampfenden Bassins des Hauptbades von Kusatsu, Netsu-no-yu, stehen, und es bedarf einer von der Regierung angeordneten, halb militärischen Disziplin, um sie zum Bade zu bewegen. Der Murray von Japan sagt darüber: „Ein Hornsignal ruft bald nach Tagesanbruch so viele Kurgäste, als das Bad fassen kann, zusammen. Jeder Kurgast ist mit einem hölzernen Schöpflöffel bewaffnet, und auf Befehl des Bademeisters begießt sich zunächst jeder mit hundert Schöpflöffeln voll Wasser, um Kongestionen zu verhindern. Wärter passen dabei wachsam auf, denn zuweilen kommen Ohnmachtsanfälle vor. Während des folgenden, dreieinhalb bis vier Minuten dauernden Bades singen Bademeister und Kurgäste einen höchst merkwürdigen Chorgesang, um sich gegenseitig Mut einzuflößen. Nach Ablauf von etwa einer Minute schreit der Bademeister laut: ‚Noch zwei Minuten‘, und die Badenden, denen die kurze Zeit bei der brennenden Hitze des Wassers wie eine Ewigkeit vorkommt, antworten im Chor: ‚Noch zwei Minuten‘. Ebenso wird nach Ablauf der zweiten Minute ‚noch eine Minute‘, dann ‚noch eine halbe Minute‘ gerufen und jedesmal und immer freudiger von den Badenden[S. 616] beantwortet. Endlich ruft der Bademeister ‚fertig‘, worauf die ganze Menge nackter, brennrot gebrühter Körper über dem Wasser erscheinen und das Bad mit einer Schnelligkeit verlassen, die jeden, der ihrem langsamen, zögernden Eintritt beigewohnt hat, in Erstaunen versetzt. Bald darauf wird das Hornsignal neuerdings geblasen, und eine andere Reihe von Badenden unterzieht sich derselben Prozedur.” Die gewöhnliche Badekur in Kusatsu erfordert hundertzwanzig Bäder, die auf den kurzen Zeitraum von vier Wochen verteilt sind, und man kann sich also vorstellen, daß dieselbe nicht dasselbe Vergnügen gewährt wie jene in Ikao.
Ueber das exponierte, gemeinschaftliche Baden der beiden Geschlechter braucht man in Europa nicht erschreckt die Hände zu falten. War es doch in den europäischen Bädern vor gar nicht vielen Generationen allgemein gebräuchlich. Als ich in den öffentlichen Bädern der japanischen Hauptstädte und Badeorte das seltsame, ungenierte Treiben beobachtete, kam mir zuweilen ein großes Oelgemälde in den Sinn, das im historischen Museum zu Basel hängt und ein Bad in dem altberühmten Baden in der Schweiz darstellt. Gerade so splitternackt wie die Japaner von heute tummeln sich auch hier Männer, Frauen und Mädchen ganz toll in dem gemeinschaftlichen Bassin umher, lachen, schäkern recht verfänglich mit den Männern, ja noch mehr: mitten im Bassin stehen auf einem großen Tische gefüllte Weingläser, und eine fröhliche Gesellschaft giebt sich während des Badens einem Trinkgelage hin. Freilich stammt das Bild aus dem Anfange des siebzehnten Jahrhunderts.
Nikko wo minai utschi wa, Kekko to yu na! „Hast du Nikko nicht gesehen, so darfst du nicht von „prächtig” sprechen!” Mit diesem Sprichwort, das im fernen Reiche des Mikado in aller Mund ist, bezeichnen die Japaner die Herrlichkeiten ihres berühmtesten und besuchtesten Wallfahrtsortes. Was die Beurteilung der Natur anbelangt, muß man den Japanern aufs Wort glauben, denn es dürfte auch in der abendländischen Welt kaum ein Volk geben, das eine so große Empfänglichkeit, ein so tiefes Verständnis für die Natur, in der[S. 618] sie leben, besitzen dürfte. Ich möchte diesen Charakterzug der Japaner als ihren schönsten bezeichnen. Man wird ihn im ganzen Lande wahrnehmen. Bei der Mehrzahl der kleineren Städte und Dörfer, die so entzückend am Fuße bewaldeter Anhöhen, an rauschenden Bächen und Flüssen, oder inmitten der reizvollsten Gegenden liegen, hat es den Anschein, als wären sie nicht mit Rücksicht auf praktische Zwecke gerade wo sie sind angelegt worden, sondern nur wegen der Schönheit der Lage, ähnlich wie wir unsere Sommersitze wählen. Ihre Gärten, ihre Plantagen und Felder zeigen die liebevolle, ja peinliche Sorgfalt, welche die Japaner ihnen zuwenden, und die man in solchem Maße vielleicht nur in Holland wiederfindet. Der ferne japanische Archipel wird so von Gebirgen durchzogen, daß nur etwa ein Zwölftel des ganzen Reiches kulturfähig ist, aber dieses Zwölftel gleicht einem Garten. Selbst in den reichbewaldeten Gebirgen der Hauptinsel von Japan ist überall diese Liebe zur Natur wahrnehmbar, vor allem in jenem romantischen Bergdistrikte, der sich etwa hundert Kilometer nördlich von der Hauptstadt Tokio gleichweit von den beiden Meeresküsten entfernt ausdehnt und den Namen Nikko führt. Schon seit undenklichen Zeiten befanden sich dort in den ungeheuren Wäldern, zwischen rauschenden Strömen und plätschernden Wasserfällen, zwischen einsamen, tiefblauen Seen und hoch emporragenden Vulkanen Götzentempel, zu denen die Japaner wallfahrten. Die wildromantische Gegend übte auf dieses empfindsame Volk einen eigentümlichen Zauber aus. Die größte Zahl der japanischen Volksmärchen und Sagen beginnt mit den Worten: „Es war einmal in den Nikkobergen ...” und als ich selbst diese einzig schönen, einsamen Gebirgslandschaften durchwanderte, schien es mir, als wären sie von allerhand zauberhaften Wesen bevölkert. Mit diesen Märchen im Kopfe erschienen mir die spärlichen fremdartigen Wanderer wie Gnomen, die zierlichen kleinen Mädchen, die in den Wäldern Beeren pflückten oder Holz sammelten, wie Feen aus einer anderen Welt, ganz die Gestalten, wie sie Hänsel und Gretel auf ihrer abenteuerlichen Wanderung begegneten. Dazu trug wohl auch die Fremdartigkeit der ganzen Natur bei. Vergeblich forschte ich in meinen Erinnerungen nach Gegenden, welche sich mit diesen vergleichen ließen. Ich dachte an den Schwarzwald, an das seenreiche Salzkammergut, aber Nikko und damit auch das ganze Japan ist doch anders, und ich kam mir vor, als wanderte ich auf einem fremden Planeten. Nirgends fühlte ich mich entfernter von unserer abendländischen Kultur und bei aller Zufriedenheit einsamer als in den lauschigen, stillen Wäldern mit ihren ungeheuren phantastischen Fichten, ihren himmelanstrebenden Kryptomerien und seltsamen Laubbäumen, und doch befand ich mich nur einige Minuten weit von europäischen Hotels. Ein eigentümlicher, nicht zu beschreibender Zauber ist über dieses herrliche Stück Erde ausgebreitet, den wohl jeder empfunden hat, der mit einem bißchen Herz und Gemüt in seinem Reisesack nach Nikko gekommen ist.
Dieser Zauber mußte wohl auch den großen Schogun aus der Familie Tokugawa, den Taiko Iyeyasu, umfangen haben, denn als dieser größte Mann der japanischen Geschichte, der Cäsar des Mikadoreiches, anfangs des siebzehnten Jahrhunderts starb, nannte er den Bergdistrikt von Nikko als den Ort, wo er begraben sein wollte.
Seine Nachfolger ließen ihm dort eine der herrlichsten Grabstätten bauen, und das kaiserliche Haus, dem Iyeyasu so unvergängliche Dienste geleistet hat, konnte ihn nicht besser ehren, als indem es den verstorbenen Staatsmann und Helden, den Einiger des Reiches, unter die Zahl der Götter versetzte und ihm den Titel „Hoheit des ersten Ranges, Licht des Ostens, erhabene Verkörperung Buddhas” verlieh. Dies geschah im Jahre 1617, und seither ist Nikko der berühmteste und heiligste Wallfahrtsort der Japaner geworden. Die Tempel aber, die dort zu Ehren Iyeyasus gebaut worden sind und zu denen Kaiser, Fürsten und das Volk selbst während Generationen beigetragen haben, sind die herrlichsten Werke der japanischen Kunst, die ja gerade zur Zeit Iyeyasus ihre höchste Blüte erreicht hat. So hat der Cäsar Japans in der That auch noch nach seinem Tode Wunder gewirkt; er hat den Künstlern des alten Japan zu ihren erhabensten Leistungen Anlaß gegeben, und ihm ist es zu danken, daß wir heute noch so viel von dieser größten Glanzperiode der japanischen Kultur bewundern können. Die Künstler haben diese Tempel nicht nur Iyeyasu, sie haben dieselben auch sich selbst errichtet.
Mit Bedauern bestieg ich in Utsunomiya, am Fuße des Nikkodistriktes gelegen, den prosaischen Eisenbahnzug, der mich und eine ganze Menge von europäischen Touristen an einem heißen Augusttage hinaufführen sollte in die Berge; mit Bedauern deshalb, weil der bisherige Weg unendlich viel reizvoller und großartiger war als diese in der Sonne glänzenden und blitzenden Schienenstränge, die, wo immer sie auch liegen mögen, dem europäischen Reisenden den Gedanken einflößen, sie führten nach Europa. Sie sind die gewaltigsten Zerstörer alles Ursprünglichen, Eigenartigen; wie ungeheure Lanzetten stechen sie in die fremden Kulturen, und in die so entstandenen Wunden dringt die abendländische Alltagswelt. Neben unserer Bahn, bald näher, bald ferner, führte der altjapanische Weg hinauf zum Grabe[S. 620] Iyeyasus, seiner ganzen, über fünfundzwanzig Kilometer betragenden Länge nach von den großartigsten Kryptomerien beschattet. Wie gewaltige Türme ragen diese stolzen Nadelbäume aus der Ebene; ein einziger allein würde Aufsehen erregen, und es sind deren viele Tausende, vor Jahrhunderten gepflanzt von einem Pilger, der zu arm war, um für das Grabmal des Nationalheiligen eine steinerne Opferlaterne zu kaufen. Seine Gabe ist schöner als alle Opferlaternen zusammengenommen. Zum Glück fährt die Eisenbahn nicht ganz hinauf nach dem etwa 700 Meter über dem Meere gelegenen Nikko, sondern der Rest des Weges muß in den bequemen Fauteuils auf Rädern, den Rickshaws, zurückgelegt werden. Auf dieser Rickshawfahrt rollt man zwischen den Riesenbäumen einher, die den Weg nach Nikko zu beiden Seiten einfassen und mit ihren ineinander verschlungenen Aesten wie mit dem Dach eines gotischen Domes überwölben.
Von Nikko als einem Ort zu sprechen, ist unrichtig. Nikko wird der ganze Bergdistrikt bis zu dem gewaltigen ausgestorbenen Vulkan Nantai-San genannt, dem höchsten Berge dieses Teiles von Japan. An seinem Fuße liegt der romantische, waldbekränzte See von Tschuzendschi, und diesem entströmt, auf seinem Laufe zahlreiche Kaskaden bildend, der rauschende Dayagawa. Dort, wo sich sein wildromantisches Thal erweitert, liegen zwei Dörfer, Hadschi-idschi und Irimadschi, und zwischen beiden, verborgen zwischen ungeheuren Kryptomerien, liegen die Prachtgräber der Schogune. Hadschi-idschi besteht nur aus einer einzigen, etwa zwei Kilometer langen Straße, und auf meiner raschen Fahrt schien es mir, als wäre jedes Haus ein Hotel, ein Kuriositätenladen oder ein Theehaus. Kommen doch in jedem Jahre Zehntausende von Pilgern hierher, um den Manen Iyeyasus ihre Verehrung zu bezeugen und dann weiterzuwandern nach Tschuzendschi, um dort den Nantai-San zu besteigen.
Am oberen Ende des langgestreckten, durch seine vielen Kaufläden und sein bewegtes Leben recht malerischen Dorfes liegt das große Kanayahotel, in dessen ganz europäisch eingerichteten Räumen ich gegen hundert Europäer fand. Am Abend zeigte der Speisesaal mit seinen elegant gekleideten Damen und Herren in steifer Abendtoilette ein Bild, wie man es in einem europäischen Badeorte erwarten könnte, aber nicht hier, im Herzen des alten Japan. Die hohe Lage in den Bergen, die prachtvollen Wälder, die Kühle und die Frische, die hier auch im Sommer herrscht (oder herrschen soll, denn ich vermißte sie während eines fünftägigen Aufenthalts schwer), haben Nikko zu einer Art ostasiatischer Schweiz gemacht. Wie die Japaner zu ihrem Iyeyasu pilgern, so pilgern die in Ostasien ansässigen Europäer hierher, um der unerträglichen Hitze von Tokio, Kobe, Shanghai, Hongkong, ja selbst von Singapore und Bangkok zu entgehen. Auch die fremdländischen Diplomaten von Tokio flüchten hierher, und auf den freien Plätzen zwischen den größten Heiligtümern des alten Japan wird die Andacht der eingebornen Pilger durch lärmende,[S. 621] rücksichtslose Cricket- und Lawntennis-Spieler gestört. Diesem ewigen Lawntennis kann man sogar hier nicht mehr entgehen.
Eine Plage in Nikko sind die unzähligen Mücken und großen schwarzen Käfer, die durch das elektrische Licht (oh heiliger Iyeyasu!) angezogen, die Zimmer und Säle des Hotels erfüllen. Um sie zu verscheuchen, zündet man auf der Windseite des Hotels am Abend große Holzfeuer an und wirft feuchtes Laub darüber, so daß die Atmosphäre zuweilen mit erstickendem Rauch geschwängert ist. Mücken und Käfer kommen deshalb durch die Hinterthüren ins Hotel.
Am nächsten Morgen war mein erster Gang hinüber zu dem von ungeheuren Kryptomerien gebildeten Hain, in welchem sich die Grabtempel Iyeyasus befinden. Zwei Brücken überspannen den wasserreichen, rauschenden Dayagawa. Die eine aus rotlackierten Balken ist gesperrt und wird nur geöffnet, wenn der Mikado in eigener Person zu den Grabtempeln pilgert, die andere ist für gewöhnliche Sterbliche bestimmt. Eine Kryptomerienallee führt jenseits des Dayagawa zu dem Tempelplateau empor. Einen schöneren Ort hätte sich Iyeyasu für seine ewige Ruhe nicht aussuchen können; eine wahre Schweizerlandschaft breitet sich hier auf beiden Ufern des Dayagawa aus, mit mächtigen, kühn emporstrebenden Bergen, ausgedehnten buschigen Wäldern, grünen Matten und rieselnden Bächen; zwischen den ungeheuren Baumstämmen der Kryptomerien hindurch gewahrte ich den oberen Teil des Thales mit dem idyllischen Dörfchen Irimatschi und ein paar europäischen Neubauten, unter denen das Nikkohotel der größte ist; näher der Tempelstraße erhebt sich inmitten eines großen Gartens ein kaiserliches Schloß, das im Sommer vom japanischen Kronprinzen bewohnt zu sein pflegt, und nicht weit davon prangt eine fünfstöckige Pagode aus rotlackiertem Holz zwischen dem Grün der Bäume. Weiter aufwärts liegen ein paar anspruchslose Gebäude für die Priester, und jenseits derselben breitet sich die mit Mauern umgebene Tempelanlage aus.
Die Gebäude, Thore, Tempelhallen, Opferpagoden und Heiligenschreine, die hier in mehreren Höfen vor dem eigentlichen Grabtempel liegen, sind keineswegs durch besondere Größe oder Höhe ausgezeichnet, und man würde fehlgehen, in Nikko, wie in Japan überhaupt, irgend etwas zu erwarten, das sich mit unseren Kirchen oder mit den Tempeln der Araber, Perser, Indier vergleichen ließe. Weder in Bezug auf Architektur, noch nach Masse, Schönheit der Formen, Größe oder Baumaterial haben sie auch nur die entfernteste Aehnlichkeit mit diesen, ja sie sind eher das gerade Gegenteil. Klein, gedrückt, niedrig, durchweg aus Holz gebaut, sind sie im Verhältnis ebenso unschön wie die japanischen Wohnhäuser, so daß sie, von außen besehen, jeden fremdländischen Besucher enttäuschen. In Nikko ist diese Enttäuschung um so größer, als die Japaner hier recht eigentümliche Mittel anwenden, um die Tempel gegen Feuersgefahr und den Einfluß der Witterung zu schützen. Rings um die einzelnen Bauten sind ungeheure Drahtnetze gezogen, ähnlich wie unsere[S. 622] Hausfrauen Drahtglocken über die Butter stülpen, um sie vor den Fliegen zu bewahren. Manche Tempel sind mit einer verwitterten Bretterhülle umgeben, so daß sie, von außen betrachtet, sich ganz wie unsere Dorfscheunen zeigen. Man hat also gar keine Gelegenheit, den Bau und seine Architektur als Ganzes zu sehen; erst wenn man die wenigen Treppen zu den die Tempel rings umgebenden Veranden emporgestiegen ist und zwischen der Bretterhülle und den Außenwänden der Tempelbauten selbst näher schreitet, gewahrt man etwas davon, und dann wirkt nur die sorgfältige Zusammenfügung des Holzrahmens, der schöne rote, weiße oder Goldlack, mit dem er überzogen ist, nicht aber der Tempel als solcher.
Die hauptsächlichste Sorgfalt, die größte Kunst und den verschwenderischsten Reichtum der Ausschmückung verwenden die Japaner auf die gedrückten, inneren Räumlichkeiten, und wären sie nicht so finster, so hätte man Gelegenheit, seine Herrlichkeiten zu bewundern, die mit den größten Kunstschätzen des Abendlandes den Vergleich aushalten. Sie mit Worten zu schildern, vermag wohl kaum eine Feder, und ebensowenig kann es dem Pinsel des Malers gelingen. Wenn an irgend etwas, so erinnern die inneren Tempelräume mit ihren entzückenden Vergoldungen, Schnitzereien und Malereien an unsere byzantinischen Bauten, an die Kapellen im Markusdom von Venedig, oder die königliche Kapelle in Palermo, und fast möchte man der japanischen Ausschmückung den Vorzug geben. Vor der großen Revolution war diese in den Grabtempeln des Iyeyasu noch reicher; als aber der einfache Shintokultus an Stelle des prunkvollen Buddhismus wieder zur Staatsreligion erhoben wurde, entfernte man all die kostbaren Kleinigkeiten, Weihegeschenke, Götzenbilder und den malerischen Ausstellungsapparat der Buddhisten, so daß in diesen Tempeln nur mehr die Ausschmückung der Wände und Decken, sowie die entzückenden Thore bewundert werden können, welche die Tempelhöfe miteinander verbinden. Das köstlichste dieser Thore ist wohl das in weißem Lack und Goldzieraten prangende Jo-mei-mon mit seinen wunderbaren Deckenschnitzereien. Hier, wie auch in zahlreichen anderen Figuren zeigen die Japaner, welch hohe Kunst sie auch als Bildhauer erreicht haben. Hinter dem Tempel, welcher den stets verschlossenen Heiligenschrein Iyeyasus birgt, erhebt sich im Freien, mitten im Grün, das Grabdenkmal des Helden, eine auf einem festen Steinsockel ruhende Bronzeurne, die seine sterblichen Ueberreste enthält. Dem europäischen Besucher gewährt das in einem Nebengebäude befindliche Museum mit den Tempelschätzen größeres Interesse, denn hier sind die kostbarsten Meisterwerke der japanischen Kunst zur Besichtigung aufgelegt, dazu auch die Kleider, Waffen, Rüstungen des Iyeyasu und allerhand Gegenstände, deren er sich bedient hat, alle mit dem aus drei gegeneinander gerichteten Blättern bestehenden Tokugawawappen geschmückt. Einige Wochen vorher war ich über den einsamen Bergpaß auf dem Wege nach Hakone an der Stelle vorbeigekommen, wo Iyeyasu von Feinden angefallen worden und ihnen nur[S. 623] wie durch ein Wunder entgangen war. Jetzt sah ich hier die Sänfte, in der er sich bei dieser Gelegenheit befunden hatte, mit dem Loch, das der Pfeil in die Wand gebohrt; wäre er einen Zoll tiefer geflogen, diese Nikkotempel wären niemals erbaut worden. Die Oeffnung des Museums für das allgemeine Publikum ist übrigens dem Besuch des Erzherzogs Franz Ferdinand von Oesterreich-Este zu danken. Bis dahin waren die Tempelschätze unzugänglich; sie wurden nur ihm zu Ehren ausgestellt, und seither bilden sie das Hauptziel der europäischen Touristen.
Wie in allen größeren Shintotempeln, so befindet sich auch hier in einem Hofe eine offene Tanzbühne, auf welcher eine Priesterin die heiligen Tänze ausführt. In einen weißen Talar und roten Unterrock (das Zeichen der Jungfräulichkeit) gekleidet, in der einen Hand einen Fächer, in der anderen einen Schellenstab haltend, macht sie mit ihren nackten Füßen einige Schritte nach der einen, einige Schritte nach der anderen Seite, bewegt die Arme und Hände, fächelt sich, macht einige Verbeugungen und kauert sich dann wieder auf ihre Fersen nieder. Das ist der ganze Tanz, aber trotz seiner Einfachheit ist er nicht ohne Wirkung, wozu die Erscheinung der Tänzerin, ihre Kleidung und ihr schneeweiß gepudertes Gesicht mit abrasierten Augenbrauen das Ihrige beitragen.
In der Nähe der Iyeyasutempel befinden sich auch die sehr sehenswerten Grabtempel des Enkels und zweiten Nachfolgers Iyeyasus im Schogunat, des Schoguns Iyemitsu, der noch die ganze Pracht der buddhistischen Tempeleinrichtungen zeigt. Auch hierher wallfahrten die Japaner und bringen den Priestern ihre Gaben dar, indem sie vor jedem Gebet einige kleine Münzen auf den Boden des Tempels werfen. In ganz Japan bekommt man die kleinste Münze, den Rin, von dem etwa fünf auf einen deutschen Pfennig gehen, im Handel und Verkehr fast nirgends zu sehen; dafür bestehen die Tempelgaben der Mehrzahl nach aus solchen Rin, die augenscheinlich für diese Zwecke eigens aufbewahrt werden.
Weiter aufwärts im Flußthale des Dayagawa giebt es keine Tempel und keine Ortschaften mehr bis zu dem etwa sechs Wegstunden inmitten der zentralen Bergketten gelegenen See von Tschuzendschi. Ein an wildromantischen Reizen reicher Weg führt den rauschenden Dayagawa entlang zu diesem etwa vierzehnhundert Meter über dem Meere gelegenen Bergsee, über den sich der kahle, mächtige Scheitel des Nantai-San erhebt. Auf dem schmalen Landstreifen zwischen Berg und Seeufer liegt das urjapanische Dörfchen Tschuzendschi, fast ausnahmslos aus Hotels und Theehäusern bestehend, die halb in den See hineingebaut sind und auf Pfählen offene Veranden tragen. Kleine, ewig lächelnde Nesans sorgen hier für die Wünsche der Reisenden; der prächtige Lachs wird für die Mahlzeiten frisch aus dem See gefangen, der Reis ist von blendender Weiße, und wer sich an die leichten japanischen Papierhotels gewöhnt hat, kann hier ein paar reizvolle Wochen verleben; nur darf er nicht in den ersten Augusttagen kommen wie wir, denn dann drängen[S. 624] sich in das kleine Oertchen Zehntausende von Pilgern; dem Seeufer entlang, auf heiligem Boden, der durch ein mächtiges Steintorii bezeichnet wird, liegen langgestreckte, einstöckige Pilgerkasernen, und in diesen war jedes Plätzchen von den weißgekleideten Pilgern belegt, die am nächsten Morgen noch vor Sonnenaufgang die Besteigung des heiligen Berges Nantai-San unternehmen wollten. Ein Gitterthor versperrt den breiten Treppenweg, der zu dem nahezu dreitausend Meter hohen Gipfel führt, und wer die Besteigung ausführen will, muß den Priestern, die um den nahe dem Thore gelegenen Shintotempel hausen, einen Viertel Yen bezahlen. Aber ich hatte kurz zuvor die Besteigung des höchsten Berges von Ostasien, des Fudschiyama, ausgeführt, und der Nantai-San, ein Zwerg gegenüber diesem Bergriesen, reizte mich nicht weiter. Dafür wanderte ich den stillen, romantischen See entlang, an den einsamen Sommerhäusern des deutschen und des englischen Gesandten vorüber, nach dem kleinen Badeorte Yumoto, wo unter Flugdächern an der Straße Scharen von Männern und Frauen jeden Alters zusammen badeten. Woran man sich in dem Bergdistrikt von Nikko nicht sattsehen kann, ist die wunderbare Natur, die in solcher Großartigkeit in ganz Ostasien nicht wiederzufinden ist. Nur gehört gutes Wetter dazu, und das ist leider den Sommer über in Nikko selten. Es regnet hier gerade so häufig und so viel wie in Salzburg.
Im Reiche der aufgehenden Sonne hat sich in den letzten Jahren sehr viel geändert, manche Sitten und Gebräuche sind der modernen Kultur, der sich die Japaner ergeben haben, leider zum Opfer gefallen, aber viele nationale Züge und Eigenarten haben sich dennoch bis auf den heutigen Tag erhalten und werden auch noch für lange Jahre hinaus erhalten bleiben.
Dem Reisenden in dem herrlichen Inselreiche des Stillen Ozeans wird es nicht schwer, diese Züge herauszufinden, denn sie bieten sich ihm sozusagen auf Schritt und Tritt dar. In erster Linie möchte ich die Liebe der Japaner zur Natur und zu deren schönstem Schmuck, den Blumen, nennen. Nirgends wird dem Blumenkultus größere Liebe, größeres Verständnis, größere Kunst entgegengebracht. Vom Kaiserpaare herab bis zum letzten Bettler huldigt alles den Blumen, Männer wie Frauen, Greise wie Kinder hegen und pflegen sie mit der größten Zärtlichkeit. Wohin ich auf meinen Reisen auch gelangte, überall fand ich die Wohnungen mit Blumen geschmückt. Im kaiserlichen Palast von Tokio fand ich sie in kostbaren Vasen prangen, in den Holz- und Papierhütten der Feldarbeiter in Bambusgefäßen als einzigen Schmuck der ärmlichen Räume; blieb ich in einem japanischen Hotel länger als einen Tag, dann wurden jeden Morgen von zarten Mädchenhänden die Blumen in meinem papierenen Zimmer gewechselt; die halbnackten Kuli, welche mich in ihren leichten Handwägelchen, den Rickshaws, durch das Land zogen, steckten sich eine Blume hinters Ohr; in den Straßen der Städte wandern Blumenverkäufer, die schöne Last in Körben auf eine Bambusstange gehängt, umher, und kein Bettler ist zu arm, um nicht für einige Rin (Zehntelpfennigstücke) eine Blume zu erwerben.
Aber noch mehr: der Kalender der Japaner setzt sich auch heute noch aus Blumenfesten zusammen; statt die Monate und Jahreszeiten mit unseren Namen zu bezeichnen, geben die Japaner ihnen den Namen ihrer Blumen. Mit Blumennamen nennen sie auch ihre Töchter, und diese, wie alle Damen Japans überhaupt, kleiden sich je nach der Blume, welche zu gewissen Jahreszeiten in ihren Gärten vorherrscht. Zur Zeit der Kirschblüte tragen sie Kimonos (schlafrockartige Oberkleider), auf welche Kirschblüten eingestickt sind; sind diese verblüht, dann kommen in der Natur, wie auf den Toiletten Azaleen an die Reihe, und so fort, bis der November die herrlichste Blume Japans, die Chrysanthemum, bringt. Ja sogar der Wandschmuck der Wohnräume richtet sich nach den Blumen. Die Japaner pflegen auf die kahlen nackten Papierwände ihrer Wohnungen Kakemonos zu hängen, lange mit Blumen und anderen Sujets bemalte Papierstreifen; blühen die Glycinen oder Päonien oder der Lotos, dann werden auch in den Häusern Kakemonos mit solchen Blumen aufgehängt und vor diese Vasen mit frischen Blüten gestellt.
Wir Europäer sind gewiß ebenfalls den Blumen hold, und viele von uns pflanzen und pflegen sie mit derselben Liebe wie die Japaner; aber in Bezug auf ihre Zusammenstellung sind wir im Vergleich zu ihnen noch weit zurück, und nur die deutschen Blumenzüchter befleißigen sich ähnlicher Sorgfalt. Wie plump und sinnlos sind die Sträuße, welche auf dem allwöchentlichen Blumenmarkte rings um die Madeleinekirche in Paris feilgeboten werden! Dutzende von Rosen derselben Farbe werden dort eng aneinander gequetscht, und das Ganze wird in einer großen weißen Papiertüte steckend feilgeboten. Ein derartiges Unding würde in Japan Entsetzen erregen. Dort wird auch die geschnittene Blume einzeln und für sich behandelt, als säße sie noch auf der Pflanze im Garten. Der Japaner legt nicht so viel Wert auf den Geruch und die Farbe der Blume selbst, wie auf die Form, das künstlerische Zusammenwirken von Blume, Stengel und Blättern. Sind die letzteren auch wenig schön, so heben sie doch durch ihre Zusammenstellung die Schönheit der ersteren. Die zarte Kunst der Behandlung von Blumen, ob lebender oder geschnittener, gehört in Japan mit zu den schönsten Künsten, und die Erziehung einer Japanerin wird als unvollständig betrachtet, wenn sie nicht einen Kurs in der Blumenkunst durchgemacht hat.
Bei dieser Vorliebe, ja ich möchte sagen Leidenschaft der Japaner für ihre herrliche Flora ist es nicht zu verwundern, daß die Blumen die wichtigsten Sujets sind, welche in den japanischen Malereien und Skulpturen, bei der Ausschmückung von Bronzen und Porzellanen zur Verwendung kommen, ja daß sie vom japanischen Adel als Wappenbilder gewählt werden.
Und wie bei jedem einzelnen Japaner, so äußert sich die Liebe zu den Blumen im ganzen Lande durch zahlreiche, allgemein gefeierte Blumenfeste. Wie es bei uns ein Weihnachts-, Oster- und Pfingstfest giebt, so giebt es in Japan ein Kirschblüten-, Azaleen- und Chrysanthemumfest. Selbst zur Neujahrszeit werden die Häuser in Ermangelung von Blumen mit Immergrün, Tannen und Bambus geschmückt. Kommt aber der Frühling, dann bringen die wärmeren Sonnenstrahlen die zarten Knöspchen der Kirschbäume zur Blüte, und das ganze Inselreich ist bald in das herrlichste Rosenrot gehüllt, als wären Massen kleiner, von der Sonne durchleuchteter Wölkchen vom Himmel herabgeflogen, um für einige Wochen zwischen den Baumkronen der Gärten zu verweilen. Wer jemals das Glück gehabt hat, den unbeschreiblich üppigen Blütenschmuck der Kirschbäume in Japan zu sehen, der wird die Begeisterung der Japaner gerade für diese Blüte wohl begreifen und es natürlich finden, daß sie die Kirschbäume nur ihrer Blüten wegen pflanzen, denn die japanische Kirsche ist ungenießbar. Nach der unwirtlichen kalten Jahreszeit wirkt der rosenrote Schnee, in den sich die Bäume hüllen, um so stärker. Die Kirschblüte, und nicht, wie es im Abendlande allgemein geglaubt wird, die Chrysanthemumblüte ist die Lieblingsblume der Japaner.
Schon vor der vollen Entfaltung der Blüten wird in den Tagesblättern Japans über das Fortschreiten derselben berichtet. Depeschen aus allen Teilen des Landes verkünden die Freudenbotschaften, daß hier oder dort die Bäume bereits in Blüte stehen, und unter den Stadtneuigkeiten kann man lesen, daß Prinz Sandscho oder der Premierminister Graf Ito sich für drei Tage nach Nara oder Kioto begeben haben, um die blühenden Kirschbäume zu bewundern.
Endlich prangen auch die Kirschbäume in der Hauptstadt selbst in ihrem unglaublich reichen Blütenschmuck. Wer in der ersten Aprilhälfte die Kirschhaine des Uyénoparks oder von Mukodschima an den Ufern des Sumidagawa durchwandert, der sieht dort die riesigen Bäume, hoch wie alte Eichen, mit Blüten vollständig bedeckt, ohne daß noch ein einziges grünes Blatt erschienen wäre; nicht kleine leichte Blütchen, sondern rosenrote, blattreiche, doppelte Blumen, so groß wie Centifolien. Auf jedem Ast, jedem Zweiglein sitzen sie dicht aneinander gedrängt, kaum daß die größeren Aeste sichtbar sind; und dahinter erheben sich die dunkelgrünen mächtigen Kryptomerien, diese schönsten Nadelholzbäume des Orients. Die Blüten hauchen einen zarten Duft aus, fremdartige Vögel singen und trillern in den dichten rosenroten Kronen, die sich in den stillen Lotosteichen wiederspiegeln.
Dann kommt der Kirschblütensonntag, ein Nationalfest der Japaner, dieses Phäakenvölkchens. Ueber Nacht sind in den weiten Avenuen, ebenso wie in den Seitenwegen und entlang den schmalen lauschigen Waldpfaden Hunderte und Aberhunderte von leichten Buden entstanden, in denen kleine putzige Japaner und Japanerinnen allen möglichen Flittertand verkaufen. Jede dritte Bude ist ein Theehaus, in welchem Reiswein feilgeboten wird, und Tausende von Familien mit Kind und Kegel, alle in seidene Festgewänder gehüllt, lustwandeln in dem rosenroten Wald, bleiben hier und dort vor irgend einem besonders prächtigen Baume stehen, um ihn mit Kennerblick zu bewundern oder möglicherweise Gedichte, seine Pracht verherrlichend, an den Stamm zu heften. Jeder Besitzer eines Gartens hat um diese Zeit sein Kirschblütenfest und versendet große mit Kirschblüten gezierte Einladungskarten an seine Freunde; sogar der Hof ladet die Gesellschaft und das diplomatische Korps zu einer Gardenparty ein, welche in den weiten in üppiger Pracht stehenden Palastgründen des Hama Rikiu abgehalten wird.
Wer aber das japanische Volksleben in seiner ganzen Eigenart kennen lernen will, der muß nach Mukodschima im Südosten von Tokio gehen. Dort wurden, als noch das Schogunat (Vizekaisertum) der mächtigen Tokugawafamilie in voller Blüte war, Kirschbäume gepflanzt, die heute ungeheure Dimensionen erreicht haben, so daß in den weiten Alleen ihre Zweige sich verschlingen und einen rosenroten Dom bilden. Dort vor allem ist der Schauplatz der Hanami, d. h. Familienpicknicks, auf welche sich die Kinder das ganze Jahr über freuen. Schon lange vorher werden von verschiedenen Familien gemeinschaftliche Ausflüge vereinbart. Zu Fuß, in Booten oder[S. 628] in langen Reihen von Rickshaws treffen sie ein, jede Gruppe durch ein gemeinschaftliches Zeichen erkenntlich; die einen tragen buntfarbige Tücher um den Kopf gewunden, die anderen gleiche Halstücher, die dritten irgend einen bunten Fleck auf ihren Kimonos. Männer, Frauen, Mädchen, Kinder, alle in ihren buntesten Schlafröcken, durch ebenso bunte Papierschirme gegen die Sonne geschützt, ebenso bunte Fächer schwenkend; auf jedem Boote ausgelassene Fröhlichkeit, Gesang, Gelächter, Trommelschlag und Samisengezupfe; ein Karneval im blühenden Frühling!
Die Mädchen spielen heitere Gesellschaftsspiele, Männer tanzen wie Satyre, Poeten sagen ihre den Bäumen gewidmeten Oden her, Seiltänzer, Akrobaten, Märchenerzähler, Wettringer unterhalten das Volk. Dazu die eigentümlichen langen Gewänder, die fremdartige Landschaft, so daß man sich ein paar tausend Jahre zurück versetzt denken könnte, mitten in irgend eine Saturnalie des Petronius. Mit dem Einbruch der Dämmerung erscheinen Tausende und Abertausende von buntfarbigen Papierlampions in den Bäumen, auf den Booten im Flusse, rings um die zahlreichen Sakeläden und Theehäuser. Damit ist die Zeit für das Abendbrot gekommen. Im Kreise sitzen die Familien und Gesellschaften beisammen, handhaben lachend, scherzend ihre Eßstäbchen, trinken dazu aus winzig kleinen Porzellanschalen Sake und lassen sich mit Samisen und Gesang unterhalten. Schöne Maiko- und Gaishamädchen in den herrlichsten Gewändern, die Gesichtchen bemalt, das rabenschwarze Haar unter einem Wald von Schmetterlingsnadeln verborgen, tanzen und führen kleine Szenen auf. Am fröhlichsten wird das Treiben, wenn irgend ein plötzlicher Windstoß durch die Bäume fährt, die Blüten entblättert und sie wie rosenroten Schnee auf die ganze Gesellschaft herabfallen läßt.
Nur zu bald geht es mit der Kirschblütenherrlichkeit zu Ende, aber an ihre Stelle treten, noch während sie auf den Bäumen prangt, die Azaleen und nur wenige Tage später die Päonien, nicht wie wir sie kennen, sondern wie sie in solcher Größe, Menge und Pracht nur Ostasien besitzt. Ich habe in Japan mannshohe Azaleen- und Päonienbäume gesehen mit Tausenden von Blüten, ja in dem Klostergarten von Hia Hungtien an der Ostgrenze von Deutsch-China bewunderte ich einen Azaleenbaum, dessen Stamm einen halben Meter Durchmesser besaß und dessen haushohe Krone an zwanzigtausend Blüten beherbergen mochte. Die Päonien, in Japan Botan genannt, zeigen sich Anfang Mai in wunderbarer Farbenpracht. Auf sie folgen im Juni die herrlichen, die Teiche und Wassergräben mit einem lila Teppich bedeckenden Iris; wie die Tulpen in Holland, so prangen die Iris hier auf weiten Feldern, mehrere Morgen einnehmend; kommen einige Tage später die Glycinen, auf Japanisch Fudschi genannt, zur Blüte, dann ist in manchen Gebieten lila die hervorragende Farbe in der Landschaft. Den Wänden der Landhäuser entlang, an Palästen und Hütten, auf Theehäusern und künstlich errichteten Lauben und Gängen winden sie sich in unglaublicher Ueppigkeit empor und über die Dächer[S. 629] hinweg; dazu wird bei vielen Häusern des ärmeren Volkes der Dachfirst mit Iris bepflanzt, so daß sie im Juni vollständig mit lila Blüten bedeckt sind. Am berühmtesten ist die dreihundertjährige Glycine (Wistaria chinensis) im Garten des Kameidoklosters, das Ziel unzähliger Wanderer, welche im Frühsommer hierher pilgern, um diese mehrere hundert Meter langen blütengespickten Ranken zu bewundern. Schattige Laubgänge bildend, Theehäuser mit einem Blütendach bedeckend, reichen sie bis weit in den kleinen See hinaus, in dessen stillem Wasser sich diese lila Blütenpracht wiederspiegelt. Ebenso besucht wie der Glycinengarten von Kameido ist die fünfhundert Jahre alte Glycine in Kasukabe, nordöstlich von Tokio, eine wunderbare Pflanze, deren Ranken rebenartig eine Laube von vierhundert Quadratmetern bedecken.
Für das nächste Blumenfest des Jahres bieten die schönen weißen Lotos den Anlaß, die neben den Kirschblüten und Chrysanthemen die beliebtesten Blumen Japans sind und als Symbole der Reinheit, Tugend und Nützlichkeit bewundert werden: der Reinheit, weil ihre zarten weißen Blüten sich aus dem Schlamm der Pfützen und Moräste erheben, der Tugend wegen ihres leichten balsamischen Geruches, der Nützlichkeit, weil die Samenkörner, die sie enthalten, genießbar sind. Ueberall in Japan, in den Wassergräben der alten Daimioschlösser, in Teichen und Seen, an Kanälen und Flüssen entlang sind während des Monats August diese schönen großen Blumen zu sehen. In Tokio ist der Schinobadzusee des Uyenoparkes mit ihnen buchstäblich gefüllt, und dann pilgert die ganze Stadt hinaus, um an den kleinen Inselchen und Brücken und Theehäusern diese Blütenpracht zu bewundern. Noch schöner als der Lotossee des Uyenoparkes erschien mir der kleine Teich hinter der Pagode des Schibaparkes; umgeben von mächtigen Kryptomerien schlummert er in deren tiefem Schatten; ein Inselchen mit einem winzigen Tempel erhebt sich aus seiner Mitte, und die Wasserfläche ist so dicht mit Lotosblüten bedeckt, daß man sie für einen großen Teppich halten könnte.
Aber der größte Kultus wird in Japan getrieben mit der letzten Blume des Jahres, der Wappenblume des Kaiserhauses, dem Chrysanthemum. Seit Jahrhunderten ist die Gilde der japanischen Gärtner, von Vater auf Sohn, damit beschäftigt, diese Blume zu veredeln und durch allerhand nur ihnen bekannte Mittel so vielfarbig und vielgestaltig wie nur möglich zu ziehen. Große Vermögen werden in Chrysanthemum angelegt, große Vermögen damit gewonnen. Die Gärtnergilde in Yokohama besitzt an fünfhundert Gärten, zweihundert Morgen Landes umfassend, in denen sechs- bis achthundert verschiedene Arten von Chrysanthemen gezogen werden. Die Gilde in Tokio besitzt wohl eine noch größere Zahl von Gärten in der Vorstadt Dangozaka, und die schönsten Blumen, die sie das Jahr über zieht, werden gelegentlich des Chrysanthemumfestes in den kaiserlichen Gärten vom Akasaka zur Schau gestellt. Schon diese Gärten allein mit ihren ungeheuren Cedern und[S. 630] Kryptomerien, ihren lauschigen Alleen, grünen Rasen, mit von Tempeln und Kiosken gekrönten Hügeln, ihren Wasserflächen mit Inselchen und kurios geschwungenen Brücken sind Wunderwerke der Japaner, die leider nur wenigen Auserlesenen zu schauen beschieden sind. Staunend durchwanderte ich dieses Buen Retiro der Kaiserin, das als passendsten und bezeichnendsten Namen den Namen „Kaiserin Frühling” führt. Dem großen Park wird im November durch die Kunst der japanischen Gärtner wahre Frühlingspracht gegeben, und wem die Auszeichnung zu teil geworden, von der Kaiserin zu dieser Gardenparty befohlen zu werden, der wird die schwärmerische Leidenschaft der Japaner für die Kaiserblume, Kiku, begreiflich finden.
Nach Zehntausenden müssen die Chrysanthemen zählen, welche hier in der wunderbarsten Farbenpracht erblühen; den besandeten Wegen entlang sind leichte Flugdächer aus Bambusstangen errichtet, verhüllt durch violette Gazevorhänge, auf welchen die weiße kaiserliche Chrysanthemumblüte eingestickt ist. Unter jedem Flugdach sind verschiedene Arten von Chrysanthemen ausgestellt, verschieden in Farbe, Größe, Form und Gestaltung der Pflanze selbst. Manche Blüten sind größer als unsere Teller, je eine auf einer Pflanze mit einem einzigen Stiel, andere mit den zartesten ineinander gerollten Blättern haben das Aussehen großer Schneeballen; wieder andere mit Hunderten von Blättern, die wie lange Haare von den Blüten herabhängen, oder solche, die steif wie bei einer Sonnenrose ringsum stehen. Besonders merkwürdig sind Pflanzen mit einem ganzen Strauß von Blüten bedeckt, jede von einer anderen Farbe; das größte Wunder der Gärtnerkunst aber sind einzelne Pflanzen, welche auf demselben Stiel ein Dutzend Blüten jede von verschiedener Größe und dabei verschiedener Farbe zeigen. Weiter im Innern des Gartens sind große Flächen buchstäblich mit einem Teppich von Chrysanthemen bedeckt, hier ein weißer, dort ein roter oder violetter Teppich, in welchem jede einzelne Blume genau dieselbe Farbe zeigt, jede genau so geöffnet ist wie die andere, so daß sie gleichzeitig welken und vielleicht an demselben Tage verblühen. Mitten in diesen Beeten erheben sich Riesenpflanzen, die auf ihren zwei Meter und noch längeren Stielen bis zu sechshundert Blüten zeigen. An jeder Pflanze hängen kleine Papierzettelchen mit dem Namen der betreffenden Art in japanischen Lettern, Namen wie „der weiße Drache”, „goldener Tau”, „Fischers Laterne”, „das Federnkleid”, oder auch „zehntausendmal mit Gold bestreut” und dergleichen.
Um dieselbe Zeit, wie die kaiserliche Chrysanthemumparty finden auch im ganzen weiten Reiche, hauptsächlich aber in Tokio selbst, Festlichkeiten statt, für welche die Chrysanthemen die Veranlassung sind. Die ganze Bevölkerung, hoch und niedrig, wandert dann hinaus nach Dango Zaka, dem Quartier der Gärtner, dem Schauplatz der fröhlichsten Hanami. Jeder einzelne Gärtner hat dort seine eigene aus Bambusstäben errichtete Schaubude, in welcher er die schönsten Produkte seiner Kunst gegen ein Eintrittsgeld von wenigen Pfennigen zur Schau stellt. Aber hier sind es nicht[S. 631] so sehr die Blüten selbst, als ihre eigentümliche Zusammenstellung zu Figuren und Landschaften, welche die festlich gestimmten Japaner in hellen Scharen herbeilocken. Die Buden sind dementsprechend in einen Zuschauerraum und eine Bühne mit Kulissen eingeteilt, und auf den Bühnen stehen die seltsamsten Chrysanthemumfiguren. Alle möglichen Sujets, aus der Geschichte des Landes, der Mythologie und der Gegenwart, Landschaften, volkstümliche Helden, berühmte Schauspieler in ihren Lieblingsrollen, Scenen aus populären Theaterstücken, alles das wird für die Darstellung gewählt, ein ungeheures Panoptikum, wie jenes von Madame Tussaud in London oder Castan in Berlin, nur mit dem Unterschiede, daß die Kleidungsstücke und Trachten ganz aus Chrysanthemumblüten bestehen. Die Gesichter, Hände und Füße werden mit großer Treue und Lebenswahrheit aus Wachs geformt, die Kleider aber, ebenso wie die einzelnen Landschaftsbilder, ob sie nun Felsen, Berge, Wasserfälle, Tempel darstellen, bestehen ausschließlich aus Chrysanthemumblüten und -blättern, so kunstvoll aneinander gebunden, daß sie sogar die glatte Oberfläche der Stoffe nachbilden, und dabei sind diese Blüten nicht etwa von ihren Stielen abgeschnitten, sondern lebende Blumen, mit ihren Stielen und Wurzeln. Wer beispielsweise die mit Stickereien bedeckten Kimonos oder die Rüstung eines altjapanischen Kriegers betrachtet, hält das für unmöglich. Besucht man aber Dango Zaka am Morgen, so hat man zuweilen in dieser oder jener Bude Gelegenheit, das Erneuern welker Blumen zu beobachten. Dazu müssen kleine Partien von Blumen losgebunden werden, und dann sieht man, daß diese Figuren aus einem Bambusgestell bestehen, hinter welchem die Pflanzen selbst verborgen sind, die Wurzel sorgfältig in feuchte Erde verpackt, mit den für die Darstellung erforderlichen Blüten oder Blättern zwischen den Bambusplatten hervorgezogen und kunstvoll mit- und ineinander verflochten. Des Morgens und Abends werden die Pflanzen mit Wasser besprengt und erhalten sich, durch das Mattendach der Schaubude gegen die Sonnenstrahlen geschützt, einen ganzen Monat lang, als ständen sie in einem Garten.
Dem leichtlebigen japanischen Völkchen gilt das Chrysanthemumfest wie ein Abschied von der schönen warmen Jahreszeit, es ist das letzte der Blumenfeste, und schon deshalb nimmt jede Familie, jeder Einzelne bis zum geringsten Bettler daran teil. Sind die Chrysanthemen verblüht, dann erhält die Landschaft nur noch durch die vom Spätherbst rot und gelb gefärbten Ahornblätter Abwechselung, und während die Japaner diese bewundern, zählen sie auch schon die Wochen, die sie von dem nächsten Kirschblütenfest trennen.
Mit der Insel Formosa haben die Japaner eine selbständige chinesische Provinz von über vierunddreißigtausend Quatratkilometern Größe und etwa dreieinhalb Millionen Einwohnern gewonnen, ein Gebiet, auf das sie zur Erfüllung ihrer handelspolitischen Pläne längst ein Auge geworfen hatten und dessen Besitz sie in Zukunft noch unabhängiger von dem europäischen Handel und noch gefährlicher für den letzteren machen wird als bisher. Den Chinesen dagegen war das Opfer, das sie brachten, kein besonders großes, denn der Wert Formosas war für sie bisher recht problematisch, und früher oder später hätten sie diese kleinste ihrer[S. 633] Provinzen doch an die eine oder die andere Macht verloren. Bei einem Länderbesitz von mehr als elf Millionen Quadratkilometern bildete Formosa nur den dreihundertsten Teil des chinesischen Reiches, und selbst davon war nur eine Hälfte im Laufe der letzten Jahrhunderte unterworfen worden. Die östliche Hälfte Formosas wird heute noch von den der Hauptsache nach malayischen Urbewohnern eingenommen, welche die Chinesen trotz fortwährender Kämpfe doch noch nicht zu bezwingen im stande waren und wohl nie mit Waffen hätten bezwingen können. Dies wird den Japanern überlassen bleiben. Auch diese werden sich die Zähne an den wilden, tapferen Stämmen ausbeißen, die in den Gebirgen und Urwäldern des östlichen Formosa hausen. Die Insel kam überhaupt erst vor etwa zweieinhalb Jahrhunderten in den Besitz der Chinesen. Die ersten Besitzer waren die Portugiesen, die hier eine Handelsniederlassung gründeten und der Insel ihren wohlverdienten Namen, Formosa, die Schöne, gaben. Wie die meisten Besitzungen der Portugiesen, fiel auch diese bald in andere Hände. 1643 setzten sich die Holländer hier fest und erbauten, nahe der Nordspitze, bei Tamsui, ein Fort, das zum Teil noch heute steht und eine Zeitlang in seinen Mauern die Residenz des englischen Konsuls beherbergte. 1661 ließen die Chinesen die Fremdlinge durch ihren berüchtigten Piratenchef Koksuiga vertreiben, gewiß zum Nachteil dieses herrlichen Eilandes, das im Besitz einer europäischen Macht sich längst zu einer blühenden Kolonie entwickelt haben würde. Bis zum französisch-chinesischen Kriege von 1884 bildete Formosa einen Teil der benachbarten Provinz Fokien; damals wurde der Chinesengeneral Liu-Ming-Chuan mit einer Armee von vierzigtausend Mann nach Formosa gesandt, um die Franzosen daraus zu vertreiben, und wahrscheinlich zur Belohnung für die vielen Niederlagen, die er bis zum Friedensschlusse dort erlitt, wurde er zum ersten Generalgouverneur der neugeschaffenen Inselprovinz ernannt und konnte die Summen, die bis dahin von dem Gouverneur von Fokien vom Volke erpreßt wurden, nunmehr selbst einstreichen. Vor 1885 war nämlich der Gouverneur von Fokien gleichzeitig Fu, d. h. Präfekt, von Formosa, mit der Verpflichtung, die Insel alle drei Jahre zu besuchen. Dem Laufe der Dinge gemäß mußten bei diesen Besuchen die Unterbeamten der Insel dem Präfekten Geschenke in Geld und Waren machen, und die Mandarine kehrten von ihren Ausflügen nach Formosa gewöhnlich mit wohlgefüllten Geldsäcken zurück.
Liu-Ming-Chuan war übrigens ein vortrefflicher Gouverneur, ein kleiner Li-Hung-Tschang des Südens, und die Japaner, welche die Insel nun übernahmen, haben ihm sehr viel zu danken, sogar eine Eisenbahn, die zweite, die innerhalb des Bereiches des Drachenbanners überhaupt gebaut wurde. Unter seiner Regierung machten auch die wilden Stämme lange nicht so viel zu schaffen wie früher. Liu wußte sehr wohl, daß es den Chinesen nicht gegeben sei, Völkerschaften mit den Waffen in der Hand zu unterdrücken; deshalb setzte er sich mit den feindlichen[S. 634] Häuptlingen ins Einvernehmen, und nach dem alten Lehrsatz, daß kleine Geschenke die Freundschaft erhalten, ließ er den Häuptlingen Tücher, Decken, Pfeifen, Messer, Waffen u. dergl. verabfolgen, Dinge, welche die Häuptlinge gewissermaßen als Tribut betrachteten. Jedenfalls verhinderten sie aus Dankbarkeit dafür die bisherigen Raubzüge ihrer Stämme nach der von den Chinesen besiedelten Westhälfte der Insel, bei denen sie stets ganze Dörfer und Städte zu plündern pflegten. Aber das altherkömmliche Vergnügen, das die Formosaner darin finden, den Chinesen die Köpfe abzuschlagen, konnten die Häuptlinge nicht unterdrücken. Wie die berüchtigten Dajaken von Borneo, so sind auch die Formosaner auf Menschenköpfe passioniert. Bei manchen Stämmen darf kein junger Mann heiraten, ohne vorher mindestens den Kopf eines Chinesen dem Häuptling überbracht zu haben. Das Köpfen erfolgt aber nicht etwa in offenem Kampfe. Die jungen Leute lauern reisenden Chinesen auf, überfallen sie von rückwärts, und sobald sie die Köpfe vom Rumpfe getrennt haben, laufen sie mit diesen blutigen Trophäen ihren Lagern zu. Dort wird zunächst ein Kriegstanz ausgeführt, währenddessen der glückliche Bräutigam seine Braut in Empfang nimmt, um sie nach seiner aus Baumrinde gebauten Hütte zu führen. Dort wird die Braut von allen Squaws des Stammes besucht. Ob die Formosaner auf die Köpfe der Japaner ebensolchen Appetit haben werden wie auf jene der Chinesen, wird die Folge zeigen. Jedenfalls werden sie auf ihre eigenen Köpfe etwas mehr achten müssen als bisher. Zwischen Japanern und Formosanern herrscht entschieden größere Rassenverwandtschaft als zwischen den letzteren und den Chinesen. Wie die Japaner, so bedecken auch die wilden Formosaner ihre Körper mit Tättowierungen, eine Verrichtung, die den Weibern obliegt. Manche Krieger zeigen auf ihrer Haut ihre ganze Lebensgeschichte. Auch die Weiber werden vor ihrer Vermählung tättowiert, und am Vermählungstage müssen sie sich außerdem ihre Augenzähne ausziehen lassen. Ein eigentümlicher Gebrauch der Formosaner ist der, ihre Toten an derselben Stelle zu beerdigen, auf der sie gestorben sind, und ist dies in ihrem eigenen Hause geschehen, so werden sie unter dem Fußboden desselben eingescharrt. Kriegern werden außer Lebensmitteln auch ihre Waffen mit ins Grab gelegt.
Die Bedürfnisse der wilden, der Mehrzahl nach großen und kräftigen Formosaner sind sehr gering; ihre Bekleidung ist ebenso spärlich wie die der Malayen, und ihre Nahrung gewinnen sie durch Jagd und Fischfang. Sie sind also keine nennenswerten Abnehmer für europäische oder japanische Waren, aber dafür birgt ihre Heimat so große Naturschätze, daß die Japaner dennoch sehr bald in Beziehungen zu ihnen werden treten müssen. Ohne blutige Kämpfe wird dies nicht abgehen, denn die leichtfüßigen Formosaner leben nur in den schwer durchdringlichen Urwäldern und dem zerklüfteten Hochgebirge, dessen Gipfel die Höhe von dreitausend Metern erreichen. Dort liegen große Kohlen-, Eisen-, Kupfer- und[S. 635] Goldlager, die bei regelrechter Ausbeutung reichen Ertrag liefern würden, und die Urwälder bestehen hauptsächlich aus großen Kampferbäumen, auf die es die Japaner hauptsächlich abgesehen haben.
Von Wichtigkeit für den russischen und amerikanischen Markt ist auch das Vorhandensein von Petroleum in Formosa. Rußland besaß bisher eine Petroleumeinfuhr in China im Umfange von jährlich zehn Millionen Gallonen, Amerika eine solche von vierzig Millionen Gallonen; Japan dagegen bezahlte bisher jährlich zwischen drei und vier Millionen Yen für Petroleum an die genannten beiden Länder. Sollten sich die Petroleumlager auf Formosa in der That als so ergiebig erweisen, wie man glaubt, so dürfte dies der Einfuhr vom Auslande her einen empfindlichen Schlag versetzen.
Während die mineralischen Schätze Formosas noch größtenteils brach liegen, haben die von den benachbarten Provinzen des chinesischen Festlandes eingewanderten Chinesen mit gewohntem Fleiß die ungemein fruchtbaren Ebenen des westlichen Formosa in ausgedehnte Thee-, Reis- und Zuckerpflanzungen verwandelt. 1887 gelang es dem Vizekönig Liu, einige Stämme der wilden Formosaner zur Unterwerfung zu bringen. Wenigstens fand ich in der Pekinger Zeitung vom 26. Juni 1887 einen langen Bericht, in dem Liu die Vollendung einer Straße in westöstlicher Richtung quer durch Formosa von Chang-hua nach Shui-wei meldete. Dadurch konnten chinesische Truppen bis an die Ostküste vordringen und neunundachtzig Ortschaften mit einundzwanzigtausend Einwohnern der chinesischen Verwaltung einverleiben. In einem späteren Bericht meldet Liu die Unterwerfung von weiteren Distrikten an der Ostküste mit gegen sechzigtausend Einwohnern. Dieselben nahmen chinesische Ortsvorsteher und Präfekten sowie den chinesischen Kalender an, ja heute tragen sie chinesische Kleidung und Haartracht mit langen Zöpfen; sie haben Jagd und Fischfang aufgegeben und sind friedliche Ackerbauer geworden. Dadurch wurden Hunderttausende von Morgen des fruchtbarsten Landes der Kultur gewonnen. Die zahlreichen Mischlinge zwischen den Eingeborenen und Chinesen, Pepos genannt, nähern sich im Charakter mehr den Chinesen und sind ebenfalls fleißige, intelligente Pflanzer. In ihrer langsamen Weise und trotz aller Unehrlichkeit der Beamten haben die Chinesen im ganzen genommen während der zweihundert Jahre, die sie wirklich auf Formosa waren, jedenfalls mehr zuwege gebracht als die Spanier auf den Philippinen in dreihundert Jahren.
Früher bildete Reis den wichtigsten Exportartikel von Formosa; allein durch die Unterwerfung so großer Massen von Eingeborenen, die früher von Jagd und Fischfang lebten, durch die große Zuwanderung und die starken aus China nach Formosa gesandten Truppenkörper stieg der Reisbedarf der Insel derart, daß der Export vollständig aufgehört hat. An seine Stelle tritt als wichtiger Ausfuhrartikel im Norden Thee, im Süden Zucker. Der Formosathee (Oolang) wird[S. 636] hauptsächlich nach Amerika ausgeführt und kommt nach Europa nur in ganz geringen Mengen, vermischt mit chinesischem Thee. Zucker wurde früher nach Europa und Australien ausgeführt. Durch das Fallen der Zuckerpreise hier lohnte sich der Export nicht mehr, und der größte Teil des Formosazuckers geht jetzt nach Japan und dem chinesischen Festlande. Man sieht also, welche Wichtigkeit die Landesprodukte Formosas für Japan besitzen, das dafür wieder mit den europäischen Staaten in Bezug auf die Einfuhr wetteifert. Dieselben Artikel, die es mit so vielem Erfolg auf den chinesischen Markt wirft, führt es auch in Formosa ein, und da die Insel nunmehr ganz in den Besitz Japans übergegangen ist, wird es mit der Einfuhr europäischer Waren in Formosa, die in den letzten Jahren durchschnittlich einen Wert von fünfzehn bis zwanzig Millionen Mark erreichte, nun ganz zu Ende sein. Ein großer Teil des Warenverkehrs zwischen Formosa, China und Japan erfolgte bisher auf deutschen Schiffen; auch diese dürften in Zukunft durch japanische ersetzt werden. Bisher hatte die japanische Nipon Yusen Kaisha, eine der größten Dampfergesellschaften der Welt, wohl regelmäßige Linien nach den benachbarten Lutschuinseln und den chinesischen Häfen Amoy und Futschau, die Formosa gegenüberliegen, aber nicht nach dieser Insel selbst. Einen Monat nach dem Friedensschluß schon wurde von der Yusen Kaisha beschlossen, nunmehr auch regelmäßig Dampfer nach Formosa laufen zu lassen. Geht diese Ausbreitung des japanischen Dampferverkehrs so weiter fort, so werden noch eine Anzahl anderer deutscher Dampfer, hauptsächlich die sogenannten Tramp Steamers, in Ostasien ihren Verkehr einstellen müssen. Die Japaner unterhalten heute schon regelmäßige Dampferverbindung unter japanischer Flagge mit Korea, China, den Philippinen, Indien, Java, Australien und sogar der Südsee. Eine der ersten Thaten der Japaner auf Formosa wird es auch sein, die Seidenzucht einzuführen, was den Chinesen bisher trotz mehrfacher Versuche nicht glückte. Heute schon ist Japan neben China das wichtigste Seidenland und erreicht bei einer Seidenausfuhr im Werte von jährlich sechzig Millionen Yen beinahe die Ausfuhr von Frankreich und Italien. Formosa wird die Produktion der Rohseide noch weiter vermehren, japanische Fabriken werden sie verarbeiten; und bei den alle Konkurrenz unmöglich machenden billigen Löhnen wird die Ausfuhr der Seidenstoffe aus Japan, die heute etwa siebzehn Millionen Yen erreicht, sehr bald zu ungeahnter Höhe steigen. Deutschland ist daran mit Frankreich und Italien lebhaft interessiert, denn wir besitzen eine jährliche Ausfuhr von Seidenwaren im Werte von hundertundsechzig Millionen Mark. Diese ostasiatische Konkurrenz wird in den kommenden Jahrzehnten eine Existenzfrage für Millionen werden.
Durch die Abtretung der Insel Formosa an Japan ist auch die Kampfererzeugung sozusagen ein Monopol der Japaner geworden, denn dieser in der Arzneikunde sowohl wie in manchen Industrien so ungemein wichtige Artikel wird nur auf den[S. 637] südlichen Inseln des Mikadoreiches und auf der Insel Formosa gewonnen. Wohl habe ich auch auf den Sundainseln, in Siam, Malakka, Andalusien und Westindien Kampferbäume angetroffen, aber Wälder und Pflanzungen dieser höchst wertvollen Bäume haben nur die japanischen Inselgruppen bis zum fünfunddreißigsten Breitengrad aufzuweisen, und die zivilisierte Welt wurde von diesen mit dem Bedarf an Kampfer versorgt. Bisher wurde die größte Menge des rohen Kampfers nach Europa (hauptsächlich nach London und Hamburg) sowie Nordamerika verschifft und dort in eigenen Raffinerien für den Gebrauch zubereitet. Von Formosa kamen sehr bedeutende Mengen zunächst in Hongkong auf den Markt, und durch diese wurde der Preis des japanischen rohen Kampfers innerhalb gewisser niedriger Grenzen gehalten. Dadurch aber, daß Formosa nunmehr an Japan gefallen ist, beherrschen die Japaner nicht nur den ganzen Markt, sondern sie dürften auch die Ausfuhr des Rohkampfers mit hohen Zöllen belegen, um dadurch die einheimischen Kampferraffinerien zu heben.
Die Japaner werden auch gewiß die beiden bisherigen Haupthäfen Formosas, Tamsui und Tainan, aufgeben und einen dritten Hafen, Kelung, an ihrer Stelle wählen. Tamsui und Tainan sind dem europäischen Handel seit 1858 geöffnet gewesen, es sind dort eine Anzahl europäischer, darunter auch deutsche, Firmen etabliert; dieselben haben Godowns und Hongs (Geschäfts- und Warenhäuser) mit großen Kosten aufgeführt und mit vieljähriger Mühe endlich den Handel auf eine gewinnbringende Grundlage gebracht. Damit dürfte es bald ein Ende haben; die Europäer werden ausziehen und den Japanern Platz machen müssen. Nicht etwa, daß sie durch Gewalt vertrieben würden, die Japaner werden sie einfach, figürlich gesprochen, aushungern. Die beiden Häfen Tamsui und Tainan sind nämlich den Dampfern nicht zugänglich; diese müssen weit außerhalb auf offener Reede liegen bleiben, und während des Südwestmonsuns, der hier sehr stark bläst, von den hier sehr häufigen Taifuns gar nicht zu sprechen, kommt es oft genug vor, daß die Schiffe, ohne Ladung zu löschen, nach den Pescadores oder gar nach Amoy oder Futschau weiterdampfen müssen. In Kelung, das nur etwa dreißig Kilometer östlich von Tamsui an der Nordostspitze von Formosa liegt, ist die Wassertiefe bis dicht an die Werften selbst für große Kriegsdampfer hinreichend, und überdies ist der Hafen durch eine vorliegende Insel gegen Stürme geschützt. Außerdem liegen dicht bei Kelung die großen Kohlenlager, die bisher Südchina, vor allem Futschau, mit Kohlen versahen. Kelung ist also unzweifelhaft der zukünftige Haupthafen Formosas, während Tamsui und Tainan nur den chinesischen Dschunkenverkehr, wenigstens zum Teil, behalten dürften.
Tamsui sowohl wie Tainan sind nicht etwa kompakte Ortschaften wie andere chinesische Hafenstädte. Beide sind nur Sammelnamen für mehrere Ortschaften. Etwa fünfzehn Kilometer südlich des mit Tamsui bezeichneten Küstenplatzes an[S. 638] der Nordspitze Formosas liegt nämlich an dem Taipeifluß die gleichnamige Hauptstadt der Insel. Tamsui besitzt nur das Zollamt, einige Warenhäuser und ein altes holländisches Fort mit einigen offiziellen Gebäuden. Die europäischen Kaufleute wohnen größtenteils in Tuatutiah, einige Kilometer stromaufwärts in der Nähe von Taipei gelegen; und noch weiter stromaufwärts liegt die Chinesenstadt Banka, an der Grenze des großen Reisdistrikts von Formosa. Taipei ist eine Schöpfung des Generalgouverneurs Liu; er ließ die Stadt ganz nach amerikanischem Muster, schachbrettförmig, mit breiten Straßen anlegen, eine Straße nach Tuatutiah bauen, die Stadt elektrisch beleuchten und baute sich aus dem Erlös der Bauplätze seiner Städtegründung einen herrlichen Yamen (offiziellen Palast); selbst japanische Jinrikshaws führte er in Taipei ein.
Ebenso wie Tamsui besteht Tainan, der südliche Hafen, aus drei Ortschaften. Tainan oder Taiwan-fu ist eine von Cantonesen gegründete Chinesenstadt, etwa sechs Kilometer von der Küste entfernt gelegen und durch einen für Dschunken passierbaren Kanal mit dem eigentlichen Hafen von Tainan, Anping, verbunden. Wenn auf den Landkarten Takao, etwa fünfundvierzig Kilometer weiter südlich gelegen, als europäischer Haupthafen angegeben steht, so ist dies unrichtig. In früheren Jahren war allerdings Takao der Hauptlandungsplatz der Schiffe, allein er ist, wie gesagt, fünfundvierzig Kilometer von der Stadt Taiwan-fu entfernt und nur durch einen elenden Karrenweg mit ihr verbunden. Außerdem war das Klima den europäischen Kaufleuten nicht zuträglich, trotz der herrlichen Vegetation Takaos und des hinter ihr gelegenen Ape-hill (Affenberg). Die Kaufleute und mit ihnen der Handels- und Schiffahrtsverkehr haben sich deshalb nach Anping gezogen, das auch der Sitz der Konsulate, darunter des kaiserlich deutschen Vizekonsulats, geworden ist. Statt Takao sollte deshalb auf den Landkarten Anping als Haupthafen verzeichnet werden. Ebenso müßte statt Taiwan auf den Landkarten Tainan oder Taiwan-fu stehen, denn Taiwan ist eine ganz andere Ortschaft, im Herzen der Insel gelegen und von Liu zur Hauptstadt derselben bestimmt. Daß die Schiffe in den Häfen nicht anlaufen können, sondern kilometerweit außerhalb der Schlamm- und Sandbänke im Meere ankern müssen, kommt ja nicht nur in Formosa, sondern in anderen Häfen Ostasiens vor. Aber nirgends ist die Brandung, besonders bei Südmonsun, so heftig wie hier, wo die Wellen der chinesischen Südsee mit voller Gewalt anprallen. Deshalb ist bei Monsun die Ladung nicht einmal in kleinen Booten möglich und kann nur mittels Catamarans erfolgen. Diese sind Flöße, bestehend aus zwölf etwa sieben Meter langen Bambusrohren, in deren Mitte eine Art Badewanne festgebunden ist. In diese müssen sich die Passagiere setzen, und so werden sie von den Wellen ans Land getragen, nicht ohne jedesmal gehörig durchnäßt zu werden. Aehnlich geht die Landung der Waren vor sich, und es ist deshalb begreiflich, daß die Japaner Kelung als Haupthafen vorziehen werden.
Die Japaner werden auch binnen kurzer Zeit die von den Chinesen längst projektierte Eisenbahn vollenden, welche die Insel von Nord nach Süd durchziehend, Kelung und Tamsui mit Anping verbinden soll und von der bisher nur etwa dreißig englische Meilen in Betrieb standen.
Der unternehmende Liu betraute 1887 europäische Ingenieure mit der Ausarbeitung der Linie, übertrug aber die Ausführung chinesischen Truppen. Der zwischen Tamsui und Kelung gelegene Höhenzug sollte mittels eines Tunnels durchbrochen werden, dem chinesischen General wollte indessen das schwarze Loch nicht recht einleuchten, und so gab er den Befehl, die Bergkette mitten durchzuschneiden. Nach jahrelanger, unsinniger Arbeit wurde dieses Projekt als unausführbar aufgegeben und der Tunnel doch ausgeführt. Aber die Chinesen scheuten sich, durch diese dunkle Höhle zu fahren, und monatelang nach der Eröffnung der Eisenbahn zwischen Tamsui und Kelung blieben die Züge diesseits des Tunnels stehen, und die Passagiere überkletterten mühsam den Höhenzug, während die Züge leer durch den Tunnel rasselten. Erst allmählich gewöhnten sich die Chinesen an die Durchfahrt.
Die Briefpost wird durchweg von Läufern besorgt, und die Gebühren für einen fünfzehn Gramm schweren Brief betragen beispielsweise zwischen Anping und Tamsui zweihundertfünfzig Cash, etwa fünfzig Pfennige. Diese in Formosa zur Verwendung gelangenden Cash sind die schlechtesten von ganz China, vielfach durchlöchert und großenteils aus Eisen hergestellt. Banken giebt es auf Formosa nicht, und da es sich bei der großen Ein- und Ausfuhr doch häufig um beträchtliche Summen handelt, werden von den chinesischen Hongs (Geschäftshäusern) gewöhnlich fünfzig mexikanische Silberdollars oder japanische Yen in eine Rolle gethan, und die Papierhülle wird mit dem Hongstempel versehen. Sind diese Hongs achtbar und angesehen, so wandern die Silberrollen ungeöffnet von Hand zu Hand, bis sie auseinanderfallen. Dann kommt gewöhnlich die sonderbarste Münzensammlung zum Vorschein. Falsche Münzen werden von den Hongs, welche die Rollen ausgegeben haben, sofort gegen echte umgewechselt.
Die japanische Verwaltung hat natürlich versucht, Ordnung in diese Verhältnisse zu bringen, zum Segen des Landes und seiner Einwohner; allein bisher ist dies den Japanern nicht gelungen. Die Eingeborenen setzen den neuen Herren den heftigsten Widerstand entgegen, und es ist gar keine Aussicht vorhanden, die Insel in absehbarer Zeit dem Frieden zuzuführen.
Von beachtenswerter Seite ist vor kurzem die Ansicht ausgesprochen worden, Japan werde sich kaum jemals zu einem Industriestaate entwickeln, sondern für immer vorzugsweise ein Ackerbaustaat und deshalb auch ein bedeutender Abnehmer fremder Industrieerzeugnisse bleiben. Auf welcher Grundlage diese Bemerkungen fußen, ist schwer zu erkennen, es sei denn, daß man die Verhältnisse in dem alten Japan, wie es vor 1870 war, als Maßstab angenommen hat. Damals war Japan allerdings ein Ackerbaustaat; aber man braucht nur die verschiedenen Zweige der nationalen Thätigkeit durchzusehen, um zu erkennen, daß sich in den letzten drei Jahrzehnten eine ganz entschiedene Umwandelung des ostasiatischen Inselreiches aus einem Ackerbaustaat in einen Industriestaat vollzogen hat. Mit jedem Jahre tritt diese Umwandelung kräftiger hervor, und setzt man einige Haupterzeugnisse Japans, wie Thee, Seide und Reis, beiseite, so wird man in Zukunft mit Japan als mit einem geradezu ausschließlichen Industriestaate zu rechnen haben, dessen mächtiger Einfluß auf die Ausfuhr Europas nach Ostasien und die Küstenländer des Stillen Ozeans sich von Jahr zu Jahr mehr fühlbar machen wird.
Dank der Anregung und Unterstützung durch die japanische Regierung, dank der Vermehrung der Bevölkerung in Japan um 25 Prozent innerhalb zweier Jahrzehnte, dank dem allgemeinen Erwachen und Anspannen der nationalen Thätigkeit, hat natürlicherweise auch der Ackerbau sehr bedeutende Fortschritte aufzuweisen, die hauptsächlich der Verbesserung der Bodenbewirtschaftung und der größeren Sorgfalt zuzuschreiben sind; denn die bebaute Bodenfläche hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht in dem gleichen Verhältnis vergrößert. Während beispielsweise die Reisländereien seit fünfzehn Jahren nur um 8½ Prozent zugenommen haben, beträgt die Zunahme der Reiserzeugung das Dreifache, nämlich 25½ Prozent. Die Getreideländereien haben um 20 Prozent, die Getreideerzeugung aber um 58 Prozent zugenommen. Die Zunahme von Thee und Seide ist noch beträchtlicher, denn sie betrug innerhalb der letzten fünfzehn Jahre bei Thee etwa 240 Prozent, bei der Seide sogar 300 Prozent. Zu diesen Stapelartikeln des japanischen Ackerbaues ist durch die Einverleibung Formosas in das japanische Reich auch noch Kampfer und vor allem Zucker gekommen. Bisher war Japan in Bezug auf Zucker hauptsächlich auf die Einfuhr vom Auslande angewiesen, und sein Bedarf an diesem für die deutsche Ausfuhr bekanntlich äußerst wichtigen Artikel steigerte sich von 28 Millionen Kilogramm im Jahre 1872 auf das Fünffache, nämlich gegen 150 Millionen Kilogramm im Jahre 1898, für die es an das Ausland etwa 58 Millionen Mark bezahlte. Die eigene Erzeugung war 1894 schon auf nahezu 50 Millionen Kilogramm gestiegen, und die Verhältnisse für die weitere Vermehrung[S. 641] der Zuckerplantagen im japanischen Reiche liegen so günstig, daß es mit der Einfuhr von Zucker vom Auslande her voraussichtlich bald ein Ende haben wird.
Die genannten Agrikulturzweige waren in Japan schon bei der Eröffnung des Landes für den ausländischen Handel vorhanden und haben nur eine Steigerung erfahren. Die heutige Industrie von Japan ist aber seither in weitaus den meisten Zweigen vollständig neu geschaffen worden, und der Wohlstand, die Zukunft und Stellung Japans in Bezug auf Ostasien liegt nunmehr hauptsächlich in seiner industriellen Weiterentwickelung. Alle Bedingungen sind dafür vorhanden: Kohle, Eisen, Kupfer, Gold, Silber, Wasserkraft, Transportmittel zu Lande und zu Wasser und endlich große Absatzgebiete in unmittelbarer Nähe. Dazu kommen die Förderung und Unterstützung der Regierung, die äußerst wohlfeilen Arbeitskräfte, die ein Drittel bis ein Fünftel der europäischen Löhne beziehen, und endlich die Gewißheit, daß seit der Einführung der neuen Verträge mit den europäischen Mächten die heimischen Industrien durch Erhöhung der Einfuhrzölle noch weiter beschützt und entwickelt werden können.
Die industrielle Entwickelung Japans steht in der Geschichte geradezu beispiellos da und wird in ihrem Umfange und in ihren Gefahren für den europäischen Markt in Ostasien immer noch nicht hinreichend gewürdigt. In den ersten Industriestaaten der Welt stellt sich das Verhältnis der Ausfuhr an Industrieerzeugnissen in Bezug auf die Gesamtausfuhr wie folgt:
Von der gesamten Ausfuhr sind Fabrikate in England 82 Prozent, in der Schweiz 75 Prozent, in Deutschland 65,9 Prozent, in Frankreich 55,6 Prozent, in Belgien 37,4 Prozent, in Oesterreich-Ungarn 27,2 Prozent, in Schweden 16,4 Prozent, in Amerika 9 Prozent.
In Japan, wo es vor dreißig Jahren überhaupt keine nennenswerte Ausfuhr an Fabrikaten gab, beträgt diese heute schon 38 Prozent, und Japan steht somit in der obigen Liste an der fünften Stelle und übertrifft sogar bereits Belgien. In den letzten fünf Jahren ist die Ausfuhr von Fabrikaten aus Japan um nahezu das Dreifache gestiegen, während die Ausfuhr von Rohmaterial ziemlich stationär geblieben ist. 1872 belief sich der Wert der japanischen Warenausfuhr auf kaum einige Millionen Mark, 1899 auf etwa 180 Millionen Mark. Die hauptsächlichsten Abnehmer der japanischen Fabrikate sind naturgemäß die asiatischen Länder, wohin die Ausfuhr innerhalb zweier Jahrzehnte um 650 Prozent gestiegen ist und heute einen Wert von 150 Millionen Mark besitzt. Australien hat bis 1880 von Japan beinahe gar keine Fabrikate bezogen, heute besitzen diese einen Wert von über 5 Millionen Mark jährlich.
Es ist von großem Interesse, die Entwickelung der einzelnen Industriezweige in Japan näher zu betrachten. Diese Entwickelung steht naturgemäß mit der Beschaffung billigen Brennmaterials, d. h. mit der Ausbeutung der reichen Steinkohlengruben[S. 642] in innigem Zusammenhang, die Japan zunächst auf der Insel Kiushiu besitzt. Im Jahre 1886 wurden schon 2 Millionen Tonnen Steinkohlen gewonnen, 1897 6 Millionen, die Produktion hat sich somit in einem Jahrzehnt verdreifacht. Der Preis der Kohle hat sich inzwischen mehr als verdoppelt. Jetzt macht japanische Kohle der englischen bereits in Vorderindien, in Bombay, Konkurrenz. 1898 hat der Wert der Steinkohlenausfuhr 39 Millionen Mark betragen. Im Inlande selbst hat sich der Bedarf der Fabriken an Kohle in demselben Zeitraum verzehnfacht.
Der zweitwichtigste Rohstoff, nämlich Roheisen, wurde 1862 noch in ganz unbedeutenden Mengen eingeführt, nämlich 33000 Kilogramm; im Jahre 1880 betrug diese Einfuhr 6 Millionen Kilogramm, 1891 14 Millionen, 1894 sogar 40 Millionen Kilogramm, die Zunahme seit 1872 ist demnach 12000 Prozent. Der Bedarf Japans an europäischem Roheisen im Werte von 16 Millionen Mark (1894) war natürlich für die europäischen Ausfuhrländer nutzbringend. Nun giebt es aber in Japan große Eisenlager, und binnen kurzem wird dieses Rohmaterial an Ort und Stelle gewonnen werden. Der Preis des in Japan eingeführten Roheisens stellt sich auf etwa 62 Yen pro Tonne, im Lande selbst kann es aber nach einer genauen Schätzung für 15 bis 20 Yen pro Tonne erzeugt werden. Im Marinearsenal von Yokosuka bei Yokohama wird schon seit mehreren Jahren mittels ganz neuer Methoden vorzüglicher Stahl gewonnen, und das Aufhören der Einfuhr von Roheisen in Japan ist fortan nur eine Frage der Zeit. 1898 wurde Roheisen nur mehr im Wert von 10 Millionen Mark eingeführt, darunter zum Nachteile der europäischen Produzenten auch schon chinesisches Roheisen.
Die japanischen Erzlager werden auf 70 Millionen Tonnen geschätzt. In neuester Zeit baute die Regierung in Bamstamura mit einem Kostenaufwand von 18 Millionen Mark ein großartiges Eisen- und Stahlwerk mit 2 Hochöfen und 200 Koksöfen und einer jährlichen Leistungsfähigkeit von 90000 Tonnen fertiger Ware.
In Bezug auf die Fabriken veröffentlicht der Ostasiatische Lloyd folgende bemerkenswerte Statistik:
Im Jahre 1883 gab es in Japan deren überhaupt nur 84 mit im ganzen etwa 1700 Pferdestärken. Im Jahre 1893 gab es bereits 1163 Fabriken mit etwa 35000 Pferdestärken, wovon 31165 durch Dampf- und 4142 durch Wasserkraft erzeugt werden. In einem Jahrzehnt hat demnach die Dampfkraft um 2226 Prozent, die Wasserkraft 2134 Prozent zugenommen. Dabei ist die letztere noch in ihrer Kindheit. Hunderte von Wasserläufen können in Japan der Industrie nutzbar gemacht werden, so daß die Erzeugungskosten noch weitere Verminderungen erfahren werden, gewiß in größerem Verhältnis, als die Arbeitslöhne steigen. In den Baumwollspinnereien haben die Löhne seit 1899 eine Steigerung von 37 Prozent erfahren und betrugen 1898 für männliche Arbeiter 47 Pfennig, für die weiblichen 28 Pfennig den Tag. In anderen Gewerben betragen die Löhne heute wie folgt:
Tagelöhner erhalten für den Tag 75 Pfennig, Träger 1 Mark 40 Pfennig bis 1 Mark 50 Pfennig, Tischler 1 Mark 10 Pfennig bis 1 Mark 20 Pfennig, Dachdecker 1 Mark 20 Pfennig, Tapezierer 1 Mark 10 Pfennig bis 1 Mark 20 Pfennig, Mattenweber 1 Mark 10 Pfennig bis 1 Mark 20 Pfennig.
Auch Elektrizität wird seit etwa fünf Jahren immer mehr als Triebkraft angewendet, und seit 1890 wurden in Japan Elektromotoren im Werte von 5 Millionen Mark eingeführt. Mit der Zeit werden jedoch auch diese im Lande selbst fertiggestellt werden, ebenso wie heute schon die Telegraphen- und Telephonapparate. In Osaka wird eben an einer elektrischen Anlage gearbeitet, für die Wasserkräfte von 15000 Pferdestärken zur Verfügung stehen. Die ganze Triebkraft in den Fabriken Osakas beläuft sich nach dem letzten Konsularbericht über die dortigen Industrien auf 25000 Pferdestärken, und die Eigentümer der elektrischen Anlagen berechnen die Ersparnis, die durch die Anwendung von Elektrizität an Stelle der Dampfkraft erzielt würde, auf eine Million Yen jährlich.
Osaka ist auch der hauptsächlichste Sitz der japanischen Baumwollspinnerei, also jener Industrie, die von allen wohl die größten Fortschritte gemacht hat. Die ersten Anfänge datieren aus dem Jahre 1871, als der Fürst von Satsuma, Schimadzu, einige Spinnmaschinen einführte. Die Revolution unterbrach die Entwickelung, und erst 1880 griff die Regierung die Sache wieder auf, indem sie fünf Spinnereien errichtete. Das Beispiel fand im Volke bald Nachahmung, denn schon im Jahre 1886 gab es in Japan 65000 Spindeln, 1891 war deren Zahl auf 354000, 1894 auf 664000 angewachsen, 1896 betrug sie über 800000 und 1899 eine und eine viertel Million. Die Produktion von Geweben [S. 644]verschiedener Art betrug 1883 etwa 2⅓ Millionen Meter, 1891 schon etwa 45 Millionen Meter und 1895 etwa 65 Millionen Meter. Der Bedarf an roher Baumwolle hat sich innerhalb eines Jahrzehntes verfünfundzwanzigfacht. 1885 wurde in Japan Rohbaumwolle im Werte von über 3 Millionen Mark eingeführt, im Jahre 1898 war diese Einfuhr auf 93 Millionen Mark gestiegen. Die Einfuhr von Baumwollgarnen von Europa erreichte ihren Höhepunkt im Jahre 1888, nämlich mit 31 Millionen Kilogramm, fast ausschließlich aus England. 1894, also sechs Jahre später, war diese Einfuhr auf 10 Millionen Kilogramm gesunken, und seinerseits exportierte Japan schon im vergangenen Jahre etwa 2½ Millionen Kilogramm nach China. Japan hat sich also in Bezug auf Baumwollgarne und Stoffe von Europa bereits unabhängig gemacht. Die Folgen davon sind deutlich zu spüren; in Lancashire arbeiteten 1895 gegen 100 Spinnereien mit Verlust, während jene von Japan 16 bis 25 Prozent Dividende abwarfen. Am empfindlichsten war die Entwickelung der japanischen Spinnereien für Indien. Im Jahre 1880 wurden von dort 4500 Ballen Baumwollgarne nach Japan eingeführt, 1897 nur mehr 750, und seither ist die Ausfuhr noch weiter gefallen.
Einen ähnlichen Aufschwung hat die Seidenfabrikation und die Seidenindustrie genommen, obschon die japanische Rohseide an Güte sich nicht entfernt mit der chinesischen Seide messen kann. Im Jahre 1889 betrug die Produktion 3½ Millionen Kilogramm, wovon 2¾ Millionen Kilogramm im Werte von über 100 Millionen Mark ausgeführt wurden; 1894 betrug die Erzeugung über 10 Millionen Kilogramm, die Ausfuhr aber 6¼ Millionen Kilogramm im Werte von 170 Millionen Mark. Das betrifft nur die Rohseide. Aber auch Seidenstoffe werden in ungeheuren Mengen ausgeführt, namentlich aus der Provinz Fukui, wo es im Jahre 1890 nur 2200 Webstühle mit 3000 Arbeitern gab. Im Jahre 1894 gab es schon 12500 Webstühle mit 12000 Arbeitern, hauptsächlich Mädchen, die als Arbeitslohn für das Stück Seide 50 Yen erhalten und den Monat 5 bis 10 Stück weben können. Die Ausfuhr von Seidenstoffen besaß 1885 einen Wert von 216000 Mark, im Jahre 1898 jedoch 35 Millionen Mark.
Die Teppichindustrie in Sakai, einer kleinen Stadt in der Nähe von Osaka, beschäftigt über 16000 Arbeiter. Im Jahre 1890 wurden aus Japan 27000 Teppiche ausgeführt, 1898 bereits 800000, und heute haben die japanischen Teppiche sogar in England einen ganz bedeutenden Markt, weniger wegen ihrer Qualität, als wegen ihrer hübschen, den orientalischen Teppichen nachgemachten Muster und ihrer großen Wohlfeilheit, ein Drittel bis ein Viertel des Preises der orientalischen Teppiche.
Eine interessante Statistik betrifft den Aufschwung einer ganzen Anzahl anderer Industrien, von denen die meisten vor einem Jahrzehnt überhaupt gar nicht bestanden haben. So z. B. betrug der Wert der Gesamtausfuhr in Mark im Jahre 1889 140 Millionen, im Jahre 1899 428 Millionen. In Bezug auf die Waren gestaltete sich die Ausfuhr folgendermaßen:
Zu den großgewerblichen Erzeugnissen, durch deren Herstellung die emsigen Japaner den Absatz der europäischen gleichartigen Erzeugnisse immer mehr beeinträchtigen, ist nunmehr auch noch das Bier getreten. Die bedeutendste Bierbrauerei in Tokio, die der Nihon-Bakuscha-Kaischa (zu deutsch: Japanische Biergesellschaft) stand vor etwa sechs Jahren am Rande des Zusammenbruchs; im Jahre 1895 aber verkaufte sie bereits 7515 Koku (etwa 13500 Hektoliter) Bier, und ihre Aktien stiegen daraufhin von 40 auf 80 Yen, beziehungsweise von 12½ auf 34 Yen. Nicht viel schlechter entwickeln sich die andern Bierbrauereien Japans, woraus der Rückgang der Ausfuhr deutscher Biere nach Englisch- und Holländisch-Indien, nach Japan, China, den Philippinen, kurz nach Ostasien, in der Zeit von 1891 bis 1895 von 96000 Hektoliter auf 81000 Hektoliter sich leicht erklärt.
Das Merkwürdigste in dem Aufschwung der japanischen Industrie ist die Mannigfaltigkeit der Produkte. Mit Ausnahme einer beschränkten Anzahl ganz spezieller Artikel, vornehmlich was die Chemie betrifft, wird heute in Japan alles erdenkliche hergestellt, und wenn auch die Qualität sehr viel zu wünschen übrig läßt, so werfen doch alle Industriezweige ansehnlichen Verdienst ab. Bedeutende Ausfuhrartikel sind z. B. Streichhölzer, Papiertapeten (Imitation von gepreßtem Leder), künstliche Blumen, Laternen, Vorhänge aus Glasperlen, Schildkrotartikel geworden. Japan hat heute drei große Flanellfabriken, für welche die Wolle aus Australien importiert wird. Die Fabrik in Osaka besitzt 250 Webemaschinen und 2000 Spindeln, aus Deutschland und England bezogen; in Osaka befinden sich ferner Fabriken von Wand- und Taschenuhren, Zahnbürsten, Unterwäsche aus Papier, Zuckerraffinerien, Papiermühlen, Druckereien und Schriftgießereien, im ganzen 2600 industrielle Etablissements mit 16000 männlichen und 20000 weiblichen Arbeitern. Im Maschinenbau sind ebenfalls großartige Fortschritte zu verzeichnen: die Japaner bauen bereits Lokomotiven, Eisenbahnwaggons, ja sogar ihre großen Panzerschiffe. Von 19 in den letzten 5 Jahren angeschafften Kriegsschiffen wurden nicht weniger als 12 auf japanischen Werften erbaut.
Mit dieser großartigen Entwickelung der Industrie hält auch jene des Transportwesens gleichen Schritt; die eine läßt sich ohne die andere nicht denken. Die Eisenbahnen haben innerhalb 27 Jahren um 12250 Prozent zugenommen, der Tonnengehalt der japanischen Dampfer hat in 24 Jahren um 1380 Prozent zugenommen. 1898 besaß Japan bereits 970 Dampfer mit 273000 Tonnengehalt, dazu 714 Segelschiffe mit 45000 Tonnengehalt. Schiffe japanischer Bauart besaß es 17000.
Diese ungeahnte und beispiellose industrielle Entwickelung Japans ist naturgemäß auch auf die Inlandsverhältnisse nicht ohne Einfluß geblieben. In jeder Hinsicht ist eine Steigerung der Preise eingetreten; Luxusartikel, wie z. B. Seide, sind im Preise um 30 bis 40 Prozent gestiegen, und ein japanisches Blatt veröffentlichte[S. 646] kürzlich eine Liste von 22 Artikeln, deren Kaufpreis in den zwei letzten Jahren um 24 Prozent gestiegen ist. Darunter befinden sich gerade die zum Lebensunterhalt wichtigsten Artikel, wie z. B. Reis, Gerste, Salz, Zucker, Brennmaterial, Metallartikel, Baumwollwaren.
Für eine weitere Reihe von Jahren wird sich die japanische Industrie in demselben Maße wie bisher wohl noch weiter entwickeln, aber mit der Zeit wird auf dem ostasiatischen Markte selbst Japan ein wichtiger und gefährlicher Konkurrent entstehen, nämlich China.
Freilich dürften darüber noch viele Jahrzehnte vergehen, und in diesen wird Japan aus dem chinesischen Handel von allen beteiligten Staaten den allergrößten Nutzen ziehen, denn es liegt an der Pforte zu dem chinesischen Reiche und kennt die Verhältnisse, Eigenheiten und Bedürfnisse des chinesischen Volkes wie kein anderes Industrieland. Die europäischen Mächte holen den Japanern während jeder Expedition, an denen sie beteiligt sind, einfach die Kastanien aus dem Feuer. Aber daran ist nichts zu ändern.
Dschiudschutsu ist ein japanisches Wort, das gewiß nur den allerwenigsten bekannt sein dürfte. Selbst Leuten, die jahrelang in Japan gelebt haben, wird es kaum jemals zu Ohren gekommen sein. Es steht in keinem mir bekannten Buche über Japan, und die einzige Abhandlung, die ich darüber gesehen habe, befindet sich in den Transactions of the Asiatic Society. Sie hat Kano Dschigoro, einen der größten Lehrer des Dschiudschutsu, zum Verfasser.
Aber das fremdartige unbekannte Wort wird gewiß mit der Zeit auch in Europa immer geläufiger werden, denn Dschiudschutsu ist der Schlüssel zum japanischen Volkscharakter in seinen Beziehungen zum Ausland, es ist das Geheimnis der Erfolge des fernen Inselreiches.
Dschiudschutsu heißt etwa: durch Nachgeben siegen.
Während die vielen Gebäude der kaiserlichen Hochschule in Tokio den modernen europäischen Baustil zeigen, steht mitten unter ihnen auch ein Haus in rein japanischem Stil mit dem Unterschied, daß es an Stelle der horizontal verschiebbaren Papierfenster Glasscheiben besitzt. Ueber der Thür dieses langen, niedrigen Gebäudes stehen in chinesischen Schriftzeichen die Worte Zui-ho-kwan, d. h. „Die Halle unseres heiligen Landes”. Tritt man in das Innere, so befindet man sich in einer geräumigen Halle ohne irgendwelche Einrichtungsstücke, nur daß der erhöhte Fußboden mit dicken, weichen Matten bedeckt ist. Zeitweilig ist diese Halle mit Studenten gefüllt. In der Mitte des Raumes, auf den weichen Matten, befinden sich dann vielleicht zehn bis zwölf junge Leute, nur mit einem dünnen Leibchen bekleidet, die anscheinend, immer zwei und zwei, im Ringkampf miteinander begriffen sind. Rings um sie stehen Gruppen von Studenten, welche mit der größten Aufmerksamkeit den verschiedenen Bewegungen der Ringer folgen. Aber ihr Gesichtsausdruck ist wie in Stein gegraben. Niemals zeigt sich irgend eine Freude, eine Teilnahme, niemals wird ein Wort des Beifalls hörbar. Ist ein Zweikampf zu Ende, dann treten zwei andere junge Leute vor, und so geht es oft stundenlang bei Grabesstille weiter.
In dieser Halle wird Dschiudschutsu gelehrt. Die vermeintlichen Ringkämpfe sind nicht solche, wie wir sie üben, und wie sie in England, Amerika, in der Schweiz und von den professionellen Ringkämpfern auch in Japan zur Vorführung kommen, sondern die uralte Kunst der Samurai, der japanischen Kriegerkaste, ohne Waffen zu kämpfen. Häufig wurden sie auf ihren Reisen, vielleicht im Lager oder zur Nachtzeit, überrascht und hatten keine Waffen bei der Hand, um ihre Angreifer mit solchen zu besiegen. Dann brachten sie Dschiudschutsu zur Anwendung, und gewöhnlich gelang es ihnen, selbst die stärksten Gegner kampfunfähig zu machen, ja lebensgefährlich zu verwunden, wenn nicht gar zu töten.
Für Dschiudschutsu ist keine besondere Körperkraft erforderlich, sondern langjährige Uebung, Kaltblütigkeit, Ruhe und die Kenntnis der menschlichen Anatomie. Schon als Knaben begannen die Samurai sich in dieser Kunst zu üben, und selbst für den Stärksten, Kräftigsten unter ihnen war eine siebenjährige fortdauernde Uebung erforderlich, um in Dschiudschutsu Meister zu werden. Die Geheimnisse dieser Kunst müssen bei den Samurai auf das strengste gewahrt werden, und auch heute scheinen ihre Nachfolger unter Eid verpflichtet zu sein, alle Finten als Geheimnis zu bewahren, weshalb darüber auch nichts oder doch nur sehr wenig in die Oeffentlichkeit gedrungen ist.
Der Meister des Dschiudschutsu bringt nicht seine eigene Körperstärke bis zur Ermüdung in den Kampf, sondern er verwendet die Stärke seines Gegners, um ihn zu besiegen. Er veranlaßt den Gegner zu einem heftigen Angriffe und weicht diesem geschickt aus, er verleitet den Gegner vielleicht zu dem Versuche, mit aller Kraft seinen Arm auszurenken, aber während wir gewöhnlich mit Aufwendung unserer Kraft einem solchen Versuche entgegenarbeiten, giebt der Meister des Dschiudschutsu plötzlich geschickt nach, der Widerstand hört auf, und durch die unwillkürliche Weiterbewegung renkt sich der Gegner seinen eigenen Arm aus. Für jede Stellung, jeden Angriff giebt es eine derartige Finte, die nicht auf Stärke, sondern auf Geschicklichkeit und genauester Kenntnis des menschlichen Körperbaues beruht und die, wenn erfolgreich, ein ausgerenktes Gelenk oder ein gebrochenes Bein oder ein gebrochenes Genick zur Folge hat. Der Kenner des Dschiudschutsu siegt nicht durch den Angriff, sondern, wie das Wort selbst besagt, durch Nachgeben, ja er thut mehr als das, er unterstützt das Nachgeben durch einen schlau berechneten Kunstgriff, gegen welchen Stärke allein nicht gewachsen ist.
Es ist schwer, ein für unsere Verhältnisse verständliches Beispiel davon zu geben. Auch der spanische Stierkämpfer verwendet Dschiudschutsu und besiegt dadurch den Stier desto leichter, je stärker und massiger dieser ist. Soll er den Todesstoß ausführen, so verleitet er das wütende Tier, auf das entfaltete rote Tuch in seiner ausgestreckten Linken loszustürzen; dann springt er geschickt zur Seite, ohne daß der massige Stier dieser raschen Bewegung folgen kann, und stößt ihm den Degen in den Nacken. Das ist auch Dschiudschutsu, aber lange nicht so fein, so geschickt und kunstvoll wie das Dschiudschutsu der Japaner, von welchem das, wie es im Zweikampf zum Ausdruck kommt, nur eine der vielen Verwendungen ist. Dschiudschutsu ist nämlich nicht allein auf die Abwehr eines persönlichen Angriffes berechnet, es ist eine ganze Wissenschaft für den Schwachen gegenüber dem Starken, ein, wie Lafcadio Hearn in einem seiner Bücher sagt, philosophisches, ein ökonomisches und ethisches System. Es lehrt, wie man der Kraft nicht Kraft gegenüberzustellen braucht, sondern, wie man den Angriff leitet und zu eigenen Gunsten verwendet, es lehrt im Gegensatz zu den geraden Wegen des Abendländers die krummen Wege[S. 649] des Orientalen, und es ist demnach beinahe der Ausdruck eines Rassengeistes, der von den in Ostasien interessierten Mächten verstanden werden muß, wenn sie dem Japaner erfolgreich gegenübertreten wollen.
Wie der einzelne Samurai Dschiudschutsu benutzt, so war das ganze Auftreten der Japaner gegenüber dem Auslande bisher nichts weiter als Dschiudschutsu. Man wird es in der ganzen Geschichte des letzten Jahrzehntes als den Grundton der japanischen Politik vorfinden, und ist Japan aus seinen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Krisen bisher erfolgreich hervorgegangen, so hat es dies hauptsächlich gerade diesem, den japanischen Staatsmännern so geläufigen Dschiudschutsu zu danken.
Welcher Japanschwärmer (und Europa hat deren so viele!) hätte nicht vor zwei Jahrzehnten mit Bestimmtheit darauf gerechnet, Japan würde die abendländische Kultur in Bausch und Bogen annehmen, nicht nur die Industrie, Verkehrsmittel und Wissenschaften, sondern auch die Moral, und vor allem das Christentum? Wer hätte nicht darauf gerechnet, die Japaner würden mit der europäischen Kleidung auch europäische Sitten annehmen, ihr Land den Europäern öffnen, europäisches Kapital durch Gewährung günstiger Bedingungen heranziehen, um seine natürlichen Hilfsquellen zu entwickeln? Man hielt die Japaner für so aufgeweckt, so intelligent, so ehrlich und gerade, daß man auf das Entstehen eines europäischen Kulturstaates in Ostasien hoffte, man half ihnen bona fide in jeder Hinsicht, man hielt ihnen sozusagen die Leiter, damit sie leicht und bequem emporklettern konnten. Es war aber alles im Grunde genommen nur Dschiudschutsu, ein Spielen der Schwachen mit den Kräften der Stärkeren, ein rücksichtsloses Ausbeuten dieser Stärkeren zur Förderung ihrer eigenen nationalen Bestrebungen, ein Kampf zwischen den Orientalen und den Europäern, bei welchem die letzteren einfach an der Nase herumgeführt wurden. Es wäre gut, das in allen Einzelheiten aufzudecken, als Warnung für die Zukunft. Besonders für das Deutsche Reich ist es von Wichtigkeit, jetzt, nachdem dasselbe in Ostasien festen Fuß gefaßt hat und nicht nur in China, sondern auch im Stillen Ozean der Nachbar von Japan geworden ist.
Man halte sich doch ein wenig das Werden des modernen Japan vor Augen: überallhin hat es seine äußerlich so bescheidenen, liebenswürdigen und zutraulichen Sendboten ausgesandt, um Industrieen, Wissenschaften, Armeen zu studieren, ohne daß man dabei etwas anderes vermutete als den guten Willen, sich ganz auf die europäische Kulturstufe emporzuheben. Ja, einer der besten Kenner des fernen Ostens, der frühere englische Gesandte Sir Harry Parkes, berichtete an seine Regierung, Japan thäte dies alles nur aus Nachahmungsgeist, ohne ernste Ziele, und es würde sich aus Japan eine Art südamerikanische Republik entwickeln!
Was geschah in Wirklichkeit? Japan holte sich alle unsere modernen Erfindungen und Entdeckungen, es prüfte alle Systeme, die es vorfand, und nahm sie im eigenen[S. 650] Lande nicht etwa gerade so auf, nein, es verwendete sie nur so weit, als sie zur Förderung seiner Starke nötig waren. Es benutzte Europa, wie gesagt, als eine Stufenleiter, über welche es hinwegschritt, um an die Spitze des fernen Orients emporzugelangen. So ist das heutige Japan als Nachbar der deutschen Kolonien in Ostasien nicht etwa, wie man gehofft hatte, ein europäisches Kulturreich, sondern trotz seiner modernen Armee, trotz seinen Eisenbahnen, Telegraphen und Maschinen ebenso orientalisch, ebenso japanisch, wie vor Jahrhunderten. In dem Kampfe, der sich zwischen den europäischen Großmächten und außereuropäischen selbständigen Reichen seit geraumer Zeit abspielt, sind die meisten der letzteren unterlegen, Japan allein ist es geglückt, die Kräfte des Stärkeren auszunützen, um selbst stark aus dem Kampfe hervorzugehen. Es hat einfach das wunderbare, ihm eigene System der Selbstverteidigung angewendet, das nationale Dschiudschutsu.
Ich habe im Laufe der letzten Jahre unzählige Male Gelegenheit genommen, in Zeitungen und Vorträgen auf diese eigentümliche Wandlung Japans, also stets innerhalb des Rahmens seiner nationalen Eigenart, hinzuweisen. Japan ist ganz Japan geblieben und wird auch Japan bleiben. Man entgegnete mir, beispielsweise in Bezug auf die Kleidung, die Regierung hätte doch die europäischen Trachten eingeführt, der Kaiser sei mit gutem Beispiel vorangegangen, und er besitze eine solche Machtfülle und Autorität, daß die Japaner gewiß binnen kurzem seinem Beispiel folgen würden. Man rechnete auf einen ungeheuren Markt von Kleidern, Stiefeln, Hüten, Wäsche und dergleichen in Japan, und ich erhielt selbst zahlreiche Anfragen von Kaufleuten und Industriellen in Bezug auf diese kommenden „großen Geschäfte”. Es war alles nur Dschiudschutsu, alles Schein. Die abendländischen Trachten sind für Japan geradezu unmöglich und undenkbar. Der Japaner hätte nicht nur seine eigenen Füße in die engen Lederstiefel zu zwängen, sondern ich möchte sagen auch seine ganze Lebensweise, er müßte sein Hauswesen, die Einrichtung seiner Wohnung von unterst zu oberst stürzen. Seine schlafrockartige Nationalkleidung, der Kimono, gestattet ihm, direkt auf dem Boden niederzuhocken; er bedarf deshalb auch keiner Stühle, keiner Tische; seine nationale Kleidung ist auch im Winter warm genug, um ihm den Ofen entbehrlich zu machen. Die so leicht abzustreifenden Holzsandalen gestatten ihm, in seinem Hause in Socken einherzugehen und demnach den Fußboden mit feinen weißen Matten zu bekleiden. Die Einführung der Stiefel würde Dielen oder Parkettböden zur Folge haben, die Einführung von europäischen Kleidern Oefen zum heizen der Wohnungen, die Oefen würden wieder die feuergefährlichen Holz- und Papierwände unmöglich machen.
Die europäischen Hosen gestatten kein Niederkauern auf die Waden; es müßten nun in allen Haushaltungen Stühle und damit auch Tische eingeführt werden. All das wäre gleichbedeutend mit dem Umbau oder vielmehr Niederreißen der bisherigen Wohnhäuser und dem Aufbau, der Einrichtung neuer Häuser. Wo aber sollten die[S. 651] fünfundvierzig Millionen Japaner, im ganzen großen ein armes Volk, das Geld hernehmen, um nicht nur neue Kleider zu kaufen, sondern auch neue Wohnhäuser zu bauen? Wer sich das vor Augen hält, der sieht, wie unsinnig die Hoffnung der Japanenthusiasten in dieser Hinsicht war.
Aber selbst in den Hofkreisen und in den Regierungsämtern ist die europäische Tracht nur im öffentlichen Dienste eingeführt. Als ich die Ehre hatte, vom Kaiser in Privataudienz empfangen zu werden, hörte ich, daß er zu diesem Zwecke die europäische Militäruniform erst anlegte, vor und nach der Audienz trug er, wie in seinen Privaträumen überhaupt, den Kimono. Der Minister des Aeußern empfing mich in seinem Bureau im Ueberrock nach abendländischen Schnitt; als ich ihn einige Stunden später im Klub traf, trug er den Kimono. Als ich nach Korea reiste, stiegen mit mir eine Anzahl gestiefelter und gespornter Kavallerieoffiziere, den Säbel zur Seite, den Revolver im Gürtel, auf das Schiff, um sich zu ihren Truppenkörpern an die Front zu begeben. Eine halbe Stunde später kamen sie, ihre sonst nackten Körper nur mit einem Kimono bekleidet, die nackten Füße in Sandalen steckend, aufs Verdeck. In der Reichshauptstadt tragen die Beamten nur in ihren modern europäisch eingerichteten Aemtern europäische Kleidung; zu Hause und im Privatleben kleiden sich nicht nur sie, sondern auch alle Generale und Admirale und Polizeikommissare gut japanisch. Sonst haben nur noch die Aerzte, Studenten und eine kleine Klasse von eingefleischten Reformfreunden unsere Kleidung. Die großen Massen der Japaner aber, von tausend neunhundertneunundneunzig, sind urjapanisch geblieben. Als ich mich erkundigte, warum in den Aemtern überhaupt unsere Kleidung getragen würde, antwortete man mir: des guten Eindruckes wegen, im Verkehr mit Diplomaten, Ausländern und dergleichen. Also wieder Dschiudschutsu.
Es geschieht aber nicht nur aus ökonomischen und Bequemlichkeitsgründen, wenn die Japaner an ihrer altjapanischen Kleidung festhalten, es geschieht aus Nationalstolz und gleichzeitig aus Mißachtung der Ausländer, um nicht zu sagen Haß gegen dieselben. Sonst würde man doch in den geöffneten Häfen, in Yokohama, Nagasaki, Kobe, wenigstens vereinzelt europäisch gekleidete Japaner und japanische Häuser im europäischen Baustil antreffen. Aber auch dort sind ausschließlich die Fabriken, Arsenale, Brauereien, Post- und Zollämter notwendigerweise im europäischen Baustil, alles andere ist trotz dem innigen Verkehr und Beisammenleben mit den Europäern urjapanisch: Baustil, Kleidung, Religion, Festlichkeiten, Sitten und Gebräuche.
Aehnlich ist es mit der Moral gegangen. Wir betrachten die Monogamie als unzertrennlich von der europäischen Kultur. Die Japaner nahmen sich aber von dieser nur, was sie davon brauchen konnten. Die Monogamie paßte nicht zu ihren Sitten, und so sind sie Polygamisten geblieben, vom Kaiser abwärts. Die Geishamädchen, die leichtfertigen Yoshiwaras, der Verkauf der Töchter durch die Eltern,[S. 652] alles ist noch beim alten. Was den Japanern paßte, war die Unterstellung der Yoshiwaras unter die Sitten- und Sanitätspolizei, und deshalb wurde sie eingeführt. Wie elastisch die berühmte „europäische Kultur” der Japaner in Bezug auf die Moral ist, dafür genügt die folgende Notiz, welche noch 1897 die Runde durch die europäischen Blätter machte: „Die japanische Regierung erteilt jetzt in Menge armen Eltern die Erlaubnis, ihre Töchter zu verkaufen, damit die Familien Brot in das Haus bekommen. Die zur Zeit in Japan herrschende Hungersnot ist so furchtbar, daß die Regierung diesen schmachvollen Handel sogar ermutigt. Für die Eltern jedes Opfer zu bringen, um sie vor Entbehrungen zu bewahren, ist in Japan etwas Selbstverständliches. Das Mädchen verkauft sich als zweite Frau an einen reichen Japaner. Ihr Alter muß mindestens zwölf Jahre betragen. Der Kaufpreis beträgt jetzt nur fünfundzwanzig Frank, unter gewöhnlichen Verhältnissen aber tausend Frank. Der Kaufkontrakt wird gerichtlich abgeschlossen. Nach drei Jahren muß der Käufer das Mädchen freilassen, sobald das Geld, welches er für dasselbe verwendet hat, ihm zurückgezahlt ist, und nach sechs Jahren ist das Mädchen überhaupt wieder frei ohne irgend welche Zurückzahlung.”
Ebensowenig, wie ohne Moral, können wir uns die europäische Kultur ohne Christentum denken. Aber die Japaner stehen diesem nicht nur feindlich oder doch vollkommen gleichgültig gegenüber, sie sind überhaupt trotz Buddhismus und Shintoismus kein religiös angelegtes Volk. Als im Jahre 1549 einer der größten Apostel der katholischen Religion, der heilige Franziskus Xaverius in Kagoschima auf der Insel Kiushiu landete, war allerdings Aussicht vorhanden, die Japaner zum Christentum zu bekehren, denn vor allem war der heilige Eifer und die Ueberzeugungskraft dieses erfolgreichsten aller Missionare des Christentums unwiderstehlich; überdies benutzten die Heerführer der zwei großen damaligen Daimioparteien, der Minamoto und Taira, das Christentum für ihre politischen Zwecke, und der gelehrte Japanforscher Ernest Satow führt als weiteren Grund ein historisches Dokument des Daimio von Yamagutschi an, in welchem dieser den katholischen Missionaren Konzessionen erteilt, damit „sie die Religion des Buddha predigten”, denn in ihrer Unwissenheit betrachteten die Japaner damals die christliche Lehre als eine höhere Form des Buddhismus.
Die schreckliche Niedermetzelung der Christen im siebzehnten Jahrhundert ist bekannt, und seither ist das Christentum in Japan nicht mehr wiedererstanden. Wohl gestattete Japan später wieder die Religionsfreiheit, aber doch nur aus Gründen des Dschiudschutsu. Die Regierung konnte den europäischen Mächten gegenüber in dieser Hinsicht keinen Widerstand entgegensetzen, wollte sie als Regierung eines Kulturstaates gelten, und sie konnte um so leichter die Missionare ins Land lassen, als sie wußte, daß, um nur ein Beispiel hervorzuheben, die christliche Lehre, welche es dem Gatten gebietet, Vater und Mutter zu verlassen, um dem Weibe zu[S. 653] folgen, mit den Grundgesetzen der japanischen Kultur in allerdirektestem Widerspruch steht und auf großen Erfolg der Missionare also nicht zu rechnen war. Wieder Dschiudschutsu, durch Nachgeben siegen. Die Regierung hatte richtig gerechnet. Nur die katholische Religion mit ihren 92 Missionaren hat verhältnismäßig Erfolg, denn trotz der geringen Mittel, die den letzteren zu Gebote stehen, haben sie doch eine Gesamtzahl von etwa 50000 Katholiken im Lande. Hätte die Regierung wirklich die Absicht gehabt, aus Japan einen europäischen Kulturstaat zu machen, sie hätte das Christentum als Staatsreligion einführen können, aber statt den europäischen Glauben führte sie im Gegenteil den altjapanischen heidnischen Glauben, Shinto, als Staatsreligion ein und läßt nicht nur dem Kaiser, sondern auch den Bildnissen des Kaisers dieselbe Verehrung vom Volke zu teil werden, wie einem Gott. Wie die Japaner in dieser Hinsicht den europäischen Mächten und deren Gesandten in Tokio scheinbar nachgaben und dabei doch ihre eigene Stellung stärkten, so geschah es auch mit der Eröffnung ihres Landes für europäischen Handel und Industrie. Alles nur Dschiudschutsu, bei welchem nicht nur politische Schachzüge, sondern auch vornehmlich Rasseninstinkt mitwirkten.
Japanenthusiasten frohlocken über den vermeintlichen Einzug der europäischen Kultur in Japan. Herrscht diese irgendwo in einem Staate, so gilt es wohl als selbstverständlich, daß dieser Staat den fremden Touristen, Kaufleuten und Industriellen und dazu auch ihren Unternehmungen geöffnet ist. Könnte man sich etwa England oder Frankreich denken, mit verschlossenem Inland und nur fünf oder sechs Häfen, in welchem Ausländer wohnen und Handel treiben dürfen? Genau dasselbe that aber Japan, und doch verstand es, überall den Glauben an seine europäische Kultur zu erwecken. Seine Emissäre, Studenten, Beamten durchzogen frei und ungehindert die ganze Welt, das eigene Inland aber blieb dieser Außenwelt verschlossen. Der Grund war, wie gesagt, Rasseninstinkt, der sich zuweilen auch bei uns, aber nur untergeordneten Rassen gegenüber, geltend macht. So verschlossen sich Amerika und Australien der chinesischen Einwanderung, weil die Chinesen den Kaukasier in den Lebensbedingungen unterbieten und bei ungehinderter Einwanderung den Kaukasiern von unten herauf Konkurrenz machen könnten. Die Japaner haben den Spieß umgedreht. Der Kaukasier überbietet in seinen Lebensbedingungen den Orientalen, er bringt ihm von oben herab Konkurrenz, gelangt durch seinen Reichtum, sein Wissen, seine Energie, seine positiven Eigenschaften zur Herrschaft, wie der Chinese etwa gewissermaßen durch seine negativen Eigenschaften. Das erkannten die Japaner, oder fürchteten es wenigstens, und bei ihrem ausgesprochenen Nationalstolz traten demgegenüber alle anderen Rücksichten, die Erschließung der natürlichen Hilfsquellen Japans durch Europäer, die Hebung des nationalen Reichtums, die Erhöhung der Einnahmen und dergleichen, in den Hintergrund. Die Japaner haben gesehen, daß, wo immer Europäer in einem außereuropäischen Lande freie Hand bekamen, dieses Land früher[S. 654] oder später seine Selbständigkeit verlor, und deshalb hielten sie ihr Land verschlossen, bis ihre eigenen Einwohner in politischer, kommerzieller und industrieller Hinsicht selbständig geworden waren und das Heft demnach in Händen hielten. Europäische Lehrmeister halfen ihnen dazu auf jedem einzelnen Gebiete, und wußten die Japaner, was sie wissen wollten, dann wurden die europäischen Lehrer entlassen und aus dem Lande geschickt.
Nun konnte dem Druck der Mächte in Bezug auf die Aufschließung des Landes nachgegeben werden, aber auch nur mit Dschiudschutsu, welches dieses Nachgeben in einen glänzenden Sieg für Japan verwandelte. Das Land wurde geöffnet, Ausländer dürfen im Inlande wohnen und Handel treiben, sie mußten aber dazu ihre eigene Gerichtsbarkeit aufgeben und sich der japanischen Gerichtsbarkeit unterwerfen. Ihre bisher ihnen gehörigen Landkonzessionen in den offenen Häfen fallen an Japan zurück; sie dürfen in Japan keinen Grundbesitz käuflich erwerben, sondern nur auf eine gewisse Zeit mieten, und nach dem Tode des Mieters fallen die Grundstücke auch vor Ablauf der Mietzeit an Japan zurück. Der Küstenhandel ist ihnen nicht gestattet, selbst nicht mit einigen der bisher offenen Häfen, und aller Handel der Ausländer wird empfindlich besteuert.
Auf diese Art wird den Europäern in Japan kein besonders verlockender Aufenthalt geboten, ja der Vertrag ist eher geeignet, die dort seit Jahren und Jahrzehnten ansässigen Europäer aus Japan zu vertreiben. Ihr Handel mit den Japanern war nur durch ihre gesicherte Stellung und im Schutze ihrer eigenen europäischen Gerichte halbwegs einträglich. Nun sollen sie sich den japanischen Richtern unterwerfen? Wohl nur ein Bruchteil dürfte sich dazu entschließen. Japan hat sein Land den Europäern erschlossen, aber so, daß es von diesen in Zukunft voraussichtlich mehr verschont bleiben wird als bisher. Wieder Dschiudschutsu, durch Nachgeben siegen.
England war es diesmal, das sich zuerst übertölpeln ließ; die anderen Mächte folgten, obschon die Notwendigkeit dafür keineswegs selbstverständlich erscheint.
Sechzehn Mächte mit sechzehn Gesandten standen den Japanern gegenüber, aber das japanische Dschiudschutsu half diesen über alle Argumente hinweg und gab ihnen die vollständige Unabhängigkeit und Gleichstellung mit den ersten Mächten der Erde, ohne daß sie dafür irgend etwas geopfert hätten, ja im Gegenteil, sie eroberten sogar alle Verluste und Nachteile ihrer früheren Verträge zurück.
Diese politischen Siege wurden durch den erfolgreichen Krieg mit China erheblich gestärkt, er hat den Japanern Zuversicht in ihre militärische, den Europäern abgelauschte Organisation gegeben, er hat das Nationalgefühl gehoben, die Parteien dem Auslande gegenüber geeinigt, so daß Japan schon heute auf weitere Erwerbungen in Asien, auf festeres Auftreten gegenüber den europäischen Mächten spekuliert. Nichts bringt dies klarer zum Ausdruck als eine damalige Rede des früheren Ministers des Auswärtigen, Graf Okuma, in der es heißt:
„Die europäischen Mächte zeigen bereits Anzeichen des Verfalles, und das kommende Jahrhundert wird Zeuge sein von der Zertrümmerung ihrer Verfassung und dem Auflösen ihrer Reiche. Selbst wenn das nicht eintreten sollte, werden ihre Hilfsquellen durch die erfolglosen Versuche zur Kolonisation aufgebraucht sein. Wer soll dann ihr Nachfolger werden, wenn nicht wir? Welcher Staat, ausgenommen Deutschland, Rußland, Frankreich, Oesterreich und Italien, kann binnen einem Monat 200000 Mann ins Feld stellen? In Bezug auf intellektuelle Kraft ist der Japaner den Europäern in jeder Hinsicht gewachsen, ja, noch mehr. Haben die Japaner nicht die Vervollkommnung einer Erfindung zuwege gebracht, welche den Europäern trotz jahrelanger Arbeit nicht gelang? Unser Volk setzt durch die Vorzüge seiner Arbeit sogar das erste Arbeitsvolk, die Franzosen, in Erstaunen. Wahr ist es, unser Volk ist klein von Statur, aber die Ueberlegenheit des Körpers beruht nicht auf der Größe, sondern auf der Konstitution. Ist die Revision der Verträge vollzogen, und hat Japan China besiegt, dann sollten wir eine der ersten Großmächte der Welt werden, und keine andere Macht könnte sich in irgend eine Unternehmung einlassen, ohne zuerst uns zu befragen. Japan könnte dann mit Europa in Wettbewerb treten als der Vertreter der orientalischen Rassen.”
Diese Sätze geben viel zu denken, zumal die für Europa so ungünstigen Vertragsbestimmungen zur Einführung gekommen sind, und der Krieg mit China in der That den Japanern die leitende Stellung in Ostasien gegeben hat. Schon denkt es an das von Okuma angedeutete, wenn nicht klar ausgesprochene Zusammengehen der orientalischen Rassen, denn erst kürzlich drang die Nachricht zu uns nach Europa, daß Japan sich um den Abschluß eines Bündnisses mit China bemüht. Dieses ist durch das Einschreiten Rußlands vorläufig verhindert worden, aber schon der Versuch allein sollte dem Europäer zu denken geben. Schon haben beachtenswerte Gelehrte wiederholt die Ansicht ausgesprochen, daß unser Erdball niemals ganz durch das Abendland beherrscht werden wird und daß die Zukunft den orientalischen Rassen gehört, und wer diese letzteren, vor allem die Japaner und die Chinesen, kennen gelernt hat, der wird solche Ansichten leider nicht ohne weiteres von der Hand weisen können. Darüber, daß die europäischen Völker den orientalischen weitaus überlegen sind, herrscht wohl nirgends ein Zweifel, ebenso wahr ist es aber auch, daß die orientalischen Völker die fähigsten zum Ueberleben sind. Schon in der gewöhnlichen Lebenskraft stehen die abendländischen Völker weit hinter den Orientalen zurück. Die letzteren haben sich unsere so teuer erkauften Erfindungen und Errungenschaften ohne irgend welche Gegenleistung angeeignet und verwenden sie, ohne auch nur entfernt unsere Bedürfnisse zu haben. Der Lebensunterhalt eines Abendländers genügt für mindestens ein Dutzend Orientalen. Unser Lebens- und Ernährungsprozeß ist viel zu kostspielig, als daß wir in einem künftigen Wettlaufe mit den jetzt schon viel zahlreicheren Orientalen dort ganz sicher als Sieger[S. 656] hervorgehen sollen. Gerade in den künstlichen und kostspieligen Verhältnissen, welche mit unserer Ueberlegenheit verbunden sind, liegt unsere Schwäche. Wohl wird demgegenüber entgegnet, daß, je mehr die Orientalen sich unserer Kultur ergeben, auch ihre Bedürfnisse sich in demselben Maße steigern werden, wie es thatsächlich schon in Japan der Fall ist. Aber bleiben wir denn in dieser Hinsicht stehen? Steigern sich nicht auch vielleicht in noch größerem Verhältnis unsere Bedürfnisse? Man braucht nur an die Zeit unserer eigenen Väter zu denken, um zu sehen, wie sich unsere ganzen Lebensbedingungen verbessert, aber auch entsprechend verteuert haben, und wird das, wie bisher, nicht auch in Zukunft der Fall sein?
Die durch die Verträge mit Japan anerkannte Gleichstellung der Europäer mit den Japanern, die Unterstellung der ersteren unter die Gesetze der letzteren, die vermehrten Handelsbeziehungen mit Ostasien, die immer steigende industrielle Thätigkeit des Abendlandes und dementsprechend auch das Bedürfnis immer größerer Absatzgebiete, die Erwerbung von Kolonien in China und im Stillen Ozean und damit auch die gefährliche Nachbarschaft eines Reiches wie Japan bringt die vorhin ausgesprochenen Fragen der Gegenwart immer nachdrücklicher vor Augen. Nicht nur Ostasien ist in den Vordergrund gerückt, auch die Ostasiaten sind es, und es ist deshalb keineswegs zwecklos, noch einmal in die Warnungstrompete zu stoßen. Ein bißchen weniger Vertrauensseligkeit in Bezug auf die Orientalen wäre gewiß von größtem Nutzen. Man hat bisher wohl sehr viel mit den ostasiatischen Reichen sich beschäftigt, aber wenig mit dem eigenartigen, verschlossenen, schwer zu erfassenden Charakter ihrer Völker.
S. Wells Williams „The Middle Kingdom”.
C. F. Gordon Cumming „Wanderings in China”.
Archdeacon Moule „New China and old”.
Chester Holcombe „The real Chinaman”.
Dyer Ball „Things chinese”.
W. Spencer Percival „The Land of the Dragon”.
Knollys „English Life in China”.
Leon Rousset „A travers la Chine”.
Eugen Simon „La Cité chinoise”.
Griffis „The Mikado’s Empire”.
Douglas Sladen „The Japs at home”.
W. T. Finck „Lotostime in Japan”.
Henry Normann „The Real Japan”.
Chamberlain „Things Japanese”.
Alice Bacon „Japanese girls and woman”.
Alice Bacon „A Japanese Interior”.
de Riseis „Giappone moderno”.
Morse „Japanese Homes”.
Knollys „Sketches of Life in Japan”.
Scydmore „Jinrikishaw days in Japan”.
Ch. Loonen „Le Japon moderne”.
Comte Dalmas „Les Japonais”.
„Ostasiatischer Lloyd”.
„Pekinger Staatszeitung”.
„North China Daily News”.
„North China Herald”.
„Eastern World” „Japan Daily Mail”.
Ernst v. Hesse-Wartegg „Schantung und Deutsch-China” (Leipzig, J. J. Weber).
„Journal of the China Branch of the Royal Asiatic Society”.
Die chinesischen Illustrationen wurden großenteils nach photographischen Aufnahmen des Verfassers, ferner nach Photographien von D. K. Griffith in Hongkong, Kae Hing in Hongkong und Sze Yuen Ming & Co., 42 Nanking Road, Shanghai hergestellt. Besonders das letztgenannte Haus besitzt eine sehr große Auswahl chinesischer Photographien zu billigen Preisen und kann besonders empfohlen werden. — Die Photographien für die japanischen Illustrationen wurden teilweise von Kelly & Walsh, Buchhändler, Yokohama bezogen.
Siam, das Reich des weißen Elefanten. Leipzig, J. J. Weber, 1899. Preis 15 Mark.
Schantung und Deutsch-China. Leipzig, J. J. Weber, 1899. Preis 14 Mark.
Korea, eine Sommerreise in das Land der Morgenruhe. Leipzig, Carl Reißner. Preis 7 Mark.
Tausend und ein Tag im Occident. Leipzig, Carl Reißner. 2 Bände. 2. Auflage. Preis 6 Mark.
Kuriosa aus der Neuen Welt. Leipzig, Carl Reißner. Preis 5 Mark.
Andalusien und ein Ausflug nach Marokko. Leipzig, Carl Reißner. Preis 8 Mark.
Mississippifahrten. Reisebilder aus dem amerikanischen Süden. Leipzig, Carl Reißner. Preis 8 Mark.
Prairiefahrten. Leipzig, Gustav Weigel. Preis 3 Mark.
Nordamerika, seine Städte und Naturwunder, Land und Leute. 2. Auflage. 4 Bände. Leipzig, Gustav Weigel. Preis 20 Mark.
Canada und Neufundland. Freiburg i. B., Herders Verlag. Preis 8 Mark.
Mexiko, Land und Leute. Wien, C. Hölzels Verlag. Preis 10 Mark.
Tunis. Wien, Hartlebens Verlag. Preis 8 Mark.
Chicago, eine Weltstadt im amerikanischen Westen. Stuttgart, Union, Deutsche Verlagsanstalt. Preis 4 Mark.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.
Druck von J. J. Weber in Leipzig.
Verlag von J. J. Weber in Leipzig
Schantung und Deutsch-China
Von Kiautschou ins heilige Land von China und vom Jangtsekiang nach Peking. Von E. v. Hesse-Wartegg.
Mit 145 in den Text gedruckten und 17 Tafeln Abbildungen, 6 Beilagen und 3 Karten. Preis kartoniert 14 Mark. In Originaleinband (mandarinblaues Leder mit aufgepresstem Mandarinbrustschild in Gold, Silber und vier Farben) 18 Mark.
Ernst v. Hesse-Wartegg konnte dem deutschen Leser keine willkommenere Gabe bringen als das Ergebnis seiner neuesten Reise nach China. Kein Land des Erdballes steht heute so sehr im Vordergrunde der allgemeinen Aufmerksamkeit wie das Reich der Mitte. Kein Land ist für den deutschen Leser, aber ebenso auch für den deutschen Kaufmann, den Industriellen, den Soldaten und Seemann von so grosser Wichtigkeit. Die Erschliessung Chinas, die Ernst v. Hesse-Wartegg seit Jahren in Zeitungsartikeln und zahlreichen Vorträgen befürwortet hat, ist erfolgt. Das Deutsche Reich hat sich in thatkräftiger Weise seinen Anteil daran gesichert und mit Kiautschou eine Eingangspforte, einen Stützpunkt gewonnen, der für die Entwickelung der deutschen Beziehungen in Ostasien von grösster Wichtigkeit ist.
Norddeutscher Lloyd, Bremen
Dampfschiffahrts-Gesellschaft.
Der Norddeutsche Lloyd unterhält ausser regelmässigen Schnell- und Postdampferverbindungen nach Nord- und Südamerika folgende
Reichspostdampferlinien:
Zweiglinien:
Anschlussverbindungen:
Bremen — Ostasien, Frachtdampferlinie. Abfahrten laut besonderem Fahrplan.
Nähere Auskunft erteilt der Norddeutsche Lloyd, Bremen.

 Verlag von J. J. Weber in Leipzig
Verlag von J. J. Weber in Leipzig


 Siam
Siam

das Reich des weissen Elefanten
von E. v. Hesse-Wartegg.
Mit 120 in den Text gedruckten und 18 Tafeln Abbildungen, sowie einer Karte von Siam. Preis geheftet 12 Mk., in Originaleinband 15 Mk.
Das ganze Wunderland des weissen Elefanten, die feenhafte Pracht seines Königshofes, die fremdartigen an die Märchen aus „Tausend und eine Nacht” erinnernden Festlichkeiten, das Leben und Treiben der Siamesen, der seltsame Buddhistenkultus mit seinen Hunderttausenden von Priestern, die grauenhaften Totengebräuche, Aberglaube, Geisterfurcht und Gottesgerichte, daneben Jagden, Theater und Vergnügungen, alles das wird von Hesse-Wartegg mit Meisterhand in fesselndster Weise dargestellt; dann folgen Schilderungen der Landesprodukte, des Handels und Verkehrs und hochwichtige Bemerkungen für die Sicherung und Ausbreitung des deutschen Handels.
HAMBURG-AMERIKA-LINIE
Direkter deutscher Post- und Schnelldampferdienst.
ferner mit den Dampfern der Deutschen Ostafrika-Linie: Hamburg-Ostafrika
und mit den Dampfern der Hamburg-Südamerikanischen D.-G.: Hamburg-Brasilien, Hamburg-Argentinien, Hamburg-Uruguay.
Hamburg-Neuyork via Southampton und
Cherbourg
Schnelldampferdienst.
Nähere Auskunft erteilt die
HAMBURG-AMERIKA-LINIE,
Abteilung Personenverkehr
Hamburg, Dovenfleth 18–21
sowie deren Vertreter.