Title: Elf Jahre Gouverneur in Deutsch-Südwestafrika
Author: Theodor Gotthilf von Leutwein
Release date: March 18, 2019 [eBook #59088]
Language: German
Credits: Produced by Peter Becker and the Online Distributed
Proofreading Team at http://www.pgdp.net
Elf Jahre Gouverneur
in Deutsch-Südwestafrika
von Theodor Leutwein
Generalmajor u. Gouverneur a. D.
Berlin,
E. S. Mittler & Sohn.
Theodor Leutwein
Elf Jahre Gouverneur in Deutsch-Südwestafrika
Von
Theodor Leutwein
Generalmajor und Gouverneur a. D.

Mit 176 Abbildungen und 20 Skizzen
Berlin 1906
Ernst Siegfried Mittler und Sohn
Königliche Hofbuchhandlung
Kochstraße 68–71
Alle Rechte aus dem Gesetze vom 19. Juni 1901
sowie das Übersetzungsrecht sind vorbehalten.
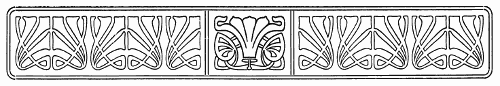
Gehe hinaus in die Welt, mein Buch, du Ergebnis vieler Arbeitsstunden, aber auch die Freude meiner Mußezeit. Du sollst meinen Mitbürgern einen Einblick in elf Jahre deutscher Kolonialpolitik geben, vielfach von Erfolgen gekrönt, aber auch von Rückschlägen begleitet sowie mit Fehlern und Irrtümern durchsetzt. Mögen wir aus beidem lernen, in erster Linie, daß, unbeschadet der höheren Stellung der kolonisierenden Rasse, das Ziel einer großzügigen Kolonialpolitik die Angliederung der in erworbenen Ländern vorgefundenen Urbevölkerung sein muß und nicht deren gewaltsame Unterdrückung oder gar Vernichtung. Diese Lehre wird umsomehr einleuchten, wenn dir der Nachweis gelingt, daß eine solche Politik nicht bloß im Sinne der Humanität und des Christentums gelegen ist, sondern vor allem im eigensten Interesse der kolonisierenden Macht. Denn eine andere Kolonialpolitik lohnt die zu bringenden Opfer nicht. Sie wird daher für das Mutterland stets zu dem werden, was man ein »schlechtes Geschäft« nennt und infolgedessen besser ganz unterlassen. Denn, um ein schlechtes Geschäft zu machen, geht der Staat sowenig wie der einzelne in die Kolonien.
Freiburg in Baden, im August 1906.
Der Verfasser.
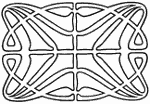
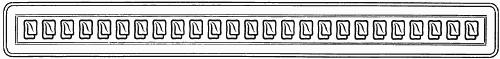
| Kapitel I. | |
| Aus der Vergangenheit des Schutzgebietes | Seite |
| Einwanderung der Orlams | 1 |
| Eindringen der Bantus und deren Kämpfe mit den Hottentotten | 3 |
| Die ethnographischen Verhältnisse des Schutzgebietes 1892 | 9 |
| Kapitel II. | |
| Aufrichtung der deutschen Schutzherrschaft. | |
| Die Zeit der nominellen Schutzherrschaft | 13 |
| Unser erster Zusammenstoß mit Witbooi | 15 |
| Tatsächliche Aufrichtung der Schutzherrschaft im Namalande | 21 |
| Der letzte Entscheidungskampf mit Witbooi | 31 |
| Die Aufrichtung der tatsächlichen Schutzherrschaft im Hererolande | 59 |
| Abermals ins Namaland | 65 |
| Befestigung und Ausdehnung der deutschen Schutzherrschaft im Hererolande | 72 |
| Zuspitzung der Grenzverhältnisse bei den Hereros bis zum Aufstand 1896 | 92 |
| Kapitel III. | |
| Der Aufstand 1896 | 97 |
| Kapitel IV. | |
| Viehseuchen. — Eisenbahn. — Mole. | |
| Rinderpest | 126 |
| Texasfieber | 131 |
| Pferdesterbe | 132 |
| Eisenbahn, Telegraph und Mole | 132 |
| Kapitel V. | |
| Von 1897–1901. | |
| Der Afrikaneraufstand 1897 | 141 |
| Der Aufstand der Swartbooi-Hottentotten 1897/98 | 143 |
| Die Expedition in das Namaland 1898 | 152 |
| Ostexpedition 1899 | 156 |
| Nordexpedition 1900 | 160 |
| Aufstand der Bastards von Grootfontein 1901 | 166 |
| [S. x] | |
| Kapitel VI. | |
| Unsere Beziehungen zu den Ovambos. | |
| Ethnographisches | 170 |
| Geschichtliches | 172 |
| Politisches | 186 |
| Wirtschaftliches | 198 |
| Kapitel VII. | |
| Die militärische und bürgerliche Organisation des Schutzgebietes. | |
| Die Schutztruppe | 209 |
| Die allgemeine Wehrpflicht | 215 |
| Militärisch ausgebildete Eingeborene | 216 |
| Die Stellung des Gouverneurs | 219 |
| Bezirks- und Distriktsverwaltungen. — Gerichtswesen | 224 |
| Teilnahme der Bevölkerung an der Verwaltung | 227 |
| Kirche und Schule | 230 |
| Statistik der weißen Bevölkerung | 232 |
| Post und Telegraphie | 235 |
| Kapitel VIII. | |
| Die Eingeborenen. | |
| Schutzverträge | 237 |
| Rechtspflege | 243 |
| Kreditverordnung | 246 |
| Waffen und Munition | 249 |
| Der Alkohol | 254 |
| Verliehene Land- und Minenrechte | 257 |
| Die Reservatsfrage | 266 |
| Die Mission | 278 |
| Kapitel IX. | |
| Die Häuptlinge des Schutzgebietes. | |
| Im allgemeinen | 297 |
| Hendrik Witbooi | 298 |
| Oberhäuptling Samuel Maharero | 306 |
| Häuptling Manasse von Omaruru | 310 |
| Kapitän Wilhelm Christian von Warmbad und sein Nachfolger | 314 |
| Die übrigen Kapitäne des Namalandes | 316 |
| Morenga und Morris | 319 |
| Die wichtigsten Unterhäuptlinge der Hereros (Kambazembi, Tjetjo und Zacharias) | 322 |
| Die Stellung der Häuptlinge zu ihren Stammesgenossen | 326 |
| [S. xi] | |
| Kapitel X. | |
| Wirtschaftliches. | |
| Meteorologische Verhältnisse, Acker-, Gartenbau, Forstkultur | 328 |
| Klima und Gesundheitsverhältnisse | 344 |
| Die Viehzucht und deren Feinde | 348 |
| Handel und Verkehr | 369 |
| Der Bergbau | 374 |
| Über den gegenwärtigen Stand des Bergbaues in Deutsch-Südwestafrika. Von G. Duft, Kaiserlicher Bergrat | 375 |
| Kapitel XI. | |
| Die wirtschaftliche Erschließung des Schutzgebietes. | |
| Die Konzessionsgesellschaften | 391 |
| Die Besiedlungstätigkeit der Regierung | 405 |
| Der Ansiedlungsplan der Zukunft | 411 |
| Bureneinwanderung | 413 |
| Die landwirtschaftlichen Ausstellungen 1899 und 1902 in Windhuk | 417 |
| Die Entschädigungsfrage | 424 |
| Kapitel XII. | |
| Die Jahre 1903/04. | |
| Die Stellung der Eingeborenen zur weißen Bevölkerung | 428 |
| Die bisherigen Eingeborenenaufstände | 432 |
| Die Wehrkraft des Schutzgebietes vor dem Bondelzwartsaufstande | 434 |
| Der Bondelzwartsaufstand 1903 | 439 |
| Das Namaland nach dem Bondelzwartsaufstande | 451 |
| Der Abfall Witboois | 454 |
| Kapitel XIII. | |
| Der Hereroaufstand 1904. | |
| Allgemeines | 465 |
| Der Hereroaufstand bis zum Eintreffen der ersten Verstärkung | 466 |
| Ereignisse in Omaruru | 470 |
| Otjimbingwe | 471 |
| Okahandja | 472 |
| Windhuk | 477 |
| Gobabis | 479 |
| Outjo | 480 |
| Grootfontein | 481 |
| Die Kompagnie Franke | 484 |
| [S. xii] | |
| Das Landungskorps S. M. S. »Habicht« | 492 |
| Die Westabteilung | 499 |
| Die Ostabteilung | 501 |
| Die Hauptabteilung | 508 |
| Der Kommandowechsel | 522 |
| Kapitel XIV. | |
| Kriegführung in Deutsch-Südwestafrika. | |
| Der kriegerische Wert der Eingeborenen | 526 |
| Die Besonderheiten der Kriegführung in Afrika | 532 |
| Eine Kolonialarmee | 537 |
| Kapitel XV. | |
| Ein Ausblick in die Zukunft | 541 |
| Reisen Anfang 1894 | 25 | |||
| Übersichtsskizze zu den Gefechten in der Naukluft | 47 | |||
| Nordreise des Gouverneurs 1895 | 81 | |||
| Gefechtsfeld von Gobabis | 101 | |||
| Plan zum Gefecht bei Otjunda-Sturmfeld am 6. Mai 1896 | 109 | |||
| Reise des Gouverneurs August bis November 1896 | 121 | |||
| Vormarsch zum Gefecht von Grootberg im Februar 1898 | 149 | |||
| Nordexpedition des Gouverneurs 1900 | 161 | |||
| Reise des Oberleutnants Volkmann von Mai bis Juli 1902 | 179 | |||
| Ethnographische Karte des Ovambolandes | 193 | |||
| Der sog. Caprivi-Zipfel | 207 | |||
| Missionskarte | 283 | |||
| Zum Bondelzwartsaufstand 1903 | 449 | |||
| Gefechtsfeld von Omaruru | 487 | |||
| Beiderseitige Stellung am Morgen des 9. April 1904 | 513 | |||
| Gefecht bei Onganjira am 9. April 1905 | 514 | |||
| Gefecht bei Oviumbo am 13. April 1904 | 517 | |||
| Stellung zur Zeit der Kommando-Übergabe. Mitte Juni 1904 | 519 | |||
| Landbesitz und Minengerechtsame | Zwischen | 266 | u. | 267 |
| Zum Hereroaufstand 1904 | " | 464 | " | 465 |

Die Ureinwohner des Schutzgebietes waren anscheinend die in zahlreichen Resten jetzt noch vorhandenen Bergdamaras und Buschmänner. Zu ihnen stießen in einer Zeit, über die uns nichts bekannt ist, die alteingesessenen Hottentottenstämme der Bondelzwarts, mit dem Hauptsitze in Warmbad, und der roten Nation, mit dem Hauptsitze in Hoachanas. Der letzteren hatten sich noch die Stämme der Feldschuhträger, der Franzmann-Hottentotten und der Swartboois angegliedert, sie übte aber auch eine stillschweigend anerkannte Oberherrschaft über den Bondelzwartsstamm aus. Ganz abseits standen die Topnaars am unteren Swakop, die sich schließlich vor den ewigen Kriegsunruhen in die Dünen des unteren Kuiseb flüchteten und dort heute noch unter englischer Herrschaft (Walfischbai) leben. Ein Teil dieses Stammes hatte sich jedoch schon vorher abgezweigt und war die Küste entlang in das Kaokofeld gezogen, zur Zeit mit dem Hauptsitz in Zesfontein. Dahin zog auch später, um dies vorauszuschicken, gleichfalls wegen der ewigen Kriegsunruhen, der Stamm der Swartboois aus Rehoboth und nahm seinen Hauptsitz in Franzfontein. Der größte Teil dieses Stammes empörte[S. 2] sich in der Folge (1897) gegen die deutsche Herrschaft und befindet sich zur Zeit als kriegsgefangen in Windhuk. Mit dem Eindringen der Hottentotten verschwanden die Urbewohner, die Bergdamaras und die Buschmänner. Entweder zogen sie sich in schwer erreichbares Gelände zurück, oder sie traten in die Dienste der Eindringlinge. Den gleichen Prozeß sehen wir in der Folge sich auch im Hererolande abspielen.
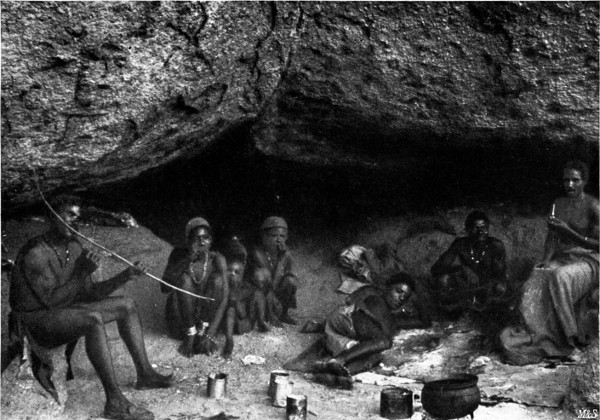
Zu diesen alteingesessenen Hottentottenstämmen kommen später,[2] vor der eindringenden weißen Rasse zurückweichend, Auswanderer aus der Kapkolonie, die sogenannten Orlams. Es waren dies die Witboois, die Khauas-, die Bethanier- und die Bersaba-Hottentotten, letztere ethnographisch gleichfalls zu den Khauas gehörend. Auch diese neuen Eindringlinge erkannten zunächst die Oberherrschaft der roten Nation an und ließen sich von ihr Wohnsitze anweisen. Nach mehr oder weniger langem, zuweilen durch kriegerische Zusammenstöße mit den alten Stämmen unterbrochenem Umherschweifen finden wir schließlich die Witboois in Gibeon, die Khauas in[S. 3] Gobabis, die Bethanier und die Bersabaer, wie deren Namen besagt, in Bethanien bzw. Bersaba. Diese biblischen Namen hat die Mission den Hauptorten der betreffenden Stämme gegeben, die dann auch nach jenen benannt wurden. Die letzte größere Orlameinwanderung, von der wir Nachricht haben, ist der Übertritt des Stammes der Afrikaner unter dem Häuptling Jager Afrikaner, die sich zunächst in der Südwestecke des heutigen Schutzgebietes niedergelassen haben. Später sollten sie, wie wir noch sehen werden, die rote Nation in der Oberherrschaft über die Hottentotten ablösen.

Im allgemeinen lebten die eingewanderten Hottentottenstämme mit den alteingesessenen in Frieden, bis ihn die Einwanderung einer ganz neuen Rasse dauernd störte. Es waren dies die der Banturasse zugehörigen Hereros.[3] Sie kamen, auf der Suche nach immer neuen Weidegründen, aus dem inneren Afrika über den Kunene nach dem Kaokofeld und drangen[S. 4] allmählich längs der Küste und Swakop aufwärts bis in die Gegend von Okahandja vor. Dieses, dem Hererovolk bis in die neueste Zeit anhaftende Bestreben, die Weideplätze für seine gewaltigen Rinderherden immer weiter auszudehnen, mußte stets zu Konflikten mit den Nachbarn führen. So auch jetzt mit den Hottentotten. Ihr Oberhaupt, der Häuptling Oasib von der roten Nation, fühlte sich allein zu schwach zum Widerstande und rief den damals kriegerischsten der eingewanderten Orlamstämme, den Afrikanerstamm, zu Hilfe. Dieser kam unter dem Sohne des mittlerweile gestorbenen Jager, dem als Staatsmann wie als Krieger gleich hervorragenden Jonker Afrikaner und warf die damals noch keineswegs geeinigten Hereros nieder. Sie wurden die Viehwächter und Sklaven der Hottentotten.
Aber nun ging es dem Häuptling der roten Nation wie dem bekannten Zauberlehrling: »Die ich rief, die Geister, werd' ich nicht mehr los.« Jonker Afrikaner riß jetzt selbst die Oberherrschaft über die Hottentotten an sich, was natürlich nicht ohne Bürgerkriege abgehen konnte. Während sich infolgedessen die Hottentotten selbst zerfleischten, erstarkten die unterworfenen Hereros wieder. Nach dem Tode des gefürchteten Jonker Afrikaner, 1861 in Windhuk, erhoben sich die Hereros unter Kamaharero, dem Vater des jetzigen Oberhäuptlings Samuel Maharero, und brachten den Hottentotten 1863 bei Otjimbingwe eine völlige Niederlage bei. Der seinem Vater anscheinend wenig ähnliche Sohn und Nachfolger Jonkers, Christian Afrikaner, verlor dort mit der Schlacht auch sein Leben. Ihm folgte sein Bruder Jan Afrikaner, welchem es vorläufig noch gelang, eine gewisse Oberherrschaft über die Hottentottenstämme zu behaupten und diese zum weiteren Kampf gegen die Hereros einig zu halten. In letzterem hatte indessen Jan mehr Niederlagen als Siege zu verzeichnen, darunter am 5. November 1864 westlich Okahandja eine Niederlage bis fast zur Vernichtung.
Endlich gelang es 1870 den Bemühungen der Missionare, dem nahezu zehnjährigen Kriege durch Friedensschluß in Okahandja, in dem Jan Afrikaner Windhuk zugesprochen erhielt, ein Ende zu bereiten.
In diese Friedenszeit fällt dann der Versuch der Kapregierung, mittels Eingehens von Schutzverträgen sich selbst in den Besitz unseres heutigen Schutzgebietes zu setzen. Die Sache war auch bereits dem Abschlusse nahe, als 1880, genau zehn Jahre nach dem Friedensschluß von Okahandja, die Kriegsfackel zwischen den beiden Rassen von neuem aufflammte. Die Ursache war ein auf einem Mißverständnis beruhender Streit zwischen Angehörigen der beiden Nationen, bei dem eine Anzahl Hereros nieder[S. 5]gemacht worden war. Dies veranlaßte den damaligen Oberhäuptling Kamaharero zu dem Befehl, sämtliche unter den Hereros wohnenden Hottentotten zu ermorden. Nun war der Krieg fertig, und der noch im Lande befindliche Unterhändler der Kapregierung, Palgrave, mußte zur Rettung seines Lebens eiligst nach der Küste flüchten.

Bei Otjikango (Groß-Barmen) kam es Ende 1880 zu einem zweitägigen Gefecht, in dem die unter der Führung Jan Jonkers geeinigten Hottentotten wiederum eine entscheidende Niederlage erlitten. Von diesem Schlage hat sich Jan nicht wieder erholt. Es ging nunmehr die nominelle Oberherrschaft über die Hottentotten von den Afrikanern an die Witboois über, zunächst an Moses Witbooi, den Vater des späteren Kapitäns Hendrik Witbooi. Aber auch er war zunächst nicht glücklicher als Jan und erlitt mehrere Niederlagen, darunter am 21. November 1881 die entscheidende Niederlage bei Osona. Nach echter Hottentottenweise hatte Moses Witbooi vorher seine Kriegserklärung an den Oberhäuptling der Hereros in den hochtönendsten Phrasen losgelassen. Eine Abschrift des betreffenden Briefes hatte ich Gelegenheit einzusehen und folgende Stelle im Gedächtnis behalten:
[S. 6] »Ich werde nicht ruhen, bis meine Pferde Dein Wasser in Okahandja getrunken haben. Mach klar, mach klar! Aber die Überwindung ist auf meiner Seite. Du bist ein Tiger, ein Bluthund, ein schlechter Mensch.«
Unter diesem Briefe stand: »Ich bin Dein Freund und Bruder.« Wahrscheinlich hatte der Kapitän gehört, daß die europäischen Fürsten sich in dieser Weise zu unterzeichnen pflegen, und nur übersehen, daß sie die Grobheiten weglassen.
Nach der Niederlage von Osona waren die Hottentotten in die Defensive gedrängt, während die Hereros zum angreifenden Teil wurden. Doch trat jetzt bei den ersteren wieder ein neuer Mann auf, der anscheinend beabsichtigte, ihren alten Kriegsruhm aus der Zeit Jonker Afrikaners in frischem Glanze erstrahlen zu lassen. Es war dies der Sohn Moses Witboois, der Kapitän Hendrik Witbooi. Er hatte sich mit seinem Vater wegen eines von diesem unternommenen Raubzuges gegen die Bastards von Rehoboth überworfen, trennte sich mit seinen Anhängern von dem Stamme und unternahm selbständige Kriegszüge gegen die Hereros. Indessen hatte auch er zunächst wenig Glück. Nach einem unentschiedenen kleinen Gefecht in der Nähe von Kranzneus bei Rehoboth kam es 1884 zu einem großen Gefecht bei Osona, südlich Okahandja, 1886 zu einem zweiten bei Okahandja, die beide mit einer Niederlage Hendriks endeten. Immerhin war in allen drei Fällen, trotz Minderzahl und Niederlagen, Hendrik Witbooi der Angreifende gewesen. Doch war nun auch seine Kraft gebrochen. Der Kapitän verlegte sich von jetzt ab lediglich auf die bei den Hottentotten so beliebten Viehräubereien, in denen er sich als ein vollendeter Meister erwies.
Ein Wendepunkt für Hendrik trat mit dem im Jahre 1887 erfolgten Tode seines Vaters Moses ein, der im Alter von 86 Jahren ermordet wurde. Hierdurch kam Hendrik in den Besitz der Herrschaft über ganz Gibeon, während er bis jetzt nur mit etwa der Hälfte seines Stammes hatte rechnen können. Zunächst wandte er seine neue Macht zur Befestigung seiner Herrschaft unter den Hottentotten an. Nacheinander kamen der Bandenführer Visser, der Mörder von Moses Witbooi, dann die Feldschuhträger, die Afrikaner und die rote Nation an die Reihe. Jan Jonker, der letzte Afrikanerhäuptling, verlor hierbei sein Leben, sein Stamm verschwand völlig. Als einziger Nebenbuhler Hendriks war im Namalande jetzt nur noch der Kapitän des starken Stammes der Bondelzwarts, Wilhelm Christian, übrig geblieben. Mit diesem würde es wohl 1889, gelegentlich des Angriffs auf die Feldschuhträger, gleichfalls zur Auseinandersetzung gekommen sein,[S. 9] wenn nicht Hendrik durch ungünstige Nachrichten aus dem Norden zum Abmarsch nach dort bewogen worden wäre. Die hierdurch erhaltene freie Hand benutzte Wilhelm Christian, um Keetmanshoop, das bis jetzt unter einem selbständigen Kapitän gestanden hatte, seinem Gebiete einzuverleiben. Wir werden noch sehen, wie später dieser Platz unter Mitwirkung Hendriks deutsches Kronland geworden ist.
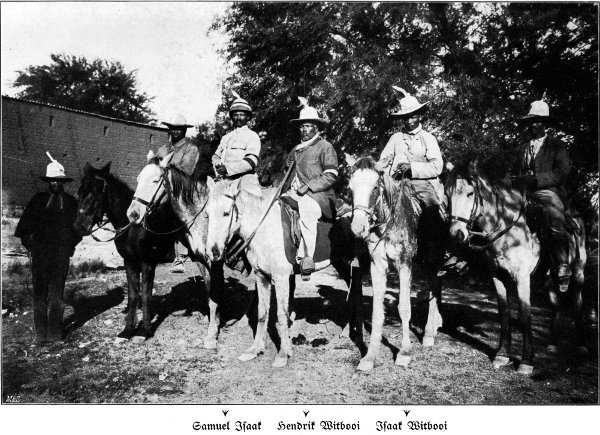
Nach den vorstehend geschilderten kriegerischen Ereignissen hatten sich 1892, d. h. zur Zeit des Beginns einer tatsächlichen deutschen Schutzherrschaft, die ethnographischen Verhältnisse des Schutzgebietes wie folgt gestaltet.
Im Süden wohnten die Hottentotten oder Namas, in acht selbständige Stämme gespalten, und zwar die Witboois, Bethanier, Bondelzwarts, Feldschuhträger, Bersabaer, Franzmann-Hottentotten, die Khauas-Hottentotten und die rote Nation. Der letztgenannte Stamm war bei dem Zusammenstoße mit Witbooi aus seinem Stammsitze Hoachanas vertrieben worden und lebte in kümmerlichen Resten, aber immer noch geschlossen, unter seinem Kapitän Manasse, mitten unter den Hereros. Der ehemals mächtige Stamm der Afrikaner war so gut wie ganz verschwunden; einem kleinen Teil desselben werden wir später im Süden des Schutzgebietes wieder begegnen. Die Witboois endlich hatten unter ihrem Kapitän Hendrik ihren Stammsitz Gibeon verlassen und sich in Hornkranz, einem Platz zwischen Kuiseb und Swakop, festgesetzt, um hier den Rinderherden der Hereros näher zu sein. Ein kleiner Teil war in Gibeon geblieben, gehörte aber noch direkt zum Stamme.
Inzwischen war als letzter Zuwachs aus der Kapkolonie, Ende der sechziger Jahre, eine dritte Rasse eingewandert, nämlich die sogenannten Bastards, die Hauptmasse unter Leitung des Missionars Heidmann jetzt in Rehoboth. Sie waren den Räubereien der Buschmänner und verwilderten Hottentotten, Koranas genannt, gegen die die Kapregierung sie nicht schützen zu können erklärt hatte, gewichen. Die Ausgewanderten teilten sich in drei Gruppen, die sich nach wechselnden Schicksalen in Rehoboth, Grootfontein (südlich) und Rietfontein (südlich) niederließen. Von diesen wurde der Stamm von Rehoboth der für uns wichtigste. Er hat von dem Witbooikriege ab bis in die jetzige Zeit treu zur deutschen Regierung gehalten. Der Stamm von Rietfontein fällt mit dem größten Teil seines Gebietes in die englische Machtsphäre und kommt daher für uns nicht in Betracht. Der Stamm von Grootfontein hatte während der[S. 10] Witbooikriege seinen Wohnsitz verlassen und wurde nach deren Beendigung von uns wieder dorthin zurückgeführt. Ihm werden wir später gleichfalls wieder begegnen.
Die Bastards sind Abkömmlinge von Buren und Hottentottenfrauen. Sie selbst zählen sich mehr zu den Weißen als zu den Eingeborenen. Bei allen Fehlern haben sie uns doch in Krieg und Frieden sehr wertvolle Dienste geleistet. Sie sollten wir daher immer mehr an uns ketten und, ihren eigenen Wünschen entsprechend, den Weißen möglichst nahestellen. Wächst doch auch im Schutzgebiet schon jetzt ein den Bastards verwandtes Geschlecht heran, welches das volle Bürgerrecht besitzt. Es sind dies die Nachkommen von Reichsdeutschen und Bastardmädchen, Verbindungen, welche nicht gerade selten sind. Von ihren hottentottischen Voreltern haben die Bastards bedauerlicherweise den Hang zum Müßiggang sowie zur leichtsinnigen Vermögensverwaltung und zum Umherschweifen geerbt.
Nördlich an die Hottentotten schloß sich das mächtige Volk der Hereros an, nominell unter einem gemeinsamen Oberhäuptling stehend, tatsächlich jedoch gleichfalls in verschiedene Stämme zerfallend, deren Unterhäuptlinge die Autorität des Oberhäuptlings entweder gar nicht oder nur widerwillig anerkannten. Einem äußeren Feinde gegenüber pflegten sie sich indessen zu einigen.

Der äußerste Norden des Schutzgebietes war und ist noch von den Ovambos besetzt, die wie die Hottentotten, sowohl dem Namen nach wie tatsäch[S. 11]lich, in verschiedene selbständige Stämme zerfallen. Mit ihnen sind wir bis jetzt noch wenig in Berührung gekommen.
Der beiden im Nordosten des Schutzgebietes in das Kaokofeld verirrten Hottentottenstämme, nämlich der Swartboois und der Topnaars, habe ich bereits gedacht.
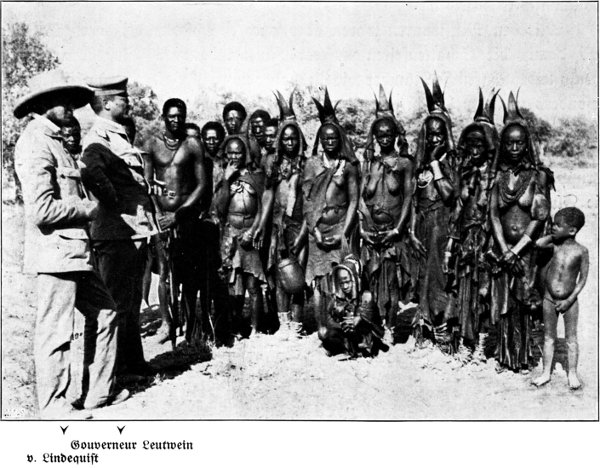
Die Gesamtstärke der Eingeborenen in Deutsch-Südwestafrika betrug 1892 etwa
| 15000 | bis | 20000 | Hottentotten, |
| 3000 | " | 4000 | Bastards, |
| 70000 | " | 80000 | Hereros, |
| 90000 | " | 100000 | Ovambos. |
Die Buschmänner und Bergdamaras sind schwer zu schätzen, sie mögen vielleicht zusammen 30000 bis 40000 Köpfe betragen.
Vermöge des langen Wirkens der Mission ist der Kulturzustand unserer Eingeborenen bereits ein verhältnismäßig hoher. Die sämtlichen Christen sowie die reicheren Heiden gehen in europäischer Kleidung. Als[S. 12] Kirchen- und Schulsprache haben die Missionare das von den Buren eingeführte Holländisch angenommen. In dieser Sprache kann man sich mit allen Stämmen verständigen, da sich bei jedem derselben eine Anzahl findet, die ihrer mächtig ist. Auch der Schriftwechsel mit den Häuptlingen sowie dieser unter sich wird holländisch geführt. Ebenso ist der Titel »Kapitän«, den die Häuptlinge des Schutzgebietes durchweg angenommen haben, dem Holländischen entlehnt.
Mit den Missionaren waren aber auch Händler und Jäger gekommen und damit die Schattenseiten unserer Kultur. Unsere Eingeborenen sind ebenso leidenschaftliche Raucher wie Liebhaber von Alkohol. Was aber für uns besonders unangenehm ist, sie kennen und besitzen den Hinterlader schon seit 30 bis 40 Jahren. Demzufolge ist ihre Fechtweise durchaus europäisch; wir werden daher in Südwestafrika von Gefechten, in denen 50 Reiter der Truppe Tausende von Eingeborenen ohne nennenswerte eigene Verluste in die Flucht geschlagen haben, nie etwas zu hören bekommen.
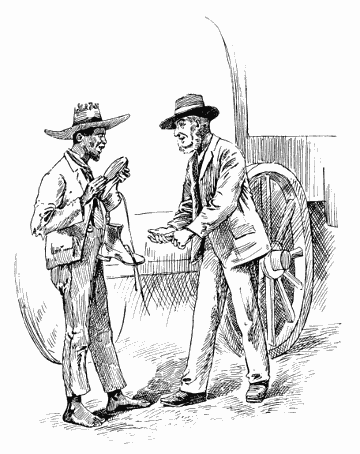

Noch mitten unter den vorstehend geschilderten Kämpfen der Eingeborenen untereinander hatte sich in aller Stille ein Ereignis vollzogen, das die ganze Zukunft des Schutzgebietes in andere Bahnen lenken sollte, nämlich die Annahme der deutschen Schutzherrschaft seitens der meisten Eingeborenenstämme. Die Art der Aufrichtung unserer Herrschaft in Südwestafrika war nämlich der Abschluß von Verträgen, in denen die Eingeborenen-Häuptlinge einen Teil ihrer Regierungsgewalt an uns abgaben und dafür das Versprechen des Schutzes erhielten. Aber diejenigen, die im Namen des Reiches diesen Schutz versprachen, hatten hierzu nicht die geringste Macht. Wenn trotzdem damals die hochfahrenden Hereros sowie der größte Teil der freiheitliebenden Hottentotten sich unter deutschen Schutz gestellt haben, so haben sie dies nur getan, weil sie es mit dem verheißenen Schutze ernst meinten. Der ewigen Kriege unter sich müde, erwarteten sie von der deutschen Regierung ein Eingreifen in diese Kämpfe zu ihren Gunsten. Der einzige, der einen solchen Gedanken weit von sich wies, war der Kapitän Hendrik Witbooi. Dieser fuhr fort, die Rinderherden der Hereros, soweit er deren habhaft werden konnte, als die seinigen zu betrachten. Infolgedessen war von der nominell bestehenden deutschen Herrschaft im Schutzgebiete bis 1891 nichts, bis 1893 nur wenig zu merken.
Schließlich ergriff die Eingeborenen, an der Spitze die Hereros, neben der Mißachtung gegen die Weißen auch noch Mißmut und Erregung, deren Ausbrüche 1891 zur Abreise des damaligen deutschen Regierungsvertreters, Dr. Göring, geführt haben. Jetzt erst sandte das Deutsche Reich Soldaten, und zwar 1891 bis Anfang 1893 steigend von 30 bis 50 Mann, an ihrer Spitze den neuen Reichskommissar, Hauptmann v. François. Diese kleine Macht vermochte wenigstens die Person des deutschen Regierungsvertreters zu schützen sowie ihn mit einer gewissen Autorität zu umgeben. Immerhin mußte er sich z. B. unter dem 13. und 14. Juni 1891 von dem schlauen Hererohäuptling Manasse von Omaruru u. a. folgendes sagen lassen:[4]
»Lieber Hauptmann v. François. Ich habe Sie auch über etwas zu fragen, damit Sie mir's sagen; nämlich bezüglich der Hilfe, von der Sie mir sagten, daß Sie mir solche gebracht, bitte ich sehr, mir mitzuteilen, welche? Denn ich weiß noch nicht, welche Hilfe, und sollte ich es wissen, so habe ich es vergessen. Sie müssen mir's nochmal sagen: Ich meine diese oder jene Hilfe« usw.
Und ferner:
»Was nun diese Verordnungen betrifft, die Sie erlassen, so erkenne ich an, daß dieselben recht gut sind. Nachdem ich jedoch etwas darüber nachgedacht, will es mir scheinen, daß es gut gewesen wäre, wenn Sie, da Sie jetzt Stellvertreter des Kaisers sind, zunächst mit den Häuptlingen der Hereros sich verständigt und dann die Verordnungen erlassen hätten. Ich sage so, weil mir noch nicht erkennbar ist, worin die Hilfe besteht, über die wir zuletzt auf Okahandja gesprochen, als wir mit Ihnen und Dr. Göring zusammen waren. Vielmehr sind Menschen und Eigentum der Hereros nach jenem Bündnis in höherem Maße als früher durch den Krieg vernichtet worden, und keine Hand eines Deutschen hat sich geregt, sie zu schützen. Die unverständigen Hereros, die die Weise dieser Verordnungen nicht einsehen, werden deshalb dieselbe jetzt nicht anerkennen« usw.
An logischem Denken fehlt es nach diesen Briefen unseren »Wilden« nicht, wie sie auch für Recht und Unrecht stets ein feines Gefühl zeigen.
Während der Jahre 1891 und 1892 bemühte sich dann der Reichskommissar, den Kapitän Witbooi zum Einstellen seiner Kriegszüge gegen die Hereros, daneben auch zur Annahme der deutschen Schutzherrschaft zu bewegen. Letzteres lehnte der Kapitän rundweg ab, wie er dies auch noch mit großer Hartnäckigkeit bis zum Naukluftfeldzug im September 1894 mir[S. 15] gegenüber getan hat. Ich glaube daher nicht, daß, wie von mancher Seite behauptet wird, Witbooi bei einer anderen Behandlung der Sache je zu einer friedlichen Unterwerfung geneigt gewesen wäre. Der Reichskommissar suchte sich infolgedessen an die Hereros anzulehnen, um mit deren Hilfe Witbooi zur Vernunft zu bringen. In rascher Auffassung der ihm hieraus drohenden Gefahr schloß jedoch Witbooi unter Vermittlung des Kapitäns von Rehoboth, Hermanus van Wyk, im November 1892 Frieden mit den Hereros.
Mit Abschluß dieses Friedens war das erreicht, was die Kolonialverwaltung in Berlin angestrebt hatte, nämlich Herstellung friedlicher Zustände im ganzen Schutzgebiet. Trotzdem wurde Anfang 1893 die Truppe auf über 200 Mann verstärkt und dem Reichskommissar die einzige Instruktion gegeben, die deutsche Herrschaft unter allen Umständen aufrecht zu erhalten. Ob er dies verteidigungsweise oder mittels Angriffs tun wolle, war ihm überlassen. Der Reichskommissar beschloß nach Abwägung aller Umstände[5] an einem der Eingeborenenstämme behufs Einschüchterung der übrigen unsere Macht zum Ausdruck zu bringen, und hielt hierzu die Witboois für das geeignetste Objekt. Hierbei leitete ihn der Gedanke, daß Witbooi schon aus Nahrungsrücksichten den geschlossenen Frieden nicht lange halten würde, anderseits galt der genannte Kapitän als der gefürchtetste aller Kapitäne des Schutzgebiets. Seine Demütigung mußte mithin auf die anderen den größten Eindruck ausüben.
Unter Bewahrung der größten Heimlichkeit überfiel die Truppe am Morgen des 12. April 1893 unvermutet Hornkranz, den Sitz Witboois. Dieser hatte anscheinend auf eine vorherige förmliche Kriegserklärung gerechnet und war vollständig überrascht; er soll gerade friedlich beim Kaffee gesessen haben. Doch gelang es ihm, sich und fast alle seine waffenfähigen Männer durch rechtzeitige Flucht zu retten. Nur Weiber und Kinder fielen in die Hände der Truppe. Wie immer, zeigte sich der Kapitän Witbooi auch jetzt am größten im Unglück. Die Truppe war — anscheinend in Überschätzung des errungenen Erfolges — nach Windhuk zurückgegangen. Kaum hier eingerückt, erhielt sie die Nachricht, daß Witbooi soeben ihre Pferde auf dem Posten Aredareigas — glücklicherweise nur noch einen[S. 16] kleinen Rest — weggenommen habe, und einen Tag später diejenige, daß auch 120 einem deutschen Kaufmann gehörige Pferde, welche die Truppe hatte ankaufen wollen, aus einem entfernt gelegenen Weideplatz weggeholt worden seien. Damit waren unsere Reiter mangelhaft, die Witboois dagegen gut beritten, und jeder Südwestafrikaner weiß, welche Überlegenheit dadurch auf die Seite der letzteren fiel. Die Folge war ein nicht endender Guerillakrieg, in welchem zwar Witbooi noch manchen Schlag erlitt, aber doch in seinen und der übrigen Eingeborenen Augen als Sieger dastand, weil es ihm überhaupt gelungen war, solange Widerstand zu leisten. Noch Anfang 1894 fühlte er sich stark genug, um Friedensvorschläge des mittlerweile Landeshauptmann gewordenen Reichskommissars mit einem gewissen Hohne zurückzuweisen. In dem bezüglichen Schreiben Witboois befand sich folgende charakteristische Stelle: »Wer ist würdiger von uns beiden, Frieden zu machen, Du oder ich?«
In diesen Worten spricht sich die ganze durch den Überfall von Hornkranz hervorgerufene Abneigung des Kapitäns gegen uns aus. Sie zog sich in der Folge wie ein roter Faden auch durch den Briefwechsel des Kapitäns mit mir. Denn mitten in den Kriegswirren gegen Witbooi war mein Eintreffen in dem Schutzgebiet erfolgt, und zwar genau in der Neujahrsnacht 1893/94. Meine Instruktion lautete folgendermaßen:
Berlin, den 20. November 1893.
Euer Hochwohlgeboren ersuche ich mit Genehmigung Seiner Majestät des Kaisers und Königs ergebenst, eine Reise nach dem südwestafrikanischen Schutzgebiete zu unternehmen, um mir auf Grund eigener Anschauung über die dortigen Verhältnisse Bericht zu erstatten.
Die spärlichen und unsicheren Verbindungen mit dem stellvertretenden Kommissar Major v. François machen sich auch insofern empfindlich bemerkbar, als ich nicht imstande bin, die Sachlage im Schutzgebiet, weder die militärische noch die administrative, hinreichend zu übersehen. Sie werden deshalb darauf Bedacht zu nehmen haben, daß Sie sich durch Verkehr mit dem Major v. François, mit Deutschen und mit Eingeborenen so weit als angängig informieren und mir, sowie Sie sich ein Urteil gebildet haben und eine Gelegenheit finden, berichten. Sie wollen sich jeden Eingreifens in die Truppenführung wie in die Verwaltung enthalten, doch haben Seine Majestät der Kaiser zu genehmigen geruht, daß, falls während Ihrer Anwesenheit im Schutzgebiet der Major v. François durch Tod oder sonstige[S. 17] andauernde Gründe behindert sein sollte, seinem Amte vorzustehen, Sie berechtigt sein sollen, dasselbe vertretungsweise zu übernehmen.
Ihre nächste Aufgabe wird darin bestehen, sich über das Verhältnis der Weißen zu den Eingeborenen im mittleren Teile des Schutzgebietes und namentlich über die gegen den Hottentottenhäuptling Hendrik Witbooi ergriffenen und noch zu ergreifenden Maßnahmen zu unterrichten. Dabei wollen Euer Hochwohlgeboren den Gesichtspunkt im Auge behalten, daß unsere Machtstellung den Eingeborenen gegenüber unter allen Umständen aufrecht erhalten und mehr und mehr befestigt werden muß. Ob die Schutztruppe dieser Aufgabe gewachsen ist, wird eingehend untersucht werden müssen.
Gleichzeitig wollen sich Euer Hochwohlgeboren bemühen, über die Stärke und Hilfsquellen unserer Gegner tunlichst genaue Kunde zu erhalten und die Frage, ob danach auf eine längere Dauer der Feindseligkeiten gerechnet werden muß, oder ob es in Kürze möglich sein wird, des Aufruhrs Herr zu werden, einer genauen Prüfung zu unterziehen. Vorschläge, die geeignet sind, die Leistungsfähigkeit der Truppe zu erhöhen, würde ich mit Interesse entgegennehmen. Größere Mittel als die in dem Etatsentwurf für 1894/95 vorgesehenen in Anspruch zu nehmen, wird tunlichst vermieden werden müssen.
Einen weiteren Gegenstand Ihrer Beobachtungen wird die Frage zu bilden haben, ob nach endgültiger Niederwerfung Witboois von seiten der sonstigen Eingeborenen, namentlich der Hereros, Feindseligkeiten zu erwarten sind, und ob hiernach die wünschenswerte Verminderung der Truppe in absehbarer Zeit wird eintreten können.
Endlich bitte ich auch, die Beziehungen der im Schutzgebiet ansässigen Europäer untereinander in den Kreis Ihrer Beobachtung zu ziehen. Euer Hochwohlgeboren werden sich ein Urteil auch über die Verhältnisse der Händler, Ansiedler und Missionare zu bilden haben. Alle diese Aufgaben werden Sie am ehesten erfüllen können, wenn es Ihnen gelingt, ein gutes Verhältnis zum Major v. François und den Offizieren der Schutztruppe zu erhalten.....
gez. Graf v. Caprivi.
Die Lage des Schutzgebietes war bei meinem Eintreffen durchaus keine rosige und ähnelte in gewissem Sinne der heutigen.[6] Langandauernde[S. 18] Kriegsunruhen hatten seine wirtschaftliche Entwicklung, soweit von einer solchen damals überhaupt schon gesprochen werden konnte, bereits wieder im Keime erstickt. Die Eingeborenen standen uns als offene Feinde, bestenfalls in zweifelhafter Neutralität gegenüber. Einzig die Bastards von Rehoboth waren — genau wie heute — offen auf unsere Seite getreten. Aus dieser einfachen Darstellung gegebener Tatsachen gegen irgend jemand einen Vorwurf erheben zu wollen, liegt mir fern. Die Verhältnisse hatten sich in logischer Weise so entwickelt. Fast zu lange hatte das Reich gezögert, den Eingeborenen seine Macht zu zeigen. Wohl ist es ein gutes Wort, das einst Fürst Bismarck gesprochen hat: »In den Kolonien muß der Kaufmann vorangehen, der Soldat und die Verwaltung nachfolgen«, indessen, namentlich derart kriegerischen Eingeborenen gegenüber, wie wir sie in Südwestafrika fanden, darf der Soldat nicht zu lange auf sich warten lassen. In Südwestafrika läßt sich mit dem Begriff »regierender Kaufmann« allein nicht operieren. Unsere älteren Kaufleute im Schutzgebiet wissen davon zu erzählen.
Trotz unserer damaligen Ohnmacht hatten wir Verordnungen gegeben, die jedoch von den Eingeborenen mißachtet wurden. Einzig der Verordnung über Waffen und Munition konnte, weil letztere meist zur See eingeführt wurden, Geltung verschafft werden. Diese Verordnung empfanden die Eingeborenen auch am schwersten. Wir erteilten und bestätigten ferner Konzessionen über Gebiete und Gerechtsame, die uns nicht gehörten. Wir gründeten so z. B. 1892 ein Syndikat für Siedelungszwecke, das von Windhuk aus »in der Richtung auf Hoachanas und Gobabis« besiedeln sollte. Dabei saßen damals noch in Gobabis die räuberischen Khauas-Hottentotten, in deren Nähe sich zu wagen, ich keinem Farmer hätte raten mögen. Auf Hoachanas machte dagegen nach Vertreibung der roten Nation der Kapitän Witbooi Anspruch. Aber dieser sowohl wie die Khauas-Hottentotten dachten sich die Grenze ihrer Machtsphäre dicht vor den Toren Windhuks.
Alles dies erregte in der Heimat den Anschein, als ob wir Herren im Schutzgebiete wären. Tatsächlich aber war bis 1894 von einer Regierungsgewalt außerhalb des Sitzes der Regierung Windhuk keine Rede. Höchstens bestand eine solche noch längs des Bayweges nach der Küste. Denn selbst die 1893 verstärkte Schutztruppe war nicht stark genug, neben Führung des Krieges gegen Witbooi auch noch eine Regierungsgewalt im übrigen Schutzgebiet aufzurichten.
[S. 19] Ebensowenig, wie unsere Machtverhältnisse, hatte auch die erste weiße Einwanderung unseren südwestafrikanischen Eingeborenen einen Eindruck zu machen vermocht. Denn nicht als stolze Eroberer waren die Einwandernden vor etwa 60 Jahren zu ihnen gekommen, sondern als Missionare, Händler und Jäger, mithin in bescheidenem Gewande und gezwungen, sich dem Schutz der Häuptlinge sowie deren oft wunderlicher Rechtsprechung anzuvertrauen. Die später erfolgende, ebenso bescheidene Art der Aufrichtung unserer Regierungsgewalt, wie ich sie geschildert habe, hatte dieses Verhältnis nicht bessern können.
Gut gedacht war die Sache gewiß. Die mit den Eingeborenen abgeschlossenen Schutzverträge stellen sich lediglich als Handelsverträge dar. Der Artikel III. in dem Schutzvertrage mit den Hereros vom 21. Oktober 1885 lautet z. B. wie folgt:
»Der Oberhäuptling sichert allen deutschen Staatsangehörigen und Schutzgenossen für den Umfang des von ihm beherrschten Gebietes den vollständigen Schutz der Person und des Eigentums zu sowie das Recht und die Freiheit, in seinem Lande zu reisen, daselbst Wohnsitz zu nehmen, Handel und Gewerbe zu treiben.
Die deutschen Staatsangehörigen und Schutzgenossen sollen in dem dem Maharero gehörigen Gebiete die bestehenden Sitten und Gebräuche respektieren, nichts tun, was gegen die deutschen Strafgesetze verstoßen würde, und diejenigen Steuern und Abgaben entrichten, welche bisher üblich waren.
Dagegen verpflichtet sich Maharero in dieser Beziehung keinem Angehörigen einer anderen Nation größere Rechte und Vergünstigungen zu gewähren als den deutschen Staatsangehörigen.«
In gleichem Sinne sind alle anderen Schutzverträge gehalten. Da indessen der den Eingeborenen als Gegenleistung zugesagte Schutz lediglich auf dem Papier stand, so waren die letzteren die Gebenden, wir die Nehmenden. Und sich bei einem so ungünstigen Geschäft auf die Dauer wohl zu fühlen, dazu waren unsere Eingeborenen doch nicht ideal genug veranlagt. Ich habe bereits erwähnt, wie der deutsche Reichskommissar vor der Entrüstung über den ausgebliebenen Schutz 1891 aus dem Schutzgebiet hatte weichen müssen.
Der nach der Wegnahme von Hornkranz bei den Eingeborenen gewachsene Respekt vor der Truppe war infolge des dann folgenden langen Widerstandes Witboois Anfang 1894 bereits wieder auf den Gefrierpunkt gesunken. Da außerdem dieser vor unserem Angriff sich bereits mit[S. 20] den Hereros vertragen hatte, so haben die letzteren bis in die neueste Zeit nicht einsehen wollen, daß unser Eingreifen im Grunde zu ihren Gunsten erfolgt war. Sie hatten wir uns daher nicht zu Freunden, Witbooi dagegen zum erbitterten Feinde gemacht und uns so glücklich zwischen zwei Stühle gesetzt. Dies war das Bild des Schutzgebiets im Januar 1894, wie es sich — ich wiederhole es — nicht durch die Schuld einzelner, sondern aus den Verhältnissen entwickelt hatte.
Bereits auf meiner Reise nach Windhuk hatte ich Gelegenheit, mit den Hereros Fühlung zu gewinnen und mit Überraschung ihr finsteres Mißtrauen gegen die deutsche Regierung festzustellen, eine große Gefahr im Rücken der gegen Witbooi kämpfenden Truppe. Da Major v. François noch auf einem Kriegszuge gegen letzteren abwesend war, hielt ich es daher für zweckmäßig, die damit gebotene Frist zur Anknüpfung besserer Beziehungen zu den Hereros zu benutzen. Infolgedessen ritt ich Anfang Februar 1894 nach Okahandja.
Charakteristisch war dort mein erstes Zusammentreffen mit dem Oberhäuptling Samuel. Mit diesem hatte ich eine Zusammenkunft vormittags 9 Uhr in dessen Wohnung verabredet. Als ich kam, saßen die Hererogroßleute im Halbkreise vor dem Hause. Er selbst war nicht zu sehen. Anscheinend wollte er nach Negersitte mich etwas antichambrieren lassen. Der ausgesandte Dolmetscher (Schulmeister) kam mit der Bitte des Oberhäuptlings zurück, wir möchten uns zum Verhandeln ins Schullokal begeben, er würde mit seinen Leuten gleich nachkommen. Indessen hatte ich mir die Richtung, in welcher der Dolmetscher gekommen war, gemerkt, ging ihr nach und traf hinter dem Hause den Oberhäuptling mit zwei seiner Großleute auf einer Bank sitzend. Als ich zur Begrüßung auf ihn zuging, wollte er sich erheben, die anscheinend etwas wacklige Bank brach und alle drei kollerten zu meinen Füßen. Damit war die zum Empfang des Weißen erstrebte Würde zu Wasser geworden.
Im Schullokale eröffneten wir dann die Verhandlung damit, daß wir uns gegenseitig erklärten, wir hätten uns nichts zu sagen. Anscheinend wollte der Oberhäuptling zunächst mich aushorchen. Nach vergeblichen Bemühungen, ihn zum Sprechen zu bringen, schlug ich Schluß der Versammlung und Wiederzusammenkunft nachmittags im Hause des Missionars vor. Hier eröffneten wir jedoch die Unterhaltung abermals mit der gegenseitigen Versicherung, daß wir uns nichts zu sagen hätten. Als ich dann mit der Bemerkung Eindruck zu machen gedachte, der Deutsche Kaiser habe mich gesandt,[S. 21] um seine, des Oberhäuptlings, Worte zu hören, erhielt ich zu meinem Staunen die Antwort: »Als vom Deutschen Kaiser gesandt, hat sich hier schon mancher vorgestellt, aber nie haben die Hereros etwas davon gehabt.« Jetzt gab ich die Hoffnung auf und wollte auch diese Versammlung schließen. Der als Dolmetscher waltende Missionar Viehe, der seine Leute kannte, hielt mich indessen mit der Bemerkung zurück, der Oberhäuptling werde jetzt gleich loslegen. Und so kam's denn auch. Es gab kaum eine Sünde, die der Oberhäuptling nicht der Windhuker Regierung aufs Konto gesetzt hätte. Es fehlte nur noch, wie Bülow in seinem Buche »Drei Jahre im Lande Hendrik Witboois«[7] richtig bemerkt, daß er auch den mangelnden Regenfall deren Sündenregister zugeschrieben hätte. Ich beruhigte, so gut ich konnte, und sparte auch mit Zukunftshoffnungen nicht. Im allgemeinen trennten wir uns schließlich in bester Freundschaft.
Aber jetzt braute sich im Osten des Schutzgebietes ein Gewitter zusammen, das neben einem noch fortdauernden Witbooikriege recht unangenehm werden konnte. Bei den übelberufenen Khauas-Hottentotten war etwa im Oktober 1893 ein deutscher Händler ermordet worden, die seitens des Major v. François verlangte Auslieferung der Mörder indessen bis jetzt unterblieben. Letzteres mit gutem Grunde, denn der Kapitän war, wie wir später sehen werden, selbst bei der Sache beteiligt gewesen. Dafür hatten die Khauas dann Anfang 1894 noch die unter deutschem Schutz stehende Betschuanen-Ansiedlung Aais überfallen, ausgeplündert und die Bewohner, soweit sie nicht niedergeschossen oder geflüchtet waren, als Gefangene weggeführt. An diesem Raubzuge hatte sich auch eine Anzahl Gokhaser Hottentotten beteiligt. Derartige Vorkommnisse legten den Gedanken nahe, daß es Zeit sei, unsere bisherige nominelle Herrschaft, im Namalande wenigstens, in eine tatsächliche umzuwandeln. Überdies war sicher, daß Witbooi von seinen dortigen Stammesgenossen fortgesetzt heimliche Unterstützung erhielt. Es wurde daher zur
geschritten. Major v. François, der am 12. Februar 1894 von seinem Kriegszug zurückgekommen war, stimmte diesem Plan sofort zu. Wir verabredeten eine Teilung der Truppe, er sollte mit dem einen Teil das westliche Namaland pazifizieren und zugleich den immer noch trotzig im Felde stehen[S. 22]den Witbooi im Schach halten, ich das östliche und zugleich die Khauas-Hottentotten bestrafen. Um während dieser auf lange Monate berechneten Abwesenheit der Truppe von Windhuk jeder Besorgnis für den Rücken enthoben zu sein, wurde ferner beschlossen, den Bayweg, vor allem den an ihm gelegenen wichtigen Hereroplatz Otjimbingwe zu besetzen. Unvermutet tauchten daher Mitte Februar plötzlich deutsche Truppen an letztgenanntem Platze auf und ließen sich — unter Leutnant Schwabe — dort häuslich nieder. Daß der dortige Hererohäuptling Zacharias zu diesem Zuwachs an seinem Platze ein freundliches Gesicht gemacht hätte, kann ich nicht sagen. Ich war indessen persönlich mitgeritten und beruhigte ihn, so gut ich konnte. Mit einer stärkeren Besatzung wurde ferner der Hafenplatz Swakopmund unter dem Leutnant Eggers belegt und die Verbindung zwischen diesem und Otjimbingwe durch die Unterstationen Salem und Haigamchab hergestellt; Tsaobis hatte schon vorher bestanden. Somit war die erste Stationsgründung größeren Stiles im Schutzgebiete vollzogen. (S. Kartenskizze S. 25.) Zur Deckung des hierdurch entstandenen sowie des noch durch die Stationsgründung im Namalande zu erwartenden Ausfalles wurde beim Herrn Reichskanzler die Verstärkung der Truppe um 250 Mann beantragt.
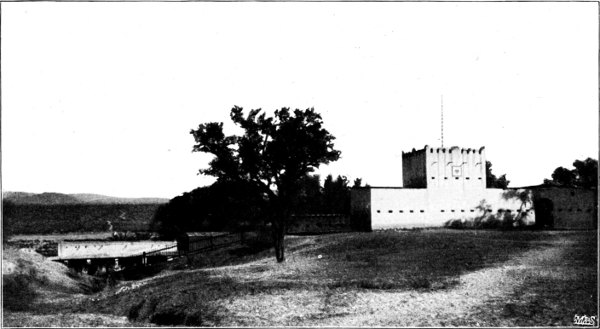
Am 24. Februar 1894 fand dann Abmarsch meiner Abteilung von Windhuk nach Gobabis statt, während der Major v. François sich bereits einige Tage vorher über Rehoboth in Marsch gesetzt hatte. Die mir zur[S. 23] Verfügung stehende Abteilung zählte etwa 100 Köpfe, darunter 70 Weiße (ein Drittel beritten) mit einem Geschütz, gemessen an den heutigen Verhältnissen gewiß eine geringe Macht. Indessen genügte zum Ausgleich damals noch das einzige Geschütz vollständig. Vor diesem hatten die Eingeborenen eine geradezu wahnsinnige Angst, während sie heutzutage das Feuer ganzer Batterien aushalten. Der Mensch gewöhnt sich eben an alles. Die der Abteilung zugeteilten Offiziere waren die Leutnants v. François und v. Zieten. Der erstere hat mit seiner ausgedehnten Landeskenntnis mir, dem Neuling, die schätzenswertesten Dienste geleistet, was ich hiermit dankbar anerkenne.[8] Der Truppe hatten sich auch etwa 20 bewaffnete Betschuanen von zweifelhaftem kriegerischen Wert angeschlossen. Der Marsch ging auf dem nächsten Wege über die zerstörte Betschuanenwerft Aais nach Naossanabis, dem damaligen Hauptorte der Khauas. Ihrem Kapitän, Andreas Lambert, hatte ich mein Kommen angekündigt. Er schwebte in vielen Ängsten und sandte der Truppe — wohl mit der Nebenabsicht des Spionierens — zwei Boten mit den friedlichsten Versicherungen entgegen. Letztere wurden festgehalten und dafür ein ebenso tapferer wie verständiger Unteroffizier (Bohr) in die Werft des Kapitäns vorausgesandt, um sich gleichfalls die dortigen Verhältnisse anzusehen. Die nach einem tüchtigen Nachtmarsch am Morgen des 17. März im Galopp einrückende berittene Abteilung überraschte dann den Kapitän vollständig. Nach kurzer Verhandlung wurde das Lager mitten in der Werft aufgeschlagen und dorthin der Kapitän mitgenommen. Für[S. 24] den Abend waren die Großleute[9] des Stammes in das Lager bestellt. In der nun folgenden Verhandlung wurde vereinbart, daß der Kapitän die deutsche Schutzherrschaft anzunehmen und für die Ermordung des deutschen Händlers sowie für die Ausraubung der Betschuanen eine angemessene Buße zu entrichten habe. Unter dieser Voraussetzung wollte ich ihm glauben, daß er an dem Morde des weißen Händlers unschuldig gewesen sei und den Mörder, weil geflohen, nicht habe ausliefern können.
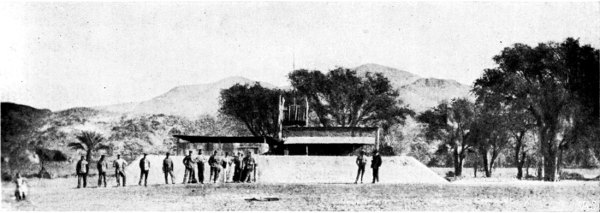
Behufs Anordnung des Erforderlichen wurde der Kapitän entlassen und für ihn zwei Geiseln zurückbehalten, darunter sein Bruder und späterer Nachfolger Eduard Lambert. Bald darauf meldeten indessen Spione, daß der Kapitän Vorbereitungen treffe, die entweder auf Angriff oder auf Flucht schließen ließen. Rasch wurde die Werft von zwei Seiten umfaßt, abgesucht, die vorgefundenen Gewehre konfisziert, die — durchweg gesattelten — Pferde weggenommen und der Kapitän wieder gefangen gesetzt.

Ein am andern Tag zusammengetretenes Kriegsgericht fand bestätigt, daß der Kapitän die Absicht gehabt hatte, sich durch heimlichen Abmarsch den eingegangenen Verpflichtungen zu entziehen. Nunmehr wurde auch auf die früheren Anklagen gegen ihn zurückgegriffen und gefunden, daß er zu der Ermordung des deutschen Händlers angestiftet, um auf diese Weise seiner Schulden an jenen ledig zu werden, sowie daß er die bei dem Raubzug gegen Aais gefangenen Betschuanen zum Teil eigenhändig niedergeschossen hatte. Hieraus erfolgte seine Verurteilung zum Tode; das Urteil wurde einen Tag später vollzogen.
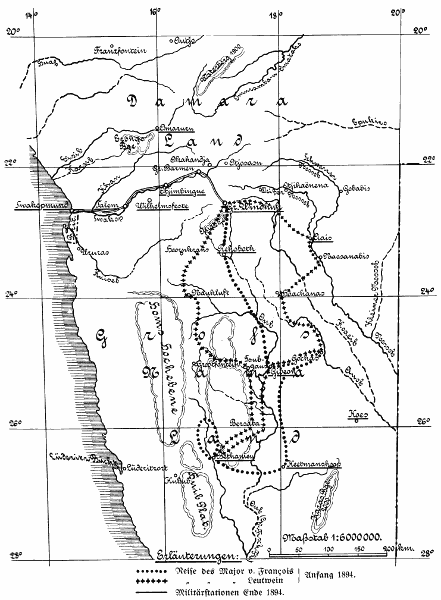
[S. 26] Eines tragikomischen Zwischenfalles möchte ich noch Erwähnung tun. Die unter den Khauas wohnenden Bergdamaras erkannten, unbeschadet der Oberherrschaft der Khauas-Hottentotten, als ihr eigenes besonderes Oberhaupt den sogenannten Kapitän Apollo an. Um die Ermordung des deutschen Händlers anzuzeigen, wohl auch zugleich eigene Klagen vorzubringen, war Kapitän Apollo Ende 1893 nach Windhuk gegangen. Von Major v. François mit dem Verlangen der Auslieferung der Mörder zu Andreas Lambert zurückgeschickt, erhielt er von diesem nicht weniger als 150 Hiebe zudiktiert. »Was geht mich die deutsche Regierung an«, schnauzte Andreas. Als dann im Verlauf der geschilderten Ereignisse Apollo merkte, daß es mit den Khauas bergab ging, fand er sich unaufgefordert als Zeuge vor dem Kriegsgericht ein und verlangte Sühne für die in Erfüllung eines Auftrages des deutschen Regierungsvertreters erhaltenen Hiebe. Auf die Frage, wieviel er verlange, antwortete er prompt: »700 Pfd. Sterl.«. Auf meine Einwendung, daß 7 Pfd. Sterl., d. i. der Wert eines Andreas abgenommenen Pferdes, genügten, erfolgte ebenso prompt die Zustimmung. Auf meine fernere Frage, wie ihm die 150 Hiebe bekommen seien, meinte Apollo, er hätte drei Wochen nicht sitzen können, sonst hätten sie ihm nichts geschadet.[10]
An Stelle des Kapitäns Andreas Lambert wurde sein Bruder Eduard, dem ein für einen Hottentotten denkbar bester Ruf zur Seite stand, zum Regierungsverweser eingesetzt. Das Gefühl der Legitimität war in ihm so mächtig, daß er die Kapitänswürde selbst nicht hatte annehmen wollen, weil von seinem zweitälteren Bruder noch ein Sohn vorhanden war, der unter den Stammverwandten in Bersaba lebte. »Und Kapitän müsse man sein, ehe man geboren sei«, meinte er. Der erschossene Kapitän Andreas selbst hatte keinen Sohn hinterlassen. Im übrigen sind die Eingeborenenmachthaber nicht immer so skrupulös. Wenn für einen Minderjährigen der[S. 27] nächste erwachsene Agnat die Häuptlingswürde übernimmt, pflegt er sie nach erreichter Volljährigkeit des eigentlichen Erben nicht wieder abzugeben. In dieser Lage befindet sich z. B. auch der Oberhäuptling der Hereros, Samuel, dessen älterer Bruder im Kriege gegen Witbooi gefallen ist und einen nunmehr erwachsenen Sohn, Wilhelm Maharero, hinterlassen hat.
Bei dieser Gelegenheit erscheint eine Einschaltung über das Erbrecht der Eingeborenen angezeigt. Bei den Hottentotten wie bei den Bastards folgt in der Regel in der Häuptlingswürde der älteste Sohn. Er hat sich indessen einer Wahl zu unterziehen, die mitunter auch einen jüngeren Sohn trifft, wenn dieser für geeigneter gehalten wird. Doch bleibt man stets innerhalb der Häuptlingsfamilie, solange in dieser überhaupt noch ein Anwärter vorhanden ist. Bei den Hereros gilt dagegen, wie bei allen Bantus, das Mutterrecht, d. h. sie huldigen dem ihren Sittlichkeitsgefühlen entsprechenden Gedanken, die Mutter kennt man immer, den Vater aber nicht. Infolgedessen geht die Häuptlingswürde auf den Sohn der ältesten Schwester des Vorgängers über. Mit dem Christentum und der Monogamie ist jedoch auch bei den Hereros dieser Grundsatz allmählich durchbrochen worden. So war dem Oberhäuptling Kamaharero, durch die Großleute Okahandjas gewählt, dessen zweiter Sohn Samuel gefolgt, während nach Hererogesetz der Nächstberechtigte der Häuptling Tjetjo, als Sohn der ältesten Schwester des verstorbenen Häuptlings, gewesen wäre. Da dieser verzichtete, ging die Anwartschaft auf Nikodemus über, der seinerseits gar keine Lust zum Verzicht zeigte, vielmehr dem Oberhäuptling bis zu seinem — des Nikodemus — 1896 erfolgten Tode das Leben möglichst sauer gemacht hat. Zum zweiten Mal wurde in der Folge das Mutterrecht bei den Hereros in Omaruru durchbrochen, wo auf den Kapitän Manasse 1898 dessen Sohn Michael folgte. Endlich folgten 1904 auf den Kapitän Kambazembi in Waterberg, sich in die Erbschaft wie Herrschaft teilend, dessen Söhne David und Salatiel. Alle die genannten jüngeren Kapitäne waren beim Ausbruch des Hereroaufstandes 1904 am Ruder und an diesem als Führer beteiligt.
Nach dieser Abschweifung kehre ich zur Schilderung des Ganges der Ereignisse zurück. Mit dem neuernannten stellvertretenden Kapitän Eduard Lambert wurde dann ein Schutzvertrag abgeschlossen, sowie dem Stamm etwa 500 den Betschuanen geraubte Ochsen wieder abgenommen und letzteren zurückgegeben, die übrige Beute dagegen, bestehend aus etwa 60 Gewehren und 30 Pferden, nach Windhuk geschickt. Der Stamm der Khauas-Hottentotten erschien nunmehr verarmt und in seiner Wehrfähigkeit wesentlich[S. 28] beeinträchtigt. Dies hinderte aber nicht, daß er etwa ein Jahr später sich bereits wieder als gut bewaffnet und gut beritten erwies; mit welchen Mitteln, konnte nie ergründet werden.
Am 9. März erfolgte dann der Aufbruch über den damals gänzlich verlassenen Hauptort der roten Nation, Hoachanas, von da den stark fließenden Auob abwärts nach Gokhas, bei welchem Platze die Truppe am 17. März eintraf. Der dort residierende Kapitän der Franzmann-Hottentotten, Simon Cooper, hatte sich an den Räubereien seines Freundes Lambert vielfach beteiligt, so zuletzt auch an dem Raubzuge gegen die Betschuanen. Da er indessen viel mächtiger war als der letztere, ihm auch direkt Strafbares nicht nachgewiesen werden konnte, so schien es angesichts des noch drohenden Witbooikrieges ratsam, ein Auge zuzudrücken und den Kapitän als einen ehrenwerten Mann anzusehen und zu behandeln. Von dieser meiner Gesinnung suchte ich den letzteren durch eine vorausgesandte Botschaft zu überzeugen (Unteroffizier Bohr). Indessen die Erschießung von Andreas Lambert hatte Simon Cooper bei seinem bösen Gewissen nervös gemacht und ihn, wie sein Volk, in die höchste Erregung versetzt. Durch den zurückkehrenden Boten von dieser Sachlage in Kenntnis gesetzt, richtete ich mich auch auf einen feindlichen Empfang ein. Ein Nachtmarsch brachte die Truppe zur frühen Morgenstunde an die Werft, bei der die ganze waffenfähige Mannschaft des Stammes in den Schanzen lag. Um nochmals eine friedliche Einigung zu versuchen, ließ ich meine Truppe zunächst außerhalb Schußweite in Gefechtsbereitschaft zurück, ritt selbst mit wenig Begleitern in die Werft und fand den Kapitän mit seinem Stab in deren Mitte auf einer Art Feldherrnhügel. Von seiner Nervosität zeugte es, daß er sich bei meiner Annäherung schußfertig machte. Indessen war er wieder entwaffnet, als ich ihm mit einem freundlichen »Guten Morgen« die Hand bot. Es ergab sich nunmehr, daß auch ihn nur eine geringe Kriegslust beseelt und er daher verboten hatte, den ersten Schuß zu tun. Wir verabredeten um 10 Uhr eine Zusammenkunft im Missionshause und trennten uns freundschaftlich.
Ganz war des Kapitäns Mißtrauen indessen noch nicht geschwunden, denn er ließ mir um 10 Uhr sagen, er hätte mir nichts mitzuteilen. Nunmehr ging ich in Begleitung des Leutnants v. François selbst zu ihm. Jetzt zeigte sich doch ein ritterlicher Zug bei ihm. Als er sah, daß wir beide unbewaffnet waren, schnallte er seinen Revolver ab und warf ihn hinter einen Busch. In den nun folgenden Verhandlungen, die auf An[S. 29]nahme der deutschen Schutzherrschaft abzielten, zeigte der Kapitän jedoch einen hohen Starrsinn. Um diesen zu brechen, bedurfte es einer dreitägigen Verhandlung und schließlich der Stellung eines Ultimatums. Der Kapitän hatte sogar mit der Behauptung Zeit zu gewinnen gesucht, er bedürfe auch noch der Zustimmung seiner Weiber und Kinder, aber diese seien geflüchtet. Auf meine Frage, wann deren Rückkehr zu erwarten sei, meinte er, dies könne einen Tag dauern, aber auch ein Jahr! Als dann bereits unterschrieben war, fragte der Kapitän wieder, wie lange dieser Vertrag gelten solle. Kurz, die Sache schien ihm höchst unbequem. Anerkennen muß ich indessen, daß Simon Cooper in der Folge den Vertrag bis zum Ausbruch des Aufstandes 1904 ehrlich gehalten hat.
Um Zersplitterung zu vermeiden, nahm ich von einer Stationsgründung in Gokhas Abstand. Eine kleine Station erschien dort gefährdet, und zu einer großen reichte es nicht. Dafür wurde eine solche an dem früheren, jetzt verlassenen Stammsitz der Witboois, Gibeon, eingerichtet und ihr befohlen, sich von Zeit zu Zeit durch Patrouillen von dem Wohlverhalten des Kapitäns Simon zu überzeugen. Die Truppe traf — von Gokhas kommend — in Gibeon am 24. März ein und ließ den bereits mehrfach genannten Unteroffizier Bohr mit 14 Gewehren als Stationsbesatzung zurück. Als Stationsgebäude wurde die noch wohlerhaltene Kirche eingerichtet. Von Gibeon ging's den ebenfalls stark fließenden Fischfluß entlang nach Bersaba, dessen Bewohner sich als durchaus friedlich gesinnt erwiesen, wie sie dies auch bis zum heutigen Tage geblieben sind. Sie sind der einzige geschlossene Hottentottenstamm, der sich 1904 dem Aufstande nicht angeschlossen hat. Das Verdienst hierfür gebührt in gleicher Weise dem langjährigen Missionar des Stammes, Hegner, und dessen Zögling, dem intelligenten Kapitän Christian Goliath. In Bersaba traf ich auch den bereits erwähnten Erben der Kapitänswürde bei den Khauas-Hottentotten, Manasse Lambert, der sich indessen als ein bequemer, ängstlicher Charakter erwies und wenig Lust zeigte, die gefährliche Bürde zu übernehmen. Er legte sie auch ein Jahr später förmlich nieder.

Während dieser Ereignisse hatte Major v. François das Namaland durchquert und dessen wichtigsten Platz Keetmanshoop mit einer Station unter Oberleutnant Bethe belegt. Von da war er nach Bethanien marschiert, wo kurz vorher auch Witbooi gewesen war, um einen Streit um die Kapitänswürde zu schlichten. Ein solcher war zwischen dem berechtigten Erben, Paul Frederiks, der jetzt noch Kapitän ist, und dessen Vetter, Cornelius Frederiks, dem Schwiegersohn Witboois — neben Morenga zur Zeit Bandenführer[S. 30] gegen uns im Namalande[11] — ausgebrochen. Da Witbooi sich damals nicht stark genug fühlte, um zugunsten seines Schwiegersohnes einzugreifen, nahm er diesen nebst Anhang mit, was für ihn einen Zuwachs von 60 Gewehren nebst einer namhaften Rinderherde bedeutete. Behufs Vereinigung mit Major v. François marschierte ich dann von Bersaba gleichfalls nach Bethanien. Ersterer wollte mir den Rest seiner Abteilung übergeben, da er beschlossen hatte, nach einer vierjährigen Tätigkeit im Schutzgebiete auf Heimatsurlaub zu gehen. Da der Major über die Kapkolonie reisen wollte, führte ihn später sein Weg über Warmbad, die Residenz des bereits erwähnten Nebenbuhlers Witboois, Wilhelm Christian. Letzterer hatte unseren Kampf mit ersterem mit erfreuter Genugtuung verfolgt und die deutsche Fahne im Süden hoch gehalten. Auf meinen Wunsch benutzte Major v. François die Gelegenheit, um auf der Durchreise auch in Warmbad eine kleine Station zu gründen, da mir selbst die Zeit zum Besuch des Platzes nicht mehr reichte. Auch in Bethanien blieb eine stärkere Station unter Leutnant v. Zieten zurück. Den nunmehr vereinigten Rest unserer beiden Abteilungen entsandte ich in das Lager von Tsubgaus, wo[S. 31] er vorläufig unter Befehl des Leutnants v. François verblieb, während ich mich persönlich nach Keetmanshoop begab. Auch die Keetmanshooper Hottentotten zeigten sich als ein friedliches Völkchen, das unter dem Missionar Fenchel aber auch einen Leiter besaß, der Kopf und Herz an der richtigen Stelle hatte. In der Nähe Keetmanshoops wohnten damals drei Weiße, bzw. Halbweiße, welche in dem Verdacht standen, Munitionslieferanten für Witbooi gewesen zu sein. Sie wurden alle drei ausgewiesen. Einer derselben, Duncan, erkaufte sich später mittels freiwilliger Gestellung wieder die Rückkehr. Er wurde zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Zur Unterbindung weiteren Schmuggels wurde in Koes eine Grenzstation errichtet, womit auch zugleich Hand auf das Gebiet der Feldschuhträger gelegt war.
Soweit die mäßigen Stationsbesatzungen dies verbürgen konnten, erschien nunmehr das Namaland gesichert und als einziger Feind nur noch Witbooi übrig. Ich begab mich jetzt persönlich in das Lager von Tsubgaus und trat von da am 24. April den Vormarsch gegen Witbooi an.
Kapitän Hendrik Witbooi befand sich noch an derselben Stelle, an der die letzten Kämpfe mit ihm unter Major v. François stattgefunden hatten, nämlich in der Eingangsschlucht des Naukluftgebirges. Indessen war die Nachricht hierüber zunächst noch nicht als verbürgt anzusehen, da von den Eingeborenen es niemand wissen wollte, teils aus Furcht vor Witbooi, teils aus Sympathie mit ihm. Weder Führer noch Spione waren zu finden. Zunächst blieb daher nichts anderes übrig, als aus dem Lager von Tsubgaus aufs Geratewohl den Marsch nach der Naukluft anzutreten. Unterwegs stieß der Führer der Bastards, Hans Dirgaard, zur Truppe. Obwohl er nur 10 seiner Leute bei sich hatte — die Kriegslust der Bastards hatte stark abgenommen —, war mit seinem Eintreffen dem Führermangel doch sofort abgeholfen. Hans Dirgaard ritt eines Morgens los, hob eine abseits gelegene Buschmannswerft aus und brachte deren Insassen ins Lager. Die vier Intelligentesten wurden als Führer angeworben, der Rest beschenkt und entlassen. Diese Buschmänner brachten die erste bestimmte Nachricht, daß Witbooi noch in der Naukluft sitze.
Am 6. Mai traf die Truppe vor der Naukluft ein. Sobald ich Gewißheit über den Aufenthalt Witboois hatte, war ich mit diesem in Briefwechsel getreten, um über seine Persönlichkeit und seine Absichten Klar[S. 32]heit zu gewinnen. Taktisch hat einem eingeborenen Gegner gegenüber ein solcher Briefwechsel nebenbei auch den Vorteil, daß man stets über dessen Verbleib unterrichtet wird. Die in Afrika für uns unliebsamste Möglichkeit, daß der Gegner spurlos verschwindet und uns das Nachsehen überläßt, wird so ohne viel eigene Anstrengung und Gefahr vermieden. Aus diesem Briefwechsel möge das Wichtigste hier folgen:

Naauklof, den 4. Mai 1894.
Mein lieber hochedler Deutsch-Kaiserlicher Herr
Stellvertreter v. François.
Euer Edeln fragen mich, ob ich Frieden mit Ihnen will machen oder Krieg? Darauf antworte ich: François weiß es ganz gut und Euer Hochedeln auch, obwohl Euer Edeln nicht hier waren, daß ich von alters her mit Ihnen, mit François und mit allen weißen Leuten Frieden gehalten habe.[12] François hat mich nicht geschossen um des Friedens willen, sondern darum, daß ich mit ihm in Frieden war. Ich lag ruhig in meinem Hause und schlief, da kam François, mich wach zu schießen, und das nicht um des Friedens willen oder um einer Missetat, deren ich mich durch Wort oder[S. 33] Tat gegen ihn schuldig gemacht haben könnte, sondern darum, daß ich etwas, was allein mein Eigentum ist und worauf ich Recht habe, nicht aufgegeben habe. Ich habe meine Unabhängigkeit nicht aufgegeben, denn ich habe allein ein Recht auf das Meinige, um es jemand, der mich darum fragt, zu geben oder nicht zu geben, wie ich will. François hat mich bekriegt, weil ich mein eigenes Gut nicht geben wollte. Das kann ich nicht verstehen, und ich bin erstaunt und höchlichst verwundert, daß ich von dem Großmann François solch traurige und schreckliche Vergewaltigung erlitten habe. Zuerst wurde mir das Schießgut gestopft, und als ich dann mit leeren Händen dastand, wurde ich geschossen. Solche Werke hatte ich von François nicht erwartet, umsoweniger, als ihr weißen Menschen die verständigsten und gebildetsten Menschen seid und uns die Wahrheit und Gerechtigkeit lehrt. Ich kann nicht verstehen, daß das Sünde und Schuld ist, wenn ein Mensch sein Eigentum und Gut nicht geben will, wenn ein anderer Mensch dasselbe verlangt. Ferner sage ich Euer Hochedeln, der Krieg und Frieden liegt nicht in meinen Händen, denn dieser Krieg liegt nicht an mir und ist nicht durch mich verursacht, da ich François in keiner Weise Schaden zugefügt oder beleidigt habe. Nun sagen Euer Hochedeln in Ihrem Briefe, daß François nach Deutschland zurückgereist ist und Sie vom Deutschen Kaiser als dessen Stellvertreter gesendet sind, um mich zu vernichten, wenn ich keinen Frieden haben will. Dies beantworte ich so: Der Friede ist etwas, was Gott eingesetzt hat auf Erden, denn Gott hat gesagt in seinem Worte, es ist eine Zeit des Krieges, und es ist wieder eine Zeit des Friedens, darum will ich den Frieden nicht abschlagen, wenn Euer Edeln mit freundlicher und wahrer Aufrichtigkeit zu mir von Frieden sprechen, denn François hat meinen Frieden weggenommen, und wenn Sie nun gekommen sind, um alles, was François unrecht und ungesetzlich an mir gehandelt hat, in Richtigkeit zu bringen und die Sachen, um welche François mich geschossen hat, totzumachen und allein Frieden zu machen, dann will ich dem Frieden nicht widerstreiten. Ich werde Euer Hochedeln dann den Frieden geben und bin gewillig, Ihnen Frieden zu geben, um des Herrn willen. Dies ist mein letzter Hauptpunkt, und ich will hier schließen und grüße Euch, hochedler Herr, Ich, Ihr Freund und Kapitän,
Der Hauptkapitän von Namaland
gez. Hendrik Witbooi.
Lager vor der Naauklof, 5. Mai 1894.
An Kapitän Hendrik Witbooi, Naauklof.
Deinen Brief habe ich erhalten und will versuchen, ihn klar zu beantworten. Auf Wunsch der meisten Kapitäne des Nama- sowie des Hererolandes hat Seine Majestät der Deutsche Kaiser die Schutzherrschaft über beide Länder übernommen, dabei aber diejenigen Kapitäne, welche die Schutzherrschaft nicht annahmen, unbehelligt gelassen, solange sie mit den anderen Kapitänen Frieden hielten. Du aber hast letzteres nicht getan, sondern verschiedene Kapitäne des Namalandes abgeschossen und schließlich Dich in Hornkranz festgesetzt und von da Raubzüge in das Hereroland unternommen. Du hast mithin in dem Gebiete, das unter dem Schutze des Deutschen Kaisers stand, Ruhe und Frieden gestört. Seine Majestät hat Deinem Treiben lange in Geduld zugesehen, dann aber, als Du nicht davon ablassen wolltest, befohlen, daß auf Dich geschossen werde. Denn wie mit allen seinen Pflichten, so nimmt es der Deutsche Kaiser auch ernst mit seinen Pflichten als Schutzherr des Namalandes. Wenn Du ruhig in Gibeon geblieben wärest und Dein Volk in Frieden regiert hättest, so würde nicht auf Dich geschossen worden sein. Daß Du uns Weißen vorher nie etwas getan, das weiß ich wohl; aber nicht unseres Vorteils willen ist auf Dich geschossen worden, sondern, wie oben gesagt, lediglich um der Ruhe und des Friedens des Namalandes willen.
Ob Dir der Herr Major v. François das alles so deutlich erklärt hat, darüber habe ich kein Urteil; ich denke aber, daß er es getan und daß Du ihn zu lange nicht hast verstehen wollen. Jedenfalls hat es keinen Zweck, wenn wir jetzt darüber noch viele Worte machen. Unsere Pflicht ist, jetzt nur zu reden von dem, was geschehen soll, und da finde ich, daß Deine Antwort nicht deutlich ist. Ich habe Dir klargemacht, daß Du jetzt keine andere Wahl mehr hast als bedingungslose Unterwerfung unter den Willen Seiner Majestät des Deutschen Kaisers oder Krieg bis zur Vernichtung, und darauf ersuche ich Dich um klare Antwort. Der Wille Seiner Majestät geht dahin, daß im Namalande jeder in Ruhe und Frieden seine Arbeit tun und kein Kapitän den andern bekriegen soll. Welche weiteren Bedingungen Seine Majestät Dir persönlich noch stellt, das kann ich Dir erst mitteilen, wenn Du mir gesagt hast, ob Du Dich unterwerfen willst oder nicht. Ich habe Dir bereits geschrieben, daß ich jetzt noch hoffen kann, Dir günstige Bedingungen auszuwirken.
Das eine sage ich im voraus und werde mich freuen, wenn Du dies ehrlich Deinen Leuten mitteilen wolltest. Wir Deutsche führen keinen Krieg gegen Deine Leute, sondern wir wollen in Frieden mit den Namas zusammen arbeiten. Ich hoffe daher, daß Deine Leute von der Erlaubnis, bis zum 25. d. M. friedlich in ihre Wohnplätze zurückkehren zu können, recht zahlreich Gebrauch machen.
Wir führen dagegen Krieg gegen Dich persönlich, solange Du Dich für den Oberherrn des Namalandes hältst und glaubst, das Recht zu haben, andere Kapitäne nach Belieben abzuschießen. Das hast Du früher so tun können, das soll aber jetzt nach dem Willen Seiner Majestät aufhören.
Wenn Dir nun etwas noch nicht klar sein sollte, so halte ich es für das Beste, wir treffen uns zur mündlichen Unterredung mitten zwischen unseren Lagern; aber es muß bald geschehen, da ich wenig Zeit habe.
Ich bin mit freundlichem Gruß
Der Kaiserlich deutsche Landeshauptmann
I. V.:
gez. Leutwein, Major.
Naauklof, den 7. Mai 1894.
Mein lieber Kaiserlich deutscher Herr,
Stellvertreter v. François, Major!
Ich habe Ihren Brief empfangen und verstanden, stelle jedoch nochmals dieselbe Bitte an Euer Hochedeln. Die zwei Tage, die Euer Hochedeln mir gegeben, sind mir noch nicht genug, denn die Sache, die Euer Hochedeln mich fragen, ist keine leichte und auch keine gewöhnliche Sache. Sie lastet schwer auf des Menschen Gemüt und ist schwer für einen Menschen, der ein unabhängiges freies Leben gewöhnt ist.
Darum bitte ich Sie, lieber Herr, sich doch erst in Frieden zurückzuziehen, auf daß ich mehr Zeit habe, mir die Sache ernstlich und reiflich zu überlegen, ich meine nicht allein, um sie abzuschlagen. — Lassen Sie mir doch meine eigene freie Wahl in einem längeren Zeitraum, daß ich über die Sache nachdenken kann in Tiefsinnigkeit, ob ich sie annehmen soll oder nicht. Solange Euer Edeln mit Ihrer Kriegsmacht vor mir stehen, kann ich keinen Entschluß fassen, zu dem ich die Zustimmung aller meiner Männer haben muß, damit es nicht den Anschein hat, daß die Sache durch das Hiersein Eurer Kriegsmacht übereilt und ich dieselbe angenommen hätte, ohne daß ich[S. 36] von Herzen geneigt und willig wäre. Darum bitte ich Sie, lieber hochedler Herr, doch vorläufig von mir zurückzugehen in Frieden. Ich hoffe, daß Euer Edeln mich diesmal gut verstehen werden.
Hiermit will ich schließen und grüße Sie freundlichst.
Ich bin Ihr Freund und Kapitän
gez. Hendrik Witbooi.
Lager vor der Naukluft, den 7. Mai 1894.
An den Kapitän Hendrik Witbooi, Naauklof.
Mein lieber Kapitän!
Ein ordentlicher Krieg ist besser als ein fauler Friede. Und wenn ich von diesem Platze ginge, lediglich mit Deiner Friedensversicherung und nicht zugleich mit Deiner Unterwerfung unter den Willen Seiner Majestät des Deutschen Kaisers, so würde dies ein fauler Friede sein. Obwohl ich noch nicht lange im Lande bin, so weiß ich doch, daß Du seit 1884, mithin seit zehn Jahren, nur von Raub und Blutvergießen lebst, obwohl Du dazwischen oft Frieden geschlossen hast. Und darum werde ich nicht von Dir weichen, bis Du Dich entweder unterworfen hast oder vernichtet bist, und sollte dies Monate und Jahre dauern. Wenn es Dir persönlich jedoch so sehr schwer wird, Du aber Deinem Volke doch den Frieden verschaffen willst, so bringe das Opfer der Selbstüberwindung, setze einen Deiner Söhne in Deine Rechte ein, und dieser mag dann den Vertrag abschließen. Dir selbst werde ich in diesem Falle das Leben verbürgen, auch das Recht des Aufenthalts außerhalb des deutschen Schutzgebiets. Ich wiederhole: »Friede ohne ausdrückliche Unterwerfung unter die deutsche Schutzherrschaft« gibt's für Dich und Dein Volk nicht mehr. Das ist mein letztes Wort in dieser Sache.
Mit freundlichem Gruße
Der Kaiserlich-deutsche Landeshauptmann
I. V.:
gez. Leutwein, Major.
Am 10. Mai erschienen dann etwa 70 Bastards als Verstärkung im Lager mit der Nachricht, daß Witbooi diese, unsere Bundesgenossen, um 700 Ochsen erleichtert hätte. Dies veranlaßte mich, die Feindseligkeiten zu eröffnen, jedoch mehr um Witbooi Ernst zu zeigen, als um wirklich Ernst zu machen. Denn die mir zur Verfügung stehende Truppenmacht von 160 Gewehren, darunter 90 Weiße, und zwei Geschütze war zur Erzwingung[S. 37] einer Unterwerfung des Kapitäns ganz unzureichend. Denn ein bloßes Hinauswerfen des Gegners aus dem Gebirge hätte nicht zu einem solchen Ziele geführt. Ich beschloß daher, den Krieg hinhaltend zu führen und die Entscheidung über die beantragte Verstärkung von 250 Mann abzuwarten. Die so gewonnene Zeit wurde zur gründlichen Erkundung der Stellung Witboois benutzt.
Die Naukluft ist ein Gebirgsstock etwa von dem Umfange des Harzes, aber viel zerklüfteter und unwegsamer, dabei auf allen vier Seiten steil aus dem umliegenden Gelände ansteigend. Was jedoch ein Vorteil der Stellung war, nämlich diese auf allen Seiten stark abfallende Verteidigungslinie, war auch deren Nachteil. Das Gebirge ließ sich so von allen Seiten leicht umstellen, umsomehr als überall Wasser vorhanden war. Eine für uns günstigere Stellung konnte Witbooi daher gar nicht wählen, während er selbst sie wahrscheinlich als die für ihn selbst günstigste angesehen hat. Umsoweniger konnte uns daran liegen, den Gegner voreilig aus dieser Stellung hinauszuwerfen. Das Aufsuchen und Erkunden einer neuen Stellung des Feindes hätte nur abermals Zeit und Mühe gekostet. Infolgedessen begegneten der Kapitän und ich uns in dem gleichen Bestreben. Er wollte aus seiner für vorzüglich gehaltenen Stellung nicht heraus, ich wünschte dagegen dringend, daß er in ihr bleibe.
Endlich traf am 22. Mai das erlösende Telegramm ein, daß die beantragten 250 Mann bewilligt seien und Anfang Juli landen würden. Jetzt erschien es angezeigt, etwas Wasser in meinen Wein zu tun und Witbooi die erbetene Bedenkzeit in Form eines Waffenstillstandes anzubieten. Witbooi beantwortete dieses Anerbieten mit folgendem Brief:
Naauklof, den 24. Mai 1894.
Mein lieber hochgeachteter Herr Major Leutwein,
Kaiserlich deutscher Gesandter!
Ihren letzten Brief habe ich empfangen und daraus ersehen, daß Euer Edeln mich nun gut verstanden haben und daß wir so weit einig geworden sind. Ich danke dem Herrn von Herzen, daß er in dieser großen und schweren Sache selbst als Mittler zwischen uns gestanden und bewirkt, daß das Blutvergießen, welches wir im Sinne hatten, nicht ferner geschieht, sondern wir in Frieden auseinandergehen. Auch ferner möge der Herr uns helfen, daß doch kein Blutvergießen mehr zwischen uns ist.
Ferner geben mir Euer Hochedeln noch zwei Monate Bedenkzeit über den Schutzvertrag, und soll ich während dieser Zeit keine Feindseligkeiten[S. 38] gegen unter deutschem Schutz stehende Menschen unternehmen. Die Kriege, die ich geführt, sind keine Kriege, die ich zuerst begonnen habe, denn die roten, schwarzen und selbst ihr weißen Menschen haben mich zuerst geschossen, und mein Pulver hat nie zuerst gegen Menschen gebrannt, auch habe ich niemanden beleidigt oder sonst Schaden getan von all den Menschen, warum sie mich mit Wort und Tat hätten schießen können. Ohne Ursache und Schuld meinerseits haben sie mich alle geschossen. Da wir nun Frieden gemacht haben, versichere ich Euer Hochedeln, so als Sie auch in Ihrem Briefe sagen, daß Sie glauben, ich würde mein Wort halten, daß ich nicht der erste sein werde, welcher den Frieden bricht, und ich werde keinen Menschen zuerst schießen oder sein Vieh nehmen. Euer Edeln kennen mich noch nicht, aber Sie sagen, daß Sie versichert seien, daß ich mein Wort halten würde, jetzt in diesem Frieden sollen Euer Hochedeln mich selber kennen lernen und selbst erfahren und sehen, daß alle Dinge, deren die Menschen mich beschuldigen und warum sie mich geschossen, nicht wahre Dinge sind. Ich werde nichts tun bis zu der Zeit, die Euer Edeln mir gesetzt haben usw.
Ich bin Ihr Freund und Kapitän
gez. Hendrik Witbooi.
Um auch die persönliche Bekanntschaft des Kapitäns zu machen, ritt ich in sein Lager und fand einen wohlgebildeten Hottentotten von kleiner, gedrungener Figur und würdevollem Benehmen. Wir unterhielten uns über die Ereignisse der jüngsten Zeit und schieden äußerlich als die besten Freunde. Heimlich aber hatte jeder beim Anerbieten wie bei der Annahme des Waffenstillstandes seine Hintergedanken. Ich wollte meine Verstärkung abwarten, und er hatte, wie sich später ergab, noch einen Teil seiner Leute — auch Munition — außerhalb der Naukluft. Wenigstens stand der Kapitän, als die Truppe zwei Monate später wieder vor der Naukluft erschien, in ganz anderer Rüstung da, wie auch der Ton seiner Briefe ein anderer wurde.
Nach abgeschlossenem Waffenstillstand trat die Truppe den Rückmarsch nach Windhuk an. Die jetzt gewonnene Frist benutzte ich, um den Grund zur Zivilverwaltung des Schutzgebietes zu legen. Hierzu war ich durch das mittlerweile erfolgte Eintreffen eines weiteren höheren Beamten, des Assessors v. Lindequist (des heutigen Gouverneurs), in die Lage versetzt worden. Das Namaland wurde in zwei Bezirksämter, Windhuk und Keetmanshoop, eingeteilt. Das erstere, zugleich mit meiner Vertretung im Falle von Abwesenheit,[S. 41] was während der Kriegszeit Normalzustand war, erhielt der Assessor v. Lindequist, das letztere der Berginspektor Duft.

Ein glückliches Zusammentreffen ermöglichte es, daß die gegebene Pause im Witbooikriege auch noch benutzt werden konnte, um den Hauptplatz des Hererolandes, Okahandja, in unsere Machtsphäre einzubeziehen. Die Gelegenheit hierzu bot ein Zwist zwischen dem Oberhäuptling Samuel und einem seiner Unterhäuptlinge, auf den ich im nächsten Abschnitt näher eingehen werde. Für hier genügt die Feststellung, daß im Verlaufe dieses Ereignisses Okahandja sogar auf eigenen Wunsch des Oberhäuptlings mit einer Stationsbesatzung belegt wurde. Günstiger konnte sich die Sache für uns gar nicht entwickeln, da jetzt jede Gefahr von seiten der Hereros während des Restes des Witbooikrieges ausgeschlossen war. Nach Erledigung dieser Aufgabe begab ich mich an die Küste, behufs Empfangnahme der Verstärkung, die jedoch nicht am 1., sondern erst am 18. Juli eintraf. — Aber auch Witbooi war während der ihm gegebenen Frist nicht müßig geblieben. An der Spitze von etwa 40 Reitern hatte er das ganze Namaland durchzogen, sorgfältig jedoch die von uns besetzten Stationen vermeidend, und an Kräften herangezogen, was ihm erreichbar war. Nach dem ersten Zusammenstoß mit ihm hatte ich ausreichend Gelegenheit, mich über seine personell wie materiell gewaltig gestiegenen Mittel zu wundern.

Da der Waffenstillstand nur bis zum 1. August lief, konnte die Verstärkung nicht mehr rechtzeitig vor der feindlichen Stellung erscheinen. Um Witbooi jede Möglichkeit zu einer unliebsamen Überraschung zu nehmen, beorderte ich daher, was von der alten Truppe verfügbar war, unter dem Leutnant Schwabe derart vor die Naukluft, daß es spätestens zu dem genannten Datum dort ankommen mußte. Es waren dies etwa 50 Reiter und 2 Geschütze, denen sich in Rehoboth ebensoviel Bastards anschlossen. Leutnant Schwabe entledigte sich seiner Aufgabe mit Geschick und hatte[S. 42] hierbei einen wunderlichen Briefwechsel mit den Witbooischen Unterführern[13]. Noch wunderlicher war deren Benehmen, indem sie, anscheinend auf Befehl ihres Kapitäns, ihre eigenen Vorposten zum Teil in unsere Absperrungslinie vom Mai vorgeschoben hatten. Da indessen Witbooi den Befehl gegeben hatte, nicht den ersten Schuß zu tun, gelang es dem Leutnant Schwabe, die ungebetenen Gäste in friedlicher Weise wieder aus unserer Linie herauszumanövrieren.
Als ich dann am 4. August für meine Person vor der Naukluft erschien, hatte sich zwischen beiden Lagern ein friedliches Stilleben entwickelt. Die Weiber wuschen bei dem unserigen, gegen Tabak und Kaffee, täglich die Wäsche unserer Soldaten. Das letzte Mal taten sie dies am 26. abends, und am 27. früh erfolgte der Sturm. Am 5. August traf auch der Leutnant Lampe mit den für die Verstärkung mittels Vertrags aus der Kapkolonie gelieferten Pferden ein. Den Vertrag hatte in meiner Abwesenheit der Assessor v. Lindequist aus eigener Initiative rechtzeitig abgeschlossen. Indessen bis zur Küste hatten die Pferde nicht mehr kommen können, sie waren daher über Land direkt nach der Naukluft dirigiert worden. Die Verstärkungsmannschaft, durchweg Kavallerie, hatte daher bis dort zu Fuß marschieren müssen.
Vorläufig galt es, den Gegner noch hinzuhalten, da die in zwei Kolonnen marschierende Verstärkung noch lange nicht zu erwarten war. Sie hatten die Umwege über Windhuk, bzw. Gurumanas machen müssen, während ich mit meinem Stabe auf schwer gangbaren Gebirgspfaden über Hornkranz direkt nach der Naukluft geritten war. Dieses Hinhalten geschah mittelst erneuten Briefwechsels mit dem Kapitän, von dem ich gleichfalls das Wichtigste nachstehend gebe. Dazwischen wurde auch die Absperrung des Gebirges zu Ende geführt.
Lager vor der Naauklof, den 15. August.
An den Kapitän Hendrik Witbooi, Naauklof.
Dein zweimonatliches Nachdenken hat Dich also dahin geführt, daß Du die Anerkennung der deutschen Oberherrschaft abermals ablehnst. Das bedaure ich. Denn nach dem, was ich Dir bis jetzt über diese Sache geschrieben habe, mußt Du wissen, daß Deine Ablehnung einer Kriegserklärung gleichzuachten ist, usw. Zum Schlusse will ich Dir als Zeichen[S. 43] meines freundlichen Wohlwollens noch folgendes schreiben: Die Zeiten der unabhängigen Kapitäne im Namalande sind für immer vorbei, und diejenigen Kapitäne, die das rechtzeitig erkannt und sich offen der deutschen Regierung angeschlossen haben, das waren die klügeren, denn sie haben bei der Sache nur Nutzen und gar keinen Schaden gehabt. Ich halte Dich auch für einen klugen Mann, aber in dieser Sache hat Dich Deine Klugheit verlassen, weil Dein persönlicher Ehrgeiz Deinen Verstand verdunkelt hat. Du mißkennst die Verhältnisse bis auf den heutigen Tag. Dem Deutschen Kaiser gegenüber bist Du nur ein kleiner Kapitän. Ihm Dich zu unterwerfen würde für Dich keine Schande, sondern eine Ehre sein. usw.
gez. Leutwein.
Naauklof, den 18. August 1894.
Mein lieber Hochedler Herr Leutwein, Major!
Sie sagen ferner, daß es Ihnen leid tut, daß ich den Schutz des Deutschen Kaisers nicht anerkennen will und daß Sie mir dies als Schuld anrechnen und mich mit Waffengewalt strafen wollen. Dies beantworte ich so: Ich habe den Deutschen Kaiser in meinem Leben noch nicht gesehen, deshalb habe ich ihn auch noch nicht erzürnt mit Worten oder Taten. Gott, der Herr hat verschiedene Königreiche auf die Welt gesetzt, und deshalb weiß und glaube ich, daß es keine Sünde und kein Verbrechen ist, daß ich als selbständiger Häuptling meines Landes und Volkes bleiben will, und wenn Sie mich wegen meiner Selbständigkeit über mein Land und ohne Schuld töten wollen, so ist das auch keine Schande und kein Schade, denn dann sterbe ich ehrlich über mein Eigentum. Es ist wahrlich keine Schuld, daß ich Ihnen nicht stehen will, denn ich habe wahrhaftig keine Schuld an all den Sachen, welche Sie mir in Ihrem Briefe als Verbrechen vorgetragen haben und welche Sie als Gründe gebrauchen, um über mich ein Todesurteil zu sprechen. Denn das sind Ihre eigenen Gedanken, die Sie zu Ihrem Vorteil ausgesonnen haben, die Sie selber ausgedacht haben, um vor der Welt die Ehre, das Recht und die Wahrheit auf Ihrer Seite zu haben. Aber ich sage Ihnen, lieber Freund, ich bin wahrhaftig frei und ruhig in meinen Gedanken, weil ich weiß, daß ich wahrhaftig unschuldig bin. Aber Sie sagen Macht hat Recht, und nach Ihren Worten handeln Sie mit mir, weil Sie mächtig in Waffen und allen Bequemlichkeiten sind, darin stimme ich überein, daß Sie wirklich mächtig sind und daß ich nichts gegen Sie bin. Aber, lieber Freund, Sie kommen zu mir mit Waffengewalt und haben mir erklärt,[S. 44] daß Sie mich beschießen wollen. So denke ich diesmal auch, wieder zu schießen, nicht in meinem Namen, nicht in meiner Kraft, sondern in dem Namen des Herrn und in Seiner Kraft, und mit Seiner Hilfe werde ich mich wehren. Weiter sagen Sie auch, daß Sie unschuldig sind an diesem Blutvergießen, welches nun geschehen soll, und daß Sie die Schuld auf mich legen; aber das ist unmöglich, daß Sie so denken können, da ich Ihnen gesagt habe, daß ich Ihnen den Frieden geboten habe und daß durch mich kein Blutvergießen geschehen soll. So liegt die Rechenschaft über das unschuldige Blut, das vergossen werden soll von meinen Leuten und von Ihren Leuten, nicht auf mir, denn ich bin nicht der Urheber dieses Krieges. Ich ersuche Sie, lieber Freund, nochmals! Nehmen Sie den wahren und aufrichtigen Frieden, den ich Ihnen geboten habe und lassen Sie mich stehen in Ruhe. Gehen Sie zurück. Nehmen Sie Ihren Krieg zurück, gehen Sie von mir weg, dies ist mein ernstliches Ersuchen an Sie. Zum Schluß grüßt Sie
Ihr Freund und Kapitän
gez. Hendrik Witbooi.
Meine Antwort datierte vom 21. August und enthielt die Stellen:
Auf Deinen letzten Brief vom 17. d. M. antworte ich folgendes: Daß Du Dich dem Deutschen Reiche nicht unterwerfen willst, ist keine Sünde und keine Schuld, aber es ist gefährlich für den Bestand des Deutschen Schutzgebietes.
Also, mein lieber Kapitän, sind alle weiteren Briefe, in denen Du mir Deine Unterwerfung nicht anbietest, nutzlos.
Ich hoffe indessen, daß Du mit mir darin einverstanden bist, daß wir den Krieg, der bei Deiner Hartnäckigkeit leider nicht zu vermeiden ist, menschlich führen, und hoffe ferner, daß derselbe kurz sein werde.
Ferner bin ich gern bereit, Dir auch während des Krieges jede Aufklärung zu geben, die Du wünschst, da ich dann hoffen kann, daß nicht mehr Blut vergossen wird, als durchaus notwendig ist.
gez. Leutwein.
Nach Eintreffen der Verstärkungsmannschaften, etwa am 20. August, wurde die Truppe in drei Feldkompagnien eingeteilt und gliederte sich von da ab, wie folgt:
Stab: Major Leutwein, Adjutant: Oberleutnant Diestel, Stabsarzt a. D. Dr. Sander (Kriegsfreiwilliger).
1. Feldkompagnie: Hauptmann v. Estorff, Leutnant Volkmann.
2. Feldkompagnie: Hauptmann v. Sack, Leutnant Troost, Assistenzarzt Dr. Schöpwinkel.
3. Feldkompagnie: Oberleutnant v. Perbandt, Leutnant Schwabe, Unterroßarzt Rickmann.
Artillerie-Abteilung: Leutnant Lampe.
Selbständiges Süddetachement: Oberleutnant v. Burgsdorff.

Die Gesamtstärke betrug 300 Gewehre und 2 Geschütze. Die 2. Feldkompagnie und die 50 Bastards hatten die Absperrung zu übernehmen, die 1. und 3. Feldkompagnie sollten stürmen (siehe nachstehende Skizze). Doch waren auch die überschüssigen Kräfte der zweiten Kompagnie auf der Nordfront zum offensiven Vorgehen angewiesen, falls die Verhältnisse dies gestatteten. Die Truppeneinteilung zum Angriff war demgemäß folgende:
A. Angriffs-Abteilung.
1. Hauptkolonne: 1. und 3. Kompagnie, 120 Reiter, 2 Geschütze.
2. Rechte Kolonne: v. Sack: 40 Reiter von Uhunis und als eine besondere Seitenabteilung dieser Kolonne Feldwebel Gilsoul mit 15 Reitern, von Bullsport vorgehend.
B. Absperrungs-Abteilung.
1. Nordlinie im Tsondabtal, Posten 1 bis 8 unter Hauptmann v. Sack, solange dieser für seine Person nicht mit seiner Kompagnie zur Offensive übergegangen war.
2. Südlinie unter Oberleutnant v. Burgsdorff, Posten 1 bis 6, im Tsauchabtal. Diese Abteilung sollte 2 Tage lang sich rein abwartend verhalten und, sofern sich dann noch nichts vor ihrer Front gezeigt hatte, nach Umständen handeln.
Im Osten sperrte bis zum erfolgten Angriff die Hauptabteilung selbst ab; sie hatte außerdem zwei Absperrungs- und Verbindungsposten ausgestellt (Zarrat und Pitt). Um von dem äußersten Flügelposten der Nordlinie zu demjenigen der Südlinie zu gelangen, bedurfte es eines scharfen Rittes von 5 bis 6 Tagen. Von welchem Nutzen hier ein Feldtelegraph gewesen wäre, liegt auf der Hand. Im ganzen waren für die lange Absperrungslinie nur 130 Gewehre verfügbar. Die Absperrung bestand daher lediglich aus Posten von 4 bis 6 Gewehren, die in einer Entfernung von 4 bis 5 km voneinander aufgestellt waren, eine Maßnahme, die ein europäischer Taktiklehrer seinen Schülern nicht empfehlen dürfte. Trotzdem mußte hier zu ihr gegriffen werden, denn, wie bereits erwähnt, bedeutete es den für uns ungünstigsten Fall, wenn dem Gegner ein unbemerkter Abmarsch aus dem Gebirge gelang. Die Absperrungslinie charakterisierte sich daher mehr als eine Beobachtungslinie, die einen etwaigen Durchbruch weniger verhindern, als rechtzeitig entdecken und melden sollte. Infolgedessen hatten sämtliche Absperrungsposten den Befehl, sich dem etwa durchbrechenden Gegner ungesäumt anzuhängen. Dann war die Möglichkeit gegeben, daß die Truppe den Feind, der durch Weiber, Kinder und Viehherden in seiner Bewegungsfreiheit beengt war, wieder einholte und zum Schlagen im freien Felde zwang. Zweifelhaft blieb die Sache indessen immer, denn Witbooi konnte auch seinen ganzen Troß im Stiche lassen und sich mit seiner berittenen Mannschaft bei Nacht und Nebel durch die Zwischenräume unserer Absperrungslinie hindurch in neue Berge flüchten. Dann befand sich die Truppe in der Lage eines Arztes, der — es sei mir der Vergleich gestattet — eine Bandwurmkur gemacht hat, ohne den Kopf zu treffen, es wächst einfach ein neuer Körper nach.
Auch die Absicht, in drei räumlich nicht in Verbindung stehenden Kolonnen anzugreifen, würde nach europäischen Begriffen unter allen Umständen verwerflich sein. Denn der Gegner hatte es stets in der Hand, sich[S. 48] mit Überlegenheit auf eine derselben zu werfen. Vorliegend schien jedoch diese Maßregel gerechtfertigt. Einerseits besaß Witbooi die Offensivfähigkeit eines europäischen Gegners nicht, wenn er auch in der Verteidigung sehr gutes leistete, auf der andern Seite aber erschien nach den bisherigen Erfahrungen lediglich dessen Einkesselung zum Ziele zu führen. Indessen bin ich nach meinen, dort sowie in einem späteren Falle gemachten Erfahrungen von einer solchen Teilung der Kräfte in Afrika für immer abgekommen. Ein gemeinsames Zusammenwirken räumlich getrennter Abteilungen ist leicht zu befehlen, aber schwer durchzuführen. Vorliegend erreichte denn auch in der Folge lediglich die Hauptabteilung unter dem Führer selbst dem Befehle gemäß ihr Ziel, die zweite (v. Sack) verschwand gänzlich und die dritte (Gilsoul) schloß sich dispositionswidrig der Hauptabteilung an. Auch die Erfahrungen des gegenwärtigen Herero- und Hottentottenkrieges sprechen gegen eine Trennung der Kräfte, obwohl die modernen Mittel zur Herstellung der Verbindung zwischen den einzelnen Abteilungen, wie Feldtelegraphie und Funkentelegraphie, die uns damals vollständig fehlten, jetzt bei der Truppe vorhanden sind.
Der Angriff erfolgte am 27. August früh programmäßig gleichzeitig von allen Punkten aus. Bei der Hauptabteilung sollte die 1. Kompagnie den Angriff in der tiefen Schlucht, in der die Hauptwerft Witboois sich befand, ausführen, die dritte dagegen auf den gleichfalls stark besetzten Höhen links vorgehen. Diese Kompagnie wurde indessen, um dies vorgreifend zu bemerken, weniger durch den Feind als durch das über alles Erwarten schwierige Gelände derart festgehalten, daß sie erst in später Abendstunde zum Eingreifen gekommen ist. Daher fiel des Tages Arbeit lediglich der 1. Kompagnie und den beiden Geschützen zu.
Der Feind war, trotz Geheimhaltung der Absicht des Angriffs, auf seinem Posten. Die im Morgengrauen vorgehende 1. Kompagnie erhielt sofort tüchtiges Feuer. Indessen erstürmte sie, sprungweise vorgehend, unter der tapferen Führung des Hauptmanns v. Estorff binnen einer Stunde die feindliche Stellung auf der Schluchtsohle, freilich mit dem Verlust des Führers selbst, der eine schwere Verwundung in den Fuß erhalten hatte; außerdem waren noch einige Mannschaften mehr oder minder schwer verwundet. Bei diesem Angriff trat gleich eine von den heimatlichen Gepflogenheiten abweichende taktische Lehre zutage. Sobald man den Eingeborenen energisch auf den Leib rückt, wird ihr Schießen schlecht, wogegen sie, wenn gar nicht oder aus unwirksamer Entfernung beschossen, eine bedeutende Schießfertigkeit an den Tag legen. Demzufolge müssen wir in den afrikanischen[S. 49] Kriegen von der Theorie des Ausnutzens der größeren Schußweite unseres Gewehrs, d. h. dem Heranschießen von der Grenze der Leistungsfähigkeit ab, absehen und an den Gegner, sobald er sich lediglich verteidigungsweise verhält, sofort so nahe wie möglich heranrücken und die Verluste in den Kauf nehmen. Andernfalls riskieren wir, daß nach einer nutzlosen Schießerei auf weite Entfernungen der Feind spurlos verschwindet und wir das Nachsehen haben. Das Schlimmste aber würde sein, daß er bei einer derartigen Fechtweise keine Verluste haben und ihm daher eine Verlängerung des Krieges auf unabsehbare Zeit lediglich als eine angenehme Abwechslung erscheinen würde. Und einem Gegner, der sich, wie unsere Eingeborenen, ausgezeichnet zu decken versteht und dessen dem Erdboden gleichende Farbe ihn hierin unterstützt, sind auch mit unserem vorzüglich schießenden Gewehr empfindliche Verluste nur auf den nächsten Entfernungen beizubringen.
Nach der Verwundung des Hauptmann v. Estorff übernahm Leutnant Volkmann, fast zu hastig vorwärtsstürmend, die Kompagnie, so daß ich, um Rückschläge zu vermeiden, die beiden Geschütze in der tiefen Schlucht dicht hinter der Kompagnie aufschließen lassen mußte — wieder ein nach europäischen Begriffen durchaus unrichtiges Verfahren, für Afrika indessen richtig. Einerseits haben wir dort auf gegnerischer Seite Artillerie nicht zu befürchten, auf der andern Seite zeigten damals noch die Eingeborenen vor den Geschützen eine solche Angst, daß schon der Anblick eines »großen Rohrs«, wie sie es nennen, genügte, um ihr Feuer abzuschwächen. Bei der Artillerie gibt es daher erst recht kein langsames Heranschießen von weiten Entfernungen ab, sondern ein sofortiges Heranfahren in die wirksamste Schußweite, womöglich dicht hinter die Schützenlinie. Auf Europa anzuwendende Lehren bietet daher der afrikanische Krieg von allen Waffengattungen der Artillerie die wenigsten, höchstens haben wir auch dort die Erfahrung gemacht, daß die beste Wirkung von einem ausgiebigen Schrapnellschuß zu erwarten ist, und daß daher das Kaliber unter ein gewisses Maß nicht herabgehen darf. Das gleiche gilt übrigens auch für die Gewehre. Die Eingeborenen sind gegen den Schmerz viel weniger empfindlich als wir und vermögen auch schwere Wunden ohne äußeren Nachteil zu ertragen. Daher die Erscheinung, daß man so gut wie nie auf verlassenen Schlachtfeldern feindliche Verwundete findet, da die letzteren auch mit schweren Wunden noch wegzulaufen imstande sind.
Um nun wieder auf das Gefechtsfeld zurückzukehren, so war die Lage nach verschiedenen Momenten des Kampfes, die uns noch manche Verluste gebracht hatten, am 27. August abends folgende:
[S. 50] Am weitesten vorgeschoben, gleichsam als eine Art Vorposten, stand der Rest der 1. Kompagnie auf der sogenannten Volkmannshöhe. Weiter zurück in der eroberten Hauptwerft Witboois standen die beiden Geschütze mit ihrer Bedienungsmannschaft und einigen Ordonnanzen, zugleich als Hauptquartier; noch weiter zurück, in einer Nebenwerft Witboois, war der Hauptverbandplatz aufgeschlagen. Von der auf die Höhen links entsendeten 3. Kompagnie war vorläufig noch nichts zu fühlen. Wie ich die Verhältnisse heute zu übersehen vermag, hätte ich am Mittag des 27. August in der Hauptwerft Witboois Halt machen und Nachrichten von der 3. Kompagnie abwarten sollen. Damals aber glaubte ich den Gegner in voller Auflösung geflüchtet und fürchtete, die Fühlung mit ihm zu verlieren. Diese Annahme erwies sich aber als ein Irrtum. Der Feind hatte in dem schwierigen Gebirgsgelände, weil er sich lediglich auf die Verteidigung beschränkte, wenig Verluste erlitten und, von Stellung zu Stellung zurückgehend, bis zum Abend hartnäckigen Widerstand geleistet. In der Nacht vom 27./28. August biwakierten daher beide Gegner, Gewehr im Arm auf Schußweite sich gegenüberliegend, wie wir solches in den künftigen europäischen Kriegen mit ihren Massenheeren und langandauernden Schlachten häufig finden werden. Auch ein anderer Übelstand stellte sich ein: es war nämlich weder Wasser, Holz noch Proviant vorhanden.
Der Kapitän Witbooi hatte nunmehr Gelegenheit, sich als gewandter Taktiker zu zeigen. Mit raschem Blick hatte er die klaffende Lücke zwischen der Abteilung des Leutnants Volkmann und seiner ehemaligen Werft, die zum Hauptlager ausersehen war und die beiden Geschütze enthielt, erkannt, eine Abteilung dazwischengeschoben und einen heftigen Angriff auf das Lager gemacht. Glücklicherweise traf gerade noch im letzten Augenblick, von ihrem Führer im Laufschritt herangeführt, die 3. Kompagnie ein und verjagte die Angreifer. Mit diesem Eintreffen war die Kriegslage wieder eine naturgemäße geworden, nämlich eine starke Infanterieabteilung mit zwei Geschützen als Rückhalt, eine kleinere Abteilung als Vorposten vorgeschoben. Daß zwischen beiden sich die ganze Nacht feindliche Posten und Patrouillen herumtrieben, ist bei der dortigen Kriegführung, wo die Begriffe »Flanke«, »Front«, »Rückzugslinie« sich weniger hervorheben, nichts besonders Auffallendes.
Von den beiden anderen Gefechtskolonnen hatte diejenige bei Bullsport sich nach einem kleinen, geschickt durchgeführten Gefecht der Hauptabteilung wieder angeschlossen, obwohl sie zur 2. Kompagnie nach Uhunis hatte übertreten sollen. Von letzterer trafen dagegen am 28. August früh trübe Nachrichten ein. Nach anfänglich siegreichem Vorgehen war sie von allen[S. 51] Seiten von einem überlegenen Feinde eingeschlossen worden. Noch bevor indessen die jetzt zu Hilfe gesandte Abteilung Gilsoul eingetroffen war, hatte der Gegner in der Nacht vom 27./28. freiwillig den Rückzug angetreten, wohl auf die Nachricht von der Erstürmung seiner Hauptstellung. Im übrigen hatte diese Kompagnie schwere Verluste erlitten, etwa 27 vH.; dicht neben dem Führer Hauptmann v. Sack war der beste Krieger der Bastards, der bereits erwähnte Hans Dirgaard, gefallen.[14]
Der Erstürmung der Hauptstellung folgte ein überaus schwieriger neuntägiger Gebirgskrieg, in welchem sich Witbooi als vollendeter Meister in Lieferung von Rückzugsgefechten sowie in der Deckung seiner Werft, bestehend aus Weibern, Kindern und Viehherden, zeigte. Überhaupt konnte der Kapitän mit Recht in den so beliebten »Leutnantsaufgaben« aus dem kleinen Kriege, Versteck, Überfall, Hinterhalt, vor allem Deckung und Wegnahme eines Transportes, auch europäischen Offizieren als Muster dienen.
Uns alle aber beherrschte damals die bange Frage: »Wird es dem Feinde gelingen, an unseren schwachen Absperrungsposten vorbei aus dem Gebirge zu entkommen?« Die Aussicht darauf wurde für den Gegner um so geringer, je mehr es gelang, eine Verstärkung der Absperrungslinie an derjenigen Front herbeizuführen, an welcher der Ausbruch versucht wurde. Hierzu war es nötig, vor allem die Rückzugslinie des Feindes festzustellen.
Bis dies geschehen war, blieb ich für meine Person in dem eroberten Hauptlager Witboois am Gebirgseingang in der Nähe der noch vorhandenen geringen Reserve. Bei letzterer befanden sich auch die zwei Geschütze, die der Truppe in das Gebirge nicht hatten folgen können. Der Führer der 2. Feldkompagnie hatte sich inzwischen durch die Nachricht, Witbooi wolle nach Westen ausbrechen, täuschen lassen und war nach dem Gefecht von Uhunis ohne Befehl nach dort abmarschiert. Er erhielt Weisung zur sofortigen Umkehr, denn ein Durchbruch nach Westen erschien ausgeschlossen, da das Naukluftgebirge an der westlichen Seite an die Sanddünen grenzt, wo weder Menschen noch Tiere bestehen können. Witbooi konnte nur entweder nach Norden in das Tsondabtal oder nach Süden in das Tsauchabtal durchbrechen. Die größere Wahrscheinlichkeit sprach für das letztere, da der Gegner in den Gebirgen des Bethaniergebietes viel mehr Bewegungsfreiheit fand, sich auch immer mehr seinen Hilfsquellen im Namalande näherte, während wir uns von den unsrigen entfernten.
[S. 52] Die wichtige Frage, nach welcher Richtung Witbooi seinen Durchbruch versuchen werde, von deren rechtzeitiger Lösung der Erfolg des Feldzuges abhing, entschied sich erst am 30. August, aber noch früh genug, um die entsprechenden Gegenmaßnahmen im Augenblick des Durchbruchs in Wirksamkeit treten zu lassen. An dem genannten Tage wurde die Fühlung mit dem nach dem Sturm vom 27. August verschwundenen Gegner bei der Wasserstelle Gams, mitten im Gebirge, wiedergewonnen. Der an der Südfront kommandierende Oberleutnant v. Burgsdorff hatte von der Erlaubnis, nach zweitägiger Ruhe vor seiner Front nach Umständen zu handeln, dahin Gebrauch gemacht, daß er in dem Streben, an den Feind zu kommen, mit 14 Reitern in das Gebirge eingedrungen war. Nach ungemein anstrengendem Marsch war diese kleine Abteilung am 30. August isoliert auf die zurückgehenden Witboois gestoßen, die gerade im Begriff waren, sie einzuschließen, als die Hauptabteilung überraschend dazwischen kam. Nach einem mehrstündigen Gefecht traten die Witboois den Rückzug, und zwar direkt nach Süden hin, an, während die bisherige Richtung eine westliche gewesen war. Oberleutnant v. Burgsdorff eilte nunmehr mit seiner Abteilung über das diesseitige Hauptlager wieder nach der Südfront, wo er noch rechtzeitig eintraf. Ich selbst sandte auf die erhaltene Meldung, was an Reserven verfügbar war, vor allem ein Geschütz nebst einem Wagen mit Proviant, letzteren für die aus dem Gebirge tretende Hauptabteilung, nach der südlichen Front und eilte für meine Person nunmehr der Truppe in das Gebirge nach. Die Hauptabteilung, die jetzt stets in Fühlung mit dem Feinde blieb, hatte dann am 2. und 3. September das schwere Gefecht bei Gurus. In diesem verteidigte Witbooi seine letzte Wasserstelle im Gebirge und wollte durchaus nicht weichen. Die durch die überstandenen Strapazen erschöpfte Truppe hatte einen schweren Stand, aber sie hielt unter der tapferen Führung ihrer Offiziere, und zwar des Oberleutnants v. Perbandt, der Leutnants Schwabe, Volkmann, Lampe und Troost, mit Zähigkeit aus. Da ein Bajonettangriff in diesen Bergen ausgeschlossen war, blieb nur ein schrittweises Heranschießen an die von dem Feinde besetzte Wasserstelle übrig. Am Abend des 3. September war die letztere in unserer Hand. Witbooi entschloß sich daher zur Räumung des Gebirges. Am Nachmittag des 4. September erschienen gegenüber dem Posten 4 der südlichen Absperrungslinie die dicken Haufen seines Trosses: Weiber, Kinder und Viehherden, von allen Seiten durch berittene Bewaffnete gedeckt. Genau bei dem genannten Posten, als dem Mittelpunkt seiner Linie, hatte jedoch Oberleutnant v. Burgsdorff das[S. 53] ihm zugesendete Geschütz aufgestellt. Diese Tatsache rettete den Feldzug. Denn vor den sechs Gewehren des Postens 4 hätte Witbooi, der noch über 250 Bewaffnete verfügte, schwerlich Halt gemacht. Dagegen konnten seine Leute den jetzt in die dicken Kolonnen hineinsausenden Granaten nicht widerstehen, sie flüchteten rückwärts in das Gebirge. Witbooi kam nunmehr in eine üble Lage, vor sich Burgsdorff mit dem Geschütz, links rückwärts die nachdrängende Hauptabteilung. Der sonst taktisch so geschulte Kapitän hatte den Fehler gemacht, auf der Südfront gar nicht zu erkunden, und war sonach in Unkenntnis über unsere dortige Absperrungslinie geblieben. Jedoch erwies er sich jetzt wieder sofort als Herr der Lage. Rasch hatte er eine Gefechtslinie gegen die Abteilung Burgsdorff gebildet und eine zweite gegen die nachdrängende Hauptabteilung. Unter dem Schutz dieser beiden Linien sowie auch der mittlerweile hereinbrechenden Dunkelheit brachte der Kapitän seinen Troß in annähernder Ordnung wieder in das Gebirge zurück.
Schwere Opfer hatte das Gefecht von Gurus noch gekostet, darunter der Adjutant der Truppe, Oberleutnant Diestel. Ihn hatte ich mit einer Proviantkolonne zur Hauptabteilung vorausgesendet mit dem Befehl, mich dort zu erwarten. In seinem Tatendrange hatte er sich fortgesetzt freiwillig als Führer der Spitze gemeldet und war dann den ungeheuren Schwierigkeiten des Geländes zum Opfer gefallen. Angesichts der steil aufsteigenden Höhen rechts und links hatte er es unterlassen, sich durch Seitenpatrouillen zu sichern, was jeder, der diese Höhen gesehen hat, wohl verstehen wird. Zur Überwindung seitwärts mündender Schluchten bedurfte es eines tagelangen mühsamen Kletterns, und dann hatte man in der Luftlinie einige hundert Meter zurückgelegt. Kein Wunder, wenn uns zuweilen Zweifel am Erfolge beschlichen. Die Hottentotten ihrerseits überwanden diese Bergriesen mit affenartiger Behendigkeit, womit unsere, noch dazu meist aus Kavallerie bestehende Truppe nicht wetteifern konnte. Indessen muß ich ihr das Lob spenden, daß sie sich redlich bemüht hat, es den Hottentotten gleich zu tun und schließlich mit eiserner Disziplin und Ausdauer der Geländeschwierigkeiten gleichfalls Herr wurde. Vorliegend machte sich indessen das Fehlen der Seitenpatrouillen insofern übel bemerkbar, als die auf den Bergen sitzenden Hottentotten den Oberleutnant Diestel mit seiner Spitze ruhig durch ihre vordersten Reihen durchmarschieren ließen und dann wie auf einer Treibjagd niederschießen konnten. Diestel starb mit fünf seiner Leute. Im Gefecht selbst fiel noch ein sechster Mann, so daß Gurus sieben Tote gekostet hat. Bei der Leiche des Oberleutnants Diestel war folgender Brief des Kapitäns Witbooi gefunden worden:
Gurus, 3. September 1894.
Mein lieber edler Herr Major Leutwein, hierbei mache ich diese Zeilen für Sie und bitte Sie darum, sei doch so gut und drehe doch um, sehen Sie denn nicht, daß ich fliehe, ich bin doch nicht so Großes schuldig für Sie, so bitte ich Euer Edelen, warum? Laß mich doch stehen und drehe um, wenn es Ihnen beliebt; hoffend, daß Euer Edeln dies tun, schließe ich mit herzlichen Grüßen. Ich bin Ihr Freund
gez. H. W., Kapitän.
Laß doch nach diesem Brief kein weiteres unschuldiges Blut fließen.
Da in diesem Brief wieder kein Wort von Unterwerfung stand, nahm ich keine Notiz von ihm, sondern setzte die Operationen fort.
Nach der Zurückwerfung des Gegners in das Gebirge hatte sich die Kriegslage insofern eigentümlich gestaltet, als wir aus dem Gebirge heraus waren, Witbooi dagegen wieder darin. Der Kapitän hatte es nunmehr in der Hand, einfach nach seiner, von unserer Seite nur schwach besetzten ehemaligen Stellung zurückzumarschieren und wir konnten dann von vorn anfangen. Taktisch wäre es daher das Richtige gewesen, die Truppe in das Gebirge zurückzuführen, um dem Gegner die Nordfront wieder abzugewinnen. Doch war hierzu die Truppe zu erschöpft; aber auch Witbooi war so wenig wir wir imstande, irgend etwas Ernstliches zu unternehmen. Beide Teile brachten daher die Nacht vom 4. zum 5. September, die Truppe bereits am südlichen Gebirgsrande, in total erschöpftem Zustande zu. Nachdem dann am Morgen des 5. September noch ein Ausfall von etwa 50 der anscheinend noch frischesten Witbooireiter aus dem Gebirge zurückgewiesen war, führte ich die Truppe nach dem Posten 3 der Südabsperrungslinie, wo der vorausgesandte Proviant aufgestapelt war, und ließ ihr dort eine zweitägige Ruhepause. Schwere Sorge beherrschte uns aber, da noch ein größerer Provianttransport durch das Gebirge im Anmarsch war. Man sieht zumeist im Kriege nur seine eigenen Schwierigkeiten, diejenigen des Gegners aber nicht, und ist daher geneigt, den letzteren zu überschätzen. Denn Witbooi konnte dem Provianttransport nicht mehr gefährlich werden. Er hatte sich nach dem Zurückwerfen in das Gebirge 2 bis 3 Tage fast ohne Wasser behelfen müssen. v. Burgsdorff hatte von den noch im Gebirgsrande liegenden Wasserstellen die ergiebigste durch vier Mann besetzen lassen, die sie unter der tapferen Führung des Reiters Schüle gegen die anstürmenden Hottentotten erfolgreich verteidigten. Der führende Unteroffizier hatte dagegen[S. 55] bei der Annäherung der Hottentotten den Kopf verloren und den Posten verlassen, angeblich »um Verstärkung zu holen«, und war unterwegs erschossen worden.
Erst am 7. September waren die Witboois wieder bewegungsfähig. Sie zogen sich tiefer in das Gebirge nach der Wasserstelle Tsams zurück, wo wir sie wieder treffen werden. Eine an diesem Tage vorgenommene gewaltsame Erkundung am Südfuße des Gebirges entlang hatte ergeben, daß nur noch einige erschöpfte Weiber und Kinder sich außerhalb des Gebirges befanden, der waffenfähige Teil des Gegners dagegen in diesem verschwunden war.
Die von ihrem Zug nach Westen zurückgerufene 3. Kompagnie war inzwischen, wieder auf eigene Initiative, diesmal aber einem unterwegs befindlichen Befehle vorauseilend, über das Gebirge und das Hauptlager direkt nach der Südfront marschiert, wo sie am 5. vormittags eintraf. Nach einem Ruhetage sandte ich sie, weil noch verhältnismäßig am frischesten, über das Hauptlager in das Gebirge zurück mit dem Befehl, wieder von Norden her Fühlung mit dem Feinde zu gewinnen, im übrigen aber sich defensiv zu verhalten. Die neue Stellung wie die Verfassung des Feindes war dagegen durch ein einfaches Mittel erkundet worden. Der Gefreite Melchior ritt, mit einer weißen Fahne und irgend einem mündlichen Auftrag für den Kapitän ausgestattet, in das Gebirge und fand überall zersprengte Hottentotten. Aus Gesprächen mit diesen erfuhr er die neue Stellung Witboois.
Nunmehr folgte ich am 9. September mit der 1. und 3. Kompagnie der vorausgesandten 2. Kompagnie, so daß am 11. September die ganze verfügbare Truppe, mit dichter Fühlung am Feinde, vor der neuen Stellung Witboois bei Tsams vereinigt war. Auf dem Marsche dorthin traf mich eine Botschaft des Kapitäns, in der dieser zum erstenmal ein ernstliches Unterwerfungsangebot machte. Nunmehr trat die wichtige Entscheidung über die Frage an mich heran, ob ich den Krieg bis zur Vernichtung Witboois fortsetzen oder dem letzteren eine goldene Brücke bauen und ihn für uns zu gewinnen suchen sollte. Ich entschloß mich zu letzterem und habe diesen Entschluß in einem unter dem 14. November an meine vorgesetzte Behörde erstatteten Bericht, wie folgt, begründet:
»Wenn ich Witbooi in seiner derzeitigen ungünstigen Stellung bei Tsams angriff, so hätte er zweifellos eine weitere Niederlage erlitten. Daß es dabei gelingen würde, den Führer selbst zu fangen oder sonst unschädlich[S. 56] zu machen, schien mir mit Sicherheit aber nicht zu erwarten. Gelingt es Witbooi, mit nur 30 bis 40 Reitern, die sich unschwer einzeln bei Nacht zwischen unseren Absperrungsposten durchschleichen können, zu entkommen, so ist mit dem Siege, der gewiß weitere Opfer kosten wird, nichts erreicht. Mit den zurückgelassenen Weibern und Kindern können auch wir nichts anfangen. Wir müssen sie laufen lassen und ihnen vielleicht, wollen wir sie nicht dem Hungertode preisgeben, sogar das wenige Vieh belassen.[15] Witbooi dagegen, der dann nichts mehr zu verlieren hat, wird seine Leute vollständig zu einer schwer faßbaren Räuberbande ausbilden, welche allmählich wieder durch Zulauf verstärkt werden wird. Uns bliebe dann nur ein fernerer opfervoller Kampf in Aussicht. Und daß Witbooi bei dem Angriff entkommen wird, ist nahezu als sicher anzunehmen. Witbooi ist beim Vorgehen zum Gefecht stets der Letzte, beim Rückzuge dagegen stets der Erste. Es liegt immer in seiner Hand, uns in dem schwer zugängigen Gelände mit wenigen seiner Leute stundenlang aufzuhalten, sich selbst mit seiner näheren Umgebung in unzugängliche Schlupfwinkel zurückzuziehen, um dann bei Nacht in der oben angedeuteten Weise zu entfliehen. Wenn daher Witbooi die ernste Absicht hat, sich der deutschen Regierung zu unterwerfen, so ist es nützlich, auf sein Anerbieten einzugehen und seinen Einfluß nutzbar zu machen, um seine bis jetzt lediglich an Jagd, Krieg und Raub gewöhnten Leute zur Friedensarbeit zu erziehen.«
Dieser langen Rede kurzer Sinn ist einfach, daß die vorhandenen Kräfte nicht zu einem Vernichtungsschlag gegen Witbooi gereicht haben. Diese Wahrnehmung habe ich aber erst während des Krieges selbst machen können, und nun mußte ich mit ihr rechnen.[16] Die Absperrungslinie war zu dünn, und die jetzt vereinigten drei Kompagnien waren jede nur noch einen Offizier und etwa 40 Gewehre stark. Den Rest hatten Strapazen und Gefechtsverluste — diese 27 vH. der Truppenstärke — verschlungen.
Witbooi hat in der Folgezeit zehn Jahre lang sein Wort treu gehalten und so die ihm — notgedrungen — gewährte Milde gelohnt. Wie gerechtfertigt dagegen die Besorgnis gewesen war, es würde uns doch nicht gelingen,[S. 57] den Kapitän auf Gnade und Ungnade zu fassen, das haben wir dann elf Jahre später, 1905, gesehen. Und ein allgemeiner Guerillakrieg im Namalande, mit dem wir hätten rechnen müssen, würde für uns damals noch viel schwieriger geworden sein als heute. Das Land war uns noch ganz unbekannt, landeskundige Führer waren, wie ich bereits die Erfahrung gemacht hatte, fast nicht zu finden, und die Nachschubverhältnisse noch schlimmer wie jetzt.
Es war nur naturgemäß, wenn dieser Friedensschluß in der Heimat geteilte Aufnahme fand. Denn für die Schwierigkeiten und Gefahren eines Hottentottenkrieges konnte man dort keine richtige Schätzung haben, so daß die Gründe für mein Handeln nicht verstanden worden sind. Am meisten beanstandet wurde der § 7 des Vertrages mit Witbooi, der dem letzteren Waffen und Munition beließ, sogar auch die neuen deutschen Gewehre, die während des Kriegs in seine Hände gefallen waren. Indessen war deren spätere Rückgabe vorgesehen; sie erfolgte auch nach fünf Monaten anstandslos, nachdem der Kapitän Vertrauen zu uns gefaßt hatte. Beim Friedensschluß fehlte dieses Vertrauen noch, dessen Erwachen mußte daher erst abgewartet werden. Auch hat der Kapitän etwa ein Jahr später, d. i. am 16. November 1895, einen Zusatzartikel zu seinem Schutzvertrag abgeschlossen, dessen Wortlaut folgender ist:
Zusatz zu dem zwischen dem Kaiserlichen Landeshauptmann Herrn Major Leutwein und dem Kapitän Hendrik Witbooi am 15. September 1894 abgeschlossenen Schutzvertrage.
Um deutlich und öffentlich zu zeigen, wie fest der Kapitän Witbooi auf den Bedingungen steht, die der Schutzvertrag Seiner Majestät des Deutschen Kaisers Wilhelm II. mit ihm am 15. September 1894 geschlossen hat, um ferner zu beweisen, wie der Kapitän Witbooi sich mit ganzem Herzen der deutschen Sache zu ergeben bemüht und schließlich, um den vielen Mißtrauen erregenden Gerüchten, die fortgesetzt durch das Land laufen, ein für allemal einen festen Damm entgegenzusetzen, haben der Kaiserliche Landeshauptmann Herr Major Leutwein und der Kapitän Hendrik Witbooi dem obenerwähnten Schutzvertrag folgenden Artikel hinzugefügt:
Zusatzartikel (9).
Der Kapitän Hendrik Witbooi verspricht für sich und seine Nachfolger Seiner Majestät dem Deutschen Kaiser und der Regierung Desselben, gegen alle äußeren und inneren Feinde des deutschen Schutzgebietes auf den Ruf[S. 58] des von Seiner Majestät dem Deutschen Kaiser eingesetzten Landeshauptmanns hin mit allen waffenfähigen Männern unbedingt und unverzüglich Heeresfolge zu leisten.
Die dieses heilige Versprechen betreffenden Einzelheiten, als da sind: jährliche Angaben über die Zahl der waffenfähigen Männer, ihre Bewaffnung usw., setzt ein zwischen dem Kapitän Witbooi und dem Distriktschef von Gibeon besonders aufzusetzender Vertrag fest.
Gibeon, den 16. November 1895.
(Folgen Unterschriften.)
Dieses Waffenbündnis hat der Kapitän bis zum Aufstande 1904 treu gehalten.
Daß es leicht gewesen sei, Witbooi auch nur zu diesem für ihn vorteilhaften Frieden zu bewegen, kann ich dabei nicht einmal behaupten. Ihm graute vor dem Wort »Unterwerfung«, das er hinter dem Vertrage witterte. Bei der ersten persönlichen Verhandlung mit Witbooi über den Vertragsabschluß, die in seinem Lager gepflogen wurde, fand ich den Kapitän wieder derart hartnäckig, daß ich bereits Vorkehrungen zu einem erneuten Angriff auf den 16. Sept. 1894 traf. Hauptmann v. Sack erhielt als ältester Offizier den Befehl, das Gelände für einen solchen zu erkunden; ebenso bereitete ich auch die Truppe in einer Ansprache auf Fortsetzung des Krieges vor. Über die zur Verfügung stehende Truppenmacht habe ich bereits gesprochen. Die noch vorhandenen Offiziere, zugleich Kompagnieführer, waren Leutnant Volkmann bei der 1., Hauptmann v. Sack bei der 2., Leutnant Troost bei der 3. Kompagnie; dazu Unterroßarzt Rickmann als Offizierdiensttuer. Assistenzarzt Dr. Schöpwinkel war im Lager vor der Naukluft bei den Verwundeten zurückgeblieben. Von den übrigen Offizieren waren Oberleutnant Diestel gefallen, Hauptmann v. Estorff verwundet, Oberleutnant v. Perbandt infolge der Strapazen erkrankt, dem Leutnant Schwabe war die Sicherung der rückwärtigen Verbindungslinie durch das Gebirge bis zum Hauptlager übertragen, Leutnant Lampe endlich an Stelle des gefallenen Oberleutnants Diestel als Adjutant zum Stabe übergetreten.
Als ich jedoch am 15. vormittags in das feindliche Lager kam, erwartete mich Witbooi inmitten seiner Großleute in einer Haltung, die mir sofort den Eindruck erweckte, als ob seine gestrige Hartnäckigkeit wieder verschwunden wäre. Auf meine Annäherung stand der Kapitän auf und ging mit den Worten auf mich zu: »Ich werde mich unterwerfen«. Der[S. 59] Vertrag wurde sofort aufgesetzt und vom Kapitän und seinen Großleuten unterschrieben, worauf ich ihn in Gedanken, ohne zu unterschreiben, in die Tasche steckte. Der Kapitän sah dem mit Mißtrauen zu und bat mich, vor seinen Augen auch noch zu unterschreiben. Die unvermutete Nachgiebigkeit des Kapitäns lag fraglos an der geschwundenen Kriegslust seiner Leute, der sogar seine festgewurzelte Autorität nicht hatte widerstehen können, in Verbindung mit den milden Bedingungen, die ich ihm bereits am 14. abends in Umrissen mitgeteilt hatte.
Noch einige Tage blieb die Truppe behufs Regelung von Einzelheiten im Lager vor der Naukluft und trat dann in drei Kolonnen den Rückmarsch über Rehoboth nach Windhuk an. Nur der zum Stationschef von Gibeon ernannte Oberleutnant v. Burgsdorff blieb mit 30 Reitern im Hauptlager zurück, um die aus dem Gebirge heraustretenden Witboois zu empfangen und ihren Abmarsch nach Gibeon, ihrem ausbedungenen künftigen Wohnsitz, zu regeln.
Der Truppe wurde indes in Windhuk wieder keine Ruhe gegönnt, denn bereits hatten sich im Osten und im Norden des Schutzgebietes die Vorboten weiterer ernster Ereignisse gezeigt. Bei der neugegründeten Station Aais war es zu einem Zusammenstoß der Stationsmannschaft mit den Khauas-Hottentotten gekommen, bei dem drei Hottentotten gefallen waren, die Station aber ihren gesamten Viehbestand verloren hatte. In Omaruru war seitens der Hereros ein Engländer ermordet worden, und im Süden waren Mißhelligkeiten zwischen der Station Keetmanshoop und der Bevölkerung entstanden.
Nach Aais entsandte ich zunächst den Oberleutnant v. Heydebreck mit 60 Reitern und einem Geschütz, um vorläufig die Khauas in Schach zu halten. Nach Omaruru wendete ich mich selbst, und es erfolgte nunmehr:
Bereits oben habe ich erwähnt, wie in der Pause, die der Witbooikrieg gelassen hatte, in Verfolg eines Streites zwischen dem Oberhäuptling Samuel und einem seiner Unterhäuptlinge sich erstmals Gelegenheit bot, auch in die Verhältnisse des Hererolandes einzugreifen. In Okahandja residierte neben dem Oberhäuptling der reiche und einflußreiche alte Riarua, früher erster Berater des Oberhäuptlings Kamaherero und zugleich dessen Feldhauptmann. Dieser konnte sich nicht darein finden, daß jetzt ein junger Oberhäuptling sein Herr sein und er selbst keinen Einfluß mehr besitzen[S. 60] sollte. Er machte daher dem neuen Oberhäuptling Samuel das Leben so sauer, daß letzterer schließlich Okahandja verließ und sich eine Stunde davon in Osona festsetzte. Dies teilte mir Samuel mit dem Bemerken mit, er sei in Okahandja seines Lebens nicht mehr sicher. Eine derart günstige Gelegenheit zum Eingreifen in die Hereroangelegenheiten war sobald nicht wieder zu erwarten. Ich stellte daher dem Oberhäuptling meine Unterstützung in Aussicht und wies ihn an, bis zu meinem Eintreffen nichts Feindliches zu unternehmen.
Groß und gewichtig war die Macht nicht, welche die Truppe damals in die Wagschale zu werfen hatte. Sie war erst vor 14 Tagen von dem ersten langen Kriegszuge in das Namaland zurückgekommen, abgerissen, schlecht beritten und nach Abgabe der Stationsbesatzungen im Namalande gewaltig zusammengeschmolzen. Mühsam wurden ein Offizier (Leutnant Troost), 40 Reiter und ein Geschütz aufgebracht, mit denen ich mich am 23. Juni nach Okahandja in Marsch setzte. Glücklicherweise aber ergänzte der damals noch große Respekt der Eingeborenen vor dem Geschütz, was der Truppe an Stärke abging. Neben dem Hererolager wurde in Osona spät abends das unsere aufgeschlagen. Den andern Tag, am 24. Juni, fand Zusammenkunft mit dem Oberhäuptling statt, den ich trotz hochgezogener deutscher Flagge recht niedergeschlagen fand. Auf Nachmittag 3 Uhr wurde ein Zusammentreffen der beiden Gegner in dem deutschen Lager, als neutralem Boden, verabredet. Wer aber nicht kam, war Riarua, der sich mit der üblichen Krankmeldung entschuldigte. Mein sofortiges eigenes Erscheinen vor dessen Wohnung in Okahandja noch an demselben Tage vermochte zunächst hieran nichts zu ändern. Der Alte war vielmehr jetzt ganz verschwunden. Auf dem Rückwege zum Lager begegnete ich indessen seinem Sohne, dem heute vielfach genannten Assa Riarua. Einige aufklärende Worte an diesen genügten, um den Vater Riarua zur freiwilligen Gestellung bei mir noch an demselben Abend zu bewegen. Dann fand am 25. Juni im Hause des Missionars ein Zusammentreffen der beiden Feinde mit schließlicher feierlicher Versöhnung statt. Während der Besprechung war auf Antrag des Oberhäuptlings Riarua um seine Waffen und Munition erleichtert worden. Eine Abteilung, gemischt aus Deutschen und Hereros, holte sie in dessen Hause ab. Samuel nahm dann den ihm nahegelegten Antrag, zu seinem Schutze um eine deutsche Garnison in Okahandja zu bitten, mit Freuden auf. Die Station wurde vorläufig in dem Hause der Firma »Wecke & Voigts« untergebracht und an ihre Spitze der Leutnant Eggers gestellt. An seine Stelle trat in Swakopmund der mit dem neuen Transport kommende Leutnant[S. 61] v. Erckert, derselbe, der später auf dem Ritt zur Naukluft ein bedauerliches Ende durch Verdursten gefunden hat. Damit war der Hauptplatz des Hererolandes in die tatsächliche Machtsphäre der Schutzherrschaft eingezogen. Wenn auch der Oberhäuptling selbst wenig Macht besaß, so mußte doch ein etwaiger aufständischer Unterhäuptling mit ihm rechnen und dessen direkte Anhänger stets auf unsere Seite bringen.
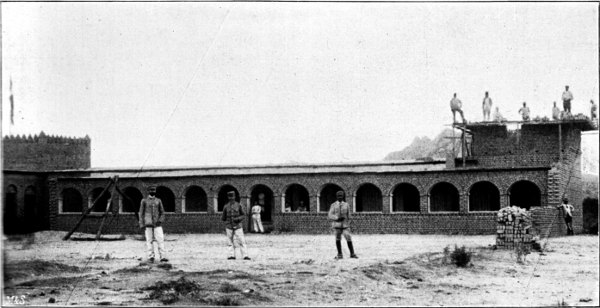
Bei dieser Gelegenheit lernte ich auch den Unterhäuptling Nikodemus kennen, den Thronprätendenten im Hererolande, zugleich Stiefsohn des alten Riarua. Er suchte behufs Stärkung seiner Erbansprüche jetzt gleichfalls Anlehnung an die deutsche Regierung. Da ein solcher Keim der Zwietracht unter den Hereros für uns von Nutzen sein konnte, behandelte ich die Sache dilatorisch und vertröstete auf die Zukunft. Einen Antrag Samuels, mit ihm zusammen gegen seinen anderen erbitterten Feind, den Unterhäuptling Tjetjo, zu marschieren, lehnte ich dagegen für jetzt ab; hatten wir doch vorläufig noch genug mit Witbooi zu tun.
Einschaltend will ich hier bemerken, daß die zuweilen als Vorwurf erhobene Behauptung, die deutsche Regierung hätte den Oberhäuptling Samuel als solchen eingesetzt, nicht richtig ist. Letzterer war als Sohn des verstorbenen Oberhäuptlings Kamaherero, über die Proteste der nächstberechtigten Agnaten Tjetjo und Nikodemus hinweg, seitens der Groß[S. 62]leute in Okahandja gewählt worden. Mein Vorgänger nahm die gegebene Tatsache einfach hin.[17] Ich selbst betrat den gleichen Weg, ohne jedoch die Nebenbuhler Samuels uns direkt zu verfeinden. Von den letzteren ist jedoch der eine, Nikodemus, später mit Gewalt in sein Verderben gerannt.
Diesem Zwischenfall folgte der bereits geschilderte Entscheidungskampf gegen Witbooi und letzterem dann im November 1904 mein Besuch bei dem nächstmächtigsten Häuptling der Hereros, Manasse in Omaruru. Dieser Besuch, zuerst friedlich gedacht, nahm jedoch infolge der Ermordung eines Engländers im Gebiet des Häuptlings Manasse einen kriegerischen Charakter an. Der Engländer hatte seinerseits einen Eingeborenen ermordet. Da damals eine Vertretung der deutschen Regierungsgewalt in Omaruru noch nicht vorhanden war, wollte Manasse das Strafgericht selbst in die Hände nehmen und den Täter verhaften lassen. Den Befehl dazu überschritten jedoch die Abgesandten des Häuptlings und schossen den Weißen tot. Der Häuptling, einer der intelligentesten des Schutzgebietes, verhehlte sich nicht, daß dies einen Kriegsfall bedeuten könnte und traf seine Gegenmaßnahmen. Zeitweilig sollen in Omaruru bis zu 800 Bewaffnete versammelt gewesen sein. Dazwischen sandte mir jedoch der Häuptling Botschaft auf Botschaft, daß er glücklich wäre, wenn die Sache friedlich erledigt werden könnte. Unsere Truppenmacht bestand aus 100 Mann und 1 Geschütz, jedoch moralisch und materiell verstärkt durch die Teilnahme des Oberhäuptlings Samuel, dessen Interesse zur Sache ich durch die Aufforderung, jetzt auch in Omaruru seine Würde als Oberhäuptling zur Geltung zu bringen, gewonnen hatte. Dieser Verlockung konnte er nicht widerstehen, umsoweniger, als Manasse ihn niemals anerkannt hatte und ein vor mehreren Jahren gemachter Versuch Samuels, diesen gewaltsam hierzu zu zwingen, mißglückt war. Auch der Häuptling Zacharias von Otjimbingwe schloß sich dem Zuge an. Am 26. November 1894 traf die Truppe, von Otjimbingwe kommend, in Omaruru ein. Die Macht Manasses hatte sich, wohl aus Proviantmangel, größtenteils wieder verlaufen, so daß bei unserer Ankunft nur noch 200 bis 300 Bewaffnete vorhanden waren. Doch auch diese leisteten keinen Wider[S. 63]stand. Manasse hatte die Mörder bereits festgesetzt, so daß der als Kaiserlicher Richter mitgekommene Assessor v. Lindequist die Untersuchung sofort beginnen konnte. Derjenige Herero, der den tödlichen Schuß abgegeben hatte, wurde zum Tode und der Führer der Abteilung, ein Neffe Manasses, zu drei Monaten Gefängnis verurteilt. Sowohl Assessor v. Lindequist wie ich hatten das Gefühl, als ob der zum Tode Verurteilte, ein Mann niederen Standes, aus Achtung vor dem Höhergeborenen dessen Schuld mit auf sich genommen hätte. Eine Veranlassung, dieser Sache auf den Grund zu gehen und so den Kapitän unnötig zu verstimmen, hatten wir jedoch nicht. Der verurteilte »kleine Mann« erlitt den Tod, und der verurteilte »große Mann« ging als Gefangener nach Windhuk.

Wichtiger war es, die üble Lage des Kapitäns politisch auszunutzen. Etwa einen Tagemarsch unterhalb Omaruru liegt an dem gleichnamigen Flusse eine Bergdamaraniederlassung namens Okombahe. Diese, erklärte ich, müsse die deutsche Regierung wegen der dort vorhandenen Arbeitskräfte haben. Der Kapitän, zuerst überrascht, daß ich von dieser Niederlassung[S. 64] überhaupt Kenntnis hätte,[18] gab schließlich wohl oder übel nach, er trat den Platz an die deutsche Regierung ab. Okombahe, bis zum heutigen Tage direkt unter der Regierung stehend, ist auch während des gegenwärtigen Aufstandes treu geblieben. Als Gegenleistung für seine Befreiung von den Hereros mußte der Werftkapitän Cornelius in wechselndem Turnus, seiner Bevölkerungszahl entsprechend, Arbeitskräfte stellen. Die Kaffern von Okombahe sind meist Christen, da sich dort eine Station der Rheinischen Mission befindet.
Ferner wurde die Gelegenheit benutzt, um auch Omaruru mit einer Garnison zu versehen. Es blieben dort unter dem Oberleutnant Volkmann 26 Mann und 1 Geschütz. Schließlich wurden zwischen den drei anwesenden Häuptlingen die Grenzen geregelt. Zweifelhafte Grenzbestimmungen, um den Wetteifer der Häuptlinge um die Gunst der deutschen Regierung wach zu erhalten, blieben jedoch noch genug übrig. Die Frage einer etwaigen Unterstellung Manasses unter den Oberhäuptling Samuel wurde dagegen von mir wohlweislich nicht mehr berührt.
Am 30. November wurde der Abmarsch nach Windhuk über Okahandja angetreten. An letztgenanntem Platze wurde nach zweitägigen Verhandlungen mit den Hereros deren Südgrenze gegen das Kronland bis an den Weißen Nosob zurückgeschoben. Diesen für die Hereros schwerwiegenden Vertrag unterschrieb Samuel, wie immer, leicht und vergnügt, mit ernstem Bedenken aber seine Großleute, an der Spitze Assa Riarua.
Die Hereros innerhalb ihrer Grenzen zu halten, war eine der schwierigsten Aufgaben der deutschen Regierung. Wir hatten uns gleichsam als Puffer zwischen sie und die Hottentotten eingeschoben, nachdem die Niederwerfung Witboois sowie die spätere Vertreibung der Khauas-Hottentotten uns ein stattliches Kronland östlich Windhuk über den Weißen und Schwarzen Nosob[S. 65] bis an die englische Grenze verschafft hatte. Das ehemalige Jan Jonker-Gebiet zwischen Swakop und Kuiseb westlich Windhuk gehörte der Kolonialgesellschaft für Südwestafrika, dies mußte mithin seitens der Regierung gleichfalls geschützt werden. Durch uns befreit von dem Alp, den Witbooi mit seinen fortgesetzten Raubzügen über den Hereros hatte lasten lassen, überschwemmten diese nunmehr ihrerseits die Grenzen. Hatten sie damit früher die Hottentotten belästigt, so traf dieses Schicksal jetzt uns, und gerade während der eben geschilderten Wirren in Omaruru waren die Hereros in Unzahl aus dem Süden ihres Gebiets herübergezogen, so daß es beinahe zu einem bewaffneten Zusammenstoß mit der in Windhuk zurückgebliebenen kleinen Garnison gekommen wäre. Die Festsetzung einer Südgrenze war daher dringend nötig, es fragte sich jetzt nur, ob die Hereros diese respektieren würden.
Nach kurzem Aufenthalt in Windhuk ging es am 21. Dezember gegen die Khauas-Hottentotten vor. Diese Gelegenheit des Durchmarsches einer Truppenabteilung unter meiner Führung wurde benutzt, um verschiedene über die Grenze gedrungene Hererowerften zurückzuweisen. Am 31. Dezember fand das Eintreffen in Aais und die Vereinigung mit der dorthin vorausgesandten Abteilung des Oberleutnants v. Heydebreck statt, so daß dort nunmehr etwa 100 Gewehre und zwei Geschütze zur Verfügung standen. Die 2. Kompagnie unter Hauptmann v. Sack war als zweite Kolonne über Hoachanas an den unteren Nosob entsendet, um den Khauas den Weg zu ihren Stammesgenossen im Süden zu verlegen, mithin wieder eine Trennung; aber es war die letzte, die ich angeordnet habe. Denn viele Tage lang war ich ohne Nachricht von der 2. Kompagnie und hatte bezüglich ihres Schicksals schwere Sorgen auszustehen. Als dann endlich die beiden Abteilungen Fühlung miteinander bekamen, wäre es noch beinahe zum Gefecht zwischen ihnen gekommen, da sie sich gegenseitig für Hottentotten gehalten hatten.
Der Abmarsch der in Aais versammelten Abteilung fand am 2. Januar 1895 statt; am 5. abends Ankunft in Hoagousgeis, der ergiebigsten Wasserstelle am unteren Nosob. Die Khauas hatten sich an der letzten für größere Abteilungen brauchbaren Wasserstelle an dem genannten Fluß, in Arahoab, festgesetzt. Im übrigen sah es mit den Wasserverhältnissen bei dem jetzt mangelhaften Regenjahr recht bedenklich aus. In Hoagousgeis wurde Halt[S. 66] gemacht, um Nachrichten von der 2. Kompagnie abzuwarten. Diese kam trotz aller ausgesandten Boten erst vier Tage später, am 9., zugleich mit der Meldung, daß eine Patrouille der Station Hoachanas mit einer Abteilung Khauas zusammengestoßen sei und hierbei zwei Tote gehabt hätte. Ferner verlautete, die Khauas-Hottentotten hätten auf die Nachricht von dem Anmarsch der Truppe aus Aais ihre Stellung bei Arahoab geräumt und seien querfeldein gegen Gochas gezogen. Dies war die für uns ungünstigste Richtung, da sie den aufrührerischen Stamm zu den unzuverlässigen Franzmann-Hottentotten und in die Nähe der eben erst unterworfenen Witboois führte. Nachdem eine stärkere Patrouille unter Leutnant Troost den erfolgten Abmarsch der Khauas bestätigt hatte, trat ich am 15. Januar den Abmarsch von Hoagousgeis direkt über Oamsib und Gungab nach Gochas an. Die mittlerweile gleichfalls im Nosobtal in der Nähe Arahoabs eingetroffene 2. Kompagnie erhielt Befehl, auf demselben Weg zu folgen. Diese Art Trennung, nämlich Zerlegung in hintereinander marschierenden Staffeln, ist die einzige, die ich seitdem in Afrika vorgenommen habe. Zu ihr zwingen zuweilen die Wasserverhältnisse. Sie ist indessen taktisch ungefährlich, da bei einer etwa eintretenden schwierigen Lage die vordere Staffel nur einfach Halt zu machen und das Aufschließen der hinteren abzuwarten braucht.
Der Kriegsschauplatz hatte sich mithin nach Gochas verzogen, wo inzwischen sich mancherlei Wichtiges ereignet hatte. Der etwa seit vier Wochen in Gibeon ansässige Kapitän Witbooi hatte sich als über die Kriegsereignisse stets genau orientiert erwiesen und über sie auch seinen Stationschef v. Burgsdorff auf dem laufenden erhalten. So auch jetzt in bezug auf den Marsch der Khauas-Hottentotten nach Gochas, zugleich unter freiwilligem Hilfsangebot. Oberleutnant v. Burgsdorff nahm zu zehn seiner Soldaten zehn Witboois und eilte mit diesen nach Gochas. Das Erscheinen der zehn weißen Hüte auf unserer Seite brachte auch dem Kapitän von Gochas zum Bewußtsein, auf welche Seite er gehöre. Damit war den Khauas-Hottentotten der Boden zum ferneren Widerstande entzogen. Als einem auf Posten ziehenden weißen Reiter seitens des Gegners das Pferd unter dem Leibe erschossen, mit einem zweiten Schuß der Karabiner zerschmettert worden war, ritt Simon Cooper persönlich in das Lager der Khauas-Hottentotten, verbat sich das Schießen in seinem Lande und erwirkte Schadenersatz.
Erfreulich zeigte sich ferner bei den Offizieren der Truppe das Streben nach einheitlichem Zusammenwirken sowie das Drängen nach dem Orte der Gefahr. Des lobenswerten Eingreifens des Oberleutnants v. Burgsdorff[S. 67] habe ich schon gedacht. Hauptmann v. Estorff, welcher zur Heilung seiner im Witbooifeldzuge erhaltenen Wunde auf dem Wege nach der Heimat war, kehrte in Kapstadt um und eilte über Lüderitzbucht nach Gochas. In Gibeon gab ihm Kapitän Witbooi einige Reiter zum Schutze mit. Leutnant Eggers, der mit 30 Reitern als Verstärkung von Windhuk über Hoachanas nach dem Nosobtal im Anmarsch war, schwenkte auf die Nachricht von dem Marsch der Khauas nach Gochas sofort ab und wandte sich gleichfalls nach letztgenanntem Orte. Das Verdienst dafür, daß den Leutnant Eggers diese Nachricht rechtzeitig traf, fällt dem Reiter Schüle der Truppe zu, demselben, der als Verteidiger einer Wasserstelle gegen die Witboois bereits rühmlich genannt ist. Er hatte den Auftrag, in Begleitung einiger von Simon Cooper gestellter Reiter die Meldung von den Ereignissen in Gochas nach dem Nosobtal zu bringen und den klugen Gedanken, in Gungab, einem Hauptknotenpunkt zwischen dem Nosob- und dem Auobtal, sichtbar angebracht, eine Meldung zurückzulassen. Die letztere schilderte in anschaulicher Weise das Eintreffen der Khauas, etwa 120 Hinterlader stark, in Gochas und wie »sein Leutnant« sich dadurch in höchster Gefahr befände. Diese Meldung versah Leutnant Eggers, nachdem er sie gelesen, mit seinem Visum und steckte sie wieder an ihren Platz. Dort fand auch ich sie, und war damit über die Lage aufs vortrefflichste orientiert. Während so die Truppe Windhuk mit zwei Offizieren und etwa 100 Reitern verlassen hatte, hatten sich schließlich in Gochas sechs Offiziere und etwa 180 Reiter zusammengefunden.
Am 22. Januar 1895 erfolgte der Einmarsch in Gochas. Dies veranlaßte die in der Nähe des Platzes lagernden Khauas zum eiligen Abmarsch, und — was recht merkwürdig war — Simon Cooper mit seinen Leuten schloß sich ihnen sofort an. Die Ursache hierzu war das ewig böse Gewissen des Kapitäns, obwohl er zu einem solchen gerade jetzt gar keine Veranlassung hatte. Samuel Isaak, der anwesende Feldherr der Witboois, hemmte schließlich diese allgemeine Flucht. Das Erscheinen zweier flüchtiger Stämme in dem kaum beruhigten Namalande konnte damals von unheilvollen Folgen sein. Dies umsomehr, als bei dem Zusammenstoße in Aais, der den Anlaß zur Eröffnung der Feindseligkeiten gegeben hatte, äußerlich ein gutes Teil Unrecht auf unserer Seite gewesen war.
Aus diesem Grunde betrat ich den von den Kapitänen Witbooi und Simon Cooper vorbereiteten Boden des friedlichen Ausgleichs und begnügte mich mit Rückgabe des geraubten Viehs und der erbeuteten Gewehre seitens der Khauas. Ferner wurde der Stamm seines Landes für verlustig erklärt,[S. 68] zur Ansiedlung im Witbooigebiet gezwungen und der Oberaufsicht des Kapitäns Witbooi unterstellt. Dieser war nach meinem Eintreffen in Gochas an der Spitze von 70 Reitern persönlich nach dort gekommen und nahm sich der Durchführung der getroffenen Abmachungen auf das eifrigste an. Nur eine Bedingung konnte er, wie ich hier vorgreifend bemerken will, dauernd nicht durchführen, nämlich die zwangsweise Ansiedlung der Khauas in seinem Gebiete. Nach wenigen Monaten war der ganze Stamm geflüchtet und wieder in seinen alten Raub- und Jagdgründen am Nosob aufgetaucht, wo wir ihm ein Jahr später nochmals begegnen werden, aber dann zum letzten Male. Der nominelle Kapitän der Khauas, Manasse in Bersaba, hatte — von Witbooi beinahe mit Gewalt hergeholt — sich bei dieser Regelung der Verhältnisse seines Stammes ziemlich passiv verhalten. Er verschwand nachher wieder in Bersaba, um nicht wieder zum Vorschein zu kommen. Der bisherige stellvertretende Kapitän der Khauas, Eduard Lambert, nahm dann den Titel Kapitän an.
Kaum dieser Sorge ledig, drängte sich mir jetzt eine andere, sehr viel schwerere auf. Eilboten der Station Aais brachten die Meldung, der Assessor v. Lindequist, der gemeinsam mit den Abgesandten des Oberhäuptlings Samuel die neue Südgrenze des Hererolandes hatte abreiten sollen, sei zugleich mit seinen sechs weißen Begleitern von aufsässigen Hereros gefangen gesetzt. Seine seitens des Oberhäuptlings mitgegebenen Hererobegleiter seien gleichfalls gefangen, aber nicht festgebunden, wie die Weißen. Diese Meldung ließ an schwerwiegender Bedeutung nichts zu wünschen übrig, denn in Verbindung mit den bald darauf eintreffenden nicht minder bedrohlichen Nachrichten aus dem Namalande stellte sie nicht mehr und nicht weniger in Aussicht als einen Krieg nach zwei Fronten. Einem solchen hatten wir 180 Mann mit 4 Geschützen entgegenzusetzen. Für jetzt blieb nichts anderes übrig, als Zerlegung dieser schwachen Truppe in zwei gleich starke Teile, von denen der eine unter Hauptmann v. Estorff nach dem Norden, der andere unter mir nach dem Süden abrückte. Witbooi sollte behufs Unterbringung der Khauas in Gochas bleiben. Die erwähnten bedenklichen Meldungen aus dem Namalande hatten folgendes besagt:
1. Eine Patrouille sei von den Feldschuhträgern überfallen, ein Reiter erschossen und einer verwundet worden.
2. Keetmanshoop sei von den Feldschuhträgern belagert, der auf Patrouille befindliche Distriktschef Oberleutnant Bethe mit 10 Reitern von den Bondelzwarts erschossen worden.
[S. 69] Auch diese beiden Meldungen trugen den Stempel sicherster Glaubwürdigkeit. Und doch erwies sich von ihnen, wie auch von der erwähnten Nachricht aus dem Hererolande, mithin von drei Meldungen, in der Folge nur eine einzige als wahr, nämlich diejenige von dem Abschießen einer kleinen Patrouille im Feldschuhträgergebiet; aber nicht durch den Stamm der Feldschuhträger war dies geschehen, sondern durch einige auf eigene Faust räubernde Hottentotten. Sie wurden später mit Hilfe der betreffenden Kapitäne eingebracht, sechs von ihnen kriegsgerichtlich zum Tode verurteilt und erschossen. Der Mord war an einer Wasserstelle geschehen, an der die zwei Mann starke Patrouille friedlich gelagert hatte. Der Überlebende (Unteroffizier Walter), obwohl selbst am Arm schwer verwundet, war verständig genug, aus dem Gewehre seines Kameraden das Schloß herauszunehmen und dieses dadurch unbrauchbar zu machen. Dann schleppte er sich nach der sechs Stunden entfernten Station Koes, wo er auch glücklich eintraf. In dem Punkte der Überlassung von Gewehren an den Feind habe ich sonst unsere Leute immer von einer ganz unglaublichen Sorglosigkeit gefunden, während die Eingeborenen gerade das Gegenteil zeigen. Die Folge ist, daß in jedem Feldzuge in bezug auf Gewehre und Munition trotz aller Siege das Verlustkonto auf unserer Seite das größere zu sein pflegt.
Nachdem sich derart bestimmt auftretende Nachrichten von dem schwersten Gewichte, wie sie hier vorgelegen hatten, als rein aus der Luft gegriffen erwiesen hatten, wird es jeder nur billigen, wenn ich später in bezug auf Nachrichten aus dem Schutzgebiete skeptisch geworden bin. Südwestafrika ist das Land der sogenannten »Stories«, wie man dort die herumgetragenen Nachrichten nennt. Solche pflegen sich mit einer unglaublichen Geschwindigkeit fortzupflanzen. In Beziehung auf ihre Weiterverbreitung konnte daher der Telegraph an Geschwindigkeit nichts verbessern, wohl aber bedurften wir seiner dringend, um sie zu kontrollieren.
Bis zum 6. Februar 1895 blieb ich in Gibeon unter häufigen Besprechungen mit dem mittlerweile gleichfalls zurückgekehrten Kapitän Witbooi über Stammesangelegenheiten, darunter auch die Frage der Wiedereinrichtung einer Missionsstation. Einer solchen zeigte sich der Kapitän wohl zugeneigt, obwohl die Mission selbst — wie sich später erwies, mit Unrecht — seiner neuerwachten christlichen Gesinnung nicht recht traute. Am schwierigsten zu lösen war indessen die Ernährungsfrage. Der Stamm war total verarmt. Seine 3000 Menschen ernährten sich damals lediglich von Harz und Feld[S. 70]früchten. Diese hungernden Gestalten anzusehen war ein Jammer, in ihnen lag aber auch eine Gefahr für die umwohnenden Viehbesitzer. Mittels Beschäftigung der Leute beim Wege- und Stationsbau sowie mittels Überlassung von Muttervieh auf halben Anteil wurde die Not einigermaßen gehoben. Letztere Maßregel ist so zu verstehen, daß dem Nutznießer gegen die Verpflichtung, das Vieh zu hüten, die Hälfte des Nachwuchses zufällt, eine in Südwestafrika allgemein übliche Vereinbarung. Auf diese Weise kann der Nutznießer allmählich wieder zu einer Viehherde kommen, während der Besitzer ohne eigene Arbeit und ohne Kosten in der andern Hälfte des Nachwuchses eine Verzinsung seines Kapitals findet.
In Keetmanshoop bestand damals zwischen Bevölkerung und Distriktschef eine gewisse Mißstimmung. Die erstere, an der Spitze der Unterkapitän, hatte zum Teil den Platz verlassen. Die Ursache war nicht minder schwer zu ergründen, wie die Schuldfrage. Bei Eingeborenen kann auch schon das harmloseste Tun und Reden Weißer Mißtrauen erregen. Doch hatte der Distriktschef, Oberleutnant Bethe, als richtiger Mann am richtigen Platz, an der Spitze von seinen wenigen Leuten durch tapferes Eingreifen die drohende Empörung im Keime erstickt. Auf der andern Seite hatte sich der Bezirksamtmann Duft bereits das Vertrauen der Eingeborenen ausreichend genug erworben, um von deren größtem Teil die Gewehre ausgeliefert zu erhalten. So blieb für mich nach meiner Ankunft in Keetmanshoop nicht mehr viel zu tun übrig. Mit Unterstützung eines Bevollmächtigten des Kapitäns Wilhelm Christian von den Bondelzwarts, unter dessen Oberherrschaft, wie bereits erwähnt, Keetmanshoop seinerzeit gekommen, konnte die Sache leicht wieder vollständig eingerenkt werden.
Nunmehr erübrigte im Namalande nur noch der Besuch von Warmbad, des Sitzes des Bondelzwartskapitäns. Die Stellung dieses unseres damals besten Freundes im Süden des Schutzgebietes war bei seinen Untertanen schwer erschüttert. Der Grund war die Verleihung weitgehender Konzessionsrechte an eine englische Gesellschaft, die fortgesetzt diese Rechte nicht nur in den seitens der deutschen Regierung bestätigten engeren Grenzen, sondern weit darüber hinaus auszunutzen versuchte. Z. B. verlangte sie von sämtlichen im Bondelzwartsgebiet ansässigen Weißen Weideabgaben und bestritt dem Kapitän Wilhelm Christian das Recht zum Verkauf von Bauplätzen in den Ortschaften Warmbad und Keetmanshoop, da diese Plätze »ihre Farmen« seien. Der gute Wilhelm, der weder lesen noch schreiben konnte, hatte, wohl unter dem Einfluß von Alkohol, dem er leider sehr[S. 71] zugetan, seinerzeit blindlings unterschrieben, was ihm der Gesellschaftsvertreter vorgelegt hatte, und war nun sehr erstaunt über die vielen Gerechtsame, die er angeblich verliehen haben sollte. Seine Untertanen aber, die sich in ihrem Besitz bedroht sahen, sprachen deutlich von Absetzung. In diese verwickelten Verhältnisse mußte eingegriffen werden. Die Gesellschaft wurde in ihre Schranken zurückgewiesen und der Stamm in öffentlicher Ansprache über die guten Absichten der deutschen Regierung aufgeklärt. Die Vorführung eines Geschützes, welche Waffe den Bondelzwarts bis dahin unbekannt gewesen war, befestigte dann noch die allgemein eintretende friedliche Stimmung. Vor allem zeigte der Kapitän große Dankbarkeit. Er ist auch unter den wechselnden Stationschefs mit einer einzigen Ausnahme im Jahre 1898, die ich noch besprechen werde, bis zu seinem Tode stets friedlich geblieben. Der Kapitän war verständig und nicht ohne Würde, beides jedoch durch seine starke Neigung zum Alkohol beeinträchtigt.
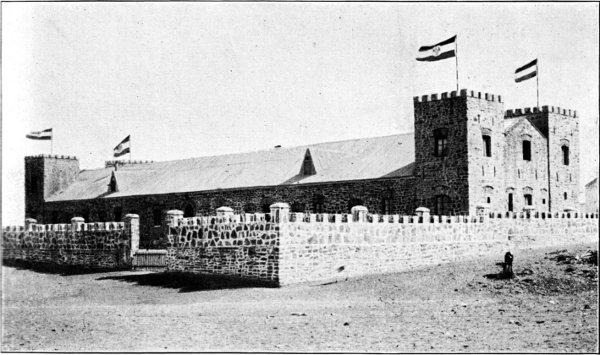
Am 28. Februar erfolgte der Abmarsch von Warmbad, und nach einem kurzen Aufenthalt in Keetmanshoop, Gibeon und Rehoboth am 24. März die Rückkehr nach Windhuk, vorläufig der Stab allein, während die Truppe langsam nachmarschierte. Unterwegs ereignete sich an Bemerkens[S. 72]wertem nichts, als daß Kapitän Witbooi unsere während des Krieges erbeuteten Gewehre, Modell 88, herausgab, und daß er sowohl wie die Kapitäne von Bersaba und Rehoboth von mir, jeder auf Kosten seines Nachbarn, eine bedeutende Verschiebung ihrer Grenzen verlangte. Ich verwies alle drei zunächst auf direkte Einigung untereinander und dann erst auf Anrufen meiner Entscheidung. Abgesehen von derartigen geringfügigen, für uns aber ganz günstigen Eifersüchteleien unter den Eingeborenen selbst, konnte jetzt das Namaland als beruhigt angesehen und unsere ganze Aufmerksamkeit auf das Hereroland gerichtet werden. Zu einem Eingreifen im Namalande ist die Truppe erst fünf Jahre später wieder gezwungen worden.
Diesen Abschnitt könnte man ebensogut »Kampf um die Grenzen« nennen. Zwar hatte der im Februar 1895 zur Rettung des angeblich gefangenen Assessors v. Lindequist herbeigeeilte Hauptmann v. Estorff diesen wohl und munter in der Nähe von Windhuk gefunden sowie eifrig beschäftigt, die Hereros tunlichst über die neue Grenze zurückzudrängen, aber immer und immer wieder fanden Grenzüberschreitungen, verbunden mit Belästigungen der weißen Farmer, statt. Die östlich Okahandja am oberen Weißen und Schwarzen Nosob wohnenden Hererostämme, die unter der Botmäßigkeit oder wenigstens unter dem Einflusse der Unterhäuptlinge Tjetjo, Nikodemus und Kahimema standen, erkannten die mit dem Oberhäuptling getroffene Abmachung anscheinend überhaupt nicht an. Ich ließ daher den Oberhäuptling nach Windhuk kommen und verabredete mit ihm einen — zunächst friedlich gedachten — Zug zu den genannten Unterhäuptlingen.

Die 1. Kompagnie war nach ihrer Rückkehr nach Windhuk an den unteren Swakop marschiert, um sich mit Verbesserung des Bayweges zu beschäftigen. Ich beließ sie in dieser nützlichen Beschäftigung, auch auf die Gefahr, daß infolgedessen die zu dem beschlossenen Zuge zur Verfügung stehende Macht wesentlich herabgesetzt werden mußte. Sie bestand aus nur 60 Mann und einem Geschütz. Auf den dringenden Rat des Oberhäuptlings, der seinen Untertanen noch weniger Vertrauen schenkte als ich,[19] fügte[S. 75] ich später noch ein weiteres Geschütz hinzu. Den Oberhäuptling selbst hatte ich zur Verminderung des Trosses angewiesen, nur 50 seiner Leute mitzunehmen. Doch hatte dieser seine in der Nähe der Marschstraße wohnenden Anhänger zum Anschluß an den Zug an die Straße herangezogen, so daß sich schließlich 200 bewaffnete Hereros auf unserer Seite befanden, unter ihnen die Unterhäuptlinge Mambo, Barrachio und der in der neuesten Zeit vielgenannte Kajata, der kriegerischste aller Hereros.
Am 17. Mai fand der Abmarsch nach Windhuk über Seeis statt, am 19. die Ankunft in Otjihaenena, dem Sitze der Ovambandjerus, eines Seitenzweiges der Hereros unter dem Häuptling Kahimema. Ihm hatte sich auch Nikodemus mit seinen Anhängern zugesellt, so daß etwa 500 Bewaffnete versammelt gewesen sein mögen. Der alte Tjetjo hatte sich, seiner Gewohnheit gemäß, abseits gehalten, anscheinend abwartend, wer sich als der Mächtigere erweisen werde, um dann sich mit diesem zu vertragen. Die Ovambandjerus lagen bei unserer Ankunft in den Schanzen und gedachten, wie wir nachträglich erfuhren, in der Tat, der friedlich einrückenden Truppe eine Falle zu stellen. Indessen bin ich in unsicheren Zeiten niemals in eine Eingeborenenwerft eingerückt, ohne dem Werftoberhaupt durch vorausgesendete Boten meine Ankunft angesagt zu haben. So konnte auf die einfachste Weise festgestellt werden, was die Truppe in der Werft erwartete. Allerdings gehören zu einem solchen Verfahren eingeborene Bundesgenossen, tunlichst vom gleichen Stamm, da nur solche absolut sicher sind. So auch hier. Es ritt auf eigenen Wunsch der Assessor v. Lindequist voraus, aber in Begleitung des Halbbruders von Nikodemus, Assa Riarua, für den eine Gefahr ausgeschlossen war. Diese beiden brachten die Meldung von der Gefechtsbereitschaft der Hereros zurück. So konnten die erforderlichen Gegenmaßnahmen getroffen werden. Die Truppe rückte selbst gefechtsbereit in eine der feindlichen gegenüber liegende Stellung — beide Stellungen durch das breite Bett des Weißen Nosob getrennt — und machte sich gleichfalls zum Gefecht fertig.[20]
Von seiten des Gegners fiel indessen kein Schuß, auch nicht, als ich persönlich hinüberritt, um dessen Wünsche zu hören. Ich selbst legte gar keinen Wert auf eine kriegerische Erledigung der Sache. Denn in den Kolonialkriegen bedeutet der erste Schuß nicht den Anfang fröhlicher Siege, sondern den Anfang von Wirren, deren Ende unabsehbar ist. Nikodemus entschuldigte sich[S. 76] für seine kriegerischen Maßnahmen mit den ihm zugetragenen »Stories«. Ich gab ihm eine halbe Stunde Zeit, um seine Stellung zu räumen, widrigenfalls von unserer Seite der erste Schuß fiele. Nach der ausbedungenen Frist war von der gegenüberliegenden Linie schwarzer Wollköpfe nichts mehr zu sehen.
Nicht verschweigen will ich, daß die ohnehin schwache Truppe damals zum Teil noch mit dem minderwertigen Gewehr Modell 71 ausgerüstet war. Wie in jedem Feldzuge, so war auch in demjenigen gegen Witbooi eine Menge Gewehre Modell 88 unbrauchbar geworden, der Ersatz für sie aber noch nicht eingetroffen.
Ich verabredete nun mit Nikodemus und Kahimema eine Zusammenkunft zur Besprechung der Lage. Von den beiden Unterhäuptlingen war der letztere der mächtigere, der erstere der energischere und die Seele der Sache. Für ihn war der jetzige Versuch nur eine Etappe in dem Kampfe um die Oberhäuptlingswürde. Weniger der Truppe hatte daher seine Gefechtsbereitschaft gegolten, als vielmehr dem Oberhäuptling Samuel, dem er wieder ein »ôte-toi, que je m'y mette« hatte zurufen wollen. Eine Einladung zur Besprechung in unserem Lager lehnten die mißtrauischen Häuptlinge auch in dem jetzigen Falle ab, so daß ich mich zu dem Ritte in das ihrige bequemen mußte. Dort erhob sich auf meine Frage, wer denn eigentlich der Oberhäuptling der Hereros sei, eine mächtige Debatte. Wenn es überhaupt einen solchen gäbe, so wollte von den anwesenden Unterhäuptlingen es wenigstens jeder selbst sein. Hiergegen wendete ich ein, daß die Frage, ob es überhaupt einen Oberhäuptling der Hereros gäbe, ausscheiden müsse, da der Deutsche Kaiser mit einem solchen seinerzeit einen Schutzvertrag abgeschlossen habe und er mithin damals vorhanden gewesen wäre. Sonach sei lediglich die Frage zu erörtern, wer jetzt an dessen Stelle getreten sei. Dieser Auffassung stimmte aus naheliegenden Gründen der gleichfalls anwesende ehemalige Minister und Feldherr des früheren Oberhäuptlings Kamaherero, der alte Riarua, sofort zu.
Behufs Erledigung der Frage, wer der Nachfolger des früheren Oberhäuptlings sei, gab ich den Unterhäuptlingen 24 Stunden Zeit zur Überlegung. Wie vorauszusehen, einigten sie sich schließlich alle auf den bisherigen Oberhäuptling Samuel, da von den Anwesenden keiner diese Würde dem anderen hatte gönnen wollen.[21] Von diesem Tage ab war Samuel,[S. 77] der sich den Verhandlungen auf meinen Wunsch persönlich ferngehalten, der, wenn auch noch nicht sehr machtvolle, aber immerhin unbestritten anerkannte Oberhäuptling der Hereros. Seine Freundschaft hat uns in der Folge gestattet, auch bei einer nur schwachen Schutztruppe Herr des Hererolandes zu bleiben. Er hat, wie wir noch sehen werden, dem letzteren in der Folge uns zuliebe mehr Schaden zugefügt, als wir, auf unsere Macht allein gestützt, es je hätten tun können.
Recht schlau wußte Nikodemus sich mit der gegebenen Lage abzufinden. Konnte er nicht der Erste werden, so wollte er wenigstens der Zweite sein. Er nahm seinem nunmehr anerkannten Herrn und Gebieter Samuel gegenüber eine loyale Miene an und bat diesen, ihn zum Kapitän der Osthereros zu machen. Der Oberhäuptling, der ohnehin mit den letzteren nicht fertig werden konnte, bewilligte diese Bitte gern und auch ich hatte keine Veranlassung, mich dem damit in die geschlossene Macht der Hereros getriebenen Keil entgegenzustellen. In erster Linie wurde durch dieses Abkommen der Häuptling der Ovambandjerus, Kahimema, betroffen. An Stelle des machtlosen Oberherrn in Okahandja hatte er nunmehr in einer kraftvollen und zielbewußten Persönlichkeit einen solchen in nächster Nähe erhalten. Nikodemus dagegen war jetzt aus einem lediglich großen Viehbesitzer zu einem wirklichen Kapitän mit Land und Untertanen geworden. Wie er diese neu gewonnene Macht benutzt hat, werden wir ein Jahr später sehen. Einzig von der Oberherrschaft des Nikodemus befreit blieb der gleichfalls im Osten wohnende Unterhäuptling Tjetjo. Dieser würde seine nominelle Selbständigkeit freiwillig niemals an Nikodemus abgegeben haben und sie ihm mit Gewalt zu nehmen, dazu hatte weder die deutsche Regierung, noch der Oberhäuptling Veranlassung. Am 21. Mai 1895 vormittags fand eine Schlußversammlung statt, in der ich den Hereros nochmals die Notwendigkeit einer bestimmten Grenze zwischen den beiden Gebieten auseinandersetzte. Es sei ein Verdienst des Oberhäuptlings, dies rechtzeitig erkannt zu haben, an ihnen aber sei es jetzt, die vereinbarte Grenze auch zu halten. Im übrigen war man bei dem im Januar 1895 stattgehabten Abreiten der Grenze durch Assessor v. Lindequist den Hereros bereits insoweit entgegengekommen als nicht, wie seinerzeit in Okahandja vereinbart, der Weiße Nosob selbst die Grenze bilden sollte, sondern eine Mittellinie zwischen Nosob und Seeisfluß. Hierdurch sollte das Zusammendrängen beider Parteien an einer Flußlinie mit den hieraus sich ergebenden unvermeidlichen Streitigkeiten vermieden werden.
[S. 78] Für jetzt aber handelte es sich darum, auch unsere Maßnahmen dem neu erstandenen Ostreich der Hereros entsprechend anzupassen. Dies geschah durch Gründung eines neuen Ostbezirks. Bis jetzt hatte im Osten nur die uns bereits bekannte Station Aais bestanden, welche die Wacht über die Khauas hatte übernehmen sollen. Jetzt waren diese in den Hintergrund getreten, da der Schwerpunkt des Bezirks sich nunmehr an die Hererogrenze verschoben hatte. Ich zog daher mit dem neuen Kapitän des Ostens gleich nach dort, als Zielpunkt den wichtigen Platz Gobabis. Dieser Platz war früher Hauptsitz der Khauas-Hottentotten gewesen, von ihnen jedoch wegen des dort herrschenden Fiebers verlassen worden. Ihn hätte Nikodemus auch gern zur Residenz seines neu gegründeten Ostreichs erhoben. Seine mehrfach wiederholten Anregungen hierzu lehnte ich jedoch entschieden ab. Denn auch für uns war Gobabis der unentbehrliche Schlüsselpunkt des Ostens. Am 28. Mai fand unser Eintreffen daselbst und die Vereinigung mit dem dorthin aus Aais bestellten Distriktschef des Ostens, Leutnant Lampe, statt. Mit diesem gemeinsam ging es dann über Oas, Stampriet an die englische Grenze, um mittels Gründung einer Station dem neuen Ostreich den Bezug von Waffen und Munition auf dem Wege des Schmuggels tunlichst abzuschneiden. Die durchzogene Gegend erwies sich als ein vorzügliches Farmland. Kein Wunder, wenn auch die Hereros die Lust nach ihm anwandelte. Früher war das Land unbestrittenes Eigentum der Khauas-Hottentotten. Nachdem diese jetzt durch uns zurückgedrängt waren, erstrebten die Hereros deren Erbschaft, genau, wie sie dies im Westen nach der Beseitigung Witboois versucht hatten. Vereinzelte Khauas-Hottentotten zeigten sich uns noch da und dort. Sie sowohl wie die Hereros fanden sich in dem Bestreben einig, den Weißen die Wasserstellen möglichst zu verbergen. Auch der mit anwesende Kaffernkapitän Apollo schloß sich, anscheinend durch Nikodemus eingeschüchtert, diesem Bestreben an.
Die neue Station wurde in Olifantskluft gegründet, ein Platz, bei dem eine starke Quelle in Kaskaden in die Schlucht hinabstürzt. Nach zweijährigem Bestand mußte sie bedauerlicherweise als zum englischen Gebiet gehörig anerkannt und daher wieder geräumt werden. An ihrer Stelle wurde dann die weniger günstig gelegene Station Oas gegründet.
Nach Festlegung der Station Olifantskluft ging es in Eilmärschen nach Aais zurück, immer in Begleitung von Nikodemus, mit dem ich am 15. Juni in Aais einen besonderen Grenzvertrag abschloß. Er versprach, die Osthereros, die gleichfalls in gewaltigen Massen über die[S. 79] neue Grenze gedrungen waren, hinter diese zurückzuziehen. Dafür sollte ihm für seine Person gestattet sein, vorläufig, jedoch ohne jedes Eigentumsrecht, in Gobabis wohnen zu dürfen. Dorthin verlegte dann auch der Distriktschef seinen Sitz, während Aais nur mit einer schwachen Mannschaft besetzt blieb. In Gobabis wurde dann später eine festungsartige Kaserne gebaut und der Platz mittels Entwässerungsarbeiten von dem dort herrschenden Fieber befreit.
Auf dem Rückweg nach Windhuk hatte ich demnächst noch ausgiebig Gelegenheit, die auch im Westen erneut über die Grenze gedrungenen Viehherden der Hereros zu bewundern. Wo es ging, wurden sie zurückgetrieben, einmal unter Pfändung von Ochsen. An dem wichtigen Platze Seeis wurde eine Station gegründet, und nach meinem Eintreffen in Windhuk am 20. Juni an den Oberhäuptling Samuel ein wenig freundlicher Brief geschrieben. Letzterer kam am 1. Juli selbst und entschuldigte sich mit seiner Ohnmacht seinen Leuten gegenüber. Wir verabredeten daher gemeinsame Besetzung der Grenze, vor allem einen gemeinsamen Zug durch das Hereroland, um den Untertanen des Oberhäuptlings sowohl unsere Macht wie unser beider Freundschaft zu zeigen. Dieser Zug wurde Anfang August in Begleitung der von ihren Wegearbeiten zurückgerufenen 1. Kompagnie und einem Geschütz angetreten.
Bevor ich auf diesen Zug eingehe, muß ich noch eines bei Witbooi vorgekommenen Zwischenfalles Erwähnung tun. Längst schon hatte ich den Kapitän zu einem Besuch in Windhuk zu bewegen gesucht, dessen Mißtrauen jedoch nicht überwinden können. Er sagte zu seinem Bezirksamtmann wörtlich, ihm und dem Major traue er wohl, wir seien jedoch Soldaten und müßten daher Gehorsam leisten, wenn wir aus Berlin Befehl erhielten, ihn tot zu machen. Der Kapitän sandte daher lediglich seinen Unterfeldherrn Samuel Isaak mit vier Begleitern, dem sich auch der Bezirksamtmann v. Burgsdorff anschloß. Und nun kommt ein zweites merkwürdiges Zeichen des Mißtrauens. In Windhuk war mittlerweile Major Mueller als stellvertretender Truppenkommandeur eingetroffen. Ihn beauftragte ich, sich während meiner Expedition ins Hereroland im Namalande zu orientieren und bei dieser Gelegenheit Witbooi einen Besuch abzustatten. Als Major Mueller sich Gibeon näherte, erfaßte den Kapitän Witbooi, den die Ankunft eines neuen deutschen Majors ohnehin mit schwerem Mißtrauen erfüllt hatte, zumal auch sein Bezirksamtmann noch abwesend war, eine solche Unbehaglichkeit, daß er über die englische Grenze nach Rietfontein eilte. Hier verblieb er, bis ihn Major Mueller auch dort aufsuchte[S. 80] und von seinen guten Absichten zu überzeugen vermochte. Auch der Bezirksamtmann v. Burgsdorff war nach seiner Rückkehr dem Kapitän sofort nachgeeilt und in Rietfontein mit Major Mueller zusammengetroffen.
Diese Flucht des Kapitäns Witbooi hat dann zu einem weiteren merkwürdigen Zwischenfall geführt. Während des Aufenthaltes Witboois in Rietfontein erschien eines Tages in einer Kapstädtischen Zeitung ein in holländischer Sprache geschriebener Brief, datiert aus Rietfontein und angeblich von Witbooi herrührend. In diesem Brief bedankte sich der Kapitän bei der Redaktion für die während des Kampfes gegen die Deutschen gewährte Unterstützung. Namentlich hätte ihre Schilderung über die »Morderei in Hornkranz der Welt die richtige Erleuchtung gegeben«. Durch Vermittlung des Generalkonsulats Kapstadt kam dieser Brief nach Windhuk und ging von da behufs Aufklärung nach Gibeon. Darauf ging im Monat Dezember ein persönlicher Brief Witboois an mich ein, dessen ungefährer Wortlaut folgender war:
»Der Bezirksamtmann v. Burgsdorff hat mir einen Brief in einer Zeitung gezeigt, den ich geschrieben haben soll. Darauf erkläre ich folgendes. Diesen Brief habe ich weder geschrieben noch unterschrieben. Auch hat ihn keiner meiner Leute geschrieben noch unterschrieben. Diesen Brief hat ein böser Mensch mit schlechten Absichten geschrieben. Überhaupt schreibe ich und meine Leute schon lange nicht mehr in die Zeitungen. Auch denke ich nicht mehr an so alte Dinge, wie Hornkranz.
Glauben Sie doch nicht alles Böse, was über mich gesagt wird. Ich habe ja einen Vertrag mit Ihnen gemacht, den ich mit meinem Herzblut unterschrieben habe. Ich bin usw.«
Mit dem letztgenannten Vertrag meinte der Kapitän den vom 15. November 1895 über die unbedingte Heeresfolge seinerseits. Und trotz dieses Vertrages und trotz allen Entgegenkommens seitens des Bezirksamtmanns v. Burgsdorff noch solches Mißtrauen! Ist es da ein Wunder, wenn wir sehen, wie in dem gegenwärtig noch tobenden Aufstand die Hottentotten so schwer zur Abgabe ihrer Waffen zu bringen sind?
Nach dieser Abschweifung kehre ich wieder zu dem Zuge nach dem Hererolande zurück.
Der Weg ging durch dichtbevölkertes Land über Okandjose, Osire nach Waterberg, wo wir am 12. August eintrafen. Die Abteilung bestand aus etwa 70 Weißen und 50 Hereros, letztere unter dem Oberhäuptling. In[S. 81] Waterberg lernte ich den Unterhäuptling und großen Viehzüchter Kambazembi kennen, einen echten alten Herero, welcher unter äußerer Sanftmut durchtriebene Schlauheit verbarg. Um sich der ihm unbequemen Landfrage zu entziehen, erklärte er, »nur Kapitän der Beester« zu sein, die Politik sei Sache des Oberhäuptlings. Trotzdem hatte der Aufenthalt bei Kambazembi auch seine politische Bedeutung, da der Alte einer der einflußreichsten Hereros und die Beseitigung etwaigen Mißtrauens auf seiner Seite daher von[S. 82] Wichtigkeit war. Unterstützt wurde diese Absicht durch seine stark hervortretende Kriegsunlust. Kambazembi hat auch bis zu seinem Tode, ungeachtet mancherlei Unzuträglichkeiten, die ihm das Zusammenleben mit Weißen zuweilen bereitete, den Frieden um jeden Preis aufrecht erhalten. Erst nach seinem Ableben, aber auch nicht lange darauf brach der allgemeine Hereroaufstand aus.
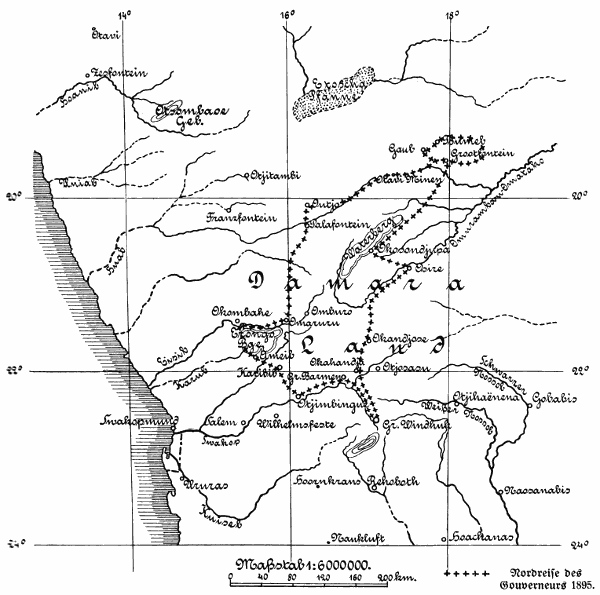
Damals sah es mitten im Hererolande, in welchem die Grenzfrage keine Rolle spielte, sehr friedlich aus. Überall wurde die Truppe mit freudigem Staunen begrüßt und überall schwärmten die Hereros unbewaffnet und zutraulich umher, nur stark um Tabak bettelnd. Dem alten Kambazembi ließ ich auf seinen Wunsch das mitgebrachte Geschütz vorführen. Auf die von mir geäußerte Besorgnis, verirrte Sprengstücke könnten Unheil anrichten, meinte der Alte, wenn auch ein Herero getroffen würde, er bezahle alles. Das ist der Standpunkt des reichen Herero. Demjenigen, der es bezahlen kann, ist alles erlaubt, Strafe ereilt nur den Armen. Trotzdem das Hereroland während meines Marsches äußerlich einen friedlichen Eindruck machte, konnte ich wahrnehmen, daß die Hereros das Zentrum ihres Landes geräumt hatten, um sich mehr nach der Peripherie zu ziehen. Sie ahnten das bevorstehende Eindämmen von allen Seiten und wollten sich daher rasch noch viele Wasserstellen »ersitzen«.
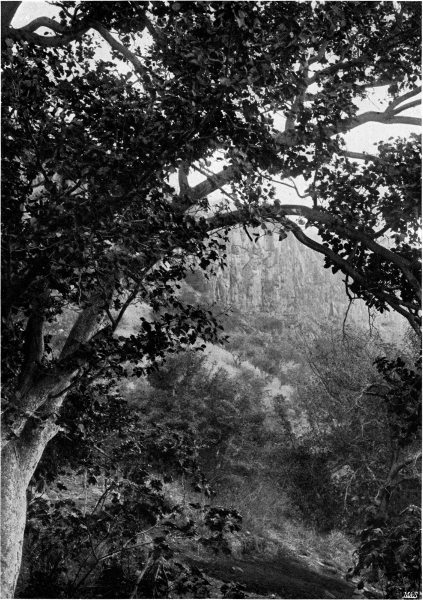
Am 15. August fand der Abmarsch von Waterberg in der Richtung auf Grootfontein statt, Eintreffen an dem letzteren Platz am 21. Die Minen- und zum Teil auch die Landrechte in dem herrenlosen Gebiet zwischen Herero- und Ovamboland sind einer englisch-deutschen Gesellschaft, der South-West-Africa Co., überlassen, deren damaliger rühriger Vertreter, Dr. Hartmann, seinen Sitz in Grootfontein aufgeschlagen hatte. Dort lernte ich auch zum erstenmal eine geschlossene Burenniederlassung kennen, die Dr. Hartmann mit 25 Familien gegründet hatte. Diese waren der Teil eines »Treks« von 200 Familien, Auswanderern aus Transvaal, die über Rietfontein (nördlich) an der Grenze des Hererolandes entlang nach Grootfontein gekommen waren und sich von da zum größten Teil nach dem portugiesischen Gebiet gewendet hatten. Dr. Hartmann hatte so aus dem vorher öden Grootfontein ein freundliches Burendorf geschaffen. Indessen waren es, wie sich später ergab, nur sein Einfluß und seine Tätigkeit, welche die Buren hier zusammenhielten. Mit ihm verschwand im Jahre 1897 auch die Burenniederlassung.
Für jetzt erschöpften sich die Buren in Loyalität. Sie verpflichteten sich, deutsche Untertanen zu werden und sogar die Wehrpflicht über sich ergehen[S. 87] zu lassen. Das Wichtigste aber war, daß in Grootfontein auch ein Vertrag mit dem Oberhäuptling über die Nordgrenze des Hererolandes zustande kam. Der miterschienene Vertreter Kambazembis, sein ältester Sohn Kanjunga, bequemte sich nach einigen Einwendungen gleichfalls zur Unterschrift. Zwar banden die Untertanen des Oberhäuptlings zunächst sich hier so wenig wie an der Südgrenze an diese Abmachung. Wenigstens hatten wir unsern Schein und konnten ihn in Wirksamkeit treten lassen, sobald es erforderlich wurde. Vorläufig war dies nicht dringlich, da es außer den Buren in Grootfontein weiße Ansiedler in dieser Gegend damals noch nicht gab. Nördlich Grootfontein, an dem wasserreichen Platz Gaub, hatte sich noch eine Anzahl Kaffern und Buschmänner zu einer Werft zusammengetan und sich in einem Hererobastard namens Krüger ein Oberhaupt gegeben, das in seiner Würde bestätigt wurde. Da Gaub gleichfalls im Gesellschaftsgebiete lag, nahm sich Dr. Hartmann auch dieses Platzes an und unterstützte namentlich die Rheinische Mission, die dort eine Station errichtet hatte (Missionar Kremer).

Den Rest des Aufenthalts in Grootfontein benutzte ich zu einer vierzehntägigen Rundfahrt in die Umgegend. Ich fand viel Wasser, Palmen, Ackerboden, in Tsumeb reiche Erzlager und, was nicht das Schlechteste war, keine Hereros. Letztere hatten aus Furcht vor den viehstehlenden Buschmännern und wohl auch vor den Ovambos nie so weit vorzudringen gewagt. Auch diese Fahrt fand in Begleitung des Gesellschaftsvertreters, Dr. Hartmann, statt.
Am 6. September erfolgte der Abmarsch von Grootfontein in der Richtung auf Outjo. Der Weg führte über Otavi, wo die Besichtigung der dortigen Kupferminen stattfand. An ihr beteiligte sich auch der Oberhäuptling[S. 88] mit Staunen. Er bewies seine körperliche Gewandtheit, indem er hier vom Pferd aus einen flüchtenden Schakal lebend fing. Bei Otavifontein bewunderten wir die starke Quelle. Doch mußte leider aus ihrer Versumpfung, wie aus dem abgeweideten Grasfeld auf die vorher stattgehabte Anwesenheit von Hereros geschlossen werden. In Naidaos stellte sich ein Buschmannsvormann namens Aribib vor, der, ähnlich wie Krüger im Osten als Kapitän der Buschmänner des Westens anerkannt wurde. Damit war die Hoffnung gegeben, diese flüchtigen und scheuen Menschen wenigstens einigermaßen in der Hand zu behalten. In Okateveni, kurz vor Outjo, das natürlich auch von Hereros besetzt war, wurde dem Platzkapitän seitens des Oberhäuptlings in meiner Gegenwart auseinandergesetzt, daß er mit Rücksicht auf die neuabgeschlossene Grenze in der nächsten Regenperiode den Platz zu räumen habe. Am 16. fand dann der Einzug in Outjo statt.

Die Haupttätigkeit während des fünftägigen Aufenthaltes in Outjo bestand in der Regelung der Verhältnisse der beiden nach dem Kaokofelde verschlagenen Stämme der Swartboois und der Topnaars. Von beiden Stämmen hatten sich die Kapitäne mit Großleuten eingefunden. Der seitens des Assessors v. Lindequist mit den zu diesem Zweck nach Windhuk gekommenen Swartboois 1894 abgeschlossene Schutzvertrag wurde auch von den Topnaars angenommen. Bei den Swartboois wurde dann noch ein Streit um die Kapitänswürde zwischen zwei Vettern durch Bestätigung des[S. 89] legitimen Erben, David Swartbooi, erledigt. Doch spielte zwei Jahre später, wie wir noch sehen werden, dieser Zwiespalt in der Geschichte des Stammes abermals seine Rolle.
In Outjo erhielten wir die ersten Nachrichten aus Windhuk. Sie meldeten wiederum fortgesetztes Überschreiten der Grenze seitens der Hereros und, dadurch hervorgerufen, Zwistigkeiten mit den weißen Farmern. Jetzt redete ich ein ernstes Wort mit Samuel und stellte ihm die Anwendung von Waffengewalt gegen seine unbotmäßigen Leute in Aussicht. Aber nicht ihm, dem Oberhäuptling und seinen loyalen Untertanen, solle sie gelten, sondern lediglich den ersteren. Samuel stimmte zu und versicherte mir erneut seine unverbrüchliche persönliche Treue. In Windhuk hatte sich der als Militärbefehlshaber dort zurückgebliebene Hauptmann v. Sack bemüht, die Hereros tunlichst zurückzudrängen, und marschierte später zu dem gleichen Zweck nach Gobabis, wo er sich bei Rückkehr der Truppe nach Windhuk noch befand.

Am 21. September fand der Abmarsch von Outjo statt, und am 26. der Einzug in Omaruru. Unterwegs war noch mit zwei Werftkapitänen,[S. 90] Katarrhe in Pallafontein und Kawaio in Ongombe, abzurechnen. Der erstere hatte sich durch ungehöriges Auftreten gegen Weiße, der letztere durch Verweigerung des Wassers an die Truppe unliebsam bemerkbar gemacht. Kawaio entschuldigte sich und versprach Besserung. Katarrhe dagegen war geflüchtet und konnte erst ein Jahr später zur Rechenschaft gezogen werden. Eine fernere interessante Bekanntschaft war diejenige mit dem durch seine Fettleibigkeit bekannten Unterhäuptling Mbandjo, 3⅓ Ztr. schwer. »Meine Beine sind in Omaruru«, sagte er einst zu dem Distriktschef Oberleutnant Volkmann, und meinte damit seinen Ochsenwagen. Jedenfalls war er vermöge seiner Schwerfälligkeit der friedliebendste aller Hererogroßen. Dem allgemeinen Aufstand 1904 hat er sich freilich auch nicht entziehen können, es wird ihm indessen dabei recht schlecht gegangen sein. Für jetzt wurde der alte Herr als eine Merkwürdigkeit photographiert und ging so in zahlreichen Ansichtspostkarten nach der Heimat.
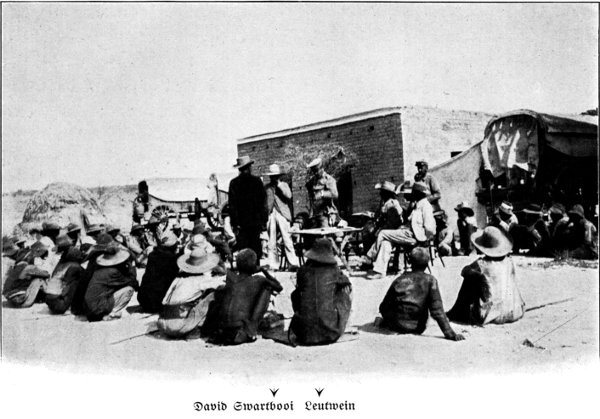
Die Bevölkerung von Omaruru zeigte sich bei dem diesmaligen Einzug wie umgewandelt, überall deutsche Flaggen und freundliche Gesichter. Im übrigen waren wichtige politische Fragen, nachdem seit meinem letzten Besuche bei dem Häuptling Manasse noch nicht ein Jahr verflossen war, nicht[S. 91] zu erledigen. Dagegen trieb es mich, unser neugewonnenes Kaffernreservat Okombahe zu besuchen. Am 1. Oktober ging ich dahin ab. In einem zweitägigen Aufenthalt wurde alles Nötige geregelt, und namentlich den wenigen noch anwesenden Hereros bedeutet, daß sie den Platz zu räumen hätten. Von ihnen hatte sich der bisherige Werftkapitän Daniel Kariko, der sich in die Abtretung des Platzes nicht ohne weiteres hatte finden wollen, durch unberechtigtes Auftreten bemerkbar gemacht. Für jetzt wurde er verwarnt, ein Jahr später jedoch ins Gefängnis gesetzt, da er sich nicht besserte. Die Bergdamaras zeigten sich dagegen für die Befreiung vom Joch der Hereros äußerst dankbar.
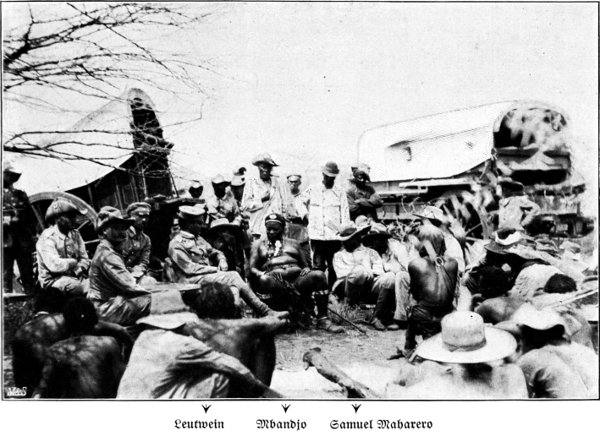
Am 3. Oktober ritt ich über den malerischen Platz Ameib und die schöne Farm Spitzkoppjes — beide damals noch leer — nach Karibib, wohin die Truppe direkt marschiert war. Auch dort, wo heute ein betriebsames Städtchen mit Eisenbahnstation sich befindet, stand noch kein einziges Haus. Am 8. Oktober erfolgte das Eintreffen in Otjimbingwe, wo an politischen Fragen gleichfalls nicht viel zu regeln war. Der Häuptling Zacharias war ein friedliebender ängstlicher Mann, mehr dem Alkohol als den Staats[S. 92]geschäften zugetan. Von hier wurde der Oberhäuptling nach Okahandja entlassen, während ich nach Windhuk zurückritt, wo ich am 16. Oktober eintraf. Unterwegs konnte ich mich überzeugen, daß der Distriktschef von Otjimbingwe, Oberleutnant Held, sich an die Verbesserung des Bayweges gemacht und bereits ein schönes Ergebnis erzielt hatte.
Mit dem nunmehr zum Abschluß gebrachten Zug durch das Hereroland hatte eine tatsächliche Besitzergreifung des nördlichen Teils durch Stationsgründung nicht verbunden werden können. Bei der Schwäche der Truppe hätte dies zur Zersplitterung geführt. Zunächst ging daher der Antrag auf eine Erhöhung der Etatsstärke der Truppe nach Berlin (100 Reiter, 4 Geschütze). Dieser Antrag wurde, wie ich vorgreifend bemerken will, anfangs abgelehnt, aber nach dem tatsächlich ausgebrochenen Hereroaufstand 1896 mit einer Erhöhung bis auf 400 Köpfe bewilligt. Daß die Grenzfrage mit den Hereros nicht friedlich zu lösen war, trat im übrigen immer mehr zutage. Um so wichtiger erschien die Besetzung des Landes zwischen den Hereros und den Ovambos, um die zu fortgesetzten Munitionsschmuggeleien führende Verbindung zwischen beiden Stämmen zu unterbrechen.
Zur Bekämpfung des ganzen Volkes der Hereros erschien indessen auch bei seiner größten Unterschätzung, wie sie schon damals üblich war und bekanntlich zum Teil bis 1904 vorgehalten hat, eine Verstärkung der Truppe nicht um Hunderte, sondern um Tausende erforderlich. Und diese ohne Eisenbahn, lediglich durch Ochsenwagen zu ernähren, war ausgeschlossen. Es blieb daher nur übrig, die unter den Hereros vorhandenen Interessengegensätze auch ferner zur Ausspielung des einen Stammes gegen den andern auszunutzen.
Die größte Schwierigkeit war hierbei, daß der für uns als Verbündeter in erster Linie in Betracht kommende Hererostamm von Okahandja auch zugleich derjenige war, dessen Grenzüberschreitungen uns die meisten Belästigungen brachten. Trafen diese doch die Gegend von Windhuk, mithin die am meisten besiedelte. Jedoch zeigte sich dieser Schwierigkeit gegenüber der Wert der Freundschaft des Oberhäuptlings. Mit ihm wurde jetzt ein Vertrag abgeschlossen, nach dem wir das Recht hatten, sämtliche die Grenze überschreitenden Viehherden der Hereros zu pfänden. Das gepfändete Vieh sollte dann versteigert und der Erlös zwischen der deutschen Regierung und dem Oberhäuptling geteilt werden. Während sonst das Wegnehmen von[S. 93] Vieh bei den Eingeborenen einen zweifellosen Kriegsfall darstellt, hatten wir durch den erwähnten Vertrag das legitime Recht dazu erhalten. Von diesem Recht wurde Anfang 1896 erstmals Gebrauch gemacht und bei einer von Major Mueller geleiteten Razzia die in Heusis und Harris sitzenden Hereroviehherden — mehrere tausend Stück — weggenommen. Jetzt erst schienen die Hereros sich über die Tragweite des Vertrages klar zu werden. Aufregung und Kriegslust verbreiteten sich durch das ganze Gebiet. Die im Innern des Landes befindlichen weißen Händler wurden bedroht und mußten sich eiligst zurückziehen. Als charakteristisch will ich hier noch erwähnen, daß der Sohn und der Neffe des Oberhäuptlings — beide waren ein Jahr später auf der Kolonial-Ausstellung in Deutschland —, die damals in Windhuk freiwilligen Dienst bei der Truppe taten, bei der Nachricht von dem Wegnehmen des Viehes in Tränen ausbrachen und um ihre sofortige Entlassung baten.
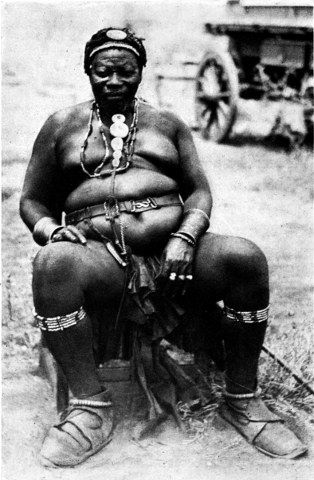
Die Kriegslust flaute jedoch indessen am Platze Okahandja selbst wieder ab, als einige Tage später vertragsgemäß die Hälfte des Erlöses aus der Versteigerung des gepfändeten Viehes bei dem Oberhäuptling eintraf, als Zeichen, daß die deutsche Regierung lediglich in Ausübung ihrer Vertragsrechte gehandelt habe und sich auch ihrer Pflichten aus dem Vertrage bewußt gewesen sei. Jedoch außerhalb Okahandjas gingen die Kriegswogen im Hererolande zunächst noch hoch, so daß sich hiervon schließlich auch die Weißen anstecken ließen, und zwar Privatleute ebensogut wie Angehörige der Regierung. Namentlich bei[S. 94] einem Teil der Offiziere machte sich eine mit Unterschätzung des Gegners verbundene Kriegslust bemerkbar.
Auf beiden Seiten waren es daher nur die Regierungen, die vorläufig die Fahne des Friedens hochhielten. Um der weißen Bevölkerung über die angesichts der beiderseitigen Machtverhältnisse ernste Lage die Augen zu öffnen, hielt ich am 20. Januar 1896 eine zahlreich besuchte öffentliche Versammlung ab, in der im allgemeinen noch die friedliche Stimmung zum Durchbruch kam. Am gleichen Tage ritt ich mit 30 Reitern nach Okahandja, wo ich am 21. eintraf. Die Hereroregierung zeigte nunmehr auch ihrerseits friedliche Gesinnung, indem etwa 30 Großleute, an ihrer Spitze der Oberhäuptling, sämtlich mit deutschen Fahnen versehen, der Truppe entgegenritten. Auch zahlreiche auswärts wohnende Großleute, darunter Nikodemus und Kahimema, waren erschienen. Als Haupt der Oppositionspartei zeigte sich jetzt wieder der alte Riarua, der anscheinend die schwierige Lage des Oberhäuptlings benutzen wollte, um im Trüben zu fischen. Bei der am 22. vormittags stattfindenden Versammlung der Hererogroßleute wurde daher Riarua, der sich als Oberhaupt der ganzen Hereros aufspielen wollte, in seine Schranken zurückgewiesen; ihnen selbst aber wurden zwei Fragen vorgelegt:
1. Welche Grenze sie wünschten.
2. Welche Strafe auf deren Überschreiten gesetzt werden sollte.
Begründet wurden beide Fragen mit der andernfalls drohenden Kriegsgefahr. Und einen Krieg mit uns sollten die Hereros sich anders als einen Hottentottenkrieg vorstellen. Ein solcher könnte nur mit Vernichtung der einen Partei endigen, und diese Partei könnten nur die Hereros sein. Noch heute ist mir erinnerlich, wie nach diesen Worten bei den Hereros diejenige nachdenkliche Stille eintrat, von der man sagt, man »könne eine Stecknadel fallen hören«.
Die Hereros faßten denn auch die Sache gebührend ernst auf und berieten unter Vorsitz des Oberhäuptlings mit einer kurzen Unterbrechung 24 Stunden lang über die Beantwortung der gestellten Fragen. Als Ergebnis brachten sie durch den Mund des Oberhäuptlings am nächsten Tage vor:
1. Als Grenze möge ihnen der Seeisfluß, dessen salzhaltiges Wasser für ihre Viehherden unentbehrlich sei, belassen werden.
2. Die Strafe für Grenzüberschreitungen sollten auch ferner der Oberhäuptling und ich bestimmen.
In bezug auf Punkt 2 verblieb es mithin beim alten, in bezug auf Punkt 1 handelte es sich um eine stellenweise Verschiebung der Südgrenze des Hererolandes um etwa 8 km. Da der Vorteil dieser Grenzverschiebung indes nur den Westhereros, d. i. dem Stamm von Okahandja, zugute kommen mußte, kam Nikodemus gleichzeitig für die Osthereros auf die Forderung von Gobabis zurück. Nun war die schönste Gelegenheit gegeben, das »divide et impera« in Kraft zu setzen. Dem Stamm von Okahandja wurde sein Wunsch bewilligt, Nikodemus aber der seine rundweg abgeschlagen. Der letztere schritt infolgedessen drei Monate später zum Aufstand, wogegen die Okahandja-Hereros auf unserer Seite geblieben sind.
Das den Okahandja-Hereros bewilligte Zugeständnis wurde überdies dadurch eingeschränkt, daß es in keiner schriftlichen Vereinbarung niedergelegt worden ist. Ich erklärte den Hereros, daß dieses Zugeständnis nur vorläufig gelte und ich mir seine jederzeitige Zurücknahme vorbehielte, falls sie diese Grenze wieder nicht beachteten. Der bald darauf ausbrechende Aufstand, in Verbindung mit der ein Jahr später auftretenden Rinderpest, brachte es indessen mit sich, daß diese Abmachung eine praktische Wirksamkeit nicht mehr erhielt. Beide Ereignisse verminderten die Viehherden der Hereros derart, daß sie nachher an Grenzüberschreitungen überhaupt nicht mehr dachten.
Während so bei den Hereros die Kriegslust wieder beseitigt schien, hatte sie sich jetzt umsomehr der Weißen bemächtigt. Dies trat auf einer zweiten, am 3. Februar 1896 bei Windhuk abgehaltenen öffentlichen Versammlung zutage. Ihr Ergebnis war eine Resolution, in der eine Verstärkung der Schutztruppe um 2000 Mann beantragt wurde. Diese Resolution ging nach Berlin mit dem Hinzufügen, daß allerdings einem allgemeinen Aufstande der Hereros gegenüber die gegenwärtige Stärke der Truppe nicht ausreiche. Indessen für die Regierung bildete nicht die Verstärkung der Truppe die Hauptsorge, sondern die bereits berührte Lösung der Proviantfrage. War doch bereits in gewöhnlichen Zeiten am Ende der sogenannten Trockenperiode der Bayweg derart abgeweidet, daß die Zufuhr von der Küste unterbunden war und in Windhuk die Bevölkerung mit aus Regierungsbeständen ernährt werden mußte. Außerdem aber haben wir 1904 die Erfahrung gemacht, daß auch 2000 Mann zur Bewältigung eines allgemeinen Hereroaufstandes nicht genügt haben würden.
Vorläufig schleppte sich jedoch der Friede noch so hin. Am 3. Februar erschien der Oberhäuptling wieder in Windhuk und sprach ernstlich[S. 96] vom Schießen auf seine Leute, weil sie immer noch unbotmäßig seien. Vom 4. ab fand dann seinerseits in Gemeinschaft mit dem Assessor v. Lindequist das Abreiten des noch übrigen Stückes der Hererogrenze zwischen dem oberen Nosob und Okapuka statt. Bald zogen sich auch die Hereros hinter die neue Grenze zurück, so daß alles friedlich zu endigen schien. Die Kapitäne des Schutzgebietes wetteiferten sogar, zu der Mitte 1896 geplanten Kolonial-Ausstellung in Berlin ihre Vertreter zu senden. Angenommen wurden der Sohn und der Neffe des Oberhäuptlings nebst Dolmetscher, ein Neffe des Kapitäns Witbooi, ein Bastard und — last not least — der Sohn des Unterhäuptlings Nikodemus. Den letztgenannten Umstand glaube ich als Beweis auffassen zu sollen, daß Nikodemus seinen Aufstand nicht von langer Hand geplant, sondern den Entschluß hierzu erst infolge der abschlägigen Antwort in bezug auf Gobabis gefaßt hat. Man kann daher füglich auch den Aufstand 1896 den Abschluß des »Kampfes um die Grenze« nennen.
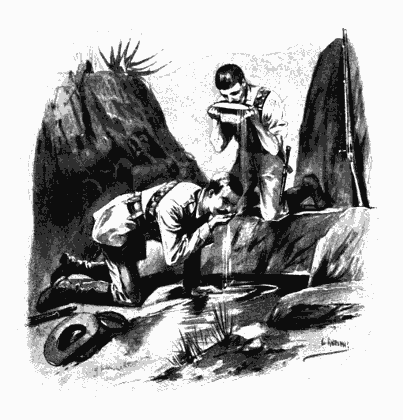

Der Distriktschef von Gobabis, Leutnant Lampe, hatte schon längst eine verdächtige Annäherung der Khauas-Hottentotten an den Unterhäuptling Nikodemus wahrgenommen. Auf seine bezügliche Meldung war, wie bereits erwähnt, während meiner Abwesenheit Hauptmann v. Sack mit der 2. Kompagnie und einem Geschütz nach Gobabis marschiert. Nachdem die Ruhe wiederhergestellt schien, wurde die Kompagnie nach Windhuk zurückgezogen.
Da traf Ende März 1896 in Windhuk ein Bur mit der Meldung des Leutnants Lampe ein, daß Gobabis und Aais seitens der Khauas-Hottentotten belagert seien, Nikodemus scheine sich noch im Hintergrunde zu halten. Der Augenblick war seitens der Aufständischen insofern für sie günstig gewählt, als die nach Ablauf der Dienstzeit zur Entlassung kommenden Mannschaften der Schutztruppe sich bereits auf dem Heimwege befanden und ihr Ersatz noch nicht gelandet war. Glücklicherweise aber hatten die Aufständischen doch insofern auch wieder zu früh losgeschlagen, als die Entlassungsmannschaften noch nicht eingeschifft waren und daher mit Eilboten zurückgerufen werden konnten. Und jetzt zeigte sich ein recht guter Geist bei der Truppe. Angesichts der heimatlichen Schiffe machten die Mannschaften in fröhlichster Stimmung Kehrt, einige erbaten und erhielten sogar die Erlaubnis, vorauszureiten, um sicher noch an den Feind zu kommen. Von diesen fiel einer bei Otjunda (Reiter Gräber), ein zweiter wurde schwer ver[S. 98]wundet. Der letztere, ein Unteroffizier, hatte während des Witbooi-Krieges in einem Augenblick der Gefahr die Überlegung verloren und so den Anschein des Mangels an Mut auf sich geladen. Seine Stellung bei den Kameraden war infolgedessen derart erschüttert, daß er um seine Entlassung nach der Heimat gebeten hatte. Nunmehr hatte er die Gelegenheit, sich zu rehabilitieren, mit vollem Erfolge benutzt. Seine Verwundung, Schuß in den Unterleib, war sehr schwer, und er wird wohl sein Leben lang an ihr zu tragen haben.
Die wesentlichste Frage war jetzt, ob Nikodemus gleichfalls bei dem Aufstande beteiligt sei. In diesem Falle mußten wir auch mit der Feindschaft der mächtigen Riaruapartei in Okahandja rechnen. Um so sicherer aber war uns der Oberhäuptling, dessen Stellung bei seinen Anhängern infolge des erlangten Zugeständnisses in der Grenzfrage wesentlich gestärkt war.
Zunächst marschierte, was in Windhuk verfügbar war, d. i. 50 Reiter (1. Kompagnie) und ein Geschütz unter Hauptmann v. Estorff, nach Gobabis ab. Da ich selbst bis zur Klärung der politischen Lage Windhuk nicht verlassen konnte, schloß sich als mein politischer Vertreter der Assessor v. Lindequist der Truppe an. Nachdem jedoch in der Folge sich ergeben hatte, daß politisch nichts mehr zu machen sei, trat Assessor v. Lindequist in seiner Eigenschaft als Reserveoffizier bei der Truppe ein und machte auch als solcher mit Auszeichnung den Feldzug mit. Den Leutnant Helm sandte ich nach Seeis, um die Gesinnung der in dieser Gegend wohnenden Hereros zu sondieren, und den Oberleutnant v. Perbandt zu dem gleichen Zweck nach Okahandja. Ich selbst zog an alten Schutztruppenangehörigen ein, was noch militärpflichtig war (Dispositionsurlauber) und was sich freiwillig meldete. So konnte ich am 4. April mit weiteren 60 Mann als neuformierter 2. Kompagnie und einem Geschütz folgen. Die 2. Kompagnie führte Leutnant Helm, nachdem Hauptmann v. Sack schon vorher krankheitshalber auf Urlaub gegangen war. Als Garnisonkommandant in Windhuk blieb Oberleutnant v. Perbandt zurück. Der letztere stellte vor seinem Abreiten nach Okahandja die Frage an mich, ob er als dritte Staffel nachmarschieren dürfe, wenn es ihm gelänge, 60 Reiter zusammenzubringen. Dies bewilligte ich gern, hatte aber keine Ahnung, woher die 60 Reiter kommen sollten. Und doch brachte sie der Oberleutnant v. Perbandt zusammen und traf Ende April mit einer neuformierten 3. Kompagnie in Gobabis ein.
Nunmehr folgten sich die Ereignisse Schlag auf Schlag. Leutnant Helm hatte die bei Seeis wohnenden Unterhäuptlinge Mambo, Baratjo und[S. 99] Kajata vollständig loyal gefunden. Dagegen war — ein bedenkliches Zeichen — Kahimema mit seinem ganzen Stamm, anscheinend behufs Vereinigung mit Nikodemus, nach dem Osten verschwunden. Oberleutnant v. Perbandt traf in Okahandja bei Samuel und seinen direkten Anhängern großes Entgegenkommen, bei dem alten Riarua und seiner Partei dagegen schlecht verhüllte Feindschaft. Von einer etwaigen Teilnahme des Unterhäuptlings Nikodemus an dem Aufstande war jedoch noch nichts bekannt. Ganz Okahandja aber schielte nach Gibeon, gespannt, welche Stellung der alte Witbooi einnehmen würde. Über diesen schwirrten derartige Gerüchte umher, daß man sogar in Swakopmund die Spuren seiner Leute feststellen zu können glaubte, und doch war der Kapitän bereits auf dem Wege nach Gobabis, aber um auf unsere Seite zu treten.
Oberleutnant v. Perbandt entledigte sich seiner nicht leichten Aufgabe mit Energie und Geschick. Wesentlich unterstützt wurde er durch die jetzt eintreffende Nachricht von dem inzwischen bei Gobabis stattgehabten ersten Zusammenstoß und dessen siegreichem Ausgang für uns. Nunmehr konnte der Oberhäuptling seine bisher mehr zur Neutralität neigenden Anhänger zur offenen Teilnahme auf unserer Seite mit fortreißen, während die Riaruapartei verstummte. Der Oberhäuptling schloß sich mit etwa hundert seiner Leute dem mit der dritten Staffel der Schutztruppe nach Gobabis marschierenden Oberleutnant v. Perbandt an. Zur Formierung dieser dritten Staffel (3. Kompagnie) hatte v. Perbandt die Bureaus geleert, an Reservisten und Freiwilligen eingestellt, was noch zu erreichen war, und endlich auch Bastardsoldaten aus Rehoboth herangezogen. Einschaltend muß ich hier bemerken, daß auf Grund eines besonderen Vertrages die wehrfähigen Bastards alljährlich 6 Wochen, beginnend 1895, militärisch ausgebildet worden sind und dann 12 Jahre zum Kriegsdienst sowie zu jährlichen Übungen verpflichtet waren. Diese Bastardsoldaten haben sich in der Folge, erstmals in dem Kriege 1896, durchaus bewährt.
Auf dem Kriegsschauplatze hatte inzwischen Hauptmann v. Estorff die Station Aais entsetzt und sich dann gegen Gobabis gewendet. Ein seitens des Assessors v. Lindequist mit dem Unterhäuptling Nikodemus angeknüpfter Briefwechsel ließ den letzteren zwar stark verdächtig erscheinen, ergab indessen bis zum Gefecht von Gobabis noch nicht volle Klarheit. Nikodemus wollte zu klug sein und fiel infolgedessen in das Gegenteil. Er gedachte sich anscheinend im Hintergrunde zu halten, um, wenn die Sache schief ging, alles von sich abwälzen zu können. Statt daher mit seinen Verbündeten, den[S. 100] Khauas-Hottentotten, sich zu einem gemeinsamen Angriff auf die schwache Abteilung des Hauptmanns v. Estorff zu vereinigen, zersplitterte er sich in zwei nacheinander folgenden Angriffen, die dann beide scheiterten. Bei so vielen Mitwissern konnte Nikodemus ja doch nicht hoffen, daß seine Teilnahme dauernd verborgen bleiben würde.
Die Abteilung v. Estorff langte am 5. April 1896 vor Gobabis an, wo auf Befehl des Führers der dortige Distriktschef Leutnant Lampe mit einigen Reitern der Station sich ihr anschloß. Das Kommando in Gobabis übernahm Assessor v. Lindequist in seiner Eigenschaft als Oberleutnant der Reserve. Am 6. April früh erfolgte der Angriff der Khauas-Hottentotten, nachdem diese bei Annäherung der Abteilung die Belagerung von Gobabis aufgegeben hatten. Die Hottentotten wurden von ihrem Kapitän, dem mehrfach genannten Eduard Lambert, in fast allzu kühner Weise zum Angriff vorgeführt, bei dem der Kapitän etwa 20 Schritt vor der deutschen Schützenlinie fiel. Sie versuchten dann, wie dies ihre Gefechtsweise ist, die deutsche Linie links zu umfassen, wozu sie ihre numerische Überlegenheit (etwa 150 Gewehre gegen 60) auch befähigte. Durch eine Gegenumfassung von deutscher Seite unter Leutnant Eggers, verbunden mit einem Angriff in der Front, wurde jedoch der Sieg für uns entschieden. Die Hottentotten verließen in eiliger Flucht das Gefechtsfeld. Leutnant Eggers war bei seinem Vorgehen durch einen Schuß in das Bein verwundet worden, jedoch auf dem Kampfplatz verblieben.
Erst nach dieser Niederlage setzte Nikodemus seine eigenen Leute zu einem zweiten Angriff ein. Sie stießen auf die jetzt in breiter Front vorreitende Abteilung v. Estorff in der linken Flanke, letztere saß ab, schwenkte ein und nahm das Gefecht in der Front auf. Auch hier versuchte der Feind durch Umfassen des linken Flügels den Sieg an sich zu reißen, wozu auch ihm seine bedeutende Überlegenheit (etwa 300 Gewehre) die Möglichkeit bot. Der drohenden Umklammerung suchte sich Hauptmann v. Estorff durch einen Gegenangriff zu Pferde zu entziehen. Er nahm aus der Front heraus, was dort einigermaßen entbehrlich war, ließ zunächst den Leutnant Lampe eine Attacke reiten, der er, links rückwärts gestaffelt, unter seiner eigenen Führung eine zweite folgen ließ. Die erste Attacke scheiterte vollständig. Sie bestätigte die Regel, daß ein Reiterangriff zu mißlingen pflegt, wenn die Infanterie — und sei dies auch nur eine schwarze — standhält. Und der Gegner hielt stand. In kurzer Zeit waren daher 50 v. H. der Angreifer außer Gefecht gesetzt, darunter Leutnant Lampe (tot). Der Rest wich nach[S. 101] kurzem, zu Fuß geführtem Handgemenge. Die zweite Attacke, diejenige des Hauptmanns v. Estorff selbst, die auf den Flügel des Feindes sowie auf einen durch die erste Attacke immerhin bereits erschütterten Gegner stieß, gelang dagegen. Der Feind wandte sich zur Flucht und riß auch den Teil der eigenen Gefechtslinie mit sich fort, der bis jetzt standgehalten hatte. Damit war der Sieg für uns entschieden.
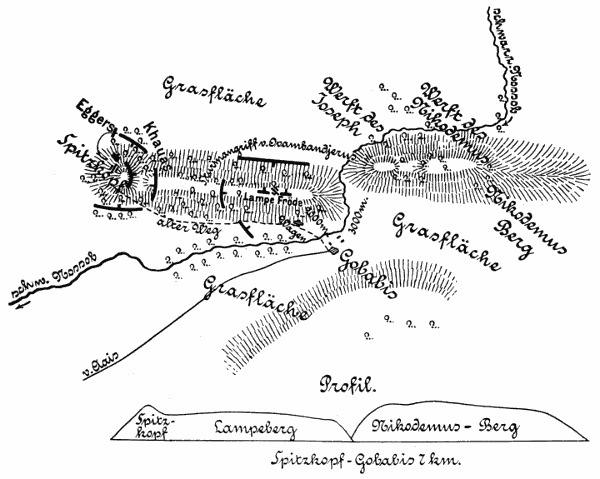
An Verlusten hatte das Gefecht 6 Tote und 5 Verwundete, mithin 22 v. H. gekostet.
Dieses Gefecht wirkte wie ein reinigendes Gewitter. Die noch schwankenden Eingeborenen traten offen auf unsere Seite, die feindlich gesinnten wurden still. Mich traf die Kriegsnachricht, als ich bereits auf dem Marsche nach Gobabis begriffen war. Der Oberhäuptling hatte seinen guten Willen schon vorher gezeigt, indem er mir als Zeichen seiner Parteinahme zwei Großleute mitgegeben hatte. Diese schickte ich nach erhaltener Nachricht von dem Gefecht bei Gobabis mit einer Proklamation in das Innere des Hererolandes, um bei allen etwa noch[S. 102] Schwankenden Klarheit zu schaffen. Am 11. April traf ich in Gobabis ein. Vom Feinde fand sich weit und breit keine Spur mehr. Sowohl die Ovambandjerus wie die Khauas-Hottentotten hatten am Tage nach dem Gefecht freiwillig ihre Stellungen geräumt. Über ihren neuen Aufenthalt war noch nichts bekannt.

Um so gefährdeter erschien bei ihrer abgelegenen Lage die Grenzstation Olifantskluft. Sie zu entsetzen, wurde daher eine Expedition unter Hauptmann v. Estorff zusammengestellt, die in der Stärke von rund 90 Köpfen und 2 Geschützen zwischen dem 13. und dem 20. April diese Aufgabe erfüllte. Die Station wurde eingezogen. Auf dem Rückmarsch stieß die Abteilung am 18. und 19. April bei Siegsfeld auf einen Teil des Gegners, zumeist Hottentotten, die angegriffen und geschlagen wurden. Der Erfolg dieses Sieges bestand in zahlreichen Gefangenen und mehreren hundert Stück Großvieh. Aus den Aussagen der ersteren sowie aus den vorgefundenen Spuren ergab sich, daß der Gegner im wesentlichen nach Norden ausgewichen war. Das Gefecht von Siegsfeld hatte unserseits einen Verlust von 2 Toten und 3 Verwundeten gekostet, unter den letzteren Leutnant Helm.
Ende April traf dann Oberleutnant v. Perbandt mit der 3. Kompagnie und den verbündeten Hereros in Gobabis ein, desgleichen am 1. Mai aus Gibeon Oberleutnant v. Burgsdorff mit 22 Reitern seines Distrikts und etwa 70 Witboois, letztere unter dem Kapitän selbst. Im ganzen bestand jetzt die Truppe aus etwa 180 Weißen und Bastardsoldaten, 70 Witboois und 120 Hereros. Dazu kamen noch die eingeborenen Soldaten der Truppe, die bewaffneten Treiber und Leiter der Wagenstaffel und 3 Geschütze, in Summa etwa 400 Köpfe. Es wurden nun folgende Verbände hergestellt:
A. Abteilung von Estorff.
1. Feldkompagnie: Oberleutnant d. R. v. Lindequist, Leutnant Eggers;
2. Feldkompagnie: Leutnant Schmidt, Leutnant Helm;
3. Feldkompagnie: Oberleutnant v. Perbandt, Leutnant a. D. v. Zieten.
B. Abteilung von Burgsdorff.
22 weiße Reiter,
etwa 70 Witbooireiter unter dem Kapitän Hendrik Witbooi.
C. Herero-Abteilung.
Etwa 120 Hereroreiter unter dem Oberhäuptling Samuel Maharero.
Beigegeben Unteroffizier Voigts (Reserve-Offizieraspirant).
D. Artillerie-Abteilung.
3 Geschütze unter dem ehemaligen Oberleutnant d. L. Hermann.
Der Kriegsfreiwillige, Unteroffizier Voigts, hatte als Kaufmann lange Jahre unter den Hereros gelebt und beherrschte deren Sprache. Er war deren eigentlicher Führer und hat als solcher recht gute Dienste geleistet. Der Kriegsfreiwillige, ehemalige Oberleutnant d. L. Hermann, war als Farmer im Schutzgebiet ansässig, früher in Kubub, später in Nomtsas. Wenn auch seine artilleristischen Kenntnisse etwas veraltet waren — die letzte Dienstleistung datierte aus dem Jahre 1870 — so hat er doch das entschiedene Verdienst, den in der Artillerie vorhandenen guten Geist belebt und gestärkt zu haben. Der einzige Artillerieoffizier der Truppe, Leutnant Lampe, war, wie erwähnt, bei Gobabis gefallen.
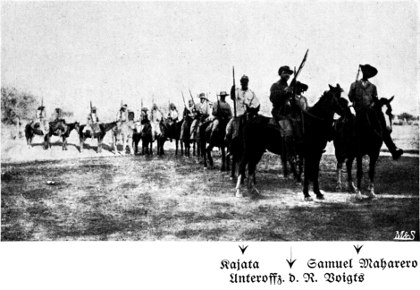
Überhaupt war der Mangel an Offizieren recht fühlbar. Ihn hatten auch die aus der Reserve bzw. Inaktivität eingezogenen Oberleutnants Hermann, v. Lindequist sowie der Chef des Pferdedepots, Leutnant a. D. v. Zieten, nicht beheben können. Der beurlaubte und bereits unterwegs befindliche Oberleutnant Schwabe wurde zurückgerufen, ihm jetzt der so wichtig gewordene Platz Okahandja übertragen, und dessen bisheriger Stationschef, Leutnant Schmidt, der Feldtruppe zugeteilt. Das Kommando in Swakopmund übernahm der Leutnant à l. s. Troost.
Der behufs Entlassung der ausscheidenden Mannschaften in Swakopmund befindliche stellvertretende Truppenkommandeur Major Mueller erhielt den Auftrag, aus den wieder zurückbeorderten Entlassungs- und den demnächst zu erwartenden Ersatzmannschaften eine Reserve-Feldtruppe zu bilden und mit dieser den Rücken der vor dem Feinde stehenden Truppe gegen etwaige aufsässige Elemente im Hererolande zu decken. Major Mueller entledigte sich dieser Aufgabe in sachgemäßer Weise dadurch, daß er nach Omaruru Verstärkung sandte und seine Abteilung, in zwei Kompagnien formiert, um und in der Nähe von Okahandja zusammenzog. Seine Truppeneinteilung war:
4. Feldkompagnie: Oberleutnant d. R. Schmidt (Zolldirektor), Leutnant Graf v. Kageneck.
5. Feldkompagnie: Leutnant v. Zülow, dazu Stabsarzt Dr. Sobotta.
Der letztere sowie die Leutnants Graf v. Kageneck und v. Zülow waren mit dem Ersatztransport aus Deutschland eingetroffen. Wie wir sehen, war die Truppe des Majors Mueller auch nicht reichlich mit Offizieren ausgestattet. Einen Adjutanten hatte, aus Offiziersmangel, weder der Major Mueller noch ich. Etwas ausgeglichen wurde dieser Mangel durch die besonders tapfere Haltung von zwei Offizieren, der Leutnants Helm und Eggers. Obwohl in den bisherigen beiden Gefechten verwundet, schlossen sie sich den weiteren Operationen, auf dem Ochsenwagen fahrend, an und machten noch das Gefecht von Otjunda mit. In diesem wurden sie beide abermals verwundet, aber diesmal so schwer, daß sie für längere Zeit dienstunbrauchbar blieben, Leutnant Eggers sogar bereits aufgegeben war.
Unter unseren verbündeten Eingeborenen war in Gobabis auch der Kapitän der einst so mächtigen roten Nation, Manasse, von Hoachanas eingetroffen, um wenigstens seinen guten Willen zu zeigen. Er hatte ganze 12 Reiter zusammengebracht. Bei dem Austausch von Erinnerungen in einer in Gobabis abgehaltenen Versammlung ergab sich, daß alle jetzt unter deutscher Führung geeinigten Stämme, nämlich Witboois, rote Nation und Hereros, vor nicht allzulanger Frist aufeinander geschossen hatten, und daß die meisten noch Andenken aus jenen Zeiten mit sich herumtrugen. So war Witbooi im Kampfe mit der roten Nation der Daumen der rechten Hand abgeschossen worden; sein Unterfeldherr, Samuel Isaak, trug zwei Kugeln mit sich herum, eine gleichfalls von der roten Nation, eine von den Hereros; der Oberhäuptling Samuel hatte eine Witbooikugel zu quittieren, der Unterhäuptling Kajata gar deren fünf. Dazu kam später noch unser[S. 105] Kampf mit den Witboois, aus dem der mitanwesende Hauptmann v. Estorff gleichfalls eine Kugel aufzuweisen hatte.

Bei der in dieser Zusammenkunft stattgehabten Besprechung zeigte der Oberhäuptling, der sich noch nie durch Tapferkeit ausgezeichnet hatte, eine gedrückte Stimmung. Um so energischer trat dagegen der alte Kajata auf. Auf meine Anfrage, ob nicht einer der Hereros lieber umkehren wollte, als vielleicht mit Unlust auf seine eigenen Landsleute schießen, stand Kajata auf und erklärte: »Kahimema ist mein nächster Verwandter, aber ich schieße auf ihn, denn er hat unrecht.« Diese Worte schlugen auch bei den anderen anwesenden Hereros durch; keiner wollte zurück, sogar der Oberhäuptling wurde wieder munterer und stimmte für energische Bestrafung der Schuldigen. Der Halbbruder von Nikodemus, Assa Riarua, erbot sich, zu diesem zu reiten[S. 106] und ihn zur freiwilligen Gestellung zu bewegen. Selbstverständlich stimmte ich unter dem Versprechen gerechter Bestrafung zu. Nachdem Tags darauf noch eine große Parade über die ganze Truppe, einschließlich Hilfsvölker, abgehalten worden war, wurde am Abend des 2. Mai der Abmarsch angetreten. Die in Afrika schwierigste Seite der Kriegführung, d. i. das Auffinden des Feindes in dem weiten Lande, hatte trotz aller ausgesandten Spione und Kundschafter noch nicht völlig gelöst werden können. Bekannt war nur, daß der Rückzug des Gegners in nördlicher Richtung stattgefunden hatte, sowie ferner, daß Nikodemus und Kahimema sich im Unmut getrennt hatten und daß die Khauas-Hottentotten bei letzterem geblieben waren. Der Vormarsch wurde daher aufs Geratewohl in nördlicher Richtung nach Owingi angetreten, einem Platz mit viel Wasser, bei dem die verbündeten Hereros den Feind vermuteten. Als nächster Gegner galt Kahimema, weil nach der erfolgten Trennung der Verbündeten er sowohl an sich wie auch infolge Anwesenheit der Khauas-Hottentotten der Mächtigere war. Der Befehl für den Vormarsch lautete:
Gobabis, den 29. April 1896.
Operationsbefehl.
1. Der Feind hat sich anscheinend getrennt. Kahimema soll sich bei Owingi, Nikodemus nordwestlich davon, in der Nähe von Tjetjo, befinden, bei ersterem auch die Khauas-Hottentotten.
2. Ich werde mich zunächst gegen Kahimema wenden.
3. Truppeneinteilung.
1. Avantgarde.
Hauptmann v. Perbandt, 3. Kompagnie, 1 Abteilung Hereros.
2. Gros.
Rest der Abteilung von Estorff, 1 Abteilung Hereros, Artillerie-Abteilung.
3. Train.
1. Staffel: 2 Karren, 1 Munitionswagen; 2. Staffel: Vizefeldwebel Vahlkamp 6 Wagen.
4. Den Abmarsch der Avantgarde werde ich noch bestimmen.
Das Gros folgt auf etwa 1 km. Die beiden Trainstaffeln schließen so nahe als möglich auf.
5. Drei Proviantwagen bleiben gepackt und jederzeit zum Abmarsch bereit in Gobabis.
6. Ich werde zunächst an der Spitze des Gros, später bei der Avantgarde reiten.
gez. Leutwein.

Gleich am ersten Marschtage zeigte sich der Wert eingeborener Bundesgenossen. Die als erstes Ziel in Aussicht genommene Wasserstelle war nahezu ausgetrocknet. Somit stand der Truppe gleich ein Dursttag bevor. Einer der verbündeten Hereros führte sie jedoch seitwärts nach einem stattlichen, uns damals noch unbekannten See. Ähnlich ging es den ganzen Feldzug. Die 400 Köpfe starke Abteilung hatte auch nicht ein einziges Mal Mangel an Wasser und Weide zu verzeichnen. Auch von einem Abschießen von Spitzen und Patrouillen, unter dem eine weiße Truppe in Südwestafrika sonst sehr zu leiden hat, blieben wir verschont. Denn nur Eingeborene, höchstens unter weißer Führung, wurden zu solchem Zweck verwendet.[22] Und Eingeborene sind vermöge ihrer guten Augen vor Überraschungen geschützt. Auch das Auffinden des Gegners erledigte sich mit ihrer Hilfe glatt.
Das zunächst als Marschziel bezeichnete Owingi wurde am Morgen des 5. Mai erreicht und vom Gegner verlassen gefunden. Daß dieser den[S. 108] Platz einige Zeit besetzt gehabt hatte, war aber noch zu erkennen. Nach kurzer Ruhe wurde eine Hereropatrouille auf seine Spuren gesetzt. Nun äußerte Witbooi mir gegenüber den Verdacht, daß die Hereros aus landsmannschaftlichen Rücksichten ein falsches Spiel spielten, und bat, selbst eine Patrouille schicken zu dürfen. Das geschah, regte aber wiederum die Eifersucht der Hereros an, die schleunigst als Erste losritten. So erlebten wir das Schauspiel, daß zwei Patrouillen 18 Stunden lang hintereinander herjagten, wobei die Hereros sich bemühten, stets die Spitze zu behalten. Bei Ruhepausen sattelten sie immer wieder auf, sobald sie hinter sich die Witboois am Horizont auftauchen sahen, so daß schließlich doch sie die Entdecker des Feindes wurden. Ihr Führer war allerdings auch der energische Kajata.
Am Abend des 5. Mai lagerte die Truppe am Epukiro, als von der Hereropatrouille die bestimmte Nachricht zurückkam, der Feind hätte bei der Wasserstelle Otjunda, 10 km weiter, Halt gemacht, und zwar in zwei getrennten Werften, die Wasserstelle in der Mitte. Nun wurde der Abmarsch für den andern Morgen derart angesetzt, daß die Truppe mit Tagesanbruch vor der feindlichen Stellung anlangen mußte. Unterwegs trafen wir auf den alten Kajata, der in der Nähe der feindlichen Werft ganz allein an einem verdeckten Feuer saß. Auf meine Frage, zu welchem Zweck er hiergeblieben sei, sagte er, er habe beobachten wollen, ob nicht etwa der Feind heimlich abmarschiere. Was unsern Kriegsschülern im Taktikunterricht gelehrt wird, nämlich, daß die einmal gewonnene Fühlung mit dem Feinde nicht wieder aufgegeben werden dürfe, das hatte hier ein einfacher Naturkrieger mit seinem gesunden Menschenverstand von selbst herausgefunden. In der Nähe der Werft ließ ich die fechtende Truppe, 350 Reiter stark, aufmarschieren, rechts und links die Reiter, Artillerie in der Mitte, einige Plänkler vor der Front. Auch seitens der Eingeborenen wurde der Weitermarsch in dieser Form in lobenswerter Ordnung ausgeführt. Nur war es schwierig, die Hereros in der erforderlichen Stille zu halten.
Gefechtsaufmarsch.
| ========== | Φ Φ Φ | ========== | ========== | ||
| 3. Kompagnie | Artillerie | 2. Kompagnie | 1. Kompagnie | ||
| ======= | ======== | ||||
| Hereros | Witboois | ||||
Wie sich aus vorstehender Skizze ergibt, befanden sich die eingeborenen Bundesgenossen auf den Flügeln. Einerseits sollten sie diese sichern, anderseits die Flanken der feindlichen Stellung fassen. Direkt stürmen sollten nur[S. 109] die drei Feldkompagnien. Die räumliche Trennung des Feindes in zwei Werften mußte auch zu einem räumlich getrennten Gefecht führen. Die 3. Feldkompagnie und die Hereros nebst zwei Geschützen wandten sich gegen die rechte, die 1., 2. Feldkompagnie, die Witboois und ein Geschütz gegen die linke Flügelwerft des Feindes. Den Befehl über die letztgenannte Kolonne übertrug ich dem Hauptmann v. Estorff, denjenigen über die erstere behielt ich selbst. Wie sich später ergab, befanden sich in der rechten Flügelwerft der Hererounterkapitän Kahikaeta, in der linken Kahimema und die Khauas-Hottentotten. Beide Werften waren mit Verteidigungsverhauen umgeben.
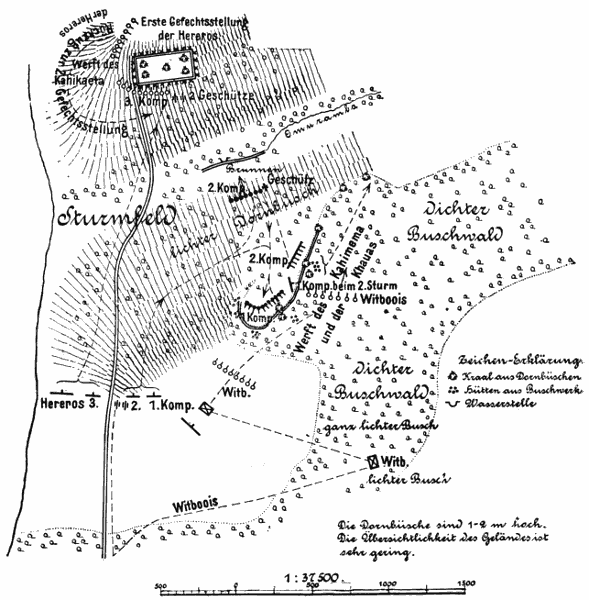
Der Gegner schien Sicherheitsmaßnahmen nur in seiner nächsten Nähe getroffen zu haben, da die Truppe bereits dicht am Verhau war, als der[S. 110] erste Schuß fiel. Indessen raffte er sich rasch wieder auf und hielt sich bis zum Schluß des Gefechtes recht tapfer. Die diesseitigen Hereros kamen in dem Busch zu weit rechts, stießen infolgedessen nicht, wie beabsichtigt, auf die Flanke, sondern auf die Front des Feindes und hatten in kurzer Zeit einen Toten und 5 Verwundete. Dies war mehr, als sie ertragen konnten. Sie zogen sich hinter unsere Front zurück und kamen von da während des Gefechtes auch nicht wieder zum Vorschein, mit Ausnahme eines kleinen Teiles unter Kajata, der noch tapfer den letzten Sturm mitmachte. Als bald nach Beginn des Angriffes die beiden Geschütze auf meinen Befehl dicht hinter der Schützenlinie der 3. Feldkompagnie erschienen, wurde sofort eine Abschwächung des feindlichen Feuers bemerkbar. Doch hielten die Verteidiger der Werft bis zum letzten Angriff stand, der etwa um 8 Uhr vormittags stattfand. Rasch wurde nach gelungenem Sturm durch die Werft durchgestoßen und vom jenseitigen Rand der flüchtende Gegner mit Schnellfeuer verfolgt.
Auf dem andern Flügel geriet zuerst die 2. Kompagnie an der Wasserstelle mit den Khauas-Hottentotten zusammen, die, weil selbst noch nicht angegriffen, nach dem Fallen der ersten Schüsse der Werft des Kahikaeta hatten zu Hilfe kommen wollen. Hätte ich durch die Patrouillenmeldungen keine Kenntnis von der Aufstellung des Feindes in zwei Werften gehabt, so würde sich naturgemäß die Truppe mit allen Kräften gegen die zuerst entdeckte Werft gewendet und so ihren Rücken der andern preisgegeben haben. Mit diesem bei dem dichten Gebüsch Erfolg versprechenden Plan hatte der Gegner auch anscheinend gerechnet und hatten die Khauas mit dessen Ausführung begonnen. So aber wurden letztere noch rechtzeitig von der 2. Kompagnie gefaßt, während sich der in seiner Werft zurückgebliebene Kahimema bald in ein Gefecht mit der 1. Feldkompagnie verwickelt sah. Die Khauas zogen sich zurück, die 2. Kompagnie wurde zur 1. herangezogen und nun nach einem kurzen Feuergefecht, bei dem das Geschütz ebenfalls in der Schützenlinie mitgewirkt hatte, in einem zweimaligen Anlauf die Werft erstürmt. Auf diesem Flügel hatten die eingeborenen Bundesgenossen (Witboois) richtig Rücken und Flanke des Gegners gewonnen und unter dem flüchtenden Feinde viel Schaden angerichtet.
Das damit beendete Gefecht hatte uns einen Verlust von 6 Toten und 11 Verwundeten gebracht, letztere bei der kurzen Entfernung zwischen den Gegnern durchweg schwer. Unter den Toten befand sich der Leutnant Schmidt, unter den Schwerverwundeten die Leutnants Helm und Eggers.[S. 111] Zu diesem Verluste kamen dann noch der Tote und die fünf Verwundeten auf seiten unserer verbündeten Hereros. Die Witboois hatten keine Verluste.
Eine aufmerksame Verfolgung des Gefechtsverlaufs läßt die geringe Tapferkeit auf seiten unserer Hereros gegenüber den auf feindlicher Seite kämpfenden auffällig hervortreten. Die letzteren verteidigten eben ihr Dasein, vor allem ihre Viehherden, während die ersteren für eine fremde Sache fochten. Nach beendigtem Kriege habe ich daher Gelegenheit genommen, in einer Umlaufsverfügung allgemein auf diesen Unterschied hinzuweisen, um nicht eine Unterschätzung eines etwaigen künftigen Gegners aufkommen zu lassen. (Siehe Kapitel XI.) Eine solche ist aber mit der Zeit doch eingetreten.
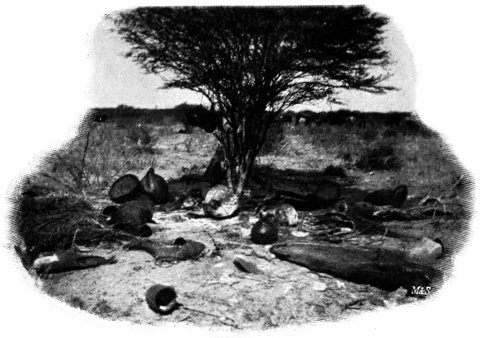
Die Ausbeute des Sieges war groß. Sie bestand in einer Menge Gewehre, 6 Wagen, 3000 Stück Vieh und zahlreichen Gefangenen, aber diese meist Weiber und Kinder. Vom Gegner wurden 40 Tote gefunden, darunter ein Bruder und zwei Söhne Kahimemas und drei Söhne Kahikaetas. Nur die Verluste von Großleuten zählen bei den Eingeborenen mit, kleine Leute werden nicht gerechnet. Von unseren Hereros hatten mehrere unter den feindlichen Toten Verwandte entdeckt, einer sogar seinen Bruder. Dies in[S. 112] Verbindung mit den eigenen Verlusten erregte unter ihnen für einige Tage eine trübe Stimmung, die aber auf gutes Zureden wieder wich.
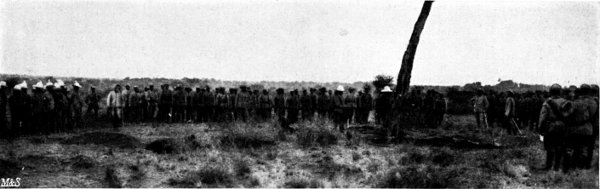
Jetzt trat von neuem die Lösung der in Afrika immer schwierigen Frage nach dem Verbleib des Gegners an uns heran. Seine Spuren liefen, wie gewöhnlich, nach allen Seiten auseinander, während auf die besten Merkzeichen, nämlich Wagenspuren, nicht mehr zu rechnen war, da seine sämtlichen Wagen in unsere Hände gefallen waren.
Es begann nun beim Aufsuchen des Feindes in bezug auf die beste Erkundungsart eine Art Wettbewerb. Der unermüdliche Hauptmann v. Estorff machte zweimal den Versuch mit einer größeren Patrouille und konnte immer nur die Meldung zurückbringen, daß die und die Gegend vom Feinde frei sei, nur einmal unter dem Hinzufügen, die Spuren deuteten auf eine Flucht nach Rietfontein. Ich selbst hielt mit dem Rest der Truppe die Wasserstelle Otjunda fest und versuchte es wieder mit meinem aus dem Witbooikriege bewährten Mittel. Ein gefangener Khauas-Hottentott wurde mit einem Brief, in dem jedem, der die Waffen abgeben würde, Begnadigung zugesichert war, an seine Stammesgenossen gesendet. Vorher wurde dem Boten noch der Kapitän Witbooi vorgestellt, damit er im feindlichen Lager dessen Anwesenheit bestätigen könne. Bis zum letzten Augenblick hatten nämlich weder Hereros noch Khauas an sie glauben wollen.
Jetzt bestätigte sich wieder, daß dieses Mittel der Erkundung, solange man von ihm Gebrauch machen kann, in Afrika schließlich doch das beste ist. Der abgesandte Bote kam nach sechs Tagen mit der Meldung zurück, die Khauas-Hottentotten sowie die Reste des Kahimemastammes befänden sich in Kalkfontein, einer Wasserstelle, etwa 30 km Epukiro abwärts, unweit von[S. 113] dessen südlichem Ufer. Den Brief hatte er nicht abgeben können, da der einzige des Lesens kundige Mann des Stammes, der Magistrat Fledermuis, bei Otjunda gefallen wäre. Er hätte daher seinen Stammesgenossen den Inhalt mündlich mitgeteilt. Sie seien alle zur Übergabe bereit.

Unter Zurücklassung einer starken Wache für die Verwundeten und Gefangenen am alten Lagerplatze marschierte die Truppe am 13. Mai ab und traf am 14. Mai vor Kalkfontein ein. Hier wurde Gefechtsstellung bezogen und durch eine Eingeborenen-Patrouille der Gegner aufgefordert, sich bedingungslos zu ergeben, widrigenfalls mit dem Feuern begonnen würde. Der Feind zog das erstere vor. Kahimema kam mit seinen wenigen Leuten sofort herüber,[23] die Khauas-Hottentotten wurden während der folgenden[S. 114] Nacht in ihrer Werft bewacht und den andern Tag von mir persönlich abgeholt. In meiner Begleitung befanden sich nur die Witboois, die mit ungemeiner Schnelligkeit die Werft von allen Seiten umzingelt hatten. Ich sicherte den Gefangenen in einer Ansprache das Leben zu, da die Hauptschuldigen bereits tot seien.[24] Nach dieser Ansprache ergriff auch Witbooi das Wort zu einer Strafpredigt, während der er unter den Gefangenen drei seiner eigenen Leute entdeckte. Diese nahm er sofort vor die Front und ließ sie mit Stockhieben bestrafen.
Ein Teil der Khauas-Hottentotten hatte sich jedoch direkt in das Lager von Otjunda begeben und dort die Waffen gestreckt. Augenscheinlich hatten sie sich vorher überzeugen wollen, ob die Gefangenen wirklich nicht getötet würden. Bei einem Teil von ihnen wiederholte sich dann nach der Rückkehr in unser Lager die Prozedur des Prügelns, da sie seitens der anderen verbündeten Hottentottenstämme von Hoachanas und Gochas gleichfalls als Stammesgenossen erkannt worden waren. Unter den etwa noch 70 waffenfähigen Männern des Khauasstammes war hiernach mindestens die Hälfte fremder Stammesangehörigkeit. Wo es etwas zu rauben gibt, ist der Hottentott eben schnell bei der Hand. An Gewehren hatte der Stamm noch 43 Stück. Die noch fehlenden Männer des Stammes wurden festgestellt und mittels öffentlicher Ausschreibung für vogelfrei erklärt, falls sie sich nicht bis zu einer bestimmten Frist stellen würden. Dreizehn von ihnen sind später festgenommen und auf Fluchtversuchen erschossen worden. Die jetzt Gefangenen wurden nach Windhuk überführt, wo sie sich heute noch befinden.
Inzwischen hatte auch Kapitän Simon Cooper, ohne von mir gerufen zu sein, sich mit 120 seiner Leute auf dem Kriegsschauplatze eingefunden. Zu fechten gab es jedoch nichts mehr, wohl aber hat er sich noch eifrig an dem Aufheben von Viehposten beteiligt. Und dies wird auch der Zweck[S. 115] seines Kommens gewesen sein. Gleich von Kalkfontein aus wurde ein zwei Tagesmärsche entfernter Viehposten Kahimemas in der Stärke von 1200 Stück aufgehoben, und später ein ebensolcher des Kahimemagroßmannes Kahikaeta mitsamt dem letzteren selbst und noch 14 Gewehren. An Widerstand dachte niemand mehr. Auch Nikodemus hatte sich auf Zureden seines Halbbruders Assa in Okahandja gestellt und war dort durch Major Mueller festgesetzt worden.

Sonach stand kein Feind mehr im Felde. Es blieb lediglich ein diplomatisch-gerichtliches Nachspiel übrig, dessen Schauplatz naturgemäß nur der Hauptort der Hereros, Okahandja, sein konnte. Dorthin setzte sich die Truppe am Abend des 22. Mai in Marsch. Der Weg führte über die Werft des Unterhäuptlings Tjetjo, der sich jetzt in Loyalitätsversicherungen erschöpfte. Ich freute mich jedoch, ihn den Anblick der vorbeimarschierenden, nunmehr auf 500 Reiter angewachsenen Truppe genießen lassen zu können.
Auch die Großleute des Nikodemus stellten sich in der Zahl von neun freiwillig, teils in Okahandja, teils unterwegs bei der Truppe. Am 2. Juni[S. 116] fand feierlicher Einmarsch in Okahandja und die Vereinigung der alten und der neuen Truppe statt. Letztere stand in Parade und nahm den Vorbeimarsch der siegreichen, durchaus nicht parademäßig, dafür aber sonnenverbrannt und kriegerisch aussehenden alten Truppe mit ab. Zuerst kamen die Feldkompagnien, dann die Witboois, die Hereros, Simon Cooper und schließlich die Artillerie. Dazu an allen Häusern Flaggen und Glockengeläute, kurz ein Bild, das jedem, der es gesehen hat, unvergeßlich bleiben wird. Die deutsche Oberherrschaft schien nunmehr im Schutzgebiete endgültig gesichert.
Nachholen muß ich noch, daß der bereits in Kapstadt befindliche Hauptmann v. Sack auf die Nachricht vom Ausbruch des Aufstandes sofort in das Schutzgebiet zurückgekehrt war, aber die Truppe erst erreicht hatte, als diese sich bereits auf dem Rückmarsche befand. Ihm hatte sich Leutnant a. D. v. Levinsky angeschlossen, der sich im Schutzgebiet als Farmer niederzulassen gedachte. Beide traten für den Rest des Kriegszustandes in die Truppe ein.
Die gerichtliche Untersuchung über die Ursachen und die Urheber des Aufstandes wurde durch Assessor v. Lindequist geführt. Sie ergab mit unzweideutiger Klarheit, daß der Anstifter zum Aufstande einzig und allein Nikodemus gewesen war, und zwar hatte er seine Wühlereien unmittelbar nach seiner Einsetzung als Kapitän des Ostens begonnen. Auch Witbooi hatte er hineinzuziehen versucht, indem er ihm die anscheinend harmlose Frage stellte, wie er, Witbooi, sich unter deutscher Herrschaft fühle. Witbooi ließ sich klugerweise auf einen Briefwechsel gar nicht ein, gab vielmehr durch Boten eine mündliche, nichtssagende Antwort. Nikodemus selbst leugnete auch angesichts der gegenübergestellten Zeugen, einschließlich seines Mitschuldigen Kahimema, alles. Letzterer beschönigte nichts, wies aber nicht mit Unrecht darauf hin, daß wir, d. h. der Oberhäuptling und ich, ihn unter Nikodemus gestellt hätten, und daß er daher diesem hätte folgen müssen. Angesichts dieses zweifellos mildernden Umstandes sowie wegen seines offenen Geständnisses würde ich Kahimema gern begnadigt haben, jedoch sprach sich Samuel entschieden dagegen aus. Infolgedessen wurden in Vollziehung des gefällten Urteils die beiden Führer am 12. Juni erschossen. Kahimema starb mutig, Nikodemus dagegen als Feigling, vor Angst schon halbtot, als er zum Richtplatz geführt wurde. Von den gefangenen Großleuten wurden elf als Mitschuldige zu längeren Freiheitsstrafen verurteilt und zur Strafverbüßung nach Windhuk überführt. Erwähnen will ich noch, daß die gerichtlichen Verhandlungen von Anfang bis zu Ende in voller Öffentlichkeit stattgefunden haben. Von[S. 117] der Erlaubnis des Zutritts hat namentlich der Missionar sowie der alte Riarua Gebrauch gemacht, beide in der heimlichen Hoffnung, daß Nikodemus noch gerettet werden könnte. Eine Beteiligung Riaruas an dem Aufstande hatte nicht nachgewiesen werden können. Wäre sie augenscheinlich vorhanden gewesen, so würde ihn Nikodemus bei seiner Feigheit wohl nicht geschont haben. Ferner waren auch beim Kriegsgericht zwei seitens des Oberhäuptlings bestellte Großleute als Richter anwesend.
Aus dem übrigen Hererolande ist endlich noch eine unbedeutende aufrührerische Bewegung in Otjimbingwe zu erwähnen, hervorgerufen durch Aufreizungen eines gewissen Wallace, der außerdem den Eingeborenen verbotenerweise Spirituosen geliefert hatte. Einige 30 betrunkene Hereros rotteten sich zusammen, trieben Unfug und setzten der herbeieilenden Militärpatrouille Widerstand entgegen. Schließlich kam es zu einer Schießerei, bei der zwei Hereros verwundet wurden. Der gerade mit einem Teil der Truppe angekommene Leutnant d. R. Schmidt setzte Wallace in Haft und stellte bei den Hereros die Ruhe wieder her. Seitdem ist sie dort nicht wieder gestört worden.
Nach Beendigung des Feldzuges habe ich über seinen Verlauf an meine vorgesetzte Behörde folgenden Schlußbericht erstattet:[25]
»Wenn ich nun noch einmal auf den Verlauf des Krieges zurücksehe, so muß ich sagen, daß er ein ungewöhnlich glücklicher gewesen ist. In dem für uns ungünstigsten Momente ausgebrochen, schien der Aufstand das Schutzgebiet an den Rand des Abgrundes zu bringen, zumal in den ersten Anfängen nicht zu übersehen war, welche Ausdehnung er gewinnen würde. Indes gelang dessen Lokalisierung und war damit die größte Gefahr beseitigt. Ein wesentliches Verdienst hierfür gebührt der unerschütterlichen Freundschaft des Oberhäuptlings Samuel in Verbindung mit der ebenso unerschütterlichen Vertragstreue Witboois. Samuels persönliche Macht ist ja nicht groß, aber auch bei den Schwarzen ist das Gewicht der Legitimität nicht zu unterschätzen. Sehr zustatten ist uns auch die Gerechtigkeit unserer Sache gekommen. Dem frivolen Friedensbruch von seiten unserer Gegner stand die immer wieder bewiesene und von keinem Eingeborenen mehr bezweifelte Friedensliebe auf unserer Seite gegenüber.
»Was die verbündeten Hereros uns genutzt haben, kann nicht hoch genug angeschlagen werden. Das für uns in dem weiten Lande Schwierigste,[S. 118] nämlich Auffinden des Gegners, der Weide und Wasserstellen, ging mit ihrer Hilfe und vermöge ihrer Ortskunde glatt und ohne jede Störung vonstatten. Niemals haben wir trotz unseres bedeutenden Viehbestandes auch nur im geringsten an Wassermangel gelitten. Was das heißen will, kann nur der Landeskenner richtig würdigen. Unsere übrigen Bundesgenossen habe ich mir bereits in meinem letzten Bericht zu charakterisieren gestattet und dem nichts mehr hinzuzufügen. Überhaupt hat sich die diesmalige Zusammensetzung der Feldtruppe — Weiße nur als Kern, die Masse Eingeborene — als die für hiesige Verhältnisse in der Tat zweckmäßigste erwiesen. Ich ziehe eine solche Truppe dem bestausgebildeten heimatlichen Jäger-Bataillon vor. Nicht stolze Heeresmassen verbürgen den Sieg, sondern die Geeignetheit der Truppe für die gegebenen Verhältnisse. Die Kriegs- wie auch die Kolonialgeschichte gibt hierfür deutliche Lehren. Fern muß uns daher jede Politik bleiben, welche uns die Eingeborenen entfremdet und daher in schwierigen Lagen lediglich auf uns selbst anweist. Dank einem guten Requisitionssystem und der Bemühung der Kaiserlichen Intendantur hatten wir auch nie Proviantmangel und bringen sogar noch einen reichlichen Vorrat nach Hause usw.
»Unter den 500 Reitern, aus denen, wie bereits gemeldet, die Truppe schließlich bestanden hat, befanden sich noch nicht 100 Angehörige der Schutztruppe selbst. Der Rest war aus wieder eingezogenen Reservisten, Kriegsfreiwilligen und Eingeborenen zusammengesetzt usw.«
Diesen Ausführungen habe ich auch heute nichts hinzuzufügen.
Am 11. Juni abends marschierte die Truppe von Okahandja ab und zog am 13. früh in feierlicher Weise in Windhuk ein. Es fehlte weder an Triumphbogen noch an Ehrenjungfrauen, welch letztere allerdings — mangels erwachsener Mädchen — noch im Kindesalter standen. An dem Einzuge in Windhuk nahmen auch die Hilfsvölker aus dem Namalande teil, während die Hereros bereits in Okahandja entlassen worden waren.
Nach einer achttägigen Pause wurde in Windhuk eine neue Expeditionstruppe zusammengesetzt, die unter dem Befehl des Majors Mueller die Aufgabe hatte, die den Aufständischen auferlegte Buße an Vieh einzutreiben. Von letzterem war den eingeborenen Bundesgenossen ein gewisser Prozentsatz als Beuteanteil in Aussicht gestellt. Abordnungen von diesen, namentlich, was sehr wesentlich war, auch der verbündeten Hereros, begleiteten daher die Truppe. Inzwischen hatten die in Windhuk gefangenen Hereros von der den Eingeborenen eigenen Geschicklichkeit, sich einer Gefangenschaft durch Flucht zu entziehen, Gebrauch gemacht und waren sämtlich weggelaufen.[S. 119] Einer derselben war hierbei erschossen worden. Dem Major Mueller fiel daher noch die weitere Aufgabe zu, die Flüchtigen wieder einzubringen und zu diesem Zweck es auch auf einen neuen Waffengang ankommen zu lassen. Die etwa 100 Köpfe starke Abteilung vermochte indessen, in einem zweimonatlichen Zuge sich ihrer Aufgabe in friedlicher Weise zu entledigen. Sie brachte sämtliche Gefangene wieder ein sowie mehrere tausend Stück Vieh. Außerdem wurden noch verschiedene Werfte entwaffnet. Das Beutevieh wurde später meistbietend an die Ansiedler versteigert und würde manchem zum Wohlstande verholfen haben, wenn nicht einige Monate später die Rinderpest alles wieder vernichtet hätte.
Mich selbst erwartete im Westen des Schutzgebiets eine andere Aufgabe. Ganz unvermutet war nämlich bereits auf dem Rückmarsche vom Kriegsschauplatz die Nachricht von der bevorstehenden Landung der bereits erwähnten 400 Mann Verstärkung eingetroffen (genau 15 Offiziere, 2 Sanitätsoffiziere, 407 Unteroffiziere und Reiter). Diese Verstärkung war höheren Orts nur als vorübergehend gedacht, sie sollte nach Erfüllung ihrer Aufgabe wieder nach Hause gesendet werden. Als ihre Aufgabe dachte man sich in Berlin, anschließend an die Niederwerfung des Aufstandes, eine allgemeine Entwaffnung der Hereros. Der verflossene Feldzug hatte uns jedoch die Widerstandsfähigkeit dieses Volkes sowie die Schwierigkeit, mit ihm ohne die Hilfe von Stammesgenossen fertig zu werden, zu sehr erkennen lassen, als daß ich mich damals auf ein solches Unternehmen hätte einlassen können. Und die Hilfe des Oberhäuptlings war, wie wir noch weiter sehen werden, für die Entwaffnung einzelner unbotmäßiger Werften stets zu erhalten, niemals aber für eine solche allgemeiner Art. Der Versuch zu einer solchen mußte vielmehr zu einem blutigen, unabsehbaren Krieg führen, und für einen solchen brauchten wir nicht 400 Mann Verstärkung, sondern 4000. Unsere Erfahrungen 1904 reden eine deutliche Sprache.
Diese Auffassung meldete ich nach Berlin und fand dort für sie Zustimmung. Ein zwingender Grund zu einem Unternehmen von solcher Tragweite lag überdies gerade damals umsoweniger vor, als kurz zuvor noch die Hereros uns gegen ihre eigenen Stammesgenossen Heeresfolge geleistet hatten. Die fernere Ausnutzung dieser Geneigtheit in Verbindung mit scharfer Überwachung des Handels mit Waffen und Munition ließen dagegen auch eine allmähliche Entwaffnung der Eingeborenen erhoffen. Ihre Vorräte mußten bei dem Mangel an Ersatz fortgesetzt abnehmen, während die unsrigen fortgesetzt zunehmen konnten.
Von der Mitte Juli eingetroffenen Verstärkung wurden 150 Mann nach Windhuk, der Rest nach Karibib entsendet. Die ersteren sollten einerseits als allgemeine Reserve in Windhuk bleiben, anderseits zur Verstärkung der Besatzung des Namalandes dienen. Mit den übrigen 250 Mann beabsichtigte ich einen Zug durch das Westhereroland, um im Anschluß an einen solchen den längst gehegten Plan durchzuführen, durch Besetzung des herrenlosen Gebietes zwischen Ovambo- und Hereroland die Verbindung zwischen diesen beiden Ländern abzuschneiden. Dies gebot jetzt außerdem der Grenzschutz gegen die herannahende Rinderpest, in den wir das Ovamboland, weil außerhalb unserer Machtsphäre liegend, nicht mit hereinziehen konnten. Wie gewöhnlich, wurde zu diesem Zuge, der am 2. August angetreten wurde, auch der Oberhäuptling Samuel mit etwa 50 seiner Leute mitgenommen.
Der Marsch ging programmäßig von Karibib über Omaruru[26], Outjo, Franzfontein, Orusewa (Vogelkranz), Spitzkoppjes und zurück (siehe Skizze). Sein Ergebnis war folgendes: Kapitän Manasse, der nun sehr loyal geworden war, wurde bewogen, den seitens der Deutschen Kolonial-Gesellschaft für Südwestafrika auf Spitzkoppjes erhobenen Anspruch anzuerkennen. Ferner wurde in Omaruru der bereits genannte ehemalige Unterkapitän von Okombahe, Daniel Kariko, in Haft gesetzt und gerichtlich wegen hochverräterischer Umtriebe zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. In Otjikango, südlich Outjo, wurde der gleichfalls schon genannte Werftkapitän Katarrhe, der sich dieses Mal gestellt hatte, entwaffnet. In Outjo wurde der in Aussicht genommene Nordbezirk gegründet mit den Stationen Grootfontein (nördlich), Otavifontein, Naidaos, Outjo und Franzfontein. Outjo wurde der Sitz des Bezirksamtmanns, zugleich Kompagniechefs, und als solcher der Hauptmann Kaiser eingesetzt, Grootfontein Distriktshauptort unter Leutnant Steinhausen, die übrigen Plätze Unteroffizierstationen. Die beiden genannten Offiziere waren mit der neuen Truppe gekommen, später wurden auch Otavifontein und Franzfontein mit Offizieren besetzt.
In Franzfontein hatte ich zum erstenmal Gelegenheit, den Stamm der Swartboois in seiner Heimat zu besuchen. Wie überall, hatten sich die Hereros auch an der Westgrenze weiter ausgedehnt, als ihnen nach An[S. 121]sicht der Nachbarn, in diesem Falle der Swartboois, zukam. Der Kapitän verlangte daher von dem anwesenden Oberhäuptling, er solle die Hereroposten entsprechend zurückziehen, worauf dieser auf die Zuständigkeit Manasses in Omaruru hinwies. Von mir verlangte der Kapitän Gewehre und Munition, wofür ich ihn auf die Zukunft vertröstete. Dagegen wurden dem Stamm die Gewehre Modell 88 abgenommen (8), die ihm die Vertretung der an dem Gebiete der Swartboois interessierten Kaoko-Land- und Minengesellschaft mit Genehmigung der Regierung während des Hereroaufstandes überlassen hatte. Im übrigen aber lag keine Veranlassung vor, die in der Grenzfrage zwischen den Swartboois und Westhereros hervorgetretene, für uns vielleicht noch nützliche Rivalität jetzt schon durch unser Eingreifen zu beseitigen.
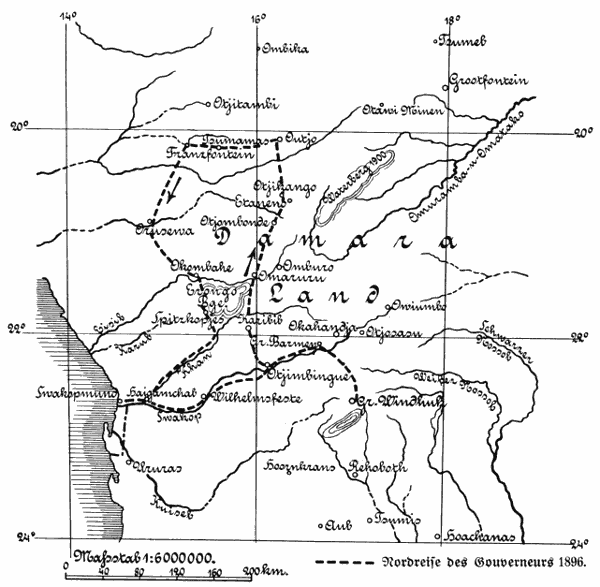
[S. 122] Im weiteren Verlauf der Expedition wurden in Orusewa (Vogelkranz) noch einige Genossen von Daniel Kariko festgesetzt und zu Geldbußen verurteilt. Am genannten Platze hatte ich wieder eine ernste Unterredung mit dem Oberhäuptling über die andauernde Sucht der Hereros, sich über ihre Grenze auszubreiten. Er gab dies zu und bat um Geduld, seine Leute seien zu dumm und begriffen nicht, daß sie im Unrecht seien. In Okombahe, dem neugewonnenen Kronland, wurde ein englischer Untertan ausgewiesen und ein Kaffer ins Gefängnis gesetzt, beide, weil sie während des Hereroaufstandes durch Verbreiten von falschen Gerüchten Unheil angestiftet hatten. In Spitzkoppjes hatte die Deutsche Kolonial-Gesellschaft bereits angefangen, sich häuslich einzurichten.
Von Spitzkoppjes marschierte die Truppe nach Windhuk zurück, während ich selbst einen scharfen Ritt die Nacht hindurch[27] nach Swakopmund unternahm. Die hier gegebene Zeit benutzte ich zu einem Abstecher nach Kap Croß, wo vor etwa einem Jahr eine englische Gesellschaft mit der Ausbeutung des dortigen Guanos begonnen hatte. Hier hatte ich Gelegenheit, die englische Betriebsamkeit zu bewundern. An dem sonst öden Platze herrschte ein reges Leben. Während wir über die Notwendigkeit eines Bahnbaues von Swakopmund in das Innere noch redeten und schrieben, hatten dort die Engländer eine Bahn von 20 km Länge bereits gebaut.
Noch eines für das Schutzgebiet wichtigen Ereignisses muß ich Erwähnung tun, nämlich der Einrichtung einer deutsch-katholischen Mission neben der bereits bestehenden deutsch-evangelischen. Die Vorbereitungen hierzu hatte der katholische Präfekt Schoch von Transvaal getroffen. Jetzt traf in Swakopmund der zum Leiter der Mission im Schutzgebiete ausersehene Pater Hermann ein, der später den Titel Propräfekt erhielt.

Nach der Rückkehr von Swakopmund, Ende November, ging es an die endgültige Verschmelzung der alten mit der neuen Truppe. Von den eingetroffenen 400 Mann Verstärkung wurde im Laufe des Jahres 1897 die Hälfte nach Hause geschickt, die andere Hälfte aber auf diesseitigen Antrag endgültig der Truppe einverleibt, so daß deren Etatsstärke Ende 1897 von rund 500 Mann auf rund 700 Köpfe gestiegen war. Sie wurde in vier Feldkompagnien und eine Feldbatterie eingeteilt; daneben sowie ganz[S. 125] unabhängig von der Feldtruppe bestanden die Distriktstruppen, die zu Polizeidiensten den Verwaltungsbezirken zugeteilt waren. Die Bezirke setzten sich damals aus den Bezirksämtern Keetmanshoop, Gibeon, Windhuk, Otjimbingwe, Swakopmund, Outjo und dem selbständigen Militärdistrikt Gobabis zusammen. Von den Bezirksämtern standen drei unter Zivilbeamten, die zugleich Kaiserliche Richter waren, der Rest sowie sämtliche Distrikte unter Offizieren.



Die in Afrika gefürchtetste Tierseuche, die Rinderpest, kam dem Schutzgebiet Ende 1896 immer näher. Zunächst glaubte man, ihr durch Absperrung begegnen zu können. Es wurde daher längs der Grenze eine viehfreie Zone von 20 km Durchmesser geschaffen und eine entsprechende Vermehrung der Grenzstationen angeordnet. Der Absperrung gegen die Ovambos habe ich bereits gedacht. Die Zahl der Tierärzte wurde um zwei vermehrt. Doch ist nach wirklichem Ausbruch der Seuche die Hauptarbeit und damit auch die größte Leistung dem bereits im Lande befindlichen Roßarzt Rickmann zugefallen. Denn alle Absperrungsmaßnahmen hatten nichts genützt. Das Eindringen der Seuche war auf die Dauer schon infolge der Tatsache, daß sie auch das Wild ergreift, nicht zu hindern. Nur das Namaland blieb von ihr verschont, da sie in diesem schwach bewohnten trockenen Gebiet für ihre Verbreitung wenig günstige Bedingungen vorfand. Auch war die Absperrung gegen die Kalaharisteppe dort leichter durchzuführen und daher wirksamer.
Dagegen drang die Rinderpest Anfang 1897 nördlich Gobabis über die Ostgrenze und ergriff zuerst die Viehherden des Häuptlings Tjetjo. Bevor noch die Meldung hiervon an das Gouvernement gekommen war, war die Seuche durch Händler mitten in den Bezirk Windhuk verschleppt.[S. 127] Die erste Meldung von einer verdachterregenden Krankheit unter den Viehherden am Schaffluß traf in Windhuk am 6. April ein, als wir gerade die Enthüllung des zu Ehren der im Witbooikriege gefallenen Angehörigen der Truppe errichteten Denkmals feierten. Der Bezirksamtmann von Windhuk, der mittlerweile zum Regierungsrat beförderte Assessor v. Lindequist, faßte die Sache mit gewohnter Energie an. Es wurden Absperrungsmaßnahmen, Desinfizierungen und Impfung angeordnet. Das inzwischen seitens des Geheimrats Koch in der Kapkolonie erfundene Impfverfahren kannten wir damals noch nicht. Indessen waren der Roßarzt Rickmann und im Norden der ebenso tüchtige Bakteriologe Stabsarzt Dr. Kuhn von selbst auf ein wenigstens den bösesten Wirkungen der Seuche vorbeugendes Impfverfahren gekommen. — Eine wirklich systematische Bekämpfung der Rinderpest konnte jedoch erst nach dem im Monat Juni 1897 erfolgten Eintreffen des Stabsarztes Dr. Kohlstock, bisher Assistent bei Geheimrat Koch, eingeleitet werden. Das von letzterem erfundene Verfahren war, die Rinder durch Impfung mit bakterienfreier Galle bis zu einem gewissen Grade zu immunisieren und dann bei den so immunisierten Rindern mittels der Einspritzung von Rinderpestblut die Seuche künstlich zu erzeugen. Dies Verfahren rief in der Regel einen nur leichten Krankheitsfall hervor, von dem die Tiere bald wieder genasen, worauf sie als aktiv immunisiert galten. Der mit der Leitung des Impfverfahrens im Norden betraute Stabsarzt Kuhn setzte bei den gewaltigen Viehherden Kambazembis an Stelle des mühsamen Impfens der einzelnen Rinder mit Rinderpestblut das Treiben der mit Galle geimpften Herden in verseuchte Viehkraale. Denn auch in diesen konnte Ansteckung und somit aktive Immunisierung erfolgen; bei den großen Viehherden, um die es sich dort handelte, ein recht praktisches Verfahren.

[S. 128] Das ganze Schutzgebiet wurde in Impfbezirke geteilt und dessen sämtliche personelle wie materielle Kräfte zur Bekämpfung der Rinderpest in Dienst gestellt. Offiziere, Beamte, Soldaten und Ansiedler wurden im Impfen ausgebildet, und alle erschöpften sich in gleichmäßigem Wetteifer behufs Ausführung des Impfgeschäftes. Dank dieser gemeinsamen Anstrengung war das im Schutzgebiet erzielte Ergebnis das beste, das damals in Südafrika erreicht worden ist. Im übrigen pflegte die Wirkung des Impfverfahrens, je nachdem es bei einer bereits angesteckten oder bei einer noch ganz unberührten Herde angewendet wurde, verschieden zu sein. Im Hererolande wurden durchweg 50 vH. des Bestandes gerettet, bei den Weißen der Bezirke Windhuk und Otjimbingwe 60 bis 80 vH., bei den Bastards von Rehoboth 70 vH. Im Namalande, wo nur von der Seuche noch ganz freie Herden geimpft worden sind, war das Ergebnis 82 bis 95 vH. Bereits Ende 1897, mithin nach noch nicht einem Jahre, war die Seuche im ganzen Schutzgebiet wieder erloschen.

Um dieses günstige Ergebnis dem Lande zu erhalten, wurde die Grenze zwischen dem Namalande und dem Hererolande gegen das Überschreiten durch ungeimpfte Tiere gesperrt. Diese Sperre blieb drei Jahre bestehen, nach welcher Zeit sie im Interesse des Verkehrs wieder aufgehoben wurde. Bald nach ihrer Beseitigung wurden wir jedoch durch den Wiederausbruch der Seuche überrascht. Hieraus ergab sich die Schlußfolgerung, daß der Keim der Krankheit in dem Wasser und der Weide des nördlichen Schutzgebietes noch vorhanden gewesen war. Während jedoch der im Norden von immunisierten Eltern geborene, nicht geimpfte Nachwuchs diese Keime ohne Schaden ertragen hatte, traf solches bei den aus dem Namalande gekommenen ungeimpften Tieren nicht zu. Bei ihnen brach vielmehr die Seuche aus, die dann auch den ungeimpften Nachwuchs des Nordens ergriff. Das vor drei Jahren geimpfte Großvieh erwies sich dagegen mit vereinzelten Ausnahmen noch als immun. Das Impfgeschäft wurde nunmehr[S. 131] wieder in der früheren Weise eingerichtet. Der Süden ward abermals von Norden abgesperrt und blieb auch dieses Mal von der Seuche verschont.
Im übrigen trat die Rinderpest jetzt in viel milderer Form auf. Die Verluste würden daher gering gewesen sein, wenn nicht eine weitere Komplikation hinzugetreten wäre. Die Untersuchungen des Roßarztes Rickmann ergaben nämlich, daß diesmal mit der Rinderpest auch das Texasfieber verbunden war; beide Seuchen zeigten sich meist in ein und demselben Tiere zugleich, ganz selten das Texasfieber allein. Da mit dem zum Teil ungeschulten Personal beide Seuchen gleichzeitig nicht zu bekämpfen waren, so wurde der Kampf auf die Rinderpest, als die gefährlichere Krankheit, beschränkt und, sofern nicht ein wirklich Sachverständiger an Ort und Stelle war, das Texasfieber nicht beachtet. Nach etwa zwei Jahren waren beide Seuchen wieder erloschen. Sie traten von nun ab nur noch vereinzelt auf. Gestützt auf die früheren unliebsamen Erfahrungen, wurde dieses Mal jedoch die Absperrung von Nord gegen Süd bis zum Ausbruch des Bondelzwartsaufstandes 1903 aufrechterhalten. Ihre Aufhebung sowie die Einführung zahlreicher Zugtiere von außerhalb während des Aufstandes mag wohl die Ursache sein, daß die Rinderpest sich bis in die neueste Zeit wieder fühlbar gemacht hat.

Diese Krankheit ist eine ausschließlich Südafrika eigentümliche. Sie entsteht nur während der Regenperiode und hört mit dieser wieder auf. Die Heftigkeit ihres Auftretens richtet sich auch in der Regel nach der Reichhaltigkeit des Regenfalles.
Ein sicheres Mittel gegen diese Seuche ist noch nicht gefunden, obwohl die beiden Hauptbakteriologen des Schutzgebietes, der jetzige Veterinärrat Rickmann sowie der Stabsarzt Kuhn, sich fortgesetzt mit der Pferdesterbe beschäftigt haben und der Lösung des Rätsels wohl auch schon ziemlich nahe gekommen sind. Als vorbeugendes Mittel haben sich jedoch bereits die Verbringung des ganzen Pferdebestandes auf sogenannte Sterbeplätze (hoch oder in der Nähe der Küste gelegen) oder Unterbringung der Pferde in Ställen bewährt. Während der Sterbeperiode wurden daher militärische Expeditionen ohne zwingenden Grund vermieden und Übungen zu Pferde nur auf den Sterbeplätzen selbst unternommen, indem die Truppenabteilungen sich dort mit ihren Pferden vereinigten. Mit Hilfe dieser Maßnahme ist es gelungen, in normalen Zeiten den Verlust an Pferden durch die Sterbe, der 1894, in dem Jahre meines Eintreffens im Schutzgebiet, noch 70 vH. betragen hatte, auf 5 bis 25 vH. des Bestandes herabzudrücken.

Ferner herrschen im Schutzgebiet noch verschiedene Tierkrankheiten, die wir auch in Europa kennen, wie Lungenseuche, Druse, Rotz und Räude. Sie unterscheiden sich indessen in nichts von den europäischen Krankheiten gleicher Art; es erübrigt sich daher hier ein Eingehen auf sie.

Die wichtigste Folge, die dem Schutzgebiet aus der Rinderpest erwachsen ist, war der schon längst ersehnte und dringend notwendige Bau einer Bahn von der Küste nach Windhuk. Ich habe bereits erwähnt, daß auf dem sehr in Anspruch genommenen Wege von dem Hafenplatz Swakopmund nach Windhuk am Ende der trockenen Jahreszeit Wasser[S. 133] und Weide stets derart versagten, daß der auf Ochsenwagen beruhende Verkehr eingestellt werden mußte. Derjenige Teil der Bevölkerung, der nicht in der Lage war, in der für die Zufuhr günstigen Jahreszeit Vorräte aufzuhäufen, war daher in den Monaten Oktober bis Dezember fast regelmäßig auf die Unterstützung der Regierung angewiesen. Und das geschah in normalen Zeiten. In anormalen Zeiten, wie sie z. B. angesichts der Rinderpest gedroht hatten und wie sie bei jeder Truppenanhäufung im Hererolande zu erwarten waren, konnte eine Hungerkatastrophe eintreten. Einem Bahnbau stand seitens der Regierung jedoch die sogenannte Damaralandkonzession vom 12. September 1892 entgegen. Mittels dieser war der South-West-Africa-Company, einer englischen Gesellschaft, das Monopol zum Bau und Betrieb einer Eisenbahn von einem Punkte nördlich Sandwichhafen bis zum Kunenefluß überlassen worden, und zwar auf zehn Jahre, mithin bis 1902. Ein Mittel, die Gesellschaft zwangsweise zu einem früheren Bahnbau zu veranlassen, war jedoch nicht vorgesehen. Es war daher eine rettende Tat, als die Kolonialverwaltung, an der Spitze der damalige Kolonialdirektor — spätere Staatssekretär — Freiherr v. Richthofen,[28] einfach über die Ansprüche der Gesellschaft hinwegging und 1897 den Bahnbau von Staats wegen einleitete. Der Bau wurde im September 1897 begonnen und nach etwa fünf Jahren im Juni 1902 beendet. Am 19. Juni 1902, genau am Tage der Eröffnung einer landwirtschaftlichen Ausstellung in Windhuk, lief dort der erste Personenzug ein. Zuerst war lediglich ein Bau über die Namibwüste hinweg bis ins Weideland (Jakalswater) geplant gewesen, um wenigstens den infolge der Rinderpest drohenden schlimmsten Schäden vorzubeugen. Der um Indemnität angegangene Reichstag bewilligte[S. 134] in der Folge nicht nur diese Strecke, sondern nach und nach auch die Mittel zu deren Fortsetzung bis Windhuk. Ich hatte damals selbst die Ehre, im Reichstag für diesen Bahnbau einzutreten und bei den kolonialfreundlichen Parteien allgemeines Entgegenkommen gefunden.
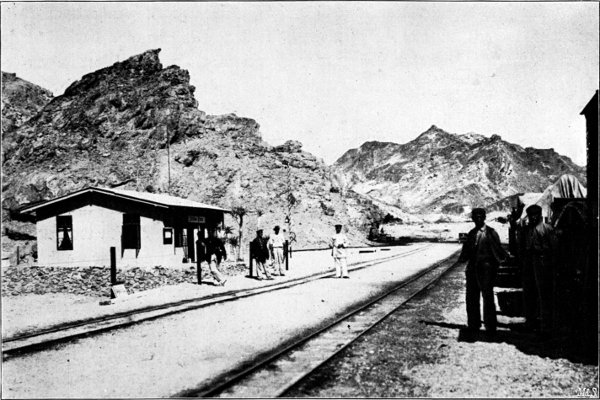

Aber nicht nur vor einer etwa drohenden Hungersnot hat die Bahn das Schutzgebiet gerettet, sondern vor der drohenden Stagnation überhaupt. In unseren Kolonien dürfen wir mit dem Bahnbau nicht warten, bis das wirtschaftliche Leben einen solchen verlangt, vielmehr muß umgekehrt der erstere dem[S. 135] letzteren vorausgehen. Mag sich doch jeder selbst ausrechnen, was im Innern des Landes ein Hausbau kostet, wenn die Baumaterialien von der Küste auf dem schwerfälligen Ochsenwagen befördert werden müssen! Der damalige Kolonialdirektor Freiherr v. Richthofen hat sich daher mit seiner tatkräftigen Initiative ein unvergängliches Verdienst um die Entwicklung des Schutzgebietes erworben.

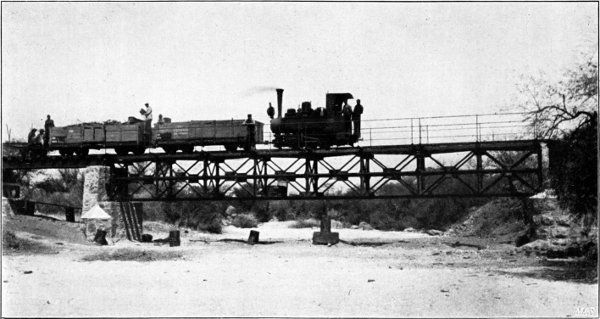
Durchgeführt wurde der Bau durch Offiziere der Eisenbahnbrigade, und zwar zuerst durch die Oberleutnants Kecker und Schulze. Als Material[S. 136] wurde das nächst zur Hand liegende, das der Eisenbahnbrigade gehörige, und mit ihm die 60 cm Spurweite angenommen. Als dann an die Stelle der ursprünglich geplanten kurzen Wüstenbahn eine solche bis nach Windhuk trat, wurde dem Oberstleutnant Gerding von der Eisenbahnbrigade die Festlegung der Trasse und dem Major Pophal die Fortführung des Baues übertragen. Viel Schwierigkeit machte die Gewinnung von Arbeitskräften. Die zuerst aus der Kapkolonie angeworbenen zeigten sich ebenso zweifelhaft, wie sie während des Hereroaufstandes 1904 gewesen waren.[29] Dann wurden 150 deutsche Arbeiter angeworben und daneben bis zu 1000 Eingeborene, durchweg Hereros und Ovambos, die während des Bahnbaues den ihnen anhaftenden Ruf der Faulheit im allgemeinen als ungerechtfertigt erwiesen haben.

Hand in Hand mit dem Bau der Eisenbahn gingen der Bau einer Telegraphenleitung von Swakopmund in das Innere des Schutzgebietes sowie der Anschluß an das englische Unterseekabel nach Europa. Der Telegraphenbau wurde 1899 begonnen; der Telegraph erreichte, dem Bahnbau vorauseilend, Windhuk ein Jahr früher, im Juli 1901. Im Anschluß an ihn wurde am 9. Dezember 1901 eine heliographische Verbindung nach Keetmanshoop dem Verkehr übergeben, ihr folgte im Jahre 1902 eine solche von Karibib über Omaruru nach Outjo.

Zur richtigen Ausnutzung einer Eisenbahnverbindung von der Küste nach dem Innern gehört jedoch auch ein guter Landungshafen, und an einem solchen fehlte es damals. Swakopmund stellte sich lediglich als einfache Reede dar, durch deren starke Brandung sich hindurchzuarbeiten zuweilen mit Lebensgefahr verbunden war. Gleichzeitig mit dem Bahnbau war daher eine Summe zur Verbesserung der Landungsverhältnisse in Swakopmund beantragt und bewilligt worden. Der mit der Leitung der Arbeiten betraute Regierungsbaumeister Ortloff landete mit dem nötigen Arbeiterpersonal am 25. November 1898. Der Grundstein zur Mole wurde am 2. September 1899 gelegt und die Zwischenzeit mit den erforderlichen Vorarbeiten ausgefüllt. Zu diesen gehörte auch der Bau einer dem ganzen Orte zugute kommenden Wasserleitung. Der Hafen war zunächst nur als sogenannter Leichterhafen gedacht, d. h., es sollte mittels einer bis über die stärksten Brecher hinausreichenden Mole die Wirkung der Brandung ausgeglichen und so an der Landungsstelle ruhiges Wasser geschaffen werden, innerhalb dessen die kleinen Leichter an der Mole landen sollten. Die großen Schiffe sollten dagegen nach wie vor etwa 1 bis 2 km von der Küste entfernt auf der Außenreede liegen bleiben.
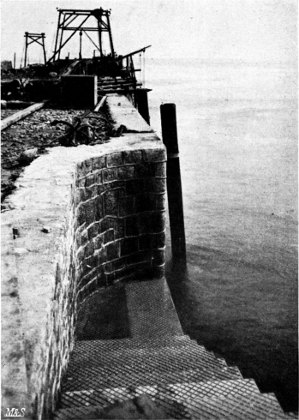
[S. 140] Es war ein harter Kampf, der sich nunmehr zwischen menschlicher Kunst und Energie und den Naturgewalten entspann. Immer und immer wieder rissen die Wellen die schweren, in das Meer versenkten Betonblöcke weg, und immer wieder wurden sie gesetzt, bis sie sich schließlich doch als die Stärkeren erwiesen und die Mole am 12. Februar 1903 dem Verkehr übergeben werden konnte. Sie ist 375 m lang; nicht ganz an der äußersten Spitze ist zur Sicherung eines ruhigen Wasserbassins ein 35 m langer Querarm angebracht. Den Verkehr zwischen Mole und Dampfern vermitteln der Schleppdampfer »Pionier« und drei Leichterboote zu je 30 t Tragfähigkeit.
Aber noch war die Gewalt der Elemente nicht völlig überwunden. Wenige Monate nach der Eröffnung fiel die Spitze des Molendammes bis nahe an den Querdamm der Gewalt der Brandungsbrecher zum Opfer. Nachdem dieser Schaden beseitigt war, zeigte sich im Hafenbassin der Mole dieselbe Erscheinung, wie in allen Häfen der Westküste. Es fing zu versanden an. Man suchte sich durch Baggermaschinen, Anlage einer Landungsbrücke außerhalb der Mole und den Bau von Landungssflößen zu helfen. Aufhören wird dieser Kampf indessen nie, und es erscheint trotz aller Energie doch zweifelhaft, wem der endgültige Sieg zufallen wird. Der natürliche Hafen im zentralen Teil unseres Schutzgebietes, die Walfischbai, befindet sich bekanntlich in englischen Händen — das ist gerade so, als wenn jemand ein Haus besäße und ein anderer den Schlüssel dazu. Gewiß hat der Hafen von Walfischbai auch seine Schattenseiten. Indessen würde der Kampf gegen sie doch erfolgversprechender sein als der an der durchaus ungeschützten Reede von Swakopmund.
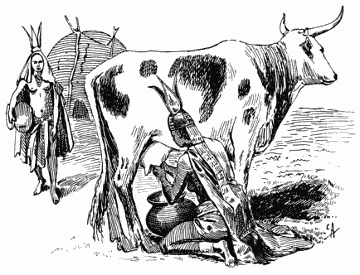
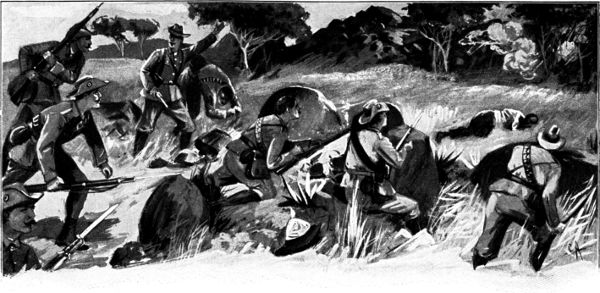
Nach dem Feldzuge 1896 und der an ihn anschließenden mit Gründung des Nordbezirks verbundenen Nordexpedition folgte für das Schutzgebiet eine Zeit des allgemeinen Friedens, fast ausschließlich durch wirtschaftliche Arbeiten ausgefüllt. An kriegerischen Zusammenstößen fanden während dieser Zeit nur kleinere von lediglich lokaler Bedeutung statt. Irgend eine hemmende Wirkung haben sie auf die Entwicklung des Schutzgebietes in keiner Weise gehabt.
Mit welchen Arbeiten größeren Stiles diese Zeit ausgefüllt gewesen ist, geht aus Kapitel IV hervor. Weiteres wird noch im nächsten Kapitel folgen. Hier beschränke ich mich auf die Schilderung der ferneren historischen Ereignisse bis zum Ausbruch des großen Aufstandes 1903/04.
Von dem einst mächtigen Stamm der Afrikaner[30] hatte sich in dessen früherem Stammesgebiet in der Südostecke des Schutzgebiets noch ein kümmerlicher Rest unter einer Art Kapitänschaft zusammengefunden. Hier fristete er sein Leben mit Jagd, Hunger, Viehdiebstählen und zeitweisem Dienste[S. 142] bei den weißen Farmern, letzteres jedoch möglichst wenig. Solange der Stamm die Diebstähle nur vereinzelt betrieb, wurden die Diebe, wenn gefangen, auf dem ordentlichen Gerichtswege abgeurteilt. Mitte 1897 fing er jedoch an, sich in größeren Abteilungen zusammenzurotten und den Viehraub im großen zu betreiben. Der zuständige Distriktschef in Warmbad, Oberleutnant d. Res. v. Bunsen, früher aktiver Offizier, jetzt Zivilbeamter, rückte daher Ende Juni 1897 mit der ihm zur Verfügung stehenden geringfügigen Truppe (14 Köpfe) aus und glaubte im Interesse der Autorität der Regierung von einem Angriff auch dann nicht absehen zu sollen, als ihm die Überlegenheit des Gegners bekannt geworden war. Es kam am 5. Juli zu einem Zusammenstoß, der bei dem Mißverhältnis der Kräfte (etwa 14 gegen 60) mit einem Rückzug der deutschen Truppe endete. Von dieser hatten zwei Reiter den Tod gefunden. Nunmehr erhielt der älteste Offizier des Südbezirks, Leutnant Helm, von mir den Befehl, mit allen verfügbaren Kräften gegen die Räuber vorzugehen. Dem eben erst eingetroffenen Bezirksamtmann Dr. Golinelli gelang es, an der Hand der guten Grundlage, die ihm sein Vorgänger, Bezirksamtmann Dust, hinterlassen hatte, die nächstbeteiligten Hottentottenstämme, die Bondelzwarts und die Feldschuhträger, zum Anschluß an die Expedition zu veranlassen. Die Stärke der gesamten Expeditionsgruppe betrug daher schließlich: 4 Offiziere, 1 Arzt, 54 Unteroffiziere und Mannschaften, 13 Feldschuhträger, 24 Bondelzwarts, 1 Geschütz. Im ganzen 96 Kombattanten.
Am 2. August kam es in der Gamsibschlucht zu einem zweiten Zusammenstoße, der nach einem eintägigen Gefecht abends mit der Flucht des Gegners endete. Dieser hatte — bei den Hottentotten ein ganz seltener Fall — einen Verlust von etwa einem Drittel seiner Stärke (20 Tote) ausgehalten. Sonst pflegen die Hottentotten auf ein derartiges zähes Standhalten keinen Wert zu legen, vielmehr bei den ersten ernsten Verlusten ihre Stellung zu räumen, um den Kampf anderswo zu erneuern. Denn einen Rückzug sehen die Eingeborenen an sich niemals als Niederlage an, und aus dem Aufgeben von Land machen sie sich gar nichts. Infolgedessen kleben sie nie an einer Wasserstelle, sondern verschwinden, wenn ernstlich angefaßt, unbemerkt, solange sie dies noch können. Den aus Hottentottenkriegen gemeldeten Verlusten von 50 und gar 150 Toten gegenüber kann ich mich daher einer gewissen Skepsis nicht entschlagen.
Wenn in dem uns hier beschäftigenden Gefecht die Hottentotten einen so schweren Verlust ertragen haben — die gemeldeten Toten sind auf dem[S. 143] räumlich wenig getrennten Gefechtsfelde sämtlich gesehen worden —, so lag dies an besonderen Umständen. Einerseits hatte der Gegner eine taktisch wenig günstige Stellung — dicht hinter sich den Orangefluß — innegehabt, anderseits der diesseitige Führer, Leutnant Helm, taktisch besonders sachgemäße Maßnahmen getroffen, indem er die Stellung von drei Seiten umfassend angriff, so daß dem Gegner nur der direkte Rückzug über den Orangefluß verblieb. Da außerdem das Gefecht von Hause aus in möglichst naher Entfernung begann, so fühlten die Hottentotten selbst, daß ein Rückzug über den Orangefluß unter dem feindlichen Verfolgungsfeuer einer Vernichtung gleichgekommen wäre. Infolgedessen zogen sie von zwei Übeln das kleinere vor, sie hielten bei Tage trotz ihrer schweren Verluste aus und traten den Rückzug erst unter dem Schutze der hereinbrechenden Dunkelheit an. Als dann die Truppe am andern Tag den Angriff erneuern wollte, fand sie die feindliche Stellung geräumt.
Die Verluste unserseits betrugen 1 Offizier (v. Altrock), 1 Reiter tot, 1 Offizier, 3 Reiter schwer verwundet, 2 weiße, 2 eingeborene Reiter leicht verwundet, mithin an Offizieren 50 v. H., an weißen Unteroffizieren und Mannschaften 12 v. H. Verluste. Unter den Schwerverwundeten befand sich auch der Führer Leutnant Helm, der bereits im Hereroaufstande 1896 zwei schwere Verwundungen erlitten hatte. Die beiden noch übrigen Offiziere waren die Leutnants v. Winterfeld und v. Bunsen. Das Kommando ging nach dem Gefecht an den ersteren als den ältesten über.
Auf erhaltenen Befehl war inzwischen aus Gibeon auch der Bezirksamtmann und Hauptmann d. Res. v. Burgsdorff mit einem Teil seiner Distriktsbesatzung und einem Kommando Witboois, dieses unter dem Kapitän selbst, auf dem Kriegsschauplatz erschienen. Doch kam es nur noch zu kleineren Patrouillengefechten, da den Afrikanern zu weiterem die Kraft nicht mehr reichte. Die Reste, darunter ihr Führer Kividoe, flüchteten schließlich nach der Kapkolonie, wo sie durch die englische Polizei verhaftet und auf das Betreiben des Bezirksamtmanns Dr. Golinelli an diesen ausgeliefert wurden. Sie wurden vor ein Kriegsgericht gestellt und sämtlich erschossen.
Ein für das Schutzgebiet weit ernsteres Ereignis war der noch im gleichen Jahre ausbrechende Aufstand der Swartboois, eines, wie bereits erwähnt, nach dem Kaokofelde abgesprengten Hottentottenstammes. Denn[S. 144] nicht um den Rest eines Stammes handelte es sich hier, sondern um ein vollständiges, etwa 400 waffenfähige Männer zählendes Volk, das zudem von dem Zentrum der deutschen Macht weit entfernt und daher schwer erreichbar war. Umsomehr lag die Gefahr des Übergreifens des Aufstandes auf die Nachbarn vor, was in der Folge auch eingetreten ist. Sowohl der andere in das Kaokofeld geratene Hottentottenstamm, die Topnaars, schloß sich später dem Aufstande an, als auch merkwürdigerweise ein Teil der Westhereros unter dem Unterhäuptling Kambata, obwohl diese mit den Swartboois in unaufhörlichen Grenzstreitigkeiten gelegen hatten. Ein Gegengewicht gegen diesen Zuwachs an Macht für die Aufständischen bot dagegen der Umstand, daß ein kleiner Teil des Swartbooistammes unter dem Nebenbuhler des Kapitäns David, dem Unterhäuptling Lazarus Swartbooi, auf seiten der Regierung verblieben war. Mit dieser Tatsache war die größte Schwierigkeit der afrikanischen Kriegführung, die Beschaffung landeskundiger Führer sowie die rechtzeitige Wiederaufnahme der Verbindung mit den Aufständischen behoben.
Des Zwiespaltes zwischen dem legitimen Kapitän des Stammes, David Swartbooi, und dessen selbst nach der Kapitänschaft strebendem Vetter Lazarus Swartbooi habe ich bereits in Kapitel II gedacht. In ihm liegt wohl die innerste Ursache des Aufstandes. Aus den Reihen der Anhänger von Lazarus gingen dem damaligen Bezirksamtmann von Outjo, Hauptmann v. Estorff, fortgesetzt Nachrichten über aufrührerische Pläne Davids und seines Anhanges zu. Dies veranlaßte Hauptmann v. Estorff, mittels eines nächtlichen Gewaltmarsches im Mai 1897 plötzlich mit 20 Reitern in Otjitambi, dem damaligen Wohnsitze Davids, zu erscheinen und die ihm bezeichneten Hauptaufwiegler aufzuheben. Nachdem die angestellte Untersuchung die Richtigkeit der Beschuldigungen ergeben hatte — vorläufig hatten jedoch nur Worte, keine Taten vorgelegen —, wurde Kapitän David nach Windhuk überführt und an seiner Stelle Lazarus Swartbooi als Kapitän eingesetzt. Damit hatte letzterer sein Ziel erreicht; die Anhänger Davids aber gaben sich mit dieser Tatsache nicht zufrieden, die Wühlereien gegen die deutsche Regierung wie gegen den neuen Kapitän Lazarus Swartbooi dauerten vielmehr fort. Als dann im November 1897 offene Feindseligkeiten zwischen beiden Parteien auszubrechen drohten, erschien Hauptmann v. Estorff mit 50 Reitern und einem Geschütz abermals unter dem Stamm, diesmal in Franzfontein, wo mittlerweile ein Distriktskommando unter Leutnant Graf v. Bethusy-Huc eingerichtet worden war.
Hauptmann v. Estorff fand Franzfontein von den Anhängern des Kapitäns David unter ihren neuen Anführern Samuel und Joel Swartbooi, beide gleichfalls der Kapitänsfamilie entstammend, verlassen. Während Hauptmann v. Estorff noch mit den Häuptern der Aufständischen Verhandlungen pflog, nahmen diese am 3. September die eine Stunde von Franzfontein weidenden Pferde und Esel der Kompagnie weg. Hauptmann v. Estorff faßte das mit Recht als Kriegsfall auf und brach die Verhandlungen ab. Es folgte nunmehr ein Feldzug mit allen der afrikanischen Kriegführung eigentümlichen Erscheinungen und Schwierigkeiten, und zwar abwechselnd zwischen Überfällen, Patrouillenschießereien und größeren Gefechten, stets aber erschwert durch die große Abhängigkeit der Truppe von Wasser und Weide. Wie meist in Afrika erlitt die Truppe ihre größeren Verluste nicht in Gefechten, sondern bei Patrouillenritten und Transportkommandos.
Das Wegnehmen seiner Pferde und Esel beantwortete Hauptmann v. Estorff mit einem Gewaltmarsch nach Ehobib und mit einem Überfall auf die dort befindliche neue Stellung des Feindes in der Nacht vom 4. auf den 5. Dezember. Dieser Überfall brachte der Kompagnie bei einem Verlust von nur einem Toten und zwei Leichtverwundeten ihr ganzes geraubtes Vieh wieder zurück. Weniger günstig erging es dagegen einer gleichzeitig entsandten Seitenpatrouille unter dem Unteroffizier Wesch, die sich direkt auf die Spuren des gestohlenen Viehs hatte setzen sollen. Sie geriet bei Klein-Aub in einen Hinterhalt und büßte bei einer Stärke von drei Köpfen zwei Tote und einen Verwundeten ein. Die ihr als Begleitung beigegebenen Hottentotten des Kapitäns Lazarus hatten sich dagegen rechtzeitig aus dem Staube gemacht. Diesem Verlust folgte am 17. Dezember ein weiterer von abermals zwei Toten und einem Verwundeten aus dem Begleitkommando von zwei Wagen, die vom Lager der Kompagnie nach Franzfontein hatten zurückfahren sollen. Der ganze Inhalt der Wagen, darunter Gewehre und Munition, fiel dem Gegner in die Hände. Einem der Wagenführer (Bur) erlaubte jedoch der Führer der Hottentotten nach geschehener Plünderung die Fortsetzung der Fahrt nach Franzfontein und die Mitnahme des verwundeten Reiters Nosper. (Vgl. Karte Seite 149.)
Indessen sollten die Hottentotten sich dieses Raubes nicht lange erfreuen. Mittlerweile war der Distriktschef von Omaruru, Leutnant Bensen, mit 20 Reitern in Franzfontein eingetroffen, hatte die Anwesenheit von feindlichen Kräften in Tsaub erfahren und brach am 17. Dezember auf, um auf[S. 146] einem Umwege den Anschluß an die Kompagnie Estorff zu gewinnen. Hierbei traf er am 19. Dezember bei Anabis auf die mit ihrer Beute zurückkehrenden Hottentotten. Leutnant Bensen griff sie an, zerstörte einen Teil des erbeuteten Proviants und eroberte 15 Trekochsen zurück. Einer drohenden Umklammerung durch den numerisch überlegenen Gegner entzog sich Leutnant Bensen dann durch einen geschickten Rückzug nach Franzfontein. Seine Abteilung hatte nur einen Leichtverwundeten.
Auf die Nachricht von diesen Vorgängen in ihrem Rücken, die eine Gefahr für den wichtigen Depotplatz Franzfontein befürchten ließen, hatte sich die Kompagnie Estorff, die auf der Suche nach dem Verbleib der Hauptmacht des Feindes inzwischen Otjitambi erreicht hatte, ebenfalls nach erstgenanntem Platze zurückgezogen. Am 23. Dezember standen infolgedessen in Franzfontein vereinigt rund 90 Weiße und 32 Eingeborene, sämtlich jedoch schlecht beritten. Der letztgenannte Mißstand zieht sich durch die ganze Feldzugsgeschichte hin. Die in bezug auf ihre Leistungen stets stark angespannten Pferde konnten sich bei der mangelhaften Weide nicht wieder erholen, da die Regenperiode im Jahre 1897/98 spät, dann allerdings um so gründlicher einsetzte.
Am 25. Dezember traf vom Osten des Nordbezirks Grootfontein eine weitere Verstärkung von 20 Reitern unter dem Assistenzarzt Dr. Kuhn ein, so daß die Kompagnie nunmehr auf 110 Köpfe angewachsen war. Anfang Januar 1898 ergab eine Erkundung, daß Tsaub wieder vom Feinde besetzt sei. Die Kompagnie rückte dorthin ab und vertrieb den letzteren am 4. Januar 1898 unter einem eigenen Verlust von zwei Toten und einem Verwundeten (Leutnant Bensen), worauf sie wieder nach Franzfontein zurückkehrte. Der Rest des Monats Januar war mit Erkundungen und mit dem Heranziehen von Proviant ausgefüllt. Im übrigen hatte die Kompagnie sich aus dem Überfall auf die zwei Wagen bei Tsaub die richtige Lehre gezogen; denn nunmehr wurde zum Zwecke des Abholens von Proviant aus Outjo ein größeres Kommando von 13 Wagen unter einer Bedeckung von 1 Offizier und 40 Mann zusammengestellt. Außerdem marschierte später die Kompagnie selbst der zurückkehrenden Kolonne auf dem halben Wege entgegen. Letztere wurde denn auch dieses Mal vom Feinde in keiner Weise belästigt.
Inzwischen hatte das Gouvernement in Windhuk — ich selbst befand mich damals auf Heimatsurlaub — aus den eingegangenen Nachrichten erkannt, daß die Wirren im Nordbezirk doch einen recht bedenklichen Charakter[S. 147] annehmen müßten, falls es nicht gelänge, ihnen baldigst ein Ziel zu setzen. Fingen doch jetzt die Westhereros sowie die Topnaars an, sich den Aufständischen anzuschließen. Wie immer, hatten auch hier die Eingeborenen die Tatsache, daß es ihnen gelungen war, den Feldzug in die Länge zu ziehen, schon als einen Sieg ihrerseits aufgefaßt. Wie unternehmungslustig die Swartboois noch waren, bewies ein am 23. Januar stattgehabter Überfall auf den Viehposten der 4. Feldkompagnie bei Khauas dicht östlich Outjo, wobei ein Reiter schwer verwundet wurde. Doch wurde dem Gegner durch einen Teil der Besatzung Outjo unter dem Zahlmeisteraspiranten Nürnberger mittels eines schneidigen Angriffes seine Beute wieder abgejagt.
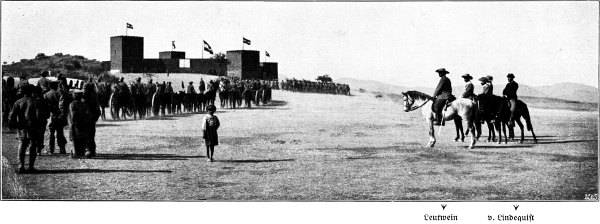
Nun wurde auch der in Windhuk stehende Teil der Truppe (1. Feldkompagnie, Feldbatterie) nach dem Kriegsschauplatze herangezogen, die Bastards einberufen und Witbooi an seine Bündnispflicht erinnert. Mit Ausnahme der Witboois, die bei der großen Entfernung nicht mehr den Anschluß hatten erreichen können, traf diese Verstärkung unter dem stellvertretenden Truppenkommandeur Major Mueller noch rechtzeitig ein, um[S. 148] den Feldzug zum Abschluß zu bringen. Von dem Vormarsch dieser Truppe auf den Kriegsschauplatz wäre nur zu erwähnen, daß am 7. Februar eine Patrouille unter Leutnant v. Schönau im Hautamabtal eine Hererowerft überfallen und ihr eine Viehherde abgenommen hatte. Als Major Mueller Mitte Januar in Franzfontein eintraf, war der neue Aufenthalt des Feindes noch nicht festgestellt. Er griff daher zu dem Mittel, durch einen der treu gebliebenen Swartboois eine Botschaft an ihn zu senden. Hierbei ergab sich, daß der vereinigte Feind, Swartboois, Topnaars und Hereros, in der Stärke von 200 bis 300 waffenfähigen Männern am Grootberge, nördlich Franzfontein, saß und noch viel Kriegslust zeigte. Nachdem sämtliche Verstärkungsabteilungen in Franzfontein vereinigt waren, trat Major Mueller am 16. Februar seinen Vormarsch nach dem Grootberge an. Zur Verfügung standen jetzt:
1. Kompagnie unter Hauptmann Kaiser; 4. Kompagnie unter Hauptmann v. Estorff.
Eine besondere Abteilung unter Oberleutnant Franke (Distriktsmannschaften von Otjimbingwe-Omaruru); Feldbatterie unter Oberleutnant v. Heydebreck, in Summa rund 200 Weiße, darunter 13 Offiziere, 34 Bastardsoldaten, 24 sonstige eingeborene Soldaten nebst den nötigen Führern aus den treu gebliebenen Swartboois.
Wie alle Führer, die damit in Afrika noch keine schlechten Erfahrungen gemacht haben, bestrebt, den Gegner von allen Seiten zu fassen und so einen Vernichtungsschlag zu führen, ordnete Major Mueller einen Vormarsch in drei räumlich getrennten Kolonnen an, wie aus nachstehender Skizze hervorgeht. Die Kolonnenführer waren: Hauptmann Kaiser, Hauptmann v. Estorff, Oberleutnant Franke. Major Mueller schloß sich für seine Person der Kolonne Kaiser an.
Der Marschbefehl des Majors Mueller lautete in seinem zweiten Punkt, wie folgt:
»Das Detachement soll am 16. d. Mts. in drei Kolonnen auf den Grootberg vorgehen, und zwar die rechte Flügelkolonne über Otjitambi, Kamaniab, Kakatswa, die mittlere Kolonne über Groß-Achas, Klein-Achas, Olifantskoop, Bauwasser, die linke Flügelkolonne über Keium, Bethanis, Nugas-Wasser. Die drei Kolonnen haben bei ihrem Eintreffen in Kakatswa, Olifantskoop und Nugas-Wasser untereinander Verbindung zu suchen. Ich rechne darauf, daß dieselben mit ihren Spitzen am 22. d. Mts. an den genannten Plätzen eintreffen.«
Major Mueller hatte mithin jeder Kolonne einen Platz bezeichnet, von dem aus sie Verbindung mit der andern zu suchen hätte, und ausgerechnet, daß diese Plätze am 22. Februar erreicht sein müßten. Aber, wie oft in der Welt und in Afrika insbesondere, kam die Sache anders.
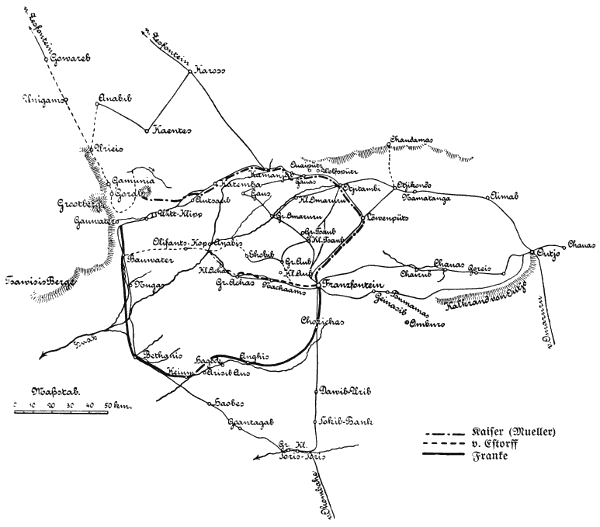
Die mittlere Kolonne erreichte, durch höhere Gewalt aufgehalten, ihr Ziel überhaupt nicht. In Groß-Achas angekommen, hatte sie sich bereits zur nächtlichen Ruhe begeben, als das bis jetzt ganz trockene Revier plötzlich mit überraschender Gewalt abkam und das Wasser die im Flußbett weidenden Pferde nebst deren Wache ergriff. Der Reiter Bergmayer, drei eingeborene Reiter sowie ein Teil der Pferde und Esel ertranken. Da zum Weitermarsch das Revier selbst hätte benutzt werden müssen, so war ein solcher für diese Kolonne überhaupt unmöglich geworden. Die linke Flügelkolonne erreichte dagegen die feindliche Stellung 24 Stunden vor der rechten und hätte einem[S. 150] unternehmenden Gegner gegenüber in eine üble Lage kommen können, zumal sie die schwächste der Kolonnen war. Fühlung zwischen ihr und der rechten Kolonne war noch nicht gewonnen. Doch gelang glücklicherweise eine solche unmittelbar nachdem am 25. Februar auch die rechte Kolonne vor der feindlichen Stellung eingetroffen war, bevor der Feind etwas Ernstliches hatte unternehmen können. Major Mueller beschloß jetzt sehr richtig, mit den beiden zur Hand befindlichen Kolonnen die feindliche Stellung anzugreifen, ohne auf die ausgebliebene mittlere Kolonne zu warten. Am 26. Februar erfolgte ein gut geleiteter konzentrischer Angriff, der bei einem eigenen Verlust von nur 1 Unteroffizier tot und 4 Eingeborenen schwer verwundet zu einem durchschlagenden Erfolge führte. Vom Gegner wurden später 10 Tote gefunden; er flüchtete sich nach Nordwesten und wurde soweit wie möglich durch Artilleriefeuer verfolgt. Während anfangs angenommen worden war, daß der Feind nach Zesfontein zurückgewichen sei, ergaben die in der Zeit vom 28. Februar bis 3. März vorgenommenen Erkundungen, daß er noch im Gebirge säße. Die bereits bis zu den Wasserstellen Gorab und Gamonia vorgedrungene Truppe ging daher wieder an den Grootberg zurück und vereinigte sich hier am 5. März auch mit der inzwischen gleichfalls eingetroffenen mittleren Kolonne v. Estorff.
Um die neue Stellung des Feindes genau zu erfahren sowie sich über die Verhältnisse bei demselben zu orientieren, griff Major Mueller wieder zu dem Mittel der Verhandlung, dieses Mal jedoch mit dem Erfolge, daß der Gegner seine Unterwerfung anbot. Aus dem Brief des Führers der Aufständischen, den ich hier folgen lasse, geht hervor, daß dessen christlicher Sinn in dem wilden Kriegsleben noch nicht erstorben war. Geschrieben hat ihn jedoch wahrscheinlich der zweite Führer der Swartboois, der durch die Mission ausgebildete Schulmeister Joel Swartbooi, den ich selbst einmal in durchaus gewandter Weise habe predigen hören. Dieser hatte auch das Bestreben, den Feldzug in menschlicher Weise zu führen, tunlichst aufrechterhalten.
Grootberg, 13. März 1898.
An den Major Mueller der Kaiserlichen Schutztruppe
Hochwohlgeboren.
Unterzeichneter sendet diesen Brief und gibt Kenntnis damit, daß es unser aller herzlichster Wunsch ist, Frieden zu machen, und wir danken dem Herrn dafür, der solches, was unmöglich zu sein schien für die Menschen, möglich machen kann nach den Gebeten der vielen Christen hier im Gebirge.
[S. 151] Und ich hoffe, daß dies wahrer Friede sein wird, den Gott in uns allen auf einmal hat zustande bringen wollen, und ich bitte den Herrn, daß er wird mit uns vollbringen.
Also bitte ich Euer Hochwohlgeboren um wahren Frieden, und sende als Beweis von demselben zwei Männer voraus mit Boab Davids, mit Namen Sem Swartbooi, und Paul Hendriks. Ich werde Montag nachmittag von hier laufen (gehen), und Herr Riechmann[31] kann (soll) Dienstag von dort aus gehen, daß wir vormittags bei der Pforte untereinander unterhandeln können.
Mit Gruß von mir
gez. Samuel Swartbooi.

Am 17. März erschien der ganze Stamm der Swartboois, etwa noch 150 Männer und 400 Weiber und Kinder stark, im Lager und gab die Waffen ab. An Vieh brachten sie etwa 1000 Stück mit. Der Stamm[S. 152] wurde nach Windhuk überführt, wo er sich heute noch befindet und mit öffentlichen Arbeiten beschäftigt wird. Die Topnaars hatten sich dagegen nach ihrem weitentfernten Stammsitz Zesfontein zurückgezogen. Da es sich nicht der Mühe lohnte, ihretwegen einen zweiten kostspieligen Feldzug anzuschließen, wurde denselben nach Entrichtung einer Buße, bestehend in Vieh und Gewehren, verziehen. Die aufrührerischen Herero dagegen, die sich nicht mehr zu ihren treu gebliebenen Stammesgenossen zurückwagten, flüchteten zu den Ovambos, wo sie beraubt und später ermordet worden sind. Die Witboois, die erst nach abgeschlossenem Frieden auf dem Kriegsschauplatze eingetroffen waren, erlitten noch zahlreiche Verluste infolge Malaria. Die hinterlassenen Witwen und Waisen wurden hierfür durch einen Beuteanteil entschädigt, worauf sie nach Hottentottenart alle Verluste wieder vergaßen.
Nach fünf Jahren trat endlich wieder die Notwendigkeit zu einem Zuge in das Namaland an die Truppe heran, da zwei Hottentottenstämme aufsässig geworden waren. Die Ursache war die Gewehrstempelungsfrage. Behufs besserer Kontrolle über Waffen und Munition war nämlich im März 1897 eine Verordnung erschienen, die für Weiße und Eingeborene die Zwangsstempelung der Gewehre sowie das Tragen von Waffenscheinen anordnete. Eine Zuwiderhandlung zog Geldstrafe, verbunden mit Konfiszierung des betreffenden Gewehres, nach sich. Es war vorauszusehen, daß diese Verordnung bei den Eingeborenen auf Mißtrauen stoßen würde, das zu beseitigen der Geschicklichkeit der Verwaltungsbeamten anheimgestellt wurde. Denn die Eingeborenen mußten, wenn nicht richtig aufgeklärt, hinter der Stempelung die Wegnahme ihrer Gewehre wittern. Daher war auch mit Widerstand zu rechnen, denn ein südwestafrikanischer Eingeborener läßt sich lieber Weib und Kind wegnehmen, als Gewehr und Munition.
Während ich indessen einen Ausbruch des Volksunwillens in erster Linie unter den unwissenden Feldhereros erwartet hatte, kam es zu einem solchen nur bei den Hottentotten, und zwar im Bezirk Keetmanshoop bei den Stämmen der Bondelzwarts und der Bethanier. Bezirksamtmann war Dr. Golinelli, Distriktschef bei den Bondelzwarts Leutnant Graf Kageneck, beide in der Behandlung von Eingeborenen durchaus geschickt. Die Bethanier hatten damals noch kein Distriktskommando.
Ende August kamen die ersten Nachrichten von der im Bezirk Keetmanshoop herrschenden Unruhe nach Windhuk. Es wurde ein auffälliger[S. 153] Verkehr zwischen Bethanien und Warmbad festgestellt, der füglich den Abschluß eines vollständigen Bündnisses zwischen den beiden in Frage stehenden Hottentottenstämmen mutmaßen ließ. In einem Anflug von Furcht, verbunden mit Schlauheit, reichten die aufsässigen Kapitäne dem Bezirksamt Keetmanshoop einen sehr charakteristisch abgefaßten Brief des Bondelzwartkapitäns an den Kapitän der Bethanier ein. Sein Wortlaut war folgender:
Warmbad, den 15. Juni 1898.
An Bruder und Kapitein Paul Frederiks.
Geachteter und mich liebhabender Bruder, mit wenigen und kurzen Worten melde ich Dir in diesem Briefe, nicht mit vielen Worten und Erklärungen teile ich Dir meine Gedanken mit. In Betreff der Zustände, in denen wir uns befinden, sende ich Dir meinen Sprecher, den Träger dieses Briefes, Abraham Schyer, welcher Euer Edlen ferner mündlich Einsicht geben soll und erklären, was eigentlich meine vornehmlichen Gedanken sind, Euch und den lieben Landes-Häuptern. Ich kann Euch nicht nötigen mit mir mündlich zu sprechen, vornehmlich über die Krankheiten, welche im Lande sind, von Vieh- und Menschenkrankheiten, aber ich bin der Meinung, wir Kapiteine müßten zusammenkommen um miteinander brüderlich zu verhandeln über die Landeszustände, in welchen wir uns gegenwärtig befinden. Deshalb sende ich meinen Sprecher in dieser wichtigen Sache und stelle, für den Fall Ihr mein Anerbieten auf eine mündliche Aussprache, sowie Euere lieben Großleute, annehmt, in Eueren Willen und Hände, anzugeben, über welche Dinge wir zusammenkommen wollen.
Ferner, mein Bruder, ist es schwierig für uns einer dem anderen Briefe zu schreiben. So lege ich es in Euere Hände, an die anderen Kapiteine bekannt zu geben, was meine Gedanken sind. Ich erwarte eine beschleunigte Antwort mit demselben Mann, Abraham Schyer, ob Du mein Anerbieten annimmst. Ich erwarte ferner schriftlich oder mündlich zu hören, wie es mit Euch dort geht, wir haben Nachrichten (Stories), aber nichts Gewisses, wie es mit Euch geht. Durch Gottes Güte blieb ich gesund und hoffe ich, gleiches von Euch zu hören.
Ich schließe damit meinen Brief und wünsche Euer Edlen bald wiederzusehen.
Mit herzlichen Grüßen verbleibe ich Euer Freund und Mit-Kapitein
(gez.) Willem Christian.
[S. 154] Aus diesem Wortlaut geht hervor, daß der Verfasser sich bemüht hat, der Sache einen so harmlosen Anstrich wie nur möglich zu geben, daß jedoch dessen gegen die deutsche Regierung gerichtete Spitze zwischen den Zeilen zu lesen ist. Auch die vier übrigen Kapitäne des Namalandes suchten die aufrührerischen Kapitäne in die Bewegung mit hineinzuziehen. Dieser Versuch scheiterte indessen an der Vertragstreue Witboois, der seine Gewehre anstandslos hatte stempeln lassen. Denn die Kapitäne von Gochas und von Koes waren gewöhnt, den Spuren Witboois blindlings zu folgen, während derjenige von Bersaba, Christian Goliath, intelligent genug war, den Zweck der Gewehrstempelung selbst einzusehen.
Trotz des moralischen Rückschlages, den die aufrührerische Bewegung durch diesen Mangel an Teilnahme in dem übrigen Namalande erlitten hatte, schien doch die Gefahr des Ausbruchs ernsterer Feindseligkeiten immer näherzurücken. Dies veranlaßte mich, mit dem in Windhuk stehenden Teil der Feldtruppe (1. Feldkompagnie und Feldbatterie) am 30. September 1898 persönlich nach dem Schauplatz der Unruhen abzumarschieren. Die in Staffeln vorrückende Truppe vereinigte sich ohne Zwischenfall am 5. Oktober mit dem Stab in Gibeon, wo Kapitän Witbooi uns an der Spitze von 50 Reitern feierlichst einholte. Auch der Kapitän von Bethanien, Paul Frederiks, hatte, durch das böse Gewissen getrieben, sich eingefunden. Ebenso war der Bezirksamtmann von Keetmanshoop, Dr. Golinelli, der Truppe dorthin entgegengekommen. So konnte hier die Untersuchung gleich eingeleitet, in Ermanglung des zweiten Mitschuldigen, des Kapitäns der Bondelzwarts, aber nicht zu Ende geführt werden. Dies geschah erst in Keetmanshoop. Nach der ersten Unterredung mit dem Bethanierkapitän, in der ich diesem an der Hand des Schutzvertrages das Unzulässige von politischen Verhandlungen der Kapitäne untereinander nachgewiesen hatte, tat Witbooi den charakteristischen Ausspruch: »Diese Kapitäne haben nicht gewußt, was sie unterschrieben haben; ich aber habe es gewußt, und darum habe ich vorher geschossen«.
Von Gibeon ging es wieder in Staffeln nach Keetmanshoop, wo am 16. Oktober sowohl die Truppe wie die sämtlichen Kapitäne des Namalandes, mit Ausnahme desjenigen der Bondelzwarts, vereinigt waren. Unterwegs hatte ich der Diamantenmine Mukurop im Bersabaer Gebiet einen Besuch abgestattet. Die diamanthaltige Blaugrunderde war vorhanden, Diamanten waren jedoch nicht gefunden. Dies ist auch bis zum heutigen Tage noch nicht geschehen, da die Gesellschaft aus Mangel an Betriebsmitteln die Arbeit vorzeitig hat einstellen müssen.
[S. 155] Endlich am 21. Oktober abends traf auch der Kapitän der Bondelzwarts, Wilhelm Christian, ein. Er war längst unterwegs gewesen; doch hatten ihn, je näher er an Keetmanshoop herankam, wie dies bei Eingeborenen vorkommt, wieder Furcht und Mißtrauen beschlichen. Er zögerte und verlangsamte seinen Marsch immer mehr. Erst der auf meine Veranlassung ihm entgegenreitende Unterkapitän von Keetmanshoop, selbst ein Bondelzwart, hatte Wilhelm Christian zum Weitermarsch veranlassen können. Am 22. früh, dem Geburtstage Ihrer Majestät der Kaiserin, fand große Parade statt, bei der die vier treu gebliebenen Stämme als Mitwirkende, die zwei aufrührerischen aber als Zuschauer beteiligt waren.
Am Nachmittag des 22. war Versammlung der sechs Kapitäne. Sie erhielten hier von mir einen historischen Rückblick auf die Entwicklung der Schutzverträge und eine Klarlegung ihrer eigenen Stellung zur deutschen Regierung. Dann wurde unter dem Vorsitz des von Windhuk mitgekommenen Regierungsrates v. Lindequist aus den vier unbeteiligten Kapitänen ein Gericht zusammengesetzt, das über Schuld und Sühne zu beschließen hatte. Nach zweitägiger Beratung wurden die beiden angeklagten Kapitäne der Verletzung der Schutzverträge für schuldig befunden und zur Tragung der Kosten der durch ihr Verhalten veranlaßten Expedition, der Kapitän von Bethanien außerdem zur Abtretung eines am unteren Orange für Regierungszwecke günstig gelegenen Stückes Land verurteilt. Da bei den Hottentotten an Geld und Geldeswert nur wenig zu holen ist, entledigten sich die beiden Kapitäne der Abtragung der Expeditionskosten durch Landabtretung. Wilhelm Christian trat den Platz Keetmanshoop mit dem dazu gehörigen Weideland, einschließlich des Pferdepostens Kabus, an die Regierung ab, Paul Frederiks 15 ha Gartenland am Platze Bethanien selbst, das jedoch später als nicht wertvoll genug erkannt und daher gegen zwei besonders günstige Bedingungen bietende Farmen umgetauscht worden ist.
Unter den so erlangten Zugeständnissen war die Abtretung von Keetmanshoop für uns die wertvollste. Ich habe bereits im Kapitel I erwähnt, wie dieser ursprünglich unter einem eigenen Kapitän stehende Platz 1889 von Wilhelm Christian annektiert worden ist. Nach seinem Übergang an die Regierung war dieser wichtigste Platz des Südens, zugleich Sitz der Regierung, dem Machtbereich eines eingeborenen Kapitäns dauernd entzogen. Der dortige Stamm der Swartmodder-Hottentotten, losgelöst von der Oberherrschaft der Bondelzwarts, ist denn auch bei dem Aufstande der letzteren 1903 bis zum heutigen Tage auf seiten der Regierung geblieben.
[S. 156] Um auch in Bethanien deutsche Macht zu zeigen und dem Kapitän die Entrichtung der auferlegten Buße seinen Untertanen gegenüber zu erleichtern, setzte sich die Truppe Anfang November 1898 nach dort in Marsch. Außerdem war aus Bethanien in Verbindung mit den Wirren ein Waffen- und Munitionsschmuggel bekannt geworden. Als Beweis, welche Übertreibungen im Schutzgebiet die sogenannten »Stories« mit sich zu bringen pflegen, führe ich an, daß fraglicher Munitionsschmuggel dem Bezirksamt als Schmuggel eines Wagens voll Gewehre und Munition gemeldet worden war, daß aber die jetzt eingeleitete Untersuchung diese Meldung auf ein Gewehr und 20 Patronen zusammenschrumpfen ließ. Der Schuldige wurde zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt, die ich ihm jedoch erließ, da die Wegnahme des teuer bezahlten Gewehres nebst Munition als ausreichende Strafe erschien.
Mitte des Jahres 1899 kamen Nachrichten nach Windhuk, daß der im Osten des Schutzgebietes lebende Stamm des Hererohäuptlings Tjetjo bei der Gewehrstempelung gleichfalls Schwierigkeiten mache. Auch sonst zeige der Stamm Neigung zur Unbotmäßigkeit. Diese Nachrichten führten zu einer Expedition nach dem Distrikt Gobabis, die von der in Windhuk garnisonierenden Truppe am 25. August 1899 angetreten wurde. Am 3. September war Gobabis erreicht. Vom bösen Gewissen getrieben, fanden sich auch bald Tjetjo und dessen Sohn Traugott ein, um durch freiwillige Empfangnahme der Strafe dem ihnen unbequemen Zug der Truppe in ihre Werften vorzubeugen. Diesen zu unterlassen, lag jedoch nicht in meinem Sinn. Infolgedessen wurden beide mit einer Strafpredigt entlassen und angewiesen, meinen Besuch bei sich abzuwarten. Das friedliche Entgegenkommen der Unbotmäßigen hatten wir vor allem dem Umstand zu verdanken, daß auf unserer Seite der Oberhäuptling Samuel mit 40 seiner Leute sich am Zuge beteiligt hatte.

Am 11. September erfolgte der Abmarsch von Gobabis den starkfließenden Schwarzen Nosob aufwärts und am 13. das Eintreffen vor der Werft des Häuptlings Tjetjo, Gefechtsaufmarsch und dann Einreiten in die Werft, wobei mich neben dem Adjutanten (Böttlin) auch der Oberhäuptling Samuel begleitete. Dieses Mitreiten Samuels konnte als ein unbedingt friedliches Zeichen aufgefaßt werden, andernfalls würde er sein Mißtrauen zu erkennen gegeben haben. Tjetjo saß auch ganz friedlich in seiner Werft,[S. 159] sein Sohn Traugott dagegen mit seinen Leuten, anscheinend schußbereit, seitwärts im Busch. Doch auch dieser kam jetzt zur Begrüßung herbei. Die vorgenommene Untersuchung ergab, daß die treibende Kraft bei der aufrührerischen Bewegung Traugott gewesen war, sein Vater dagegen lediglich der Getriebene. Letzterer kam daher mit einer Strafpredigt und nachträglicher Einlieferung seiner Gewehre behufs Abstempelung davon. Traugott dagegen, der eine zwei Stunden weiter entfernte eigene Werft bewohnte, wurde zwei Tage später in dieser aufgesucht und ihm die Wahl zwischen Gefecht und freiwilliger Abgabe seiner Gewehre gelassen. Traugott zog das letztere vor und lieferte rund 60 gute Hinterlader ab.[32]
Somit würde diese Expedition zur allgemeinen Zufriedenheit verlaufen sein, wenn nicht das unbegreifliche Handeln eines Offiziers das Bild getrübt und auch Südwestafrika mit einem Eingeborenenexzeß belastet hätte, womit es seit seinem Bestehen bis jetzt verschont geblieben war. Es war dies der sattsam bekannte Fall des Leutnants Prinz von Arenberg. Dieser Offizier stand à la suite der Schutztruppe und leistete bei ihr zur Zeit freiwillig aktiven Dienst, um sich Kenntnisse über Land und Leute zu erwerben. In Erfüllung seines Wunsches hatte ich ihn zunächst nach Osten gesendet und dem damaligen Distriktschef Leutnant Reiß[33] zur beliebigen Verwendung zur Verfügung gestellt. Dieser setzte ihn als Chef der Grenzstation Epukiro ein.
Nach Beendigung der Ostexpedition befahl ich dem Leutnant Prinz von Arenberg, mit der Truppe nach Windhuk zurückzugehen, um nunmehr auch andere Teile des Schutzgebietes kennen zu lernen. Der Prinz bat jedoch, noch vier Wochen im Distrikt bleiben zu dürfen, da er einem größeren Schmuggel auf der Spur sei. Da ein solcher gerade im Distrikt Gobabis nicht ausgeschlossen erschien, wurde die Bitte bewilligt, und die Truppe marschierte am 25. September ohne ihn ab. Am 27. September kam der Leutnant Prinz von Arenberg nach Lehmwater nachgeritten und meldete die durch ihn vollzogene Bestrafung des Herero-Bastards Willi Kain wegen Hochverrats mit dem Tode. Die Meldung wurde anscheinend in der aufrichtigen Überzeugung vorgetragen, sich um das Deutsche Reich[S. 160] ganz besondere Verdienste erworben zu haben. Zur Untersuchung des Falles marschierte ich mit der Truppe nach Gobabis zurück. Nachdem die Untersuchung beendet war, wurde der abermalige Rückmarsch nach Windhuk angetreten, aber diesmal auf dem nördlichen Wege mitten durch das Hereroland, wobei auch Tjetjos Werft noch einmal berührt wurde. Der Zweck dieser Abänderung der Marschroute war, eine im Hererolande etwa auftretende Erregung über den Fall Kain niederzuhalten. Indessen ergab sich, daß von einer solchen nirgends die Rede gewesen war. Die Truppe rückte am 19. Oktober ohne Zwischenfall wieder in Windhuk ein.
Im übrigen sind die Einzelheiten des Falles »Arenberg« bekannt genug, so daß ich hier über sie hinweggehen kann. Die Untersuchung hat ergeben, daß die Gefahren, von denen sich der Leutnant Prinz von Arenberg in dem Augenblick seines Handelns bedroht geglaubt hat, nur in seiner Phantasie bestanden hatten. Er wurde für sein Vergehen in der Heimat zum Tode verurteilt, dann zu fünfzehnjähriger Freiheitsstrafe begnadigt, später aber für geistig nicht normal erklärt und aus dem Gefängnis in eine Anstalt für Geisteskranke überführt.
Bei dem Marsch durch das Osthereroland, das ich seit der Rinderpest nicht mehr gesehen hatte, trat unverkennbar zutage, wie sehr die Seuche nicht nur die Herden, sondern durch ihre Begleiterscheinungen auch das Volk der Hereros dezimiert hatte. Der Rinderpest war nämlich s. Zt. unmittelbar der Typhus gefolgt, der unter Weißen wie Eingeborenen aufräumte, unter den letzteren jedoch ungleich mehr. Die Eingeborenen zeigten sich durchaus widerstandsunfähig und starben in großer Anzahl. Das sonst so volk- und namentlich viehreiche Land war beinahe ganz leer geworden.
Nicht im Zusammenhang mit der Ostexpedition stehend, aber hier zu erwähnen ist noch die während des Rückmarsches der Truppe erfolgte Ermordung zweier Weißer durch Hottentotten und Buschmänner bei Kowas im Bezirk Windhuk. Namentlich durch die damals gerade zur Übung eingezogenen Bastards unter dem Leutnant v. Schönau wurden die Räuber verfolgt und entweder niedergeschossen oder gefangen genommen und gerichtlich abgeurteilt. Als Ursache des Mordes hatte sich ergeben, daß die Eingeborenen glaubten, sich auf diese Weise am zweckmäßigsten ihrer Schulden an die betreffenden Weißen entledigen zu können.
Da ich seit Gründung des Nordbezirks 1896 das Nordhereroland nicht mehr gesehen hatte, beschloß ich jetzt eine erneute Expedition nach Outjo[S. 161]-Grootfontein. Die eigentümliche Stellung des Gouverneurs als Oberherr von Völkerschaften, die nicht unter Anwendung von Gewalt unterworfen waren, sondern ihn freiwillig als solchen anerkannt hatten, bedingte sein häufiges Erscheinen bei den Häuptlingen. Er mußte fortgesetzt Fühlung mit diesen halten und überall persönlich nach dem Rechten sehen. War der Gouverneur doch für den Schutz der unter den Eingeborenen lebenden Weißen bei seinen geringen Machtmitteln sehr auf die Mitwirkung der Häuptlinge angewiesen.
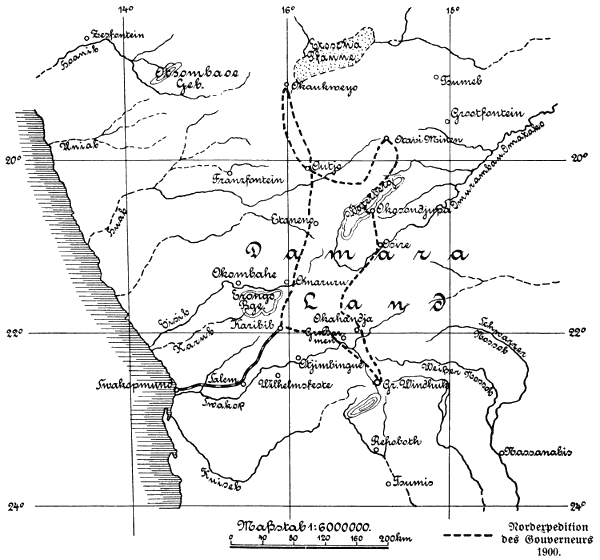
Wie gewöhnlich bei meinen Zügen durchs Hereroland, nahm der Oberhäuptling mit 50 seiner Leute an der Expedition teil. Umsomehr konnte diese[S. 162] als reiner Friedensmarsch ausgeführt werden. Um jedoch das Angenehme mit dem Nützlichen zu vereinigen, wurde sie mit einer großen Felddienstübung verbunden, bei der die Feldtruppe von Windhuk einschließlich der verbündeten Hereros die eine Partei, die 4. Feldkompagnie in Outjo und die aus Omaruru herangezogene 2. Feldkompagnie die andere Partei bildeten. Es war dies ein Manöverfeld, wie wenn in Deutschland etwa die Garnison von Karlsruhe i. B. gegen diejenige von Königsberg operieren würde.
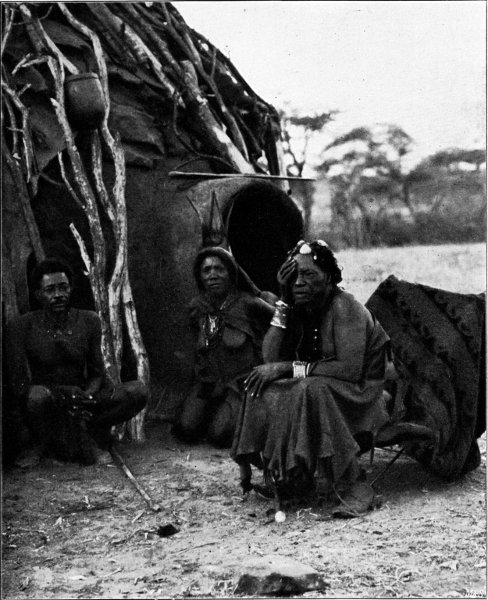
[S. 163] Die Expedition wurde am 3. Oktober 1900 angetreten und dauerte bis Ende Dezember. In Waterberg konnte ich jetzt zum letztenmal den alten Häuptling Kambazembi begrüßen, der vollständig erblindet war. Der Streit um die Nachfolge zwischen seinen beiden Söhnen David und Salatiel warf seine Schatten bereits voraus. Nach dem etwa zwei Jahre später erfolgten Tode Kambazembis einigten sich schließlich die Brüder dahin, daß David Platzkapitän von Waterberg wurde, Salatiel die sonstige Herrschaft zufiel. Der erstere, ein Günstling des Oberhäuptlings, hat sich später an dem allgemeinen Aufstand beteiligt, der letztere erst, nachdem er selbst angegriffen worden war. Wäre eine richtige Ausnutzung dieses Zwiespaltes möglich gewesen, so hätten wir daher vielleicht beim Beginn des Aufstandes auf Bundesgenossen auch aus den Reihen der Aufständischen rechnen können.

Ein weiteres politisches Ereignis der Expedition war ein drohender Zusammenstoß mit dem Ovambohäuptling Negumbo, über den das Nähere im nächsten Kapitel folgen wird. Ferner erschien der Kapitän der Topnaars aus Zesfontein und wünschte Gewehre und Munition, um sich gegen die zum Zwecke von räuberischen Jagdzügen fortgesetzt den Kunene überschreitenden Portugiesen zu wehren. Dies wurde unter dem Hinweis auf seine Beteiligung an dem Swartbooiaufstande abgeschlagen, ihm dagegen die Einrichtung einer Station in Zesfontein in Aussicht gestellt. Letzteres geschah[S. 164] auch drei Monate später; erster Distriktschef war Oberleutnant Schultze,[34] der dann auch den bisher von portugiesischer Seite betriebenen Raubjagden ein Ende setzte.
Die »Felddienstübung« verlief völlig programmäßig und insofern viel kriegsgemäßer als in Europa, weil in Südwestafrika die Rücksicht auf Flurschäden fortfällt. Weit vorausgeschickte Reiterpatrouillen gewannen bereits in der Gegend von Naidaos Fühlung miteinander. Patrouillenführer auf Windhuker Seite war der als Vizefeldwebel der Reserve eingezogene, uns noch vom Feldzuge 1896 her bekannte Kaufmann Gustav Voigts. Es war interessant, zu sehen, wie infolge der Kriegserfahrung und Landeskenntnis des Führers die Überlegenheit in der Aufklärung entschieden auf Windhuker Seite blieb, bis auf der andern Seite in dem Leutnant v. Wöllwarth[35] ein ebenbürtiger Gegenführer auftrat. Von da ab hielt sich die Aufklärung auf beiden Seiten die Wage. Bei Khauas, östlich Outjo, kam es dann am 10. November zum Zusammenstoß, bei dem sich die verbündeten Herero den Platzpatronen gegenüber durch große Tapferkeit auszeichneten. Damit war dann das Manöver beendet.

Vom 17. bis 24. November schob ich eine Fahrt nach Okaukuejo ein, einem wichtigen Straßenknotenpunkt westlich der Etoschapfanne, der zur Anlage einer Grenzstation gegen die Ovambos in Aussicht genommen war. Mit dieser Fahrt wurde auch ein Besuch der Etoschapfanne verbunden, eines[S. 165] in dieser Jahreszeit trockenen Salzsees, der sich bei Sonnenschein wie ein Schneefeld, bei bewölktem Himmel wie ein Meer ausnahm. In meiner Begleitung befanden sich 20 Reiter der Station Outjo unter dem Kompagniechef und zugleich Bezirksamtmann Hauptmann Kliefoth.[36] Auffällig war, daß jeden Abend auf der Höhe unseres Lagerplatzes am Horizonte Feuer aufflackerte, aus dem wir auf das Vorhandensein von uns anscheinend beobachtenden Spionen des Häuptlings Negumbo schlossen.


Auf dem Rückmarsch nach Windhuk konnte ich in Omaruru zum erstenmal den Häuptling Michael begrüßen, den Nachfolger seines inzwischen[S. 166] verstorbenen Vaters Manasse, wobei die üblichen Ermahnungen und Gelöbnisse ausgetauscht wurden. Der junge Häuptling machte im ganzen einen gesetzten und würdigen Eindruck. Von hier marschierte die Truppe direkt nach Windhuk zurück, während der Oberhäuptling Samuel mich noch bis Karibib, dem damaligen Endpunkte der Bahn, begleitete. Hier hatte der Oberhäuptling Gelegenheit, mit mir das mittlerweile entstandene Städtchen zu bewundern, dies an einem Platze, den wir bei dem gemeinsamen Zuge vor fünf Jahren noch vollständig leer gesehen hatten. Nach Befahrung der Bahn bis zur Bauspitze — etwa 20 km östlich Karibib — und Besichtigung des Unterbaues, der wieder bereits 14 km weiter vorgetrieben war, erfolgte dann die Rückkehr nach Windhuk.

Auch jetzt sollte die Truppe hier nicht lange Ruhe haben. Anfang Februar 1901 kam es wieder zum ernsten Schießen, und zwar an einem Orte, an dem wir es zu allerletzt erwartet hätten, nämlich bei den zum Bezirk Gibeon gehörigen Bastards von Grootfontein.
Auch dieser Aufstand entsprang dem so leicht erregbaren Mißtrauen der Eingeborenen gegen Maßnahmen von unserer Seite. Wie bereits erwähnt, war mittels eines 1895 abgeschlossenen besonderen Vertrages die militärische Ausbildung der wehrfähigen Rehobother Bastards mit der Verpflichtung zur Heeresfolge vereinbart worden. Der Vertrag war 1896 auch auf den kleinen Zweig der Bastards ausgedehnt worden, der sich in Grootfontein (südlich) niedergelassen hatte. Diese Grootfonteiner Bastards hatten alle Veranlassung, der Regierung dankbar zu sein. Sie hatten sich während der Witbooiunruhen in ihrem allzu nahe bei der Naukluft gelegenen Wohnsitz nicht mehr sicher gefühlt, ihn aufgegeben und sich in das Bethaniergebiet zurückgezogen. Etwa Waffenhilfe gegen den Eindringling zu leisten, daran dachten sie nicht im entferntesten. Als Landeskenner würden sie im Naukluftfeldzuge sehr von Nutzen gewesen sein.
Trotzdem setzte sie die Regierung nach Beendigung des Witbooikrieges wieder in den Besitz ihres bisherigen Wohnplatzes Grootfontein, wo sie als[S. 167] gute Viehzüchter bald, wie vordem, stattliche Wollschafherden auf die Weide führen konnten. Als Gegenleistung hatten sie lediglich ihre wehrfähige Mannschaft unter denselben Bedingungen wie die Rehobother Bastards der Regierung zur Verfügung zu stellen.
Zu den Mobilmachungsvorarbeiten gehört bekanntlich auch die Lösung der Pferdefrage. Hierzu war die Feststellung erforderlich, inwieweit die Eingeborenenstämme, die zur Heeresfolge verpflichtet waren, mithin die Witboois, die Rehobother und die Grootfonteiner Bastards, in der Lage sein würden, sich selbst beritten zu machen. Während die zu diesem Zwecke erforderlichen Erhebungen bei den beiden erstgenannten Stämmen anstandslos vor sich gingen, widersetzten sich die Grootfonteiner Bastards, angeblich, weil sie befürchteten, es handele sich um Wegnahme ihrer Pferde — dieselbe Befürchtung, wie wir sie an anderer Stelle bei der Gewehrstempelungsfrage haben zutage treten sehen. Bei der Beurteilung dieser Widersetzlichkeit muß indessen berücksichtigt werden, daß den Witboois und den Rehobother Bastards ihre derzeitigen Verwaltungsbeamten (v. Burgsdorff, Oberleutnant Böttlin) genau bekannt waren und ihr Vertrauen besaßen, daß dagegen der Distriktschef der Bastards von Grootfontein, Leutnant v. Lekow,[37] erst neuernannt und daher noch nicht in der Lage gewesen war, sich dieses Vertrauen zu erwerben. Es ist das die alte Geschichte von der Wichtigkeit der Personalfrage in den Kolonien. Ob Leutnant v. Lekow, ein ruhiger und vornehmer Charakter, durch eine andere Art des Auftretens den Aufstand hätte verhindern können, wie damals in einem Teile der heimatlichen Presse behauptet worden ist, ließe sich nur an Ort und Stelle beurteilen. Aus dem äußeren Hergang der Sache zu schließen, muß die Schuld fraglos den Bastards zugeschrieben werden. Der Verlauf war folgender:
Als der Distriktschef Leutnant v. Lekow in Begleitung von nur zwei eingeborenen Soldaten zur Feststellung des Pferdebestandes der Bastards erschien, widersetzte sich der Kapitän Claß Swart, mit der Waffe drohend, und verweigerte dann die Abgabe der Waffen, als nunmehr der Distriktschef sie verlangte. Dieses Verlangen kann allerdings nicht als zweckmäßig bezeichnet werden, da dem Leutnant v. Lekow zu dessen Durchsetzung keinerlei Machtmittel zur Seite standen. Der Kapitän hatte zwölf, der Distriktschef zwei Gewehre zur Stelle, und letztere waren nicht einmal geladen.
Als dann der Distriktschef mit verstärkten Machtmitteln zurückkehrte, wurde er ohne weiteres mit Schüssen empfangen. Ein Versuch des Kapitäns Swart, bei seinen Nachbarn, den Rehobother Bastards und den Bethanier Hottentotten, Hilfe zu erlangen, schlug dagegen fehl. Nur einige gerade zum Besuch anwesende Rehobother Bastards, darunter bedauerlicherweise auch ausgebildete Soldaten, trieb das Verwandtschaftsgefühl so weit, sich dem Aufstande anzuschließen. So blieben die Aufständischen auf ein kleines Häufchen von 20 bis 25 Gewehren beschränkt, denen Leutnant v. Lekow aus seinem Distrikt nur etwa 15 Bewaffnete, meist ausgebildete Witbooisoldaten, entgegenzusetzen hatte. Es folgte nun ein seitens des Leutnants v. Lekow mit außerordentlicher Energie geführter Kriegszug, bei dem es zu zwei größeren Zusammenstößen kam. Die Aufständischen sahen sich schließlich zur Übergabe bewogen, noch bevor die von Windhuk heranbeorderten Verstärkungen sowie die aus Gibeon im Anmarsch befindlichen Witboois auf dem Schauplatze der Unruhen eingetroffen waren. Bezeichnenderweise aber erfolgte diese Übergabe nicht an den Distriktschef, sondern an eine Abteilung Witboois. Die Verluste betrugen auf unserer Seite: tot ein weißer Reiter (Reer) und ein Witbooisoldat, auf seiten der Aufständischen: der Kapitän und drei seiner Leute.

Am 14. März fand Kriegsgericht über die Gefangenen in Rehoboth statt, zu welchem Zweck ich mich selbst dorthin begeben hatte. Es standen im ganzen 22 Angeklagte vor Gericht, zu dem als Richter auch Bastards von Rehoboth hinzugezogen worden waren. Von den Angeklagten wurden[S. 169] 3 zum Tode, die übrigen zu Gefängnisstrafen von 1–10 Jahren mit Zwangsarbeit verurteilt; sieben wurden freigesprochen. Die zum Tode Verurteilten waren ausgebildete Bastardsoldaten, die nachweislich auf deutsche Soldaten geschossen hatten. Mit Rücksicht auf die sehr entwickelten verwandtschaftlichen Beziehungen des Bastardvolkes begnadigte ich jedoch auch sie zu 10 Jahren Kettenhaft, jedoch unter Ausstoßung aus dem Soldatenstande. Letzteres geschah öffentlich angesichts des Volkes von Rehoboth sowie der Bastardsoldaten, die, soweit man ihrer habhaft werden konnte, rasch eingezogen und eingekleidet worden waren.[38] Die Gefangenen wurden sämtlich nach Windhuk überführt, wo in der Folge nach Ausbruch des Hereroaufstandes 1904 die letzten von ihnen begnadigt worden sind. Wie bekannt, haben die Bastards während des Aufstandes bis zum heutigen Tage treu auf unserer Seite ausgehalten.
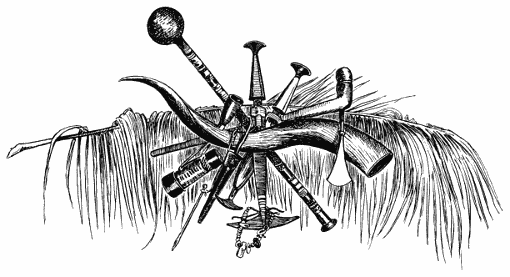

Soviel aus den dürftigen Nachrichten hervorgeht, die bis jetzt, namentlich von Missionsseite, zu uns gekommen sind, wohnen auf deutschem Gebiet, vom Kunene bis zum Okawango, zum Teil auch von der Grenze selbst durchschnitten, folgende Ovambostämme:
1. die Uukualuitsis, Stärke nicht zu schätzen, Regierungsform unbekannt, keine Mission;
2. die Ongandjeras, unter einem gemeinsamen Häuptling stehend, Stärke unbekannt. Nördlich davon befinden sich:
3. die Ombarantus (von anderer Seite auch Ovambandje genannt), Stärke 60000 bis 80000 Köpfe, in mehrere kleine Häuptlingsschaften zerfallend, ob unter einem gemeinsamen Oberhäuptling, ist nicht bekannt. Das Stammesgebiet ist wahrscheinlich durch die deutsch-portugiesische Grenze zerschnitten;
4. die Uukuambis unter Häuptling Negumbo, Stärke 50000 bis 60000 Menschen. Alle drei ohne Mission;
5. die Ondongas, in zwei Stämme unter dem Häuptling Kambonde und Nechale zerfallend. Stärke jedes Stammes etwa 20000 Menschen. Zwei Missionsstationen (Finnische). Nördlich davon
6. die Uukuanjamas unter einem gemeinsamen, von sämtlichen Unterhäuptlingen anerkannten Oberhäuptling. Bis vor etwa einem Jahre war dies Uejulu, jetzt Nande. Stärke 70000 bis 80000 Menschen. Das Stammesgebiet wird durch die Grenze derart durchschnitten, daß der weitaus größere Teil in das portugiesische Gebiet fällt. Zwei Missionsstationen (Rheinische). Östlich von diesem Stamm folgen dann noch:
7. die Ovakvimas (nach Missionsangabe) unter einem Häuptling. Stärke 5000 bis 6000 Menschen. Ob das Stammesgebiet diesseits oder jenseits der Grenze fällt, oder von dieser durchschnitten wird, ist ungewiß. Gleichfalls nach Missionsangabe wohnen noch nordöstlich von diesem Stamm
8. die Ovambuela, wahrscheinlich ganz in das portugiesische Gebiet fallend.

Von da bis zum Okawango scheinen keine Ovambostämme mehr zu wohnen, vielmehr das Land lediglich den Buschmännern überlassen zu sein. Die am Okawango wohnenden Stämme leben auf portugiesischem Gebiet und kommen daher für uns nur indirekt in Betracht. Wir werden ihnen später noch begegnen.
Von den vorstehend genannten Ovambostämmen sind wir bis jetzt lediglich mit den Uukuambis (4.), den Uukuanjamas (6) und vor allem den beiden Ondongastämmen (5) in Beziehungen gekommen. Daß die deutsch-portugiesische[S. 172] Grenze so vielfach Stammesgebiete durchschneidet, kann natürlich nicht als ein günstiger Zustand angesehen werden. Diese Trennung erleichtert besonders den unter den Ovambos lebhaft betriebenen Waffen- und Sklavenhandel.
Einer Regelung werden auch die Verhältnisse bei den im Okawangotal wohnenden Stämme bedürfen, sobald wir mit einer Besiedlung des Südufers des Flusses beginnen, das in unser Gebiet fällt. Die auf dem Nordufer wohnenden Ovambostämme beanspruchen gleichfalls Besitzrechte auf dem anderen Flußufer, während es eine portugiesische Regierungsgewalt auch dort nicht gibt.
Bis jetzt hatte die Brücke zu den Ovambos lediglich die Mission gebildet, und zwar im Westen die finnische sowie die rheinische (deutsch), im Osten die katholisch-deutsche Mission. Weitere Beziehungen bestanden nur darin, daß ab und zu seitens der Ovambos ein Händler schlecht behandelt wurde, oder daß seitens unserer Eingeborenen einmal einem durchpassierenden Ovambo Pferde und Waffen weggenommen worden sind, oder endlich, daß Munitions- und Schnapshandel über die Grenze gemeldet wurde. Entweder folgten dann Klagen beim Gouvernement, die einen durch Vermittlung der Mission geführten Briefwechsel mit dem betreffenden Ovambohäuptling zur Folge hatten, oder aber diplomatische Verhandlungen zwischen Berlin und Lissabon. In beiden Fällen wurde selten ein befriedigender Abschluß erzielt, vielmehr endigte die Sache meist in einer endlosen Verschleppung. Ich selbst bin so während meiner Amtszeit nacheinander mit den Häuptlingen Kambonde, Nechale, Uejulu und Negumbo in Briefwechsel gekommen.
Zum erstenmal geschah dies während des Nordzuges im Jahre 1895. Kurz vorher war die Nachricht von der Niederwerfung Witboois zu den Ovambohäuptlingen gedrungen und hatte diese in nervöse Stimmung versetzt, die sich mit der jetzt kommenden Nachricht von dem Anmarsch einer stärkeren deutschen Truppe nach dem Norden noch steigerte. Durch den Vertreter der South-West-Africa-Company, Herrn Dr. Hartmann, der fortgesetzt Beziehungen zu den Ovambohäuptlingen unterhielt, kam es zu meiner Kenntnis, daß diese Kriegsvorbereitungen träfen. Um die Truppe nicht in den Verdacht geraten zu lassen, sie hätte einen geplanten Besuch in dem Ovambolande aus Furcht unterlassen, schrieb ich an den nächstwohnenden Häuptling, den sonst als friedfertig bekannten Kambonde, ich hätte aus Mangel an Zeit dieses Mal bedauerlicherweise nicht die Möglichkeit eines Besuches bei ihm ins[S. 173] Auge fassen können. Im übrigen versicherte ich ihn meiner friedlichen Gesinnung. Durch Vermittlung des Missionars Rautanen erhielt ich einige Monate später in Windhuk die Antwort, dahin lautend, daß alles, was ich geschrieben hätte, sehr schön sei, daß aber er, Kambonde, doch wünschte, mich in seinem ganzen Leben nicht zu sehen. Denn die Deutschen kämen mit freundlichen Worten, wenn sie aber da seien, wollten sie regieren, und regieren könne er allein. Das war gewiß deutlich, schadete aber weiter nichts, da ein Übergreifen unserseits auf das Ovamboland vor dem unzweifelhaften Feststehen unserer Herrschaft im Hererolande und im Namalande ein Fehler gewesen wäre und daher in absehbarer Zeit nicht zu erwarten war.
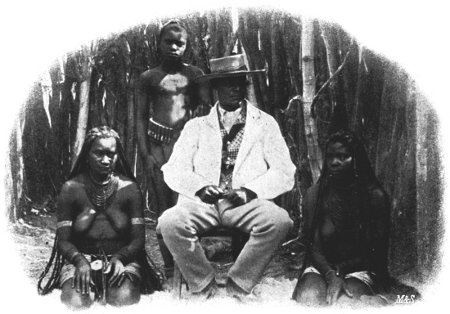
Seitdem schliefen die Beziehungen zu den Ovambos so ziemlich wieder ein, bis einer der Bezirksamtmänner von Outjo, Oberleutnant Franke, im Jahre 1900 einen Besuch bei den Häuptlingen Kambonde und Uejulu unternahm und ihn bis zu dem portugiesischen Fort Humbe ausdehnte. Seine Aufnahme bei den beiden Häuptlingen war eine durchaus freundliche, ebenso anscheinend auch bei dem portugiesischen Kommandanten im Fort Humbe. Doch erfolgte später aus Anlaß dieses Besuches eine Beschwerde in Berlin wegen Grenzverletzung durch deutsche Soldaten. Infolgedessen wurde der Besuch portugiesischen Gebietes den Angehörigen der Schutztruppe in Uniform[S. 174] von nun ab untersagt. Die nächsten Besuche deutscher Offiziere im Ovambolande, und zwar des Leutnants Schultze, des Hauptmanns Kliefoth und des Leutnants Sixt von Armin, sämtlich im Nordbezirk stationiert, beschränkten sich daher auf das deutsche Gebiet, soweit nicht schon ein Besuch bei dem Häuptling Uejulu als ein Überschreiten der in jener Gegend noch nicht festgelegten portugiesischen Grenze betrachtet werden muß. Das Land dieses Häuptlings liegt zum Teil auf deutscher Seite, sein persönlicher Wohnsitz indessen wohl auf portugiesischem Gebiet.

Besonders Bemerkenswertes bot der Zug des Hauptmanns Kliefoth Ende 1901, weil es dabei fast zu einem kriegerischen Zusammenstoß gekommen wäre. Bei der Schilderung des im Jahre 1900 stattgehabten Zuges der Truppe nach den Nordbezirken (Kapitel IV) habe ich bereits einen politischen Zwischenfall im Ovambolande erwähnt. Im Gebiete des Häuptlings Negumbo der Uukuambis waren zwei deutsche Händler beraubt worden und hatten ihr Leben nur durch eilige Flucht retten können. Sie erreichten[S. 175] mühsam die damalige nächste Grenzstation Outjo, wo gerade die Truppe eingetroffen war. Zufällig befand sich daselbst auf der Durchreise auch der bei dem Häuptling Kambonde stationierte Missionar Rautanen, so daß durch dessen und Kambondes Vermittlung Verbindung mit dem Häuptling Negumbo hergestellt werden konnte. Dieser erhielt die Aufforderung, bis zum 1. April 1902 eine Buße von bestimmter Höhe zu entrichten, widrigenfalls der Kriegsfall als gegeben angenommen würde. Der in meiner Begleitung befindliche Oberhäuptling Samuel wurde gleichfalls kriegerisch gestimmt und schrieb an Negumbo folgenden Brief:
Outjo, den 15. November 1900.
Mein Freund Negumbo!
Ich schreibe Dir einige Worte. Ich und mein Freund, der Gouverneur Leutwein, haben von Deinen Leuten und Deinem Stamm Böses gehört.
Und nun sage ich Dir, tue, was wir von Dir fordern, bezahle die 60 Ochsen für das Geschehene, 50 für die Händler und 10 für die Kleinen von dem Getöteten. Sonst kommen wir, Dich zu schießen, sonst aber werden wir Freunde bleiben. Genug.
Viele Grüße. Ich bin Samuel Maharero, Herr der Hereros.

Kambonde empfing für seine Vermittlung ein entsprechendes Geschenk. Die Antwort Negumbos erhielt ich am 1. Januar 1901 in Windhuk. Sie lautete dahin, daß er alles bezahlen wolle und daß ich daher nicht zu ihm zu kommen brauche. Da jedoch in der Folge die rechtzeitig eingegangene[S. 176] Buße dem Bezirksamtmann von Outjo, Hauptmann Kliefoth, in bezug auf Qualität zur Beanstandung Veranlassung gab, so beschloß dieser seinerseits im Monat Juni 1901 einen persönlichen Besuch bei dem Häuptling Negumbo und nahm hierzu 25 Reiter und ein Geschütz mit. In Negumbos Werft Omukuju angekommen, begegnete Hauptmann Kliefoth einer mächtigen Aufregung. Wie ein aufgerührter Ameisenhaufen wimmelten die Bewohner durcheinander und empfingen die Truppen mit drohenden Gebärden und mit Geschrei. Alle Versuche des Hauptmanns Kliefoth, sich Gehör zu verschaffen, mißlangen. Das Vergebliche weiterer Bemühungen einsehend, zog er in der Nacht wieder ab, da er mit Recht glaubte, die Verantwortung für die Entfesselung eines Ovambokrieges nicht auf sich nehmen zu sollen. Ein Telegramm meinerseits, das seinen Zug überhaupt untersagte, hatte ihn nicht mehr erreicht. Will man unzivilisierten Völkerschaften einen Besuch abstatten, so muß man entweder mit möglichst wenig Begleitern kommen, so daß die Wilden von dessen friedlichem Zweck im voraus überzeugt sind, oder man muß mit einer so starken Macht kommen, daß ihr gegenüber die Eingeborenen Feindseligkeiten überhaupt nicht wagen. Dies ist die Lehre, die auch dieser Zug wieder gegeben hat. 25 Mann und ein Geschütz waren zu einem friedlichen Zug zu viel, zu einem kriegerischen zu wenig. Im übrigen wurde später der Verdacht, daß die Unterhändler, die das Vieh bei Negumbo[S. 177] hatten in Empfang nehmen sollen, in gewinnsüchtiger Absicht Unterschlagungen und Umtausch vorgenommen hätten, infolge von deren Flucht über den Kunene als gerechtfertigt anerkannt. Hauptmann Kliefoth wurde daher angewiesen, die Sache auf sich beruhen zu lassen.

Der nächste Besuch bei den Ovambos erfolgte 1901, mithin kurze Zeit später, seitens des Dr. Hartmann, der als Vertreter der neugegründeten Otavi-Gesellschaft eine Eisenbahntrace durch das Ovamboland nach dem portugiesischen Hafen Port Alexander festlegen sollte. Auf seinen Wunsch hatte ich ihm den Adjutanten der Truppe, Oberleutnant v. Winkler, beigegeben, was ich um so lieber tat, als dadurch auch eine Bereicherung der Landeskenntnisse der Truppe zu erwarten war. Die Expedition ging von Otavi über die Werft der Häuptlinge Nechale, Kambonde und Uejulu über den Kunene nach Humbe und Port Alexander und von da nach Mossamedes. Der Oberleutnant v. Winkler kehrte jedoch bereits an den Kunenekatarakten wieder nach Windhuk zurück.
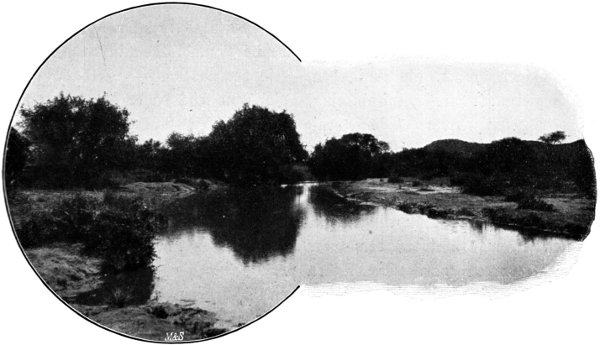
Als Nachwehen des Besuches durch Hauptmann Kliefoth bei Negumbo glaubte Dr. Hartmann noch Mißtrauen und Unruhe bei den Ovambo-Häuptlingen feststellen zu können, ein Umstand, der ihn bewog, das Gebiet des Häuptlings Negumbo zu meiden und für seine Eisenbahntrace lieber einen Umweg nach Norden in den Kauf zu nehmen. Dr. Hartmann hat[S. 178] seine Erlebnisse in einem interessanten Vortrag niedergelegt, auf den hiermit verwiesen sei.[39]
Den letzten friedlichen Zug bei den Westovambos unternahm ein Jahr später, d. i. Ende 1902, der Referent für Forst- und Landwirtschaft beim Gouvernement, Dr. Gerber, in Begleitung des Regierungsbaumeisters Laubschat aus Swakopmund. Die Ausbeute dieser Expedition lag, wie bei der Stellung des Expeditionsleiters naturgemäß, vorzüglich auf landwirtschaftlichem Gebiete, das in einem besonderen Abschnitt behandelt werden wird. Sie ging über die Werften von Nechale, Kambonde nach der des Häuptlings Uejulu, zugleich Missionsstation Ondjiva. Hier wurde Dr. Gerber zuerst als Privatmann freundlich empfangen, welche Freundlichkeit in das Gegenteil umzuschlagen drohte, als er in den — ja begründeten — Verdacht geriet, ein Regierungsvertreter, mithin ein »Spion« zu sein, da er als solcher nicht offen aufgetreten war. Ebensowenig Freundlichkeit brachte ihm später ein Besuch in Humbe ein. Nur der Anschluß an zwei zufällig getroffene portugiesische Offiziere ließ die Stimmung für ihn wieder etwas günstiger werden. Aus dieser Tatsache schloß Dr. Gerber mit Recht, daß der bisher als deutschfreundlich bekannte Häuptling Uejulu wieder in portugiesisches Fahrwasser geraten sei, was übrigens dem Gouvernement auch schon von anderer Seite gemeldet worden war. Die beiden portugiesischen Offiziere waren nichts anderes als eine Gesandtschaft an den Häuptling Uejulu, der sich angeblich bereit erklärt hatte, die portugiesische Flagge zu hissen und den Bau eines Forts in seinem Gebiet zu gestatten.
Von der Werft Uejulus durchquerte Dr. Gerber den Raum zwischen Kunene und Okawango, zog am Nordufer des letzteren Flusses abwärts und kehrte dann auf einem bereits von Oberleutnant Volkmann hergestellten Wege über Grootfontein nach Windhuk zurück. Sehr unterstützt wurde er auf seiner Reise durch einen ihm seitens der Truppe — als Zivilist — beigegebenen Unteroffizier Gaß.[40] Mit dem mächtigsten der auf dem Nordufer des Okawango lebenden Häuptlinge, dem alten Himarua, schloß Dr. Gerber aus eigenem Entschluß einen anscheinend vorteilhaften Vertrag wegen Aufnahme einer deutschen katholischen Mission, der jedoch für diese, wie wir noch sehen werden, sich in der Folge nicht als haltbar erwiesen hat.
Damit sind wir zu den Ostovambos gelangt, von denen kein Stamm auf deutschem Gebiet wohnt. Nur vereinzelte Werften finden wir in der Nähe der Mündungen des Ombungo- und des Löwen-Omuramba auf diesem. Indessen betrachten die Eingeborenen durchweg auch das südliche Flußufer als ihr Eigentum. Beziehungen zu diesen Ovambos hatten die Chefs des mittlerweile vom Nordbezirk losgelösten selbständigen Distrikts Grootfontein angeknüpft und aufrechterhalten. Es waren dies nacheinander Leutnant Eggers, Assistenzarzt Dr. Jodtka und hauptsächlich Oberleutnant Volkmann. Der erste Distriktschef von Grootfontein, Stabsarzt Dr. Kuhn, hatte mit Recht von einer so weitgreifenden Unternehmung abgesehen und sich besonders der Verbesserung der Gesundheitsverhältnisse des Platzes Grootfontein, um die er sich auch ein bleibendes Verdienst erworben hat, gewidmet. Der früher malariareiche Platz ist jetzt einer der gesundesten des Schutzgebietes geworden.
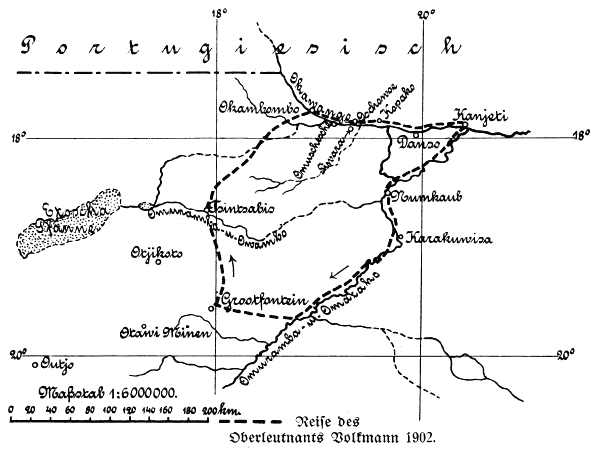
Die interessanteste Ausbeute von allen diesen verdienstvollen Reisen bot diejenige des Oberleutnants Volkmann von Ende Mai bis Anfang Juli 1902. Sie ging von Grootfontein auf bisher fast noch nicht begangenem[S. 180] Wege direkt nördlich über Tsintsabis, die Oberläufe des Löwen- und des Ombungo-Omuramba, nach dem Okawango, in dessen Tal die Expedition gegenüber der Werft des Häuptlings Himarua anlangte. Der Weg war mittels mühsamen Durchschlagens durch Wälder und dichtes Buschwerk hergestellt worden. Viel Hilfe hatten hierbei Buschmänner geleistet, jenes scheue Volk, dem bereits der Leutnant Eggers[41] Zutrauen zu der deutschen Regierung einzuflößen verstanden hatte. Der letztere, einer der sprachgewandtesten Offiziere, die ich je kennen gelernt habe, hatte sich sogar das Idiom dieser Buschmänner zu eigen gemacht. Letztere, als einzige Bewohner dieser Gegend, beschreibt Oberleutnant Volkmann in seinem Tagebuche folgendermaßen:
»Die Buschmänner, die fast unbekleidet sind, sind sehr empfindlich gegen Kälte usw. Morgens hat jeder Buschmann ein brennendes Holzscheit in der Hand, das dicht vor die Brust gehalten wird, die andere Hand liegt mit dicht an den Leib gepreßtem Oberarm auf der Schulter. Am Halteplatz wird das Holzscheit dann gleich zum Feueranmachen benutzt. Die Ausrüstung der Buschmänner ist recht ärmlich. Ein kleiner Lederschurz vorn und hinten ist die einzige Kleidung, an der Seite tragen sie ein Ledertäschchen, in dem sich bei wohlhabenden Buschmännern ein Messer, eine Tabakspfeife und eine Zündeldose befinden. Die in der Erde befindlichen Feldfrüchte werden mit einem zugespitzten Stock herausgeholt. Geht ein Buschmann als Führer vor dem Pferd, so springt er mit unglaublicher Schnelligkeit bald hierhin, bald dorthin, irgend eine Knolle oder Wurzel aus der Erde zu holen. Sehr beliebt sind auch verschiedene Beerenfrüchte, die an niedrigen Sträuchern wachsen. Von Baumfrüchten sind am beliebtesten die des Marulabaumes, des sogenannten Mandelbaumes, und zweitens Strychnosarten. Als Tabakspfeife wird alles mögliche benutzt: Kuduhörner, Kalebassen, ausgehöhlte Früchte des Strychnos, alte Patronenhülsen aus Metall usw. Am liebsten rauchen sie durch Wasser, das nie erneuert wird. Geht der Tabak aus, und das ist häufig der Fall, kochen sie Rinde eines Baumes in dem dickflüssigen Tabakswasser, trocknen dann die Rinde, die etwas Tabakgeschmack annimmt, und rauchen sie dann. Sehr gern rauchen sie Hanf.
Waffen hat auf dieser Reise kein Buschmann mit, wohl als Zeichen ihrer friedlichen Gesinnung, sonst führen sie Pfeil und Bogen, erstere aus Holz mit Eisenspitzen, die sie aus dem Ovamboland bekommen.«



Über die ethnographischen Verhältnisse unter den Ovambos am nördlichen Ufer des Okawango sagt Oberleutnant Volkmann, daß bis zur Einmündung des Fontein-Omuramba zwei größere Stämme zu unterscheiden seien. Der eine unter dem Häuptling Himarua habe seine Werften im Okawangotal bis unterhalb der Mündung des Ombuno-Omuramba, von da ab beginne die Machtsphäre des ehemaligen weiblichen Häuptlings Kapongo, der etwa vor zwei Jahren gestorben sei. An ihre Stelle traten dann deren drei Söhne, Karupu, Haussika und Nambaze, von denen der mittlere, Haussika, von seiner eigenen Werft Oschane aus eine Art Oberherrschaft über die andern auszuüben scheint, eine Herrschaft, die bis in die Gegend der Einmündung des Fontein-Omuramba anerkannt wird. Dann folgen nach Osten noch drei weitere Stämme, und zwar die Bomogandas, die Njangamas und die Diêbes (früher Andaras). Die Stärke der Stämme wird auf je 7000 bis 8000 Seelen geschätzt. Reiner Ovambostamm ist nur derjenige des Himarua, eines Eindringlings aus dem Ovamboland, von da ab sind die Stämme sehr mit Betschuanenblut gemischt, bis wir bei Andaras Werft einen fast reinen Betschuanenstamm finden. Die von Himarua und den Söhnen Kapongos[S. 184] beherrschten beiden westlichen Stämme werden Owakwangaris genannt. Die Werft Haussikas, die für sämtliche Ovambowerften typisch ist, beschreibt Oberleutnant Volkmann folgendermaßen:
»Die Werft mit einem Durchmesser von etwa 50 m ist von 3 m hohen, in die Erde gerammten Bäumen umgeben, innerhalb der Werft sind wieder eine Menge einzelner Abteilungen durch kreisförmig eingerammte Baumstämme gebildet, die aber knapp 2 m hoch sind und nicht dicht beieinander stehen. Um die Bäume jeder Abteilung sind etwa 1,60 m hohe Riedmatten gezogen, die dem Ganzen ein nettes, sauberes Ansehen geben. Innerhalb der Abteilungen, deren jede einem besonderen Zweck dient, stehen die Pontoks, runde Hütten mit spitzem Dach, alles sauber mit Matten bekleidet.«
Von dem Volke der Ostovambos im allgemeinen gibt Oberleutnant Volkmann folgende Beschreibung:
»Wir stehen unmittelbar gegenüber Ossone, das direkt über dem nördlichen steilen Flußufer gebaut ist. Die Owakwangaris sind durchweg sehr gut gebaut, Kleider sieht man nicht, die meisten tragen einen Ledergürtel, an dem vorn und hinten lange, schmale Lederstreifen hängen; viele tragen hinten statt des Leders das Fell eines Leoparden oder einer Ginsterkatze. Das Haar wird in allerlei Formen getragen, meist ist es so weit kurz geschoren, daß ein Streifen oder ein Kranz von Haaren übrig bleibt. Um den Hals tragen sie mit Vorliebe Ketten aus bunten Perlen oder Eisenstückchen, die dünn geklopft und gerollt sind, an den Füßen sind sie unbekleidet oder tragen einfache Sandalen aus Wildfell. Die meisten Männer führen sogenannte Ovambomesser, die von Oukuanjamas stammen, wo das Schmiedehandwerk stark entwickelt ist, ab und zu sieht man Speere, die für sehr wertvoll gelten, und Vorderladeflinten. Auch einige Henry-Martini-Gewehre findet man, und ein Großmann von Himarua hatte von einem Portugiesen eine 8 mm-Büchse mit 3/4 Mantelgeschossen gekauft. Bogen und Pfeile habe ich eigentlich nur bei Kindern als Spielzeug gesehen, dagegen sind viele arme Leute mit Kirris bewaffnet. Die Owakwangaris rauchen fast gar nicht, schnupfen aber durchgängig und haben den Tabak in Dosen von Steinbock- oder Deukerhorn mit Lederdeckel. Sie sind keine großen Jäger, und so findet man viel Wild nahe den Dörfern, Kaffee kennen sie kaum, sie trinken morgens ein aus Mehl bereitetes, wenig schmackhaftes Getränk, dagegen brauen sie ganz gutes Bier aus Korn, das sie aber der Ernte wegen nur wenig herstellen. Töpfe werden aus Ton gefertigt, der überall am Flusse vorkommt, sie werden gebrannt und sind ganz haltbar. Ganz hübsche Arbeiten werden aus Stroh oder Binsen[S. 185] gefertigt: Körbe, Teller, Matten, Fischreusen usw. Die Kanoes zeichnen sich nicht durch Schönheit aus, sie sind grob und vielfach aus ganz krummen Stämmen gearbeitet, die kleinsten Kanoes fassen einen, die größeren vier bis sechs Mann. Es wird im Stehen oder Sitzen gerudert. Die Ruder haben nur auf einer Seite eine Schaufel, sogenannte Paddeln sind unbekannt.«
Sowohl bei Himarua wie bei Haussika gelang die Herstellung eines freundlichen Verkehrs mit den Eingeborenen. Wie überall, wurden seitens der Eingeborenen Geschenke gebracht, große Gegengeschenke erwartet und sehr viel gebettelt. Oberleutnant Volkmann zog von da den Fluß abwärts bis zur Mündung des Fontein-Omuramba, dann letzteren aufwärts bis zum Omuramba-u-Omatako, und diesen entlang über Otjituo nach Grootfontein zurück.

Etwa ein Jahr später mußte Oberleutnant Volkmann wider Erwarten seinen Zug infolge eines noch zu schildernden politischen Zwischenfalls wiederholen. Gelegentlich dieses Marsches dehnte er dann seine Erforschung des Okawangotales bis zu dem Punkte aus, bei dem der Fluß mit einer plötzlichen Wendung nach Süden zum Ngamisee abbiegt. Dort liegt die Residenz des früheren Häuptlings Andara, jetzt im Besitz von dessen Sohne Diêbe, mitten im Fluß auf einer Insel. Der Fluß teilt sich an dieser Stelle in viele Arme, die von Stromschnellen durchsetzt sind, und schließt sich erst weiter unterhalb wieder in einem gemeinsamen Bett zusammen.
Des Vertrages, den Forstassessor Dr. Gerber auf seiner Durchreise wegen Aufnahme einer katholischen Mission mit dem Häuptling Himarua geschlossen hatte, habe ich bereits gedacht. Wie es bei Verträgen mit Eingeborenen infolge der beiderseits mangelhaften Sprachkenntnisse manchmal zu gehen pflegt, so haben sich auch hier beide Teile anscheinend nicht richtig verstanden, vielmehr jede Partei den Vertrag mehr zu ihren Gunsten ausgelegt, als der andere Teil bewilligt zu haben glaubte. Außerdem ist wohl auch als sicher anzunehmen, daß auf seiten des als räuberisch bekannten Häuptlings Himarua böser Wille seine Rolle mitgespielt hat. Hatte Himarua doch erst vor einigen Jahren Hereros, die zu ihm geflüchtet waren, um den Regierungsmaßnahmen gegen die Rinderpest zu entgehen, zuerst freundlich aufgenommen und dann zu seiner Bereicherung meuchlings ermorden lassen.
Dieser üble Ruf konnte jedoch den tatkräftigen Präfekten der katholischen Mission in Windhuk, Herrn Nachtwey, nicht abhalten, seine Wirkungssphäre bis zum Okawango auszudehnen, sobald er Kenntnis von dem Vertrage des Dr. Gerber erhalten hatte. Er entsandte eine Expedition, bestehend aus drei Patres (Biegner, Filliung, Hermandung) und zwei Laienbrüdern (Bast, Reinhart), die am 16. März 1903 am Okawango anlangte und sich Himaruas Werft gegenüber auf dem deutschen Ufer niederließ. Nach kurzer Zeit jedoch entstanden Mißhelligkeiten zwischen beiden Parteien. Himarua sah sich in seiner Erwartung auf große Geschenke seitens der Missionare, namentlich an Gewehren und Munition, wie er solches von portugiesischer Seite gewohnt war, getäuscht. Er behauptete sodann, trotz seiner gegebenen Unterschrift, von einem Vertrage mit Dr. Gerber nichts zu wissen. Der Hinweis eines der Missionare, sie seien auf deutschem Boden und daher an die Wünsche Himaruas gar nicht gebunden, schlug dem Faß den Boden vollends aus. Denn von einer solchen Beschränkung seiner Herrschaft wollte der Häuptling erst recht nichts wissen. Die Missionare beschlossen nun, dieser ungastlichen Stelle den Rücken zu kehren, und suchten Fühlung mit dem nächsten Häuptling, flußabwärts, Nambaze. Dieser sicherte ihnen freundliche Aufnahme zu, wagte aber aus Furcht vor Himarua zunächst noch kein offenes Hervortreten. Die Patres kehrten daher vorläufig auf den alten Lagerplatz zurück, wo die bald darauf erfolgende Ankunft des inzwischen mittels Eilboten benachrichtigten Distriktchefs von Grootfontein im April 1903 und dessen ernstes Zureden Himarua äußerlich wieder zur Vernunft brachten.[S. 187] Doch hielt diese nicht lange vor. Nach der Abreise des Oberleutnants Volkmann begann das Schikanieren von neuem, es artete bald zu Räubereien aus, so daß die Mission es vorzog, das Feld ganz zu räumen, zumal beinahe sämtliche Mitglieder von der Malaria befallen waren. Die Expedition traf Ende Mai nach Überwindung ungemeiner Schwierigkeiten wieder in Grootfontein ein. Einer der Missionare, Pater Biegner, war noch am Okawango als Opfer seines Berufs der Malaria erlegen. Ein Laienbruder, Reinhart, nahm den Keim zu dieser Krankheit nach Windhuk mit sich und fiel ihr später dort zum Opfer.

[S. 188] Dieses üble Verhalten Himaruas verlangte Sühne. Eigentlich hätte eine solche auf diesseitige Reklamation von portugiesischer Seite erfolgen sollen. Da jedoch die portugiesische Regierung in jener Gegend keine Machtmittel besitzt, so mußte die Bestrafung des Schuldigen von unserer Seite, so gut dies ohne Verletzung portugiesischen Gebietes möglich war, erfolgen. Dieses erforderlichenfalls betreten zu dürfen, wurde jedoch gleichzeitig in Berlin beantragt. Mit der Ausführung der Bestrafung wurde der Distriktschef von Grootfontein, Oberleutnant Volkmann, beauftragt, der die Initiative hierzu bereits selbst ergriffen hatte. Seine Mannschaft war allerdings gering, dafür aber der Führer einer der energischsten Offiziere der Schutztruppe. Eine stärkere Truppenmacht konnte in der jetzigen Jahreszeit die bis zu 160 km lange Durststrecke zwischen Grootfontein und Okawango ohne besondere Vorbereitungen ohnehin nicht überwinden. Eine Expedition größeren Stiles wurde daher für die Zeit unmittelbar nach der Regenperiode 1904 in Aussicht genommen. Sie kam jedoch infolge des Hereroaufstandes nicht zur Ausführung und Himarua daher mit der Bestrafung davon, die ihm die schwache Truppe des Oberleutnants Volkmann angedeihen lassen konnte. Diese langte, etwa 22 Köpfe stark, Mitte Juli vor der Werft Himaruas an. Ihr hatten sich der Chef des Vermessungwesens, Oberlandmesser Görgens, wie auch Präfekt Nachtwey selbst angeschlossen. Am 16. Juli kam es zum Gefecht gegen Himarua, dessen Werft von dem diesseitigen Ufer aus — mithin aus etwa 200 m — mit Schnellfeuer überschüttet wurde. Himarua war auf den Angriff vorbereitet gewesen und hatte etwa 150 waffenfähige Männer zusammengezogen, die, gedeckt durch die Palisaden der Werft, das Feuer erwiderten. Ein Versuch des Gegners, den Fluß stromab zu überschreiten, um in den Rücken des Angreifers zu gelangen, wurde durch eine der von Oberleutnant Volkmann vorsichtigerweise seitwärts geschobenen Patrouillen vereitelt. Erst die Dunkelheit setzte dem Gefecht ein Ende. Die Truppe hatte keine Verluste, während der Gegner, wie Oberleutnant Volkmann glaubt, vermöge des ruhig abgegebenen diesseitigen Feuers solche zahlreich erlitten hatte. Namentlich war die Wirkung des Salvenfeuers gegen die Palisaden nicht zu verkennen. Diese Annahme findet ihre Bestätigung in dem Umstande, daß während der Nacht der Gegner den jetzt aussichtsvoller gewordenen Versuch zu einer Flußüberschreitung nicht wiederholte und auch den Abmarsch der kleinen Truppe am nächsten Tage in keiner Weise störte. Auch fand Oberleutnant Volkmann auf seinem Weitermarsch flußabwärts die Ovambowerften sämtlich von großem Schrecken erfüllt. Sein[S. 189] Marsch erstreckte sich dieses Mal, wie im vorigen Abschnitt erwähnt ist, bis zu Andaras Werft, wo mit dem neuen Häuptling Diêbe freundschaftlicher Verkehr, verbunden mit Austausch von Geschenken, stattfand. Auch diesem Zuge hatten sich die beiden freiwilligen Kriegsteilnehmer, Präfekt Nachtwey und Oberlandmesser Görgens, angeschlossen.
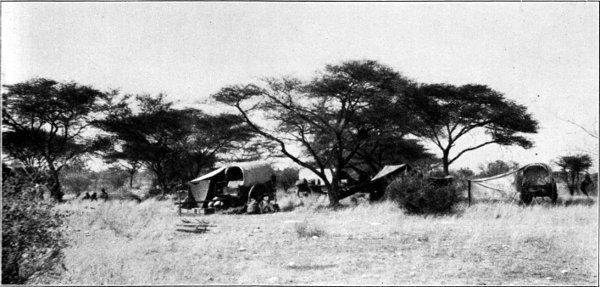
Ein weiterer Zwischenfall von politischer Bedeutung hatte sich etwa in derselben Zeit weiter abwärts am Okawango zugetragen. Dort war ein deutscher Händler und Farmer Namens Paasch nebst Familie ermordet worden. Im Gegensatz zu verschiedenen Stimmen, die glaubten, die Unterlassung eines Kriegszuges behufs Bestrafung dieser Tat dem Gouvernement zum Vorwurf anrechnen zu sollen, urteilt ein Landeskenner, der mehrfach genannte Dr. Hartmann, in einer Broschüre,[42] wie folgt:
»Bei dem Aufstand im Ovamboland handelt es sich um die Ermordung der deutschen Familie Paasch. Wer den Paasch gekannt hat, wird es begreifen, daß er mit den Eingeborenen in Konflikt geraten und schließlich ihr Opfer werden mußte. Ich habe mit Paasch jahrelang im Otavigebiet zu tun gehabt. Paasch war übrigens Landsmann von mir, und so war es natürlich, daß ich mich anfangs besonders freundlich seiner annahm. Paasch vertrug sich aber mit niemand, und selbst seine eigene Familie[S. 190] behandelte er so hart, daß sogar die Buren zu mir kamen und vorstellig wurden, ob man nicht gegen ihn einschreiten könnte. Kein Wunder, wenn ein solcher Mann oben am Okawango (dem nordöstlichsten Grenzfluß unserer Kolonie), wo noch vollständig unabhängige Eingeborenenstämme wohnen und wohin sich Paasch mit seiner Familie zurückgezogen hatte, schließlich das Opfer seines Charakters wurde. Auf das tiefste zu beklagen sind seine armen Angehörigen, die das grausame Schicksal des Familienvaters teilen mußten. So beklagenswert dieser Vorfall nun auch ist, so wäre es doch verkehrt, aus ihm eine Haupt- und Staatsaktion zu machen und ihn als Anlaß zu einem großen Ovambofeldzuge zu benutzen. Handelte es sich doch zunächst nur um ein rein örtliches Vorkommnis in einem kleinen Distrikt am Okawango, der mit dem eigentlichen Ovambolande absolut nichts zu tun hat.«

In dieser Darstellung habe ich nur das Wort »Aufstand« zu beanstanden. Denn ein solcher lag nicht vor, sondern lediglich ein Mord, wie er bei wilden Völkerschaften häufig vorkommt und immer vorkommen wird. Die Bestrafung eines solchen kann in einer so abgelegenen Gegend der Tat nicht unmittelbar folgen, muß vielmehr auf eine günstige Gelegenheit vertagt werden, zumal wenn die Täter noch dazu Untertanen einer andern Nation sind und daher diplomatische Verhandlungen vorhergehen müssen. Und eine solche Gelegenheit würde sich ohne den Hereroaufstand im Jahre 1904 gegeben haben.

Ich kehre nunmehr zu den politischen Verhältnissen des Westovambolandes zurück, das, wie gesagt, durch die deutsch-portugiesische Grenze zwischen Kunene und Okawango in zwei ungleiche Teile zerschnitten ist. Von dieser ihnen »völkerrechtlich« zugedachten Stellung an der Grenze zweier europäischen Nationen haben die Ovambohäuptlinge naturgemäß keine Ahnung. Sie fühlen sich durchaus unabhängig und denken nicht daran, weder die eine noch die andere Oberherrschaft anzuerkennen. Von portugiesischer Seite bereits unternommene Versuche, diese Anerkennung mit Waffengewalt zu erzwingen, sind bis jetzt stets mißlungen, während von deutscher Seite solche noch gar nicht begonnen haben. Ursprünglich war bei Beginn des Hereroaufstandes fast allgemein die Rede davon, seiner Beendigung unmittelbar einen Ovambofeldzug folgen zu lassen;[43] doch ist jetzt die gegenteilige Parole ausgegeben. Abgesehen von manchem anderen, halte ich es für dringend nötig,[S. 192] daß mit Rücksicht auf die Nachschubsverhältnisse einer etwaigen Ovamboexpedition die völlige Fertigstellung der im Bau begriffenen Otavibahn vorausgehe.
Und so werden sich die Ovambofürsten noch lange ihrer Freiheit erfreuen dürfen. Diese Freiheit ist jedoch nur eine solche für die Häuptlinge, nicht aber für deren Völker. Denn bei den Ovambos finden wir noch die alte afrikanische Herrscherform der unumschränkten Macht der Häuptlinge. Ihre Willkür und Launen sind allein Gesetz, Leben und Besitz ihrer Untertanen sind ihr ausschließliches Eigentum. Dort spielt daher die Person des Häuptlings eine weit größere Rolle als bei den Hereros und den Hottentotten, welche Völkerschaften eine für Eingeborene fast zu freie Regierungsform besitzen. Hier gilt es daher für die kolonisierende Macht, die Autorität der Häuptlinge zu stärken, dort dagegen, sie zu brechen. Ein Glück ist für jede das Ovamboland erobernde Macht, daß die dort wohnenden bedeutenden Volksmassen — etwa 300000 Seelen — in 10 bis 11 Stämme gespalten sind, von denen keiner die Autorität des andern anerkennt. Vielmehr liegen sie zum Teil untereinander in bitterer Fehde. Immerhin steht einer gemeinsamen Gefahr gegenüber ein Zusammenschluß einzelner Stämme nicht außer Bereich der Möglichkeit.
Die Häuptlinge der für uns hauptsächlich in Betracht kommenden Stämme der Uukuambis und der beiden Ondongastämme sind Negumbo, Kambonde und Nechale. Negumbo ist ein alter Mann, der für seine Person den Frieden wünscht, aber vollständig von seinen anders denkenden Söhnen beherrscht wird. Weiter ist nichts über ihn bekannt geworden. Kambonde und Nechale sind Brüder, von denen dem ersteren die eigentliche Häuptlingswürde zusteht. Er setzte seinerzeit seinen Bruder Nechale als Unterkapitän über die Ostondongas ein, worauf dieser sich baldmöglichst unabhängig machte. Infolgedessen herrscht naturgemäß zwischen den beiden Brüdern keine besondere Freundschaft.
Ich kenne den kriegerischen Wert der Ovambos nicht, der Hereroaufstand hat jedoch gezeigt, wohin die Unterschätzung des Gegners führt, namentlich aber, daß auch Bantuneger, wenn einmal in einzelne Banden zersprengt, einen gefährlichen, jede Kolonisation hindernden Gegner abgeben können. Dieser Gefahr gegenüber bietet ein Bundesgenosse aus dem gegnerischen Volksstamm einen Kristallisationspunkt, an den allmählich die kriegsmüden Elemente des geschlagenen Feindes angegliedert werden können. In Ermanglung eines solchen ist es schwer, Eingeborenen dasjenige[S. 193] Vertrauen beizubringen, das zur schließlichen freiwilligen Gestellung und Ablieferung der Waffen gehört.
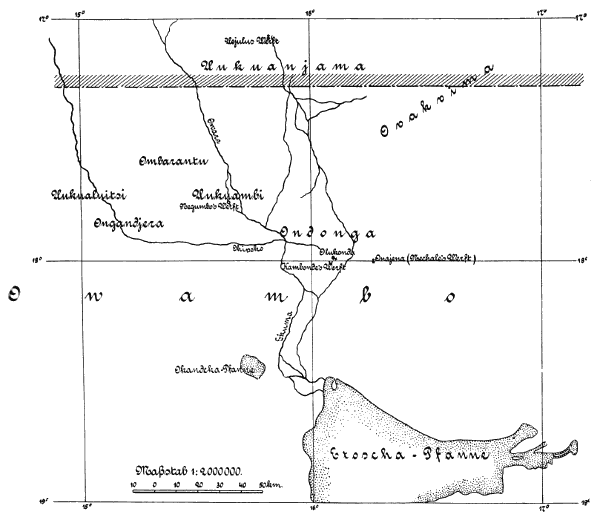
Der Häuptling Nechale genießt einen recht üblen Ruf. Es werden ihm Grausamkeit gegen seine eigenen Leute wie auch der eine oder andere an Weißen begangene Mord nachgesagt. Daß er den Beginn des Hereroaufstandes im Februar 1904 zu einem Überfall unserer Station Namutoni benutzt hat, um sich an dem Stationsgut zu bereichern, ist bekannt. Ebenso ist bekannt, daß seine Leute, die anscheinend mit großer Tapferkeit vorgegangen sind, unter schweren Verlusten abgewiesen worden sind. Seitdem mag[S. 194] Nechale wohl von einem recht bösen Gewissen geplagt sein. Etwa zwei Jahre vorher hatte ihn noch der Vertreter der Otavi-Gesellschaft, Dr. Hartmann, besucht und über den Empfang in seinem bereits genannten Vortrag folgende Schilderung gegeben:
»Interessant war unser Besuch bei dem Häuptling Nechale, einem der gefürchtetsten Häuptlinge. Die Ovambohäuptlinge haben die Gewohnheit, die Besucher, auch wenn es Weiße sind, recht lange warten zu lassen. Ich hatte Nechale mitteilen lassen, daß ich nicht warten, sondern sofort wieder meiner Wege gehen würde. In der Tat wurden wir auch sofort empfangen. Winkler[44] hatte für alle Fälle seinen geladenen Revolver in der Tasche, Nechale saß auf einem Stuhl, er hatte europäische Kleidung an. Neben ihm kniete sein Ratgeber, ein dicker, großer Ovambo mit einem schlauen Bauerngesicht. Für uns standen zwei Stühle dem Häuptling gegenüber bereit.
»Ich habe selten ein so häßliches Gesicht gesehen wie das von Nechale. Er blickte unausgesetzt vor sich hin, nur selten streifte uns ein scheuer Blick. Nach dem Austausch einiger Begrüßungsworte entstand eine Verlegenheitspause, die ich absichtlich etwas lang werden ließ, weil ich merkte, daß Nechale etwas verlegen und nervös wurde. Endlich sagte ich, daß wir sehr durstig seien und daß wir gern etwas Bier trinken möchten. Fast unmerklich glitt ein Lächeln über seine Züge. Ganz leise sprach er einige Worte. Plötzlich erschien eine Ovambofrau, ließ sich auf die Kniee vor ihm nieder, erhielt mit gesenktem Blick ihren Auftrag, wobei wir nur hörten: »I ongeama omuhona« (ja Herr und Löwe). Dann erhob sie sich, ging, den Blick auf den Boden, rückwärts bis zur Tür und verschwand eiligst. Sie brachte zwei Becher Bier, wir leerten dieselben und verabschiedeten uns auf das freundlichste von Nechale.«
Eine weit sympathischere Erscheinung ist der ältere Bruder Nechales, Kambonde, dem die äußerste Gutmütigkeit und Friedfertigkeit nachgesagt wird. Nur beeinträchtigt seine Würde eine unüberwindliche Neigung zum Alkohol. Von morgens 10 Uhr ab soll er in der Regel nicht mehr zu sprechen sein. Des etwas unliebenswürdigen Briefes, den mir Kambonde im Jahre 1895 schrieb, habe ich bereits gedacht. Seitdem aber sind wir bis zu meiner Abreise aus dem Schutzgebiet fortgesetzt in freundschaftlichem Briefwechsel geblieben. Namentlich während des Konfliktes mit Negumbo 1901/02 hat uns Kambonde durch seine Vermittlung gute Dienste geleistet.[S. 195] Ein vom Beginn des Hereroaufstandes ab meinerseits mit ihm gepflogener Briefwechsel hatte zum Zweck die Verhinderung einer etwaigen Verbindung seinerseits mit den Hereros. Denn wenn die Eingeborenen nicht über unsere Absichten unterrichtet sind, betrachten sie diese stets mit Mißtrauen und spielen schließlich aus lauter Angst das Präveniere. Sehr gesteigert wird dieses Mißtrauen durch die bereits mehrfach gekennzeichneten Storie-Eigentümlichkeiten des Schutzgebietes.

Einen Brief Kambondes aus der Zeit des Hereroaufstandes nebst einem erläuternden Anschreiben des bei ihm stationierten Missionars Rautanen lasse ich hier folgen:
Okoloko, den 2. Juni 1904.
Mein lieber Freund!
Die Worte, die Du meinem Missionar Rautanen geschrieben hast, habe ich gehört. Die Hereros, von welchen Du sprichst, sind nicht zu mir gekommen, und ich weiß überhaupt nicht, wo sie sich aufhalten. Ich denke aber, wenn die Hereros hierher kommen sollten, so werden sie zu meinem Bruder Nechale gehen, wodurch viel Unruhe entstehen wird. Sage mir, was ich zu tun habe, wenn die Hereros kommen sollten.
Ich grüße Dich vielmals
Dein Freund gez. Kambonde, Häuptling.
Olukonda, den 2. Juni 1904.
An den Kaiserlichen Gouverneur usw.
Das Schreiben Ew. Hochwohlgeboren vom 4. 5. 04 habe ich die Ehre gehabt, gestern zu empfangen und habe dasselbe dem Häuptling Kambonde genau übersetzt.
Schon vor langer Zeit haben wir dem Häuptling Kambonde klarzumachen versucht, daß er die Feindschaft der Deutschen auf sich zieht, wenn er den Hereros irgendwie behilflich ist oder Flüchtlinge in Schutz nimmt. Dieses weiß er ganz genau und sieht es auch ein. Ob er aber, falls größere Horden hierher kommen sollten, gegen dieselben aufzutreten imstande ist, ist eine andere Frage. Ich denke, solange er nicht weiß, daß Truppen in der Nähe sind, wird er es kaum tun; denn er fürchtet, von den anderen Stämmen überfallen zu werden. Ob diese seine Befürchtung irgendwie begründet ist, kann ich leider nicht sagen. Die Häuptlinge von Uukuanjama und Uukuambi haben sich ja bis jetzt noch ruhig verhalten und sollen Nechales Auftreten gegen die Weißen getadelt haben. Soweit ich beurteilen kann, fühlt er sich zu schwach, um ihnen beizustimmen.
Dem Nechale das zu sagen, was Sie schrieben, wäre ein Wagnis, welches unser aller Tod sein könnte. Es sei mir und den anderen Missionaren nicht übel genommen, wenn wir es unterlassen haben.
gez. Rautanen.
[S. 197] Das, was vorstehend Herr Rautanen sich weigert, an Nechale weiterzugeben, war eine Warnung auch für diesen.

Schließlich wäre unter den Ovambohäuptlingen, zu denen wir in Beziehungen getreten sind, noch der Häuptling Uejulu von den Uukuanjamas zu nennen, dessen Werft Onjiva jedoch, wie erwähnt, auf portugiesischem Gebiete liegt. Die beim Gouvernement einlaufenden Meldungen betonten stets dessen deutsch-freundliche Gesinnung, bis im Jahre 1902 auf dem Umwege über das Deutsche Konsulat in Loanda gegenteilige Nachrichten kamen, die dann durch Dr. Gerber bestätigt worden sind. Die bisherigen Nachrichten stammten im wesentlichen von den bei Uejulu stationierten deutschen Missionaren, bei denen vielleicht der Wunsch der Vater des Gedankens gewesen ist. Wohl mag ferner auch die deutsch-freundliche Gesinnung Uejulus durch das plötzlich erfolgte Auftreten einer französischen Mission erschüttert worden sein, von deren Anwesenheit wir gleichfalls auf dem Wege über Loanda Kenntnis erhielten. Der Vorsteher dieser Mission, Pater Lecomte,[S. 198] hat sich 1902 auch dem Hauptmann Kliefoth während dessen Besuches bei Uejulu vorgestellt.
Inzwischen sind in der neueren Zeit aus dem Gebiete der Uukuanjamas Nachrichten zu uns gelangt, nach denen sich die Lage daselbst vollständig geändert haben muß. Anscheinend hat bei den Uukuanjamas eine Staatsumwälzung stattgefunden, gelegentlich welcher der Häuptling Uejulu bei Verteidigung seiner Werft nach heftigem Kampfe den Tod gefunden haben soll.[45] Auch die Ermordung des Paters Lecomte wurde gemeldet, nichts Bestimmtes dagegen über den Verbleib der übrigen Missionare. Ferner wissen wir von einer großen Niederlage, die Anfang 1904 eine portugiesische Expedition am Kunene erlitten haben soll. Ob dieses Ereignis mit den Umwälzungen bei den Uukuanjamas in irgend einer Verbindung steht, ist nicht bekannt geworden.
Bewaffnet sind die Ovambos nach Angabe aller vorstehend genannten amtlichen Reisenden sehr gut, bedauerlicherweise auch vielfach mit Modell 88. Letzteres beziehen sie durch portugiesische Händler, die ihrerseits sich wieder über Mossamedes des deutschen Handels bedienen. Die diplomatischen Reklamationen wegen dieses Waffenhandels, die auf Anregung des Gouvernements in Windhuk zwischen Berlin und Lissabon gepflogen worden sind, rissen gar nicht ab. Erfolg hatten sie jedoch weiter nicht, als fortgesetzte Versicherungen der portugiesischen Regierung, daß »zur Unterdrückung dieses Waffenschmuggels alles mögliche geschehen solle«. Die Macht, diesen Versicherungen Nachdruck zu geben, besaß und besitzt Portugal jedoch zur Zeit im Ovambolande so wenig wie wir.
Indem ich mir die Schilderung der wirtschaftlichen Verhältnisse in dem übrigen Schutzgebiete in einem besonderen Kapitel vorbehalte, will ich diejenige des Ovambolandes des Zusammenhanges halber hier vorwegnehmen und dann mit diesem Lande abschließen.
Das Ovamboland ist, soweit wir es kennen, ein flachgewelltes Sandfeld, in dem die Erhöhungen in der Regel mit Wald, die Einsenkungen mit Gras bestanden sind. In den Senkungen pflegen sich das ganze Jahr mit Wasser gefüllte Vleys zu befinden. Das Land ist derart eben, daß das Wasser schwer Abfluß findet. Die Folge ist, daß während der[S. 199] Regenperiode (Dezember bis April) das ganze Land einen See bildet, aus dem die Erhöhungen wie Inseln hervorragen. In dieser Zeit ist das Reisen im Ovambolande so gut wie ausgeschlossen. Hat das Wasser sich verlaufen, so bleibt es noch monatelang in Vleys und Omurambas stehen, welch letztere, wie ein Blick auf die Karte ergibt, zwischen Kunene und der Etoschapfanne, mit einem im allgemeinen sanften Abfall nach Süden sich in zahlreichen Ästen verzweigen. Solange daher der Kunene Hochwasser führt, gibt er seinen Überfluß an die Etoschapfanne ab. Was den wirtschaftlichen Wert des Landes betrifft, so gibt über ihn Dr. Gerber folgendes Urteil:[46]
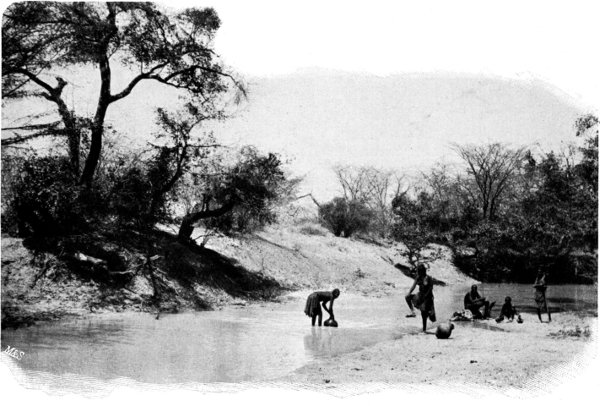
»Es ist das geborene Land für Baumwolle, Tabak, Feigen und Datteln; es gaben dies selbst Missionar Petnien in Omandangua für Baumwolle, Missionar Wulfhorst für Tabak und Feigen zu; nur sind wir alle der Meinung, daß nur große Plantagen rentieren können. Und nun kommt für mich noch ein Hauptgrund, wir haben hier ein arbeitskräftiges, gesundes und zahlreiches Volk. Ich sah hier einzelne Familienwerften, wo von einer[S. 200] Familie 15 bis 20 ha große Äcker von Hirse, Korn usw. angepflanzt sind, und dies ohne Pflug, mit den primitivsten Werkzeugen. Das ganze Land ist ein Acker, Werft an Werft, um jede Werft größere Äcker, nie unter 4 bis 5 ha.

Wie schon mitgeteilt, ist das Land für Tabak, Baumwolle, Feigen und Datteln vorzüglich, doch alles dies nur in großen Anlagen, die ein großes Anlagekapital verlangen, jedenfalls müßte das Land vollkommenes Regierungsland und somit unter günstigen Bedingungen feilgeboten sein. Mein größtes Bedenken für seine weiße Ansiedlung liegt in den ungesunden klimatischen Verhältnissen, die eine größere Ansiedlung von Weißen in Frage stellen, und das ist auch ein Grund, warum ich von großem Plantagenbau in wenigen weißen Händen spreche; Baumwolle wächst hier allerorten wie Unkraut, Tabak wurde von Missionar Wulfhorst und vielen Eingeborenen in großen Mengen gepflanzt und erreicht eine vorzügliche Güte mit festem natürlichen Aroma. Das Land wird stets seinen Bedarf an Korn decken und viel noch abgeben können. Wasser findet sich beim Graben im ganzen Land.
»In bezug auf Viehzucht läßt sich sagen, daß durch die schlechten Futterverhältnisse und Inzucht das Vieh klein und unansehnlich, durch Zuchtwahl aber sich viel bessern läßt. Es ist eben hier ein Mißstand, der die wirtschaftliche Entwicklung und Lage oft brach legt: das ganze Land gehört dem[S. 201] Häuptling, er verteilt die Äcker und Werften und kann jeden von heute auf morgen wegjagen, deshalb pflanzen die Leute oft nur ihren notwendigsten Bedarf, weil sie fürchten, daß ihre Arbeit oft vergeblich ist; dann verfügt der Häuptling willkürlich über das Vieh seiner Leute; ferner ist das ganze Jahr gegenseitiger Krieg, d. h. mit anderen Worten gegenseitiges Viehstehlen, nicht nur unter den verschiedenen Stämmen, sondern oft unter benachbarten Werften. Solche Verhältnisse legen natürlich jede Viehzucht lahm, trotzdem kann der Viehbestand im allgemeinen noch als gut genannt werden.«

Schließlich erklärt sich Dr. Gerber durch seine Erfahrungen im Ovambolande zu einer Anlage großer Dattelkulturen im Damaralande längs des Swakopflusses angeregt.
Noch günstiger wie über das Westovamboland äußern sich die bisherigen Besucher über den wirtschaftlichen Wert des Ostovambolandes, als welches für uns lediglich das Okawangotal in Betracht kommt. Hier verbindet sich ein reicher Boden mit den günstigsten Wasserverhältnissen. Die Eingeborenen bauen mit ihren geringen Hilfsmitteln dort jetzt schon zahlreich Korn, Mais, Hirse, Hülsenfrüchte und Tabak. Diese günstigen Verhältnisse gelten in dem deutschen Gebiet jedoch nur für das Flußtal selbst, da mit den südlichen Talrändern die weite südwestafrikanische Grassteppe wieder[S. 202] beginnt. Eine Ausnahme innerhalb dieser Steppe scheinen die Omurambas zu machen, über die Dr. Jodtka, wie folgt,[47] urteilt:
»Bevor ich den Charakter des Okawangotales selbst bespreche, möchte ich vorweg gleich wegen vielfacher Ähnlichkeiten das Gebiet, das durch die Betten des Fontein-Omuramba, Blockfontein-Omuramba und Großomuramba gebildet wird, beschreiben. Die Umgebung dieser Flußbetten zeigt dasselbe Bild wie das Sandfeld. Hohe Dünen begleiten dieselben beiderseits. Prächtiger Wald mit alten Stämmen von zum Teil mächtigem Umfang und bedeutender Höhe, wenn auch nur licht, wächst hier wie dort. Die Tierwelt ist dieselbe, und auch die sie bewohnenden Menschen sind desselben Stammes und derselben Sprache. Aber die in vielen Pützen enthaltenen bedeutenden Mengen Wassers geben den Flußbetten selbst ein anderes Gepräge. Namentlich im Fontein-Omuramba ist die tiefste Stelle der Bettmulden ein zusammenhängendes Gewässer, in dem man eine langsame Strömung — dem Okawango zu — beobachten kann. 2 bis 3 m hohes Riedgras und -rohr wächst in demselben und bildet den beliebten Aufenthaltsort und sicheren Schlupfwinkel für eine unserem Reh an Gestalt, Farbe und Größe ähnliche Antilopenart, den Ried- oder Wasserbock. Der Boden ist infolge der alljährlichen Grasbrände und durch gelegentlich von Regenwasser mitgeführten Schlamm fruchtbar, da eine aus einer Vermischung von Sand mit Asche, Schlamm usw. entstandene Ackerkrume von 1/2 bis 1 Fuß Stärke den Boden bedeckt. Diesen Charakter zeigt das gesamte Flußbett des Fontein-Omuramba südlich bis Karakuwisu. Südlich dieser reichen, von Buschleuten bewohnten Wasserstelle allerdings wird die Vegetation ärmlich. Erst spärlich, dann immer stärker tritt der Dornbusch wieder in seine Rechte. Tiefer Triebsand bedeckt das Flußbett, und jegliches Wasser versiegt hier zur kalten Zeit. Gelänge es jedoch, auf dieser Strecke — von Eriksonspütz bis Karakuwisu 124 km — Wasser zu eröffnen, so wäre damit ein weites Gebiet für die Ansiedlung erschlossen. Ich habe mich bemüht, für solche Bohrungen geeignete Stellen auf dieser Wegestrecke ausfindig zu machen, und glaube auch mehrere Punkte gefunden zu haben, wo gewisse dort wachsende Bäume und Gräser mir den Versuch einer solchen Bohrung nicht aussichtslos erscheinen lassen.
»Das Flußbett der oben genannten fruchtbaren Partie ist überall so breit, daß es die Anlage großer Felder zuläßt. Die Flüsse kommen nicht mehr ab, so daß die Gefahr der Vernichtung der Saaten bei plötzlichen[S. 203] Regengüssen nicht besteht, anderseits ist aber so reichlich Wasser vorhanden, daß dasselbe für Mensch und Vieh und zur Bewässerung von Gartenanlagen vollkommen ausreichen würde. Futter für das Vieh bieten die reichen Grasbestände in den lichten Wäldern und den kleineren oder größeren Savannen. Die dortigen Buschleute sind sehr dienstwillig, dabei sehr genügsam, so daß sie gute und billige Arbeitskräfte abgeben würden. Soweit ich es beurteilen kann, würde man in diesem Gebiet dieselben Nutzpflanzen anbauen können wie am Okawango, und müßte aus dem jungfräulichen Boden dieselben großen Erträge erzielen können wie dort. Zum Hausbau liefern die Wälder ein dauerhaftes, festes Material.«
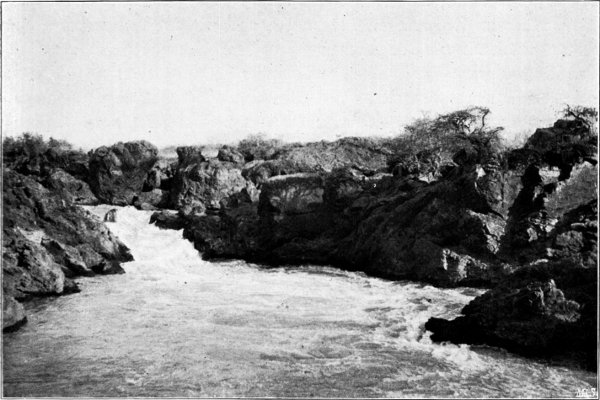
Aber auch das Tal des Okawango für sich allein würde Raum für eine zahlreiche weiße Besiedlung bieten. Über dessen wirtschaftlichen Wert sei hier ein Urteil des Oberleutnants Volkmann[48] wiedergegeben:
»Kommt man zum Okawango, so beginnt mit einem Male ein anderes Bild. Werft reiht sich an Werft, am ganzen Talrande entlang sind ausgedehnte Kornfelder. Der leichte, mit rotem Lehm vermischte Boden ist sehr fruchtbar; ohne daß gedüngt wird, werden jährlich zwei gute Ernten erzielt. Ist ein Feld jahrelang bewirtschaftet, bleibt es brach liegen, und die Eingeborenen machen ein neues Stück Land urbar. Dabei wird das Flußtal, das als enger, aber auch bis zu 6 km breiter Streifen den Okawango begleitet, nicht ausgenutzt, da es alljährlich überschwemmt ist und dann lange feucht und ungesund bleibt; die Felder liegen meist an dem Talrand oder auf demselben. In dem Flußtale selbst könnten Hunderttausende von Hektaren ohne weiteres beackert werden, wenn man sich auf eine Ernte beschränken oder sich durch Dünen gegen ein Übermaß von Wasser schützen wollte.
»Leider würde einer Anpflanzung rein tropischer Gewächse ein schweres Hindernis entgegenstehen: die in den Monaten Juni bis August alljährlich auftretenden Nachtfröste. Die Temperatur am Okawango ist in den Wintermonaten überraschend niedrig, morgens liegt über dem Fluß ein dicker Nebelstreifen, und bis nach 9 Uhr ist es bitterkalt. Kurz bevor ich zum Okawango kam, waren den Fluß entlang sämtliche Tabakspflanzen erfroren. Die Owakwangaris bauen besonders Kafferkorn, Bohnen, Kürbisse und Erdnüsse. Kafferkorn bildet die Hauptnahrung und wird in ungeheuren Quantitäten produziert; der Verkaufspreis stellt sich, mit Handelsgut bezahlt, auf 3 bis 4 Mark pro Zentner. Ein vielversprechender Handelsartikel ist der Wurzelkautschuk. Zwar kommt dieser nicht nahe dem Okawango vor, aber die dem Owakwangaris ergebenen Buschmänner nördlich des Okawango im portugiesischen Gebiet, westlich des Kuito, sammeln ihn und bringen ihn den Häuptlingen. Der Kautschuk kommt in viereckigen Stücken von 1 kg Gewicht, etwa 20 cm lang, 18 cm breit, 4 bis 5 cm dick, in den Handel. Bisher kamen von Zeit zu Zeit portugiesische Händler von Mossamedes, um den Kautschuk einzukaufen.
»Die Vegetation längs des Okawango ist keine tropische. Die am meisten vorkommenden Bäume sind der Omumboranganga (Combretum primigenum), dem nach ihrem Glauben die Damaras und Ovambos entstammen, sowie der wilde Feigenbaum (Ficus damarasis). Vereinzelt sieht man niedrige Büsche von Palmen (Hyphaene ventricosa), und westlich von Ossovue stehen größere Gruppen von hohen Palmen. In dem Busch längs des Flusses kommen häufig zwei Strychnosarten vor, die wohlschmeckende Früchte tragen; dieselben Bäume stehen vereinzelt im ganzen Sandfeld und bilden eine beliebte Kost der Buschmänner. Sehr wohlschmeckende Früchte trägt auch der sogenannte[S. 205] Mandelbaum (Scherogewga Schweinfurthiana), ein Baum, dessen Stamm mit weißgrüner, glatter Rinde einen mächtigen Umfang hat und dessen Früchte mit roter Schale, von der Größe runder Pflaumen, namentlich wenn sie trocken vom Baum fallen, in großen Mengen von den Buschmännern gesammelt und für schlechte Zeiten aufbewahrt werden. Das trockene Fruchtfleisch schmeckt ähnlich wie das der Palmäpfel oder wie Johannisbrot, der innere Kern wird geröstet und dann gegessen, oder er wird gestampft, und der ölige Inhalt wird zum Einreiben des Körpers verwendet.
»Die Fauna beim Okawango ist sehr reichhaltig. Zwar sind Elefanten und Flußpferde selten geworden, aber längs des Flusses stehen starke Rudel von Bastardgemsböcken, Bastardhartebeesten, Zebras, Roriböcken, Riedböcken und Wasserböcken. Im Flusse sollen viele Krokodile sein, doch habe ich kein einziges gesehen, sie sollen in der kalten Zeit nicht an die Oberfläche des Wassers kommen, werden übrigens von den Ovambos nicht gefürchtet und sollen nie einem Menschen etwas tun. Groß ist der Fischreichtum im Okawango. Es kommen viele Arten vor, besonders ein Raubfisch mit scharfen Zähnen, unserem Barsch ähnlich, ein breiter, karpfenähnlicher Fisch, eine Art Wels und Weißfische. Mit Ausnahme des Wels, der einen schlammigen Geschmack hat, schmecken die Fische vorzüglich.
»Die Vogelwelt ist überaus reichlich vertreten, vom Strauß bis zu den kleinsten buntgefiederten Arten. Zahllos sind die großen Wasservögel, Störche, Reiher usw. Gänse und Enten habe ich weniger beobachtet. Von Raubtieren kommen vor: Löwe, Leopard und zwei Arten Hyänen; von kleinerem Raubzeug: Wildkatze, Ginsterkatze, zwei Schakalarten und im Fluß Fischottern.«
Viehzucht wird nach einer weiteren Angabe des Oberleutnants Volkmann im Okawangotale so gut wie nicht betrieben. Auch der Handel scheint infolge der stattgehabten Beraubung einzelner Händler fast ganz aufgehört zu haben. Die Häuptlinge sind im Besitz großer Mengen Elfenbein, wollen es aber nur für Munition verkaufen, nach deren Besitz ihr ganzes Sinnen und Trachten steht. Kautschuk wurde nur bei Himarua gefunden, flußabwärts dagegen nicht. Doch vermutet Oberleutnant Volkmann das Vorhandensein kautschukhaltiger Wurzeln und Pflanzen auch flußaufwärts. Im ganzen sieht Oberleutnant Volkmann den großen wirtschaftlichen Wert des Okawangotales weniger im Handel als in der landwirtschaftlichen Produktion, was auch für dessen Zukunft weit bessere Aussichten eröffnet. Im übrigen sind alle Besucher des Okawangotales darin einig, daß es in dem wirtschaftlichen Leben der Kolonie dereinst eine wichtige Rolle spielen werde.
Die wirtschaftliche Bedeutung des Okawangotales wird noch größer werden, wenn die auf Grund der Angaben früherer Reisender vermutete Bifurkation des Okawango nach dem Tschobefluß und damit nach dem Zambesi in der Tat sich als vorhanden herausstellen sollte (siehe die Skizze auf S. 207). Dann würde der schon vielfach teils ernst-, teils scherzhaft genannte »Caprivizipfel« für die südwestafrikanische Kolonie noch das werden können, was sein Urheber, der ehemalige Reichskanzler Graf Caprivi, sich gedacht hatte, nämlich eine natürliche Verbindung mit unserer ostafrikanischen Kolonie wie mit dem Indischen Ozean. Der Okawango ist bei einer Breite von 100 bis 150 m und einer Tiefe von 3 bis 5 m sowie bei gleichmäßig ruhigem Fahrwasser innerhalb der deutschen Interessensphäre überall als schiffbar zu betrachten. Schwierigkeiten scheint nur die zahlreiche Armbildung, verbunden mit Stromschnellen, bei Andaras Werft zu bieten. Denn unweit des genannten Platzes ändert der Fluß seinen Charakter vollständig. An die Stelle des bisherigen gemeinsamen Bettes tritt eine Anzahl mehr oder weniger breiter Arme, die sich mit reißendem Gefälle durch Felsen ihren Weg bahnen und eine Menge Inseln bilden. Diese ragen entweder als nackte Steininseln empor, oder sie sind mit üppigster Vegetation bedeckt, darunter eine Menge stattlicher Laubbäume mit vortrefflichem Nutzholz. Auf einer dieser Inseln liegt, 5 km flußabwärts von seines Vaters ehemaliger Werft, abgeschlossen von der übrigen Welt, die Werft Diêbes, des Sohnes von Andara. Anscheinend hat sich der Häuptling durch diese abgeschlossene Lage den Räubereien seiner Nachbarn entziehen wollen. Außer der Hauptwerft befinden sich auf den Inseln noch mehrere dicht bewohnte, unverschanzte Dörfer, die gleichfalls Diêbes Herrschaft anerkennen.
Diesen Werften gegenüber sattelte Oberleutnant Volkmann, dessen Darstellung ich hier zumeist folge, bei seinem Besuche ab und schickte Botschaft zu Diêbe, um seine Ankunft zu melden. Die Ovambokuschu — dies ist der Name des Andarastammes — zeigten sich zuerst scheu, wurden aber später zutraulich. Die von Diêbe zurückgekommenen Boten brachten die Bitte mit, die Besucher möchten seiner, Diêbes, Werft näher kommen, was auch geschah. Der Weitermarsch ging in dem immer enger werdenden Flußtale durch eine ungemein reizvolle Landschaft. Steile Felsenpartien, zwischen denen das Wasser, schäumende Schnellen bildend, über gewaltige Felsblöcke dahinschoß, wechselten mit Stellen üppigster Vegetation ab. Bald sah Oberleutnant Volkmann, noch einige hundert Meter entfernt, aber durch reißende Flußarme getrennt, im Hintergrunde einer Felseninsel die Werft Diêbes auf[S. 207]tauchen. Hier wurde das neue Lager bezogen und bald darauf von Oberleutnant Volkmann in Begleitung des Präfekten Nachtwey die Überfahrt zur Werft angetreten. Diese Überfahrt nahm einige Zeit in Anspruch, da die Stromschnellen eine solche direkt nicht gestatteten. Zuerst ging es über einen 30 m breiten Flußarm auf eine bewaldete Insel, dann auf dieser zu Fuß 50 Schritte stromauf, wo die Besucher von neuen Kanus in Empfang genommen und auf einem großen Umwege nach Diêbes Insel gefahren wurden. Die Eingeborenen steuerten hierbei mit außerordentlicher Geschicklichkeit durch die Schnellen.
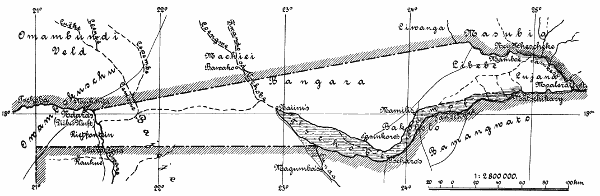
Auf der Werft waren die Großmänner versammelt, bald erschien auch der Häuptling, von der Versammlung mit Händeklatschen begrüßt. Den weiteren Verlauf seines Besuches schildert nun Oberleutnant Volkmann, wie folgt:
»Diêbe ist ein etwa 35jähriger Mann von nicht unsympathischem Aussehen und Wesen. Er hat es nicht verstanden, den großen Ruf, den Andara als Zauberer und Regenmacher genoß, zu erhalten, und der Stamm ist anscheinend im Zurückgehen begriffen. — Man sieht auch keinen einheitlichen Rassetyp mehr, sondern die Typen der verschiedensten untereinander gemischten Stämme. Die Unterhaltung machte[S. 208] einige Schwierigkeiten, da dieser Stamm nicht mehr die Ovambosprache, sondern die der Betschuanen spricht, welche mein Dolmetscher nur schlecht beherrscht.
»Nachdem in einer schöngeschnitzten Kalebasse Bier gebracht und herumgereicht war, fuhren wir zum Lager zurück. Am folgenden Tage entspann sich ein lebhafter Handel um Proviant und Kuriositäten. Es wurden mehrere Zentner Korn, Hirse, Bohnen und Erdnüsse eingetauscht, auch eine Menge schöner Schnitzarbeiten. Nachdem ich nachmittags nochmals bei Diêbe gewesen war und ihn wiederholt ermahnt hatte, alle durchreisenden Weißen gut aufzunehmen, ließ ich einspannen und trat den Rückmarsch an.
»Der nächste Tag brachte einen kleinen Zwischenfall, indem zwei Pferde in den Okawango fielen, von denen das eine wieder zum Ufer schwamm, während das andere ein Stück stromabwärts getrieben wurde und eine etwa 150 m vom Lande entfernte Insel erreichte. Nach langem Bemühen gelang es, Eingeborene mit Kanus zu rufen, die einige Leute von uns auf die Insel fuhren. Hier wurde das Pferd eingefangen und an Ochsenriemen in das Wasser gezogen, worauf es ruhig hinter den Kanus herschwamm und glücklich wieder am südlichen Flußufer ankam.«
Über den weiteren Lauf des Okawango bis zum Ngamisee, beziehungsweise zum Tschobe, falls die Abzweigung dorthin vorhanden, sowie über den Tschobe selbst wissen wir dagegen nichts Bestimmtes.
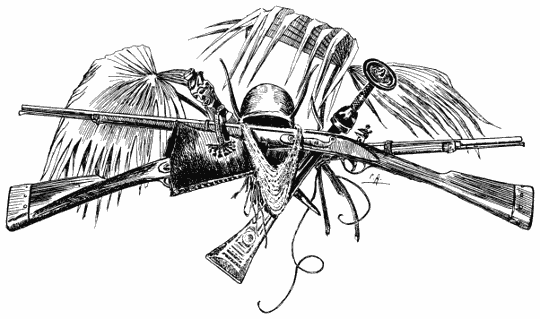
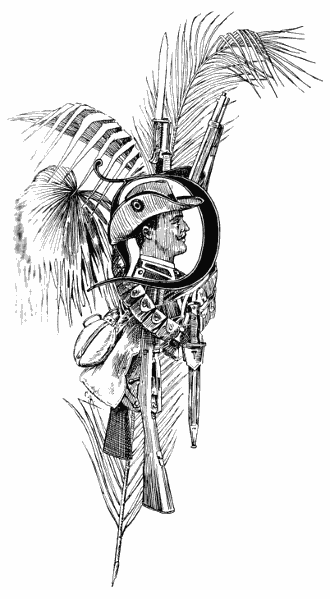
Da die Verwaltung des Schutzgebietes bis in die neueste Zeit zu einem großen Teil der Schutztruppe mit obgelegen hat, ist es erforderlich, zunächst deren Organisation kennen zu lernen. Der Gedanke des Fürsten Bismarck, unsere überseeischen Besitzungen lediglich als Handelskolonien anzusehen und in diesen dem Kaufmann zugleich mit der Verwaltung auch den Schutz zu übertragen, hat sich in unseren drei großen afrikanischen Kolonien Ostafrika, Kamerun und Südwestafrika nicht lange halten können. In allen drei finden wir schließlich sogar eine mehr oder weniger ausgeprägte reine Militärverwaltung.
Die Zeit der, um mich so auszudrücken, kaufmännischen Verwaltung reichte in Südwestafrika von 1885 bis 1891. Das letztgenannte Jahr ist das Gründungsjahr der südwestafrikanischen Schutztruppe, die indessen zunächst nur eine mittels Anwerbung ergänzte und der Person des Kommandeurs verpflichtete Privattruppe war. Solange die Truppe, wie solches von 1891 bis 1893 der Fall, nur aus 30 bis 50 Köpfen bestand, ergaben sich aus diesem Privatverhältnis keine Unzuträglichkeiten. Die Truppe führte in der genannten Zeit im allgemeinen ein friedliches Stilleben, mehr durch ihr Dasein als durch kriegerische Tätigkeit wirkend. Die Notwendigkeit eines Einschreitens gegen Kapitän Witbooi brachte ihr jedoch 1893 eine Erhöhung auf[S. 210] 350 Köpfe. In dieser Stärke fand ich sie bei meinem Eintreffen im Schutzgebiet vor. Ihr bisheriger Führer war der Hauptmann, später Major v. François, der nach der Abreise des damaligen Reichskommissars, Dr. Göring, 1892 auch interimistisch mit dem Reichskommissariat betraut worden war, so daß von da ab Zivil- und Militärgewalt in einer Hand vereinigt blieben. Das Reichskommissariat wurde demnächst 1893 in eine Landeshauptmannschaft, 1898 in ein Gouvernement umgewandelt.

Als dann im Verlauf des Kampfes mit Witbooi die erforderlich gewordene Besetzung des Namalandes eine weitere Verstärkung der Schutztruppe notwendig machte, erschien das Beibehalten einer verhältnismäßig so bedeutenden Truppe im Rahmen einer Privattruppe doch bedenklich. Sowohl die Dienstverpflichtung wie die disziplinaren Verhältnisse waren lediglich auf die Person des Kommandeurs zugeschnitten.[49] Diese Bedenken wurden sowohl in Windhuk als in Berlin gleichmäßig wie gleichzeitig erwogen. Denn, sich kreuzend mit dem diesseitigen Antrage, traf zugleich mit der weiteren Verstärkung 1894 eine Allerhöchste Kabinettsordre ein, mittels der die Schutztruppe in eine Kaiserliche umgewandelt wurde. Das Jahr 1894 muß mithin als das eigentliche Geburtsjahr der heutigen Kaiserlichen Schutztruppe Südwestafrikas betrachtet werden. Ihre Stärke betrug in dem genannten Jahre 15 Offiziere und rund 500 Mann. Von diesen führten 250 Mann den letzten Kampf gegen Witbooi in der Naukluft durch, während 300 Mann in 15 Stationen das Namaland und das Südhereroland besetzt hielten.
Die oberste militärische Behörde der Schutztruppe in der Heimat war bis 1896 das Reichsmarineamt gewesen, in bezug auf Verwendung dagegen unterstand sie dem Reichskanzler. Dieser Dualismus erwies sich auf die Dauer als unhaltbar. 1896 wurde daher für die drei afrikanischen Schutztruppen das jetzt noch bestehende Oberkommando eingerichtet, an dessen Spitze der Reichskanzler steht. Diesem ist ein militärischer Stab unter einem älteren Stabsoffizier[50] beigegeben. Mit Stellvertretung des Reichskanzlers, auch in bezug auf das Oberkommando, ist bis jetzt mittels besonderer Kabinettsordre stets der jeweilige Kolonialdirektor betraut worden.
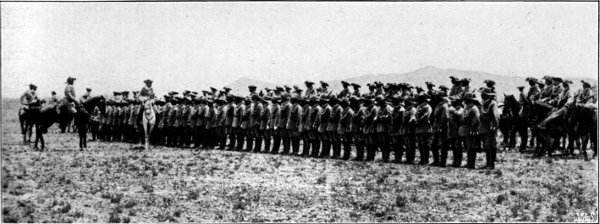
Die Notwendigkeit, das Schutzgebiet behufs Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit mit einem Netz von Stationen besetzt zu halten, brachte es ferner mit sich, daß die Truppe auch nach Beendigung des Witbooikrieges in zwei Teile zerlegt blieb, von denen der kleinere in zwei Feldkompagnien und einer Artillerie-Abteilung in Windhuk vereinigt wurde, der größere Teil auf die zu Distriktsverbänden zusammengeschlossenen Stationen fiel. 1895 finden wir sieben Militärdistrikte mit 35 Stationen. Neben Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe und Ordnung hatten die Distriktstruppen, an deren Spitze damals ausschließlich Offiziere standen, auch die erforderlichen polizeilichen und Verwaltungsaufgaben zu erfüllen. Mit fortschreitender Gewöhnung der Eingeborenen an unsere Herrschaft wurden schließlich die letzteren zur Hauptaufgabe der Distrikte, während die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe lediglich der Feldtruppe überlassen blieb. Indessen durfte[S. 212] dann diese nicht mehr in Windhuk versammelt bleiben, sondern mußte gleichfalls auf das ganze Land verteilt werden. So finden wir Ende 1896 vier Feldkompagnien und eine Feldbatterie zu einer Feldtruppe vereinigt, von der damals noch drei Kompagnien und die Batterie in Windhuk standen und eine Kompagnie in Outjo. 1897 wurde dann eine Feldkompagnie nach Keetmanshoop verlegt und 1898 eine solche nach Omaruru. In Windhuk verblieben von da ab nur noch der Stab, die 1. Feldkompagnie und die Feldbatterie.
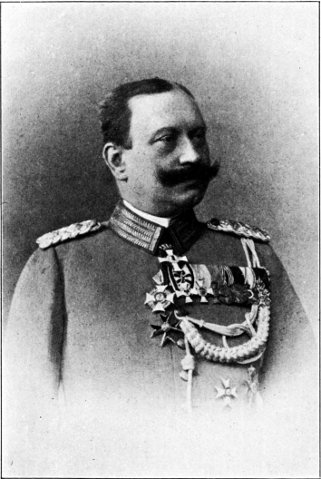
Der Etat der Truppe hatte durch die wegen des Aufstandes der Osthereros und der Khauas-Hottentotten gesendete Verstärkung im Jahre 1896 abermals eine Erhöhung erfahren. Er betrug am Ende des genannten Jahres 33 Offiziere, einschließlich 5 Sanitätsoffiziere, und rund 900 Mann. Infolge späterer Zurücksendung eines Teiles der Verstärkung sank der Etat 1897 wieder auf 31 Offiziere und rund 700 Mann herab. Im Jahre 1902 erfolgte durch Formierung einer Gebirgsbatterie abermals eine Erhöhung um 60 Mann nebst drei Militärunterbeamten, so daß der Etat wieder 42 Offiziere und Sanitätsoffiziere, 1 Roßarzt und rund 780 Unteroffiziere und Mannschaften betrug. In dieser Stärke verblieb die Truppe bis zum Hereroaufstand, und zwar mit etwa 500 Köpfen bei der Feldtruppe und 280 bei den Polizeitruppen. Unter den letzteren waren 30 bis 40 auch im Zolldienst verwendet, teils ausschließlich, teils in Verbindung mit dem Polizeidienst. Die Feldtruppe war stets zum Ausmarsch bereit, nicht aber zur sofortigen gemeinsamen Verwendung, da sie auf einen Raum so groß wie Deutschland verteilt werden mußte. Der in Windhuk stationierte Teil der Feldtruppe konnte ebensogut im Norden wie im Süden verwendet werden.[S. 215] Infolgedessen konnten im Norden in etwa 14 Tagen drei Kompagnien und eine Batterie zur Verwendung gegen die Hereros vereinigt stehen (1., 2. und 4. Kompagnie), im Süden in etwa drei Wochen zwei Kompagnien (1. und 3. Kompagnie) und eine Batterie gegen die Hottentotten. Für die Niederwerfung eines allgemeinen Aufstandes war diese Truppenmacht natürlich nicht berechnet. Sie hatte lediglich die Aufgabe, schon durch ihre Anwesenheit die Aufrechterhaltung des Friedens zu sichern und im Falle eines Aufstandes als Kern für die eingeborenen Hilfstruppen zu dienen, die sich um sie zu gruppieren hatten. Ihre Stärke war daher auf der Voraussetzung gegründet, daß es stets gelingen würde, die Eingeborenen auf diplomatischem Wege zu trennen und einen Stamm gegen den andern auszuspielen. Und daß dies in der Tat 10 Jahre lang gelungen ist, darin liegt das Geheimnis der Tatsache, daß eine Truppe von 300 bis 700 Köpfen in dieser ganzen Zeit in einem Lande den allgemeinen Frieden aufrechterhalten konnte, in welchem ihn in den Jahren 1904/06 eine solche in der Stärke bis zu 15000 Mann nicht völlig wiederherzustellen vermochte.

| Diestel, gefallen 2.9.94 bei Gams. | Lampe, gefallen 6.4.96 bei Gobabis. |
| Schmidt, gefallen 6.5.96 bei Otjunda. | |

Eine wesentliche, zunächst aber nur in den Listen erscheinende Verstärkung hatte die Schutztruppe infolge der auf diesseitigen Antrag 1896 mittels Allerhöchster Verordnung im Schutzgebiet eingeführten allgemeinen Wehrpflicht erhalten. Sämtliche im Schutzgebiet sich aufhaltenden Mannschaften des Beurlaubtenstandes unterlagen von dem genannten Jahre ab in Fällen der Gefahr der Einziehung bei der Schutztruppe. Diese Einziehung hatte durch Kaiserliche Ordre zu erfolgen, konnte jedoch im Falle der Dringlichkeit,[S. 216] vorbehaltlich nachträglich einzuholender Allerhöchster Bestätigung, auch durch den Gouverneur angeordnet werden. Zu diesem Zweck wurden die wehrpflichtigen Personen unter militärische Kontrolle genommen und die Gestellungsordres für jeden einzelnen auf den Distriktskommandos bereitgelegt sowie auf dem laufenden erhalten. Bei Beginn des Hereroaufstandes hatte die Zahl der Wehrpflichtigen im ganzen Schutzgebiet die Höhe von rund 750 Köpfen erreicht, deren Einziehung durchweg rechtzeitig gelang.

Einer besonderen Kategorie von Wehrpflichtigen ist hier noch Erwähnung zu tun, nämlich der Söhne derjenigen Buren, die die deutsche Reichsangehörigkeit angenommen hatten und die daher gleichfalls der Dienstpflicht unterworfen waren. 1903 betrug die Zahl der militärisch ausgebildeten Buren 15 Köpfe.

In dieser Kategorie sind zunächst die Bastards zu nennen. Wie bereits erwähnt, wurde von 1895 ab auf Grund eines besonderen Vertrages die wehrfähige Jugend der Rehobother Bastards in alljährlich wechselndem[S. 217] Turnus sechs Wochen lang ausgebildet. Wenn einmal ausgebildet, unterlagen sie 12 Jahre lang in Kriegszeiten der Einziehung und in Friedenszeiten der Verpflichtung, sich alljährlich zu einem vierwöchentlichen Wiederholungskurse zu stellen. Sie bildeten daher eine Miliztruppe nach schweizerischem Muster und waren für die südwestafrikanischen Verhältnisse unter der Führung tüchtiger Offiziere ganz besonders brauchbar. Der in Rehoboth stationierte Offizier, zugleich Distriktschef, hatte die Bastards im Frieden auszubilden und im Kriege zu führen. Ich betone auch hier wieder, daß man bei unseren südwestafrikanischen Eingeborenen die europäischen Führer ohne zwingenden Grund nicht wechseln soll. Haben die Eingeborenen einmal Vertrauen zu ihrem Führer gefaßt, so kann dieser das Höchste von ihnen verlangen, während sie unter einem ihnen fremden Führer, mag dieser auch den andern[S. 218] an persönlichen Eigenschaften übertreffen, leicht versagen. Der letzte Führer der Bastards war der jetzige Hauptmann Böttlin. Unter diesem haben sie in der Zahl von 70 bis 80 Köpfen an der Niederwerfung des Bondelzwartsaufstandes und, daran anschließend, an derjenigen des Hereroaufstandes teilgenommen; von ihr sind sie im November 1904 — mithin nach einem ununterbrochenen einjährigen Feldzuge — nach Rehoboth zurückgekehrt. Nach kurzer Ruhepause sind sie dann zur Verteidigung ihres eigenen Landes gegen die mittlerweile aufgestandenen Witboois wieder eingezogen worden und haben, wie die ganze Zeit über, auch jetzt nur Gutes geleistet.

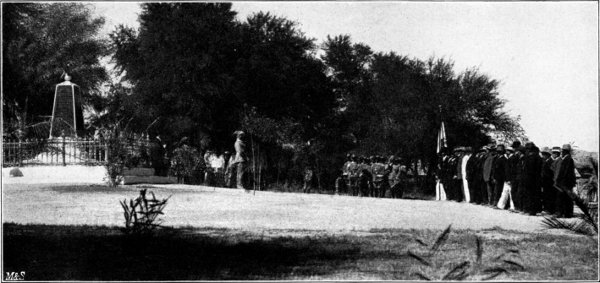
Ferner gab es noch eingeborene Polizisten und Soldaten, deren Annahme mittels ein- bis zweijährigen Kontraktes den Kompagnie- und Distriktchefs überlassen war.[51] Auch sie waren militärisch ausgebildet und haben, wenn richtig behandelt und verwendet, der Truppe stets gute Dienste geleistet. Bei Aufständen der eigenen Stammesgenossen versagten sie indessen zuweilen und gingen zu jenen über. Manchmal geschah dies auch aus Furcht, sie würden unserseits für das Tun ihrer Stammesgenossen mit haftbar gemacht werden. Indessen sind auch in solchen Fällen zahlreiche Züge von Treue bekannt geworden. So haben z. B. während des Hereroaufstandes 1904 die Hereropolizisten im Distrikt Grootfontein bei ihrem Distriktschef, Oberleutnant Volkmann, ausgehalten und mit gegen ihre Stammesgenossen gekämpft. Ebenso hat die Truppe während des jetzigen allgemeinen Hottentottenaufstandes[S. 219] immer noch eingeborene Soldaten besessen, unter denen zweifellos auch Stammesangehörige der Aufständischen gewesen sind. Vor dem Aufstande mag die höchste Zahl der ausgebildeten eingeborenen Soldaten und Polizisten bei der Truppe 130 betragen haben.
In bezug auf die Stellung des Gouverneurs zur Schutztruppe bestimmt die Allerhöchste Kabinettsordre vom 16. Juli 1896 folgendes:
»Die in den afrikanischen Schutzgebieten zur Verwendung gelangenden Schutztruppen werden dem Reichskanzler unterstellt. In weiterer Folge unterstehen sie dem betreffenden Gouverneur oder Landeshauptmann und demnächst dem Kommandeur. Ob und inwieweit diese Unterstellung unter den Gouverneur bzw. Landeshauptmann eintretendenfalls auf deren Stellvertreter überzugehen hat, bestimmt der Reichskanzler.«
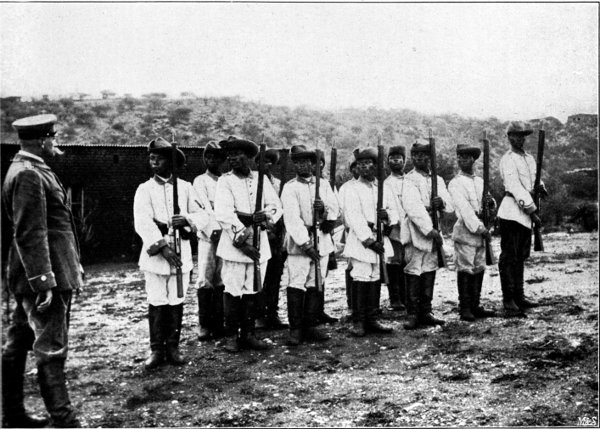
⋁
Hauptmann Kliefoth,
Gefallen am 17.12.05
bei Toasis.
Die eingeborenen Soldaten der 1. Kompagnie in Windhuk 1901.
Die schwierige Frage, in welches Verhältnis hiernach ein Gouverneur, falls er nicht selbst Soldat ist, zur Schutztruppe treten soll, hat die Schutztruppen-Ordnung in sehr glücklicher Weise gelöst. Sie bestimmt hierüber folgendes:
»Dem Gouverneur steht die oberste militärische Gewalt im Schutzgebiete zu. Er kann die Schutztruppe nach eigenem Ermessen sowohl im ganzen wie in ihren einzelnen Teilen zu militärischen Unternehmungen verwenden. Von ihm wird das Verhältnis der obersten Verwaltungschefs zu den in ihren Bezirken befindlichen Teilen der Schutztruppe mit der Maßgabe geregelt, daß alle militärischen Anordnungen lediglich von dem Führer der Schutztruppe verantwortlich getroffen werden. Er darf zu Zwecken der Zivilverwaltung Teile der Schutztruppe so weit verwenden, als die militärischen Rücksichten nicht entgegenstehen. Über diese hat er vorher den Kommandeur zu hören.«
»Er erläßt seine Weisungen für die Schutztruppe an den Kommandeur. Sollte er sich ausnahmsweise veranlaßt sehen, einzelnen Personen oder Unterabteilungen Befehle unmittelbar zugehen zu lassen, so hat er hiervon alsbald dem Kommandeur Mitteilung zu machen. Ob und inwieweit die Befugnisse des Gouverneurs eintretendenfalls auf dessen Stellvertreter überzugehen haben, bestimmt der Reichskanzler.« usw.
»Hat der Kommandeur in militärischer Beziehung gegen Anordnungen des Gouverneurs Bedenken, so ist er verpflichtet, dieselben zur Sprache zu bringen. Beharrt der Gouverneur auf seinen Anordnungen, so hat der Kommandeur sie auszuführen, kann aber unter Mitteilung an den Gouverneur an das Oberkommando der Schutztruppen berichten, das hierüber entscheidet. Gegen diese Entscheidung steht sowohl dem Gouverneur als auch dem Kommandeur der Rekurs an Seine Majestät den Kaiser zu.«
»In allen Angelegenheiten der Truppe, die eine höhere Entscheidung als die des Gouverneurs erfordern, ist durch Vermittlung und unter Äußerung des letzteren an das Oberkommando der Schutztruppen zu berichten.«
Folgerichtig mußte hiernach — als einziger Fall in der ganzen deutschen Armee — auch einem Nichtsoldaten der Schutztruppe gegenüber eine Disziplinarstrafgewalt eingeräumt werden, und zwar ist dem Reichskanzler diejenige eines kommandierenden Generals, dem Gouverneur diejenige eines Divisionskommandeurs übertragen. In der Praxis ist die Frage der Unterstellung der Schutztruppe unter einen Zivilbeamten bei uns bis jetzt nur in Kamerun Tatsache geworden. Denn in Südwestafrika ist bis zu der Ernennung des Herrn v. Lindequist das Amt des Gouverneurs mit dem des Truppenkommandeurs in einer Hand vereinigt gewesen, da der erstere selbst Offizier war. Ebenso ist dies in Ostafrika mit einer kurzen Ausnahme bis zur Berufung des Herrn Frhr. v. Rechenberg der Fall gewesen.
[S. 221] Ferner tritt der Gouverneur auch hinsichtlich der Wehrpflicht in Beziehung zur Schutztruppe. Nach §§ 6 und 7 der Allerhöchsten Verordnung vom 5. Dezember 1902 hat er bei Bestimmung der Einstellungstermine für die Dienstpflichtigen mitzuwirken und kann die letzteren nach Anhörung des Kommandeurs vor Ablauf der gesetzlichen Dienstzeit wieder entlassen. Daß er ferner berechtigt ist, in Fällen der Gefahr, vorbehaltlich nachträglicher Allerhöchster Genehmigung, die Wehrpflichtigen zur Schutztruppe einzuberufen, habe ich bereits erwähnt.

In der Zivilverwaltung sind dem Gouverneur naturgemäß noch weitergehende Machtbefugnisse eingeräumt. Gesetzlich ist er in seinen Amtshandlungen nur durch die Unterstellung unter seine vorgesetzte Behörde in Berlin beschränkt. Das in den Schutzgebieten Seiner Majestät dem Kaiser auf allen Gebieten der Verwaltung zustehende Verordnungsrecht ist zum Teil auf ihn übertragen. Er kann in seinen Verordnungen als Strafmaß bis zu drei Monaten Gefängnis sowie Geldstrafe von unbegrenzter Höhe androhen.
Trotz dieser anscheinend unbeschränkten Machtbefugnisse war indessen die Stellung des Gouverneurs bis jetzt nichts weniger als eine leichte. Ein[S. 222]gezwängt zwischen Weißen und Eingeborenen, die beide seiner Sorge anvertraut sind, sollte er den meist widerstreitenden Interessen beider gerecht werden. Legte er mehr Gewicht auf diejenigen der Weißen, so setzte er sich dem Vorwurf der Unterdrückung der Eingeborenen und der Heraufbeschwörung von Aufständen aus, im entgegengesetzten Falle aber demjenigen der Vernachlässigung der wirtschaftlichen Entwicklung der Kolonie sowie der Zurücksetzung seiner eigenen Rasse. Dazu hatte der Gouverneur von Deutsch-Südwestafrika mit Eingeborenenstämmen zu rechnen, die nicht unterworfen, sondern lediglich durch freiwillig eingegangene Verträge an uns gebunden waren. Da infolgedessen nicht klar ausgesprochen war, welche von beiden Rassen die herrschende sei, wollten sie es beide sein.
Eine gewisse Herrenstellung der Weißen lag jedoch in der Rechtspflege auch jetzt schon vor. Bei Streitigkeiten zwischen Angehörigen beider Rassen unterstand der Weiße auf Grund der Verträge lediglich der Gerichtsbarkeit seiner Stammesgenossen, der Eingeborene dagegen derjenigen der Weißen, unter ganz geringer Beteiligung seiner eigenen Leute. Naturgemäß trat bald zutage, daß der Weiße Leben und Eigentum seiner Stammesgenossen höher einschätzte als dasjenige der Eingeborenen. Das Odium hierfür den Eingeborenen gegenüber mußte jedoch der Gouverneur auf sich nehmen. Denn diese verstanden es nicht, daß auf das Gerichtsverfahren gegen Weiße dem Gouverneur keinerlei Einfluß zufiel. Liegt doch nach ihren Rechtsbegriffen alle Gewalt im Staate, auch die Rechtsprechung, in den Händen des Häuptlings. Die Weißen dagegen verstanden zum Teil nicht, daß der Gouverneur auch für die Rechte der Eingeborenen zu sorgen habe. Vielmehr waren sie geneigt, ihn als das Haupt ihrer, d. h. der weißen Regierung ausschließlich für sich in Beschlag[52] zu nehmen und so in das Schutzgebiet zwei Regierungen, eine weiße und eine eingeborene, hineinzukonstruieren.
Indem ich auf die Rechtspflege der Eingeborenen in dem nächsten Kapitel noch des näheren zu sprechen kommen werde, will ich hier nur einen Fall erwähnen: Im Frühjahr 1903 erschoß ein Weißer in der Trunkenheit ein friedlich in einem Wagen schlafendes Hereroweib, weil er sich von Hereros angegriffen wähnte und nun blindlings um sich herumschoß. Die Gerichtsverhandlung ergab das gänzlich Unbegründete des seitens des Weißen vermuteten Hereroangriffs. Es hatte sich lediglich um die Halluzinationen[S. 223] eines nicht mehr nüchternen Menschen gehandelt. Trotzdem sprachen in dem Verfahren erster Instanz die Beisitzer den Weißen frei, weil sie annahmen, er habe in gutem Glauben gehandelt. Diese Freisprechung erregte im Hererolande ungeheures Aufsehen, zumal es sich bei der Ermordeten um eine Häuptlingstochter gehandelt hatte. Überall frug man sich, ob denn die Weißen das Recht hätten, eingeborene Frauen zu erschießen. Ich reiste damals persönlich nach dem Hereroland, um zu beruhigen, wo ich konnte, sowie auch, um den Eingeborenen klarzumachen, daß ich mit dem Urteil nicht einverstanden sei, aber keinen Einfluß auf dasselbe gehabt habe. Glücklicherweise hatte in dem vorliegenden Falle der Staatsanwalt rechtzeitig Berufung eingelegt. Der Angeklagte wurde dann bei dem Obergericht in Windhuk zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Zu der Erregung unter den Hereros, die dem ein halbes Jahr später ausbrechenden Aufstand vorausging, hatte dieser Fall jedoch bereits seinen Teil beigetragen.
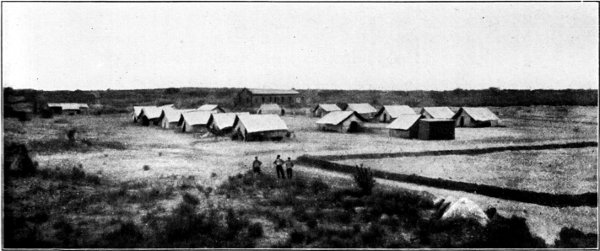
Alles in allem ist die Stellung des Gouverneurs in Südwestafrika bis jetzt keine beneidenswerte gewesen. Er war eingeengt zwischen der Zentralgewalt in Berlin, den Rücksichten auf den Reichstag, den Anforderungen der weißen Bevölkerung des Schutzgebietes, der Sorge für eine humane Behandlung der Eingeborenen und — last not least — den Rassegegensätzen. Neben diesen Schwierigkeiten lief dann noch ein langjähriger Kampf mit den großen Konzessionsgesellschaften des Schutzgebietes, deren Interessen mit denjenigen des Allgemeinwohls auch nicht immer in Einklang zu bringen waren.

Das Streben, die Militärdistrikte nach und nach lediglich mit Verwaltungsaufgaben zu betrauen, führte von selbst zu deren allmählicher Umgestaltung in Polizeidistrikte, die den nächsthöheren Verwaltungskörpern, d. i. den Bezirksämtern,[53] angegliedert wurden. Die bisherigen, für beide Verwaltungen getrennten Instruktionen wurden nunmehr in eine gemeinsame umgewandelt, die in Anlage 1 wiedergegeben ist. Die Bezirksämter waren in der Regel mit Zivilbeamten besetzt, die Distrikte mit Offizieren, doch gab es, wie das nachfolgende Verzeichnis bezeugt, in beiden Fällen auch Ausnahmen. Im allgemeinen herrschte bei der Kolonialverwaltung das Bestreben, die Verwaltungsstellen allmählich sämtlich mit Zivilbeamten zu besetzen. Auch die Ersetzung der bisher von der Truppe abkommandierten Polizisten durch ein Zivilpolizeikorps nach dem Muster der heimatlichen Schutzmannschaften war bei Beginn des Hereroaufstandes bereits beschlossene Sache und ist nur infolge desselben vertagt worden. Einzelne Zivilpolizisten, durchweg ehemalige Angehörige der Schutztruppe, waren jedoch zur Entlastung der letzteren auch jetzt schon angeworben worden.
Im Jahre 1903 gab es im Schutzgebiet sechs Bezirksämter mit 13 diesen unterstellten Distriktsverwaltungen. Daneben bestanden noch zwei infolge besonderer Umstände erhalten gebliebene selbständige Militärdistrikte, deren[S. 225] Umwandlung in Bezirksämter jedoch auch nur eine Frage der Zeit war. Die Besetzung der Bezirksämter und Militärdistrikte war bei Beginn des Bondelzwartsaufstandes, wie folgt:

Bezirksamt Outjo: Hauptmann Kliefoth. Distriktsamt Seßfontein: Oberleutnant Frhr. v. Schönau-Wehr.
Bezirksamt Omaruru: Hauptmann Franke. Distriktsamt Karibib: Zivildistriktschef Kuhn.
Bezirksamt Swakopmund: Bezirksamtmann Dr. Fuchs.
Bezirksamt Windhuk: Bergrat Duft. Distriktsamt Okahandja: Zivildistriktschef Zürn; Distriktsamt Rehoboth: Oberleutnant Böttlin.
Bezirksamt Gibeon: Bezirksamtmann v. Burgsdorff. Distriktsamt Maltahöhe: Oberleutnant Graf v. Kageneck.
Bezirksamt Keetmanshoop: Bezirksamtmann Dr. v. Eschstruth. Distriktsamt Bethanien: Zivildistriktschef Wasserfall. Distriktsamt Warmbad: Stellvertretender Distriktschef Leutnant Jobst. (Zivildistriktschef Dr. Merensky war zur Vertretung des noch nicht eingetroffenen neuen Bezirksamtmanns abkommandiert).
Militärdistrikt Gobabis: Oberleutnant Streitwolf.
Militärdistrikt Grootfontein: Oberleutnant Volkmann.
Von den sechs Bezirksämtern waren mithin zwei, Outjo und Omaruru, durch Offiziere besetzt, die gleichzeitig die an den genannten Plätzen[S. 226] stationierten Kompagnien (4. und 2.) zu führen hatten. Von den 13 Polizeidistrikten wurden diejenigen sechs, deren Hauptorte mit dem Sitze des Bezirksamtmanns zusammenfielen, von diesem gleichzeitig mitverwaltet. Die übrigen sieben unterstanden drei Offizieren und vier Zivilbeamten, unter letzteren drei ehemalige Offiziere. Der nominell zum Bezirk Omaruru gehörende Distrikt Karibib war wegen der näheren Verbindung mit dem Gouvernement 1901 vom Bezirksamt Omaruru losgelöst und selbständig gestellt worden. Dessen förmliche Umwandlung in ein Bezirksamt ist bei seiner starken weißen Besiedlung im übrigen gleichfalls nur eine Frage der Zeit.
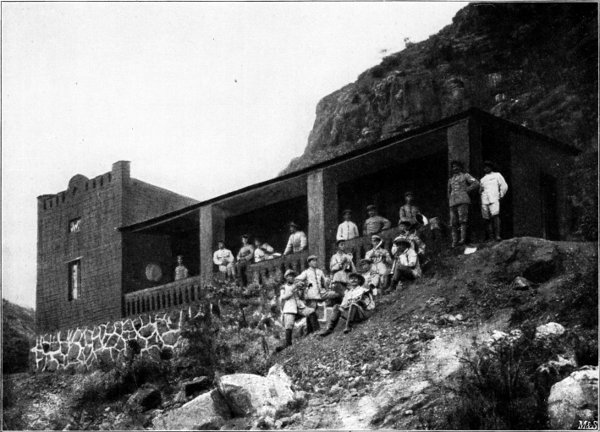
Mit Ausnahme der beiden genannten Fälle, in denen die Bezirksamtmänner zugleich Kompagniechefs waren, war die Trennung zwischen Militär- und Zivilgewalt scharf durchgeführt. Die zur Polizei abkommandierten Unteroffiziere und Mannschaften hatten mit der Truppe dienstlich nur insoweit zu tun, als es die disziplinaren Verhältnisse, die Uniform und die Ausrüstung sowie die Ausbildung — die letztere beschränkte sich auf Reiten und Schießen — bedingten. Eine Versetzung von der Feld- zur Polizeitruppe und umgekehrt konnte auch in denjenigen zwei Bezirken, in denen[S. 227] der Bezirksamtmann zugleich Kompagniechef war, nur durch den Gouverneur verfügt werden. Ebenso waren Fahrzeuge, Reit- und Zugtiere für beide Verwaltungen scharf getrennt. Immerhin blieben zwischen diesen noch mancherlei Reibungsflächen bestehen, wie solche zu den kolonialen Eigentümlichkeiten zu gehören scheinen. Im allgemeinen aber hat der Verwaltungsmechanismus, der, soweit die Kriegsverhältnisse dies gestatteten, bis zum heutigen Tage aufrechterhalten geblieben ist, gut ineinander gegriffen.

Ursprünglich hatten die Bezirksamtmänner, soweit sie juristisch gebildete Beamte waren, nebenamtlich auch als Richter zu funktionieren. Mit Zunahme der weißen Bevölkerung wurde indessen dieser Zustand unhaltbar. Es ging nicht an, daß der Bezirksamtmann auf erfolgte Berufung über beanstandete Verwaltungsmaßnahmen dann in seiner Eigenschaft als Richter gegen sich selbst entschied. 1903 finden wir daher das Schutzgebiet in drei große Gerichtsbezirke geteilt mit dem Sitz der Richter in Keetmanshoop, Windhuk und Swakopmund (Dr. Forkel, Dr. Schottelius, Dr. Oswald). Außerdem bestand in Windhuk ein Obergericht mit einem eigenen Richter (Oberrichter Richter).
Auch die Gerichtsverwaltung nahm mangels eigener Kräfte diejenigen der Schutztruppe mit in Anspruch. Namentlich empfand letztere störend die Übermittlung von Vorladungen und Zahlungsbefehlen an einzeln wohnende Farmer, die bei den ungeheuren Entfernungen große Anforderungen an das Pferdematerial stellte.
Zum ersten Male fand in Südwestafrika die Heranziehung der Bevölkerung zur Beratung bei einer Verwaltungsmaßnahme anläßlich der 1895[S. 228] zur Einführung gelangenden Eingangszölle statt. Es traten damals zu diesem Zweck die Kaufleute von Windhuk und der nächstliegenden größeren Plätze, die aber zum Teil schon Ritte bis zu fünf Tagen zu machen hatten, zur gemeinsamen Beratung unter Leitung des zuständigen Ressortbeamten zusammen. In der Folge wurde dann vor Ergreifung von Maßnahmen wichtiger Art seitens des Gouvernements mit Vertrauenspersonen aus der Bevölkerung verhandelt. Zu einer Zeit, in der die Masse der deutschen Einwanderung sich auf Windhuk und Umgegend beschränkte, genügte dies Verfahren auch. Als aber die Verwaltung immer mehr dezentralisiert werden mußte, erwies sich als zweckmäßig, auch jedem Bezirksamtmann seine Berater aus der Bevölkerung zur Seite zu stellen und dies als dauernde Einrichtung beizubehalten. Das geschah mittels Gouvernementsverfügung vom 18. Dezember 1899, in der u. a. ausgeführt ist:

»Es kann im Gegenteil den Verwaltungsbeamten nur von Wert sein, wenn sie ihre gesetzgeberischen Maßnahmen nicht lediglich vom grünen Tische beschließen, sondern vorher die Ansichten der Bevölkerung kennen lernen. Beim Gouvernement selbst ist diese Gepflogenheit bis jetzt im allgemeinen bereits eingehalten worden. Doch ist hierbei die Erfahrung gemacht, daß öffentliche Versammlungen, zu denen jeder Zutritt hat, sich weniger zu dem gedachten Zweck eignen, da in diesen die mit der besten Sprachgewandtheit begabten Elemente das größte Wort führen und die weniger gewandten und daher in der Regel auch bescheideneren Elemente zurückzudrängen pflegen. Infolgedessen ist es vorzuziehen, lediglich mit Vertrauenspersonen aus der Zivilbevölkerung zu verhandeln und diesen die weiteren Verhandlungen mit ihren Mitbürgern zu überlassen.«
[S. 229] Des weiteren wurde die Zahl der Beiräte für jeden Bezirk auf drei festgesetzt, und zwar sollte unter dieser Zahl der Stand der Kaufleute, der Farmer und Handwerker durch je ein Mitglied vertreten sein. Bezüglich der Wahl wurde angeordnet:
»Ob der Bezirksamtmann sich diese Personen selbst wählt, oder sie sich durch die Bevölkerung präsentieren läßt, hängt von den örtlichen Verhältnissen ab. Im allgemeinen ist aus naheliegenden Gründen das letztere vorzuziehen, jedoch nicht immer durchführbar. Die Mandate sind alljährlich am 1. Januar zu erneuern. Einer Wiederernennung der bisherigen Mitglieder steht indessen nichts im Wege.«
Von einer Wahl der Beiräte durch die Bevölkerung mußte anfänglich an solchen Plätzen abgesehen werden, an denen eine nennenswerte Anzahl von Reichsdeutschen noch nicht vorhanden war. Denn, wenn auch nicht direkt angeordnet, so wurde doch stillschweigend darauf gehalten, daß der Beirat möglichst nur aus deutschen Reichsangehörigen bestände.
Diesen Beirat vor jeder gesetzgeberischen Maßnahme zu hören, war der Bezirksamtmann verpflichtet. Der Gouverneur selbst hielt sich zu dem gleichen Zweck an den Beirat von Windhuk, der in einem solchen Fall durch die jeweilige Einberufung von drei weiteren Mitgliedern auf sechs erhöht wurde. Inzwischen ist unter dem 4. Dezember 1904 eine Verordnung des Herrn Reichskanzlers, betreffend die Bildung eines besonderen Gouvernementsbeirats für die Kolonien, erschienen. Der letztere setzt sich aus dem Gouverneur und einer Anzahl amtlicher und nichtamtlicher Mitglieder zusammen. Die Mindestzahl der nichtamtlichen Mitglieder muß drei betragen, während die Zahl der amtlichen Mitglieder diejenige der ersteren nicht überschreiten darf. Die amtlichen Mitglieder ernennt der Gouverneur, die nichtamtlichen beruft er nach gutachtlicher Anhörung von Berufskreisen. Die nichtamtlichen Mitglieder sollen ihren Wohnsitz möglichst am Sitze des Gouvernements oder in dessen Nähe haben. Die Rechte des Gouvernementsbeirats sind:
a) Prüfung des jährlichen Haushaltungsvoranschlages.
b) Prüfung der von dem Gouverneur zu erlassenden Verordnungen.
c) Einbringung von Anträgen auf gesetzgeberische Maßnahmen.
Dem Gouverneur steht dagegen zu:
a) Den Beirat auch zu anderen Angelegenheiten als den vorgenannten einzuberufen.
b) In dringenden Fällen ausnahmsweise von der Vorlage seiner beabsichtigten Maßnahmen an den Gouvernementsbeirat überhaupt abzusehen.
[S. 230] c) Den Anträgen des Beirats zu vorstehend unter c die Beratung zu versagen, wenn sie nicht von mindestens zwei nichtamtlichen Mitgliedern eingebracht worden sind.
In jedem Falle ist ein Protokoll aufzunehmen, das erforderlichenfalls unter Anschluß eines begründenden Berichts seitens des Gouvernements an die Kolonialabteilung in Berlin einzureichen ist.
Ich persönlich habe die Teilnahme der weißen Bevölkerung an den gesetzgeberischen Maßnahmen der Regierung stets für einen Vorteil gehalten, vor allem für den Gouverneur selbst. Namentlich Südwestafrika bedarf dessen angesichts seiner zahlreichen weißen Bevölkerung. Auch müssen dort die Bezirksbeiräte nach bisherigem Muster neben dem Gouvernementsbeirat beibehalten werden. Dürftig ist die jetzt geschaffene parlamentarische Vertretung der Bevölkerung ja immer noch; aber sie bildet eine Grundlage, auf der weitergebaut werden kann. Inwieweit und wie rasch dies geschehen wird, hängt in erster Linie von der Bevölkerung selbst ab. Versteht sie von den ihr überwiesenen, wenn auch noch geringen Rechten den richtigen Gebrauch zu machen, vor allem die Rücksicht auf das allgemeine Wohl über das eigene Interesse zu stellen, so wird ihr auf die Dauer eine größere parlamentarische Mitwirkung weder vorenthalten werden können, noch vorenthalten werden. Eine große Klippe liegt für die Beiräte in dem Umstande, daß sie wohl Ausgaben beschließen können, nicht aber für deren Deckung zu sorgen haben, letzteres vielmehr dem Reiche überlassen müssen. In dieser Beziehung gilt es mithin, weises Maß zu halten und in den beschlossenen Ausgaben stets das Streben für das Allgemeinwohl in den Vordergrund treten zu lassen. Dann wird das alte Vaterland der weiteren Ausgestaltung der parlamentarischen Verhältnisse in den Kolonien seine Mitwirkung gewiß nicht versagen.
Zu erwähnen bleibt noch die im Jahre 1902 erfolgte Errichtung eines besonderen landwirtschaftlichen Beirats am Sitze des Gouvernements in Windhuk, dem später ebensolche in Outjo und Keetmanshoop folgten. Der in Windhuk bestehende landwirtschaftliche Beirat war als sachverständiger Beirat für den Gouverneur gedacht und bestand aus amtlichen und nichtamtlichen Mitgliedern, die in landwirtschaftlichen Fragen für kompetent galten. Die Anregung zu dessen Bildung war aus der Bevölkerung ergangen.
In bezug auf Kirche und Schule war das Wirkungsfeld unter den Eingeborenen vollständig der Mission überlassen, worüber näheres im nächsten[S. 231] Kapitel folgt. Hier interessiert uns dieses Gebiet nur, insoweit die weiße Bevölkerung des Schutzgebietes in Betracht kommt. Auch zwischen dieser und der Mission blieb ein Zusammenhang insofern bestehen, als da, wo die Zahl der weißen Bevölkerung zur Gründung einer eigenen weißen Gemeinde nicht ausreichte, nach gegenseitiger Vereinbarung die Seelsorge für sie seitens der Missionare mit übernommen wurde. Ebenso war in bezug auf die Seelsorge innerhalb der Schutztruppe eine solche Vereinbarung getroffen worden. Für diese Mehrarbeit erhielt die Mission beider Konfessionen einen staatlichen Zuschuß von je 6000 Mark.
Zur Gründung einer besonderen Gemeinde hatte bis jetzt im Schutzgebiet nur die Zahl der Weißen evangelischer Konfessionen in Windhuk gereicht. Diese besitzen einen eigenen Geistlichen, der zur Mission in keinerlei Beziehung steht. Vielmehr befindet sich außer ihm in Windhuk noch ein besonderer evangelischer Missionar; jede der beiden Gemeinden besitzt eine eigene Kirche. Indessen besteht dieser Zustand erst seit 1899; bis dahin war auch in Windhuk die Seelsorge der Weißen durch einen auf Anregung des Gouvernements seitens der Mission entsandten Geistlichen wahrgenommen worden. Dieser hatte dann im Nebenamte die Eingeborenen mit zu besorgen.
Die Seelsorge für die katholische weiße Bevölkerung liegt dagegen noch in den Händen der (katholischen) Mission. Da diese jedoch unter den meist bereits protestantisch getauften Eingeborenen Windhuks ein nennenswertes Arbeitsfeld nicht besitzt, so kann auch dort von einer katholischen weißen Gemeinde mit eigener Seelsorge gesprochen werden. Eine bedeutendere Wirksamkeit unter den Eingeborenen, und zwar überall verbunden mit derjenigen unter den Weißen, übt die katholische Mission nur außerhalb Windhuks aus.
Ähnlich verhält es sich mit den Schulen. Regierungsschulen können nur da eingerichtet werden, wo die Zahl der Schüler dies lohnt. Dies ist bis jetzt nur an den Orten Windhuk, Karibib, Swakopmund, Grootfontein (nördlich), Gibeon und Keetmanshoop der Fall gewesen, und zwar werden diese Schulen von den Kindern aller Konfessionen besucht, sie sind mithin paritätisch. Der Religionsunterricht bleibt den Geistlichen bzw. Missionaren der einzelnen Konfessionen überlassen. Um den auswärts wohnenden Farmern die Unterbringung ihrer Kinder in den mit allen Schulen verbundenen Pensionaten zu erleichtern, bewilligte die Regierung für jedes Kind einen Pensionszuschuß von jährlich 300 Mark. Es sollte dieser namentlich die Buren zur Sendung ihrer Kinder in die Regierungsschulen aneifern. Denn[S. 232] von der Einführung eines allgemeinen Schulzwanges im Schutzgebiete mußte mit Rücksicht auf die oft weitab gelegenen Farmen und die teuren Lebensbedingungen bis jetzt abgesehen werden. Es blieb daher jedem Familienoberhaupt überlassen, in welcher Weise es für den Unterricht seiner Kinder sorgen wollte. Praktisch zur Geltung kam diese Frage indes in der Regel nur für Burenkinder. Die reichsdeutschen Farmer lebten bis jetzt meist noch in junger Ehe und stellten daher nur wenig schulpflichtige Kinder. Die Schülerzahl betrug Mitte 1903 in Windhuk 36, Grootfontein 10, Gibeon 45, Keetmanshoop 20, Swakopmund 13. Sehr viel hat sich auch die katholische Mission dem Unterrichte weißer Kinder ohne Unterschied der Konfession gewidmet. Sie war hierzu umsomehr in der Lage, da sie, weil erst seit dem Jahre 1896 in dem Schutzgebiet, unter den Eingeborenen selbst noch nicht ein sie vollständig beschäftigendes Arbeitsfeld hatte finden können.
Frauenfrage.
Die letzte Aufstellung einer Bevölkerungsstatistik hat im Schutzgebiet am 1. Januar 1903 stattgefunden. Für das Jahr 1904 ist sie infolge des Aufstandes weggefallen.
Am 1. Januar 1903 betrug die gesamte weiße Bevölkerung des Schutzgebietes 4640 Seelen, davon waren 3391 männlichen, 1249 weiblichen Geschlechts. Von den Personen männlichen Geschlechts waren 622 verheiratet, und unter diesen 42 mit eingeborenen Frauen. Der Regierung bzw. Schutztruppe gehörten 939 männliche Personen an.
Nach der Staatsangehörigkeit verteilte sich die weiße Bevölkerung, wie folgt: Deutsche 2998, Kapländer und Buren 973, Engländer 453, Österreicher 40, Schweden und Norweger 35, Russen 19, Holländer 29, sonstige Staatsangehörige 34, ohne Staatsangehörigkeit 101, zusammen 4682.
Bei staatlich gemischten Ehen folgen die Kinder ohne weiteres der Staatsangehörigkeit des Vaters. Dies gilt auch für die Ehen Weißer mit eingeborenen Frauen. Infolgedessen wächst im Schutzgebiet allmählich ein Stamm Bastards mit der Zugehörigkeit zu einer weißen Nation heran. Daß ein Umsichgreifen dieser Rasse nicht wünschenswert sein würde, liegt auf der Hand. Gehoben kann die Gefahr hierzu jedoch nur durch Beseitigen ihrer Ursache werden, nämlich des Mangels an weißen Frauen. Wohin die Verbindung Weißer mit Eingeborenen führen kann, hat in einem Vortrage in Coblenz Bergrat Busse treffend, wie folgt, ausgeführt:

»Es ist eine bekannte Tatsache, daß sich bei Mischehen zwischen Weißen und Farbigen die schlechten Eigenschaften der Eltern auf die Kinder in höherem Grade vererben als die guten. Diese bei den Mestizen in Amerika, den Mischlingen in Ostafrika scharf hervortretende Tatsache hat sich auch bei den Bastards in Südwestafrika bestätigt, die, wenn auch entschieden höher stehend als die Hottentotten, Namas und Buschleute, doch bei weitem unter der Wertstufe ihrer germanischen Voreltern geblieben sind. Und die Ehen, die in neuerer Zeit unter den Augen der Missionare zwischen Weißen und Bastards- und Hottentottenmädchen geschlossen sind, haben kein besseres Resultat erzielt. Nicht die Frau und die Nachkommenschaft steigt herauf zu der Bildungsstufe des weißen Mannes und Vaters, sondern der Mann sinkt zurück auf diejenige der Frau. Sein Haus wird nicht zur Stätte deutschen Wesens und deutschen Familienlebens, sondern er verlumpt und verkommt mehr oder minder in seiner Hütte, die den Stempel durch das Wesen der Frau[S. 234] aufgedrückt erhält und den Mann nach vielleicht anfänglichem Sträuben schließlich in seinem Denken und Handeln auf den Standpunkt und die Sphäre hinabzieht, in der die Frau geboren ist und sich wohlfühlt.« ...
»Überall in der Welt, soweit man in der Geschichte zurückblickt, war, wo ein Volk sich anschickte, neue Gebiete in Besitz zu nehmen und zu besiedeln, die Frauenfrage diejenige Frage, durch deren Entscheidung die Zukunft der Kolonie bestimmt wurde. Und die Entscheidung fiel stets so aus, wie sie den Verhältnissen, dem Charakter und dem sittlichen Standpunkt des kolonisierenden Volkes entsprach. Der Raub der Helena und der Raub der Sabinerinnen zeigt, wie die Frauenfrage im Altertum gelöst wurde. Die Sklavenjagden in Afrika, bei denen es zum großen Teil auf die Frauen abgesehen ist, kennzeichnen die Frauenfrage der Araber und mohammedanischen Völker.«
Auch wir dürfen daher dieser Sache nicht mit verschränkten Armen gegenüberstehen. Andernfalls setzen wir uns der Gefahr aus, in 50 Jahren keine deutsche Kolonie mehr zu haben, sondern eine Bastardkolonie. Und so gewiß wie wir seinerzeit den Ruf gehört haben: »Kuba den Kubanern«, so werden wir dann dort den Ruf hören: »Südwestafrika den Afrikanern«. Denn Kolonien, wenn erstarkt, haben nach den Lehren der Geschichte stets die Neigung, dem Mutterlande, dessen sie nun nicht mehr bedürfen, undankbar den Rücken zu kehren. Und diese Neigung wird umsomehr zum Durchbruch kommen, je mehr die Rassengemeinschaft mit dem Mutterlande unterbunden worden ist. Auf Anregung des Gouvernements erklärte sich daher die Deutsche Kolonial-Gesellschaft unter der tatkräftigen Leitung des Herzogs Johann Albrecht von Mecklenburg bereit, wenigstens dem größten Übelstande zu steuern. In der Zeit von 1896 bis 1902 wurden seitens der Deutschen Kolonial-Gesellschaft unentgeltlich nach Südwestafrika gesendet: 18 Bräute, 21 Dienstmädchen, 18 weibliche Familienangehörige von Farmern. Insgesamt 57 weibliche Personen.
Dem Bedarf gegenüber ist diese Zahl nicht groß, aber sie bedeutet immerhin einen Anfang, und dieser ist bekanntlich in allen Dingen das Schwierigste. Die Mädchen haben sich bis auf wenige Ausnahmen in Südwestafrika verheiratet, meist an ehemalige Angehörige der Schutztruppe. Die bei diesen verkehrenden unverheirateten Kameraden lernten da — zunächst par distance — die Schwestern, Verwandten und Freundinnen der jungen Ehefrau kennen. Auf diese Weise ist noch manche Ehe zustande gekommen. Die Gefahr, daß die unverheirateten Ansiedler aus Mangel an weißen[S. 235] Mädchen sich an Eingeborene hingen, verminderte sich daher von Jahr zu Jahr.[54]
Mit der Zahl der Ehen wuchs auch diejenige der weißen Kinder. Die Beaufsichtigung für diese den durch ihre Berufspflichten abgehaltenen Eltern zu erleichtern, ist in Afrika ein noch dringenderes Erfordernis als in der Heimat. Andernfalls ist ein dauernder Verkehr mit eingeborenen Kindern nicht zu vermeiden, und bei den durchaus verschiedenen sittlichen Anschauungen der beiden Rassen sind letztere keineswegs als wünschenswerte Spielgenossen für weiße Kinder anzusehen. Mit der tatkräftigen Hilfe des Deutschen Frauen-Vereins für die Kolonien wurde daher an die Errichtung eines Kindergartens, zunächst für Windhuk, herangetreten. Der Verein sendete die leitende Schwester, während dessen Abteilung Leipzig allein 6000 Mark bar für den Bau eines eigenen Hauses beisteuerte. Den erforderlichen Rest für das letztere brachte die Gemeinde Windhuk auf. Die Einweihung des Hauses konnte im Dezember 1902 stattfinden. Es hat durchschnittlich 50 Kindern ohne Unterschied der Konfession Aufnahme gewährt.
Im Jahre 1894 gab es im Schutzgebiet nur die einzige Postagentur Windhuk, die 1897 in ein Postamt umgewandelt wurde. Zur Zeit der Eröffnung der Kabelverbindung mit der Heimat, d. i. im April 1899, finden wir im Schutzgebiet bereits 32 Postanstalten, die im Jahre 1903 auf 34 angewachsen waren. Auch der Telegraphenverkehr auf der längs der Bahn eingerichteten Telegraphenlinie wurde der Postbehörde übertragen und dieser desgleichen das Mitbenutzungsrecht an den Militär-Heliographenlinien (siehe Kapitel IV) eingeräumt. Schließlich richtete die Postbehörde in den Jahren 1901 bis 1903 in den Plätzen Swakopmund, Windhuk und Okahandja auch Stadtfernsprecheinrichtungen ein.
An der Spitze des Post- und Telegraphenwesens stand schließlich ein Postdirektor mit dem Sitze in Windhuk. Ihm unterstanden drei Ober- und zehn Unterpostfachbeamte, dazu neun farbige Unterbeamte. Postverbindungen mit Europa bestanden zwei, und zwar eine von Swakopmund aus direkt nach[S. 236] Hamburg und eine zweite über Kapstadt-Southampton nach Cöln. Die Postbeförderungsmittel im Schutzgebiet waren Eisenbahn, Karren und Fußboten. Von den Karrenposten ging eine von Karibib über Omaruru nach Outjo, eine zweite von Windhuk auf der 860 km langen Strecke über Gibeon, Keetmanshoop, Warmbad nach Ramansdrift am Orangefluß. Botenposten gab es zehn nach den kleineren Plätzen mit ein- bis zweiwöchentlichem Turnus, so daß es schließlich keinen einigermaßen nennenswerten Platz im Schutzgebiete ohne Postverbindung gab. Die abseits wohnenden Farmer mußten ihre Verbindung mit der nächsten Poststation selbst herstellen.
Welchen Umfang die Benutzung der Post angenommen hatte, mögen folgende Zahlen beweisen. Es sind in den Postanstalten des Schutzgebietes in dem Jahre 1903/04 insgesamt ein- und ausgegangen: Briefe rund 990000, Postanweisungen rund 36000, Pakete 13000, Zeitungen 1800, Telegramme 19500, Ferngespräche geführt 60000.
Bei den Paketen zeigt sich zwischen den eingegangenen und abgesandten ein bedeutendes Mißverhältnis, indem rund 12000 eingegangen und rund 900 abgegangen sind, mit ein Beweis für die noch bestehende große Abhängigkeit des Schutzgebietes von der Heimat.
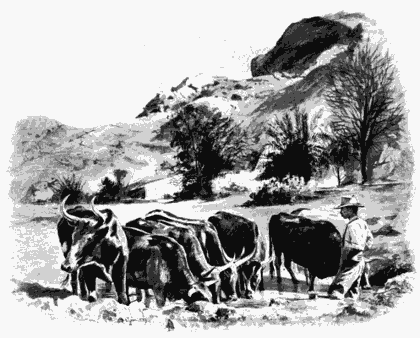
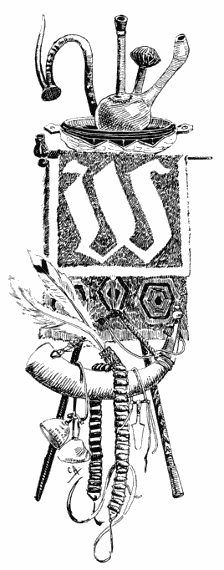
Wie bereits in Kapitel II ausgeführt, gründete sich bisher das Verhältnis der deutschen Regierung zu den Eingeborenenstämmen des Schutzgebietes auf sogenannte Schutzverträge, deren Entstehung und Bedeutung ebendaselbst gewürdigt ist. Inhaltlich glichen sich diese Verträge aber nur annähernd. Die Kapitäne gelobten in ihnen im allgemeinen folgendes: 1. Den deutschen Reichsangehörigen und Schutzgenossen in ihren Gebieten das Recht und die Freiheit des unbeschränkten Reisens und Handelns zu geben; 2. deren Leben und Eigentum zu sichern; 3. anläßlich etwaiger Rechtsstreitigkeiten zwischen beiden Rassen die Gerichtsbarkeit des Deutschen Kaisers anzuerkennen; 4. ohne Zustimmung der deutschen Regierung keinen Grund und Boden abzugeben sowie auch sonst in ihren Gebieten keinerlei Gerechtsame zu erteilen; 5. zur Aufrechterhaltung des Friedens im Schutzgebiete beizutragen und bei Streitigkeiten mit anderen Kapitänen die Entscheidung der deutschen Regierung anzurufen; 6. die für das Schutzgebiet erlassenen deutschen Gesetze anzuerkennen.
Dagegen verpflichtete sich die deutsche Regierung: 1. Dem Kapitän und seinen Leuten Schutz zu gewähren; 2. dem ersteren die Gerichtsbarkeit über seine eigenen Leute zu belassen; 3. dafür zu sorgen bzw. zuzulassen, daß die weißen Leute die Gesetze, Sitten und Gebräuche der Eingeborenen achteten sowie auch die bisher üblichen Abgaben ferner entrichteten.
Man braucht nun aber nicht zu glauben, daß die Häuptlinge etwa wie ein deutscher Student hinter seinem corpus juris hinter ihren Schutzverträgen gesessen haben, um deren Inhalt sich zu eigen zu machen. Auf die einzelnen Bestimmungen der Verträge kam es daher nicht an, es genügte die Tatsache ihres Abschlusses. Die Art der Ausführung hing dann lediglich von der Macht ab, die hinter dem deutschen Vertragschließenden stand. Solange der deutschen Regierung im Schutzgebiete keinerlei Machtmittel zur Seite standen, hatten die Verträge gleich wenig Bedeutung; nachdem sich dies geändert hatte, wurden sie in der Praxis ohne Rücksicht auf die Einzelheiten ihrer Festsetzungen ganz gleichmäßig angewendet. So wurden die Stämme gleichviel, ob und wie diese Sache in den Verträgen geregelt war, sämtlich der deutschen Gesetzgebung wie auch genau dem gleichen Gerichtsverfahren unterworfen und erhielten deutsche Garnisonen. Abgaben seitens Weißer an Eingeborene wurden dagegen, mit Ausnahme des Gebiets der Bastards von Rehoboth, nirgends entrichtet. Hiermit waren die Häuptlinge auch ganz zufrieden, ihnen war über den Inhalt ihrer Verträge nur klar, daß sie einen Teil ihrer Souveränität aufgegeben, aber auch einen wesentlichen Teil behalten hatten. Empfindlich pflegten sie sich nur gegenüber einer wirklichen oder vermeintlichen Verletzung der letzteren zu zeigen.
War bei den Eingeborenen der Beweggrund zum Abschluß solcher die Souveränität beeinträchtigenden Verträge zuerst das Schutzbedürfnis gewesen, so trat bei den späteren — während meiner Amtszeit abgeschlossenen — Verträgen an dessen Stelle die Anwendung von mehr oder weniger sanfter Gewalt. Es geschah dies bei den Verträgen mit 1. Witboois, 2. Khauas-Hottentotten, 3. Franzmann-Hottentotten.
Indessen ganz unumschränkte Machtvollkommenheit hatte der deutsche Regierungsvertreter bei deren Abschluß auch nicht besessen. Die Verträge mit den Khauas- und Franzmann-Hottentotten mußten während des noch fortdauernden Witbooifeldzuges abgeschlossen werden. Ließen es daher die genannten Stämme auf die Anwendung von Waffengewalt ankommen, so drohte uns ein Krieg nach zwei Fronten, damals eine höchst gefährliche Sache. Der Vertrag mit Witbooi dagegen entstand unter dem Eindruck eines Feldzuges, der nach unsäglichen Schwierigkeiten nicht hatte zur völligen Niederwerfung des Gegners führen können.
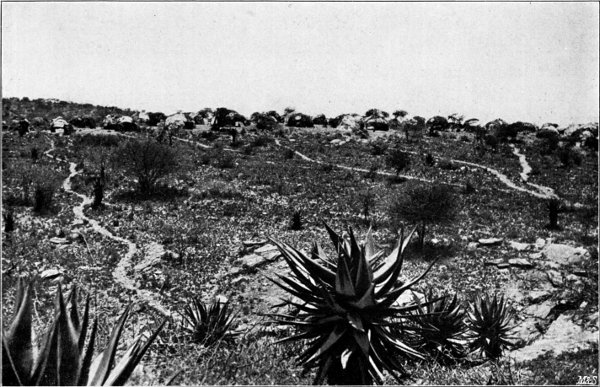
Ferner wurde 1895 noch ein Schutzvertrag mit den weitab im Kaokofeld wohnenden Swartbooi-Hottentotten abgeschlossen. Dieser Stamm bot nach Beendigung des Witbooikrieges den Abschluß eines solchen von selbst[S. 239] an, in der Hoffnung, durch den Vertrag gegen die sie von allen Seiten bedrängenden Hereros, wenn auch nur mittels Lieferung von Waffen und Munition, Schutz zu finden. Als sie sich dann in ihrer Hoffnung getäuscht sahen, fingen sie ihre Umtriebe an, die schließlich zu dem im Kapitel V geschilderten Swartbooiaufstande führten. Von den drei übrigen Stämmen haben die Witboois und die Franzmann-Hottentotten den Vertrag bis zum allgemeinen Aufstand 1904 treu gehalten, obwohl die Kapitäne gerade dieser Stämme dem Abschluß am meisten widerstrebt hatten. Die Witboois mußten in einem eineinhalbjährigen Kriege, die Franzmann-Hottentotten durch die Androhung eines solchen angesichts der zum Gefecht aufmarschierten Truppe dazu gezwungen werden (siehe Kapitel II). Der Kapitän des letztgenannten Stammes, Simon Cooper, fragte mich damals gleich nach vollzogener Unterschrift, wie lange dieser Vertrag gelte, und war über meine Antwort: »Für ewig« sichtlich wenig erfreut. Willig dagegen hatten im März 1894 der stellvertretende Kapitän der Khauas-Hottentotten, Eduard Lambert und seine Großleute unterschrieben, denn es war ihnen angesichts einer in ihrer Werft befindlichen Truppenmacht sowie angesichts ihrer bereits erfolgten[S. 240] Entwaffnung nicht viel anderes übrig geblieben. Dafür haben sie den Vertrag bereits 1896 wieder gebrochen und in Verbindung mit den Osthereros den damaligen Aufstand begonnen. Sie sowohl wie der größte Teil der Swartboois befinden sich jetzt als Kriegsgefangene in Windhuk.
Die Stellung des Gouverneurs den Häuptlingen des Schutzgebietes gegenüber gründete sich infolgedessen lediglich auf Verträge und ähnelte daher derjenigen des jetzigen deutschen Kaisertums den Bundesfürsten gegenüber, insoweit Staatsverträgen mit Eingeborenen überhaupt Wert beigemessen werden kann. Noch mehr stimmt jedoch der Vergleich mit der Stellung des römisch-deutschen Kaisers im Mittelalter zu den Stammesherzögen. Zwar war der erstere nach dem damaligen Lehensrecht gesetzlich der wirkliche Oberherr der letzteren und nicht bloß der »primus inter pares«. Er konnte die Stammesherzöge ein- und absetzen. Indessen nahm man es in der damaligen rohen Zeit mit Gesetz und Recht überhaupt weniger genau, und daher liegt der Vergleich mit dem alten Kaisertum hier näher. Aus der Geschichte wissen wir, wie sehr die Regierungszeiten der alten deutschen Kaiser mit der fortgesetzten Niederschlagung von Aufständen ausgefüllt gewesen sind, wie oft sie einem geschlagenen Rebellen verziehen haben, um diesen später abermals die Fahne des Aufruhrs erheben zu sehen. Bei der hieraus für das Reichsoberhaupt sich ergebenden Notwendigkeit, stets im Reiche herumzuziehen, gelangte das alte deutsche Kaisertum nicht einmal zu einer festen Residenz, und damit das Reich auch zu keinem Mittelpunkt. Indessen würden die alten Kaiser schließlich doch Oberherren in ihrem Reiche geblieben sein, wenn sie sich nicht auf die wenig glückliche italienische Politik eingelassen hätten. Überall in der Weltgeschichte finden wir mithin ein »Wenn« und »Aber«.
Wenn auch die eingeborenen Häuptlinge sich über den Inhalt der Schutzverträge wenig Gedanken gemacht haben, so waren sie sich doch über deren tatsächliches Bestehen völlig im klaren, d. h., sie wußten, daß der Gouverneur als Abgesandter des deutschen Kaisers auf Grund von meist freiwillig eingegangenen Verträgen eine Art Oberherrschaft über sie auszuüben habe. Und diese Freiwilligkeit war die Klippe, an der die Macht des Gouverneurs scheitern konnte. Dieser Gefahr zu begegnen, gab es zwei Wege. Entweder mußten die Verträge umgestürzt und an Stelle der Schutzherrschaft eine auf Waffengewalt gegründete tatsächliche Herrschaft aufgerichtet werden, oder aber der deutsche Regierungsvertreter mußte sich die Kapitäne in die Hände arbeiten, sie so allmählich an die deutsche Herrschaft gewöhnen und mit ihr versöhnen. Im Falle einer trotzdem vorkommenden Widersetz[S. 241]lichkeit konnte dann ein Stamm gegen den andern ausgespielt werden. Die Einschlagung des ersteren Weges, d. h. gewaltsamen Umsturzes der Verträge, war ausgeschlossen. Ihn hätte das alte Vaterland weder verstanden noch gebilligt, bevor der Nachweis von der Ungangbarkeit des zweiten durchaus sicher beigebracht war, und zwar dies nicht mittelst bloßer Überzeugung, sondern mittelst tatsächlicher Beweise. Und diese Beweise hat uns erst das Jahr 1904 gebracht, wenn auch leider mit recht blutigem Lehrgeld. Aber jetzt können wir dafür die aus einer gewaltsamen Unterwerfung der Eingeborenen entspringenden schweren Opfer mit gutem Gewissen in Kauf nehmen.[55]

So wurde denn unter Zustimmung so ziemlich des ganzen Vaterlandes der zweite Weg betreten, der die einmal abgeschlossenen Schutzverträge[S. 242] als zu Recht bestehend beließ. Bei Schonung der Eigentümlichkeiten der Eingeborenen, wie dies durch die Verträge vorgesehen war, bei gerechter und wohlwollender Behandlung, sowie endlich, gestützt auf eine ausreichende Truppenmacht, der sich bei Aufständen immer der eine oder der andere der treugebliebenen Eingeborenenstämme anzugliedern hatte, war die Hoffnung gegeben, die Eingeborenen allmählich an den bestehenden Zustand zu gewöhnen. Von der alten Selbständigkeit mußte ihnen schließlich nichts mehr bleiben als die Erinnerung. Hand in Hand mit einer solchen Friedenspolitik konnte in Fällen von Unbotmäßigkeit eine allmähliche Entwaffnung der Eingeborenen, verbunden mit Auflösung der Stammesverbände, gehen, wie das auch tatsächlich schon teilweise geschehen war. Dieser Weg erforderte jedoch Geduld, nicht nur von seiten der Regierung, sondern auch von seiten aller weißen Einwanderer, und hieran hat es zum Teil gefehlt. Vielen Weißen war der Wechsel auf lange Sicht unbequem, sie wollten raschere Erfolge sehen. So wurde zuweilen dem Gouverneur seine den Machtverhältnissen wie den bestehenden Verträgen angemessene Politik der Versöhnung zwischen den Rassengegensätzen nicht nur durchkreuzt, sondern ihm geradezu zum Vorwurf und schließlich unmöglich gemacht.[56] Mit der Weisheit, die wir von der Rathaustreppe her kennen, auf der man beim Herabgehen bekanntlich klüger ist als beim Heraufgehen, wissen wir daher jetzt, daß eine nur auf Verträge mit Eingeborenen gegründete Kolonialpolitik in einer Besiedlungskolonie auf die Dauer nicht durchführbar erscheint. Entweder muß man beide Rassen gleichstellen (Kapkolonie), oder man muß die eine mit Waffengewalt unterwerfen.
Eine dritte Möglichkeit gibt es noch, nämlich Trennung der beiden Rassen mittels Eindämmung der einen in Reservate (Lokationen), deren Betreten der andern verboten ist. Und diese wird vielleicht die Zukunft für sich haben.
Das Gebiet, auf dem Zusammenstöße zwischen der weißen und farbigen Rasse am ehesten zu erwarten waren, war naturgemäß dasjenige der Rechtspflege. Mit Recht waren die Schutzverträge darauf bedacht gewesen, die weiße Rasse der Gerichtsbarkeit der Eingeborenen zu entziehen. Indessen waren die bezüglichen Vertragsbestimmungen weder klar noch einheitlich. Dies ergibt sich aus der nachstehenden Zusammenstellung. Es sollten die Streitigkeiten zwischen Weißen und Eingeborenen — welcher Art, ob krimineller oder ziviler Natur, ist nicht immer hinzugefügt — wie folgt, entschieden werden:

1. Durch den von Seiner Majestät hierzu berufenen Vertreter im Verein mit einem Beisitzer des betreffenden Kapitäns:
In den Verträgen mit den Bethanier-Hottentotten und den Hereros.
2. Desgleichen, aber ohne eingeborene Beisitzer:
In den Verträgen mit den Kapitänen von Warmbad, der Veldschoendrager und von Bersaba.
3. Durch das Kaiserliche Gericht mit Beisitzern des Kapitäns:
In dem Vertrage mit dem Kapitän Witbooi und den Bastards von Rehoboth.
4. Desgleichen, aber ohne eingeborene Beisitzer:
In dem Vertrage mit dem Kapitän von Gochas.
Endlich ist in dem Vertrage mit dem Kapitän von Hoachanas festgesetzt, daß die Regelung der Sache »später« erfolgen solle.
Solange die deutsche Verwaltung nicht auch tatsächlich von dem Schutzgebiet Besitz ergriffen hatte, waren diese Bestimmungen überhaupt auf dem Papier verblieben. Die wenigen damals unter den Eingeborenen lebenden Weißen mußten sich daher deren — oft recht wunderlicher — Rechtsprechung fügen.
Als ein Beispiel für die Rechtsprechung der Eingeborenen will ich einen Fall anführen: 1890 oder 1891 hatte ein unter den Feldschuhträgern wohnender Weißer aus Versehen einen Eingeborenen erschossen. Der genannte Stamm hatte zwar schon den deutschen Schutz angenommen, irgend eine deutsche Regierungsgewalt aber noch nicht bei sich gesehen. Die »berufenen« Richter des Stammes, d. i. der Kapitän mit seinem Rat, nahmen daher die Sühne des Falles selbst in die Hand. Zunächst quartierten sie sich für einige Zeit bei dem Weißen ein, selbstverständlich auf dessen Kosten. Dann verurteilten sie ihn zu nicht weniger als 800 Hieben, allerdings nicht in der Absicht, dieses Urteil zur Vollstreckung zu bringen, sondern lediglich, um an seine Stelle eine Ablösung in Geld treten zu lassen, die so ziemlich die ganze Habe des Weißen verschlang. Die Richter zogen mit ihrem Raub vergnügt ab und der Weiße blieb mittellos zurück. Solange die Schutzverträge den Eingeborenen einen derartigen Spielraum ließen, waren sie mit ihnen naturgemäß recht einverstanden.
Dieses ursprüngliche Übergewicht der Eingeborenen auf dem Gebiete der Rechtspflege wandelte sich mit der tatsächlichen Besitzergreifung des Landes durch die deutsche Regierungsgewalt allmählich in das Gegenteil um. Nunmehr wurden die Weißen die Überlegenen, nicht sowohl wegen ihres größeren Verständnisses für die Rechtsverhältnisse, sondern auch, weil sie sich nur dem Urteil von Stammesgenossen zu unterwerfen[S. 245] hatten.[57] Da jedoch den Streitigkeiten zwischen den beiden Rassen meist ein politischer Beigeschmack anhaftete, so mußte die Regierung ihnen ihre besondere Aufmerksamkeit zuwenden. Lag doch die Ausführung von Urteilen mangels eigener Exekutivorgane der Gerichtsbehörden ausschließlich in den Händen der Schutztruppe. Namentlich auf dem Gebiete des Zivilrechts bestand daher stets die Gefahr, daß der Eingeborene ein behördliches Eingreifen als »Krieg« ansah. Denn ein Gerichtsvollzieher, der ihm sein Vieh nehmen will, ist für den Eingeborenen ein viehraubender Feind. Das Interesse des allgemeinen Wohls gebot daher, Sorge zu tragen, daß auf dem Gebiete der Rechtspflege das Übergewicht der Weißen nicht den Charakter der Ungleichheit vor Gericht annahm. Diese Bestrebung erhielt dann in den Jahren 1895/96 für das alte Vaterland infolge der bekannten, in den anderen afrikanischen Kolonien vorgekommenen Übergriffe weißer Beamter noch einen besonderen Anstoß. Alles wetteiferte damals geradezu in Humanität gegen die Eingeborenen. Mittels Verordnung des Herrn Reichskanzlers vom 22. April 1896 wurde die bisher ungeregelte Materie, zunächst auf dem Gebiete des Strafverfahrens, in eine feste Norm gebracht. Als Strafrecht blieb für die Eingeborenen vorläufig noch das deutsche Strafgesetzbuch bestehen, jedoch mit einem gewissen Spielraum für den Richter behufs Berücksichtigung der Sitten und Gebräuche der Eingeborenen. Ein Versuch, ein eigenes Strafrecht für diese auszuarbeiten, ist wegen der Schwierigkeit der Sache bis jetzt nicht über das Stadium der Erwägungen hinausgekommen. In Anerkennung des oben erwähnten politischen Beigeschmacks der Sache war durch die Verordnung des Herrn Reichskanzlers das Strafverfahren gegen die Eingeborenen nicht in die Hände der richterlichen Beamten, sondern in diejenigen der politischen (Verwaltungs-) Beamten gelegt, mit der höchsten Macht in den Händen des Gouverneurs. Letzterem stand die Bestätigung wie auch Milderung aller Urteile von 6 Monat Freiheitsstrafe aufwärts zu. Die zu erkennenden Strafen waren: Gefängnis mit Zwangsarbeit, Kettenhaft, Todesstrafe. Außerdem selbständig oder mit Freiheitsstrafe verbunden: Prügelstrafe und Geldstrafe.
Eine amtliche Übersicht ergibt, daß z. B. im Berichtsjahre 1902/03 gegen Eingeborene zusammen 799 Strafen verhängt worden sind, darunter 473 Prügelstrafen, der Rest Freiheitsstrafen.
Ohne Regelung blieb zunächst noch das Gebiet des Zivilrechts. Solange das Schutzgebiet nur von einer geringen weißen Bevölkerung bewohnt war, trat ein Bedürfnis hierzu auch nicht zutage. Die Parteien pflegten sich, meist unter wohlwollender Vermittlung des nächsterreichbaren Beamten oder Offiziers, direkt zu einigen. Mit zunehmender weißer Bevölkerung, mit Ausdehnung von Handel und Wandel nahm die Sache jedoch eine andere Gestalt an. Nachdem einige krasse Fälle vorgekommen waren, und da die Einklagung alter Schulden Eingeborener — zum Teil aus Zeiten, in denen die deutsche Schutzherrschaft noch nicht einmal nominell bestanden hatte — nicht abreißen wollte, erwies sich eine Regelung auch auf diesem Gebiete der Rechtspflege als dringend erforderlich. Es wurde daher zum Erlaß einer
geschritten. Der Kampf um diese Verordnung mit den Interessenten dauerte von 1899 bis 1903, mithin volle fünf Jahre. Seine einzelnen Phasen gehen aus den in Anlage 2 zusammengestellten Schriftstücken hervor, an deren Schluß sich als Ergebnis die diese Sache regelnde Verordnung des Herrn Reichskanzlers vom 23. Juli 1903 befindet.
Wie aus dieser Anlage ersichtlich ist, wünschte ich den Handel zwischen Weißen und Eingeborenen auf die Grundlage des Bargeschäftes zurückzuführen, während die Verordnung des Reichskanzlers, wie aus § 1 hervorgeht, eine einjährige Verjährungsfrist festsetzt. Diese war das Ergebnis eines Kompromisses zwischen meinen Anschauungen und denjenigen der Interessenten, abgeschlossen im Schoße des Kolonialrates. In letzterem, in dem sich als Interessenten die Vertreter der an den Handelsverhältnissen des Schutzgebietes beteiligten Gesellschaften befinden, hatte sich gegen meinen seitens der Kolonialverwaltung vorgelegten Entwurf heftiger Widerspruch erhoben. Man befürchtete einen Rückgang der Anziehungskraft des Schutzgebietes auf die weiße Einwanderung, wenn die Möglichkeit einer Kreditgewährung an Eingeborene unterbunden würde. Der vorgelegte Entwurf empfing Bezeichnungen wie »monströs« und »ungeheuerlich«, und dessen Verfasser den Vorwurf des »mangelnden Verständnisses für Rechtsverhältnisse«. Trotz lebhaften Eintretens der Vertreter der Kolonialverwaltung für den Entwurf kam es schließlich doch zu dem erwähnten Kompromiß einer einjährigen Verjährungsfrist an Stelle der Barzahlung. Diese wohlgemeinte Bestimmung hat dann in der Folge wider Erwarten zu dem Hereroaufstande mit beigetragen. Denn nun verlegten sich die Händler, um der Verjährung ihrer Forderungen vorzubeugen,[S. 247] mit aller Macht und mit allen Mitteln auf die Schuldeneintreibung unter den Hereros. Da dies Vorgehen gerade mit dem eben ausgebrochenen Bondelzwartsaufstande und der dadurch herbeigeführten Entblößung des Hererolandes von Truppen zusammentraf, so war es der Funken, der das schon reichlich angefüllte Pulverfaß mit zur Explosion gebracht hat.
Fern sei es aber von mir, gegen diejenigen, die diese Verjährungsfrist durchgesetzt haben, deswegen einen Vorwurf zu erheben. Denn eine solche Entwicklung der Dinge hat niemand voraussehen können. Schon über die Notwendigkeit einer Kreditverordnung überhaupt sind die Ansichten von Hause aus auseinandergegangen. Indessen würde ich ohne die dringendste Veranlassung nicht fünf Jahre lang für deren Durchführung gekämpft haben. Die Akten des Gouvernements in Windhuk sowie der Distriktskommandos in Okahandja und Grootfontein enthalten hierfür Belege genug. Nicht aus Liebe zu den Eingeborenen hat sich die Regierung bei diesem Vorgehen leiten lassen, wie dies namentlich mir fortgesetzt vorgeworfen worden ist, sondern aus Sorge um Leben und Eigentum der unter den Hereros ansässigen Weißen. Entweder mußte etwas in der Sache geschehen, oder aber die Schutztruppe behufs stärkerer Besetzung des Hererolandes vermehrt werden.
Das Hauptfeld des Handels war Waterberg und Umgebung. Dort wohnte der schon mehrfach genannte viehreiche Häuptling Kambazembi. Zu allen unglücklichen Zufällen kam in der entscheidenden Zeit noch hinzu, daß dieser alte Häuptling, der stets für Aufrechterhaltung des Friedens gesorgt hatte, starb und seine Erbschaft an seine andersdenkenden, dabei auch stark verschuldeten Söhne überging.
Welche Sorge die Auswüchse dieser Sache dem Gouvernement stets bereitet haben, dafür gebe ich als Beweis das nachstehende Schreiben wieder, das ich unter dem 6. Juni 1903, mithin ein halbes Jahr vor Ausbruch des Aufstandes, an das Bezirksgericht Windhuk gerichtet habe:
»Über das Treiben der unter den Hereros befindlichen kleinen Händler sind bereits wiederholt Klagen an das Gouvernement herangetreten, indessen noch nie in der jetzt vorliegenden präzisen Form. Umsomehr ist es dem Gouvernement von wesentlichem politischen Interesse, daß, falls die Aussagen der Ankläger als wahrheitsgetreu erwiesen werden, eine scharfe Bestrafung der Schuldigen erfolgt. Wird diesem Treiben der kleinen Händler nicht ein Ziel gesetzt, so könnte das Gouvernement in die Lage kommen, nicht mehr für die Sicherheit der unter den Eingeborenen lebenden Weißen einstehen zu können. Insbesondere muß ferner hier hervorgehoben werden, daß der Herero[S. 248]kapitän Kajata[58] unserer Sache politisch schon viel genützt und namentlich im Feldzuge 1896 auf unserer Seite tapfer gegen seine eigenen Verwandten und Freunde mitgefochten hat. Derselbe ist hierfür dekoriert worden. Das Gouvernement hat alles Interesse daran, daß eine derartige gute politische Gesinnung nicht durch das lediglich auf Gewinnsucht beruhende Auftreten unverständiger Weißer, die sich hierdurch in erster Linie selbst in Gefahr setzen, gestört werde.«
Nicht versäumen will ich, diesen Abschnitt mit dem Hinweise zu schließen, daß es falsch sein würde, aus den Verfehlungen kleiner Händler im Hererolande Rückschlüsse auf den ganzen Handel im Schutzgebiete zu ziehen. Die großen Handelshäuser sind auch den Eingeborenen gegenüber stets in soliden Bahnen geblieben.[59] Sie hatten daher nicht nötig, wie es zum Teil geschehen ist, sich mit den Auswüchsen des Handels zu identifizieren. Ebenso wäre es falsch, wollte man die Eingeborenen in dieser Sache von der Schuld freisprechen. Sie waren bei ihrer Genußsucht und ihrem Leichtsinn, verbunden mit Arbeitsunlust, zum Drängen auf Kredit geradezu angewiesen, während sie zum Bezahlen sich schon weniger gedrängt haben. An der Spitze aller Schuldenmacher stand der Oberhäuptling Samuel Maharero selbst. Umsomehr würde die einfache Zurückführung des Handels mit Eingeborenen auf das Bargeschäft für Käufer wie Verkäufer von Vorteil gewesen sein, an deren Zustand sich beide Teile gewiß bald gewöhnt hätten.[60]
Neben gerechter und wohlwollender Behandlung der Eingeborenen war das beste Mittel zur Aufrechterhaltung des Friedens, ihnen den Besitz von Waffen und Munition zu erschweren. Vollständig ausgeschlossen erschien dagegen ihre gewaltsame Entwaffnung, wie sie von vielen Seiten fortgesetzt verlangt worden ist. Sie würde einfach damals schon den jetzt noch nicht niedergeschlagenen Aufstand hervorgerufen haben. Die Verantwortung für diesen hätte dann der betreffende Gouverneur auf sich nehmen müssen. Es ist nicht denkbar, daß hierzu sich ein Gouverneur bereit gefunden, noch weniger aber, daß er sich hiermit in der Heimat Beifall erworben haben würde, ganz abgesehen davon, daß ein Krieg gegen die Gesamtheit der Hereros ohne die Eisenbahn Swakopmund-Windhuk überhaupt nicht durchführbar gewesen wäre.
Zum Verständnis für den Ursprung der, wie sich nach dem Aufstande ergab, verhältnismäßig guten Bewaffnung der Eingeborenen bedarf es eines historischen Rückblickes. Wir haben in bezug auf den Handel mit Waffen und Munition drei Perioden zu unterscheiden.
1. Die Periode der unbeschränkten Handelsfreiheit, beginnend in nicht mehr kontrollierbarer Zeit und bis zum 1. April 1890, mithin bis in das Bestehen der deutschen Schutzherrschaft hineinreichend. Von der Aufrichtung der letzteren, mithin vom Jahre 1884 ab, wurde die Einfuhr von Waffen und Munition indessen wenigstens unter eine gewisse behördliche Kontrolle genommen.
2. Die Periode der beschränkten Handelsfreiheit. In dieser war der Handel mit Waffen und Munition der Genehmigung der Regierung unterstellt worden. Sie dauerte von 1890 bis 1897. Aber erst von Ausbruch des Witbooikrieges, d. i. 1893, ab wurden die Grenzen der Genehmigung zur Einfuhr derart eng gezogen, daß sie einem Verbote gleichzuachten waren.
3. Die Periode des Regierungsmonopols, begründet durch die Verordnung vom 29. März 1897.[61]
Nach der amtlichen Zusammenstellung wurden in der Zeit von 1884 bis 1893 über die Häfen des Schutzgebietes 2586 Gewehre und 1128780 Patronen eingeführt. Davon allein über Walfischbai 2289 Gewehre und 690080 Patronen. Von letzterer Einfuhr darf als bestimmt angenommen werden, daß sie lediglich in das Hereroland gegangen ist. Während die[S. 250] Einfuhr in dem Jahre 1891 mit 807 Gewehren und 66830 Patronen ihren Höhepunkt erreicht hatte, ging sie von da unter dem Zwang zur Einholung einer Regierungsgenehmigung rasch abwärts. An dem Handel selbst hatten sich Kaufleute aller Nationen einmütig beteiligt, wie dies auch naturgemäß ist.[62] Denn selbst der geizige Herero zahlte für Waffen und Munition jeden Preis. Der Besitz eines Hinterladers war das Bestreben eines jeden einigermaßen vermögenden Hereros. Vorderlader führten nur noch die in Dienerstellung befindlichen Leute.
Die genannten Zahlen können jedoch nicht als erschöpfend gelten. Die Menge der tatsächlich in das Schutzgebiet eingeführten Waffen und Munition muß vielmehr als weit bedeutender angenommen werden. Denn auch unter der Herrschaft der amtlichen Kontrolle ist mangels ausreichenden Aufsichtspersonals nicht jede Einführung von Waffen und Munition zur amtlichen Kenntnis gekommen. Zur Zeit der unbeschränkten Handelsfreiheit haben dagegen Händler und Konzessionsjäger ganze Wagenladungen von Waffen und Munition eingeführt. Sogar die Regierung überwies einmal infolge Unzulänglichkeit ihrer Machtmittel 200 Gewehre, Modell 71, nebst Munition an den Hottentottenstamm von Hoachanas als Belohnung für seine Loyalität sowie, um sich gegen den damals recht unloyalen Witbooistamm zu schützen. Wie harmlos in jenen Zeiten überhaupt die Lieferung von Gewehren und Munition an Eingeborene allgemein aufgefaßt wurde, beweist auch ein Blick in unsere von der Regierung nachträglich bestätigten Konzessionsurkunden. Als Beispiel will ich die ältesten, nämlich die von Lüderitz abgeschlossenen Verträge herausgreifen, auf denen sich die heutige Kolonial-Gesellschaft für Südwestafrika gründet. In ihr finden wir unter anderem als Gegenleistung für erhaltene Landrechte die Lieferung von 260 Gewehren an den Kapitän von Bethanien ausbedungen. Weiter sind die Zahlungen an den Oberhäuptling der Hereros entweder in bar oder in Gewehren und Munition usw. versprochen. Bei den übrigen Konzessionen der Gesellschaft ist von Gewehren und Munition zwar nicht ausdrücklich die Rede, sicher aber haben dieselben bei den bezüglichen Unterhandlungen eine Rolle mitgespielt. Bekannt ist ferner, daß das ehemalige Karraskoma-Syndikat den Stamm der Bondelzwarts zu dessen Kriegszügen gegen die Feldschuhträger und die Keetmanshooper Hottentotten neben Proviant auch mit Gewehren und Munition ausgerüstet hat.
Von den Schriftstellern, die diese Sache behandelt haben, schätzt der damalige Hauptmann v. François die Zahl der allein 1888 bis 1891 in das Schutzgebiet eingeführten Gewehre auf 3000, v. Bülow nimmt dagegen in seinem Buche »Drei Jahre im Lande Hendrik Witboois«[63] im allgemeinen die Zahl von 20000 an, während Dr. Schinz in seinem bereits genannten Werke[64] auf Seite 157 von »massenhaft« eingeführten Gewehren spricht. Da sich die Zeit, die der letztgenannte Verfasser hierbei im Auge hat, wohl auf dessen Reisejahre im Schutzgebiete von 1884 bis 1887 bezieht, so würde seine Angabe derjenigen des Hauptmanns v. François hinzuzurechnen sein und sonach die v. Bülow angegebene Zahl ihre Erklärung finden.
Die Tatsache, daß die Hereros keine Jäger sind und vom Jahre 1892 ab, mithin ungefähr gerade nach der Zeit der für den Waffen- und Munitionshandel eingetretenen Beschränkungen Frieden gehabt haben, gibt schließlich die Erklärung dafür, daß dies Volk seine Munitionsvorräte bis zum jetzigen Aufstande konservieren konnte. Für den geringen Abgang boten der nie ganz zu unterdrückende Munitionsschmuggel, vor allem aber die Waffen der ermordeten Farmer und der gefallenen Angehörigen der Schutztruppe ausreichenden Ersatz.
Mit der erwähnten Verordnung vom 29. Mai 1897 trat der Handel mit Waffen und Munition im Schutzgebiet in ein ganz neues Stadium. Infolge Einführung der Stempelungspflicht war die bisher lediglich an der Grenze gehandhabte Kontrolle auch in das Innere des Schutzgebietes verlegt worden. In Verbindung mit der Einrichtung amtlicher Verkaufsstellen ermöglichte sie nunmehr eine bessere Übersicht über den Waffenbesitz der Eingeborenen. Um diese auch in bezug auf Erwerb von Munition von der Regierung abhängig zu machen, wurde ihnen der Umtausch der in ihren Händen befindlichen englischen Gewehrsysteme in das deutsche System Modell 71 unter günstigen Bedingungen gestattet. Mit Verschwinden der englischen Gewehrsysteme mußte der Munitionsschmuggel an der englisch-deutschen Grenze von selbst aufhören. Die nach amtlicher Feststellung in den Jahren 1898 bis 1902 in das Hereroland gegangenen 141 Gewehre, Modell 71, schließen daher nicht nur die dort an die Weißen mitverkauften Gewehre in sich, sondern auch die umgetauschten englischen Gewehre, die zumeist in Henry-Martini und Snider bestanden hatten.
[S. 252] Während sonst auf dem Gebiete der Rechtspflege die Regierung eine ungleichmäßige Behandlung von Weißen und Eingeborenen tunlichst vermeiden mußte, war auf dem uns hier beschäftigenden Gebiete eine solche im Gegenteil dringend geboten. Eine schwierige Frage war nur, wie dies in unauffälliger Weise durchgeführt werden könnte. Denn äußerlich mußten aus naheliegenden Gründen beide Rassen gleich behandelt werden, wogegen der Wert der gesetzgeberischen Maßnahme auf diesem Gebiet gerade in der allmählich herbeizuführenden Entwaffnung der Eingeborenen gelegen hatte. Dieses Ziel wurde daher auf dem Wege von Verwaltungsmaßnahmen zu erreichen versucht. Für die Eingeborenen wurden die Preise für Gewehre und Munition auf das Doppelte der von den Weißen zu entrichtenden Beträge festgesetzt, anderseits aber auch den Verwaltungsbeamten eine besonders sorgfältige Prüfung der Anträge von Eingeborenen auf Gewährung von Ankaufserlaubnisscheinen zur Pflicht gemacht. Es ist nicht zu verkennen, daß dies für die Verwaltungsbeamten eine recht schwierige Ausgabe gewesen ist. Sie sollten mit den einflußreichsten Mitgliedern ihrer Eingeborenenstämme, auf deren Unterstützung sie angewiesen waren, auf gutem Fuße, anderseits aber deren Drängen auf Überlassen von Waffen und Munition gegenüber möglichst taub bleiben.[65] Tatsächlich ist auch diese Sache von den Verwaltungsbeamten ganz verschieden gehandhabt worden. Während z. B. Omaruru innerhalb vier Jahren 69 Gewehre und rund 5000 Patronen an Eingeborene abgegeben hat, weist die Liste für Okahandja für die gleiche Zeit nur drei Gewehre und rund 350 Patronen auf.
Zur amtlichen Stempelung haben die Hereros in den Jahren 1898 bis 1902 1900 Gewehre gebracht. Diese Zahl kann jedoch nicht als erschöpfend angesehen werden, da in dem weiten Lande mit seinen spärlichen Polizeistationen eine Unterschlagung von Gewehren wohl möglich war. Die zweite im Jahre 1903 fällige Stempelung konnte dagegen infolge des Aufstandes nicht mehr zur Durchführung gebracht werden.
Es erübrigt noch, die Stellung der Weißen zur Gewehr- und Munitionsfrage darzulegen. Sollten die gegen die Eingeborenen gerichteten strengen Maßnahmen von Erfolg sein, so mußte naturgemäß auch die weiße Bevölkerung unter eine gewisse Kontrolle genommen werden. Denn die Verlockung, durch Abgabe von Schießbedarf an Eingeborene auf billige Weise[S. 253] zu Vieh zu gelangen, war zu groß, als daß ihr gegenüber jedem Weißen die erforderliche Charakterfestigkeit zugetraut werden konnte. Namentlich Buren, die ja auch zu den Weißen zählen, haben es gern an solcher fehlen lassen, zumal sie im Betretungsfalle das Schutzgebiet wieder leichten Herzens verlassen konnten.[66]
Infolgedessen wurden die Verwaltungsbeamten angewiesen, auch die Anträge Weißer auf Erteilung von Erlaubnisscheinen zum Ankauf von Waffen und Munition in bezug auf die Zuverlässigkeit der Antragsteller einer Prüfung zu unterziehen und hiernach die Zahl der zu bewilligenden Patronen zu bemessen. Die Anzahl dieser war auf 50 bis 100 monatlich festgesetzt,[67] und zwar konnte der Weiße sie entweder bei den amtlichen Verkaufsstellen entnehmen, oder aber selbst einführen. Da sich jedoch die Einfuhr einer so kleinen Anzahl von Patronen nicht lohnte, unterlag die Menge der einzuführenden Munition keinerlei Beschränkung. Nur mußte das eingeführte Quantum auf der nächsten Polizeistation abgegeben werden, von wo es dann der Besitzer in den gesetzlich zulässigen Raten wieder zurückerhielt.
Da die amtlichen Verkaufsstellen außer mit reinen Jagdflinten nur mit Modell 71 ausgestattet waren, so beschränkten sich die Weißen meist gleichfalls auf den Besitz des letztgenannten Systems. Doch war ihnen gestattet, auch jedes andere System, mit Ausnahme des Militärgewehres, zu führen. Tatsächlich regelte sich die Sache daher so, daß den Eingeborenen alle Systeme, mit Ausnahme des bei der amtlichen Verkaufsstelle erhältlichen Gewehres Modell 71, verboten, den Weißen dagegen alle Gewehrsysteme, mit Ausnahme des Militärgewehres, erlaubt waren. Zur Bequemlichkeit der Weißen war ferner bereits begonnen worden, den Verkaufsstellen auch moderne Repetiergewehre zuzuführen, jedoch von anderem Kaliber, als das Militärgewehr aufweist. Der Aufstand hat die weitere Ausgestaltung dieser Einrichtung unterbrochen.
Eine ganz besondere Vorliebe zeigten indes die einwandernden Ansiedler gerade für den Besitz des Militärgewehres, sei es Modell 88, sei es Modell 98, beide mit dem Kaliber 7,9 mm. Um den fortgesetzten Anträgen[S. 254] auf Gestattung der ausnahmsweisen Einfuhr dieser Gewehre ein Ende zu machen, wurde schließlich das Einfuhrverbot für sie aufgehoben und an dessen Stelle ein Einfuhrzoll von 150 Mark pro Gewehr und von 10 Mark pro Kilogramm Patronen gesetzt, ein Zoll, der einem Einfuhrverbot gleichkommt.
Die Gründe zur Verhinderung der Bewaffnung der Zivilbevölkerung mit dem Militärgewehr liegen nahe. Kein seiner Verantwortung bewußter Gouverneur hätte sie außer acht lassen können, am allerwenigsten, solange er mit selbständigen Eingeborenenstämmen zu rechnen hatte. Die Gefahr, daß dieses Gewehr, noch viel mehr aber die Munition auf unrechtmäßige Weise auch in die Hände von Eingeborenen käme, war zu groß und die Kontrolle über die zum Teil auf kleine Stationen zersplitterte Schutztruppe zu schwierig. Eine allgemeine Bewaffnung der Zivilbevölkerung mit dem Militärgewehr, wie sie bei dessen Freigabe ohne Zweifel erfolgt sein würde, hätte daher die Rechtschaffenheit unserer Ansiedler wie auch die Pflichttreue einzelner Schutztruppenangehöriger auf eine harte Probe gestellt.[68] Wäre die Gewißheit gegeben gewesen, daß etwa veruntreute Munition wenigstens in den Händen Weißer geblieben wäre, so würde man sich eher mit der Sache haben abfinden können. Diese Gewißheit lag aber nicht vor, und man mußte daher auch für die Weißen eine Beschränkung eintreten lassen, die jedoch von diesen übel empfunden worden ist, obschon die dadurch erstrebte Sicherheit und Ruhe im Schutzgebiet mit in ihrem eigensten Interesse lag.[69]
Die Alkoholfrage hat insofern eine gewisse Ähnlichkeit mit der Bewaffnungsfrage, als auch für Spirituosen der Eingeborene bereit ist, sein letztes Hab und Gut zu opfern. Einen wesentlichen Unterschied bietet sie indessen wieder insofern, als seine Freigabe die Macht der Eingeborenen nicht erhöht, sondern gebrochen haben würde. Kennen wir doch eine ähnliche Erfahrung aus Amerika, wo das »Feuerwasser des weißen Mannes« wesentlich[S. 255] zum Untergange der Indianer beigetragen hat. Solchen Weg einzuschlagen, haben uns Humanität und Christentum verboten, daneben aber auch unser eigenes Interesse, da wir zur wirtschaftlichen Entwicklung des Schutzgebietes die Eingeborenen nicht entbehren können.
Eine Ähnlichkeit mit der Waffenfrage tritt dagegen wieder insofern zutage, als die Stellung der Verwaltungsbeamten beiden Fragen gegenüber gleichmäßig schwierig gewesen ist. Solange den Weißen der unbeschränkte Genuß von Spirituosen freigestellt blieb, konnte man den Eingeborenen das so heiß erstrebte Genußmittel auch nicht gänzlich verschließen, vor allem nicht den Häuptlingen und den einflußreicheren »Großleuten«. Denn diese waren bis zur freiwilligen Annahme der deutschen Schutzherrschaft im Spirituosenbezug keinerlei Beschränkung unterworfen gewesen. Im Gegenteil, es pflegten Händler, Konzessionsjäger und sonstige Jäger, die auf den Schutz und das Wohlwollen der Häuptlinge angewiesen waren, die schwache Seite der letzteren mittels reichlicher Alkoholspenden auszunutzen. Dazu kommt, daß in einer Besiedlungskolonie, in die jeder Weiße einwandern kann, die soziale Stellung der weißen Rasse sich anders zu gestalten pflegt als in einer Plantagenkolonie, die nur eine beschränkte Einwanderung gestattet und die Übernahme schwerer körperlicher Arbeit durch Weiße überhaupt nicht erlaubt. Leider konnte daher in Südwestafrika z. B. nicht vermieden werden, daß sich Weiße den Eingeborenen in betrunkenem Zustande zeigten. Die Frage: Warum wird diesen erlaubt, was uns verboten ist, lag daher sehr nahe. Somit konnte es sich in der Spirituosenfrage nur um eine Einschränkung des Alkohols für Eingeborene handeln, und diese wurde gleichfalls in die Hände der Verwaltungsbeamten gelegt. Auch der Häuptling mußte sich der gleichen Beschränkung unterwerfen und seinen Erlaubnisschein vom Bezirksamtmann oder Distriktschef beziehen. Gegenüber unverbesserlichen Alkoholikern unter den Häuptlingen, wie es z. B. der Oberhäuptling der Hereros, Samuel, war, hatte der Verwaltungsbeamte daher keinen leichten Stand.
Auch in der Zeit, in der eine deutsche Herrschaft lediglich in der Person eines einzigen Regierungsvertreters vorhanden war, hatte man schon Versuche zur Beschränkung des Handels mit geistigen Getränken gemacht. Die erste Spirituosenverordnung datiert vom 1. August 1888. Durch sie wurde der Handel mit Spirituosen im allgemeinen der Genehmigung des Reichskommissars unterstellt und einer Steuer unterworfen. Eine besondere Beschränkung des Verkaufs an Eingeborene trat dagegen erst durch Verordnung vom 1. August 1892 ein, wonach die Abgabe von Spirituosen an Eingeborene[S. 256] nur nach Beibringung eines behördlich ausgestellten Erlaubnisscheines gestattet war. Da es jedoch eine Regierungsgewalt außerhalb Windhuks damals noch nicht gab, blieb diese Verordnung mehr oder weniger auf dem Papier.
Vom Jahre 1894 ab erfolgte mit der allmählichen Ausdehnung der Regierungsgewalt auf das übrige Schutzgebiet auch eine weitere Ausdehnung der Spirituosengesetzgebung. Insbesondere wurde 1896 den Eingeborenen durch Auferlegung einer Stempelabgabe für die erhaltenen Erlaubnisscheine der Bezug von Alkohol noch weiter erschwert. Außerdem hatte diese Abgabe den Vorteil, daß durch sie eine Kontrolle über den an Eingeborene verabfolgten Alkohol möglich wurde. Ihre letzte Ausgestaltung erhielt die Spirituosengesetzgebung durch die Verordnung vom 18. Dezember 1900, die noch zu Recht besteht.
Auf Grund der eingegangenen Permitgelder ist berechnet worden, daß in den drei letzten Jahren vor dem Aufstande folgende Mengen Alkohols in die Hände von Eingeborenen gekommen sind:
| Jahr | Einfuhr von Alkohol im ganzen | Davon Abgabe an die Eingeborenen | ||
| 1901 | 127824 | l | 5971 | l |
| 1902 | 116212 | " | 2100 | " |
| 1903 | 91892 | " | 4400 | " |
Unter der Annahme, daß das Herero- und das Namaland zusammen etwa 15000 erwachsene Männer gezählt haben — auf das Ovamboland erstreckt sich die Statistik nicht — würde auf jeden erwachsenen Eingeborenen jährlich etwa 1/6 bis 1/3 l Alkohol entfallen.
Im allgemeinen sind sonach die zur Einschränkung des Alkoholgenusses durch Eingeborene getroffenen Anordnungen als sehr weitgehend zu betrachten. Ihre Handhabung konnte jedoch aus den angegebenen Gründen nicht überall dieselbe sein, da je nach Gestaltung der wirtschaftlichen und politischen Lage der einzelnen Stämme die Zügel fester oder lockerer anzuziehen waren. So hat es z. B. der Bezirksamtmann von Keetmanshoop, Dr. Golinelli, während mehrerer Jahre verstanden, die amtliche Erlaubnis zur Abgabe von Alkohol an Eingeborene ganz zu unterbinden. Hierzu bot die fortschreitende Verarmung der Hottentotten die erforderliche Handhabe. Im Bezirk Windhuk, in dem mit reichen Eingeborenen, insbesondere mit einem alkoholfreudigen Oberhäuptling zu rechnen war, würde dagegen eine solche Maßnahme schon schwieriger durchzuführen gewesen sein.
Unter allen schwierigen im Schutzgebiete zu lösenden Fragen war die weitaus schwierigste die Landfrage. Einerseits hatten wir es mit nomadisierenden Hirtenvölkern zu tun, die an sich schon mehr Land bedürfen als seßhafte Ackerbauer, anderseits aber auch mit einer weißen Einwanderung, für die Raum geschaffen werden mußte. Dazu kam die Konzessionsjägerei, die schon vor Aufrichtung der deutschen Schutzherrschaft begonnen und auch denjenigen Eingeborenen die Augen über den Wert ihres Landes geöffnet hatte, die es andernfalls nicht so genau genommen haben würden, und zu diesen gehörten die Hottentotten. Obwohl auch sie in erster Linie nur von Viehzucht leben, bedürfen sie bei ihren geringen Viehherden nicht so sehr des Weidelandes wie die viehreichen Hereros. Es ist bezeichnend, daß von all den Landkonzessionen, die vor der Besitzergreifung des Landes durch uns seitens eingeborener Häuptlinge vergeben worden sind, sich keine einzige durch einen Hererohäuptling verliehene befindet. Auch der Mächtigste unter diesen hatte es nicht wagen dürfen, seinem Volke eine Landabtretung zu bieten. Nur Minenkonzessionen finden wir daher aus jener Zeit im Hererolande.
Anders die Hottentotten. Sie gaben unbedenklich jedem Liebhaber an Land ab, was dieser sich nur wünschte, auch solches, das sie nicht besaßen. Als Gegenwert erhielten sie nominell Geld, das indessen meist in Warenlieferungen, wie Munition und Alkohol, umgewandelt worden sein wird. Die wichtigsten Verträge dieser Art sind diejenigen des Kaufmanns Lüderitz, die dann in der Folge Veranlassung zur amtlichen Besitzergreifung Südwestafrikas durch uns gegeben haben. Die Verträge bestehen aus Land- und Minenverträgen:
A. Landverträge.
1. Am 1. Mai 1883 mit dem Kapitän von Bethanien.
2. Am 19. August 1884 mit dem Kapitän der Topnaars.
3. Am 16. Mai 1885 mit dem Kapitän der Afrikaner.
4. Am 19. Juni 1885 mit dem Kapitän der Swartboois.
Diese vier Verträge sind durch Lüderitz abgeschlossen. Ihnen gesellten sich hinzu:
5. Am 8. April, 19. Mai und 25. Juli 1890 mit den Kapitänen der Bondelzwarts, der Swartmodder- und der Feldschuhträger-Hottentotten, betreffend Landrechte verschiedener Art und Größe innerhalb der betreffenden Stammesgebiete und abgeschlossen von einer englischen Gesellschaft, dem sogenannten Kharraskhoma-Syndikat.
[S. 258] Durch die Verträge zu 1. und 2. kam alles Land längs der Küste vom Orange bis zum unteren Omarurufluß in die Hände von Lüderitz und dessen Rechtsnachfolgern. Nach dem Innern des Landes betrug die Breite des Küstenstrichs 20 Meilen; ob geographische oder englische, ist nicht gesagt. Der Vertrag Nr. 3 umfaßte das Jan Jonkergebiet, d. h. alles Land zwischen Swakop und Kuiseb bis an die Grenze von Windhuk, der Vertrag Nr. 4 mit den Swartboois endlich das ganze Kaokofeld.
B. Minenrechte.
1. In den mit den Verträgen zu A. bezeichneten Gebieten, in denen sämtliche Minenrechte mit abgetreten worden waren.
2. In dem Gebiete der Bastards von Rehoboth, abgeschlossen am 4. Juni 1884.
3. In dem Lande der Hereros, abgeschlossen am 11. Oktober 1884.
Als sofortigen Gegenwert für die Landabtretung erhielten die vertragschließenden Eingeborenenstämme: Zu 1. Bethanien 600 Pfd. Sterl. und 260 Gewehre, zu 2. die Topnaars 20 Pfd. Sterl., zu 3. die Afrikaner 100 Pfd. Sterl., zu 4. die Swartboois 150 Pfd. Sterl. (hiervon erhielt 50 Pfd. Sterl. der Kapitän der in Zesfontein wohnenden Abzweigung der Topnaars, der den Mitbesitz des Kaokofeldes beanspruchte), zu 5. die drei Stämme insgesamt rund 2300 Pfd. Sterl. und eine Anzahl Anteilscheine des Syndikats.
Für die abgegebenen Minenrechte erhielten die Eingeborenen nur Abgaben in Aussicht gestellt, sobald der Betrieb begonnen haben würde. Wenn sonach auch die Minenkonzessionen ihnen keinerlei greifbare Vorteile einbrachten, konnten sie später doch ohne jede Schwierigkeit in Kraft gesetzt werden, da die Eingeborenen für deren Wert keinerlei Verständnis besaßen. Sogar die Hereros haben dem Beginn des Bergbaues in den in ihrem Gebiete gelegenen Otjosongatibergen mit Gleichmut zugesehen. Dagegen haben sie das dortige Land selbst — noch etwa sechs Monate vor dem Aufstande — zur Verwertung an die Regierung abgetreten, nachdem sie die Erfahrung gemacht hatten, daß sie sich selbst angesichts der dort entdeckten Kupferfunde der eindringenden Landspekulanten nur schwer würden erwehren können.
Unendliche Schwierigkeiten hat dagegen dem Gouverneur die spätere tatsächliche Durchführung der Landkonzessionen bereitet. Anscheinend hatten die Eingeborenen unterschrieben, ohne sich der Tragweite ihrer Unterschriften[S. 261] bewußt geworden zu sein. Da war zunächst der unaufgeklärte Punkt, ob in bezug auf den 20 Meilen breiten Küstenstreifen (A. 1. und 2.) »geographische« oder »englische« Meilen zu verstehen seien. Wenn der betreffende Landstrich nur 20 englische Meilen breit war, reichte er nirgends über den Wüstensaum hinaus, war somit so gut wie wertlos. Wurden jedoch die 20 Meilen als geographische angesehen, so erstreckte sich der Gürtel auch auf Weideland, dessen Wert für den Frachtverkehr von und nach der Küste in die Augen springt. Eine besondere Bedeutung gewann diese Frage an den beiden Eingangshäfen Swakopmund und Lüderitzbucht.
Der Zugang von Swakopmund in das Innere führt den stets Wasser sowie auch etwas Weide aufweisenden Swakopfluß entlang. Auf diesem Wege sind daher die Schrecknisse der Namibwüste wesentlich abgeschwächt. Anders der Weg von Lüderitzbucht landeinwärts. Der Nachteil des letztgenannten, sonst so vorzüglichen Hafens ist gerade der schwierige Zugang über den Dünengürtel in das Innere. Nicht weniger als ein fünftägiges Aushalten ohne Wasser und Weide verlangt dort die zweimalige Durchquerung der Dünen von den — mit dem Fortschaffen von 4000 bis 5000 Pfund belasteten — Ochsen. Es läßt sich somit leicht ermessen, in welchem Zustande die Tiere auf dem ersten Weide- und Wasserplatz landeinwärts anzukommen pflegen. Und dieser Platz ist Kubub, der ganz naturgemäß zum Zankapfel zwischen Gesellschaft und Eingeborenen werden mußte. Denn die Frage, in wessen Eigentum dieser wichtige Platz fällt, hängt eben von der Lösung der Meilenfrage ab. Deren Wichtigkeit sich bewußt, haben seinerzeit bei der Vertragsschließung anscheinend beide Teile das Eingehen auf sie vermieden, sie vielmehr stillschweigend jeder in seinem Sinne beantwortet. Diese Vogelstraußpolitik rächte sich, als nach der tatsächlichen Aufrichtung der deutschen Schutzherrschaft im Namalande, d. i. 1895, die Rechtsnachfolgerin von Lüderitz, die Deutsche Kolonial-Gesellschaft für Südwestafrika, auf Grund der ihr »vertragsmäßig zustehenden« 20 geographischen Meilen die Hand auf Kubub legen wollte. Denn nunmehr erhoben die Eingeborenen entschiedenen Einspruch. Beide Teile wandten sich an das Gouvernement und verlangten kategorisch ihr »Recht«. Erst nach langem Streite sowie nach einigen Zugeständnissen seitens der Gesellschaft gelang die Beilegung der Streitfrage dahin, daß unter den Meilen geographische zu verstehen seien und somit Kubub in das verkaufte Gebiet falle.
Noch schwieriger gestaltete sich die Lösung der Meilenfrage in dem Gebiete nördlich des Swakops. Dort hatten die selbst noch nicht allzulange[S. 262] Zeit am unteren Kuiseb wohnenden Topnaars unbedenklich das ganze Gebiet längs der Küste vom 26. Breitengrad bis zum Unterlauf des Omaruruflusses auf 20 Meilen landeinwärts an Lüderitz verkauft (Vertrag A. 2.). In diesem Falle erschien überhaupt das Eigentumsrecht der verkaufenden Partei anfechtbar. Soweit das verkaufte Gebiet aus Küstensand bestand, brauchte diese Tatsache Bedenken nicht zu erregen. Denn auf wertloses Land pflegt niemand Anspruch zu erheben. Anders aber lag die Sache da, wo die 20 geographischen Meilen — auch hier wurden sie seitens des Käufers als solche aufgefaßt — bis in das Weideland hineinreichten. Auf diese erhob, ohne sich auf den spitzfindigen Unterschied zwischen »geographisch« und »englisch« überhaupt einzulassen, der Kapitän Manasse von Omaruru Anspruch. Auch hier gelang erst nach schwierigen Verhandlungen, verbunden mit Zugeständnissen seitens der Gesellschaft, die Durchsetzung der von der letzteren gewünschten Grenze. Infolge dieser Vereinbarung erhielt die Gesellschaft u. a. auch das Eigentumsrecht auf den wichtigen Platz Spitzkoppjes, an dem sie dann ein Viehzuchtunternehmen größeren Stiles eingerichtet hat.
Einige Reibung verursachte auch der Vertrag mit dem Kapitän Jan Jonker (A. 3.). Als dieser das ganze weite Gebiet zwischen Swakop und Kuiseb um 100 Pfd. Sterl. veräußerte, befand er selbst sich — sowohl von den Witboois wie von den Bastards hart bedrängt — nur in dem tatsächlichen Besitze des Platzes Hudab am unteren Kuiseb. Bei der Veräußerung angeblicher Besitzrechte kommt es eben den Eingeborenen auf etwas Phantasie nicht an. Indessen schieden hier in der Folge die Witboois nach niedergeschlagenem Aufstande mit ihren Ansprüchen aus, während die Bastards zu loyal waren, um der Regierung dauernd Schwierigkeiten zu bereiten. Mit ihnen kam bald eine gütliche Einigung zustande und die Gesellschaft in den Besitz des gekauften Landes. Ganz ohne Schwierigkeit vollzog sich dagegen der Übergang des seitens der Swartboois und der Kaokofeld-Topnaars verkauften Kaokofeldes an die Kolonial-Gesellschaft. Einerseits genügten die Reservate, die die beiden Stämme sich vorbehalten hatten — Franzfontein und Zesfontein nebst Weideland —, deren Bedürfnissen vollauf, anderseits vollzog sich der Übergang unmittelbar unter dem Eindruck des soeben niedergeschlagenen Swartbooiaufstandes 1898. Nachdem in dessen Folge von den Swartboois der größere Teil in die Kriegsgefangenschaft nach Windhuk übergeführt war, hatten die Zurückgebliebenen mitsamt dem Stamm der Topnaars alle Veranlassung, sich tunlichst bescheiden zu verhalten.
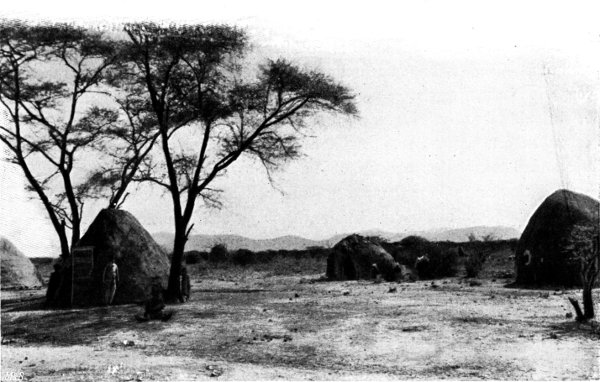
Einen besonders merkwürdigen Verlauf nahm dagegen die Entwicklung der Vertragsabschlüsse des Kharraskhoma-Syndikats im Süden des Schutzgebietes (A. 5.). In den fraglichen Verträgen hatten die Eingeborenen anscheinend noch mehr wie sonst unterschrieben, ohne zu wissen, was sie taten. Denn sie lieferten dem Syndikate ihr ganzes Land auf Gnade und Ungnade aus. Zum Glück für beide Teile bestand indessen damals im Süden des Schutzgebietes noch keine deutsche Schutzherrschaft. Die Verträge waren daher für den Geber ungültig, für den Empfänger aber wertlos. Dessen sich wohl bewußt, drängten die vertragschließenden Weißen auf Aufrichtung der deutschen Schutzherrschaft in dem betreffenden, nach den internationalen Abmachungen in unsere Interessensphäre fallenden Gebiete. Die drei in Frage kommenden Stämme, nämlich die Bondelzwarts, Feldschuhträger und Keetmanshooper Hottentotten, nahmen auch im Laufe des Jahres 1890 die deutsche Schutzherrschaft an. Nunmehr legte die Gesellschaft in Berlin ihre Verträge zur Genehmigung vor, worauf diese einer weisen Nachprüfung mit dem Ziele einer wesentlichen Einschränkung unterzogen wurden. Die Eingeborenen blieben dagegen trotzdem in dem Besitz der ausbedungenen[S. 264] Vorteile, ein ganz richtiger Standpunkt, denn die seitens der Käufer erworbenen Rechte blieben immer noch umfangreich genug, nämlich das Monopol auf sämtliche Bergwerksgerechtsame innerhalb des betreffenden Gebietes sowie das Recht zur freien Auswahl von insgesamt 512 Farmen. Dagegen wurden der Gesellschaft als weitere Gegenleistungen neben den mit den Eingeborenen vereinbarten und diesen belassenen Vergünstigungen auch noch Abgaben an die Regierung sowie besondere Aufwendungen im Interesse des Landes, namentlich der Bau einer Bahn von der Küste in das Innere, auferlegt. Bis wie weit der Bahnbau gehen sollte, ist nicht gesagt. Doch wurde seitens der Regierung ein solcher bis Aus, nordwestlich Kubub, als dem ersten nach Überwindung des Wüstengürtels einigermaßen in Betracht kommenden Wasserplatz, angestrebt. Indessen auch diese wesentlich reduzierte Konzession war, soweit sie Landabtretungen betraf, ohne Anwendung von Gewalt nicht durchführbar. Denn 512 Farmen hätten sich, auch wenn sie vorhanden gewesen wären, die Eingeborenen nicht ohne weiteres abnehmen lassen. Es war daher ein Glück, daß in der Folge die Gesellschaft ihren Verpflichtungen in bezug auf den Eisenbahnbau nicht nachzukommen vermochte und daher von ihrer Landkonzession zurücktreten mußte. Unter Vermittlung des Gouvernements hat sie lediglich die ersten 128 Farmen erhalten, und diese nur mit Mühe und Not, und nachdem die Gesellschaft mit Ernst angehalten worden war, auch die an die Eingeborenen fälligen Gegenleistungen nicht zu vergessen.
Auch innerpolitische Folgen für die Eingeborenen haben die Kharraskhomaverträge nach sich gezogen. Bereits in Kapitel 1 ist erwähnt, wie der Häuptling der Bondelzwarts sich Keetmanshoops, des Hauptsitzes der Swartmodder-Hottentotten, bemächtigte und wie er 1892 anläßlich eines Vorgehens gegen die Feldschuhträger beinahe mit Witbooi zusammengeraten wäre. An diesen beiden Unternehmungen scheint das Kharraskhoma-Syndikat nicht ganz unbeteiligt gewesen zu sein. Ihm war naturgemäß erwünscht, wenn sein ganzes Konzessionsgebiet in einer Hand, und zwar in derjenigen des mächtigsten der drei Stämme, der Bondelzwarts, vereinigt war. Der Kapitän des letztgenannten Stammes, Wilhelm Christian, war infolge seiner Alkoholfreudigkeit ohnehin ein Spielball in den Händen der in Warmbad wohnenden Syndikatsmitglieder. Er soll für die beiden Kriegszüge seitens des Syndikats reichlich mit Proviant und Munition ausgestattet worden sein. Doch gelang ihm nur die Unterwerfung der Swartmodder-Hottentotten, während die Feldschuhträger sich auch fernerhin als selbständiger Stamm zu behaupten[S. 265] vermochten. Die Möglichkeit hierzu hatte der Stamm lediglich dem Glück zu verdanken, als Zankapfel zwischen zwei Mächtigen, Witbooi und Wilhelm Christian, von beiden begehrt und daher von keinem dem anderen gegönnt zu sein.
Aus sämtlichen unter A. und B. genannten Land- und Minenkonzessionen haben sich schließlich nach erfolgter Bestätigung durch die deutsche Regierung folgende Gesellschaften entwickelt:
1. Deutsche Kolonial-Gesellschaft für Südwestafrika, umfassend die Konzessionen A. 1., 2. und 3., einschließlich der Minenrechte, mithin den Zwanzigmeilenstreifen längs der Küste bis zur Mündung des Omaruruflusses und das ehemalige Jan Jonker-Gebiet zwischen Kuiseb und Swakop, ferner die nach B. 3. besonders verliehenen Minenrechte, d. h. diejenigen im Hererolande.
2. Die Kaoko-Land- und Minengesellschaft, umfassend die Konzessionen A. 4., Minenrechte eingeschlossen, mithin das ganze sogenannte Kaokofeld zwischen Omaruru- und Kunenefluß.
3. Hanseatische Land-, Minen- und Handelsgesellschaft, umfassend die Konzessionen B. 2., d. h. die Minenrechte im Gebiete der Rehobother Bastards, sowie der Khauas-Hottentotten. Außerdem erhielt die Gesellschaft durch einen mit der Regierung abgeschlossenen besonderen Vertrag vom 11. August 1893 im Gebiet der Khauas-Hottentotten die Minengerechtsame sowie die Anwartschaft auf 10000 qkm Kronland, sobald solches verfügbar sei.
4. Die South African Territories Ltd., sich gründend auf die Verträge zu A. 5., Land- und Minenrechte betreffend, soweit solche durch die Regierung bestätigt worden waren, mithin Land- und Minenrechte im Gebiete der Hottentotten von Keetmanshoop, der Bondelzwarts und der Feldschuhträger.
Ferner konzessionierte die Regierung direkt noch folgende zwei Gesellschaften:
5. Die Siedelungsgesellschaft für Deutsch-Südwestafrika, gegründet auf eine Landüberweisung von 20000 qkm in dem Gebiete der Hoachanas- und der Khauas-Hottentotten.
6. Die South West Africa Company Ltd., gegründet auf Minen- und Länderüberweisung (10000 qkm) in dem früher herrenlosen Gebiet zwischen Herero- und Ovamboland.
Da die beiden letztgenannten Gesellschaften nicht auf vorher mit den Eingeborenen abgeschlossenen Verträgen beruhen, sondern seitens der[S. 266] Regierung konzessioniert waren, so erübrigt hier deren Besprechung, die im nächsten Kapitel erfolgen wird.
Die Grenzen sämtlicher Land- und Minengesellschaften des Schutzgebietes sowie des Kronlandes sind aus beiliegender Skizze ersichtlich.
Nachdem im Verfolg der Aufrichtung der deutschen Schutzherrschaft die ferner ohne Genehmigung der Regierung seitens der Eingeborenen etwa verliehenen Land- und Minenrechte für ungültig erklärt und so der weiteren Verschleuderung solcher Rechte ein Riegel vorgeschoben worden war, blieb noch übrig, der eindringenden Landspekulation einzelner gleichfalls Halt zu gebieten. Die Verordnung vom 1. Oktober 1888 setzte daher fest, daß auch die Verträge über den Verkauf einzelner Farmen zwischen einzelnen Weißen und Eingeborenen der Regierungsgenehmigung bedürften. Die Versagung der Genehmigung war in Aussicht gestellt, falls eine Übervorteilung der Eingeborenen oder eine Bedrohung allgemeiner öffentlicher Interessen zu befürchten wäre. Diese Verordnung wurde im Jahre 1892 auch auf Pachtverträge ausgedehnt. In eine festere Form wurde dann die ganze Materie durch die Allerhöchste Verordnung vom 21. November 1902 gebracht, zu welcher der Gouverneur am 22. Mai 1903 Ausführungsbestimmungen erließ, deren § 2, wie folgt, lautet.
»Zur Besitzergreifung oder Erwerbung von Rechten an herrenlosem Lande sowie zu Verträgen, die den Erwerb des Eigentums oder dinglicher Rechte an Grundstücken Eingeborener oder die Benutzung solcher Grundstücke durch Nichteingeborene betreffen, bedarf es innerhalb des Schutzgebietes der Genehmigung des Gouverneurs. Die Genehmigung kann an Bedingungen geknüpft werden.«
Indessen, alle Schutzmaßnahmen genügten nicht, einer weiteren beängstigenden Verschleuderung von Land durch die Eingeborenen Einhalt zu tun. Ungünstig wirkte hierbei der Umstand mit, daß nach den Rechtsanschauungen der Eingeborenen das Land nicht Eigentum des einzelnen, sondern des Stammes ist. Verkaufen kann es daher nur die Stammesregierung, d. i. der Kapitän und seine sogenannten Großleute. Je nachdem diese ihre Pflichten auffaßten, waren sie auf die Erhaltung des Stammesvermögens bedacht, oder auf dessen Verwertung zur Befriedigung ihrer Genußsucht. Wo letzteres der Fall, war es geradezu eine Ausnahme geworden, wenn ein Einwanderer von Eingeborenen Land gegen Barzahlung erwarb.[S. 267] Meist hatte der Kapitän mit seinem Rat den Preis in Gestalt von Waren jeder Art bereits vorweg erhalten. Der Käufer dagegen hatte sich entweder nur vorübergehend mit dem Umsatz von Waren befaßt, um auf diese Weise billig zu Vieh und zu Land zu kommen, oder aber die ständigen Kaufgeschäfte gaben so lange auf Kredit, bis der Wert einer Farm erreicht war, und legten dann der Regierung einen Kaufvertrag zur Genehmigung vor. Diese letztere Seite der Landfrage fällt unter das Kapitel der bereits behandelten Kreditverordnung.
Erklärungen:
 | Regierungsland, in dem die Bergrechte der Regierung zustehen. | |
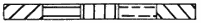 | Regierungsland, in dem die Bergrechte Anderen zustehen. | |
 | Landbesitz der Deutschen Colonial-Ges. für Südwest-Afrika (Lüderitz'sche Erwerbung, von den Eingeborenen-Kapitänen durch Verträge erworben). | |
 | Landbesitz der Kaoko-Land- u. Minen-Ges. (von der Deutschen Colonial-Ges. für Südwest-Afrika an die Kaoko-Land- u. Minen-Ges. abgetreten). | |
 | Landbesitz der Siedelungsgesellschaft (Konzession der Regierung). | |
 | Landbesitz der South West Africa Co. (Konzession der Regierung). | |
 | Landbesitz der Otavi-Minen- u. Eisenbahnges. (von der South West Africa Co. erworben). | |
 | Farmen der South African Territories Ltd. (Konzession der Regierung auf Grund von Verhandlungen mit Eingeborenen-Kapitänen). | |
 | Minengerechtsame der Deutschen Colonial-Ges. für Südwest-Afrika. | |
 | Minengerechtsame der Kaoko-Land- und Minen-Ges. | |
 | Minengerechtsame der South West Africa Co. | |
 | Minengerechtsame der Otavi-Minen- u. Eisenbahnges. | |
 | Minengerechtsame der South African Territories Ltd. | |
 | Minengerechtsame der Hanseat. Land- u. Minen-Ges. | |
Solange sich jedoch der Übergang des Landes aus den Händen der Eingeborenen in diejenigen der Weißen in mäßigen Grenzen hielt, handelte es sich nur um einen naturgemäßen und mit Freuden zu begrüßenden Prozeß. Dies änderte sich jedoch mit zunehmender Einwanderung. Denn jeder kaufte natürlich sein Land da, wo er es am billigsten erhalten konnte. Die höchsten Landpreise hatten die landbesitzenden Gesellschaften, weit geringere dagegen die Regierung, mit denen diejenigen der Eingeborenen sich annähernd die Wage hielten. Die Gepflogenheit, bei den letzteren an Stelle der Barzahlung diejenige mit teuer berechneten Waren treten zu lassen, ließ jedoch bei diesen das Land am billigsten erscheinen, auch wenn die Regierung Zahlungsbedingungen auf längere Sicht gewährte. Infolgedessen drängten die Käufer nach den Stammesgebieten, vor allem nach denjenigen der Hereros. Hier lockten nicht nur die allgemeinen besseren Wasser- und Weideverhältnisse, sondern auch die Nähe der Bahn, sowie ein über die Maßen genußsüchtiger und verschwenderischer Oberhäuptling, der für seine Rechte als Herr der Hereros sehr viel Verständnis besaß, für seine Pflichten aber umsoweniger. Oberhäuptling Samuel war die fortgesetzte Sorge aller seiner Distriktschefs, die ihn zuweilen geradezu unter Kuratel stellen mußten. Und doch kam er auch beim Verkauf einer Farm nach der anderen aus seinen Schulden niemals heraus. Er zehrte daher an dem Kapital seines Volkes und huldigte offensichtlich dem bekannten Grundsatz »après nous le déluge«. Auch Ermahnungen und Warnungen, die ich persönlich an ihn verschwendete, nützten nichts. Er pflegte schuldbewußt das Haupt zu senken, sein und seiner Leute Leichtsinn einzugestehen und — weiter Farmen zu verkaufen. Trat dann ein Weißer mit den von Samuel und seinen Großleuten unterschriebenen Kaufverträgen mit der Bitte um Bestätigung an das Gouvernement heran, so wollte eine etwaige abschlägige Antwort wohl überlegt sein. Und doch erfolgte eine solche mit Rücksicht auf die gefährdeten Interessen der verkaufenden Eingeborenen nicht selten. Aber stets riskierte die Regierung[S. 268] hierwegen den Vorwurf, die Besiedlung des Landes aufzuhalten, häufig auch unter der Drohung: »Ich werde mich an den Reichstag wenden.«
Aber auch die Untertanen des Oberhäuptlings sahen nicht immer stumpfsinnig dessen Landverschleuderung zu. So erhielt ich im Jahre 1901 folgenden charakteristischen Brief:
Otjihaenena, den 19. August 1901.
Sehr geehrter Herr Gouverneur!
Soeben kommen die unterzeichneten Herero-Großleute zu mir und bitten mich, Euer Hochwohlgeboren folgendes mitzuteilen: Kajata von Okatumba erzählt, daß um Ostern 1900 ein Ansiedler, Herr Westphal, nach Okatumba gekommen sei und habe sich dort ein kleines Pfahlhaus gebaut und darin einen kleinen Store eröffnet. Jetzt habe er vor etwa fünf Wochen angefangen, ein Haus aus Lehmsteinen zu bauen. Er wie auch Muambo hätten ihm dieses verboten, weil er kein Eigentum habe; aber Herr Westphal habe sich gar nicht daran gekehrt. Sie könnten Herrn Westphal in Okatumba keine Heimstätte geben, da der Platz ihnen und ihren Kindern bleiben solle, da sie denselben seit 1893 bewohnten, auch seien sie in dieser Zeit nicht nach anderen Plätzen gezogen. Die Handlungsweise hätte ihn mit veranlaßt, die anderen Großleute zu einer Beratung zusammenzurufen. Da sie nun niemand hätten, welcher die deutsche Sprache gut verstände und schreiben könnte, so seien sie zu ihrem Missionar gekommen, damit derselbe Euer Hochwohlgeboren obiges und noch folgendes schreibe.
Vorige Woche ist ein Herr Stöpke hier angekommen und dieser hat uns gesagt, er habe den Platz zwischen der Farm des Herrn Conrad in Orumbo und der Farm des Herrn Schmerenbeck in Ommadjereke von der Bezirkshauptmannschaft in Windhuk gekauft und verlange daher, daß Mbaratjo mit seinen Leuten, welche auf demselben wohnen, von dort wegziehen sollen. In Otjivero wohnt Herr Heldt, welcher nun schon drei Jahre dort wohnt und sucht den Platz auf allerlei Art und Weise zu kaufen. In Okamaraere gegenüber von Orumbo wohnt Herr Wosidlo, in Omitava wohnt Herr Eilers und in Okahua hat sich in diesen Tagen Herr v. Falkenhausen niedergelassen. Orumbo ist dahin, Ommadjereke und Ogipave ist an Herrn Schmerenbeck übergegangen und Otjituepa an die Herren Voigts. Dieses ist aber nicht von uns geschehen, sondern von Samuel Maharero.
Aber nun geehrter Herr Gouverneur, wo sollen wir bleiben, wenn unser ganzer Fluß und alles Land uns abgenommen wird? Anbei legen[S. 269] wir ein Verzeichnis aller Werften, welche im Gebiete von Otjituepa bis Omitava liegen. Diese alle tränken ihr Vieh im Weißen Nosob. Und so fragen wir nochmals, wo sollen alle diese Leute hin?
Wir sehen mit Entsetzen, wie ein Platz nach dem anderen in die Hände der Weißen übergeht, und bitten wir daher unseren geehrten Herrn Gouverneur untertänigst, doch keinen weiteren Verkauf hier im Gebiete des Weißen Nosob zu genehmigen und alles Land, welches noch nicht verkauft ist, zu einem großen Hereroreservat zu machen; denn dann sind wir und unsere Kinder geborgen, d. h. wir haben einen Platz, wo wir wohnen können und Gärten machen. Alle auf dem Verzeichnis verzeichneten Werften haben sich an dem Aufstande in Gobabis nicht beteiligt, ja viele von uns haben sogar gegen unsere Landsleute Kahimema und Nikodemus mitgefochten. So haben wir auch treu bis heute auf seiten der Regierung gestanden und werden auch noch ferner dasselbe tun. So dürfen wir auch hoffen, daß Sie, geehrter Herr, unsere Bitte erfüllen werden.
Wir Endesunterzeichneten bemerken noch zum Schluß, daß Herr Missionar Lang in dieser Sache nichts zu tun hat. Wir haben unter Darlegung, wie alles gekommen ist, versucht, unser Herz vor Ihnen auszuschütten, und das konnte hier nur Herr Missionar in Worten wiedergeben.
Alle Unterzeichneten senden darum ihrem geehrten Gouverneur
viele Grüße.
Dieser Brief stammt von den in der Nähe der Missionsstation Otjihaenena wohnenden Herero-Großen, an der Spitze der schon mehrfach genannte Kajata, und hat viel dazu beigetragen, daß man der Frage der Schaffung unveräußerlicher Reservate für die Eingeborenen auch im Hererolande näher trat.
Denn mit noch mehr Sorge als die Regierung hatte die Rheinische Mission dem Schwinden des Stammesvermögens der Eingeborenen zugesehen. Sie war es daher, die in zahlreichen Eingaben immer wieder auf die Notwendigkeit der Schaffung von unverkäuflichen Reservaten für die Eingeborenen zurückkam. In einem Schreiben vom 21. April 1902 führte deren Vertretung z. B. folgendes aus:
»Und nun erlauben Sie uns, daß wir etwas näher auf die ganze Art und Weise eingehen, wie die Europäer mehr und mehr in den Besitz des Landes kommen. Es ist ja durchaus anzuerkennen, daß die Regierung jeden einzelnen Landverkauf erst genehmigen muß. Wie schon oben angedeutet,[S. 270] vollziehen sich aber fast alle Landverkäufe in der Art, daß die Hereros bei den Händlern, die gar nicht selten gegen den Willen der Hereros sich unter ihnen niederlassen, auf Borg, oder wie man dort zu Lande sehr bezeichnend sagt, »auf Bankerott« alle möglichen Waren, und zwar keineswegs nur gute und nützliche Dinge, sondern vielfach ganz unnötigen Putz und dgl. kaufen, wozu sie von den betreffenden Händlern auf alle Weise ermuntert werden, solange sie noch irgend etwas, sei es Vieh oder Land, besitzen. Gegen dieses sehr zweifelhafte Verfahren hatte der Herr Gouverneur unter dem 1. Januar 1899 eine sehr heilsame Verordnung erlassen. Aber leider wurde dieselbe schon am 23. Februar desselben Jahres wieder suspendiert. Man kann sich des Eindruckes kaum erwehren, daß solches dadurch zu erklären ist, daß der Herr Gouverneur dem Drängen der weißen Ansiedler, oder besser gesagt, Kaufleute nachgegeben hat. Denn tatsächlich gibt es nur sehr wenige der sogenannten »Ansiedler«, die nicht gleichzeitig oder sogar ausschließlich Händler wären, und manche von ihnen haben so viele Farmen erworben, daß sie offenbar Landspekulation im Sinne haben.
»Daß diese Ansiedler es offen aussprechen, wie es in der »Deutsch-Südwestafrikanischen Zeitung« vom 22. Januar dieses Jahres zu lesen steht: »Daß das Land aber überhaupt aus den Händen der Eingeborenen in die der Weißen übergeht, entspricht nur dem Zwecke der Kolonisation in diesem Gebiete. Das Land soll durch Weiße besiedelt werden. Dann müssen die Eingeborenen aber weichen und sich entweder in den Dienst der Weißen begeben oder sich in die ihnen bestimmten Reservate zurückziehen.« Anderwärts wird noch hinzugefügt, daß die weißen Farmer nicht so billig Viehzucht treiben könnten wie die Hereros. Darum müsse diese Konkurrenz dadurch abgetan werden, daß man letzteren ihre wirtschaftliche Selbständigkeit nimmt. Wir sagen, daß dies die Meinung und das Ziel der weißen Ansiedler sei, das ist nicht zu verwundern, sondern ganz natürlich. Aber wogegen wir auf das entschiedenste protestieren müssen, ist dies, daß sich die Regierung diesen Standpunkt aneignet und danach verfährt. Solcher unser Protest stützt sich auf drei gute Gründe, nämlich auf das feierliche Wort unseres Kaisers, auf die Kaiserliche Verordnung, betreffend Schaffung von Eingeborenen-Reservaten, und endlich auf das, was unsere Mission in diesem Gebiete in fast 60jähriger mühsamer Arbeit zustande gebracht hat.«
Diese Ausführungen enthalten vieles Wahre. Immerhin erscheint aber der Standpunkt der Mission ebensosehr als zu weitgehend wie derjenige mancher Weißen. Denn daß die Eingeborenen möglichst besitzlos gemacht[S. 271] werden sollten, erscheint ebenso unberechtigt wie daß sie möglichst in ihrem Besitz erhalten werden sollten. Auf alle Fälle aber verlangten unser Vertragsverhältnis zu den Eingeborenen sowohl wie auch die bestehenden Machtverhältnisse ein schonendes Vorgehen in dieser schwierigen Sache. Wenn demgegenüber der Verfasser des in dem Schreiben der Mission erwähnten Artikels der »Südwestafrikanischen Zeitung« kurzer Hand eine Entrechtung der Eingeborenen verlangt, so hat er anscheinend beides übersehen.
In diesem Zwiespalt der Meinungen mußte daher der Standpunkt des Gouverneurs ein vermittelnder sein. Das Ziel unserer Kolonisation war zweifellos die Schaffung einer von Weißen bevölkerten Kolonie, aber die Erreichung dieses Zieles war ohne Härte und ohne Gewaltmaßregeln anzustreben. Auch erschien es so sehr wohl erreichbar. Denn die Tatsache, daß die Eingeborenen nun einmal arbeitsscheu und genußsüchtig sind, daß sie von der Hand in den Mund leben und somit in dem wirtschaftlichen Wettkampf mit den betriebsameren Weißen schließlich der Sieg diesen zufallen mußte, kann auch der wohlwollendste Berater der Eingeborenen nicht aus der Welt schaffen.
Um indessen bei diesem Wettkampfe die größten Härten von vornherein auszuschließen, war es ein auf den ersten Blick einleuchtender Gedanke, beide Rassen mittels Eindämmung der einen von ihnen in bestimmte Gebiete einerseits zu trennen, anderseits die Eingeborenen, als die wirtschaftlich Schwächeren, lebensfähig zu erhalten. Daher stand die Kolonialverwaltung den Anträgen der Mission auf Reservatsbildung, soweit sie dies mit ihren Pflichten gegenüber einer Besiedlungskolonie vereinbaren konnte, auf das wohlwollendste gegenüber. Geringere Schwierigkeiten als im Hererolande mußte im übrigen die Reservatbildung im Namalande bieten. Dort wohnte ein viehbesitzendes, hier dagegen ein vieharmes Volk. Im Namalande kam denn auch diese Frage zuerst in Fluß, dort wurde sie seitens der Mission bereits 1895 in Anregung gebracht, worauf nach mehrjährigen Verhandlungen die diese Sache regelnde Allerhöchste Verordnung vom 10. April 1898 erlassen worden ist.
In der Fassung dieser Verordnung blieb das Reservat unbeschränktes Eigentum der Eingeborenenstämme, wogegen es der Mission unbenommen war, ihre Ziele durch Abschluß besonderer Verträge mit den ersteren zu erreichen. Erstmals zur Anwendung kam die Verordnung im Gebiete Witboois. Dieser kluge und einsichtige Kapitän hatte den Vorteil, den eine Reservatbildung für die Zukunft seines Stammes bieten mußte, wohl erkannt. Denn, so klug[S. 272] er auch war, den raschen Übergang seines Landes in die Hände der Weißen vermochte auch er nicht zu hindern. Der Zudrang weißer Einwanderer in sein Gebiet war vielmehr bei der in diesem herrschenden Sicherheit sowie bei der anerkannten Tüchtigkeit des dortigen Bezirksamtmanns v. Burgsdorff gerade am lebhaftesten. Schulden hatte dagegen stets sogar auch Kapitän Witbooi. Denn seine Leute waren so wenig wie die übrigen Hottentotten produzierende Elemente. Höchstens waren sie zeitweise an öffentlichen Arbeiten beschäftigt. Da nun nach der Stammessitte der Eingeborenen der Kapitän für seine hungernden Untertanen zu sorgen hat, so konnte auch dem Kapitän Witbooi das Schuldenmachen nicht erspart bleiben, obwohl er — im Gegensatz zu Oberhäuptling Samuel — für seine Person durchaus mäßig lebte.
Der Kapitän, der gewiß zuweilen gleichfalls mit Sorge in die Zukunft seines Volkes gesehen hat, gab daher gern seine Zustimmung zur Schaffung eines Reservates für sein Gebiet. Auf Grund der erwähnten Allerhöchsten Verordnung wurde im Juli 1898 mittels Gouvernementsverfügung das Gebiet von Rietmond und Kalkfontein in einer ungefähren Ausdehnung von insgesamt 120000 ha zum unveräußerlichen Reservat des Witbooistammes erklärt. Die Mission sicherte sich dann ihren Wirkungskreis in diesem durch besonderen Vertrag mit dem Kapitän, in dem ihr für die Dauer von 70 Jahren das Recht eingeräumt war, sich mit ihren Angehörigen im Reservat beliebig niederzulassen und alle Einrichtungen zu treffen, die das Wohl der Eingeborenen in seelsorglicher wie in wirtschaftlicher Hinsicht zu fördern geeignet seien. Die zu erzielenden Einnahmen verpflichtete sich die Mission nur zur Bestreitung von Ausgaben im Interesse des südwestafrikanischen Schutzgebietes zu verwenden. Dieses Reservat wurde auch sofort eingerichtet, und Witbooi wohnte von da ab meist in ihm und nicht mehr in seiner alten Residenz Gibeon.
Das nächste Reservat ward in Hoachanas, dem Hauptorte der roten Nation, gebildet. Dort wurde 1902 der Platz selbst mit einem Flächeninhalt von 50000 ha für unveräußerliches Eigentum des Stammes erklärt. Amtlich festgelegt konnten indessen seine Grenzen bis zum Ausbruch des Aufstandes noch nicht werden. Weitere Reservate wurden im Namalande vorläufig nicht gebildet, da bei der geringen Seelenzahl der Hottentotten im Verhältnis zu dem weiten Lande ein Bedürfnis hierzu noch nicht vorlag. Während sich so im Namalande die Frage der Reservatbildung mithin in der glattesten Weise abgewickelt hatte, nahm sie im Hererogebiet einen ganz anderen Verlauf.
Die Mission, der im Hererolande in dieser Sache zu erwartenden Schwierigkeiten sich wohl bewußt, regte die Frage überhaupt für dort erst im Jahre 1901 an. Nach längeren Verhandlungen erging auf Grund einer Weisung von Berlin unter dem 31. Januar 1902 an die Bezirks- und Distriktsämter im Hererolande nachstehende Weisung des Gouverneurs:
».... Die pp. ersuche ich ergebenst, hiernach festzustellen, welche Reservate für die einzelnen Hererostämme gewünscht werden. Das Bezirksamt Windhuk wird voraussichtlich deren mehrere in Vorschlag bringen müssen. Für die übrigen Verwaltungsbehörden dürfte je eins genügen, da auch nur je ein geschlossener Hererostamm in deren Bezirk wohnhaft ist.
»Um übertriebenen Forderungen, die namentlich seitens der Mission zu erwarten sind, zu begegnen, bitte ich, bei den bezüglichen Besprechungen mit Missionaren und Häuptlingen stets den Begriff »Reservat« klar festzuhalten. Dieser Begriff geht dahin, daß das zum Reservat erklärte Land seitens der Eingeborenen nie verkauft werden darf, daß aber alles übrige Land nach wie vor in deren Eigentum verbleibt und dieselben niemand zu dessen Verkauf zwingen kann. Die Mission hat zunächst mit den Reservaten an sich nichts zu tun, doch ist es naturgemäß, wenn die letzteren sich um die Missionsstationen herum gruppieren und wenn dann die Missionare versuchen werden, mittels besonderer Abmachungen mit den Eingeborenen sich innerhalb der Reservate unter Ausschluß aller übrigen Weißen gewisse Rechte zu sichern. Unter diesem Gesichtspunkte der drohenden Monopolisierung einerseits, anderseits aber auch der Sicherung der Zukunft der Eingeborenen sind daher die Lage und der Umfang der Reservate festzusetzen. Auch ersuche ich, bei den Verhandlungen zu betonen, daß die Schaffung der Reservate selbst vorläufig noch nicht in allzu naher Zeit in Aussicht zu nehmen sei.
»Im übrigen verweise ich auf die Allerhöchste Verordnung vom 10. April 1898.«
Die hieraus eingegangenen Vorschläge wurden einstweilen zurückgelegt, bis ich Gelegenheit hatte, während eines Heimaturlaubes im Jahre 1902 in der Sache persönlich im Kolonialamt Vortrag zu halten. In einer Konferenz zu Berlin, November 1902, bei der auch der Missionsinspektor Dr. Schreiber zugegen war, wurde beschlossen: 1. Im Gebiet von Otjimbingwe jetzt schon ein förmliches Reservat zu bilden. 2. In den übrigen Gebieten des Hererolandes lediglich sogenannte »papierne« Reservate[S. 274] festzulegen, d. h., es sollten durch eine Kommission einstweilen diejenigen Gebiete bezeichnet werden, die in Zukunft für den Fall der Einrichtung fester Reservate in Betracht kämen. In diesen Gebieten sollten dann Landveräußerungen schon jetzt nur in dringenden Ausnahmefällen zugelassen werden.
Nachdem ich in das Schutzgebiet zurückgekehrt war, erging demnächst unter dem 21. Mai 1903 an die Verwaltungsbehörden im Hererolande folgendes Rundschreiben:
»Die pp. ersuche ich um Vorschläge über die in Aussicht genommenen Reservatbildungen, wobei ich jedoch dringend festzuhalten bitte, daß nur annehmbare Vorschläge eingereicht werden, und verweise in dieser Beziehung auf die Verfügung vom 31. Januar 1902. Die auf letztere eingegangenen Vorschläge entsprechen nicht immer dieser Anforderung. Ein Stamm wie derjenige des Häuptlings Tjetjo mit vielleicht 2000 Seelen bedarf nur ein bis zwei guter Wasserstellen nebst dem dazu gehörigen Weideland. Zu weitgehend sind auch die Vorschläge, die seinerzeit für die Stämme von Omaruru und Okahandja-Waterberg eingereicht worden sind. Als annehmbar können — um dies zu wiederholen — nur Vorschläge bezeichnet werden, die 1. nicht allzu ausgedehnte Gebiete beanspruchen, 2. nicht verkehrsreiche Plätze in Aussicht nehmen, deren Besiedlung durch Weiße bereits in Angriff genommen oder zu erhoffen ist.
»Den gelegentlich der Missionskonferenz in Windhuk zusammengetretenen Herero-Missionaren habe ich die vorstehenden Gesichtspunkte auseinandergesetzt und im großen und ganzen Verständnis gefunden. Indessen sind doch von dieser Seite Versuche zu weitergehenden Anforderungen zu erwarten, als die Regierung sie zu bewilligen vermag.
»Wie aus den Beschlüssen der Kommission hervorgeht, ist bis jetzt einzig und allein das Reservat von Otjimbingwe bewilligt. In diesem Stammesgebiete war solches möglich, da die Eisenbahn dessen Entwicklung bereits festgelegt hat. Ich ersuche den Distriktschef von Karibib, in Gemeinschaft mit dem Missionar von Otjimbingwe die Grenzen des künftigen Reservats nunmehr im Gelände festzulegen und das Ergebnis zur Genehmigung hierher einzureichen. Sämtliche bereits von Weißen gekauften Farmen müssen selbstredend außerhalb des Reservats bleiben, daran anschließend auch diejenigen Farmen, die voraussichtlich noch ein Kaufobjekt für Ansiedler bilden könnten. Auch ist die Mission zu verpflichten, einem etwaigen späteren Bergwerksbetrieb innerhalb des Reservats keinerlei Hindernisse in den Weg zu[S. 275] legen. Daß dies die Eingeborenen nicht tun werden, darf wohl als selbstverständlich angenommen werden.
»Zu der Kommission, welche die Grenzen des Reservats festlegt, sind auch zwei Ansiedler hinzuzuziehen. Den einen wählt der Distriktschef, den zweiten der Missionar. Ob auch zur Festlegung der vorzubereitenden Reservate bereits Kommissionen gebildet werden sollen, stelle ich anheim. Diese Reservate können bei eintretendem Bedürfnis jederzeit wieder geändert werden.«
Nachdem die Vorschläge eingegangen waren, wurde unter dem 8. Dezember 1903 ein Teil des Gebietes von Otjimbingwe zum unveräußerlichen Reservat des dortigen Stammes erklärt, in den Distrikten Okahandja und Gobabis dagegen sogenannte papierne Reservate festgelegt. Die Bestimmung der Grenzen für ein solches im Bezirk Omaruru wurde dagegen vorläufig ausgesetzt, da mittlerweile die Otavi-Gesellschaft gegründet worden war und sonach ein Eisenbahnbau durch das dortige Gebiet in Aussicht stand, den abzuwarten rätlicher erschien, da in seinem Gefolge sich im Bezirk die Besitzverhältnisse verschieben mußten.
Bei Festsetzung dieser Reservate im Hererolande, auf welche die Mission schon so lange gedrungen hatte, mußte angenommen werden, daß es den Hereromissionaren bei ihrer Beherrschung der Landessprache gelungen wäre, den Eingeborenen die Bedeutung wie auch den Nutzen unveräußerlicher Reservate klarzumachen. Außerdem kamen noch drei Monate vor dem Aufstande die Großleute der Hereros unter Führung des Distriktschefs von Okahandja zur Besprechung zu mir nach Windhuk. Hierbei habe auch ich ihnen persönlich die Bedeutung der Reservate für ihre Zukunft klarzulegen versucht. Ich habe sie auf ihre leichtsinnige Schuldenwirtschaft hingewiesen und hinzugefügt, daß diese den Anlaß zur Aufrollung dieser Frage gegeben habe. Besonders aber habe ich betont, daß auch das nicht zum Reservat erklärte Hereroland ihr, der Hereros Eigentum bliebe, das sie nach Belieben verkaufen oder auch behalten könnten. Als Zeichen, daß mich wenigstens die Großleute verstanden hatten, glaubte ich den Zwiespalt auffassen zu dürfen, der nunmehr zwischen der Partei des Oberhäuptlings Samuel und derjenigen des mehr zur Wirtschaftlichkeit neigenden Unterhäuptlings Assa Riarua zutage trat. Die erstere wollte die Reservate möglichst klein, die letztere möglichst groß bemessen haben, die eine, um auch ferner viel Land verkaufen zu können, die andere, um für alle Zeiten viel Weideland zu behalten. Ich selbst habe mich entschieden auf die Seite der letzteren gestellt.
Erst nach Ausbruch des Aufstandes tauchten Gerüchte auf, die Reservatsfrage sei mit ein Anlaß zu ihm gewesen. Aus dieser Tatsache würde man zwei Schlüsse ziehen können. Entweder, daß die Mission an diese Frage ohne Fühlung mit der Masse des Hererovolkes herangetreten sei, oder daß dessen Großleute die Bedeutung der Sache doch nicht verstanden, vielleicht aber auch nachträglich absichtlich so getan hätten. Die Regierung ihrerseits würde keinerlei Interesse gehabt haben, die Frage jetzt schon aufzurollen. Wäre nur die geringste Unzuträglichkeit zu erwarten gewesen, so hätte sie anstandslos bis in spätere Zeiten vertagt werden können.
»Kein Weißer kann je ein Kafferngehirn verstehen«, sagt mit Recht ein altes afrikanisches Sprüchwort. Jedenfalls haben wir in der Landfrage die Hereros nicht verstanden, und sie uns auch nicht. Außerdem müssen die Hererogroßleute ein falsches Spiel gespielt haben. Kein Mensch hat diese je zu einem Landverkauf gezwungen. Im Gegenteil, sie wurden nicht nur durch die Verwaltungsbeamten, sondern auch durch die Missionare, außerdem aber auch der Oberhäuptling selbst durch mich persönlich oft genug belehrt und ermahnt, sie sollten endlich ihrem wilden Schuldenmachen und der damit verbundenen Landverschleuderung ein Ende setzen. Alles vergeblich! An ihrer unüberwindlichen Genußsucht, verbunden mit Arbeitsscheu, prallten alle Ermahnungen ab. Hierüber ist zweifellos die Masse des Hererovolkes nie aufgeklärt worden, vielmehr haben der Oberhäuptling und die Großleute ihre Landverschleuderungen anscheinend mit einem »Drucke« seitens der deutschen Regierung entschuldigt.
Nicht anders hat es sich wohl bei der Reservatsfrage verhalten. Die Großleute waren hinreichend aufgeklärt worden, um auch der Masse des Volkes sagen zu können, daß niemand zur Einpferchung in die vorgesehenen Reservate gezwungen werden solle, daß vielmehr das bisherige Weideland auch ferner unumschränktes Eigentum der Hereros bleibe. Aber diese Aufklärung ist anscheinend nicht weitergegeben worden. Vielmehr tauchten unmittelbar nach Rückkehr der Großleute von der oben geschilderten Konferenz in Windhuk die Mißverständnisse in Masse wieder auf. Die vorgesehenen Reservate wären zu klein, so wurde behauptet, ferner zu abgelegen und die Weide zu schlecht. Es sollen dann noch erneute Verhandlungen in Okahandja stattgefunden haben, die ich nicht mehr verfolgen konnte, da mich bald darauf der Aufstand der Bondelzwarts nach dem Süden des Schutzgebietes rief. Der Präses der Hereromission, an den ich mich nach Ausbruch des Hereroaufstandes mit der Bitte um Aufklärung gewendet habe, antwortete mir folgendes:
»Die nachdem erschienene Gouvernementsverordnung vom 15. Oktober 1903 über die vorläufige Festlegung des im Distrikt Okahandja zu schaffenden Eingeborenenreservats ist zu wenig unter dem Volke bekannt oder mit Vorurteil angehört worden. In derselben war ja darauf hingewiesen, daß die Reservate weder eine Einpferchung der Eingeborenen in dieselben, noch eine Änderung des jetzigen Besitzstandes bedeuteten, und daß die Schaffung von genügendem Weideland im Umkreis der Gemeinden ebenfalls baldigst angestrebt werden solle. Auf dies Schreiben hin haben wir es nicht unterlassen, schriftlich wie mündlich die Leute über die bei ihnen aufgetauchten schlimmen Befürchtungen, als wolle man sie durch die Anlegung von Reservaten aus ihrem gegenwärtigen Besitz verdrängen, eines Besseren zu belehren. Auch Herr Oberleutnant Zürn[70] hat sich in dieser Beziehung rechte Mühe gegeben. Aber viel scheint es doch nicht genutzt zu haben. Solcher Verdacht läßt sich schwer aus dem Herzen verbannen, wenn man geneigt ist, immer das Schlimmste vorauszusetzen. Es ist dem gerade nicht in öffentlicher Weise widersprochen worden, so daß man annehmen durfte, die Gemüter hätten sich etwas beruhigt. Darin haben wir uns jedoch getäuscht, wie über so manches, was der Aufstand zutage gefördert hat. Einige Tage nach der Katastrophe von Waterberg warf ein angesehener Herero von dort Missionar Eich vor, die Deutschen hätten sie bis an den Omuramba verdrängen und jenseits mit einem kleinen Stück Land abspeisen wollen. Das Feld, das sie bis dahin innegehabt, wäre ihnen damit verloren gegangen. Vielleicht, daß in dieser Leute Herzen auch noch ein gewisser Groll steckte, weil sie überhaupt bei der Reservatsfrage nicht zu Worte gekommen waren. Bekanntlich waren die Kambazembischen Großleute zu dem Zweck unterwegs nach Okahandja, als ihnen am Omuramba der Bescheid zuging, sie möchten wieder umkehren, die Sache sei erledigt.«
Das vorstehende Schreiben trifft den Kernpunkt der Sache. Das stets rege Mißtrauen der Eingeborenen gegen den weißen Eindringling war nun einmal wieder erweckt, und einer ganz besonders geschickten Hand hätte es bedurft, es wieder einzuschläfern. Diese Hand scheint vorliegend am Hauptplatze der Hereros gefehlt zu haben. So wurde die nur von dem größten Wohlwollen gegen die Eingeborenen getragene Regelung der Landfrage ganz unerwarteterweise ebenfalls zu einem Funken, der das Pulverfaß mit zum Auffliegen bringen half. Den Ausschlag[S. 278] gab indessen, daß gerade in diesem ungünstigen Augenblick der Bondelzwartsaufstand ausgebrochen war. Ohne ihn würde die Reservatsfrage eine solche Tragweite niemals gewonnen haben.
So ziemlich die ältesten deutschen »Eindringlinge« im südwestafrikanischen Schutzgebiete waren die Missionare. Wurde doch schon 1849 die erste Missionsstation in Otjimbingwe gegründet. Etwa gleichzeitig mit den Missionaren kamen aber auch andere weiße Elemente, wie Händler und Jäger. Manche von diesen brachten den Eingeborenen gleichfalls »Errungenschaften der Zivilisation«, aber ganz anderer Art, nämlich Branntwein, Hinterlader und Krankheiten geheimer Art. Um so härter wurde der Kampf, den die Mission durchzufechten hatte. Den durch den Waffen- und Munitionshandel beförderten Kriegen der Eingeborenen unter sich fielen nur zu häufig auch blühende Missionsstationen zum Opfer. Mancher Missionar erlag den Entbehrungen und Leiden einer eiligen Flucht. Aber immer wieder kehrten die Überlebenden oder die Nachfolger der Verstorbenen an die Stätte des früheren Wirkens zurück und begannen ungebeugten Mutes ihre Arbeit von neuem. Und warum? wozu? Lediglich zu dem idealen Zweck der Verbreitung des Christentums.

Eine menschliche Einrichtung, die in bezug auf ihre Tätigkeit mit Menschen rechnen muß, bleibt die Mission indessen gewiß gleichfalls. Wie jeder menschlichen Einrichtung haften daher auch ihr Fehler und Schwächen an. Aber diejenigen, die deswegen abfällig über sie urteilen, bieten nach meiner Erfahrung dem alten Vaterlande weniger günstige Kolonisationselemente als die, welche das Gute der Mission herauszufinden und anzuerkennen wissen. Ein Hauptvorwurf gegen die letztere ist das Betreiben eigenen Handels mit den Eingeborenen gewesen. Gewiß war der Missionshandel[S. 279] seit dem Bestehen weltlicher Handelsfirmen im Schutzgebiete nicht mehr zeitgemäß. In diesem Sinne habe ich auch seinerzeit mit dem verstorbenen Missionsinspektor Dr. Schreiber die Sache besprochen und volles Verständnis gefunden. Von da ab ist in neu besetzten wie auch neu gegründeten Missionsstationen in der Tat auch kein Missionshandel mehr betrieben worden; in den alten Missionsstationen ist er dagegen allmählich immer mehr zusammengeschrumpft.
In jenen Zeiten dagegen, in denen im Schutzgebiet überhaupt noch keinerlei Handelstätigkeit bestand, war die Mission zu einer solchen geradezu gezwungen. Wollte sie den Eingeborenen neben dem Christentum auch Kultur beibringen, so mußte sie dieselben mit Kleidern versehen, wie ihnen auch sonst die Möglichkeit einer kultivierten Lebensweise schaffen. In dieser Tatsache ist der Grund dafür zu finden, daß die Mission sich überhaupt je mit Handelsgeschäften befaßt hat. Daß sie bei ihren knappen Mitteln die aus den letzteren entspringenden Zuschüsse auch wohl hat brauchen können, liegt auf der Hand. Das Einstellen ihrer Tätigkeit auf diesem Gebiete hat ihr daher Opfer auferlegt. Die Konkurrenz von weltlicher Seite hätte sie an sich nicht zu scheuen brauchen, denn sie übervorteilte die Eingeborenen nie, und hat neben den solideren, weltlichen Geschäften den Beweis geliefert, daß der Handel mit den Eingeborenen auch bei nur legitimem Gewinn zu bestehen vermag.

Ein entschiedenes Verdienst hat sich dagegen die Mission in Südwestafrika um die Aufrichtung der deutschen Schutzherrschaft erworben. War es doch überhaupt schon ein günstiger Umstand, daß wir im Lande[S. 280] gerade eine deutsche Mission vorgefunden haben. Als die Frage, ob englische oder deutsche Schutzherrschaft an die Eingeborenen herantrat, waren es im wesentlichen die Missionare, die durch ihr Eingreifen die Entscheidung für Deutschland herbeigeführt haben. Auch später, als es galt, mit den zur Verfügung stehenden geringen Mitteln unsere nominelle Schutzherrschaft in eine tatsächliche umzuwandeln, waren es wieder die Missionare, die als Dolmetscher und Vermittler diese Frage in friedlichem Sinne lösen halfen. Ohne deren vermittelnde Aufklärung würde es vielleicht während des Zuges des Majors v. François und von mir im Jahre 1894 durch das Namaland an manchem Platze lediglich aus Mißtrauen und Mißverständnis auf seiten der Eingeborenen zum Schießen gekommen sein. Eine nichtdeutsche Mission würde diese überaus wertvolle politische Mitarbeit nicht haben leisten können. Als Gegenwert hat die Mission in dem bisher durch Kriege zerrütteten Lande Ruhe und Frieden eingetauscht, aber auch das Zuströmen zweifelhafter weißer Elemente, die durch ihr bloßes Vorhandensein ihre Arbeit unter den Eingeborenen zu erschweren geeignet waren. Überhaupt ist eine starke weiße Einwanderung angesichts der ohnehin auf lockeren Füßen stehenden Moralbegriffe der Eingeborenen der Missionsarbeit nicht förderlich. Da aber die Regierung für die weiße Rasse gleichfalls »Ellbogenfreiheit« zu schaffen hatte, kam es dem oft allzu starken Eintreten der Missionare für ihre Pflegebefohlenen gegenüber in der Folge auch zwischen diesen und der Verwaltung zu mancher Meinungsverschiedenheit, so in der Reservats- wie in der Landverkaufsfrage. Meist aber wurden bei der auf beiden Seiten vorhandenen Neigung zum Entgegenkommen solche leicht wieder ausgeglichen.
Die erste in das Land gekommene Mission war die evangelische von der Rheinischen Missionsgesellschaft. Bezeichnenderweise hat in der Folge das Christentum bei den Hottentotten mehr Anklang gefunden als bei den Hereros. Bei letzteren konnte man die Christen leichter zählen, bei ersteren die heidnisch Gebliebenen. Die von Weißen abstammenden Bastards sind dagegen durchweg Christen. Das »mein Reich ist nicht von dieser Welt« hatte bei den Hottentotten mehr Verständnis gefunden als bei den Vieh und Frauen besitzenden Hereros. Zudem huldigen letztere dem Ahnenkultus, d. h. für sie ist der Geist des verstorbenen Vaters der Gott. War der Vater als Heide gestorben, konnte er im Jenseits dem Sohne das Abweichen von der väterlichen Religion übelnehmen und ahnden. Hierin mag der Grund liegen, daß wir häufig sämtliche Söhne angesehener, aber noch lebender Hereros als[S. 281] Christen finden, während die Väter selbst bis zum Tode Heiden bleiben. Denn nur sie haben den Geist des verstorbenen Vaters zu fürchten, während die eigenen Söhne durch die von dem noch lebenden Vater erhaltene Erlaubnis zum Übertritt gedeckt sind. In diese Kategorie zählen z. B. Kambazembi, Riarua und Tjetjo, sämtlich Heiden, aber mit christlichen Söhnen. Zweifelsohne spielt aber auch die Frauenfrage hierbei ihre Rolle. Das Christentum verlangt kurz und bündig eine Frau, mithin Trennung von dem bisherigen Harem, und dies leuchtet den Großleuten nicht ein. Dagegen ist dies bei den Hottentotten, deren Besitzlosigkeit ihnen das Halten mehrerer Frauen ohnehin nicht gestattet, weit weniger von Bedeutung. Durch ihr Drängen auf Einehe ist aber die Mission ebensogut zu einem Eingangstor für die europäische Kultur geworden, wie durch die Gewöhnung der Eingeborenen an europäische Lebensweise.
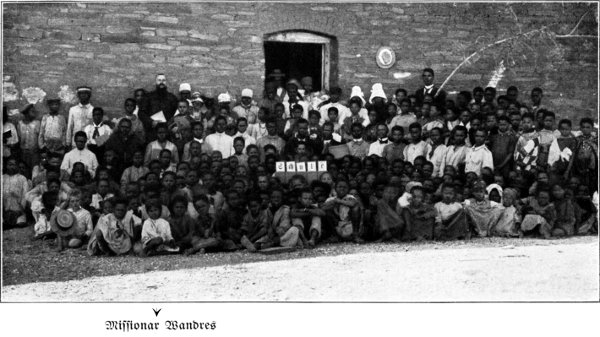
Als Kirchensprache hatte die Mission ursprünglich das durch die Buren in ganz Südafrika verbreitete Holländisch angenommen, diese Sprache aber nach Aufrichtung der deutschen Schutzherrschaft allmählich durch die deutsche ersetzt. Auch in dieser Beziehung kam es daher vorteilhaft zur Geltung, daß wir in Südwestafrika mit einer deutschen Mission hatten rechnen können. Im ganzen war nach Ansicht der Mehrzahl der Missionare die Schule der[S. 282] erfreulichere Teil der missionarischen Arbeit, aber auch sie litt sehr unter der nomadisierenden Lebensweise der Eingeborenen.
Nach einer von der Mission aufgestellten Statistik ergab die Hereromission für 1903, also vor dem Aufstande, folgendes Bild:[71] 15 Hauptstationen, 32 Filialen, 48 Schulen, 1985 Schüler, 7508 Gemeindemitglieder. Da sich die Zahl der Hereros insgesamt auf etwa 60000 bis 70000 veranschlagen läßt, hatte mithin etwa der zwölfte Teil des ganzen Volkes das Christentum angenommen. Dabei ist indessen zu beachten, daß auch die Bastards in Rehoboth sowie die zur Station Windhuk zählenden Hottentotten, endlich auch die im Kaokofeld wohnenden Hottentottenstämme der Swartboois und der Topnaars auf Grund ihrer geographischen Lage statistisch zur Hereromission gerechnet werden.
Bezüglich der Namamission ergibt die Statistik für dieselbe Zeit folgendes Bild: 8 Hauptstationen, 1 Filiale, 5 Schulen, 472 Schüler, 5111 Gemeindemitglieder. Obwohl die Gesamtzahl der hier in Betracht kommenden Hottentotten höchstens 10000 bis 12000 erreicht, ist so mit die Zahl der von diesen getauften doch nicht weit von derjenigen des soviel stärkeren Hererovolkes entfernt. Im übrigen aber erscheinen äußerlich die Hottentotten sämtlich als Christen, da bei diesen auch die Heiden in europäischer Kleidung gehen, während bei den Hereros die Heiden — zum Teil auch die reichsten — durchweg bei der alten Hererotracht verblieben sind. Als ich z. B. 1895 meinen ersten Besuch bei dem Unterhäuptling Kambazembi in Waterberg machte, erhielt ich von diesem auf die Frage, warum er bei seinem Reichtum nicht europäische Tracht trage, die Antwort: »Ich habe dies einmal versucht, aber da haben mich meine Ochsen nicht mehr erkannt und sind vor mir weggelaufen, als ich sie zählen wollte. Seitdem tue ich es nicht wieder«. Tatsächlich starb Kambazembi 1903 noch als Heide, während seine Söhne und Nachfolger David und Salatiel Christen sind.
Zu der evangelischen Mission kam 1896 auch die katholische, und zwar für den Norden des Schutzgebietes die Oblaten von der unbefleckten Jungfrau Maria, für den Süden die Oblaten vom Heiligen Franz von Sales. Die erstere bildet für Südwestafrika in ihrem Seminar Hünfeld nur deutsche Missionare aus, der letzteren, einer ursprünglich rein französischen Gesellschaft, ist für Gestattung ihrer Wirksamkeit im Schutzgebiete die Bedingung der Sendung nur deutscher oder wenigstens deutsch sprechender Brüder und[S. 284] Schwestern auferlegt worden. Da bei dem Erscheinen der katholischen Mission bereits fast das ganze Schutzgebiet in den Händen der evangelischen Mission war, so schien die Gefahr nicht ausgeschlossen, daß bei dem Nebeneinanderwirken der beiden Missionen unter den Eingeborenen die unter diesen schon zahlreich genug vorhandenen Keime der Zwietracht noch um einen weiteren vermehrt würden. Ferner konnten auch beide Missionen in den Augen der Eingeborenen durch die Wiedergabe verschiedener Lehren nicht gewinnen, in so friedfertiger und auf gegenseitiger Achtung gegründeter Weise dies auch geschehen mochte. Die unwissenden Eingeborenen mußten auf alle Fälle stutzig werden, wenn ihnen Sendboten desselben europäischen Volkes verschiedene Lehren brachten. Es wurde daher beiden Missionen zur Pflicht gemacht, sich jede von dem bereits gewonnenen Wirkungsfeld der anderen fernzuhalten, was sie verständigerweise auch taten. Den schwereren Stand hatte hierbei naturgemäß die katholische Mission, als die später gekommene. Indessen verstand sie diese Schwierigkeit mit Klugheit zu überwinden und so ohne Störung des friedlichen Nebeneinanderwirkens zu einem weiteren, dem Gouvernement sehr willkommenen Kulturfaktor zu werden. Sie erreichte dies, indem sie nicht die Eingeborenen aufsuchte, sondern sich von diesen aufsuchen ließ, d. h., sie erwarb Farmen und missionierte hier diejenigen[S. 285] Eingeborenen, die sich behufs bleibender Niederlassung freiwillig bei ihr eingefunden hatten. Auf diese Weise sind im Norden des Schutzgebietes die Missionsstationen Epukiro und Kaukurus entstanden, im Süden die Station Heirachabis. An den behufs seelsorgerischer Tätigkeit unter den Weißen eingerichteten Stationen Windhuk und Swakopmund sind dagegen für die sich freiwillig meldenden eingeborenen Kinder Pensionate eingerichtet.

Später ging die Station Kaukurus wieder ein, da dieser Platz zu dem Gebiet der Siedlungsgesellschaft gehört und die Mission den von der letzteren geforderten Landverkaufspreis nicht zu bewilligen in der Lage war. An deren Stelle trat die etwas südlicher gelegene Station Aminuis. Diese bildet insofern von der übrigen Art der katholischen Missionsarbeit eine Ausnahme, als es sich dort um deren Angliederung an einen bereits vorhandenen Eingeborenenstamm handelt, und zwar an einen aus dem englischen Südafrika eingewanderten Betschuanenstamm, den wir bereits im Kapitel II gelegentlich des dort geschilderten Zusammenstoßes der deutschen Regierungsgewalt mit den Khauas-Hottentotten begegnet sind. Seine Stärke betrug etwa 400 bis 500 Seelen.

Dieser Betschuanenstamm steht mit den übrigen Eingeborenen des Schutzgebietes in keinerlei Zusammenhang. Die Betschuanen sind weder[S. 286] Bantus noch Hottentotten, nähern sich aber dem ausgesprochenen Negertypus und ähneln daher äußerlich den Hereros. Sie unterscheiden sich indessen durch ihre Charakteranlagen sehr von diesen. Sie sind harmlos und weniger kriegerisch, überragen sie aber an Fleiß und infolgedessen auch an höherer Kultur. Bei großer Geschicklichkeit in Handarbeiten sind sie fleißige Gartenbauer und wohnen nicht in den bienenkorbähnlichen primitiven Pontoks der übrigen Eingeborenen, sondern in selbsterbauten sauberen Häusern. Der Religion nach waren die bei uns eingewanderten Betschuanen durchweg Anglikaner, jedoch schon jahrelang ohne Missionar, so daß ihnen der Begriff Christentum allmählich wieder abhandengekommen war, während die Jugend völlig im Heidentum aufwuchs. Sie wurden daher der katholischen Mission überlassen, die sich klugerweise auf die Erziehung der heranwachsenden Jugend beschränkt, und die bereits anglikanisch getauften Erwachsenen, soweit diese nicht selbst eine Änderung wünschten, unbehelligt gelassen hat. Aminuis ist eine der wenigen Missionsstationen des Schutzgebietes, die in der Folge während des großen Aufstandes erhalten blieben, da die Betschuanen sich unter weißer Herrschaft wohl fühlten und gar nicht daran dachten, sich den Aufständischen anzuschließen. Indessen hat doch nicht verhindert werden können, daß einer der in Aminuis stationierten Missionare, Pater Jäger, im Jahre 1904 während eines Ausflugs nicht allzu weit vom Platze als Opfer herumstreifender Aufständischer gefallen ist.
Der Einrichtung der Missionsstation war in Aminuis die einer Militärstation bereits vorausgegangen, aber keineswegs um etwa kriegerische Neigungen der Betschuanen im Zaume zu halten, sondern, um deren Handelstätigkeit zu überwachen. Bei ihrem Erwerbssinn betreiben die Betschuanen mit Vorliebe Munitionsschmuggel, den allerertragsreichsten aller Schmuggel, und sind infolge ihrer Beziehungen zu den Stammesgenossen jenseits der Grenze dazu wohl in der Lage.
Neben Kirche und Schule legte die katholische Mission ein besonderes Gewicht auf Ausbildung der eingeborenen Kinder in Handwerken aller Art, wozu das Vorhandensein von dem Handwerkerstande angehörigen Laienbrüdern sie auch befähigte. Ferner trat sie im Anlegen von Gärten auf allen ihren Farmen mit der evangelischen Mission in rühmliche Konkurrenz. In ihren Gärten in Klein-Windhuk leistete sie im Weinbau sogar derartig Gutes, daß sie auf der letzten landwirtschaftlichen Ausstellung in Groß-Windhuk 1902 sämtliche drei Preise erhielt. Nicht unerwähnt will ich endlich lassen, daß[S. 287] ich bei Gelegenheit einer Schulrevision in Groß-Windhuk die kleinen Missionsschüler unter Leitung eines Soldat gewesenen Laienbruders auch recht flott habe exerzieren sehen.
Die katholische Mission im Norden des Schutzgebietes steht zur Zeit unter Leitung des Präfekten Nachtwey. Die diesem unterstellte Präfektur trägt den Namen »Nieder-Zimbabesien« und schließt das Schutzgebiet vom Wendekreis des Krebses nördlich, noch über die deutsch-portugiesische Grenze übergreifend, in sich ein. Nach der zuletzt im Jahre 1903 eingereichten Statistik zählte die Präfektur 11 Priester, 13 Laienbrüder und 5 Stationen. In den letzteren unterhält sie eine Handwerkerschule, sowie eine Schule für weiße Kinder in Windhuk (diese ohne Unterschied der Konfession; sie ist jedoch 1903 mit Rücksicht auf die gut geleitete Regierungsschule wieder aufgegeben worden), ein Waisenhaus für Bastardkinder in Klein-Windhuk. In den Schulen befanden sich 83 Schulkinder und 12 in Handwerken auszubildende Knaben.

Zu der Zeit, als sich noch nicht übersehen ließ, ob ein einträchtiges Zusammenwirken der beiden Missionen im Nama- und im Hererolande zu ermöglichen sein würde, war der katholischen Mission die Beschränkung auf die noch von keiner Mission in Angriff genommene Nordostecke des Schutzgebietes, d. h. auf die Gegend am Okawango und den sogenannten Caprivizipfel, auferlegt worden. Eine leichte Aufgabe war ihr damit nicht zugedacht. In jenen weltentlegenen, damals noch fast ganz unbekannten Gebieten konnte eine einsame Missionsstation auf die Dauer nicht bestehen. Die Erreichung[S. 288] wie die Behauptung jener Gegend ist nur mittels Vorrückens von Etappe zu Etappe, also mitten durch das Hereroland hindurch, über Grootfontein möglich, ähnlich wie die Staatsgewalt bisher bei der tatsächlichen Besitzergreifung des Schutzgebietes nach und nach vorgegangen ist. Ohne die Besetzung des Distrikts Grootfontein würde auch eine Militärstation am Okawango nicht lebensfähig bleiben. Ich sage ausdrücklich Distrikt Grootfontein, dessen Bereich bis zum Okawango geht. Denn die Station Grootfontein selbst liegt gleichfalls immer noch zu weit vom Okawango ab, ganz abgesehen von der zwischen ihr und dem Okawango befindlichen 160 km langen Durststrecke. Mit dieser Tatsache erledigt sich auch der seinerzeit von sonst unterrichteter Seite ausgegangene Vorschlag, im Okawangotale eine Sträflingskolonie anzulegen.
Trotz dieser Schwierigkeiten machte die katholische Mission im Jahre 1899 und 1900 den Versuch, bis zum Okawangotale vorzudringen. Er scheiterte beide Male, allerdings ein Mal auch infolge hinzugetretener Rinderpest. Zum dritten Male wurde der Versuch im Jahre 1903 unternommen. Die damalige Expedition erreichte zwar ihren Bestimmungsort, mißlang aber dann gleichfalls infolge des illoyalen Verhaltens der Eingeborenen. Das Nähere ist im Kapitel VI »Unsere Beziehungen zu den Ovambos« geschildert. Eine weitere Entsendung hat infolge des mittlerweile ausgebrochenen Hereroaufstandes nicht mehr stattgefunden, ohne daß jedoch die Mission etwa die Sache ganz aus dem Auge verloren hätte. Bei ihrer tatkräftigen Leitung unter Präfekt Nachtwey ist auch bestimmt zu erwarten, daß sie nach völliger Beendigung der Feindseligkeiten im Hererolande ihr Ziel doch noch erreichen wird.
Die südlich vom Wendekreis des Krebses wirkende katholische Mission der Oblaten vom Heiligen Franz von Sales, deren Präfektur sich in Pella (Kapkolonie) befindet, hat bisher nur die eine Missionsstation Heirachabis gegründet, nachdem sie den Platz nebst 100000 ha Weideland käuflich erworben hatte. Auf der Station befanden sich 1903 zwei Patres und vier Schwestern, daneben 50 Weiße und 200 Eingeborene, von denen 130 getauft waren. Zur Abhaltung des Gottesdienstes ist eine Kapelle erbaut neben einer von 45 Kindern besuchten Schule. Die Lehr- und Kirchensprache ist durchweg die deutsche. Wie die Tätigkeit der Mission während des allgemeinen Aufstandes ergab, hat sie sich auch außerhalb ihres engeren Stationskreises eines gewissen politischen Einflusses unter den nicht direkt zu einer evangelischen Mission gehörigen Eingeborenen zu erfreuen.
[S. 289] In diese friedliche Arbeit beider Missionen fiel 1904 als Folge des Bondelzwartsaufstandes wie der Blitz aus heiterem Himmel der allen unerwartet kommende allgemeine Aufstand der Hereros. Wie es bei allen Katastrophen zu gehen pflegt, wurde auch hier nach deren Ursache geforscht und unter anderem solche auch bei der anscheinend nur nach idealen Zielen strebenden Hereromission gefunden. Indessen liegt hier nur eine Erscheinung vor, der wir auch sonst begegnet sind. Professor Warneck sagt in seiner kürzlich erschienenen Broschüre, »Die gegenwärtige Lage der deutsch-evangelischen Mission«, hierüber:

»Es ist derselbe Kampf, der einst von den nordamerikanischen Ansiedlern gegen die Indianermission, von den Sklavenbesitzern gegen die Negermission, von den ozeanischen Händlern und Kolonisten gegen die Südseemission, von der ostindischen Kompagnie gegen die Mission in ihrem Bereich geführt worden ist: der Kampf der materiellen Interessen gegen die idealen Aufgaben der Mission, der Ausbeutung der Eingeborenen gegen ihre Inschutznahme durch die Mission, der Kampf — um es[S. 290] milde auszudrücken — der sittlichen Laxheit gegen die Forderungen der christlichen Ethik, welche die Mission vertritt. Diesen Kampf müssen wir aufnehmen, selbst auf die Gefahr eines Konfliktes hin; aber es ist ein schwerer Kampf.«
Daß die Missionare den Aufstand nicht vorausgesehen haben, dies Mißgeschick teilen sie mit sämtlichen damals unter den Hereros wohnenden Weißen. Diese Tatsache spricht weniger gegen die Mission als für die wunderbare Disziplin der Eingeborenen. Auch daß die christlichen Eingeborenen sich an dem Aufstande mitbeteiligt haben, wird der Mission mit Unrecht zum Vorwurfe gemacht, so bedauerlich diese Erscheinung an sich auch ist. Vielmehr könnte man in ihr auch ein günstiges Zeichen für die Mission finden, und zwar den Beweis, daß diese sich von politischen Umtrieben unter ihren Gemeindemitgliedern ferngehalten und sich lediglich auf ihre ideale Aufgabe beschränkt hat. Daß sie dies in der Tat getan und keinerlei Versuche gemacht hat, etwa einen Staat im Staate zu bilden, hat zur Folge gehabt, daß die Mission unter einer heidnischen Stammesregierung ebenso ungestört hat wirken können wie unter einer christlichen, sowie daß Streitigkeiten zwischen heidnischen und christlichen Eingeborenen niemals vorgekommen sind. Der Übergang von der heidnischen zur christlichen Religion hat sich daher unter den Stämmen des Schutzgebietes unter weniger staatsrechtlichen Umwälzungen vollzogen als z. B. seinerzeit in dem kaiserlichen Rom. Die Christen fühlten sich nach wie vor mit ihren heidnischen Stammesgenossen eins und gehorchten ihrer heidnischen Obrigkeit so gut wie einer christlichen. In der Tat, ein solches Verhalten könnte nur allen Religionsstiftern empfohlen werden. Politisch gewirkt haben die Missionare unter ihren Eingeborenen, wie schon erwähnt, nur in einer Beziehung, nämlich zugunsten der deutschen Oberherrschaft. Wenn diese politische Wirksamkeit gerade in einem entscheidenden Moment versagt hat, und wenn sich vor dem Aufstande unter den eingeborenen Christen auch nicht ein einziger gefunden hat, dem schließlich das Gewissen schlug, so ist dies ebenso staunenswert wie bedauerlich. Während sich jedoch einzelne Weiße fanden, die den Missionaren sogar den ungeheuerlichen Vorwurf nicht ersparten, sie hätten von dem Aufstande gewußt, aber nichts verraten, haben dagegen die Eingeborenen selbst den letzteren durchaus nicht getraut. Dies ergibt sich aus dem Befehl des Oberhäuptlings Samuel vom 11. Januar 1904, in dem ausdrücklich angeordnet ist, daß die Absicht zum Aufstande den Missionaren geheim zu halten sei.
[S. 291] Einen großen Erfolg hat immerhin die Mission auch aus dieser schwierigen Zeit zu verzeichnen, indem in dem gleichen Befehl die Schonung von Leben und Eigentum der Missionare angeordnet ist. Mit dem Instinkt, den wir bei jedem Tiere finden, hatten die Eingeborenen erkannt, daß sie es in den Missionaren mit Leuten zu tun hätten, die es — obwohl der als Unterdrücker angesehenen verhaßten Nation der Deutschen angehörig — im Grunde gut mit ihnen meinten. Auch das sichtlich hervortretende Bestreben der Eingeborenen, bei allen ihren furchtbaren Mordtaten wenigstens Frauen und Kinder zu schonen, ist ohne Frage auf den Einfluß des Christentums zurückzuführen. Denn in der heidnischen Zeit kannten sie eine solche Rücksichtnahme nicht. Wenn auch dieses Bestreben der Schonung da und dort versagt hat, so liegen Untaten einzelner vor, für welche die Gesamtheit nicht verantwortlich gemacht werden kann. Solche Dinge passieren auch bei uns. Tatsache ist, daß zahlreiche dem Blutbade entronnene oder seitens der Hereros absichtlich geschonte Frauen und Kinder ihre erste Zuflucht in dem nächsten Missionshause gefunden haben, bzw. durch Eingeborene dort abgeliefert worden sind. Unter ihnen befand sich sogar ein Händler Namens Conrad, dessen Schonung, wie bereits erwähnt, vom Oberhäuptling Samuel gleichfalls ausdrücklich befohlen worden war. Tatsache ist ferner, daß die Verzögerung des Aufstandes in Omaruru um fünf Tage, in Otjimbingwe sogar um elf Tage gegen Okahandja neben der Einwirkung der betreffenden Verwaltungsbeamten dem Wirken der Missionare zuzuschreiben ist. Wollte die Mission Böses mit Bösem vergelten, so würde sie ihren Anklägern gegenüber mit einem gewissen Schein von Recht darauf hinweisen können, daß die genannten Termine im umgekehrten Verhältnis zu der Überschwemmung der betreffenden Gebiete mit Wanderhändlern ständen. Denn am meisten war von solchen der Distrikt Okahandja heimgesucht, wo der Aufstand zuerst ausbrach, am wenigsten Otjimbingwe, wo dies zuletzt geschah. Indessen dürfte sich diese Erscheinung natürlicher mit der Tatsache erklären, daß der Distrikt Okahandja der Zentralregierung der Hereros direkt untersteht, während die beiden anderen eine nominell selbständige eigene Regierung besitzen.

Auch der katholischen Mission hat der Aufstand einen Rückschlag gebracht. Sie mußte ihre blühende Station Epukiro aufgeben und der Zerstörung überlassen. Dagegen hat sie den Triumph erlebt, daß sämtliche bei ihr angesiedelten Eingeborenen, darunter auch Hereros, treu geblieben sind. Auf dem Marsche von Epukiro nach Gobabis hat sich sogar die kleine Gemeinde unter ihren Patres (Christ und Watterott) tapfer einiger Angriffe[S. 292] herumschweifender Banden erwehrt. Überhaupt haben die durch keinerlei Familienbande gefesselten katholischen Patres und Laienbrüder sich bei Beginn des Aufstandes auch militärisch nützlich gemacht, wo sie nur konnten. Der Präfekt Nachtwey hat sich im April 1904, unter Gestellung eigener Transportmittel, der Truppe als Feldgeistlicher angeschlossen und die Gefechte bei Onganjira und Oviumbo mitgemacht. Auch von den Oblaten im Süden wird berichtet, daß der Pater Malinowsky bei den im Juni und Juli 1905 stattgehabten Verhandlungen mit dem Bandenführer Morenga die deutschen Abgesandten in das feindliche Lager begleitet hat, während der evangelische Missionar von Keetmanshoop, Herr Fenchel, im Hauptquartier des Generals v. Trotha als Dolmetscher sowie als Vermittler der Korrespondenz gedient[S. 293] hat. Die gleiche Aufgabe hatte er auch schon während des Bondelzwartsaufstandes bei mir übernommen.[72]

Überhaupt hat, um dies gleich hier zu erwähnen, der im Süden des Schutzgebietes dem Hereroaufstand folgende allgemeine Hottentottenaufstand der Mission nicht die bitteren Vorwürfe des ersteren eingetragen. Einerseits hatte man über ein solches Ereignis überhaupt ruhiger denken gelernt, anderseits war diesmal der Aufstand nicht derart unerwartet gekommen wie damals. Wenn aber richtig ist, was erzählt worden ist, nämlich daß der in Rietmond,[S. 294] der zweiten Residenz des Kapitäns Hendrik Witbooi, stationierte Missionar Holzapfel von der Kanzel herunter den Witboois als Strafe für ihre Sünden die bevorstehende Entwaffnung durch die deutsche Regierung verkündet habe, so würde hierin allerdings eine unbegreifliche Unvorsichtigkeit liegen. Herr Holzapfel ist auch der einzige Missionar im Schutzgebiete, der nach Ausbruch des Aufstandes seitens der Eingeborenen ermordet worden ist. Infolge seines Todes wird jetzt die Wahrheit schwer festzustellen sein. Ein Seitenstück zur fraglichen Erzählung bildet die Tatsache, daß dem Kapitän Witbooi einige Wochen vor seinem Aufstande zugetragen worden ist, der Missionar Wandres in Windhuk habe von der Kanzel herab gepredigt, Gott würde Isaak Witbooi[73] durch die deutsche Regierung ebenso strafen, wie er den Kapitän Abraham Christian in Warmbad habe strafen lassen. Durch Vermittlung des Bezirksamtmanns in Gibeon kam diese Nachricht behufs Feststellung der Wahrheit an das Gouvernement in Windhuk. Der Missionar leugnete die ihm zugeschriebene Äußerung entschieden, eine Richtigstellung, die dann wieder nach Gibeon übermittelt worden ist. Kapitän Witbooi aber gab sich — ein Zeichen seines bereits wieder erwachten Mißtrauens — hiermit nicht zufrieden. Er unterzog den Überbringer jener Nachricht — einen seiner Untertanen — in Gegenwart des Bezirksamtmanns einem nochmaligen peinlichen Verhör. Der Mann blieb unter Nennung von Zeugen bei seiner Aussage, worauf die Sache abermals nach Windhuk zurückging. Doch auch die jetzt angestellten Zeugenerhebungen ergaben die vollständige Haltlosigkeit der erhobenen Verdächtigung. Die erneute Richtigstellung kam jedoch nicht mehr in die Hände des Kapitäns, da dieser mittlerweile die Fahne des Aufruhrs erhoben hatte. Diese Episode gibt indes einen weiteren Anhalt für die Einflüsse, die von allen Seiten auf den alten Witbooi eingewirkt haben, bis er sich zu seinem verzweifelten Schritte entschlossen hat.
Einen Lichtblick für die Mission möge es dagegen wieder bedeuten, wenn ich, gestützt auf meine Personalkenntnisse, der bestimmten Ansicht bin, daß die Treue derjenigen zwei Hottentottenstämme, die sich dem Aufstande nicht angeschlossen haben, und zwar der Stämme von Bersaba und Keetmanshoop, in erster Linie dem Einflusse der Missionare zuzuschreiben ist. Bei Keetmanshoop könnte man vielleicht noch entgegnen, daß zu diesem Ergebnis neben dem bei den Eingeborenen wohl angesehenen, stellvertretenden Bezirksamtmann, Zolldirektor Schmidt, auch die dortige starke Stationsbesatzung[S. 295] beigetragen habe. Aber auch diese Faktoren hätten nicht hindern können, daß die Bewohner behufs Anschluß an die Aufständischen ganz oder zum Teil vom Platze verschwanden. Daß dies nicht geschehen, ist zweifellos mit ein Verdienst des dortigen Missionars Fenchel. In Bersaba befand sich dagegen nicht einmal die kleinste Station. Die Treue des dortigen Stammes beruht ausschließlich auf der loyalen Gesinnung des Kapitäns Goliath, und diese ist ihm durch seinen Lehrer, den früheren Missionar Hegner, eingepflanzt worden. Wenn ferner auch ein Teil des Bethanierstammes treu geblieben ist, so beruht diese Tatsache mehr auf dem Zwiespalt, der zwischen dem Kapitän Paul Frederiks und dessen Vetter Cornelius Frederiks, einem Schwiegersohn Witboois, bestand. Aber immerhin ist von diesen beiden Aspiranten auf die Kapitänswürde der treu gebliebene, d. h. der erstere, derjenige, welcher der Mission am nächsten gestanden hat.[74]
Schließlich erübrigt noch ein Streiflicht auf die Ovambomission. Unter jenem Volke besitzt auf deutschem Gebiet die im übrigen Schutzgebiete wirkende evangelische Rheinische Mission nur eine Station, nämlich Namakunde. Dagegen hat sie auf portugiesischem Gebiet noch zwei weitere Stationen eingerichtet, Omupanda und Ondjiva, alle drei in dem Gebiete des früheren Häuptlings Uejulu (jetzt Nande) gelegen. Auf deutschem Gebiet, und zwar in demjenigen Teile des Ondongastammes, der dem Häuptling Kambonde untersteht, befinden sich außerdem noch zwei evangelische Missionsstationen, aber nicht einer deutschen, sondern einer finnischen Missionsgesellschaft zugehörig. Indessen haben sich die durchweg das Deutsche beherrschende finnischen Missionare im Verkehr mit der deutschen Regierung stets ebenso entgegenkommend gezeigt wie die deutschen Missionare. Auch sie sind uns als Vermittler mit den Eingeborenen von hohem Nutzen gewesen, obwohl sie im Falle der Entdeckung stets ihr Leben riskierten. Einzelheiten[S. 296] über diesen Verkehr mit den Ovambos sind im Kapitel VI »Unsere Beziehungen zu den Ovambos« gegeben. Über die Zahl der getauften Ovambos sind mir nähere Angaben nicht bekannt geworden. Allzuviele scheinen es auch nicht zu sein. Die Mission hat dort anscheinend mit denselben Schwierigkeiten zu kämpfen wie unter den Hereros, nämlich mit nicht ausreichenden materiellen Lebensbedingungen sowie mit der Vielweiberei. Was die katholische Mission betrifft, so habe ich bereits erwähnt, daß auch das Ovamboland der in Windhuk eingerichteten Präfektur »Nieder-Zimbabesien« zugeteilt ist. Doch hat diese aus den bereits gleichfalls im Kapitel VI geschilderten Ursachen ihre Wirksamkeit dort noch nicht beginnen können.
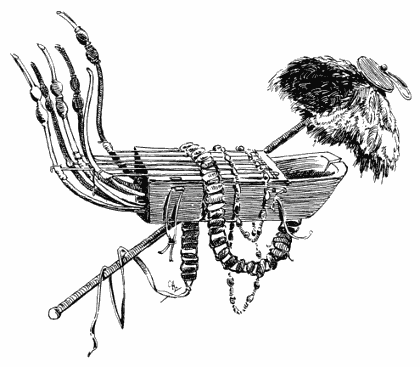
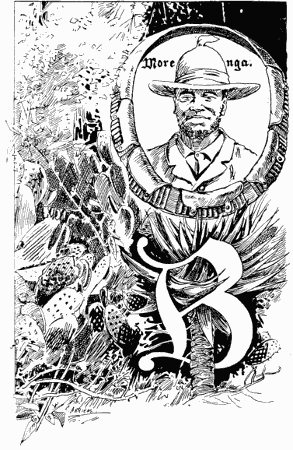
Bereits in dem Abschnitt »Schutzverträge« habe ich dargelegt, daß die Stellung des Gouverneurs bisher in etwa derjenigen der alten römisch-deutschen Kaiser geglichen hat (S. 240). Auch letztere hatten auf den guten Willen ihrer Vasallen, sowie mit Aufständen von deren Seite rechnen müssen, falls sie Grund zur Unzufriedenheit zu haben glaubten. Erst durch die Ereignisse getrieben, sind wir jetzt an eine Änderung dieses Verhältnisses herangetreten. Aber welche Opfer es kostet, das sehen wir auch jetzt erst. Für das alte Vaterland würde es daher schon besser gewesen sein, wenn es gelungen wäre, den Ausgleich zwischen der weißen und der farbigen Rasse auf weniger gewaltsamem Wege herbeizuführen. Anscheinend sind wir vor Beginn des jetzigen großen Aufstandes auf dem Wege hierzu gewesen. Welche Ursachen diese beginnende Entwicklung so jäh unterbrochen haben, will ich einer späteren Erörterung vorbehalten. Vorbedingung des Verständnisses hierfür ist jedoch auch die Kenntnis von den Persönlichkeiten der mächtigsten eingeborenen Häuptlinge und ihrer politischen Stellung.
Da sind zunächst zwei Männer zu nennen, deren Einfluß — des einen im Norden, des anderen im Süden — bei Lösung der Frage, ob dem Schutzgebiete eine friedliche oder eine kriegerische Entwicklung beschieden sei, in die Wagschale fiel. Gesetz und Erbfolge, verbunden mit Wahl, hatten beiden die Häuptlingswürde zufallen lassen. Mächtig waren sie jedoch, der eine durch die Menge seiner Untertanen, der andere durch das Gewicht seiner Persönlichkeit. Der erstere war, wie der Leser vielleicht bereits erraten hat, der Oberhäuptling der Hereros, Samuel Maharero, der letztere der Kapitän Hendrik Witbooi. Neben ihnen spielten noch zwei jetzt bereits verstorbene Kapitäne eine gewisse Rolle, der eine gleichfalls im Norden, der andere im Süden des Schutzgebietes. Der eine war der Kapitän Manasse von Omaruru, der andere Kapitän Wilhelm Christian von Warmbad. Ihr Tod hat die jetzt über das Schutzgebiet hereingebrochene Katastrophe ohne Frage beschleunigt. Sie liebten die deutsche Oberherrschaft auch nicht mehr als die übrigen Häuptlinge des Schutzgebietes; aber sie waren schon bei Jahren, daher nicht mehr in der besten körperlichen Verfassung und infolgedessen zur Ruhe und zum Frieden geneigt. Auch waren sie intelligent genug, um die schwerwiegenden Folgen eines bewaffneten Widerstandes gegen die neue Entwicklung der Dinge vorauszusehen, und auch einflußreich genug, um ihr Volk vor unüberlegten Schritten abzuhalten. Um diese vier Kapitäne und Häuptlinge gruppierten sich die übrigen mehr oder weniger mächtigen Stammesoberhäupter des Schutzgebietes. Mit ihnen hatte ich nach meinem Eintreffen im Schutzgebiete daher in erster Linie zu rechnen. Nach ihrem Verhalten mußte sich infolgedessen mein eignes richten. Als besonders erwähnenswertes Stammesoberhaupt könnte vielleicht auch der Kapitän Christian Goliath von Bersaba genannt werden, da dieser an Intelligenz ersetzte, was ihm an Macht abging. Jedoch zu irgendwelchem Einfluß über die engeren Grenzen seines Landes hinaus hatte er es bei der Geringfügigkeit seiner Machtmittel doch nicht bringen können.
An der Spitze der vorgenannten Häuptlinge steht naturgemäß Hendrik Witbooi. Nach seinem im November 1905 infolge einer Verwundung erfolgten Tode habe ich ihm in der in Berlin erscheinenden »Gegenwart«[77] einen Nachruf gewidmet, der seine wesentlichsten Charaktereigenschaften[S. 299] schildert. Ich kann mich daher hier darauf beschränken, das Bemerkenswerteste aus diesem Artikel zu wiederholen und nur noch einiges hinzuzufügen. Der Hauptzug im Charakter Hendrik Witboois ist die Neigung zur religiösen Mystik gewesen. Der Kapitän war bereits als Kind getauft worden und durch Missionar Olpp[78] erzogen worden. Dieser hat ihn sicher genau kennen gelernt und nennt ihn in einer seiner Schriften »einen Mann, an dem kein Falsch ist«. Unter seiner Leitung wurde Hendrik Witbooi in der Residenz seines Vaters, Moses Witbooi, Kirchenältester. Ich habe bereits im Kapitel I, S. 6, erwähnt, wie sich später Witbooi mit seinem Vater, und zwar aus einem ihn durchaus ehrenden Grunde, überwarf und sich ein eigenes Reich zu gründen versuchte. Ursprünglich hatte er die Absicht, dieses im Norden des Schutzgebietes zu suchen, wohin ihm etwa die Hälfte seines Stammes zu folgen bereit war. Die Hereros gestatteten jedoch nicht seinen Durchzug durch das Hereroland, sehr zu ihrem eigenen Schaden, wie sich später ergeben sollte, brachten ihm vielmehr mittels verräterischen Überfalls einige Verluste bei. Erst jetzt zog Witbooi rachedürstend nach Hornkranz und nährte sich lange Jahre von den Viehherden der Hereros. Denn zu einer Vertilgung der »Amalekiter«, wie Witbooi in seiner Bibelfestigkeit die Hereros zu nennen pflegte, reichten schließlich seine Machtmittel doch nicht, auch nicht, nachdem der Tod seines Vaters ihn zum Herrn seines ganzen Stammes gemacht hatte. Aber immerhin geschädigt hat er die Hereros schwer, bis schließlich das Eingreifen des Deutschen Reiches seinen Räubereien ein Ziel setzte.
Aber in einem eineinhalbjährigen Kampfe hat Witbooi uns dann die Palme des Sieges streitig gemacht und sich als ein vollendeter Meister in der afrikanischen Kriegführung gezeigt. Beendigt wurde schließlich dieses Ringen nicht durch eine für ihn vernichtende Niederlage, sondern einfach mittels Aufzwingung der deutschen Schutzherrschaft unter ihn wenig drückenden Bedingungen. Damals wollte das deutsche Reich für Südwestafrika noch nicht die gewaltigen Mittel aufwenden, die es notgedrungen heute aufwendet. Mir, welchem den Schlußkampf mit Witbooi herbeizuführen beschieden gewesen ist, standen zu seiner Niederwerfung wie zur Niederhaltung der übrigen Stämme des Schutzgebietes damals rund 500 Gewehre und 2 Geschütze zur Verfügung, gegen 15000 Gewehre und 40 Geschütze von heute. Die damalige Stärkeberechnung beruhte auf den Angaben meines Vorgängers, dem anscheinend eine Unterschätzung der Widerstandskraft der[S. 300] Eingeborenen mit unterlaufen ist. Denn in Afrika kann der Friede nicht durch bloßes Erringen von Siegen wiederhergestellt werden, sondern lediglich durch Vernichtungsschläge, zu denen es eines gewissen Überschusses an Kraft bedarf.
Nachdem aber Witbooi einmal für unsere Sache gewonnen war, hat er die ihm notgedrungen gewährte Gnade reichlich gelohnt. Als Beweis möge die Aufzählung nachstehender Kriegszüge dienen, in denen allen er auf unserer Seite gefochten hat:
| Jahr | Gegner | Erzieltes Ergebnis |
| 1896 | Osthereros und Khauas-Hottentotten | Osthereros zersprengt. 12000 Stück Großvieh abgenommen, Führer erschossen. Khauas-Hottentotten entwaffnet und in Windhuk interniert. |
| 1897 | Afrikaner-Hottentotten | Stamm gefangen. Führer kriegsrechtlich erschossen. |
| 1898 | Swartbooi-Hottentotten | Stamm entwaffnet und in Windhuk interniert. |
| 1900 | Bastards von Grootfontein | Stamm nach Entwaffnung aufgelöst und zum Teil als Strafgefangene in Windhuk interniert. |
| 1903 | Bondelzwarts | Stamm entwaffnet, die geflüchteten Führer geächtet. |
| 1904 | Hereros | Vor Beendigung die Witboois als Bundesgenossen wieder ausgeschieden. |
Wie der Kapitän außerdem im Jahre 1898 durch sein Standhalten auf unserer Seite einen anläßlich der Gewehrstempelungsfrage drohenden Aufstand im Namalande im Keime hat ersticken helfen, ist bereits oben erwähnt (Kapitel V, S. 154).
Hendrik Witbooi war von kleiner Statur und daher äußerlich keine besonders imponierende Erscheinung, aber er machte bei näherer Bekanntschaft doch Eindruck durch seine auf unbeugsamer Willensstärke gegründete Ruhe und Festigkeit. Langsam und sicher war seine Rede, kein unüberlegtes Wort kam aus seinem Munde. »Hei is en diegen Kerl« (er ist ein tüchtiger Kerl), sagte einst bewundernd ein alter Afrikaner zu dem Bezirksamtmann v. Burgsdorff. Sein äußeres Auftreten war bescheiden. Aber es war die Bescheiden[S. 301]heit des selbstbewußten Mannes. Ihm lag sowohl das Kriechende wie das protzenhaft sich Überhebende der gewöhnlichen Hottentotten fern. Als ich dem Kapitän einst meine Geschütze zeigte und hinzufügte, solche besäße der Deutsche Kaiser mehrere tausend, erwiderte er, indem eine Art entsagungsvollen Zuges über sein Gesicht flog: »Ich weiß ja wohl, daß der Deutsche Kaiser mächtiger ist wie ich, aber Du brauchst es mir doch nicht immer zu sagen.« Auch die Gesichtszüge Hendrik Witboois waren feiner und einnehmender, als sie sonst bei Hottentotten zu sein pflegen. Aber nicht nur jene zu einem geborenen Herrscher gehörigen Charaktereigenschaften hatten dem kleinen Kapitän eine unbedingte Autorität über sein Volk verschafft, sondern auch das religiöse Moment.
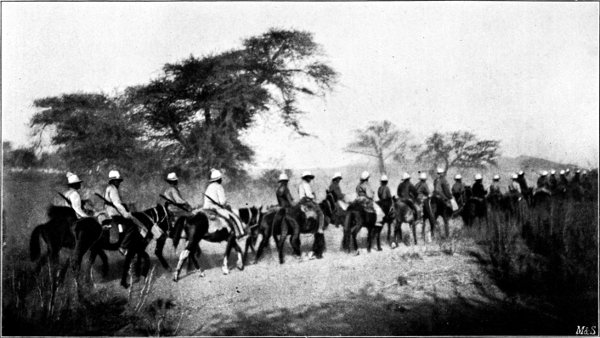
Während seines Aufenthaltes in Hornkranz hat Witbooi auch ohne Missionar stets für Abhaltung regelmäßigen Gottesdienstes gesorgt sowie ein strenges Regiment im christlichen Sinne über seine Leute geführt. Trunkenheit wie Vergehen gegen die Sittlichkeit hatten immer strenge Ahndung zur Folge. Etwa während seiner Kriegszüge erbeuteten Alkohol hat er stets vernichten lassen. Dabei war der Kapitän aber klug genug, unverbesserlichen Trinkern gegenüber, wenn diese ihm sonst nützlich waren, auch zeitweise ein[S. 302] Auge zuzudrücken. Zu letzteren gehörte z. B. sein Finanzminister Keister.[79] Unter der deutschen Herrschaft hat dann Witbooi seine Abneigung gegen Alkohol fallen lassen. Er blieb zwar persönlich immer mäßig, trank aber immerhin gern ein Gläschen Likör oder Schaumwein. Aber fast nie nahm er von mir ein Geschenk dieser Art an, ohne zugleich um ein solches für seine Begleitung zu bitten. Auch seine Maßnahmen auf sittlichem Gebiete sah Witbooi einer Korrektur zu unterziehen sich veranlaßt, als die Anwesenheit einer deutschen Garnison zur Folge hatte, daß die Mitschuldigen bei den sittlichen Verfehlungen der Töchter seines Volkes zuweilen nicht seiner Rechtsprechung unterstanden. Da hat er es dann für unrecht gehalten, nur den einen Teil zu bestrafen. Vorher hatte die Geburt eines illegitimen Kindes stets die Prügelstrafe für beide Eltern zur Folge gehabt. Eine der letzten schweren Strafen auf diesem Gebiete mußte der Kapitän an einer seiner Töchter vollziehen lassen, die ihn bereits mit einem zweiten illegitimen Kinde überrascht und aus Furcht vor Strafe dieses gleich nach der Geburt getötet hatte. Zuerst wollte er die junge Mutter wegen Mordes erschießen lassen, fragte aber vorher hierwegen bei seinem Bezirksamtmann um Rat. Dieser machte ihn darauf aufmerksam, daß das deutsche Strafgesetzbuch einen solchen Fall nicht als Mord auffasse, ihn vielmehr unter ein besonderes milderes Gesetz gestellt habe. Dies leuchtete dem Kapitän ein. Er ließ seiner Tochter so viel Schambokhiebe aufzählen, als sie aushalten konnte, und zwang sie dann, ihren Verführer, gleichfalls einen Mann seines Stammes, zu heiraten.
In der Art, wie Witbooi das Christentum auffaßte und zu seinen politischen Zwecken benutzte, lag zweifellos etwas von der Selbstüberhebung eines Mahdi. Er wußte, daß die Verbindung von geistlicher und weltlicher Macht ihm eine größere Autorität über seine Leute sichern mußte, als die letztere allein. Während seiner zehnjährigen Friedensregierung unter deutscher Herrschaft hat dann Witbooi diesen Zug seines Charakters zurücktreten lassen; doch betätigte er für seine Person christliche und kirchliche Gesinnung und unterstützte mit seiner Autorität die Mission innerhalb seines Stammes, soviel in seiner Macht lag. Aber immer schlummerte die Verquickung von[S. 303] Religiosität, Mystik und weltlicher Herrschaft in seiner Seele. Nach seinem ersten Kriegszuge gegen die Hereros hatte ihn einst die Mission vor ihr Gericht gezogen, da er als Kirchenältester Blut vergossen habe. Doch allen an ihn verschwendeten Ermahnungen der Missionare gegenüber verblieb er starr bei dem Standpunkte: »Gott hat mich's geheißen«, worauf er seines Amtes als Kirchenältester entsetzt wurde. Für niemand hat mehr wie für ihn das Wort Bedeutung gehabt: »Man muß Gott mehr gehorchen als den Menschen.« Aber was Gott wünschte, das zu entscheiden nahm er lediglich für sich in Anspruch. So hatte denn auch eines Tages sein Volk mit ehrfürchtigem Staunen vernehmen müssen, Gott habe ihm — Witbooi — befohlen, die Hereros mit Krieg zu überziehen und sie zu vernichten. Wenn auch das letztere nicht gelang, so wurde es wenigstens versucht. Kein in die Hände der Witboois gefallener Herero hatte die geringste Aussicht auf Erhaltung seines Lebens, während gegen die Hottentotten wie später auch gegen uns Deutsche die Kriegführung Witboois sich stets in den Grenzen der Menschlichkeit gehalten hat. »Witbooi ist ein rechter Mann, aber das sind keine rechten Leute«, sagte mir 1895 der Kaffernkapitän Apollo zur Erklärung des Umstandes, daß kein Kaffer sich als Bote zu den Khauas-Hottentotten wagen wollte. Aber auch bereits während seiner Kriegszüge gegen die Hereros hatte den Weißen gegenüber der Kapitän sich immer von der humanen Seite gezeigt. Ihr Eigentum wurde von ihm und seinen Leuten stets aufs peinlichste geschont. War aus Versehen einmal Vieh von Weißen mit geraubt worden, wurde es auf erhobenen Einspruch stets zurückgegeben. Allerdings war hierbei Witbooi auch von dem klugen Gedanken beraten, sich ohne Not keinen weiteren Feind zu schaffen.
Ein für ihn charakteristisches Ereignis sei aus jener Zeit noch erwähnt. Als das Deutsche Reich den Kämpfen der Eingeborenen unter sich noch gleichmütig zusah, hatte die Schutztruppe die Weisung, strengste Neutralität zwischen den Parteien zu beobachten. Daher verweigerte einst der Chef der deutschen Station Tsaobis den von einem Kriegszuge gegen Otjimbingwe zurückkehrenden Witboois das Wasser. Der Stationschef, ein Unteroffizier, stellte seine aus ganzen zwei Mann bestehende Macht gefechtsbereit im Stationsgebäude auf und ging für seine Person zur Verhandlung dem Kapitän entgegen. Witbooi, der 600 Reiter und zahlreiches Vieh bei sich hatte, hatte einen langen Durstmarsch hinter sich und bedurfte dringend des Wassers. »Was wirst Du tun, wenn ich mir das Wasser mit Gewalt nehme?,« herrschte er den Unteroffizier an. »Dann werde ich schießen, wie mir das befohlen ist.«[S. 304] Nach einigem Nachdenken erwiderte der Kapitän: »Du tust nur Deine Pflicht, wenn Du den erhaltenen Befehl befolgst. Dir werde ich daher nichts tun. Wäre aber Dein Herr (Major v. François) hier, dann würde ich das Wasser mit Gewalt nehmen.« Hieraus wandte sich der Kapitän gegen die Wasserstelle, an der seine verdursteten Leute bereits angefangen hatten, sich zu laben, und prügelte diese sowie die nachfolgenden von dem Wasser weg, worauf er sich als Letzter dem Zuge wieder anschloß.
In der Seele eines solchen Mannes, in der mystisch-religiöse Anschauungen mit der gleichfalls in ihr schlummernden Selbstüberhebung des weltlichen Herrschers um die Palme rangen, konnte eine Lehre, wie sie die sogenannte äthiopische Kirche gibt, nämlich »Afrika auch in religiöser Beziehung für die Schwarzen«, nur Unheil anrichten. Und unglücklicherweise erschien gerade mitten in dem unheilschwangeren Jahr 1904 ein aus der Kapkolonie stammender »Prophet« dieser Kirche in dem Lager in Rietmond. Die äthiopische Kirche leitet ihren Namen von dem ersten getauften Heiden her, jenem äthiopischen Kämmerer, den nach der Bibel ein Apostel im Evangelium lesend gefunden, bekehrt und sofort getauft hat. Nach allen den Einflüssen, die während des Hereroaufstandes auf den alten Witbooi eingestürmt waren, hat dieser »Prophet« anscheinend den letzten Ausschlag gegeben. Der Brief, den der Kapitän kurz nach dem Aufstande an mich geschrieben hat, kann für diese Annahme als Beweis dienen. Der volle Wortlaut desselben findet sich im Kapitel XII. (S. 457.)
An die übrigen Nama-Kapitäne schrieb Witbooi:
»Ich sende Dir diesen Brief und mache Dir bekannt, wie Du weißt, habe ich lange Zeit unter dem Gesetz und in dem Gesetz und hinter dem Gesetz gelaufen und wir alle mit Gehorsamkeit, aber mit der Hoffnung und Erwartung, daß Gott der Vater zu seiner Zeit es wird beschicken, um uns zu erlösen aus der Mühseligkeit dieser Welt, denn soweit habe ich mit Frieden und Geduld getragen und alles, was auf mein Herz drückt, vorübergehen lassen, weil ich auf den Herrn hoffe.«
Endlich sagte er zu dem Überbringer meines Briefes:
»Das Schicksal meiner bei den Deutschen gefangenen Leute ist mir ganz gleichgültig, ich habe von Gott eine andere Arbeit empfangen.«
Auch der sonst durchaus nicht religiöse, vielmehr klardenkende Unterkapitän Witboois, Samuel Isaak, war plötzlich von den Anschauungen seines Herrn angesteckt worden und behauptete, es sei alles von Gott gekommen.
[S. 305] In der Tat, Hendrik Witbooi hatte anscheinend zwei Seelen in der Brust. Die eine war die christliche und anständige, die er während seiner zehnjährigen Friedenszeit unter unserer Herrschaft gezeigt hatte. Die zweite Seele war die grausame, fanatische Hottentottenseele, die anscheinend nur geschlummert hatte und anläßlich seines letzten Aufstandes wieder erwacht ist. Der Kapitän verfuhr jetzt auch nicht anders als die von ihm stets als blutdürstig und grausam verachteten Hereros. Er ließ zu, daß die in seinem Lande unter seinem Schutz wohnenden Weißen, wo man ihrer habhaft werden konnte, ermordet wurden, an deren Spitze der von ihm so sehr geschätzte Bezirksamtmann v. Burgsdorff. Wer den kleinen, überlegenen Mann mit der stillen und bescheidenen Natur gekannt, wer sein geradezu väterlich-freundschaftliches Verhältnis zu seinem Bezirksamtmann gesehen hat, und wer endlich auch die loyalen Beziehungen zwischen ihm und dem Gouverneur und nicht am wenigsten seine loyale Gesinnung gegen den Deutschen Kaiser kennen zu lernen Gelegenheit hatte, der hätte Witbooi solch ein seiner ganzen Vergangenheit widersprechendes Verhalten niemals zugetraut. Bis zu seinem letzten Aufstand war auch der geringste Mensch, der sich unter seinen Schutz gestellt und dem er solchen zugesagt hatte, niemals gefährdet gewesen, geschweige denn ein höhergestellter. War ich doch selbst während meiner Kriegszüge gegen Witbooi zweimal mit nur geringer Begleitung in seinem Lager und hatte nie das Gefühl, irgendwie bedroht zu sein. Zu dem letzten Bondelzwartsaufstand, nach dem Witbooi, wie gewöhnlich, sofort Heeresfolge geleistet hatte, wollte er z. B. nicht ohne seinen Bezirksamtmann abmarschieren und erklärte diesem auf Befragen: »Ich muß da sein, wo mein Sohn ist, ich muß aufpassen. Denn ich will meinen Herrn wieder gesund in sein Haus zurückbringen, darum bin ich hier.« Während des gemeinsamen Aufenthaltes auf dem Kriegsschauplatze unterhielt dann Herr v. Burgsdorff eine rege Korrespondenz mit seiner in Gibeon zurückgebliebenen Frau, in die mir freundlichst Einblick gewährt worden ist. In dem Briefe finden sich folgende Stellen: »Der alte Witbooi ist rührend. Ohne daß ich es merken soll, stellt er anscheinend heimlich immer einen Posten auf zu meinem Schutze.« Ferner in einem späteren Briefe: »Unser alter Witbooi ist rührend und riesig frisch.« Endlich in einem dritten Briefe nach einem gemeinsamen Gefecht gegen die Aufständischen: »Mein Gefecht war tüchtig heiß, der alte Witbooi ist ein großartiger Mann. Ich fahre gleich fort mit ihm, wie gewöhnlich, auf einer Karre.«
Gleichviel, ob der Kapitän die nach dem Aufstande in seinem Lande vorgekommenen Mordtaten direkt befohlen oder nur passiv zugelassen hat,[S. 306] die Verantwortung bleibt für ihn dieselbe. Wäre er in unsere Hände gefallen, so hätten wir daher die seinerseits uns geleisteten guten Dienste nicht mehr zu seinen Gunsten in die Wagschale werfen können. Sein Leben war verwirkt. Und darum war die deutsche Kugel, die ihn schließlich getroffen hat, eine Erlösung für ihn und für uns. Ihm hat sie einen ehrlichen Soldatentod gebracht und uns aus einem vielleicht schwierigen Dilemma befreit. In die Geschichte des südwestafrikanischen Schutzgebietes hat jedoch der kleine Kapitän[80] seinen Namen für immer eingetragen. Sein hartnäckiger Widerstand gegen das mächtige Deutsche Reich an der Spitze einer kleinen, kriegsgewandten, aber ebenso zerlumpten, wie bettelhaften Schaar, dann sein zehnjähriges treues Festhalten an unserer Sache und endlich das Wagnis eines abermaligen Aufstandes gegen uns haben seinen Namen in gutem wie in bösem Sinne mit der Geschichte des Schutzgebietes untrennbar verbunden. So steht er noch vor mir, der kleine Kapitän, der mir zehn Jahre lang treu zur Seite gestanden hat. Bescheiden und doch selbstbewußt, anhänglich, aber politisch doch nicht ohne Hintergedanken, niemals von dem abweichend, was er für Pflicht und Recht gehalten hat, voll Verständnis für die höhere Kultur der Weißen, ihr nachstrebend, aber doch deren Träger nicht immer liebend, ein geborener Führer und Herrscher, dies war Witbooi, der gewiß auch in der allgemeinen Weltgeschichte unsterblich geworden sein würde, hätte ihn das Schicksal nicht nur auf einem kleinen afrikanischen Thron geboren werden lassen. Es war der letzte Nationalheros einer dem Untergange geweihten Rasse.
Der reine Gegensatz zu Witbooi ist und war der Oberhäuptling der Hereros, Samuel Maharero. Schon äußerlich unterschieden sich beide. Samuel ist eine große, imponierende Erscheinung von stolzer Haltung, ein schöner Neger, äußerlich daher als geborener Herrscher erscheinend, auch nicht ohne Geist und Verstand, aber mangelhaft von Charakterbildung wie Anlage. Er nahm für sich nur Rechte in Anspruch, die Pflichten opferte er dagegen seiner Genußsucht. Für seine in der Tat vorhandenen Herrschereigenschaften spricht es jedoch wieder, wenn es Samuel gelang, sich aus der anfänglich schwierigen und machtlosen Stellung eines mühsam anerkannten Oberhäuptlings zu dem machtvollen Führer durchzuarbeiten, als der er uns im letzten Aufstand gegenübergetreten ist. Ohne seinen Namen und[S. 307] ohne sein Machtwort wäre ein derart gemeinsames Handeln der Hereros, wie es der letzte Aufstand gezeigt hat, überhaupt nicht möglich gewesen. Inwieweit indes bei Beginn des Aufstandes der Oberhäuptling der Geschobene oder der Schiebende gewesen ist, darüber sind die Akten noch nicht geschlossen. Wie ich ihn beurteile, möchte ich ersteres annehmen. Er liebte zu sehr sein bequemes Herrenleben, um es ohne Zwang aufzugeben. Hat Samuel doch bei allen seinen Staatshandlungen sonst in erster Linie nur an sein eigenes Wohl gedacht. Zwei Momente werden es wohl gewesen sein, die den Oberhäuptling bewogen haben, sich an die Spitze der Aufstandsbewegung zu stellen. Das eine war Furcht vor Verlust der eigenen Stellung, das andere die ganz bestimmt auftretende Nachricht vom Tode des Gouverneurs, an dem er seit zehn Jahren in schwierigen Lagen stets eine Stütze gefunden hatte. Ist doch im Januar 1904 in Omaruru sogar die abgeschnittene Hand eines Weißen als diejenige des Gouverneurs herumgezeigt worden. Vor Jahren schon hatte der Häuptling mir gegenüber geäußert, er würde, wenn es ihm schlecht ginge, sich in Windhuk sicherer fühlen als bei seinen eigenen Untertanen. Wie dem auch sein mag, ich glaube bestimmt, daß der Oberhäuptling vor seinem Anschluß an den Aufstand zunächst Fühlung mit mir gesucht haben würde, hätten die Verhältnisse mich nicht Ende 1903 zur Abreise nach dem Bondelzwartskriegsschauplatze gezwungen. In dem Briefe vom 6. März 1904, den der Oberhäuptling über die Ursachen des — bereits ausgebrochenen — Aufstandes an mich gerichtet hat, heißt es z. B. wörtlich: »Und jetzt in diesem Jahre, als die Weißen sahen, daß Du Frieden mit uns und Liebe zu uns hast, da begannen sie zu sagen, euer Gouverneur, der euch lieb hat, ist in einen schweren Krieg gezogen. Er ist tot, und weil er tot ist, so werdet ihr sterben.« Gleichviel, ob diese Behauptung an sich wahr ist oder nicht, die Worte enthalten jedenfalls die Ansichten und Gedanken des Oberhäuptlings und seiner Großleute.
Daß Samuel seine Stellung seinen Leuten gegenüber mittels Anlehnung an die deutsche Oberherrschaft zu befestigen gewußt hat, ist schon ein Zeichen politischer Klugheit. Uns aber hat er durch seine Anlehnung in seiner Art ebensoviel genutzt wie Hendrik Witbooi durch seine langjährige Heeresfolge. Unter seiner Beihilfe sind mehrere hundert Gewehre aus dem Besitz der Hereros in den unsrigen übergegangen. 1896 half er ferner den Stamm der Ovambandjerus[81] niederschlagen und den gefährlichsten aller Hererohäuptlinge,[S. 308] seinen Konkurrenten Nikodemus, dem Tode entgegenführen. In demselben Jahre half er den Unterhäuptling Katarrhe — einen Untertan von Omaruru — entwaffnen und 1899 desgleichen den Sohn seines alten Feindes Tjetjo. Mit allen diesen Häuptlingen aber war er 1904 wieder gegen uns einig und wird von ihrer Seite wohl bittere Vorwürfe über die vorherige Wegnahme ihrer Waffen haben hören müssen.
Die Eifersucht auf die wachsende Macht Samuels bewog ferner auch den intelligenten Kapitän von Omaruru, Manasse, zur Anlehnung an die deutsche Regierung. Wie im Süden dem Kapitän Witbooi, so verdanken wir es daher im Norden dem Oberhäuptling Samuel, wenn es gelungen ist, mit den geringsten Machtmitteln lange Jahre Ruhe und Frieden im Schutzgebiete aufrechtzuerhalten. Ich habe bereits erwähnt, daß ich bei Expeditionen in das Hereroland zur Vermeidung von Mißverständnissen stets den Oberhäuptling nebst einer angemessenen Begleitung mitgenommen habe. Es war dies den zu passierenden Werften mißtrauischer und unwissender Feldhereros gegenüber stets das klarste Zeichen friedlicher Absicht. Bei diesen Expeditionen wurden die Reisemärsche meist in Staffeln zurückgelegt, da diese Art des Marschierens in Südwestafrika der Wasser- und Weideverhältnisse wegen vorzuziehen ist. In solchem Falle pflegte ich die Staffeln der Schutztruppe ihren europäischen Führern zu überlassen, zu meiner persönlichen Bedeckung aber lediglich den Oberhäuptling mit seinen Hereros zu befehlen. Bei ihnen durfte ich mich so sicher fühlen wie bei meinen eigenen Leuten. Alle im jetzigen Aufstande genannten Hereroführer, wie Kajata, Baratjo, Oanja und Friedrich Maharero, der Sohn des Oberhäuptlings, haben auf diese Weise mich schon »gesichert«. Wie sehr sich hierbei der Oberhäuptling in seiner Würde fühlte, möge folgende Episode dartun. Als einst infolge Unvorsichtigkeit eines eingeborenen Dieners mehrere unserer Pferde bei einem Stallbrande zugrunde gingen, stellte Samuel sofort teilweise Ersatz. »Das ist Pflicht des Oberhäuptlings aller Hereros,« meinte er, »wenn das Unglück in seinem Lande und in seiner Gegenwart geschehen ist.«
Oberhäuptling Samuel war schon als Kind getauft worden, aber er hatte an der Mission wenig Freude, ebensowenig die Mission an ihm. Sein Christentum war ein recht laues. Ihm legten Genußsucht, Neigung zum Alkohol und endlich auch — last not least — zu den Frauen fortgesetzt Fallen. Auch waren die unaufhörlichen Farmverkäufe des Oberhäuptlings der Mission ein Dorn im Auge. In Summa, Samuel Maharero[S. 309] steht vor uns als leichtsinniger, aber geistig nicht unbegabter Genußmensch von stattlicher Erscheinung und — wenn von den Geistern des Alkohols nicht befangen — auch von würdevollem Auftreten. Er erinnerte mich stets an den lebensfrohen, aber klugen König eines der orientalischen Kleinstaaten, für den die Genüsse des bekannten Babylons an der Seine mehr Anziehungskraft besessen hatten als die Regierungsgeschäfte, die er auch schließlich zugunsten seines Sohnes freiwillig abgegeben hat. Auf ein Ereignis ähnlicher Art, durch den Druck seitens seiner empörten Untertanen herbeigeführt, bin ich bei Samuel stets gefaßt gewesen. Nur die Beteiligung an dem Aufstande hat ihn vielleicht in letzter Stunde davor bewahrt.
Nachdem jedoch der Oberhäuptling sich einmal zur Teilnahme am Aufstande entschlossen hatte, wuchs er zu einer Stellung heran, wie sie kraftvoller auch sein Vater Kamaherero nicht besessen hatte. Hierin stimmen die Aussagen aller Überläufer und Gefangenen überein. Samuels Befehle wurden blind befolgt. Er wußte die Schwankenden aufzurichten, die Mutlosen zu erneutem Widerstande aufzumuntern und die Ungehorsamen zu bestrafen. So wäre ohne sein Eingreifen die Masse des Hererovolkes, darunter sogar der kriegstüchtige Kajata, bereits nach den Gefechten von Onganjira und Oviumbo über die Grenze verschwunden. Ein Waterberg hätte es dann nicht mehr gegeben. Als dann vor dem Gefecht von Waterberg der eine Sohn Kambazembis, Salatiel, der sich am Aufstande bis dahin noch nicht beteiligt hatte, eine zweifelhafte Haltung zeigte, entsandte Samuel einen seiner zuverlässigsten Unterhäuptlinge mit einigen hundert Mann und dem Befehl, sich hinter Salatiel aufzustellen, und auf ihn zu schießen, falls er das Gefecht gegen die Deutschen nicht aufnehmen würde. Ferner hat ein bei den Hereros gefangen gewesener und wieder entkommener Bastard zu Protokoll gegeben, daß Samuel im Gefecht von Onganjira sechs Hereros, als sie vorzeitig die Flucht ergreifen wollten, eigenhändig niedergeschossen habe. In der Tat, wenn ich diesen Oberhäuptling mit dem vergleiche, der 1896 auf unserer Seite ins Feld gezogen ist, so treten uns zwei ganz verschiedene Menschen entgegen. 1896 hat z. B. in dem Gefecht von Otjunda Samuel seine Person nicht früh genug hinter einen Busch in Sicherheit bringen können. Immerhin war er wenigstens freundschaftlich genug, mich aufzufordern, auch dorthin zu kommen.
Oberhäuptling Samuel war klug genug, zu wissen, daß er va banque gespielt hatte, daher sein anderes Auftreten in dem jetzigen Kriege. »Ihr habt den Krieg gewollt, nun kämpft auch«, soll er mehrfach seinen Leuten[S. 310] zugerufen haben. Er war sich klar, daß die Verantwortung für alles Geschehene auf ihm lastete und daß er Gnade nicht mehr zu erwarten habe. Nach dem Gefecht von Waterberg scheint indessen auch er den Mut verloren zu haben. Wir sehen der deutschen Verfolgung gegenüber nichts mehr von irgendwelchem Widerstande, sondern nur eilige Flucht über die sichernde Grenze. Jetzt befindet sich Samuel unter englischer Polizeiaufsicht am Ngamisee, bei ihm sein ältester Sohn Friedrich und einige seiner nächsten Großleute, unter letzteren sein Feldherr Kajata. Dort mag der Oberhäuptling wohl oft mit Sehnsucht an die schönen Tage von Okahandja zurückdenken, wo es ihm an Kaffee, Tabak, Alkohol und Frauen nie gefehlt hat, an jene angenehmen Tage des Schuldenmachens und der Einnahme aus Farmverkäufen. Hoffentlich halten ihn die Engländer nunmehr auch dauernd fest, denn seine Rückkehr in das Hereroland würde zu erneuten schweren Verwicklungen führen können.
Ein wahrer, bewußter und unbewußter Komiker tritt uns in diesem Häuptling entgegen, aber ein solcher von hoher Klugheit. Schon die Art seines Regierungsantritts entbehrte nicht eines gewissen komischen Beigeschmacks. Manasse war Christ und eifriger Vorbeter in der Kirche, eine wahre Stütze der Mission, als er vor der Frage stand, die Häuptlingswürde anzunehmen. Mit ihr war die weitere schwierige Frage verknüpft, ob der neue Häuptling mit dieser Würde nach Hererositte auch den ganzen Harem seines Vorgängers übernehmen wolle. Letzteres würde aber nicht mit dem Christentum, noch viel weniger mit der Würde eines Kirchenältesten in Übereinstimmung zu bringen gewesen sein. Zum Mißvergnügen der Mission und zum Kummer seiner christlichen Frau entschied sich schließlich Manasse zur Annahme der ihm zugefallenen Häuptlingswürde. Damit war der Rückfall in die heidnische Gewohnheit der Vielweiberei verbunden, was seine christliche Frau, Albertine, zu einem Selbstmordversuch veranlaßte und ihm die Ausschließung aus der Christengemeinde eintrug. In der Folge versuchte jedoch der Häuptling, Christentum und Heidentum in weiser Abwägung miteinander zu vereinigen. Meist wohnte er bei seinem Harem in der heidnischen Werft, eine Viertelstunde von Omaruru entfernt, zuweilen aber auch in seinem christlichen Hause in Omaruru bei Frau Albertine, namentlich dann, wenn es ihm schlecht ging. So traf ich ihn z. B. Ende 1894, als die Ermordung eines Weißen in seinem Lande zu einem ernsten Zusammenstoß seinerseits[S. 311] mit der deutschen Regierung zu führen drohte (Kapitel II), in Omaruru in seinem christlichen Hause. An Bülow[82] schrieb Manasse einst: »Ich bin wieder Christ geworden, wohne bei Albertine und gehe zur Kirche, aber ich trinke immer noch Branntwein.« Letzteres sollte wohl ein Wink sein. Aber auch wenn er Heide war, brach Manasse die Beziehungen zu seiner christlichen Frau nie ab, namentlich die Kinder der letzteren besuchten ihn täglich.
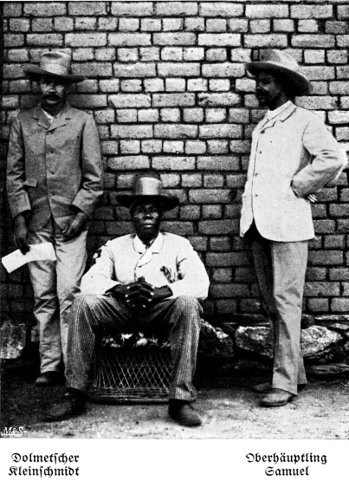
Manasse war ein herkulisch gebauter Neger von hoher Intelligenz. In den früheren Kriegen seines Stammes gegen die Swartboois soll er sich durch Tapferkeit und Tatkraft ausgezeichnet haben. Als ich ihn kennen lernte, war er jedoch schon von einer Krankheit befallen, die ihm das Gehen erschwerte und das Reiten ganz unmöglich machte. Infolgedessen war Manasse an seine Residenz Omaruru gefesselt, so daß sein Einfluß bei seinen Untertanen allmählich abnahm. Aber immerhin blieb dieser groß genug, um des Häuptlings politische Stellungnahme auch für sie zur Richtschnur werden zu lassen. Für uns aber war die Bewegungsunfähigkeit Manasses nur günstig, denn sie zwang ihn zu einer friedlichen Politik, die er lediglich im Anschluß an die deutsche Regierung durchführen konnte. Äußerlich war Manasse daher immer deutschfreundlich gesinnt, wie er auch mir viel Unterstützung gewährt, nie aber ernste Schwierigkeiten bereitet hat.[83]
[S. 312] Früher, als die deutsche Regierung in Omaruru noch nicht festen Fuß gefaßt hatte, bewies Manasse einmal die Kunst des Balancierens zwischen jener und der Festhaltung seiner eigenen Würde dadurch, daß er einen weißen Händler, der wegen Vergehens gegen die Spirituosengesetzgebung seitens des deutschen Regierungsvertreters mit 600 Mark Geldbuße belegt worden war, mit der gleichen Summe bestrafte. Damit war seine Gleichberechtigung erwiesen und der Fall zu seiner Zufriedenheit erledigt, weniger jedoch zu derjenigen des doppelt bestraften Händlers. Überhaupt war Manasse auf die deutsche Regierung anfänglich schlecht zu sprechen. Ihn störten sowohl die Spirituosengesetzgebung als auch das Verbot des Handels mit Waffen und Munition wie überhaupt alle deutschen Verordnungen. Seine deswegen an meinen Vorgänger gerichteten Briefe haben wir bereits in Kapitel II kennen gelernt. Während ferner der Oberhäuptling Samuel bei Entwaffnung seiner eigenen Untertanen mir gleichmütig Unterstützung gewährte, erregte bei Manasse jedes den Seinigen abgenommene Gewehr Mißbehagen. Weniger als Samuel lediglich an seine persönlichen Interessen denkend, machte er sich klar, daß jedes aus Hererobesitz verschwundene Gewehr eine Schwächung seiner eigenen Macht bedeutete. Die Stellung Samuels als Oberhäuptling aller Hereros hat Manasse im übrigen nie anerkannt und einen ernsten Versuch des letzteren nach seiner »Thronbesteigung«, eine Anerkennung mittels Zwang zu erreichen, durch einen geschickten Gegenzug vereitelt. Samuel hat sich zwar dann weiter »Oberhäuptling aller Hereros« genannt, im übrigen aber die Selbständigkeit Manasses stillschweigend anerkannt. Auch die deutsche Regierung hat letzteres dadurch getan, daß sie den mit dem Oberhäuptling abgeschlossenen Schutzvertrag durch Manasse als auch für ihn rechtsverbindlich ausdrücklich anerkennen ließ.
Tragikomisch, wie meine Beziehungen zu Manasse häufig gewesen sind, war auch meine letzte Berührung mit ihm. Vor einigen Jahren hatten in seinem Gebiet Hereros einige viehstehlende Bergkaffern gefangen und unter besonderer Beteiligung von Frauen derart grausam mißhandelt, daß die Mißhandelten an den Folgen starben. Vor ihrem Tode hatten die Kaffern jedoch noch flüchten und die Tat bei der nächsten Polizeistation zu Protokoll geben können. Der betreffende Werftvorstand, dem infolgedessen das Gewissen schlug, lieferte jetzt zwei Männer als Täter ein und befahl diesen galant, alle Schuld auf sich zu nehmen und für die Frauen zu sterben, da diese das schwächere Geschlecht seien. Dies taten die beiden zunächst auch, als es jedoch zur Hinrichtung gehen sollte, vermochten sie der Lust zum Leben nicht[S. 313] zu widerstehen und gaben die Frauen als Haupttäter an. Nunmehr wurden auch letztere gefangen gesetzt und nach Feststellung des Tatbestandes ebenfalls zum Tode verurteilt. Jetzt schrieb Manasse einen Brief an mich, der schmeichelnd mit den Worten begann: »Ich weiß, daß Du mich liebst, und Du weißt, daß ich Dich liebe«, und dann gleichfalls galant ausführte, die Männer sollten sterben für ihre Blutschuld, die Frauen aber, die das schwache Geschlecht seien, die müßten wir leben lassen. Nach Einsichtnahme in die Akten fand ich jedoch, daß die Frauen bei Begehen der Mißhandlungen die schlimmsten gewesen waren. Da ich indessen Manasse gefällig sein wollte und schließlich Kaffern, die, statt zu arbeiten, lediglich von Viehdiebstahl zu leben versuchten, auch keine besondere Rücksicht verdienten, so begnadigte ich die Frauen, mit ihnen aber auch die weniger schuldigen Männer zur Gefängnisstrafe. Sofort sandte Manasse die Männer zur Strafverbüßung nach Windhuk, die Frauen aber behielt er. Als ich bald darauf persönlich nach Omaruru kam, versicherte mir Manasse auf Befragen, die Weiber säßen ihre Strafen in seinem Gefängnis ab, er hätte gedacht, daß ich hiergegen nichts einzuwenden hätte. Ich ließ mir die Verurteilten vorstellen und fand, daß sie jung waren und recht gut aussahen. Obwohl daher der Verdacht gerechtfertigt erschien, daß Manasse die Frauen seinem Harem einverleibt hatte, beließ ich sie ihm, umsomehr, als unsere eigenen Gefängniseinrichtungen damals noch nicht zum besten bestellt waren und in ihnen Frauen daher nicht leicht zu isolieren waren. Für diese Rücksicht zeigte sich Manasse recht dankbar und versicherte wiederholt, er werde die Frauen sehr streng behandeln. Als ich aber etwa ein Jahr später wieder nach Omaruru kam, bat mich Manasse »Nimm jetzt die Frauen wieder weg, sie tun nicht gut bei mir.« Anscheinend hatte der Zuwachs bei den übrigen Haremsdamen Mißfallen erregt. Nunmehr setzte ich beide Weiber ganz in Freiheit.
Dies war mein letztes Zusammentreffen mit Manasse. Wenige Monate später erhielt ich die Nachricht von seinem Tode. Manasse hat sich auf dem Sterbebette wieder zum Christentum bekehrt, so daß er doch noch ausgesöhnt mit der Mission dahingegangen ist, wie er auch schließlich sich als wirklich aufrichtiger Freund unserer Sache gezeigt hat. Viel zu dieser, von seiner früheren Gesinnung abweichenden Haltung hat der erste Distriktschef Manasses, Oberleutnant Volkmann, beigetragen, der ihn ausgezeichnet zu nehmen verstand. In dem Wohnzimmer Manasses hing neben dem Bild des Deutschen Kaisers dasjenige des Oberleutnants Volkmann, beide anscheinend für ihn die Hauptpersonen in dieser Welt.
[S. 314] Als Nachfolger Manasses wurde seitens der Hereros — auch hier unter Durchbrechung des alten Hererogesetzes — sein Sohn Michael aus seiner christlichen Ehe gewählt. Michael ist während des großen Aufstandes als Führer der Omaruruhereros mehrfach genannt worden. Vor kurzem wurde sein Übertritt in die englische Walfischbai gemeldet. Michael besitzt die gleiche stattliche Figur wie sein Vater, dabei einen gesetzten, ruhigen Charakter, und ist ebenfalls nicht ohne Würde. Besondere Regententugenden zu entfalten, dazu hat er noch nicht ausreichend Gelegenheit gehabt. Schließlich möchte ich noch erwähnen, daß die hinterlassene christliche Witwe Manasses, Albertine, die Mutter des neuen Häuptlings, trotz ihrer vorgerückten Jahre wieder geheiratet hat. Wo dagegen die heidnischen Weiber Manasses geblieben sind, ist mir nicht bekannt geworden. Seinem Sohn Michael war deren Übernahme erlassen worden.
Wilhelm Christian war gleichfalls eine große stattliche Erscheinung, voll Würde und Sicherheit des Auftretens, obwohl er, im Gegensatz zu sämtlichen übrigen Kapitänen des Namalandes, weder des Lesens noch des Schreibens kundig war. Er ist im Gegensatz zu den übrigen Hottentottenkapitänen Heide geblieben und hat sich erst auf dem Sterbebette taufen lassen. Die Ursache hiervon lag in dem Besitz von vier Weibern, die dem Christentum zum Opfer zu bringen der Kapitän sich nicht hatte entschließen können.
Kapitän Wilhelm Christian war infolge der geographischen Lage seines Landes am Orangefluß frühzeitig mit Weißen in Berührung gekommen und daher nicht ohne Verständnis für deren Kultur. Ein Zurückfallen in die alten Zeiten, in denen sein Volk ohne Kleider und nur mit Pfeil und Bogen bewaffnet war, würde für ihn undenkbar gewesen sein. Aber bedauerlicherweise hatte er sich auch mit einer Schattenseite unserer Kultur innig befreundet, nämlich mit dem Alkohol. War er von diesem »eingenommen« — und dies war oft der Fall —, so verlor der Kapitän jede Überlegung. Er konnte sich in diesem Zustande wie ein Tier benehmen und Hab und Gut seines Volkes verschleudern. Unter dem Einfluß des Alkohols hat der Kapitän auch seinerzeit die Verträge mit dem Kharraskhoma-Syndikat unterschrieben, worin er diesem nahezu sein ganzes Land auslieferte. Der Alkohol auch hat es in erster Linie verhindert, wenn Wilhelm Christian in dem Wettstreit mit seinem Nebenbuhler Witbooi nicht schließlich mehr erreicht hat. Der Weg zum unumschränkten Beherrscher des Südnamalandes lag ihm offen,[S. 315] als Hendrik Witbooi in den schweren Kampf mit der deutschen Regierung verwickelt war. Wilhelm Christian hat diese Gunst des Schicksals zwar insofern benutzt, als er während des Kampfes offen für die deutsche Regierung Partei ergriff und sogar in deren Namen und Auftrag eine gewisse Regierungsgewalt über die Stämme des Südens ausübte, aber nur moralisch hat er dadurch seine Stellung zu verbessern vermocht. Nicht einmal die schon unterworfenen Feldschuhträger hat der Kapitän unter seiner Herrschaft zu halten vermocht, da er sich die Tatkraft nicht mehr zutraute, einen derart unbotmäßigen Stamm im Zaume zu halten. Denn es drohte ihm bereits der Verlust jeden Haltes auch innerhalb seines eigenen Stammes, als 1894 das Kharraskhoma-Syndikat an die Ausnutzung der ihm verliehenen weitgehenden Rechte herangehen wollte. Nur ein Eingreifen meinerseits stellte damals seine Stellung einigermaßen wieder her, und dieses Eingreifen verdankte der Kapitän seiner loyalen Haltung während des Witbooiaufstandes.
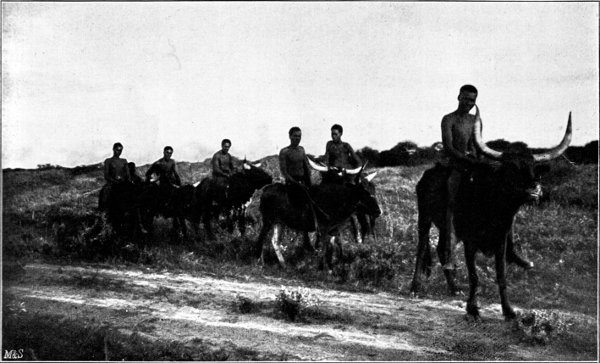
Als dann später eine deutsche Garnison nach Warmbad gelegt wurde und die Anwesenheit eines deutschen Distriktschefs die Selbständigkeit des Kapitäns zu beengen begann, ließ dessen Loyalität etwas nach. Verstand[S. 316] ihn aber ein Distriktschef richtig zu nehmen, war immerhin mit ihm auszukommen. So leistete er noch dem Distriktschef v. Bunsen 1897 Heeresfolge gegen den Stamm der Afrikaner (Kapitel V). 1898 brachte den Kapitän dagegen die Gewehrstempelungsfrage beinahe zum offenen Aufstand, trotz persönlich guter Beziehungen zu seinem damaligen Distriktschef Oberleutnant Graf v. Kageneck, einem sonst bei den Eingeborenen besonders beliebten Offizier. Von da ab aber bis zu seinem 1902 erfolgten Tode hat dann der Kapitän keine Schwierigkeiten mehr gemacht, sich vielmehr äußerlich loyal und dienstbeflissen gezeigt. Bei seinen Lebzeiten würde es wohl zu einem Bondelzwartsaufstande nie gekommen sein.
Anders nach seinem Tode. Wilhelm Christian hinterließ zwei Söhne, Abraham und Johannes Christian. Der erstere war der ältere und daher nach Hottentottengesetz zunächst zur Erbfolge berufen. Er war ein finsterer, verschlossener Charakter, auch im Äußeren seinem Vater wenig ähnlich und stand im ganzen in üblem Ruf. Johannes Christian dagegen war das Ebenbild seines Vaters, eine stattliche Erscheinung mit offenen Gesichtszügen. Kapitän Witbooi, der sich persönlich nach Warmbad begeben hatte, um seinem alten Nebenbuhler vor dessen Tode noch Lebewohl zu sagen, interessierte sich sehr für die Wahl des Johannes Christian. Bibelfest, wie immer, äußerte er sich über Abraham: »An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, und dessen Früchte sind nicht gut.« Trotzdem wurde Abraham gewählt, was die deutsche Regierung, ihrem Grundsatz getreu, sich in innere Stammesangelegenheiten tunlichst nicht zu mischen, als gegeben hinnahm. Abraham Christian hat dann, wie wir noch sehen werden, später die Fahne des Aufruhrs erhoben, allerdings nicht ganz ohne Mitschuld auf unserer Seite.
Des intelligenten, aber mit wenig Machtfülle ausgestatteten Kapitäns von Bersaba habe ich bereits gedacht. Von dessen Schulbildung gibt unter anderem eine Tatsache Beweis, die ich jetzt in der Broschüre des Oberst v. Deimling[84] gefunden habe. Der Kapitän habe, als er gehört, daß einer der deutschen Offiziere aus Tilsit stamme, diesen gefragt, ob dies der Platz wäre, wo einst der Frieden abgeschlossen worden sei. Auch ist er kurz vor dem letzten Witbooiaufstand eines Tages mit einer Zeitung zu dem Bezirksamtmann von Keetmanshoop gekommen und hat diesem gesagt: »In der[S. 317] Zeitung steht, wir Kapitäne sollen abgesetzt und unsere Leute entwaffnet werden, ist das richtig?«
Außer den bis jetzt genannten Kapitänen, einschließlich Christian Goliath, gibt es noch drei weitere im Namalande, und zwar Paul Frederiks von Bethanien, Hans Hendrik von den Feldschuhträgern und Simon Cooper von den Franzmann-Hottentotten in Gochas. Dem Kapitän Paul Frederiks sind wir bereits bei Erwähnung seines Thronstreites mit seinem Vetter Cornelius begegnet. Viel mehr ist auch nicht über ihn zu sagen. Er ist harmlos, im ganzen gutartig und unbedeutend, dabei aber vernünftig genug gewesen, sich dem allgemeinen Hottentottenaufstande nicht anzuschließen. Einerseits ist der Bethanierstamm bei seiner geographischen Lage an der südlichen Eingangsstraße des Schutzgebietes, Lüderitzbucht-Keetmanshoop, schon zu sehr mit der Kultur der Weißen in Berührung gekommen,[85] um wieder an dem alten unkultivierten Zustand etwas Verlockendes finden zu können, anderseits aber auch infolge dieser Lage selbst zu sehr gefährdet, weil durch die treugebliebenen Stämme von Bersaba und Keetmanshoop von den übrigen Hottentottenstämmen abgeschnitten. Dazu mußte schon die Tatsache, daß sein Nebenbuhler Cornelius die Fahne des Aufruhrs erhoben hat, dem Kapitän von selbst seine Stellung auf der entgegengesetzten Seite anweisen. 1898, als Unruhen anläßlich der Gewehrstempelungsfrage drohten, war es umgekehrt gewesen. Damals war der Kapitän aufsässig, Cornelius aber mit seinem Anhang auf seiten der Regierung verblieben. Letzterer steht zur Zeit noch im Felde und hat durch verschiedene kühne Züge und überraschende Überfälle von sich reden gemacht.[86] Als ich im Juni 1904 die Truppe an den General v. Trotha übergab, kämpfte Cornelius noch als Führer der Bethanier auf unserer Seite. Nach dem Gefecht von Waterberg, im August 1904, erbat und erhielt er von seinem nächsten weißen Vorgesetzten Urlaub. Ich würde ihm diesen Urlaub nicht gegeben haben, da ich auf Grund der mir bekannten Personalverhältnisse in Bethanien zu beurteilen in der Lage war, daß in den damaligen aufgeregten Zeiten ein Fernbleiben des Cornelius von seinen Stammesgenossen den auch bei diesen aufgehäuften Zündstoff nur mindern konnte. Unmittelbar nach seiner Rückkehr nach Bethanien hat sich auch[S. 318] Cornelius, im Anschluß an den Abfall seines Schwiegervaters Witbooi, zum Aufstand entschlossen. Wahrscheinlich hat er beim Passieren von Gibeon sich darüber mit dem letzteren verständigt.
Über den Kapitän der Feldschuhträger, Hans Hendrik, ist am allerwenigsten zu sagen. Er war von kleiner, unansehnlicher Erscheinung, unbedeutend äußerlich und unbedeutend nach Charakter und Geist. Für das Verhalten seines Stammes gab nicht er den Ausschlag, sondern umgekehrt, der Stamm schrieb ihm seine Richtung vor, und diese konnte nur eine üble sein. Solange Ruhe und Frieden im Schutzgebiet herrschten, zügelte der Stamm seine stets schlummernde Raublust. Die Möglichkeit, bei einem allgemeinen Aufstand mit im Trüben zu fischen, erschien den Feldschuhträgern jedoch zu verführerisch, um widerstehen zu können. Hätte sich der Kapitän dem widersetzen wollen, so würde über ihn noch viel schneller, als dies die übrigen Kapitäne riskierten, zur Tagesordnung übergegangen worden sein. Ermordet wurde jedoch nach dem Ausbruch des Aufstandes im Gebiet der Feldschuhträger niemand, was besonders der umsichtigen Tätigkeit des stellvertretenden Bezirksamtmanns Zolldirektor Schmidt zu verdanken war. Nach den neuesten Nachrichten hat sich jetzt Hans Hendrik mit dem kleinen Rest seines Anhanges in Bersaba gestellt und die Waffen abgegeben.
Endlich ist noch der Kapitän von Gochas, Simon Cooper, zu erwähnen. Dieser vermöge der Bevölkerungszahl seines Stammes etwas mächtigere Kapitän hebt sich vor seinen Standesgenossen auch insofern hervor, als er zur Zeit als einziger Kapitän des Schutzgebietes noch gegen uns im Felde steht. Sonst kann ich ihn aber nur als einen widerlichen Patron und abgefeimten Gauner, jedoch nicht ohne eine gewisse Bauernschlauheit, bezeichnen. In seinem Stamm war er keineswegs ohne Ansehen. Seine Politik schrieb auch dem ersteren die Richtung vor. Früher, als die deutsche Oberherrschaft der Raublust der Hottentotten noch keine Schranken auferlegte, hat der Kapitän ruhig zugesehen, wenn seine Leute weiße Reisende belästigten und beraubten, falls er dies nicht gar direkt befohlen hat. Auch einem zeitweisen Raubzug gegen benachbarte Eingeborene war er nicht abgeneigt, wenn bei geringer Gefahr eine große Beute winkte. Bei der geographischen Lage seines Landes an der Grenze des Schutzgebietes gegen die Kalahari hatte im übrigen sein Stamm sich eines langen Friedens erfreut und war daher, anders als die übrigen Hottentottenstämme, in einem gewissen Wohlstand sowie bei einer höheren Bevölkerungsziffer verblieben. Anderseits aber wurde diese günstige Lage an der Grenze auch tüchtig zum Munitionsschmuggel[S. 319] benutzt. Noch 1898 ist ein solcher im großen Stile entdeckt und der Kapitän hierfür bestraft worden.
Wie Simon Cooper 1894 zur Annahme der deutschen Schutzherrschaft bewogen worden ist, habe ich bereits im Kapitel II geschildert. Sein damaliges Drehen und Wenden, um dieser ihm unbequemen Sache zu entgehen, hätte dem geriebensten Rechtsanwalt Ehre gemacht. Wenn der Kapitän damals nicht zu den Waffen griff, um seinem Freunde Witbooi zu Hilfe zu eilen, so lag dies nicht am fehlenden guten Willen, sondern an persönlicher Unlust zum Kriegführen; man könnte es auch geradezu Feigheit nennen. »Ich mag keinen Krieg sehen«, sagte er einst. Indessen, getraut habe ich ihm nie, und ihn daher fortgesetzt überwachen lassen (siehe S. 29). Vom Friedensschluß mit Witbooi ab folgte Simon Cooper nur noch den Spuren des letzteren. Mit ihm hat er zehn Jahre lang Frieden gehalten, mit ihm ist er dann auch aufgestanden. Während der zehnjährigen Friedenszeit hat dagegen Simon Cooper sich den deutschen Gesetzen und Maßnahmen willig gefügt und keinerlei Schwierigkeiten bereitet, abgesehen von dem obenerwähnten Munitionsschmuggel, den er aber, vom bösen Gewissen getrieben, selbst zur Anzeige gebracht hatte. Nach dem neuerdings erfolgten Tode Witboois würde Simon sich sicher gern unterworfen haben. Denn große Kriegslust wird ihn auch jetzt nicht beseelen. Aber das Blut der in seinem Lande ermordeten Weißen lastet auf dem Kapitän. Er wird daher bis zur letzten Patrone weiterkämpfen und dann seine Zukunft wohl auf englischem Gebiet suchen.
Während des gegenwärtigen Aufstandes haben im Namalande neben dem bereits genannten Cornelius noch drei weitere Bandenführer von sich reden gemacht; es dürfte daher den Leser interessieren, im Zusammenhang mit dem Vorhergehenden auch über sie etwas zu erfahren. Hat doch der eine von ihnen, Morenga, auch Marinka genannt, den deutschen Truppen fast noch mehr Schwierigkeiten verursacht als selbst der alte kriegserfahrene Witbooi. Die beiden anderen sind die Gebrüder Morris, beide meist mit Morenga vereinigt. Alle drei sind ehemalige Großleute des Bondelzwartsstammes und waren schon während des Bondelzwartsaufstandes als Führer des in den Kharrasbergen sitzenden Teiles des Stammes hervorgetreten.
Morenga ist ein Hererobastard, d. h. Abkömmling eines Hottentotten und einer Hererofrau. In seinen kriegerischen Eigenschaften scheint er die Vorzüge beider Stämme zu vereinigen, d. h., die Verschlagenheit und Schlau[S. 320]heit des Hottentotten mit der Tapferkeit und dem Fanatismus des Hereros. Daneben besitzt er auch die stattliche Figur der letzteren. Die Morris sind dagegen Abkömmlinge eines Kapengländers und einer Hottentottenfrau, mithin echte Bastards. Alle drei haben das gemeinsam, daß sie sich viel in der Kapkolonie aufgehalten und dort sich eine gewisse höhere Kultur angeeignet haben. Sie können alle drei fertig holländisch lesen und schreiben. Schließlich haben sie auch das gemeinsam, daß sie in dem mit den Bondelzwarts am 27. Januar 1904 abgeschlossenen Friedensvertrag von Kalkfontein alle drei geächtet worden sind, die Gebrüder Morris wegen Räubereien, Morenga wegen Mordes, doch war nicht die Todesstrafe über sie verhängt, sondern sie waren lediglich von der ihren übrigen Stammesgenossen gewährten Gnade ausgeschlossen, bis sie sich für ihre Untaten vor Gericht verantwortet haben würden. Alle drei entzogen sich jedoch dieser Verantwortung durch Flucht in die Kapkolonie, aus der sie dann später an der Spitze von Räuberbanden zurückkehrten. Alle drei stehen zur Zeit noch im Felde, zwar schon mehrfach besiegt, aber anscheinend immer noch ungebrochenen Mutes.[87]
Ihre höhere Kulturstufe haben sowohl Morenga wie die Gebrüder Morris auch durch die Art ihrer Kriegführung bewiesen. Während des Bondelzwartsaufstandes legte mir ein ausgeplünderter Farmer eine in gutem Holländisch geschriebene Bescheinigung vor. Sie befindet sich bei den Akten des Gouvernements in Windhuk und lautet nach meiner Erinnerung in Übersetzung etwa folgendermaßen:
»Requiriert beim Farmer X. 2 Gewehre, X Patronen, X Pfd. Kaffee, X Pfd. Tabak usw.
Dies bescheinigen:
Der Kommandant: gez. Morris. Der Feldkornett: gez. X.«
An den Personen des Farmers und seiner Angehörigen hatten sich die Plünderer dagegen nicht im geringsten vergriffen. In der gleichen anständigen Weise hat auch Morenga den Krieg geführt. Er hat bei seinen »Requisitionen« nicht nur das Leben der Weißen geschont, sondern auch den Ausgeplünderten den notwendigsten Lebensunterhalt belassen.[88] In seine Hände gefallenen verwundeten deutschen Soldaten hat Morenga die Freiheit wiedergegeben.[S. 321] Während im Juni 1905 zwei deutsche Abgesandte sich behufs Friedensverhandlungen im Lager Morengas befanden, griff eine deutsche Abteilung, die von der Anknüpfung der letzteren nicht rechtzeitig hatte verständigt werden können, versehentlich an. Morenga hätte es nun in der Hand gehabt, die Abgesandten zu töten. Er zog es jedoch vor, lediglich die Verhandlungen abzubrechen und sein Lager zurückzuziehen. Das gleiche Versehen war kurz vorher im Lager des Bandenführers Cornelius vorgekommen, in diesem Falle aber der deutsche Abgesandte von den Hottentotten erschossen worden. (Leutnant v. Trotha, Neffe des Generals.)

Weniger ritterlich als das vorstehend geschilderte Verhalten erscheint dagegen die Ursache, wegen der Morenga nach dem Bondelzwartsaufstande geächtet worden ist. Eine Patrouille der damals mit uns verbündeten Witboois war in einen von ihm gelegten Hinterhalt geraten. Ein Mann der Patrouille wurde erschossen, einem zweiten das Pferd unter dem Leibe getötet. Der letztere wollte zu Fuß flüchten, wurde jedoch hieran bald durch einen Beinschuß gehindert. Einsehend, daß weitere Flucht doch nichts nützen würde, kehrte der Verwundete zurück, um sich zu ergeben. Da sprang Morenga aus seiner Deckung auf und schoß dem herankommenden Witbooi auf etwa 10 Schritt Entfernung eine Kugel durch den Kopf. Da der Getötete ein Neffe des Kapitäns Witbooi war, so tat ich dem letzteren den Gefallen, auch Morenga wegen dieser Untat von der dem übrigen Stamm gewährten Gnade auszuschließen. Witbooi bat mich dann noch, diesen Tod seines Neffen für die deutsche Sache dem Deutschen Kaiser zu melden,[S. 322] da derselbe die Ehre gehabt hätte, während der Kolonial-Ausstellung 1896 von Seiner Majestät empfangen zu werden.
(Kambazembi, Tjetjo und Zacharias.)
Während wir im Frieden bei den Hottentotten neben den Kapitänen selbständige Unterkapitäne nicht finden, brachte es die weit höhere Bevölkerungszahl der Hereros mit sich, daß sich bei ihnen auch Unterhäuptlinge von Ansehen und Macht entwickeln konnten. Bei den Hottentotten konnte ein einziger Kapitän seinen höchstens 3000 bis 4000 Seelen starken Stamm übersehen und leiten, was bei den 70000 bis 80000 Hereros ausgeschlossen war.
Neben und unter den beiden selbständigen Häuptlingen, die wir bei den Hereros kennen gelernt haben (Samuel und Manasse), besaß jede Werft ihren eigenen Vorstand, der sich mit Vorliebe gleichfalls Kapitän nennen ließ. Unter diesen Werftkapitänen traten wieder drei auf Grund der Zahl ihrer Untertanen, oder, was bei den Hereros die Hauptsache war, auf Grund der Zahl ihrer Ochsen an Machtfülle hervor. Es sind dies die Unterhäuptlinge Kambazembi von Waterberg, Tjetjo von Okazeva im Distrikt Gobabis und Zacharias von Otjimbingwe, alle drei die Oberherrschaft des Oberhäuptlings Samuel mehr oder weniger gutwillig anerkennend.[89]
Dem Unterhäuptling Kambazembi sind wir bereits in Kapitel II und VIII begegnet. Wir haben ihn als einen viehreichen, im ganzen gutmütigen, dabei aber schlauen Herero von altem Schrot und Korn kennen gelernt. Trotz seines Reichtums — nach unseren Anschauungen könnte man ihn Millionär nennen — hat Kambazembi in seiner einfachen Hererolebensweise nichts geändert. Er verschmähte alle europäischen Genußmittel. Seine Nahrung bestand nach der Väter Sitte lediglich in Fleisch, Milch und Feldfrüchten. Bei dieser einfachen Lebensweise hätten seine Viehherden ins ungemessene wachsen müssen, wenn nicht zuerst die Rinderpest eine tüchtige Lücke in sie gerissen und dann das fortgesetzte Schuldenmachen seiner zahlreichen Söhne von Zeit zu Zeit einen weiteren Aderlaß verursacht hätte. Gerade Kambazembis Gebiet war das Hauptziel des Feldhandels, denn dort war noch etwas zu holen. Und man muß es dem Alten lassen, was an ihm lag, einen Ausgleich zwischen dem Schuldenmachen seiner Leute und den Forde[S. 323]rungen der Händler herbeizuführen, das hat er redlich getan. Doch hat er nicht verhindern können, daß noch während seines letzten Lebensjahres einer seiner Söhne, um sich seinen Schulden zu entziehen, unter Mitnahme auch fremden Gutes nach dem Ovamboland flüchtete. Indessen, auch da hat Kambazembi das von seinem Sohn zu Unrecht mitgenommene Gut trotz der erhobenen unangemessen hohen Gegenforderungen bereitwillig ersetzt.[90]
Die letzten Lebensjahre Kambazembis wurden sehr durch den Zwiespalt zwischen seinen beiden als Nachfolger in Betracht kommenden Söhnen David und Salatiel verbittert. Der erstere war sein ältester Sohn überhaupt, der letztere aber derjenige der Hauptfrau. Das Gouvernement enthielt sich der Einmischung, behielt aber diesen Zwiespalt im Auge, um ihn gegebenenfalls politisch auszunutzen. Nach dem Tode Kambazembis, der kurz vor Ausbruch des Bondelzwartsaufstandes erfolgte, haben sich dann die beiden Söhne unter Vermittlung des Oberhäuptlings dahin geeinigt, daß sie sowohl Herrschaft wie Viehherden teilten. David wurde Herr des Platzes Waterberg, Salatiel des übrigen Gebietes. Einig waren sie darum aber doch nicht. So hat sich David, auf den die Anhänglichkeit seines Vaters Kambazembi an den Oberhäuptling übergegangen war, in der Folge dem Aufstande angeschlossen, Salatiel aber nicht. Der erstere verhinderte nicht die Ermordung zahlreicher Weißer auf seinem Platze Waterberg und zog dann mit seiner ganzen Macht nach dem Süden, dem Oberhäuptling Samuel zu Hilfe. Salatiel dagegen blieb, Gewehr bei Fuß, bei Waterberg stehen und zeigte große Lust zu einer friedlichen Verständigung mit der deutschen Regierung. Ich habe schon oben erwähnt, wie der Oberhäuptling diese schwankende Haltung Salatiels wieder zu befestigen wußte. Andernfalls würde eine Benutzung dieses günstigen Umstandes unserseits uns möglicherweise Bundesgenossen aus dem eigenen Stamm der Aufständischen zugeführt haben, was für afrikanische Kriege stets einen ganz erheblichen Vorteil bedeutet. Salatiel hat sich dann am Kampfe bei Waterberg beteiligt und soll auf der Flucht gestorben sein, während David sich auf englisches Gebiet gerettet haben soll.
Der Unterhäuptling Tjetjo ähnelte in vielem dem Häuptling Kambazembi. Schon äußerlich glichen sie sich in bezug auf Schwerfälligkeit der[S. 324] Figur und Neigung zur Dickleibigkeit. Auch Tjetjo war Heide geblieben, aber er trug — im Gegensatz zu Kambazembi — stets europäische Kleidung und war auch sonst den Genüssen der Zivilisation nicht abhold. Ebenso war Tjetjo ein großer Viehbesitzer und Herr einer Werft, die etwa 600 bis 700 waffenfähige Männer zu stellen vermochte. Aber er war alt, bequem und daher friedliebend. In einem Punkte aber unterschied sich Tjetjo wesentlich von Kambazembi. Er war ein ebenso erbitterter Feind des Oberhäuptlings, wie jener dessen Freund war. Trotzdem hat auch er sich schließlich mit dem Oberhäuptling geeinigt, als es sich um den gemeinsamen Aufstand handelte. Die treibende Kraft hierbei wird wohl sein ältester Sohn Traugott gewesen sein, ein Christ, aber wegen Rückfalls in die Vielweiberei aus der Gemeinde ausgeschlossen. Traugott war ein energischer Mensch, eine Art Nikodemusnatur. Bei ihm schwankte das Zünglein der Wage fortgesetzt zwischen Wohlverhalten und Aufstand. Nur hielt ihn sein friedliebender Vater im Zaum. Bei der im Jahre 1899 erfolgten Expedition gegen den Stamm Tjetjos (Kapitel V) habe ich daher diesen Zwiespalt benutzt und den Sohn entwaffnet. Damals wurde Traugott auch auf Betreiben des Oberhäuptlings zum Verlegen seines Wohnsitzes in das Gebiet von Okahandja verurteilt. Traugott aber bat mich flehentlich, von dieser Strafe abzusehen, da ihm, nachdem er durch Abgabe seiner Gewehre waffenlos geworden sei, die Okahandja-Hereros alles Vieh wegnehmen würden. Da ich auf der andern Seite auch keinen Anlaß zur allzu großen Verstärkung der Machtstellung des Oberhäuptlings besaß, willfahrte ich dieser Bitte. Und doch hat auch Traugott sich schließlich behufs Teilnahme an dem Aufstande wieder mit dem Oberhäuptling vertragen. Er befindet sich zur Zeit gleichfalls auf englischem Gebiet. Tjetjo ist dagegen nach Waterberg den Strapazen der Flucht erlegen.
Endlich würde hier noch Zacharias, der Häuptling von Otjimbingwe, zu erwähnen sein. Eine baumlange Erscheinung von auffallender Magerkeit, stets mit einem freundlich wohlwollenden Lächeln im Gesicht, unbedeutend nach Verstand, Charakter und Autorität, dabei leidenschaftlicher Liebhaber von Alkohol, so tritt uns Zacharias entgegen. Persönlich wie politisch eine Null, hing er sich an die Rockschöße des Oberhäuptlings Samuel, zwischen diesem und den Wünschen seiner eigenen Leute hin- und herschwankend. Bis zum Aufstande hat auch Zacharias zu allem, was von der Regierung ausging, Ja und Amen gesagt, stets ängstlich bedacht, tunlichst mit allen Menschen im Frieden zu leben. Im Schuldenmachen und damit zusammen[S. 325]hängend im Tempo seiner Farmverkäufe übertraf er fast noch seinen Oberhäuptling Samuel. Damit würde es indessen bald zu Ende gewesen sein, denn ihm war bereits ein festes und unverkäufliches Reservat zugemessen worden. Bei einem einzigen, noch dazu recht wichtigen Anlaß schien sich dagegen Zacharias der Nachfolge auf den Wegen des Oberhäuptlings entziehen zu wollen, und das war bei Beginn des großen Aufstandes. Nicht weniger als elf Tage hat er den Anschluß verweigert und es vorgezogen, sich auf die Ratschläge des Missionars und des Stationschefs zu stützen. Wenn er auf die Dauer nicht hat widerstehen können, so ist bei keinem Hererohäuptling wie bei ihm so sehr die Annahme gerechtfertigt, daß die Wogen schließlich über seinem Haupte zusammengeschlagen sind. Geschadet hat er aber für seine Person uns gewiß nicht viel. Auch war er der erste aller Hererohäuptlinge, der sich im Vertrauen auf sein gutes Gewissen freiwillig gestellt hat. Zur Zeit befindet er sich in einem Konzentrationslager.

Die Regierungsform hatte sich bei den Hottentotten sowohl wie bei den Hereros in einer ganz anderen Bahn entwickelt als bei den übrigen Eingeborenen Afrikas. Während wir dort sonst die Häuptlinge immer und überall als unumschränkte Herren über Leben und Eigentum ihrer Untertanen, mithin die absolute Monarchie in ihrer ausgesprochensten Form finden, treten uns hier die Stammeshäupter mehr als »primi inter pares« entgegen. Die Regierungsgewalt liegt mehr bei dem Rat der Ältesten, deren Vorsitzender der Häuptling ist, als bei der Person des letzteren. Nur besonders begabte Herrschernaturen wie Witbooi haben, aber lediglich gestützt auf die eigene Person, eine wirklich beherrschende Stellung zu gewinnen verstanden. Sogar gestraft konnte der Kapitän durch das Gericht der Stammältesten werden. Die einzige Strafe, der er nicht unterlag, war die Prügelstrafe, die sonst ohne Ansehen der Person verhängt wurde.
Diese für Hottentotten und Neger fast allzu freie Regierungsform mag bei den ersteren der frühzeitigen Berührung mit den in die Kapkolonie eingedrungenen Weißen ihre Entstehung verdanken. Zufällig waren die ersten Eindringlinge Holländer, denen dann die Engländer folgten, die beide damals schon unter den Völkern Europas gleichfalls die freieste Regierungsform besaßen. Die vom Norden in das Schutzgebiet gekommenen Bantus haben dann wohl während der zahlreichen kriegerischen und friedlichen Berührungen mit den Hottentotten sich allmählich wohl oder übel auch deren Regierungsform angepaßt. Der Vater des jetzigen Oberhäuptlings, der alte Kamaherero, hatte noch eine nahezu autokratische Gewalt besessen. Er verfuhr mit Leben und Eigentum seiner Untertanen ganz nach der alten Negersitte. Mit seinem Tode und der damit beginnenden Erbfolgestreitigkeit verfiel jedoch diese Machtstellung wieder. Die anfängliche Ohnmacht seines Sohnes und Nachfolgers haben wir ja bereits kennen gelernt. Strafen innerhalb des Stammes und gar die Todesstrafe hat es seit dem Ableben des alten Kamaherero unter den Hereros nicht mehr gegeben. Selbst Morde blieben ungesühnt. Im Gegensatz zu den Hereros hat sich dagegen bei den für sich abgeschlossen lebenden Ovambos die alte absolute Häuptlingsgewalt in ihrer krassesten Form aufrechterhalten. Bei ihnen pflegt sich jeder Häuptling zu einem mehr oder weniger blutgierigen Tyrannen zu entwickeln.
Bei aller Ohnmacht ist jedoch auch bei den Hottentotten und Hereros die Stellung der Stammesoberhäupter in ihrer Mehrzahl immerhin in einer[S. 327] Beziehung noch mit einer gewissen Machtfülle umgeben, nämlich in bezug auf Zulassung des Bösen. Wird der Krieg vom Kapitän nicht gewollt, so kann er auch nicht ausbrechen, wünscht der Kapitän keine Schädigung von Leben und Eigentum der in seinem Lande wohnenden Angehörigen anderer Nationen, so sind diese sicher, seien sie weiß oder schwarz, oder aber es folgt deren etwaiger Verletzung die Ahndung unfehlbar. Nur laues Verhalten des Häuptlings, das Zudrücken von einem oder gar von beiden Augen, gibt den Übelgesinnten unter seinen Leuten Mut und Spielraum zu Untaten. Diese autoritative Stellung schließt aber nicht aus, daß bei einem die Leidenschaften des ganzen Stammes aufwühlenden Anlaß, wie dies der allgemeine große Aufstand des Jahres 1904 war, es vorkommen kann, daß der Häuptling sich lediglich vor die Wahl gestellt sieht, ob er mitmachen oder seinen Platz räumen will. Das ist jedoch in Europa auch nicht anders. Auch dort finden wir Beispiele genug, daß ein regierender Fürst gegen seine Überzeugung in einen Krieg hineingezogen worden ist, weil er dem Drängen der öffentlichen Meinung seines Landes nicht hatte zu widerstehen vermocht.


Beinahe bis zum Überdruß ist schon verkündigt worden, daß das Schutzgebiet das Land der Viehzucht und des Bergbaues sei. Da aber in dieser Beziehung in der Heimat immer noch irrige Ansichten zutage treten, so kann es nicht oft genug wiederholt werden. Wer nach Südwestafrika auswandert, der lasse den Gedanken an Egge und Pflug zu Hause, es sei denn, daß er seine Schritte nach dem Grootfonteiner Gebiet oder dem Ovambolande lenkt.
Das ausschlaggebende Moment für den Weg, auf dem die wirtschaftliche Ausnutzung eines Landes erfolgen kann, bildet die Wasserfrage, und diese ist wieder von den Niederschlägen abhängig. Um ein richtiges Urteil über den wirtschaftlichen Wert des Schutzgebietes zu gewinnen, wurde daher das ganze Land mit einem Netz von meteorologischen Beobachtungsstationen überzogen und die Oberleitung über das Ganze einem Gouvernementsbeamten übertragen. Unmittelbar vor dem Aufstande hatten die Beobachtungsstationen die Zahl von 54 erreicht. Ihre Ergebnisse sind alljährlich in den Jahresberichten des Gouvernements veröffentlicht worden. Für hier genügt es, die Durchschnittszahlen der Hauptstationen anzuführen. Nach den Beobachtungen in den letzten drei Berichtsjahren vor dem Aufstande, [S. 329]d. i. vom 1. April 1900 bis 1. April 1903, betrugen die Regenhöhen: 1. für das Grootfonteiner Gebiet durchschnittlich 521 mm, 2. für Windhuk 226 mm, 3. für Gobabis 339 mm, 4. für Gibeon 85 mm, 5. für Keetmanshoop 83 mm, 6. für Bethanien 69 mm.

Zum Vergleich füge ich hinzu, daß der Jahresdurchschnitt für Deutschland etwa 500 bis 600 mm beträgt, für Mittelspanien aber nur 300 mm. Diese Zahlen beweisen, daß im Grootfonteiner Gebiet wohl die Möglichkeit des Ackerbaues vorliegt, während man im mittleren Teile des Schutzgebietes wenigstens stets auf so viel Feuchtigkeit wird rechnen können, als der Bestand der Weide verlangt. Im Süden muß man dagegen zufrieden sein, wenn der alljährlich fallende Regen zur Erneuerung der Weide überhaupt ausreicht. Die Witterungsverhältnisse des Ovambolandes sind bereits im Kapitel VI besprochen. (S. 198 ff.)
Zu erörtern wäre noch die Frage, wo im Herero- und Namalande das Niederschlagwasser bleibt. Es ist bekannt, daß die sämtlichen südwestafrikanischen Flüsse in der Trockenzeit wasserlos sind, während sie in der[S. 330] Regenzeit oft gewaltige Wassermengen zu Tale führen. Die Ursache dieser Erscheinung ist in erster Linie in der Tatsache zu suchen, daß in Südwest sowohl der Schneefall wie die Wälder fehlen, mithin die natürlichsten Reservoirs für Wasseraufspeicherungen. Die zweite Ursache liegt in dem trockenen Höhenklima des Schutzgebietes, das zwar der Gesundheit sehr förderlich ist, aber offenes Wasser mit unangenehmer Schnelligkeit aufsaugt. Die dritte Ursache findet sich in dem ungeheuren Gefälle unserer Flüsse. So liegt z. B. Berlin 39 m über dem Meere, Windhuk dagegen 1600 m, während von beiden Orten die Gewässer bis zum Meere annähernd den gleichen Weg zurückzulegen haben. In Berlin finden wir daher einen gemächlich fließenden, geduldig der Schiffahrt dienenden Niederungsfluß, in Windhuk dagegen einen reißenden Gebirgsstrom. Die vierte und letzte Ursache ist, daß die südwestafrikanischen Niederschläge nur während einer kurzen Periode von wenigen Monaten fallen, und zwar in der Regel Dezember bis April, während die ganze übrige Zeit frei von Regen ist, sowie daß diese Niederschläge selten in Gestalt andauernder, für das Eindringen in das Erdreich förderlicher Strichregen erfolgen, sondern meist in Form gewaltiger Wolkenbrüche, die in kurzer Zeit Wege in Flüsse, Flüsse in mächtige Ströme, Niederungen in Seen verwandeln. Aber nur die letzteren, Vleys genannt, vermögen sich einige Zeit zu halten, die übrigen Gewässer stürzen eilends zu Tale oder weichen der austrocknenden Gewalt der Sonne.[92] Nach einer Berechnung des Ingenieurs Rehbock wäre indessen der zur Verdunstung gelangende Teil der Niederschläge auf nur ein Viertel der Gesamtmengen zu schätzen. Hieraus würde zu schließen sein, daß der größere Teil der Wassermengen unter dem Erdboden verschwindet. Das würde ein sehr günstiger Umstand sein. Wir hätten dann zwar auch noch keine Reservoirs für Flußbildungen, aber doch für zahlreiche Brunnen.[93]


Aber auch jetzt schon ist die Zahl der natürlichen Quellen Südwestafrikas größer, als man gewöhnlich annimmt. Diese haben jedoch entweder keinen Abfluß, oder der letztere verfällt schon nach kurzem Lauf als Bach[S. 333] dem Schicksal der reinen Regenflüsse, d. h., er verdunstet oder verschwindet im Erdboden. Solche Bäche entspringen z. B. mehrfach dem Waterberggebirge im Norden des Hererolandes. Auch im Naukluftgebirge habe ich einige gesehen. Ferner findet man in den sonst trockenen Flußbetten gleichfalls zuweilen natürliche Quellen. Das innerhalb der Regenzeit dort verschwundene Wasser sickert in diesen Betten während der trockenen Zeit langsam talabwärts. An manchen Stellen zwingt dann die Gestaltung des Untergrundes das Wasser, auf eine kurze Strecke zutage zu treten. So führen der Omarurufluß bei dem Orte gleichen Namens und bei Okombahe, der Schwarze Nosob bei Gobabis, der Windhuker Swakop bei den Tabaksdünen stets laufendes Wasser. Wo dagegen in den Flußbetten dieses Sickerwasser nicht auf natürlichem Wege zutage tritt, kann es auf künstlichem Wege gehoben werden. In und neben ihnen finden sich mithin die gegebenen Stellen für Brunnenanlagen. Auch warme Quellen — vulkanischen Ursprungs — findet man im Schutzgebiete, so in Windhuk sieben. Würde man diese zusammenfassen, so würde ein das ganze Jahr laufender stattlicher Bach entstehen. Jetzt[S. 334] verschwindet das Wasser in den Gärten, wo es leider infolge seines Schwefelgehaltes das Gedeihen mancher Pflanzenart hindert. Geeignete Stellen zum Herstellen künstlicher Brunnen befinden sich außerhalb der Reviere auch in den sogenannten Kalkpfannen, sofern in diesen das Wasser nicht schon von selbst in Gestalt von Teichen zutage getreten ist.
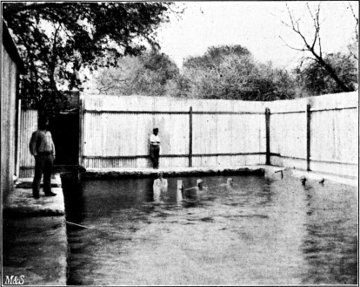
Aus den Erträgnissen der Wohlfahrtslotterie hat das Kolonial-Wirtschaftliche Komitee in Berlin etwa ein Jahr vor dem Aufstande mit Unterstützung des Gouvernements begonnen, im Schutzgebiet Brunnenbohrungen vorzunehmen und im ganzen bereits 52 Bohrungen mit insgesamt 2600 m Tiefe vollendet. Die Kosten stellten sich auf 11 Mark pro Fuß. Ein Erfolg ist bei 21 Bohrungen, gleich 40 vH., erzielt worden. Im Jahresbericht des Gouvernements von 1903/04 ist die genaue Tabelle der erfolgten Bohrungen enthalten.


Nach den dargelegten Wasserverhältnissen des Herero- und des Namalandes kann kein Zweifel bestehen, daß das tragfähige Rückgrat unserer wirtschaftlichen Bestrebungen in Südwestafrika nur Viehzucht sein kann. Dies schließt nicht aus, daß jeder Farmer an Acker- und Garten[S. 335]früchten sich wenigstens seinen eigenen Bedarf zieht. Er muß nur der launischen Natur zu Hilfe kommen und das, was sie an tropischem Platzregen einmal zu reichlich spendet, nicht abfließen lassen, sondern mittels Dammanlagen für die Zeiten der Not aufspeichern, sowie dasjenige, was in dem Erdboden verschwunden ist, mittels Brunnen wieder heraufholen. Wo Wasser vorhanden, ist auch unser südwestafrikanischer Boden zu reichlichem Ertrage fähig, das beweisen die zahlreichen Gärten der Militär- und Missionsstationen. Die zu erzielenden Produkte sind sämtliche europäischen Gemüse- und Getreidearten sowie Wein, Tabak und Südfrüchte. Auch mit in Deutschland wachsenden Baumfrüchten, wie Äpfel und Birnen, sind Versuche gemacht worden, jedoch ohne Erfolg. Für diese Früchte ist die afrikanische Sonne zu heiß, sie lohnen dem fleißigen Gartenbauer lediglich mit Produkten von minderwertiger Beschaffenheit. Gute Aussichten bieten dagegen der Wein- und der Tabakbau. Beide leiden jedoch im Schutzgebiet zum Teil noch unter dem Mangel an zweckmäßiger Behandlung. Diesem Übelstande abzuhelfen, war bereits ein Sachverständiger angeworben, dessen Ausreise jedoch der Hereroaufstand verzögert hat. Unmittelbar vor dem Aufruhr wurde namentlich in der Gegend von Okahandja, im Distrikt Grootfontein[S. 336] und im Bezirk Outjo viel Tabakbau betrieben. Weinbau findet sich dagegen in fast sämtlichen Gärten des Schutzgebietes. Der Erfolge der katholischen Mission auf diesem Gebiete in Klein-Windhuk habe ich bereits gedacht.

Das Ziel, wenigstens den eigenen Bedarf an Feld- und Gartenfrüchten aus dem trockenen Boden herauszuwirtschaften, erreicht in Südwestafrika der Farmer nur mittels kleiner Staudämme, wie wir solche auf den Bildern (S. 337 und S. 339) finden. Die durch Brunnen zu gewinnende Wassermenge reicht für gedachten Zweck in der Regel nicht aus. Im übrigen ist nach meiner Ansicht die Wasseranstauung im kleinen behufs Ackerberieselung im Schutzgebiete vorläufig der Anlage großer Staudämme, wie sie die Ingenieure Rehbock und Kuhn geplant haben, vorzuziehen. Die großen Dämme sollen Dorfanlagen ermöglichen und nicht bloß dem eigenen Bedarf dienen, sondern auch das Dasein der Ackerbauer mittels Absatz der erzielten Erträgnisse sichern. Vor dem Vorhandensein einer ausreichenden Industrie, als die in Südwestafrika zur Zeit nur der Bergbau in Frage kommen kann, fehlt indessen dem Farmer ein lohnendes Absatzgebiet. Ein solches bietet gegenwärtig nur die Schutztruppe, deren zukünftige Stärke zur Zeit niemand zu übersehen vermag.


Schließlich wäre noch die Forstkultur zu erwähnen. Auf diesem Gebiete scheint uns im Schutzgebiet der schwerste Kampf bevorzustehen. Wohin das Auge reicht, bietet sich im Herero- und Namalande an Holzbeständen nur niedriges Buschwerk, lediglich an den Flußläufen durch einen Baumbestand größerer Art unterbrochen. Wälder in unserem Sinne finden wir nur im Distrikt Grootfontein wie im Ovambolande, dort allerdings zum Teil in tropischer Fülle. Die Gebirge dagegen, die man in der übrigen Welt bis zu einer gewissen Höhe mit Bäumen bestanden zu sehen gewohnt ist, sind in Südwestafrika völlig kahl. Infolgedessen haben die wolkenbruch[S. 338]artigen Regen von den Bergen auch das Erdreich mitgenommen, so daß uns überall der nackte Fels entgegenstarrt und daher eine Aufforstung dort überhaupt ausgeschlossen ist. Die Holzfrage ist hiernach im Schutzgebiet eine brennende. Das warme Klima erfordert zwar glücklicherweise nur selten ein wärmendes Feuer, dagegen vermag weder der Weiße noch der Eingeborene für die Zubereitung seiner Nahrung des Brennmaterials zu entbehren. Dieses wird durch Sammeln des trockenen Holzes gewonnen. Es ist klar, daß in der Nähe größerer Plätze der von der Natur gespendete Vorrat immer mehr zusammenschmilzt und schließlich ganz verschwindet. Während beispielsweise in der Nähe von Windhuk vor einigen Jahren noch eingeborene Frauen und Kinder ausreichend Holz heranzuschleppen vermochten und durch diese Tätigkeit ihren Lebensunterhalt gewannen, hat sich jetzt schon die industrielle Tätigkeit dieses Gebietes bemächtigt, indem sich eine Art mittels Fuhrwerks betriebenen Holzhandels entwickelt hat. Denn von immer weiter her muß der Bedarf geholt werden. Bald wird aber auch dieses Mittel nicht mehr genügen, so daß schließlich an den größeren Plätzen Südwestafrikas zu den bisherigen Erwerbszweigen auch der Handel mit zum Teil von außerhalb eingeführtem Feuerungsmaterial treten muß.

Welche Unsummen von Holz der gegenwärtige Krieg in Südwestafrika verschlungen hat und noch verschlingen wird, läßt sich nur mit Sorge ermessen. Monatelang biwakieren starke Truppenkörper unter freiem Himmel. Sie bedürfen nicht nur des Holzes zum Zubereiten von Speisen, sondern auch zum Erwärmen in den langen kalten Biwaksnächten. An den ohnehin spärlichen Holzvorräten wird daher fortgesetzt gezehrt, während ein Ersatz nicht[S. 339] hinzutritt, und jeder abgeschlagene Baum daher z. Zt. in Südwestafrika einen unersetzbaren Verlust bedeutet. Unverständig geschädigt wird der Holzbestand außerdem noch durch fahrlässig oder absichtlich angelegte Grasbrände. Absichtlich rufen namentlich die Buschmänner und Bergkaffern solche hervor, um das Wild, dessen sie zu ihrer Nahrung bedürfen, an das nach dem Brande um so frischer emporsprießende Gras heranzulocken.
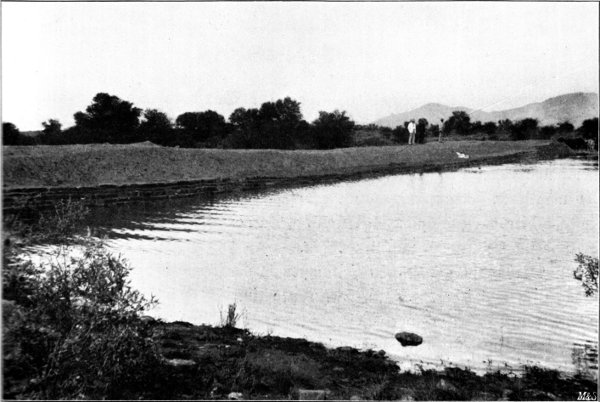
Die Erhaltung des Holzbestandes war daher dem Gouvernement stets eine schwere Sorge. Mittels strenger gesetzlicher Maßnahmen wurde versucht, sowohl den Grasbränden wie der sonstigen absichtlichen Vernichtung des Baumbestandes Einhalt zu tun. Lediglich das dürre, bereits vom Baume gefallene Holz blieb der freien Benutzung überlassen. Aber auch an Ersatz wie überhaupt an die Verbesserung der Holzbestände wurde gedacht und zu diesem Zweck beim Gouvernement ein Forstreferat eingerichtet. Der erste Inhaber dieses Amtes war der bereits im Kapitel VI als Forschungsreisender in das Ovamboland genannte Forstassessor Dr. Gerber. Dieser faßte seine Aufgabe mit großer Rührigkeit an, fand jedoch, daß bei den geringen[S. 340] Niederschlägen in bezug auf Anpflanzung im Herero- und Namalande nur an wenigen Stellen etwas zu erreichen sei. Nur, wo die Niederschläge zur Ackerwirtschaft ausreichen, genügen sie auch dem Baumwuchs, während künstliche Bewässerungsanlagen für eine Aufforstung größeren Stiles nicht ausreichen. Infolgedessen wurde seitens des Forstreferenten für eine Aufforstung in erster Linie eine Baumart ins Auge gefaßt, die mit wenig Wasser auszukommen vermag, d. i. die Dattelpalme. Doch mißlang ein Versuch, diesen Baum im Flußbett in Windhuk zu ziehen, wohl weil das dortige schwefelhaltige Wasser der Pflanze nicht zusagte. Dagegen gedieh eine Anpflanzung in Ukuib am Swakopflusse, südlich der Bahnstation Kubas, durchaus zufriedenstellend. Die besten Aussichten für Aufforstungsanlagen, aber auch noch anderer Art, bietet jedoch der Boden in und um Okahandja, der sich infolge hochstehenden Grundwassers auch für Acker- und Gartenbau besonders geeignet erwiesen hat. Am Platze Okahandja selbst wie in dem eine halbe Stunde entfernten Osona wurden Baumschulen angelegt, in denen alle möglichen Baumarten, auch europäische, mit Erfolg gezogen wurden. Ableger hiervon sind unentgeltlich an die Farmer behufs eigener Aufforstungsversuche im kleinen abgelassen worden. Dr. Gerber glaubte aus der Forststation Okahandja jährlich 10 Millionen Pflanzen liefern zu können. Versuche mit ausländischen Baumarten hatte im übrigen schon vor Eintreffen des Referenten für Forstwesen ein gleichfalls im Gouvernementsdienst stehender Botaniker[94] in Brackwater begonnen, von wo sie dann auf Veranlassung des ersteren in den aussichtsreicheren Boden Osonas übergeleitet worden sind.
Derartige Aufforstungsarbeiten sind im Nama- und Hererolande, wenigstens an den wenigen Stellen, an denen sie möglich sind, um so notwendiger, als der dortige geringe Baumbestand nur Feuerungsmaterial, aber kein Nutzholz liefert. Die derzeitigen Baumarten Südwestafrikas, meist Akazienarten, sind knorrig und bestehen aus einem steinartig harten, nicht zu bearbeitenden Holze. Als Brennholz ist es auch nur zu verwenden, nachdem es im Laufe der Zeit verwittert und vom Stamme abgefallen ist. Das Bauholz hat dagegen bis jetzt durchweg von auswärts eingeführt werden müssen. Auch auf diesem Gebiete wenigstens unseren eigenen Bedarf zu decken, muß daher wie beim Acker- und Gartenbau das Ziel unseres Strebens sein. Dagegen habe ich meinen früher einmal gehegten Gedanken, dereinst vielleicht auch noch die Berge Südwestafrikas mit einem stattlichen Baum[S. 341]wuchs bestanden zu sehen und so eine der Grundlagen für natürliche Quellen zu schaffen, längst aufgegeben. Denn hierzu fehlen alle und jegliche Vorbedingungen.
Endlich seien auch noch einige Worte der Palme im allgemeinen gewidmet, jenem schönen pappelähnlichen Baum, dessen Anblick allein schon uns in die Tropen zu versetzen vermag. Ihr Gebiet beginnt im Schutzgebiet nördlich Grootfontein. Dort wie im ganzen Ovamboland stellt sie sich als eine im Freien häufig vorkommende Pflanze dar. Im übrigen, also im südlichen Schutzgebiete wird sie in den Gärten künstlich gehegt, und man findet sie selbst in den südlichsten Missionsgärten, so in Warmbad. Ihr Wert, auch als Nutzpflanze, ist bekannt; je nach der Art liefert sie Kokosmilch, Palmwein und Früchte, unter letzteren hauptsächlich die Dattel der bereits erwähnten Dattelpalme. Der einzige Nachteil der letzteren ist, daß sie erst innerhalb acht bis zehn Jahren erntereif wird. Um diese Zeit abzukürzen, wurden seitens des Gouvernements aus Algier bereits fünfjährige Wurzelsprößlinge bezogen, von denen die Zeit der Ernte um so viel früher zu erwarten war.
Nicht schließen kann ich diesen Abschnitt, ohne noch eines argen Feindes der südwestafrikanischen Bodenkultur Erwähnung zu tun, nämlich der Heuschrecken. Zufällig habe ich dieser Tage in einer größeren Tageszeitung[95] eine aus Argentinien stammende Schilderung dieser Plage gefunden, die auch auf Südwestafrika zugeschnitten ist. Ich will sie daher hier wörtlich folgen lassen:
»Eine Missionsschwester in Diamante hat an ihre Angehörigen in Wörishofen einen vom 9. Januar datierten Brief gerichtet, in dem sie einen Heuschreckeneinfall schildert. Sie berichtet so anschaulich, daß ein Teil des Briefes auch weitere Kreise interessieren wird. Der Brief beginnt: »Heute bin ich in der Lage, von einem Ereignisse zu berichten, das wir Entrerianer (d. h. die Bewohner der Provinz Entre Rios) in den letzten 14 Tagen erlebten. Es war am 2. Weihnachtstag, als wir, beim Mittagsmahl sitzend, plötzlich von draußen laute Rufe der Verwunderung, des Staunens und unangenehmer Überraschung hörten. Wir sahen uns erstaunt an, und mit der Frage: ‚Was soll das bedeuten?‛ sprangen wir von unseren Sitzen auf und eilten heraus in den Hof. Welch ein Anblick! Auf dem Boden war ein Gewimmel und ein Getue, ein Hüpfen und ein Springen von unzähligen,[S. 342] rotgelben, nicht unschönen Tierchen. Wieder fragte man sich: ‚Was ist das?‛ Andere, die dergleichen schon früher gesehen, kamen mit dem erschreckten Ausrufe: ‚Die unheilvollen Heuschrecken sind gekommen!‛
»Wir schauten nun nach der Straße, da bot sich den vor Staunen fast starren Blicken ein seltsames Schauspiel dar. Soweit das Auge reichte, sah es nichts anderes als Heuschrecken, so daß man unwillkürlich an die Heuschreckenplage im alten Ägypten dachte, von der die Bibel berichtet. Alle Straßen, Wege und Stege, kurz alles war wie dicht besät mit diesen unwillkommenen Gästen. In endlosen Reihen marschierten sie daher, ein Tier am andern, in schönster Ordnung, in Reih und Glied, so schön wie ein Heer Soldaten, das ins Feld zieht. Es war wirklich ein imposanter Anblick. Aber bald begannen diese Unberufenen ihr verderbenbringendes Geschäft. Mit einem wahren Heißhunger fielen sie über Gräser, Kräuter, Blumen, Sträucher, Bäume, kurz über die ganze Pflanzenwelt her. Hättet Ihr das doch sehen können! Man muß es angesehen haben, um es glauben zu können, was diese Tiere in ihrer Freßgier leisten können. Keine Zierstaude, keine Pflanze, keine Palme, kurz, kein Gewächs blieb verschont. Alles wurde eine Beute dieser gefräßigen Sechsfüßler. Und das sind noch erst die jungen, hüpfenden Heuschrecken, denen die Flügel noch ganz und gar fehlen. Die Orangen-, Feigen- und Pfirsichbäume wurden bis zuletzt gespart, d. h., die waren ihnen nicht zart genug, als aber nichts Besseres mehr vorhanden war, nahmen sie auch damit vorlieb.
»Wirklich interessant war es, zu beobachten, wie sie an den Pfirsichbäumen vorgingen. Erst wurden die Früchte aufgezehrt, obgleich sie noch ganz unreif waren, dann die Blätter, endlich die Rinde der Bäume. Wenn sie wenigstens diese noch verschont hätten, damit die Bäume doch nicht ganz abstürben, aber nein, alles wird von den Fressern abgenagt und abgeschält. Zum Erbarmen ist es auch, wie sie die Blumengärten so übel zurichten. Die herrlichen Gärten sind ihrer Pracht und Schönheit beraubt, kein Blumenbeet ist mehr kennbar, alles ist dem Erdboden gleichgemacht und verwüstet, und wo sonst Blumenkelche dufteten, da breitet sich jetzt ein übelriechender Dunst aus. Man könnte fragen, ob feindliche Horden hier ihr Unwesen getrieben haben, so entsetzlich sieht es aus. Die unliebsamen Besucher drangen sogar in die Häuser, Betten usw. ein. Tag und Nacht hatten wir keine Ruhe. Bevor wir uns schlafen legten, hatten wir jedesmal eine halbe Stunde zu tun, um die Betten zu säubern und die kleinen Unholde hinauszuwerfen.
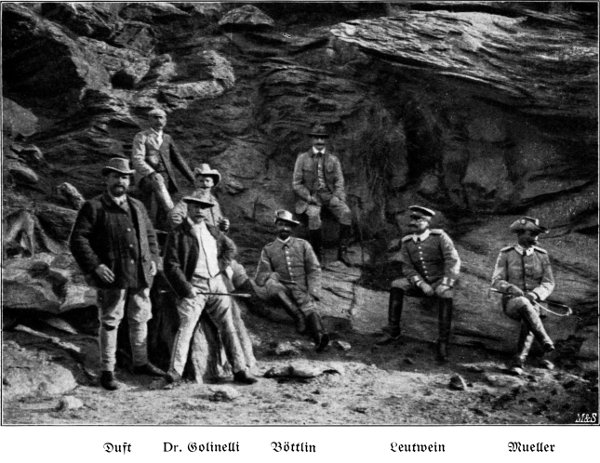
»Wenn das aber nun alles wäre! Aber nicht weniger unverschämt hausten die Heuschrecken draußen auf dem Kamp. Ein Kolonist sagte mir, es sei draußen auf den Feldern auch nicht ein grünes Blättchen mehr zu sehen. Die bedauernswerten Kolonisten! Soviel Mühe, Arbeit und Schweiß verloren! Es war dieses Jahr Aussicht auf eine reiche Maisernte. Nun ist alles, alles vernichtet! Der Schaden ist enorm und kaum abzuschätzen. Ihr werdet denken, man müsse dem so verderblichen Treiben der kleinen Fresser doch Einhalt tun können. Ja, gegen den Strom läßt sich nicht gut anschwimmen. In unserem Garten hatten wir zehn tiefe Gruben gemacht. Diese wurden zur Hälfte mit Wasser gefüllt, da hinein trieben wir die Tiere nun nach Tausenden, und doch konnte man nicht gewahren, daß ihre Masse sich verringert hätte. Den ganzen Tag waren wir auf der Jagd; die einen schlugen, andere traten sie tot, andere trieben sie in die Gruben, und so schafften wir fast acht Tage lang. Mehr als einmal mußte man davonlaufen und die Heuschrecken, die sich in den Kleidern verkrochen hatten, hervorsuchen; ich zählte einmal bei einer derartigen Jagd 30 Stück. Selbst die[S. 344] Haustiere halfen uns bei unserem Vernichtungswerke. Kälber, Kühe, Borstentiere, Vögel und Hühner hielten alle Tage, ja den ganzen Tag Festschmaus, selbst Hund und Katze taten sich gütlich an den fetten Bissen, aber gegen dieses Millionenheer konnten wir nichts ausrichten.
»Wie schon erwähnt, waren dies erst die jungen Heuschrecken, bald sollen nun die alten fliegenden nachkommen. Diese verzehren vollends auf den Bäumen, was etwa da und dort noch übrig geblieben, sie bleiben aber nur eine Nacht. Heute, da ich dies schreibe, also 14 Tage nach der Ankunft der Heuschrecken, hüpfen immer noch einige in unserem Garten herum, die übrigen sind teils vernichtet, teils glücklich abgeschoben. Ich erwähne noch, daß eine Heuschrecke achtzig Eier legt, daher die große Vermehrung. Sie sehen ganz anders aus als die grasgrünen in Deutschland. Die kleinen hier haben einen rötlich gelben Leib, der Kopf ist rot, die Beine braun mit schwarzen Pünktlein; die alten sind häßlich grau.««
Glücklicherweise erscheinen diese Schädlinge nicht jedes Jahr und nur in einzelnen Landstrichen, da sie ähnlich wie unsere Maikäfer bis zur Reife verschiedene bestimmte Zeitperioden in Anspruch nehmende Wandlungen durchzumachen haben.
Südwestafrika stellt sich als eine von der Küste ab stetig ansteigende Hochfläche von etwa 1200 m Durchschnittshöhe dar. Der Hauptort Windhuk liegt sogar auf 1600 m, mithin nahezu in der Höhe des Rigi in der Schweiz. Aus dieser Hochfläche erheben sich dann wieder zahlreiche vereinzelte Kuppen und Gebirge von meist tafelförmiger Gestaltung bis zu 2700 m Höhe, sonach bis in die Region des ewigen Schnees der Alpen. In seiner Hauptmasse liegt das Land zwischen dem 20. und 30. Breitengrade, durchschnitten von dem durch Rehoboth gehenden Wendekreis des Steinbocks. Das Schutzgebiet liegt mithin in derselben Entfernung vom Äquator wie die Wüste Sahara, und nur der Höhenlage verdanken wir es daher, wenn Südwestafrika nicht gleichfalls ein tropisches, den Europäern ungesundes Klima aufweist. Dafür haben wir dort mit gewaltigen Temperaturunterschieden zu rechnen. Innerhalb 24 Stunden kann der Thermometer einen Unterschied von 40 Grad ausweisen; nachts belästigt uns Kälte, bei Tage große Hitze. Die Jahreszeiten liegen genau umgekehrt wie in Deutschland. Die heißesten Monate fallen in Südwestafrika auf Dezember und Januar, die kältesten auf Juni[S. 345] und Juli. Diese klimatischen Verhältnisse drücken dem Schutzgebiet in bezug auf die Art der Bodenkultur ihren Stempel auf, und zwar im allgemeinen nicht im günstigen Sinne. Die kalten Nächte verbieten den Anbau von tropischen Pflanzen, deren Zucht in diesen Breitengraden sonst möglich sein würde, wie z. B. Kaffee, Kakao und Tee. Wir müssen uns daher dort auf die Zucht von Kulturpflanzen mit geringeren Wärmeansprüchen beschränken, wie Zitronen, Bananen, Orangen, Feigen, Mandeln, Datteln, Wein und Tabak. Dafür aber bietet Südwestafrika wieder die Möglichkeit des Anbaues auch von europäischen Nutzpflanzen, darunter unsere sämtlichen Getreidearten, sowie das wichtige Volksnahrungsmittel, die Kartoffel. Vor allem finden sich in dem dortigen Boden reichlich die Daseinsbedingungen für das, worauf schon die Wasserverhältnisse seine Bewohner hinweisen, nämlich Gras und Futterkräuter aller Art zur Ernährung gewaltiger Viehherden. Für die Bodenerträgnisse ist dagegen wieder die Verteilung des Regens auf die Jahreszeiten ungünstig. Es fallen warme Jahreszeit und Regen zusammen, und zwar in die Monate Januar bis April. Hat sich infolgedessen im Monat[S. 346] April die Natur mit allen nur denkbaren Reizen geschmückt, so ertötet die bald daraus einsetzende kalte Jahreszeit diese wieder. Bis zum nächsten Regenfall, d. i. in der Regel fünf Monate lang, zeigt sich dann das Schutzgebiet von einer weniger vorteilhaften Seite. An Stelle des frischen Grüns ist ein trauriges Graugelb getreten, zum Glück jedoch behalten die auf dem Halm verdorrten Futtergewächse wenigstens ihren Nährwert, hierbei unterstützt durch die während der Trockenzeit fallenden starken Tauniederschläge.
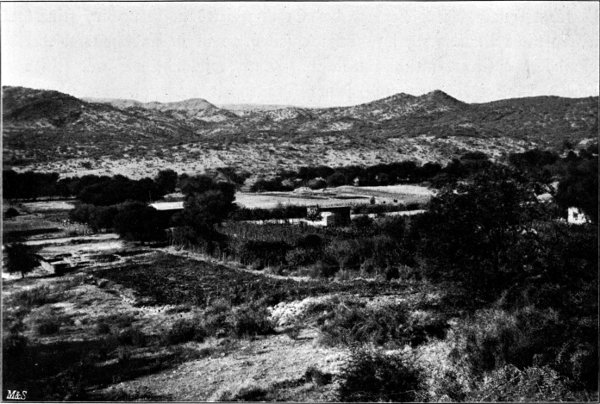
Hat sonach die Höhenlage des Schutzgebietes in bezug auf seine landwirtschaftliche Ausnutzung ihre Schattenseiten, so ist sie anderseits wieder der Gesundheit außerordentlich zuträglich. Ein Hochlandklima mit seinen erfrischend kühlen Nächten und seiner Trockenheit muß an sich schon dem Europäer zuträglicher sein als das feuchte Tieflandsklima in der gleichen geographischen Breite. Die gefürchtetste Tropenkrankheit, die Malaria, finden wir daher in Südwestafrika nur selten. Sie beschränkt sich auf wasserreiche, tiefer gelegene Stellen, wo indessen durch Entwässerungsarbeiten viel verbessert werden kann. So waren z. B. Gobabis und Grootfontein vor Zeiten ausgesprochene Fieberplätze. Beide wurden aus diesem Grunde, obwohl sie sonst viele Vorteile bieten, von den Eingeborenen gemieden. Nach der Besitzergreifung durch uns haben Kulturarbeiten an beiden Plätzen die gleichen Gesundheitsverhältnisse geschaffen wie in dem übrigen Schutzgebiet. Ähnlich liegt die Sache in Gibeon, wo früher eine sumpfige Quelle sowie die stagnierenden Wasser des Fischflusses den Fieberkeimen einen günstigen Herd boten. Wenn dagegen unter den zur Zeit in Südwestafrika im Feld stehenden Truppen eine nicht tropische Krankheit, der Typhus, zahlreiche Opfer fordert, so ist dies eine Erscheinung, die sich in jedem Kriege findet, also nicht mit der Beschaffenheit des Landes in Verbindung zu stehen braucht. Das schließt allerdings nicht aus, daß die genannte Krankheit gerade in Südwestafrika günstige Vorbedingungen findet, weil wir dort in bezug auf Trinkwasser vielfach auf stehende Tümpel angewiesen sind.[96]
Im übrigen kann in Südwestafrika der Weiße auch bei körperlicher Arbeit ohne Schaden für seine Gesundheit leben. Die große Reinheit und Trockenheit der Luft läßt die Hitze dort niemals so schwer empfinden wie selbst in Deutschland bei seinem größeren atmosphärischen Feuchtigkeitsgehalt. Für Personen mit kranken Atmungsorganen kann der Aufenthalt im süd[S. 347]westafrikanischen Klima geradezu als Kur betrachtet werden. Die Lebensbedingungen können dort genau so eingehalten werden wie in Europa, so daß sich der Einwanderer in seiner gewohnten Lebensweise keine besonderen Beschränkungen aufzuerlegen braucht. Nur in einem Punkte zeigt sich die dünne Höhenluft dem menschlichen Körper auf die Dauer nicht immer zuträglich: in bezug auf die Herztätigkeit. Wer hierin von schwacher Konstitution ist, dem kann nur geraten werden, Südwestafrika zu meiden. Sogar in Zeiten tiefsten Friedens pflegt von den Angehörigen der Schutztruppe ein ganz erheblicher Prozentsatz nach abgelaufener Dienstzeit mit mehr oder minder gestörter Herztätigkeit auszuscheiden und zum Teil invalidisiert zu werden. Hier ist mithin die Grenze gegeben, innerhalb welcher der Einwanderer sich in bezug auf seine Lebensgewohnheiten vielleicht Beschränkungen auferlegen muß, nämlich, je nach der körperlichen Veranlagung, teilweise oder völlige Vermeidung derjenigen Genußmittel, die auf die Herztätigkeit einwirken, wie Tabak, Kaffee, Tee und Alkohol.

Unter den in Südwestafrika vorhandenen Nutztieren unterscheiden wir folgende Arten: 1. Pferde und Esel, 2. Rindvieh, 3. Fleischschafe, 4. Wollschafe, 5. gewöhnliche Ziegen, 6. Strauße.
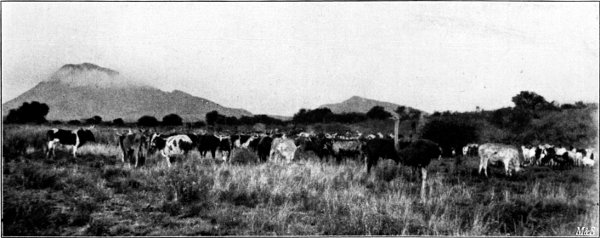
Diese Arten sind entweder seitens der einwandernden Europäer bereits vorgefunden oder schon vor langer Zeit eingeführt worden. Zu ihnen traten noch unter der deutschen Herrschaft: 7. Schweine, 8. sonstige Zuchten, wie Geflügel usw.
Auf dem Gebiet der Viehzucht ist für Südwestafrika nur Erfreuliches zu berichten. Denn ihm stehen alle erforderlichen Vorbedingungen für eine Viehzucht ersten Ranges zur Seite. Erstens gestattet das gleichmäßige Klima mit einem Winter ohne Schnee- und Regenfall für das ganze Jahr freien Weidegang. Zweitens bewirkt die Verbindung des Regenfalls gerade mit dem Sommer, welchen Umstand wir für Acker- und Gartenbau als nachteilig erkannt haben, für die Viehzucht das Gegenteil. Sie wird zur Ursache, daß gerade in den heißesten Monaten das Wasser am reichlichsten vorhanden ist und daß die Futterpflanzen schnell zur Reife kommen. Das Vieh erreicht daher während der heißen Zeit einen besonders guten Futterzustand und vermag dann auch die futterärmere Winterszeit mit kalten, dafür aber regenlosen Nächten bei freiem Weidegang zu überdauern. Eine Verbindung des Regens mit den kalten Nächten würde dagegen Stallpflege notwendig und damit eine Viehzucht im großen unmöglich machen, denn diese würde dann zu kostspielig werden.
[S. 349] Die dritte und wesentlichste Vorbedingung für ein Gedeihen des Viehes ist der hohe Nährwert des Grases und der sonstigen Futterpflanzen Südwestafrikas. Der in das Land gekommene Neuling wird das schwer glauben, wenn er die dortigen, oft recht unscheinbar aussehenden Weidefelder mit ihrem struppigen Buschwerk und spärlichen Grasarten sieht. Selten vermag er sich an dem Anblick hoher, wogender Grasfelder zu erfreuen, und gerade diese bilden die schlechtesten Weidegründe. Ihr Gras wird bald hart und holzig, ist wenig nahrhaft und schwer verdaulich. Ein alter Afrikaner sieht daher nicht auf die äußere Beschaffenheit des Weidefeldes. Das beste Futter ist das niedere, büschelförmig wachsende Gras, das einen hohen Nährwert besitzt und stets weich bleibt. Der Kenner weiß daher auch eine Buschlandschaft mit dünn verstreuten Grasbüscheln zu schätzen. Vor allem aber ist das Land infolge seines salzhaltigen Bodens reich an dem ganz unscheinbar aussehenden Brackbusch, und ohne diesen kann das Vieh auch bei dem üppigsten Graswuchse nicht gedeihen.

Die Möglichkeit freien Weideganges für das Vieh das ganze Jahr hindurch ist die Grundlage für eine billige Viehwirtschaft. Einige Eingeborene zur Aufsicht und einige Einzäunungen in Gestalt von Dornbuschkraalen, für die das Material überall vorhanden ist, sind die ganzen Unterhaltungskosten. Im übrigen nährt und vermehrt sich das Vieh von selbst. Der Viehzüchter muß, um Inzucht zu vermeiden, nur für rechtzeitigen Wechsel der männlichen Zuchttiere sorgen. Würden nicht die im Kapitel IV[S. 350] geschilderten Viehkrankheiten von Zeit zu Zeit böse Lücken in die Herden reißen, so wäre die Viehzucht Südwestafrikas vielleicht das rentabelste Geschäft auf dieser Erde.
Als Beweis für diese Behauptung mögen die gewaltigen Viehherden dienen, welche die Hereros vor Aufrichtung der deutschen Schutzherrschaft besessen haben. Ich schätzte deren Gesamtbestand zur Zeit meines Eintreffens im Schutzgebiet (1894) auf 500000 Stück. Viel Genuß hatten die Hereros von diesem Reichtum indessen nicht. Denn der Besitz großer Viehherden war für sie Endzweck und nicht ein Mittel, mit dessen Hilfe sie sich etwa das Leben angenehm zu gestalten versucht hätten. Nur einen verschwindend geringen Prozentsatz ihres Viehbestandes setzten sie im Handel um. Fast ebensowenig schlachteten sie davon. Der größte Teil des Viehs ging daher nach mehrjährigem zwecklosen Dasein an Altersschwäche zugrunde. Bis zum Ausbruch der Rinderpest habe ich damals diese Entwicklung der Dinge mit großer Sorge betrachtet und häufig mit den Hererohäuptlingen besprochen. Denn bei einer derart unzweckmäßigen Viehwirtschaft mußte dereinst sicher der Zeitpunkt kommen, an welchem die in das Ungemessene angewachsenen Rinderherden der Hereros ihre Herren zum Suchen nach neuen Weideplätzen zwangen. Wie schwer es überhaupt damals schon war, das Volk hinter seinen Grenzen zurückzuhalten, ist im Kapitel II geschildert. Auch den Gefahren einer fortgesetzten Inzucht standen die Hereros gleichgültig gegenüber und ließen ihr Vieh ruhig degenerieren. Erst die dem Schutzgebiet sonst so schädlich gewesene Rinderpest hat die Herden und mit ihnen die Viehwirtschaft der Hereros auf ein vernünftiges Maß zurückgeführt sowie deren Indolenz in bezug auf die Sorge um den Nachwuchs etwas aufgerüttelt.
Was die Art der Viehzucht anlangt, eignet sich auf Grund der Futterverhältnisse das Namaland mehr für die Zucht von Kleinvieh, das Hereroland für die von Großvieh. Die zahlreichen Dornbüsche des Hererolandes schließen die Zucht von Wollschafen überhaupt aus. Indessen weist im Namalande auch die Großviehzucht hinsichtlich der Güte die besseren Ergebnisse auf, und das Namarind übertrifft das Hererorind an Größe wie an Fleischgehalt. Die Ursache dieser Erscheinung liegt nicht nur in den verschiedenartigen Futterverhältnissen — die Namaweide ist spärlicher, dafür aber um so nahrhafter —, sondern auch in der bereits geschilderten Indolenz der Hereros gegen die Inzucht. Nicht als ob die Hottentotten verständigere Viehzüchter wären, das Verdienst für das bessere Namarind gebührt vielmehr den frühzeitig aus der Kapkolonie dort eingewanderten Weißen.
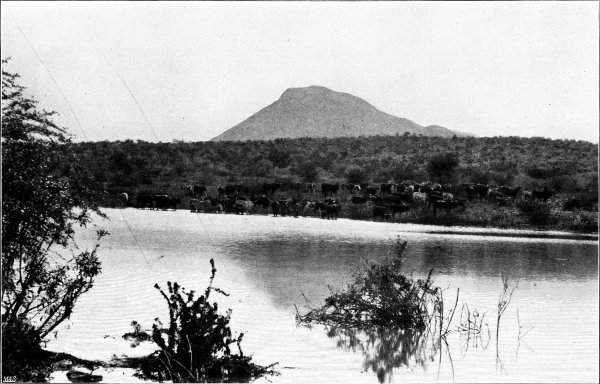

Um nunmehr auf die Zucht der einzelnen Tiergattungen überzugehen, so beginne ich mit
1. dem Pferd. Bis vor dem Aufstand krankte die Pferdezucht in Südwestafrika an der noch nicht durchgeführten Trennung der Gebrauchspferde von den Zuchtpferden. Man ließ durchweg die Hengste treiben, was sie wollten, und ritt die trächtigen Stuten ohne jede Rücksicht. Das eine ergab einen schlechten Nachwuchs infolge der oft unglaublichen Kreaturen von Hengsten[97], die frei umherliefen, das andere ein häufiges Verfohlen. Verschiedene Male wurden seitens des Gouvernements Maßnahmen hiergegen in Anregung gebracht.[98] Aber ohne Unterstützung seitens der gesamten Bevölkerung schweben Regierungsmaßnahmen auf diesem Gebiete in der Luft, und an ihr fehlte es noch zum Teil. Daher beschränkte sich die Verwaltung vorerst auf Maßnahmen innerhalb ihres eigenen Bereiches. Sämtliche im Regierungsbesitz befindlichen Hengste wurden, soweit sie nicht zu Zuchtzwecken brauchbar waren, verschnitten, die Stuten tunlichst vom Gebrauch aus[S. 354]geschlossen, die besten derselben als Zuchtstuten verwendet, die übrigen gegen Wallache umgetauscht und endlich in Nauchas (Distrikt Rehoboth) ein Gestütsdepot eingerichtet. Dieses wurde mit den besten Stuten sowie den besten inländischen und auch mit von außerhalb eingeführten Deckhengsten ausgestattet. Von dem Nachwuchs wurde das geeignetste Material wieder der Zucht zugeführt, das übrige in den Regierungsdienst eingestellt oder verkauft. Sobald mehr als ausreichende Landbeschäler vorhanden waren, wurden diese auch zu Zuchtzwecken nach außerhalb abgegeben, eine Gelegenheit, von der im Jahre 1902/03 46 einsichtige Pferdezüchter Gebrauch gemacht haben. Die von außerhalb eingeführten Hengste waren sowohl englischer wie auch ostpreußischer Herkunft. Aber nicht deren direkter Nachwuchs hat sich für den Gebrauch in Südwestafrika schon als besonders geeignet erwiesen, sondern erst dessen nochmalige Vermischung mit inländischem Zuchtmaterial, mithin erst die Enkel der eingeführten Hengste.
Bei dieser Gelegenheit sei auch erwähnt, daß von den während des gegenwärtigen Aufstandes von außerhalb eingeführten Pferdearten sich am besten die aus der Kapkolonie bewährt haben, dann folgten die Argentinier und zuletzt die Ostpreußen. Die Ursache dieser Abstufung ergab sich jedoch nicht aus der Beschaffenheit der Pferde, sondern lediglich aus deren Anpassungsvermögen an die südwestafrikanischen Verhältnisse. Die beiden erstgenannten Pferdearten sind unter denselben Lebensbedingungen groß geworden wie die Südwestafrikaner, während die Ostpreußen sich an das afrikanische Gras als einzige Nahrung nur schwer zu gewöhnen vermochten und daher anfangs, oft mitten im Futter stehend, Hungers starben. Denn Hafer läßt sich bei den schwierigen südwestafrikanischen Transportverhältnissen im Kriege nur in beschränktem Maße nachführen. Ob nach meiner Abreise aus dem Schutzgebiet noch andere Rassen eingeführt worden sind, z. B. die wohl gleichfalls für südwestafrikanische Verhältnisse geeigneten Pferde Australiens und Mexicos, ist mir nicht bekannt geworden.
Leiter der Gestütsverwaltung war zuletzt Gestütsdirektor v. Clavé, der seine Aufgabe mit Tatkraft und Sachkenntnis angefaßt hat. Er richtete neben dem Hauptgestüt noch ein Pferdedepot in Areb, etwa eine Stunde von Nauchas, ein, wohin aus ersterem die von der Mutter entwöhnten Fohlen gebracht und bis zur Gebrauchsfähigkeit gehalten wurden. Der Bestand der gesamten Gestütsverwaltung an Pferden betrug am 31. März 1903: 11 Landbeschäler, 188 Zuchtpferde und Saugfohlen in Nauchas, 160 Pferde in Areb.
Im Berichtsjahre 1902/03 hat das Gestütsdepot Areb 72 Pferde nach erreichter Reife abgegeben, davon 11 zu Zuchtzwecken an das Hauptgestüt in Nauchas zurück.
Die Pferdezucht ist in Südwestafrika wie eigentlich überall diejenige Züchterei, die das meiste Anlagekapital erfordert. Sie ist mithin Ansiedlern mit nur beschränkten Mitteln nicht zu empfehlen, wenigstens für den Anfang nicht. Vor dem gegenwärtigen Aufstand schwankte der Preis eines Pferdes zwischen 300 und 600 Mark. Wie er sich nach Wiederbeginn des Farmbetriebes gestalten wird, läßt sich nicht übersehen. Auch die Pferde haben in Südwestafrika freien Weidegang. Unmittelbar nach ihrer Erwerbung muß man daher mit dem Zurücklaufen auf die alten Weideplätze rechnen. Um so hartnäckiger bleiben sie aber auch wieder an dem neuen Platz kleben, sobald sie sich einmal an ihn gewöhnt haben. In bezug auf Weide ist das Pferd das wählerischste von allen unseren Tieren. Daher eignet sich auch nicht jede Farm schon von Hause aus zur Pferdezucht. Das an den Bergabhängen wachsende kurze, weiche Gras wird von den Pferden am meisten bevorzugt. Den Brackbusch brauchen sie ebenfalls, wenn auch weniger als das sonstige Großvieh.
Der schlimmste Feind der Pferdezucht ist die bereits im Kapitel IV erwähnte Pferdesterbe. Auf sie kann man beinahe den bekannten Vers anwenden: »Gegen die Cholera gibt's kein Mittel«; indessen braucht man, wie in dem genannten Kapitel schon angedeutet, noch nicht alle Hoffnung aufzugeben. Örtlich findet sich die Pferdesterbe fast durchweg mit der Malaria vereinigt. Wo die letztere herrscht, haben wir auch mit der Sterbe zu rechnen, wie diese denn auch genau wie die Malaria vom Süden nach dem Norden des Schutzgebietes an Heftigkeit zunimmt. Das Namaland wird von ihr am wenigsten heimgesucht, das Ovamboland dagegen derart, daß dort eine berittene Truppe stets in der Gefahr schwebt, plötzlich wieder Fußtruppe zu werden. Schon im Distrikt Grootfontein verursachte die Erhaltung des Pferdebestandes dem Gouvernement viel Sorge. Im Innern des Landes verschont die Seuche nur hochgelegene Punkte, den tiefgelegenen Küstenstrich läßt sie sogar ganz in Ruhe. Je näher der Küste, um so sicherer ist daher ein Platz gegen Sterbe. In beiden Fällen dürfte die kältere Luftströmung, die den Stechfliegen, den Hauptträgern der Seuche, das Dasein unterbindet, die Ursache der Verschonung sein. Auch von diesem Gesichtspunkte aus muß daher der Einwanderer, der sich der Pferdezucht widmen will, die Lage seiner künftigen Farm beurteilen. Ich wiederhole indessen,[S. 356] daß von einer rationellen Pferdezucht im Schutzgebiet erst nach Einführung einer sogenannten Körordnung, die das freie Umherlaufen der Hengste verbietet, die Rede sein kann. Einzäunungen der Farmen würde ja gleichfalls gegen unliebsame Besuche schützen, sie ist jedoch, vorläufig wenigstens, viel zu kostspielig.
Eine Abart der Pferdezucht ist die Maultierzucht. Das Maultier ist leistungsfähiger als das Pferd, auch genügsamer als dieses, und vor allem der Pferdesterbe nicht so unterworfen. Sein größerer Wert kommt auch in der Tatsache zum Ausdruck, daß es durchschnittlich höher bezahlt wird. Seine Zucht ist daher besonders lohnend, obwohl das Tier selbst nicht fortpflanzungsfähig ist. Gewonnen wird das Maultier bekanntlich aus der Kreuzung von Eselhengsten mit Stuten. Daher ist auf diesem Gebiet das freie Umherlaufen der Hengste besonders gefährlich. Denn der schwächere Esel vermag seinen »Harem« nicht gegen die eindringenden Hengste zu verteidigen, und der Züchter sieht sich nach abgelaufener Tragezeit zu seiner Überraschung statt im Besitze eines wertvollen Maultierfohlens in dem eines mehr oder weniger schlechten Pferdefohlens. Wenn schwerwiegende Mißstände auf diesem Gebiete bis jetzt noch nicht allzusehr zutage getreten sind, so liegt das am Fehlen einer eigentlichen Maultierzucht. Die Maultiere sind bis jetzt meist von außerhalb eingeführt worden, und zwar aus der Kapkolonie, aus Argentinien wie aus Spanien. Als am wenigsten geeignet haben sich die Argentinier erwiesen, da ihre Hufe auf den weiten Grasflächen der Heimat für unser zum Teil steiniges Gelände zu weich geblieben sind.
Namentlich die Truppe macht von den Maultieren viel Gebrauch. Die ganze Artillerie, zahlreiche Kolonnen sowie einzelne Truppenfahrzeuge sind mit ihnen bespannt. Vor dem Aufstand war der Preis eines Maultieres 600 bis 800 Mark. Der reine Esel dagegen findet im Schutzgebiet, weil zu schwach, wenig Verwendung.
2. Rindvieh. Das Rindvieh wurde von den ersten europäischen Einwanderern, den Portugiesen, am Kap der guten Hoffnung bereits vorgefunden. Das südwestafrikanische Rind ist durchweg von größerer, massigerer Figur als das europäische, namentlich gilt dies von demjenigen des Namalandes. Auch sein Hörnerschmuck überragt an Länge den des europäischen Rindes und läßt allein schon das afrikanische Tier als das stattlichere erscheinen. Nur in einer Beziehung wird das afrikanische Rind von dem europäischen übertroffen, nämlich in Hinsicht auf den Milchertrag. Die Ursache hiervon[S. 357] mag in den anders gearteten Lebensbedingungen, vor allem in dem freien Weidegang liegen. Sonst gedeiht auch das Rind bei diesem am besten. Die Tiere wissen von selbst am Tage das beste Futter zu finden und kommen abends wieder zur Tränke.
Bei dem Rind ist die Gefahr, daß durch fremde Bullen die Nachzucht verdorben wird, nicht dieselbe wie bei der Pferdezucht. Der eigene Vorteil schon gebietet dem Züchter das frühzeitige Verschneiden nicht zur Zucht bestimmter Bullen, da das verschnittene Tier, der Ochse, sowohl ein besseres Zug- wie Schlachttier abgibt. Im übrigen ist auch auf diesem Gebiete die Regierung zur Einfuhr fremder Bullen geschritten und hat es mit folgenden Rassen versucht:
a) Simmentaler Bullen. Diese haben sich gut akklimatisiert und als Nachwuchs besonders gute Zugtiere geliefert.
b) Pinzgauer Bullen. Von diesen ist ähnliches zu berichten. Doch eignet sich ihr Nachwuchs vermöge des großen Fleischgehaltes besser zum Schlachten.
c) Vogelsberger Bullen. Diese haben zwar noch besseres Schlachtvieh ergeben als die heimischen Rassen, doch blieb ihr Nachwuchs hinter dem der auch nicht höher im Preise stehenden Pinzgauer so weit zurück, daß in der Folge von ihrer Einführung Abstand genommen worden ist.
d) Englische Rassen. Unbeschadet der Tatsache, daß auf der Ausstellung in Windhuk 1902 ein Abkömmling eines Shorthorn-Bullen prämiert worden ist, sind doch im allgemeinen die Erfahrungen mit diesen Bullen (Shorthorns und Herefords) in Südwestafrika sonst derartig ausgefallen, daß nach den ersten Versuchen keine weiteren mehr unternommen wurden, denn das Ergebnis hatte die Kosten nicht gelohnt.
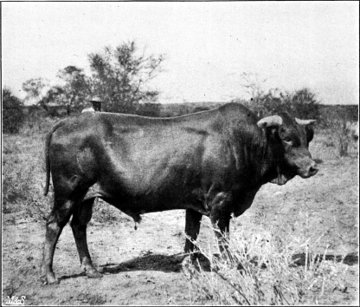
Von privater Seite wurden auch noch holsteiner und oldenburger Bullen eingeführt, die aber, weil in ausgesprochenem Niederungslande[S. 358] aufgewachsen, in dem südwestafrikanischen Höhenklima nicht recht zu gedeihen vermochten. Etwas besser sollen sich die gleichfalls privatim eingeführten Holländerrassen angewöhnt haben, doch sind die Versuche mit ihnen noch nicht abgeschlossen.
Eine eigene Zucht hat das Gouvernement auf diesem Gebiete als überflüssig erachtet, vielmehr die eingeführten Bullen gegen geringe Entschädigung an Private abgegeben sowie die Viehzüchter bei der Einfuhr von solchen unterstützt. Auch mit der Einfuhr weiblicher Zuchttiere wurde einmal ein Versuch gemacht, indessen als zu kostspielig nicht wiederholt. Der Preis einer Pinzgauer Kuh stellte sich 1899 in Windhuk auf 700 Mark gegen damals 150 Mark für eine gute einheimische Kuh. Und eine teurere ausländische Kuh vermag auch nicht mehr Kälber in die Welt zu setzen als eine einheimische, während der eingeführte Bulle naturgemäß einen weit bedeutenderen Einfluß auf die Verbesserung der Rasse auszuüben vermag, als die Kuh. Erwähnenswert ist noch, daß auf der landwirtschaftlichen Ausstellung in Windhuk 1902 von 18 zur Verteilung gelangten Preisen die Simmentaler Kreuzungsprodukte 10 erhalten haben.
Ich habe bereits auf das hierzulande übliche Sprichwort hingewiesen, daß »das Auge des Herrn die Rinder fett mache«. Im Anschluß daran kann ich nur davor warnen, in Südwestafrika Geld in Viehzuchtunternehmungen anzulegen, um diese dann aus der Ferne zu überwachen. Die Begriffe der Eingeborenen über Mein und Dein sind durchaus kindliche. Sie betrachten die Milch der Herden ihres Herrn als ihr Eigentum und schlachten, wo diese versagt, ruhig auch einzelne Tiere, die dann nach ihrer Angabe an allen möglichen Krankheiten zugrunde gegangen oder den Raubtieren zum Opfer gefallen sind. Ist es dagegen gelungen, für solche Viehzuchtunternehmungen einen ganz besonders tüchtigen Leiter zu finden, so können die zu befürchtenden Unzuträglichkeiten wohl vermindert werden, aber auch bei den ausgezeichnetsten Charakteranlagen eines solchen Leiters sowie bei dessen bestem Willen entspricht es nur der menschlichen Natur, wenn auch er nicht immer die gleiche unermüdliche Tätigkeit an den Tag legt, wie der wirkliche Besitzer und wie sie die Viehwirtschaft verlangt. Unermüdlich und, wenn es nötig ist, 24 Stunden im Sattel muß in Südwestafrika der Viehzüchter sein, so daß das eingeborene Aufsichtspersonal niemals vor ihm sicher ist. Auch in bezug auf den Nachwuchs findet der Eingeborene nichts dabei, wenn einmal seine eigene Kuh zwei Kälber im Jahre zur Welt bringt, diejenige seines Herrn dafür aber keine. Indessen wollen wir Weißen uns deshalb doch nicht besser machen,[S. 359] als wir sind: Ein europäischer Gutsbesitzer, der seinen Wirtschaftsbetrieb lediglich von der Ferne überwacht, wird bei seinem weißen Aufsichtspersonal auch nicht immer von unliebsamen Erfahrungen verschont bleiben. Diese Verhältnisse waren es, die neben dem Bestreben, dem viehzüchtenden Ansiedler keine Konkurrenz zu machen, das Gouvernement bewogen haben, schließlich von jeder amtlichen Viehwirtschaft abzusehen. Auch den einzelnen Offizieren und Beamten ward eine solche verboten, um sie nicht von ihren dienstlichen Aufgaben abzulenken. Nur in besonderen Fällen wurden Ausnahmen gestattet.

Eines ferneren Übelstandes, der zur Zeit mit der südwestafrikanischen Viehwirtschaft verbunden ist, will ich noch Erwähnung tun. Dem Reisenden fällt es dort auf, daß während des größten Teiles des Jahres in der Nähe bewohnter Wasserstellen die Weide fehlt, während einige Kilometer weiter wieder die schönsten Weidegründe zu finden sind. Die Ursache dieser Erscheinung liegt in dem alljährlichen Beginn des Weideganges nach der erfolgten Erneuerung der Weide von der Wasserstelle aus, statt umgekehrt von außerhalb auf die Wasserstelle zu. Hierdurch wird einerseits der Reise[S. 360]verkehr gestört, und zwar umsomehr, je bevölkerter das Land wird, anderseits die Weide an den Wasserstellen derart abgenutzt, daß sie sich schließlich überhaupt nicht mehr zu erneuern vermag. Die Viehbesitzer haben sich dann selbst geschädigt, indem sie in der trockenen Jahreszeit auch das wenige für den eigenen täglichen Gebrauch erforderliche Vieh weit ab auf die Weide schicken müssen. Die sämtlichen größeren Wohnplätze Südwestafrikas besitzen dicht vor ihren Toren selten noch Weide, wenn auch da und dort ein Bezirksamtmann versucht hat, durch eine Verordnung Abhilfe zu schaffen.
Der in der Nähe größerer Plätze wohnende Viehzüchter findet für seine Produkte stets lohnenden Absatz. Das Liter Milch galt vor dem Aufstand in Windhuk 0,40 bis 0,50 Mark, ein Pfund Butter 2,50 Mark, bei der billigen Art der Viehwirtschaft ganz zufriedenstellende Preise. Auch Käse fand reichlich Abnahme, das Stück, etwa so groß wie ein Harzer Handkäse, zu 0,25 Mark.
Über die Krankheiten des Rindviehs, wie Rinderpest, Texasfieber und Lungenseuche, ist bereits im Kapitel IV gesprochen worden.
3. Fleischschafe. Hier ist in erster Linie das Fettschwanzschaf zu nennen, das eigentliche Heimatschaf Südwestafrikas. Es besitzt nur eine geringe Wolle, dafür aber vorzügliches und reichliches Fleisch. Das besonders Wertvolle an diesem Tiere ist der Fettschwanz, der enthäutet etwa zehn Pfund wiegt und Fett von der Art des Gänseschmalzes liefert. Die äußerste Spitze des Schwanzes ergibt sogar ein vorzügliches, zum Einfetten geeignetes Öl. Wo die Großviehzucht ausreichend Butter liefert, wird der Wert dieses Fettschwanzes nicht genug gewürdigt, dagegen gibt er einen guten Ersatz, wo die Butter fehlt. Bei gutem Ernährungszustand der Tiere nimmt in erster Linie der Fettschwanz an Gewicht zu, andernfalls ebenso wieder ab. Das Fettschwanzschaf liebt Gras mit zahlreichen lange saftig bleibenden Büschen, unter diesen wieder den Brackbusch in erster Linie. Auf 100 weibliche Tiere rechnet man drei Böcke. Durch Kreuzung mit Merinoschafen hat man versucht, das Fettschwanzschaf auch für die Wollproduktion nutzbar zu machen; wie viele Generationen jedoch nötig sind, um die erste Schur zu erzielen, ist noch nicht ausreichend erprobt worden.[99]
Feinde der Fettschwanzschafe sind nach Farmer Hermann-Nomtsas die sogenannte Kremmsikte sowie die Gell- und die Blutsikte. Deren Natur wie[S. 361] Art der Heilung sind noch unbekannt. Der Preis für ein Fettschwanzschaf betrug vor dem Aufstande 12 Mark.
4. Wollschafe. Zu diesen gehört in erster Linie das Merinoschaf, indirekt aber kann man in zweiter Linie auch die Angoraziege dazu rechnen. Beide Rassen erfordern etwa dieselben Lebensbedingungen wie das Fleischschaf. Sie verursachen jedoch dem Züchter etwas mehr Mühe, da er neben dem Fleisch auch auf die Erzielung einer guten Wolle zu sehen hat. In diesem Umstand wird wohl der Grund liegen, daß die Wollschafzucht im Schutzgebiete noch nicht derart eingebürgert ist, als dies wünschenswert und auch möglich sein würde. So ziemlich der einzige, dafür aber auch ein ausgezeichneter Züchter von Merinoschafen war der schon mehrfach genannte Farmer Hermann-Nomtsas, der alljährlich für einige tausend Mark Wolle ausgeführt hat. Erst in neuerer Zeit ist mit Hilfe von Mitteln der Wohlfahrtslotterie ein zweites Wollschafzuchtunternehmen ins Leben gerufen worden, die Deutsch-Südwestafrikanische Schäfereigesellschaft in Gibeon. Leider ist das Unternehmen bereits in seinen Anfängen dem Aufstande zum Opfer gefallen.
Dort, wo der Dornbusch vorherrscht, können natürlich Wollschafe nicht gezüchtet werden, da die Wolle an den Dornen hängen bleibt, und dies ist so ziemlich im ganzen Hererolande der Fall. Dafür aber ist der Süden des Schutzgebietes für die Wollschafzucht ebenso geeignet wie das in bezug auf Wollproduktion zur Zeit ergiebigste Land der Welt, nämlich Australien. Letzteres liefert allein mehr als ein Viertel des gesamten Weltbedarfs, und was dort geleistet werden kann, können wir auch. Aus den vor etwa zwei Jahren veröffentlichten[100] »Australischen Skizzen« von Stefan v. Kotze ist zu ersehen, daß Australien mit denselben meteorologischen Bedingungen zu rechnen hat wie Deutsch-Südwestafrika. Unter anderem habe ich dort folgende Ausführungen gefunden:
»Es ist eins der meteorologischen Wunder in diesem Lande größter klimatischer Gegensätze, wie plötzlich die gewaltigen durstigen Flußadern sich mit dem wogenden Schwall füllen. Weit oben in den Bergen ist vielleicht ein schwerer Wolkenbruch gefallen und wie eine solide Mauer stürzt das Wasser dem Tale zu. Frachtwagen, die für die Nacht im Bette an einem Wasserloch ausgespannt haben (denn der Himmel war blau und die Dürre[S. 362] herrschte ringsumher), wurden in wenigen Stunden einige hundert Meilen weiterexpediert, Häuser fortgerissen, Vieh und Menschen überrascht und von den heimtückischen Wassern im Schlafe ermordet.[101] Es gibt nur äußerste Gegensätze — Darben oder Überfülle. Man verdurstet oder man ertrinkt.
»Im Zentrum Australiens gibt es große Flüsse, die überhaupt keine Mündung haben, die sich in der Wüste verlieren, so ganz beiläufig, wie so viele Existenzen dort. Und die Zukunft des Kontinents gründet sich auf eins: die Wasserkonservierung. Jeder Regen, der fällt, wird sofort in das Meer abgeführt oder sickert in totem Sande ein. Und mit Ausnahme der schmalen östlichen Küstenregion heißt das ganze Vaterunser jedes Australiers: Wasser!
»Abgesehen von einigen Strömen im Südosten, bilden die Flüsse zur Sommerszeit nur eine Kette von Wasserlöchern, die immer mehr zusammenschrumpfen, bis schließlich die Fische darin mit den Händen gefangen werden können. Unter dem Sande ist gewöhnlich durch Graben auch noch Wasser zu finden; aber es ist nicht leicht, mit einem blechernen Trinkbecher ein 15 Fuß tiefes Loch in den Sand zu machen.«
Ferner:
»Weihnachten war vorüber, und nun fragte es sich, wird die Regenzeit kommen oder nicht. Jedoch dieses Jahr kam sie, vielleicht aus Zerstreutheit und siehe da, wie auf Zauberwort veränderte sich das Land umher. Die nackten Sanddünen, denen man nie einen Keim zugetraut, die öden, von der Hitze gespaltenen Ebenen und die grimmig toten Granithügel kleideten sich in das Gewand des Frühlings — nein, des Sommers. Frühling gibt es so wenig wie eine Dämmerung in dem Innern Australiens. Bald stand das Vieh bis über den Rücken in Gras und kräftigen Kräutern, und ein feuchtwarmer Brodem der Befruchtung zog über die Weite. Überall Blumen und junge Blätter, Zufriedenheit und Fülle. Wer hätte geglaubt, angesichts dieser wogenden Gefilde, daß hier noch vor kaum vierzehn Tagen eine lechzende Wüste das Blut aus allen Lebewesen zog.«
Über diese Schilderung dürfte man nur »Aus Deutsch-Südwestafrika« setzen und brauchte sonst nichts zu ändern. —
Die Angoraziege gehört nicht zur Rasse der Schafe, sondern zu derjenigen der Ziegen. Sie liefert jedoch eine feinere Wolle, das sogenannte[S. 363] Mohair. Ihr Hauptzuchtgebiet ist Kleinasien. Da sie ausschließlich auf hohem trockenen Gelände mit mäßigem Klima fortkommen kann, so findet sie auch in Südwestafrika die besten Vorbedingungen für ihr Gedeihen. Mit der gewöhnlichen Ziege läßt sie sich wohl kreuzen. Nach Ansicht des Farmers Hermann-Nomtsas bedarf es jedoch nicht weniger als 8 bis 9 Generationen (etwa 12 Jahre), bis das Kreuzungsprodukt ein befriedigendes Ergebnis zeigt. Im übrigen scheint zwischen dem Nutzen, den das Wollschaf bringt, und demjenigen der Angoraziege kein bedeutender Unterschied zu bestehen. Das erstere liefert zwar eine minderwertige Wolle, dafür aber eine um so größere Menge. Herr Hermann rechnet für das Merinoschaf bei guter Zucht auf je 6 Pfund Wolle, auf jede Angoraziege 3 Pfund Mohair. Wenn als Preise für die erstere 0,50 Mark, für das letztere 1 Mark pro Pfund angenommen wird, so würde der Jahresertrag in bar genau der gleiche sein. Dagegen würde noch ein Unterschied in den Transportkosten bleiben, da auf dem Weltmarkt mit dem Mohair stets nur das doppelte Quantum Wolle konkurrieren kann. Den hieraus sich ergebenden Unterschied berechnet Herr Hermann auf 0,94 Mark zugunsten einer jeden Angoraziege.
Vor dem Aufstand betrug der Preis eines Merinoschafes 30 bis 40 Mark, derjenige einer Angoraziege bis 100 Mark, für einen Rammen wurden sogar bis 400 Mark bezahlt.

Behufs Hebung der Reinzucht hat 1902 das Gouvernement 181 Angoraziegen und 3 Ramme, im Jahre 1903 234 Ziegen und 6 Ramme eingeführt und an die Farmer käuflich abgelassen. Bei den hohen Preisen der Tiere wurden auch Herden zu 40 bis 50 Stück auf drei Jahre leihweise abgegeben und den Entleihern lediglich die Verpflichtung zur Reinzucht sowie zur[S. 364] späteren Rückgabe der gleichen Anzahl Ziegen aus dem Nachwuchs auferlegt. Mit dem Überschuß konnte der Farmer dann weiterarbeiten, während die zurückgegebene verjüngte Herde an einen andern Züchter weiterging. Im ganzen hat die Angorazucht im Schutzgebiete mehr Anklang gefunden als die Wollschafzucht.
5. Gewöhnliche Ziege. Ein bescheidenes, dafür aber um so nützlicheres Tier tritt uns in der Ziege entgegen. Es ist erstaunlich, auf wie elendem Weidefelde, das dem Beschauer nicht das geringste Freßbare zeigt, die Ziege noch fortkommt. Dafür aber liefert sie dem glücklichen Besitzer 2 bis 4 Lämmer im Jahr, und nach dem Tode noch ein brauchbares Fell. Mit Recht wird sie daher das Tier des kleinen Mannes genannt. Auch der ärmste Eingeborene besitzt wenigstens einige Ziegen. Seitens des Gouvernements angestellte Versuche, die afrikanische Ziege durch Kreuzung mit deutschen Milchziegen in bezug auf Milchproduktion zu verbessern, sind bis jetzt fehlgeschlagen, da die europäischen Tiere den Landtransport nicht aushielten und dann weitere Versuche durch den Aufstand unterbunden worden sind.
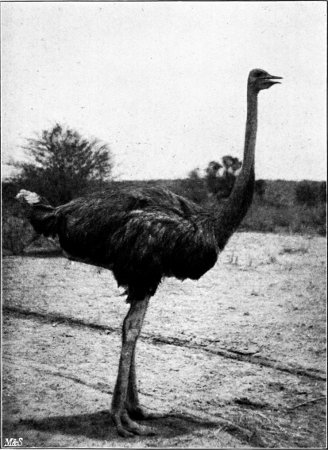
6. Die Straußenzucht ist im ganzen Schutzgebiet möglich. Material zu ihr liefert der zahlreich vorkommende wilde Strauß, der sich, jung eingefangen, leicht zähmen läßt. Das Produkt des Straußes besteht lediglich in seinen Federn, die als Luxusartikel in ihrer Preislage erheblichen[S. 365] Schwankungen unterworfen sind. Doch bleibt die Zucht bei der Genügsamkeit und Dauerhaftigkeit des Vogels wohl immer lohnend.[102]
Im Schutzgebiet ist diese Zucht bis jetzt nur vereinzelt betrieben worden, so z. B. von dem auch auf landwirtschaftlichem Gebiete sehr rührigen Kaufmann Gustav Voigts auf seiner Farm Voigtsland in der Nähe von Windhuk.
7. Schweinezucht. Das Schwein liebt Sumpf und Pfützen, mithin gerade das, was wir in Südwestafrika wenig haben. Es bedarf daher dort mehr der künstlichen Fütterung als anderswo und wird infolgedessen im Schutzgebiet eine größere Verbreitung nicht finden. Wo die Hauptbedingungen für sein Dasein vorhanden sind, wie in dem wasserreichen Windhuk, gedeiht es dagegen gut. Namentlich die Truppe betreibt eine größere Schweinezucht behufs Aufbesserung der Menage. Die stets zahlreich vorhandenen Abfälle aus der Truppenküche gestalten die Zucht auch weniger kostspielig.

Vor dem Aufstande konnte man ein der Mutter entwöhntes Ferkel bereits für 5 Mark erstehen.
8. Sonstige Zuchten. Hier sei vor allem der Seidenraupe Erwähnung getan. Der Maulbeerbaum, dessen die Raupe zu ihrem Dasein bedarf, hat sich in Südwestafrika gut einzubürgern vermocht. Versuche des Gouvernements, die Raupe (Kokon) einzuführen, sind jedoch bis jetzt nicht gelungen, da die Tierchen auf der Reise zugrunde gingen. Doch darf bei den sonstigen guten Aussichten, welche die Zucht bietet, ein Mißerfolg nicht für alle Zukunft abschrecken.
Ferner wäre noch die Hühnerzucht zu nennen. Auch sie hat sich in Südwestafrika als lohnend erwiesen. Der Preis der Eier betrug durchschnittlich 3 Mark für das Dutzend, mithin schon recht viel für den Eigentümer, da das Huhn selbst bis zuletzt nur 3 bis 5 Mark kostete. Viel natürliche Nahrung finden die Hühner in dessen in dem trockenen Südwestafrika nicht, doch sind sie ja genügsam und nehmen auch mit den eingeführten, auf dem Transport verdorbenen Nahrungsmitteln, wie besonders Reis, vorlieb. Als selbständiger Erwerbszweig würde sich aber Hühnerzucht nicht lohnen, sie kann vielmehr nur nebenbei betrieben werden.
Schließlich sei hier auch noch des Kamels gedacht, aber nicht als eines für den Farmer lohnenden Zuchtobjekts. Es handelt sich vielmehr nur um Tiere, die zu Gebrauchszwecken, fast ausschließlich für die Truppe, von außerhalb eingeführt sind. Die Schutztruppe besitzt solche schon seit 15 Jahren. Viel Freude hat sie jedoch an ihnen bis jetzt nicht erlebt. Man sollte meinen, Südwestafrika mit seinen Grassteppen und seinem trockenen Boden sei ein Eldorado für die so wenig wasserbedürftigen Kamele. Nur im Hinblick auf den letztgenannten Umstand sind überhaupt die Versuche mit ihnen gemacht worden; man wollte mit ihrer Tragkraft die Zugkraft des viel durstigeren Ochsen ersetzen. Woher es kommt, ich weiß es nicht, aber die bei uns eingeführten Kamele haben sich in der Folge als ebenso wasserbedürftig erwiesen wie der Ochse, dafür aber als störrischer, bösartiger und dummer.
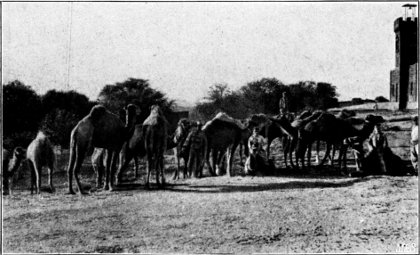
[S. 367] Die Kamele verlangen eine ganz besonders nachsichtige Behandlung und eine unendliche Geduld. Mangelt es hieran, und dies ist beim Militär häufig der Fall, so versagt das Tier einfach und ist weder mit Güte noch mit Strenge zu irgend einer Arbeitsleistung zu bringen. Bei dem letzten seitens der Truppe vor dem Aufstande gemachten Versuch (1900) wurden mit schweren Kosten arabische Wärter mit eingeführt. Solange diese anwesend waren, ging die Sache einigermaßen, aber nachher griff man wieder schleunigst auf das geduldige südwestafrikanische Pferd und den noch geduldigeren Ochsen zurück. Im ganzen kann das Kamel nur als Notbehelf, als eine Art Verzweiflungsmittel in Frage kommen, wenn, wie dies bei den jetzigen Verpflegungsschwierigkeiten in Südwestafrika der Fall, die bisherigen Reit- und Zugtiere ihre Aufgabe nicht mehr zu bewältigen vermögen. Was die Fortpflanzung des Kamels anbetrifft, so stockt sie in der Gefangenschaft des Tieres nicht ganz, bleibt aber nur vereinzelt.
9. Statistik. Am Schlusse dieses Abschnittes sei das Ergebnis einer amtlichen Viehzählung aus sämtlichen Bezirken des Schutzgebietes vom Jahre 1902 wiedergegeben. Hierbei ist aber zu beachten, daß die den Weißen gegenüber stets mißtrauischen Eingeborenen ihre Tiere so gut wie seinerzeit die Gewehre der amtlichen Registrierung zu entziehen versucht haben. Anspruch auf annähernde Sicherheit können daher nur die bei den Weißen gegebenen Zahlen machen. Hiernach waren vor dem Aufstande im Besitze von:
| a. Pferden: | ||
| die Weißen | die Eingeborenen | |
| Hengste | 260 | 185 |
| Stuten | 1700 | 770 |
| Wallache | 770 | 380 |
| Fohlen | 860 | 340 |
| 3590 | 1675 | |
| b. Großvieh: | ||
| die Weißen | die Eingeborenen | |
| Bullen | 760 | 1390 |
| Ochsen | 14330 | 6030 |
| Kühe | 14190 | 18620 |
| Färsen | 5700 | 6390 |
| Kälber | 9510 | 13480 |
| 44490 | 45910 | |
| [S. 368]c. Kleinvieh: | ||
| die Weißen | die Eingeborenen | |
| Ziegen | 82010 | 74710 |
| Angoraziegen | 2230 | 1160 |
| Fettschwänze | 122150 | 60390 |
| Wollschafe | 3910 | 290 |
| 210300 | 136550 | |
Der seitens der Eingeborenen der Zählung wahrscheinlich entzogene Bestand wurde damals bei dem Großvieh auf 1770 Stück, bei dem Kleinvieh auf 2630 Stück geschätzt. Die Gesamtzahlen wurden danach rund berechnet auf 5260 Pferde, 92160 Stück Großvieh, 349500 Stück Kleinvieh.
Ich meinerseits möchte indessen die seitens der Eingeborenen verheimlichten Bestände weit höher bemessen, als sie damals seitens der Bezirksverwaltungen eingeschätzt worden sind. Zumal in dem weiten, von Polizeistationen nur wenig besetzten Hererolande ist eine auch nur annähernde Veranschlagung gar nicht möglich gewesen.
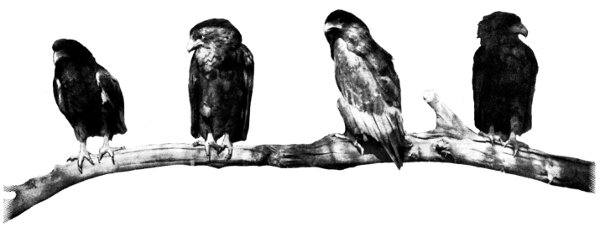
Von Interesse ist hier noch die Erwähnung, daß in der Handelsbilanz des Schutzgebietes im Jahre 1902 der Wert der Ausfuhr lebender Tiere mit 1023000 Mark, im Jahre 1903 mit 2337000 Mark verzeichnet ist.
Raubtiere. Unter den Feinden der Viehzucht Südwestafrikas sind auch die Raubtiere zu nennen, und zwar der Leopard, dort Tiger genannt, die Hyäne, der wilde Hund (Hyänenhund) und der Schakal. An erwachsenes Großvieh und Pferde wagt sich auch das stärkste dieser Tiere, der Tiger, nicht heran; eher tun dies in Rudeln jagende Hyänen und wilde Hunde.[S. 369] Doch weiß sich ihrer das einheimische gesunde Großvieh wohl zu erwehren. Nur kranke, bereits schwache sowie noch nicht ausgewachsene Tiere fallen ihnen zum Opfer, aber auch eben eingeführte, die sich bei einem Angriff seitens der Raubtiere einem ungewohnten Ereignis gegenüber sehen und sich nun nicht zu helfen wissen. So ist 1901 sogar ein neu eingeführter Simmentaler Bulle in der Nähe Windhuks durch Hyänen zerrissen worden. Unter dem Kleinvieh sucht jedoch das Raubzeug zahlreiche Opfer. Der Farmer hilft sich dagegen durch Fallen und Gift, weniger mittels offener Jagd, die wenig aussichtsvoll ist, da sämtliche südwestafrikanischen Raubtiere solange wie möglich dem Menschen ausweichen. Letzteres tut sogar auch der Löwe, der sich nur noch in den nördlichen und östlichen Grenzgebieten des Schutzgebietes findet.
Für Jagdliebhaber bemerke ich noch, daß die südwestafrikanische Fauna ungeheuer reich an Antilopen und eßbaren Vögeln jeder Art ist. Wer die Beschwerlichkeiten einer Jagd dort nicht scheut, wird daher stets auf seine Rechnung kommen.[103]
Wir betreten jetzt ein Gebiet, auf dem wir zur Zeit in Südwestafrika mehr noch als auf jedem anderen nur von der Vergangenheit sprechen können. Das Innere des Hererolandes war das Hauptabsatzgebiet für den Handel, man nannte es daher kurzweg das »Handelsfeld«. In der Zukunft wird sich daher der Handel neue Bahnen schaffen müssen und sie mit der Zeit gewiß auch finden. Bis dahin aber wird vielleicht manches nicht fest genug fundierte Handelshaus den neuen Verhältnissen zum Opfer fallen, was indessen nicht gerade als Schaden angesehen zu werden braucht.
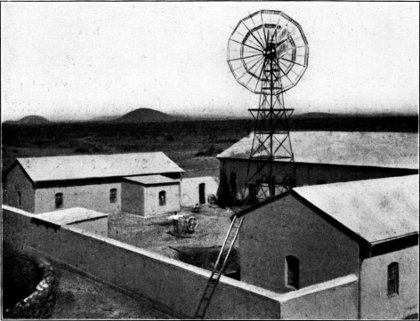
Die Hauptträger des Binnenhandels im Schutzgebiet waren die feststehenden großen Kaufgeschäfte, wenn sie auch nicht den Handel mit den Eingeborenen direkt betrieben haben. Ihn vermittelten vielmehr die kleinen Händler, sei es in gleichfalls feststehenden Geschäften mitten unter den Eingeborenen, sei es als Wanderhändler. Der letzteren habe ich bereits im Kapitel VIII (Abschnitt »Kreditverordnung« S. 246) gedacht. Obwohl der Beruf eines solchen kleinen Händlers recht wenig Verlockendes bot, so hatte ihre Zahl vor dem Aufstande doch weit über den Bedarf zugenommen, und namentlich zu dem Berufe eines Wanderhändlers drängten sich manche[S. 370] zweifelhaften Elemente, die das mit ihm verbundene freie, wenn auch mühsame Leben der regelmäßigen Arbeit vorzogen. Die Folge war eine ungesunde Konkurrenz, und die weitere Folge dieser die Zunahme des das wirtschaftliche Interesse beider Teile schädigenden Kreditunwesens, letzteres wieder verbunden mit eigenmächtigem Eintreiben von Außenständen den im Bezahlen gern säumigen Eingeborenen gegenüber.[104] Daß es bei diesem häufig nicht ohne Roheiten abging, ist nur natürlich. Gehört doch zum Ergreifen des Berufs als Wanderhändler an sich schon ein gutes Teil Abenteureranlage. Der Händler befindet sich allein mitten unter Eingeborenen, die es mit Mein und Dein gerade nicht genau nehmen, und während des mühsamen Feilschens um die kleinste Ware muß er die Augen überall haben, andernfalls ist sein Fahrzeug im Augenblick leer. Eine an sich schon skrupelfrei angelegte Natur kann unter solchen Umständen selbstverständlich nicht feiner werden. Daß dagegen die Hereros sich die Selbstjustiz der Wanderhändler so lange Zeit haben gefallen lassen, ohne daß einem derselben, die doch wochenlang wehrlos unter ihnen lebten, auch nur ein Haar gekrümmt worden[S. 371] ist, beweist, daß in letzter Linie die Achtung der Eingeborenen vor der deutschen Regierungsgewalt doch nicht so gering gewesen sein kann, wie nachträglich angebliche »Sachverständige« wissen wollten. Bis zum 12. Januar 1904, d. i. dem Tage des Aufstandes, ist keiner der unter den Hereros lebenden Weißen in bezug auf seine Person irgend einer Gefahr ausgesetzt gewesen.

Der in das Hereroland ziehende Wanderhändler pflegte seine Waren nicht selbst in das Schutzgebiet einzuführen, sondern von den großen Kaufgeschäften zu beziehen, selten gegen bar, meist in Kommission. Mit den auf einem Wagen oder einer Karre untergebrachten Gegenständen zog der Händler in das Feld und setzte sie ab, so gut es ging. Meist wurde der Käufer durch den in entgegenkommendster Weise angebotenen Kredit zum Kaufen unnötiger Dinge verleitet, aber durch die bereits nach wenigen Wochen erfolgende Schuldeneintreibung belehrt, daß die Sache doch nicht so liebenswürdig gemeint gewesen war, wie er geglaubt hatte. In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle konnte der Wanderhändler nach Rückkehr von seinem Zuge mit seinem eigenen Kreditgeber zur Zufriedenheit abrechnen und für sich selbst noch einen guten Gewinn einstreichen. Hatte er doch seine schon an sich nicht billig erstandenen Waren noch mit einem namhaften Aufschlag an die Eingeborenen abgesetzt. Die außer den Wanderhändlern noch im[S. 372] Hererolande befindlichen zahlreichen feststehenden kleinen Kaufgeschäfte verfuhren bei Bezug, wie bei Absetzung ihrer Waren ähnlich wie jene, nur pflegten sich bei ihnen die Schuldsummen mehr anzuhäufen, so daß zu deren Regulierung meist die Behörden in Anspruch genommen werden mußten.
Gegen den bedeutenden Warenabsatz unter den Eingeborenen an sich ist nichts einzuwenden. Mochte derjenige Eingeborene, der nicht arbeiten, dabei aber doch die Güter dieser Welt nicht entbehren wollte, sich allmählich ruinieren, während der betriebsame Weiße dabei gewann. Damit würde nur ein ganz naturgemäßer Prozeß gegeben gewesen sein. Vom Übel waren lediglich das unsinnige Kreditgeben und die erst durch dieses hervorgerufene Kauflust der Eingeborenen, endlich aber beim Eintreiben der entstandenen Schulden die Inanspruchnahme der Regierung ebenso wie Eigenmächtigkeiten in dieser Sache. Ersteres ging, wie im Kapitel VIII (S. 245) auseinandergesetzt, nicht ohne einen politischen Beigeschmack ab und konnte daher zu Verwicklungen führen, und die Schutztruppe vermehren, lediglich damit Weiße, die nicht schnell genug reich werden konnten, freiere Hand erhielten, das würde wohl auch der fanatischste Eingeborenenfeind nicht vorzuschlagen gewagt haben. Daß im übrigen das Kreditgeben für die Eingeborenen nicht nur zwecklos, sondern auch überflüssig sei, habe ich in den in Anlage 2 befindlichen Ausführungen zu den Kommissionsbeschlüssen des Kolonialrates vom 8. März 1903 auseinanderzusetzen versucht. Sie gipfeln darin, daß der erwerbslose Eingeborene, der heute nicht bezahlen kann, in einigen Wochen oder Monaten hierzu ebensowenig imstande sei und daher keinerlei Kredit verdiene. Er brauche jedoch auch solchen nicht, da er sehr wohl zeitweise oder ganz auf europäische Genüsse verzichten könne, die er nicht bar zu bezahlen vermöge.
Insoweit die großen Geschäfte mit den Eingeborenen direkt handelten, haben sie sich bedauerlicherweise gleichfalls nicht immer des Kreditgebens enthalten können. In der Regel aber beschränkte sich deren Warenabgabe auf die Häuptlinge und die sonstigen Großleute. Hatte die Schuldsumme eine ausreichende Höhe erreicht, so erfolgte dann ihre Regulierung durch Landabtretung; ein auch für den Kaufmann nicht immer angenehmer Prozeß, er sah sich dann häufig in der Zwangslage, mehr Land übernehmen zu müssen, als er zu verwerten vermochte.
Was den Außenhandel des Schutzgebietes betrifft, so stellt er sich nach der Statistik der letzten drei Jahre, wie folgt:
| Einfuhr | Ausfuhr | Gesamthandel | ||||
| 1901 | 10075494 | Mk. | 1241761 | Mk. | 11317255 | Mk. |
| 1902 | 8567550 | " | 2212973 | " | 10780523 | " |
| 1903 | 8330000 | " | 3540000 | " | 11870000 | " |
Diese Handelsbilanz ist ja immer noch recht passiv, d. h., die Einfuhr überwiegt in ihr bei weitem, dafür aber zeigt sich die Ausfuhr im fortgesetzten Steigen begriffen. Eine Hauptrolle bei der letzteren spielte die Ausfuhr von lebenden Tieren. Sie betrug an Wert 1901: 120225 Mk., 1902: 1023637 Mk. 1903: 2337682 Mk. Bemerkenswert ist ferner, daß unter der Ausfuhr von 1903 sich ein Betrag von 66000 Mk. für Erze befindet, vorerst jedoch nur Probesendungen.

Die Masse der Einfuhr (1903 gleich 85 vH.) kommt aus Deutschland, an zweiter Stelle aus Kapstadt, an dritter aus England. Von der Ausfuhr gingen ungefähr zwei Drittel, d. h. das gesamte lebende Vieh, nach der Kapkolonie, dann folgt England, wohin der größte Teil des gewonnenen Guano ging, und an dritter Stelle Deutschland. Die Ausfuhr erstreckte sich[S. 374] neben den bereits genannten lebenden Tieren auf tierische Erzeugnisse, darunter hauptsächlich Hörner, Robbenfelle, Straußenfedern und Guano. Eingeführt wurden dagegen so ziemlich alle übrigen Bedarfsartikel, da das Schutzgebiet zur Zeit weder eine Industrie noch einen ausreichenden Acker- und Gartenbau aufweist.
Der Schiffsverkehr mit Europa wurde durch die Woermannlinie mit dem Sitze in Hamburg vermittelt, in der Regel je zweimal im Monat direkt und außerdem ein drittes Mal über Kapstadt mit Anschluß an die dortigen englischen Linien. Falls Bedarf vorlag, wurde zeitweise auch eine weitere Verbindung eingeschaltet. Außerdem liefen jährlich durchschnittlich zwei deutsche Kriegsschiffe die Häfen des Schutzgebietes an. Diese Verhältnisse haben sich während des gegenwärtigen Aufstandes naturgemäß völlig verschoben. Jetzt gehen die Dampfer nach Bedarf, und zwar neben der Verbindung mit Kapstadt, noch durchschnittlich zwei- bis viermal im Monat direkt nach Hamburg und zurück. Der Postverkehr ist bereits im Kapitel VII (S. 235) besprochen.
Unter dem Abschnitt »Konzessionsgesellschaften« (Kapitel XI) wird dargelegt werden, wie wir auf dem Gebiet des Bergbaues insofern auf eine schiefe Ebene geraten sind, als wir, statt den einzelnen Schürfer vorangehen und das Kapital nachfolgen zu lassen, ein umgekehrtes Verfahren eingeschlagen haben. Wir haben weite Gebiete behufs bergbaulicher Erschließung an Aktiengesellschaften abgetreten, und diese schicken nun ihrerseits den Schürfer vor oder sie lassen ihr Gebiet brach liegen. Obwohl das Schutzgebiet ohne Frage sehr mineralhaltig ist, haben wir infolge dieser Entwicklung Ergebnisse aus dem Bergbau noch nicht zu verzeichnen. Indessen hatte sich trotzdem kurz vor Beginn des letzten Aufstandes auf diesem Gebiete schon ein gewisses Leben zu regen begonnen, worunter vor allem der Bau einer Bahn lediglich behufs Ausbeutung von Kupferminen zu verstehen ist, der Otavibahn. Was sonst noch auf dem Wege des Bergbaues bis jetzt erreicht ist, sowie welche Aussichten er überhaupt in der südwestafrikanischen Kolonie bietet, darüber glaube ich am zweckmäßigsten denjenigen Beamten zu Worte kommen zu lassen, der auf bergbaulichem Gebiete 15 Jahre lang Sachverständiger der Landesregierung und mir persönlich eine treue Stütze gewesen ist. Dieser — Bergrat Duft — hat mir auf meine Bitte in freundlicher Weise nachstehendes Material zur Verfügung gestellt.
Von G. Duft, Kaiserlicher Bergrat.
Die nachstehende Betrachtung verfolgt den Zweck, ein allgemeines Interesse an einem der bedeutendsten und besonders für die Kolonie höchst wichtigen Industriezweige zu erwecken und ein Miniaturbild der gegenwärtigen Lage des Bergbaues in Deutsch-Südwestafrika dem größeren Publikum vor Augen zu führen.
Als Zeitpunkt des Beginns oder des Versuchs einer planmäßigen bergmännischen Durchforschung im Schutzgebiete muß der Erlaß der Kaiserlichen Verordnung vom 25. März 1888 angesehen werden, weil durch sie zuerst die Bergwerksrechte und die Regelung der Aufsuchung und Gewinnung gewisser Mineralien gesetzlich niedergelegt waren. Durch diese Verordnung wurde der Deutschen Kolonial-Gesellschaft für Südwestafrika als Rechtsnachfolgerin von Lüderitz das Bergregal auf alle für den Bergbau in Betracht kommenden Mineralien eingeräumt. Der Inhalt dieses Regals bestand darin, daß die Gesellschaft die sogenannte Bergbauhoheit unter Aufsicht des Reichs ausüben und gewisse fiskalische Einkünfte aus dem Bergbau beziehen sollte. Im übrigen war der Bergbau freigegeben.
Den Schauplatz der Schürftätigkeit in den Anfangsstadien der wirtschaftlichen Entwicklung des Schutzgebietes bildeten das südliche Hereroland und die nördlichen Teile des Rehobother Bastardgebietes, weil von hier aus die ersten Goldfunde gemeldet wurden und man eine ähnliche rapide steigende Goldausbeute vermutete, wie sie in der jetzigen englischen Nachbarkolonie Transvaal vorauszusehen war. Aber im Gegensatz zu dem an Gold wirklich sehr reichen Witwatersrand bei Johannesburg entsprachen die Goldvorkommen im Hinterlande von Walfischbai und die zum Zwecke der bergmännischen Durchforschung nach dorthin entsandten Expeditionen und Privatschürfunternehmungen nicht den gehegten Erwartungen.
Wenn auch die Schürfarbeiten aus jener Zeit nur eine geringe Ausdehnung annahmen, so ist doch erwiesen, daß reine Golderze, d. h. solche, die Gold als vorherrschend oder als alleiniges Metall enthalten, in den genannten Gebieten nicht vorkommen. Ohne hier im einzelnen auf die genauen geologischen Verhältnisse der einzelnen Fundpunkte hinzuweisen, mögen die wichtigsten Goldvorkommen aus jener Zeit in folgender Aufzählung erläutert sein.
Örtliches Vorkommen und kurze Bemerkung über geologischen Charakter und Begleiter des Goldes.
A. Im Hererolande.
Usap (Husap) am Swakopfluß: Als Spuren von Gold in Biotitgneis zusammen mit Wolfram und Kupferglanz.
Potmine: In Granatfels im Ausgehenden von Kupfersulfideinlagerungen.
Usakos: In körnigem Kalk in zersetzten Kupfer- und Schwefelkieseinlagerungen.
Ussis: In der Nähe eines Granitmassivs mit Wismut in streichenden Quarzgängen.
Chuosgebirge: In mit Kupfererzen durchsetzten Quarzadern in kristallinischen Gesteinsarten der archäischen Formation.
B. Im Bastardgebiet von Rehoboth (i. J. 1899/1900 weiter aufgeschlossen).
Aub, südlich von Rehoboth: In Tonschieferschichten in der Nähe von Konglomeratbänken zwischen quarzitähnlichem Gestein.
Großer und kleiner Spitzkopf: Kupfererz führende Quarzgänge mit auf- und unterliegenden Glimmerschieferschichten. Gold sichtbar in fettem Quarz, fein verteilt in zerbröckeltem, mattem und braungefärbtem Quarz, 3 bis 4 g Gold, 20 g Silber in 1000 kg Ganggestein.
Swartmodder: Im Gneis auftretende Kupfergänge und Nester.
Nauas: In Brauneisensteingängen.
Areb: In kupfererzhaltigen Quarzgängen der Tonschieferzone.
Mit Sicherheit kann bei dem eigenartigen Vorkommen dieser goldhaltigen Kupfererzlagerstätten jetzt schon behauptet werden, daß sich weitere Aufschlußarbeiten der Goldausbeute wegen allein nicht lohnen werden, wohl aber, da der Goldgehalt an die Kupfererze gebunden bleibt, eine eingehendere Untersuchung besonders der im Rehobother Gebiete auftretenden Lagerstätten zu raten ist, zumal diese sich nach der Tiefe zu aushaltender zeigen als die genannten Funde im Hererogebiete.
Nachdem sich gezeigt hatte, daß die Entwicklung des Bergbaues im Schutzgebiete sich in einer Richtung vollziehen würde, die nicht im Einklang mit der oben genannten Verordnung stand und nachdem auch die im Schutzgebiete herrschenden Zustände, insbesondere die feindliche Haltung der Hereros und die fortwährenden Kämpfe zwischen den letzteren und dem Witbooistamm[S. 377] ein unmittelbares Eingreifen der Regierung sehr bald nötig machten, ging auch die Bergverwaltung auf Grund der Kaiserlichen Verordnung vom 15. August 1899 in die Hände der Regierung über.
Hiermit beginnt die zweite Ära der bergbaulichen Entwicklung, und zwar fällt nun, soweit es die politischen Verhältnisse zuließen und die Privattätigkeit sich entfaltete, in die Folgezeit die Entwicklung des Kupfererzbaues. — Hatte sich bereits bei dem Aussuchen der Goldlager gezeigt, daß nur die Kupfererze in denselben vorherrschend waren, so kam man bald mit Rücksicht auf die übrigen schon bekannten Vorkommen und neuen Funde zu der richtigen Erkenntnis, daß die Kupferfunde von größter wirtschaftlicher und lukrativ hoffnungsvollster Bedeutung für unsere junge Kolonie sein müßten.
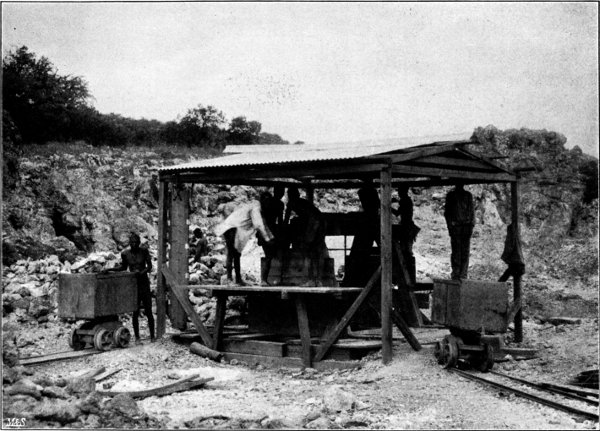
Mehrere Gesellschaften, die im Wege staatlicher Verleihung Rechte erworben hatten, wurden mit dem ausgesprochenen Programm des Minenbetriebs gegründet. Aber nur höchst mangelhaft oder in sehr großen Zeitintervallen[S. 378] entfalteten diese mit ausgedehnten Konzessionen versehenen Gesellschaften wegen Mangels an ausreichenden Geldmitteln ihre bergbauliche Tätigkeit.
Erst im Jahre 1898 wurden die Bergwerksgerechtsame der Deutschen Kolonial-Gesellschaft für Südwestafrika und im Jahre 1901 die der South African Territories dem allgemeinen Wettbewerb dadurch zugänglich gemacht, daß sie die Erlaubnis zum Schürfen und auch für den Fall der Entdeckung ergiebiger Fundstellen das Recht zum Abbau derselben unter gewissen Bedingungen an die Bewerber verliehen.
Aber immer nur waren es das weitere Hereroland, das Gebiet der Rehobother Bastards und das Küstengebiet, in denen in erheblichem Umfang eine ersprießliche Tätigkeit entfaltet wurde.
Die im Süden des Schutzgebietes im Gebiet der South African Territories ausgeführten Arbeiten auf bergbaulichem Gebiet blieben ohne Erfolg.
Nachdem bereits im Jahre 1893 die South West Africa Company die in ihrem Konzessionsgebiet liegenden und früher von den Eingeborenen ausgebeuteten Otaviminen durch eine Minenexpedition aufgeschlossen hatte, wurden im Jahre 1900/01 durch die Otavi Minen- und Eisenbahn-Gesellschaft an der Tsumebmine, der reichsten der Otaviminen, die Vorabeiten so weit ausgeführt, daß nicht nur ein regelrechter bergmännischer Betrieb bis 1907 in Angriff genommen, sondern auch die Eisenbahn von Swakopmund nach dem Minengebiet von Otavi auf Kosten der Gesellschaft gebaut und in Betrieb genommen werden kann. Die Otavi- (Tsumeb-) Mine ist deshalb von ganz besonderer Bedeutung, weil durch sie die Möglichkeit, daß der Erzgehalt in recht bedeutender Tiefe niedersetzen kann, erwiesen ist.
Eine im Jahre 1899 ins nördliche Gebiet der Rehobother Bastards, das Konzessionsgebiet der Hanseatischen Land-, Minen- und Handels-Gesellschaft, entsandte Expedition kehrte allerdings mit einem endgültigen Urteil über die Abbauwürdigkeit der vielen aufgeschlossenen Fundpunkte nicht zurück, doch war das Ergebnis immerhin ein solches, daß die Ausführung weiterer Aufschlußarbeiten warm empfohlen werden konnte.
Neben den genannten Gebieten verdienen nach den bisherigen Feststellungen noch besondere Aufmerksamkeit die Kupfererzvorkommen bei Gorob und Otyosonjati,[105] beide im Konzessionsgebiet der Deutschen Kolonial-Gesellschaft für Südwestafrika gelegen. Die Rehobother und diese der Gneis-Granit-Formation angehörigen Vorkommen erwecken in geologischer und wirt[S. 381]schaftlicher Beziehung ein besonderes Interesse, und es wäre zu wünschen, daß die zur Beurteilung ihrer Rentabilität unbedingt nötigen vollständigen Aufschlußarbeiten nach Art der Otaviminen bald zum Abschluß gelangten.
Die folgende übersichtliche Darstellung der wichtigeren Kupfererzlagerstätten Deutsch-Südwestafrikas möge ihre große geologische Verbreitung veranschaulichen.
Örtliches Vorkommen und Bemerkungen über geologischen Charakter des Vorkommens von Kupfererzen und bisherige Aufschlußarbeiten.
A. Im nördlichen Schutzgebiete Otaviminen.
1. Tsumeb, 600 km von Swakopmund und 19 km östlich von der Wasserstelle Otjikotosee: Typisches Lager in grauem bis schwarzem Kalkstein mit Quarzadern. Das Ausgehende streicht Ostwest, Einfallen gegen Süd, etwa 200 m lang, 22 m breit und 13 m hoch. Zwei Lager getrennt durch Sandsteinschichten. Erze: Bleiglanz, Kupferglanz und deren Karbonate. Durch Schächte, Strecken und Querschläge aufgeschlossen. Erzvorrat bis zur zweiten Sohle auf 293330 t mit 12,61 vH. Kupfer und 25,29 vH. Blei und 190519 t mit 2,91 vH. Kupfer, 4,37 vH. Blei berechnet. Aussichten nach der Tiefe zu günstig, da Mächtigkeit zunimmt und Zwischenmittel von Sandstein zwischen Ost- und West-Erzkörper abnimmt. Für Betrieb ist Bahnverbindung erste Voraussetzung. Empfehlenswert ist die Zugutemachung der Erze an Ort und Stelle durch zweimalige Schmelzung auf metallisches Blei und 60 prozentigen Kupferstein. Bei täglicher Produktion von 200 t werden 42 t 60 prozentiger Kupferrohstein und 47,7 t metallisches Blei ergeben. Bei 61000 t Roherz Jahresproduktion dauert der Minenbetrieb nach bisherigen Aufschlüssen 4,7 Jahre, und da ein gleiches Quantum Erz für die Tiefe vorauszusehen ist, würde die Mine 8½ Jahre aushalten.
2. Klein-Otavi: Hier ist ein kleinerer Erzkörper von ausgezeichneter Qualität der Kupfererze ohne Bleierze durch die Untersuchungsarbeiten aufgeschlossen. Regelmäßiges Streichen und vertikales Einfallen. Weitere Arbeiten sind aussichtsvoll und empfehlenswert.
3. Guchab (Anrab): Am östlichen Ende und an der Nordseite des Otavitales gelegen. Unvollkommen aufgeschlossen. Weitere Aufschlußarbeiten durch Stollenbetrieb sind zu empfehlen, da anscheinend auch keine Bleierze.
4. Groß-Otavi. Unregelmäßig geformte und nesterartige Ausfüllung von guten Kupfererzen. Von den Eingeborenen ausgebeutet. Neue Arbeiten sind nicht vorgenommen und weniger aussichtsvoll.
B. Im mittleren Schutzgebiete.
Gorob (auch Gorap genannt), 100 bis 120 km von der Küste im Hinterlande von Walfischbai: Das Ausgehende ist durch eisenschüssige quarzitische Ausbisse gekennzeichnet. Nebengestein bilden dunkel gefärbte Schiefer mit Ausscheidungen von Granat, Staurolith, Hornblende und Zyanit, die wiederum von grauen Gneisen, Glimmerschiefer und Amphiboliten eingeschlossen sind. Streichen Nordost bis Südwest, Einfallen unter 40 bis 50° gegen Nordwest. Die Schürfarbeiten, kleinere Schächte und Gräben zeigen derbes Erz, bestehend aus dichtem Gemenge von Kupfererz und Kupferkies, oder Erzadern in quarzitischer Grundmasse. Der quarzitische »eiserne Hut« zeigt Malachit und derbes Brauneisenerz. Vermutliche Ausfüllung nach der Tiefe derbes Erz neben mit Erz durchsetztem Schiefer. Vorkommen kann als Lagerzug mit großer Längserstreckung (5 km) und mäßiger, aber für den Betrieb ausreichender Mächtigkeit angesehen werden.
Die Analyse ergab günstige Resultate: bei typischen Erzmustern 31 vH. Kupfer, bei einem Haufen roher Erze 18,9 vH. Kupfer. Durchschnittsgehalt kann durch Anreicherung mittels Handscheidung auf 30 vH. Kupfer ohne große Verluste an Quantität ermöglicht werden. Weitere umfassende Untersuchungsarbeiten mit Aussicht auf günstige Resultate sind zu empfehlen, auch wenn ärmere Erze in größerer Tiefe angetroffen werden.
Auf demselben Gebiete sind noch zu erwähnen die Vorkommen der Hopemine und der sog. Naramasmine, von denen die letztere in der Verlängerung der Gorobminenlagerstätte liegt, die erste schon 1885, aber nicht vollständig erschürft wurde.
Rehobother Minen am großen und kleinen Spitzkopf: Fünf deutlich ausgeprägte Gänge streichen von Osten nach Westen und fallen nach Süd ein; enthalten als Gangart Quarz, Spateisenstein und Kalkspat, auch metamorphisches Nebengestein.
Kupferglanz ist eingesprengt in Gangquarz, ferner in Erznieren und Nestern von oft mehreren Kubikmetern Inhalt.
Quarz ist goldhaltig (siehe oben). Der reine Kupferglanz enthält kein Gold, wohl aber 0,1 bis 0,3 vH. Silber. Das derbe Kupfererz ist durch Handscheidung auf 50 vH. Kupfer zu bringen.
Swartmodder: Gang im Gneisgebiet, der durch Schächte und Strecken aufgeschlossen ist. Ausfüllung besteht aus braunem, verwittertem Gestein mit Einlagerungen von derben Kupfererzen und nachweisbarem Goldgehalt (siehe oben). Pro Tonne 20 g Gold und 362,5 g Silber. Im Durchschnitt 4,5 g Gold, 37,1 g Silber und 10 bis 12 vH. Kupfer.
Areb: Lagergänge im Tonschiefer, die mehrere hundert Meter zu verfolgen sind, bei 2 bis 3 m Mächtigkeit. Die Kupfererze, bestehend aus Kupferkies und Kupferglanz, kommen in Quarz in Nesterform von 1/4 cbm Inhalt vor.
Matchless-Mine, 25 km westlich von Windhuk am nördlichen Rande der Khomdo-Hochebene: Diese um die Mitte des vorigen Jahrhunderts mit Erfolg ausgebeutete Mine ist im Jahre 1901 durch die Kapländische Gesellschaft weiter aufgeschlossen, jedoch nicht in Betrieb genommen.
Hier treten zwei bis drei schwierig zu erkennende, von Kupfererzen imprägnierte Glimmerschieferzonen auf, die Quarzitnester enthalten, von Südwesten nach Nordosten streichen und unter einem Winkel von 45 bis 50 Grad einfallen. Dieser ganze Schichtenkomplex, der bei seiner Erzführung an sog. Fahlbandvorkommen erinnert, ist von Amphibolitgesteinen eingeschlossen. Die Erze bestehen aus Kupferkies, Schwefelkies, Kupferglanz und Malachit. Beachtenswerte Kupfererzfunde sind noch zu erwähnen von Nauas, Rehoboth, Oamites, Garis, Kamrivier, Kuissorobis, Kabiras, Kamasis, Arrowvley, Kuddies und Slip.
Otyosonjati-Minen, 60 km östlich von Okahandja: Zone von parallel zueinander laufenden Quarzgängen im Biotit und Hornblendegneis von nord-südlichem Streichen und vertikalem Einfallen.
Da Granit (Pegmatit) in der Nähe auftritt, ist genetischer Zusammenhang mit diesem nicht ausgeschlossen. Am Ausgehende erstaunlicher Erzreichtum, zum Teil mit gediegenem Kupfer. Quarz und Kalkspat bilden die Gangart mit Kupferglanz, Rotkupfererz und wenig Kupferkies, sowie den Zersetzungsprodukten derselben, Malachit und Kupferlasur als Erze. Analysen ergaben sehr gute Resultate, so daß sich bei anhaltender und gleicher Ausfüllung der Gänge die Erze durch Handscheidung bis 40 vH. Kupfer anreichern lassen.
Erze sind frei von schädlichen Bestandteilen und zeigen für ihre Verhüttung gute Zusammensetzung, so daß außergewöhnliche Unkosten beim Schmelzprozeß nicht entstehen.
Weiterer Betrieb verspricht gute Aussichten.
Fernere beachtenswerte Kupfererzfunde sind noch zu erwähnen aus dem westlichen Hereroland bei der sogenannten Ebony-Mine, ferner bei Kain-Kachas im Khanflußgebiet, aus dem Gebiete östlich von Windhuk (Hohewarte, Witvley), nördlich von Karibib, Otjimakoka an der Bahn Swakopmund-Windhuk, von der sogenannten Sinclair-Mine 150 km östlich von Hottentott[S. 384]-Bai, ferner von der Küste südlich von Lüderitzbucht (Prince of Wales-Bay) und vielen anderen Orten, wo jedoch Schürfarbeiten in größerem Maßstabe noch nicht ausgeführt sind.
Im Anschluß an diese Kupfererzvorkommen will ich nicht unerwähnt lassen, daß auch noch Bleierze (Otavi, Hohewarte), Manganerze, Wolframerze, Eisenerze, Wismut, Molybdän, ferner von nicht metallischen Bodenschätzen Halbedelsteine (Korund, Zirkon, Spinell, Apatit, Topas) in jenen Gebieten vorkommen, über deren bergbauliche Gewinnung jedoch wegen zu geringer Aufschließung sich nichts sagen läßt.
Eine Ausnahme bildet der »Marmor«, der unweit der Regierungsbahn am südlichen Rande des Geiassibgebirges, vor allem bei Etusis in einer Längserstreckung von 6 bis 7 km in wirtschaftlich verwertbarer Weise zutage tritt. Von hervorragenden Bildhauern ist er wegen seiner vortrefflichen Eigenschaften sehr gerühmt, und wenn auch die größeren Probesendungen noch einige Beimengungen (Tremolit) an der Oberfläche zeigten, so ist zu hoffen, daß der Marmor aus größerer Tiefe kompakter und reiner, dadurch seine Festigkeit größer und die Porosität geringer wird. Schon jetzt zeigt dieser dolomitische Marmor eine große chemische Reinheit, ist vor allem eisenfrei, daher fleckenlos, feinkörnig kristallinisch, von lebhafter Farbe und kantendurchscheinend. Neben diesem als Statuenmarmor in Betracht kommenden Material tritt auch noch der für Architekturzwecke geeignete schwarzgeäderte Marmor auf, der dem sehr geschätzten und nicht häufig vorkommenden Pavonazzamarmor von Carrara ähnelt.
Während sich nach dem Gesagten der Bergbau vorwiegend in dem mittleren Teile des Schutzgebietes bewegte, oder ein solcher mit Gewißheit sich voraussehen läßt, entwickelte sich die Schürftätigkeit im Süden nur in geringem Maße. Es hängt dies in erster Linie mit der geologischen Beschaffenheit des Landes zusammen, da der südliche Teil des Schutzgebietes eine von dem nördlichen wesentlich verschiedene geologische Ausbildung erfahren hat.
Das hervorragendste Interesse bietet das Gebiet von Gibeon und Bersaba, wo bereits Ende der 80er Jahre die »Blaugrundlager« entdeckt und damals von den Engländern erschürft wurden. Erst im Jahre 1896 dachte man von deutscher Seite an ihre Nutzbarmachung, und im Jahre 1903 bildete sich nach mancherlei Bemühungen die rein deutsche Gibeon-Schürf- und Handels-Gesellschaft m. b. H., deren Zweck die Untersuchung der in dem Gibeoner Konzessionsgebiet liegenden Blaugrundstellen auf Diamanten und Edelsteine bildet.
Das Bersabaer Gebiet, südlich und südwestlich von Gibeon gelegen, wurde im Hinblick auf das Vorkommen von Blaugrund im Jahre 1897 auf Grund der Bergverordnung zum öffentlichen Schürfgebiet erklärt, und es ist zur Zeit besonders in Mukorop und auf anderen Farmen eine rege Schürftätigkeit entfaltet.
Bekanntlich ist der Blaugrund (englisch blueground) das Muttergestein der in Südafrika (bei Kimberley, in der Orangefluß-Kolonie und in Transvaal) vorkommenden Diamanten. Die Untersuchungen der von den verschiedenen Fundpunkten entnommenen Proben haben ergeben, daß der Blaugrund unserer Kolonie petrographisch identisch mit demjenigen von Kimberley ist und auch in der gleichen Erscheinungsform (Krater) auftritt wie dort.
Da sich die bisherigen Aufschlüsse nur in verhältnismäßig geringer Tiefe bewegten, Diamanten auch anstehend, d. h. im Blaugrund selbst noch nicht gefunden wurden, so wird es die Aufgabe der genannten Gesellschaft sein, durch weitgehende Aufschlußarbeiten den Nachweis von Diamanten in abbauwürdiger Menge zu liefern. Charakteristisch für das Vorkommen der Diamanten ist auch in Südafrika, daß neben diamantführenden Blaugrundlagerstätten auch solche ohne Diamanten auftreten, daß ferner dasselbe Muttergestein z. B. in Transvaal (Premier-Mine) unter gänzlich verschiedenen geologischen Verhältnissen mit Diamanten auftritt, mithin das Nebengestein keinen Einfluß auf die Diamantführung zeigt.
Für die richtige Beurteilung des Wertes der zu hebenden Bodenschätze ist nun noch die Frage zu beantworten, unter welchen Verhältnissen und Vorbedingungen die Gruben einen gewinnbringenden Betrieb gestatten. Eine längst bekannte Tatsache ist, daß die Entwicklungsfähigkeit des Erzbergbaues eine reine Transportfrage bildet, d. h., daß die Eröffnung eines Bergbaubetriebes auch die Notwendigkeit des Eisenbahnbaues einschließt. Die bislang gezahlten Preise für Landtransporte mittels der schwerfälligen Ochsenwagen, die gegen früher in den letzten Jahren infolge der Rinderpest und der kriegerischen Unruhen eine außergewöhnliche Höhe erreicht haben (z. B. 2 Mark pro Zentner von Otyosonjati nach Okahandja, 60 km), lassen erkennen, daß ohne Eisenbahnverbindung der Gruben mit der Küste auch der ordnungsmäßigste Grubenbetrieb aussichtslos ist.
Es wird die schon im Interesse des Verkehrs und der Landwirtschaft immer wieder und allgemein betonte Ansicht mehr und mehr Boden gewinnen, auch für Grubenbetriebe die atmosphärischen Niederschläge großer Geländeflächen durch Dämme anzusammeln, sowie mittels Tiefbohrungen und[S. 386] Brunnen Wasser im umliegenden Gelände zu erschließen. Wird es nun auch in einigen Fällen gelingen, bei sparsamstem Betriebe ausreichende Wassermengen zu gewinnen, so fürchte ich dennoch, daß diese Bemühungen, in den regenlosen Küstenstrecken und in Jahren großer Dürre, selbst für den Wirtschaftsbetrieb sämtlicher Haushaltungen und für ein Aufbereitungswerk Wasser zu finden, nicht von befriedigendem Erfolg sein werden. Da es zur Zeit auch noch an billigem Brennmaterial im Schutzgebiete mangelt, die Zugutemachung der Erze mittels Schmelzverfahrens nicht möglich ist, so ergibt sich als notwendige Folge, nur durch eine tunlichst sorgfältige Handscheidung und die damit verbundene Anreicherung der Erze einen ökonomischen Transport zur Küste zu ermöglichen.
Mit dem weiteren Ausbau der Eisenbahnen, der billigeren Zufuhr der Lebensmittel und der Entstehung geordneter Gemeinwesen werden auch die bislang noch beträchtlich hohen Tarifsätze für Eisenbahnfrachten und Löhne für europäische Arbeitskräfte in dem unentwickelten Lande wie in der englischen Nachbarkolonie sich einem Minimum nähern, so daß es später möglich sein wird, auch die ärmeren Erze aus dem weiteren Innern zur Küste zu versenden.
Die bisher mit eingeborenen Arbeitern gemachten Erfahrungen sind sehr gute gewesen, und es ist wohl kein Zweifel, daß sich bei ihrer gerechten und geschickten Behandlung ein guter Arbeiterstand herausbilden wird. Sowohl der Herero wie auch der Ovambo eignet sich, wie dies beim Eisenbahnbau und Minenbetrieb wiederholt erprobt, vorzüglich zu bergmännischen Handfertigkeiten über und unter Tage, zum Unterschied von dem indolenten Bastard und Hottentotten. Auch die Hereroweiber haben sich bereits als brauchbare Arbeitskräfte bei den Erzsortierungsarbeiten erwiesen, so daß sich die Lohnverhältnisse als billige und für den Betrieb günstige gestalten werden.
Hinsichtlich der Ertragsfähigkeit des zukünftigen Bergbaues sind jedoch noch andere sehr wesentliche Gesichtspunkte in Betracht zu ziehen, die ich hier nicht unerwähnt lassen darf. Es beruhen diese auf speziell afrikanischen Beobachtungen, die aber längst in anderen fremdländischen Kolonien ähnlichen Charakters gemacht sind und sich dort wiederholt haben. Zunächst fragt es sich, ob die zur Zeit aufgeschlossenen Kupfererzlagerstätten, denn diese kommen in erster Linie in Betracht, sich als nachhaltig erweisen werden.
Nur gar zu oft hört man die pessimistische Ansicht, daß es sich in Südwestafrika ausschließlich um nesterartige und somit nicht abbauwürdige Vorkommen handelt, sobald die am Ausgehenden gefundenen, meist überraschend reichen Erze nach der Tiefe zu sehr schnell verschwinden. Wie[S. 387] überall auf der Erde, besonders in der archäischen und paläozoischen Formation, treten erzhaltige Nester und Gangtrümmer auch in Südwestafrika auf, ebenso verstärken und verschwächen sich hier die Quarzgänge im Streichen und Fallen, letzteres bis zu vollständigem Auskeilen, und nur allzuoft kommt es vor, daß die reichen Anbrüche in geringwertige Erze übergehen. Selbstverständlich würde es direkt falsch und nicht sachgemäß sein, die ganze Erzlagerstätte nach dem reichen Ausgehenden zu beurteilen, weil dadurch nur übertriebene Anschauungen von dem Werte des Bergbaues entstehen.

Anderseits ist aber auch erfahrungsmäßig festgestellt, daß mancherlei Erschwerungen, die sich besonders bei gangartig vorkommendem Bergbau in den Weg stellen, nämlich die baldige Verminderung der zersetzten und angereicherten Erze des Ausgehenden, Sprünge, Verwerfungen und andere Störungen der Lagerstätten, ferner die Ansicht, daß sie nur bis in ganz[S. 388] geringe Tiefe erzhaltig seien, das Vertrauen in die Zukunft des Bergbaues erschütterten. Später wieder aufgenommene und mit zäher Beharrlichkeit durchgeführte Arbeiten lieferten den Beweis, daß man sich durch derartige Schwierigkeiten nicht abschrecken lassen soll. Durch weiteres Abteufen der Schächte, durch Untersuchung des Hängenden und Liegenden, durch glückliches Ausrichten der verworfenen Teile der Erzlagerstätte fanden sich in der Tiefe neue Erzmittel, und es erwiesen sich die gehegten Befürchtungen als haltloses Vorurteil. Obwohl nun die in Südwestafrika vorgenommenen geologischen und bergbaulichen Untersuchungsarbeiten mit nur einer Ausnahme nicht so weit gediehen sind, um Parallelen zu stellen und bestimmte Angaben über das voraussichtliche Verhalten und die wirtschaftliche Verwertbarkeit einzelner Lagerstätten zu machen, so liegt doch auch kein Grund vor, nicht darauf Wert zu legen, daß solche notwendigen Untersuchungsarbeiten zur genaueren bergbaulichen Erforschung ausgeführt werden.
Die erwähnte Ausnahme bildet Otavi. Nachdem, wie aus obiger Übersicht ersichtlich, in dem unzersetzten Teile des lagerartigen Erzkörpers von Tsumeb (Otavi) ebenso vorzügliche Erze aufgeschlossen sind wie im Ausgehenden, ist die Möglichkeit des Niedersetzens der reichen Erze erwiesen. Außerdem trage ich nach Maßgabe der von fachmännischer Seite gemachten Beobachtungen keine Bedenken, anzunehmen, daß Vorkommen wie Gorob, das geologisch demjenigen von Otavi ähnelt, und ebenso die Gänge von Otyosonjati und Rehoboth einen genügenden Erzgehalt nach der Fall- wie nach der Streichrichtung behalten werden, sobald auch hier größere Tiefen im unzersetzten Zustande erreicht sein werden.
Im engsten Zusammenhange mit diesen Erörterungen steht nun die Kapitalisierung derjenigen Unternehmungen, die zum Zwecke der Erschließung und Ausbeutung der von mir ins Auge gefaßten Erzlagerstätten gegründet werden.
Ist schon von vornherein eine Überspekulation und außerordentliche Preissteigerung des Verkaufsobjektes ausgeschlossen, so muß auch vor einem allzu beträchtlichen Anlagekapital dringend gewarnt werden, da eine solche Kapitalisierung eine Ertragsfähigkeit in den meisten Fällen ausschließt und nicht nur der Zusammenbruch der überkapitalisierten Bergwerks-Gesellschaft unausbleiblich ist, sondern auch die Bereitwilligkeit der Kapitalisten, Mittel zur weiteren Erforschung der Minen beizusteuern, einen harten Stoß erleidet. Wird jedoch die Finanzierung in die richtigen Bahnen gelenkt, und werden zunächst die genaueren Untersuchungsarbeiten vorgenommen, so vermag bei[S. 389] ihrem günstigen Ausfall der zunächst darauffolgende Kleinbetrieb bei sparsamer Bewirtschaftung eine Rente abzuwerfen.
Bedingt schon der Bergbau im allgemeinen ein größeres Risiko als fast alle anderen Gebiete der Industrie, so stehen dem Kupfererzbergbau selbst beim sachgemäßen Vorgehen durch die Werte der gewonnenen Produkte, die fast täglichen Schwankungen unterliegen, bedeutende Schwierigkeiten entgegen.
Die Frage endlich, ob im Laufe der Zeit auch noch andere Lagerstätten als die oben erwähnten gefunden werden, muß wohl zustimmend beantwortet werden.
Ein Blick auf die geographische Lage der bisher in Betracht kommenden Funde genügt, um zu sehen, daß noch große Ländergebiete wegen der Unwirtlichkeit und Schwierigkeit der Wasserversorgung der Erforschung durch Bergleute und Geologen harren.
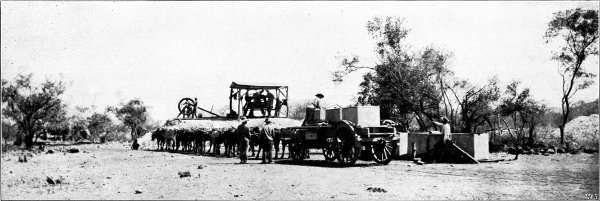
Die außerordentliche Verbreitung nutzbarer Fossilien, z. B. in den nördlichen und östlichen Nachbargebieten, vor allem auch der Steinkohlen in Rhodesia, läßt daher fast mit Gewißheit voraussehen, daß nach Erschließung der seither noch[S. 390] unbekannten Gebiete im Norden und Osten der Kolonie manche Überraschungen bereitet werden.
Zum Schluß möge noch erwähnt sein, daß die neue Bergverordnung vom 8. August 1905, die sich auf dem Boden der allgemeinen Bergbaufreiheit, aber der Trennung von Bergwerks- und Grundeigentum aufbaut, vorteilhaft auf die Untersuchung der Kolonie auf ihre Bodenschätze einwirken wird und die freie Entfaltung der bergbaulichen Tätigkeit gewährleistet.
Fassen wir das Gesagte zusammen, so glaube ich ersichtlich gemacht zu haben, daß unser südwestafrikanisches Schutzgebiet bei Anwendung gebührender Vorsicht die besten Hoffnungen für einen lohnenden Betrieb, für deutsches Kapital ein gutes Anlagegebiet und ein großes Feld gewinnbringendster Tätigkeit bietet. Verwirklichen sich diese Hoffnungen, so wird der Bergbau der Ausgangspunkt einer weiteren Seßhaftmachung deutschen Elements bilden, dem auch die Hebung der so sehr geprüften Kolonie in landwirtschaftlicher Beziehung bald folgen wird.
gez. Duft.


Fragen wir nun, in welcher Weise das alte Vaterland die im Schutzgebiet vorgefundenen Werte zu erschließen versucht hat, so müssen wir leider die Konzessionsgesellschaften an die Spitze setzen. Denn diese haben vermöge ihres großen Besitzes im Schutzgebiet, nicht zum wenigsten aber durch ihre Macht in der Heimat seiner wirtschaftlichen Erschließung ihren Stempel aufgedrückt. Aber nicht einzelne Personen haben diese wenig erfreuliche Erscheinung etwa verschuldet, sondern, wie ich noch des näheren darlegen werde, die Gesamtheit des deutschen Vaterlandes und Volkes. Vor dem Aufstand befanden sich etwa 40 vH. des ganzen Schutzgebietes in den Händen der Gesellschaften, gegen etwa 20 vH. in denjenigen der Regierung.[106] Allerdings muß von dem Landbesitz der Gesellschaften[107] der ganze Küstenstrich, als zu Besiedlungszwecken ungeeignet, abgestrichen werden, so daß der verbleibende Rest höchstens[S. 392] ein Viertel des nutzbaren Grund und Bodens des Schutzgebietes betragen mag, immerhin noch genug, um den Gang der Entwicklung des letzteren wesentlich zu beeinflussen. Mögen indessen die Konzessionsgesellschaften in den Kolonien Geschäfte aller Art betreiben, sie sollen und müssen uns mit ihrem Kapital willkommen sein. Nur von einem Geschäft sollen sie die Hände lassen, und dies ist die Siedlungstätigkeit. Denn letztere bringt, wenn richtig betrieben, nichts ein, und die Aktionäre einer Gesellschaft wollen naturgemäß für ihre eingeschossenen Kapitalien Dividende sehen. Die Landgesellschaften stehen daher nur vor der Wahl, entweder auf einen Gewinn zu verzichten, oder diesen bei den einwandernden Ansiedlern zu suchen, d. h. das Besiedlungsgeschäft unrichtig zu betreiben und so die Einwanderung zu verlangsamen.
Vor diesem Dilemma steht der Staat nicht. Für ihn genügt es, wenn aus dem Einwanderer sich mit der Zeit ein tüchtiger Steuerzahler entwickelt. Er kann daher die Besiedlungstätigkeit nicht nur mit den leichtesten Bedingungen für den Ansiedler verknüpfen, sondern auch diesem noch weitgehende Unterstützung gewähren. Wenn der Staat nur in bezug auf Auswahl der Ansiedler Vorsicht beobachtet, dann verbürgen ihm deren Tatkraft und Fleiß in absehbarer Zeit seinen Gewinnanteil. Darum muß in jungen Kolonien die Siedlungstätigkeit ausschließlich dem Staate vorbehalten bleiben, zumal in einem Lande, dessen Boden nicht reich genug ist, um neben dem Eigentümer auch noch Verwaltung und Aktionäre einer heimatlichen Gesellschaft in Nahrung zu setzen.
Aber auch die Verleihung von Bergwerksgerechtsamen an Gesellschaften hat sich nicht als vorteilhaft erwiesen. Dem eigentlichen Bergbau muß das Prospektieren vorausgehen, d. h. die Tätigkeit des einzelnen zum Zweck des Aufsuchens und Findens mineralhaltiger Stellen. Erst wenn solche gefunden sind, kann behufs deren Ausbeutung das große Kapital einsetzen, und zwar des Risikos wegen zweckmäßig das genossenschaftliche Kapital. Wir haben die Sache umgekehrt gemacht, wir haben zuerst das Großkapital herangezogen und diesem die Minenrechte weiter Länderstrecken überlassen. Ursprünglich lag dem wohl der Gedanke zugrunde, daß die Gesellschaften selbst das Prospektieren und dann den Abbau betreiben könnten. Dies würde jedoch unzweckmäßig sein. Wo noch gar keine Anzeichen von Mineralfunden vorhanden sind, wird eine Anzahl auf weitem Raum zerstreuter Mineralsucher mehr erreichen als eine geschlossene größere Expedition. Diejenigen Minengesellschaften, die einsahen, daß zur Verwertung ihrer Rechte etwas geschehen müsse, machten es daher wie die Regierung, d. h., sie traten die Schürf[S. 393]berechtigung an einzelne ab, nur zu etwas höheren Preisen. Einige aber taten gar nichts und ließen auch andere nichts tun. Für ihre Gebiete hieß es: »Über allen Wipfeln ist Ruh.« Hieraus ergibt sich, daß ebenso die Entwicklung des Bergbaues in den Händen der Regierung besser aufgehoben gewesen sein würde. Auch in dem weiteren Stadium seiner Tätigkeit macht sich das Dasein der Gesellschaften dem Bergbauer insofern wenig angenehm bemerkbar, als er sich einer doppelten Besteuerung ausgesetzt sieht, und zwar seitens der Gesellschaften wie seitens der Regierung. Zuweilen werden auch Untergesellschaften gegründet, die an die Muttergesellschaften eine Abfindungssumme zu entrichten haben. Kurz, auch die Verleihung der Minenrechte an große Privatgesellschaften hat kein anderes Ergebnis gehabt, als einen hemmenden Faktor in die Entwicklung des Schutzgebietes zu bringen.
Daß wir auf eine derart schiefe Bahn gelangt sind, dafür darf man jedoch, wie schon gesagt, nicht einzelnen Personen die Schuld beimessen, am allerwenigsten aber der Regierung. Einerseits hat diese bei Besitzergreifung des Schutzgebietes, wie im Kapitel VIII dargelegt, die Mehrzahl der Konzessionen bereits vorgefunden, anderseits stammt deren Bestätigung wie auch die Verleihung reiner Regierungskonzessionen aus einer Zeit, wo in ganz Deutschland niemand viel für die Kolonien übrig hatte und niemand für sie Lasten übernehmen wollte. Bestand doch sogar bis 1892 eine deutsche Regierungsgewalt in Südwestafrika im Grunde nur auf dem Papier, und für das Schutzgebiet drohte zu jener Zeit allgemeine Stagnation. Der damalige Kolonialdirektor versuchte infolgedessen — es sei mir der Ausdruck gestattet — wieder »Leben in die Bude« zu bringen. Er griff zu diesem Zweck auf das Ideal zurück, das dem Fürsten Bismarck vorgeschwebt hatte: »Der Kaufmann muß voran, Regierung und Schutztruppe erst nachfolgen«, und schob kaufmännische Gesellschaften in den Vordergrund mit dem Bedeuten, sich zu helfen, so gut sie könnten. Die Konzessionen kosteten mithin dazumal dem Staate nichts als einige Federstriche, waren aber dafür um so reichlicher ausgestattet. Für die Gesellschaften dagegen bedeuteten sie bei geringen eigenen Anlagekosten einen Wechsel auf die Zukunft, den bei gegebener Zeit zu präsentieren sie sich vorbehalten konnten. Bestand doch der größte Teil des Anlagekapitals bei fast allen in sogenannten Gründeraktien, für die keinerlei Barzahlung zu leisten gewesen war. Der Kaufmann Lüderitz und dessen Rechtsnachfolgerin, die Deutsche Kolonial-Gesellschaft für Südwestafrika, die als einzige Ausnahme ihre Konzessionen sofort auszunutzen versuchten, hatten dagegen nur ein gründliches Fiasko zu verzeichnen.[S. 394] Als dann das Reich, durch den Gang der Ereignisse gezwungen, eine wirkliche Herrschaft im Schutzgebiete aufrichtete, entdeckte man erst, daß für die Regierung nur Pflichten übrig geblieben, die Rechte aber an die Privatgesellschaften übergegangen seien. Und nun begann in dieser Sache eine rückläufige Bewegung. Nicht nur wurden keine Konzessionen mehr verliehen, man fing auch an, die alten in ihren Befugnissen, soweit es die nun einmal bestehenden Verträge zuließen, zurückzuschrauben.
Auch bei diesem Versuch, einer wenig glücklichen Entwicklung der Dinge Einhalt zu tun, fand die Regierung in der öffentlichen Meinung zunächst wenig Unterstützung. Denn letztere war damals — 1896 — in kolonialen Fragen aus ihrer Lethargie noch nicht erwacht. Einflußreich waren dagegen die Verfechter der Gesellschaften in den kolonialfreundlichen Kreisen wie in der Presse, sie hatten das Wort sowohl im Kolonialrat wie im Vorstande der sonst nur ideale Zwecke verfolgenden Deutschen Kolonial-Gesellschaft. Angriffe und Feindschaft waren daher die Folge, mit denen namentlich meine Person beehrt wurde. Auf der andern Seite aber ist anzuerkennen, daß auch die Gesellschaften viel Freude an ihren Konzessionen nicht erlebt haben, weil sie solche eben nicht erleben konnten. Einen nennenswerten Gewinn hat noch keine erzielt, manche dagegen Verluste zu verzeichnen. Jede gebotene Gelegenheit, mit Anstand aus einer verlorenen Sache wieder herauszukommen, sollten sie daher mit Vergnügen ergreifen.
Diese Gelegenheit scheint nun zur Zeit gegeben. Denn neuerdings haben die Gegner der Konzessionsgesellschaften eine wesentliche Unterstützung in der öffentlichen Meinung gefunden. Den ersten Anstoß im Kampfe gegen das Konzessionswesen in der Presse und in Versammlungen hat bereits das Jahr 1899 gebracht. In diesem Jahre tauchte es unter dem damaligen Leiter der Kolonialverwaltung gegen alles Erwarten plötzlich wieder aus der Versenkung empor und gelangte in Kamerun zu neuer Blüte. Ich meine die Gründung der Nord- und Süd-Kamerun-Gesellschaft und das Aufbäumen der öffentlichen Meinung gegen diese »Verschenkung Kameruns« mit dem Ergebnis, daß der damalige Leiter der Kolonialverwaltung zurücktrat. Was bis jetzt über die Erfolge der beiden Kamerun-Gesellschaften in die Öffentlichkeit gedrungen ist, bestätigt im übrigen lediglich die in Südwestafrika gemachten Erfahrungen. Die Erfolge scheinen gleich Null, und die Konzessionsinhaber haben bis jetzt weder zur Entwicklung des Schutzgebietes Besonderes beizutragen vermocht, noch an ihrem Besitz viel Freude erlebt. Mit dem Verschenken von Rechten innerhalb von Landgebieten, die an Umfang ganzen Königreichen gleichkommen, entwickelt man[S. 395] Kolonien eben nicht. Außerdem vermag eine kaufmännische Zentralleitung Gebiete von solchem Umfange gar nicht zu beherrschen, und die Gründung von kleinen Untergesellschaften, um eine Dezentralisation herbeizuführen, kann die Kolonialregierung besser direkt vornehmen. Dies war aber auch das letzte Aufflackern des Konzessionswesens.
Wie bereits im Kapitel VIII dargelegt, sind aus den mit den Eingeborenen abgeschlossenen und seitens der Regierung nachträglich bestätigten Verträgen folgende Gesellschaften entstanden:
1. Deutsche Kolonial-Gesellschaft für Südwestafrika.
2. Kaoko-Land- und Minengesellschaft.
3. Hanseatische Land-, Minen- und Handelsgesellschaft.
4. The South African Territories Ltd.
Ferner sind seitens der Regierung direkt konzessioniert worden:
5. Siedelungsgesellschaft für Deutsch-Südwestafrika.
6. South West Africa Company Ltd.
Hierzu treten zwei weitere, noch nicht genannte Gesellschaften:
7. Otavi-Minen- und Eisenbahngesellschaft, eine Untergesellschaft der Gesellschaft Nr. 6.
8. Gibeon-Schürf- und Handelsgesellschaft.
In die Einzelheiten alles dessen einzugehen, was diese Gesellschaften bis jetzt für das Schutzgebiet geleistet oder auch nicht geleistet haben, dazu fehlt hier der Raum. Den Leser, der sich hierfür interessiert, verweise ich auf die hierüber seitens der Kolonialverwaltung verfaßte und an den Reichstag gegangene Denkschrift vom 28. Februar 1905.[108] Für hier will ich mich darauf beschränken, die während meiner Tätigkeit in Südwestafrika mit den Gesellschaften gemachten Erfahrungen darzulegen. Nach diesen haftet allen unseren Gesellschaften, mit zwei Ausnahmen, der Mangel an Betriebskapital an. Die eine dieser Ausnahmen betrifft die Otavi-Minen- und Eisenbahngesellschaft, die bei 20000000 Mark Grundkapital auch 20000000 Mark Betriebskapital besitzt, die andere finden wir in der Gibeon-Schürf- und Handelsgesellschaft, bei der sich Grundkapital und Anlagekapital gleichfalls die Wage halten. Beide betragen je rund 1000000 Mark. Alle übrigen sechs Konzessionsgesellschaften besitzen zusammen rund 65000000 Mark Grund-, d. h. Aktienkapital, und nur rund 13000000 Mark Betriebskapital. Die Masse des Kapitals steht daher bei[S. 396] ihnen auf dem Papier und setzt sich, wie schon erwähnt, aus sogenannten Gründeranteilen zusammen. Am übelsten tritt dies bei der Hanseatischen Land-, Minen- und Handelsgesellschaft und bei der Kaoko-Land- und Minengesellschaft hervor. Die erstere besitzt rund 2600000 Mark Aktienkapital und nur rund 380000 Mark Betriebskapital, die letztere bei rund 10000000 Mark Aktienkapital sogar nur 800000 Mark Betriebskapital. Beide Gesellschaften haben sich auch bis jetzt von allen am meisten durch Tatenlosigkeit ausgezeichnet. Die Hanseatische Land-, Minen- und Eisenbahngesellschaft hat ihr ganzes kleines Betriebskapital auf eine Schürfexpedition verwendet, die im Jahre 1900 das Rehobother Gebiet auf Mineralien untersuchte. Das Ergebnis war, daß die mineralischen Vorkommen in den betreffenden Gebieten sich nicht für den Großbetrieb, sondern nur für den Abbau im kleinen eigneten. Bei dieser Feststellung hat sich die Gesellschaft beruhigt und von da ab für die weitere Erschließung ihres Gebietes nichts getan, nicht einmal mittels Ausgabe von Schürfscheinen, womit Kosten für sie nicht verbunden gewesen sein würden. Durch das Gebiet der Kaoko-Land- und Minengesellschaft sind dagegen zwei seitens der South West Africa Company gesendete Expeditionen unter Führung des Vertreters der letzteren, Dr. Hartmann, gegangen, ob unter einem Beitrag seitens der erstgenannten Gesellschaft zu den Kosten, ist mir nicht bekannt.
Was den Nutzen für das Schutzgebiet betrifft, so verdient von unseren Gesellschaften die Otavi-Minen- und Eisenbahngesellschaft an die Spitze gestellt zu werden. Sie besitzt, wie bereits erwähnt, ein voll eingezahltes Aktienkapital von 20000000 Mark und will diese auch vollständig auf das Schutzgebiet verwenden. Ihre wesentlichste und verdienstvollste Tätigkeit ist zur Zeit der Bau einer Eisenbahn von Swakopmund nach den Otaviminen, um mit deren Hilfe dann die letztgenannten auszubeuten, dies ohne jede staatliche Hilfe, gewiß ein gutes Zeichen für den Wert unseres Schutzgebietes. Trotz des Hereroaufstandes ist die Bahn bereits beinahe fertiggestellt. Vor meinem Verlassen des Schutzgebietes habe ich sie noch von Usakos ab bis zur Küste befahren. Sie ist vorzüglich gebaut und, obwohl nur in der gleichen Schmalspurweite wie die Regierungsbahn, doch viel leistungsfähiger als diese, da sie stärkeres Schienenmaterial besitzt. Diese Gesellschaft steht daher als ein wahrer Lichtblick in unserer sonstigen Gesellschaftsmisere da. Ihr mag sich später vielleicht noch würdig die Gibeon-Schürf- und Handelsgesellschaft anschließen. Wenn diese auch vorläufig nur ein geringes Aktienkapital besitzt, so ist es wenigstens voll ein[S. 397]gezahlt. Der Zweck der Gesellschaft ist auch zunächst nur die Feststellung, ob in der Gibeoner Blaugrunderde sich überhaupt Diamanten, und in abbauwürdiger Zahl befinden. Nur der Aufstand hat bis jetzt den Beginn der Arbeiten verhindert.
Die übrigen sechs Gesellschaften haben von ihrem 13500000 Mark betragenden Betriebskapital bis jetzt nach eigener Angabe rund 7500000 Mark bar auf das Schutzgebiet verwendet. In der Tat, unser Schutzgebiet müßte mit allen Gütern des Himmels gesegnet sein, wenn es gelingen soll, mit einem Betriebskapital von 13000000 Mark Dividenden für 65000000 Mark herauszuwirtschaften. In diesem Mißverhältnisse sowie in der noch nicht genügenden Ausnutzung der erhaltenen Konzessionen mögen die Gründe für die bisherige Dividendenlosigkeit unserer Gesellschaften zu suchen sein. Das Reich hat in dem gleichen Zeitraum (1885 bis 1903 einschließlich) auf das südwestafrikanische Schutzgebiet rund 65000000 Mark verwendet. Dafür besaß vor dem Aufstand das Reich etwa 20 vH. des besiedlungsfähigen Landes, die Gesellschaften dagegen 40 vH., von den Minenrechten ganz zu schweigen, die, abgesehen von den Gebieten von Bersaba und Gibeon, ausschließlich in den Händen der Gesellschaften lagen.
Die Otavi-Minen- und Eisenbahngesellschaft ist eine Tochtergesellschaft der South West Africa Company Ltd. Schon in der Konzessionsurkunde der letzteren ist etwas von dem Zug der neueren Zeit zu spüren, indem deren weitgehenden Rechten auch streng umgrenzte Pflichten gegenübergestellt sind. Sie mußte binnen vier Jahren mindestens 600000 Mark auf die Erschließung des ihr überlassenen Gebietes verwenden und binnen acht Jahren den ordnungsmäßigen Beginn eines Bergwerksbetriebes nachgewiesen haben. Bei Verletzung einer dieser beiden Bedingungen war die Konzession verfallen. Derartig sachgemäße Grenzen fehlen bei den sonstigen älteren Konzessionen zum Teil. Dagegen hat die South West Africa Company mit diesen gemeinsam, daß ein Termin, innerhalb dessen das ihr überwiesene Land besiedelt sein muß, nicht festgesetzt ist. Im übrigen hat die Gesellschaft die ihr auferlegten Bedingungen erfüllt, jedoch infolge von durch höhere Gewalt herbeigeführten Behinderungsgründen für den Bergbaubeginn eine Verlängerung erhalten. Immerhin hat im Konzessionsgebiet dieser Gesellschaft unter der rührigen Leitung ihres langjährigen Vertreters, des Dr. Hartmann, fast immer ein gewisses wirtschaftliches Leben geherrscht. So sind auch Untersuchungsarbeiten an den bereits bekannten Kupferminen Tsumeb und Otavi vorgenommen worden. Dagegen hat ein schwacher Punkt in der Konzession, nämlich, daß die Regierung zugunsten der Gesellschaft auf den Bau einer[S. 398] eigenen Bahn von der Küste nach dem Innern auf zehn Jahre verzichtet hat, ohne aber dafür der Gesellschaft einen Zwang zum Bahnbau aufzuerlegen, zu einer weiteren Konzession an diese geführt. Im Kapitel IV ist dargelegt, wie die Rinderpest zur Durchführung des Bahnbaues zwang, ehe die zehnjährige Vertragsfrist verflossen war, und wie daher der Gesellschaft seitens der Regierung ihr Recht abgekauft werden mußte. Das geschah mittels Überlassung von Minenrechten im Ovambolande, die indessen bei der Bodengestaltung jenes Landes sich künftig vielleicht als wenig wertvoll erweisen werden. Das Hauptverdienst der South West Africa Company besteht jedoch in der Gründung der Otavibahn, der sie ihre Pflichten und Rechte in Minenbetrieb und Bahnbau übertrug. Zu deren 20000000 Mark betragendem Kapital hat sie selbst 8000000 Mark beigesteuert. Dafür ließ sie sich jedoch von der Tochtergesellschaft für die abgetretenen Rechte 1000000 Mark vergüten, womit ihre bisherigen eigenen Aufwendungen für ihr Konzessionsgebiet wieder eingebracht sind. Von ihrem 1300000 ha betragenden Landbesitz hatte die Gesellschaft bis zum Ausbruch des Aufstandes nur 39000 ha verkauft und 15000 ha verpachtet. In bezug auf Besiedlung hat die Gesellschaft somit von ihrer sonstigen Rührigkeit nichts merken lassen, sie ist sogar in dieser Richtung von allen unseren Landgesellschaften die zurückhaltendste gewesen, trotzdem bei der Güte des ihr überwiesenen Bodens der Andrang gerade zu ihr ziemlich rege war. Als Grund für ihre Zurückhaltung gab sie an, daß ein ersprießliches Vorwärtskommen der Ansiedler bis zur Fertigstellung der Bahn Swakopmund-Otavi nicht hinreichend gesichert sei; ein wenig stichhaltiger Grund, denn diese Sorge hätte die Gesellschaft besser ihren Ansiedlern selbst überlassen. Der Verdacht, sie wolle sich selbst die nach Fertigstellung der Bahn zu erwartenden höheren Landpreise sichern, liegt daher nahe. Im ganzen aber ist anzuerkennen, daß die South West Africa Company immerhin eine der rührigsten unserer Gesellschaften gewesen ist, wozu sie ihr verhältnismäßig hohes Betriebskapital von rund 8000000 Mark auch instandgesetzt hat.
In einem gewissen Zusammenhang mit der South West Africa Company steht die zweite englische Gesellschaft, die South African Territories Ltd., hervorgegangen aus dem alten Kharraskhoma-Syndikat. Dem letzteren kann ich nicht viel Gutes nachsagen. Seine Tätigkeit hätte 1894 im Süden des Schutzgebietes beinahe einen Eingeborenenaufstand hervorgerufen. Aber auch die Weißen zeigten damals große Unzufriedenheit, da das Syndikat in dem ganzen Konzessionsgebiet von den mit Genehmigung der Eingeborenen[S. 399] dort wohnenden Weißen Wasser- und Weideabgaben beanspruchte. Sich seßhaft machen, d. h. Farmen kaufen, hatten die Weißen dagegen nicht können, da in der Konzessionsurkunde die Regierung sich verpflichtet hatte, für 15 Jahre in dem Konzessionsgebiet keinerlei Farmverkäufe zuzulassen. Dies war die wenigst glückliche Bestimmung dieser Konzession, denn damit war der Gesellschaft ein Monopol verliehen, das sie erst 1897 wieder verloren hat. Bis dahin saßen die weißen Ansiedler gleichsam in der Luft, und nur die wenigen vor Bewilligung der Konzession erworbenen Farmen konnten die Regierungsgenehmigung erlangen. Der Kapitän Wilhelm Christian dagegen war über die Tätigkeit des Syndikats derart betroffen, daß er mich bei meiner Anwesenheit in Warmbad 1895 allen Ernstes fragte, ob er Kapitän von Warmbad sei oder der Syndikatsvertreter, Herr Gibson. Nachdem das Syndikat in seine Schranken zurückgewiesen war, verschwand es und überließ seine Konzession einer neuen Gesellschaft, und zwar der am 11. September 1895 gegründeten South African Territories Ltd. Unter den Rechten des Syndikats hatte sich auch dasjenige der Auswahl von 512 Farmen befunden. Doch kam es hierzu nicht, da auch die neugegründete Gesellschaft in der Folge die an deren Auswahl geknüpften Bedingungen, darunter Bau einer Eisenbahn von Lüderitzbucht nach Aus, nicht zu erfüllen vermochte. Es fielen ihr daher nur die ersten 128 Farmen zu, der Rest der Landkonzession wurde für verwirkt erklärt. Von ihren tatsächlich erhaltenen, insgesamt 1280000 ha hat die Gesellschaft bis jetzt 49300 ha verkauft und 323000 ha verpachtet.
Auf dem Gebiete des Bergwesens hat sich die Gesellschaft bis jetzt auf eine Schürfexpedition beschränkt, die einen Erfolg nicht gehabt hat. Auf Betreiben der Kolonialverwaltung hat sie dann im Jahre 1901 die allgemeine Schürffreiheit im Gesellschaftsgebiete eingeführt und im Einvernehmen mit der Regierung ein Bergregulativ erlassen. Das Betriebskapital beträgt bei einem Aktienkapital von 10000000 Mark rund 2460000 Mark. Das Direktorium der Gesellschaft ist ebenso wie dasjenige der South West Africa Company aus deutschen und englischen Mitgliedern gemischt.
Ich komme nunmehr zu den beiden rein deutschen Gesellschaften und beginne mit der ältesten derselben, der Deutschen Kolonial-Gesellschaft für Südwestafrika. Die Geschichte namentlich dieser Gesellschaft weist mehr Leiden als Freuden auf. Nach dem Tode des Kaufmanns Lüderitz waren seine geschäftlichen Unternehmungen im Schutzgebiete in Zahlungsschwierigkeiten geraten. Um sie dem alten Vaterlande zu erhalten, wurde im August 1885 die Deutsche Kolonial-Gesellschaft für Südwestafrika gegründet.[S. 400] Da im Schutzgebiet mangels einer deutschen Staatsgewalt wenig sichere Zustände herrschten, war seitens der Gesellschaft auf dem neuerworbenen Besitz nicht viel zu machen, und auch das wenige, was geschah, bot nur geringe Aussichten auf Gewinn. Zu ihren verfehlten Unternehmungen ist z. B. auch eine Konservenfabrik in Sandwichshafen zu rechnen. Unter solchen Umständen war es kein Wunder, wenn die Kolonial-Gesellschaft Anerbietungen ausländischen Kapitals zum Verkauf ihrer Rechte, wie sie im Jahre 1889 und 1890 an sie herangetreten sind, ein williges Gehör schenkte. Beide Male scheiterte jedoch der Verkauf an dem Veto der Aufsichtsbehörde (des Reichskanzlers). Dagegen gelang der Gesellschaft 1894 ein Vertrag mit einem englischen Unternehmer, der diesem die Ausbeutung der Guanolager bei Kap Croß gegen eine Pachtzahlung von jährlich 10000 Mark überließ. Diese Pachtsumme war sehr niedrig bemessen, umsomehr aber ließ sie der Kolonialverwaltung Raum zur Einziehung eines Teiles des Gewinnes in Gestalt eines bedeutenden Zolles auf die Guanoausfuhr. Im ganzen sind durch letzteren während der neunjährigen Tätigkeit des Unternehmens der Reichskasse 1300000 Mark zugeführt worden.
Auch auf dem Gebiete des Bergbaues sowohl wie der eigenen landwirtschaftlichen Tätigkeit ist die Gesellschaft zuzeiten rührig gewesen.[109] An der letztgenannten Tätigkeit hat sie aber gleichfalls nicht viel Freude erlebt. Ihre Unternehmungen sind durchweg mißglückt. Eine aktive Siedlungstätigkeit auf ihrem Landbesitz hat sie dagegen nicht entfaltet. Sie verkauft einfach an Liebhaber, die von selbst kommen, und zwar wie die anderen Landgesellschaften zu einem höheren Preise als die Regierung. Zuweilen drangen auch Klagen an das Gouvernement, daß die Gesellschaft mit Landverkäufen zurückhalte, was sie aber stets in Abrede gestellt hat. Einen Lichtblick für sie bildete dagegen wieder das Steigen der Bodenpreise in den zu ihrem Landbesitz gehörigen Eingangshäfen des Schutzgebietes, Swakopmund und Lüderitzbucht, eine Gunst des Schicksals, eine sie jedoch lediglich der kolonisatorischen Tätigkeit des alten Vaterlandes zu verdanken hat. Ohne diese würde weder der Sandboden in Swakopmund noch derjenige in Lüderitzbucht etwas wert sein. Indessen hat sie schon derart reichliche Nackenschläge erlitten, daß ihr diese kleine Freude gegönnt werden mag.
Aus dem Gebiete des Bergbaues hat die Deutsche Kolonial-Gesellschaft mangels ausreichenden Betriebskapitals sich von eigenen bergmännischen[S. 401] Arbeiten fern gehalten. Dagegen hat sie wenigstens ihr Gebiet durch Ausgabe von Schürfscheinen dem allgemeinen Wettbewerb erschlossen, selbstverständlich aber wieder zu einem etwas höheren Preise, als die Regierung verlangt. Ihr Gebiet hat sich bis jetzt neben demjenigen der South West Africa Company als das mineralreichste des Schutzgebietes erwiesen. Zahlreiche Kupfervorkommen sind dort von allen Seiten gemeldet, darunter zwei, an deren Abbauwürdigkeit nicht mehr zu zweifeln ist. Es sind dies die Otjisongatimine bei Okahandja und die Gorobmine am unteren Kuiseb. Aus diesen beiden Minen dürfte für die Gesellschaft ein reicher Gewinn, für das mittlere Schutzgebiet aber ein bedeutender Aufschwung zu erwarten sein.
Ihr Betriebskapital beträgt 1300000 Mark bei einem Aktienkapital von 2000000 Mark, viel zu wenig für die Erschließung ihres bedeutenden Gebietes. Verkauft hat sie von letzterem bis zu Beginn des Aufstandes an Farmen rund 155000 ha, an Bauplätzen rund 141000 qm, verpachtet an Farmen rund 140000 ha, an Bauplätzen rund 18000 qm. Der Erlös betrug aus Verkäufen rund 240000 Mark, aus Verpachtungen rund 33000 Mark. Der Aufstand hat der Gesellschaft gleichfalls bedeutende Verluste gebracht, doch hat sie wenigstens einen Ausgleich in der durch ihn gestiegenen Entwicklung der beiden Hafenplätze Swakopmund und Lüderitzbucht gefunden.
Während wir mit der Deutschen Kolonial-Gesellschaft für Südwestafrika als mit einem auf der historischen Entwicklung des Schutzgebietes beruhenden Unternehmen rechnen und somit deren Bestehen als eine gegebene Tatsache hinnehmen müssen, ist die Siedlungsgesellschaft für Deutsch-Südwestafrika unter entschiedenem Widerstande aus dem Schutzgebiete heraus entstanden. Sowohl mein Vorgänger, der Major v. François, wie ich und mein Vertreter, der jetzige Gouverneur v. Lindequist, sind Gegner ihrer Gründung gewesen. Sie verdankt ihr Entstehen einer Zeit, in der man — im Gegensatz zu heute — das Betreiben des Siedlungsgeschäftes von Regierungs wegen für bedenklich hielt und dasselbe lediglich der Privattätigkeit überlassen zu müssen glaubte. Die Gründer der Gesellschaft sind wohl auch von patriotischen Erwägungen geleitet gewesen. Darauf läßt schon die Tatsache schließen, daß sie aus dem Schoße der Deutschen Kolonial-Gesellschaft erwachsen, und daß ihr erster Präsident, Fürst zu Hohenlohe-Langenburg, eine kurze Zeit auch Präsident des Siedlungs-Syndikats (Vorgängerin der Gesellschaft) gewesen ist. Nach langen Verhandlungen, die bereits im Jahre 1892 begonnen hatten, erfolgte im Jahre 1896 die endgültige Verleihung der Konzession an das Syndikat unter der Bedingung, daß es sich[S. 402] in eine Kolonial-Gesellschaft mit einem Betriebskapital von 300000 Mark umwandle. Eine Zeitlang hatte es geschienen, als ob man an leitender Stelle in Berlin durch die Berichte aus dem Schutzgebiete in bezug auf die Nützlichkeit der Gründung einer neuen landbesitzenden Gesellschaft — der sechsten im Schutzgebiet — wieder schwankend geworden wäre. Welche Einflüsse schließlich doch den Ausschlag zugunsten der Gesellschaft gegeben haben, ist nicht bekannt geworden. Sollten sie auf den Vorstand der neuzugründenden Gesellschaft selbst zurückzuführen sein, so hat dieser damals gewiß mehr Freude aus dem Unternehmen erwartet, als er in der Folge gefunden hat. Gerade diese Gesellschaft mußte infolge ihrer geographischen Lage dicht vor den Toren Windhuks ganz von selbst zum Stein des Anstoßes sowohl für das Gouvernement wie für die Ansiedler werden. Für ersteres, weil ihr Vorhandensein dessen eigene Siedlungstätigkeit beengte, für die Ansiedler, weil sie naturgemäß nach deren geographisch so günstig gelegenem Gebiete strebten und daher sogleich Gelegenheit hatten, Anstoß an den höheren Preisen der Gesellschaft zu nehmen.
Im Schutzgebiet selbst rissen die Differenzen zwischen der Regierung und dem Gesellschaftsvertreter nie ab. Erst mit dem Auftreten des letzten, zur Zeit noch im Schutzgebiet befindlichen Gesellschaftsvertreters kam eine versöhnlichere Stimmung in die beiderseitigen Beziehungen, was aber das Weiterbestehen sachlicher Meinungsverschiedenheiten — weil eben unvermeidlich — nicht zu unterbinden vermochte. An gutem Willen, etwas zu leisten, hat es der Siedlungsgesellschaft gewiß nicht gefehlt, schon weil damit auch der Begriff »Verdienen« für sie verbunden war. Untätigkeit kann man ihr daher keineswegs zum Vorwurf machen. Anderseits aber krankte sie sehr an ihrem zu geringen Betriebskapital — von dem an sich schon unbedeutenden Grundkapital von 300000 Mark sind bis jetzt nur 163000 Mark eingezahlt — sowie ferner an der bereits beleuchteten Tatsache, daß eine Besiedlungstätigkeit für eine Aktiengesellschaft das ungeeignetste Arbeitsfeld ist. Wenn sie ihre Aufgabe richtig auffaßt, soll die Gesellschaft Ansiedler anwerben, herausbefördern, mit Vieh, Baumaterial und Saatgut, sogar mit Geld unterstützen, ihnen Wasser erbohren und für alle diese Aufwendungen Gewinn erst in langer Sicht suchen, d. h., wenn der Einwanderer wirtschaftlich erstarkt ist. Zu einer solchen Art der Besiedlungstätigkeit gehören jedoch viel Mittel und viel Geduld. Die ersteren besitzt die Gesellschaft nicht, und die letztere paßt nicht zu dem Begriff »Aktionär«. Die Siedlungsgesellschaft hat daher auch eine direkte aktive Siedlungstätigkeit mit verschwindenden Ausnahmen[S. 403] nie betrieben, sondern gleichfalls abgewartet, bis die ansiedlungslustigen Einwanderer von selbst kamen.
Die der Gesellschaft verliehenen Rechte bestanden in der Überweisung von 20000 qkm Land zum Zwecke der Besiedlung mit Deutschen oder deutschredenden Einwanderern, wogegen sie die Verpflichtung übernahm, aus dem Erlös für den Verkauf oder die Verpachtung des Landes 10 vH. an die Regierung zu entrichten und 15 bis 30 vH. auf Verbesserung des Landes zu verwenden. Nach Ablauf von 25 Jahren sollte dann alles nichtverkaufte oder nicht verpachtete Land an die Regierung zurückfallen. Die an die Verleihung der Konzession geknüpfte Bedingung der Aufbringung eines Kapitals von 300000 Mark hat die Gesellschaft nur mit Mühe und Not zu erfüllen vermocht. Diese Kleinigkeit störte indessen den damaligen unerschrockenen Gesellschaftsvertreter im Schutzgebiete 1896 nicht; er stellte mutig den Antrag auf Überweisung des Landes auch ohne Nachweis der 300000 Mark und zeigte sich über den erhaltenen abschlägigen Bescheid höchst ungehalten.
Die Leistungen der Gesellschaft bestehen in erster Linie in der Errichtung zweier eigenen Viehzuchtsfarmen in der Nähe von Windhuk. Vor dem Ausbruch des Aufstandes befanden sich daselbst rund 740 Stück Großvieh und 1400 Stück Kleinvieh. Aus dieser Farm erhielten auch junge Landwirte gegen Zahlung von 130 Mark im Monat freie Station sowie Gelegenheit, sich über den Wirtschaftsbetrieb zu unterrichten. Gut gedacht war diese Sache jedenfalls. Ich habe indes bereits ausgeführt (S. 168), daß genossenschaftliche Viehfarmen mit einem bezahlten Leiter an der Spitze nie dieselben Leistungen aufzuweisen haben wie Privatfarmen. Denn der Eigentümer muß seine Farm persönlich leiten und sich um das Gedeihen seiner Rinder selbst kümmern. In der unweit der beiden Siedlungsfarmen gelegenen Farm des tatkräftigen Hauptmanns a. D. v. François konnte nach meinem Dafürhalten z. B. ein afrikanischer Neuling mehr lernen als auf den ersteren. In diesem Umstande liegt ja auch der Grund für das bereits erwähnte Mißlingen der Farmtätigkeit der Deutschen Kolonial-Gesellschaft für Südwestafrika. Damit soll kein Vorwurf gegen die Gesellschaft ausgesprochen werden. Ihre Bestrebungen auf diesem Gebiete sind auf alle Fälle anzuerkennen. Jedenfalls hat die Siedlungsgesellschaft mit dieser Seite ihrer Tätigkeit wenigstens in etwas den Zweck ihrer Gründung erfüllt, wie sie überhaupt von allen unseren landbesitzenden Gesellschaften sich ihrer Ansiedler immerhin noch am meisten angenommen hat. Wenn sie trotzdem zu einem Stein des Anstoßes geworden ist, so liegt die Ursache weniger in ihrer[S. 404] Tätigkeit wie in ihrem Dasein überhaupt, dessen Notwendigkeit für die Entwicklung des Schutzgebietes jetzt, nachdem sie zehn Jahre Zeit gehabt hat, sie zu beweisen, immer noch durchaus zweifelhaft erscheint.
Den Stein des Anstoßes für das Gouvernement, d. h. die Einengung der Besiedlungstätigkeit des letzteren, hat dagegen die Gesellschaft in der Folge beseitigen helfen. Gelegentlich meines ersten Heimatsurlaubs habe ich auf diesen Mißstand hingewiesen und bei dem damaligen Kolonialdirektor, dem leider jetzt verstorbenen Staatssekretär v. Richthofen, volles Verständnis gefunden. Die Siedlungsgesellschaft verzichtete damals zugunsten des Gouvernements für 15 Jahre auf die Hälfte ihrer Landkonzession, mithin auf 10000 qkm, unter der Bedingung, daß das, was bis dahin von dieser nicht verwertet sei, wieder an die Gesellschaft zurückfalle. Von dem Erlös für die innerhalb des fraglichen Gebietes verkauften Farmen hat sich die Gesellschaft ferner einen Anteil vorbehalten, der nach Verwertung sämtlicher 10000 qkm die Hälfte ihres Aktienkapitals, somit 150000 Mark, erreichen sollte. Doch hat sie 100000 ha behufs unentgeltlicher Überlassung an ehemalige Angehörige der Schutztruppe freiwillig abgezweigt, wohl unter einem kleinen Drucke seitens des Präsidenten der Kolonial-Gesellschaft, des Herzogs Johann Albrecht. Letzterer Umstand soll aber die Anerkennung für ihr in dieser Sache bewiesenes Entgegenkommen nicht beeinträchtigen.
Schließlich hat die Gesellschaft sich auch mit einem Beitrag von 20000 Mark an einem sogenannten Bewässerungssyndikat beteiligt, das durch Sachverständige die Zweckmäßigkeit der Anlegung von Stauanlagen im Schutzgebiet untersuchen sollte. An der Spitze dieses Syndikats stand zuerst Ingenieur Rehbock und dann Ingenieur Kuhn. Beide Herren haben sehr wertvolle Arbeiten geliefert, die aber bis jetzt leider nur auf dem Papier stehen.
Von ihrem Landbesitz hat die Gesellschaft bis Ende 1903 rund 81270 ha verkauft und dafür 148400 Mark erlöst. Dies gibt einen Durchschnittspreis von 1,80 Mark pro ha. Aus dem Verkauf von Gartenland in Klein Windhuk — sogenannten Heimstätten — hat sie außerdem einen Gewinn von 17000 Mark erzielt. Dazu kommen noch die Gewinne aus der Dampferverbindung mit der Heimat, die sie während der ersten fünf Jahre ihres Bestehens in eigene Verwaltung genommen hatte. Sämtliche Gewinne hat sie nicht zur Verteilung gebracht, sondern der Reserve zugeführt. Nach ihren Angaben hat sie insgesamt 560000 Mark zu Gesellschaftszwecken verwendet, mithin rund 400000 Mark mehr, als ihr Betriebskapital beträgt.
[S. 405] In Zusammenfassung des in diesem Abschnitt Gesagten wiederhole ich, daß die Form, in der wir das genossenschaftliche Kapital zur Mitwirkung bei der Entwicklung des Schutzgebietes bis jetzt herangezogen haben, sich mit zwei Ausnahmen als ungeeignet erwiesen hat. Diese Ausnahmen haben uns den Weg gezeigt, den wir künftig einzuhalten haben. Die Otavi-Gesellschaft baut z. B. eine bestimmt bezeichnete Bahn und beutet bereits festgestellte Mineralfunde aus. Dem genossenschaftlichen Kapital dagegen aufs Geratewohl große Länderstrecken behufs Besiedlung sowie Bergbau zu überlassen, heißt gleichsam mit Gewalt zwischen einen Arbeitgeber und einen Arbeitnehmer einen überflüssigen Dritten einschieben. Denn sowohl der landwirtschaftliche Betrieb wie das Schürfen auf Mineralien ist Sache des Einzelkapitals. Und letzteres setzt sich mit dem Vorbesitzer, d. i. in diesem Falle mit der Regierung, besser direkt auseinander als mit einer nach eigenem Gewinn trachtenden Aktiengesellschaft. Es wäre daher jetzt, nachdem dies erkannt ist, sowohl für die Kolonialverwaltung wie für die Gesellschaften selbst ein Glück, wenn sich — ich wiederhole es — ein Weg finden ließe, auf dem beide Teile mit Anstand wieder aus einer unhaltbar gewordenen Lage herauszukommen vermöchten.
Wie unter dem Abschnitt Konzessionsgesellschaften bereits erwähnt, hatte die Kolonialverwaltung zu Beginn unserer Kolonisation von einer Besiedlung von Regierungs wegen abzusehen und diese in der Gegend von Windhuk, Hoachanas und Gobabis dem Syndikat für Siedlungswesen übertragen zu sollen geglaubt. Das letztere begann seine Tätigkeit mit Entsendung eines Landmessers in das Schutzgebiet und mit Vermessung sogenannter Heimstätten in Klein-Windhuk sowie der Abgrenzung von einigen Farmen außerhalb. Ferner faßte damals das Syndikat seine Tätigkeit insofern richtig auf, als es nicht wartete, bis die Ansiedler von selbst kamen. Es warb vielmehr solche an und sandte sie, zum Teil noch mit Geldmitteln unterstützt, in das Schutzgebiet. Doch blieb das ganze schön gedachte Unternehmen in seinen Anfängen stecken, da einerseits die politischen Verhältnisse des Schutzgebietes — damals tobte noch der Witbooikrieg —, anderseits die noch ungeregelten Besitzverhältnisse wie endlich die unzureichende Organisation des Syndikats dessen Tätigkeit Schranken zogen. So fand ich die Lage, als ich 1894 das Schutzgebiet betrat und hierüber nach Berlin berichtete. Insbesondere hatten auch die Hereros die Farmvermessungen des Syndikats[S. 406] außerhalb Windhuks mit Mißtrauen betrachtet. Von da ab stockte dann die Tätigkeit des letzteren, bis es sich 1896 in die jetzt noch bestehende Siedlungsgesellschaft für Deutsch-Südwestafrika umwandelte.
Aber eine Errungenschaft des Syndikats ist auf deren Nachfolgerin übergegangen, nämlich der bei dessen Gründung festgesetzte Minimalpreis von 2 Mark pro Hektar. Zunächst war das Gouvernement diesem Wege gefolgt, hat ihn jedoch trotz Widerstrebens der Gesellschaft bald wieder verlassen, da bei einem so hohen Preise nur reiche Leute bestehen können und auf die Einwanderung von solchen in den seltensten Fällen zu rechnen war. Die Regierung setzte daher bald den Mindestpreis für einen Hektar auf 1 bis 1,50 Mark fest und ging im Jahre 1898 auf 0,50 bis 1 Mark herunter für wehrpflichtige Reichsangehörige sogar bis 0,30 Mark, Angehörige der Schutztruppe brauchten gar nichts zu entrichten. Die übrigen Bedingungen aber wurden enger gezogen als bei den Gesellschaften, mit dem Ziel, jede Spekulation mit dem so billig erworbenen Lande auszuschließen. Die allgemeinen Bedingungen für den Verkauf von Farmen sowie die Vorzugsbedingungen für wehrpflichtige Reichsangehörige sind in Anlage 4 beigefügt. Übrigens ist die Siedlungsgesellschaft, wenn sie auch theoretisch an ihrem Mindestpreis von 2 Mark pro Hektar festgehalten hat, in der Praxis doch mannigfach unter ihn gegangen, so daß, wie wir gesehen haben, ihr Durchschnittspreis — aber auch noch zu hoch — 1,80 Mark betragen hat.
Nach weiteren Erfahrungen hat sich die Kolonialverwaltung dem Gedanken nicht verschließen können, daß der Ansiedler neben billigstem Erwerb des Landes auch noch namhafte Barunterstützung erhalten müsse, wenn die Besiedlung des Schutzgebietes in regeren Fluß gebracht werden soll. Zum Nachweis dessen hatte ich im Jahre 1902 durch einen Sachverständigen die Anlagekosten für eine Farm von 5000 ha zu einem Preise von 2 Mark pro Hektar berechnen lassen. Es ergab sich folgendes Bild: Der Farmer zahlt bei einem Gesamtpreise von 2 × 5000 = 10000 Mark für die Farm:
| 1. 1/10 Anzahlung (sowohl Regierungs- wie Gesellschaftsbedingung) | 1000 | Mark. | |
| 2. Für Anschaffung von Großvieh (20 Kühe, 1 Bulle) | 4000 | " | |
| 3. 100 Stück Kleinvieh | 1200 | " | |
| 4. Zum Bau eines Hauses | 5000 | " | |
| 5. Für zwei Pferde | 800 | " | |
| Transport | 12000 | Mark. | |
| [S. 407]6. Eine Ochsenkarre mit 12 Zugochsen | 3600 | " | |
| 7. Für Handwerkszeug und sonstige Wirtschaftsgeräte | 1000 | " | |
| 8. Für Verpflegung für sich und 5 Eingeborene | 1095 | " | |
| 9. Desgleichen für das zweite Jahr | 1095 | " | |
| Summa | 18790 | Mark. | |
Bei dieser Berechnung ist mit Recht angenommen, daß der Farmer auf Erträgnisse aus seiner Viehzucht für das erste und das zweite Jahr nicht rechnen könne. Mithin könnte ein Einwanderer nur mit mindestens 20000 Mark Vermögen an einen solchen Ankauf herantreten, und als Ergebnis seiner Arbeit bliebe ihm dann nach den ersten zwei Jahren ein Rest von 1210 Mark. An den Ankauf einer etwas größeren Farm würde dagegen ein Einwanderer mit dem genannten Vermögen gar nicht denken können. Denn im Falle des Ankaufs einer Farm von 10000 ha würden z. B. die Landpreise allein einschließlich Zinsen innerhalb 15 Jahren
| bei | einem | Verkaufspreis | von | 2,00 | Mark | 27160 | Mark | |
| " | " | " | " | 1,50 | " | 20620 | " | |
| " | " | " | " | 0,50 | " | 6900 | " |
betragen. Wer zu 2 Mark gekauft hat, hat alljährlich im Durchschnitt für Ratenzahlungen und Zinsen 1600 Mark aus der Farm herauszuwirtschaften. Für denjenigen, der zu 1,50 Mark gekauft hat, beträgt die Summe 1000 bis 1200 Mark. Daneben will aber auch noch der eigene Lebensunterhalt verdient sein. Unter solchen Bedingungen kann kein Farmer bestehen, es sei denn, daß er den Kaufpreis für die Farm nebst den Kosten für den Wirtschaftsbetrieb und den ersten Lebensunterhalt, zusammen im Betrage von 30000 bis 40000 Mark, bereits in der Tasche mitbringt. Und auf derart finanziell gutgestellte Leute können wir nur in ganz beschränktem Maße rechnen.
Welchen Einfluß aber die Farmpreise auf die Stärke der Einwanderung ausüben, mögen folgende Zahlen beweisen. In den Jahren 1898 bis 1902 sind seitens der Regierung wie aus den Stammesgebieten der Eingeborenen, welch' letztere gleichfalls annähernd zu Regierungspreisen verkaufen, an Ansiedlungslustige 1093694 ha verkauft worden, seitens sämtlicher Konzessionsgesellschaften dagegen während der ganzen Zeit ihres Bestehens zusammen nur 324510 ha, dazu verpachtet 478505 ha. Die letztere Zahl spricht auch[S. 408] noch ihre besondere Sprache. Während die Regierung von der Abgabe mittels Verpachtung ganz abgesehen hat, übertrifft bei den Gesellschaften der Flächeninhalt des verpachteten Landes denjenigen des verkauften. Der Gedanke liegt daher nahe, daß die letzteren Verpachtungen vorziehen, um an der künftigen Wertsteigerung des Landes ihren Anteil zu behalten; ein Gedanke, den man ja Erwerbsgesellschaften nicht übelnehmen kann. Der Fehler liegt lediglich in dem Vorhandensein von solchen zu Besiedlungszwecken.
Um indessen die Besiedlung in noch rascheren Fluß zu bringen, wurden von seiten der Kolonialverwaltung im Etat 1901 zunächst 100000 Mark als Ansiedlungsbeihilfen eingestellt. Mit dieser Summe sind 28 Soldaten angesiedelt worden, mithin jeder mit einem Zuschuß von 3000 bis 4000 Mark, der in Form von Vieh, Baumaterial und landwirtschaftlichen Gerätschaften gegeben wurde. Als Bedingung war den Bewerbern der Nachweis eines eigenen Kapitals von 2500 Mark auferlegt, einer Summe, die ein sparsam wirtschaftender Soldat sich während seiner Dienstzeit erübrigen konnte. Letzteres gab dann die Gewähr, daß aus dem Unterstützten ein brauchbarer Ansiedler würde, wie es denn überhaupt unrichtig wäre, einen Farmer ausschließlich mit fremder Beihilfe wirtschaften zu lassen. Nur wenn er auch eigene Mittel in seinen Betrieb hineingesteckt hat, wird er das erforderliche Interesse daran behalten.
Der Versuch, einen Farmbetrieb mit so wenig Betriebskapital beginnen zu lassen, konnte man den Angehörigen der Schutztruppe gegenüber schon wagen, da deren bereits erworbene Landeskenntnis allein schon mehrere tausend Mark wert war. Sie hatten ferner keine Übersiedlungskosten zu tragen und konnten auch die Auswahl ihrer Plätze schon während ihrer Dienstzeit, mithin ganz kostenlos, treffen. Ferner war ihnen ausnahmsweise für eine gewisse Zeit vor dem Ausscheiden aus der Schutztruppe das Halten eigener Viehposten gestattet, so daß sie auch in bezug auf Ankauf von Zuchtvieh die besten Preise sowie die günstigsten Gelegenheiten erfassen konnten. Tatsächlich sind diese Ansiedler auch gut fortgekommen, jedenfalls besser als in der Heimat, wo sie fast durchweg den besitzlosen Klassen angehört haben würden.
Im Jahre 1903 trat man dann an einen Versuch zur Besiedlung in größerem Stil heran, indem auf die Anregung des damaligen Kolonialdirektors Dr. Stuebel in den Etat 300000 Mark eingestellt wurden.[S. 409] Von dieser Summe sollten 100000 Mark für eine Kommission abgezweigt werden, die nach eingehendem Studium, auch in den Nachbarkolonien, praktische Vorschläge für eine allgemeine Besiedlung des Schutzgebietes vorzulegen hatte. Sie sollte aus einem Beamten als Vorsitzendem, einem weiteren Beamten des Gouvernements als Sachverständigem und mehreren Angehörigen der Farmerkreise des Schutzgebietes zusammengesetzt werden. Als Einwanderer waren deutsche Bauernfamilien mit tadellosem Leumund, die auch über eigene Mittel verfügten, in Aussicht genommen. Der aufgestellte Voranschlag zur Ansiedlung für eine Familie von 4 Köpfen wies folgende Zahlen auf:
| 1. | Kosten der Reise vom Wohnort in der Heimat bis zur Farm: | |||
| a) Zwischendeck Hamburg-Swakopmund, 4 mal 250 Mark | 1000 | Mark, | ||
| b) Reisekosten vom Wohnorte nach Hamburg und Unkosten an Bord | 300 | " | ||
| c) Reise- und Frachtkosten im Schutzgebiete | 200 | " | ||
| 1500 | Mark. | |||
| 2. | Acker- und Wirtschaftsgeräte (Pflüge, Egge, Beile, Spaten, Schaufeln, Harken, Picken, Buttermaschine, Maismühle) | 1000 | " | |
| 3. | Baumaterialien für ein Wohnhaus und innere Einrichtung | 3500 | " | |
| 4. | Sämereien, Kartoffeln für zwei Ernten | 200 | " | |
| 5. | Eine Ochsenkarre | 1200 | " | |
| 6. | 10 Zugochsen à 200 Mark | 2000 | " | |
| 7. | 10 Milchkühe à 150 Mark | 1500 | " | |
| 8. | Ein Bulle | 200 | " | |
| 9. | 50 Schafe und Ziegen | 600 | " | |
| 10. | Eine Reitstute mit Fohlen | 400 | " | |
| 11. | Verpflegung einer Familie von vier Köpfen auf die Zeit von 1½ Jahren oder rund 550 Tagen, auf den Tag 4 Mark gerechnet | 2200 | " | |
| 12. | Verpflegung für drei Eingeborene für die gleiche Zeit pro Tag 1,50 Mark, in der Annahme, daß denselben Milch aus eigenem Betriebe gegeben wird | 825 | " | |
| 13. | Bar zu sonstigen Bedarfsgegenständen | 875 | " | |
| Insgesamt | 16000 | Mark. | ||
[S. 410] Zu dieser Summe tritt noch der Kaufpreis für das Land in der üblichen Höhe von 0,50 bis 1 Mark. In Berücksichtigung dieser Auslagen wie des Staatszuschusses müßte der Einwanderer daher über eigene Mittel von etwa 10000 Mark verfügen und könnte somit seine Wirtschaft im Schutzgebiete mit einem Betriebskapital von insgesamt 20000 bis 30000 Mark beginnen. Während er mithin in der Heimat nur ein mäßig begüterter Mann war, trat er im Schutzgebiet in die Reihe der Wohlhabenden, zumal er in bezug auf Zins- und Kapitalzurückzahlung seitens der Regierung keinen Druck zu erwarten hatte.
Die Vorbereitungen zur Durchführung dieses Planes waren im besten Gange, als sie durch Ausbruch des Hereroaufstandes jäh unterbrochen wurden. Darum darf und wird aber die Sache doch nicht aufgegeben werden. Unsere bisherigen Erfahrungen lehren eindringlich, daß ohne eine tatkräftige Unterstützung aus Staatsmitteln auf eine Besiedlung des Schutzgebietes im großen Stile nicht zu rechnen ist; ohne sie wird Südwestafrika auch ferner gleichsam nur »von der Hand in den Mund leben« und aus diesem Stadium der Entwicklung nicht herauskommen. Weiter wissen wir jetzt, daß zwar der südwestafrikanische Boden manche Werte birgt, daß diese aber erst durch hineingestecktes Kapital zur Auferstehung gebracht werden können, und zwar mit je mehr Kapital, um so rascher. Wenn wir es gewagt haben, landeskundige Angehörige der Schutztruppe mit nur 6000 bis 7000 Mark Betriebskapital anzusiedeln, so liegt hier eine Ausnahme vor, die ich oben begründet habe, aber nicht zur Regel lassen werden möchte. Ansiedler dieser Art vermögen wohl ihr eigenes Dasein zu sichern, niemals aber die Kolonie zu einem auf dem Weltmarkt konkurrierenden Viehzuchtland zu erheben. Letzteres ist aber unser Ziel, und dieses vermögen wir nur mittels Großbetrieb auf zahlreichen, Reihe an Reihe gelegenen Farmen zu erreichen. Aber auch die Großfarmer müssen, ehe sie an Ausfuhr denken können, selbst ausreichend mit Muttervieh versehen sein. Ansiedlungskommissar Dr. Rohrbach hält für die Möglichkeit einer nennenswerten Ausfuhr etwa 1000 Farmbetriebe mit je 200 bis 300 Stück Muttergroßvieh für erforderlich. Bei einem solchen Bestande rechnet er auf einen jährlichen Nachwuchs von 150000 Köpfen und infolgedessen mit einer Ausfuhrmöglichkeit von jährlich etwa 100000 Köpfen, einer Berechnung, der ich mich vollständig anschließe. Zählen wir zu dieser Ausfuhrmöglichkeit noch diejenige von Pferden, von Wolle, Mohair, Straußenfedern und sonstigen Produkten der Tierzucht, so vermag sich auch ohne Bergbau, lediglich gestützt auf die Ausnutzung des[S. 411] Bodens, Südwestafrika als lebensfähig erweisen. Aber, es kann nicht genug wiederholt werden, der Boden muß erst tüchtig befruchtet werden, soll er ertragsfähig werden, und zu dieser Befruchtung muß der einzelne viel Arbeit und etwas Kapital, die Allgemeinheit aber viel Kapital beitragen und sich dann ihren Anteil am Gewinn aus der Arbeit des einzelnen sichern.
Das Ziel jedes Einwanderers wird sein, in dem neuen Vaterlande diejenige Selbständigkeit zu gewinnen, die ihm das alte Vaterland versagt hat. In dem Erreichen dieses Zieles findet er den Ausgleich für die Entsagungen und Entbehrungen, die seiner in der Unwirtlichkeit des neuen Vaterlandes warten. Nach diesem Gesichtspunkt müssen sonach die dem Einwanderer für den Landerwerb zu stellenden Bedingungen zugeschnitten sein, wenn namentlich eine deutsche Einwanderung ermutigt werden soll. Denn bei uns ist der bürgerliche Kleinbesitz durchweg verbreiteter als in anderen Ländern, und daher auch dem weniger bemittelten Landwirt schon in der Heimat die Möglichkeit zur Erreichung eines eigenen Wirtschaftsbetriebes geboten. Um so kleiner ist aber auch der Kreis, auf den wir bei einer künftigen deutschen Einwanderung rechnen können, und um so verlockender müssen wir daher wiederum die Ansiedlungsbedingungen gestalten. Auf der anderen Seite aber müssen diese Bedingungen wieder derart begrenzt sein, daß sie jedwede Spekulation mit dem unter so leichten Bedingungen erworbenen Lande ausschließen. Dagegen wird das künftige Besiedlungswerk durch die Tatsache erleichtert werden, daß jetzt die freien Eingeborenenstämme mit ihren großen Landeigentumsrechten aus der Berechnung ausscheiden, sowie ferner, wenn es gelingen sollte, auch den Landbesitz der Gesellschaften unter für beide Teile befriedigenden Bedingungen der staatlichen Besiedlung nutzbar zu machen, wie es den Anschein hat.
Zwar sind die bisherigen Ansiedlungsbedingungen für den Verkauf von Regierungsfarmen, wie sie in Anlage 4 wiedergegeben sind, schon von dem oben dargelegten Gesichtspunkte aus aufgestellt, indessen waren wir auf diesem schwierigen Gebiete doch aus dem Versuchsstadium noch nicht herausgekommen. Die genannten Bedingungen sind daher durchaus nicht mustergültig, und waren auch bereits in der Umarbeitung begriffen, als der Aufstand diese Absicht, wie so viele, durchkreuzt hat. Im allgemeinen wird man immer das Richtige treffen, wenn der Möglichkeit eines leichten und billigen Landerwerbs der Zwang zur Leistung bestimmt abgegrenzter wirtschaftlicher[S. 412] Arbeiten auf dem erworbenen Grund und Boden gegenübergestellt wird, so daß der Ankauf einer Farm ausschließlich zum Zweck des Wiederverkaufs bei günstiger Gelegenheit unterbunden ist. Die Kaufbedingungen müssen daher immer ein Rückforderungsrecht seitens der Regierung enthalten.
Für praktisch halte ich den Vorschlag des Ansiedlungskommissars Dr. Rohrbach, behufs Durchführung des Besiedlungswerkes für jeden Verwaltungsbezirk eine besondere Ansiedlungskommission einzusetzen. Diese würde dann auch die Verkaufsbedingungen mit zu beraten haben. Die in die Kommission zu berufenden nichtamtlichen Mitglieder dürfen jedoch nur aus selbständigen Landwirten bestehen und keinem anderen Berufe angehören. Dr. Rohrbach schlägt ferner vor, im Schutzgebiete jährlich etwa 100 neue Farmwirtschaften mit etwa 50 Stück Muttervieh beginnen zu lassen; dann würde am Ende des achten Wirtschaftsjahres der Bestand an Muttervieh 250 Stück erreicht haben und somit für den Farmer die Verkaufsmöglichkeit beginnen. Für den männlichen Nachwuchs würde dagegen diese Möglichkeit schon früher eintreten. Um dieses Ziel in absehbarer Zeit für das Schutzgebiet zu erreichen, wünscht Dr. Rohrbach einen jährlichen staatlichen Zuschuß zu Besiedlungszwecken von 1000000 Mark steigend bis 1500000 Mark und glaubt dann das ganze Werk in zehn Jahren als beendigt ansehen zu dürfen. Über die Einzelheiten dieses Planes kann man verschiedener Ansicht sein, aber seine Grundsätze sind ohne Frage gesund, und geschehen muß in der Sache auf alle Fälle etwas.
Auch wenn Dr. Rohrbach die Auswahl der künftigen Farmer möglichst auf die verheirateten heimischen Landwirte beschränkt wissen will, kann ich mich dem nur anschließen. Der einsam auf seiner Farm wohnende weiße Ansiedler verfällt zu leicht dem Konkubinat mit einer eingeborenen Frau, die ihm gleich auch ihren ganzen Familienkreis mitbringt. Dann ist es aus mit dem Weißen, er »verkaffert« vollständig, während seine Bastardkinder weder für das alte Vaterland noch für die Zukunft der Kolonie viel Wert besitzen. Nicht vernachlässigen dürfen wir aber auch die weitere Ansiedlung alter Soldaten aus der Schutztruppe, auf deren besondere Brauchbarkeit ich bereits im vorigen Abschnitt hingewiesen habe. Vergünstigungen, die man ihnen zuteil werden läßt, werden daher auch künftig lohnend erscheinen.
In engem Zusammenhang mit der Frage einer Besiedlung Südwestafrikas steht die nach der Zweckmäßigkeit einer
Mit ihr kommen wir auf eine Frage, die in den letzten Jahren in Deutschland viel besprochen worden ist und manchen Widerstreit der Meinungen hervorgerufen hat, deren Beantwortung jedoch nach meiner Ansicht nicht schwierig ist, wenn sie, wie naturgemäß, lediglich an Hand der Forderungen des nationalen Egoismus erfolgt. Indessen, wir Deutsche vermögen — was rein menschlich betrachtet uns ja Ehre macht, aber politisch nichts einbringt — diesen selbstverständlichen Standpunkt nicht immer beizubehalten, obwohl es eine alte Erfahrung ist, daß Kolonien, wenn sie einmal politisch und wirtschaftlich erstarkt sind, für das alte Vaterland leicht zu undankbaren Kindern werden. In ihnen erwacht dann die Neigung, unter Mißachtung der empfangenen Wohltaten dem Mutterlande schnöde den Rücken zu drehen, falls dieses für die gebrachten Opfer auch einmal eine Gegenleistung verlangt. Und diese Neigung wird umsomehr zum Durchbruch kommen, je weniger die Kolonien durch Stammes- und Spracheneinheit mit dem alten Vaterlande verbunden sind. Darum gebietet uns der nationale Egoismus, unsere Opfer auf die Ansiedlung von Reichsdeutschen sowie von solchen, die es werden wollen, zu beschränken, ohne aber etwa anderen unsere Grenzen zu verschließen. Auch sie mit ihrem Kapital und ihrer Arbeitskraft willkommen zu heißen, gebietet uns der nationale Egoismus, sofern sie keinen Staat im Staate bilden, sondern sich unseren Gesetzen fügen wollen. Aber dann mögen sie von selbst kommen, sowie auf eigene Rechnung und Gefahr. Für sie mittels staatlicher Unterstützung noch gleichsam eine Prämie auf Festhaltung ihrer fremden Nationalität zu setzen, solange die eigene noch Einwanderungsmaterial genug bietet, das ist mit einer gesunden nationalen Kolonialpolitik nicht zu vereinigen.
Diesen Standpunkt hat die Kolonialverwaltung der Bureneinwanderung gegenüber auch von Anfang an eingenommen. Ihr ist jedoch eine Zeitlang ein Teil der öffentlichen Meinung Deutschlands entgegengetreten, die in der Begeisterung über den tapferen Widerstand des kleinen Burenvolkes gegen das mächtige England in jedem Buren von Hause aus einen für Deutsch-Südwestafrika brauchbaren Ansiedler sehen wollte. Indessen geht es den Buren nicht anders als den anderen Nationen; auch bei ihnen sind die Gaben verschieden ausgeteilt, es gibt fleißige und unfleißige, brauchbare und unbrauchbare Buren.
[S. 414] Der Bur, im allgemeinen betrachtet, stellt sich als der richtige niederdeutsche Bauer mit allen seinen Vorzügen und Nachteilen dar. Er ist ehrlich, gastfrei, ein vortrefflicher Familienvater, dabei konservativ bis zum Übermaß, und daher zäh am Alten festhaltend. Bei dem lange Zeit in seiner innerafrikanischen Grassteppe abgeschlossen lebenden Buren hat sich die letztgenannte Eigenschaft in solchem Maße entwickelt, daß sie ihm schließlich wieder zum Nachteil geworden ist. Er ist in seiner ganzen Wirtschaft rückständig geblieben und folgt genau den wirtschaftlichen Geleisen seiner Vorfahren. Trotzdem aber hat der Bur in Afrika dem einwandernden Europäer gegenüber viel voraus, so daß für den Anfang er der Überlegene ist und letzterer von ihm lernen kann. Der Bur ist unabhängiger von den Genüssen Europas, seine persönlichen Bedürfnisse sind daher geringer, wogegen er die Hilfsmittel Afrikas besser auszunutzen versteht. Hat jedoch der Neuling dies gleichfalls gelernt, dann wird er seinerseits den Buren überholen, da dieser zu indolent ist, um nun auch vom Deutschen das, was er voraus hat, anzunehmen. Während daher mit einer starken Burenbesiedlung eine gesunde fortschreitende Entwicklung des Landes nicht zu erreichen wäre, können wir einzelne Buren als Lehrmeister für die deutsche Einwanderung nur willkommen heißen.
Zu einer landläufigen Redensart, wie es deren so viele gibt und die nicht auszurotten sind, ist ferner die Behauptung geworden, die deutschen Beamten sähen die Einwanderung von Buren nicht gern, weil diese in ihrem Freiheitsstolze dem »Bureaukratismus« zu viel Schwierigkeiten bereiteten. Nach meiner Erfahrung ist gerade das Gegenteil der Fall. Schwierigkeiten haben während meiner Amtsperiode der Verwaltung nur deutsche Ansiedler gemacht, niemals aber Buren. Nur mit den Gerichten kamen die minderwertigen Elemente unter den letzteren häufig in Konflikt. Sonst aber verstehen die Buren in Afrika sich in schwierigen Lebenslagen selbst zu helfen, insbesondere sind sie in der Behandlung der Eingeborenen durchweg geschickter als die übrigen Einwanderer. Daß sie dagegen im allgemeinen mehr Neigung zur Unbotmäßigkeit gegen die Gesetze zeigten als andere Nationen, ist mir nicht aufgefallen. Unbequem wurden sie nur durch eine gewisse, ihnen vielfach anhaftende Scheu vor der Seßhaftigkeit. Sie ziehen gern mit Ochsenwagen, Viehherden und ihren meist zahlreichen Familien von Wasserstelle zu Wasserstelle und entgehen auf diese Weise tunlichst den Kaufpreisen für den Landerwerb wie auch etwaigen sonstigen staatlichen Verpflichtungen. Diese den Buren anhaftende Neigung zum zigeunerähnlichen Umherziehen findet ihre Erklärung[S. 415] in ihrem Kinderreichtum sowie in ihrer geringen Lust zu einem anderen Berufe als zu dem des Viehzüchters. Der meist mit zahlreichen Söhnen gesegnete Bur ist nicht in der Lage, jedem der letzteren ein ausreichendes Weidefeld zu übergeben. Er setzt daher die mündig gewordenen jüngeren Söhne mit Frau und Kind auf einen Ochsenwagen, gibt ihnen etwas Vieh sowie das notwendigste Hausgerät, unter letzterem die nie fehlende Büchse nebst ausreichender Munition, mit und läßt sie in die weite Welt ziehen. Die wirtschaftlichen Elemente unter diesen jüngeren Söhnen erwerben sich vielleicht nach und nach die Mittel, sich seßhaft zu machen. Die übrigen aber gewöhnen sich an das Zigeunerdasein, sie leben von der Hand in den Mund und sehnen sich schließlich gar nicht mehr nach einem bleibenden Wohnsitz, d. h. sie werden und bleiben »Trekburen«. Mit Buren dieser Art war das südwestafrikanische Schutzgebiet bis zum Jahre 1898 überschwemmt. Die Rücksicht auf die immer mehr zunehmende deutsche Einwanderung gebot schließlich, diesem Wanderburentum ein Ende zu bereiten. Die Betreffenden wurden vor die Wahl gestellt, sich binnen einer bestimmten Frist seßhaft zu machen oder das Schutzgebiet zu verlassen. Die besseren Elemente machten sich auch sämtlich seßhaft, und diese sind für das Schutzgebiet von Nutzen geworden. Namentlich als Frachtfahrer sind die Buren unübertrefflich. Die übrigen aber verschwanden wieder. Diejenigen Buren dagegen — es waren allerdings nicht viele —, die bei Eingeborenenaufständen als Freiwillige in die Reihe der Schutztruppe traten, konnten geradezu als vorbildlich bezeichnet werden. Denn sie vereinigten mit den kriegerischen Vorzügen der Eingeborenen die höhere Kultur des Weißen.
Zweimal ist ferner im Schutzgebiete der Versuch einer Art amtlicher Ansiedlung von Buren gemacht worden, das erste Mal im Jahre 1895/96 durch die South West Africa Company im Gebiete von Grootfontein, das zweite Mal im Jahre 1900 durch die Regierung selbst mit Flüchtlingen aus dem Kriege in Transvaal. 1895 fand ich gelegentlich eines Besuches in Grootfontein (S. 82) im Gebiete der South West Africa Company an der sonst unbewohnten Wasserstelle ein neu entstandenes hübsches Burendorf, gegründet unter Heranziehung von Gesellschaftsmitteln durch den Gesellschaftsvertreter Dr. Hartmann. Die Buren, denen es auf diese Weise ganz gut ging, waren begeistert und erklärten in feierlicher Versammlung, sämtlich Deutsche werden zu wollen. Doch reichte diese Begeisterung nicht lange über die nächste Regenperiode hinaus. Denn, wie ich schon erwähnt habe (S. 179), war Grootfontein ein ebenso wasser- wie fieberreicher Platz,[S. 416] dessen Gesundheitsverhältnisse nur lediglich mittels Trainierungsarbeiten verbessert werden konnten. Diese Arbeiten zu leisten, waren die Buren anscheinend nicht geneigt, umsoweniger, als ihr rühriger Leiter Dr. Hartmann in dem genannten Jahre das Schutzgebiet verlassen hatte. 1897 fand ich die Masse dieser Buren in Omaruru, wohin sie sich, erschreckt durch ihre Fieberverluste, geflüchtet hatten. Der dortige Häuptling Manasse klagte mir bitter über diese Eindringlinge und verlangte den Schutz der Regierung gegen sie, nachdem sie auch dort, ohne jemand zu fragen, einfach Wasser und Weide in Mitbenutzung genommen hatten. Ihnen wurde daher gleichfalls anderweitige Seßhaftmachung oder Auswanderung auferlegt. Später nahm dann eine nach Grootfontein verlegte deutsche Garnison die erforderlichen Entwässerungsarbeiten unter der Leitung des Stabsarztes Dr. Kuhn in Angriff, und heute kann der Platz in bezug auf Gesundheitsverhältnisse mit jedem anderen des Schutzgebietes den Vergleich aushalten. Der erwähnte zweite Fall des Versuches einer Burenansiedlung aus dem Jahre 1900 endigte ebensowenig zufriedenstellend. Im ganzen wurden damals 27 Burenfamilien angesiedelt, über die nach zwei Jahren die Verwaltungsbehörden zum Bericht aufgefordert wurden. Das Ergebnis war, daß nur fünf von ihnen das Zeugnis wirklich brauchbarer Ansiedler erhalten haben.
Trotz dieser Erfahrungen bin ich jedoch weit entfernt, nunmehr den Stab über die Buren im allgemeinen zu brechen, sie sollen nur das Urteil über diese auf das richtige Maß zurückführen, d. h. dahin, daß es auch unbrauchbare Buren gibt und daß gerade diese zahlreich zu uns gekommen zu sein scheinen. Auch nach dem englischen Kriege müssen die besten Elemente in ihrer Heimat verblieben sein. Ganz naturgemäß, denn die Trümmer einer Farm sind immer noch mehr wert als gar keine. Die soliden Farmbesitzer haben daher im Vertrauen auf eine bessere Zukunft das Verbleiben in der Heimat vorgezogen. Irgend einer Beschränkung in der Einwanderung unterlag indessen selbstverständlich kein Bur. Nun wurden wiederholt an das Gouvernement herantretende Anträge auf staatliche Unterstützung bei Gründung holländischer Kirchen und Schulen abschlägig beschieden, die Gründung selbst aber keineswegs verhindert. Aus Mangel an Mitteln ist es aber dann in der Folge zu einer solchen nirgends gekommen. Nur hielten sich einige besonders reiche Buren holländische Hauslehrer, die Masse aber gab ihren Kindern entweder selbst Unterricht oder schickte sie in die Regierungsschulen. Aus der auf Seite 232 mitgeteilten Statistik ist zu[S. 417] ersehen, daß vor dem Aufstande im Schutzgebiete unter einer weißen Bevölkerung von 4683 Köpfen sich 973 Kapländer und Buren befanden, außerdem 101 Köpfe »ohne Staatsangehörigkeit«, die in überwiegender Mehrzahl von burischer Abkunft sind. Mithin bestand bereits etwa ein Viertel unserer weißen Bevölkerung aus Buren, was einerseits dem Bedarf genügen dürfte, anderseits aber auch beweist, daß von etwaiger Erschwerung einer Bureneinwanderung nie die Rede gewesen ist.
Nicht schließen will ich diesen Abschnitt, ohne den Buren in einem Punkte noch ein besonderes Lob zu spenden. Sie hüten sich vor der Vermischung mit Eingeborenen, und sind hierzu infolge der Möglichkeit einer frühen Verheiratung mit weißen Mädchen auch imstande. Diese Tatsache hat ihre Rasse rein erhalten und sie, die vermöge ihres einsamen Hirtenlebens ohnehin Neigung haben, sich dem Kulturzustande der Eingeborenen zu nähern, doch diesen überlegen erhalten. In früheren Zeiten, als weiße Frauen anscheinend noch fehlten, ist zwar eine Vermischung erfolgt. Das beweisen die Abkömmlinge aus Mischehen, die Bastards von Rehoboth und Rietfontein. Aber das waren vereinzelte, durch die Not herbeigeführte Ausnahmen. Andernfalls würden die Buren als weiße Nation längst verschwunden und zu einer Mischlingsrasse geworden sein, die sich, wie das Beispiel der Bastards Südwestafrikas beweist, nicht viel über die Eingeborenen erheben würde.
Da wir gegenwärtig im Zeitalter der Ausstellungen leben, so haben wir auch in Südwestafrika zu diesem Mittel gegriffen, um die wirtschaftlichen Fortschritte des Landes festzustellen und mittels Preisverteilung für gute Leistungen zur Fortarbeit zu ermutigen. Solche Ausstellungen fanden 1899 und 1902 statt. Eine vergleichende Gegenüberstellung der Ausstellungsobjekte dürfte das beste Bild sowohl darüber geben, was in dem Schutzgebiete auf den verschiedenen Gebieten des wirtschaftlichen Lebens geleistet worden ist und geleistet werden kann, wie auch über die Frage, ob und welche Fortschritte auf den einzelnen Gebieten innerhalb drei Jahren erzielt worden sind. Beide Ausstellungen haben an dem Regierungssitze des Schutzgebiets, in Groß-Windhuk, stattgefunden. Mit Vieh beschickt konnten sie bei den mangelhaften Verbindungen des Landes daher nur aus dem mittleren Teile des Schutzgebietes werden, mit den Erzeugnissen des Landbaues sogar nur[S. 418] aus der näheren Umgebung Windhuks, in erster Linie aus den Gärten Klein-Windhuks. In Berücksichtigung dieser Beschränkung schien es erforderlich, auch in bezug auf Ausstellungen eine gewisse Dezentralisation in Erwägung zu ziehen. Eine Sonderausstellung im Süden des Schutzgebietes, und zwar in Gibeon oder Keetmanshoop, war daher bereits in Aussicht genommen, als der Aufstand zur Vertagung dieser Frage zwang.
Die Ergebnisse der beiden Ausstellungen waren folgende:
| A. Pferde. | |||
| 1899 | 1902 | ||
| Zahl der Aussteller | 7 | 11 | |
| Zahl der Pferde | 43 | 35 | |
Äußerlich betrachtet, ist somit auf diesem Gebiete ein Rückschritt eingetreten. Namentlich mit Zuchthengsten war die Ausstellung 1902 schwach beschickt. Indessen ist bei dieser Erscheinung offenbar nur die im vorigen Kapitel erwähnte Tätigkeit der Regierung auf dem Gebiete der Pferdezucht zum Ausdruck gekommen. Die guten Züchter — und nur solche stellen ja aus — hatten die Zucht eigener Hengste in den Hintergrund treten lassen, nachdem ihnen die Aussicht eröffnet war, ihren Bedarf auch leihweise bei der Regierung zu decken. Auf der Ausstellung 1902 hatte sich daher nur ein einziger Schimmelhengst eingefunden, und dieser konnte nur mit dem zweiten Preis prämiert werden, so daß der erste Preis überhaupt unvergeben blieb. Es wurden daher auch die übrigen für Hengste ausgeworfenen Preise den Stuten und Fohlen zugeführt. Denn mit letzteren war auch die Ausstellung 1902 gut beschickt. Vom Standpunkt einer vernünftigen Pferdezucht aus kann daher der Ausstellung 1902 doch die bessere Zensur erteilt werden. Denn gute Stuten im Privatbesitz, gute Hengste im Regierungsbesitz: das ist ja die Art und Weise, wie man überhaupt in Kulturländern die Pferdezucht betreibt.
| B. Rindvieh. | |||
| 1899 | 1902 | ||
| Zahl der Aussteller | 15 | 24 | |
| Zahl der Rinder | 133 | 330 | |
Auf diesem Gebiete ist gegen 1899 nicht nur in bezug auf Quantität, sondern auch in bezug auf Qualität ein erheblicher Fortschritt zu verzeichnen. Nachdem sich bereits 1899 die infolge der Einfuhr ausländischer[S. 419] Zuchtbullen eingetretene Veredelung des Rindviehs unverkennbar gezeigt hatte, war dies 1902 in noch erhöhtem Maße der Fall. An Ochsen wurden wahre Kolosse vorgeführt, unter ihnen wie auch unter den Zuchttieren selbst Abkömmlinge der Simmentaler, der Pinzgauer, der Vogelsberger, der Shorthorn und der Oldenburger. Über deren verschiedenartige Qualität habe ich bereits unter dem Abschnitt »Viehzucht« gesprochen. Aber immerhin zeigte sich auch die Afrikanerrasse neben der europäischen Reinzucht von vorteilhafter Seite. Was das hochgezüchtete Rind an Körperform, Milch und Fleischertrag gewinnt, verliert es wieder an Ausdauer, Genügsamkeit und Widerstandsfähigkeit. Die richtige Mischung zwischen beiden zu finden, bleibt daher der Kunst des Züchters überlassen.
Es erhielten 1902 an Preisen:
1. die Zuchtabkömmlinge europäischer Rassen je drei Preise für Bullen, Kühe, Färsen, Bullkälber und Kuhkälber;
2. die Zuchtabkömmlinge einheimischer Rassen gleichfalls je drei Preise für Bullen, Kühe und Kuhkälber;
3. die Ochsen aller beiden Rassen gemischt, je drei Preise, und zwar bezeichnenderweise die Afrikanerrasse den 1. und 2. Preis, die Abkömmlinge von Simmentaler nur den dritten Preis.

[S. 420] 4. Mehrere Farmer brachten Kollektivausstellungen und wurden hierfür in folgender Reihe mit 6 Preisen bedacht:
| 1. | Preis | für | Abkömmlinge | von | Simmentaler, |
| 2. | " | " | " | " | Shorthorn und Afrikaner, |
| 3. | " | " | " | " | Vogelsberger, |
| 4. | " | " | " | " | Simmentaler, |
| 5. | " | " | " | " | Simmentaler, |
| 6. | " | " | " | " | Simmentaler und Afrikaner. |
| C. Kleinvieh. | |||
| 1899 | 1902 | ||
| Zahl der Aussteller | 5 | 13 | |
| Zahl des Kleinviehs. | 146 | 164 | |
Hier war vor allem ein Fortschritt auf dem Gebiete der Angorazucht zu erkennen. Nachdem im Jahre 1899 nur ein Aussteller Angoraziegen vorgeführt hatte, traten 1902 zwei Aussteller mit solchen auf. Unter denjenigen des Jahres 1899 hatten sich auch Produkte der ersten Kreuzung des Angorabocks mit der einheimischen Ziege befunden, die bereits einen Wollansatz trugen. 1902 waren Tiere erster und zweiter Kreuzung vorhanden, und war es lehrreich, die weitere Entwicklung des Wollansatzes zu vergleichen. Preise erhielten Angoraziegen, Angoralämmer, afrikanische Ziegen und afrikanische Schaframme.
Erwähnenswert dürfte noch sein, daß auf allen vorstehend genannten Gebieten der Viehzucht, und zwar der Pferde-, Groß- und Kleinviehzucht, ein Eingeborener (Bastard) mitkonkurriert und auf sämtlichen Preise erzielt hat, in bezug auf Afrikanerbullen sogar den ersten. Im übrigen waren Eingeborene nur unter der Firma eines Weißen zugelassen, aber dann ohne Anstand.
D. Sonstige Zuchten.
1902 erhielten 1 Eber, 4 Mutterschweine sowie verschiedene Enten, Hühner und Puten Preise. Ein Fortschritt auf diesem Gebiete trat gegen 1899 gleichfalls hervor.
E. Erzeugnisse des Landbaues.
Auf diesem Gebiete läßt sich nicht mittels Zahlen, sondern nur durch Besichtigung an Ort und Stelle ein Vergleich anstellen. Und dieser fiel ebenfalls entschieden zugunsten der Ausstellung 1902 aus. Beide Ausstellungen[S. 421] hatten auf dem Gebiete des Landbaues überhaupt mit dem Mißstande zu kämpfen, daß sie im Monat Juni stattfanden, mithin in der kalten Jahreszeit. Diese Zeit war mit Rücksicht auf die für das Land wichtigere Viehzucht gewählt worden. Doch haben die Aussteller diese Schwierigkeit zu überwinden gewußt, was aus einer Zusammenstellung dessen ersehen werden möge, was geboten war. Es war in beiden Jahren ausgestellt:
a) Getreide, und zwar Mais, Hafer, Kaffernkorn und Weizen. Bei dem ausgestellten Weizen befand sich 1902 eine Notiz, daß eine Aussaat von 10 Pfund eine Ernte von 1600 Pfund ergeben habe.
b) Wein. Die katholische Mission hatte 1902 vier Muster ausgestellt und erhielt hierfür alle drei Preise. Die Weine waren noch jung, boten aber günstige Zukunftsaussichten. Als einziger Konkurrent der Mission war ein Ansiedler aus Klein-Windhuk aufgetreten, dessen Weinberg dicht neben demjenigen der ersteren liegt, sonach mit den gleichen Verhältnissen zu rechnen hat. Nur die Art der mehr oder weniger sachverständigen Behandlung hatte mithin den Unterschied ergeben.

[S. 422] c) Tabak. Während im Jahre 1899 nur Tabakstauden zur Stelle waren, hatten sich aber 1902 bereits 6 Konkurrenten mit fertigen Fabrikaten eingefunden, die mit vier Preisen bedacht worden sind.
d) Obst und Konserven. 1899 wie 1902 waren ausgestellt Apfelsinen, Bananen, Granaten, Apfelschnitte, Rosinen, und an eingemachten Früchten Feigen, Feigenmarmelade, Wassermelonen und Maulbeergelee.
e) Kartoffeln. Auch diese waren in beiden Jahren gleich reichlich ausgestellt, darunter die bekannte deutsche blaßrote Kartoffel, die sich im Schutzgebiete alle Jahre hindurch als fortpflanzungsfähig erwiesen hat. Ferner fiel eine sehr große Kapsche Kartoffel mit viel Stärkegehalt auf.
f) Futterrüben und Luzerne. Nichts Besonderes zu erwähnen.
g) Unter den übrigen Erzeugnissen des Gartenbaues waren außerdem fast sämtliche Rüben und Kohlarten, Karotten, Kürbisse, Hülsenfrüchte und Zwiebeln vertreten. Ferner erhielt im Jahre 1899 ein Ansiedler in Klein-Windhuk, der sich ganz besonders mit der Einführung der heimatlichen Obstsorten befaßt hatte, für selbstgezogene Obstbäume (Bismarckäpfel und Goldreinetten) einen Preis. Für 1902 ist er jedoch nicht mehr erschienen, so daß der Schluß nahe liegt, daß er seine Kultur als zu wenig lohnend wieder aufgegeben hat.
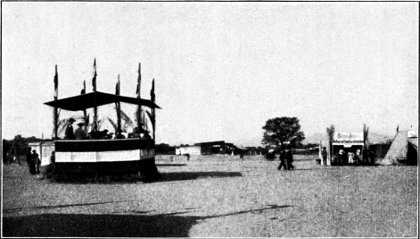
Ferner hat die Ausstellung 1902 diejenige von 1899 weit übertroffen in bezug auf die
F. Erzeugnisse der Viehwirtschaft,
und zwar Butter, Käse und fertige Fleischwaren. Die schärfste Konkurrenz fand in der Butterausstellung statt, für die 11 Konkurrenten mit durchweg guten Proben erschienen, dagegen nur drei Preise ausgesetzt waren. An Käse waren Handkäse und Kochkäse ausgestellt. Für letzteren hatte sich jedoch nur ein Aussteller eingefunden. Ganz hervorragend war dagegen eine[S. 423] Sammlung hergerichteter Fleischwaren, ausgestellt seitens eines Schlächtermeisters in Windhuk.
Trotzdem somit die Ausstellung 1902 diejenige von 1899 übertroffen hatte, bot sie doch nicht das belebte Bild der letzteren. Vielleicht hat die Neuheit der Veranstaltung 1899 mitgewirkt; nicht zu verkennen ist aber auch, daß damals die allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse bessere gewesen sein mögen. Denn die Einwanderung in das Schutzgebiet hatte sich in den zwischen beiden Ausstellungen liegenden drei Jahren nicht immer in gesunden Bahnen gehalten. Die Anzahl der Verdienst und Arbeit suchenden Einwanderer hatte diejenige der Verdienst und Arbeit gebenden Elemente weit überstiegen; ein Mißstand, dem auch künftig in Südwestafrika nur eine staatlich geleitete Ansiedlungspolitik im großen Stile wird begegnen können. Im übrigen aber hat jede junge Kolonie ihre sogenannten Kinderkrankheiten durchzumachen.
Ein besonderer Lichtblick in die Zukunft war jedoch noch mit der Ausstellung 1902 verbunden, nämlich die Eröffnung der Eisenbahn Swakopmund-Windhuk. Es war dies ein absichtlich herbeigeführtes Zusammentreffen, das zu erreichen die den Eisenbahnbau leitenden Offiziere mit anerkennenswertester Energie angestrebt hatten. Aber auch diesen Lichtblick verdankt die Kolonie lediglich der Selbsttätigkeit der Regierung, nachdem ein Versuch, für den Bahnbau Privatkapital zu gewinnen, gescheitert war. (South West Africa Company, siehe Kapitel IV, S. 133.)

Für denjenigen Leser, der sich in erster Linie über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Schutzgebietes unterrichten will, wird der vorstehende Abschnitt der lehrreichste gewesen sein. Denn mit langen Abhandlungen und Vorschlägen über das, was eine Kolonie leisten könnte, gibt man kein derart klares Bild über den Wert und die künftigen Aussichten eines Landes, wie durch Vorführung dessen, was es in der Tat geleistet hat.[S. 424] Von diesem Standpunkte aus habe ich unsere beiden Ausstellungen als das Beste angesehen, was in bezug auf Entwicklung der Kolonie getan worden ist. So hielt z. B. einst bei einer Versammlung des Landwirtschaftlichen Vereins in Windhuk 1899, bei der ich anwesend war, einer der Herren einen schönen Vortrag über den Kartoffelbau, während ein zweiter einige von ihm selbst gezogene Gartenfrüchte, darunter auch Äpfel, vorzeigte. Ich konnte nicht umhin, bei aller Anerkennung des ersteren Vortrages doch den zweiten, der lediglich in dem Vorzeigen des Ergebnisses praktischer Arbeit bestanden hatte, als den besseren zu bezeichnen. Über Südwestafrika sind schon Berge von Büchern geschrieben worden, namentlich von solchen, die nur kurze Zeit drüben waren, dann aber in der Heimat für lange Zeit als »hervorragende Landeskenner« galten. Ich kann nur sagen, wer einen Vorschlag über die Entwicklung Südwestafrikas zu machen hat, der schreibe und drucke möglichst wenig darüber, sondern gehe hinüber und führe ihn aus, oder lasse ihn durch einen anderen ausführen. Denn ein Farmer, der drüben bei der landwirtschaftlichen Ausstellung einige gute Zuchtkühe vorführt, ist für den Wert der Kolonie weit höher einzuschätzen als ein solcher, der ein gutes Buch über die dortige Viehzucht schreibt, selbst aber zu Hause bleibt.
Da das vorliegende Kapitel auch die Zukunft des Schutzgebietes in den Bereich seiner Betrachtungen gezogen hat, so kann es nicht geschlossen werden, ohne gleichfalls die Frage des Wiederaufbaues des durch den Aufstand Zerstörten zu berühren. Wir können in Zukunft kein staatlich geleitetes Besiedlungswerk größeren Stiles beginnen und dabei achtlos an den früher schon vorhanden gewesenen blühenden, jetzt aber verwüsteten Farmen vorübergehen. Im staatlichen Leben kennt man nur den Standpunkt der reinen Interessenpolitik, der jedoch auf seiten des einzelnen nicht minder vorherrscht wie auf seiten des Staates. Nur ist der Staat der hierzu Berechtigtere, da ihm die Vertretung des Allgemeinwohls obliegt. Denn was er dem einen Teil seiner Untertanen zuwendet, muß er dem anderen entziehen, und letzteres kann er nur verantworten, wenn das erstere im Interesse der Allgemeinheit liegt. Gefühlspolitik gibt's für ihn nicht.
Bedauerlicherweise ist in der vorliegenden Sache dieser Kernpunkt infolge Hereinziehens anderer Fragen vollständig verdunkelt worden. Mit mehr Energie als Klugheit stellten sich die Geschädigten auf den Standpunkt: »Uns steht das Recht zur Seite, denn Ihr — die Regierung wie die gesetz[S. 425]gebenden Faktoren — seid schuld an unserem Unglück.« Da war es nur naturgemäß, wenn als Antwort entgegenschallte: »Ihr habt gar nichts zu fordern; so ganz unschuldig, wie Ihr tut, seid Ihr denn doch nicht an der Katastrophe; außerdem habt Ihr wissen müssen, daß in jungen Kolonien Leben und Eigentum nicht so sicher sein können wie in der Heimat.« Und da der Staat in diesem Falle der Stärkere ist — ist er doch der Gebende, die anderen lediglich die Empfangenden —, so fiel bei diesem Frage- und Antwortspiel der Nachteil auf die Seite der Geschädigten.
Entkleiden wir daher diese Sache alles übrigen Beiwerks und beschränken wir uns lediglich auf die Frage: »Kann der Staat die Millionen, die zum Wiederaufbau des Schutzgebietes gehören, vor der Gesamtheit seiner Steuerzahler verantworten?« Zu den für den Wiederaufbau erforderlichen Millionen gehören in erster Linie diejenigen verhältnismäßig wenigen, die zur Wiederherstellung der durch den Aufstand zerstörten Werte erforderlich sind. Diese Millionen werden sich künftig gerade so lohnen wie diejenigen, die wir zugunsten neuer Farmgründungen werden opfern müssen, ja vielleicht noch mehr, denn die Erfahrungen der alten Ansiedler können wir den neuen nicht mitgeben, wohl aber können wir die letzteren auf jene verweisen. Darum kann die oben gestellte Frage nur bejaht werden.
Dies ist der klare Interessenstandpunkt, demgegenüber der gleichfalls vorhandene moralische weit zurücktritt; aber ganz unberücksichtigt kann auch letzterer nicht bleiben. Denn sicher ist, daß von den nach Südwestafrika ausgewanderten Reichsdeutschen zur Zeit wohl nur die Angehörigen der Mission sich dort befinden würden, wenn das Land nicht seinerzeit unter deutschen Schutz gestellt worden wäre. Und dies Vertrauen auf seinen Schutz darf ein großer Staat nicht enttäuschen, auch wenn er rechtlich hierzu nicht verpflichtet ist. Ebenso wie das Reich jetzt für sein nun einmal verletztes Ansehen im Kampfe gegen die Eingeborenen Hunderte von Millionen opfern muß, von denen es nicht weiß, ob sie je wieder einbringlich sein werden, ebenso darf es auch die Ausgabe weniger Millionen für die Wiederherstellung seines Ansehens bei seinen enttäuschten Untertanen nicht scheuen. Nur müssen diese Millionen streng an Bedingungen geknüpft werden, die ihren Zweck, d. h. den Wiederaufbau des Zerstörten, tatsächlich sichern, anderseits aber auch denjenigen versagt bleiben, die nachgewiesenermaßen durch ihr Verhalten mit zu dem Aufstande beigetragen haben. Beide Gesichtspunkte sind in der Verordnung des Herrn Reichskanzlers vom 2. Juni 1904 berücksichtigt. Nur müssen sie in der Praxis auch durchgeführt werden. Die einschlägigen Bestimmungen lauten, wie folgt:
§ 2.
»Berücksichtigt können alle diejenigen in Deutsch-Südwestafrika ansässigen Personen und Gesellschaften werden, die nicht nachgewiesenermaßen beim Aufstande eine der Landesregierung unfreundliche Haltung angenommen oder den Aufstand durch eigenmächtige oder gesetzwidrige Handlungen mitverschuldet haben.
Inwieweit Ausländer zu berücksichtigen sind, bleibt der Entscheidung des Reichskanzlers (Auswärtiges Amt, Kolonial-Abteilung) vorbehalten.«
§ 3.
»Darlehen und Hilfeleistungen sind grundsätzlich nur solchen Geschädigten zu gewähren, die sich — möglichst unter entsprechender Sicherheitsleistung — zum Wiederaufbau ihrer Anwesen und Fortsetzung ihres Wirtschaftsbetriebes im Schutzgebiete verpflichten.
Ausnahmen von diesem Grundsatze können jedoch zugelassen werden, wenn nach Lage der Verhältnisse die Weiterführung des Betriebes aus persönlichen oder sachlichen Gründen als unmöglich anerkannt wird. In einem solchen Falle kann die Abtretung des Anwesens an den Landesfiskus zur Bedingung gemacht werden.«
Die Geschädigten aber mögen bedenken, daß man, es sei mir der Ausdruck gestattet, »einem geschenkten Gaul nicht ins Maul sieht«, und mögen daher weniger Wert auf die Form legen, in der ihnen ihre Verluste zurückerstattet werden, als auf die Tatsache, daß dies überhaupt geschieht. Dann mögen sie ferner bedenken, daß man, in einer jungen Kolonie lebend, in der Tat niemals auf die gleiche Sicherheit rechnen kann wie in den ausgefahrenen Geleisen des alten Vaterlandes. Nur unter diesem Vorbehalte können offiziöse Auslassungen über den dort erzielten Sicherheitszustand aufgenommen werden. Ich meinerseits habe, wenn ich von diesem Thema privatim oder öffentlich sprach, etwaigen Versicherungen dieser Art fast immer die Einschränkung hinzugefügt, »falls wir keine Fehler machen«. Denn daß der wirtschaftlich Schwächere, aber an Ort und Stelle physisch Überlegene gegen eine ihm ungerecht erscheinende Behandlung sich schließlich auch einmal auf seine Weise wehren könnte, das konnte sich jeder denkende Mensch selbst sagen. Daß auch ich in dieser Richtung keineswegs von Sorge frei gewesen bin, habe ich bereits im Kapitel VIII, insbesondere unter dem Abschnitt »Kreditverordnung« dargelegt. Oft habe ich mich gewundert, woher angesichts der nun einmal bestehenden Machtverhältnisse, die zu übersehen ein jeder in[S. 427] der Lage gewesen ist, mancher Weiße mitten im Eingeborenenlande den Mut zu der Art seines Auftretens genommen hat.
Dem mithin in den Kolonien unleugbar vorhandenen lückenhafteren Polizeischutz steht dagegen auf der anderen Seite auch die geringere Bevormundung durch die Polizei gegenüber. Und letzteres liebt nun einmal der Deutsche, so hohe Anforderungen er auch gern an die Polizei stellt, wo es sich um deren Pflichten handelt. »Mir gefällt es hier, weil nicht an jeder Straßenecke ein Schutzmann steht«, hat mir mancher Ansiedler gesagt. Endlich aber mögen die Geschädigten bedenken, daß, wenn in jungen Kolonien mehr mit Verlusten gerechnet werden muß als in der Heimat, dort dafür auch die Gewinnaussichten entsprechend höher sind. Obgleich vor dem Aufstande alles über den geschäftlichen Niedergang geklagt hatte, haben die nachher angemeldeten Schadenersatzansprüche ergeben, daß trotzdem hohe Gewinne erzielt worden sind. Leute, die ich vor wenig Jahren noch als mittellose Schutztruppenangehörige oder als nicht bessergestellte Einwanderer gekannt habe, haben jetzt Verluste von 30000 bis 40000 Mark angemeldet und sind auch hierfür seitens der Prüfungskommission anerkannt worden. Wollte das alte Vaterland die Logik auf die Spitze treiben, würde es sagen können: »So wenig wie ich auf Anteil an eurem Gewinn gerechnet habe, so wenig gehen mich jetzt eure Verluste an.« Selbstverständlich wird es diese Schlußfolgerung nicht ziehen, dafür aber entsprechenden Dank erwarten dürfen. Möge daher an Stelle des laut Fordernden der dankbar Empfangende treten, dann wird diese Frage bald zur Zufriedenheit beider Teile, aber auch zum Wohle des alten ebensogut wie des neuen Vaterlandes gelöst sein.
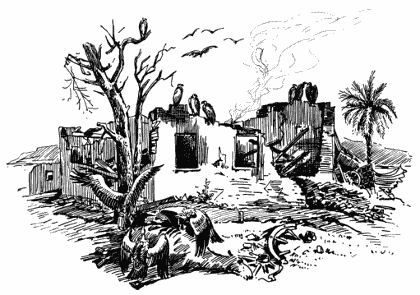

Sollen wir die innersten Gründe zu den genannten Jahren der Katastrophe verstehen, müssen wir auf dasjenige zurückgreifen, was ich bereits in dem Kapitel VIII, besonders unter den Abschnitten »Schutzverträge« und »Rechtspflege« gesagt habe, selbst auf die Gefahr hin, daß mir Wiederholungen mit unterlaufen.
Es gab eine Zeit, in der — hervorgerufen durch die bekannten Ausschreitungen in den Kolonien Kamerun und Ostafrika — die Stimmung im alten Vaterlande derart geworden war, daß man nunmehr umgekehrt für Exzesse von Eingeborenen gegen Weiße fast kein Empfinden mehr zu haben schien. Damals konnte sogar ich, dem stets Überhumanität gegen die Eingeborenen vorgeworfen worden ist, mich nicht enthalten, dem Bericht über einen seitens Eingeborener an einem Weißen begangenen Mord die Bemerkung hinzuzufügen: »Da es sich bloß um die Ermordung eines Weißen handelt, wird sich in diesem Falle die öffentliche Meinung in der Heimat wohl nicht besonders aufregen.« Fern sei es jedoch von mir, dieses öffentliche Empfinden tadeln zu wollen, aber an dasselbe zu erinnern, gehört mit in den Rahmen dessen, was ich unter dem vorliegenden Abschnitt zu sagen habe. Im übrigen aber ist es keine Unehre für uns, wenn der Durchschnittsdeutsche die Neigung besitzt, sich stets auf die Seite des Schwächeren zu schlagen. Und als solche erschienen damals zweifellos die Eingeborenen. Um so jäher aber schlug die Meinung wieder um, als unsere Eingeborenen ihren[S. 429] Aufstand mit der Ermordung wehrloser Weißer begonnen hatten. Denn nun erschienen doch sie als die Stärkeren, und wie sehr sie im Rechte waren, sich im Grunde genommen auch als solche zu fühlen, das hat dann der Verlauf des Aufstandes erwiesen. Denn eine volle, kriegsstarke Division, ausgestattet mit allen technischen Hilfsmitteln neuzeitlicher Kriegführung, hat bis jetzt noch nicht dem Lande den Frieden wiederzugeben vermocht, obwohl man zur Zeit den Aufständischen so weit entgegenkommt, als dies mit unserer Würde überhaupt zu vereinbaren ist.
Infolge dieses Umschlages der öffentlichen Meinung schien man unmittelbar nach dem Ausbruch des Aufstandes im alten Vaterlande geneigt, das bisherige System als die Hauptursache der Katastrophe anzusehen und daher zu verurteilen. Die Eingeborenen seien zu milde behandelt worden, und erst dadurch hätten sie den Mut zu dem Aufstande gefunden. Denn Milde betrachteten die Eingeborenen als Schwäche. Dieses Urteil erscholl, und mit ihm wurde das bisherige System kurzweg abgetan. Hiermit aber komme ich auf den springenden Punkt der Sache. Es hat in bezug auf Eingeborenenbehandlung in Südwestafrika niemals das System eines einzelnen oder einzelner gegeben, auch im Gegensatz zur öffentlichen Meinung in der Heimat niemals geben können. Es gab vielmehr lediglich ein System des deutschen Mutterlandes, das keine blutige Eroberungspolitik wünschte, vielmehr in Südwestafrika seine Kolonisation mit dem Abschluß von Schutz- und Handelsverträgen mit den Eingeborenen begonnen und so den Schutz des deutschen Handels wie von Leben und Eigentum der unter den Eingeborenen wohnenden Weißen den Stammeshäuptlingen anvertraut hatte. Im Verfolg dieses Systems mußten daher die Häuptlinge gleichsam als Beamte des Reiches für den Schutz der in ihren Gebieten befindlichen Weißen interessiert werden. Auch die seitens des Mutterlandes in der Kolonie entfalteten Machtmittel entsprachen lediglich diesem Gesichtspunkte, indem sie ohne die Mitwirkung der Häuptlinge den Weißen ausreichenden Schutz nicht bieten konnten. Wer mithin dieses System für falsch hielt, der durfte nicht die angeblich zu nachsichtige Behandlung der Eingeborenen angreifen, er mußte vielmehr den Bruch mit dem System selbst verlangen. Und dieser Bruch bedeutete nichts anderes als Aushebung der Verträge und gewaltsame Unterwerfung der Eingeborenen, koste es, was es wolle. Mit anderen Worten: der Änderung unseres Systems mußte eine bedeutende Verstärkung unserer Machtmittel in personeller wie materieller Richtung vorhergehen, um wieviel, möge jeder sich selbst sagen, wenn er jetzt nach Südwestafrika hinübersieht.
[S. 430] Von diesem logischen Gedankengang mußte jede gegen die Art unserer Eingeborenenbehandlung gerichtete Bewegung getragen sein. Unter dem Druck der öffentlichen Meinung in der Heimat würde es dann vielleicht möglich gewesen sein, diejenigen Machtmittel zu erlangen, die als Vorbedingung für eine Änderung unseres Kolonisationssystems erforderlich gewesen sein würden, wie dies ja auch jetzt tatsächlich eingetreten ist. Statt dessen aber richtete sich die mit zunehmender weißer Einwanderung steigende Bewegung gegen die Eingeborenen lediglich gegen die bisherige Politik. So konnte in der Heimat der Gedanke entstehen, die Kolonialverwaltung, insbesondere der Gouverneur ließen sich bei ihrer Politik lediglich durch übelangebrachte Sentimentalität leiten, obwohl die zur Verfügung stehenden Machtmittel eine andere Politik gestattet hätten.[110] Hatte doch sogar noch kurz vor dem Bondelzwarts-Aufstande 1903 der Bezirksverein des Hauptortes des Schutzgebietes, Windhuk, die Kolonialverwaltung wegen Verstärkung unserer Schutztruppe um eine Gebirgsbatterie angegriffen, da die hierfür erforderlichen Mittel besser einem wirtschaftlichen Zweck zugeführt worden wären. Dabei sah man an sich schon in der Heimat eine Verminderung der Schutztruppe stets lieber als deren Verstärkung. Aber auch die unter den Eingeborenen selbst lebenden Weißen schienen aus ihren Angriffen gegen den Gouverneur wegen dessen wohlwollender Behandlung der ersteren zu schließen, der Ansicht zu sein, daß — die diesem zur Verfügung stehenden Machtmittel zu einer anderen Art Eingeborenenpolitik ausreichend gewesen wären.
Allerdings war in Wirklichkeit auch schon mit den damaligen Machtmitteln eine scheinbare Herrenstellung der Weißen über die Eingeborenen erzielt und von diesen stillschweigend anerkannt worden. Dies war aber lediglich das Ergebnis der sonst von Wohlwollen gegen die Eingeborenen getragenen Politik des Mutterlandes. Die Sache selbst möge ein Ausflug[S. 431] auf das Gebiet der Rechtspflege erweisen, indem wir die Sühne für an Weißen begangene Morde mit derjenigen in bezug auf Eingeborene in Vergleich stellen. Während meiner Amtszeit im Schutzgebiet kamen zu Tode:
| A. Weiße durch Handlungen Eingeborener. | |
| Namen | Sühne |
| a) 1894 Engländer Christi | 1 Todesurteil u. 1 Freiheitsstrafe, |
| b) 1895 ein Reiter der Schutztruppe. | 6 Todesurteile, |
| c) 1895 Bur Smith | 2 Todesurteile, |
| d) 1896 Engländer Feyton. | 1 Todesurteil, |
| e) 1899 Ansiedler Claasen und Dürr. | 2 Todesurteile, |
| f) 1900 ein weißer Polizist | 3 Todesurteile. |
| B. Eingeborene durch Handlungen Weißer. | |
| a) 1896 Hottentotten Jantje und Kurieb | 1. Instanz: 5½ Jahre Zuchthaus, |
| 2. Instanz: 3 Monate Gefängnis, | |
| b) 1901 Herero Leonhardt. | 1 Jahr Gefängnis, |
| c) 1902 Herero Kamauru | 2 Jahre Gefängnis, |
| d) 1903 Tochter des Häuptlings Zacharias von Otjimbingwe | 1. Instanz: Freisprechung, |
| 2. Instanz: 3 Jahre Gefängnis. | |
Diese Zusammenstellung möge erkennen lassen, welche Bewandtnis es im Grunde mit der angeblichen Milde gegen die Eingeborenen unter dem bisherigen System gehabt hat. Sie ergibt, daß das Leben des Weißen höher eingeschätzt worden ist, als dasjenige des Eingeborenen, was auch der ziffermäßigen Unterlegenheit der Weißen entsprochen hat. Immerhin ist aber die Ahndung dieser Vergehen gegen das Leben Eingeborener von weißer Seite als unstreitig zu milde zu bezeichnen. Denn während das weiße Gericht bei seinen Stammesgenossen stets Milderungsgründe gefunden und bloß Totschlag angenommen hat, kennen die Eingeborenen solch eine subtile Auffassung nicht. Für sie ist Mord und Totschlag genau dasselbe.
Abgesehen von den aufgezählten Verletzungen Eingeborener mit nachgefolgtem Tode, sind nach Ausweis der Akten des Lazaretts Windhuk in den Jahren 1901/03 noch acht Eingeborene wegen körperliche Verletzungen, die durch Mißhandlung seitens Weißer, meist der Dienstherrschaft, herbeigeführt wurden, in Lazarettbehandlung gewesen. Die gerichtliche Sühne hatte in diesen[S. 432] Fällen stets in Geldstrafen bestanden, die im Nichtbeitreibungsfalle in entsprechende Gefängnisstrafen umzuwandeln waren. Umgekehrt sind Fälle tätlichen Angriffs Eingeborener auf Weiße stets mit Kettenhaft und Hieben bestraft worden. Bei dieser Gelegenheit sei mir vergönnt, den vielen Klagen über die angeblich vorhandene besondere Faulheit und Unzuverlässigkeit der eingeborenen Bediensteten entgegenzuhalten, daß solche Klagen auch den weißen Dienstboten Europas gegenüber nicht zu verstummen pflegen, sowie daß, wenn man die letzteren fragen würde, sie über ihre Herrschaften auch ihr eigenes Urteil haben dürften.
Einen weiteren Beweis für die ausreichende Stärke der Schutztruppe schienen nach Verlauf und Ergebnis auch
zu liefern. Deren Niederschlagung war stets derart glatt gelungen, daß die öffentliche Meinung im Schutzgebiete sowohl wie in der Heimat über den kriegerischen Wert der südwestafrikanischen Eingeborenen sich allmählich irrige Anschauungen zu eigen gemacht hatte. Bei Beginn des Hereroaufstandes 1904 erwartete man daher nur »Sedans« und hatte für andere Erfolge lediglich Mißachtung. Hierbei war eben übersehen worden, daß wir die früheren rascheren Erfolge neben der zwar kleinen, aber landeskundigen und kriegsgewohnten Schutztruppe in erster Linie der Mitwirkung der Eingeborenen selbst zu verdanken hatten. Dies möge aus folgender Zusammenstellung der bisherigen Aufstände hervorgehen:
| Aufständische | Eingeborene Bundesgenossen | Erzieltes Ergebnis sowie Kriegsdauer | |
| 1. 1893 94 Witboois | Bastards | Bis jetzt verweigerte Unterwerfung unter die deutsche Schutzherrschaft. Dauer 1½ Jahr. | |
| 2. 1896 Khauas-Hottentotten und Osthereros | Zentral-Hereros unter Oberhäuptling Samuel, Witboois, Hottentotten von Gochas und Hoachanas | Führer der Osthereros nebst Großleuten gefangen, erstere erschossen. Ganzer Stamm der Khauas in Windhuk interniert. Dauer 2 Monate. | |
| 3. 1897 Afrikaner-Hottentotten | Bondelzwarts und Feldschuhträger | Ganzer Stamm gefangen, Rädelsführer kriegsrechtlich erschossen. Dauer 3 Monate. | |
| [S. 433]4. 1898 Swartbooi-Hottentotten und Nordwesthereros | Witboois und ein Drittel des Swartbooistammes | Der aufständische Teil des Stammes in Windhuk interniert. Dauer 4 Monate. | |
| 5. 1901 Bastards von Grootfontein | Witboois | Ganzer Stamm in Windhuk interniert, Rädelsführer kriegsrechtlich zum Tode verurteilt, aber aus politischen Rücksichten begnadigt. Dauer 2 Monate. | |
| 6. 1903 Bondelzwarts | Witboois, Feldschuhträger und die Hottentottenstämme von Bersaba und Bethanien | Stamm entwaffnet und auf ein Reservat beschränkt, die — sämtlich geflüchteten — Rädelsführer geächtet. Dauer 3 Monate. | |
Abgesehen von Nr. 1, Krieg gegen Witbooi, war somit das Schlußergebnis nach raschem Verlauf der Kriegshandlungen stets Entwaffnung der Aufrührer und Bestrafung der Rädelsführer, außerdem bei Nr. 2, 4 und 5 Internierung der Stämme als Kriegsgefangene in Windhuk. Im ganzen war daher nur gegen den Stamm der Witboois Milde geübt worden, und bei diesem lagen besondere bei Schilderung des letzten Entscheidungskampfes gegen ihn (Kapitel II) aufgeführte Gründe vor. Sonst aber sind die Ergebnisse etwa dieselben, wie wir sie jetzt nach einem langen, mit bedeutender Übermacht durchgeführten, opfervollen Kampfe erzielt haben.
Die Ursache dieses Unterschiedes liegt, wie schon erwähnt, mit in der Teilnahme treugebliebener Eingeborener auf unserer Seite. Sie verhinderte einerseits den Abfall weiterer Stämme, anderseits bot sie aber auch eine stets betretbare Brücke zu den Aufständischen. Sobald letztere genügend geschlagen waren, konnte man mittels dieser Brücke wieder rechtzeitig Fühlung mit ihnen gewinnen und so deren Auseinanderlaufen behufs Bildung gefährlicher Guerillabanden verhüten. An dieser Brücke hat es bei dem gegenwärtigen Aufstande gefehlt. Andernfalls würde unter den Bedingungen, wie sie jetzt geboten werden, die Masse der Hereros wohl schon nach dem Gefecht von Waterberg zur Übergabe bereit gewesen und infolgedessen der Hottentottenaufstand nicht ausgebrochen sein. Denn kriegsmüde waren die Hereros nach allen Nachrichten vielfach schon vor Waterberg, und nur das Eingreifen des infolge seines Schuldbewußtseins tatkräftig gewordenen Oberhäuptlings[S. 434] Samuel hat damals deren Masse noch einmal zum Widerstande bei Waterberg zu vereinigen vermocht.
Am deutlichsten war dieser Wert der eingeborenen Bundesgenossen während des Krieges 1896 zutage getreten (Nr. 2 des oben gegebenen Verzeichnisses). Damals hatten wir mit einem allgemeinen Hereroaufstand rechnen müssen, als der offene Übertritt des Oberhäuptlings Samuel auf unsere Seite der Sache eine andere Wendung gab. Nunmehr wurde der eine Gegner, Nikodemus, durch dessen Halbbruder Assa Riarua lediglich gegen Zusage gerechter Behandlung zur freiwilligen Ergebung bewogen.[111] Zu dem anderen Gegner, Kahimema[112], ritten dagegen nach dem Gefecht von Otjunda zwei unserer verbündeten, mit jenem verwandten Hereros und bewogen ihn gleichfalls zur Ergebung, indem sie ihm erklärten, »weiteres Fechten nützt Dir doch nichts, der Major (Gouverneur) hat uns gesagt, daß er mit Schießen nicht aufhören werde, bis er Dich habe«. Gleichzeitig wurden die Khauas-Hottentotten durch einen Stammesgenossen, der nach dem Gefecht von Otjunda zu uns übergegangen war, lediglich gegen Zusicherung des Lebens zur Übergabe bewogen. Andernfalls hätten namentlich die Khauas-Hottentotten einen Guerillakrieg noch lange fortsetzen und damit die Entwicklung des Distrikts Gobabis ebensolange in Frage stellen können. Im übrigen gestatte ich mir, aus dem Schlusse meines im Juni 1896 erstatteten Berichts über das Ergebnis des damaligen Feldzuges (siehe Kapitel III) folgende Sätze zu wiederholen: »Überhaupt hat die diesmalige Zusammensetzung der Feldtruppe — Weiße nur als Kern, die Masse Eingeborene — sich als die für hiesige Verhältnisse in der Tat zweckmäßigste erwiesen usw. Nicht stolze Heeresmassen verbürgen den Sieg, sondern die Geeignetheit der betreffenden Truppe für die gegebenen Verhältnisse.«
Unter diesem Abschnitt muß ich des Zusammenhanges halber gleichfalls manches wiederholen, was bereits im Kapitel VII unter »Schutztruppe« gesagt worden ist. Wie dort bereits erwähnt, betrug die Stärke der Schutztruppe vor Beginn des Bondelzwartsaufstandes im Jahre 1903 etatmäßig rund 780 Köpfe. Davon waren etwa 500 in einer Feldtruppe, bestehend aus vier Feldkompagnien und einer Batterie, vereinigt, der Rest als Polizeitruppe[S. 435] verwendet. Die Feldtruppe war in ihrer vollen Stärke beritten sowie mit bespannten und marschbereiten Fahrzeugen versehen, daher auch jederzeit zum Ausmarsch befähigt. Bei dem großen Raum, auf dem sie disloziert werden mußte, war sie jedoch nicht auch zur sofortigen gemeinsamen Verwendung bereit, sondern hätte zu ihrer Vereinigung etwa vier Wochen bedurft. Infolge der Art ihrer Dislozierung konnten jedoch im Norden, d. h. im Hererolande, bereits binnen zehn Tagen drei Kompagnien und eine Batterie zum gemeinsamen Handeln vereinigt stehen, im Süden dagegen, d. h. im Namalande, erst innerhalb 20 Tagen zwei Kompagnien und eine Batterie. Erleichtert wurde diese Sache dadurch, daß sämtliche Kompagnie- bzw. Batteriestabsquartiere mit dem Truppenstabsquartier heliographisch verbunden waren. Die Kompagniestabsquartiere befanden sich, um dies nochmals zu wiederholen, in Keetmanshoop (3. Kompagnie), Omaruru (2. Kompagnie), Outjo (4. Kompagnie).
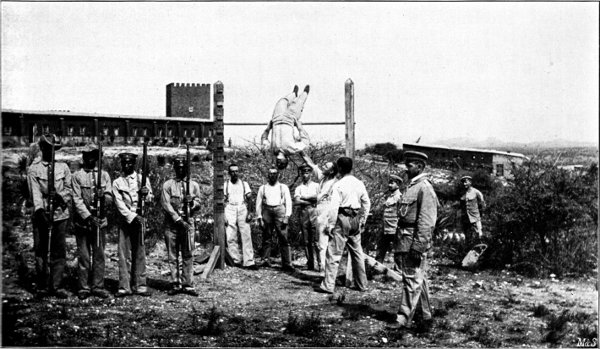
In Windhuk, dem Truppenstabsquartier, lagen die 1. Kompagnie und die Gebirgs-Batterie. Für die Errichtung einer zweiten Batterie war Johann-Albrechtshöhe bei Karibib ins Auge gefaßt und dort der Kasernenbau bereits begonnen worden.
[S. 436] Auf die 280 Mann Polizeitruppe war dagegen im Falle kriegerischer Verwicklungen nur insoweit zu rechnen, als es sich um die Verteidigung der eigenen Stationen handelte. Denn die letzteren konnten nicht unbesetzt bleiben, gleichviel in welcher Gegend des Schutzgebietes die Verwicklungen entstanden waren. Auch den Polizeitruppen war Artillerie zugeteilt, und zwar vier aus früherer Zeit stammende Geschütze C. 73, von denen je eines in Keetmanshoop, Gobabis, Omaruru und Outjo stationiert war.
Die Feldtruppe stand unter dem stellvertretenden Truppenkommandeur und war scharf getrennt von der Polizeitruppe, die den Verwaltungsbeamten unterstellt war. Zur Wehrkraft des Schutzgebietes traten schließlich noch die Mannschaften des Beurlaubtenstandes in der Stärke von etwa 750 Mann, ferner 15 militärisch ausgebildete Buren und endlich etwa 120 militärisch ausgebildete Bastards. Bei einer allgemeinen Mobilmachung konnte die Truppe daher um etwa 900 Köpfe verstärkt werden. Im ganzen Schutzgebiet standen sonach rund 1600 ausgebildete Soldaten zur Verfügung, die jedoch niemals auf einen Punkt zusammengezogen werden konnten, da im Falle kriegerischer Verwicklungen kein Teil des Landes ohne militärischen Schutz belassen werden durfte.
Zum Verständnis ist es erforderlich, auch noch die Wehrkraft der Eingeborenen kurz zu streifen. An Prozentzahlen übertrifft diese die unserige insofern bedeutend, als bei den Eingeborenen jeder Mann vom kaum erwachsenen Jungen an bis zum Greise nicht nur wehrpflichtig, sondern auch wehrfähig ist. Denn die Eingeborenen erhalten sich ihre körperliche Leistungsfähigkeit länger wie die Kulturvölker. Infolgedessen muß man die Wehrkraft eines Stammes auf mindestens 10 bis 15 vH. der Gesamtbevölkerung schätzen. Ausgeglichen werden jedoch die hieraus sich ergebenden bedeutenden Zahlen wieder durch den Umstand, daß bei den Eingeborenen nicht jeder Mann ein Gewehr besitzt. Dafür aber spielen infolgedessen Verluste wieder eine geringere Rolle, da für jeden außer Gefecht gesetzten Mann immer ein bisher Unbewaffneter eintreten kann. Im ganzen war die Zahl der waffenfähigen Männer zu schätzen bei:
| 1. | den Hereros auf 7000 bis 8000, nach amtlicher Berechnung mit etwa 2500 Gewehren; |
| 2. | den Bondelzwarts auf 300 bis 400; |
| 3. | den Bethaniern auf 300 bis 400; |
| 4. | den Feldschuhträgern auf 150 bis 200; |
| 5. | den Witboois auf 600 bis 700; |
| 6. | den Gochaser Hottentotten auf 600 bis 700; |
| 7. | der Roten Nation auf 90 bis 100. |
[S. 437] Die Zahl der bei den Hottentotten amtlich festgestellten Gewehre ist mir hier nicht gegenwärtig, ich möchte sie jedoch auf etwa 2/3 bis 3/4 der vorhandenen waffenfähigen Männer schätzen. Zusammen ergeben die Zahlen der waffenfähigen Eingeborenen des Schutzgebietes die Summe von 9000 bis 10500 Köpfen. In dieser Gesamtzahl fehlen jedoch noch folgende Hottentottenstämme: 1. die Topnaars, 2. die Swartboois, 3. die Bersabaer, 4. die Keetmanshooper.
Die beiden ersteren kamen infolge ihrer abgelegenen geographischen Lage (Kaokofeld) nicht in Betracht, der zweite ist zudem seit dem Feldzuge 1898 zu zwei Dritteln in Windhuk interniert. Die beiden letzteren haben sich dagegen dem Aufstande nicht angeschlossen, andernfalls würden sie den Aufständischen noch 500 bis 600 Waffenfähige zugeführt haben.
Wenn wir dieser Stärke der Stämme im Schutzgebiet die der Regierung zur Verfügung stehenden Machtmittel gegenüberstellen, so ergibt sich, daß die letzteren keineswegs auf eine gewaltsame Niederwerfung der Eingeborenen zugeschnitten waren. Sie sollten lediglich die Aufrechterhaltung des Friedens sichern und im Falle einer vereinzelten Unbotmäßigkeit als Kern dienen, um den sich die treugebliebenen Eingeborenenstämme zu scharen hatten. Wie die oben gegebene Zusammenstellung der bisherigen Eingeborenenaufstände ersehen läßt, ist dies auch bis einschließlich des Bondelzwartsfeldzuges gelungen. Ja sogar noch im Monat Juni 1904, mitten im Hererokriege, habe ich die Truppe dem Generalleutnant v. Trotha mit Bundesgenossen aus allen Hottentottenstämmen übergeben können.
Der Bemessung der Stärke unserer Wehrkraft lag somit die Voraussetzung zugrunde, daß auch die Diplomatie einsetzen und mittels dieser es gelingen würde, stets einen Eingeborenenstamm gegen den anderen auszuspielen, bis im Laufe der Zeit und durch Gewohnheit alle aufständischen Neigungen der Eingeborenen verschwunden sein würden. An die Möglichkeit eines gleichzeitigen Aufstandes unserer sämtlichen unter sich so gespaltenen und eifersüchtigen Eingeborenen hatte mit anscheinendem Recht niemand ernstlich gedacht, wenn dies auch nachträglich von manchem angeblich »Kundigen« behauptet worden ist. Indessen hatte ich doch seinerzeit in meinem bereits erwähnten Bericht über den Abschluß des Feldzuges 1896 die Äußerung einfließen lassen: »Fern muß uns daher jede Politik bleiben, die uns die Eingeborenen entfremdet und uns in schwierigen Lagen lediglich auf uns selbst anweist.« Ein Gouverneur, der eine solche Politik weder durchführen wollte noch konnte, mußte also entweder zurücktreten oder unter Vernachlässi[S. 438]gung aller wirtschaftlichen Ausgaben das Schutzgebiet vom Orange bis zum Kunene mit Soldaten anfüllen. Dies durchzusetzen, mußte ihm jedoch die Gabe des Propheten Daniel zur Seite stehen. Gewöhnlichen Sterblichen — und zu ihnen gehört eben nun einmal der Durchschnitt unserer Gouverneure — war solches nicht beschieden. Zwar wird mir, wie so manche andere, auch die angebliche Äußerung zugeschoben, der gegenwärtige Aufstand hätte kommen müssen. Jedoch habe ich diese Prophetengabe leider gleichfalls nicht besessen, andernfalls hätte ich nicht unterlassen, die erforderlichen Schlußfolgerungen zu ziehen. Fragliche Äußerung habe ich mithin niemals getan.
Was die Ausbildung der Schutztruppe betrifft, so konnte sich diese, da der Ersatz mit wenigen Ausnahmen aus bereits gedienten Mannschaften bestand — die Infanteristen und Artilleristen hatten in der Heimat im zweiten, die Kavalleristen im dritten Jahre gedient —, auf Vervollkommnung der Schießfertigkeit, auf Reiten und vor allem auf die Gewöhnung an die afrikanischen Verhältnisse beschränken, und letzteres war die Hauptsache. Dies tritt klar hervor, wenn wir während der Kriegsjahre 1903/04 die Leistungen der alten Truppe mit denjenigen der jungen vergleichen. An Disziplin, Tapferkeit und willigem Ertragen von Strapazen wetteiferten die neuen Soldaten mit den alten völlig, aber Leistungen, wie sie z. B. die Kompagnie Franke aufzuweisen hatte, haben die ersteren nicht zu verzeichnen. Dazu pflegten bei größeren Leistungen die Verluste der alten Truppe sogar geringer zu sein als diejenigen der neuen, da die alten Afrikaner sich besser zu helfen wissen. Ein geradezu ausgezeichnetes Material boten die ausgeschiedenen Mitglieder der Schutztruppe, die sich seit Jahren im Schutzgebiet angesiedelt hatten und nun auf Grund der allgemeinen Wehrpflicht wieder eingezogen waren. Denn ihnen standen neben der höheren Disziplin des deutschen Soldaten sowie neben der allgemeinen Überlegenheit des Weißen über den Eingeborenen auch noch die erforderlichen Landeskenntnisse zur Seite. Hierin liegt auch der Grund, weshalb z. B. die Buren mit ihren Eingeborenen besser fertig zu werden pflegten als die direkt aus Europa gekommenen, an militärischem Wert äußerlich die Buren übertreffenden regulären Soldaten.
Waffen, Munition und Ausrüstung waren im Schutzgebiet auch für die Mannschaften des Beurlaubtenstandes vollzählig vorhanden und wurden auf diesseitigen Antrag seitens des Oberkommandos der Schutztruppen stets rechtzeitig ergänzt. Namentlich das reichliche Vorhandensein von Proviant hatte sich beim gegenwärtigen Aufstand bewährt. Die Stationen Outjo,[S. 439] Gobabis und Grootfontein wie auch später Gibeon waren durch die Aufständischen wochen- und monatelang von jeder Zufuhr abgeschnitten. Trotzdem haben sie nie unter Proviantmangel zu leiden gehabt, obwohl sie eine zahlreiche Zivilbevölkerung mit zu ernähren hatten. Die Stationen selbst waren sämtlich in festungsartigem Stil angelegt, sowie derart, daß sie möglichst auch die zu ihnen gehörende Wasserstelle beherrschten. Während des Aufstandes ist auch keine Militär- oder Polizeistation gefallen, die regelrecht angegriffen wurde, wie überhaupt ein Sturm auf Mauerwerk nicht im Charakter unserer Eingeborenen liegt. Eingenommen sind nur diejenigen Polizeistationen, die unversehens überfallen wurden, bevor der Besatzung der ausgebrochene Aufstand bekannt geworden war. Daß schließlich für sämtliche Wehrpflichtige die Gestellungsordres auf dem laufenden erhalten worden sind, habe ich bereits im Kapitel VII (S. 216) erwähnt.
Für den freundlichen Leser, der meinen bisherigen Ausführungen über die Stellung der Stammesregierung zur deutschen Regierung wie über die beiderseitigen Machtmittel aufmerksam gefolgt ist, genügt es, sich in bezug auf die Ursache des Bondelzwartsaufstandes ein Urteil zu bilden, wenn ich einfach den tatsächlichen Verlauf der Ereignisse wiedergebe.
Der Kapitän der Bondelzwarts, Abraham Christian, der vor etwa zwei Jahren seinem Vater Wilhelm Christian gefolgt war (Kapitel IX), hatte Ende Oktober 1903 einem seiner Untertanen widerrechtlich einen Hammel zum eigenen Gebrauch weggenommen. Der Geschädigte beklagte sich bei dem deutschen Distriktschef, Leutnant Jobst, über das erlittene Unrecht. Der letztere nahm die Klage an und forderte den Kapitän vor sein Gericht. Dieser erschien jedoch nicht, da es sich, wie er nicht ohne Berechtigung geltend machte, um seine eigene Angelegenheit handele. Doch zeigte er wenigstens so viel Achtung vor dem Vertreter der deutschen Regierung, daß er, um die Sache aus der Welt zu schaffen, dem Kläger den Hammel mit 20 Mark vergütete. Trotzdem forderte der Distriktschef den Kapitän nochmals vor sein Gericht, und zwar behufs »Belehrung«. Nunmehr meldete sich letzterer krank, schickte jedoch seine sämtlichen Großleute. Jetzt aber glaubte der Distriktschef im Interesse seiner Autorität den Kapitän mit Gewalt holen zu müssen. Er setzte die Großleute als Geiseln in Haft und rückte mit den ihm zur Verfügung[S. 440] stehenden fünf Polizeisoldaten, denen sich freiwillig zwei Ansiedler angeschlossen hatten, gegen die Werft des Kapitäns vor. Dieser gegenüber bezog die kleine Macht Gefechtsstellung, während sich zwei Polizeisoldaten in dieselbe begaben, um sich der Person des Kapitäns zu bemächtigen. Sogar dies gelang noch, obwohl der Kapitän seinerseits über 50 Gewehre verfügte. Aber während die beiden Polizeisoldaten den sich sträubenden Kapitän noch zwischen den beiderseitigen Stellungen hinter sich herzogen, eröffneten die Hottentotten das Feuer, dem sowohl der Kapitän mitsamt den beiden Polizeisoldaten wie auch der Distriktschef zum Opfer fielen; ferner wurden zwei Soldaten verwundet. Und der Aufstand der Bondelzwarts, dem bald darauf der Hereroaufstand folgte, war entfacht.
Mit diesem Vorgange seien die Bestimmungen des Schutzvertrages mit den Bondelzwarts verglichen. Dort heißt es im Artikel 4:
»Ich — d. h. der Kapitän Wilhelm Christian — bin damit einverstanden, daß bei Streitigkeiten ziviler und krimineller Art zwischen weißen Leuten untereinander und mit Eingeborenen die Gerichtsbarkeit von der durch Seine Majestät den Deutschen Kaiser eingesetzten Behörde ausgeübt wird.
Dagegen behalte ich mir die Gerichtsbarkeit in allen anderen Fällen vor. Von den weißen Leuten erwarte ich, daß sie die Gesetze, Sitten und Gebräuche meines Landes achten, auch diejenigen Abgaben entrichten, die bis dahin üblich waren oder durch Vereinbarung zwischen der deutschen Regierung und mir zu meinen Gunsten sollten ferner festgesetzt werden.«
Aus diesem Artikel geht hervor, daß der vorliegende Fall als ein Streitfall zwischen zwei Eingeborenen gar nicht vor die Gerichtsbarkeit des Distriktschefs, sondern vor diejenige des Kapitäns selbst gehörte. Daher war es für ersteren schon ein moralischer Erfolg, wenn trotzdem sowohl der Geschädigte sich an ihn gewendet hatte, wie auch, wenn der Kapitän freiwillig den verursachten Schaden wieder ersetzte. Mit diesem Erfolge hätte der Distriktschef sich unbeschadet seiner Autorität wohl zufrieden geben können. Als er dann trotzdem in der Sache weiter ging, erzielte er wiederum einen Erfolg, indem der Kapitän wenigstens seine Großleute auf die Station schickte, sich selbst aber — aus Angst natürlich — krank meldete und damit anerkannte, daß er eigentlich — was er immerhin auch hätte bezweifeln können — verpflichtet gewesen wäre, dem Rufe des Distriktschefs zu folgen. Aber auch diese zweite Möglichkeit zu einer gütlichen Beilegung der Sache benutzte der Distriktschef nicht, sondern schritt zu dem Wagnis einer gewalt[S. 441]samen Vorführung des Kapitäns. Mit Bezug hierauf sei auf die in Anlage 1 befindliche Instruktion für die Bezirksamtsleute verwiesen. Dort heißt es in § 12:
»Mit dem Kapitän sowie mit den Missionaren und sonstigen angesehenen Weißen ihres Bezirkes haben die Bezirkshauptleute, die Distrikts- und Stationschefs fortlaufend gute persönliche Beziehungen zu unterhalten.«
Zur Aufrechterhaltung persönlich guter Beziehungen gehört die gewaltsame Vorführung eines Kapitäns keinesfalls, zumal wenn dieser eigentlich nichts begangen hatte, was gegen die deutsche Regierung gerichtet war. Daß seinem Sohn und Nachfolger eine solche Möglichkeit blühen könnte, hat der alte Kapitän Wilhelm Christian sicher nicht gedacht, als er in dem Schutzvertrage »gestattete«, daß die Weißen in seinem Lande in Sicherheit sollten Handel treiben und wohnen dürfen. Aber auch abgesehen von diesem mehr moralischen Gesichtspunkte, stand dem Distriktschef die zur Durchführung seiner Absicht erforderliche Wehrmacht in keiner Weise zur Seite. Seit der im Jahre 1894 erfolgten Gründung des Distrikts Warmbad war dieser nie mit mehr als mit 15 bis 20 Polizeisoldaten besetzt gewesen, davon etwa die Hälfte in Warmbad selbst. Eine stärkere Besetzung hatten die vom Deutschen Reich bewilligten Mittel nicht gestattet. Man mag dies tadeln, aber der an Ort und Stelle befindliche Verwaltungsbeamte mußte mit den nun einmal gegebenen Verhältnissen rechnen. Er konnte als überlegender Mann sich selbst sagen, daß er mit diesen Machtmitteln einen 300 bis 400 wehrfähige Männer starken Stamm nur im Zusammenwirken mit dem Stammeshaupt würde beherrschen können, wie ihm dies seine Instruktion auch vorschrieb. Hätte ihm letztere ein anderes Verhalten auferlegt, so würde es eine Grausamkeit gewesen sein, den Distrikt mit lediglich 15 bis 20 deutschen Polizisten auszustatten.[114] Auch die Rücksicht auf das Andenken des als tapferer Offizier gefallenen Distriktschefs darf mich an dieser Stelle, wo ich Geschichte schreibe, nicht hindern, mich lediglich an die Wahrheit zu halten. Die Schlußfolgerungen mag sich der Leser selbst ziehen. Außerdem aber können wir aus begangenen Fehlern nur lernen, wenn wir sie offen zu[S. 442]gestehen. Von Interesse dürfte in dieser Beziehung eine Stelle aus einem Privatbrief des Bezirksamtmanns v. Burgsdorff sein, den dieser auf dem Marsche in das Aufstandsgebiet unter dem 21. November 1903 aus Keetmanshoop an mich gerichtet hat:
»Vorgänge wie die Warmbader schaden uns in jeder Beziehung: wirtschaftlich in Europa, in unserem Ansehen und bei den Eingeborenen, und kosten viel Geld! Der alte Witbooi hält ja treu zu uns, aber Vorgänge wie Grootfontein[115] und die letzten machen ihn stutzig. Ich hoffe noch sehr, daß in Warmbad jetzt bestimmt festgestellt werden kann, daß von seiten der Bondels der erste Schuß gefallen ist; dies gibt etwa die Möglichkeit, alle Schuld vor seinen Augen auf die Bondels zu schieben, und sich in das öffentlich anerkannte Recht zu setzen, ist auch bei den Hottentotten von ausschlaggebendem Werte.
»Ich glaube, daß ich die Mittel und Wege finden würde, jede Gärung und Unzufriedenheit unter den Eingeborenen verschwinden zu lassen und doch dem weißen Element wachsenden Einfluß zu verschaffen. Ich brauchte sicher nicht, wie es geschehen ist, zu dem Mittel zu greifen, in der Not den Eingeborenen Versprechungen und selbst Belohnungen zuzusichern, wenn sie ihre Schuldigkeit tun und der Regierung ergeben bleiben wollen; im Notfall muß dies gefordert werden, und dies kann gefordert werden, wenn sie in friedlichen Zeiten richtig behandelt werden.«
Militärisch bot der nunmehr beginnende Feldzug nicht viel. In seinem Anfang ward er beeinflußt durch die Trockenheit in dem ohnehin regenarmen Bondelzwartslande, an seinem Ende dagegen durch den ausgebrochenen Hereroaufstand. Infolgedessen wickelte er sich mehr auf diplomatischem als auf militärischem Wege ab. Was die Trockenheit anlangt, so erhebt sich die Regenhöhe in dem Bezirke Keetmanshoop selten über 100 mm, gegen etwa 300 mm in Windhuk. In diesem schon so trockenen Bezirk ist das Bondelzwartsgebiet noch dazu das allertrockenste. Deshalb hatte bereits in Friedenszeiten die Ernährung der geringen Besatzung des Distrikts Schwierigkeiten verursacht. Weniger die Waffentüchtigkeit der Bewohner war daher zu überwinden als der Charakter des Landes. Zunächst war eine Entfaltung größerer Truppenmengen bis zum Einsetzen der nächsten Regenzeit überhaupt so gut wie ausgeschlossen. Glücklicherweise trat letztere bereits Ende Dezember und ziemlich ausgiebig ein.
Zu der auf der Trockenheit des Landes beruhenden Schwierigkeit trat dann noch sein Gebirgscharakter. Aus einer sonst weiten Ebene erheben sich unvermittelt in schroffster und steilster Höhe im Norden die Kharrasberge, im Süden die Orangeflußberge. Es sind dies dieselben Berge, in denen uns seinerzeit Morenga, Morris sowie zum Teil auch Cornelius die Spitze geboten haben und noch bieten. Mühsam sind die Kharrasberge genommen (Oberst Deimling), aber seitens der Eingeborenen zeitweise wieder besetzt worden.

Das oben erwähnte Gefecht in Warmbad, mit dem der Aufstand begann, hatte am 25. Oktober 1903 stattgefunden. Nach demselben zog sich die daran beteiligte Distriktsmannschaft wieder in die Station zurück und richtete sich hier zur Verteidigung ein. Auch die deutschen Ansiedler Warmbads eilten dorthin, so daß die Besatzung nunmehr aus 11 Mann bestand, über die ein ehemaliger Leutnant v. dem Bussche[116] das Kommando übernahm. Die nächstverfügbare größere Abteilung der Schutztruppe war die[S. 444] 3. Feldkompagnie in Keetmanshoop unter Hauptmann v. Koppy. Dieser setzte seine Kompagnie nebst einem Geschütz sofort in Marsch, eilte aber für seine Person mit 15 Reitern voraus und erreichte nach einem kühnen Marsche durch die kleinen Kharrasberge am 1. November Warmbad, wo er die Station noch unversehrt antraf. Die belagernden Hottentotten verließen nunmehr den Platz. Die Feindseligkeiten waren bisher auf leichtere Plänkeleien beschränkt geblieben, da auch hier die Eingeborenen einen Angriff auf Mauern nicht gewagt hatten. Andernfalls würde ihnen eine Menge Proviant und Munition in die Hände gefallen sein. Die Hottentotten faßten sogar in ihrer leichtlebigen Art den Krieg derart harmlos auf, daß sie verschiedene Frachtfahrer, die ohne Kenntnis von dem Geschehenen durch Warmbad durchkamen, unbehelligt passieren ließen, darunter auch die Postkarre. Bald erschien der Rest der 3. Feldkompagnie in Warmbad sowie 80 Witboois unter Führung des Oberleutnants Graf v. Kageneck und des Unterkapitäns Samuel Isaak.
Mit dieser Truppenmacht (3. Feldkompagnie, ein Geschütz, 80 Witboois, zusammen etwa 170 Köpfe) rückte Hauptmann v. Koppy gegen die bei Sandfontein südlich Warmbad stehende Hauptmacht des Gegners vor und brachte ihr am 21. November ohne eigene Verluste eine Niederlage bei. Nur sechs Witboois waren die Pferde unter dem Leibe erschossen worden, außerdem dasjenige des Oberleutnants Graf v. Kageneck. Hierauf flüchteten die Aufständischen in die Orangeberge, wo sie ziemlich sicher saßen. Während jetzt auf dem Kriegsschauplatze eine Ruhepause eintrat, sammelten sich allmählich in Keetmanshoop unter dem stellvertretenden Truppenkommandeur Hauptmann v. Fiedler die aus Windhuk heranmarschierende Feldtruppe (1. Kompagnie, Gebirgs-Batterie) sowie Bundesgenossen aus allen Hottentottenstämmen, an der Spitze Bezirksamtmann v. Burgsdorff mit weiteren 40 Witboois, diese unter dem Kapitän Witbooi selbst. Die Zahl der eingeborenen Bundesgenossen wurde schließlich so groß, daß ich der Verpflegungsschwierigkeiten wegen heliographisch Einschränkung und Entlassung der Überschießenden anordnen mußte. Das Verhalten dieser in Keetmanshoop versammelten Truppenmacht mußte sich nach demjenigen des in den Kharrasbergen sitzenden Teiles des Bondelzwartsstammes richten, der sich dem Aufstande bis jetzt noch nicht angeschlossen hatte. Die Sachlage dort zu erkunden, begab sich Bezirksamtmann v. Burgsdorff mit den Witboois, Bersaba-Hottentotten und Feldschuhträgern in die Kharrasberge. Hauptsächlich unter dem Einfluß der Autorität Witboois erklärten die dortigen[S. 445] Bondelzwartsgroßleute, sich dem Aufstande nicht anschließen zu wollen, worauf v. Burgsdorff die Kharrasberge in südöstlicher Richtung wieder verließ. Inzwischen aber hatte der neue Kapitän der Bondelzwarts, Johannes Christian, jüngerer Bruder des Gefallenen, die ihm notgedrungen gewährte Ruhepause benutzt, um behufs Insurgierung der Kharrasberge eine stärkere Abteilung dorthin zu entsenden. Mit dieser stieß am 10. Dezember die Abteilung v. Burgsdorff am Südostrande der Berge zusammen. Nach einem zweitägigen Gefecht, in dem, wohl einzig in unserer Kolonialgeschichte, auf beiden Seiten nur eingeborene Irreguläre gefochten hatten — die Abteilung v. Burgsdorff etwa 60 Gewehre, die gegnerische etwa 40 bis 50 Gewehre stark — floh die letztere unter Hinterlassung einiger Gewehre und zahlreichen Viehs in die Kharrasberge. Der diesseitige Verlust betrug 1 Witbooi (Neffe des Kapitäns) und 2 Feldschuhträger tot, 2 Eingeborene verwundet. Die Führer der Aufständischen waren der bekannte Morenga und die Gebrüder Morris gewesen.

War somit auch der taktische Erfolg dem Feinde versagt geblieben, so war es ihm doch gelungen, in die Kharrasberge einzudringen und damit seinen Zweck zu erreichen, denn die Kharrasbergbewohner wagten nun nicht mehr, sich vom Aufstande fernzuhalten. Jetzt hatten wir zwei Kriegsschauplätze, den einen in den Orange-, den anderen in den Kharrasbergen. Inzwischen war auch im engeren Bondelzwartsgebiete die Station Uhabis, westlich Warmbad, von Hottentotten überfallen und die aus zwei Reitern bestehende Besatzung niedergemacht sowie ein kapländischer Farmer aus seiner im Distrikt Warmbad gelegenen Farm ermordet worden. Wie sehr man in den Kolonien darauf gefaßt sein muß, daß in kriegerischen Zeiten unsaubere Elemente im Trüben zu fischen versuchen, beweist ferner der Umstand, daß[S. 446] auch im Gebiete der auf unserer Seite fechtenden Witboois ein weißer Farmer nebst Frau (Jäger) durch Buschmänner ermordet und beraubt worden ist. Eine Patrouille Witboois unter dem Leutnant Müller v. Berneck ging gegen die Mörder vor und erschoß sechs von ihnen. Wie im Schutzgebiet üblich, entstand in der Folge aus diesem Vorfall das Gerücht, auch die Witboois seien aufgestanden und in der Stärke von 80 Köpfen im Anmarsch auf Windhuk begriffen.
So fand ich die Lage, als ich Ende Dezember mich selbst auf den Kriegsschauplatz begeben hatte und in Keetmanshoop eingetroffen war. Die etwa 500 Köpfe starke Truppe (200 Weiße und 300 Eingeborene) war folgendermaßen disloziert:
1. in Groendorn 1. Feldkompagnie, 2 Gebirgsgeschütze;
2. in Kalkfontein 2 Gebirgsgeschütze und etwa 20 bis 30 Distriktsmannschaften sowie sämtliche eingeborenen Hilfsvölker mit Ausnahme der unter 3 genannten.
3. am Orangefluß, wo sich auch der Führer Hauptmann v. Fiedler befand, die 3. Feldkompagnie, ein Feldgeschütz, die Bastardabteilung, der größte Teil der Bethanier-Hottentotten.
Unmittelbar nach meinem Eintreffen begannen die Kharrasberg-Hottentotten sich aktiv am Aufstande zu beteiligen, und zwar nach Hottentottenart mittels Ausplünderns der Farmer der Umgebung, wogegen sie keinen am Leben schädigten. Schon damals zeigte sich, daß ihr Hauptführer Morenga den Krieg in den Grenzen der Menschlichkeit zu halten bemüht war. Bald empfing ich eine weitere ungünstige Nachricht, dahin lautend, daß auf dem Orangekriegsschauplatz der Oberleutnant Böttlin am 12. Dezember mit einer Patrouille von 23 Mann, meist Bastards, gegen die Stellung der Bondelzwarts bei Hartebeestmund[117] vorgegangen und nach anfänglichem Erfolge mit seiner ganzen Abteilung über die englische Grenze gedrängt, er selbst aber durch fünf Schüsse schwer verwundet sei. Wenn somit die Lage militärisch nicht besonders günstig zu nennen war, so hatte sie sich politisch doch insofern gebessert, als die Aufständischen bereits Kriegsmüdigkeit zeigten und sich einer durch Hauptmann v. Fiedler unter Vermittlung des Bezirksamtmanns v. Burgsdorff und des Kapitäns Witbooi an sie gerichteten Aufforderung zur Ergebung gegenüber nicht abgeneigt erwiesen hatten. Es sollte nur noch meine Ankunft abgewartet werden.
Indessen hielt ich nach meinem Eintreffen die Aufständischen für noch nicht genügend geschlagen, um jetzt schon, ohne spätere politische Schwierigkeiten heraufzubeschwören, an deren Begnadigung denken zu können, mindestens erschien es mir im Interesse unseres Ansehens erforderlich, dies an der Spitze einer stärkeren Macht von weißen Truppen zu tun. Aus diesem Grunde befahl ich heliographisch das Heranziehen der in Omaruru zum Ausmarsch bereitstehenden 2. Feldkompagnie. Die aus den Kharrasbergen ausgebrochenen Bondelzwarts wurden durch die Heranbeorderung der 1. Feldkompagnie von Groendorn auf Wasserfall, den hauptsächlichsten Westausgang des Gebirges, zum Rückzug in dieses genötigt. Ferner wurde, der neuen Kriegslage entsprechend, die ganze Feldtruppe jetzt in zwei Gruppen eingeteilt, die nördliche unter dem Hauptmann v. Heydebreck, die südliche unter dem Hauptmann v. Fiedler, das Ganze unter meinem Kommando. Zur nördlichen traten die in Groendorn — jetzt Wasserfall — und Kalkfontein stehenden Truppenabteilungen, zur südlichen die am Orangefluß befindlichen. Für die erstere war auch die 2. Feldkompagnie bestimmt, nach deren Eintreffen der Angriff auf die Kharrasberge beginnen sollte. Auch Hauptmann v. Fiedler wurde angewiesen, die Entscheidung am Orangefluß nur noch im Gefecht zu suchen.

Zur Durchführung dieses Planes ist es jedoch nicht mehr gekommen. Der am 12. Januar 1904 ausgebrochene Hereroaufstand rief die auf dem Vormarsche nach dem Süden bereits in Gibeon angelangte 2. Feldkompagnie wieder zurück. Wir selbst aber standen jetzt einer ganz anderen Lage gegen[S. 448]über. Es mußte mit den Bondelzwarts unter allen Umständen ein baldiges Abkommen getroffen werden, denn ein Krieg nach zwei Fronten hätte damals zu einer Katastrophe führen können. Die bereits eingeleiteten Verhandlungen wurden daher wieder aufgenommen und führten in der Folge am 27. Januar zu dem Frieden von Kalkfontein unter Bedingungen, wie wir sie angesichts unserer Lage kaum hätten erhoffen dürfen. Diese Bedingungen waren im wesentlichen:
1. Abgabe von Waffen und Munition sowie der während der Unruhen geraubten Güter;
2. Beschränkung des Stammes auf ein Reservat, das aus dem engeren Gebiet von Warmbad bestehen sollte. Die Kharrasberge und das Gebiet von Keetmanshoop sollten dagegen Kronland werden.[118]
3. Auslieferung aller Personen, die unter dem Verdacht des Mordes oder der Plünderung standen. Falls sie flüchtig werden sollten, war auf ihre Einlieferung eine Prämie von 500 Mark gesetzt. Sie sollten sich nach erfolgter Festnahme vor einem Gericht verantworten, zusammengesetzt aus den treugebliebenen Kapitänen des Namalandes, das unter Vorsitz des Bezirksamtmanns v. Burgsdorff im Mai 1904 in Warmbad zusammentreten sollte. Gleichzeitig sollte dort auch die genaue Abgrenzung des künftigen Stammesreservats erfolgen.
Mit Durchführung dieser Friedensbedingungen war der Hauptmann v. Fiedler betraut worden, während ich mich selbst durch die Kapkolonie über Steinkopf-Port Nolloth und von da zu Schiff nach Swakopmund begab, wo ich am 11. Februar eintraf und das Kommando auf dem Hererokriegsschauplatze übernahm.
Wirklich vollzogen wurde in der Folge von den bei Kalkfontein vereinbarten Friedensbedingungen nur die Abgabe von Gewehren und Munition, allerdings gerade die wichtigste. Die Ende Januar in das Lager von Kalkfontein gekommenen Großleute der Aufständischen sowohl aus den Orangebergen wie aus den Kharrasbergen lieferten dort ihre Gewehre an mich selbst aus. Es waren etwa 60 Stück. Die übrigen nahm in Warmbad Hauptmann v. Fiedler, in den Kharrasbergen Hauptmann v. Heydebreck ab. Die sämtlichen abgegebenen Gewehre erreichten nach amtlicher Meldung schließlich die Zahl von 289 Stück. Von Durchführung der zweiten Bedingung, Beschränkung des Stammes auf ein Reservat, mußte zunächst abgesehen werden,[S. 449] da es bei der zur Zeit des vereinbarten Termins (Mai 1904) im Namalande herrschenden Gärung zu gefährlich erschien, die Kapitäne des Landes von ihren Stammessitzen zu entfernen. Damit fiel auch die Verwirklichung der dritten Bedingung, Stellung der Schuldigen vor Gericht, ganz abgesehen davon, daß dies auch insofern nicht zu bewerkstelligen gewesen wäre, als[S. 450] sämtliche zehn im Friedensvertrag mit Namen genannten Geächteten sich in die Kapkolonie geflüchtet hatten, unter ihnen Morenga und die beiden Gebrüder Morris. Die Gründe, die zur Ächtung dieser drei geführt haben, sind im Kapitel IX, Seite 320 dargelegt.
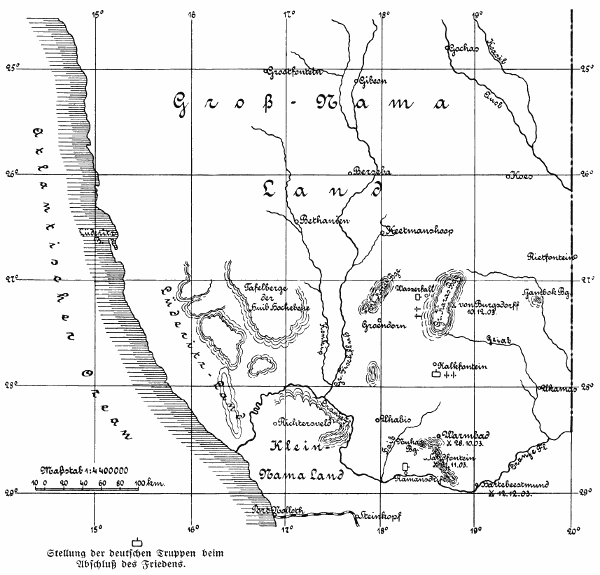
Nach erfolgter Entwaffnung der Aufständischen war die Aufgabe der Truppe beendigt; die Feldtruppe aus Windhuk (1. Kompagnie und Gebirgs-Batterie) wurde daher nach dem Hererokriegsschauplatz in Marsch gesetzt mit dem Befehl, diesen Marsch langsam zu vollziehen und sich längere Zeit in Gochas, Gibeon und Hoachanas zu zeigen. Die Hoachanaser Hottentotten, die nicht übel Lust gezeigt hatten, sich dem Hereroaufstande anzuschließen, sollten außerdem entwaffnet werden, was durch den Führer Hauptmann v. Heydebreck in sachgemäßer Weise ausgeführt worden ist. Im Süden blieben unter Hauptmann v. Fiedler vorläufig nur die um ein Gebirgsgeschütz verstärkte 3. Feldkompagnie und eine Abteilung Polizeimannschaften nebst den Hilfsvölkern von Bethanien unter Leutnant Baron v. Stempel[119] zurück, letztere an der Ramansdrift zur Empfangnahme der etwa aus der Kapkolonie zurückkehrenden flüchtigen Aufständischen.
Der Friede von Kalkfontein ist in der Folge zum Gegenstand vieler Angriffe geworden. Man hätte mehr erreichen müssen, wurde namentlich von Ansiedlern des Südens, die sich durch den Hereroaufstand nicht direkt betroffen fühlten, ausgesprochen wie auch gedruckt. Nicht einmal alle und nur die schlechtesten Gewehre seien von den Aufständischen abgegeben worden. Ebenso wurden entsprechende aufreizende Äußerungen Eingeborener kolportiert sowie an das Gouvernement gemeldet. Sogar die Betätigung der treu gebliebenen Eingeborenen auf unserer Seite gegen ihre eigenen Landsleute wurde bemängelt. »Was nützen uns 200 Mann Bundesgenossen, wenn wir 200 Mann Weiße brauchen, um sie zu überwachen!«, so hieß es u. a. Im Norden dagegen widerhallte es von Vorwürfen wegen Wegziehens der 2. Feldkompagnie aus dem Hererolande, da dies der äußere Grund zum Hereroaufstande gewesen sei, was nach den Kenntnissen, die uns jetzt zur Seite stehen, allerdings nicht unrichtig ist. Nachdem ich indessen in vorstehendem die Zwangslage dargelegt habe, unter der damals gehandelt wurde, darf ich wohl dem aufmerksamen Leser selbst das Urteil überlassen. Nur bezüglich der Entwaffnung sei mir eine Bemerkung gestattet. Ein Eingeborenenstamm von 300 bis 400 waffenfähigen Männern,[S. 451] der 289 Gewehre abgibt, muß als entwaffnet gelten. Hatten doch die amtlichen Listen anläßlich der Gewehrstempelung bei den Bondelzwarts seinerzeit nur etwa 200 Gewehre als vorhanden festgestellt. Was die Qualität der abgegebenen Gewehre anbelangt, so waren die, welche ich selbst gesehen habe, mit nicht nennenswerten Ausnahmen gute Hinterlader, und zwar Snider, Henry-Martini sowie einige Modell 71. Über diejenigen, die ich nicht gesehen habe, kann ich nicht urteilen. Es sollen gleichfalls überwiegend Hinterlader gewesen sein. Schließlich möchte ich mir nicht versagen, auf den Wortlaut eines jüngst eingegangenen amtlichen Telegramms aus Windhuk vom 20. Februar 1906 hinzuweisen: »In Bersaba stellten sich 300 Hottentotten von Cornelius' Anhang, darunter 160 Männer, und gaben 25 Gewehre ab.«
Daß sich unterwerfende Eingeborene ihre Gewehre zum Teil vorher verstecken, kann eben niemand hindern. Es würde aber nach dem Sprüchwort vom »Sperling in der Hand« politisch unklug sein, sie wegen des begründeten Verdachts, dies getan zu haben, etwa von der zugesicherten Begnadigung auszuschließen. Diese Erscheinung möge im übrigen auch dartun, welche Aussichten eine im Frieden vorgenommene allgemeine gewaltsame Entwaffnung unserer sämtlichen Eingeborenen gehabt haben würde, auch wenn es uns gelungen wäre, diese Absicht bis zur Ausführung mit dem tiefsten Geheimnis zu umgeben.
Trotz der aufgeregten Stimmung, die sich nach dem Friedensschluß von Kalkfontein im Namalande geltend machte, ließen sich doch die politischen Verhältnisse daselbst äußerlich zunächst günstig an. Die Rädelsführer der Bondelzwarts waren über die englische Grenze verschwunden, während der Stamm selbst unter dem neuen Kapitän Johannes Christian, einem ruhigen und zuverlässigen Charakter, soweit man das von einem Hottentotten sagen kann, sich allmählich wieder in Warmbad sammelte. Zum Distriktschef daselbst war der frühere Distriktschef Leutnant Graf v. Kageneck ernannt worden, den sich schon im Lager von Kalkfontein die Bondelzwarts selbst erbeten hatten. Die Hottentotten in den Kharrasbergen dagegen, die später gleichfalls in die Gegend von Warmbad ziehen sollten, verblieben gemäß dem Friedensvertrag bis auf weiteres in den bisherigen Wohnsitzen. Was aber als das beste Zeichen für die zur Zeit noch loyale Gesinnung der Hottentotten erschien, war die Tatsache, daß sofort wieder Bundesgenossen[S. 452] aus allen Namastämmen auf dem Hererokriegsschauplatze eintrafen, an der Spitze 80 Witboois, die der Kapitän später auf über 100 verstärkte. Dagegen waren er selbst sowie sein hervorragendster Unterkapitän Samuel Isaak nicht mit ausgerückt, beide von dem dreimonatlichen Bondelzwartsfeldzuge noch kriegsmüde; zudem hatte der Kapitän während des letzteren einen schweren Dysenterieanfall gehabt, von dem er sich nur langsam hatte erholen können. Deshalb blieb auch Bezirksamtmann v. Burgsdorff in Gibeon. Mit ihm habe ich dann bis zum Ausbruch des Witbooiaufstandes fortgesetzt korrespondiert, aber bis zuletzt weder amtlich noch privatim eine Mitteilung erhalten, die auf Unruhe auch unter den Witboois schließen ließ. Die Erregung schien sich vielmehr auf den Bezirk Keetmanshoop zu beschränken, der allerdings schließlich geradezu nervös geworden war.
Nach unserer Gepflogenheit, möglichst alles in breitester Öffentlichkeit zu verhandeln, wurde, als kaum der Hereroaufstand ausgebrochen war, auch die Frage öffentlich angeschnitten, was nach Niederwerfung der Hereros mit den Hottentottenstämmen begonnen werden sollte. Es wurde von einer erforderlich werdenden Auflösung der Stammesverbände, Beseitigung der Kapitäne und allgemeiner Entwaffnung gesprochen, geschrieben und gedruckt. Dies konnte den Eingeborenen nicht verborgen bleiben und beunruhigte sie im höchsten Maße. (Siehe Kapitel IX, Christian Goliath.) Infolgedessen richtete ich unter dem 19. April 1904 an den Redakteur der »Deutsch-Südwestafrikanischen Zeitung« die Bitte, wenigstens in seinem Blatte derartige Fragen mit Vorsicht zu behandeln, andernfalls würden schließlich im Namalande die Gewehre von selbst losgehen. Als dann im April 1904 nach dem Ausfall der von Typhus durchseuchten Kolonne Glasenapp eine namhafte Verstärkung der Schutztruppe auf dem Hererokriegsschauplatze beschlossen worden war (Kap. XIII, S. 507), wurde damit auch die Entsendung von zwei Kompagnien und einer Batterie in das Süd-Namaland verbunden. Dabei verhehlte man sich aber durchaus nicht, daß diese notwendige und gut gemeinte Maßnahme unter den obwaltenden Umständen auch gerade das Gegenteil dessen erzielen konnte, was sie beabsichtigte. Denn die Nervosität, die bisher vornehmlich nur unter den Weißen herrschte, konnte sich nunmehr auch der ohnehin mißtrauischen Eingeborenen bemächtigen. Der stellvertretende Bezirksamtmann von Keetmanshoop, Zolldirektor Schmidt, tat zur Beruhigung, was er nur konnte, doch mußte auch er noch unter dem 3. Juli 1904 dem Gouvernement melden: »Auch hat bei ihnen — nämlich den Eingeborenen — die Erörterung von Fragen, was nach Ansicht der Weißen in Zukunft mit den[S. 453] Eingeborenen geschehen müsse (Abnahme der Gewehre und ihres gesamten Landes), eine begreifliche Unruhe hervorgerufen. So saßen auf der einen Seite die Weißen an größeren Plätzen, wie Keetmanshoop, Bethanien, Bersaba, oder dicht an der englischen Grenze, um sofort übertreten zu können, und sprachen vom Aufstand und dessen Folgen, und auf der anderen Seite die Eingeborenen und berieten über den Krieg. Bei beiden herrschte Furcht, meines Erachtens nicht am wenigsten bei den Hottentotten.«
Aber immerhin hätte diese auf beiden Seiten im Bezirk Keetmanshoop vorhandene Nervosität noch nicht zum Aufstand geführt, wenn nicht ein weiterer Umstand hinzugetreten wäre. Die mit der Kapregierung eingeleitet gewesenen Verhandlungen wegen Auslieferung der geflüchteten und geächteten Bondelzwarts waren gescheitert. Dagegen erschienen im Monat Juli die tatkräftigsten von ihnen, Morenga und die Gebrüder Morris, an der Spitze von etwa einem Dutzend Bewaffneter wieder diesseits der Grenze und begannen mit erneuter Ausplünderung von Farmen. Das mußte in dem an sich schon aufgeregten Bezirk um so unheilvoller wirken, als den Aufständischen zunächst der Erfolg zur Seite stand. Deren erste Tat war die Entwaffnung und Beraubung von neun zusammenwohnenden Farmern, der dann noch diejenige von drei einzeln wohnenden Ansiedlern folgte. Der damals im Süden kommandierende Offizier Major v. Lengerke setzte daher Ende August eine größere Expedition gegen die Bande an. Bevor sie jedoch zum Eingreifen gekommen war, stieß am 30. August der zur Befreiung einer abgeschnittenen Patrouille vorausgesandte Leutnant Baron v. Stempel an der Spitze von 34 Mann bei Sjambokberg[120] auf Morenga, dessen Truppe inzwischen bis auf etwa 70 Gewehre angewachsen war. Beim Angriff fiel Leutnant Baron v. Stempel mit zwei Reitern, zwei Reiter wurden schwer verwundet, drei vermißt. Der Rest der Abteilung verschanzte sich rückwärts bei Plattbeen, wurde hier am 4. September von Morenga angegriffen und dann durch eine Abteilung der 3. Kompagnie unter Leutnant Schmidt entsetzt. Hierbei war wieder ein Reiter verwundet worden. Es erscheint nur naturgemäß, wenn dieser Zusammenstoß von den Hottentotten als ein Sieg Morengas aufgefaßt worden ist und wenn nunmehr der Zustrom zu ihm derart anschwoll, daß der Bandenführer binnen wenigen Wochen an der Spitze von etwa 300 Gewehren stand. Ist doch der arbeitsscheue, aber auf dem Rücken seines Pferdes unermüdliche Hottentott stets zu haben, wo es[S. 454] etwas zu plündern gibt. Morenga aber mußte von jetzt ab als kriegführende Macht betrachtet werden. An erzielten Erfolgen hat er sogar noch den alten kriegserfahrenen Witbooi übertroffen.
Die Hottentottenkapitäne selbst vermochten zwar der Flucht vieler ihrer Leute zu Morenga nicht zu steuern, blieben aber für ihre Person, wie mit der Mehrzahl ihrer Leute, treu. Um sie zum offenen Anschluß an die Aufständischen zu bewegen, bedurfte es einer noch stärkeren Triebkraft, und diese war erst gegeben, als ein ganz unerwartetes Ereignis hinzukam:
Die Gründe, die den alten 80jährigen Mann noch an seinem Lebensende bewogen haben, sein eigenes Werk zu zerstören, die Befestigung der Deutschen Schutzherrschaft im Namalande, zu der er in zehnjähriger Arbeit redlich beigetragen hatte, werden jetzt nach seinem Tode wohl nie völlig aufgeklärt werden können. Wir sind daher auf Vermutungen angewiesen. Von langer Hand vorbereitet war der Aufstand jedenfalls nicht, andernfalls würde es für den Kapitän richtiger gewesen sein, unsere ungünstige Lage zu Beginn des Hereroaufstandes auszunutzen, statt uns sogar noch Unterstützung zu senden. Ferner wäre es ihm auch später noch leicht gewesen, seine auf unserer Seite im Felde stehenden Leute durch heimlichen Befehl zurückzubeordern. Einen Zuwachs von 70 bis 80 wohlbewaffneten und berittenen Leuten hätte er recht gut brauchen können.[121] Mißtrauisch war der Kapitän allerdings anscheinend bereits seit einiger Zeit wieder geworden. Der bei[S. 455] der Truppe inzwischen erfolgte Kommandowechsel mag wohl dieselben Gefühle in ihm erregt haben, die ihn seinerzeit im Jahre 1895 nach Eintreffen des neuernannten stellvertretenden Truppenkommandeurs Major Mueller zu der im Kapitel II, Seite 79 geschilderten Flucht über die englische Grenze bewogen haben. Die Eingeborenen sind nun einmal nicht für eine Sache, sondern nur für eine Person zu haben, ein Gefühl, das allerdings in den Kolonien die Gründung dauernder Verhältnisse erschwert, aber nicht aus der Welt zu schaffen ist. Als ich z. B. im Juni 1904 das Feldlager von Owikokorero verließ, um das Kommando abzugeben, kam eine Deputation der verbündeten Witboois mit der Anfrage zu mir, ob sie jetzt nicht auch zurückgehen dürften, denn sie hätten nur mit mir Vertrag, nicht mit einem anderen. Ich beruhigte sie mit dem Versprechen, bald wiederzukommen. Von dem neuerwachten Mißtrauen des Kapitäns Witbooi zeugt auch die im Kapitel IX, Seite 294 erwähnte Tatsache, daß er auf eine ihm hinterbrachte angeblich abfällige Kanzeläußerung des Missionars in Windhuk über seinen Sohn und Nachfolger Isaak so großen Wert gelegt hat.
Zu diesem Mißtrauen Witboois kam Ende August der schwerwiegende Umstand, daß nach dem Gefecht von Waterberg 19 Witboois kriegsmüde und mit Waffen und Munition flüchtig geworden waren. Hiervon benachrichtigt, sandte mir der Kapitän nachstehendes, vom 21. August 1904 datiertes Heliogramm:
»Höre mit Bedauern, daß einige Witboois flüchtig geworden sind. Ich befürchte, daß viele falsche Stories die Schuld tragen. Ich erwarte, daß die Namas, die noch im Felde stehen, treu ihre Pflicht tun werden. Ein Brief von hier geht heute an die Namas ab.«
Dieser hier angekündigte Brief lief gleichfalls durch meine Hände und war an den Führer der im Felde stehenden Witboois gerichtet, die immer noch 70 bis 80 Köpfe stark waren. Er enthielt die strengste Weisung zur ferneren Pflichterfüllung, da er, der Kapitän, wie immer, treu zur deutschen Sache stände. Es hat Stimmen gegeben, die diese beiden, äußerlich so loyalen Kundgebungen Witboois noch wenige Wochen vor seinem Abfall für eine Heuchelei erklärt haben, aus dem Bedürfnis entsprungen, der deutschen Regierung Sand in die Augen zu streuen. Diese Stimmen übersahen jedoch, daß zwischen beide Handlungen des Kapitäns ein weiteres Ereignis von weittragender Bedeutung gefallen ist, nämlich die Ankunft der aus dem Felde geflüchteten Witboois in ihrer Heimat. Diese scheint Mitte[S. 456] September erfolgt zu sein, und Anfang Oktober schlug der Kapitän los.[122] Sehr nahe liegt daher der Gedanke, daß die Erzählungen dieser Flüchtlinge, die in deren eigenstem Interesse nur gefärbt sein konnten, neben den später noch zu erwähnenden religiösen Beweggründen bei dem Kapitän den letzten Ausschlag gegeben haben. Die zurückgekehrten Witboois werden sich wohl mit schlechter Behandlung entschuldigt, aber auch ihrer Überzeugung Ausdruck gegeben haben, daß die Deutschen mit den Hereros nicht fertig werden würden. Fehler in der Behandlung der Witboois mögen seitens der neu ins Land gekommenen Offiziere und Mannschaften wohl auch gemacht worden sein. Dies geht wenigstens aus einem damals in Omaruru aufgenommenen Protokoll hervor. Im übrigen aber ist es wieder ein Beweis für die überlegene Findigkeit der Eingeborenen, daß es sämtlichen Witbooi-Flüchtlingen gelungen ist, durch die deutschen Truppen, durch das insurgierte Hereroland, endlich durch sämtliche auf sie aufmerksam gemachte Polizeistationen hindurch unbehelligt Gibeon zu erreichen und sich dort bei ihrem Kapitän zu melden. Dabei hatten sie auf ihrer Flucht keinerlei Proviant mitnehmen und trotzdem mehrere Wochen unterwegs sein können. Für die in Treue bei der Truppe zurückgebliebenen Witboois war es dagegen ein tragisches Verhängnis, wenn sie, gehorsam dem Befehle ihres Kapitäns, nunmehr auf deutscher Seite ausharrten, um dann von demselben Kapitän treulos im Stiche gelassen zu werden. Sie wurden nach der Erhebung des letzteren entwaffnet und nach Togo überführt, wo sie wohl dem Klima erliegen werden.
Im übrigen muß man dem alten Witbooi gewiß Milderungsgründe zubilligen, wenn er allen diesen auf ihn einstürmenden Eindrücken erlegen ist und sich schließlich die Überzeugung bei ihm festgesetzt hat, die deutsche Regierung hätte nichts Gutes mit ihm im Sinn. Das einzige, was den Kapitän von seinem Beginnen vielleicht noch hätte abhalten können, wäre meine eigene Reise zu ihm gewesen, wie sie bereits von Abgabe des Truppenkommandos ab geplant war.
Bedauerlicherweise hatten jedoch die Verhältnisse auf dem Hererokriegsschauplatze es nicht gestattet, die von mir als erforderlich erachtete[S. 457] Begleitkompagnie vor Ende September freizumachen, und dann war es zu spät, da der Aufstand bereits Anfang Oktober ausbrach. Ohne starke Begleitung aber hätte ich bei dem Charakter der Eingeborenen nicht auf ein ausreichendes politisches Gewicht rechnen können. Denn was der Eingeborene nicht sieht, glaubt er nicht. Hätte ich die kommenden Ereignisse voraussehen können, so würde ich den Besuch natürlich auch ohne diese Kompagnie gewagt haben.
Nachdem ich dann bis zum Eintreffen des für das Kommando im Süden bestimmten Obersten Deimling den Befehl gegen die Witboois übernommen hatte, war mein erstes, daß ich meiner Gewohnheit gemäß unter der Firma »Bote« einen Spion an den Kapitän sandte mit einem Briefe, in dem ich ihn um Angabe der Gründe für seinen Abfall ersuchte. Um aber von Hause aus ungerechtfertigten Behauptungen vorzubeugen, in denen ich Witbooi als Meister kannte, versicherte ich im voraus, daß weder ich noch überhaupt die deutsche Regierung Übles gegen ihn geplant hätten, da wir dazu seine treuen Dienste viel zu sehr schätzten. In seiner Antwort beschränkt sich der Kapitän auf allgemeine Phrasen, wie aus nachstehendem Wortlaut hervorgeht:
»Ich habe Ihren Brief vom 1. Oktober gelesen und will Ihre erste Frage nach der Ursache (des Krieges) beantworten. Die Ursache liegt weit zurück. Sie haben mir gesagt, daß Sie den Brief an Hermanus van Wyk gelesen haben, so haben Sie gesehen, wovon mein Herz voll ist. Wie Sie in Ihrem Briefe schreiben, habe ich zehn Jahre in Ihrem Gesetz, hinter Ihrem Gesetz und unter Ihrem Gesetz gestanden, und nicht ich allein, sondern alle Häuptlinge von Afrika. So fürchte ich Gott den Vater. Die Seelen (Leute), die in den zehn Jahren ausgefallen sind von allen Nationen in Afrika und bei allen Häuptlingen ohne Schuld und Ursache und ohne wirklichen Krieg im Frieden und im Vertrag vom Frieden (der Kapitän will wohl sagen: »lasten schwer auf mir«.)
»Die große Rechenschaft, die ich vor Gott dem Vater zu geben habe, der im Himmel ist, ist sehr groß. So hat Gott unsere Tränen und Bitten und Seufzen gehört und uns erlöst. Denn ich warte auf ihn und flehe zu ihm, damit er unsere Tränen trocknet und uns erlöst zu seiner Zeit. So hat jetzt Gott aus dem Himmel den Vertrag gebrochen. Weiter haben Sie mir geschrieben, ich hätte wehrlose weiße Menschen totgemacht und daß 80 meiner[S. 458] Leute in Ihrer Gewalt sind für die Menschen, um die weißen Leute mit meinen Leuten zu bezahlen. Und nun bitte ich Sie, wenn Sie diesen Brief gelesen haben, dann müssen Sie sich in Ruhe hinsetzen und darüber nachdenken und die Seelen ausrechnen, die in den zehn Jahren ausgefallen sind von dem Tage an, seitdem Sie ins Land gekommen bis zum heutigen Tage. Und rechnen Sie auch die Monate von zehn Jahren und Wochen und Tage und Stunden und Minuten, seit die Leute ausgefallen sind. Und rechnen Sie die weißen Menschen, die in dieser kurzen Zeit in meine Hände gefallen sind, so sage ich Ihnen, diejenigen meiner Leute, die in Ihrer Hand sind, wissen nichts von meinen Werken, und sie haben Ihnen treu gedient. So geben Sie die Leute frei, ohne ihnen etwas zu tun, alle Leute, die die Häuptlinge Ihnen gegeben haben. Und den weißen Menschen kann es (mein Vorhaben) nicht unbekannt gewesen sein, weil der Hauptmann v. Burgsdorff selbst meinen Brief gelesen hatte, bevor ich etwas gemacht habe. Ferner bitte ich Ew. Hochwohlgeboren, nennen Sie mich doch nicht Rebell. Soweit bin ich
gez. Kapitän Hendrik Witbooi.«

Da Witbooi die im ganzen Namalande vorhandene Gärung nicht unbekannt geblieben war, hatte er gleichzeitig mit der Erhebung der Fahne des Aufruhrs unter dem 3. Oktober an sämtliche Hottentottenkapitäne wie an den Bastardkapitän die im Kap. IX, S. 304 erwähnte Aufforderung zum Anschluß gerichtet.
Der Bastardkapitän übergab den an ihn gelangten Brief sofort dem Distriktschef von Rehoboth, das gleiche tat der Kapitän von Bersaba, der den seinigen nach Keetmanshoop sandte, denn beide Kapitäne dachten nicht daran, sich dem Aufstande anzuschließen. Treu blieb auch mit seinem Anhang der Kapitän Paul Frederiks von Bethanien, während der größere Teil des Stammes dem Schwiegersohn Witboois, dem Unterkapitän Cornelius, mit in das Feld folgte. Ebenso folgten dem Rufe Witboois der Feld[S. 459]schuhträgerkapitän Hans Hendrik, der Gochaser Kapitän Simon Cooper und der Kapitän von Hoachanas, Manasse.
Die erst vor kurzem entwaffneten Bondelzwarts blieben zunächst unter Bewachung in Warmbad, dann schlossen sie sich allmählich, nicht als Ganzes, sondern einzeln den Aufständischen an, zuletzt auch der Kapitän Johannes Christian selbst. Ihre Neubewaffnung werden sie wohl in geraubten sowie gefallenen deutschen Soldaten weggenommenen Gewehren gefunden haben.
Ermordet wurden bei Beginn des allgemeinen Hottentottenaufstandes nur Farmer und die Besatzung einiger kleiner Polizeistationen im Bezirk Gibeon. Im Bezirk Keetmanshoop gelang dagegen dem stellvertretenden Bezirksamtmann Schmidt die rechtzeitige Warnung der Weißen sowie die Einziehung gefährdeter Stationen. Letzteres war in Gibeon nicht möglich gewesen, da dort mit dem Entschluß zum Aufstand auch dessen Ausbruch zusammenfiel. Kapitän Witbooi hatte geglaubt, genug getan zu haben, wenn er dem Bezirksamtmann v. Burgsdorff am 3. Oktober die Nachricht von seiner Absicht sandte, dann aber in der Nacht vom 3. zum 4. Oktober die Ermordung ahnungsloser Farmer und Soldaten gestattete. Wie bekannt, ritt der Bezirksamtmann am 3. persönlich zu dem Kapitän nach Rietmond, um ihn wieder umzustimmen, erreichte ihn aber nicht mehr, sondern fand unterwegs seinen Tod.
Mit dem Bezirksamtmann v. Burgsdorff, der als Opfer seiner Pflicht gefallen ist, hat das Vaterland einen Kolonialbeamten verloren, wie es einen besseren schwer wird finden können. Er hatte genau zehn Jahre vorher die ebenso schwierige wie undankbare Aufgabe übernehmen müssen, den soeben erst unterworfenen, in langjährigen Kriegen verwilderten Witbooistamm wieder auf den Boden eines geordneten Staatswesens zurückzuführen. Zur Unterstützung bei dieser Ausgabe konnten ihm nur 30 Unteroffiziere und Reiter zur Verfügung gestellt werden.
Und wie hat v. Burgsdorff seine Aufgabe gelöst! Bereits drei Monate nach dem Friedensschluß trat Witbooi gegen die Khauas-Hottentotten wie auch gegen den noch schwankenden Kapitän von Gochas offen auf unsere Seite (Kapitel II). Dies war ausschließlich das Verdienst des Bezirksamtmanns, damals noch Oberleutnants v. Burgsdorff. Und welch einsames Leben war letzterem dabei auf seiner Station Gibeon beschieden, und auf welch sittlicher Höhe hatte er sich seinen Hottentotten gegenüber halten müssen, unter denen er zwei Jahre lang ohne jeden[S. 460] gebildeten Umgang ausharren mußte. Auch für Kirche und Schule sorgte er während dieser Zeit und feierte mit seinen Pflegebefohlenen stets die kirchlichen Feste. Denn die Mission wurde in Gibeon erst 1896 wieder eingerichtet.[123]
Durch sein Wirken hatte sich Bezirksamtmann v. Burgsdorff schließlich den Kapitän Witbooi vollständig in die Hand gearbeitet und damit auch unter den übrigen Eingeborenen des Namalandes eine maßgebende Stellung gewonnen.
Aber nicht etwa lediglich mittels wohlwollenden Entgegenkommens hatte er sich diese Stellung erworben. Er konnte vielmehr auch scharf auftreten und dem alten Witbooi, wenn dieser einmal gleichfalls Neigung zu einer leichtsinnigen Hottentottenwirtschaft zeigte, recht bittere Wahrheiten sagen, die dieser stets geduldig hinnahm. Desgleichen hatte Bezirksamtmann v. Burgsdorff häufig einen schweren Stand gegen den einflußreichen Unterkapitän Samuel Isaak wegen dessen Neigung zum Alkohol.
In der Tat, man steht vor einem Rätsel, wollte man glauben, der alte Witbooi habe die Ermordung dieses seines langjährigen Freundes selbst befohlen. Ich vermag mich der Ansicht nicht zu entschlagen, daß die Tat schließlich doch gegen seinen Willen lediglich durch die Kriegspartei unter seinen Leuten geschehen ist, die aus naheliegenden Gründen eine Aussprache zwischen den beiden Männern hat verhindern wollen.
Im übrigen ist auch der Bezirksamtmann v. Burgsdorff dem Vorwurf zu großer Nachsicht gegen die Eingeborenen nicht entgangen. Diesen Kritikern möchte ich zurufen: »Macht es erst einmal nach, mit 12 bis 15 deutschen Polizeisoldaten — so gering war schließlich die Polizeimacht im Bezirk Gibeon — zwei Hottentottenstämme[124] mit zusammen 1200 bis 1400 waffenfähigen Männern nicht nur in Ordnung zu halten, sondern sie sich auch vollständig in die Hand zu arbeiten, und dann will ich Euch gern das Recht zur Kritik geben.«
Zehn Jahre lang hat Herr v. Burgsdorff das anscheinend Unmögliche fertig gebracht, und daß zu dem von ihm geschaffenen Frieden auch Vertrauen bestanden hat, möge die Tatsache beweisen, daß in keinem Bezirk die Ein[S. 461]wanderung weißer Farmer stärker gewesen ist wie in dem seinigen. Auch sein schärfster Kritiker wird Herrn v. Burgsdorff zugeben müssen, daß dessen Streben, mit den ihm zur Verfügung stehenden Machtmitteln auszukommen, eine undankbarere und schwierigere Aufgabe gewesen ist, als ein fortgesetztes Petitionieren um Verstärkung. Aber nicht nur Frieden hat Herr v. Burgsdorff in seinem Bezirk aufrechterhalten, er hat auch den letzteren zu hoher wirtschaftlicher Blüte gebracht.
Den weiteren Verlauf des Witbooiaufstandes zu schildern, fällt nicht in den Rahmen meiner Aufgabe, da das Kommando Ende 1904 an den Obersten Deimling überging. Bei den bestehenden Machtverhältnissen — Anfang Oktober nur eine Ersatzkompagnie, das übrige mußte erst aus dem Hererogebiete herangezogen werden — hatte es sich zunächst nur um Deckung des Bastardlandes gehandelt. Dies geschah durch Besetzung der wichtigsten Eingangstore in das letztere, und zwar von Nomtsas, Kub und Hoachanas. Glücklicherweise beschränkte sich auch der Gegner auf einzelne Vorstöße, die durchweg abgewiesen wurden.
Leider aber hatte Nomtsas, der Wohnsitz des Farmers Hermann,[125] nicht früh genug erreicht werden können, um jenen erfahrenen sowie dem Schutzgebiete wertvollen Mann noch zu retten. Er war einer von denjenigen ermordeten Weißen, die gerade ein solches Schicksal um die Eingeborenen am wenigsten verdient hatten, da er ein stets wohlwollender und gerechter Dienstherr gewesen war. Und doch war seine Ermordung durch seine eigenen Leute erfolgt, die zudem zum größten Teil gar nicht dem Witbooistamm angehört hatten.
Ich habe oben von einem zum Kapitän Witbooi gesandten Spion unter der Firma eines Boten gesprochen; dieser gab nach seiner Rückkehr folgendes zu Protokoll:
»Als ich nach Narris, unweit Rietmond, kam, legten sich mir sechs Witboois schußfertig vor. Als ich ihnen zurief, ich sei ein Bote, antworteten sie, die Zeit für Boten sei nicht mehr da, jetzt würde alles erschossen. Die Leute rieten mir dann, nicht durch die Werfte, sondern direkt nach Rietmond zum Kapitän zu gehen. Unterwegs traf ich einen Feldkornett, der mir einen berittenen Mann mitgab, mit der Weisung, mich zum Kapitän zu bringen.
[S. 462] »Kapitän Witbooi wohnt, wie bisher, in seinem Hause in Rietmond. Bei dem Hause standen zahlreiche Bewaffnete. Dem Kapitän gab ich sofort meinen Brief, er las ihn und fragte mich dann, ob mich der Gouverneur persönlich geschickt hätte. Nachdem ich dies bejaht hatte, erklärte der Kapitän, er werde mit mir nicht weiter verhandeln, sondern nur eine Antwort schreiben. An mich persönlich fügte er doch noch die Frage hinzu: »Weshalb bringst Du mir noch einen Brief von meinem Feinde?« dann fügte er ferner hinzu: ‚Das Schicksal meiner bei den Deutschen gefangenen Leute ist mir ganz gleichgültig, ich habe von Gott eine andere Arbeit empfangen‛. Hierauf wies er mir ein Unterkommen an und sprach dann die drei Tage, die ich noch da war, weiter nichts mehr mit mir.
»Dann fragte ich auch Samuel Isaak um die Gründe des Aufstandes. Dieser erwiderte, es sei alles von oben gekommen, d. h. von Gott. Die Haupttriebfeder hierzu ist ein Kaffer aus der Kapkolonie, der sich für einen Propheten ausgibt. Dieser befindet sich in Rietmond und sagte mir bei einer Unterredung, er würde 50 Witboois salben und dann mit diesen alle Deutschen aus dem Lande jagen.
»Anscheinend glaubt der Kapitän an eine solche Verheißung, denn es ist bei den Witboois nicht das Geringste zur Befestigung ihrer Stellung geschehen. Auch werden keine Sicherheitstruppen ausgestellt, dagegen viel Patrouillen gesendet.
»Bezüglich der Verhältnisse bei den übrigen Hottentottenstämmen habe ich folgendes erfahren: Die Leute von Gochas sind aufständisch, befinden sich aber noch in ihrem Lande und scheinen auch nicht die Absicht zu haben, sich mit den Witboois zu vereinigen. Die Kapitäne von Bersaba und Bethanien haben sagen lassen, daß sie nicht mitmachten. Der Kapitän der Feldschuhträger habe Anschluß an die Gochaser gesucht, sei aber unfreundlich empfangen worden. Die Witboois scheinen sämtlich an die Worte des Propheten zu glauben. Sie glauben, die Macht zu haben, die Deutschen aus dem Lande zu jagen. Dies wollen sie jedoch anscheinend nicht durch Angriff mit ganzer Macht erreichen, sondern durch das Abschießen einzelner Patrouillen. Während meiner Anwesenheit ist Samuel Isaak mit einigen Leuten nach Bersaba geritten, um den dortigen Kapitän, wenn es sein muß, mit Gewalt zum Anschluß an den Aufstand zu bewegen. Von den Angehörigen der bei den Deutschen[126] befindlichen Witbooileute habe ich nur[S. 463] die Frau des Unterkapitäns Samuel Pitter gesprochen. Diese verfluchte den Kapitän, weil er ihren Mann, der treu gedient, in eine so üble Lage gebracht hätte.
»Bezüglich des Hererokrieges habe ich den Witboois erzählt, daß die Hereros zum Lande hinausgejagt seien, und daß unsere Bastardsoldaten bereits nach der Heimat entlassen seien und viel Beutevieh mitgebracht hätten. Die Witboois wollen dies entweder nicht glauben, oder sie bleiben dabei, daß sie jetzt eine höhere Aufgabe hätten. Letztere Meinung läßt auch die Masse sich über das Schicksal ihrer gefangenen Landsleute hinwegsetzen.
»Ich war während meines Aufenthaltes in Rietmond bewacht und habe daher selbst nicht viel sehen können. Anscheinend sitzt die Masse der Witboois bei Mariental. Letztere sind zahlreich, meist junge Leute, und gut mit Waffen und Munition versehen. Über ihre Pläne habe ich nichts in Erfahrung bringen können. Sie scheinen im Vertrauen auf die Hilfe von oben auf ihren derzeitigen Plätzen einen Angriff abwarten zu wollen. Da sie sicher an Sieg glauben, so denken sie anscheinend nicht weiter hinaus.
»Der sogenannte Prophet ist ein Betschuane aus der Kapkolonie, weiter weiß ich nichts über ihn. Derselbe hat auch im Bastardlande aufreizen wollen, der Kapitän ließ ihn jedoch wegjagen.
»Der Kapitän Witbooi hat mir persönlich einen Brief an den Herrn Gouverneur mitgegeben. Beim Durchpassieren durch Kub auf dem Rückwege hat mir Hauptmann v. Krüger den Brief abgenommen, um ihn schneller zu befördern. Er ist jedoch bis jetzt noch nicht eingetroffen. Der Kapitän sagte mir noch beim Abschied, wenn er es mit dem Gouverneur allein zu tun hätte, so wäre es nicht so weit gekommen, weiter wolle er mir nichts sagen, da es jetzt mit der Freundschaft zwischen dem Gouverneur und ihm doch vorbei sei.«
Aus diesem Protokoll geht hervor, daß bei dem ohnehin zur Mystik neigenden Kapitän auch religiöse Beweggründe ihre Rolle mitgespielt haben. Das Weitere habe ich im Kapitel IX unter dem Abschnitt »Kapitän Witbooi« geschildert. Dort ist darauf hingewiesen, daß die äthiopische Kirche, die zur Zeit auch den Engländern in Südafrika viel Sorge bereitet, auf ihre Fahne die Devise geschrieben hat: »Auch in religiöser Beziehung Freiheit der Schwarzen von den Weißen.« Was aber hauptsächlich aus der Aussage des Spions hervorgeht, das war der Aufschluß über die Stellungen und die[S. 464] Absichten des Gegners, eine Kenntnis, die mittels Patrouillen zu erwerben voraussichtlich manches Opfer gekostet haben würde.[127] Diesen Aufschluß habe ich dann dem Obersten Deimling übergeben können.
Es erübrigt nunmehr die Darstellung des Hererofeldzuges, soweit dieser noch unter mein Kommando fiel. Ihres Umfanges wegen erscheint es zweckmäßig, ihr ein besonderes Kapitel zu widmen.
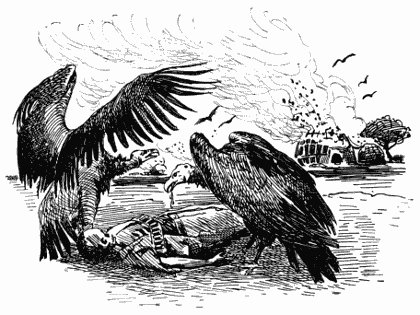
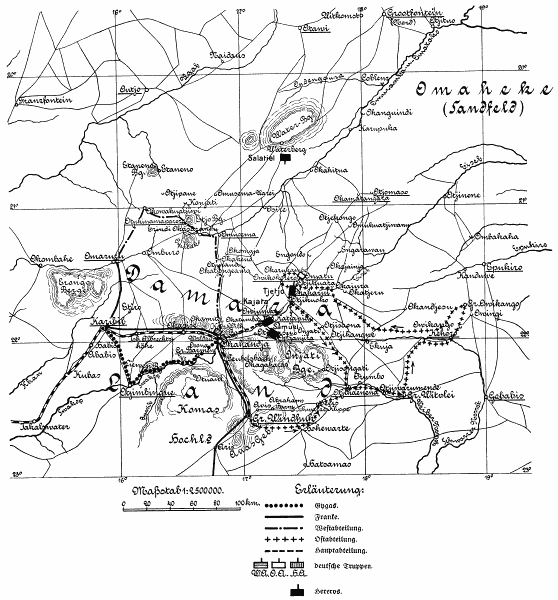

Als die Kriegslage im Bondelzwartsgebiet zwang, auch die 2. Feldkompagnie aus dem Hererolande dorthin zu beordern, war ich nicht im unklaren darüber, daß diese Maßnahme auf die Lage im Hererolande eine bedenkliche Wirkung ausüben könnte. Niemand konnte besser wissen als der Gouverneur, daß, abgesehen von den Rassengegensätzen, die Hereros auch sonst noch glaubten, Gründe zur Unzufriedenheit zu haben. Ich darf an dieser Stelle wohl erwähnen, daß ich dem Führer der 2. Feldkompagnie, der als tapferer Soldat gleich mit nach dem Süden ins Feld rücken wollte, auf seine dahingehende Bitte einen abschlägigen Bescheid gegeben habe. Hauptmann Franke war zugleich Bezirksamtmann von Omaruru und als solcher in der Behandlung der Eingeborenen im Frieden ebenso geschickt, wie er sich später im Kriege bei ihrer Bekämpfung tatkräftig erwiesen hat. »Er sei seiner Hereros auch während seiner Abwesenheit ganz sicher,« schrieb er mir. Als dann später Hauptmann Franke nach seiner Rückkehr vom Süden sich in die Lage versetzt sah, seine Wohnung in Omaruru mit stürmender Hand wieder nehmen zu müssen, wollte er nach seinem eigenen Bericht zuerst gar nicht glauben, daß seine Hereros es überhaupt wagen würden, auf ihren langjährigen Bezirksamtmann zu schießen. Er setzte sich daher bei Beginn des Gefechts absichtlich dem feindlichen Feuer aus, mußte jedoch bald seinen Irrtum einsehen. Dieser erscheint indessen verzeihlich, wenn man die Loyalität, um nicht zu sagen Treue mit angesehen hat, mit der die Hereros äußerlich an ihrem Bezirksamtmann zu hängen schienen.
Ich hatte daher zunächst vorgezogen, die Kompagnie Franke in Omaruru zu belassen. Als dann später die Kriegslage zu ihrer Heranziehung auf den südlichen Kriegsschauplatz zwang, wurde damit sofort die Einberufung sämtlicher Mannschaften des Beurlaubtenstandes der Nordbezirke verbunden. Die Folge war, daß dann der Aufstand in Omaruru eine zweite Ersatzkompagnie, in Windhuk eine erste Ersatzkompagnie, in Okahandja eine wesentlich verstärkte Stationsbesatzung vorgefunden hat, und diese drei Plätze sind gleich zu Beginn des Aufstandes die Brennpunkte des Kampfes geworden. Eine weitere Wirkung war, daß infolge ihrer Einziehung zahlreiche Mannschaften des Beurlaubtenstandes, die vorher einzeln unter den Eingeborenen gewohnt hatten, ihr Leben gerettet haben.
Über die Gründe des Aufstandes glaube ich mich nicht weiter auslassen zu sollen. Wer meinen bisherigen Ausführungen mit Aufmerksamkeit gefolgt ist, wird sie dort bereits gefunden haben. Im übrigen dürfte diese Frage im Schutzgebiet sowohl wie in der Heimat doch eine zu große Rolle gespielt und allzuviele ebenso überflüssige wie unerquickliche Erörterungen hervorgerufen haben. Auch die größte Kolonialmacht, England, ist Katastrophen solcher Art nicht entgangen. So haben wir z. B. im Jahre 1896 einen ganz überraschend gekommenen Aufstand im Maschona- und Matabeleland gesehen, der ebenfalls vielen Hunderten wehrloser weißer Männer, Frauen und Kinder das Leben gekostet hat. Auch dort ist das Wegziehen eines Teiles der bewaffneten Macht — zum Zwecke des Einfalles in Transvaal (Zug Jamesons) — die äußere Veranlassung gewesen, nur mit dem Unterschied, daß keine Zwangslage dieses Wegziehen geboten hatte. Doch hat man damals in der englischen Presse zwecklose Erörterungen über die Schuldfrage im allgemeinen vermieden.
Diese Periode kann man die Zeit der Überlegenheit der Hereros nennen. Sie war ausgefüllt mit der Ermordung einzeln wohnender Weißer, deren die Eingeborenen hatten habhaft werden können, mit Plünderung sämtlicher Farmen und Belagerung verschiedener Stationen, in erster Linie von Okahandja und Omaruru bis zu deren Entsetzung durch die Kompagnie Franke. Die Zahl der ermordeten Weißen betrug im ganzen 123.[129] Unter ihnen befanden sich[S. 467] 13 aktive Soldaten aus den wenigen, einem unvermuteten Überfall erlegenen Stationen (im ganzen 4), ferner 7 Buren und 5 Frauen. Der Befehl des Oberhäuptlings zum Aufstande hatte folgenden Wortlaut:
»Ich bin der Oberhäuptling der Hereros, Samuel Maharero. Ich habe ein Gesetz erlassen und ein rechtes Wort, und bestimme es für alle meine Leute, daß sie nicht weiter ihre Hände legen an folgende: nämlich Engländer, Bastards, Bergdamaras, Namas, Buren. An diese alle legen wir unsere Hände nicht. Ich habe einen Eid dazu getan, daß diese Sache nicht offenbar werde, auch nicht den Missionaren. Genug.«

Aus diesem Wortlaut geht hervor, daß die sieben Buren gegen den Willen des Oberhäuptlings mit als Opfer gefallen sind. Ebenso scheint bei der Hereroführung die Absicht vorgelegen zu haben, sämtliche Frauen und Kinder zu schonen. Wenn trotzdem solche ermordet worden sind, so ist dies auf Rechnung der Tatsache zu setzen, daß es überall Unmenschen gibt, die sich an derartige Grenzen nicht halten. Ferner richtete der Oberhäuptling sowohl an Witbooi wie an den Bastardkapitän Briefe — mit der Aufforderung zum Anschluß. Die Schreiben haben folgenden Wortlaut:
[S. 468] 1. An Witbooi.
11. Januar 1904.
»Ich mache Dir bekannt, daß die Weißen ihren Frieden mit mir gebrochen. Und halt es gut fest, so als wir hören. Und wir sollen für unsern Teil in unserer Schwachheit tun, was wir können. Und wenn es Gottes Wille ist, laß die Arbeit im Namaqualande nicht zurückgehen. Es bleibt noch übrig, daß Du kommst, um nach Swakopmund zu gehen, um zu sehen, was sie dort machen. Und ich bin ohne Munition. Wenn ihr Munition bekommen habt, helft mir und gebt mir zwei englische und zwei deutsche Gewehre, denn ich bin ohne Gewehre. Das ist alles. Grüße.«
2. An den Bastardkapitän.
11. Januar 1904.
»Ich mache Dir bekannt, daß unser Bündnis zwischen uns und den Deutschen gebrochen ist. Wir sind nun Feinde geworden, das mache ich Euch bekannt, daß Ihr wissend seid, denn Ihr müßt wissen, daß ein Bastard ein Herero ist und ein Namaqua und ein Englischmann. Ein Bergdamara ist ein Knecht der genannten Stämme. Das sind alle von unserer Seite, da ist es, nimm es und halte es fest. Und mach diese Arbeit fertig, und das ist alles, kommt, laßt uns nach Swakopmund gehen, laßt uns dort bleiben. Den einliegenden Brief[130] sende weiter und halt Deinen Mann fest, er hat keine Arbeit. Rühre keinen Buren und keinen Englischmann an.«
Etwas später wurde ein zweiter Brief Samuels an beide Kapitäne — ohne Datum — eingeliefert, in dem unter anderem ausgeführt ist:
1. An Witbooi.
»Laß uns lieber zusammen sterben und nicht sterben durch Mißhandlung, Gefängnis oder auf allerlei andere Weise. Weiter mache es allen Kapitänen da unten bekannt, daß sie aufstehen und arbeiten.
Ich schließe meinen Brief mit herzlichen Grüßen mit dem Vertrauen, daß der Kapitän meinen Wunsch erfüllen wird. Und schicke mir noch vier von Deinen Männern, daß wir von Mund zu Mund sprechen. Weiter verhindere den Krieg des Gouverneurs,[131] daß er nicht vorbeikommt. Und mache doch schnell, daß wir Windhuk stürmen, dann haben wir Munition. Weiter, ich fechte nicht allein, wir fechten alle zusammen.«
[S. 469] 2. An den Bastardkapitän.
»Weiter will ich Dich, Kapitän, wissen lassen, daß ich mit meinen anderen Kapitänen den Traktat zwischen mir und den Deutschen gebrochen habe. Hier auf Okahandja haben wir dreimal gefochten mit Maschinen und ich habe gewonnen. Ich fechte jeden Tag mit Maschinen. Weiter will ich Dich, Kapitän, benachrichtigen, daß mein Wunsch der ist, daß wir schwache Nationen aufstehen gegen die Deutschen, laß uns lieber aufreiben und laß sie alle in unserem Lande wohnen. Alles andere wird uns nichts helfen. Weiter sei so gut und laß vier Ratsmänner von Dir zu mir kommen, daß wir zusammen sprechen von Mund zu Mund und mache auf schnellste Weise, daß wir Windhuk in die Hände bekommen, wo genug Munition ist. Weiter habe ich alle Händler ermordet, außer Hälbich, Dannert, Buren, Redecker und Engländer. Hiermit schließe ich meinen Brief.«
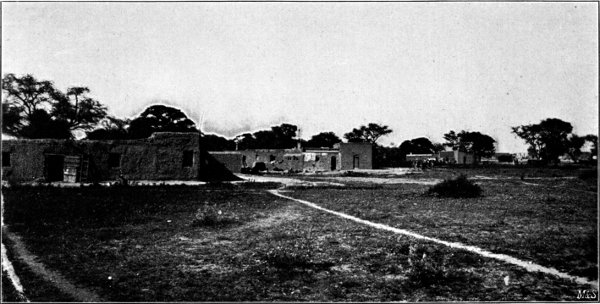
Beide Briefe an Witbooi kamen nicht in dessen Hände, sondern wurden seitens des Bastardkapitäns — zugleich mit dessen eigenen — auf der Station Rehoboth abgeliefert.
Der Ausbruch des Aufstandes selbst erfolgte im Bezirk Okahandja am 12., in Omaruru am 17., in Otjimbingwe sogar erst am 23. Januar. Die[S. 470] vorgekommenen Ermordungen fielen daher fast durchweg in den Bezirk Okahandja-Waterberg, zu dem auch die Gegend von Grootfontein (Nord) gerechnet werden muß, da in dessen Nähe die Waterberg-Hereros wohnen. In den beiden übrigen Bezirken waren dagegen die Weißen rechtzeitig gewarnt und hatten sich größtenteils retten können.
Das Verdienst für die Rettung Omarurus gebührt dem Stabsarzt der Schutztruppe Dr. Kuhn in Verbindung mit dem dortigen Missionar Hegner. Ein glücklicher Zufall hatte es gefügt, daß der Erstgenannte, der auf einer Reise begriffen war, gerade in den kritischen Tagen in Omaruru eintraf. Der Hererosprache vollständig mächtig, trat er sofort mit dem noch schwankenden Kapitän Michael und seinen Großleuten in Verbindung, was diese zum einstweiligen Zuwarten bewog. Noch am 15. abends waren der Häuptling Michael und der Kirchenälteste Assa als Gäste des Stabsarztes auf der Station. Erst am 16. vormittags fiel, anscheinend unter dem Druck der zahlreichen von außerhalb zugezogenen Feldhereros sowie der Nachrichten aus Okahandja, die Entscheidung für den Aufstand. Die ihm so gewordene Frist hatte jedoch Stabsarzt Kuhn bereits benutzt, um zu retten, was noch zu retten war. Sämtliche Weiße des Bezirks konnten — mit Ausnahme von vier — noch in Sicherheit gebracht werden. Die kleineren Stationen wurden eingezogen, dafür die wichtige Station Okombahe verstärkt, vor allem die Pferde der Kompagnie von dem Sterbeposten Sorris-Sorris herangeholt und schließlich die Station Omaruru in Verteidigungszustand gesetzt. Die Bergkaffernniederlassung Okombahe, von der im Kap. II, S. 63 die Rede gewesen ist, war treu geblieben und mußte daher besetzt bleiben. So vorbereitet, konnte Stabsarzt Kuhn den am 16. eröffneten Feindseligkeiten ruhig entgegensehen und die Station bis zu ihrer Entsetzung durch die Kompagnie Franke am 2. Februar halten. Sie wies sämtliche Sturmversuche der Hereros zurück und hatte an Verlusten nur einen Toten und einen Verwundeten, beide gelegentlich eines Ausfallgefechts am 27. Januar.[132]

In Otjimbingwe residierte der schwache und darum sehr friedliebende Kapitän Zacharias (s. Kap. IX, S. 324). Ihn, der ohnehin wenig zum Aufstande geneigt war, konnte Missionar Olpp bis zum 23. Januar vom Aufstand zurückhalten. Der Kapitän sandte sogar noch ein Ergebenheitsschreiben an das Gouvernement in Windhuk. Daß dagegen Mord und Plünderung aus dem Bezirk Okahandja sofort auch in das Gebiet von Otjimbingwe übergriffen, konnte er nicht hindern. Schließlich gaben aber auch in Otjimbingwe der Druck des Zustromes von außen wie die Nachrichten aus Okahandja den Ausschlag zum Anschluß an den Aufstand. Diesen begann indessen der Häuptling mit seiner Flucht vom Platze, während seine zurückgebliebenen jungen Leute einen Weißen ermordeten, der zu lange in seinem Hause gesäumt hatte. Die hiermit eröffneten Feindseligkeiten führten aber in Otjimbingwe zu nichts weiter, als zu einem zwecklosen Hin- und Herschießen, verbunden mit Verwüstung des Platzes. Die Stationsbesatzung mit allen Weißen und den zum Teil treugebliebenen Bastards von Otjimbingwe hatte sich in der Gesamtstärke von 49 Gewehren unter Führung des Landmessers und Leutnants a. D. v. Frankenberg in das Gebäude der Firma[S. 472] Hälbich[133] zurückgezogen, da dieses günstiger gelegen war als die Station. Endgültig befreit von allen Belästigungen feindlicherseits wurde dann Otjimbingwe am 15. Februar durch das Landungskorps S. M. S. »Habicht«.
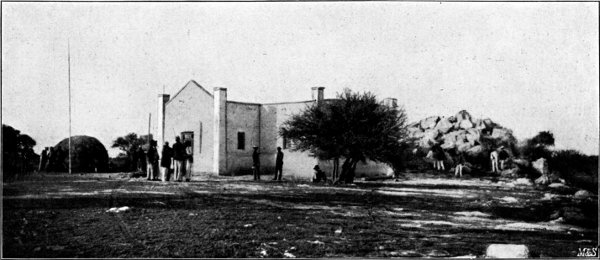
Am heftigsten tobte der Kampf um Okahandja. Anzeichen, daß irgend etwas in der Luft schwebe, waren dort insofern bereits am 10. Januar bekannt geworden, als aus Waterberg eine auffallende Kauflust der Hereros, namentlich für Pferde und Reitzeug um jeden Preis, gemeldet war. Dazu kam am 11. die Nachricht, daß mehrere hundert bewaffnete Hereros auf Okahandja im Anmarsch seien und 200 bereits bei Osona lagerten, während der Oberhäuptling Samuel vom Platze verschwunden sei. Rasch wurden mit der Bahn noch 20 Mann von Windhuk nach Okahandja geworfen, sowie auch die Verstärkung der Station Waterberg versucht, die jedoch die hierzu bestimmte Mannschaft nicht mehr zu erreichen vermochte. Der Bezirksamtmann von Windhuk, Bergrat Duft, hatte sich der nach Okahandja gesandten Verstärkung persönlich angeschlossen, um zu sehen, ob die Hereros nicht vielleicht noch wieder zur Vernunft zu bringen seien. Indessen erwies sich dieser Versuch als vergeblich. Am 11. Januar wurde der Bezirksamtmann mit allerlei Redensarten hingehalten, und am 12., als er sich wieder zur Versammlung begeben wollte, durch einen christlichen Herero[S. 473] gewarnt. Denn der Aufstand war bereits beschlossene Sache, und Bergrat Duft mußte während der nun folgenden Belagerung mit in der Feste ausharren. Glücklicherweise konnte er jedoch vorher noch die Sachlage sowohl nach Berlin wie nach Windhuk telegraphieren. Die Feindseligkeiten selbst begannen am 12. Januar vormittags mit der Ermordung einiger Weißer, die unvorsichtigerweise in ihren Häusern geblieben waren. Die dann folgende Belagerung der Feste seitens der Hereros beschränkte sich auf bloßes Schießen, während sie einen Sturm auf die von 71 Gewehren unter Oberleutnant der Reserve Zürn verteidigten Mauern nicht wagten.

Auch Swakopmund hatte vor Zerstörung des Telegraphen noch rechtzeitig von der Lage in Okahandja benachrichtigt werden können. Dort sowohl wie in Windhuk dachte man jedoch nicht daran, sich lediglich auf die eigene Verteidigung zu beschränken. Vielmehr wurden von beiden Orten Entsatzabteilungen nach dem anscheinend noch viel bedrängteren Okahandja entsendet. Nachdem bereits am 11. Januar von Windhuk aus kleinere Abteilungen unter den Leutnants der Reserve Maul und Voigts nach Teufelsbach und Brackwater vorgeschoben waren, versuchte mit diesen vereint am 12. Januar eine dritte Kolonne unter dem Leutnant der Reserve Boysen, der ein Maschinengewehr beigegeben war, nach Okahandja vorzustoßen.[S. 474] Alle drei zusammen, etwa 34 Gewehre, gelangten unter Führung des ältesten der drei Offiziere, des Leutnants der Reserve Voigts, mit ihrem Eisenbahnzug bis dicht an Okahandja heran, wurden dort gegen eine überwältigende Übermacht in ein schweres Gefecht verwickelt und mußten sich unter Verlust von 7 Toten, darunter Leutnant Boysen, wieder nach Windhuk zurückziehen. Auch die Besatzung der Feste, die unter Oberleutnant Zürn einen Ausfall gemacht hatte, konnte nicht bis zur Entsatztruppe durchdringen.

Besser verlief der Entsatzversuch aus Swakopmund unter Führung des Oberleutnants v. Zülow. Dieser Vorstoß durch ein insurgiertes Land mittels gepanzerten Eisenbahnzuges auf der zum Teil zerstörten Eisenbahn, die dann unter Gefechten erst wiederhergestellt werden mußte, bot des Interessanten besonders viel. Die kleine Truppe setzte sich am 12. Januar vormittags in der Stärke von etwa 60 Mann, fast durchweg der Reserve und Landwehr angehörend, nach Okahandja in Bewegung. An Offizieren besaß sie außer dem Führer den Leutnant der Reserve Oßwald, den Stabsarzt Dr. Jacobs und als Offizierdiensttuer den Veterinärrat Rickmann. Noch in der Nacht zum 13. erreichte die Abteilung Karibib, wo sie sich um weitere 30 Mann, gleichfalls Reserve und Landwehr, unter Leutnant der[S. 475] Reserve Schluckwerder verstärkte. Erst auf der nächstfolgenden Station Wilhelmstal traf man auf die Spuren der Verwüstung durch die Hereros. Namentlich waren Telephon und Telegraph in einem Umfang zerstört, daß man an deren Wiederherstellung gar nicht denken konnte. Am 13. abends wurde glücklich die Hauptstation Waldau erreicht, die sich ebenso wie Karibib gehalten hatte, aber von umherschweifenden Hereros fortgesetzt beunruhigt worden war. Hier machte die Kolonne vorläufig Halt und erkundete zunächst die Bahnstrecke nach Okahandja. Man fand diese, den bisherigen Meldungen entsprechend, vielfach zerstört. Nunmehr wurde der Eisenbahnzug mit Wellblechplatten, gefüllten Reis-, Hafer- und Kohlensäcken gepanzert und ein Wagen mit 200 m Schienen und Handwerkszeug zu Reparaturzwecken eingeschoben. Diese Arbeit wurde unter fortgesetztem Geplänkel am 14. vorgenommen und am 15. früh die Fahrt in folgender Formation angetreten: An der Spitze fuhr eine Lokomotive mit drei Wagen, die das Arbeitspersonal und Material mitführten. In einem Abstand von 500 m folgte der Hauptzug, bestehend aus zwei Lokomotiven, sechs gepanzerten Mannschaftswagen und vier Gepäckwagen, letztere mit Munition, Proviant und Bekleidung. In einem Abstand von weiteren 500 m kamen zum Schluß zwei Doppelmaschinen und ein Tender. Nicht weniger als siebenmal mußte die Fahrt unterbrochen werden, dreimal wegen Entgleisung und viermal behufs Wiederherstellung von Zerstörungen, sei es am Bahndamm, sei es an den Geleisen oder den Durchlässen. Die Reparaturen mußten stets unter feindlichem Feuer vorgenommen werden, wobei ausgeschwärmte Schützen die Arbeiter deckten. Auf diese Weise brauchte der Zug 6 Stunden, um die 22 km nach Okahandja zurückzulegen. Nur 1500 m von der dortigen Station entfernt, mußte behufs Herstellung einer schwer beschädigten Stelle nochmals unter Gefecht 3/4 Stunde gehalten werden. Am 15. Januar, etwa um 12 Uhr mittags, traf der Zug bei dem 200 m von der belagerten Feste entfernt gelegenen Eisenbahnstationsgebäude ein und begann sofort mit Entladung. Diese Arbeit war unter fortgesetztem Gefecht mit Einbruch der Dunkelheit beendet. Okahandja war jetzt insoweit entsetzt, daß von irgendwelcher Gefahr für den Platz nicht mehr gesprochen werden konnte. Erreicht war dieser Erfolg mit einem Verlust von nur einem Mann tot und einem Eingeborenen schwer verwundet. Der Gegner überschüttete noch am 16. die vorläufig nur provisorisch mitbesetzte Eisenbahnstation mit Feuer, zog sich aber in der Nacht vom 16. zum 17. auf die umliegenden Höhen zurück, von wo aus er auf etwa 800 m fortfuhr, den Platz wirkungslos zu beschießen.

Oberleutnant v. Zülow beschränkte sich von jetzt ab auf zwei Ziele, und zwar erstens auf Reinigung des Platzes, denn nunmehr erschien der Ausbruch einer Seuche in der überfüllten Feste gefährlicher als der Feind, zweitens auf Wiederherstellung der Verbindung mit der Außenwelt. Zu größeren Offensivunternehmungen wäre er mit seinen 200 Mann nicht in der Lage gewesen, da er weder Artillerie noch Reit- und Zugtiere besaß. Sein Hauptbeförderungsmittel blieb daher auch ferner der mitgebrachte Eisenbahnzug. Nachdem die notwendigsten Arbeiten zur Säuberung des Platzes erledigt und die Besatzung neu gegliedert war, versuchte Oberleutnant v. Zülow am 19. Januar zunächst einen Vorstoß nach Windhuk. Aber dieser scheiterte bereits wenige Kilometer südlich Okahandja, bei Osona, wo das Geleise auf 200 m aufgerissen war. Nach einem kurzen Gefecht, währenddessen der Platz selbst nach allem Brauchbaren abgesucht worden war, ging es nach der Feste zurück. Merkwürdigerweise war noch eine Menge Munition gefunden worden. Diesem Versuche folgte dann am 20. Januar ein zweiter Vorstoß in der Richtung auf Karibib, der bis über 8 km jenseits Waldau gelangte, bis zu der dortigen zerstörten, 20 m langen Eisenbahnbrücke. Während des Versuches, sie wiederherzustellen, griffen die Hereros an, es entspann sich ein Gefecht, bei dem die 70 Mann starke Abteilung vier Tote, drei schwer und einen leicht Verwundeten verlor, wogegen auch die Hereros schwere Verluste erlitten zu haben schienen. Da indessen ein weiteres[S. 477] Vordringen über die zerstörte Brücke nicht möglich war, kehrte der Zug abends nach Okahandja zurück. Die Verbindung mit Karibib wurde sodann durch zwei zuverlässige Eingeborene gesucht und auch gefunden. Um mit der im Anmarsch befindlichen Kompagnie Franke Fühlung zu gewinnen, ging Oberleutnant v. Zülow am 22. und 23. wieder gegen Osona vor, wo es am 23. zu einem unblutig verlaufenden Gefecht gegen etwa 70 Hereros kam. Endlich am 27., als gerade der Geburtstagssalut für Seine Majestät gegeben wurde, erschienen ausgeschwärmte Schützen vor der Station, denen eine im Galopp heransprengende Reitertruppe folgte. Es war dies die erwartete Kompagnie Franke. Damit war auch Okahandja endgültig befreit, und Oberleutnant v. Zülow durfte sich sagen, daß er und seine Leute die ihnen gestellte Aufgabe glänzend gelöst hatten. An Verlusten hatte die Belagerung im ganzen nur einen Toten gekostet.
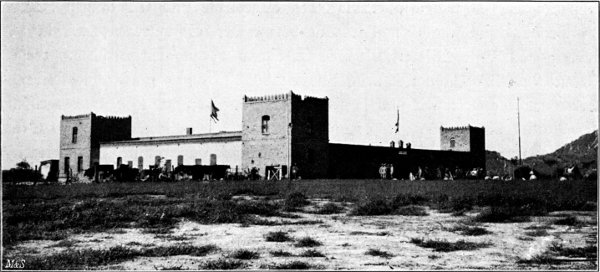
Die Schreckenszeit einer drohenden Belagerung dauerte für Windhuk nur eine Woche, vom 12. bis 19. Januar, an welch letzterem Tage die Kompagnie Franke einrückte, aber, wer sie mitgemacht hat, wird sie nicht vergessen. Auch hier wagten zwar der verhältnismäßig starken Besatzung gegenüber — 230 Mann, durchweg Reserve, Landwehr und Landsturm, unter Oberleutnant Techow, später unter Hauptmann a. D. v. François — die Hereros einen förmlichen Angriff nicht, aber die Luft war stets von Gerüchten über das Bevorstehen eines solchen angefüllt. Es verdient daher[S. 478] alle Anerkennung, wenn die Besatzung sich trotzdem nicht auf Abwehr beschränkt hat, vielmehr einen offensiven Vorstoß an den andern reihte.
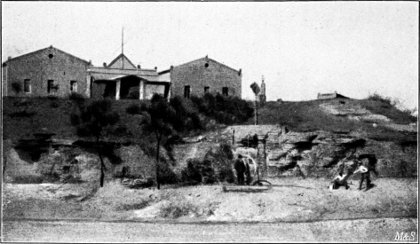
Des Entsatzversuches von Okahandja am 12. Januar unter Leutnant der Reserve Voigts habe ich bereits gedacht. Ihm folgte am 15. Januar ein Vorstoß gegen die Farm Hoffnung, östlich Windhuk, unter Hauptmann a. D. v. François mit etwa 60 Mann und einem Geschütz, der zu einem mehrstündigen siegreichen Gefecht führte. Ebendahin ging am 21. Januar eine Patrouille von 30 Mann unter Leutnant der Reserve Maul und Oberveterinär Rassau. Sie jagte eine etwa gleichstarke Hererobande in die Flucht, verfolgte sie zu Pferde und machte eine erhebliche Anzahl nieder. Die erfolgreichste Patrouille aber war diejenige des Oberfeuerwerkers — jetzt Leutnants a. D. — v. Niewitecki vom 22. Januar ab nach Hohewarte-Seeis. Von beiden noch besetzten Stationen war schon lange keine Nachricht mehr eingetroffen. Die Zahl der Patrouillenreiter betrug nur zehn Mann; es waren aber durchweg altgediente und seit langen Jahren im Lande befindliche ehemalige Angehörige der Schutztruppe, mithin für drüben das beste Material. Der Erfolg war auch entsprechend. Gegen Abend des 22. Januar wurde eine etwa 100 Köpfe starke, viehtreibende Hererobande angetroffen und sofort mit Gewehrfeuer und Hurra angegriffen; ihr Verlust betrug 15 Tote; auch wurden ihr vier Gewehre und 80 Stück Vieh abgenommen. Ihre Beute brachte die Patrouille nach Station Hohewarte, tauschte dort fünf ihrer Reiter gegen ebensoviele der Station um und zog am 25. Januar wieder weiter, um auch Fühlung mit der Station Hatsamas zu suchen. Dies gelang gleichfalls. Die dortige, nur vier Mann starke Besatzung unter Feldwebel Kiep war guten Mutes und entschlossen, sich unter allen Umständen zu halten. Abends kehrte die Patrouille nach Hohewarte zurück. An beiden Tagen hatte sie je über 100 km zurückgelegt.
[S. 479] In Hohewarte fand die Patrouille eine Verstärkung von 14 Mann aus Windhuk vor, darunter sechs Buren. Nunmehr ging v. Niewitecki am 26. Januar mit einer Gesamtstärke von 27 Köpfen auf Seeis vor, traf 3 km diesseits der Station auf mehrere hundert Hereros und setzte sich sofort im Galopp sowie mit Hurra in den Besitz der nächstgelegenen Höhe, von wo aus die Hereros mit Feuer überschüttet wurden. Nach etwa zweistündigem Gefecht zogen sich diese unter einem Verlust von 25 Toten zurück und sollen später in wilder Flucht die ganze Gegend von Seeis geräumt haben, wenigstens wurde die Station seitdem nicht wieder belästigt. Die Patrouille hatte in dem Gefecht nur einen Schwerverwundeten. Nachdem sie am 27. Januar Kaisers Geburtstag gefeiert hatte, traf sie am 28. Januar mit mehreren nach Seeis geflüchtet gewesenen Familien wieder in Windhuk ein. Am 4. Februar ritt v. Niewitecki mit neun Reitern eine weitere Patrouille, und zwar nach Harris, südwestlich Windhuk. Auch sie war erfolgreich. Eine Bande Hereros wurde beim Pferdestehlen überrascht und fast völlig aufgerieben. Zum Teil war es hierbei zum Handgemenge gekommen.
Wie aus den Daten hervorgeht, fielen diese Patrouillenritte aus Windhuk auf die Zeit nach dem Durchpassieren der Kompagnie Franke durch den Platz. Die Umgebung des letzteren war mithin durch den Zug der genannten Kompagnie nicht in dem Maße vom Feinde befreit worden, wie solches später in Okahandja und Omaruru geschehen ist. Dies war nur natürlich, denn die mit zahlreichen Farmen besetzte Umgebung der Hauptstadt, wie letztere selbst mit den dorthin geflüchteten Viehherden boten den umherstreifenden Banden auch ferner eine zu große Anziehungskraft, um sie lediglich wegen der damit verbundenen Gefahren zu meiden. Die Viehdiebstähle haben bei Windhuk auch in den folgenden Monaten bis zum Rückzug der Hereros nach Waterberg nie ganz aufgehört. Eine Gefahr für den Platz selbst und seine Bewohner bestand jedoch nicht mehr.
In diesem Bezirk zeigte sich bereits Anfang Januar eine gewisse Gärung. Viehdiebstähle waren immer vorgekommen, aber jetzt verweigerten die Diebe, wenn ertappt, das Wiederherausgeben des gestohlenen Viehs, und das war bisher nicht vorgekommen. Der Sohn des Kapitäns Tjetjo, Traugott, versprach zwar am 6. Januar noch in Gobabis viel, vermochte aber nichts davon zu halten. Nunmehr ritt der Distriktschef Oberleutnant Streitwolf[S. 480] am 7. Januar mit neun Reitern persönlich nach dem Schauplatz der Viehdiebstähle, bemerkte dort weitere verdächtige Anzeichen, riet daher auf seinem Weiterritte allen Farmern die Übersiedlung nach Gobabis an, setzte selbst mit seiner Patrouille den Weg bis Epukiro fort und ließ diese Station in Verteidigungszustand bringen. Querfeldein reitend, traf die Patrouille dann am 17. Januar wieder in Gobabis ein, fand es bereits belagert, konnte aber noch ohne Verluste hineinkommen. Die Feste war nunmehr von 27 waffenfähigen Männern besetzt. Ihre Umschließung hat dann bis zum 25. Januar gedauert. Von diesem Tage an beschränkte sich der Gegner auf Beobachtung, während seine Masse auf Kehoro am oberen Nosob abzog und sich dort anscheinend verschanzte. Durch Überfall genommen worden war die kleine Station Witvley. Oas hatte sich dagegen gehalten und wurde später freiwillig geräumt. Desgleichen zog sich auch die Besatzung von Epukiro nach Gobabis heran. Aminuis wurde ebenfalls geräumt, bald aber wieder besetzt.
Die Verhältnisse in diesem Bezirk lagen insofern günstiger, als in ihm eine volle Feldkompagnie garnisonierte, der noch dazu eine geringere Hererobevölkerung gegenüberstand. Der dort befehlende Hauptmann Kliefoth beschränkte sich daher gleichfalls nicht auf eine passive Verteidigung, sondern rückte auf die Nachricht von dem Falle der Station Waterberg am 12. Januar mit allen verfügbaren Kräften, etwa 500 Gewehren und einem Geschütz, nach dort ab. Am 16. Januar stieß die Abteilung etwa halbwegs Waterberg auf mehrere hundert Hereros und wurde von diesen mit Feuer begrüßt. Nach 1½stündigem Gefecht wurde die feindliche Stellung, unter einem diesseitigen Verlust von einem Schwerverwundeten, erstürmt. Nunmehr kehrte die Kompagnie nach Outjo zurück, um am 17. Januar mit 60 Gewehren und 2 Geschützen einen zweiten Vorstoß, und zwar in der Richtung auf Omaruru, zu unternehmen. Hierbei kam es am 29. Januar abermals zu einem Zusammenstoß mit einer Hererobande, in dem der Hauptmann selbst verwundet, der Gegner aber in die Flucht geschlagen wurde. Von jetzt ab beschränkte sich die Kompagnie auf Sicherung des Platzes Outjo, wohin sich mittlerweile die Masse der Farmer des Bezirks mit ihren Viehherden hatte retten können, sowie auf Beobachtung der Ovambos und der Franzfonteiner Hottentotten. Zu einem weit ausholenden Offensivstoß nach dem Hererolande waren dagegen die Kräfte der Kompagnie zu schwach, es lag auch ein solcher nicht in ihrer Aufgabe.
In der mit dem Bezirk Grootfontein in einem gewissen Zusammenhang stehenden Station Waterberg hatte der Aufstand mit Niedermetzelung der 5 Mann starken Stationsbesatzung sowie 7 weißer Ansiedler begonnen. Aus dem kürzlich erschienenen Buch einer deutschen Ansiedlersfrau aus Waterberg[134] ist zu ersehen, daß unheilverkündende Anzeichen am Platze bereits vom 4. Januar ab beobachtet worden sind. Nicht nur kauften die Hereros sinnlos in den Stores, was sie nur erhalten konnten, auf Kredit natürlich, sondern sie traten auch immer frecher auf. Dann fielen sie am 14. plötzlich über die Weißen her und ermordeten sie sämtlich. Eine rechtzeitige Versammlung der ermordeten 12 weißen Männer mit Waffen und Munition auf der Station würde diese gerettet haben. Allerdings war es zweifelhaft, ob auf lange. Indessen pflegt man in solchen Fällen nicht nach dem Morgen zu fragen, sondern sich mit dem Heute zu begnügen. Der Stationschef Sergeant Rademacher, ein besonders ausgewählter, tüchtiger Unteroffizier, hat jedoch anscheinend bis zum letzten Moment an den Ernst der Lage nicht geglaubt.
Im übrigen erschien der Distrikt Grootfontein infolge seiner abgeschnittenen Lage als der gefährdetste von allen. Er konnte auf irgendwelche Hilfe von außen erst nach der vollständigen Niederlage der Hereros rechnen. Lag doch das ganze Hereroland zwischen ihm und der Basis der deutschen Macht, Okahandja-Windhuk. Trotzdem habe ich für meine Person für den Distrikt eigentlich die wenigste Sorge gehabt. Wußte ich doch dort einen Offizier, den Oberleutnant Volkmann, auf den ich mich verlassen konnte. Er hatte bereits zehn Jahre mit mir in Afrika gedient und ich daher genügend Zeit gehabt, ihn kennen zu lernen. Und diese auf ihn gesetzte Erwartung hat er auch nicht getäuscht. Dank seiner Umsicht und Tatkraft wurden die im Bezirk wohnenden Farmer rechtzeitig benachrichtigt und nach Grootfontein gerettet. Ermordet wurden nur zwei, von denen einer seine Farm nicht verlassen wollte. Ferner wurde am 18. die Station Otjituo mittels Überfalls nur deswegen genommen, weil die Besatzung gegen den erhaltenen Befehl in völliger Sorglosigkeit verblieben war. Hierbei wurden drei Reiter niedergemacht, drei entkamen nach Grootfontein. Dagegen hielt sich die Station Otavi bis zum 19., an welchem Tage sie[S. 482] durch eine starke Patrouille aus Grootfontein entsetzt wurde; desgleichen hielt die Station Amutoni am 28. einem Angriff von 500 Ovambos gegenüber stand. Nach mehrfachen Sturmversuchen zogen diese unter schweren Verlusten — man schätzte bis zu hundert Toten — wieder ab. Aber auch die kleine fünf Mann starke Besatzung unter dem Sergeanten Großmann mußte aus Mangel an Munition die Station räumen und wurde von einer ihr aus Grootfontein entgegenkommenden Entsatzpatrouille aufgenommen. Nunmehr waren die ganze Distriktsmannschaft sowie sämtliche geretteten Farmer in Grootfontein vereinigt. Bezeichnenderweise waren auch die zehn Hereropolizisten des Distrikts treu geblieben, obwohl sie angesehenen Hererofamilien angehörten. Auch die Bergdamaraniederlassung in Gaub unter Kapitän Krüger (Kap. II, S. 87) blieb treu und leistete gute Dienste; später zog auch sie sich nach Grootfontein heran. An weißen waffenfähigen Männern waren schließlich in Grootfontein über hundert vereinigt. Der Platz selbst wurde durch Befestigungsanlagen in verteidigungsfähigen Zustand versetzt und demnächst die Verbindung mit Outjo aufgenommen sowie dauernd erhalten. Auf diesem Umwege erhielt die Station wenigstens zeitweise die wichtigsten Nachrichten über den Verlauf der Ereignisse im übrigen Schutzgebiet. Die Proviantbestände wurden durch Abernten der umliegenden Farmen ergänzt, denn auf eine Zufuhr, die selbstverständlich nur unter einer besonders starken Bedeckung möglich war, konnte zunächst nicht gerechnet werden.
Indessen beschränkte sich der Distriktschef bei allen Abwehrmaßnahmen keineswegs auf eine passive Verteidigung des Platzes. Fortgesetzt wurden Patrouillen geritten und die Gegend von umherstreifendem Diebesgesindel gesäubert. Das hiernach von Anfang an hervortretende moralische Übergewicht der Besatzungstruppe über den zahlenmäßig so sehr überlegenen Feind hatte Oberleutnant Volkmann durch eine kühne Offensive gegen die erste gemeldete feindliche Angriffsbewegung erreicht, und zwar mittels des Gefechts bei Uitkomst am 18. Januar. An dem genannten Platze wohnte ein Bur Namens Joubert, der vorläufig auf seiner Farm geblieben war. Auf die Nachricht, daß auf den Bergen in der Nähe der Farm sich eine starke Hererobande (etwa 170 Köpfe) unter dem Unterhäuptling Batona sammle, sandte Oberleutnant Volkmann am 17. abends eine Patrouille von 18 Mann, um die Familie Joubert zu holen, und folgte den andern Morgen mit 12 Mann, um die Hereros anzugreifen, falls sie wirklich auf Grootfontein marschieren sollten. Unterwegs begegnete er der bereits zurückkehrenden Wagenkolonne mit der Familie Joubert. Oberleutnant Volkmann[S. 483] verstärkte sich aus deren Begleitmannschaft auf 20 Reiter, worunter 14 Kriegsfreiwillige und Buren, und setzte seinen Marsch fort. Unvermutet stieß die Abteilung auf eine dichte Masse Hereros, an der Spitze die Reiter, dahinter eine breite Kolonne Fußvolk, und zwar nach Hereroart in ziemlicher Sorglosigkeit.[135] Diese günstige Gelegenheit benutzte der deutsche Führer, ließ aufmarschieren und in scharfem Galopp mit Hurra auf den Feind einreiten. Erschreckt flüchteten die Hereros in den nächsten Busch; was sich nicht retten konnte, wurde niedergemacht. Doch sammelte sich der Gegner bald wieder und überschüttete hierauf die Reiter mit Schnellfeuer. Deshalb ließ nun Oberleutnant Volkmann zum Gefecht zu Fuß absitzen und begegnete einer drohenden Überflügelung, zu der die Hereros vermöge ihrer Übermacht befähigt waren, mittels Durchstoßes durch deren Mitte. Diese wich zurück, und nunmehr wurde rechts und links eingeschwenkt und der Feuerkampf gegen die beiden Flügel der Hereros wieder eröffnet. Nachdem aber hierbei Kapitän Batona[136] und sechs Großleute gefallen waren, wandten sich jetzt die Hereros in völliger Auflösung zur Flucht. Die Abteilung Volkmann hatte einen Verlust von einem Toten und vier Verwundeten, außerdem von 7 Pferden, die bei der Attacke erschossen worden waren. Es war kein Wunder, wenn nach diesem Gefecht die Angriffslust der Nordhereros erlahmte. Sie räumten den Distrikt vollständig, um sich mit den Waterberghereros zu vereinigen.

Von der ferneren Tätigkeit des unermüdlichen Offiziers interessieren uns hier noch zwei Ereignisse. Das eine ist die am 7. April erfolgte Ein[S. 484]richtung der Station Coblenz mit 30 Mann Besatzung auf den erhaltenen Befehl, den Omuramba-u-Omatako zu sperren. Eine damit verbundene Erkundung vom 10. bis 14. April stellte fest, daß die Gegend beinahe bis Waterberg und südlich bis in das Sandfeld auf mehrere Tagemärsche von den Hereros frei sei. Erst Ende Mai fingen sie an, sich dort wieder zu sammeln. Die Station Coblenz wurde dann am 22. Mai wegen ihrer ungesunden Lage wieder aufgegeben. Die Absperrung des Omuramba übernahm von da ab die gegen Waterberg sich sammelnde Feldtruppe selbst. Das zweite Ereignis ist das Gefecht bei Okangundi am 28. April, d. h. ein Überfall auf die dortige, einer der berüchtigtsten Räuberbanden als Schlupfwinkel dienende Werft. Es gelang die unvermutete Umstellung und fast völlige Vernichtung der Bande, von der 31 Tote gefunden wurden, bei einem eigenen Verlust von nur einem Toten.
Im Monat Mai wurde dann mit Hilfe der inzwischen von Deutschland eingetroffenen Verstärkungen eine Nordabteilung in der Stärke von 1 Kompagnie, 2 Maschinengewehren und 2 Feldgeschützen formiert und diese dem Oberleutnant Volkmann unterstellt. Auf dem Marsche nach dem Norden führte sie Oberleutnant v. Zülow, welcher mittlerweile von Okahandja wieder nach Swakopmund zurückgekehrt war. Von ihm übernahm sie Oberleutnant Volkmann am 8. Juni in Otavi und führte sie dann in den Gefechten von Waterberg wie auf der anschließenden Verfolgung in das Sandfeld. Die Episode der Verteidigung von Grootfontein war mit ihrem Eintreffen abgeschlossen.
Wie oben erwähnt, war die Kompagnie Franke auf ihrem Marsche nach dem südlichen Kriegsschauplatze bereits in Gibeon angelangt, als sie von der Nachricht über den Ausbruch des Hereroaufstandes erreicht wurde. Der Kompagnieführer erbat und erhielt am 15. Januar von mir auf heliographischem Wege die Erlaubnis zur Umkehr. Die erste hervorragende unter den vielen Leistungen der Kompagnie war dann die Zurücklegung der 380 km bis Windhuk in 4½ Tagen, und zwar — was das Wesentlichste war — ohne daß nach diesem Marsche die Leistungsfähigkeit der Pferde beeinträchtigt war. Es war dies das Ergebnis einer vorzüglichen Ausbildung im Frieden wie der strengen Anwendung des Gelernten jetzt im Kriege. Nach einem kurzen Gefecht bei Arris traf die Kompagnie am 19. nachmittags in Windhuk ein. Nach einem Ruhetage setzte sie am 21. ihren Vormarsch auf Okahandja fort. Die Kompagnie war durch Zuwachs aus der Besatzung[S. 485] Windhuks auf einen Stand von 6 Offizieren, 137 Mann und 2 Geschützen gebracht worden. Am 22. Januar kam es zu einem Zusammenstoß bei der Station Teufelsbach, in dem die Hereros nach kurzem Feuergefecht mit aufgepflanztem Seitengewehr in die Flucht gejagt wurden.

Phot. H. Noack, Berlin.
Hauptmann FrankeBedauerlicherweise kam der Vormarsch an dem Swakoprevier bei Osona zum Stocken. Aus dem sonst trockenen Swakop war ein reißender Strom mit etwa der Wassermasse des Rheins bei Schaffhausen geworden. In Südwestafrika pflegt man unter solchen Umständen einfach zu warten, bis das Wasser wieder verschwunden ist, andere Mittel zum Übergang gibt es nicht. In dem vorliegenden Falle befand sich zwar nahebei die Eisenbahnbrücke über den Swakop, aber sie war zerstört. Das war nun eine unangenehme Lage, die das Ergebnis des bisher so gut gelungenen Gewaltmarsches wieder in Frage zu stellen drohte.
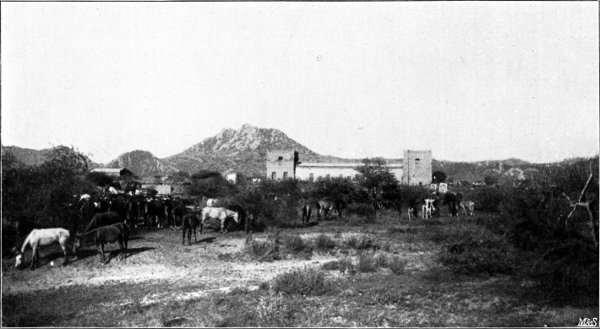
Man sah damals die Gefährdung Okahandjas für schlimmer an, als sie war. Wie wir jetzt wissen, bestand für den Platz seit Eintreffen der Abteilung Zülow eine eigentliche Gefahr nicht mehr. Indessen Hauptmann Franke wußte dies nicht, er trug sich daher mit keinem anderen Gedanken, als rasch nach Okahandja durchzustoßen. Ein Versuch, den Fluß zu[S. 486] Pferde zu durchqueren, hatte lediglich den Erfolg, daß einige Tiere ertranken und beinahe ein Offizier, der Leutnant v. Wöllwarth, dieses Schicksal geteilt haben würde, wenn ihn nicht der Hauptmann selbst noch rechtzeitig dem Wasser entrissen hätte. Mißmutig ritt daher die Kompagnie am 24. Januar nach Teufelsbach zurück. Eine am 26. vorgenommene Erkundung ergab jedoch, daß das Wasser wieder abzunehmen anfing, und am 27., an Kaisers Geburtstage, gelang der Übergang in der Tat. Ohne Widerstand zu finden, ging es eilends nach Okahandja, wo die Kompagnie von der gerade zum Appell versammelten Besatzung jubelnd begrüßt wurde. Von feindlicher Seite war nur schwaches, seitens der Kompagnie rasch zum Schweigen gebrachtes Gewehrfeuer erfolgt. Infolgedessen glaubte Hauptmann Franke die Berge um den Platz lediglich noch von der feindlichen Nachhut besetzt und beschloß daher, am 28. Januar den anscheinend nach Otjosasu geflohenen Hereros zu folgen.
Wie sich später ergab, war diese Annahme unrichtig. Als die Kompagnie am 28. früh unter den erforderlichen Sicherheitsmaßregeln an dem dicht beim Platze gelegenen, 1670 m hohen Kaiser Wilhelms-Berg vorbeimarschieren wollte, erhielt sie von dem Bergabhang starkes Feuer. Hauptmann Franke entwickelte rasch die Kompagnie nach rechts und erstürmte in einem sechsstündigen Gefecht den Berg, den die Hereros unter Zurücklassung zahlreicher Toter und Verwundeter sowie vielen Hausrates in eiliger Flucht räumten. Die Kompagnie hatte selbst nur drei Verwundete. Diese geringen Verluste verdankt sie den am Bergabhange befindlichen toten Winkeln sowie dem Umstande, daß letztere in der vorzüglichsten Weise ausgenutzt wurden. Auch schoß der Gegner meist zu hoch. Die Besatzung von Okahandja (v. Zülow) hatte an diesem Gefecht nicht teilgenommen, sondern, da die Möglichkeit zu einem solchen gar nicht vorhergesehen war, sich mit Wiederherstellungsarbeiten an der Eisenbahn südlich Okahandja beschäftigt. Sie wurde hier gleichfalls in ein kleines Gefecht verwickelt. Von diesem Tage ab war dann die Umgebung Okahandjas erst völlig vom Feinde befreit. Einzelne kleine Hererobanden trieben sich jedoch bis zum Gefecht von Onganjira noch auf dem Kaiser Wilhelms-Berg herum und wurden von Zeit zu Zeit mittels eines Streifzuges vertrieben. Am 30. Januar folgte dann Hauptmann Franke den Hereros nach Otjosasu, fand jedoch auch diesen Ort bereits verlassen und kehrte daher noch an demselben Tage nach Okahandja zurück.
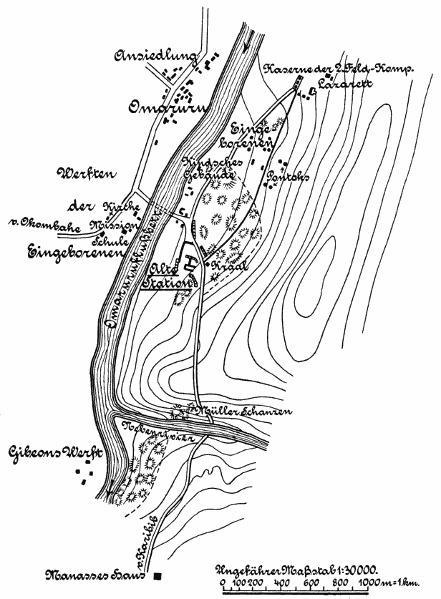
Nunmehr galt es die Befreiung des anscheinend gleichfalls hart bedrängten Omaruru. Die Kompagnie brach bereits am 31. dorthin auf und[S. 487] traf am 2. Februar in Karibib ein. Hier wurde abermals ein Umtausch mit Mannschaften der Besatzung vorgenommen. Besonders erwähnenswert ist der Eintritt eines schweizer Offiziers, der bis jetzt als Ingenieur beim Bau der Otavibahn beschäftigt gewesen war, des Leutnants Leutenegger, als Artillerieführer. Er hat, wie ich vorausschicken will, in der Folge für seine[S. 488] militärischen Leistungen alle Anerkennung gefunden. Der bisherige Artillerieoffizier Oberleutnant Techow, Adjutant der Truppe, der die Expedition bis jetzt freiwillig mitgemacht hatte, verfügte sich dagegen zum Empfang des vom südlichen Kriegsschauplatz zurückerwarteten Gouverneurs nach Swakopmund. Die übrigen der Kompagnie zugeteilten Offiziere waren: Oberleutnant Grießbach, Leutnant der Reserve v. Nathusius, Leutnant Freiherr v. Wöllwarth, Leutnant Leutwein. Zu diesen trat dann noch in Karibib der Leutnant der Reserve Hauber. Die Stärke der Kompagnie betrug jetzt im ganzen 7 Offiziere, 2 Ärzte, 126 Mann, 2 Geschütze.
Am 3. Februar nachmittags wurde der Vormarsch von Karibib auf Omaruru fortgesetzt und am 4. vormittags gegen 9 Uhr die Gegend des letztgenannten Platzes erreicht. Hauptmann Franke hoffte nunmehr, wie schon erwähnt, durch sein bloßes Erscheinen die Hereros zum Einstellen der Feindseligkeiten bewegen zu können. Er legte daher eine weiße Korduniform an und setzte sich auf seinen im ganzen Bezirk bekannten Schimmel. Indessen ließen sich die Hereros hierdurch keineswegs abschrecken, feuerten vielmehr erst recht auf das sich ihnen bietende günstige Ziel. Anfangs erschienen sie jedoch durch das Erscheinen der Kompagnie überrascht und räumten daher nach wenigen Schüssen die als vorgeschobene Stellung besetzte Werft (vgl. die Skizze S. 487) des früheren Kapitäns Manasse, wobei auch eine Viehherde in die Hände der Deutschen fiel. Die Kompagnie setzte sich nunmehr bei Manasses Werft fest und ließ die Artillerie auffahren. Es entspann sich hier ein längeres Feuergefecht, das aber gegen den sehr gut gedeckten Gegner wenig Erfolg zu haben schien. Hauptmann Franke beschloß daher, dem Feinde näher auf den Leib zu rücken, und befahl sprungweises Vorgehen, das schließlich zur Wegnahme der feindlichen Stellung führte, leider aber unter Verlust des tapferen Leutnants v. Wöllwarth. Nunmehr setzte sich der Gegner in einer zweiten Stellung fest, gegen die sich die Kompagnie zunächst wieder zu einem längeren Feuergefecht entwickelte. Der Angriff auf diese Stellung wurde dann aber durch eine völlig unerwartete, jedoch um so willkommenere Unterstützung erleichtert. Als der in Omaruru kommandierende Stabsarzt Dr. Kuhn das Näherrücken des Feuergefechtes vernommen hatte, ließ er mit allen entbehrlichen Leuten unter dem Feldwebel Müller einen Ausfall gegen den Rücken des Feindes machen. In ununterbrochenem Anlauf überrannte die kleine Schar eine rasch nach rückwärts Front machende Hereroabteilung, wobei leider ihr tapferer Führer fiel. Dagegen ließ der Feind an dieser Stelle 17 Tote zurück. Den hierdurch gebotenen günstigen[S. 489] Augenblick benutzte Hauptmann Franke, um nun die zweite feindliche Stellung zu nehmen, worauf die Ausfallabteilung sich mit der Kompagnie vereinigte.
Aber noch war der Sieg nicht errungen, denn abermals setzte sich der zähe Gegner in einer dritten Stellung fest, und zwar in der Nähe der alten Station, der früheren Wohnung des Hauptmanns Franke. Der Widerstand, den der Feind in dieser seiner letzten Stellung leistete, war ganz besonders hartnäckig. Er versuchte sogar einen Vorstoß gegen die rechte Flanke des Angreifers, bei dessen Abwehr der Oberleutnant Grießbach schwer verwundet wurde. Außerdem entwickelte sich nun auch im Rücken der Kompagnie ein heftiges Gefecht gegen die Bedeckung der Bagage unter Leutnant der Reserve v. Nathusius. Hierbei wurde der Führer verwundet, so daß das Kommando an den Leutnant der Reserve Hauber überging. Jetzt wurde die Lage sehr kritisch, zumal der Artillerie die Munition ausging. Als bestes Mittel, aus dieser Lage herauszukommen, erschien dem Hauptmann Franke ein abermaliger Sturmangriff. Dieser wurde wiederum durch Eingreifen der Besatzungstruppe erleichtert; Stabsarzt Dr. Kuhn hatte die schwierige Lage der Kompagnie erkannt und war persönlich an der Spitze von weiteren 12 Mann zum zweiten Male dem Feind in den Rücken gefallen. Nachdem ein kräftiges dreifaches Hurra das Nahen dieser Hilfe der Kompagnie bekannt gegeben hatte, setzte sich Hauptmann Franke auf seinen Schimmel und sprengte vor die Front, damit das Signal zum Beginn des Sturmes gebend. Dieses Beispiel zündete, mit lautem Hurra wurde nunmehr auch die letzte Stellung des Gegners genommen und in dieser ein fröhliches Wiedersehen mit der Ausfalltruppe gefeiert.

Die Hereros räumten infolge des Gefechts die Umgebung Omarurus vollständig, und damit war auch für diesen Platz von jetzt ab alle Gefahr[S. 490] beseitigt. Der diesseitige Verlust betrug 7 Mann tot, 3 Offiziere und 12 Mann meist schwer verwundet, somit etwa 40 vH. der Offiziere, etwa 15 vH. der Mannschaften. Von den drei verwundeten Offizieren starben der Leutnant v. Wöllwarth bereits nach wenigen Tagen, der Oberleutnant Grießbach erst nach langem Leiden in der Heimat. Auf die Ausfallabteilung entfielen von den Verlusten zwei Tote und zwei Verwundete. Vom Feinde wurden dagegen etwa 100 Tote gefunden. Aber trotz dieser schweren Verluste werden wir ihm bereits einige Wochen später bei Otjihinamaparero begegnen und ihn dort einen ebenso hartnäckigen Widerstand leisten sehen.
Dieser denkwürdige Zug der Kompagnie Franke hat mit einem Schlage das Bild des Feldzuges völlig geändert. Die Hereros waren nunmehr auf der ganzen Linie in die Verteidigung zurückgeworfen, in der sie uns allerdings noch recht viel zu schaffen machen sollten. Vor allem aber war die Bahnlinie Swakopmund-Windhuk dem Machtbereich des Feindes entzogen und daher für den Nachschub weiterer Verstärkungen freigemacht. Zwar hatte bereits eine kleinere Abteilung Matrosen, das Landungskorps S. M .S. »Habicht« in der Stärke von etwa 50 Köpfen, längs der Bahn mit eingegriffen und die geängstigten Bewohner der betreffenden Orte mit beruhigen helfen. Bei allem Dank und bei aller Anerkennung für die rasche Hilfe seitens unserer Marine darf aber die Behauptung doch gewagt werden, es hätte ihr Fehlen die Erfolge der Kompagnie Franke nicht zu beeinflussen vermocht. Somit darf auch die fernere Behauptung hinzugefügt werden, daß das Schutzgebiet in dieser schweren Zeit sich des ersten Ansturmes des Gegners aus eigener Kraft hat erwehren können. Dies war neben dem einmütigen und unverzagten Zusammenwirken der ganzen deutschen Bevölkerung die segensreiche Folge der seit dem Jahre 1896 im Schutzgebiete eingeführten allgemeinen Wehrpflicht nach heimatlichem Muster. Sie ließ an Stelle der andernfalls sich gewiß auch bereitwilligst anbietenden, aber ungeregelten Scharen von Kriegsfreiwilligen disziplinierte und organisierte Soldatenkommandos treten, vor allem aber diese in den zahlreichen Offizieren des Beurlaubtenstandes mit Führern ausstatten, denen nicht nur die erforderlichen Kenntnisse, sondern auch die mächtige Autorität des Gesetzes zur Seite stand. Und — man mag die Begeisterung für eine Sache noch so hoch einschätzen — angesichts des Todes kann sich schließlich doch nur die auf eiserne Disziplin gestützte Kraft des Gehorsams als über jedes Schwanken erhaben erweisen.
Der Befehl zur Einziehung der Wehrpflichtigen in den Nordbezirken war, wie bereits erwähnt, zugleich mit demjenigen des Abmarsches der[S. 491] 2. Kompagnie nach dem südlichen Kriegsschauplatze am 25. Dezember 1903 gegeben worden. Bei Ausbruch des Aufstandes am 12. Januar — mithin schon nach drei Wochen — sehen wir in Windhuk eine 1., in Omaruru eine 2. Ersatzkompagnie und in Okahandja eine starke Besatzungstruppe gebildet, sämtliche Formationen reichlich mit Offizieren des Beurlaubtenstandes ausgestattet. Fast nur solche haben dann in der Zeit der Abwehr bis zum Eingreifen der Kompagnie Franke als Führer fungiert. Später sind sie auch bei der aktiven Truppe zahlreich verwendet worden.
Schließlich erscheint es noch des Hinweises würdig, wie wertvoll die großen Stationen als Stützpunkte in den einzelnen Bezirken sich erwiesen haben. Sie wurden zu Zufluchtsorten für die weißen Farmer und Ansiedler, aber auch zu Stützpunkten für die deutsche Macht, so daß diese in keinem Bezirk je ganz zu bestehen aufgehört hat. Von ihnen ging nach dem Umschwung der Dinge auch die Wiederinbesitznahme des betreffenden Bezirkes aus, denn sie waren über die Verhältnisse beim Gegner, über die man sich andernfalls mühsam hätte wieder orientieren müssen, fortgesetzt auf dem laufenden geblieben. Einen dauernden Schaden haben dagegen die Eingeborenen keinem der Plätze zuzufügen vermocht, vielmehr sind diese, mit Ausnahme des am schwersten bedrohten Okahandja, von Anfang bis zu Ende selbst die Angreifenden geblieben. Auch den Eintritt von Nahrungsmangel bei der Militär- wie bei der Zivilbevölkerung haben die gefüllten Proviantmagazine der Stationen verhindert. Im ganzen haben diese Stützpunkte somit ihren Zweck erfüllt.
Diejenigen aber, die der Ansicht sind, man hätte mittels gewaltsamen Eingreifens bereits vor Jahren die jetzige Katastrophe heraufbeschwören sollen, mögen bedenken, wieviel größere Schwierigkeiten unsere Truppen damals hätten überwinden müssen als jetzt, wo sie schon gerade groß genug gewesen sind. Ohne die Eisenbahn, ohne die gefüllten Proviantmagazine im Innern, vor allem ohne eigene Landeskenntnisse einen Krieg durchzufechten, hätte damals noch blutigere Opfer gekostet als jetzt. Ich habe es durchgemacht, was es heißt, Krieg zu führen, wenn man lediglich von dem guten Willen landeskundiger Eingeborener abhängig ist. Dieser Erfahrung verdankt der § 17 der Instruktion für die Bezirksamtmänner usw. (Anlage 2) seine Entstehung, dessen Wortlaut ist:
»Die in einem Bezirk stehenden Angehörigen der Truppe, wie Polizisten, haben sich fortgesetzt über dessen Wege-, Wasser- und Weideverhältnisse zu orientieren. In allen unter deutscher Verwaltung stehenden Bezirken[S. 492] muß die Feldtruppe operieren können, ohne sich außerhalb der Truppe und Polizei stehender Führer bedienen zu müssen. In jedem Bureau einschließlich derjenigen der Polizeistationen müssen stets genaue Wege- usw. Karten des betreffenden Verwaltungsbezirkes zu finden sein.«
Nicht übersehen dürfen wir ferner, wie viele deutsche Soldaten der Tatsache das Leben zu verdanken haben, daß es so lange Jahre gelungen ist, für unsere Sache Eingeborene gegen Eingeborene auszuspielen. Gedanken solcher Art mögen uns trösten über die tiefschmerzlichen Opfer an Menschenleben, welche die inzwischen fortgeschrittene Besiedlung des Landes bei Ausbruch des Aufstandes gefordert hat, und die niemand näher gehen können, als dem seiner Verantwortlichkeit sich bewußten Gouverneur. Sie mögen aber auch dem Reichstagsabgeordneten zur Seite stehen, der heute die Summen für das Schutzgebiet bewilligt, die er vor zehn Jahren vielleicht versagt hätte. Wer aber jetzt noch der Ansicht sein sollte, die Niederwerfung der Eingeborenen hätte damals weniger Opfer gekostet als heute, der befindet sich im Irrtum. Ich meinerseits bin der gegenteiligen Ansicht. Noch mehr aber irrt derjenige, welcher glaubt, daß eine gewaltsame Entwaffnung oder eine sonstige Entrechtung der Eingeborenenstämme, wenn früher vorgenommen, gar keinem Widerstand begegnet sein würde. Auch wenn vorläufig nur an einem einzigen Stamm zur Ausführung gebracht, würde diese Maßnahme sofort das Mißtrauen aller hervorgerufen und sie geradezu gewaltsam zum Anschluß aneinander gebracht haben. Dafür hat das Jahr 1904 den vollen Beweis erbracht. Als sie sich von der gleichen Gefahr bedroht glaubten, haben damals Hereros und Hottentotten, früher bitterste Feinde, sofort unverkennbare Neigung zum Zusammenschluß gezeigt. Daß es gelungen ist, diesen Zusammenschluß neun Monate bis Oktober 1904 hintanzuhalten, war zu Beginn des Hereroaufstandes zweifellos unsere Rettung. Heute können wir ferner die erforderlichen Opfer als unvermeidlich hinnehmen; wenn aber von uns selbst heraufbeschworen, würden wir uns angesichts ihrer Größe vielleicht doch nicht der zweifelnden Frage entschlagen können: »War es durchaus notwendig, diese Opfer zu bringen, und ist das Schutzgebiet sie auch wert?« Und wer würde die Verantwortung für solche Folgen eines Friedensbruchs unsererseits, ohne daß eine Zwangslage gegeben war, übernommen haben?
Die erste Hilfe von außerhalb kam dem Schutzgebiet durch unsere Marine. Am 18. Januar nachmittags traf der kleine Kreuzer »Habicht« auf der[S. 493] Reede von Swakopmund ein und begann ungesäumt die Ausschiffung seiner Landungsmannschaften. Der Schiffskommandant Korvettenkapitän Gudewill übernahm für den auf dem südlichen Kriegsschauplatz abwesenden Gouverneur den Oberbefehl über die Streitkräfte des Hererokriegsschauplatzes. Führer des Landungskorps wurde der Erste Offizier S. M. S. »Habicht«, Kapitänleutnant Gygas. Das Korps hatte zunächst die Stärke von 1 Offizier, 1 Arzt und 52 Mann. Kapitänleutnant Gygas erhielt Befehl, sich nach der wichtigen Eisenbahnstation Karibib zu begeben, diesen Ort sowie die Bahnlinie bis dort zu sichern, weitere Unternehmungen jedoch, wenn nicht dringend geboten, in Anbetracht seiner geringen Machtmittel zu unterlassen.
Bereits am Abend des 18. verließ das Korps mittels Extrazuges Swakopmund und traf mit Einbruch der Dunkelheit in Karibib ein. Unterwegs waren einige beschädigte Stellen an der Bahn wiederhergestellt und einige Stationen mit Besatzung versehen worden. In Karibib befanden sich etwa 40 waffenfähige Männer unter Kommando des Distriktschefs Oberleutnants Kuhn, der den Platz hatte verbarrikadieren lassen. Dessen Bewohner begrüßten das Eintreffen des Landungskorps als erstes Zeichen der Hilfe vom alten Vaterland mit aufrichtiger Freude.
Inzwischen waren zu dem Landungskorps auf telegraphische Requisition als weitere Verstärkung noch 5 Unteroffiziere mit 2 Feldgeschützen C. 73 und 1 Maschinengewehr aus Kamerun hinzugetreten. Weiter wurde aus der Heimat noch ein gleichfalls telegraphisch erbetenes Seebataillon sowie die bereits unterwegs befindliche regelmäßige Schutztruppenablösung von 200 Mann erwartet. Mit Recht beschränkte sich daher bis zum Eintreffen dieses bedeutenden Zuwachses das kleine Landungskorps auf Behauptung der Bahnstrecke Swakopmund-Karibib, verbunden mit deren gründlicher Wiederherstellung. Die Leitung der Wiederherstellungsarbeiten übernahm freiwillig der Chefingenieur der Otavi-Eisenbahn, Herr Solioz, der den Bau seiner eigenen Bahn vorläufig hatte einstellen müssen. Nach schwierigen, mehrfach durch erneuten Regen beeinträchtigten Wiederherstellungsarbeiten war die Bahn endlich Ende Februar wieder bis Karibib betriebsfähig. Inzwischen hatte S. M. S. »Habicht« zur Verstärkung des schwachen Landungskorps noch nach Karibib entsendet, was das Schiff nur irgendwie entbehren konnte. Es waren dies 28 Mann unter Leutnant z. S. Eckhold. Mit dieser Verstärkung betrug das Korps 80 Köpfe, so daß nunmehr Wiederherstellungsarbeiten an der Bahnstrecke auch in der Richtung auf Okahandja begonnen werden konnten.
Vom Feinde ist aus dieser Zeit nur ein Angriff durch etwa 100 Hereros auf die Station Kubas zu erwähnen, bei dem das dort stehende Vieh abgetrieben wurde. Die schwache Besatzung versuchte vergeblich dessen Wiedernahme, wobei der Führer, Unteroffizier Patriok, verwundet wurde. Inzwischen war es Kapitänleutnant Gygas gelungen, von allen eingeschlossenen Orten Nachrichten zu erlangen. Es ergab sich, daß die Kolonne Zülow sicher in Okahandja eingetroffen war, und daß Windhuk, Omaruru und Otjimbingwe, wenn auch bedroht, so doch nicht direkt gefährdet seien. An der Bahnlinie selbst kam es hin und wieder zu nur unbedeutenden Schießereien. Am 2. Februar traf dann auf ihrem Vormarsch nach Omaruru die Kompagnie Franke in Karibib ein. Mit ihr hatte ein Zug der Besatzungstruppe Okahandja verlassen und Bahn- wie Telegraphenlinie bis Karibib wiederhergestellt.
Endlich landete am 3. nachmittags in Swakopmund die Schutztruppenablösung unter Oberleutnant v. Winkler. Sie wurde, notdürftig bewaffnet und ausgerüstet, durch Korvettenkapitän Gudewill sofort nach Windhuk weiter beordert. Ihr schloß sich in Karibib auch der Rest des Landungskorps unter Kapitänleutnant Gygas an. Jetzt zeigte sich, wie wichtig die Wiederherstellung der Eisenbahn gewesen war, da nunmehr die Abteilung von Winkler Windhuk binnen 26 Stunden zu erreichen vermochte. Da Oberleutnant Winkler keine Artillerie besaß, überwies ihm Kapitänleutnant Gygas ein Feldgeschütz C. 73, eine Revolverkanone und ein Maschinengewehr, dazu 14 Artilleristen als Bedienung, diese unter dem Oberleutnant z. S. Hermann. Diese Mannschaften verblieben dann dauernd bei der Abteilung Winkler und traten später mit dieser zur Ostabteilung über.
Kapitänleutnant Gygas vereinbarte während seiner Fahrt nach Windhuk mit den Stationsältesten von Windhuk, Okahandja und Karibib eine dauernde Besetzung der ganzen zu diesem Zweck in Abschnitte eingeteilten Bahnlinie. Am 5. Februar rief indessen ein Telegramm des Korvettenkapitäns Gudewill sowohl das Landungskorps wie das Korps Winkler nach Karibib zurück, um von da gegen Omaruru vorzugehen. Es war nämlich Hauptmann Franke ergangen, wie es schon manchem Führer ergangen ist. Er war sich am Abend seines glänzenden Siegestages von Omaruru der Größe seines Erfolges noch nicht bewußt gewesen und hatte unter dem Eindrucke des zähen Widerstandes des Feindes sowie der gebrachten schweren Opfer geglaubt, daß ihm am nächsten Tage ein erneuter Kampf bevorstehe. In diesem Sinne hatte er telegraphiert. Erst den andern Tag ergab sich, daß der Feind den Platz in[S. 495] kopfloser Flucht verlassen hatte, worauf ein Gegentelegramm die Abteilung Winkler wieder nach dem Osten berief. Das Landungskorps kehrte dagegen nach Karibib zurück, woselbst nach allen Abgaben dem Führer nur noch 23 Köpfe verblieben.

Am 9. Februar traf das Seebataillon in Swakopmund ein. Es brachte eine Maschinenkanonen-Abteilung, eine Eisenbahnbau-Abteilung und eine Ersatz-Abteilung für S. M. S. »Habicht« mit. Bewundernswert war in der Tat, mit welcher Energie im alten Vaterlande die Reichsregierung an die Rettung des schwer bedrohten Schutzgebiets herantrat. Noch war kein voller Monat seit Ausbruch des Aufstandes verstrichen, als diese bedeutende Verstärkung — nahezu 800 Köpfe — in Swakopmund landete. Sie hatte nur eine Lücke, nämlich Mangel an Pferden, die erst aus Argentinien geholt werden mußten. Der Kommandeur des Seebataillons, Major v. Glasenapp, übernahm jetzt den Oberbefehl, während den Korvettenkapitän Gudewill, dessen ruhigem und sachgemäßem Eingreifen das Schutzgebiet viel zu verdanken hatte, leider ein schweres Leiden auf das Krankenlager warf, von dem er sich nicht wieder erheben sollte. Doch hatte ich noch die Freude, nach meinem Eintreffen in Swakopmund ihn daselbst begrüßen zu können.
[S. 496] Mit dem Seebataillon war auch ein langjähriger Kriegsgefährte von mir wieder im Schutzgebiet eingetroffen, Major v. Estorff, den ich zu meiner Vertretung im Norden vom südlichen Kriegsschauplatz aus telegraphisch erbeten hatte. Ferner brachte das Seebataillon den Allerhöchsten Befehl mit, nach dem die Leitung der Operationen in der Heimat der Große Generalstab übernehmen sollte. Zum Führer des gesamten Marine-Expeditionskorps war Oberst Dürr ernannt, der jedoch erst in drei Wochen landen konnte. Das Marine-Expeditionskorps war somit als eine geschlossene Operationsabteilung unter eigener Führung gedacht. Doch ist es zu einer solchen Verwendung nie gekommen. Die Lage zwang, dasselbe einzusetzen, wo es gerade nottat, und daher zu seiner Teilung. Auf der einen Seite handelte es sich um Ausnützung der Erfolge der bei Omaruru zum Stehen gekommenen Kompagnie Franke, auf der anderen um Absperrung der englischen Grenze, damit der Gegner nicht mit seinen geraubten Viehherden ungestört über diese verschwinden konnte. Hiernach traf Major v. Glasenapp seine vorläufigen Anordnungen, denen ich mich nach meiner Ankunft in Swakopmund am 11. Februar im allgemeinen angeschlossen habe. Sie gingen dahin, daß
1. die Kompagnie Franke um eine Kompagnie des Seebataillons zu verstärken sei, den Oberbefehl über die so entstandene »Westabteilung« habe Major v. Estorff zu übernehmen und zu ihr auch die 4. Feldkompagnie aus Outjo heranzuziehen,
2. die Abteilung Winkler um zwei Kompagnien des Seebataillons zu verstärken sei, die so gebildete »Ostabteilung« habe unter das Kommando des Majors v. Glasenapp zu treten und den Distrikt Gobabis zu säubern sowie die Hereros von einem etwaigen Entweichen über die englische Grenze abzuhalten,
3. die letzte Kompagnie des Seebataillons zur Besatzung Okahandjas überzutreten habe, um dieses Zentrum der deutschen Basis bis zum Eintreffen der bereits unterwegs befindlichen weiteren Verstärkungen aus der Heimat zu halten,
4. endlich das Landungskorps S. M. S. »Habicht« unter Kapitänleutnant Gygas, durch verschiedenen Zuwachs verstärkt, den Distrikt Otjimbingwe zu säubern und von da Anschluß nach Okahandja zu suchen habe.
In den vorliegenden Abschnitt gehört nur die Berichterstattung über die Abteilung des Kapitänleutnants Gygas. Den übrigen Teilen des Marine-Expeditionskorps werden wir bei der Schilderung der Kämpfe der Schutztruppe wieder begegnen. Das Detachement Gygas setzte sich zusammen aus:
51 Mann der Besatzung S. M. S. »Habicht«,
55 Mann der Eisenbahn-Schutztruppe,
18 alten Schutztruppenreitern,
34 schwarzen Polizeisoldaten und Treibern;
dazu an Artillerie: ein Feldgeschütz C. 73, eine Revolverkanone, ein Maschinengewehr.
Am 12. Februar nachmittags rückte das Detachement von Karibib ab[137]. Seine Schwäche für Südwestafrika lag in dem Mangel an Pferden. Die Reiterei bestand aus nur 12 Mann, die sich später in Otjimbingwe auf 16 Köpfe ergänzten. Nach Überwindung großer, in dem mangelhaften Treiberpersonal sowie in der geringen Marschfähigkeit der Mannschaften beruhenden Schwierigkeiten langte das Korps, ohne vom Feinde gestört worden zu sein, am 15. früh in Otjimbingwe an. Hier wurde der für die Station bestimmte Proviant abgeladen und am Abend weitermarschiert, um den nach umhergehenden Gerüchten etwa 30 km swakopaufwärts lagernden Gegner anzugreifen. Dieser bestand aus den Otjimbingwe-Hereros unter der nominellen Führung des Häuptlings Zacharias. Als landeskundige Offiziere waren dem Detachement der rührige Distriktschef von Karibib, Oberleutnant Kuhn, sowie Oberleutnant Ritter (seinerzeit Miterbauer der Eisenbahn) beigegeben, letzterer als Führer der Reitertruppe. Der Feind saß genau da, wo er vermutet worden war, am Liewenberg, und kam es dort am 16. Februar zu einem Gefecht. Nach genügender Vorbereitung durch Artillerie- und Infanteriefeuer wurden nach siebenstündigem Kampfe die in guter Stellung befindlichen Hereros geworfen. Der diesseitige Verlust betrug ein Mann tot, zwei Mann verwundet. Vom Gegner fanden sich vier Tote sowie eine Menge Gewehre, Munition und Hausrat. Mit diesem Gefecht war auch Otjimbingwe endgültig vom Feinde befreit. Es blieb daher dem Kapitänleutnant Gygas nur noch die Lösung des zweiten Teiles seiner Aufgabe, nämlich der Vormarsch nach Okahandja.
Am 17. früh wurde der Marsch fortgesetzt und am 19. Groß-Barmen erreicht, wo die Abteilung die von Okahandja entgegengesendeten Reiter zu finden hoffte, unvermutet aber von den Bergen ringsherum Feuer erhielt. Da durch dieses auch die Wagenkolonne in Mitleidenschaft gezogen war, hatten sich sämtliche Treiber zum Ausreißen veranlaßt gesehen. Hierdurch entstand anfänglich eine schwierige Lage, die jedoch nicht hinderte, daß nach[S. 498] etwa zweistündigem Feuergefecht die Erstürmung der feindlichen Stellung gelang. Der Kampf hatte einen Toten und sieben Verwundete gekostet, während vom Feinde in der eroberten Stellung neun Tote und eine Anzahl Gewehre gefunden wurden. Inzwischen war die Reiterei des Detachements hinter der Gefechtslinie weiter nach dem Platze Groß-Barmen selbst vorgeritten und hatte dort Fühlung mit der Reiterei aus Okahandja gewonnen, die unter Veterinärrat Rickmann sich bereits seit zwei Tagen dort befand. Sie hatte während des Gefechts versucht, durch einen Angriff auf den Rücken der feindlichen Stellung der Abteilung Gygas Unterstützung zu bringen, war jedoch hierbei in deren Artilleriefeuer geraten. Nunmehr setzte das Detachement seinen Vormarsch auf Okahandja fort, wo es am 20. eintraf. Nach Vereinbarung mit dem Kommandanten S. M. S. »Habicht« wurde dann das Landungskorps gegen die inzwischen eingetroffenen Ersatzmannschaften des Kreuzers ausgetauscht. Diese trafen am 26. Februar in Okahandja ein und gingen bis zu ihrer späteren Rückreise im großen und ganzen in der Schutztruppe auf. Das bisherige Landungskorps kehrte dagegen wieder an Bord zurück, mit Ausnahme des Oberleutnants zur See Hermann, des Assistenzarztes Dr. Velten und 14 Mann, die bei der Ostabteilung geblieben waren, und 6 Mann, die sich auf entfernter gelegenen Stationen befanden. Ebenso mußte Leutnant zur See Eckhold infolge eines Schenkelbruchs — Sturz vom Pferde — im Lazarett Karibib bleiben.

Auch das Landungskorps der Marine konnte mit Befriedigung auf seine Tätigkeit zurückblicken. Obwohl der Landkrieg eigentlich nicht in den[S. 499] Bereich seiner Tätigkeit fällt, hat es doch seine Aufgabe zur vollen Zufriedenheit gelöst. Besonders sein tatkräftiger Führer Kapitänleutnant Gygas hat mir einen derart guten Eindruck gemacht, daß ich ihn nur mit Bedauern wieder scheiden sah.
Die Tätigkeit der übrigen Teile des Marine-Expeditionskorps war untrennbar mit derjenigen der Schutztruppe verbunden, so daß sich deren besondere Behandlung erübrigt. Teile des Korps befanden sich bei allen Abteilungen der Schutztruppe, die, wie wir gesehen haben, in eine Westabteilung und eine Ostabteilung gegliedert war. Zu ihnen trat dann später noch die Hauptabteilung, die sich nach Maßgabe der aus der Heimat eintreffenden Verstärkungen allmählich bei Okahandja bildete.
Ich beginne mit der Schilderung der Tätigkeit der
Am 13. Februar standen von der Westabteilung in Omaruru vereinigt: Kompagnie Franke, Marinekompagnie Häring, ein Zug Maschinenkanonen, zwei Geschütze der Schutztruppe.
Zu diesen Truppenteilen sollte, sobald erreichbar, die in Outjo stehende 4. Feldkompagnie der Schutztruppe — nach der Verwundung des Hauptmanns Kliefoth unter Oberleutnant Freiherr v. Schönau-Wehr — treten. Den Befehl über das Ganze hatte Major v. Estorff, Adjutant war Leutnant Freiherr v. Buttlar.

Als seine erste Aufgabe sah Major v. Estorff mit Recht die Herstellung der Verbindung mit der 4. Feldkompagnie an. Demgemäß setzte sich die Westabteilung am 20. Februar nach Outjo in Marsch. Bereits 65 km nördlich Omaruru stieß sie jedoch auf die 4. Feldkompagnie, die der Drang, wieder Fühlung mit der Außenwelt zu gewinnen, gleichfalls zum Vor[S. 500]marsch, und zwar nach Süden, veranlaßt hatte. Nachdem die heliographische Verbindung zwischen Outjo und Omaruru wiederhergestellt und gesichert war, wendete sich die Abteilung gegen die wichtige Wasserstelle Otjihinamaparero, wo der bei Omaruru geschlagene Gegner vermutet wurde. Die bei der Abteilung befindliche Marinekompagnie war nach Abgang der von ihr gestellten Sicherungsmannschaften jetzt nur noch 60 Köpfe stark. Die Hereros wurden in der Tat an der vermuteten Wasserstelle entdeckt, und es kam am 25. Februar zu dem hartnäckigen Gefecht bei Otjihinamaparero, das erst gegen Abend durch Sturmangriff einer aus allen anwesenden Truppenteilen gemischten Kolonne unter Hauptmann Franke entschieden werden konnte. Der weit überlegene Gegner hatte sogar eine von anfänglichem Erfolg begleitete Umfassungsbewegung gegen unseren linken Flügel vorgenommen. Der diesseitige Verlust betrug 1 Offizier (Oberleutnant Schultze) tot, 3 Offiziere (Oberleutnants v. Schönau, Hannemann, Leutnant v. Stülpnagel), 7 Reiter verwundet. Vom Feinde wurden auf dem Gefechtsfelde 53 Tote gefunden und 2000 Stück Vieh erbeutet.
Die Westabteilung blieb nunmehr bis zum 14. März in der schwer erkämpften Stellung und füllte diese Zeit mit Erkundungen und mit Ergänzung des Proviants aus. Der Gegner war anscheinend in der Richtung auf Waterberg abgezogen. Einzelne Hereros schwärmten indessen fortgesetzt noch vor der Front der Deutschen umher. So wurde noch zwei Tage nach dem Gefecht ein Reiter dicht bei dem Kampfplatz aus dem Hinterhalte erschossen. Ein Offizier, der das Gefechtsfeld absuchen wollte, wurde sogar seitens eines verwundeten Hereros noch mit einer — glücklicherweise fehlgehenden — Kugel bedacht. Etwa Mitte März berief ich den Major v. Estorff nach Karibib und erteilte ihm auf Grund der festgestellten Kriegslage den Befehl, nunmehr auch seinerseits, wenn irgend möglich, behufs gemeinsamen Zusammenwirkens mit der in der Formation begriffenen Hauptabteilung in der Richtung auf Okahandja zu operieren.
Infolgedessen trat die Westabteilung am 14. März ihren Vormarsch auf Okahandja an. Am 16. wurde ihre Spitze im dichten Busch überrascht und zwei Mann erschossen. Der führende Offizier,[139] den sein stürzendes Pferd abgeworfen hatte, wurde nur durch den mit vier Reitern rasch herbeieilenden Unteroffizier d. Res. Hümann (Landmesser) gerettet. Schnell entwickelte sich die Westabteilung zum Gefecht und nahm die feindliche Werft[S. 501] (Erindi Okaserandu) unter einem weiteren Verlust von 2 Verwundeten. Dazu kamen noch als Abgang die 9 Pferde der Spitze. Infolge dieser Überraschung wurde von jetzt ab mit äußerster Vorsicht durch den dichten Busch weitermarschiert, und am 24. März langte die Westabteilung in Okahandja an. Sie hatte ihre Aufgabe glänzend gelöst. Am 19. März war noch eine feindliche Werft (Otjinaua Naua) weggenommen und eine Viehherde erbeutet worden.
Von Beginn des Aufstandes ab war sowohl in der Heimat wie im Schutzgebiete die öffentliche Meinung mehr durch die Furcht vor einer Flucht der Hereros mit dem geraubten Vieh über die englische Grenze, als vor einer etwaigen Schwierigkeit, sie zu besiegen, beherrscht. Bei dem bisherigen geringen politischen Zusammenhalten der Hererostämme unter sich erschien auch mir eine solche Fluchtmöglichkeit, wenigstens seitens des im Osten wohnenden Stammes des Unterhäuptlings Tjetjo, als naheliegend. Dieser Annahme trat der Distriktschef von Gobabis, Oberleutnant Streitwolf, in einer Meldung vom 9. Februar gleichfalls bei, die ich am 15. Februar in Karibib erhielt. Der genannte Offizier empfahl in ihr dringend die Entsendung einer starken Truppe nach dem Distrikt Gobabis, und zwar rasch, da andernfalls die Gefahr einer Entweichung der Hereros vorliege. Es wurde daher zur Formierung einer stärkeren Ostabteilung unter dem Kommando des Majors v. Glasenapp geschritten. (Siehe S. 496.) Dieser erhielt Befehl, sich zur Rücksprache bei mir in Karibib einzufinden, der bereits im Vormarsch nach dem Osten befindlichen Marinekompagnie Fischel wurde dagegen aufgegeben, zu halten, wo sie sich gerade befände. Die Abteilung von Winkler war bereits im Distrikt Gobabis angelangt und daher wenigstens der dringendste Bedarf an Verstärkung dortselbst gedeckt. Sie hatte auf ihrem Vormarsch am 11. Februar eine feindliche Werft überfallen und mit geringen eigenen Verlusten genommen. Nachzuholen ist noch, daß die Kompagnie Fischel in der Nacht vom 14. auf den 15. in der Nähe von Seeis einen Überfall auf ihre Sicherheitstruppen und hierbei einen Verlust von 3 Toten und 2 Verwundeten erlitten hatte. Auch diese Meldung war am 15. in Karibib eingetroffen.
Nach ihrer vollständigen Zusammensetzung war die Kriegsgliederung der Ostabteilung folgende:
Führer: Major v. Glasenapp,
[S. 502]Stab: Hauptmann a. D. v. François,
Adjutant: Leutnant Schäfer,
Ordonnanzoffizier: Oberleutnant Graf v. Brockdorff,
Artillerieoffizier: Oberleutnant z. S. Manshold,
Stabsarzt Graf,
Marineinfanterie-Oberassistenzarzt Dr. Velten,
Marine-Kompagnien Fischel, Lieber,
Schutztruppen-Feldkompagnie von Winkler,
Kavallerie-Abteilung Oberleutnant d. L. Köhler[140], Oberleutnant Eggers,
2 Maschinengewehre,
6 Geschütze verschiedenen Kalibers,
in Summa rund 400 Gewehre, darunter 80 Berittene. An landeskundigen Offizieren befanden sich bei der Abteilung der Kriegsfreiwillige Hauptmann a. D. v. François und die Oberleutnants v. Winkler und Eggers. Aber auch zahlreiche Landeskundige, sei es als Kriegsfreiwillige, sei es als Reserve und Landwehr, waren bei der Schutztruppenkompagnie. Sie haben bei der durchweg aus Neulingen bestehenden Ostabteilung nach dem Zeugnisse des Führers die wertvollsten Dienste geleistet, trotzdem empfand der letztere immer noch unliebsam den Mangel an wegekundigen Eingeborenen.
Wenn die Ostabteilung bei ihren Operationen auch nicht so durchweg vom Glück begünstigt gewesen ist wie die Westabteilung, so verdienen ihre Leistungen doch die höchste Anerkennung. Die Marschdisziplin der zum Teil noch aus Rekruten bestehenden Marineinfanterie war bewundernswert. Sie hat den weiten Weg von Windhuk nach Gobabis und von da, stets den Spuren des Feindes folgend, gegen Westen bis in die Nähe der Onjati-Berge ohne nennenswerte Verluste an Marschunfähigen zurückgelegt.[141] Zu einem Gefecht gegen den noch isolierten Feind, wie wir dies bei der Westabteilung gesehen haben, ist es dagegen bei der Ostabteilung nicht gekommen. Die Kriegslust des Tjetjostammes scheint diejenige der Omaruru-Hereros nicht erreicht zu haben. Er blieb vielmehr beim Anrücken der Ostabteilung in ununterbrochenem Rückzuge und fand erst nach gewonnener Fühlung mit der Hauptmasse seiner Landsleute in der Nähe der Onjati-Berge den Mut zum Widerstande.
[S. 503] Zunächst hatte daher die Ostabteilung lediglich Marschleistungen aufzuweisen.[142] Deren Ziel war Kehoro am oberen Nosob, wo der Tjetjostamm gemeldet war. Indem sowohl die Abteilung von Winkler wie die von Major v. Glasenapp selbst geführten beiden Marinekompagnien diesem Ziel zustrebten, gewannen sie am 24. Februar in der Nähe von Groß-Owikango Fühlung miteinander. Der Platz Kehoro aber fand sich bereits vom Feinde geräumt. Gemeinsam wurde jetzt die Verfolgung aufgenommen, und zwar in zwei Kolonnen, die eine den Epukiro, die andere den Schwarzen Nosob auswärts. Die breite Front war gewählt worden, um eine Rückkehr des Gegners um die Flanken des Verfolgers herum nach Osten tunlichst zu erschweren. Wo die Hauptmasse der Hereros geblieben war, ob bei Waterberg oder in den Onjati-Bergen, war damals beim Oberkommando der Truppe wohl bekannt, aber noch nicht bis zur Ostabteilung durchgedrungen. Die Spuren des zurückziehenden Tjetjostammes führten dagegen stets nach Westen, bis Onjatu, welcher Platz seitens der linken Kolonne am 12. März erreicht wurde. Hier aber verloren sie sich. Da das zweckmäßigste Erkundungsmittel, nämlich Eingeborene als Späher, hier versagte und kleinere Patrouillen in Südwestafrika überhaupt unzweckmäßig sind, in dem dortigen dichten Buschgelände aber erst recht keinen Erfolg versprechen, so wurde eine größere Erkundungsabteilung zusammengesetzt und zu ihr alle in Onjatu entbehrlichen Offiziere herangezogen, um bei dem Pferdemangel die Zahl der Berittenen tunlichst zu erhöhen. Auch der Stab schloß sich an. In Summa betrug die Stärke der Erkundungsabteilung 11 Offiziere, 46 Reiter und 3 Eingeborene, von welchen 36 Gewehre am Gefecht teilgenommen haben.
Dieser Erkundungsritt führte am 13. März zu dem Gefecht von Owikokorero. Nach den Aussagen einer unterwegs eingefangenen Hererofrau sollte der Gegner im Abzug begriffen sein und sich an dem Platze nur noch seine Nachhut sowie eine Viehherde befinden. Dies schien sich zu bestätigen, als die ersten entdeckten Schwarzen vor der in breiter Front und rascher Gangart vorreitenden Patrouille davonliefen. Sogar die Viehherde konnte anstandslos weggenommen werden. Aber bald wurde die Patrouille von Schüssen begrüßt, worauf sie zum Fußgefecht absaß. Das anfänglich nur schwache feindliche Feuer verstärkte sich zusehends, und bald war kein Zweifel mehr möglich, daß man nicht die Nachhut des Tjetjostammes, sondern diesen selbst vor sich habe. Mit Recht ließ Major v. Glasenapp jetzt das Gefecht abbrechen, doch war man bereits zu sehr mit dem Feinde handgemein geworden,[S. 504] als daß dies noch ohne schwere Verluste möglich gewesen wäre. Sogar das Maschinengewehr ging, nachdem dessen Bedienungsmannschaft in mehrfachem Wechsel außer Gefecht gesetzt worden war, verloren. Es war daher fast ein Wunder, wenn dem übermächtigen sowie heftig nachdrängenden Gegner gegenüber überhaupt noch eine teilweise Rettung der Patrouille gelang. Die Mehrzahl der Kämpfer jedoch, und zwar 7 Offiziere und 19 Mann, war gefallen. Zwei schwer verwundete Offiziere konnten noch gerettet werden. Im Verhältnis zu der im Gefecht gewesenen Kopfzahl betrugen die Verluste somit etwa 70 vH. Wenn daher in diesem Gefecht für die deutschen Waffen manches verloren gegangen ist, so war eins nicht verloren, nämlich die Waffenehre. Auch die beiden alten Afrikaner, deren Rat bei Durchführung dieses Patrouillenrittes wesentlich mitgewirkt hat, waren gefallen.[143]
Nunmehr blieb die Ostabteilung vom 14. bis 28. März im Lager von Onjatu, das Eingreifen der zur Zeit noch nicht operationsfähigen Hauptabteilung erwartend. Denn was die Abteilung zu wissen nötig hatte, wußte sie jetzt, nämlich, daß ihr ein starker Feind in einem für diesen günstigen, für die deutschen Waffen aber höchst ungünstigen Gelände gegenüberstände.
Erst der nächste von Windhuk kommende Befehl vom 11. März — eingegangen am 17. März — brachte Aufschluß über die Gesamtlage beim Feinde. Er lautete auszüglich:
1. Samuel mit den Okahandjaleuten sitzt in der Linie Otjosasu-Okatumba (am Swakop) — Katjapia und südlich (etwa 1000 Gewehre).
Der Tjetjostamm ist im Rückzuge von Kehoro, den Schwarzen Nosob aufwärts nach den Onjati-Bergen (etwa 500 Gewehre).
Michael mit den Leuten von Omaruru geht vom Etjo-Gebirge in östlicher Richtung zurück (etwa 1000 Gewehre).
Im Bezirk Otjimbingwe, bei Sneyrivier und am Liewenberge und südlich sitzen weitere Hereros (etwa 1000 Gewehre).
Aus dem Nordosten keine Nachricht.
2. Ich beabsichtige, nach Formation der Hauptabteilung die Okahandjaleute und Tjetjo von Westen und Osten her gleichzeitig anzugreifen.
3. bis 8. usw.
9. Ich treffe Ende März in Okahandja ein und begleite den Vormarsch der Hauptabteilung.
[S. 505] Notizen: 1. usw.
2. Die Formation der Hauptabteilung kann Anfang April beendet sein.
Der Tag des Angriffs wird noch befohlen werden.
3. bis 5. usw.
Ergänzt wurde dieser Befehl durch einen zweiten vom 18. März, der die Aufgabe der Ostabteilung, wie folgt, genauer bestimmt:
»Wenn über den Tjetjostamm nunmehr andere Nachrichten dort eingegangen sind, so liegt die Sache für die Ostabteilung natürlich anders und würde dieselbe freie Hand zu jeder anderen Operation gegen diesen haben. Die Hauptoperationsaufgabe der Ostabteilung ist und bleibt der Tjetjostamm und die Sperrung der Ostgrenze.«
Gleichzeitig mit diesem Befehl trafen am 21. März aus Windhuk als Ersatz für die Gefallenen vier andere Offiziere ein, darunter drei Reserveoffiziere, von denen der eine (Nörr) bereits 12 Tage später bei Okaharui fiel.
Die weiteren Ereignisse zeigten dann von neuem, wie schwer in Afrika ein einheitliches Zusammenwirken getrennt operierender Abteilungen herzustellen ist. Die Hauptabteilung war nicht am 1. April, sondern infolge eingetretener Hemmnisse erst am 7. operationsfähig. Die Nachricht von dieser Verschiebung traf jedoch die Ostabteilung erst am 3. April, aber auch jetzt konnte noch nicht bestimmt gesagt werden, an welchem Tage der Angriff der Hauptabteilung auf die feindliche Stellung zu erwarten sei. Es hieß nur »um den 6. herum«.[144] Am 3. mußte jedoch, wie wir noch sehen werden, die Ostabteilung sich eines feindlichen Angriffs bei Okaharui erwehren, da sie sich in ihren Operationen an den ersten Befehl gehalten hatte, nach dem die Hauptabteilung Anfang April marschbereit sein sollte. Ein solch mangelhaftes Zusammenwirken wird erklärlich, wenn wir die Art der Verbindung zwischen beiden Abteilungen betrachten. Diese ging mittels Heliographenlinie von Okahandja über Windhuk nach Seeis und von da mittels Reiter oder Fußboten zum Lager der Ostabteilung. Auch bei der größten Beschleunigung bedurften die Befehle und Meldungen zum Zurücklegen dieses Weges eines Zeitraumes von 5 bis 8 Tagen. Beide Abteilungen mußten daher auch isoliert sowie nach den Umständen handeln. Indessen lag hierin keine besondere Gefahr, da jede ihren eigenen Gegner hatte, und ihre bloße Anwesenheit genügte, um diesen festzuhalten. Wenigstens hat der Tjetjostamm bei den Gefechten der Hauptabteilung nicht mitgewirkt. Ebenso unwahrscheinlich war eine Teilnahme[S. 506] der bei Onganjira stehenden Hauptmacht der Hereros an dem Gefecht bei Okaharui. Denn die Eingeborenen pflegen über die Maßnahmen des Feindes stets völlig unterrichtet zu sein. Und so konnte auch dem bei Onganjira stehenden Oberhäuptling Samuel die immer stärker werdende Ansammlung von Truppen in Okahandja unmöglich entgangen sein.
In der Annahme, daß die Hauptabteilung ihren Vormarsch Anfang April beginnen werde, stieß die Ostabteilung am 1. April bis Ojikuoko vor. Hier tauchten ihr Zweifel auf, ob die Hauptabteilung ihren Vormarsch in der Tat angetreten hätte, da von dort weder Nachrichten eingetroffen, noch Signalzeichen zu sehen waren. Major v. Glasenapp beschloß daher den Rückmarsch auf Onjati, da ihm die Lage seiner Abteilung dicht vor dem starken Feinde doch zu gefährdet erschien. Nachdem die berittene Abteilung unter Oberleutnant v. Winkler zur Erkundung bereits vorher zurückgesendet worden war, lagerte die Ostabteilung selbst in der Nacht vom 2. bis 3. April bei Okaharui mit der Absicht, am andern Tage den Rückmarsch auf Otjikuara fortzusetzen. Auf diesem Rückmarsch traf am 3. April — mithin noch ungewöhnlich schnell — der Befehl des Truppenkommandos vom 29. März ein, wonach die Hauptabteilung erst etwa am 6. marschbereit wäre und daß zwei Geschütze nebst Munition sowie Proviant unter Hauptmann a. D. Fromm im Anmarsch seien. Nun hatte Major v. Glasenapp selbstverständlich erst recht keine Veranlassung zum Bleiben; doch erwies sich bald, daß eine ungestörte Fortsetzung des Rückmarsches nicht mehr in seiner Hand lag. Denn anscheinend übermütig geworden durch den mit erdrückender Übermacht errungenen Erfolg bei Owikokorero, war der Gegner der Abteilung in dichten Massen gefolgt und hatte am 3. vormittags die Nachspitze angegriffen. Hieraus entwickelte sich nunmehr das Gefecht von Okaharui.
Der Angriff der Hereros traf die Ostabteilung in einer recht schwierigen Lage. Mit einem Train von 22 Ochsenwagen belastet, war sie in dem ganz unübersichtlichen Gebüsch auf 2½ km auseinandergezogen. Die Arrieregardenkompagnie (Fischel) machte sofort Kehrt, um ihrer hart bedrängten Nachspitze Unterstützung zu bringen. Die in der Mitte der Marschkolonne befindliche Schutztruppenkompagnie — jetzt von Oberleutnant Graf v. Brockdorff geführt — sowie die Artillerie erhielten Befehl, gleichfalls wieder Front zu machen und behufs Aufnahme der Arrieregardenkompagnie sich bei einer Lichtung zu entwickeln. Auch die auf dem Rückmarsch am weitesten vorn befindliche Kompagnie (Lieber) bekam Weisung, sich an diese Stellung heranzuziehen. Letzteres konnte jedoch nicht zur Ausführung gebracht werden, da[S. 507] inzwischen die Kompagnie selbst angegriffen worden war. Es entwickelte sich daher ein räumlich getrenntes Gefecht nach zwei Fronten, bei dem der Gegner bald entdecken sollte, daß er es nicht mehr mit der schwachen Abteilung von Owikokorero zu tun hätte. Er wich unter schweren Verlusten, noch bevor der auf beiden Gefechtsfeldern beschlossene Sturmangriff zur Ausführung gekommen war. Aber auch die diesseitigen Verluste waren groß. Sie betrugen 1 Offizier, 31 Mann tot, davon 1 Offizier, 18 Mann allein von der Nachspitze, und 2 Offiziere, 15 Mann verwundet. Nachdem der geschlagene Feind noch 7 km verfolgt war, wurde in der Nacht zum 4. April auf dem Gefechtsfelde biwakiert und am anderen Tag der Rückmarsch nach Onjatu fortgesetzt. Hier erhielt die Ostabteilung erst am 20. die Nachrichten von den Ereignissen bei der Hauptabteilung, aus denen zu ersehen war, daß bei dieser die Operationen vorläufig zum Stillstand gekommen waren. Das fernere Verhalten der Ostabteilung sollte daher bis auf weiteres rein defensiv bleiben, zu welchem Zweck ihr die Aufstellung überlassen blieb. Auch wurde ihr ein etwaiger Linksabmarsch nach Otjihangwe, jedoch unter Aufrechterhaltung der Beobachtung des Gegners, freigestellt.
Inzwischen hatte sich bei der Abteilung ein neuer Feind eingestellt, der noch mehr Opfer fordern sollte als die Hereros, nämlich der Typhus. Am 16. April hatte die Abteilung bereits 66 Typhuskranke, und täglich kamen neue Erkrankungen hinzu. Es war daher ein ganz richtiger Entschluß, wenn die Ostabteilung die auf dem Kriegsschauplatz eingetretene Ruhepause benutzte, um die verseuchte Gegend zu räumen. Sie marschierte am 21. April ab und erreichte am 24. Otjihaenena, wo Missionshaus und Kirche die Möglichkeit zur Einrichtung eines Lazaretts boten. Auf die Nachricht von dem Geschehenen wurde dort die Abteilung unter dem 3. Mai in Quarantäne gesetzt. Die berittene Abteilung war infolge ihrer Entsendung bereits vor dem Gefecht von Okaharui glücklicherweise nicht infiziert worden und konnte daher auch ferner außerhalb des Verbandes der Abteilung verbleiben. Sie wurde zunächst in Seeis stationiert. Mit diesen Maßnahmen hatte die Ostabteilung zu bestehen aufgehört. Ihre Aufgabe, den Ostdistrikt zu säubern und einen etwaigen Übertritt feindlicher Banden mit Viehherden nach dem britischen Gebiet zu verhindern, hat sie vollauf gelöst und in zwei schweren Gefechten dem Gegner Achtung vor den deutschen Waffen beigebracht. Die stets ungebeugte Energie und frische Initiative des Führers, des Majors v. Glasenapp, verdient alle Anerkennung.
[S. 508] Von den Aufgaben, die bisher der Ostabteilung obgelegen hatten und deren Erfüllung infolge ihres Ausscheidens gefährdet erschien, konnte die eine auch ferner nicht unberücksichtigt bleiben, nämlich Verhinderung eines etwaigen Abmarsches der Hereros über die englische Grenze. Glücklicherweise gibt es vom Hererolande aus über diese eigentlich nur zwei für große Massen brauchbare Übergänge, nämlich längs des Omuramba-u-Omatako sowie längs des Epukiroriviers. Diese beiden Riviere mußten daher gesperrt werden. Die Sperrung des ersteren erfolgte durch Besetzung der Wasserstelle Coblenz seitens des Distrikts Grootfontein,[145] diejenige des letzteren durch Stationierung einer neu zusammengestellten Abteilung von etwa 100 Reitern und 2 Geschützen unter Oberleutnant v. Winkler bei Epukiro. Mannschaften und Geschütze waren zum Teil der Ostabteilung (Reitertruppe) entnommen, zum Teil der Station Windhuk. Außerdem hatte die Ostabteilung bereits im Monat März den Leutnant Eymael mit 30 Reitern nach Rietfontein entsendet. Einzelne Banden, anscheinend mit der Absicht, die Grenze zu überschreiten, hatten sich in der Nähe dieses Platzes bereits gezeigt.
Schließlich erscheint noch die Tatsache erwähnenswert, daß nach dem Gefecht von Onganjira eine Meldung des bei Okaharui kommandierenden Hereroführers über das dortige Gefecht in dem Pontok des Oberhäuptlings gefunden worden ist. Diese Meldung war jedoch nicht von Tjetjo unterzeichnet, sondern von Oanja, einem der Großleute Samuels, den dieser in anscheinendem Mißtrauen gegen Tjetjo über letzteren gesetzt hatte. Der Inhalt des Briefes war ungefähr: »Wir haben gestern gefochten und wollten die Wagen der Deutschen nehmen, doch diese hielten stand, wir auch; und dann haben wir eine große Sache gemacht, nämlich zwei große Rohre weggenommen. Die Deutschen verloren 31 Tote.« Wie wir jetzt wissen, war die Meldung von der Wegnahme zweier Geschütze eine Flunkerei seitens des Hereroführers.
Während die beiden deutschen Flügelabteilungen ihre weiten Umfassungsbewegungen vollendeten, benutzte die in Okahandja sich sammelnde Hauptabteilung die so gegebene Zeit zu ihrer Formation. Sie sollte sich aus der vom Süden zurückzuerwartenden Feldtruppe und aus den von Deutschland bereits angekündigten weiteren Verstärkungen in der Höhe von 500 Köpfen,[S. 509] endlich aus der in Okahandja zurückgebliebenen Marinekompagnie (Schering) zusammensetzen, die ganze Abteilung unter dem Befehl des inzwischen eingetroffenen Führers des Marine-Expeditionskorps, des Obersten Dürr. Leider aber machte sich bei dem genannten Offizier bald die Wirkung des südwestafrikanischen Höhenklimas geltend. Ein schweres Herzleiden zwang ihn, das Schutzgebiet bereits nach vier Wochen wieder zu verlassen. Ich bedauerte dies tief, da ich mir bewußt war, bei meiner schweren Aufgabe die Unterstützung seitens eines so erfahrenen und tüchtigen Offiziers wohl brauchen zu können.[147] Infolge seines Ausscheidens trat der Stab des Obersten Dürr zum Kommando der Schutztruppe über (die Hauptleute Salzer und Bayer als Generalstabsoffiziere, Oberleutnant v. Bosse als Adjutant, deren Unterstützung mir um so wertvoller war, als ich bis jetzt hatte froh sein müssen, wenn ich überhaupt nur einen einzigen Adjutanten besaß).

Bis Ende Februar hatte die Hauptabteilung lediglich aus der Marinekompagnie bestanden. Am 28. traten zwei aus den eingetroffenen Verstärkungen mittlerweile neuformierte Kompagnien der Schutztruppe, und zwar die 5. unter Hauptmann Puder, die 6. unter Hauptmann v. Bagenski,[148] hinzu, zwei gleichfalls neu gekommene Batterien[S. 510] befanden sich noch in der Formation begriffen im Bezirk Swakopmund. Da der im Bezirk Otjimbingwe stehende, seinerzeit durch die Abteilung Gygas geschlagene Gegner anfing, sich wieder lästig zu machen, wurde beschlossen, die noch fortdauernde Ruhepause vor der Front zu einer abermaligen Expedition gegen ihn auszunutzen. Es wurden hierzu bestimmt:
| Kompagnie Puder, | ||
| Marinekompagnie Schering, | ||
| 23 Mann vom Landungskorps S. M. S. »Habicht«, | ||
| 1 Feldgeschütz C. 73 | } | |
| 2 Maschinenkanonen | unter Leutnant z. S. Rümann. | |
| 1 Revolverkanone | ||
Außerdem wurde zur Aufklärung eine besondere berittene Patrouille von 30 landeskundigen Reitern unter Oberleutnant Ritter vorausgeschickt. Diese meldete am 3. März frische feindliche Spuren in der Richtung von Groß-Barmen nach Klein-Barmen.
Die Abteilung selbst unter Kommando des Hauptmanns Puder trat ihren Vormarsch am 2. März an. Am 4. früh stieß die Spitze in der Nähe von Klein-Barmen auf eine geschickt gewählte feindliche Stellung. Spitze und Reiterabteilung waren hierbei unvermutet in das feindliche Feuer geraten und hatten mehrere Reiter und Pferde verloren. Rasch entwickelte Hauptmann Puder die Kompagnie Schering gegen die Front des Feindes, seine eigene gegen dessen rechte Flanke. Mittels dieser Umfassungsbewegung wurde nach vierstündigem Gefecht, bei dem schließlich ein seitens des Leutnants v. Rosenberg[149] mit seinem Zug ausgeführter Sturmangriff den Ausschlag gab, der Gegner mit einem diesseitigen Verlust von 5 Toten und 1 Verwundeten aus seiner Stellung geworfen. Eine weit ausholende Verfolgung lag nicht in der Aufgabe der Abteilung Puder, da sie sich von dem Schwerpunkt unserer Operationen, Okahandja, nicht allzusehr entfernen durfte. Sie kehrte daher am 8. März an diesen Platz zurück.
Indessen hatte die Expedition vorher doch noch einen weiteren wesentlichen Erfolg, indem eine am 6. unter Leutnant v. Rosenberg entsendete Patrouille zur allgemeinen Überraschung ein weiteres großes Hererolager bei Oruware am Swakop feststellte. Ein bei der Patrouille befindlicher Bur schätzte dessen Stärke auf 1500 bis 2000 Waffenfähige mit[S. 511] unzähligem Vieh. Diese wichtige Meldung eröffnete die Aussicht auf einen weiteren Kriegsschauplatz, für den deutscherseits keinerlei Truppen verfügbar waren, da die zur Zeit vorhandenen oder noch zu erwartenden dem östlich Okahandja stehenden Feind gegenüber gerade ausreichend erschienen. Diese neue Kriegslage wurde nach der Heimat telegraphiert und um weitere 1000 Mann Verstärkung gebeten, die auch sofort bewilligt wurden. Mit ihnen gedachte ich später einen besonderen Feldzug in dem Gebiet von Otjimbingwe zu unternehmen und hoffte, bis zu deren Eintreffen den dortigen Gegner durch fortgesetzte Beobachtung und scheinbare Angriffsbewegungen in seiner derzeitigen Stellung fesseln zu können, denn seine Vereinigung mit der östlich Okahandja stehenden Hauptmacht der Hereros lag nicht in unserem Interesse. Trotz aller Gegenmaßnahmen, gelang es jedoch den auf die Dauer sich anscheinend doch zu isoliert fühlenden Hereros von Oruware, in der Nacht vom 28. zum 29. März bei Teufelsbach die stark besetzte Bahnlinie zu überschreiten und sich mit den im oberen Swakoptal stehenden Hereros zu vereinigen; eine Tatsache, welche die Kriegslage für uns wesentlich ungünstiger gestaltet hat. Denn nun hatten wir in den nächsten Gefechten auch noch mit diesen Hereros zu rechnen, während die zu ihrer Bekämpfung bestimmten 1000 Mann nebst zwölf Geschützen vor vier Wochen nicht eintreffen konnten.
Als ich im Februar 1904 auf dem Herero-Kriegsschauplatze eingetroffen war, herrschte über die Stellung der Hauptmasse der Hereros vollständige Unklarheit. Man vermutete sie nur in den Onjati-Bergen. Gewißheit hierüber verschaffte ich mir auch dieses Mal wieder durch mein gewöhnliches Mittel, nämlich durch Übersendung eines Briefes an Samuel Maharero mit der Anfrage nach den Gründen seines Aufstandes. Daß ich nebenbei auch neugierig gewesen bin, diese Gründe kennen zu lernen, nachdem ich zehn Jahre lang seitens des Oberhäuptlings eine Unterstützung erfahren hatte, die nahezu an Verrat an seinem eigenen Volke grenzte, wird mir niemand verargen.[150] Nach einigen Tagen überbrachte Missionar Kuhlmann, der auf der Flucht von seiner Station das Hererolager passiert hatte, die Antwort.
Der Brief datiert vom 6. März und ist adressiert: »An den Großen Gesandten des Kaisers, Gouverneur Leutwein.« Er beginnt mit dem Satz: »Deinen Brief habe ich erhalten und habe ich gut verstanden, was Du mir und meinen Großleuten geschrieben hast.« Dann begannen lange Klagen über das Treiben der Händler in seinem Lande, sowie auch, daß sie ihm gesagt hätten, der Gouverneur, »der Euch liebt«, sei in einen schweren Krieg gezogen, sei tot, und weil er tot sei, müßten sie, die Hereros, auch sterben. Schließlich folgt noch die merkwürdige Behauptung, der Distriktschef von Okahandja hätte Anschläge auf sein, des Oberhäuptlings, Leben gemacht.[151] Was aber das Wichtigste war, das Missionar Kuhlmann zurückbrachte, war seine Nachricht, daß die Masse der Hereros, die bis jetzt in den Onjati-Bergen vermutet worden war, im oberen Swakoptal von Okatumba aufwärts bis Okaharui säße und der Oberhäuptling selbst bei Onganjira. Um diese Nachricht nachzuprüfen, wurde aus Windhuk eine Patrouille unter Oberleutnant Reiß[152] durch die Onjati-Berge vorgetrieben und durch sie festgestellt, daß diese Berge in der Tat vom Feinde völlig frei waren.
Inzwischen waren Ende März in Okahandja die Westabteilung, S. 501, sowie vom südlichen Kriegsschauplatze die 1. Feldkompagnie und die Gebirgsbatterie, desgleichen je 80 Witbooi- und Bastardreiter eingetroffen, erstere unter Leutnant Müller v. Berneck, letztere unter ihrem bisherigen Führer, dem kaum von seinen schweren Wunden wiederhergestellten Oberleutnant Böttlin. Ende März war daher die Hauptabteilung vollzählig, dagegen war es nicht gelungen, auch die Artillerie bereits bis zum 1. April marschfähig zu machen, da das Einfahren der Maulesel große Schwierigkeiten verursacht hatte. Infolgedessen wurde der Abmarsch der vereinigten Haupt- und Westabteilung bis zum 7. April verschoben.
Nach der oben erwähnten, Ende März erfolgten Vereinigung der Otjimbingwer Hereros mit der östlich Okahandja stehenden Hauptmasse ihrer Stammesgenossen würde es die Kriegslage eigentlich geboten haben, den Angriff auf den nunmehr in doch zu bedeutender Mehrzahl befindlichen Gegner bis zum Eintreffen der bereits bewilligten weiteren Verstärkungen zu vertagen. Eine solche Verzögerung würde jedoch den Feind moralisch zu sehr gestärkt haben. Hatte doch der bei Okatumba befehligende kriegslustige Häuptling Kajata infolge unseres bisherigen, von ihm falsch aufgefaßten[S. 513] Zögerns dem Missionar Kuhlmann die Frage vorgelegt: »Fechten denn Deine Landsleute nur hinter Häusern?« Bei weiterem Zuwarten stand daher auf gegnerischer Seite eine Zunahme der Unternehmungslust zu befürchten, die gefährlicher werden konnte als ein vorzeitiger Angriff. Aus dieser Erwägung heraus entschloß ich mich zum Vormarsch.
Nachdem am 7. April der Vormarsch von Okahandja aus angetreten war, standen am 8. April die Haupt- und Westabteilung in Otjosasu vereinigt. Auf dem Marsche dahin wurde der von Waterberg geflüchtete Missionar Eich angetroffen, der weitere wichtige Nachrichten aus dem Hererolager brachte. Auch er hatte bei Okatumba und Owiumbo große Massen von Hereros gesehen und konnte hinzufügen, daß ein Teil der Waterberg-Hereros unter Salatiel an ihrem Platze verblieben, Michael von Omaruru mit der Masse seiner Leute zu Samuel gestoßen sei.
Die Zusammensetzung der vereinigten Haupt- und Westabteilung war folgende:
1., 2., 4., 5. und 6. Feldkompagnie, Marinekompagnie Schering, 1 Maschinengewehrabteilung, 1., 2. und 3. Batterie Hauptmann v. Oertzen, Hauptmann v. Heydebreck, Oberleutnant Bauszus, Bastard-Abteilung, Witbooi-Abteilung.
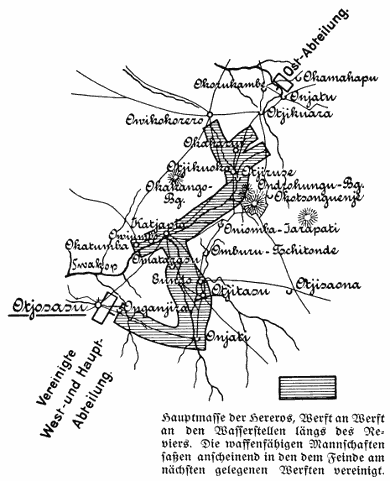
Im ganzen waren es etwa 800 Weiße, 12 Geschütze und 160 fechtende Eingeborene, mithin eine Macht, wie sie Südwestafrika auf deutscher Seite noch nicht vereinigt gesehen hatte, trotzdem aber noch zum gleichzeitigen Angriff auf den in zwei Gruppen stehenden Feind (Okatumba und[S. 514] Onganjira) zu schwach. (Vgl. die Skizze.) Bei dem Angriff auf die eine mußte man sich daher auf eine Beobachtung und Beschäftigung der andern beschränken.
Der erste Angriff mußte dem bei Onganjira stehenden Oberhäuptling gelten. Zur Beobachtung des anderen Herero-Flügels wie zur Deckung der Bagage blieben die Marinekompagnie und die Bastard-Abteilung in Otjosasu zurück, erstere als Rückhalt, letztere mit dem Befehl, gegen Okatumba zu demonstrieren, um den dortigen Gegner von einer Mitwirkung bei Onganjira möglichst abzuhalten. Wie ich vorausschicken will, hat die Bastard-Abteilung ihre Aufgabe insofern gelöst, als der bei Okatumba stehende Hereroführer Kajata sich anscheinend zunächst täuschen ließ. Erst spät nachmittags setzte er sich mit 300 Reitern, dahinter zahlreiches Fußvolk, gegen Onganjira in Bewegung, immer vor sich die Bastard-Abteilung, die Schritt für Schritt zurückwich, aber rechtzeitig Meldung vorausschickte. Letztere traf vor dem Sturm auf die feindliche Stellung ein und beschleunigte den Entschluß zu diesem.
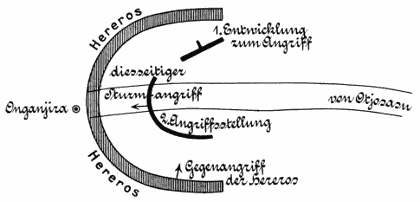
Die vereinigten Abteilungen traten ihren Vormarsch nach Onganjira am Morgen des 9. April an. Genaueres über die feindliche Aufstellung war nicht bekannt. Aus den eintreffenden Meldungen der an der Spitze befindlichen Witboois wie auch von seiten deutscher Reiter ging jedoch allmählich hervor, daß die Hereros sich auf den Onganjira umgebenden Höhen in einem Halbkreis festgesetzt hatten, an dessen innerem Ende sich die Wasserstelle befand.
Anscheinend lag die Absicht vor, der deutschen Truppe, falls sie direkt der Wasserstelle zustreben würde, eine Falle zu stellen. Diesen Gefallen taten wir jedoch den Hereros nicht; vielmehr wurde zunächst gegen den linken feindlichen Flügel eingeschwenkt und dieser lediglich mittels Artilleriefeuer in die Flucht gejagt. Den bereits angesetzten Infanterieangriff[S. 515] von vier Kompagnien wartete der Gegner nicht ab. Nun erst ging es gegen die Wasserstelle weiter. Die sich ihr vorsichtig nähernde Spitze unter Oberleutnant Reiß erhielt dort Feuer, worauf sich die Avantgarde, bestehend aus der 1. Kompagnie und der Gebirgsbatterie, zum Gefecht entwickelte. Im Galopp heransprengend, folgte dann links verlängernd die 2., die 6., die 4. und schließlich die 5. Kompagnie, die beiden letzteren gerade noch zurechtkommend, um einen Gegenangriff des rechten Flügels der Hereros abzuwehren. Diese hatten mit anerkennenswerter Tapferkeit ihre gut verschanzte Stellung verlassen und waren, begünstigt durch das dichte Gebüsch, bis auf 50 bis 100 m vorgestürmt. Ein Gegenangriff der 4. Feldkompagnie, die hierbei zwei Offiziere verlor (Oberleutnant v. Estorff, Leutnant d. Res. Freiherr v. Erffa), warf jedoch den Gegner zurück. Von der[S. 516] Artillerie stand die Batterie Bauszus auf dem rechten Flügel unserer Gefechtsstellung, die Batterie Heydebreck in der Front, die Batterie Oertzen auf dem linken Flügel, alle drei dicht hinter oder in der Infanterielinie. Die Batterie Oertzen hatte bei Abwehr des feindlichen Angriffs durch Kartätschen mitgewirkt. Auch auf die Batterie Bauszus hatte der Gegner einen Angriff versucht; doch hatten ihn wenige Schüsse wieder in seine Deckung zurückgejagt.

In allmählich vorschreitendem Feuergefecht wurde im Zentrum wie auf dem linken Flügel Gelände gewonnen und abends die Hauptstellung des Feindes auf einer die Wasserstelle beherrschenden Höhe von der Kompagnie Franke durch Sturmangriff genommen. Auch auf dem linken Flügel war die Bedeutung dieser Hauptstellung erkannt und die 5. Kompagnie gegen sie eingesetzt worden, die dann noch mit der 2. zusammenwirken konnte. Hierdurch war mit Anbruch der Dunkelheit der Sieg für uns entschieden.
Im Verhältnis zu seiner Bedeutung wie zu den feindlichen Verlusten hatte der Erfolg wenig Opfer gekostet. Nur vier Tote (2 Offiziere, 2 Reiter) haben wir den andern Tag begraben müssen. Zu ihnen trat nach wenigen Wochen noch der schwer verwundete Leutnant v. Rosenberg. Außerdem waren 7 Reiter schwer, 5 leicht verwundet, während eine Absuchung des Gefechtsfeldes am anderen Tag vom Feinde 80 Tote ergab. Erbeutet wurden etwa 350 Rinder und 10 Gewehre. Die Ursache unserer geringen Verluste lag in der Möglichkeit einer ausgiebigen Verwendung der Artillerie, eine Möglichkeit, wie sie in den späteren Gefechten — durchweg Buschkämpfe — nicht wieder in gleichem Maße eingetreten ist.
Der oben erwähnte, noch am Abend einsetzende Angriff Kajatas war dagegen nur noch matt, nachdem der feindliche Führer sich von der bereits eingetretenen Flucht seiner Landsleute überzeugt hatte. Er wurde daher durch unsern linken Flügel leicht abgewiesen. Eine am anderen Morgen vorgenommene Verfolgung ergab, daß der Feind die Gegend bis einschließlich Otjitasu geräumt hatte.
Eine weitere Verfolgung verbot die Rücksicht auf den noch bei Okatumba stehenden intakten rechten Flügel des Gegners. Erst mußte mit diesem abgerechnet werden, da andernfalls bei weiterem Vorrücken eine ernstliche Bedrohung der diesseitigen Verbindungslinie eintreten konnte. Auf einen Vernichtungsschlag gegen die Hereros war aber auch dort noch nicht zu rechnen, da hierzu die Truppe noch nicht stark genug war. Auch[S. 517] für Okatumba bestand daher bei mir lediglich die Absicht, dem anderen feindlichen Flügel die Gewalt der deutschen Waffen fühlbar zu machen und dann nach Umständen zu handeln.
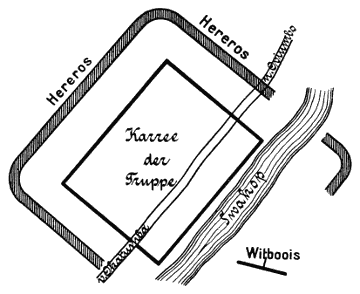
Da eine direkte Verbindung zwischen Onganjira und Okatumba nicht besteht, marschierten die vereinigten Abteilungen am 11. April nach Otjosasu zurück und setzten sich nach einem Ruhetag von da am 13. in Vormarsch nach Okatumba. Bald ergab sich, daß dieser Platz geräumt war. Infolgedessen wurde der Marsch nach Oviumbo fortgesetzt und um 11 Uhr in der Nähe des letztgenannten Ortes zum Abkochen und zum Tränken Halt gemacht. Vom Feinde waren nur verlassene Werften gefunden worden, das ringsum außerordentlich dichte Gebüsch gestattete auch keinerlei Überblick. Die auf dem südlichen Ufer patrouillierenden Witboois meldeten dieses gleichfalls vom Feinde frei. Wegen des dichten Gebüsches waren die Wagenstaffeln unter Bedeckung von einer halben Marinekompagnie vorläufig in Otjosasu zurückgelassen worden, davon die erste unter steter Marschbereitschaft.
Mitten im Tränken erfolgte jedoch seitens der Hereros ein plötzlicher Angriff. Während die Pferde im Trabe zurückgeführt wurden, stürmte der an der Spitze befindliche Oberleutnant Reiß mit 17 Reitern gegen den Feind vor und fiel hier, allzu kühn vorgehend, mit sieben seiner Begleiter. Der Rest zog sich feuernd auf das Gros zurück, das sich mittlerweile gleichfalls zum Gefecht entwickelt hatte. Nunmehr lernten wir eine Gefechtsart kennen, wie sie mir während meines langjährigen Aufenthaltes in Südwestafrika bis jetzt fremd geblieben war, nämlich den Kampf im dichten Busch mit einem unsichtbaren Gegner. Von dem bald von allen Seiten anstürmenden Feinde sah man nichts, man hörte ihn bloß. Nur einige auf Bäumen eingenistete Hereros waren sichtbar, dafür aber auch um so lästiger. Was aber das[S. 518] Ungünstigste war, die Artillerie hatte in dem dichten Gebüsch keinerlei Wirkung. Schußfeld war allein an der rechten Flanke vorhanden, die sich an den 200 m breiten Swakop anlehnte. Rasch formierte sich die Truppe gegen den von allen Seiten stürmenden Feind zu einem Karree, zu dem auch die auf das südliche Ufer übergegangene Avantgarde, der größeren Geschlossenheit halber sowie um gegenseitiges Beschießen zu vermeiden, herangezogen wurde.
Nur die Witboois blieben zur weiteren Beobachtung auf dem Südufer. Auch die Bastards, die mit Deckung der linken Flanke beauftragt waren, hatten sich nachmittags an das Karree herangezogen. Sie waren auf eine auf das Gefechtsfeld eilende, berittene Herero-Abteilung von mehreren hundert Köpfen gestoßen und in dem dichten Gebüsch vollständig überrannt worden. Der Führer, Oberleutnant Böttlin, mußte sogar sein Pferd mittels eines Revolverschusses von einem Herero, der es gefaßt hatte, befreien. Die Reste der Abteilung — noch etwa die Hälfte — zog sich auf das Karree zurück, verfehlte dieses jedoch in dem Gebüsch auf etwa 200 m und geriet gleichfalls auf das südliche Swakopufer. Hier wurde sie durch eine mit der Beobachtung rückwärts beauftragte Patrouille unter dem Sergeanten Cordes (vom Stabe) entdeckt und von diesem zum Karree herangeführt. Die Meldung von dem Anrücken weiterer feindlicher Kräfte in unserer linken Flanke — Oberleutnant Böttlin schätzte sie auf 800 Reiter — traf mit ihr gerade noch rechtzeitig ein. Das Merkwürdigste aber war, daß die zersprengte andere Hälfte der Bastard-Abteilung sich im Laufe der nächsten 24 Stunden ohne jeden Verlust wieder bei der Truppe einfand; wieder ein Beweis für die überlegene Findigkeit eingeborener Soldaten.
Während eines zehnstündigen Feuergefechtes wurden im Karree mehrere hundert Schritt Gelände nach vorwärts gewonnen, stets unter dem Feuer des unsichtbaren Gegners. Ein Sturmangriff auf diesen, der wohl erwogen worden war, würde, gleichviel mit welcher Karreeseite unternommen, in dem dichten Gebüsch, weil von allen Seiten umfaßt, die beiden Flügel der Sturmkolonne gekostet haben. Es fragte sich daher, ob der dadurch zu erreichende Zweck das Leben so vieler deutscher Soldaten wert wäre. Diese Frage habe ich verneint, da ein Vernichtungsschlag keinesfalls zu erreichen war. Zu einem solchen bedurfte es noch der bereits auf der Fahrt begriffenen Verstärkungen.
Es blieb daher nur die Frage, ob ein Sturmangriff nicht aus moralischen Rücksichten zu unternehmen, und ob die zu erwartenden Ver[S. 519]luste nicht durch solche aufgewogen werden würden. Diese Frage habe ich damals gleichfalls verneint. Denn der moralische Erfolg war bereits auf unserer Seite. Die Truppe hatte bei eigenen geringen Verlusten (2 Offiziere tot, 1 schwer verwundet, 7 Reiter tot, 14 verwundet) in unerschütterter Haltung sämtliche Sturmangriffe des Feindes abgewiesen. Wie die Folge ergab, fühlten sich die Hereros nach dem Gefecht bei Oviumbo auch derart moralisch erschüttert, daß sie unmittelbar darauf ihren Rückzug nach Waterberg begannen. Es war sogar für unsere Zwecke nützlicher, wenn wir dem Gegner Raum für ein abermaliges Festsetzen und damit uns die nochmalige Gelegenheit zu einem tatsächlichen Vernichtungsschlag ließen.
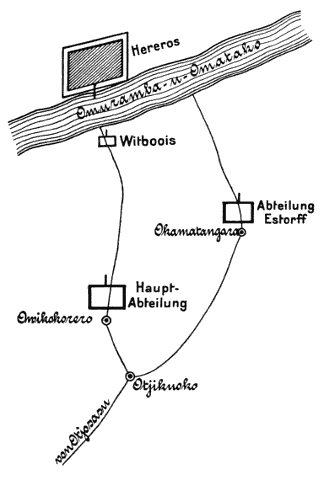
Ein Stehenbleiben in der genommenen Stellung verbot dagegen der Mangel an Munition (die Infanterie hatte sich zu drei Vierteln, die Artillerie fast ganz verschossen) und die Unmöglichkeit, zu deren Ergänzung in dem dichten Busch die erste Wagenstaffel heranzuziehen. Wenige seitwärts des Weges aufgestellte Hereros hätten mittels Abschießens der vordersten Ochsen jede Wagenkolonne bewegungsunfähig machen können, da das dichte Gebüsch ein Ausbiegen zur Seite verbot. Ein solches Abschießen aber war zu erwarten, da der Gegner auch auf den rückwärtigen Verbindungen herumschwärmte. Infolge dieser Erwägung entschied ich mich für den Abmarsch zur Wiedervereinigung mit der in Otjosasu stehenden Staffel sowie zum erneuten Vorgehen erst nach Einrangierung der erwarteten Verstärkung. Nach Einbruch der Dunkelheit wurde daher im Karree abmarschiert, in Okatumba von nachts 10 bis 1 Uhr gerastet und von da der Rückzug in der Marsch[S. 520]kolonne fortgesetzt. Der Feind störte diesen in keiner Weise. Morgens 3 Uhr wurde Otjosasu erreicht. Hier übergab ich drei Tage später das Kommando dem Major v. Estorff mit dem Befehl, den Feind im Auge zu behalten und sich bei jeder seiner Bewegungen an seine Fersen zu heften. Ich persönlich begab mich mit dem Stab zur Empfangnahme der nach und nach eintreffenden weiteren Verstärkungen nach Okahandja zurück.
Das Ergebnis des Gefechts von Oviumbo ist anfänglich in der Heimat ungünstiger angesehen worden, als es verdiente. Es wurde daher die Entsendung von noch mehr Verstärkungen sofort in Erwägung gezogen. Nach erhaltener Kenntnis von dem Ausfall der Ostabteilung[153] habe ich auch einer solchen um weitere 1500 Köpfe zugestimmt, wovon 500 Mann und vier Geschütze zur Beruhigung des aufgeregten Südens in Lüderitzbucht landen sollten. Diese Verstärkungen waren indes vor dem Juni nicht zu erwarten. Dagegen traf vorher schon ein neuer Generalstabsoffizier, Major Quade, ein, an dessen Unterstützung ich mit ganz besonderem Danke mich zu erinnern Veranlassung habe.
Aus den zunächst anlangenden 1000 Mann wurden in der Folge eine 4., 5. und 6. Batterie sowie eine 7., 8., 9., 10., 11. und 12. Feldkompagnie, ferner eine weitere Maschinengewehr-Abteilung (Dürr) gebildet. Die neuen Truppenteile in Verbindung mit einigen aus der bisherigen Hauptabteilung abgezweigten bildeten eine neue Hauptabteilung, während die Reste der bisherigen West- und Hauptabteilung unter dem Major v. Estorff die Rolle der bisherigen Ostabteilung übernahmen. Diese neue Ostabteilung (Estorff) folgte von Ende April ab langsam den ihre Stellung am oberen Swakop nach und nach räumenden Hereros und bestand mit ihnen noch mehrere glücklich verlaufene Verfolgungsgefechte. Die neue Hauptabteilung trat dagegen in der Stärke von 4 Kompagnien,[154] 3 Batterien, 4 Maschinengewehren, 1 Funkentelegraphen-Abteilung und den Witbooireitern ihren erneuten Vormarsch am 5. Juni über Otjosasu-Okatumba an und erreichte am 13. Owikokorero, wo sie auf höheren Befehl vorläufig Halt machte. Selbst in Verbindung mit der annähernd ebenso starken Abteilung Estorff erschien sie zu einem Vernichtungsschlage für die Hereros immer noch nicht ausreichend. Zusammen waren beide Abteilungen rund 1400 Gewehre und 24 Geschütze stark. Ein Angriff auf die Hereros erschien daher nur gerechtfertigt, wenn Gefahr im Verzuge war. Das war jedoch nicht der Fall, da die inzwischen[S. 521] in Waterberg angelangte Masse der Hereros sich dort festgesetzt hatte und anscheinend keinerlei Neigung zum freiwilligen Verlassen des dortigen wasser- und weidereichen Geländes zeigte; es erschien daher richtiger, zunächst die bereits beschlossene weitere Verstärkung abzuwarten. Dies ist auch geschehen; wie wir aber jetzt wissen, ist es in der Folge auch bei dieser Truppensendung nicht geblieben, sondern es mußten fortgesetzt neue Verstärkungen nachgeschickt werden, und zwar bis in die neueste Zeit, so daß die Kopfzahl der gegenwärtig in Südwestafrika stehenden Truppen rund 14000 Köpfe beträgt.
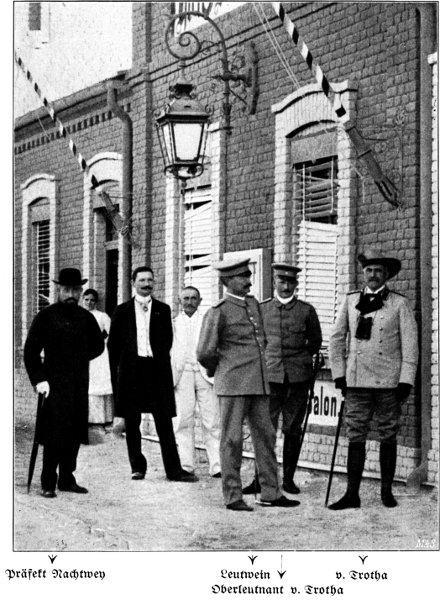
[S. 522] Meine letzte Befehlshandlung war die Entsendung der Witbooireiter unter Leutnant Müller v. Berneck zur Erkundung der neuen Stellung des Feindes bei Waterberg. Sie bestätigten nach einem erfolgreichen Ritte, auf dem sie ohne eigene Verluste zahlreiche Hereros erschossen, daß die Masse des Gegners in Hamakari südlich Waterberg stehe und anscheinend nicht an den Abmarsch denke. — Ich habe gesagt meine letzte Befehlshandlung. Denn inzwischen war
eingetreten. Mittels Telegramm des Herrn Reichskanzlers vom 4. Mai war ich in Kenntnis gesetzt worden, daß im Hinblick auf die beschlossenen weiteren Verstärkungen Seine Majestät der Kaiser zum Führer der in Südwestafrika sich sammelnden Truppenabteilungen den Generalleutnant v. Trotha in Aussicht zu nehmen geruht habe. Ich solle bis zu dessen Ankunft das Kommando weiterführen und dann lediglich die Geschäfte des Gouverneurs beibehalten. So schmerzlich es mir als Soldat auch erklärlicherweise sein mußte, mitten im Kriege meine Truppe verlassen zu müssen, so hatte ich anderseits doch alle Veranlassung, in dem Kommandowechsel eine gewisse Erleichterung zu finden.
Niemand kann aus seiner Haut, namentlich wenn er der ehrlichen Überzeugung ist, daß er sich mit »seiner Haut« auf dem richtigen Wege befindet. Auf Grund meiner Erfahrungen hatte ich die unumstößliche Gewißheit gewonnen, daß man in dem unwegsamen, weiten Südwestafrika Eingeborene nur mit Hilfe von Eingeborenen besiegen könne, sowie daß man aufständischen Eingeborenen nach genügender Bestrafung wieder rechtzeitig die Hand bieten müsse, wolle man nicht die Gefahr einer Verlängerung des Krieges bis ins Unendliche heraufbeschwören.
Aber dieses System war damals bei der durch die Untaten der Hereros aufgerüttelten öffentlichen Meinung in der Heimat verpönt. Mithin konnte es mir nur erwünscht sein, wenn es nun ein anderer mit einem anderen System versuchte. Entweder mußte er von selbst wieder zu dem meinigen zurückkehren oder Folgen mit in Kauf nehmen, die es schließlich doch als das richtigere erscheinen ließen. Das letztere ist eingetreten. Falsch aber wäre es, hierwegen gegen irgend jemand einen Vorwurf zu erheben. Für einen Neuling war es unmöglich, anderer Ansicht zu sein als die ganze Heimat. Dazu gehören eigene Erfahrungen, und diese stehen dem Ankömmling nicht zur Seite. Dagegen konnte als Gouverneur mein Nachfolger v. Lindequist unter dem Drucke unserer inzwischen gemachten Erfahrungen zu dem alten System zurückkehren und bald nach seiner Ankunft im Schutzgebiet folgenden Aufruf an die Hereros erlassen:
Windhuk, den 1. Dezember 1905.
»Hereros! Seine Majestät der Kaiser von Deutschland, der hohe Schutzherr dieses Landes, hat die Gnade gehabt, mich zum Nachfolger des Gouverneurs Leutwein zu ernennen und als Gouverneur über dieses Land zu setzen, nachdem General v. Trotha vor einigen Tagen nach Deutschland zurückgekehrt ist, der die deutschen Truppen gegen Euch geführt hat. Seine Abreise bedeutet, daß der Krieg jetzt aufhören soll.
Hereros, Ihr kennt mich! Fünf Jahre bin ich früher in diesem Lande gewesen als Kaiserlicher Richter und als Stellvertreter des Gouverneurs Leutwein — als Assessor und als Regierungsrat — zur Zeit, da Manasse von Omaruru und Kambazembi von Waterberg noch lebten, die mir stets treu gesinnt untergeben waren. Es ist jetzt mein Wunsch, daß der Aufstand, den Eure Häuptlinge und Großleute und die Kinder, die ihnen gefolgt sind, frevelhafterweise begonnen haben und der das Land verwüstet hat, nunmehr sein Ende erreicht, auf daß wieder Ruhe und Ordnung herrscht. Ich rufe daher alle Hereros, die sich jetzt noch im Felde und in den Bergen herumtreiben und sich von ärmlicher Feldkost und Diebstählen ernähren: Kommt und legt die Waffen nieder. Hereros! Tausende Eurer Stammesgenossen haben sich bereits ergeben und werden von der Regierung ernährt und gekleidet. Es ist jede Vorsorge von mir getroffen, daß sie gerecht behandelt werden. Dasselbe sichere ich auch Euch zu.
Es ist ferner angeordnet worden, daß vom 20. Dezember ab, also drei Wochen nach dem heutigen Tage, im Damaralande keine Hererowerften aufgesucht und aufgehoben werden sollen, da ich Euch Zeit geben will, selbst in Frieden zu mir zu kommen und Euch zu unterwerfen. Kommt nach Omburo und Otjihaenena! Dort werden Eure Missionare von mir hingeschickt werden. Sie werden auch Proviant mitnehmen, damit Ihr Euren ersten und großen Hunger stillen könnt. Es soll Euch auch etwas Kleinvieh für die Unterhaltung Eurer Weiber und Kinder zur vorläufigen Benutzung gelassen werden, sofern Ihr noch solches habt. Diejenigen, die kräftig sind und arbeiten können, sollen, wenn sie besonders tüchtig arbeiten, eine kleine Belohnung erhalten. Es werden in Omburo und Otjihaenena keine weißen Soldaten stationiert werden, damit Ihr nicht Angst habt und denkt, es soll noch weiter geschossen werden. Je schneller Ihr kommt und die Waffen niederlegt, desto eher kann daran gedacht werden, Euren Stammesgenossen, die jetzt gefangen sind, Erleichterungen in ihrer jetzigen Lage zu gewähren und ihnen später die Freiheit wiederzugeben. Wem von Euch Omburo oder Otjihaenena[S. 524] zu weit ist, der kann seine Waffen auch bei irgend einer Militärstation abgeben und sich dort stellen. Auch die Soldaten, die auf diesen Stationen sind, werden nicht schießen. Ebenso sind die Soldaten, die Wagentransporte begleiten und deshalb im Lande herumziehen, angewiesen, nicht auf Euch zu schießen, solange Ihr nichts Feindliches gegen sie unternehmt. Fürchtet Euch also nicht, wenn Ihr sie seht.
So kommt denn schnell, Hereros, ehe es zu spät ist.
Auch im Namalande wird es bald wieder ruhig sein, denn Hendrik Witbooi ist durch eine deutsche Kugel getötet worden, und sein Unterkapitän Samuel Isaak hat sich ergeben und ist in unseren Händen.«

Mit diesem Abschwenken in andere Bahnen kann jeder Einsichtige lediglich einverstanden sein, nur hätte es nach meiner Ansicht bereits ein Jahr früher — nach dem Gefecht von Waterberg — geschehen sollen. Auch der Matabeleaufstand 1896 hat nur dadurch beendet werden können, daß Cecil Rhodes sich in das Lager der Aufständischen begab und sie mittels Unterhandlungen zur Ergebung bewog. Jener Aufstand hatte ebenso wie der unsere, mit der Ermordung zahlreicher wehrloser Weißer begonnen. Sicher aber hat Cecil Rhodes damals so wenig aus Liebe zu den Eingeborenen so gehandelt, wie ich dies je getan habe, der ich gleichfalls behufs Wiederherstellung des Friedens zuweilen im feindlichen Lager gewesen bin, sondern aus kluger Überlegung und getragen von dem Bestreben der Schonung des Nationalvermögens des eigenen Volkes und des Lebens der eigenen Soldaten.
Im Staatsleben muß man sich bei allen seinen Handlungen die Frage vorlegen, ob der zu erhoffende Erfolg den zu bringenden Einsatz lohnt. Gelingt es uns, die politische Machtstellung aufständischer Eingeborenenstämme zu zerstören und so der Wiederkehr derartiger Ereignisse vor[S. 525]zubeugen sowie die Schuldigen gebührend zu bestrafen, so ist dies ein Erfolg, der immer den Einsatz lohnt. Er ist auch stets mit verhältnismäßig wenig Opfern zu erreichen, wenn man den Aufständischen rechtzeitig wieder die Hand bietet. Und das kann man, da bei allen Aufständen die große Masse nur aus Verführten und Mitläufern besteht. Eine Vernichtungspolitik beraubt uns dagegen nicht nur eines wichtigen Faktors im wirtschaftlichen Leben der Kolonien, nämlich der eingeborenen Arbeitskräfte, sondern sie führt auch unvermeidbar zum Guerillakrieg, und für einen solchen gibt es auf der ganzen Welt vielleicht keinen günstigeren Boden als unser Südwestafrika. Ich fürchte daher, wir haben trotz aller unserer Opfer auch jetzt noch nicht alle bitteren Erfahrungen daselbst ausgekostet.[155]


Infolge einer Anregung aus der Mitte des Reichstages wurde ich im Jahre 1895 zu einem Bericht über den militärischen Wert der Eingeborenen für unseren Dienst aufgefordert. Dies gab mir Veranlassung, mittels eines Rundschreibens die Distriktschefs zu einer Äußerung darüber aufzufordern. Die Berichte liefen vor Ausbruch des Feldzuges 1896 ein und blieben während desselben liegen. Sie boten daher nach dem Feldzug ein um so interessanteres Studium, als während des letzteren Eingeborene aller Stämme als Bundesgenossen auf unserer Seite gefochten hatten. Unter dem 26. Juli 1896 ging daher nachstehendes zusammenstellende Rundschreiben an die Distriktschefs, das ich auszüglich, soweit es für den vorliegenden Abschnitt in Betracht kommt, wiedergebe:[156]
In bezug auf die einzelnen Völkerschaften des Schutzgebietes sind seitens der Herren Distriktschefs nachstehende Ansichten aufgestellt worden:
1. Bastards.
Zwei Distriktschefs, die zum Sammeln bezüglicher Erfahrungen besonders Gelegenheit hatten, haben diesen Stamm als durchaus einstellungsfähig bezeichnet und aus ihm nach geschehener Ausbildung ein gutes Soldatenmaterial in Aussicht gestellt. Der verflossene Feldzug hat dieser Ansicht völlig recht gegeben. Die in die Truppe eingestellten und eingekleideten[S. 527] Bastards haben sich in jeder Hinsicht bewährt, und ist ein Unterschied zwischen ihnen und unseren Soldaten schließlich wenig mehr hervorgetreten.
2. Hottentotten.
Ein Distriktschef bezeichnet diesen Stamm als in der Zukunft möglicherweise einstellungsfähig, ein Distriktschef will nach schwierigen Anfängen und nachdem es gelungen war, das Vertrauen der Leute zu gewinnen, jetzt schon gute Erfahrungen gemacht haben, ein Distriktschef will von deren Einstellung als Soldaten ganz absehen und sie lediglich als irreguläre Kavallerie verwendet wissen. Gerade in Beziehung auf Hottentotten hat der letzte Feldzug besonders reiche Erfahrungen gebracht, und möchte es sich empfehlen, zunächst diese ins Auge zu fassen.
a) Die Witboois haben sich, wo sie unter dem direkten Befehl ihres Kapitäns standen, als diszipliniert und im Patrouillendienst wie im Gefecht als brauchbar erwiesen. Wo sie jedoch dem bezeichneten mächtigen Einflusse einige Zeit entzogen waren, ist die Unzuverlässigkeit aller Hottentotten auch bei ihnen zum Durchbruch gekommen. Der Kapitän hat sich infolgedessen schließlich veranlaßt gesehen, nach dem Feldzuge gegen seine ursprüngliche Absicht nochmals nach dem Osten zu gehen und seine beim Eintreiben der Kriegsentschädigung mitbeschäftigten Leute persönlich zu beaufsichtigen.
b) Simon Cooper-Leute trafen erst am Schlusse des Feldzuges ein und sind daher nicht mit im Gefecht gewesen. Sie haben indessen einen guten Eindruck gemacht und sich auch gut gehalten, jedenfalls weit besser, als zu erwarten stand. Ich schreibe solches mit dem Beispiel Witboois zu, welch' letzterer anscheinend auf Simon Cooper einen bedeutenden Einfluß ausübt.
c) Hottentotten der roten Nation aus Hoachanas. Es handelt sich bei diesen vorliegend um eine kleine Abteilung von zwölf Mann, die geschlossen in eine Kompagnie eingestellt war. Dieselben haben sich bemüht, unseren militärischen Anforderungen gerecht zu werden und sich auch im Gefecht über alles Erwarten gut gehalten. Diese Erscheinung dürfte vor allem als Verdienst des Unteroffiziers Pewersdorf, unter dessen Führung die Hottentotten gestellt waren, aufzufassen sein. Derselbe hatte als Stationschef von Hoachanas es seinerzeit verstanden, sich das Vertrauen der Leute zu erwerben.
d) Außer den drei vorgenannten geschlossenen Stämmen waren noch einzelne schon längst im Truppendienst sich befindende Hottentotten als Soldaten eingestellt. Von diesen haben sich zwei so gut gehalten, daß sie zur[S. 528] Auszeichnung in Vorschlag gebracht werden konnten, während die übrigen weder im guten noch im schlechten aufgefallen sind, ihnen daher mindestens das Zeugnis »zur Zufriedenheit« gegeben werden kann.
3. Hereros.
Dieser Volksstamm erfährt seitens der sämtlichen vier in Betracht kommenden Distriktschefs eine durchaus abfällige Beurteilung. Zwei erklären deren Einstellung wenigstens als eingeborene Soldaten für möglich, die beiden anderen wollen überhaupt nichts von ihnen wissen. Einer der letzteren bezweifelt, daß die Hereros je auf Stammesgenossen schießen werden,[157] beide erkennen zwar die deutschfreundliche Gesinnung des Oberhäuptlings an, erklären ihn jedoch durch seine Machtlosigkeit hierzu gezwungen und daher für uns von wenig Nutzen. Die Erfahrungen des letzten Feldzuges haben jedoch ergeben, daß die Macht der Legitimität auch bei den Eingeborenen ihre Wirkung ausübt, und daß daher die Person des Oberhäuptlings für uns von größerem Nutzen gewesen ist, als angenommen worden war. Es hat sich ferner ergeben, daß die Hereros, wenn richtig angefaßt, auch für eine fremde Sache auf ihre Stammesgenossen schießen. Letzteres ist um so anerkennenswerter, als die verwandtschaftlichen Verhältnisse der Hereros weit verzweigt sind und das Volk selbst ein hohes Gefühl für verwandtschaftliche Pflichten besitzt. Nach dem entscheidenden Gefecht bei Otjunda-Sturmfeld fand z. B. ein Herero, der auf unserer Seite gefochten hatte, in der feindlichen Werft die Leiche seines Bruders. Da auch sonst bei Feststellung der Toten zutage getreten war, daß Verwandte gegen Verwandte gefochten hatten, war unmittelbar nach dem Gefechte bei den diesseitigen Hereros eine auffällig trübe Stimmung zum Durchbruch gekommen, die jedoch auf gütliches Zureden nach ein bis zwei Tagen wieder verschwunden ist. Im übrigen waren die Leistungen der Hereros im Kriege in bezug auf Auffinden von Wegen, Wasser- und Weideplätzen sowie bei Erkundung des Feindes einfach unschätzbar. Es kam ja wohl vor, daß das Stammesgefühl durchbrechen und die ausgeschickten Kundschafter sich unwissend stellen wollten, doch verschwand eine solche Anwandlung auf freundliche Zusprache stets wieder.
Vor allem aber finden sich auch bei ihnen besonders zuverlässige Elemente, die, richtig verwendet und behandelt, die anderen mit fortreißen. Ich stehe nicht an, zu behaupten, daß im letzten Kriege von allen Ein[S. 529]geborenen die Hereros uns die besten Dienste geleistet haben. Sie besaßen, was uns selbst sowie unseren übrigen eingeborenen Bundesgenossen gänzlich abging, nämlich Kenntnis von Land und Leuten, Dinge, die sich während des Krieges selbst nicht mehr erwerben lassen. Ohne die Teilnahme der Hereros auf unserer Seite würde der Krieg nicht seinen außergewöhnlich glücklichen Verlauf genommen haben. Aus dieser Erfahrung mögen die im Hererolande befindlichen Offiziere und Beamten ihre Nutzanwendung ziehen. Auch die Hereros lohnen die Mühe des Versuchs, aus ihnen den vorhandenen guten Kern zur Unterstützung unserer kolonialen Sache heranzuziehen. Auch im Gefecht haben die Hereros sich nicht von der ihnen allseitig nachgesagten Feigheit gezeigt. In dieser Richtung finden gleichfalls sich einzelne unter ihnen, die mit gutem Beispiel den anderen vorangehen, so z. B. Kajata und Daniel Kaviseri. Geradezu besonders tapfer haben sich die feindlichen Hereros gezeigt, die bei Otjunda-Sturmfeld ihre Werften verteidigten. Drei Söhne des Werftbesitzers Kahikaeta, mit unseren Gewehren bewaffnet (bei Gobabis erbeutet), hielten z. B., unter einem Wagen liegend, hartnäckig stand und verteidigten sich bis zuletzt so erfolgreich, daß ihre geringe Anzahl erst nach geschehener Einnahme der Werft erkannt wurde. Man fand sie alle drei durch Granaten getötet. Auch die übrigen in diesen Werften befindlichen Hereros haben sich tapfer gehalten und erst nach schweren Verlusten den Platz geräumt. Wenn die auf unserer Seite kämpfenden Hereros sich etwas lauer gezeigt haben, so liegt dies in der Natur der Sache.
Ein Volk, das derartige Erscheinungen zeitigt, darf man nicht ohne weiteres in seiner Allgemeinheit als feige bezeichnen. Man würde sich damit der Unterschätzung eines etwaigen Gegners schuldig machen, die sich auch einmal rächen könnte.
4. Bergdamaras und Buschleute.
Die beiden Distriktschefs, die in Beziehung auf diese Stämme haben Erfahrung machen können, halten einen Versuch nicht für aussichtslos. Hinsichtlich der Bergdamaras müssen wir die geschlossenen und freien Stämme von den einzelnen Individuen unterscheiden, welche als eine Art Haussklaven bei Weißen, Bastards, Hereros und Hottentotten bedienstet sind. Die ersteren sind gewiß mehr wert, und z. B. die in Okombahe und Umgebung wohnenden bei ihrem Haß gegen die Hereros, wie auch der dortige Distriktschef vorschlägt, wohl verwendbar. Allen Bergdamaras[S. 530] gemeinsam scheint ein gewisser Fatalismus angesichts des einmal nicht mehr zu vermeidenden Todes innezuwohnen, immerhin kein Zeichen von Feigheit. Aber gerade diese Menschen müssen stets die Macht sehen. Der in Gobabis ansässig gewesene Bergdamarastamm ist z. B. bei Kriegsausbruch trotz des Hasses gegen die Hereros zu diesen übergegangen, weil seine Angehörigen die Machtverhältnisse lediglich nach Zahlen abschätzten und infolgedessen zu den Hereros glaubten mehr Vertrauen haben zu sollen. Doch auch ein Beispiel von Treue haben die Bergdamara gegeben, und zwar diejenigen der Station Olifantskluft, die, zehn an der Zahl, nach Räumung der Station die überschüssigen Waffen und Munition durch feindliches Land hindurch nach Gobabis getragen haben. Wie ich mich selbst überzeugt habe, war vor allem Vertrauen zu dem Stationsunteroffizier Ficke die Triebfeder ihres braven Verhaltens. Die Buschmänner ziehen ihre schrankenlose Freiheit bis jetzt dem angenehmsten Dienst vor. Ab und zu sind sie im Distrikt Gobabis als Wegeführer verwendet worden und haben sich als solche gut bewährt. —
An der Hand der vorstehenden Schilderungen ersuche ich die Herren Distriktschefs, in ihren Bestrebungen, Eingeborene für unsere Dienste zu gewinnen, nicht zu erlahmen. Eine lediglich aus deutschen Soldaten, wenn auch den besten Elementen zusammengesetzte Truppe hat für hiesige Verhältnisse gerade so gut ihre Schattenseiten, wie eine nur aus Eingeborenen bestehende. Das günstigste Ergebnis liefert die Mischung von beiden. Unter den 500 Reitern, aus denen am Schlusse des letzten Feldzuges die Truppe bestand, befanden sich kaum 180 Weiße. Und doch war der Erfolg völlig zufriedenstellend. Auf Grund solcher Erfahrungen müssen wir unsere Bemühungen, die Eingeborenen an unser Interesse zu fesseln, soviel in unseren Kräften steht, fortsetzen, dabei aber bedenken, daß dieselben ein sachliches Interesse nicht kennen, sondern lediglich ein persönliches. Nur das Vertrauen zur Person wird bei ihnen auch das Interesse zur Sache erwachsen lassen. Des Beispiels der Hottentotten von Hoachanas habe ich schon gedacht. Ganz dasselbe trat auch bei den Witboois und Simon Cooper-Leuten zutage.
Auch diese wollten lediglich mit ihren betreffenden Stationsmannschaften zu tun haben, während sie sich gegen die übrigen Angehörigen der Schutztruppe durchaus ablehnend verhielten. Besonders angenehm fiel mir das gute Verhältnis der Simon Cooper-Leute zu dem Stationschef von[S. 531] Gochas, Unteroffizier Stubenrauch, auf. Bei den Hereros waren ähnliche Erscheinungen in bezug auf die zum Teil auch mit in das Feld gerückte Stationsmannschaft von Okahandja nicht zu bemerken.
Ferner möchte ich den Hinweis nicht unterlassen, daß wir über die militärischen Eigenschaften der Eingeborenen auch nicht vorschnell urteilen dürfen. Bei ihnen kämpft jeder ohne militärische Disziplin und Ausbildung für sich, während er Belohnung für gutes Verhalten und Strafe für Feigheit nicht kennt. Wer zuerst wegläuft, hat die meisten Chancen, Leben und Gesundheit zu retten, irgendwelchen Nachteil aber aus diesem Akt des Selbsterhaltungstriebes nicht zu befürchten. Unter solchen Bedingungen würden, wie die Erfahrung bereits reichlich gelehrt hat, weiße Truppen — ich möchte fast sagen — noch weniger leisten. Das beste Beispiel bilden die Bastards, die derjenige, der sie in den Witbooikriegen[158] gesehen hat, nicht wiedererkennt. Und diese Veränderung hat eine Ausbildung von nur sechs Wochen fertig gebracht.
Schließlich gebe ich dem Wunsche Ausdruck, daß das Schutzgebiet nie in die Lage kommen möge, Aufstände von Eingeborenen ohne die Mithilfe von solchen bekämpfen zu müssen. Das alte Vaterland würde so viel Soldaten schicken können, als im Schutzgebiete überhaupt nur zu ernähren sind, wir würden gewiß stets siegen, aber in dem weiten und zum Teil noch unbekannten Lande den Gegner nicht besiegen. Daß eine solche Möglichkeit nicht eintritt, dafür zu sorgen ist daher nicht nur unser aller Pflicht, sondern es gebietet solches schon der einfachste Selbsterhaltungstrieb. Ich ersuche sämtliche Herren Offiziere der Schutztruppe, auch in dieser Richtung auf ihre Untergebenen einzuwirken und ihnen namentlich immer wieder klarzumachen, daß wir die Eingeborenen notwendig brauchen, ja ohne sie hier zunächst gar nicht bestehen können, und daß es den höchsten Grad von Kurzsichtigkeit bedeuten würde, wenn wir sie insgesamt zu Haß und Feindschaft gegen uns erziehen wollten.
In vorstehendem ist der kriegerische Wert der Eingeborenen mehr von dem Standpunkte einer Bundesgenossenschaft seitens derselben abgewogen.
Als Feinde dagegen sind die Hottentotten entschieden die gefährlichsten. Sie sind gute Reiter, gewandte Schützen, ausnehmend bedürfnislos, mithin ein geborenes Soldatenmaterial. Würde es gelingen, ihnen noch die Disziplin[S. 532] und Zuverlässigkeit des deutschen Soldaten beizubringen, so würden sie in den afrikanischen Verhältnissen dem letzteren weit überlegen sein. Die Hereros sind weniger gewandte Krieger. Sie entbehren die Reit- und Schießfertigkeit der Hottentotten sowie deren Gewandtheit in der Benutzung des Geländes. Dagegen sind sie tapfer und daher für den deutschen Soldaten ein dankbareres Angriffsobjekt, bei ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit aber auch ein nicht minder gefährliches. Jedenfalls aber sind, wie der letzte Aufstand gelehrt hat, die Hereros bisher durchweg unterschätzt worden. Die Bastards werden wohl nie als Gegner gegen uns auftreten, für ihre Beurteilung genügt daher das in dem obigen Rundschreiben von 1896 Gesagte. Über den kriegerischen Wert der Ovambos endlich liegt uns als Material nur das Gefecht von Amutoni vor. In diesem sind sie mit ebenso großer Todesverachtung wie blinder Torheit vorgestürmt. Sie haben daher selbst schwere Verluste erlitten, ohne den Unsrigen irgendwelche beizubringen. Wenn sie stets in derselben Weise verfahren, so werden wir sie nicht zu fürchten brauchen. Indessen müssen uns doch die bei den Hereros gemachten Erfahrungen vor einem vorschnellen Urteil über den kriegerischen Wert der Ovambostämme bewahren.
In den Kolonien handelt es sich nicht um die Kriegführung mit einem Gegner im völkerrechtlichen Sinne, sondern um Niederschlagen von Aufständen, mithin um Wiederherstellung von Ruhe und Frieden im eigenen Lande. Hieraus ergibt sich schon ein wesentlicher Unterschied gegenüber dem Kampf mit einem auswärtigen und europäischen Gegner. Bei diesem kann eine Reihe von hintereinander erlittenen Niederlagen, verbunden mit Verlust an Land und Kriegsmaterial, den Feind derart materiell schädigen und moralisch niederdrücken, daß er kriegsmüde und zum Frieden geneigt wird. Anders bei aufständischen südwestafrikanischen Eingeborenen. Diese machen sich aus einem Verlust an Land gar nichts, ihnen ist jede Wasserstelle gleichviel wert, noch weniger aber stört sie die infolge einer Niederlage etwa angegriffene Ehre. Haben die flüchtenden Eingeborenen keine Viehherden zu decken, so stieben sie nach einem Gefecht auseinander und versammeln sich wieder an einer vorher verabredeten Wasserstelle, wo sie wiederzufinden eine der schwierigsten Seiten der afrikanischen Kriegführung ist. Gelingt dem Gegner die häufige Wiederholung dieses Manövers und damit die Verlängerung des Krieges ins Unabsehbare, dann fühlt er sich[S. 533] als Sieger, wie er auch in den Augen seiner Landsleute als solcher dasteht. Etwas günstiger wird die Lage für uns, wenn der Gegner Viehherden zu decken hat. Dann ist er zu einem geschlossenen Rückzug und zum zeitweiligen Standhalten gezwungen. Sobald er jedoch die Herden verloren hat, kann er dieselbe Rolle spielen wie der besitzlose Eingeborene. So haben wir 1904 nach Waterberg eine große Verfolgungsaktion gegen die geschlagenen Hereros gesehen, nach derselben aber das Auftauchen einzelner Räuberbanden, wie bei den Hottentotten.
Derartige Möglichkeiten müssen uns daher veranlassen, die diesseitigen Operationen nicht auf einen bloßen Sieg über den Gegner anzulegen, sondern stets auf dessen Vernichtung. Ob diese Vernichtungsoperation mittels konzentrischen Vormarsches räumlich getrennter Abteilungen auf das voraussichtliche Gefechtsfeld oder mittels umfassenden Angriffs auf diesem selbst angestrebt wird, hängt von den Umständen ab. Das erstere erscheint theoretisch als das bessere; indessen ist in Afrika ein Zusammenwirken getrennter Abteilungen, namentlich einem so gewandten Gegner gegenüber, wie dies der Hottentott ist, zu schwer zu erzielen. Wir haben den Versuch hierzu im Jahre 1905 dreimal mißlingen sehen, wenn auch schließlich der taktische Erfolg auf unserer Seite geblieben ist. Das erste Mal geschah dies bei den Operationen im Auobtal gegen die Witboois und Franzmann-Hottentotten im Januar, das zweite Mal in den Kharrasbergen gegen Morenga im März, das dritte Mal im Zarrisgebirge wieder gegen Witbooi im September. In allen drei Fällen sehen wir eine der vormarschierenden Kolonnen isoliert auf die Masse des Gegners stoßen und in ein verlustreiches Gefecht verwickelt werden, bevor die anderen zum Eingreifen kommen konnten.
Ich meinerseits bin daher auf Grund meiner eigenen Erfahrungen von jeder Teilung der Kräfte in Afrika abgekommen. Eine vernichtende Umfassung des Gegners kann auch auf dem Gefechtsfelde selbst erstrebt werden, wie dies 1897 in dem Gefechte an der Gamsibschlucht gegen die Afrikaner[159] geschehen ist. Gelingt eine solche jedoch nicht, bleibt immer noch die Möglichkeit, mit den zusammengehaltenen Kräften über den Feind die Feuerüberlegenheit zu gewinnen und ihm schwere Verluste beizubringen. Letztere, wenn häufig wiederholt, vermögen den Eingeborenen gleichfalls zu entmutigen. Aus diesem Grunde ist es auch erforderlich, das Schießen auf weite[S. 534] Entfernungen zu vermeiden, vielmehr dem Feind von Hause aus möglichst nahe auf den Leib zu rücken. Aus einer wenig verlustreichen Schießerei auf weite Entfernungen, während deren der Eingeborene, sobald es ihm beliebt, unvermerkt wieder verschwinden kann, macht sich dieser gar nichts. Dagegen können auch mehrere mit schweren Verlusten verknüpfte Niederlagen rasch hintereinander bei ihm dieselbe Wirkung hervorbringen wie ein einziger gelungener Vernichtungsschlag, nämlich Kriegsmüdigkeit. Um aber diese Stimmung rechtzeitig ausnutzen zu können, ist es erforderlich, stets in Fühlung mit dem eingeborenen Gegner zu bleiben. Denn, falls der richtige Augenblick verpaßt wird, läuft er auseinander, um den Guerillakrieg zu beginnen, und wir haben das Nachsehen. Eigentlich muß man daher die Eingeborenen nach jeder erlittenen Niederlage fragen, ob sie noch nicht genug hätten, denn von selbst sagen sie dies in ihrem Mißtrauen dem weißen Manne gegenüber nie.
Der allerschwierigste Teil der Kriegführung ist jedoch in Südwestafrika die Aufklärung, sei es mittels einzelner Patrouillen, sei es im Sicherungsdienst während des Marsches, dies namentlich Hottentotten gegenüber. Wie oft haben wir 1905 gelesen: »Auf Patrouille gefallen: 1 Offizier, so und so viel Mann«, ferner auch: »Im Gefecht von ..... gefallen 1 Offizier, 5 bis 6 Reiter, leicht verwundet 2 bis 3 Reiter«. Man darf als sicher annehmen, daß in beiden Fällen die deutschen Reiter lediglich einem Versteck der unsichtbar hinter ihren Klippen liegenden Hottentotten auf 20 bis 30 Schritt Entfernung zum Opfer gefallen sind. War es eine Spitze, so entwickelt sich die dahinter marschierende Abteilung zum Gefecht, in dem dann die 2 bis 3 Leichtverwundeten als weitere Verluste hinzutreten. Die Hottentotten aber berauben die dicht vor ihrer Front Gefallenen und pflegen nach einem kurzen Feuergefecht wieder zu verschwinden, sich auf Grund ihres Raubes aber triumphierend den Sieg zuzuschreiben, während die deutschen Reiter schließlich eine leere Stellung erstürmen. Dann kann dasselbe Spiel von neuem beginnen und so ein Feldzug in Südwestafrika sich auf unabsehbare Zeit ausdehnen. Eine Teilnahme von Eingeborenen auf unserer Seite gibt dagegen die Möglichkeit, die vorausgesendeten Sicherheitsabteilungen mit diesen zu mischen, und sie sind bei deren weit besserem Seh- und Orientierungsvermögen vor Überraschungen geschützter als weiße Reiter allein.
Auf Grund von Erwägungen vorstehender Art habe ich seinerzeit in einem 1898 in der Militärischen Gesellschaft in Berlin gehaltenen Vor[S. 535]trag für die südwestafrikanische Kriegführung nachstehende Schlußfolgerungen gezogen:[160]
Sonach bin ich zum Schlusse meines Vortrags gelangt und gestatte mir nur noch kurz zu rekapitulieren, daß der Südwestafrikanische Kriegsschauplatz uns folgende Gefechtslehren bietet, die mitunter wohl auch für europäische Verhältnisse beachtenswert sein mögen, und zwar:
1. Beginn des Gefechts stets auf möglichst nahen Entfernungen, dies auch von der Artillerie (wegen der besseren Wirkung. Es ist auch durchführbar, da der Gegner keine Artillerie besitzt).
2. Angriff von allen Seiten umfassend, stets einen Vernichtungsschlag anstrebend.
3. Von Hause aus in der Regel alle Kräfte einsetzen. Selten Ausscheiden einer Reserve — sei es zu Fuß, sei es zu Pferde —, denn Überraschungen drohen so gut wie nicht. Es genügt daher Sicherung des Gefechtsfeldes durch Patrouillen (d. h. in den Flanken).
4. Auch in Afrika muß das Endziel jedes Angriffs der Sturm mit dem Bajonett sein. Aber auch dort ist gute Vorbereitung durch Feuer Bedingung.
5. Für Kavallerie bestätigt der südwestafrikanische Kriegsschauplatz die Lehre, daß man unerschütterte Infanterie nicht attackieren soll.
6. Auf dem Gebiete des Vorposten- und Aufklärungsdienstes ist in Afrika noch weniger wie in Europa ein Schema angezeigt. Eine lagernde Abteilung bedarf dort der Sicherung nach allen Seiten, daher muß der Postengürtel stets eng gezogen sein. Durch vorgeschobene Lauerposten denselben zu verstärken, wie solches in Europa üblich ist, lohnt sich indessen bei uns nur, wenn die Stellung des Gegners genau bekannt ist, so daß die Patrouillen bis zu dieser herangeschoben werden können. Wir bedürfen daher weniger der sogenannten »defensiven«, als vielmehr der »offensiven« Aufklärung. Und diese ist in Südwestafrika der schwierigste Teil der Kriegführung. Zu einer nahezu unlösbaren Aufgabe wird sie dagegen, wenn wir über eingeborene Hilfsvölker nicht zu verfügen vermögen. Löblich zeigte sich z. B. im letzten Feldzuge das Bestreben der Witboois, zuverlässige Nachrichten zu bringen, was auch die Hereros, die es andernfalls weniger genau genommen haben würden, einmal zur Nachahmung begeistert und die Entdeckung des Feindes vor dem Gefecht bei Otjunda ermöglicht hat. Dort hatte Witbooi mir gegenüber den Verdacht geäußert, daß die Hereros ein[S. 536] falsches Spiel spielten, und gebeten, selbst eine Patrouille schicken zu dürfen. Dies regte wiederum die Eifersucht der Hereros an, und so erlebten wir das wundersame Schauspiel, daß zwei Patrouillen 18 Stunden lang hintereinander herjagten, wobei die vorne befindlichen Hereros immer aufsattelten, sobald sie hinter sich die Witboois am Horizonte auftauchen sahen, so daß sie schließlich doch die Entdecker des Feindes wurden.
7. Auf dem Gebiete der Kriegführung im großen wird die Lehre, daß die einmal mit dem Gegner gewonnene Fühlung nicht wieder verloren gehen darf, wie Sie im Verlauf des Vortrags gesehen haben, bei uns vollständig ad absurdum geführt. Nach jedem Gefecht stiebt der Feind auseinander und pflegt für einige Zeit verschwunden zu sein.[161] Eine unmittelbare Verfolgung verbietet sich daher von selbst — und — da heißt es für den Sieger, sich in Geduld zu fassen, an der eroberten Wasserstelle tage-, ja wochenlang kleben zu bleiben und durch eingeborene Patrouillen, Spione oder diplomatische Unterhandlungen den neuen Aufenthaltsort des Gegners zu ermitteln. Ist dies gelungen, dann aber kein Zögern mehr, sondern Eilmärsche bei Tage und bei Nacht, um den Gegner jeder Möglichkeit, sich einem erneuten Zusammenstoße zu entziehen, zu berauben. Beinahe einer Niederlage aber ist es gleichzuachten, wenn dies nicht gelingt, und sogar einem verlorenen Feldzuge, wenn sich solches häufig wiederholt. Denn jeder Tag drohender Kriegsgefahr bedeutet einen Aufenthalt in der Entwicklung der Kolonie. Der eingeborene Gegner vermag sich daher mit Recht den Sieg zuzuschreiben, wenn es ihm nur gelingt, den Krieg in unabsehbare Länge zu ziehen.
Diesen Ausführungen habe ich auch heute noch nur diejenigen Einschränkungen hinzuzufügen, die aus den beigefügten Bemerkungen hervorgehen.
Schließlich sei noch eines drastischen Beispiels für die Überlegenheit des Eingeborenen über den weißen Soldaten im Kleinkriege Erwähnung getan. Etwa vom Jahre 1900 ab hatte eine kleine Räuberbande unter der Führung eines »Blauberg« genannten Kaffern den Bezirk Otjimbingwe unsicher gemacht. Mehrfach gegen sie ausgesandte weiße Patrouillen — einmal sogar die ganze 2. Feldkompagnie unter Hauptmann Fromm — hatten die Bande nicht unschädlich zu machen vermocht. Als dann die Klagen über deren Viehräubereien immer mehr anschwollen und schließlich sogar nach[S. 537] Berlin drangen, ersuchte ich im Jahre 1903, kurz vor dem Bondelzwartsaufstande, den Kapitän Witbooi um Überlassung von 20 seiner besten Leute. Diese wurden als deutsche Soldaten eingekleidet und unter Führung eines Offiziers, des schon mehrfach genannten Leutnants Müller v. Berneck, gestellt, der imstande war, wenn es sein mußte, auch einmal 24 Stunden im Sattel zu sitzen. Nach sechs Wochen war die ganze Räuberbande ausgerottet; es stellte sich heraus, daß sie nur aus etwa sechs Gewehren bestanden hatte; ein trüber Ausblick auf die Zukunft des Schutzgebietes, falls es jetzt nicht gelingen sollte, sämtliche Eingeborenen zum Frieden zu bringen. Daß die Witboois diese Leistung ohne ihren tüchtigen Führer nicht hätten vollbringen können, ist sicher; aber ebenso sicher ist, daß der letztere, wenn lediglich auf weiße Reiter angewiesen, hierzu auch nicht in der Lage gewesen sein würde.
Der Aufstand in Südwestafrika hat neben allem Schmerzlichen, das er uns gebracht hat, doch auch sein Gutes gezeitigt. Er hat uns über manchen Irrtum und manche Unterlassungssünde aus der Vergangenheit aufgeklärt, und so auch unsere Augen auf die Lücken gelenkt, die innerhalb unserer kolonialen Wehrkraft bestanden haben, unter anderem auf das Fehlen einer stets zum Ausrücken befähigten Reserve im alten Vaterlande. Zwar ist dort den Seebataillonen eine derartige Rolle zugedacht. Indessen sind diese für die besonderen Aufgaben des Kolonialkrieges nicht vorgebildet, außerdem aber leiden sie unter dem Mißstande einer für ihre Zwecke zu kurzen Dienstzeit. Ihre ältesten Soldaten dienen zwei Jahre, ihre jüngsten vielleicht nur wenige Monate, je nach der Zeit, in der die Notwendigkeit des Ausrückens an die Truppe herantritt. Endlich aber erscheinen die Seebataillone für unsere überseeischen Aufgaben zur Zeit nicht mehr als ausreichend. Sowohl in China wie jetzt in Südwestafrika konnten sie nur als erste Staffel sowie zur Ausfüllung des dringendsten Bedarfs in Tätigkeit treten, während die Masse der erforderlichen Streitkräfte improvisiert werden mußte. Diese Improvisationen aber wiesen alle Mängel von solchen auf.
Die südwestafrikanische Kriegführung verlangt von jedem Kriegsteilnehmer besonders gutes Schießen sowie eine gewisse Reitfertigkeit. Nimmt man daher zu den Improvisationen den Ersatz aus der Kavallerie, so fehlt das erstere, wenn aus der Infanterie, das letztere. In Friedenszeiten konnten beide Lücken im Schutzgebiet ausgefüllt werden, in Kriegszeiten dagegen blieb nur die Wahl, den Beginn der Kriegshandlungen zu vertagen,[S. 538] oder die Truppe unfertig an den Feind zu führen. Daß beides seine Schattenseiten hat, liegt auf der Hand. In den Kolonien selbst aber ständig so viele Truppen zu halten, daß man allen eintretenden Möglichkeiten gewachsen sein würde, dazu ist kein Staat reich genug. Auch die anderen großen Kolonialstaaten, England und Frankreich, tun dies daher nicht. Das letztere besitzt in der Heimat eine stets verwendungsfähige Kolonialarmee, und in England kann bei seinem Werbesystem die ganze Armee als eine solche gelten.
Uns bleibt daher gleichfalls nichts übrig, als eine besondere Reserve in der Heimat bereitzustellen, gleichviel welchen Namen wir ihr geben. Hauptmann v. Haeften vom Großen Generalstab, der in den »Vierteljahrsheften für Truppenführung und Heereskunde« diese Frage behandelte, hat den Namen »Auslandstruppe« gewählt, ein guter Gedanke. Denn dann wäre schon mit dem Namen zu erkennen gegeben, daß eine solche Truppe nicht lediglich für koloniale Zwecke vorhanden wäre, sondern sowohl für unsere sonstigen überseeischen Aufgaben wie auch in einem europäischen Kriege als Zuwachs für die heimatliche Armee.
Mithin würde es sich lediglich darum handeln, einen Teil der Landarmee abzuzweigen und diesen für den Kolonialdienst besonders auszubilden. Ob man ihn aus Kapitulanten der Landarmee zusammensetzt oder mittels Aushebung ergänzt, würde eine nebensächliche Frage sein. Auf alle Fälle aber müßte den Angehörigen dieser Truppe eine längere Dienstverpflichtung auferlegt werden, was sich bereits auch unter den gegenwärtigen gesetzlichen Bestimmungen rechtfertigen ließe, da sie nur eine berittene sein kann. Besonders zu gewährende Vergünstigungen müßten dagegen den Eintritt verlockend erscheinen lassen, da sie nur als Elitetruppe ihren Zweck erreichen kann.
Das Hauptverwendungsfeld dieser Auslandstruppe würden auf kolonialem Gebiet aus klimatischen Rücksichten Südwestafrika und Kiautschou bilden. Dies schließt jedoch eine vorübergehende Verwendung in den Küstengebieten der tropischen Kolonien keineswegs aus.
Es wäre noch die Frage der Unterstellung dieser Truppe zu lösen. Wie bereits erwähnt, untersteht die koloniale Wehrmacht dem Reichskanzler als derjenigen Behörde, die auch über deren Verwendung zu bestimmen hat. Dies hat aber nicht verhindern können, daß während des gegenwärtigen Aufstandes bei der südwestafrikanischen Schutztruppe schließlich fünf Behörden zusammenzuwirken hatten. Hauptmann v. Haeften sagt in seiner[S. 539] Bearbeitung hierüber folgendes: »Die Kolonialabteilung hatte die Verrechnung der gesamten Kosten, das Reichs-Marine-Amt die Verwaltung für das Marine-Expeditionskorps, das preußische Kriegsministerium und das Oberkommando der Schutztruppen teilten sich in die Organisation und Verwaltung der Verstärkungen für die Schutztruppen, und dem Chef des Generalstabes der Armee war die Leitung der Operationen übertragen. Diese fünf Behörden hatten sich in vielen Fragen erst untereinander zu verständigen, und hierüber ging viel kostbare Zeit verloren.« Es war unter solchen Umständen ein Wunder, wie gut trotzdem die Sache funktioniert hat. Solange ich das Kommando führte, mithin gerade zu Beginn des Aufstandes, trafen die Verstärkungen so rasch ein und waren so vollständig ausgerüstet, daß man ihnen etwaige Friktionen in der Heimat nicht angesehen hat. Indessen den betreffenden Behörden selbst werden, wie zu vermuten, unliebsame Erfahrungen doch nicht erspart geblieben sein. Es erscheint daher auf alle Fälle besser, die Organisation künftig so zu gestalten, daß ein Zusammenarbeiten so vieler Behörden wegfällt.
Unter der Voraussetzung, daß auch die heimatliche Reserve der kolonialen Wehrkraft lediglich zu kolonialen Zwecken bestimmt sei, habe ich früher einmal vorgeschlagen, sie gleichfalls dem Reichskanzler zu unterstellen. Wenn sie dagegen als »Auslandstruppe« ein Teil der heimatlichen Armee bleibt und nicht nur bei überseeischen Aufgaben, sondern unter Umständen auch mit dem Heere zusammenzuwirken hat, dann muß sie naturgemäß auch mit letzterem organisatorisch verbunden bleiben. Somit würde ihre Unterstellung unter das Kriegsministerium als das einzig Mögliche erscheinen. Das Oberkommando der Schutztruppen würde dann mit dieser Behörde in bezug auf Requisition der Auslandstruppe und den Austausch von Angehörigen der beiderseitigen Truppenteile in Verbindung treten müssen. Letzteres wird auch jetzt schon ähnlich gehandhabt; nur holt sich das Kriegsministerium zur Zeit den Ersatz aus der ganzen Armee, während er dann nur aus der mit bereits vorgebildetem Material versehenen Auslandstruppe entnommen werden würde. Ebenso hätten auch zeitweise aus der Schutztruppe ausscheidende Offiziere und Mannschaften zum Teil zur Auslandstruppe überzutreten, um dort ihre Erfahrungen zu verwerten.
Im übrigen wird in Südwestafrika in absehbarer Zeit die Besiedlung hoffentlich einen derartigen Umfang annehmen, daß die Reserve für die Schutztruppe sich mit der Zeit im Lande selbst vorfindet, wie dies ja gegenwärtig schon zum Teil der Fall war.
[S. 540] Haben wir doch bei Beginn des Hereroaufstandes mittels Einziehung der Mannschaften des Beurlaubtenstandes die Schutztruppe auf das Doppelte ihrer Friedensstärke zu bringen vermocht. Jedoch auf eine Auslandstruppe wird das alte Vaterland mit Rücksicht auf seine übrigen überseeischen Aufgaben trotzdem nicht verzichten können. Ob neben der letzteren die bisherige Marineinfanterie weiterbestehen oder ob sie in die neue Kolonialtruppe aufgehen solle, ist eine Frage, deren Erörterung ich zuständigerer Seite vorbehalten möchte. Mit ihr hängt auch die Frage nach Stärke und Zusammensetzung der Auslandstruppe zusammen. Bei ihrer Beantwortung werden die jetzt in Südwestafrika gemachten Erfahrungen berücksichtigt werden müssen.
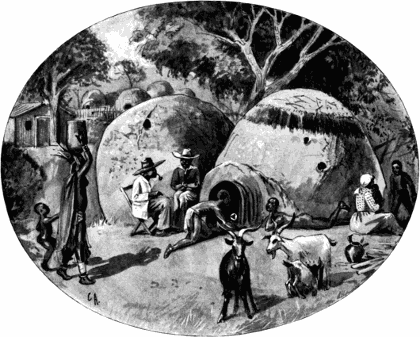

Das Endziel jeder Kolonisation ist, von allem idealen und humanen Beiwerk entkleidet, schließlich doch nur ein Geschäft. Die kolonisierende Rasse will der Urbevölkerung des zu kolonisierenden Landes nicht das von dieser vielleicht erwartete Glück bringen, sie sucht vielmehr in erster Linie ihren eigenen Vorteil. Ein solches Streben entspricht nur dem menschlichen Egoismus und ist daher naturgemäß. In bezug auf die Art der Kolonisation gibt es infolgedessen im Grunde nur eine einzige Richtschnur, nämlich diejenige, die am sichersten zu dem erstrebten guten Geschäft führt. Die einen glauben, dies durch vollständige Entrechtung der Urbevölkerung zugunsten der eingedrungenen Rasse erreichen zu können. »Der Weiße muß von Staats wegen turmhoch über den Eingeborenen gestellt werden, gleichviel weß Geistes Kind er ist, eine Gleichstellung beider Rassen im Staatsleben wie vor Gericht gibt es nicht«, so hört man die Verfechter dieser Lehre sagen. Die anderen dagegen wollen auch der Urbevölkerung »ihren Platz an der Sonne« gönnen. — Lediglich vom Standpunkte des zu erwartenden guten Geschäfts aus betrachtet, kann aber die Entscheidung auf diese Frage nicht nach einem gemeinsamen Schema, sondern muß von Fall zu Fall erfolgen.
Durch die Ereignisse gezwungen, haben wir z. B. in Südwestafrika die Eingeborenen mit Waffengewalt unterwerfen müssen. Wer jetzt noch glaubt,[S. 542] dafür eintreten zu sollen, daß die letzteren infolgedessen politisch machtlos gemacht sowie ihres Landbesitzes für verlustig erklärt werden müssen, der rennt offene Türen ein. Denn das versteht sich nach allen unseren Opfern und nachdem die Eingeborenen schwere Schuld auf sich geladen haben, von selbst und wird auch von diesen, die das Recht des Siegers stets anerkennen, nicht anders erwartet. Prüfen wir dagegen, welches Geschäft wir mit unserer Gewaltpolitik gemacht haben, so tritt ein Bild zutage, das nicht die mindeste Ähnlichkeit mit einem vorteilhaften besitzt. Gegen einen Einsatz von mehreren hundert Millionen Mark und von einigen tausend deutschen Soldaten haben wir von den drei wirtschaftlichen Werten der Kolonie, dem Bergbau, der Viehzucht und den eingeborenen Arbeitskräften, den 2. gänzlich, den 3. zu zwei Dritteln zerstört. Was aber das bedenklichste ist, wir haben mit allen unseren Opfern bis zum heutigen Tage[162] noch nicht den Frieden wieder vollständig herzustellen vermocht.
Als einziger errungener Gegenwert bleibt uns somit das den Eingeborenen abgenommene Land. Aber auch dieses nutzt uns nichts, solange nicht die Eingeborenen sämtlich zur Ruhe gebracht sind. Denn, wenn wir einen Farmbetrieb nur dadurch ermöglichen wollen, daß wir jedem Farmer eine Schutzwache von 6 bis 8 Reitern beigeben, so haben wir erst recht ein schlechtes Geschäft gemacht. Die Farm bringt vielleicht 6000 Mark jährlich ein, 6 bis 8 Reiter kosten dagegen jährlich 18000 bis 24000 Mark. Auch der größte Optimist wird daher nicht sagen können, daß unsere Gewaltpolitik in Südwestafrika lohnend gewesen ist. Unsere Rechtfertigung für sie bleibt mithin nur, daß wir zu ihr gezwungen worden sind.
Und darum war es ganz richtig, wenn das alte Vaterland seine Kolonialpolitik zunächst auf dem Versuch einer Versöhnung der Urbevölkerung mit ihrem Schicksal aufgebaut hat. Nicht mit Blut und Eisen nach der Art eines Tatarenchans sollte sie betrieben werden, sondern mit Verständnis für die historisch gewordene Eigenart der vorgefundenen Bevölkerung. Ich selbst aber habe diese Politik in vollem Einverständnis mit ihr durchführen helfen, dies umsomehr, als gleich zu Beginn meiner kolonialen Tätigkeit der Witbooikrieg mir über die Schwierigkeiten der Niederschlagung von Eingeborenenaufständen in Südwestafrika die Augen geöffnet hat. Mein Streben ging seitdem dahin, die einheimischen Stämme selbst in den Dienst[S. 543] unserer Sache zu stellen, um sie dann gegeneinander auszuspielen. Auch ein Gegner dieser Politik wird mir zugeben müssen, daß es schwieriger, aber auch verdienstvoller war, die Eingeborenen zu bewegen, für uns sich gegenseitig totzuschießen, als vom alten Vaterlande Ströme von Blut und Ströme von Geld zu deren Unterdrückung zu verlangen. Daß diese Politik sich auf die Dauer nicht als durchführbar erwiesen hat aus Gründen, die in meinen bisherigen Ausführungen zu finden sind, ist kein Beweis dafür, daß sie gar nicht hätte versucht werden sollen.
Interessant ist in dieser Beziehung, auch einmal einen Blick auf das britische Weltreich zu werfen. Eine im Jahre 1901 in diesem angeordnete Volkszählung, deren Ergebnisse vor kurzem veröffentlicht worden sind, stellt fest, daß von rund 400 Millionen Untertanen des Königs von England nur 54 Millionen oder 13½ vH. Weiße sind, letztere mithin ihrer Zahl nach noch unter derjenigen des Deutschen Reiches stehend. In der Tat, es wäre sicher des Studiums wert, wie die 54 Millionen Weißer im britischen Reiche es anfangen, die 350 Millionen Eingeborener zu beherrschen. Daß dies durchweg mit einer Gewalt- und Unterdrückungspolitik geschehen sollte, erscheint ausgeschlossen, weil undurchführbar. Es bleibt daher nur die Annahme, daß die Engländer es besser verstehen als wir, ihre Eingeborenen für ihre Sache zu gewinnen und ihr dienstbar zu machen. Je nach dem Charakter ihrer Kolonialgebiete und deren Bewohner scheinen sie auch ganz verschiedene Systeme anzuwenden. Wir wissen z. B., daß sie in der Kapkolonie, einem Lande, in dem die Niederschlagung von Aufständen genau von den gleichen Schwierigkeiten begleitet sein würde wie in unserem Südwestafrika, die Eingeborenen einfach zu vollwertigen Staatsbürgern gemacht haben.[163] Nur wo ein Eingeborenenstamm sich durchaus nicht einer geordneten Staatsverfassung einfügen lassen wollte, wie z. B. die räuberischen Koranas, haben sie ihn mit Waffengewalt, aber auch nicht ohne Unterstützung der übrigen Eingeborenen-Stämme vernichtet. Allerdings sind sie[S. 544] seinerzeit einen Teil ihrer unruhigen Hottentottenstämme auch durch deren Auswanderung in unser jetziges Schutzgebiet losgeworden, wie wir dies im Kapitel I, Seite 1 bis 3 gesehen haben (die Orlams). Im Basutolande dagegen, in dem ein kriegerischer Stamm in einem wenig einladenden Gebirgsgelände sitzt, haben die Engländer sich mit einer nominellen Herrschaft begnügt und behufs Vermeidung von Reibungen eine weiße Einwanderung daselbst gar nicht zugelassen.
In Ostindien endlich mit seinen rund 250 Millionen Einwohnern finden wir noch ungefähr 60 Millionen in mehr oder minder großen Vasallenstaaten vereinigt, die in ihren eigenen Angelegenheiten vollständig selbständig sind und lediglich einen Residenten als Aufsichtsperson besitzen. In den Kronländereien sind dagegen Beamtenschaft wie Armee aus Eingeborenen und Weißen gemischt.[164] In dieser — für uns auch ferner nachahmenswerten Heranziehung der Eingeborenen zu der Verwaltung liegt das Geheimnis, daß in Indien die knapp 160000 Köpfe starken Weißen den 250 Millionen Eingeborenen gegenüber ihre Herrenstellung zu behaupten vermögen. In der Tat, es bedarf eines besonderen Verständnisses für die Gewohnheiten und Sitten der Eingeborenen, soll unter den Zahlenverhältnissen, wie wir sie im britischen Reiche sehen, die weiße Rasse Herr im Hause bleiben. Ein Volk aber, das diese Kunst nicht versteht, sollte das Kolonisieren lieber lassen. Denn es wird daran schwerlich je Freude erleben.
»Der Eingeborene ist nur durch Strenge und Rücksichtslosigkeit seitens des Weißen in seinen Schranken zu halten, das Gegenteil hält er für Schwäche; nicht infolge einer zu schroffen, sondern einer zu nachsichtigen Behandlung ist der Aufstand in Südwestafrika entstanden«, so lauten dagegen bei uns zur Zeit die neuesten Schlagworte. Revolutionen pflegt indessen der Durchschnittsmensch nur zu beginnen, wenn er sich schlecht behandelt fühlt und nicht, wenn das Gegenteil der Fall. Wenn z. B. die Indier 1858 aufgestanden sind, während sie jetzt an ein solches Beginnen anscheinend nicht[S. 545] denken, so müssen sie damals schlechter behandelt worden sein als heute. Daß dies so gewesen sei, lehrt auch die Geschichte in der Tat. Damals herrschte eine kaufmännische Gesellschaft im Lande, für die naturgemäß die Erzielung großer Gewinne der Hauptzweck ihrer kolonisatorischen Tätigkeit sein mußte. Heute ist das Land Kronkolonie und wird daher nach anderen Gesichtspunkten verwaltet. England hat anscheinend aus jenem furchtbaren Ereignis, das gleichfalls mit der Ermordung fast sämtlicher englischen Ansiedler begonnen hat, gelernt.
Dieser Rückblick in unsere koloniale Vergangenheit wie in diejenige des größten Kolonisationsvolkes war für einen Ausblick in die Zukunft Deutsch-Südwestafrikas erforderlich. Längst ehe es möglich war, die Frage, wann wir Südwestafrika wieder zu beruhigen imstande sein würden, auch nur annähernd zu beantworten, haben berufene und unberufene Federn das Fell des Bären verteilt, d. h. über das Schicksal der Eingeborenen Beschluß gefaßt, bevor man noch wußte, wie man diese überhaupt zum Frieden bringen solle. Ganz richtig gehen jedoch alle Vorschläge von dem Gedanken aus, daß das künftige Schicksal Südwestafrikas mit von der Art der Lösung der Eingeborenenfrage abhängen würde. Diese kann indessen in letzter Linie nur der an Ort und Stelle befindliche und verantwortliche Gouverneur bestimmen. Alles andere ist graue Theorie. Wenn ich mich trotzdem jetzt gleichfalls mit dieser Frage befasse, so tue ich dies nur, weil es in den Rahmen dieses Buches gehört und weil es daher wohl seitens des Lesers erwartet wird. Ich werde mich aber auf Umrisse beschränken.
Die Frage über das künftige Schicksal der Eingeborenen Südwestafrikas läßt sich gleichfalls nur an der Hand unseres eigenen Interesses beantworten. Das »gute Geschäft«, das wir in den Kolonien für uns erstreben, verlangt einerseits, daß wir die Eingeborenen, soweit sie noch vorhanden sind, erhalten, anderseits, daß wir sie zufriedenstellen. Denn ohne die Arbeitskräfte der Eingeborenen können wir weder Bergbau noch Viehzucht, und ohne ihre Zufriedenheit kein wirtschaftliches Unternehmen in Sicherheit betreiben. Kein Land bedarf so sehr der Ruhe und des Friedens wie dasjenige des freien Weidegangs. In einem solchen vermögen wenige mit Kirris bewaffnete Räuberbanden den Farmbetrieb im weiten Umkreise zu lähmen. Wo das Vieh Tag und Nacht unter der Aufsicht von ein bis zwei Wächtern auf der Weide frei herumläuft, ist es jedem Handstreich preisgegeben. Seinen Schutz jedoch durch Belegung einer jeden Farm mit Angehörigen der bewaffneten Macht herbeiführen zu wollen, ist,[S. 546] wie wir gesehen haben, nur ein kostspieliger Notbehelf, der je früher, je besser wieder verschwindet. Andernfalls würden wir billiger fahren, wenn wir jeden Farmer Südwestafrikas mit einem ausreichenden Ruhegehalt zur Disposition stellen würden. Dies ganz abgesehen davon, daß auch ein solcher Schutz die Sicherheit des Farmbetriebes noch nicht unbedingt zu gewährleisten vermag.
Mithin erübrigt uns auch jetzt, nachdem wir die Eingeborenen unter schweren Opfern niedergeworfen haben, in unserem eigenen Interesse immer noch nichts anderes, als sie mit ihrem Lose zu versöhnen. Ob wir sie künftig in Reservaten oder in Lokationen eindämmen, oder in beiden Systemen gemischt, ist hierbei eine Frage ohne Bedeutung, denn stets müssen wir ihnen so viel Land geben, als sie bedürfen, aber auch nicht über diesen Bedarf hinaus. Infolgedessen ist es gleichgültig, ob wir ihnen an dem Lande Besitzrechte (Reservate) oder nur Nutzungsrechte (Lokationen) zugestehen; denn mittels Verkauf dürfen sie von demselben auch in dem ersteren Falle doch nichts verwerten. Daß wir ferner keiner Eingeborenenregierung mehr bedürfen, erscheint gleichfalls unrichtig. Ein weißer Beamter kann sich nicht um den Personenstand der Eingeborenen kümmern, er kann nicht deren Geburten, Trauungen und Sterbefälle registrieren, sich auch nicht in deren innere kleine Streitigkeiten einmischen. Diese Dinge müssen wir in jedem Reservat usw. einem von der Regierung eingesetzten wie auch besoldeten Werftvorstand und dessen Räten übertragen. Auch den Missionaren kann man die Stammesangelegenheiten, soweit sie das kirchliche Gebiet betreffen, uneingeschränkt belassen.
Was aber der Hauptzweck einer eingeborenen Obrigkeit bleibt, ist die Bürgschaft für das Wohlverhalten ihrer Untertanen der weißen Regierung gegenüber. Wenn es in der Vergangenheit so lange Jahre gelungen ist, im Schutzgebiet für Leben und Eigentum mindestens die gleiche Sicherheit aufrechtzuerhalten, wie wir sie in der Heimat finden, so war dies lediglich der Mitwirkung der Stammesregierungen zu verdanken. Wenn z. B. hinter einem eingeborenen Viehdieb nur weiße Polizei herritt, hat sie ihn selten gefangen. Der eingeborene Kapitän pflegte ihn dagegen nach der ihm bestimmten Frist pünktlich einzuliefern. Diese Rolle muß künftig der Reservats- usw. Vorstand übernehmen. An ihn kann sich dann der Regierungsvertreter halten. Zu allen diesen Gründen für die Aufrechterhaltung einer eingeborenen Regierung auch in der Zukunft tritt noch der diplomatisch-moralische Beweggrund, daß der Eingeborene sich lieber von einem Stammes[S. 547]genossen beherrschen, wenn man will, auch tyrannisieren läßt, als von einem weißen Mann. Wollen wir jedoch aus irgend einem Grunde von den vorgeschlagenen Mitteln, die Eingeborenen zu beherrschen, aber doch zufriedenzustellen, absehen, dann erübrigt nur, dem Beispiel der Kapkolonie zu folgen und ihnen in Südwestafrika das volle Bürgerrecht zu verleihen. Andernfalls werden wir dort schwer wieder zur Ruhe kommen, höchstens zu derjenigen des Kirchhofs.
Was aber durchgeführt werden muß, ist die Gleichstellung der beiden Rassen vor Gericht, ob auch in bezug auf Glaubwürdigkeit, mag in jedem einzelnen Falle der Richter entscheiden. Weist doch auch die weiße Rasse in diesem Punkte manche zweifelhafte Elemente auf. Daß dagegen Eingeborene niemals über Weiße aburteilen dürfen, ist selbstverständlich, dies unbeschadet der Notwendigkeit eines seitens des Werftvorstandes abzuordnenden Beisitzers, gleichsam als Zeuge zu der Gerichtsverhandlung, falls der Angeklagte ein Eingeborener ist. Diese Vorsichtsmaßregel beugt von Hause aus den mißtrauischen Eingeborenen gegenüber allen Gerüchten über ein etwaiges parteiisches Gerichtsverfahren vor.
In jedem Reservat usw. muß dagegen die Spitze der Regierungsgewalt bei dem deutschen Regierungsvertreter liegen. Doch ist, um die Rassen getrennt zu halten, dringend erforderlich, daß außer diesem und seinen Organen nur Mitglieder der Mission sich in den Reservaten usw. niederlassen dürfen. Wir haben jetzt genugsam gesehen, daß beide Rassen sich nicht nebeneinander vertragen, auch wenn, wie dies zur Zeit der Fall, ein Einwanderungsgesetz eine Fernhaltung wenigstens der unliebsamsten weißen und schwarzen Elemente vom Schutzgebiet erhoffen läßt. Denn wenn die Eingeborenen auch von jetzt ab politisch machtlos sind, so sind sie darum doch nicht ungefährlich geworden. Ihre heimliche Flucht aus den Reservaten und Lokationen, um sich von Raub und Viehdiebstahl zu nähren, wird niemand hindern können. Die zum Teil auffallend geringe Gewehrabgabe seitens der zur Zeit sich freiwillig stellenden Eingeborenen scheint darauf schließen zu lassen, daß auch diese an die Möglichkeit eines solchen Rückweges denken. Sie wollen, wie man zu sagen pflegt, erst sehen, »wie der Hase läuft«, und halten sich daher ihre Waffen in Reserve. Darum möge der Gouverneur Südwestafrikas sich nicht durch diejenigen unverständigen Stimmen beirren lassen, welche die Eingeborenen künftig als Parias oder Sklaven behandelt wissen wollen. Die Entrechtung der Stämme darf noch lange nicht zur Entrechtung des einzelnen Individuums führen. Eine solche würde unserem[S. 548] Interesse durchaus widersprechen, aber auch unserer Stellung als einer gesitteten Kolonialmacht, die sich jetzt erst recht den Schutz des Schwachen zur Pflicht machen muß.
Neben den Lokationen und Reservaten kann es noch eine dritte Stellung für die Eingeborenen geben, nämlich lediglich im Dienst bei den Weißen. Der weiße Arbeitgeber, der sich auf die Behandlung seiner Arbeiter versteht, wird allmählich zu einem Stamm seßhafter Eingeborener gelangen, und zwischen beiden wird eine Art patriarchalischen Verhältnisses entstehen. Diese Eingeborenen werden stets auf derselben Farm wohnen, und das Dienstverhältnis wird sich von den Vätern auf die Söhne fortpflanzen. Bei den übrigen Arbeitgebern wird ein fortgesetzter Austausch der Arbeitskräfte mit den Reservaten und Lokationen stattfinden, wobei aber jeder Zwang zu vermeiden sein wird, mit Ausnahme desjenigen zur Arbeit überhaupt. Letzterer kann mittels Auferlegung von Abgaben zugunsten der Staatsverwaltung herbeigeführt werden. Wo und wie sich jedoch der Eingeborene die Mittel zu seinen Steuern erwirbt, ist seine Sache. Von Vorteil wird es sein, sich zur Steuereintreibung die Mitwirkung der Werftvorstände zu sichern, indem sie mittels Anweisung ihrer Gehälter auf die eingehenden Abgaben für die Sache interessiert werden.
Das sind etwa die Grundzüge unserer künftigen Eingeborenenpolitik. Ob und wie weit sie durchzuführen sind, muß jedoch, wie ich schon gesagt habe, dem an Ort und Stelle befindlichen Gouverneur überlassen werden. Binde man ihm die Hände nicht, höre man aber auch nicht auf die wohl zu erwartenden Anklagen Weißer über Mangel an Arbeitskräften, die sie dem Gouverneur zuschreiben, aber nur ihrem eigenen Unverständnis für die Behandlung Untergebener verdanken. Gelingt es, die Eingeborenenfrage in dem angedeuteten Sinne zu regeln, dann lassen sich auf ihr die Faktoren für die wirtschaftliche Entwicklung unseres südwestafrikanischen Schutzgebietes, Bergbau und Viehzucht, leichter aufbauen, als dies bei der unklaren Stellung der weißen zu der schwarzen Rasse bisher der Fall gewesen ist. Ob dann das Schutzgebiet die gewaltigen Opfer des jetzigen Aufstandes je zu lohnen imstande sein wird, ist dagegen eine Frage, die ich mir nicht zu beantworten getraue. Wer würde überhaupt dem alten Vaterlande den Erwerb wie die Festhaltung des Schutzgebietes zu empfehlen gewagt haben, hätte er diese Opfer voraussehen können? Jetzt, nachdem unsere nationale Ehre in Mitleidenschaft gezogen ist, kommt diese Frage für uns dagegen gar nicht mehr in Betracht.
[S. 549] Die Ausgaben des gegenwärtigen Aufstandes können wir ruhig auf das Konto »Für die nationale Ehre« buchen. Lohnt dann die Kolonie dereinst die bis zum Aufstand gemachten und die nach ihm zu machenden Aufwendungen — und daran möchte ich nicht zweifeln —, dann werden wir immer noch das erreicht haben, was in letzter Linie das Ziel jeder Kolonisation sein wird, nämlich ein gutes Geschäft. Mit dem Wunsche, daß es meinem Nachfolger, dem Gouverneur v. Lindequist, gelingen möge, die Kolonie auf diesem Wege ein gutes Stück vorwärts zu bringen, will ich dieses Buch schließen.
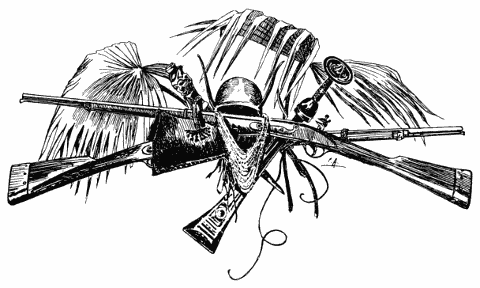
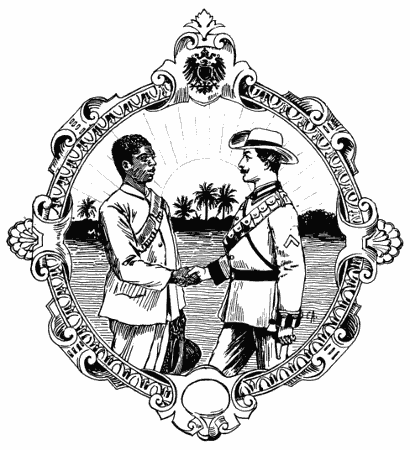
Anlage 1.
Instruktion
für die Bezirkshauptmannschaften, Militär- und Polizeidistrikte
sowie die detachierten Feldkompagnien.
Stellung und allgemeine Aufgaben des Bezirkshauptmanns.
§ 1. An der Spitze der Bezirksverwaltung steht der dem Gouverneur unterstellte Bezirkshauptmann. Er vertritt in allen, die allgemeine Landesverwaltung betreffenden Angelegenheiten den ersteren und ist demselben für die Durchführung der Gesetze und Verordnungen innerhalb seines Bezirks verantwortlich. Als seine Organe dienen ihm hierzu die Distriktsverwaltungen und die Polizeistationen.
§ 2. Die erste Aufgabe des Bezirkshauptmanns liegt in der kolonisatorischen Hebung seines Bezirks durch Beförderung der Ansiedlung, Verbesserung der Wege-, Wasser- und Weideverhältnisse, Unterdrückung der Viehseuchen sowie Aufrechterhaltung der politischen Ruhe mittels richtiger Behandlung der Eingeborenen. Die für Abgabe von Regierungsländereien erforderlichen allgemeinen Regeln werden vom Gouverneur gegeben. Ebenso verbleibt diesem die Bestätigung von Landverkäufen.
Endlich hat der Bezirkshauptmann die Listen der in seinem Bezirk wohnenden Weißen auf dem laufenden zu halten unter besonderer Bezeichnung derjenigen, welche wehrpflichtig sind oder — ohne wehrpflichtig zu sein — sich im Kriegsfalle zur freiwilligen Heeresfolge verpflichten. Für beide Listen dienen die vorgeschriebenen polizeilichen Anmeldungen als Grundlage.
§ 3. In Beziehung auf Verwaltung der Bezirks- und Distriktskassen wird auf die Geschäftsanweisung vom 10. März 1899 hingewiesen. Der Bezirkshauptmann leitet ferner die Verwaltung der direkten Steuern nach den vom Gouverneur gegebenen Grundsätzen.
§ 4. Über die wichtigeren, von dem Bezirkshauptmann getroffenen Anordnungen und Verfügungen ist fortlaufend dem Gouvernement Bericht zu erstatten. (Vgl. auch §§ 7 und 8.)
Stellvertretung.
§ 5. Sofern dem Bezirkshauptmann ein dauernder Stellvertreter nicht beigegeben oder letzterer abwesend ist, hat derselbe bei vorübergehender Abwesenheit von seinem Amtssitze, aus der Zahl der vorhandenen Beamten und Offiziere einen Vertreter zu[S. 554] bestellen. Diese Vertretung ist dem nächsten dienstältesten Beamten oder Offizier zu übertragen. Falls der Bezirkshauptmann seinen Bezirk ganz verläßt, ernennt den Vertreter der Gouverneur, dessen Entscheidung rechtzeitig einzuholen ist.
Ausübung der Polizeigewalt.
§ 6. Der Bezirkshauptmann hat die Funktion der Landespolizeibehörde in seinem Bezirk wahrzunehmen. Ihm sind zur Unterstützung die Distriktsverwaltungen und Polizeistationen beigegeben, welche die von ihm getroffenen Maßnahmen auszuführen gehalten sind.
§ 7. Der Bezirkshauptmann ist befugt, für den Umfang des ganzen Bezirks oder einzelner Teile desselben gültige Verordnungen zu erlassen und gegen die Nichtbefolgung derselben Gefängnis- bzw. Haftstrafe bis zu 6 Wochen, Geldstrafe bis zu 150 Mark und Einziehung einzelner Gegenstände anzuordnen. Sofern keine Gefahr im Verzuge, sind diese Polizeiverordnungen vor der Veröffentlichung stets dem Gouvernement zur Genehmigung vorzulegen. Andernfalls ist die letztere nachträglich einzuholen. Das Weitere, betreffend Handhabung der Polizeigewalt, ist aus dem seinerzeit als Anhang zu dieser Instruktion erlassenen Dienstanweisung für die Polizeibehörden ersichtlich (Anlage 1).
Es empfiehlt sich, Polizeiverordnungen vor Erlaß stets mit dem nach Gouvernementsverfügung vom 18. Dezember 1899, J. Nr. 8351, geschaffenen Beirat zu beraten. Doch ist der Bezirkshauptmann an dessen Ansicht nicht gebunden.
§ 8. Die Polizeiverordnungen sind in geeigneter Weise unter Festsetzung einer Frist über den Beginn ihrer Wirksamkeit bekannt zu geben. Die letztere ist derart zu bemessen, daß die betreffende Verordnung an dem für das Inkrafttreten bestimmten Zeitpunkt in allen Teilen des Bezirks, für den sie erlassen ist, bekannt sein kann. Über etwa wieder aufgehobene Verordnungen ist stets an das Gouvernement zu berichten.
Distriktsverwaltungen.
§ 9. Unter der Bezirksverwaltung stehen die Distriktsverwaltungen und unter diesen die im Distriktsbereiche befindlichen Polizeimannschaften und Polizeistationen. Die Leiter dieser Verwaltungen führen den Titel »Distrikts- bzw. Stationschef«. An den Stationsorten der Bezirkshauptleute übernehmen diese, sofern ein besonderer Distriktschef daselbst nicht stationiert ist, die Geschäfte des letzteren und damit auch der Ortspolizeibehörde selbst. Sofern die Distrikts- und Stationschefs aktive Offiziere sind, sind sie zur Übernahme einer Zivilverwaltungsstelle abkommandierte Militärpersonen. Deren amtliche Unterstellung unter die Bezirkshauptleute zieht keine persönliche nach sich, mithin führt dieselbe auch nicht das Recht zur Erteilung von Rügen nach sich, es sei denn, daß der Bezirkshauptmann gleichfalls Offizier ist, und zwar dem Patent nach älterer.
Meldungen und Berichte der Distriktsverwaltungen gehen, sofern sie reine Polizei- und Verwaltungssachen betreffen, an die Bezirkshauptmannschaften, sofern sie politischer, wirtschaftlicher und militärischer Natur sind, durch diese im Original an das Gouvernement bzw. Truppenkommando, wobei die Bezirkshauptleute berechtigt sind, Stellung zu denselben zu nehmen. Meldungen persönlicher Natur sind dagegen dem Kaiserlichen Gouverneur (Truppenkommandeur) direkt einzureichen, falls der Bezirkshauptmann nicht selbst dem Dienstalter nach älterer Offizier ist. Den ihnen unterstellten Angehörigen[S. 555] der Schutztruppe gegenüber haben die Distriktschefs, wenn Offiziere, die Disziplinarstrafgewalt eines detachierten Hauptmanns der Armee. Falls ein Verwaltungsbeamter nicht dem aktiven Offizierkorps der Schutztruppe angehört, werden die demselben unterstellten Angehörigen der Schutztruppe in disziplinarer und sonstiger militärischer Hinsicht einem der ihrem Bezirke zugeteilten Offiziere überwiesen. Die dem Zivilstande angehörenden Verwaltungsbeamten selbst stehen zueinander in dem durch das Reichsbeamtengesetz vom 31. März 1873 (R. G. Bl. S. 61) bzw. durch die Verordnung, betreffend die Rechtsverhältnisse der Landesbeamten in den deutschen Schutzgebieten, vom 9. August 1896 bestimmten Unterordnungs- bzw. Vorgesetztenverhältnis.
Polizeitruppe.
§ 10. Zur Durchführung ihrer polizeilichen Aufgaben ist den Bezirkshauptleuten und Distriktschefs eine Polizeitruppe beigegeben. Dieselbe besteht aus Weißen und Eingeborenen. Die ersteren werden, soweit es nicht gelingt, Mannschaften des Beurlaubtenstandes hierfür zu gewinnen, der Schutztruppe entnommen und auf Ansuchen des Gouverneurs durch den Truppenkommandeur zur Zivilverwaltung des Schutzgebietes abkommandiert. Zu den Vorgesetzten in der Schutztruppe bleiben diese Mannschaften in dem durch die allgemeinen Kriegsgesetze bestimmten Unterordnungsverhältnis. Behufs baldtunlichsten Antritts gegen dieselben verfügter Strafen ist, wo erforderlich, eine Vereinbarung mit dem zuständigen Zivilverwaltungsbeamten herbeizuführen. Auch ist vor Verhängung der Strafe tunlichst die Ansicht desselben über die allgemeine dienstliche Führung des betreffenden Mannes zu hören. Mannschaften des Beurlaubtenstandes werben die Bezirkshauptleute direkt an und melden lediglich die betreffenden Namen dem Gouvernement. Behufs Herbeiführung einer gewissen Gleichmäßigkeit wird jedoch der ungefähre Inhalt der mit diesen Leuten abzuschließenden Kontrakte seitens der letztgenannten Behörde vorgeschrieben. Die Eingeborenen werden sowohl von den Bezirkshauptleuten wie von den Distriktschefs direkt angeworben. (Vgl. Instruktion betr. Einstellung, Bestrafung usw. eingeborener Soldaten und Polizisten vom 30. Juni 1899, J. Nr. 1606.) Die Zahl sowohl der weißen wie der farbigen Polizisten wird durch besondere Verfügung des Gouverneurs festgesetzt. In Beziehung auf letztere gilt als Grundsatz, daß sie, soweit die Etatsmittel reichen, bis zur Hälfte der Anzahl der weißen Mannschaften betragen darf.
§ 11. In bezug auf Bewaffnung und Bekleidung der Polizeitruppe, desgleichen in bezug auf deren Ausrüstung mit Reit-, Zugtieren und Fahrzeugen ist der Truppenkommandeur zuständig und verantwortlich. Der bezügliche Schriftwechsel mit den Distriktsverwaltungen geht indessen gleichfalls durch die Hände der Bezirkshauptmannschaften (§ 9). Als Grundsatz gilt, daß jeder Bezirkshauptmannschaft und jedem Distriktskommando je ein Wagen oder eine Karre mit den nötigen Zugtieren nebst eingeborenem Personal zusteht. Ferner ist, soweit der Etat reicht, zu erstreben, daß die Bezirkshauptleute und Distriktschefs mit je 3, jeder weiße Polizist mit je 2 und jeder eingeborene Polizist mit 1 Pferde ausgestattet wird.
Verhalten zu Weißen und Eingeborenen.
§ 12. Mit dem Kapitän sowie den Missionaren und sonstigen angesehenen Weißen ihres Bezirks haben die Bezirkshauptleute, die Distrikts- und Stationschefs fortlaufend gute persönliche Beziehungen zu unterhalten.
[S. 556] Detachierte Feldkompagnien.
§ 13. Falls in dem Bereich einer Bezirkshauptmannschaft eine Feldkompagnie garnisoniert, so hat, abgesehen von Windhuk, der Bezirkshauptmann das Recht, dieselbe zu politischen Zwecken zu requirieren. Dieser Requisition ist seitens des Kompagniechefs, sofern zwingende militärische Gründe nicht entgegenstehen, Folge zu geben. Im übrigen ist der Kompagniechef in seinen militärischen Maßnahmen dem Bezirkshauptmann gegenüber selbständig. In ihren Schriftwechsel mit den vorgesetzten Behörden, soweit solcher vom politischen, militärischen und wirtschaftlichen Standpunkte aus wichtig erscheint, haben sich Bezirkshauptmann und Kompagniechef gegenseitig Einsicht zu gewähren.
§ 14. Falls der Kompagniechef zugleich die Geschäfte des Bezirkshauptmanns wahrnimmt, gelten für ihn die Bestimmungen des § 13 sinngemäß. Im übrigen ist auch in diesem Falle die Trennung zwischen Feld- und Polizeitruppe beizubehalten. In den militärischen Angelegenheiten bleibt der Kompagniechef dem Kommando der Feldtruppe (stellvertr. Truppenkommando) unterstellt, als Bezirkshauptmann dagegen dem Gouvernement. Demgemäß hat derselbe auch zu berichten. Die Disziplinarstrafgewalt sowie die gerichtsherrlichen Befugnisse des Kompagniechefs regeln die bezüglichen Allerhöchsten Verordnungen vom 26. Juli 1896 (vgl. auch Verfügung des Gouvernements vom 3. Juni 1897, Nr. 773 M. B.).
§ 15. Die Zahl der eingeborenen Soldaten kann auch bei den Feldkompagnien, soweit der Etat dies gestattet, die Hälfte der Anzahl der weißen Mannschaften erreichen. Bezüglich der Grundsätze für deren Anwerbung und Behandlung wird auf die obengenannte Instruktion vom 30. Juni 1899 sowie auf die Verfügung des Gouvernements vom 27. Juli 1896, Nr. 1255 C. B., verwiesen. Die Zahl der Pferde beträgt — soweit die Etatsmittel reichen — für jeden Offizier 3, für jeden Reiter 1 pro Kopf, außerdem pro Kompagnie und Batterie je 3 Wagen und 1 Karre nebst Gespann. Die Pferde wie auch diejenigen der Polizeidistrikte (§ 11) sind während der Sterbezeit auf Sterbeposten zu verbringen. Ausgenommen hiervon sind die unbedingt nötigen Gebrauchspferde, denen indessen während dieser Zeit tunlichst Stallfütterung zuteil werden muß. In den von der Sterbe besonders heimgesuchten Bezirken usw. treten während der Sterbezeit an Stelle der Pferde tunlichst Reitochsen und Maulesel. Für richtige Durchführung dieser Bestimmung sind die betreffenden Befehlshaber persönlich verantwortlich.
Mannschaften des Beurlaubtenstandes.
§ 16. Für die Mannschaften des Beurlaubtenstandes fungieren die Distriktsverwaltungen als Meldeämter, während die Kontrolle selbst durch den Truppenkommandeur ausgeübt wird. Diejenigen Bezirkshauptmannschaften, in welchen Feldkompagnien stehen, bilden indessen einen Kontrollbezirk für sich, in welchem der Kompagniechef im Auftrage des Truppenkommandeurs über die Wehrpflichtigen gemäß Allerhöchster Verordnung vom 30. März 1897 nebst Zusatzbestimmungen des Gouvernements die Kontrolle ausübt. Im Falle des Ausbruchs kriegerischer Unruhen in größerem Maßstabe in seinem oder in der Nähe seines Bezirks zieht der Kompagniechef die Offiziere und Mannschaften des Beurlaubtenstandes seines Bezirks ein und wartet — falls die Umstände ihm kein anderes Verhalten vorschreiben — nach Meldung des Veranlaßten in seiner Garnison weitere Befehle ab. Daß die für Einkleidung, Bewaffnung usw. der[S. 557] beurlaubten Mannschaften erforderlichen Vorräte vorhanden sind, dafür trägt der Kompagniechef die Verantwortung. Die Regelung des Proviantwesens behält sich das Gouvernement vor, doch hat auch der (stellvertretende) Truppenkommandeur die Pflicht, rechtzeitig auf einen etwaigen Fehlbetrag bei einer Feldkompagnie aufmerksam zu machen.
Erwerbung von Landeskenntnissen.
§ 17. Die in einem Bezirk stehenden Angehörigen der Truppe wie Polizisten haben sich fortgesetzt über dessen Wege-, Wasser- und Weideverhältnisse zu orientieren. In allen unter deutscher Verwaltung stehenden Bezirken muß die Feldtruppe operieren können, ohne sich außerhalb der Truppe und Polizei stehender Führer bedienen zu müssen. In jedem Bureau, einschließlich derjenigen der Polizeistationen, müssen stets genaue Wege- usw. Karten des betreffenden Verwaltungsbezirks zu finden sein.
Allgemeines.
§ 18. Die Bezirkshauptmannschaften haben das Recht, diese Instruktion, wo erforderlich, für die Distriktsverwaltungen vom lokalen Standpunkte aus zu ergänzen, desgleichen das Kommando der Feldtruppe (stellvertr. Truppenkommando) für die detachierten Feldkompagnien. Mit ihr sind alle entgegenstehenden Bestimmungen, insbesondere der bisherige Entwurf dieser Instruktion vom 18. Februar 1899, die Instruktion für die 3. Feldkompagnie vom 29. August 1897 sowie sämtliche noch vorhandenen Instruktionen für die bisherigen Distriktskommandos aufgehoben. Einzig ausgenommen hiervon ist die Instruktion für den Distrikt Gobabis, welcher in Ansehung der dort vorliegenden besonderen Verhältnisse bis auf weiteres noch Militärdistrikt bleibt und dem Gouvernement (Truppenkommando) direkt untersteht.
Windhuk, den 1. Mai 1900.
Der Kaiserliche Gouverneur.
gez. Leutwein.
Anhang.
Als solcher gilt zu vorstehender Instruktion:
Anlage 1.
Anhang zur Instruktion für die Bezirkshauptleute und Distriktschefs vom 18. Februar 1899 (in Druckexemplaren an sämtliche Dienststellen versendet).
Anlage 2.
Auszug aus einer Rundverfügung vom 5. April 1900, M. B., wie folgt:
Da es infolge der geringen Anzahl der Beamten des Schutzgebietes nicht zu vermeiden ist, daß der diesseitige Verwaltungs-, Polizei- und Zolldienst durch die Schutztruppe mitbesorgt und daher auch eine gewisse Anzahl von Offizieren zum Verwaltungsdienste abkommandiert werden muß, war es erforderlich, zwischen diesen und den Zivilverwaltungsbeamten in bezug auf das gegenseitige amtliche Verhältnis eine bestimmte Regelung zu schaffen. Eine solche ist mit § 9 der Instruktion vom 18. Februar v. Js. versucht worden. Dieser Paragraph ist von der Voraussetzung ausgegangen, daß die Stellen der Bezirkshauptleute und Distriktschefs sowohl durch Offiziere wie durch Beamte wahrgenommen werden können. Wenn bis jetzt beide Stellungen in überwiegender Anzahl in militärischen Händen gewesen sind, so kann dies durchaus nicht als feststehende Regel gelten.
usw. usw.
Will man das Schutzgebiet nicht in eine unendliche Menge selbständiger Kreise zersplittern, ein Modus, welcher die Verwaltung desselben unendlich erschweren würde, so ist nicht zu vermeiden, daß eine gewisse Anzahl Kreise (Distrikte) zu einem größeren Kreise (Bezirkshauptmannschaft) vereinigt wird. An die Spitze des letzteren müssen selbstredend die älteren der zur Verfügung stehenden Verwaltungsbeamten, gleichviel ob Zivil- oder Militärpersonen, treten. Das meist höhere Lebensalter der Assessoren und sonstiger hierzu geeigneter Zivilbeamten bringt es daher mit sich, daß diesen sowie den Hauptleuten der Schutztruppe in der Regel die Verwaltung der Bezirkshauptmannschaften zufällt, während den im jüngeren Lebensalter stehenden Oberleutnants und Leutnants der Truppe die Distriktschefsposten überlassen bleiben. Indessen ist dies durchaus keine feststehende Regel und muß vielmehr von Fall zu Fall stets von neuem entschieden werden.
usw.
(L. S.) gez. Leutwein.
Anlage 2.
Windhuk, den 2. Januar 1899.
Der Kolonial-Abteilung lege ich beifolgend eine vorläufige Verordnung, betreffend die Gerichtsbarkeit gegen die Eingeborenen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, gehorsamst vor. Die Gründe, die zu derselben geführt haben, gehen aus dem in Abschrift gleichfalls mitfolgenden bezüglichen Anschreiben an die Bezirkshauptmannschaften hervor. Sie sind äußerst dringender Natur, und glaube ich daher, mit Erlaß dieser Verordnung nicht zögern zu dürfen.
Ich verkenne nicht, daß sich an der Zuständigkeit des Gouverneurs zum Erlaß einer derartigen Verordnung Zweifel erheben lassen, da mit Rücksicht auf die Allerhöchste Verordnung vom 25. Februar 1896 (Kolonialgesetzgebung Seite 213) lediglich der Herr Reichskanzler direkt hierzu befugt erscheint. Indessen sind ähnliche Verordnungen auch bereits für Ost-Afrika und die Marshall-Inseln erlassen, die ersteren veröffentlicht in der Sammlung der Kolonialgesetzgebung Band II, Seite 40 und 41, die letzteren in Band I, Seite 625 und 626. Mit Rücksicht hierauf sowie auch auf das zustimmende Gutachten des hiesigen Kaiserlichen Richters glaubte ich mich wenigstens vorläufig zur Erlassung fraglicher Verordnung für zuständig, und bitte für sie nachträglich um hohe Genehmigung.
Im übrigen aber ist, wenn wir in der angeregten Sache ruhig weiter zusehen, gewiß Gefahr im Verzuge. Die Eingeborenen verhalten sich gerade in bezug auf das Schuldenmachen sowie in bezug auf Verschleuderung des Stammesvermögens wie unmündige Kinder. Aber auf der anderen Seite sind auch die Händler nicht immer als böswillige Kreditgeber anzusehen. Dieselben sind vielmehr häufig nicht in der Lage, sich dem Drängen der Eingeborenen auf Kredit zu entziehen. In dieser Richtung wird daher die Verordnung beiden Teilen zu Hilfe kommen. Dagegen gibt es aber gewiß auch Händler, die lediglich in der Sucht, Geschäfte zu machen, den Eingeborenen in der leichtsinnigsten Weise Kredit gewähren, darauf bauend, daß behufs Eintreibung der hierdurch entstandenen Schulden die Regierung schließlich doch hilfreiche Hand reichen müsse. Erwägt man nun, zu welch ungeheuren Preisen die Händler ihre Waren gerade an die Eingeborenen abzusetzen pflegen, so läßt sich ermessen, wie rasch es mit dem Stammesvermögen der Eingeborenen zu Ende gehen muß, und welche Menge von Land sich schließlich in den Händen der großen Firmen vereinigen muß. Denn als wirkliches Vermögen besitzt der einzelne Eingeborene lediglich seinen zur Zeit durch die Rinderpest hart mitgenommenen Viehbestand, während als gemeinsames Stammesvermögen nur Land zu gelten vermag. Während — abgesehen von den Namas — die Eingeborenen den Viehbestand ängstlich festhalten, sehen sie dem Übergang des Landes in die Hände[S. 560] ihrer Gläubiger stumpfsinnig zu, nicht ahnend, daß der Bestand des Viehes von demjenigen der Weide mit abhängig ist. Sind dieselben indessen dereinst wieder in ihrem Viehbesitz erstarkt, dann werden sie Hilfe bei der Regierung suchen oder — was bei den Hereros bestimmt zu erwarten ist — mit ihren Viehherden einfach die abgetretenen Farmen überschwemmen, was dann auf der anderen Seite wieder Klagen der Weißen bei der Regierung zur Folge haben wird.
Was insbesondere die Einklagung alter Schulden betrifft, so ist es geradezu unglaublich, welcher Mißbrauch mit dieser Sache getrieben wird. Es werden Schulden eingeklagt, die bereits 10 bis 15 Jahre zurückdatieren. Da ist es denn ganz unmöglich, deren Richtigkeit zu kontrollieren; während die Eingeborenen zwar auch Genaueres nicht mehr wissen, aber ehrlich genug sind, nicht in Abrede zu stellen, daß sie in der fraglichen Zeit mit dem betreffenden Händler überhaupt Geschäfte gemacht hätten. Um nur ein Beispiel zu erwähnen, so wurde das jetzige Stationshaus in Bethanien seinerzeit seitens des dortigen Kapitäns einem englischen Händler für 6000 Mark zum Verkauf angeboten. Sofort hatte der letztere zur Deckung des Kaufpreises eine alte Schuld von gleicher Höhe zur Hand. Als dann die Regierung den Kaufpreis für zu niedrig erklärte und denselben auf 20000 Mark festsetzte, präsentierte der Händler umgehend eine weitere alte Schuldforderung von 14000 Mark. Ferner werden jetzt nach dem Tode des Kapitäns Manasse von Omaruru seitens der dortigen Händler alte Schulden des letzteren angemeldet und Bauplätze für dieselben verlangt. Sonach liegt die Gefahr vor, daß die noch kommenden weißen Ansiedler ihre Baugrundstücke daselbst nicht direkt von den Eingeborenen, sondern zu unverhältnismäßigen Preisen von den Storebesitzern werden kaufen müssen. Der gleiche Prozeß scheint sich in Okahandja zu vollziehen, nachdem die Gewißheit besteht, daß genannter Platz durch die Eisenbahn berührt werden wird.
Endlich sei noch erwähnt, daß es hier Firmen gibt, die schon 100000 ha Land besitzen. Eine derselben bietet im »Windhuker Anzeiger« bereits Farmen zum Verkauf aus. Solche Verhältnisse fördern gewiß nicht die wirtschaftliche Entwicklung des Schutzgebiets.
Wenn ich schließlich beantrage, daß auch die bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, insoweit Eingeborene die Beklagten sind, den Händen des Kaiserlichen Richters entzogen und den Verwaltungsbehörden überwiesen werden, so habe ich hierfür triftige Gründe. Ein Richter, der nicht zugleich Verwaltungsbeamter ist, besitzt naturgemäß die Neigung, lediglich nach seinen heimischen Rechtsgrundsätzen zu urteilen, während, soweit Eingeborene mitbeteiligt sind, bei Rechtsstreitigkeiten auch wirtschaftliche bzw. politische Erwägungen eine Rolle zu spielen haben. Und in bezug auf letztere sind die Verwaltungsbehörden mehr kompetent sowie auch mehr geneigt, denselben Rechnung zu tragen, da etwaige unliebsame Folgen mit auf sie zurückfallen.
Der Kaiserliche Gouverneur.
Leutwein.
Verordnung,
betreffend die Gerichtsbarkeit über die Eingeborenen des Schutzgebiets
einschließlich der Bastards in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten.
Auf Grund des § 11 des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzgebiete, vom 15. März 1888 wird für den Umfang des südwestafrikanischen Schutzgebiets verordnet, was folgt:
§ 1. Forderungen gegen Eingeborene, die von dem Tage der Verkündung dieser Verordnung ab dadurch entstanden sind, daß an dieselben Waren auf Kredit gegeben wurden, sind nicht mehr klagbar. Ausgenommen hiervon sind nur Forderungen, die dadurch entstanden sind, daß in Fällen eines nachweislich dringenden Bedürfnisses Nahrungsmittel (außer alkoholhaltigen Getränken) auf Kredit verabfolgt worden sind.
§ 2. Die Entscheidung bürgerlicher Rechtsstreitigkeiten zwischen Weißen und Eingeborenen, insoweit letztere Beklagte sind, wird den Verwaltungsbehörden des Schutzgebiets übertragen.
Zuständig sind die Bezirkshauptleute, welche die ihnen zustehenden Befugnisse an die Distriktschefs ihres Bezirks übertragen können.
Zu den Verhandlungen ist in Gemäßheit der abgeschlossenen Schutzverträge und in sinngemäßer Anwendung des § 13 der Verfügung des Reichskanzlers vom 22. April 1896 (»Kolonial-Blatt« 1896 Seite 241 ff.) stets ein Eingeborener als Beisitzer hinzuzuziehen.
§ 3. Insoweit bei Verkündigung dieser Verordnung bürgerliche Rechtsstreitigkeiten mit Eingeborenen bei den zur Ausübung der Gerichtsbarkeit erster Instanz ermächtigten Beamten anhängig sind, werden sie noch von diesen erledigt.
§ 4. Diese Verordnung tritt überall mit dem Tage ihrer Verkündigung in Kraft.
Windhuk, den 1. Januar 1899.
Der Kaiserliche Gouverneur.
gez. Leutwein.
Rundschreiben an sämtliche Bezirkshauptmannschaften.
Windhuk, den 31. Dezember 1898.
Mittels Verfügung vom 27. August d. J. Nr. 5837 und vom 29. Oktober d. J. Nr. 7917 habe ich das Verfahren in bezug auf Einklagung alter Schulden gegen Eingeborene von seiten weißer Händler zu regeln gesucht. Einzelne seitdem vorgekommene besondere Fälle haben mich nunmehr veranlaßt, die bezüglichen Bestimmungen der Schutzverträge zum Vergleich heranzuziehen. Es ergab sich, daß durch die letzteren die einschlägigen Verhältnisse in ganz verschiedener Weise geregelt sind, nach ihnen sollen »Streitigkeiten« zwischen Weißen und Eingeborenen — meist ist hinzugefügt »krimineller und ziviler Natur« — wie folgt, geregelt werden:
1. Durch »den von Sr. Majestät hierzu berufenen Vertreter im Verein mit einem Beisitzer des betreffenden Kapitäns«: In den Verträgen mit Bethanien und den Herero-Kapitänen von Okahandja und Omaruru.
2. Desgleichen, aber ohne eingeborenen Beisitzer: In den Verträgen mit den Kapitänen von Warmbad, der Veldschoendrager und von Bersaba.
3. Durch das Kaiserliche Gericht mit Beisitzern des Kapitäns: In dem Vertrage mit Kapitän Witbooi und den Bastards von Rehoboth.
4. Desgleichen, aber ohne eingeborenen Beisitzer: In dem Vertrage mit dem Kapitän von Gochas.
Schließlich ist in einem Vertrage, und zwar in demjenigen mit dem Kapitän von Hoachanas, festgesetzt, daß die Regelung dieser Sache »später« erfolgen soll.
Inzwischen ist durch Verordnung des Herrn Reichskanzlers vom 22. April 1896 das Gerichtsverfahren in bezug auf die Eingeborenen, soweit dasselbe »krimineller Natur« ist, für das ganze Schutzgebiet einheitlich geregelt. Es erübrigt daher nur noch die einheitliche Regelung auch in Beziehung auf das zivilrechtliche Verfahren. Daß solches für das Schutzgebiet gleichfalls einheitlich geschehen muß, läßt sich auf die Dauer nicht mehr abweisen.
Wie bereits in meiner Verfügung vom 27. August d. J. ausgeführt, haben sich in neuerer Zeit die Fälle, in denen weiße Händler sehr alte Schulden gegen Eingeborene eingeklagt haben, in auffallender Weise gemehrt. Und zwar richten sich diese Einklagungen in der Regel nicht gegen den einzelnen eingeborenen Schuldner, sondern gegen dessen ganzen Stamm, mit dem Ziel, durch Landkonzessionen eine Begleichung der Schuld zu erwerben. Bis jetzt sind das Gouvernement sowie die übrigen Verwaltungsbehörden des Schutzgebiets hierbei vermittelnd eingetreten und haben in der Regel einen Ausgleich zwischen beiden Teilen zu erzielen vermocht. Die Folge war indessen, daß Landstrecken von besorgniserregender Höhe allmählich in die Hände der Storebesitzer übergegangen sind und nicht der wirtschaftlichen Entwicklung des Schutzgebiets dienen, sondern zu Spekulationszwecken geworden sind. Dieser Zustand erscheint um so unhaltbarer, als nach so langer Zeit die Richtigkeit der betreffenden Schuldforderungen sich schwer kontrollieren läßt und die in solchen Dingen wenig bewanderten Eingeborenen sich leicht übervorteilen lassen. Ferner vermag die Gewißheit, bei der Regierung stets hilfreiche Hand zu finden, zum leichtsinnigen Gewähren neuen Kredits an die in dieser Beziehung unverständigen Kindern gleichenden Eingeborenen zu verleiten. Die Folge würde der Fortgang des Prozesses des Übergangs des Landes in tote Hand sein. In absehbarer Zeit müßte aber auch der Fall eintreten, daß die Eingeborenen-Reservate nicht mehr genügten, woraus sich für die Regierung schwere Unzuträglichkeiten ergeben würden.
Zur Verhinderung der Gewährung neuer Kredite habe ich daher die beifolgende Verordnung erlassen, die ich in dem dortseitigen Bezirk in Kraft zu setzen bitte. Was dagegen die Einklagung alter Schulden betrifft, so verjähren nach den Grundsätzen des Preußischen Landrechts, insbesondere nach § 1 des Gesetzes wegen Einführung kürzerer Verjährungsfristen vom 31. März 1838 alle Forderungen von Kaufleuten nach zwei Jahren in der Weise, daß der Beklagte den Einwand der Verjährung erheben kann und alsdann die Forderung nicht mehr klagbar ist. Nach diesem Grundsatze ist künftig auch im Schutzgebiete zu verfahren und zutreffendenfalls der eingeborene Beklagte zu belehren.
Bei Eingehung neuer Verbindlichkeiten hat der betreffende Gläubiger stets nur einen Anspruch gegen denjenigen Eingeborenen, der diese Verbindlichkeiten übernommen hat. Ist dieser, wie solches bei den einzelnen Eingeborenen wohl die Regel,[S. 563] ohne Vermögen, so kann der Kapitän deswegen nicht in Anspruch genommen und dazu angehalten werden, mit dem Stammesvermögen für den Schuldner einzutreten.
Vorstehendes ersuche ich in geeigneter Weise sowohl den Händlern wie auch den Kapitänen und deren Leuten bekanntzugeben. Beide sind dringend zu warnen, und zwar die ersteren vor leichtsinnigem Kreditgeben, die letzteren vor leichtsinnigem Kreditnehmen. Den ersteren ist außerdem klarzumachen, daß die Kaiserliche Regierung nicht in der Lage sei, fortgesetzt für sie die Stelle eines Gerichtsexekutors zu übernehmen, noch auch dem gewaltsamen Ruin der Eingeborenen zuzusehen. Indessen auch die Kaufleute werden bei der nunmehr geschaffenen Sachlage ihre Rechnung finden, wenn sie es verstehen, sich unter Hinweis auf die neue Verordnung auf Kredit drängende Eingeborene vom Leibe zu halten.
Der Kaiserliche Gouverneur.
gez. Leutwein.
Windhuk, den 4. Februar 1901.
Nachdem seit meiner mit Bericht vom 22. Februar 1899 eingereichten Bekanntmachung desselben Datums[165] zwei Jahre verstrichen sind, ist die den Kaufleuten gegebene Frist, ihren den Eingeborenen gewährten Kredit einzuschränken, für genügend zu erachten. Tatsächlich sind auch die besonnen und solide geleiteten Geschäfte der in der Bekanntmachung ausgesprochenen Warnung nachgekommen. Dagegen sind gerade in der letzten Zeit seitens der lokalen Verwaltungsbehörden vielfache Klagen laut geworden, daß die Kreditgewährung an Eingeborene neuerdings bei solchen Kaufleuten wieder zunehme, die ohne eine gesunde Geschäftsgrundlage nur darauf ausgehen, durch gewissenlose Ausbeutung der Eingeborenen sich mühelos zu bereichern, ja daß sogar Geschäfte im Vertrauen darauf, daß die suspendierte Verordnung vom 1. Januar 1899 nicht mehr in Kraft gesetzt werden würde, neu aufgetan würden. Ich halte daher den Zeitpunkt für gekommen, die Klaglosigkeit der mit Eingeborenen geschlossenen Kreditgeschäfte allgemein einzuführen und beehre mich, den anliegenden Entwurf mit der gehorsamen Bitte zu überreichen, entweder selbst eine dementsprechende Verordnung für das hiesige Schutzgebiet zu erlassen oder mich zu ihrem Erlasse besonders zu ermächtigen.
Im einzelnen sei mir gestattet, zur Rechtfertigung der Abweichungen des Entwurfes von der Verordnung vom 1. Januar 1899 folgendes anzuführen: Die Ausnahme zugunsten der Frachtfahrer (§ 1) hat sich als notwendig erwiesen. Bei den infolge des ungünstigen Geländes dem Transport sich entgegenstellenden Schwierigkeiten ist die Dauer einer Reise im voraus schwer zu berechnen. Der Frachtfahrer kann daher unverschuldeterweise in die Lage kommen, daß die zur Beendigung seines Transportes notwendigen Mittel vor der Zeit aufgebraucht sind. Ihm die Möglichkeit zum Ersatze zu gewähren, liegt im Interesse des Verkehrs. Als Zeitpunkt des allgemeinen Inkrafttretens erlaube ich mir den 1. Januar 1902 vorzuschlagen.
Der Kaiserliche Gouverneur.
Leutwein.
An das Auswärtige Amt, Kolonial-Abteilung, Berlin.
Entwurf.
Verordnung,
betreffend die Gerichtsbarkeit über die Eingeborenen des südwestafrikanischen
Schutzgebiets in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten.
Auf Grund der Allerhöchsten Verordnung vom 25. Februar 1896 wird für den Umfang des südwestafrikanischen Schutzgebiets folgendes bestimmt:
§ 1. Gegen Eingeborene sich richtende Forderungen, die vom Tage des Inkrafttretens dieser Verordnung ab dadurch entstanden sind, daß an Eingeborene Waren auf Kredit gegeben wurden, sind nicht mehr klagbar.
Keine Anwendung findet diese Bestimmung auf Forderungen, die dadurch entstanden sind, daß Nahrungsmittel — mit Ausnahme von alkoholhaltigen Getränken — oder daß Frachtfahrern zum Zwecke des Frachtfahrens notwendige Gegenstände auf Kredit verabfolgt worden sind.
§ 2. Die Entscheidung bürgerlicher Rechtsstreitigkeiten zwischen Weißen und Eingeborenen, insoweit letztere Beklagte sind, wird den Bezirkshauptleuten übertragen. Diese sind berechtigt, ihre Befugnisse den Distriktschefs ihres Bezirks zu übertragen.
Zu den Verhandlungen soll ein Eingeborener (Kapitän oder Großmann) als Beisitzer zugezogen werden.
§ 3. Wenn der Wert des Streitgegenstandes 500 Mark übersteigt, ist jede Partei berechtigt, binnen einem Monate, nachdem ihr die Entscheidung bekannt gegeben ist, Berufung einzulegen. Zuständig in zweiter Instanz ist der Gouverneur oder der von ihm beauftragte Beamte.
§ 4. Die Verordnung tritt am ....... in Kraft.[166]
Zu den Kommissionsbeschlüssen des Kolonialrats.
Berlin, den 8. März 1903.
Ein an solide und zahlungsfähige Eingeborene gegebener Kredit führt durchaus nicht zu Unzuträglichkeiten, nur der an zahlungsunfähige Eingeborene in leichtfertiger Weise, oft auch geradezu mit Zwang gegebene Kredit. Zu den leichtsinnigen Schuldenmachern unter den Eingeborenen gehört z. B. in erster Linie der Oberhäuptling der Hereros Samuel Maharero, mit einem Teil seiner Großleute.
Hat der Eingeborene keine Mittel zum Anschaffen von Kleidern, so soll er, wie in früheren Zeiten, mit einem Lendenschurz gehen, hat er keine Mittel zum Anschaffen von Kaffee und Tabak, so soll er sich mit Milch und Feldkost begnügen. Hat derselbe dagegen diese Mittel, so liegt es allerdings im Interesse unserer Kolonisationsarbeit, wenn er sie auf das Anschaffen europäischer Bedarfsartikel verwendet. Hier den richtigen Mittelweg zu finden, muß der Händler lernen. Er muß dem zahlungsunfähigen Eingeborenen überhaupt den Kredit versagen, dem zahlungsfähigen dagegen nur in denjenigen Fällen Kredit geben, in denen dieser seine Gegenwerte aus irgend einem[S. 565] Grunde zufällig nicht zur Stelle hat. Man kann den eingeborenen Käufer nicht mit einem Weißen vergleichen. Der letztere arbeitet und hat Verdienst. Er kann daher vielleicht in einigen Wochen die Mittel zum Kaufen besitzen, die ihm heute fehlen. Auch kann er mit Befriedigung seiner Bedürfnisse nicht lange warten. Der Eingeborene dagegen kann dies. Der Weiße braucht daher den Kredit. Der auf seiner Werft untätig sitzende Eingeborene wird auch nach Ablauf von Wochen oder Monaten nicht mehr Mittel besitzen als zur Zeit des Kaufes. Ein solcher Eingeborener muß daher gezwungen werden, seine Bedürfnisse so lange zu vertagen, bis er die Mittel zu deren Befriedigung besitzt, oder aber seine Wünsche ganz aufzugeben. Dann wird unser Handel mit den Eingeborenen auf gesunde Grundlage gestellt sein, und der Kaufmann, der sich gegenwärtig häufig mit totem Kapital, d. h. Land belasten muß, wird seine Mittel flüssig halten. Dieses Ziel zu erreichen, war der Zweck der Kreditverordnung.
Ich erhebe nicht den Anspruch, mit meiner vorgelegten Kreditverordnung den allein gangbaren Weg gefunden zu haben. Ich bin daher gern bereit, mich den jetzt vorgelegten Kommissionsbeschlüssen so weit wie nur angängig zu nähern. Im Anschluß an dieselben gestatte ich mir daher folgende Vorschläge:
1. Für den an Eingeborene gegebenen Kredit soll die Verjährungsfrist ein halbes Jahr betragen. Um den Behörden eine nachträgliche Kontrolle zu ermöglichen, hat der Verkäufer dem Käufer sofort eine Rechnung auszustellen.
2. Zur Befriedigung von Schulden einzelner darf Stammesvermögen überhaupt nicht in Anspruch genommen werden. Die Worte »mit Genehmigung des Gouverneurs« bitte ich zu streichen, da dieselben eine ganze Flut von Reklamationen zur Folge haben würden. Es ist besser, gleich reinen Tisch zu schaffen, dann weiß jeder, woran er ist.
3. Bei den geringen Beständen der Eingeborenen an persönlichen Habseligkeiten können Lebensmittel und Proviant überhaupt vom Pfänden ausgenommen werden. Muttervieh dagegen in einer Höhe, die nur an Ort und Stelle festgestellt werden kann.
4. Rechtsgeschäfte, die zur Umgehung dieser Vorschriften abgeschlossen werden, sind ungültig. Auch hier bitte ich im Interesse der Klarheit die Worte »eventuell sind solche Geschäfte, wenn sie zur Abtretung oder Sicherung bestehender Forderungen abgeschlossen werden, nur mit Genehmigung des Gouverneurs gültig« zu streichen. Denn diese würden nur wieder Tür und Tor zur Umgehung der ganzen Verordnung öffnen.
Wenn der Ausschuß darin einig war, »daß die Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten nach Rechtsgrundsätzen erfolgen müsse, nicht nach wirtschaftlichen oder politischen Erwägungen, eine Abneigung gegen eine streng juristische Rechtsprechung sei nicht zu billigen, zumal der Eingeborene ein ausgeprägtes Gefühl für Recht besitze«, so kann ich auf Grund meiner an Ort und Stelle gesammelten persönlichen Erfahrungen dieser Auffassung nicht beitreten. Wohl besitzt der Eingeborene ein gewisses Rechtsgefühl, aber nur in seinem Sinne, nicht im Sinne der deutschen Zivilprozeßordnung. Für Gerichtsbeschlüsse mit nachfolgender Pfändung durch einen Polizisten — Gerichtsvollzieher wird es für absehbare Zeit in Südwestafrika noch nicht geben — hat der Eingeborene kein Verständnis, wohl aber für die vermittelnde Tätigkeit seines ihm persönlich bekannten Verwaltungsbeamten, mit dem er auch in seinen sonstigen ihn betreffenden Angelegenheiten vielfach zu verhandeln hat. So gut wie der Herr Reichskanzler seine Gründe hatte, seinerzeit die Strafrechtspflege gegen die Eingeborenen nicht den Richtern, sondern dem Verwaltungsbeamten zu übertragen, so gut hatte ich meine Gründe zu dieser Maßnahme auch in bezug auf das Zivilprozeßverfahren. Vor allem muß so gut[S. 566] wie im Strafrecht, so auch im Zivilrecht die höchste Instanz für die Eingeborenen der Gouverneur bleiben. Denn letzterer trägt die Verantwortung für die Ruhe und Sicherheit in seiner Kolonie, während der Richter mit dieser Verantwortung nichts zu tun hat. Gerichtsbeschlüsse, deren Durchführung auf politische Bedenken stößt, werden die Verwaltungsbehörden eingedenk ihrer Verantwortlichkeit nicht durchführen, beziehungsweise der Gouverneur wird gezwungen sein, die Ausführung zu untersagen. Und über politische Bedenken kommen wir bei der hier vorliegenden Materie in Südwestafrika noch lange nicht hinweg. Es folgt dies schon aus der Art unserer Besitzergreifung mittels Schutzverträgen.
Endlich spricht auch noch die einer Behörde, namentlich dem wirtschaftlich Schwächeren gegenüber, obliegende Pflicht ausgleichender Gerechtigkeit für meinen Vorschlag. Der dem Eingeborenen schon an sich überlegene Weiße pflegt vor dem Richter auch noch mit einem Rechtsanwalt zu erscheinen. Einer solch rechtskundigen Partei steht der erstere hilflos gegenüber. Der Richter dagegen kann sich der Pflicht, den Ausführungen der gesetzeskundigen Partei zu folgen, nur schwer entschlagen. Rechnen wir hierzu noch die Schwierigkeit, die Forderungen des Weißen in bezug auf ihre Richtigkeit zu prüfen, so liegt die Befürchtung nahe, daß wir auf diesem Wege den Versuchen zur Ausbeutung der Eingeborenen durch weniger gewissenhafte Weiße Tür und Tor öffnen würden. Die Staatsgewalt würde dann vor die Wahl gestellt sein, entweder Gerichtsbeschlüssen die Unterstützung zu versagen, oder aber die Gefahren politischer Schwierigkeiten zugunsten derartiger Weißer mit in den Kauf zu nehmen. Ich schlage daher für diese Verordnung an Stelle der Kommissionsbeschlüsse folgenden Inhalt vor:
1. In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten zwischen Weißen und Eingeborenen entscheiden die Bezirksamtmänner, die diese Befugnis an die Distriktschefs übertragen können.
2. Bei einem Wertobjekt von über 300 Mark ist die Berufung an den Gouverneur zulässig, der entweder selbst oder durch einen von ihm zu beauftragenden Beamten entscheidet.
Sollte Wert darauf gelegt werden, daß der unter 2 genannte Beamte ein richterlicher sei, so würde ich bei der jetzt vorgeschlagenen Fassung keine Bedenken erheben, wenn das Wort »richterlich« ausdrücklich beigefügt wird.
Der Kaiserliche Gouverneur.
gez. Leutwein.
Verfügung des Reichskanzlers, betreffend Rechtsgeschäfte und Rechtsstreitigkeiten Nichteingeborener mit Eingeborenen im südwestafrikanischen Schutzgebiet.
Vom 23. Juli 1903.
Auf Grund des § 15 des Schutzgebietsgesetzes (Reichs-Gesetzbl. 1900, Seite 813) und der Allerhöchsten Verordnung, betreffend die Gerichtsbarkeit über die Eingeborenen in den afrikanischen Schutzgebieten, vom 25. Februar 1896 wird hiermit für den Bereich des Schutzgebiets Deutsch-Südwestafrika verfügt, was folgt:
§ 1. Verbindlichkeiten Eingeborener aus Rechtsgeschäften mit Nichteingeborenen erlöschen innerhalb eines Jahres nach Abschluß der Rechtsgeschäfte, es sei denn, daß vor Ablauf dieser Frist der Gläubiger bei der nach dieser Verfügung zuständigen Behörde Klage erhoben hat.
Abgesehen hiervon findet eine Unterbrechung oder Hemmung des Laufes dieser Frist nicht statt.
Die Klageerhebung gilt als nicht erfolgt, sobald der Gläubiger den Rechtsstreit einschließlich der Zwangsvollstreckung innerhalb einer ihm zu stellenden Frist fortzusetzen unterläßt.
Die Frist ist von der Behörde, bei der der Rechtsstreit schwebt, unter der Androhung zu stellen, daß ihre Versäumnis das Erlöschen des Anspruchs zur Folge haben werde.
§ 2. Ist die Verbindlichkeit des Eingeborenen gemäß den Vorschriften des § 1 erloschen, so ist der Nichteingeborene von dem Eingeborenen Rückgabe des Geleisteten nur insoweit zu verlangen befugt, als das Geleistete in einer nicht vertretbaren Sache besteht und sich noch im Vermögen des Eingeborenen befindet.
Eine Forderung auf Ersatz wegen Verlust oder Verschlechterung der Sache ist ausgeschlossen.
§ 3. Die Entscheidung über Ansprüche Nichteingeborener gegen Eingeborene liegt dem Bezirksamtmann ob, in dessen Bezirk der Eingeborene zur Zeit des Antrages auf die Entscheidung seinen Wohnsitz oder beim Fehlen eines solchen seinen Aufenthalt hat. Der Bezirksamtmann kann diese Befugnis auf die Distriktschefs seines Bezirks übertragen. Die Übertragung hindert den Bezirksamtmann nicht, jederzeit Geschäfte der betreffenden Art selbst wahrzunehmen.
Die Entscheidung ist schriftlich abzufassen, mit Gründen zu versehen und den Parteien bekannt zu machen.
Der Gouverneur ist ermächtigt, den im Absatz 1 bezeichneten Behörden allgemein oder im Einzelfall Anweisungen über das Verfahren zu erteilen.
§ 4. Übersteigt der Wert des Streitgegenstandes den Betrag von 300 Mark, so findet gegen die Entscheidung der im § 3 Absatz 1 bezeichneten Behörden innerhalb eines Monats Berufung an den Oberrichter statt.
Die Frist zur Einlegung der Berufung beginnt für jeden Teil mit dem Zeitpunkt, in dem ihm die Entscheidung bekannt gemacht ist.
§ 5. Abgesehen von dem Falle des § 4 Absatz 1 ist der Gouverneur ermächtigt, die Entscheidungen der ihm untergeordneten Behörden in Rechtsstreitigkeiten zwischen Nichteingeborenen und Eingeborenen von Amts wegen aufzuheben oder abzuändern.
§ 6. Die Bekanntmachung der Entscheidungen erfolgt nach den allgemeinen, für die Bekanntmachung von Entscheidungen der Verwaltungsbehörden bei Ausübung ihrer Zwangs- und Strafbefugnisse geltenden Vorschriften.
§ 7. Der Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen aus den nach §§ 3, 4, 5 ergangenen Entscheidungen unterliegen diejenigen Vermögensstücke der Eingeborenen nicht, die notwendig sind, um ihnen und ihren Familien die Möglichkeit des wirtschaftlichen Bestehens zu sichern.
Der Gouverneur ist ermächtigt, allgemeine Vorschriften darüber zu erlassen, inwieweit hiernach das Vermögen der Eingeborenen von der Zwangsvollstreckung ausgeschlossen ist.
§ 8. Für Verbindlichkeiten einzelner Eingeborener darf das Stammesvermögen von dem Gläubiger nicht in Anspruch genommen werden.
§ 9. Der Gouverneur ist ermächtigt, allgemeine Vorschriften über den Ansatz von Gebühren und Auslagen bei Rechtsstreitigkeiten zwischen Nichteingeborenen und Eingeborenen zu erlassen.
§ 10. Für die vor dem Inkrafttreten dieser Verfügung abgeschlossenen Rechtsgeschäfte zwischen Nichteingeborenen und Eingeborenen beginnt der Lauf der in § 1 Absatz 1 vorgeschriebenen Frist mit dem Tage des Inkrafttretens dieser Verfügung.
§ 11. Jede Vereinbarung, durch die eine Vorschrift dieser Verfügung abgeändert oder aufgehoben werden soll, ist nichtig.
Das gleiche gilt von einer Vereinbarung, wonach an einem nach § 7 der Zwangsvollstreckung entzogenen Gegenstande oder für Verbindlichkeiten einzelner Eingeborener am Stammesvermögen ein Pfandrecht oder ein Recht ähnlichen Inhalts begründet werden soll.
§ 12. Soweit Rechtsgeschäfte unbewegliche Sachen zum Gegenstande haben, finden die Vorschriften der §§ 1, 2, 10 dieser Verfügung keine Anwendung.
§ 13. Der Gouverneur bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verfügung.
Nach diesem Zeitpunkte finden die Verordnung des Gouverneurs, betreffend die Gerichtsbarkeit über die Eingeborenen des Schutzgebiets von Deutsch-Südwestafrika einschließlich der Bastards in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, vom 1. Januar 1899 sowie die Bekanntmachungen des Gouverneurs, betreffend Kreditgewährung an Eingeborene, vom 23. Februar 1899 und betreffend Klagen aus Kreditgeschäften gegen die Angehörigen des Stammes der Bastards vom 2. Oktober 1900 keine Anwendung.
Die Vorschriften der Schutzverträge über die Zuziehung eingeborener Beisitzer zu den Verhandlungen über Rechtsstreitigkeiten zwischen Eingeborenen und Nichteingeborenen bleiben von dieser Verfügung unberührt.
Norderney, den 23. Juli 1903.
Der Reichskanzler.
gez. Graf v. Bülow.
[S. 569] Anlage 3.
Bedingungen
für den öffentlichen Verkauf von Regierungsfarmen.
§ 1. Sind für eine Regierungsfarm mehrere Bewerber vorhanden, so wird dieselbe zur öffentlichen Versteigerung gebracht. Andernfalls erfolgt der Verkauf freihändig zu einem Preise von mindestens 0,50 bis 1 Mark für den Hektar (Kapschen Morgen).
§ 2. Der Zuschlag wird nach Wahl des Kaiserlichen Gouvernements einem der drei Höchstbietenden erteilt, wenn das Gebot mindestens die Höhe von 0,50 bis 1 Mark für den Hektar (Kapschen Morgen) erreicht hat.
§ 3. Der Kaufpreis kann nach Wahl des Käufers in einer Summe auf dem Verkaufstermine oder in Teilzahlungen, die nicht weniger als je 1/10 des Kaufpreises betragen dürfen, entrichtet werden. Im letzteren Falle muß 1/10 des Kaufpreises am Tage des Kaufabschlusses bar bezahlt werden. Ein zweites Zehntel ist spätestens nach Ablauf eines Jahres, vom Tage des Kaufabschlusses an gerechnet, zu entrichten. Binnen 15 Jahren vom Verkaufstermine ab muß das Restkaufgeld getilgt werden. Vom zweiten bis zum zehnten Jahre sind in gleichen jährlichen Raten mindestens vier Zehntel desselben zu zahlen; die dann noch verbleibenden vier Zehntel verteilen sich in gleicher Weise auf die letzten fünf Jahre.
§ 4. Was vom Kaufgelde am Verkaufstage nicht bar bezahlt wird, ist von diesem Termine ab mit jährlich vier Prozent zu verzinsen.
§ 5. Die Zinsen sind in halbjährlichen oder jährlichen Raten im Laufe desjenigen Monats, in dem sie fällig werden, bei der Hauptkasse des Kaiserlichen Gouvernements von dem Schuldner einzuzahlen.
§ 6. Bis zur vollständigen Tilgung des Kaufpreises bleibt die Farm wegen des jeweiligen Kaufgeldrestes und der etwaigen Zinsen dem Kaiserlichen Gouvernement mit der Maßgabe verpfändet, daß der schuldige Betrag als erste Hypothek in das Grundbuch einzutragen ist.
§ 7. Der Käufer darf die Farm während eines Zeitraums von zehn Jahren vom Verkaufstermine ab ohne Zustimmung des Gouvernements nicht veräußern.
Das Gouvernement ist befugt, dieses Verbot durch Eintragung in das Grundbuch oder auf andere Weise Dritten gegenüber rechtswirksam zu machen.
§ 8. Auf Verlangen des Gouvernements hat der Käufer seine Farm auf seine Kosten und durch einen vom Gouvernement als geeignet bezeichneten Landmesser ver[S. 570]messen zu lassen, widrigenfalls das Gouvernement befugt ist, die Vermessung für Rechnung des Käufers vornehmen zu lassen.
§ 9. Der Käufer ist verpflichtet, mit der Bewirtschaftung der Farm spätestens innerhalb sechs Monaten vom Verkaufstermin ab zu beginnen. Innerhalb weiterer zwei Jahre muß der Käufer auf der Farm Vorkehrungen getroffen haben, die einen ordnungsmäßigen Betrieb derselben ermöglichen. Als ordnungsmäßig gilt hierbei ein solcher Betrieb, der unter Berücksichtigung aller in Betracht kommenden Verhältnisse den Anschauungen im Lande und den dortselbst bisher gemachten Erfahrungen entspricht. Das Gouvernement ist befugt, durch eine Kommission, die aus je einem Vertreter des Gouvernements und des Käufers und einem von beiden zu wählenden Obmann — im Nichteinigungsfalle dem zuständigen Bezirkshauptmann — bestehen soll, Erhebungen darüber anstellen zu lassen, ob der Käufer den in diesem Paragraphen erwähnten Verpflichtungen nachgekommen ist. Zu diesem Zwecke hat der Käufer der Kommission Zutritt zu der Farm und zu allen dortselbst errichteten Vorkehrungen zu gestatten.
§ 10. Kommt das Gouvernement auf Grund des Berichts der Kommission zu der Überzeugung, daß der Käufer seinen Verpflichtungen zu § 9 nachgekommen ist, so erhält der Käufer eine entsprechende Bescheinigung und finden dann weitere Besichtigungen der Farm durch die Kommission nicht mehr statt.
§ 11. Hat dagegen der Käufer mit der Bewirtschaftung der Farm nicht innerhalb der vorgeschriebenen Zeit begonnen, oder kommt das Gouvernement auf Grund des Berichts der Kommission zur Überzeugung, daß der Käufer den übrigen ihm in § 9 auferlegten Verpflichtungen nicht nachgekommen ist, so erläßt das Gouvernement an den Käufer die Aufforderung, binnen weiteren sechs Monaten mit der Bewirtschaftung der Farm zu beginnen, bzw. dortselbst die einen ordnungsmäßigen Betrieb ermöglichenden Vorkehrungen (§ 9) binnen einem weiteren Jahre herzustellen.
§ 12. Hat der Käufer auch die in § 11 festgesetzten Fristen verstreichen lassen, ohne mit der Bewirtschaftung der Farm begonnen zu haben, bzw. ohne den übrigen ihm in § 9 auferlegten Verpflichtungen nachgekommen zu sein, und trifft ihn in bezug auf die Versäumnis nach der einen oder anderen Richtung hin ein Verschulden, so fällt die Farm in das Eigentum des Gouvernements mit der Maßgabe zurück, daß der Käufer keinerlei Ansprüche wegen Ersatzes der bereits geleisteten Teilzahlungen oder der auf die Farm etwa gemachten Verwendungen hat. Die Entscheidung über die Frage, ob ein auf Grund dieses Paragraphen von dem Gouvernement geltend gemachter Anspruch begründet erscheint, erfolgt unter Ausschluß des Rechtsweges durch ein Schiedsgericht, das aus je zwei von den Parteien zu bezeichnenden Mitgliedern und einem von der letzteren zu wählenden Obmann, dessen Person im Nichteinigungsfalle von dem zuständigen Bezirkshauptmann bestimmt wird, besteht.
Zur Entscheidung wegen aller übrigen Meinungsverschiedenheiten, die zwischen dem Gouvernement und dem Käufer aus dem gegenseitigen Vertragsverhältnisse entstehen sollten, bleiben die ordentlichen Gerichte zuständig.
§ 13. Der Käufer und seine etwaigen Rechtsnachfolger haben für die Instandhaltung der Grenzmarken und der an öffentlichen Wegen liegenden, in das Farmgebiet fallenden Wasserstellen und für gute Zufahrtswege von dem Farmgehöft zu den nächsten öffentlichen Straßen Sorge zu tragen, widrigenfalls das Gouvernement nach vorheriger, ohne Erfolg gebliebener Warnung berechtigt ist, die betreffenden Anlagen auf Kosten des Käufers oder seiner Rechtsnachfolger vorzunehmen.
[S. 571] § 14. Die Auferlegung einer allgemeinen Grund- und Häusersteuer bleibt dem Kaiserlichen Gouvernement vorbehalten.
§ 15. Die Aufsuchung und Gewinnung von Mineralien auf den verkauften Farmen unterliegt den besonderen hierüber erlassenen oder zu erlassenden Vorschriften.
§ 16. Anzahlungen auf das Restkaufgeld im Betrage von mindestens 500 Mark können jederzeit direkt oder durch Vermittlung einer sonstigen Regierungskasse an die Hauptkasse des Kaiserlichen Gouvernements zu Windhuk geleistet werden.
Windhuk, den 1. August 1899.
Der Kaiserliche Gouverneur.
gez. Leutwein.
Vorzugsbedingungen für den Verkauf von Regierungsfarmen für wehrpflichtige Reichsangehörige.
§ 1. Es werden Farmen in einer Größe bis zu 5000 ha zum Preise von 30 Pf. für den Hektar zum Verkaufe gestellt. Hat das Gouvernement auf der Farm Meliorationen, wie Anlegung von Brunnen und Wegen u. dgl., vorgenommen, so wird der Selbstkostenpreis hierfür auf den Kaufpreis aufgeschlagen.
Sind für einen und denselben Platz mehrere Kauflustige vorhanden, so kann das Gouvernement eine öffentliche Versteigerung des fraglichen Platzes veranstalten. Der Zuschlag wird alsdann nach Wahl des Gouvernements erteilt. Wird hiernach der Zuschlag zu einem höheren Preise als 50 Pf. für den Hektar erteilt, so werden die vertraglichen Beziehungen zwischen Gouvernement und Käufer nicht nach diesen Vorzugsbedingungen, sondern nach Maßgabe der erwähnten allgemeinen Bedingungen für Verkäufe von Regierungsland festgesetzt.
§ 2. Der Kaufpreis kann nach Wahl des Käufers in einer Summe auf dem Verkaufstermine oder in Teilzahlungen, die nicht weniger als je 1/15 des Kaufpreises betragen dürfen, entrichtet werden. In letzterem Falle muß 1/15 des Kaufpreises am Tage des Kaufabschlusses bar bezahlt werden. Von Vollendung des sechsten Jahres nach dem Kaufabschluß ab ist jedes Jahr bis zur vollständigen Tilgung des Kaufpreises wenigstens ein weiteres Fünfzehntel des Kaufpreises nebst 4 Prozent Jahreszinsen für das Restkaufgeld, die vom Beginn des siebenten Jahres nach dem Kaufabschluß an laufen, zu zahlen. Bis zur vollständigen Tilgung des Kaufpreises bleibt die Farm wegen des jeweiligen Kaufgeldrestes und der etwaigen Zinsen dem Gouvernement hypothekarisch verhaftet.
§ 3. Der Käufer darf die Farm während eines Zeitraums von zehn Jahren vom Verkaufstermine ab ohne Zustimmung des Gouvernements nicht veräußern. Das Gouvernement ist befugt, dieses Verbot durch Eintragung in das Grundbuch oder auf andere Weise Dritten gegenüber rechtswirksam zu machen.
§ 4. Auf Verlangen des Gouvernements hat der Käufer seine Farm auf seine Kosten und durch einen vom Gouvernement als geeignet bezeichneten Landmesser vermessen zu lassen, widrigenfalls das Gouvernement befugt ist, die Vermessung für Rechnung des Käufers vornehmen zu lassen.
§ 5. Der Käufer ist verpflichtet, mit der Bewirtschaftung der Farm spätestens innerhalb sechs Monaten vom Tage des Kaufabschlusses ab zu beginnen. Innerhalb weiterer zwei Jahre muß der Käufer auf der Farm Vorkehrungen getroffen haben, die einen ordnungsmäßigen Betrieb derselben ermöglichen. Als ordnungsmäßig gilt hierbei ein solcher Betrieb, der unter Berücksichtigung aller in Betracht kommenden Verhältnisse den Anschauungen im Lande und den daselbst bisher gemachten Erfahrungen entspricht. Das Gouvernement ist befugt, durch eine Kommission, die aus je einem Vertreter des Gouvernements und des Käufers und einem von beiden zu wählenden Obmann — im Nichteinigungsfalle dem zuständigen Bezirksamtmann — bestehen soll, Erhebungen darüber anstellen zu lassen, ob der Käufer den in diesem Paragraphen erwähnten Verpflichtungen nachgekommen ist. Zu diesem Zwecke hat der Käufer der Kommission Zutritt zu der Farm und zu allen dortselbst errichteten Vorkehrungen zu gestatten.
§ 6. Kommt das Gouvernement auf Grund des Berichtes der Kommission zu der Überzeugung, daß der Käufer seinen Verpflichtungen zu § 5 nachgekommen ist, so erhält der Käufer eine entsprechende Bescheinigung und finden dann weitere Besichtigungen der Farm durch die Kommission nicht mehr statt.
§ 7. Hat dagegen der Käufer mit der Bewirtschaftung der Farm nicht innerhalb der vorgeschriebenen Zeit begonnen, oder kommt das Gouvernement auf Grund des Berichts der Kommission zu der Überzeugung, daß der Käufer den übrigen, ihm in § 5 auferlegten Verpflichtungen nicht nachgekommen ist, so erläßt das Gouvernement an den Käufer die Aufforderung, binnen weiterer sechs Monate mit der Bewirtschaftung der Farm zu beginnen bzw. dortselbst die einen ordnungsmäßigen Betrieb ermöglichenden Vorkehrungen (§ 5) binnen einem weiteren Jahre herzustellen.
§ 8. Hat der Käufer auch die in § 7 festgesetzten Fristen verstreichen lassen, ohne mit der Bewirtschaftung der Farm begonnen zu haben, bzw. ohne den übrigen ihm in § 5 auferlegten Verpflichtungen nachgekommen zu sein, und trifft ihn in bezug auf die Versäumnis nach der einen oder anderen Richtung hin ein Verschulden, so fällt die Farm in das Eigentum des Gouvernements mit der Maßgabe zurück, daß der Käufer keinerlei Ansprüche wegen Ersatzes der bereits geleisteten Teilzahlungen oder der auf die Farm etwa gemachten Verwendungen hat. Die Entscheidung über die Frage, ob ein auf Grund dieses Paragraphen von dem Gouvernement geltend gemachter Anspruch begründet erscheint, erfolgt unter Ausschluß des Rechtsweges durch ein Schiedsgericht, das aus je zwei von den Parteien zu bezeichnenden Mitgliedern und einem von den letzteren zu wählenden Obmann, dessen Person im Nichteinigungsfalle von dem zuständigen Bezirksamtmann bestimmt wird, besteht.
Zur Entscheidung wegen aller übrigen Meinungsverschiedenheiten, die zwischen dem Gouvernement und dem Käufer aus dem gegenseitigen Vertragsverhältnis entstehen sollten, bleiben die ordentlichen Gerichte zuständig.
§ 9. Der Käufer und seine etwaigen Rechtsnachfolger haben für die Instandhaltung der Grenzmarken und der an öffentlichen Wegen liegenden, in das Farmgebiet fallenden Wasserstellen und für gute Zufahrtswege von dem Farmgehöft zu den nächsten[S. 573] öffentlichen Straßen Sorge zu tragen, widrigenfalls das Gouvernement nach vorheriger, ohne Erfolg gebliebener Warnung berechtigt ist, die betreffenden Anlagen auf Kosten des Käufers oder seiner Rechtsnachfolger vorzunehmen.
§ 10. Die Auferlegung einer allgemeinen Grund- und Häusersteuer bleibt dem Kaiserlichen Gouvernement vorbehalten.
§ 11. Die Aufsuchung und Gewinnung von Mineralien auf den verkauften Farmen unterliegt den besonderen hierüber erlassenen oder zu erlassenden Vorschriften.
§ 12. Ehemaligen Angehörigen der Schutztruppe für Deutsch-Südwestafrika, die bei dieser als Kapitulanten gedient und sich während ihrer Dienstzeit tadellos geführt haben sowie den Besitz eines Kapitals von wenigstens 2500 Mark nachzuweisen vermögen, können nach freiem Ermessen des Gouvernements in dem Kronland Farmen je nach der Höhe des nachgewiesenen Kapitals bis zur Größe von 5000 ha unentgeltlich mit der Maßgabe abgelassen werden, daß der Erwerber einer solchen Farm die sämtlichen in den vorstehenden Paragraphen für den Käufer festgesetzten Bedingungen, insoweit sich diese nicht auf die Bezahlung des Kaufgeldes beziehen, zu erfüllen bzw. eintretendenfalls die dort festgesetzten Nachteile zu erleiden hat.
§ 13. Die Abgabe von Farmen innerhalb des von der Siedlungsgesellschaft dem Gouvernement abgetretenen Teiles des Konzessionsgebiets dieser Gesellschaft erfolgt, insoweit nicht die Voraussetzungen des § 12 vorliegen, nach Maßgabe besonderer Bedingungen.
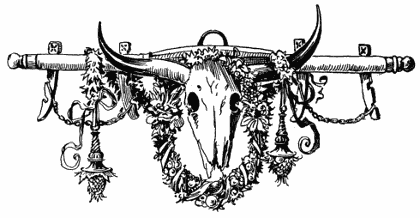
[1] Wer mehr Einzelheiten über dieses Thema wissen will, sei auf die betreffenden Kapitel in dem trefflichen Buche von Dr. Schinz, »Deutsch-Südwestafrika« verwiesen, sowie auf das eben erschienene Werk des Missionars Irle, »Die Hereros«.
[2] Nach Irle 1800 bis 1820.
[3] Nach Irle wohnten die Ostherero (Mbanderus) schon seit etwa 1800 zwischen Gobabis und Ngamisee. Zu ihnen seien dann später erst die vom Kaokofeld kommenden Westhereros getreten.
[4] H. v. François, Deutsch-Südwestafrika. Berlin 1899. Dietrich Reimer. S. 146.
[5] H. v. François. a. a. O. S. 16 ff.
[6] Geschrieben Ende 1905.
[7] F. J. v. Bülow, Deutsch-Südwestafrika. Drei Jahre im Lande Hendrik Witboois. 2. Aufl. Berlin 1897. E. S. Mittler & Sohn.
[8] Zehn Jahre später habe ich den mittlerweile Hauptmann gewordenen Herrn v. François zu gleichem Zweck dem Major v. Glasenapp überwiesen, er fand bei Owikokorero einen ruhmreichen Tod.
[9] »Großleute« nennen die Eingeborenen ihre angesehenen Stammesmitglieder, die zugleich den dem Kapitän beigegebenen »Rat« bilden.
[10] Ein Beispiel für die Rechtsprechung unter den Khauas hat mir auch ein Missionar mitgeteilt. Die Rheinische Mission hatte einst versucht, die Khauas für das Christentum zu gewinnen. Eines Sonntags morgens fand der Missionar (Rust, später in Hoachanas) in seinem Garten einen Jungen mit Obststehlen beschäftigt. Als dieser den Missionar erblickte, gab er Fersengeld und ließ sich hierin auch nicht durch den mehrmaligen Ruf: »Halt« stören. Entrüstet warf ihm der Missionar eine Handvoll Erde nach und verklagte den Jungen dann vor dem Stammesgericht. Dieses entschied nach langer Beratung, daß der Junge straflos sei, weil er lediglich aus Hunger gestohlen hätte, der Missionar dagegen 20 Mark und die Kosten zu tragen habe, weil er am heiligen Sonntag mit Erde geworfen hätte. Woraus zu schließen, daß das Christentum bei dem Stamm anscheinend schon mehr Wurzel geschlagen hatte, als der Missionar selbst ahnte.
[11] Ist inzwischen gefangen.
[12] Es ist richtig, daß Witbooi während seiner Kriege mit den Hereros Leben und Eigentum Weißer stets geschont hat.
[13] Siehe Schwabe, »Mit Schwert und Pflug in Deutsch-Südwestafrika«, 2. Aufl. Berlin 1904. E. S. Mittler & Sohn. Kapitel 8.
[14] Eine genaue Verlustliste beizufügen, war mit Rücksicht auf den zur Verfügung stehenden Raum leider nicht möglich.
[15] Nach den letzten aus Südwestafrika eingetroffenen Nachrichten hat es Witbooi elf Jahre später in der Tat ähnlich gemacht. Er hat Ende Oktober 1905 nach vergeblichem Angriff auf die Wasserstelle Aminuis und Kirris der Truppe 350 Weiber und Kinder überlassen.
[16] Die Stärke der zum Kampf gegen Witbooi erforderlichen Truppe gründete sich auf die Berechnungen des Majors v. François.
[17] Dies ist die Darstellung, wie sie aus den Akten des Gouvernements in Windhuk hervorgeht. Nach dem mittlerweile erschienenen Buche des Missionars Irle, »Die Hereros«, Seite 217, soll dagegen mein Vorgänger, Major v. François, bei der Wahl Samuels zum Oberhäuptling in der Tat den Ausschlag gegeben haben.
[18] Diese Kenntnis hatte ich kurz vorher durch einen vertraulichen Besuch des Bergdamarakapitäns Cornelius bei mir in Windhuk erhalten. Dieser war eigens zu dem Zweck gekommen, mich um Erlösung von dem Hererojoch zu bitten, so daß ich die jetzt gegebene Gelegenheit hierzu um so lieber benutzt habe. Im Gegensatz hierzu schreibt die Befreiung der Bergdamaras von Okombahe der Missionar Irle in seinem Buche »Die Hereros«, Seite 150, der Mission zu, die sie bereits 1870 herbeigeführt hätte. Wie dem auch sein mag, Cornelius fühlte sich jedenfalls 1895 noch nicht von den Hereros frei. Andernfalls würde er mit seiner Bitte nicht zu mir nach Windhuk gekommen sein. Die Bergdamaras hatten z. B. bis 1895 aus ihren Gartenerzeugnissen an Manasse einen Tribut zu bezahlen, den dieser selbst auf 1200 Mk. jährlich bewertete. Auch saß bis 1895 in Okombahe neben dem Kaffernkapitän noch ein Hererokapitän (zuletzt Daniel Kariko) als Bevollmächtigter Manasses, und ihm stand auf dem Platz die Oberhoheit zu.
[19] Samuel sagte mir: »Major trau den Hereros nicht, ich muß das wissen, denn ich bin selbst einer.« Zugleich zeigte er mir einen Brief seines Halbbruders Gerhardt (gefallen 12. Januar 1904 in Okahandja), in welchem dieser vor einer seitens der feindlichen Häuptlinge beabsichtigten Falle warnte.
[20] Als ich jetzt den Oberhäuptling fragte, ob zwei Schrapnells genügten, um die gegenüber sichtbare dichte Linie schwarzer Wollköpfe zum Verlassen ihrer Stellung zu bewegen, antwortete er lakonisch: »Nein, einer.«
[21] Während der zweitägigen Verhandlungen waren zwischen beiden Lagern Posten ausgestellt, diesseits Weiße und Eingeborene gemischt. Von der Machtlosigkeit des Oberhäuptlings zeugte es, daß jeden Abend dessen Sohn Friedrich auf Posten ziehen mußte, weil ein anderer hierzu nicht hatte bewogen werden können.
[22] Hierbei hatten einmal die Hereros Gelegenheit, ihren Mangel an Kriegsfertigkeit zu zeigen. Eine Hereropatrouille hatte zwei feindliche Hereros gefangen und sandte dieselben unter Bedeckung eines Mannes in unser Lager. Dieser ließ den Gefangenen die Waffen und ritt stolz voraus, mit der Weisung, ihm zu folgen. Natürlich schossen sie ihn nach kurzer Zeit vom Pferde und verschwanden sowohl mit dem Roß wie mit dem Gewehr ihres Überwinders. Allerdings war dies ein Ausnahmefall, aber einem Hottentotten wäre so etwas überhaupt nie begegnet.
[23] Charakteristisch zeigte sich hier das Mißtrauen Samuels gegen Kahimema. Bei dessen Eintreffen machte er sich schußfertig und sprang hinter einen Busch, ihm von dort strafende Worte zurufend. Erst nachdem Kahimema sein Gewehr abgenommen worden war, beruhigte sich der Oberhäuptling wieder.
[24] Diese Schuldigen waren der Kapitän Eduard Lambert, gefallen bei Gobabis, der Magistrat Fledermuis, gefallen bei Otjunda, und endlich der Führer einer Patrouille, die beschuldigt war, vor Bekanntgabe des Kriegszustandes eine Patrouille von uns überfallen und grausam ermordet zu haben. Dieser Führer war auf dem Gefechtsfelde von Siegsfeld anscheinend tot gefunden worden. Trotzdem war er mit dem Leben davongekommen. Er hatte einen Schuß in der Hüfte, einen Bajonettstich im Schenkel und einen Kolbenschlag auf den Kopf. Mit diesen Verwundungen machte er den Feldzug weiter mit und focht auch noch bei Otjunda. Ich erklärte dem Mann, daß er nicht zu den Begnadigten gehöre, daß mir aber jetzt die Hände gebunden seien, da er nunmehr gleichfalls mein Wort habe. Den Eingeborenen muß ein gegebenes Wort unverbrüchlich gehalten werden, sonst ist ihr Vertrauen niemals wieder zu gewinnen.
[25] Abgedruckt aus Nr. 15 des Deutschen Kolonialblattes vom 1. 8. 1896.
[26] Als Beweis für die kindliche Auffassung der Eingeborenen möge dienen, daß, als die 250 Mann starke Truppe in Omaruru einmarschierte, der Missionar seitens der Hereros gefragt wurde, ob denn der Deutsche Kaiser jetzt noch Soldaten zu Hause hätte.
[27] Wegen des Wasser- und Futtermangels ist dies die einzige Art, durch die Namibwüste zu kommen.
[28] Leider inzwischen verstorben.
[29] Einer der Bewohner Swakopmunds leistete sich damals den treffenden Witz, die aus Kapstadt eingeführten Arbeiter hätte der mit ihrer Anwerbung betraute Hauptmann v. Perbandt mit Genehmigung der Kapregierung vom Galgen abgeschnitten.
[30] Siehe Kapitel I, S. 4.
[31] Der Missionar des Stammes.
[32] Der Oberhäuptling, bekanntlich längst ein erbitterter Feind der Familie Tjetjo, freute sich unverhohlen über diese Entwaffnung seiner Stammesgenossen. Bei der allgemeinen Erhebung der Herero 1904 wird er diese Gewehre jedoch schwer vermißt haben. Traugott hat auch an dem Aufstande teilgenommen, ob und wie bewaffnet, ist nicht bekannt geworden.
[33] Gefallen am 13. April 1904 bei Oviumbo.
[34] Gefallen am 22. Februar 1904 bei Otjihinamaparero.
[35] Gefallen am 4. Februar 1904 bei Omaruru.
[36] Gefallen am 17. Dezember 1905 bei Toasis.
[37] Gefallen am 11. August 1904 bei Waterberg.
[38] Um jedoch diesen treugebliebenen Bastardsoldaten zu zeigen, daß mein Vertrauen zu ihnen nicht verloren gegangen sei, wurden ihnen während meiner Anwesenheit in Rehoboth die Wachen anvertraut.
[39] »Meine Expedition 1900 ins nördliche Kaokofeld und 1901 durch das Amboland«. W. Süfferott, Berlin.
[40] Gefallen im Januar 1904 bei Witvley.
[41] Wie bereits erwähnt, gefallen am 13. März 1904 bei Owikokorero.
[42] »Die Zukunft Deutsch-Südwestafrikas«. Berlin 1904. E. S. Mittler & Sohn.
[43] Erhielt ich doch sogar von autoritativer Seite in einem Privatbriefe die Anregung hierzu. Ich bat den Herrn Verfasser, mich doch in einigen Jahren an diese Sache zu erinnern, da ich sie bis zur Niederschlagung des Hereroaufstandes vielleicht wieder vergessen hätte.
[44] Oberleutnant in der Schutztruppe.
[45] Der neue Häuptling soll »Nande« heißen.
[46] In einem Privatbrief.
[47] Deutsches Kolonialblatt 1900.
[48] Deutsches Kolonialblatt vom 1. Januar 1904. Ich selbst hatte während meiner Amtszeit — durch meine Pflichten noch zu sehr an das Herero- und Namaland gefesselt — weder Gelegenheit noch Zeit zu einem Besuche des Ovambolandes gefunden.
[49] Glaubten doch die Truppen, nach der Abreise des Majors v. François im Juli 1894 nicht mehr an ihren Kontrakt gebunden zu sein, sondern mit mir einen neuen, für sie vorteilhafteren Kontrakt schließen zu können.
[50] Von der Einrichtung des Oberkommandos ab bis zum Jahre 1906 ist dies der jetzige Oberst Ohnesorg gewesen; ein Beweis, daß er sich seiner umfangreichen Aufgabe mit Geschick entledigt hat.
[51] Siehe Instruktion für die Bezirksamtsleute, Anlage 1.
[52] »Es ist traurig, wenn man von seiner Regierung im Stich gelassen wird,« sagte mir einst ein Kaufmann, dem die Unterstützung der Regierung beim Schuldeneintreiben gegen Eingeborene nicht weitgehend genug erschien.
[53] 1899 erhielten die bisherigen Bezirkshauptmannschaften diese Bezeichnung.
[54] Auch Kollekten, die ich während meines Heimatsurlaubes 1898 zu Heiratszwecken sammelte, hatten Erfolg. So kamen an einem Abend im April 1898 in Wiesbaden allein 2400 Mark zusammen, darunter von Archivrat Dr. Hagemann 1000 Mark. Mit diesem Gelde wurden vier junge Paare unter der Bedingung ausgestattet, daß sie dem ersten Kinde den Vornamen des Gebers, bzw. dessen Frau beizulegen hätten.
[55] Diese Opfer sind im Schutzgebiet sowohl wie in der Heimat arg unterschätzt worden. Noch unmittelbar nach beendigtem Bondelzwartskrieg, Anfang 1904, habe ich einem Ansiedler, der über dessen Ergebnisse sich unzufrieden ausgedrückt hatte, geantwortet: »Und wenn der Deutsche Kaiser eine ganze Division in dieses Land sendet, so werden wir auch mit einer solchen Truppenmacht mit den Eingeborenen kaum fertig werden.«
[56] Hatte doch z. B. der Deutsche Kolonialbund kurz vor Beginn des Aufstandes der Bondelzwarts folgende Forderung aufgestellt:
1. Jeder Farbige habe einen Weißen als »höheres Wesen« zu betrachten.
2. Vor Gericht sollten erst die Aussagen von sieben Farbigen diejenige eines Weißen aufwiegen.
Diesen Forderungen hat in der Heimat niemand widersprochen, im Schutzgebiet dagegen wurden sie mit Vergnügen begrüßt. Ich will mich hier über deren Zweckmäßigkeit nicht äußern, aber zur Anwendung würde man sie nur unterworfenen Völkerschaften gegenüber bringen können.
[57] Die bei Streitigkeiten zwischen beiden Rassen seitens der Kapitäne abzuordnenden Beisitzer hatten tatsächlich kein Aburteilungsrecht über die weißen Angeklagten. Sie sollten — als zuhörende Beisitzer — den mißtrauischen Eingeborenen lediglich eine Gewähr für die Unparteilichkeit unserer Rechtsprechung geben.
[58] Kajata war der Ankläger. Die Angeklagten waren zwei deutsche Händler, bezüglich derer der Ankläger gleichzeitig den Antrag auf zwangsweise Entfernung von ihren derzeitigen Wohnsitzen im Hererolande stellte, die sie ohne Genehmigung des Gouvernements in Besitz genommen hatten. Beide wurden für ihre Tat seitens des Bezirksgerichts Windhuk zu Geldstrafen verurteilt. Ein halbes Jahr später aber fielen sie mit unter den Ersten dem ausgebrochenen Hereroaufstande zum Opfer.
[59] Die größte Handelsfirma im Hererolande war diejenige von Wecke und Voigts in Windhuk. Die Geschäftsinhaber Gebrüder Voigts waren sogar in dem Befehl des Oberhäuptlings Samuel, der bei Beginn des Aufstandes die Ermordung sämtlicher Deutschen anordnete, unter denjenigen bezeichnet, die zu schonen seien. Dies traf auch auf den in Orumbo wohnenden Farmer und Händler Conrad zu, der, noch ehe es eine deutsche Herrschaft gab, mit den Hereros Handelsgeschäfte getrieben hatte. Bei ihm kam der Befehl des Oberhäuptlings auch zur praktischen Geltung. Er wurde nach der Gefangennahme durch die Hereros auf ein Pferd gesetzt und bei der Missionsstation Otjihaenena abgeliefert.
[60] Unter der Herrschaft der bisher üblichen Gepflogenheit kam es nur zu häufig vor, daß ein Händler unbegrenzten Kredit gab und dann das Verzeichnis der Schulden einfach dem Distrikts- und Bezirksamt behufs Eintreibung übersandte. Diese üble Gepflogenheit, die die Behörden zu Schuldeneintreibungsinstituten stempelte, würde auch die Kreditverordnung, wie sie schließlich erlassen worden ist, wohl gemildert, aber nicht beseitigt haben.
[61] Veröffentlicht im Deutschen Kolonialblatt 1897.
[62] Das Verzeichnis der einzelnen Handelsfirmen, die sich an dem Waffenhandel beteiligt haben, befindet sich bei den Akten des Gouvernements in Windhuk.
[63] 2. Aufl. Berlin 1897. E. S. Mittler & Sohn.
[64] Dr. Schinz, »Deutsch-Südwestafrika«.
[65] Gleich nach Empfang der Preisfestsetzungen für die amtlichen Verkaufsstellen haben denn auch zwei Bezirksamtmänner (Keetmanshoop und Gibeon) gegen die höheren Verkaufspreise für Eingeborene dringende Vorstellungen erhoben.
[66] Aber auch Reichsdeutsche hatten in dieser Beziehung manchmal ein weites Gewissen. So enthielt das bei einem ermordeten Händler aufgefundene Schuldenverzeichnis mehrfach die Notiz »geliehen an den Herero so und soviel Patronen«. Ferner hielt ein deutscher Händler die Zeit des Hereroaufstandes für geeignet, um nach dem Ovambolande zwei Gewehre mit Patronen zu verkaufen. Hierwegen gefaßt, meinte er, daß unsere Gesetzgebung sich auf jenes Land doch nicht beziehe.
[67] Eine Verfügung hierüber siehe Anlage 4.
[68] 1895 wurde z. B. auf dem Scheibenstande in Windhuk eine Kiste mit 20000 Patronen, Modell 88, vergraben gefunden, in welcher Absicht, liegt nahe.
[69] Noch 1904 erfolgte auf die fortgesetzten Klagen der Ansiedler seitens der Kolonialabteilung eine Anfrage an das Gouvernement, ob nicht das Militärgewehr freigegeben werden könnte. Da ich damals das Truppenkommando bereits abgegeben hatte, wies ich darauf hin, daß an dieser Frage der Truppenkommandeur mehr beteiligt sei als der Gouverneur, und übersandte die Frage dem General v. Trotha mit der Bitte um Antwort. Der letztere sprach sich dann gegen die Freigabe noch viel schärfer aus, als ich dies je getan hatte.
[70] Distriktschef von Okahandja.
[71] Die Stationen sind auf der Karte Seite 283 eingetragen.
[72] Dies veranlaßte eine Hamburger Zeitung, gestützt auf eine Zuschrift aus Keetmanshoop, zu der Behauptung, es sei von mir im Hause des Missionars häufig »Kriegsrat« abgehalten worden.
[73] Sohn und Nachfolger des Kapitäns.
[74] Der Streit um die Kapitänswürde war zwischen Cornelius Frederiks und dessen Vetter, dem Kapitän Paul Frederiks von Bethanien, unmittelbar nach dem Tode des vorhergehenden Kapitäns ausgebrochen und hatte damals (1894) sogar zu einem offenen Kampfe zwischen beiden auf dem Platze Bethanien geführt. Da die Masse des Stammes dem Paul Frederiks, als dem Erbfolgeberechtigten, treu geblieben war, mußte der schwächere Cornelius Frederiks das Feld räumen. Er trat zu seinem Schwiegervater, dem damals noch im Kriege gegen uns befindlichen Kapitän Witbooi, über. Nach dessen Unterwerfung erfolgte die Aussöhnung zwischen den beiden Vettern. Cornelius Frederiks kehrte nach Bethanien zurück und war dort eine Zeitlang deutscher Polizist. Unter der Asche glimmte jedoch die Nebenbuhlerschaft zwischen den beiden Vettern weiter. Im Anschluß an den Aufstand Witboois ist sie dann wieder zum offenen Ausbruch gekommen.
[75] Wie bereits erwähnt, haben im Schutzgebiet die Häuptlinge aus dem Holländischen die Bezeichnung »Kapitän« angenommen. Bei den Hereros hat sich indessen dieser Titel nie völlig einzubürgern vermocht, da sie sich — anders als die Hottentotten — durchweg ihrer eigenen Sprache bedienen und sich in dieser gegenseitig mit dem Titel »Omuhona«, d. i. »Herr«, anreden. Diesem Titel entspricht mehr das deutsche »Häuptling«, daher ziehe ich bei den Hererokapitänen diese Benennung vor.
[76] Siehe Bild Seite 39.
[77] Nr. 49 vom 9. Dezember 1905.
[78] Lebt im Ruhestande im Rheinland.
[79] Eine überaus komische Persönlichkeit. Mitten im Kriege mit Witbooi, in dem ich zuweilen zur persönlichen Verhandlung im feindlichen Lager war, bettelte mich Keister, wo er mich sah, um Kaffee, Tabak und Alkohol an. Als Beweis, daß er dieser Vergünstigung würdig sei, glaubte er einst hinzufügen zu sollen. »Ik soll ni vecht ni, ik is allteid achter bei de Frumensche« (Ich fechte nie, ich bin immer hinten bei den Weibern). Auch in der späteren Friedenszeit gab dieser Keister noch vielfach Veranlassung zu Scherzen.
[80] Kapitän »Kort« war allgemein der Name für Witbooi unter den Eingeborenen.
[81] Eine Abzweigung der Hereros, aber mit diesen politisch vereinigt.
[82] Drei Jahre im Lande Hendrik Witboois. Berlin 1897. E. S. Mittler & Sohn. Seite 260.
[83] Seinen komischen Anstrich behielt Manasse auch bei den ernstesten politischen Verhandlungen, indem er während derselben mit seinen besonders lang geratenen Fingern fortgesetzt Fliegen totschlug und auch mit unfehlbarer Sicherheit eine nach der anderen traf.
[84] Südwestafrika, Land und Leute. Berlin 1906.
[85] Der Vater von Paul Frederiks war derjenige Kapitän, der den ersten Vertrag mit Lüderitz geschlossen, somit auch die erste Veranlassung zur Aufrichtung der deutschen Schutzherrschaft in Südwestafrika gegeben hat.
[86] Erst in jüngster Zeit gelang es Hauptmann Volkmann, Cornelius mit seinem gesamten Anhang gefangen zu nehmen.
[87] Morenga ist inzwischen gleichfalls gefangen.
[88] Ferner hatten im Oktober 1904 die Viehwächter des Missionars Fenchel in Keetmanshoop in Unkenntnis der Verhältnisse dessen Vieh den Leuten Morengas in die Hände getrieben. Es wurde sämtlich mit vielen Grüßen an den Missionar zurückerstattet.
[89] Der selbst aus der Familie des Oberhäuptlings stammende Tjetjo tat es z. B. weniger gutwillig. Er war ursprünglich selbst Konkurrent um die Oberhäuptlingswürde gewesen, später aber freiwillig zurückgetreten.
[90] Als dann durch Bemühung der Regierung zwei weißen Händlern die gestohlenen Pferde seitens der Ovambos zurückgegeben waren, behielten die bisherigen Besitzer sowohl Pferde wie den bereits erhaltenen hohen Schadenersatz (Kühe im Werte von etwa 1700 Mark pro Pferd), letzteren für die »Abnutzung«. Weder Verwaltung noch Gericht waren in der Lage, hiergegen einzuschreiten.
[91] An dieser Stelle sei Einwanderungslustigen die treffliche Broschüre des verstorbenen Farmers Hermann in Nomtsas »Viehzucht und Bodenkultur in Südwestafrika, zugleich Ratgeber für Auswanderer« (Deutscher Kolonial-Verlag, Berlin W. 62) vom Jahre 1902 auf das wärmste empfohlen.
[92] Lange pflegt sich das Wasser auch z. B. im Fischfluß zu halten, der überhaupt im Unterlauf fast ständig fließt. Von dessen Wassermassen — etwa mit der Lahn vergleichbar — während der Regenperiode zeugt jetzt wieder der bedauernswerte Umstand, daß nach den letzten Verlustlisten aus Südwestafrika drei Reiter beim Baden im Fischfluß ertrunken sind.
[93] Wer mehr über die Mittel zur Erbohrung wie zur Stauung des Wassers zu wissen wünscht, dem sei das Werk von Rehbock, »Deutsch-Südwestafrika«, empfohlen.
[94] Dinter.
[95] Frankfurter Zeitung vom 22. Februar 1906.
[96] In dieser Beziehung kann man jedoch Abhilfe schaffen durch strenge Durchführung des Verbotes, ungekochtes Wasser zu genießen.
[97] »Klopphengste« nannte man sie bezeichnenderweise in Südwestafrika.
[98] Namentlich seitens des damaligen stellvertretenden Truppenkommandeurs Major Mueller (jetzt in Kamerun), der für Pferdezucht besonderes Interesse zeigte.
[99] Farmer Hermann-Nomtsas rechnet bereits für die zweite Generation auf eine marktfähige Wolle.
[100] In der »Täglichen Rundschau«.
[101] Genau wie bei der Kolonne Estorff beim Vormarsch gegen den Grootberg während des Swartbooi-Feldzuges (Kapitel V, S. 149).
[102] Vergleiche auch das Schriftchen »Strauße und Straußenzucht in Südafrika« von C. W. S. Nolte. Sonderabdruck aus dem Journal für Ornithologie, XLIII. Jahrgang, Januar 1895.
[103] Dem Jagdlustigen empfehle ich das Buch von Wissmann: »In den Wildnissen Afrikas und Asiens«.
[104] In den zur Zeit in der »Südwestafrikanischen Zeitung« erscheinenden »Erlebnissen« des bereits genannten Farmers und Händlers Conrad in Orumbo klagt dieser selbst über den eingerissenen Zwang zum Kreditgeben und wünscht dessen Beseitigung.
[105] Siehe »Deutsches Kolonialblatt« Jahrgang XVII Nr. 6 vom 15. März 1906, Seite 160.
[106] Nach einer Berechnung der Landesvermessung in Windhuk stellen sich die Zahlen genau, wie folgt. 1. Gesellschaften 276450 qkm, 2. Eingeborene 287567 qkm, 3. Regierung 149860 qkm. Hierbei ist der sogenannte Caprivizipfel außer Betracht gelassen.
[107] Auf die einzelnen Gesellschaften verteilt sich das benutzbare Gesellschaftsland, wie folgt: 1. Kolonial-Gesellschaft für Südwestafrika 33000 qkm, 2. Kaoko-Land- und Minengesellschaft 25000 qkm, 3. Hanseatische Land-, Minen- und Handelsgesellschaft 10000 qkm, 4. South African Territories Ltd. 10300 qkm, 5. Siedlungsgesellschaft für Deutsch-Südwestafrika 10000 qkm, 6. South West Africa Company 13000 qkm.
[108] Auch auf einen von mir stammenden Aufsatz im August-Heft der »Deutschen Revue« 1906 darf ich verweisen.
[109] Namentlich unter ihrem mehrjährigen Leiter im Schutzgebiete, Dr. Rhode, welcher fortgesetzt große Unternehmungslust an den Tag gelegt hat.
[110] Diesen Standpunkt vertritt vor allem die seitens der Mutter des in Warmbad gefallenen Leutnants Jobst verfaßte Broschüre: »Mußte es sein?«. Nach der mir vor kurzem zu Gesicht gekommenen Vorrede zur 4. Auflage war die Verfasserin auch im November 1904 noch nicht anderer Ansicht geworden. Auch die Broschüre »Die Schutzverträge in Südwestafrika« von Dr. Hesse befleißigt sich dieses Standpunktes, obwohl sie erst 1905 geschrieben ist. Sie enthält außerdem mancherlei Irrtümer und Unrichtigkeiten. Im übrigen erscheint die Frage gerechtfertigt, warum der Herr Verfasser sein angeblich besseres Wissen nicht bereits vor Jahren zum besten gegeben hat. Damals hätte es noch nützen können. Jetzt aber setzt er sich dem Verdacht aus, lediglich die bekannte Weisheit der Rathaustreppe zu verkünden.
[111] Wurde dann vom Kriegsgericht zum Tode verurteilt und erschossen.
[112] Desgleichen.
[113] Siehe Skizze Seite 449.
[114] Anscheinend ist es eine Unterschätzung des Gegners, welcher der zwar tapfere, aber sonst klar denkende Offizier zum Opfer gefallen ist. Leutnant Jobst hatte seinerzeit den chinesischen Feldzug mitgemacht und von dort wie fast alle damaligen Kriegsteilnehmer eine Geringschätzung des kriegerischen Wertes Eingeborener mitgebracht. »Das sind keine Chinesen,« konnte man die ziemlich zahlreich bei der Schutztruppe vertretenen, ehemals in China gewesenen Offiziere nach dem ersten Zusammentreffen mit unseren Eingeborenen fast immer sagen hören.
[115] Siehe Kapitel V, S. 167.
[116] Vertreter der South African Territories Ltd.
[117] Dieser Platz ist auch im jetzigen Feldzuge vielfach als Sitz Morengas genannt worden.
[118] Der Platz Keetmanshoop selbst nebst Weidefeld war bereits 1898 Kronland geworden (Kapitel V, S. 155).
[119] Gefallen am 30. August 1904 bei Sjambokberg.
[120] Siehe Skizze Seite 449.
[121] Der deutsche Führer der auf unserer Seite gegen die Hereros im Felde stehenden Witboois, Leutnant Müller von Berneck, sagte mir auf meine Frage nach deren Verhalten anläßlich ihrer Entwaffnung und Gefangennahme später in Rehoboth wörtlich folgendes:
»Bei der Entwaffnung der Witboois in Otjosondu sagten wir dem Unterkapitän, daß ein Teil der Witboois aufständisch — ob der Kapitän selbst dabei sei, sei noch unbestimmt. Wir müßten, da Gefahr vorläge, daß, wenn seine Leute vom Aufstande hörten, noch mehrere mit Gewehren entlaufen könnten, ihnen diese abnehmen. Der Unterkapitän machte keine Schwierigkeiten und sagte, daß die Leute sich ruhig verhalten würden. Er glaube nicht, daß die alten Witboois den Orlog (Krieg) machten, dies wären jedenfalls nur Räuber. Als der Unterkapitän dies sagte, habe ich den Eindruck gehabt, daß der Mann aus innerer Überzeugung sprach. Den Tag vor der Entwaffnung hatten die Leute schon durch Frachtfahrer von Unruhen im Süden gehört; sie sagten, sie glaubten nicht daran. Hätten sie es getan und von dem Aufstande vorher gewußt, wäre es ein leichtes für sie gewesen, mit Pferden und Gewehren zu entkommen, denn wir waren nur wenige weiße Begleitmannschaften.«
[122] Von etwaigen Empörungsabsichten des Kapitäns muß z. B. auch der Unterkapitän Samuel Isaak bis zuletzt nichts gewußt haben. Wenigstens kam noch Anfang Oktober einer von dessen Wagen durch Rehoboth, um in Windhuk Fracht zu holen. Ich habe ihn dort persönlich mit Beschlag belegen und die Begleitmannschaft gefangensetzen lassen.
[123] In diesem Jahre verheiratete sich auch Herr v. Burgsdorff, der mittlerweile zum Bezirksamtmann ernannt worden war, mit Malta geb. v. Dallwitz, die ihm als Lohn für seine lange Einsamkeit in Gibeon eine schöne Häuslichkeit geschaffen hat.
[124] Die Witboois und die Gochaser Hottentotten.
[125] Es ist derjenige, der im Kapitel X mehrfach (S. 360, 363) genannt ist.
[126] Im Hererolande.
[127] Nach meiner Abreise gingen zwei Offizierpatrouillen gegen die Stellung der Witboois bei Rietmond vor. Das Ergebnis war: 2 Offiziere (v. der Marwitz, Roßbach) und 9 Mann tot.
[128] Siehe beiliegende Skizze.
[129] Das genaue Verzeichnis befindet sich in Rust, »Krieg und Frieden im Hererolande«, Seite 145.
[130] An Witbooi.
[131] d. h. Der noch auf dem südlichen Kriegsschauplatz befindliche Teil der Schutztruppe.
[132] Auch die Gattin des Stabsarztes Dr. Kuhn, eine Nichte des bekannten Schiffsreeders Woermann, war während der Belagerung mit in der Feste eingeschlossen und hat durch ihr unerschrockenes Verhalten den übrigen Frauen ein gutes Beispiel gegeben wie auch ihrem Gemahl wertvolle Unterstützung geleistet.
[133] Siehe Bild Seite 370.
[134] Elise Sonnenberg: »Wie es am Waterberg zuging«.
[135] Welch andere Kriegsweise zeigten demgegenüber die Hottentotten. Bei diesen waren die Überraschung und die Verluste in der Regel auf deutscher Seite.
[136] Ein übel beleumundetes Subjekt, er hatte es bisher stets vorgezogen, zu verschwinden, wenn ihr Weg die Truppe in seine Nähe führte.
[137] Siehe Karte zwischen S. 496/497.
[138] Siehe Karte zwischen S. 496/497.
[139] Leutnant Leutwein.
[140] Nach dessen Anfang März wegen Malaria erfolgter Rückkehr nach Windhuk von Oberleutnant v. Winkler mit übernommen.
[141] Dagegen waren von den Pferden der Abteilung bei Ankunft am Ziel 12 vH. unbrauchbar geworden; ein Beispiel für die Überlegenheit der Infanterie über die Kavallerie bei länger dauernden Märschen.
[142] Siehe Karte zwischen S. 496/497.
[143] Beide, Hauptmann v. François und Oberleutnant Eggers, namentlich der letztere, hatten von jeher zu einer Unterschätzung der Hereros geneigt. Ich habe in Privatgesprächen manchmal versucht, sie zu einer anderen Überzeugung zu bringen.
[144] Wer an diesem unbestimmten Ausdruck Anstoß nehmen sollte, würde sich doch zu sehr auf dem Boden europäischer Anschauungen bewegen.
[145] Siehe S. 520.
[146] Siehe Karte zwischen S. 496/497.
[147] Ich betone dies ausdrücklich, weil ein Teil der deutschen Presse die Rückkehr des Obersten Dürr sofort auf Rechnung angeblich vorgekommener Differenzen zwischen ihm und mir gesetzt hat. Nichts ist unrichtiger als dies. Oberst Dürr ist mir seit seiner Fähnrichszeit bekannt, um nicht zu sagen befreundet. Trugen wir doch sogar eine Zeitlang auch dieselbe Regimentsnummer (113 zu Freiburg i. Br.). Umsomehr hatte ich mich gefreut, gerade ihn zur Unterstützung erhalten zu haben. Daß er selbst ungern wegging, ohne seine Aufgabe erfüllt zu haben, brauche ich wohl nicht besonders zu betonen. Indessen war sein Leiden derart, daß ein längeres Verweilen hätte zur Katastrophe führen müssen.
[148] Gefallen am 13. April bei Oviumbo.
[149] Schwer verwundet am 9. April bei Onganjira und am 25. gestorben.
[150] Anscheinend war es dieser Brief, der damals einen Ansiedler in Swakopmund veranlaßte, einer großen deutschen Zeitung zu telegraphieren, ich hätte Friedensverhandlungen mit den Hereros angeknüpft. Die Redaktion blieb dann auch einem Dementi gegenüber bei dieser Behauptung, da ihr die Nachricht von »unbedingt zuverlässiger Seite« zugegangen sei. Ich habe vergeblich versucht, diese »unbedingt zuverlässige Seite« festzustellen.
[151] Der Brief ist nie in seinem Wortlaut veröffentlicht worden; ich gebe daher hier auch nur dasjenige, was von dessen Inhalt allmählich durchgesickert ist.
[152] Gefallen am 13. April 1904 bei Oviumbo.
[153] Wegen Typhus. Siehe S. 507.
[154] Die 8. Kompagnie war mit zwei Geschützen und zwei Maschinengewehren nach dem Bezirk Grootfontein, die 12. in den Bezirk Omaruru entsendet.
[155] Geschrieben Anfang März 1906.
[156] Ist auch im »Deutschen Kolonial-Blatt« von 1896 veröffentlicht.
[157] Diese Meldung stammt aus der Zeit vor dem Aufstande 1896, denn in diesem haben die Hereros auf ihre Stammesgenossen geschossen.
[158] 1893/94.
[159] Kapitel V, Seite 143.
[160] Veröffentlicht im Beiheft 1 des Militär-Wochenblattes von 1899.
[161] d. h., wenn er keine Viehherden zu decken hat, oder wenn er nicht mehr die Kraft in sich fühlt, diese zu decken.
[162] Geschrieben im März 1906.
[163] In einem Briefe eines unserer für die Minen in Johannesburg angeworbenen Hereros, datiert aus Banksdrift (Transvaal) vom 25. Januar 1904, ist folgende Stelle enthalten, die beweist, daß der Briefschreiber den Unterschied zwischen deutscher und englischer Eingeborenenbehandlung rasch erkannt hat.
»Ich teile Dir mit, das Land der Engländer ist wahrlich ein gutes Land; da sind keine Mißhandlungen; Weißer und Schwarzer stehen auf gleicher Stufe, und wenn er Dich schlägt. (unleserlich) allenthalben, wo Du willst. Und da ist viel Arbeit und viel Geld, und wenn auch Dein Vorgesetzter da ist, so schlägt er Dich nicht, aber wenn er Dich schlägt und hat das Gesetz übertreten, so wird er auch bestraft.«
[164] v. Brandt stellt in seiner Broschüre »England in deutscher Beleuchtung« folgende Statistik auf:
1893 waren von 824 höheren Stellen im Dienst der Zivilverwaltung 93 den Eingeborenen vorbehalten, in den Provinzen im ganzen 2450 Eingeborene im höheren Verwaltungs- und Justizdienst beschäftigt, endlich von 114150 mittleren Beamtenstellen mit einem 1000 Rupien übersteigenden Gehalt nicht weniger als 96 vH. in den Händen von Eingeborenen.
[165] Nach welcher die Verordnung vom 1. Januar 1899 (Seite 561) auf Drängen der Kaufleute vorläufig suspendiert worden war.
[166] Dieser Entwurf ist dann dem Kolonialrat zur Beratung vorgelegt worden. (Seite 246.)
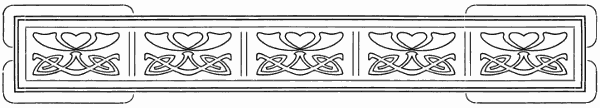
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.
W.
Z.
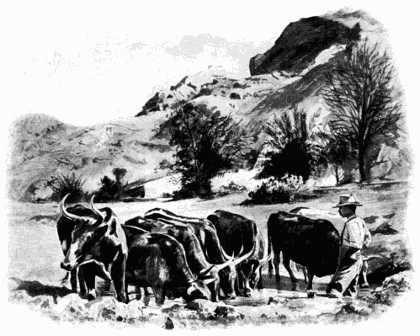
[S. 590]
Gedruckt in der Königlichen Hofbuchdruckerei von
E. S. Mittler & Sohn, Berlin SW 68, Kochstr. 68–71.