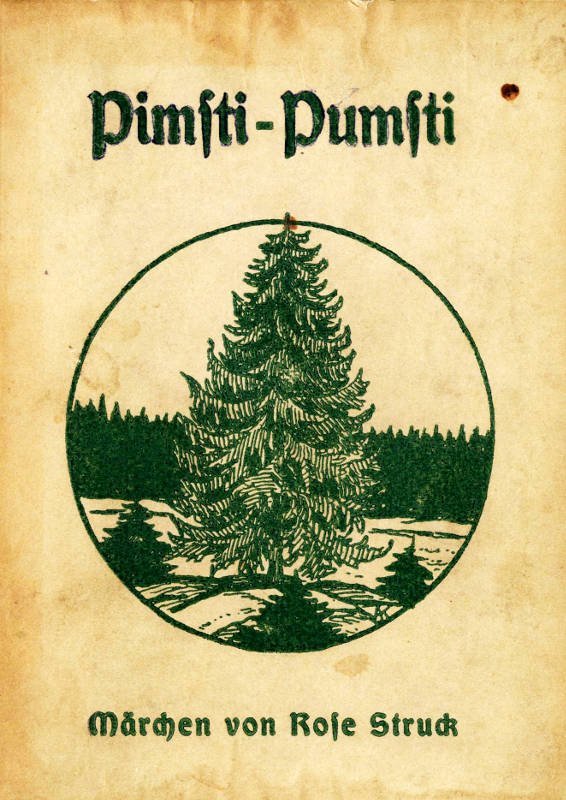
Title: Pimsti-Pumsti
Author: Rose Struck
Release date: March 28, 2020 [eBook #61684]
Most recently updated: October 17, 2024
Language: German
Credits: Produced by The Online Distributed Proofreading Team at
https://www.pgdp.net
Anmerkungen zur Transkription
Das Original ist in Fraktur gesetzt. Im Original gesperrter Text ist so markiert.
Weitere Anmerkungen zur Transkription befinden sich am Ende des Buches.
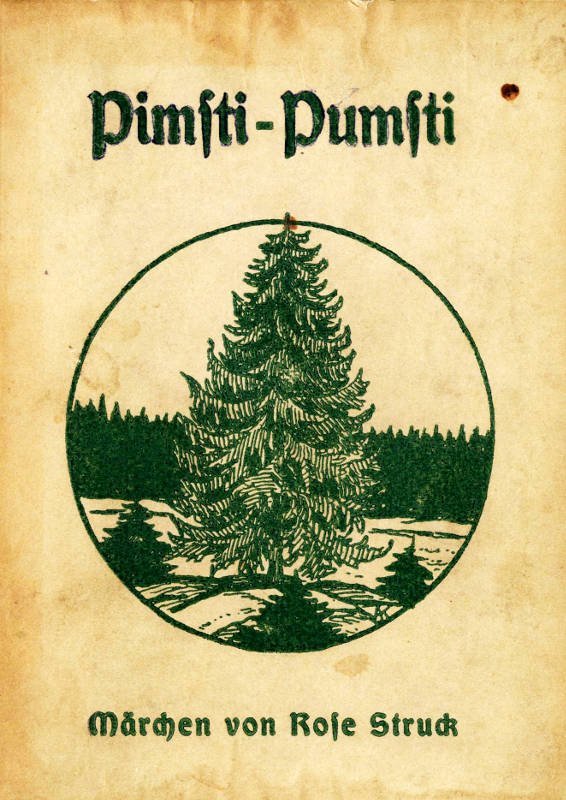
Rose-Struck.
Zweite Auflage.
Verlag der Hochland-Buchhandlung Garmisch.
Copyright 1919 by
Hochland-Verlag, Garmisch.

Im Zimmer war es ganz still und dunkel. Mutter lag krank in dem großen Bett hinten in der Ecke und auf dem Fensterbrett neben dem Rosmarinstock saßen Lenchen und Lottchen. Lenchen spielte mit ihrer Nasenspitze, Lottchen knackte mit ihren Fingergelenken. Sonst war es ganz still.
Auf einmal rührte sich hinten in der Ecke die kranke Mutter, seufzte schwer und sagte: »Ihr armen Kinder – und heute ist Weihnachten!«
Dann war's wieder ganz still.
Da stieß Lottchen Lenchen am Ellenbogen und flüsterte: »Weihnachten!«
Und Lenchen antwortete: »Ja, Weihnachten! – aber wo denn?« Dann saßen sie wieder still; nur daß Lottchen an ihrer Nase spielte und Lenchen die Fingergelenke knacken ließ.
Da fiel kurz und schnell ein heller Lichtschein durch's Fenster und verschwand gleich wieder. Die Kinder schauten hinaus – schauten und erblickten in der Ferne über dem Walde ein helles Leuchten und Strahlen.
»Da, da ist ja Weihnachten!« flüsterte Lenchen und Lottchen stellte sich auf das Fensterbrett und drückte die Nase gegen die Scheiben und Lenchen machte es ihr nach.
»Da ist Weihnachten – da müssen wir hin!« flüsterte Lenchen und öffnete ganz leise das Fenster.
Da sahen sie vor dem Fenster eine herrliche goldene Treppe, die führte hinab in das Gärtchen. Die stiegen sie ganz vorsichtig hinunter und gingen Hand in Hand hinaus auf die Landstraße. Nun suchten sie mit den Augen den hellen Schein über dem Walde. Der war aber nicht mehr zu sehen. Da fürchteten sich die Kinder sehr und wollten wieder umkehren. Plötzlich hörten sie über sich ein feines Schnarren und als sie in die Höhe[5] sahen, flog da ein reizender kleiner Engel mit silbernen Flügeln und hatte ein blankes Rauschgoldröcklein an. Das Englein winkte ihnen und flog immer vor ihnen her. So kamen sie in den Wald auf einen breiten Weg. Rechts und links standen ernste, hohe Tannenbäume Spalier, so wie die Soldaten es machen, wenn der König vorüberkommt. Und Lenchen und Lottchen hätten große Angst gehabt, wenn ihnen das liebe Englein nicht den Weg gezeigt hätte. Da begann das Englein zu fingen und die Kinder stimmten mit ein in das schöne Lied: »O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit« und marschierten tapfer drauflos. Endlich hörte der breite Weg auf und sie standen vor einem engen, dunklen Waldpfade.
»Wer kommt in mein Reich?« rief eine laute Stimme. »Was sucht Ihr hier?«
Ein riesengroßer, bärtiger Mann trat aus dem Dunkel und fragte: »Was sucht Ihr denn bei mir, Ihr Kinder, he?«
»Weihnachten suchen wir!« antworteten zitternd die Kleinen. »So, das ist aber merkwürdig. Warum sucht Ihr Weihnachten denn nicht zu Hause wie andere Kinder auch?« meinte der Riese.
»Da ist doch keines« erwiederte Lottchen und Lenchen weinte.
»Hm« machte der große Mann, »da ist keines? Wohl weil Ihr nicht artig gewesen seid, he?«
»Nein,« jammerte Lenchen.
»Nein,« sagte Lottchen.
»Nun, warum denn?« fragte der Riese.
»Weil Mutter im Bette liegt und krank ist.«
»So,« sagte der Bärtige und zog ein großes, buntes Schnupftuch aus dem Sack und schneuzte sich fürchterlich laut, damit die Kinder nicht sahen, daß er aus Mitleid mit ihnen weinte.
»So, so? Na, dann kommt. Dann wollen wir mal zusammen Weihnachten suchen.« Er nahm die beiden Schwestern bei der Hand und führte sie freundlich den dunklen Weg entlang. Und wieder flog das Englein singend über ihnen.
Da frug der Riese die Kinder nach ihren Namen.
»Ich heiße Lottchen.«
»Und Du?«
»Lenchen.«
»So,« meinte er, »Lottchen und Lenchen. Das sind schöne Namen. Und wie mag ich wohl heißen, was meint Ihr?«

»Knecht Rupprecht!« schrie das dreistere Lottchen.
»Der Weihnachtsmann!« flüsterte Lenchen.
»Falsch geraten! Falsch geraten!« rief der Riese und lachte, daß alles wackelte.
»Rübezahl!« rief da Lottchen.
»Auch nicht! Ich muß es Euch wohl sagen. Pimsti-Pumsti heiße ich. Sprecht mal nach: Pimsti-Pumsti. –«
»Das ist lustig! Das ist lustig!« krähte Lottchen. »Pimsti-Pumsti.«
»Pimsti-Pumsti,« flüsterte Lenchen und sah den Riesen erstaunt an.
»Was machst Du denn hier im Walde, Pimsti-Pumsti?« frug Lottchen und pruschte laut los, weil ihr der Name so sehr komisch vorkam.
»Was ich mache?« antwortete der. »Garnichts mache ich. Das heißt, ich schlafe das ganze Jahr über in meiner Höhle.« »Na, und heut?« sagte Lottchen. »Heute schläfst Du doch nicht!«
»Nein, Du kleiner Naseweis, heute nicht. Heute ist der heilige Abend. Das ist der einzige Tag im Jahre, an dem ich munter bin. An dem ich nicht schlafen darf, denn da muß ich in jedem Jahre dafür sorgen, daß auch im Walde Weihnachten[9] ist. Ihr werdet's ja sehen! Da, es fängt schon an, seht mein Englein!«
Als nun die kleinen Mädchen das Englein mit den Augen suchten, flog es nicht mehr geradeaus über ihnen. Es flog hin und her, von rechts nach links, von links nach rechts und berührte mit einem goldenen Stäbchen die Spitzen der großen Tannen auf beiden Seiten des Weges, der nun immer breiter wurde. Und wo sein Stab die Baumspitze berührt hatte, flammte auf derselben ein lichter, strahlender Stern auf. Das sah herrlich aus. So herrlich, daß die Schwestern immerfort nach dem Engel und nach den Sternen auf der Spitze der Bäume sahen und gar nicht auf den Weg. Und hätte der gute Pimsti-Pumsti sie nicht fest bei der Hand gehabt, sie wären sicher gestolpert und hingefallen.
So gingen sie tapfer weiter und merkten es gar nicht und standen plötzlich auf einem großen freien Platz. Da ließ Pimsti-Pumsti sie los und klatschte in die Hände, daß es weithin schallte. Dann sagte er laut und feierlich das eine Wort: »Weihnachten!«
Da flog das Englein herbei und setzte sich auf die höchste Spitze der himmelhohen Tanne, die in[10] der Mitte des Platzes stand, und läutete mit einem silbernen Glöcklein und im Nu erstrahlte der hohe Tannenbaum von tausend Lichtern und funkelte und glitzerte und war nun ein himmlisch schöner Weihnachtsbaum. Und auf den großen, schweigsamen Tannen, die den Platz umstanden, wurde es lebendig. Auf der Spitze einer jeden ließ sich ein Englein nieder. Und alle sangen nun mit heller Stimme: »Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen!« Dann wurde es still, ganz still, und den Kleinen klopfte das Herz in der Brust.
Und noch einmal rief Pimsti-Pumsti mit lauter Stimme: »Weihnachten! Weihnachten im Walde!« Dabei lächelte er freundlich.
Da hörten die Kinder leises Knistern und Knastern im nahen Gesträuch. Das wurde immer lauter. Und durch die Aeste des Gebüsches nahten sie alle: Rehe, Hirsche, Wildschweine, Füchse, Dächse, Häslein! Alle, alle die lieben Bewohner des Waldes. Und auf den Zweigen rührte es sich von Vöglein aller und jeder Art und von roten und schwarzen Eichhörnchen. Und alle die lieben Tiere verharrten ganz still und sahen andächtig auf den Lichterbaum.
Und Pimsti-Pumsti lachte vergnügt vor sich hin und rieb sich vor Freude die großen, breiten Riesenhände. Dann verschwand er hinter dem Weihnachtsbaum und kehrte mit einem großen Schlitten voll süß duftendem Heu und prallen Säcken zurück. Das Heu streute er den lieben Rehen und anderen Tieren hin und aus den Säcken kamen süße Wallnüsse und braune Haselnüsse zum Vorschein für die Eichhörnchen und anderen Tiere, die Nußkerne lieben. Da gab es ein Nagen und Knuspern und Beißen und Knattern, daß es eine Lust war. Es war die richtige Weihnachtsfestmahlzeit für alle Gäste des guten Pimsti-Pumsti. –
Als die ganze vierbeinige und gefiederte Gesellschaft sich rechtschaffen sattgegessen hatte, gab der Riese den Tieren allen einen Wink und so leise, wie sie gekommen, verschwanden sie wieder.
Dann trat er zu den beiden Kindern und sprach: »Macht einmal die Augen fest zu, ihr Lieben, bis ich in die Hände klatsche. Aber ganz fest zu.«
Das taten die Kinder und rührten sich nicht vor lauter Erwartung, was nun kommen würde.
Da klatschte Pimsti-Pumsti in die Hände. Die Kleinen waren wie geblendet.
Rechts und links von dem großen Lichterbaum stand ein kleineres Bäumchen, eines für Lottchen, eines für Lenchen, ganz und gar mit Zuckerwerk behangen.
Und unter den Bäumen lagen die herrlichsten Geschenke.
Für Lottchen stand da eine Puppenküche mit blankem Geschirr darinnen, wie sie sich schon so lange eine gewünscht hatte. Und Kleider und Schuhe und alles, alles Mögliche.
Und Lenchen fand unter ihrem Bäumchen die große Lockenpuppe mit den Schlafaugen, die sie immer im Schaufenster des Spielwarenladens in der nächsten Stadt so bewundert und sehnsüchtig betrachtet hatte. Und auch Kleider und Schuhe und dasselbe schöne Buch, das Nachbars Grete hatte.
Und sie sprangen an Pimsti-Pumsti in die Höhe vor Seligkeit und Dank und er neigte sich ganz tief zu den kleinen Mädchen herunter und ließ sich von ihnen den bärtigen Mund küssen. Dann verschwand er ganz geheimnisvoll in seiner Höhle und als er wieder herauskam – ja, war[13] denn das noch der alte Pimsti-Pumsti? Nein, er war ein großer, hölzerner Nußknacker geworden, mit ganz steifen Armen und Beinen und einem großen Maul voll Riesenzähnen.
Am Boden lagen unnatürlich große Nüsse, die durften die Kinder ihm in den Mund schieben, und als sie dann hinten an seinem langen, steifen Rockschwanz zogen, gab es einen fürchterlichen Krach, die Nuß zerbrach und heraus fiel ein Badepüppchen, ein Nähkästchen, ein kleines Wiegenbettchen und noch vieles mehr. Das war zu schön!
Und wieder ging Pimsti-Pumsti in seine Höhle und erschien alsdann mit braunem Gesicht, braunen Händen und Füßen, Augen, die aussahen wie Mandelkerne, und als er sich dann lang am Boden ausstreckte, bekamen die Kleinen einen großen Schrecken – er war ja so platt wie ein Brett.
Und er sprach mit einer wahren Grabesstimme: »Greift hier mal hin!« und zeigte auf sein großes, braunes Ohr. Und »greift da mal hin!« und streckte ihnen den Arm hin.
Und sie taten zitternd wie er gesagt hatte, und als er rief: »Packt nur kräftig zu!« – da hatte[14] Lottchen ein Ohr in der Hand und das war aus süßem Honigkuchenteig.
Und Lenchen hatte eine Hand ergriffen und auch die war aus braunem Pfefferkuchen. Da sahen die Kleinen näher zu und merkten: Pimsti-Pumsti hatte sich in einen Honigkuchenmann verwandelt. Der konnte eben alles.
Und sie knabberten und brachen an ihm herum nach Herzenslust – bis er lachend in die Höhe sprang. Da war er wieder der alte liebe Pimsti-Pumsti.
Nun wollten die Kinder mit ihren schönen Sachen spielen und Pimsti-Pumsti ging mit ihnen zu ihren Plätzen. Da schlug in der Ferne eine Uhr – 1 – 2 – 3 – 4 bis zu 12 dumpfen Schlägen und – oh Schreck! Die Lichter am Baume erloschen – es wurde ganz stockfinster – nur am Himmel leuchteten die Sterne.
Wie Lenchen und Lottchen dann wieder zu ihrer lieben, kranken Mutter zurückgekommen waren, das wußten sie nicht mehr zu sagen, als sie am nächsten Morgen erwachten.
Sie saßen wieder auf dem Fensterbrett neben dem Rosmarinstock und rieben sich den Schlaf aus[15] den Augen. Dann erzählten sie ihrem lieben Mütterlein von Pimsti-Pumsti und dem herrlichen Weihnachtsabend im Walde.
Mütterlein hörte glückselig zu, dann sagte es: »Seht ihr, seinen Kindern gibt's Gott schlafend.«
Sie meinte nicht anders, als die Kleinen hätten das alles geträumt.
Wir aber wissen es besser.


Tief unten im Keller eines großen, düsteren Hauses lebte ein alter Schuster mit seiner lahmen Frau. Tag für Tag hörte man aus dem niedrigen Fenster das Pochen seines Hammers, mit dem er in die Sohlen der vielen großen und kleinen, groben und feinen Stiefel und Schuhe kleine Holznägel schlug. Sonst aber war es mäuschenstill im Zimmer, denn die alte Frau war leider viel zu schwach, um laut reden zu können, und der Vogel, der im verrosteten Bauer an der Wand hing, war schon vor Jahren einmal plötzlich tot von der Stange gefallen und saß nun schon lange leblos und mit Werg ausgestopft neben dem leeren Futternapf.[17] Am Schnabel war ihm ein Federchen lose geworden und stand lustig und frech in die Luft. Das sah so aus, als wenn das Vöglein lachte, aber es sah wirklich nur so aus. Zum Lachen gab es ja nichts in dem dunklen Stübchen und auch draußen vor dem Fenster nicht. Früher hatte wenigstens gegen Abend die liebe Sonne durch dasselbe hineingeschienen. Aber das war nun auch schon lange vorbei, denn auf der anderen Seite der Gasse hatte man ein hohes Haus mit fünf Stockwerken gebaut und dieses nahm alle Strahlen der Abendsonne für sich selber und ließ keinen einzigen für den armen Schuster und seine Frau übrig.
Nun hätte der gute Alte gewiß auch für sein weniges Geld ein helleres Zimmer bekommen, aber seine liebe Frau begann sofort zu weinen, wenn er davon sprach, sie in ein anderes Haus zu bringen. »Laß mich hier sterben, lieber Mann,« sprach sie. »Ja diesem Zimmer, in dem wir jung und glücklich waren. In dem unsere lieben Kinderchen geboren wurden.« Dann versprach er, ihren Wunsch zu erfüllen, aber sehr, sehr schwer wurde es ihm, in dem auch bei Tage fast ganz düsteren Raum zu arbeiten. Oft rieb er sich die[18] Augen und seufzte leise, wenn es gar nicht mehr gehen wollte, oder er schlich sich vor die Haustüre und blickte sehnsüchtig zu dem hellen Himmel auf, der, ach, so hoch und fern über ihm war. Abends, bevor er die ärmliche Lampe anzündete, ging er regelmäßig ein wenig vors Haus, um die reine Abendluft einzuatmen.
So stand er wieder einmal in der stillen Straße, über sich den herrlichen Nachthimmel, der von Millionen Sternen blinkte und strahlte. –
»Einen von Euch Sternlein in meiner dunklen Kammer und mir wäre geholfen!« dachte der alte Mann und faltete die Hände.
Da gab es oben am Himmel eine große Bewegung. Die Sternlein plinkten sich gegenseitig zu, als wollten sie sagen: »Tue Du es!« Oder: »Du solltest es dem alten Manne zuliebe tuen!«
Siehe da, noch ehe der arme Schuster es gedacht, fiel ein leuchtender, lieblicher Stern herab zur Erde. Wie festgebannt stand der Alte auf einem Fleck, dann griff er sich an den Kopf, bewegte sich und lief, lief, was er nur laufen konnte, immer geradeaus in der Richtung, in welcher er den Stern hatte fallen sehen. Immer dunkler wurde[19] es um ihn her. Längst hatte er die Stadt verlassen. Von dem Sternlein war nichts zu sehen.
Endlich sah er in einiger Entfernung etwas Helles am Boden liegen.
»Da ist's«, rief er laut, daß es in der Stille der Nacht ganz schaurig wiederhallte, und stürzte sich auf den hellen Gegenstand. Mit beiden Händen griff er darnach. Aber seine Hände griffen ins Leere. Nur einige Sandkörnlein vom Wege blieben an seinen Fingern haften. »Was war das nur?«
Taumelnd griff sich der Alte an die Stirn. Dann gewahrte er, daß das vermeintliche Sternlein nichts anderes war als der Schein eines Lichtleins, der durch den Türspalt einer ärmlichen Hütte auf die Erde fiel. Leise, leise trat der arme Mann zur Seite. Er schämte sich seiner Dummheit.
Dann kehrte er um und lief, so schnell seine müden Beine es erlaubten, zurück zu seiner kranken, schlafenden Frau.
Am nächsten Tage saß er wieder gebückt über der Arbeit und strengte in der Finsternis seine armen Augen an bis sie tränten.
Als aber der Abend kam und sein Weib eingeschlummert war, überfiel ihn eine große Unruhe. Das Sternlein hatte es ihm angetan und ließ ihm keine Ruhe.
Wieder lief er weit, weit ins Land hinein. Von dem Stern war aber keine Spur zu sehen.
So trieb er es nun viele, viele Abende, aber immer kehrte er traurig und ohne sein Sternlein wieder heim.
Es war wie eine Krankheit – wie ein Zauber. Wohin er auch blickte – überall sah er das blinkende Sternlein, wie es leise, leise zur Erde hinabglitt. Ja, er hatte es damals ganz genau gesehen. Irgendwo mußte es ja liegen, und wartete nun auf ihn, daß er es in seine dunkle Werkstatt holen würde, damit es darin hell würde.
So wanderte er langsam die Landstraße entlang, denn die müden Füße versagten schon den Dienst. Gottlob schien der Mond hell auf den Weg, so daß er sich wenigstens nicht an den vielen Steinen, die umherlagen, stoßen mußte. Sollte heute sein Wunsch in Erfüllung gehen?

Forschend suchten seine Augen die Gegend ab und Seligkeit bemächtigte sich seiner. Da, da[22] drüben in einem Gärtchen vor einem schlafenden Hause leuchtete es ihm entgegen, eine strahlend helle Kugel, genau wie der Stern ausgesehen hatte, als er zur Erde hinuntergeglitten war. Ehrfürchtig, ängstlich nahte der alte Schuster. Ja das war der schöne, grünschillernde Stern! Inmitten eines Rosenbaumes war er gefallen und hing nun fest auf der Spitze des Stockes, an welchem das Bäumchen angebunden war.
»Mein Stern!« flüsterte der alte Mann, griff freudig darnach und hielt nun zitternd die leuchtende Kugel in den Händen.
Da schrie im nahen Walde ein Käuzchen, so laut und schrill, daß der Schuster vor Schreck seinen Schatz fallen ließ.
»Klirr-klirr,« machte es zu seinen Füßen, und als er sich bückte, lagen da die grünschillernden Scherben einer Glaskugel, wie sie manche Leute zum Schmucke ihres Gartens aufstecken.
»Wieder nichts! – Wo bist Du nur mein Sternlein?« seufzte der Alte und Tränen rollten über seine eingefallenen Backen. Nun gab er das Suchen auf. Gewiß war der Stern doch nicht für ihn zur Erde herabgekommen und er hatte sich das nur eingebildet.
Und jeden Tag kamen Leute und brachten Schuhe, die besohlt und geflickt werden sollten, und die kranke Frau brauchte Essen und Arzeneien, und darum mußte der Alte arbeiten und Geld verdienen, wenn auch die alten Augen dabei fast erblindeten.
So kam die erste Maiennacht wieder einmal heran, die Nacht, in der aller Zauber und aller Spuk auf Erden los ist.
Da stand der Schuster wieder vor seiner niederen Türe und blickte zum Himmel auf, der dicht mit Sternen besät war. Und die Sternlein winkten und blinkten und lächelten ihn an, als wollten sie ihm Mut machen.
»Sei es denn,« murmelte er, »einmal versuche ich es noch. Heute finde ich sicher etwas, das fühle ich. Wer weiß – alle guten Dinge sind drei.«
Munter stapfte er los und sang ein Lied dabei. So wanderte er, vorbei an Hütten, Schlössern und Kirchen, an Gärten und Wiesen. Dann kam er in einen Wald, darin war es ganz sonderbar. Die Bäume flüsterten miteinander. Die Blumen sangen leise vor sich hin. Die Vöglein leuchteten wie lauter Edelsteine und es duftete so schön, wie[24] es nur im Paradies duften kann. Dem Schuster schwindelte vor lauter Entzücken. Und als er gar vor einem silbern schillernden See stand, war er ganz und gar benommen. Inmitten des Sees war es taghell. Da schwebten über dem Wasser sechs schöne Mädchen in weißen Gewändern immer im Kreise um eine auf- und niedersteigende, schillernde Lichtkugel.
»Mein Stern!« schluchzte der Alte und sank in die Knie. »Mein Stern!« Und die Mädchen sangen:
Da rief der Alte: »Mein, mein ist das Sternlein. Mir hat es Gott gesandt, daß ich nicht völlig erblinde.«
Da riefen die Mädchen:
»Nun, guter Alter, das werden wir gleich sehen!« Und sie kamen angeschwebt und nahmen ihn auf ihre Arme und trugen ihn in die Mitte des Sees.
sangen die Mädchen.
»Ja,« jubelte der Alte, »die leuchtende Kugel soll mir heilig sein, auch wenn die Menschen sonst das schönste, hellste, strahlendste Licht in ihre Häuser bringen, ich behalte mein Sternlein, mein Licht von oben.«
Dann griff er mit bebenden Fingern nach der auf- und niederschwebenden Kugel, in die sich das Sternlein bei seinem Sturz in den Wundersee verwandelt hatte.
Und siehe da – die Kugel blieb ruhig in seinen Händen.
»Er ist's! Er ist der Rechte! Für ihn war sie bestimmt!« jubelten die Mädchen und trugen ihn mitsamt seinem Schatz ans Ufer des Sees.
Wie er damals nach Hause gekommen ist, weiß er heute noch nicht. Aber mit dem Lichtlein von oben ist Helligkeit und Glück in seiner Werkstatt eingekehrt. Er hält es aber auch hoch in Ehren. Noch heute, wo doch überall das elektrische Licht leuchtet, so daß man nur zu knipsen braucht[26] und es wird taghell im Zimmer – bei ihm könnt ihr noch die wasserhelle Kugel sehen.
Geht nur und betrachtet sie euch bei dem armen Schuster im Keller nebenan. Da hängt sie über seinem Arbeitstisch und leuchtet hell. Das macht das Sternlein, das darin gefangen ist.
Die Leute aber, die das nicht wissen, nennen sie kurzweg –
»Die Schusterkugel«.


Zwischen zwei wildreißenden Gebirgsbächen, die sich einen, um nunmehr einen einzigen reißenden Fluß zu bilden, entsteht eine Landzunge. Auf solcher Landzunge stand ein großes, weißes Haus. Weithin strahlte es in reiner Schönheit und hieß darum im ganzen Lande nur »das schöne Haus«. Glücklich die Menschen, die dort wohnen durften, denn nicht nur das Haus selber war so wunderbar schön – es war umstanden von den herrlichsten, stolzesten Bäumen, umblüht von Matten, die bis hart an die Ufer der reißenden Bäche mit blauen Enzianen, lichten Vergißmeinnicht, goldenen Dotterblumen und vielen anderen lieblichen Blüten[28] besät waren. Das war ein Leuchten prächtigster Farben, ein Atmen süßester Düfte ringsum, so einzig schön – passend zu dem schönen Hause.
In dem schönen Hause wohnte ein Ehepaar in der Blüte der Jahre mit zwei lieblichen Kindern. Wer das Glück hatte, die Besitzer der blühenden Halbinsel aus der Nähe zu sehen, dem wurde es auch sogleich klar, warum das Volk sie nur »die Schönsten« nannte. Sie waren die Schönsten, das Schönste, was man sich denken konnte. Der Gatte in kräftiger Männlichkeit, die Gattin in zartester Frauenschöne; die Kinderlein in wonnigstem Kinderliebreiz. Sie waren sich ihrer Schönheit bewußt und waren stolz auf dieselbe und pflegten sie als das, was sie war, ein Geschenk des Höchsten.
Da wurde dem Paare wieder ein Kindlein geboren, ein Kindlein wie alle anderen, mit runzeliger Haut, winzigem Stumpfnäschen, spärlichem Haar und rotem Körperchen. Die Eltern lachten. Sie wußten ja, wie bald sich in ihrer Familie aus solch unansehnlichem kleinen Wesen eine Schönheit entwickeln würde. Sie lachten – bis sie merkten, daß es anders kam. Das kleine Mädchen wuchs und gedieh, aber es wurde von Tag zu Tag unschöner – es wurde häßlich von[29] Gestalt und Antlitz und hatte einen zu kurzen Fuß. Da grämten sich die Eltern, ja sie schämten sich. Nun würde man sie nicht mehr im ganzen Lande »Die Schönsten« nennen und sie waren auf diesen Namen doch so stolz gewesen. Es erschien ihnen als eine große Schande, daß ihnen, den Schönsten, ein so unschönes Kind geboren war. Sie verbargen es vor den Blicken der Menschen. Als das Mädchen aber so groß wurde, daß es sich nicht mehr verstecken ließ, beratschlagten sie, was zu tuen sei, um ihre Schande zu verbergen.
Sie kamen überein, Gisela, so hieß das Kind, zu einer alten Wäscherin zu geben, die ganz weit unten am Ufer des Flusses ein Häuschen hatte. Die würde gut für die kleine Häßliche sorgen und sie selber wären vor der Schande bewahrt, nicht mehr »Die Schönsten« genannt werden zu können. So wurde Gisela in dunkler Nacht zur alten Bärbel gebracht. Die Schönsten aber lebten ungestört auf ihrer blühenden Landzunge mit ihren Kinderlein, zu denen noch ein paar, eines lieblicher als das andere, hinzukamen.
Unterdessen wuchs Gisela heran, einsam und still, denn die alte Bärbel hatte ein mitleidiges Herz und wollte nicht, daß das Mädchen bemerkte,[30] wie häßlich es war. Darum ließ sie es gar nicht mit anderen Kindern zusammenkommen.
So waren die Blumen im Gärtchen, Katze und Hund, die rauschenden Wogen des Flusses des Mädchens einzige Gespielen. Den Fluß liebte Gisela mit ganzer Seele.
Stundenlang sah sie dem Tanzen und Springen der Wellen zu und lauschte ihrem Murmeln. Tief unter ihrem Kammerfenster rauschten die Wogen dahin, tagaus, tagein. Aber im Frühling, wenn hoch oben in den Bergen der Schnee schmolz, wurde der Fluß übermütig und wollte über die Ufer hinausspringen mit überschäumenden Wassermengen. Dann geschah es, daß eine Welle hoch, hoch an der Hausmauer emporhüpfte bis zu Giselas Kammerfensterchen und neugierig durch dasselbe hineinschaute.
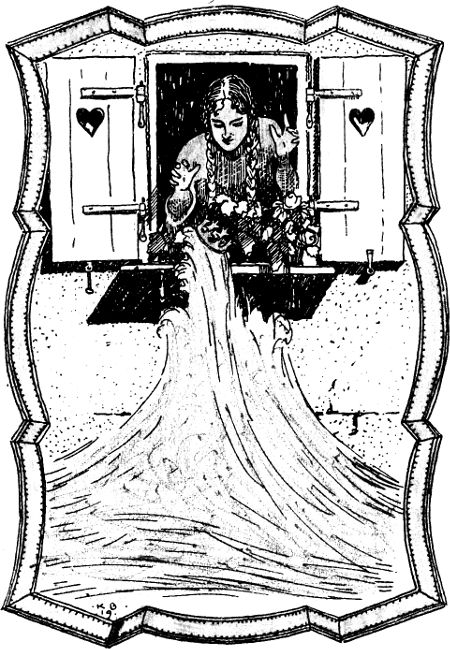
Die Welle trug ein silbern leuchtend Schaumkrönlein auf dem Haupte. Gisela stand und schaute und lachte und breitete der lustigen Woge die Arme entgegen. Da geschah es: Die Welle verlor ihr Krönlein! Blinkend lag es im Mondenschein auf dem Fensterbrett zwischen des Mädchens Nelken und Rosenstöcken. Lockend lag es da als spräche es: »Nimm mich hin!« Mit[32] zitternden Fingern ergriff es Gisela. Kühl faßte es sich an und leicht war's, aber wunderlieblich und strahlend. Schnell trat das Mädchen vor den kleinen Spiegel, setzte sich die Krone aufs Haupt und fand sich sehr schön. Das arme Kind wußte ja gar nicht, was wahre Schönheit ist. Und glücklich war das Mädchen, denn es war einmal etwas anderes in ihrem stillen Leben, sich zu schmücken und sich zu bewundern. Vor lauter Freude hörte es nicht, daß unter dem Fenster die Woge jammerte: »Gib mir mein Krönlein zurück, mein silbernes Krönlein!« Und vor lauter Freude gewahrte es nicht, daß die Woge mit dünnen, weißen Fingerlein auf das Fenstersims tastete und nach ihrem Krönlein suchte.
In der Nacht, als Gisela im Bette lag und es im Häuschen so still war, da hörte sie wohl ein jämmerliches Stimmchen klagen: »Mein Krönlein! Gib mir doch mein Krönlein wieder!« Aber sie rührte sich nicht und blickte seelig auf ihren Schatz, der auf dem Schemmel neben ihrem Lager lag. »Das behalte ich«, murmelte sie. »Warum soll ich nicht auch ein Krönlein haben?«
So war es nun immer. Bei Tage achtete Gisela nicht auf die Jammerlaute, die dem Flusse[33] entstiegen, aber in der Stille der Nacht konnte sie bald keinen Schlummer mehr finden, so herzzerreißend drang die Klage der Welle aus der Tiefe zu ihr herauf. Längst war es Sommer geworden und ruhig rollten nun die Wasser unten im Bette des Flusses dahin ohne lustige, übermütige Sprünge. Aber die klagende Stimme verstummte nicht. Eines nachts konnte Gisela es nicht mehr mitanhören. Die Tränen traten ihr in die Augen. Sie erhob sich vom Bett und öffnete das Fenster. Hell schien der Mond. Da war es ihr, als blicke aus dem Strudel der Wellen ein bleiches Antlitz zu ihr empor. Als reckten zarte, weiße Arme sich sehnsüchtig in die Höhe. »Gib mir mein Krönlein!« flehte ein bleicher Mund. »Gib es mir, ich bringe Dir etwas Anderes, Schöneres im nächsten Frühling an Dein Fenster.«
Da neigte sich Gisela weit hinaus und rief: »Gut, bringe mir etwas, das mich noch mehr beglückt, das mich ganz selig macht, dann sollst Du Dein Krönlein haben.«
Von dem Tage an schwieg die klagende Stimme und Gisela konnte ruhig schlafen und sich heimlich ihres Krönleins freuen. Bald hatte sie[34] das Versprechen der Welle ganz und gar vergessen.
Da, eines Nachts, als wieder Frühlingsstürme das Häuschen umbrausten, erwachte Gisela. Erschrocken setzte sie sich im Bette auf und lauschte. »Mach' auf! Mach' auf!« tönte es vom Fenster her. »Ich bringe Dir mein neues Geschenk und hole mir mein Krönlein. Mach' auf!« Da sprang Gisela ans Fenster und öffnete und fühlte in ihren Armen die kühle, schäumende Woge, die wie damals zum Fenster hineinhüpfte.
Zitternd nahm sie die versprochene Gabe entgegen. Ein köstlicher, leuchtend weißer Schleier legte sich um ihre Schultern. Sie eilte zum Spiegel und betrachtete sich und gefiel sich sehr. Da streifte ihr Blick das Krönlein. Das sollte sie nun hergeben! Nein, so schön war der Schleier denn doch nicht, daß sie das Krönlein dafür opfern mochte!
Unterdessen griff die Woge mit sehnsüchtigen Händen ins Kämmerlein hinein und schluchzte: »Nun gieb es mir wieder und behalte den Schleier. Ist er nicht schön?« »Nein,« erwiederte Gisela, »um den Schleier gebe ich die Krone nicht zurück. Bringe mir etwas viel, viel Schöneres« und legte[35] den Schleier in die weißen Hände der Woge. Seufzend sank diese in die Tiefe des Flußbettes zurück. Gisela aber stand im Schmucke ihres Krönleins vor dem Spiegel. Als die Sommersonne strahlte – der Herbst die Bäume im Gärtchen mit goldenen Aepfeln behing – der Winter vor die Fensterscheiben weiße Spitzenvorhänge zauberte, immer war es des Mädchens größte Freude, sich mit dem Krönlein zu schmücken.
Und wieder ward es Frühling. Der Fluß schwoll an und leichtfüßig hüpfte die Woge an der Hausmauer hinauf zu Giselas Fensterchen. Diesmal brachte sie einen Arm voll der herrlichsten, seltensten Blüten, wie sie nur hoch oben in den Bergen gedeihen, zum Angebinde und forderte flehend ihr Krönlein dafür. Aber Gisela gab es auch diesmal nicht her – so lieblich die Blüten lockten. Wehklagend sank die Woge mit ihrer Blütenlast wieder hinab. Gisela aber glaubte nicht anders, als daß sie ihren Schau nun für Lebenszeit behalten würde, daß ihr die Woge nichts Besseres zu geben hätte.
Und wieder nahte der Frühling. Mit Donnergebrause schoß der Fluß zu Tal, ließ übermütige Wellen über die Ufer hinausspringen.[36] Wieder klopfte Giselas Woge mit zarten Fingern an des Mädchens Kammerfenster und als diese es öffnete, setzte sie vorsichtig und leis ein liebliches Kind, ein Knäblein, auf das Fensterbrett zwischen Nelken- und Rosenstöcke.
Gisela sah es und stand gebannt und konnte den Blick nicht von dem Kinde wenden, das zärtlich die Arme nach ihr ausstreckte.
»Nun gieb mir aber mein Krönlein!« bat die Woge. »Besseres kann ich Dir ja niemals bringen.«
Da fühlte Gisela tief im Herzen, wie recht die Woge hatte. Daß dies Kindlein sie so glücklich machen würde wie sonst nichts auf dieser Erde. Ohne Besinnen nahm sie das Krönlein vom Tische und setzte es der Woge wieder aufs Haupt. Mit einem Jubellaut sank diese in die Tiefe zurück und winkte glückselig zu den beiden hinauf, die ihr lachend nachschauten. Dann nahm Gisela das Bübchen auf den Schoß und sah ihm tief in die leuchtenden Blauaugen und küßte seinen roten Mund. Noch nie im Leben war ihr so wohl ums Herz gewesen. »Bübchen,« sprach sie, »woher kommst Du denn?« Und das Kind erzählte, daß es aus dem »schönen Hause« zwischen den silbernen[37] Bächen käme. Daß sie zu Hause alle »Die Schönsten« hießen. Daß es am Bache gespielt hätte, ehe die Woge es davon getragen. Da kam Erinnerung über Gisela und sie erbleichte. Das »schöne Haus«, »die Schönsten«! Auch sie war ja dort und zwischen ihnen gewesen bevor sie in der Nacht hierhergebracht worden. Mit zitternder Stimme fragte sie: »Sag, mein Kleiner, wieviele Geschwister seid Ihr denn im »schönen Hause«?«
»Fünf«, krähte der Kleine, »aber«, flüsterte er dicht an Giselas Ohr, »wir haben noch eine Schwester gehabt. Gisela hat sie geheißen. Die haben die Eltern weit, weit fortgeschickt, weil sie so sehr, sehr häßlich ist. Das darfst du aber niemandem erzählen, hörst du. Die Eltern dürfen nie wissen, daß ich es weiß. Unsere alte Wärterin hat mir's erzählt, einmal als sie sehr böse war auf unsere schöne Mutter.«
»Weil sie so häßlich war« klang es weiter in Giselas Ohr. »So häßlich.«
Das Kind auf dem Arm ging sie zum Spiegel. »Ja«, dachte sie, »häßlich bin ich, das sehe ich jetzt neben dem schönen, schönen Brüderlein.« Aber, daß die Eltern sie darum nicht bei[38] sich behalten hatten – das tat so weh, so bitter weh.
Bitterlich mußte sie schluchzen und große Tränen liefen über ihre Wangen.
Da legte das Brüderlein beide Arme um ihren Hals und sprach: »Nicht weinen, Schwesterlein, ich hab' dich ja so lieb – so lieb«.
Gisela mußte trotz ihres Kummers lächeln vor Freude und sie küßte das Kind und fragte: »Lieb hast Du mich? Bin ich denn nicht zu häßlich zum liebhaben?«
»Häßlich?« lachte der Kleine, »Du bist doch nicht häßlich. Du bist doch so gut.«
Und das Mädchen erzählte dem Kinde, daß es seine unbekannte Schwester sei und daß sie es nun gleich zu den Eltern zurückbringen würde. Im »schönen Hause« verlebten sie unterdessen Stunden der größten Angst und Sorge. Die Eltern suchten überall vergeblich nach ihrem Liebling – in den Bächen, im Fluß, in den Felsspalten des Gebirges.
Da verzweifelten sie und in ihrem Jammer gedachten sie ihrer verstoßenen Tochter und meinten, der Verlust des Knaben sei wohl die[39] Strafe für das an ihr begangene Unrecht. Und sie weinten bitterlich. Anderen Tages, als die ganze Familie trauernd versammelt war, öffnete sich leise die Tür und herein trat ein großes, unschönes Mädchen.
»Gisela!« riefen die Eltern und eilten ihr entgegen. »Gisela, unsere Tochter! Dich schickt Gott zur rechten Zeit um mit uns zu weinen um unser goldlockiges Kind. Komm und vergieb, daß wir aus törichter Eitelkeit so unrecht an Dir handelten.«
Da stammelte das Mädchen: »Ich habe Euch vergeben. Aber nicht um mit Euch zu weinen, bin ich gekommen. Freuen will ich mich mit Euch und dann wieder gehen.«
Gisela öffnete die Tür und führte den staunenden Eltern das Brüderlein zu. Da gab es ein Jubeln und Jauchzen und Schluchzen der Freude und Gisela mußte erzählen, wie sich alles zugetragen hatte.
Da fielen ihr die Eltern um den Hals und dankten ihr von Herzen und als sie baten, nun für immer zu Hause zu bleiben und sie leise fragte: »Bin ich Euch denn nicht zu häßlich«, antworteten[40] beide wie das Bübchen: »Häßlich? Du bist doch nicht häßlich. Du bist doch so gut!«
Und Gisela blieb bei den Eltern und diese erzählten es allen Leuten, wie unrecht sie an ihrem Kinde gehandelt hätten und waren nun doppelt liebevoll zu ihr.


Wo ein Feuer ist, da ist auch ein Seelchen. Ihr kennt es aber nicht. Ihr seht nur das Tüchlein, das es lustig schwingt, wenn das Feuer brennt – und nennt das Rauch. Unter dem Teekessel, im Herdfeuer, im Stubenofen, im Fabrikschornstein haust es, das Feuerseelchen. Es ist ein lustiges Ding und meint es gut mit den Menschen und singt und jauchzt ihnen etwas vor, aber verstehen tuen es nur wenige und diese wenigen das sind die Dichter. Die unterhalten sich ganz richtig mit dem Feuerseelchen und lieben es und sind an Winterabenden ganz glücklich, mit ihm allein im Stübchen zu sein. Solch ein Feuerseelchen hat es gut. Haust es unter dem Teekessel, so lebt es mitten in der frohen Kinderschaar[42] neben Vater und Mutter und nimmt an allem Menschenglücke teil.
Lebt es im Ofenloch, so hört es mit an, was Großvater und Großmutter sich erzählen aus alter, alter Zeit. Und hüpft es im Küchenherd umher, da darf es tanzen zu den munteren Gesängen der jungen, frohen Köchin und in die Töpfe schauen, in denen es brodelt und kocht – und den guten Bratengeruch riechen. Aber, aber so ein armes Feuerseelchen im Fabrikschornstein: Tief, tief unten im eisernen Ofenloch sitzt es geduckt und hört nur das Donnern und Stampfen der großen Maschinen. Das ist kaum auszuhalten.
Wenn es den blauen Himmel sehen will, muß es mühsam in dem hohen, engen Schornstein emporklettern. So dunkel und schwarz ist es darinnen und es riecht so häßlich nach Ruß und Teer.
So ein armes, verlassenes Fabrikfeuerseelchen war es auch, das weit draußen vor der Stadt in einem häßlichen Ofen hausen mußte. Bei Nacht kauerte es unter der Asche versteckt schlafend tief unten im Feuerloch. Da war es dann still, nur hin und wieder piepste eine Maus oder der Nachtwächter öffnete die Ofentür und sah hinein, ob das Feuer auch ganz erloschen sei. Vor dessen bärtigem,[43] bösem Gesicht hatte Seelchen große Angst und war jedesmal froh, wenn die schwere Ofentür wieder zuklappte.
Am Morgen, wenn der Ofen wieder tüchtig geheizt wurde, erwachte Feuerseelchen zu neuem Leben, dehnte und reckte sich in den hellen Flammen, hüpfte zwischen ihnen hin und her und schaute voll Sehnsucht hoch, hoch in die Höhe über sich, wo ein kleines, rundes Loch ein Stücklein blauen Himmel zeigte. Wenn dann das Feuer munter prasselte, die Flammen lustig in den Schornstein hinaufflackerten, schwang Feuerseelchen sich auf ihnen in die Höhe und kletterte dann mühsam im Innern des Schlotes hinauf, setzte sich hoch oben auf den Rand des Schornsteines und atmete tief die frische Himmelsluft ein. Dann saß es ganz still und sah sich im Kreise um. Aus den anderen Schornsteinen auf den Häusern tief unter Seelchen grüßten dann viele, viele andere Feuerseelchen zu ihm hinauf. Schnell ließ dann Fabrikfeuerseelchen sein Tüchlein in die blaue Luft wehen zum Gegengruß – jeden Tag. Das war ein lustiges Spiel.
Aber auf die Dauer wurde es etwas langweilig. Seelchen sehnte sich nach etwas Anderem,[44] Neuem, zur Unterhaltung. Sein Blick schweifte ringsum über Häuser, Wiesen, Felder, Hügel dahin. Da sah es tief unter sich in einer Senkung einen tiefblauen kleinen See. Wie der da so friedlich lag, so still. Wie ein Stückchen Spiegelglas, das man zwischen hohe Gräser und wehende Farrnkräuter hingelegt hätte. Ruhig spiegelte der Himmel sich darinnen.
So lange Feuerseelchen auch dorthin blickte, nichts rührte sich. Der See schien zu schlafen.
Das verdroß das übermütige, lebhafte Ding und böse rief es: »Herr jemineh, hat denn das Wasser gar keine Seele?«
»Es hat eine!« antwortete eine vorüberfliegende Taube. »Es hat auch eine Seele!« und flog lachend davon.
»Es hat eine Seele, also doch,« flüsterte Feuerseelchen und stellte sich ganz steil hoch oben auf den Rand des Schlotes, ließ sein Tüchlein in der Luft wehen und sang hinunter. »Erwache, erwache, Wasserseelchen, daß wir uns ein wenig unterhalten können. Erwache!« Aber unbeweglich ruhte der kleine See zwischen seinen grünen Ufern.

Jeden Tag hoffte nun Feuerseelchen auf das Erwachen des Wasserseelchens, sang ihm seine schönsten Lieder hinunter, winkte mit dem Tüchlein und weinte dann herzbrechend vor Enttäuschung. Das sah Skriba, der Dichter, der im nächsten Hause hoch oben im Dachkämmerlein wohnte, und wunderte sich.
Als nun der Jammer dort in der Höhe gar kein Ende nahm, öffnete er eines Tages sein Fenster, machte aus seinen beiden mageren Händen ein Sprachrohr und rief hinauf:
Da lachte Feuerseelchen unter Tränen und jubelte: »Daß ich nicht eher an Dich gedacht habe, Du guter Dichterling. Du einziger Mensch, der uns versteht.« Und es erzählte ihm seinen Kummer.
Da stützte Skriba den Kopf in die Hand und dachte nach. Nach einer Weile rief er hinauf:
Der Spruch war leicht zu verstehen. Am frühen Morgen sollte Feuerseelchen nach Wasserseelchen Ausschau halten.
Ueberglücklich winkte es dem Dichter zu und tanzte vor Freude rund um den Rand des Schornsteines herum.
Am Abend duckte es sich nicht wie sonst untätig in die Ecke des Ofenloches. Leise nahm es einen Funken des erlöschenden Feuers, versteckte ihn unter ein Aschenhäufchen und hütete ihn wohl vor den arglistigen Augen des Wächters. Beim Erwachen des ersten Morgenlüftchens war auch Feuerseelchen munter, blies mit vollen Backen in die gehütete Glut, daß heller Schein in den Schlot hinaufzüngelte, schwang sich auf ihm in die Höhe, kletterte, kletterte und stand nun bei Sonnenaufgang hoch oben auf dem Schornstein. Schwacher Tagesschein beleuchtete die Gegend. Kaum konnte man noch Täler und Höhen unterscheiden. Aber über der Stelle, wo der kleine See ruhte, da regte sich's. Erst war's, als wenn nur die Luft über dem Wasser sich leise bewegte, aber bald sah Feuerseelchen ganz deutlich einen hell-blau-grauen Schleier wehen.
»Wasserseelchen, Wasserseelchen!« rief es laut und schwenkte vergnügt sein Tüchlein. Und jeden Morgen begrüßten sich nun die beiden Seelchen so. Wenn die Sonne höher stieg, verwehte Wasserseelchens Schleier in den Lüften und wieder ruhte der See totenstill im Grünen.
Das ärgerte Feuerseelchen nun bald auch, daß es nie mit Wasserseelchen zusammenkommen konnte, um mit ihm zu spielen und zu tanzen. Da begann hoch oben auf dem Schornstein der alte Jammer. Wieder half der gute Dichter dem armen Ding.
So sang Skriba und Feuerseelchen ließ sich das nicht zweimal sagen. In einer Ecke des Ofenloches häufte es fleißig glühende Funken auf. Als dann der Abend kam, hockte es innen vor der Ofentür und blies mit vollen Backen die Funken durchs Gitter hinaus in den Fabrikraum – und wartete.
Bald roch es von draußen gar brenzlig; bald kroch dicker Rauch zur Spalte hinein; bald[49] hörte man laut rufen: »Feuer! Feuer! Es brennt in der Fabrik!«
Und nun geschah es: In großen Eimern und Kübeln schöpften die Männer das Wasser aus dem See und gossen es in die prasselnden Flammen.
Im Nu sah man da Wasserseelchens dampfblauen Schleier und Feuerseelchens rauchgraues Tüchlein wehen. Munter sprangen die beiden Seelchen auf einander zu, faßten sich bei den Händen, wirbelten in den Flammen umher und tanzten – tanzten, bis von dem Fabrikgebäude mit dem hohen Schornstein und von dem Hause, in dessen Dachkammer der Dichter wohnte, nichts mehr zusehen war – aber auch gar nichts.


Butter und Marmelade, und Pflaumenmus – das alles schmeckt gut auf der Brotschnitte! Das fand Peterle auch und aß stets vergnügt seine Stullen bis auf das letzte Krümchen auf.
Dann aber kam eine Zeit der größten Not über das Vaterland. – Da hieß es, trocken Brot essen. Die größeren Geschwister gewöhnten sich ganz schnell daran. Peterlein aber, das Nesthäkchen, streikte.
»Brot ohne Schmier, nein Mutter, das esse ich aber nicht!« jammerte er, worauf Mutter nichts weiter erwiderte als: »Du ißt es, mein Sohn, so gut wie wir alle!«
»Hm«, dachte Peter, »das meinst Du wohl so!« und verkroch sich zum Nachdenken in seinen Lieblingswinkel hinter der Laube. Das Stück trocken Brot hielt er unversehrt in der Hand.
Als er dort grübelnd saß, kam gackernd ein Huhn daher und suchte Futter am Boden. Peterle sah das Huhn an, dann das Brot in seiner Hand und schon war's geschehen! Das Brot lag im Grase, das Huhn pickte gierig daran herum. Peter frohlockte. »Ich esse bestimmt kein trocken Brot!« dachte er. »Wozu gibt es denn Hühner und Spatzen?« Von nun an jammerte er nicht mehr, so daß Mutter ihm öfters voll Zufriedenheit mit der Hand über den Lockenkopf streichelte. Da wurde Peter aber doch rot vor Verlegenheit, besonders, wenn eben draußen auf dem Hofe ein Huhn so recht zufrieden und satt gackerte.
Jedoch das Schicksal schreitet schnell. Immer konnte es ja nicht so weitergehen.
Zuerst fiel es Mutter doch auf, daß Peterle gar nicht mehr satt zu machen war. Immer wollte es noch mehr zu essen haben, sogar von den dicken weißen Bohnen, von denen er sonst sehr bald genug hatte. Das erschien der Mutter merkwürdig[52] und als es eines Tages nur grüne Kräutersuppe gab und Peter weinte, weil er nicht satt war, meinte sie: »Wie kannst Du denn so hungrig sein, Du hattest doch um 10 Uhr ein besonders dickes Stück Brot?«
Da verschnappte er sich und brüllte: »Wenn ich es aber doch gar nicht gegessen habe!«
Da ging der Mutter ein Licht auf – nein – verschiedene Lichtlein.
Am nächsten Tage spürte sie Peter leise nach und sah nun, mit welcher rührenden Liebe er sein Brot unter Hühner, Enten und Spatzen verteilte. Sie sagte aber gar nichts als: »Von jetzt an ißt Du Dein Brot immer bei mir in der Küche auf, mein Junge.« Und Peter verstand wohl, was sie meinte.
Würgend und kauend stand nun der Junge jeden Tag eine Stunde neben dem Herde, wo die Mutter das Mittagessen kochte, und dachte: »Das riecht gut – das riecht besser als mein Brot ohne Schmier schmeckt!« Aber gegessen wurde nun das Brot, dafür sorgten Mutters wachsame Blicke, die wie Schutzmänner daneben standen. Eines Tages wurde Mutter vor die Haustüre gerufen. Der[53] Mann mit dem großen Wagen voller kreischender, flatternder Gänse war gekommen und Mutter mußte sich für den Winter 10 Stück davon aussuchen. »Ha«, machte da Peter und benutzte die Gelegenheit, sein trockenes Brot nicht zu essen. Aber wo sollte er es nun lassen, daß es Mutter nicht fände?
Da fiel sein Blick auf das offene Feuerloch – und drinnen lag das Brot.
Kaum aber hatten die Flammen es ergriffen, da gab es einen fürchterlichen Knall, die Herdringe flogen in der Küche umher, ein feurig leuchtendes, riesengroßes Weib mit brennenden Haaren entfuhr dem Feuerloch, packte Peter mit eisernem Griff und schoß mit ihm durch den Schornstein hinaus. Jetzt muß ich sterben! war Peters letzter Gedanke. Dann schwanden ihm die Sinne.
Als er wieder erwachte, sah er, daß das feurige Weib mit ihm weit über die Felder lief in glühendem Sonnenschein.
Da packte ihn die Angst. Mit beiden Fäusten stieß er um sich und schrie: »Laß mich los! Wer bist Du denn, Du böse Frau? Ich will zurück zu Mutter!« »Das sollst Du auch!« lachte das Riesenweib.[54] »Aber erst komm' mal mit. Ich bin die Roggenmuhme und will Dich schnell lehren, trocken Brot zu essen.«
Sie stieg mit ihm eine Anhöhe hinab in ein finsteres Loch. Darinnen kroch sie ganz tief hinein – immer tiefer und zog Peter nun an der Hand hinter sich her. Und je weiter sie krochen, um so heißer wurde es, so daß Peter das Wasser von der Stirne lief.
Endlich stand die Frau stille und strich mit der Hand leise über die Decke des niederen Gewölbes. Da wurde diese hell und durchsichtig und hing voll lauter zarten Fäserchen und Fädchen.
»Siehst Du das?« fragte die Roggenmuhme. »Das sind alles die Wurzeln des Kornes, aus dem das Brot gemacht wird. Jede Wurzel trägt einen Halm, jeder Halm trägt eine Aehre. Nun zähle sie mal – so – mit dem Finger.«
Und Peterle zählte und es war fürchterlich heiß und als er bis 100 gekommen war, wollte er aufhören.
»Weiter!« rief die Muhme und sah sehr böse aus.
So ging es bis 200 – 300 – 400 und immer weiter und Peter konnte vor Hitze kaum stehen.

Als er bis 1000 gekommen war, sagte die Frau: »So, nun reicht es wohl. Soviele Körner müssen Wurzel schlagen und Halme treiben, damit droben auf der Erde ein Brot gebacken werden kann.«
Und sie nahm Peter fest bei der Hand und kroch mit ihm wieder aus dem Erdloche heraus und lief in glühender Hitze mit ihm weiter. Als sie nun um einen Berg herumbogen, wehte ihnen ein böser Wind entgegen und schlug ihnen Regen und Hagelkörner ins Gesicht und peitschte wie wild die Halme eines beinahe reifen Winterroggenfeldes.
»So, da stell' Dich hin – dicht daneben und steh' gerade und still!« sagte die Muhme.
Da stand er nun neben den wogenden Halmen und konnte wie diese sich kaum aufrecht halten. Und wurde vom Sturme gestoßen und gebogen und mußte aushalten. Denn wie zu Hause Mutters Augen, so standen hier die Augen der Roggenmuhme Wache, daß alles richtig geschah.
Und der Regen klatschte auf seinen Kopf herab, daß die Haare ganz schwer wurden, aber immer, wenn er sich duckte oder fortlaufen wollte,[57] rief die Muhme: »Sieh auf die Halme, wie sie ihre Pflicht tuen, damit Ihr undankbaren Menschen Brot zu essen habt.«
Endlich erhob sich die Frau von dem Stein, auf dem sie gesessen, nahm Peter bei der Hand und sprach: »Komm weiter!«
Sie gingen bis zu einem nahen Felde, auf dem das Korn geschnitten wurde. Da drückte die Muhme Peter eine Sichel in die Hand und befahl ihm, mit den Leuten zu arbeiten. Die sahen den Knirps spöttisch von der Seite an, verhöhnten ihn auch. Er aber mußte schneiden, schneiden in sengendem Sonnenschein. Ebenso erging es ihm in einer Scheune, wo die Leute beim Dreschen waren. Der schwere Dreschflegel riß ihn beinahe zu Boden, aber er mußte dreschen, dreschen bis er zusammenbrach.
»Ich habe solchen Hunger!« rief er da zum ersten Male.
»So,« meinte die Muhme, »das glaube ich wohl. Aber das Brot, das Du essen möchtest, ist noch lange nicht fertig. Komm zur Mühle!«
In der Mühle mußte er die schweren Getreidesäcke tragen und in die Mahlgänge ausschütten. Und später die Säcke mit fertigem Mehl auf[58] den Speicher schleppen. Nun mußte er weinen vor Müdigkeit.
Da sah ihn die Muhme zum ersten Male freundlich an und sprach: »Nun haben wir nur noch einen Weg. Nun gehen wir zum Bäcker.«
Da erwachten Peterles Lebensgeister aufs neue und er schritt tapfer drauflos. Und tapfer half er dem Bäcker den Teig zu kneten und die großen Brote zu formen. Dann schob er sie mit aller Kraft seines kleinen Leibes auf einer großen Schaufel in den glühenden Backofen und zog sie, als sie fertig gebacken waren, wieder heraus.
Als er sich nun aber nach der Roggenmuhme umsah, war sie verschwunden.
Da flehte der Knabe den Bäcker an: »Um Gottes Barmherzigkeit willen, schenkt mir ein Stücklein Brot!« Und er mußte sich schnell hinsetzen, sonst wäre er umgefallen vor lauter Schwäche.
Der schnitt ihm ein großes Stück Brot und gab es ihm.
Und Peterle biß in das trockene Brot, als wenn es das schönste Butterbrot gewesen wäre, so herzhaft und glücklich.
Er wußte nun, was es heißt, Hunger zu haben, und wieviel Segen und Pflichttreue und Arbeit dazu gehört, bis ein einziges Brot auf dem Ladentische des Bäckers liegt.
Die Roggenmuhme hatte ihn gelehrt, trocken Brot zu essen, und wer darüber am glücklichsten war, das war Peterles Mutter.


Der schöne junge König saß noch immer einsam auf dem Throne. Der goldgestickte Sessel zu seiner Rechten blieb leer.
So manche junge, liebliche Prinzessin schielte nach demselben hin und dachte in ihrem Herzen: »Könnte ich doch dort sitzen im langen samtenen Schleppkleide, die blinkende Krone auf dem Haupte! Könnte ich doch des jungen, schönen Königs Gemahlin werden!«
Manche dachte so und weinte nachts ihre Kissen naß, denn Königin wurde sie nicht.
Zwar wollte der junge König sich gerne verheiraten und dem Lande eine Königin geben. Zwar mußten einmal im Jahre an seinem Geburtstage[61] alle Prinzessinnen des Reiches und der Nachbarreiche vor ihm erscheinen, daß er unter ihnen die Gattin wähle – aber die Rechte fand er nie. Und ganz eigen war es, wie er sich bei dieser Prinzessinnenschau benahm. Er blickte nicht nach dem Antlitz der jungen Schönen. Er sah nicht auf ihre edle Gestalt. Nur die Hände ließ er sich zeigen – nur sie betrachtete er und schüttelte dann jedesmal verneinend das Haupt. So viele schöne, zarte, beringte, feine Prinzessinnenhände er auch sah, nie gefielen sie ihm. Nun dachten die Prinzessinnen nicht anders, als daß ihre Hände dem jungen Könige noch immer nicht schön genug wären. Sie sannen nur noch darüber nach, wie sie dieselben pflegen könnten. Wuschen sie mit Morgentau, badeten sie in süßer Mandelmilch, ließen sie vom Mondenlichte bescheinen, bis sie zart und weiß schimmerten wie die Blütenblätter der Lilie.
Da war besonders ein feines, blondes Prinzeßchen mit Namen Gerda, das hatte den jungen König von Herzen lieb und sehnte sich Tag und Nacht darnach, seine Gemahlin zu werden. Aber auch ihre Hände fanden keine Gnade vor des jungen Königs Augen.
So stand wieder einmal des jungen Königs Geburtstag im Kalender, der Tag der Brautschau. Am Tage vorher waren natürlich alle Prinzessinnen sehr aufgeregt.
Um sich zu zerstreuen, machte Prinzeß Gerda im nahen Walde einen Spaziergang in Begleitung ihrer sechs jungen Hofdamen. Singend und scherzend hüpften diese auf dem weichen Moose umher. Nur Prinzessin Gerda ging toternst ihren Gedanken nach. Plötzlich kreischten die sechs Fräulein entsetzt auf und fuhren aufgeregt auseinander. Da erwachte Prinzeß Gerda aus tiefem Sinnen und als sie vor sich auf den Weg blickte, sah sie dort eine dicke, aufgeblasene, braune Kröte, die, sich mühsam vorwärtsschleppend und hinkend, langsam den Weg überquerte. Das eine Bein des armen Tieres war gebrochen.
»Oh, Du armes, armes Tierchen!« rief Prinzessin Gerda, kniete nieder und streichelte mit ihren feinen, weißen, edelsteinfunkelnden Fingern die verletzte Kröte. Staunend und kopfschüttelnd standen die Hofdamen und wagten vor Grausen und Ekel nicht näherzutreten.

Die Kröte aber hielt in ihrem mühseligen Gange inne, sah Prinzeß Gerda mit großen, erstaunten[64] Augen an und sagte: »Du geliebtes, herzensgutes Kind! Mit den himmlischzarten Fingerlein streichelst Du mein ekliges, warziges Fell! Mit den schönen, schönen Prinzessinnenhänden!«
»Ach!« seufzte Prinzeßchen und besah traurig seine Finger. »Ach! Schön nennst Du sie? Dem Könige gefallen sie aber gar nicht und ich habe doch nur den einen einzigen Wunsch, daß sie ihm endlich gefallen möchten, dem jungen Könige, den ich so lieb habe und dessen Gemahlin ich doch so furchtbar gerne werden möchte!«
»So – so,« murmelte die Kröte und lächelte mit ihrem breiten Krötenmaule so süß, wie man es bei diesen Tieren selten sieht. »So – so? – Na – na? – Da soll ich alte Humpelliese dem schönen Kindchen wohl dazu verhelfen, daß aus dem Prinzeßchen eine kleine Königin wird? Ja, ja, ich weiß es wohl, daß der junge König bei der Wahl seiner Gemahlin nur nach den Händen sieht und ich weiß auch, warum er dies tut. Nun geh einmal dorthin, liebes Kind, und pflücke die Wolfsmilch, die da am Wege steht. Du kennst sie doch, die Wolfsmilch?«
»Ja, die niedliche Blume,« sprach Prinzeßchen, »die die vielen, vielen kleinen Blättchen und die hübschen, rötlichen Blüten hat.«
»Ja, die ist's,« erwiderte die Kröte. »Aber wie oberflächlich ihr Menschenkinder doch alles betrachtet und benennt! Was Du da als Blättchen ansiehst, sind nämlich lauter kleine Stiele, und die paar rötlichen Blättchen an der Spitze, die Du Blüten nennst, das sind die eigentlichen Blätter. Merke Dir das, Kind. Und nun zur Sache. Die Pflanze zerdrücke zwischen den Fingern, benetze mit dem weißen Saft, der ihrem Stengel entquillt, tüchtig Deine Hände und ich verspreche Dir, Deine Hände ganz allein werden Gnade vor des Königs Augen finden und Dich wird er zu seiner Gemahlin machen.«
So eifrig rieb nun Prinzessin Gerda ihre Finger mit dem weißen Wolfsmilchsafte ein, daß sie gar nicht bemerkte, wie die Kröte leise lachend von dannen humpelte.
Dann ging sie mit freudig klopfendem Herzen heim.
Wie groß aber war der Schrecken der Prinzessin, als sie am nächsten Morgen beim Erwachen entdeckte, daß ihre wohlgepflegten Finger durch[66] das Einreiben mit dem Safte der Wolfsmilch ganz und gar mit braunen Flecken übersät waren. »Oh, die böse Kröte,« rief sie. »Das ist der Dank für meine Freundlichkeit gegen sie. Und wie häßlich hat sie mich belogen!«
Unter Weinen und Jammern rieb und wusch sie nun ihre zarten Hände. Die Flecken verschwanden nicht.
Am Abend, als alle anderen Prinzessinnen bei der Brautschau dem Könige ihre Hände hinstreckten, stand Prinzeß Gerda traurig abseits und versteckte die ihren beschämt auf dem Rücken.
Im Kreise umstanden die Schönen den König und warteten und jede hoffte in ihrem Herzen, daß ihre Hände heute dem Könige gefallen würden und er sie zu seiner Königin machen würde. Der König betrachtete nacheinander ganz genau die vielen zarten Finger, die sich ihm entgegenstreckten. Dann lächelte er wehmütig, schüttelte den Kopf und wollte grade betrübt die Stufen zum Throne einsam und allein emporsteigen, als er Prinzeß Gerda stehen sah, die scheu zu Boden blickte und die Hände auf dem Rücken versteckte. Leise trat er zu ihr und sprach: »Warum stehst Du hier so verlassen und zeigst mir heute Deine[67] Hände nicht? Wünschest Du Dir nicht mehr, meine Gemahlin zu werden?«
»Ich kann sie ja nie, nie mehr sehen lassen; sie sind zu häßlich!« erwiderte Gerda.
»Zeige sie!« gebot der König. Da mußte Prinzeßchen gehorchen und streckte dem König ängstlich ihre Fingerlein entgegen. Der warf nur einen Blick auf dieselben, dann stutzte er, sah Prinzeßchen tief in die Augen und sprach: »Endlich habe ich das Glück gefunden, das ich so lange schon suchte. Du, Prinzessin Gerda, Du wirst meine Gemahlin und die Königin meines Landes.«
Prinzessin Gerda war vor freudigem Schreck ganz benommen, als der König sie bei der Hand nahm und sie zu dem Thronsessel führte. Die vielen neidischen Blicke aber, die ihr die anderen Prinzessinnen zuwarfen, die spürte sie bis tief ins Herz hinein.
Wieder ergriff der König ihre Hand, küßte sie und sprach laut zu den Versammelten: »Ich habe nun eine Königin gewählt und wollt Ihr wissen, warum meine Wahl just auf Prinzessin Gerda fiel? Weil ich an den braunen Flecken, die Ihr an ihren Händen erblickt, sehe, daß sie ihre Tage nicht mit Nichtstun zubringt. Daß sie arbeitet. Eine[68] Königin aber, die nicht arbeitet, wäre für die anderen Frauen ihres Reiches ein schlechtes Beispiel.«
Als die Prinzessin dies hörte, wurde sie tieftraurig und sprach: »Wenn Ihr so denkt, lieber König, kann ich Eure Gemahlin nicht werden. Ich habe ja noch nie in meinem Leben gearbeitet. Die Flecken an meinen Händen kommen ja nur von dem giftigen Saft der Wolfsmilch her, mit dem ich sie eingerieben habe.« Und nun erzählte sie die ganze Geschichte von der Kröte mit dem gebrochenen Bein und allem, was diese ihr geraten, gesagt und versprochen hatte. Darnach schickte Prinzeß Gerda sich an, die Stufen des Thrones wieder hinabzusteigen, und weinte bitterlich.
Da ergriff der junge König ihre Hand, küßte die Prinzessin auf den Mund und sagte: »Und dennoch wirst Du meine Gemahlin! Du hast aus lauter Mitleid und Herzensgüte mit Deinen zarten Prinzessinnenhänden die ekle Kröte gestreichelt. Du wirst aus Liebe zu mir und zu Deinem Volke auch arbeiten, wenn es nottut.«
»Das werde ich,« sprach schlicht die Prinzessin und lehnte das Haupt glückselig an die Schulter des Königs. Sie hat ihr Versprechen[69] treulich gehalten. Als schwere Zeiten über das Land kamen, hat sie ihre feinen Hände nicht geschont und gearbeitet wie eine einfache Tagelöhnersfrau. Wenn dann der König an den schönen Fingerlein einen Flecken entdeckte, fragte er neckend: »Hast Du sie wieder mit Wolfsmilch eingerieben?« Dann lachten sie beide. Sie waren sehr glücklich bis an ihr Ende.


Warum der Brunnen vor dem Nachbarhause das Engelbrünnlein hieß, das wollten die Kinder wissen.
Weil es nun so schön warm im Zimmer war, die Bratäpfel im Ofen so lustige, unmanierliche Tönchen von sich gaben, die Kinder den ganzen Tag über brav gewesen waren, war Mutter so recht guter Laune und ließ sich erweichen.
Da erzählte sie denn, daß der Brunnen früher gar keinen besonderen Namen gehabt hätte. Eines Tages aber war großer Kummer im ganzen Dorfe. Ein liebes, kleines, pausbäckiges Büblein war so lange auf dem Brunnenrand herumspaziert,[71] bis es hineingefallen war. Weil aber alle Leute auf dem Felde bei der Arbeit waren, hatte niemand das jämmerliche Schreien des Kleinen gehört und so konnte er aus dem nassen, kalten Wasser nicht wieder herausgezogen werden. Da aber wuchsen ihm tief unten im Brunnen zwei herrliche Flüglein, er wurde ein liebes Englein, flog aus dem Brunnen heraus, plusterte und schüttelte sich, daß das Wasser nur so umherspritzte, flog hinauf zum lieben Gott in den Himmel und niemand hat das herzige Büblein je wiedergesehen.
»Ah«, riefen da die Kinder und sahen durch das Fenster zum bestirnten Nachthimmel auf und beneideten das Büblein, das so flink ein Engel Gottes geworden war.
Nun durfte es ja immerzu mit den anderen Engeln um die Wette singen und spielen.
Die kleine Rosa schwieg zuerst ganz still, dann aber fragte sie: »Mutter, wird denn jeder, der hineinfällt, ein Englein?«
»Nicht jeder, nur die ganz kleinen Kinder, die sich noch nicht selber helfen und nicht wieder herausklettern können,« antwortete die Mutter.
Der Winter verging, der Frühling kam. Die Kinder spielten Ringelreihen oder flochten Blumenkränze und setzten sie sich auf. Der Sommer folgte und brachte Beeren und schöne Pilze und niemand dachte mehr ans Geschichtenerzählen.
Vater und Mutter arbeiteten bis abends spät draußen auf dem Felde, die größeren Kinder mußten ihnen helfen. Die kleineren durften die Ziegen hüten und die Gänse. Das war des Jahres schönste Zeit.
Wenn dann der Abend kam, war die ganze liebe Familie so müde, daß ihnen allen die Augen zufielen und es im Hause neben dem Engelbrünnlein schon mäuschen-, mäuschenstill war, wenn der gute Mond über den Wald herübergewandelt kam.
So war es auch eines Abends mäuschenstill. (Hört Ihr Kinderlein?) Nur das Brünnlein rauschte und der Bach, der an der Seite aus dem Brünnlein herausfließt, murmelte und rieselte.
Jetzt aber paßt auf! Jetzt beginnt die eigentliche Geschichte.
Also, der Mond schien so schön hell, daß man alles ganz genau sehen konnte. Da öffnete sich an dem Hause neben dem Engelbrünnlein leise, leise die Türe und ohne Schuhe und Strümpfe,[73] im Nachthemdlein kam die kleine Rosa geschlichen, just wie sie aus dem Bettlein gestiegen war.
»Ei, ei,« dachte der Mond, »was gibt es denn da? Das kleine Mädchen gehört doch in die Federn!«
Er zog ein ganz schiefes, böses Gesicht, so ärgerlich war er.
Aber die kleine Rosa merkte nicht, daß jemand sie so böse ansah. Munter trippelte sie drauflos und hielt dabei mit beiden Händen ihr buntes Holzpüppchen fest.
Immer ärgerlicher wurde das Gesicht des Mondes, denn die kleine Rosa ging nun geradeswegs auf den Brunnen zu.
Er schnitt dem Kinde die bösesten Gesichter, furchte die Stirne, runzelte die Brauen, öffnete den Mund ganz weit. Es half alles nichts.
Klein Rosa stieg auf den Rand des Brunnens und deutlich hörte er sie sagen: »Ein Englein möchte ich haben, ein richtiges mit Flügeln, das fliegen kann. Liebes Engelbrünnlein, mache mir aus meinem Püppchen ein Engelein.« Dann beugte sich die kleine Rosa weit vor, gab ihrem Püppchen einen Kuß und tauchte es vorsichtig ins Wasser.
Der Mond aber war nun gar nicht mehr böse. Nein, er lächelte liebevoll und gütig und sandte einen seiner silbernen Strahlen aus, daß er dem Kinde helfe. Und siehe da, der Strahl tauchte in den Brunnentrog, berührte leise das Holzpüppchen, und als die Kleine die Puppe wieder aus dem Wasser hob, hatte sie schöne, goldene Flügel am Rücken. Laut jubelte das Kind und erzählte es dem Monde, den Wolken, den Bäumen, den schlafenden Häusern: »Ich habe ein Englein, ein richtiges Englein! Mein Püppchen ist ein Englein geworden!«
Und sie nahm das Englein in beide Hände und rief: »Englein flieg! Englein flieg!«
Aber das Englein flog nicht. Es war eben doch nur ein Puppenenglein – kein Menschenenglein. Und soviel die Kleine es auch in der Luft schwang – es rührte sich nicht und die goldenen Flügel blieben unbeweglich.
Da weinte die kleine Rosa bitterlich.
Das hörte der alte Nachtwächter des Dorfes und kam so schnell herbeigelaufen, wie es seine schweren Stiefel und das mächtig große Tuterohr erlaubten.

»Was, das ist ja die Rosa, die hier so schreit!« rief er. »Die Rosa mitten in der Nacht und im Hemde! Ei der Tausend – was werden die Eltern dazu sagen? Schnell, schnell, zurück ins Bett!«
Flink ergriff er das Kind bei der Hand und zog es mit sich fort dem Hause zu. So schnell mußte Rosa laufen, daß sie ihr Englein aus der Hand fallen ließ. Da half alles Jammern und Schreien nichts – der böse alte Nachtwächter ließ nicht los und brachte Rosa zu den Eltern.
Das Englein war in den Bach gefallen.
Erst drehte es sich ein paarmal im Kreise herum, stieß hier mit einem Flügel, da mit einem Händchen an einen großen Stein – dann ging es heidi! immer weiter, immer weiter, dahin auf den Wellen des Baches.
Als der Morgen graute, schwamm Rosas Englein bereits in einem großen, breiten Strom. Die Sonne beschien seine goldenen Flügel, so daß sie weithin leuchteten.
Das sah aber niemand als der liebe Gott und die Vögel, die über den Fluß dahin flatterten.
Aber um Mittag, als die Sonne schön warm schien, fanden bei einem Dorfe die Fischer in einem[77] ihrer Netze das Puppenenglein, das sich darin gefangen hatte. Sie trauten ihren Augen nicht und wunderten sich und lachten und wollten das Englein mit nach Hause nehmen.
Da schüttelte der älteste Fischer den Kopf und sagte: »Tut das ja nicht! Das bringt Euch Unglück ins Haus. Seht Ihr denn nicht, daß das einer von den geschnitzten Englein von unseres Heilandes Altar ist? Den hat ein Bösewicht gestohlen und ihn dann aus Furcht vor Strafe in den Strom geworfen. Laßt ihn wieder schwimmen.«
Da taten die Männer, was der Alte gesagt hatte und Englein wurde von den Wellen immer weiter getragen, vorbei an Wäldern, Feldern und Ortschaften.
In einer großen, großen Stadt mit vielen Türmen lagen am Ufer des Stromes mächtige Kähne, auf denen allerhand Waren aufgestapelt waren. Da gab es Fässer, und Kohlen und Gemüse. Am lustigsten sah ein Kahn aus, auf dem es nur rotbackige und goldgelbe Aepfel gab.
Und lustig waren die beiden Alten, ein Männlein und ein Weiblein, die ihr schönes Obst an die vorübergehenden Städter verkauften.
Die beiden saßen gemütlich auf dem Vorderteil ihres Schiffes und sonnten sich. Da machte Mütterchen große Augen und zeigte mit der Stricknadel ins Wasser. Und Väterchen rief: »Nanu, was schwimmt denn da?« und versuchte mit einer langen Stange den blinkenden Gegenstand aus dem Wasser zu ziehen. Als es ihm endlich gelang, jubelten die beiden vor Freude und riefen: »Ein Engel! Ein Englein! Das schickt uns der liebe Herrgott – das wird uns Glück bringen!«
Und Mütterchen nahm klein Rosas Puppenenglein auf den Schoß und trocknete ihm mit ihrer Schürze ganz vorsichtig Gesicht und Hände und Füße und ließ die liebe Sonne auf die goldenen Flügel scheinen, daß sie wieder schön sauber und blank wurden.
Wie die Kinder freuten sich die beiden Alten an ihrem Schatz.
Da kam eine schwarz verschleierte Dame auf das Schiff um Aepfel zu kaufen. Die führte an der Hand ein kleines Mädchen mit großen, traurigen Augen.
Als die Kleine das Puppenenglein sah, lachte sie jedoch sogleich und lief eilig darauf zu[79] und rief: »Mutter, Mutter, sieh die reizende Puppe. Bitte, bitte, kaufe sie mir!«
Da sahen die beiden Alten sich an und das Mütterlein sprach: »Mein liebes Kind, das Püppchen ist nicht zu kaufen. Das hat uns eben der liebe Herrgott geschickt.« Da schlich das Kind betrübt bei Seite.
Die Mutter aber trat zu den alten Leuten und bat: »Gebt mir das Spielzeug, wenn es irgend geht. Ihr tut ein gutes Werk. Gott wird es Euch lohnen. Meine kleine Hilda hat vor wenigen Wochen ihr einziges Schwesterchen verloren. Seitdem hat sie das Lachen und Spielen verlernt. Verkauft mir das Püppchen, damit sie wieder eine Freude hat.« Da legte das alte Mütterlein dem Kinde die Puppe in den Arm und die kleine Hilda war glückselig und lachte. Als die Mutter mit dem Kinde das Obstschiff verlassen hatte, fanden die alten Leute im Strickkorbe des Mütterchens eine Menge Goldstücke, welche die Dame zum Dank heimlich hineingetan hatte. Da freuten sie sich und der Greis sprach: »Nun können wir endlich unser altes, morsches Schiff wieder ausbessern. Das Englein hat uns doch großes Glück gebracht.« »Und,« sagte das Mütterchen,[80] »und das arme Kindchen hat eine Freude und lacht nun wieder.«
Am glücklichsten aber war klein Hildes Mutter, denn ihr kleines Mädchen vergaß nun über dem lieblichen Puppenengel den Kummer über die gestorbene kleine Schwester. Klein Rosas Püppchen mußte immer bei ihr sein, bei Tag und bei Nacht und wenn andere Kinder ihre gewöhnlichen Puppen, die keine Flügel hatten, spazieren trugen, hielt Hilde stolz ihr Englein im Arm und ließ die Sonne auf seine goldenen Flügel scheinen. Die glänzten und glitzerten und erfüllten die Herzen der anderen Kinder mit Neid. Davon merkte die kleine Hilde in ihrer Freude garnichts, bis sie eines Tages hörte, wie ihre Gespielen hinter ihr hersangen:
Dabei lachten sie laut und schadenfroh.
Das tat Hildes kleinem Herzen sehr weh. Immer wenn sie ihr Püppchen herzte und mit ihm spielte, tönte es ihr im Ohr:
Dann wurde sie traurig und flüsterte: »Englein, flieg! Nur ein einzigesmal, flieg, mein Englein!«
Dabei hob sie das Püppchen hoch in die Luft.
Aber, wer nicht flog, weil es ja nicht konnte, war das Engelspüppchen.
Als dann ein großer Sturm über die Stadt dahinbrauste, Schornsteine und Fensterladen zerschlug und Bäume entwurzelte, da öffnete Hilde ganz heimlich das Fenster, hielt ihre Puppe hinaus und rief: »Nun wird's schon gehen, Englein, flieg!« Und ehe sie sich's versah, riß der Sturm ihr ihren Liebling aus der Hand. Nun flog das Englein, aber nicht in die Höhe, wie richtige Engel es tun in den grauwolkigen Himmel hinein. Nein, es drehte sich ein paarmal in der Luft und flog dann, plumps! in die Tiefe, mitten auf den Schoß des Königs, der gerade vorüber fuhr.
Der erschrack sehr, sprang vom Wagensitz in die Höhe und rief dem Kutscher zu: »Halt! So halt doch Friedrich!«
Der Kutscher griff schnell in die Zügel – die Rosse standen still.
Im selben Augenblick stürzte dicht vor den Pferden ein hohes, steinernes Tor durch die Gewalt[82] des Sturmes zusammen. Das hätte den König erschlagen, wenn er einen Schritt weiter gefahren wäre. Und er wäre weiter gefahren, wenn nicht das Puppenenglein ihm in den Schoß gefallen wäre.
»Du bist mein kleiner Lebensretter,« rief der König und hielt das Püppchen hoch, daß jeder es sehen konnte und das Volk jubelte und jauchzte.
Der König aber suchte mit den Augen in der Höhe, um zu sehen, woher das Englein wohl gekommen sein mochte. Da erblickte er klein Hilde weinend am Fenster stehend und winkte ihr, herabzukommen.
Schnell, schnell kam das Kind die Treppe heruntergelaufen und knixte vor dem Könige. Nun mußte es ihm die ganze Geschichte erzählen und als der König erfuhr, daß Hilde ihr Englein hatte fliegen lehren wollen, da lachte er herzlich und sprach: »Mein liebes, kleines Mädchen, dies Puppenenglein lernt das Fliegen nie, aber ich schenke Dir eine große, schöne Engelspuppe, die fliegen kann. Die sollst Du Dir am nächsten Weihnachtsabend bei mir im Schlosse holen.
Meinen kleinen Lebensretter mußt Du mir aber dafür lassen, nicht wahr, der darf mich nie mehr verlassen, solange ich lebe.«
Hilde nickte dem König selig zu und lief schnell zur Mutter, um ihr zu erzählen, was der König ihr versprochen hatte. Der fuhr vergnügt nach Hause in sein herrliches Schloß. Dort ließ er seinen Hoftapezier zu sich rufen, der mußte über des Königs Bett einen Himmel aus hellblauseidenen Wolken anbringen und das Englein darin schwebend befestigen.
So sah es der König jeden Morgen und jeden Abend und freute sich daran. Er schlief vergnügt ein und erwachte frohen Herzens, denn sein kleiner Lebensretter schwebte über ihm.
Für Hilde bestellte er bei einem berühmten Künstler eine schöne, große Engelspuppe mit goldenen Flügeln. Die trug unsichtbar innerlich eine Maschine. Wenn man sie mit einem Uhrschlüssel aufzog, flog sie ganz richtig im Zimmer umher – und tut es vielleicht heute noch, wenn sie nicht unterdessen längst »kaputgegangen« ist.
Als dann der König alt und krank wurde und immer im Bett liegen mußte, war sein einziger Trost das Puppenenglein, das über seinem Bette[84] in blauen Wolken schwebte. Ihm lächelte er zu – und das Englein lächelte wieder. Sie verstanden sich sehr gut. »Wir gehören für immer zusammen!« das wollte das Lächeln sagen.
In seiner Todesstunde, als der alte König vor Schwäche kaum noch reden konnte, sprach er: »Mein – Englein – gebt – mir – mit – wenn – ich – sterbe!«
Und so geschah es. –
Auf diese Weise ist klein Rosas Puppe zugleich mit dem König in den Himmel gekommen.


Zu ihren Füßen Vergißmeinicht, Verbenen und Heliotrop. Zu ihren Häupten nur den blauen Himmel – so stand die stolze Lilie in strahlender Schönheit inmitten eines herrlichen Parkes. Kerzengerade stand sie da, Tag und Nacht, edel und schön. Morgens schmückten sie unzählige Edelsteine – der Nachttau war's, der sich leise auf sie niedergelassen hatte. Mittags kleidete der Sonnenschein ihre schlanke Gestalt in goldene Gewänder. Und wenn die Nacht zur Erde stieg, geschah es oft, daß das Mondenlicht die Holde in silberweiße Schleier hüllte. Das kleine Mädchen, das an der Hand einer lieben alten Frau auf den Wegen des Parkes dahintrippelte, stand oft mit[86] gefalteten Händen vor der stolzen Lilie und konnte sich nicht sattsehen an ihrer Pracht. Eines Tages sagte das Kind: »Sieh, Großmutter, wie sie dasteht! Keine andere Blume hat eine so stolze Haltung, ein so köstliches Kleid und eine so wunder-wunderbare Krone. Ich glaube, sie ist eine Fürstin. Wir müssen sie verehren!« Und die Kleine hob mit beiden Händchen ihr Kleidchen und machte einen tiefen Knix vor der Blume und bat die Großmutter, es ebenso zu machen. Die lächelte – dann verneigte sie sich tief vor der Fürstin unter den Blumen, ruhig und feierlich, wie alte Damen sich verneigen, wenn der Kaiser des Weges kommt. Seitdem hieß die schlanke Lilie nur »Die Fürstin« und Großmutter und Enkelin zeigten ihr ihre tiefe Verehrung durch eine Verbeugung, so oft sie vorübergingen.
Die Fürstin hatte aber auch noch andere Verehrer die Menge. Da war der weiche Südwind, der sie umschmeichelte und ihr seine Bewunderung ins Ohr flüsterte. Da waren die buntschillernden Schmetterlinge, die sie umgaukelten. Die großen und die kleinen Käferlein, die sie umsurrten. Surr – surr! Sum – sum! So ging es den ganzen Tag. Die Fürstin hatte ein Recht, stolz zu sein[87] auf ihre prächtigen Gewänder, ihre herrlichen Juwelen und die vielen, vielen Verehrer.
Wenn der Winter in das Land zog, legte sie sich ruhig schlafen zusammen mit allen anderen Blumenkindern unter die weiche, linde Schneedecke. Sie wußte ja, der Sommer würde sie in alter, stolzer Pracht wieder erstehen lassen.
So war es einmal Spätherbst geworden und alle Blumen waren zur Ruhe gegangen. Da durchwandelten andere Leute laut und herrisch den schönen Park, Großmutter und die Kleine gingen nicht mehr darinnen umher. Ein Gärtner nahte mit schwerer Eisenschaufel und eine schrille Frauenstimme rief: »Hier müssen Rosen gepflanzt werden, viele feuerrote Rosen, damit die Vorübergehenden vor Staunen stehen bleiben. Fahren sie diese alte Erde hier fort und bringen Sie gute, neue dafür her.«
Der Gärtner holte eine Karre, schaufelte die Erde hinein, und mit ihr die Lilie, die jetzt in der unscheinbaren Knolle versteckt im Boden schlief. Er schob die Karre weit, weit fort in das Gebüsch, schüttete sie dort aus und ging von dannen.

Nun schlief die Fürstin ihren Winterschlaf in einem neuen Bette und wußte es nicht einmal,[89] bis im Frühling alle Blumen erwachten und auch sie die Augen wieder aufschlug.
»Wo bin ich?« flüsterte sie. »Ist dies ein Gefängnis, daß es so dunkel um mich her ist, daß ich so ganz allein bin?«
Dunkle, dunkle Taxusbüsche beschatteten den Winkel, in dem die Fürstin nun wieder zum Leben erwachte, müde und traurig, denn hier gefiel es ihr gar nicht. Hier sah sie den blauen Himmel nicht. Kein Nachttau schmückte ihr Haupt mit Juwelen. Kein goldenes Sonnenkleid umhüllte sie mehr zur heißen Mittagsstunde. Um sie her am Boden lag in wüster Unordnung Schutt und Geröll. Und wo blieben Liebe und Verehrung, die bisher das Glück ihres Lebens ausgemacht hatten? Großmutter und Enkelin sah sie niemals wieder. Der laue Südwind konnte nicht mehr zu ihr gelangen. Lichtblaue und weiße Falter umgaukelten nun wohl andere Blumen – zu ihr ins dunkle Gebüsch fanden sie nicht mehr den Weg.
Zitternd stand Fürstin Lilie einsam in der Verbannung und weinte bitterlich.
Da krabbelte und kraspelte es zu ihren Füßen. Unscheinbare braune Käferlein waren es, die einzigen[90] Freunde, die ihr aus den Tagen ihres Glanzes in die Verbannung gefolgt waren. Sie wisperten und tuschelten ihr Worte des Trostes zu, aber Fürstin Lilie hörte nicht auf zu weinen. Ihr Leben war zu trostlos und öde geworden. Sie achtete gar nicht auf das Flüstern der kleinen Tierchen.
Eine armselige kleine Abwechslung gab es aber doch in dem Gefängnis für sie. Durch einen schmalen Spalt in dem dunklen Gebüsch konnte sie in die Ferne blicken. Da sah sie oft ein großes, schwarzes Ungetüm vorüberbrausen und hörte es laut fauchen und schnauben und stampfen. So schnell wie es gekommen war, verschwand es aber auch immer wieder. In einer besonders dunklen Nacht erwachte sie von den wilden Tönen, die das Ungetüm ausstieß, und war geblendet. Goldgelbe, silbernschillernde, rubinrote, himmelblaue Edelsteine spie es fauchend aus. Zu beiden Seiten des Weges sanken sie hin und waren dann nicht mehr zu sehen.
»Oh, könnte ich diese wenigstens haben, um mich in meiner Einsamkeit damit zu schmücken. Dann wüßte ich doch einmal wieder, daß ich die[91] schöne Fürstin Lilie bin,« seufzte die Stolze. – Das hörten die Käferlein – die kleinen, unscheinbaren Käferlein. Ihnen war es ja bekannt, daß das Ungetüm die Eisenbahn war, und, daß die ersehnten Edelsteine die Funken waren, die die Lokomotive im Fahren ausspie. Gerne wollten sie den Wunsch der geliebten Fürstin erfüllen. So flogen sie denn am nächsten Abend ganz leise zu der Stelle, an welcher der Eisenbahnzug vorüberbrauste. Auf ihren kleinen braunen Rücken fingen sie jedes einen der schönen, schillernden Funken auf. Wohl tat es zuerst ein bißchen weh, aber das ertrugen sie gerne.
In Scharen kamen sie nun dahergeflogen, funkelnd in dunkler Nacht, und schwirrten hinein in den traurigen Winkel hinten im Gebüsch des Parkes, und schwebten im Kreise – ganz leise, um Fürstin Lilie herum. Dann setzten sie sich ihr aufs Haupt, auf die schneeigen Schultern, die weißen Hände, und selig zitternd dankte ihnen die also königlich Geschmückte mit einem lieblichen Lächeln.
Und sehnt auch Ihr Euch einmal nach Fürstin Lilies Juwelen, dann sucht an warmen Sommerabenden[92] in dunklen Büschen, im Grase am Wegesrande. Da werden sie Euch lieblich entgegenfunkeln und Euch umschweben, so wie sie Fürstin Lilie umschwebt haben – die lieben, kleinen Glühwürmchen.


Brüderlein und Schwesterlein lebten in einer niedrigen Hütte mit Vater und Mutter. Brüderlein half dem Vater im Walde das Holz zu sammeln und es nach Hause zu fahren. Oder er lief mit ihm weit, weit über Land um Obst, Kartoffeln und Gemüse einzuhandeln und an andere Leute zu verkaufen. Schwesterlein aber blieb bei Mutter in der Küche, trocknete Schüsseln und Teller ab, schälte Kartoffeln und kehrte sogar schon die einzige Stube des Häuschens mit einem großen, struppigen Besen aus.
Wenn die Kinder fleißig gewesen waren, ging es ans Spielen. Dann holte Brüderlein seinen alten Baukasten hervor und baute die herrlichsten Festungen und Schlösser.
Schwesterlein legte ihr Püppchen »Wunderhold« zu Bett in eine große Zigarrenkiste ohne Deckel und sang ihm ein schönes Wiegenlied vor. War es aber Sommer und die Sonne schien so schön warm, dann spielten die Kinder auf der Wiese vor dem Häuschen und sprangen vor Freude in die Luft und wälzten sich im Grase und die Eltern freuten sich und lachten mit ihren Kindern um die Wette.
Nicht weit von dem Häuschen zog sich eine lange, hohe weiße Mauer hin. Herrlich grünende und blühende Bäume sahen stolz über dieselbe hinweg zu den Geschwistern herunter. Mal neigten sie vornehm kühl das Haupt, mal nickten sie den Kleinen freundlich zu. Auch flüsterten die Bäume eifrig miteinander. Sonst schien sich hinter der weißen Mauer nichts Lebendes zu regen. Eines Tages aber hörte Brüderlein mitten im Purzelbaumschlagen auf, setzte sich aufrecht ins Gras, hob den Zeigefinger in die Höhe und lauschte. Schwesterlein sprang vom Boden auf, ließ alle Blümlein aus ihrer Schürze fallen und flüsterte: »Horch!«
Aus dem Nachbarsgarten scholl jubelndes, seliges Kinderlachen. Da faßten die Geschwister[95] sich an den Händen, liefen zur Mauer hin und versuchten dieselbe zu erklettern. Oh weh, es wollte nicht gehen! Vater und Mutter, die ihnen sicher geholfen hätten, waren fort auf Arbeit.
Endlich gelang es aber doch. Brüderlein nahm Schwesterlein auf seine Schultern, so daß es leicht hinaufsteigen konnte, und dann zog Schwesterlein Brüderlein an den Händen hinauf. Da saßen sie nun unter dem grünen, wehenden Blätterdach und sahen den ganzen blühenden Garten vor sich und den plätschernden Springbrunnen und die lachenden Kinder und waren stumm vor Staunen. Da waren kleine Knaben in weißen Höschen, die spielten mit einem prächtigen großen Hunde. Und kleine Mädchen in seidenen Kleidern schlugen mit blinkenden Schlägern nach rosenroten, himmelblauen und goldgelben Federbällen.

Dann sprangen sie lachend auf eine Bank zu und jedes Mädchen nahm zärtlich eine große Puppe mit blonden Locken in den Arm und tanzte mit ihr auf dem grünen Rasen. Und die Sonne schien noch schöner als sonst und die Vögel jubelten wie noch nie und als dann aus der Ferne eine[97] silberne Glocke rief und die fremden Kinder ihr Spielzeug ergriffen und davon schwebten – nur der Springbrunnen weiterplätscherte und die Bäume leise flüsterten, sahen Brüderlein und Schwesterlein sich ganz verdutzt an und glaubten, daß alles nur ein Traum gewesen wäre, und rutschten von der Mauer wieder herunter. Schwesterlein nahm sein Püppchen in den Arm, deren Kopf nur eine Kartoffel und deren Kleid ein Stück von Mutters Schürze war, und Brüderlein spielte mit den Karnickeln und waren seelenvergnügt. Am nächsten Tage scholl wieder das fröhliche Kinderlachen aus dem Nachbarsgarten zu ihnen herüber und wieder erkletterten sie die Mauer und erblickten die gleiche Herrlichkeit. Und so geschah es mehrere Tage fort. Da wurden die Kinder traurig, wenn sie in ihr ärmliches Heim zurückkehrten. Ihre billigen Kleider gefielen ihnen nicht mehr und an Puppe »Wunderhold« mit dem Kartoffelkopf und an dem alten Baukasten hatten sie keine Freude mehr. Sie erzählten nun den Eltern, was sie von der Mauer aus gesehen hatten. Und Brüderlein fragte: »Vater, warum haben es die Kinder so himmlisch schön?« Und Schwesterlein sagte: »Wie können denen ihre[98] Puppen so schöne blonde Locken haben und Wunderhold hat keine!«
Da sah Mutter sehr traurig aus und Vater meinte: »Glück muß man haben, Kinder. Wer das Glück zu finden weiß, der hat's gut.«
Da gingen die Kinder aus, das Glück zu suchen. Jeden Nachmittag, wenn die Eltern zur Arbeit fort waren, schlichen sie sich leise aus dem Hause und liefen querfeldein und suchten und suchten, bis sie müde wurden und die Füße ihnen wehe taten. Das Glück hatten sie nirgends gesehen.
So gelangten sie eines Nachmittags in eine unbekannte Gegend. Still war es dort – keine Seele war zu sehen. Sie standen vor einer hohen goldenen Gittertüre. Die öffnete sich lautlos ganz von selber und ließ die Kinder ein. Staunend traten sie in einen herrlichen Garten, der war noch viel, viel schöner als der Nachbarsgarten zu Hause und, was das Schönste war, Brüderlein und Schwesterlein waren die einzigen Kinder darin. »Hier ist unser Glück!« flüsterte Brüderlein. »Ja, ja, unser Glück!« stammelte Schwesterlein. Und sie nahmen sich bei der Hand und gingen von Blume zu Blume, von Busch zu Busch.[99] Und sie betrachteten sich im Spiegel des Sees und schämten sich ihrer schlechten Kleider. Sie behängten sich mit blühenden Ranken und siehe da – es wurden schöne seidene Kleider daraus. Und sie legten große grüne Blätter auf ihre Köpfe und diese wurden die allerschönsten Hüte.
»Das Glück, das Glück!« jubelten die Kinder. »Hier ist unser Glück!«
Und sie nahmen einen Apfel vom Boden und spielten damit und siehe da – er wurde ein goldener Ball. Und sie bliesen die Samen der weißen Pusteblumen in die Luft und siehe da – sie wurden rosenrote, himmelblaue und goldgelbe Federbälle. Mit einem dürren Zweiglein schlugen sie darnach und es wurde zum blinkenden Schläger. Endlich wurden die Kinder aber müde und setzten sich und Schwesterlein seufzte: »Hätte ich doch eine Puppe!«
Da nahm Brüderlein einen Apfel, steckte ihn auf ein Hölzlein und umwickelte es mit Schwesterleins Tüchlein. »Da, da hast Du eine!« sprach er. Kaum aber hatte Schwesterlein die Puppe im Arm, da schlug diese große, blaue Augen auf, die grünen Aepfelwänglein färbten sich rosig. Blonde[100] Locken umringelten das Wachsköpfchen und Schwesterlein hatte nun eine ebenso schöne Puppe wie die kleinen Mädchen im Nachbarsgarten. Das war ein Glück! Die armen Kinder waren ganz betäubt und saßen wie Prinz und Prinzeßlein inmitten all des herrlichen Spielzeuges. Tiefer sank die Sonne und wollte bald der Welt gute Nacht sagen. Da erschrak Schwesterlein sehr, zupfte Brüderlein am Aermel seines weißen Wämsleins und rief: »Mutter!« und Brüderlein sprang auf und sah verstört um sich und schrie mit lauter Stimme: »Vater, Vater!«
Schnell packten sie die goldenen Bälle, die Federbälle, die Puppe in ihre Röckchen und liefen, was sie laufen konnten, zum goldenen Tor zurück. Lautlos öffnete dasselbe sich vor ihnen, aber – als sie hindurchgeschlüpft waren, fiel es hinter ihnen mit lautem »Bum« zu. Im selben Augenblick fielen die herrlichen, seidenen Kleider von ihnen ab. Zu ihren Füßen lag statt der schönen Lockenpuppe die häßliche Puppe mit dem Apfelkopf, und statt der goldenen Bälle kollerten grüne Aepfel von dannen. Von den bunten Federbällen war nichts mehr zu sehen, aber in der Luft drehten sich ein paar feine, kleine Samenpinselchen der[101] Pusteblume. Aus war's mit der ganzen Herrlichkeit – mit dem endlich gefundenen Glück. Betrübt kamen die Geschwister zu Hause an und waren nun noch trauriger über ihre ärmlichen Kleider und das schlechte Spielzeug, als bevor sie in dem Wundergarten gewesen waren.
Sie wanderten auch noch öfters dorthin, freuten sich der seidenen Röckchen, des schönen Spielzeugs, aber immer wieder trieb die Sehnsucht nach den Eltern sie abends heim. Jedesmal aber mußten sie alle ihre herrlichen Schätze dort zurücklassen und die armen Kinderlein bleiben.
Da fielen ihnen die glücklichen Nachbarskinder wieder ein und sie dachten, ob sie wohl auch alle ihre schönen Sachen wieder hergeben müßten, wenn die silberne Glocke sie am Abend zu den Eltern zurückriefe.
Um dies zu erfahren, kletterten sie wieder mal auf die Mauer hinauf und sahen mit neidischen Augen dem Spielen der Kleinen zu. »Dürft Ihr das alles behalten?« fragte Brüderlein.
»Gewiß,« antwortete ein trotziger Junge, »das gehört uns doch, hier gehört uns doch überhaupt alles!«
»Auch wenn Du zu Deiner Mutter zurückgehst, auch dann hast Du das schöne Kleid an?« fragte Schwesterlein.
»Zu Mutter?« erwiderten die Kinder. »Wir haben ja gar keine Mutter.«
»Oder zu Eurem Vater,« meinten die Geschwister.
»Vater? – Vater ist immer in der Stadt – den sehen wir fast nie – aber er ist sehr reich!«
Da war es, als wenn ein böser, kalter Wind aus dem Garten hinaufwehte, so kalt, daß Brüderlein und Schwesterlein sehr erschraken und schnell, schnell von der Mauer herunterkletterten und in ihr Häuslein zurückliefen.
Da saß Vater am Tische und las die Zeitung und Mutter flickte an einem Nachtröckchen von Schwesterlein. Da holte Brüderlein wieder seinen alten Baukasten hervor und Schwesterlein wiegte seine Wunderhold und es war so still und warm im Stübchen. Mit einemmal hörten die Kinder ein leises Singen, und als sie aufschauten, saß zwischen ihnen ein liebliches Wesen mit blonden Locken in einem rosenroten Kleide und lachte sie an.
»Wer bist Du denn?« fragten die Kinder ganz leise.
»Ich? Ich bin doch das Glück, Ihr kennt mich doch!« erwiderte die Lichtgestalt.
»Das Glück bist Du? Wie kommst Du denn dann hierher zu uns?« frug Brüderlein.
Da lachte das Glück hellauf und zwitscherte: »Ihr seid aber mal dumm, Ihr Menschlein! Ich war doch schon immer, immer hier an Eurem Tisch gesessen.«
Da sprangen die Geschwister auf und küßten Vater und Mutter und riefen: »Wir haben ja schon lange das Glück – das Glück wohnt ja schon immer bei uns – das Glück! Das Glück!«


Trauer herrschte im ganzen Lande: Der junge Kronprinz war gestorben und hinterließ keine anderen Geschwister. Die Königin Mutter wollte schier vergehen vor Kummer, war es doch erst wenige Jahre her, daß sie den König, ihren Gemahl, begraben hatten, und nun stand sie ganz allein auf der Welt.
Dem Lande aber war die Hoffnung der Zukunft, der kleine Thronerbe, genommen. Was sollte nun werden?
Wohl gedachten einige Greise einer jahrhundertealten Weissagung, welche lautete: »Dem herrscherlosen Lande wird dennoch ein König erstehen. Das Knäblein, in dessen Schoße man dereinst die Königskrone finden wird, soll König werden.[105] Und es wird ein Wunder geschehen.« Die jungen Leute aber lachten der alten Weissagung und schüttelten ungläubig die Köpfe in den Städten und auf dem Lande.
Die armen Bauersfrauen, an deren Schürze oft 3 und 4 Kindlein hingen, hatten inniges Mitleid mit der reichen und doch so armen kinderlosen Königin. – – – – – –
In einer elenden Hütte am Waldesrande war eben ein Knäblein angelangt, das erste. Glückstrahlend lag die junge Mutter am Abend im Bette mit ihrem Kleinen und wollte eben einschlafen. Da regte sich's hinter der Kammertür. Eine große, schwarze Gestalt trat mit feierlichen Schritten herzu.
Die Frau meinte nicht anders, der Eindringling wäre einer der Paten des Kindes, der sich seinen schönsten Bratenrock angezogen hätte, um sie und den kleinen Jungen zu besuchen.
»Nur näher, nur herein, Herr Gevatter!« rief sie und winkte ihm freundlich mit der Hand.
Geschmeichelt trat der Gerufene näher und laut mußte die junge Mutter lachen. Der Storch war es, der alte, schwarze Storch! Der einzige, der in der Gegend nistete.
Der aber trat mit gravitätischen Schritten an das Bett und trug seinen langen, roten Schnabel stolz erhoben. »Herr Gevatter« hatte ihn noch niemand genannt. Durch das laute Lachen der Bäuerin waren die Nachbarsleute herbeigerufen worden. Die standen nun alle im Zimmer umher und lachten und freuten sich. Die Kinder aber jubelten: »Storch, Storch Steiner! Mit die langen Beiner! Der hat ja 's Mäxchen gebracht!«
Damals glaubten die Kinder noch an das alte Ammenmärchen, daß der Storch die Kinder bringt. Wir wissen heute ja längst, daß der liebe Gott die kleinen Geschwister schickt. Von dem Tage an hieß der schwarze Storch nur noch »Gevatter Langbein«. Und er war stolz auf den Namen und trug ihn mit Würde und Hoheit. Er benahm sich aber auch wie ein richtiger Gevatter. Wo Mäxlein war, da war auch er. Stand auf einem Bein neben der Wiege des Kindes und bewachte seinen Schlummer, und wenn die Mittagssonne zu heiß auf Mäxleins Gesicht schien, zog er mit seinem langen Schnabel ganz vorsichtig die Gardinen zu. So wuchs der Knabe fröhlich heran, treu behütet von Vater, Mutter und dem guten Gevatter Langbein. Dem machte es ganz besondere Freude, als[107] das Kind die ersten Schritte machte. Da packte er's mit seinem Schnabel fest, fest hinten am Hemdenzipfel, und hielt es so vorsichtig und gut wie eine Mutter. Und Mäxlein jubelte und jauchzte und war seelenfroh mit seinem lieben Gevatter Langbein.
Dann kamen die trüben Wintertage, da konnte der kleine Max nicht mehr vor der Türe im Sonnenschein mit Ringelblumen und Kieselsteinen spielen. Da mußte er im Zimmer bleiben und langweilte sich. Das sah Gevatter Langbein und dachte ernstlich nach, wie er dem Kinde Unterhaltung verschaffen könnte. Endlich reiste er heimlich ab und ging auf die Suche nach schönem, blinkendem Spielzeug. Am Weihnachtsabend, als der Christbaum brannte, war auch der Gevatter plötzlich wieder da und trug in seinem Schnabel ein Körbchen mit den herrlichsten Geschenken: Bretzeln, Zinnsoldaten, Hampelmänner, Trompeten, – alles lag in dem Körbchen und war für Mäxchen bestimmt. Das war ein Jubel ohne Ende und auch Langbein konnte sich vor Freude gar nicht lassen und sprang fröhlich klappernd auf seinen langen Stelzbeinen im Zimmer umher. Langbein hatte den kleinen Jungen eben allzu[109] lieb. Darum war er auch nicht wie die anderen Störche im Herbst in südliche Länder gezogen. Er konnte sich von dem Kinde nicht trennen. Nun hatte Mäxchen Beschäftigung genug mit all den schönen Sachen. Die Bretzeln waren bald aufgezehrt, aber mit dem Hampelmann und den Soldaten ließ es sich zu schön spielen, und in die Trompete blies er mit vollen Backen wenn er auf Langbeins Rücken im Stübchen umherritt. Taterata!!
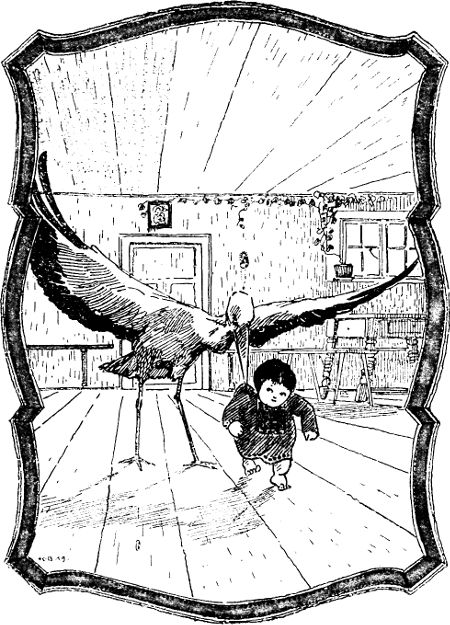
Endlich aber hatte auch diese Freude ein Ende. Der Hampelmann wurde zu alt und humpelte nicht mehr. Die Soldaten hatten im Kriege Köpfe, Arme und Beine verloren. Die Trompete hatte keine lustigen Töne mehr im Bauch, so sehr Mäxlein auch die Backen aufblies und hineintutete. Da weinte das Kind bitterlich. Das konnte der Gevatter nicht mit ansehen und ging schnell wieder auf Reisen. Weit, weit flog er bis in die Hauptstadt des Landes. Da sah er in den Schaufenstern der herrlichen Läden viel schönes Spielzeug, aber es sah alles so zerbrechlich aus. Das würde doch wieder nicht lange halten, meinte er. Er suchte nach etwas ganz besonders Schönem, Unzerbrechlichem. –
Im Schlosse sollte abends das Ordensfest stattfinden – das einzige Fest, das seit dem Tode des kleinen Kronprinzen noch gefeiert wurde. Da wurden die prachtvollen Säle gekehrt, geschrubbt, gebohnt, daß sie abends schön sauber wären, und nach langer Zeit wieder zum ersten Male die Fenster zum Lüften geöffnet.
Neugierig umflog Gevatter Langbein das weite Schloß und blickte zu den Fenstern hinein. Was er da alles sah, blendete ihn schier. Das Schönste aber war ein blinkender, edelsteinleuchtender, goldener Gegenstand, der auf purpurrotem Kissen lag. Das war etwas für Mäxchen! Das mußte er haben. Leise, leise huschte Langbein durchs Fenster hinein, ergriff die leuchtende Königskrone und flog mit ihr in hohem Bogen weit über Seen, Flüsse und Berge zum Dorfe zurück. Nun hatte Mäxchen ein Spielzeug wie keines der anderen Kinder eines besaß, und unzerbrechlich war es auch, so viel er es auf dem Fußboden auch hin- und hertrudelte. Im Königsschlosse herrschte unterdessen die größte Unruhe. Die Krone war spurlos verschwunden. Laut jammernd liefen die Minister umher und heimlich flüsterten sie untereinander: »Das bedeutet das[111] Ende! Unser Königreich ist verloren!«
Nur wenige, sehr alte Männer lächelten geheimnisvoll, gingen zur Königin und sprachen: »Gedenket der alten Weissagung, vielteure Landesmutter. – Das Kindlein, in dessen Schoße die Königskrone gefunden wird, soll König werden. Und es wird ein Wunder geschehen. Gedenket dessen wohl und lasset nun im ganzen Lande nach diesem Kinde suchen. Der Verlust der Krone bedeutet uns Glück – nicht Unglück.«
Da sandte die Königin berittene Boten aus, daß sie nach dem zukünftigen Könige forschten. Lange Zeit geschah es vergebens. Schon war der Sommer wieder ins Land gezogen und Königin und Volk wollten gerade die Hoffnung auf Erfüllung ihrer Sehnsucht aufgeben. – Da geschah das Wunderbare: Ein kleines Häuflein von den Abgesandten der Königin ritt durch ein Dörflein und kam am Ende desselben vor eine arme Hütte. Da sahen die Männer ein eigenartiges Bild. Auf der Schwelle des Hauses saß ein kleiner Knabe und hielt einen blanken Gegenstand im Schoß. Neben dem Kinde aber stand gravitätisch auf einem Bein ein alter, schwarzer Storch und sah den Nahenden neugierig entgegen. –
Die fürchteten sich aber keineswegs vor dem großen Vogel, stiegen von den Pferden, traten näher und schlugen vor Freuden die Hände über dem Kopf zusammen. Da war sie ja endlich, die verschwundene Krone! Und wie es seit Jahrhunderten vorausgesagt worden war, lag sie im Schoße eines Kindleins, eines Knäbleins. Einer der Männer hob Mäxlein vom Boden auf, setzte ihm die Krone auf seinen dicken, blonden Lockenkopf und alle riefen nun laut: »Hoch lebe unser kleiner Kronprinz, unser zukünftiger König!«
Die Eltern, die der Lärm aus dem Hause gelockt hatte und denen die Reiter nun alles berichteten, konnten sich vor Staunen und freudigem Schreck nicht fassen. Aber sie begannen doch zu weinen, als einer der Männer nun ihren Knaben zu sich aufs Pferd hob und sie eilends mit ihm davonritten.
Aber Gevatter Langbein tröstete sie und sprach: »Ihr seht Euer Mäxchen bald wieder, denn auch Ihr müßt nun in die Hauptstadt ziehen und werdet in einem schönen Hause wohnen und herrliche Kleider tragen und in goldener Kutsche fahren. Ich fliege aber sogleich hinterher und weiche auch ferner nicht von Eures Knaben Seite.«
Mit großen Schritten eilte nun der Gevatter noch einmal ins Häuschen. Dort rieb er mit einem feuchten Waschlappen tüchtig seinen roten Schnabel, daß er schön blank weithin leuchtete, reinigte seinen schwarzen Gehrock von jedwedem Stäubchen und versteckte unter seinem linken Flügel ein Stück Brot, eine Bretzel und eine fette Leberwurst, die für das Frühstück des Bauern auf dem Tische bereit lagen. Er hatte nämlich erfahren, daß es an Königshöfen mit dem Essen gar oft nicht weit her sei.
Dann nahm er gerührten Abschied von den Eltern des zukünftigen Königs Max und heidi – gings im Fluge der Großstadt zu.
Rechtzeitig langte er im Schlosse an, um der feierlichen Handlung beiwohnen zu können. Dort waren die Königin, Minister, hohe Herren und Damen und viel Volks um Mäxchen versammelt, der auf seidenen Windeln in einem goldenen Korbe thronte. Hinter dem Korbe stellte der Gevatter sich auf und machte sein allerwürdigstes Gesicht. Nun sprach der Minister: »Geehrte Anwesende! Unsere Sehnsucht ward erfüllt. Dem Lande wurde der erhoffte Kronprinz bescheert.[114] Das geweissagte Wunder ist geschehen. Hoch unser kleiner Kronprinz Max!«
»Hoch! Hoch! Hoch!« jauchzte es durch den Saal.
Da wurden einige Stimmen laut und riefen: »Wie geschah denn das Wunder? Laßt es uns wissen.«
Alles schwieg.
Endlich trat Langbein vor, verneigte sich und erzählte wie er dem Kindlein die Krone gebracht habe.
Laut jubelte das Volk. Aber einige Stimmen erhoben sich dagegen und riefen: »Wo ist denn da das geweissagte Wunder? Das ist doch ganz natürlich zugegangen. Es ist der rechte Kronprinz nicht.«
Schreiend umdrängte das Volk den goldenen Korb.
Niemand sah das listige Schmunzeln in Langbeins Zügen.
Niemand sah, wie Langbein mit seinem Schnabel die Windeln ordnete, wie Langbein mit seinem Schnabel unter seinem linken Flügel einen Gegenstand hervorzog und denselben schnell unter Mäxchens kleinem Hinterteil versteckte.
»Es ist der rechte Kronprinz nicht!« »Er ist es doch!« so riefen alle durcheinander. Da begann das Kind bitterlich zu weinen. Endlich erbarmten sich die Hofdamen seiner, hoben ihn empor und –[115] starrten wie gebannt in den Korb hinein.
»Das Wunder!« »Da ist es ja, das Wunder!« riefen sie.
In Mäxchens seidenen Windeln lag eine schöne, blanke Leberwurst.
»Hoch! Hoch!« riefen nun alle Anwesenden und verneigten sich tief vor dem Kinde.
»Er ist der rechte Kronprinz! Das geweissagte Wunder, hier ist es! Noch nie fand man in den Windeln eines Kindes eine Leberwurst.« Der Jubel wollte kein Ende nehmen.
Endlich traten die Minister zusammen, besprachen sich heimlich und hingen dann feierlich um Gevatter Langbeins Hals das Großkreuz des silbernen Piepvogelordens.


Friedel war ein lieber, lieber Bub, den alle Leute gut leiden mochten. Immer war er freundlich und lustig wenn er mit seinen Spielkameraden zusammen war. Schon von weitem hörte man sein helles Lachen. Nur, wenn er allein im Zimmer saß, oder in der Laube hinten im Garten, oder am Bach, wo die Fischlein springen, da wurde er oft ganz still und traurig und mußte weinen. Dann dachte er an sein Mütterlein, das er so lieb gehabt hatte, so lieb, wie man gar nicht beschreiben kann, und das nun nicht mehr bei ihm war, weil der liebe Gott es zu sich in den schönen Himmel genommen hatte. Solch ein Mütterlein, wie sein Mütterlein gewesen war, hatte kein anderes Kind das wußte er immer besser, je älter er wurde. So[117] schön war Mutter gewesen, wie ein Engel. Und so herrliche Lieder hatte sie gesungen den ganzen Tag, wie die Vögel im Walde es tuen. Des Abends hatte sie ihn in den Schlaf gesungen mit einem Lied, das war eigentlich gar kein Lied, es war wie ein süßer Hauch. Es hatte keine Worte gehabt – nur Töne, aber nie wieder hatte er ein so schönes Lied gehört. Den Anfang hatte er wohl behalten und summte ihn oft vor sich hin, wenn er ganz allein war. Aber wenn er an eine bestimmte Stelle kam, dann wußte er nicht weiter. Dann quälte er sich und suchte in seinem Kopfe nach den fehlenden Tönen, aber er fand sie nicht und war sehr traurig darüber. Als er größer wurde, zeigte es sich, daß er der Mutter Talent für die Musik geerbt hatte. Mit Leichtigkeit lernte er die Noten, die auf dem Papier die Töne darstellen, und lernte sie auf dem Klavier zu spielen und sie zu singen.
Nun suchte er in allen Musikheften, ob er nicht in einem von ihnen das Lied der Mutter fände. Er suchte, suchte, aber fand es nicht. Da weinte er oft bitterlich.
Das sah nun sein Mütterlein im Himmel droben und hatte keine Ruhe, weil ihr Kind sich so sehr grämte und sie ihm nicht helfen konnte.[118] Darum bat sie den lieben Herrgott: »Bitte, bitte, laß mich nur solange wieder hinunter auf die Erde, bis ich dem Friedel mein Wiegenlied gelehrt habe. Er kann es ja nirgends finden, mein armer Bub. Es steht ja nirgends geschrieben. Ich habe es mir ja selber für ihn ausgedacht.«
Als der liebe Gott den Schmerz der Mutter sah, sprach er: »Dein Sohn soll nicht länger weinen. Schwebe in der Nacht zu ihm hinunter und singe ihm Dein Liedchen vor.«
Ueberselig war da die Mutter und bedankte sich bei Gott Vater.
Als die Nacht kam, saß die Mutter als schöner, lichter Engel an Friedels Bett und sang ihm das Lied so lange vor, bis auch er es bis zu Ende singen konnte. Wie selig war da Friedel! Aber am Morgen, als er erwachte und sah, daß er ganz allein war und merkte, daß alles nur ein Traum gewesen, versuchte er wenigstens das Liedchen zu singen, wie er es im Traume so schön gekonnt hatte. Da mußte er nun erst recht bitterlich weinen, denn mitten im Gesang blieb er stecken. Den Schluß hatte er wieder vergessen. Oben im Himmel aber saß seine Mutter traurig auf einem[119] Wolkenkissen und dachte darüber nach, wie sie ihren Friedel von seinem Kummer erlösen könnte.
Da vernahm sie ein leises Rauschen in den Lüften, und als sie aus dem Himmelsfenster schaute, sah sie, daß ein feiner Regen zur Erde niederging. »Ihr Regentröpfchen!« sprach sie, »die Ihr die Erde befruchtet, daß sie Blüten und Früchte trägt, die Ihr den Menschen so viel Segen bringt, bringt meinem Friedel das Lied seiner Mutter.«
Und sie neigte sich weit aus dem Himmelsfenster hinaus und sang den Tröpflein ihre Melodie vor.
Die trugen sie hinunter zur Erde und: »Punk – punk! Punk – punk!« hörte es Friedel in die Dachrinne und gegen die Fensterscheiben schlagen und dachte: das klingt mir doch so bekannt – wie ein Lied! –
Daß es das Lied seines Mütterleins war, das verstand er nicht.
Da verzweifelte die Mutter im Himmel und in ihrer Not bat sie den Abendwind, sich ihres Friedels anzunehmen, ihm ihr Schlummerlied vorzusingen. Der lauschte aufmerksam ihrem Gesang und versprach, sein Bestes zu tun.
In den Aesten der großen Linde vor Friedels Zimmerchen rauschte und flüsterte er und hatte keinen Ton des schönen Liedes vergessen. Wohl horchte Friedel auf und dachte: Heute weht der Wind einmal schön! Aber das Lied der Mutter erkannte er nicht.
Da winkte die Mutter einem Zug Schwalben, der am blauen Himmel hin und wieder flog. Die Vöglein kamen gehorsam herbei und ließen sich von dem Leid des schönen Engels erzählen. Dann steckten sie ein Weilchen die Köpfe zusammen und wippten mit den Schwänzen und endlich zwitscherten sie: »Wir erfüllen Deine Bitte ganz gewiß. Wozu nennt man uns denn sonst die Liebesboten? Wenn Friedel auch unseren Gesang nicht versteht – wir machen uns ihm auch anders verständlich. Wir kennen die Welt und ihre Einrichtungen ja so genau. Sei nur ganz ruhig und baue auf uns!«
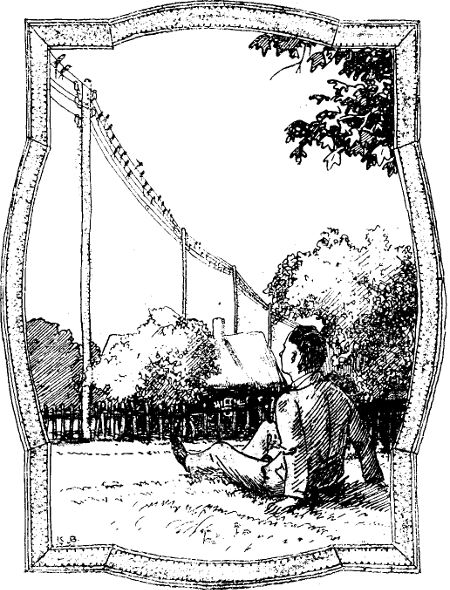
Am nächsten Tage lag Friedel im Garten auf dem Rasen und träumte in die blaue Luft hinein, in der die Schwälblein munter singend hin und her huschten. Aber er hörte nicht auf ihren Gesang. Er war in Gedanken wie so oft mit Mütterleins Lied beschäftigt und summte erst leise, dann immer lauter die ihm bekannten Töne, und es[122] war, als wenn das Lied eine Leiter wäre, auf der er höher, immer höher zum Mütterlein steigen könnte. Aber plötzlich konnte er nicht weiter, das Lied brach mitten drin ab, die Leiter war zu Ende. Vor Kummer schlug er nach den Blumen im Grase und biß mit den Zähnen in die Halme. Endlich aber blickte er wieder unverwandt sehnsüchtig in die Wolken hinauf. Da bemerkte er über sich die langen Linien der Telephondrähte und wünschte in seinem Herzen, daß solch ein Draht doch auch in den Himmel hinaufführen möge. Wie schön wäre das! Dann würde er den ganzen Tag über mit Mutter telephonieren und den Hörer gewiß erst wieder anhängen, wenn es Abend wäre und er ins Bett müßte.
Er konnte den Blick nicht von den blanken Drähten abwenden, auf denen sich eben die Schwälblein niederließen. Nun saßen sie einzeln und in kleinen Gesellschaften beieinander im Sonnenschein und rührten sich nicht, und sangen nicht. Ordentlich feierlich still war es in der Luft. Gebannt hing Friedels Blick an all den schwarzen Punkten auf den dünnen Linien.
»Ei, das sind ja richtige Noten,« rief er aus und sprang vom Boden auf. »Das ist ja, das ist[123] ja!« Jetzt sang er selig die Noten nach. Dann klatschte er in die Hände und jubelte laut: »Das ist ja Mutters Lied!« Und die Vöglein saßen ganz still, bis Friedel das Lied so oft gesungen hatte, daß er es ganz genau kannte. Da winkte er ihnen selig zu und rief: »Habt Dank, habt Dank, Ihr lieben Schwälblein, nun vergesse ich es niemals, niemals wieder!« Und Mutter droben im Himmel war nun ganz glücklich, daß ihr Friedel sich nicht mehr zu grämen brauchte und immer, wenn er sein Liedel so recht von Herzen sang, daß Blumen, Vögel und Menschen ihre Freude daran hatten, stimmte Mütterlein glücklich mit ein, und bald sangen alle Englein im Himmel es mit. Die Schwälblein aber sind zwitschernd von dannen geflogen. Und eines ist an mein Fenster gekommen und hat mir die ganze schöne Geschichte erzählt.


Es war im Lande der blauen Sterne. Wohin man blickte, schauten sie vom Boden auf wie Tausende lieber, blauer Kinderaugen. Als wäre ein Stück des Himmels zur Erde gesunken, so sahen die breiten, breiten Felder des Flachses aus, und die Menschen, die ihn gesät hatten, waren glücklich, denn sie wußten nun, daß sie eine reiche Ernte haben würden. Sie waren arme Weber und bauten sich selber den Flachs, aus dem sie die schöne, glatte Leinewand herstellten. Aber die Freude der armen Leute wurde vernichtet. Krieg[125] überzog das Land. Wilde, berittene Soldatenhorden rasten über die Felder, über die blauen Sterne hin und scharfe Pferdehufe zertraten die Hoffnung der Webersleute. Da ging ein Jammern und Wehklagen durch die Hütten. Weinend standen Männer und Weiber vor den zertrampelten Feldern und manch wilder Fluch wurde zum Himmel geschickt. Die sonst fromm und gläubig gewesen waren, zürnten dem Herrgott und verlernten das Beten. Nur die Gret, die junge Witwe, die mit ihren beiden Kindern hinten am Waldesrande in einer winzigen Hütte wohnte, fluchte und jammerte nicht. Sie weinte nur heimlich und still vor sich hin, wenn sie an kommende Tage des Elends und der Not dachte. Auch ging sie fleißig zur Kirche wie bisher und betete zu Gott, daß er ihr helfe und sie und ihre Kleinen vor dem Hungertode bewahre. Abends las sie eifrig in dem Gebetbuche, das sie von ihrer seligen Großmutter geerbt hatte. Eines Tages, als sie es wieder zur Hand nahm und es aufschlug, fand sie darin einen vergilbten Zettel, den sie in den langen, langen Jahren noch niemals gesehen hatte. Auf dem stand von unbekannter Hand geschrieben: »Bete und arbeite«.
Lange saß die Gret und dachte nach, woher diese Mahnung wohl kommen mochte, bis es ihr klar wurde, daß Gott sie ihr gesandt haben mußte. Von diesem Tage an war sie noch fleißiger im Gebet und in der Arbeit. Es nahte die Zeit der Beerenlese. Da zog sie früh mit ihren Kindern aus und sammelte mit ihnen am Bergeshang in glühendem Sonnenbrand lachende Erdbeeren, Heidelbeeren und Himbeeren, die sie in der nächsten Stadt für schönes Geld verkaufte. Dafür erwarb sie dann Brot zum Lebensunterhalt.
Aber die Leute im Dorfe wunderten sich, daß sie so zufrieden blieb und niemals dem Herrgott wegen ihres Unglückes zürnte, und verhöhnten sie darum.
Als der Sommer zu Ende ging und sie nun wohl zum letzten Male Beeren suchte, hörte sie hoch oben in den Felsen ein jammervolles Klagen. Sie suchte und fand ein Ziegenböckchen, das sich verstiegen hatte und mit gebrochenem Fuß im Grase lag. Behutsam trug sie es heim, machte ihm im Schuppen neben der Hütte ein weiches Lager und kühlte liebevoll das schmerzende Glied. Die Nachbarn kamen und schlugen die Hände zusammen[128] und lachten und riefen: »Was willst Du denn mit dem Elendswurm? Das wird doch nie wieder gesund und Milch gibt es doch auch keine, weil's ein Bock ist.«

Aber die Grete kehrte sich nicht an ihre Reden und sorgte weiter liebevoll für das Tierchen.
Am Tage trug sie es zum Wiesenrain und ließ es dort grasen und oft, wenn es in der Nacht vor Schmerzen jammerte, sprang sie aus dem Bett, um ihm das Bein zu kühlen. Eines Nachts, als das Böcklein ganz besonders schmerzlich klagte, eilte sie flink zu ihm in den Schuppen und dachte nicht anders, als daß ihre Augen verzaubert wären. Golden leuchteten die Hörner des Böckchens aus der Tiefe des Stalles ihr entgegen, und leuchtend heller Schein lag hinter dem Tierchen. Als sie zitternd näher trat, öffnete es das rosige Schnäuzchen und sprach: »Gret, brave Gret! Achte auf das, was ich nicht fresse, und denke, es wäre Flachs!« Sogleich wurde es dunkel im Stalle und auch die Hörner des Ziegenbockes leuchteten nicht mehr golden. Um Mittag trug sie wie immer das Zicklein hinaus zum Wiesenrain, ließ es äsen, legte sich selber daneben ins Gras[129] und paßte genau auf. Da bemerkte sie, daß es gierig alle Gräser und Halme und Blättlein fraß, aber eine Pflanze ließ es stehen, die rührte es gar nicht an. Das war die Brennessel. Am nächsten Tage geschah es ebenso und auch am nächstnächsten. Da dachte die Gret: Die Brennessel ist's, von der ich denken soll, sie wäre Flachs. Wo sie nun ging und stand, sammelte sie Brennesselpflanzen und trug sie heim und behandelte sie ganz genau, wie sie es sonst mit dem Flachs gemacht hatte, und als sie dann die Stengel genau betrachtete, da sah sie innen darin genau solche graue Fäden wie im Stengel des Flachses. Da wußte sie, wie reicher Ersatz ihr nun für die verdorbene Leinernte beschert worden war und sie jubelte vor lauter Glück und dachte sogleich an ihre vielen, vielen Leidensgenossen, an die anderen unglücklichen Weber, und zeigte ihnen ihre Entdeckung. Die aber lachten sie laut schallend aus und verhöhnten sie wieder und riefen: »Mach nur zu! Das wird ein feines Zeug werden, Dein Nesselgespinst!«
Die Gret ließ sich jedoch nicht beirren und sammelte fleißig weiter die verachtete Brennessel. Als der Winter ins Land zog, sahen die Leute mit[130] Erstaunen die Gret am Fenster sitzen und spinnen. Sie schüttelten die Köpfe und tuschelten untereinander, die Gret wäre wohl verrückt geworden – sie wolle Brennesseln spinnen.
Um Weihnachten hörte man aus dem Häuschen der Gret tagaus, tagein das Klappern des Webstuhles – in allen anderen Hütten stand er still. Um so lauter gingen die Zungen der Weberleute mit Schimpfen und Schelten.
Der Winter nahm seinen Abschied mit Sturmgebraus. Heißer wurden die Strahlen der Sonne und beschienen auf der Wiese vor Grets Häuschen breite Streifen selbstgewebten Zeuges, die die Gret dort zum Bleichen hingelegt hatte. Mit ihrer Gieskanne ging sie hin und her und begoß den Stoff und die Sonne tat ihre Schuldigkeit und bleichte das Gewebe, bis es weithin leuchtete, weil es so wunderbar weiß geworden war wie die allerschönste Leinewand. Als das die Leute im Dorfe sahen, ergriff sie wilder Neid. Wütend drohten sie der Gret mit den Fäusten über den Zaun hinweg und schrien: »Das geht nicht mit rechten Dingen zu! Da ist Zauberei dabei!« Und sie nannten sie von nun an »die Nesselhexe«. Aber[131] die Gret ließ sie reden und war ihnen nicht böse darum. Im Gegenteil! Sie bot ihnen freundlich an, ihnen zu zeigen, wie sie es machen mußten, um aus der verachteten Nessel so schönes Zeug zu gewinnen. Aber sie hörten nicht auf ihr freundliches Angebot und liefen scheltend von dannen.
Die Gret war nun im siebenten Himmel mit ihren beiden Kinderlein. In der Stadt war sie alsbald berühmt für ihre schönen Nesselstoffe und bekam hohe Preise für dieselben bezahlt, denn durch das Kriegsunglück konnte man sonst nirgends welche kaufen. Sie wurde bald eine reiche Frau. Konnte eine Kuh kaufen, die ihr ein Kälbchen brachte, konnte ein Schweinchen mästen und Hühner anschaffen und wäre nun ganz glücklich gewesen, hätte sie bei den anderen Dorfbewohnern nicht so viel Elend und Unglück sehen müssen. Oft versuchte sie es ganz schüchtern, sie zur Verwertung der Brennesselfaser zu bewegen, aber immer vergebens, und nicht selten hörte sie sie hinter sich herrufen: »Nesselhexe! Nesselhexe!«
Was aber alles gute Zureden und alle Liebe der Gret nicht vermochte, das erreichte endlich die liebe Eitelkeit bei den Leuten. Als eines Tages, wie jetzt immer, alle Dorfbewohner in schäbigem,[132] zerfetztem Gewand zur Kirche kamen, erschienen Gret und ihre kleinen Mädchen in herrlichen neuen, seidenglänzenden Kleidern. Da reckten die Leute die Hälse und sperrten vor Neid und Staunen die Mäuler auf und konnten sich nicht sattsehen an den feinen Stoffen. Als der Gottesdienst vorüber war, schlichen sich die Dorfkinder leise an Grets Kinder heran, befühlten ihre feinen Kleider. Und auch die Frauen traten herzu und betrachteten mit großen, glänzenden Augen den Feststaat der Gret. Anderen Tages erschien in Grets Hütte eine eitle Frau, um ihr Geheimnis zu erfragen, am nächsten kamen gar vier und so wurden es immer mehr. Sie sagten, ihre Kinder hätten ihnen keine Ruhe gelassen, sie wollten auch so schön gekleidet gehen. Im Grunde war es aber nur die liebe Eitelkeit, die sie dazu zwang – sie gestanden es nur nicht ein.
So kam es, daß im nächsten Sommer alle Einwohner des Dorfes Brennesseln sammelten, um daraus schöne Stoffe zu machen – daß nun alle Not ein Ende hatte.
Die Gret hieß nun aber nicht mehr »die Nesselhexe«. Sie wurde weit und breit geachtet und geliebt.
Ihr Ziegenböcklein aber, das ihr so viel Glück ins Haus gebracht, hat sie hoch in Ehren gehalten und liebevoll gepflegt bis zu seinem Tode.


Was man ein Sonntagskind nennt, das wißt ihr Kinder ja schon lange und auch, daß ein solches sieht, hört und erlebt, was andere Menschenkinder nicht sehen, hören und erleben.
Heute will ich Euch einmal erzählen, was einem Sonntagskinde an einem schönen Sommermorgen im Walde begegnete.
Flipsius war schon ein älterer Herr, aber noch gesund und munter, seines Zeichens Glasschleifer.
Im Winter saß er fleißig hinter dem Tische in seiner Werkstatt und schliff die herrlichsten Glassachen.
Wenn aber der Frühling ins Land kam, Berge und Täler das schöne grüne Kleid mit den bunten Blümlein darin anzogen, dann duldete es Flipsius nicht mehr zu hause.
Dann zog er aus in Gottes Wunderwelt und lauschte und horchte und äugte, daß ihm ja keine von allen ihren Schönheiten entginge.
Es war im Hochsommer vor Sonnenaufgang, da griff Flipsius zum Wanderstabe und schlich zum Hause hinaus. Er wollte einmal sehen, wie es in aller Herrgottsfrühe draußen in der Natur zugeht. Mit ganz leisen, vorsichtigen Schritten, daß er ja in der Dämmerung kein Würmchen und kein Blümlein zertrete, betrat er den grünen Wald.
Da war es so still wie in der Kirche. Unter grünen Farnblättern schliefen Eidechsen und Frösche. Behutsam verkroch er sich unter die breiten Blätter des Huflattich und wartete geduldig. Endlich erscholl von der höchsten Spitze einer Tanne der leise Pfiff eines Vögleins – und wieder – und noch einmal.
Da reckte Flipsius vorsichtig die Nase aus seinem Versteck hervor, roch die würzige Morgenluft[136] und sah allzugleich, daß Frau Sonne mit ihren ersten, rosigen Strahlen die Kronen der Bäume streichelte.
Wups verkroch er sich wieder hinter die Blätter. Er wollte ja sehen, aber selber nicht gesehen werden.
Jetzt ließen schon mehrere Vöglein ihre Stimme erschallen und als gar ein Nußhäher mit lautem Schrei sein Erwachen ankündigte, da wurde es rings lebendig.
Dicht neben Flipsius regte es sich. Eine Amsel kam geschäftig dahergetrippelt und machte sich mit Klopfen und Pochen an der breiten Spalte in der Rinde einer morschen Eiche zu schaffen bis aus dem Innern des Stammes ein feines Stimmchen antwortete.
Da bog Frau Amsel mit ihrem Schnabel ein Farnkraut beiseite, das den Eingang versperrte und heraus schlüpfte ein Elflein zart und rosig, rieb sich die Augen, gähnte recht herzhaft und schaute umher, ob auch kein Lauscher in der Nähe sei.

Dann hüpfte es vergnügt zu einem großen Fliegenpilz, in dessen Mitte sich eine Menge Tautropfen[138] gesammelt hatten, ließ das Hemdlein aus allerfeinstem Nebelbatist herunter bis auf die zarten Füße und wusch Gesicht, Brust und Arme, daß es eine Lust war.
Flipsius lächelte und hielt den Atem an – es sah ja gar zu lieblich aus.
Als nun das ganze Geschöpfchen schön sauber war bis hinter die winzigen Ohren, griff die kleine Elfe zum Handtuch aus Spinnengewebe, das nebenan auf einer Distelstaude hing und trocknete und rieb sich ab; zuletzt kamen die Aeuglein daran. Da stieß sie einen gellenden Schrei aus, so daß Flipsius sich vor Schreck beinahe verraten hätte, hielt beide Hände vor's Gesicht und rief: »Mein Auge! Oh mein Auge! Helft mir doch! Herbei! Herbei!«
Da kamen von allen Seiten viele, viele andere Elflein herbeigeeilt, besahen das kranke Auge, betrachteten das Handtuch, das an dem Schmerz schuld sein sollte und rangen ratlos die Hände.
Endlich erschien Frau Amsel, brachte auf einem Frauenmantelblatt kühlenden Morgentau für das geschwollene Auge und sagte: »Ich hole[139] den Doktor Humpelpumpel. Mit Eurem Heulen und Zetern ist da nicht geholfen!« und flog eilends davon.
Nun konnten die kleinen Elflein sich nicht genug tun mit Bedauern und Streicheln und »ach! und oh!«
Die arme Kranke saß mitten unter ihnen auf einem Baumstumpf und weinte bitterlich. Als dann endlich der Doktor Humpelpumpel kam, wußte Flipsius sogleich, daß er zum Geschlecht der Zwerge gehörte und warum er den Namen Humpelpumpel führte. Er hatte einen kurzen Fuß und humpelte ganz fürchterlich. Dafür aber hatte er eine riesengroße, spitze Nase und sah dadurch sehr gescheit aus. Er besah sich sofort das kranke Auge, runzelte die Stirne, pfiff durch die Zähne und lachte.
»Da haben wir ja schon den Schaden! Einen Augenblick!« Mit spitzen Fingern griff er zu. Elflein schrie herzzerreißend.
»Da, da ist das ganze Malheur – ein Spinnenbein war im Handtuch gehängt und hat sich im Augapfel festgehakt!« sagte er. »Ich habe es natürlich sofort entdeckt!« Stolz warf sich Dr.[140] Humpelpumpel in die Brust. »Morgen früh komme ich wieder nachsehen. Bis dahin kühlen Sie das Auge nur weiter, mein schönes Fräulein!« Hier machte er eine herrliche Verbeugung und verschwand.
»Ein Spinnenbein!« riefen die Elfenfreundinnen. »Wer hätte das gedacht? Ja, ja, man kann nicht vorsichtig genug sein!«
Nun wartete Flipsius bis das ganze kleine Volk sich in den Schatten verkrochen hatte, dann ging er vergnügt heim. Was er erlebt hatte, das sah doch nur ein Sonntagskind. Wie gut ist's, am Sonntag geboren zu sein!
Als er am nächsten Morgen wieder ganz leise in sein Versteck kroch und durch die Blätter äugte, saß Elflein schon auf seinem Baumstumpf mit einem großen Verband über dem Auge und wartete auf seinen Leibarzt. Hin und wieder stöhnte es leise und seufzte ein wenig. Als endlich der Herr Doktor erschien im schönen, neuen, hellgrauen Sommeranzug, da ließ Elflein gar das Köpflein tief auf die Brust sinken und tat als wenn's mit ihm zu Ende ginge. Der Herr Doktor lächelte und streichelte ein ganz klein wenig das[141] Händchen der Patientin. Dann entfernte er den Umschlag.
»Ja,« rief er, daß es laut im Walde widerhallte, »ja, was wollen Sie denn, teures Fräulein? Das Auge ist durch meine Pflege ja vollständig gesund. Da ist keine Spur von einer Erkrankung mehr zu sehen. Es ist genau so lieblich und schön himmelblau wie das andere Auge auch!«
Da plinkte und blinzelte Elflein ein wenig und sagte: »Wenn ich doch aber lange nicht mehr so gut sehe wie vorher! Das ist doch schrecklich!«
»Nun, eine kleine Sehschwäche bleibt nach solchen Verletzungen ja gerne zurück. Aber, schönes Fräulein, wozu haben Sie denn den berühmten Geheimen Sanitätsrat Professor Doktor Humpelpumpel zum Arzt? Ich weiß auch hier Rat. Sehen Sie einmal her. Sehen Sie einmal auf dieses Blatt am Boden – hier – und nun betrachten Sie das gleiche Blatt hier an der Stelle wo der Wassertropfen liegt. Sehen Sie es da nicht viel deutlicher?«
»Freilich,« meinte Elflein. »Das ist mal nett. Das hatte ich noch nie bemerkt. Aber was soll[142] mir das helfen? Ich kann doch nicht die ganze Welt durch dies Tröpflein betrachten!«
»Doch, doch, das ist's ja eben, meine Gnädige. Die Wissenschaft macht sich dies Tröpflein zu Nutze. Das heißt: Die Wissenschaft bin in diesem Falle ich. Mit Hülfe solches Tröpfleins stelle ich einen Sehapparat her – ein Guckerohr. Passen Sie auf.«
Er nahm vom Boden ein dünnes hohles Aestlein, tat einen Tautropfen hinein, ließ ihn nach vorne an die Spitze der Röhre gleiten, sah hindurch und rief: »Famos, famos! Schauen Sie einmal hindurch!«
Das tat Elflein nun und war begeistert.
»Doktor, Doktor, Sie sind ein Schatz! Wenn ich Sie nicht hätte!« jauchzte sie und gab ihm einen herzhaften Kuß.
Humpelpumpel stand erst wie versteinert. Dann reckte er sich stolz über Lebensgröße. Einen Elfenkuß hatte er doch noch nie bekommen. Als der Doktor gegangen war, lief Elflein mit seinem Guckerohr hin und her. Sah in den blauen Himmel, in die Berge hinein und wollte nun auch einen Blick ins Tal werfen. Dazu erklomm es[143] einen kleinen runden Hügel, der ganz und gar mit einem grünen Moosteppich überzogen war. Sie erklomm ihn und trippelte munter darauf herum. Hätte sie geahnt, woraus der Hügel bestand, sie hätte es nicht getan. Sie hätte großes Unglück verhütet.
Solange es eben ging, hielt Flipsius sich tapfer. Als aber die kleinen zierlichen Füße der Elfe gar zu lebhafte Sprünge machten, hielt er es nicht länger aus und mußte laut lachen. Er war eben wie die meisten Menschen kitzelig und der kleine, runde Hügel, auf dem Elflein stand, war sein Bauch, der in einer grünen Sammetweste steckte.
Kaum hatte er das schallende Gelächter ausgestoßen, da stürzte Elflein vor Schreck von seinem schönen Aussichtshügel herunter und als es davoneilen wollte, schrie es laut auf. Es konnte ja nicht aufstehen. Es hatte sich bei dem Sturze den Fuß gebrochen. Zum Glück hatte Dr. Humpelpumpel den Schrei noch vernommen und kehrte eilig zurück. Als er aber den großen bärtigen Mann im Grase sitzen sah, erschrak er heftig und wollte davoneilen, aber die Kleine machte so[144] flehende Augen, daß er sich überwand, zu ihr eilte und sie auf seinen Armen in das Dickicht trug.
Da saß nun Flipsius, das Sonntagskind und grämte sich über das Unheil, das er angerichtet hatte.
»Schade! Schade!« murmelte er und ging betrübt nach Hause. Dort überlegte er noch einmal das ganze Erlebnis und als er an das Guckerohr dachte, das Humpelpumpel aus einem Aestchen und einem Tautropfen gemacht hatte, kam ihm ein guter Gedanke. Er konnte ja so viele schöne Dinge aus Glas machen – warum sollte er nicht auch einen schönen, klaren, großen Tropfen schleifen können?
Sogleich ging er an die Arbeit und siehe – in wenigen Wochen war das Kunstwerk gelungen. Den Glastropfen faßte er in eine blanke Metallröhre und Flipsius wurde nun weit und breit als Erfinder des Fernrohres geehrt und bewundert. Von Dr. Humpelpumpel, der doch eigentlich zuerst auf den Gedanken gekommen war, wußte niemand. So ergeht es eben den meisten Erfindern auf dieser Welt.
Wollt Ihr Euch solch ein gläsernes Tröpflein einmal genau betrachten, so seht nur das Theaterglas an, das Mutter im Beutel hat, wenn sie schön geputzt in die Oper geht – oder Vaters Brille, die hat zwei solche geschliffene Glastropfen.


Auf den höchsten Höhen des Gebirges, dort, wo ewiger Schnee und ewiges Eis leuchten, herrscht der Berggeist. Kein menschliches Auge hat ihn je gesehen, aber die Bäche, die von dort oben mit Donnergepolter heruntertosen, die erzählen, daß er einen langen, silberweißen Bart hat und sein Gewand so grau ist wie das älteste Gestein. Auf dem Haupte trägt er eine Krone von leuchtenden Bergkrystallen. Er regiert dort oben über Wetter und Winde, über Blitz und Donner. Und damit er seinen Willen weithin über alle Gipfel kund tuen kann, hat er unter sich viele, viele kleine, drollige Berggeistchen, die müssen für ihn laufen und springen. Müssen das Echo wecken,[147] wenn es eingeschlafen ist und die breiten, schimmernden Nebeltücher hin und her ziehen, vor die Sonne und wieder zurück, ganz wie der alte Berggeist befiehlt.
Sie haben einen strengen Dienst, die Kleinen, und wenig Zeit für ihre eigenen Späßchen und Vergnügungen. Am meisten freut es sie, wenn sie Schneebälle den Berg hinuntertrudeln lassen dürfen. Die machen dabei so lustige Hopser und Sprünge und werden im Hinabrollen größer und größer, bis sie so groß sind, wie ein Haus. Dann stürzen sie mit Donnergepolter ins Tal hinab und nehmen dabei Felsen und Bäume mit. Die Menschen nennen einen solchen Riesenschneeball Lawine und haben große Angst davor. Nun war einmal unter der Schar der Berggeistchen ein besonders pfiffiger und lustiger. Dem wurde es bei der vielen Arbeit und dem ewigen Hin- und Herlaufen zu langweilig. Besonders seit er einmal ein Menschenpaar gesehen hatte, das mit Eispickel und Stöcken bewaffnet, jubelnd und jauchzend auf der allerhöchsten Bergspitze gestanden war. Da packte ihn die Sehnsucht, mehr von der Welt zu sehen als nur die öden Gebirgshöhen. Er wollte in das Tal hinab, woher die lustigen Menschen[148] gekommen waren. Aber wie sollte er das anfangen?
Er wußte sehr gut, daß es streng verboten war, die Grenze des Bergreiches zu überschreiten. Auch kannte er wohl das Heer von alten Steinböcken, die dort ringsum aufgestellt waren, um Wache zu halten. Vor denen hatte er große Furcht.
Wenn Ihr im zoologischen Garten einen Steinbock gesehen habt, werdet Ihr es verstehen. Wie ein sehr strenger, würdiger Geheimer-Ober-Schulrat sieht er aus und daß man vor dem sich fürchtet, das wißt Ihr wohl. – Berggeistchen überlegte hin und her, wie es seine Talfahrt am besten machen könne. Endlich fiel ihm etwas ein. Es setzte sich auf den Erdboden, nahm einen großen Fichtenzweig in beide Hände, so daß derselbe ihn ganz und gar verdeckte und rutschte so, heidi, den Berg hinab. Beinah wäre die Talfahrt gelungen, aber leider nur beinah.
Als die alten Ober-Schulräte, ich meine die Steinböcke, den rutschenden Zweig sahen, dachten sie sich erst nichts dabei. Dann kam es ihnen wohl in den Sinn, daß die Abfahrt desselben merkwürdig[149] geschwind vor sich ging. Schnell hoppelten sie herbei, hielten den struppigen, grünen Wanderer an und erblickten darunter Berggeistlein. Da wurden sie sehr, sehr böse auf den Ausreißer, grommelten in ihre Bärte hinein und jagten den beschämten Kleinen schnell wieder den Berg hinauf.
Nun war ihm alle Lust zur Talfahrt vergangen. Nun lebte er wieder tagaus, tagein so, wie der alte Berggeist es verlangte: weckte das Echo, zog die Nebelvorhänge hin und her und putzte die blanken Gletscherfirnen, bis sie weithin leuchteten. Da erschien eines Tages eine Schar junger Männer und junger Mädchen auf dem Berge. Die lachten und jubelten und sangen, daß es eine Lust war. Sie zündeten ein großes Feuer an und tanzten im Scheine desselben. Berggeistchen stand hinter einem Felsen und sah das alles und sein Herz klopfte laut vor Aufregung. »So lustig sind die Menschen! Und sie singen so schön. Und so schöne rote Flammen können sie machen, um sich daran zu wärmen! Wir hier oben müssen immer warten, bis die Sonne so gnädig ist, uns auf dem Pelz zu scheinen.« So dachte Berggeistchen und ging nun wieder nur mit dem Gedanken[150] um, wie es unbemerkt durchwitschen und zu den lustigen Menschen ins Tal kommen könnte.
Endlich hatte es einen guten Einfall. Es rollte sich so lange im dicken Schnee herum, bis der ihn ganz und gar einwickelte und kullerte nun als kleine Lawine den Berg hinab. Erst ging's sehr schön, dann aber wurde ihm himmelangst, es bekam keine Luft mehr. »Was wird denn das?« stöhnte es noch, dann wußte es von nichts mehr und wäre um ein Haar erstickt. Zum Glück rollte der große Schneeball gegen einen dicken Baum, zerschellte und wie in einer weißen Eierschale lag Berggeistchen darinnen. Erst rührte es sich nicht, als wär's gestorben. Aber bald kam Leben in den lustigen Kerl. Sein Näschen, das ganz weiß gewesen war, färbte sich wieder rot. Er schlug die Augen auf, sah sich erstaunt um und sagte betrübt: »Wieder nix!« Dann klopfte er sich den Schnee ab und stieg seinen Berg wieder hinauf.
Nun grübelte er aber erst recht. »Beinah' wäre die Reise gelungen – nur an der Luft hat mir's gefehlt,« überlegte er. »Das muß doch zu ändern sein!« Er war ein findiger Kopf. Schon am nächsten Tage wußte er, wie 's zu machen war. Er suchte sich einen gänzlich hohlen Baumstamm,[152] der am Boden lag. Den nahm er mit in seine Lawine, so daß er als Schornstein an der Seite herausragte. Durch den bekam er Luft und fuhr nun lustig zu Tale, und als er an der alten Steinbock-Grenzwache vorübersauste, da sprangen die würdigen Herren ängstlich auf die Seite und schüttelten die Köpfe: »Bei dem Wetter eine Lawine und solch ein langer Baum darin, merkwürdig!« sagten sie.
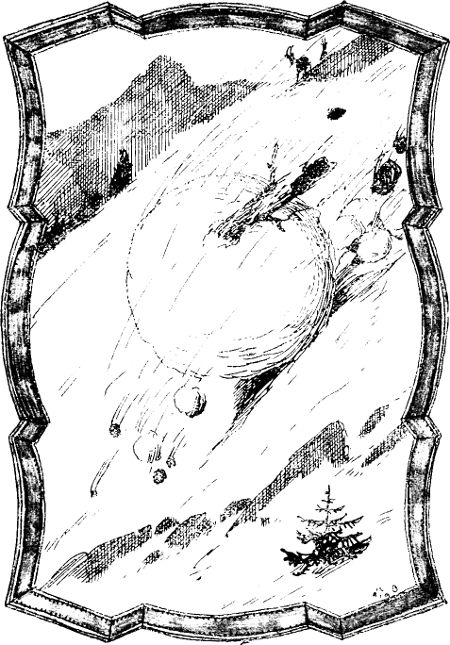
Berggeistchen machte ihnen in Gedanken eine schöne »lange Nase«. In Wirklichkeit konnte er sie ja nicht machen – dazu war's in seinem Gefängnis von Schnee viel zu eng. Es rollte – rollte – rollte – rollte – endlich lag es ganz still. »Nun bin ich angelangt!« dachte voll Freuden der kleine Reisende und allsogleich fing er an, mit Händen und Füßen zu stoßen und zu strampeln. Die Schneehülle barst und Geistchen lag im Sonnenschein auf einer schönen grünen Wiese. Schnell sprang es auf und schüttelte sich und trappelte emsig hin und her, denn es war recht verfroren und auch im Magen war's ihm sonderbar zumute. Der verträgt es eben nicht, in eine rollende Lawine verpackt zu sein. Dann sah Geistlein sich rings um und holte tief Atem, aber die Luft[153] schmeckte ihm nun gleich gar nicht. Die schmeckte ganz genau wie der Dampf, der aufstieg, wenn oben auf der Höhe die Sonne recht lange auf ein nasses Fleckchen Erde geschienen hatte. Schnell lief der Kleine weiter, weil er meinte, an einer anderen Stelle würde die Luft wieder schön klar und frisch sein, so wie er's gewohnt war. Aber er täuschte sich. Im Tale weht eben keine Bergluft. Er schnappte und schnappte und warf einen sehnsüchtigen Blick hinauf zu den schimmernden Gipfeln. Da kam ein Mann des Weges daher in prächtigen Kleidern. In der Hand trug er ein Stöcklein mit einem großen goldenen Knopf daran. »Aha«, dachte Geistlein, »nun wird's lustig,« lief dem Herrn entgegen, verneigte sich und rief: »Grüß Gott, Mensch!« Der aber sah ihn erst gar nicht an, stieß mit dem Stock heftig auf den Boden und brummelte: »Tölpel«.
»Nanu«, sagte Geistchen und blickte dem Brummbären bestürzt nach. Es wußte eben nicht, daß es eine schwere Beleidigung ist, einen Erdenbürger mit »Mensch« anzureden. Nachdenklich schlich der Kleine weiter und kam in die Nähe von Wohnhäusern. »Oh, wie still ist's hier,« seufzte er. »Da brennt kein schönes, rotes Feuer, da lacht[154] niemand, da singt niemand und doch laufen genug Leute herum.«
Doch endlich, hinter der Hecke, da wurde gesungen und gejauchzt, aber wie anders klang es als damals oben auf dem Berge, und als Geistchen genau hinsah, prallte es erschrocken zurück. Gar nicht froh und lustig sahen die Menschen aus, nein, eher böse. Und sie schlugen mit den Fäusten auf den Tisch, daß es knallte, und hatten wilde, rote Gesichter.
Schnell lief es weiter. Als es dämmerig wurde, verkroch es sich in ein Haus und versteckte sich im Zimmer in der dunklen Ecke hinter dem Kleiderschranke. Im Zimmer war es still. Eine Frau nähte und seufzte dabei und ein Mann las stirnrunzelnd in einem Buche. Zwei Kinder stießen und pufften sich heimlich mit den Füßen, daß die Eltern es nicht sahen. Und Geistchen fror viel, viel mehr als es je auf seinem Berge gefroren hatte. Wohl entdeckte es, daß die Leute Feuer hatten, aber es war gar nicht lustig.
Es war eingesperrt in einen großen steinernen Kasten und streckte nur hin und wieder ein dünnes, rotes Fingerlein durch die schwarze Gittertüre. Und die Menschen froren wohl auch, denn[155] sie sahen so griesgrämig aus und gaben sich gegenseitig kein gutes Wort. »Das sind doch nicht dieselben Menschen, die bei uns oben waren!« flüsterte Geistchen in seiner Ecke und schüttelte den Kopf. Dann hockte es sich auf den Boden, aß einen Apfel, den es im Sack hatte, und schlief ein. Am Morgen schlüpfte es unbemerkt aus dem Hause und ging weiter auf die Suche nach seinen Menschen, den frohen, glücklichen. Er fand sie nicht. Daß sie zu ihm nicht freundlich waren, kam wohl daher, daß sie ihn nicht kannten. Aber, warum waren sie untereinander so fremd und kalt? Woher kam das nur? Daß sie sich bei jedem Wort so erstaunt ansahen, als verständen sie sich nicht. Woher kam das nur? Das mußte es erfahren. Es versuchte nun, sich selber den Menschen zu nähern. Leise schlich es sich an ein junges, schönes Mädchen heran, ganz, ganz dicht – und prallte zurück. An etwas Festes, ganz Durchsichtiges rührte seine Hand – von dem Mädchen spürte es nichts. Ebenso erging es ihm bei den jungen Burschen, den Kindern und Frauen. Es war da etwas, das man nicht sah um jeden Menschen herum, das man nur fühlte und das es unmöglich machte, sich ihm richtig, herzlich zu nähern.
Unter einem blühenden Baume stand eine junge Frau mit einem Kindchen auf dem Arme – die sah glückselig aus und lächelte Geistchen freundlich an. Da faßte es sich ein Herz und sprang frisch und frank auf die Frau zu, um ihr an den Hals zu fliegen. Aber – oh weh, auch hier prallte es zurück, fiel auf den Rücken und hielt sich die Nase, die es sich übel gestoßen hatte. Nun sah es näher hin und bemerkte – eine dünne, dünne Wand von Glas umgab rings die Frau. Nun wußte er's – die Menschen in dem Tale lebten jeder ganz für sich allein unter einer feinen undurchdringlichen Glasglocke – darum sahen sie so unglücklich aus. Nur die jungen Mütter hatten ihre ganz, ganz kleinen Kinder mit unter ihrer Glocke, und darum waren sie die einzigen Menschen in dem stillen Tale, die nicht einsam und die darum glücklich waren.
Nein, in dem Tale konnte es Berggeistchen wahrlich nicht gefallen. Zum Glück war der taube Kräutersepp grade auch unten am Waldesrand. Dem kroch er heimlich, als derselbe schlief, in den Korb, den er immer auf dem Rücken trug, und ließ sich so wieder, ungesehen von der[157] alten Steinbockwache, hinauf auf seinen Berg tragen.
Mit einem lauten »Gottseidank« sprang er oben aus der Kiepe, so daß den alten Kräutersepp, der ja von nichts ahnte, beinah vor Schrecken der Schlag gerührt hätte.
Nun tut Geistchen freudig seine Arbeit.
Nach dem Tale der armen einsamen Menschen spürt es keine Sehnsucht mehr.

Gedruckt bei
Mages & Müller, München.
Weitere Anmerkungen zur Transkription
Offensichtliche Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ansonsten wurde die Originalschreibweise beibehalten.