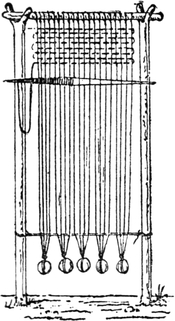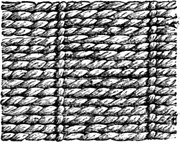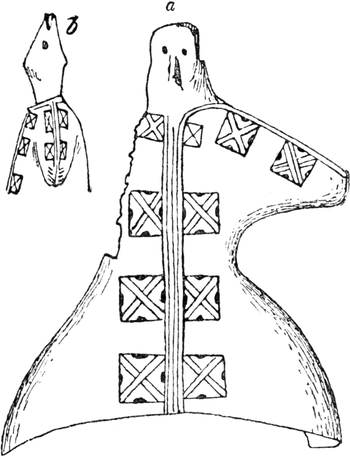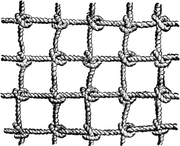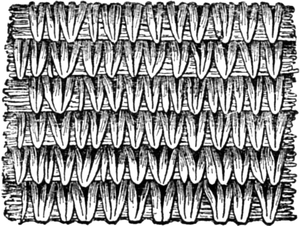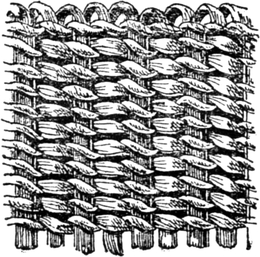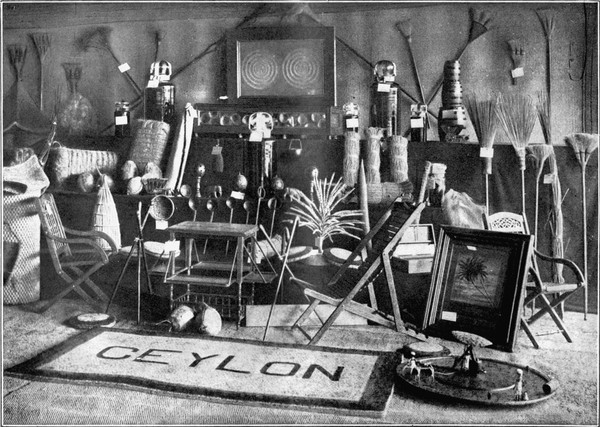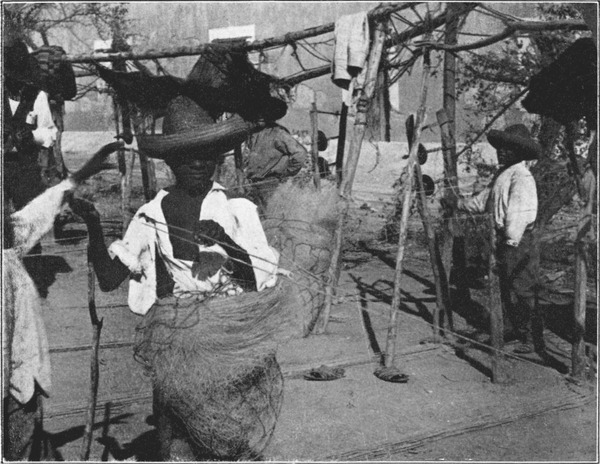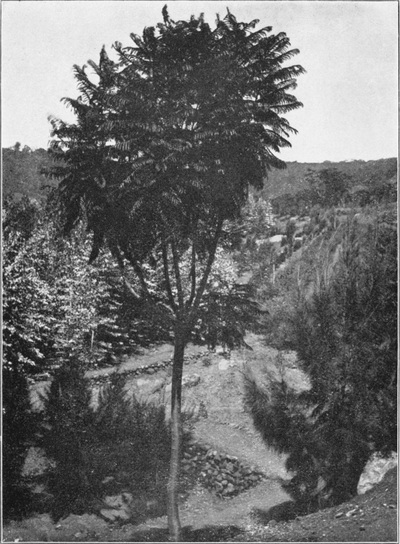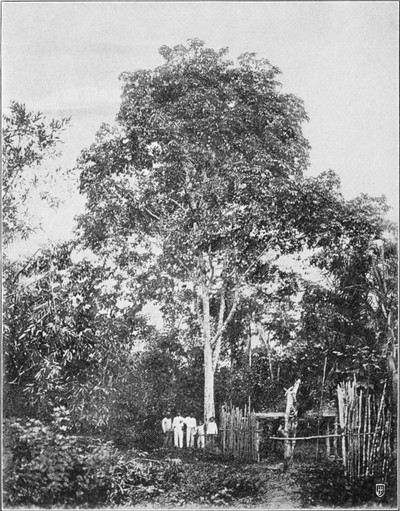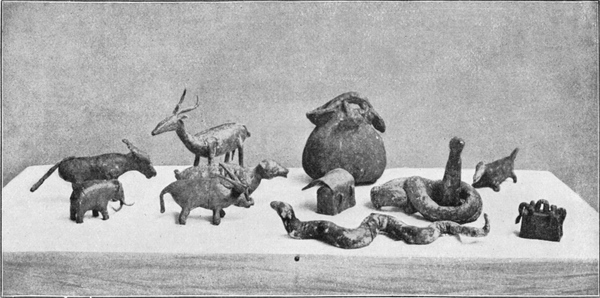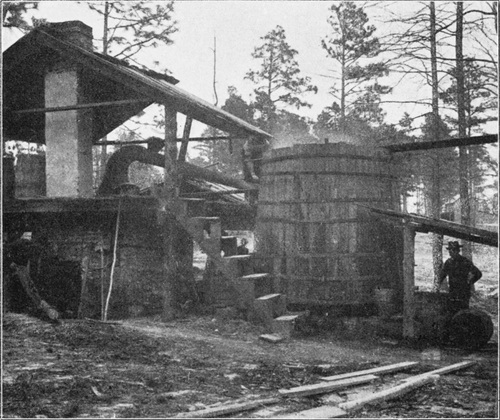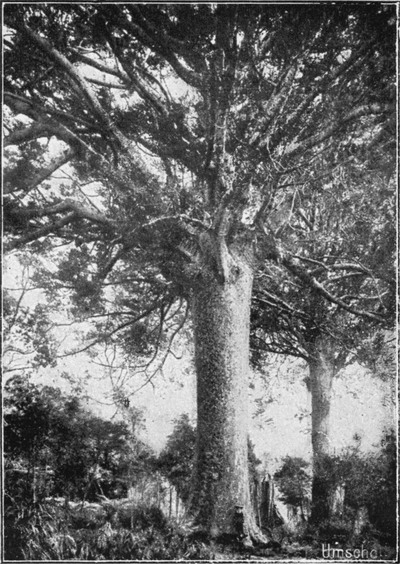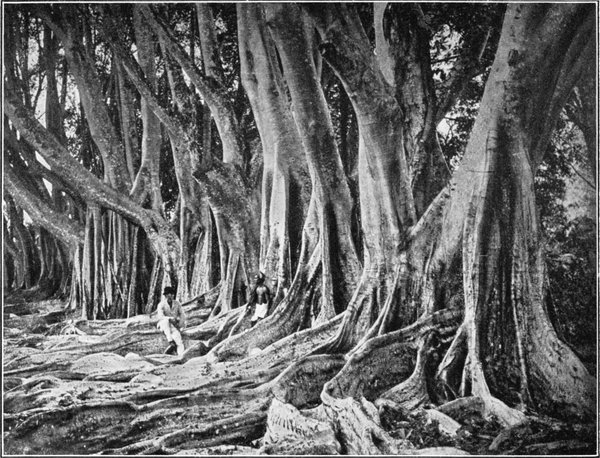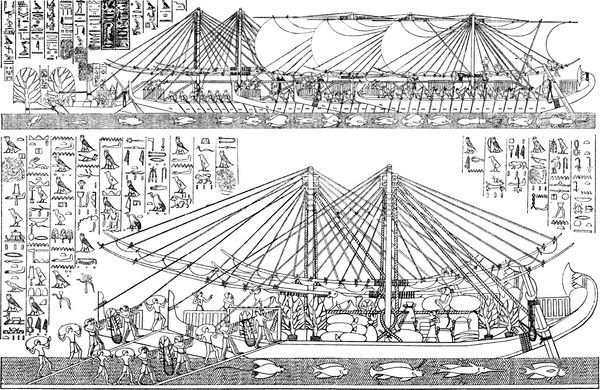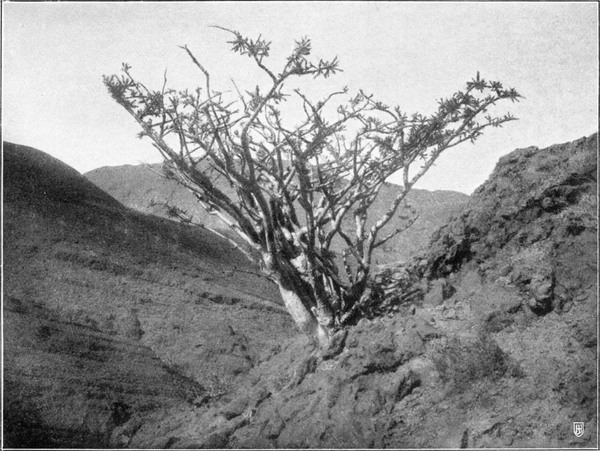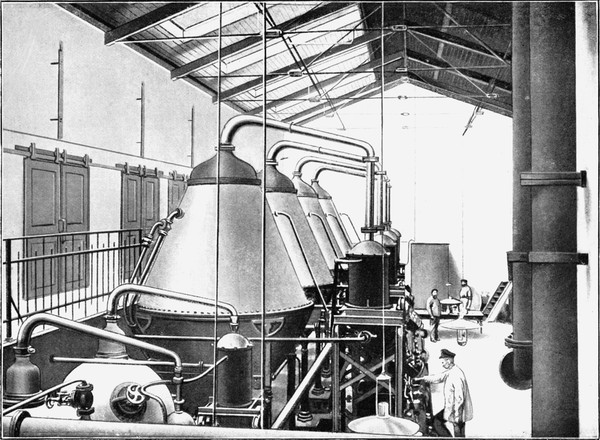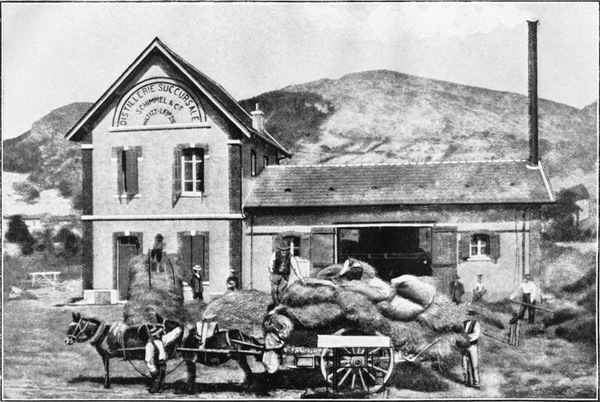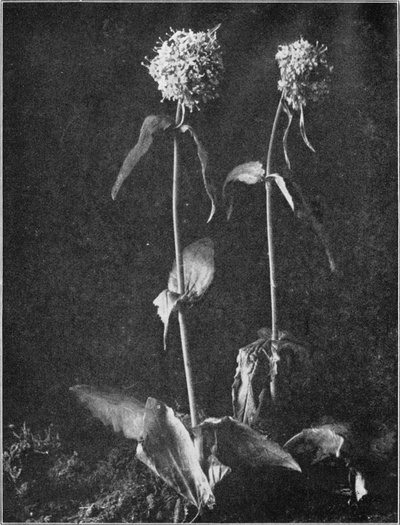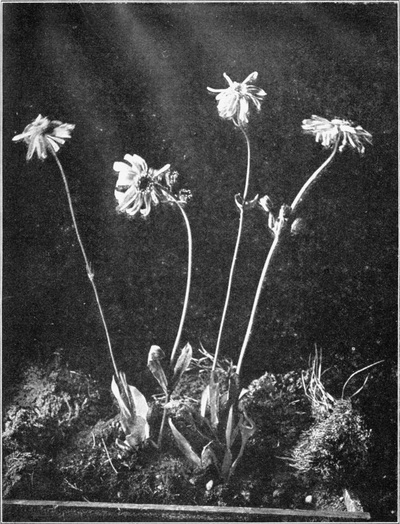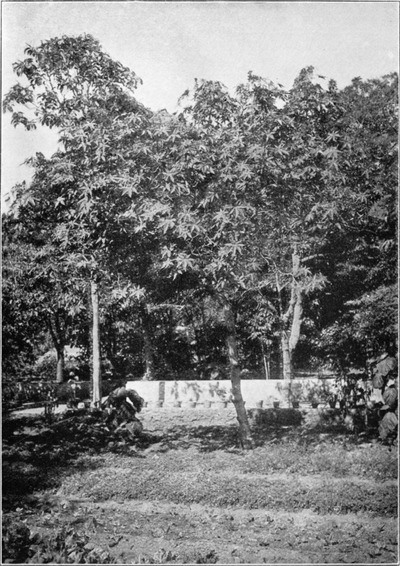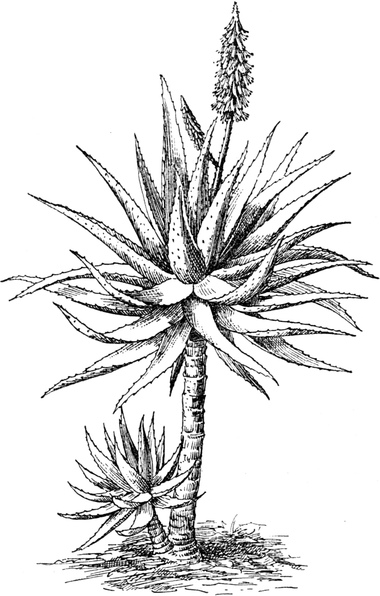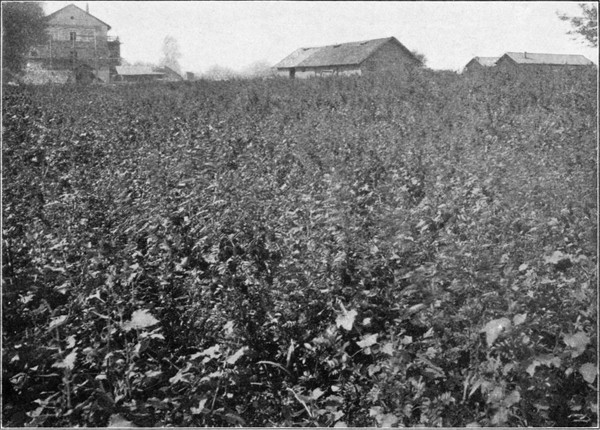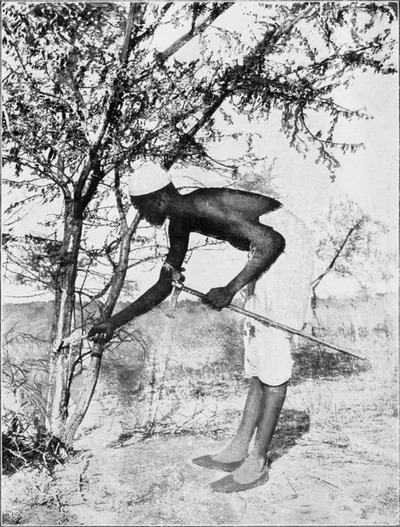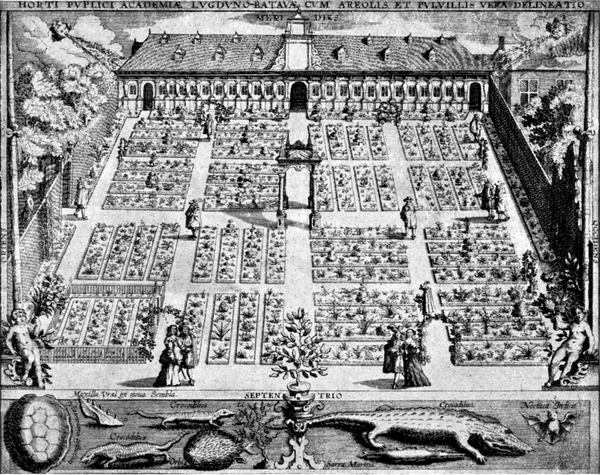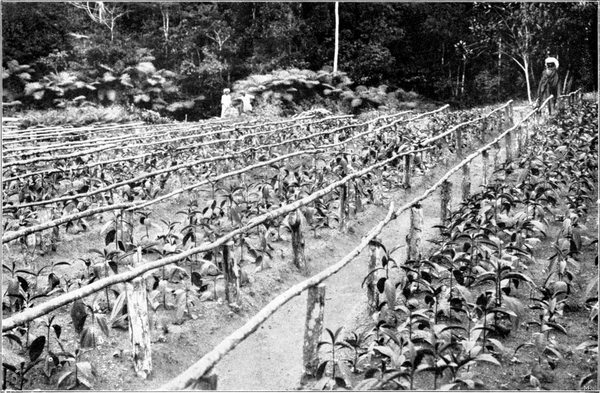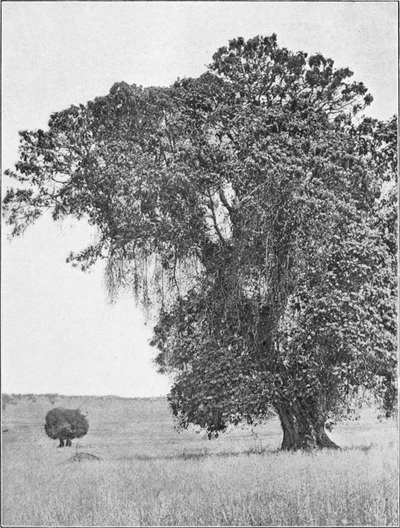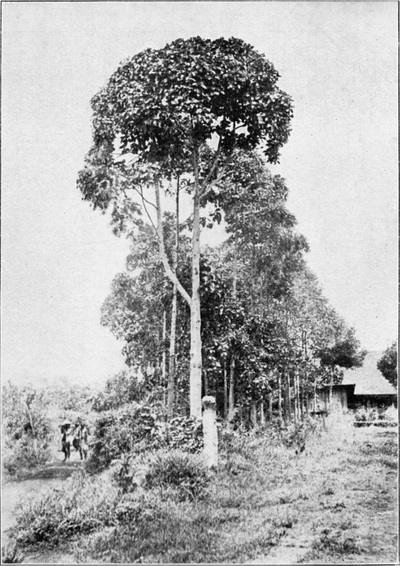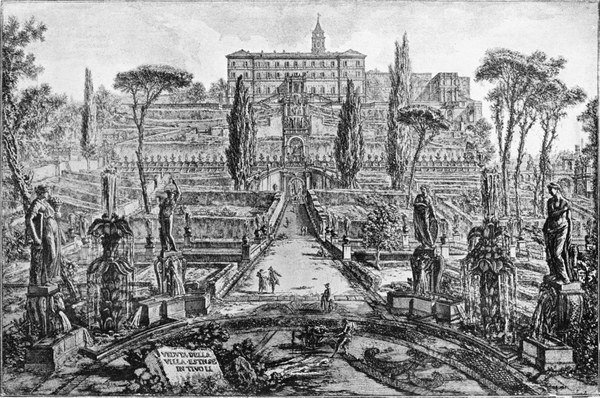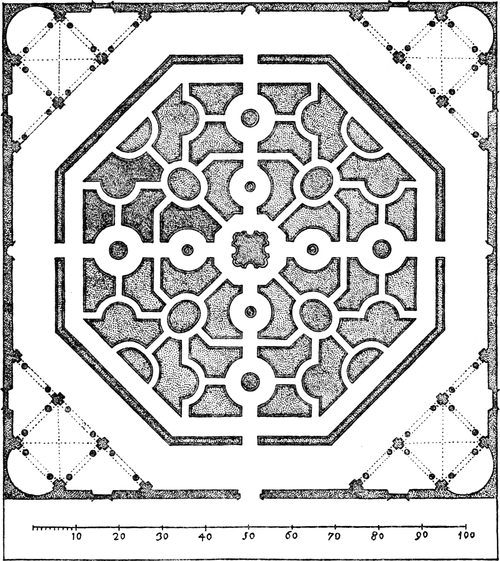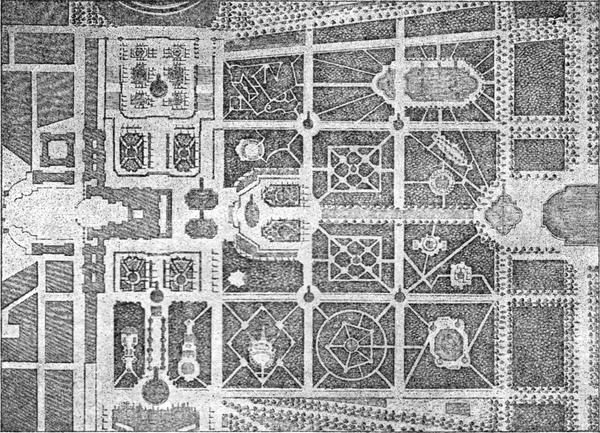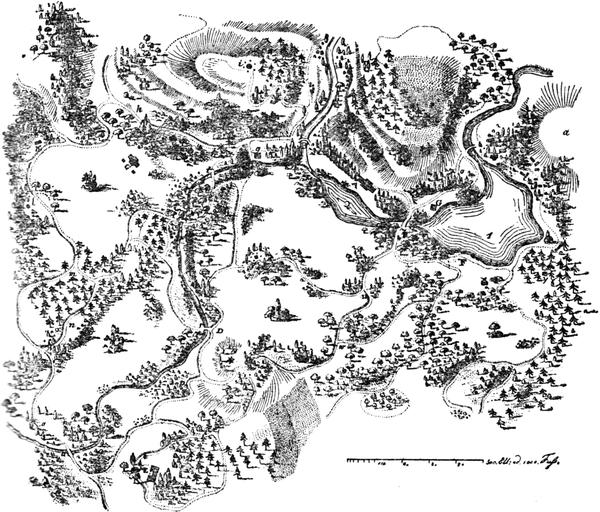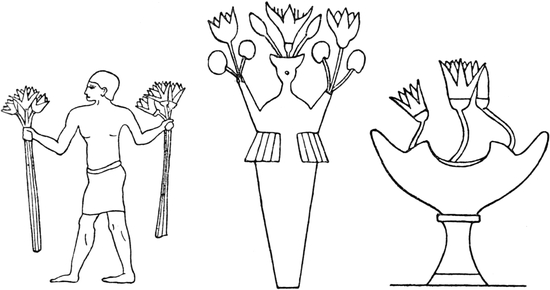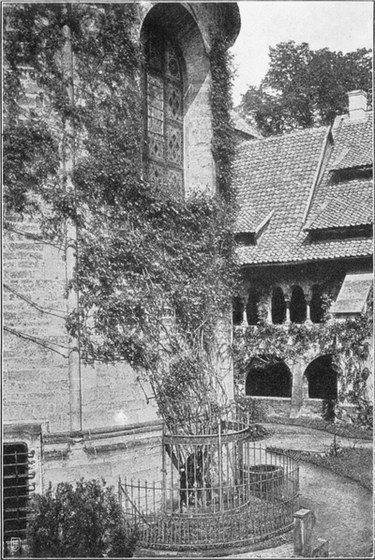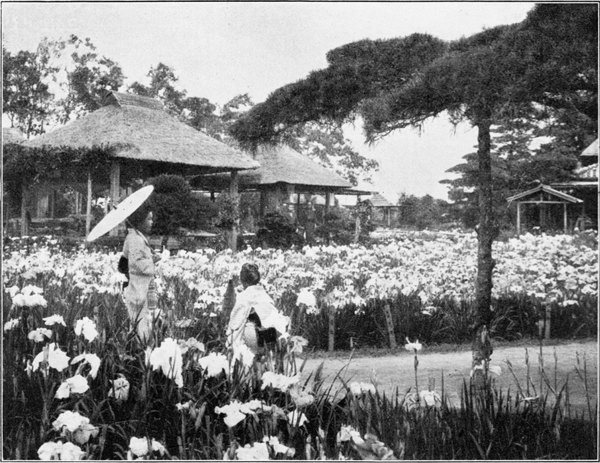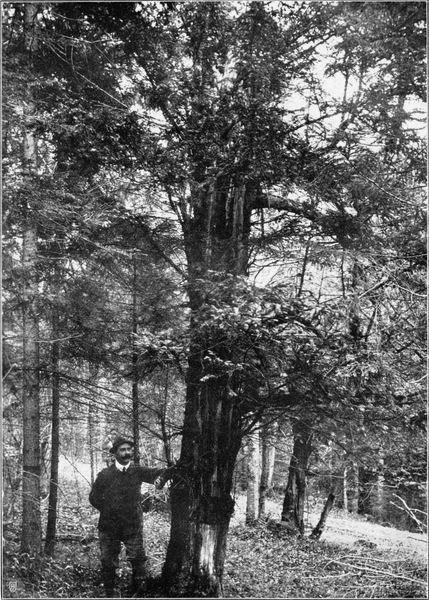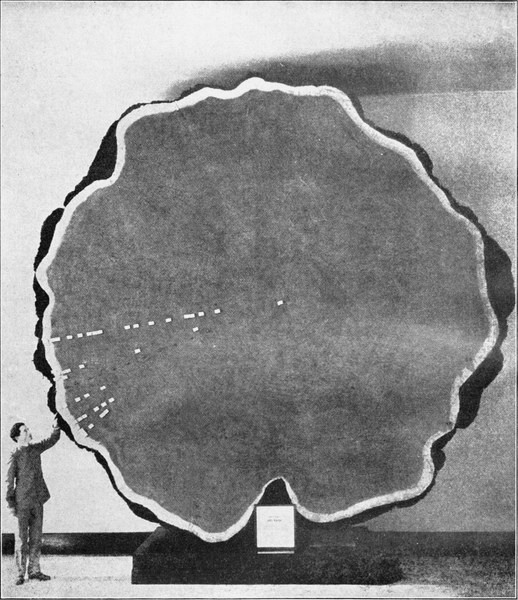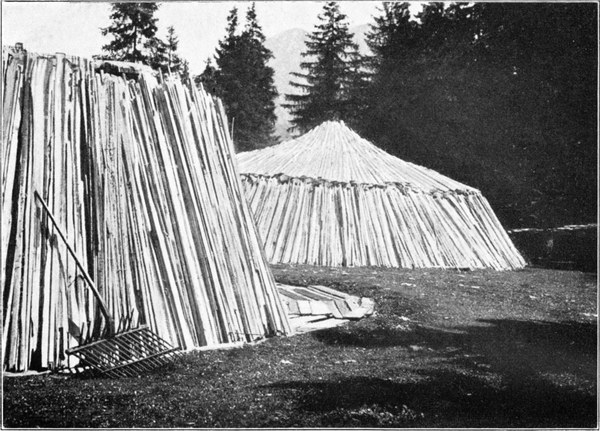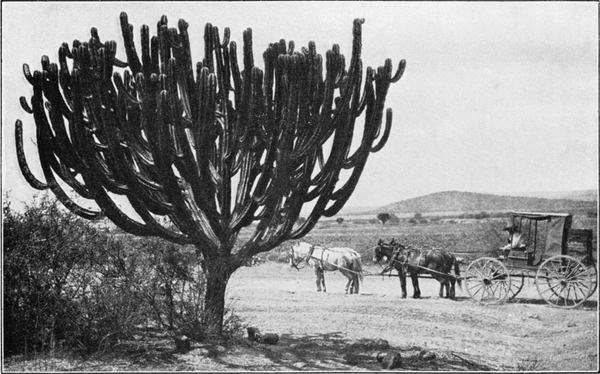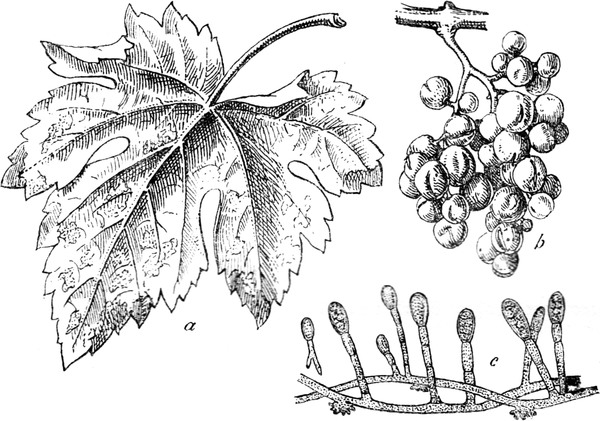Anmerkungen zur Transkription
Der vorliegende Text wurde anhand der 1911 erschienenen
Buchausgabe so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben.
Typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert;
Rechtschreibvarianten wurden nicht vereinheitlicht, sofern die
Verständlichkeit des Textes dadurch nicht berührt wird. Fremdwörter
und Transliterationen (vorwiegend aus dem Griechischen) wurden weder
korrigiert noch vereinheitlicht.
Einige Bildtafeln enthalten mehrere Abbildungen.
Fußnoten wurden an das Ende des jeweiligen Kapitels gesetzt.
Die gedruckte Fassung wurde in einer Frakturschrift
gesetzt, in der die Großbuchstaben I und J identisch sind; die Auswahl
in der vorliegenden Ausgabe erfolgte daher mitunter willkürlich.
Im Sachregister wird nunmehr zwischen den Begriffen mit den
Anfangsbuchstaben I und J unterschieden, was im Original nicht möglich
war.
Abhängig von der im jeweiligen Lesegerät
installierten Schriftart können die im Original gesperrt gedruckten
Passagen gesperrt, in serifenloser Schrift, oder aber sowohl serifenlos
als auch gesperrt erscheinen.
Kulturgeschichte der
Nutzpflanzen
2. Hälfte
Die Erde und die Kultur
Die Eroberung und Nutzbarmachung
der Erde durch den Menschen
In Verbindung mit Fachgelehrten
gemeinverständlich dargestellt von
Dr. Ludwig
Reinhardt
Bd. IV in zwei Teilen
Kulturgeschichte der Nutzpflanzen
München 1911
Verlag von Ernst
Reinhardt
Kulturgeschichte der Nutzpflanzen
von
Dr. Ludwig
Reinhardt
Band IV, 2. Hälfte
Mit 35 Abbildungen im Text und 76
Kunstdrucktafeln
München 1911
Verlag von Ernst
Reinhardt
Alle Rechte vorbehalten
Roßberg’sche Buchdruckerei, Leipzig.
Inhalt der zweiten Hälfte.
22.
Die Farb- und Gerbstoffpflanzen
23.
Der Kautschuk und die Guttapercha
25.
Die duftenden Pflanzenharze
26.
Die pflanzlichen Wohlgerüche
28.
Die Geschichte des Ziergartens
30.
Die Zierbäume und Ziersträucher
32.
Die nützlichen Wüstenpflanzen
33.
Die Feinde der Kulturgewächse
Tafelverzeichnis
des ersten Bandes.
2.
Alter Pflug; Die Entwicklung des Pfluges
16
3.
Dreschen in Galiläa
16
4.
Dampfdreschmaschine
16
7.
Mohrenhirse; Buchweizen
48
9.
Singhalesen beim Pflügen
56
10.
Reisfelder; Pflanzen des Reises
56
11.
Entkernen des Reises; Dreschen des Reises
56
12.
Singhalesinnen b. Reisstampfen
56
13.
Maisscheune der Zulu
64
14.
Maismühle der Zulu
64
15.
Längsspalier von Birnen
81
16.
Kreuzspalier von Birnen
81
17.
Blühende Mandelbäume; Traubenernte
81
18.
Konservenfabrik Lenzburg
81
19.
Maulbeerbäume; uralter Feigenbaum
129
20.
Alter Ölbaumhain in Arco
129
21.
Ölbaum in Antibes
152
22.
Olivenhain auf Capri; Dattelpalmen am Nil
152
23.
Dattelpalmen in Algier; Dattelernte in Algerien
168
24.
Kokospalme in Westafrika
168
25.
Ölpalme; Zuckerpalme
176
26.
Kokospalmen; verschiedene Palmen
176
27.
Arekanüsse; Sagopalmen
176
28.
Auf Arekapalmen kletternde Inder
176
30.
Seychellenpalme; Victoria Regia
185
32.
Bananenhain; Verladung von Bananen
192
34.
Brotfruchtbaum; Brotfrucht
201
35.
Zweig der Brotfrucht
201
36.
Baobab; Malaienwohnung
201
38.
Durian; Mangostane
208
39.
Tamarindenallee; Ananas
208
41.
Tropisches Gewächshaus
216
42.
Fruchtladen auf Ceylon; Fruchtladen in Südindien
216
43.
Kastanienbäume; Alter Feigenbaum
232
44.
Johannisbrotbaum; Zitronenhain in Salo
232
46.
Japanischer Gemüsehändler
289
47.
Artischockenpflanzung; Wassermelonen
337
49.
Japanische Bäuerin; Japanischer Bauer
352
50.
Maniokpflanzung; Papyrusdickicht
352
51.
Fufustampfen auf d. Goldküste; Yamsknollen auf Jamaika
368
52.
Yamsknollen; Frauen in Bonaberi
368
53.
Champignonkultur bei Paris; Champignonernte
392
54.
Verarbeitung von Champignons
392
55.
Szenerie aus dem Urwald; Schibutterbäume
416
56.
Karnaubapalme; Rizinuspflanzung
416
57.
Wildes Zuckerrohr
441
58.
Zuckerrohrernte; Zuckerrohrernte
441
61.
Pflücken der Teeblätter
480
62.
Pflücken der Teeblätter
480
63.
Singhalesinnen Tee verlesend
480
64.
Trocknen der Teeblätter
480
68.
Junge Kakaopflanzung
512
70.
Kakaobaum; Vanillestrauch
512
73.
Wilder Hopfen; Hopfengarten
545
74.
Hopfenpflücker; gedörrter Hopfen
545
75.
Zimtbaum; Schälen des Zimtrohrs
577
76.
Muskatnüsse; Gewürznelkenbäume
577
77.
Hydraulische Kelter; Moderne Weinfässer
625
78.
Faune nach Rubens; Champagnerkellerei
625
79.
Pulquegewinnung; Kokapflanze
640
80.
Opiumraucher; Opuntie
640
82.
Anlage einer Tabakpflanzung
672
83.
Trockenscheune in einer Pflanzung
672
84.
Reifer Tabak; Trockenscheune (Inneres)
672
85.
Sortieren der Tabakblätter
680
86.
Fermentieren der Tabakblätter; Zigarettenfabrik
680
88.
Moderner Backraum
697
89.
Malztenne der Löwenbrauerei; Sudhaus der Löwenbrauerei
705
90.
Gärkeller der Löwenbrauerei; Lagerkeller der Löwenbrauerei
705
91.
Hofbräuhaus (außen)
705
92.
Hofbräuhaus (innen)
705
Tafelverzeichnis
des zweiten Bandes.
[S. 1]
XIX.
Die Futterpflanzen.
Als die Germanen in das Licht der Geschichte traten, waren sie noch
kein ausgesprochen Ackerbau treibendes Volk, wie dies erst seit dem
Mittelalter der Fall ist, sondern Jagd und Viehzucht waren ihre
Hauptnahrungsquellen, neben denen der Pflanzenbau eine sehr bescheidene
Stelle einnahm. Persönliches Grundeigentum gab es bei ihnen noch nicht,
das Land gehörte vielmehr der Gesamtheit der Gaugenossen. Jede Sippe
erhielt ein Stück davon auf ein Jahr zur Bebauung zugewiesen, und
dieses wurde nun von den Frauen behackt und mit allerlei Nährfrüchten
wie Hafer, Gerste, Einkorn und etwas Flachs bepflanzt. Soweit Männer
zu solcher in ihren Augen erniedrigenden Arbeit zugezogen wurden,
waren es Kriegsgefangene, die man am Leben ließ, um sie als eine
Art Arbeitstiere zu verwenden. Die Freien trieben Viehzucht, soweit
nicht die leidenschaftlich gerne getriebene Jagd und der Krieg mit
den Nachbarstämmen, der mit Vorliebe in Form von Raubzügen ausgeübt
wurde, ihre Zeit in Anspruch nahm. Irgend welche schwere Arbeit war
ihnen zuwider, und wenn sie es irgendwie vermochten, lagen sie zu
Hause miteinander plaudernd auf den Bärenfellen und überließen die
Sorge für Haus, Herd und Land den Frauen und Hörigen, welch letzteren
naturgemäß alle schwere Arbeit zufiel. Die bescheidenen Hütten mit
aus Lehm verstrichenem Flechtwerk, die zu errichten ebenfalls den
Weibern oblag, wurden häufig gewechselt, um neue Weideplätze und
fruchtbaren, jungfräulichen Boden aufzusuchen. Düngung des Bodens war
noch unbekannt; daher wurde neuer Boden durch Abbrennen des darauf
wachsenden Gehölzes urbar gemacht, sobald das zuerst umgebrochene
Ackerland an Fruchtbarkeit nachließ.
Dieser halbnomadische Wirtschaftsbetrieb der alten Germanen wich erst
dann einer größere Ansässigkeit bedingenden Feldwirtschaft, als[S. 2] sich
der Strom der unruhig wandernden Stämme derselben an dem mit dem
berühmten Wall und Pfahlgraben, dem limes romanus, umgebenen
und von römisch-gallischen Ansiedlern bewohnten Dekumatenland brach
und die nimmer Rastenden zwang, feste Wohnsitze einzunehmen. Ein
Ausweichen nach Norden und Osten gab es nicht mehr; denn verwandte
Stämme saßen schon hier, und von rückwärts drohten die nachdrängenden
Slawen. Der Not gehorchend und nicht dem eigenen Trieb mußten
die Germanenstämme ihr Wanderleben aufgeben, um sich durch einen
geregelteren Ackerbaubetrieb neue und reichere Quellen zur Befriedigung
ihrer Bedürfnisse zu erschließen; denn die Zahl des Volkes wuchs, die
Jagd auf den beschränkten, zur Verfügung stehenden Gebieten wurde
weniger einträglich, und zur Gewinnung der nötigen Nahrungsmittel mußte
eine intensivere Feldbebauung, welche mehr und mehr auch die Kräfte der
freien Männer in Anspruch nahm, eingeführt werden.
Die Anleitung zu rationellerem Pflanzenbau und neue Kulturgewächse
erhielten die an den limes angrenzenden Stämme
begreiflicherweise zuerst von den auf höherer Wirtschaftsstufe
stehenden Ansiedlern des Dekumatenlandes. Zwischen den neuen Nachbarn
entwickelte sich bald ein reger Verkehr, der sich während eines
zweihundertjährigen Friedens immer lebhafter gestaltete, bis die
Völkerwanderung mit ihren zahllosen gewaltigen Kämpfen längere Zeit
anhaltende Völkerverschiebungen bewirkte. Als diese dann ausgetobt
hatte, waren die einst so wanderlustigen Stämme teils aufgerieben,
teils von den fremden Völkern, mit denen sie sich mischten, absorbiert
und ihrem Volkstum angepaßt, teils auch durch die starke Beeinflussung
des an Kultur weit höher stehenden Römertums für eine ansässige, sich
vorzugsweise auf den Landbau stützende Lebensweise gewonnen.
Schon zur Zeit des römischen Geschichtschreibers Cornelius Tacitus
(54–118 n. Chr.), der uns die erste ausführlichere Schilderung von
der Lebensweise und den Anschauungen der Germanenstämme gab, begann
in Germanien das Bedürfnis nach fester Ansiedelung sich in weiteren
Kreisen geltend zu machen. Jede Sippe besaß damals bereits einen
Anteil an Wald, Wiese und Ackerland als Sondereigentum, woneben der
gemeinschaftliche Flurbesitz der gemeinen Mark oder Allmende weiter
bestehen blieb. Hofstätte und Anrecht an Ackerland und Allmende
wurden zusammen mit dem Ausdruck Hufe oder Hub benannt. Die damalige
Betriebsform war die Feldgraswirtschaft, wo[S. 3]bei jedes Stück Land nur
ein Jahr bepflanzt wurde, um dann mehrere Jahre hindurch als Wiese oder
Weide brach zu liegen. Damals war die Viehzucht noch viel wichtiger als
der Ackerbau, der noch sehr primitiv mit dürftigem Ackergerät ausgeübt
wurde.
Einen entschiedenen Fortschritt brachte die zu Beginn des
Mittelalters aufkommende, wahrscheinlich von den Römern übernommene
Dreifelderwirtschaft, die sich bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts
in fast unveränderter Form erhielt. Sie bestand darin, daß man
ein Drittel des Ackerlandes brach liegen ließ, damit sich der
Boden erhole und durch das Hineinhacken oder -pflügen des auf ihm
gewachsenen Unkrautes, soweit es nicht vom Vieh abgeweidet wurde,
gedüngt werde. Das zweite Drittel wurde mit Wintergetreide und das
letzte Drittel mit Sommerfrucht bepflanzt. Dieser Wechsel von Winter-
und Sommergetreide gestattete die Feldarbeiten besser über das Jahr
zu verteilen. Besondere Verdienste um die Verbreitung dieser neuen
Betriebsweise erwarb sich Karl der Große, der in seinen Verordnungen
über die Bewirtschaftung der königlichen Domänen seinen Beamten genaue
Vorschriften machte, immer mit dem Zweck, seine musterhaft geleiteten
Güter möchten den bäuerlichen Betrieben als Vorbild zur Nacheiferung
dienen. Seinem guten Beispiel sind nachher vor allem die Klöster mit
ihren klugen und umsichtigen Mönchen gefolgt und haben damit viel zur
Hebung der Landwirtschaft beigetragen. Auch ihre Güter lieferten den
umliegenden Bezirken ein nachahmenswertes Beispiel. Besonders aber
beförderten die Klöster den Garten-, Obst- und Weinbau, die vornehmlich
persönliche Sorgfalt lohnten. Selbst die um das 10. Jahrhundert
einsetzende Städtegründung hatte einen fördernden Einfluß auf die
Landwirtschaft; denn die hinter Mauern Schutz suchenden Bürger blieben,
soweit sie sich nicht einem besonderen Handwerk zuwandten, Bauern, und
ihr außerhalb der Ringmauern gelegener Besitz erfreute sich bald einer
hohen Kultur, die wiederum hauptsächlich dem Garten- und Obstbau zugute
kam.
Dadurch, daß alle Brach-, Winter- und Sommerfelder auf je einer
zusammenhängenden Fläche lagen, die zunächst noch Eigentum der
Markgenossenschaft blieb und erst nach und nach in den Besitz von
einzelnen Familien überging, bestand ein gewisser Flurzwang, indem
die Arbeit von allen Genossen, die ein bestimmtes Stück Land zur
Bebauung erhalten hatten, gleichzeitig ausgeführt werden mußte. Ebenso
nachteilig auf die Entwicklung der Landwirtschaft wie dieser Flurzwang
wirkten auch die sozialpolitischen Verhältnisse, vor allem[S. 4] die
zahlreichen, alle Kultur zerstörenden und keinen rechten Fortschritt
aufkommen lassenden Kriege und Fehden der Machthaber untereinander,
unter denen die Bauern in erster Linie zu leiden hatten, und der sich
immer mehr ausbildende Gegensatz zwischen Privat- und Gemeindebesitz.
Durch ausgiebige Belehnung von seiten der Könige für geleistete
Dienste gelangte einerseits der Adel, und durch reiche Schenkungen
der um ihr Seelenheil besorgten Begüterten die Kirche zu ausgedehntem
Landbesitz, während das Bauerntum seit den Staufenkaisern mehr und mehr
verarmte. Die durch diese ungünstigen Verhältnisse genährte allgemeine
Unzufriedenheit der Landbevölkerung machte sich beim Erwachen der
Geister zur Reformationszeit in den verschiedenen Bauernaufständen
Luft; doch half ihr diese Auflehnung, die von den Herren aufs
blutigste geahndet wurde, nicht nur nichts, sondern verschlimmerte
noch wesentlich ihre Lage. Diese wurde im Laufe des 30jährigen Krieges
geradezu trostlos. Nicht nur wurde die Bauernschaft um alle Habe
gebracht und ihr Zug- und Nutzvieh fast ganz vernichtet, sondern in
der allgemeinen Unsicherheit auch die Äcker nicht mehr bepflanzt, da
keine Saat mehr vorhanden war oder das Zugvieh fehlte und die endlosen
Beraubungen den Leuten allen Mut zur Bestellung ihrer Felder nahmen.
Wozu auch säen, wenn doch nicht zu ernten war! So bedeckte sich die
unbebaute Flur weithin mit Gestrüpp, die Wiesen verschlammten, Haus
und Hof wurden zerstört oder verfielen, weil die Bewohner getötet oder
in völliger Verarmung verzogen waren. Zahlreiche einst betriebsame
Ortschaften verschwanden vom Erdboden, ihr einstiges Dasein nur noch
in gewissen Flurbezeichnungen zurücklassend. Dafür hausten Tausende
heimatlos Gewordener in Wald und Einöde. Und wer dem allgemeinen
Elend der Zeit trotzte und auf der elterlichen Scholle ausharrte,
der gewöhnte sich an elende Wohnung, dürftige Nahrung und schlechte
Behandlung, verlor allen Lebensmut, allen Drang zur Arbeit, die ja doch
nicht lohnte, nahm von der zügellosen Soldateska, mit der er verkehrte,
rohe Sitten und gewalttätiges Wesen an. Die Folge war, daß die Bauern
von den Grundherren immer mehr verachtet und bedrückt, ja vielfach bis
zur Leibeigenschaft herabgewürdigt wurden.
Im allgemeinen brachte erst das 18. Jahrhundert bessere Zeiten
für die Landwirtschaft, indem ihr einzelne Fürsten größere
Aufmerksamkeit schenkten, Ackerbaugesellschaften sich bildeten und
Kommissionen eingesetzt wurden, um über Verbesserungen im Betrieb zu
beraten. Die erste Anbahnung eines Fortschritts brachte die große
französische Re[S. 5]volution, indem sie eine weitgehende Änderung der
Untertänigkeitsverhältnisse in allen Kulturstaaten Mitteleuropas
herbeiführte und die Herren zwang, auch den unterdrückten Bauern einige
Menschenrechte zuzuerkennen. Dadurch hob sich langsam der ganze Stand,
man gab sich mehr Mühe, die Bodenverhältnisse durch Entwässerung,
soweit Versumpfung vorlag, oder Bewässerung in trockenen Lagen zu
verbessern, die Erträge der Felder durch Einführung von Fruchtwechsel
und größere Sorgfalt in der Bereitung und Verwendung des Düngers zu
steigern. Hierin ging Preußen allen anderen Staaten Deutschlands
voran, und, wie sein haushälterischer Vater, war besonders Friedrich
der Große nach der heilsamen Schulung, die er während seiner Küstriner
Verbannungszeit in der Administration des Landes durchgemacht hatte,
eifrig besorgt, die Einkünfte seiner Gebiete zu vermehren und den
allgemeinen Wohlstand zu heben. Um die schwachbevölkerten Landesteile
mit wertvollem Menschenmaterial zu beleben, suchte er wie schon sein
Vater möglichst viel Fremde ins Land zu ziehen und durch Einführung
neuer Industrien und Kulturpflanzen sein Land zu bereichern und vom
Auslande möglichst unabhängig zu machen, damit das Geld im eigenen
Lande bleibe. Die Zuzügler erhielten mancherlei Reiseunterstützung,
Hilfsgelder für den ersten Anbau auf geschenktem oder möglichst
billig überlassenem Land, das öde lag, Befreiung von den staatlichen
und kommunalen Lasten je nachdem auf 2–15 Jahre, wie auch Befreiung
vom Militärdienst auf drei Generationen. Außerdem genossen sie, die
vielfach wegen religiöser Bedrückung ihre alte Heimat verlassen hatten,
völlige Religionsfreiheit. Nach einem bekannten Ausspruche des großen
Monarchen sollte ein jeder seiner Untertanen „nach seiner eigenen
Fasson selig werden“.
Diese meist mit wertvollen Kenntnissen ausgestatteten Zugereisten
wurden meist auf Domänen, seltener auf Rittergütern angesiedelt. Um
keine unheilvolle Latifundienwirtschaft, wie in den meisten anderen
Kulturstaaten, aufkommen zu lassen, forderte der einsichtsvolle
Preußenkönig eine Aufteilung größerer, in einer Hand vereinigter
Ländereien, ja schon größerer Bauerngüter unter mehrere Söhne oder
sonstige Erben. In kleinere Besitztümer verwandelt, mußte das Land
intensiver bearbeitet werden und lieferte so weit höhere Erträge.
Zwischen Dörfern, deren Flur sich zu weit erstreckte, als daß sich
der Anbau noch recht lohnte, wurden neue gegründet, deren Bewohner
schon durch die größere Nähe ihr Land besser bewirtschaften konnten.
In noch höherem Maße als sein Vater ließ er durch Austrocknung von
Sümpfen und Urbar[S. 6]machung von Ödländereien neues Kulturland gewinnen,
das mit fleißigen Ansiedlern besetzt wurde. Vielfach wurde der
Gemeindebesitz an Wiesen unter die nachweislich dazu Berechtigten
aufgeteilt. Auch er suchte durch eine möglichst gute Verwaltung der
Domänen vorbildlich zu wirken. In Verbindung mit dem Streuen von Mergel
zur Verbesserung des Bodens wurde die Anwendung des Tiefpfluges, der
Anbau von Futterkräutern, von Hopfen und namentlich Kartoffeln, wie
auch die Einführung von Hühner- und Bienenzucht empfohlen. Die Pflege
des Obstbaues wurde dadurch gefördert, daß Gärtner eingesetzt wurden,
die das Landvolk unentgeltlich in der Pflege und Veredelung der
Obstbäume zu unterrichten hatten. Endlich bemühte sich der König um
die Anpflanzung von Färberwaid, um den teuren ausländischen Indigo zu
ersetzen, um diejenige des mährischen Flachses und besonders des weißen
Maulbeerbaums für die Zucht der Seidenraupe, um das Rohmaterial für die
von den französischen Emigranten im westlichen Gebiet seines Reiches
eingeführte Fabrikation von Seidenstoffen zu gewinnen. Für letzteres
Unternehmen mußte allerdings der schließliche Erfolg ausbleiben, da die
Naturbedingungen für das Gedeihen dieses für die Kälte empfindlichen
südlichen Gewächses in Preußen fehlten.
Dem fortschrittlichen Preußen gegenüber waren die anderen Kulturstaaten
des europäischen Kontinents im Rückstand; einzig England, das durch
keine Kriege von längerer Dauer in seiner Kulturentwicklung gestört
wurde, war im rationellen Ausbau seiner Landwirtschaft etwas weiter
fortgeschritten. Bald aber wurde es von Preußen nicht nur eingeholt,
sondern sogar überflügelt. Dieser folgenschwere Umschwung, der bald
allen deutschen Landen und schließlich der ganzen Kulturwelt zugute
kam, ist in erster Linie dem Auftreten Albrecht Thaers (sprich
tär) zu verdanken. Dieser überaus verdienstvolle Mann wurde am 14.
Mai 1752 in Celle im preußischen Regierungsbezirk Lüneburg als Sohn
eines Arztes geboren, der ebenfalls das Medizinstudium ergriff und
sich in seiner Vaterstadt als Arzt niederließ, wo er bald reichlich
Beschäftigung fand. In seinen Mußestunden beschäftigte er sich
schon früh mit naturwissenschaftlichen Studien und widmete sich dem
Gartenbau, der mit der Zeit ein solches Interesse in ihm erweckte,
daß er diese Tätigkeit seiner ärztlichen vorzuziehen begann. Diese
seine Vorliebe für die Natur brachte ihn auch in Berührung mit den
wichtigsten Fragen des Ackerbaues, und seinem klaren Verstande
konnten die Schäden, an denen die damalige Landwirtschaft krankte,
nicht lange[S. 7] verborgen bleiben. Sein Interesse für diese wuchs
derart, daß er ein kleines Landgut in der Nähe von Celle erwarb, das
als Versuchsgut dienen sollte, um alle theoretischen Auffassungen
jener Zeit auf ihren praktischen Wert hin zu prüfen. Er benutzte
ferner die landwirtschaftliche Literatur fremder Länder, namentlich
diejenige Englands, dessen Agrikultur eine ähnliche Krisis hatte
durchmachen müssen, um seine Kenntnisse zu bereichern und sie dann
seinem Vaterlande zur Verfügung zu stellen. Mehrere Schriften
landwirtschaftlichen Inhalts machten ihn bald weithin bekannt und
viele junge Leute kamen nach Celle, um seinen Wirtschaftsbetrieb zu
studieren und von ihm zu lernen. So entstand von 1802–1804 das erste
landwirtschaftliche Institut in Celle. Sein Bemühen, eine größere
Domäne in der Nähe Göttingens zu pachten, um dort seine Lehrtätigkeit
in noch ausgedehnterem Maße zu entfalten, scheiterte am Widerstande
der verpachtenden Behörde. So folgte denn Thaer einem ehrenvollen Rufe
König Friedrich Wilhelms III. nach Preußen. Er erwarb das im Kreise
Niederbarnim gelegene Rittergut Möglin, wo er 1806 eine Akademie des
Landbaus errichtete, die 1824 zu einem königlichen Institut erhoben
wurde. Im Jahre 1828 starb dann der um die Allgemeinheit so überaus
verdiente Mann.
Die Verdienste, die sich Albrecht Thaer um die deutsche Landwirtschaft
erworben hat, sind sehr vielseitiger Art. Sein Hauptverdienst ist,
daß er die Naturwissenschaften in den Dienst der Landwirtschaft
stellte und in Anwendung der aus ihnen gezogenen Lehren vor allem
die veraltete Dreifelderwirtschaft abschaffte und an ihre Stelle
die Fruchtwechselwirtschaft stellte, mit einem Wechsel von Halm- zu
Blattfrüchten, insbesondere den Schmetterlingsblütlern, den Wurzel-
und Knollengewächsen. Er machte auf die Bedeutung einer eingehenden
Buchführung aufmerksam, führte bessere Geräte und Maschinen, die
Drillkultur, d. h. das Aussäen in Reihen, meist mittels Maschinen, den
Hackfruchtbau und eine Vermehrung des Kartoffelbaus ein. Er schaffte
die Brache ab, die von da an dem Anbau lohnender Gewächse Platz
machte. Auch auf die günstigen Wirkungen der Mergelung und vermehrten
Stallmistdüngung machte er aufmerksam und führte die Stallfütterung
ein. Bedeutungsvoll ist auch seine Mitwirkung bei der gesetzlichen
Regelung der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse, der Teilung
der Allmenden und der Zusammenlegung von Grundstücken, die erst eine
Fruchtwechselwirtschaft ermöglichte. Die Vorzüge dieser letzteren
gegenüber den anderen Wirtschaftssystemen liegen vor allem darin, daß
die Bodenkräfte des Ackers durch den stetigen Wechsel von Blatt- und[S. 8]
Halmfrucht, von Pflanzen mit tief in den Boden eindringenden Wurzeln
mit solchen, deren Wurzeln sich nur flach ausbreiten, besser ausgenützt
werden. Es findet keine einseitige Erschöpfung des Bodens statt, wie
dies der Fall ist, wenn stets dieselben Pflanzen auf ein und demselben
Grundstück aufeinander folgen.
Bei der Vielseitigkeit der anzubauenden Pflanzen läßt sich daher der
Fruchtwechsel bei allen Klima-, Boden- und Wirtschaftsverhältnissen
anwenden. Der je nach der Größe der Viehhaltung größere oder geringere
Anbau von Futterpflanzen, namentlich Klee, machte den Landwirt
unabhängig von Wiesen und Weiden. Die Einführung von Blattpflanzen in
die Fruchtfolge bedingt ferner, daß der Boden stark beschattet wird
und damit feucht, locker und verhältnismäßig rein von Unkraut bleibt;
dadurch wird eine Brache fast in allen Fällen überflüssig.
Die Lehren Albrecht Thaers und seiner Schüler, die lediglich das
Resultat sorgfältig durchgeführter praktischer Versuche waren,
denen aber die wissenschaftliche Begründung zum Teil fehlte,
hatten bewirkt, daß während der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
eine große Umwälzung in der Art des Betriebes der Landwirtschaft
eintrat. Bald gingen größere wie kleinere Betriebe von den
veralteten einfachen Wirtschaftsweisen zur Fruchtwechselwirtschaft
oder doch zu einem verbesserten Wirtschaftssystem über. Diese
Entwicklung der Landwirtschaft nahm auch in der zweiten Hälfte des
vergangenen Jahrhunderts ihren Fortgang, besonders da es gelungen
war, die durch praktische Versuche erworbenen Erfahrungen durch
die Naturwissenschaften wissenschaftlich zu begründen und aus
der weiteren Entwicklung der Wissenschaft neue Gesichtspunkte im
landwirtschaftlichen Betrieb zu verwerten. Agrikulturchemie und -physik
einerseits, und Pflanzenphysiologie andererseits wirkten unter Führung
von Männern wie Liebig, Knop, Wolny, Sachs, Hellriegel, Kühn, Orth und
andern in hohem Maße befruchtend, und in den weitesten Kreisen brach
sich die Überzeugung Bahn, daß nur durch das innigste Zusammenarbeiten
von Wissenschaft und Praxis ein weiteres Emporblühen der Landwirtschaft
möglich ist. Diesem Fortschritt dienen in erster Linie die zahlreichen,
in allen Kulturstaaten eingerichteten landwirtschaftlichen Schulen und
Versuchsinstitute, für deren rationellen Betrieb namentlich Julius
Kühn sich große Verdienste erwarb. Dieser Mann ist geradezu der
Schöpfer des modernen landwirtschaftlichen Universitätsstudiums, so
daß er es wohl verdient, daß wir hier etwas eingehender von ihm reden.
Dieser am 14. April 1910 im[S. 9] 85. Lebensjahre gestorbene Gründer der
landwirtschaftlichen Anstalt der Universität Halle a. S. wurde am 22.
Oktober 1825 als Sohn eines Landwirts zu Pulsnitz in der sächsischen
Oberlausitz geboren. Von Jugend auf war der lebhafte Wunsch in ihm
rege, gleichfalls Landwirt zu werden, und schon als kleiner Junge
begleitete er seinen Vater, der damals Wirtschaftsinspektor in Gosda
bei Spremberg war, auf seinen Gängen durch die Ställe und Felder. Mit
einer für einen jungen Landwirt seiner Zeit ausgezeichneten Vorbildung
trat er 1841 bei einem der hervorragendsten Landwirte seiner engeren
Heimat, Blochmann in Wachau, als Ökonomielehrling ein. Von 1848 an war
er selbständig tätig und beschäftigte sich damals besonders mit dem
Studium der Düngung und der verschiedenen Pflanzenkrankheiten. Die
Ergebnisse der letzteren veröffentlichte er 1858 unter dem Titel: „Die
Krankheiten der Kulturgewächse, ihre Ursachen und ihre Verhütung“.
Im Jahre 1861 erschien die im Jahre zuvor von der Schlesischen
Gesellschaft für vaterländische Kultur preisgekrönte Schrift: „Die
zweckmäßigste Ernährung des Rindviehs vom wissenschaftlichen und
praktischen Standpunkte“, ein Werk, das in 12 deutschen Auflagen und
zahlreichen Übersetzungen Jahrzehnte hindurch die Führung auf dem
Gebiet der landwirtschaftlichen Fütterungslehre behielt. 1862 nahm
er eine Berufung an die an der Universität Halle neu zu errichtende
Professur für Landwirtschaft an, nachdem er kurz vorher einen gleichen
Ruf nach Berlin abgelehnt hatte, „weil er wegen des Umfangs der
Großstadt und der Lage derselben eine ersprießliche Wirksamkeit für
seine Wissenschaft hier nicht zu erhoffen haben würde“. Im ersten
Semester hatte er 3 Zuhörer, im folgenden 20, dann 56 und bereits im
fünften Semester überstieg die Zahl der in Halle studierenden Landwirte
die Besuchsziffer der ältesten und meistbesuchten Lehranstalten
Deutschlands. 1871 war die Zahl der in Halle studierenden Landwirte
mit 218 größer als an allen landwirtschaftlichen Lehranstalten
Preußens insgesamt. Nachdem sich unter Kühns Führung die Eingliederung
des Studiums der Landwirtschaft in die Universität so glänzend
bewährt hatte, wurden in der Folge auch an anderen Universitäten
landwirtschaftliche Institute nach Halleschem Vorbild ins Leben
gerufen. Trotzdem nahm, obgleich auch an anderen Universitäten die
Zahl der studierenden Landwirte von Jahr zu Jahr wuchs, der Besuch der
Landwirtschaftlichen Anstalt der Universität Halle noch stetig bis
in die Gegenwart zu, so daß bis zum Sommer 1909 fast 8000 Landwirte
daselbst studiert hatten. Dieser beispiellose Erfolg beruht in erster
Linie[S. 10] auf der Bedeutung Kühns als Lehrer und Forscher. Die Verbindung
eines umfassenden naturwissenschaftlichen Wissens mit einer reichen
landwirtschaftlichen Erfahrung gab seiner Lehr- und Forschertätigkeit
ihre inhaltliche Bedeutung und war die Ursache seiner so ungemein
erfolgreichen Wirksamkeit.
Außer Kühn ist noch als besonders erfolgreicher Lehrer der vom großen
Reformator Thaer begründeten Landwirtschaftswissenschaft Albert
Orth von der Landwirtschaftlichen Hochschule in Berlin zu nennen,
der jetzt in seinem 76. Lebensjahre auf ein 50jähriges Wirken als
landwirtschaftlicher Dozent und auf 46 Jahre Hochschultätigkeit
zurückblickt. Er wurde am 15. Juni 1835 zu Lengefeld bei Corbach
geboren, studierte zu Göttingen und Berlin, war von 1860–65 Oberlehrer
an der Landwirtschaftlichen Lehranstalt Boberbeck, promovierte 1868
zu Göttingen, wurde 1870 Dozent in Halle a. S. und wirkt seit 1871
als Professor an der damals „Landwirtschaftliches Institut“ genannten
Landwirtschaftlichen Hochschule in Berlin. Er ist Begründer des
Laboratoriums für Bodenkunde, publizierte eine Schrift über „Kalk- und
Mergeldüngung“ und nahm wertvolle wissenschaftliche Bodenuntersuchungen
des Rüdersdorfer Kalkdistrikts vor. Er schuf sechs Wandtafeln für
Bodenkunde, die typischen Bodenprofile des deutschen Flachlandes
betreffend, machte auch mit einem Fachgenossen eine Bodenaufnahme
der Pontinischen Sümpfe zwischen Rom und Neapel, die erste ihrer
Art. Als Vorsteher des agronomisch-pedologischen Instituts der
Landwirtschaftlichen Hochschule pflegte er vornehmlich die Erforschung
und die Lehre von der Bodenbeschaffenheit in ihren Beziehungen zum
Pflanzenleben, ein Verhältnis, dessen enorme Wichtigkeit für den
landwirtschaftlichen Betrieb auch dem Laien ohne weiteres klar sein
dürfte. Studienausflüge in Landwirtschaftsgegenden ergänzen das bei
ihm gebotene theoretische Studium; auch bieten die Rieselfelder
der Stadt Berlin prachtvolle Modelle für die Bewässerungs- und
Entwässerungslehre, Muster für sehr bedeutende Aptierungs- und
Dränierungsarbeiten. Ein für das Studium höchst wichtiges Hilfsmittel
ist das von Orth während der letzten 25 Jahre mit erheblichen eigenen
Geldopfern errichtete Museum, das unschätzbares Illustrationsmaterial
zum Unterricht beisteuert. Darin sind unter anderem in einem
Bodenschrank 60 typische, geologisch geordnete Bodenprofile des
Deutschen Reiches enthalten, ferner das Wurzelherbarium der wichtigsten
landwirtschaftlichen Kulturgewächse auf bis 4 m hohen Tafeln
unter Glas, eine Sammlung, die in den Jahren 1882 und 1883 von Orth[S. 11] im
Sandboden der Berliner Talebene mit Hilfe der Assistenten aufgenommen
wurde. Kein Besucher Berlins, der sich für diesen wichtigsten Zweig
der menschlichen Erkenntnis interessiert, sollte es unterlassen, diese
Sehenswürdigkeit der Reichshauptstadt zu besichtigen.
In neuester Zeit hat neben dem Studium der chemischen Beschaffenheit
des Bodens besonders dasjenige der Bodenbakterien und deren Einfluß auf
das gute Gedeihen der Pflanzen eine große praktische Bedeutung erlangt.
Zahlreiche Arten derselben, besonders die sich in den Wurzelknöllchen
der Leguminosen ansiedelnden und daselbst den Stickstoff der Luft,
der sonst für die Pflanze unbrauchbar ist, durch Verwandlung in
salpetersaure und salpetrigsaure Salze nutzbar machenden Rhizobien
oder Wurzellebewesen werden heute im großen in Reinkultur gezüchtet
und zur Besiedlung des Bodens an Stelle von Düngung bei der Kultur
der Leguminosen verwendet. Auch die frühere Brache hat im Grunde nur
auf dem ruhigen Sichvermehrenlassen solcher stickstoffvermehrender
Bakterien der verschiedensten Arten beruht. So fand schon der
französische Chemiker Berthelot in seinen grundlegenden Versuchen,
daß sich in liegengelassenen dürren Blättern durch die reichliche
Entwicklung solcher ein Zuwachs an Stickstoff nachweisen ließ, und
daß 50 kg Ackererde auf demselben Wege in sieben Monaten einen
Zuwachs von 12,7 g Stickstoff erlitten. Alle diese winzigen,
meist einzelligen Pilze, die teils sauerstoffbedürftig sind, teils
ohne solchen gedeihen, sind vom Vorhandensein kohlenstoffhaltiger
Nahrung abhängig, da sie die Kohlensäure der Luft nicht zu assimilieren
vermögen. Sie können also nur dort gedeihen, wo sich Pflanzen
finden, die ihnen diese Nahrung liefern.[1] Besonders kommen dafür
winzige grüne Algen in Betracht, die sich überall in den obersten
Bodenschichten finden, wohin das für die Zerlegung der Kohlensäure der
Luft und die Assimilation des Kohlenstoffs nötige Sonnenlicht dringt.
Eine solche Vergesellschaftung von stickstoffassimilierenden Pilzen
und kohlenstoffassimilierenden Algen ist eine Pflanzengenossenschaft,
die von allen chemischen Bedingungen so gut wie unabhängig ist, da
sie sich gegenseitig alles zum Leben Nötige, außer dem aber sonst
in der Regel reichlich zur Verfügung stehenden Wasser, liefern. In
besonders inniger Vergesellschaftung finden sie sich speziell in
der Flechtengenossenschaft, die bei der[S. 12] ersten Besiedlung nackten
Gesteines, um es nach und nach zur Wohnstätte höheren Pflanzenlebens
vorzubereiten, eine überaus wichtige Rolle im Haushalte der Natur
spielt. Für allen höheren Pflanzenwuchs ist ihre Tätigkeit unbedingt
erforderlich, weil die stickstoffsammelnden Bakterien beim Zerfall
ihrer Leiber nach dem Tode den in ihnen aufgespeicherten Stickstoff den
Pflanzen ebenso nutzbar machen, wie jeden andern organischer Substanz
entstammenden Stickstoff. Und zwar geht die Ansammlung solchen durch
sie aus der Luft kondensierten Stickstoffs erfahrungsgemäß in schweren
Böden besser vor sich als in leichten, weil sich in letzteren die
nicht minder allgegenwärtigen denitrifizierenden Bakterien leichter
vermehren und durch ihr gutes Gedeihen dem durch jene bewirkten
Nitrifikationsprozeß entgegenarbeiten. Von wie großer praktischer
Wichtigkeit eine Förderung dieser Stickstoffsammlung des Bodens
ist, zeigt die einfache Erwägung, daß die deutsche Landwirtschaft
jährlich über 100 Millionen Mark für Stickstoffdünger ausgibt, die zum
allergrößten Teil für Chilisalpeter außer Landes gehen. Auf diesem
Felde lassen sich noch große praktische Erfolge erzielen, die der
Landwirtschaft in der Zukunft zugute kommen werden. Vor allem soll man
durch reichliche Lüftung und Besonnung des Bodens, durch ausgiebiges
und tiefes Umgraben die Ansiedlung dieser Wohltäter der Menschheit
begünstigen.
Außer dem Stickstoff gehören auch Phosphorsäure, Kalk und Kali zu den
wichtigsten Nährstoffen der Pflanzen, deren reichliches Vorhandensein
geradezu erntebestimmend für die meisten Kulturen wirkt. Die
Phosphorsäure spendet man den Feldern in Form von Knochenpulver oder
neuerdings meist zerstampfter Thomasschlacke, in welcher das dem Eisen
beim Thomasverfahren entzogene Phosphor angesammelt wurde. Den Kalk
gibt man, wenn er nicht genügend im Boden selbst enthalten ist, in
Form von Kalkmergel und das Kali in Form der sogenannten Abraumsalze,
so genannt, weil man diese früher beim Graben nach Kochsalz als
unbrauchbaren Abfall abräumte, bis man dann die überaus große
Bedeutung derselben als Nährstoff für die Landwirtschaft erkannte,
und nun vielmehr die Kalisalze ausbeutet und die dabei entstandenen
Hohlräume mit dem viel weniger wertvollen Kochsalz ausfüllt. Diese
Kalisalzlager, die sich in Schichten der Zechsteinperiode (Dyas) um
den Harz herum erstrecken und in Staßfurt zuerst 1857 beim Bohren
nach Kochsalz in großer Menge gefunden wurden, bilden ganz eigentlich
den viele Milliarden Mark an Wert umfassenden Reichtum Deutschlands.
Andere Bodenschätze, wie vor[S. 13] allem die verschiedenen Metalle, haben
auch andere Länder aufzuweisen; aber Kalisalze besitzt bis jetzt nur
Deutschland, was für seine Landwirtschaft einen unendlich wertvollen
Schatz bedeutet, um so mehr diese immer mehr zur Verbesserung der Böden
und dadurch zur Erhöhung des Ernteertrags zur Anwendung gelangen.
Gerade in unserer Zeit, da die außerordentlich verbesserten
Transportgelegenheiten die Einfuhr von billigem Getreide aus dem
Ausland einen starken Zurückgang der Getreidekultur und dafür ein
Überhandnehmen der Milchwirtschaft als besser rentierend bewirkte,
spielt der Anbau von Futterpflanzen für die zahlreichen, fast
ausnahmslos Gras fressenden Haustiere eine sehr große Rolle in der
Landwirtschaft. Deshalb besitzen die Futterpflanzen als Kulturpflanzen
des Menschen eine zunehmende Bedeutung für ihn. Unter ihnen sind
vor allem die verschiedenen Grasarten schon so lange in Kultur, als
der Mensch überhaupt Ackerbau und Viehzucht treibt; denn nur bei
vollständiger Sicherheit, stets genügendes Futter wie für sich selbst,
so auch für die ihm unentbehrlichen Haustiere zur Hand zu haben, war es
möglich, daß einigermaßen eng beieinander wohnende Menschen in größerem
Maße Viehzucht treiben konnten.
Wenn wir auch nicht mehr mit Sicherheit die ältesten Futterpflanzen
der Kulturmenschheit bestimmen können, so kann doch keinerlei Zweifel
darüber herrschen, daß diese unter den in 3500 Arten über die ganze
Erde verbreiteten Gräsern zu suchen sind, die auch die wichtigsten
Getreidearten lieferten. Wie in großer Artenzahl finden sie sich
in der größten Menge der Individuen besonders in der nördlichen
gemäßigten Zone, wo sie vorzugsweise die niedrige Vegetationsdecke,
den Hauptbestandteil der Steppen, und in Form von Wiesen auch der vom
Menschen geschaffenen Kultursteppe bilden. Gegen den Äquator nimmt zwar
die Zahl der Grasarten zu, aber die Menge der Individuen ab. Ganz auf
die Tropen beschränkt sind die gigantischen baumartigen Formen wie die
Bambusse. Die südliche Halbkugel ist etwas weniger reich an Gräsern als
die nördliche, die in dieser Beziehung besonders bevorzugt ist. Gegen
die Pole zu wie auch in den höheren Gebirgsregionen nehmen die Gräser
an Zahl ab und verschwinden allmählich ganz.
In der Ebene und den tieferen Gebirgslagen treten gewisse Gräser
wiesenbildend auf, andere machen im Schatten der Wälder den
Hauptbestandteil der niedrigen Vegetation aus, wieder andere wachsen
nur auf dürrem, sandigem oder steinigem Boden, auf Heiden usw.
Da die[S. 14] auf Sandboden wachsenden Gräser mit weithin kriechenden,
ausläuferreichen Wurzelstöcken versehen sind, werden sie mit
Vorliebe zur Verfestigung sandiger Ufer und Straßenböschungen, von
Eisenbahndämmen, Festungswällen usw. und zur Bindung des Flugsandes auf
den Dünen angebaut.
Früh schon hat der zu höherer Kultur emporgestiegene Mensch durch
Rodung von Wäldern nicht nur Ackerland, sondern auch Wiesen zum
Weiden seines Viehs gewonnen. Aber erst spät und nur durch dichtere
Besiedlung der von ihm besetzten Gebiete kam er auch dazu, durch
das Schneiden und Trocknen der die Wiesen vorzugsweise besiedelnden
Grasarten sich Vorräte an Viehfutter für den Winter in Form von
Heu anzulegen. Die ältesten Nachrichten, die wir von den
Kulturvölkern des Altertums haben, gehen nicht über die Mitte des
letzten vorchristlichen Jahrtausends zurück. So berichtet der um 50
v. Chr. die ethnographisch geordnete Geschichte fast aller damals
bekannten Völker bis 60 v. Chr. in 40 Büchern schreibende griechische
Historiker Diodoros aus Sizilien, daher Siculus genannt, bei der
Schilderung der persischen Geschichte: „Als die Phönikier sich gegen
den persischen König Artaxerxes (A. I., zweiten Sohn des Xerxes, der
von 465–425 v. Chr. regierte; unter ihm begann der Verfall des Reichs)
empörten, begannen sie die Feindseligkeiten damit, daß sie im großen
königlichen Park, in welchem die persischen Könige ihren Aufenthalt zu
nehmen pflegten, die Bäume umhieben und das Heu verbrannten, wovon die
Satrapen ein Magazin für ihre Kavallerie angelegt hatten.“ Daß nun die
Perser bei ihrem so ausgedehnten Postdienst und bei der zahlreichen von
ihnen unterhaltenen Reiterei Fouragemagazine besaßen, kann uns nicht
weiter wundern. Auch die Griechen und Römer haben solche teils für
Militär-, teils für Friedenszwecke errichtet. Heuvorräte für den Winter
anzulegen, war schon im klassischen Altertum ein wichtiges Geschäft
für den Landmann, wie uns schon der ältere Cato (234–149 v. Chr.), der
unversöhnliche Feind von Roms machtvoller Nebenbuhlerin, Karthago,
berichtet. Eine ausführliche Schilderung der Heuernte bei den alten
Römern gibt uns der zu Gades (dem heutigen Cadix) in Spanien gebürtige
römische Ackerbauschriftsteller Columella im 1. Jahrhundert n. Chr.
in seinem Buche über den Landbau, worin er sagt: „Der Landmann bedarf
für sein Vieh mancherlei Futter, namentlich aber Heu (foenum,
im französischen foin noch erhalten). Daher muß er auch seine
Wiesen, denen die alten Römer den ersten Rang in der Landwirtschaft
einräumten, gehörig hegen und[S. 15] pflegen. Marcus Portius (der eben
genannte Cato) hebt besonders hervor, daß die Wiese keinen Schaden
durch Wetterschlag leidet wie die Feldfrüchte, daß sie einen sehr
geringen Aufwand erfordert und doch jährlich ihren Ertrag gibt, und
zwar einen doppelten, indem sie ebensoviel frisches Gras als Futter,
wie Heu für die Scheuer liefert. — Wir unterscheiden trockene Wiesen
und bewässerte Wiesen. Ist der Boden fruchtbar und fett, so bedarf er
keiner Bewässerung, und das darauf gewonnene Heu gilt für besser, wenn
es auf einem von Natur fruchtbaren Boden gewachsen und nicht nur durch
Wasser hervorgelockt ist. Das letztere muß jedoch auf magerem Boden
geschehen, und wo Wasser zu Gebote steht, kann auch der magerste als
Wiese benutzt werden. Übrigens darf man weder eine Vertiefung wählen,
in der sich das Wasser sammelt, noch einen steilen Abhang, an welchem
es rasch herabfließt. Ein sanfter Abhang dagegen schadet nicht. Am
liebsten hat man aber doch eine Fläche, die sich ein wenig senkt, so
daß der Regen und künstlich darauf geleitetes Wasser ganz allmählich
hinuntersickern. An sumpfigen Stellen muß das Wasser in Gräben
abgeleitet werden; denn ein Übermaß an Wasser ist ebenso schlimm für
das Gras, wie ein Mangel daran.
Die Kultur der Wiesen erfordert mehr Sorgfalt als Anstrengung. Erstens
darf man auf ihnen weder Baumstrünke, noch Sträucher, noch Dornbüsche,
noch allzustarkes Gras dulden. Dergleichen muß im Herbst ausgerottet
werden, wie z. B. Brombeerstauden, Gesträuch und Binsen, oder im
Frühjahr, wie Cichorien (intubum). Schweine dürfen auf der Wiese
nicht weiden, weil sie den Boden aufwühlen; auch darf schweres Vieh
auf ihnen nur gehen, wenn der Boden trocken ist, weil sonst die Hufe
zu tief einsinken und die Wurzeln des Grases beschädigen. — Magere
Abhänge müssen im Februar bei abnehmendem Monde mit Mist gedüngt
werden. Alle Steine und sonstigen Dinge, die der Sichel im Wege sein
könnten (Sensen kannte man im Altertum noch nicht), müssen abgelesen
werden. Alte, mit Moos (muscus) überzogene Wiesen befreit man
von diesem, indem man es auskratzt und dann Grassamen aus der Scheuer
aufstreut, oder indem man Mist auffährt; jedoch ist Asche das beste
Mittel, um Moos auszurotten.
Das Gesagte bezieht sich auf Wiesen, die schon als solche vorhanden
sind. Kommt es dagegen darauf an, neue anzulegen oder verdorbene neu in
Stand zu setzen, so ist es oft vorteilhaft, den Boden erst zu pflügen;
denn eine alte Wiese gibt, wenn sie umgepflügt ist, oft einen hohen
Ertrag. Es wird also ein solches zur Wiese bestimmtes[S. 16] Stück Land im
Sommer mehrmals mit dem Pfluge gewendet, dann im Herbst mit Rüben
(rapum), Raps (napus) oder Saubohnen (faba) besät
und im folgenden Jahre mit Getreide. Im dritten wird es dann sorgsam
gepflügt und mit Wicken (vicia), die mit Heusamen (semen
foeni) gemengt sind, besät. Hierauf werden die Schollen mit
Hacken kleingeschlagen und mit Eggen geebnet, auch werden die kleinen
Hügel, die sich da bilden, wo man die Egge wendet, dem Boden gleich
gemacht, damit gar nichts zurückbleibt, woran die Sichel des Mähers
(foenisex) sich stoßen könnte. Die Wicke bleibt so lange stehen,
bis sie ganz reif ist und schon eine Anzahl Samen auf den Boden hat
fallen lassen. Dann wird sie samt dem Grase gemäht, in Bündel gebunden
und weggeschafft. Ist der Boden fest, so kann man ihn nun wässern,
wenn Wasser zu haben ist. Ist er aber locker, so darf man nicht eher
eine größere Menge Wasser darauf fließen lassen, als bis er dicht mit
Graswurzeln durchzogen ist, sonst würde das Wasser die Erde mitnehmen
und die Wurzeln des Grases bloßlegen. Auch das Vieh darf nicht auf
die junge Wiese gehen. So oft das Gras emporgewachsen ist, wird es
mit Sicheln (falx) geschnitten. Erst im zweiten Jahr gestattet
man nach der Heuernte (foenisicium) dem kleinen Vieh, auf eine
solche Wiese zu gehen, wenn sie trocken und zur Weide günstig gelegen
ist. Im dritten Jahr kann auch das große Vieh auf ihr weiden, wenn sie
fest geworden ist. Noch ist darauf zu sehen, daß die magersten und die
höchsten Stellen der Wiese im Februar mit Heusamen und Mist beworfen
werden. Ist die Höhe gedüngt, so führt der Regen oder die Bewässerung
die Nährkraft auch auf die tieferliegenden Teile. Aus eben diesem
Grunde düngt man die Höhen der Äcker stärker als die Tiefen.
Tafel 93.

Wirkung der künstlichen Düngung auf den Heuertrag.
Links beginnend: 1. Ohne Düngung. 2. Mit
Superphosphat. 3. Mit Kainit und Superphosphat.
❏
GRÖSSERES BILD
Tafel 94.

Rotbuchen-Kuhbüsche (vorderster Busch 3,5 m hoch) von der Weide
des Hüttenwasens beim Feldberg im Schwarzwald, wie die Geißtannli der
schweizerischen Alpenweiden durch beständiges Abgefressenwerden der
jungen Triebe durch das weidende Vieh entstanden. (Nach Photogramm von
L. Klein aus den Vegetationsbildern von G. Karsten und A. Schenck.)
❏
GRÖSSERES BILD
Das Heu wird am besten zur Zeit geschnitten, da es erwachsen, aber
noch nicht dürr ist; man bekommt dann mehr davon und es gibt ein
wohlschmeckenderes Futter für das Vieh ab. Beim Dörren hat man darauf
zu achten, daß es weder zu trocken, noch zu frisch eingefahren wird.
Das allzu trockene ist strohartig, das allzu frische geht in der
Scheuer (tabulatum) in Fäulnis über, erhitzt sich auch oft so,
daß Feuer daraus emporschlägt. Wird geschnittenes Heu auf der Wiese
vom Platzregen durchnäßt, so läßt man es ruhig liegen, bis es obenweg
wieder von der Sonne getrocknet ist. Erst dann wird es gewendet und,
wenn es auf beiden Seiten getrocknet ist, auf Schwaden (striga)
gebracht und in Bündel (manipulus) gebunden. Nun bringt man es
so bald als möglich unter Dach oder baut, wenn solches nicht möglich[S. 17]
ist, Schober (meta, so hieß übrigens auch der als Ziel oder
Wendepunkt dienende kegelförmige Stein in der Rennbahn) aus ihm, die so
spitzig als möglich sein sollen. So wird das Heu am besten vor Regen
geschützt; auch haben die Schober, abgesehen vom Schutz gegen Regen,
das Gute, daß das Heu in ihnen schwitzt und so die noch vorhandene
Feuchtigkeit verdunsten läßt. Auch wenn man Heu unter Dach bringt, tut
man gut daran, es zunächst nur lose aufzuschichten und es erst später,
nachdem es geschwitzt hat, festzutreten, da, wo es bleiben soll.“
Der fruchtbarste und bedeutendste Gelehrte Roms, Marcus Terentius Varro
(116–27 v. Chr.) schreibt in seinem Buche über den Landbau: „Hört das
Gras (herba) der Wiesen (pratum) auf zu wachsen und
beginnt vor Hitze dürr zu werden, so muß es mit Sicheln abgeschnitten
werden, dann wendet man es mit Gabeln, bis es dürr ist, bindet es in
Bündel und fährt es in das Landhaus (villa). Nun kratzt man die
Stoppeln (stipula) von der Wiese mit Harken und legt sie zum
Heuvorrat (foenisicia). Ist dies geschehen, so werden die Wiesen
noch gesichelt, d. h. es wird noch das mit den Sicheln weggeschnitten,
was die Heumäher (foenisex) beim ersten Schnitt haben stehen
lassen, nach welchem die Wiese noch ganz höckerig aussieht.“ Palladius
im 4. Jahrhundert n. Chr. rät die als Weide dienenden Wiesen
(pascuum) im August in Brand zu stecken, damit die Sträucher
(frutex) bis auf den Strunk (stirps) abbrennen und die
Gräser nach dem Brande um so freudiger wieder aufsprießen. Auch rät er
die Scheuern nicht bloß trocken und luftig, sondern auch weit genug vom
Landhaus weg zu bauen, damit letzteres im Falle eines Brandes nicht
gefährdet werde.
In welch hohen Ehren der Landbau bei den Römern noch in der Kaiserzeit
stand, das bezeugt uns Plinius der Ältere (23–79 n. Chr.), der uns in
seiner Naturgeschichte bezeugt: „Auch bei den Ausländern hat es für
eine passende Beschäftigung für Könige und Feldherrn gegolten, über den
Landbau zu schreiben. Das haben z. B. die Könige Hiero, Philometor,
Attalus und Archelaos, die Feldherrn Xenophon und Mago der Punier
getan. Als das römische Heer Karthago erobert hatte (146 v. Chr.),
schenkte unser Senat die dortigen Büchersammlungen den kleinen Fürsten
Afrikas; die 28 kleinen Schriften des Mago (lebte etwa um 520 v. Chr.)
aber hielt er in Ehren und ließ sie ins Lateinische übersetzen,
obgleich der ältere Cato damals schon über den Landbau geschrieben
hatte. — Auch unter den Weltweisen, den ausgezeichneten Dichtern, den
berühmten Schriftstellern sind tüchtige Landwirte gewesen. Ich habe
deren Namen in der Einleitung zu[S. 18] meinem Buche genannt, erwähne aber
ganz besonders den Marcus Varro, der sich noch in seinem 81. Lebensjahr
entschloß, über die Landwirtschaft zu schreiben.“
Derselbe Plinius aber bemerkt zur Tatsache, daß die römischen Landgüter
zu seiner Zeit nur noch durch die infolge der zahlreichen Kriege im
Überfluß auf den Sklavenmarkt geworfenen Kriegsgefangenen bearbeitet
wurden: „In alter Zeit bebauten unsere Feldherrn mit eigener Hand ihre
Felder, und man darf wohl annehmen, daß sich die Erde selbst über den
mit Lorbeer bekränzten Pflug und den durch Triumphe berühmten Pflüger
gefreut habe. Dem Serranus wurden seine Ehrenstellen übertragen, wie
er gerade mit Säen (serere) beschäftigt war, und so erhielt
er jenen Namen. Dem Cincinnatus überbrachte der Staatsbote (458
v. Chr.) die Diktatur, wie er seine vier Joche Landes am Vatikan
pflügte; sie heißen noch jetzt die Qintischen Wiesen (er hieß nämlich
Lucius Qinctius Cincinnatus). — Heutzutage wird das Land von Sklaven
bearbeitet, deren Füße gefesselt, deren Hände verdammt und deren
Gesichter gebrandmarkt sind. Das kann die Erde doch nur mit Widerwillen
dulden.“
Neben den Gräsern spielte die Luzerne (Medicago sativa)
schon bei den Kulturvölkern des Altertums eine nicht unwichtige
Rolle. Dieser Schmetterlingsblütler mit bläulichen oder violetten
Blüten in lockeren Trauben und spiralig zusammengerollten Hülsen ist
vom südwestlichen Rußland durch Asien bis zur Mongolei, Tibet und
Vorderindien heimisch, während die ihr nahe verwandte gelbblühende
Abart, der Sichelklee (Medicago falcata), von Mittel-
und Südeuropa bis zum nördlichen Sibirien und nach Zentralasien
wildwachsend vorkommt. Die Luzerne ist ein sehr wertvolles Futterkraut,
das so gut wie niemals versagt und sehr viele Jahre hindurch einen
unverminderten Ertrag gibt, weshalb sie auch als „ewiger Klee“
bezeichnet wird. Sie kann auf gutem Boden bei uns jährlich viermal, in
Südeuropa sogar sechsmal geschnitten werden. Die Kreuzung derselben
mit dem einheimischen gelbblühenden Sichelklee hat die ihrem
Ursprung gemäß häufig Farbenübergänge von Gelb nach Violett zeigende
Sandluzerne (Medicago media) hervorgebracht, so genannt,
weil sie noch auf magerem Boden mit Vorteil angebaut werden kann.
Im rossereichen alten Medien, der Landschaft südöstlich vom Kaukasus,
scheint die Luzerne zum erstenmal in größerem Umfange als Pferdefutter
angepflanzt worden zu sein; wenigstens gelangte sie von dort zu den
Kulturvölkern der Mittelmeerländer, zu den Griechen als[S. 19] mēdikḗ
póa oder einfach mēdikḗ und von diesen zu den Römern
als medica. Die, wie vorhin gesagt, einen außerordentlich
ausgedehnten Gebrauch vom Pferd für die zahlreiche Kavallerie und
den Postdienst machenden Perser nannten sie aspest, d. h.
Pferdefutter, pflanzten sie ebenfalls viel an und sollen sie auf ihren
Kriegszügen nach dem Urteil des Plinius nach Griechenland verbreitet
haben. Von den griechischen Schriftstellern erwähnt sie zuerst der
Komödiendichter Aristophanes (455–387), und zwar gleichfalls als
Pferdefutter. Auch Aristoteles (384–322) spricht wiederholt von ihr,
urteilt aber in ziemlich abfälliger Weise von ihrem Nutzen: „Sie ist
zwar den Bienen zuträglich, aber ihr erster Schnitt taugt nichts und
sie entzieht den Tieren, besonders den Wiederkäuern, die Milch.“ Die
Römer urteilten, nachdem sie dieses Futterkraut von den Griechen
kennen gelernt hatten, günstiger darüber. Cato (234–149 v. Chr.)
kannte es offenbar noch nicht, denn er schweigt sich vollständig
über die Luzerne aus. Der erste, der sie erwähnt, der gelehrte Varro
(116–27 v. Chr.), sagt von ihr, daß die Schafe durch die Fütterung
mit medica, deren Samen beim Säen wie Getreide geworfen werde,
wie auch mit dem baumförmigen Schneckenklee (cytisus) fett
werden und viel Milch geben. Sehr eingenommen von ihr ist besonders
der römische Ackerbauschriftsteller Columella aus dem 1. Jahrhundert
n. Chr., der von ihr schreibt: „Unter allen Futterkräutern ist das
medische Kraut (herba medica) von höchstem Wert, da es, einmal
gesät, zehn Jahre ausdauert, jährlich vier-, bisweilen auch sechsmal
geschnitten werden kann, das Feld düngt, mageres Vieh fett und krankes
gesund macht. Von einem Morgen Luzerne können drei Pferde das ganze
Jahr hindurch reichlich genährt werden.“ Er gibt uns eine ausführliche
Schilderung seines Anbaues auf dreimal gepflügtem Feld, das zuvor gut
gedüngt worden sein muß. Nach der Aussaat dürfe das Kraut nicht mit
Eisen berührt werden, deshalb jäte man es mit hölzernen Hacken. Später
könne man es so klein schneiden als man will, nur dürfe man nicht
dem Vieh von vornherein zu viel davon geben, da es sonst blähe; es
müsse sich zuerst daran gewöhnen. Sein Zeitgenosse, der aus Kilikien
gebürtige griechische Arzt Dioskurides sagt von der Luzerne, jeder
Landmann, der Vieh hält, pflanzt sie an, und Plinius rühmt von ihr, daß
sie 30 Jahre ausdauere und so wichtig sei, daß der Grieche Amphilochos
(aus Athen) über sie und den baumförmigen Schneckenklee ein Werk
geschrieben habe. Auch Palladius im 4. Jahrhundert n. Chr. weiß nur
Gutes von ihr zu berichten. Um die Mitte des 6. Jahrhunderts legte der
sassanidische König[S. 20] Chosroes I. eine hohe Steuer auf ihre Kultur, was
bei der großen Bedeutung der Pferdezucht im Lande Iran für das Volk
sehr drückend, aber für ihn recht einträglich war. Später verbreiteten
dann die Araber ihre Kultur weithin über Nordafrika, und durch die
Kulturvölker Europas gelangte sie in der Neuzeit über die ganze Erde.
Und zwar erlangte sie überall deshalb eine große Bedeutung, weil sie
diejenige Futterpflanze ist, die in den Subtropen und Tropen am besten
gedeiht und die sichersten Erträge gibt. Dabei hält sie 4–10 Jahre aus
und gewährt 3–4 Heuschnitte jährlich. Neben dem Grünmais ist sie eine
der wertvollsten Futterpflanzen für wärmere Gegenden.
Wie der Anbau der Luzerne um 490 durch die Perser nach Griechenland und
zwischen 150 und 50 v. Chr. von Griechenland nach Italien gelangte,
so kam er etwa hundert Jahre später von dort nach Spanien, von wo er
dann im 16. Jahrhundert nach Frankreich eingeführt wurde. 1565 treffen
wir ihn in Belgien. Die Provenzalen aber erhielten diese Futterpflanze
von der Riviera, wohin sie ums Jahr 1550 von Italien her gelangt war,
und nannten sie nach dem italienischen Ort Clauserne, woraus dann
Luzerne wurde. Letzterer Name stammt indessen erst aus der Mitte des
18. Jahrhunderts; früher wurde sie burgundisch Heu oder welscher Klee
genannt. Um 1570 fand sie durch Wallonen in der Rheinpfalz Eingang;
doch machte ihr Anbau im 17. Jahrhundert kaum Fortschritte. Um 1730
tauchte sie, wahrscheinlich von Mainz aus dahin gelangend, plötzlich in
Erfurt auf und verbreitete sich von da weiter über Deutschland.
Als Futterpflanze nicht minder beliebt als die Luzerne war bei den
alten Griechen und Römern der in den Mittelmeerländern heimische,
aber daselbst nicht allgemein verbreitete, jedoch um Smyrna, auf
den ägäischen Inseln, in Griechenland und Süditalien wildwachsende
baumförmige Scheckenklee (Medicago arborea), von
den Griechen kýtisos und in Anlehnung daran von den Römern
cytisus genannt. Wie in China und später auch anderwärts
der weiße Maulbeerbaum für die Nahrung der Seidenraupe, so wurde
in Griechenland und Italien im Altertum dieser strauchförmige
Lippenblütler nur seiner Blätter wegen an den Wegrändern und als
Einfassung von Äckern angepflanzt, um diese als beliebtes Viehfutter
zu verwenden. Man köpfte ihn und zog ihn niedrig, benutzte also
vorzugsweise den immer erneuten Stockausschlag. Acht Monate im Jahr
lieferte der Baum den Tieren grünes Futter, das ihnen nach dem
einstimmigen Urteil der alten Schriftsteller sehr zuträglich sein
und ihre Milchabsonderung befördern sollte,[S. 21] und den Rest des Jahres
Trockenfutter. Dabei war die Kultur sehr bequem und mühelos, da sich
die Pflanze mit dem magersten Boden begnügte und gegen noch so große
Trockenheit unempfindlich war. In dieser Weise drücken sich Columella
und Plinius aus, wobei der letztere noch hinzufügt, bei solchen
großen Vorzügen sei es „nur zu verwundern, daß der cytisus
in Italien nicht häufiger angepflanzt werde. Dieser Strauch stammt
von der Insel Kythnos (einer der ägäischen Inseln) und wurde von da
zum großen Gewinne der Käsebereitung nach Griechenland und von dort
nach Italien verpflanzt. In Italien ist er aber noch selten, obschon
das Vieh bei keinem andern Futter mehr und bessere Milch geben soll.
Man sät im Frühjahr die Samen oder steckt im Herbst Stecklinge, am
besten ellenlange.“ Selbst säugenden Frauen gebe man eine Abkochung
von Cytisusblättern mit Wein, wodurch auch das Kind gestärkt und sein
Wuchs befördert werde. Auch in Spanien muß der Strauch zur Römerzeit
angepflanzt worden sein; denn dort wird er heute verwildert angetroffen.
Überhaupt wurde bei den Alten auch verschiedenes anderes Laub
als Viehfutter verwendet. Da dem heißen, gebirgigen Süden die
blumenreichen Wiesen des Nordens versagt sind, lag es nahe, dem Vieh
nicht nur die bei der Beschneidung von Ölbaum und Rebe abfallenden
Zweige, sondern auch die Blätter von den die Wege und Äcker
einfassenden Bäumen als Futter zu geben, wie das dürre Laub als Streu
diente. Schon der ältere Cato (234–149 v. Chr.) erteilt in seiner
Schrift über den Landbau die uns seltsam klingende Vorschrift: „Gib
den Ochsen Laub von Ulmen, Pappeln, Eichen und Feigenbäumen, so lange
du davon hast. — Den Schafen gib Baumlaub, so lange du solches
hast“ und wiederholt später: „Hast du kein Heu, so gib dem Ochsen
Eichen- und Efeublätter.“ Auch bei den späteren landwirtschaftlichen
Schriftstellern wird diese Art Fütterung so oft erwähnt und
vorausgesetzt, daß sie allgemein üblich gewesen sein muß.
Neben der Luzerne spielte bei den Griechen und Römern des Altertums
auch die von den ersteren thérmos, von den letzteren dagegen
lupinus genannte Lupine eine große Rolle als Viehfutter.
Wie Theophrast im 4., so sagt der ältere Cato im 2. Jahrhundert v. Chr.
von ihr, daß sie sogar auf magerem, trockenem Boden gedeihe
und sandiges Erdreich fettem vorziehe; und Columella rühmt von ihr:
„Unter den Hülsenfrüchten ist die Lupine vorzüglich wichtig, weil
sie wenig Mühe macht, sehr wohlfeil ist und den Acker, auf dem sie
wächst, sehr verbessert. Sie gibt eine herrliche Düngung, gedeiht
selbst[S. 22] auf ganz erschöpftem Boden und läßt sich in der Scheuer fast
ewig gut erhalten. In Hungerjahren gibt sie auch den Menschen eine
sättigende Speise. Man sät sie gleich von der Tenne weg; sie gedeiht
auch, wenn man sie nur ganz schlecht unter die Erde bringt. Um kräftig
zu werden, bedarf sie lauen Herbstwetters; auch leidet sie durch
Frost, wenn er eintritt, bevor sie erstarkt ist. Samen, die nicht zur
Saat verwendet werden, sollen trocken auf dem vom Rauch durchzogenen
Speicher aufbewahrt werden, damit sie nicht von den Würmern angegriffen
werden.“ Sein Zeitgenosse Dioskurides unterscheidet eine zahme Lupine,
die dem Menschen zur Speise dient und auch arzneilich verwendet
wird, und eine wilde, der zahmen ähnliche, aber kleiner als diese,
obwohl dieselben Eigenschaften besitzend. Um 200 n. Chr. urteilt der
griechische Grammatiker Athenaios aus Naukratis in Ägypten über sie:
„Die Lupine ist eine Speise für Hungerleider. Der Dichter Diphilos
nannte sie thermokýamos, und so heißt sie noch jetzt. Polemon
sagt, daß die Lakedämonier sie lysiláis nennen. Der Philosoph
Zenon der Kittier war ein flegelhafter, jähzorniger Mensch, pflegte
aber höflich und sogar zärtlich zu sein, wenn er eine tüchtige Portion
Wein getrunken hatte. Wie er nun gefragt wurde, wie das möglich sei,
antwortete er: Mir geht es wie den Lupinen; sie sind erbärmlich bitter,
so lange sie trocken sind, dagegen süß und lieblich, sobald sie sich
recht satt getrunken haben.“ Endlich empfiehlt sie Palladius im 6.
Jahrhundert n. Chr. zur Gründüngung.
Heute noch sind die gelbe Lupine (Lupinus luteus) und
die schmalblätterige blaue Lupine (Lupinus hirsutus)
für unsere Landwirtschaft sehr wichtige Futterkräuter. Beide sind
ursprünglich im Mittelmeergebiet heimisch und gedeihen sehr gut auf
magerem Sandboden, in den sie ihre Pfahlwurzel 1 m tief und
darüber hinabsenken. Erstere mit großen, goldgelben, wohlriechenden
Blüten in langer Ähre und rundlichen, weißgefleckten Samen kam aus
Sizilien nach Deutschland und wurde zuerst 1840 in Groß-Ballerstedt in
der Altmark angebaut. Von da verbreitete sie sich bald über das ganze
Sandgebiet Preußens, da sie nicht nur mannigfaltigen Nutzen zur Weide,
als Grünfutter, zur Heu- und Körnergewinnung gewährt, sondern auch zur
Gründüngung von höchstem Werte ist. Mit den in ihren Wurzelknöllchen
angesiedelten Rhizobien wirkt sie energisch stickstoffsammelnd. Am
besten gedeiht sie an freier, sonniger Lage; dabei befördert eine
Zugabe von Gips den Blattwuchs.
Noch genügsamer als die gelbe ist die blaue Lupine, die selbst noch auf
grandigem, d. h. aus grobem Sand und feinem Kies bestehendem[S. 23] Boden
gedeiht. Sie kam aus Spanien zu uns, und besitzt einen nach oben stark
verästelten Stengel, kurze, ährenförmige Trauben mit blauen Blüten und
rötlichgraue, weißpunktierte Samen von der Größe von Wickensamen. Das
Vieh frißt die Körner der blauen Lupine lieber als die der gelben, aber
bei ersterer dringen die Wurzeln nicht so tief in den Boden ein und die
Nachfrucht, wozu gewöhnlich Roggen gewählt wird, fällt viel schlechter
aus. Die Lupinensamen bilden ein leichtverdauliches, bei richtiger
Verwendung für Mastzwecke vortrefflich geeignetes Futter. Da sie aber
bitter sind, müssen sich die Tiere erst daran gewöhnen, wenn auch
Pferde und Rinder sie deshalb anfänglich zurückweisen, so nehmen sie
sie schließlich doch an und kehren sich nicht mehr an die Bitterkeit
derselben, zu deren Beseitigung schon zahlreiche Methoden angegeben
wurden. Die Samen dienen auch als Arzneimittel und häufiger als man
glaubt als Kaffeesurrogat wie Zichorie.
Viel weniger häufig als die beiden vorgenannten wird bei uns die
aus dem Orient stammende weiße Lupine (Lupinus albus)
angebaut. Sie diente schon den alten Griechen und Römern als
Futterpflanze, wie auch die aus Westasien stammende rauhhaarige
Lupine (Lupinus hirsutus) mit blauen Blüten, die bei uns
als Gartenzierpflanze angetroffen wird. Die Früchte dieser beiden
Lupinenarten galten den alten Griechen und Römern als Leckerbissen.
Gleicherweise wurde von diesen Kulturvölkern des Altertums, teils zur
Benutzung der Samen für den Menschen, teils als Viehfutter die von
den Griechen láthyros, von den Römern dagegen cicercula
genannte Saatplatterbse (Lathyrus sativus), auch deutsche
Kichererbse, Kicherling oder weiße Erve genannt, angepflanzt. Sie
ist ein 30–60 cm hoch werdendes Sommergewächs Südeuropas mit
unpaarigen Fiederblättern, in drei Ranken auslaufenden Blattstielen,
einzeln stehenden, langgestielten, weißen, roten oder violetten Blüten
und 4 cm langen, zusammengedrückten Hülsen, die 2–3 ziemlich
große, eckige, gelbweiße, rot- und violettbräunliche Samen enthalten.
Obschon letztere etwas bitter sind, wird die Pflanze zu deren Gewinnung
als Speise für die Menschen noch in den gebirgigen Teilen Griechenlands
und Italiens angebaut. Sonst wird die Pflanze in ganz Südeuropa,
besonders in Rumänien, wenig dagegen in Mitteleuropa, speziell
Deutschland als gutes Viehfutter auf trockenem Boden angepflanzt.
Vielfach werden deren Samen unreif wie Erbsen gegessen, sind aber
weniger wohlschmeckend.
Vielfach findet man auf Wiesen als ein Zeichen von deren besserer
Qualität die ausdauernde Wiesenplatterbse (Lathyrus
pratensis)[S. 24] mit gelben Blüten. Wo sie aber in größeren Massen
auftritt, schadet sie dem Graswuchs. Sie wird auch vielfach als
Futterpflanze angebaut, da sie eine große Menge guten Futters
liefert. Wegen seiner Bitterkeit wird ihr Laub im grünen Zustand
vom Vieh nicht gern gefressen, wohl aber als Heu. Es ist dann sehr
schmackhaft und kräftig. Ein feineres Futter als diese erzeugt die
Sumpfplatterbse (Lathyrus palustris), die ebenfalls
ausdauernd ist und reiche Trauben von blauen Blüten besitzt. Sie
wächst auf feuchten, moorigen Wiesen, wo sonst verhältnismäßig
wenig Futterpflanzen gedeihen, und wird vom Vieh auch grün gerne
gefressen, weil sie nicht so unangenehm bitter ist als die vorige.
Die Waldplatterbse (Lathyrus silvestris), eine in
Mitteleuropa an Waldrändern und an Hecken wachsende Staude mit
kletterndem, ästigem Stengel, lanzettlichen Blättern, roten Blüten in
Trauben und flachen, runzeligen Samen, eignet sich dagegen zum Anbau
als Futterkraut auf steinigem, grobem und dürrem Boden. Sie ist durch
ein stark entwickeltes Wurzelsystem und eine große Fähigkeit die
Gesteine zu zersetzen ausgezeichnet, treibt um 8–14 Tage früher als
die Luzerne und ist gegen Spätfröste unempfindlich, was große Vorteile
bedeuten. Den höchsten Ertrag liefert sie nach drei Jahren, indem sie
10000 kg Heu pro Hektar ernten läßt. Dabei kann sie ebenso gut
grün, wie getrocknet verfüttert werden.
Während der in Südeuropa heimische Kronsüßklee (Hedysarum
coronarium) in Italien und den Balearen als Futterpflanze angebaut
wird, spielt der Gebirgssüßklee (Hedysarum obscurum)
auf den bewässerten Alpenwiesen eine große Rolle als sehr geschätzte
Nahrung des dort sömmernden Viehs. Deren nahe Verwandte sind die
Esparsette und die Serradelle. Die Esparsette (Onobrychis
sativa) ist eine in höheren Lagen des gemäßigten Europa heimische,
östlich bis zum Baikalsee gehende, kalkstete, 30–60 cm hohe
Pflanze mit lanzettlichen Blättern, langgestielten Ähren von roten
Blüten und rundlichen Nüßchen, die auf trockenem, über zerklüftetem
Kalkstein oder Mergel stehendem Boden das beste Futtergewächs ist und
Kalkgegenden, die sonst zu den unfruchtbarsten gehören, fruchtbar
macht, deshalb auch in Deutschland überall auf Kalk- und Kreideboden
angebaut wird. Auf Boden mit kiesigem oder sandigem Untergrund
gedeiht sie schlecht, weil die Wurzeln über 1 m tief gehen,
sehr gut dagegen auf recht kalkreichem, wobei sie 3–6 Jahre aushält,
jedoch meist nur einen Schnitt und Weide gibt. Den Griechen und
Römern war sie durchaus unbekannt. Erst im Laufe des 15. Jahrhunderts
tritt sie uns in Mitteleuropa als[S. 25] Kulturpflanze entgegen. Allem
Anscheine nach hat ihre Kultur im südlichen Frankreich ihren Ursprung
genommen, und zwar möglicherweise erst im 15. Jahrhundert. Im 16.
Jahrhundert, zu Lebzeiten Olivier de Serres, der uns darüber in
seinem Buche Théâtre de l’agriculture berichtet, war sie, die
lupinella der Italiener, dort bereits eine sehr geschätzte
Futterpflanze. In Italien hat sich ihr Anbau erst im 18. Jahrhundert,
namentlich in Toskana, weiter ausgebreitet. Schon ums Jahr 1560
wurde sie vor der Luzerne, aber nach dem roten Klee in
Süddeutschland als Futterpflanze angebaut und verbreitete sich von da
weiter. Sie ist nächst Luzerne und Wiesenklee unser vorzüglichstes
Futterkraut besonders für milchende Kühe, düngt mit ihren zahlreichen
Wurzelknöllchen den Boden gut und liefert in ihren honigreichen Blüten
eine treffliche Bienenweide.
Wie die Esparsette der Klee des Kalkbodens, so ist die auf
der iberischen Halbinsel, in Spanien und Portugal, heimische
Serradelle (Ornithopus sativus) der Klee des Sandbodens.
Sie besitzt 30–60 cm hohe Stengel, vielblütige Köpfchen von
lilafarbenen Blüten und 25 cm lange, perlschnurartig gegliederte
Hülsen, wird von allen herbivoren Haustieren gerne gefressen und
kommt dem Wiesenheu an Nährwert gleich. Da sie den Boden vermöge der
stickstoffsammelnden Knöllchenbakterien düngt und ihn bei gutem Stand
auch trefflich beschattet, ihn damit in guter Gare hinterläßt, wird sie
zur Verbesserung schlechter Ländereien verwendet. Sie ist eine gute
Vorfrucht, zumal für Getreide, eignet sich aber auch vorzüglich als
Nachfrucht, indem man sie im Frühjahr in Wintergetreide sät und nach
der Ernte desselben noch einen guten Futterschnitt oder im schlimmsten
Fall eine gute Weide erhält. Sie wurde in ihrer Heimat wohl erst gegen
den Anfang des 19. Jahrhunderts in Kultur genommen und gelangte von
dort um die Mitte desselben zu uns.
Eine gute Futterpflanze ist auch der gelbe oder Steinklee
(Medicago lupulina), eine auf Wiesen und an Wegrändern in
ganz Europa mit Ausnahme der arktischen Gebiete, in Nordafrika
und Mittelasien wildwachsende Pflanze mit niederliegendem oder
aufsteigendem Stengel, eiförmigen Blättchen, gelben Blüten in ährigen
Trauben und nierenförmigen, eingerollten Hülsen, die ein- und
zweijährig kultiviert wird. Ihre Samen werden fast ausschließlich in
Mittel- und Niederschlesien gezogen, während diejenigen der Luzerne
und Sandluzerne vorzugsweise in der Provence und in Italien vertrieben
werden.
Auch die verschiedenen Arten von Honigklee (Melilotus)
finden[S. 26] als Futterkräuter Verwendung. So wurde der in Italien und
Griechenland als überall angetroffenes Unkraut heimische sizilische
Honigklee (Melilotus messanensis) mit gelben Blüten von den
Alten als Viehfutter gepflanzt. Noch heute heißt er in Griechenland
hémeron triphýlli, d. h. zahmer Klee. Bei den alten Griechen
hieß er melílōtos, war dem Apollon und den Musen geweiht und
galt als Symbol der Schönheit und wohlgesetzten Rede. Das wohlriechende
Kraut war zu Kränzen beliebt und diente nach Nikander um den Kopf
gewunden zur Linderung von Krankheiten aller Art. Der griechische
Arzt Dioskurides um die Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. schreibt in
seiner Arzneikunde: „Der beste Honigklee (melílōtos) wächst bei
Athen, Kyzikos und bei Karthago, und zwar mit safrangelber Farbe und
Wohlgeruch. Er wächst auch in Kampanien bei Nola, hat die Eigenschaften
des Bockshornklees (telízōn), aber sein Geruch ist schwächer.
Man braucht ihn gegen Kopfweh und einige andere Übel.“
Der gelbblütige Honigklee (Melilotus officinalis), der
durch achselständige, lange, lockere Blütentrauben ausgezeichnet ist
und sehr kurze, meist einsamige Früchte zeitigt, ist eine ebenfalls
als Viehfutter beliebte, 1–1,25 m hohe Staude, die in allen
Teilen, besonders getrocknet, einen starken Geruch nach frischem,
duftigem Heu wie das Ruchgras (Anthoxantum odoratum) und andere
vorzügliches Futter gebende Gräser aushaucht. Bei allen diesen rührt
der Duft von dem besonders in den Tonkabohnen enthaltenen und daraus
gewonnenen, auch dem Waldmeister sein köstliches Aroma verleihenden
Kumarin, das in der Parfümerie eine große Rolle spielt, auch zum
Aromatisieren von Schnupftabak dient. Die Blätter und Blüten dieses,
wie auch des ebenfalls gelbblütigen behaartfrüchtigen Honigklees
(Melilotus macrorhiza) dienen zu erweichenden Umschlägen
und besonders zur Herstellung des zerteilenden Melilotenpflasters.
Letztere Art wird namentlich in England auf schlechtem Boden für
Pferde kultiviert, während der bis 1,95 m hohe weißblütige
Honigklee (Melilotus alba) als Wunder- oder amerikanischer
Riesenklee als die beste die Luzerne ersetzende Kleeart eine Zeitlang
auf magerem Boden viel gepflanzt wurde. Sein Same wurde sehr teuer
bezahlt; allein nach den gemachten Erfahrungen gibt dieser Honigklee
zwar eine gute Weide für Schafe, kann aber als Trockenfutter wegen
seines starken Geruchs nicht unvermengt verfüttert werden und ist im
erwachsenen Zustande wegen seiner langen, holzigen Stengel und Äste und
den wenigen Blättern eine harte Pflanze.
[S. 27]
Überhaupt sind alle diese Honigkleearten nur im jungen Zustande gute
Futterkräuter, werden aber des bitteren Geschmacks wegen, der von
ihrem Gehalte an Kumarin herrührt, unvermengt vom Vieh nicht gern
gefressen. Weitaus am stärksten riecht unter allen Honigkleearten,
besonders in getrocknetem Zustande, der aus Nordafrika stammende
Bisamhonigklee (Melilotus coerulea) mit bläulichen
oder hellila gefärbten Blüten, der hier und da in Deutschland und
in der Schweiz, so namentlich im Kanton Glarus, angebaut wird. Sein
getrocknetes und fein zerriebenes Kraut gibt nämlich dem vorzugsweise
im Kanton Glarus in der Schweiz hergestellten Kräuterkäse oder
Schabzieger seine grünliche Farbe und seinen eigentümlichen Geruch und
Geschmack.
Denselben starken Geruch besitzt auch der im Orient und in Griechenland
heimische Bockshornklee oder griechisches Heu
(Trigonella foenum graecum), das ebenfalls zur Herstellung
von Kräuterkäse dient. Dieser einjährige, 30–50 cm hohe
Schmetterlingsblütler mit eiförmigen Blättern, blaßgelben Blüten und
8–12 cm langen, sichelförmig gekrümmten, längsgestreiften
Hülsen kommt auch in ganz Nordafrika bis Indien wild vor und wird
dort wie in Südeuropa von altersher als Viehfutter gepflanzt; auch in
Südfrankreich, in Thüringen und im Vogtland wird er der Samen wegen
kultiviert. Diese schmecken gekocht schleimig-bitter, riechen stark
nach Honigklee und standen bei den Ägyptern, Griechen und Römern
in hohem Ansehen als Arzneimittel. Plinius sagt von der Pflanze:
„Der Bockshornklee hat als Arznei einen großen Ruf. Er heißt bei
den Griechen télis, búkeras oder aigókeras
(d. h. Rinds- oder Bockshorn, weil seine Fruchthülsen wie Hörnchen
gekrümmt sind), bei den Römern aber heißt er silicia (d. h.
Hülsenfrüchtler).“ Sein Zeitgenosse, der griechische Arzt Dioskurides
schreibt von ihm in seiner Arzneimittellehre: „Die zu Mehl zerriebenen
Samen des Bockshornklees (télis) dienen als Arznei. Man
legt sie auch in Olivenöl und preßt die Mischung aus.“ Und der
römische Ackerbauschriftsteller Columella aus Spanien berichtet:
„Das griechische Heu (foenum graecum), das die Landleute
siliqua (Hülse) nennen, wird im September gesät, wenn es als
Grünfutter dienen soll, dagegen Ende Januar, wenn die Samen geerntet
werden sollen. Kommt der Same mehr als vierfingerbreit unter die
Oberfläche, so geht er nicht leicht auf.“ Letzterer wurde geröstet von
den Alten als Speise benutzt. Heute noch werden die Samen im Orient,
vornehmlich in Ägypten, mit Milch zubereitet sehr gerne gegessen und
sollen namentlich von den Haremsdamen zur Erlangung der als Zeichen
von besonderer Schönheit gelten[S. 28]den Wohlbeleibtheit gebraucht werden.
Bei uns finden sie fast nur noch in der Tierarzneikunde und, ihres
Schleimes wegen, auch in der Tuchfabrikation Verwendung. Die jungen
Triebe werden im Orient gerne als wohlschmeckendes Gemüse gegessen. Der
Bockshornklee, dessen Anbau Karl der Große in den Verordnungen für die
kaiserlichen Güter vom Jahre 812 befahl, wird auch bei uns gelegentlich
als Grünfutter und zur Heugewinnung angepflanzt, doch schmeckt er
so stark, daß er nur mit andern Futterpflanzen vermischt vom Vieh
gerne gefressen wird. Das Stroh der Hülsen dient bei den Arabern als
Pferdefutter.
Von den eigentlichen Kleearten mit dreigeteilten Blättern (daher
trifolium schon von den alten Römern genannt) ist der an
feuchten Stellen Kleinasiens und Griechenlands äußerst häufig
wachsende Erdbeerklee (Trifolium fragiferum) mit
fleischroten Blüten schon von den Griechen und Römern als lōtós
beziehungsweise lotus als geschätztes Viehfutter angepflanzt
worden. Er ist das Kraut lōtós, das bei Homer die Gefilde
bedeckt und von den Pferden der Helden gefressen wird. Der römische
Dichter Vergil (70–19 v. Chr.) rät in seiner Georgika, der in
Hexametern verfaßten Abhandlung über den Landbau, für das Vieh
viel solchen Klee (lotos) zu säen, und der griechische Arzt
Dioskurides um die Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. unterscheidet
außer dem wilden Erdbeerklee (lōtós), der auch der libysche
heiße, weil er besonders häufig in Libyen wächst, über zwei Ellen hoch
werde und Blätter wie der gewöhnliche Wiesenklee habe, den in Gärten
wachsenden zahmen lōtós.
Dem Erdbeerklee ähnlich ist der überall auf Wiesen und Triften
gemeine kriechende Klee (Trifolium repens) mit weißen,
seltener fleischfarbenen Blüten, der auf den Wiesen, auf welchen er
erscheint, stets als ein Zeichen von deren Güte gilt; er wird häufig
auf minder gutem Boden, namentlich auf Marschboden kultiviert und kann
noch da angebaut werden, wo der sonst bessere rote oder Wiesenklee
wegen mangelnder Feuchtigkeit nicht mehr gedeiht. Er dient wie alle
andern Kleearten teils zur Grünfütterung, teils zur Weide. Ebenso
werden die als sehr geschätzte Futterpflanzen auf Bergwiesen häufigen
Arten, der weißblütige Bergklee (Trifolium montanum),
der rotblütige Bergklee (Tr. alpestre), der große
rotblütige Bergklee (Tr. rubens) und der purpurblütige
mittlere Bergklee (Tr. medium) auch im Tiefland häufig
angebaut. Der anfänglich weißlich und zuletzt rötlich blühende
Ackerklee (Tr. arvense) ist auf Äckern zwar ein Unkraut,[S. 29]
gibt aber daselbst nach der Ernte dem weidenden Vieh Futter und eignet
sich auch auf schlechtem Boden zum Anbau, speziell als Weidekraut. Mehr
in südlichen Gegenden wird der gelblichweißblütige Rosenklee
(Tr. ochroleucum) angepflanzt, während der auf feuchten Wiesen
und Triften Mitteleuropas wildwachsende schwedische oder
Bastardklee (Tr. hybridum) mit langgestielten, rundlichen
Köpfen von weißen innern und leicht rosenroten Randblüten auch bei
uns als ein sehr gutes, hinsichtlich des Bodens wenig anspruchsvolles
Futterkraut angebaut wird. Es gedeiht selbst noch auf so dürftigem
Grunde, wie ihn sonst keine andere Kleeart annimmt.
Auch der als Kulturpflanze der Landwirtschaft aus Italien zu uns
gekommene, mit schön purpur- oder fleischroten Blüten in länglichen
Köpfchen gezierte Blut- oder Inkarnatklee (Trifolium
incarnatum) wird häufig in Deutschland angepflanzt. Diese
einjährige Futterpflanze, die in Nordspanien, auf Sardinien und in
Nordafrika wildwachsend angetroffen wird, scheint in Katalonien
zuerst angepflanzt worden zu sein. Von da kam sie erst zu Beginn des
19. Jahrhunderts über die Pyrenäen nach der südfranzösischen Provinz
Ariège, wo de Candolle ihre Kultur beschränkt fand. Bald verbreitete
sie sich über das übrige Frankreich, war um 1830 schon bei Genf in der
Schweiz und drang später auch nach Deutschland vor, wo sie wegen ihrer
Vorzüge bald ziemliche Verbreitung fand.
Aber der in Deutschland, wie dem übrigen Europa und der ganzen
Kulturwelt als wichtigste Futterpflanze überhaupt angebaute Klee,
der Klee schlechthin, ist der rote oder Wiesenklee
(Trifolium pratense) mit meist purpurroten Blüten, der bei uns
überall auf Wiesen als Merkmal besonderer Güte wildwachsend angetroffen
wird. Er wird allgemein auf Äckern, teils für sich, teils im Gemenge
(besonders mit Timothygras, Phleum pratense) kultiviert und ist
auf schwerem, tiefgründigem Boden das vorteilhafteste Futterkraut in
Nordeuropa, bleibt aber nur einige Jahre ergiebig und darf erst nach
längerer Pause auf demselben Felde wieder gepflanzt werden, weil solche
Felder an den für den Klee erforderlichen Nährstoffen erschöpft werden,
die sogenannte Kleemüdigkeit zeigen.
Diesen Wiesenklee hat das Altertum nicht angebaut. Gewiß war er schon
zu Ende des Mittelalters in Spanien eine geschätzte Futterpflanze, aber
seine Kultur wurde erst um die Mitte des 16. Jahrhunderts durch die aus
Spanien vertriebenen Protestanten in Mitteleuropa eingeführt. Zuerst
läßt sich sein Anbau gegen die Mitte des[S. 30] 16. Jahrhunderts in Flandern
nachweisen, von wo ihn die Engländer im Jahre 1633 durch den Einfluß
des damaligen Lordkanzlers Weston, Graf von Portland, erhielten. Um
1566 finden wir den roten Kopfklee in Frankreich und Belgien als
Futterpflanze angebaut. In der Folge kam er dann vor dem weißen
Klee, wie auch der Esparsette und Luzerne auch in Deutschland auf. Und
zwar war es zuerst die Kurpfalz, wo er durch unter dem Schutze des
Kurfürsten angesiedelte spanische Refugianten eingeführt wurde. Von da
aus eroberte er sich bald ganz Deutschland. Später begann man in den
1760er Jahren zuerst in Süddeutschland die Kleekultur zu verbessern
und gewann damit bedeutend mehr Futter, so daß man den Viehstand zu
vergrößern vermochte. Auch führte man zur Schonung der unnötig vom
Vieh niedergetretenen Kleeäcker die Stallfütterung ein, bei welcher
gleichzeitig die Aufsicht, wie sie der Weidgang erforderte, wegfiel.
Durch die günstigen Erfolge angeregt, führte der Gutsbesitzer Johann
Christian Schubart (1734–1786), der das neue Feldsystem in Darmstadt
kennen gelernt hatte, mit diesem die Kultur von Kopfklee, Runkelrüben
und Kartoffeln auf seinen Gütern bei Zeitz in Norddeutschland ein. Seit
1781 wirkte er auch schriftstellerisch für die weitere Verbreitung des
Kleebaues, wie für die übrigen Neuerungen, die in der Folge ziemlich
rasch in Thüringen und Sachsen Eingang fanden. Für seine zweifellos
großen Verdienste wurde dann Schubart 1784 als Edler von Kleefeld
geadelt. Durch falsche Anwendung gelangte seine Lehre vorübergehend in
Mißkredit, bis sich Albrecht Thaer ihrer annahm. Auf die in England
mit dieser neuen Kultur gewonnenen günstigen Erfahrungen hinweisend,
vermochte er in weiten Kreisen das erschütterte Vertrauen in den
Kleebau wieder zu befestigen. So fand dieser von 1848 an schnell
allgemeine Verbreitung. Er bewährte sich besonders in solchen Gegenden,
in denen die Kultur der Luzerne versagte. Heute ist der Kleehandel am
stärksten in Deutschland, und zwar in Schlesien, dann in Steiermark und
Südfrankreich, diese Länder versorgen alle übrigen mit Kleesamen. Wegen
der geringen Widerstandsfähigkeit seiner Kleearten vermag Nordamerika
damit bei uns keinen Markt zu gewinnen.
Auch in Sage und Geschichte spielt der Klee eine gewisse Rolle. So
hat man früher vierblätterigem Klee allseitig wunderbare Zauberkraft
zugeschrieben. Dem Finder sollte es Glück und Heil bringen, noch mehr
aber demjenigen, dem unbewußt solches von jemand zugesteckt wurde.
Noch heute glaubt das Volk in Griechenland, daß ein vierblätteriges
Kleeblatt Schätze heben und die gefährlichsten Krank[S. 31]heiten heilen
könne. Besondere Wertschätzung als Spender übernatürlicher Kräfte
genoß es namentlich auch in England, noch mehr aber das viel seltenere
siebenblätterige Kleeblatt. Das Dreiblatt des weißblütigen kriechenden
Klees (Trifolium repens), nach andern wohl richtiger des
Hasenklees oder gemeinen Sauerklees (Oxalis acetosella) ist der
von den Dichtern englischer Zunge oft besungene shamrock, das
Nationalzeichen der Irländer, das sie zur Ehre ihres Schutzheiligen St.
Patrick (Patricius) tragen.
Endlich wird auch der auf sandigen Äckern als Unkraut wachsende
Ackerspörgel (Spergula arvensis) mit kleinen, weißen
Blüten, deren Stiele sich nach dem Verblühen herabschlagen, als
ausgezeichnetes, reichlich Milch lieferndes Weidekraut angepflanzt.
In der Kultur ist die Pflanze gegenüber den Wildlingen gebliebenen
Verwandten viel größer und saftiger und wird deshalb als Spark
(S. maxima) von jenen unterschieden. Sie gedeiht noch recht gut
in Sandgegenden, wo Klee und Gras nur kümmerlich fortkommen, und gibt
für Sommer und Herbst treffliches frisches Grünfutter. Auch dient die
Pflanze zur Gründüngung; die zurückbleibenden Sparkwurzeln verbessern
den Boden bedeutend, so daß er mit der Zeit auch für anspruchsvollere
Futterkräuter verwendet werden kann.
Neuerdings werden auch verschiedene rasch wachsende Getreidearten
zur Grünfütterung gepflanzt. So liefert vielfach Grünroggen und
Grünbuchweizen um Anfang Mai das erste grüne Futter für das Vieh.
An deren Stelle treten später Grüngerste, Grünweizen und namentlich
Grünmais, welch letzterer für wärmere Gegenden weitaus das ausgiebigste
Futter ist. Für trockene und zugleich warme Gebiete sind auch die
kleine Kolbenhirse oder der Fennich (Setaria
viridis), besonders die Varietät mit orangegelben Körnern —
in Ungarn mohar genannt — und die wehrlose Trespe
(Bromus inermis) von sehr großer Bedeutung.
Eine der ältesten Handfertigkeiten des Menschen ist das Flechten,
dem später das Spinnen und Weben folgte. Dazu benutzte er die
verschiedensten ihm bekannten und zugänglichen Faserstoffe des
Pflanzenreichs, so vor allem den geschmeidigen Bast mancher Bäume,
besonders der Linde, und die zähen Stengel der Binsen, später auch die
in der nördlichen Pflanzenregion heimische, wasserreichen Untergrund
liebende Korbweide.
Als früheste kultivierte Faserpflanze tritt uns in Europa der
schmalblätterige Lein (Linum angustifolium) entgegen, der
in nicht zu feuchten Gegenden der Mittelmeerländer von den Kanaren bis
Syrien und dem Kaukasus heimisch ist und auf sterilem Boden überall
wildwachsend angetroffen wird. Im Gegensatz zu unserem Kulturlein
ist er nicht einjährig, sondern ausdauernd und treibt statt einem
mehrere Stengel mit schmäleren Blättern und kleineren, an der Spitze
kaum gekerbten Samen. Als südliche, wärmeliebende Pflanze ist er
nicht imstande, die jetzigen Winter der östlichen Schweiz, wo er zur
jüngsten Steinzeit in Robenhausen und anderen Pfahlbauniederlassungen
in ziemlicher Menge angepflanzt und verarbeitet wurde, zu ertragen.
Es muß also das Klima hier vor 4000–5000 Jahren ein wärmeres als
heute gewesen sein. Aus dem Süden gelangte diese Gespinstpflanze
mit den sie begleitenden Unkräutern, wie dem kretischen Leinkraut
(Silene cretica), das heute noch zahlreich in den Leinfeldern
Italiens wuchert, zu ihnen und wurde von ihnen auf ihren Hackfeldern
angebaut, um daraus Garn für die Anfertigung von Schnüren, Fischnetzen,
Matten und zum Weben von meist groben Stoffen, die jedenfalls als
Unterkleidung unter den für gewöhnlich getragenen Pelzen getragen
wurden, herzustellen. Diese Stoffe, die sie auf äußerst primitiven
hängenden Webstühlen mit Gewichten aus gebranntem Ton zum[S. 33] Strecken der
Zettel herstellten, verstanden sie bereits mit verschiedenen einfachen
geometrischen Figuren zu verzieren, rot, blau und gelb zu färben und
sogar schon mit allerlei primitiven Stickereien zu schmücken.
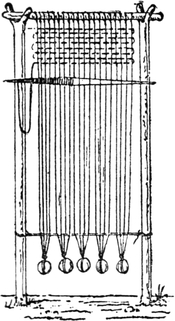
Bild 58. Rekonstruktion des aufrechten
Pfahlbauwebstuhls. Die unten durch eine Schnur zusammengehaltenen
Zettel werden durch Gewichte aus gebranntem Ton gestreckt. Der
Einschlagfaden wird vermittelst des Weberstabes eingetragen.
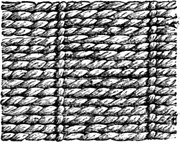
Bild 59. Grober Leinenstoff aus dem neolithischen
Pfahlbau von Robenhausen.
Die nördlichste neolithische Station Deutschlands, wo er gefunden
wurde, ist Schussenried im südlichen Württemberg. Es mag ja sein,
daß der Flachsbau damals schon etwas weiter nach Norden zu in
Süddeutschland verbreitet war, aber nach Norddeutschland oder gar dem
nördlichen Europa kann er unmöglich vorgedrungen gewesen sein, da diese
südliche Pflanze die Winter dieser Länder durchaus nicht auszuhalten
vermöchte.
Aus der älteren Bronzezeit sind noch nirgends in Europa Funde von
Flachs gemacht worden. Erst aus der jüngeren Bronzezeit sind in
Dänemark Reste eines feinen Linnenstoffes zutage getreten, woraus
freilich noch nicht geschlossen werden darf, daß der Flachs damals
bereits dort gebaut wurde, da bei den regen Handelsbeziehungen jener
Zeit für das Leinen die Möglichkeit des Importes vorliegt. Außerdem
wissen wir, daß alle aus jener Zeit auf uns gekommenen Gewebereste
aus Wolle bestehen, aus der verfertigte Kleider damals im Norden
ausschließlich getragen wurden. Die ersten Beweise der Flachskultur
auf norddeutschem Boden stammen aus der älteren Eisenzeit. Man fand
nämlich in der Karhofhöhle eine Art grobgeschrotenes, aus Weizen und
Hirse bereitetes Brot, dem, ähnlich wie beim Brot der schweizerischen
Pfahlbauern, teilweise Leinsamen zugesetzt war. Welcher Art der Flachs
angehörte, läßt sich allerdings in diesem Falle nicht entscheiden. Im
slawischen Burgwall von Poppschütz bei Freistadt in Schlesien hat sich
ebenfalls Flachssamen, der vermutlich zur Nahrung diente, gefunden,
und zwar scheint hier nach Buschan, soweit ein Urteil aus den Samen
allein möglich ist, eine Übergangsform zwischen dem[S. 34] mehrjährigen,
schmalblätterigen Lein der Pfahlbauzeit und dem erst später nach Europa
gekommenen, heute noch bei uns kultivierten Lein zu sein.
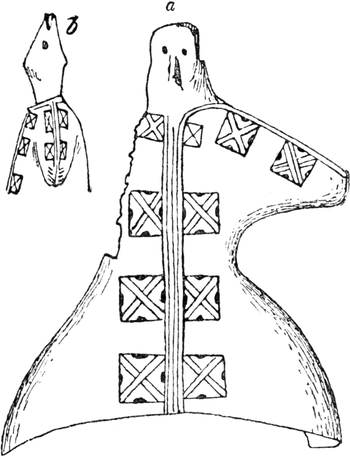
Bild 60. Idol (Götzenbild) aus gebranntem Ton vom
neolithischen Pfahlbau von Laibach in Krain mit einem hemdartigen, mit
gemusterten Vierecken verzierten Gewand. a Vorder-, b
Seitenansicht.
Unser Kulturlein (Linum usitatissimum) hat seine Heimat
im westlichen Persien und in Südkaukasien, wo die Stammpflanze auf
trockenen Hügeln manchenorts noch wild angetroffen wird. Sie ist eine
bis 60 cm hoch werdende einjährige Pflanze mit im Gegensatz zum
schmalblätterigen Lein nur einem Stengel, breiteren Blättern
und größeren, an der Spitze gekerbten Samen, die rascher reifen als
diejenigen der schmalblätterigen wilden Art und den Vorzug haben, nicht
ausgestreut zu werden wie dort, sondern in den Samenkapseln geerntet
werden zu können, die bei dieser Art meist nicht mehr aufspringen.
Diese Samen dienten den Leinbau treibenden Völkern der Vorzeit als
willkommene fettreiche Nahrung und wurde von ihnen gerne gegessen
und als Totenspeise auch den Verstorbenen mitgegeben. Der Kulturlein
besitzt schöne blaue Blüten, die nur einen Tag, und zwar nur vormittags
blühen. Ein solch blühendes Leinfeld bietet einen hübschen Anblick dar,
der die sagenhafte Begebenheit einigermaßen glaubwürdig erscheinen
läßt, die uns der fränkische Geschichtschreiber Paulus Diaconus
in seiner älteren, d. h. voritalischen Geschichte der Langobarden
erzählt, wonach die von den Langobarden besiegten Heruler auf ihrer
Flucht ein blühendes Leinfeld für einen See gehalten hätten, in den
sie sich hineinstürzten, als ob sie schwimmen wollten. So seien sie
von den verfolgenden Siegern ereilt und niedergemacht worden. Nur
in Amerika, wohin der Flachs bald nach der Entdeckung dieses neuen
Weltteils gebracht wurde, zieht man außer der blau blühenden auch
eine weiß blühende Abart. Jede Kapsel enthält[S. 35] zehn längliche, flach
zusammengedrückte, hellbraune, glänzende Samen, die in ihren äußeren
Zellenschichten ein im Wasser stark aufquellendes, schleimhaltiges
Gewebe enthalten, weshalb man sie zermahlen und gekocht zu breiigen
Umschlägen und ihren Schleim auch innerlich als einhüllendes Mittel
verwendet.
Schon sehr früh, nämlich im 5. Jahrtausend v. Chr. muß der Lein in
Babylonien gepflanzt worden sein; denn man hat Spuren von ihm bereits
in altchaldäischen Gräbern der vorbabylonischen Zeit entdeckt. Wie er
bei den Babyloniern hieß, ist bis jetzt nicht bekannt geworden. Sein
Name dürfte aber ähnlich wie im Hebräischen pischta gelautet
haben. Im Sanskrit hieß er nach dem um 500 v. Chr. verfaßten Ayur
Veda Susrutas akasa, im Altägyptischen māhi, bei
den Griechen línon und von diesen entlehnt bei den Römern
linum. In Ägypten tritt er uns als Kulturpflanze schon zu
Ende des 4. vorchristlichen Jahrtausends entgegen. In einem Ziegel
der Stufenpyramide von Daschur, die bald nach 3000 v. Chr. gebaut
wurde, fanden sich Bastfasern und Samenkapseln, die Unger als vom
einjährigen Kulturlein stammend bestimmte. Aber erst ein Jahrtausend
später, beim Beginn des mittleren Reiches, zur Zeit der 11. Dynastie
(2160–2000 v. Chr.), hatte seine Kultur in Ägypten eine bedeutendere
Entwicklung erlangt und findet man infolgedessen auch ziemlich häufig
in Gräbern Leinsamen unter den Totenspeisen. So fand Mariette in einem
1881 geöffneten Grabe der 12. Dynastie (2000–1788 v. Chr.) in Theben
vortrefflich erhaltene Kapseln von Leinsamen, die völlig der heute noch
in Ägypten und Abessinien gepflanzten Art entsprechen.
Erst im mittleren Reich (2160–1788 v. Chr.) begann die in der Folge
für die Ägypter so wichtige Leinentechnik in Aufnahme zu kommen,
nachdem der Lein vorher lange vorzugsweise nur seiner nahrhaften,
fetten Samen wegen kultiviert worden war, während die Menschen sich
noch in Wollenstoff kleideten. Von da an wurde für den Ägypter das
linnene Gewand der Gegenstand seines Stolzes und der Auszeichnung den
„Barbaren“ gegenüber. Aber nicht bloß die Lebenden trugen es, und
zwar in um so feinerer Qualität, je vornehmer sie waren, sondern auch
die Toten wurden bei der Einbalsamierung in Leinwandbinden gewickelt,
nachdem noch im alten Reiche zur Zeit der Erbauer der großen Pyramiden
von Giseh, von der 3. bis 6. Dynastie (2980–2475 v. Chr.) letzteren,
die überhaupt auch noch nicht mumifiziert wurden, ausschließlich grobe
Wollengewänder in die Gruft mitgegeben worden waren. Vom mittleren
Reiche (2160–1788 v. Chr.)[S. 36] an galt es den Ägyptern überhaupt als
Greuel, einen Leichnam in Wollengewändern zu bestatten. Dazu mußten
unbedingt Linnenstoffe verwendet werden. Auch ihre Priester durften,
wie Herodot berichtet, nur reinlinnene Unterkleider tragen und
höchstens außerhalb des Tempels einen wollenen Mantel überwerfen.
Ägypten deckte damals nicht nur seinen ganzen Bedarf an Flachs, sondern
es exportierte noch ziemlich viel seiner feinen, von den Griechen
meist als býssos bezeichneten Leinengewebe, die im Auslande
zur Herstellung von Prunkkleidern für die Vornehmen äußerst begehrt
waren. Das ganze Altertum ist des Lobes voll über die unnachahmlich
feinen ägyptischen Byssusgewänder, und dieses Lob begreifen wir
vollständig, wenn wir die außerordentliche Feinheit der Mumienbänder
der Reichen und die halb durchsichtige Gewandung nicht nur an den
bildlichen Darstellungen an den Wänden der Totenkammern, sondern auch
an den vornehmen Toten direkt in Berücksichtigung ziehen. Als Beispiel
der Feinheit dieser Byssusstoffe berichten Herodot und Plinius, daß
der ägyptische König Amasis (ägyptisch Amose) II. der 26. Dynastie,
der von 570 bis 526 v. Chr. regierte, den Spartanern und dem Tempel
der Athene zu Lindos auf der Insel Rhodos je ein linnenes Panzerhemd
mit Tierbildern und mit Fäden aus Gold und Baumwolle durchwirkt von
solcher Feinheit der Fäden geschenkt habe, daß jeder derselben aus 360
Einzelfäden bestand.
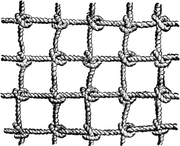
Bild 61. Aus Flachsschnüren geknüpftes, engmaschiges Netz aus dem neolithischen
Pfahlbau von Robenhausen im Kanton Zürich. (⅔ natürl. Größe.)
Verschiedene altägyptische Wandmalereien zeigen uns die ganze
Bearbeitung des Flachses, vom Raufen der Pflanze auf den Feldern, vom
Rösten und Kämmen derselben bis zum kunstvollen Weben am Webstuhl.
Zum Lockern der Fasern wurde der Flachs in der ältesten Zeit in
Kesseln gekocht und sodann mit keulenförmigen Hölzern geschlagen.
Später dagegen wurde er auf kaltem Wege „geröstet“ und vermittelst
Holzkämmen, von denen das ägyptische Museum in Berlin zwei besitzt,
gehechelt. Das Spinnen und Weben wurde von den Frauen und teilweise
auch Männern als besonderes Gewerbe betrieben. Wie dieses Handwerk
ausgeübt wurde, erkennen wir an verschiedenen Grabgemälden des
mittleren Reiches. Spindeln aus Holz und Leder von einfacher und
komplizierter Form sind uns vielfach in den Grä[S. 37]bern erhalten, und das
Bild der Spindel gehört mit unter die Hieroglyphenzeichen. In einem
Grabe von Beni Hassan ist u. a. ein Ägypter dargestellt, der mit der
Spindel hantiert. Derselbe hockt vor einem aufrechtstehenden, oben
gegabelten Stabe, an den der Flachsfaden geknüpft ist. Ein Näpfchen
zum Befeuchten der Finger beim Drehen des Fadens steht am Fuße des
Stabes. Eine andere Darstellung zeigt sechs unter der Kontrolle einer
Aufseherin arbeitende Frauen, von denen drei Spinnerinnen einen Faden
ziehen, eine vierte dagegen mehrere einfache Fäden zu einem stärkeren
zusammendreht. Von den beiden Weberinnen besorgt die eine den Aufzug,
die andere den Einschlag. Bei zwei anderen Spinnerinnen vertritt der
schlanke Körper selbst den Stab, indem sie das fertige Stück Faden um
sich selbst herumdrehen. Daß gewandte Frauen auch mit zwei Spindeln
zugleich umzugehen verstanden, bezeugen dem mittleren Reich (2980–2475
v. Chr.) angehörende Wandgemälde. Von den beiden in Beni Hassan beim
alten Theben dargestellten Weberinnen besorgt die eine die Kette des
wagrecht am Boden aufgespannten Webstuhls, die andere den Einschlag,
der mit einem gekrümmten Holze durchgezogen wird, wobei die Öffnung
durch zwei zwischen die Fäden der Kette geschobene Holzstäbe bewirkt
wird. Auf demselben Wandgemälde webt ein Mann in einen zwischen einem
Rahmen ausgespannten Stoff ein schachbrettartiges Muster. Daß aber
später viel bessere Webstühle benutzt wurden, zeigt ein Wandgemälde
aus der Totenstadt Theben, in welchem ein Weber an einem ähnlich wie
die Webstühle der Neuzeit gebauten Webstuhle sitzt und mit den Füßen
den Apparat bedient, der das Weberschiffchen hin- und herfliegen läßt.
Herodot (484–424 v. Chr.), der selbst in Ägypten war, führt als etwas
Bemerkenswertes an, daß die ägyptischen Weber gegen die sonstige
Gewohnheit den Einschlag nicht aufwärts, sondern niederwärts zu werfen
pflegen.
Durch wohlerhaltene Reste können wir uns selbst davon überzeugen,
daß die wegen ihrer Feinheit bei allen Mittelmeervölkern berühmten
altägyptischen Gewebe tatsächlich an Zartheit und Genauigkeit
unübertroffen waren. Dabei begnügte man sich nicht mit einfachen,
glatten Zeugen, sondern stellte auch wellen-, bogen- oder
zickzackförmig gestreifte, flechtwerk-, schachbrett- oder mäanderartig
gemusterte und solche mit einem feinen Arabeskenwerk von zierlich
geschlungenen Spirallinien her, zwischen welche sich Rosetten, Sterne,
Lotosblüten, gebüschelte Papyrusstengel, Skarabäen, Uräusschlangen, die
geflügelte Sonnenscheibe, Namensschilder und Hieroglypheninschriften
als füllende[S. 38] Elemente einschmiegen. Die verschiedenen dabei zur
Anwendung gelangenden Farben waren, wie uns Plinius berichtet, nicht
aufgemalt, sondern die Zeuge wurden in verschiedene Kessel mit
Farbstofflösungen getaucht und dennoch schließlich verschiedenfarbig
und schöngemustert herausgezogen. In einem Grabe zu Beni Hassan sehen
wir den Eigentümer die Länge der fertigen Leinwand ausmessen; dabei
steht ein Schreiber, der die Zahl der fertig verpackten Ballen ausmißt.
Aus Leinwand huma wurde vor allem der über den Hüften mit einem
Gürtel zusammengehaltene, bis an die Knie oder Knöchel reichende
Leibrock sten, daneben vielfach auch das Überkleid hbos
hergestellt. Herodot sagt von den Ägyptern: „Alle Ägypter tragen
eine Gewandung aus Leinen, die immer frisch gewaschen ist, was ihnen
die größte Angelegenheit ist. Die Gewandung der Priester ist nur von
Leinen, die Sandalen nur von býblos (Papyrus); eine andere
Kleidung und andere Beschuhung dürfen sie nicht tragen. Ihr Anzug sind
leinene Röcke, an den Beinen mit Franzen besetzt. Darüber tragen sie
weiße, wollene Oberkleider. Keiner jedoch geht mit wollenem Anzug in
den Tempel, noch wird einer damit begraben, und das stimmt mit dem
sogenannten arphyschen (einem ägyptischen) und mit dem pythagoräischen
Geheimdienst überein.“ Ungeheuer war auch der Verbrauch an Leinwand für
die Einhüllung der Mumien in die oft über 400 m langen Binden.
Darüber sagt Herodot: „... Alsdann waschen sie die Toten und umwickeln
den ganzen Leib mit Bändern, die aus Leinenzeug und býssos
(feinste Leinwand) geschnitten sind; sie streichen auch (arabischen)
Gummi darunter, dessen sich überhaupt die Ägypter statt des Leimes
bedienen.“
Außer gewöhnlichen Stoffen zu Kleidern wurden auch namentlich für den
Export kunstvoll gewirkte, mit Goldfäden durchzogene, bunte Gewänder
in Weiß, Rot, Gelb, Grün, Blau und Schwarz, oft mit den schönsten
Mustern angefertigt. Aber auch Halstücher und Mäntel, Teppiche, Decken,
Panzer, Netze, Zelte, Taue und Segel wurden aus Flachs hergestellt.
So berichtet derselbe Herodot, daß die Ägypter zu der gewaltigen
Schiffbrücke, die der Perserkönig Xerxes, der seinem Vater Dareios
Hystaspis 485 v. Chr. gefolgt war und mit einem Landheer von einer
Million Mann und einer Flotte von 1200 Schiffen im Jahre 482 aufbrach,
um Griechenland zu unterjochen, über den Hellespont bauen ließ, die
Taue aus Byblos (Papyrus) und Flachs liefern mußten.
Von der Feinheit des in Ägypten erzeugten Flachses weiß auch[S. 39] noch
Plinius zu berichten, der in seiner Naturgeschichte schreibt: „Der
Flachs der Ägypter hat zwar die geringste Stärke, bringt ihnen
aber einen großen Gewinn. Es gibt dort vier Sorten: den tanischen,
pelusischen, butischen und tentyritischen; eine jede führt den Namen
von der Landschaft, in der sie wächst.“
Schon zur Zeit des Auszugs der Juden aus Ägypten (um 1280 v. Chr.)
muß es im Niltal ausgedehnte Flachskulturen gegeben haben, um den
großen Bedarf an Linnengewändern für den eigenen Bedarf und den damals
schon sehr ausgedehnten Export nach Syrien, Kleinasien und die Länder
am Ägäischen Meere zu bestreiten. Deshalb muß eine Flachsmißernte
damals in Ägypten einen großen Verlust in volkswirtschaftlicher
Beziehung bedeutet haben; denn sonst hätte man eine solche Mißernte
nicht unter die sieben Plagen gerechnet, die von Jahve, dem Gott der
Juden, durch Mose über die Ägypter verhängt wurden, da der Pharao
sie nicht aus seinem Lande ziehen ließ. „Und der Herr ließ Hagel
regnen über Aegyptenland, so grausam wie desgleichen dort noch nie
beobachtet worden war, seit Leute darin wohnen. Und der Hagel schlug in
Aegyptenland alles, was auf dem Felde war, beides Menschen und Vieh,
und schlug alles Kraut auf dem Felde und zerbrach alle Bäume auf dem
Felde. Also ward geschlagen der Flachs und die Gerste; denn die Gerste
hatte Schosse getrieben und der Flachs Knoten gewonnen. Aber Weizen und
Roggen ward nicht geschlagen; denn es war spätes Getreide.“ 2. Mose 9,
23 u. f.
In Palästina wurde bereits Flachs angebaut als die Juden von diesem
Lande Besitz nahmen. Wir erfahren dies aus dem Umstande, daß die
Kundschafter, welche Josua aussandte, auf dem Dache eines Hauses
unter Flachsstengeln verborgen gehalten wurden, die hier offenbar
zum Rösten an der Sonne ausgebreitet lagen. Die Verwendung des
Flachses muß bei den alten Juden eine recht vielfache gewesen sein;
so finden wir ihn zu Schnüren, Saiten, Lampendochten, Gürteln, wie zu
den verschiedenartigsten Kleidungsstücken verwendet. Feine linnene
Gewänder waren ihren Priestern, wie denjenigen Ägyptens, denen sie
diesen Brauch entlehnten, bei der Ausübung ihres Amtes als Tracht
vorgeschrieben. Grobe Gewänder aus ungeröstetem Flachs bildeten
hingegen die Bekleidung der ärmeren Volksklassen. Hier scheinen wie
anderwärts besonders die Frauen sich mit der Bearbeitung des Flachses
abgegeben zu haben. Auch in ganz Vorderasien, speziell Babylonien muß
nach dem um 25 n. Chr. gestorbenen griechischen Geographen Strabon seit
den ältesten Zeiten eine sehr rege Flachs[S. 40]industrie bestanden haben. Er
bezeichnet insbesondere die Stadt Borsippa (einst am Euphrat gelegener
Stadtteil Babylons) als ein großes Industriezentrum für Leinen, das
dort jedenfalls fabrikmäßig hergestellt wurde. Derselbe Autor sagt von
den Babyloniern, daß sie einen leinenen, bis zu den Füßen gehenden
Rock, und darüber einen wollenen tragen. Auch von den Indiern sagt
er, sie tragen blumige Leinenkleider. Schon lange vor Strabon wußte
Herodot (484–424 v. Chr.) von den Assyrern zu berichten: „Die Assyrier,
welche stromabwärts Waren nach Babylon bringen, tragen einen leinenen
Rock, der bis zu den Füßen reicht,“ und an einer andern Stelle: „Die
Assyrier, welche im Heere des Xerxes (482 v. Chr.) dienten, trugen
leinene Panzer.“
Solche leinene Panzer müssen in ganz Westasien bis Griechenland schon
lange getragen worden sein; denn bereits in der Ilias werden sie
als linothṓrēx bei einigen auf seiten der Troer kämpfenden
kleinasiatischen Bundesgenossen erwähnt. Auch sonst ist der homerischen
Welt Linnen bekannt, aber zunächst wohl nur als fremdländische
Importware. So läßt in der Ilias Achilleus seinem ihn nach Troja
begleitenden Erzieher Phoinix ein weiches Bett zurecht machen, dem
als Decke Schaffelle und zarte Leinwand dienten, und in der Odyssee
bereiten die Phäaken dem Odysseus ein Lager aus leinenen Decken. Aber
der Gebrauch von linnener Gewandung war bei den ältesten Griechen
durchaus nicht gebräuchlich. Mit dieser ägyptisch-vorderasiatischen
Sitte scheinen sie erst durch die solche Ware auf ihren Schiffen
feilbietenden phönikischen Kaufleute bekannt gemacht worden zu sein.
Denn die bei ihnen übliche Bezeichnung chitṓn für das später unter
dem eigentlichen Kleide aus Schafwolle getragene leinene ärmellose
Unterkleid entstammt offenkundig dem phönikischen Worte kitonet
für Leinwand.
Die ältesten Griechen trugen wie alle übrigen arischen Stämme
ursprünglich nur wollene Gewandung, die bei ihnen die ältere
Fellkleidung abgelöst hatte. Zuerst wurde nur das Hemd aus Wolle
angefertigt und darüber trug man noch einen Fellüberwurf. Dann wurde
auch letzterer durch einen Wollmantel ersetzt. Solchermaßen waren auch
die Griechen der älteren Zeit gekleidet, bis sie durch die Vermittlung
der Phönikier ein kurzes, ärmelloses, leinenes Untergewand unter ihrem
wollenen Obergewand zu tragen begannen. Zuerst hatten die Ionier in
Asien das lange herabfließende Kleid aus Leinwand von ihren reichen
Nachbarn in Karien angenommen, und von ihnen ging dann diese Tracht[S. 41]
zu den blutsverwandten, früh die morgenländische Zivilisation bei sich
aufnehmenden Athenern über. Erst gegen die Zeit des peloponnesischen
Krieges, der von 421–404 v. Chr. währte, kam, wie der zeitgenössische
Geschichtschreiber Thukydides (470–402 v. Chr.) berichtet, auch bei
den Athenern das altgriechische wollene Untergewand wieder zu Ehren.
Er sagt: Nur unter den reicheren Bürgern hätten die älteren, am
Hergebrachten hängenden Leute den ihnen liebgewordenen Luxus linnener
Unterkleider nicht aufgeben wollen. Seitdem trugen nur die Frauen noch
linnene Stoffe, deren feinere Sorten als Byssos aus dem Morgenlande
eingeführt wurden.
Schon in den homerischen Epen werden, vermutlich noch ausschließlich
auf dem Handelswege aus Phönikien oder Ägypten eingeführte,
linnene Gewänder erwähnt. Die othónē wenigstens, ein feines
linnenes Frauenkleid von weißer Farbe, war, wie der Name und der
Zusammenhang der Stellen, in denen sie erscheint, lehrt, ein Erzeugnis
westasiatischer, nicht griechischer Kunstfertigkeit. Die auch sonst
mit semitisch-phrygischem Luxus umgebene Königin Helena, die eben
ein Gewand gewebt hat, doppelt und purpurn, in welchem die Kämpfe
der Troer und der Achäer zu schauen waren, eilt nach dem Dichter
in die weiße othónē gehüllt aus dem Gemache. Auf dem runden
Prunkschilde des Achilleus sah man tanzende Jünglinge in Chitone
gekleidet, während die Jungfrauen mit der zarten othónē angetan
waren. In dem Wunderschlosse der Phäaken sitzen die Mägde webend und
die Spindel gleich den im Winde bewegten Blättern der Zitterpappel
drehend; auch sie sind in die von Salböl triefende othónē
gekleidet, die als dichtgewebt und mit Fransen, einer spezifisch
westasiatisch-babylonischen Erfindung, versehen hervorgehoben wird.
Ebenso ist das bereits erwähnte Lager, das die Phäaken dem Odysseus
auf dem Schiffe bereiten und mit dem sie ihn ans Land tragen, statt
wie sonst mit Pelzen und Wollstoffen mit zartem Linnen bedeckt. Auch
die als weiß hervorgehobenen Segel der homerischen Schiffe müssen aus
Leinwand bestanden haben; nur das Tauwerk und die Riemen, in denen
die Ruder sich bewegten, waren aus Rindshaut hergestellt. In der
Odyssee, dem jüngeren homerischen Gedicht, wird ein Schiffsseil aus
býblos (Papyrus) erwähnt, das wie die linnenen Gewebe auf dem
Wege des Tauschverkehrs aus Ägypten eingehandelt wurde.
Über den Anbau der Leinpflanze selbst auf griechischem Boden liegen aus
älterer Zeit keine bestimmten Zeugnisse vor. Der im 8. vorchristlichen
Jahrhundert lebende griechische Dichter Hesiod erwähnt[S. 42] nirgends in
seinen Gedichten den Flachs. Dagegen erwähnt der um die Mitte des 7.
vorchristlichen Jahrhunderts lebende griechische Lyriker Alkman aus
Sardes in Lydien Leinsamen neben Mohn- und Sesamsamen als Genußmittel.
Als solches erwähnt ihn auch der im 4. vorchristlichen Jahrhundert
lebende Theophrast, der hinzufügt, der Flachs verlange zu seiner
Kultur einen guten Boden. Die späteren Schriftsteller wie Vergil und
Columella sagen von ihm, er sauge den Boden stark aus. Letzterer sagt
in seiner Schrift über den Landbau: „Wo der Lein nicht reichlich
wächst und gut bezahlt wird, sollte man ihn nicht säen, da er das Land
sehr aussaugt. Jedenfalls verlangt er sehr fetten, etwas feuchten
Boden und wird von Anfang Oktober bis Mitte Dezember gesät. Will man
recht zarte Fäden erzielen, so sät man ihn auf recht mageren Boden.
Man kann die Aussaat auch im Februar vornehmen.“ In bezug auf seinen
Anbau in Griechenland, der während der römischen Zeit allgemein war,
berichtet der Grieche Pausanias in seiner zwischen 160 und 180 n. Chr.
verfaßten Reisebeschreibung von den Bewohnern der Landschaft Elis,
in der das panhellenische Heiligtum von Olympia lag, daß sie je nach
der Beschaffenheit des Bodens Hanf oder Lein pflanzten. Jedenfalls
nahm der Lein zu keiner Zeit in der griechischen Bodenwirtschaft die
hervorragende Stellung ein, wie in manchen Gegenden des asiatischen
Kontinents, besonders in Persien und Babylonien, wo sich alle Vornehmen
und die Priester ausschließlich in Linnengewänder kleideten. Und zwar
waren diejenigen der letzteren, gleich denen aller vorderasiatischen
Kulte, wie die der ägyptischen Priester weiß als Symbole der reinen
Gottesdiener. Nach Philo warf der Hohepriester das bunte Gewand ab,
sobald er das Allerheiligste betrat, und trat im weißen Linnenhemde
vor die Gottheit. Diese asiatisch-ägyptische Kultussitte, der auch die
Juden huldigten, ging dann später in Europa auf die ähnliche Satzungen
befolgenden Pythagoräer, die Orphiker, die Priester des Isis und
des Mithras zur römischen Kaiserzeit und auf alle gottesdienstliche
Funktionen Ausübenden über und erhielt sich als weißes Chorhemd bis auf
den heutigen Tag.
Von dem Lande der ältesten Flachskultur, Babylonien, drang diese
Industrie sehr früh auch zu den Bewohnern von Kolchis in Transkaukasien
vor, die später bei den Umwohnern einen besonderen Ruf für ihre
ausgezeichneten Leinenstoffe erhielten. Diese müssen auch von
besonderer Güte gewesen sein, denn Herodot sagt: „Einzig die Kolchier
kommen den Ägyptern gleich, wie auch ihre ganze Lebensweise und die
Sprache Ähnlichkeit mit derjenigen der letzteren hat. Die[S. 43] kolchische
Leinwand wird von den Hellenen sardonische genannt, die jedoch, welche
von Ägypten kommt, nennt man ägyptische.“ Solches sardonisches Leinen
wurde wie ägyptisches viel nach Griechenland importiert und hier von
den Vornehmen, die sich gern in solch feine, teure Ware kleideten,
gekauft. Wie bei den übrigen Asiaten war solches Leinen meist bunt
gefärbt und glänzend durchwirkt und wegen ihrer höchsten Feinheit halb
durchsichtig, wie es von den Reichen gerade so geschätzt wurde wie
an den vorderasiatischen Höfen. Eine spezielle, in Asien wohl seit
alten Zeiten gebräuchliche Anwendung des Flachses war die zu linnenen
Panzern, durch welche das Geschoß des Feindes, wie die Zähne und
Krallen der bekämpften Raubtiere wenigstens einigermaßen abgehalten
wurden. Von dem vom ägyptischen König Amasis II. (570–526 v. Chr.) den
Spartanern und dem Tempel der Athene zu Lindos auf Rhodos geschenkten,
auf das prächtigste mit Tierbildern und Goldfäden durchwirkten leinenen
Panzerhemd, einem Meisterwerk der ägyptischen Kunstfertigkeit, war
bereits die Rede. Solche schönbestickte Panzerhemden waren auch in
ganz Vorderasien geschätzte Schmuckstücke der Anführer, während
die gemeinen Soldaten unbestickte trugen. So waren nach Herodot
die Assyrier und Perser vielfach mit solchen linnenen Panzerhemden
bekleidet, und auch die Bemannung der phönikischen und kleinasiatischen
Schiffe im Kriegszug des Xerxes (482–480 v. Chr.) trug die bei ihnen
landesüblichen linnenen Panzer. Xenophon berichtet in seiner Anabasis,
der Heimkehr der zehntausend Mann griechischer Truppen nach der
unglücklichen Schlacht von Kunaxa im Jahre 401 v. Chr., daß sowohl die
im armenischen Hochlande hausenden Chalyber, als auch die Mossynöken
an der Südküste des Schwarzen Meeres bis über die Knie reichende
kittelartige linnene Panzer trugen, die zum besseren Schutze gegen
allfällige Verletzungen ihres Trägers gepolstert waren.
Durch das ganze griechische Altertum wird öfter der linnene Panzer
erwähnt. So trug in der Ilias nicht nur der halbbarbarische Asiate
Amphios, Sohn des Merops, einer der troischen Bundesgenossen,
sondern auch ein Grieche, Ajax, der Führer der Bogen und Schleuder
statt der Speere und Schilde führenden Lokrer, wie die Chalyber
des Xenophon solche Linnenpanzer. In dem um die Mitte des 7.
vorchristlichen Jahrhunderts von Delphi ergangenen, später berühmt
gewordenen Orakelspruch werden die Bewohner von Argos mit dem sie
charakterisierenden Beiwort die linnenbepanzerten belegt. In einem
Gedicht des als Zeitgenosse der Sappho um 600 v. Chr. lebenden[S. 44]
griechischen Lyrikers Alkaios aus Mytilene auf Lesbos wird unter
anderen Kriegswaffen auch der Linnenpanzer genannt, und solche Panzer
sah der Verfasser des griechischen Baedeker, Pausanias, noch um die
Mitte des 2. christlichen Jahrhunderts als sehr alte Weihgeschenke
öfter in den von ihm besichtigten Tempeln aufgehängt. Derselbe Autor
berichtet, daß auch in den aus Söldnern sehr verschiedener Herkunft
bestehenden karthagischen Heeren der Linnenpanzer einen wichtigen
Bestandteil ihrer Bewaffnung ausmachte.
Es konnte nun nicht fehlen, daß verschiedene aus Linnen bestehende
Handelsartikel, vornehmlich Tücher und Kleider, durch den
regen Schiffsverkehr der Griechen frühzeitig auch nach Italien
hinübergebracht wurden. Nach Diogenes von Laerte soll zur Zeit, als der
von Samos gebürtige griechische Philosoph Pythagoras nach Kroton in
Unteritalien übersiedelte — es war im Jahre 529 v. Chr. —, das Tragen
des ionischen Linnenkleides daselbst noch ungebräuchlich gewesen sein,
so daß sich Pythagoras wie alle übrigen Einwohner jener Stadt in weiße
Wolle kleidete. Dagegen berichtet uns der römische Geschichtschreiber
Livius, daß die Etrusker um Veji nach der Mitte des 5. Jahrhunderts
v. Chr. sich linnener Panzerhemden bedienten, oder daß wenigstens ihr
König, wenn er zu Pferd in die Schlacht zog, einen solchen trug. Denn
als A. Cornelius Cossus den König Tolumnius von Veji in der Schlacht
tötete, weihte er dessen thorax linteus dem Tempel des Jupiter
feretrius auf dem Kapitol in Rom, wo ihn Kaiser Augustus
noch sah und die Weihinschrift las, als er den genannten Tempel,
der zu verfallen drohte, wieder herstellte. Und von einer anderen
etruskischen Stadt, Tarquinii, meldet er, daß sie gegen das Ende des
zweiten punischen Krieges, der von 218–201 v. Chr. dauerte, Leinwand
zu Segeln an die damals neu zu erbauende römische Flotte beisteuerte.
Derselbe Livius berichtet von den tapferen, das Hochland des Appennins
bewohnenden und kulturell von den Etruskern stark beeinflußten
Samniten, die in drei Kriegen (343–341, 326–304 und 298–290 v. Chr.)
gegen die Römer kämpften, bis sie von ihnen 290 unterworfen wurden:
„Als die Samniten den Entschluß gefaßt hatten, auf Tod und Leben
gegen die Römer zu kämpfen, warben sie 40000 Mann, umzäunten mitten
im Lager einen Platz von 200 Schritt Durchmesser, bedeckten ihn mit
linnenen Tüchern und ein alter Priester las beim Opfer aus einem alten
linnenen Buche vor.“ Es hatte also die weiße Leinwand an sich schon
etwas Sakrales, und derselbe Autor bemerkt in seiner Geschichte Roms
mehrmals, daß auch bei den Römern die[S. 45] ältesten Urkunden und Verträge
auf Leinwand geschrieben seien und in Tempeln aufbewahrt würden.
Als dann die Römer die Erbschaft der Samniten und der Griechen
übernahmen, wurden auch die orientalischen Linnenkleider, wenigstens
bei den Vornehmen, die sich solchen Luxus leisten konnten, Sitte. Aber
bis weit in die Kaiserzeit hinein waren solche nicht Erzeugnisse der
heimischen Industrie, sondern fremde Importware, die um schweres Geld
vom Morgenlande eingehandelt werden mußte. So führt der römische Redner
und Schriftsteller Cicero (106–43 v. Chr.) in einer seiner berühmten
Reden gegen Gajus Verres, der als Statthalter von Sizilien während der
Jahre 73–71 nicht weniger als 40 Millionen Sesterzien (= 6 Millionen
Mark) aus jener Provinz erpreßt hatte und darob im Jahre 70 angeklagt
wurde, neben dem Purpur von Tyrus, Weihrauch, wohlriechenden Essenzen,
feinen Weinen, geschnittenen Steinen und Perlen auch Linnenkleider als
Gegenstände des verschwenderischen Luxus seiner Zeit an, so wie wir
etwa sagen würden: Diamanten und Spitzen. Aber nicht nur sich selbst
kleideten die vornehmen Römer in diese kostbaren Erzeugnisse der
morgenländischen Industrie, sondern auch ihre Geliebten, jene gefällige
Freundinnen, deren körperliche Reize durch die purpurfarbigen und
goldgestickten, infolge ihrer Feinheit schleierartig durchsichtigen
linnenen Gewänder von Tyrus, Kos und Amorgos, den berühmtesten Zentren
ihrer Herstellung, mehr verraten als verhüllt wurden. Selbst die
Dienerschaft trug kostbares Linnen, so besonders die jungen Sklaven,
die bei den schwelgerischen Gastmählern servierten.
Mehr und mehr wurde die fremde Leinwand zumal im Rom der Kaiserzeit
populär. Um das zuschauende Volk vor der Sonne zu schützen, ließen
reiche Magistrate und Cäsaren Schutzdächer aus Leinwand über die
Theater und Amphitheater wie auch über die Gerichtsstätte, das
Forum, spannen. Beim Wechsel der Mode, über den schon früh, noch
zur Zeit der Republik, geklagt wurde, erschienen stets wieder neue
Kleiderformen, Tücher, Binden usw. aus Leinenstoff, so beispielsweise
der supparus. Ursprünglich war dies die Bezeichnung eines
kleinen Segels, dann eines Frauengewandes; denn, wie in Athen,
bürgerten sich in Rom und in dessen westlichen und nördlichen Provinzen
jeweilen zuerst linnene Frauengewänder vor solchen für die Männer ein.
Dann wurde es vornehme Sitte, ein Stück feines Linnen als Schmucktuch
in oder an der Hand zu tragen, ganz nach Art jener „Handtücher“ im
ursprünglichen Sinne des Wortes, die auch die vor[S. 46]nehmen Griechen
zu Herodots Zeit im 5. vorchristlichen Jahrhundert getragen hatten.
Dieses, nach dem damit abzutrocknenden Schweiße als sudarium
bezeichnete feine, weiße Linnentüchlein wurde als manipulum
(von manus Hand, also „Handtuch“) nicht nur die ganze römische
Kaiserzeit hindurch als Zierde und Auszeichnung des vornehmen Standes
getragen, sondern dann auch von den Byzantinern übernommen. Auf allen
Darstellungen des höfischen Lebens jener Zeit, von denen diejenigen
auf den berühmten Mosaiken der Kirche San Vitale in Ravenna mit der
Darstellung des Kaisers Justinian und seiner Gemahlin Theodora die
bekanntesten sind, tritt uns bei den vornehmen Männern des kaiserlichen
Gefolges dieses viereckige, feine, weiße Linnentüchlein außen am
Gewand angeheftet entgegen. Und während es bei uns in die erst später
erfundenen Gewandtaschen wanderte, um als gemeines Taschentuch einem
praktischen Zwecke zu dienen, hat es in der Hand der Dorfschönen
besonders bei den Südslawen als Ziertuch immer noch den alten Adel
gewahrt. Die konservativste aller menschlichen Einrichtungen,
die Kirche, hat dieses alte „Handtuch“, das manipulum der
spätrömischen Zeit, als ein Stück gestickten Brokats am Arme des
katholischen Meßpriesters erhalten, während es in der griechischen
Kirche zum Orarion umgebildet wurde.
In den luxuriösen Bädern des alten Rom dienten dichtgewebte
Leinwandtücher zum Abtrocknen und als Tischdecken. Letztere waren unter
dem Namen mantelia oder mantela dazu bestimmt, den aus
kostbarem Holz — meist citrum, d. h. harzreichem, duftendem
Holz verschiedener Koniferenarten, besonders einer auf dem Atlasgebirge
in Afrika wachsenden Zypresse — bestehenden Tisch gegen Beschädigungen
der beim Speisen aufgetragenen Schüsseln zu schützen. Solche nahmen die
germanischen Barbaren bei ihren räuberischen Einfällen in römisches
Gebiet an sich und benutzten sie als willkommene Umschlagtücher, deren
lateinische Bezeichnung zum deutschen Mantel wurde.
Auch die in Theater und Amphitheater ausgespannten großen Tücher zum
Spenden von Schatten waren aus Leinen verfertigt. Plinius (23–78
n. Chr.) erzählt uns darüber: „Der erste, der solche Tücher aus Leinwand
ausspannte, war Lentulus Spinther bei den Apollinischen Spielen
im Theater. Dann spannte der Diktator Cäsar über das ganze Forum,
ferner über die Heilige Straße von seinem Hause bis an das Kapitol
eine Leinwanddecke aus. Auch Marcellus, Schwestersohn des Augustus,
hat das Forum mit einer Leinwanddecke überzogen. Neulich haben sogar
himmelblaue, mit Sternen übersäte leinene Segel[S. 47]tücher im Amphitheater
des Nero gehangen; die über den Höfen seines Hauses sind rot.“ Später
wurde noch weit größerer Prunk mit diesen als vela bezeichneten
Sonnentüchern getrieben.
Trotz allem Fortschreiten des Luxus, der große Mengen von Leinwand
bedurfte, hat aber Italien südlich von Rom — und dieser Teil der
Halbinsel war ja in den ersten Zeiten der römischen Weltherrschaft
gerade der zunächst gebende und empfangende, derjenige, auf den
gleichsam das Gesicht der Hauptstadt gerichtet war und über den der
Weg in die wichtigsten Provinzen des römischen Reiches führte — auch
in späterer Zeit nur verhältnismäßig sehr wenig Flachs angebaut. Der
149 v. Chr. gestorbene ältere Cato, der unversöhnliche Gegner des nach
dem zweiten punischen Kriege (218–201 v. Chr.) wieder aufblühenden
Karthago, erwähnt in seinem Buche über die Landwirtschaft nicht einmal
den Flachs. Auch Columella, der römische Ackerbauschriftsteller des
1. Jahrhunderts n. Chr., legt dieser Kultur keinen Wert bei. Er
erwähnt zwar den Flachs, aber er zählt ihn mit Bohnen, Linsen, Erbsen
und anderen Arten von legumina, also Gemüsen, zur Gewinnung
von Leinsamen zu Speisezwecken auf. Erst der im Jahre 79 n. Chr.
beim Vesuvausbruche umgekommene ältere Plinius lenkt die Blicke
seiner Landsleute auf die Asien und Ägypten seit langem bereichernde
Leinkultur, für die sich auch Italien eignen würde. Aber in diesem
Lande gab sich nur der ehemalig etrurische und keltische nördliche
Teil eingehender mit dieser Kultur ab. So sagt Plinius in seiner
Naturgeschichte: „Die Anwendung des Leins erstreckt sich über alle
Länder und Meere, denn mit Hilfe leinener Segel schiffen wir von der
sizilischen Meerenge in 6–9 Tagen nach Alexandrien, von Gades (Cadix in
Spanien) in 7 Tagen nach Ostia (an der Tibermündung), aus Afrika dahin
in 2 Tagen. Die Leinpflanze wächst aus einem ganz unbedeutendem Samen
und muß, wenn sie dem Menschen dienen soll, erst bis zur Feinheit der
Wolle verarbeitet werden. Damit weben die Ägypter, Gallier und Germanen
leinene Segel.“
Berühmt durch seinen Flachsbau war schon im 1. Jahrhundert n. Chr.
Spanien, aus dem überaus feines Linnen besonders nach Rom ausgeführt
wurde. Hier muß diese Kultur schon alt gewesen sein; denn der
Geschichtschreiber Livius berichtet, daß die Iberer in der Schlacht
bei Cannae (216 v. Chr.), jenem glänzenden Siege Hannibals, in dessen
Gefolgschaft sie gegen die Römer kämpften, nach Landessitte farbig
gesäumte Linnenröcke trugen. Nach Strabon trieben besonders die
Emporiten eine ausgedehnte Leinwandindustrie, und trugen die[S. 48] wilden,
räuberischen Lusitanier im heutigen Portugal Linnenharnische. Plinius
rühmt die feinen Siebe aus Flachsfäden als ursprünglich spanische
Erfindung und nennt die ferne Stadt Zoelae am Strande des Atlantischen
Ozeans im Lande der rohen Asturer als Flachs bauend. Besonders berühmt
für ihr feines Leinen war Saetabis und Tarraco (die heutigen Städte
Xativa und Tarragona), wo das Produkt die phönikische Bezeichnung
carbasus trug, die ihrerseits wiederum mit dem indischen Namen
karpasi für Baumwolle zusammenhängt.
Der ältere Plinius (23–79 n. Chr.) gibt uns eine ausführliche
Schilderung der Leinkultur bei den alten Römern: „Der Lein
(linum) wird vorzugsweise auf sandiges, einmal gepflügtes Land
gesät und wächst ungemein schnell. Im Frühjahr gesät wird er schon
im Sommer gerauft. Das Reifen derselben erkennt man am Schwellen
des Samens und am Gelbwerden der Pflanze. Nun wird er ausgerissen,
in Bündel gebunden, die man mit der Hand umspannen kann. Diese
Bündel werden 6 Tage lang an die Sonne gehängt, wobei der Samen
ausfällt. Dieser hat Heilkräfte, wurde auch sonst jenseits des Padus
(Po) in eine ländliche süße Speise getan; jetzt wird er nicht mehr
gegessen, wohl aber bei Opfern. Nach der Weizenernte werden die
Flachsstengel in Wasser gelegt, das von der Sonne durchwärmt ist,
und durch ein Gewicht unter die Oberfläche gedrückt. Ob sie gehörig
gerottet (macerari) sind, sieht man daran, daß sich der
Bast (membrana) leicht ablösen läßt. Dann werden sie an der
Sonne getrocknet und hernach auf einem Stein mit einem besonderen
hölzernen Hammer geklopft. Die der Rinde am nächsten liegenden
Schichten sind von geringem Wert und werden besonders zu Lichtdochten
verwendet. Gleichwohl werden auch sie durch die eisernen Haken
gekämmt (gehechelt), bis sie ganz entrindet sind. Das innere Mark
(medulla) wird noch mehrfach nach Glanz, Weiße und Weichheit
unterschieden. Den Flachs zu hecheln und zu sortieren ist eine Kunst;
denn aus 50 Pfund Flachsbündeln müssen 15 Pfund reiner Flachsfäden
gemacht werden. Auch das gesponnene Garn und das fertige Gewebe wird
noch durch Eintauchen in Wasser und Klopfen veredelt. Das kumanische
Garn aus Kampanien eignet sich trefflich zu Fisch- und Vogelfang, ja
zum Fangen der Wildschweine in Netzen. Die Fäden der Ebergarne sind aus
150 einfachen Leinfäden zusammengesetzt. Gezupfte Leinwand, vorzüglich
aus Segeln der Schiffe, wird vielfach in der Heilkunst gebraucht. —
Man färbt auch Leinwand. Dies soll zu Alexanders (des Großen) Zeit
zuerst geschehen sein. Seine Flotte fuhr (326 v. Chr.) mit farbigen[S. 49]
Flaggen den Indus hinab. In der Schlacht bei Actium (31 v. Chr.) trug
das Admiralsschiff, auf welchem sich Kleopatra und Antonius befanden,
purpurfarbige Segel.“
Ganz Gallien bis zum äußersten Norden wird von Plinius als Flachs
bauend und Leinwand webend geschildert. Die Anfänge der flämischen
Leinenindustrie reichen wenigstens bis zum 1. Jahrhundert n. Chr.
zurück, und daß auch die Gegend um Reims feine Leinwand erzeugte, das
lehrt uns die italienische Sprache in dem Worte renso für eine
von dort bezogene besonders gute Qualität. Selbst bis zu den Germanen
jenseits des Rheins, fährt Plinius fort, ist diese Kunstfertigkeit
gedrungen. „Das germanische Weib kennt kein schöneres Kleid als das
linnene; dort sitzen sie in unterirdischen Räumen (Grubenwohnungen)
und spinnen und weben.“ Ungefähr dasselbe sagt der Geschichtschreiber
Tacitus (54–117 n. Chr.) in seiner Germania: „Die Frauen kleiden
sich wie die Männer, nur daß sie sich häufiger als diese in linnene
Tücher hüllen, die sie mit roter Farbe verzieren.“ Die Männer trugen
also noch die Wollkleidung, selbst Felle, während die Frauen auf
ihren Hackfeldern Flachs zogen und sich mit daraus hergestellten
Linnenkleidern schmückten.
All dieser Flachs war der einjährige, von Linum usitatissimum,
der im Gegensatz zum minder wertvollen mehrjährigen der Pfahlbauern
erst sehr spät aus Westasien nach Mitteleuropa gelangte. Durch seine
einjährige Vegetationsdauer eignete er sich auch viel besser für die
rauhen Gegenden Germaniens. Und zwar wurde diese Kulturpflanze wie im
Griechischen línon, so im Lateinischen linum und von da
bei allen Nordvölkern Lein bezeichnet. Nur in Westgermanien kam die mit
dem Begriff Flechten zusammenhängende Bezeichnung Flachs für ihn auf.
Bei den Kelten und Germanen hat sich dann die vom Süden her durch die
Römer vermittelte Sitte der linnenen Kleidung sehr rasch eingebürgert;
ja, diese Völkerschaften beeinflußten sogar ihre vormaligen Lehrmeister
in der Weise, daß sie ihnen neue Verwendungen des Linnens lehrten. So
haben die Gallier zuerst mit Pferdehaaren oder Vogeldaunen gestopfte
Leinwandsäcke als Polster und Kissen verwendet und sie in der Folge
auch in Italien populär gemacht, wo man sich zum Sitzen und Liegen bis
dahin bloßer Lagen von Decken und weichen Stoffen bedient hatte. Sie
waren es ebenfalls, die durch alle Schichten der Bevölkerung zuerst das
Hemd aus Leinen trugen, wofür sie den zuerst beim heiligen Hieronymus
vorkommenden Namen camisia auf[S. 50]brachten, woraus später das
französische chemise für Hemd wurde. Vor ihnen hatten nur Frauen
vornehmen Standes Leinwand unmittelbar am Körper getragen, und vom
römischen Kaiser Alexander Severus, der von 222 an regierte und im
Jahre 235 unweit Mainz von aufrührerischen Soldaten ermordet wurde,
schreibt sein Biograph Lampridius, daß er weißes Linnen als Unterkleid
liebte, weil es nichts Rauhes (wie die sonst getragene Wolle) habe.
Einige Dezennien später schenkte Kaiser Aurelian seinem Volke
weiße, mit Ärmeln versehene Tuniken, die in verschiedenen Provinzen
angefertigt waren, darunter auch ungefärbte linnene aus Ägypten und
Afrika.
Im Laufe der Völkerwanderung hat sich das linnene Kleid bei allen
Germanenstämmen als gewöhnliche Volkstracht eingebürgert. Die Westgoten
trugen über den Leinenhemden, die uns vom Berichterstatter Sidonius
Apollinaris, der mit den Ältesten derselben im Namen des byzantinischen
Kaisers verhandelte, als sehr schmutzig bezeichnet werden, Pelze, und
die Franken neben den ledernen auch linnene Hosen. Von den Germanen kam
dann der Flachsbau mit dem dem Lateinischen entnommenen Namen zu den
Slawen. Wie die deutsche Hausfrau bis in die Neuzeit selbst gesponnenes
Leinenzeug als ihren wertvollsten Schatz aufspeicherte, so bildete
Leinwand in den Grenzgebieten der Germanen und Slawen das gewöhnliche
Tauschmittel. Als solches wird sie aber auch in altnordischen Gesetzen
genannt; in Skandinavien bildete sie neben dem einheimischen Wollstoff
eine sehr gerne in Tausch genommene Wertsache. Endlich fand beim
Weiterrücken der Kultur der Leinbau an der Ostsee und in Rußland eine
neue Heimstätte, wo sie bis auf den heutigen Tag zunehmende Bedeutung
erlangte.
Es kann nicht unsere Sache sein, die Bedeutung des Flachses durch das
Mittelalter, wo jedermann wenigstens am Tage — nachts lag man nackt
im Bett — Leinenhemden trug, bis zur Jetztzeit zu illustrieren. Es
genüge nur daran zu erinnern, welche große Bedeutung Leinenzeug, zumal
die Brabanter und Venezianer Spitzen, im 17. und teilweise noch im 18.
Jahrhundert genoß, bis schließlich auch hierin der ältere Lein durch
die jüngere Baumwolle, die ihren Siegeszug durch die ganze Welt antrat,
verdrängt wurde.
Der Lein gedeiht am besten in feuchtem, kühlem Klima; bei Trockenheit
bleibt er kurz im Stengel. Die beste Qualität wächst auf humosem
Lehmboden unter dem Einfluß des Seeklimas, so in den Ostseeprovinzen
Rußlands, in Belgien, Holland und vor allem Irland. Gepflanzt wird
er gewöhnlich nach frisch umgebrochenem Rotklee oder[S. 51] nach Getreide.
Weil er dem Boden viel Nährsalze entzieht, versagt er nach sich
selber. Er wird möglichst frühzeitig gesät und braucht zur Vollendung
seines Wachstums 90–120 Tage. Sobald das untere Drittel der Stengel
gelblich geworden ist wird er gerauft, auf dem Felde getrocknet, dann
die Samenkapseln an einem eisernen Kamm abgeriffelt. Zur Gewinnung
des Rohflachses werden die Stengel zur Zerstörung des Pflanzenleims,
der den Bast, das eigentliche Fasermaterial verbindet, gerottet, d.
h. in weichem, möglichst kalkfreiem Wasser einer gelinden Fäulnis
unterworfen, bis sich der Bast leicht vom inneren Holz abstreifen läßt,
was in 10–14 Tagen der Fall ist. Dann werden die sortierten Stengel
mit der Brake gebrochen, um den holzigen Kern des Flachsstengels in
kleine Stückchen zu zerlegen, die dann durch Schwingen mit Hilfe eines
hölzernen Messers entfernt werden. Zuletzt werden noch die bandartig
zusammenhängenden Fasern gehechelt, d. h. durch Eisenkämme gezogen,
welche alle Unreinlichkeiten, sowie die kurzen und verwirrten Fasern
zurückhalten. Diese heißen Werg oder Hede (alt- und
mittelhochdeutsch rîste) und dienen zum Polstern oder auch zur
Herstellung grober Gespinste und Gewebe. Die glatten, gleichmäßigen
Strähne aber liefern den eigentlichen Flachs, der früher in vielen
Häusern zu Leinengarn gesponnen wurde, eine Manipulation, die
gegenwärtig fast ausschließlich durch Maschinen besorgt wird. Die
Spinnmaschine, welche in ihren Grundzügen von Ayres konstruiert wurde,
ist neben dem vom Engländer Cartwright im Jahre 1787 konstruierten
mechanischen Webstuhl eine der wunderbarsten und nützlichsten
Erfindungen des menschlichen Geistes. Sie zieht nicht nur den Faden
aus, sondern dreht und wickelt ihn zugleich auf die Spule.
Der ausgehechelte Flachs hat Fasern von 30–60, höchstens 70 cm
Länge, die durch den Rest des Pflanzenleims zusammengehalten werden.
Sie bestehen aus festen, fast bis zum Verschwinden des Hohlraums
verdickten sogenannten Bastzellen. Der beste Flachs mit den
längsten Fasern ist lichtblond oder silbergrau mit Seidenglanz. Die
Gesamtproduktion Europas wird auf 700 Millionen kg geschätzt;
davon entfallen 500 Millionen kg auf Rußland und etwa 100
Millionen kg auf Deutschland und Österreich. Auch Ägypten und
Nordamerika erzeugen große Mengen desselben. Die Fabrikationsdistrikte
für leinene Gewebe sind für Deutschland besonders in Schlesien und
Westfalen (um Bielefeld) gelegen. Seit langem ist besonders das
Brabanter Leinen in Form von Battist wegen seines überaus feinen
Gewebes berühmt. Auch Irland liefert sehr gute Leinen, ebenso das
nördliche Böhmen.
[S. 52]
Sehr viel später als der Lein ist der Hanf (Cannabis
sativa), ein naher Verwandter des Hopfens, in die Länder am
Mittelmeer und nach Europa gelangt. Die alten Babylonier, Ägypter,
Juden und Phönikier haben ihn noch nicht gekannt. Zuerst wird er in
Indien zwischen 800 und 900 v. Chr. als angebaute Nutzpflanze unter
dem Namen bhanga erwähnt, dann in dem um 500 v. Chr. verfaßten
chinesischen Buche Schu-king. Seine Heimat ist Zentralasien, wo er in
Turkestan bis zum Baikalsee, aber auch südlich vom Kaspischen Meer
und in Südrußland stellenweise noch als Wildling gefunden wird. Dort
irgendwo muß er von einem uns unbekannten Volksstamme zuerst als
Nährpflanze zur Erlangung der ölreichen Samen, dann als Genußpflanze
zur Gewinnung des Haschisch und zuletzt erst als Gespinstpflanze
gezogen worden sein und sich langsam als Kulturpflanze allseitig
ausgebreitet haben. Zu den mit ihren zahlreichen Herden nomadisierenden
Skythen in Südrußland kam er als Genußmittel, indem diese sich nach
dem Berichte des Vaters der Geschichte, Herodot (484–424 v. Chr.), in
der Weise berauschten, daß sie in geschlossenen, kleinen Filzzelten
(Jurten) Hanfsamen auf heiß gemachte Steine warfen und die sich dabei
entwickelnden betäubenden Dämpfe einatmeten, bis sie, in Ekstase
geratend, „vor Freude brüllend“ daraus herausrannten. Von den Thrakern
berichtet derselbe Autor, daß sie aus den Fasern dieser Pflanze Kleider
webten. Damals, im 5. vorchristlichen Jahrhundert war diese Pflanze den
Griechen noch unbekannt. Erst später erhielten sie dieselbe aus dem
Balkan unter dem Namen kánnabis, der dann unverändert von den
Römern übernommen wurde. Und die Balkanstämme, die ihn den Griechen
vermittelten, gaben ihn dann auch nordwärts in die Donaugegenden und
nach Germanien ab. In Albanien als kanep, bei den Tschechen
und Slawen als konop bezeichnet, gelangte er als hanaf
zu den Germanenstämmen. Aus diesem althochdeutschem Worte ist dann
mittelhochdeutsch hanef und neuhochdeutsch Hanf geworden. Nach
einer sehr ansprechenden Vermutung Schraders liegt die einfachste
Form des Namens im tscheremissischen (einer Sprache des Kaukasus)
kene Hanf vor, während der zweite Bestandteil bis oder
pis in der syrjänischen und wotjakischen (sibirischen Stämmen)
Benennung der Nessel piš seine Entsprechung finden würde, so daß
also cannabis eigentlich „Hanfnessel“ bedeuten würde.
Von Griechenland wanderte die Kenntnis und der Anbau des Hanfes erst in
verhältnismäßig später Zeit nach Sizilien und Unter[S. 53]italien und von da
nach Mittel- und Norditalien. Der ums Jahr 200 n. Chr. in Alexandrien
und Rom lebende Grieche Athenaios, der uns in seinen auf uns gekommenen
15 Büchern Deipnosophistai wichtige Nachrichten über Leben und
Leistungen der alten Griechen hinterließ, berichtet von König Hieron
II. von Syrakus (regierte von 269–215 v. Chr.), er habe ein ungeheures
Prachtschiff bauen lassen, zu dem er von allen ihm bekannten Ländern
je das Vorzüglichste in seiner Art kommen ließ. Pech und Hanf habe er
vom Rhonefluß in Gallien bezogen. Dort muß also zu seiner Zeit der Hanf
besonders gut gediehen sein. Zu den Kelten, die sich seiner Samen, wie
wir aus anderer Quelle wissen, auch als Ölspender und Betäubungsmittel
bedienten, was bei den Griechen und den von diesen damit beschenkten
Römern durchaus nicht üblich war, wird er jedenfalls nicht durch
griechische Vermittlung über die Kolonie Massalia, dem heutigen
Marseille, sondern direkt von Osten her aus der Donaugegend gekommen
sein.
Der ältere Cato (234–149 v. Chr.) nennt in seiner Schrift über den
Landbau weder Flachs noch Hanf. Der erste römische Schriftsteller, der
den Hanf erwähnt, indem er von einem hänfenen Strick spricht, ist der
ums Jahr 100 v. Chr. lebende Satiriker Lucilius. Nach ihm erwähnt ihn
der gelehrte Varro (116–27 v. Chr.) in seiner Schrift über den Landbau.
Er schreibt darin: „Hanf, Lein, Simsen (juncus) und Spartgras
(spartum) werden auf Feldern gezogen, um aus ihnen Stricke und
Seile anzufertigen.“ Das seit dem zweiten punischen Kriege (218–201
v. Chr.) von Spanien her bei den Römern als Bastpflanze aufgekommene
Spartgras (auch Esparto, von Stipa tenacissima), das bis
auf den heutigen Tag viel von Südspanien und dem westlichen Nordafrika
exportiert wird, schränkte den Anbau des Hanfes in Italien sehr ein.
Doch wurde er in der Zeit der römischen Kaiser stellenweise angepflanzt
und gedieh vortrefflich; denn der 79 n. Chr. beim Vesuvausbruch als
Befehlshaber der bei Misenum stationierten Heimatflotte umgekommene
ältere Plinius berichtet in seiner Naturgeschichte, daß in dem durch
seine Fruchtbarkeit berühmten Landstrich um Reate im Sabinerland der
Hanf baumhoch werde. Sein Anbau fand damals wie heute besonders in den
Niederungsdistrikten Italiens und Siziliens statt.
Nach dem nördlichen Europa verbreitete sich die Hanfkultur ziemlich
spät und nur strichweise, soweit das Klima milde und der Boden
humusreich und feucht ist. Die Pflanze wächst in größeren weiblichen
und kleineren männlichen Individuen. Merkwürdigerweise aber be[S. 54]zeichnet
der Deutsche die letzteren als Fimmel oder Femell (vom lateinischen
femella Weibchen) und die ersteren als Mäschel (vom lateinischen
masculus Männchen), wohl von der Vorstellung ausgehend, daß das
Kürzere und Schwächere weiblich und das Größere, Stärkere männlich
sein müsse. Der Hanf liebt wärmeres Klima als der Flachs und ist
gegen Kälte und Spätfröste sehr empfindlich. Da er aber nur eine
Vegetationsdauer von 90–105 Tagen hat, so läßt er sich in Europa noch
in den Küstenländern der Ostsee kultivieren. Am besten gedeiht er
auf tiefgründigem Humusboden. Man sät ihn, wenn keine Fröste mehr zu
befürchten sind, zieht die kürzeren männlichen Hanfpflanzen aus, sobald
deren Blätter gelb werden, ebenso nach weiteren 4–6 Wochen die höheren
weiblichen, wenn diese gelb zu werden beginnen. Die Gewinnung der zum
Verspinnen oder zur Seilfabrikation usw. bestimmten Fasern erfolgt
im allgemeinen in der beim Flachs angegebenen Weise durch Rotten,
Brechen, Schwingen und Hecheln. Die 1 bis 2 m langen Hanffasern
sind weißlich oder grau und weit gröber als die Flachsfasern; die
darin enthaltenen einzelnen Bastzellen sind 1,5 bis 2,5 cm lang
und sehr hygroskopisch. Die Hanfproduktion Europas und Nordamerikas
beziffert sich auf etwa 500 Millionen kg. Davon entfallen auf
Rußland 150, Italien 50, Österreich-Ungarn 87, Frankreich, Deutschland
und Vereinigte Staaten je 70 Millionen kg. In Rußland, wo der
Hanf wie in Italien südlich vom unteren Po zum Teil im Lande selbst zu
Stricken, Tauen und Segeltuch verarbeitet wird, gewinnt man als ein
Hauptprodukt der Hanfkultur das aus dem Samen gepreßte Hanföl, das
allgemein besonders während der langen und strengen griechischen Fasten
als Speisefett dient. Natürlich wird solches zu gewinnen in Italien
verschmäht, da es an seinem Olivenöl ein besseres Speisefett besitzt.
Von ausländischen Faserstoffen, die ähnlich wie Hanf verwendet werden,
ist zunächst der bengalische Hanf zu nennen, der von einer
bis 2 m hohen, von Vorderindien bis Australien verbreiteten
Leguminose mit lanzettförmigen, seidenhaarigen Blättern und schönen,
großen, gelben Blüten (Crotalaria juncea) gewonnen wird. Aus
deren Stengeln bereitet man auf dieselbe Art wie bei unserem Hanf eine
blaßgelbliche, seidenglänzende Bastfaser. Sie wird deshalb seit alter
Zeit fast überall in Südasien, besonders in Indien, auf Java und Borneo
kultiviert.
Der gleichfalls zur Herstellung von Tauen und Stricken und anderen
Geflechten verwendete Manilahanf stammt von der auf den
Philippinen heimischen Faserbanane (Musa textilis), die
in großer[S. 55] Menge in den vulkanischen Gegenden dieser Inselgruppe
kultiviert wird. Die wildwachsenden Pflanzen liefern zwar auch, aber
nur sehr wenig Faserstoff. Man hat diese nützliche Faserpflanze auch in
anderen tropischen Gegenden anzubauen versucht, aber nur mit geringem
Erfolg. So stammt diese Bastfaser, die nach dem Exporthafen Manila so
heißt, fast ausschließlich aus den Philippinen. Die Faserbanane hat
im dritten Jahre eine Höhe von 6 m und einen Stammdurchmesser
von 18 cm erreicht und wird dann vor der Blüte geerntet. Die
gefällten Stämme läßt man einige Tage liegen, um sie saftärmer zu
machen und schneidet dann die Fasern nach kurzer Röstung der Schäfte
durch Handarbeit heraus, indem man sie durch Eisenkämme hindurchzieht.
Dadurch werden die 1–2 m langen verholzten Fasern, die aus
kurzen, feinen Bastzellen bestehen, rein gewonnen. Sie kommen in
bräunlichen bis gelblichweißen Strängen von seidenartigem Glanz in
den Handel und dienen zur Anfertigung von Seilerwaren und zu vielen
Luxusartikeln, die besonders geschätzt sind, wenn die Faser mit Seide
verwebt wurde, was bei den Manilataschentüchern u. dgl. der Fall ist.
Wegen ihrer Leichtigkeit und Haltbarkeit im Wasser werden aus ihnen
auch Schiffstaue hergestellt, doch sind sie schwerer zu verarbeiten als
der Hanf. Da der Manilahanf sehr billig ist, wird er von den Schiffern
meist nur als Ballast verladen. Die Insel Manila allein soll jährlich
über 31 Millionen kg davon ausführen. Ungefähr 14 Millionen
kg gehen nach den Vereinigten Staaten, besonders nach New
York, etwa 6 Millionen kg nach England und gegen 2,5 Millionen
kg werden in Manila selbst zu Schiffstauen von 1–15 cm
Umfang und bis 200 m Länge verarbeitet. Gröbere und zugleich
geringere Sorten stammen von anderen Musaarten, besonders von der
überall in den Tropen angebauten gewöhnlichen Banane, dem Pisang.
Der Mauritiushanf stammt von einer mächtigen, hohen Staude
aus der Familie der Amaryllideen (Fourcroya gigantea), die im
tropischen Mittelamerika heimisch ist und seit 1750 auf der Insel
Mauritius, in neuester Zeit auch in Ostindien zur Fasergewinnung
kultiviert wird. Die bis 2,5 m langen Blätter werden vom
dritten Jahre an geerntet und werden mit der Hand oder mit Maschinen
verarbeitet.
Der Familie der Liliengewächse gehört der neuseeländische Flachs
(Phormium tenax) an, eine ausdauernde Pflanze, aus deren kurzem,
dickem Wurzelstock 1–2 m lange, 2–4 cm breite, graugrüne,
lederartige Blätter hervorsprießen. Sie wächst auf Neuseeland, der
Insel Norfolk und in verschiedenen Teilen Australiens wild, wird aber
hier[S. 56] wegen ihrer Fasern auch kultiviert. Seit alter Zeit dienen die
Fasern der Blätter zu Seilen, gröberen Bekleidungsstoffen und sonstigen
Geflechten, während der bittere Wurzelstock wie die Sarsaparille gegen
Skrofulose und Syphilis verwendet wird. Erst durch den englischen
Entdeckungsreisenden Cook wurde diese Faserpflanze nach 1769 bekannt.
Die durch Verfaulenlassen der Blätter gewonnene Rohfaser ist etwa
1 m lang, gelblich, stellenweise weißlich und wird erst in Europa,
und zwar fast ausschließlich in England, gereinigt und zu Flechtereien
wie Tauen und gröberen Webereien, namentlich Segeltuch, verarbeitet.
Diese sind biegsamer und leichter als diejenigen aus gewöhnlichem Hanf
und werden selbst bei langem Liegen in Wasser kaum verändert.
Ebenso verhält es sich mit dem Sanseveriahanf, der aus den
langen, dickfleischigen, graugrünen, mit dunkleren Bändern quer
gestreiften Blättern einer in mehreren Arten im tropischen Afrika
heimischen Lilie der Gattung Sanseveria gewonnen wird. Am häufigsten
wird in Westafrika Sanseveria guineensis, in Ostafrika dagegen
S. cylindrica und ehrenbergi ausgebeutet. In ihrer Heimat
wachsen sie in großen Beständen wild, meist auf steinigen Steppen im
Schatten von Gebüsch; um jedoch die Gewinnung zu erleichtern, werden
sie an verschiedenen Orten der Tropen kultiviert. Dabei sind sie höchst
anspruchslos, werden außer durch Samen meist durch Wurzelschößlinge,
die in großer Zahl um die Pflanze herum aufschießen, vermehrt und
erreichen ein hohes Alter, so daß eine Anlage erst nach vielen Jahren
erneuert zu werden braucht. Die Aufbereitung der Faser geschieht in
mühsamer Weise wie bei den vorgenannten Arten von Hand, könnte aber,
wenn Pflanzungen in größerem Maßstabe angelegt würden, weit einfacher
durch Maschinenbetrieb gewonnen werden. Die Kultur im großen würde
sich sehr lohnen, da die Sanseveria-Bastfasern von hervorragender
Güte liefern. Von Deutsch-Ostafrika wurden bis jetzt davon nur
154000 kg exportiert.
Tafel 95.

Anpflanzung von Manilahanf (Musa textilis) in Mindanao auf den
Philippinen.

Zum Trocknen aufgehängter Manilahanf auf San Ramon
auf der Insel Mindanao. (Beide nach einer in der Sammlung des botan.
Instituts der Universität Wien befindlichen Photogr. von Dr.
Hans Hallier.)
Tafel 96.

(Phot. Vincenti, Daressalam.)
Sisalagavenplantage in Deutsch-Ostafrika. Die der Blätter beraubten
Pflanzen haben Blütenschosse getrieben, womit ihre Daseinszeit zu Ende
ist.
❏
GRÖSSERES BILD
In Mexiko, besonders auf der Halbinsel Yucatan, wird die in
Mittelamerika heimische Sisalagave (Agave rigida) gebaut, so
genannt nach der Hafenstadt Sisal in Yucatan, die lange Zeit der
Hauptausfuhrort für den Sisalhanf war. Derselbe wird von den
bis über 1 m langen, dicken, fleischigen Blättern der trockene
Standorte wie ihre Verwandten liebenden Agave gewonnen. Diese gehört
zu den Amaryllisgewächsen und entwickelt am Ende ihrer Vegetationszeit
einen holzigen Schaft von 3–5 m Länge mit rispenförmigen Blüten.
Nach dem Reifen der Früchte stirbt die Pflanze ab. Die Sisalagave[S. 57]
wächst am besten in tropischen und subtropischen Gebieten mit nicht
zu großer Feuchtigkeit und wird noch mit gutem Erfolg auf Boden
angepflanzt, der für andere Kulturgewächse zu schlecht ist. Dort
gedeiht sie ohne Pflege, nur muß anfänglich, solange die Pflanzen
klein sind, das Unkraut niedergehalten werden. Die Fortpflanzung
geschieht entweder durch Wurzelschößlinge, die vom dritten Jahre an als
Triebe des Wurzelstocks reichlich aus dem Boden hervorbrechen und nur
abgegraben und verpflanzt zu werden brauchen, oder durch zwiebelförmige
Brutknospen, die sich ebenfalls in großer Zahl, bis zu 3000, an der
Pflanze bilden, um abzufallen und ihre meist schon vorher gebildeten
Wurzeln in die Erde zu versenken. Ist die Pflanze fünf Jahre alt,
so können bis zu ihrem 15.-20. Jahre zwei- bis viermal jährlich die
ausgewachsenen Blätter abgeschnitten werden. An diesen werden dann
vermittelst einer Maschine die Fasern von den Fleischteilen des Blattes
abgetrennt, gereinigt, getrocknet und gebleicht, um als Sisalhanf in
den Handel zu gelangen. Dieser ist leicht, gelblich-weiß, glänzend,
stärker und elastischer als Hanf, härter und weniger biegsam als
Manilahanf, widersteht der Nässe, braucht also nicht geteert zu werden,
und erlangt unter Wasser sogar eine erhöhte absolute Festigkeit. Er
dient zur Herstellung von Tauen, Segeltuch, Packtüchern, Teppichen,
Papier und als Indiafaser zum Polstern. Mexiko führt davon jährlich
500000 Ballen im Werte von 40 Millionen Mark aus. Seine Kultur ist
neuerdings auch in den deutschen Kolonien, besonders Ostafrika, aber
auch Neuguinea eingeführt worden. Diese führten schon 1907 für 2,2
Millionen Mark aus. Seitdem hat sich die Produktion noch wesentlich
gehoben. Im Jahre 1908 wurden in Ostafrika allein die vorhandenen
Sisalpflanzungen auf 10355 Hektar mit 24 Millionen Pflanzen geschätzt
und kamen fast 3 Millionen kg Sisalhanf im Werte von über 2
Millionen Mark zur Ausfuhr.
Von einer verwandten Agave, der in Mexiko heimischen Agave
heteracantha, die dort vom Volke lechuguilla genannt wird,
stammt die im Lande selbst als ixtli, bei uns aber nach dem
Hauptausfuhrhafen Tampico meist als Tampicofaser bezeichnete,
zwar grobe und kurze, aber äußerst haltbare und starke Faser. Sie
wird durch Abschaben der fleischigen Blätter, solange diese noch grün
und saftig sind, gewonnen. Die Faserbündel werden dann ausgehoben,
gewaschen, an der Sonne getrocknet, mit einem Holzkamme wie Frauenhaar
gekämmt, in verschiedenen Längen zu Strähnen gebunden und in Ballen
verpackt. Die Ausfuhr beträgt über 3 Millionen kg jährlich.
[S. 58]
Im Gegensatz zu ihr steht die fast ausschließlich in Zentralamerika von
verschiedenen Bromeliazeen aus der engsten Verwandtschaft der Ananas,
besonders von Bromelia karatas gewonnene Pitafaser oder
das Hondurasgras. Aus diesem sehr feinen und festen Faserstoff
hat man früher den sogenannten Ananasbattisthergestellt, während man
sich heute damit begnügt, ihn zu gröberem Flechtwerk zu verwenden. Die
ihn liefernde waldbewohnende Faserpflanze wird nirgends eigentlich
kultiviert. In Mexiko, wo sie auch vorkommt, besteht die ganze Pflege
darin, daß im Walde das Unterholz abgebrannt wird, um den Schößlingen
Platz zu machen, die nach ihrer Anpflanzung sich selbst überlassen
bleiben. Die Besitzer stellen sich nur zur Ausbeutung ein und lichten
vielleicht bei dieser Gelegenheit den Bestand aus, wenn er durch das
Emporschießen von Schößlingen zu dicht geworden ist. Auch auf der
Halbinsel Malakka und den Philippinen wird eine wilde Ananas, wie
anderwärts die als Obst kultivierte eßbare Ananas zur Gewinnung von
Fasermaterial benutzt.
Ein uralter, schon den alten Römern als spartum bekannter und
von ihnen vielfach zu allerlei Flechtwerk verwendeter Faserstoff
rührt vom sehr zähen Pfriemengras (Stipa tenacissima)
her, das in den dürren, beinahe Wüstencharakter aufweisenden,
außerordentlich regenarmen und lufttrockenen Steppen Algeriens,
Marokkos und Südspaniens heimisch ist und von den dortigen Eingeborenen
seit Urzeiten zu allerlei Flechtwerk benutzt wird. So werden heute
noch wie im Altertum von der armen Bevölkerung daraus die als einziges
Kleidungsstück dienenden Schürzen, wie auch die Sandalen, Tragtaschen
und Stricke angefertigt, die von einer geradezu unverwüstlichen
Dauerhaftigkeit sind. Die Römer lernten dieses außerordentlich
feste Flechtmaterial von den Karthagern kennen, die es ausgiebig zu
mancherlei Flechtwerk, auch zur Herstellung von Schiffstauen für
ihre zahlreichen Handels- und Kriegsschiffe, verwendeten. Seit dem
2. punischen Kriege (218–201 v. Chr.) machten sie sich die im 1.
punischen Kriege bei den Karthagern gemachten Erfahrungen mit diesen
fast unzerstörbaren Tauen und Netzen zunutze. So berichtet der römische
Geschichtschreiber Livius aus Padua (59 v. bis 17 n. Chr.) folgende
Episode aus dem zweiten punischen Krieg, als Scipio gegen Hannibals
Bruder Hasdrubal kämpfte, 210 v. Chr. Neu-Karthago und 206 das ganze
von den Karthagern innegehabte Südostspanien eroberte: „Während die
Römer in Italien gegen Hannibal kämpften, sandten sie eine Kriegsflotte
nach Spanien; diese verwüstete die Gegend um Neu-[S. 59]Karthago und fand
nicht weit von da zu Longuntica eine gewaltige Menge von getrocknetem
Pfriemengras (spartum), das Hasdrubal dort für den Bedarf
seiner Schiffe angehäuft hatte. Die Römer nahmen von dieser Beute,
soviel sie brauchen konnten, und verbrannten das übrige.“ Der ältere
Cato, der unversöhnliche Gegner des nach dem zweiten punischen Kriege
wieder aufblühenden Karthago (234–149 v. Chr.) sagt in seinem Buche
über Landwirtschaft, der Landmann müsse aus spartum geflochtene
Seile und Körbe haben, und der Gelehrte Varro (116–27 v. Chr.) meint:
„Der Landwirt muß Hanf, Lein, Binsen und spartum pflanzen,
um daraus Schnüre, Stricke und Seile zu drehen.“ Der aus Spanien
gebürtige römische Ackerbauschriftsteller Columella um die Mitte des
1. Jahrhunderts n. Chr. schreibt: „Wenn die Klauen eines Ochsen an
Entzündung leiden, so schützt man sie durch einen aus spartum
geflochtenen Schuh (solea spartea)“, ferner: „Bei der
Olivenernte braucht man außer vielen andern Dingen Seile von Hanf und
von spartum.“
Das von den Spaniern esparto, von den muhammedanischen
Nordafrikanern halfa genannte Pfriemengras mit sehr
faserreichen, zähen Blättern gedeiht auf trockenem, kalkhaltigem Boden
am besten; auf sehr sandigem Boden liefert es eine noch kräftigere,
aber kürzere Faser. Es erhebt sich nicht über 1000 m, treibt im
Binnenlande längere und weißere, aber dünnere und schwächere Fasern
als an der Küste, wächst in Büscheln und pflanzt sich so leicht fort,
daß auf dem Boden, von dem es einmal Besitz ergriffen hat, endlose
Ernten eingeheimst werden können. Das ist die Ursache, weshalb diese
Grasart trotz ihrer großen Wichtigkeit als Faserpflanze nirgends
kultiviert wird. Man überläßt ihr einfach das Gelände, auf dem sie
sich angesiedelt hat, und denkt nicht daran, ihr irgend welche Pflege
angedeihen zu lassen. Die Blätter werden zur Zeit der Reife im Mai
und Juni meist noch durch Ausreißen mit den Händen, indem man sie zum
festeren Anpacken um einen Stock wickelt, geerntet, getrocknet und, in
Bündel gebunden, in den Handel gebracht. Die wichtigste Bezugsquelle
ist Algerien, das aus dem über 400 km langen und 170 km
breiten, in den Departements Oran und Algier gelegenen sogenannten
Halfameer jährlich über 100 Millionen kg im Werte von 10
Millionen Mark bezieht. Nach ihm kommt Spanien mit etwa 48 Millionen
kg und hernach Tunis und Tripolis mit immer zunehmenden Massen.
Die Hauptmenge gelangt zur Papierfabrikation nach England, ein großer
Teil wird nach Frankreich, hauptsächlich Marseille, verschifft,[S. 60] um
zu grobem Packtuch, Matten, Körben und Seilerartikeln Verwendung zu
finden. Wie in Nordafrika, so gelangt dieses Rohmaterial auch in
Spanien zu einer sehr vielseitigen Verarbeitung. Unter den hier daraus
verfertigten Gegenständen sind namentlich die dünnen aber starken, in
den Bergwerken verwendeten Seile, sowie die sehr dauerhaften Sandalen
zu nennen, die nicht bloß im eigenen Lande überall von der ärmeren
Bevölkerung getragen, sondern auch in Menge exportiert werden.
Kein eigentliches Gras, sondern ein grasartiges Nixenkraut (Najadazee)
ist das in wenig tiefem Wasser an den Küsten von Europa, Kleinasien,
Ostasien und Nordamerika in dichten Beständen, wiesenartig weite
Flächen bedeckend, wachsende Seegras (Zostera marina).
Nach heftigen Stürmen werden oft sehr große Massen von ihm, zum
Teil mit den Wurzeln, ausgerissen, bei abstillender See ans Land
geschwemmt und hier zu ganzen Haufen aufgetürmt oder zu Kugeln geformt.
Wie so manche andere Meergewächse hat es lange fadenförmige Pollen
(Blütenstaub), die im Meere umhertreiben, bis sie von den Narben
angezogen und festgehalten werden. Getrocknet dient es an Stelle der
teuren Pferdehaare zum Stopfen und Polstern von Matratzen, Betten,
Möbeln usw., daneben wird es auch verbrannt und zur Gewinnung von Soda
benutzt.
Als vegetabilisches Roßhaar, Baumhaar, Caragate oder
Tillandsiafasern kommen die durch Rotten im Wasser ihrer
Hautgewebe entkleideten silberweißen, fadenförmigen, 0,5–1 m
langen Luftwurzeln der als Greisenbart bezeichneten Bromeliazee
Tillandsia usneoides in Form von schwarzbraunen, dem Roßhaar
ähnlichen Fasern von 1 mm Dicke in den Handel, um ebenfalls an
Stelle von Roßhaar zum Stopfen von Matratzen und Polstern von Möbeln,
wie auch zum Verpacken von Glaswaren benutzt zu werden. Dieses als
Überpflanze auf Bäumen lebende Ananasgewächs kommt im ganzen warmen
Amerika von Argentinien bis Carolina in den Vereinigten Staaten vor und
bedeckt in den Wäldern oft in ungeheuren Mengen weithin die Baumäste,
indem es seine dunkeln, roßhaarähnlichen Zweige wie Bartflechten um
sie spinnt und die die Nahrung und das Wasser aus der Luft an sich
reißenden Luftwurzeln tief herabhängen läßt. Letztere werden neuerdings
in Menge gesammelt und kommen besonders aus den Südstaaten Nordamerikas
als Louisianamoos in den Handel.
In Westindien und Brasilien wird von dem unserem Seidelbaste
nahe verwandten Strauche Funifera utilis, der vielfach
zur Faser[S. 61]gewinnung angepflanzt wird, der einem Spitzengewebe
ähnliche rahmweiße, als Spitzenrinde bezeichnete Bast zum Flechten
von Frauenhüten, Kragen und anderen Gegenständen verwendet,
während derjenige des in Ostindien auf trockenen, felsigen Hügeln
wachsenden Strauches Marsdenia tenacissima aus der Familie
der Asklepiadazeen oder Seidenpflanzengewächse als Jiti oder
Rajmahalhanf viel gebraucht wird. Er ist nicht so kräftig
wie unser Hanf, übertrifft ihn aber an Elastizität bedeutend. Seine
häufigste Verwendung ist die zu Fischnetzen, denn dieser Faserstoff
besitzt eine sehr große Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit.
Ein anderer, grober Faserstoff ist der als Dunchi bezeichnete
Bast eines südasiatischen, bis 2,4 m hohen Strauches Sesbania
aculeata aus der Familie der Leguminosen, der in Indien und China
auf nassem Boden und ohne Sorgfalt, die er auch nicht beansprucht,
kultiviert wird. Bisweilen kommt er auch unter dem in Bengalen üblichen
Namen Jayanti in den Handel.
Der Bast des auf Tahiti roa genannten strauchartigen
Nesselgewächses Urtica argentea liefert die blendend weißen,
glänzenden, zu Seilerartikeln und Luxusgegenständen verarbeiteten
Roafasern, während die ebenfalls überall in Ozeanien
anzutreffenden Schraubenpalmen Pandanus utilis (ursprünglich in
Madagaskar zu Hause) und odoratissimus (deren wohlriechende,
schon in den ältesten indischen Sanskritgedichten unter dem Namen
kekata erwähnten Blüten mit Öl ausgezogen ein in Indien sehr
geschätztes Parfüm liefern) die sehr zähen, zur Anfertigung von Matten
und Seilen verwendeten Pandanusfasern liefert.
Häufig wird in verschiedenen Gegenden Ostindiens die daselbst heimische
einjährige Hanfrose Hibiscus cannabinus angepflanzt. Diese bis
2,4 m hohe strauchartige Eibischart mit stacheligem Stengel
liefert in den tief gelappten, säuerlich, etwas herb und schleimig
schmeckenden Blättern ein von den Eingeborenen häufig gegessenes
Gemüse, aus den Samen wird Brenn- und Speiseöl gepreßt, während der
braune, rauhe Bast der Stengel, der schon in der Sanskritliteratur als
nalika erwähnt wird, als geschätztes Spinn- und Flechtmaterial
dient. Es ist dies der als indischer oder Gambohanf, der
auch als Jute von Madras in allerdings mangelhafter Zubereitung in den
Handel gelangt. Er ist weich und geschmeidig, weiß mit einem Stich ins
Graugelbe, und besteht aus wenig glänzenden, feinen und gröbern, 10
bis 90 cm langen, aber nicht sehr festen Fasern. Obschon mehr
dem[S. 62] Flachs und den besseren Hanfsorten als der Jute ähnlich, wird er
auch Bastardjute genannt und bisweilen der Jute beigemengt. Obgleich
die Hanfrose das ganze Jahr hindurch wächst, wird sie doch nur in der
kühlen Jahreszeit gesät. Drei Monate danach steht sie in Blüte und muß
dann zur Gewinnung des Bastes geschnitten werden.
Ihm sehr ähnlich und nicht selten unter seinem Namen gehend ist der von
einer nahe verwandten Eibischart, Hibiscus sabdariffa, gewonnene
Rosellahanf, dessen Hauptproduktionsgebiet die Präsidentschaft
Madras in Südindien ist. Deren Blätter dienen als Salat, während
die fleischigen Blütenkelche von angenehm säuerlichem Geschmack in
Ostindien zur Bereitung von Gelee und Torten, in Westindien, wohin die
Nutzpflanze neuerdings gebracht wurde und ebenfalls ziemlich häufig
angepflanzt wird, auch als Bestandteil von kühlenden Getränken benutzt
wird.
Eine noch sehr viel wichtigere Pflanzenfaser Ostindiens als die
ebengenannten ist die Jute, die ihren Namen von dem schon
im Sanskrit als djuta erwähnten indischen djut d. h.
Faser erhielt. Zuerst wurde dieser in Indien seit den ältesten Zeiten
verwendete Faserstoff durch den Engländer Dr. Roxburgh bekannt,
der im Jahre 1795 an die Direktion der ostindischen Handelsgesellschaft
in London einen Ballen Faserstoff sandte, den er als „Jute“ der
Eingeborenen bezeichnete. Aber erst im zweiten Viertel des 19.
Jahrhunderts fand dieses neue Flechtmaterial in England Beachtung,
nachdem man um 1830 in Dundee begonnen hatte, es in der Technik zu
verwenden. Die Jute wird von einer mit unsern Linden verwandten
einjährigen Pflanze (Corchorus capsularis) gewonnen, die im
feuchtwarmen Klima Bengalens heimisch ist und dort in großer Menge
zur Bastgewinnung angepflanzt wird. Für Bengalen und teilweise auch
das benachbarte Assam spielt diese Gespinstpflanze fast dieselbe
Rolle wie die Baumwolle in den Südstaaten der nordamerikanischen
Union. Die Jutepflanze wird 1,5–4,6 m hoch und gelangt in zwei
Spielarten mit hellgrünen oder rötlichen Stengeln und Blattrippen
zum Anbau. An den 2–4 cm dicken Stengeln sitzen gezähnelte
Blätter und weißlich-gelbe Blüten in Trauben geordnet, die runzelige,
kirschengroße, kugelige bis zylindrische Kapseln liefern. Man
gewinnt die sehr festen Fasern von den vier Monate nach der im März
stattfindenden Saat geschnittenen Stengeln, indem man sie von den
Seitentrieben, Blättern und Stengeln befreit und in langsam fließendem
Wasser einer leichten Fäulnis unterwirft. Schon nach einigen Tagen kann
dann der Bast[S. 63] von dem leicht brechenden Holz und der übrigen Rinde
befreit werden. Die besten Sorten sind weißlichgelb bis silbergrau, von
seidenähnlichem Glanz, beim Anfühlen glatt und weich. Die schlechten
Sorten sind bräunlich, hart und holzig. Die Jutefasern werden dann
vermittelst hydraulischer Pressen in Ballen von 180 kg
zusammengepreßt, von denen Bengalen allein jährlich 5,6 Millionen
Stücke ausführt. Über Bombay gingen 1890 1500 Millionen kg
derselben im Werte von 160 Millionen Mark hauptsächlich nach England,
um speziell in Dundee zu gröberen Stoffen wie Decken, Portieren,
Sofaüberzügen, aber auch Hemden verarbeitet zu werden.
Vor wenig mehr als einem Jahrhundert trug die ärmere Bevölkerung
Bengalens noch ausschließlich aus selbst verwebten Jutefasern
hergestellte Kleider, die aber als etwas grob mit der Einführung
billiger europäischer Baumwollwaren mehr und mehr an Beliebtheit
einbüßten. Dafür stieg ihre Wertschätzung in Europa. Da nun
infolgedessen der Jutebedarf hier immer mehr steigt und die
Juteproduktion Bengalens trotz ihrer beständigen Steigerung nicht
genügt, so ist man bemüht, die Kultur der Jutepflanze auch anderwärts,
so in Deutsch-Ostafrika, einzuführen, wo das von der Pflanze verlangte,
gleichmäßig warme, feuchte Klima vorhanden ist und bei rationellerem
Anbau, als er in Nordindien gebräuchlich ist, sehr gute Resultate zu
erwarten wären.

Bild 62. Die Jutepflanze
(Corchorus capsularis).
Sehr nahe verwandt mit dieser Jutepflanze ist die in Südchina oder
Hinterindien heimische Corchorus olitorius, ebenfalls eine
einjährige, 1,5–3 m hohe Pflanze mit gelben Blüten, die sich
frühzeitig[S. 64] als Gemüsepflanze in Indien verbreitete. Sie kam dann
später durch die Perser nach Vorderasien und durch die Araber etwa zu
Beginn der christlichen Zeitrechnung nach Syrien und Ägypten und wird
jetzt noch im östlichen Mittelmeergebiet, wie auch in den Tropen der
ganzen Welt als Gemüsepflanze gebaut, während die Kultur dieser Art als
Faserpflanze auf Bengalen beschränkt blieb.

Bild 63. Die Ramiepflanze
(Boehmeria tenacissima).
Ein ebenfalls sehr wichtiger südasiatischer Faserstoff ist die
Ramie, im malaiischen Archipel so genannt. Unter diesem Namen
lernten sie die Holländer in Java, wo sie schon lange in ziemlicher
Menge produziert wird, kennen und vermittelten sie den übrigen Völkern
Europas. In Indien heißt der Faserstoff rhea und in China
tschu-ma. Die seidenglänzenden, geschmeidigen, auffallend
starken Fasern wurden schon seit undenklichen Zeiten in Indien, Siam,
Kambodscha, Cochinchina, Südchina, Japan und der ganzen südasiatischen
Inselwelt zu allerlei Geweben, vom groben Segeltuch und Fischnetz bis
zum eleganten, feinen als Kantonseide oder Seersucker in den Handel
gelangenden Tuch, verarbeitet. Der erste Ballen davon kam 1810 nach
England. Er wird von einer 1,9–2,3 m hohen, ausdauernden, nicht
brennenden Nessel Ostasiens (Boehmeria tenacissima) gewonnen.
Ein Wurzelstock der Pflanze treibt bis zu 15 Stengel aus mit ziemlich
spärlichen, wolligen Blättern. Die Ernte erfolgt, sobald die Oberhaut
der Stengel dunkelbraun geworden ist. Die Fortpflanzung geschieht
durch Wurzelausläufer oder Stecklinge; die Pflege der in Reihen
gestellten Pflanzen beschränkt sich auf Lockerung und Reinhaltung
des Bodens von Unkraut. Sie wird hauptsächlich in China, Japan, den
Philippinen, Indien und im Süden der Vereinigten Staaten angebaut.
Das Rohmaterial für die besonders in Frankreich, dann auch in[S. 65]
Deutschland (Emmendingen) und in der Schweiz etablierten europäischen
Ramiespinnereien wird ausschließlich aus China bezogen.
Nicht minder häufig wird das von der nahe verwandten Boehmeria
nivea gewonnene Chinagras in ganz Ostasien, Indien und den
Sundainseln angepflanzt. Die durchschnittlich 1,5 m hohe Pflanze
ist ebenfalls ausdauernd und wird durch Wurzelstöcke vermehrt; sie
besitzt auf der Unterseite weißlich gefärbte Blätter. Unter günstigen
Bedingungen in den Tropen sind die in Mehrzahl aus einem Wurzelstock
hervorgehenden Stengel in 3–4 Monaten schnittreif und können daher
zwei- bis dreimal im Jahre geerntet werden. Sie liefern einen
gelblichen Bast, der gleicherweise einer leichten Verwesung unterworfen
wird, bevor man ihn nach England, wohin er vorzugsweise gelangt, zu
„Grasleinen“ verarbeitet, aus welchem man außerordentlich dauerhafte
gröbere und feinere Gewebe herstellt. Chinas Ausfuhr davon beträgt
durchschnittlich 11 Millionen kg jährlich, wovon Deutschland
etwa 600000 kg im Wert von über 400000 Mark einführt.
Alle Nesseln enthalten sehr feste Bastzellen in ihren Stengeln, weshalb
man sie früher, bevor man die besseren ausländischen Faserstoffe
einführte, auch bei uns als Gespinstpflanzen schätzte und sogenanntes
„Nesseltuch“ daraus herstellte. Einer der größten Gelehrten
des Mittelalters, Albertus Magnus (eigentlich Graf von Bollstädt,
1193–1280), ist der erste, der die gemeine Brennessel (Urtica
urens) als Gespinstpflanze erwähnt. Er nennt sie mit Flachs und
Hanf zusammen, fügt aber hinzu, daß Nesselgewebe auf der Haut Jucken
verursache, was flächsenes und hänfenes nicht tue. Neuerdings ist
es nun einer Wiener Firma gelungen, auf einfache, billige Weise die
Brennessel zu einer vorzüglichen Weberfaser zu verarbeiten. Aus
100 kg Nesseln werden 13 kg Fasern von sehr guter Qualität
im Werte von 9 Kronen gewonnen. Da sie die Festigkeit der Bastfasern
und die Geschmeidigkeit der Baumwolle besitzen, kann dieses billige
inländische Material, das aus dem an sonst für Kulturpflanzen
unbenützbaren Orten wachsenden Unkraut gewonnen wird, ganz gut mit der
ausländischen Ramie konkurrieren.
Gleicherweise wurde einst aus dem 1–1,25 m hohen Stengel der
wildwachsenden Malve (Malva officinalis) oder weißen
Pappel (mittelhochdeutsch papele) eine Gespinstfaser gewonnen,
die nach dem Zeugnisse von Papias und Isidor, dem Bischof von Sevilla
(gestorben 636), auch zur Herstellung von Kleidern verwendet wurde.
Deren Blüten geben eine weinrote Farbe, und wenn daher der um 800
v. Chr.[S. 66] lebende Franke Angilbert von der Tochter Karls des Großen
Gisala berichtet, sie habe in einem malvenen Kleide geprangt, so kann
damit sowohl der Stoff, als die Farbe gemeint sein. Immerhin ist es
wahrscheinlich, daß der Stoff des Gewandes aus Malvenfasern bestand.
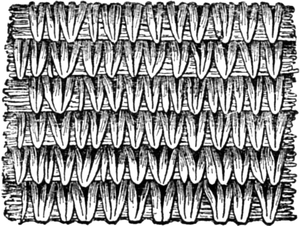
Bild 64. Stück einer aus Binsen geflochtenen Matte aus
dem neolithischen Pfahlbau von Wangen am Bodensee. (⅔ natürl. Größe.)
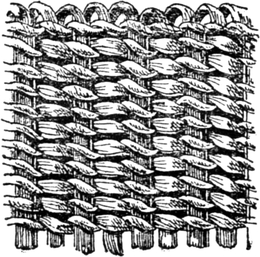
Bild 65. Geflecht aus schmalen Riemen von Baumbast aus
dem neolithischen Pfahlbau von Wangen am Bodensee. (⅔ natürl. Größe.)
In vorgeschichtlicher Zeit und im frühen Altertum trug man auch bei
uns in Europa aus Baumbast verfertigte Kleider. So berichtet
der ums Jahr 50 n. Chr. lebende römische Geograph Pomponius Mela,
der uns eine Erdbeschreibung hinterließ, daß die Germanen teils
Wollmäntel, teils solche aus Baumbast trugen. Und wenn diese Sitte
auch nicht mehr aus späterer Zeit bezeugt ist, so hat doch die
Sprache wenigstens unverstandene Erinnerungen an den alten Brauch
bewahrt. Der Bast wurde vornehmlich von der Linde genommen, wie die
noch spät vorkommende Doppelbedeutung des Wortes lint als
Lindenbaum und Bast zugleich lehrt; und wenn altnordisch lind
der Gürtel bedeutet, so ist dieser eben in den ältesten Zeiten aus
Lindenbast hergestellt gewesen, wie gleicherweise eine noch späte
Glosse (Erklärung eines dunkeln, veralteten Wortes) limbus bast
auf alte Verwendung dieses Stoffes zu Kleiderbesatz und ein Zeitwort
basten, d. h. schnüren, nähen, flicken, auf die Anwendung von
Bastfaden in der Vorzeit deutet. Noch heute ist dieses Wort als basteln
für sorgfältiges Verrichten von irgendwelcher feiner Handfertigkeit bei
uns gebräuchlich. Zudem weisen auf die alte Technik des Bastflechtens,
die uns schon bei den neolithischen Pfahlbauern der Schweiz in hoher
Vollendung und in den mannigfaltigsten Produkten wie Mänteln, Matten,
Körben usw. entgegentritt, zwei Wörter hin, die später gleichbedeutend
mit weben wurden, aber ursprünglich nur das enge Zusammenfügen und
Verschlingen der groben Baststränge gemeint haben können, nämlich[S. 67]
dringen für das Drehen und feste Anlegen des Flechtmaterials, wie noch
mehrere alte Belege verraten, später im Sinne zwischen Flechten, Wirken
und Weben schwankend, und briden für Zwängen, Zusammenfassen,
das im Mittelhochdeutschen aber sowohl für das Netzflechten, als für
das Bortenwirken und Stoffweben gebraucht wurde.
Den Baumbast als Flechtmaterial hat später die Leinfaser, und diese
dann zum größten Teil die Baumwolle verdrängt, welche heute das
am meisten benutzte Gespinstmaterial ist und deshalb wegen ihrer
ungeheuren Bedeutung für die heutige Menschheit in einem besonderen
Abschnitt gewürdigt werden soll. Sie ist aber durchaus nicht die
einzige technisch verwendete Pflanzenwolle. Eine solche liefern
uns verschiedene Wollbäume, die in den tropischen Wäldern der ganzen
Erde wachsen; sie kann aber wegen ihrer Sprödigkeit und der geringen
Länge ihrer Fasern kaum versponnen werden und wird deshalb seit langem
von den betreffenden Eingeborenen als Polstermaterial verwendet.
Die gebräuchlichste Pflanzenwolle außer der Baumwolle ist die
Seidenbaumwolle, im Sudan Kapok genannt. Sie stammt
vom Seidenwollbaum (Ceiba pentandra), der nicht nur in Afrika
überall wächst, sondern auch in Brasilien, dann in ganz Südasien und
Indonesien, vorkommt. Hier pflanzen ihn die Eingeborenen nicht, da sie
ihren Bedarf an Seidenwolle von den wilden Beständen decken können.
Dagegen wird der Kapokbaum außer in Ostafrika in besonders ausgedehntem
Maße in Niederländisch-Indien, speziell Java, und neuerdings auch auf
Neuguinea als Nebenkultur auf Kaffee- und Teeplantagen, als Stützbaum
für Pfeffer und Vanille oder als Schattenbaum zur Einfassung von
Straßen an Wegrändern in etwa 5 m Abstand von den Europäern
angepflanzt. Er ist ein fast im ganzen Tropengürtel verbreiteter
großer Baum aus der Familie der Bombazeen mit starkem, geradem
Stamme und breiten, oberirdischen Brettwurzeln, aber sehr weichem,
von den Eingeborenen zu Kähnen ausgehöhltem Holz, dessen Rinde bei
jungen Bäumen mit starken Stacheln besetzt ist, handförmig geteilten
Blättern und in Büscheln angeordneten, ziemlich großen, weißen
Blüten. Die Frucht ist eine 15 cm lange und 6 cm dicke,
länglichrunde, gurkenähnliche, holzige, fünffächerige, braune Kapsel,
welche in fünf Klappen aufspringt. Darin sind die Samen in kugelige
Bäusche von weißen, seidenglänzenden Fasern eingebettet, welche sich
beim Öffnen der Frucht ausbreiten und zu deren Verbreitung durch den
Wind beitragen. Und zwar geht diese seidige Wolle nicht wie die der
Baumwolle von den Samen, sondern von der[S. 68] inneren Fruchtwand aus, sie
ist also keine Samenwolle, sondern ein Gewebe der Fruchtkapsel.
Da der Kapokbaum keinerlei Pflege beansprucht und in jedem Boden,
im Tieflande, wie in Höhenlagen bis 1000 m gedeiht, so ist
seine Kultur eine sehr einfache. Er verträgt reichliche Niederschläge
und entwickelt sich, wo ihm solche geboten werden, besonders üppig;
aber er nimmt auch mit spärlicherem Regenfall vorlieb und übersteht
auch längere Trockenzeiten verhältnismäßig gut. Er kann leicht durch
Stecklinge, wie auch durch Samen vermehrt werden und wächst sehr
rasch. Im 4. Jahre wird er zuerst tragbar, bringt aber selten vor
dem 6. Lebensjahre größere Erträgnisse. Ein großer Kapokbaum bringt
jährlich 1000–1500 Wollkapseln zur Reife, die 1–1,5 kg reine
Pflanzenwolle ergeben. Wenn die Wollkapseln sich zu öffnen beginnen,
werden sie geerntet, indem sie mit langen Bambusstangen, an denen sich
oben ein Häkchen befindet, gepflückt werden. Man läßt sie dann auf
einer reinen Unterlage in der Sonne nachreifen, so daß sie sich ganz
öffnen. Dann wird die Seidenbaumwolle zugleich mit den Samen durch
Frauen und Kinder aus der Fruchtkapsel herausgenommen. Nachdem diese im
Verlauf eines oder einiger Tage an der Sonne völlig ausgetrocknet ist,
wird sie entkernt, was früher von Hand geschah, neuerdings aber durch
Maschinen, wie sie zur Entkernung von Baumwolle dienen, besorgt wird.
Das wichtigste Erzeugungsgebiet für Kapok ist Niederländisch-Indien,
und zwar speziell Java, das jährlich etwa 5 Millionen kg in
den Handel bringt. Der Hauptmarkt Europas dafür ist Amsterdam, wo das
Kilogramm nicht unter 1 Mark zu haben ist.
Dem Kapok ähnlich, nur braun statt weiß, ist die Wolle der verwandten
Ochroma lagopus, ebenfalls eines großen Baumes mit gelappten
Blättern und an den Enden der Zweige stehenden großen Blüten. Die
ganz analog gebauten Früchte sind 20 cm lang und 5 cm
dick. Die Wolle dieser beiden Bombazeenarten eignet sich wegen ihrer
Glätte und Kürze nicht zum Spinnen, gibt aber ein ausgezeichnetes
Polstermaterial für Möbel, Matratzen, Kissen u. dergl., wird aber
auch, da äußerst leicht, zur Herstellung von Schwimmgürteln und
Rettungsringen benutzt. Gepreßter Kapok trägt nämlich das 36fache
seines Gewichtes. Neuerdings findet er auch in der Chirurgie statt
Baumwolle Verwendung.
Die Samen vieler Pflanzen, z. B. des allbekannten Löwenzahns, sind mit
einem Haarschopf versehen, um vom Winde möglichst weit weg[S. 69]getragen
zu werden. Manche dieser Haarschöpfe bestehen aus langen, seidigen
Haaren, die bisweilen als Pflanzenseide in den Handel kommen.
In Westindien und Südamerika wird solche Seide von Asclepias
curassavica gewonnen. Eine Strophantusart Senegals liefert
eine rötlichgelbe, feine Seide. Die beste Pflanzenseide aber, die
merkwürdigerweise am wenigsten zur Verwendung gelangt, wird in Indien
aus den Samenhaaren von Beaumontia grandiflora gewonnen. Sie ist
nicht nur rein weiß und prächtig glänzend, sondern auch beinahe so fest
wie Baumwolle, während sich sonst die Pflanzenseide gerade durch ihre
Brüchigkeit in Mißkredit setzt. Die einzelnen Samenhaare sind bis
5 cm lang und lassen sich leicht vom Samen abtrennen.
Während diese Seidenpflanze ungerechtfertigterweise so wenig beachtet
wird, ist eine andere Seidenpflanze, die aus Nordamerika stammende
Asclepias syriaca, eine unglückliche Liebe aller Produzenten, an
die immer wieder fruchtlose Spinnversuche verwendet werden, obgleich
die Unbrauchbarkeit der Faser zu Textilzwecken schon längst erwiesen
ist. Die unselige Pflanze, die auch als Zierpflanze in unseren Gärten
wächst, hat wohl ziemlich lange, schön glänzende Samenhaare in ihren
Balgkapseln, aber deren Brüchigkeit ist so groß, daß die Faser für
sich überhaupt nicht versponnen werden kann. Mit Baumwolle zusammen
versponnen, fällt die trügerische Seide beim ersten Waschen aus dem
Gewebe heraus. Nicht einmal zur Herstellung von Schießbaumwolle ist sie
geeignet, da sie nicht schnell genug abbrennt und zudem noch viel zu
viel Asche enthält.
Groben Pflanzenbast, den man für die Herstellung von Besen, Pinseln,
Bürsten u. dgl. mehr verwendet, liefern eine ganze Anzahl von Palmen in
der Piassavefaser. Es ist dies ein aus dem spanischen piaçaba
verändertes Wort für die Fasern der südamerikanischen Piassavepalme
(Attalea funifera), die zuerst in den Handel kamen; doch
erhält man heute solche Piassave auch von anderen Palmenarten, wie
von der westafrikanischen Weinpalme (Raphia vinifera), von der
Palmyra- und der Kitulpalme auf Ceylon (Borassus flabellifer und
Caryota urens) und von der madagassischen Palme Dictyosperma
fibrosum. Sie besteht aus den oft mehr als 1 m langen,
festen, bis bindfadendicken, rotbraunen oder dunkelfarbigen Strängen,
welche in großer Zahl am Stamme dieser Palmen entspringen und entweder
aufgerichtet sind oder mit ihren Enden herabhängen, wobei sie den
betreffenden Palmstämmen ein überaus charakteristisches Aussehen
verleihen. Diese höchst eigenartigen Gebilde sind nichts anderes,
als die äußerst wider[S. 70]standsfähigen Leitbündel (Blattadern) der
Blattscheiden und Blattstiele, welche auch nach dem Absterben und der
Verwesung der Blätter am Stamme erhalten bleiben.
Die südamerikanische Piassavepalme wird nirgends kultiviert, sondern
die Faser wird ausschließlich von wildwachsenden Bäumen geerntet.
Sie wächst in ganzen Hainen vorzugsweise auf sandigem Boden, ist
stammlos, mit großen, dickstengeligen Blättern, an deren Basis die von
den abgefallenen Blättern stehen gebliebenen, zerschlitzten, festen
Leitbündel eine Hülle von groben Borsten bilden. Nach dem Ablösen
wird die Masse zuerst einige Tage in Wasser aufgeweicht, bis das noch
daran hängende weiche Gewebe abgefault ist; darauf werden die Fasern
getrocknet, gereinigt, gehechelt, in bestimmte Länge geschnitten und
nach der Qualität sortiert. Die Piassavepalmenbüsche liefern je
5–10 kg Fasern jährlich und bleiben bei schonender Behandlung bis 30
Jahre lang ertragsfähig. Die Piassave dient zur Herstellung von Besen,
Bürsten und Seilerwaren. Zur Zeit der alten Kolonialherrschaft betrieb
die portugiesische Regierung die Herstellung dieses Erzeugnisses des
Landes Brasilien als Monopol, das für sie sehr einträglich war. Denn
außer der Piassave erzeugt die Palme eine große Anzahl nußartiger
Früchte, die dicht über dem Erdboden erscheinen und die Größe eines
Truthuhneis erreichen. Diese sogenannte Coquilhonüsse finden zur
Fabrikation von Knöpfen, Rosenkranzperlen, Zigarrenspitzen usw.
Verwendung. Außerdem gewinnt man von ihnen ein wertvolles Schmieröl,
das besonders für Uhren und ähnliche feine Mechanismen geeignet ist.
Hauptexporthafen der Erzeugnisse der Piassavepalme ist Bahia nördlich
von Rio de Janeiro, das jährlich etwa 140000 kg Fasern und
60000 kg Nüsse exportiert.
Den besonders von den Gärtnern als geschmeidiges und dennoch sehr
starkes Material zum Binden ihrer Pfleglinge an Stützen verwendete
Raphiabast gewinnt man von der an der ostafrikanischen
Tropenküste und auf Madagaskar wachsenden Raphia ruffia. Es
ist dies eine hohe Palme mit 10–15 m langen Blättern, deren
Fiedern oft 2 m lang werden. Sie sind von mächtigen, mit den
Epidermiszellen eng verwachsenen Bastrippen durchzogen, die sich mit
der Epidermis (Oberhaut) in Streifen abziehen lassen. Man schneidet die
jüngeren Blätter ab, wenn sie im Begriffe stehen sich zu entfalten,
entfernt die Mittelrippen der Fiedern und zieht die Epidermis zuerst
von der Unterseite, dann von der Oberseite ab. Die erhaltenen
7–9 mm breiten und 1–2 m langen sandfarbenen Streifen werden[S. 71]
an der Sonne getrocknet. So erhält man einen hellgelben, zähen und
geschmeidigen Bast von höchst bedeutender Zerreißungsfestigkeit, der zu
allerlei Flechtwerk und in der Gärtnerei als Material zum Binden und
Okulieren benutzt wird. Einzig gegen Feuchtigkeit ist er empfindlich.
Den besten Raphiabast liefert Madagaskar. Er wird in solcher Menge von
dieser Insel ausgeführt, daß man sich genötigt sah, die Ausfuhr durch
ein Gesetz zu beschränken, um einer Ausrottung der Palme vorzubeugen.
Die westafrikanischen Raphiaarten liefern zwar auch Raphiabast, doch
zerfasert dieser leichter als der ostafrikanische.
Technisch noch wichtiger als die eben genannten Faserstoffe ist die
im Handel als Coïr bezeichnete Kokosnußfaser, die aus
den äußerst zähen und unverwüstlichen Leitbündeln besteht, welche in
einer etwa zwei Finger dicken Schicht die sehr hartschalige eigentliche
Kokosnuß mit drei Löchern an der Spitze umgiebt. Man gewinnt sie
in allen Ländern, welche Kokospalmen ziehen, so vor allem an den
Küsten Indiens und der indonesischen Inselwelt, als Nebenprodukt bei
der Gewinnung der als Kopra bezeichneten getrockneten, fetthaltigen
Kerne, indem man nach dem Öffnen der Nüsse die Faserschicht abschält
und sie zur Isolierung der Fasern im Wasser einer leichten Fäulnis
aussetzt, ein Prozeß, der zwischenhinein zur Beförderung der Ablösung
derselben durch Klopfen mit hölzernen Hämmern unterbrochen wird.
Merkwürdigerweise erhält man bei Anwendung von fließendem Wasser
ein schöneres und helleres Material als in stehendem Wasser. Auch
der Salzgehalt desselben hat einen Einfluß, indem die Fasern bei
zunehmendem Salzgehalt dunkler rot werden. Tausend Kokosnüsse ergeben
bis 60 kg feine, zu Stricken und Tauen und zur Herstellung
von Matten, Läufern, Teppichen usw. verwendbare und bis 12 kg
dicke, kürzere Fasern, aus denen man vorzugsweise Bürsten und Pinsel
verfertigt. Dieser Coïr ist entschieden die für gröbere Geflechte
wichtigste Pflanzenfaser, von der die Insel Ceylon allein etwa 70
Millionen kg jährlich ausführt. Obschon außerordentlich fest,
ist er dennoch sehr leicht und gegen Wasser äußerst widerstandsfähig.
Daraus verfertigte Taue und Stricke sehen zwar nicht so schön aus wie
hänfene, nehmen auch keinen Teer an, aber sie schwimmen auf dem Wasser
und sind fast unverwüstlich, weshalb sie sich namentlich zu Ankertauen
sehr eignen. Für feinere Geflechte wird der Coïr an der Sonne oder
durch schwefelige Säure gebleicht.
Die harte Steinschale der Kokosnuß, die nicht nur von den Eingeborenen
zu allerlei Gefäßen und Schöpflöffeln, sondern wegen ihrer[S. 72] Festigkeit
und Dauerhaftigkeit in der ganzen Kulturwelt eine ausgedehnte
Verwendung für Drechsler- und ähnliche Arbeiten gefunden hat,
verspricht in der Zukunft den Coïr noch an Bedeutung zu übertreffen.
Auf der Suche nach einem Stoff, der besser und nachhaltiger als
Wasser, das seine radioaktiven Eigenschaften außerordentlich schnell
verliert, zur Aufspeicherung der Radiumemanation für ärztliche Zwecke
dienen kann, hat vor zwei Jahren ein amerikanischer Gelehrter,
Rutherford, gefunden, daß die aus der Kokosnuß hergestellte Kohle
die gasförmige Ausstrahlung des Radiums, Thoriums oder Aktiniums
ausgiebig aufzuschlucken und durch längere Zeit festzuhalten vermag.
Auf diesem Ergebnis hat Dr. Shober in Philadelphia weitere
Forschungen aufgebaut, die ergaben, daß Kokosnußkohle dreihundertmal
so radioaktiv ist als das Wasser und diese Eigenschaft wenigstens
zwei Wochen lang ganz beibehält. Die Herstellung der Radiumkokoskohle
ist sehr einfach und wenig kostspielig, da bei deren Bestrahlung
nichts von den kostbaren Radiumpräparaten verloren geht. Sie ist
ein vollkommen neutraler Stoff, der bei der innerlichen Darreichung
absolut harmlos und dennoch für manche Krankheitszustände sehr wirksam
ist, so daß dieser Umstand, nunmehr auf einfache und billige Weise
Radiumpräparate herzustellen, die Anwendung derselben in der Medizin
ganz außerordentlich erleichtert.
Außer diesen erwähnten Bastarten dienen die getrockneten und
zerschlitzten Blätter der verschiedensten Palmen- und Pandanusarten
den Eingeborenen zu den mannigfaltigsten Flechtereien in Form von
Matten, Körben usw. In ganz Südasien, Madagaskar und der Inselwelt
des Stillen Ozeans finden wir besonders Pandanus odoratissimus
teils wild, teils angebaut. Dieser palmenartige Strauch, dessen
3–5,5 m hoher Stamm stelzenartig auf zahlreichen Luftwurzeln
ruht, hat seine 1 m langen, starren, schwertförmigen Blätter
in schöner Schraubenlinie gestellt und trägt hängende, zapfenartige
Blütenstände, die ihres Wohlgeruches wegen in den Wohnungen aufgehängt
werden. Die mit einem Stein weichgeklopften Früchte geben einen
aromatischen Saft und liefern auf vielen Inseln, gebacken, ein würziges
Volksnahrungsmittel, das aber meist nur gegessen wird, wenn Mangel an
Brotfrucht herrscht. Die Blütenknospen und der untere Teil der Blätter
werden als Gemüse verspeist und aus den Fasern der Blätter werden
Matten, Segel, Schürzen, Körbe u. dgl. mehr geflochten. Gleicherweise
wird Pandanus utilis auf die mannigfaltigste Weise ausgenutzt;
auch dessen mandelartige Fruchtkerne werden gegessen.
[S. 73]
Wichtiger als sie ist für uns Europäer die südamerikanische
strauchartige Panamapalme (Carludovica palmata), aus
deren noch jungen, zusammengefalteten Blättern die nicht nur auf dem
ganzen amerikanischen Festlande und in Westindien, sondern neuerdings
auch bei uns so beliebten Panamahüte geflochten werden. Es ist dies
eine bloß 2–3 m hoch werdende Palme, die in Kolumbien, Ekuador
und Peru wild wächst und nicht kultiviert wird. Um ein möglichst
weißes Material zu erzielen, werden die in den Wäldern gesammelten,
unentfalteten Blätter zunächst kurz in heißes Wasser getaucht, dem der
Saft einiger Zitronen beigemischt wurde, dann werden sie, nachdem sie
aller Rippen und gröberen Fasern beraubt sind, zunächst im Schatten
und dann in der Sonne getrocknet und mit dem Nagel des rechten Daumens
in ganz schmale Streifen zerschlitzt, um zu Körbchen, Zigarrentaschen
usw., besonders aber zu Hüten geflochten zu werden. Der überaus hohe
Preis dieser sogenannten Panamahüte ergiebt sich nicht sowohl aus
der Schwierigkeit, als aus der Langwierigkeit ihrer Herstellung. Bei
täglich sechsstündiger Arbeitszeit braucht ein Arbeiter zum Flechten
eines gewöhnlichen 4 Mark-Hutes 6–7 Tage. Ein Hut im Wert von 5
bis 12 Mark beansprucht bereits 14 Tage, ein feiner, etwa 100 Mark
kostender sogar 6 Wochen Arbeitszeit. Am feinsten, leichtesten und
schönsten gearbeitet sind diejenigen von Montecristi, die auch von
allen die berühmtesten sind. Die gewöhnlichen derselben kosten 10–16,
die halbfeinen 20–30 und die feinen 40–200 Mark, ja noch mehr. Von
gleichfalls sehr guter Qualität sind die Hüte von Santa Elena, die
zwar nicht so fein, aber durch regelmäßiges, festes Flechtwerk, fein
geschlungenen Rand und rein weißes Material in hohem Maße ausgezeichnet
sind. Da sie über Panama exportiert werden, nennt man sie so, obschon
sie nicht dort hergestellt werden.
Weiter kommen für uns noch die Faserstoffe in Betracht, die der
Papierfabrikation dienen. Wie die Mexikaner bei der Eroberung ihres
Landes durch Fernando Cortez im Jahre 1519 außer Baumwolle die
Fasern der Agave als Material für Kleidungsstoffe, Papier, Bindfaden
und Stricken benutzten, so bedienten sich die Hindus zum Schreiben
ihrer heiligen Bücher der Palmblätter und teilweise auch eines aus
Birkenrinde verfertigten Papieres, während das uralte Kulturvolk
der Chinesen anfänglich Tafeln aus Bambusrohr, später Seide und
Papier aus der Rinde des Papiermaulbeerbaums und zuletzt aus
Baumwollumpen angefertigtes Büttenpapier zum Schreiben gebrauchten.
Der in China heimische, durch schöne, große Blätter ausgezeichnete
Papier[S. 74]maulbeerbaum (Broussonetia papyrifera) wird
gegenwärtig in größtem Maßstabe auch in Japan, China und auf vielen
Inseln des großen Ozeans nach Art der Weiden kultiviert, weil die
Innenrinde der zweijährigen Zweige das Material zu den außerordentlich
schönen, festen und haltbaren chinesischen und japanischen Papieren
gewährt, deren Festigkeit gestattet, sie wie gewebte Zeuge zu
Regenschirmen, Zimmerwänden, Taschentüchern usw., ja, mit Öl getränkt,
sogar zu wasserdichten Kleidungsstücken und statt Fensterglas zu
verwenden. Es ist dies ein Milchsaft führender Baum von 9–12,5 m
Höhe mit süßlich schmeckenden, fleischigen Beeren, die überall in
Ostasien gern gegessen werden.
Die alten Ägypter aber bedienten sich zur Herstellung ihres Papieres
der Stengel der Papyrusstaude (Cyperus papyrus), die
diesem Produkt überhaupt den Namen gab. Es ist dies eine ursprünglich
im tropischen Afrika heimische Sumpfpflanze, deren dreikantige,
fingerdicke Halme 5 m hoch werden und an ihrer Spitze eine
Kugel von hunderten, strahlenförmig auseinanderschießenden, dünnen
Zweigen mit den Blättern und Blütenrispchen tragen. Sie wächst in allen
Flüssen des tropischen Afrika in ungeheuren Mengen und beteiligt sich
an der Bildung der Pflanzenbarren, welche den Lauf der größeren Ströme
zuweilen verstopfen und die so undurchdringlich sind, daß Reisende auf
Dampfschiffen, die von ihnen eingeschlossen wurden, kaum mehr loskommen
konnten und der Gefahr des Verhungerns ausgesetzt waren.
Einst wuchs der Papyrus im alten Ägypten in Menge wild und wurde bei
dem zunehmenden Bedarfe seiner Stengel auch angebaut, besonders in
den zahlreichen Kanälen, die das sonst dürre, weil regenarme Land
durchzogen. Heute ist er aus diesem Lande gänzlich verschwunden
und ist erst wieder in Nubien am Oberlaufe des Nils und seiner
Zuflüsse zu treffen, wo er mit dem Ambatsch (Herminiera
elaphroxylon), einem bis 7 m hohen Hülsenfrüchtler mit
wundervollen Blüten, dessen Holz ungemein leicht und schwammig ist, so
daß die Eingeborenen ihre floßartigen Fahrzeuge daraus verfertigen, und
der Pistie (Pistia stratiotes), einer Wasserlinse von
riesigen Ausmessungen, jene erwähnten undurchdringlichen Pflanzenbarren
bildet.
Tafel 97.

Der Pineta genannte Pinienwald bei Ravenna.

Ein Papyrusdickicht am Flusse Anapo bei Syrakus auf
Sizilien.
Tafel 98.

(Nach Phot. von W. Busse in „Karsten u. Schenck, Vegetationsbilder“.)
Ein Kapokbaum in Togo. Auf der Wiese junge Ölpalmen.
❏
GRÖSSERES BILD
Die alten Ägypter bauten aus den Stengeln des Papyrus ebenfalls
floßartige Fahrzeuge. In einem solchen fuhr nach der altägyptischen
Sage die Göttin Isis über die Lotosblumen, weshalb auch die Krokodile
einem jeden Papyrusnachen mit heiliger Scheu ausweichen sollten.
Wenn nun der jüdische Prophet Jesaias, der seit 740 v. Chr.[S. 75] in
Jerusalem wirkte, ein „Wehe“ über das Volk, das in Fahrzeugen von
Papyrusschilf fährt, ausruft, so ist das ein Beweis, daß diese
altägyptische Sitte den Völkern des Altertums wohl bekannt war. Auch
Stricke und Taue wurden damit hergestellt. So wird schon in der Odyssee
ein Tau aus Papyrusbast (býblos) erwähnt, und der griechische
Geschichtschreiber Herodot meldet uns, daß, als der persische König
Xerxes, der seinem Vater Dareios 485 v. Chr. nachfolgte und vier Jahre
darauf mit einem Heer von einer Million Mann und einer Flotte von 1200
Schiffen zur Unterjochung Griechenlands aufbrach und zur Übersiedelung
seines Heeres nach Europa eine Schiffbrücke über den Hellespont
schlagen ließ, zum Befestigen der Schiffe Leinen- und Papyrustaue
verwendet wurden. Auch Körbe, Matten, Segel und andere Geflechte wurden
in Ägypten aus Papyrus angefertigt, ebenso Sandalen, die zu benützen
den ägyptischen Priestern ausschließlich erlaubt war. In einem Korbe
aus Papyrus setzte jene Jüdin nach dem Berichte im Alten Testament ihr
erstgeborenes Kind, das Mosesknäblein, in einem Papyrusdickicht am Nile
aus, wo er von der ägyptischen Prinzessin aufgefunden und an Sohnes
Statt angenommen wurde. In der Heilkunde brauchte man den Papyrusbast
zum Anlegen von Bandagen und zum Trocknen und Erweitern von Fisteln.
Aus dem Mark der Pflanze stellte man Lampendochte her. Die Asche
dieser Pflanze galt mit Wein eingenommen als Schlafmittel und
sollte, in Wasser aufgeweicht, Schwielen heilen. Die fleischigen
Grundachsen des Papyrus bildeten, wie wir früher sahen, ein wichtiges
Volksnahrungsmittel. Mit den pinselartigen Blütendolden schmückte man
die Tempel der Götter und flocht Kränze für deren heilige Bildsäulen,
wie für die zu ehrenden Könige. Plutarch erzählt, daß, als der König
Agesilaos von Sparta, einer der berühmtesten Feldherrn des Altertums,
nach verschiedenen Siegen über die Perser und Thebaner 361 einen Zug
nach Ägypten unternahm, er sich über einen ihm als Zeichen besonderer
Verehrung überreichten Papyruskranz so gefreut habe, daß er sich beim
Abschied vom Könige Ägyptens einen zweiten solchen erbat. Der um 200
n. Chr. in Alexandreia lebende Grieche Athenaios aus Naukratis in Ägypten
verspottete allerdings diejenigen, die Rosen in einen Kranz von Papyrus
einflechten; er fand dies ebenso lächerlich, als wenn jemand Rosen zu
einem Kranze von Knoblauch verwenden wollte.
So zahlreich auch die Verwendung der Papyrusstaude im alten Ägypten
war, so bestand doch späterhin ihre Hauptbedeutung darin,[S. 76] daß aus
ihr das allgemein gebräuchliche Schreibmaterial gewonnen wurde.
Heute noch lebt ihr Name in unserer Bezeichnung dafür: Papier fort.
Dieses Schreibmaterial, dessen sich schon die Priester der ältesten
ägyptischen Dynastien zum Aufschreiben ihrer Mitteilungen und Gebete
in heiligen Schriftzeichen, den Hieroglyphen, bedienten, wurde in
folgender Weise bereitet: Die schwammigen, dreikantigen Stengel
wurden in meterlange Stücke geschnitten, der Länge nach gespalten
und die einzelnen hautartigen Schichten von innen, wo die feinsten
Fasern lagen, nach außen vermittelst einer Nadel in dünnen Streifen
abgezogen, die zuerst ausgewaschen und dann mit Beigabe von etwas
Klebstoff — meist Kleber — auf Bretter ausgebreitet wurden, und zwar
schichtenweise zuerst neben- und dann übereinander. Hierauf wurde die
Masse durch Schlagen mit Hämmern gepreßt, getrocknet und schließlich
mit einer Muschel oder einem größeren Tierzahn geglättet. Selbst der
beste, durch Benetzen und Ausbreiten an der Sonne gebleichte Papyrus
war gelblich und gerippt, nicht glatt. Man erkannte an ihm deutlich
die quer übereinander gelegten Fasern. Gewöhnlich wurde mit der aus
Ölruß mit Wasser und arabischem Gummi hergestellten Tinte nur auf einer
Seite geschrieben, da die Farbe durchschlug. Um den zerbrechlichen
Stoff nicht zu knicken, wurde er gerollt und in einer Leinwandhülle
aufbewahrt, die wohl auch mit Pech überzogen war, um den Inhalt vor
Feuchtigkeit zu schützen.

Bild 66. Papyrusernte im alten Reich.
Darstellung aus dem Grabe des Ptah hotep (5. Dynastie. 2750–2625
v. Chr.)
(Nach Dümichen.)
Die Papierfabrikation ist in Ägypten eine uralte Kunst, die bereits
im alten Reiche zu hoher Blüte gelangt war. Im Grabe des Ptah hotep
aus der Zeit der 5. Dynastie (2750–2625 v. Chr.) finden wir eine
interessante Darstellung der Papyrusernte. Am Nil, dessen Ufer mit
einem prächtigen Flor von Lotosblüten mit Knospen und Blättern
eingefaßt ist, durch den sich träge ein Krokodil bewegt, sehen wir wie
die Papyrusstauden geschnitten und in dicken Bündeln auf den Rücken von
Männern zur Bearbeitung fortgetragen werden. Aber erst aus[S. 77] römischer
Zeit haben wir eine ausführliche Beschreibung der Papierbereitung
daraus durch den älteren Plinius (23–79 n. Chr.), der verschiedene
Sorten Papier (charta) beschreibt. „Das feinste Papier aus
den innersten Schichten der Papyrusstengel“, sagt er, „hieß in alter
Zeit das hieratische und wurde nur zu heiligen Schriften gebraucht.
Aus Schmeichelei nannte man es später Augustuspapier. Eine zweite,
etwas weniger feine Sorte heißt nach des Augustus Gemahlin Livia das
livianische Papier und erst die dritte heißt das hieratische Papier.
Die nächstfolgende, aus noch weiter außen befindlichen Schichten
der Papyrusstengel bereitete Sorte heißt die amphitheatrische. Aus
dieser stellt Fannius in Rom ein so vortreffliches Papier her,
daß das Erzeugnis seiner Fabrik fürstliches Papier heißt. Eine
geringere Qualität aus noch weiter außen befindlichen Schichten
der Papyrusstengel heißt die saitische nach der Stadt Sais (in
Unterägypten), wo eine schlechte Papyrussorte verarbeitet wird. Das
taniotische Papier kommt von den Schichten, die der Rinde noch näher
liegen, hat seinen Namen von einer Stadt und wird nicht nach der Güte,
sondern nach dem Gewichte verkauft. Das emporetische Papier taugt
nicht zum Schreiben, sondern bloß zum Einwickeln des guten Papiers und
anderer Waren. Die Breite der Papierbogen (plagula) ist sehr
verschieden. Die besten sind 13 Finger breit, die hieratischen 11,
die fannianischen 10, die amphitheatrischen 9, die saitischen sind
noch schmäler. Das emporetische Papier (Packpapier) ist nicht über 6
Finger breit. Außerdem kommt beim Papier die Feinheit, Dichtigkeit,
Weiße und Glätte in Anschlag. Zwanzig Papierbogen heißen im Handel ein
scapus. — Das augusteische Papier widerstand, wie es anfangs
zubereitet wurde, wegen seiner allzugroßen Feinheit dem Schreibrohr
nicht genügend, ließ auch die Schrift durchscheinen, so daß sie auf
der Rückseite an Lesbarkeit litt; es war auch so durchsichtig, daß es
nicht gut aussah. Diesen Fehlern hat Kaiser Claudius (Sohn des Drusus,
Stiefsohn des Augustus, 9 v. Chr. in Lyon geboren, ward 41 n. Chr.
nach Caligulas Ermordung von den Prätorianern zum Kaiser ausgerufen,
überließ sich ganz der Leitung seiner schlimmen Gemahlin Messalina und
der Freigelassenen Pallas und Narcissus, war schwelgerisch und träge,
doch Freund der Wissenschaften, errichtete große Bauten, wurde 54
durch seine zweite Gemahlin Agrippina mit einem Pilzgericht vergiftet)
dadurch abgeholfen, daß er die erste Lage auf dem Brette aus Schichten
zweiter Güte legen ließ und diese mit quergelegten Schichten erster
Güte decken ließ. Er vergrößerte auch die Breite der Bogen.“ Außer
der sehr feinen, weißen[S. 78] charta claudia und der ähnlichen
noch glatteren charta fannia unterschied man später noch die
charta salutatrix als viel begehrtes Briefpapier, dann die
charta macrocolla mit Blättern in Form langer Streifen und die
charta nigra, ein schwarzes Papier, auf welches die Schrift
farbig aufgetragen wurde.
So versorgte Ägypten im Altertum das ganze ausgedehnte Römerreich mit
seinem Papier, das selbst den Weg nach Gallien und Britannien fand. Da
nun aber der Papyrus nicht alle Jahre gleich gut gedieh, gab es öfter
erhebliche Preisschwankungen und bisweilen sogar Papierteuerungen.
So schreibt derselbe Plinius: „Es gibt Jahre, in denen der Papyrus
mißrät. Unter Tiberius (geb. 42 v. Chr., Stiefsohn des Augustus, durch
Heirat der Kaiserstochter Julia im Jahre 12 v. Chr. Schwiegersohn des
Augustus, wurde 4 n. Chr. von Augustus adoptiert und regierte, nachdem
er im Jahre 14 nach des Augustus Tod vom Senat als Kaiser anerkannt
worden war, bis 37, da er am 16. März auf seinem Schloß auf Kapri
bereits im Todeskampf durch Macro mit Kissen erstickt wurde) trat
so großer Mangel an Papier ein, daß eigene Beamte vom Senat mit der
Verteilung desselben beauftragt wurden, weil sonst die ganze Verwaltung
in Verwirrung gekommen wäre.“
Welche Dimensionen der Anbau und Verbrauch der Papyrusstaude und die
Papierfabrikation im alten Ägypten angenommen haben muß, kann man aus
dem riesigen Nachlasse von Papyrusrollen und aus den Zeugnissen der
Schriftsteller des Altertums entnehmen. Der Geschichtschreiber Diodor
berichtet uns, daß schon Ramses II. der 19. Dynastie (1292–1225
v. Chr.) in Theben eine sehr umfangreiche Reichsbibliothek errichten
ließ. Berühmt war im Altertum die von Ptolemaios Philadelphos
(regierte 285–247 v. Chr.) außer dem Museion in Alexandrien errichtete
Bibliothek, die es auf die erstaunliche Zahl von 400000 Papyrusrollen
brachte und erst von den Arabern verbrannt wurde. Mit dieser
alexandrinischen rivalisierte unter Eumenes II. (regierte 197–159
v. Chr.) und Attalos II. (folgte seinem Bruder 159 und starb als
Verbündeter Roms 138 v. Chr.) diejenige von Pergamon in Kleinasien mit
damals schon 200000 Bänden. Dies erregte die Eifersucht des ägyptischen
Königs Ptolemaios VI. Philometor (der von 181–145 v. Chr. regierte)
dermaßen, daß er ein Gesetz gegen die Ausfuhr des Papiers aus seinem
Lande erließ. Dies nötigte dann Eumenes, das nötige Schreibmaterial
aus besonders präparierten und mit einer Kreideschicht überzogenen
Schaffellen herstellen zu lassen.[S. 79] Dieses gelangte als charta
pergamena, d. h. pergamenisches Papier in den Handel, und daraus
wurde dann später die Bezeichnung Pergament. Dieser äußerst dauerhafte
Papierersatz spielte besonders im Mittelalter eine sehr wichtige Rolle
und hat sich zum Aufdruck von Doktordiplomen bis auf den heutigen Tag
im Gebrauch erhalten.
Die ägyptischen Papierfabriken, die unter Tiberius hoch besteuert
wurden, waren sehr gut eingerichtet und arbeiteten schon nach dem
Prinzip der Arbeitsteilung. Man unterschied da glutinatores
(von gluteum Kleber), d. h. Leimer, malleatores (von
malleum Hammer), d. h. Hämmerer usw. Während die Papyruspflanze
bei den alten Ägyptern natit hieß, nannten sie die Griechen
wahrscheinlich nach dem ägyptischen Wort papuro, d. h.
königlich, pápyros. Für den Bast der Papyruspflanze diente
die schon bei Homer und dann bei Herodot vorkommende Bezeichnung
býblos, woraus dann býblon für Schriftrolle wurde.
Aus dieser griechischen Bezeichnung machten die Römer, die die
Schriftrollen aus Ägypten durch griechische Vermittlung erhielten, ihr
biblium im Sinne von Buch, im Pluralis biblia lautend,
und aus der Aufschrift biblia sacra, d. h. heilige Bücher,
entstand dann unser Wort Bibel. Die einheimische alte Bezeichnung der
Römer für das Schriftstück war liber, d. h. Bast, weil sie als
ältestes Schreibmaterial „den Bast einiger Bäume“, wie sich Plinius
ausdrückt, benutzten, später aber auch zum Privatgebrauch auf Leinwand
und auf Wachs schrieben. Aus dem lateinischen liber im Sinne
von Schriftstück ging dann die französische Bezeichnung livre
für Buch hervor, während die deutsche Bezeichnung dafür von Buche
herrührt, aus deren Holz die Stäbe genommen waren, in welche die alten
Germanen die Runen einschnitten, die man zu allerlei Zauber und zur
Erforschung der Zukunft benutzte. Die Buchenstäbe mit den verschiedenen
Runen wurden dann gemischt und ein einzelner, der gelten sollte, daraus
hervorgezogen. Das war dann der entscheidende Buchenstab, nach späterer
Redeweise: der Buchstabe, und die Gesamtheit derselben das Buch.
Die blühende Papierindustrie Ägyptens wurde nun nicht, wie dies
gewöhnlich behauptet wird, infolge der Eroberung durch die Araber
vernichtet, sondern diese setzten sie zunächst fort und brachten die
von ihnen aus Ägypten nach Syrien verpflanzte Papyrusstaude am Ende des
9. Jahrhunderts nach Sizilien, wo sie dieselbe in dem danach Papireto
benannten Flüßchen bei Palermo ansiedelten, um sie ebenfalls zur
Papierfabrikation zu verwenden. Dort wuchs sie reichlich bis zum[S. 80] Jahre
1591, in welchem auf Veranlassung des damaligen Vizekönigs die ganze
Gegend wegen des vom Papireto ausgehenden Wechselfiebers trocken gelegt
wurde und damit auch der Papyrushain verschwand. Noch jetzt heißt jene
Örtlichkeit piano del papireto, d. h. Ebene des Papyrushains.
Heute findet sich der Papyrus in größeren Beständen nur noch am
Flüßchen Anapo bei Syrakus und im Süden und Osten jener Insel wild,
häufig jedoch als Zierpflanze in den Gärten der Reichen kultiviert. Die
Exemplare in den europäischen Gewächshäusern scheinen alle aus Sizilien
zu stammen, wo die Stengel des Papyrus nur noch zum Kalfatern der
Schiffe dienen.
Die Papyrusindustrie erlosch von selbst, als im Zeitalter der Kreuzzüge
durch die Vermittlung der Araber das chinesische Büttenpapier
nach Europa kam und man es hier selbst darzustellen vermochte. In China
bediente man sich nämlich schon längere Zeit eines anderen Papieres
als in Ägypten, indem schon im Jahre 123 v. Chr. der Ackerbauminister
Tsai-lün aus dem Bast des Papiermaulbeerbaums, aus chinesischem Gras
und sogar aus den Fasern des Bambusrohres Papier zu bereiten lehrte.
Ums Jahr 610 n. Chr. kam diese Kunst nach Korea und Japan. Unter den
chinesischen Kriegsgefangenen, die im Jahre 751 n. Chr. nach dem
damals muhammedanischen Samarkand kamen, befanden sich auch solche,
die sich auf die Papierfabrikation verstanden. Hier wurden sie zur
Ausübung ihrer Kunst angehalten und fabrizierten Papier aus dem ihnen
dazu zur Verfügung gestellten Material. Hier haben die Araber zum
erstenmal leinene und baumwollene Lumpen, sogenannte Hadern, zur
Papierfabrikation benutzt, indem sie dieselben nach einer Mazeration
in Wasser in Mörsern zerstampften und zu Papier preßten. Später wurden
dann an Stelle von Menschenhänden vom fließenden Wasser getriebene
maschinelle Einrichtungen als sogenannte Papierstampfen von ihnen zu
Hilfe genommen und in der Folge zu eigentlichen Papiermühlen ausgebaut.
Von Samarkand wanderte dieser von den Arabern aufgegriffene neue
Fabrikationszweig über Buchara und Persien westwärts nach Bagdad,
wo 794 ebenfalls die Papierbereitung eingeführt wurde. Die Bagdader
Papierfabriken versorgten bald das ganze Morgenland mit ihren
Erzeugnissen. Der Residenzstadt eiferte bald Damaskus nach, das im
10. Jahrhundert mit anderen kunstgewerblichen Gegenständen, wie
namentlich den nach jener Stadt benannten Damastgeweben, feinsten
Brokaten, Linnen- und Seidenstoffen, dann den weltberühmten Damaszener
Stahlwaren, vorzügliches Papier auf den Markt brachte[S. 81] und in Menge
sogar nach dem Abendlande vertrieb. Unter diesem Papier gab es die
verschiedensten Sorten von Schreibpapier, starkes und schwaches,
glattes und geripptes, weißes und farbiges, daneben Seiden- und
Packpapier. Neben diesem ungleich billigeren Schreibstoff —
der Vorbedingung für die Verbreitung von Bildung, Literatur und
Wissenschaft — mußten natürlich Papyrus und Pergament völlig
zurücktreten. Letzteres erhielt sich nur in Gegenden, wohin die
trefflichen arabischen Papiere nicht so leicht gelangen konnten,
noch länger im Ansehen. Über Ägypten verbreitete sich die arabische
Papierfabrikation aus Lumpen der nordafrikanischen Küste entlang nach
dem von den Mauren beherrschten Spanien, wo sie im Jahre 1154 in Jativa
bei Valencia ihren ersten Sitz in Europa aufschlug. Wahrscheinlich von
Italien her, das das arabische Papier nach den Ländern nördlich der
Alpen verhandelte und es mit der Zeit selbst zu fabrizieren lernte, kam
die Papiermacherkunst zu Ende des 13. Jahrhunderts nach Deutschland,
wo sich 1290 in Ravensburg, 1312 in Kaufbeuren, 1319 in Nürnberg, 1320
in Augsburg und 1380 in Basel die ersten Papiermühlen in Mitteleuropa
nachweisen lassen. Eine außerordentliche Begünstigung erfuhr die
Papiermacherei durch die Erfindung der Buchdruckerkunst durch den
Mainzer Johann Gensfleisch zum Gutenberg und die durch den Wittenberger
Augustinermönch Martin Luther begründete Kirchenreformation in
Verbindung mit dem durch die Renaissance aufgekommenen allgemeinen
geistigen Aufschwung. Da war es kein Wunder, daß das schöne,
geschmeidige und glatte Leinenpapier den brüchigen, rauhen Papyrus und
selbst das äußerst dauerhafte Pergament, das sich als Schreibmaterial
noch länger als jenes erhielt, bald ganz zum Schwinden brachte. Und mit
ihnen verschwand auch das bis dahin mit dem Papyrus aus Ägypten als
Schreibfeder in Bündeln in den Handel gebrachte ägyptische Rohr, das
als kálamos bei den Griechen und durch deren Vermittlung als
calamus bei den Römern Jahrhunderte hindurch im Gebrauch war.
Dieses Schreibrohr wurde aus der größten Grasart der Mittelmeerländer,
dem Pfeilrohr (Arundo donax), das bis 3,6 m Höhe und
2,5 cm Dicke erreicht und im Altertum besonders zu Pfeilen
benutzt wurde, in der Weise hergestellt, daß man die knotigen Halme
zuschnitt und an der Spitze spaltete. Dieses Rohr war das einst bei
allen Kulturvölkern am Mittelmeer allein gebräuchliche Schreibgerät und
wurde hauptsächlich im Delta Ägyptens, außerdem auch in Sumpfgegenden
Kleinasiens gewonnen. Erst in der römischen Kaiserzeit kam daneben
auch eine aus[S. 82] gerolltem Kupferblech hergestellte Nachahmung dieses
Schreibrohrs auf, von dem man je ein Exemplar in Herkulaneum, Mainz
und Ungarn fand. Doch war dies jedenfalls mehr eine Kuriosität,
die gegenüber dem leichten und weicher schreibenden Rohr nicht
aufkommen konnte. Erst um die Mitte des 7. Jahrhunderts wurde bei den
christlichen Kulturvölkern die bis dahin allgemein üblich gewesene
Schilfrohrfeder durch die bedeutend elastischere und deshalb eine
leichtere und besonders auch zierlichere und kunstvollere Schrift
erlaubende Gänsefeder ersetzt. Diese erhielt sich im Gebrauch bis
zu Anfang des vorigen Jahrhunderts, als die von dem Prager Aloys
Senefelder 1796 aus einem Stück gehärtetem Stahl, nämlich einer
Uhrfeder, zum Beschreiben seiner lithographischen Steine erfundene
Stahlfeder von den Engländern fabrikmäßig hergestellt wurde. So
entstand 1820 in Birmingham die erste Stahlfederfabrik, und seit 1826
stellte der Inhaber derselben, Josiah Mason, besondere Spezialmaschinen
in den Dienst der neuen Industrie. Bei den muhammedanischen Völkern
des Orients aber ist die altägyptische Rohrfeder, der calamus
der Römer als kelâm (arabisch) bis auf den heutigen Tag als
ausschließliches Schreibgerät in Ehren geblieben.
Bei dem im Lauf des 19. Jahrhunderts ins Ungeheure angewachsenen
Papierverbrauch, der bei weitem nicht mehr aus Lumpen gedeckt zu
werden vermochte, sah man sich gezwungen, zu den verschiedenartigsten
Ersatzstoffen zu greifen, deren hauptsächlichste der Holzstoff des
Holzes, besonders des weichen Nadelholzes, dann von Getreidestroh,
Hülsenfrüchten, Heu, Binsen, Brennesseln, Disteln, Ginster und der
verschiedensten Palmenblätter und Grasarten bilden, der in dem um die
Mitte des 18. Jahrhunderts an Stelle der Papierstampfen aufgekommenen
„Holländer“ mit Zuhilfenahme chemischer Mittel gelöst wird. Es ist dies
eine ursprünglich deutsche Erfindung, die in Holland zuerst in Aufnahme
kam und sich von da aus auch in Deutschland Eingang verschaffte.
Auf die Herstellung von Papier aus Holz haben die Wespen, die daraus
ihre leichten und dennoch soliden Nester bauen, den Menschen geführt.
Als ein Engländer, Dr. Hill, die Papierfabrikanten darüber
jammern hörte, daß sie Mühe haben, genügend Lumpen zusammenzubringen,
und deshalb das Papier so teuer sei, zeigte er einem solchen ein
Wespennest und meinte: „Warum folgen Sie nicht dem Beispiel der Wespen,
die bei der Errichtung ihres Nestbaus Holz zerfasern und daraus einen
Brei machen, den sie in dünnen Lagen mit Speichel zu[S. 83] Papier leimen und
trocknen lassen?“ Das führte zur Entdeckung des Holzpapiers. Am meisten
wird dazu, weil am leichtesten zu beschaffen, das Nadelholz verwendet,
das weit über die Hälfte der jährlich erzeugten 800 Millionen kg
Papier liefert. Es wird hauptsächlich zu dem billigen Zeitungspapier
verarbeitet, indem der zum Zerstören der Lignite und Harze mit
Sulfitlauge gekochte Holzstoffbrei in der gegen das Ende des 18.
Jahrhunderts erfundenen Zylindermaschine zu fortlaufendem, sogenanntem
endlosem Papier ausgewalzt wird. Die Zeitungen Europas und Nordamerikas
verbrauchen jährlich ganze Wälder von Fichten- und Tannenholz. Da nun
eine Einschränkung des Zeitungswesens unmöglich ist und andererseits
die Nadelholzwaldungen nicht entsprechend ihrer technischen
Verarbeitung zu Papier und anderen Erzeugnissen wachsen, so verwendet
man neuerdings als Ersatz dafür die verschiedensten Stroharten, die
leicht zu behandeln und zu bleichen sind und durchschnittlich 45–46
Prozent, Reisstroh sogar 50 Prozent Holzstoff enthalten. Nun reicht
leider auch die jährlich erzeugte Strohmenge bei weitem nicht aus, um
einen erheblichen Teil des Holzes in der Papierfabrikation zu ersetzen,
um so mehr, da Stroh noch zu anderen Zwecken, als Viehfutter, Streu,
Verpackungsmaterial usw. in größeren Mengen verbraucht wird. Nur haben
diese Surrogate des älteren Hadernpapiers leider die Eigenschaft,
unter dem Einfluß von Luft und Licht rasch zu vergilben und brüchig zu
werden; indessen gelang es der Technik, durch besondere Behandlung mit
allerlei Chemikalien aus Holz- oder Strohschliff diejenigen Stoffe,
welche das Gelb- und Brüchigwerden beschleunigen, zu entfernen, ohne
damit die Fasern zu zerstören.
Von anderen Holzstofflieferanten, die als Papierrohstoffe neuerdings
eine zunehmende Bedeutung erlangt haben, sind das im westlichen
Mittelmeergebiet auf trockenen, salzfreien Steppen massenhaft wachsende
Pfriemen- oder Spartgras (Stipa tenacissima) zu
nennen, das besonders von englischen Papierfabriken zur Herstellung
besserer Papiere verwendet wird. Diese bereits von uns gewürdigte
Grasart mit äußerst zähen und biegsamen, 40–70 cm langen,
graugrünen, nach der Breitseite zusammengerollten Blättern, hat ihre
heutige spanische Bezeichnung esparto aus dem lateinischen
spartum, während der andere dafür gebräuchliche arabische
Ausdruck alfa oder halfa der zwischen den beiden Ketten
des Atlas eingeschlossenen Steppenregion im mittleren Algerien den
Namen gab. Hier werden über 200 Millionen kg Pfriemengras
geerntet, von denen 75 Millionen kg[S. 84] nach England ausgeführt
werden. Ebendorthin geht auch die Produktion von Spanien und Tripolis
von zusammen über 80 Millionen kg, von denen 100 kg
durchschnittlich 10 Mark wert sind.
Ein wichtiges Rohmaterial der indischen und chinesischen
Papierfabrikation bilden die bis zu 55 Prozent Holzstoff enthaltenden
Bambusfasern, die aber für die europäischen und amerikanischen
Papierfabriken ebensowenig in Betracht kommen können, wie der Bast des
Papiermaulbeerbaums. Ein Papierstoff aber, der vielleicht in einiger
Zeit für die amerikanische Papierindustrie größere Bedeutung erlangen
dürfte, sind die als Bagasse bezeichneten ausgepreßten Stengel
des Zuckerrohrs, die sehr reich an Holzstoff sind und beim ausgedehnten
Anbau von Zuckerrohr in großen Mengen bei der Zuckergewinnung abfallen
und nur zum Teil als Heizmaterial Verwendung finden. So wird bereits in
mehreren amerikanischen Fabriken zurzeit Bagassepapier hergestellt.
Von den Tropenpflanzen, unter denen man schon ihres schnellen, üppigen
Wachstums wegen den Ersatz für das Holz als Papierrohstoff in erster
Linie wird suchen müssen, kommen eine Reihe von Grasarten wie das
Bhabur-, Munj- und Cogongras und solche Stauden und Sträucher in
Betracht, die heute schon ihre Fasern zur Herstellung von Seilen,
Matten usw. liefern, wie die vorhin besprochenen verschiedenen
Bananen und Agaven, der Majaguastrauch u. a. m. Aus den Resten der
Seilfabrikate und aus den Abfällen bei der Hanfbereitung werden heute
schon größere Mengen sehr haltbarer Papiere hergestellt, die als
Manilapapiere in den Handel gelangen.
Auch die Torffasern hat man zur Papierfabrikation herangezogen
und stellt daraus, besonders in Amerika, ein gutes und billiges
Packpapier her, das wenig empfindlich gegen Feuchtigkeit ist. Zur
Fabrikation von Druckpapier jedoch eignen sich die Torffasern nicht,
da es bis jetzt nicht hat gelingen wollen, geeignete Bleichverfahren
für sie zu finden. Trotzdem erscheint es bei der großen Menge des
verfügbaren Torfes sehr wohl möglich, daß dieser mit der Zeit einen
größeren Teil des Holzes als Papierrohstoff ersetzen dürfte, um so
mehr, da in den letzten Jahren die Ausbeutung der Torflager, nicht
zuletzt der deutschen, im Vordergrunde des Interesses steht.
Als neuester Papierrohstoff sind die Weinreben zu nennen, mit
denen man zur Zeit in den französischen Weinbaugebieten Versuche
macht, die bisher zufriedenstellende Resultate sowohl hinsichtlich
der Ausbeute als auch in bezug auf das Bleichen ergaben. Eine solche[S. 85]
Verwertung der bisher sozusagen wertlosen Reben wäre den notleidenden
französischen Weinbauern wohl zu gönnen; große Mengen Holz würde man
aber dadurch nicht sparen. Und da zur Zeit die Papierindustrie noch
nicht Miene macht, sich des einen oder des anderen der oben angeführten
Rohstoffe in wirklich ausgedehntem Maße zu bedienen und dadurch den
Holzverbrauch einzuschränken, so wird sie noch auf eine Reihe von
Jahren hinaus die Wälder verwüsten, bis die Holzpreise unerschwinglich
geworden sind und man — dann freilich viel zu spät — eingesehen
hat, daß unser Papierbedarf auch ohne die Verarbeitung des zu anderen
Zwecken so notwendigen Nutzholzes gedeckt werden kann.
Das unter dem Namen „chinesisches Seidenpapier“ in China selbst
viel gebrauchte, auch in Deutschland zum Abdruck von Holzschnitten,
Lithographien und dergleichen benützte feine Papier, das durch seinen
Seidenglanz, seine geringe Dicke und Weichheit ausgezeichnet ist,
wird aus den Fasern der jüngeren Triebe des Bambus (meist
vom gemeinen Bambus, Bambusa arundinacea) gewonnen, deren
gelbe, knotige, einer inneren Höhlung ermangelnde Wurzelausläufer
uns als Spazierstöcke dienen. Es gibt 42 Arten dieser ausdauernder
holziger Gräser, die sich besonders im tropischen Asien, namentlich
im malaiischen Gebiete, finden und hier förmliche Waldungen bilden.
Einige Arten steigen im Himalaja bis 3800 m Meereshöhe empor. In
Amerika gedeihen beträchtlich weniger Bambusarten, von denen eine, die
Chusquea aristata, in den Anden Perus bis 4700 m, d. h.
an der Schneegrenze vorkommt. Auch in Asien gehen einzelne Arten weit
über die Wendekreise hinaus, wie z. B. die auch bei uns als Zierpflanze
im Freien aushaltende Phyllostachys bambusoides.
Von besonders wertvollen Vertretern dieser Pflanzengattung
seien Bambusa arundinacea und B. tulda genannt,
die in Ostindien und Hinterindien wesentlich an der Bildung der
Dschungeldickichte teilnehmen und wegen ihrer hervorragenden
Nützlichkeit für den Menschen auch weit über ihr Vaterland hinaus in
den Tropen beider Hemisphären kultiviert werden. Ihre Stengel werden
bis zu 25 m hoch und am Grunde 20–30 cm dick. Bambusa
brandini erreicht eine Höhe von 38 m und Dendrocalamus
giganteus sogar 40 m bei einem Stammumfang von 80 cm.
Aus einem vielfach verästelten, mächtigen Wurzelstock wachsen sie
stoßweise hervor, wobei an einem Bambushalm an drei aufeinander
folgenden Tagen Zuwachslängen von 57, 3 und 48 cm gemessen
wurden. Bei solchem raschen Wachstum kann[S. 86] ein Sproß von 20 m
Höhe in wenigen Wochen ausgewachsen sein. Die jungen Triebe mächtiger
Bambusen durchbrechen die Erde als teilweise mehr als armdicke, mit
scheidenartigen Blättern dichtbedeckte Kegel. Indem sie Wasser zwischen
ihren Blattscheiden hervorpressen, befeuchten und erweichen sie damit
den Boden, was das rasche Hindurchstoßen erleichtert.
Die Bambusstengel bilden starre, tragkräftige und zugleich
biegungsfeste Hohlzylinder, deren Holz außen herum reichlich mit
Kieselsäure imprägniert ist und in denen die Festigkeit noch durch
Einschaltung mehr oder weniger enggestellter Knoten gesteigert ist.
Hier hat also die Natur eine Form des Trägers gewählt, die die
geringste Materialaufwendung mit der größten Leistungsfähigkeit in sich
vereinigt, ganz so wie sie der Mensch, durch theoretische Erwägungen
geleitet, bei künstlich von ihm hergestellten Stützen, z. B. bei
eisernen Hohlträgern, in Anwendung bringt. Erst in einer gewissen
Höhe wachsen aus den allmählich verholzenden Halmen über den Knoten
Seitenzweige hervor, die sich abermals quirlig verzweigen und die
im Verhältnis zu ihrer Länge ziemlich breiten, deutlich gestielten
Grasblätter tragen. Die schwankenden Enden der Seitenzweige und der
sich nach oben verjüngenden Hauptachse tragen schwer an der Menge ihrer
Blätter und neigen sich, in leichtem Bogen überhängend, herab, so daß
das einzelne Bambusgebüsch einer vielstrahligen Fontäne gleicht und
einen äußerst zierlichen Anblick gewährt. Übrigens gibt es auch einige
schlaffe, kletternde Formen, die sich hoher Bäume als Stütze bedienen.
Merkwürdig sind die Blütenverhältnisse dieser Riesengräser. Bei einigen
Arten erscheinen die Blüten alljährlich, während bei anderen nach
einer zuweilen jahrzehntelangen vegetativen Periode — so hat man in
Vorderindien beim gemeinen Bambus eine 32jährige Periode beobachtet —
ein mit allgemeinem Laubfall verbundenes einmaliges Blühen erfolgt,
wobei die Individuen nach der Fruchtreife absterben. Dann aber blüht
dieselbe Art meist auf weite Strecken zugleich. Die massenhafte
Produktion der mehlreichen Samen, die gekocht eine im Geschmack an
den Reis erinnernde, sehr geschätzte Nahrung für den Menschen bilden,
hat dann häufig eine außerordentlich starke Vermehrung der Mäuse
und Ratten zur Folge, die später, nach Aufzehrung der Bambusfrüchte
über die benachbarten Felder herfallen und diese plündern. Bei
solchen Bambusarten vergehen dann eine Reihe von Jahren, bis aus den
Keimpflanzen wieder stattliche Bestände herangewachsen sind. Noch
andere Bambusarten zeigen hinsichtlich ihres[S. 87] Blühens ein mittleres
Verhalten, indem jährlich einzelne Halme des Stockes ihr Laub abwerfen,
zur Blüte gelangen und nach der Fruchtbildung absterben.
Die Nutzbarkeit der Bambusen ist eine so große, daß sie nur mit
derjenigen der Kokospalme verglichen werden kann. Ohne sie könnte
man sich die Kultur der Malaien und anderer in den Tropen lebender
Volksstämme gar nicht vorstellen. Nicht nur dienen die Samen als
willkommene Speise, die auch zu Brot verbacken wird — wiederholt
ist, so 1812, durch das Blühen der Bambuse eine Hungersnot in Indien
abgewehrt worden —, auch die jungen, noch weichen Schößlinge werden
gekocht oder in Essig eingemacht gegessen. Sie kommen als Achia
in den Handel. Vornehmlich die Chinesen verwenden sie zur Bereitung
eines beliebten Konfektes, das oft dem Ingwer zugesetzt wird. Junge
Blätter dienen als Viehfutter. Aus den bei aller Härte und Zähigkeit
dennoch leichten Halmen werden Häuser errichtet, welche wegen ihrer
Luftigkeit im Sommer auch von den Europäern bevorzugt werden. Die
Pfosten, Dielen, Sparren, Türen, Fenster und die Dachbedeckung bestehen
aus runden oder gespaltenen und flach ausgebreiteten Bambusstämmen,
die mit Stücken des alsbald zu besprechenden geschmeidigen, sehr zähen
Rotangs verbunden werden. Brücken, Flösse, Zäune, Palisaden, Leitern,
Wasserleitungen, Dachrinnen, Masten für Schiffe und vieles andere
werden aus den Stämmen gemacht. Fast die ganze Hauptstadt von Siam,
Bangkok, schwimmt auf Bambusflössen und aus Bambus sind deren Häuser
errichtet. Aus demselben Material bestehen die Betten, Stühle und
Tische, die Eß- und Trinkgeräte, chirurgischen Instrumente, Haarkämme
und was sonst an Hausrat vorhanden ist. Auch mancherlei Waffen sind aus
ihm verfertigt, wie Blasrohre, Lanzen, Wurfspeere und Pfeile, die große
Leichtigkeit mit unvergleichlicher Härte verbinden. Zugleich damit trug
einst der chinesische Soldat einen mit einem Überzug von gefirnißten
Maulbeerpapier versehenen Sonnenschirm aus Bambus. Ferner werden die
hohlen Stengelteile des Bambus zu Musikinstrumenten der verschiedensten
Art verarbeitet, liefern selbst Resonanzböden und Saiten. Mit Harz
gefüllt dienen sie als Kerzen, deren Hülle zugleich mit der Füllung
in Flammen aufgeht. Die einzelnen Glieder des Rohres werden zu
Wassereimern und verschiedenen Behältern, ja sogar zu Kochtöpfen
verarbeitet. In solchen, die zwar verkohlen, aber vermöge ihrer starken
Imprägnation mit Kieselsäure nicht verbrennen, kocht der Javaner
an einem von trockenem Bambus genährten Feuer die ihm zur Nah[S. 88]rung
dienenden spargelartigen, nur viel dickeren jungen Bambustriebe. Aus
dünnen, schmalen Bambusstreifen flicht er Taue und Stricke, Vorhänge,
Matten, Körbe, Tragkörbe, Hüte, Reusen zum Fischfang, fertigt er
Krausen und Schmuck aller Art. Zerklopfter Bambussplint liefert
ihm Pinsel, Geschabsel des Rohres dient zum Polstern der Möbel und
Matratzen; ein Span von kegelförmigem Querschnitt, dessen scharfe Kante
von der kieselsäurereichen und infolgedessen ungemein harten äußeren
Schicht gebildet wird, gibt ein sehr scharfes Messer. Dieselbe äußere
Schicht dient als Wetzstein für eiserne Werkzeuge. Weil die ganze
Oberfläche des Stammes verkieselt ist, widersteht er allen äußeren
Angriffen und erhält sich sehr lange nicht bloß an der Luft, sondern
auch im Boden. Deshalb ist der Bambus ein so gutes und dauerhaftes
Baumaterial. Einen merkwürdigen Eindruck macht es, wenn ein solches
aus Bambus errichtetes Dorf in Brand gerät. Dabei erhitzt sich nämlich
die Luft in den abgeschlossenen Hohlräumen im Innern der Stengel und
sprengt dieselben mit gewaltigem Knall auseinander. Man glaubt aus der
Ferne starken Kanonendonner zu hören, aus welchem die Eingeborenen der
Molukken deutlich den Ruf „bambu, bambu“ hören.
Daß ein so überaus wertvolles Produkt der Tropen auch für uns allerlei
nützliche Gegenstände liefert, kann uns nicht verwundern. Wir
Europäer schätzen die leichten Garten- und Balkonmöbel aus Bambus.
Auf Jamaika wird der Bambus nur zur Erzeugung von Rohmaterial für die
nordamerikanischen Papierfabriken angepflanzt. Die schlanken dünnen
Ruten dienen als Pfefferrohr zu Pfeifenröhren, zu Angelruten, Stützen,
um Pflanzen daran anzubinden, zu Spazierstöcken und Regenschirmstielen;
meist wählt man dazu solche Gerten aus, an denen noch ein knopfförmiges
Stück der Grundachse als Griff gelassen ist.
Tafel 99.
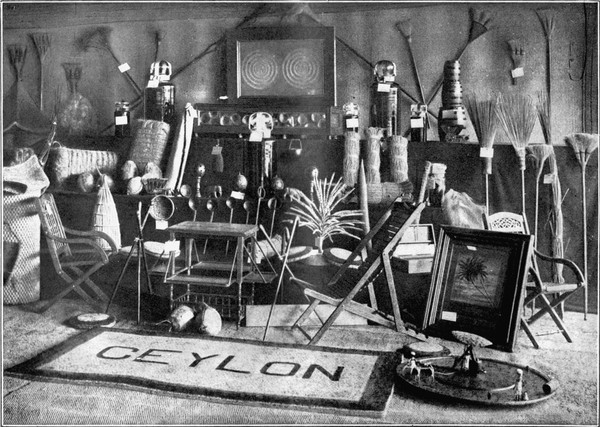
Zusammenstellung der von den verschiedenen Teilen
der Kokospalme gewonnenen Produkte in einem Exportgeschäfte Ceylons.
❏
GRÖSSERES BILD
Tafel 100.

(Phot. Vincenti, Daressalam.)
Eine Bambusgruppe in Deutsch-Ostafrika.
❏
GRÖSSERES BILD
Tafel 102.

Rotangpalmen im Botan. Garten zu Buitenzorg auf Java.
(Nach einer in der Sammlung des Botan. Instituts der Universität Wien
befindlichen Photogr. von Heermann.)
❏
GRÖSSERES BILD
Bei manchen Arten enthalten die Höhlungen der jüngeren, bei anderen
der älteren Stengelglieder ein klares, teilweise süßes Wasser, das
dem Reisenden einen angenehmen Trunk liefert. An den Knoten älterer
Halme mancher Arten, wie beispielsweise des gemeinen Bambus, finden
sich daneben eigentümliche Ausschwitzungen einer schmutzigweißen bis
braunen, ja schwärzlichen Masse, die an der Luft verhärtet. Sie hat
einen zuckerartigen Geschmack, weshalb man sie auch als Bambuszucker
bezeichnet. Sie besteht zu 86 Prozent aus Kieselsäure und verwandelt
sich beim Glühen, wobei die organische Masse zerstört wird, in reine
Kieselerde in Form eines chalzedonähnlichen Körpers, der bald[S. 89]
weiß und undurchsichtig, bald bläulich weiß, durchscheinend und
farbenschillernd aussieht.
Bei der überaus großen Nützlichkeit des Bambus lag es für den
Naturmenschen auf der Hand, dieser geheimnisvollen Ausschwitzung
besondere Heilkräfte zuzuschreiben. Seit undenklichen Zeiten verwenden
sie die Asiaten als kostbare Medizin und übermittelten sie als solche
auch ihren Nachbarn. So kam sie zu den Persern, die sie in ihrer
Sprache als tovakschira, d. h. Rindenmilch bezeichneten. Daraus
bildeten die Araber, die sie auch schon sehr früh von jenen erhielten,
das Wort Tabaschir, als welches es heute noch im ganzen Orient
einen gesuchten Handelsartikel bildet. Schon die Ärzte der römischen
Kaiserzeit wandten diese aus dem Orient mit dem Nimbus wunderbarer
in ihr schlummernder Heilkräfte zu ihnen gelangende Droge, die ja
an sich gerade so unlöslich wie reiner Kieselsand ist, gestützt auf
orientalische Traditionen, viel an. Einen Weltruf gewann der Tabaschir
aber erst durch die arabischen Ärzte im 10. und 11. Jahrhundert, so
daß sein Ruhm selbst nach Europa drang. Im Morgenlande hat er bis zur
Gegenwart seine Wertschätzung als hervorragendes Arzneimittel zu wahren
gewußt. Aus den wertvollen Untersuchungen des Geographen Ritter und des
Botanikers Ferdinand Kohn scheint nun mit Sicherheit hervorzugehen,
daß diejenige Substanz, welche die alten Griechen mit sákcharon
und nach ihnen die Römer mit saccharum bezeichneten,
nicht Rohrzucker, sondern Tabaschir war. Nach Bopp bedeutet das
Sanskrit-Stammwort sarkara nicht sowohl etwas Süßes, als
etwas Festes, Zerdrückbares. Im alten Indien wurde das Tabaschir als
sakkar mambu, d. h. süßer Bambusstein bezeichnet und erst die
Araber haben dann die Bezeichnung sakkar als sukkar
auf den später erfundenen, dem Tabaschir ähnlichen, kristallinischen
Rohrzucker übertragen.
Ist der Bambus nach dem Prinzipe möglichster Biegungsfestigkeit gebaut,
so repräsentiert der Rotang dasjenige maximaler Zugfestigkeit.
Bei ihm bildet, ganz im Gegensatz zu den biegungsfesten Konstruktionen,
das mechanisch leistungsfähigste Material die Achse und Hohlheit
ist vollkommen ausgeschlossen. Es sind natürliche Taue von
150–200 m Länge, in denen auch innerlich die einzelnen mechanischen
Elemente nicht parallel nebeneinander herlaufen, sondern durcheinander
geflochten sind, wodurch die Zugfestigkeit bedeutend erhöht wird. Die
Gebrauchsmöglichkeiten des Rotangs werden wie beim Bambus durch fast
unbegrenzte Spaltbarkeit noch außerordentlich vermehrt. So ist[S. 90] er in
seiner Heimat ebensosehr wie der Bambus mit den Lebensgewohnheiten der
Bevölkerung derartig verwachsen, daß sie ihn in der Tat ebensowenig wie
jenen würde entbehren können.
Der Rotang — richtiger rotan zu schreiben, wie das malaiische
Wort lautet — hat wie der Bambus seine Heimat in Südasien und
Indonesien, hauptsächlich im Verbreitungsgebiet der Malaien. Von den
200 Calamusarten des indischen Florengebiets finden sich die meisten
auf der Halbinsel Malakka und den Sundainseln bis Neuguinea. Sie
kommen noch in Nordaustralien vor, aber nur eine Art in Afrika. In
der Neuen Welt fehlen sie ganz. Am Südfuß des Himalaja steigt eine
Art (Calamus montanus) bis zu 2000 m Höhe. Sie stellen
kletternde Palmen dar, die aber ihre bis 150 m und mehr langen,
glatten, glänzenden, dünnen Stämme nicht um ihre Stützen herumwinden,
wie es die Lianen tun, sondern mit eigentümlichen Haftapparaten in
die Höhe streben. Häufig sind ihre Blattscheiden so stachelig, daß
sie schon an den Stützen hängen bleiben; in anderen Fällen sind die
Blattenden mit den oberen Fiedern zu bestachelten, peitschenförmigen
Anhängen verlängert, die sich überall, wohin sie gelangen, festkrallen.
Jedes höhere Blatt greift mit seiner leichtbeweglichen, vom Winde hin
und hergeschaukelten, mit widerhakig gekrümmten Stacheln versehenen
Geißel an höhere Baumzweige und auf diese Weise klettert der dünne
Rotangstamm bis in die höchsten Baumwipfel, über denen die häufig
außerordentlich zierlichen Blätter mit ihren Fangspitzen, die
keine neuen Stützen mehr erfassen können, graziös im Winde hin und
her schwanken. Da nun der im Boden hinkriechende Wurzelstock der
Rotangpalmen zahlreiche Schößlinge treibt und außerdem jeder derselben
reichlich haselnußgroße, umgekehrten Tannenzapfen gleichende Früchte
von brauner, roter oder gelber Farbe hervorbringt, von denen ein großer
Teil in nächster Nähe der Mutterpflanze keimt, so bildet der Rotang
überall, wo er auftritt, undurchdringliche Dickichte von unzerreißbaren
Tauen, starrend von Stacheln und Widerhaken, die jeden Eindringling
an der Kleidung und am Körper unbarmherzig verwunden. Immer ist es
ein sehr unangenehmes, schmerzhaftes Wagnis, in ein Rotangdickicht zu
dringen, darin zu jagen oder zu sammeln.
In seiner Heimat dient er den Bewohnern als das hauptsächlichste Binde-
und Flechtmaterial. Ohne weitere Bearbeitung liefert er vorzügliche
Taue, die beim Hausbau das ausschließliche Bindemittel für alle
Balken, Pfosten und Sparren aus Bambus oder Holz bilden.[S. 91] Infolge des
Besitzes dieses vorzüglichen Bindematerials stellen die Malaien kaum
je Stricke aus geflochtenen Pflanzenfasern her; höchstens etwa aus
den geschmeidigeren Blattscheidenfasern der Zuckerpalme (Arenga
saccharifera), die noch unverwüstlicher als selbst der Rotang
sind. Mit Rotangtauen werden die auf Bambusflößen errichteten Häuser
und Badeplätze an den Flußufern befestigt, die Hängebrücken und deren
Geländer errichtet, die Palisaden befestigt. Durch Verflechten mehrerer
dünner Rotangstämme werden Gurte, Körbe und ganze Wände geflochten;
häufiger verwendet man nur die kieselsäurereichen, glänzenden äußeren
Schichten als Flechtrohr, während man den weicheren inneren Kern, das
Peddig- oder Markrohr, anderweitig verwendet oder wegwirft. Daraus
stellen besonders die Chinesen Südostasiens die verschiedensten Möbel
und Geräte her, mit denen sie einen schwunghaften Handel treiben. Die
jungen Sprosse vieler Arten werden roh oder gekocht gegessen, das
säuerliche Fruchtfleisch einiger Arten wie Tamarindenmus verzehrt.
Der Rotang wird niemals angebaut; da er in den sumpfigen Wäldern
seiner Heimat in Menge wild wächst, vermag man daraus zur Genüge
seinen Bedarf zu decken. Für den Export werden die 9–10jährigen, also
völlig ausgereiften Stämme, die sich durch einen scharfen Schleim
klebrig anfühlen, abgeschnitten und zur Entfernung der stacheligen
Blätter zwischen enggestellten, geschärften Brettern oder Pflöcken
hindurchgezogen. Dann schneidet man sie in 6–8 m lange Stücke,
von denen 50–100 ein Bündel bilden, das in der Mitte noch einmal
zusammengebogen wird. Der Hauptexporthafen dafür ist Singapur,
daneben Batavia und Makassar. Er kommt zu uns als „spanisches Rohr“
oder „Stuhlrohr“, so genannt, weil besonders Rohrstühle aus ihm
angefertigt werden. Früher benutzten die Korbmacher und Stuhlflechter
nur die äußeren Schichten zum Flechten und warfen das Peddigrohr weg;
neuerdings wird aber auch letzteres industriell verwertet. In den
Fabriken wird das Flechtrohr auf maschinellem Wege vom Peddigrohr
abgetrennt und außerdem auf chemischem Wege die Farbe des Rohrs
verbessert. Wegen ihrer größeren Elastizität und Dauerhaftigkeit
haben die früher verworfenen glanzlosen Peddigstreifen zum guten
Teil die Korbweide verdrängt, die nur noch das Material zu groben
Flechtwerken liefert. Man benutzt sie zum Überflechten von Gefäßen, zu
Sieben, Körben, Matten, Modellbüsten für Schneider und Schneiderinnen
und Luxusartikeln aller Art. Das Flechtrohr dient vorzugsweise zum
Überziehen von Sitzen und Rücklehnen der sog.[S. 92] Joncmöbel, und die beim
Glätten des Flechtrohrs und der Peddigstreifen sich ergebenden Abfälle
dienen in der Putzmacherei und als Polster- und Scheuermaterial.
Das Malakkarohr von Calamus scipionum, eine besonders starke
Ware, die in 1–3 m langen Stäben in den Handel kommt, wird
hauptsächlich zu Spazierstöcken verarbeitet, während das Sarawakrohr
von Calamus adspersus vornehmlich Peitschenstöcke liefert.
Calamus draco gibt die weißen und braunen Maniladrachenrohre,
und aus den zur Zeit der Reife mit einem roten Harz bedeckten
pflaumengroßen Früchten gewinnt man das dunkelrote, geruch- und
geschmacklose Drachenblut, das neben dem schon im Altertume
im Orient und in den Mittelmeerländern bekannten Drachenblut des
Drachenbaumes von der Insel Sokotra am östlichen Zipfel von Afrika auch
bei uns früher als Arzneimittel benutzt wurde, jetzt aber, in Alkohol
oder ätherischem oder fettem Öl gelöst, nur noch zur Färbung der
Tischlerpolitur und von rotem Firnis und Lack dient. Die beste Sorte
gewinnt man dadurch, daß die Früchte in Säcken so lange geschüttelt
werden, bis das Harz abspringt, eine geringere dagegen durch Auskochen
der Früchte mit Wasser, wobei sich das Harz an der Oberfläche sammelt.
Ersteres wird dann zu Stangen und letzteres zu Kuchen geformt und in
Kisten von 50–60 kg von Singapur aus, das jährlich etwa
30000 kg ausführt, in den Handel gebracht.
Die Baumwolle ist nicht nur die wichtigste aller spinnbaren Fasern,
sondern eine der wichtigsten Waren des Welthandels überhaupt, weshalb
die Engländer für sie die Bezeichnung king cotton, d. h. König
Baumwolle, aufgebracht haben. Wenn auch die wichtigen Nahrungsspender
des Menschen, Weizen, Reis und Mais, in der Weltwirtschaft eine noch
größere Rolle spielen — nimmt doch allein die Weizenkultur der Welt
eine etwa fünfmal so große Fläche als diejenige der Baumwollstaude
ein, und übertrifft auch der Wert des auf der Erde produzierten
Weizens denjenigen der Baumwolle um das Vierfache —, so ist doch
die Kultur dieser Gespinstpflanze, in deren Fruchtfasern sich etwa
⅘ der Menschheit, d. h. etwa 1200 Millionen, kleiden, von ganz
außerordentlicher Bedeutung. Die jetzige jährliche Weltproduktion
an Baumwolle entspricht nach O. Warburg in Berlin einem Wert von
wenigstens 4½ Milliarden Mark, wozu noch für die Saat mindestens
eine halbe Million Mark hinzukommt. Über 15 Millionen Menschen sind mit
der Erzeugung von Baumwolle beschäftigt. Der Transport von 12 Millionen
Ballen von den Plantagen über das Meer und von den Hafenplätzen in die
Spinnereien kommt wenigstens auf 360 Millionen Mark und entspricht
2400 Dampfschifftransporten zu je 5000 Ballen. Rechnet man noch die
Landtransporte der übrigen 8 Millionen Ballen hinzu, so ergibt es
sich, daß schon der Transport der Baumwolle einem Wert von wenigstens
einer halben Milliarde Mark jährlich entspricht. In den die Baumwolle
verarbeitenden Spinnereien und Webereien, sowie den Nebenbetrieben
stecken über 10 Millionen Mark, die verzinst werden müssen; dabei
finden mehr als 4 Millionen Menschen Beschäftigung, deren Arbeitslohn
über 3 Milliarden Mark jährlich beträgt. Rechnen wir nun die Gewinne
all dieser Fabrikanlagen und der dabei beteiligten Menschen, sowie[S. 94] die
Erträge der Bleichereien, Druckereien, Färbereien, dann der Betriebe
zur Weiterverarbeitung der fertigen Stoffe, ferner der Schneider und
Konfektionsarbeiter beiderlei Geschlechts, wie auch der Groß- und
Kleinhändler, die alle von der Baumwolle leben und durch ihre Arbeit
den Wert derselben erhöhen, hinzu, so gelangen wir zum Schluß, daß die
von der Baumwolle jährlich geschaffenen Werte 10 Milliarden Mark weit
übersteigen.
Diese für die Weltwirtschaft so ungemein wichtige Nutzpflanze, von der
reichlich 25 Millionen Menschen in ihrer ganzen Existenz abhängen, ist
ein zu den Malvengewächsen gehörender Strauch, der in manchen Arten
sogar baumartig auftritt und dann eine Höhe bis zu 5 m erreicht.
Unter den äußerst mannigfaltigen Formen, in denen diese Pflanze gezogen
wird, unterscheidet man fünf schärfer charakterisierte Arten, von denen
drei der Neuen und zwei der Alten Welt angehören.
Bei zweien derselben, nämlich der Baumwollstaude von Peru — eigentlich
ist sie aber in Brasilien heimisch und wurde von den Stämmen
der Inkas von dorther in Kulturpflege erhalten — (Gossypium
peruvianum) und Barbados — der bekannten Insel der Kleinen
Antillen — (Gossypium barbadense) läßt sich die meist als
Stapel bezeichnete Baumwolle leicht von den Samen, denen sie die von
der Pflanze angestrebte Flugfähigkeit erteilen soll, ablösen und ist
bei ihnen ein Überzug von kurzen Haaren nicht vorhanden. Dabei sind die
Samen der ersteren nierenförmig und hängen dicht und fest zusammen,
während sie bei der letzteren, die hauptsächlich in den Küstengegenden
gedeiht, birnförmig gestaltet sind und lose nebeneinander liegen.
Daher wird erstere von den Engländern als Kidney, d.
h. Nierenbaumwolle und letztere als Sea Island, d. h.
Meerinselbaumwolle, bezeichnet.
In die zweite Gruppe mit schwierig sich von den Samen ablösender
Baumwolle, die zudem einen Überzug von kurzen Haaren trägt, gehört
als dritte, ebenfalls in wärmeren Gebieten Amerikas heimische Art
die großblätterige, in höheren Lagen gebaute und deshalb englisch
als Upland bezeichnete rauhe Baumwolle (Gossypium hirsutum).
Letztere, die Upland, blüht reinweiß, während die andern vorhin
genannten gelb blühen. Aber auch sie zeigt am Nachmittage gelbe
Streifen, ist am nächsten Morgen fleischfarben geworden, verwelkt
dann und fällt nachmittags ab. Ebenfalls gelbe Blüten wie die drei
erstgenannten besitzt die in Indien heimische kleinblätterige krautige
Baumwolle (Gossypium herbaceum), die durch die Araber nach[S. 95]
Ägypten kam und heute in allen Baumwolle liefernden Ländern gebaut
wird. Rotblühend dagegen ist die in Afrika heimische und vielfach
noch im Innern dieses Kontinents wildwachsend gefundene, aber auch
in Asien und Amerika kultivierte baumartige Baumwolle (Gossypium
arboreum), deren wie bei den andern Arten gelappte Blätter in den
Buchten Zwischenzipfel tragen. Mit ihr nahe verwandt ist jene Abart,
welche einzig in der Gattung gelbe Wolle hervorbringt, die sogenannte
Nangkingbaumwollstaude, die in China zu Hause ist und dort viel gebaut
wird. Sie trägt ihren Namen Gossypium religiosum mit Unrecht;
denn die in Indien in der Nähe der brahmanischen Tempel gezogene und
als heilig geltende Art, aus deren Wolle die heilige Brahmanenschnur
verfertigt wird, ist nicht diese, sondern die aus Afrika stammende
baumartige Art (G. arboreum) mit purpurnen oder gelben Blüten,
welche von Oberguinea bis Oberägypten und Abessinien wildwachsend
angetroffen wird.
Alle diese Baumwollarten, von denen Sir George Watt in seiner im Jahre
1907 erschienenen Monographie mit den wichtigeren Kulturvarietäten
nicht weniger als 42 Formen unterscheidet, sind im Laufe der Zeit auf
das mannigfaltigste gekreuzt worden, so daß es überaus schwierig ist,
nachträglich an den einzelnen Arten zu bestimmen, welchen Stammes ihre
verschiedenen Ahnen gewesen sein mögen. Alle Arten sind ursprünglich
ausdauernde Gewächse, auch die krautartige (G. herbaceum), die
allein außerhalb des Tropengürtels meist zu einer einjährigen Pflanze
wird. Sie zeigen einen ausgebreiteten Wuchs, indem der behaarte Stamm
reich verästelt ist. Daran sitzen die langgestielten breiten, meist
gelappten Blätter mit spitzen Blattzipfeln und großen, an ebenfalls
langen Stielen in den Achseln der Blätter entstehenden Blüten, die
blaß- bis dunkelgelb, oft am Grunde rotgefärbt oder mit purpurnem
Mal versehen, einzig bei der baumförmigen Art dunkelrot und bei der
Upland weiß sind. Die sehr zahlreichen Staubfäden sind zu einer Röhre
verwachsen, welche außen die kleinen herzförmigen Staubbeutel trägt.
Der von den Staubgefäßen fast ganz eingeschlossene Griffel ist an der
Spitze keulig verdickt und trägt ebenso viele Narben als die Kapsel
Fächer aufweist. Die Frucht wächst zu einer walnußgroßen Kapsel
heran, die sich bei der Reife in drei bis fünf Klappen öffnet, um die
hervorquellenden, von ihrer Wolle umhüllten schwärzlichen Samen dem
Winde preiszugeben, der sie zur Verbreitung der Art verschleppen soll.
Die wilden Baumwollarten haben meist eine gelbe bis bräunlichrote
Wolle, während die Kultursorten durch Auslese[S. 96] von seiten des Menschen
gewöhnlich eine blendend weiße Wolle besitzen. Von diesen zeigen aber
manche Sorten Rückschläge ins Rötliche, so besonders die baumartige, in
den Tempelgärten Indiens gezogene.

Bild 67. Eine blühende Baumwollpflanze
(Gossypium barbadense).
Tafel 104.

Japanische Baumwollspinnerin.
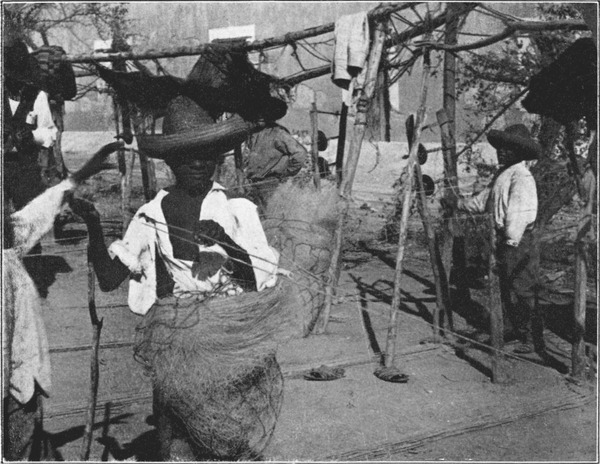
(Copyright
by Underwood & Underwood.)
Mexikaner, aus den Fasern der Magueypflanze (Agave) Seile drehend.
An Ergiebigkeit der Baumwollfasern ist die westindische (Gossypium
barbadense) in Form der Sea Island weitaus die beste und sollte,
wo immer angängig, angepflanzt werden. Sie bringt um ein Viertel bis
ein Drittel mehr und langstapeligere Wolle hervor als die krautige
indische. Nächst dieser dürfte die Uplandspielart für den Anbau an
zweiter Stelle in Frage kommen. Nur in kühleren Gegenden ist die
indische krautartige Baumwolle die gegebene, weil sie klimahärter
als die westindische ist. Je nach den Sorten liefern 500 bis 800
Fruchtkapseln etwa 1 kg Fasern, die aus fast reinem Zellstoff
(Zellulose) bestehen und nur in der innern Höhlung einen schwachen
Belag einer eingetrockneten Eiweißsubstanz als dem einstigen Plasma der
Zelle aufweisen. Jede Faser entspricht einer langgestreckten Zelle,[S. 97]
die bei der krautigen Baumwolle 2,0–2,8 cm, bei der peruanischen
3,4–3,6 cm, bei der von Barbados (Sea Island) in Ägypten 3,8
bis 4,0, auf dem amerikanischen Festlande in Florida 4,0–4,6, auf den
dem Festlande vorgelagerten Inseln, z. B. Galveston, bis 5,2 cm
Länge besitzt. Da die Faser an den letzteren Orten gleichzeitig einen
seidenartigen Glanz gewinnt, so ist ersichtlich, daß das Klima,
insbesondere die Luftfeuchtigkeit, in hervorragender Weise zur
Erzeugung einer guten Baumwollfaser maßgebend ist. Je länger und feiner
sie ist, um so leichter läßt sie sich verspinnen und um so wertvoller
ist sie für die Verarbeitung.
In ganz Südasien sowie in China ist die Kultur der Baumwollstaude eine
uralte. Dasselbe gilt teilweise auch von Ägypten; doch wurde früher
daselbst nur die baumförmige oder eine Varietät derselben kultiviert.
Erst seit dem Anbau der Barbadosbaumwolle (Sea Island), der seit
einigen Dezennien dort eingeführt wurde, hat die ägyptische Baumwolle
einen hervorragenden Platz im Welthandel gewonnen, obwohl sie ja,
wie wir oben sahen, die in Nordamerika selbst gezogene an Güte nicht
erreicht. Auch in Peru stand bereits bei der Entdeckung und Eroberung
dieses Landes durch die Spanier im Jahre 1532 die Baumwollkultur
auf einer hohen Stufe. Diese Nutzpflanze wurde von den Indianern im
staatlich wohlorganisierten Reiche der Inka-Ketschua in großem Maße
angepflanzt und zur Herstellung von buntgefärbten, mit zahlreichen
eckig stilisierten Zeichnungen und Mustern, wie auch Stickereien und
Passementerien versehenen Baumwollstoffen und anderen Erzeugnissen,
namentlich auch Hängematten, verwendet.
Von der Baumwollernte der ganzen Welt, die sich auf 3300 Millionen
kg im Werte von etwa 2700 Millionen Mark beläuft, liefern die
Südstaaten Nordamerikas nicht weniger als 62,5 Prozent. Ihnen folgen
Ostindien mit 15 Prozent, China mit fast 8 Prozent und Ägypten mit 7,3
Prozent. Auch in Buchara, Persien, Brasilien und Japan wird ziemlich
viel Baumwolle gewonnen. Afrika außer Ägypten liefert nur 2,1 Prozent
der Welternte, und zwar sind daran die deutschen Kolonien, besonders
Deutsch-Ostafrika und Togo, mit bloß 3007 Ballen zu 250 kg
im Werte von 700000 Mark beteiligt. Das ist allerdings ein fast
verschwindender Bruchteil der Gesamtsumme von etwa 400 Millionen Mark,
die Deutschland jährlich für Baumwolle ausgibt. Bedenkt man aber, daß
die Baumwollproduktion der deutschen Kolonien Afrikas in den letzten
fünf Jahren eine vierzigfache Steigerung erfuhr, so steht zu erwarten,
daß sich Deutschland hierin allmählich vom ame[S. 98]rikanischen Markte
emanzipieren und den eigenen Bedarf aus seinen Kolonien decken könne.
Europa, das einst im Mittelalter, so weit die arabische Herrschaft
reichte, Baumwolle kultivierte, pflanzt solche in geringem Maße noch
in Ostrumelien auf der Balkanhalbinsel und in Griechenland, während
Süditalien und Südspanien den Anbau derselben fast ganz aufgegeben
haben.
Die weitaus erste Stelle in der Baumwollindustrie nimmt England
ein, das etwa 20 kg Baumwolle auf den Kopf der Bevölkerung
verbraucht, dann folgt Nordamerika mit ca. 14 kg und an dritter
Stelle Deutschland mit etwa 8 kg auf den Kopf. Letzteres besitzt
zur Zeit mit 9½ Millionen die größte Zahl von Baumwollspindeln
auf dem europäischen Kontinent und verarbeitet jährlich etwa 1800000
Ballen = 800 Millionen kg im Werte von 400 Millionen Mark. Die
wichtigsten Baumwollhäfen Europas sind Liverpool mit 3½ Millionen
Ballen, dann Bremen mit 2 Millionen, Havre mit 820000, Manchester mit
500000, Genua mit 465000, Barcelona mit 282000, dann erst Hamburg
mit 205000 Ballen jährlicher Einfuhr. Man sieht daraus, daß sich der
europäische Kontinent in bezug auf den Baumwollhandel fast ganz von
England befreit hat. England bezieht jetzt beinahe nur so viel, als es
für den eigenen Verbrauch und denjenigen seiner Kolonien bedarf; dafür
hat Bremen einen großen Teil des festländischen Handels an sich zu
ziehen vermocht.
Man kann Baumwolle in allen Gegenden zwischen dem 36° nördlicher
und 36° südlicher Breite ziehen, in denen eine verhältnismäßig
hohe Sommertemperatur herrscht und keine heftigen Herbstregen
eintreten; denn die Ernte der Wolle wird durch die letzteren nicht
bloß geschädigt, sondern geradezu vernichtet. Es ist dies eine
Tatsache, die sofort einleuchtet, wenn man bedenkt, daß die Kapseln
in aufgesprungenem Zustande geerntet werden müssen. Am besten gedeiht
die Baumwolle in Niederungen oder im Flachlande mit gleichmäßig
warmem, nicht zu trockenem Klima. Viel Sonne am Tag und reichlicher
Taufall während der Nacht sagen der Baumwollstaude am besten zu. Lange
anhaltender Regen, namentlich bei kühler Temperatur, ist ihr in jedem
Stadium der Entwicklung schädlich; vor der Blüte wirkt eine anhaltende
Dürre ebenfalls schädlich. Das mit ihr zu bepflanzende Feld soll eine
vor Winden gesicherte, sonnige Lage haben. Was die Beschaffenheit des
Bodens anbelangt, so darf er nicht zu schwer, sondern muß durchlässig
und sandig sein, also sind Lehmboden sowie eine dicke Humusschicht
ihr nachteilig. Dagegen verlangt sie einen möglichst[S. 99] hohen Gehalt
an Kieselsäure und muß regelmäßig mit Stallmist und der Asche der
verbrannten Stauden oder Baumwollsamenmehl gedüngt werden.
Die Fortpflanzung der meist mehrjährigen Sorten, die 3–5 Jahre hindurch
tragen, geschieht durch Samen. Der Anbau geschieht in dem uns nächsten
Baumwollande, Ägypten, wo durch Kreuzung der ursprünglich allein
vorhandenen Sudanbaumwolle von Dongola mit der langfaserigen, feinen
Sea Island-Baumwolle von Nordamerika und stetige Auslese der besten
Sorten ebenfalls eine sehr gute Qualität in den letzten 100 Jahren
gezüchtet wurde, in folgender Weise. Die dort die Baumwollkultur
betreibenden Fellachen oder Bauern pflügen zunächst die Felder mit
ihrem von zwei Ochsen gezogenen altmodischen Hakenpflug und bewässern
sie ausgiebig. So vorbereitet werden in sie im März mit einem spitzen
Pflanzstock in Abständen von einem halben Meter 5–7 cm tiefe
Löcher gemacht, in die je 7–10 Samen der zu pflanzenden Baumwollart
zu liegen kommen, welche dann mit der Hand locker mit Erde bedeckt
werden. Man legt nur deshalb so viel Samen in ein Loch, damit durch die
vereinte Kraft der zahlreichen Sämlinge die durch die Sonnenhitze rasch
verhärtende Kruste des Bodens leichter durchbrochen werden könne.
Nach anderthalb Wochen wird die eben keimende Saat leicht überflutet
und hernach entfernt man die überflüssigen Pflänzchen bis auf die
zwei kräftigsten in jedem Loche. Von da an werden die Baumwollfelder
alle 2–3 Wochen berieselt, in der Zwischenzeit wird der Boden mit der
Hacke gelockert und vom Unkraut befreit, später auch mit künstlichen
Düngemitteln versehen. Dabei wird nach Möglichkeit auf die Raupen
zweier der Baumwollkultur besonders schädlicher Kleinschmetterlinge,
die streckenweise bisweilen die ganze Ernte vernichten, Jagd gemacht,
auch die übrigen Schädlinge tierischer und pflanzlicher Herkunft nach
Möglichkeit zu vernichten gesucht.
100–120 Tage nach der Aussaat beginnt die Blütezeit der Stauden,
während welcher die Baumwollfelder einen sehr hübschen Anblick
gewähren. Zweieinhalb bis drei Monate danach reifen die Kapseln. Die
Ernte findet Ende September oder Anfang Oktober, also fünf Monate
nach der Aussaat, statt, wobei alt und jung mithilft. Mit großer
Geschwindigkeit wird, ohne daß dabei die Pflanze beschädigt werden
darf, die aus den aufgeplatzten Fruchtkapseln herausschauende Baumwolle
mit Stehenlassen der holzigen Kapselwände herausgenommen und in den
vorne sackartig aufgerafften hemdartigen Rock gelegt.
[S. 100]
Gewöhnlich stehen 10–15 Pflücker unter einem Aufseher und erhalten je
zwei Reihen Baumwollstauden zum Ablesen der Wolle zugewiesen. Sind ihre
Taschen bald voll, so eilen sie auf ein gegebenes Kommando zu dem an
der Zufahrtstraße gelegenen Sammelplatz, um ihre Gürtel zu lösen und
die Baumwolle in auf die Erde ausgebreitete Säcke zu schütten. Während
sie dann zum Weiterpflücken wiederum dem Felde zustreben, suchen
Männer die schlechte Baumwolle sowie alle Verunreinigungen aus dem
Haufen heraus und füllen zuletzt die gute Baumwolle in große Säcke, wo
sie von einem in diese hineingestiegenen Manne mit den nackten Füßen
zusammengepreßt wird. Schließlich werden die Säcke zugenäht und auf
Wagen ins Lagerhaus geschafft.
Die Stauden läßt man dann vom Vieh abweiden und benutzt die
übrigbleibenden Strünke in dem an Feuerungsmaterial so armen Lande
als Feuerungsmaterial für die zahlreichen Dampfpumpen. In holzreichen
Ländern dagegen werden sie später in den Boden gepflügt oder auch
verbrannt und so als Dünger verwendet. Nur ausnahmsweise werden in
Ägypten die Stauden bis auf eine Höhe von etwa 60 cm über dem
Erdboden zurückgeschnitten, um von ihnen noch im nächsten Jahre eine
etwas kleinere Ernte zu erhalten.
Ganz ähnlich wie im Niltal ist auch in den Südstaaten Nordamerikas und
überall anderwärts die Baumwollkultur. Nur die Baumwollernte wird hier
in anderer Weise vorgenommen. Es hat nämlich jeder Arbeiter einen Sack
mit einem Tragband um die Schulter gehängt. Dieser reicht bis zur Erde,
damit ihn der Arbeiter nicht zu tragen, sondern nur zu heben braucht,
wenn er zur nächsten Staude will. Wenn der Sack voll ist, wird er auf
den nächsten Weg gestellt, wo ihn der die Runde machende Wagen, der
auch die leeren Säcke verteilt, aufnimmt. Beschmutzte, beschädigte
oder fehlerhafte Baumwolle wird in eine besondere Tasche getan. Im
Wirtschaftsgebäude muß die Baumwolle auf einem hölzernen Trockenboden
getrocknet werden. Dann werden zunächst die zwei Drittel des Gewichts
ausmachenden Samen durch besondere Maschinen von den Fasern getrennt
— egreniert, wie der technische Ausdruck lautet. Von der Sorgfalt,
mit der dieses Egrenieren vorgenommen wird, hängt ja die Reinheit der
Baumwolle ab. Dies geschieht in einfachster Weise durch Auszupfen
mit der Hand. Doch haben selbst die Neger eine Vorrichtung erfunden,
vermittelst der das Entfernen der Samen rascher von statten geht. In
europäischen Betrieben geschieht das Entkernen mit den Entkernungs-[S. 101]
oder Ginmaschinen, die an den Mittelpunkten der Baumwollerzeugung,
den Ginstationen, aufgestellt sind. Hernach wird die Baumwolle durch
hydraulische Pressen in 450 kg schwere Ballen gepreßt, die dann
in Säcke von Hanf oder Jute eingenäht und mit Bandeisen verschnürt
in den Handel kommen. Der weitaus größte Teil derselben wird dann in
Fabriken zu den verschiedensten Garnen und Stoffen verarbeitet und nur
ein kleiner Teil dient, entfettet, zur Herstellung von Verbandwatte,
Schießbaumwolle, Kollodium und Chardonnetseide, welch letztere zu einem
neuen aussichtsreichen Industriezweige Veranlassung gegeben hat.
So lange die Baumwolle lediglich durch Handbetrieb zu Garnen und
Geweben verarbeitet wurde, wie dies in Indien und im Orient, dann auch
im Abendlande gegen das Ende des 18. Jahrhunderts der Fall war, waren
die daraus hergestellten Kleider und anderen Gebrauchsgegenstände
naturgemäß teuer und konnten nicht in allgemeinen Gebrauch gelangen.
Erst als in England in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die
Spinnmaschinen und mechanischen Webstühle in Gebrauch kamen, wurde das
Fabrikat billiger, so daß Baumwollstoffe auch in minder bemittelten
Kreisen in allgemeinen Gebrauch kommen konnten. Nur sogenannte
Nangkinfabrikate (von Gossypium religiosum) kommen noch aus
Ostindien zu uns. Sonst wird der ganze Bedarf in Europa selbst erzeugt,
und zwar ersetzen die 45 Millionen Spindeln Englands die Handarbeit von
230 Millionen Menschen und spinnen zusammen jährlich einen Faden, der
130mal die Entfernung der Sonne von der Erde durchspannen würde.
Ehe die Verarbeitung der Baumwolle zu Garn beginnt, wird sie zunächst
mit größeren Mengen derselben Sorte gut gemischt, um Garne von
möglichst gleichmäßiger Güte zu erzielen, dann bei 30° C.
getrocknet, in einer Wolf genannten Maschine gelockert, gründlich
gereinigt und, nachdem sie von der Schlag- oder Wattenmaschine in
breite, zusammenhängende, flache Streifen (Watte) gebracht worden,
von der Kratzmaschine in zarte, lockere Bänder verwandelt. Hierauf
werden diese durch die Streckwalze gestreckt und geglättet, dann in
der Vorspinnmaschine verfeinert und erst zu dicken, lockeren und durch
weiteres Verspinnen zu feineren Fäden gedreht. Endlich werden sie
auf der Spinnmaschine zu Garn versponnen, das so fein sein kann, daß
½ kg desselben 1672 km lang ist, d. h. von Leipzig
bis Konstantinopel reichen würde. Nach der Feinheit des verwendeten
Garns unterscheidet man Kattun (nach der arabischen Bezeichnung für
Baumwolle),[S. 102] Indienne (so genannt, weil ursprünglich aus Ostindien
stammend mit allerlei bedruckten Figuren), Kalikos (ebenfalls ein
bedruckter Baumwollstoff, so genannt, weil er zuerst aus Kalikut
bezogen wurde), Nangking (ein gelbliches oder rötliches Baumwollenzeug,
nach dem früheren Bezugsort in China so genannt), Perkal (dichtes,
leinwandartiges Baumwollgewebe, die gröberen gleichen den Kalikos,
die feinsten dagegen sind dichter als Musselin), Musselin (feinstes,
durchscheinendes Baumwollgewebe — glatt, gestreift, durchbrochen
usw. — aus wenig gedrehtem Garn und deshalb mit zartem Flaum, nach
der Stadt Mossul am Tigris so genannt, doch ist der ostindische noch
immer besonders fein und zart), Jakonett (französisches, glattes
Musselin, nach einem französischen Fabrikanten so geheißen), Gingan
(das ursprünglich ostindische, glatte oder gestreifte Gewebe in
Baumwolle mit Bast, auch in reiner Baumwolle oder Leinen nachahmt, vom
javanischen ginggan vergehend, verbleichend), Tüll (netzartiges
Zwirnzeug nach dem ersten Fabrikationsort desselben, der französischen
Stadt Tulle, so genannt), Barchent (geköpertes Baumwollgewebe,
ursprünglich mit leinener Kette, auf einer Seite rauh und wollig),
Pikee (vom französischen piqué gesteppt, mit doppelter Kette
gewebtes Baumwollgewebe mit erhöhtem Muster), Manchester (nach dem
ersten Fabrikationsort so bezeichneter Baumwollensamt) usw.
Früher warf man die beim Egrenieren zurückgebliebenen Samen der
Baumwollpflanze, soweit man sie nicht als Saatgut verwendete, als
nutzlos weg. Bald aber fand man, daß sie zu 20–30 Prozent ein sehr
wertvolles Öl enthalten, das man nun sorgfältig aus ihnen preßt. Ja,
man würde heute die Pflanze lediglich als Ölpflanze kultivieren, wenn
sie nicht auch noch die wertvolle Faser lieferte. Der noch die Hälfte
des Gewichtes Eiweiß enthaltende Preßrückstand dient als wertvolles
Viehfutter.
Über die Anfänge der Baumwollkultur ist wenig Sicheres bekannt. In
der Alten Welt hat sie augenscheinlich in Indien ihren Ursprung
genommen, wo zuerst die niedrige krautige Baumwolle vom Menschen in
Pflege genommen wurde. Zu ihr kam dann später ebenfalls in Indien die
baumförmige Art hinzu, von der in der Folge die heilige dreiteilige
Brahmanenschnur, das Sinnbild der göttlichen Dreiheit, angefertigt
wurde. Die indische Baumwolle, im Sanskrit kârpâsi genannt,
wird zuerst in den zwischen 600 und 500 v. Chr. entstandenen jüngsten
vedischen Schriften, den Sutras, und zwar schon in Verbindung mit
Gewändern erwähnt. Sicher wurde sie schon da[S. 103]mals in Indien in
beträchtlichen Mengen zu Geweben verarbeitet. Von dort aus hat sich
ihre Kultur über Hinterindien nach China verbreitet, wo zuerst der
Kaiser Wu-ti um 600 v. Chr. sich in wertvolle, jedenfalls aus den
Kulturländern im Süden importierte Baumwollkleider hüllte. In der Folge
wurde nach Einführung der Baumwollstaude die Baumwolle im Reiche der
Mitte das am meisten benutzte Zeugmaterial, wenngleich auch noch viel
Hanf und besonders Ramie oder chinesische Nessel zur Herstellung von
Geweben verwendet wird. Indessen läßt sich eine eigentliche Kultur der
Baumwolle in China nicht vor dem 11. Jahrhundert n. Chr. nachweisen,
und manche Gelehrte nehmen an, daß sie sogar erst im 13. Jahrhundert
durch die das Reich erobernden Tataren eingeführt wurde.
Die erste Kunde von der in Indien als Faserstoff zur Herstellung von
leichten Gewändern benutzten Baumwolle verdanken wir dem Vater der
Geschichtschreibung, dem Griechen Herodot (484–424 v. Chr.), der von
460–456 Ägypten, Syrien und Babylonien bereiste und in seinem in
ionischem Dialekte verfaßten Werke über die Geschichte des Orients
und Griechenlands nach der auf seiner asiatischen Reise in Erfahrung
gebrachten Kunde berichtet: „In Indien gibt es wilde Bäume, welche
als Frucht eine Wolle (eírion) tragen, die an Schönheit und
Güte die Schafwolle übertrifft. Die Indier machen aus dieser Wolle
ihre Kleider.“ Nach demselben Autor war das indische Hilfskorps des
Xerxes bei seinem Zuge zur Eroberung Griechenlands im Jahre 492 in
solch baumwollene Kleider gehüllt. Auch der Grieche Ktesias aus
Knidos, der von 416–399 Arzt am persischen Hof in Susa war und eine
wertvolle, leider nur in Auszügen erhaltene persische Geschichte
schrieb, weiß von der Baumwolle als einer Gespinstpflanze Indiens zu
berichten. Die Pflanze selbst und ihr Produkt lernten aber erst die
Begleiter Alexanders des Großen auf ihrem Zuge nach Indien kennen. Die
Leute am Indus trugen nämlich baumwollene Gewebe, und die Baumwolle
trat den Makedoniern daselbst so häufig entgegen, daß sie dieselbe
zum Ausstopfen von Kopfkissen und Pferdesätteln benutzten. Diese
Begleiter Alexanders auf seinem Zuge nach Indien brachten eingehendere
Mitteilungen darüber in die Mittelmeerländer, wo diese Gespinstpflanze
bis dahin völlig unbekannt geblieben war; denn die alten Babylonier,
Ägypter und Griechen hatten bis dahin außer der tierischen Wolle
stets nur den Lein zur Herstellung von Stoffen verwendet. Der
Aristotelesschüler Theophrast erwähnt in der zweiten Hälfte des 4.
vorchristlichen Jahrhunderts, daß in Indien eine Gespinstpflanze[S. 104]
kárpasos gedeihe, aus der hergestellte Stoffe die Begleiter
Alexanders von dort mitbrachten. Dieser Begründer der Botanik schreibt
in seiner Pflanzengeschichte: „Auf der Insel Tylos im Arabischen
Meerbusen (heute Bachraim am Eingang des Persischen Golfes) sollen
viele wolletragende Bäume (déndra erióphora) stehen, deren
Blätter wie Weinblätter, nur kleiner sind. Statt der Früchte bringen
sie geschlossene Behälter von Apfelgröße hervor. Werden diese reif, so
nimmt man die darin befindliche Wolle und webt aus ihr sowohl geringe
als auch sehr kostbare Gewänder. Solche Bäume wachsen auch in Indien
und Arabien.“ Diesen Passus schrieb der ältere Plinius um die Mitte des
ersten christlichen Jahrhunderts fast wörtlich ab mit der Bemerkung,
daß diese Bäume gossypini (Einzahl gossypinus) heißen
— woraus dann die Botaniker später die wissenschaftliche Bezeichnung
gossypium schufen. Nach ihm soll es wie in Indien und Arabien
auch in dem an Ägypten angrenzenden Negerlande wolletragende Bäume
geben, „deren Kapseln etwa so groß wie Granatäpfel sind“. Auch der
römische Dichter Vergil, der Verfasser der berühmten, Augustus und
seinem Geschlechte gewidmeten Äneis (70–15 v. Chr.) sagt in seinem
Georgica benannten Lehrgedicht über den Landbau: „Im Negerlande gibt es
Bäume, die weiche, weiße Wolle tragen.“ Der griechische Schriftsteller
Flavius Arrianus (geb. um 100 n. Chr. zu Nicomedia in Bithynien, ward
136 unter Hadrian Präfekt von Kappadokien und starb unter Marcus
Aurelius ums Jahr 176) schreibt in seiner indischen Geschichte: „Die
Kleidung der Indier wird, wie Nearchos (der Flottenführer Alexanders
des Großen, der nach dessen Feldzug nach Indien im Jahre 325 v. Chr.
die Flotte vom Indus aus durch das Erythräische Meer in den Persischen
Meerbusen führte und wie er in seinem „Paraplus“ genannten Reisebericht
darüber meldet, auf dieser Fahrt die Mündungen des Euphrat und Tigris
fand) sagt, aus dem Lein gefertigt, der auf Bäumen wächst. Dieser Lein
ist entweder reiner weiß als jeder andere Lein oder scheint wenigstens
weißer, weil die Indier, die ihn tragen, schwarz sind.“
Durch die Perserherrschaft wurde der Anbau und die Verwendung von
Baumwolle als Gespinstmaterial in Vorderasien allgemeiner. Von
Persien, besonders aber aus Indien führte man in der hellenistischen
und mehr noch zur römischen Kaiserzeit über die Hafenstädte am Roten
Meer und Alexandrien ziemliche Mengen fertiger Baumwollstoffe in die
reichen Städte am Mittelmeer, zumal dem üppigen Rom, aus, wie uns
der zu Ende des 2. Jahrhunderts n. Chr. in letzterer Stadt[S. 105] lebende
Sophist Flavius Philostratos der Ältere berichtet. Außer in Persien,
Syrien und Ägypten wurde nach der Schilderung des griechischen
Geschichtschreibers und Geographen Pausanias in seiner zwischen 160
und 180 n. Chr. geschriebenen Periegesis oder Reisebeschreibung von
Griechenland, Kleinasien, Syrien, Ägypten und Italien einzig in Elis,
im westlichen Peloponnes, Baumwolle gepflanzt. „Eleia ist das einzige
griechische Land, in der die Baumwolle (býssos) gedeiht. Die
eleische Baumwolle ist ebenso zart wie die hebräische, aber nicht so
gelb.“ Und Plinius (23–79 n. Chr.) sagt in seiner Naturgeschichte:
„Das baumwollene Zeug (býssinon), welches in der Umgegend
von Elis und in Achaia gewonnen wird, ist bei den Damen so beliebt,
daß es früher dem Gewicht nach mit Gold in gleichem Werte stand.“
Doch hat sich damals die Baumwollkultur nicht weiter im römischen
Reiche verbreitet, und das ganze Altertum hindurch kam weitaus das
meiste an fertigen Baumwollstoffen als kostbare Handelsware aus
dem Orient, besonders aus Indien, nach Europa. Dies blieb auch so
nach dem Untergange der römischen Weltherrschaft, als die eleische
Baumwollindustrie zugrunde gegangen war.
In der Folge dehnten die Araber mit der Ausdehnung ihrer Herrschaft
das Verbreitungsgebiet der Baumwolle weiter aus. Sie brachten die
Kultur dieser Staude mit derjenigen des Zuckerrohrs im 8. Jahrhundert
nach Nordafrika, im 9. nach Sizilien und im 10. nach Südspanien. In
Andalusien beförderte besonders der Kalif Abdurrhaman II. (912–961)
den Anbau dieser Gespinstpflanze. Obschon die Araber selbst viel,
allerdings gewöhnliche Baumwollstoffe herstellten, bezogen sie die
feinsten Baumwollstoffe immer noch aus Indien. Zwei Araber, die im
9. Jahrhundert Indien bereisten, erzählen, daß dort fast völlig
durchsichtige Kleider hergestellt würden, so fein, daß ein ganzer
Rock durch einen Fingerring hindurchgezogen werden könne. Tavernier
berichtet, daß türkische Turbane aus 16 m feinstem, indischem
Musselin zusammengewunden seien, doch nur vier Unzen (= 120 g)
wögen. Die feinsten dieser Gewebe, zu Gantipuru und Datta in Indien
gefertigt, sehe man nicht, wenn sie, auf eine Wiese ausgebreitet, vom
Tau befeuchtet sind. Die Inder nennen sie „gewebten Wind.“
So gebräuchlich im frühen Mittelalter Baumwollstoffe bei den
Muhammedanern waren, so überaus selten waren sie bei den
Abendländern anzutreffen. In seiner Geschichte der Franken hebt der
Geschichtschreiber Gregor von Tours hervor, es sei im Jahre 580 ein
Fremder zu Tours erschienen, der über einem ärmellosen Rock einen[S. 106]
Mantel aus Baumwolle trug; und im Jahre 807 erregten Zelte, die der
Kalif von Bagdad Harun al Raschid (d. h. H. der Gerechte) Karl dem
Großen geschenkt hatte, große Bewunderung bei den Franken, nicht
nur ihrer Größe und Buntheit wegen, sondern vor allem weil sie aus
Baumwollenzeug hergestellt waren. Welchen Wert man bis tief ins
Mittelalter der Baumwolle gab, beweist der Umstand, daß man ihr im
Mittellatein den Namen der Seide oder eine Nebenform desselben, nämlich
bombix oder bombax gab. Erst im 12. Jahrhundert kam
im Volke der deutsche Name Baumwolle auf, so daß daraus geschlossen
werden darf, daß damals weitere Kreise mit ihr rechneten. So wird im
Gedicht „Erec“ des Hartmann von Aue (lebte 1170 bis 1215, nahm an den
Kreuzzügen von 1189 und 1197 teil und lernte wohl die Baumwollpflanze
in Palästina oder Syrien kennen) ein Sattelkissen linde sam ein
boumwol, d. h. weich wie Baumwolle bezeichnet, und im 13. Jahrhundert
berichtet ein Autor lateinisch „von der bombaxwolle, welche jetzt
beim Volke boumwolle heißt“. Eine zu Anfang des 14. Jahrhunderts
vorkommende, aber nur vereinzelte Bezeichnung cottûn im
Marienleben des Walther von Rheinau, in welcher solcher neben „flachs,
wolle und sîden“ gefärbt als Gegenstand des Webens aufgezählt wird,
geht auf das italienische cotone für Baumwolle (und zugleich
Baumwollstaude) zurück, das aber selbst aus dem arabischen kutn
für jene Gespinstpflanze und deren Produkt stammt. Ebendaher rühren
auch das französische und englische coton und das spanische
algodon (mit dem arabischen Artikel al — z. B. auch in
Alkohol, Alchemie usw. zu erkennen — davor). Erst im 17. Jahrhundert
wird jenes arabische Wort als Kattun mit der Verarbeitung der Baumwolle
zu Geweben auch in Deutschland häufiger. Ein eigenartiges, aus Leinen
und Baumwolle gemischtes Zeug wird mit einem ursprünglich Wollstoff
bezeichnenden fremden Wort barchât, später barchant
belegt; aus diesem wurde dann unser Barchent für geköpertes
Baumwollgewebe mit oft leinener Kette.
Die Einführung der Baumwolle als Gespinstfaser neben dem
altgebräuchlichen Lein hat dann in Europa wie in China die Kunst der
Weberei beträchtlich gesteigert. Es konnten nun viel mannigfaltigere
Stoffe hergestellt werden, wie Zwilich und Drilich (als Umdeutschung
des lateinischen bilix und trilix, woraus später unsere
Bezeichnungen Zwilch und Drilch entstanden) für zwei- oder dreifädig
gewebtes Zeug, dann — seit dem 14. Jahrhundert — damasch für
gemusterte Stoffe aus Seide, Baumwolle oder Leinen nach der Stadt
Damaskus, wo[S. 107] solche zuerst von den Arabern hergestellt wurden. Mit
der Herstellung des Damastes bürgerte sich auch in Europa jene Art von
Weberei ein, welche es versteht, auch in gebleichtes Garn allerlei
Muster zu weben, so daß sie nicht sowohl durch Farbe, als bloß durch
verschiedene Fadenlage zeichnerisch hervorstechen.
Noch das ganze Mittelalter hindurch kamen arabische und indische
Baumwollgewebe über Venedig und Genua, von wo sie durch Säumer über
die Alpenpässe nach Norden gebracht wurden, nach Augsburg und Ulm, wo
bedeutende Stapelplätze dafür waren. Später suchte man die Rohbaumwolle
nach Europa zu bringen und hier zu verarbeiten. Und zwar war es das
für die Herstellung aller Gewebe von den wollenen Tuchstoffen bis
zum Leinengewebe hervorragend tüchtige Flandern, das diesen neuen
Industriezweig zuerst einführte. So entstanden am Ende des 16.
Jahrhunderts in Gent und Brügge die ersten von Christen hergestellten
Gewebe mit fast reiner Baumwolle, die an Güte den arabischen und
indischen bald gleichgekommen sein sollen.
Diese Kattune in Form von buntbedruckten Baumwollengeweben kamen dann
zu Anfang der selbständigen Regierung Ludwigs XIV., die 1661 nach
Mazarins Tode begann, in Frankreich in Mode. Zuerst wurden sie von den
Schiffen der Compagnie des Indes von der Koromandelküste, wo
Frankreich Kolonien besaß, nach Frankreich importiert, wo die heiteren
Farben, die große dekorative Wirkung und der exotische Stempel dieser
leichten Stoffe sie überall sehr beliebt machte. Man kleidete sich
vielfach damit, ließ Morgenröcke und Möbelüberzüge daraus verfertigen,
so daß die Ware trotz ihres hohen Preises reißenden Absatz fand. Da
diese Stoffe selten waren, kamen einheimische Handwerker auf den
Gedanken, aus dem Orient eingeführte weiße Baumwollengewebe in der
Art der indischen Kattune zu bedrucken und machten damit sehr gute
Geschäfte, da die Beliebtheit des Kattuns immer mehr stieg und zwischen
1670 und 1680 unter der vornehmen Welt geradezu eine Kattunmanie
herrschte. Die Fabrikanten anderer Stoffe und ein Teil der Handwerker
fühlten sich darob so beunruhigt, daß sie sich an den Minister Colbert
wandten, der sich ihrer annahm und im Jahre 1681 die Fabrikation und
den Verkauf dieser gefärbten Tücher strengstens verbot. Die Folge davon
war die Entstehung großer Kattunfabriken in England und der Schweiz.
Auch entstand ein wahrer Kampf zwischen den französischen Behörden und
der kattunsüchtigen Frauenwelt, die sich an das Verbot nicht hielt.[S. 108]
Von 1681–1716 versuchten mehr als 30 Erlasse die Pariserinnen zur
Vernunft zu bringen; doch fruchtete alles nichts. Im Gegenteil, das
Verbotene reizte, und trotz aller Beschlagnahme wurde Kattun nach
Frankreich eingeführt. Dabei waren die Beamtenfrauen die ersten, die
die verbotenen Stoffe trugen. Die seit 1748 als Geliebte Ludwigs XV.
am Hofe lebende Madame Jeanne Antoinette Poisson, die zur Marquise von
Pompadour erhoben wurde und bis zu ihrem Tode 1764 in Versailles einen
großen Einfluß auf die Regierungsgeschäfte ausübte, stattete in ihrem
Schloß Bellevue eine ganze Zimmerflucht mit diesem Stoffe aus. Bald
berieten selbst die Minister über ihre Maßnahmen gegen den Kattun in
Räumen, die mit Kattun ausgeschlagen waren! Da gab am 9. November 1759
die Regierung endlich nach: die Herstellung und der Verkauf des Kattuns
wurde in Frankreich gestattet. Derselbe behauptete von nun an noch
längere Zeit seine Herrschaft. Noch der sonst fortschrittlich gesinnte
Kaiser Josef II. von Deutschland, der von 1765–1790 regierte, verbot
das Tragen von Kattun in seinen Ländern wegen dessen hohen Preises.
Seine Untertanen sollten sich an die altgewohnte Linnenkleidung halten.
In England, wo man zuerst unter Heinrich VIII. (regierte von 1509–1547)
in Lancashire und unter dessen Sohn Eduard VI. (1547 bis 1553) auch
in Manchester und Cheshire Baumwolle zu verarbeiten begann, verstand
man sehr lange keine festen Ketten aus Baumwolle zu machen, sondern
verwandte dazu Leinengarne. Erst 1772 brachte man dieses Kunststück
zustande und vermochte von nun an reine Baumwollengarne anzufertigen.
Als dann der Schotte James Watt 1769 die Dampfmaschine verbessert
hatte, und gleichzeitig die Spinnmaschine und der mechanische Webstuhl
erfunden worden waren, begann dem vermehrten Bedarf an Baumwolle
entsprechend eine größere Zufuhr des Rohmaterials nach England, das
schon 1782 mehr als 33000 Ballen aus Syrien, Makedonien und Cayenne
einführte. Die Länder, welche heute für Baumwollausfuhr in erster Linie
in Betracht kommen, produzierten damals nur für ihren eigenen Bedarf.
Ja Ägypten konsumierte selbst so viel, daß es noch Baumwolle aus Cypern
und Kleinasien kaufen mußte. Nur die Südstaaten Nordamerikas, in
welchen die Baumwollkultur ums Jahr 1770 eingeführt wurde, erzeugten
damals schon in zunehmendem Maße Baumwolle, so im Jahre 1800 bereits 9
Millionen kg. Schon nach Beendigung der napoleonischen Kriege
bezog England 85 Prozent seines Baumwollbedarfes aus Nordamerika. Die
Produktion nahm dort immer mehr zu, so daß[S. 109] jenes Land 1860 4824000
Ballen zu 450 kg ausführte. Da brach 1861 der bis 1865 dauernde
unheilvolle Bürgerkrieg aus, der die Kultur dieser Nutzpflanze
hochgradig behinderte, so daß bald in der Baumwollindustrie, die
von dort aus ihr Rohmaterial hauptsächlich bezog, ein förmlicher
„Baumwollhunger“ ausbrach. Die Folge war, daß sehr hohe Preise für den
Rohstoff bezahlt wurden. Dies bewog die verschiedensten tropischen und
subtropischen Länder, diese wertvolle Nutzpflanze in Kultur zu nehmen.
Indien, das vor dem nordamerikanischen Bürgerkriege nur 9–26 Prozent
der in England verarbeiteten Baumwolle lieferte, lieferte nun während
desselben 50 Prozent des Bedarfes, während Nordamerika von 46–84
Prozent der Einfuhr auf 7 Prozent sank. Aber nach dem Kriege eroberten
die Vereinigten Staaten nicht bloß ihre alte Position zurück, sondern
übertrafen noch ihre früheren Leistungen bedeutend. Während die dortige
Ernte im Dezennium vor dem Kriege 1300 Millionen kg jährlich
betrug, stieg sie im Dezennium nach dem Kriege auf 20000 Millionen
kg.
Dieser ungeheure Baumwollverbrauch war erst möglich, als die Spinn-
und Webemaschinen eingeführt waren. Den Anstoß dazu gab im Jahre 1767
der englische Zimmermann Hargraves durch seine nach seiner Tochter
Jenny bezeichnete Spinnmaschine, auf der viel mehr und besseres Garn
als mit der Hand hergestellt zu werden vermochte. 1796 erfand dann
der Engländer Arkwright seine Wasserspinnmaschine, so genannt, weil
sie zuerst durch Wasser getrieben wurde. Beide Systeme vereinigte
dann Crampton in seiner Mêlemaschine. Und so kam ein Fortschritt nach
dem andern, bis besonders in England die heutige Baumwollspinnerei
und -weberei ausgebildet wurde. Heute noch steht dieses Land mit
45 Millionen Spindeln an der Spitze der gesamten Baumwollindustrie
der Welt, ihm folgen die Vereinigten Staaten von Nordamerika mit 16
Millionen Spindeln, dann kommen der Reihe nach Deutschland, Frankreich,
Rußland, Ostindien, Österreich, Italien. Neuerdings macht Japan, wie
allen Industrien, so auch hierin den Kulturstaaten starke Konkurrenz.
Erst im Jahre 1875 wurde die Baumwollspinnmaschine dort heimisch, und
schon 1894 arbeiteten 780000 Spindeln in jenem Lande.
Nach China kam die Baumwollstaude im 10. Jahrhundert, war aber noch im
11. Jahrhundert Gartengewächs. Erst vom 13. Jahrhundert an wurde sie im
freien Felde angepflanzt, doch nie in der Ausdehnung, daß man auf die
Einfuhr von Indien oder Burma hätte verzichten können. Gegen das Ende
des 18. Jahrhunderts brach[S. 110] eine große Hungersnot in Südchina aus; da
verordnete der Kaiser, daß der größte Teil des zum Anbau von Baumwolle
verwendeten Landes dem Getreidebau zurückgegeben werden solle.
Wie die Portugiesen bei den Kaffern und Mungo Park bei den Negern in
Senegambien und Guinea, so fanden Kolumbus, Cortez, Pizarro und Almagro
den Gebrauch der Baumwolle überall in Amerika gebräuchlich.
Während in der Alten Welt die Flachskultur, die wir außer bei den
neolithischen Pfahlbauern zuerst in Vorderasien, speziell Babylonien
und dann Ägypten antreffen, dann auch die schon früh aus Indien nach
Persien gebrachte Hanfkultur, sowie in China die Seidenzucht neben
der Wollverwertung dem Baumwollbau lange voranging, scheint sich in
Amerika die Webekunst und Färberei direkt an der Gespinstfaser der
westindischen Baumwollpflanze entwickelt zu haben. Nicht nur finden
wir die verschiedensten Gewebe und Fabrikate aus Baumwolle als
Grabbeigaben in den Gräbern der alten amerikanischen Kulturvölker
von Peru bis Mexiko, sondern die Berichte der Spanier zur Zeit der
Entdeckung Amerikas bezeugen, daß wie auf den Antillen, so auch in
ganz Mittel- und dem warmen Südamerika die Kultur und Verarbeitung
der Baumwolle überall eingeführt war. So benutzten die Azteken, die
Bewohner Mexikos zur Zeit der Conquista, außer der Baumwolle auch
die Faser der Agave als Gespinstmaterial, während sie den Flachs nur
zur Gewinnung seiner fetten Samen anbauten. Wie sie pflanzten auch
die übrigen amerikanischen Kulturvölker, die Mayas in Yucatan, die
Chibchas in Kolumbien und die Ketschuas im alten Peru die Baumwolle,
um daraus Gewebe anzufertigen, die als gesuchte Handelsartikel weithin
transportiert wurden. Um sie zu färben und auf ihnen die zierlichsten
Muster zu malen, benutzten sie bereits den Indigo, die Cochenille und
das Brasilholz. Baumwollzeuge dienten überall in Amerika an Stelle des
Geldes als beliebtestes Tauschmittel; sogar schon Papier, ja selbst
Panzerhemden wurden daraus verfertigt. Ebenso waren die Segel ihrer
aus mehreren walzenförmigen, an den Enden zugespitzten Binsenbündeln
hergestellten floßartigen Fahrzeuge aus Baumwolle gewebt. Mit diesen
sogenannten balsas wagten sie sich handeltreibend der Küste
entlang bis hinauf zur Mündung des Rio San Juan am 4. Grad nördlicher
Breite. Wunderbare Erzeugnisse speziell der altperuanischen Webekunst
sind uns in den Gräbern des Totenfeldes von Ancon bei Lima erhalten
geblieben. In ihnen waren die Toten in Hockstellung, von Decken und
Tüchern[S. 111] umhüllt und mit einem reichen Inventar von Beigaben zum
Leben im Geisterreich ausgestattet, in brunnenartigen Vertiefungen
mit Seitennischen bestattet. Außer prächtig gemusterten und gefärbten
Geweben aus Lamawolle, Baumwolle oder Pflanzenfaser, fanden sich
auch mannigfaltige Kleidungsstücke, bei denen an den querlaufenden
Fäden bunte Federchen in hübschen Mustern geknüpft waren, nebst den
Webegeräten, vermittelst welcher sie hergestellt waren.
Leider hat sich diese hochstehende Kultur nicht weiter entwickeln
können, sondern sie ging unter den rohen Händen der goldgierigen
christlichen Konquistadoren bis auf kümmerliche Reste unter. Nur an
ganz vereinzelten Stellen hat sich in abgelegenen Andentälern die
alte, heimische Hausindustrie in der Verarbeitung der Baumwolle zu
buntgemusterten Stoffen erhalten. Diese neuweltliche Baumwollkultur
steht natürlich außer allem Zusammenhang mit der altweltlichen
Ausbildung derselben. Beide haben sich vielmehr ganz selbständig aus
den ihnen zu Gebote stehenden, eine natürliche Wolle als Ersatz der
älteren Tierwolle darbietenden Pflanzen entwickelt.
Während die vorderasiatischen Gebiete unseren Vorfahren im Mittelalter
schon die aufs kunstreichste hergestellten, hochgeschätzten
Baumwollstoffe lieferten, die vielfach nach der Stadt Mossul am Tigris
als Musseline bezeichnet wurden, waren diese über die Herkunft dieser
Stoffe noch in vollständiger Unkenntnis befangen. Noch bis ins 17.
Jahrhundert berichten uns die abendländischen Gelehrten in ihren
Chroniken, daß der Baumwollstoff das Produkt der Wolle des tatarischen
oder syrischen Pflanzenschafs, Barometz genannt, sei, dessen Früchte
von der schönsten weißen Wolle bedeckte Lämmer enthalten. „Und daran
wuchs“, schreibt Sir John Mandeville, ein englischer Ritter, der viele
Länder bereiste, um deren Gebräuche und Wunder kennen zu lernen, „eine
Art Früchte, als ob es Kürbisse wären; und wenn sie reif sind, kann man
sie essen, und man findet darinnen ein kleines Tier mit Fleisch, Bein
und Blut, als wie ein kleines Lamm, außen mit Wolle bedeckt; und man
ißt beides, Frucht und Tier, und das ist ein großes Wunder. Und auch
ich habe von dieser Frucht gegessen; aber obgleich es wunderbar ist, so
weiß ich doch, daß Gott noch wunderbarer ist in seinen Werken.“
Andere wieder berichteten, dieser Barometz sei ein Lamm, das mit seinem
Nabel auf dem Stamm der betreffenden Pflanze befestigt sei und sich von
den ringsum wachsenden Gräsern ernähre; wenn aber das Futter aufgezehrt
sei, so verwelke der Stamm und sterbe das Tier.[S. 112] So unglaublich schien
unseren in größter Unwissenheit über alles, was jenseits der von ihnen
bewohnten Länder geschah, dahinlebenden Vorfahren im Mittelalter die
Möglichkeit des Vorkommens pflanzlicher Wolle, daß sie eben solche
Märchen sich aufbinden ließen. Und dieses Märchen vom Schaf, das in
Früchten auf Bäumen wachse, war noch lange nicht das Wunderbarste, das
unsere biederen Ahnen damals glaubten und als verbürgte Wahrheit in
ihren Chroniken aufzeichneten.
[S. 113]
XXII.
Die Farb- und Gerbstoffpflanzen.
Die Kunst der Färberei hat sich im Anschluß an die Körperbemalung und
Tätowierung entwickelt, die auch der vorgeschichtliche Europäer vor
Zehntausenden von Jahren ausübte. Nebst Amulettschmuck sind Knollen
von durch Eisengehalt rotem Ocker, der mit Tierfett vermischt zum
Bemalen des Körpers diente, die ältesten nachweisbaren kosmetischen
Gegenstände des Menschen. Dabei war es ja naheliegend, die Schmuckfarbe
von der menschlichen Haut auf die geglättete Innenseite der zum
Wärmeschutz umgehängten Tierfelle und später auch an die Außenseite
der aus Leinfasern gewebten ältesten Kleidungsstoffe zu übertragen.
So haben schon die neolithischen Pfahlbauern, und noch in erhöhtem
Maße diejenigen der Bronzezeit, ihre neben den Fellen der erlegten
Beutetiere getragenen Leinenkleider, wie wir aus der Verzierung
ihrer gleicherweise bekleideten Idole aus gebranntem Ton schließen
dürfen, mit einfachen linearen Ornamenten aus Erd- und Pflanzenfarben
bedeckt. Neben Ruß und Roteisenstein dienten ihnen, nach den in ihren
Kulturresten gefundenen Samen zu schließen, die Beeren des Attichs,
einer Holunderart (Sambucus ebulus), zu einem hellen Blau,
das Kraut des Wau (Reseda luteola) zu Gelb und vermutlich die
Wurzeln der gemeinen Färberröte (Rubia tinctorum) zu einem
schön leuchtenden Rot. Wahrscheinlich benutzten sie auch die aus den
zerquetschten Blättern des Waids (Isatis tinctoria) gewonnene
dunkelblaue bis schwarzgrüne Farbe, mit der sich nach dem Berichte
Julius Cäsars die ihm bei seiner Landung in England im Jahre 55 v. Chr.
entgegentretenden Britannier an Gesicht und Leib abschreckend bemalt
hatten. Bei allen Naturvölkern werden dieselben Farbstoffe, die zur
Hautbemalung dienen, trocken oder mit Wasser, seltener Fett oder Öl
verrieben, auf ihre Fell- oder Zeugkleidung übertragen.
[S. 114]
Die Chinesen, Inder, Perser, Babylonier, Syrer und Ägypter kannten
und übten die Färberei seit uralter Zeit. Wie überall sonst dienten
gefärbte Kleider auch bei ihnen als gesuchte und deshalb kostbare
Gegenstände des Schmuckes und der persönlichen Auszeichnung. Schon in
der Genesis wird erzählt, daß Israel seinem viel jüngeren Bruder Joseph
einen „bunten Rock“ machte, um ihn zu erfreuen. In den Büchern Moses
werden blau, purpurn und scharlachrot gefärbte Kleider als besonders
kostbar erwähnt. Vorzugsweise wurde von den Phönikiern in Tyrus die
Färberei und der Handel mit gefärbten Stoffen betrieben, und der
aus dem Safte der zerquetschten, im Mittelländischen Meere lebenden
Purpurschnecken (Murex brandaris und M. trunculus)
gewonnene, vom Sonnenlichte nicht abschießende, sondern immer
leuchtkräftiger werdende, dunkelviolettrote Purpur, der als Symbol
priesterlicher und fürstlicher Würde galt, soll in jener phönikischen
Stadt erfunden worden sein. Bereits die ältesten Ägypter verstanden
ihre Leinenkleider, wie auch die aus demselben Material verfertigten
Binden, mit denen sie ihre mumifizierten Toten einwickelten, kunstreich
zu färben und unterschieden ihre Hauptgötter an den verschiedenen
Farben ihrer heiligen Gewänder. Der römische Naturforscher Plinius
der Ältere, um die Mitte des 1. christlichen Jahrhunderts, berichtet
voll Bewunderung von dem eigentümlichen Verfahren der hochentwickelten
ägyptischen Färberei, wonach das Zeug in die heiße Farbbrühe getaucht
und einfarbig herausgezogen, später aber mit noch anderen Farben
geschmückt wurde. Es scheint, als ob hier schon von Färberei mit
Wachsdeckung in Verbindung mit nachfolgender Zeugdruckerei die Rede
sei. Die Produkte des ägyptischen Kunstfleißes wurden weit verführt,
und werden sowohl von jüdischen, als von griechischen Schriftstellern
häufig erwähnt. Der Sitz der ägyptischen Linnenmanufaktur und -färberei
war die alte Hauptstadt Memphis in Unterägypten, woselbst die
bedeutendsten tyrischen Kleider- und Stoffhändler besondere Faktoreien
und Färbereien besaßen. Auch die von ihnen in Tyrus selbst zu färbenden
Zeuge, Gewänder und Teppiche bezogen sie zum großen Teil aus Ägypten,
wie im Klagelied des im Jahre 598 v. Chr. mit dem König Jojachin von
Juda von den Assyriern nach Mesopotamien abgeführten Propheten Hesekiel
über die Zerstörung von Tyrus zu lesen ist.
Die alten Griechen scheinen auf kunstvoll gefärbte Kleider weniger
gehalten zu haben; denn sie trugen, im Gegensatz zu den prunkliebenden
Orientalen, meist ungefärbte Gewänder. Dies war wenigstens[S. 115] in der
klassischen Zeit der Fall; aber noch im 7. und teilweise noch im
6. vorchristlichen Jahrhundert hatten auch sie, vom phönikischen
Handelsimport beeinflußt, vielfach buntfarbige Gewänder getragen,
mit denen sie in späterer Zeit nur noch die Statuen ihrer Götter
bekleideten und die ihre Schauspieler als Abzeichen der alten Zeit
trugen, wenn sie in den als gottesdienstliche Handlungen aufgefaßten
öffentlichen Schauspielen die in längstvergangener Zeit lebenden Heroen
darstellten, als ob sie noch unter den Sterblichen wandelten. In
demselben Sinne brachten auch die attischen Jungfrauen der Stadtgöttin
Pallas Athene an dem ihr geweihten Feste der Panathenäen ein kunstvoll
farbig verziertes Obergewand, das péplon, zu einer Zeit dar,
da sonst niemand mehr in Athen solch orientalisch bunte Kleider
trug. Bei den Römern war eine rote Verbrämung des weißen, als Toga
bezeichneten Obergewandes die Auszeichnung der noch nicht mannbaren
Knaben und der Standespersonen. Die Ritter trugen den rotgestreiften
Mantel, die trabea. Bei Trauer wurde die Toga schwarz gefärbt.
Bei den Spielen im Zirkus unterschieden sich die verschiedenen
Parteien durch die Farbe ihrer Anzüge und Plinius spricht von Grün,
Orangerot, Grau und Weiß. Als Farbmaterial benutzte man im Altertum
nach dem Pflanzenverzeichnis des Dioskurides und anderer Autoren
Safran, Waid, Färberginster, Krapp, Alkanna, Galläpfel, die Samen des
Granatapfels und einer ägyptischen Akazie, verschiedene Früchte und
als Phykos bezeichnete Farbflechten. Da man außerdem Alaun, Eisen- und
Kupfervitriol anwandte, muß das Beizen schon bekannt gewesen sein. Von
allen diesen Farbpflanzen wurde aber außer Safran, der mehr als Gewürz
diente, Wau, Waid und Krapp keine einzige von den Römern angebaut.
Auch bei den Kelten und Germanen der frühgeschichtlichen Zeit war die
Kunst des Färbens ziemlich ausgebildet. So berichtet der römische
Geschichtschreiber Tacitus (74–118 n. Chr.) von den deutschen Frauen,
daß sie ihre Kleidung mit Rot zu verzieren pflegen. Aus Gallien führt
er purpurrot färbendes Kraut an, womit er jedenfalls die zu jener Zeit
auch in Germanien bekannte und angewandte gemeine Färberröte oder
Krapppflanze meinte. Die Kultur dieser Pflanze wurde dann, wie wir
bald sehen werden, im späteren Mittelalter in gewissen Landschaften
Mitteleuropas sehr intensiv betrieben. Ebenso geschätzt war bei den
frühgeschichtlichen Mitteleuropäern der zum Blaufärben benutzte
Waid, der unter diesem Namen für Westgermanien bezeugt ist und im 6.
Jahrhundert bei den Goten unter dem Namen[S. 116] wizdila gebräuchlich
war. Auch die gelbfärbende Färberdistel wurde auf Wiesen und an
feuchten Orten, wo sie wild wächst, gesammelt und von den Frauen zum
Färben benutzt.
Die Entwicklung der Färberei wurde in Europa im 5. Jahrhundert durch
die Wirren der Zeit der Völkerwanderung erstickt, blühte aber im
Orient weiter, dessen bunte Textilstoffe von der tyrischen Blütezeit
ab im ganzen Abendland hochgeachtet waren. Besonderen Ruf für ihre
Produkte erlangten in ihm die Perser und Syrer, die gleich den
Indern die kunstvollsten Webereien und Stickereien in den buntesten
Farbenzusammenstellungen, wie sie nur die glanzvolle Beleuchtung unter
dem südlichen Himmel eingab, schufen. Im Morgenlande übertrug sich auch
die seit alter Zeit beobachtete Standesunterscheidung durch Farben
der Gewänder auf die Muhammedaner, bei denen Grün die Auszeichnung
der Familie des Propheten, der grüne Turban aber das Kennzeichen des
Hadschi, d. h. desjenigen ist, der die vom Propheten vorgeschriebene
Pilgerreise nach Mekka absolviert hat. Ähnlich wie in Indien heute
noch den einzelnen Kasten, wie auch den verschiedenen Rangstufen
innerhalb derselben genau vorgeschrieben ist, welche Farben und in
welcher Zusammenstellung sie dieselben tragen dürfen. Die europäischen
Fabrikanten kennen diese Gesetze ganz genau und haben eigene
Musterbücher dafür.
In Indien steht die Kunst der Färberei auf derselben hohen Stufe
wie vor tausend Jahren. Hier gibt man den Zeugen an den Stellen der
Zeichnung, die anders gefärbt werden sollen, einen Überzug von Mastix,
den weder kalte, noch warme Farbstofflösung aufzulösen vermag. Ist
das Gewebe in der betreffenden Farblösung gefärbt, so braucht man nur
den Mastix in Spiritus aufzulösen, unter dessen Hülle dann der Grund
des Zeuges in seiner ursprünglichen Färbung zum Vorschein kommt.
Die Malaien Indonesiens verfahren in ähnlicher Weise beim Färben
ihrer Sarongs oder Lendentücher, ihrem oft einzigen, jedenfalls aber
wichtigsten Kleidungsstück, dem sie die zierlichsten Muster zu geben
wissen. Auf einem Kohlenfeuer wird eine bestimmte Wachsmischung
flüssig gemacht, in einen pfeifenkopfähnlichen Behälter oben an einer
dünnen Kupferröhre gegossen und fließt von da durch die Röhre ab,
durch welche es vermittelst Fingerdruck auf das Zeug geleitet wird.
Hier deckt es alle jene Stellen, welche nicht in der betreffenden
Farbe koloriert werden sollen. Natürlich muß die Zeichnung von beiden
Stellen gleichmäßig mit der Wachslösung bedeckt werden, damit die Farbe
nicht von einer Seite eindringen könne.[S. 117] Nach dem Färben in kalter
Farblösung wird das Wachs durch Kochen in heißem Wasser entfernt und
dieselbe Prozedur für alle folgenden Farben vorgenommen, soviel solcher
zur Anwendung gelangen. Mit dieser sogenannten Battikfärberei
vermögen die Malaien besonders des östlichen Java die wunderbarsten
Effekte zu erzielen und farbige Muster von staunenswerter Grazie zu
erzeugen.
Auch die Bewohner der polynesischen Inseln färbten, ehe sie die
europäischen Baumwollstoffe kennen lernten, ihre mit Holzklöppeln
breit geschlagenen Lendentücher aus weichem Baumbast mit den
verschiedensten einfachen Mustern. Unsere Museen bergen teilweise
bemerkenswerte Proben dieser verzierten polynesischen Tapa. Noch sehr
viel kunstvoller verstanden die alten Peruaner und Mexikaner vor der
Zerstörung ihrer hohen Kultur durch die goldgierigen Spanier ihre
Lama- und Baumwollgewebe, wie auch Lederarbeiten mit Farbmustern zu
bemalen. Proben mexikanischer Gewebe, die Fernando Cortez an Karl
V. nach Europa sandte, erregten durch ihre Schönheit nicht geringes
Aufsehen. Und wer je das Berliner Völkermuseum besuchte, wird von den
zahllosen hübschen Mustern überrascht sein, welche in den Umhüllungen
und Beigaben der Mumien von Ancon und anderer Gräberfelder in Peru aus
der Zeit der Inkas zutage gefördert wurden. Sie gefielen den modernen
Europäern in so hohem Maße, daß diese schematisierten Muster auf
zahllosen Erzeugnissen der heutigen Textilindustrie kopiert wurden
und uns häufig, besonders an Tischdecken, entgegentreten. Auch die
Indianerinnen Nordamerikas wußten einst Fasern und Schnüre zu färben,
mit denen sie die Kleider und Mokassins, d. h. Schuhe aus weichem
gegerbtem Leder, wie auch die Zeltdecken aus Büffelhaut schmückten.
Heute noch üben die von der Kultur noch nicht zugrunde gerichteten
Indianerstämme Alaskas, wie besonders die Thlinkiten und Bella-kula,
ihre hochentwickelte Färbekunst auf Leder und Holz zur Freude der
ethnographischen Sammlungen aus. Als Färbemittel gebrauchen die
verschiedenen Indianerstämme Zinnobererde, Büffelbeeren, Blaubeeren,
Gelbholz, Quercitron, Galläpfel usw.
Durch die Vermittlung der Kreuzzüge, die das Abendland in nähere
Verbindung mit dem Morgenlande brachten, gelangte die Schönfärbekunst
im 12. und 13. Jahrhundert wiederum nach Europa, abgesehen von Spanien,
das in den Mauren treffliche Färbekünstler besaß. Zunächst wurde diese
für das übrige Europa neue Kunst in Italien geübt, das ja durch seine
Schiffahrt in regster Verbindung mit[S. 118] dem Oriente stand. Zuerst war
es Florenz und dann Venedig, deren Färbereien bald den höchsten Ruhm
im Abendlande erlangten. Ein Einwohner der erstgenannten Stadt hatte
im 13. Jahrhundert das Geheimnis der Darstellung der blaufärbenden
Orseille aus einer Flechte in Kleinasien erworben und brachte durch
die Einführung derselben in die Praxis seiner Vaterstadt unermeßliche
Vorteile. In Venedig erschien 1548 das erste Werk über Färberei von
Giovanni Ventura Rosetti, das großes Aufsehen erregte und nicht
wenig dazu beitrug, das Interesse an der Färberei in ganz Europa zu
erwecken. Nördlich der Alpen gewann sie zuerst größere Bedeutung in
Flandern, dessen Tuch- und Leinenweberei in hoher Blüte stand. Von
hier aus verbreitete sich die Kunst der Schönfärberei allmählich über
die anderen Länder Europas. In Deutschland war es der mächtige Bund
der Hansa, der auch diesem Erwerbszweig große Aufmerksamkeit schenkte.
Er ließ zuerst aus Italien, dann aus Flandern geschickte Färber als
Lehrmeister der einheimischen kommen. Diese bildeten damals schon
stattliche Zünfte, so in Augsburg 1390 und bald darauf auch in anderen
schwäbischen Städten. Nach London ließ König Eduard III. von England
ums Jahr 1373 Färber aus Flandern kommen, die das einheimische Gewerbe
in die Höhe brachten, so daß die Zunft der Färber 100 Jahre später
in London so stark vertreten war, daß sie eine eigene Kompagnie der
städtischen Miliz bildete.
Von großem Einfluß auf die Entwicklung der Färberei war die Entdeckung
von Amerika, indem dadurch nicht allein alle Verkehrsverhältnisse von
Grund aus verändert wurden, sondern auch eine Menge wichtiger neuer
Farbstoffe wie Rot- und Blauholz, Cochenille, Orlean und Quercitron
in den Handel kamen. Nicht minder bewirkte die Auffindung des Seewegs
nach Ostindien einen vermehrten und zugleich billigeren Bezug des bis
dahin sehr kostbaren Indigo. Weil sich aber durch dessen Einfuhr die
Waidbauern beeinträchtigt fühlten, so hatte der edle indische Farbstoff
in Europa mit den größten Schwierigkeiten zu kämpfen. Auf Anstiften
der einheimischen Waiderzeuger verbot ihn ein Edikt der Königin
Elisabeth in ganz England; zugleich wurden die im Lande befindlichen
Vorräte zerstört. Die Verwendung von Indigo wurde sogar mit Todesstrafe
bedroht; erst im Jahre 1661 unter Karl II. wurde seine Einfuhr und
Anwendung wieder gestattet.
Zu Anfang des 16. Jahrhunderts kam der Krappbau aus dem Orient nach
Schlesien und Holland und 100 Jahre später auch nach Südfrankreich.
Die Purpurfärberei mit der seit 1526 getrocknet als[S. 119] Cochenille von
Mexiko in den Handel kommenden Schildlaus des Nopalkaktus nahm einen
unerwarteten Aufschwung, als im Jahre 1650 der Holländer Cornelius
Drebbel das Zinnsalz als Ersatz des Alauns einführte und auf Grund
seiner Erfindung eine großartige Färberei besonders für Rot bei London
errichtete. Ein Landsmann von ihm, Adrian Brauer, war es, der 1667
die Wollfärberei in England einführte. Nachdem man in der Mitte des
16. Jahrhunderts Indigo und Blauholz in England eingeführt hatte,
eignete sich das Land erst mit Ende des 18. Jahrhunderts die Färberei
mit Quercitron und Türkischrot, vorzugsweise auf Bankrofts Betreiben
hin, an, dessen 1790 erschienenes Werk über Färberei die Grundlage der
neueren Kunst bildete. In Frankreich begann sich die Färberei erst
unter Ludwig XIV. zu heben, als der seit 1660 als Generalkontrolleur
der Finanzen an der Spitze der Verwaltung stehende Staatsmann Colbert
durch d’Albo eine tüchtige Färberordnung aufstellen ließ, die 1669
in Paris veröffentlicht und von den segensreichsten Folgen war. Und
als später die französische Akademie diesem Zweige des Kunstgewerbes
ihre Aufmerksamkeit zuwandte, und 1762 Joannes Althen, ein Armenier,
das Geheimnis der Türkischrotfärberei zuerst nach Frankreich gebracht
hatte, entwickelte sich die Färbekunst in diesem Lande so gewaltig, daß
es darin bald an der Spitze aller übrigen Länder zu stehen kam.
Um 1700 entdeckte man in Berlin das Berlinerblau, und 1740 erfand Barth
die Sächsischblaufärberei mit Indigosulfosäuren. Die neueste Zeit hat
die Färberei durch das Studium des Verhaltens der Beizen gegen die
Farbstoffe sehr gefördert; außerdem häuften sich die Entdeckungen aus
dem Mineralreich, und in neuen Verbindungen der organischen Chemie
lernte man die wertvollsten Rohmaterialien für glänzende Farben
kennen. Erregte in dieser Beziehung schon das Murexid aus Harnsäure
großes Aufsehen, so wurden alle bisherigen Erfolge seit 1859 durch
die Entdeckung der Teerfarben, und zwar zunächst des Fuchsins, noch
weit übertroffen. Diese beherrschen jetzt vollständig die Färberei und
geben Farben in allen Nüancen von einer Leuchtkraft und vielfach auch
Echtheit, wie sie vorher ganz unbekannt waren. Zudem wurden allerlei
Verfahren gefunden, um einige der wichtigsten Pflanzenfarbstoffe
wie Alizarin und Indigo künstlich herzustellen, so daß der Krappbau
ganz und die Indigopflanzungen Indiens wenigstens zum größten Teile
eingestellt wurden.
Wenden wir uns nun nach diesem kurzen Überblick über die Geschichte der
Färberei zu den einzelnen Farbpflanzen, und zwar sei mit[S. 120] einer der
ältesten und wichtigsten begonnen, welche die dem naiven Empfinden des
primitiven Menschen am stärksten in die Augen stechende und deshalb
am meisten zusagende Farbe, nämlich die rote, in großer Leuchtkraft
liefert. Es ist dies der Krapp, oder die Färberröte
(Rubia tinctorum), eine 60–90 cm hohe Staude mit
dornig scharfen Stengeln und Blättern, gelben Blüten und schwarzen
Früchten. Ihre technische Bedeutung verdankt sie dem kurzen, knorrigen
Wurzelstock von 20–30 cm Länge und 5–12 mm Dicke, der
außen von einer rotbraunen Rinde bedeckt, innen aber gelbrot ist.
Die Pflanze gedeiht am besten auf humusreichem Boden und wird durch
Ausläufer vermehrt, die man im März setzt. Im Herbst wird das Kraut,
das ein gutes Viehfutter bildet, gemäht, wonach man die Stöcke zum
Schutz gegen die Winterkälte mit Erde bedeckt. Die Ernte der Wurzeln
geschieht erst im Spätherbst des dritten, im Morgenland sogar erst
des fünften und sechsten Jahres. Nach der Entfernung der wenig
wertvollen Oberhaut werden die Wurzeln zunächst getrocknet und kommen
dann zerschnitten, meist aber gemahlen, als Krapp in den Handel. Er
bildet ein grobes, safranfarbiges Pulver von eigentümlichem Geruch
und säuerlichsüßem Geschmack, das begierig Feuchtigkeit aus der Luft
an sich zieht und infolgedessen leicht zusammenbackt. Deshalb muß es
sorgfältig vor Luft und Licht geschützt werden. Durch mehrjährige
Aufbewahrung verbessert der Krapp seine Qualität, geht aber nach dem
5. bis 6. Jahre zurück. Außer den gewöhnlichen Pflanzenbestandteilen
enthält er ein farbloses Glykosid, Ruberythrin, das sich unter dem
Einfluß eigentümlicher Fermente langsam in Zucker und einen roten
Farbstoff, das Alizarin, zersetzt. Daher kommt es, daß der Krapp beim
Aufbewahren an Kraft des Färbevermögens gewinnt.
Seine Heimat hat der Krapp im Mittelmeergebiet bis Syrien und
Persien, wo zunächst die Wurzeln der wilden Pflanze vom Menschen
gesammelt und zum Färben benutzt wurden; doch wurde er im Orient und
in Griechenland schön früh angebaut, ebenso von den Römern, die ihn
den Völkern nördlich der Alpen vermittelten. Der griechische Arzt
Dioskurides berichtet um die Mitte des 1. christlichen Jahrhunderts,
daß das auch als Arzneimittel gebrauchte erythródanon
angepflanzt werde und wild vorkomme; seine Wurzeln verwende man aber
hauptsächlich zum Färben. Er sagt: „Der Krapp (erythródanon)
auch téuthrion, drákanos und kinnábaris, bei den
Römern rubia passiva, bei den Etruskern lappa minor, bei
den Ägyptern aber sophobí genannt, hat eine rote Wurzel, die
zum Färben dient. Es gibt[S. 121] eine wildwachsende und eine kultivierte
Sorte, welche letztere beispielsweise in Ravenna angepflanzt wird. In
Karien sät man den Krapp zwischen Ölbäumen. Sein Anbau bringt großen
Gewinn. — Die Wurzel ist dünn, lang, rot, dient auch als Arznei.“ Sein
Zeitgenosse Plinius schreibt in seiner Naturgeschichte: „Der Krapp
(rubia, von rubus rot) ist zum Färben der Wolle und des
Leders unentbehrlich und sein Anbau bringt viel Gewinn. Für vorzüglich
gilt der bei Rom gezogene, doch wird er in fast allen Provinzen
kultiviert. Man sät ihn wie die Kicherplatterbse (ervilia), doch
wächst er auch wild. Er dient auch als Arznei.“ Der unter Cäsar und
Augustus lebende Kriegsingenieur Vitruvius sagt in seinem Buche de
architectura über ihn: „Um für Wandgemälde eine Purpurfarbe zu
bekommen, färbt man Kreide mit Krapp (rubia) und Kermesbeeren
(hysginum) von der Kermeseiche rot. Man bereitet auch andere
Farben aus Blütenpflanzen. Um ein Ockergelb zu gewinnen, wirft man
getrocknete Veilchen (viola) in ein Gefäß, gießt Wasser dazu und
läßt die Mischung kochen. Ist sie wieder abgekühlt, so schüttet man sie
in ein leinenes Tuch, drückt sie aus und tut das von Veilchen gefärbte
Wasser in einen Mörser und reibt es mit eretrischer Kreide (Eretria,
Stadt auf der Südwestküste von Euböa in Griechenland, wurde 490 v. Chr.
durch die Perser zerstört, aber wieder aufgebaut) zusammen. Man
macht auch eine schöne Purpurfarbe aus Heidelbeeren (vaccinium),
indem man sie ebenso behandelt und Milch hinzufügt. Ein schönes Grün
bekommt man, wenn man etwas Blaugefärbtes mit der gelben Farbe des
Wau (luteum, d. h. gelben, von Reseda luteola) tränkt.
Fehlt es an Indigo (color indicus, d. h. indischer Farbe), so
wendet man Waid (vitrum, von Isatis tinctoria) an, einen
Farbstoff, den die Griechen hyalon nennen.“
In dem Verzeichnis der Pflanzen, die Karl der Große auf seinen
Gütern angepflanzt haben wollte, wird die Färberröte unter dem
fränkischen Namen warentia angeführt, doch verbreitete sich
die Krappkultur erst einige Jahrhunderte später in Frankreich, wo
sie in mittelalterlichen Akten öfter erwähnt wird. Sie erlosch dann
wieder, so daß sie gegen das Ende des 16. Jahrhunderts fast nur noch
in Holland betrieben wurde. Im Jahre 1760 ließ der französische
Minister Bertin Samen des morgenländischen Krapps, der von Rubia
peregrina abstammt und heute noch der farbstoffreichste und
infolgedessen geschätzteste ist, nach Frankreich kommen und unter die
Landleute verteilen. In der Grafschaft Avignon führte der bereits
erwähnte Armenier Joannes[S. 122] Althen 1766 den bis dahin dort unbekannten
Krappbau ein, der sich wenig später auch im Elsaß verbreitete. In
Deutschland wurde wohl zuerst in Schlesien Krapp gebaut; wenigstens
datiert eine Breslauer Röteordnung von 1574. In Böhmen, wo im 16. und
17. Jahrhundert der Krappbau ebenfalls blühte, wurde er durch den
Dreißigjährigen Krieg zugrunde gerichtet; auch in Sachsen, Bayern
und Baden ging er ganz zurück. In der Pfalz datiert er seit 1763. In
den 1830er Jahren nahm er aber wieder einen großen Aufschwung und
wurde besonders in Südfrankreich um Avignon, dann in Holland und im
Elsaß betrieben, bis im Jahre 1860 die deutschen Chemiker Gräbe und
Liebermann den Krappfarbstoff, das Alizarin, künstlich aus Anthracen,
einem Teerprodukt, darstellten. Dadurch wurde der Krappbau an
seiner Wurzel angegriffen und ging begreiflicherweise stark zurück,
obschon Napoleon III. zum Schutze des südfranzösischen Krappbaus
die Hosen und teilweise auch die Mützen des französischen Militärs
mit dem Krappfarbstoff rot färben ließ. Jetzt wird hauptsächlich in
Kleinasien, Ägypten und Ostindien, teilweise auch in Nordamerika und
Australien Krapp gebaut. In Ostindien wird die einheimische Rubia
munjista gepflanzt, woher der aus jenem Lande stammende Krapp als
Munjit bezeichnet wird. In Westindien und Südamerika werden ebenfalls
besondere Arten von Rubia kultiviert, deren Wurzeln zum Färben
dienen. Heute wird der Krapp meist nur noch in technisch veralteten
Färbereien benutzt. Durch Anwendung verschiedener Beizen können mit
ihm, beziehungsweise dem künstlich hergestellten Alizarin, alle Nüancen
von Rot und Violett und teilweise auch von Braun erzielt werden. Er
dient mit dem Samen der syrischen Raute (Peganum harmala) zur
Türkischrotfärberei und zum Rotfärben von Tinte und Lack.
Einen ebenfalls schon sehr lange zum Färben benutzten dunkelroten
Farbstoff liefert die Wurzel der echten Alkanna oder
Alhenna, des kýpros der Alten von Lawsonia
inermis, einem in Ostafrika, Arabien, Ostindien, den Sundainseln
und Nordaustralien wachsenden sehr ästigen, wild meist bedornten, in
der Kulturpflege aber vielfach dornenlos gewordenen Strauch von
2–4 m Höhe mit 1–1,5 cm langen Blättern und gelblichweißen
bis ziegelroten Blüten. Seit uralter Zeit wird er im Orient und in
Nordafrika, neuerdings auch in Ostafrika kultiviert und findet sich
jetzt ostwärts bis Südchina und westwärts bis Marokko und Senegambien
angebaut. Die braunrote, etwas zusammenziehend schmeckende Wurzel kam
früher nach Südeuropa[S. 123] in den Handel und ist heute noch in Persien
und Indien als Heilmittel und zum Färben im Gebrauch. Sie wird, wie
auch die Stengel, mit Wasser gekocht und gibt eine gelblichrötliche
Flüssigkeit, welche auf weiteren Zusatz von Alkalien intensiver rot
wird, bis eine fast karminrote Lösung entsteht. Die Blüten sind wegen
ihres Wohlgeruchs sehr geschätzt und spielen bei den religiösen
Akten der Buddhisten eine große Rolle, die Blätter aber werden, wie
die Mumienfunde aus dem alten Ägypten beweisen, seit sehr langer
Zeit im Niltal zum Gelbrotfärben der Nägel der Finger und Zehen,
der Fingerspitzen, der Handflächen und Fußsohlen verwendet, womit
die Frauen ihre Schönheit zu erhöhen glauben. Die Pflanze heißt im
Altägyptischen puker, woraus durch Umstellung das koptische
kuper, das hebräische kopher und das griechische
kýpros entstand. In einigen altägyptischen Parfümerierezepten
und als Bestandteil des heiligen Räucherpulvers kyphi wird
kuper als Bestandteil angeführt. Und wie die Frauen im alten
Ägypten, so bedienen sich die heutigen Bewohnerinnen des Niltals wie
überhaupt die Araberinnen des von ihnen fagu oder fagia
genannten Strauches in der oben genannten kosmetischen Weise. Zu
diesem Zwecke werden die Blätter, die getrocknet und gepulvert unter
dem Namen Henna in den Handel kommen, mit Kalkmilch verrieben
und aufgetragen. Alternde Frauen färben sogar ihre weiß werdenden
Haare, Männer ihren Bart und die Mähne ihrer Pferde damit orangerot.
Diese unserem Geschmack wenig zusagende Verschönerung ihres Äußeren
halten die Orientalinnen für ebenso notwendig, als das Bemalen der
Augenlidränder und Stirnmitte mit Strichen des schwarzen kuhl,
einer aus Ruß oder zerstoßenem Schwefelantimon hergestellten Paste,
die bereits die Frauen im alten Ägypten benutzten, wie wir aus den
Gräberfunden und alten Rezepten auf Papyri wissen. In Indien dient die
Henna zum Schwarzfärben von Leder.
Denselben prachtvollen roten Farbstoff Alkannin wie die echte birgt
die unechte Alkanna, die Wurzel der in der Türkei, in Kleinasien und
besonders in Ungarn angepflanzten und in Ballen von etwa 100 kg
zu uns in den Handel gelangenden Färberochsenzunge (Anchusa
tinctoria), die zum Rotfärben von Haarölen, Pomaden, Polituren
usw. dient, außerdem zum Färben von Leder und in Lyon zum Färben von
Seide benutzt wird. Schon die alten Griechen und Römer bedienten sich
ihrer zum Rotfärben und Schminken, wie auch als Arznei. So schreibt
Theophrast im 4. vorchristlichen Jahrhundert: „Die Färberochsenzunge
(anchúsa) hat eine rote Wurzel wie der Krapp,[S. 124] und färbt rot.“
Hesychios schreibt: „Sich anchusieren (anchusízesthai) heißt:
die Wangen mit anchusa schminken,“ und der Arzt Dioskurides
sagt, die Wurzel sei fingerdick, fast blutrot und werde als Arznei
benutzt und in Salben getan. Sein Zeitgenosse Plinius schreibt:
„Die fingerdicke Wurzel der anchusa färbt die Finger blutrot
und bereitet die Wolle für kostbare Farben vor. Auch wird sie als
Arznei gebraucht.“ Bei der Besprechung der Salben erwähnt er die
anchusa neben dem von dem Drachenbaume (Dracaena draco)
auf der ostafrikanischen Insel Sokotra stammenden Drachenblut
(cinnabaris, d. h. Zinnober) als Farbstoff (color).
Auch im Mittelalter und in die Neuzeit hinein war dieser Farbstoff
gebräuchlich, bis er durch bessere verdrängt wurde.
Ein ähnliches Rot wie die Färberochsenzunge liefert der
Färberkroton oder die Tournesolpflanze (Chrozophora
tinctoria), eine einjährige Wolfsmilchart von den sandigen Küsten
des Mittelmeergebiets und aus Arabien mit langgestielten, behaarten
Blättern und hängenden Fruchtkapseln. Sie diente bei den Alten zum
Vertreiben der Würmer und zum Wegätzen der Warzen; jetzt wird sie
zur Herstellung der Bezetten oder Schminkläppchen benutzt. Es sind
dies Leinwandläppchen, die in Südfrankreich mit dem Safte der Blüten
und Früchte des Färberkrotons, jetzt aber meist mit dem Extrakte des
Pernambukholzes so stark getränkt werden, daß sie leicht Farbstoff
abgeben. Man verwendet die Bezetten zum Schminken, zum Färben von
Backwerken, Likören, Gelees und namentlich in Holland zum Färben der
2–10 kg schweren runden Süßmilchkäse, die nach der Stadt Edam
benannt werden, aber vorzugsweise in der Gegend von Hoorn und Alkmaar
in Nordholland hergestellt werden. Der Färberkroton wird hier und da,
so namentlich bei Montpellier, angepflanzt.
Weniger wichtig ist der rote Farbstoff der syrischen Raute
(Peganum harmala), eines ausdauernden Gewächses mit
30–40 cm langem Stengel und ziemlich großen, weißen Blüten, das
gesellig in den Steppen Spaniens, Nordafrikas und von Südrußland bis
zur Dsungarei und Tibet wächst. Die Samen dienen in der Türkei als
schweißtreibendes, Würmer vertreibendes und berauschendes Mittel,
auch als Gewürz, besonders aber in Verbindung mit der pulverisierten
Krappwurzel zur türkischen Rotfärberei. Aus ihnen wird das auch sonst
vielfach zum Färben benutzte Harmalin oder Harmalarot gewonnen.
Von anderen roten Farben finden wir in der Alten Welt den unschädlichen
Farbstoff der Kermesbeeren oder Scharlachkörner in[S. 125]
Form von braunroten, erbsengroßen, mit rotem Safte angefüllten
Hüllen der Kermesschildlaus (früher Coccus, jetzt Lecanium
ilicis), die sich an der in Südeuropa wachsenden strauchartigen
Kermeseiche (Quercus coccifera) finden. Sie werden von armen
Leuten, besonders Hirten und Kindern, die sich zu diesem Zwecke die
Nägel lang wachsen lassen, von den Zweigen abgekratzt und kommen
besonders von Nauplia in Griechenland aus in den Handel, um speziell
nach Marokko, Tunis und Alexandrien verschifft zu werden, wo dieselben
in hohem Preise stehen, weil die Muhammedaner ihre Wolltücher,
namentlich aber ihre von uns nach der Stadt Fez in Marokko als
Fez bezeichneten Kopfbedeckungen rot färben. Bei uns dienten sie
früher an Stelle der teueren Cochenille in der Färberei, namentlich
zur Herstellung eines schlechten Karmins, des Kermesbeeren- oder
Karminlacks, und in der Apotheke zur Bereitung des Kermes-Sirups und
des Alkermes-Konfekts, Präparaten, mit denen die arabischen Ärzte im
Mittelalter das Abendland bekannt machten. Al ist der arabische
Artikel und kermes oder kermas heißt arabisch-persisch
wurmerzeugt (von kirm, Wurm). Von diesem Kermes rührt das
arabisch-persische kirmasi für Karminrot her, ein Ausdruck, der
als Karmoisin (später in Karmin abgekürzt) ins Deutsche überging. Der
Karmoisinlack wurde besonders in Persien zur Herstellung der berühmten
roten Lackwaren benutzt und kam ebenfalls durch die Vermittlung der
Araber zur Kenntnis der Völker des Abendlandes. Diese Kermesbeeren
wurden schon bei den alten Griechen zum Färben verwendet und hießen
bei ihnen kókkos. So schreibt Dioskurides: „Die Kermeseiche
(kókkos baphiké) ist ein kleiner, ästiger Strauch, an welchem
Körner (kókkos) wie Linsen (phakós) hängen, welche
gesammelt und aufbewahrt werden. Die besten kommen aus Galatien und
Armenien, geringere aus Asien (dem nordwestlichen Kleinasien, das bei
den Römern die Provinz Asia bildete) und Kilikien, die geringsten aus
Spanien. Außer zum Färben gebraucht man sie in der Heilkunde, mit Essig
verrieben, äußerlich als zusammenziehendes Mittel.“ Wie wir von Vitruv
im letzten Jahrhundert v. Chr. erfahren, hieß das Kermesbeerenrot bei
den Römern hysginum und wurde viel zum Färben und Schminken,
auch zum Rotmalen von Wänden und Wandgemälden benutzt. Noch heute sind
in Griechenland ausgedehnte Landstrecken, namentlich Bergabhänge und
für anderweitige Kultur unbrauchbare Berge dicht mit dem Gestrüpp der
Kermeseichen besetzt, die zur Kermesgewinnung ausgebeutet werden.
Ein Surrogat dieser echten Kermesbeeren der Kermeseiche bilden[S. 126] die
schwarzen Beeren der aus Nordamerika bei uns eingeführten und in
Südeuropa verwilderten gemeinen Kermesbeere (Phytolacca
decandra), eines ausdauernden Krautes mit länglicheiförmigen,
ganzrandigen Blättern. Mit dem roten Safte der Beeren färbt man in
Frankreich und Portugal die Weine und in ganz Europa die Zuckerwaren,
besonders Sirup rot; doch ist dieser Farbstoff weit weniger haltbar
als derjenige der echten Kermesbeeren der Kermeseiche. Von Bordeaux
verbreitete sich der Anbau dieser Pflanze seit 1770 nach Süddeutschland
und Norditalien. Die jungen Blätter und Schößlinge werden gekocht als
Gemüse gegessen. Ihr naher Verwandter, der Kermesbeerenspinat
(Phytolacca esculenta) wird in seiner Heimat Südamerika wegen
seines würzigen Wohlgeschmacks als Spinatpflanze kultiviert, verträgt
aber unser Klima schlecht, so daß er kaum je bei uns eingebürgert
werden dürfte.
Weitere, noch wertvollere rote Farbstoffe hat uns die Neue Welt in
der Cochenille und dem Brasilholz geschenkt. Erstere besteht
aus den getrockneten Weibchen der in ganz Mittelamerika heimischen,
aber vorzugsweise in Mexiko auf Opuntien (Nopalkaktussen) gezüchteten
Cochenilleschildlaus (Coccus cacti), die den modernen Karmin
— früher nach den Kermesschildlauskörnern der Mittelmeerländer aus
dem arabischen kirmasi Karmoisin genannt — liefern. Was die
Kermeskörner der Kermeseiche den Kulturvölkern der Alten Welt, das war
denjenigen der Neuen Welt, zumal den Azteken in Mexiko, die Cochenille,
die ihnen vorzugsweise zum Rotfärben diente. Als die Spanier diesen
prächtigen Farbstoff kennen lernten, waren sie so sehr von ihm
entzückt, daß sie ihn sofort in ihrer Heimat einführten. Um diesen
Farbstoff selbst zu produzieren, wurde die Cochenillekultur mit dem
Nopalkaktus im 18. Jahrhundert von Mexiko aus nach Südspanien und 1853,
als die Weinkultur durch die Traubenkrankheit fast ganz ruiniert war,
auch nach den Kanarischen Inseln, besonders Teneriffa, verpflanzt, wo
sie bald zum Haupterzeugnis des Landes wurde. Von 1853 bis 57 wurden
von Teneriffa über 2 Millionen kg und 1857 allein ¾ Millionen
kg exportiert. Noch früher wurde diese Schildlaus mit ihrer
Nährpflanze nach Java verbracht, von wo 1853 über 45000 kg
Cochenille gewonnen wurden. Erst seitdem die auf künstlichem Wege
aus Teerabkömmlingen hergestellten echteren und intensiver färbenden
Anilinfarben, besonders das Fuchsin, in der Färberei aufkamen, wurde
die Cochenillezucht völlig zurückgedrängt.
Ein anderer amerikanischer roter Farbstoff ist das Pernambuk-[S. 127]
oder echte Brasilholz, das von einem baumartigen Hülsenfrüchtler
(Caesalpinia echinata) mit kurzstacheligen Ästen, unpaarig
gefiederten Blättern, kurzgestielten, gelb und rot gefleckten,
wohlriechenden Blüten in fast rispiger Traube und dornigen Hülsen
stammt. Seine indianische Bezeichnung brasil soll dem Lande Brasilien
den Namen gegeben haben. Letzteres wird nämlich erst seit 1580 so
genannt, während man das Brasilholz unter diesem Namen schon seit
1494 kannte. Früher hieß es auch „Königinholz“, weil seine Verwertung
jahrhundertelang ein Monopol der portugiesischen Krone war. Der in ihm
enthaltene Farbstoff, der sich auch im Limaholz aus Peru und Chile, im
St. Martholz aus Zentralamerika und im Jamaikaholz von den Antillen
findet, heißt Brasilin. Das echte Brasilholz kommt in armdicken, außen
rotbraunen bis schwärzlichen, innen gelbroten Knüppeln meist über
Pernambuco — daher der Name — in den Handel. Außer als Farbholz wird
es auch in der Kunsttischlerei und Drechslerei benutzt.
Ein anderer schöner roter Farbstoff südamerikanischen Ursprungs ist
das Chicarot oder Caracuru, das aus den Blättern der
an den Ufern des Orinoko, Cassiquiare und anderer Flüsse Südamerikas
wachsenden Bignonia chica gewonnen wird. Es ist dies ein Strauch
mit doppelt gefiederten Blättern, die beim Trocknen rot werden, und
violetten, hängenden Blüten. Werden die Blätter abgekocht, so scheidet
sich in der erkalteten Lösung der zinnoberrote, beim Reiben goldgrün
metallisch glänzende Farbstoff ab, der unlöslich in Wasser, schwer
löslich in Alkohol, aber leicht löslich in Ölen und Alkalien ist. Er
wird von den Indianern, die an den obengenannten Flüssen hausen, zum
Bemalen der Haut, in Nordamerika aber zum Gelb- und Rotfärben von Wolle
und Seide benutzt.
Nahe verwandt mit dem Brasilholzbaum ist der Campeche- oder
Blauholzbaum (Haematoxylon campechianum), ein
10–12 m hoher Baum mit meist krummem Stamm, runzeliger, schwarzbrauner
Rinde, vielfach hin- und hergebogenen Ästen, paarig gefiederten
Blättern, kleinen hochgelben Blüten in einzelnen Trauben und
lanzettlichen, meist einsamigen Hülsen. Er ist ursprünglich in Mexiko
und Mittelamerika heimisch, von wo das Holz von meist wildwachsenden
Bäumen vorzüglich aus der Campechebai — daher der Name — und Honduras
in den Handel gelangt. Bald nach der Entdeckung Amerikas gelangte
sein von den mittelamerikanischen Kulturvölkern zum Färben benutztes
Holz aus den mexikanischen Häfen durch die Spanier nach Europa. Im
Jahre 1570, zur Zeit der Königin Elisabeth, wurde es in Eng[S. 128]land
eingeführt; da man aber nicht echt damit zu färben verstand, verbot ein
Parlamentsbeschluß vom Jahre 1581 streng seine Einfuhr und Verwendung.
Dieses Verbot der Verwendung des als logwood, d. h. Stammholz,
bezeichneten Blauholzes zum Färben wurde über ein Jahrhundert hindurch
aufrechterhalten, obgleich es vielfach dadurch umgangen wurde, daß
man es unter dem neuen Namen blackwood, d. h. Schwarzholz,
einschmuggelte. Von Mittelamerika kam der es liefernde Baum im Jahre
1715 durch Barham nach Westindien, dann auch nach dem nördlichen
Südamerika. Neuerdings wird er auch in den niederländischen Kolonien
in Westindien gepflanzt. Das auswendig blauschwarze, innen rotbraune,
schwere, harte Holz nimmt eine gute Politur an und dient daher außer
zum Färben in der Kunsttischlerei zur Herstellung wertvoller Möbel.
Es enthält einen blauen Farbstoff, das Hämatoxylin, das sich in
Alkalien mit violetter Farbe löst, auch zum Schwarzfärben und in der
mikroskopischen Technik als vorzügliches Kernfärbungsmittel verwendet
wird.
In der Alten Welt ist das älteste Blaufärbemittel der Waid
(Isatis tinctoria), ein zweijähriger, 0,5–1 m hoch
werdender Kreuzblütler mit gelben, in Trauben geordneten Blüten, der
im mittleren und südlichen Europa sowie im Orient auf sonnigen Plätzen
wild wächst. Die Blätter geben Indigblau und waren schon den Alten als
Färbematerial bekannt, weshalb die sie liefernde Pflanze teilweise auch
angebaut wurde. Der Waid bevorzugt lehmhaltigen Boden, auf dem er meist
nur eine Höhe von 40–60 cm erlangt. Die Blätter wurden, so lange
man bei uns den Waid anpflanzte, zwei- bis dreimal im Jahre abgebrochen
und in den Waidmühlen zerstampft. Der so entstehende Brei wurde, meist
von Kindern, zu kleinen Kugeln geformt und getrocknet. Später wurden
die Ballen in Bottiche getan und mit Wasser übergossen, wodurch sie
bald in Gärung gerieten und eine Temperatur von 15–20° C.
zeigten. Von den Bottichen zog man die Flüssigkeit ab und setzte ihr
Kalkwasser zu, worauf der nunmehr gelbe Farbstoff sich zu Boden setzte.
Durch Hinzufügen von Salzsäure erhielt er erst die blaue Farbe, die
dann unter starker Hitze getrocknet und in den Handel gebracht wurde.
Ursprünglich ließ man aber das in der Lösung befindliche Indoxyl durch
längeres Stehenlassen sich unter Freiwerden von Indigo zersetzen.
Deshalb stampfte man die nicht nur zerquetschte, sondern völlig
zerfallene Waidmasse in Fässer ein, in denen sie durch Fermentwirkung
nach und nach immer reicher an Indigo wurde.
[S. 129]
Schon die alten Kelten, Germanen und Slawen bedienten sich des Waides
zum Blaufärben. Von den Kelten Britanniens berichtet uns Julius Cäsar
in seiner Beschreibung von der Expedition nach England in seinem Werke
über die Unterwerfung Galliens unter die römische Oberhoheit, sie
seien ihm mit Waid (vitrum) blau gefärbt entgegengetreten und
sähen dadurch in der Schlacht überaus wild aus. Auch die Griechen und
Römer bedienten sich des Waides, den erstere isátis nannten.
So spricht Dioskurides von dem Waid (isátis), „dessen sich
die Färber bedienen“, er werde mehr als ellenhoch und seine Blätter
würden auf Geschwülste, Geschwüre und Wunden gelegt. Die Römer nannten
ihn, wie uns Plinius berichtet, nach seiner Bezeichnung im Gallischen
glastum. Nach der uns erhaltenen Verordnung Karls des Großen
über die Verwaltung der kaiserlichen Domänen aus dem Jahre 812 mußte
er, wie der Krapp, als Abgabe bestimmter Dörfer in die königlichen
Weiberhäuser zu Händen der dort mit Spinnen, Weben und Färben der
für den königlichen Hofhalt bestimmten Gewänder beschäftigten Frauen
geliefert werden. Der geringste Teil desselben wird von wildwachsenden
Pflanzen gesammelt worden sein; da er bereits angebaut wurde, wird
das meiste von kultivierten Waidpflanzen abgestammt haben. Diese
hieß damals bei den Franken wisdila, ewaisda oder
waisdo. Im Mittelalter wurde er allgemein in Mitteleuropa
angebaut und bildete hier das wichtigste Blaufärbemittel. Die ersten
Nachrichten über den Anbau des Waides in Schwaben stammen aus dem
Jahre 1276. Noch früher aber scheint er in Sachsen gepflanzt worden
zu sein; denn die Stadt Erfurt war schon im Jahre 1290 wegen ihres
Waidbaues berühmt. Die Erfurter Waidhändler bildeten die Aristokratie
der Stadt und waren so reich, daß sie im Jahre 1392 die Mittel zur
Gründung und später auch für Erhaltung der einst weithin berühmten,
erst 1816 eingegangenen Universität Erfurt aufbringen konnten, die also
gewissermaßen aus den Erträgnissen der Waidkultur und des Waidhandels
errichtet und unterhalten wurde. Daraus kann man schon ersehen, wie
außerordentlich wichtig die Erzeugung und der Handel mit diesem
Farbstoffe im Mittelalter war. Später erwarben neben Erfurt auch noch
Gotha, Arnstadt, Langensalza und Tennstedt das Recht Waid zu bauen,
und zu Anfang des 17. Jahrhunderts beschäftigten sich damit außer den
Einwohnern dieser Städte noch diejenigen von mehr als 300 thüringischen
Dörfern. Erst in der Neuzeit hat die große Wohlfeilheit des aus
Indien eingeführten Indigos den Waid trotz aller zu seinem Schutze[S. 130]
unternommener amtlicher Verfügungen so ziemlich außer Anwendung
gebracht. Umsonst versuchte ihn auch der edeldenkende und um seine
Untertanen besorgte Kaiser Josef II. im Deutschen Reiche wieder in
Aufnahme zu bringen. Nur vorübergehend, während der verhängnisvollen
Kontinentalsperre, legte man sich in Mitteleuropa wieder eifriger
auf seinen Anbau, da damals auch der von den Engländern aus Indien
gebrachte Indigo gesperrt war. Napoleon I. setzte sogar einen Preis von
einer halben Million Franken auf die lukrative Gewinnung von Indigo aus
Waid; doch hat ihn bis auf den heutigen Tag noch niemand gewonnen, denn
auch bei der rationellsten Verarbeitung liefert 1 Zentner Waid kaum
130 g Indigo, während die gleich zu besprechende Indigopflanze 30mal
mehr davon liefert. Immerhin wird der Anbau von Waid, der am besten
auf trockenem Lehmboden gedeiht, gegenwärtig noch in beschränktem Maße
in Thüringen, Böhmen, und Frankreich betrieben. Seine Samen liefern
gepreßt ein dem Leinöl an Wert gleichkommendes fettes Öl.
Denselben blauen Farbstoff, wie ihn der Waid liefert, gewinnt man,
wie gesagt, in weit ausgiebigerer Weise aus den Indigoarten,
von denen die ostindische Indigofera tinctoria die wichtigste
ist. Es ist dies eine bis 1,5 m hohe Staude aus der Familie
der Schmetterlingsblütler mit zerstreut stehenden, gefiederten
Blättern, kurzen Trauben, sehr kleinen, dunkelrosenroten und weißen
Blüten und stielrunden, herabgebogenen Hülsenfrüchten. Ihr größtes
Anbaugebiet ist Bengalen, neben dem die andern wenig bedeuten. Vor
allem verlangt sie ein feuchtes, heißes Klima. In gut gedüngtem
und gepflügtem Boden wird der Same in Reihen von 30–50 cm
Abstand gesät und mit Erde leicht bedeckt. Nach drei Monaten werden
die Pflanzen kurz vor dem Beginn der Blüte etwa 12 cm über
dem Boden geschnitten und nach der Faktorei gebracht, wo heute noch
wesentlich nach derselben Methode wie einst im Altertum der Farbstoff
aus ihnen gewonnen wird. Beim Binden und Einfahren der Ernte, deren
man in guten Lagen drei, manchmal sogar vier im Jahre erhält, ist
darauf zu achten, daß die Pflanzen nicht zu sehr gepreßt werden. In
Stücke zerschnitten werden sie in großen gemauerten Kufen mit Wasser
übergossen; darin bleiben sie liegen, bis der Saft in kurzer Zeit
in Gärung gerät und eine grünlichgelbe Farbe annimmt. In dieser als
nila bezeichneten Lösung bildet sich alsbald eine Schaumschicht
und ammoniakalischer Geruch macht sich geltend. Dabei beginnt sich
der Prozeß zu vollziehen, der das in der Pflanze enthaltene farblose
Glykosid In[S. 131]dikan in Zucker und Indigweiß spaltet und durch Oxydation
des letzteren das Indigblau, eben den Farbstoff Indigo, entstehen läßt.
Die in Ammoniak gelöste, Indigweiß enthaltende Flüssigkeit wird nun
in andere Behälter abgezogen, worin sie durch anhaltendes Schlagen
und Rühren mit Schaufeln in innigste Berührung mit dem Sauerstoff der
atmosphärischen Luft gebracht wird. Dabei färbt sich der gelblichgrüne
Saft blau, indem das Indigweiß durch Sauerstoffaufnahme zu Indigblau
oxydiert wird. Letzteres ist unlöslich, scheidet sich aus und setzt
sich bei ruhigem Stehen als schlammiger Niederschlag ab. Nach dem
Ablaufenlassen der klar gewordenen Flüssigkeit wird der Niederschlag an
der Sonne getrocknet und im halbtrockenen Zustande in backsteinartige
Formen gepreßt; diese werden völlig getrocknet und sind dann
versandfertig. 250 kg rohe Indigopflanzen ergeben 1 kg
festen Farbstoff. Die Gesamtproduktion daran betrug im Jahre 1903 3,4
Millionen kg, davon fielen 2,7 Millionen kg auf Indien,
0,5 Millionen kg auf Holländisch-Indien und 0,2 Millionen
kg auf Mittelamerika. Der Durchschnittswert per kg
beträgt 10 Mark, während er noch vor zwei Jahrzehnten das Doppelte
davon und mehr betrug. Der Preis ist so stark gesunken infolge der vom
deutschen Chemiker A. von Baeyer erfundenen künstlichen Herstellung des
Farbstoffs, so daß sich die Indigokultur nur noch sehr schlecht lohnt
und selbst in Bengalen mehr und mehr zurückgeht.
Der Indigo ist einer der wichtigsten Farbstoffe, der auf Wolle,
Leinen, Baumwolle und Seide das echteste Blau gibt und infolgedessen
schon im hohen Altertum als Deckfarbe zum Malen und zum Färben der
verschiedensten Stoffe benutzt wurde. Zuerst wurde er in seiner
Heimat Indien gewonnen und von da auf dem Handelswege in die westlich
davon gelegenen Länder gebracht. Im Alten Testament wird er einigemal
genannt. Jedenfalls verwandten ihn die Juden so gut wie die Babylonier
und Ägypter, die diesen geschätzten Farbstoff zum Blaufärben schon in
früher Vorzeit durch den Tauschhandel aus Indien bezogen. Von dort
her erhielten ihn auch die Griechen und Römer, die ihm den Namen
indikón beziehungsweise indicum, den indischen (nämlich
Farbstoff) gaben, woraus unsere Bezeichnung Indigo hervorging. Plinius
schreibt in seiner Naturgeschichte darüber: „Als Farbstoff steht das
indicum in hohem Ansehen; es kommt aus Indien und besteht aus
einer erdigen Masse. Wird es gerieben, so ist es schwarz; wird es aber
in Wasser aufgelöst, so gibt es eine prächtige Mischung von Purpur
und Blau. Das echte erkennt man daran, daß es auf[S. 132] brennende Kohlen
gestreut eine herrlich purpurrote Flamme und einen nach Meerwasser
riechenden Rauch gibt. (Tatsächlich entwickelt Indigo bei rascher
Erhitzung einen purpurroten Dampf, verbrennt und hinterläßt nur wenig
Asche.) Das Pfund indicum kostet 20 Denare (= 12 Mark).“ Dieser
Farbstoff wurde wie die übrigen Produkte Indiens über das Rote Meer und
Alexandrien nach dem Römerreiche gebracht. Als dieses zusammenbrach,
verhandelten die Araber den Völkern des Abendlandes diesen Farbstoff
unter der indischen Benennung nila oder anil, was
blau bedeutet. Davon heißt er heute noch in Spanien anil und
bezeichnete die Wissenschaft der Chemie das bei der Destillation des
Indigos mit Kali entstehende Produkt als Anilin. Erst die Araber
haben dann im Mittelalter diese Farbstoffpflanze, die sie auf ihren
Handelsfahrten nach Indien in jenem Lande kennen lernten, in Westasien
anzubauen und daraus den Indigo selbst herzustellen unternommen. So
wurde noch im Jahre 1320 Indigo bei Jericho angepflanzt; doch scheint
dieser Anbau als unrentabel bald aufgegeben worden zu sein. Jedenfalls
war es dieser an ein feuchtwarmes Klima gewöhnten Pflanze hier zu
trocken und zu wenig warm.
Lange wußte man im Abendlande nicht, woraus dieser indische Farbstoff
gewonnen werde. So rechnete ihn eine Halberstädter Bergwerksordnung
aus dem Jahre 1705 zu den schürfbaren Mineralien; er hieß deshalb auch
in Verbindung mit seiner Würfelgestalt „indischer Stein“. Und doch
hatte der bis nach China gereiste Venezianer Marco Polo nach seiner
Rückkehr in die Vaterstadt im Jahre 1295 die Gewinnung desselben
nach eigener Anschauung beschrieben. Die Italiener, die ihn von den
Arabern erhalten hatten, waren auch die ersten Abendländer, die ihn
anwandten. Erst nach der Entdeckung des Seeweges nach Ostindien durch
Vasco da Gama kamen von 1516 an größere Mengen von Indigo nach Europa,
und zwar nahm Portugal diesen Handel an sich, bis sich in der Mitte
des 16. Jahrhunderts die Holländer seiner bemächtigten. Im Jahre 1631
brachten sieben holländische Schiffe 290173 kg Indigo im Werte
von über fünf Tonnen Gold aus Batavia nach Amsterdam. Erst ungefähr
ums Jahr 1600 begann man in Deutschland den Waidküpen etwas Indigo
zuzusetzen, um deren Färbkraft für Blau zu erhöhen und zu beleben.
Dieser kleine Zusatz vergrößerte sich mit der Verbilligung des Indigos
fortwährend, bis schließlich der Waid gänzlich wegfiel. Doch spielte
sich dieser Prozeß keineswegs glatt ab; denn wie bei der Einführung
vieler anderer[S. 133] fremder Stoffe stemmte sich auch hier das Vorurteil und
der Eigennutz der Waidbauern gegen die ausländische „Teufelsfarbe“. So
wurde nämlich der Indigo im ersten ihn streng verbietenden Frankfurter
Reichspolizeierlaß von 1577 betitelt. Das Verbot, ihn zu verwenden,
wurde wiederholt in Erinnerung gebracht, so noch 1654 unter Ferdinand
III. In Sachsen war von 1650–1653 sogar die Todesstrafe auf seine
Verwendung gesetzt, und in Nürnberg mußten die Färber alljährlich
einen feierlichen Eid schwören, kein „Teufelsauge“ — so hieß dort der
Indigo — zu benutzen. Zu dieser Verfolgung des Indigos mag zum Teil
die Unkenntnis der Färber beigetragen haben, die ihn in Schwefelsäure
gelöst anwandten und nachher nicht genügend neutralisierten, so daß
manches Stück Zeug infolge davon verdarb. Erst 1740 gab der Deutsche
Barth zu Großenhain in Sachsen ein gutes Verfahren für dessen Anwendung
an, wodurch Mißerfolge ausgeschlossen blieben.
Auch in Frankreich und England war aus Rücksicht für den einheimischen
Waidbau die Einfuhr und Verwendung von Indigo streng verboten, bis
er in letzterem Lande 1661 und in ersterem 1669 unter Colbert wieder
freigegeben wurde. Unbeschränkte Anwendung genoß er aber in Frankreich
erst vom Jahre 1737 an, als den Färbern erlaubt wurde, jedes beliebige
Färbemittel zu verwenden. Seit 1783 wurde der Anbau des Indigos durch
die Engländer in Ostindien in Angriff genommen und bald zu großer
Blüte gebracht, wofür sie in Europa willige Abnehmer fanden, da man
dort diesen vorzüglichen Farbstoff immer mehr schätzen lernte. Noch
vor einem Vierteljahrhundert betrug die für den Anbau des Indigos in
Anspruch genommene Fläche in Bengalen allein 390000 Hektar Landes.
Auch auf der Koromandelküste, auf Ceylon und Java wurde er im großen
angepflanzt, ebenso in Ägypten, wo ihn Mehemed Ali in den 1820er Jahren
einführte. Endlich bemühte sich auch Rußland, ihn in Transkaukasien
heimisch zu machen.
Neuerdings hat aber der Anbau dieses wichtigsten und einträglichsten
Ausfuhrartikels Indiens, das Jahrhunderte hindurch den Weltmarkt
beherrschte und an dem vor allem England sich ungeheuer bereicherte,
zum großen Leidwesen aller Indigopflanzer einen gewaltigen
Stoß erlitten und ist nicht mehr konkurrenzfähig gegenüber dem
künstlichen Indigo, den wir dem Scharfsinne deutscher
Chemiker verdanken. Die erste Indigosynthese gelang 1870 Engler
und Emmerling; 1880 vermochte Baeyer ihn auf verschiedene Art
aus Zimtsäure[S. 134] herzustellen und 1890 gab Heumann sein Verfahren
an, das in zehnjähriger Arbeit von der badischen Anilin- und
Sodafabrik in Ludwigshafen bei Mannheim zu praktischer Brauchbarkeit
ausgebildet wurde, so daß er heute den Markt vollständig beherrscht
und wegen seiner größeren Billigkeit in Verbindung mit andern
guten Eigenschaften, die erlauben, die mannigfaltigsten neuen
Farbenvarietäten, wie rote, gelbe und grüne in den wunderbarsten
Nuancen herzustellen, den natürlichen Indigo immer mehr verdrängt.
So sank seit dessen Aufkommen in den letzten zehn Jahren die Ausfuhr
des natürlichen Indigos im Werte von 75 Millionen auf ungefähr 10
Millionen Mark. Gleichzeitig stieg die Ausfuhr des künstlichen Indigos
aus Deutschland von 7,5 Millionen Mark im Jahre 1898 auf 38,6 Millionen
Mark im Jahre 1908. Damit trat Deutschland das Erbe Indiens an und
heimst statt jenes Landes Reichtum ein. Der beste Abnehmer für sein
vorzügliches Kunstprodukt ist Japan, das 1908 für 10,7 Millionen Mark
davon einführte. Ihm folgen China mit 7,3 Millionen und die Vereinigten
Staaten mit 3,1 Millionen Mark. Selbst Großbritannien, das alle
Anstrengungen machte, seinen Indigobau zu schützen, führte im Jahre
1908 für 2,7 Millionen Mark deutschen Indigo ein. Die Einfuhr des meist
aus Indien bezogenen natürlichen Indigos, von dem Deutschland noch 1895
für 21 Millionen Mark bezog, sank schon 1903 auf 1,8 und 1908 gar auf
0,9 Millionen. So hat deutsche Intelligenz und Tatkraft statt einer
Ausgabe von 20 Millionen eine Einnahme von 40 Millionen Mark jährlich
bewirkt. Diese Tatsache kennzeichnet die überaus große wirtschaftliche
Bedeutung des künstlichen Indigos für den deutschen Handel und die
deutsche Volkswirtschaft.
Auch die alten Azteken in Mexiko, die Inkas in Peru und die übrigen zu
höherer Kultur gelangten Indianerstämme Amerikas verwandten bereits
vor der Ankunft der Europäer eine Art Indigo zum Blaufärben. Doch
wurden nach der Entdeckung dieses Weltteils frühzeitig ostindische
Indigopflanzen nach Amerika eingeführt, und zwar zunächst nach den
Antillen, von wo der englische Gouverneur Lukas 1699 Samen an seine
Tochter in Carolina sandte, die eine Pflanzenliebhaberin war und
der es nach mehreren fehlgeschlagenen Versuchen gelang, das Gewächs
zur Blüte und zur Reife zu bringen. Ihr Vater sandte später einen
gelernten Indigoarbeiter, der die Gewinnung des Farbstoffs unternahm
und dabei so gute Geschäfte machte, daß bald jedermann Indigo bauen
wollte. In wenigen Jahren wurden nicht weniger als 100000 kg
nach England gesandt, und vor dem Kriege[S. 135] im Jahre 1775, der am 4. Juli
1776 zur Loslösung der 13 nordamerikanischen Kolonien vom Mutterlande
führte, betrug die Ausfuhr 550000 kg. Jetzt ist, wie gesagt,
der Indigobau auf der ganzen Erde bedeutend zurückgegangen, seitdem
die Badische Anilinfabrik in Ludwigshafen bei Mannheim zuerst den
europäischen Markt mit künstlichem Indigo zu versehen begann. Denselben
Farbstoff gewinnt man seit undenklicher Zeit in China aus dem dort
heimischen Färberknöterich (Polygonum tinctorium), einer
dem Buchweizen verwandten einjährigen Pflanze, die 1835 in Frankreich
und 1838 in Deutschland eingeführt wurde. Obschon zahlreiche Versuche
zur möglichst rationellen Gewinnung des Farbstoffs damit gemacht
wurden, vermochte er dem echten Indigo keinerlei Konkurrenz zu machen,
da 1000 kg seiner grünen Blätter nur etwa 7,5 kg Indigo
geben.
Dem Indigo sehr nahe verwandt ist der von den im Mittelmeer lebenden
kleinen Purpurschnecken der Gattungen Murex und Purpura gewonnene
Purpurfarbstoff, der in chemisch reiner Form dem Indigo
äußerlich zum Verwechseln ähnliche, kupferglänzende, violette
Kristalle bildet. Kürzlich hat Professor Friedländer in Wien
1,5 g davon aus dem farblosen, am Sonnenlicht erst dunkelviolett
werdenden Saft einer bestimmten Drüse von 12000 Purpurschnecken
gewonnen. Die chemische Analyse ergab, daß er seiner Zusammensetzung
nach Dibromindigo ist, d. h. Indigo, in welchem zwei Wasserstoffatome
durch zwei Bromatome ersetzt sind. Nun vermöchte man auch diesen
im Altertum so überaus geschätzten, weil außerordentlich teuern
Farbstoff synthetisch darzustellen und so billig im großen zu
verwenden. Doch gibt dieser Purpur auf der Gewebefaser ein ziemlich
unreines, rotstichiges Violett, das an Schönheit mit unsern modernen
Farbstoffen keineswegs in Wettbewerb treten kann und auch in bezug auf
die Echtheit seiner Färbungen den echten Teerfarben durchaus nicht
überlegen ist. Wenn wir nun bedenken, wie im ganzen Altertum nur die
Könige und Vornehmsten sich solche trotz allen Rühmens übrigens recht
unscheinbar dunkle, fast schwarze, beim seitlichen Darüberblicken einen
rotvioletten Schimmer aufweisende Purpurgewänder leisten konnten —
kostete doch zu Diokletians Zeit im Jahre 301 das Pfund der besten
Purpurwolle noch 950 Mark unseres Geldes — so geht daraus mit aller
Deutlichkeit hervor, wie überaus gering die Ansprüche der Alten an die
Leistungen ihrer Färber gewesen sein müssen und wie sehr wir moderne
Menschen durch die Erfolge der heute so hoch entwickelten Farbenchemie
verwöhnt sind.
[S. 136]
Von den zum Gelbfärben Verwendung findenden Pflanzen sind als für
Europa älteste der Wau oder das Gilbkraut (Reseda
luteola), das schon die neolithischen Pfahlbauern benutzten und
später die Römer unter der Bezeichnung luteum, d. h. das Gelbe,
zur Farbstoffgewinnung anpflanzten, dann der Färberginster
(Genista tinctoria) und die Färberscharte (Serratula
tinctoria) zu nennen, die in großen Teilen Europas wild
wachsen, aber auch in vielen Gegenden Deutschlands, Englands und
Frankreichs kultiviert wurden, bis sie durch die Einführung der
Quercitronrinde und des Gelbholzes aus Amerika verdrängt
wurden. Erstere ist die Rinde der in mehreren Varietäten auftretenden
und in den mittleren Vereinigten Staaten große Waldungen bildenden
Färbereiche (Quercus tinctoria), die, von der Oberhaut
befreit und zu Pulver zermahlen, als Quercitron in den Handel
gelangt und einen der schönsten gelben Farbstoffe liefert, der in
allen Zweigen der Färberei Verwendung findet. Seit 1818 hat man den
Baum in Frankreich und bald hernach auch in Bayern angepflanzt. Das
Färbevermögen seiner Rinde entdeckte Bancroft im Jahre 1784, und zwei
Jahre darauf erhielt er auf eine Eingabe hin vom englischen Parlament
ein Monopol für Einfuhr und Gebrauch dieses neuen Färbemittels auf
eine Reihe von Jahren. Der Farbstoff des Quercitrons, das Quercitrin,
findet sich auch im ungarischen Gelbholz oder Fiset, der
vom Färbersumach oder Perückenbaum (Rhus cotinus)
herrührt, und den chinesischen Gelbkörnern, den unentwickelten
Blütenknospen der Sophora japonica, die beide noch heute
in der Färberei Verwendung finden. Das amerikanische Gelbholz
dagegen stammt von dem auf den Antillen und in Brasilien heimischen
Färbermaulbeerbaum (Maclura tinctoria), deren färbender
Bestandteil, das Morin, in der Wollfärberei zu Grün und Braun, in der
Baumwoll- und Seidenfärberei aber zu Gelb und Grün benutzt wird.
Eine sehr geschätzte gelbe oder rote Farbe liefert das
Gummigutt, der eingetrocknete Milchsaft mehrerer hoher Bäume
aus der Familie der Guttiferen, die in den feuchten Wäldern Südasiens
wachsen. In Kambodscha, Siam und dem südlichen Cochinchina ist es
die bis 15 m hohe Garcinia hanburyi und in Südindien
und auf Ceylon die bis 18 m hohe Garcinia morella, die
beide 10–12 cm lange, kurzgestielte, elliptische Blätter,
kleine Blüten und kirschengroße Beeren tragen. Sind die Bäume 20–30
Jahre alt geworden, so macht man vor Eintritt der Regenzeit, d.
h. von Februar bis April, spiralig verlaufende Einschnitte in den
Stamm, durch welche die Ölgänge der[S. 137] Rinde angeschnitten werden. Der
dabei austretende gelbe Milchsaft wird in unterhalb aufgestellten
Bambusröhren aufgefangen, von denen ein Baum im Laufe von 3–4 Wochen
bis 3 Bambusröhren von 50 cm Länge und 6–7 cm Dicke voll
Saft liefert. Das bald eingedickte Harz wird schließlich in den Röhren
durch Erwärmen am Feuer erhärtet, so daß man es in Stangenform aus den
Hohlzylindern herausschieben oder die Hülle von ihm ablösen kann. Die
erstgenannte Art liefert mehr Gummigutt als die zweite. Es ist eine
außen grüngelbe, innen aber rotgelbe, sehr dichte Masse, die zerstoßen
ein gesättigt gelbes Pulver bildet. Mit zwei Teilen Wasser verrieben,
liefert es eine gelbe Emulsion, in ätzenden Alkalien dagegen löst es
sich mit roter Farbe. Es schmeckt brennend scharf und übt eine äußerst
heftige, abführende Wirkung aus, weshalb es arzneilich verwendet
wird, so in den berüchtigten Morrisonpillen, die schon bedenkliche,
hauptsächlich auf den Gehalt an Gummigutt zurückzuführende Vergiftungen
herbeigeführt haben und deshalb als gefährlich gemieden werden sollten.
Als solche medizinische Droge kam dieser eingetrocknete südasiatische
Milchsaft überhaupt im Jahre 1603 zuerst nach Europa, und wurde 1605
in Frankfurt am Main für einen Gulden (im Werte von gegen zwei Mark)
das Quentchen, d. h. 1,66 g verkauft; da es aber an Giftigkeit
und stark reizender Wirkung dem Krotonöle verglichen werden kann, so
wird es als Abführmittel kaum mehr verwendet. Dagegen wird es als
Wasserfarbe zum Gelbmalen und zum Färben von Weingeistfirnissen viel
gebraucht. Die Hauptmenge des Gummigutt wird in Kambodscha gewonnen
und gelangt über Bangkok, Saigon und Singapur in den Handel. Letztere
Stadt allein führt jährlich etwa 30000 kg im Werte von 150000
Mark aus. Von Kambodscha aus scheint auch seine Verwendung ausgegangen
zu sein. Ein Chinese, der dieses Land von 1295–1297 bereiste, erwähnt
diese von ihm kiang-hwang genannte Droge als Produkt desselben.
Von weiteren Pflanzen zum Gelbfärben, denen aber geringere
Bedeutung als den vorgenannten zukommt, ist die Curcuma oder
Gelbwurz (Curcuma longa) zu nennen, eine sonst meist
als Gewürz gebrauchte indische Verwandte des Ingwers, deren Farbstoff
Curcumin bei uns vornehmlich zum Gelbfärben von Zuckerwerk, Likören und
Spielwaren, aber nur selten in der Zeugfärberei Verwendung findet, da
es sich auf die Dauer nicht hält. Mit Alkalien gibt es braunrote Salze,
weshalb mit einer wässerigen Lösung desselben getränkte Papierstreifen
zum Nachweisen derselben dienen. In den Gelbbeeren, den[S. 138]
Früchten mehrerer Wegdornarten Südeuropas (hauptsächlich von
Rhamnus infectoria und Rh. amygdalina), findet sich der
Farbstoff Rhamnin, der heute noch in der Färberei ziemlich ausgedehnte
Verwendung findet. Die chinesischen Gelbschoten aber, die
als wong-schi bezeichneten Früchte einiger Gardeniaarten,
vorzugsweise von Gardenia grandiflora, werden in ihrem
Heimatlande Ostasien, wie in China, so auch in Japan, zum Gelbfärben
von Zeug, besonders Seide, benutzt, sind aber für den europäischen
Handel belanglos. Ihr gelber Farbstoff ist mit demjenigen des Safrans,
dem Crocin, identisch.
Für die alten Kulturvölker des Orients und der Gegenden am
Mittelmeer war einst der Safran (Crocus sativus) der
geschätzteste Farbstoff zum Gelbfärben von Gewändern, Schleiern und
Schuhen. Die griechische Bezeichnung krókos für Safran rührt
vom semitischen karkôm für Gelb her, das seinerseits mit
dem indischen kurkum — beispielsweise auch in der von uns
gebrauchten Bezeichnung Curcuma für die indische Gelbwurz enthalten
— zusammenhängt. Nach den Berichten der griechischen und römischen
Schriftsteller waren gelbe Krokus- wie Purpurgewänder die Lust der
Orientalen und Kleinasiaten. Mit solchen schmückten sich nach dem
römischen Dichter Vergil die Phryger; nebst safrangelben Schuhen und
der Tiara gehörten sie zur kennzeichnenden Tracht der Perserkönige.
Den Abglanz der geheiligten gelben Safranfarbe zeigen noch die
ältesten, vom Orient beeinflußten mythischen Vorstellungen der
Griechen, wonach die aus dem Morgenlande zu ihnen gekommenen Götter,
wie Dionysos-Bacchus, und Göttinnen wie die orientalischen Könige
und Königinnen das gelbe Safrankleid trugen. Der in Argos ansässige
griechische Dichter Pindar (522–442 v. Chr.) läßt auch den Argonauten
Jason mit einem safranfarbigen Gewande bekleidet sein, das er abwarf,
als er sich anschickte, in Kolchis mit den feuerspeienden Stieren zu
pflügen. Krokosfarbene Gewänder trugen dessen Gattin Medeia, Iphigeneia
bei ihrer Opferung in Aulis nach Äschylos, die Königstochter Antigone
in den Phönikierinnen des Euripides, die an den Fels geschmiedete
Andromeda bei Aristophanes. Nach Vergils Äneis hatte Agamemnons Gattin
Helena von ihrer Mutter Leda eine goldgestickte palla, d. h.
Frauenüberwurf und einen mit Krokos umsäumten Schleier zum Geschenk
erhalten und mit nach Mykenä gebracht.
Die Bekanntschaft mit der Safranfarbe geht bei den Griechen bis in die
Zeit der Ausbildung des Heroenmythus zurück. Sie lernten sie von den
Vorderasiaten kennen, die ihrerseits — nach der vorhin mit[S. 139]geteilten
Geschichte der Verbreitung des Wortes für Gelb identisch mit Safran
— die Verwendung dieses Farbstoffs vermutlich von den Indern kennen
lernten. Von den Griechen lernten die Römer und Byzantiner und nach
ihnen die Araber den intensiv gelbfärbenden Farbstoff des Safrans zum
Färben verwenden. Heute ist er als Farbstoff zu teuer, eignet sich aber
als völlig unschädlich zum Färben von Zuckerwerk, Kuchen und Likören.
Reiche Araberinnen färben sich damit die Augenlider, Fingerspitzen und
Zehen.
Das dem indischen kurkum entstammende orientalische
karkôm für Gelb und zugleich den Spender der gelben Farbe,
den Safran, hat auch der Färberdistel den lateinischen Namen
Carthamus — tinctorius — verliehen. Dieses auch als
Saflor bezeichnete einjährige, 1–1,3 m hohe, kahle Kraut
aus der Familie der Kompositen besitzt länglich eiförmige, stachelig
gezahnte Blätter und von grünen Hüllblättern umgebene zuerst gelbe,
dann orangerote Blüten. Seine Heimat ist wohl das vorderasiatische
Steppengebiet; doch läßt sich dies nicht mehr bestimmen, da die Pflanze
nirgends mehr wild gefunden wird. Jedenfalls ist sie eine der ältesten
Kulturpflanzen, die dem Menschen zum Rot- und Gelbfärben diente.
Schon die Kleider ägyptischer Mumien aus dem dritten vorchristlichen
Jahrtausend sind damit gefärbt, während China die Pflanze erst im
2. Jahrhundert v. Chr. erhielt. Das spricht wohl schon für ihre
westasiatische Herkunft. Seither hat sie eine sehr weite Verbreitung
gefunden und wird heute, außer in Bengalen, Persien und Ägypten, in
China, Japan, Neusüdwales, Mittelamerika und Kolumbien, in geringem
Umfang auch in Spanien, Frankreich, Italien, Ungarn und in einigen
Gegenden Deutschlands kultiviert. Das wichtigste Produktionsland
ist Indien, und zwar Bengalen, wo die 30–60 cm hohe Pflanze
zur Gewinnung des Farbstoffs im großen angebaut wird. Die aus dem
Blütenkörbchen im Juli und August bei trockenem Wetter gezupften, in
einem Ofen unter leichter Pressung getrockneten und zuletzt in Kuchen
gepreßten Blüten, die als Saflor in den Handel gelangen, liefern
einen leuchtenden gelben und roten Farbstoff, der neben dem Indigo
den wichtigsten Pflanzenfarbstoff darstellt. Ähnlich dem Safrangelb
Crocin ist das in Wasser lösliche Saflorgelb, dem in geringer Menge ein
harzartiger, nur in alkalischer Flüssigkeit löslicher roter Farbstoff,
das Saflorrot oder Carthamin beigemengt ist. Letzteres wird aus dem mit
Soda versetzten wässerigen Auszug durch Fällen mit Essigsäure gewonnen
und ist ein dunkelbraunroter, in Alkohol leicht, in Wasser kaum
und[S. 140] in Äther nicht löslicher Farbstoff, der leider nicht besonders
dauerhaft, aber außerordentlich schön und von solcher Färbekraft ist,
daß eine ganz geringe Menge davon hinreicht, um eine große Fläche
damit zu decken. Man kann damit in verschiedenen Nuancen von Rosa bis
Dunkelrot färben; er gibt auch die feinste rote Schminke, welche als
spanisches Rot bekannt ist und auf flachen Porzellantellerchen oder
auf Blättern ausgebreitet in den Handel kommt. Die Saflorkuchen haben
helle Fleischfarbe und riechen tabakartig. Als beste Sorten gelten der
bengalische und der persische Saflor. Nach ihnen kommt der ägyptische,
der ebenfalls von vorzüglicher Qualität und größtem Reichtum an
Farbstoff ist und deshalb am meisten zu uns gelangt; man kann annehmen,
daß jährlich etwa 1,5 Millionen kg davon in Form von gepreßten
Scheiben in den Handel gelangen. Da der Farbstoff aber nicht sehr
lichtbeständig ist, wird er mehr und mehr von den Teerfarben verdrängt.
Im 17. Jahrhundert baute man im Elsaß und in Thüringen so viel Saflor,
daß eine beträchtliche Ausfuhr besonders nach England stattfand. Im 18.
Jahrhundert kam der Saflorbau durch den billigen und farbstoffreicheren
levantischen Saflor in Verfall, zumal die deutsche Ware durch vielfache
Verfälschungen in Verruf gekommen war. Aus den bitteren Samen gewinnt
man in Indien, Ägypten und Algerien ein fettes Öl, das sich sehr gut
als Brennöl, weniger dagegen als Speiseöl eignet. Nach Herodot gewannen
schon die alten Ägypter Öl aus seinen Samen, die man gewöhnlich als
„Papageienkörner“ bezeichnet. Sie, wie auch die alten Babylonier,
Syrier und Hebräer benutzten den Saflor zum Färben. In Johann Bauhins
berühmtem Garten zu Boll in Württemberg wuchs der Saflor im Jahre
1495 als indische Zierpflanze. Im Laufe des 16. Jahrhunderts begann
sein Anbau in Mitteleuropa, der aber heute infolge des Aufkommens der
billigeren und schöneren Teerfarbstoffe völlig außer Gebrauch gekommen
ist.
Einen gelbroten Farbstoff stellt der Orlean dar, der in
Südamerika und Westindien aus der roten, fleischigen Oberhaut der Samen
des Orleanbaumes (Bixa orellana) gewonnen wird. Dieser Farbstoff
und die ihn liefernde Pflanze wird von den Tupiindianern urucu,
von den Aruakindianern dagegen bicha geheißen, woraus der
Name Bixa entstand, während er von den Brasilianern orelhana
genannt wird, nach seinem hauptsächlichsten Fundort, dem gleicherweise
benannten Maranhonfluß. Der im tropischen Südamerika heimische,
5–10 m hohe Baum mit großen, herzförmigen, gezahnten, immergrünen
Blättern[S. 141] und endständigen Rispen von ansehnlichen, lebhaft blau
gefärbten Blüten ist schon seit langer Zeit in allen Tropenländern
bis nach Polynesien und Madagaskar hin verbreitet worden und vielfach
verwildert. Seine zum Färben dienenden Fruchtschalen hat man mehrfach
in peruanischen Gräbern gefunden, und noch heute bemalen die
südamerikanischen Indianer mit dem durch Vermengung des fleischigen,
roten Samenüberzuges mit Zitronensaft und Gummi oder Rizinusöl
erhaltenen Farbstoff ihre Leiber als Zierde und zugleich Schutz gegen
die blutsaugenden Moskitos. Blätter, Samen und Wurzeln werden in
Südamerika und Asien als Volksheilmittel verwendet. Zur Gewinnung des
Farbstoffs läßt man die zerriebenen Fruchtschalen in Wasser gären,
gießt die Masse durch Siebe und entfernt das Wasser vom Niederschlag,
den man über Feuer oder im Schatten trocknen läßt. Er bildet dann einen
gleichförmigen, roten, veilchenartig riechenden, bitter schmeckenden
Teig, der, um völliges Austrocknen zu verhindern und ihm zugleich einen
lebhafteren Farbenton zu verleihen, vielfach mit Harn befeuchtet wird.
Wasser entzieht dem Orlean gelbbraunes, auch in Alkohol, nicht aber
in Äther lösliches Orellin, das mit Alaun gebeizte Stoffe gelb färbt.
Im Rückstand bleibt der wichtigere Farbstoff Bixin, der dunkelrote
Kristallblättchen bildet und in Alkohol und Äther leicht löslich ist
und orangerot, in Alkalien und ätherischen Ölen dunkelgelb färbt. Kocht
man Orlean mit Sodalösung und setzt dann Alaun oder ein Zinnsalz zu,
so erhält man einen orangegelben Lack. Der Orlean wird in Cajenne,
Guiana und Brasilien dargestellt und dient außer in der Kattundruckerei
hauptsächlich in der Seidenfärberei, in England — dann allerdings ohne
Harnzusatz — auch zum Färben des Chesterkäses und der Butter.
Um Seide und andere Gewebe echt grün zu färben, verwendet man das
Lo-kao oder chinesische Grün, das man durch wässerigen
Auszug aus der Rinde zweier Kreuzdornarten, Rhamnus chlorophorus
und Rhamnus utilis, gewinnt. Diese beiden werden als
Hom-bi und Pa-bi im ganzen mittleren und nördlichen China
zur Farbstoffgewinnung kultiviert. Der aus ihnen gewonnene Farbstoff
kommt in flachen, bläulichgrünen Scheibchen in den Handel. Aus den
reifen Beeren eines andern Kreuzdorns (Rhamnus catharticus)
stellt man das Saftgrün her, das mit Kalk oder Pottasche einen
grünen Niederschlag gibt, der vollkommen ungiftig ist und besonders als
Wasserfarbe benutzt wird.
Ein auffallender Farbstoff, der in saurer Lösung schön rot, in[S. 142]
alkalischer dagegen intensiv blau ist, und daher in der Chemie als
sogenannter Lackmus als Reagens oder Nachweisestoff für Säuren
und Alkalien verwendet wird, stammt von verschiedenen Flechten mit
strauchförmigem Thallus, die vorzugsweise an felsigen Meeresküsten
wachsen. Ihre Verwendung zum Färben war schon im Altertume bekannt; so
benutzten sie die Römer unter der allgemeinen Bezeichnung fucus
— was eigentlich Seetang bedeutet — zur Darstellung des unechten
Purpurs. Die Kenntnis ihrer technischen Verwendung ging aber in den
Stürmen der Völkerwanderungszeit im Abendlande verloren, erhielt
sich aber im Morgenlande, wo sie ein in Florenz ansässiger Deutscher
namens Federigo (Friedrich) im 13. Jahrhundert kennen lernte. Von
einer Handelsreise in die Levante brachte er Färberflechten mit und
lehrte daraus vermittelst Harn eine schöne rote Farbe darstellen. Damit
begründete er seinen großen eigenen Reichtum als Stammvater des später
mit den Medici rivalisierenden florentinischen Adelsgeschlechtes der
Rucellai, so genannt nach der für sie so bedeutungsvollen Färberflechte
rucella, die heute im Italienischen oricello heißt, woraus
das auch im Deutschen gebrauchte französische Wort orseille
hervorging. Wie die Medici, deren Stammvater Arzt gewesen war und
von ihm her den Namen und die drei Kugeln — eigentlich Pillen — im
Wappen führten, so hielten es die Rucellai mit der Färberflechte,
die sie zu Reichtum und Ehren gebracht hatte. Dieser von ihrem
Ahnherrn eingeführten neuen Industrie verdankte aber nicht bloß dieses
Geschlecht, sondere viele Städte Italiens, die den gesamten Handel
mit Färberflechten aus der Levante und dem griechischen Archipel an
sich gerissen hatten, ihren Reichtum, bis im Jahre 1402 der Normanne
Béthencourt die Kanarischen Inseln entdeckte und auf ihnen gleichfalls
den kostbaren Stoff fand. Später entdeckte man ihn auch auf den Azoren,
auf Sardinien und Korsika, in den Pyrenäen, der Auvergne usw.
Die Orseille ist in Form von schwachen organischen Säuren
in einer ganzen Reihe von Flechten vorhanden, unter welchen die
Roccella tinctoria die gesuchteste ist. Sie liefert die
levantische und kanarische Orseille, von der auf den Kanarischen Inseln
allein jährlich etwa 130000 kg gesammelt werden und in den
Handel gelangen; doch wird sie auch an den felsigen Küsten Südamerikas,
des Kaps der Guten Hoffnung, Senegambiens und Ostindiens gesammelt.
Im Gegensatz zu dieser Meerorseille wird die von der Variolaria
orcina und V. dealbata in Europa gewonnene Orseille als
Landorseille bezeichnet.[S. 143] Eine andere ebenfalls sehr farbstoffreiche
Flechte ist Roccella montagnei, die an der ostafrikanischen
Küste in den Ästuarien auf Mangrovebäumen wächst. Aus der Flechte
Lecanora tartarea, die auf den Inseln nördlich von Schottland,
den Orkneys und Hebriden, heimisch ist, wird der rote Indigo
oder Persiko gewonnen, der im Jahre 1765 zuerst von Cuthbert
dargestellt wurde. Durch Behandlung mit Alkalien — früher Harn, jetzt
Ammoniak — wird der violettrote Farbstoff, das Orcein, frei, mit dem
man Wolle und Seide rot oder violett färbt. Da er aber für sich allein
nicht echt genug färbt, so wendet man ihn meist mit anderen Farbstoffen
hauptsächlich zur Herstellung von braunen Nuancen an.
Ein schon im hohen Altertum im Orient gebräuchlicher Farbstoff ist das
Drachenblut, ein von den am äußersten westlichen und östlichen
Zipfel Afrikas, auf den Kanaren und der Insel Sokotra bis in die
Gegenwart am Leben gebliebenen Drachenbäumen (Dracaena draco
u. a.) aus der Familie der Lilienblütigen gewonnenes Harz. Es sind
dies 16–18 m hohe Bäume, die wie die Dikotyledonen dauernd in
die Dicke wachsen und zu äußerst auf den gabelig verzweigten Ästen
und auf dem Gipfel des Stammes büschelig gehäufte, über 1 m
lange, schwertförmige Blätter tragen. Sie können ein außerordentlich
hohes Alter erreichen und lassen von selbst oder durch Einschnitte
das dunkelrotbraune, spröde, geruch- und geschmacklose, an der Luft
erhärtende Harz ausfließen, das gepulvert blutrot ist und sich in
ätherischen und fetten Ölen wie auch in Alkalien zu einer roten
Farbe auflöst. Es kommt entweder in Form von in Schilfblättern
eingewickelten Kugeln oder in ebenfalls in Blättern eingewickelten
Stangen in den Handel. Das kanarische Drachenblut machte früher einen
bedeutenden Handelsartikel von Madeira aus und findet sich auch in
den Gräbern der Guanchen genannten Ureinwohner der Kanaren, welche
dasselbe wahrscheinlich zur Einbalsamierung ihrer Leichen benutzten.
Jetzt wird es seiner zusammenziehenden Wirkung wegen vorzugsweise zu
Zahnpulver und Zahntinkturen, zumal bei leicht blutendem Zahnfleisch
benutzt, sowie zu Tischlerpolitur und verschiedenen Lacken. Von
Sokotra erhielten es die alten Griechen unter der Bezeichnung
indischer Zinnober. Der im 2. Jahrhundert n. Chr. in Kleinasien
lebende griechische Schriftsteller Flavius Arrianus schreibt in
seinem Bericht über die Umschiffung des Roten Meeres: „Der sogenannte
indische Zinnober (kinnábari) wird auf der Insel des Dioskurides
(Sokotra) von Bäumen, aus denen er tröpfelt, gesammelt.“[S. 144] In derselben
Weise, wie dieses Drachenblut, wird auch das ebenso genannte Harz, das
auf den Philippinen von den Früchten der Drachenrotangpalme (Calamus
draco) gewonnen wird, verwendet.
Außer den bisher genannten Pflanzen sind noch einige andere zu
erwähnen, die wegen ihres Gehaltes an Katechin oder Gerbstoffen
zum Schwarzfärben und zum Gerben verwendet werden. Unter dem Namen
Katechu kommen die verschiedensten gerbstoffhaltigen Massen
in den Handel, die teils aus den Früchten der Arekapalme (Areca
catechu), teils aus den Zweigen und dem Kernholze einer Akazie
(Acacia catechu), teils aus den Blättern der Gambirpflanze
(Uncaria gambir) durch Auskochen mit Wasser gewonnen werden.
Demnach unterscheidet man Palmen- oder Areka-Katechu, dunklen Akazien-
oder Pegu-Katechu und gelben oder Gambir-Katechu.
Die in den Tropen häufig angebaute, ursprünglich in Südasien heimische
Arekapalme ist ein äußerst zierlicher Baum von etwa 15 m Höhe
mit sehr geradem, dünnem, weißem Stamm und etwas krauser Krone von
dunkelgrünen Fiederblättern. Seine eiförmigen, etwa 4 cm langen
Früchte enthalten ein ziemlich hartes, marmoriertes Nährgewebe, das,
in Querscheiben geschnitten, mit Kalkmilch in ein scharf schmeckendes
Blatt des Betelpfeffers gewickelt, in ganz Südasien und Indonesien zum
sogenannten Betelkauen verwendet wird. Durch Kochen in Wasser wird aus
den Arekanüssen der Areka-Katechu gewonnen.
Ebenfalls im südlichen Asien heimisch ist die in ganz Vorder- und
Hinterindien, auf Ceylon und im tropischen Afrika von Abessinien bis
zum Sambesi verbreitete Katechu-Akazie, ein 4–8 m hoher Baum
aus der Familie der Hülsenfrüchtler mit brauner, rissiger Rinde,
sehr verzweigter, schirmförmiger Krone, weißlich behaarten, dornigen
Zweigen, zerstreut stehenden, paariggefiederten Blättern und gelben
Blüten. In der Trockenzeit fällt sein Laub ab. Das in möglichst kleine
Späne gehauene, vom hellgelben Splint befreite Kernholz wird etwa 12
Stunden lang in mit Wasser angefüllten irdenen Töpfen ausgekocht und
der dunkelbraune Auszug dann in Schalen eingedickt, um zuletzt in
Formen vollständig zu erhärten. Er kommt in Klumpen in den Handel,
die vor dem Gebrauch durch Chemikalien und heißes Wasser wieder
aufgelöst werden. Wie der Areka-Katechu wird er massenhaft in der
Färberei gebraucht, sowohl als Beize, als auch zur Erzeugung von sehr
dauerhaften schwarzen, braunen und grünen Farbenschattierungen und zum
Gerben von weichem, geschmeidigem Leder.
Tafel 105.
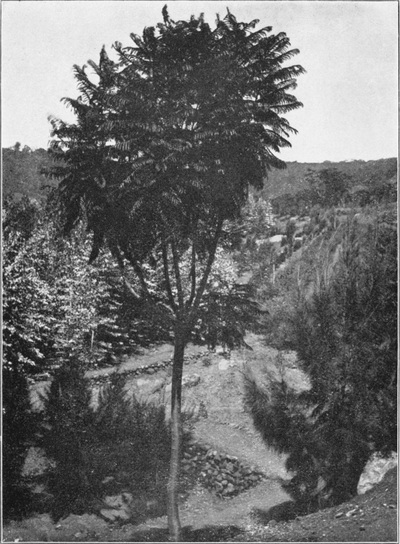
(Copyright by F. O. Koch.)
Junger Blauholzbaum (Haematoxylon
campechianum) angepflanzt in Kwai (Ostafrika).

(Copyright by F. O. Koch.)
Junger Rotholz- oder Brasilbaum
(Caesalpina sappan).
Tafel 106.

Mangrovendickicht mit zahlreichen Stelzwurzeln am
Kamerunfluß in Westafrika.
❏
GRÖSSERES BILD
[S. 145]
Bis jetzt sind nur die Katechubestände in Indien ausgenutzt worden,
und zwar in dem Maße, daß die Gewinnung in den letzten Jahren sehr
zurückging und nur für etwa 5 Millionen Mark exportiert wurde.
Infolge davon hat die englische Regierung die Katechugewinnung aus
den wildwachsenden Beständen geregelt und den Anbau des Baumes
angeordnet. Dagegen sind die großen Katechubestände des tropischen
Afrika noch vollständig unbenutzt geblieben. Besonders im Steppenwalde
Deutsch-Ostafrikas kommt der Baum massenhaft vor und dürfte mit der
Zeit zur Gewinnung von Katechu, der recht gute Preise erzielt, reizen.
In den Spalten des Stammes der Katechu-Akazie findet man nicht selten
kristallinische Ablagerungen von Katechin oder Katechusäure, nach
der Katechugerbsäure dem wichtigsten Bestandteil des Katechu, die
unter dem Namen khersal in Indien als stopfendes Arzneimittel
bei Diarrhoe Verwendung finden. Der von dieser Pflanze gewonnene
Katechu wurde zuerst 1514 von Barbosa als Handelsartikel Südasiens
erwähnt. Eine Beschreibung der Stammpflanze und der Darstellung des
Katechu gab aber erst Sassetti im Jahre 1586, und bald darauf gelangte
Katechu auch nach Europa. Um die Mitte des 17. Jahrhunderts erscheint
er als eine sehr teuere Droge in deutschen Apothekertaxen, und 1680
schilderte Clayer den ungeheuren Verbrauch desselben in Ostasien
hauptsächlich zum Betelkauen, dem dort sozusagen jedermann huldigt.
Neben dem in Vorderindien gewonnenen Bombay-Katechu ist der aus
Hinterindien stammende Pegu-Katechu der im Handel gewöhnlichste und
für pharmazeutische Verwendungen neben dem Gambir allein zulässige.
Er bildet unregelmäßige dunkelbraunrote Kuchen, wie der vorhergehend
besprochene Areka-Katechu, und kommt in Matten oder Kisten verpackt in
den Handel.
In mittelgroßen, graubraunen, porösen, leicht zerreiblichen, sehr
leichten und daher auf Wasser schwimmenden Würfeln kommt der gelbe
oder Gambir-Katechu in den Handel. Er bildet ein durch vielstündiges
Kochen in Wasser und nachheriges Eindicken gewonnenes Extrakt aus den
jungen Trieben von Uncaria gambir, einem kletternden Strauch
Hinterindiens und der Sundainseln aus der Familie der Rubiazeen oder
Krappgewächse, die besonders auf der Halbinsel Malakka, aber auch auf
Java und Sumatra angebaut wird und über Singapur in den Handel gelangt.
Drei- bis viermal im Jahre werden die jungen Zweige und Blätter des
Gambirstrauchs zur Gewinnung des sehr reichlich Katechin (neben
Katechugerbsäure) enthaltenden Gam[S. 146]birs abgeschnitten, zerkleinert,
durch Kochen in Wasser extrahiert und, auf Sirupkonsistenz eingedickt,
an der Luft noch völlig getrocknet. Der Gambir ist fast geruchlos,
schmeckt bitter, ist in kaltem Wasser schwer, leicht dagegen in
heißem Wasser löslich, färbt sich mit Eisenoxydsalzen grün und dann
auf Zusatz von Alkali purpurn. Er wurde in Europa gegen das Ende des
18. Jahrhunderts bekannt, hat aber erst seit den 1830er Jahren eine
ungemein große Bedeutung in der Färberei und zum Gerben schweren
Leders, wie auch zum Imprägnieren von Stoffen, die beim Gebrauch der
Nässe ausgesetzt sind, wie Fischernetze, Zeltstoffe und Kofferüberzüge,
erlangt. Auch gegen den Kesselstein in Dampfmaschinen findet er häufig
Verwendung. Die Ausfuhr von Singapur, wo fast die gesamte Produktion
zusammenkommt, beziffert sich auf jährlich etwa 40 Millionen kg
im Werte von 19 Millionen Mark. Davon empfängt London allein gegen 15
Millionen kg, während Deutschland nur etwa 7 Millionen kg
verbraucht.
Ebenfalls reich an Gerbstoff ist der in dunkelbraunroten bis
schwärzlichen, in dünnen Splittern rubinrot durchscheinenden Stücken
in den Handel gelangende Kino, der sich in Weingeist mit
dunkelblutroter Farbe löst und wie Katechu und Gambir teilweise in
der Medizin als adstringierendes Mittel, besonders aber technisch zum
Färben und Gerben Anwendung findet. Meist kommt er als Malabar- oder
Amboina-Kino zu uns und bildet den nach Einschnitten in den Stamm des
Baumes Pterocarpus marsupium, eines Schmetterlingsblütlers,
ausgeflossenen und dann eingetrockneten, rötlichen, gerbsäurehaltigen
Saft, während der gleichfalls zu uns gelangende australische Kino aus
dem in gleicher Weise gewonnenen Saft verschiedener Eukalyptusarten
besteht. Kaum Bedeutung für uns hat der bengalische Kino, der aus dem
eingedickten Saft der Rinde von Butea frondosa besteht, ebenso
der westindische, der aus der Rinde von Coccoloba uvifera
gewonnen wird, traubentragend wegen seiner Früchte genannt, die
angenehm sauer schmecken und in Westindien und Südamerika, wo der Baum
kultiviert wird, gerne mit Zucker gegessen werden; auch bereitet man
aus ihnen erfrischende Getränke. Das schwere, geaderte Holz dieses mit
wohlriechenden weißen Blüten in Trauben versehenen Baumes wird zur
Herstellung feiner Möbel benutzt, und aus ihm durch chemische Umsetzung
eine rote und violette Farbe gewonnen. Die wässerige rötlichbraune
Lösung des Kino färbt sich nämlich mit Alkalien versetzt rotviolett und
gibt mit Eisenchlorid einen dunkelgrünen Niederschlag, der mit Alkalien
purpurn wird. Der westindische Kino ist seit[S. 147] 1757 gebräuchlich,
während der Malabar-Kino erst seit 1811 bei uns eingeführt ist. Der
am frühesten in Europa gebrauchte Kino war übrigens der afrikanische,
von Pterocarpus erinacea gewonnen, der seit 1733 als
zusammenziehendes Mittel im Arzneischatze geführt wird.
Als Myrobalanen kommen seit dem frühen Mittelalter, da uns
die Araber ihre Kenntnis vermittelten, die 5 cm langen und
2,5 cm dicken, länglich birnförmigen, grünlich gelben oder
gelbbraunen Früchte mehrerer ostindischer Bäume zu uns, die wegen
ihres Gehaltes von 32–45 Prozent Gerbstoff ebenfalls zum Schwarzfärben
und Gerben verwendet werden. Die meisten der in den Handel kommenden
stammen von verschiedenen Vertretern der Gattung Terminalia,
die in den regengrünen Wäldern von ganz Vorderindien, Ceylon,
Hinterindien und dem indischen Archipel wachsen, von deren einer Art,
Terminalia catappa, die mandelähnlichen Samen gegessen und
auch zur Ölgewinnung benutzt werden, während die Rinde zum Gerben
dient. Früher wurden noch als schwarze oder graue Myrobalanen die
getrockneten Früchte eines ebenfalls in Ostindien wachsenden Strauches,
Phyllanthus emblica, eines Wolfsmilchgewächses, in den Handel
gebracht; jetzt aber werden meist die zuerst genannten nach Europa,
und zwar vorzugsweise nach England importiert. Im Altertum verstand
man unter Myrobalanen die Früchte der in Ägypten wildwachsenden
Balanites aegyptiaca, die zum Salben benutzt wurden. Im
Mittelalter übertrug man dann den Namen zuerst auf die in Syrien
wachsenden gelben Pflaumen, unsere jetzigen Mirabellen, und dann erst
auf die gelben Früchte, deren gerbstoffhaltige äußere braune Schicht
gewöhnlich pulverisiert in den Handel gelangt.
Demselben Zwecke des Gerbens und Schwarzfärbens dienen die
gerbstoffreichen Hülsenfrüchte eines in Westindien, Mexiko und
dem nördlichen Südamerika, besonders in Kolumbien und Venezuela,
heimischen, 6–8 m hohen Schmetterlingsblütlers, der
Caesalpinia coriaria, die als Dividivi in den Handel
gelangen. Sie sind gegen 8 cm lang und 2–3 cm breit
und enthalten 20–30 Prozent Gerbstoff. Diese von den Indianern schon
längst als Gerbmittel verwendeten Gerbschoten wurden zuerst im Jahre
1768 von den Spaniern nach Europa gebracht, kommen aber erst seit
Anfang des 19. Jahrhunderts in größeren Mengen dahin. Kolumbien führt
davon jährlich 4,2 und Venezuela 3,4 Millionen kg aus, von
denen Deutschland über Hamburg etwa 5 Millionen kg im Werte
von 1 Million einführt. Von einer anderen Caesalpinia-Art stammen
die als falsche Dividivi be[S. 148]zeichneten Gelbschoten, während
Caesalpinia tinctoria die in Chile und Peru zum Gelb- und
Schwarzfärben gebrauchte Dividivi von Bogotá in Form von großen,
flachen Hülsen mit roter oder hellbrauner Haut hervorbringt. Ebenso
reich an Farbstoff sind die kurzen, breiten Hülsen von Caesalpinia
digyna, die als Tarihülsen aus Vorderindien importiert
werden.
Weiter finden zum Schwarzfärben und Gerben die als Bablach in
den Handel kommenden unreif gesammelten Hülsenfrüchte verschiedener
Akazienarten Verwendung. Die ostindische Sorte stammt von Acacia
arabica var. indica in Form von 5–8 cm langen, flachen,
dunkel- oder hellbraunen Schoten, die 14–20 Prozent Gerbstoff
enthalten, die ägyptische dagegen rührt von Acacia nilotica
her in Form von grünbraunen Hülsen mit ähnlichem Gerbstoffgehalt. Sie
dienen zum Gelb-, Braun- und Schwarzfärben, zur Bereitung von Tinte und
zum Gerben von leichterem Leder.
Ähnliche Verwendung findet der Sumach oder Schmack,
der aus den getrockneten Blättern verschiedener Rhus-Arten und von
Coriaria myrtifolia gewonnen wird. Die beste Sorte liefert der
Gerbersumach (Rhus coriaria), dessen Blätter schon die Alten
als Gerbmaterial benutzten, wie sie auch seine Beeren als Gewürz wie
Myrtenbeeren oder Pfeffer gebrauchten, um die Speisen schmackhafter zu
machen. Zuerst nennt ihn der athenische Gesetzgeber Solon zu Anfang
des 6. vorchristlichen Jahrhunderts. Seit der Zeit der arabischen
Herrschaft wird der trockene, steinige Standorte bevorzugende Strauch
in Unteritalien und Sizilien in großem Maßstabe kultiviert. Aus dem
arabischen sommâq ging der italienische Name sommaco
hervor, woraus die deutsche Bezeichnung Sumach oder Schmack hervorging.
Der Gerbersumach ist ausgewachsen ein 5–6 m hoher Strauch, dem
man jährlich die beblätterten Schößlinge abschneidet, so daß er nur
etwa 1,5 m hoch wird. Zur Sumachgewinnung läßt man dann die
abgeschnittenen Zweige der kultivierten Pflanze an der Sonne trocknen,
streift die dürren Blätter ab und mahlt sie. Dadurch erhält man ein
grünliches Pulver von zusammenziehendem Geschmack und eigentümlichem
Geruch, von dem Sizilien allein für mehr als 16 Millionen Mark
jährlich ausführt. Es wird zum Schwarz- und Dunkelrotfärben und zum
Gerben feiner, leichter Ledersorten verwendet, während die Früchte des
Gerbersumachs, der bei uns auch als Zierstrauch kultiviert wird, im
Orient noch heute als Gewürz an Speisen und zum Sauermachen von Essig
dienen.
[S. 149]
Bis zu 10 Prozent Gerbstoff — in der Wissenschaft als Gerbsäure
oder Tannin bezeichnet — enthält die von verschiedenen Eichen
(besonders Quercus pedunculata und Q. sessiliflora)
abgeschälte Rinde, die an sich geruchlos ist, aber zerkleinert, mit
Wasser und tierischer Haut in Berührung gebracht, den bekannten
Lohgeruch entwickelt. Die beste Eichenrinde wird von jungen,
höchstens 25 Jahre alten Bäumen gewonnen, die in einer besonderen
Art von Niederwaldbetrieb gezogen werden. Dazu gehört ein mildes
Klima innerhalb der Grenze des Rebbaus. In den Eichenschälwäldern
Deutschlands werden nur Stiel- und Traubeneichen genutzt, und zwar
gibt man letzteren den Vorzug. Auf 4500 Hektar gewinnt man nur 2,5–3
Millionen kg. Deutschland verbraucht davon jährlich etwa 500
Millionen kg, von denen 80–100 Millionen kg im Werte
von 11 Millionen Mark aus dem Auslande, besonders aus Österreich und
Frankreich, bezogen werden. Zur Herstellung guten Sohlleders gibt es
kein besseres Material als dieses.
In Amerika dient die Rinde der bis 30 m hohen
Kastanieneiche (Quercus prinus), die in den mittleren und
südlichen Vereinigten Staaten wächst, zu demselben Zwecke. Man gewinnt
sie von alten, wildgewachsenen Stämmen. Sie ist meist 2–3 cm
dick und enthält bis 16 Prozent Gerbsäure. Man bereitet daraus einen
Extrakt, der bis über 30 Prozent derselben enthält. In derselben
Weise verwendet man die durchschnittlich nur 10 Prozent Gerbstoff
enthaltende, aber als billiges Material gleichwohl angewandte,
rotbraune Rinde der kanadischen Hemlocktanne (Tsuga
canadensis), eines 25–30 m hohen Baumes des kälteren
Nordamerika, der dem Grenzgebiet der Laub- und Tannenwaldregion
angehört und selbst in nassen, kalten Sümpfen gedeiht. Man beutet in
den Vereinigten Staaten etwa 4 Millionen Hektar von ihm bestandenen
Waldes zur Gewinnung der Rinde aus. Die Hemlocktanne kam im Jahre 1736
durch Collinson nach Europa und wird in unseren Gartenanlagen als eine
der schönsten Koniferen in mehreren Varietäten angepflanzt.
Als teilweiser Ersatz der verschiedenen Arten von Eichenrinde wird
neuerdings in immer steigenden Mengen die sehr gerbstoffreiche
Rinde der Mangrovenbäume aus den tropischen
Küstengebieten in den Handel gebracht, von der Deutsch-Ostafrika
beispielsweise jährlich für 40000 Mark ausführt. Diese Mangroven-
oder Manglebäume (Rhizophora mangle, Rh. mucronata
u. a.) umgürten in dichten Beständen die meisten flachen Küsten
und Flußmündungen der Tropen. Es sind[S. 150] bis 15 m hohe Bäume,
deren Stämme und Äste zahlreiche, vielfach bogenförmig gekrümmte
Luftwurzeln entwickeln, mit denen sie sich gleichsam im lockeren
Uferschlamm verankern, was sehr nötig ist, wenn man bedenkt, daß bei
der steigenden Flut sich die Wellen oft stürmisch an die von ihnen
eingenommenen Standorte herandrängen und ihren Schaum hoch über die im
Winde gebogenen Wipfel aufspritzen lassen. Ihr Holz ist außerordentlich
zähe und hart und findet deshalb als Nutzholz in verschiedenster Weise
Verwendung. Die immergrünen, dicken, lederartigen Blätter sind durch
starke Verdickung der Oberhaut in wirksamer Weise gegen übermäßigen
Wasserverlust geschützt. Das scheint auf den ersten Blick unnötig,
da die Pflanzen doch im Wasser stehen; bedenken wir aber, daß dieses
Wasser salzhaltig ist und daß Kochsalz für alle Gewächse, wenn es in
unbeschränkter Menge in den Körper derselben eingeführt wird, ein sehr
stark wirkendes Gift ist, so begreifen wir diese Schutzeinrichtung
vollkommen.
Eine andere, durch ihren Standort im Wasser bedingte Eigentümlichkeit
der Mangroven sind die Pneumatophoren oder Atmungswurzeln, die von
einem mächtigen Aërenchymmantel umhüllt sind und durch Lentillen
genannte Spalten reichlich Kohlensäure ausscheiden und Sauerstoff
einatmen, um so den Gasstoffwechsel der unter Wasser befindlichen
Organe zu ermöglichen. Aus den paarweise gestellten weißen Blüten gehen
längliche, einsamige, nicht aufspringende Früchte mit lederartiger
Schale hervor, die auch wiederum die höchst zweckmäßige Einrichtung
aufweisen, bereits am Baume zu keimen. Der Keimblattstamm verlängert
sich dabei monatlich um etwa 4 cm und wächst durch die Frucht
heraus, so daß der Keimling nach neun Monaten gegen 0,5 m, unter
Umständen sogar 1 m Länge erreicht. Er ist unten am dicksten
und etwa 80 g schwer. Diese langen, schweren, aus den Früchten
heraushängenden Keimblattstöcke pendeln nun bei Luftströmung hin und
her, endlich reißen die Gefäßbündel, durch welche noch immer die
Verbindung mit dem röhrenförmigen Teile des Keimblatts erhalten war,
der Keimling fällt in die Tiefe und bohrt sich durch die Wucht des
Sturzes mit seinem unteren, zur Ausbildung der Wurzel bestimmten Ende
tief in den Schlamm ein. Sogar eine 0,5 m hohe Wasserschicht
wird von ihm mit solcher Gewalt durchfahren, daß er in dem darunter
befindlichen Schlamme aufrecht stehend stecken bleibt. Hier entwickeln
sich im Laufe weniger Stunden Wurzeln, die den Keimling endgültig
im Boden befestigen. Durch diese ingeniöse Einrichtung ist dafür
gesorgt, daß die Nachkommenschaft im[S. 151] Schlammgebiet selbst Wurzel
faßt, wo sie die günstigsten Existenzbedingungen findet, und nicht in
der Frucht von den Wogen ans Ufer geschwemmt wird an Orte, die für
die Weiterentwicklung höchst ungünstig sein könnten. Geschieht es
nämlich, daß bei hoher Flut der Keimling die hohe Wasserschicht nicht
mit genügender Kraft durchfährt, um sich in den Schlamm einzubohren,
so führen ihn die Wogen weiter, um ihn ans Land zu werfen, wo es ihm
gleichwohl oft noch gelingt Fuß zu fassen.
Abgesehen von ihrer als Gerbmaterial für Leder höchst wertvollen
gerbstoffreichen Rinde sind die Mangrovendickichte, welche nur dadurch
einigermaßen zugänglich sind, daß die netzförmig ausgebreiteten
Stelzwurzeln der Bäume über den Wasserspiegel hervorragen und auf
diese Weise einen Stützpunkt zum Überklettern bieten, von hoher
Wichtigkeit als landerobernde Vegetationsformen, die immer weiter ins
Meer hinaus vorschreiten und nach und nach bedeutende Gebiete an den
Küsten in Land verwandeln. Die bogenförmig ausgespreizten Stelzwurzeln
sammeln nämlich wie Reusen alles hineingeratene Pflanzenmaterial und
sämtlichen Auswurf des Meeres an, halten es fest und verdichten den
Untergrund des Sumpfwaldes schließlich so weit, daß er fest und gangbar
wird. Diese für die seichten Küsten der Tropen so charakteristischen
Mangrovenwälder sind durchaus an das Salzwasser des Meeres gebunden
und steigen an den Mündungen der Flüsse nur so weit herauf, als das
Wasser noch brackig ist. Im Bereiche des reinen Süßwassers verschwinden
sie vollkommen. Leider sind diese Mangrovenbezirke durch das viele
stehende Wasser gefürchtete Brutplätze der Moskitos, von denen die
Anophelesarten die Überträgerinnen der Malaria sind.
Von weiteren gerbstoffhaltigen Drogen, die technisch außer der
Gerberei besonders für die Färberei in Betracht kommen, sind die
Galläpfel zu nennen, die bekanntlich durch den Stich bestimmter
Gallwespenweibchen auf den Blättern und Knospen verschiedener
Eichenarten entstehen, indem durch den Reiz der aus dem Ei
hervorgegangenen Insektenlarve Wucherungen der betroffenen Stellen
des Blattgewebes in Form von blasigen Austreibungen bewirkt werden.
Unsere einheimischen Eichen (Quercus pedunculata und Q.
sessiliflora) werden von einer Anzahl Gallwespen befallen, deren
jede eine Galle von bestimmter Form hervorbringt. So erzeugt Cynips
scutellaris die kirschgroßen, weichen, auswendig grün bis rot
gefärbten kugeligen Gallen, die man so häufig an der Unterseite der
Eichenblätter findet.[S. 152] Reicher an Gerbstoff als unsere einheimischen
sind die großen ungarischen, die von Cynips hungarica an der
Unterseite der Blätter von der Stieleiche (Quercus pedunculata),
und die kleinen ungarischen Galläpfel, die von Cynips kollari
gleichfalls an den Blättern der Stieleiche erzeugt werden. Während
diese 25–30 Prozent Gerbstoff enthalten, steigt der Tanningehalt bei
den kleinasiatischen, von Cynips gallae tinctoriae auf der
Unterseite der Blätter von Quercus infectoria erzeugten auf 60
Prozent und mehr. Von diesen in ganz Vorderasien gefundenen Gallen sind
die nördlich von Aleppo in Nordsyrien gesammelten die gehaltreichsten
an Gerbsäure. Aus dem westlichen Gebiet kommen sie über Alexandrette
nach Europa, aus dem östlichen dagegen gehen sie über Mossul nach
Bombay und gelangen als indische Gallen in den Handel, um außer zum
Färben zur Tintenbereitung und zur Gewinnung von Gerbsäure und zur
Herstellung von Galläpfeltinktur zu dienen.
Kleinasiatische und griechische Galläpfel wurden schon zur Zeit des
Hippokrates, des berühmtesten Arztes des Altertums (460–364 v. Chr.),
medizinisch und technisch verwertet. Auch Theophrast (390–286 v. Chr.)
erwähnt sie, und der ältere Plinius um die Mitte des 1. christlichen
Jahrhunderts berichtet, daß man mit Galläpfelsaft getränktes Leinen zur
Prüfung des Kupfervitriols auf seinen Gehalt an Eisenvitriol benutze.
Auch später blieben die Galläpfel besonders in medizinischem Gebrauch,
bis nach den Kreuzzügen solche aus Syrien und Kleinasien einen
regelmäßigen Ausfuhrartikel jener Länder bildeten. In guten Jahren
kommen allein von Aleppo 8–9000 Säcke im Werte von je 140–160 Mark in
den Handel.
Die Knopperneiche (Quercus vallonea), die in Kleinasien und im
kilikischen Taurus vorkommt, liefert in ihren Fruchtbechern die 20
bis 35 Prozent Gerbsäure enthaltenden kleinasiatischen oder
Smyrnavalonen, während die Knoppern durch den Stich einer
Gallwespe (Cynips calycis) in die jungen Früchte vorzugsweise
der Stieleiche (Quercus pedunculata), seltener der Traubeneiche
(Quercus sessiliflora) hervorgebrachte, auf der Oberfläche mit
flügelartigen Höckern besetzte Gallen mit 24–35 Prozent Gerbstoff
sind, die in der Färberei und, besonders in Österreich, auch noch zum
Gerben des Sohlleders dienen. Sie kommen als levantinische Knoppern
in den Handel. In der oft mit Mannazucker bedeckten besten Sorte von
Smyrna beträgt der Gerbstoffgehalt 30–35 Prozent. Trotz ihres herben
Geschmackes dienten die Früchte der Knopperneiche schon der armen
Bevölkerung bei den[S. 153] alten Griechen als Nahrungsmittel, und auch
jetzt noch werden sie in ihrer Heimat roh oder geröstet verspeist,
während unsere einheimischen Eicheln heute nur noch als geschätztes
Schweinefutter dienen. In Griechenland allein werden jährlich 5000–7400
Tonnen geerntet, die als vorzügliches Gerbmaterial besonders für
Sohlleder, aber auch zum Schwarzfärben, z. B. von Seidenhüten, dienen.
Der Gerbprozeß, bei welchem die Gerbsäure Anwendung findet, ist
nebenbei bemerkt ein in seinen Einzelheiten noch nicht völlig
aufgeklärter Vorgang, der mit der Färberei einige Verwandtschaft
besitzt. Dabei verwandelt der Gerbstoff unter Aufnahme von
Sauerstoff aus der Luft die von der haartragenden Oberhaut und der
fettdurchwachsenen Unterhaut befreite Lederhaut, die der Gerber auch
wohl als Corium bezeichnet, zu einem vor jeglicher Fäulnis bewahrten
Gebilde, dem Leder. So wichtig der Sauerstoff auch für den Gerbprozeß
ist, so bewirkt er an sich noch keine Lederbildung des Coriums. Legt
man ein Stück der letzteren, die aus einem festen Gefüge vielfach
verschlungener Faserbündel besteht, in feuchtem Zustande in eine
Sauerstoffatmosphäre oder übergießt sie in einem Becherglase mit
reichlich Sauerstoff abgebenden Wasserstoffsuperoxyd, so wird noch kein
Leder daraus; dies geschieht erst bei Gegenwart einer Gerbstofflösung.
Die älteste Methode der Lederfabrikation haben wir in der Sämisch-
oder Ölgerberei vor uns. Die Jäger- und Nomadenstämme unserer Tage,
welche, wie die Jäger der Urzeit, das Fell des erlegten Wildes auf
der Fettseite mit dem Steine bearbeiten, um ihm seine Geschmeidigkeit
auch nach dem Eintrocknen zu erhalten, stellen damit eine primitive
Art sämisch gegerbtes Leder her. Etwas vollkommener ist das
Gerbverfahren, das beispielsweise die Frauen der nordamerikanischen
Indianer anwandten, um die Tierhaut in Leder zu verwandeln, d. h. in
solcher Weise zu verändern, daß sie weder in Fäulnis übergeht, noch
ausgetrocknet hart wird. Zu diesem Zwecke spannten sie die abgezogene
Haut eines von den Männern erbeuteten Büffels oder sonst eines
Wildes zwischen Holzpflöcke auf dem Boden aus und schabten mit einem
geschärften Stein das anhaftende Fett und Fleisch, wie auch die Haare
ab. Dann rieben sie die Haut mit dem Gehirn und Fett des Tieres ein und
bearbeiteten sie tüchtig längere Zeit mit dem Schaber oder einem andern
Stein, bis sie weich wurde wie sämisch gegerbtes Leder. Ähnlich wie sie
verfahren andere primitive Völker der Gegenwart, die zum Einreiben der
rohen Felle außer Gehirn auch Fett oder Öl verwenden. Noch heutzutage
werden die in Kleienbeizen[S. 154] angeschwellten „Blößen“, wie die in Leder
zu verwandelnde Mittelschicht der Haut von den Gerbern genannt wird,
mehrere Male mit Tran eingerieben; zwischendurch hängt man sie einige
Zeit an der Luft auf und läßt sie zuletzt in Wärmekammern angären.
Dabei nehmen die Fette Sauerstoff aus der Luft auf, es entstehen
sauerstoffreiche Fettsäuren, sogenannte Oxyfettsäuren, die sich mit dem
geschwellten Corium so fest verbinden, daß sie selbst durch Waschen mit
Soda und Seife nicht mehr entfernt werden können.
Ein anderes, in der Alten und Neuen Welt gebräuchliches, ganz
rationelles Verfahren, um das Fell vor Fäulnis zu bewahren, ist
die Anwendung des Rauches. Die moderne Technik macht auch hiervon
wenigstens insoweit Gebrauch, als ein großer Teil der aus Amerika
zu uns kommenden rohen Rindshäute der vorläufigen Erhaltung halber
etwas geräuchert wird — andere salzt man ein —, und daß man
Felle und Bälge für Sammlungen mit Kreosot, also mit demjenigen
Bestandteile des Rauches präpariert, der die Tierfaser gegen Fäulnis
widerstandsfähig macht. Auch die Anwendung von Alaun, die Grundlage der
Weißgerberei, muß schon lange bekannt sein, da schon die Römer neben
dem lohgegerbten festen Leder, von ihnen corium genannt, ein
weiches und geschmeidiges, mit Alaun bearbeitetes Leder unter dem Namen
aluta kannten.
Neuen Datums ist die Chromgerberei, die ein sehr widerstandsfähiges
Leder liefert, während die altgeübte Lohgerberei ein allerdings noch
besseres Produkt erzeugt. Sie wurde schon im frühesten Altertum
geübt und dazu in Europa vorzugsweise die bis 16 Prozent Gerbstoff
aufweisende Eichenrinde als die tanninreichste von allen Rinden
unserer Waldbäume verwendet. In Rußland, wo die Eichen fehlen, gerbt
man von alters her mit den Rinden der Birken, Weiden und Erlen, wie
in Nordamerika mit der Rinde der Hemlocktanne. Das auf diese Weise in
Nordamerika erzielte rote Sohlleder wurde zuerst im Jahre 1844 nach
England und bald über den ganzen europäischen Kontinent eingeführt,
doch erwies sich dieses Hemlockleder trotz seiner Billigkeit nicht als
dem einheimischen lohgegerbten Leder gleichwertig.
Schon die Ägypter des vierten vorchristlichen Jahrtausends übten die
Gerberei mit gerbstoffhaltigen Brühen, die sie aus den Rinden der
einheimischen Pflanzen herstellten. Auf den ältesten Wandbildern
der Gräber des alten Reiches zu Beginn des dritten vorchristlichen
Jahrtausends sehen wir dasselbe Gerbverfahren angewandt, das man
heute noch betreibt. Im frühen Altertum waren die persischen und
baby[S. 155]lonischen Leder berühmt; man fertigte dort nicht bloß gröbere,
sondern auch sehr feine und schön gefärbte Ware an. Mit Safran gelb
gefärbte pantoffelartige Schuhe waren das Kennzeichen der Vornehmen.
Diese altasiatische Industrie arbeitete selbst für Europa, wohin die
schiffahrtkundigen Phönikier diese beliebte Handelsware brachten
und gegen einheimische Produkte umtauschten. Gegen den Anfang der
christlichen Zeitrechnung hatten die Juden fast ausschließlich den
Lederhandel Syriens in Händen und versorgten mit dieser Ware Rom und
die übrigen bedeutenderen Städte des römischen Reiches. Zur Zeit der
arabischen Herrschaft kam im westlichen Afrika und in Spanien eine
Luxusgerberei zur Blüte, für deren ausgezeichnete Produkte die Völker
Mitteleuropas lange Zeit gute Käufer waren, bis man hier, zuerst
in Frankreich, das Geheimnis der Fabrikation dieser besseren Ware
ausgekundschaftet hatte und dann in der Neuzeit selbst zu fabrizieren
anfing. Die Erinnerung an diese Verhältnisse ist in den Bezeichnungen
der verschiedenen Ledersorten bis in die Gegenwart erhalten geblieben.
So haben wir dem Namen nach noch heute Leder aus Marokko als Maroquin,
aus der Stadt Safi in Marokko ausgeführtes Leder als Saffian und Leder
aus Cordova in Südspanien als Corduan. Von jener südwestländischen
Kunstgerberei aber hat man allen Grund anzunehmen, daß die Araber sie
auf ihren Eroberungszügen in Asien kennen lernten und sie nachträglich
bis an die Gestade des Atlantischen Ozeans verpflanzten. Daß Asien, wie
überhaupt die Wiege der Kultur, so auch die einer Industrie wie der
feineren Gerberei gewesen sein wird, läßt sich wohl sicher annehmen,
und dafür spricht auch, daß eben in den östlichen Gegenden Europas,
bei den Russen, Bulgaren, Ungarn, Türken usw., die Lederbereitung
frühzeitig in ausgezeichneter Weise betrieben wurde. Wir lesen
bereits bei Plinius, daß das indogermanische Volk der Kelten sein
Leder vermittelst Birkenteer bereitete; daraus ergibt sich, daß die
Juchtengerberei nichts Nationalrussisches ist, sondern schon von den
Urindogermanen geübt wurde, von denen sie manche Zweige später wieder
aufgaben.
Außer den bereits genannten Gerbstofflieferanten werden für die
Lohgerberei des Leders noch verschiedene andere verwendet, von
denen wir die wichtigsten kurz aufzählen wollen. Dahin gehört die
Rinde der Aleppokiefer (Pinus haleppensis),
eines 10–16 m hohen harzreichen Baumes des Mittelmeergebiets,
der in der Region des Ölbaums im Meeressand wie auf verwittertem
Felsboden gedeiht. Seit der Zeit Theophrasts im 4. vorchristlichen
Jahrhundert bis heute wird sie zum[S. 156] Gerben benutzt und weithin
exportiert. In Australien und Tasmanien wird zu diesem Zwecke die Rinde
eines daselbst heimischen, 12 m hohen Schmetterlingsblütlers,
Acacia penninervis, benutzt. Noch mehr, nämlich über 30 Prozent
Gerbstoff, enthält die schwere, schwarzviolette Rinde der in Süd- und
Ostaustralien häufig vorkommenden besten Gerberakazie, der Acacia
decurrens, die dort in Schälwäldern mit einer Umtriebszeit von nur
acht Jahren gewonnen wird. Ein ausgewachsener Baum von zehn Jahren
liefert etwa einen Zentner Rinde von 44 Prozent Tanningehalt, die
neuerdings auch gemahlen als Mimosarinde nach Europa ausgeführt
wird. So bringt Australien allein von Acacia decurrens jährlich
etwa 15 Millionen kg im Wert von 1,85 Millionen Mark in den
Handel. Wie der Baum neuerdings auf Anregung der Regierung in seiner
australischen Heimat in Kultur genommen wird, so wird er jetzt auch in
Deutsch-Ostafrika in größerem Maße angepflanzt. Die Bäume brauchen 5–8
Jahre, bis sie die ersten Erträge liefern. Dann aber kann das Abschälen
eines Teiles der Rinde in bestimmten Abständen eine Reihe von Jahren
hindurch wiederholt werden.
Wie Australien in seinen verschiedenen Gerberakazien, so besitzt
Neuseeland in der Rinde der 20–23 m hohen, sellerieblätterigen
Tanekahafichte (Phyllocladus trichomanoides), einer
weitläufigen Verwandten der Eibe, ein Material mit 28–39 Prozent
eines außerordentlich wertvollen Gerbstoffs, das neuerdings in
erhöhtem Maße exportiert wird, um zum Gerben feiner, weicher
Ledersorten zu dienen. Daher zieht Grenoble, dieser berühmte Sitz der
Glacéhandschuhfabrikation, den größten Teil der Ausfuhr desselben an
sich. Südamerika dagegen hat einen sehr wichtigen Gerbstofflieferanten
in dem harten, fleischroten Holz eines in den Wäldern Argentiniens
und Paraguays häufig wachsenden hohen Baumes, des Quebracho —
sprich kebratscho — (Schinopsis lorentzii). Dasselbe enthält
bis 20 Prozent Gerbsäure und wird zur Extraktion derselben, da es
sehr hart ist, mit kräftigen Maschinen zerkleinert. Die Rinde dieses
Baumes mit bläulichgrünen Blättern und gelben Blüten wird medizinisch
verwendet. Sie gelangte 1878 zum erstenmal nach Europa und wurde als
Ersatz der Chinarinde gegen Fieber empfohlen. Sie wird besonders gegen
Asthma angewandt.
Äußerst wichtige ostasiatische Gerbstofflieferanten sind auch die
chinesischen Galläpfel, die seit dem Jahre 1846 aus China
und seit 1860 aus Japan auf den europäischen Markt gelangen. Sie[S. 157]
werden durch den Stich einer Blattlaus (Aphis chinensis)
an den Blättern und Blattstielen des geflügelten Sumachs (Rhus
semialata) hervorgebracht und stellen ursprünglich grüne, später
graubraune, dünnwandige Blasen mit 59–77 Prozent Gerbstoffgehalt dar.
Sie sind 3–10 cm lang und 1,5–4 cm dick und bergen im
frischen Zustande im Innern zahlreiche junge Blattläuse. Um diese
abzutöten, werden die Gallen in weitgeflochtenen Weidenkörben heißen
Wasserdämpfen ausgesetzt. Man bedient sich ihrer zum Schwarz-, Braun-
und Graufärben von Geweben und Leder und zur Bereitung schwarzer Tinte.
Unser Wort Tinte kommt vom romanischen, speziell italienischen
tinta Farbe, das seinerseits aus dem lateinischen tincta
gefärbtes (nämlich aqua Wasser) hervorging. Schon im hohen
Altertum schrieb man mit schwarzer Tinte, die aus Ruß, arabischem Gummi
und Wasser bereitet wurde, jedenfalls aber im ganzen sehr wenig haltbar
war. Aus der römischen Kaiserzeit sind uns verschiedene Rezepte zur
Bereitung solcher Tinte erhalten geblieben, so von Plinius: „Schwarze
Tinte und Farbe (atramentum) wird aus Ruß von verbranntem Harz
und Pech gemacht, und man hat zu diesem Zwecke auch geschlossene
Kammern, in denen sich der Ruß sammelt. Die beste schwarze Tinte
kommt von Kiefern. Sie wird übrigens mit dem Ruß aus Öfen und Bädern
verfälscht. Man macht auch welche aus geglühter Weinhefe. Die berühmten
Maler von Athen Polygnotus und Mikon machten ihre schwarze Farbe auch
aus Weintrestern. Apelles erfand die schwarze Farbe aus verkohltem
Elfenbein, und man nennt solche elephantinon. Es wird auch
schwarze Farbe aus Indien gebracht, deren Zusammensetzung mir aber
unbekannt ist. (Damit meint Plinius jedenfalls die über Indien zu
den Römern gelangende chinesische Tusche.) Es wird auch welche aus
feinem Ruß gemacht, der sich an ehernen Kesseln ansetzt, oder aus
Kiefernkohle, die man in einem Mörser zerstößt. — Alle schwarze Farbe
wird an der Sonne fertiggemacht, die Schreibtinte mit Zusatz von Gummi,
die Malerfarbe mit Zusatz von Leim. Man macht sie mit Essig flüssig,
damit sie sich nicht leicht wieder auswaschen läßt, und mischt eine
Abkochung von Wermut darunter, damit die Mäuse nicht an sie gehen.“
Außer der schwarzen waren auch farbige, besonders rote, allerdings
ebenso leicht schimmelnde Tinten im Gebrauch, die alle in gleicher
Weise mit dem zugespitzten und an der Spitze gespaltenen Schreibrohr
calamus auf die Schreibrollen aus Papyrus oder Pergament
aufgetragen wurden. Unsere Bezeichnung Rubrik kommt ja aus dem
lateinischen[S. 158] rubrum das Rote, von der kurzen, seit der
altägyptischen und römischen bis fast in unsere Zeit rotgeschriebenen
Inhaltsangabe als Aufschrift bei Aktenstücken und am Eingang von
amtlichen Verfügungen. Schon im 3. Jahrhundert n. Chr. begann man
die Tinte in der heute noch gebräuchlichen Weise anzufertigen, indem
man eine stark gerbstoffhaltige Galläpfelabkochung mit Eisenvitriol
versetzte. Dadurch entstand ein feiner Niederschlag von gerbsaurem
Eisenoxydul, der durch schleimige Verdickungsmittel, wie arabischer
Gummi, später auch Dextrin, in Suspension erhalten wurde. Erst seit
einem halben Jahrhundert kennt und benutzt man klare, filtrierbare
Gallustinten, in denen das Eisen in gelöster gerbsaurer und
gallussaurer Verbindung enthalten ist und sich erst nach dem Schreiben
in unlöslicher Form auf dem Papier niederschlägt. Die erste derartig
zubereitete Tinte, die heute noch als Vorbild der meisten im Handel
befindlichen Gallustinten gelten kann, war die im Jahre 1855 von
Leonhardi in Dresden erfundene Alizarintinte, so genannt, weil
sie außer Indigo auch noch Krapp zugesetzt erhielt. Da man aber später
erkannte, daß die Indigobeigabe an sich genügt, um der Tinte gehörige
Schwärze zu verleihen, ließ man den Krappzusatz als überflüssig
weg. Neuerdings ersetzt man die Indigolösung in zunehmendem Maße
durch andere sauer reagierende Lösungen von Farbstoffen, besonders
Anilinfarben.
Die Blauholztinten werden aus Blauholzextrakt unter Anwendung
von doppeltchromsaurem Kali, Chromalaun und verschiedenen in der
Färberei als Beizen gebrauchten Salzen und Säuren dargestellt.
Gegenüber den Gallustinten haben sie den Nachteil, daß die Schriftzüge
leichter vom Papier entfernt werden können; dagegen kommt ihnen der
Vorteil einer vorzüglichen Kopierfähigkeit zu. Ihrer Billigkeit wegen
benutzt man sie, z. B. in Form der Kaisertinte, häufig für Schulzwecke.
Die Anilintinten sind halb- bis einprozentige Lösungen der
entsprechenden, auf chemischem Wege dargestellten Farben in Wasser
unter Zusatz von Oxalsäure und Zucker. In bezug auf Echtheit und
Beständigkeit stehen sie den Gallus- und Blauholztinten bei weitem
nach, besitzen aber große Kopierfähigkeit, die sich mit der Menge des
darin gelösten Farbstoffs steigert. Vor der Anwendung der Anilinfarben
stellte man die rote Tinte meist aus Pernambukholz oder aus der
Kochenille gewonnenem Karmin, die blaue dagegen aus Indigokarmin oder
Berlinerblau her.
Wie die Tinte der Abendländer im Altertum und Mittelalter aus Ruß,
der durch Verbrennen von Öl oder Holz vorzugsweise von harz[S. 159]reichen
Koniferen gewonnen wurde, wird auch die Tusche der Chinesen
und Japaner, mit der sie vermittelst eines feinen Haarpinsels auf
Papier meist vom Papiermaulbeerbaum schreiben, aus Ruß gewonnen,
und zwar vornehmlich aus dem Ruße des Sesamöles, der mit dem bei
allen Ostasiaten so beliebten Patschuli parfümiert wird, was ihm den
typischen echten Geruch gibt. Dieses Parfüm, das auch zum Parfümieren
der indischen Schale und anderer Erzeugnisse Ostindiens dient, ist
der haltbarste unter allen Pflanzendüften und wird aus den durch
einen reichen Gehalt an ätherischem Öl wohlriechenden Blättern des
südindischen Halbstrauches Pogostemon patschuli in Bengalen
gewonnen, wo er auch, wie auf Ceylon und Malakka, kultiviert und
patschapat oder patschuli geheißen wird. Schon im
Altertum gelangte die chinesische Tusche durch indische Vermittlung
nach den Mittelmeerländern, wo sie bei den Griechen indikón
mélan und bei den Römern indicum nigrum, d. h. schwarzes
Indigo (eigentlich schwarze indische Farbe) hieß. Vitruvius bezeichnet
es als kohlschwarz, auch Plinius erwähnt es in seiner Naturgeschichte
an der vorhin von uns erwähnten Stelle, und der weitgereiste Grieche
Arrian im 2. Jahrhundert n. Chr. sagt in seinem Bericht über die
Umschiffung des Roten Meeres, daß es nebst seidenen Zeugen und seidenen
Fäden von der Stadt Minnagara an der Indusmündung über Alexandrien in
den Handel gelange.
Wie alle orientalischen Völker die Wohlgerüche über alles lieben
und sich und ihre Waren nach Möglichkeit parfümieren, so sind sie
auch besondere Freunde bunter Farben, die sie in der Kleidung und
ganzen Lebensführung zur Geltung kommen lassen. Weniger angenehm für
unseren Geschmack ist ihre mit diesem gesteigerten Farbenbedürfnisse
zusammenhängende Freude am Schminken. Wie die Orientalinnen
in ihren Frauengemächern, haben auch die vornehmen Frauen in ganz
Vorderasien und Ägypten sich schon im höchsten Altertume geschminkt und
ihre Haare, Handflächen und Fingernägel gefärbt. In den Grabkammern
der alten Ägypter hat sich uns ein reiches Inventar von wohlriechenden
Salben und Schminken mit allem übrigen Toilettenzubehör vornehmer
Damen gefunden, das uns von der großen Bedeutung dieser Artikel
Kunde gibt. Bei den Ägypterinnen war der zwerghafte, unterwachsene
und bucklige Besa, ein durchaus nicht einheimischer, sondern aus dem
asiatischen Orient mit der ganzen höheren Toilettenkunst eingeführter
Gott, der Toilettengott, den wir sehr häufig auf Schminkbüchsen und
anderen Toilettegegenständen abgebildet finden.[S. 160] Von ihnen und den
vornehmen Asiatinnen Syriens, Phönikiens und Kleinasiens nahmen dann
naturgemäß die wohlhabenden Griechinnen, und von diesen wiederum die
Römerinnen der späteren Zeit diese von uns als Unsitte empfundene
Gewohnheit des Färbens und Schminkens hauptsächlich des Gesichtes an.
Aus vielen Stellen griechischer Schriftsteller geht hervor, daß es
bei den griechischen Damen ganz allgemein Sitte war, das Gesicht zu
schminken. Die dazu verwandte weiße Farbe war Bleiweiß, während das Rot
von der Färberochsenzunge (Anchusa tinctoria), von der Pflanze
paidéros, von Maulbeeren und von phýkos (einem Tang,
zweifellos der Lackmusflechte) gewonnen wurde. So führt Athenaios eine
Stelle des Dichters Eubulos in einem Stück, das Die Kranzverkäuferinnen
heißt, an, in der es heißt: „Wie die blonden Augenbrauen mit Ruß oder
Antimonsalbe, so werden die Wangen mit Bleiweiß und Maulbeersaft
beschmiert; und geht nun die Dame im Sommer aus, so fließen von den
Augen her zwei schwarze Tintenbäche auf die Wangen, von den Wangen
aber rote Streifen auf den Hals, und die Haare der Stirne reiben sich
am Bleiweiß grau.“ Gleicherweise sprechen römische Schriftsteller vom
Schminken der römischen Damen, bei denen besonders roter Lackmus zum
Färben der Wangen benutzt wurde. Aber alles Eifern dagegen war umsonst,
die Sitte blieb bestehen. Schon der Athener Xenophon, der Schüler des
Sokrates (440–355 v. Chr.) sagt: „Wenn ich eine Dame sehe, die sich
dick mit Bleiweiß angestrichen hat, um weißer zu erscheinen als sie
wirklich ist, und sich auch dick mit Färberochsenzunge angepinselt
hat, um röter zu erscheinen als sie wirklich ist, und die Schuhe mit
hohen Absätzen trägt, um größer zu erscheinen als sie wirklich ist,
dann muß ich doch bemerken, daß dergleichen Betrug wohl mitunter Fremde
täuschen kann, aber diejenigen gewiß nicht, welche die Dame näher zu
beobachten Gelegenheit haben. Denn sie sieht früh morgens, bevor sie
sich geschmückt hat, ganz anders aus, als wenn sie Toilette gemacht
hat; und ist sie angepinselt, so verrät doch jeder Schweißtropfen, jede
Träne, jeder Wassertropfen den Pinsel.“
Zu allen Zeiten hat der Mann „die Herrin des Liebreizes, der Anmut und
der Liebe“, „die Palme der Liebe und Anmut für ihren Gatten“, „welche
geschützt ward von ihrem Manne“, und wie sonst die Wendungen zur
Kennzeichnung der Frau in den altägyptischen Grabdenkmälern lauten,
gewähren lassen, wenn sie auch von ihrem Triebe nach Putz auf falsche
Bahnen geleitet wurde. Denn wie vor 5000 Jahren gelten noch heute
die Worte des Prinzen und Gaufürsten[S. 161] Ptah-hotep, der im alten Reich
unter dem König Tet-kara der 5. Dynastie (2750–2625 v. Chr.) lebte
und dessen im Papyrus Prisse, dem ältesten Moralbuche der Welt, uns
erhaltenen Anstands-, Sitten- und Weisheitslehren Jahrtausende hindurch
als Richtschnur und Norm im Pharaonenlande dienten. Sie lauten: „Wenn
du weise bist, sorge für dein Haus, liebe deine Frau in Züchten, nähre
sie, kleide sie und schmücke sie, das ist die Lust ihrer Glieder. Gib
ihr Wohlgerüche, erfreue sie, so lange du lebst; denn sie ist ein Gut,
das seines Besitzers würdig sein soll. Sei kein Tyrann. Freundliches
Wesen erreicht mehr als Gewalt. Munter ist alsdann ihr Atem und munter
ihr Auge, das sie im Spiegel schaut. Gern mag sie wohnen in deinem
Hause und mit Lust und Liebe darin arbeiten.“
[S. 162]
XXIII.
Der Kautschuk und die Guttapercha.
Wenn man den Stengel einer Wolfsmilch- oder einer andern
Milchsaftpflanze abbricht, so erscheint an den Bruchflächen ein
Tropfen dichten, weißen Milchsafts, der zahlreiche Stoffe wie Gummi,
Zucker, Eiweiß, Gerbstoffe, verschiedene Salze und Alkaloide, ferner
häufig Harze und Kautschuk in Form kleiner Körnchen und manchmal auch
eigenartig gestaltete Stärkekörner enthält. Er befindet sich in einem
System dünnwandiger Röhren und dient teils als Reservenährlösung, teils
aber als wichtiges Schutzmittel für die Pflanze. Wird eine solche
nämlich verletzt, so tritt der unter starkem Druck im Individuum
gehaltene Milchsaft rasch in großen Mengen aus und bedeckt, an der Luft
schnell erhärtend, die Wundfläche mit festem Verschluß, so daß keine
Krankheitserreger in sie hineindringen können.
Begreiflicherweise hat diese Eigenschaft frühzeitig die Aufmerksamkeit
des Menschen erregt, der ja zunächst alle Erzeugnisse der Schöpfung
nur nach ihrem Gebrauchswert für sein eigenes Dasein zu beurteilen
pflegt. So haben die Indianerstämme Brasiliens schon seit langer
Zeit den rasch vertrocknenden, dicken Milchsaft eines stattlichen
Baumes aus der Familie der Euphorbiazeen oder Wolfsmilchgewächse
der von ihnen bewohnten Wälder technisch zur Herstellung von
weichen und zugleich elastischen Flaschen und andern Gegenständen
benutzt, indem sie einen Klumpen Lehm am Ende eines Stockes in die
dickflüssig gewordene Milchsaftmasse tauchten, die sie nach dem
Anschneiden der betreffenden Bäume mit Steinbeilen durch eine Rinne
aus Schilfrohr in daruntergestellte Kalabassen, d. h. ausgehöhlte
Flaschenkürbisse, geleitet hatten. War der federnde Harzüberzug
erstarrt, so wurde der trockene Lehm ausgeklopft und zurück blieb eine
als Wassergefäß benutzbare Flasche mit engem Hals, die sehr elastisch
und unzerbrechlich war. Um nun den ganzen Prozeß zu beschleunigen,
wurde die so ge[S. 163]wonnene Form über einem Feuer getrocknet, dessen
Rauch der ursprünglich hellbraunen Kautschukflasche eine dunkle Farbe
verlieh. Solche kamen früher als „Negerköpfe“ in den Handel und werden
von Pará an der Mündung des Amazonenstroms heute noch in dieser Form
ausgeführt. Auch Schuhe, in denen es sehr angenehm zu marschieren
war und die die Füße trocken hielten, was in den morastigen Wäldern
von nicht zu unterschätzender Bedeutung war, Spielbälle und Fackeln
wurden aus diesem wegen seiner Federkraft im Deutschen zunächst
Federharz genannten Stoff verfertigt. Die Indianer bezeichneten ihn
als kautschu oder kahutschu, welch fremdartiger Name
sich dann bald einbürgerte, und zwar zunächst bei den Franzosen als
caoutchouc (mit unhörbarem c am Ende).
Es war nämlich der französische Gelehrte Charles Marie de la Condamine
(in Paris 1701 geboren und 1774 ebendort verstorben), der Europa
mit diesem neuartigen Stoffe bekannt machte, nachdem ihn allerdings
schon der Spanier Gonzalo Fernandez d’Oviedo y Valdes in seiner 1536
erschienenen „Allgemeinen Geschichte Indiens“ (d. h. Amerikas, das man
zuerst für Indien ansah) erwähnt hatte bei Gelegenheit der Beschreibung
des Ballspiels der Indianer. Er sagt von letzterem, es werde anders
gespielt und auch der Ball sei aus einer andern Masse hergestellt als
derjenige, dessen sich die Christen bedienen. Nach ihm beschrieb der
Jesuit Charlevoix den „batos“ genannten Ball der Indianer als
eine Kugel aus einer festen, außerordentlich elastischen Masse. „Er
springt höher als unsere Bälle, fällt auf den Boden und springt viel
höher wieder auf, als die Hand ihn nach unten warf; er fällt nieder und
springt von neuem, obgleich dieses Mal weniger hoch, und so nimmt die
Höhe der Sprünge allmählich ab.“ Diesen eigenartigen Stoff bezeichnet
der spanische Geschichtschreiber Antonio de Herrera Tordesillas zum
erstenmal als Gummi; aber ihn nach seinem Ursprunge bekanntgemacht zu
haben gebührt durchaus dem Franzosen la Condamine. Dieser Gelehrte
hielt sich von 1736–1744 in Südamerika auf, zuerst als Teilnehmer an
der von der französischen Akademie der Wissenschaften organisierten
Gradmessung in Peru, nach welcher er dann Brasilien bereiste, wobei
er diesen Rohstoff bei den Indianern kennen lernte. Er brachte Proben
davon mit nach der Heimat und reichte 1751 darüber eine Denkschrift
bei der Akademie der Wissenschaften zu Paris ein. Doch fanden seine
Mitteilungen über die merkwürdigen Eigenschaften des elastischen
Baumharzes aus Brasilien ebensowenig Beachtung wie die etwas späteren
von Fresneau[S. 164] und Aublet du Petit-Thouar. Man betrachtete den
Kautschuk als eine Kuriosität, mit der man nichts anzufangen wußte,
und glaubte endlich seinen ganzen Nutzwert erschöpft zu haben, als
man die Fähigkeit desselben entdeckte, Bleistiftstriche durch Reiben
damit vom Papier zu entfernen. Zu diesem Zwecke ward er längere Zeit
hindurch in geringen Mengen eingeführt; doch war er noch so teuer, daß
ein würfelförmiges Stück von 12 mm Seitenlänge nicht weniger
als 3 Mark kostete. In England erhielt er davon den Namen „india
rubber“, der ihm bis heute verblieb, während er in Deutschland die
lateinische Bezeichnung „Gummi elasticum“, auch schlichtweg nur
Gummi bekam. Doch nannte man ihn hier in Anlehnung an das französische
caoutchouc auch Kautschuk, wobei das k am Schlusse betont wurde.
In den Jahren 1761 und 1768 veröffentlichte der französische Chemiker
Macquer seine chemischen Untersuchungen über den Kautschuk, der bei
gewöhnlicher Temperatur einen höchst elastischen Stoff darstellt.
Bei 0° verliert er jedoch diese Eigenschaft fast ganz, ohne indessen
brüchig zu werden. Die gewöhnlichen Lösungsmittel wirken auf ihn
gar nicht ein und selbst gegen starke chemische Agenzien verhält er
sich sehr indifferent, nur konzentrierte Schwefel- und Salpetersäure
zersetzen ihn. Bei Temperaturerhöhung ändern sich seine chemischen
und physikalischen Eigenschaften. Bei 50° wird er etwas weicher,
bei 100° fängt er an stark zu kleben, bei 120° schmilzt er und geht
bei 200° in eine braunschwarze, schmierige Masse über, welche durch
Abkühlen nicht wieder in ihren früheren Zustand zurückkehrt. Noch
weiter erhitzt, verbrennt er an der Luft mit rötlicher, stark rußender
Flamme. Im Jahre 1791 stellte Grassart in Paris Röhren aus Kautschuk
her, indem er Streifen desselben um Glasröhren wickelte und die Ränder
durch Erwärmen verklebte. Doch wurden solche anfänglich kaum technisch
benutzt. Noch im Jahre 1820 kannte man kaum eine andere Verwendung des
Kautschuks als zum Auswischen von Bleistiftstrichen, wie solches nach
dem Vorschlage des Chemikers Priestley seit dem Jahre 1770 geübt wurde,
dann zu Verschlüssen und Röhrenverbindungen an chemischen Apparaten, zu
elastischen Verbänden, luftdichten Firnissen und zum Wasserdichtmachen
von Leder und Geweben nach dem Vorgange des Engländers Samuel Peal
seit 1791. Um 1820 wurden in Paris die ersten Bougies und Katheter
aus Kautschuk verfertigt. In jenem Jahre nahm der Engländer Hancock
ein Patent auf elastische Gewebe mit Kautschukstreifen; gleichzeitig
gelang es 1820 Stadler in Wien, den Kautschuk in Fäden zu ziehen
und diese, übersponnen, zu[S. 165] elastischen Geweben zu verbinden, eine
Industrie, die dann namentlich von Reithofer in Wien erfolgreich
weiter entwickelt wurde. Damals begann auch Macintosh in Glasgow seine
ersten Versuche zur Anfertigung wasserdichter Stoffe durch Auftragen
von Kautschuklösung auf Gewebe. Er nahm 1823 ein Patent darauf, doch
verschwanden die Übergewänder aus seinem wasserdichten Zeug bald
wieder, weil sie in der Kälte hart und unelastisch wurden, in der Wärme
dagegen leicht zusammenklebten. Im Jahre 1830 machte Thomas Hancock
die ersten Versuche mit der Herstellung von Überschuhen aus Kautschuk,
den sogenannten Gummischuhen. Doch vermochte diese Industrie erst
von 1836 an einen Aufschwung zu nehmen, als es Chaffee in Roxburgh
(Nordamerika) und Nickels in England gelang, Maschinen zu erfinden,
welche den Kautschuk durch bloßes Kneten bei mäßiger Wärme in einen
erweichten, fast unelastischen Körper umwandeln, der mit Leichtigkeit
jede gewünschte Gestalt annimmt.
Trotz allen diesen Errungenschaften blieb der Kautschuk ein Stoff von
nur untergeordneter industrieller Bedeutung, bis der Amerikaner Charles
Goodyear zu Newhaven im Staate Connecticut 1839 das Vulkanisieren
desselben erfand durch Imprägnieren mit Schwefel und Erhitzen. Dadurch
wurden ihm die Nachteile des unangenehmen Geruchs und der Veränderung
durch die Temperatur genommen und hatte man es in der Hand, durch
geringen Zusatz von geschmolzenem Schwefel, mit dem sich der Kautschuk
zu einer eigenen Masse verbindet, und kurzem starken Erhitzen bei
allen Temperaturen weich bleibenden Gummi, durch stärkeren Zusatz von
Schwefel in Verbindung mit langdauerndem Erhitzen dagegen als Ebonit
bezeichneten Hartgummi von hornartiger Beschaffenheit zu erzeugen.
Diese Erfindung erst ermöglichte eine unbeschränkte Anwendung des
Kautschuks und verschaffte diesem Pflanzenprodukt eine ungeheure
Bedeutung, die heute noch immer zunimmt. Den Anstoß zu diesem
Aufschwung gab die Entdeckung des Dr. Lüdersdorff in Berlin, daß
dem durch Terpentinöl aufgeweichten Kautschuk die nach dem Trocknen
zurückbleibende Klebrigkeit genommen wird, wenn man ihm Schwefel
beimischt. Auf diese Beobachtung baute Goodyear seine Erfindung auf,
die er sofort nach amerikanischer Art im großen technisch verwertete,
indem er alle möglichen Gebrauchsartikel daraus anfertigte. Im Jahre
1842 kamen die ersten vulkanisierten Kautschukartikel aus seiner
Fabrik nach Europa, aber erst die Weltausstellung vom Jahre 1851 im
Kristallpalast in London und noch mehr diejenige von 1855 zu Paris
verschafften seinen[S. 166] äußerst mannigfaltigen Erzeugnissen allgemeine
Anerkennung und Nachahmung in der ganzen Kulturwelt.
Welchen Aufschwung die Kautschukindustrie seither genommen hat, dessen
sind wir alle Zeugen. Tatsächlich gibt es heute kaum einen Zweig der
Industrie, der nicht in irgend einer Form Kautschuk verwendet, so daß
man ohne Übertreibung sagen kann, dieser Stoff begleite den Menschen
von der Wiege bis zum Grabe. Schon der Säugling saugt die ihm als
Ersatz oder wenigstens als Ergänzung der Muttermilch verabreichte
Tiermilch mit dem Gummisauger und streckt sich behaglich auf seiner
weichen Gummiunterlage aus. Dann spielt er mit seiner Gummipuppe
oder greift zum Gummiball. Mit einem Schwamm aus weichem Gummi wird
er gewaschen und mit einem Kamm aus hartem Gummi wird er gekämmt,
und so geht es das ganze Leben hindurch fort. Es ist ganz unmöglich,
alle Gebrauchs-, Sport- und Luxusgegenstände aus Kautschuk, die der
Kulturmensch der Gegenwart im täglichen Leben verwendet, auch nur
aufzuzählen. Es sei hier beispielsweise nur an die Pneumatik der
Fahrräder und Automobile erinnert, dann an die mancherlei Verwendung,
die dieser Stoff in der Chirurgie, Orthopädie, Chemie, Elektrotechnik,
Meteorologie, Luftschiffahrt usw. findet. Es ist im Laufe eines
Menschenalters so weit gekommen, daß wir uns die moderne Kultur ohne
Kautschuk und seine Derivate überhaupt nicht mehr vorstellen können.
Entsprechend dem ins ungeahnte gesteigerten Bedarf ist auch die
Gewinnung des so kostbaren Stoffs mit Riesenschritten vorwärtsgegangen.
Während der Jahresverbrauch an Kautschuk im Jahre 1840 noch kaum
400000 kg betrug, ist er 1909 auf über 68 Millionen kg im Werte
von etwa 500 Millionen Mark gestiegen. Davon lieferte Südamerika 42,8
Millionen kg, Afrika 23,4 Millionen kg und Asien und
Polynesien 1,8 Millionen kg. Deutschlands Einfuhr an Kautschuk
beträgt rund 153 Millionen Mark.
Der Kautschuk ist eine Substanz, die sich in Form mikroskopisch
kleiner Kügelchen in geringem Maße bei den milchenden Pflanzen auch
Mitteleuropas wie Mohn, Zichorie oder Wolfsmilch findet, während er
in den Milchsäften zahlreicher Tropenpflanzen einen überwiegenden
Bestandteil bildet, der sich beim Stehen des Saftes vielfach von selbst
abscheidet. Er findet sich im Milchsaft der betreffenden Pflanzen in
ähnlich feiner Verteilung wie die Butter in der Milch und sammelt
sich beim Stehen desselben wie jene an der Oberfläche in Form eines
Rahmes an. Das Zusammenballen der Kautschuk[S. 167]kügelchen erfolgt, indem
das Ganze durch den Rauch gewisser Nüsse und Hitze oder durch den
Zusatz von Alkalien, Säuren oder Salzen zur Gerinnung gebracht wird.
Hierbei gerinnen aber die Eiweißstoffe des Milchsaftes, nicht der
Kautschuk, und dabei kleben die kleinen Kautschuktröpfchen zusammen,
wie im Blute der gerinnende Faserstoff, das Fibrin, die Blutkörperchen
zusammenballt. Infolgedessen ist der Kautschuk stets ausgiebig mit
Eiweißstoffen durchsetzt und dadurch leicht geneigt, in Fäulnis
überzugehen oder einen üblen Geruch anzunehmen. Durch Zentrifugieren
kann er allein rein und geruchlos erhalten werden. Chemisch besteht er
im wesentlichen aus einem zu den Polyterpenen (C10H16)
gehörenden Kohlenwasserstoff, gemengt mit Harz, wenig ätherischem Öl,
Wachs, Eiweiß und Fett. Seine chemische Beschaffenheit wechselt aber
bei den verschiedenen Pflanzenfamilien, was schon aus der voneinander
abweichenden Beschaffenheit der verschiedenen Handelssorten gefolgert
werden kann. Diese Kohlenwasserstoffe stehen durch ihre Zusammensetzung
den ätherischen Ölen, durch ihre Nichtflüssigkeit, ihr Verhalten gegen
Lösungsmittel und ihre Zersetzungsprodukte den Harzen nahe.
Der älteste technisch zur Anwendung gelangte Kautschuk stammt vom
brasilianischen Kautschukbaum (Hevea brasiliensis),
der am Amazonenstrom und an dessen großen Zuflüssen, besonders
in den ausgedehnten Wäldern an der rechten Seite des Stromes, am
Madeira, Tapajoz und Purus wächst. Diese Flüsse werden allein der
Kautschukgewinnung wegen auf weite Strecken hinauf mit Dampfern
befahren. Der hohe, schlanke Baum erreicht eine freie Stammhöhe
bis zu 15 m und trägt dann eine lockere, luftige Krone von
langgestielten, dreizähligen Blättern, kleinen, unscheinbaren,
rispig angeordneten, teils männlichen, teils weiblichen Blüten und
dreifächerigen Kapseln, deren Fächer mit zwei Klappen aufspringen und
je einen großen, länglichen, gescheckten Samen enthalten. Letzterer
enthält ein dem Leinöl ähnliches fettes Öl und wie die Blätter Aceton
und Blausäure. Beim Aufspringen der Kapseln wird der Samen eine Strecke
weit fortgeschleudert und so durch den Urwald verbreitet. Mit diesem
verwandte Heveaarten wachsen in Guiana und weiter südlich bis zum Rio
Negro, der sich bei der Stadt Manaos in den Amazonenstrom ergießt,
dann in Venezuela am Orinoko und seinen Zuflüssen bis zu den Anden
von Peru und Bolivia. Sie bilden keine kompakten Wälder, sondern
wachsen zerstreut zwischen anderen Bäumen, so daß man nur selten
zwei oder drei Heveabäume nebeneinander findet. Sie[S. 168] sind auf die
Niederungen beschränkt, in denen ein heißes, feuchtes Klima herrscht
und eine ausgeprägte Regenzeit sich einstellt, infolge deren ihr
Besiedelungsgebiet regelmäßig alle Jahre einmal überschwemmt wird.
Infolge unausgesetzter, rücksichtsloser Ausbeutung sind die
Kautschukbäume in den zugänglicheren Partien der Flußläufe vielfach
ausgerottet worden; doch ist das Gebiet, in dem sie wachsen, so groß,
daß gleichwohl noch keine Erschöpfung der Produktion eingetreten
ist, obschon das Amazonasgebiet allein jährlich bis 30 Millionen
kg Parákautschuk, so genannt, weil er über Pará ausgeführt
wird, produziert. Immerhin ist es auffallend, daß trotz der enormen
Bedeutung des Kautschuks für das Amazonasgebiet der Baum in seiner
Heimat kaum irgendwo kultiviert wird. Die wildwachsenden Bäume
werden von den nach den flaschenartigen, als seringas, d. h.
Spritzen, bezeichneten Rohformen des Kautschuks seringeros genannten
Kautschuksammlern in der Weise angezapft, daß mit einem kleinen Beile
Vförmige Einschnitte in die Rinde geschlagen werden, unter
deren Verbindungsstelle kleine Blechbecher angebracht werden, deren
Seiten mit Ton verschmiert sind, damit nichts von dem reichlich aus den
Wunden hervorquellenden Milchsaft daneben fließe und so verloren gehe.
Jeder Einschnitt liefert innerhalb 1–3 Stunden durchschnittlich
30 ccm Milchsaft. Die Schnitte, die nur ganz oberflächlich geführt
sein dürfen, damit der Holzkörper nicht verletzt werde, da sich sonst
leicht Bohrkäfer in die betreffenden Wunden einnisten, werden von unten
nach oben fortschreitend in Horizontalreihen angebracht. Dabei erträgt
ein Baum von 1,25–2,5 m Stammumfang sehr gut 10–20 Einschnitte
alle 2 oder 3 Tage, bis er endlich erschöpft ist und eine weitere
Milchsaftabsonderung unterbleibt.
Tafel 107.
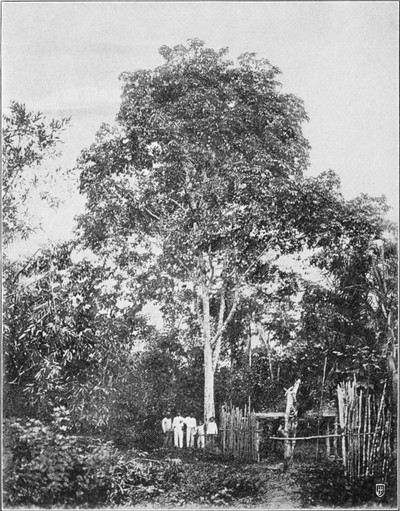
Kautschukbäume (Hevea brasiliensis) in Manaos am Amazonenstrom
in Brasilien.

Das Einschneiden solcher zur Gewinnung des Kautschuksaftes.
Tafel 108.

Das Anzapfen von Kautschukbäumen (Hevea brasiliensis)
vermittelst Spiralschnitt auf einer Plantage Ceylons.

Das Räuchern des vom Kautschukbaum gewonnenen
Kautschuks.
Die der Kuhmilch ähnliche, trinkbare, nur etwas nach Ammoniak
riechende Flüssigkeit wird dann aus den Blechbechern in ein größeres
Gefäß gegossen und zur Beschleunigung der Gerinnung geräuchert. Man
bringt zu diesem Zwecke die steinharten Früchte der sogenannten
Shevonpalme (Attalea excelsa) oder Paránüsse, oder solche
von Maximiliana regia und Euterpe edulis zum Glühen,
was einen starken, ölhaltigen Rauch erzeugt. Dieser letztere wird
dadurch zusammengehalten, daß man ein krugartiges, irdenes Gefäß
mit enger Mündung darüber aufstellt. Der Seringero gießt nun mit
einer Kürbisschale etwas vom dicklichen Milchsaft über ein Holz mit
spatenähnlich verbreitertem Ende, läßt den Überschuß desselben in
die darunter gestellte große Blechschale abtropfen und hält dann den
hängengebliebenen Teil[S. 169] in den weißen Qualm, wobei er den Stock in
fortwährender Drehung erhält. Durch die Wärme des Feuers und die bei
der Verbrennung entstehenden kreosotartigen Bestandteile des Rauches
nimmt die Milch in kaum 15 Minuten eine gelbe Farbe an und wird fest.
Hierauf wird dasselbe Verfahren wiederholt und eine Schicht legt sich
über die andere, bis man einen Klumpen von der Größe einer Kegelkugel
erlangt hat, der etwa 15 kg wiegt. Dieser wird dann, nachdem
er eine Nacht hindurch getrocknet hat, aufgeschnitten und vom Holze
heruntergestreift, das zu dessen leichteren Lösung vorher mit einer
dünnen Tonschicht bestrichen wurde, und kommt als seringa in den
Handel. Er zeigt auf dem Querschnitt eine deutliche Schichtung, ist
außen braun bis braunschwarz, aber schon in einer Tiefe von 1 cm
bernsteingelb. Aus dem Reste des Milchsaftes, der in den Gefäßen haften
bleibt und deshalb nicht zu Kugeln verarbeitet werden kann, stellt man
kleine, formlose Stücke her, die unter dem Namen barrocha oder
sernamby de seringa in den Handel kommen, aber nur zwei Drittel
vom Preise des Kugelfeingummis erzielen. Dieser sogenannte Speckgummi,
an dem man noch an der verschiedenen Farbe die einzelnen Schichten
erkennen kann, ist äußerst elastisch und fest und übertrifft alle
anderen Sorten des Kautschuks bei weitem an Güte.
Eine geringere Sorte ist der caucho (sprich kautscho), der
in der Weise gewonnen wird, daß man die Bäume fällt und ihnen durch
angebrachte Einschnitte den Milchsaft entzieht, den man in einem vorher
fertiggestellten Erdloch oder in einem ausgehöhlten Holzklotz sammelt.
Hierauf löst man in einer Blechschüssel ein Stück Seife auf, mischt das
Seifenwasser mit dem zerstampften Kraut der Betilla nigra, einer
dort überall vorkommenden Pflanze, und vermengt diese Mischung mit der
Kautschukmilch, die sehr bald fest wird. So entsteht eine Art Block,
den man mehrere Monate liegen läßt, bis das darin befindliche Wasser
zum größten Teil verdunstet ist. Die Herstellung von caucho auf
die beschriebene Weise wird weniger in Brasilien als in Peru betrieben.
Seine Ausfuhr geht meist über die Anden nach Bolivia, wohin neuerdings
auch der feinere Parágummi des hohen Ausgangszolles wegen, womit
ihn Brasilien belastet, vielfach transportiert wird, um ihn aus den
Hafenplätzen der Westküste Südamerikas zu exportieren.
Wegen der großen Bedeutung des von ihnen gewonnenen Kautschuks hat man
die Heveabäume, deren höchste Ertragsfähigkeit, nebenbei bemerkt, erst
mit dem 24. Jahre beginnt, auch anderwärts in den Tropen angepflanzt,
so besonders auf Ceylon, Malakka und Java in[S. 170] über zehn Millionen
Exemplaren. Es gelang auch, sie dort vollkommen einzubürgern, aber
überall da, wo der Boden nicht recht naß gehalten werden konnte, war
der Ertrag an Milchsaft ein so überraschend geringer, daß die mit
großen Hoffnungen auf reichen Gewinn unternommenen Kulturen wieder
aufgegeben wurden; die Bäume wurden gefällt und an ihrer Stelle
pflanzte man andere Nutzpflanzen an. Da man auch in Südamerika nur im
Überschwemmungsgebiet des Amazonenstroms reichlich guten Kautschuk
gewinnt und sich mit der weiteren Entfernung von diesem nicht nur
die Menge, sondern auch die Güte desselben verringert, obgleich die
Bäume selbst vorzüglich gedeihen, so hätte dieser Umstand schon einen
Fingerzeig dafür geben sollen, daß die Heveaarten eine ganz besondere
Empfindlichkeit gegen Standort und Klima aufweisen, also nur da mit
Erfolg angesiedelt werden können, wo regelmäßige Überschwemmungen den
Boden sehr stark durchtränken. Von den deutschen Kolonien würde daher
besonders das Küstengebiet von Kamerun mit seinen vielen Flußarmen und
feuchten Niederungen einige Aussicht auf erfolgreiche Kautschukkultur
mit Heveaarten darbieten.
Nun hat man glücklicherweise außer diesen auch weniger anspruchsvolle
Kautschukpflanzen kennen gelernt, unter welchen an erster Stelle
die ebenfalls Nordostbrasilien angehörende Euphorbiazee Manihot
glaziovii, ein 8–15 m hoher Baum mit rötlichgrauer Rinde,
von der sich silberweiße Querstreifen in derselben Weise wie bei der
Birke ablösen, langgestielten, fingerförmig geteilten Blättern und
unansehnlichen, gelbroten Blüten, von denen männliche und weibliche
an denselben Blütenständen sitzen, zu nennen ist. Die Frucht ist eine
2–3 cm große, fast kugelige dreifächerige Kapsel, die mit
drei Längsschlitzen aufspringt und in jedem Fach einen gescheckten,
sehr hartschaligen Samen besitzt. Die Pflanze enthält in fast allen
Teilen, den Milchsaft ausgenommen, Blausäure. Sie ist in der Provinz
Ceara heimisch und wird deshalb auch Ceara-Kautschukbaum
genannt. Sie bildet einen wichtigen Bestandteil der Certâoflora
von Nordostbrasilien, einer den Stein- und Sandsteppen ähnlichen
Formation, und wird ebenfalls neuerdings zu kultivieren begonnen. Sie
läßt sich sehr leicht aus Samen und Stecklingen erziehen und wächst
außerordentlich rasch. Diese guten Eigenschaften zeigten sich auch bei
ihrer Überführung nach den Tropenländern der Alten Welt. Überall wo
man den Baum anpflanzte, auf Ceylon, in Vorder- und Hinterindien, auf
Java, in Ost- und Westafrika, gedieh er auch auf ganz geringwertigem
Boden vortrefflich bis zu einer[S. 171] Meereshöhe von 1000 m, gab
aber eine so geringe und minderwertige Ausbeute an Kautschuk, daß
man an allen Orten mit feuchtem tropischen Klima seinen Anbau wieder
aufgab. Nur in Gegenden mit einer halbjährigen Trockenzeit liefert er
einigermaßen Milchsaft zur Kautschukgewinnung. Schon nach vier Jahren
kann er angezapft werden und liefert dann, wenn dies behutsam, ohne
grobe Verletzung des Holzes geschieht, eine Reihe von Jahren hindurch
das Material zum sogenannten Cearakautschuk, dessen Marktpreis 6,50–7
Mark pro kg beträgt. Noch besser ist es aber, mit dem Anzapfen
zu warten, bis der Baum 6–7 Jahre alt geworden ist, da er dann mehr
aushält. Als 8–9jährig liefert er dann bei insgesamt 24 Anzapfungen im
Jahre höchstens 6 kg Kautschuk, der aber geringwertiger als der
echte Parákautschuk ist. Die Gerinnung seines Milchsaftes wird durch
Hinzugießen von Alaunlösung, neuerdings auch mit Zitronensaft oder
einer billigeren Säure bewirkt. Gegenwärtig wird dieser Kautschukbaum
im trockenen, steinigen Gelände von Deutsch-Ostafrika im großen
angebaut, doch sind die meisten der Bäume dort noch nicht alt genug, um
ertragsfähig zu sein.
Ebenfalls in Nordostbrasilien heimisch und sehr anspruchslos an
Boden und Klima ist der 5–7 m hohe Mangabeirabaum
(Hancornia speciosa) aus der Familie der Apocynazeen mit schlaff
herabhängenden Ästen, ziemlich großen Blüten und einer pflaumengroßen,
gelben, rotgestreiften, beerenartigen Frucht. Sie ist in ihrer Heimat
als manguba allgemein bekannt und wird hoch geschätzt, da der
Fruchtbrei, in welchem die Samen liegen, sehr angenehm süß-säuerlich
schmeckt und deshalb gerne gegessen wird. Der Baum wächst in den
trockenen Gegenden Brasiliens von Rio de Janeiro bis Pernambuco,
besonders in den Campos cerrados den Provinzen Bahia und
Pernambuco, geht südlich bis S. Paulo und westwärts durch Matto Grosso
bis zu den Grenzen Perus. Die gelernten Kautschuksammler zapfen zwar
nur erntereiche Bäume sachgemäß an, die herumziehenden Sammler aber
haben arg gehaust und die Bestände stark gelichtet. Der Staat S. Paulo
hat daher zum Schutz und zur Aufmunterung der Anpflanzung dieser
Bäume ein Gesetz erlassen, das weiteste Beachtung verdient. Seine
Genügsamkeit in Verbindung mit früher Ergiebigkeit und verhältnismäßig
hoher Ernte lassen ihn für die trockenen Gebiete von Deutsch-Ostafrika
und des Hinterlandes von Westafrika geeignet erscheinen; jedenfalls
dürfte er bessere Resultate geben als die anderen bisher genannten
Kautschuklieferanten.
[S. 172]
Ein Baumriese des mittel- und südamerikanischen Urwaldes ist die
den Maulbeer- und Feigenbäumen verwandte Castilloa elastica.
Einzelne Exemplare des Baumes sollen bis 50 m hoch werden,
seine durchschnittliche Höhe ist aber 20–30 m. Die länglich
herzförmigen, hellgrünen Blätter werden bis 30 cm lang und
18 cm breit. Die achselständigen Blütenstände weisen einzelne
weibliche und gehäufte männliche Blüten auf, aus welch ersteren
3–5 cm breite, flache Früchte mit zahlreichen Einzelfrüchten
hervorgehen. Eigentümlich ist, daß der Baum zwei Arten von Zweigen
besitzt, von denen die einen, in der Jugend gebildeten, später
abgeworfen werden. Der Baum wächst vom südlichen Mexiko bis Ecuador
und dem nördlichen Peru, meist in Wäldern, aber auch auf den
Grasflächen. Da nun die wilden Bestände durch den rücksichtslosen
Raubbau, der beim Abzapfen des Milchsaftes meist getrieben wird, sich
schon bedenklich vermindert haben, pflanzte man den Baum zuerst in
Westindien und Zentralamerika, dann auch an zahlreichen anderen Orten
der Tropen plantagenmäßig an. Er ist nämlich eine der sichersten und
ergiebigsten Kautschukpflanzen und läßt sich überall da kultivieren,
wo der Anbau von Kakao mit Erfolg betrieben werden kann. Da er dabei
in betreff des Bodens nicht zu wählerisch ist und eine 3–4monatliche
Trockenzeit verträgt, so sind Aussichten auf erfolgreiche Kultur
in vielen Tropenländern vorhanden. Allerdings stehen angepflanzte
Bäume in bezug auf die Menge und Beschaffenheit des Milchsaftes
wildwachsenden nach, doch wird wohl diesem Übelstande bei mehr
Erfahrung in der Pflege einigermaßen abgeholfen werden können. Auch
sind die Versuche, den Baum als Schattenbaum für Kakao und Kaffee zu
verwenden, beachtenswert. In den deutschen Kolonien scheint er in dem
feuchtwarmen Küstenklima von Kamerun, Samoa und Neuguinea fortzukommen.
In Kamerun haben allerdings die Kulturen unter einem Bohrkäfer stark
zu leiden; auf Neuguinea lieferten dagegen die ersten Anzapfungen
recht befriedigende Ergebnisse. Die Gerinnung des Milchsaftes wird in
der Heimat dieses Kautschukbaumes meist durch Hinzufügen von Saft der
zerquetschten Ipomaea bona nox, eines sehr häufigen Unkrautes
aus der Familie der Windengewächse, hervorgerufen. Die von den
gewissenlosen Kautschuksammlern vielfach geübte, weil bequemste Art der
Kautschukgewinnung besteht auch hier darin, daß die Bäume kurz über der
Wurzel gefällt werden. Dabei gewinnt der Sammler eine fünfmal so große
Menge Saft als durch das schonende Anzapfen, das den Baum erhält und
eine spätere regelmäßige Wiederholung des Anschneidens möglich macht.
[S. 173]
Der größte Teil des aus Kolumbien kommenden Kautschuks wird von
einem andern hohen Waldbaum aus der Familie der Euphorbiazeen oder
Wolfsmilchgewächse mit gestielten lanzettlichen Blättern, einfachen
Blütenähren und von Fruchtfleisch umgebenen kugeligen Samen, Sapium
verum, gewonnen, der vornehmlich in Höhen von 2–3000 m
wächst. Auch andere Arten derselben Gattung, die in niederen Regionen
heimisch sind, geben guten Kautschuk, während es zweifelhaft ist,
ob Sapium biglandulosum in Mittel- und Südamerika, von der
man zuerst die Herkunft des kolumbischen Kautschuks ableiten wollte,
überhaupt ein brauchbares Produkt liefert.
Nächst Südamerika ist Afrika das an Kautschukpflanzen reichste Land,
dessen Kautschukerzeugung in den letzten Jahren, zusammen mit der
wirtschaftlichen Erschließung des Erdteils überhaupt, einen bedeutenden
Aufschwung genommen hat. Unter diesen sind die verschiedenen
Landolphia-Arten die weitaus wichtigsten. Es sind dies Schlinggewächse
aus der Familie der Apocynazeen oder Hundsgiftgewächse mit holzigem
Stengel, die sich vermittels Ranken an benachbarte Sträucher oder Bäume
klammern und an diesen bis in die höchsten Baumwipfel emporklettern.
Sie haben 10 und mehr cm lange, eiförmige Blätter, große, bis
3,5 cm lange trichterförmige Blüten mit aufrechten Zipfeln
in dichten Blütenständen und kleinen Orangen gleichende, gelbe oder
rote Beerenfrüchte, in deren gelbem, säuerlichem Fruchtfleisch die
großen vieleckigen Samen eingebettet sind. Diese Früchte bilden
eine Lieblingsspeise der Affen, werden aber auch vom Menschen gerne
gegessen. Diese Landolphia-Arten, von denen jetzt 14 als gute
Kautschuklieferanten bekannt geworden sind, kommen hauptsächlich in
den Urwäldern West- und Mittelafrikas sehr verbreitet vor und bilden
durch den aus ihnen gewonnenen Kautschuk den Reichtum, aber auch,
wie man es durch die Mißwirtschaft im Kongostaat genugsam erfahren
hat, zugleich, wie früher das weiße und schwarze Elfenbein, den Fluch
des Landes. Manche Arten sind aber schon so weit vermindert, ja fast
ausgerottet worden, daß man sich neuerdings dazu bequemen mußte, sie
auch anzubauen, was allerdings seine Schwierigkeiten hat.
Der Kautschuk wird in der Weise aus ihnen gewonnen, daß man die
dickeren Triebe der Lianen anschneidet, worauf der Saft ausfließt und
mitunter schon an der Luft gerinnt. In den einzelnen Gegenden bedient
man sich verschiedener Mittel, um ihn zum Gerinnen zu bringen; meist
aber wird der saure Saft der Früchte derselben Schlingsträucher dazu
verwendet. Schließlich formt man aus ihm kopfgroße Klumpen, die dann
als solche in den Handel gelangen. Bei der Ge[S. 174]winnung des Kautschuks
verfahren die Neger sehr unvernünftig, indem sie sich nicht die Mühe
nehmen, die Liane anzuschneiden, sondern sie hauen sie einfach kurz
über dem Erdboden ab und fangen den auslaufenden Saft auf. Dies ist
natürlich die bequemste Art der Gewinnung desselben, die auch eine
einmalige größere Ausbeute als das Anzapfen liefert; aber dabei
geht die Pflanze zugrunde, und bei der großen Nachfrage und den
hohen Preisen des Kautschuks liegt die Gefahr nahe, daß durch diesen
Raubbau die ganzen Bestände an Kautschuklianen vernichtet werden. Die
Kolonialregierungen suchen deshalb durch Belehrung der Schwarzen und
Gesetze dieses verhängnisvolle Raubsystem möglichst einzuschränken und
die Eingeborenen zu einer vernünftigen Behandlung der so wertvollen
Kautschuklianen anzuleiten.
Den Landolphien nahe verwandt sind die Clitandra-Arten, ebenfalls in
den Urwäldern der afrikanischen Tropen wachsende Klettergewächse,
die man bis jetzt am häufigsten im Kongobecken und in Kamerun
angetroffen hat. Erst in jüngster Zeit hat man ihren hohen Wert für
die Kautschukgewinnung erkannt, und sie nehmen heute schon in dieser
Industrie eine bedeutende Stellung ein. Der Milchsaft ist bei ihnen
außerordentlich reichlich vorhanden, und zwar in derselben Güte wie
bei den besseren Landolphia-Arten, wird auch in derselben Weise
wie bei jenen gewonnen. In Togo und Kamerun werden versuchsweise
neben den Landolphia- auch Clitandra-Arten auf einigen europäischen
Pflanzungen angebaut. Von niederen, strauchartigen Apocynazeen
derselben Gattung und von mehreren Carpodinus-Arten, die an mehr
trockenen Stellen Westafrikas gefunden werden, gewinnt man den in
den fingerdicken, weithin verästelten Rhizomen in verhältnismäßig
großer Menge abgelagerten Kautschuk, der als Wurzelkautschuk
aus dem nördlichen Kongogebiet und Angola in den Handel kommt.
Zur Gewinnung desselben werden die Wurzelstöcke der krautigen,
schmalblätterigen, etwa meterhohen Pflanzen zerschnitten, einige Tage
der Sonne ausgesetzt, dann gegen zehn Tage in Wasser gelegt, hierauf
mit Holzlatten geschlagen und schließlich gekocht. Das dabei gewonnene
Produkt, dem von den Eingeborenen gewöhnlich Würfelform gegeben wird,
ist sehr minderwertig und enthält oft bis zur Hälfte des Gewichts
Rinden- und Holzstücke. In Ostafrika und Madagaskar liefert eine andere
Apocynazee, Mascarenhasia elastica, die vielfach an sumpfigen
Bachufern wächst, einen Kautschuk mittelmäßiger Qualität, der meist mit
Landolphiakautschuk vermischt in den Handel kommt.
Als weit besserer Kautschuklieferant als diese genannten afrika[S. 175]nischen
Arten wächst in denselben Gegenden Westafrikas von der Goldküste bis
zum Kongo ein ebenfalls in die Familie der Apocynazeen gehörender
30 m hoher Baum, Kickxia elastica, mit grauer Rinde,
lanzettlichen, lang zugespitzten, lederartigen, dunkelgrünen Blättern
und gelblichen Blüten in dichten Trugdolden. Aus ihnen gehen die
aus zwei Kapseln bestehenden, zahlreiche Samen enthaltenden,
15–20 cm langen Früchte hervor. Dieser Baum ist erst in neuerer
Zeit als Kautschuklieferant entdeckt worden. Im Jahre 1894 brachten
eingeborene Händler aus dem Lagosgebiet eine bis dahin unbekannte
Kautschuksorte zum Verkauf an die Küstenplätze. Bei näherer
Untersuchung erwies sich das neue Produkt als sehr wertvoll; es wurde
gern gekauft, gut bezahlt und infolgedessen bald in großen Mengen von
den Eingeborenen auf den Markt gebracht. Lange kannte man die Pflanze
nicht, die diesen Kautschuk lieferte, bis im Jahre 1898 der Deutsche
Dr. Paul Preuß am Mungofluß in Kamerun die Pflanze entdeckte und
Kickxia elastica benannte. Von den Franzosen und Engländern wird
sie aber nach einem auf der Goldküste einheimischen Namen gewöhnlich
Funtumia elastica genannt. Der Baum ist sehr reich an stark
kautschukhaltigem Milchsaft, der in zweierlei Weise gewonnen wird. Bei
der ersten klettert der Eingeborene auf den Baum und schneidet von der
Krone bis fast auf den Erdboden eine Rinne in die Rinde des Baumes, in
welche in bestimmten Abständen schräglaufende Seitenrinnen einmünden.
Der ausrinnende Milchsaft wird in einem Topf am Boden aufgefangen und
nach dem Gerinnen zu Ballen geformt. Wird dieses Anzapfen vorsichtig
gemacht, ohne daß man durch die Rinde hindurch in den Holzkörper
einschneidet, so wächst der Baum weiter und kann im folgenden Jahre
wieder angezapft werden. Bei der zweiten, allerdings bequemeren Methode
wird der Baum gefällt und der aus ihm herauslaufende Saft gewonnen. Da
durch diesen von den Schwarzen mit Vorliebe geübten Raubbau schon große
Kickxiabestände vernichtet wurden, so daß ein erheblicher Rückgang der
Kautschukgewinnung in den nächsten Jahren zu befürchten ist, hat man
auch diesen Baum neuerdings in Plantagenkultur genommen. So finden sich
heute in Kamerun und auf Neuguinea große, in Togo und Ostafrika kleine
Anpflanzungen des Kickxiabaumes, dessen Kautschuk an Wert dem echten
Parákautschuk nur wenig nachsteht. Da die Nachfrage nach ihm steigt,
wird er neuerdings in größerem Maße auch im Kongostaat angepflanzt,
weil er bedeutend schneller wächst und ertragsfähig wird als die
Kautschuklianen, welch letztere durch die ge[S. 176]wissenlose Raubwirtschaft
der die Neger dazu mißbrauchenden Beamten schon bedenklich dezimiert
sind. Während die ersten Anzapfungen der Kickxia elastica
bereits nach 6–7 Jahren ohne irgend welchen nennenswerten Schaden für
die Weiterentwicklung des Baumes vorgenommen werden können, tritt
eine Verwertungsmöglichkeit der Lianen erst nach 20 Jahren ein. Man
kommt daher vom Anbau der Lianen mehr und mehr zurück und pflanzt
sie nur noch dort, wo die Kickxia elastica nicht fortkommen
will. Der Milchsaft der Kickxia africana dagegen, auf den
man wiederholt von England aus aufmerksam gemacht hat, ist nach
eingehenden Untersuchungen von Dr. Traun, einer Autorität in der
Kautschukindustrie, ein für die Technik völlig unbrauchbarer Rohstoff,
der, gutem Kautschuk beigemischt, denselben nur entwertet. Es muß daher
vor seiner Verwendung sehr gewarnt werden.
Ein in ganz Westafrika von Senegambien bis an den Kongo vorkommender
Kautschukbaum ist auch Ficus vogelii aus der Familie der
Morazeen oder Maulbeerbaumgewächse. Er besitzt auf stattlichem Stamm
eine breit ausladende Krone von dunkelgrünen, stark glänzenden, großen
Blättern, deretwegen er von den Eingeborenen gern als willkommener
Schattenspender auf Dorfplätzen angepflanzt wird. Seine haselnußgroßen,
runden, grünen Früchte bilden eine gesuchte Speise der Vögel und Affen.
Der durch Einschnitte aus ihm gewonnene Milchsaft liefert einen nicht
gerade hervorragenden, aber doch gut verkäuflichen Kautschuk, der
besonders gern mit besseren Sorten gemischt in den Handel gebracht
wird. Deshalb hat man neuerdings in Kamerun begonnen, den Baum in
Kultur zu nehmen.
Tafel 109.

Ein der Kautschukgewinnung dienender indischer Gummibaum (Ficus
elastica) mit zahlreichen Luftwurzeln auf Sumatra.
❏
GRÖSSERES BILD
Tafel 110.

Allee in einer Anpflanzung von
Kixia elastica in Westafrika.

Mit Spiralschnitt versehene
Castilloa elastica in Stephansort auf Neuguinea.
Tafel 111.

Blick in eine Gummiwarenfabrik (A.-G. Metzeler &
Cie. in München).
❏
GRÖSSERES BILD
Tafel 112.
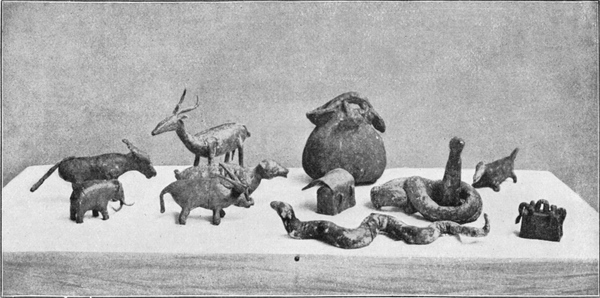
Figürchen aus roher Guttapercha, wie sie von den
Eingeborenen von Brasilien geknetet werden.

Eine Pflanzung von Guttaperchabäumen
(Isonandra gutta) auf Java.
Größere Bedeutung als er hatte bis jetzt sein südostasiatischer
Verwandter, die auch bei uns als Zierpflanze gehaltene und unter dem
Namen Gummibaum allgemein bekannte Ficus elastica, die in ihrer
Heimat als die dort beste Kautschukpflanze kultiviert wird. Sie ist
ein riesiger, bis 60 m hoher Baum, der in der Jugend meist
als Überpflanze auf anderen Bäumen wächst, wohin seine Samen durch
die Vögel und Affen verbracht werden. Später wird er ein Baumwürger
und schließlich erst ein selbständiger Baum mit stark zerklüftetem
Stamm, der von zahlreichen stammartigen Luftwurzeln gestützt wird.
Diese Luftwurzeln erreichen oft die Länge von 25 m bei
1,5 m Umfang. Die Zweigenden sind mit tütenförmig eingerollten,
schön roten oder weißen Nebenblättern bedeckt, die nach dem Abfallen
eine Ringnarbe hinterlassen. Die Blätter sind an den Bäumen bedeutend
kleiner als bei[S. 177] den als Zimmerpflanzen gehaltenen Exemplaren.
Männliche, weibliche und Gallenblüten bedecken die Innenseite der
Feigen, die gereift gelbgrün und ziemlich fleischig werden. Der Baum
wächst vom östlichen Himalaja, von Sikkim über Assam durch das ganze
westliche gebirgige Hinterindien, über Malakka und Sumatra bis Java
und Borneo. Er bevorzugt den unteren Bergwald, steigt aber im Himalaja
bis 1600 m hoch. Nirgends bildet er Wälder; er findet sich
vielmehr zerstreut im Urwald, und in den kautschukreicheren Wäldern
wachsen auf 1 Hektar nicht mehr als 1–2 Gummibäume. Seit einigen
Jahrzehnten hat man in Assam, auf Java, Sumatra und Borneo, in neuerer
Zeit mit bestem Erfolg auch auf Neuguinea, in Togo, Kamerun und
Ostafrika Pflanzungen des Baumes angelegt, da infolge des Raubbaues die
Produktion des Kautschuks aus wildwachsenden Bäumen stetig abnimmt und
trotz den Bemühungen der Forstverwaltungen ein Schutz der Bäume schwer
durchführbar ist. Ein ungünstiger Umstand für die Rentabilität solcher
Pflanzungen ist die beträchtliche Anzahl von Jahren, die vergehen
müssen, ehe man den Milchsaft in genügender Menge gewinnen kann. Die
Anzapfung der Bäume geschieht wie bei den anderen Arten, indem man mit
starken Messern oder Äxten Einschnitte in die Rinde macht, aus denen
dann meist der geronnene Milchsaft herausgekratzt wird. Ein großer Baum
mit einer Laubkrone von 45–50 m liefert bei einem einmaligen
Anzapfen mehr als 2 kg Kautschuk, und diese Menge vermag er 40
und mehr Jahre hindurch jährlich zu geben. Das Produkt ist infolge
von Verunreinigung häufig schwarz und klebrig und hat im Vergleich
zum Parákautschuk einen geringen Wert, ist aber doch für mancherlei
Erzeugnisse zu gebrauchen. Die Vermehrung des Baumes erfolgt fast stets
durch etwa 1 m lange Stecklinge, die, in die Erde gesteckt, sich
sehr schnell bewurzeln und rasch zu jungen Pflanzen heranwachsen, doch
müssen sie ungefähr 15 m auseinander gepflanzt werden, weil sie
später mächtige Kronen entwickeln und ihre weitausladenden Äste mit
Luftwurzeln stützen.
Weiter sind noch Willoughbya coriacea und andere Arten der
Gattung zu nennen, die als große, relativ dickstämmige Lianen des
Urwaldes Hinterindien und den malaiischen Archipel bewohnen und
zur Gewinnung von Kautschuk angezapft werden. Sie haben ebenfalls
lanzettliche, lederartige Blätter, dagegen achselständige Blüten mit
flacher Blumenkrone in Rispen, aus denen große, innen saftige, kugelige
Beeren mit harter Schale und schmackhaftem Fruchtfleisch hervorgehen.
Sie winden sich vermittelst langer, fadenförmiger Ranken an Bäumen[S. 178]
empor, sind aber niemals in Masse an einem Orte zu finden, was die
Ausbeutung erschwert. Der größte Teil des von Borneo ausgeführten
Kautschuks stammt von diesen Lianen. Auf Neuguinea gewinnen die
Eingeborenen aus Ficus rigo, einem 15 m hohen Baum, einen
guten Kautschuk. Da aber der Baum sich nur auf einem beschränkten
Gebiet findet und von den Eingeborenen sehr unvernünftig behandelt
wird, so dürfte er bald ausgerottet sein, wenn man ihn nicht vorher in
Kultur nimmt. Nach seinen Eigenschaften verdient er ernste Beachtung
für Kaiser-Wilhelms-Land.
Endlich sind in neuester Zeit noch zwei Kautschukproduzenten in Kultur
genommen worden, die es verdienen kurz genannt zu werden. Der eine
ist die in Venezuela und Guiana heimische Kautschukmistel,
ein Schmarotzergewächs gleich unserer Mistel, die unter anderem
auch auf dem Kaffeebaum gedeiht und sich daher dazu eignet, solche
Kaffeeplantagen, die aus irgend einem Grunde nicht mehr recht
ertragsfähig sind, wieder ertragsfähig zu machen. Der Kautschuk wird
aus den alljährlich erzeugten Früchten gewonnen. Die andere ist
eine den Guayulekautschuk liefernde Komposite Mexikos, die
sich zum Anbau in trockenen Gebieten eignet. Sie bildet niedrige
Halbsträucher, die abgeschnitten werden müssen, um einen Ertrag zu
liefern. Doch ist ihr Anbau bis jetzt, so lange man andere ergiebigere
Kautschuklieferanten besitzt, ein sehr beschränkter.
Im allgemeinen hat die Kautschukproduktion in neuester Zeit nicht in
dem Maße zugenommen, wie es beim immer steigenden Bedarfe für die
Industrie wünschenswert gewesen wäre; Asien nimmt darin im Durchschnitt
eher ab als zu, Afrika erhält sich knapp auf der erreichten Höhe und
selbst das Amazonengebiet scheint den Höhepunkt überschritten zu
haben. Nun darf man allerdings damit rechnen, daß noch manche wichtige
Kautschukpflanzen entdeckt werden, daß die zum Teil recht rohe Art der
Gewinnung verbessert wird, daß es gelingen dürfte, die Ergiebigkeit zu
steigern und auch aus bisher wenig beachteten Pflanzen guten Kautschuk
zu gewinnen. Am meisten ist aber von der Ausbildung der Kulturen in
großem Maßstab zu erwarten. Es müssen für die einzelnen Länder und
Standorte die geeignetsten Kautschukpflanzen ausfindig gemacht werden,
deren Milchsaft wenn immer möglich mit Zuhilfenahme von maschinellen
Einrichtungen zu verarbeiten wäre, was die Qualität des Rohproduktes
bedeutend verbessern würde.
Aus einem im April 1910 in der Times erschienenen Aufsatz:[S. 179] Rubber
developments in 1910 entnehmen wir, daß die Vereinigten Staaten
den größten Teil des aus Südamerika auf den Markt gebrachten
Kautschuks konsumieren. Im Jahre 1909 belief sich die Produktion an
wildgewachsenem Kautschuk auf 64 Millionen kg; davon entfielen
auf Brasilien 38 Millionen kg. Man könnte annehmen, daß die
fortwährende und enorme Preissteigerung dieses Handelsartikels
auch eine stetige Produktion desselben herbeiführen müßte. Aber
Brasilien dürfte am Ende seiner Leistungsfähigkeit angelangt sein.
Man wird kaum allzusehr fehl gehen, wenn man die Erzeugung von
Urwaldkautschuk in den nächsten Jahren auf 66–72 Millionen kg
berechnet; zählt man noch 27 Millionen kg aus Plantagen
hinzu, so gelangt man zu einer Gesamtproduktion von annähernd 100
Millionen kg. Vorläufig ist sie allerdings noch wohl imstande,
die Nachfrage zu decken; da aber diese weit rascher wächst als das
Angebot, so werden sich beide binnen kurzem die Wage halten. Deshalb
beginnen die großen Kautschukproduzenten ihr Augenmerk darauf zu
richten, wie die Kontinuität der Erzeugung erhalten oder gar eine
Vermehrung herbeigeführt werden könne. Es ist dies eine für die
Weltwirtschaft sehr wichtige Frage, die aber nicht in Afrika, sondern
der Hauptsache nach in der Neuen Welt gelöst werden muß. Nicht nur
ist der afrikanische Kautschuk qualitativ durchaus minderwertig,
sondern er ist durch die jahrzehntelang geübte Raubwirtschaft immer
seltener geworden. Von den 70 Millionen kg Kautschuk des
Jahres 1908 lieferte Afrika nur 14 Millionen kg und dieser
Ertrag hat seither nicht in erwähnenswerter Weise zugenommen,
wenn auch in jüngster Zeit englische Gesellschaften auf deutschem
Kolonialgebiet größere Landerwerbungen zum ausgesprochenen Zweck der
Kautschukgewinnung machten. Es ist geradezu ein Trost, zu vernehmen,
daß vor allem das Kongobecken, in welchem die unglückliche Bevölkerung
unter dem Zwang des vom hartherzigen Leopold II. eingeführten Systems
der Gummierzeugung beinahe zugrunde gerichtet wurde, schon jetzt fast
nicht mehr mitkonkurrieren kann. Denn wenn die Kautschukgewinnung
am Kongo auf die Dauer nicht mehr rentiert und preisgegeben werden
muß, so könnte noch derjenige Teil der schwarzen Bevölkerung, der den
Anforderungen der großen Kautschukproduktionsgesellschaften noch nicht
erlag, gerettet werden.
Auch in Brasilien fordert das ungesunde Klima der Urwälder
am Amazonenstrom, in denen der wichtigste und ertragreichste
Kautschuklieferant, die Hevea brasiliensis, die heute noch 60
Prozent der Ge[S. 180]samtproduktion liefert, wächst, zahlreiche Opfer, so
daß dadurch der Wert der wildwachsenden Bestände von Kautschukbäumen
beeinträchtigt wird. Deshalb beruht die Zukunft der Kautschukindustrie
durchaus auf den Anpflanzungen dieses Baumes, der schon im 5. Jahre
angezapft werden kann, während die Castilloa elastica dies
erst im 7. bis 9. Jahre zu tun gestattet und zudem einen geringeren
Ertrag liefert. Diese haben besonders in Malakka, auf Java, Sumatra
und Ceylon bereits eine große Ausdehnung erlangt und sind recht
einträglich, da der Plantagenkautschuk zurzeit besser als der wilde
brasilianische bezahlt wird. Wenn er auch reiner und sauberer als
dieser ist, kann sich gleichwohl dieses von nicht ausgewachsenen Bäumen
stammende Produkt an innerem Wert nicht mit dem von den wilden, oft
bis zu 30 Jahre alten brasilianischen Gummibäumen gewonnenen Erzeugnis
messen. Auch weist die in den asiatischen Plantagen gezüchtete Hevea
bereits eine gefährliche Krankheit auf, deren Ursache man noch nicht
recht auf die Spur gekommen ist. Man ist geneigt anzunehmen, daß das
südamerikanische Gewächs dem vulkanischen Boden von Java und Sumatra
sich nicht anzupassen vermag. Mit großen Opfern suchen die Pflanzer
nach einem Heilmittel dafür; denn ihre ganze Existenz hängt davon ab.
Zudem hat die indische Regierung vom Juni 1910 an alle Arbeitsverträge
der zahllosen aus Indien stammenden Kulis, die als Plantagenarbeiter
auf Kautschukpflanzungen des malaiischen Archipels verdingt sind,
aufgehoben, so daß bei der Schwierigkeit, aus der einheimischen
malaiischen Bevölkerung die nötigen Arbeitskräfte zu erhalten,
neue Heveaplantagen kaum angelegt werden können. Auch in Brasilien
und Peru, wo neuerdings eine englisch-französische Finanzgruppe an
den Ostabhängen der Anden in Gebieten, die für die Züchtung des
Guttaperchabaumes geradezu ideale Vorbedingungen aufweisen, große
Heveakulturen angelegt haben, bildet die Beschaffung der nötigen
Arbeitskräfte einen Gegenstand der Besorgnis, da auf die trägen und
sorglosen Eingeborenen nicht zu rechnen ist. Nun hat die japanische
Regierung die Überführung japanischer Arbeiter, die sich durch
Fleiß und Genügsamkeit auszeichnen, nach diesen südamerikanischen
Kautschukplantagen in großen Massen gestattet, so daß dadurch die für
alle Plantagen so wichtige Arbeiterfrage aufs beste gelöst zu sein
scheint. Wenn sich dann nur keine Rassenfrage mit der Zeit daraus
entwickelt. Schon in wenigen Jahren können aus diesen Heveakulturen
allfällige Ausfälle in der Ernte des brasilianischen wilden Kautschuks
gedeckt werden. Jedenfalls beruht die Entwicklung und Zu[S. 181]kunft der
modernen Kautschukindustrie in erster Linie in der sehr zukunftsreichen
südamerikanischen Kautschukproduktion aus der Hevea brasiliensis.
Dem Kautschuk sehr nahe verwandt ist die Guttapercha —
aus dem Malaiischen getah-pertcha, d. h. Milchsaft von
Sumatra, entstanden — die im malaiischen Archipel aus dem Milchsaft
einiger zur Familie der Sapotazeen gehörender Bäume gewonnen wird.
Merkwürdigerweise war der Gebrauch dieses Pflanzenproduktes zu allen
technischen Zwecken bei den Eingeborenen Malakkas und Indonesiens
lange nicht so verbreitet, wie derjenige des Kautschuks unter den
brasilianischen Indianerstämmen. Die Bekanntschaft der Kulturwelt mit
demselben ist noch ziemlich jungen Datums. Zwar waren schon im Jahre
1830 Muster dieses Harzes aus Singapur an die Asiatische Gesellschaft
nach London gesandt worden, sie fanden jedoch nicht die geringste
Beachtung. Diese wurde erst erregt, als im Jahre 1843 der Engländer
Montgomery dem Londoner Gewerbeverein Mitteilungen über diesen Stoff
machte, den er als Stiel einer von Eingeborenen benutzten Axt, der sich
im warmen Wasser erweichen und biegen ließ, kennen lernte. Kurze Zeit
darauf legte der Spanier Joze d’Almeida der Asiatischen Gesellschaft
in London eine Probe der Guttapercha vor; daraufhin gelangten
100 kg dieses Materials versuchsweise aus Singapur nach London.
Die ausgezeichneten Eigenschaften desselben riefen aber sehr schnell
eine bedeutende Nachfrage nach ihm hervor, so daß schon 1845
11000 kg nach England gebracht wurden. Die so schnell hervorgerufene
Nachfrage hatte zur Folge, daß die Gewinnung der Guttapercha, die
zunächst nur in den Sümpfen von Dschohor auf der Insel Singapur aus
dem Guttaperchabaum (Palaquium gutta) von Malaien und
Chinesen gesammelt wurde, bald gewaltige Dimensionen annahm. Aber
durch die dabei geübte rücksichtslose Raubwirtschaft, der ganze Wälder
des so wertvollen Baumes durch Umhauen zum Opfer fielen, wurde dieser
Guttaperchalieferant auch in der weiteren Umgebung von Singapur ganz
ausgerottet. Da sah sich die englische Guttaperchahandelsgesellschaft
gezwungen, einen rationellen Betrieb einzuführen und nur noch das
Anzapfen der Bäume wie beim Kautschuk zu dulden. An Stelle des
inzwischen gänzlich ausgerotteten Palaquium gutta, eines bis
20 m hohen dickstämmigen Baumes mit glänzenden, lederartigen
Blättern, gelben Blüten und Beerenfrüchten, von dem in den ersten vier
Jahren der Guttaperchagewinnung über 300000 Exemplare gefällt wurden,
traten andere Arten von Palaquium, sowie[S. 182] Payena leeri, welch
letztere aber einen leicht faserig werdenden Stoff, der auch weniger
elastisch ist, liefert. Ihr Milchsaft ist auch weißer als derjenige
der Palaquium-Arten. Um Getah zu sammeln, ziehen die Eingeborenen
Sumatras in Gruppen von 3–4 Personen in den Wald, meist in Begleitung
eines Mannes, der es versteht, die Geister der zu fällenden Bäume zu
beschwören. Haben sie solche gefunden, so werden sie gefällt, die
Stämme horizontal gelegt und vermittels eines breiten Messers in
Entfernungen von 30–50 cm auf der oberen Hälfte mit 2 cm
breiten, um ein Drittel des Umfangs herumlaufenden Einschnitten
versehen. Der hierbei herausfließende Saft wird nicht eingesammelt,
da er für minderwertig gilt. Die breiten Einschnitte füllen sich aber
bald mit einem dickeren Milchsaft, der alsbald mit einem hakenförmigen
Werkzeug so gründlich als möglich aus den Rinnen herausgekratzt
wird, wo er mit Rindenteilen und Holzsplittern vermischt zu Klumpen
gerinnt. Nach Hause zurückgekehrt werfen die Getahsammler die Klumpen
in Töpfe mit 70° C. heißem Wasser und kneten die schnell
erweichende Masse so lange mit den Händen durch, bis alle Rinden-
und Holzstücke entfernt sind, was aber selten vollständig gelingt.
Dann formt man die Masse zu kugeligen oder rechteckigen Stücken und
bringt sie zur Ausfuhr. Nach Burck liefert ein Baum von 40 cm
Stammumfang durchschnittlich 160 g Getah. In Borneo werden nach
demselben Gewährsmanne jährlich gegen 26 Millionen Bäume gefällt, um
den stets wachsenden Bedarf an Guttapercha zu decken. Es wäre dies
aber nicht nötig, wenn man den Milchsaft in ähnlicher Weise gewänne
wie den Kautschuk. Deshalb ist es erklärlich, daß die holländische
Regierung ihre Aufmerksamkeit diesem Vernichtungswerke zugewandt hat,
und da es sich undurchführbar erwies, das Einsammlungsverfahren der
Eingeborenen zu verbessern, so begann sie damit, an verschiedenen Orten
Kulturen von Guttaperchabäumen anzulegen, die recht gut gedeihen und
für später Erfolg versprechen. Die durch Einschnitte erhaltene rohe
Guttapercha, von den Malaien getah-muntah genannt, wird, bevor
sie nach Europa geschickt wird, mit Wasser und etwas Zitronensaft oder
Kokosnußöl gekocht, von Verunreinigungen befreit und in Formen von
10–20 kg gegossen.
Die Guttapercha des Handels ist in den besten Sorten fast weiß, sonst
rötlich, oft ziemlich dunkel und marmoriert, auf dem Schnitt heller;
sie fühlt sich fettig an und ist im Gegensatz zum Kautschuk bei
gewöhnlicher Temperatur nur biegsam und wenig dehnbar, aber nicht[S. 183]
elastisch. Sie wird aber bei 45° C. teigig, bei 65° weich und
knetbar, läßt sich dann zu dünnen Blättern auswalzen und in Formen
pressen, deren feinste Details sie nachher bewahrt. Bei 100° wird
sie klebrig und bei 150° schmilzt sie bei teilweiser Zersetzung.
Sie widersteht den meisten Lösungsmitteln und besteht aus 78–82
Prozent Gutta (C10H16)n und drei Oxydationsprodukten dieses
Kohlenwasserstoffes: Fluovil, Alban und dem sehr unbeständigen Guttan.
Außerdem enthält sie Gerbstoffe, Salze und zuckerähnliche Stoffe. An
der Luft und am Licht wird sie durch Sauerstoffaufnahme so verändert,
daß sie, die vorher ein Nichtleiter der Elektrizität war, ein guter
Leiter derselben wird. Man bewahrt sie deshalb am besten in Gruben
auf, die mit Wasser gefüllt und vom Licht abgeschlossen sind. Auch
im Erdboden hält sie sich sehr gut. So waren unterirdisch gelegte
Telegraphenkabel nach mehr als 25 Jahren noch völlig unverändert,
ebenso Seekabel, die in den Jahren 1850–69 gelegt worden waren. Gegen
Schwefel verhält sich Guttapercha ähnlich wie Kautschuk, nur läßt sie
sich schwieriger vulkanisieren. Ein Gemenge von 1 Teil Guttapercha
und 2 Teilen Kautschuk steht in bezug auf seine Eigenschaften in
der Mitte zwischen beiden Substanzen. Guttapercha wird technisch
zu den verschiedensten Gegenständen verwendet, bei denen es auf
Undurchdringlichkeit gegen Wasser, Widerstand gegen Alkohol, Laugen und
Säuren ankommt und keine höhere Temperatur mitwirkt. Am meisten findet
sie in der Elektrizität zur Isolierung der Leitungsdrähte in Kabeln
usw. Verwendung. Bei oberirdischen elektrischen Leitungen werden die
Drähte einfach mit dem dünn ausgewalzten Guttaperchapapier umwickelt,
diese durch die Spiritusflamme zum Schmelzen gebracht und die Isolation
ist fertig. Unersetzlich ist die Guttapercha — und darin liegt ihr
Hauptwert — bei der Herstellung unterseeischer Kabel, während nämlich
alle anderen Isolatoren vom Seewasser angegriffen und endlich zerstört
werden, ist sie der einzige Stoff, der sich nicht nur hält, sondern mit
der Zeit eher härter und undurchdringlicher wird. Bis jetzt sind sowohl
für den Kautschuk, als für die Guttapercha nur schlechte Surrogate
bekannt, so daß es für die Industrie sehr wichtig ist, daß diese
beiden Stoffe weiterhin in guter Qualität beschafft werden können.
Hauptstapelplatz aller Sorten von Rohguttapercha ist Singapur. Zwei
Drittel von dessen Ausfuhr, die von 1885–96 32 Millionen kg im
Werte von 100 Millionen Mark betrug, gehen nach London und Liverpool;
den Rest nehmen die Märkte von Hamburg, Rotterdam und Marseille auf.
In dieselbe Familie der Sapotazeen wie der Guttaperchabaum ge[S. 184]hört auch
der amerikanische Zapotill- oder Balatabaum (Achras
ballota), ein Baum Guianas und sämtlicher Antillen, dessen beim
Ausschneiden herausfließender Milchsaft zu einer der Guttapercha
ähnlichen, lederartig zähen, schneidbaren und sehr elastischen Masse
wird, die gegenwärtig unter dem einheimischen Namen Balata jährlich in
Mengen von gegen 100000 kg namentlich von Berbice, dem östlichen
Distrikt von Britisch-Guiana, aus in den europäischen Handel gelangt,
um als Surrogat der Guttapercha namentlich zu Treibriemen, Schuhsohlen
und -Absätzen, sowie zu chirurgischen Zwecken gebraucht zu werden.
Der Stamm dient in seinem Vaterlande als Bauholz und kommt auch als
Nutzholz unter der Bezeichnung bully tree wood oder Balata
rouge in den Handel.
Sehr nahe verwandt mit ihm sind der Zapota- oder
Breiapfelbaum (Achras sapota) und die
Mammei-Sapote (Lucuma mammosa), die in Westindien und
im nördlichen Südamerika heimisch sind. Der Milchsaft beider findet
technische Verwendung und beide liefern zugleich eßbare Früchte. Die
Mammei-Sapote liefert eine Art Guttapercha, die aber bisher wenig
Verwendung fand. Größere Bedeutung kommt dem Zapota- oder Breiapfelbaum
zu, dessen guttaperchaähnliches Produkt zur Fabrikation des bei den
Bürgern der Vereinigten Staaten so überaus beliebten Kaugummis
verwendet wird. Es ist dies der Chiclegummi, der durch Anzapfen
des Zapotabaumes gewonnen wird. Die aus den Einschnitten der Rinde
dieses Baumes hervortretende milchweiße Flüssigkeit wird über Feuer
eingedickt und soll schließlich eine hellgraue Farbe annehmen. Für den
Export gibt man dem Chiclegummi eine brotlaibähnliche Gestalt. Ein
Gummisammler oder „Chiclero“ kann täglich bis zu 7,5 kg Chicle
gewinnen und erhält für das Kilogramm 20–30 Cents (= 85–135 Pfennige).
Um einen Teil des Eingangszolls nach den Vereinigten Staaten zu sparen,
der zurzeit 20 Cents pro Kilogramm beträgt, läßt man den Chicle zuerst
in Kanada reinigen und trocknen, wodurch er etwa die Hälfte seines
ursprünglichen Gewichtes verliert. Bei der Weiterverarbeitung wird der
Gummi noch mit allerlei Zutaten wie Zucker, Vanille und Pfefferminze
versehen. Irgend welche medizinisch wirksame Stoffe sind in dem reinen
Chiclegummi nicht vorhanden, gleichwohl wirkt er schon auf mechanischem
Wege konservierend auf die Zähne. Die Menge des nach den Vereinigten
Staaten eingeführten Chicle belief sich im Jahre 1908/09 auf
2725019 kg im Werte von 1987112 Dollar, während die Einfuhr im Jahre
1885 erst 464979 kg betrug. Der[S. 185] Preis des Gummis, der vor dem
Jahre 1888 nur 14–16 Cents pro Kilogramm betrug, ist heute auf 96 Cents
gestiegen. Die Jahresproduktion der amerikanischen Fabriken wird auf 3
Milliarden Stück Kaugummi angegeben. Sicherlich ist nicht sowohl das
Kauen, als vielmehr das damit verbundene Spucken, in welcher Fertigkeit
die Yankees geradezu eine verblüffende Virtuosität erlangt haben, eine
für Fremde wenig angenehme Gewohnheit dieses Volkes.
Der den Chiclegummi liefernde Zapotabaum, der teils wild wächst,
teils angepflanzt wird, liefert daneben, wie gesagt, auch eine
sehr geschätzte Frucht, den Breiapfel. Ferner wird sein Holz,
das sehr schwer und hart und dem Mahagoni ähnlich ist, gerne zur
Möbelfabrikation verwendet. In den alten mexikanischen Ruinen
findet man ausgezeichnet erhaltene Türrahmen und Balken, wie auch
Wandschnitzereien aus Zapotaholz als Beweis dafür, wie außerordentlich
dauerhaft dieses ist.
Wie Milchsaft, Gummi und ätherische Öle, so sind Balsame, Gummiharze
und Harze sehr häufig in Pflanzen enthalten und können auf verschiedene
Weise daraus gewonnen werden. Die Milchsäfte und die daraus
hervorgehenden Federharze wie Kautschuk und Guttapercha wurden im
vorigen Abschnitte besprochen, während die Balsame und Gummiharze
in den folgenden Abschnitten behandelt werden sollen. Sie sind mit
größeren oder kleineren Mengen von ätherischen Ölen vermengte Schleime
und Harze, die nach dem Ausfließen durch Verdunsten der ersteren mehr
oder weniger rasch erhärten. Die ätherischen Öle, die ihnen meist
einen starken Geruch verleihen, können durch Destillation mit Wasser
aus ihnen ausgezogen werden, wobei Schleim und Harz zurückbleiben. Es
sind Schutzstoffe der Pflanze zum Verschließen von Wunden und dadurch
zur Abhaltung des Eindringens von irgend welchen Krankheitserregern
bestimmt. Meist werden sie durch künstlich beigebrachte Verletzungen
gewonnen. Zu den Balsamen gehören Mekka-, Peru-, Tolu-, Kopaiva-,
Styrax- und Kanadabalsam, zu den Gummiharzen Styrax, Benzoë,
Ammoniakum, Asa foetida oder Stinkasant, Euphorbium, Galbanum,
Gummigutti, Sagapenum, Myrrhe und Weihrauch, die alle meist medizinisch
Verwendung finden.
In der Pflanze sind auch die Harze mit flüchtigen ätherischen Ölen
vermengt, als deren Oxydationsprodukte sie überhaupt entstehen.
Sie unterscheiden sich von ihnen durch Sauerstoffgehalt und
Nichtflüchtigkeit. Sie finden sich besonders in tropischen Pflanzen
und bei uns in den Nadelhölzern; und zwar kommen sie in allen
Pflanzenteilen vor, sind aber am reichlichsten in den Rinden, aus denen
sie durch Einschnitte gewonnen werden. Sie sind meist gelb oder braun,
durchscheinend, anfänglich weich, verhärten aber durch Verdunstung
der[S. 187] in ihnen enthaltenen ätherischen Öle. Als solche nennt man sie
Hartharze, weil sie bei gewöhnlicher Temperatur spröde und fest sind.
Sie brennen mit rußender Flamme und geben bei trockener Destillation
brennbare Gase und Öle ab. In ihren physikalischen Eigenschaften
stehen sie den Fetten nahe, doch besitzen sie eine vollständig von
jenen abweichende chemische Konstitution. Kein Harz ist ein chemisches
Individuum, sondern ein Gemisch von Resinen, Resenen, Harzsäuren usw.
Die ätherischen Öle, aus denen die Harze durch Sauerstoffaufnahme
und andere Veränderungen hervorgehen, sind meist sauerstofffrei,
nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff zusammengesetzt, daher leicht
brennbar. Das wichtigste derselben ist das Terpentinöl, das
aus dem Terpentin, einem durch Einschnitte in den Stamm von
Nadelhölzern gewonnenen balsamartigen Harzfluß durch Destillation
vermittelst Wasserdämpfen gewonnen wird. In Deutschland dienen zur
Terpentingewinnung verschiedene Kiefern und Fichten, so besonders
Pinus silvestris und Picea excelsa; das südfranzösische
Terpentin dagegen, das weniger Terpentinöl als das deutsche besitzt,
wird von der Strandkiefer (Pinus maritima) gewonnen. Das
Straßburger Terpentin wird von der Weißtanne (Abies pectinata),
das venezianische in Südtirol von der Lärche (Larix decidua)
gewonnen. In den Vereinigten Staaten von Amerika, die weitaus das
meiste Terpentin erzeugen, wird es außer von verschiedenen Pinusarten
namentlich von der Hemlockstanne (Tsuga), einem im östlichen
Nordamerika sehr verbreiteten, bis 40 m hohem Baum von
1,3 m Durchmesser, vom Bau der Rottanne, gewonnen, während der
verwandte Kanadabalsam ein in Kanada und den Nachbarländern aus der
Balsamtanne (Abies balsamei und fraseri) erzielter
Terpentin ist. Alle diese werden vorzugsweise im Frühjahr durch
Eröffnen der Harzgänge der Rinde durch Schnitte oder Anbohrungen
gewonnen und in darunter gestellten Gefäßen gesammelt. Die Menge
wechselt zwischen 2 und 3,5 kg pro Baum und Ernte, kann aber
bei alleinstehenden, starken Fichten, auf deren Erhaltung es weiter
nicht ankommt, bis auf 40 kg getrieben werden, wonach allerdings
ein so mißhandelter Baum gewöhnlich eingeht. Dieses gelblichweiße,
honigdicke, starkklebende, balsamische Harz reagiert sauer, ist
löslich in Alkohol, Äther und ätherischen Ölen, enthält 15–20 Prozent
Terpentinöl, Harz, Harzsäuren, wenig Ameisen- und Bernsteinsäure.
Durch Destillation des Terpentins mit Wasser wird daraus das klare,
farblose, stark lichtbrechende Terpentinöl gewonnen, das an der Luft
Sauerstoff aufnimmt und ihn teilweise in Ozon verwandelt, wodurch es
bleichend wirkt, dickflüssig wird[S. 188] und zu einer durchsichtigen, harten
Harzschicht eintrocknet. Es löst Harze, Kautschuk, Schwefel, Fette
und dient zum Herstellen von Lacken und Firnissen, zum Verdünnen von
Ölfarben, zum Entfernen von Fett- und Farbenflecken aus Kleidern,
zum Bleichen von allerlei Geweben und Elfenbein, als Arzneimittel,
als Schutz gegen Phosphorvergiftung in Zündhölzchenfabriken und zum
Verfälschen ätherischer Öle. Der bei der Gewinnung des Terpentinöls
aus dem Terpentin zurückbleibende entwässerte Rückstand ist das
Kolophonium oder Geigenharz, das bei 130–135° schmilzt
und, außer zum Bestreichen der Geigenbogen, zur Herstellung von
Siegellack, Harzseifen, Harzöl, Firniß, Kitt, zum Löten, zum Leimen
des Papiers, zu Blitzpulver usw. dient. Die Produktion der Vereinigten
Staaten allein an Terpentinöl beträgt jährlich 70 Millionen kg
im Wert von 32 Millionen Mark, und zwar wird über die Hälfte davon
von Savannah im Staate Georgia exportiert, das der erste Weltmarkt
für Terpentin ist. Die bedeutendsten europäischen Märkte sind London,
Hamburg, Antwerpen, Bordeaux. Qualitativ ist die französische Sorte die
beste; sie wird in der Technik vielfach der amerikanischen vorgezogen.
An dritter Stelle kommt die Produktion Rußlands, die zum größten Teil
im Lande selbst Verwendung findet.
Schon im Altertum kannte und verwendete man solches Terpentin.
So schreibt der um die Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. lebende
griechische Arzt Dioskurides in seiner Arzneimittellehre: „Aus der
Pinie (pítys) und Kiefer (peúkē) kommt ein flüssiges
Harz, das aus Gallien und Etrurien in den Handel kommt, früher auch aus
Kolophon — der ionischen Stadt an der Küste Lydiens — gebracht wurde
und deswegen kolophōnía genannt wird. Es kommt auch vom Fuße
der Alpen vom Baume, den die Leute dort larix (Lärche) nennen.
An Farbe ist es verschieden; denn es gibt reinweißes, ölfarbiges,
honigfarbiges, wie das vom Lärchenbaum. Auch die Zypresse gibt ein
flüssiges Harz. — Trockenes Harz kommt von der Arve, der Weißtanne,
der Schwarzkiefer, der Pinie. Von allen wählt man das, was am besten
riecht, durchsichtig, weder zu trocken, noch zu naß ist, sondern wie
Wachs ist und sich zerreiben läßt. Am besten ist das von Pinien und
Weißtannen, das gut, fast wie Weihrauch riecht. Vorzüglich schätzt man
das von der Insel Pityusa (d. h. Pinieninsel, jetzt Iviza), welche
bei Spanien liegt. Es wird mit und ohne Wasser über einem Kohlenfeuer
gekocht und zu wohlriechenden, erweichenden Pflastern benutzt.
Ausgeglühtes Harz wird auch zu Pflastern, zu stärkenden[S. 189] Arzneien und
zum Färben der Salben gebraucht. Durch Verbrennen des Harzes gewinnt
man Ruß, wie aus dem Weihrauch. Er dient vorzugsweise zum Färben der
Augenlider, wie auch zum Heilen von deren Krankheiten. Aus Ruß wird
auch die schwarze Tinte (to mélan, eigentlich: das Schwarze)
bereitet, mit der wir schreiben.“
Unter Terpentin verstand man im Altertum das Harz der von den
Griechen therébinthos genannten Terpentinpistazie (Pistacia
therebinthus), eines südeuropäischen, dem Nußbaume ähnlichen
Baumes, der heute besonders auf Chios und den benachbarten Inseln,
dann auf Rhodos und Cypern zur Gewinnung des nach dem Anschneiden
herausfließenden Terpentins kultiviert wird. Wir erhalten ihn
hauptsächlich von den Kykladen, und zwar Chios, doch meist mit
venezianischem Terpentin vom Lärchenbaume oder mit Straßburger
Terpentin von der Weißtanne verfälscht. Außerdem liefert die
Terpentinpistazie rundliche, durch Stiche der Pistazienblattlaus
(Aphis pistaciae) hervorgerufene, oft innen mit gelben
Harztropfen gefüllte, Pistazien- oder Terpentingalläpfel genannte
Gallen, die, wie auch die Blätter des Baumes, zum Gerben und
Rotfärben dienen. Diesen Baum und seine Produkte beschreibt schon der
pflanzenkundige Grieche Theophrast (390 bis 286 v. Chr.) in seiner
Pflanzengeschichte. „Die Terebinthe (términthos) wächst am Ida
und in Makedonien klein und strauchartig; bei Damaskus in Syrien ist
sie aber groß und schön. Es soll dort ein Berg sein, der ganz mit
Terebinthen bestanden ist. Das Holz ist zäh, die Wurzeln sind stark
und gehen tief. Die Blüte ist derjenigen des Ölbaumes ähnlich, aber
rot. Außer der Frucht trägt der Baum auch Gallen, worin kleine Tierchen
wohnen. In diesen steckt eine harzige Flüssigkeit, die man aber nicht
sammelt. Das Harz gewinnt man aus dem Holze, die Frucht gibt nicht viel
Harz.“ Von letzterem sagt der vorhin genannte Arzt Dioskurides, es
werde aus dem steinigen Arabien gebracht, aber auch in Judäa, Syrien,
Libyen, auf Cypern und den Kykladen gewonnen. Es sei das beste aller
Harze; nach ihm folge an Güte das Mastixharz, dann dasjenige von Pinie
und Tanne. „Es wird innerlich und in Pflastern viel angewandt. Man gibt
dem durchsichtigen, farblosen, jedoch etwas bläulichen, wohlriechenden
den Vorzug, auch muß es den echten Terpentingeruch haben.“
Die Verwendung des Harzes der Terpentinpistazie ist in den
Mittelmeerländern und im Morgenlande uralt. Die alten Ägypter nannten
es sunter und bezogen es teils aus Syrien und Cypern, teils aus
dem Lande Punt (Südarabien). Noch häufiger gebrauchten[S. 190] sie das Harz
der ihr nahe verwandten Mastixpistazie (Pistacia lentiscus),
das sie fatti nannten, während der Baum selbst bei ihnen
schub hieß. Dieses Mastixharz, von dem man drei Sorten, nämlich
ein schwarzes, rotes und weißes unterschied, diente in Ägypten seit
den ältesten Zeiten zu Räucherungen in den Tempeln und als Heilmittel.
Es war ein wichtiger Bestandteil der kyphi genannten und zu
heiligen Räucherungen verwendeten Harzmischung und wird schon in
Inschriften aus der Zeit Pepis I. (um 2600 v. Chr.) erwähnt; auch
diente es zum Einbalsamieren der Leichen. Heute findet es im ganzen
Orient seine Hauptverwendung als Kaumittel, um das Zahnfleisch fest
und den Atem wohlriechend zu machen. Diese besonders bei den Frauen
im Harem zur Kurzweil geübte Sitte muß ebenfalls schon uralt sein;
denn nach ihr nannten die Griechen dieses Harz mastíchē (von
mastázein kauen, mástax Mund, Bissen). So schreibt
Dioskurides in seiner Arzneimittellehre: „Das Harz, das aus dem
Mastixbaum (schínos) gewonnen wird, heißt mastíchē und
macht gekaut den Atem angenehm und zieht das Zahnfleisch zusammen. Es
wird auch zu Zahnpulvern benutzt und als Arznei gebraucht, wird auch
in die Haut des Gesichtes gerieben, um ihr Glanz zu verleihen. Das
beste und meiste liefert die Insel Chios; solches ist glänzend, hat
die Farbe des tyrrhenischen Wachses, ist zerreiblich, wohlriechend.
Das grüne ist schlechter. Die Verfälschung geschieht mit Weihrauch und
Zapfenharz.“ Sein Zeitgenosse Plinius sagt in seiner Naturgeschichte:
„Es gibt verschiedene Sorten von Mastix (mastiche); am höchsten
wird der weiße von Chios geschätzt. Von ihm kostet das Pfund 20 Denare
(12 Mark), während der dunkelfarbige nur 12 gilt. Der Mastix von
Chios soll wie ein Gummi aus der Mastixpistazie (lentiscus)
herausfließen und erhärten. Er, wie auch die Blätter des Baumes sind
vielfach in arzneilichem Gebrauch. So weiß ich, daß der Arzt Demokrates
der Considia, Tochter des Konsularen Marcus Servilius, geraten hat,
Milch von Ziegen zu trinken, die mit lentiscus gefüttert wurden,
und daß der Erfolg ein günstiger war.“
Auch im Mittelalter war der Mastix ein wichtiges Arzneimittel. In
Westeuropa war er im 9. Jahrhundert n. Chr. eine große Seltenheit,
doch fand er bald darauf durch Vermittlung der arabischen Ärzte im
Arzneischatze des Abendlandes Eingang. Im 16. Jahrhundert wurde er
regelmäßig in den Apotheken geführt. Heute noch wird er hauptsächlich
auf der Insel Chios, daneben in geringerer Menge auf Samos und Cypern
gewonnen. Zu dem Zwecke wird der strauchartige Mastix[S. 191]baum in großen
Beständen kultiviert und aus ihm das Balsamharz, das sich in besonderen
Behältern in der Rinde befindet, durch Einschnitte in Stamm und
Zweige gewonnen. Diese werden von Mitte Juni an zwei Monate hindurch
von der Basis des Stammes bis hinauf in die Äste in Form von geraden
oder gekreuzten Schnitten gemacht, aus denen das Harz in Tropfen
heraustritt, um entweder direkt am Baum, oder, wenn es herabtropft,
auf untergelegten Blättern oder Steinplatten zu erhärten, was nach
2–3 Wochen der Fall ist. Dann wird es sorgfältig in mit Papier oder
Baumwollenzeug ausgelegte Körbchen gesammelt. Ein Bäumchen liefert
4–5 kg. Von den in den Handel gelangenden etwa 300000 kg
Mastix im Werte von einer halben Million Mark liefert die von den
Türken Sakîs ada, d. h. Mastixinsel genannte Insel Chios den
größten Teil, und zwar ist die beste Sorte die an den Zweigen von
selbst ausgeschwitzte, die kleine, durchsichtige, anfänglich grünliche,
später gelbliche Stücke bildet. Die Masse wird bei langsamem Kauen
im Munde erweicht, schmilzt bei 108° und entwickelt dabei einen
balsamischen Geruch. Außer als Kaumittel dient sie im Orient als
Beigabe zu Konfitüren und zur Darstellung des sehr beliebten, feinen
Likörs Raki oder Mastichi, den man mit Wasser vermischt trinkt, bei uns
zu Räucher- und Zahnpulvern, Kitt und besonders Firnis.
In ähnlicher Weise wird das wohlriechende Elemiharz verwendet,
das Theophrast als Gummi des äthiopischen Ölbaums erwähnt. Schon im
16. Jahrhundert fand es als Resina elemnia als Räucher- und
Wundheilmittel, wie auch zu Salben bei uns ziemlich häufige Verwendung.
Es ist dies ein Sammelname für mehrere Harze, die aus Ostindien zu
uns kamen. Das am meisten gebrauchte ist das offizinelle Manilaelemi,
das von dem auf den Philippinen, besonders der Insel Luzon, aber auch
auf dem asiatischen Festland kultivierten Canarium luzonicum
gewonnen wird, und zwar durch zweimal jährlich wiederholtes Anschneiden
des Baumes. Um einen rascheren Erguß des Harzes zu erzielen, wird in
der Nähe des Baumes ein Feuer angezündet. In frischem Zustande stellt
es eine klare, wenig gefärbte Auflösung von Harzen in ätherischem Öl
dar, aus der sich das Harz zum Teil in fester Form ausscheidet, so daß
es undurchsichtig ist. Es riecht balsamisch und schmeckt gewürzhaft
bitter. Die beste Sorte ist gelblich bis grünlichweiß, zähflüssig,
klebrig und erhärtet beim längeren Aufbewahrtwerden. An Stelle dieser
schwer in Europa zu beschaffenden Droge führte man nach der Entdeckung
Amerikas verschiedene[S. 192] ähnliche wohlriechende Harze ebenfalls unter
demselben Namen Elemi in Europa ein, so das grünlichgelbe, später durch
Ausscheidung von festem Harz kreidig aussehende Harz der in Yukatan und
Mexiko wachsenden Amyris plumieri, einer sehr nahen Verwandten
des Weihrauchbaumes, dann dasjenige von Carana- und Protiumarten in
Westindien, Venezuela und Nordbrasilien. Später haben auch Ost- und
Westafrika von Boswelliaarten Elemi geliefert. Doch wird neuerdings
wieder am häufigsten der Manilaelemi verwendet, den der Jesuit Camellus
1701 zuerst erwähnt.
Dem Elemi ähnlich ist das Gommartharz, das auf Martinique
und Guadeloupe von Bursera gummifera gewonnen wird. Es
ist außen weißlich, innen grünlich oder gelblich, geschichtet,
riecht terpentinartig und wird zu Firnissen benutzt, ebenso zu
lithographischen Umdruckfarben, zum Steifmachen der Hüte und zu
Salben und Pflastern. In derselben Weise dient der Cayenneweihrauch
von Icica heptaphylla und das Harz von Occumé vom Gabunfluß in
Westafrika.
Viel wichtiger als diese ist das Dammarharz. Dammar ist ein
malaiisches Wort, das Harzträne, Harz bedeutet. Das in den Handel
gelangende Dammarharz ist das freiwillig in großen Mengen austretende
und bald an der Luft erhärtende Harz von Shorea wiesneri und
anderen Dipterocarpazeen, hohen, Wälder bildenden Bäumen Vorder- und
Hinterindiens und der südasiatischen Inseln. Es stellt gelblichweiße,
durchsichtige, außen bestäubte Körner oder unförmliche Massen
verschiedener Größe dar, ist im Bruche glasglänzend, muschelig,
etwas klebend, leicht zerreiblich, riecht angenehm balsamisch und
löst sich vollständig in Alkohol, Äther, Chloroform, Benzol und
Schwefelkohlenstoff. Es dient zu technischen und Beleuchtungszwecken,
zur Herstellung von Heftpflaster und liefert einen Firnis, der zwar
nicht so dauerhaft wie der Bernstein- oder Kopalfirnis ist, aber,
weil billig, farblos, klar und glänzend, sich sehr gut zum Überziehen
von Ölgemälden eignet. Die erste Aufzeichnung über das Dammarharz
findet sich um 1670 bei Rumphius, einem 1627 geborenen Deutschen,
der als holländischer Konsul auf Amboina wirkte. Es gelangt seit
1827 hauptsächlich von Sumatra in den Handel. Die echte Droge ist
das dammar putih oder weiße Harz der Malaien, während das
dammar batu oder Steinharz, eine Art Manilakopal, der früher für
das Dammar des europäischen Handels gehalten wurde, von der mit dem
Dammarbaum verwandten Dipterocarpazee Vateria indica stammt.
Das dammar item oder schwarze Harz rührt vom ostindischen
Canarium stric[S. 193]tum und C. rostratum der Molukken
her. Das dammar mekong oder gelbe Harz und das dammar mata
kutjing oder Katzenaugenharz stammt von Hopeaarten der Halbinsel
Malakka, während der dammar dagieng oder Rosendammar von
Resinodendron rassak, der dammar selo vom indischen
Jackbaum (Artocarpus integrifolia) besonders auf Malakka und das
Saulharz von Shorea robusta auf Sumatra und Java gewonnen wird.
Tafel 113.

Gewinnung von Rohterpentin in den Fichtenwäldern von Nordkarolina.
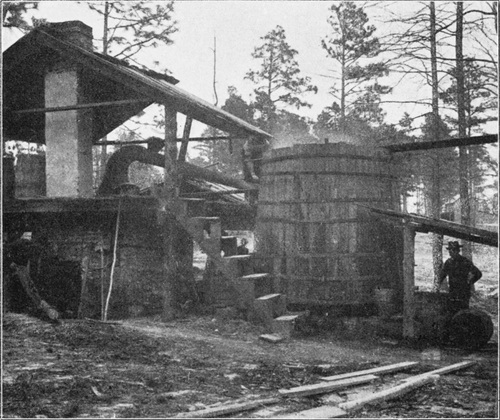
Destillation des reinen Terpentins in den Wäldern von
Nordkarolina.
(Beide Bilder: Copyright by Underwood & Underwood.)
Tafel 114.
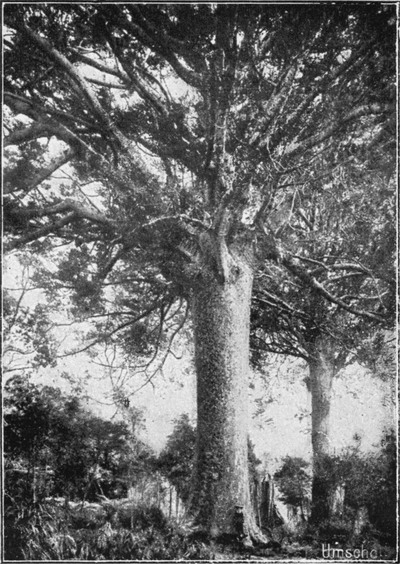
Die neuseeländische Kaurifichte (Agathis australis).

Kopalbäume (Trachylobium verrucosum) in
Deutsch-Ostafrika.
(Nach „Karsten u. Schenck, Vegetationsbilder“.)
Erst seit dem Mittelalter ist in Europa das nordafrikanische
Sandarakharz bekannt, das man von Wacholderarten abstammend
wähnte und deshalb auch Wacholderharz hieß, bis der Naturforscher
und Arzt Broussonet (1761–1807) von Montpellier, der längere Zeit
auf den Kanarischen Inseln lebte und dort Pflanzen sammelte, zu Ende
des 18. Jahrhunderts die in den Gebirgen des nordwestlichen Afrika,
besonders im Atlas und seinen Vorbergen, heimische Zypressenart
Callitris quadrivalvis als den wirklichen Erzeuger des von
den Arabern Sandarak genannten Baumharzes entdeckte. Als solches kam
es erst durch die arabischen Ärzte in Europa als innerliches und
äußerliches Heilmittel, das auch zu Räucherungen und zur Herstellung
von Pflastern und Salben diente, auf. Unter sandarache verstand
man im Altertum das von uns Realgar genannte Schwefelarsen, während
das von uns Sandarak geheißene Harz den Alten nicht bekannt war.
Wohl kannten diese sehr wohl die ihn erzeugende Zypressenart, die
die Griechen kédros und die Römer nach ihnen citrus
nannten und deren Holz sie außer zu Schiffsbauten besonders in der
Luxustischlerei zu kostbaren Möbeln und mottensicheren Kleiderkisten
benutzten, aber daß ein Harz von ihr gewonnen werde, wird von keinem
Schriftsteller derselben erwähnt. In der arabischen wie auch in der
persischen Literatur des Mittelalters wird es als sindarûs oder
sandarûs mehrfach erwähnt und dabei seine Ähnlichkeit mit dem
Bernstein hervorgehoben.
In Europa hieß das Harz im Mittelalter vernix oder bernix
— wie übrigens wohl auch der Bernstein —, was auf seine Verwendung zu
Firnissen schließen läßt; denn das deutsche Wort Firnis ist wie
auch das französische vernis und das englische varnish
aus vernix hervorgegangen. Heute noch dient es außer in der
Arzneikunde besonders zur Herstellung von Firnissen, Kitten und
Lacken. Die Sandarakzypresse ist ein in Algerien forstlich gepflegter,
meist 6 m hoher, sparrigästiger Baum oder Strauch, der teils
freiwillig, teils aber durch Einschnitte in Stamm und Äste — durch
letztere gewöhnlich geübte Manipulation wird eine viel größere Ausbeute
erhalten — den in der[S. 194] Außenrinde enthaltenen Harzsaft herausfließen
läßt. Getrocknet bildet es spröde, blaßgelbliche bis fast bräunliche,
durchsichtige Körner, die beim Kauen nicht erweichen; es schmeckt
balsamisch-harzig, etwas bitter, riecht beim Erwärmen balsamisch
und etwas terpentinartig. Es wird mit Mastix, Kolophonium, Fichten-
und Dammarharz verfälscht. Außer diesem hauptsächlich aus Marokko
zu uns gelangenden echten Sandarak wird neuerdings in großer Menge
ein ihm sehr ähnliches, nur in Weingeist reichlicher lösliches Harz
von verschiedenen Callitrisarten als australischer oder tasmanischer
Sandarak aus den Küstengebieten Australiens und Tasmaniens zu uns
gebracht.
Bei dieser Gelegenheit wird es am Platze sein, einige Worte über
den Firnis zu sagen, dessen Bezeichnung, wie gesagt, aus der
mittelalterlichen Benennung des Sandaraks seinen Ursprung nahm. Man
versteht darunter an der Luft schnell trocknende und eine glänzende,
meist durchsichtige Decke auf den damit überzogenen Gegenständen
bildende Flüssigkeit. Dabei unterscheidet man aus trocknenden Ölen
bereitete fette Firnisse, dann durch Lösung von Harzen in
diesen Ölen hergestellte Lackölfirnisse oder fette Lacke
und endlich durch Lösung von Harzen in Terpentinöl oder Alkohol
hergestellte Terpentinöl- und alkoholische Firnisse.
Auch Äther, Kampferöl, Holzgeist und Aceton werden als Lösungsmittel
angewendet. Unter ihnen sind die fetten Firnisse weitaus am
dauerhaftesten, widerstehen der Wärme und Feuchtigkeit am besten,
trocknen aber am langsamsten. Sie bestehen aus trocknenden Ölen,
besonders Lein- und Mohnöl, deren Fähigkeit an der Luft unter Aufnahme
von Sauerstoff zu trocknen durch Behandlung mit sauerstoffabgebenden
Stoffen wie Bleiglätte, Braunstein oder Bleizucker erhöht werden kann.
So wird beispielsweise Leinölfirnis in der Weise hergestellt, daß man
helles, kalt gepreßtes Leinöl unter Umrühren etwa 2 Stunden kocht, dann
nach Hinzufügen von 3 Prozent Bleiglätte abermals 3 Stunden kocht.
Hierauf läßt man die Flüssigkeit mehrere Monate lagern, bleicht sie
auch in einem mit einer Glasplatte bedeckten Bleikasten in 10 cm
hoher Schicht durch Sonnenlicht. Der weitaus feinste Firnis aber ist
der Kopallack, wie auch der Bernsteinlack.
Unter dem Sammelnamen Kopal versteht man sehr verschiedene,
schwer schmelzbare, bernsteinähnliche Baumharze, die nach den
verschiedenen Verschiffungsplätzen unterschieden werden und teils
rezent, zum größten Teil aber fossil sind, d. h. von vorweltlichen
Harzbäumen getropft sind und in kleineren oder größeren Klumpen aus der
Erde[S. 195] gegraben werden. Besonders Afrika ist reich an Kopalen, von denen
man hauptsächlich den ostafrikanischen oder Sansibar- und Mosambikkopal
und den westafrikanischen oder Kamerunkopal unterscheidet.
Der ostafrikanische Sansibar- und Mosambikkopal wird
meist an der Küste zwischen 5 bis 15° südlicher Breite gegraben
und stammt von der Leguminose Trachylobium verrucosum. Es
ist dies ein bis 40 m hoher Baum mit mächtigem Stamm und
weit ausgebreiteten Ästen, lederförmigen Blättern, ziemlich großen,
roten Schmetterlingsblüten in Rispen und länglichen, warzigen, nicht
aufspringenden Hülsenfrüchten. Er ist ein typischer Küstenbaum, der nur
im Bereich der Seewinde gedeiht, auch an den Küsten Madagaskars wächst
und neuerdings zur Harzgewinnung auf Ceylon und Java angepflanzt wird.
Stamm und Äste sind vielfach mit einem klaren Harzüberzug reichlich
bedeckt. Dieses Harz wird vom Baume abgelöst und kommt als Baumkopal
in den Handel. Weitaus der meiste Kopal wird aber in einem
150–300 km breiten Küstenstreifen, wo der Baum einst unweit des Meeres
gedieh und in der Folge spurlos bis auf das von ihm ausgeschwitzte
unverwesliche Harz verschwand, aus der Erde gegraben. Dieser ist
im rohen Zustande von einer mit Sand vermengten undurchsichtigen
Verwitterungskruste bedeckt, im Innern jedoch vollständig klar und
durchsichtig, von blaßgelber bis blaßrötlicher Farbe. Um diese
Sand- und Verwitterungskruste zu entfernen, wird er mit Soda oder
Pottaschenlauge gewaschen und zeigt dann eine facettierte Oberfläche,
welche man allgemein als Gänsehaut bezeichnet. Er ist der härteste
aller Kopale und kommt darin dem Bernstein fast gleich. Er dient
zur Herstellung der besten Lacke und Firnisse, die imstande sind,
Wind und Wetter lange Zeit erfolgreich zu widerstehen. Die größten,
schönsten und durchsichtigsten Stücke werden wie Bernstein zu Dreh-
und Schnitzarbeiten verwendet. Übrigens unterscheidet man von diesem
fossilen Kopal zwei Sorten: eine, die Chakazzi genannt wird, nur
eine schwache Verwitterungskruste besitzt und eine geringe Härte
aufweist, als Beweis dafür, daß sie erst verhältnismäßig kurze Zeit
im Boden gelegen haben kann. Sie findet sich über dem Boden oder
ganz oberflächlich im Boden an Stellen, wo der Baum noch vorkommt,
zumeist aber im Rückgang begriffen ist. Der eigentliche, reife Kopal
aber liegt tiefer im Boden, von Sand und Erde überlagert, an Stellen,
wo weit und breit keine Kopalbäume mehr zu sehen sind, weil sich
das Meer inzwischen weit zurückgezogen hat und infolgedessen die
Lebensbedingungen für dieselben aufhörten günstige zu sein. Es ist
schon längst[S. 196] auch aus andern Tatsachen festgestellt worden, daß die
Ostküste Afrikas in langsamem Vorrücken begriffen ist und das Meer
einst jene steppenartigen, öden Gegenden bespülte, in denen jetzt der
Kopal gegraben wird. Wenn die auf den Nordostmonsun folgenden Regen die
Erde aufgelockert haben, beginnen die Eingeborenen mit kleinen Hacken
nach diesem fossilen Harze zu graben, von dem jetzt schon jährlich für
über eine Million Mark über Sansibar ausgeführt wird. Bei geordnetem
Betrieb könnte noch viel mehr davon gewonnen werden, was eine wichtige
Einnahmequelle für das Deutsche Reich bedeuten würde, da fast die ganze
Kopalgegend zur deutschen Kolonie gehört.
Auch die Küste von Westafrika weist von Sierra Leone bis nach Benguela
hin an zahlreichen Orten fossilen Kopal auf. Er wird in Mergel, Sand
oder Lehm in Tiefen bis zu 3 m gefunden und kommt neuerdings
in viel größeren Mengen als der ostafrikanische in den Handel, ist
aber von geringerer Qualität und wird nur mit 2 Mark per kg
bezahlt, während jener beinahe das Dreifache davon gilt. Während der
Kopal von Angola eine demjenigen von Sansibar ähnliche, nur größere
Oberflächenfacettierung zeigt, auch in größeren, bis 2 kg
schweren Klumpen ausgegraben wird, ist derjenige von Gabun oder
Benguela von eigenartigen, tiefen Sprunglinien durchzogen, an denen er
leicht erkannt werden kann. Diese sind dadurch entstanden, daß sich
das Harz im Laufe der Zeit an der Peripherie stärker zusammenzieht als
im Innern; wenn dies nur in geringem Maße geschieht, so bildet sich
die für den Sansibarkopal charakteristische facettierte Oberfläche
von kleinen, polygonalen Wärzchen. Seit einigen Jahren kommt auch
aus Kamerun Kopal in den Handel, der für diese Kolonie von Bedeutung
zu sein scheint. Er wird in faust- bis kindskopfgroßen, graugelben
Stücken gefunden und ist meist von einer starken, gelblichweißen
Verwitterungskruste bedeckt. Dies und seine außerordentliche Härte
beweisen, daß wir es ebenfalls mit einem fossilen Baumharze zu tun
haben. Rezent vom Baume gewonnenes Harz ist dort nicht bekannt; doch
findet sich in Kamerun ein Kopalbaum, aber kein Trachylobium, sondern
eine andere, Copaifera genannte Leguminose. An einzelnen Stellen
Nordkameruns findet sich dieses Harz in mächtigen Lagern im Boden und
kann leicht gegraben werden. An Stellen, an denen es vermutet wird,
legt man Probeschürfungen an und beutet dann das Gefundene aus. Doch
wird hier wie überall sonst in Afrika die Kopalgewinnung bis jetzt
recht nachlässig betrieben. In Jahren, da die Feldfrüchte gut geraten
und der[S. 197] Neger genug zu essen hat, wird er nie daran denken, Kopal zu
graben; denn solches verursacht Mühe, und jede Anstrengung sucht er
nach Möglichkeit zu vermeiden. Merkwürdig ist, daß hier so wenig als in
der ostafrikanischen Kolonie sich das deutsche Kapital bis jetzt um die
Ausbeutung dieser Naturschätze bekümmerte.
Ist nun Afrika recht eigentlich das Land der Kopale zu nennen, so
findet sich dieses Naturprodukt auch anderwärts, so als Brasilkopal
an der Ostküste Südamerikas, als Manilakopal auf den Philippinen,
Sundainseln und Molukken und als Kaurikopal auf der Nordinsel von
Neuseeland. Der Brasilkopal ist die weichste Kopalart, findet
sich niemals fossil, sondern stammt durchgehends von jetzt noch
lebenden Bäumen. Am häufigsten kommt das von Hymenae courbaril
stammende Harz in Form von knolligen, gelben bis dunkelgrünen Stücken
mit einem ganz dünnen, kreidigen Überzug in den Handel. Wahrscheinlich
liefern auch noch andere Arten von Hymenae in Südamerika
Kopal. Der Manilakopal fließt in Massen aus dem Stamm einer
stattlichen Fichte, Agathis dammara, hervor, vereinigt
sich an den Wurzeln in Klumpen, wird häufig vom fließenden Wasser
fortgeschwemmt und sammelt sich nicht selten am Ufer der Flüsse in
großen Blöcken an. Er kommt in bis zu 40 kg schweren Stücken in
den Handel. Die Oberfläche derselben ist meist etwas dunkler gefärbt
als das Innere, doch fehlt eine eigentliche Verwitterungskruste.
Die Farbe ist gewöhnlich bernsteingelb, seltener braun, der Geruch
ist angenehm balsamisch, ähnlich demjenigen des Kaurikopals. Dieser
Kaurikopal stammt von der neuseeländischen Kaurifichte
(Agathis australis), die auf den nördlichsten Teil der Nordinsel
beschränkt ist und hier nur an ihr besonders zusagenden Stellen
vorkommt. Das ist um so bedauerlicher, da sie nicht nur ein sehr
schöner, stattlicher, bei einem Stammdurchmesser von bis zu 7 m
50 m Höhe erreichender Baum mit zahlreichen Ästen und dunkeln
Blättern ist, sondern auch treffliches Nutzholz und große Mengen Harz
liefert. Dieses letztere fließt freiwillig aus dem Stamm und sammelt
sich in großen Klumpen an den Wurzeln, findet sich aber auch am und
im Boden an Stellen, wo ehemals Kauriwälder standen, massenhaft,
oft in mehreren Lagen übereinander, vor, so daß das zumeist von
dort angesiedelten Österreichern ausgeübte Gewerbe des Kopalgrabens
ein sehr lohnendes ist. Diese Kopalgräber, fast ausschließlich
Dalmatiner, wohnen meist in Auckland und ziehen mit einem dünnen
Stahlspeer und einer gewöhnlichen Schaufel ausgerüstet auf die Suche
nach dem Kaurikopal. Zunächst wird der Speer[S. 198] in die Erde gestoßen.
Fühlt nun der Gräber, daß er auf einen Kaurikopalklumpen gestoßen
ist, so beginnt er zu graben. Neuerdings werden auch weite Strecken
umgegraben, ohne daß erst der Stahlspeer Anwendung findet. Die Klumpen
schwanken von Nuß- bis Kindskopfgröße, doch hat man gelegentlich auch
bis 46 kg schwere Massen gefunden. Als Zeichen, daß sie schon
sehr lange im Boden gelegen haben, sind sie meist mit einer starken
Verwitterungskruste überzogen. Im Gegensatz zur weißlichen Farbe des
frisch aus dem Kauribaume geflossenen, auch viel weicheren Kopals ist
diejenige des härteren fossilen, seiner Entstehungszeit nach meist
ins Tertiär zurückreichenden Kopals hellgelb bis dunkelbraun; doch
sind letztere Stücke, die meist aus sumpfigen Stellen gegraben werden,
weniger beliebt. Die Masse ist hart, riecht intensiv balsamisch und
schmeckt gewürzhaft. Als der neuseeländische Kaurikopal gegen das
Ende der 1840er Jahre zuerst aufgefunden und nach London geschickt
wurde, hatte man zunächst keine Verwendung dafür. Von den Amerikanern
lernten dann die Engländer seine trefflichen Eigenschaften kennen und
schätzen. So benutzten sie ihn bald außer zur Herstellung von Lacken
und Firnissen zum Beschweren der Seide, bei der Linoleumfabrikation
usw. Infolge der vermehrten Nachfrage wurde seine Gewinnung immer
eifriger betrieben. Während sein Export noch im Jahre 1860 nur wenig
über 100000 kg im Werte von 890000 Mark betrug, war er 1899 auf
über 11 Millionen kg im Werte von 13 Millionen Mark gestiegen.
In letzter Zeit ging die Produktion desselben etwas zurück; doch sind
jetzt noch über 7000 Personen mit seiner Gewinnung beschäftigt. Ein
ganz ähnliches, ebenfalls von einer Agathis stammendes fossiles Harz
wird übrigens auch in Neu-Kaledonien gegraben und kommt ebenfalls als
Kaurikopal in den Handel.
Zur Herstellung von Lacken und Firnissen wird der Kopal, um ihn
löslich zu machen, geschmolzen. Ist er wieder erstarrt, so wird er
gepulvert und längere Zeit der Luft ausgesetzt. Zur Bereitung von
fettem Kopalfirnis mischt man den geschmolzenen Kopal sofort mit
erhitztem Leinölfirnis, kocht, wenn der Lack weich werden soll,
einige Zeit, setzt dann das ebenfalls erhitzte Terpentinöl hinzu und
filtriert nach dem Erkalten durch graues Löschpapier. Elastischen
Kopalfirnis erhält man aus 3 Teilen Kopal, 1,5 Teilen Leinölfirnis
und 9 Teilen Terpentinöl. Doch wird letzteres erst zugesetzt, nachdem
der Leinölfirnis mit dem Kopal 2–3 Stunden gekocht hat. Etwas mehr
Leinöl macht den Lack noch elastischer; nimmt man aber nur 1,25
Teil Leinölfirnis[S. 199] und kocht nicht, so trocknet der Firnis schnell.
In Chloroform oder Benzol gelöster Kopal wird als Kaltlack in der
Photographie benutzt.
Für die Kulturgeschichte Europas von außerordentlicher Bedeutung ist
der Bernstein, von den Franzosen und Engländern als gelbe Ambra
bezeichnet — ein Produkt, über das alles Mögliche gefabelt wurde (die
echte graue Ambra, deutsch ursprünglich Amber, nach dem arabischen
anbar, da die arabischen Ärzte zuerst diesen Stoff dem
Abendlande übermittelten, genannt, findet sich in Stücken von bis zu
90 kg Gewicht, 1,5 m Länge und über 0,5 m Dicke bei
Madagaskar, Java, Japan, Surinam, Brasilien im Meere schwimmend, bis
seine Herkunft als Auswurfsstoff des bis 25 m Länge erreichenden
Pottwals dadurch erkannt wurde, daß man ihn auch in den Gedärmen jenes
Zahnwales fand. Der Amber ist eine graubraune, leichte, wachsartige, in
der Hand erweichende Masse von sehr verschiedener, meist graubrauner
Färbung und höchst angenehmem Geruch, löst sich in Alkohol und Äther,
läßt sich in kochendem Wasser in eine ölige Flüssigkeit umwandeln und
bei großer Hitze verflüchtigen. Er wurde früher als Aphrodisiacum,
dann als Arzneimittel verwendet, dient heute nur noch als Parfüm in
Räuchermitteln und wohlriechenden Ölen und Seifen). Der deutsche
Ausdruck Bernstein, der noch im 16. und 17. Jahrhundert Börnstein
(im angelsächsischen burn brennen ebenfalls enthalten) hieß,
bedeutet Brennstein, weil dieser an der südlichen Ostseeküste in
Ostpreußen vom stürmischen Meere meist in sogenanntem Bernsteinkraut
(Tangen, besonders Fucus vesiculosus und fastigiatus)
eingehüllt ans Ufer geworfene zitronengelbe bis weiße oder rotbraune,
mehr oder weniger durchsichtige Stein ins Feuer geworfen mit rußender
Flamme und Ausströmenlassen eines aromatischen Geruches verbrennt.
Seine geheimnisvolle Herkunft auf den Wogen des Meeres in Verbindung
mit der für einen Stein höchst merkwürdigen Eigenschaft, brennbar
zu sein, machte ihn schon in sehr früher vorgeschichtlicher Zeit
zuerst in seiner Heimat und dann weit darüber hinaus zu einem höchst
wertvoll geachteten Amulette und zugleich, dank seiner schönen
Farbe und prächtigen Politurfähigkeit, auch Schmuckstein. Von der
jüngsten neolithischen Zeit an wurde er besonders zur Bronze- und
ersten Eisenzeit durch Tauschhandel immer weiter nach Süden zu den
reichen Völkern am Mittelmeer, den Etruskern, Mykenäern, Syrern und
Ägyptern verbreitet, in deren Gräbern wir ihn in Perlenform zum
Tragen an einem Bande um den Hals finden. Kein anderes Naturprodukt
hat die Kultur Deutschlands in der jüngeren vorgeschichtlichen Zeit
so[S. 200] mächtig beeinflußt als der Bernstein, der bald auf zwei durch
zahlreiche Depotfunde von dagegen eingetauschten Artikeln, besonders
Bronzewaffen, dann auch durch Beeinflussung ihrer Ornamentik und ihrer
Töpfereiprodukte deutlich als solche charakterisierten Handelswegen
nach Süden transportiert wurde. Der eine führte der Weser entlang,
durchs Tal der Fulda nach dem Rheintal und von da über einige
Alpenpässe nach Italien und gleichzeitig ins Rhonetal, der andere
führte die Oder aufwärts durch das Tal der March ins Gebiet der Donau.
Die Griechen nannten den Bernstein élektron — ein Ausdruck,
aus welchem bekanntlich unsere Bezeichnung Elektrizität hervorging,
weil man am Elektron, wenn er gerieben wurde, zuerst die später als
elektrisch erkannten Eigenschaften entdeckte. Wie die vornehmen
Mykenäer Bernsteinschmuck trugen, den wir in ziemlicher Menge unter den
Totenbeigaben ihrer reich mit kunstvoll aus Gold und Silber und einer
wegen der Farbe ebenfalls als élektron bezeichneten Mischung
beider Edelmetalle hergestellten Schätzen ausgestatteten Gräber
finden, so trugen auch die Männer und Frauen der homerischen Zeit
Bernsteinschmuck. Nach den ältesten auf uns gekommenen Nachrichten der
Griechen sollen die diesen wertvollen Schmuckstein zu ihnen bringenden
phönikischen Bernsteinhändler erzählt haben, daß im Nordwesten der
Erdscheibe sich der Eridanos (als mythologischer Name später auf den
Po bezogen) in den Okeanos (das die Erdscheibe umgebend gedachte
Meer) ergieße, an dessen Mündung gewisse Bäume von der dort nahe
vorbeifahrenden Sonne Bernstein ausschwitzen. Aus dieser Sage geht
hervor, daß schon die alten Phönikier und die von ihnen weitgehend
beeinflußten Griechen den Bernstein richtig als Baumharz erkannten.
Dies war auch bei den Römern der Fall, die ihn succinum nannten,
weil er aus dem Saft (succus) bestimmter Bäume, die Plinius
geradezu als eine Art Pinien bezeichnet, entstanden sei.
Selbstverständlich hat es schon die Kulturvölker des Altertums aufs
höchste interessiert, zu erfahren, was für eine Bewandtnis es mit dem
aus unbekanntem Norden zu ihnen gelangenden Bernstein auf sich habe.
Der erste, von dem wir wissen, daß er um die Säulen des Herkules (die
Meerenge von Gibraltar) herum eine Entdeckungsreise nach dem Norden
unternahm, um die Heimat des Bernsteins wie auch des Zinnes und
köstlicher Felle zu erkunden, war der Grieche Pytheas aus Massalia
(Marseille) zur Zeit Alexanders des Großen um 330 v. Chr. Über seine
Reise nach Britannien, der Insel Thule (wohl eine der Shetlandinseln)
und dem Bernsteinland (wahrscheinlich an der Nord[S. 201]seeküste Schleswigs)
schrieb er dann nach seiner Rückkehr in die Vaterstadt einen Periplus,
d. h. Umfahrt, benannten, uns in einzelnen Fragmenten erhaltenen
Bericht, worin er erzählt, daß der Bernstein (élektron) auf
der Insel Abalos im Okeanos gegenüber dem germanischen Volke der
Guttonen von den Wellen angetrieben werde. Jedenfalls ist er nicht
in die Ostsee, geschweige denn ins Samland gelangt, sondern wird den
von ihm mitgeteilten Bescheid von den Bewohnern Nordfrieslands an
der Westküste Schleswigs, zu denen er gelangte und bei denen er den
Bernstein eintauschte, erhalten haben. Jedenfalls ist auch späterhin
noch Bernstein von der friesischen Nordseeküste her zu den Völkern
des Mittelmeeres gebracht worden, da der um 79 n. Chr. verstorbene
Römer Plinius die von ihm Glessarien oder Elektriden genannten
Bernsteininseln ins germanische Meer gegenüber Britannien verlegt.
Die erste sichere Andeutung der samländischen Küste im jetzigen
Ostpreußen als Heimat des Bernsteins gibt uns der seit 30 v. Chr. 22
Jahre in Rom als Lehrer der Rhetorik lebende und sich daneben mit dem
Studium der römischen Geschichte beschäftigende Grieche Dionysios von
Halikarnaß südlich von Milet an der Westküste Kleinasiens. Der römische
Geschichtschreiber Cornelius Tacitus (54–117 n. Chr.), der uns die
erste ethnographische Schilderung des alten Germaniens und seiner
Bewohner gab, wußte, daß die Ästyer (Esthen) von der rechten Küste des
suevischen Meeres (Ostsee) den Bernstein glesum (wohl später auf
das ähnlich durchsichtige und glänzende Glas übertragen) nannten, daß
sie ihn als Auswurf des Meeres sammelten und an die Römer verhandelten.
Um mit den Bewohnern der Bernsteinküste direkt in Verbindung zu
treten, sandte dann der von 54–68 regierende Kaiser Nero eine römische
Expedition unter Anführung eines römischen Ritters an die Ostseeküste
nach Norden, von wo sie mit diesem kostbaren Erzeugnis des Samlandes
reich beladen heimkehrte.
Im Mittelalter fand ein ausgedehnter Bernsteinhandel besonders nach
dem Oriente hin statt, wo er heute noch als Amulett zum Schutze vor
Erkrankung und als Schmuckstein sehr geschätzt wird. In den ältesten
Zeiten war das Auflesen des Bernsteins jedermann erlaubt. Erst die
mittelalterlichen Bischöfe erkannten in dem lapis ardeus vulgo
Börnstein ein geeignetes Steuerobjekt, das ihnen großen Gewinn brachte.
Die erste Urkunde darüber datiert aus dem Jahre 1264. Nach ihnen
beuteten die Deutschen Ritter das Bernsteinregal in größtem Maßstabe
aus und verkauften den Bernstein an die Bernsteininnungen,[S. 202] die sich
um 1300 in Lübeck und Brügge, 1450 in Stolp, Kolberg und Danzig und
1640 in Königsberg bildeten. Köln, Frankfurt am Main, Nürnberg und
Venedig waren damals die Haupthandelsplätze für Bernstein. Später
wurden mit großer Strenge waltende Bernsteingerichte eingesetzt, und
die Strandbewohner mußten den Bernsteineid schwören, in welchem sie
gelobten, allen gefundenen Bernstein an die Behörde abzuliefern, die
sich das alleinige Recht am Bernstein anmaßte. Und diejenigen, die das
anstrengende und gefährliche Amt hatten, den Bernstein aus dem Meere
mit Netzen zu fischen, erhielten als einzige Entschädigung das für
ihr Fischereigewerbe nötige Salz. Diese unnatürlichen Verhältnisse
führten zur Verpachtung der Bernsteinnutzung an Danziger Kaufleute,
die alsbald den Handel bis Indien und Persien ausdehnten und in vielen
Städten Faktoreien einrichteten. Die guten Geschäfte, die sie dabei
machten, veranlaßte die Regierung, die Sache wieder selbst in die Hand
zu nehmen. Doch wechselten in der Folge noch vielfach Verpachtung und
Selbstverwaltung miteinander ab. Erst zu Ende des 18. Jahrhunderts
wurde der Bernsteineid abgeschafft, seit 1811 wurde das Recht der
Bernsteingewinnung in Generalpacht gegeben und seit 1837 an den
Meistbietenden verkauft.
Der Bernstein der preußischen Ostseeküste wurde später auch aus dem
Meere gebaggert und wird seit 200 Jahren am Lande in großem Maßstabe
gegraben. Er findet sich in der sogenannten Blauen Erde, einer durch
Glaukonitkörnchen bläulich gefärbten, sandig-tonigen Bildung von
1,25–6 m Mächtigkeit, zusammen mit Holzresten, Haifischzähnen,
Meeresmuscheln usw. Diese Blaue Erde ist unteroligozänen Alters, doch
findet sich der Bernstein in ihr auf sekundärer Lagerstätte; er muß
also älter sein und wurde von einem damals durch das Meer zerstörten,
gegen Skandinavien zu gelegenen Land hier eingeschwemmt. Mit welcher
Gewalt heute noch besonders Nordweststürme Bernstein vom Meeresgrunde
loslösen, um ihn, meist in Tange eingewickelt, mit den Wellen ans Land
zu treiben, das beweist, daß in einer einzigen Herbstnacht 1862 in der
Gegend von Palmnicken und Nodems nicht weniger als gegen 2000 kg
Bernstein angeschwemmt wurden. Meist sind es nur kleine Stücke, und
solche von 500 g kommen darunter nur selten vor. Das größte bis
jetzt bekannt gewordene Stück Bernstein wog 6750 g und befindet
sich im königlichen Mineralienkabinett in Berlin.
Wie schon der große Aristoteles (384–322 v. Chr.) richtig vermutete,
ist der Bernstein ein von einem Baume geflossenes Harz. Diese[S. 203]
Erkenntnis einiger Gelehrter des Altertums ging im Mittelalter wieder
verloren und an ihre Stelle traten die vagsten Vermutungen, bis erst
wieder Boch 1796 ihn für ein fossiles Pflanzenharz erklärte und
Struve ihn 1811 von einem Nadelholze ableitete. Conventz wies dann
nach, daß der Bernstein des Samlandes von einer Fichte, Picea
succinifera, abstammt, deren Holz- und Rindenreste häufig im
Bernstein eingeschlossen vorkommen. Wie bei den heutigen Kiefern und
Fichten sogenannte Harzgallen mitten im Holz entstehen, so bildeten
sich solche bei der Bernsteinfichte auch im Kambium. In ihrem
Harzreichtum kann letztere mit der vorhin besprochenen neuseeländischen
Agathis australis verglichen werden, deren Stamm und Äste
dermaßen von Harz triefen, daß sie vielfach davon wie mit Eis in
Krusten und Zapfen bedeckt sind. Das Harz der Bernsteinfichte wurde in
solchen Massen ausgeschieden, daß es den Stamm herablief und sich um
die Wurzeln sammelte, oder von den Zweigen tropfte und auf allerlei am
Boden liegende Blätter fiel, deren Form es im Abdruck bewahrte. Dabei
wurden zahlreiche Insekten und andere Tiere vom zähen Harz umflossen
und in ganz idealer Weise durch die Jahrmillionen bis auf unsere Zeit
konserviert. Die zahlreichen pflanzlichen Einschlüsse beweisen, daß
der Bernsteinwald, der spätestens eozänen Alters ist und von manchen
selbst in die oberste Kreide verlegt wird, außer Tannen und Fichten
Lebensbäume (Thuja), Eichen, Palmen, Lorbeergewächse, Erikazeen,
Farne, Flechten und Moose enthielt. Ungeheure Zeiträume hindurch
standen diese Wälder und sammelte sich in ihnen der Bernstein an.
Die Bäume selbst, die ihn ausgeschwitzt haben, sind mit allen andern
Lebewesen schon längst zugrunde gegangen und nur das unverwesliche Harz
derselben hat sich durch die ungeheuren Zeiträume, die uns von jener
Periode trennen, erhalten.
Der Bernstein ist meist klar und gleichmäßig honiggelb, seltener
gelblichweiß bis braun gefärbt; nur ausnahmsweise ist er mit Luftblasen
erfüllt und schaumig. Er entwickelt beim Reiben einen eigentümlichen
Geruch, wird dabei negativ elektrisch, schmilzt bei 287°, brennt mit
rußender Flamme, wobei er einen angenehmen Geruch entwickelt, wird
beim Erhitzen in Öl weich und biegsam und läßt sich dann in Formen
pressen, dabei wird milchiger Bernstein durchsichtig. Früher wurde
er hauptsächlich zu Amulettschmuck verarbeitet, wie heute noch aus
ihm bestehende Perlenhalsbänder mit Vorliebe zahnenden Kindern zum
vermeintlichen Erleichtern des Zahnens um den Hals gehängt werden.
Gegenwärtig wird er meist zu Zigarren- und Pfeifen[S. 204]spitzen verarbeitet,
während der Abfall und die kleinen Stücke zur Herstellung eines
trefflichen Firnisses benutzt werden. Früher glaubte man bei uns wie
heute noch in Rußland, daß er alle Krankheiten anziehe und so seinen
Träger davor beschütze, weshalb Bernsteinhalsbänder sehr beliebt und
geschätzt waren. Desgleichen sollten aus Bernstein verfertigte Schalen
und Schüsseln jede Vergiftung der aus ihnen genossenen Speisen und
Getränke verunmöglichen und aufheben, was besonders im alten Rom der
Cäsaren für sehr wertvoll gelten mußte, da dort solche in gewissen
Kreisen an der Tagesordnung waren. Gegenwärtig ist Bernstein namentlich
in China und Japan als geschätztes Amulett gegen Krankheiten,
in Marokko gegen die Gefahren des Krieges viel im Gebrauch. Im
ganzen wird in Deutschland jährlich für 2165000 Mark Bernstein für
Zigarren- und Pfeifenmundspitzen, für 145000 Mark für Halsperlen
und für 190000 Mark für Firnis und Lack verbraucht. Plinius erzählt
in seiner Naturgeschichte, daß er zu seiner Zeit besonders von den
Kelten der Poniederung und der Südabhänge der Alpen als Schutzmittel
gegen den Kropf getragen wurde. Schon in den vorgeschichtlichen
Niederlassungen Oberitaliens findet er sich häufig, ist aber hier
nicht der ostpreußische gelbe, sondern ein in der miozänen Molasse des
Landes selbst, speziell der Emilia, gefundener rötlicher oder brauner
Bernstein, der aber nur in erbsen- bis nußgroßen Stücken vorkommt. Bei
der überaus großen Wertschätzung, die aller Bernstein seit der jüngeren
Steinzeit bei sämtlichen europäischen Völkern genoß, ist es nicht zu
verwundern, daß solcher bereits in vorgeschichtlicher Zeit auch aus dem
Potal nach den danach lüsternen Ländern im östlichen Mittelmeergebiet
gelangte, sonst hätten nicht, wie wir vorhin sahen, die phönikischen
Kaufleute den ältesten Griechen angegeben, daß der Bernstein von den
Ufern des Eridanos (= Po) komme, wo er durch die starke Hitze der dort
in der Nähe vorbeifahrenden Sonne aus gewissen Bäumen ausgeschwitzt
werde. Übrigens gibt es in den meisten Ländern Europas und anderwärts
verschiedenerlei, meist tertiären Landbernstein, der eine mehr oder
weniger starke Verwitterungskruste besitzt, wodurch er sich vom
Seebernstein der Ostseeküste unterscheidet; doch ist er nirgends in
solcher Massenhaftigkeit wie in der Blauen Erde der ostpreußischen
Küste vorhanden, wird zudem meist nur in kleinen, gewöhnlich dunkel
gefärbten Stücken gefunden und hat infolgedessen auch keinerlei
Bedeutung als Handelsartikel erlangt.
Ferner findet zur Bereitung von Firnis das Lackharz vielseitige[S. 205]
Verwendung. Es ist dies ein in mehr oder weniger dicken Krusten,
seltener auch Tropfen von Zweigen indischer und hinterindischer
Sträucher und Bäume wie Aleurites lactifera, Schleichera
trijuga, Butea frondosa, besonders aber Feigenarten wie
Ficus religiosa und indica abgelesenes Harz, das durch
die Weibchen der Lackschildlaus (Coccus lacca) hervorgebracht
wird. Diese sammeln sich an den betreffenden Zweigen so massenhaft
an, daß jene von ihnen geradezu rot bestäubt erscheinen. Nach ihrer
Befruchtung stechen sie ihre lebende Unterlage an und scheiden durch
Umwandlung des von ihnen aufgesaugten Saftes in ihrem Körper die
Harzmasse als Exkret aus, die die Tierchen völlig umhüllt und oft auf
die darunter befindlichen Zweige herabtropft. Unter dieser schützenden
Umhüllung, in welcher der aufgebrauchte weibliche Organismus zugrunde
geht und der Nachkommenschaft als Wiege dient, entwickeln sich die
jungen Schildläuse, bis sie, reif geworden, dieselbe durchbohren
und ausschlüpfen. Der Lack wird nun samt den Zweigen von den Bäumen
abgebrochen und von jenen abgelöst, und zwar meist erst nach dem
Ausschlüpfen der Schildläuse, um die Produktion nicht herabzusetzen.
Früher wurde der undurchbohrte Lack, der noch die jungen Schildläuse
und damit viel roten Farbstoff enthält, höher geschätzt als jetzt und
speziell in Indien zur Gewinnung eines scharlachroten, dem Karmin
der Cochenille an Leuchtkraft sehr nahe kommenden, zur Färbung von
Baumwolle und Seide verwendeten Farbstoffs benutzt, der daselbst heute
noch als Lacklack in den Handel kommt. Entzieht man der Masse
den roten karminartigen Farbstoff mit schwacher Sodalösung, so entsteht
der gelblichbraune Körnerlack, aus dem man durch Schmelzen
und Auffangen der bei 140° geschmolzenen Masse auf Bananenblättern
den Schellack in Form von glänzenden, braunroten, dünnen,
flachen Stücken mit muscheligem Bruch gewinnt. Der Schellack schmilzt
leicht, löst sich größtenteils in Weingeist und Äther, in Alkalien und
gesättigter Boraxlösung; er kann auch durch Chlor gebleicht werden,
wodurch er für die Herstellung von farblosen Firnissen besonders
geeignet wird. Man gebraucht ihn namentlich zur Bereitung der
Weingeistfirnisse, der Tischlerpolitur, des Siegellacks, verschiedener
Kitte und in der Feuerwerkskunst, auch bildet er die Hauptmasse des
Marineleims und der Elektrophorkuchen. In Borax aufgelöst dient er
als Wasserfirnis zum Steifen und Wasserdichtmachen der Filzhüte, zum
Firnissen von Papier und, mit feinem Ruß versetzt, als unauslöschliche
Tinte.
In China und Japan dagegen wird der Lack durch Einschnitte[S. 206] in Stamm
und Äste des zu den Terebinthen oder Balsamgewächsen gehörenden
Firnissumachs (Rhus vernicifera) gewonnen. Es ist dies ein
daselbst heimischer, zur Lackgewinnung vielfach auch angepflanzter
äußerst giftiger Baum, dessen Ausdünstungen schon schädlich sind und
dessen übelriechender Saft, auf die Haut gebracht, starke Entzündung
derselben mit Bildung von schmerzhaften Geschwüren hervorruft. Er
erreicht eine Höhe von 8–10 m und hat gestielte, eiförmige,
zugespitzte, unten mit feinen Haaren bedeckte Blätter, die nicht giftig
sind. In dem durch Einschnitte in die Rinde ausfließenden weißen
Milchsaft ist das Lakkol enthalten, das durch ein Lakkase genanntes
Ferment an der Luft in den glänzend schwarzen Lack umgewandelt
wird. Aus diesem Produkt stellen die Ostasiaten, besonders die
Japaner, durch Mischen mit dem Öle der Bignonia tomentosa,
eines Kletterstrauches mit großen trompetenartigen Blüten, oder der
Perilla ocymoides, mit Zusatz von Zinnober, wenn die Farbe
eine rote sein soll, sonst ohne solchen, ihren berühmten Lackfirnis
her. Schon im Mittelalter war bei ihnen dieser prächtige, fast
unverwüstliche Firnis im Gebrauch, um mit ihm fast alle Holzgegenstände
des täglichen Gebrauchs, Eß- und Trinkgeschirr, wie auch kleine und
große Möbel, selbst ganze Tempel zu überziehen. Schon aus der Zeit des
12.-15. Jahrhunderts sind uns Namen berühmter Lackkünstler überliefert,
und um 1700 hatte die Lackkunst besonders durch den Maler Ogata Korin
ihren Höhepunkt erreicht. Die ersten japanischen Lackwaren gelangten
in der zweiten Hälfte des 16. und zu Beginn des 17. Jahrhunderts durch
die seit 1557 auf der Insel Macao an der Mündung des Perlflusses
133 km südöstlich von Kanton niedergelassenen Portugiesen
und dann aus Manila, der Hauptstadt der durch die seit 1569 von den
Spaniern besetzten Philippinen, nach Europa. War doch das durch die
Reisebeschreibung des Venezianers Marco Polo aus dem 13. Jahrhundert
als Zipangu im Abendlande bekannte Japan 1543 von den Portugiesen
entdeckt und von ihnen der erste Handelsverkehr mit jenem kunstsinnigen
Volke angebahnt worden. Sie brachten dann die Jesuiten ins Land, als
deren berühmtester Missionar der heilige Franz Xaver zu nennen ist.
Aber von 1617–1637 gab es dann Reibereien zwischen den Vertretern
beider Nationen, die damit endigten, daß die zahlreichen unter den
Japanern gewonnenen Christen wieder ausgerottet und die Portugiesen
vertrieben wurden. Dafür erhielten die Holländer, die seit 1609 freien
Zutritt und Erlaubnis zum Handeln erlangt hatten, eine allerdings recht
beschränkte Möglichkeit der Ausfuhr japanischer[S. 207] Kunstgegenstände,
unter denen außer Porzellan- und Metallgegenständen hauptsächlich
Lackartikel eine wichtige Rolle spielten. Da diese letzteren bei den
Vornehmen Europas großen Beifall fanden und viel begehrt wurden,
suchten die Holländer sie bald auch nachzuahmen, was ihnen indessen
nicht gelang. Eine ganze Sammlung japanischer Lackarbeiten besaß im 18.
Jahrhundert die unglückliche Königin Marie Antoinette; diese ist jetzt
im Louvre zu sehen.
Heute wird der Japanlack in folgender Weise gewonnen und benutzt.
Zuerst wird der Milchsaft des im Japanischen urushi-no-ki
genannten Lackbaums in der Weise gewonnen, daß man die Bäume
einschneidet, den zwischen den Schnittflächen sich ansammelnden,
rasch trocknenden, zähen schmutzigweißen, an der Sonne erst braun und
dann schwarz werdenden Saft auskratzt und sammelt. Der beste Lack
wird im August gewonnen, und zwar aus dem Stamm; der von den Ästen
herrührende ist härter und zäher. Er enthält 60–80 Prozent Lack- oder
Urushinsäure (C14H18O2), 3–6 Prozent
Gummi, 1–3 Prozent Eiweiß, 10–30 Prozent Wasser und eine geringe Menge
giftiger, flüchtiger Säure. Infolge des letzteren ist das Sammeln des
Lackharzes eine gefährliche Beschäftigung und wird nur von der ärmsten
Volksklasse geübt. Das Lackieren selbst ist viel weniger gefährlich
und es beschäftigen sich damit zahlreiche Personen. Die Gefährlichkeit
dieser Arbeit wird durch den Umstand vermindert, daß diejenigen, die
eine heftigere Vergiftung damit durchmachten, eine solche nicht mehr zu
befürchten haben.
Die japanische Industrie hütete bis vor kurzem sorgfältig das Geheimnis
ihres Lackes vor den Augen der Europäer, und obschon die Holländer
mit großem Eifer bestrebt waren, dasselbe zu erfahren, konnten sie
doch die Qualität des japanischen Lackes nicht erreichen, der erst
neuerdings als Rhus- oder Japanlack auf den europäischen Markt
gelangt. In Japan ist seine Verwendung eine sehr allgemeine. Da diese
vulkanische Insel kein so vorzügliches Kaolin und solchen Lehm wie
das meist aus alten Sedimentformationen aufgebaute benachbarte China
besitzt, kamen seine Bewohner schon früh dazu, ihre Gefäße statt aus
gebranntem Ton und Porzellan wie die Chinesen aus Holz herzustellen
und dieses durch einen Harzüberzug wasser-, feuer- und säuredicht zu
machen. Dazu wurde außer dem Harz von Euphorbien und Anacardiazeen
vor allem das Harz des Lackbaumes benutzt. Die alten Lackerzeugnisse,
unter welchen 600–700jährige Arbeiten vorkommen, sind die besten und
widerstandsfähigsten. Echte Lackgefäße[S. 208] werden auch von siedendem
Wasser nicht beschädigt; auch Säuren und andere Ätzflüssigkeiten können
ihnen nichts anhaben. Nur im Feuer geht der Lack zugrunde, wenn das
seinen Grundstoff bildende Holz zu Kohle gebrannt ist. Das damit zu
überziehende Holz wird zuerst geglättet, jede Fuge mit Papier oder Werg
ausgefüllt und dann mit dünnem Bast oder Hanf überklebt, worauf die aus
Ocker und Pappe bestehende Schicht kommt. Auf diese Grundierung werden
je nach Art des Objektes und der Feinheit des gewünschten Überzuges
3–30 dünne Lackschichten aufgetragen. In die obere Schicht kommen die
Farbstoffe, besonders Zinnober und Goldstaub, und schließlich der
Glanzstrich. Die Hauptsache dabei ist, daß die einzelnen Lackschichten
gut trocknen, was nicht in trockener, sondern in etwas feuchter Luft
geschehen muß, weshalb auch der echte japanische Lack in alter Zeit in
feuchten Gruben oder in der Nähe von Wässern auf schwimmenden Kähnen
getrocknet und poliert wurde.
Die hochentwickelte japanische Lackindustrie hat nicht nur die
Abendländer zur Nachahmung gereizt, sondern auch deren einheimische
Firnisverwendung in weitgehendem Maße beeinflußt. Weniger war dies bei
der indischen und persischen Lackfabrikation der Fall, die sich seit
dem Altertum selbständig entwickelte. Die Produkte derselben stehen
nicht auf der Höhe der japanischen Lackarbeiten und haben ein für
unseren Geschmack zu buntes Aussehen. Sowohl Muster als Farben sind
zweifellos von ihr der einheimischen Schalfabrikation entlehnt, die in
diesen Ländern eine uralte einheimische Industrie ist, deren Produkte
früher auch von den Damen des Abendlandes, besonders um die Mitte des
letzten Jahrhunderts viel mehr als heute geschätzt wurden.
Wie die buntgemusterten Schale und Lackarbeiten ist der aus dem
indischen Lacke hergestellte rote Siegellack ebenfalls eine Erfindung
und ein Erzeugnis Ostindiens, das aus jenem Lande ums Jahr 1560 durch
die Portugiesen nach Europa gebracht wurde und hier als „spanisches
Wachs“ bald weitere Verbreitung fand. Vorher hatte man hier allgemein
auf Wachs — die Babylonier mit ihren hübsch aus Halbedelsteinen
geschnittenen Siegelzylindern auch auf weichem, später gebranntem Ton
— gesiegelt, und zwar durften bis zur Aufnahme des roten indischen
Siegellacks nur Kaiser und Könige in rotem Wachs siegeln. Später wurde
bei uns der rote indische Siegellack auf mancherlei Weise nachgeahmt.
Tafel 115.
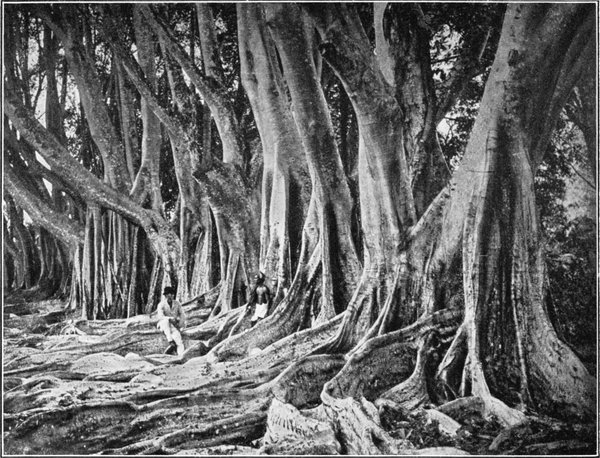
Allee des kautschukliefernden indischen Feigenbaumes (Ficus
elastica) im Botanischen Garten von Peradeniya auf Ceylon. Die
Bäume sind mit schmalen, hohen Wurzelstützen, sogenannten Tafelwurzeln,
zum Schutze gegen das Umgeworfenwerden durch Orkane ausgestattet.

Japanische Bronze- und Lackarbeiter.
Tafel 116.

Altchinesische Fruchtschale in geschnitzter Lackarbeit (Peking-Lack).
Aus „Berichte des k. ethnographischen Museums in München 1909“.
Durchmesser 45 cm bei 14 cm Höhe. Die dünne Holzwandung
ist nach Ausgleichung aller Unebenheiten und Verbindungsnähte durch
feines Werg und Papier mit Gaze überzogen; darüber liegt eine Schicht
aus einer Mischung von Schmirgel- oder Sandsteinpulver und einem
harzigen oder tierischen Bindemittel, die nach vollständiger Trocknung
mit einem Polierstein sorgfältig geglättet ist. Auf diese Unterlage,
die an kleinen Bruchstellen nachgeprüft werden kann, sind drei
Lackschichten aufgetragen, die vom Künstler einzeln bearbeitet wurden.
Den Grund bildet eine ledergelbe Schicht, der eine braungrüne Lage
folgt, und über beide ist eine zinnoberrote Decke gelegt. Die in diese
drei Lackschichten eingeschnittene Ornamentierung zeigt ein in der
chines. Kunst gewohnheitsmäßig wiederkehrendes, auch von den Japanern
übernommenes Dekorationsmotiv, nämlich den Drachen als symbolisierten
Blitz in einer stilisierten Regenwolke.
❏
GRÖSSERES BILD
Während der Lack in Indien außer zu Siegellack besonders zur[S. 209]
Gewinnung des roten Farbstoffs benutzt wird, verwenden wir ihn zu den
verschiedensten schützenden Überzügen namentlich auf Gegenständen
von Holz oder Pappe (papier mâché). Der meiste Lack kommt
aus den Gangesländern, Siam und Annam zu uns, und zwar ist der
Hauptausfuhrhafen dafür Kalkutta.
Von nicht aus solchem indischen Lack hergestellten Firnisüberzügen,
die technisch in Europa und allen Kulturländern von Bedeutung sind,
ist der wichtigste der aus Zelluloid, d. h. nitrierter, mit einer
alkoholischen Lösung von Kampfer und je nach Bedarf auch Farbstoffen
und Rizinusöl versetzter Baumwolle oder Seidenpapier hergestellte
Zaponlack, den man verwendet, um blanke metallische Flächen,
die keiner erheblichen Wärme und keinen starken mechanischen Angriffen
ausgesetzt sind, vor der Einwirkung von Luftgasen oder Säuren zu
schützen. Außer der Elektrotechnik haben sich auch andere Industrien
die Vorteile desselben zunutze gemacht. So ist z. B. heute fast alles
Silber zum Schutze gegen Oxydierung in Zaponlack getaucht. Wenn man
häufig gebrauchte silberne Geräte einige Zeit nachdem man sie gekauft
hat besieht, bemerkt man, daß gewisse gelbliche Stellen des Lackes
abgeblättert sind. Das ist eben der infolge des starken Gebrauchs
abgegriffene Zaponlack.
[S. 210]
XXV.
Die duftenden Pflanzenharze.
Wie sich der Mensch gerne zu festlichen Anlässen mit wohlriechendem
Öle salbt und die Kleidungsstücke mit parfümiertem Wasser besprengt,
so verwendet er seit Urzeiten gerne zu gottesdienstlichen Handlungen
Räucherungen von duftenden Hölzern und Harzen, als deren vornehmstes
der Weihrauch sich bis auf unsere aufgeklärte Zeit erhalten hat.
Schon im vierten und fünften vorchristlichen Jahrtausend haben die
alten Kulturvölker des Morgenlandes ihren Göttern teils in Verbindung
mit blutigen oder unblutigen Opfern, teils mit Gebet und Gesang
Weihrauch, Myrrhen und Galbanum geopfert, um sie durch den dabei
ausströmenden Wohlgeruch zu erfreuen. Nach der Mitteilung des Vaters
der Geschichtsforschung Herodot, verbrannten die Chaldäer beim Feste
des Bel in Babylon alljährlich für tausend Talente, d. h. 4710000 Mark
Weihrauch, und nach Plutarch brachten die Ägypter morgens, mittags und
abends der Sonne ein Weihrauchopfer dar. Auch bei den Juden wurden
morgens und abends auf dem vor dem Vorhange des Allerheiligsten in
der Stiftshütte und später im Tempel stehenden, mit Gold überzogenen
Räucheraltar allerlei wohlriechende Spezereien, vor allem auch
Weihrauch, verbrannt. Bei den Griechen kam der Gebrauch des Weihrauchs
zum Opfer durch Vermittlung der Phönikier etwa im 7. vorchristlichen
Jahrhundert auf, bei den Römern erheblich später, in Verbindung mit
Weinspenden, während vorher Met oder Milch der Herdentiere dazu gedient
hatte. Die Christen betrachteten anfänglich solche Rauchopfer als
heidnische Greuel; aber bereits im Verlaufe des 4. Jahrhunderts drangen
sie auch in den christlichen Kultus ein, nur verbot man, diese Gott und
den Heiligen allein zukommende Ehrung nach römischer Sitte auch den
kaiserlichen Bildsäulen zukommen zu lassen.
[S. 211]
Der Weihrauch und die anderen beim Verbrennen duftenden Pflanzenharze
wurden im heidnischen wie im jüdischen und zuletzt im christlichen Kult
in Metallgefäßen verbrannt, die an Ketten getragen und hin und her
geschwungen wurden, um die Tempelräume mit Wohlgerüchen zu erfüllen.
Solche bronzene Räucherpfannen (lateinisch turibula incensoria)
wurden mehrfach in Pompeji gefunden und sind schon in altägyptischen
Tempeldarstellungen abgebildet. In nichts ist ja der Mensch so
konservativ als im Kult. Und damit der Gottheit dargebrachte Rauchopfer
lassen sich bis in das früheste Altertum zurückverfolgen. Aus der
biblischen Geschichte kennen wir sehr wohl den Wert, der auf solche
Räucherharze gelegt wurde, und wissen aus der Weihnachtsgeschichte wie
die Weisen aus dem Morgenlande, die dem Sterne nachgegangen waren,
bis sie das Jesuskindlein in Bethlehem fanden, anbetend vor ihm
niederfielen und ihre Schätze auftaten und ihm Gold, Weihrauch und
Myrrhen als das Kostbarste, was es damals gab, schenkten.
Beim altisraelitischen Gottesdienst wurde neben Weihrauch und Myrrhe
auch chelbenah, was (erhärtete) Milch bedeutet, lateinisch
galbanum, geopfert, eine Droge, die der berühmte griechische
Arzt Hippokrates, der große Aristotelesschüler Theophrastos und
andere als chalbánē erwähnen. Es ist dies der am Stengel und
an der Basis des persischen Doldengewächses Ferula galbaniflua
freiwillig austretende erhärtete Milchsaft, der in Form von mehr
oder weniger verklebten, außen grünlichbraunen Körnern, die oft zu
einer gleichartigen Masse vereinigt sind, in den Handel gelangt. Er
ist in der Kälte spröde, zwischen den Fingern knetbar, riecht stark
aromatisch, schmeckt etwas bitter, terpentinartig und diente früher
auch als Arzneimittel, indem man ihm eine gewisse Einwirkung auf das
Uterinsystem zuschrieb. Heute wird er bei uns nur noch äußerlich
als leicht hautreizendes Pflaster unter der Bezeichnung Mutterharz
verwendet. Noch im Mittelalter war er eine nicht unwichtige Droge,
die als ein Handelsartikel Venedigs mehrfach erwähnt wird und sich
auch unter den Effekten des im Jahre 1360 in England gefangenen Königs
Johann von Frankreich befand.
Wichtiger war den alten Kulturvölkern des Morgenlandes die aus Arabien
stammende Myrrhe, ein in unregelmäßigen Körnern oder Knollen
von Nuß- bis Faustgröße in den Handel gelangendes, gelbliches bis
braunes, durchscheinendes Gummiharz verschiedener in Nordostafrika
und Südarabien heimischer Terebinthenarten, von denen[S. 212] der echte
Myrrhenbaum, Commiphora (d. h. Gummierzeuger) myrrha,
der wichtigste ist. Von dem nur etwa 6–8 m hohen Baum fließt
das Myrrhenharz von selbst nach austrocknenden Winden, die die Rinde
zum Bersten bringen, nachdem sich das Holz durch vorausgegangene Regen
mit Wasser gefüllt hat, aus in Form eines milchig trüben, gelblichen
Saftes und erstarrt, allmählich dunkler werdend, zu einer eigentümlich
balsamisch riechenden und gewürzhaft bitter schmeckenden Masse, die
sich beim Erhitzen aufbläht und einen angenehmen Geruch verbreitet.
Die Myrrhe enthält verschiedene ätherische Öle, Gummi und Harz und hat
ihren Namen aus dem arabischen murr, was bitter bedeutet. Seit
den ältesten Zeiten bildete sie neben dem Weihrauch einen wichtigen
Bestandteil der Räucherungsmittel und wohlriechenden Salben, die im
Orient bei allen gottesdienstlichen Handlungen zur Anwendung gelangten.
Der griechische Geschichtschreiber Plutarch berichtet uns, daß die
Priester im Tempel der Isis täglich dreimal räucherten, und zwar des
Morgens mit Balsam, gegen Mittag mit Myrrhen (bal) und am
Abend mit kyphi, einer Mischung von 16 und mehr verschiedenen
Ingredienzen, bei deren Anfertigung auf die Heiligkeit der Zahl vier
Rücksicht genommen werden mußte.
Das Kyphi ist ein in den hieroglyphischen Inschriften ungemein häufig
erwähntes heiliges Räuchermittel. Das altägyptische Totenbuch nennt
verschiedene Bestandteile desselben; außerdem haben uns griechische
Schriftsteller so ausführliche Mitteilungen darüber hinterlassen, daß
wir die wichtigsten Bestandteile desselben kennen. Allerdings stieg die
Zahl der Ingredienzen, die anfänglich nur wenige betrugen, im Lauf der
Jahrhunderte auf mehrere Dutzend. Deren Mischung wurde in den Tempeln
selbst vorgenommen, und nach Plutarch las man den Salbenreibern und
Räuchermittelmischern während ihrer Arbeit aus heiligen Schriften
vor, damit ihre Gedanken dabei auf das Göttliche gerichtet seien. Aus
den Inschriften an den Tempelwänden und dem Texte der Papyri erfahren
wir von der harzigen Ausschwitzung eines nicht näher definierbaren
arabischen Baumes aus der Familie der Myrrhenbäume, aus welcher
die Salbenreiber der ägyptischen Tempel in besonderen Laboratorien
(asit) ein Räuchermittel herstellten. Dann wird das Produkt des
ebenfalls arabischen Tesepbaumes (vermutlich auch einer Commiphora-Art)
häufig in den Kyphirezepten erwähnt, auch fand dessen Gummiharz wie
die Myrrhe beim Einbalsamieren der Leichen Verwendung. Die wichtigsten
Bestandteile des Kyphi aber waren verschiedene Weihrauch- und
Myrrhenarten; daneben gelangte[S. 213] auch Mastixharz zur Anwendung, von dem
man zur Zeit der Pharaonen schon drei Sorten, nämlich schwarzes, weißes
und rotes unterschied.
Bei den alten Ägyptern dienten Myrrhen auch als Arznei, zum Würzen
von Wein und zum Herstellen von wohlriechenden Salben, mit denen bei
festlichen Anlässen vor allem das Haupthaar gesalbt wurde. Auf letztere
nimmt das älteste uns aus der altägyptischen Literatur erhaltene
Gedicht aus dem mittleren Reich (2160–1788 v. Chr.) Bezug, nämlich das
„Lied des Harfners“, der den Schmausenden in den Häusern der Reichen
während des Mahles vorsang und sie folgendermaßen zum Lebensgenusse
aufforderte.
„Folge deinem Wunsch, dieweil du lebst,
Lege Myrrhen auf dein Haupt,
Kleide dich in feines Linnen
Getränkt mit köstlichen Wohlgerüchen,
Den echten Dingen der Götter.
Vermehre deine Wonne noch mehr,
Laß dein Herz nicht müde sein,
Folge deinem Wunsch und deinem Vergnügen
Und schaffe dir ein Schicksal auf Erden
Nach den Wünschen deines Herzens,
Bis jener Tag der Trauer zu dir kommt;
Denn Osiris erhört ihr Schreien nicht,
Und keinen Menschen ruft die Totenklage aus dem Grabe zurück.
Feiere den frohen Tag und ruhe nicht an ihm!
Denn siehe, niemand nimmt seine Güter mit sich,
Und noch keiner kehrte zurück, der dorthin gegangen ist.“
Auch bei den Juden im Alten Testamente ist viel von Myrrhen zu
gottesdienstlichen Räucherungen und als profanes Duftmittel bei
festlichen Anlässen die Rede. Was alles an solchen Wohlgerüchen damals
bekannt war, zählt uns der um 800 v. Chr. lebende Dichter des Hohen
Liedes auf, wenn er in Kap. 4, 13 von der Geliebten sagt, ihr Körper
dufte „wie Zypern mit Narden, Narden mit Safran, Kalmus und Kinnamom
(Zimt), mit allerlei Bäumen des Weihrauchs, Myrrhen und Aloē (dem zu
Räucherungen verwandten wohlriechenden Aloeholz), mit allen besten
Würzen“. Und in Kap. 5, 5: „Meine Hände troffen von Myrrhen(-salbe)
und Myrrhen liefen über meine Finger.“ In[S. 214] Kap. 3, 10 spricht er zur
Geliebten: „Der Geruch deiner Salben übertrifft alle Gewürze.“
Von den Ägyptern und Vorderasiaten gelangte der Gebrauch der Myrrhe
als gottesdienstliches Räucherwerk und Parfüm bei festlichen Anlässen
zu den Griechen und Römern, die sie in ähnlicher Weise wie die Ägypter
anwandten. Als geschätztes Heilmittel empfehlen sie die römischen Ärzte
Scribonius Largus und Alexander Trallianus (im 6. Jahrhundert n. Chr.).
Cornelius Celsus spricht von einer schwarzen, bei Augenkrankheiten
angewandten Myrrhe. Auch im Dispensatorium des Valerius Cordus wird
die Myrrhe angeführt. Die heilige Hildegard nennt im 12. Jahrhundert
mirrha und empfiehlt sie gegen allerlei Erkrankungen. So hat
sich die Myrrhe als geschätztes Heilmittel, wenn auch nicht als
Räucherwerk, bis auf unsere Tage auch im Abendlande im Gebrauch
erhalten.
Noch viel wichtiger als die Myrrhe war als Räuchermittel bei allen
gottesdienstlichen Handlungen der Orientalen der Weihrauch, von
welchem die Alten, wie auch von der Myrrhe, verschiedene, größtenteils
nach den Orten der Herkunft benannte Arten unterschieden. Ihre Erzeuger
sind verschiedene Boswellia-Arten, von denen Boswellia carteri,
der echte Weihrauchbaum, von den Altägyptern anti genannt,
der wichtigste war. Die Weihrauchbäume sind, wie die Myrrhenbäume,
in Nordostafrika nahe dem Kap Guardafui und auf einem beschränkten
Saum der mittleren, als Hadramaut bezeichneten Südostküste Arabiens
heimisch. In deren Stämme werden zu Ende Februar oder Anfang März und
dann noch zweimal jeweilen innerhalb Monatsfrist von den Eingeborenen
tiefe Einschnitte gemacht, aus denen ein milchweißer Saft reichlich
ausfließt, nach einiger Zeit erstarrt er zu gelben Körnern, die dann
von den Stämmen abgelöst oder am Boden aufgelesen werden. Sie schmecken
aromatisch, etwas bitter, erweichen im Mund und geben, auf glühende
Kohlen gestreut, einen angenehmen balsamischen Geruch von sich. Wie
dieser Geruch den Menschen angenehm war, so dachte man sich, werde er
auch die Götter erfreuen. So verbrannte man schon im ältesten Ägypten
zu Ehren der Himmlischen den Weihrauch (anti), den man als eine
der größten Kostbarkeiten mit der Myrrhe und den Gewürzen Indiens aus
dem südlichen Arabien bezog. Wegen dieser aufs höchste geschätzten
Produkte wurde jenes Land von allen weiter westwärts wohnenden
Völkern, denen es dieselben übermittelte, stark beneidet und glücklich
gepriesen. Das Land Jemen in der Südwestecke Arabiens war ihnen das
„Glückliche[S. 215] Arabien“. Hier bestand in frühest nachweisbarer Zeit schon
in der ersten Hälfte des zweiten vorchristlichen Jahrtausends das
Reich von Machīn, das dann später von demjenigen von Saba vernichtet
und abgelöst wurde. Von den Sabäern berichtet der griechische
Geschichtschreiber Diodoros aus Sizilien, daher Siculus genannt,
der zur Zeit Cäsars und Augustus’ in 40 Büchern die bis zum Jahre
60 v. Chr. reichende Geschichte fast aller damals bekannten Völker
schrieb: „Die Sabäer wohnen im Glücklichen Arabien, haben zahmes Vieh
in unermeßlicher Menge und so viel Balsam, Kassia, Zimt, Kalmus,
Weihrauch, Myrrhen, Palmen und andere wohlriechende Gewächse, daß das
ganze Land von einem wahrhaft göttlichen Wohlgeruch durchzogen ist, den
selbst die Seefahrer aus beträchtlicher Entfernung wahrnehmen; es ist
ihnen dann zumute, als röchen sie die fabelhafte Ambrosia.“
Der um 25 n. Chr. gestorbene griechische Geograph Strabon berichtet auf
Grund eigener Anschauung auf Reisen und des Studiums älterer Geographen
in seiner 17 Bücher umfassenden Geographika: „Im Lande der Sabäer, dem
gesegnetsten Arabiens, wächst Myrrhe, Weihrauch, Zimt und Balsam. Sie
holen auch Gewürze aus dem Negerlande, wohin sie mit ledernen Kähnen
fahren. Ihr Vorrat an dergleichen Herrlichkeiten ist so groß, daß sie
Zimt, Kassia und dergleichen wie Brennholz verbrennen und die reichsten
von ihnen, die Gerrhäer, alle Geräte im Hause wie Ruhebetten, Dreifüße,
Milchtöpfe, Teller usw. von Gold und Silber, und auch die Türen, Wände,
Decken mit Elfenbein, Gold, Silber und Edelsteinen geziert haben.“
Der griechische Philosoph Theophrast, Schüler des Aristoteles,
schreibt in seiner Pflanzengeschichte schon im 4. Jahrhundert v. Chr.:
„Weihrauch (líbanos), Myrrhe (smýrnē) und Balsam
(bálsamon) kommen aus Arabien und werden durch Einschnitte
gewonnen oder quellen von selbst aus den Bäumen hervor, die teils auf
dem Gebirge wild wachsen, teils auf eigenen Feldern am Fuß der Gebirge
kultiviert werden. Der Weihrauchbaum soll nur etwa fünf Ellen hoch und
sehr ästig sein. Seine Blätter sollen denjenigen des Birnbaums ähnlich,
nur viel kleiner und sehr grün sein; die Rinde soll glatt wie beim
Lorbeer sein. Der Myrrhenbaum ist noch kleiner, strauchartiger, der
Stamm soll hart, an der Erde hin und her gebogen und dicker als ein
Unterschenkel sein. Andere beschreiben diese Bäume anders. Seefahrer,
welche das Gebirge gesehen haben, berichten, die Bäume seien dort durch
Einschnitte verwundet, die Tropfen fielen teils herab, teils blieben
sie am Baume kleben. Man breite aus Baumblättern ge[S. 216]flochtene Matten
darunter, oder stampfe den Boden fest. Der von den Matten stammende
Weihrauch und die Myrrhe seien klar und durchscheinend, die vom
Erdboden aufgelesenen weniger, und die von den Bäumen geschabten seien
durch Rindenstücke verunreinigt.
Auf dem Gebirge der Sabäer fanden die Seefahrer keine Wächter, weil
dort kein Einwohner dem andern stiehlt. Diesen Zustand benutzten die
Fremden, sammelten große Massen dieser Stoffe und fuhren damit weg.
Übrigens hörten sie, daß die Sabäer ihren Weihrauch und ihre Myrrhe in
den Sonnentempel bringen, der von bewaffneten Wächtern beschützt wird.
Dort tut ein jeder seine Ware auf einen Haufen und legt auf diesen ein
Täfelchen, worauf der Preis angegeben ist. Kommen nun die Kaufleute, so
sehen sie nur nach den Täfelchen. Billigen sie den Preis, so nehmen sie
die Ware und legen das Geld hin.
Die Stücke Weihrauch, die in den Handel kommen, sind sehr verschieden
und manche wohl so groß, daß sie die Hand füllen können. Von der
Myrrhe hat man eine Sorte von natürlichen Tropfen, eine andere in
künstlich gestalteten Stücken.“ Der griechische Schriftsteller Flavius
Arrianus (um 100 n. Chr. zu Nikomedia in Bithynien geboren, ward 136
unter Hadrian Präfekt von Kappadokien und starb unter Marcus Aurelius)
berichtet in der Geschichte der Feldzüge Alexanders des Großen nach
den besten Quellen: „Als Alexander in die Wüste der Gedrosier (jetzt
Mekrân in Beludschistan) kam, standen dort viele ungewöhnlich große
Myrrhenbäume, die noch niemand ausgebeutet hatte. Die phönikischen
Kaufleute, die dem Heere folgten, führten ganze Ladungen von Myrrhe
weg.“ Und Plinius endlich sagt in seiner Naturgeschichte über dieses
Pflanzenprodukt: „Die Myrrhe (myrrha) wächst an mehreren
Stellen Arabiens, namentlich da, wo der Weihrauch wächst. Auch kommt
eine geschätzte Sorte von Inseln, und die Sabäer holen sogar Myrrhen
jenseits des Meeres bei den Troglodyten. Die Bäume sind dornig, wachsen
teils wild, teils absichtlich gepflanzt; aus ihnen schwitzt die Myrrhe,
kommt in Beutel gepackt zu uns, und die Salbenhändler sortieren sie
dann nach dem Geruch und der Fettigkeit. Auch Indien liefert eine
Myrrhensorte, aber eine schlechte.“
Endlich schreibt der griechisch-ägyptische Großkaufmann Kosmas
Indikopleustes (d. h. der Indienfahrer), ein Zeitgenosse des
oströmischen Kaisers Justinian I. (483–565 n. Chr.), der mit seinem
Freunde und Kollegen Menas von Alexandrien — beide gingen im höheren
Alter ins Kloster — eine Reise nach Ostafrika und Indien machte:
„Das Land, welches den Weihrauch hervorbringt, ist an der Südgrenze
von[S. 217] Äthiopien gelegen, im Innern des Kontinents; aber der Okeanos
reicht noch darüber hinaus. Daher ziehen die benachbarten Bewohner
Barbarias nach dem Hochland, und im Handelsverkehr führen sie von
dort die meisten Spezereien aus. Weihrauch, Kassia, Kalmus und vieles
andere, und sie schaffen es auf dem Seewege nach Adule (dem heutigen
Zeila in Massaua) und Glücklich-Arabien, nach Indien und Persien.
Schon im Altertum pflegte das zu geschehen; denn die Königin von Saba,
welche Christus die Königin von Mittag nennt, brachte Wohlgerüche und
Kostbarkeiten zu Salomo, welche auf der afrikanischen Ostküste heimisch
sind, ferner Ebenholz, Affen und Gold aus Äthiopien, da sie Äthiopien
benachbart jenseits des Roten Meeres wohnte.“ Hier erweist sich
allerdings der biedere Religiöse (denn er schrieb seinen Reisebericht
erst als Mönch) nicht als völlig bibelfest, da er die Geschenke der
Königin von Saba mit den Produkten zusammenwirft, die Salomo auf seinen
wiederholt ausgeführten Expeditionen nach Ophir (im jetzigen Rhodesia)
holen ließ. Später haben dann erst wieder arabische Geographen vom
Weihrauchlande aus eigener Anschauung Zuverlässiges zu berichten gewußt.
Sehr groß war der Verbrauch des Weihrauchs zu gottesdienstlichen
Räucherungen schon im alten Ägypten. Dabei wurden daselbst wie bei der
Myrrhe verschiedene Sorten unterschieden, die je nach der Gottheit,
der die Räucherung galt, verschieden gewählt wurden. So führt eine
Inschrift des Tempellaboratoriums in Edfu aus der Zeit der Ptolemäer
14 Sorten Anti-Harz (Weihrauch) neben 8 Sorten Ab-Harz (eine Abart der
Myrrhe) auf. Von den 14 Anti-Harzsorten bildeten 11 die erste und 3
die zweite Qualität. Alle hatten besondere Namen und sollten aus den
Augen der betreffenden Gottheit, der sie geweiht waren, herausfließen.
An den Festen der Gottheit, der sie entsprungen sein sollten und der
sie deshalb geweiht waren, wurde nur die betreffende Sorte, und zwar
in gewaltigen Mengen verbraucht. So steht im Osiristempel in Dendera
geschrieben, man solle am Osirisfeste im Monat Choiak besonders mit der
zweiten Sorte der ersten Qualität die Räucherbecken füllen; denn es
heißt: „Es entsteht aus dem Auge des Osiris ein Anti-Harz in Wahrheit,
herauskommend aus dem linken Auge; seine Farbe ist rötlich.“
In Nachahmung dieser ägyptischen Sitte benutzten auch die alten
Juden nach ihrem Auszuge aus Ägypten den Weihrauch zu ihren
gottesdienstlichen Räucherungen, wie schon im 2. Buch Mose 30, 34 u. f.
zu lesen ist. „Und der Herr (Jahve) sprach zu Mose (am Sinai[S. 218] um 1280
v. Chr.): Nimm zu dir Spezerei, Balsam, Bdellium, Galbanum und reinen
Weihrauch, von einem so viel als vom andern, und mache Räucherwerk
daraus, nach der Apothekerkunst gemengt, daß es rein und heilig sei.
Und sollst desselben tun vor das Zeugnis (nämlich die Bundeslade) in
der Stiftshütte, wo ich mich dir offenbaren werde. Das soll euch das
Allerheiligste sein. Und desgleichen Räucherwerk sollt ihr euch nicht
machen, sondern es soll dir heilig sein dem Herrn. Wer ein solches
machen wird, daß er damit räuchere, der soll ausgerottet werden von
seinem Volke.“
Infolge seiner überaus großen Wertschätzung und vollkommenen
Unentbehrlichkeit bei den gottesdienstlichen Funktionen nicht nur bei
den Ägyptern, sondern auch bei den Kulturvölkern Vorderasiens und am
Mittelmeer war der Handel mit Weihrauch noch viel mehr als derjenige
mit Myrrhe ein sehr wichtiger Faktor und brachte den Völkern, die
sich mit seiner Erzeugung und seinem Transport abgaben, reichen
Gewinn. Ja, man kann sagen, daß kaum ein anderes Pflanzenerzeugnis im
Altertum einen derartigen Einfluß auf das Wirtschaftsleben und die
ganze Kulturentwicklung der beteiligten Völker ausgeübt hat, wie die
wohlriechenden Gummiharze Weihrauch und Myrrhe. Welchen Reichtum er
den Völkern Glücklich-Arabiens brachte, haben wir bereits gesehen.
Allerdings ist die Menge von Gold, die sie besaßen, im Lande selbst
gewonnen worden. Dann aber brachte ihnen der Zwischenhandel mit
den indischen und ostafrikanischen Waren reichen Gewinn. Wie uns
griechische und römische Schriftsteller berichten, muß einst im
südlichen Teil des Roten Meeres ein großer Verkehr von Handelsschiffen
bestanden haben, die Waren aus Indien und Ostafrika holten. So
sagt uns Arrians Bericht über die Umschiffung des Roten Meeres
(Periplus maris erythraei) aus dem 2. Jahrhundert n. Chr., daß
die Einwohner Glücklich-Arabiens aus Makrolus an der Küste Ostafrikas
Weihrauch, Myrrhe, Kankamon (ein der Myrrhe ähnliches Gummiharz)
und anderes Räucherwerk, von anderen Häfen derselben Küste aber
Elfenbein, Hörner des Nashorns, Schildplatt und Sklaven bezogen, aus
Indien aber erhielten sie Reis, Sesamöl, Zucker („sacchari“),
Pfeffer, Baumwollgewebe, Seidenstoffe, Indigo, das ingwerartige
Gewürz und Heilmittel Costus, Zimtkassia, Narde und Nardensalbe, das
wohlriechende, ebenfalls zu Räucherungen dienende Gummiharz Bdellium,
Onyx und andere Edelsteine, murrhinische Gefäße und Stahlwaren.
Von Südarabien aus wurden diese Produkte auf dem Landwege[S. 219] weiter
expediert. Die Hauptkarawanenstraße dafür, die berühmte Weihrauchstraße
des Altertums, führte zunächst nach Syrien, wo sie sich teilte,
um einerseits nordostwärts nach Babylonien und südwestwärts nach
Ägypten abzuzweigen. Sie verödete erst als zu Beginn der römischen
Kaiserherrschaft die unternehmenden ägyptischen Kaufleute regelmäßig
mit ihren Schiffen in den südarabischen Häfen erschienen und die
verschiedenen stark begehrten Handelsartikel an Ort und Stelle kauften.
Die Folge davon war, daß die am Karawanenhandel beteiligten Stämme,
ihres früheren reichen Verdienstes beraubt, teilweise nach Nordarabien
auswanderten und sich dort fruchtbarere neue Niederlassungen
erkämpften, oder als Söldner in die Dienste der Parther und Römer
traten. Diese semitischen Stämme aus Südarabien werden im Alten
Testament als Ismaeliten bezeichnet, d. h. als Nachkommen Ismaels,
des Sohnes Abrahams und seiner Nebenfrau Hagar, die später von ihrem
Manne samt dem Sohne verstoßen und in die Wüste geschickt wurde. Es
sei beispielsweise nur an den Bericht in 1. Mose 37, 25 erinnert, in
welchem die Söhne Jakobs hinter dem Rücken des Vaters ihren jüngsten
Bruder Joseph an eine nach Ägypten ziehende Karawane verkauften: „Und
sahen einen Haufen Ismaeliten kommen aus Gilead (dem Ostjordanland) mit
ihren Kamelen, die trugen Würze, Balsam und Myrrhe und zogen hinab nach
Ägypten.“

Bild 68. Darstellung eines Weihrauchbaums im Grabtempel
der Königin Hatschepsut in Der el Bahri. (Nach Dümichen.)
Die Inschrift lautet: „Grünende Weihrauchbäume 31 Stück, herbeigeführt
unter den Kostbarkeiten des Landes Punt für die Majestät des Gottes
Amon, des Herrn der irdischen Throne. Niemals ist Ähnliches gesehen
worden seit Erschaffung des Weltalls.“
Dieser Handelsverkehr der Sabäer und Minäer, wie die Angehörigen des
älteren Reiches von Machīn von den griechisch-römischen Schriftstellern
bezeichnet werden, reicht in sehr hohes Altertum zurück. So bezogen
schon die Ägypter der ältesten Dynastien Weihrauch, Myrrhe und die
übrigen für ihre Gottesdienste gebrauchten Räucherharze von ihnen.
Außerdem aber haben je und je mächtige Herrscher des Pharaonenlandes
eigene Expeditionen zu Schiff nach Südarabien ausgesandt, um diese
kostbaren und wichtigen Produkte in größeren Mengen zu holen. Das
Land, das diese heiligen Gummiharze hervorbrachte, hieß bei den alten
Ägyptern taneter, d. h. Gottesland. Es galt ihnen als die Heimat
ihrer Götter, die nach allgemeinem Glauben einst dort wohnten und von
dort her nach dem Niltal gelangt sein sollten. Die in den Inschriften
gebräuchliche geographische Bezeichnung für dieses Land ist Punt
(eigentlich Pun, da das t am Schlusse nur der weibliche
Artikel ist; da aber dieser Name einmal eingeführt ist, so behalten wir
ihn bei). Es umfaßte außer Südarabien die gegenüberliegende Küste von
Afrika und wurde schon sehr früh von den Ägyptern selbst aufgesucht.
Schon vor dem Jahre 3000 v. Chr., zur[S. 220] Zeit der Könige der 1. und
2. Dynastie, die sich als Grabstätten Pyramiden aus an der Sonne
getrockneten Lehmziegeln errichteten, sandten die machtvollen Herrscher
des Niltals, die in Memphis in Unterägypten residierten, ihre Schiffe,
wie nach Syrien, um als wertvolles Bauholz für das holzarme Land
Zedernstämme von den Abhängen des Libanon und andere Güter zu holen, so
nach dem Lande Punt, um die wohlriechenden Harze, die man zum Räuchern
und zu den im Leben des Orientalen so wichtigen Salben und Schminken
brauchte, auf direktem Wege zu beschaffen. Genauere Nachrichten über
solche Expeditionen erhalten wir durch die Denkmäler erst aus der
Zeit des Königs Sahurê der 5. Dynastie, der von 2743 bis 2731 v. Chr.
herrschte, und die sich bereits unter König Snofru (2930–2906) zu
entwickeln beginnende älteste ägyptische Seemacht mächtig förderte. Wir
erfahren von ihm, daß er eigene Schiffe nach Punt sandte, die 80000 Maß
Weihrauch (anti), 6000 Gewichte Elektron (eine Legierung aus
Gold und Silber) und 2600 Stäbe einer kostbaren Holzart, vielleicht
Ebenholz, nach der Hauptstadt Memphis brachten. Kürzlich entdeckte
Reliefs aus seinem Pyramidentempel schildern die Heimkehr dieser
Flotte und diejenige einer anderen, die[S. 221] aus Phönikien mit semitischen
Gefangenen und einheimischen Matrosen anlangte. Es ist dies die älteste
Darstellung seetüchtiger Fahrzeuge und syrischer Semiten, die wir
besitzen.
Während der 6. Dynastie (2625–2475 v. Chr.) waren die Gaufürsten
von Elephantine die Erforscher der südlich und östlich von Ägypten
gelegenen Länder und führen in ihren Grabinschriften den Titel
„Karawanenführer, der seinem Herrn die Erzeugnisse der Fremdländer
überbringt“. Einer derselben, namens Harchuf, brachte dem König
Phiops II. einen Zwerg aus dem Lande Punt mit, wofür er von jenem
einen Anerkennungsbrief erhielt, auf den er so stolz war, daß er ihn
auf der Vorderseite seines Grabes bei Assuan einmeißeln ließ als ein
Zeichen der großen Gunst, die er beim Könige genoß. Von einer größeren
Expedition nach dem Lande Punt erfahren wir erst wieder während der 18.
Dynastie. Veranlaßt wurde sie von der energischen Tochter und Erbin
Thutmosis I., Hatschepsut, die mit ihrem Halbbruder Thutmosis II.
verheiratet war und nach dessen Tode von 1516–1481 v. Chr. selbständig
regierte. Um die oberste der drei Terrassen ihres Grabtempels in Der
el Bahri westlich von Theben mit den Bäumen, die den Weihrauch, das
heilige anti, hervorbrachten, zu schmücken, entsandte sie
eine Expedition nach dem Gotteslande Punt, deren Einzelheiten sie in
Inschriften und äußerst lebendigen szenischen Darstellungen an den
Wänden eben jener Tempelhalle schildern ließ. Im neunten Jahre ihrer
Regierung lief die aus fünf großen Seeschiffen bestehende Flotte durch
einen Kanal im östlichen Delta ins Rote Meer aus und fuhr südwärts
nach dem Lande Punt. Dort angekommen, wurde der ägyptische Admiral vom
Fürsten Parihu, seiner Frau Ati, zwei Söhnen und einer Tochter aufs
freundlichste aufgenommen. Nach dem Austausch der üblichen Geschenke
und der Aufstellung der mitgebrachten Statuen der Königin und der
beiden Hauptgötter Ägyptens, Amon und Ra, wurden die gewünschten
Produkte des Landes Punt gegen die von zu Hause mitgebrachten Waren
getauscht. Eine Darstellung mit der erklärenden Inschrift „Belasten der
Transportschiffe“ zeigt uns das Einladen der Waren mit allen Details.
Wir sehen darauf, wie ägyptische Matrosen bemüht sind, drei in Kübeln
gepflanzte, blattlos gezeichnete, starkstämmige, knorrige Bäume,
die ausdrücklich als anti, d. h. Weihrauchbäume, bezeichnet
werden,[2] die[S. 222] Landungsbrücke hinauf auf das Verdeck des Schiffes
zu tragen, wo bereits fünf andere solche Weihrauchbäume zwischen den
aufgestapelten Schätzen sichtbar sind.
Die sechszeilige, hieroglyphische Inschrift erklärt den Vorgang in
folgender Weise: „Das Belasten der Transportschiffe mit einer großen
Menge von herrlichen Produkten Arabiens, mit allen kostbaren Hölzern
des heiligen Landes, mit Haufen von Weihrauchharz, mit grünenden
Weihrauchbäumen, mit Ebenholz, mit reinem Elfenbein, mit Gold und
Silber aus dem Lande Amu, mit dem wohlriechenden Tesepholze, mit
Kassiarinde (Zimtkassia), mit Ahamweihrauch (vom Balsambaum), mit
Mestemschminke, mit Anāuaffen (Cynocephalus hamadryas),
Kophaffen (Cynocephalus babuinus) und Tesemtieren, mit Fellen
von Leoparden des Südens, mit Frauen und ihren Kindern. Niemals ist
gemacht worden ein Transport gleich diesem von irgend einer Königin
seit Erschaffung des Weltalls.“
Wie werden die Einwohner Thebens gestaunt haben, als diese seltsamen
Dinge alle vom ägyptischen Befehlshaber „Ihrer Majestät“ überbracht
wurden! Die Weihrauchbäume aber ließ sie, 31 an der Zahl, auf der
obersten Terrasse ihres schönen Totentempels dem Gotte Amon zu Ehren
aufstellen und rühmt sich in der Inschrift: „Ich habe ihm ein Punt
gemacht in seinem Garten, wie er mir befohlen hatte..., es ist groß
genug für ihn, um sich darin zu ergehen.“ Neuerdings hat man hinter
diesem ihrem Totentempel, in welchem ihr und ihrem Vater der übliche
Totendienst abgehalten wurde, ihr und nicht weit davon ihres Vaters
Grab gefunden.
Die Beziehungen zum Lande Punt blieben auch unter ihren Nachfolgern
der 18. und 19. Dynastie erhalten und öfter melden uns die Inschriften
an den Tempelwänden von Expeditionen dahin. So lieferte der Handel
mit Punt Thutmosis III., der 54 Jahre, und zwar wie astronomisch
bestimmt wurde, vom 3. Mai 1501 bis zum 17. März 1447 v. Chr. regierte,
regelmäßige und reiche Einkünfte. Auch Haremheb, der von 1350–1315
über Ägypten herrschende Begründer der 19. Dynastie, entsandte nach
einer urkundlichen Inschrift an den Wänden seiner Grabkammer eine
erfolgreiche Expedition nach Punt. Dies wiederholten seine großen
Nachfolger, vor allen Sethos I. (1313–1292)[S. 223]
[S. 224] und Ramses II. (1292–1225
v. Chr.). Besonders unter letzterem muß ein reger Schiffsverkehr nicht
nur im östlichen Mittelmeer, sondern auch durch den Süßwasserkanal
der Landenge von Suez nach den Küsten des Roten Meeres stattgefunden
haben. Aber nicht nur jene machtvollen Könige, sondern auch die reichen
Priesterschaften der großen Tempel des Amon, Ra und Ptah besonders
in der Reichshauptstadt Theben besaßen ihre eigenen Flotten auf dem
Mittelmeer und im Roten Meere, welche, wie die Inschriften melden,
„die Erzeugnisse von Phönikien, Syrien und Punt in die Schatzkammern
des Gottes lieferten“. Es muß also damals die Schiffahrt in Ägypten in
größerem Maßstab als je zuvor betrieben worden sein.
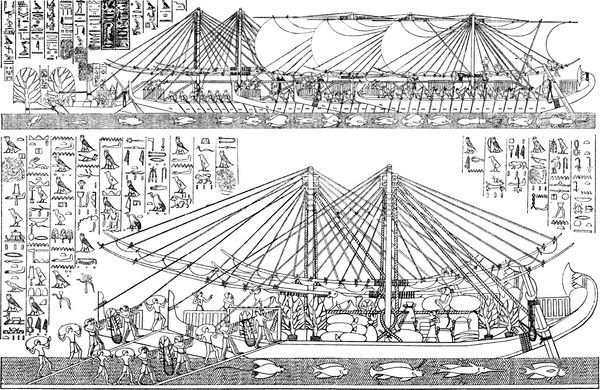
Bild 69 u. 70. Die Weihrauchexpedition der Königin
Hatschepsut. Oben: Ankunft der Flotte im Lande Punt. Die Schiffe sind
an am Ufer stehende Bäume gebunden worden. Unten: Die Schiffe werden
mit Weihrauchbäumen, Weihrauch in Säcken, Affen und anderen Schätzen
des Landes beladen. (Nach Dümichen.)
❏
GRÖSSERES BILD
Später hat dann der dritte König von Israel, Salomo (993–953),
unter dem die jüdische Königsmacht ihren höchsten äußeren Glanz
erreichte, wohl in Nachahmung der ägyptischen Herrscher, ebenfalls
eine Handelsexpedition nach Punt und darüber hinaus nach dem Goldlande
Ophir, das wir neuesten Feststellungen zufolge in Rhodesia zu suchen
haben, entsandt. Die von ihm in Ezeon-Geber im Lande der Edomiter am
Ufer des Schilfmeeres erbauten Schiffe bemannte er mit der Schiffahrt
kundigen Knechten des phönikischen Königs Hiram von Tyrus, seines
Bundesgenossen. Jene Expedition brachte dem Salomo 420 Zentner Gold,
und da sie sich so überaus rentabel erwies, ließ er sie mehrfach
wiederholen. So heißt es in 1. Könige 26–28, wo ausführlich darüber
berichtet wird: „Die Schiffe Salomos aber kamen in dreien Jahren einmal
und brachten Gold, Silber, Elfenbein, Affen und Pfauen“ — letztere
von indischen Kaufleuten eingetauscht. Auch die Königin von Saba „aus
dem Lande Reich-Arabien“ — wahrscheinlich die Königin Bilkis der
sabatäischen Inschriften — kam, wie in 1. Könige 10, 2 zu lesen ist,
„gen Jerusalem mit sehr viel Volk mit Kamelen, die Spezerei trugen und
viel Goldes und Edelgestein“. Es sind dies dieselben Dinge, die bis
dahin die Minäer aus dem Lande Punt nach Ägypten und Syrien verhandelt
hatten. Später ließ dann auch der ägyptische König Nekau der 26.
Dynastie — der Pharao Necho der Bibel (612–596 v. Chr.) —, dessen
Schiffe im Mittelmeere und im Roten Meere fuhren, und der den Kanal
von Bubastis nach Suez wollte erneuern lassen, von ihm dienstbaren
phönikischen Schiffsleuten ganz Afrika umfahren. Jedenfalls sind jene
damals auch in das Innere, nach Rhodesia, gelangt, wo man in den Ruinen
von Simbabwe allerlei phönikische und ägyptische Altertümer fand. Das
war die letzte Umseglung Afrikas, von der wir wissen, vor derjenigen[S. 225]
Vasco da Gamas im Jahre 1497; denn die um 460 v. Chr. unternommene
Afrikafahrt des karthagisch-punischen Admirals Hanno die Westküste
Afrikas entlang, wobei er die ersten Gorillas zu Gesicht bekam, endete
vor der Umschiffung des Kaps der Guten Hoffnung.
Tafel 117.

Blick zum Terrassentempel der Königin Hatschepsut in der Gräberstadt
Der el Bahri westlich von Theben, in welchem die im Text abgebildete
und beschriebene Expedition nach dem Lande Punt zur Erlangung von
Weihrauchbäumen dargestellt ist.
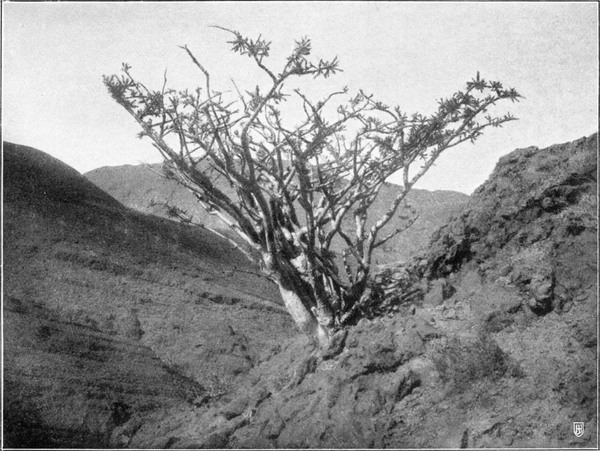
Ein Weihrauchbaum (Boswellia carteri) auf den
Kalkbergen von Fartak in Südarabien. (Nach einer in der Sammlung des
Bot. Instituts der Universität Wien befindlichen Photogr. von Prof.
Dr. O. Simony.)
Tafel 118.

Ernte von Orangenblüten auf den Feldern der
Parfümerie B. Court in Grasse.

Jasminernte der Parfümeriefabrik B. Court in Grasse.
Was den Schiffsverkehr der Ägypter nach Südarabien, dem Lande des
Weihrauchs, anbetrifft, so war er wieder besonders lebhaft zur
Ptolemäerzeit. Aber auch damals tat er den Handelsbeziehungen der
Sabäer zum Norden keinen bedeutenden Eintrag. Nach wie vor blieben
diese letzteren, wie uns eine Inschrift aus der Ptolemäerzeit beweist,
die Weihrauchlieferanten aller großen Tempel Ägyptens. Der Reichtum der
Sabäer war immer noch weltberühmt und ihre Unbezwingbarkeit bewährte
sich selbst gegenüber dem Feldherrn des römischen Kaisers Augustus,
der nach anfänglichen Erfolgen von dem uneinnehmbaren Marib abziehen
mußte. Noch heute zeugen die gewaltigen Ruinen, die 20 Stockwerke
hohe Burg Gomdān in Sanaa, der Tempel von Marib, dessen 9,5 m
hohe Mauern ellipsenförmig um eine natürliche Bodenerhöhung verlaufen
und die große Talsperre von Marib, deren Bersten die Araber mit dem
Untergange der Sabäermacht in Zusammenhang brachten, von der einstigen
hohen Kultur jenes Reiches, das außer durch seine eigenen Produkte,
vor allem Weihrauch und Myrrhe, durch seine Lage auf dem Wege von
Indien nach Ägypten und den Ländern am Mittelmeer zum Handelsstaate
prädestiniert war. Sein Machtbereich erstreckte sich bis nach Gaza
am Mittelländischen Meere und überall dem Handelswege entlang besaß
es befestigte Niederlassungen als Ablagen für den Handelsverkehr und
Stützpunkte seiner Macht. Aus spätsabäischer Zeit sind Gold-, Silber-
und Kupfermünzen der Herrscher, die zugleich oberste Priester ihres
Volkes waren, auf uns gekommen. Sie bekunden eine starke Abhängigkeit
von griechischen, später von römischen Vorbildern und zeigen uns die
Könige zuerst in altarabischer Haartracht mit frei herabhängendem,
langem Haar, später in geringelten, langen Strähnen und zuletzt im
kurzen Haar der römischen Imperatoren.
Wie bei den Ägyptern war auch bei den Vorderasiaten, namentlich den
Babyloniern, der Weihrauch ein bei den Gottesdiensten zu Räucherungen
viel gebrauchter Handelsartikel. Herodot berichtet uns im 5.
Jahrhundert v. Chr., daß die Araber alljährlich dem Perserkönige
Dareios (um 500 v. Chr.) einen Tribut von tausend Talenten
(= 26200 kg) Weihrauch abliefern mußten. Derselbe Autor sagt, daß die
Weihrauchbäume in Arabien von vielen kleinen, geflügelten Schlangen[S. 226]
bewacht werden. Wollen nun die Leute den Weihrauch holen, so müssen
sie erst Styrax (griech. stýrax, der aus Stamm und Ästen des in
Syrien und Arabien wachsenden Styraxbaumes, Styrax officinalis,
gewonnene, zähflüssige, graubraune, aromatisch riechende Balsam)
anbrennen, um die gefährlichen Tiere durch den Dampf zu vertreiben.
Welche Rolle dieses Räuchermittel auch bei den Juden spielte, ist uns
aus dem Alten Testament genugsam bekannt. Den Propheten des Alten
Bundes ist das um seiner kostbaren, wohlriechenden Harze wegen viel
beneidete Glücklich-Arabien, das Land der Sabäer, der Inbegriff des
Reichtums. So begreifen wir, daß Jesaias, der seit 740 v. Chr. in
Jerusalem wirkte, da er seinem Volke alle Herrlichkeiten der Erde
versprach, wenn es Jahve die Treue halte und ihm allein diene, ihm (in
Kap. 60, Vers 6) verhieß: „Dann wird die Macht der Heiden zu dir kommen
und die Menge der Kamele wird dich bedecken; sie werden aus Saba alle
kommen und Gold und Weihrauch bringen und des Herrn Lob verkündigen.“
Und im Neuen Testament hat die sinnige, die Geburt des Heilandes mit
den verschiedensten außergewöhnlichen Begebenheiten ausschmückende Sage
als Beweis der besonderen Verehrung des Jesuskindleins die uns allen
von Jugend auf bekannte Geschichte von den Weisen (eigentlich Magiern)
aus dem Morgenlande erdichtet, die dem Sterne nach Bethlehem folgten,
um das Kind anzubeten. Und das Kostbarste, was jene Zeit sich erdenken
konnte, brachten sie dem Kindlein dar; so heißt es Matthäus 2, 16:
„und sie taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und
Myrrhen“.
Von den seefahrenden Phönikiern lernten die Griechen den Weihrauch
und seine gottesdienstliche und profane Verwendung als Räuchermittel
namentlich bei Begräbnissen und als Arzneimittel kennen. Das
beweist schon die Übernahme der semitischen Bezeichnung desselben
lebonah, d. h. weiß, in die griechische Sprache als
líbanos, woraus dann später die Römer, als sie diese Droge
von den süditalischen Griechen kennen lernten, olibanum
machten. Später benutzten die Griechen auch die aus dem griechischen
thýein opfern gebildete Bezeichnung thýos, woraus
das lateinische thus für Weihrauch wurde. Auch den Griechen
war, wie den Ägyptern und Vorderasiaten, der Weihrauch so sehr der
Inbegriff alles Herrlichen, daß der Dichter Pindar (522–442
v. Chr.), der erhabenste Lyriker seines Volkes, in einer herrlichen Ode
die Seelen der Abgeschiedenen auf den Gefilden der Seligen unter
Weihrauchbäumen wandeln läßt, während sie noch bei Homer,[S. 227] der
diese Droge überhaupt noch nicht gekannt zu haben scheint, in der
Unterwelt auf Asphodeloswiesen (Asphodelus ramosus, einer
in den Mittelmeerländern in Menge wachsenden Lilienart mit weißen
Blütentrauben, deren scharfe Wurzelknollen als Arznei und ihres
Reichtums an Stärkemehl wegen auch als Nahrung gegessen wurden, so
auch, wie Porphyrius uns erzählt, vom Philosophen Pythagoras, der
sie sehr liebte) wandelten und sich hier vornehmlich mit Spiel und
Jagd die Zeit vertrieben. Der griechische Arzt Dioskurides (im 1.
Jahrhundert n. Chr.) sagt in seiner Arzneimittellehre: „Der Weihrauch
(líbanos) wächst in demjenigen Teile Arabiens, den man als das
weihrauchtragende bezeichnet. Der beste ist der sogenannte männliche,
auch stagoniás genannt, von Natur in walzigen Stücken. Er ist
weiß, inwendig fettig und brennt, an die Flamme gebracht, schnell. Man
wendet den Weihrauch und den aus verbranntem Weihrauch gewonnenen Ruß
als Arznei an.“ In derselben Weise wurden übrigens auch nach demselben
Autor die Myrrhe und der Myrrhenruß benutzt.
Der griechische Geschichtschreiber und Geograph Arrianus (ums Jahr 110
n. Chr. in Nikomedien geboren und unter Marcus Aurelius gestorben),
der einzige Schriftsteller des Altertums, der eine genaue Kenntnis der
arabischen Küste besaß, schreibt in seinem Buche über die Umschiffung
des Roten Meeres: „An der Südküste Arabiens liegt der Handelsplatz
Kane in der weihrauchtragenden Gegend. Landeinwärts von Kane liegt
die Hauptstadt des Landes, Sabbatha, in der der König wohnt. Nach
Kane wird der Weihrauch, der im Lande gewonnen wird, wie in ein
gemeinschaftliches Magazin gebracht, was teils auf Kamelen, teils auf
Fellbooten, teils auf eigentlichen Schiffen geschieht. Von Kane aus
wird der Weihrauch weiter verhandelt. — Das Weihrauchland erstreckt
sich von Kane weiter ostwärts an der Küste hin bis zum Vorgebirge
Syagros und der sachalitischen Handelsstadt Moscha, ist bergig, sehr
schwer zugänglich, hat eine dicke, neblige Luft. Die Weihrauchbäume
sind nicht groß. Der Weihrauch quillt in Tropfen hervor und erstarrt
an der Rinde, wie bei uns in Ägypten das Gummi (kómmi).
Er wird von den Sklaven des Königs und verurteilten Verbrechern
gesammelt. Die Gegend ist ungeheuer ungesund, selbst für Leute, die nur
vorbeischiffen. Die Weihrauchsammler sind demnach einem sicheren Tode
geweiht; dieser wird oft noch durch Nahrungsmangel beschleunigt. Auch
auf dem Vorgebirge Syagros ist eine Burg mit einem Weihrauchmagazin und
einem Hafen. — Östlich[S. 228] vom Vorgebirge Syagros liegt an der Südküste
Arabiens im sachalitischen Gebiete die Hafenstadt Moscha, wohin der
sachalitische Weihrauch gebracht wird, welcher von königlichen Beamten
verhandelt wird. Der Weihrauch liegt hier auf einem großen Haufen, der
gar nicht bewacht wird, indem die Götter selbst den Ort schützen. Denn
nimmt ein Schiffer ohne Erlaubnis der königlichen Beamten auch nur ein
Körnchen heimlich oder offen, so ist das Schiff, durch Göttermacht
gebannt, nicht imstande, den Hafen zu verlassen.“
Arrian berichtet auch in seinem Buche über Indien, daß die Leute
Alexanders (des Großen) an der Mündung des Euphrat das Dorf Diridotis
fanden, wohin Kaufleute Weihrauch und anderes Räucherwerk aus Arabien
brachten, und Plinius sagt in seiner Naturgeschichte: „Weihrauch
und Myrrhe (thus et myrrha) sind Erzeugnisse Arabiens, doch
wächst die Myrrhe auch im Lande der Troglodyten, der Weihrauch aber
sonst nirgends, und nicht einmal in ganz Arabien, sondern nur in der
Landschaft Saba, wo in einer gebirgigen Gegend die Weihrauchwälder
stehen. Der Weihrauch wird von Saba aus auf einer schmalen Straße,
welche durch das Land der Minäer geht, verführt. — Den Baum selbst
kennen wir nicht, obgleich die römischen Waffen tief nach Arabien
hinein vorgedrungen sind. Die griechischen Beschreibungen weichen sehr
voneinander ab. — Als Alexander (der Große) noch ein Kind war und
große Massen Weihrauch auf die Altäre warf, hatte ihm sein Erzieher
Leonides gesagt, er möge erst dann soviel davon vertun, wenn er die
Weihrauchländer erobert habe. Wie nun Alexander später Arabien erobert
hatte, schickte er dem Leonides eine ganze Schiffsladung Weihrauch,
damit er tüchtig räuchern könne. — In Rom kostet jetzt das Pfund
des besten Weihrauchs 6 Denare (= 3 Mark), das der zweiten Sorte
5 Denare (= 2,50 Mark) und das der dritten Sorte 3 Denare (= 1,50
Mark). Jährlich wird jetzt eine ungeheure Menge von Weihrauch bei
Leichenbegängnissen verbrannt, während man in alten Zeiten den Göttern
nur etwas Mehl und Salz opferte, und gleichwohl waren sie damals
gnädiger als sie jetzt sind.“ Derselbe Autor berichtet weiterhin, daß
Kaiser Nero beim Leichenbegängnis seiner zweiten Gemahlin, Poppaea
Sabina, die er nach Verstoßung der achtbaren Oktavia durch schnöden
Freundschaftsbruch in seinen Besitz gebracht hatte, aber, ihrer
überdrüssig, sie im Jahre 65 durch Mißhandlung in hochschwangerem
Zustande tötete, als Opfer für die Götter mehr Weihrauch verbrennen
ließ, als nach der Berechnung Sachkundiger ganz Arabien in einem Jahre
hervorzubringen vermöge.[S. 229] Allerdings waren die Eigenliebe und die
Gefallsucht dieser Frau sehr groß. Obschon sie nicht mehr jung war,
lebte sie nur der Pflege ihrer Körperschönheit, trug zur Erhaltung
ihres zarten Teints eine Maske, die sie vor dem Sonnenbrande schützen
sollte, und führte auf ihren Reisen und während des Sommeraufenthaltes
stets 500 Eselinnen mit sich, um täglich in deren Milch baden und
so, wie sie glaubte, die Weiße ihrer Haut erhalten zu können. Ferner
berichtete Statius, daß, als der reiche Abascontius seine Gattin
Priscilla bestatten ließ, im langen Leichenzuge, als zur Verbrennung
bestimmt, alle Blumen, die Arabiens und Kilikiens Frühling erzeugt,
auch die Blumen des Sabäerlandes, die Gewürze Indiens, Weihrauch und
Balsam aus Palästina getragen wurden.
Außer als Räucherwerk spielte der Weihrauch bei den Griechen und
Römern auch medizinisch eine wichtige Rolle. Schon die Hippokratiker
bedienten sich seiner bei Asthma, Uterusleiden und äußerlich zu
verschiedenen Salben. Diese Verwendung blieb das Mittelalter
hindurch, wie auch die christliche Kirche von den antiken Kulten das
Verbrennen von Weihrauch in besonderen Räuchergefäßen, die vielfach
mit großer Kunst hergestellt wurden, übernahm und in den römisch-
und griechisch-katholischen Abzweigungen bis auf den heutigen Tag
beibehielt. Auch die katholisierende englische Hochkirche und die Sekte
der Irvingianer bedient sich noch dieses uralten Rauchopfers bei ihren
Gottesdiensten. Vom lateinischen incensum, d. h. das, was (bei
den Gottesdiensten) verbrannt wird, hat der Weihrauch die Bezeichnung
encens im Französischen und incense im Englischen. Auch
hier bewahrheitet sich die immer wiederkehrende Tatsache, daß der
Mensch in nichts so konservativ ist, als in Sachen der Religion.
Bedeutende Mengen von Weihrauch verbrauchen auch die Chinesen zu
Opfern und bei Leichenbegängnissen. Sie erhielten ihn seit dem 10.
Jahrhundert von den Arabern. Auch in Indien wird seit dem frühesten
Altertum von einheimischen Commiphoraarten Weihrauch gewonnen und bei
den Gottesdiensten als Brandopfer verbrannt. So wird er schon um 500
v. Chr. im Ayur veda Susrutas erwähnt. Dieser indische Weihrauch,
der schon im Altertum neben dem arabischen und heute noch von den
Muhammedanern mit Vorliebe verbraucht wird, stammt von Boswellia
thurifera, einer vom Gangesgebiet bis zur Koromandelküste
wachsenden, dem echten Weihrauchbaum sehr nahe verwandten Burserazee,
die Colebrooke 1809 in Ostindien entdeckte. Diesen Baum haben
wahrscheinlich schon die Griechen auf dem Alexander[S. 230]zuge im Pandschab
kennen gelernt. Jedenfalls wurde auch dieser Weihrauch später neben dem
arabischen verwendet. Dioskurides bezeichnet ihn als syagrium;
er sei bräunlich und werde mit der Zeit gelblich. Er werde absichtlich
zu walzigen Stücken geformt. Außer ihm gebe es noch eine geringe
dunkler gefärbte und eine geringe weiße Sorte. Verfälscht werde dieser
wie auch der arabische Weihrauch mit Pinienharz und Gummi; doch sei der
Betrug leicht zu merken, weil der Gummi nicht brennt, das Pinienharz
sich in Rauch verwandelt, der Weihrauch aber klar brennt. Auch der
Geruch gebe ein sicheres Merkmal, um den Unterschied festzustellen.
In derselben Weise diente auch das dunkelbraune bis grünliche Gummiharz
der im nordwestlichen Indien und in Belutschistan einheimischen
Commiphora roxburghi und das mehr gelbrote ostafrikanische von
Commiphora africana. Beide wurden besonders zu Rauchopfern
wie auch arzneilich viel verwendet und kamen als Bdellium in
den Handel. Dieses Bdelliumharz wurde schon von den alten Ägyptern
für sich allein oder mit Myrrhen, Weihrauch und Mastix (dem Harz
von Pistacia lentiscus) in Form einer Kyphimischung zum
Rauchopfer oder zur Herstellung von Arzneien verwendet. Auch die Juden,
die es hebräisch bdolah nannten, benutzten es wie Myrrhe,
ebenso die Griechen, die dieses Harz wie die übrigen Weihrauchharze
durch Vermittlung der Phönikier kennen lernten. Durch die Griechen
wurden dann die Römer damit bekannt gemacht. Plinius erwähnt es,
und sein Zeitgenosse, der griechische Arzt Dioskurides, sagt von
ihm: „Das bdéllion tröpfelt aus einem arabischen Baume. Das
beste ist bitter, durchscheinend, wie Leim anzusehen, fett, in
der Mitte leicht erweichend, ohne Beimischung von Holzteilen und
andern Verunreinigungen. Auf glühende Kohlen gestreut gibt es einen
angenehmen Geruch. Eine zweite Sorte ist schmutzig und schwarz, bildet
größere Klumpen und kommt aus Indien. Es kommt auch eine Sorte von
Petra (der alten Hauptstadt der Nabatäer in Nordwestarabien bei der
Sinaihalbinsel); sie ist trocken, harzig, bläulich und ist von zweiter
Güte. Man verfälscht das Bdellium mit (arabischem) Gummi; dann ist es
aber nicht mehr so bitter und riecht beim Räuchern nicht so angenehm.
Es wird innerlich und äußerlich angewendet.“ Außer Arrian, dessen
Bericht über seine Umschiffung des Roten Meeres wir vorhin erwähnten,
nennt es auch Vegetius als ein Produkt des fernen Morgenlandes.
Wie von Weihrauch und Myrrhe hat man in einigen altägyptischen Gräbern
auch Überreste von Mekka- oder Gileadbalsam ge[S. 231]funden,
die alle den Toten als Opfergabe mitgegeben wurden. Sein Erzeuger
ist der arabische Balsambaum (Commiphora opobalsamum), ein
5–6 m hoher Baum mit papierdünner, ledergelber Rinde und
rutenförmigen Ästen, die nur nach den Winterregen belaubt sind.
Wie sein naher Verwandter, der echte Weihrauchbaum, ist er im
Somalland in Nordostafrika und im südlichen Arabien heimisch und
wurde schon im Altertum nicht nur in Arabien, sondern auch in Syrien
zur Gewinnung eines höchst wohlriechenden flüssigen Gummiharzes
angepflanzt. Dieses ist der Balsam der alten Schriftsteller, der zwar
auch zu gottesdienstlichen Räucherungen, besonders aber heute noch
als hochgeschätzte Arznei Verwendung findet. Die beste, von selbst
ausfließende oder durch Ritzen des Stammes und der Äste gewonnene Sorte
ist dünnflüssig, blaßgelb, riecht dem Zitronenöl ähnlich und kommt
nicht in den Handel, da sie von den vornehmen Orientalen ausschließlich
für sich als Heilmittel und zu feinen Parfüms und Salben verwendet
wird. Eher ist der weniger wohlriechende, gelbrötliche, trübe,
dickflüssige Balsam im Orient zu kaufen, der dort seit dem Altertum zu
rituellen Zwecken und als Arznei sehr begehrt ist.
Schon die alten Ägypter bedienten sich häufig seiner und nannten ihn
aham. Auch die Juden benutzten es gern zu gottesdienstlichen und
profanen Zwecken als Arzneimittel und zur Herstellung wohlriechender
Salben. Ebenso kannten ihn die Schriftsteller des Altertums sehr wohl
als Handelsartikel Arabiens. Der griechische Geograph Strabon (um
25 n. Chr. gestorben) schreibt, der Balsam (bálsamon) werde
an der Küste des Sabäerlandes gewonnen, während ihn der römische
Geschichtschreiber Tacitus (54–117 n. Chr.) nur in Judäa von mäßig
großen Bäumen gewinnen läßt. Auch Theophrast und Plinius sagen, er
gehe nur aus letzterem Lande hervor. Ersterer schreibt in seiner
griechischen Pflanzengeschichte: „Der Balsam wird im syrischen
Tieflande gewonnen, aber, wie man sagt, nur aus zwei großen Gärten.
Der Baum soll die Größe eines Granatbaums und sehr viele Äste haben.
Das Blatt soll ähnlich der Raute, nur mehr weiß und dabei immergrün
sein. Die Frucht soll an Größe, Gestalt und Farbe derjenigen der
Terebinthe gleichen. Ihr Geruch soll ganz herrlich und lieblicher sein
als der Geruch der ausfließenden Tropfen. Um letztere zu gewinnen,
soll man zur Zeit der größten Hitze mit eisernen Nägeln den Baumstamm
und die Äste ritzen. Dann wird der Balsam bis zum Winter gesammelt.
Der Ertrag ist aber gering; denn ein Mann sammelt den Tag über nur
eine Muschel voll. Der Geruch ist ganz[S. 232] ausgezeichnet und so stark,
daß wenig Balsam für einen großen Raum genügt. Übrigens wird kein
reiner Balsam, sondern nur mit fremdartigen Zusätzen gemischter in den
Handel gebracht. Auch die Zweige riechen sehr gut und werden teuer
bezahlt, weswegen man den Baum oft beschneidet. Wilder Balsam soll
nirgends vorkommen. Aus dem größeren Balsamgarten soll man 36 Pfund,
aus dem kleineren 6 Pfund gewinnen.“ Und 350 Jahre später schrieb
Plinius in seiner Naturgeschichte: „Allen andern Wohlgerüchen wird
der Balsam (balsamum) vorgezogen, welchen nur Judäa erzeugt.
Dort fand er sich nur in zwei königlichen Gärten. Die zwei Vespasiane
(Vespasian und sein Sohn Titus, die den mit der Zerstörung Jerusalems
und der Vernichtung des jüdischen Volkes als Nation im Jahre 70
n. Chr. endigenden Krieg in Judäa führten) haben dieses Bäumchen
auch der Stadt Rom gezeigt. Das Land, in welchem es wächst, gehört
jetzt uns; es ist aber ganz anders beschaffen, als es römische und
ausländische Schriftsteller beschrieben haben. Als die Römer Judäa
eroberten, wollten die Juden den Balsambaum ausrotten; allein die
Römer verteidigten ihn, und so entstand ein Kampf um einen Strauch.
Jetzt wird er auf Staatskosten angepflanzt und ist zahlreicher
und höher als je. Seine Höhe erreicht nicht ganz zwei Ellen. Man
unterscheidet drei Sorten dieses Strauches. Der frisch aus gemachten
Ritzen fließende Saft heißt Saftbalsam (opobalsamum) und sein
Geruch ist ungemein lieblich. Die zarten Tröpfchen werden in Hörner
gesammelt und dann in neue irdene Gefäße gegossen. Der Balsam gleicht
anfangs einem dicken Öl und ist farblos, später wird er rötlich und
hart. Jeder Strauch wird jetzt im Sommer dreimal geritzt und später
abgeschnitten. Auch die Teile des abgeschnittenen Strauches kommen in
den Handel und haben nach der Eroberung Judäas in weniger als fünf
Jahren einen Ertrag von 80 Millionen Sestertien (etwa 12 Millionen
Mark) gegeben. Der Balsam, den man aus den abgeschnittenen Stücken des
Strauches kocht, heißt Holzbalsam (xylobalsamum) und wird unter
Salben gekocht. — Die Verfälschung des reinen Balsams wird recht grob
und großartig betrieben, so daß ein Gefäß reinen Saftes, welches vom
kaiserlichen Schatzamte für 300 Denare (etwa 15 Mark) gekauft wird,
dann durch Verfälschung vermehrt für 1000 Denare (50 Mark) verkauft
wird.“ Der römische Geschichtschreiber Älius Lampridius meldet uns
vom schwelgerischen Heliogabalus, der im Jahre 218 17jährig durch die
Bemühungen seiner ehrgeizigen Großmutter Julia Maesa, der Schwägerin
des Kaisers Septimius Se[S. 233]verus, von den Legionen in Syrien zum Kaiser
ausgerufen wurde und bis zu seiner Ermordung durch die Prätorianer im
Jahre 222 regierte, als Ausdruck höchster Verschwendung, er habe sogar
den kostbaren Balsam in Lampen gebrannt.
Im Mittelalter betrieben die Araber die Kultur des arabischen
Balsambaums. Noch der Venezianer Prosper Alpino, der 1617 64jährig
als Professor der Botanik in Padua starb, sah, als er Ägypten um 1590
besuchte, im Sultansgarten von Matarie, wenige Kilometer nordöstlich
von Kairo, den echten Balsambaum angepflanzt. Er berichtet uns darüber
in einem 1592 veröffentlichten eigenen Dialog. Seither wurde er erst
wieder im letzten Jahrhundert von Europäern gesehen. Einst besaß dieser
Balsam, den wir neben Myrrhe und Würze aller Art als Ladung der von
Gilead im Ostjordanland nach Ägypten ziehenden Karawane der Ismaeliter
erwähnt finden, an die Jakobs Söhne ihren später zu so hoher Stellung
in Ägypten gelangten Bruder Joseph verkauften, eine große Bedeutung
als Handelsartikel auch des Abendlandes. War er doch ursprünglich das
heilige Salböl der christlichen Kirche, das zum sogenannten Chrisma
— deshalb bei uns auch Chrisam genannt — benutzt wurde, wie ihn die
morgenländischen Kulte bereits in gleicher Weise verwendeten. Erst als
das den Balsam erzeugende Land Arabien und Syrien in die Hände der
Muhammedaner fiel und dieser Handelsartikel infolge der gespannten
Beziehungen mit den Christen immer seltener wurde und schließlich fast
gar nicht mehr zu haben war, ist dann nach Entdeckung der Neuen Welt
durch eine päpstliche Bulle im 16. Jahrhundert der aus dem nördlichen
Südamerika bezogene Perubalsam zum heiligen Salböl befördert worden,
als welches es seither ausschließlich dient. Übrigens werden auch die
nach Verletzung der Rinde ausgeschwitzten Gummiharze einiger anderer
amerikanischer Balsambäume als des Perubalsambaums, so besonders
dasjenige des in Westindien und dem nördlichen Südamerika heimischen
westindischen Elemibaumes (Commiphora plumieri — so genannt
nach dem 1646 zu Marseille geborenen Franziskaner Charles Plumier, den
Ludwig XIV. dreimal nach Amerika schickte, um besonders von Guiana aus
Heilpflanzen nach Frankreich zu bringen; er starb, als er eine vierte
Reise antreten wollte, im Hafen von Sta. Maria bei Cadix), auch aus der
Familie der Burserazeen oder Balsambäume wie die Erzeuger der vorhin
genannten wohlriechenden Gummiharze. Dessen ausgeschwitzter Balsamharz
wird als westindisches Elemi bezeichnet, im Gegensatz zum viel
länger bekannten ost[S. 234]indischen Elemi, das in Indien ebenfalls
seit Urzeiten zu gottesdienstlichen Räucherungen, als Arzneimittel und
zur Herstellung von wohlriechenden Salben dient. Ein dem westindischen
Elemi sehr ähnliches wohlriechendes Gummiharz liefert auch der
im nördlichen Südamerika heimische brasilische Elemibaum
(Commiphora ambrosiaca), dessen nach Verletzungen aus der Rinde
ausfließender Balsam, an der Luft erhärtet und in großen, unförmlichen,
zusammengebackenen, blaßgelblichen Klumpen in den Handel gelangt. Es
riecht eigentümlich aromatisch und dient außer zu Räucherungen auch
zur Herstellung von Salben und Pflastern. In gleicher Weise wird das
Caranna- oder Mararaharz von der am Orinoko wachsenden
Amyris caranna, das die Eingeborenen Guianas von alters her bei
Quetschungen und Wunden gebrauchen, und das von dem ebenfalls in Guiana
wachsenden Baume Amyris heptaphylla gewonnene Conimaharz
verwendet. Letzteres stellt eine Art Kopal dar und wird auch als
solches zur Herstellung von Firnissen und Lacken benutzt.
Auch verschiedene solche wohlriechende Gummiharze bergende Hölzer
werden zu gottesdienstlichen und medizinischen Räucherungen
benutzt, so das Holz des orientalischen Balsambaums (Commiphora
opobalsamum) und das ebenfalls balsamisch riechende Gafaholz
von Commiphora erythraea auf den Dahlakinseln an der Küste der
italienischen Kolonie Erythräa am Südufer des Roten Meeres. Letzteres
wird besonders in der muhammedanischen Welt zu Räucherungen in den
Moscheen und zum Beräuchern der Wassergeschirre benutzt.
Als Surrogat der teuren orientalischen Myrrhe diente den Griechen,
wie wir von Dioskurides erfahren, zu Räucherungen und als
Heilmittel die kleingeschnittene Wurzel der Pferdesellerie
(hipposélinon), einer besonders in Böotien wildwachsend
gefundenen Pflanze (Smyrnium olusatrum), die getrocknet als
böotische Myrrhe in den Handel gelangte. Am brauchbarsten sei sie,
meint jener Arzt, wenn sie den angenehmen Geruch der echten Myrrhe habe.
Ein wertvolleres Räuchermittel, das auch zur Herstellung von
Arzneien eine ziemliche Bedeutung besaß, war den Griechen wie den
vorderasiatischen Völkern, von denen sie seine Verwendung kennen
lernten, der Styrax, ein wohlriechendes Gummiharz, das bereits
in den hieroglyphischen Texten als minaki erwähnt wird. Bei
den regen Handelsverbindungen mit Syrien und Babylonien kann es
uns nicht wundern, daß dieses wohlriechende Balsamharz aus Syrien,
wo es im Altertum in ziemlicher Menge gewonnen wurde, schon frühe
nach dem[S. 235] Niltal gelangte, um so mehr die Ägypter einen so ungemein
großen Bedarf an solchen Räuchermitteln und wohlriechenden Drogen
zur Herstellung von gottesdienstlichen Räucherungen und Salben und
Arzneien hatten. Durch die Phönikier wurde dieses Gummiharz nach
Griechenland gebracht, was nach Herodots Aussage noch zu seiner Zeit,
im 5. vorchristlichen Jahrhundert, der Fall war. Die Hippokratiker
bedienten sich seiner vielfach als Heilmittel, besonders bei den
Frauen zur Beförderung der Menstruation. Der um 25 n. Chr. verstorbene
griechische Geograph Strabon aus Amasia am Südrande des Schwarzen
Meeres gibt als Vaterland des dieses Balsamharz liefernden Baumes
Arabien und das Taurusgebirge in Nordsyrien an. Er sagt darüber:
„Hoch auf dem Rücken des Taurusgebirges, bei der Stadt Selge, wächst
der Styraxbaum (stýrax) in großer Menge. Von ihm kommen die
Styraxlanzenschäfte, welche denen von der Kornelkirsche ähnlich sind.
In den Stämmen dieser Bäume wohnt eine Art Holzwürmer. Diese bohren
sich Gänge durch die Rinde und aus ihnen fällt dann das Wurmmehl, das
sich unten um den Stamm sammelt. Danach tropft auch eine Flüssigkeit
heraus, welche wie Gummi leicht zusammenbackt. Sie vermischt sich am
Boden mit dem Wurmmehl und mit Erde; ein Teil aber bleibt am Stamme
kleben und ist rein. Auch der am Boden liegende unreine Styrax wird
gesammelt; er riecht besser als der reine, ist aber in anderer Hinsicht
schwächer wirkend. Er wird besonders zum Räuchern gebraucht.“
Um die Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. sagt der aus Kilikien
stammende griechische Arzt Dioskurides von ihm: „Der Styrax
(stýrax) tröpfelt aus einem Baume, der dem Quittenbaum ähnlich
ist. Für den besten gilt der gelbe, fette, harzige, der weißliche
Klümpchen enthält, recht lange wohlriechend bleibt und beim Erweichen
eine honigartige Flüssigkeit ausschwitzt. So ist der syrische
aus Gabale, ferner der aus Pisidien und Kilikien beschaffen. Der
dunkelfarbige, zerreibliche, kleienartige taugt nichts. Selten ist
der durchsichtige, gummi- und myrrhenartige Styrax. Man verfälscht
den Styrax mit dem aus dem Baume kommenden Wurmmehl, dem man Honig,
pulverisierte Schwertlilienwurzel und sonst allerlei beimischt. Es gibt
auch Leute, welche Wachs und Talg mit Gewürzen und Styrax an der heißen
Sonne kneten, dann durch ein weites Sieb in kaltes Wasser treiben,
wodurch wurmartige Stücke entstehen, die als Wurmstyrax verkauft
werden und bei Unerfahrenen für echten Styrax gelten. — Der Styrax
hilft gegen mancherlei Übel, man verbrennt ihn auch so, daß man viel[S. 236]
Ruß gewinnt, den man ebenfalls braucht (namentlich für schwarze Tinte
zum Schreiben). Von Syrien wird auch die Styraxsalbe in den Handel
gebracht.“ Ähnlich drückt sich sein Zeitgenosse Plinius aus. Er sagt
nämlich: „Syrien erzeugt in der oberhalb Phönikiens gelegenen Gegend
den Styrax (styrax); auch wird der von Pisidien, Sidon, Cypern
und Kilikien gerühmt, nicht aber der von Kreta. Der beste ist der
braunrote, fettigzähe aus dem syrischen Amanus. Verfälscht wird der
Styrax mit Zedernharz und Gummi, auch mit Honig und bittern Mandeln.
Vom besten kostet das Pfund 17 Denare (etwa 10 Mark). Der Styrax wird
innerlich und äußerlich gebraucht.“ Dieses Styrax ist das der Benzoe
verwandte balsamisch riechende Gummiharz des Styraxbaumes (Styrax
officinale), eines 4–7 m hohen, strauch- bis baumartigen
Gewächses mit kurzgestielten, eiförmigen, unterseits weißfilzigen
Blättern, endständigen Trauben wohlriechender Blüten und filzigen,
grünen Steinfrüchten. Er wächst in Südeuropa, Kleinasien, Syrien,
Cypern und Kreta.
An die Stelle dieses festen Styrax, der den alten Kulturvölkern allein
bekannt war, ist seit dem 17. Jahrhundert der flüssige Styrax
getreten, der aus dem unter der Rinde liegenden Splint des in Lykien
und Karien wachsenden Amberbaums (Liquidambar orientalis)
durch Kochen mit Wasser und Abpressen gewonnen wird. Das wiederum
getrocknete Holz dient mit gepreßter Borke in der griechischen Kirche
als Christholz neben Weihrauch zu rituellen Räucherungen und kam
früher als Weihrauchrinde in den Handel.
Außer dem Holz des Amberbaums wurden im Altertum wie heute noch im
Orient, besonders aber bei den verschiedenen südasiatischen Völkern,
andere wohlriechende Hölzer zu Kultzwecken, beim Gottesdienst und bei
feierlichen Opfern verbrannt. Unter ihnen sind das Sandelholz
und das Aloeholz weitaus die wichtigsten. Ersteres ist
das höchst aromatisch, rosenartig riechende, gelbe Kernholz oder
Holz von älteren Stämmen des an der Malabarküste heimischen, aber
in ganz Vorder- und Hinterindien, besonders auf den Sundainseln,
angepflanzten Sandelbaumes (Santalum album — weiß genannt,
weil das geruchlose Splintholz weiß ist). Die Hindus, Malaien und
Chinesen benutzen das wohlriechende Holz zu mancherlei kostbaren
Gerätschaften und zu Götzenbildern. Die Buddhisten schnitzen sich
mit Vorliebe Rosenkränze daraus und die Chinesen bedienen sich des
Holzes zugleich mit Weihrauch als Räuchermittel in den Tempeln und bei
Leichenbegängnissen. Auch die wohlhabenden Inder und Araber räuchern
in[S. 237] ihren Häusern mit demselben und lassen sich daraus Pfeifenrohre
schneiden. Letzteres dagegen, das als Aloe gerühmte Räucherwerk des
Alten Testaments, ist ein dunkelbraunes, sehr hartes und sprödes Holz,
das von Aquilaria agallocha, einem Baume Hinterindiens stammt.
Es enthält nur wenig wohlriechendes Harz; man schneidet daher die
harzfreien Teile weg oder gräbt die Stämme in die Erde, wobei dann
das ganze Holz gleichmäßig damit durchtränkt wird. Die Kulturvölker
des Altertums schätzten es hoch und bezahlten es sehr teuer. Der
um die Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. lebende griechische Arzt
Dioskurides nennt es in seiner Arzneimittellehre agállochon und
sagt, es sei ein punktiertes, wohlriechendes Holz, das aus Indien und
Arabien gebracht werde und zum Kauen diene, um dem Munde Wohlgeruch zu
verleihen, auch zum Räuchern statt Weihrauch, und außerdem in manchen
Fällen als Arznei benutzt werde. Nach dem Untergange des Römerreiches
wurde es nur noch im üppigen Byzanz verwendet und kam erst wieder,
als das Abendland zur Zeit der Kreuzzüge mit dem Morgenlande in
Beziehungen trat, durch die Araber nach Europa. Es galt im Mittelalter
als besonders heilkräftig, während es jetzt noch in Ostasien in der
Parfümerie und zu Heilzwecken Verwendung findet. In seiner Heimat
Hinterindien wird es regelmäßig in den Tempeln verbrannt. Napoleon I.
benutzte es in seinen Palästen mit Vorliebe zu Räucherungen als Parfüm.
Endlich sind noch zwei nicht in den europäischen Handel gelangende
Produkte zu nennen, die bei den ostasiatischen Kulturvölkern eine große
Rolle spielen. Erstens der Sumatra- oder Borneokampfer,
ein dem gewöhnlichen Laurineenkampfer ähnliches, zugleich aber etwas
nach Patschuli riechendes festes ätherisches Öl von weißer Farbe
und kristallinischem Aussehen, das in den Stämmen des hohen, auf
Sumatra und Borneo wachsenden Kampferbaums oft in großen, mehrere
Pfund schweren Stücken ausgeschieden wird, sonst das ganze Kernholz
zur Konservierung und zum Schutze vor Insektenfraß und Pilzinvasion
durchtränkt. Bevor der echte oder Laurineenkampfer aufkam, war er
wie heute noch in China und Japan der allein als Räuchermittel bei
gottesdienstlichen und andern feierlichen Handlungen verwendete, der
dort auch zum Einbalsamieren der Leichen Vornehmer dient. Er ist
sehr teuer und kam zu Beginn des Mittelalters als wertvolle Arznei
und kostbares Räuchermittel nach Syrien, wo ihn der griechische Arzt
Aetios aus Amida im 6. Jahrhundert als kaphura zuerst erwähnt.
Ins Abendland kam er durch die Vermittlung der sich seiner häufig[S. 238]
bedienenden arabischen Ärzte und wird um 1070 in Italien vom jüdischen
Arzt Simon Seth und um 1150 von der gelehrten Hildegard, Äbtissin
des Klosters Rupertsberg bei Bingen, erwähnt. Erst zu Beginn des
17. Jahrhunderts wurde er durch den weit billigeren ostasiatischen
Laurineenkampfer ersetzt. Zweitens der in Cochinchina, Java und Amboina
aus der Komposite Blumea balsamifera gewonnene Blumea-
oder Ngaikampfer, der seiner Kostbarkeit wegen in seiner Heimat
und in China nicht mehr zu Räucherungen, wohl aber als Arzneimittel
und in letzterem Lande auch zum Parfümieren der feinen Schreibtusche
verwendet wird.
[S. 239]
XXVI.
Die pflanzlichen Wohlgerüche.
Die Hervorbringung von Duftstoffen ist eine ungemein verbreitete
Erscheinung in der Pflanzenwelt. Von den niederen Pilzen bis
hinauf zu den höchsten Blütenpflanzen wird dieser Weg mit Vorliebe
eingeschlagen, um die verschiedenen Insekten zur Verschleppung
der Sporen oder zur Befruchtung der Blüten durch Übertragung des
Blütenstaubs herbeizulocken. Auch bei den Tieren steht die Ausbildung
von Duftstoffen in engster Beziehung zur Fortpflanzung, und zwar wenden
sie hier die Männchen zur Anlockung und geschlechtlichen Erregung der
Weibchen an. Man denke außer vielen anderen nur an den Duftstoff der
Schmetterlinge, des Bibers, des Moschustieres und der Zibetkatze, welch
beide letzteren dem Menschen die stärksten überhaupt existierenden
Parfüme lieferten. Daß Wohlgerüche auch auf den Menschen anregend und
belebend wirken, ist eine längst festgestellte Tatsache, die neuerdings
auch durch wissenschaftliche Versuche belegt wurde. So konnte man
beispielsweise feststellen, daß ein Mann, der unter gewöhnlichen
Bedingungen am Ergographen 1 kg mit dem Daumen hochzuheben
vermochte, unter dem Banne des Geruches von Tuberosen 1 kg
und 100 g hochhob. In ähnlicher Weise die Psyche anregend
und dadurch die Muskelkraft und die körperliche Leistungsfähigkeit
überhaupt steigernd wirken andere Wohlgerüche. Vor allem wird aber
die geistige Tätigkeit, besonders die Phantasie durch gewisse Düfte
angeregt, die bei den verschiedenen Menschen ganz verschieden
bevorzugt werden. So liebte der große Dichter Friedrich Schiller beim
Geruche faulender Äpfel, die er sich stets in der Schublade seines
Schreibtisches hielt, Viktor Hugo dagegen bei demjenigen der wilden
Winde zu dichten. Starke Düfte wie Moschus regen auf, und unangenehme
Gerüche können empfindsame Menschen geradezu krank machen. So wurde der
große Albrecht von Haller durch den Geruch von Käse, der Herzog[S. 240] von
Epérnay durch denjenigen des Hasen geradezu ohnmächtig; Knoblauchgeruch
entkräftete Heinrich III. von Frankreich, spornte dagegen Heinrich IV.
zu den tollsten Streichen an.
In besonders nahen Beziehungen stehen Wohlgerüche zur Mystik und
zum Geschlechtsleben. Im vorigen Abschnitt haben wir gesehen, wie
das Verbrennen wohlriechender Harze und solche enthaltender Hölzer
schon sehr früh in den Gottesdienst der orientalischen Kulturvölker
eingeführt wurde, um durch die Geruchsorgane die Sinne zur leichteren
suggestiven Aufnahme übersinnlicher Eindrücke in das für solche
Dinge empfängliche Gemüt vorzubereiten und es so in Ekstase zu
versetzen. Von den morgenländischen Religionen ging dieser Gebrauch
auf die abendländischen über und spielt heute noch eine bedeutende
Rolle im Kulte. Vom Verbrennen solch wohlriechender Drogen wie
Weihrauch, Myrrhen und bei den alten Europäern namentlich von Holz und
getrockneten Beeren des Wacholders, rührt auch der in den deutschen
Sprachgebrauch übergegangene französische Ausdruck Parfüm her, der
aus dem Lateinischen per fumum abzuleiten ist, was „durch den
Rauch“, d. h. durch die Verbrennung gewisser Substanzen erzeugter
Wohlgeruch bedeutet.
Alles deutet darauf hin, daß sich das Weib zuerst der Wohlgerüche als
sexuellen Reizmittels bediente und erst weit später dieselben zur
Verdeckung eigener übler Gerüche verwendete. Es ist durchaus kein
Zufall, daß bei allen Verführungsszenen im Alten Testament Parfüms
erwähnt werden. So weit wir in der Geschichte zurückzugehen vermögen,
finden wir wohlriechende Salben und Öle im Inventar vornehmer Frauen
und Hetären, und zwar war schon im alten Reiche in Ägypten die
Verwendung der Wohlgerüche so spezialisiert, daß für alle Körperteile
besondere Parfüms zur Anwendung gelangten. Von den Orientalen, die bis
auf den heutigen Tag große Liebhaber von Wohlgerüchen sind, so daß
sie sogar das Konfekt nach unserm Empfinden übermäßig parfümieren,
übernahmen die Griechen und Römer diese Vorliebe für Wohlgerüche. Als
die Makedonier im Gefolge Alexanders des Großen nach der Niederlage
des Dareios bei Gaugamela am 1. Oktober 331 v. Chr. die luxuriösen
Zelte des persischen Großkönigs Dareios plünderten, waren sie nicht
nur über die mancherlei darin befindlichen Kostbarkeiten, sondern
vor allem auch über den unermeßlichen Reichtum an wohlriechenden
Salben und köstlichen Gewürzen erstaunt. Doch bald lernten sie an
diesen Produkten einer verfeinerten Kultur selbst große Freude haben,
und so war bald auch in den reichen[S. 241] Griechenstädten der Luxus an
Parfümen ein gewaltiger, so daß sich schließlich die Gesetzgeber
genötigt sahen, dagegen einzuschreiten. Das von den Alten wegen der
in dieser Stadt herrschenden Vorliebe für diese wohlriechende Blume
als „veilchenduftend“ bezeichnete Athen trieb in den drei letzten
vorchristlichen Jahrhunderten die Parfümverschwendung so weit, daß für
die verschiedenen Teile des Körpers besondere Salben im Gebrauch waren.
Dort rieben die üppigen Frauen die Haare mit einem Parfüm aus Majoran
ein, Kinn und Nacken dagegen mit einem solchen aus Thymian und die Arme
mit einem aus Minze. In dem verweichlichten Rom der Cäsaren wurde die
Verschwendung mit Wohlgerüchen auf die Spitze getrieben. Damals war
das unter dem Konsulat des Licinius Crassus aufgebrachte Gesetz, das
in Italien den Verkauf ausländischer Parfümerien verbot, schon längst
als unhaltbar aufgegeben, und von weither bezog man die kostbarsten
Essenzen, den Veilchenduft von Athen, Rosenöl aus Kyrene, Nardensalbe
aus Assyrien, Hennablütenextrakt aus Ägypten usw. Die Verwendung der
Parfüms stand ganz im Dienste der Liebesgöttin Venus, und der Handel
mit den Wohlgerüchen wurde meist von Kurtisanen, Kupplerinnen und
Bordellwirten ausgeübt.
Man macht sich keinen rechten Begriff von den Unsummen, die damals in
Rom für Wohlgerüche und kostbare Salben ausgegeben wurden. Zahllos
sind die von den alten griechischen und römischen Schriftstellern
genannten Drogen, die zur Bereitung der täglich nach dem Bade zur
Geschmeidigmachung des Körpers angewandten Salben verwendet wurden.
Die hauptsächlichsten sind das Rosen-, Lilien-, Veilchen-, Narzissen-,
Myrten-, Majoran-, Thymian-, Minzen-, Basilikum-, Iris-, Narden-,
Kalmus-, Kardamom-, Balsamholz-, Zimt-, Kassia-, Malabathron- (von
der ostasiatischen Kassienart Cinnamomum dulce), Safran-,
Weihrauch-, Myrrhen- und Galbanumöl.
In seiner Naturgeschichte berichtet uns der beim Vesuvausbruch, der
Pompeji und Herkulanum verschüttete, 79 n. Chr. umgekommene ältere
Plinius, daß wohl die Perser die Erfinder der Salben seien; „denn diese
schmieren sich bis zum Triefen damit ein. Das erste Salbenkästchen hat,
so viel mir bekannt, Alexander nach der Besiegung des Darius unter den
Sachen vorgefunden, die dieser König mit sich führte. Später hat sich
der Gebrauch der Salben auch bei uns verbreitet. Man schätzt sie hoch,
man glaubt, sie gehören zu den Annehmlichkeiten des Lebens, ja man geht
so weit, daß man die Leute noch einsalbt, wenn sie tot sind.“
[S. 242]
Die Namen der Salben sind teils von ihrem Ursprung, teils von ihren
Bestandteilen, teils aus anderer Veranlassung hergenommen. Bald hat
man der einen, bald der andern den Preis zuerkannt, bald hat man die
einzelnen Salben am liebsten aus dem einen, bald aus dem andern Lande
bezogen. Sie bestehen aus einem mit einem Riechstoff imprägnierten
Öl und sind vorzugsweise mit Drachenblut (dem blutroten Harz des
Drachenblutbaumes von Sokotra, der bekannten Insel Ostafrikas) oder
Färberochsenzunge gefärbt. Dabei bewirkt eine Beimengung von Harz
oder Gummi, daß sich der Riechstoff nicht so schnell verflüchtigt.
Verfälscht werden die Salben auf vielerlei Art.
Es gibt Leute, welche die Salben lieber dickflüssig als dünnflüssig
haben, die sich also mit ihnen lieber beschmieren als begießen lassen.
Marcus Otho hat sogar den Kaiser Nero dahin gebracht, daß er sich die
Fußsohlen salben ließ, was doch wohl barer Unsinn ist. Man hörte auch
von einem einfachen Bürger, der die Wände seiner Bäder salben ließ.
Der Kaiser Cajus (Caligula) ließ die Badesessel salben, und später
machte sich auch ein Sklave des Nero dieses kaiserliche Vergnügen.
Die Liebhaberei für Salben hat sich sogar in die römischen Feldlager
eingeschlichen, und an festlichen Tagen werden die Adler der Legionen
und andere bestäubte, von Lanzenspitzen umstarrte Feldzeichen gesalbt.
Wann der Gebrauch der Salben sich unter den Römern verbreitet habe,
wage ich nicht zu sagen. Jedenfalls ist es aber gewiß, daß im Jahre der
Stadt 565 (188 v. Chr.), nach Besiegung des Antiochus (im Jahre 190)
und Asiens, die Zensoren Publius Licinius Crassus und Lucius Julius
Cäsar das Gesetz gaben, daß niemand ausländische Salben verkaufen
dürfe. „Jetzt aber ist es längst so weit gekommen, daß gar manche sie
sogar in die Getränke tun und sich so auch inwendig parfümieren. Es
ist auch eine Tatsache, daß Lucius Plotius, Bruder des Konsuls und
Zensors Lucius Plancus, als er von den Triumvirn geächtet war und sich
im Salermitanischen verborgen hielt, durch seinen Salbengeruch verraten
wurde. Wird ein solcher Mensch totgeschlagen, so erleidet die Welt eben
keinen großen Verlust.“ Plinius kann sich also mit diesem übermäßigen
Parfümgebrauch, der durch griechischen Einfluß aufkam, nicht recht
befreunden. Anderthalb Jahrhunderte später weiß uns der in Naukratis
in Ägypten geborene und im luxuriösen Alexandreia lebende Grieche
Athenaios manch interessanten Zug von der Salbenmanie der üppigen
Griechen jener reichen Handelsstadt zu erzählen. So sagt er, daß es bei
den Reichen Sitte[S. 243] sei, nach der Mahlzeit Salben in goldenen Gefäßen
herumzugeben und man sich den Spaß mache, einem schlafenden Gaste das
Gesicht tüchtig damit einzuschmieren.
Um zu zeigen wie sich ein echter griechischer Stutzer salbt, führt
dieser sehr belesene Grammatiker Athenaios eine Stelle aus der Alkestis
des Dichters Antiphanes an, wo es heißt: „Wenn er sich gebadet, läßt
er sich aus einem goldenen Becken Hände und Füße mit ägyptischer
Salbe einreiben, mit phönikischer Salbe dagegen Wangen und Brust,
mit Minzensalbe die Arme, mit Majoransalbe die Augenbrauen und das
Haupthaar, mit Thymiansalbe Knie und Hals.“ Dann führt er eine Stelle
aus dem Gedichte Prokris an, wo vorgeschrieben wird, wie dem Schoßhund
der Prokris abgewartet werden soll. A.: „Mach dem Hündchen ein
weiches Lager aus milesischer Wolle zurecht und lege eine hübsche
Purpurdecke darüber.“ — B.: „Du lieber Gott!“ — A.:
„Koch ihm Weizengraupen mit Gänsemilch (wohl mit Honig gemischte Milch,
worin Lebern eingeweicht sind)!“ — B.: „Potz tausend!“ —
A.: „Salbe ihm die Füße mit megallischer Salbe!“ —
Derselbe Autor berichtet: „König Antiochos Epiphanes (A. IV., syrischer
König aus dem Stamm der Seleukiden, regierte 175–163 v. Chr., reizte
durch grausame Tyrannei die Juden zum Aufstand unter den Makkabäern
und machte einen erfolglosen Angriff auf Ägypten) pflegte sich in
öffentlichen Bädern unter der Menge des badenden Volkes mit zu baden
und ließ jedesmal ganze, mit den kostbarsten Salben gefüllte Fäßchen
mitbringen. Bei dieser Gelegenheit sagte einmal jemand zu ihm: ‚Ihr
Könige seid doch recht glücklich, daß ihr so herrliche Salben führt
und einen so angenehmen Wohlgeruch verbreitet!’ Der König gab keine
Antwort, kam aber am anderen Tage wieder, brachte ein gewaltiges Gefäß
mit, das mit der kostbaren Myrrhensalbe, welche stáktē heißt,
gefüllt war, und ließ es über dem Kopfe dessen, der ihn glücklich
gepriesen hatte, ausgießen. Sobald dies geschehen war, sprangen alle,
die sich im Badehause befanden, scharenweise auf, rannten herbei, um
auch etwas von der Salbe zu erwischen und sich damit einzuschmieren.
Auch der König rannte in derselben Art herbei, und wie nun der Boden
schlüpfrig war und einer über den andern herfiel, so gab es ein laut
schallendes Gelächter.“ Späterhin schreibt er: „Bei einem großen,
feierlichen Aufzuge, den derselbe König bei Gelegenheit der Daphnischen
Spiele abhielt, befanden sich auch 300 Weiber, welche aus goldenen
Urnen Salben umherspritzten.“
[S. 244]
Auch bei öffentlichen Schaustellungen liebte man im üppigen Rom der
Kaiserzeit, das Publikum mit Wohlgerüchen zu bespritzen; so schreibt
der römische Philosoph und Tragödiendichter Lucius Annaeus Seneca (2–65
n. Chr.), besser als Erzieher und Leiter des jugendlichen Nero bekannt,
in einer seiner Episteln: „Heutzutage hat man sogar die Erfindung
gemacht, in verborgenen Röhren Wasser, das mit Safran gemischt ist,
bis zu einer ungeheuren Höhe emporzupumpen, um die Leute im Theater
damit zu bespritzen und zu parfümieren. Man hat die Kunst erfunden,
das Theater plötzlich mit Wasser zu füllen und es so in einen Teich
zu verwandeln, und wieder trocken zu legen; ebenso hat man die Kunst
erfunden, bei Schmausereien dem Speisesaal bei jedem Gericht eine neue
Decke zu geben.“
Von Kaiser Hadrian, der von 117–138 regierte, schreibt der
Geschichtschreiber Älius Spartianus: „Kaiser Hadrian teilte zu Ehren
seiner Schwiegermutter Gewürze (aroma) unter das Volk aus und
ließ zu Ehren (seines Vorgängers) Trajan über die Stufen des Theaters
(wohlriechenden Mekka-) Balsam und (zur Parfümierung in Wein gelösten)
Safran fließen.“ Zu dessen Zeit wurden auch die Statuen in den Theatern
mit duftenden Essenzen aller Art, besonders auch dem sehr beliebten
Safran gesalbt, von welchem nach dem griechischen Arzte Dioskurides
Thessalos behauptete, er sei das einzige wirklich gut riechende Ding.
Es gab damals auch hohle Bildsäulen aus Erz, die mit feinen Poren
bedeckt waren, aus welchen man wohlriechende Essenzen herauszupressen
vermochte, so daß die Luft ringsum mit Wohlgerüchen erfüllt war. Auch
bei Gastmählern der Vornehmen war die Einrichtung getroffen, daß aus
den Kuchen und dem Obst bei der geringsten Berührung wohlriechende
Parfüms, mit Vorliebe in Wein gelöster Safran herausflossen. Und von
Kaiser Heliogabalus (eigentlich Valerius Avitus Bassianus, wurde als
Oberpriester des syrischen Gottes Elogabalus, dessen Namen er selbst
annahm, auf Anstiften seiner Großmutter Julia Mäsa, der Schwägerin des
Kaisers Septimius Severus, 218 17jährig von den syrischen Legionen
zum Kaiser ausgerufen, zog 219 in Rom ein, wohin er den orgiastischen
Dienst seines Gottes verpflanzte und ein schwelgerisches, wollüstiges
Leben führte, bis er schon 222 von der Leibgarde, den Prätorianern,
ermordet wurde) berichtet sein Biograph Älius Lampridius: „Kaiser
Heliogabalus ließ die Polster, auf denen er mit seinen Gästen bei
Tische lag, oder die Betten, auf denen er ruhte, mit Rosenblättern
füllen, ließ die Säulenhallen mit Rosenblättern bestreuen und ging
auf diesen spa[S. 245]zieren, oder er gebrauchte statt der Rosen allerlei
Blumen wie Lilien, Veilchen, Hyazinthen und Narzissen. Er badete nur
in Teichen, deren Wasser mit edlen Essenzen oder mit Safran gemischt
war. Die Polster, auf denen er gewöhnlich bei der Mahlzeit lag, waren
mit Hasenhaar oder Rebhuhnfedern ausgestopft. — Einst lud Heliogabalus
die vornehmsten Herren zu Gast und wies ihnen als Sitz Sofas an, die
mit Safran gepolstert waren.“ Auch andere antike Schriftsteller melden
allerlei von solchem, erst durch orientalische Einflüsse in das Rom der
Cäsaren gekommenen extravaganten Luxus.
Nach dem Untergange der römischen Weltherrschaft beschränkte sich
die Anwendung der feineren Parfümerien wesentlich auf das an Kultur
höher stehende Morgenland und die Vornehmen von Byzanz, während das
die Weltflucht predigende Christentum des Abendlandes solchem Luxus
nicht gewogen war. Unter den Arabern, die, wie alle Orientalen,
Wohlgerüche sehr lieben, wurde mit den Parfümen besonders von Rosen
ein großer Luxus wenigstens unter den Vornehmen, die sich solches
leisten konnten, getrieben. Und diese Liebhaberei verbreiteten sie
überall in Nordafrika, Spanien und Sizilien, wo sie Fuß faßten. Hier
war im Gegensatz zum asketischen Christentum überall eine Stätte
frohen Lebensgenusses. Wie in Bagdad so wurden auch in Andalusien
Blumengärten angelegt und heitere Feste gefeiert. Zur Zeit der
Abbaditenherrschaft hatte Sevilla beispielsweise 400000 Einwohner und
war ganz Andalusien durch die Fülle seiner reichbewässerten Kulturen
ein Paradies, von dessen Herrlichkeiten sich als letzte Zeugen die
auf Mandelbäume gepfropften Rosen erhielten. Als Beispiel des hier
im Fürstenhause herrschenden Luxus sei erwähnt, daß, als einmal der
Lieblingsgattin des als Dichter hervorragend begabten Abbaditenfürsten
Muchtamid die Lust ankam, es den Weibern aus dem Volke nachzumachen,
die sie mit bloßen Füßen Lehm treten sah, dieser duftende Spezereien
zerreiben und auf den Boden des Saales ausstreuen ließ, so daß sie
ihn ganz bedeckten. Alsdann ward Rosenwasser darauf gegossen, und mit
Vergnügen wateten die vornehmen Damen in der schlammartigen Masse von
Myrrhen, Weihrauch, Zimt, Ambra und Moschus. Erst durch den Einfluß
der Kreuzzüge und der arabischen Ärzte kam auch im Abendlande die
Anwendung von Wohlgerüchen bei den Wohlhabenden auf und drang während
der Renaissance in breitere Volksschichten zunächst in den reichen
Städten Italiens, später auch Mitteleuropas ein. Aus ihrer Heimat
Florenz verpflanzte Katharina von Medici 1533 bei ihrer Vermählung mit
Franz I. Sohn,[S. 246] dem nachmaligen König Heinrich II., den übermäßigen
Gebrauch von Parfümen an den französischen Hof, der dann unter Ludwig
XIV. und XV. die Verwendung von Wohlgerüchen beinahe so weit trieb,
als es die Vornehmen im kaiserlichen Rom getan hatten. Wie der Kaiser
Nero seine Gemächer stets mit Rosenessenzen parfümiert haben wollte,
liebte Ludwig XIV. in einer stark nach Orangenblüten duftenden
Atmosphäre zu leben. Der allmächtige Minister Richelieu, der seit 1624
unter Ludwig XIII. die Geschicke Frankreichs leitete, verließ nur
selten sein scharfparfümiertes Arbeitszimmer. Zu seiner Zeit war der
Geruch faulender Äpfel sehr beliebt und man rieb deren zersetztes, mit
Gewürznelken und Zimt gespicktes Fleisch mit Fett zusammen, um sich
mit der so erhaltenen Masse die Haare zu parfümieren. Es ist dies die
Pomade, die von den faulen Äpfeln pommes ihren Namen erhielt
und deshalb eigentlich wie im Französischen Pommade geschrieben werden
sollte. So üppig auch der französische Hof war, so war er in bezug auf
Reinlichkeit kein Muster, und hier wurden die Parfüme zum großen Teil
zum Verdecken der eigenen üblen Gerüche verwendet. Im Gegensatz zur
Badfreundlichkeit des Mittelalters war jene Zeit sehr wasserscheu; bis
zum König hinauf mied man als Nachwirkung der mittelalterlichen Askese
nach Möglichkeit selbst das tägliche Waschen von Gesicht und Händen mit
Wasser, befeuchtete vielmehr nur diese Körperteile bei der Toilette
mit Parfümen, und war daneben äußerst sparsam mit dem Wechseln der
Leibwäsche, die viele Wochen anbehalten wurde, bis man sich endlich
zum Wechseln derselben entschloß. Besonders unter dem liederlichen
Ludwig XV. wurde die Verschwendung in der Anwendung von Parfümen eine
heillose, so daß dessen eine Mätresse, die Pompadour, jährlich dafür
mehr als eine halbe Million Franken ausgab. Und zwar waren damals die
stärksten Düfte die beliebtesten, so außer Peau d’Espagne besonders
Moschus, Zibet, Ambra und sogar Asa foetida (Teufelsdreck). In
den Räumen, in denen sich der König aufhielt, mußte jeden Tag mit den
Parfümen gewechselt werden. Noch die Kaiserin Josephine überfüllte ihr
Schlafzimmer mit Moschusduft, während der Kaiser Napoleon I. sich mit
Kölnischem Wasser überschwemmte.
Heute verwenden selbst die Vornehmen nicht mehr solch übertriebene
Parfümierung, die nur ein Zeichen stumpfer Geruchsnerven und unfeiner
Art ist. Am meisten Parfümluxus treiben noch die elegant sein wollenden
Frauen, deren Geruchsorgan, wie durch eingehende wissenschaftliche
Versuche festgestellt wurde, überhaupt weniger fein[S. 247] empfindet als
dasjenige der Männer, so daß ihnen ein Parfüm noch angenehm ist, das
letzteren vielfach schon unangenehm stark erscheint. Aber wenn auch
heute bedeutend weniger ausgiebig wie früher parfümiert wird, so ist
dennoch der Verbrauch an Parfümen sehr viel größer als je in der
parfümwütigsten Vergangenheit, weil derselbe sich nicht mehr auf die
höchsten Kreise, die sich diesen Luxus erlauben konnten, beschränkt,
sondern sich auf alle Volkskreise gleichmäßig ausgedehnt hat, so daß
die Herstellung derselben einen bedeutenden Industriezweig darstellt.
Und zwar wird heute im Gegensatz zum Altertum nicht sowohl der Körper,
als die getragene Leibwäsche und die Schränke und Behälter, in denen
sie aufbewahrt wird, parfümiert, wobei jedes Individuum am besten sein
eigenes, seiner Persönlichkeit entsprechendes Parfüm wählt und dann
auch beibehält. Denn es ist entschieden als ein Fehler zu bezeichnen,
daß man die Wohlgerüche alle Tage wechselt, wie es zwar auch manche
Modeköniginnen tun, die immer das Parfüm gebrauchen, das nach ihrem
Geschmack zur Farbe ihrer jeweiligen Toilette zu gehören scheint. Es
ist ein Zeichen viel höherer Kultur und feinerer Sitte, wenn Damen
unter allen Umständen den von ihnen als sympathisch empfundenen und
deshalb gewählten Wohlgeruch immer, als unzertrennlich von ihrer
Art und Person wählen, gleich der Rose, Lilie oder Nelke, die auch
stets nur ihren spezifischen, ganz zu ihnen gehörenden und mit zur
Kennzeichnung ihres Wesens dienenden Duft aufweisen. Am raffiniertesten
wird der Parfümgebrauch in Frankreich getrieben, wo die eleganten
Damen in die Säume ihrer Röcke und in die Achselseiten der Taillen
schmale Streifen getrockneten Parfüms in Pulverform einnähen lassen,
der bei jeder Bewegung des Rocksaumes und der Gestalt fein berauschend
emporwirbelt. Dabei wird das Haar niemals parfümiert, da es bei
jeder Person seinen eigenen Wohlgeruch hat, der sich nur bei der
allergrößten, peinlichsten Reinlichkeit bei Anwendung vielfacher
Waschung zeigt, und um so mehr hervortritt, je mehr das Haar gereinigt
und gepflegt wird. So soll, um nur zwei Beispiele anzuführen, nach Ada
von Gersdorff, das nun weiß werdende Blondhaar der deutschen Kaiserin
Auguste Viktoria einen feinen, an Veilchenduft erinnernden Geruch
aufweisen, während das einst dunkle, nun ebenfalls grau werdende
Haar der Königinwitwe Margarita von Italien einen zarten Ambraduft
aushauchen soll. Beide Fürstinnen parfümieren es niemals.
Europa verbraucht jährlich etwa 1 Million kg flüssiges Parfüm,
800000 kg Pomaden und Essenzen, außerdem aber ungeheure Mengen[S. 248]
parfümierter Seifen, Puder, Räucherkerzen, Waschwässer usw. Die
meisten Parfüms liefert Frankreich, das jährlich für über 12 Millionen
Franken davon ins Ausland versendet, während Deutschland in demselben
Zeitraum für gegen 2 Millionen Mark ein- und für 6½ Millionen Mark
ausführt. Erst neuerdings ist auch England in den Wettbewerb mit
jenen beiden Ländern getreten. In Frankreich ist die Südküste an der
Riviera der Produktionsort der meisten Wohlgerüche, und zwar ist das
Zentrum dieser Industrie das Städtchen Grasse, wenige Stunden westlich
von Nizza, dann auch Cannes und Nizza selbst, wo gewaltige Kulturen
wohlriechender Blumen angelegt sind, um dem Bedarfe der Parfümfabriken
zu genügen. Diese verarbeiten jährlich ebenfalls über 1 Million
kg der verschiedensten wohlriechenden Blumen und Kräuter und
beschäftigen dabei etwa 15000 Menschen. Die Kunst der Parfümgewinnung
aus Blumen ist hier erst in der Neuzeit aufgekommen. Und zwar sind
die zur Parfümgewinnung verwandten Stoffe des Pflanzenreichs fast
stets ätherische Öle, die aus den Blüten, Blättern, Fruchtschalen
oder anderen Teilen der betreffenden Pflanze durch Auspressen, durch
Destillation mit Wasserdampf oder durch Zusammenbringen mit Fetten,
die sie aufnehmen, gewonnen werden. Die Destillation mit Wasserdampf
wird da angewendet, wo der Duftstoff, wie z. B. in den Blüten der
Rose, quantitativ ein für allemal ausgebildet ist. Dadurch würde man
nun bei anderen Blüten, wie Jasmin, Tuberose und dergleichen, die
während ihrer Blütezeit immer nur ganz geringe Mengen Parfüm auf einmal
bilden, da sie durch den Wasserdampf getötet werden, bloß minimale
Mengen des Duftstoffes gewinnen. Hier wendet man das Zusammenbringen
mit einem das Parfüm gierig aufsaugenden Körper wie Fett an. Bei
diesem Prozeß, den die Franzosen Enfleurage bezeichnen, kommen die
betreffenden wohlriechenden Blüten auf hölzernen Gestellen zwischen
zwei Fettschichten zu liegen, an die sie ihren Riechstoff abgeben,
indem das Parfüm der vom Fett durch Gaze getrennten Blüten durch
darüber geleitete Luft auf dieses Medium übertragen wird. Das Fett —
früher reines Tierfett, jetzt bevorzugt man das geruchlose Vaselin —
wird dann durch Extraktion mit Äther von dem eingedrungenen ätherischen
Öl befreit oder kommt direkt als Pomade in den Handel. Auch nach
der Extraktion ist meist noch so viel Duftstoff im Fett enthalten,
daß dieser Rückstand als Haarpomade verkauft werden kann. Aus
1000 kg Jasminblüten lassen sich durch Destillation 200 g
ätherisches Öl entziehen; bei der Enfleurage aber gewinnt man aus
demselben Quantum etwa 1800 g ätherisches Öl und[S. 249] überdies
noch die vorgenannte Menge bei der schließlichen Destillation. Dies
macht also zusammen 2 kg Duftstoff.
Tafel 119.

Ein Feld von zur Parfümgewinnung angepflanzten
Tuberosen in Südfrankreich.

Rosenernte auf den Feldern der Parfümerie B. Court
in Grasse (Südfrankreich).
Tafel 120.

Das Sortieren der Rosen zur Gewinnung von Rosenöl.
(Parfümerie B. Court in Grasse.)

Das Extrahieren der ätherischen Öle im Wasserbad.
(Parfümerie B. Court in Grasse.)
Tafel 121.

Rosenernte der Firma Schimmel & Co. in Miltitz bei Leipzig.
❏
GRÖSSERES BILD
Tafel 122.
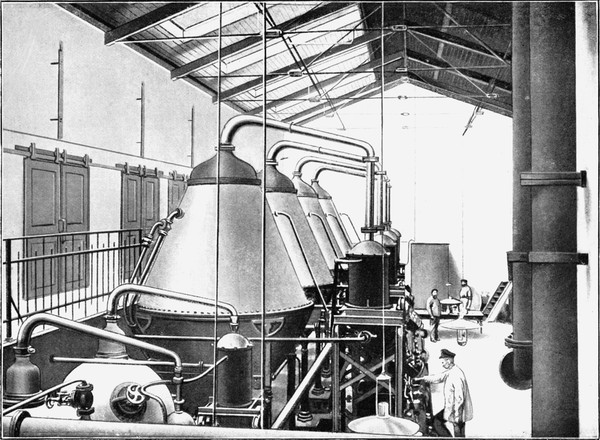
Destillierraum für Rosenöl der Firma Schimmel &
Co. in Miltitz bei Leipzig.
❏
GRÖSSERES BILD
Je mehr Farbe und Gerbstoff eine Blüte ausbildet, um so weniger
Riechstoff entwickelt sie. Weiße Blüten bilden, besonders wenn sie auf
die Befruchtung durch in der Dämmerung fliegende Falter angewiesen
sind, sehr starke Wohlgerüche aus, dann kommen die mehr auf den Besuch
von Taginsekten eingerichteten gelben und roten und erst zuletzt die
blauen Blüten. Grüne Blüten sind stets geruchlos, während bräunliche
und schmutzigrote, faulendem Fleisch ähnlich gefärbte, zur Anlockung
der die Befruchtung bei ihnen vollziehenden Aasfliegen jenen angenehme,
für uns aber unangenehme indoloide Düfte entwickeln. Eine Überfülle
von Licht erhöht wohl die Menge des Parfüms, vermindert aber dessen
Feinheit; deshalb sind viele im Norden gezogene Duftstoffe an Qualität
viel feiner als im Süden gewonnene. So übertrifft deutsches Rosenöl
an Feinheit das bulgarische, das übrigens auch mit weniger Sorgfalt
gewonnen wird, und Südengland bringt das wohlriechendste Lavendel- und
Pfefferminzöl hervor.
Die meisten Pflanzen verdanken ihren Geruch einem komplizierten Gemisch
verschiedener Verbindungen, und gerade die charakteristischsten
darunter finden sich oft in äußerst geringer Menge, so daß die
naturgetreue künstliche Nachahmung derselben zu den schwierigsten
Aufgaben der chemischen Technik gehört. Seltener ist ein einzelner
Stoff der alleinige oder wesentliche Geruchsträger, wie das Iron der
Iris- oder Schwertlilienwurzel, das identisch ist mit dem Jonon in der
Veilchenblüte — deshalb wird erstere im Volksmund auch Veilchenwurzel
genannt —, das Vanillin in der Vanilleschote, das Kumarin in der
Tonkabohne, im Waldmeister und Ruchgras, das Eugenol im Nelkenöl, der
Zimtaldehyd im Kassia- oder Zimtöl. Eine Analyse des Blumenduftes
ist deshalb meist ausnehmend schwierig, weil selbst Stoffe, die
quantitativ nur in Spuren vorhanden sind, oft die gewichtigsten
Faktoren im Konzert der verschiedenen Geruchskomponenten bilden. So
sind Hauptbestandteile des höchst aromatisch riechenden Nelkenöls die
schon längst bekannten beiden Duftstoffe Eugenol und Karyophyllen.
Mischt man nun auch diese beiden Körper im richtigen Verhältnis, wie
sie in den Gewürznelken enthalten sind, so hat diese Komposition
durchaus noch nicht den Geruch des Nelkenöls. Da wurde im Laboratorium
der größten deutschen Parfümfabrik, von Schimmel & Co. in Miltitz bei
Leipzig, die Beobachtung gemacht, daß das allererste Destillat des
ätherischen Öls ganz geringe Mengen eines äußerst intensiv und[S. 250] ganz
anders riechenden Körpers enthielt. Setzte man nur wenige Tropfen
von diesem dem Eugenol-Karyophyllengemisch zu, so erzielte man dann
erst den charakteristischen Geruch des natürlichen Nelkenöls. Eine
solche Substanz ist z. B. der Anthranilsäuremethylester, der dem
Orangenblütenöl seinen Duft verleiht; mit seiner Hilfe kann man eine
ganze Reihe noch anderer feiner Blumendüfte synthetisch erzeugen.
Allerdings sind das alles mehr oder weniger glückliche Nachahmungen
des Naturprodukts. Zu einem künstlichen Aufbau eines natürlichen
Parfüms gelangt man meist nur dann, wenn der Geruchsträger ein
einheitlicher Stoff ist. Eine solche Synthese gelang beim Vanillin
aus Eugenol und beim Veilchenduft Jonon (identisch mit dem Iron
der Schwertlilienwurzel) aus Geraniol, dem mit dem Rhodinol der
Rose identischen ätherischen Öl des Geraniums und wohlriechender
Grasarten. Ein Surrogat dagegen ist der künstliche Moschus, zu dessen
Herstellung ein Zufall geführt hat. Als Bauer nämlich das Butyltoluol
(das Toluol wird durch Destillation des Steinkohlenteers gewonnen)
mit Salpetersäure behandelte und dabei in jenes drei Nitrogruppen
einführte — dieselben Gruppen, die beispielsweise aus dem Glyzerin den
gefürchteten Sprengstoff Nitroglyzerin hervorgehen lassen — erhielt
er eine Substanz, die dem natürlichen, fast unerschwinglich teuren,
der sexuellen Anreizung des Weibchens dienenden Sekret des männlichen
Moschustieres täuschend ähnlich duftet.
Die Duftstoffe gehören den verschiedensten Körperklassen an. Die
ätherischen Öle sind Verbindungen von Kohlenwasserstoffen und
enthalten teilweise auch sauerstoffhaltige Körper. Viele scheiden
beim Erkalten einen Stearopten genannten festen Körper von anderer
Zusammensetzung als das flüssig bleibende Eläopten aus. Teilweise
sind die Duftstoffe Alkohole, wie das Geraniol (identisch mit
Rhodinol), das riechende Prinzip des kostbaren Rosenöls, oder das aus
dem billigen Terpentinöl gewonnene Terpineol, das dem Fliederparfüm
seinen charakteristischen Duft verleiht. Der Benzylalkohol ersetzt
zusammen mit Benzylacetat den Wohlgeruch des Jasmins, der Zimtalkohol
duftet nach Hyazinthen, das Menthol — auch ein Alkohol — gibt der
Pfefferminze ihr würziges, erfrischendes Aroma. Von Aldehyden ist
das Citral der Träger des Zitronengeruchs, Anisaldehyd derjenige des
blühenden Weißdorns; auch das Vanillin der Vanille und das Piperonal
des Heliotrops sind Aldehyde. Das Nitrobenzol ist das synthetische
Bittermandelöl. Künstlich gewinnt man auch das Neroliöl genannte Öl
der Orangenblüten, einen wesentlichen Bestandteil des Kölnischen
Wassers.[S. 251] Eine wichtige Gruppe bilden auch die Ester, Verbindungen
aus organischen Säuren und Alkoholen, weil sie nicht nur Geruchs-,
sondern auch Geschmacksträger sind, und zwar vermitteln sie gewöhnlich
Geschmack und Geruch von Obstsorten, wie Birne, Apfel, Ananas
usw. Schon im Jahre 1850 erschienen sie als die ersten künstlich
zusammengesetzten Parfüms im Handel, und zwar zuerst auf dem englischen
Markt als apple-oil und pear-oil. Heute verwendet man sie
meist für Limonaden, Fruchtbonbons und dergleichen mehr. Geruch und
Geschmack stehen ja in engem Zusammenhang, und erst die Kombination von
Geruchs- und Geschmackssinn vermittelt die Geschmacksabstufungen. Der
leichteste Schnupfen hebt ja nicht nur die Geruchs-, sondern auch die
Geschmacksempfindung mehr oder weniger auf.
Manche Duftstoffe riechen verdünnt und unverdünnt ganz gleich,
so z. B. der Moschus; andere wieder duften nur in chemischer
Reinheit sehr angenehm, während die geringste Verunreinigung einen
widerwärtigen Mißgeruch bewirkt. Andere wieder, wie das Jonon,
Vanillin und Kumarin, riechen in konzentrierter Form unangenehm
scharf und kampferartig und erst in sehr großer Verdünnung lieblich.
Die Gegenwart mancher Duftstoffe läßt andere selbst in den kleinsten
Dosen stark hervortreten, so beispielsweise der Kampfer die im Schweiß
enthaltenen Duftstoffe. Daher kommt es, daß, wenn jemand ein kürzlich
erst aus dem kampferhaltigen Behälter geholtes Kleid anhat, er schon
beim leichtesten Schwitzen einen unangenehm starken Schweißgeruch
verbreitet. Wie sich einerseits das Geruchsorgan gegen bestimmte Düfte
abstumpfen kann, so daß man sie vorübergehend oder dauernd nicht mehr
riecht, so kann dasselbe andererseits auch durch Übung sehr verfeinert
werden, was uns die Tee-, Hopfen- und Zigarrenhändler beweisen, die
Unterschiede der von ihnen zu beurteilenden Ware herausriechen, die ein
Ungeübter gar nicht herauszufinden vermag.
Man sollte meinen, das Vermögen, die Wohlgerüche zum Teil genau zu
kopieren und auf künstlichem Wege vielfach in größerer Vollkommenheit
darzustellen, habe die betreffenden Naturprodukte langsam verdrängen
müssen. Dies ist aber durchaus nicht der Fall, sondern der Verbrauch
der Drogen selbst steigt vielmehr und beide, Natur- und Kunstprodukt,
beherrschen nebeneinander den Markt, wie dies beispielsweise bei
der Vanille der Fall ist. Da viele Laien unbegreiflicherweise eine
unbezwingliche Scheu vor allen chemischen Kunstprodukten empfinden,
wird auch trotz allen Triumphen der Chemie in Zukunft stets[S. 252] das
Naturprodukt neben dem Kunstprodukt in Ehren gehalten werden und seine
alte Stellung behaupten.
Das älteste durch Destillation gewonnene ätherische Öl ist das Rosenöl,
das im 9. Jahrhundert n. Chr. zuerst in Persien durch Ärzte aus den
herrlich duftenden Centifolien des Landes gewonnen wurde. Ihm folgten
die Destillate von anderen wohlriechenden Pflanzenteilen, besonders
Orangenblüten, Levkojen, Moschusweide, Pfefferminze und anderen.
Bald war dieser neue Industriezweig an seinem ältesten Herd, in
Schiras in Persien, so verbreitet, daß der Staat von den Darstellern
solcher ätherischer Öle, unter denen das Rosenöl an Bedeutung weit
vorausstand, eine Steuer erhob. Die Kunst der Destillation kam dann im
10. Jahrhundert durch die Araber nach Spanien und drang von da über
Frankreich allmählich nach Deutschland vor, wo sie auch zum Extrahieren
der verschiedensten ätherischen Öle benutzt wurde. In Mitteleuropa
war die Rose zu selten, als daß es sich lohnte, aus ihr das Rosenöl
darzustellen. Dazu benutzte man die Fülle der wohlriechenden
orientalischen Rosen. In Südeuropa ist eine Haupterzeugungsstätte des
Rosenöls Kasanlik am Südabhange des Balkans in Bulgarien, wo die rote
Damaszenerrose in solchen Mengen an Hecken gezogen wird, daß trotz
der höchst primitiven, unzureichenden Destillation der Rosenblätter
in kupfernen Retorten über direktem Holzfeuer alljährlich an
3000 kg Rosenöl gewonnen werden. Bedenkt man nun, daß
5000–6000 kg Blumenblätter der Rose nötig sind, um 1 kg Rosenöl
zu liefern, so kann man sich vorstellen, um was für Mengen von Rosen
es sich dabei handelt, die alle innerhalb eines Monats gepflückt und
bearbeitet werden müssen. Die aufbrechenden Blüten werden in den ersten
Morgenstunden, während welcher der Ölgehalt am größten ist, gepflückt
und sollen noch an demselben Tage destilliert werden. An schönen,
sonnigen Tagen, wenn der Rosenflor in überreicher Menge sich entfaltet,
kommt man mit dieser Arbeit kaum nach, so daß dann viele Blüten
unbenutzt stehen bleiben und verblättern. Welch herrlichen Anblick
diese blühenden Rosenhecken im Mai und Juni gewähren, kann man sich
leicht vorstellen. Bei der ungeheuren Menge an Blüten, die erforderlich
sind, um größere Mengen des Rosenöls zu erzeugen, ist es kein Wunder,
daß 1 kg davon im Großhandel gegen 800 Mark kostet. Dieses von
den Türken Athar, d. h. Äther genannte Rosenöl ist hellgelb, von sehr
intensivem Rosengeruch und erstarrt bei 15–22° C. Infolge seiner
Kostbarkeit ist es kaum je unverfälscht zu haben. Am meisten dient dazu
das denselben Riech[S. 253]stoff in reichem Maße enthaltende und deshalb sehr
ähnlich duftende ätherische Geraniumöl, das in Almeria in Spanien,
dann in Algerien und seit 1887 besonders auf der Insel Réunion aus
den Blättern des hochrote Blüten aufweisenden, bis 1,6 m Höhe
erreichenden Rosengeraniums (Pelargonium roseum) gewonnen wird.
Dieses wird wiederum mit dem indischen Lemongrasöl verfälscht, das aus
dem in Südindien heimischen bläulichgrauen Lemongras (Andropogon
schoenanthus) gewonnen wird. Wie mit diesen beiden ätherischen Ölen
wird das Rosenöl auch mit dem überaus wohlriechenden, balsamartigen
ätherischen Öle verfälscht, das aus dem Holz des in Argentinien und
Paraguay wachsenden, 18 m hohen Guajakbaumes (Bulnesia
sarmienti) gewonnen wird und eine Ausbeute von 5,4 Prozent liefert.
Meist wird von den bulgarischen Rosenölfabrikanten das billige
ostindische, als Palmarosaöl bezeichnete Lemongrasöl zum Verfälschen
benutzt, von dem jährlich an 1000 kg dort eingeführt werden.
Demnach ist also nicht weniger als ein Drittel des bulgarischen
„Rosenöls“, von dem 1 kg im Großhandel, wie gesagt, gegen 800
Mark kostet, ostindisches Lemongras- oder Palmarosaöl, von dem
1 kg im Großhandel auf 23 Mark zu stehen kommt. Dabei wissen die
schlauen Bulgaren mit der größten Raffiniertheit die Kontrolle des
Staates zu umgehen und die beaufsichtigenden Beamten zu überlisten.
Sie wissen dem Lemongrasöl durch längeres Stehenlassen an der Sonne
seine Schärfe zu nehmen und ihm einen dem Rosenöl ähnlicheren Geruch
zu verleihen und besprengen dann mit diesem Öl die frischgepflückten
Rosenblüten schon auf dem Felde, so daß der im Destillierraum die
Prüfung vornehmende Beamte nie andere als solche mit Lemongrasöl
bespritzte Rosenblumenblätter zu Gesicht bekommt. Wer nun auch immer
für schweres Geld erworbene kleine, längliche Glasfläschchen mit
einigen Tropfen Inhalt aus der Türkei mit nach Hause bringt, kann
sicher sein, kein reines Rosenöl gekauft zu haben; oft hat er nur
Geranium- oder das noch billigere Lemongrasöl eingehandelt.
Mehr Garantie für reine Ware bieten die südfranzösischen Destillerien
hauptsächlich in Grasse, ein tadelloses Produkt dagegen liefert die
deutsche Firma Schimmel & Co. (Inhaber Gebrüder Fritzsche) in Miltitz
bei Leipzig, die mit zielbewußter Energie die Rosenölgewinnung in
die Hand genommen hat. Schon vor zehn Jahren hatte diese Firma 35
Hektare mit der roten, auch in Kasanlik angepflanzten Damaszenerrose
angebaut, die über 260000 kg Blüten lieferten. Sie bringt
jährlich etwa 100 kg Rosenöl in den Handel, welches an Reinheit
und in[S. 254]folgedessen an Qualität das bulgarische Produkt weit übertrifft
und deshalb im Großhandel das kg auf 1500 Mark zu stehen kommt.
Doch liefert diese Firma auch ein künstliches Rosenöl zu 280 Mark als
Engrospreis. Die von ihr benutzten Vakuumdestillationsapparate, die
bis zu 45000 Liter zu fassen vermögen, entsprechen selbstverständlich
den höchsten Anforderungen der Gegenwart, und die hohe technische
Vervollkommnung bedingt bei gleichem Destillationsprinzip eine viel
rationellere Ausnutzung des Rohmaterials und die Gewinnung eines in
jeder Beziehung ausgezeichneten Produktes. Das Rosenöl selbst besteht
aus einem duftlosen, wachsartigen, festen und einem flüssigen Körper,
welch letzterer der eigentliche Duftträger ist und Rhodinol genannt
wurde. Später stellte es sich heraus, daß es mit dem im Geraniumöl
und Lemongrasöl enthaltenen Geraniol identisch ist, die Bulgaren also
für ihre Verfälschung auf ein ätherisches Öl gestoßen sind, dessen
wichtigster Bestandteil genau derselbe ist wie beim echten Rosenöl.
Die große Verschiedenheit des Duftes ist auf geringfügige Beimengungen
zurückzuführen, die trotz ihrer zurücktretenden Quantität den Charakter
des Duftes bestimmen.
Da nun dem Altertum die Kunst der Destillation fehlte, die, wie
gesagt, erst im 9. Jahrhundert n. Chr. von persischen Ärzten erfunden
wurde, ist das, was die Alten unter Rosenöl verstanden, etwas ganz
anderes, als was wir darunter verstehen. Ihr Rosenöl war eine Art
Salbe (griechisch mýron), die wesentlich aus mit Rosenduft
imprägniertem, fettem Öl, und zwar Olivenöl bestand. In seiner
Arzneimittellehre teilt uns der um die Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr.
lebende griechische Arzt Dioskurides ihre Zubereitung in folgenden
Worten mit. „Rosenöl (ródinon élaion) wird so bereitet: Es
werden 5 Pfund und 8 Unzen (lateinisch uncia, im Gewicht von
1⁄12 Medizinalpfund oder rund 30 g) schoínos (Lemongras
oder wohlriechendes Bartgras, Andropogon schoenanthus, von
dem Dioskurides an einer anderen Stelle sagt, daß es in Arabien, und
zwar die beste im Lande der Nabatäer wachse, frisch, mit der Hand
gerieben, einen Rosengeruch verbreite, gekostet auf der Zunge heftig
brenne und vielfach als Arznei angewendet werde) klein geschnitten, in
Wasser geweicht, in 20 Pfund und 5 Unzen Olivenöl gekocht und zuweilen
umgerührt. Hierauf wird das Öl durchgeseiht und es werden ihm die
Blumenblätter (pétalon) von 1000 Rosen zugesetzt; diese dürfen
nicht naß sein, werden aber vorher mit wohlriechendem Honig gesalbt und
im Öle einen Tag lang zu wiederholten Malen mit den Händen gedrückt
und umgerührt. Hat[S. 255] sich nun etwas Hefeartiges zu Boden gesetzt, so
kommt die Masse in einen mit Honig ausgestrichenen Mischkrug. Die
Rosenblätter werden aus dem Öle genommen, ausgedrückt, in ein anderes
Gefäß getan, mit 8 Pfund 3 Unzen eingedickten Öles übergossen und
wiederum ausdrückt. Das letztere Verfahren gibt die geringere Sorte
Rosenöl. Man kann das Verfahren noch zweimal wiederholen, wodurch man
eine dritte und vierte Sorte Öl bekommt. Jedesmal wird aber das Gefäß
erst mit Honig ausgestrichen. Will man alle diese Rosenölsorten recht
stark machen, so wirft man in das zuerst gewonnene Öl wieder ebensoviel
frische Rosenblumenblätter, rührt sie mit Händen, die mit Honig gesalbt
sind, um, drückt sie aus und setzt dieselben dann auch noch ebenso
zur zweiten, dritten und vierten Sorte. So kann man siebenmal neue
Rosen ins Öl bringen, dann aber muß man aufhören. Auch die Presse wird
übrigens mit Honig bestrichen, und endlich wird das Öl sorgfältig
von dem Safte der Rosenblätter getrennt; denn bleibt von diesem nur
das Geringste darin, so verdirbt das Öl. — Manche Leute zerstampfen
die Rosen, stellen die Masse an die Sonne, werfen sie dann in Öl und
stellen dieses an die Sonne. Manche dicken vorher das Öl mit einem
Zusatz von Kalmus und langdornigem Ginster ein; andere tun, um ihm eine
schöne (rote) Farbe zu verleihen, Färberochsenzunge (anchúsa)
hinzu, oder, um die Haltbarkeit zu befördern, Salz. — Das Rosenöl wird
innerlich und äußerlich vielfach gebraucht.“
Seit der Gewinnung des echten Rosenöls im 9. Jahrhundert bildet es
als persisches Athar einen sehr wichtigen Handelsartikel im ganzen
Orient und gelangte von Persien aus bis nach Indien und China, wo es
ebenfalls sehr geschätzt wurde. Seit der Mitte des 15. Jahrhunderts
treten uns bestimmte Angaben über den Gebrauch dieses Rosenöls auch
in Europa entgegen. Seit dem 17. Jahrhundert verbreitete sich die
Rosenölindustrie von Persien aus weiter und gelangte damals auch nach
Bulgarien, wo sie aber erst im 19. Jahrhundert die jetzige große
Bedeutung erlangte. Die französische Rosenölindustrie begann um die
Mitte des 19. Jahrhunderts, die deutsche erst 1883.
Wie auf Ceylon und Malakka das in Arabien und Ostindien wildwachsende,
sehr gewürzhaft riechende und duftende Bartgras (Andropogon
schoenanthus) als Lemongras zur Gewinnung des wohlriechenden
Grasöles im großen angebaut wird, so ist dies in noch weit größerem
Umfange mit dem in trockeneren Gegenden Südasiens verbreiteten
Citronellgras (Andropogon citratus) der Fall, das sich von[S. 256]
jenem durch seine rote Behaarung, die schmalen Blätter und die kurzen
Blütenähren unterscheidet. Das 2–2,5 m hohe Gras wird aus Samen
gezogen und gerade vor dem Blühen geschnitten. Bei sorgfältiger Kultur
gibt es zwei bis drei Ernten im Jahr. In Südindien wird besonders auch
das aus den Wurzelstöcken von Andropogon muricatus gewonnene
Kuskus- oder, wie die Tamilen sagen, Votiveröl viel benutzt, aber in
nicht sehr großen Mengen nach Europa ausgeführt. Dort wird auch viel
Sandelholzöl aus dem in kleine Späne gehackten, rosenartig riechenden
Kernholz des kleinen Sandelbaumes (Santalum album) destilliert,
das in allerdings weniger ertragreicher Qualität auch auf den kleinen
Sundainseln gewonnen und exportiert wird. In der Medizin dient es zur
Behandlung der Gonorrhoe an Stelle des älteren Copaivabalsams. Das
wohlriechende Holz dient zum Fournieren von Möbeln, zur Herstellung
von allerlei kleinen Geräten, Götzenbildern und Rosenkränzen. Am
meisten dient es — bei den Chinesen zugleich mit Weihrauch — als
Räuchermittel in Tempeln und bei Begräbnissen; auch die wohlhabenden
Araber räuchern mit demselben und lassen sich daraus wohlriechende
Pfeifenrohre schnitzen.
Tafel 123.
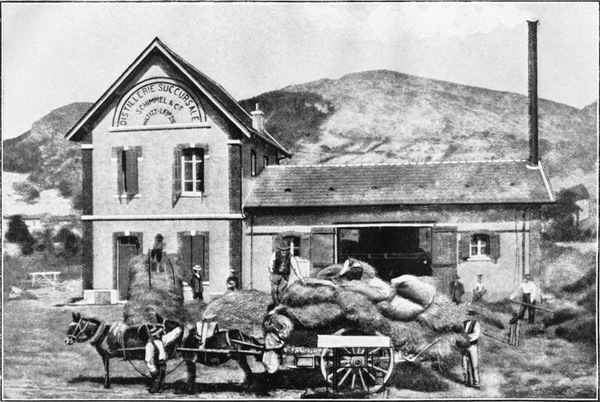
Einbringen des Lavendels zur Destillation von
Lavendelöl in Barrême (Alpes maritimes).
❏
GRÖSSERES BILD
Tafel 124.

Vorbereitung zur Destillerie von Lavendelöl in
Barrême (Alpes maritimes).
❏
GRÖSSERES BILD
Ebenfalls bei den Chinesen als Parfüm und Medizin sehr beliebt
ist die wohlriechende Wurzel der indischen Komposite Saussurea
lappa, die von Kaschmir aus in bedeutenden Mengen über Kalkutta
und Bombay dorthin exportiert wird. So importiert allein der Hafen
Hankau jährlich für über 100000 Mark dieser Droge, die das ganze
Mittelalter hindurch als Costuswurzel auch in Europa zu den stark
begehrten Handelsartikeln aus dem Oriente gehörte. Auch im Morgenlande
wurde sie viel gebraucht. Während diese aromatische Wurzel heute in
der abendländischen Medizin keine Rolle mehr spielt, ist dies noch
bei dem aus den gewürzhaft riechenden Blättern zweier nahe verwandter
australischer Bäume destillierten Cajaputöl (vom malaiischen caju
puti, d. h. weißer Baum, Melaleuca leucadendron) und beim
Eucalyptusöl (von dem bis 130 m Höhe erreichenden, äußerst
rasch wachsenden und daher zur Entsumpfung fieberreicher Gegenden
benutzten Eucalyptus globulus) der Fall. Aus den Blättern einer
anderen Myrtazee, Amomis caryophyllacea, wird in den kleinen
Antillen, und zwar bis jetzt fast ausschließlich von wildwachsenden
Bäumen, das Bayöl gewonnen, während aus den Früchten des hauptsächlich
auf Jamaika kultivierten Pimentbaumes das Pimentöl hergestellt wird.
Gleicherweise destilliert man aus den verschiedenen Gewürzen wie
Zimt, Kassia, Gewürznelken, Muskatnuß, Cardamomen, Ingwer, Kalmus,[S. 257]
Anis, Sternanis, Fenchel, Koriander usw. die betreffenden ätherischen
Öle, die mancherlei Verwendung finden. Das gleiche ist mit den
wohlriechenden Lippenblütlern der Fall, wie Pfefferminze, Fenchel,
Melisse, Citronell, Krauseminze, Rosmarin, Lavendel, Thymian, Basilicum
und Salbei, zu denen als eines der wichtigsten tropischen ätherischen
Öle dasjenige eines Halbstrauchs von Indien, Ceylon und Malakka,
Pogostemon patschuli, hinzukommt, das nach der bengalischen
Benennung Patschuli heißt. Diese alle werden durch Destillation
aus den Blättern und übrigen krautigen Pflanzenteilen gewonnen. Mit
dem durchdringend riechenden Patschuli parfümieren die indischen
Frauen ihre Kopfhaare, die Kaufleute die teuren Schale und den Tabak,
die Chinesen ihre Tusche. Auch in Europa wird diese Essenz häufig zu
Parfümerien verwendet, da der Duft derselben der haltbarste unter allen
Pflanzengerüchen ist.
Mit dem Patschuliduft wurden übrigens die Europäer durch die damit
parfümierten indischen Schale bekannt, die früher zu ganz enormen
Preisen verkauft wurden. Einige französische Fabrikanten aber ahmten
sie in so ausgezeichneter Weise nach, daß die Kaufleute das indische
Fabrikat nur durch sein eigentümliches Parfüm zu unterscheiden
vermochten. Natürlich boten die französischen Fabrikanten alles auf, um
zu demselben Parfüm zu gelangen, damit kein Mensch mehr ihr Fabrikat
vom indischen unterscheiden könne und sie dafür dieselben hohen
Preise wie für jenes erhielten. Längere Zeit blieben ihre Bemühungen
erfolglos, bis es endlich gelang, das Geheimnis zu lüften. Das
getrocknete Patschulikraut kam nach Europa und der französische Schal
war fortan auch durch die Nase nicht mehr vom echt indischen, durch
Handarbeit hergestellten, zu unterscheiden.
Das in der Pflanze enthaltene Patschuliöl ist ein Beispiel dafür, wie
der Naturprozeß, durch den der Duftstoff entsteht, erst künstlich
eingeleitet werden muß. Die frisch gepflückten Blätter enthalten
nämlich das Öl noch nicht; sie werden halbtrocken in den Schiffsraum
verpackt und machen nun auf der Reise nach Europa eine Art Gärung
durch, bei welcher erst der Duftstoff entsteht. Ganz ähnlich ist es mit
der Entwickelung von anderen Duftstoffen, z. B. bei den Vanilleschoten,
die in frischem Zustande keine Spur Vanillin enthalten. Erst durch
einen künstlich eingeleiteten Gärungsprozeß kommt es zur Bildung dieses
wohlriechenden Stoffes, der dann in feinen, weißen Kristallen die durch
die Gärung schwarz gewordenen Schoten bedeckt. Ebenso entwickelt sich
das gleich zu besprechende Kumarin der Tonkabohne,[S. 258] des Waldmeisters
und verschiedener Grasarten erst nach dem Trocknen als Heu, wodurch
erst jene Substanzen den bekannten, ihnen eigentümlichen betäubenden
Duft erhalten.
Eines der feinsten und kostbarsten der flüchtigen Öle, dem in
Südasien sogar der allererste Rang eingeräumt wird, ist das
Ylang-Ylangöl, das aus den grünlichen Blüten des etwa
20 m hohen, auf den südasiatischen Inseln heimischen, von den
Malaien als Kananga bezeichneten Baumes Cananga odorata, aus
der Familie der Anonazeen, gewonnen wird. Es kommt fast ausschließlich
aus den Philippinen über Manila in den Handel und wird aus den Blüten
von kultivierten Bäumen, deren Duft sehr viel feiner als derjenige
der wildwachsenden ist, hergestellt; das Öl der letzteren, das als
Kanangaöl bezeichnet wird, kostet deshalb auch fast zwanzigmal weniger,
nämlich bloß 25 Mark das kg, während das echte Ylang-Ylangöl
von kultivierten Bäumen 480 Mark das kg im Großhandel kostet.
Es ist lichtgelb, etwas leichter als Wasser und von großem Wohlgeruch.
Durch die große Nachfrage und die sehr hohen dafür bezahlten Preise
veranlaßt, wurde es seit Anfang der 1860er Jahre zuerst auf Luzon,
dann auch auf Java dargestellt. Seit vier Jahren sind mit der Kultur
des Kanangabaumes auch auf der französischen Insel Réunion bedeutende
Erfolge erzielt worden, beträgt doch die Zahl der blütentragenden Bäume
dort bereits etwa 200000. Der Baum nimmt zwar mit jedem Boden vorlieb,
gibt aber den meisten Ertrag an Blüten auf gutem Boden. Auch müssen die
Pflanzungen vor dem Winde geschützt werden, da die Zweige sich sonst
durch Aneinanderreiben beschädigen. Nur die Bäume, die in geschützten
Vertiefungen und auf kräftigem, feuchtem Boden gepflanzt wurden, haben
sich als widerstandsfähig und nutzbringend erwiesen. Bei guter Pflege
trägt die Pflanze schon nach 1½ Jahren die ersten Blüten, die aber
noch arm an dem wohlriechenden Öl sind. Die erste volle Blüte pflegt
vom vierten Jahre an einzutreten, steigert sich bis zum zehnten Jahre
und bleibt dann eine ganze Reihe von Jahren auf demselben Ertrag.
10 kg Blüten von einem Baum entsprechen einer Mittelernte,
doch kann ein solcher ausnahmsweise 50 bis 60 kg liefern.
Durchschnittlich kann man pro Hektar 2000 kg Blüten rechnen, die
20 kg höchstwertigen Ylang-Ylangöles im Werte von 9600 Mark,
oder 40 kg minderwertigen Ylang-Ylangöles liefern; es ist dies
also eine mit Rücksicht auf die geringen Erzeugungskosten sehr rentable
Kultur, die auch für die deutschen Kolonien sehr empfehlenswert wäre.
[S. 259]
In Südasien werden schon lange die wohlriechenden Samenkörner einer
strauchartigen Malve (Hibiscus abelmoschus) als Parfüm benutzt,
z. B. zwischen die Wäsche gelegt. Sie riechen ähnlich wie Moschus und
kommen deshalb als Moschuskörner in den Handel. Von Indien aus
hat sich der Strauch, dessen unreife Früchte als beliebtes Gemüse
gegessen werden, über die ganzen Tropen und Subtropen verbreitet
und wird besonders in Westindien, speziell Martinique, im großen
kultiviert. In den beiden letzten Jahrzehnten hat sich der Verbrauch
des aus den Moschussamen gewonnenen ätherischen Öles außerordentlich
gesteigert. Ihm im Geruche ähnlich ist das aus der bitteraromatischen
Wurzel der in der zentralasiatischen Steppe heimischen Sumbulpflanze,
eines Doldengewächses (Ferula sumbul), gewonnene andere
Moschusöl, das ebenfalls ein Surrogat des echten Moschusöles bildet.
Der echte Moschus stammt bekanntlich von dem zwischen Nabel
und Geschlechtsteilen liegenden, 30–50 g schweren Beutel des
rehähnlichen, auf den Gebirgen Hinterasiens, besonders in Tibet und
der Mongolei lebenden, 1,15 m langen Moschustieres (Moschus
moschiferus), der mit einer bräunlichen, schmierigen Substanz von
sehr durchdringendem Geruch gefüllt ist. Diese dient zur Anlockung
und geschlechtlichen Erregung des Weibchens. Der beste Moschus kommt
von der Provinz Jün-nan im südwestlichen China in kleinen, verlöteten
Bleikästen zu 20–30 Stück in den Handel und kostet bis zu 3500 Mark
das kg. In ähnlicher Weise wird auch das Zibet der
männlichen Zibetkatze und das Bibergeil des Bibermännchens
verwendet. Sie sind nebst der Ambra des Pottwales, die meist in
größeren Knollen freischwimmend auf dem Meere angetroffen und gefischt
wird, die einzigen aus dem Tierreiche gewonnenen Duftstoffe, denen in
der Parfümerie eine große Bedeutung zukommt. Obschon wir hier nur die
pflanzlichen Duftstoffe zu besprechen haben, müssen wir sie dennoch
erwähnen, da sie zur Geltendmachung der pflanzlichen Duftstoffe sehr
wichtig sind. So unangenehm sie konzentriert auf unser Geruchsorgan
wirken, so angenehm sind sie stark in Alkohol verdünnt. Was sie für die
Parfümerie so wichtig macht, ist nicht sowohl ihr eigenes Aroma, als
vielmehr ihre Fähigkeit, die Geruchsentwicklung der ihnen beigemischten
pflanzlichen Ingredienzen zu fördern und andererseits wieder zu
fixieren, d. h. eine etwas zu rasche Verflüchtigung zu verhindern.
Hierin werden sie am wirkungsvollsten von den künstlichen Riechstoffen
unterstützt, dem zweiten großen Faktor in der[S. 260] Parfümeriefabrikation,
den wir im wesentlichen der deutschen Riechstoffchemie zu verdanken
haben. Von ihnen war bereits die Rede, so daß wir hier nicht näher
darauf einzutreten brauchen.
Wie das in den Orchideenblüten nicht seltene Vanillin, das
jetzt auch künstlich hergestellt wird, sich in konzentrierter Form
in den gegorenen Schoten der Vanillepflanze vorfindet, so ist das
in der Pflanzenwelt als Duftstoff weitverbreitete Kumarin,
das, wie gesagt, dem Waldmeister, dem Ruchgras und dem Heu den
charakteristischen Geruch verleiht, in der südamerikanischen
Tonkabohne in besonders hohem Maße angehäuft. Die sie
hervorbringenden Tonkabäume (Dipterix odorata) sind
20–27 m hohe Schmetterlingsblütler, die in den Wäldern Guianas,
Venezuelas und Nordbrasiliens heimisch sind. Von dort kommen die
über mandelgroßen, glänzend schwarzen, runzeligen Samen in den
Handel, die sich nach vorübergehendem Einlegen in Rum mit farblosen
Kumarinkriställchen bedecken. Während sie wie die Vanilleschoten
und das Kraut von Waldmeister und Ruchgras frisch fast geruchlos
sind, duften sie jetzt stark nach Heu, indem sich wahrscheinlich das
Kumarin, wie das Vanillin und ähnliche Duftstoffe, aus einer andern
leicht zersetzlichen Substanz erst bildet. Es dient vielfach zur
Parfümerie, als wohlriechende Beigabe zum Schnupftabak, zur Bereitung
von Maitrankessenz und zur Imprägnierung von gewöhnlichen, geruchlosen
Kirschbaumtrieben, die dann als Weichselrohr zur Herstellung von
Pfeifenrohren, Spazierstöcken usw. dienen. In der Medizin wird damit
der penetrante Geruch des Jodoforms gemildert.
Reichliche Verwendung finden auch die in den Blüten und Früchten der
Agrumen, wie auch in den wohlriechenden Blüten der verschiedenen
Gartenpflanzen, wie Veilchen, Reseda, Maiglöckchen, Heliotrop,
Hyazinthen, Tuberosen, Jasmin, Akazien usw. enthaltenen ätherischen
Öle. Die Stadt Grasse in Südfrankreich ist das Zentrum von deren Kultur
und Gewinnung. Dabei werden die gepflückten Blüten mit geschmolzenem
Fett übergossen und umgerührt, erstarrt 24 Stunden liegen gelassen.
Dann wird das Fett wieder geschmolzen und dieser Prozeß wiederholt,
bis das Fett mit dem Riechstoff gesättigt ist. Zur Erreichung dieses
Resultates sind von manchen Blüten bis 6 kg auf 1 kg Fett
erforderlich. Für die feinsten Gerüche verfährt man in der Weise, daß
man große, starke Glastafeln 0,5 cm hoch mit ebensolchem reinem
Fett — früher Schweineschmalz und Rindstalg, jetzt meist Vaselin —
belegt und in diese die Blüten, deren Duft man auffangen will, mit
dem Kelch nach oben steckt. Auf die Glastafel wird eine zweite, in
derselben Art zugerichtete gelegt, welche, als Deckel dienend, den
Geruch[S. 261] nicht entweichen läßt; darauf wird eine dritte wiederum mit
Blüten besteckt, Glasseite auf Glasseite gelegt, die man ebenfalls
mit einer Deckplatte versieht, und so fort. Nach 25–30 Tagen ist das
Fett mit dem Dufte der täglich gewechselten Blüten gesättigt. Diese
als Pomaden bezeichneten parfümierten Fette bilden die Grundlage
der meisten Parfümartikel. Aus ihnen kann man durch Extraktion mit
Weingeist den Riechstoff als Essenz erhalten und in einzelnen Fällen
ihn auch als ätherisches Öl für sich abscheiden. Der Sprit gibt dem
Parfüm die Frische, und sein Geruch hat etwas Belebendes. Um nun die
verschiedenen, vielfach mit Phantasienamen belegten Parfümwässer zu
erhalten, werden die Essenzen in mannigfaltiger, als Fabrikgeheimnis
geheimgehaltener Weise gemischt und zur gegenseitigen Durchdringung der
Duftstoffe oft längere Zeit in Holzfässern gelagert.
Mehr von historischem Interesse ist das uns allen aus der biblischen
Geschichte bekannte Nardenöl, mit dem auch die Füße des Heilands
von der Ehebrecherin gesalbt wurden und das im Altertum als
kostbares Parfüm eine große Rolle spielte. Es wurde bei den Alten
aus mehreren wohlriechenden Pflanzen, besonders aus der Familie
der Baldriangewächse, gewonnen. Die echte kostbare Nardensalbe des
Altertums wurde aus der im mittleren Himalaja wachsenden echten
indischen Narde (Nardostachys jatamansi) bereitet. Ihre
Wurzel schmeckt bitter gewürzhaft und war neben dem Opium ein wichtiger
Bestandteil des aus etwa 60 verschiedenen Pflanzenstoffen mit Beigabe
der widersinnigsten tierischen Substanzen, wie z. B. des Fleisches von
Giftschlangen, hergestellten Theriaks, eines vom griechischen Leibarzte
des Kaisers Nero, Andromachos, erfundenen berühmten Gegenmittels
gegen den Biß giftiger Schlangen und alle tierischen Gifte überhaupt,
das dieser einst mit einem in Versen abgefaßten Rezept dazu jenem
Kaiser zu Füßen legte. Seither wurde jenes Mittel bis ins vergangene
Jahrhundert, wie das ebenfalls in der römischen Kaiserzeit von einem
andern griechischen Arzte, Menekrates, erfundene Diachylonpflaster, ein
durch Kochen von Bleioxyd in Öl mit Zugabe von Gummiharzen und Harzen
bereitetes Zugpflaster, das bis heute in sehr hohem Ansehen beim Volke
blieb, stets feierlich in aller Öffentlichkeit unter dem Schall von
Trompeten und Trommeln hergestellt. Noch im Jahre 1787 schmetterten die
Pauken und Trompeten bei der gewichtigen Darstellung dieses Theriaks,
zu dessen Herstellung die Vipern in Neapel noch unter den Bourbonen
unter staatlicher Aufsicht gefangen wurden. Das bei den vornehmen alten
Römern besonders zum Salben des Körpers nach dem Bade sehr beliebte
wohlriechende indische Nardenöl ist heute[S. 262] noch in seiner Heimat Indien
ein geschätztes Duft- und Heilmittel, weshalb die Nardenpflanze dort zu
diesem Zwecke von alters her angebaut wird.
Das aus einer anderen Baldrianart, Nardostachys grandiflora,
in Nepal gewonnene Öl riecht weniger angenehm, aber stärker als das
aus der echten indischen Narde gewonnene. Die arabische Narde wurde
wahrscheinlich aus dem wohlriechenden Nardenbartgras (Andropogon
nardus) hergestellt, das wohl der griechische Schriftsteller
Flavius Arrianus (um 100 n. Chr. zu Nikomedia in Bithynien geboren,
ward 136 unter Hadrian Präfekt von Kappadokien, starb unter Marc Aurel)
in seiner Darstellung von Alexanders des Großen Feldzug nach Asien im
Sinne hatte, als er schrieb: „Als Alexander durch eine Wüste gegen
das Land der Gedrosier (eine iranische Landschaft, etwa dem heutigen
Beludschistan entsprechend) vorrückte, fand er viele wohlriechende
Nardenwurzeln, welche von den Phönikiern gesammelt, vom Heere aber in
solcher Menge zertreten wurden, daß die ganze Gegend danach roch.“
Die italienische Narde dagegen wurde aus dem Lavendel, die kretische
Narde aus Valeriana italica und V. tuberosa und die
gallische oder keltische Narde aus Valeriana celtica und V.
saliunca gewonnen, deren Wurzeln noch jetzt von Triest aus nach
dem Orient ausgeführt werden, wo man sie zur Herstellung einer nach
dem Bade zum Salben des Körpers beliebten Salbe benutzt. Letztere
Baldrianart hat ihren Namen nach einer alten, schon vom griechischen
Arzte Dioskurides im 1. Jahrhundert n. Chr. erwähnten ligurischen
Bezeichnung erhalten. Dieser Autor schreibt nämlich in seiner
Arzneimittellehre: „Die keltische Narde wächst auf den ligurischen
Bergen, wo sie saliunka genannt wird. Es ist dies ein kleiner
Strauch, der samt den Wurzeln gesammelt und in Bündelchen gebunden
wird. Die Blätter sind länglich, gelblich, die Blüten quittengelb. Nur
die Stämmchen und Wurzeln sind wohlriechend und im Gebrauch.“ Außerdem
unterscheidet er eine indische und syrische Narde. „Letztere“, fährt er
fort, „hat ihren Namen nicht davon, daß sie wirklich in Syrien wächst,
sondern nur deswegen, weil die Seite des Gebirges, auf welchem sie
wächst, nach Syrien zu liegt, während die entgegengesetzte Seite sich
nach Indien hinneigt. Letztere ist am besten frisch, leicht, gelb, von
starkem Wohlgeruch. Die indische Narde dagegen, die nach dem Flusse
Ganges gangitis heißt, ist kraftloser, da sie auf nassen Stellen
wächst. — Aus diesen wird die Nardensalbe (nárdinon mýron) auf
verschiedene Weise mit allerlei Zusätzen bereitet.“
So lange es Menschen gibt, haben sie allerlei Verletzungen und
Krankheiten zu erleiden gehabt, gegen die sie Linderungs- und
Heilmittel anzuwenden suchten. Diese entnahmen sie zumeist der
sie umgebenden Pflanzenwelt, der sie Zauberkräfte mancherlei Art
zuschrieben, die sie sich zu Nutzen machten. So entwickelte sich in
engstem Zusammenhang mit der Ausübung von Zauberei die älteste Medizin
der Naturvölker, deren Spuren sich noch zahlreich in unserem Volkstume
nachweisen lassen. Und während fürsorgliche Frauen und mitleidige
Stammesgenossen die erste und in leichteren Fällen einzige Handreichung
taten, wurden in schwierigeren Fällen die erfahrenen Alten der Sippe
zur Übernahme der Behandlung zugezogen. Auf solche Weise erhoben sich
die Erfahrensten des Stammes, denen die Sippengenossen volles Vertrauen
entgegenbrachten, zu Zauberpriestern und Ärzten in einer Person. Manche
unter ihnen genossen nicht nur zeitlebens das größte Ansehen, sondern
wurden nach ihrem Tode als machtvolle Geister göttlich verehrt.
Ein solcher vergöttlichter Weiser und Arzt seines Volkes war dem
uralten Kulturvolke der Ägypter I-em-hotep („der in Frieden kommt“),
meist gekürzt Imhotep genannt, der uns als der älteste mit Namen
bekannte Arzt der Welt entgegentritt und später zum Gott der Heilkunde
erhoben wurde. Als solcher war er der gute Arzt der vergöttlichten
Menschengeister und der lebenden Menschen, dem man in Krankheitsfällen
Opfer und Gelübde darbrachte, damit er die Krankheit zum Guten wende
und Heilung eintreten lasse. Denn von jeher wurde der über die
Anwendung eines Heilkrautes gesprochene Heilsegen für wichtiger und
wirkungsvoller gehalten als seine guten Eigenschaften als solche,
und über allem stand das durch Opfer erlangte Wohlwollen solcher im
Geisterreiche waltender Heilgewaltiger. Daß nun dieser Heil[S. 264]gott der
alten Ägypter eine wirkliche, im Volksbewußtsein durch die Jahrtausende
lebendig gebliebene Persönlichkeit war, darüber kann durchaus kein
Zweifel bestehen. Und tatsächlich haben die neuesten Forschungen der
altägyptischen Literaturdenkmäler ergeben, daß der Gegenstand solch
nachhaltiger Verehrung, dessen Name als der eines weisen Priesters und
mächtigen Zauberers, eines geschickten Arztes und großen Baumeisters
durch die ganze ägyptische Geschichte hindurch unvergessen blieb, ein
Zeitgenosse des Königs Zoser war, mit dem Manetho, ein ägyptischer
Priester aus Sebennytos, der unter Ptolemäus I. (305–285 v. Chr.)
lebte und in griechischer Sprache eine leider bis auf die von Julius
Africanus und Eusebius uns mitgeteilten Bruchstücke und den kurzen
Auszug bei Josephus verloren gegangene Geschichte seines Landes
schrieb, die dritte Dynastie beginnen läßt. Dieser König Zoser
herrschte vor den Erbauern der großen Pyramiden bei Gise von etwa
2980 v. Chr. an und begründete die Vorherrschaft der unterägyptischen
Stadt Memphis, die er zu seiner Residenz erhob. Seiner Regierungszeit
gehören die ersten größeren Steinbauten des Niltals an, und unter
ihm begannen die in zunächst staffelförmigen Pyramiden errichteten
Königsgräber, statt aus ungebrannten, nur an der Sonne getrockneten
Lehmziegeln wie zuvor, aus Steinquadern gebaut zu werden. Unter ihm
hat nun als einflußreicher Beamter seines Hofes und sein Hauptratgeber
Imhotep gelebt, der sich schon im Leben solchen Ansehens bei seinem
Könige erfreute, daß er sein Grab dicht neben dem Grabe seines Königs
in der Stufenpyramide von Sakkara bei Memphis erhielt. Nach einer alten
Tradition hatte er den ehrenden Beinamen „Herr der Geheimlehre und der
Zahlen“. Die Gelehrtesten seines Volkes, die Schreiber, hatten ihn zu
ihrem Schutzherrn erwählt. Und wer unter ihnen fromm war, weihte ihm
regelmäßig eine Spende aus dem Wasserbehälter seines Schreibzeugs,
ehe er seine Arbeit begann. Noch nach Jahrhunderten kannte das Volk
die ihm zugeschriebenen Sprichwörter, und 2500 Jahre nach seinem Tode
war er zum Gott der Heilkunde geworden, in welchem die Griechen, die
ihn Imuthes nannten, ihren eigenen Heilgott Asklepios zu erkennen
glaubten. Als Gott wurde er auf einem Sessel sitzend abgebildet,
mit einem einfachen Lendentuche und Hals- und Armbändern wie seine
vornehmen Volksgenossen angetan, in der Rechten den Zauberstab mit
dem Kopf des Schakals, also des Tieres, das als Wächter des Eingangs
in die Unterwelt gedacht war, an der Spitze und in der Linken den
Nilschlüssel, das Symbol des Lebens, haltend.
[S. 265]
Die ursprüngliche und angesehenste ärztliche Gottheit der alten Ägypter
war aber die Göttin Isis, der man nicht nur die Entstehung zahlreicher
Krankheiten, sondern auch die Macht zuschrieb, sie wieder zu heilen.
Ihre göttliche Wunder- und Heilkraft bewies sie dadurch, daß sie ihren
von Seth (der personifizierten Dürre) erschlagenen Sohn Horus (die am
Himmel aufsteigende junge Sonne) wieder zum Leben erweckte. Sie lehrte
dann die Menschen die Krankheiten erkennen und heilen. Die Erfindung
vieler Arzneimittel wurde auf sie zurückgeführt. Wegen der großen
Erfahrung, welche sie in der Arzneikunde besaß, brachte man Kranke
mit Vorliebe in ihren Tempel, damit sie während des Schlafes durch
einen von ihr eingegebenen Traum erführen, welches Mittel sie zu ihrer
Heilung anwenden sollten.
Als dritte medizinische Gottheit galt den alten Ägyptern der Gott
Thot (von den Griechen mit ihrem Hermes identifiziert). Von ihm heißt
es im ärztlichen Papyrus Ebers, so genannt, weil ihn der bekannte
Schriftsteller Prof. Georg Ebers während seines Aufenthaltes in
Theben-Luxor im Winter 1872/73 von einem dortigen Kopten erwarb — er
befindet sich jetzt auf der Leipziger Universitätsbibliothek und ist,
trotzdem er zur Zeit der 18. Dynastie (1580–1350 v. Chr.) geschrieben
wurde, noch so gut erhalten, als ob der Schreiber, der ihn beschrieb,
erst sein Schreibrohr beiseite gelegt habe —, er sei derjenige, „der
da die Bücher macht, die Erleuchtung schenkt den Schriftgelehrten und
Ärzten, die sich in seiner Nachfolge befinden, um (die Menschen von
ihrer Krankheit) zu erlösen.“ Er hieß eigentlich Tehuti und wurde schon
zur Zeit der ersten Dynastie des Reichs um 3400 v. Chr. als Urheber und
Beschützer des Schrifttums bezeichnet, als „Schreiber der Wahrheit“,
„Herr der göttlichen Worte“, „Darreicher der Schriften“ usw. Beim
Aburteilen der Seelen in der Unterwelt durch die Götter führte er Buch
über die Wägung der Herzen. Er wurde ibisköpfig dargestellt, mit dem
Henkelkreuz als dem Zeichen des Lebens in seiner Rechten und einer
Papyrusrolle in der Linken. Der Mittelpunkt seiner Verehrung war die
Hohe Schule von Sesennu (dem Hermopolis der Griechen), wo vornehmlich
die Schreiber und Ärzte ausgebildet wurden. Der um 180 n. Chr. lebende
griechische Sophist Claudius Älianus leitet in seinen 14 Büchern
„Vermischte Erzählung“ den Namen dieses Gottes irrtümlicherweise
von thouod Säule her, weil er als Erfinder aller Künste und
Wissenschaften seine Weisheit in steinerne Säulen grub. Aus diesen
hieroglyphischen Inschriften schöpften die Priester in den ältesten
Zeiten ihr Wissen, merkten sich die dort ver[S. 266]zeichneten Regeln der
Arzneikunde und trugen sie nach Erfindung des Papiers in die 42 Rollen
des Thot (von den Griechen entsprechend der Identifizierung des Thot
mit ihrem Hermes hermetische Bücher genannt) ein.
Da die Krankheit bei den alten Ägyptern wie bei allen Völkern durch
den Zorn der Götter herbeigeführt sein sollte und eine Versöhnung
mit denselben nach der später aufgekommenen Lehre nur durch die
Diener derselben bewerkstelligt werden konnte, so übten die Priester
zugleich die Arzneikunde aus. Sie wurden in den verschiedenen
Tempelschulen des Landes wie in den heiligen Schriften, so auch in
der Arzneikunde unterrichtet und gingen dann zum Abschluß ihrer
Studien nach Heliopolis, der berühmtesten medizinischen Hochschule
von Ägypten, wo sie sich zu Spezialärzten für die verschiedenen
Krankheiten des Menschen ausbildeten. Schon damals war die Heilkunde
weitgehend spezialisiert, und es gab Augenärzte, die wegen dem schon
damals verbreiteten Trachom sehr viel zu tun hatten und, nach einer
Stelle im Papyrus Ebers, die von der „Öffnung des Gesichts in den
Pupillen hinter den Augen“ handelt, offenbar schon Staroperationen
ausführten, dann Kopfärzte, Ohrenärzte, Zahnärzte, die, wie man an
den Kiefern mancher Mumien fand, bereits künstliche Zähne einzusetzen
verstanden, Bauchärzte, Gliederärzte usw. Zahlreiche auf den Denkmälern
abgebildete und in den Gräbern gefundene chirurgische Instrumente,
wie Scheren, Lanzetten, Messer, Rasiermesser, Pinzetten, Sonden,
Metallstäbchen zum Glühen, wie auch das Zubehör einer reichhaltigen
Reiseapotheke beweisen, daß man schon im 3. Jahrtausend v. Chr.
auch eine reiche chirurgische Tätigkeit entfaltete. Ferner sprechen
vorzüglich geheilte Knochenbrüche an Mumien für eine große praktische
Erfahrung im Einrichten von solchen und von Verrenkungen, wie auch
für die Wundbehandlung im allgemeinen. Szenen, welche uns das Anlegen
von Verbänden an diesem oder jenem Glied von Verwundeten und Kranken,
das Darreichen von Arzneien, das Anlegen von Schröpfköpfen, die
Vornahme verschiedener Operationen, wie Amputation und Kastration,
veranschaulichen, finden sich auf verschiedenen Denkmälern. Zur
durchgängig an den Knaben geübten Beschneidung, die wir beispielsweise
auf einer Darstellung am Tempel des Chonsu in Karnak an den Kindern
Ramses’ II. der 19. Dynastie (1292–1225 v. Chr.) dargestellt finden,
dienten wie zu andern chirurgischen Eingriffen des Kultes Messer aus
Feuerstein. Solche wurden auch in den Riten zahlreicher anderer Völker
noch lange nach Einführung der Metalle als Werkzeugmaterial wenigstens
bei gottesdienstlichen Handlungen beibehalten.
[S. 267]
Die altägyptischen Ärzte übten keinerlei Privatpraxis aus, sondern
standen im Solde des Staates. Sie wohnten wie die übrigen Priester
mit ihren Familien in eigenen Häusern, bildeten aber unter sich eine
durch strenge Satzungen geordnete Korporation, die auch in der Ausübung
ihrer Kunst sich gewissenhaft an die vorgeschriebenen medizinischen
Regeln des Thot zu halten hatte. Befolgten sie dieselben und starb
der Kranke, so waren sie aller Verantwortung enthoben, hielten sie
sich aber nicht an die vorgeschriebene Norm und gingen sie eigene Wege
in der Methodik der Behandlung, so wurden sie mit dem Tode bestraft,
und zwar auch dann, wenn der Ausgang der Krankheit ein günstiger war.
Jeder Kranke wurde umsonst auf Staatskosten behandelt, mußte aber bei
seiner Erkrankung nicht in das Haus des Arztes, sondern in den Tempel
schicken, um ärztliche Hilfe zu erbitten. Dabei hatte der Bote genau
anzugeben, an welchem Übel der Betreffende erkrankt sei, worauf der
Arzt des Heiligtums nach irgend einem der Spezialisten des Kollegiums
sandte und ihn in das Haus des betreffenden Patienten beorderte. Wenn
auch die ärztliche Behandlung vollständig umsonst war, da ja die
Priester vom Staate besoldet wurden und zu ihrem Unterhalt besondere
Ländereien und sonstige Einkünfte erhielten, so war es doch Sitte,
daß die Patienten nach ihrer Genesung demjenigen Heiligtum, das ihnen
den Arzt gesandt hatte, je nach Vermögen einfache oder ansehnlichere
Geschenke darbrachten oder zum Unterhalt der in den Tempelhöfen
gehaltenen heiligen Tiere beitrugen.
Bei allen Völkern des Altertums waren die ägyptischen Ärzte um
ihrer großen Erfahrung und Geschicklichkeit in der Behandlung der
verschiedenen Krankheiten willen berühmt. Und obschon bei den Römern
zu Ende der Republik und zu Beginn der Kaiserzeit die sehr angesehenen
griechischen Ärzte eine überaus erfolgreiche Tätigkeit entfalteten,
ließ man beispielsweise, wie uns Plinius berichtet, unter der Regierung
des Kaisers Tiberius Claudius (41–54 n. Chr.) beim Ausbruch einer
schrecklichen und furchtbar verheerend wirkenden Seuche ägyptische
Ärzte nach Italien kommen, die mit ihren Kuren viel Geld verdienten.
Die als Ärzte die Heilkunde ausübenden Priester bildeten den niedersten
Stand der Priesterschaft. Weit höher standen im Ansehen des Volkes
die als Propheten bezeichneten Mitglieder des Priesterkollegiums,
die nicht durch äußere Mittel, sondern durch Beschwörungen und
Zaubermittel, wie auch durch Amulette allein mit Hilfe der Dämonen die
Krankheiten zu bannen verstanden. So wurde auch bei[S. 268] diesem Volke, als
es bereits sehr hoch in seiner Kultur gestiegen war, der beim Anwenden
eines Mittels gesprochene Zaubersegen als noch viel wirksamer als
die Arznei selbst betrachtet. Zu dieser Priesterkaste der Propheten
gehörten auch alle die Weisen, Wahrsager und Zauberer, welche in den
Büchern Moses, besonders im II. Kap. 7 und 8, als mächtige Zauberer
mit ihren Beschwörungen Wundertaten vor dem Pharao verrichteten, aber
von Mose, dem Jahve beistand, besiegt wurden. In den verschiedenen
auf uns gekommenen ärztlichen Papyri wird jeweilen nicht nur die bei
den verschiedenen Krankheiten anzuwendenden Heilmittel in genauer
Rezeptierung, sondern auch die bei deren Anwendung auszusprechende
Zauber- und Beschwörungsformel als das Allerwichtigste dabei sorgfältig
angegeben. Schon bei ihrer Herstellung in den als asit bezeichneten, in
besonderen Tempelräumen eingerichteten Laboratorien, an deren Wänden
die heiligen Vorschriften zur Bereitung der Arzneien angegeben waren,
mußten gewisse Zeremonien beobachtet und bestimmte Segen zu deren
Wirksammachung gesprochen werden. Manche Kombinationen von Heilmitteln
führte man direkt auf alte berühmte Heilkünstler oder gar Götter
zurück. Die zahlreichen auf uns gekommenen Rezepte sind recht kurz
gehalten und bestehen vielfach nur in Andeutungen, weil das einzelne
als althergebracht und also allgemein bekannt vorausgesetzt wurde. Zur
Herstellung der auf den medizinischen Papyri genannten Einreibungen,
Salben, Umschläge, Pflaster, Tränke, Abkochungen, Speisemischungen,
Klistiere usw., auf denen genau angegeben war, wann und wie sie zu
applizieren oder einzunehmen waren, wurden allerlei pflanzliche und
tierische Produkte, wie auch Mineralbestandteile zuerst sorgfältig
mit der Wage gewogen und dann gemischt. Außer Natron, Brechweinstein,
Antimon und Eisen bildeten zahlreiche pflanzliche Produkte nebst
Wasser, Wein, Palmenwein, Essig, Honig, Menschen- und verschiedene
Tiermilch, Blut, Galle, Fett und Exkremente der verschiedensten Tiere,
auch Männer- und Frauenurin usw. eine wichtige Rolle. Die Mittel wurden
für 4, 8, 9 oder 10 Tage verordnet. Die zahlreichen Rezepte zu Mitteln
gegen Hautkrankheiten lassen darauf schließen, daß dieses Übel trotz
aller Reinlichkeit damals im Pharaonenreiche sehr häufig war. Als
Beispiele lassen wir drei Rezepte folgen:
„Desgleichen ein Mittel zu bewirken das Harnen:
Honig
pulverisierte Johannisbrotschalen
pulverisierte Keuschbaumsamen
je 1 Teil. Daraus eine Kugel zu machen.
[S. 269]
Arznei für Leibesöffnung:
Milch ⅓ tena
nequant-Pulver ¼ Drachme
Honig ¼ Drachme
zu kochen, umzuschütteln, zu essen.
Für vier Tage.
Weihrauch (anti)
Blut von der Eidechse
Blut von der Wanze
je 1 Teil. Gegen den Durst, das Stoßen, das
Stechen im Auge. Rupfe die Haare aus,
schmiere es darauf, um gesund zu machen.“
Wie wir durch Aristoteles erfahren, galt für jeden ägyptischen Arzt
die gesetzliche Norm: die Entwicklung der Krankheit einige Tage zu
beobachten und erst am vierten Tage mit einem entsprechenden Heilmittel
wirksam einzugreifen. Die Kuren scheinen auch vielfach gelungen zu
sein, so daß sich der Ruf der ägyptischen Ärzte weithin über die
Mittelmeerländer verbreitete. Schon in Homers Odysse heißt es ja von
Ägypten und seinen Bewohnern:
„... Dort bringt die fruchtbare Erde
Mancherlei Säfte hervor, zu guter und schädlicher Mischung,
Dort ist jeder ein Arzt und übertrifft an Erfahrung
Alle Menschen ...“
Dieser Ausspruch hat insofern seine Berechtigung, als jeder Ägypter,
um das Gesamtwohl des Volkes zu fördern, sich außer der täglichen
äußerlichen Reinigung alle Monate einmal drei Tage hindurch durch
Brech- und Abführmittel, Waschungen und Klistiere auch innerlich
zu reinigen und gewisse diätetische Vorschriften zu beobachten
hatte, da nach althergebrachter Annahme die meisten Krankheiten aus
Unreinigkeiten des Magens, der Eingeweide und der Haut entstehen
sollten. „Eben dieser Diät wegen“, sagt Herodot im 5. vorchristlichen
Jahrhundert, „sind die Ägypter neben den Libyern das gesundeste Volk
der Erde.“ Das Volk lebte sehr einfach und badete täglich, um alle
Ansteckungsstoffe, namentlich den gefürchteten Aussatz, vom Körper
fernzuhalten. Aus denselben Gründen trug man auch nicht wollene,
sondern leinene Kleider und mied gewisse Speisen, wie Schweinefleisch,
Seefische und Saubohnen. Selbst den Königen war für den täglichen
Verbrauch ein bestimmtes Quantum von Speisen und Getränken
vorgeschrieben, das nicht überschritten werden durfte.
Da die altägyptischen Ärzte aus religiöser Scheu vor dem Leichnam ihn
nicht sezierten und die Einbalsamierer eine besondere Zunft[S. 270] bildeten,
die außerhalb des Priesterkollegiums stand und sich im allgemeinen
wohl keines besonders guten Rufes erfreute, da man ihnen schöne
Frauenleichen erst am dritten oder vierten Tage nach dem Tode überließ,
so herrschten bei den Ärzten höchst abenteuerliche Vorstellungen
über den anatomischen Bau des menschlichen Körpers, auf die wir hier
allerdings nicht eintreten können. Nur das eine sei erwähnt, daß man
glaubte, das Herz nehme bis zum 50. Jahre jährlich um zwei Quentchen
zu, um von da an jährlich um ebensoviel abzunehmen, so daß notgedrungen
der Tod vor dem vollendeten hundertsten Lebensjahre erfolgen mußte.
Dieselbe Stellung wie der Heilgott Imhotep bei den Ägyptern nahm
bei den alten Griechen der göttliche Asklepios ein, der etwa im 13.
vorchristlichen Jahrhundert in Thessalien gelebt haben soll. Die
ausschmückende Sage hat ihn zu einem Sohne des Lichtgottes Apollon
und der Königstochter Koronis gemacht, der zu Trikka in Thessalien,
der Wiege seiner Verehrung, geboren und nach dem frühen Tode seiner
Mutter vom weisen Kentauren Cheiron erzogen wurde, der ihn besonders
in der Heilkunst unterrichtete. Da er sogar Verstorbene erweckte,
erschlug ihn dann nach der Sage Zeus mit dem Blitz, in der Befürchtung,
die Menschen möchten durch ihn ganz dem Tode entzogen werden; nach
anderer Überlieferung geschah dies auf die Beschwerde des Gottes
der Unterwelt hin. Bei Homer und Pindar ist Asklepios noch als
einfacher Mensch gedacht, dessen Vergöttlichung eben begann. Seine
Söhne Podaleirios und Machaon erscheinen in der Ilias als Ärzte im
Heere der Griechen. Sie und ihre Nachkommen, die Asklepiaden, hatten
sich durch einen feierlichen Eid verpflichten müssen, ihre Kunst
nur den dazu Berechtigten und unter den herkömmlichen Bedingungen
zu lehren. Bei ihrer Behandlung spielte die Inkubation (griechisch
enkoimésis genannt) die größte Rolle. Sie bestand darin, daß
der Kranke an geweihter Stätte — eben im Tempel des Heilgottes —
auf dem Felle des von ihm geopferten Tieres schlief, um im Traume vom
Heilgotte eine Offenbarung über das anzuwendende Mittel zu erlangen.
Meist leiteten die Priester, die zugleich Ärzte waren, die Inkubation
ein und legten die Träume der Kranken aus, oder träumten wohl auch
selbst für diese. Das übliche Opfer der Genesenen war ein Hahn, den
auch Sokrates nach seinem Tode (399 v. Chr.) durch das ihm auferlegte
Trinken des Schierlingsbechers dem Heilgotte darzubringen befahl. Und
zum Danke an den Gott hingen die Geheilten Votivtafeln mit dem Bericht
über die von ihnen angewandte[S. 271] Kur im Tempel auf. Eine größere Anzahl
derselben haben die neuesten Ausgrabungen zu Epidauros am äginetischen
Meerbusen in der Argolis, wo in Griechenland der Hauptsitz seiner
Verehrung war, zutage gefördert. Von diesem Orte aus verbreitete sich
der Asklepioskult über ganz Griechenland, die ägäische Inselwelt und
die Küste von Kleinasien, wo besonders in Kos, Knidos, Trikka, Pergamon
und Athen sich einst vielbesuchte Heiligtümer von ihm befanden.
Diese waren stets in gesunder Lage auf Anhöhen in heiligen Hainen,
in der Nähe von Quellen und Heilwassern errichtet, und auch die von
den Heilpriestern den Kranken befohlene Tempelkur bestand in auch
nach unseren viel weiter geförderten Anschauungen recht zweckmäßigen
hygienischen Verordnungen. So kann es uns nicht wundern, daß der
Asklepiosdienst sich mit der griechischen Kolonisation weithin in
den Ländern am Mittelmeer verbreitete. Das Symbol des Gottes, der
von den Bildhauern bärtig, im Gesichtsausdruck dem Zeus ähnlich, nur
milder und jugendlicher, dargestellt wurde, war die Schlange, und
zwar die gelbliche Natter (Coluber aesculapi), die in seinen
Tempeln gehalten und bei der Gründung neuer Kultstätten in diese
übergeführt wurde. So gelangte die Äskulapschlange mit dem Dienst des
in Italien Äskulap genannten Asklepios aus Epidauros nach Rom, als
dort sein Kult im Jahre 293 v. Chr. bei einer Pest auf Befehl der
sibyllinischen Bücher eingeführt wurde. In dieser Stadt stand der
Tempel des Heilgottes auf der Tiberinsel. Mit den Römern kam dann diese
Schlangenart, die sich in Südeuropa vornehmlich auf felsigem, spärlich
mit Buschwerk bestandenem Boden aufhält und hier eine Länge von
1,5 m erreicht, an alle natürlichen Thermen nördlich der Alpen,
wo Kranke Genesung suchten. Deshalb wird dieses in jeder Beziehung
anmutige Tier heute noch überall, wo einst Römerbäder standen, z. B. in
Schlangenbad, Baden bei Wien usw., gefunden.
Bei den alten Germanen wurde kein besonderer Heilgott verehrt. Wie bei
allen Völkern auf primitiver Kulturstufe war bei ihnen die Heilkunst
kein Privileg einer besonderen Kaste, sondern wurde von sämtlichen
älteren und durch Erfahrung belehrten Volksgenossen, besonders weisen
Frauen, denen man besondere Zauberkräfte zuschrieb, ausgeübt. Als
Heilmittel wurden außer mineralischen und tierischen Produkten die
Säfte der verschiedensten Pflanzen verwendet, wie dies heute noch bei
allen Völkern der Erde geschieht. Hat man doch ausgerechnet, daß bei
diesen gegenwärtig noch etwa 40000 Pflanzen in arzneilichem Gebrauche
stehen. Die zufällige Entdeckung einer heil[S. 272]samen Eigenschaft erweckte
begreiflicherweise die Begierde nach weiteren solchen Offenbarungen der
Natur, und wenn diese ausblieben, so bemächtigte sich die Phantasie
des Wunsches und dichtete vielen Gewächsen Heilkräfte an, die diese
gar nicht besaßen. So wurde aus geringem Wissen ein hoffendes Glauben
und aus diesem ein üppiger Aberglaube. Man glaubte, daß alle durch
Gestalt, Farbe und Entwicklungsweise ausgezeichneten Pflanzen besondere
Kräfte haben müßten, so beispielsweise das Farnkraut, das keine Blüten
aufwies und bei dem man auch keine Sämlinge fand. Dieses Kraut sollte
in der an Zauber reichen Johannisnacht seinen Samen fallen lassen, der
sofort tief in den Boden verschwinde und sich deshalb dem menschlichen
Auge entziehe. Das in den halbdunkeln Klüften goldigschimmernde
Leuchtmoos wurde als das Gold der Kobolde gedeutet, das wie die meisten
Heilsäfte aus Kräutern nur durch Zauber gewonnen werden könne. Man
glaubte, daß sich die geheimen inneren Kräfte der Pflanzen vielfach
schon an besonderen Merkmalen der äußeren Erscheinung erkennen lassen.
Das leberartig gestaltete Blatt des Leberblümchens (Hepatica
triloba) sollte heilsam sein bei Leberkrankheiten, das ohrförmige
Blatt der Haselwurz (Asarum europaeum) sollte gut sein gegen
Gehörleiden, die am Stengel entlang laufenden Blätter des Beinwells
(Symphytum officinale) sollten Knochenbrüche heilen, wie die
um den Stengel herum verwachsenen Blätter des Hasenohrs (Bupleurum
rotundifolium) Wunden zusammenschließen sollten.
Gegen alle möglichen Leiden wurde das Schellkraut (Chelidonium
majus) verwendet, das seinen Namen vom Vermögen Warzen
abzulösen und die Haut bei Krankheiten derselben abzuschälen — vom
althochdeutschen sceljan schälen — erhielt. In Rußland wird
es gegen Krebs gegeben und wurde von dorther erst kürzlich auch bei
uns als Krebsheilmittel empfohlen. Sein dunkelgelber Milchsaft sollte
Gelbsucht heilen und wurde von den Alchemisten des Mittelalters
vorzugsweise zum Goldmachen verwendet, daher die Pflanze auch Goldwurz
heißt. Wegen dieser seiner Fähigkeit, die zugleich das Vermögen der
Herstellung des „Steines der Weisen“ in sich schloß, der nach dem
damals allgemein verbreiteten Glauben seinem Besitzer ewige Jugend
und unermeßliche Reichtümer brachte, da er alle vier Elemente:
Feuer, Luft, Wasser und Erde enthalten sollte, hieß das Schellkraut
bei den Alchemisten „coeli donum“, d. h. Himmelsgabe. Der
botanische Gattungsname Chelidonium ist aber nicht etwa daraus
hervorgegangen, wie man vermuten könnte, sondern aus dem griechischen
chelidón[S. 273] Schwalbe. Die Pflanze hatte nämlich schon im
Volksglauben des Altertums mancherlei Beziehungen zu diesem Zugvogel.
Sie blüht bei der Ankunft der Schwalben und welkt nach deren Wegzug.
Aristoteles, der Vater der Naturgeschichte und Metaphysik (384–322
v. Chr.), der den Gelehrten des Mittelalters als absolute Autorität galt,
sagt von ihr: die Schwalben hätten ihren erblindeten Jungen durch deren
Milchsaft die Sehkraft wieder verschafft: dadurch seien überhaupt die
Menschen auf die Heilwirkung der Pflanze aufmerksam geworden. Der 1590
als Leibarzt des Pfalzgrafen Johann Kasimir in Heidelberg gestorbene
berühmte Arzt Tabernaemontanus (nach seinem Geburtsorte Bergzabern so
genannt) gibt in seinem Kräuterbuch, an dem er — nebenbei bemerkt —
36 Jahre gearbeitet hat, etwa 30 Rezepte an, in denen das Schellkraut
einen wesentlichen Bestandteil bildet; in einem derselben wird der
Blütensaft mit Honig zu Sirup gesotten. Als Amulett sollte die Wurzel
stets bei sich tragen, wer bei seinen Mitmenschen zu hohem Ansehen
gelangen will. Und wer über den Ausgang einer schweren Krankheit
Bescheid haben möchte, der braucht die Pflanze dem Kranken nur auf den
Kopf zu legen; weint der Kranke dabei, so wird er genesen, singt er
aber laut und hell, so muß er sterben.
Auch die Raute (Ruta graveolens) sollte mancherlei
Zauber- und Heilkräfte in sich bergen, weshalb sie schon bei den Römern
in hohem Ansehen stand. Aus ihr hergestellte Tränke sollten gegen
die verschiedensten Krankheiten, besonders aber gegen Kolikschmerzen
heilsam sein; gegen diese sollte schon ein über den Kesselbalken des
Herdes aufgehängtes Stengelbündel der Raute helfen. Stücke der Pflanze
um den Hals gehängt sollten Blatternkranken die Sehkraft erhalten;
wer sich vor Schlangengift schützen wollte, der brauchte nur die
Füße damit einzureiben. Der ums Jahr 180 n. Chr. lebende griechische
Sophist Claudius Älianus erzählt in seinen Tiergeschichten: das Wiesel
kenne diese Wirkung sehr wohl. Sobald es den Kampf mit Giftschlangen
zu unternehmen beabsichtige, fresse es Rautenblätter und dann könnten
ihm diese mit ihrem Gifte nichts anhaben. Besondere Bedeutung erlangte
die Raute durch das Christentum. Es sollte die bösen Geister und das
Ungeziefer vertreiben und, kreuzweise im Zimmer aufgehängt, gegen
Alpdrücken schützen. Aus Rautenöl wurde der „Diebsessig“ hergestellt,
der alle Ansteckungsstoffe unschädlich machen konnte und bis vor kurzem
ein in Apotheken erhältliches Desinfektionsmittel bildete. Seinen
Namen erhielt dieser Stoff von dem Umstande, daß ihn Diebe gewöhnlich
brauchten, um zu Pestzeiten ungefährdet die[S. 274] Wohnungen der Kranken
und Toten plündern zu können. Sie wurde und wird noch jetzt viel in
Bauerngärten angepflanzt und so mancher Bauer im östlichen Deutschland
genießt in jedem Frühjahr ein mit Raute bestreutes Brot, um den Magen
zu reinigen, das Jahr über guten Appetit zu haben und von Krankheiten
verschont zu bleiben.
Noch mehr Zauber wurde mit dem Johanniskraut (Hypericum
perforatum) getrieben, dessen Blätter durch das Vorhandensein von
Öldrüsen durchsichtig punktiert erscheinen und dessen Blütenknospen
einen an der Luft sich rot färbenden Saft enthalten, weshalb es
auch Blutkraut genannt wurde. Nach der deutschen Sage war es zur
Sommersonnenwende aus dem Blute des von einem Eber geritzten Gottes
Odin hervorgesproßen, während die christliche Kirche das Kraut aus
dem Blute Johannes des Täufers hervorgehen ließ. An der Johannisfeier
wurden Häuser und Kirchen damit geschmückt, damit Leib, Seele und
Besitztum vor Schaden bewahrt blieben. Man trug das Blutkraut
immer bei sich, um vor Verwundung und Verhexung geschützt zu sein;
gefolterte Hexen erhielten einen aus ihm und Distelsamen gekochten
Trank „Olebanum“, damit der Teufel ausfahre und sie bekennen
sollten. Deshalb war der Teufel gegen das Kraut sehr erbost und wollte
es vernichten. Zu diesem Zwecke ließ er sich viele Nadeln machen und
zerstach damit die Blätter; doch verdorrte das Kraut nicht, aber seine
Blätter zeigen die Nadelstiche noch heute. Will man erkennen, ob ein
Hexenmeister zugegen sei, so legt man unter das Tischtuch von der
Wurzel des Johanniskrauts, ohne daß jemand es merkt; sitzt nun ein
Zauberkundiger mit zu Tisch, so wird es ihm sofort übel und er muß
hinausgehen. Das Kraut dient auch zu Liebeszauber, wenn man es sich
an die Brust steckt und der betreffenden Person, deren Liebe man sich
zu erringen sucht, begegnen kann. Es kann aber auch Liebe vertreiben,
wenn man es der betreffenden Person in die Schuhe oder in ein Kleid
hineinpraktiziert.
Die Springwurz (Euphorbia lathyris) ist eine aus dem
Mittelmeergebiet stammende Pflanze, deren Früchte bei der Reife mit
starkem Geräusch aufspringen, wobei die Samen heftig herausgeschleudert
und so verbreitet werden. Darin glaubte man die Kraft zu erkennen,
wonach die Pflanze die Fähigkeit besitze, alles Geschlossene oder Feste
aufzusprengen und Nägel, Pflöcke usw. auszuziehen. Schon Salomo soll
den „Schamir“ als felsenspaltendes Mittel beim Bau seines Tempels in
Jerusalem benutzt haben. Er hatte sich ihn dadurch verschafft, daß er
das Nest und die Brut eines „Urhahns“ mit einem „Kristall“ be[S. 275]decken
ließ; der Vogel holte nun den Schamir herbei und wollte damit den Stein
wegsprengen, da liefen die Leute des Königs mit großem Geschrei herbei,
und der Urhahn ließ vor Schreck die Wurzel fallen, die man dem Könige
brachte. In Deutschland wuchs diese Springwurz nicht, man konnte sie
sich nur in der Weise beschaffen, daß man das Nest eines Schwarzspechts
mit einem Pflock verschloß, dann holte der Vogel die Springwurz herbei
und hielt sie an den Pflock, wie der ältere Plinius nach Demokrit und
Theophrast erzählen; in diesem Moment mußte man unter dem Nest einen
roten Mantel ausbreiten und ein lautes Geschrei erheben, dann erschrak
der Vogel und ließ die Springwurz zu Boden fallen. Der gelehrte
Konrad von Megenberg (um 1309 auf dem Schlosse Megenberg in Franken,
dessen Vogt sein Vater war, geboren und 1374 als Kanonikus am Dom zu
Regensburg gestorben), der Verfasser der ersten Naturgeschichte in
deutscher Sprache, bemerkt dazu, es sei nicht gut, wenn dieses Mittel
allgemein bekannt würde, denn dann wäre kein Schloß mehr sicher. Diese
Wirkung des Krautes galt als sehr weitgehend, indem bei Berührung mit
demselben dem Gefesselten die Ketten und Bande, wie dem Zahnkranken
die hohlen Zähne ausfallen sollten, das Pferd seine Hufeisen verliere
usw. Außer dem Specht kennen auch Elster, Rabe, Wiedehopf und Schwalbe
diese Eigenschaft des Krautes. Der Specht mit seiner Springwurz war im
römischen Altertum das Symbol des Blitzes; wie dieser alles spalten und
öffnen kann, so der Specht beziehungsweise die Springwurz. Auch in der
germanischen Göttersage spielt sie eine gewisse Rolle. Als sich nämlich
Gerda weigerte, Fros Weib zu werden, und selbst die Lockung durch die
goldenen Äpfel nichts nutzten, so drohte man ihr mit der Springwurz,
die sie schon zwingen werde. Deshalb wurde letztere auch Zähmezweig
genannt. Sonst dienten die Samen als Purgierkörner und der Saft als
Blutreinigungsmittel bei Flechten und anderen Hautausschlägen. Daher
empfahl Karl der Große den Anbau des „Pillenkrautes“.
Mit dem zauberkundigen jüdischen Könige Salomo hängt auch der
Salomonssiegel (Polygonatum anceps und P.
multiflorum) zusammen; dieser soll die Siegeleindrücken gleichenden
Narben der vorjährigen Sprosse am wagrecht im Boden kriechenden
Wurzelstock verursacht haben, um anzuzeigen, daß der Pflanze besondere
Kräfte innewohnen. Er soll sie auch als Sprengmittel beim Tempelbau
verwendet haben.
Einen ähnlichen unterirdischen Wurzelstock besitzt der Wurmfarn[S. 276]
(Polystichum filix mas), der nur in der an Zauber reichen
Johannisnacht mit goldenem Lichterglanz blüht. Es sind dies die Sporen,
die aber nur mit Hilfe des Teufels erlangt werden können, die von
großer Kraft gegen Verhexung, Irregehen und Erkrankung im allgemeinen
sein und immerwährende Jugend, Glück, Reichtum und die Erfüllung aller
Wünsche verleihen sollten. Wird der „Wünschelsame“ in den Schuhen
getragen, so sollte er unsichtbar machen.
Die Siegwurz oder der Allermannsharnisch verhilft zu
Sieg und schützt gegen Zauberei und Krankheit, die dem Menschen
auf niedriger Kulturstufe auch nur Folge von Verhexung ist. Und
zwar unterschied das Volk zweierlei Art: die weibliche Siegwurz war
Gladiolus (von gladius Schwert) communis. Schon
die schwertförmigen Blätter sollten die Schutzwirkung anzeigen, und
die von netzigen Fasern, den Resten der Blattgefäßbündel, bekleidete
rundliche Knolle erschien wie ein Panzerhemd oder Harnisch. Die
männliche Siegwurz dagegen war Allium victorialis. Ihre
längliche Zwiebel hat ebenfalls eine netzfaserige Hülle; dem sie
Tragenden sollen sieben Hämmer nichts anhaben können, daher wird sie
auch „Siebenhämmerlein“ genannt. Um für alle Fälle die gewünschte
Schutzwirkung zu besitzen, wurden die beiden Wurzeln als Mann und
Frau zusammengetan. Noch bis in unsere Zeit verlangten die Bauern
in Norddeutschland in den Apotheken „He un Se“, d. h. Er und Sie,
und nagelten sie zum Schutze gegen Zauberei und Teufelsspuk an ihre
Türen. Auch in der Schweiz hängt man Allium victorialis gegen
Unwetter und Hexerei in der Wohnung auf; aufs Bett gelegt wirke es
gegen Albdrücken und in ein Tuch eingebunden heile es Zahnschmerzen und
Kopfweh. Der vorhin angeführte Arzt Tabernaemontanus sagt in seinem
Kräuterbuch, daß die Bergknappen sie mit sich führen, um damit die
Gespenster und bösen Geister zu vertreiben, von denen sie angefochten
werden. Besonders aber ward sie von den Landsknechten hochgehalten, die
sie als Amulett stets bei sich trugen, um hieb-, stich- und schußfest
zu sein.
Das durch zwei hodenförmige, als Reservestoffbehälter dienende Knollen
ausgezeichnete Knabenkraut (Orchis maculata) diente zu
Liebeszauber und war als „Heiratswurz“ gesucht. Wird die Pflanze am
Johannistage ausgerissen, so bleibt sie monatelang grün und hält alle
Krankheit von den Bewohnern fern. Wird sie in die Kleider genäht,
so erwirbt sie dem Träger derselben die Zuneigung der Menschen. Die
handförmig geteilten Knollen des breitblätterigen Knabenkrautes[S. 277] aber
dienten als „Teufelshand“ als Talisman gegen den bösen Blick, Verhexung
und Krankheit, die natürlich wie alles Unerklärliche auch auf Zauberei
zurückgeführt wurde. Wer sie bei sich trägt, hat Glück im Spiel und
immer Geld im Beutel; nur darf man sie nicht im Hause aufbewahren,
da sonst den Kühen die Milch schwindet. Sie ist aber nur dann eine
Glückshand, wenn sie am Johannistage mittags oder nachts 12 Uhr
ausgegraben wurde.
Besonders stark beschäftigte die Volksphantasie die so geheimnisvoll
nie auf dem Boden, sondern stets nur auf Bäumen wachsende Mistel
(Viscum album), die im Winter, während sonst alles abstirbt,
weitergrünt; deshalb vermochte sie allein den Sonnengott Balder zu
töten, als der tückische Loki den blinden Hödur bewog, einen aus
Mistelholz geschnitzten Pfeil gegen ihn abzuschießen. Besonders
zauberkräftig war die allerdings äußerst selten auf einer Eiche
wachsend gefundene Mistel, die die allerschlimmsten Krankheiten heilte,
alle Giftwirkung aufhob und allem Fruchtbarkeit verlieh. Schon bei den
Kelten genoß sie das größte Ansehen. War eine solche Rarität entdeckt,
so holten sie die Druiden in feierlichem Aufzuge am sechsten Tage nach
dem Neumond. Zuerst wurden unter dem Baum allerlei Opfer dargebracht,
dann schnitt der weißgekleidete Oberpriester die zauberkräftige Pflanze
mit goldener Sichel ab und verbarg sie in seinem Mantel. Als Sühne für
den Frevel wurden dann zwei weiße Stiere geopfert und bei dem darauf
folgenden Opferschmause besondere Riten beobachtet. Die Mistel heißt
noch heute in der Altmark „Heil allen Schaden“. Am wirksamsten ist
eine mit dem Pfeil vom Baume geschossene Mistel, die man, ehe sie zu
Boden fällt, mit der linken Hand auffängt; dazu muß aber die Sonne im
Zeichen des Schützen stehen und der Mond im abnehmenden Licht sein. Da
die Zweige der Mistel immer gabelig sind, so erblickte man darin eine
Wünschelrute, welche Türen zu verborgenen Schätzen öffnen und Diebe
bannen sollte. Sie hilft gegen Albdrücken und verleiht Fruchtbarkeit.
So wurde sie als segenspendendes Symbol am Julfest in der Halle
aufgehängt und band man Zweige von ihr in der Christnacht an die
Obstbäume, damit sie im kommenden Jahre recht reichlich Frucht tragen
möchten.
Geheimnisvolle Kräfte barg nach altgermanischem Glauben auch der dem
Donnar heilige Haselstrauch (Corylus avellana). Wurden
Runen in einen Haselstock geschnitten und das richtige Zauberlied
dazu gesungen, so war das für die verschiedensten Dinge gut: es
machte unverwundbar, der fliegende Pfeil wurde dadurch im Fluge
gehemmt,[S. 278] wunde Glieder wurden geheilt, Feuer, Sturm und Wellen
gedämpft, der Sieg errungen, streitende Männer versöhnt, Gefangene
gelöst und die Minne der Frauen errungen. Diese Macht ist wohl dem
frühen Blühen der Hasel, vor allen anderen Pflanzen unserer Zone,
zuzuschreiben. Daher war sie auch ein Sinnbild des Lebens und seiner
Neuerstehung nach dem Winter, das Fruchtbarkeit verlieh. Hasel-
und Holderzweig zusammengebunden, schützten vor dem wilden Heer,
verscheuchten die Irrlichter, bewahrten vor Diebstahl und Verhexung,
bannten Giftschlangen und entzauberten verhexte Gegenstände. Unter
dem Haselstrauch, der eine Mistel trägt, wohnt der Haselwurm oder
Schlangenkönig, eine weiße, gekrönte Schlange von fabelhafter Stärke,
die durch den dicksten Eichbaum wie nichts hindurchfuhr. Um ihn
einzufangen, mußte man den betreffenden Haselstrauch im Namen Gottes
begrüßen, ihn ausgraben, den darunterliegenden Wurm durch Hersagen
eines gewissen Zauberspruches „besprechen“ und mit Beifuß bestreuen;
das nahm ihm seine Kraft. Im Besitze des Haselwurmes kannte man alle
geheimen Kräfte der Pflanzen, war gegen alle bösen Geister und alle
Zauberei übelwollender Menschen gesichert, fand alle verborgenen
Schätze, konnte durch alle Türen brechen, war unverwundbar und
unsichtbar. Sogar der Böse mußte einem zu Willen sein. Aber in jeder
Nacht zwischen 11 und 12 Uhr mußte der Haselwurm mit einem Ei und Raute
gefüttert werden.
Auch der Wacholderstrauch (Juniperus communis) galt den
alten Deutschen als mit wunderbaren Zauber- und Heilkräften begabt und
spielte als solcher in Sitte und Sage eine große Rolle. Noch heute
hält das Volk große Stücke auf den Kranawitt- oder Machandelbaum,
dessen Beeren und aus dem Holz gewonnenes Öl seit dem Altertum als
Volksheilmittel viel gebraucht werden. Wacholderreisig verwendeten die
alten Germanen zu ihren Opfern und beim Verbrennen der Toten. Nach
altem Volksglauben schützt der Rauch verbrannter Zweige vor Ansteckung
und vertreibt böse Geister und Schlangen.
Eine Allerweltszauberpflanze war ferner der Alraun oder
das Erd-, Gold- oder Galgenmännlein, so genannt, weil er unter
dem Galgen aus dem Samen eines unschuldig gehängten jungen Diebes
hervorgehen sollte. Doch ist die Erlangung desselben mit allerlei
Gefahren verbunden. Der in der Wurzel hausend gedachte Geist schrie
beim Herausgraben so entsetzlich, daß man vor Entsetzen starb; daher
benutzte man bei deren Gewinnung einen schwarzen Hund, der aber[S. 279] bei
diesem Geschäft das Leben einbüßte. Die Wurzel mußte an einem Freitag
vor Sonnenaufgang ausgegraben werden, und zwar legte man sie zuerst
ringsherum frei, schlug drei Kreuze, sprach einen Zauberspruch, band
einen Strick daran und ließ sie durch den schwarzen Hund, an dem kein
weißes Haar sein durfte, vermittelst des Schwanzes herausziehen,
nachdem man sich vorher die Ohren sorgfältig mit Wachs verstopft
hatte. Eben diese Gewinnungsart, die stets gleich geschildert wird,
erzählte eine alte Frau in Göttingen Dr. Crome. Das dabei im
Jahre 1820 unter dem Hochgericht auf dem Leineberge bei jener Stadt
gewonnene „Alruneken“ habe den Mann, der es sich mit Hilfe des Teufels
verschaffte, sehr reich gemacht. Solche Alraune verschafften nicht
bloß Reichtum, sondern schützten vor allem Zauber, machten ihren
Besitzer unsichtbar, öffneten die verschlossenen Türen, bewahrten vor
Blitzschlag, gaben Glück zu jedem Tun, Gesundheit und kinderlosen
Frauen Fruchtbarkeit. Sie mußten sehr heimlich gehalten, am besten in
einem Holzkästchen verwahrt werden und wurden bloß beim Schätzeheben,
Wahrsagen und sonstiger von ihnen verlangter Arbeit hervorgeholt. Man
setzte ihnen bei jeder Mahlzeit etwas zu essen und zu trinken vor,
wusch sie alle Freitage oder Sonnabende mit Wein oder Wasser, zog
ihnen an Neumonden frische Kleider aus weißer oder roter Seide an.
Starb ihr Besitzer, so wurde der Alraun auf den jüngsten Sohn vererbt;
starb dieser aber vor dem Vater, so erhielt ihn der älteste Bruder.
Er war der beste Talisman gegen Erkrankung, und da er sonst noch alle
möglichen guten Eigenschaften aufwies, so wurde er geradezu mit Gold
aufgewogen und ein schwunghafter Handel mit ihm getrieben.
Schon das früheste Altertum hat ihn gekannt und verehrt. Er wurde
ursprünglich aus der fleischigen Pfahlwurzel einer im ganzen
Mittelmeergebiet heimischen Nachtschattenart, der Mandragora
officinalis mit grünlichgelben Blüten und gelben Beeren von
1,5 cm Durchmesser, gewonnen. Diese sollte der menschlichen Gestalt
ähnlich sein, was schon Pythagoras bezeugt, und wurde deshalb als
ein mit Zauberkraft wie alle Geister Verstorbener ausgestattetes
Erdmännlein oder Erdweiblein — denn man unterschied auch hier
zweierlei Geschlechter — angesehen. Aber ganz abgesehen von ihrer
Zauberkraft, barg die Wurzel betäubende Stoffe, weshalb man sie im
Altertum zur Schmerzlinderung vor chirurgischen Operationen gab. Noch
im Mittelalter wurde ihr Saft mit demjenigen von Bilsenkraut und
Mohn als Betäubungsmittel verabreicht. Im Abendlande, wo die echte
Mandragora nicht[S. 280] mehr gedeiht, ersetzte man sie vielfach durch die
rübenförmige Wurzel der Zaunrübe (Bryonia dioica),
die an Zäunen und Hecken wächst. Ihr Saft dient seit alter Zeit als
Abführmittel und sie selbst als Alraun, der zu mannigfaltiger Zauberei,
namentlich aber zu Liebeszauber benutzt wurde. Noch heute ist auf dem
Lande der Glaube verbreitet, daß, wenn ein Mädchen auf dem Gange zur
Kirmeß ein Stückchen Wurzel der Zaunrübe in die Schuhe lege, ihr alle
Burschen zufliegen werden. Der ältere Plinius berichtet, daß sie vor
Raubtieren schütze und Knochensplitter aus Wunden ziehe, den Ertrag der
Milch vermehre und das Verderben derselben verhindere. Die Jungfrau
von Orleans soll einen Alraun besessen haben, daher ihre Erfolge. Der
in der Bibel mehrfach erwähnte dudaim, von Luther mit „Lilien“
übersetzt, wird vielfach als Alraun gedeutet, ist aber wahrscheinlicher
die auch heute noch im Orient vielfach zu Liebeszauber benutzte Frucht
von Cucumis dudaim.
Es würde uns zu weit führen, hier alle die zahllosen Pflanzen
anzuführen, die bei unseren Vorfahren als Arznei und Zaubermittel
gebraucht wurden, und wie bei ihnen war es bei den anderen Völkern.
Das erkennen wir deutlich an der Herkunft des griechischen Wortes
phármakon, das unserer Bezeichnung Pharmazie zugrunde liegt und sowohl
Zauber- als Heilmittel heißt. Pharmakis bedeutet die Zauberin, und
diese war bei den alten Griechen zugleich Ärztin, die mit eigener Hand
die mancherlei ihr als heilkräftig bekannten Kräuter sammelte und
daraus die verschiedenen Heiltränke bereitete. Erst sehr spät wandten
sich die Männer berufsmäßig dem Sammeln und Verkaufen der pflanzlichen
Rohstoffe zu. Die Griechen nannten sie Rhizotomen oder Wurzelschneider,
und erst als sie nach und nach auch die Zubereitung und den Verkauf
der von den Ärzten angewandten Arzneien übernahmen, wurden sie
pharmakopóles, d. h. Arzneiverkäufer, genannt. Aus ihnen wurden
dann die Pharmazeuten im Sinne von Arzneibereitern, die später auch
Apotheker hießen nach der griechischen Bezeichnung apothékē
Aufbewahrungsort (für Kräuter nämlich). Dieser von den Römern als
apotheca übernommene Ausdruck bedeutete später überhaupt das
Lager der Arzneipflanzen, weshalb es im Mittelalter als Krauthausz
verdeutscht wurde. In der mittelalterlichen Klosterwirtschaft wurde
unter dem Wort Apotheke der Raum für die Heilkräuter verstanden, der
im 13. Jahrhundert auch auf städtische Kräuterläden, in denen meist
getrocknete Heilpflanzen feilgehalten wurden, überging. Nun verstanden
begreiflicherweise die darin waltenden Apo[S. 281]theker Hilfe suchenden
Kranken auch verwickeltere Arzneien, die zu Hause nicht so leicht
bereitet werden konnten, herzustellen, was gerne benutzt wurde. So
wurden sie allmählich von Heilkräuterverkäufern zu Bereitern von aus
den Heilkräutern hergestellten Arzneien. Bei der Arzneibereitung war
das Mischen der verschiedenen Stoffe das Wichtigste; der dafür im
mittellateinischen gebrauchte Ausdruck conficere mengen führte
dazu, das Produkt als confectum zu bezeichnen. Da nun die
meisten Arzneistoffe des besseren Einnehmens wegen in Honig und später
in Zucker eingebettet wurden, so bekam dann das Wort Konfekt mit der
Zeit den Sinn einer künstlich bereiteten Süßware überhaupt, wobei der
ursprüngliche Bezug auf Heilkraft mehr und mehr verschwand, so daß
heute dieser Ausdruck nur Zuckerzeug bedeutet.
Nach dem Untergang der antiken Welt waren es in erster Linie die Araber
gewesen, die von den Kulturvölkern des Altertums die Arzneikunde und
Kenntnis der dabei angewandten Heilmittel übernahmen, um sie zur
Zeit der Kreuzzüge den Abendländern zu vermitteln. Dabei lehrten sie
diese auch allerlei neue Arzneiformen wie beispielsweise die Sirupe
bereiten, die durchaus ein Geschenk arabischer Heilkunst sind. Aus dem
arabischen scharâb Trank wurde das spanische scharope,
das italienische sciroppo, siropo, das französische
sirop und schließlich im 12. oder 13. Jahrhundert das deutsche
Sirup. Es war dies ein dickflüssiger Trank, der sorgfältig aus
allerlei Kräutern und Gewürzen mit Hilfe von Honig und später Zucker
bereitet wurde. Häufig wurde er nach arabischem Muster mit Rosen- oder
Veilchenwasser parfümiert. Sonst waren die wichtigsten Arzneiformen
des Mittelalters die Elektuarien, im Deutschen zu latweri
und zuletzt latwerg umgebildet. Es waren dies durch Kochen
eingedickte Säfte verschiedener Heil- und Würzkräuter, die nach dem
Wortlaute der ursprünglich griechischen Bezeichnung ekleiktón
zerleckt werden sollten. Sie wurden entweder wie Salben in Büchsen,
oder in Würfel geschnitten als Zeltelîn, oder in Stangenform gegossen,
wie heute noch der eingedickte Lakritzensaft, aufbewahrt. Höchst selten
gelangten Pulver und gar nie Pillen zur Anwendung, welch letztere erst
in der Neuzeit in Aufnahme kamen.
Abgesehen von der arabischen Hochschule von Cordova, in der neben
anderen Wissenschaften auch die Medizin und Alchemie reiche Pflege
fanden, war Salerno in Unteritalien die älteste Pflegestätte der
wissenschaftlich betriebenen Medizin in Europa. Im 12. Jahrhundert[S. 282]
erließ König Roger von Neapel die erste Medizinalverfassung, die dann
der seiner Zeit weit vorauseilende Kaiser Friedrich II. ausbaute und
zu der er die erste Arzneitaxe hinzufügte. Erst sehr viel später wurde
dann in Mitteleuropa die staatliche Überwachung über Zubereitung und
Verkauf der Arzneimittel eingeführt, nachdem vom Beginne des 12.
Jahrhunderts an sich in Frankreich, Deutschland usw. die Pharmazie von
der Medizin getrennt hatte und reguläre Apotheken eingerichtet worden
waren. Schon im 14. Jahrhundert erblühte eine freilich der Hauptsache
nach alchemistische Literatur über die verschiedenen Präparate und
Rohstoffe des Arzneischatzes, als deren vornehmste Träger Raimundus
Lullus, Basilius Valentius, Albertus Magnus und Roger Baco zu nennen
sind. Erst ganz allmählich und besonders durch die immer bedeutendere
Förderung von seiten der Chemie konnte die Arzneimittellehre eine
einigermaßen rationelle Gestaltung annehmen und sich von dem ungeheuren
Wust und Ballast befreien, den viele Jahrhunderte in ihr aufgehäuft
hatten. Immer mehr wurde die einst ganz unglaublich zahlreiche Menge
der in den Apotheken gehaltenen Arzneistoffe eingeschränkt, so daß
heute weitaus die Mehrzahl der einst arzneilichen Pflanzen nur durch
das Anhängsel „officinalis“ hinter ihrem Namen als solche
gekennzeichnet ist, jedoch keinerlei Verwendung mehr im Arzneischatze
findet. Im folgenden sollen nun Herkunft und Verwendung nur der
wichtigsten pflanzlichen Arzneimittel in Kürze besprochen werden.
Das Wort droga bedeutete ursprünglich einen wertvollen
Arzneirohstoff vorwiegend aus der Gruppe der aromatischen Stoffe; doch
scheint man bereits im 16. Jahrhundert den Begriff des Getrockneten
damit verbunden zu haben. Sonst nannten die Lateiner des Mittelalters
die arzneilichen Rohstoffe simplicia im Gegensatz zu den
zusammengesetzten Arzneimitteln, die man als composita
bezeichnete. Nach Tschirch ist heute noch in den holländischen
Apotheken der Ausdruck simplicia für Drogen in Anwendung, und
auch in Frankreich nennt man sie médicaments simples.
Solche Drogen waren um so geschätzter und teurer, je schwieriger sie zu
beschaffen waren. Dabei spielte vielfach schon die Art der Gewinnung
eine wichtige Rolle. Bis in die Neuzeit hinein waren nämlich nicht nur
vom Volke, sondern auch von den Ärzten genau einzuhaltene Vorschriften
bei der Herstellung von solchen gefordert. Wie bei den Menschen auf
niederer Kulturstufe die bei der Einnahme einer Arznei gesprochene
Zauberformel viel wichtiger als diese selbst ist, so[S. 283] achtete man auch
bei uns bis vor noch nicht sehr langer Zeit genau auf die „Segen“,
die bei der Gewinnung gewisser Drogen und dann wiederum bei der
Herstellung der einzelnen daraus bereiteten Medikamente gesprochen
werden mußten, wenn sie wirksam sein sollten. So sind nicht nur in
den mittelalterlichen Kräuterbüchern, sondern auch in den bis ins 19.
Jahrhundert hinein von Ärzten, Apothekern, aber auch allen besseren
Familien, besonders des Adels geführten Arzneibüchlein, in denen die
verschiedensten, von Geschlecht zu Geschlecht vererbten Rezepte zur
Bereitung von Arzneien sorgsam zu allgemeinem Nutzen gesammelt wurden,
jeweilen auch gewissenhaft die bei der Bereitung und Anwendung der
betreffenden Heiltränke zu sprechenden „Segen“ notiert. Ließ man diese
außer acht, so glaubte man, werde auch die Arznei trotz sorgfältigster
Bereitung nicht die gewünschte Wirkung ausüben.
Wie für körperliche Krankheiten wurden Heiltränke aber auch für
Liebes- und andern Zauber von den Laien so gut als von den Ärzten und
Apothekern bereitet. Mit Vorliebe wurde das heilige Salböl und die
Hostie, die heute noch vom Volke kraft der Weihung durch den Priester
als mit besonderen Wunderkräften ausgestattet angesehen werden, zu
solchem Liebeszauber, wie auch zu Krankheitszauber aller Art benutzt.
Schon Kaiser Karl der Große verbot in einer Verordnung im Jahre 813 den
Priestern bei schwerer Strafe, solches unter keinem Vorwand zu Heil-
oder Zauberzwecken irgend welcher Art herzugeben. Und drei Jahrhunderte
später beschwor Bruder Berthold namentlich die Bauern, weder mit dem
Chrisma, noch gar mit der Hostie Zauberei zu treiben.
Auch ohne Beimengung von Pflanzenextrakten galt der Wein an
sich schon als Heiltrank; er diente innerlich zum Kräftigen und
Wiederbeleben der Körperfunktionen, und äußerlich zum Waschen der
Wunden, bevor sie mit Öl getränkt wurden, wie dies ja schon im
Altertum der Fall war. Es sei hier nur an die bekannte Geschichte
vom barmherzigen Samariter erinnert. Mit Wein wurde unter anderm die
im Mittelalter sehr oft genannte potio Paulina, der Trank des
heiligen Paulus bereitet, wohl so genannt mit Anspielung darauf, daß
der Apostel Paulus dem Thimotheus Wein gegen schwachen Magen und
allerhand Krankheitsbeschwerden empfiehlt. Diese potio Paulina
war eine Art Universalmittel, die alle Krankheiten des Kopfes, des
Magens, der Brust, Schlagfluß, Lähmung und Pest heilen und den Mensch
verjüngen und verschönen sollte; nur mußte sie häufig genossen[S. 284] werden,
was sich aber nicht jedermann leisten konnte. Die letztere Vorschrift
hat nach dem Berichte des Chronisten Thietmar von Merseburg (geboren
976 als Sohn des Grafen Siegfried von Walbeck, seit 1009 Bischof von
Merseburg, gestorben 1019) der Markgraf Liuthar zu wörtlich befolgt;
dadurch zog er sich durch den paulinischen Trank einen schweren Rausch
zu und starb dabei plötzlich. Übrigens ist diese potio Paulina
nichts anderes als der aus dem Altertum überkommene, überaus geschätzte
Alantwein, der aus der Wurzel des Alantkrautes (Inula
helenium) mit Zusatz von Honig durch ein umständliches Verfahren
gewonnen wurde. Die Alantpflanze ist eine hohe Staude mit großen,
rauhen Blättern und umfangreichen gelben, mit großen Strahlenblüten
versehenen Köpfchen, die in ganz Südeuropa bis Persien heimisch ist.
Sie wurde schon bei den Griechen und Römern kultiviert. Columella
um die Mitte des 1. christlichen Jahrhunderts gibt uns ausführliche
Anweisungen über deren Anbau. Nach ihm soll sie auf gut gedüngtem,
tief gegrabenem Boden drei Fuß weit auseinandergesät und möglichst
wenig versetzt werden, damit sie besser wachse. Sein Zeitgenosse,
der ältere Plinius (gestorben 79 n. Chr. beim Vesuvausbruch, der
Pompeji und Herkulanum verschüttete), sagt in seiner Naturgeschichte,
der Alant sei an sich dem Magen nachteilig, werde aber durch Zusatz
von Süßem sehr heilsam. „Man trocknet die Alantwurzel, stößt sie
zu Pulver, tut dann eine Süßigkeit hinzu, oder man kocht sie mit
einer Mischung von Essig und Wasser und gibt dazu noch eingekochten
Weinmost, Honig, Rosinen und saftige Datteln. Man genießt sie auch mit
Quitten, Spierlingsfrüchten (einer Art Mehlbeeren), Pflaumen, wozu
man auch wohl Pfeffer und Thymian hinzusetzt. In dieser Weise dient
die Alantwurzel als Magenstärkung, und es ist bekannt, daß Julia, die
Tochter des Kaisers Augustus, sie in dieser Weise täglich aß.“ Diese
Wertschätzung blieb der Alantwurzel das ganze Mittelalter hindurch
erhalten. Noch in dem 1604 gedruckten Hausbuch des deutschen Arztes
Colerus wird dem Alantwein, dessen Zubereitung ausführlich geschildert
wird, ganz dieselben Eigenschaften zugeschrieben, die im Mittelalter
von der potio Paulina gerühmt wurden; er sollte wider alle
Gifte dienen, Brust und Lunge säubern, das Herz stärken und erfreuen,
den verschleimten Magen reinigen, die Verstopfung der Leber und Milz
beseitigen, sowie alle kalte, phlegmatische Feuchtigkeit wegnehmen, den
Weibern die monatliche Reinigung fördern, gegen den Husten dienen, der
von der Erkältung der Brust kommt, den Gries und Stein austreiben, die
Gebärmutter stärken, die natürliche Hitze[S. 285] und Kraft erhalten, fröhlich
und lustig machen und noch manches andere. Helena habe in Ägypten den
Alantwein machen lernen als einen bewährten Trank für alles Gift, Leid
und Trauern. Schon Plinius berichtet, daß die Pflanze helenium
genannt werde, weil sie aus den Tränen der schönen Gattin des
Agamemnon, Helena, hervorgegangen sein soll. Seit alter Zeit wird sie
als sehr heilkräftig auch in Deutschland kultiviert und findet sich
namentlich um Gebirgsdörfer herum verwildert. Ihr dicker Wurzelstock
ist noch heute offizinell, weshalb die Staude auch an einzelnen Orten
auf Feldern gebaut wird.
Seit dem hohen Altertum werden die Blätter und Wurzeln der
1–1,25 m hohen Eibischstaude (Althaea officinalis) gegen
Husten und als schleimige Beimengung zu Latwergen und Pillen verwendet.
Bei den alten Griechen und Römern hieß sie althaea, bei
Scribonius Largus ebiscus und hibiscum, zur Zeit Karls
des Großen mismalva oder ibischa, welch letzterer Name
sich bei der heiligen Hildegard im 12. Jahrhundert allein vorfindet
und zum süddeutschen Ibsche, wie auch zum norddeutschen Eibisch wurde.
Sie wächst auf feuchtem, am liebsten salzigem Boden in Süd-, aber auch
Mitteleuropa bis zur Ostsee, im gemäßigten West- und Nordasien, in
Nordamerika und Australien. Die 1–1,25 m hohe Staude besitzt
filzige Stengel und Blätter, große fleischfarbene Blüten und wird
zur Gewinnung des starken Rhizoms besonders bei Bamberg, Nürnberg
und Schweinfurt im großen kultiviert. Diese wird im Herbst von der
zweijährigen Pflanze gesammelt und frisch geschält, ist weißgelblich,
riecht süßlich, schmeckt fade schleimig und enthält 35 Prozent Schleim,
37 Prozent Stärke, 10 Prozent Zucker und 2 Prozent Asparagin. Sie dient
neben den schleimig schmeckenden Blättern zur Bereitung von Brusttee.
Der mit Zucker gekochte wässerige Auszug der Wurzel wird zu Sirup und
gummöser Paste, ohne Zucker dagegen bei der Appretur und sonst vielfach
verwendet.
Uralt ist auch die Verwendung des Baldrians (Valeriana
officinalis), der bekannten Staude mit kurzem, aufrechtem,
bis 1 cm dickem, oft Ausläufer und zahlreiche dünne,
stielrunde Nebenwurzeln treibendem Rhizom, 30–150 cm hohem,
oben verästeltem Stengel und rispigen Dolden von fleischroten,
wohlriechenden Blüten. Diese in ganz Nordeuropa, Nordasien und
Japan wachsende Pflanze liefert in ihrer Wurzel ein sehr wichtiges
Arzneimittel. Diese hat eine braune Außenrinde, riecht nach dem
Trocknen eigentümlich kampferartig unangenehm[S. 286] — doch lieben
bekanntlich die Katzen den Geruch sehr — und schmeckt gewürzhaft
bitter. Sie enthält 0,5–1 Prozent ätherisches Baldrianöl, das bei der
kisso genannten japanischen Abart mit schmäleren Blättern bis
6, ja 8 Prozent steigt. Bei den alten Griechen und Römern war sie
unter dem Namen phu bekannt, der sich bis zum 15. Jahrhundert
in der Literatur erhielt. Daneben kam seit dem 11. Jahrhundert der
Name valeriana auf, der nach Linné von der deutschen, auch im
Schwedischen gebräuchlichen Bezeichnung Baldrian, d. h. Baldrs (des
Lichtgottes, der als Sohn Odins und Freyas als der reinste der Asen
galt) Kraut abzuleiten ist, vielleicht aber nach dem römischen Arzte
Plinius Valerianus so genannt wurde, oder nur mit dem lateinischen
valere gesund sein zusammenhängt. Dieser Ausdruck ist aber
vorzugsweise nur von den Ärzten gebraucht worden. Beim deutschen
Landvolk war sie im Mittelalter unter dem Namen Denemarcha, noch früher
Tenemarg bekannt, ein Ausdruck, der sich in einem Teil der Schweiz bis
heute erhielt. Das Infus der Wurzel dient gegen Krämpfe und Hysterie,
wie auch als Reizmittel bei schwachen Nerven.
Ein sehr altes deutsches Volksmittel ist die Bergwohlverleih oder
Mutterwurz genannte Arnica montana, eine auf Bergwiesen Süd-
und Mitteleuropas, in Norddeutschland dagegen in der Ebene wachsende
Komposite mit 30–60 cm hohem, drüsig-kurzhaarigem Stengel und
großen, goldgelben, aromatisch riechenden Blüten, die neben dem in
der ganzen Pflanze enthaltenen Arnizin ein kamillenartig riechendes
ätherisches Öl enthalten. Im schwach aromatisch riechenden und scharf
gewürzhaft, etwas bitter schmeckenden Wurzelstock ist neben Arnizin,
Inulin, Gerbstoff und Gummi zu 1 Prozent das in größeren Dosen
Brechen erregende Arnikaöl enthalten. In gepulvertem Zustand erregt
die Wurzel Niesen. Seit alter Zeit diente die gepulverte Wurzel,
in Bier getrunken, gegen Blutungen, Durchfall, Fieber, Lähmung und
Epilepsie, die im Juni und Juli gesammelten Blüten aber, mit Weingeist
ausgezogen, als vielgerühmtes zerteilendes und Wundmittel. Die schon
zu Ende des 16. Jahrhunderts von Joel in Greifswald empfohlene
Heilpflanze wurde erst seit 1712 von den Ärzten häufiger verwendet.
1777 stellte Collin die Arnikablüten als Fiebermittel den Chinarinden
gleich. Da die heilige Hildegard die Pflanze im 12. Jahrhundert
als wolfisgelegena bezeichnet, muß der Name Wohlverleih auf
wolfsgele (Wolfsgelb) zurückgeführt werden, der sich übrigens
schon vom 10. Jahrhundert an nachweisen läßt. Das jüngere, von den
gelehrten Botanikern erfundene Wort Arnika ist vom griechi[S. 287]schen
arnákis Lammpelz — wegen der drüsigen, weichhaarigen
Blütenhülle — abzuleiten. Schon der gelehrte Basler Botaniker
Kaspar Bauhin (1560–1624) bemerkt, daß der gemeine Mann die Pflanze
Wohlverleih, der Arzt aber sie Arnica nenne.
Als Giftpflanze war die Herbstzeitlose (Colchicum
autumnale, nach der Stadt Kolchis in Kleinasien, wo die Pflanze
nach Dioskurides häufig vorkam, so geheißen) schon im Altertum
und Mittelalter bekannt. Sie wurde auch Ephemeron genannt, weil
man glaubte, daß derjenige, der eine Zwiebel derselben esse, noch
an demselben Tage sterben müsse. Erst in der Neuzeit fand sie als
Gichtmittel arzneiliche Verwendung. Zum erstenmal finden wir sie 1618
in der englischen Pharmakopoe erwähnt; in Deutschland aber kam sie erst
1763 durch Störck in Anwendung. Zeitlose heißt sie, weil sie sich an
keine Zeit wie die übrigen Blütenpflanzen hält, im Herbst blüht und
die Samen mit den Blättern erst im darauffolgenden Frühjahr treibt.
Weil sie aber zuerst im Jahre die Frucht und erst im Herbste die
Blüte zeitigt, nannten sie die Alten auch filius ante patrem,
d. h. Sohn vor dem Vater. Statt der zuerst angewandten, frisch
widrig rettigartig riechenden Knollen werden seit der Empfehlung von
Dr. Williams in Ipswich im Jahre 1820 die weit haltbareren,
im frischen Zustande weißlichen, aber beim Trocknen dunkelrotbraun
werdenden Samen zur Gewinnung des Colchicins angewandt.
Neben der Herbstzeitlose haben wir in der Familie der Giftlilien
den auf den Gebirgswiesen Europas und Nordasiens verbreiteten
Germer (Veratrum album), auch fälschlich weiße
Nießwurz genannt, zu erwähnen. Die eigentliche weiße Nießwurz
(Helleborus albus) ist eine der sogenannten Christrose verwandte
Hahnenfußart; beider Wurzelstock enthält das scharf giftige Veratrin
und wurde unter dem gemeinschaftlichen Namen helléberos, was
eine Pflanze, deren Genuß tödlich wirkt, bedeutet, als eines der
berühmtesten Arzneimittel des Altertums von den Griechen und durch
die Vermittlung dieser auch bei den Römern verwendet. Letztere
gebrauchten dafür den einheimischen Namen veratrum, das von
verare wahrsprechen — das Niesen deutete ja nach ihrer Meinung
die Bestätigung der Wahrheit an — abzuleiten ist. Schon der große
Schüler des Aristoteles, Theophrast, unterschied erstere als weiße
und letztere als schwarze helléboros. Erstere sei selten, und
die beste Art derselben wachse auf dem Oeta, letztere dagegen wachse
allenthalben in Griechenland. Nach Dioskurides müssen die Wurzeln zur
Zeit der Weizenernte ausgegraben werden,[S. 288] und zwar hat man dabei nach
Plinius folgende Maßregeln zu beobachten: „Erst schneidet man um sie
herum mit dem Schwert einen Kreis, dann blickt man nach Osten, fleht
zu den Göttern, daß sie gütigst die Erlaubnis erteilen, sie zu nehmen,
und beobachtet dabei den Flug des Adlers. Ein solcher befindet sich in
der Regel in der Nähe; fliegt er näher heran, so ist dies ein Zeichen,
daß derjenige, der die Wurzel geschnitten hat, noch in demselben Jahre
sterben muß.“ Beide Wurzelarten wurden gegen die verschiedensten
Krankheiten gegeben und sollten auch Wahnsinn und Epilepsie heilen.
Heute werden die scharfen in ihnen enthaltenen Stoffe meist nur noch
äußerlich bei Rheumatismus angewandt.
Den Alten nicht bekannt war der Stechapfel (Datura
stramonium), der wahrscheinlich aus Persien stammt und durch
Vermittlung der aus Nordindien stammenden Zigeuner erst im 16.
Jahrhundert nach Deutschland gelangte, wo er jetzt überall an Wegen
und auf Schutthaufen in der Nähe von Dörfern und Städten, wo einst die
Vertreter jenes Wandervolkes rasteten, verwildert angetroffen wird.
Er wurde von den Zigeunern wie die weißblütige Datura metel
in Ostindien und Arabien zur Herstellung von Berauschungsmitteln mit
Hanf, Opium, Gewürzen usw. verwendet. Ebenso bereiteten die alten
Peruaner aus den Samen der strauchartigen Datura sanguinea mit
großen, hängenden, halb roten, halb gelben Blüten einen tonga
genannten berauschenden Trank, den einst die Priester des Sonnentempels
zu Sogamossa, dem peruanischen Orakelsitz, tranken, um sich mit den
Geistern der Verstorbenen in Verbindung zu setzen; deshalb wird sie
heute noch in jenem Lande yerba de huaca, d. h. Gräberpflanze
genannt. Als Arzneimittel gegen Krämpfe, Asthma und Rheumatismus werden
die Blätter und Samen unseres Stechapfels erst seit 1762, da sie Störck
in Wien empfahl, angewendet.
Tafel 125.
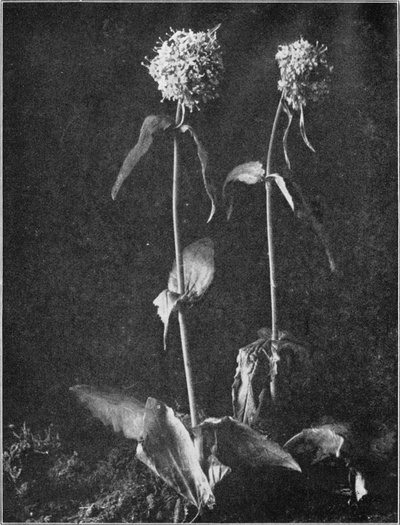
Der Baldrian.
(Nach der Natur phot. von H. Dopfer.)
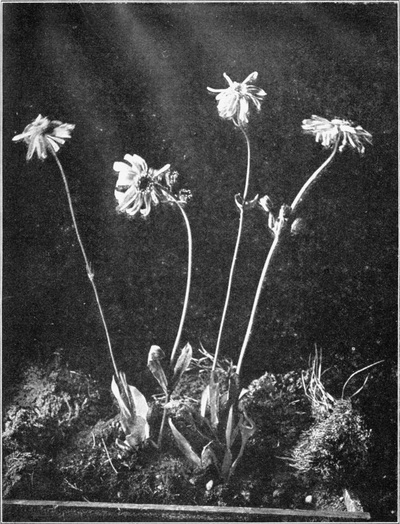
Die Arnica.
(Nach der Natur phot. von H. Dopfer.)
Tafel 126.

Tollkirsche (Atropa Belladonna) in einer Waldlichtung bei
Weidling nächst Wien. (Nach einer im Besitz des Botan. Institutes in
Wien befindlichen Phot. von A. Ginzberger.)
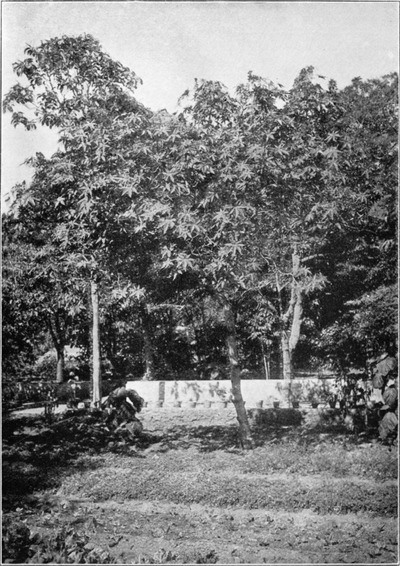
Baumartig kultivierter Rizinus auf den Kanarischen
Inseln. (Nach einer im Besitz des Botan. Institutes zu Wien
befindlichen Phot. von G. Kraskovits.)
Ebenfalls irgendwo aus Westasien zwischen dem Kaspischen Meer und
Afghanistan scheint das Bilsenkraut (Hyoscyamus niger)
nach Europa eingeführt worden zu sein, und zwar schon im Altertum.
Der aus Kilikien gebürtige griechische Arzt Dioskurides beschreibt
vier Arten des Bilsenkrautes, die alle in Griechenland wachsen. Unter
ihnen war die weiße Abart (H. albus) die gebräuchlichste
und wurde schon von den Hippokratikern angewandt. Als dem Apollon
geweihtes heiliges Kraut wurde es alljährlich von Kreta nach Rom
gebracht und stand als Liebestrank neben der Mandragora in hohem
Ansehen. Daß es Wahnsinn veranlassen könne, wußte schon Sokrates.
Von der Be[S. 289]obachtung, daß Schweine nach dem Genusse des Krautes in
Krämpfe verfallen, soll nach Helianus der Name hyoskýamos, d. h.
Schweinebohne, herrühren, während Bilsenkraut das Kraut des keltischen
Sonnengottes Beal bedeutet. Erst seit dem Jahre 1762, da eingehende
Erfahrungen über die Wirkung des Bilsenkrautes bekanntgegeben wurden,
fand es bei den wissenschaftlich gebildeten Ärzten als Beruhigungs- und
Schlafmittel Anwendung.
Eine dritte Nachtschattenart ist die in Laubwäldern der Gebirgsgegenden
Europas wachsende Tollkirsche (Atropa belladonna), die
zuerst von deutschen Botanikern und Ärzten als Giftpflanze erwähnt
wird. Erst im 16. Jahrhundert wurde sie in den Arzneischatz eingeführt
und findet sich 1771 in der Württemberger Pharmakopoe angeführt. Die
Bezeichnung Belladonna kam im 16. Jahrhundert in Italien auf, als
die Frauen sich ihrer als kosmetischem Mittel zur Erweiterung der
Pupillen bedienten, während ihr von Linné gewählter Artname von der
unerbittlichen Parze Atropos, d. h. der Unabwendbaren herrührt. Das
aus ihr gewonnene Alkaloid Atropin, das in der Augenheilkunde und
als krampfstillendes Mittel eine große Rolle spielt, wurde 1831 von
Mein zuerst isoliert. Einen ähnlichen Stoff stellten 1833 Geiger und
Hesse aus dem Stechapfel dar, dessen Identität mit Atropin dann Planta
nachwies. Zur Verarbeitung gelangen die in der Blütezeit im Juni und
Juli gesammelten Blätter 2–4jähriger Pflanzen, die bei 30° C.
rasch getrocknet werden, aber nicht über ein Jahr aufbewahrt werden
dürfen. Die Blätter wilder Pflanzen enthalten etwas mehr Alkaloid als
diejenigen kultivierter Pflanzen.
Auch die Geschichte des neuerdings als ausgezeichnetes Herzmittel zu so
großem Ansehen gelangten rotblühenden Fingerhutes (Digitalis
purpurea) läßt sich als innerlich angewandte Droge nur bis zum
16. Jahrhundert verfolgen; äußerlich wurde diese Pflanze teilweise
schon im 10. Jahrhundert in Form von Umschlägen oder als Blätterdekokt
gegen Geschwüre verwendet. Gegen Wassersucht brauchte sie zuerst der
englische Arzt Withering (1741–1799) in Birmingham, und 1783 wurde sie
in die Edinburger Pharmakopoe aufgenommen. Das Wort Digitalis, das
zuerst der als Professor der Botanik in Tübingen verstorbene Bayer
Leonhard Fuchs (1501–1566) 1542 aufbrachte, ist vom lateinischen
digitabulum Fingerhut abzuleiten. Auch vom Fingerhut werden die
sorgfältig im Schatten getrockneten, am besten zu Beginn der Blütezeit
gesammelten Blätter wildwachsender Pflanzen verwendet.
[S. 290]
Seit dem frühesten Altertum war der Eisenhut (Aconitum
napellus) den Völkern gebirgiger Gegenden, in denen er mit
Vorliebe wächst, als äußerst starkes Gift bekannt. So dienten die
knollig aufgetriebenen Wurzeln, nach denen die Pflanze den Beinamen
napellus, d. h. Rübchen hat, den alten Deutschen als Wolfswurz
und den alten Griechen als lykóktonon, d. h. Wolftöter zum
Vergiften wilder Raubtiere, besonders des die Herden umschleichenden
Wolfes, wie diejenigen der noch giftigeren Art, Aconitum ferox,
des Himalaja von den dortigen Bewohnern zum Vergiften der Pfeile
benutzt wird. Nach dem griechischen Mythos soll schon die zauberkundige
Medeia, Tochter des Königs Aetes von Kolchis, ein Gift daraus bereitet
haben, womit sie nach der Verstoßung durch ihren Gatten Jason ihre
Kinder tötete. Auch soll man nach einigen Angaben aus dem Altertum
Verbrecher damit hingerichtet haben; ebenso diente sie noch im 16.
Jahrhundert den Älplern zur Bereitung von Pfeilgift. Als Arzneimittel
gegen Kopfweh und Wechselfieber wurde sie seit dem 17. Jahrhundert
in den Apotheken geführt, kam aber erst durch die Empfehlung des
Wiener Arztes A. Störck seit 1762 allgemeiner in Gebrauch. In den
Handel gelangen die zu Ende der Blütezeit im Juli und August von
wildwachsenden Pflanzen gesammelten und rasch an der Luft getrockneten
Knollen. Sie enthalten bis 0,8 Prozent des 1833 von Geiger und Hesse
entdeckten Alkaloids Akonitin, das zur Herabsetzung von Temperatur und
Puls im Fieber, wie auch zur Herabminderung von Schmerzen peripherer
Nerven dient.
Äußerst beliebt als Volksheilmittel gegen alle möglichen Beschwerden
ist die Kamille (Matricaria chamomilla) seit dem
Altertum, da sie Hippokrates als euánthemos, d. h. gute Blume,
Dioskurides als anthemís und anthýllis und Galenos als
anthemís und chamaimḗlon, d. h. am Boden wachsender
Apfel, empfehlend erwähnen. Aus letzterer Bezeichnung ging dann
der Name Chamemilla hervor, der uns bei Till Lants zu Ende des 17.
Jahrhunderts zuerst entgegentritt.
Als beliebtes Bittermittel ist seit dem Altertum die Wurzel des auf
Bergwiesen wachsenden Enzians (Gentiana lutea u. a.)
gebräuchlich, von der meistens ein wässeriger Extrakt zur Anwendung
gelangte. Von den beiden Zeitgenossen Dioskurides und Plinius wird der
Name gentiana auf den 167 v. Chr. verstorbenen König Genthius
von Illyrien zurückgeführt, der sie als Mittel gegen die Pest empfohlen
haben soll. Galenos und Cletius Abascantus benutzten sie gegen die
Auszehrung, Origines gegen Blutspeien und Coelius Aurelianus gegen[S. 291]
Spulwürmer. Nach Celsus und Scribonius Largus war die Wurzel auch als
Antidot im Gebrauch und bis zur Einführung der Laminariastifte wurde
sie von den Chirurgen auch als Quellstift benutzt. Seit dem Mittelalter
wird auch ein gegen Kolik dienlicher Schnaps aus ihr gebrannt, der
besonders bei den Älplern viel benutzt wird.
Die im mitteleuropäischen Gebirge und im nördlichen Europa bis
Sibirien heimische Engelwurz (Angelica officinalis)
dient in ihrer Heimat als beliebtes Gemüse und fand von altersher
— so haben wir diesbezügliche Berichte aus dem 10. Jahrhundert —
als appetitbeförderndes und krampfstillendes Mittel Verwendung. In
Deutschland wurde sie im 14. und 15. Jahrhundert als Gewürzpflanze
eingeführt und galt bald als ein Hauptmittel gegen die Pest, diente
auch zur Bereitung des Angelikaschnapses, dessen Darstellung im Jahre
1500 von Brunschwig beschrieben wurde. Im 16. Jahrhundert finden wir
die Pflanze des öfteren erwähnt und bereits an vielen Orten kultiviert;
besonderen Ruf hatten zu jener Zeit die Angelikawurzeln aus den Gärten
der Mönchsklöster von Freiburg im Breisgau. Obschon die Pflanze in den
Mittelmeerländern nicht vorkommt und daher den Alten unbekannt war,
glaubten die alten deutschen Ärzte und Botaniker in ihr das Panas
heracleum, das Smyrnion, ja selbst das Silphium der alten Griechen
vor sich zu haben, was natürlich völlig irrig war. Das destillierte Öl
der graubraunen, scharf gewürzhaft und etwas bitter schmeckenden Wurzel
wurde erst in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts gewonnen und wird
zum erstenmal 1582 in der Arzneitaxe der Stadt Frankfurt und 1589 im
Dispensatorium noricum aufgeführt.
Die wurmabtreibende Wirkung der Farnwurzel (von Aspidium
filix mas) war schon dem Begründer der Botanik Theophrastos und
den späteren griechischen Ärzten bekannt. In der ganzen römischen
Kaiserzeit und im Mittelalter blieb die Wurzel des Wurmfarns
gebräuchlich, findet sich aber nur hier und da in den medizinischen
Schriften erwähnt. Erst zu Ende des 18. Jahrhunderts kam sie wieder
mehr zu Ansehen und um 1775 bildete sie den Hauptbestandteil eines
Geheimmittels, das von der französischen Regierung der Witwe des Arztes
Nuffer in Murten abgekauft wurde, wie auch desjenigen Mittels, das
Friedrich der Große von dem aus Neuchâtel stammenden Apotheker Daniel
Matthieu in Berlin erwarb. Im Jahre 1825 führte der Genfer Apotheker J.
Peschier das Ätherextrakt davon ein, das neuerdings von der Filmaron
genannten wirksamen Substanz abgelöst wurde.
[S. 292]
In Persien, Turkestan und Buchara, speziell der Kirgisensteppe, wächst
die Komposite Artemisia cina, eine dem Wermut und Estragon
sehr nahe verwandte Beifußart, der Wurmbeifuß, dessen in der
zweiten Hälfte des Juli und im August unmittelbar vor dem Aufblühen
gesammelten eigenartig aromatisch riechenden Blüten, den Zitwer-
oder Wurmsamen liefern, dessen wurmabtreibende Wirkung schon
im Altertum bekannt war. Nach Europa scheint die Droge erst durch
die Kreuzzüge eingeführt worden zu sein. Der später übliche Name
semen santonici wird auf eine Mitteilung des griechischen Arztes
Dioskurides zurückgeführt, der von einer beim keltischen Stamme der
Santonen im südlichen Gallien (Aquitanien) wachsenden Artemisiaart,
dem Wermut (Artemisia absinthium), berichtet. Danach wurde das
wirksame Prinzip des Wurmsamens, das heute fast nur noch verwendet
wird, Santonin genannt. In der besten Ware ist es zu 2,5 Prozent
enthalten und wird von an Ort und Stelle errichteten Fabriken in
Taschkent und Tschimkent gewonnen. In russisch Turkestan werden
durch die Kirgisen teils von wildwachsenden, neuerdings aber auch in
zunehmendem Maße von kultivierten Pflanzen etwa 2,5 Millionen kg
jährlich geerntet und zum größten Teil zur Extrahierung des Santonins
verwendet.
Die Pfefferminze (Mentha piperita) ist eine der
ältesten aus China nach Vorderasien und dann nach Europa gelangten
Arzneipflanzen, deren aromatische, während der Blüte gesammelte Blätter
gekocht als krampfstillendes Mittel gebraucht werden. In Ägypten findet
sie sich schon ums Jahr 1550 v. Chr. in dem Papyrus Ebers erwähnt und
wurde von Schweinfurth auch in einem Grabe in Abd-el-Quurnah aus der
Zeit von 1200–600 v. Chr. unter den Totenbeigaben nachgewiesen. Auch
die alten Griechen und Römer gebrauchten die Pflanze, die erstere
míntha, letztere dagegen menta nannten und im Gegensatz
zur wilden Wasserminze die zahme hießen. Im Mittelalter fehlte sie in
keinem Arzneigärtchen. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts wurde sie von
den Ländern Europas zuerst in England zur Gewinnung des ätherischen
Pfefferminzöles im Großen kultiviert, dann in Frankreich, Deutschland,
Rußland und seit 1816 besonders in den Vereinigten Staaten von
Nordamerika. Die weitaus ältesten Pfefferminzkulturen, die schon vor
dem Beginn der christlichen Zeitrechnung begonnen wurden, besitzen
China und Japan, wo der kristallisierbare Mentholkampfer seit ebenso
lange gewonnen und als Heilmittel im Gebrauche gewesen sein soll. Das
bittere und deshalb fast ausschließlich zur Gewinnung von Menthol
dienende japanische Pfefferminzöl soll[S. 293] von Mentha arvensis
stammen. Die Jahresproduktion des Öles beträgt in Amerika
90000 kg, in Japan 70000 kg, in England 9000 kg, in
Frankreich 3000 kg, in Deutschland 800 kg und in Italien
600 kg jährlich. Vielfach wird es mit Rizinusöl, Weingeist und
Petroleum verfälscht. Das englische Öl enthält 58–66 Prozent Menthol.
Ebenfalls als Blähungen vertreibend werden seit dem Altertum die
Blätter der Melisse (Melissa officinalis) bei Kolik und
Diarrhoe verwendet, neuerdings hauptsächlich in Form des Öles. Sie,
die ihren Namen vom griechischen melíssa Biene hat, weil der
Duft des Krautes die Bienen anlockt, ist die kalamínthē und
das melissophýllon der Griechen und das apiastrum (von
apis Biene) der Römer. Im Mittelmeergebiet heimisch, ist sie
ums Jahr 960 von den Arabern in Spanien kultiviert worden und kam früh
in die Arzneigärten Mitteleuropas. Gleicherweise verhält es sich mit
der ihr nahe verwandten Salbei (Salvia officinalis), die
ebenfalls im Mittelmeergebiet heimisch ist und seit alter Zeit als
eine der vorzüglichsten Heilpflanzen für die verschiedensten Zwecke
gebraucht wird. Schon Karl der Große gebot dieses Kraut salvia,
das von salvare heilen benannt ist, in seinen Gärten zu
pflanzen, und die heilige Hildegard im 12. Jahrhundert rühmt die
Heilkraft der von ihr als selba bezeichneten Salbei.
Denselben Zwecken diente seit dem Altertum der Rosmarin
(Rosmarinus officinalis), ein 1–2 m hoher immergrüner
Strauch mit stark aromatischen Blättern, die früher auch als Würze
und beim Brauen des Bieres dienten. Columella rühmt den Rosmarin
auch als gutes Bienenfutter, und Horaz berichtet in einer seiner
Oden, daß mit ihm und Myrten die kleinen Götterbilder der Penaten
bekränzt wurden. Nach Ovid bekränzte man sich auch bei Festen mit
Rosmarin oder Veilchen oder Rosen. Auch Quendel (Thymus
serpyllum) und Thymian (Thymus vulgaris) sind seit
uralter Zeit benutzte Heil- und Gewürzkräuter, die beide gleichförmig
von den alten griechischen und römischen Ärzten zum Vertreiben
von Blähungen verwendet wurden. Der griechische Pflanzenkenner
Theophrast, der Schüler des Aristoteles, berichtet, daß der von ihm
als hérpyllos bezeichnete Quendel oder Feldthymian allenthalben
auf den Bergen und Hügeln wachse, besonders in Thrakien gemein sei
und eine treffliche Bienenspeise liefere. Ihm vor allem verdankte der
Honig des Berges Hymettos südöstlich von Athen seinen Wohlgeschmack,
der ihn deshalb weithin berühmt machte. Auch der dort gesammelte
Quendel wurde vor anderem geschätzt. Wie Theophrast unterscheiden auch
Dioskurides, Plinius und[S. 294] Columella neben dem wilden den von ihnen als
thýmos, d. h. Kraft, Mut bezeichneten Gartenthymian, der dann
durch die Klöster in Mitteleuropa verbreitet wurde. Weil der Thymian
aus Italien nach Deutschland kam, wurde er als welscher oder römischer
Quendel bezeichnet. Im 16. Jahrhundert wurde er hier allgemein angebaut
und in den Apotheken geführt. Das aus ihm gewonnene gelbrote ätherische
Öl findet sich 1589 im Dispensatorium noricum erwähnt, und
1719 fand Kaspar Neumann das Thymol, das innerlich als fäulnis- und
gärungswidriges Mittel gegen Fieber und Eingeweidewürmer, wie auch als
desodorierendes Mittel als Ersatz der ätzenden und giftigen Karbolsäure
verwendet wird.
Seit alter Zeit ist in China das Mutterkorn (Secale
cornutum, d. h. gehörnter Roggen) — französisch ergot —,
das Sklerotium oder Dauermycelium des Pilzes Claviceps purpurea
in den von ihm bald ganz aufgezehrten Fruchtknoten verschiedener
Grasarten, besonders des Roggens, als Arzneimittel gegen Blutungen
speziell der Gebärmutter im Gebrauch. Von griechischen Ärzten kannten
Dioskurides und Galenos die Droge, deren medizinische Verwendung bei
uns erst aus dem Ende des 16. Jahrhunderts datiert. 1588 verwendete
Wendelin Thallius das Mutterkorn, das gemutertes, d. h. verändertes
Korn bedeutet, als blutstillendes Mittel; aber erst zu Ende des 17.
Jahrhunderts führte es R. J. Camerarius in Tübingen in der Geburtshilfe
als die glatten Muskelfasern der Gebärmutter zum Zusammenziehen
bringendes Mittel ein. Die genaue Kenntnis seiner Wirkung verdanken wir
1820 den Amerikanern Prescott und Stearns. 1853 erkannte Tulasne zuerst
den Entwicklungsgang des Pilzes, 1863 vervollständigte Kuhn denselben
und wies nach, daß die in langen Schläuchen erzeugten und deshalb
als Askosporen bezeichneten Sporen auf der Blüte des Roggens wieder
Mutterkorn erzeugen. Das hauptsächlich in Rußland, das den größten
Teil der Handelsware liefert, dann in Galizien, weniger in Spanien,
Portugal und in noch geringerem Maße bei uns ausschließlich vom Roggen,
und zwar kurz vor dessen Fruchtreife gesammelte Mutterkorn enthält
als wichtigste Bestandteile die Alkaloide Cornutin, Ergotinin und
Ergotoxin. Unter Ergotin versteht man Mutterkornextrakte verschiedener
Herstellungsweise, von denen das erste derartige 1842 von J. Bonjean
in Chambéry (Savoyen) dargestellt wurde. Die im Mutterkorn enthaltene
Sphacelinsäure (vom griechischen sphákelos Brand) wirkt
gangränbildend und ist vorzugsweise die Ursache des Mutterkornbrandes,
die seuchenartig als Kriebelkrankheit oder Korn[S. 295]staupe besonders in
Hungerjahren auftrat, wenn feuchte Witterung die Entwicklung des
Mutterkornes begünstigte und damit verunreinigtes Mehl, zu Brot
verbacken, die Hauptnahrung des Volkes bildete. Die erste sichere
Nachricht über diese Krankheit findet sich aus dem Jahre 857 in den
Annalen des Klosters Xanten. Dann trat sie besonders 922, 994, 1008,
1129 und in neuerer Zeit 1596, 1649 im Vogtland und 1736 in Hannover
auf. Kriebelkrankheit hieß sie, weil sich zuerst durch Zusammenziehung
zahlreicher Blutgefäße der Extremitäten ein Kriebeln darin zeigte und
diese erst hernach gefühllos wurden und abstarben.
Als Salepknollen oder Geilwurz wurden von jeher die
als Hoden imponierenden Doppelknollen verschiedener Orchisarten
als Nahrungsmittel und als die Geschlechtstätigkeit anregendes
Mittel verwendet; denn das Altertum und das Mittelalter sahen in
der Hodengestalt eine „Signatur“, d. h. ein Hinweis darauf, daß sie
vorzüglich auf die Geschlechtsorgane einwirken. Bei Dioskurides und
Galen heißt der Salep órchis Hoden, woher die Pflanzengattung
der Orchideen überhaupt ihren Namen erhielt. Das Wort Salep ist aus
dem arabischen chusjata ssalab d. h. Fuchshoden verstümmelt.
In Deutschland wird der aus dem Orient eingeführte Salep zuerst um
1480 als radix satyri in dem Drogenverzeichnis von Nördlingen
erwähnt. Vom 16. Jahrhundert an sind in den Kräuterbüchern Abbildungen
der betreffenden Pflanzen anzutreffen. Die Hauptmasse der bei uns
hauptsächlich zur Bereitung von Schleim verwendeten Handelsware kommt
über Smyrna, teilweise auch über Konstantinopel aus Kleinasien; so
expediert Smyrna jährlich etwa 642500 kg der zur Blütezeit im
Juni oder kurz danach gegrabenen, nach der Reinigung von anhängender
Erde zwecks Abtötung zuerst in siedendem Wasser gebrühten und dann
an der Luft getrockneten Orchisknollen. Ansehnliche Mengen werden
übrigens auch bei uns gesammelt. In der Türkei und in Griechenland
dient Salepschleim mit Honig vermischt als tägliches Morgengetränk
und wird im Winter in besonderen Buden ausgeschenkt oder auch in
Blechbüchsen auf den Straßen als Salepschleim ausgerufen und noch
warm verkauft. Auch mit Fleischbrühe oder Schokolade gekocht gibt
Salep eine treffliche, leichtverdauliche und deshalb besonders für
Kranke angewandte Speise, mit der sich vornehme Haremsfrauen die im
Morgenlande als besondere Schönheit angesehene Körperfülle zu erwerben
suchen.
Seit Urzeiten ist als appetitanregendes Magenmittel der außer[S. 296]
ätherischem Öl von grüner Farbe den glykosidischen Bitterstoff
Absinthiin enthaltende Wermut (Artemisia absinthium)
benutzt worden. Es ist dies eine zur Familie der Beifuße gehörende
Komposite mit weißgrauen seidenhaarigen Blättern und gelben Blüten,
die, wie deren Verwandte, namentlich der baumartige Beifuß
(Artemisia arborea), schon im Papyrus Ebers (um 1600
v. Chr.) erwähnt wird; auch die Hippokratiker wandten diese, wie auch
den verwandten Eberreiß (Artemisia abrotanum) als
magenstärkendes und die Gelbsucht heilendes Mittel an. Wie das
apsínthion der alten Griechen und Römer ist das althochdeutsche
wermuota als ein Bittertrank charakterisiert, das auch als
Wurmmittel besonders beim Vieh im Gebrauch war. In den ältesten
medizinischen und botanischen Schriften Deutschlands wird der Wermut
meist an hervorragender Stelle angeführt. Im 12. Jahrhundert finden
wir ihn im Zürcher Arzneibuch, und im 13. Jahrhundert wurde das Kraut
bis nach Island und Norwegen gebracht. Das ätherische Öl war Porta um
1570 bekannt; es dient als Erregungsmittel für die Nerven und ist der
Hauptbestandteil des besonders in Frankreich sehr beliebten Likörs
Extrait d’absinthe. Neuerdings ist dieser giftige Trank in der
Schweiz verboten worden, so daß die Wermutpflanzer des Val de Travers
im Kanton Neuchâtel sich künftighin eine andere Pflanze zu ihren
Kulturen ausersehen müssen.
Ein in ähnlicher Weise die Verdauung anregendes Bittermittel ist das
Tausendguldenkraut (Erythraea centaurium), eine auf
Bergwiesen wachsende Enzianart, die nach dem in der Kräuterkunde
sehr erfahrenen Lehrer des Herakles, Äskulap, Jason und anderer
Heroen, dem Kentauren Cheiron, schon von den alten Griechen als
kentaúrion bezeichnet wurde. Jener soll durch dieses Kraut
eine Wunde an seinem Fuße geheilt haben, wie Achilleus, ein weiterer
Schüler des Cheiron, damit nach der Ilias die Wunde des Eurypyles
heilte. Es wird wie die Enzianwurzel verwendet, ist aber gegenwärtig
fast außer Gebrauch gekommen, wie auch das einst vielbenutzte
Kardobenediktenkraut (Cnicus benedictus). Diese in den
Mittelmeerländern heimische Staude von distelförmigem Aussehen wurde
schon bei den Alten unter dem Namen hētéra knḗkos arzneilich
verwendet, kam dann durch die Mönche nach Mitteleuropa und wurde
daselbst durch die Klöster verbreitet. Hier erhielt sie auch die
Bezeichnung carduus benedictus, d. h. gesegnete Distel, weil man
darin die von Theophrast als besonders wirksam gepriesene akárna
beziehungsweise die atráktylis des Dioskurides vermutete,
deren Blätter und Samen gegen Skorpionstich[S. 297] dienten. Wahrscheinlich
sind aber diese mit Carthamus lanatus identisch. Das
Kardobenediktenkraut, das noch vielfach in Gärten gezogen und u. a. bei
Cölleda im Großen kultiviert wird, dient immer noch als Volksheilmittel
und ist ein Bestandteil der Kölner Klosterpillen.
Uralte Volksheilmittel sind die Schafgarbe (Achillea
millefolium), die schon von Plinius als Wundpflanze genannt
wird, der Vogelknöterich (Polygonum aviculare), der
als sanguinaria bei den Römern in hohem Ansehen stand und
neuerdings seit 30 Jahren mit der Angabe, ein in Sibirien neuentdecktes
Heilmittel zu sein, unter dem Namen Homeriana, Weidemanns russischer
Knöterichtee usw. als unfehlbares Mittel gegen Schwindsucht mit
großer Reklame vertrieben wird, der Dosten (Origanum
vulgare), den bereits Theophrast und Dioskurides bei Lungen- und
Leberleiden verwandten und der zur Zeit Luthers als der Ysop der
Bibel galt, das auf den semitischen Sonnengott Adonai, d. h. Herr
zurückgeführte Adonisröschen (Adonis vernalis), das
Ovid aus dem Blute des sagenhaften Jünglings Adonis, des Geliebten
der Aphrodite, hervorgehen läßt. Heute noch wird es mit Vorteil
bei Wassersucht verwendet, da es das wertvolle Herzgift Adonidin,
einen Ersatz für Digitalis, enthält. Ferner das Löffelkraut
(Cochlearia officinalis), das seit der Empfehlung des
brabantischen Arztes Joh. Wier im Jahre 1557 gegen Skorbut gebraucht
wird, der Hohlzahn (Galeopsis ochroleuca), der seit
dem Mittelalter einen Ruf als Heilmittel gegen Schwindsucht besitzt,
das harntreibende Bruchkraut (Herniaria glabra) und
das gleicherweise wirkende, schon von den alten griechischen Ärzten
verwendete, neuerdings wieder durch Pfarrer Kneipp populär gewordene
Zinnkraut oder der Schachtelhalm (Equisetum
arvense), das Kraut des Maiglöckchens (Convallaria
majalis), das von altersher vom russischen Volke gegen Wassersucht
und Herzleiden angewandt wurde und, seit Marmé die der Digitalis
ähnliche Wirkung des von Walz 1838 zuerst isolierten Glykosids
Convallamarin im Jahre 1867 erkannte, in Form des wässerigen Extraktes
als wertvolles Herzmittel auch bei uns oft an Stelle von Digitalis
gegeben wird, da es im Gegensatz zu jenem keine kumulative Wirkung
besitzt. Außer diesen wären noch viele andere einheimische Kräuter
zu nennen, auf die wir hier nicht näher eintreten können. Selbst der
als Hinrichtungsmittel beliebte giftige Schierling (Conium
maculatum), das kóneion der alten Griechen, dessen Saft
unter anderen auch Sokrates trinken mußte, als er im Jahre 399
v. Chr. als Verächter der Götter und Verführer der Jugend zum Tode
verurteilt[S. 298] wurde, war bei den Hippokratikern als innerliches und
äußerliches krampfstillendes und betäubendes Mittel sehr beliebt, wie
früher bei uns gegen Zahnschmerz eine Abkochung der scharfen, die
Speichelabsonderung befördernden Bertramwurzel (Anacyclus
officinalis) gebraucht wurde.
Von einst viel gerühmten Wurzeldrogen sind noch zu nennen die Wurzeln
des auf sonnigen Hügeln wachsenden Bibernell (Pimpinella
saxifraga und P. magna), der sich schon in einem
deutschen Manuskript des 8. Jahrhunderts als Bestandteil eines
Universalmittels findet. Bei den alten Griechen und Römern hieß die
Pflanze kaúkalis und diente als Zahnmittel, gegen Fieber und
Steinbeschwerden. Aus dem deutschen bibernella, das uns bei der
heiligen Hildegard im 12. Jahrhundert entgegentritt, ging dann die
volkstümliche Bezeichnung pimpinella hervor, die den botanischen
Namen lieferte. Die altdeutschen Ärzte gaben der P. magna den
Vorzug, welche besonders als Mittel gegen die Pest hohen Ruf erlangte.
Auch die Wurzel des Löwenzahns (Taraxacum officinale) war
schon bei den Alten im Gebrauch als leichtes Abführmittel bei Magen-
und Leberleiden. Durch die arabischen Ärzte wurde ihre Anwendung im
Abendlande populär, wo sie noch heute als Blutreinigungsmittel zu den
sogenannten Frühjahrskuren mit anderen abführenden Pflanzenprodukten
dient.
Ein uraltes nordisches Heilmittel gegen Blasen- und Nierenleiden,
das schon im 13. Jahrhundert erwähnt, seit der ersten Hälfte des 18.
Jahrhunderts von französischen, italienischen und spanischen Ärzten
benutzt wird und seit Anfang des 19. Jahrhunderts in Deutschland
offizinell ist, sind die von April bis Juni von wildwachsenden Pflanzen
gesammelten und getrockneten kleinen, lederigen, glatten Blätter der
immergrünen Bärentraube (Arctostaphylos uva ursi),
die 3,5 Prozent des mit dem Vacciniin der Heidelbeeren identischen
glykosidischen Bitterstoffes Arbutin enthalten. Außerdem enthalten sie
auch reichlich Gerbstoff, weshalb sie auch zum Färben und Gerben des
Saffianleders gebraucht werden. Der die glänzenden Blätter erzeugende
Strauch ist reich verzweigt, erhebt sich aber nur wenig über den Boden.
Er wächst mit Vorliebe auf Heiden und an Felsen und erzeugt rötliche
Blüten und rote Früchte, aus deren etwas mehligem Fruchtfleisch man im
Norden Brot backen soll.
Weiter hat uns der arktische Norden die Renntierflechte oder
das isländische Moos (Cetraria islandica) bescheert, die
nicht bloß die wichtigste Nahrung der Renntiere bildet, sondern auch
von den[S. 299] Menschen als Gemüse verzehrt und zu Brot verbacken wird. Sie
enthält 70 Prozent durch Jod nicht gebläute Flechtenstärke Lichenin,
11 Prozent durch Jod gebläutes Dextrolichenin, die beide nährend und
reizmildernd wirken, und 2–3 Prozent des Bitterstoffes Cetrarin, der
zwar appetitanregend wirkt, aber vor dem Genusse durch den Menschen
durch Mazeration mit schwach alkalischem Wasser völlig entfernt werden
muß. 1542 findet sich bei Valerius Cordus eine Angabe, welche auf
diese Droge schließen läßt, doch wurde sie mit Sicherheit erst seit
1666 durch Bartolin bekannt; 1671 empfahl sie Borrich als Abführmittel
und 1683 Hjärne gegen Lungenleiden. Als Mittel für Lungenkranke fand
sie erst durch die Empfehlung von Linné und Scopoli allgemeinere
medizinische Anwendung; auch als blutbildendes Mittel wird sie mit
Erfolg angewandt, da die Zahl der roten und weißen Blutkörperchen
durch deren Genuß vermehrt wird. Sie wird in größeren Mengen aus
Skandinavien, den Alpen, den Pyrenäen, dem Harz und dem Fichtelgebirge,
nicht aber aus Island eingeführt.
Als uraltes, reizmilderndes und stopfendes Mittel war wohl zuerst
in Westasien der als Opium bezeichnete, durch Einritzen
der unreifen Fruchtkapseln des Schlafmohns (Papaver
somniferum) gewonnene und durch Eintrocknen an der Luft durch
Sauerstoffaufnahme eingedickte Milchsaft in Gebrauch. Von den
Anwohnern der kleinasiatischen Küste lernten dann die alten Griechen
den von ihnen mḗkon genannten Schlafmohn und seine betäubenden
Eigenschaften kennen. Vielleicht war er schon in homerischer Zeit
bekannt. Nicht nur wird in der Ilias die Pflanze mḗkon erwähnt,
sondern in der Odyssee auch ein nepénthes genannter, die
Erinnerung auslöschender Zaubertrank genannt, der möglicherweise aus
Mohnsaft, vielleicht in Verbindung mit Hanfextrakt, bereitet wurde.
Diese betäubende Wirkung des Mohnsaftes muß sehr früh auch ärztlich
benutzt worden sein, obschon keine diesbezüglichen Mitteilungen auf
uns gekommen sind. Den anfänglich mēkṓnion und erst viel
später nach der griechischen Bezeichnung opós für Milchsaft
als ópion bezeichnete eingedickte Mohnsaft, das Opium, hat der
größte griechische Arzt Hippokrates (460–364 v. Chr.) nicht gekannt
oder doch nicht benutzt, obschon er den Milchsaft der Blätter und
Fruchtkapseln, wie die Fruchtkapseln selbst leer oder mit den Samen
als Heilmittel anwandte. Wie die Hippokratiker, wendet auch der
pflanzenkundige Schüler des Aristoteles, Theophrast (390–286 v. Chr.),
die Bezeichnung mēkṓnion auf den betäubenden Milchsaft einer
Wolfsmilchart (Euphorbia peplus) an. Erst die griechischen
Ärzte[S. 300] Diokles von Karystos und Herakleides von Tarent sollen im 3.
vorchristlichen Jahrhundert den eingedickten Mohnsaft als Medikament
benutzt haben, und Nikander von Kolophon in Ionien lieferte um 200
v. Chr. eine Beschreibung der gefährlichen Wirkung desselben. Der um
die Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. in Rom lebende, aus Kilikien
stammende griechische Arzt Dioskurides kennt diese Droge genau und
berichtet bereits auch von deren Verfälschung. In dem von ihm auf uns
gekommenen Arzneibuch heißt es: „Die Abkochung der Blätter und Köpfe
des Mohns (mḗkon) macht schläfrig, was auch bei der Klatschrose
(rhoiá) der Fall ist. Letztere hat ihren Namen rhoiá
davon, daß Milchsaft (opós) aus ihr fließt (rhei). Der
Milchsaft der Mohnarten, in der Größe einer Erve (órobos)
— etwa einem kleinen Linsenkorn entsprechend — eingenommen,
beschwichtigt Schmerzen, bringt Schlaf und fördert die Verdauung. In
größerer Gabe ist er gefährlich, da er Schlafsucht und Tod bewirken
kann. Der beste, durch Einschnitte mit dem Messer in die unreifen
Mohnköpfe nach dem Trocknen des Taues gewonnene Mohnsaft (opós)
ist dick, riecht stark, macht schon durch den Geruch schläfrig,
schmeckt bitter, löst sich leicht in Wasser auf, ist glatt, weiß, weder
rauh noch krümlig, schmilzt an der Sonne, brennt hell, wenn er von
der Flamme berührt wird und behält seinen Geruch, auch wenn man ihn
gelöscht hat. Man verfälscht ihn mit glaucium — dem Saft des
großblütigen Schöllkrauts (Chelidonium glaucium), das in Italien
und Griechenland wild wächst —, mit Gummi — und zwar arabischem
Gummi — und dem Saft des wilden Salats (thrídax). Ist er mit
glaucium verfälscht, so gibt er, mit Wasser vermengt, eine gelbe
Farbe; enthält er Saft vom wilden Salat, so ist der Geruch schwach und
rauher; Gummi dagegen macht ihn schwach und durchscheinend. Manche
treiben den Unsinn so weit, daß sie ihn sogar mit Fett verfälschen.“
Auch Plinius berichtet ausführlich über Gewinnung und Eigenschaften
des von ihm opion genannten Opiums, das damals schon nach ihm
hauptsächlich in Kleinasien gewonnen wurde. Er sagt ferner, daß nach
Andreas, dem Leibarzt des Ptolemaeus Philopator (221 bis 205 v. Chr.),
das Opium in Alexandrien verfälscht wurde. Im 6. Jahrhundert wird
Opium thebaicum (aus Oberägypten) von Alexander Trallianus und
im 7. Jahrhundert von Paulus Aetius genannt. Das ägyptische Opium rühmt
der um 200 n. Chr. verstorbene griechische Arzt Galenos als das beste
und kräftigste, auch spricht er von libyschem und selbst spanischem
Opium. Der arabische Arzt Avicenna (eigentlich[S. 301] Ibn Sina, 980–1037)
spricht ebenfalls von ägyptischem Opium. Durch Araber soll bereits im
7. Jahrhundert Opium nach Persien, im 8. nach Indien und im Laufe des
10. nach China gekommen sein, wo es 973 in einem Arzneibuch erwähnt
wird. Die ersten Nachrichten über in Indien selbst gewonnenes Opium
verdanken wir Odoardo Barbosa, der solches 1516 auf dem Markte von
Kalikut nebst kleinasiatischem antraf. Derselbe Portugiese, der nach
der Entdeckung des Seeweges ums Kap der Guten Hoffnung nach Ostindien
fuhr, gibt uns auch die frühesten Nachrichten über Versendung indischen
Opiums nach China, wo allerdings der Schlafmohn schon seit dem 11.
Jahrhundert zur Gewinnung von Opium angepflanzt wurde. Doch wurde
er auch hier zunächst nur als Medizin benutzt und gelangte erst im
17. Jahrhundert in großem Umfange als Genußmittel zum Rauchen zur
Anwendung. Dieser Gebrauch soll aus Formosa nach China gelangt sein,
und Formosa soll sein Opium aus Java bezogen haben. In einem zwischen
1552 und 1578 verfaßten chinesischen Kräuterbuch wird die Gewinnung des
Opiums und seine Verwendung, aber nur in der Medizin, beschrieben.
Die europäischen Ärzte des Mittelalters hielten das Opium für sehr
gefährlich und wendeten es deshalb nur selten an, so daß sein Gebrauch
gegenüber dem Altertum stark abnahm. Meist wurden nur die Mohnfrüchte
verordnet, deren schlafbringende Wirkung man sehr wohl kannte. In
Deutschland soll das aus dem Orient eingeführte Opium erst durch den
weitgereisten Schwyzer Arzt Paracelsus (1493 bis 1541) unter der
Bezeichnung laudanum eingeführt worden sein. In dem in regem
Handelsverkehr mit dem Morgenlande stehenden Italien war es schon viel
früher im Gebrauch; so erwähnt es 1290 Simon Jamensis, der Leibarzt
des Papstes Nikolaus IV. Als Bestandteil des bereits erwähnten
Theriaks wurde es in der Folge viel gebraucht. Die wissenschaftliche
Grundlage für die Verwendung des Opiums in der Medizin legte der
englische Arzt Sydenham (1624 bis 1689). Nachdem schon 1688 Ludwig
und nach diesem Wedelius, Hofmann und andere die narkotischen
Wirkungen des Opiums zum Gegenstand eingehender Untersuchungen
gemacht hatten, gelang es erst 1803 Derosne aus dem Opium eine
kristallisierbare Substanz, das Narkotin, herzustellen. 1804 stellte
dann der Paderborner Apotheker Sertürner die Mekonsäure und 1806 das
von ihm Morphin genannte „schlafmachende Prinzip“ dar. 1832 entdeckte
Robiquet das Codein und fast zu derselben Zeit Dublanc das Mekonin,
eine indifferente[S. 302] Verbindung. Heute kennen wir etwa 20 verschiedene
Alkaloide als Bestandteile des hauptsächlich zur Anwendung gelangenden
kleinasiatischen Opiums, unter denen das Morphin, das darin zu 10 bis
12 Prozent enthalten ist, die erste Rolle spielt. Nach ihm kommen an
Wichtigkeit das darin zu 0,2–0,8 Prozent enthaltene Codein, das zu
4–10 Prozent enthaltene Narkotin, das zu 0,2–0,3 Prozent enthaltene
Thebain, das zu 0,1–0,4 Prozent enthaltene Narcein usw. und schließlich
4 Prozent Mekonsäure.
Schon im Altertum benutzte man den Mohnsaft als Gegengift, und das
Opium war eines der wichtigsten Bestandteile des Theriaks,
eines Latwerges, das Neros Leibarzt Andromachos gegen den Biß
giftiger Schlangen erfunden haben soll und das nach dem Arzte
Claudios Galenos (133–200 n. Chr.) aus 70 Ingredienzen bestand. Dem
Namen thēriakón antídoton (von tḗr Tier und akéomai
abwehren), d. h. Tierbiß heilendes Gegenmittel, entsprechend war
der Theriak eigentlich ein aus giftigen Tieren bereitetes Gegengift
gegen Tiergift, dem Grundsatze der alten Heilkunde gemäß, daß das,
was schädigt, auch heilen muß. Dazu kamen später auch zahlreiche
Pflanzengifte und die heterogensten Stoffe hinzu und damit konnte es
ebensogut gegen Pflanzen- und mineralische Gifte genommen werden. Seit
dem 12. Jahrhundert finden wir das Mittel unter der volkstümlichen
Bezeichnung Trîak oder Trîakel auch in Deutschland
verbreitet. Der Verfasser der ersten in deutscher Sprache geschriebenen
Naturgeschichte, Konrad von Megenberg (um 1309 auf dem Schlosse
Megenberg bei Schweinfurt in Franken als der Sohn des Schloßvogtes
geboren und 1374 als Kanonikus am Dom zu Regensburg gestorben), läßt
ihn aus dem Fleisch der Schlange tirus und aus anderen ähnlichen
Dingen bereitet werden und gegen jegliches Gift wirksam sein, mit
Ausnahme desjenigen, das von jener Schlange selbst kommt. Schon vor
dem 15. Jahrhundert gab es verschiedene Arten von Theriak, was daraus
hervorgeht, daß damals die „grosz tiriaca“ als die allein echte,
nach altbewährtem Rezept ausgeführte, den geringwertigen Surrogaten
entgegengestellt wurde, die von herumziehenden Quacksalbern als
Universalmedizin ebenfalls unter der reklamehaften Bezeichnung Theriak
verkauft wurden. Letztere enthielten eine mehr oder weniger große
Zahl heilkräftiger Stoffe in Honig gemischt. Der Hauptfabrikationsort
für den echten Theriak war Venedig, wo er unter großem Pomp beim
Schalle von Trompeten und Pauken öffentlich hergestellt wurde. Daneben
bereitete man auch welchen in den heimischen Apotheken unter[S. 303] Aufsicht
von Ärzten aus den erlesensten dazu gehörigen Sachen. Seine Anwendung
geschah nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich; so galt er in die
Nase gestrichen als das beste Schutzmittel gegen Pestilenz.
Wie das Opium zum Stopfen bei Diarrhoe und seine Salze zur Herabsetzung
von Hustenreiz und Schmerzen aller Art dienen, so steht seit dem
Mittelalter die Faulbaumrinde (von Rhamnus frangula) als
Abführmittel in Gebrauch. Diese hat vor dem Gebrauch mindestens ein
Jahr zu lagern, da frische Rinde brechenerregend wirkt. Sie enthält als
wirksames Prinzip das Glykosid Frangulin, das in frischen Rinden fehlt,
dagegen reichlich in älteren vorhanden ist. Das Frangulin spaltet sich
in Rhamnodulcit und Frangulinsäure. Erst seit dem Jahre 1848 wird die
Faulbaumrinde in Deutschland medizinisch verwendet.
Demselben Zwecke dient auch die als Cascara sagrada
bezeichnete nordamerikanische Faulbaumrinde (von Rhamnus
purshiana), die in ihrer Heimat schon längere Zeit als mildes
Abführmittel im Gebrauche steht und 1878 von Dr. J. H. Bundy
in Calusa (Kalifornien) gegen gewohnheitsmäßige Verstopfung empfohlen
wurde. Nach Europa kam zuerst das Fluidextrakt und seit 1883 auch
die Rinde, die infolge der unsinnigen Ausbeutung des im westlichen
Nordamerika (Kalifornien, Oregon, Washington und Britisch-Kolumbien)
heimischen Gewächses in letzter Zeit sehr selten und deshalb auch sehr
teuer geworden ist.
Als mildes Abführmittel dient sonst bei uns das sehr viel billigere
Rizinusöl, das von den Samen einer im tropischen Afrika
heimischen und von da über die ganze Welt verbreiteten Wolfsmilchart
(Ricinus communis) gewonnen wird. Dieses einjährige, sehr rasch
zu gewaltiger Höhe aufschießende und deshalb bei uns, wo es in mehreren
Varietäten, meist mit Canna indica zusammen, als Zierpflanze auf
Rasen kultiviert wird, auch als „Wunderbaum“ bezeichnete Kraut mit sehr
großen, gelappten Blättern und ansehnlichen, getrennt geschlechtlichen
Blüten ist überaus anpassungsfähig und läßt sogar noch in Christiania
seine Samen reifen. In Indien, wo es schon im frühen Altertum als
Ölpflanze eingeführt wurde, dienen seine Blätter der bengalischen
Seidenraupe (vom Eria-Seidenspinner, Saturnia cynthi) als
Futter, und in Italien wird es als palma Christi geschätzt.
Die von Luther mit Kürbis übersetzte, aus einem kleinen Samenkorn zur
schattenspendenden Staude herangewachsene Pflanze kikajon vor
des Propheten Jonas (im 8. vorchristlichen Jahrhundert) Hütte, in deren
Schatten er bei Ninive ruhte und die dann ein Wurm stach, so daß sie
verdorrte,[S. 304] kann nichts anderes als eine Rizinuspflanze gewesen sein,
die in der Tat gegen Verletzungen sehr empfindlich ist.
Ihrer eiförmigen, marmorierten, ölreichen Samen wegen wird die
Rizinuspflanze schon seit sehr langer Zeit in Ägypten und Vorderasien
angepflanzt. So fand man solche als Totenbeigaben schon in ägyptischen
Gräbern aus der Zeit um 4000 v. Chr. Hier hieß die Pflanze dekam
und deren Samen kiki, und das aus den letzteren gepreßte Öl
wurde nach den Berichten von Herodot (484–427 v. Chr.) und Strabon
(63 vor bis 20 n. Chr.) ausschließlich als Brennöl und zum Salben
verwendet. Auch in Griechenland wurde die Pflanze, wie übrigens
noch jetzt, unter dem Namen kiki angepflanzt. Weil die
Samen einer gehörig mit Blut vollgesogenen Hundszecke (Acarus
ricinus) täuschend ähnlich sehen, wurde die Pflanze nach diesen
im Altgriechischen auch króton genannt, wie uns Dioskurides um
die Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. berichtet. Dieser Autor schreibt
in seinem Arzneibuche: „Das Rizinusöl (kíkinon élaion) wird
folgendermaßen gewonnen: Man nimmt die reifen Samen (króton)
und trocknet sie in der Sonne, bis ihre Schale abfällt. Dann wirft man
sie, von der Schale befreit, in einen Mörser, stößt sie sorgfältig,
tut sie in einen mit Wasser gefüllten, verzinnten Kessel und kocht
sie; so geben sie ihr Öl von sich, es schwimmt auf dem Wasser und wird
abgeschöpft. Die Ägypter, die dessen mehr gebrauchen als wir, verfahren
anders. Sie reinigen die Samen gut, mahlen sie dann in einer Mühle
und pressen das Öl aus. Dieses Öl taugt nicht zur Speise, wohl aber
für Lampen und Pflaster.“ Dagegen wandte dieser griechische Arzt die
zerstoßenen Rizinussamen als Abführmittel an.
Durch die Kreuzzüge gelangte die Rizinusstaude als Zierpflanze in die
Gärten Mitteleuropas, wo sie noch im 16. Jahrhundert gelegentlich
anzutreffen war, doch geriet sie in der Folge bei uns in Vergessenheit.
Erst um die Mitte des 18. Jahrhunderts wurde das Rizinusöl von
Westindien aus, wo es reichlich erzeugt wurde, in Europa als
Abführmittel eingeführt und fand hier bald in Ärztekreisen Anerkennung.
Durch eine 1764 veröffentlichte Dissertation von Dr. Cauvane
wurde es in weiteren Kreisen bekannt. 1788 fand es Aufnahme in der
Londoner Pharmakopoe. Als offizinelle Handelsware ist in den Apotheken
heute nur das aus den geschälten reifen Samen kalt gepreßte und mit
Wasser ausgekochte Öl zulässig, das eine Ausbeute von 40–45 Prozent
liefert. Es enthält im wesentlichen das Triricinolein, das Triglycerid
der laxierend wirkenden Ricinolsäure, daneben[S. 305] Tripalmitin und geringe
Mengen von Tristearin. In den Samen, den Preßrückständen und im
unreinen Öle findet sich das außerordentlich giftige Ricin, welches
durch Kochen des frisch gepreßten Öles mit Wasser ausgeschieden wird.
Prof. Ehrlich in Frankfurt a. M. berechnete, daß 1 g Ricin
genüge, um 1½ Million Meerschweinchen zu töten. Diese enorme
Giftigkeit übersteigt bei weitem diejenige des Zyankaliums und
Strychnins. Durch Einspritzung von immer größeren, nicht tödlichen
Dosen von Ricin gelang es Ehrlich, in den betreffenden Tieren durch
Bildung eines Gegengiftes eine so weitgehende Giftfestigkeit zu
erzeugen, daß die tausend-, ja zehntausendfache Dosis unbeschadet
ertragen wurde. Dieses im Blutserum der mit Ricin vorbehandelten Tiere
kreisende Antitoxin vermag die roten Blutkörperchen normalen Blutes
sehr rasch in eine gallertartig-klumpige Masse zu verwandeln, ganz
analog dem bakteriellen Antitoxin, das die Bakterien seiner speziellen
Art sofort zusammenballt, zur Agglutination bringt, während normales
Blutserum diese Eigenschaft nicht besitzt. Das unreine Rizinusöl
dient endlich als Brennöl und zur Seifenfabrikation. Vielfach kommt
Verfälschung desselben mit gebleichtem Sesamöl vor.
Eine seit uralter Zeit in China als Abführmittel gebrauchte
Pflanzenwurzel ist der echte Rhabarber (Rheum
officinale), der als „große gelbe Wurzel“ schon in einem angeblich
von Kaiser Shen-nung um 2800 v. Chr. verfaßten Kräuterbuche erwähnt
wird. Um die Wende der christlichen Zeitrechnung scheint diese Droge
in den Mittelmeerländern bekannt geworden zu sein. Als erster erwähnt
der griechische Arzt Dioskurides um die Mitte des 1. Jahrhunderts
n. Chr. die Wurzel rha, nach dem Flusse Rha, der Wolga, aus
welcher Gegend sie bezogen wurde, so genannt. Sein Zeitgenosse Plinius
spricht von einer rhacoma, die wohl auch als Rhabarber zu
deuten ist. Bei den späteren Autoren werden zweierlei Rhawurzeln
nach ihrer Herkunft unterschieden, nämlich ein rha ponticum,
d. h. eine pontische Wurzel, nach ihrem Bezug aus der Gegend des
Schwarzen Meeres so geheißen, und ein rha barbarum, das von
der Indusgegend über das Rote Meer und den alten Hafenort Barbarike
zunächst nach Alexandrien eingeführt wurde. Aus dieser letzteren
Bezeichnung, die allgemein im Sinne von „fremde, ausländische Wurzel“
gebräuchlich wurde, entstand dann unser Wort Rhabarber, während die
lateinische Bezeichnung Rheum aus dem rhéon des Galenos
hervorging. Im 6. Jahrhundert verordnete der Arzt Alexander Trallianus
das eine Mal Rheum, das andere Mal Rheum barbarum und
ponticum. Darunter wurden, wie[S. 306] schon Scribonius Largus und
Celsus vom Rha barbarum und vom Rha ponticum berichten,
verschiedene Rhabarberpräparate verstanden, obschon diese Ausdrücke
ursprünglich ein und dasselbe bezeichneten. Im 11. Jahrhundert wußten
die arabischen Ärzte schon, daß der Rhabarber aus China komme. Der
erste Europäer, der in die Rhabarbergegend gelangte, war der Venezianer
Marco Polo, der nach seiner Rückkehr aus China im Jahre 1295 in seiner
Reisebeschreibung über Rhabarberkulturen in Tangut berichtet. Von
dort und aus dem Gebirge um den See Kuku-nor wurden die getrockneten
Rhabarberwurzeln an die Chinesen verkauft, welche sie nach Si-ning
am Hwang-ho, d. h. dem Gelben Flusse, brachten, das von jeher der
Hauptstapelplatz dieser Droge gewesen zu sein scheint.
Im Mittelalter war der Rhabarber sehr kostbar und selten und
wurde deshalb nur wenig gebraucht. Erst durch die Entdeckung des
Seeweges nach Ostindien und dadurch, daß die Russen mit den Chinesen
Handelsverbindungen anknüpften, wurde er wohlfeiler und gelangte
aus diesem Grunde auch mehr zur Anwendung. Bis zum Ende des 17.
Jahrhunderts wurde Rhabarber über Kanton und Macao verschifft,
teilweise aber auch auf dem Landwege in die Länder im Westen
gebracht. Dann suchten die Russen den Handel damit in ihre Hände zu
bekommen. Im Jahre 1704 gelang es ihnen, denselben durch Verträge mit
der chinesischen Regierung zu monopolisieren. Über die Grenzstadt
Kiachta, wo die getrockneten Wurzeln Stück für Stück geprüft und die
verdorbenen und unansehnlichen Stücke verbrannt wurden, gelangten sie
in einer Schlittenkarawane einmal jährlich über Irkutsk nach Moskau.
Hier wurden sie nochmals revidiert und die für brauchbar erkannten
Stücke dem Handel übergeben. Dieser vorzügliche „moskowitische“ oder
„Kronrhabarber“ war bis 1842 der einzige des Handels. In jenem Jahre
öffneten nämlich die Chinesen außer Kanton und Macao weitere Häfen dem
Fremdenverkehr, wodurch den chinesischen Rhabarberhändlern Gelegenheit
gegeben wurde, sich der strengen Kontrolle der Russen in Kiachta zu
entziehen und auch schlechtere Sorten zu verkaufen. Hierdurch und durch
den Taipingaufstand von 1852–1858, der die Karawanen an der sibirischen
Grenze sehr gefährdete, verringerte sich die Zufuhr über Kiachta immer
mehr und hörte 1860 ganz auf; 1863 wurde der Rhabarberhof daselbst ganz
aufgehoben. Seither gibt es keinen moskowitischen oder Kronrhabarber
mehr im Handel. Was so bezeichnet wird, ist nach Art dasselbe, d. h.
eine kantig beschnittene und durchbohrte, dunkelgefärbte, rotbrüchige[S. 307]
Sorte, während der gewöhnliche chinesische Rhabarber weniger stark
beschnitten und in der Qualität viel gemischter ist.
Die Stammpflanze des Rhabarbers blieb dem Abendlande unbekannt, bis im
Jahre 1758 durch die Vermittlung eines tartarischen Rhabarberhändlers
Samen einer Rheumart als die der echten Rhabarberpflanze von Kiachta
nach St. Petersburg kamen. Carl von Linné beschrieb 1762 die hieraus
gezogenen Pflanzen als Rheum palmatum. 1867 sandte der
französische Konsul in Han-kau am Mittellauf des Blauen Flusses
(Yang-tse-kiang), Dr. Dabry de Thiersant, lebende Wurzeln, die
er durch Vermittlung eines Missionars in Sze-tschwan aus dem östlichen
Tibet erhalten hatte, mit der Angabe nach Paris, daß sie von der
echten, der Rhabarbergewinnung dienenden Pflanze stammten. Abkömmlinge
aus diesen Wurzeln wurden dann von Baillon als Rheum officinale,
eine neue Art, beschrieben, welche aber der vorigen nahe steht. Sie ist
mit dem vom russischen Reisenden Przewalski auf seinen Reisen in der
westlichen Mongolei und in Kan-su 1871–1873 in der Gegend von Kuku-nor
und in der Berglandschaft Tangut, dem Zentrum der Verbreitung der
besten Rhabarberpflanzen, gefundenen Rheum palmatum tanguticum
der Lieferant des echten Rhabarbers. Das Hauptverbreitungsgebiet der
1,5–2,5 m hohen, breite, handförmige, dunkelgrüne Blätter
und weiße Blüten aufweisenden offizinellen Rhabarberpflanze ist das
Hochplateau von Osttibet und das westchinesische Gebirgsland zwischen
dem Blauen und Gelben Fluß, das zu den Provinzen Sze-tschwan und Kan-su
gehört. Die Hauptmasse des Rhabarbers kommt von Rheum officinale
aus Osttibet und der chinesischen Provinz Sze-tschwan, nur ein geringer
Teil nördlich davon aus der Provinz Kan-su von Rh. palmatum
tanguticum; und zwar wird die beste Sorte von wildwachsenden
Pflanzen gewonnen. Der wahrscheinlich nur in geringen Mengen angebaute
Rhabarber gilt als minderwertig. Noch sehr viel geringer an wirksamer
Substanz ist natürlich der in Europa gepflanzte echte Rhabarber, was
leicht begreiflich ist, wenn man bedenkt, daß er in seiner Heimat in
3–4000 m Höhe gedeiht und bis 6300 m Höhe steigt. Zur
Gewinnung der offizinellen Droge benutzt man mindestens 8–10 Jahre alte
Pflanzen, deren Wurzelstöcke kurz vor der Blütezeit und wieder vor der
Samenreife gegraben, vom oberen Teil und der Rinde befreit, in kleinere
Stücke gespalten, durchbohrt und an Schnüre aufgezogen ziemlich
oberflächlich, teils an der Luft, teils am Ofen getrocknet werden.
Dann gelangen sie an die großen Häuser, die sie vollkommen putzen,
sortieren[S. 308] und noch besser trocknen. Die Ware kommt dann in großen,
außen mit gelbem oder rotem Papier überzogenen und mit chinesischen
Schriftzeichen signierten, innen mit Zinkblech ausgeschlagenen Kisten
aus der Provinz Schen-si dem Gelben Fluß entlang nach Tien-tsin und
Peking, aus der Provinz Sze-tschwan mit dem Hauptstapelplatz Kwan-juön
dem Blauen Fluß entlang nach Schang-hai und aus Tibet und Yün-nan
zum Teil auch dem südlicheren Perlfluß entlang nach Kanton in den
Handel. Die beste, orangegelbe Sorte stammt aus Schen-si und ist auch
weitaus die teuerste; die andern, billigeren Sorten sind ockergelb und
werden hauptsächlich von der großen Handelsstadt Han-kau am Mittellauf
des Blauen Flusses aus ausgeführt, von wo der meiste Rhabarber über
Schang-hai in den Welthandel gelangt.
Der Rhabarber enthält als primäre Bildungen der Pflanze zwei Gruppen
von Glykosiden, nämlich die abführend wirkenden Anthraglykoside und
deren Spaltungsprodukte, unter denen die Chrysophansäure, das Emodin
und das Rhein die wichtigsten sind, und die nicht abführend, wohl aber
zusammenziehend wirkenden Tannoglykoside und deren Spaltungsprodukte.
Daher kommt es, daß kleine Dosen Rhabarber stopfend durch letztere und
erst größere abführend durch erstere wirken, indem die Glykoside im
Darm langsam gespalten werden. Dabei wird gleichzeitig die Absonderung
der Galle angeregt.

Bild 71. Der Blütenstand der offizinellen
Rhabarberpflanze (Rheum officinale).
Eine dem chinesischen Rhabarber ähnliche Wurzel liefert der in
Südrußland und Sibirien heimische pontische Rhabarber (Rheum[S. 309]
rhaponticum), den man, als er durch den Botanikprofessor Prosper
Alpino in Padua bekannt wurde, lange Zeit für den echten Rhabarber
hielt. Wahrscheinlich wird der größte Teil des rha ponticum
der Alten aus ihm bestanden haben. Wenn auch schwächer als der
chinesische Rhabarber wirkend, wird er nicht nur in seiner Heimat und
im Morgenlande, besonders Persien, sondern auch seit der Mitte des 18.
Jahrhunderts in England, Frankreich, Deutschland, Österreich und Ungarn
im großen angepflanzt und in den Handel gebracht. Er wird namentlich in
der Tierarzneikunde seiner größeren Billigkeit wegen viel verwendet.
In England begann um 1800 der Apotheker Hayward in Hanbury bei Oxford
seine Kultur in größerem Stile, die dann seit 1845 einen bedeutenden
Aufschwung nahm. Die Hauptkulturen Frankreichs sind in den Departements
Morbihan, Doubs und Isère. Ein Teil der wirksamen Bestandteile der
echten Rhabarberwurzel fehlt in den von dieser Art gewonnenen Wurzeln,
die auch dünner sind.
Nach der Entdeckung Amerikas hielten bekanntlich die Spanier dieses
Land zuerst für den östlichen Teil Asiens und bemühten sich, außer
dem Gold, das sie in dem vom Venezianer Marco Polo als sehr goldreich
beschriebenen Lande Zipangu (Japan) zu finden hofften, auch die
wichtigsten asiatischen Gewürze und Arzneidrogen zu bekommen, um sich
an dem damit zu treibenden Handel zu bereichern. Unter den Drogen, die
Kolumbus in seinen ersten Briefen in die Heimat erwähnt, befindet sich,
so speziell in den Briefen vom 4. und 14. März 1493, auch Rhabarber.
Dieser amerikanische Rhabarber hat sich als die knollenförmig
angeschwollenen, abführend wirkenden Wurzeln verschiedener
Windengewächse erwiesen, unter denen die schon lange vor der Ankunft
der Spanier in Mexiko als Abführmittel verwendete Jalapenwurzel
seit Anfang des 17. Jahrhunderts auch in den Arzneischatz Europas
eingeführt wurde. Diese seit 1536 deutlicher erkannte Wurzel, die der
Spanier Monardes zuerst in der Provinz Mechoacan in Mexiko kennen
lernte und als Rhabarber von Mechoacan in jenem Jahre beschrieb,
figurierte in den europäischen Drogenverzeichnissen des 17. und
18. Jahrhunderts als Mechoacannawurzel, bis sie zu Beginn des 19.
Jahrhunderts nach dem mexikanischen Bezugsorte Jalapa von den
Marseillern den Namen Jalapenwurzel erhielt. Die Mutterpflanze aber
lernte man erst 1829 durch Cox in Philadelphia kennen. Sie kam dann
1830 zuerst nach Europa durch Schiede, der ihr den Namen Convolvulus
jalapa gab. Heute wird sie aber meist nach Hayne als Ipomoea
purga bezeichnet. Die Jalapen[S. 310]winde ist eine am östlichen
Abhang der mexikanischen Cordillere in Höhen von 1200–2400 m
wildwachsende ausdauernde Schlingpflanze, die auch an manchen Orten
der Tropen wie auf Jamaika, in Südamerika, auf Ceylon und in Ostindien
kultiviert wird. Die walnuß- bis faustgroßen Knollen werden das ganze
Jahr hindurch, besonders aber am Ende der Regenzeit im Mai gesammelt,
an der Sonne, in heißer Asche oder, in einem Netz aufgehängt, über
freiem Feuer getrocknet. In letzterem Falle erhalten sie ein berußtes
Aussehen und etwas Harz tritt aus. Um den Austrocknungsprozeß zu
beschleunigen, werden die größeren Knollen durchschnitten; nur
kleine läßt man ganz. Sie sind hart, fest und schwer, erscheinen
außen dunkelbraun, runzelig, innen weißlichgrau, faserig, riechen
eigenartig und schmecken anfangs süßlich, ekelhaft, dann scharf, im
Rachen lange haftend. Haupthandelsplatz der nur von wildwachsenden
Pflanzen gesammelten echten mexikanischen Jalapa ist der mexikanische
Hafenort Vera Cruz, von wo die Droge in Ballen von 50 kg Gewicht
exportiert wird. Als wichtigsten Bestandteil enthält sie das zuerst
1634 durch Ausziehen der Wurzelknolle mit Weingeist gewonnene, bis zu
über 20, meist aber zu 10–13 Prozent darin enthaltene Jalapenharz,
das aus 95 Prozent eines in Äther unlöslichen harzartigen Glykosids
Convolvulin und zu 5 Prozent des in Äther löslichen Harzes Jalapin
besteht. Aus ersterem werden im Darm die Convolvulin- und Purginsäure
gespalten. In der Wirkung steht dieses Abführmittel in der Mitte
zwischen Rhabarber und Aloe, indem es nicht so leicht verstopft, wie
ersterer, und auch nicht so stark die Gedärme reizt, wie letztere.
Als drastisches Abführmittel wird das Gummiharz einer altweltlichen
Windenart (Convolvulus scammonia) als Scammonium
verwendet. Dieses hat seinen Namen vom griechischen skámma,
das Gegrabene, und wurde schon im Altertum gebraucht, aber nach
Dioskurides schon ebenso verfälscht wie heute. Von der im östlichen
Mittelmeergebiet bis zum Kaukasus heimischen, in Kleinasien und Syrien
stellenweise häufigen ausdauernden Pflanze wird der eingetrocknet
bräunlichgelbe bis dunkelbraune Milchsaft aus der bloßgelegten Wurzel
vermittelst Einschnittes gewonnen. Er schmeckt kratzend, bitter und
riecht dem Jalapenharz ähnlich, besteht aus 10 Prozent Harz, und zwar
zum großen Teil aus Jalapin, dann aus Zucker, Gummi und Gerbstoff. Im
Mittelalter wurde er öfter unter der Bezeichnung Diagrydium arzneilich
verwendet, kommt aber heute nur ganz ausnahmsweise zur Anwendung.
[S. 311]
Häufiger wird das Podophyllin angewandt, das von einer
an schattigen, feuchten Stellen der Laubwälder des atlantischen
Nordamerika wachsenden staudigen Berberidee mit 5–9lappigen Blättern,
großen, weißen, nickenden Blüten und eiförmigen, gelblichen, etwa
einer kleinen Zitrone ähnlichen, vielsamigen Früchten mit säuerlichem,
eßbarem Fruchtfleisch gewonnen wird, indem der weiße, kriechende
Wurzelstock mit Alkohol ausgezogen und dieser spirituöse Auszug
mit Wasser gefällt wird. Das so gewonnene Podophyllin stellt ein
zitronengelbes bis orangebraunes amorphes, bitteres Pulver dar,
das 12 Prozent Harz mit den abführenden Glykosiden Podophyllotoxin
und Pikropodophyllin enthält. Auch äußerlich wird die Droge als
hautreizendes Mittel angewandt. Der Wurzelstock dieser Pflanze wurde
von alters her von den Indianern zum Laxieren verwendet. Im Jahre 1820
wurde das daraus gewonnene Harz in die Pharmakopoe der Vereinigten
Staaten, 1864 in diejenige Englands, später auch in das deutsche,
österreichische und schweizerische Arzneibuch aufgenommen. Dem
Wurzelstock dieses nordamerikanischen Podophyllum peltatum ist
derjenige des Podophyllum emodi aus Kaschmir und dem Südabhang
des Himalaja auch in der Wirkung sehr ähnlich. Auch er wird von den
Eingeboren in derselben Weise gebraucht.
Uralt ist bei den Kulturvölkern Vorderasiens und des Mittelmeergebiets
die Anwendung der Aloe als Abführ- und Wundheilmittel. Schon
2–3 Jahrtausende v. Chr. war sie in Ägypten und Babylonien im Gebrauch
und wurde unter der semitischen Bezeichnung halal, was bitter
bedeutet, aus den Küstenländern Ostafrikas eingeführt. Die Griechen und
Römer lernten sie später unter dem Namen aloe kennen. Ähnlich
wie der ältere Plinius sagt sein Zeitgenosse Dioskurides von ihr: „Die
meiste Aloe wächst in Indien und von dort kommt auch ihr Saft in den
Handel; welche wächst auch in Arabien und Kleinasien, wie auch auf
einigen Inseln, z. B. Andros, doch wird ihr Saft an letztgenannten
Orten nicht gesammelt, aber man legt die zerquetschten Blätter auf
Wunden. Man unterscheidet zwei Arten von Aloe, eine sandige und eine
leberfarbige. Beide werden mit Gummi verfälscht, was sich jedoch durch
den Geschmack, den Mangel an Bitterkeit und durch den Geruch verrät,
auch läßt sich der verfälschte nicht zwischen den Fingern zu feinem
Staube zerreiben. Innerlich wird er vielfach als Arznei gebraucht,
äußerlich aber in Pulverform auf Wunden gestreut.“ Im mittleren und
nördlichen Europa war die Aloe seit dem 10. Jahrhundert im Gebrauch
und wird zu dieser Zeit in[S. 312] angelsächsischen Arzneibüchern angeführt.
In Deutschland hat besonders der gelehrte Dominikaner Albertus Magnus,
Graf von Bollstädt (1193–1280), viel zu ihrer Einführung beigetragen.
Die Droge ist der eingekochte Milchsaft aus den Blättern verschiedener
Aloearten aus dem tropischen und subtropischen Afrika, besonders dem
Kapland. Die offizinelle Kap-Aloe wird fast ausschließlich von Aloe
ferox gewonnen, welche im südlichen und südöstlichen Kapland
öfters dichte Bestände bildet. Es ist dies eine Liliazee mit 1 bis
1,75 m hohem, meist einmal gegabeltem Stamm, bläulichgrünen,
unterseits weißgefleckten, nicht nur am Rande, sondern meist auch
an der Ober- und Unterseite stacheligen Blättern und einer großen
Traube von purpurroten, an der Spitze grünlichen Blüten. Die beste
Sorte von Aloe wird dadurch, und zwar meist von den Eingeborenen,
gewonnen, daß man die abgeschnittenen fleischigen Blätter mit der
Schnittfläche nach innen unten rings um eine über eine flache
Bodenvertiefung ausgebreitete gegerbte Rindshaut derart aufstapelt,
daß ein kuppelartiger Bau von etwa 1 m Höhe entsteht. Nach
einigen Stunden werden die Blätter einfach beiseite gestoßen und der
von selbst aus ihnen geflossene Saft in ein Gefäß gesammelt und abends
über freiem Feuer eingekocht, wobei fleißig gerührt werden muß, um das
Anbrennen desselben zu verhindern. Noch besser ist es, ihn langsam an
der Sonne eintrocknen zu lassen. In letzterem Falle scheidet sich das
Aloin des Saftes kristallinisch aus und es entsteht die, wie wir vorhin
erfuhren, schon von Dioskurides und den andern Ärzten des Altertums
unterschiedene matte, lederfarbene Aloe, während die eingekochte,
durchsichtig, glänzend und statt rot bis hellbraun wie die vorige
infolge von Überhitzung schwarz geworden ist. Eine geringere Sorte wird
durch Auspressen, und die schlechteste durch Auskochen der Blätter
gewonnen. Sie riecht eigentümlich und schmeckt widerlich bitter durch
den in ihr enthaltenen Bitterstoff Aloin, der in Wasser löslich ist und
stark abführend wirkt. Ferner sind darin 30–40 Prozent Aloeharz, 0,2
Prozent Aloe-Emodin und Spuren ätherischen Öles enthalten. Die durch
Auskochen der Blätter gewonnene geringste Sorte wird ihrer Wohlfeilheit
wegen nur von Tierärzten benutzt. Im 16. Jahrhundert gelangte die
Kultur der Aloe vulgaris nach Südeuropa und durch die Spanier
nach Westindien. Seit 1693 ist die Barbados-Aloe im englischen Handel,
während die Kap-Aloe erst seit ihrer Gewinnung durch den Buren Peter
de Wett aufkam. Aus der Barbados-Aloe stellte dann der Edinburger
Apotheker Thomas Smith 1850 als erster das Aloin[S. 313] dar. Die heute meist
von Curaçao stammende Barbados-Aloe wird in Kalabassen und diese dann
in Fässer verpackt, während die gebräuchlichere Kap-Aloe zum Teil in
Affenhäute, als dem billigsten Verpackungsmaterial, vernäht in Kisten
in den Handel gelangt und so auf den Londoner und Hamburger Auktionen
verkauft wird.
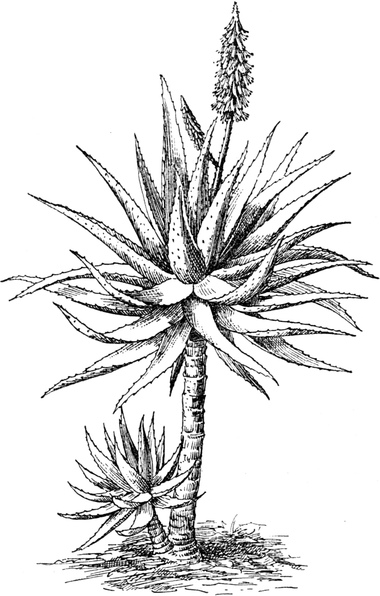
Bild 72. Die offizinelle Kap-Aloe
(Aloe ferox).
Von einem unscheinbaren Hülsenfrüchtler, der Cassia
angustifolia, einem im mittleren Nilgebiet von Assuan durch
Dongola bis Kordofan heimischen, 30–60 cm hohen Strauch mit
paariggefiederten Blättern, stammen die vom Volke als Abführmittel sehr
beliebten Sennesblätter, die vom Juni bis Dezember gesammelt
werden und getrocknet meist über England in den Handel kommen. Sie sind
1 bis[S. 314] 3 cm lang, eiförmig, lederig, mattgrün und enthalten
außer Senna-Rhamnetin, Senna-Chrysophansäure und Cathartinsäure als
eigentlichen abführenden Stoff das zu 0,8 Prozent darin enthaltene
Senna-Emodin. Die alten Griechen und Römer kannten diese Droge noch
nicht. Sie wurde erst seit dem 9. Jahrhundert durch arabische Ärzte
unter der Bezeichnung sannâ in Europa bekannt, doch wurden
im frühen Mittelalter die Fruchthülsen, und nicht die Blätter der
Pflanze von den arabischen Ärzten verwendet; letztere kamen erst seit
dem 11. Jahrhundert immer mehr in Gebrauch, während man in neuerer
Zeit wiederum den Hülsen mehr Aufmerksamkeit zuwendet. Vom Jahre
1808–1828 war der Handel mit Sennesblättern in Ägypten unter Muhammed
Ali monopolisiert und verpachtet. Als dadurch die Preise der Droge
sehr in die Höhe stiegen, verpflanzten die Engländer den Anbau des
Sennesstrauches nach Südindien und Ceylon, von wo heute die größte
Menge unter der Bezeichnung Tinnevelly-Senna von Tuticorin aus über
England in den Handel kommt, während zur Zeit des ägyptischen Monopols
Triest der Hauptstapelplatz dafür war.
Als gelindes Abführmittel wird das säuerliche Fruchtmus einer anderen
Leguminose, der indischen Tamarinde (Tamarindus indica),
gebraucht. Dieser im tropischen Afrika von Abessinien und dem oberen
Nilgebiet südwestlich bis zum Zambesi heimische Schmetterlingsblütler,
der heute überall in den Tropen meist als Alleebaum kultiviert wird,
stellt einen 25 m hohen, bis 8 m Stammumfang aufweisenden
schattigen Baum dar mit paariggefiederten Blättern, gelblichen,
purpurn geäderten Blüten und gestielten 15 cm langen und
2,5 cm breiten Fruchthülsen, die in zerbrechlicher, gelbbrauner,
rauher Schale ein braunschwarzes Mus, und in diesem rundliche,
viereckige, glänzend rotbraune Samen aufweisen. Für die trockenen,
vegetationsarmen Binnenländer Afrikas sind die als beliebtes Obst und
zur Herstellung von erfrischendem Mus und durstlöschenden Getränken
benutzten Früchte von der größten Bedeutung. Auch das gelbliche, oft
rot gestreifte, harte, sehr dauerhafte und von keinerlei Insekten,
selbst nicht den Termiten, angegangene Stammholz ist als Werk- und
Drechslerholz hochgeschätzt. Die alten Ägypter kannten den Baum als
nutem, d. h. Schotenbaum, und wandten das angenehm säuerliche
Mus seiner Früchte als abführende Arznei an. Die übrigen Kulturvölker
des Altertums erwähnen die Frucht noch nicht, sondern erst die
arabischen Schriftsteller des Mittelalters unter der Bezeichnung
tamar hindi, d. h. indische Datteln, woraus dann unsere
Benennung Tamarinde hervor[S. 315]ging. Durch Vermittlung der arabischen
Ärzte wurden die Tamarindenschoten und das daraus hergestellte Mus
in die europäischen Apotheken eingeführt. Der erste europäische
Arzt, der solches erwähnt und von dessen Anwendung als kühlendem
Abführmittel bei Gallenkrankheiten spricht, ist Johannes Actuarius
im 13. Jahrhundert. Bei den alten deutschen Ärzten findet sich dafür
die Bezeichnung siliqua arabica, d. h. arabische Schote. Seit
dem 15. Jahrhundert führen die deutschen Apotheken die Tamarinde, die
aber niemals besondere Geltung erhielt. Erst in neuerer Zeit ist das
in Bonbonform gebrachte Tamarindenmus von Frankreich aus als tamar
indien zu Abführzwecken mehr und mehr eingeführt worden. Ihre
Wirkung wird durch den Gehalt von 8 Prozent Weinstein und 15 Prozent
Weinsäure bedingt. Ein ausgewachsener Baum liefert 180–200 kg
Früchte, deren Mus überall in den Tropen gern als Kompott verspeist
wird. Aus den Ländern am oberen Nil kam der Fruchtbaum schon sehr früh
nach Indien, wo er im Ayur Veda Susrutas als ambika angeführt
wird. Bereits 1570 traf ihn Hernandez in Mexiko, und 1648 von Markgraf
in Brasilien angepflanzt.
Gleichzeitig mit der Tamarinde wurden die von arabischen und persischen
Ärzten zuerst erwähnten getrockneten Früchte des ursprünglich ebenfalls
im oberen Nilgebiet heimischen und von da über die Tropen beider
Hemisphären verbreiteten, bis 18 m hohen und schöne Bäume
bildenden Schmetterlingsblütlers Cassia fistula unter dem Namen
Röhrenkassie in die europäischen Apotheken eingeführt. Actuarius
im 13. Jahrhundert beschrieb sie als Cassia nigra und erst Mesue
führt sie als Cassia fistula an. Das honigartig riechende,
süßschmeckende, braune Mus, das aus den 30–60 cm langen,
1,5–3 cm dicken, schwarzen oder schwarzbraunen, zylindrischen,
kurzgestielten, meist etwas gekrümmten Hülsenfrüchten mit glatter,
holziger Schale gewonnen wird, enthält außer Gummi und Pektinstoffen
über die Hälfte des Gewichtes Zucker und wird als mildes Abführmittel
für sich oder als Bestandteil von Elektuarien benutzt. Die süßeste Ware
kommt, wie das meiste Tamarindenmus, aus Ostindien in zylindrischen,
aus derben Rohrspänen geflochtenen Körben in den Handel; daneben ist
amerikanische und afrikanische Röhrenkassie auf dem Markt. In Indien
benutzt man die jungen, unreifen Früchte, mit Zucker eingemacht, als
Abführmittel. Die sehr gewürzhaft riechende Rinde des Baumes, die der
Pflanze die sonst nur für eine Abart des Zimtbaums, die Zimtkassie,
gebräuchliche Benennung Cassia verschaffte, ist sehr reich an
Gerbstoff und wird deshalb vielfach zum Gerben benutzt.
[S. 316]
Als drastisches Abführmittel bei Wassersucht diente früher noch
mehr als heute der eingedickte schleimige, gelbe Saft eines in Süd-
und Hinterindien wachsenden 15 m hohen Baumes, Garcinia
hanbury, der als Gummigutti in den Handel kommt. Von
den Eingeborenen wurde er schon längst arzneilich und technisch
verwendet, als ihn die Europäer kennen lernten. Zuerst erwähnt ihn
ein chinesischer Reisender, der von 1295–97 Kambodscha besuchte,
unter dem Namen kiang-hwang. Die erste Probe davon brachte der
holländische Admiral J. van Neck nach Europa; von ihm erhielt Clusius
1603 davon unter der malaiischen Bezeichnung gutah jemon, d.
h. heilkräftiges Gummiharz. 1611 machte ein Bamberger Arzt, Michael
Reuden, den ersten medizinischen Gebrauch davon. 1651 nahm Horstius
das Mittel in seine Pharmacopoea catholica auf, und 1751
erkannte Neumann die Natur der Droge als ein Gummiharz. Von 20–30
Jahre alten Bäumen wird der gelbe Milchsaft durch spiralig um den
Stamm verlaufende Schnitte vor Eintritt der Regenzeit, d. h. von
Februar bis April gewonnen, in 50 cm langen und 6–7 cm
dicken Bambusrohren durch Erwärmen am Feuer erhärtet und dann die
stangenförmige rotgelbe Masse als Röhrengutti in den Handel gebracht.
Er enthält durchschnittlich 77 Prozent Harz, etwas in Alkohol
lösliches Gummiguttigelb und 12 Prozent Gummi. Die drastische Wirkung
der berüchtigten Morisonpillen ist wesentlich auf ihren Gehalt an
Gummigutti zurückzuführen, der in stärkeren Dosen leicht Vergiftungen
hervorruft.
Ein anderes, schon in sehr kleinen Mengen außerordentlich heftig
abführendes und, in die Haut eingerieben, in kurzer Zeit eine starke
Hautentzündung mit Pustelbildung hervorrufendes Mittel ist das
Krotonöl, das aus den zerstoßenen, geschälten, reifen Samen
einer 6 m hohen, sehr nahe mit der Rizinusstaude verwandten
Wolfsmilchpflanze, Croton tiglium, bei gelinder Wärme ausgepreßt
wird und ein dickes, braungelbes, etwas unangenehm riechendes, zunächst
milde, aber sehr bald scharf brennend schmeckendes Öl darstellt.
Innerlich bringt schon ½ Tropfen mit Zucker verrieben nach einer
halben Stunde eine Ausleerung hervor, während 1 Tropfen — übrigens die
größte Gabe, welche innerlich als Heilmittel verabreicht werden darf —
schon über ein Dutzend Ausleerungen mit starkem Drang hervorruft. Das
wirksame Prinzip ist das krotonolsaure Triglycerid und das Krotonharz,
auf welch letzterem die blasenziehende Eigenschaft des Öles beruht.
So dient es auch als Bandwurmmittel und äußerlich zu ableitenden
Salben bei Rheumatismus und Neuralgien. Die Bekanntschaft mit diesem[S. 317]
Öle verdankt das Abendland den arabischen Ärzten. Ums Jahr 950 war
es Serapion dem Älteren, und 50 Jahre später Avicenna (eigentlich
Ibn Sina, dem Leibarzte mehrerer Sultane, gestorben 1037 in Hamadan)
bekannt. 1578 lieferte D’Acosta eine genauere Beschreibung nicht nur
des Öles, sondern auch der in Ostindien heimischen Stammpflanze,
die außer hier und in Ceylon auf Java, den Philippinen und in China
kultiviert wird.
Ein uraltes Abführmittel sind endlich die faustgroßen, runden,
gelben Früchte der in großer Menge die Wüsten Nordafrikas und
Westasiens bewohnenden Bittergurke (Citrullus colocynthis),
die einst hauptsächlich den Straußen als Nahrung dienten und
als Koloquinten arzneiliche Verwendung fanden. Sie
finden sich bereits im Alten Testament erwähnt, und wie schon
Hippokrates, verwandte sie auch Dioskurides unter der Bezeichnung
kolokynthis, d. h. Eingeweidebeweger, als Arznei. Besonders von
den arabischen Ärzten wurde diese von ihnen handal genannte
Droge viel verwandt und deshalb die Koloquinte schon im 10. Jahrhundert
auf Cypern und in Spanien angepflanzt. Als Arzneimittel werden die
Früchte in angelsächsischen Arzneibüchern des 11. Jahrhunderts
angeführt. Gegen halbseitiges Kopfweh rühmte sie schon Alexander
Trallianus im 6. Jahrhundert. Die getrockneten, geschälten Früchte
kommen aus Spanien, Marokko, Syrien und neuerdings in komprimierter
Form aus Persien und Ostindien in den Handel und enthalten besonders
im Fruchtfleisch einen glykosidischen Bitterstoff, das Colocynthin, zu
0,6–2 Prozent. Die gerösteten Samen der Koloquinte werden übrigens von
der ärmeren Bevölkerung der Sahara als willkommene Speise gegessen.
Eine schon im Altertum für den Arzneischatz wichtige Pflanze bildete
das Süßholz. Es ist dies die ungeschälte Wurzel der in Südeuropa
und im südwestlichen Asien bis Persien heimischen, bis 2 m
hohen, ausdauernden Leguminose, Glycyrrhiza glabra, mit bis
20 cm langen Fiederblättern und violetten Blüten in Trauben. In
den hippokratischen Schriften wird sie zwar nur einmal erwähnt, aber
die späteren griechischen Ärzte benutzten sie als glykýrrhiza,
d. h. Süßwurzel, häufig als schleimlösendes Mittel bei Husten. Bei
den römischen Ärzten figurierte sie als radix dulcis, was
ebenfalls süße Wurzel bedeutet. Noch Alexander Trallianus im 6.
Jahrhundert benutzte sie viel gegen Brustbeschwerden. Unter den von
Karl dem Großen in seinem capitulare de villis vom Jahre 812 zum
Anbau empfohlenen Nutzpflanzen findet sie sich nicht, doch wird sie
von der heiligen Hilde[S. 318]gard, Äbtissin des Klosters Ruppertsberg bei
Bingen (1098–1179), als liquiricium aufgeführt, woraus dann das
deutsche Lakriz und das französische rêglisse hervorging, alles
natürlich Ableitungen des griechischen glykýrrhiza, das uns
schon bei dem Schüler des Aristoteles, Theophrast (390–286 v. Chr.),
entgegentritt. Die bis 2 cm dicke, gelbe Süßholzwurzel enthält
als wesentlichsten Bestandteil das als Süßholzzucker bezeichnete
Glycyrrhizin, ein an Kalk gebundenes Glykosid, das zu 6–8 Prozent
darin enthalten ist. Im 15. Jahrhundert wurde von den Benediktinern in
Bamberg die Kultur des Süßholzes in Deutschland eingeführt und meist
von da aus die deutschen Apotheken mit dieser Droge versorgt. Seit
dem 13. Jahrhundert wird es in Italien, vorzugsweise in Kalabrien und
Sizilien, besonders aber in Spanien kultiviert, von wo es, im Winter
ausgegraben und in Bündel von 30–35 kg Gewicht verpackt, in den
Handel kommt. Auch aus Südfrankreich, Mähren und Syrien, wo die Pflanze
im großen kultiviert wird, und aus der Umgebung von Smyrna, wo man sie
von wildwachsenden Exemplaren sammelt, wird sie teils als solche, teils
auf Lakrizensaft verarbeitet, exportiert. Der eingekochte Lakrizensaft
war schon dem Dioskurides und Plinius bekannt; in Deutschland erwähnt
ihn zuerst Konrad von Megenberg, der 1374 63jährig als Kanonikus am Dom
zu Regensburg verstorbene Verfasser der ersten in deutscher Sprache
geschriebenen Naturgeschichte. 1450 treffen wir ihn in der Arzneiliste
der Stadt Frankfurt a. Main. Er wird durch Auskochen der zerquetschten
minderwertigen Wurzeln in Wasser mit nachherigem Eindampfen gewonnen
und dient außer als Geschmackskorrigens für Arzneien auch in der
Bierbrauerei. Außer dem südeuropäischen und asiatischen Süßholz
kommt eine geschälte, sogenannte russische Abart von der Varietät
Glycyrrhiza glandulifera in großen, durch eiserne Bänder
zusammengehaltenen Ballen von 80–100 kg in den Handel. Sie wird
besonders bei Sarepta und den Inseln der Wolgamündungen im großen
angebaut und ihre Wurzeln werden roh über Astrachan nach Moskau und
St. Petersburg, wo sie erst geschält werden, ausgeführt. Ein anderer,
meist von wildwachsenden Pflanzen an den Ufern des Ural gesammelter
Teil kommt von Nishnij-Nowgorod aus auf den Markt. Diese eigenartig
süß schmeckende Droge gilt als das beste Süßholz; auch bei ihm ist
die Herbsternte reicher an Glycyrrhizin als die Sommerernte. Fast
ebensogut in der Qualität ist das in großen Mengen in Sibirien,
Turkestan und der Mongolei gesammelte und eine besondere Handelsmarke
bildende chinesische Süßholz von Glycyr[S. 319]rhiza uralensis,
das pharmakognostisch wesentliche Unterschiede vom russischen und
spanischen zeigt.
Von einigen dem vorigen sehr nahe verwandten Schmetterlingsblütlern
aus der Gattung Astragalus wird in Kleinasien, Syrien und
Persien der als Bindemittel in der Technik und Arzneikunde viel
gebrauchte Tragantgummi gewonnen. Er tritt als bei gutem Wetter
innerhalb 3–4 Tagen erhärtender Schleim, bei feuchter Witterung durch
entsprechende Volumzunahme freiwillig, beziehungsweise durch zufällige
Verletzungen der Rinde durch Insekten oder weidende Tiere, in der Regel
aber durch künstlich angebrachte Einschnitte aus Stamm und Ästen jener
dornigen Büsche und wird in farblosen, gelblichweißen bis bräunlichen
Blättern oder Körnern gesammelt. Die Sortierung in die verschiedenen
Handelssorten geschieht meist in Smyrna oder Konstantinopel, von wo
jährlich etwa ½ Million kg in den Handel gelangen. Besonders
groß ist der Bedarf in der Kattundruckerei als Verdickungsmittel für
Farben, in der Appretur von Seidenwaren und zum Glänzendmachen von
Sohlleder. Er quillt in Wasser stark auf, gibt gepulvert mit 20 Teilen
Wasser einen derben, vielfach auch zu Klistieren benutzten Schleim
und enthält außer einem in Wasser löslichen Gummi hauptsächlich das
in Wasser quellende, unlösliche Bassorin, ein Polysaccharid. Der
Tragant war schon den alten Griechen und Römern als tragacantha
bekannt und wurde von ihnen technisch und medizinisch benutzt.
Theophrast nennt Kreta, den Peloponnes und Medien, d. h. das Gebirge
im Nordwesten des heutigen Persien als die Heimat der ihn liefernden
Pflanzen, und Dioskurides sagt, der beste sei durchsichtig, glatt,
fast süß. Er wirke wie (arabischer) Gummi, werde in Augenheilmittel
getan und gegen Brustleiden eingenommen. Sein Zeitgenosse Plinius der
Ältere nennt Medien und Achaja als Hauptbezugsgegenden der Droge und
fügt bei, daß ein Pfund davon zu seiner Zeit drei Denare (etwa 90
Pfennige) kostete. Durch die arabischen Ärzte wurde dann das Abendland
mit dem Tragantgummi bekannt. Zum ersten Male findet sich die Droge
in Deutschland im 12. Jahrhundert erwähnt. Um 1340 berichtet der
Italiener Pegolotti über draganti als Ausfuhrartikel von Satalia
(Adalia im südlichen Kleinasien) neben dem Tragant aus Romania, dem
heutigen Griechenland. Neuerdings wird als Surrogat des Tragants der
Kuteragummi von der 6 m hohen Leguminose Maximilianea
gossypium, mit großen, gestielten Blättern und gelben Blüten, in
Vorderindien gewonnen. Außer in seiner Heimat wird er in Cochinchina,
Senegambien[S. 320] und auf der Insel Mauritius angepflanzt und liefert den
dem Tragantgummi ähnlichen, in Wasser auch nur teilweise löslichen
Kuteragummi, der in derselben Weise wie der Tragant verwendet wird.
Ein seit dem frühesten Altertum sehr geschätzter Exportartikel Afrikas
ist der arabische oder Akaziengummi, der hauptsächlich
aus Stamm und Ästen der im Nordosten Afrikas, besonders im oberen
Nilgebiet wachsenden, bis 6 m hoch werdenden Gummiakazie
(Acacia senegal) von den Eingeborenen gesammelt wird, um nicht
nur an die Fremden verkauft zu werden, sondern in erster Linie ihnen
selbst als wichtiges Nahrungsmittel zu dienen. Diese Gummiakazie bildet
in Senegambien und Kordofan, im Stromgebiet des Weißen Nil und des
Atbara ausgedehnte Wälder und besteht aus stacheligen Sträuchern oder
bis 6 m hohen Bäumen mit schirmartiger Krone, sehr hartem Holz,
grauer, rissiger Rinde und dicken Lagen gelben bis purpurroten Bastes,
kleinen, doppelgefiederten Blättern, schwarzen Stacheln, langen, gelben
Blütenähren und linealischen Fruchthülsen mit dunkeln Samen. Wenn im
Juli, August und September in dem sonst regenarmen Lande ausgiebige
Regengüsse stattfinden und daraufhin heiße Witterung eintritt, so
berstet durch die austrocknenden Ostwinde die Rinde der dann eben
blattlosen und sich mit den schönen, gelben Blütenähren bedeckenden
Gummiakazien, und aus der allmählich der „Vergummung“ anheimfallenden
Innenrinde fließt in oft größerer Menge der farblose Gummischleim
aus, der alsbald am Baume erhärtet. Mit dem Ausbrechen der Blätter
hört dann die Gummibildung auf. Je länger nun z. B. am Senegal der
austrocknende Wüsten-Ostwind weht, um so reichlicher ist die Ernte.
Nach Busse soll aber dieser Gummifluß nicht freiwillig stattfinden,
wie man bis jetzt allgemein glaubte, sondern sein Entstehen lediglich
der Verletzung durch die Rinde (und das Holz) anbohrende Insekten,
besonders Ameisen, verdanken. Jeder Gummiklumpen entspräche demnach
einer kleinen Wunde, und zwar färbt sich der austretende Gummi um so
mehr rotbraun, je tiefer die Wunde ist und je mehr sich infolgedessen
gerbstoffartige Stoffe beimischen. Smith endlich führt das Ausfließen
von Gummi auf die Tätigkeit eines von ihm als Bacterium acaciae
bezeichneten winzigen Pilzes zurück, der stets auf denselben Bäumen und
an den Stellen, wo sich Gummi bildet, aufgefunden wird. Nach Louvel
beginnt die Gummiabsonderung, sobald die Pflanze 7–8 Jahre alt ist, sie
erreicht im 30. ihren Höhepunkt und dauert bis zum 40. an. Nur selten
wird die Gummiakazie vom Menschen[S. 321] angeschnitten, um ihr wertvolles
Produkt zu erhalten. Am reichlichsten fließt der Gummi in den Monaten
Februar und März bis Mitte April, und zwar ist die Absonderung
desselben in abnorm heißen Jahren am stärksten. Früher richteten
gelegentlich Elefanten große Verwüstungen in den Gummiwäldern an, so
daß der Ertrag geschmälert wurde. Die beste Sorte kommt aus Kordofan
in den Handel; eine sehr gute Qualität liefert auch Südnubien und
Abessinien. Weniger geschätzt dagegen ist der von anderen Akazienarten
in Ost- und Südafrika, wie auch in Marokko und der Berberei gesammelte,
mehr braune Gummi. Letzterer löst sich nicht vollständig wie der echte,
helle arabische Gummi im doppelten Gewicht Wasser zu einem klebenden,
aber nicht fadenziehenden, geruchlosen, gelblichen Schleim auf.
Tafel 127.
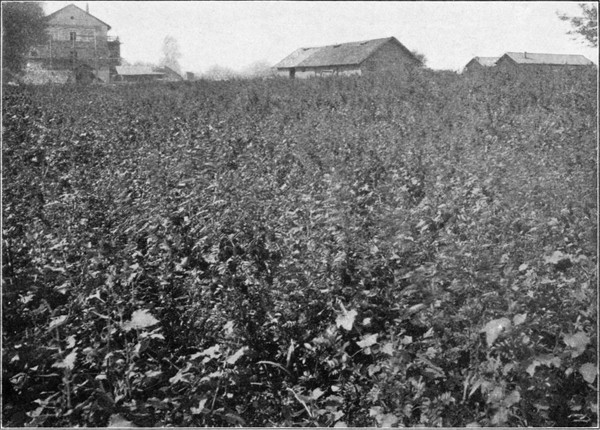
Anpflanzung von Süßholz (Glycyrrhiza) an der Save bei Bosnabrod
in Bosnien. (Nach einer im Besitz des Botan. Institutes zu Wien
befindlichen Photographie von L. Adamovic.)

In Europa wild wachsender Rhabarber (Rheum
undulatum).
Tafel 128.
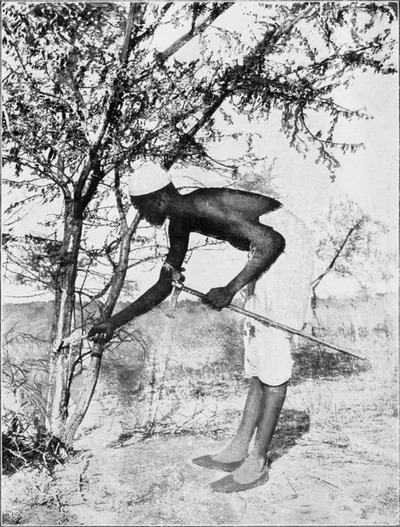
(Phot. von Dr. W. Beam.)
Anschlagen einer Gummiakazie (Acacia verek) in Kordofan.

(Phot. von Dr. W. Beam.)
Ausschwitzung von arabischem Gummi an einer angeschlagenen Gummiakazie
in Kordofan.
Beim Einsammeln des Gummis ist vor allem darauf zu achten, daß nur
immer ein und dieselbe Art gesammelt wird, oder aber die Sorten
verschiedener Arten gleich an Ort und Stelle auseinander gehalten
werden. Dies ist deshalb von großer Wichtigkeit, weil sich die
verschiedenen Gummisorten in ganz verschiedenem Maße in Wasser lösen
und es so leicht vorkommen kann, daß Gummisorten gemischt werden, von
denen die eine ganz, die andere nur zu einem gewissen Teil löslich
ist. Eine solche Mischsorte würde dadurch fast vollständig entwertet.
Derartige minderwertige gemischte Sorten kommen meist fein gepulvert in
den Handel, finden aber nur schwer Absatz, weil ein solcher auch stark
verunreinigt zu sein pflegt. Es empfiehlt sich, nur möglichst helle
und gleichmäßig gefärbte Stücke derselben Akazienart zu sammeln und
die Sorten streng auseinander zu halten. Der beste Gummi ist farblos
bis hellgelb, ziemlich durchsichtig und bildet runde oder längliche
Körper mit glatter, teilweise rissiger Oberfläche. Die Härte entspricht
ungefähr derjenigen des Steinsalzes. Der Hauptbestandteil desselben
ist Arabin, eine Verbindung der Arabinsäure mit Kalk und kleinen
Mengen Kali und Magnesia, ferner wenig Bassorin und Spuren von Zucker,
Gerb- und Farbstoffen. Die Verwendung des Gummis ist eine äußerst
mannigfaltige. In der Medizin dient er als reizmilderndes, schleimiges,
einhüllendes Arzneimittel, besonders bei Magen- und Darmentzündung
und bei Vergiftungen, dann als Konstituens bei Emulsionen, Latwergen,
Pasten, Pastillen, Pillen usw., als Streupulver bei Wunden, speziell
Brandwunden, zu Klistieren, im großen aber in Färbereien, Druckereien,
Appreturanstalten für Seidenwaren und feine Spitzen, dann Tinten- und
Zündholzfabriken usw. als Klebemittel. Allein Deutschland bedarf seiner
im Werte von etwa 16 Millionen Mark[S. 322] jährlich. Frankreich importiert
jährlich aus dem Senegal zwischen 2 und 5 Millionen kg nach
Bordeaux; der größte Teil desselben wird im Lande selbst verarbeitet.
Schon die alten Ägypter bedienten sich des arabischen Gummis in der
Malerei, wie auch in der Appretur und beim Färben von Linnenstoffen.
Auf den ägyptischen Denkmälern aus den Jahren um 1500 v. Chr., die
uns am Grabtempel der Königin Hatschepsut in Der el Bahri an der
Westseite der einstigen Residenzstadt Theben erhalten sind, wird
der Gummi als kami en punt, d. h. Gummi aus dem Lande Punt
(der Südspitze Arabiens und der gegenüberliegenden Somaliküste)
bezeichnet und neben Weihrauch als eine begehrte Droge jenes Landes
angeführt. Der ägyptische kami kam als kómmi zu den
Griechen. Der große Pflanzenkenner Theophrast sagt über ihn in seiner
Pflanzengeschichte: „Die Akazie (akántha) in Ägypten liefert den
Gummi (kómmi); er fließt von selbst aus, oder aus Wunden, die
man absichtlich macht.“ Dioskurides nennt den ägyptischen Gummibaum
akakía (woraus unser Akazie entstand) und sagt, daß der Gummi
vielfach als Arznei verwendet werde. Dasselbe sagt Plinius von der
Droge, die er gummi nennt. Der ägyptische Gummi sei weitaus die
beste Sorte, habe eine dunkle Farbe und komme in wurmförmig gedrehten
Stücken in den Handel. Schon der große Hippokrates benutzte den
kómmi als Arzneimittel, und der weitgereiste Herodot kannte
ihn als Bestandteil der Tinte. Nach dem um 25 n. Chr. gestorbenen
griechischen Geographen Strabon aus Amasia am Pontos kam der Gummi
besonders aus der Umgegend der ägyptischen Stadt Akanthos, deshalb
treffe man in den alten Schriften, z. B. bei Cornelius Celsus, die
Bezeichnung gummi acanthinum; doch seien auch die Benennungen
gummi thebaicum und g. alexandrinum gebräuchlich. Der
Name „arabischer Gummi“ — daher stammend, weil er über arabische Häfen
ausgeführt und durch die Araber verbreitet wurde — tritt uns zuerst
beim jüdischen Arzte Ibn Serapion im 11. Jahrhundert entgegen. Im
Mittelalter wurde er im Abendlande nur sehr wenig angewendet und kam
auch in sehr geringen Mengen nach Europa. Der Senegalgummi kam erst im
14. Jahrhundert durch die Portugiesen nach Europa, im 17. Jahrhundert
begann seine Verwendung in Frankreich, aber erst vom Jahre 1832 an
begann er zunächst in Frankreich den arabischen Gummi zu verdrängen.
Als durch den Mahdistenaufstand der Sudan für den Gummiexport gesperrt
wurde und infolge davon die Nilgummisorten sehr selten wurden,
eroberte sich der Senegalgummi den Weltmarkt und wird jetzt überall da
angewendet, wo das viel[S. 323] billigere Dextrin, der durch Verkleisterung
von Stärkemehl erhaltene Stärkegummi, nicht genommen werden kann.
Surrogate des arabischen oder Akaziengummis sind der indische
oder Feroniagummi, der aus dem verwundeten Stamm des
Elefantenapfelbaums (Feronia elephantum), eines großen
Baumes in Ostindien bis Ceylon mit anisartig duftenden, unpaarigen
Fiederblättern, rötlichgrünen Blüten und vielsamigen, apfelähnlichen
Früchten mit harter Rinde und genießbarem Fleisch, träufelt und in
großen, gelben bis braunen, durchsichtigen, in Wasser leicht löslichen
Klumpen erstarrt. Er klebt stark, wird wie arabischer Gummi benutzt
und ist diesem für Wasserfarben vorzuziehen. Ferner der in Westindien,
besonders auf Martinique und Guadeloupe, und Brasilien gesammelte
Cashawagummi, der aus Wunden des daselbst heimischen, jetzt
überall in den Tropen kultivierten Akajoubaumes (Anacardium
occidentale), eines Verwandten des Mahagoni, fließt. Es ist dies
einer der schönsten Kulturbäume, der sich durch hohen, dicken Stamm
und mächtige Laubkrone auszeichnet. Die Stiele der Früchte sind zu
hühnereigroßen, birnförmigen, gelben, süßlichsauren Scheinfrüchten
geworden, die ein sehr beliebtes Obst abgeben, während die als
Anhängsel daraufsitzenden kleinen, nierenförmigen eigentlichen Früchte
als westindische Elefantenläuse bezeichnete Steinfrüchte bilden,
die auch eßbar sind und aus denen ein in der Medizin und Technik
verwendetes Öl gepreßt wird.
Ein angenehm styraxartig riechendes Harz wird als Ladanum aus
verschiedenen Arten von Cistrosen auf Cypern, Kreta, Naxos und in
Spanien gewonnen. Schon von den alten griechischen Ärzten wurde es als
erwärmendes und zusammenziehendes Mittel, innerlich bei chronischem
Katarrh und äußerlich auf Wunden und Geschwüre, verwendet. Noch
jetzt ist es im Orient sehr geschätzt und gilt dort als Schutzmittel
gegen die Pest, während es bei uns nur etwa zu Räucherungen und als
Parfüm dient. Ebenfalls bloß noch äußerliche Verwendung findet bei
uns das Elemiharz, das durch Anschneiden verschiedener auf den
Philippinen heimischer Kanariumarten, in Indien, Ostafrika, Venezuela
und Brasilien von anderen Burserazeen gewonnen wird. In frischem
Zustande stellt es eine klare, wenig gefärbte Auflösung von Harzen in
ätherischen Ölen dar, aus der sich das Harz durch Verdunsten dieser
letzteren ausscheidet. Der Geruch ist balsamisch, der Geschmack
gewürzhaft, bitter. Es dient bei uns als Heilmittel auf Wunden, während
die Eingeborenen es auch innerlich, namentlich gegen Kopfschmerz, und
zu Räucherungen verwenden.
Zu scharfen Einreibungen und als Zusatz zu blasenziehenden[S. 324] Pflastern
dient das Euphorbium, ein aus der geritzten Rinde einer
nordafrikanischen, bis 2 m hohen, fleischigen, blattlosen
Wolfsmilchart (Euphorbia resinifera) ausfließender und an der
Pflanze selbst erhärtender Milchsaft, der hellgelbliche, zerreibliche
Stücke bildet, die beim Erwärmen schwach weihrauchartig riechen und
auf der Zunge scharf brennen. Die Einschnitte in den Stamm und die
vierkantigen Zweige werden zur Fruchtzeit gemacht. Dieses Gummiharz
wird ausschließlich im marokkanischen Atlas gesammelt und kommt über
Mogador in den Handel. Schon im Altertum war es bekannt und wurde als
scharfes Abführmittel von den griechischen Ärzten verordnet. Juba
II., der Sohn Jubas I. von Numidien, der sich nach der Niederlage
der Pompejaner bei Thapsus im Jahre 46 v. Chr. das Leben nahm, ein
nach dem Sturze seines Vaters nach Rom gebrachter und dort erzogener,
wissenschaftlich gebildeter Mann, dem später Augustus wieder einen Teil
seines väterlichen Reiches verlieh, schrieb über diese Pflanze seiner
Heimat, die er nach seinem Leibarzte Euphorbos benannt haben soll, eine
kleine Schrift. Später ging die Kenntnis der Stammpflanze verloren, bis
Berg im Jahre 1863 aus im Euphorbium enthaltenen Bruchstücken die schon
1804 von Jackson erwähnte Pflanze bestimmte. Die ersten Exemplare der
Pflanze kamen 1870 in den großen botanischen Garten von Kew bei London.
1868 isolierte Flückiger das neben verschiedenen Harzen darin zu 34
Prozent enthaltene Euphorbon.
Ein anderes, ebenfalls kaum mehr innerlich, sondern als Bestandteil
reizender und zerteilender Salben und Pflaster nur noch äußerlich
gebrauchtes Gummiharz ist das Ammoniacum, der zur Zeit der
Fruchtreife durch Stiche von Insekten ausfließende und an der Luft
zu innen weißlichen, außen bräunlichen, eigentümlich unangenehm
riechenden und scharf bitter schmeckenden erbsen- bis walnußgroßen
Körnern erhärtende Milchsaft einer ausdauernden, bis 2,5 m
hohen Umbellifere der mittleren und östlichen Gegenden Persiens und
der Wüsten um den Aralsee, Dorema ammoniacum. Er erweicht
in der Hand, gibt mit Wasser eine Emulsion, ist in Alkohol nicht
vollständig löslich und enthält schwefelfreie Harze und Gummi. Das von
den griechischen Ärzten des Altertums gegen mancherlei Krankheiten
gegebene hammoniacum war noch nicht dieses persische, sondern
ein von der nordafrikanischen Ferula tingitana aus Marokko
gewonnenes Produkt. Nach Plinius, der es hammoniaci lacrima, d.
h. Ammoniakträne, nennt, wächst es in den unterhalb des Negerlandes
gelegenen Sandwüsten Afrikas. „Es kommt von einem Baume, der beim[S. 325]
Orakel des Jupiter Hammon vorkommt, heißt auch metopion und
quillt wie anderes Harz oder Gummi in Tropfen hervor. Es gibt zwei
Sorten desselben; die beste ist zerbrechlich, die andere fett und
harzig und heißt auch phýrama. Das Pfund des besten kostet
40 As (etwa 1 Mark und 60 Pfennige). Es erwärmt, zerteilt, löst auf
und dient gegen allerlei Leiden.“ Den Namen hat die Droge natürlich
von der Oase des Jupiter Ammon, von der sie einst bezogen wurde, und
so dürfte Don unrecht haben, der sie, da sie von den alten Autoren
bisweilen auch armoniacum geschrieben wird, nur als verdrehtes
armeniacum aufgefaßt wissen möchte. Schon im 2. Jahrhundert
n. Chr. wurde sie allmählich durch das persische Gummiharz verdrängt,
das im 9. Jahrhundert von persischen, im 10. und 11. Jahrhundert auch
von arabischen Ärzten genannt wird, aber erst im 14. Jahrhundert
in Deutschland bekannt wurde. Die Stammpflanze wurde 1829 von Don
beschrieben und benannt.
Von einem andern Doldenblütler Irans, Ferula persica, wird das
knoblauchartig riechende Sagapenum gewonnen, das im Orient und
in Indien als Gewürz und Heilmittel heute noch Verwendung findet.
Dieses Gummiharz wurde schon in der römischen Kaiserzeit von den
griechischen Ärzten verwendet. Dioskurides beschreibt es in folgender
Weise: „Das sagápēnon ist der Saft einer unserer Ferula
ähnlichen Pflanze und kommt aus Medien. Das beste ist durchscheinend,
außen gelblich, innen weiß; der Geruch hält die Mitte zwischen dem
sílphion (Teufelsdreck) und gálbanon. Der Geschmack ist
scharf.“
Ein der Ammoniakpflanze ähnlicher Doldenblütler Griechenlands und
Kleinasiens, Ferula opopanax oder Opopanax cheironium,
eine schon von Theophrast nach dem kräuterkundigen Kentauren Cheiron
in Thessalien als pánakes cheirónion bezeichnete Heilpflanze,
liefert durch Einschnitte in die fleischige Wurzel das heute wenigstens
bei uns nicht mehr gebräuchliche Gummiharz Opopanax (zu deutsch:
Saft der Panaxpflanze, d. h. der allheilenden Kraftwurzel). Im Altertum
wurde es arzneilich viel verwendet. Dioskurides, der die Pflanze
vermutlich nach dem damaligen Hauptbezugsorte der daraus gewonnenen
Droge, der Heraklesstadt in Bithynien am Schwarzen Meer, Herakleia
pontica, einer bis zu den mithridatischen Kriegen (der letzte
— dritte — derselben dauerte von 74–63 v. Chr.) sehr blühenden
Hafenstadt Kleinasiens, pánakes herakleíon nennt, sagt in seiner
Arzneikunde von ihr: „Das pánakes herakleíon, aus welchem ein
Saft gewonnen wird, den[S. 326] man opopánax nennt und gegen viele Übel
gebraucht, wächst vorzüglich in Böotien und dem arkadischen Psophis,
wird aber auch, da der Saft mit Gewinn verkauft werden kann, in Gärten
gezogen. Übrigens wächst die Pflanze auch in Makedonien und dem
libyschen Kyrene.“
Im Gegensatz zu diesem hat sich auch bei uns bis auf den heutigen
Tag ein anderes Gummiharz als wichtiges Arzneimittel und teilweise
auch sehr beliebtes Gewürz im Gebrauch erhalten, nämlich die Asa
foetida, im Deutschen wegen ihres abscheulichen knoblauchartigen
Geruchs als Teufelsdreck bezeichnet. Die ihn liefernde Pflanze
war schon dem Hippokrates als medisches (im Gegensatz zum kyrenischen)
Silphion bekannt. Später sagt Dioskurides von ihm: „Der vom medischen
und syrischen sílphion kommende festgewordene Saft hat einen
durchdringenden Geruch und wird gegen sehr viele Leiden angewandt.“
Dieser eingetrocknete Milchsaft, den Plinius aus Persien, Armenien und
Medien kommen läßt, laser nennt und dem eingedickten Safte des
silphium von Kyrene gleichend bezeichnet, ist das Gummiharz des
Stinkasantes (Ferula asa foetida), einer bis 2,5 m hohen
Staude aus der Familie der Umbelliferen, die in Persien, Afghanistan,
dem oberen Indusgebiet, besonders in den ausgedehnten Steppen und
Wüsten zwischen dem persischen Meerbusen und dem Aralsee heimisch ist
und bei Herat und anderswo auch kultiviert wird. Bei der geringsten
Verletzung tritt der Milchsaft aus der Rinde der Wurzel aus. Er wird in
der Weise gewonnen, daß die betreffenden Sammler, gewöhnlich Hirten,
zur Zeit, da die Blätter zu welken beginnen, etwa Mitte April, den
oberen Teil der Wurzel bloßlegen, rings um sie die abgeschnittenen
Blätter, Stengel und andere Pflanzen als Schutz der Wurzel vor Wind
und Sonne anhäufen, von dem mit einem dichten Schopfe von Blattresten
versehenen Wurzelbeginne eine dünne Scheibe abschneiden und die auf
der Wundfläche angesammelte dünne Milch abkratzen. Diese Prozedur wird
nach jedesmaliger Ruhepause von einigen Tagen noch zweimal wiederholt.
Nachdem die Wurzel nun wieder 8–10 Tage unberührt geblieben, liefert
sie 2–3 Monate hindurch einen dicken Milchsaft, der die gute Asa
foetida bildet. Von einer Wurzel wird bis zu 1 kg derselben
gewonnen. Der frisch weiße Gummiharzsaft wird außen herum durch die
Einwirkung der Luft bald rot, violett und schließlich gelbbraun und
kommt in losen oder verklebten Körnern und Klumpen in den Handel. Er
ist bei gewöhnlicher Temperatur wie Wachs schneidbar, erweicht bei
geringer Erwärmung zu einer klebenden Masse, riecht höchst unangenehm
knoblauchartig,[S. 327] schmeckt widerlich scharf bitter und aromatisch,
gibt mit drei Teilen Wasser verrieben eine weißliche Emulsion und
besteht zu 61 Prozent aus dem in Äther löslichen Ferulaester des
Asaresinotannols, aus 30 Prozent Gummi, 7 Prozent ätherischem Öl, 1,5
Prozent freier Ferulasäure und Spuren von Vanillin. Bei uns dient
er als Beruhigungsmittel bei Krampfkolik, Hysterie und Nervosität,
als Stopfmittel gegen Diarrhöen beim Pferd und sonst vielfach in der
Tierarzneikunde. In Indien, Persien und dem ganzen Morgenlande ist er
zudem ein sehr beliebtes Speisegewürz, das bis vor nicht sehr langer
Zeit auch in der feineren Küche Europas sehr beliebt war. War es doch
in Frankreich, wo er noch unter dem ancien régime in Mode
gekommen war, bei jedem Gastmahl der Vornehmen Sitte, die Suppenteller
vorher mit einem Stück Stinkasant abzureiben, um die Suppe dadurch
wohlschmeckender zu machen. Überall im Orient gilt er als die Verdauung
befördernd; besonders wird stets das gebratene Hammelfleisch damit
bestrichen, um ihm den beliebten durchdringenden Knoblauchgeruch zu
verleihen. Im Orient schon lange im Gebrauch, wurde er durch die
arabischen Ärzte dem Abendlande bekannt. Die von der arabischen
Arzneiwissenschaft weitgehend beeinflußte Medizinschule von Salerno in
Unteritalien bediente sich seiner schon im 11. Jahrhundert. Auch nach
Deutschland kam die Droge sehr früh. Vom 12. Jahrhundert an bildete sie
einen Einfuhrartikel des italienischen Handels. Heute kommt die beste
Sorte durch Karawanen von Persien nach Bombay und von dort zu Schiff
nach Europa.
Einst auch in der Arzneikunde besonders des Orients vielgebrauchte
Gummiharze sind der Weihrauch und die Myrrhe. Ersterer
wird im südöstlichen Arabien, in Nordostafrika und Indien aus
verschiedenen Boswellia-Arten durch im Frühjahr ausgeführte tiefe
Einschnitte in den Stamm der mäßig hohen Bäume in Form eines reichlich
ausfließenden milchweißen Saftes gewonnen und erstarrt nach einiger
Zeit zu gelben Körnern, die von den Stämmen abgelöst oder am Boden
aufgelesen werden. Seit dem frühen Altertum war er nicht nur zu
rituellen Räucherungen, sondern auch als Medizin hoch geschätzt. Die
Hippokratiker bedienten sich seiner bei Asthma, Gebärmutterleiden und
äußerlich zur Herstellung von Salben.
Fast ebenso alt ist der medizinische Gebrauch der Myrrhe, die ebenfalls
schon im Papyrus Ebers erwähnt wird und nach Herodot im alten Ägypten
vorzugsweise zum Einbalsamieren der Leichen und als Räuchermittel
im Kulte verwendet wurde. Zu letzterem Zwecke[S. 328] wurde sie dann bei
den gottesdienstlichen Handlungen aller vom Morgenlande beeinflußter
Religionen in derselben Weise wie der Weihrauch benutzt. Schon im Alten
Testament wird sie als kostbares Erzeugnis des „glücklichen“ im Sinne
von fruchtbaren Südarabien erwähnt, das uns später der griechische
Geograph Agatharchidas in seiner Schrift über das Rote Meer in
folgender Weise schildert: „Die Sabäer sind das größte und in jeder
Hinsicht glücklichste Volk Arabiens. Ihr Land bringt alles hervor,
was zur Annehmlichkeit des Lebens gehört. Die Herden sind zahllos;
das ganze Land duftet von dem herrlichen, unvergleichlichen Geruch,
den dort die in Menge wachsenden Gewürze wie Balsam, Kassia, Myrrhe,
Weihrauch, Zimt, Kalmus und Palmen aushauchen. Der Wohlgeruch, der aus
den Wäldern kommt, läßt sich mit Worten nicht beschreiben.“
Die Myrrhe stammt von verschiedenen Commiphora-Arten, und zwar die
beste von Commiphora abessinica, einem 6–8 m hohen
Bäumchen der Berge von Abessinien, Erythraea und Südarabien. Der
entweder freiwillig aus Rissen der Rinde oder durch Einschnitte
austretende Saft ist anfangs milchig trübe, gelblich, trocknet aber
bald an der Luft ein, wobei er sich dunkler färbt. Er kommt in Form von
nuß- bis faustgroßen unregelmäßigen Knollen oder löcherigen Klumpen in
den Handel. Am häufigsten ist die von den Somalis gesammelte Myrrhe
von Commiphora playfairi, die in Kisten von 50–100 kg
von Aden aus direkt, oder über Bombay, wo die Ware sortiert wird, nach
Europa gelangt. Wie die alten Ägypter benutzten auch die Hippokratiker
die Droge äußerlich und innerlich. In seiner Arzneimittellehre schreibt
Dioskurides über sie: „Die Myrrhe besteht aus Tropfen, die von
selbst oder aus absichtlich gemachten Wunden eines arabischen Baumes
fließen. Es gibt verschiedene, mit verschiedenen Namen bezeichnete
Sorten. Aus den fettigen preßt man das wohlriechende Myrrhenöl. Die
beste Myrrhe kommt aus dem Lande der Troglodyten, ist durchscheinend,
grünlich, schmeckt beißend. Die Myrrhe wird oft verfälscht, namentlich
durch Gummi. Die echte, frische ist zerreiblich, leicht, überall
gleichfarbig, doch zerbrochen inwendig weiß gefleckt; sie besteht aus
kleinen Stücken, ist bitter, riecht gut, schmeckt scharf. Sie erwärmt,
macht schläfrig, bindet, trocknet, zieht zusammen, wird innerlich und
äußerlich gebraucht.“ Cornelius Celsus spricht von einer schwarzen, bei
Augenkrankheiten angewendeten Myrrhe. Im Arzneischatz von Scribonius
Largus, Valerius Cordus und Alexander Trallianus aus dem 6. Jahrhundert
spielt dieses Gummiharz eine nicht[S. 329] unwichtige Rolle; auch die heilige
Hildegard im 12. Jahrhundert empfiehlt die Mirrha. Innerlich wird sie
als austrocknendes Mittel, häufiger aber äußerlich als Antiseptikum in
Form von Mundwässern, Salben und Pflastern verwendet. Sie besteht aus
ätherischen Ölen, Harzen und Gummi. Häufig wird ihr Bdellium
beigemischt, ein ähnlich riechendes, bitter schmeckendes, ebenfalls
beim Kauen erweichendes, dunkelbraunes bis grünliches Gummiharz,
das im nordwestlichen Indien und in Beludschistan von Commiphora
roxburghi gewonnen und in Indien arzneilich verwendet wird. Das
ostafrikanische Bdellium von Commiphora africana ist mehr
gelbrot und findet sich unter dem Senegalgummi. Es war schon im alten
Ägypten gebräuchlich, wird von Plinius, Arrianus, Vegetius und anderen
genannt und diente, was im Orient heute noch der Fall ist, zu Salben,
Pflastern und Räucherwerk.
Eine dickflüssige, starkriechende Mischung von Harzen mit ätherischen
Ölen stellen die Balsame dar, die ebenfalls freiwillig oder nach
Verwundungen aus Stamm und Ästen mehrerer Pflanzenarten ausfließen,
oder durch Auskochen und Auspressen aromatischer Pflanzenteile gewonnen
werden. Sie riechen stark aromatisch, verlieren an der Luft den größten
Teil ihres Gehaltes an aromatischen, ätherischen Ölen, trocknen ein und
verharzen. Bei der Destillation mit Wasser geben sie die ätherischen
Öle ab und hinterlassen Harz. Ursprünglich verstand man unter Balsam
ausschließlich den von Commiphora opobalsamum, dem Balsambaum
der Alten, gewonnenen Mekka- oder Gileadbalsam, übertrug aber den
Namen später auf verschiedene andere dickflüssige Pflanzensäfte von
aromatischem Geruch.
Der eigentliche, freiwillig oder durch Einschnitte in den Stamm
des 5–6 m hohen, in Nordostafrika und dem südwestlichen
Arabien wachsenden Balsambäumchens (Commiphora opobalsamum)
ausfließende, trübe, blaßgelbe, wohlriechende, aromatisch erwärmend
schmeckende Mekkabalsam kommt überhaupt nicht in den
europäischen Handel, sondern nur der durch Auskochen der Zweige
mit Wasser gewonnene dickflüssige, gelbliche, etwas trübe, aber
weniger angenehm riechende und bitterlich schmeckende Balsam, der
allmählich verharzt, 10 Prozent ätherische Öle enthält, ähnlich wie
der Kopaivabalsam wirkt, aber ausschließlich in der Parfümerie benutzt
wird. Früher wurde er, wie auch die kleinen, meist rötlichen, geruch-
und geschmacklosen eiförmigen Steinfrüchte des Balsambäumchens viel
arzneilich benutzt. Der griechische Geschichtschreiber Diodorus Siculus
schreibt um 50 v. Chr.: „In einem[S. 330] Tale Syriens wächst der Balsam und
liefert bedeutenden Gewinn, weil er außer dort nirgends in der ganzen
Welt gefunden wird und doch von den Ärzten sehr gesucht ist.“ Und der
25 n. Chr. verstorbene weitgereiste griechische Geograph Strabon sagt:
„Außer an der Küste des Sabäerlandes wird in der Nähe von Jericho, in
einer gut bewässerten Gegend, der Balsam aus einem Strauche gewonnen,
in dessen Rinde man Einschnitte macht. Den ausfließenden schleimigen
Saft fängt man in Gefäßen auf. Er heilt Kopfschmerzen wunderbar
schnell, tut den Augen wohl und ist um so teurer, weil er hier allein,
und zwar in Gärten, gewonnen wird.“ Plinius berichtet uns, daß er
wegen seines hohen Preises viel verfälscht werde, und daß außer dem
feinen, wohlriechenden, durch dreimaliges Ritzen im Laufe des Sommers
ausfließenden Saftbalsam (opobalsamum) der geringere, durch
Auskochen von abgeschnittenen Stücken des Strauches in Wasser gewonnene
Holzbalsam (xylobalsamum) in den Handel komme; letzterer werde
hauptsächlich unter Salben gekocht. Auch Dioskurides und Tacitus
berichten ausführlicher über ihn.
An Stelle dieses sehr seltenen und teuren Balsams, der seit der Zeit,
da das Morgenland in die Hände der Muhammedaner gefallen war, nur
schwierig zu haben war, wurde nach der Entdeckung der Neuen Welt
der schon vor der spanischen Invasion von den Indianern benutzte
Perubalsam im 16. Jahrhundert durch eine päpstliche Verordnung
zum offiziellen Chrisma der katholischen Kirche erhoben. Bei der
Eroberung Zentralamerikas durch die Spanier im Jahre 1530 wurde
dieser Balsam dort als Wundheilmittel im Gebrauch vorgefunden. Er
kam dann mit anderen Waren durch den peruanischen Hafenplatz Callao
nach Spanien und erhielt so den Namen balsamum peruvianum,
obschon er niemals in Peru, sondern weiter nördlich in Südamerika bis
Mexiko gewonnen wird. In 300–700 m über dem Meer gelegenen
Bergwäldern eines als Costa del Balsamo, d. h. Balsamküste benannten
schmalen Küstenstriches der zentralamerikanischen Republik San
Salvador wächst die Stammpflanze, Myroxylon pereirae, in Form
eines bis 20 m hohen immergrünen Baumes aus der Familie der
Schmetterlingsblütler mit kurzem, sich schon 2–3 m über der
Erde in wenige aufstrebende Äste teilendem Stamm, unpaariggefiederten
Blättern, lockeren Blütentrauben und bis 10 cm langen,
3 cm breiten Hülsen, in denen die ansehnlichen Samen zwischen
zwei mit dickflüssigem, schwachgelblichem Balsam gefüllten Hohlräumen
liegt. Aus letzteren wird der weiße Perubalsam gepreßt, der nicht
in den Handel gelangt,[S. 331] aromatisch nach Vanille riecht und bitter
aromatisch schmeckt. Der dunkelbraune, klare, in dünner Schicht
rubinrot durchscheinende, dickflüssige, nicht fadenziehende,
offizinelle Perubalsam wird aus den zwischen Rinde und Holz gelegenen
Balsambehältern durch stellenweise Entrindung der Basis des Stammes zu
Ende der Regenzeit in der Weise gewonnen, daß die entrindeten Stellen
zuerst während 4–5 Minuten durch Daranhalten von Fackeln geschwelt
werden. Dann legt man auf die entblößte Holzfläche, an der der Balsam
als anfänglich hellgelber, dicker Saft heraussickert, Zeuglappen, aus
denen, wenn sie damit getränkt sind, der Balsam durch Pressen und
Auskochen mit Wasser gewonnen wird. Eine geringere, dickflüssigere
Sorte wird durch Auskochen der losgelösten Rinde gewonnen. Dieses
Verfahren wird mehrmals während vier Wochen wiederholt, so daß ein
Baum vom 10. Jahre an 30 Jahre hindurch jährlich etwa 2,5 kg
Balsam liefert. Die Bäume besitzen eine erstaunliche Lebenskraft und
gehen selbst bei übertriebener Anzapfung kaum je ein, wenn nur die
Wunden durch Überstreichen mit Lehm gegen das Eindringen von Pilzen und
Insekten geschützt werden. Der wichtigste Bestandteil des Perubalsams
ist das Cinnamein oder Perubalsamöl, das zu 62–64 Prozent nebst freier
Zimtsäure und Vanillin, auch Peruviol, einem honigartig riechenden
Alkohol, darin enthalten ist. Er wird in der Medizin äußerlich und
innerlich in der verschiedensten Weise verwendet und spielt auch in der
Parfümerie eine sehr wichtige Rolle. 1565 beschrieb ihn zuerst Monardes
(1493–1578) und 1576 erhielt Philipp II. einen genauen Bericht über
dessen Gewinnung durch Don Diego. Anfangs kosteten 30 g hundert
Dukaten. Erst zu Ende des 16. Jahrhunderts, so beispielsweise 1582 in
der Arzneitaxe von Worms, findet er sich unter seinem jetzigen Namen in
den deutschen Apotheken. Im Jahre 1861 wurde der Perubalsambaum, der,
wie Cortez 1522 an Kaiser Karl V. berichtete, schon im alten Mexiko
in den berühmten königlichen Gärten von Hoaxtepec bei der Hauptstadt
Mexiko nebst anderen Arzneipflanzen kultiviert wurde, auch in den
Tropen der Alten Welt, nämlich auf Ceylon und Java, eingeführt.
Von einem dem vorigen sehr nahe verwandten Baum Südamerikas, der
besonders im unteren Stromgebiet des Magdalena in Kolumbien, auch
unweit der Stadt Tolu in Venezuela und westlich von diesen Gegenden in
den Wäldern zwischen den Cauca und dem Sinu heimisch ist, Myroxylon
toluifera, wird der Tolubalsam gewonnen, indem der Stamm
an zahlreichen Stellen V-förmig einge[S. 332]schnitten, an der Basis
des Einschnittes angebohrt und der heraussickernde Balsam in kleinen,
vor der Öffnung befestigten Gefäßen aufgefangen wird. Er wird dann, in
Schläuche von rohen Häuten gesammelt, an die Küstenplätze geschafft und
hier in Blechbüchsen eingefüllt. Im frischen Zustande ist er braungelb,
dickflüssig, in dünnen Schichten durchsichtig. Später erhärtet er zu
einer braunroten, in der Hand erweichenden Masse, welche erwärmt einen
vanille- und benzoëartigen Wohlgeruch ausströmt und einen aromatischen,
säuerlichen, nur wenig scharfen Geschmack besitzt. Er besteht aus 80
Prozent eines harzartigen Esters von Zimt- und Benzoësäure nebst diesen
Säuren in freiem Zustande und wird als Arznei innerlich und äußerlich,
besonders aber in der Parfümerie angewandt. Monardes erwähnt seine
Herkunft aus der Provinz Tolu zwischen Cartagena und Nomen Dei; 1581
brachte ihn Clusius von London mit nach Wien. Er kam mit dem Perubalsam
durch die Spanier nach Europa und war schon im 17. Jahrhundert in
England und Deutschland verbreitet.
Ebenfalls von einer stattlichen, bis 30 m und mehr hohen
Leguminose Südamerikas mit paariggefiederten, lederigen, durchscheinend
punktierten Blättern stammt der Kopaivabalsam, der seit alter
Zeit von den Indianern als Wundbalsam angewandt wurde, bis ihn im Jahre
1600 ein portugiesischer Mönch in Brasilien entdeckte. Seit dem ersten
Drittel des 17. Jahrhunderts steht er in Europa im Gebrauch; 1636
ist er als Balsamum copaeyvae in der Amsterdamer Pharmakopoe
angeführt. Er kommt in großen Mengen aus dem ganzen nördlichen
Südamerika in den Handel. Die Stammpflanze ist meist Copaiba
officinalis; deren Holzkörper ist von bis zu 2 cm mächtigen
Kanälen durchzogen, die besonders in ihrem unteren Ende so stark mit
dem flüssigen Harzsafte erfüllt sind, daß der Stamm oft mit lautem
Knall berstet und lange Sprünge entstehen, aus denen dann der Balsam
austritt. Es wurde festgestellt, daß diese durch eine nachträgliche
Auflösung von Zellgewebe entstandenen Harzgänge bis zu 50 kg
Harzsaft enthalten können. Die Harzsammler verlassen sich aber nicht
auf diesen freiwilligen Erguß des Harzes, sondern schlagen etwa
60 cm über dem Erdboden mit der Axt tiefe Löcher bis ins Kernholz,
wo sich die Balsamgänge befinden. Darauf wird eine Rinne in das Loch
gesteckt und der klare, ziemlich dicke, gelbbräunliche, eigentümlich
aromatisch riechende Balsam fließt in dicken Tropfen aus. Bisweilen
pausiert der Erguß einige Zeit; nach einiger Zeit wird dann ein
gurgelndes Geräusch hörbar und alsbald findet wieder ein lebhafter
Balsamerguß[S. 333] statt. Als beste Sorte wird der dicke Maracaibo-Balsam
betrachtet, der 60 Prozent ätherisches Öl und den Rest Harzsäuren
enthält. Er befördert die Absonderung der Schleimhäute und dient außer
bei chronischem Lungenkatarrh besonders bei gonorrhoischer Harnröhren-
und Blasenentzündung.
Demselben Zwecke diente viel früher der Kubebenpfeffer,
ein altes indisches und arabisches Gewürz, das aus den vor der
vollständigen Reife gesammelten und durch Trocknen geschrumpften,
balsamisch riechenden, aromatisch scharf bitter, aber nicht brennend
schmeckenden Früchten von Piper cubeba besteht, einer im
malaiischen Archipel heimischen, bis 6 m hohen Kletterpflanze,
die auch auf Java, Sumatra, Westindien und Sierra Leone, meist an den
Schattenbäumen der Kaffeeplantagen emporrankend, kultiviert wird.
Sie enthalten außer Cubebin und Kubebenharzsäure ein hauptsächlich
Kubebenkampfer enthaltendes ätherisches Öl. Ihre harntreibende Wirkung
wird schon vom arabischen Arzte Ibn Sina (Avicenna) um 1006 angegeben.
Vom 12. und 13. Jahrhundert an wurden sie durch Vermittlung der
arabischen Ärzte auch in Europa angewandt, gerieten aber später wieder
in Vergessenheit, bis 1818 ein englischer Arzt, der ihre Verwendung
gegen Gonorrhoe bei den Malaien kennen lernte, sie wieder empfahl. Sie
haben ihren Namen aus dem arabischen kababeh und wurden schon
von Marco Polo beschrieben, der sie auf seinen Reisen auf Sumatra und
Java kennen lernte. Wissenschaftlich bestimmt wurde die Pflanze erst
durch Karl von Linnés Sohn im Jahre 1781. Kubebenöl war 1582 auf der
Frankfurter Messe zu haben, und die Kubeben sind 1609 im Inventar der
Ratsapotheke in Braunschweig angeführt. Das Cubebin wurde 1839 von
Soubeiron und Capitaine zuerst dargestellt.
Ganz neuen Datums ist die Verwendung des gegen dieselben Affektionen
gegebenen Sandelholzöls, das aus dem Kernholz des in den
trockenen Teilen Vorderindiens in 600–1000 m Höhe im Gebirge
wachsenden, 6–10 m hohen, dichtbelaubten, immergrünen
Sandelbaumes (Santalum album) gewonnen wird. Der Baum, der jetzt
außer in fast ganz Indien besonders auf den Sandelholz-Inseln des
indischen Archipels (Sumba, Timor, Flores, Sumbava, Lombok, Bali usw.)
kultiviert wird, gibt, wenn er ausgewachsen im Alter von 20–40 Jahren
gefällt wird, durch langsame Destillation des verkleinerten Holzes mit
Wasserdampf das 80 Prozent Santalol enthaltende dicke, farblose oder
blaßgelbliche Sandelöl, das Chapoteaut zuerst untersuchte.
[S. 334]
Während das Altertum nur den vom 4–7 m hohen Styraxbaume
in Kleinasien und Syrien gewonnenen festen Styrax kannte
und vielfach als Medizin verwandte, wird seit dem 6. Jahrhundert
daneben auch der heute ausschließlich verwendete flüssige Styrax
oder Styraxbalsam aus dem Splint des in Lykien und Karien in
Schälwäldern kultivierten Amberbaumes (Liquidambar orientalis)
durch Auskochen der Rinde mit Wasser und Abpressen gewonnen. Der bis
zu 20 m, meist aber nur 10–14 m hohe, platanenartige
Baum hat ein sehr engbegrenztes Verbreitungsgebiet und liefert aus dem
Vilajet Aidin, wo der Ort Mughla den Mittelpunkt der Styraxgewinnung
bildet, jährlich etwa 40000 kg (aus einem Gebiet von
600 qkm). Er bildet eine graue, undurchsichtige, zähflüssige,
eigenartig nach Benzoë und Perubalsam riechende, aromatisch und etwas
bitter schmeckende Masse, welche außer 36 Prozent Harz Zimtsäureester,
Styracin, Cinnamein und Benzoësäure enthält. Der Styraxbalsam wird
außer als billigerer Ersatz des teuren Perubalsams zu innerlichem und
äußerlichem Gebrauche in der Medizin, besonders in der Parfümerie
gebraucht.
Der ausschließlich im amerikanischen Handel befindliche Styraxbalsam
der Neuen Welt wird aus dem 9–12 m hohen, in Mittelamerika
und als Charakterbaum im ganzen atlantischen Nordamerika wachsenden
amerikanischen Amberbaum (Liquidambar styraciflua) mit tief
gelappten Blättern durch Auskochen des Holzes alter Stämme gewonnen.
Neuerdings wird dieser Baum vielfach auch bei uns als Zierbaum
angepflanzt und erträgt sehr gut unsere Winter, wenn er einmal eine
bestimmte Höhe erreicht hat.
Als ebensolches krankhaftes Produkt wie der Styraxbalsam fließt aus
dem Stamme verwundeter Benzoëbäume (Styrax benzoin) in Siam und
auf Sumatra das anfangs milchige, an der Luft zu einer rötlichgelben,
aromatischen Masse erhärtende Benzoëharz aus, das einen
balsamischen, reizenden Geschmack hat und beim Kauen an den Zähnen
haftet. Und zwar geben ältere Bäume eine dunklere Benzoë als jüngere.
Die beste Sorte kommt aus dem äußersten Nordosten der Shanstaaten am
linken Ufer des Mekong. Dort in Siam wird die Rinde des mittelhohen
Baumes durch Längsschnitte und Losheben der Rinde so bearbeitet, daß
sich das Harz während zweier Monate zwischen Holz und Rinde ergießt und
sich hier ansammelt. Auf Sumatra schneidet man viermal im Jahre die
Rinde jüngerer Bäume durch gerade oder schräge Längsschnitte an und
sammelt den heraustretenden[S. 335] weißen, alsbald erhärtenden Milchsaft nach
einiger Zeit, um ihn in Form von größeren, zuweilen verklebten Körnern
von muscheligem Bruche in den Handel zu bringen. Er enthält bis über 20
Prozent freie Benzoësäure und 70–80 Prozent Benzoëharz und dient als
schleimlösendes Mittel bei chronischen Katarrhen, als gelind reizendes
Mittel bei torpiden Geschwüren, zu Räucherungen, Zahnwässern und
besonders reichlich in der Kosmetik. Die erste aus Sumatra stammende
Benzoë wurde 1461 unter anderen Kostbarkeiten dem Dogen von Venedig vom
Sultan von Ägypten als Geschenk gesandt. Die arabischen Ärzte machten
deren Verwendung zuerst im Abendlande bekannt. 1521 wird sie unter den
in Venedig verkauften Drogen aufgeführt und 1571 als Asa dulcis
in der Eßlinger Arzneitaxe erwähnt. Die Siam-Benzoë kommt erst seit
1853 nach Europa.
Seit alter Zeit wird in ganz Ostasien der eingedickte wässerige
Extrakt verschiedener gerbstoffreicher Hölzer als Katechu
beim Betelkauen und als Arznei verwendet. Der Ausdruck bedeutet im
Indischen Baumsaft und wird von den Eingeborenen meist nur als Kat
bezeichnet. Diese Droge läßt sich erst seit 1514 als Kacho in der
europäischen Literatur nachweisen und wird seit der Mitte des 17.
Jahrhunderts in deutschen Apotheken gehalten. Damals, als sie aufkam,
war sie einer der teuersten Stoffe der Arzneitaxe und wurde, wie
schon der Name terra japonica sagt, für eine Mineralsubstanz
gehalten. Erst seit 1827 erscheint sie in bedeutenderen Mengen auf
dem europäischen Markt, und zwar als Pegu-Katechu, der besonders
aus der Provinz Pegu in Britisch-Birma über Rangun in den Handel
gelangt. Erst später kam der Gambir-Katechu auf, der über Singapur
nach London und Hamburg verschifft wird. Die ersten bestimmten Daten
über diese Droge stammen aus dem Jahre 1780. Der Pegu-Katechu wird von
der Katechu-Akazie (Acacia catechu), einem 4–8 m hohen
Baum Vorder- und Hinterindiens, wie auch des tropischen Afrika in der
Weise gewonnen, daß das in kleine Stücke zerhackte Kernholz derselben
etwa 12 Stunden lang mit Wasser in irdenen Töpfen ausgekocht wird.
Der dunkelbraune Auszug wird dann in Schalen so weit eingedampft,
daß er nach dem Ausgießen in der Form erstarrt. Je nachlässiger
das Eindampfen und Trocknen betrieben wird, um so dunkler wird
er. Er schmeckt zusammenziehend bitter und enthält bis 54 Prozent
Katechugerbsäure und 17 Prozent Katechin oder Katechusäure. Der gelbe
Gambir-Katechu dagegen wird aus den jungen Trieben und Blättern von
Uncaria gambir, einem kletternden Strauch[S. 336] Hinterindiens und der
Sundainseln aus der Familie der Rubiazeen oder Krappgewächse, der an
den Küsten der Halbinsel von Malakka, auf Sumatra, Java und neuerdings
auch auf Ceylon kultiviert wird, ebenfalls durch Auskochen in Wasser,
aber meist in gußeisernen Pfannen gewonnen und nach dem Eindampfen
gleicherweise in Formen, meist flachen Holzkästen, getrocknet. Er ist
gelb bis hellbraun, wird hauptsächlich von den Eingeborenen zum Kauen
mit gelöschtem Kalk, einem Stückchen Arekanuß und einem Blatt des
Betelpfeffers benutzt und enthält bis 47 Prozent Katechugerbsäure und
20 Prozent Katechin, daneben weniger Umsetzungsprodukte des letzteren
als der Pegu-Katechu. Beide dienen als zusammenziehende, stopfende
Mittel, daneben besonders der Gambir-Katechu in der Technik zum Gerben
und Färben.
Ähnlich dem Katechu, aber weniger in der Medizin, dafür besonders
in der Gerberei und Färberei verwandt, ist der Kino, eine
dunkelrotbraune bis schwärzliche, in dünnen Splittern rubinrot
durchscheinende Masse von stark zusammenziehendem Geschmack und den
Speichel rot färbend, die durch Einschnitte in die Rinde verschiedener
tropischer Bäume gewonnen wird. Unter diesem Namen kam zuerst um
1733 der eingetrocknete rote Saft des westafrikanischen Baumes
Pterocarpus erinaceus, eines Schmetterlingsblütlers aus
Senegambien, über London in den Handel. Im Jahre 1811 wurde dieser Name
auf den Saft des nahe mit diesem verwandten indischen Pterocarpus
marsupium übertragen, der an der Malabarküste wächst und dort von
den Eingeborenen in der Weise angezapft wird, daß etwas über dem Boden
rinnenförmige Einschnitte in die Rinde gemacht werden, aus denen ein
zäher, roter Saft ausfließt, der aufgefangen oder, am Stamme erhärtet,
gesammelt und an der Sonne vollends getrocknet wird. In demselben Jahre
1811 wurde unter demselben Namen der dem vorigen sehr ähnliche Saft
verschiedener Eukalyptusarten Australiens in England eingeführt, ebenso
neuerdings aus Hinterindien der von Pterocarpus indicus und
wallichii, aus Bengalen der von Butea frondosa und aus
Westindien der von Coccoloba uvifera. Der Malabarkino enthält
außer Kinoin und Kinorot bis 85 Prozent Kinogerbsäure.
Tafel 129.

(Stich von Ph. Gallo nach Joh. Stradanus.)
Darstellung der medizinischen Anwendung des Guajakholzes gegen die als
Franzosenkrankheit bezeichnete Syphilis.
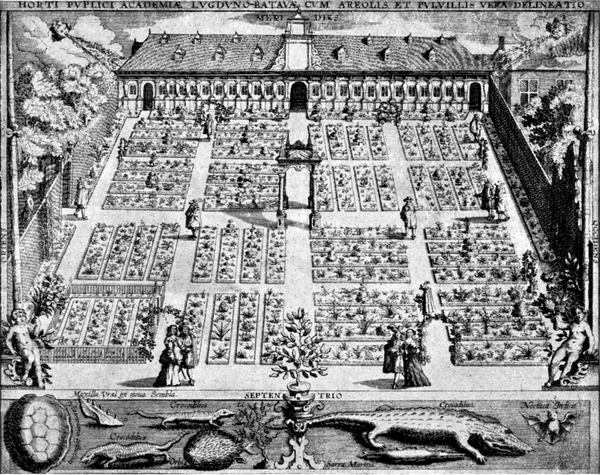
Der Botanische Garten zu Leiden.
(Nach einem in der graphischen Sammlung zu München befindlichen
Stiche.)
Tafel 130.

Ein Kampferbaum im Botan. Garten zu Tokio in Japan.
(Nach einer in der Sammlung des Botan. Institutes der Universität Wien
befindlichen Photogr. von H. Hallier.)

Stinkasant (Asa foetida).
(Nach einer Photographie aus dem Botanischen Garten zu München.)
Ihm ähnlich, nur leichter zerbrechlich und schneller in Wasser
auflösbar ist der Extrakt der peruanischen Ratanhiawurzel, die
außer Ratanhiarot bis über 40 Prozent Ratanhiagerbsäure enthält und
gleicherweise als Adstringens in der Medizin, wie auch zum Gerben
verwendet wird. Ratanhia nannten die Indianer des altperuanischen[S. 337]
Quitschastammes die relativ große Wurzel eines in Peru wie in dem
angrenzenden Brasilien und Bolivien auf sandigen Abhängen der
Kordilleren in 1000–2500 m Höhe wachsenden Halbstrauchs aus
der zu den Leguminosen gehörenden Familie der Caesalpinieen, die sie
seit langer Zeit als Heilmittel verwandten. Sie benutzten sie auch
als ein das Gebiß konservierendes Mittel zum Reinigen der Zähne, wie
alle Naturvölker Wurzeln oder Zweige bestimmter Holzarten zum meist
fleißig von ihnen geübten Zahnputzen in Anwendung bringen. Als solches
Zahnputzmittel lernte der spanische Botaniker Ruiz die Ratanhiawurzel
bei den Frauen von Huanuco und Lima kennen und brachte sie nach
Spanien, von wo sich ihre Anwendung bald über Frankreich, England und
Deutschland verbreitete. Obschon bereits 1805 Wildenow in Deutschland
die Aufmerksamkeit der Ärzte auf diese neue Droge lenkte, wurde sie
doch erst um 1818 durch die Empfehlungen von Jobst, von Klein und
anderen bei uns allgemeiner. Als beste Ware kommt von Payta und Callao
in Peru aus die von wildwachsenden Pflanzen gegrabene und getrocknete
Wurzel in bis 60 cm langen und bis 1,5 cm dicken Stücken,
neuerdings auch der in der Heimat der Pflanze selbst aus der frischen
Wurzel durch Auskochen in Wasser gewonnene Extrakt in unförmlichen
braunroten, außen matten, innen aber glänzenden Stücken in den Handel,
um innerlich bei Diarrhoen, Nierenblutungen, äußerlich zu Mund- und
Gurgelwässern zu dienen.
Von Süd-, aber auch Mittelamerika kam im 16. Jahrhundert ebenfalls
die Sarsaparillwurzel von verschiedenen Smilaxarten aus der
Familie der Liliengewächse als sehr geschätztes Heilmittel nach
Europa, um hier als Mittel gegen die von den spanischen Soldaten von
Amerika her eingeschleppte und bald ganz außerordentliche Verbreitung
findende Syphilis das bis dahin hauptsächlich gebrauchte Guajakholz zu
verdrängen. Das Wort stammt vom spanischen zarza parilla, d. h.
stachelige Schlingrebe, galt ursprünglich der in Südeuropa heimischen
Smilax aspera und wurde später auf die amerikanische Pflanze
übertragen, deren Wurzel zuerst der Spanier Pedro de Cieza de Leon,
der von 1535–1550 in Südamerika weilte und sie in der Provinz Guajakil
in Ekuador kennen lernte, als Heilmittel empfahl. Bald darauf ist auch
sein Landsmann Monardes (1493–1578) in Mexiko mit ihr bekannt geworden
und lernte etwas später eine bessere Sorte aus Honduras kennen, die
heute die allein offizinelle bei uns ist. Er wußte schon anzuführen,
daß die Wurzeln der Sarsaparille sehr weit in die Erde gehen und
daß man oft mannstief graben muß,[S. 338] um sie zu erlangen. Sie werden
fast ausschließlich von wildwachsenden Pflanzen gesammelt, und zwar
hauptsächlich im Hinterland der Westküste von Guatemala. Die Pflanze
bevorzugt feuchtes, flaches, etwas sumpfiges, den Überschwemmungen
der Flüsse ausgesetztes Waldland und läßt ihre stacheligen, verworren
durcheinander wachsenden Stengel an den Bäumen emporklettern. In der
trockenen Jahreszeit Januar bis Mai werden die Wurzeln ausgegraben, gut
gewaschen und an der Sonne getrocknet. Sie gehen von mächtigen Rhizomen
aus, sind bei einer Dicke von 7–8 mm bis 2 m lang,
gelbbraun, längsfaltig und zeigen auf dem Querschnitt eine mächtig
entwickelte, wie das zentrale Mark meist weiße, seltener blaßrötliche
Rinde und einen gelblichen Holzring. Sie sind fast geruchlos, schmecken
zuerst schleimig, dann kratzend und enthalten drei Sapotoxine:
Parillin, Smilasaponin und Sarsasaponin, welch letzteres am stärksten
abführend und als solches angeblich blutreinigend wirkt. Aus dieser
Droge wurde das einst weltberühmte Zittmannsche Dekokt gegen Syphilis
bereitet, das aber heute kaum mehr zur Verwendung gelangt, da wir in
den Quecksilberpräparaten und neuerdings in einem Arsenderivat viel
wirksamere und angenehmer einzunehmende Mittel haben.
Bevor diese Droge aufkam, galt zu Anfang des 16. Jahrhunderts auch
in Europa wie in Amerika, wo sie schon längst von den Indianern in
diesem Sinne gebraucht wurde, das harzdurchtränkte Guajakholz
als bestes Mittel gegen die Syphilis. Es stammt hauptsächlich von
der Zygophyllazee Guajacum officinale, einem bis 12 m
hohen Baum des nördlichen Südamerika und der Antillen mit intensiv
blauen Blüten und kommt in Form von oft mehrere Zentner schweren, vom
gelblichweißen Splint befreiten Stücken von dunkelgrünlichbraunem
Kernholz in den Handel. Außer verschiedenen Harzen, Guajak- und
Guajakonsäure enthält es Saponinsäure und Saponin, welch letzteres
die hauptsächlich wirksame Substanz ist, aber noch reichlicher als im
Kernholz im Splint und am allerreichlichsten in der Rinde vorhanden
ist, so daß eigentlich letztere vor ersterem weit den Vorzug verdiente.
Guajak ist die hispanisierte indianische Bezeichnung der Pflanze, die
Fernandez de Oviedo 1526 zuerst beschrieb und von der er angab, daß
1508 die erste Sendung des Holzes nach Spanien gelangte, um gegen
die dort herrschende Syphilis zu dienen. Bald breitete sich ihr Ruhm
über ganz Europa aus. Schon 1517 rühmte sich in Deutschland der
kaiserliche Leibarzt Leopold Poll, 3000 Menschen mit dem Guajakholze
von dieser damals äußerst bösartig auftretenden Krank[S. 339]heit, die alle
Volksschichten erfaßt hatte, geheilt zu haben. Auch der 1523 auf
der Insel Ufenau im Zürcher See an den Folgen dieser ansteckenden
Krankheit verstorbene Ulrich von Hutten machte vier Jahre vor seinem
Tode angeblich mit Erfolg eine Guajakkur in Augsburg durch, über
die er in seiner Schrift „De Guajaci medicina et morbo gallico
liber unus“ Mitteilung macht. 1525 beschaffte der Rat der Stadt
Straßburg 107 kg des Holzes für eine energische Behandlung
der an der Lustseuche erkrankten Bürger. In seiner zeitgenössischen
Chronik berichtet der Franzose Guiffrey von seinem Könige Franz I.,
daß dieser selbst mehrere Jahre nacheinander unter Führung eines
zuverlässigen Kapitäns eine Gallion — es waren dies die größten
Segelschiffe des Mittelalters, die besonders zur Kriegführung dienten
und stark armiert waren, im Gegensatz zu den kleinen Karavellen, mit
denen beispielsweise Kolumbus vom spanischen Seehafen Palos ausfuhr, um
nach Indien zu segeln, wobei er, ohne es zu wissen, Amerika entdeckte
— nach Brasilien sandte, um jeweilen eine Ladung Guajakholz zur
Behandlung seiner eigenen und seiner Hofleute Syphilis zu holen. Nur
einmal, im Jahre 1543, habe er bei einem Aufenthalt in La Rochelle von
normannischen Korsaren eine von ihnen erbeutete Schiffsladung gekauft,
in der sich unter anderem auch „du gayet ou palme sainte“
gefunden habe.
Im Jahre 1545 beschrieb Brasavela in seiner in Venedig erschienenen
Drogenkunde bereits drei Sorten des Holzes, worunter auch das von der
westindischen Insel San Juan, dem heutigen Puerto Rico, stammende
Palo santo oder Lignum sanctum, d. h. heiliges Holz von
Guajacum sanctum, das heute von den Bahamainseln und aus Florida
in den europäischen Handel gelangt, um vornehmlich zur Tischlerei und
Drechslerei zu dienen. In der Folge wurde letztere Sorte, so schon
1582 auf der Messe in Frankfurt am Main, als Guajacum parvum,
d. h. kleiner Guajak von dem von G. officinale stammenden
Guajacum magnum, dem großen Guajak, unterschieden. 1573 fand
der Augsburger Arzt Leonhard Rauwolf auf dem Basar der syrischen Stadt
Aleppo Guajakholz neben Chinawurzel als Heilmittel gegen Syphilis
feilgeboten. Die Arzneitaxe von Wittenberg brachte 1599 Lignum
und Cortex Guajacis (Holz und Rinde). Ein Jahrhundert hielt
der Ruf dieser Droge als Heilmittel gegen die Syphilis an, um dann,
wie gesagt, von der Sarsaparillwurzel verdrängt zu werden. Als man
als Hauptbestandteil des Holzes das darin enthaltene Harz erkannte,
benutzte man von der Mitte des[S. 340] 17. Jahrhunderts an vielfach an dessen
Stelle das Guajakharz, das seltener freiwillig ausfließt, sondern meist
durch Einschnitte in den Stamm mit nachherigem Schwelen gewonnen wird.
Als solches kommt es in haselnuß- bis walnußgroßen, dunkelrotbraunen,
außen schmutzig grünlich bestäubten Körnern in den Handel, während das
durch Auskochen des zerkleinerten Kernholzes hergestellte Präparat in
unregelmäßigen, mehr schwarzgrünen Massen verkauft wird. Letzteres
schmeckt unangenehmer und länger anhaltend kratzend als das vorige und
dient heute nur noch als Reagens für Fermente und von Blut.
Ebenfalls gegen Syphilis wurde eine Zeitlang das mittelamerikanische
Quassiaholz verwendet, das schon zu Beginn des 18. Jahrhunderts
von den aus Afrika importierten Negersklaven unter dem Namen
quasci in Surinam gegen die bösartigen epidemischen Fieber
des Landes gebraucht wurde. Nach Fermins Angaben sollen bereits
1714 die großen scharlachroten Blüten des Baumes noch vor dem Holz
als geschätztes Magenmittel von den Eingeborenen benutzt worden
sein. Nach Albrecht von Hallers Zeugnis besaß der Drogist Seba in
Amsterdam schon 1730 das Quassiaholz, und 1742 soll es bereits ein
ganz gemeines Medikament gewesen sein. Das gelblichweiße, dichte,
geruchlose Quassienholz stammt von einem kleinen, auf den Antillen
und im nördlichen Südamerika heimischen Baum aus der Familie der
Simarubazeen mit gefiederten Blättern und länglichen, schwarzen
Steinfrüchten, dem Karl von Linné 1763 nach der Bitterkeit seines
Holzes den wissenschaftlichen Namen Quassia amara gab. Er
wird außer in seiner Heimat auch in einigen Tropenländern der Alten
Welt kultiviert und liefert das echte oder surinamsche Quassiaholz,
während das leichtere, weniger dichte Jamaika-Quassiaholz von der
verwandten, viel höheren und stattlicheren, in Westindien, besonders
Jamaika, heimischen Picrasma excelsa stammt. Beide schmecken
stark bitter, und zwar ersteres durch den Gehalt des von Winkler 1834
zuerst dargestellten Bitterstoffs Quassiin, letzteres dagegen durch das
ähnliche Picrasmin; der ihn enthaltende wässerige Auszug dient, wie in
seiner Heimat, so auch bei uns als appetitanregendes Mittel. Er besitzt
schwach narkotische Eigenschaften und diente früher als Bittermittel in
der Bierbrauerei, ebenso als Fliegengift.
In gleicher Weise früher als Heilmittel gegen Syphilis, während heute
hauptsächlich noch als Blutreinigungsmittel verwendet, wurden die
im Herbst ausgegrabenen, bis 20 cm dicken, ästigen, holzigen
Wurzeln der im östlichen Nordamerika, besonders in Florida, Virginien,[S. 341]
Karolina und Pennsylvanien heimischen Lorbeerart Sassafras
officinalis. Als die Spanier 1512 unter Juan Ponce de Leon
Florida entdeckten, das sie, wie schon Kolumbus die südlicher davon
gelegenen Länder, nicht für eine neue Welt, sondern für einen Teil
des asiatischen Gewürzlandes Indien hielten, weshalb diese Gebiete
auch den Namen India erhielten, der erst später zur Unterscheidung vom
eigentlichen Indien in Westindien präzisiert wurde, hielten sie die
bis 30 m hohen diözischen Sassafrasbäume anfangs für den von
ihnen so sehnlichst erwünschten Zimt. Und der sie begleitende Mönch
Monardes, der später diese Entdeckungsreise beschrieb, sagt, daß das
Holz auch wirklich nach Zimt gerochen habe, was durchaus nicht der
Fall ist. Was man zu finden hofft, das bildet man sich schließlich ein
gefunden zu haben! Noch in späterer Zeit bezeichneten die Portugiesen
die Sassafrasrinde in Fortsetzung ihres holden Wahnes, es mit der
Zimtrinde, die übrigens von einer nahe verwandten Lorbeerart stammt,
zu tun zu haben, als canela. Die Pflanze, deren Holz schon von
den Indianern Floridas als Fiebermittel benutzt wurde, erhielt dann
später, als sie einsahen, daß sie nicht die Zimtpflanze sei, von den
Spaniern die Bezeichnung Sassafras vom spanischen salsafras =
Saxifraga, weil man ihr dieselbe Wirkung, Blasensteine zu zerkleinern,
zuschrieb, wie dem Steinbrech. Nach dem fenchelartigen Geruch und
süßlich aromatischen Geschmack erhielt die bereits um die Mitte des 16.
Jahrhunderts von Spanien aus über ganz Europa ausgebreitete holzige
Wurzel des Sassafras in Deutschland die Bezeichnung Fenchelholz. Bei
den Indianern Floridas hieß das Holz pavanne, deshalb wird
es in deutschen Apotheken, z. B. 1582 in Frankfurt a. M. und 1587
in Hamburg, als Lignum Pavanum seu Floridum oder Lignum
Sassafras aufgeführt. Schon 1598 kannte man einen Spiritus
ligni Sassafras. Der Holzteil und mehr noch die Rinde der Wurzel
enthalten bis 9 Prozent eines frisch destilliert farblosen, später aber
durch Aufnahme von Sauerstoff aus der Luft gelb bis braun werdenden
ätherischen Öles, das 80 Prozent Safrol, 10 Prozent Phellandren, 6,8
Prozent Rechtskampfer, weiter Eugenol, Cadinen usw. enthält. In den
Vereinigten Staaten von Nordamerika wird aus dem Wurzelholz mit der
Rinde ein dort viel verwendetes Fluidextrakt hergestellt, während das
daraus destillierte ätherische Öl sehr beliebt zum Aromatisieren von
Seifen, Getränken und Tabak ist.
Sehr viel wichtiger für die Arzneikunde und namentlich die Technik
als diese nordamerikanische Lorbeerart ist die gleichfalls dem Zimt
sehr nahe verwandte ostasiatische Art, der Kampferbaum (Cinnamomum[S. 342]
camphora), dessen Produkt, der Kampfer, ein altes
chinesisches Heilmittel ist. Aber nicht dieses ostasiatische, sondern
ein ähnliches südasiatisches Produkt, der Sumatra- oder Borneokampfer,
der in den Stämmen eines hohen Baumes Sumatras und Borneos aus der
Familie der Dipterocarpazeen (Dryobalanops camphora), der auch
der ostindische Kopalbaum (Vateria indica) angehört, in eigenen
Behältern in oft mehreren Pfund schweren Stücken abgesetzt wird, war
schon im Altertum in ganz Südasien als Heilmittel verbreitet und
beliebt. Dieser südasiatische Kampfer war als wertvolle Arznei auch in
China und Japan bekannt, wo er heute fast ausschließlich verbraucht und
viel höher geschätzt wird als der bei uns von dort her in den Handel
kommende Laurineenkampfer. Unter der Sanskritbezeichnung kapura,
d. h. weiß, gebrauchten ihn die alten Inder. Nach der Zeit der
Völkerwanderung war er von Indien aus nach Westasien gelangt, wo ihn
der griechische Arzt Aētios aus Amida in Mesopotamien im 6. Jahrhundert
unter dem Namen kaphura als kostbares Arzneimittel erwähnt. Auch
den Arabern zur Zeit Muhammeds war er bekannt; denn er wird im Koran
als ein Kühlungsmittel der Getränke der Seligen im Paradiese erwähnt.
Mit der von ihnen kamfur genannten Droge machten dann die
arabischen Ärzte das Abendland bekannt, wo der Dipterocarpazeenkampfer
im 11. Jahrhundert in Italien und im 12. Jahrhundert in Deutschland
als Mittel gegen Gicht und Rheumatismus verwendet wurde. So erwähnen
ihn um 1070 der jüdische Arzt Simon Seth und um 1150 die gelehrte
Äbtissin Hildegard im Kloster Rupertsberg bei Bingen. 1293 lernte
der venezianische Kaufmann Marco Polo auf seiner mit Vater und Onkel
unternommenen Rückreise von China auf Borneo und Sumatra den dort
heimischen Kampferbaum selbst kennen, wie er in seinem Reisebericht
erzählt. Zur Zeit des Paracelsus (1493–1541) war der davon gewonnene
Kampfer in Deutschland allgemein als Arzneimittel im Gebrauch.
Erst zu Beginn des 17. Jahrhunderts kam in Europa der ostasiatische
Kampfer an Stelle des teueren Sumatra- und Borneokampfers auf, indem
inzwischen die Chinesen, von der Gewinnung jenes durch Fällen, Spalten
und Auslesen der Dryobalanopsbäume veranlaßt, dieselbe Droge von
einem einheimischen Baume, eben dem echten Kampferbaum, zu gewinnen
trachteten, was denn auch gelang. Dieser echte Kampferbaum ist
ein an der chinesischen Küste von Cochinchina bis zur Mündung des
Jang-tse-kiang und den vorgelagerten Inseln bis Südjapan wachsender,
8–10 m hoher, lindenähnlicher Baum mit brauner,[S. 343] runzliger Rinde
und knorrigen Ästen. Er hat immergrüne, eirunde, glänzende Blätter,
kleine, weiße, in Rispen stehende Blüten und dunkelrote, erbsengroße
Beeren mit pfefferähnlichem Samen. Alle Teile des Baumes, besonders
aber die Wurzeln, riechen und schmecken stark kampferartig. Er verlangt
ein warmes Klima und möglichst feuchte Luft. Besonders auf Formosa
und in ganz Südjapan wird er zur Gewinnung von Kampfer benutzt und
deshalb in ausgedehnten Waldungen gezogen. Junge Bäume sind für die
Kampferausbeutung wertlos. Je älter sie aber werden und je dichter
ihr Holz wird, um so höher steigt in ihnen der Kampfergehalt, bis
er etwa im 100. Jahr ein Maximum erreicht hat. Schon 40–50jährige
Bäume werden zur Kampfergewinnung gefällt. Dabei wurde das Holz,
besonders des Stammes, gespalten und ursprünglich wie beim Sumatra-
und Borneokampferbaum das in Spalten und Klüften ausgeschiedene feste
ätherische Öl ausgekratzt. Bald aber ging man dazu über, das in kleine
Späne geschnittene und zudem durch Klopfen faserig gemachte Holz
einer Destillation mit Wasserdämpfen zu unterwerfen, um den Kampfer
zu gewinnen. Da dieses feste ätherische Öl am reichlichsten in den
Wurzeln und unteren Teilen des Stammes enthalten ist, werden lediglich
diese Teile, außer den Wurzeln noch der Stamm bis etwa in 3 m
Höhe, der meist auf sehr primitive Weise ausgeführten Destillation
unterworfen, wobei der Rohkampfer in Gestalt blaßrötlicher, körniger
Massen mit 20 Prozent flüssigem Kampferöl gewonnen wird. Als solcher
kommt er von Formosa in mit Bleiblech ausgeschlagenen Kisten von
50–60 kg Gewicht verpackt, von Japan dagegen in Bambusröhren oder
Tubbs genannten Holzbottichen von 80 kg in den Handel und wird
in Europa und Amerika, neuerdings auch schon in Japan und Hongkong, in
eigenen Kampferraffinerien durch weitere Sublimation gereinigt.
Der Kampfer, seiner chemischen Beschaffenheit nach ein Keton von der
Formel C10H16O, bildet sich im lebenden Kampferbaum aus
einem ursprünglich im Holz vorhandenen flüchtigen, farblosen Öl, dem
Kampferöl, das in frühzeitig in allen Teilen des Baumes angelegten
Ölzellen gebildet wird und sich später durch Sauerstoffaufnahme — oft
erst jahrelang nach Entstehung des Sekretes — in Kampfer umwandelt,
der dann vorzugsweise in den Spalten und Höhlungen des unteren Teiles
des Stammes zur Ausscheidung gelangt. Das vom rohen Kampfer vor dem
Raffinieren ausgepreßte und durch Zentrifugieren entfernte flüssige,
früher als wertlos beseitigte Kampferöl wird neuer[S. 344]dings auf Safrol
verarbeitet. Der raffinierte Kampfer, der in 1–5 kg schweren,
konvex-konkaven, in der Mitte durchlöcherten Kuchen in den Handel
gelangt, stellt eine weiße, durchscheinende, kristallinisch-körnige,
fettig anzufühlende, bei gewöhnlicher Temperatur allmählich ohne
Rückstand sich verflüchtigende Masse von durchdringendem Geruch
und brennend scharfem, hinterher kühlendem Geschmack dar, das
in der Medizin äußerlich als die Haut reizendes, ableitendes,
schmerzlinderndes Mittel bei rheumatischen Leiden, innerlich in
kleinen Dosen zur Beruhigung, in größeren zur Anregung und Belebung
des Nervensystems, der Atmung und Blutzirkulation, besonders aber in
der Technik als Mottengift und in sehr großem Maße zur Herstellung von
Zelluloid und rauchschwachem Pulver verwendet wird. Japan und Formosa
führen jährlich über 4 Millionen kg Kampfer aus, von denen
etwa 32 Prozent nach Deutschland, 31 Prozent nach Amerika, 22 Prozent
nach Frankreich, 13 Prozent nach England und 2 Prozent nach Indien
gehen. Zum eigenen Kampferöl bezieht Japan noch viel von Formosa, um
ihn bei der Lackbereitung zu verwenden. Bei der großen Wichtigkeit,
die dem Kampfer zukommt, werden zurzeit ausgedehnte Anpflanzungen von
Kampferbäumen von seiten der japanischen und chinesischen Regierungen
gemacht. Schon jetzt liefert die südchinesische Provinz Fo-kien über
120000 kg Kampfer jährlich. Auch werden später Madagaskar,
Ceylon, Deutsch-Ostafrika, Ägypten, Algerien und der Süden der
Vereinigten Staaten von Nordamerika sich an der Produktion beteiligen,
wenn die dort angelegten, sehr gut fortkommenden Kulturen des
Kampferbaumes zur Ausbeutung reif sein werden. Die neuerdings gehegte
Hoffnung, den Kampfer auch aus den Blättern des Baumes gewinnen zu
können, ist bis jetzt nur wenig erfüllt worden.
Außer den bereits erwähnten hat die Neue Welt noch eine ganze
Menge wichtiger Drogen aus dem Pflanzenreiche geliefert, so die
Ipecacuanha- oder Brechwurzel, die heute noch in
reichlichem Maße Verwendung findet. Sie besteht aus der unterirdisch
kriechenden Achse eines niederen Halbstrauchs aus der Familie der
Rubiazeen oder Krappgewächse (Cephaëlis Ipecacuanha) mit
nur 10–30 cm hoch aufsteigenden Stengeln, länglichovalen
Blättern, weißen Blüten und erbsengroßen, blauen Beeren. Sie wächst
in den feuchten, schattenreichen Wäldern Südbrasiliens wild und wird
neuerdings auch auf der Halbinsel Malakka im Schatten einzelner Bäume
kultiviert, um über Singapur in den Handel zu gelangen. Die beliebteste
Sorte wird mit Ausnahme[S. 345] der Regenzeit das ganze Jahr hindurch in
der südbrasilianischen Provinz Matto Grosso gesammelt, indem man
den ziemlich oberflächlich horizontal unter der Erde verlaufenden,
höchstens 5 mm dicken, knotigen Stamm aushebt, aber die an den
Knoten entspringenden, größtenteils zu Stärkemehl aufspeichernden
Reservestoffbehältern gewordenen Wurzeln abschneidet, um sie im Boden
zu belassen oder, falls sie mit herauskamen, wieder einzupflanzen.
Sie bilden dann Adventivknospen, aus denen nach 3–4 Jahren ein neuer
Bestand ausbeutungsfähiger Pflanzen hervorgeht. Die in Abständen von
1 mm von ungleichen, rundlichen Wülsten, den Narben der einst
hier entsprungenen zahlreichen Seitenwurzeln, versehenen unterirdischen
Stammstücke werden so rasch als möglich getrocknet, am Tage der Sonne
ausgesetzt und nachts durch Bedecken vor dem Tau beschützt, und
sind nach 2–3 Tagen versandfähig. In sogenannten Seronnen von
40–42 kg Gewicht werden sie von den Eingeborenen oft Tagereisen weit
auf den Köpfen aus dem Innern an die Küste getragen und gelangen über
Rio de Janeiro nach London zum Verkauf. In 15 cm langen Stücken,
noch häufiger aber fein geschnitten kommen sie in die Apotheken, um
hier meist zur Herstellung der bekannten Ipecacuanha-Aufgüsse verwendet
zu werden. Das wirksame Prinzip ist das 1817 von Pelletier und Magendie
gefundene Emetin neben Cephaëlin und Psychrotin. Es ist zu 4 Prozent
fast nur in der graubraunen Rinde und nur in Spuren im Holzkörper
vorhanden. Das offizinelle Ipecacuanha-Pulver soll 2 Prozent dieser
Alkaloide enthalten.
Diese brechenerregende und expektorierend wirkende Droge hat eine
sehr interessante Geschichte, die es wohl verdient, hier in Kürze
mitgeteilt zu werden. Der Name Ipecacuanha, den uns die Portugiesen
vermittelten, stammt aus der Tupisprache und ist aus i (klein),
pe (am Wege), caá (Kraut), guéne (brechenerregend)
zusammengesetzt, bedeutet also „kleines Kraut, das am Wege wächst und
Brechen erregt“. Die Tupi- und andern Indianer Brasiliens verwandten
sie als Brechmittel. Da sie aber außer ihr noch andere Wurzeln
als solches benutzten und mit dem Worte „pe-caá-guéne“ —
zusammengezogen in pecacuém — bezeichneten, erhielt sie zur
Unterscheidung von den größeren die Benennung i (klein), also
I-pe-caá-guéne. Der portugiesische Volksname der Droge ist aber
nicht Ipecacuanha, sondern Poaya. Zum erstenmal wird sie 1590 vom
portugiesischen Mönch Michael Tristram, der von 1570–1600 in Brasilien
lebte, unter dem Namen Igpecaya oder Pigaya erwähnt; aber erst 1648
wurde sie[S. 346] durch den holländischen Arzt Wilhelm Piso in Europa genauer
bekannt. Auf einer von 1636–1641 unter Führung des Grafen Moritz von
Nassau-Siegen unternommenen Forschungsreise durch Brasilien lernte er
sie kennen und gab dann nach seiner Heimkehr die erste Beschreibung
und Abbildung der Pflanze, die er Ipecacuanha nennt. Gleichwohl war
man über die botanische Stellung der Pflanze noch lange im unklaren.
Réjus hielt sie für eine Art Einbeere (Paris), Moriceau für
eine Art Geißblatt (Lonicera) und der große Karl von Linné für
eine Art Veilchen, weshalb er sie Viola Ipecacuanha nannte.
Erst der portugiesische Marinearzt Dr. Bernardino Antonio
Gomez gab 1801 die nötige Berichtigung über die von ihm in Brasilien
kennen gelernte Stammpflanze. 1804 beschrieb Wildenow die Pflanze als
Cephaēlis ipecacuanha; später zog der Aargauer Müller das Genus
Cephaēlis zu Psychotria.
Größere Aufmerksamkeit erregte die Droge erst zu Ende des 17.
Jahrhunderts. 1672 brachte sie der Arzt Le Gras nach einem dreimaligen
Aufenthalte in Brasilien von dort mit; von ihm erhielt sie der
Apotheker Claquenelle, ebenso Lemery. Dann brachte der Arzt Daliveau
aus Montpellier, der die Pflanze in Brasilien gesehen und dort auch
ihre Verwendung kennen gelernt hatte, Nachrichten über sie mit
nach Europa. 1680 bekam Dr. Afforti von dem aus Brasilien
zurückgekehrten und nach schwerer Erkrankung von ihm geheilten
Kaufmann Garnier zum Dank eine Portion Ipecacuanha unter dem Namen
der brasilischen Ruhrwurzel. Afforti beachtete dieselbe nicht, gab
aber davon dem Studenten Joh. Adrian Helvetius, der damit nach seiner
Etablierung in Reims 1684 sehr gute Kuren bei Ruhr machte. Er erregte
damit weithin in Frankreich Aufsehen, so daß ihm Ludwig XIV. sein als
Geheimnis behandeltes Mittel um 1000 Louisdor abkaufte und ihm dazu
noch ein Privilegium des Alleinverkaufs erteilte. In Deutschland lenkte
besonders Leibnitz die Aufmerksamkeit auf das neue Mittel, über das er
in den Verhandlungen der Leopoldinischen Sozietät der Naturforscher im
Jahre 1696 eine Abhandlung: De novo antidysenterico americano
veröffentlichte. Zwei Jahre später nahm sich Valentini der Droge im
besonderen an, doch ging es noch längere Zeit, bis sie allgemeinere
Verwendung fand. Bis weit in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts
war sie in den Apotheken noch recht selten und dementsprechend teuer.
So kostete das Pfund nach Valentini 1704 30 Gulden und das Lot
(10 g) in Mülhausen 8 Pfennige. 1887 kamen dann die ersten Proben
aus den seit 1866, anfangs allerdings ohne[S. 347] Erfolg in Indien, besonders
um Kalkutta, angelegten Kulturen auf den Londoner Markt und erwiesen
sich als der brasilianischen Droge ebenbürtig. Von der von Hooker aus
dem botanischen Garten von Kew bei London gesandten Stammpflanze waren
1872 nur noch 12 Pflanzen als Nachkommen vorhanden. Eine Vermehrung
durch Stecklinge hatte größeren Erfolg; so erzielte man auf diese Weise
von 300 in den Jahren 1871 und 1872 in Sikkim vorhandenen Exemplaren
bereits 1873 6000 Stück. Doch hatte die Kultur der Ipecacuanha auch
hier erst rechten Erfolg, als man begann, den Bedürfnissen der Pflanze
nach Feuchtigkeit und Schatten Rechnung zu tragen.
Bei der Gesuchtheit der Droge kann es uns nicht wundern, daß sie sehr
oft mit falscher Ipecacuanha vermischt und so gefälscht wird. Von
solcher kommt die in Kolumbien wachsende Cephaēlis acuminata
der echten am nächsten. Ihr unterirdisch kriechender Stamm ist
rötlichbraun und bis 8 mm dick. Man bezeichnet diese Sorte als
Cartagena-Ipecacuanha, weil sie vom gleichnamigen Hafen in Kolumbien
exportiert wird. Erheblich schwächer wirkend ist die aus dem nördlichen
Südamerika stammende dünnere, hellgraue bis graubraune „mehlige
Ipecacuanha“, so genannt, weil die mit nur schwachen Einkerbungen
versehene sehr dicke Rinde im Durchschnitt mehlig weiß ist. Sie stammt
von Richardsonia scabra. Größer und stärker als die echte
Rioware, aber sehr arm an Emetin, ist die bis 8 mm dicke,
außen graubraun bis grauschwarze „schwarze Ipecacuanha“, die von
der in Venezuela, Peru und Kolumbien (dem vormaligen Neu-Granada)
wachsenden Psychotria emetica herrührt. Ganz emetinfrei ist
die stark verästelte und mit spärlichen Einschnürungen versehene
grauweiße oder hellbraungelbe „weiße Ipecacuanha“, die von der
brasilischen Veilchenart Jonidium ipecacuanha stammt,
ebenso die von Viola itoubou, von Polygala violacea
in Venezuela, von Chamaelirium luteum und Heteropteris
pauciflora in Brasilien und andern. Ganz schwach emetinhaltig ist
dagegen die mit sehr dünner Rinde und ohne Einschnürungen versehene
Trinidad-Ipecacuanha von Cephaëlis tomentosa.
Ebenfalls durch die Portugiesen zuerst in Europa bekanntgeworden ist
die außer als appetitanregendes Mittel auch wie die Ipecacuanha gegen
Ruhr verwendete Colombowurzel, die von der in den Wäldern der
ostafrikanischen Küstenländer heimischen Jatrorrhiza palmata
stammt. Heute wird sie außer in Mozambique, wo sie die Portugiesen
bei ihrer Niederlassung von den Eingeborenen als stopfende Arznei
kennen lernten, in Deutsch-Ostafrika, auf Madagaskar, den Maska[S. 348]renen,
Seychellen und Ceylon kultiviert. Die dem kurzen Wurzelstock
entspringenden rübenförmig verdickten, bis 30 cm langen und
bis 8 cm dicken, fleischigen Wurzeln der zu den Menispermazeen
gehörenden ausdauernden, strauchartigen Pflanze werden im März
gegraben, gewaschen, in 2 cm dicke Scheiben geschnitten, auf
Schnüre gezogen und im Schatten getrocknet. In von Matten umhüllten
Ballen von etwa 50 kg Gewicht kommen sie aus Mozambique,
Sansibar oder Bombay nach Hamburg und London in den Handel. Sie sind
im Durchschnitt gelb und enthalten außer reichlich Stärkemehl und
Gummi, die dem daraus hergestellten Dekokt eine schleimige Konsistenz
geben, drei Alkaloide und zwei Bitterstoffe. Der Name Colombo hat
keinerlei Beziehung zur gleichnamigen Stadt auf Ceylon, sondern rührt
von der Bezeichnung kalumb her, die ihr die Kaffern gaben. Zuerst
empfahl der toskanische Arzt Francesco Redi 1675 die Calumba als
giftwidriges Mittel. Als solches hat sie sich nun nicht bewährt, wohl
aber als tonisches Bittermittel und zum Stopfen bei Durchfällen. Ihre
Abstammung und Heimat wurde geheim gehalten, bis Philipp Commerson
1770 die sie liefernde Pflanze im Garten des Gouverneurs Poivre auf
Isle de France (jetzt Mauritius genannt) kultiviert fand. Erst seit
sie der Arzt Gaubius in Leiden im Jahre 1771 angelegentlich empfahl,
wird sie häufiger medizinisch verwendet. Die sogenannte amerikanische
Colombowurzel von der Gentianee Frasera carolinensis aus Ohio,
Carolina und Pennsylvanien enthält nur Gerbsäure und ist minderwertig.
Am meisten wird die Droge durch die mit Ocker gelb gefärbte Wurzel der
Zaunrübe (Bryonia alba und dioica) verfälscht.
Von einem im atlantischen Nordamerika, namentlich Virginien, Florida
und Alabama heimischen immergrünen klimmenden Strauch (Gelsemium
sempervirens) aus der Familie der Loganiazeen, die sehr stark
giftige Vertreter, wie den das Strychnin liefernden Brechnußbaum,
den Curarebaum, aus dem die Indianer in Guiana und Venezuela ihr
berüchtigtes Pfeilgift, den schlingenden Upasstrauch, aus dessen
Wurzelrinde die Malaien Javas ihr nicht minder gefährliches Pfeilgift
Upas herstellen, und den vom Jesuiten Camelli 1699 nach dem Stifter
des Jesuitenordens, Ignatius Loyola, Ignatiusstrauch benannten
Schlingstrauch der Philippinen, der die äußerst giftigen Ignatiusbohnen
liefert, aufweist, stammt die Gelsemiumwurzel. Gelsemium
ist der ältere Name des Jasminum — hergeleitet vom arabischen
jasmin —, der dieser Pflanze wegen ihrer Ähnlichkeit mit diesem
orientalischen Strauche gegeben wurde. Das Rhizom kommt meist in
kleine[S. 349] Stücke zerschnitten in den Handel und enthält vier Alkaloide,
die als schmerzbetäubendes Mittel bei Neuralgien, Zahnschmerz,
Rheumatismus und Brustfellschmerzen dienen. Die Indianer brauchten
sie zum Vergiften der Fische. Diese bei uns weniger angewandte Droge
dient in Nordamerika seit langer Zeit als Volksmittel gegen Fieber
und Neuralgien. Die Wirkung besteht in Schwächung der Motilität und
Herabsetzung der Sensibilität; in größeren Gaben verursacht die
Droge Schwindel, erweiterte Pupillen und Doppeltsehen, allgemeine
Muskelschwäche und schließlich Tod durch Atmungslähmung.
Der getrocknete Wurzelstock der kanadischen Gelbwurz (Hydrastis
canadensis) liefert die neuerdings auch bei uns wie in ihrer Heimat
vielgebrauchte Hydrastis, die schon lange vor Ankunft der
Europäer von den nordamerikanischen Indianern teils zu medizinischen
Zwecken, besonders bei Entzündungen der Augen, des Mundes und des
Halses, teils zum Färben des Gesichtes und der Kleidungsstücke benutzt
wurde. In derselben Weise wurde das Rhizom noch jahrhundertelang
nach der Entdeckung Amerikas als golden seal, d. h. goldene
Siegelwurz, als Aufguß oder Tinktur weiter gebraucht, bis es 1860 in
die Pharmakopoe der Vereinigten Staaten aufgenommen wurde, nachdem
es schon seit 1833 allgemeiner als Arznei verwendet und seit 1847 in
größeren Mengen in den Handel gebracht worden war. Die Verwendung in
Europa datiert erst seit 1883. 1851 entdeckte Durand das wichtigste
der darin enthaltenen Alkaloide, das Hydrastin, das bis zu 4,8 Prozent
darin enthalten ist und sich im Körper in Hydrastinin und Opiansäure
spaltet. Hydrastis wirkt gefäßverengend und darum Blutungen stillend.
Besonders gegen Gebärmutterblutungen wird es viel verwendet, außerdem
auch bei chronischem Magenkatarrh und äußerlich bei Augenentzündungen.
Die sie liefernde Pflanze ist eine in den feuchten Wäldern Kanadas und
besonders der nordöstlichen Vereinigten Staaten heimische ausdauernde
Schattenpflanze aus der Familie der Ranunculazeen mit 2–3 handförmig
gelappten Blättern und grünlichweißen Blüten, die wegen des erhöhten
Verbrauchs im wilden Zustande fast nicht mehr vorkommt und zurzeit
in den Staaten südlich von New York an schattigen Hügeln und in
Waldlichtungen in größerer Menge angepflanzt wird. Die Wurzelstöcke
sollen nur von der dreijährigen Pflanze im Herbst nach der Samenreife
gesammelt, gereinigt und, auf große Tücher ausgebreitet, an der Luft
getrocknet werden. In Ballen oder Säcke verpackt kommen sie meist über
Cincinnati zum Versand. Vielfach werden sie mit den Wurzelstöcken der
in den dorti[S. 350]gen Waldungen heimischen Aristolochia serpentaria
und anderer ausdauernder Kräuter verfälscht.
Ebenfalls in Nordamerika heimisch ist die nach dem Stamme der
Seneka-Indianer oder Irokesen benannte Senegawurzel, die von
einer nördlich vom Tennesseeflusse vom Atlantischen Ozean bis zum
Felsengebirge vorkommenden ausdauernden Kreuzblumenart (Polygala
senega) gewonnen wird. Schon von den Indianern wurde sie als Mittel
gegen den Biß der Klapperschlange verwendet. 1736 wurde sie deshalb
von dem in Virginien ansässigen schottischen Arzte John Tennent als
Senega rattle snake root (S.-Klapperschlangenwurzel) in den
Arzneischatz eingeführt. Schon 1734 gab der Nürnberger Arzt Jakob Treu
eine Abbildung der Stammpflanze. Noch im Jahre 1779 war nach Murray
die Droge in Deutschland nur in wenigen Apotheken vorrätig. 1804
stellte dann Gehlen das bis zu 5 Prozent darin enthaltene, dem Saponin
ähnliche, in kaltem Wasser unlösliche Alkaloid Senegin dar, das neben
dem sauren Glykosid, der Polygalasäure und zwei neutralen Glykosiden
darin vorkommt. Die Wirkung der Droge ist eine schleimlösende,
schweißtreibende und leicht abführende. Wie die folgende wird sie auch
als Waschmittel benutzt.
Denselben Zwecken dient die gleicherweise meist als Abkochung
verordnete Quillaia- oder Seifenrinde, die von dem
immergrünen, in Chile, Peru und Bolivien heimischen Seifenbaume
(Quillaia saponaria) gewonnen wird. Den in seiner Heimat
gebräuchlichen Namen Quilla hat er vom spanischen Worte quillái,
das „waschen“ bedeutet; denn seine Rinde wurde seit langer Zeit im
Lande zum Waschen benutzt. Als Wasch- oder Panamarinde kam sie zuerst
von Panama aus zu Anfang der 1850er Jahre nach England und Frankreich,
einige Jahre später auch nach Deutschland. Seit dieser Zeit hat sie, da
sie die Farben nicht angreift, technisch statt Seife in den Wäschereien
eine große Bedeutung erlangt. Sie ist außen grob längsgestreift, oft
rissig, weißlich oder hellbraun, innen glatt und bräunlich, hat einen
kratzend bitteren, schleimigen Geschmack und enthält außer bis 10
Prozent Saponin die der Polygalasäure sehr nahestehende Quillaiasäure,
Sapotoxin und Lactosin. Sie wird als Ersatz der Senega bei chronischem
Lungenkatarrh in Form einer beim Schütteln stark schäumenden Abkochung
gegeben; auch kommt ein als Saponin bezeichnetes Extrakt derselben
in den Handel. Die Rinde selbst wird jetzt direkt von Chile und Peru
nach Hamburg und Havre gebracht, die die Hauptstapelplätze dafür
sind. Jährlich kommen davon über 3 Millionen kg im Werte[S. 351] von
einer halben Million Pesos (fast ebensoviel Mark) allein aus Chile
in den Handel. Auch das mittelharte Holz ist dort geschätzt und
wird zu feineren Geräten, besonders zu den im Lande gebräuchlichen
schuhartigen, hölzernen Steigbügeln, die mit reichgemusterten
Ornamenten in Kerbschnittmanier verziert sind, verwendet. Der Quillái
ist eine bis 10 m Höhe erreichende Rosazee, deren bis gegen
2 m dicker Stamm, unbeschadet des Wohlbefindens der Pflanze,
öfter im Innern vermorscht. Er ist nicht besonders dicht verzweigt und
seine Äste gehen stark auseinander. Er hat elliptische, glänzende,
lederharte, hellgrüne Blätter und zu kleinen Trauben vereinigte weiße
Blüten. Er steigt über 2000 m ins Gebirge hinauf, doch wird ihm
leider von den Rindensammlern (cascarilleros), denen man mit
ihren schwarzbraunen Lasten oft begegnet, arg zu Leibe gegangen. Früher
entrindeten sie die Bäume meist nur so weit, als sie reichen konnten,
während sie jetzt mit Hilfe von Leitern die Entrindung bis weit in das
Astwerk hinein vornehmen.
Ebenfalls aus Südamerika stammt die erst seit 1871 durch Garcia Morena,
den damaligen Präsidenten von Ekuador, nach Europa gesandte und hier
bald als angebliches Heilmittel gegen Magenkrebs sehr überschätzte und
sehr teuer bezahlte Condurangorinde, d. h. Geierrinde. Schon
lange steht sie in ihrer Heimat gegen Schlangenbiß und krebsartige
Krankheiten bei den Indianern im Gebrauch. Ihre Stammpflanze ist eine
an den Westabhängen der Kordilleren zwischen Ekuador und Peru in
1500 m und mehr Höhe wachsenden Liane (Marsdenia condurango)
aus der Familie der Asklepiadazeen mit gegenständigen, breiten,
samtartig behaarten Blättern, paarigen Rispen kleiner Blüten und
dicken, glatten Fruchtkapseln. Ihre Rinde ist graubraun, schmeckt
bitterlich, schwach kratzend, riecht aromatisch und enthält als
wichtigsten Bestandteil ein als Condurangin bezeichnetes Gemisch von
fünf Glykosiden, das appetitanregend wirkt. Deshalb wird die Rinde auch
heute noch gerne als Stomachikum gegeben.
Sehr viel wichtiger als sie ist eine andere südamerikanische, ebenfalls
aus dem Andengebiet stammende Rinde, die Chinarinde, die
weitaus die wichtigste Droge ist, die uns der neue Weltteil geschenkt
hat; ja sie kann geradezu als das wichtigste Heilmittel aus dem
Pflanzenreiche bezeichnet werden, da sie beziehungsweise das aus
ihr gewonnene Chinin allein imstande ist, die weitaus verbreitetste
und bösartigste aller Krankheiten, besonders der warmen Länder, die
Malaria, an der bisher viele Hunderttausende von Menschen jährlich
zu[S. 352]grunde gingen, zu heilen, und dadurch der Weiterverbreitung dieser
schrecklichen Krankheit durch die Anópheles-Stechmücken zu wehren. In
Berücksichtigung der ungeheuren Bedeutung, die diesem Arzneimittel zur
Ausrottung der die schönsten und fruchtbarsten Gebiete der Tropen für
Weiße bisher fast unbewohnbar machenden Infektionskrankheit zukommt,
wollen wir etwas eingehender auf die Geschichte dieser Droge eingehen.
Zunächst ist festzustellen, daß die Bezeichnung China durchaus nichts
mit dem ostasiatischen Reiche der Mitte zu tun hat, sondern der
alten Inkasprache Perus angehört, in der es als quina (sprich
kina) Rinde bedeutet. Und zwar bezeichneten die Eingeborenen
damit eine bestimmte, von stattlichen Bäumen der Ostabhänge des
nördlichen Teiles von Peru und südlichen Gebietes von Ekuador in
über 1000 m Meereshöhe gewonnene, frisch blaßgelbe, durch
Trocknen und Lagern aber braun werdende Rinde, die sie gegen Fieber
verwendeten. Im Gegensatz zu anderen Rinden, die sie als Heilmittel
verwandten, bezeichneten sie die Chinarinde durch Verdoppelung des
Wortes quina als quinaquina im Sinne von etwa guter
Rinde. Als dann die verhaßten fremden Eindringlinge, die Spanier,
die so grausam gegen das Herrscherhaus der Inkas verfuhren, das Land
besetzten, wurde ihnen zunächst das Geheimnis, das übrigens nur in
einem beschränkten Gebiet der engeren Heimat des Fieberrindenbaumes,
nämlich in der Gegend von Loxa im südlichsten Teil von Ekuador,
bekannt war, nicht verraten. Erst 1630 wurde die Chinarinde durch
die Vermittlung eines Jesuiten, der sich durch seine Leutseligkeit
das Vertrauen und die Liebe der Eingeborenen zu erwerben wußte, den
Spaniern im Innern von Peru bekannt. Der erste Weiße, der damit vom
Wechselfieber soll geheilt worden sein, war der Corregidor oder
Oberrichter — eine Art vom König eingesetzter Verwalter — der Stadt
Loxa, Don Juan Lopez de Canizares. Die cascara (Rinde) de
quinaquina de Uritusingu empfahl er bei seinen Bekannten weiter und
durch seine Vermittlung wurde im Jahre 1638 die Gemahlin des Vizekönigs
von Peru, Gräfin Anna de Chinchon (sprich Tschintschon), damit von
einem hartnäckigen Wechselfieber geheilt. Ihr zu Ehren wurde dann 1742
der Fieberrindenbaum durch Karl von Linné Cinchona — eigentlich sollte
es Chinchona heißen — genannt. Nach ihrer Genesung ließ die Gräfin
größere Mengen der so vortrefflich das Fieber bekämpfenden Rinde aus
Loxa kommen und verteilte sie bei den ihr bekannten Malariakranken der
Stadt Lima. So kam dieses neue Heilmittel als „Gräfinnen[S. 353]pulver“
polvo de la condesa zunächst in Perus Hauptstadt in Gebrauch.
1640 brachte Juan de Vega, der Leibarzt des Grafen Chinchon, das erste
Pfund der Rinde nach Sevilla in Spanien.
Tafel 131.
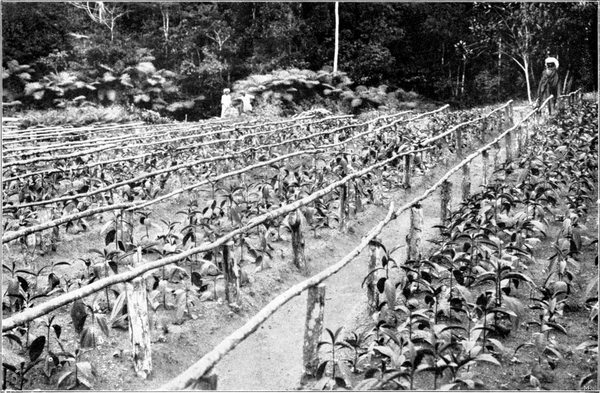
(Phot. Vincenti, Daressalam.)
Ein Saatbeet für junge Chinabäume in Deutsch-Ostafrika.
❏
GRÖSSERES BILD
Tafel 132.
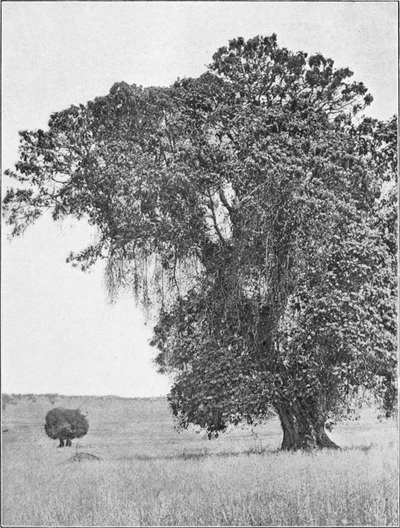
Ein Kussobaum in der Landschaft Schoa in Abessinien.
(Nach Photogr. von F. Rosen in „Karsten u. Schenck, Vegetationsbilder“.)
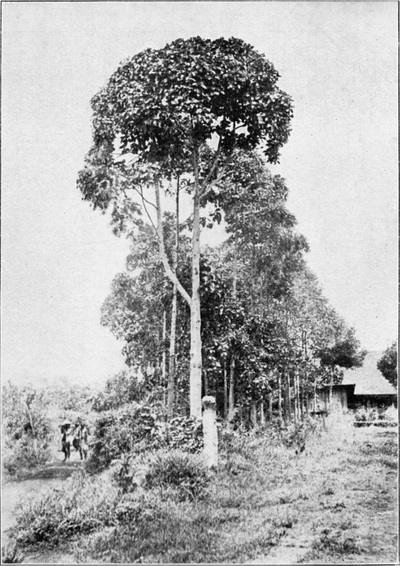
Chinabäume (Cinchona
succirubra) auf Lembang in Java.
In der Folge waren es besonders die Jesuiten, die sich des
einträglichen Handels mit der Chinarinde bemächtigten, weshalb sie
in Spanien als Jesuitenpulver, polvo de los jesuitos, bekannt
wurde. Bis zum Jahre 1811 war ja der ganze Handel mit den spanischen
Kolonien durch das Mutterland monopolisiert. In Sevilla befand sich
die berühmte, 1503 gegründete casa de contractacion de Indias,
eine zugleich verwaltende und richterliche Funktionen ausübende
Behörde, die dem 1511 eingesetzten Rate von Indien unterstellt war und
die oberste Aufsichtsbehörde für den amerikanischen Handel bildete.
Kein Schiff durfte nach Amerika absegeln oder, von dorther kommend,
in Europa landen, ohne von den Beamten der casa besichtigt
und mit der erforderlichen Erlaubnis versehen worden zu sein. Jeder
spanische Kapitän, er mochte auslaufen wo er wollte, durfte seine
Rückfahrt aus Amerika nur über Sevilla nehmen. Im Jahre 1529 erhielten
auch verschiedene andere Städte die Erlaubnis, Schiffe nach den
Kolonien zu senden, aber den Rückweg mußten alle über Sevilla nehmen,
um die Revision durch die Beamten der casa zu bestehen. Dieses
ungeheure, aber für den Handel äußerst hemmende Vorrecht besaß Sevilla
bis zum Jahre 1720, in welchem Cadix an seine Stelle trat, weil im
Laufe der Zeit der Guadalquivir durch Versandung so verflacht war, daß
ihn größere Schiffe nicht mehr befahren konnten.
Durch die Monopolisierung und den hohen Eingangszoll kam die
pulverisiert eingeführte Chinarinde, die sich in Spanien bald großer
Beliebtheit als Heilmittel gegen die Malaria zu erfreuen hatte,
sehr hoch zu stehen, so daß sich nur die Reichen ihrer bedienen
konnten. Kostete doch noch lange nach 1650 das Pfund derselben
nicht weniger als 400 Mark. Schon 1642 empfahl sie Barba, Professor
der Medizin in Valladolid. 25 Jahre später war sie in den größeren
Städten Europas bekannt und geschätzt. Zu dieser raschen Verbreitung
der quinaquina trug namentlich die rührige Tätigkeit des
Generalprokurators des Ordens Jesu, des Kardinals de Lugo, viel bei,
der in Rom den ersten Stapelplatz des aus Südamerika neu eingeführten
Heilmittels errichtete. Auf seiner Durchreise empfahl er das Mittel in
Paris dem höchst einflußreichen Kardinal Mazarin gegen die Malaria,
an der Ludwig XIV. litt. Und als dieser davon geheilt wurde, wollte
bald jedermann, dessen Geldbeutel sich diesen Luxus leisten konnte,
von[S. 354] der so wunderbar schnell vom Fieber befreienden pulverisierten
Rinde Gebrauch machen. 1653 war sie in Antwerpen, 1655 in London, 1663
in Königsberg, 1669 in Leipzig und Frankfurt am Main zu kaufen, doch
kostete ein Quentchen=1,66 g 50 Kreuzer, d. h. den zwölffachen
Preis des Opiums und den fünfundzwanzigfachen des Kampfers. Als
Geheimmittel konnte sie noch 1679 der englische Arzt Robert Talbot
ausnutzen, der in jenem Jahr dieses Fieber vertreibende Arcanum Ludwig
XIV. für 2000 Louisdor und eine Leibrente verkaufte.
Die erste rohe Beschreibung und eine allerdings sehr unvollkommene
Abbildung der Pflanze gab Blegny. Genauere Angaben über die Herkunft
und Gewinnung der Droge verdanken wir dem Franzosen La Condamine,
der von 1736–1744 Peru bereiste, 1737 bei Loxa die Cinchona
officinalis sammelte und 1740 eine ausführliche Beschreibung nebst
Abbildung der Pariser Akademie der Wissenschaften vorlegen ließ. 1739
fand dann J. de Jussieu ebenfalls bei Loxa die später als Cinchona
pubescens bezeichnete Art. 1760 wurde der Botaniker Mutis und 1777
Ruiz und Pavon vom spanischen Ministerium mit der genaueren Erforschung
des Chinabaums beauftragt. Ersterer beobachtete um die peruanische
Stadt Bogota herum 4 verschiedene Cinchonaarten und letztere, die
nach eingehendem Studium von Peru und Chile erst 1788 nach Spanien
zurückkehrten, beschrieben 1793 deren nicht weniger als 11 Arten.
1810 stellte der Apotheker Gomez in Lissabon eine amorphe Masse aus
der Chinarinde dar, in welcher 1827 die beiden Franzosen Pelletier
und Caventou die zwei Alkaloide Chinin und Cinchonin nachwiesen.
Seit dieser Zeit wurden aus den Chinarinden noch eine Anzahl anderer
Alkaloide neben Säuren, einem bittern Glykosid Chinovin und dem
Chinarot dargestellt.
Die Chinarinde wird von verschiedenen nahe miteinander verwandten
prächtigen immergrünen Bäumen der zu den Rubiazeen oder Krappgewächsen
gehörenden Gattung Cinchona gewonnen. Die ursprünglich allein
verwendete gelbe Chinarinde von Loxa stammt von der hauptsächlich
in Ekuador wachsenden Cinchona officinalis, deren in Bolivia
heimische Varietät C. ledgeriana heute besonders auf Java,
Ceylon und in Britisch Indien kultiviert wird. Sonst wird zur Gewinnung
von Chinin zurzeit namentlich auch die in Peru und Bolivia heimische
C. calisaya gepflanzt, die die gelbe Königsrinde — so genannt
weil sie als die beste erkannte Art früher für den spanischen Hof in
Madrid bestimmt war — in starken Platten oder Röhren mit dunkler,
tiefrissiger Borke liefert. Außerdem ist die von Ruiz und[S. 355] Pavon
beschriebene, in Nordperu und dem südlichen Ekuador wachsende C.
succirubra (d. h. rotsaftige Cinchona) mit rötlicher Rinde
sehr beliebt, ebenso die von denselben Autoren geschilderte C.
micrantha (d. h. kleinblütige Cinchona), deren schön gelbe Rinde
als Huanacorinde in den Handel gelangt.
Die bei weitem alkaloidreichste Chinarinde liefert die in den
bolivianischen Provinzen Enquisivi, Yungas, Larecaja und Caupolican und
in der südperuanischen Provinz Carabaya zwischen 1500 und 1800 m
Seehöhe wachsende C. ledgeriana, so genannt, weil zuerst am Rio
Mamore in Bolivia mit Hilfe des Indianers Manuel Juera Mamani durch
den Engländer Charles Ledger 1865 gesammelte Samen von Bolivia der
englischen und holländischen Regierung gesandt wurden, welch letztere
sie auf Java anpflanzen ließ, während erstere damit Kulturen in
Ceylon und Indien beschickte. Dieser dickstämmige, hohe Chinabaum mit
ausgebreiteter, reichbelaubter Krone hat schmalelliptische, unterseits
rote, fast lederartige, kahle Blätter, kleine, gelbliche, nickende
Blüten in Rispen und kreisförmige, braune Fruchtkapseln, die zahlreiche
kleine, geflügelte Samen enthalten. Ebenfalls bis über 25 m
hoch, bei einem Stammdurchmesser von fast einem Meter an seinem Grunde,
wird der Erzeuger der gelben Königsrinde C. calisaya mit
8–15 cm langen, eiförmigen Blättern mit rötlichen Blattstielen und
Mittelrippen und beinahe doldentraubigen Blütenrispen von fleischroten,
weichhaarigen, wohlriechenden Blüten. Große, saftiggrüne, kurz
behaarte, breitelliptische Blätter und große Rispen 2 cm langer,
innen kurz behaarter, rosenroter, ähnlich den Syringen duftenden Blüten
mit fünfzipfliger Blumenkrone besitzt der rotsaftige Chinabaum, C.
succirubra. Beim Austritt aus der Knospe sind die jungen Blätter
purpurrot gefärbt, und an dieser Farbe gibt sich der die übrigen
Waldbäume meist überragende Chinabaum oft weithin zu erkennen.
Die Rinden der vorzugsweise die Ostabhänge der Anden des nördlichen
Südamerika zwischen 10° nördlicher und 19° südlicher Breite (die
besten Arten gedeihen von 7° nördlicher bis 15° südlicher Breite) in
1000–3400 m Höhe bewohnenden Chinaarten wurden von besonderen,
Cascarilleros genannten Sammlern aus den Wäldern geholt. Unter einem
Majordomo zogen sie in die Chinagebiete und säuberten zunächst an
den von ihnen entdeckten Bäumen mit einem säbelartigen Messer, dem
machete, die Stämme von allen Lianen und Überpflanzen. Dann
entfernten sie die wertlose Borke und schnitten Längs- und Querrisse
in die Rinde, um diese in großen Stücken abzulösen. Zuletzt[S. 356] wurde der
Baum gefällt, um auch die dickeren Äste und dünneren Zweige von der
Rinde zu befreien, die möglichst rasch an Ort und Stelle meist über
einem gelinden Feuer getrocknet wurde. Zu diesem Zwecke wurden leichte
Hütten errichtet, auf deren Boden ein möglichst rauchloses Feuer aus
trockenem Holz unter Hürden von Palmblattstielen, auf denen die häufig
zu wendenden Rinden aufgeschichtet waren, entzündet wurde. Dabei mußte
zu starkes Feuer vermieden werden, weil durch eine hohe Temperatur die
wirksamen Bestandteile der Rinde zersetzt werden. Nach spätestens vier
Wochen waren auch die dickeren Rindenstücke genügend getrocknet, um als
haltbare Ware in den Handel zu gelangen.
Obschon in späterer Zeit den Cascarilleros vorgeschrieben war,
dort, wo sie einen Chinabaum gefällt hatten, einige Stecklinge der
Pflanze in den Boden zu stecken, so nahm doch mit der Zeit der Betrag
der jährlichen Ernte dermaßen ab, daß man mit Sorgen der Zukunft
entgegensah; denn bei dem nicht eigentlich massenhaften Auftreten der
Cinchonen und ihrer rücksichtslosen Ausbeutung erwuchs die berechtigte
Befürchtung der gänzlichen Ausrottung dieser kostbaren Bäume. Zuerst
machte der Deutsche Wedell die Kulturmenschheit auf den Schaden des
fortgesetzten Raubbaues aufmerksam, und der Straßburger Botaniker Fée
wies bald darauf auf die Wichtigkeit der Kultur der Chinabäume, um
zur wirksamen Bekämpfung der Malaria das aus ihrer Rinde gewonnene
Chinin zu einem möglichst billigen Preise in den Handel bringen
zu können. Zwischen 1830 und 1849 beschäftigten sich holländische
Botaniker wiederholt mit dem Gedanken der Kultur der Chinabäume in
den Hochtälern der südamerikanischen Anden. Dieser Anregung ist es
zweifellos zuzuschreiben, daß Jesuiten in der peruanischen Stadt
Cuzko, der einstigen Residenz der Inkas, 1849 junge Chinapflanzen nach
Zweigniederlassungen ihres Ordens in Algier sandten. Hier aber gediehen
die Kinder des Hochgebirges nicht, und auch 1850 und nochmals 1866
bewerkstelligte Nachsendungen aus Peru blieben erfolglos.
Nachdem auch La Condamines Bemühungen, lebende Cinchonen nach Europa
zu bringen, mißglückt waren, gelang es dem vorhin genannten Wedell,
wenigstens Samen herbeizuschaffen, die in Paris keimten. Damit auf
der Insel Réunion vorgenommene Akklimatisationsversuche brachten aber
keinen nennenswerten Erfolg. Glücklicher bei der Übertragung der so
wichtigen Arzneipflanze waren die Holländer, die das Gelingen des
für die Menschheit so überaus wichtigen[S. 357] Problems der Ansiedelung
von Chinabäumen in ihren indischen Kolonien in erster Linie den
unablässigen Bemühungen des holländischen Ministers Pahud, namentlich
von der Zeit an, da er Generalgouverneur von Java wurde, zu verdanken
haben. Auf Veranlassung des deutschen Botanikers Miquel, des Bruders
des einstigen preußischen Finanzministers, wurde 1852 der Deutsche
J. K. Haßkarl zur Gewinnung des erforderlichen Kulturmaterials
nach Peru gesandt. Oftmals vom Tode bedroht, gelang es ihm nach
Überwindung großer Gefahren und zahlloser Schwierigkeiten 1854 in 21
Wardschen Kulturkästen eine Menge von jungen Chinapflanzen nach Java
einzuschiffen. Auch in Europa wurden mittlerweile in den botanischen
Gärten von Paris und Leiden Chinapflanzen aus Samen gezüchtet, die
ebenfalls ihren Weg nach Java nahmen. Dort führte von 1855 an der
in holländischen Diensten stehende Deutsche Franz Wilhelm Junghuhn
(1819–1864) die Bepflanzung mit Chinabäumen in großem Maße durch, so
daß er den Bestand von 149 Pflanzen auf über 1 Million erhöhte. Im
Jahre 1876 besaßen die Holländer auf Java bereits über 2 Millionen
Cinchonen und seither haben die Chinaanpflanzungen auf jener Insel eine
solche Ausdehnung gewonnen, daß sie heute etwa 80 Prozent der gesamten
Weltproduktion von über 10 Millionen kg Chinarinde liefern.
Erst in weitem Abstand folgt auf Java Ostindien mit einer jährlichen
Produktion von nicht ganz 1½ Millionen kg Chinarinde, an
welchem Betrage Ceylon bloß mit einem Sechstel beteiligt ist. Die
Anregung zu diesem Unternehmen gab Royle der englisch-ostindischen
Handelsgesellschaft, wobei er die Nilagiris oder Blauen Berge an
der Malabarküste als besonders geeignet für die Kultur dieses
südamerikanischen Gebirgsbaumes empfahl. Die ersten Versuche damit
hatten einen wenig befriedigenden Erfolg. Erst als der mit den
Verhältnissen in Peru und Bolivia vertraute Markham durchsetzte, daß
man den in Ekuador sammelnden Botaniker Spruce mit der Gewinnung
des Samens der rotsaftigen Art beauftragte, blühte die Chinakultur
in Indien seit 1859, besonders durch Spruces Begleiter, den Gärtner
Croß, gefördert, sehr schnell auf. Die Hauptplantagen wurden nun in
Utakamund auf den Blauen Bergen und seit 1861 auf Ceylon zum Teil
in einer Höhe von 2600 m angelegt. Hier sowohl, wie in Java,
vermochte man nach und nach bessere Vermehrungsarten ausfindig zu
machen und besonders chininreiche Arten heranzuzüchten. 1867 kamen
die ersten in Indien gewachsenen Rinden auf den Londoner Markt und
1870 die ersten javanischen Rinden nach Amsterdam. Der indische[S. 358]
Export stieg dann dermaßen, daß im Jahre 1886 Ceylon allein gegen 7
Millionen kg nach London lieferte. Da aber sank der Preis des
Chinins so sehr, daß die Chinaplantagenbesitzer Ceylons es vorzogen,
die Chinabäume, deren im Jahre 1882 noch 90 Millionen sollen gestanden
haben, abschlagen zu lassen und das betreffende Land zur Teekultur
zu verwenden. Noch im Mai 1870 kostete das Kilogramm schwefelsaures
Chinin 545 Mark, dann sank der Preis, zuweilen wieder etwas ansteigend,
im Juni 1889 auf 31 Mark. An diesem starken Preisabschlag war nicht
sowohl die große Produktion von Chinarinde schuld, als vor allem die
durch die Auffindung zahlreicher, das Fieber herabsetzender chemischer
Stoffe, wie Antipyrin, Antifebrin usw., bewirkte Ersetzung des Chinins
durch Surrogate. Einzig als Spezifikum gegen Malaria und teilweise
als Heilmittel gegen Keuchhusten ist das Chinin heute noch allein in
Frage kommend und deshalb von ungeheurem Werte für die Menschheit,
so daß die Kultur des Chinarindenbaumes nach wie vor von der größten
Wichtigkeit für die Weltwirtschaft ist. So hat man den Chinarindenbaum
seit 1865 erfolgreich auf Réunion, Mauritius, Madagaskar, Teneriffe
und seit 1900 und 1902 von Java aus auch in Kamerun angepflanzt. Der
anfänglich (1868) gute Resultate aufweisende Anbau auf St. Helena ging
infolge Vernachlässigung zugrunde. In Dardschiling in Sikkim, wo der
Chinabaum 1862 eingeführt wurde, wie auch in Neuseeland und Australien,
wohin der Anbau desselben 1862 beziehungsweise 1866 gelangte, hat die
Cinchonenkultur keinerlei Bedeutung erlangt. Die Bäume lieben ein
wechselvolles, feuchtes Klima und eine mittlere Temperatur von 12–20° C.
Diese klimatischen Verhältnisse finden sie in den Tropen
besonders in einer Höhe von 1600–2400 m. Dort wachsen sie, dem
Charakter jener Gebiete entsprechend, meist zerstreut, höchstens da und
dort zu kleinen Gruppen vereinigt.
Veranlaßt durch die große Konkurrenz der südasiatischen Kulturen sind
neuerdings auch im Heimatlande der Cinchonen, von Kolumbia bis nach
Bolivia, Chinaanpflanzungen angelegt worden und wird der rationellen
Gewinnung der Rinde erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt. In allen
Plantagen nutzt man die Kulturbäume viel planmäßiger aus als früher die
wildwachsenden Bäume. Dabei beobachtet man ein doppeltes Verfahren.
Entweder richtet man den Niederwaldbetrieb ein, indem man die Bäume 6–8
Jahre alt werden läßt und sie dann etwa 15 cm über dem Boden
abschlägt. Hierauf entsteht ein kräftiger Stockausschlag, mit dem
man nach 5–8 Jahren in gleicher Weise ver[S. 359]fährt. Oder man zieht den
lebenden Bäumen etwa 4 cm breite Rindenstreifen der Länge nach
ab. Die Wunden werden dann sorgfältig mit einem Schutzmittel — meist
Moos oder Lehm — bedeckt, unter welchem eine merkwürdigerweise noch
alkaloidreichere Rinde erzeugt wird. Eine weitere Art der Gewinnung
besteht im Abschälen der Rinde mit scharfen Schabeisen bis auf das
Kambium, das dann neue Rinde erzeugt. Deutschland mit seinen vier sehr
bedeutenden Chininfabriken bezieht die Hauptmasse der Chinarinde aus
Java über Amsterdam und nur einen kleinen Teil über London und aus Peru
direkt, um aus ihr Chinin zu gewinnen. Doch wird neuerdings das meiste
Chinin auf Java und in Indien in inmitten der Pflanzungen gelegenen
Fabriken gewonnen, so daß die Einfuhr der Rinde nach Europa immer mehr
zurückgeht und keinen Maßstab mehr für den Konsum abgibt. Deutschlands
Einfuhr betrug im Jahre 1906 3678000 kg im Wert von 4781000 Mark.
Ältere Rinden weisen einen höheren Alkaloidgehalt auf als jüngere,
Stammrinden mehr als Zweigrinden, und zwar bei kultivierten Pflanzen
in weit höherem Maße als bei wildgewachsenen. In jungen Organen sind
die Alkaloide im Zellsaft gelöst, in älteren in festem, amorphem
Zustand in der Zelle, oft in gerbsaurer Verbindung, abgelagert.
Oxalsauren Kalk führende Zellen enthalten niemals Alkaloide. Im
parenchymatischen Gewebe der Mittelrinde findet man bei den in
ihrer Heimat wildgewachsenen Pflanzen nur etwa 2 Prozent Alkaloide,
während es die kultivierten Bäume Javas auf 10–17 Prozent daran
bringen. In europäischen Gewächshäusern, also unter ungünstigen
Bedingungen erzeugte Rinden enthalten dagegen gar kein Chinin, das
sonst bis zu 13 Prozent darin enthalten sein kann. Daneben sind in
den alkaloidreichsten Rinden bis 4 Prozent Chinidin, bis 8 Prozent
Cinchonidin, bis 8 Prozent Chinasäure, 2–3 Prozent Chinagerbsäure und
2 Prozent des bittern Glykosids Chinovin enthalten. Das wichtigste
Alkaloid, das Chinin, besitzt antipyretische und antiseptische Wirkung
und ist ein spezifisches Gift für die im Blute der Malariakranken
kreisenden ungeschlechtlichen Plasmodien besonders der Tertiana und
Quartana, weniger greift es die Erreger des bösartigen tropischen
Fiebers an und ist nur gegen die Geschlechtsformen der letzteren ganz
unwirksam.
Solange früher die offizinellen Chinarinden in Südamerika von
wildwachsenden Pflanzen gewonnen wurden, waren meist durch wertlose
Rinden verwandter Gattungen vorgenommene Verfälschungen häufig.[S. 360] Jetzt
kommen solche nur noch selten vor, da bloß Rinden kultivierter Pflanzen
Südasiens von den Arzneiverordnungen zugelassen werden. Im allgemeinen
kommt das Chinin allein den Chinabäumen zu. Einzig die den Cinchonen
verwandte, in Venezuela und Kolumbia wachsende Remijia purdieana
enthält auch Chinin, und zwar bis zu 2 Prozent.
Ebenfalls als Fiebermittel und Stomachicum wie die Chinarinde
wird die von einer bis 6 m hohen, in Westindien, besonders
den Bahamainseln und Kuba, heimischen Wolfsmilchart, Croton
eluteria, gewonnene Cascarillrinde verwendet. Cascarilla
heißt im Spanischen kleine Rinde. Anfänglich (1640) hielt man diese
schon damals gegen Ruhr und Fieber angewandte Rinde für eine kleine
Form der Chinarinde; daher jener Name. Zu Ende des 17. Jahrhunderts
wurde sie in Deutschland als China nova oder Cortex
eluterii bekannt. Sie kommt in röhrenförmigen Bruchstücken von
graugelber bis brauner Farbe, eigenartig aromatischem Geruch und
unangenehm bitterem Geschmack in den Handel und enthält außer dem
Bitterstoff Cascarillin 15 Prozent Harz, Gerbstoff und ätherisches Öl.
Noch weniger wichtig als sie ist die einst als Ruhrmittel benutzte
Simarubarinde, die von Simaruba officinalis, einem
stattlichen, in Französisch-Guiana und Nordbrasilien heimischen Baum
gewonnen wird. Heute kaum mehr gebraucht, kam die Rinde 1713 als
Mittel gegen blutige Diarrhoen aus Cayenne nach Paris; 1718 wurde sie
daselbst gegen die damals epidemisch herrschende Ruhr angewandt. 1723
brachte Barrère eine größere Menge der Droge nach Europa und gab 1741
eine genauere Beschreibung der Stammpflanze. Die früheste Nachricht
über letztere scheint von Desmarchais aus dem Jahre 1728 zu stammen,
wobei er schon von Simaruba oder bois amer spricht. 1775
gab dann der Apotheker Aublet eine weitere eingehende Beschreibung
der Pflanze unter dem Namen Simaruba amara. Der jamaikanische
Baum wurde 1772 von Wright entdeckt und ein Jahr später von ihm als
Quassia simaruba beschrieben. Die gelbbraune, geruchlose, stark
bitter und etwas schleimig schmeckende Rinde der dicken Wurzeln, die
meist über Ciudad Bolivar am Orinoko, der vormals Angostura (weil an
einem Engpaß gelegen) genannten Hauptstadt von Venezuela, in den Handel
gelangt, enthält ein benzoëartig riechendes Öl, Harz, Gerbstoff und
einen kristallisierbaren Bitterstoff.
Ebenso wie diese heute außer Gebrauch gekommen ist die nach demselben
Verschiffungsort als Angosturarinde bezeichnete stark
bittere[S. 361] Wurzelrinde des im nördlichen Südamerika heimischen,
20–25 m hohen, immergrünen Baumes Galipea officinalis (nach
dem Indianerstamme der Galiponen so genannt) aus der Familie der
Terebinthineen oder Balsamgewächse, die früher als Heilmittel gegen
Wechselfieber berühmt war. Im Gegensatz zu dieser echten bezeichnete
man die Rinde des in Südasien heimischen Brechnußbaumes
(Strychnos nux vomica) als falsche Angosturarinde. Sie ist
schwärzlich aschgrau, schmeckt sehr bitter und wurde zu Ende des 18.
und zu Beginn des 19. Jahrhunderts der außer als Fiebermittel auch als
Heilmittel gegen Ruhr angewandten echten Angosturarinde beigemischt.
Heute werden von dem in ganz Indien, Siam, Kochinchina und
Nordaustralien heimischen niederen Baum mit orangeähnlichen, etwa
4–5 cm langen, graugelben Früchten nur die in einem sehr trockenen,
gallertartig weichen Fruchtfleisch eingebetteten scheibenförmigen,
am Rande verdickten, 2,5 cm breiten und 0,5 cm dicken,
graugrünlichen, mit seidenglänzenden, in radialer Ausstrahlung
angedrückten Haaren dicht besetzten Samen als Krähenaugen oder
Brechnüsse medizinisch verwendet. Sie enthalten bis zu 5 Prozent
der sehr giftigen Alkaloide Strychnin und Brucin, beide annähernd zu
gleichen Teilen, doch ist das Strychnin meist in etwas geringerer Menge
vorhanden. Sie sind in der Pflanze an die Igasur- oder Strychnossäure
gebunden. Weitere Bestandteile sind Eiweiß, Zucker, Fett, Gerbsäure
und in geringen Mengen ein Loganin genanntes Glykosid. Wenn auch
die giftigen Glykoside im hornigen Nährgewebe der Samen in größter
Menge vorhanden sind, so ist doch die ganze Pflanze damit getränkt;
gleichwohl soll der Inhalt der Früchte von Vögeln unbeschadet genossen
werden. Die Giftwirkung beruht vorzugsweise auf dem Strychnin, das
tetanische Krämpfe bewirkt und zuerst die Atmungsmuskeln, dann auch
die übrigen, mit vorwiegender Beteiligung der Strecker, in Starrheit
versetzt, so daß rasch der Tod durch Erstickung eintritt. In kleinen
Dosen erhöht es den Tonus der Muskeln und Nerven; deshalb wird es mit
gutem Erfolg bei Lahmheit der Muskeln, namentlich der Darmmuskulatur,
gegeben.
Die reifen, von wildwachsenden Bäumen gesammelten und getrockneten
Samen kommen meist aus Indien nach London auf den Markt. Aus ihnen
stellt man außer Extrakten und Tinkturen das Strychnin dar, mit dem
man die schädlichen Raubtiere vermittelst Köder vergiftet. In Südasien
war die Giftwirkung der Brechnüsse schon längst bekannt; auch wurden
sie dort in früherer Zeit zur Her[S. 362]stellung eines Pfeilgiftes, daneben
auch als Betäubungsmittel benutzt. So sollen sie nach Royle im Ayur
veda Charakas als Narkotikum des indischen Arzneischatzes erwähnt
werden. In Europa wurden sie durch Vermittlung der Araber gegen Ende
des 15. Jahrhunderts in den Arzneischatz eingeführt; als solche führt
sie Brunfels 1531 unter dem Namen nux vomica an. Zuerst finden
wir sie um 1500 als Kraen Eugeln im Inventar der Apotheke zu
Zwickau angeführt. 1520 und 1521 werden sie als nux vomica neben
nux indica (Kokosnuß) in der Arzneitaxe von Annaberg erwähnt.
1561 gab Valerius Cordus eine sehr gute Beschreibung der Samen, die
er irrtümlich für Früchte hielt. Auch Bauhin und Gesner berichten von
ihnen; doch waren sie noch im 17. Jahrhundert wenig verbreitet und
kaum je als Arznei gebraucht. Als solche fanden sie erst von 1770 an
Verwendung. Das in ihnen und in anderen Strychnosarten enthaltene
Strychnin wurde nicht zuerst in ihnen, sondern 1819 und 1824 von
Caventou in den einst ebenfalls offizinellen Ignatiusbohnen
nachgewiesen. Dieselben stammen von einem ebenfalls zur Familie der
Loganiazeen gehörenden Schlingstrauch der Philippinen (Strychnos
ignatii), den der Jesuit Camelli 1699 als erster Europäer
kennen lernte und nach dem Stifter seines Ordens, Ignatius Loyala,
Ignatiusstrauch nannte, und enthalten fast dieselben Bestandteile wie
die Brechnüsse. Früher wurden sie besonders gegen Wechselfieber und
Epilepsie gebraucht. Ein naher Verwandter desselben ist der sich an den
hohen Waldbäumen der Insel Java emporschlingende, 25–32 m lange
Upasstrauch (Strychnos tieuté), aus dessen Wurzelrinde
die Eingeborenen durch Auskochen mit Wasser und nachherigem Eindicken
zu Sirupkonsistenz ihr überaus gefürchtetes Pfeilgift herstellen, das
ebenfalls Strychnin als Hauptbestandteil enthält und sehr rasch den Tod
des damit getroffenen Tieres herbeiführt.
Gleicherweise bereiten die Indianer Venezuelas aus der Rinde des sich
um andere Urwaldbäume schlingenden Curarestrauches (Strychnos
crevauxii, nach dem 1882 als Forschungsreisender in Südamerika
ermordeten französischen Arzte Crevaux so genannt) ihr nicht minder
wirksames Pfeilgift, das die Enden der motorischen Nerven lähmt,
die Tiere so bei erhaltenem Bewußtsein lähmt und durch Lähmung der
Atmungsmuskeln rasch den Tod herbeiführt. Deshalb wird es vielfach
bei physiologischen Untersuchungen benutzt, wobei man die Tiere, wenn
nötig, durch künstliche Atmung am Leben erhält; doch ist dies bei
kleineren Dosen durchaus nicht nötig.
[S. 363]
Im Gegensatz zu diesem Curarin, das die motorischen Muskeln lähmt,
steht das Strophantin, das die Zusammenziehbarkeit der Muskeln,
besonders des Herzmuskels steigert, und deshalb bei Schwächezuständen
des Herzens vielfach als Ersatz der langsamer wirkenden und die
Verdauungsorgane mehr angreifenden Digitalis gegeben wird. Als eines
der stärksten Herzgifte, die es gibt, wird es in seiner Heimat,
Westafrika, vielfach auch als Pfeilgift benutzt. Sein Erzeuger ist ein
holziger Kletterstrauch Oberguineas aus der Familie der Apocynazeen
oder Hundsgiftgewächse — zu denen u. a. auch unser Oleander gehört
— (Strophantus hispidus), der sich an den höchsten Bäumen
des Urwalds emporwindet und kreuzgegenständige, breitelliptische,
rauhhaarige Blätter, gelbe Blüten mit lang herabhängenden
Blumenblattspitzen und 30 cm lange, an beiden Enden zugespitzten
Kürbissen mit tief gefurchter Oberfläche ähnliche Fruchtkapseln —
meist zwei nebeneinander — besitzt, die bis 200 Samen enthalten.
Letztere sind bis 15 mm lang und 3,5 mm breit, braun
und etwas filzig behaart und dienen den Eingeborenen vorzugsweise
zur Gewinnung von Pfeilgift, während eine Abkochung der Wurzeln und
der Rinde innerlich gegen Malaria und Dysenterie und äußerlich zur
Behandlung von Geschwüren aller Art, auch des Guineawurms, dient.
Wie Strophantus hispidus von Senegambien bis Oberguinea wird in
Niederguinea und im ganzen Kongogebiet der gleicherweise kletternde
Strophantus gratus bei allen Negerdörfern in Halbkultur
angetroffen. Seine Balgfrüchte werden kurz vor der Reifezeit gesammelt
und bilden ein nicht unwichtiges Handelsprodukt im Verkehr der
Eingeborenenstämme, indem diese aus den leuchtend gelben, unbehaarten,
außerordentlich stark bitter schmeckenden Samen ein sehr wirksames
Pfeilgift herstellen. In gleicher Weise werden in Ostafrika die
graugrünen, weißseidig behaarten Samen von Strophantus kombe
benutzt, die heute in den deutschen Apotheken ausschließlich offizinell
sind. Die sie erzeugende Liane wächst hauptsächlich am Sambesi und wird
ebenfalls vielfach von den Eingeborenen in Halbkultur um ihre Dörfer
gehalten. Schon David Livingstone machte auf seinen Forschungsreisen
von 1858–1864 auf das ostafrikanische Pfeilgift kombe und
auf die den Herzschlag verlangsamende Wirkung desselben aufmerksam.
1861 ermittelte dann der englische Konsul in Zanzibar, John Kirk,
daß dieses Kombegift aus Strophantussamen bereitet wird. Fagge und
Stevens, später Fraser, untersuchten dieses vom Sambesi erhaltene
Kombegift und letzterer stellte 1872 das Strophantin dar, dessen
physio[S. 364]logische Wirkung er auch klarlegte. Zugleich erkannte er
die Identität dieses Giftes mit dem 1864 von Pélikan untersuchten
westafrikanischen Pfeilgift inée oder onage (von den
Samen von Strophantus gratus) aus Gabun. 1867 waren die Samen
als neues Herzgift auf der Pariser Weltausstellung ausgestellt. Schon
1802 beschrieb A. de Candolle den Strophantus hispidus aus
Sierra Leone.
Von weiteren Apocynazeen, die als wichtige Giftpflanzen bei den
Eingeborenen eine große Rolle spielen, ist der Odallam und die
Tanghinpflanze zu erwähnen. An den Küsten des Indischen Ozeans
bis Neuguinea wächst ersterer (Cerbera odallam) als häufige
Strandpflanze. Seine dicken, fleischigen Äste tragen ziemlich große,
breitlanzettliche Blätter und endigen in einer Rispe stark duftender,
weißer Blüten. Die Früchte sind faustgroße, dunkelgrün gefärbte
Steinfrüchte, in deren fleischiger Schale ein äußerst zähes Netz
eingebettet ist, das mit seinem Geflecht das Eindringen von Meerwasser
zu den Samen verhindern soll; denn die Früchte sind für den Transport
mit den Meeresströmungen eingerichtet. Auf diese Weise wird die Pflanze
über alle Küsten des Indischen Ozeans verbreitet.
Noch viel giftiger als er ist die berüchtigte Tanghinpflanze
(Tanghinia venenifera) von Madagaskar, deren Früchte bei den
Gottesurteilen des dort lebenden Malaienstammes der Hova Verwendung
finden. Derjenige, der im Verdacht steht, ein Verbrechen begangen zu
haben, muß von der Frucht genießen. Ist er schuldig, so geht er daran
zugrunde; ist er aber unschuldig, so erbricht er sie und kommt mit
dem Leben davon. Natürlich ist dabei die Hand der Zauberpriester im
Spiele, die solchen, die sie retten wollen, zugleich ein Brechmittel
verabreichen.
In der europäischen Medizin haben diese beiden Drogen noch keine
Verwendung gefunden, wohl aber eine andere, die bei den Gottesurteilen
der Neger Westafrikas eine nicht unwichtige Rolle spielt, nämlich die
Kalabarbohne. Ihr Erzeuger ist die vom Kap Palmas bis Kamerun
heimische, neuerdings auch in Indien und Brasilien eingeführte, mehr
als 15 m emporsteigende Leguminose Physostigma venenosum
mit holzigem Stamm von 4 cm Dicke, gefiederten Blättern,
achselständigen, hängenden Trauben von großen, purpurroten Blüten
und etwa 14 cm langen, leicht zusammengedrückten Hülsen, die
1–3 nierenförmige, schokoladenbraune, glatte Samen mit einer tiefen,
von erhabenen Rändern umgebenen Rinne enthalten. Diese sind sehr
giftig, wenn auch beinahe geruch- und geschmacklos. Wer von den
Einge[S. 365]borenen der Zauberei beschuldigt wird, muß davon genießen.
Stirbt er daran, so ist er schuldig, bricht er es aus, so ist er
unschuldig. Letzteres hängt natürlich auch wieder davon ab, ob ihm
die allmächtigen Fetischpriester wohlwollen oder nicht. Ist ersteres
der Fall, so bekommt er im geheimen ein Brechmittel mit seiner Dosis
Gift eingeführt, das bald seine Wirkung tut und den Schützling des
Fetisches rettet. Die Pflanze wurde 1840 durch Daniell bekannt, 1859
beschrieb sie Balfour, und wenige Jahre später entdeckte Fraser ihre
eigentümliche arzneiliche Wirkung. Diese beruht auf dem Gehalt an dem
Alkaloid Physostigmin = Eserin, das farb-, geruch- und geschmacklose
Kristalle bildet und direkt lähmend auf das Zentralnervensystem,
zuerst das Gehirn und dann das Rückenmark, wirkt. Da es schon in
minimalen Dosen eine starke Zusammenziehung der Pupillen bewirkt,
benutzen es die Augenärzte, um die nach Atropineinträufelung
entstandene Pupillenerweiterung zu beseitigen, auch als Heilmittel
bei Augenkrankheiten. Daneben wird es bei Erschlaffung des Darmes
mit Kotstauung und gasiger Auftreibung des Leibes, bei Starrkrampf,
Neuralgien, Epilepsie usw. gegeben. Neben Physostigmin ist in den
Kalabarbohnen noch das dem Strychnin ähnlich wirkende Alkaloid Calabrin
und ein indifferentes Physosterin enthalten.
Von einer nahen Verwandten dieser stammt die als Ersatz der Chinarinde
gegen Fieber 1878 nach Europa eingeführte Rinde des in Argentinien
heimischen Quebracho (sprich kebratscho) (Aspidosperma
quebracho). Es ist dies ein Baum oder Strauch aus der Familie
der meist ziemlich giftige Vertreter aufweisenden Apocynazeen
oder Hundsgiftgewächse mit sehr hartem Holz, dünnen, hängenden
Zweigen, kleinen, stachlich zugespitzten, bräunlichgrünen Blättern,
gelben Blüten und großen, holzigen, rundlichen Fruchtkapseln.
Die Quebrachorinde enthält sechs verschiedene Alkaloide, die der
Zusammensetzung nach einigen Chinarindenalkaloiden ähneln. Heute wird
sie nur noch gegen Asthma gebraucht.
Häufigere Verwendung in der Arzneikunde finden die Blätter der
südamerikanischen Rutazee Pilocarpus pinnatifolius und anderer
verwandter Arten. Diese Rautengewächse aus der Verwandtschaft der
Zitronen-, Orangen- und Quassiabäume ist ein in Brasilien heimischer,
etwa 3 m hoher Strauch mit dicht rotgelb behaarten Zweigen,
lederigen, kurzgestielten, unpaariggefiederten, großen, unterseits
kurzhaarigen Blättern, dichten Trauben mit kleinen grünen Blüten und
einsamigen Kapseln. Die Blätter dieser Art, wie auch von Pilocarpus
jaborandi[S. 366] in Nordbrasilien, von P. selloanus und P.
trachylophus in Südbrasilien und verschiedener anderer Arten
wurden von den Indianern zum Schweißtreiben bei Krankheiten, wie auch
als Gegengift bei Schlangenbissen unter dem Namen Jaborandi
verwendet. Die erste Kunde über diese Droge findet sich in der 1648
erschienenen Historia naturalis Brasiliae von Piso und Marcgraf;
doch machte sie erst der brasilianische Arzt S. Continho in Pernambuco
1873 bekannt. Er bediente sich derselben als schweißtreibendem
Mittel und sandte in jenem Jahre Proben der Blätter zur Prüfung nach
Paris. Diese riechen beim Zerreiben aromatisch, schmecken scharf und
enthalten als hauptsächlich wirksame Substanz das 1875 gleichzeitig
von Hardy und Gerrard isolierte Pilocarpin, das die gesteigerte
Absonderung von Schweiß-, Speichel- und sonstigen Drüsen bewirkt, neben
Pilocarpidin, Isopilocarpin, dem atropinartig wirkenden Jaborin und
Gerbstoff. Das Jaborin des Handels ist ein Gemisch dieser letzteren
mit einer Spur Pilocarpin. Der Gehalt an freien Alkaloiden beträgt
in den Jaborandiblättern durchschnittlich 0,75 Prozent. Nur infolge
Beimengung minderwertiger Sorten wird er geringer. Als Surrogat werden
verschiedene andere Blätter von ähnlicher Wirkung verwendet, auf die
wir hier nicht eintreten wollen.
Weit größere Bedeutung haben in der modernen Medizin die gleichfalls
in Südamerika heimischen Kokablätter erlangt, aus denen das
zur Schmerzbetäubung und zur Anregung der seelischen und motorischen
Zentren der Großhirnrinde in so reichem Maße dienende Cocain gewonnen
wird. Seit Urzeiten werden sie von den Indianern der Westküste
Südamerikas als koka, d. h. Pflanze (also Pflanze par
excellence) — von den Spaniern coca geschrieben —
als Anregungsmittel und zur Vertreibung der Müdigkeit während der
Ruhepausen zusammen mit etwas ungelöschtem Kalk oder der Asche von
Chenopodium quinoa, einer dort viel angepflanzten Nährfrucht
aus der Familie der Melden, gekaut. Dadurch wird eine reichliche
Absonderung grünen Speichels bewirkt, daneben aber ein Gefühl der
Leichtigkeit, eine lebhafte, freudige Aufregung bewirkt, die es
ermöglicht, ohne spürbare Ermüdung schwerbeladen die anstrengendsten
Märsche über die höchsten Pässe der Anden zu bewältigen. Mäßig genossen
haben die Kokablätter keine schädliche Wirkung, nur in größeren Mengen
und gewohnheitsmäßig gebraucht, wirken sie lähmend und rufen einen als
Kokakachexie bezeichneten Zustand hervor, der sich durch Abmagerung,
Verfall der Körperkräfte und Herabsetzung aller geistigen Tätigkeit
bekundet.
[S. 367]
Daß nun die Peruaner schon sehr lange vor der Entdeckung ihres Landes
durch die Europäer eine für sie so wichtige Pflanze für heilig
hielten und sie um ihre Ansiedlungen herum kultivierten, kann uns
nicht wundern. Ihre Blätter waren im ganzen Lande sehr begehrt und
galten als beliebtestes Tauschmittel an Stelle des Geldes. Bei der
Eroberung Perus unter Francisco Pizarro 1532–1533 lernten die Spanier
dieses Genußmittel kennen, wandten es aber selbst nicht an; vielmehr
verboten sie auf Veranlassung der christlichen Priester die Kultur der
Pflanze. Nach wenigen Jahren aber gestatteten sie dieselbe wieder;
denn der Anbau dieser Pflanze war seit den ältesten Zeiten eine der
Hauptarbeiten der Eingeborenen. So kommt es, daß die ursprünglich wilde
Form derselben im Lande fast nicht mehr gefunden wird. Der 1,5 m
hoch werdende Kokastrauch mit bis 8 cm langen und halb so
breiten, oben oliven- und unten graugrünen, eiförmigen, lederartigen,
kahlen Blättern wird außer in Peru und Ekuador vorzugsweise in
Kolumbia an den östlichen Abhängen der Anden in einer Höhe von
1000–2000 m in ausgedehnten, cocales genannten Plantagen
angepflanzt. Alle 2–3 Monate werden die reifen Blätter, die einen
Stich ins Gelbliche zeigen, bei trockenem Wetter gesammelt und sofort
getrocknet, um dann fest in Wollsäcke eingepreßt versandt zu werden.
Da sie aber durch längeren Transport bis zur Hälfte ihres Gehaltes
an wirksamer Substanz einbüßen, werden sie vielfach schon an Ort und
Stelle verarbeitet, wobei 1 kg trockene Blätter 2 g
Cocain geben. So nannte Niemann 1860 das höchstens bis zu 1 Prozent in
den Kokablättern enthaltene wirksame Alkaloid, das Gädicke 1855 zuerst
entdeckt und Erythroxylin genannt hatte. 1884 erst führten Freund und
Koller das Cocain als die damit bepinselten Schleimhäute unempfindlich
machendes Mittel in die Heilkunde ein. Bald wurde es auch innerlich als
Anästhetikum der Magenschleimhaut und die seelischen und motorischen
Funktionen des Gehirns anregendes Mittel gegeben und führte auch wie
das Morphin vielfach zu Mißbrauch.
Mit dem beginnenden starken Verbrauch der Droge in der ganzen
Kulturwelt wurde der in den östlichen Andengebieten Perus und
Bolivias in den nie vom Frost heimgesuchten warmen Hochtälern bis
dahin ausschließlich von den Indianern kultivierte Kokastrauch
(Erythroxylon coca) nach Westindien, Ostindien, Ceylon,
Java, Australien, Zansibar und Kamerun gebracht und dort im großen
angepflanzt. Diese Länder versorgen nun auch den Weltmarkt mit ihren
Produkten. Am üppigsten gedeiht der Strauch in feuchten Lagen; doch
gewinnen[S. 368] seine Blätter in trockenen Lagen an Güte, deshalb werden
nur solche zum Anbau ausgewählt. Schon nach 2½ Jahren geben sie
vier Ernten im Jahr und bleiben bis zum 40. Jahr ertragsfähig. Die
ersten Nachrichten von dieser Pflanze datieren von 1499. Im Jahre 1570
machte dann der spanische Arzt Nicolaus Monardes nach seiner Rückkehr
aus Südamerika die Wirkung des Kauens der Kokablätter, die von über
acht Millionen Menschen im Andengebiet täglich geübt wird, in Sevilla
bekannt, und Joseph de Jussieu sandte 1750 die erste Kokapflanze aus
Peru nach Europa, wo sie im Jardin des plantes Aufnahme fand.
Ein narkotisches, krampfstillendes Harz liefert der indische
Hanf (Cannabis indica). Es ist dies eine Varietät des in
Westasien heimischen gewöhnlichen Hanfes (Cannabis sativa),
die nur im warmen Ostindien dieses Harz reichlich erzeugt und hier
in erster Linie zur Gewinnung desselben gepflanzt wird. Erst in
gebirgigen, kälteren Distrikten, wie z. B. im Himalaja, wo die Pflanze
ihr narkotisches Harz nicht mehr produziert, wird sie, wie bei uns,
zur Gewinnung ihrer Faser angebaut. Das schon unter 50° C.
schmelzende Harz wird besonders von den weiblichen Blütenständen
der bis 2 m hoch werdenden Pflanze ausgeschwitzt und durch
eingeborene Arbeiter in der Weise gewonnen, daß sie, in der Regel
nackt und nur ausnahmsweise mit einem Lederanzuge bekleidet, durch
die Hanfpflanzungen hindurchgehen, wobei sich das Harz an ihnen
festsetzt. In Persien dagegen wird es meist dadurch erhalten, daß man
die in Blüte stehenden Spitzen und die Blätter der Pflanze stundenlang
kräftig auf rauhen, groben, wollenen Teppichen reibt, so daß sich das
Harz auf der Oberfläche des Teppichs ablagert, von wo es mit einem
Messer abgeschabt und zu Kuchen geformt wird. Die Stücke, wie sie
auf den Märkten Zentralasiens verkauft werden, stellen dicke Tafeln
von außen dunkelbrauner, innen grünlicher bis bräunlicher Farbe und
fester Konsistenz dar. Dies ist der Haschisch, ein persisches Wort,
das Kraut bedeutet, weil früher an seiner Stelle die harzreichen
Blütenteile selbst, sei es zum Rauchen, sei es als innerlich genommenes
Medikament, zur Anwendung gelangten. Der Haschisch enthält bis 37
Prozent Harz und ätherisches Öl, daneben 3,3 Prozent Cannabinol (ein
giftiges rotes Öl aus der Reihe der Phenole), das die hauptsächlich
wirksame Substanz darstellt. Die Droge muß sehr vorsichtig aufbewahrt
werden und verliert mit dem Alter bedeutend an Wirksamkeit. In Südasien
war die narkotische Wirkung des Hanfharzes schon im 8. Jahrhundert
v. Chr. bekannt; die Handels[S. 369]namen lassen sich alle auf Indien
zurückführen. Als Berauschungsmittel ist es in Vorderasien erst durch
die Muhammedaner eingebürgert worden. In Deutschland kam die Droge erst
im 17. Jahrhundert zur medizinischen Verwendung, und wissenschaftliche
Versuche über die Wirkung desselben wurden in der Mitte des 19.
Jahrhunderts auf Veranlassung von O’Shaughnessy in Kalkutta angestellt.
Sehr nahe mit dem Hanf verwandt ist der Hopfen (Humulus
lupulus), dessen Fruchtzapfen außer Harz und einem ätherischen
Öl, ein von Griesmayer zuerst Lupulin, später aber, um Verwechslungen
zu vermeiden, Humulin genanntes Alkaloid von narkotischer,
krampfstillender Wirkung enthalten. Deshalb dienen sie außer in der
Bierbrauerei auch in der Medizin, seitdem sie 1813 der französische
Apotheker Planche als Heilmittel empfahl. 1821 destillierten dann Payen
und Chevalier zuerst das ätherische Hopfenöl. Später kam dann von
Amerika her die Bezeichnung Lupulin für die Fruchtzapfen der allein
kultivierten weiblichen Pflanze auf. Die Droge wird nur von in Kultur
stehenden Pflanzen gesammelt und gut getrocknet, vor Licht und Luft
geschützt aufbewahrt, hält sich aber auch so nicht über ein Jahr in
voller Wirkung.
Mit dem Oleander und dem westafrikanischen Strophantus zu den
Apocynazeen oder Hundsgiftgewächsen gehörig ist der kanadische
Hanf (Apocynum cannabinum), dessen Wurzel seit langer Zeit
von den Indianern als Medikament verwendet wurde. Von ihnen lernten die
Weißen in Nordamerika sie kennen. Das neuerdings aus den Vereinigten
Staaten in größerer Menge besonders nach Rußland importierte, daraus
hergestellte Fluidextrakt enthält das nach Art der Digitalis auf das
Herz wirkende Glykosid Apocynin. Das Mittel verdient auch bei uns
öfter zur Anwendung zu gelangen, da ihm eine sehr gute Wirkung auf das
erkrankte Herz nachgerühmt wird.
Ebenfalls schon lange von den Indianern Nordamerikas medizinisch,
besonders als Wundmittel, benutzt wurde die nach ihrer Ähnlichkeit
mit unserer Haselnuß von den Weißen als Zauberhasel bezeichnete
Hamamelis von Virginien (Hamamelis virginiana). Dieser
bis 7 m hohe Strauch ist ein Hauptbestandteil der Wälder der
atlantischen Staaten der nordamerikanischen Union, der besonders viel
zur bunten herbstlichen Verfärbung der Wälder beiträgt. Seine holzige
Kapseln darstellenden Früchte öffnen sich mit solcher Gewalt, daß die
Samen bis 4 m weit fortgeschleudert werden. Das alkoholische
Fluidextrakt aus der Rinde enthält neben einem glykosidischen Gerbstoff
und Fett[S. 370] etwa 8 Prozent Hamamelitannin und wird als tonisches und
adstringierendes Mittel gegen Diarrhöen und Blutungen angewandt. Auch
äußerlich wird dieses Hazeline genannte Präparat als blutstillendes
Mittel und gegen Hämorrhoiden gegeben, daneben das aus der Hamamelis
gewonnene Fett zu der höchst angenehmen Hazelinecrême verarbeitet.
Als Tonikum und Sedativum des Uterus bei habituellem Abort ist auch bei
uns seit etwa 40 Jahren das aus Nordamerika eingeführte Fluidextrakt
der Rinde des amerikanischen Schneeballenbaums
(Viburnum prunifolium) im Gebrauch. Es ist dies ein in
den östlichen und mittleren südlichen Staaten der Union bis zum
Mississippi, aber auch in Kanada, wenn auch dort kleiner an Wuchs,
heimischer 3–5 m hoher Strauch oder Baum, der neuerdings
auch bei uns als Zierstrauch gepflanzt wird. Das flüssige Extrakt
der Wurzel-, Stamm- und Zweigrinden enthält neben verschiedenen
Pflanzensäuren und Gerbsäure ein bitterschmeckendes, gelbbraunes
Harz, welch letzteres in derselben Beschaffenheit auch in unserem
einheimischen Schneeball (Viburnum opulus) enthalten ist,
weshalb dessen Rinde in derselben Weise arzneilich verwendet wird.
Ein im südlichen Teile der brasilianischen Provinz Bahia häufiger Baum
mit violetten Blüten aus der Familie der Schmetterlingsblütler ist
der Ararobabaum (Andira araroba), der in kleineren und
größeren Hohlräumen des 1–2 m dicken Stammes eine zerreibliche,
fast erdige, gelbbräunliche, stark abfärbende Masse ausscheidet, deren
Anwendung als Heilmittel die in Brasilien eingewanderten Portugiesen
von den Indianern kennen lernten. Von dort brachten sie die Droge nach
ihrer ostindischen Besitzung Goa, wo sie hauptsächlich gegen parasitäre
Hautkrankheiten Anwendung fand. Dort lernte Kemp im Jahre 1864 das
Mittel kennen und machte in der Folge die europäischen Ärzte darauf
aufmerksam. Da stellte Silva Lima 1875 fest, daß die araroba
der brasilianischen Eingeborenen, die, weil von Bahia aus verschifft,
als Polvo de Bahia in den Handel gelangte, mit dem Polvo
de Goa aus Ostindien identisch sei, und fast gleichzeitig wies
Attfield Chrysophansäure in derselben nach. 1878 erkannten Liebermann
und Seidler als Hauptbestandteil der Droge (nämlich 90 Prozent)
das Chrysarobin, das sich bei Gegenwart von Luft und Alkalien zu
Chrysophansäure oxydiert; daneben sind noch 10 Prozent in Benzol
lösliche harzartige Substanzen darin enthalten. 1879 beschrieb
Aguiar die Stammpflanze als Andira araroba. Das gelbbraune
Ararobapulver[S. 371] wird aus ihr in der Weise gewonnen, daß man die Bäume
fällt, ihren Holzkörper in Blöcke zersägt, spaltet und die mit der
gesuchten Masse gefüllten Hohlräume auskratzt. Die rohe Ware gelangt
seit 1875 aus Brasilien direkt, statt wie früher aus Bahia über Goa, in
den europäischen Handel und wird in Europa von den darin enthaltenen
Holzsplittern und Rindenteilen gereinigt. Besonders zur Behandlung
der Psoriasis genannten Schuppenflechte hat sich das daraus gewonnene
Chrysarobin als außerordentlich nützlich erwiesen.
Neuerdings kommen aus Mittelchile die Früchte des Bóldo
(Boldoa fragrans) als besonders gegen Leber- und
Gallensteinleiden empfohlenes Mittel nach Europa. Es ist dies ein
immergrüner, stark duftender, dicht belaubter kleiner Baum oder
Strauch, der ziemlich häufig wild angetroffen und nicht kultiviert wird.
In mannigfaltigster Weise wird innerlich und äußerlich in der Medizin
das Terpentinöl verwendet, das von verschiedenen Fichtenarten
gewonnen wird. Beim Verwunden der Stämme derselben fließt eine
gelblichweiße, honigdicke, klebende, Terpentin genannte balsamartige
Masse aus, aus der dann durch Destillation mittels Wasserdämpfen das
neben wenig Harzen und Pflanzensäuren hauptsächlich Pinen, Dipenten
und polymere Terpene enthaltende ätherische Terpentinöl gewonnen wird.
Von Bedeutung für den Handel sind nur die nordamerikanischen, aus
Pinus australis (teilweise aber auch aus der Hemlockfichte,
Tsuga canadensis) gewonnenen, etwas nach Kolophonium riechenden
Terpentinöle und das noch bessere, von der Strandfichte Pinus
pinaster gewonnene, nach Wacholder riechende französische
Terpentinöl. An dritter Stelle kommt die Produktion Rußlands, die, wie
die französische, zum größten Teil im Lande selbst Verwendung findet.
Die Produktion der Vereinigten Staaten Nordamerikas beträgt jährlich
nicht weniger als 470000 Fässer zu 50 Gallonen (etwa 150 kg)
= 70 Millionen kg Öl im Werte von 32 Millionen Mark, die mehr
als zur Hälfte über Savannah, den bedeutendsten Handelsplatz Georgias
exportiert werden. Die bedeutendsten europäischen Märkte dafür sind
London, Hamburg und Antwerpen.
Schon im klassischen Altertum war aus dem Harz verschiedener
Fichten gewonnenes ätherisches Öl meist unter dem Namen Zedernöl in
technischem und arzneilichem Gebrauch, während man unter Terpentinöl
(terebínthinon élaion), wie uns der um die Mitte des 1.
Jahrhunderts n. Chr. lebende griechische Arzt Dioskurides berichtet,
das aus den Früchten der in den Mittelmeerländern heimischen
Tere[S. 372]binthe oder Terpentinpistazie (Pistacia therebinthus)
— griechisch terébinthos — gepreßte, später auch durch
Einschnitte in den Stamm des betreffenden Baumes gewonnene ätherische
Öl verstand. Auch in China und Japan hat auf Grund der frühen und hohen
Entwicklung der Lackindustrie die Gewinnung destillierter Koniferenöle
schon in früher Zeit stattgefunden. Aber mit der altweltlichen hat sich
die nordamerikanische Terpentinölindustrie erst seit dem Anfang des 18.
Jahrhunderts entwickelt.
Wie das Terpentinöl findet auch der durch trockene Destillation aus
dem Holze der Stämme und Zweige von Koniferen, vornehmlich Pinus
silvestris, gewonnene Holzteer in der Arzneikunde innerlich
als sekretionsbeschränkendes Mittel und äußerlich bei Hautkrankheiten
vielfach Verwendung. Er bildet eine dickflüssige, braunschwarze
Masse von eigentümlichem brenzlichem Geruche und widerlich bitterem,
brennendem Geschmacke und enthält außer indifferenten Ölen und
Pflanzensäuren Paraffin, Kreosot, Brenzkatechin, Guajakol, Phenol oder
Karbolsäure, Kresol, Benzol, Toluol, Naphthalin und andere wertvolle
Stoffe, die teilweise daraus isoliert werden, um als solche gegeben
werden zu können. Der meiste Holzteer wird im waldreichen Nordeuropa
entweder in besonderen Teerschwelereien oder als Nebenprodukt der
Holzkohlenbereitung und der Holzessigfabrikation gewonnen. Schon im
Altertum kannte man dieses Produkt, das die Römer pix liquida
nannten. Plinius beschreibt ausführlich dessen Gewinnung und Verwendung.
Ärmer an harzartigen Stoffen, dafür aber reicher an brenzlichen Ölen
als der Koniferenteer ist der aus dem Holz der Rotbuche (Fagus
silvatica) destillierte Buchenteer, aus welchem das bis zu 25
Prozent in ihm enthaltene Kreosot gewonnen wird, und der hauptsächlich
in Rußland und Polen aus dem Holz von verschiedenen Birkenarten,
besonders Betula verrucosa, pubescens und alba,
destillierte Birkenteer von an Juchtenleder (das auch damit behandelt
wird) erinnerndem Geruch. Eigentümlich naphthalinartig riecht
dagegen der durch trockene Destillation der Steinkohlen bei der
Leuchtgasfabrikation erhaltene Steinkohlenteer, der allerdings im
Gegensatz zu den vorigen kaum in der Medizin Verwendung findet, aber
das Rohprodukt sehr zahlreicher aus ihm gewonnener chemischer Stoffe
bildet und daher für die chemische Industrie von der größten Bedeutung
ist.
Von Pflanzenstoffen, die zur Vertreibung von Bandwürmern dienen, ist
teilweise schon im Altertum neben der allerdings gebräuch[S. 373]licheren
Wurzel des Wurmfarns (Aspidium filix mas), die wir bereits
besprachen, der Saft der Granatäpfel gebräuchlich gewesen. Schon der
ältere Cato (234–149 v. Chr.) empfiehlt ihn dagegen. Auch die sonst
zum Gerben dienenden Fruchtschalen des Granatbaumes (Punica
granatum) waren im Mittelalter offizinell. Die Rinde von Stamm und
Wurzel desselben hat erst Buchanan 1807 als Bandwurmmittel empfohlen,
nachdem er diese Verwendung bei den Hindus in Indien kennen gelernt
hatte. 1878 entdeckte dann der französische Apotheker Tancret die
Alkaloide der Rinde, unter denen das Pelletierin das wichtigste ist.
Außerdem enthält sie 22–28 Prozent Gerbsäure, dient daher technisch zum
Gerben des Marokkoleders (französisch marrocain genannt). Die
meiste Granatrinde kommt aus Algier und Südfrankreich in den deutschen
Handel und wird in der Regel nur von den als Obstbäume nicht mehr
verwendbaren Exemplaren geerntet. Sie wird als Pulver, Dekokt oder
Extrakt verwendet.
Ein seit uralter Zeit in Abessinien, wo infolge des beständigen
Essens von rohem Fleisch, besonders Rindfleisch, fast jedermann an
Bandwürmern leidet und regelmäßig von Zeit zu Zeit das Mittel einnimmt,
gebräuchliches Anthelmintikum sind die getrockneten, abgeblühten
weiblichen Blütenstände des Kusso genannten Baumes (Hagenia
abyssinica). Es ist dies ein in den gebirgigen Teilen Abessiniens,
am Kilimandscharo und im Usambaragebirge in Deutsch-Ostafrika
wachsender, bis 20 m hoher Baum mit zottig behaarten Zweigen,
gefiederten Blättern, großen Rispen reich mit Drüsen besetzter
weißer Blüten und eiförmigen Nüßchen. Die bis 30 cm langen,
bereits abgeblühten weiblichen Rispen, bei denen die ausgewachsenen
Kelchblätter dunkelpurpurrot geworden sind, bilden das offizinelle
Kusso oder Koso, das in Bündeln von etwa 50 cm Länge verpackt,
mit gespaltenen Halmen des gegliederten Zypergrases umwickelt, über
die an Riffen reiche Meerenge von Bab-el-mandeb, d. h. wegen der
vielen dort gescheiterten Schiffe „Tor der Tränen“ genannt, nach Aden
gebracht wird, um dann von dort aus in Säcken von 15 kg nach
Triest, Livorno und Bombay in den Handel zu gelangen. Der kräftige,
charakteristische, unangenehme Geruch und die verhältnismäßig
lebhaftrote Farbe sind Zeichen für die Güte der Droge, während alte,
unwirksame Ware braun und schwachriechend ist. Der Geschmack ist
anfangs schleimig, dann unangenehm bitter und zusammenziehend. Die
Blüten enthalten neben 24 Prozent Gerbstoff als hauptsächlich wirksamen
Stoff das Kosotoxin, außerdem Kosidin, Kosoin und Protokosin. Der
erste Europäer, der[S. 374] den Baum auf seiner Entdeckungsreise nach den
Nilquellen 1769 bis 1771 in Abessinien beobachtete und den Gebrauch der
Blüten von seiten der Eingeborenen gegen Eingeweidewürmer sah, war der
Engländer James Bruce. Er beschrieb ihn unter dem Namen Bankesia
abyssinica. Getrocknete Zweige mit Blättern und Blüten des Baumes
brachte 1822 der französische Arzt Brayer nach Paris. Danach wurde
die Pflanze von Knuth, der die ältere Brucesche Bezeichnung nicht
kannte, Brayera anthelminthica genannt. 1834 wurde die Droge in
Deutschland eingeführt, gelangte aber erst seit 1852 in größeren Mengen
durch Jabot zu sehr teuren Preisen in den Handel. Frische Kussoblüten
befördern ebenso rasch als das Extrakt der Wurmfarnwurzel und der
Granatrinde die drei hauptsächlich in Betracht kommenden Tänien-Arten
aus dem Darm, in welchem sie schmarotzen.
In Ostindien und Indonesien werden vielfach die gepulverten
gerbstoffreichen Arekanüsse, von Areca catechu, die
sonst von jedermann mit einem Blatte des Betelpfeffers und etwas
gelöschtem Kalk als Genußmittel gekaut werden, mit Kaffee oder heißer
Milch vermischt, zum Abtreiben von Würmern verwendet. Noch beliebter,
weil viel wirksamer, ist dort der von den etwa 1 cm großen
Früchten des kleinen, immergrünen Kamálabaumes (Mallotus
philippinensis) abgeriebene drüsighaarige Überzug, der als
ein leichtes, feines, weiches, ungleichförmiges, nicht klebendes
braunrotes Pulver ohne Geruch und Geschmack in den Handel kommt. Der
zu den Euphorbiazeen oder Wolfsmilchgewächsen gehörende kleine Baum
oder Strauch mit abwechselnden, gestielten, ovalen, zugespitzten,
unterseits filzig behaarten und mit roten Drüsen besetzten Blättern,
innen rotdrüsigen Blüten in achselständigen Blütenständen und mit
scharlachroten Drüsen dicht besetzten kirschgroßen Kapseln wächst
in mehreren Varietäten in ganz Südasien, der malaischen Inselwelt,
Neuguinea und Nordaustralien und liefert in den Früchten ein zum
Brennen und als Abführmittel benutztes fettes Öl. Der als Kamála in den
Handel gelangende drüsige Überzug der Früchte dient in Indien außer
als Bandwurmmittel auch seit alter Zeit zum Färben von Seide und gibt
ein schönes Orangebraun. Siedendes Wasser wird von ihm nur schwach
gelb gefärbt; Eisenchlorid färbt diesen Auszug braun, Alkalien dagegen
färben ihn dunkelrot. Die wirksame Substanz im Kamála ist außer 80
Prozent Harz das von Anderson in gelben Nadeln isolierte Rottlerin und
ein gelber, kristallisierbarer Farbstoff. Im hortus malabaricus
hat Rheede 1678 den Kamálabaum zuerst abgebildet. Die anthelminthische[S. 375]
Wirkung des Drüsenüberzuges seiner Früchte wurde erst 1841 von Irvine
in Kalkutta empfohlen. 1864 wurde es in die englische Pharmakopoe, 1871
auch in die deutsche aufgenommen. Man sammelt die Handelsware in Indien
fast ausschließlich von wildwachsenden Bäumen. Man pflückt die Früchte
im März, schüttelt sie in Sieben und reibt den Rest der Drüsen vollends
ab. Zu einer Bandwurmkur genügen 6–10 g davon. Vor dem Kusso
hat es den Vorzug, weniger leicht Übelkeit und Erbrechen zu erregen
und zugleich abführend zu wirken. Auch gegen Hautkrankheiten wird es
benutzt.
In Südarabien und den gegenüberliegenden afrikanischen Ländern wird
seit alter Zeit ein als Wurrus bezeichnetes, dem Kamála
ähnliches Präparat als Bandwurmmittel benutzt. Es sind die kleinen
Drüsen der jungen Hülsen eines Schmetterlingsblütlers (Crotalaria
erythrocarpa), die dem Kamála analoge Substanzen enthalten und
Seide goldgelb färben, und zwar noch intensiver als Kamála.
Als Volksmittel gegen Bandwurm sind endlich noch die Samen des
aus Amerika bei uns eingeführten Riesenkürbis (Cucurbita
maxima) zu erwähnen, die zu 60–80 Stück, zerstoßen und mit Wasser
verrieben, als Emulsion getrunken werden.
Im Klistier gegen Eingeweidewürmer, besonders aber äußerlich in Form
von Pulver oder Tinktur gegen Läuse werden die aus Mittelamerika
stammenden Sabadillsamen oder Läusekörner benutzt. Sie werden
von einem stattlichen, bis 2 m hohen Zwiebelgewächs aus der
Familie der Liliazeen (Sabadilla officinarum) hervorgebracht,
das in ganz Mittelamerika und Venezuela heimisch ist und an den
Küsten des Golfes von Mexiko auch kultiviert wird. Die Handelsware
wird vorzugsweise in Venezuela meist von wildwachsenden Pflanzen
gesammelt und kommt über Caracas beziehungsweise La Guayra, dem
Hafen von Caracas, an erster Stelle nach Hamburg. Sie sind bis
8 mm dick, länglich, unregelmäßig kantig und von einer dünnen,
glänzend braunschwarzen Samenschale umgeben. Sie enthalten etwa 4
Prozent Alkaloide, die das offizinelle, käufliche Veratrin bilden.
Dieses ist kein einheitlicher Körper, sondern ein inniges Gemenge
mehrerer Alkaloide, nämlich vorwiegend Cevadin und Veratrin, außerdem
Cevadillin, Sabadin, dem zum Teil an Cevadinsäure und Veratrumsäure
gebundenen Sabadinin und Veratramarin. Die wichtigste Anwendung der
Sabadillsamen ist die Gewinnung des Veratrins, das bei Neuralgien,
Rheumatismus und Lähmungen als Irritans meist in Salbenform eingerieben
wird.
[S. 376]
Die Spanier lernten um 1570 als erste Europäer den Sabadillsamen als
Mittel gegen Läuse bei den Azteken Mexikos kennen. 1572 erhielt bereits
der Arzt Nikolaus Monardes in Sevilla ein Muster davon zugeschickt.
Dieser und der später lebende Hernandez, der eine Abbildung der Pflanze
1651 veröffentlichte, verglichen die Pflanze ihres Blütenstandes wegen
mit der Gerste, spanisch cebada, und nannten sie im Gegensatz
zu jener mit dem Diminutiv cebadilla, woraus dann später
sabadilla wurde. Lemery bezeichnet die Pflanze direkt als eine
Art Gerste. Im Jahre 1726 bildete der Sabadillsamen einen wichtigen
Bestandteil des französischen „Kapuzinerpulvers“ und kam in der Folge
auch unvermischt zur Vertilgung von Ungeziefer in allgemeinen Gebrauch.
Für den vom Apotheker Wilhelm Meißner in Halle 1818 in den Läusesamen
aufgefundenen basischen Körper Sabadillin gebrauchte der Entdecker
1821 zum erstenmal den Ausdruck „Alkaloid“, der dann zur Bezeichnung
aller Pflanzenbasen in Aufnahme kam. Die beiden französischen Apotheker
Pelletier und Caventou stellten 1819 zum erstenmal den von ihnen
Veratrin genannten Stoff dar. Die Stammpflanze wurde nämlich zu dieser
Zeit mit der wissenschaftlichen Bezeichnung Veratrum officinale
belegt.
Schon im Altertum wurde der Senf sowohl als Gewürz, als auch
als Arzneimittel innerlich und äußerlich gebraucht. Die Griechen
nannten ihn sinēpi oder nápy, eine Bezeichnung, die dann
die Römer mit der Pflanze von ihnen übernahmen. Wahrscheinlich wurde
im Altertum vorzugsweise der schwarze Senf (Brassica nigra)
angebaut, der heute noch in Südeuropa bevorzugt wird. Wenigstens
verlangt der um die Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. lebende
griechische Arzt Dioskurides als Merkmal eines guten Senfes, daß er
gestoßen grün aussehe, womit nur der schwarze Senf gemeint sein kann.
Auch Palladius im 4. Jahrhundert n. Chr. spricht sich in demselben
Sinne aus. Die Hippokratiker wandten ihn besonders bei Brustkrankheiten
zur Beförderung des Auswurfs an. Dioskurides sagt von ihm, er erwärme
und ziehe, wenn er gegessen wird, den Schleim an sich. Gepulvert
geschnupft errege er Nießen. Er werde außer innerlich auch äußerlich
als Reizmittel verwendet. In Wasser erweichte, dann zerriebene und
mit Olivenöl gemischte Senfsamen reibe man in schmerzende Stellen
ein. Scribonius Largus und Alexander Trallianus (im 6. Jahrhundert)
empfehlen den Senf als Heilmittel. Auch im Mittelalter wurde er als
solches verwendet. 1607 wird Senfmehl in der Apothekertaxe der Stadt
Schweinfurt angeführt. 1608 meldet der Italiener[S. 377] Porta, daß das aus
den Samen gepreßte fette Öl flüssiger und schärfer erhalten werde,
wenn die Samen vorher in Wasser erweicht würden. Die Notwendigkeit des
Wassers zur Senfölbildung wies zuerst Glaser 1825 nach, und 1840 fanden
Boutron und Frémy, daß dabei ein Ferment wirke. Heute wissen wir, daß
in den Senfsamen außer Sinapin und Sinapinsäure das aus myronsaurem
Kalium bestehende Glykosid Sinigrin enthalten ist, das unter dem
Einfluß des ebenfalls darin enthaltenen Fermentes Myrosin bei Gegenwart
von Wasser (unter Aufnahme eines Molekels desselben) Allylsenföl,
Traubenzucker und Kaliumhydrosulfat und als Nebenprodukte Allylcyanid,
Schwefelkohlenstoff und freien Schwefel liefert. Meist wird das
Senfmehl als Senfteig und Senfpapier zur Ableitung von allerlei
Schmerzen und Entzündungen innerer Organe äußerlich angewendet, wobei
eine hauptsächlich durch das Allylsenföl hervorgerufene Rötung der Haut
eintritt.
Auch die 6 Prozent Schleim enthaltenden Leinsamen wurden
schon im Altertum innerlich als reizmilderndes, einhüllendes Mittel
bei Darmkatarrh mit Diarrhöe und Blasenentzündung und äußerlich
zu Kataplasmen verwendet. Als solches benutzten sie sowohl die
Hippokratiker als die Ärzte der römischen Kaiserzeit. Im 12.
Jahrhundert empfahl sie die heilige Hildegard von Rupertsberg bei
Bingen zu Umschlägen. Zu letzteren ist das entölte Leinsamenmehl besser
als das ölhaltige, da es mehr Wasser als jenes bindet.
Die 22 Prozent Schleim enthaltenden Quittenkerne wurden erst von
den Arabern medizinisch benutzt; von diesen lernten die europäischen
Ärzte deren Verwendung als einhüllendes Mittel und Beigabe zu
Augenwässern. Heute werden sie nur noch selten dafür gebraucht.
Als reizmilderndes, einhüllendes Mittel bei Husten wird seit
1837 in Deutschland der durch Graefe nach Berlin gelangte krause
Knorpeltang (Chondrus crispus) verwendet. Dieser wächst
überall an der felsigen Küste des nördlichen Atlantischen Ozeans
und dient den armen Küstenbewohnern Irlands als Nahrungsmittel
und Volksheilmittel. Von der irischen Bezeichnung Carraigeen, d.
h. Felsenmoos, rührt die bei uns dafür gebräuchliche Bezeichnung
Carrageen her. In Dublin wurde es 1831 als Ersatz des teuren
arabischen Gummis angewandt. Außer dem Norden und Nordwesten Irlands
liefert die Küste von Massachusetts in den Vereinigten Staaten
die größte Menge der Droge in Form der getrockneten, höchstens
handgroßen, gelappten Vegetationskörper dieser Meeresalge teilweise
mit Gigartina mamillosa vermischt. Andere Meeresalgen dürfen
nur in sehr geringer Menge darin vor[S. 378]handen sein. Die im frischen
Zustande schwarzrot, violettrot bis grünrot gefärbten Algen werden
in Fässern mit Süßwasser ausgewaschen, an der Sonne gebleicht und
getrocknet. Der rote, Phycoerythrin genannte Farbstoff zersetzt sich in
den toten Pflanzen und läßt sich mit Wasser ausziehen. Die getrocknete
Droge ist bräunlich- bis weißgelb, steifknorpelig, durchscheinend und
entwickelt, mit kaltem Wasser aufgequollen, den charakteristischen
Meeresgeruch. Sie schmeckt schleimig-fade und enthält neben 6,3
Eiweißstoffen 80 Prozent Carrageenschleim, der in der lebenden Pflanze
den Zweck hat, sie während der Ebbe durch Zurückhalten von reichlich
Wasser vor dem Austrocknen zu bewahren. Außer in der Medizin und als
leichtverdauliches Nahrungsmittel finden die Carrageen auch in der
Technik als Klär- und Klebemittel, als Bindemittel bei Wasserfarben
usw. viel Verwendung. Die 18 Prozent Asche, die sie beim Verbrennen
zurücklassen, enthält reichlich Chloride und Sulfate, weniger Jodide
und Bromide. Letztere sind reichlicher in der Asche anderer Meeresalgen
enthalten, so vor allem im Blasentang (Fucus vesiculosus) und
seinen Verwandten, die als Kelp oder Varek an den Küsten
der Bretagne und Irlands gesammelt und getrocknet werden, um nach ihrer
Verbrennung daraus durch Destillation mit Braunstein und Schwefelsäure
das im Meerwasser nur in Spuren vorhandene Jod zu gewinnen.
In derselben Weise wie die Carrageen dient eine im Indischen und
Stillen Ozean weitverbreitete Rotalge (Eucheuma spinosum)
besonders an den Küsten Chinas und Japans als Volksnahrungsmittel. Sie
enthält als Hauptbestandteil eine pektinartige Gelose und kam im Jahre
1840 unter dem Namen Agar-agar als Heilmittel nach Europa. Sie
dient in der Appretur, Konditorei und Küche. Für die Heilkunde ist
sie insofern sehr wichtig, weil aus ihr die Gallerte gewonnen, die
zur Herstellung von festen Kulturböden zur Reinzucht von Bakterien in
der Bakteriologie eine so große Bedeutung erlangt hat, weil sie im
Brutschrank bei viel höherer Temperatur als die gewöhnliche Gelatine
tierischen Ursprungs noch in festem Zustande verharrt. Deshalb ist
sie zur Kultur aller nur bei Bluttemperatur gedeihender Bakterien
unumgänglich nötig. Wie sie enthält auch die an denselben Meeresküsten
wachsende Gracilaria lichenoides nicht unbedeutende Mengen von
Nährstoffen und wird daher ebenfalls sowohl direkt als Speise genossen
als zu Agar-agar verarbeitet.
In etwas höheren Wasserschichten als die Rottange siedeln sich an den
Meeresküsten die Brauntange an, die die Leitpflanzen der oberen,[S. 379]
zwischen Ebbe- und Flutgrenze gelegenen Litoralzone darstellten.
Vermöge ihrer durch den braunen Farbstoff Phycophäin, der das
Chlorophyll oder Blattgrün verdeckt, hervorgerufenen Braunfärbung
vermögen sie sogar direkte Besonnung zu ertragen, ohne Schaden zu
leiden. Außerdem entwickeln sie zum Schutze ihres Thallus oder
Vegetationskörpers allerlei Haarbildungen, die ihn „wie eine Wolke“
umgeben. Zu ihnen gesellen sich noch einige Rottange, die aber
hier zum Schutze gegen das grelle Sonnenlicht meist bräunlich oder
schwärzlich gefärbt sind. Solche Brauntange der Uferzone sind die
Laminaria-Arten, von denen die in den Polarmeeren verbreitete
Lammaria digitata var. cloustoni, der gelappte Fingertang, die
offizinellen Stipites laminariae liefert. Aus dem stammartigen
Teile des Thallus werden die in der Chirurgie und Frauenheilkunde
früher mehr als heute gebrauchten Laminariastifte hergestellt,
die zum Erweitern von Kanälen, besonders des Uterushalses, dienen.
Beim Eintrocknen der Alge sind sie stark zusammengeschrumpft und
dünn, quellen aber infolge ihres großen Schleimgehaltes bei späterem
Feuchtigkeitszutritt stark auf und schaffen so eine ausgiebige
Erweiterung der Kanäle, in die sie eingelegt werden. Nur weil sie sich
nicht sicher sterilisieren lassen, sind sie neuerdings mehr und mehr
außer Gebrauch gekommen.
Gleicherweise verhält es sich mit den blutstillenden Spreuhaaren von
den Stengeln verschiedener meist baumartiger Farne aus der Gattung
Cibotium, die in ihrer Heimat Südasien von alters her zur Blutstillung
auf Wunden gelegt wurden. Sie bilden sehr weiche, seidig-wollige,
goldgelbe oder gelbbraune, fast metallisch schimmernde Massen und
kommen als Penghawar-Djambi (nach der Provinz Djambi auf Sumatra
so genannt) in den Handel. In Europa wurden sie erst gegen die Mitte
des vorigen Jahrhunderts bekannt. Sie enthalten außer ihrer auf die
Kapillarität zurückzuführenden Hauptwirkung Gerbstoff, Harz, Wachs und
Humussäure. Infolge der Endosmose füllen sich die Hohlräume zwischen
den einzelnen Härchen augenblicklich mit dem austretenden Blut und
bewirken so eine Gerinnung desselben. Früher wurden sie besonders
gegen Nasenbluten viel verwendet. Dies ist in ganz Südasien heute noch
der Fall, außerdem dienen sie vielfach zur Ausfüllung von Kissen und
Matratzen, da sie ein sehr weiches Polster liefern.
Endlich haben wir noch der Bärlappsamen zu gedenken, die als
austrocknendes Streupulver bei Wunden (dasselbe ballt sich nicht
zusammen und wird vom Wundsaft so wenig als vom Wasser benetzt),[S. 380]
zum Bestreuen der Pillen, damit sie nicht zusammenkleben, zu
Feuerwerk und als Blitzpulver reiche Verwendung finden. Es sind
dies die auf ungeschlechtlichem Wege in besonderen Gehäusen der
fruchtenden Blätter von Wasserfarnen der Gattung Lycopodium
entstandenen Sporen, die einst als Erdschwefel, Druden- oder
Hexenmehl zu allerlei abergläubischen Kuren Verwendung fanden; auch
wurden sie samt dem sie erzeugenden Kraut als harntreibendes Mittel
bei Blasenleiden benutzt. Gegenüber der Mannigfaltigkeit und Größe
der Bärlappgewächse der paläozoischen Zeit, die besonders in der
Karbonperiode in den Sigillarien und Lepidodendren Riesen von
30–40 m Höhe hervorbrachten, sind die heute noch lebenden Vertreter
winzige Kräutlein, die hauptsächlich in den Tropengebieten der Erde
verbreitet sind; doch kommen mehrere Arten auch bei uns vor und
sind besonders im Gebirge stellenweise sehr häufig. Der gewöhnliche
Lieferant des Bärlappsamens ist Lycopodium clavatum, der
„genagelte“ Bärlapp, nach den langen, nagelförmigen Blättern so
genannt. Im Deutschen Reich, in der Schweiz und dem für uns als
Hauptproduktionsland mit in Betracht kommenden Rußland werden die
endständigen, dachziegelartig sich deckenden Fruchtblätter mit
den an deren Innenseite befindlichen nierenförmigen, zweiklappig
aufspringenden Sporangien im Juli und August kurz vor der Sporenreife
geschnitten, an der Sonne getrocknet, ausgeklopft und zum Ausscheiden
von Verunreinigungen gesiebt. In manchen Teilen Europas finden auch
L. annotinum und complanatum, seltener auch L.
alpinum und innundatum Verwendung zur Gewinnung der Sporen,
die blaßgelb, sehr beweglich und leicht sind und sich fettig anfühlen.
Die verschiedenen Lycopodiumarten waren den alten Botanikern als
„Erdmos“ bekannt. 1587 führte Dodonäus für L. clavatum die
Bezeichnung pes lupi (= griechisch lykopodion) Wolfsfuß
— wegen der weichhaarigen Zweigspitzen — ein. Bock bildete die
Pflanze unter dem Namen „Beerlapp“, d. h. Bärenfuß — nach der Form der
Zweigspitzen — ab. 1649 finden wir Lycopodium als Puder zum
Bestreuen von Wunden medizinisch verwendet, und seit 1664 wird es als
Lycopodium in den Apothekertaxen angeführt.
[S. 381]
XXVIII.
Die Geschichte des Ziergartens.
Die ersten Gärten der Menschheit waren begreiflicherweise rohe,
ausschließlich für die Küche berechnete Nutzgärten, aus denen sich
erst auf einer beträchtlichen Höhe der Kultur eigentliche Ziergärten
entwickeln konnten, die nicht mehr nur praktischen Zwecken, sondern
vielmehr zur Befriedigung ästhetischen Lebensgenusses dienten.
Solche sind wohl zweifellos an den Urstätten menschlicher Kultur
in Zentralasien zuerst geschaffen worden. Beim kurzköpfigen,
uralaltaischen Volke von Sumer und Akkad, das den Grund zur
altbabylonischen Kultur in Mesopotamien legte, werden sie vor 6000 und
mehr Jahren ebensogut vorhanden gewesen sein, wie bei den ältesten
Chinesen, bei denen sich schon 3000 Jahre vor unserer Zeitrechnung
Ziergärten um die königliche Residenz und um die Landhäuser der
Vornehmen vermuten lassen. Gemäß den verfeinerten Lebensgewohnheiten
dieses uralten, aus Zentralasien stammenden Kulturvolkes schufen
sich dessen Herrscher und Fürsten in ihren geräumigen Gärten ideale
Landschaften, die in bunter Abwechslung allerlei Szenerien in
verkleinertem Maßstabe vorführten. Die älteste Beschreibung solcher
chinesischer Ziergärten verdanken wir dem Engländer William Chambers,
der in China gewesen war und in den Jahren 1757 und 1772 zwei Bücher
über chinesische Gebäude und chinesische Gärten herausgab, die
seinerzeit in Europa außerordentliches Aufsehen erregten und hier zur
Nachahmung wenigstens der letzteren reizten, woraus dann der neue
englische Landschaftsgarten hervorging. Nach seiner Beschreibung gab es
in diesen chinesischen Gärten bald sanft gerundete, bald felsige Berge
von wenigen Metern Höhe, von denen sich Wasserläufe in schäumenden
Kaskaden herabstürzten, um sich durch liebliche, baumbestandene und
grasige Ebenen zu winden und in mit Wasserpflanzen und Getier aller
Art belebten Seen zu sammeln. Brücken in allen möglichen Formen,
geschweift[S. 382] und eben, gerade oder im Zickzack, führten von einem
Ufer zum andern oder auf blumenbedeckte, kleine Felseninseln. An den
Ufern der Teiche, in den Ebenen zwischen Blumenpflanzungen und im
Schatten von majestätischen Baumgruppen, auf den Gipfeln der Berge
und Felsen standen die mannigfaltigsten, bunt bemalten und lackierten
Lusthäuschen, deren Dachecken mit zierlichen Glöckchen behängt
waren. Der ganze Garten war mit Leben erfüllt; im Gebüsch erscholl
der liebliche Gesang der Nachtigallen und anderer Sänger aus der
Vogelwelt, das Girren der Turteltauben, das Rufen der Pfauen, Gold- und
Silberfasanen, Hühner verschiedenster Art, Wachteln usw., während von
den Teichen das Geschnatter der Enten und Gänse erklang.
Ebenso lieblich wie diese waren die Parkgärten Japans, die in
Nachahmung der chinesischen, der Bevölkerungsdichte und dem damit
zusammenhängenden Raummangel des Landes entsprechend, in Verbindung mit
einer hoch ausgebildeten Liebe und Kenntnis der Natur eine gleichsam
potenzierte Ausbildung des chinesischen Gartenstils aufwiesen und
heute noch aufweisen. Alles im japanischen Garten ist noch weiter ins
Kleine und Feine reduziert und, um auf dem beschränktesten Raum einen
Park mit allem Zubehör errichten zu können, lernte man die sonst groß
werdenden Bäume in Zwergformen ziehen, so daß es möglich wurde, selbst
hundertjährige Exemplare in Töpfen zu halten.
Das Land, von dessen Gärten wir die ältesten geschichtlichen Urkunden
und ausführliche bildliche Darstellungen an den Wänden der Grabkammern
der Vornehmen besitzen, ist Ägypten. Um die Häuser, die, wie überall
im Morgenlande, aus einem rechteckigen, von Gemächern umgebenen Hofe
bestanden, zogen sich Reihen schattenspendender Bäume. Nach einer
Richtung verlängerten sie sich und umschlossen ein rechteckiges
Wasserbecken, das Lotosblumen und Teichrosen barg und zahlreichen
Fischen und mannigfaltigen Wasservögeln zum Aufenthalte diente.
Vielfach war es so ausgedehnt, daß es mit buntgeschmückten Gondeln
befahren werden konnte. Der Regenmangel des Landes erzeugte das
Bedürfnis, diese vornehmlich aus Sykomoren, Dattelpalmen, Zypressen
und Platanen bestehenden Baumgärten ausgiebig zu bewässern, indem man
das Wasser der aus dem Nil gespeisten Kanäle durch dieselben hindurch
in die Bassins leitete. Buntbemalte Lusthäuser luden zur Rast ein,
und im Schatten der Reblauben, Feigenbäume und anderer Obstbaumsorten
lustwandelte der reiche Ägypter, der sich solchen Luxus leisten konnte,
in seinen Mußestunden mit seiner[S. 383] Familie und seinen Freunden. Hier
saß er beim Brettspiel oder hörte auf die Musik der Harfen, Flöten
und Lauten und sah dem langsamen, feierlichen Tanze der Frauen zu,
während seine Kinder unter den Bäumen mit ihren Bällen und Puppen
spielten. Eine Menge von Dienern und Sklaven wartete der Befehle des
Herrn in Haus und Garten. Ein Verwalter führte die Aufsicht über Haus
und Grundstück, während ein Obergärtner die Sklaven in der Pflege des
Gartens anleitete.
Ein solcher von schattenspendenden Bäumen bestandener Garten galt den
alten Ägyptern als der Inbegriff des Reichtums und behaglichen Lebens.
In einem in Bulak aufbewahrten Papyrus spricht der alte Schreiber zu
einem begüterten Vornehmen: „Du hast dir ein bewässertes Grundstück
angelegt, du hast dein Gartenland mit Hecken umgeben, Sykomoren hast
du in Reihen gepflanzt, wohl sie ordnend auf dem ganzen Gebiete bei
deinem Hause. Du füllst deine Hand mit allen Blumen, welche dein
Auge erschaut...“ Und den Blumengärten wurde von den Ägyptern wie
den Gemüse- und Obstgärten große Aufmerksamkeit geschenkt. So sehen
wir einen solchen in einem Königsgrabe in Theben dargestellt. Alle
Blumenbeete sind darin halbmondförmig angelegt und die Blumen darin in
dem Beetrande parallel geschweiften Reihen gepflanzt. Jedes Beet trägt
andere Blumen, die wir jedoch nicht recht zu bestimmen vermögen.
Auf einem Gemälde des Grabes Amenhoteps III. aus der 18. Dynastie
(1411–1375) in Theben sehen wir eine Villa des Pharao mit Türmen,
Obelisken und einem tempelartigen Bau. Davor erstreckt sich ein
prächtiger Blumen- und Obstgarten, in der Mitte von einem Kanal
durchzogen und von einem Teich bewässert. In ihm wachsen Lotus
und Papyrus, und um ihn ragen verästelte Sykomoren. Die von ihren
Dienerinnen umgebene Herrin des Hauses empfängt hier eben Damenbesuch
und reicht einer der Geladenen einen schön gebundenen Blumenstrauß in
Gestalt eines Füllhorns dar. Auf einem andern Wandgemälde in Theben
blicken wir in Haus und Garten eines reichen Ägypters. Da bemerken
wir unter anderem eine Frau, welche sich einen Ölzweig gepflückt hat
und unter Granat- und Feigenbäumen dahinwandelt; eine andere tritt
eben zur Pforte ein. Sie führt an ihrer Hand zwei Kinder, die sich mit
Rebenranken geschmückt haben. Eine Dienerin trägt ihnen das Spielzeug
und ein Rebmesser nach, vermutlich um Trauben, die in Fülle am Spaliere
prangen, zum leckeren Mahle zu schneiden.
[S. 384]
Damit die Seele, der ka, des Verstorbenen sich im kühlen
Schatten laubreicher Bäume ergehen und an Farbe und Duft der
Blumen erfreuen könne, legte man vor den Gräbern kleine Gärten mit
Wasserbassins an, die aus benachbarten Kanälen gespeist wurden. Oft
liest man auf Grabstelen des neuen Reiches (1580–1205 v. Chr.) die
Formel: „Möge ich wandeln am Ufer meines Teiches Tag für Tag ewiglich;
möge meine Seele sitzen auf den Zweigen der Bäume in meinem Grabgarten,
den ich mir bereitet habe; möge ich mich erfrischen tagtäglich unter
meiner Sykomore.“ Eine dieser Epoche angehörende Stele aus Theben, die
sich nun im Museum von Bulak befindet, bringt eine Illustration zu
diesen Worten. Auf der annähernd perspektivisch gehaltenen Darstellung
des Grabgartens bemerken wir links, am Fuße einer Bergkette gelegen,
drei Totentempelchen. Seitwärts kniet mit in Anbetung erhobenen Händen
der Selige, der aus seiner Grabkammer herausgegangen ist, um im Garten
zu lustwandeln. In demselben stehen neben einer Sykomore zwei sehr
naturgetreu gezeichnete Dattelpalmen mit schweren Fruchtgehängen,
unter welchen auf einem Opfertisch Brote als Totenspeise liegen. Der
Grabgarten des zur Zeit der 18. Dynastie (1580–1530 v. Chr.) lebenden
vornehmen Anna in der Totenstadt von Theben enthielt nach dem auf uns
gekommenen Verzeichnis 90 Sykomoren, 170 Dattelbäume, 3 Mimosen, 5
Granatbäume, 2 Behennußbäume usw. und 12 Reben. Nach dieser bedeutenden
Zahl von Bäumen muß er also ziemlich groß gewesen sein.
Zu den vornehmsten Geschenken der ägyptischen Könige an ihre
Gottheiten, denen sie ihren Dank für Siege und sonstiges Wohlergehen
abstatten wollten, gehörten außer den prächtigen Tempeln, deren Wände
allseitig mit buntfarbigen Darstellungen aus dem Leben des Spenders
geschmückt waren, auch dementsprechende Gartenanlagen, die das
Heiligtum umgaben. So heißt es in der Schenkungsurkunde des Königs
Ramses III. (20. Dynastie, 1198–1167 v. Chr.) von den Gaben an den
Sonnengott in Heliopolis: „Ich machte dir große Gärten, versehen mit
ihren Bäumen, mit Reben und Ölbäumen. Ich versah sie mit Gärtnern,
zahlreichen Leuten, um reines, bestes Öl zu bereiten und damit
die Lampen in deinem prächtigen Tempel anzuzünden. Ich machte dir
Baumplätze und Gehölze mit Bäumen, Dattelpalmen, auch Weiher, versehen
mit Lotusblumen, Binsen, Gräsern und Beeten mit süßen, wohlriechenden
Blumen jedes Landes für dein schönes Antlitz...“
Besonders groß und prunkvoll mit hübschen Anlagen und Alleen von
Schattenbäumen geschmückt waren zur Zeit des neuen Reiches[S. 385] (1580–1205
v. Chr.) die Gärten um den Reichstempel, den großen Amonstempel in der
Hauptstadt Theben. Von dem prachtvollen Vorhof desselben in Luxor, der
alten südlichen Vorstadt von Theben, den die Baumeister Amenhoteps III.
(1411–1375 v. Chr.) mit unerhörter Kühnheit aus zwei Reihen mächtiger,
wohlproportionierter Säulen mit Kapitellen in Form von aufbrechenden
Papyrusknospen angelegt hatten, erstreckten sie sich bis zum glänzenden
Pylon, den derselbe König vor dem Tempel von Karnak errichtet hatte.
Mitten durch sie hindurch führte eine Doppelreihe von steinernen
Widdern, flankiert von Dattelpalmen, von einem Tempel zum andern. Die
Gesamtwirkung jener herrlichen Schöpfung muß außerordentlich imposant
gewesen sein. Die leuchtenden Farben der bunt bemalten Architektur
mit den vergoldeten Säulen und Toren und den mit Silber ausgelegten
Fußböden, darüber die an ihrer Spitze mit rot leuchtendem Kupfer
verkleideten Obelisken, hoch sich erhebend über die nickenden Wipfel
der grünen Palmen und des halb tropischen Blätterwerks, das wie ein
Rahmen das Ganze einfaßte und auf der Oberfläche des Tempelsees sich
spiegelte — alles dies muß einen prächtigen Eindruck gemacht haben,
von dem die düstern Ruinen heute kaum eine Ahnung mehr geben.
Diese prunkvolle Anlage hat weit über ein Jahrtausend bestanden und
wurde von späteren Pharaonen vergrößert. So erfahren wir, daß noch
Ramses III. der 20. Dynastie, der von 1198–1167 v. Chr. regierte,
in seiner Residenzstadt Theben einen weiteren prächtigen Bezirk und
Garten für den Gott Amon errichten ließ, der nach einer uns erhaltenen
schriftlichen Urkunde nahezu 8000 Sklaven zu seiner Bedienung erhielt.
Schon diese große Zahl von Angestellten läßt auf die Größe der Anlage
schließen. Übrigens hatten alle größeren Tempelanlagen Ägyptens wie
ihren Teich zum Baden, so auch ihren Garten zum Lustwandeln für den
betreffenden Gott und seine Diener. Speziell von Ramses III. wird uns
auch durch Inschriften bekundet, daß er nicht nur in seiner Residenz-
und Hauptstadt Theben, sondern auch im ganzen Reiche zahlreiche Bäume
pflanzen ließ, die in einem Lande, dem die natürlichen Wälder fehlten,
erquickenden Schatten boten.
Viel weniger als von diesen Gärten der Ägypter wissen wir von
denjenigen der alten Babylonier, die unter ähnlichen klimatischen
Bedingungen Ruheplätze unter schattenspendenden Bäumen in von Wasser
durchströmten Gärten liebten. Sehr stark von diesen gewöhnlichen
Lustgärten Babyloniens wich eine besonders auffallende Anlage ab,[S. 386] von
der uns etwas eingehender von einigen Schriftstellern des Altertums
berichtet wird. Es sind dies die als eines der Weltwunder angestaunten
„hängenden Gärten“, die einst am Ufer des Euphrat bei der Stadt Babylon
errichtet wurden, wie die Sage erzählt, von der assyrischen Königin
Semiramis, die zahlreiche Züge der babylonischen Liebesgöttin Ischtar
trägt, aber gleichwohl eine historisch greifbare Persönlichkeit
darstellt, nämlich die auf den königlichen Inschriftsteinen von Assur
Scha-ammu-ramat genannte „Frau des Palastes Samsiadads, des Königs der
Welt, Königs von Assyrien, Mutter des (um 800 v. Chr. regierenden)
Adad-nirari, des Königs der Welt, Königs von Assyrien“. Sie war eine
Babylonierin und muß als tatkräftige Herrscherin in den Kämpfen der
Assyrer gegen das Reich Urartu, das die Stadt Van in seinem Mittelpunkt
hatte und sich bis zum Urmiasee erstreckte, eine bedeutende Rolle
gespielt haben. Auch scheint auf ihre Mitwirkung hin im Jahre 787 unter
ihrem Sohne Adad-nirari der Gott Nebo von Babylonien nach Assyrien
eingeführt, d. h. beide Reiche staatsrechtlich vereinigt worden zu
sein. Ihr Enkel wurde dann Unterkönig von Babylon. Daß dann später
die Meder, die sich um 600 v. Chr. des Quellgebiets des Euphrat und
Tigris bemächtigten, sie als Reichsgründerin von Assyrien betrachteten,
das doch zu ihrer Zeit schon 800 Jahre bestand, und ihr zahlreiche
Züge der Liebes- und Kriegsgöttin Ischtar andichteten, beweist, daß
die Erinnerung an sie in Armenien noch lange Zeit nach ihrem Tode
lebendig blieb. Vollends sagenhaft wurde sie später bei den Persern.
Das erfahren wir aus dem Bericht, den Ktesias, der griechische Leibarzt
des persischen Großkönigs Artaxerxes II., um 400 v. Chr. in seiner
Erzählung von der Königin Semiramis von ihrem Leben gab. Jedenfalls hat
sie durchaus nichts mit den später so eng an ihren Namen geknüpften
„hängenden Gärten“ Babylons zu tun.
Der tatsächliche Erbauer dieses Wunderwerkes war einer jener
gewaltigen, mit unerhörter Machtfülle ausgestatteten Herrscher
des Landes, nach dem Berichte des Berosus, der zu Beginn des
3. vorchristlichen Jahrhunderts Belpriester in Babylon war und
in griechischer Sprache ein Buch, betitelt: „Babylonisches und
Chaldäisches“, schrieb, Nebukadnezar, der von 604–561 als Mehrer
des Reichs und Verschönerer seiner Hauptstadt Babylon herrschte und
gewaltige Kanalbauten anlegen ließ. Der griechische Geschichtschreiber
Diodoros berichtet in seiner zur Zeit Cäsars und Augustus’
geschriebenen „historischen Bibliothek“, daß dieser machtvolle
Assyrerkönig, der seine Herrschaft[S. 387] bis an die Grenzen Ägyptens
ausdehnte und im Jahre 586 Jerusalem zerstörte, diese hängenden
Gärten für seine Gemahlin Amyitis errichtet habe, die, im Berglande
Medien geboren, in der Euphratebene sich nach den Bergen und Wäldern
ihrer Heimat sehnte. Sie bestanden aus einer 50 m und mehr
hohen, bis 400 m breiten Pyramide mit mehreren übereinander
getürmten Terrassen, die auf dicken, in geringen Abständen errichteten
Backsteinmauern ruhten. Sie waren mit einer hohen Erdschicht bedeckt,
in die nicht bloß Blumen und Ziersträucher, sondern große Bäume
gepflanzt waren, die mächtig emporwuchsen und der ganzen Anlage das
Aussehen eines bewaldeten Berges gaben. Pumpwerke führten aus dem
Euphrat Wasser auf die oberste der Terrassen, um von hier in Röhren und
Rinnen durch die ganze Gartenanlage zu deren Bewässerung zu strömen und
auch noch die Bäder zu speisen, die mit allerhand anderen Gemächern und
Grotten in die Seitenwände der Terrassen eingebaut waren. Die Wurzeln
der Bäume mögen schließlich das Mauerwerk zersprengt und den Einsturz
des ganzen wunderbaren Baues herbeigeführt haben, dessen Ruinen man
heute noch am Euphrat erkennen zu können glaubt.
Über die Terrassengärten der Meder und Perser sind uns von den Griechen
allerlei Berichte erhalten. Sie waren an steilen Bergabhängen angelegt,
wo sich die Herstellung solcher von Mauern gestützter ebener Gärten in
Terrassen von selbst ergab. Sie waren mit Treppen verbunden und von
Wasserläufen durchzogen, die stellenweise anmutige Fälle bildeten und
mit Wasserpflanzen erfüllte Becken, die auch Springbrunnen besaßen,
speisten. Zwischen Reihen von schattenspendenden Bäumen, die von
Singvögeln aller Art bewohnt waren, müssen Beete von märchenhafter
Pracht der Rosen, Lilien, Safran und anderer Blumen gestanden haben. Im
Mittelpunkt der Anlage standen schloßartige Häuser mit Säulenhallen,
nach denen alle Wege führten. Außer solchen Gärten besaßen die
Könige und Großen des Reiches ausgedehnte Jagdgebiete in Gestalt
von eingehegten Parken, die von zahlreichem Wild belebt waren. Vom
persischen dafür gebrauchten Worte pardes, das Park bedeutet,
stammt die griechische Bezeichnung parádeisos und das deutsche
Paradies für den in ähnlich wunderbarer Weise mit Bäumen bestandenen
und von der mannigfaltigsten Tierwelt belebten Garten Eden, in welchem
nach der jüdischen Schöpfungssage Gott die ersten Menschen aus Erde
geschaffen haben soll. Nach den Schilderungen der Griechen müssen die
Paradiese der Perserkönige Dareios und Kyros vollkommen parkartig
ausgesehen haben. Sie lagen den[S. 388] gut unterhaltenen Poststraßen des
Reiches entlang, auf denen ein regelmäßiger königlicher Postdienst mit
allen erst später unter den Römern und dann erst wieder in der Neuzeit
eingeführten Bequemlichkeiten eingerichtet war, und beherbergten
wohnlich eingerichtete Jagdhäuser, Scheunen und Stallungen für den
König und sein zahlreiches Gefolge samt deren Pferden. In seiner
Biographie des Alkibiades (um 450 in Athen geboren, veranlaßte
seine Vaterstadt 415 zum verhängnisvollen Zug nach Syrakus, der
über 8000 Athenern das Leben kostete, und wurde nach bewegtem Leben
404 in einem Schloß in Phrygien ermordet) sagt uns Plutarch: „Der
persische Satrap Tissaphernes, zu welchem Alkibiades (im Jahre 412)
geflohen, ehrte diesen so sehr, daß er sogar seinem schönsten Parke,
der mit Springbrunnen, anmutigen Wiesen und mit königlicher Pracht
ausgeschmückten Anlagen geziert war, den Namen Alkibiades gab, den der
Park seitdem behalten hat.“
Die von den Griechen als für sie etwas ganz Neues und Unerhörtes
angestaunte Pracht dieser orientalischen Gärten steht völlig im
Einklang mit der weichlichen Genußsucht ihrer Erbauer, die ihr Leben
inmitten ihres Harems in üppigen Palästen und Gärten verträumten.
Demgegenüber ist es bezeichnend, daß wir bis in die Zeit Alexanders
des Großen, der im Juni 323 unerwartet in seinem 34. Lebensjahr in
Babylon starb, nichts von Gärten der Griechen erfahren. In ihren
kleinen städtischen Gemeinwesen nahm die Teilnahme am öffentlichen
Leben, an der Politik und an den nationalen Wettkämpfen ihr ganzes
Interesse in Anspruch. Ihre Tage verlebten sie meist außerhalb des
Hauses, auf dem Marktplatz, wo es immer etwas Neues zu verhandeln gab,
und nur soweit ihr Gewerbe sie dort festhielt, waren sie in ihrer
schmucklos einfach eingerichteten Wohnung anzutreffen. Für die träge
Ruhe des Gartengenusses der Morgenländer hatten sie weder Zeit noch
Verständnis. Was uns der Künder altgriechischen Lebens, Homer, vom
Garten zu erzählen weiß, läßt nur auf Obst- und Gemüsegärten schließen,
von deren kunstmäßiger Anlage keine Rede ist. Wohl lagen die Tempel
der olympischen Götter in Gärten, aber es waren dies keine Ziergärten,
sondern des Schattens wegen angelegte heilige Haine, in denen vielfach
Bildsäulen und andere Votivgegenstände aufgestellt wurden. Auch die
Säulenhallen der Gymnasien, in denen die Knaben und Jünglinge vor
allem in der körperlichen Ausbildung erzogen wurden und später auch
die Philosophen ihre Schüler zu regelmäßigen Vorträgen versammelten,
scheinen nur von Baumalleen umgeben gewesen zu sein. Was der Grieche
an Blumen zur Ausschmückung der[S. 389] Tafel bei Gastmählern bedurfte, wurde
in Nutzgärten gezogen und auf dem Markte zum Kauf feilgeboten. Einzig
zwei Gärten werden uns im Athen der klassischen Zeit genannt, die als
öffentliche Versammlungs- und Erholungsorte für das Volk dienten und
in welchen den Männern, die sich um den Staat verdient gemacht hatten,
Denkmäler errichtet wurden. Der eine befand sich in nächster Nähe der
Akademie, dem Lehrorte Platons, und war in der zweiten Hälfte des
5. vorchristlichen Jahrhunderts unter dem Staatsmann Kimon angelegt
worden. Der andere lag am Lykeion, wo Aristoteles lehrte. Beide waren
durch gerade Wege und Alleen regelmäßig eingeteilt, enthielten außer
den Plätzen für die körperlichen Übungen schattige Alleen und Haine
von Platanen, Terebinthen, Ulmen, Ölbäumen usw. zwischen grünen
Rasenplätzen und waren mit Altären und Statuen geschmückt.
Viel später berichtet uns der griechische Geschichtschreiber und
Geograph Pausanias, der zwischen 160 und 180 n. Chr. in seiner
Periegesis eine wertvolle Schilderung der von ihm bereisten Länder
gab: „Zu Athen hatte Apollon einen wunderschönen Hain, der aus Bäumen,
die man in Gärten zu ziehen pflegt, und aus allen möglichen Pflanzen
bestand, welche auch, ohne Frucht zu tragen, angenehm duften und
lieblich anzusehen sind.“ Ein anderer Grieche, mit dem romanisierten
Namen Longus, schildert uns seinen, allerdings mehr praktischen Zwecken
dienenden Garten folgendermaßen: „Ich habe einen Garten, den ich
mit eigener Hand besorge, und der zu jeder Jahreszeit seinen Ertrag
liefert: im Frühling Rosen, Lilien, Hyazinthen und beiderlei Veilchen
(nämlich Blauveilchen und Weißveilchen oder Levkojen), im Sommer Mohn,
den weidenblättrigen Birnbaum und alle Äpfelarten.“
Weniger bescheiden als in Griechenland mögen die Gärten in den
reichen Handelsstädten Kleinasiens gewesen sein, wo der orientalische
Einfluß den schon zuvor vorhandenen einfachen Hausgarten in den
letzten Jahrhunderten der vorchristlichen Zeitrechnung immer größer
und üppiger, mit zahlreichem Blumenflor und schattigen Ruheplätzen
ausgestaltete. Dieser von künstlerischem Standpunkt, wie alles, was
die Griechen unternahmen, eingerichtete Garten trug mancherlei vom
Orient übernommene Blumen und Zierpflanzen, war aber im übrigen recht
einfach. So lernten ihn die Römer in Unteritalien kennen und ahmten
ihn bald nach. In dem Maße als das Bürgertum Roms wohlhabender wurde,
ward das vordem vom Rauch des Herdfeuers geschwärzte Atrium zu einem
als Empfangsraum benutzten weiten Vorraum umgewandelt, der in seiner
Mitte unter der Lichtöffnung ein[S. 390] kleines Wasserbassin zur Aufnahme des
vom Dach zusammengelaufenen Regenwassers aufwies. Im hinteren Hausteil
gruppierten sich die Gemächer um einen offenen, meist von Säulenhallen
umgebenen Hof, das Peristyl, das, wie wir aus den Funden von Pompeji
wissen, häufig sehr große Abmessungen hatte und mit der Zeit ganz in
einen Garten verwandelt wurde. Regelmäßig gestaltete Rasenflächen
und Blumenbeete zerlegten ihn in mehrere Rechtecke, die von niedrig
gehaltenen Buchshecken eingesäumt waren und außer Rosenstöcken
einzelne Sträucher von Lorbeer und Myrte trugen. In der Hofmitte
befand sich gewöhnlich ein Wasserbecken, und zwischen den Säulen
der ringsum laufenden Halle liebte man in der späteren Kaiserzeit
aus dem Morgenlande eingeführte Zedratzitronen in großen Tonkübeln
aufzustellen, wie zur Zeit Ludwigs XIV. in Holzkübeln gepflanzte und
in besonderen Orangerien überwinterte Pomeranzenbäume die Alleen der
Prunkgärten einfaßten. Die Wände des Peristyls trugen meist bunte
Malereien, die dem Ganzen ein vornehmes Gepräge verliehen, und aus dem
Grün der Vegetation leuchteten farbige Statuetten hervor. Plätschernde
Springbrunnen verbreiteten im Sommer angenehme Kühlung und im Gezweig
der in Alleen gestellten Bäume trieben Vögel ihr munteres Spiel.
Besonders in Syrien verwendete man nach Plinius viel Fleiß auf die
Gärten, zumal die Gemüsegärten, so daß ein griechisches Sprichwort
sagt: „Die Syrer haben vielerlei Kohl.“ Auch ihre Obst- und Ziergärten
müssen sehr sorgfältig gepflegt worden sein. Daß später die Römer mit
Vorliebe syrische Sklaven, die in der höheren Gärtnerei, im Veredeln,
Pfropfen, Vermehren und zweckmäßigen Beschneiden der Obstbäume einen
besonderen Ruf im Altertum genossen und in aller Gartentechnik Meister
waren, zum Besorgen ihrer eigenen Gärten und Obstkulturen benutzten,
davon war bereits bei der Besprechung der Fruchtbäume die Rede. Ein
ungenannter Grieche der hellenistischen Zeit gibt uns in den Geoponiká,
einer wahrscheinlich ums Jahr 912 n. Chr. veranstalteten Sammlung
von Auszügen aus guten alten griechischen Schriften über Land und
Gartenwirtschaft, folgende Ratschläge zur Anlegung eines Ziergartens:
„Der Garten (parádeisos) muß so liegen, daß man ihn von der
Villa aus sehen, sich an seinem Anblick laben und die durch den
Blumenduft gewürzte und dadurch gesündere Luft atmen kann. Er muß von
einer Mauer oder anderen Umzäunung eingefaßt sein. Die Pflanzen selbst
dürfen nicht unordentlich gemischt gepflanzt werden, als wenn gerade
die Verschiedenheit[S. 391] angenehm ins Auge fiele, sondern sie müssen nach
den verschiedenen Arten getrennt stehen, damit nicht die kleinen von
den großen gedrängt oder der Nahrung beraubt werden. Die Räume zwischen
den Bäumen müssen mit Rosen oder Lilien oder Veilchen oder Safran
ausgefüllt sein. Diese gewähren einen lieblichen Anblick, Wohlgeruch,
sind auch sonst zu brauchen, vermehren auch die Einkünfte und geben
den Bienen Nahrung. Die Bäume müssen von Bäumen stammen, die in
voller Kraft stehen; doch muß man im voraus wissen, daß die aus Samen
gezogenen in der Regel schlechter sind als die von Ablegern stammenden.
Noch besser als diese sind aber die veredelten, nicht bloß in betreff
der Schönheit der Früchte, sondern auch an Fruchtbarkeit und baldigem
Ertrag.“
Als die Römer sich den ihnen bekannten Erdkreis unterjochten, kamen sie
in ihren östlichen Provinzen mit der hellenistischen und asiatischen
Kultur in enge Berührung. Die Folge davon war, daß die Vornehmen dieses
einst rauhen, Ackerbau treibenden und Krieg führenden Volkes es in
der luxuriösen Lebensführung ihren asiatischen Vorbildern gleich zu
tun strebten. Mit dem Reichtum und den Kunstschätzen, die sie aus den
eroberten östlichen Provinzen heimbrachten, überführten sie auch mit
der Kenntnis orientalischer Sitten die dort altgewohnte Kunst, das
Leben fern vom ermüdenden Treiben der Stadt in gartenmäßig verschönter
Natur zu genießen. So füllte sich kurz vor und während der Kaiserzeit
nicht nur die nähere Umgebung Roms, sondern ganz Italien mit prächtigen
Gärten nach den Vorbildern des Ostens. In ihnen bildete die Villa,
das große Landhaus, den Mittelpunkt, von dem die Anlagen des Gartens
gleichsam ausstrahlten. Im Gegensatz zum Stadthaus, das auf engem Raum
stets in der hergebrachten Weise mit Atrium und Peristyl errichtet
wurde, pflegte man in der Villa den besonderen Liebhabereien des
Erbauers Rechnung zu tragen und als Fortsetzung der Wohnung in die
Natur hinaus ausgedehnte Gartenanlagen mit Frucht- und Zierbäumen zu
errichten.
Einer der ersten vornehmen Römer, der orientalischen Gartenluxus in
Rom trieb, war Lucius Licinius Lucullus, der Besieger der Könige
Mithridates von Pontus und Tigranes von Armenien, der nach seiner
Abberufung aus Kleinasien im Jahre 64 v. Chr., den Staatsgeschäften
fern, seinen Liebhabereien lebte. Wie er aus Kerasos im Pontusgebiet
den Kirschbaum nach Italien brachte, war er einer der ersten, der in
der Baumzucht und Blumenkultur gewandte orientalische Gärtner nach der
Heimat überführte, um hier solch schöne Gärten, wie er sie in den[S. 392]
Kulturzentren des Ostens gesehen hatte, für sich erstehen zu lassen.
Der griechische Schriftsteller Plutarch (50–120 n. Chr.) nennt die
einst von Lucullus eingerichteten Gärten, von denen der bedeutendste
auf dem heutigen Monte Pincio sich befand, geradezu märchenhaft.
Zwischen Alleen von Obstbäumen lagen blühende Blumenbeete. Von Hecken
versteckt befanden sich darin Mästereien für feines Geflügel und Teiche
mit feinen Speisefischen. Daß dieser Römer den Freuden der Tafel
huldigte, ist ja bekannt genug, so daß die Bezeichnung lucullische
Mahlzeiten bald in Rom das Nonplusultra von Üppigkeit bezeichnete, was
gewiß zu jener Zeit des aufkommenden Luxus etwas besagen wollte.
Die üppige Lebenshaltung dieses Lucullus läßt uns bereits den
unerhörten Luxus mancher Reicher in der Kaiserzeit ahnen. Plutarch
kennzeichnet uns sein Treiben mit folgenden Worten: „Nachdem Lucullus
ein berühmter Staatsmann und Feldherr geworden und ungeheure Reichtümer
gewonnen hatte, verwendete er diese auf Lustbarkeiten, Schmausereien,
Maskeraden, Fackeltänze, prunkende Gebäude, prachtvolle Alleen und
Bäder, auf Gemälde, Bildsäulen und andere solche Dinge, namentlich
aber auf seine Gärten, so daß noch zu unserer Zeit (2 Menschenalter
nach des Lucullus Tod), wo doch die Pracht und Verschwendung aufs
höchste gestiegen ist, die lucullischen Gärten unter den kaiserlichen
für die allerprächtigsten gelten. — Er ließ auch am Meere und bei
Neapel gewaltige Bauten aufführen, die größten Berge durchstechen,
Kanäle und Seen, in die das Meereswasser geleitet wurde, rings um seine
Häuser graben, ließ auf dem Meere selbst Paläste bauen, so daß ihn der
Stoiker Tubero den römischen Xerxes nannte. Bei Tusculum hatte er eine
Menge Villen, sie hatten hohe Warten mit weit in die Ferne reichender
Aussicht und zahlreiche schöne Alleen und Pavillons. Dabei hatte er
die Einrichtung getroffen, daß er, wie er selbst äußerte, gleich einem
Kranich oder Storche zu jeder Jahreszeit eine andere Wohnung beziehen
konnte.“
Schon zu des Lucullus Zeit, zu Ende der römischen Republik, umspannte
ein reicher Kranz der schönsten Villen mit ausgedehnten Gärten die
Umgebung Roms. Nicht bloß die Abhänge des Sabinergebirges, sondern
auch die Campagna di Roma besaß ausgedehnte Villen, wie diejenigen des
Cicero, Quintilius, Pompejus, der Valerier, Voconier und Claudier.
Sie waren meist nach dem Muster eines Soldatenlagers angelegt und
das Hauptgebäude hieß auch Praetorium, d. h. Feldherrnhaus.
Ihr Reichtum an Teichen, Fontänen, Pflanzen, seltenen Tieren,
Luxusgegenständen aller Art und architektonischen[S. 393] Nachahmungen
griechischer und orientalischer Vorbilder muß geradezu erstaunlich
gewesen sein. Einzelne Villen der Campagna hatten so große Gärten, daß
diese von zwei bis drei der öffentlichen Heerstraßen durchschnitten
wurden. Der Luxus stieg noch im Laufe der Kaiserzeit, während welcher
ein prunkvoller Garten mit schönen Gebäuden, Tempeln und Bildsäulen
sich an den andern reihte.
Einen guten Begriff der Anlage solcher Villen geben uns zwei
Beschreibungen aus Briefen des jüngeren Plinius, des Schwester- und
Adoptivsohnes des im Jahre 79 n. Chr. beim Vesuvausbruch umgekommenen
älteren dieses Namens, der von 62–114 lebte und 103 Prokonsul in
Bithynien und Pontus war, von wo aus er dem ihm befreundeten Kaiser
Trajan Mitteilung von der bis dahin kaum gekannten Sekte der Christen
machte. Er beschreibt seine beiden eigenen Villen, von denen die
eine bei Ostia an der Tibermündung am Meere lag und nach der Fülle
von Lorbeergebüsch Laurentinum hieß, während die andere sich
in den Bergen Toskanas, also im Lande der Tusker befand, deshalb
Tuscum hieß und ihrer kühlen Gebirgslage wegen im Sommer bewohnt
wurde. Die erstere beschreibt er in einem Briefe an seinen Freund
Gallus folgendermaßen: „Meine laurentische Villa, mein lieber Gallus,
macht mir sehr viel Freude. Von dem einen Speisesaal hat man weithin
die Aussicht aufs Meer, auf das Ufer und die reizendsten Villen. Ein
anderer Speisesaal liegt dagegen so, daß man in ihm vom Meere nichts
sieht und selbst bei tosendem Sturm das Brausen der Wogen kaum hört.
Dieser Saal hat aber die Aussicht auf den Garten und den ihn umgebenden
Weg für Wagen und Sänften. Derselbe ist mit Buchs und stellenweise
mit Rosmarin eingefaßt. Denn der Buchs gedeiht nur da üppig, wo er
von Häusern geschützt wird; wo er dagegen freisteht und vom Winde
getroffen wird, verdorrt er. An der einen Seite des Weges zieht sich
eine schattige Rebenpflanzung hin, in der man auch mit bloßen Füßen
weich und bequem gehen kann. Der Garten ist dicht mit Maulbeer- und
Feigenbäumen bepflanzt, denen dieser Boden ganz besonders zusagt,
während andere Bäume nicht sonderlich gedeihen. Mitten im Garten steht
ein Speisesaal, von dem man landeinwärts eine herrliche Aussicht hat.
Man sieht auch von hier nach der Villa und einem Wirtschaftsgarten. An
das Gebäude stößt ein bedeckter Gang, der an beiden Seiten Fenster hat,
welche bei heiterem, ruhigem Wetter alle geöffnet werden, bei windigem
aber nur auf der Seite, wo es windstill ist. Vor dem Gange ist eine von
Veilchen duftende Terrasse.“
[S. 394]
Letztere dagegen schildert er in einem andern Briefe folgendermaßen:
„Mein tuskisches Landgut, lieber Apollinaris, liegt in einer sehr
gesunden Lage am Fuß des Apennins. Im Winter ist zwar die Luft so rauh
und kalt, daß Myrten, Ölbäume und andere Gewächse, die eine anhaltende
Wärme verlangen, absterben; doch gedeiht der Lorbeer ganz vortrefflich
und leidet zuweilen vom Frost, jedoch nicht mehr als bei Rom. Der
Sommer ist dagegen sehr mild und die Luft fast immer von sanften Winden
bewegt. Die ganze Gegend ist höchst reizend. Stelle dir ein ungeheures
Amphitheater vor, wie nur die Natur es schaffen kann. Eine sich weithin
dehnende Ebene wird von Bergen umringt; die Berge tragen auf ihrem
Rücken hohe, alte Wälder, in denen die Jagd reiche Beute gewährt. Am
Gebirgshang entlang zieht sich ein Schlagwald und zwischen diesem
erheben sich Hügel mit gutem, urbarem Boden. Der Wand entlang erstreckt
sich eine ununterbrochene Reihe von Weinbergen, die unten von Buschwerk
eingefaßt sind; dann kommen Wiesen und tiefgründige Felder. Die Wiesen
sind dicht mit Blumen wie mit lauter Edelsteinen übersät. Der Klee
und die übrigen Kräuter sind stets saftig; denn das Ganze wird durch
nie versiegende Bäche bewässert. Gleichwohl ist es nirgends sumpfig.
Mitten durch die Fluren fließt der Tiber und führt auf Schiffen die
Erzeugnisse des Bodens zur Stadt.
Meine Villa liegt am Fuße eines sanft ansteigenden Hügels. Vor der
Hauptfront derselben zieht sich eine Säulenhalle hin und vor dieser
eine Terrasse mit vielen, von Buchs eingefaßten Beeten. Weiter
unten kommt eine größere Rabatte und auf beiden Seiten derselben
stehen Buchsbäume, die so geschnitten sind, daß sie Gestalten von
verschiedenen Tieren vorstellen. Noch tiefer, da, wo der Boden
eben ist, wächst weicher, zarter Akanthus. Rings herum zieht sich
ein Heckengang mit niedrigem und mannigfach geschnittenem Gebüsch.
Gleich daran stößt eine Allee in Gestalt eines Zirkus mit niedrig
gehaltenem und in verschiedene Gestalten geschnittenem Buchs. Das
Ganze ist von einer Mauer umgeben, die treppenförmig gezogener Buchs
dem Auge entzieht. In einiger Entfernung liegt ein Wiesenplan, von
Natur ebensoschön wie die eben beschriebenen Kunstanlagen; weiterhin
erstrecken sich Felder und viele andere Wiesen und Gehölze.
Von dem Speisesaal aus übersieht man die Terrasse, die Wiese, das Feld
und den Wald. Es ist eine Rennbahn, ein Säulengang und weiter rückwärts
ein Sommerhaus vorhanden, das einen kleinen, von vier Platanen
beschatteten Platz einschließt. Auf ihm springt aus einem[S. 395] Marmorbecken
ein Brunnen, der die Platanen und den unter ihnen befindlichen
Grasplatz besprengt und erfrischt. Weiter unten im Garten sprudelt eine
kleine Quelle hervor, welche in ein Becken fließt und lieblich murmelt.
Es ist auch ein Teich im Garten, dessen Wasser sich in ein Marmorbecken
stürzt und sich dabei in lauter Schaum auflöst.
Die Rennbahn, welche zu der Villa gehört, dehnt sich weithin aus, ist
von Platanen umgeben, in der Mitte aber ganz frei. Die Platanen sind
von Epheu umrankt, also unten von fremdem Laub grün, oben von eigenem.
Der Epheu windet sich girlandenartig von einer Platane zur andern.
Unten steht Buchs zwischen den Platanen; er ist nach außen von Lorbeer
eingefaßt, dessen Schatten mit dem der Platanen zusammenfällt. Die
Rennbahn läuft eine Strecke gradaus, bricht am Ende im Halbkreis ab,
ist dort von Zypressen eingefaßt, durch deren dichteren Schatten kühl
und finster. In den innern Kreisen und Gängen dagegen wechselt kühler
Schatten mit Sonnenschein, und dort steht auch das Rosengebüsch. Aus
diesen sich mannigfaltig krümmenden Gängen kommt man wieder auf gerade
Wege, deren mehrere, von Buchs eingefaßt, nebeneinander laufen. Dort
findet sich auch ein kleiner Grasplatz, dort in tausend Gestalten
geschnittener Buchs und hier und da ist er selbst so geschnitten, daß
er Buchstaben bildet, welche den Namen des Herrn und den des Gärtners
darstellen. Dazwischen stehen kleine, zu Pyramiden geschnittene
Obstbäume. Dieser schöne Platz ist auch mit niedrig gehaltenen Platanen
geschmückt; hinter ihm steht glatter, sich ringelnder Akanthus (d. h.
kultivierter Acanthus mollis im Gegensatz zum wildwachsenden
A. spinosus, dem stachligen A.) und auf diesen folgen wieder
verschiedene Gestalten und Namen.
Am Ende des Ganzen steht eine halbkreisförmige Bank von weißem Marmor,
beschattet von Weinreben, die sich um vier Säulen aus karystischem
Marmor schlingen. In der Bank sind Röhren angebracht, und aus diesen
fließt Wasser; dasselbe strömt in ein niedliches Marmorbassin, das
immer voll bleibt, ohne überzufließen. Will man auf der Bank speisen,
so werden die Schüsseln und schweren Gerichte auf den breiten Rand
des Beckens gestellt. Die leichteren schwimmen auf Schiffchen oder
künstlich gebauten Schwimmvögeln und können so zu jedem Gaste gelangen.
Dem Marmorbassin gegenüber steht ein Springbrunnen, dessen Wasser in
die Höhe getrieben, dann aber in Röhren aufgefangen und weitergeleitet
wird.
Nicht weit von der Bank steht ein Pavillon, um den sich bis aufs[S. 396] Dach
hinauf Reben freundlich emporranken. Man ruht hier wie im Walde, ist
aber in voller Sicherheit vor Regen. Auch hier ist ein Springbrunnen,
dessen Wasser gleich weiter fließt. Hier und da findet man Marmorbänke,
welche den Müden zu sanfter Ruhe einladen. An jedem Ruheplatz ist ein
kleiner Brunnen, und die Einrichtung überhaupt so getroffen, daß der
ganze Garten bewässert werden kann.“
In den Gärten der vornehmen Römer sorgte man vor allem für reichlichen
Zufluß von Wasser, um allenthalben Kühlung zu spenden, rauschende
Sturzbäche zu bilden, große, mit buntbemalten Marmorfiguren geschmückte
Bassins zu füllen und Springbrunnen und andere Brunnen zu speisen.
Hier ließ eine Nymphe Wasser aus einer Urne in ein Becken laufen, dort
entquoll es dem Schnabel einer von einem Knaben gebändigten Gans als
Springbrunnen. In seiner berühmten Villa tiburtina, die sich
Kaiser Hadrian bei Tibur im Sabinergebirge erbaut hatte, war sogar ein
großer künstlicher See mit kunstvoll gezimmerten Miniaturschiffen,
auf dem sich der Kaiser Seeschlachten vorführen ließ. So zahlreich
und kompliziert waren in manchen dieser Gärten die Wasserkünste,
daß außer den zahlreichen Gärtnern ein eigener Wassertechniker, der
aquarius, für ihre Instandhaltung angestellt werden mußte.
Oft war auch ein Tiergarten damit verbunden, indem in eingehegten
Räumen allerlei zahme Tiere, besonders Ziervögel, und in marmornen
Becken Fische der verschiedensten Art gehalten wurden. Durch Tacitus
kennen wir den Park am „Goldenen Hause“ des Kaisers Nero, der von
beispielloser Pracht war, nicht bloß in bezug auf den architektonischen
und den plastischen Schmuck, sondern auch was die zauberhaften
Blumengärten und mannigfaltigsten Wasserkünste betrifft.
Wie Vespasians üppiger Sohn Domitian, der nach seines älteren Bruders
Titus Tode am 13. September 81 den Thron der Cäsaren bestieg, um am 18.
September 96 unter den Schwertstreichen des Prokurators Stephanus, des
Gardeoffiziers Cornelius und mehrerer Gladiatoren aus sieben Wunden
blutend sein durch gräuliche Schandtaten und übermäßige Grausamkeit
verwirktes Leben auszuhauchen, die prunkvollste und ausgedehnteste
aller Kaiserbauten auf dem Palatin mit Riesensälen in einem Walde von
Säulen aus den kostbarsten Steinarten erbauen ließ, so ließ er sich
ein an Pracht mit seinem Schlosse wetteiferndes Lustschloß auf dem
Albanergebirge errichten. Es erhob sich in vier Terrassen, die ganze
Ebene um Rom beherrschend, und umschloß in seinen ausgedehnten Gärten
auch ein Theater und ein Amphi[S. 397]theater, in welchen zahllose Feste,
besonders zu Ehren Minervas, gefeiert wurden.
An Ausdehnung und Mannigfaltigkeit der Bauten wurde diese Villenanlage
Domitians noch weit durch die gewaltige, einen Umfang von 12 römischen
Meilen aufweisende Villa Hadrians in Tibur überboten, deren großer
künstlicher See vorhin erwähnt wurde. In seinem Landsitze, an dem
er vom Jahre 118 bis zu seinem Tode 138 bauen ließ, suchte er die
Erinnerungen seines rastlosen Wanderlebens durch die herrlichen
Schöpfungen der griechischen Welt festzuhalten. Zwischen prächtigen
Gartenanlagen erhoben sich über das Areal zerstreut zwischen Bergen
und Tälern mit Wäldern, Wasserfällen und Grotten ein Hippodrom und ein
Theater, eine griechische und eine lateinische Bibliothek. Großartige
Prunksäle für festliche Empfänge wechselten mit einfacheren Bauten
des täglichen Lebens, durch den erfreuenden Ausblick in mannigfache
Gärten belebt. Im Hintergrunde scheinen die beiden berühmten Stätten
attischer Philosophie, das Lykeion und die Akademie gelegen zu haben,
schattige Haine mit Ruheplätzen, der Erinnerung an die großen Meister
geweiht. Von ihnen gelangte man zu einem Prytaneion, einem kleinen
Kuppelbau, das Solons alten Bau auf dem Markte in Athen wiederholte.
In gleich spielendem Sinne hieß ein Bau die Poikile wie das athenische
Vorbild, das nach den farbigen Wandgemälden die „Bunte“ hieß und
vermutlich eine Gemäldesammlung barg. Zwischen ihnen lag die Canopus
genannte Anlage, wo sich der Kaiser in den Frohsinn des namentlich
von den lebenslustigen Griechen aus Alexandreia besuchten ägyptischen
Badeortes zurückversetzen konnte bei dem Anblick eines mit ägyptischen
Denkmälern geschmückten Wasserlaufs. An einer andern Stelle war das den
Musen geweihte idyllische Tempetal — eine Nachahmung des thrakischen
Vorbildes —, dann der heitere Hain des Elysiums neben dem düstern
der Unterwelt zu sehen. Dazwischen sprangen wundervolle Wasserwerke,
die von Flußläufen aus dem nahen Sabinergebirge gespeist wurden und
den Kaiser, den Segner der griechischen Welt, der mit beispielloser
Freigebigkeit den Griechenstädten Wasserleitungen und Wasserwerke
wunderbarster Art erbaut hatte, an seine Tätigkeit als Kulturbringer im
Osten des Reiches erinnern sollten.
Einen schwachen Abglanz dieser altrömischen Kaiserherrlichkeiten
bewahrte das die Ansprüche des Imperiums an sich reißende Byzanz, bis
auch dieses in greisenhafter Entartung dahinzuwelken begann. Nach dem
endlichen Untergange der Weltherrschaft Roms verschwand[S. 398] in den Wirren
und der Not der Zeit allmählich alle diese bis dahin beispiellose
Pracht im Abendlande, wo die durch die Völkerwanderung mobil gewordenen
Barbarenstämme die Schöpfungen der Römer wohl anstaunten, aber kein
Verständnis für sie hatten, geschweige denn sie mit Sachverständnis
übernehmen und weiterbilden konnten. Die politischen und zugleich auch
geistigen Erben der Römer waren zunächst die Araber, denen im Laufe des
frühen Mittelalters der größte Teil des römischen Weltreiches, nämlich
Vorderasien, Afrika, Südspanien und Sizilien, zufiel. Aus den einstigen
umherschweifenden Hirtenstämmen waren seßhafte Stadtbewohner geworden,
die in den von ihnen eroberten alten Kulturländern die feinere
Lebensführung der unterjochten Völker verständnisvoll übernahmen und
ihren persönlichen Bedürfnissen anpaßten. So wurden die Villen und
Gärten ihrer Vorgänger, die sie überall auf ihrem Siegeszuge vorfanden,
für sie Vorbilder, nach denen sie ihre Städte mit einem Kranze üppiger
Gärten umgaben, wie sie heute noch beispielsweise die Stadt Damaskus
aufweist, eingeschlossen von hohen Mauern, wie es die Abgeschlossenheit
des häuslichen Lebens ihrer Bewohner verlangte. Es waren regelmäßige
Anlagen, mit breiten, geraden Hauptwegen und rechteckigen Feldern, auf
denen im bunten Wechsel ein reicher Blumenflor mit lauschigen Plätzen
von Schattenbäumen und farbigen Kiosken sich fanden. Auf abschüssigem
Boden senkte sich der Garten in Terrassen, die mit Treppengängen
verbunden waren. Mit raffiniertem Geschick war die Bewässerung,
namentlich in wasserarmen Gegenden, durchgeführt. Offene Kanäle und
unterirdisch geführte Ton- oder Kupferröhren durchzogen den Boden,
jeden der Bäume des Gartens besonders speisend. Unter diesen spielte
naturgemäß die Dattelpalme aus alter Anhänglichkeit die größte Rolle.
Im Garten des maurischen Sommerpalastes von Generalife (arabisch
dschenat al arif, d. h. Garten des Baumeisters) in der Nähe der
Alhambra (arabisch kelât al hamrah, d. h. die rote Burg) bei
Granada aus dem 13. Jahrhundert führt ein in Marmor gefaßter Kanal das
Wasser aus weiter Entfernung vom Gebirge in den hoch gelegenen Garten.
In ununterbrochenen Kaskaden stürzt es in ihm hinab, um schließlich
in ein Becken mit einem hohen Springbrunnen zu fließen, von wo es dem
Garten in kleinen Rinnsalen zur Tränkung der Pflanzen zuströmt. Überaus
groß war der Blumenreichtum dieser Gärten. Eine arabische Inschrift an
einem der zierlichen Kioske dieses Gartens von Generalife sagt: „Dein
Garten ist geziert mit Blumen, die[S. 399] von ihren Stengeln die süßesten
Düfte aushauchen. Frische Luft durchstreicht den Zitronenbaum und
verbreitet den Wohlgeruch seiner Blüten weit umher. Rund um mich her
verbreitest du Harmonie, Blumen und Grün.“ Begreiflicherweise war der
Eindruck, den die abendländischen Kreuzfahrer von solchen arabischen
Gärten des Morgenlandes erhielten, ein sehr starker und nachhaltiger.
„Darinne stund manig zederbaum mit eßten laubes riche“ heißt es von
einem sarazenischen Garten in einem Gedicht des Minnesängers Heinrich
von Veldeke aus dem Jahre 1180, und man empfindet die große Bewunderung
der Beschauer, wenn in solchen Springbrunnen von „grunem mermelstein“
und die das dazu nötige Wasser herbeiführenden Leitungen „mit funffzig
hoen swybogen“ beschrieben werden.
Es ist immerhin wenig, was wir von den arabischen Gärten des
Mittelalters wissen. Schlösser von märchenhafter Pracht mit den
prunkvollsten Gärten müssen nach den Schilderungen der arabischen
Schriftsteller aus jener Zeit die Kalifen aus dem Geschlechte der
Abbasiden in Bagdad, der damals größten und in bezug auf Industrie und
Wissenschaft bedeutendsten aller arabischen Städte, besessen haben.
Von dem damals hier getriebenen Luxus meldet uns ein Gesandter des
griechischen Kaisers in Byzanz, der im Jahre 917 mit einer Botschaft
an den Fürsten der Gläubigen von Mosul aus den Tigris hinunterfuhr.
Die Truppen bildeten vom Stadttor an im Paradeanzug Spalier und
saßen auf silbernen und goldenen Sätteln. Das Schloß wimmelte von
Hunderten von Kammerherrn nebst Tausenden weißer und schwarzer
Diener. 38000 der kostbarsten Teppiche waren überall aufgehängt und
22000 waren zum Beschauen ausgestellt. Im kostbaren, mit Arkaden aus
Marmor geschmückten Stall standen tausend Pferde, von denen jedes
von einem kostbar gekleideten Bereiter am Zaum gehalten wurde. Im
Tiergarten sah der Gesandte unter anderem vier prächtig aufgezäumte
Elefanten und hundert Löwen. Dann führte man ihn zu einem zwischen
zwei Wäldchen gebauten Pavillon. Darin war ein mit Zinn belegter
Teich, 30 Ellen lang und 20 Ellen breit, der wie Silber glänzte.
Darauf ruhten vier leichte, vergoldete und mit gestickter Leinwand
ausgeschlagene Kähne. Um den Teich herum standen 400 Palmen, den
unansehnlichen Stamm mit kostbarem indischen Tiekholz bekleidet, das
von vergoldeten Reifen zusammengehalten wurde. Am besten aber gefiel
dem Gesandten das „Baumhaus“; darin stand ein aus Silber und Gold
verfertigter Baum, dessen Blätter im Winde zitterten. In den Zweigen
saßen künstliche Vögel, welche[S. 400] sangen und girrten. In allen Teilen
des auf das kostbarste ausgestatteten Schlosses boten Diener und
Sklaven in Schnee gekühltes Wasser, Fruchtsäfte und Reisbier herum.
Zuletzt kam man vor den Kalifen, der in schwarzen, goldgestickten
Kleidern auf einem schwarzen Thron von Ebenholz saß, auf dem Haupte
die edelsteingeschmückte Mitra. Vor ihm standen fünf Söhne, drei zur
Rechten und zwei zur Linken. Die Audienz nahm den üblichen Verlauf.
Nachher schickte man dem Gesandten 50 Beutel mit je 4000 Mark in sein
Absteigequartier. Der Ehrenadjutant erhielt Ehrenkleider, da es noch
keine Orden gab.
Den von prunkvollen Gärten umgebenen Schlössern liebte man schöne
Namen zu geben, wie „das Liebesgestirn“, „die Braut“, „der König“,
„die Krone“, „der Liebende“, „der Geliebte“. Außen erschienen sie
ziemlich einfach, waren aber innen um so luxuriöser eingerichtet. Von
den üppigen Sitten der hier Wohnenden zeugt die eine Tatsache, daß,
als dem Statthalter Chumarnje vom Arzte Massage verordnet wurde, er,
um dem Daumen des Masseurs zu entgehen, den Teich seines Gartens mit
Quecksilber füllen und eine seidene, an goldenen Bolzen straffgespannte
Matte darauflegen ließ. Darauf wurde er die ganze Nacht hindurch
geschaukelt und so auf das Zarteste massiert.
Über die Privatgärten aus Bagdads Blütezeit sagt uns der Orientalist
A. Mez, dem wir auch obige Angaben verdanken: „Einen großen Garten am
Hause konnten sich nur die Allerreichsten leisten, die Wohlhabenden
hatten ihn draußen vor den Toren. Da es keinen Rasen gab und der
Palmstamm als häßlich empfunden wurde, so mußte man mit der Mischung
von Blumen und Wasser auskommen; dazwischen stand als Gartenbaum die
köstliche, ernste Zypresse. Blumenkönigin war auch hier die Rose,
danach kam die Narzisse. Gern wurde das helle Rot der Rosen mit dem
dunkeln der Anemonen zusammengestellt.“
„Rosen stehen um Anemonen herum in deinem herrlichen Garten,
Als ob Menschengesichter ringsum in eine Feuersbrunst starrten.“
(Sanaubari in Schabuschtis Klosterbuch, Handschrift Berlin, Folio 96 b.)
Dann das Veilchen „im Trauerkleide“, Jasmin, weißer Mohn, Granaten,
Minze, Nelken, Lilien, Myrten und ein paar orientalische Spezialitäten:
Churram, Sausam und Behâr. Auf dem Teiche lag „wie große Goldstücke“
der Lotos. Also kein Vergleich mit der ostasiatischen und
amerikanischen Pracht, über welche der heutige Blumenfreund verfügt;
sogar die Tulpe fehlte. In diese bunte Welt wurde[S. 401] eine Loggia oder
ein Pavillon mit Kuppelhut hineingebaut; dorthin lud man die Freunde
ein, aß und trank, labte das Auge an Schänke und Schänkin, am Tanz
von Knaben und Mädchen, das Ohr am Singen der Vögel, an kunstreichem
Saitenspiel und Gesang. Man freute sich der Aussicht, wenn nachts der
Vollmond am Horizont lag „wie Gold auf blauen Hyazinthen“, oder bleich
und dünn der junge Mond „wie, was man sich vom Nagel abschneidet“,
wenn die Zypressen als hochgeschürzte junge Mädchen im Windeswehen
spielten. Hier zechte man gerne nachts beim Schall von Zithernlaute,
Flöte und Pauke. Das Gemach war mit Blumen bestreut. Die Zecher
trugen Blumenkränze auf dem Haupt und warfen sich Blumengrüße zu.
Sie erwarteten vom Wein und der Musik, daß „ihre Seele flog“; dann
„tanzten“ sie, hüpften auf einem Bein, seufzten oder rannten mit dem
Kopf gegen die Mauer, — letztere Übung sah man auch an der Inbrunst
der Frommen gern.
Tafel 133.

Ein japanischer Tempelgarten in Kyoto.

Ein altrömischer Hausgarten. (Das nach den Funden wieder
hergestellte Peristyl im Hause der Vettier in Pompeji).
Tafel 134.

Der päpstliche Garten des Quirinal in Rom gegen das Ende des 17.
Jahrhunderts. (Nach dem Kupferstichwerk von G. B. Falda „Li giardini
di Roma“ 1683.)
❏
GRÖSSERES BILD
Tafel 135.
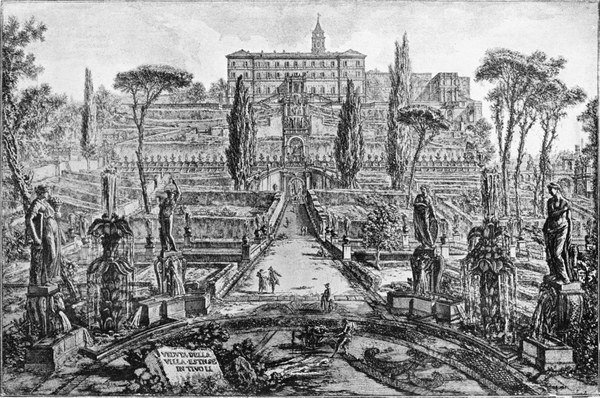
Die ursprüngliche Gartenanlage der Villa d’Este in Tivoli. (Nach einem
Stich von J. B. Piranesi).
❏
GRÖSSERES BILD
Derselbe Autor schildert uns einen vornehmen ägyptischen Garten des
Mittelalters nach der Beschreibung eines Zeitgenossen: „Im Garten
stand ein Pavillon auf vier Marmorsäulen an einem Teich, drum herum
Zitronenbäume, denen man die Früchte ließ, bis sie abfielen. Vier
Pumpen füllten den Teich, dessen Wasser oft gewechselt wurde. Darauf
lag ein Kahn aus ziseliertem Erz. Singvögel, Tauben und Pfauen
tummelten sich herum. Die Wege waren mit feinen, bunten Matten belegt,
als Tore dienten Ketten aus Eisen. Der Rosengarten lag besonders.
Dort wurde beim Rosenfest aus Girlanden ein Rosenschloß erbaut, in
dem gegessen und gesungen wurde. Auch Parke von großen Bäumen hatte
man, aber ohne Rasen. Und nirgends Wald! Dadurch sind dem Araber fünf
Sechstel unserer Romantik abgeschnitten und auch der romanischen; denn
selbst Ariosts Abenteuer spielen in Waldluft. Das romantische Land der
Muslims ist die Wüste.“
Im ganzen zeigen die muhammedanischen Hausgärten eine nicht weiter
überraschende Ähnlichkeit mit denjenigen der Römer, denen sie
nachgebildet waren. Indem der Orientale sein Haus in Nachahmung des
römischen, in welchem sich das häusliche Leben ebenfalls von der
Außenwelt abgekehrt abspielte, um innere von Säulen umgebene Höfe
aufbaute, wurden diese die Grundlage des Hausgartens, in welchem die
Familie sich an der frischen Luft erging. In der Mitte befand sich
wie beim römischen Hausgarten ein Brunnenbecken mit meist springendem
Wasserstrahl, ringsherum regelmäßige Rasenflächen mit Blumenbeeten und
Ziersträuchern, die Wege mit Marmorplatten belegt. Solche[S. 402] Höfe zeigt
uns heute noch das im 13. Jahrhundert erbaute maurische Königsschloß
der Alhambra bei Granada, allerdings ohne die ursprüngliche
Bepflanzung. Das durch seine äußerst zierliche und geschmackvolle
Architektur und Bemalung ausgezeichnete, in Abbildungen allgemein
bekannte Schloß besteht aus einer ganzen Reihe solcher rechteckiger
Gartenhöfe, deren größter der Hof der Alberca, auch Patio de los
arrayanes, d. h. Myrtenhof, genannt ist. In ihm befindet sich eine
der drei im 16. Jahrhundert im Innern der Alhambra gefundenen berühmten
Vasen aus emaillierter Fayence. Der Länge nach durchschneidet ihn ein
schmales, marmornes Wasserbecken, das zwei Springbrunnen miteinander
verbindet. Östlich davon befindet sich der berühmteste dieser Höfe,
der Löwenhof, so genannt, weil in seiner Mitte eine von zwölf recht
mangelhaft geratenen steinernen Löwen getragene Doppelschale aus
Alabaster sich findet, die von einem Springbrunnen gekrönt wird. Das
von diesem abfließende Wasser ergießt sich durch die Löwenmäuler in ein
unteres Bassin, um von da weitergeleitet zu werden.
Wie die mittelalterliche Kirche des Abendlandes die getreue
Nachfolgerin der christlich-römischen war, so führten die Klöster des
Mittelalters das aus der Römerzeit übernommene Erbe in bescheidener
Weise fort. Auch ihnen bot das römische Haus ein willkommenes Vorbild
zu einer nach außen abgeschlossenen Wohnung. Dem Peristyle desselben
entsprach der Kreuzgang, und der von diesem eingeschlossene Hof hatte
anfänglich eine ganz ähnliche Teilung wie der Löwenhof der Alhambra,
wie der zu Anfang des 9. Jahrhunderts gezeichnete Plan für einen
Neubau des Klosters St. Gallen deutlich erkennen läßt. Die späteren
Klöster schmückten diese Höfe oft mit zierlichen offenen Brunnenhäusern
und legten diese unmittelbar an den Kreuzgang, so daß man vom
Refektorium oder Speisesaal aus einen reizvollen Durchblick durch das
Brunnenhäuschen auf die Büsche und Blüten des Hofes genoß.
Abgesehen von diesem Klosterhofgarten scheint nichts von der römischen
Gartenkunst auf die nordischen Völker im Mittelalter übergegangen
zu sein, obwohl die Römer auch in ihren nordischen Provinzen, in
Gallien, Germanien und Britannien, ebenso wie in den übrigen Teilen des
Reichs, ihre Villen und Villengärten besaßen, die als Vorbilder hätten
dienen können. Die Wirren der Völkerwanderung ließen solches nicht
zu, und auch als ruhigere Zeiten kamen, verhinderten die politischen
und sozialen Zustände die Ausbildung einer Gartenkunst, trotz des
lebendigen Gefühls für die Schönheit der Blumen, das in[S. 403] den Dichtungen
des späteren Mittelalters zum Ausdrucke kommt. Der Bürger saß in den
unruhigen, von Kriegslärm durchtosten Zeiten in der ihm Sicherheit des
Lebens und Eigentums gewährenden eng ummauerten Stadt, der Adelige auf
hohem, eingeschränktem Burgsitz. Hinter den Mauern der Befestigungen
hatte der eine so wenig wie der andere Raum für ein Gartenleben, wie
es die vornehmen Römer geführt hatten, ganz abgesehen von dem Fehlen
einer Kultur, die das Bedürfnis nach einem solchen Leben hervorgebracht
hätte. Das Einzige, was von römischer Gartenkultur in diesen Ländern
zurückblieb, waren der Weinstock, die verschiedenen Obstbäume, Gemüse
und Blumen, die von den einstigen Herren aus Italien mitgebracht worden
waren.
Nach und nach erwachten die Geister aus der dumpfen Enge der geistigen
Beschränktheit, in der sie das ganze Mittelalter hindurch verharrt
hatten. Langsam erwachte die Freude an dem bis dahin für sündliche
Fleischeslust gehaltenen Naturgenuß, das ästhetische Vergnügen an
schönen Landschaftsbildern, an zierlichen Pflanzen, an der Form und
Farbe ihrer Blüten. Aus dem praktische Zwecke verfolgenden Arzneigarten
wurde am Bauernhause das rein idealen Zwecken der Freude an schönen
Farben und Formen dienende Blumengärtchen. Gleicherweise fand dieser
Prozeß in den Gärten zwischen den Höfen der Bürgerhäuser und vor den
Stadtmauern, wie bei den Adeligen an der Burgmauer statt. Gleichzeitig
erwachte die Freude an schönen Bäumen; namentlich die Linde stand
neben der Eiche und der Eberesche in hohem Ansehen, wie im Orient die
Platane als Schattenbaum bevorzugt wurde. Um die Linde waren Bänke
errichtet, die zum Ruhen einluden, und der umgebende Rasen war mit
„geschachzabelten und gevierten“, d. h. in schachbrettartig, mit
Vierecken gemusterten Blumenbeeten ausgestattet, die dem Auge Freude
gewährten. Dazwischen fanden sich allerlei Gemüse und Arzneikräuter.
War der Besitzer reich, so schmückte ein Vogelhaus den Garten und
wurden seltene Tiere in Käfigen gehalten. Manchmal war in einer
lauschigen Ecke noch eine dichte Geißblattlaube vorhanden, in die
Liebende sich mit Vorliebe zurückzogen, um ihrem jungen Glücke zu leben.
Mit der Befestigung der politischen Zustände und dem allmählich durch
den regen Handel mit dem Morgenlande beförderten Wohlstand, der die
Vorbedingung einer die Gartenkunst übenden vornehmen Lebenshaltung
bildet, erwachte in den leitenden Kreisen der Stadtrepubliken und
Tyrannenstaaten Italiens, durch die noch von den Gelehrten und den
Vertretern der Kirche gesprochene lateinische Sprache[S. 404] und die Menge
der noch vorhandenen Erinnerungen und Denkmäler begünstigt, in der
Renaissance die Wiedergeburt antiken Denkens und Lebens. War schon am
Ausgange des Mittelalters namentlich in den Dichtungen der Minnesänger
das Naturgefühl wieder so weit zum Durchbruche gekommen, daß die
einfachsten Erscheinungen in der Natur, wie das Erwachen des Frühlings,
das Knospen und Blühen der Bäume, das wohltuende Grün des Grases und
der Blätter in Wald und Feld, der liebliche Gesang der Vögel, wieder
als etwas Schönes empfunden wurden, so entstand in den Italienern
mit der Renaissance zum erstenmal in der Menschheitsgeschichte die
selbst den Gebildetsten des Altertums versagte Fähigkeit, die Gestalt
der Landschaft als Ganzes in ihrer mehr oder weniger ausgesprochenen
Lieblichkeit oder Grandiosität zu erfassen. Sie kommt in der Malerei
vom 15. Jahrhundert bereits zum Ausdruck, indem die Landschaft
nicht mehr nur mit dem Bestreben, einen Schein der Wirklichkeit
hervorzubringen, sondern schon mit der Absicht, ihr einen besonderen
poetischen Gehalt unterzulegen, dargestellt wird. Dieses modern
empfindende Naturgefühl kommt auch in der italienischen Literatur
dieser Zeit zum Ausbruch. So genießt der 1405 zu Pienza in Toskana
geborene Äneas Sylvius de Piccolomini, der von 1458–1464 als Pius
II. auf dem päpstlichen Throne saß, mit Entzücken das Panorama, das
sich ihm vom höchsten Gipfel des Albanergebirges, vom Monte Cavo aus,
darbot, oder die Schönheit des Hügellandes um Siena mit seinen Villen
und Klöstern auf den Höhen.
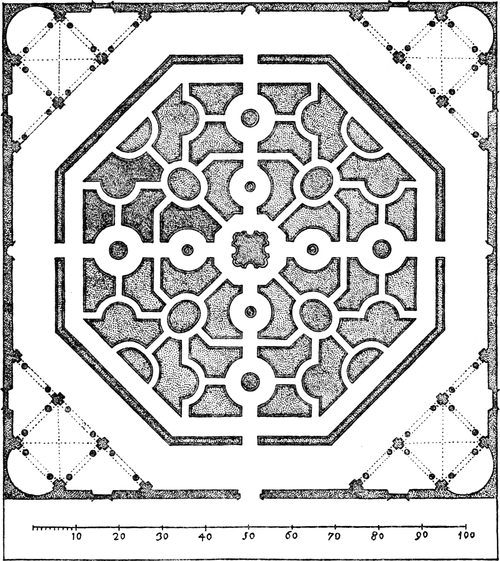
Bild 73. Anlage eines italienischen
Renaissancegartens mit Architektur.
(Nach J. B. Ferrarii „De florum cultura“
1633.)
Aus dem wachsenden Verständnisse für die landschaftliche Schönheit
erwuchs dem gebildeten Italiener eine Vorliebe für das Landleben,
die um so stärker zum Ausdruck kam, je größere politische und
polizeiliche Sicherheit die einzelnen Städte und Staaten gewährten.
Dabei waren von Sizilien und Unteritalien ausgehende Einflüsse, die
auf arabischen Einfluß zurückzuführen sind, nicht zu verkennen. Wie
die Normannen manche Feinheiten der arabischen Sitten angenommen und
an ihre Nachbarn, die Italiener des Festlandes weitergegeben hatten,
verbreitete sich die Freude an hübsch eingerichteten Gärten langsam
über die italienische Halbinsel. Und so füllte sich denn bald wieder
die Umgegend gewisser Städte, hauptsächlich Florenz, später auch Rom,
mit den Landhäusern der durch Handel und Industrie reich gewordenen
Städter. Damit war die Wiederanknüpfung an die noch vorhandenen Reste
einer der köstlichsten Schöpfungen des alten Römertums gegeben, um
so mehr, als inzwischen auch die Architektur[S. 405] bei den zahlreichen
Überbleibseln der altrömischen Baukunst in die Schule gegangen war und
einen neuen Baustil hervorgebracht hatte, eben den der italienischen
Renaissance. Denn der italienische Garten der Renaissance, der
nun entstand, war eine Schöpfung der Architektur, wie es wahrscheinlich
der altrömische Garten auch gewesen war. Die ihn schufen, waren
Architekten, jene Künstler der Renaissance, die nicht bloß Baumeister,
sondern Universalkünstler waren, die alle bil[S. 406]denden Künste
beherrschten und dadurch allen ihren Bauschöpfungen den Stempel völlig
einheitlicher Kunstwerke aufprägten. So kam es, daß der Garten in der
italienischen Renaissance nicht eine Kunstgattung für sich darstellte,
sondern stets Teil eines Kunstwerks war, indem Villa und Garten als ein
einheitliches Ganzes aufgefaßt wurden. Mit der Aufgabe, einen Palast,
eine Villa zu bauen, übernahm der Architekt zugleich die Aufgabe, auch
den dazu gehörenden Garten zu schaffen. Und da in dieser Verbindung
von Haus und Garten für die künstlerische Lösung der Aufgabe das
Haus mit seiner Lage und der Anordnung seiner Teile notwendigerweise
die Richtschnur abgab, so hatte sich die Einteilung des Gartens der
des Hauses unterzuordnen. Das Haus aber wurde von diesen Architekten
in der Anordnung der Räume, wie im ganzen Aufbau strenger Symmetrie
unterworfen; die Folge davon war, daß diese Gesetze auch auf den Garten
übertragen wurden.
Da nun Italien durchweg ein gebirgiges Land ist, und für die Lage der
Villen in erster Linie die Schönheit der Aussicht bestimmend war, sie
also meistens an den Abhängen errichtet wurden, so mußte der Garten
terrassiert werden, was an sich schon wesentlich dazu beitrug, ihn zu
einem architektonischen Kunstwerk zu gestalten. Die Anlage solcher
Terrassen aber erforderte das Aufführen von Mauern und Brüstungen,
und untereinander mußten die Terrassen durch Treppenanlagen verbunden
werden. So wurden die Terrassenanlagen mit ihren Brüstungsgeländern
und ihren Freitreppen zu dem Hauptelemente bei der architektonischen
Gestaltung, das den Charakter dieser italienischen Gärten bestimmte.
Der regelmäßigen Anlage des Ganzen entsprechend, wobei die Mittelachse
des Gebäudes sich in den Garten fortsetzte, traten auch die
schmückenden Pflanzengruppen und Blumenbeete in architektonischen
Formen auf und mußte sich der Pflanzenwuchs der Schere beugen. Die
Blumen wuchsen in geometrisch geformten Beeten, und dazwischen stellte
man die zahlreichen wieder ausgegrabenen, der Farbe beraubten,
antiken Statuen oder Nachahmungen derselben zum Schmucke als
willkommene Abwechslung für das Auge auf. Wenn immer möglich, durfte
zur Belebung des Ganzen auch das strömende Wasser nicht fehlen. In
rauschenden Kaskaden strömte es von oben herab, um, unten angelangt,
in Springbrunnen wieder aufzusteigen und sich schließlich in weiten,
gemauerten Bassins zu sammeln. Eine der ältesten solcher Anlagen war
diejenige der Villa Rucellai in Florenz, die die durch die Einführung
der Orseille[S. 407]flechte aus dem Orient in die Färberei des Abendlandes
reich gewordenen Nachkommen des im 13. Jahrhundert in der aufstrebenden
Stadt ansässig gewordenen Deutschen Federigo, d. h. Friedrich, sich
bauten. In ihr waren zur Staffage zahllose antike Trümmer aufgestellt,
an denen der junge Michelangelo Studien als Zeichner und Bildhauer
machte.
Als später in der Architektur ein anderer Geschmack aufkam und die
noch maßvolle Hochrenaissance in die weniger ruhigen Formen des Barock
überging, nahmen die Wasseranlagen in den Gärten derart überhand,
daß sie in vielen Fällen durchaus den Eindruck beherrschten. Da
konnte man bald der Wasserkünste nicht genug bekommen. Zahllose
Springbrunnen in ganzen Alleen — in der Villa d’Este in Tivoli bei
Rom z. B. zählte man deren an 1000 — schleuderten ihre Wasser in
die Höhe, und die reiche, in Marmorfiguren wieder auflebende Welt
der heidnischen Götter und Halbgötter, die als plastischer Schmuck
sich nicht nur auf den Terrassen, den Treppen und ihren Balustraden
erhob, sondern auch die Springbrunnen und Wasserbecken belebte, spie
ebenfalls in oft recht geschmackloser Weise Wasser. Brunnen entsprangen
den Treppen, sprudelten aus den Wänden der Terrassen hervor und
selbst die Kaskaden, die sogenannten Wassertreppen, wurden von ihnen
unterbrochen. Die Bergwände wurden ausgehöhlt und die Grotten, die
man hier bildete, füllte man mit allerlei Wassereffekten. Schließlich
arteten die Wasserkünste in Spielereien aus. Man ließ in den Grotten
Wasser in hohle Röhren fallen und trieb dadurch die Luft hinaus in
eine Pfeife, die tönte. Aus einer Anzahl solcher Pfeifen stellte man
ganze Wasserorgeln her. Berühmt war in dieser Beziehung der Garten
der vom Neapolitaner Pierro Ligorio für den Kardinal Hippolyto
von Este erbauten Villa d’Este in Tivoli, in welchem zwischen den
architektonischen Prospekten nicht bloß Äolsharfen, sondern auch vom
Wasser getriebene Musikwerke für den Kardinal und seine Freunde ihre
Melodien erschallen ließen. Der Vogelbrunnen in baumbeschatteter Grotte
ahmte allerlei Vogelstimmen nach, bis das plötzliche Erscheinen einer
großen, künstlichen Eule den kleinen Vögeln Schweigen gebot. Außerdem
wurde das Wasser zu allerhand schlechten Scherzen gegen uneingeweihte
Besucher benutzt, die unvermutet bespritzt wurden, wenn sie in den
Grotten oder auf den beim Herumspazieren begangenen Wegen auf bestimmte
Stellen des Fußbodens traten. Betrügerische Sitze waren angebracht;
setzte man sich auf sie nieder, so spritzte ein Wasserstrahl unter den
Füßen des[S. 408] Sitzenden hervor. In manchen Grotten standen Bildsäulen, die
sich bei Berührung einer bestimmten Stelle umdrehten und den harmlosen
Zuschauer mit Wasser begossen, und andere dergleichen Späße mehr.
Eine weitere, noch bedenklichere Ausartung betraf den Pflanzenwuchs.
Die meisten Schmuckbäume des italienischen Gartens, vor allem die
Pinie und Zypresse, welch letztere in ihrer aufstrebenden, scharf
umrissenen Form etwas durchaus architektonisches hat, das keiner
Nachhilfe bedurfte, dann die immergrüne Eiche, der Orangenbaum, der
Lorbeer, ferner die Gesträucher, wie Myrten, Azaleen, Rhododendren
und andere, haben von vornherein so bestimmte, feste Umrißlinien,
daß die Versuchung, ihre Kronen zu beschneiden, durchaus fern lag.
Anders war es schon mit den Hecken, mit denen die verschiedenen
Teile des Gartens umschlossen waren. In den älteren Gärten waren die
Flächen zwischen den Hauptrichtungslinien, die durch die Achsen der
Villa bestimmt wurden, meist in quadratische oder doch wenigstens
rechteckige Felder aufgeteilt, wobei die Kreuzungspunkte der Wege durch
Baumgruppen, Springbrunnen oder Lauben geziert waren, während Alleen
von Zypressen, den wichtigsten Bäumen des italienischen Gartens, die
Hauptwege begleiteten. Die einzelnen Felder dieses Parterres, deren
Begrenzung mit der Zeit von der einfachen, geradlinigen Linienführung
zu gewundenen, selbst verschnörkelten Formen überging, waren in ihrem
Innern mit saftig grünem Rasen, mit blühenden Gesträuchern und Blumen
aller Art erfüllt. Da begann man statt der natürlich gewachsenen
Formen allerlei aus Buchs und Eibe geschnittene Figuren, wie sie
schon die Römer der Kaiserzeit geliebt hatten, zur Ausschmückung zu
verwenden. Manche der Felder wurden auch als sogenannte Labyrinthe
ausgebildet, d. h. zwischen mit der Schere zu grünen Wänden
beschnittenen Hecken führten verschlungene Wege zu einem Platze im
Mittelpunkt des Labyrinths, den man auffinden mußte, wobei man in
allerhand Sackgassen geriet. Alle diese Buchs- und Eibenhecken reizten
begreiflicherweise dazu, außer den geradlinig beschnittenen auch andere
Formen herzustellen, z. B. die Endpunkte der Hecken durch Halbkugeln
oder Kugeln auszuzeichnen oder den Heckenrändern statt einer geraden
eine geschwungene obere Begrenzung zu geben. Solche Gärten aus dem 16.
Jahrhundert finden wir noch andeutungsweise im heutigen Italien, z. B.
in der berühmten, jetzt leider stark verfallenen Villa Aldobrandini in
Frascati bei Rom, in den Giardini Giusti in Verona und Boboli hinter
dem Palazzo Pitti in Florenz. In ihnen sind allerdings die einst in[S. 409]
strengen Formen gehaltenen Gewächse der Schere entwachsen und haben
riesige Dimensionen angenommen, die das einstige Aussehen nicht mehr
wiedergeben, heute aber nach unserem Geschmack großartiger und schöner
wirken.
Italien galt damals für tonangebend in Geschmack und Sitten der großen
Welt. So konnte es nicht fehlen, daß die französischen Könige wie die
deutschen Kirchenfürsten seinen Gartenbau nachahmten. Claude Mollet,
der Gärtner Heinrichs IV. von Frankreich, errichtete in dieser Weise
die Gartenanlagen der Schlösser von Blois, Fontainebleau und St.
Germain en Laye. Zwischen den geradlinigen Alleen waren kunstvolle
als parterres en broderie bezeichnete Blumenbeete errichtet,
zwischen denen die Kavaliere und Damen des Hofes lustwandelten. Aus
verschiedenfarbigen Pflänzchen mühsam hergestellte Buchstaben und
Sinnsprüche erfreuten die Besucher. Aus Hainbuchen und Weißdorn schnitt
man Tiergestalten, Menschen und Schiffe, zwischen welchen weiße
Marmorstatuen eine wohltuende Abwechslung boten. Und während die Gärten
der Renaissance sich auf die nähere Umgebung der sie schmückenden
Paläste beschränkt hatten, ging man mehr und mehr zu dem weiten,
ausgedehnten Garten des folgenden Barock über.
Die Gärten der Barockzeit, wie sie uns in Italien in der Villa Borghese
und in der Villa Pamphili Doria in Rom, leider stark verballhornisiert,
entgegentreten, zeigen alle mehr oder weniger entwickelt schon
Vorboten des freien Landschaftstils in Gestalt von in rein natürlichen
Formen gehaltenen Waldpartien, die auf begrenztem Raum möglichst viel
Naturschönheit künstlich vereinigen. Nach diesem Muster entstand in
Frankreich allmählich der nach dem Architekten und Gartenkünstler
Le Nôtre benannte regelmäßige Gartenstil zur Zeit Ludwigs XIV., der
vorbildlich für ganz Europa wurde. Le Nôtre war 1613 als Sohn des
Palast- und Gartenintendanten der Tuilerien geboren und mag sich
schon früh mit Gartenangelegenheiten beschäftigt haben. Doch wurde
er zunächst Maler und ging als solcher nach Italien, wo er besonders
in Rom die dortigen Gärten kennen lernte. Die Eindrücke, die er hier
vom Zusammenwirken von Haus und Garten als einheitlichem Kunstwerk
und von der Wirkung und verschiedenen Verwendung des Wassers erhielt,
sind zweifellos bestimmend für sein späteres Schaffen gewesen. Als
Ludwig XIV. an Stelle des von Heinrich IV. angelegten und von Ludwig
XIII. erweiterten Jagdschlosses im Walde von Versailles mit einem
Aufwand von insgesamt mehr als einer Milliarde alter Franken eine üppig
ausgestaltete neue Residenz baute,[S. 410] berief er Le Nôtre zur Anlage
des gewaltigen, das Schloß umgebenden Gartens und fand in ihm den
geeigneten Mann zur Verwirklichung seiner großartigen Pläne. Bis an das
Ende seines langen Lebens — er starb 87jährig im Jahre 1700 — blieb
er im Dienste des Königs, der ihm stets seine volle Gunst zuwandte, und
schuf die Gärten der übrigen Königsschlösser der französischen Krone
um. Er hat das große Verdienst, aus dem bis dahin nur regelmäßigen
französischen Garten einen architektonischen geschaffen zu haben.
Nicht, daß er dazu etwas Neues hätte erfinden müssen, er wandelte
vielmehr nur um, was schon vorhanden war, unter dem Eindrucke dessen,
was er in Italien gesehen hatte. Er verband Haus und Garten zu einem
künstlerischen Ganzen und tat das in einer Weise, die dem nach
theatralischen Effekten verlangenden Geiste seiner Zeit durchaus
angemessen war.
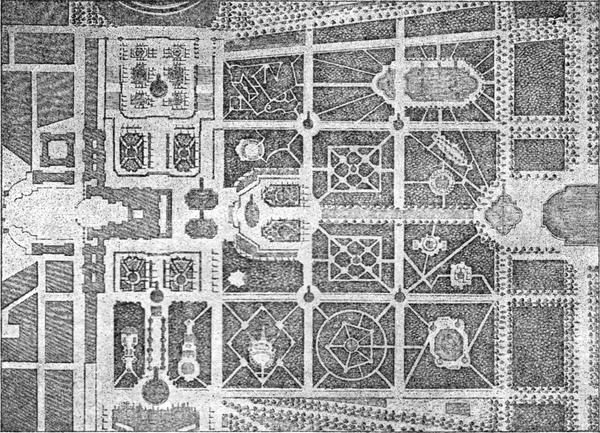
Bild 74. „Wahrer Grundriß des weltberühmten
kgl. Lustgartens zu Versailles.“
(Nach einem Stich von M. Diesel.)
Vor ihm hatte sich die Gartenkunst Europas nördlich der Alpen unberührt
von derjenigen der Renaissance entwickelt. Hier war man noch viel
ärmer als dort und fühlte sich außerhalb der ummauerten[S. 411] Städte und
Burgen nicht sicher genug, um den vorhandenen kleinen Ziergarten hinaus
in die Landschaft zu verlegen. Und als auch die wirtschaftlichen
und politischen Zustände sich hier so weit gebessert hatten, daß
man an ein Landhausleben wie in Italien denken konnte, so blieb die
Gartenanlage wie sie im Mittelalter gewesen war, eine „geschachzabelte
und gevierte“, d. h. eine schachbrettartig regelmäßig aufgeteilte,
ebene Anlage. So sehen wir diese Gärten, von denen kaum etwas erhalten
ist, noch in den Kupferstichwerken des 17. Jahrhunderts als eintönige,
regelmäßige Anlagen, deren meist gleich große quadratische Felder mit
geschnittenen Hecken umgeben waren. Die Wege waren oft mit Laubengängen
aus Gitterwerk überdacht, die zu zierlichen Pavillons führten. Auch
Springbrunnen und Skulpturen fehlten nicht, ebenso waren mit Vorliebe
verwickelte Gänge in Form von zu senkrechten Wänden geschnittenen
Buchs- und Eibenhecken als Labyrinthe vorhanden, die den Besucher nach
langer Irrfahrt endlich zu einem Platze im Mittelpunkt der Anlage
führte; doch war bei ihnen von einer einheitlichen Kunstwirkung,
zusammen mit dem Hause, keine Rede, wie sie im italienischen Garten
so eindrucksvoll durchgeführt war, ganz abgesehen davon, daß diese
kleinen Anlagen sich in der Ebene befanden und schon deshalb für einen
architektonischen Aufbau, wie im italienischen Garten, keine Keime in
sich trugen.
Schon zu Ende des 16. Jahrhunderts begann unter italienischem Einflusse
ein neuer großzügiger Geist in die Gartenanlagen der französischen
Königsschlösser zu kommen. Man brachte wie in Italien die Linien des
Hauptgebäudes, des Schlosses, mit dem Garten in Verbindung und schuf
damit einen weiten Durchblick, eine Perspektive; auch legte man um das
Schloß einen freien Platz, um dadurch das Gebäude als den Mittelpunkt
der ganzen Anlage hervorzuheben. Durch diese Neuerungen, die Claude
Mollet, der Gärtner Ludwigs XIII., an den königlichen Gärten von
Fontainebleau in Verbindung mit der Anlage großer Wasserbecken mit
Springbrunnen zuerst in Frankreich einführte, erhielt der Garten
einen Zug ins Großartige und begann sich damit dem Glanze der
französischen Kultur anzupassen, die im 17. Jahrhundert diejenige
der Nachbarländer, namentlich Deutschlands, das währenddem unter
den Schrecknissen des Dreißigjährigen Krieges zu leiden hatte, weit
überragte. Ihren Höhepunkt erreichte diese Zeit unter der Regierung
des Sonnenkönigs, Ludwigs XIV., und die Gärten, die in der zweiten
Hälfte des 17. Jahrhunderts für ihn und die Ersten des Landes angelegt
wurden, spiegeln deutlich die Eigentümlichkeiten des franzö[S. 412]sischen
Hoflebens dieser Periode wieder mit der Gemessenheit und Steifheit
seines Zeremoniells und seiner theatralischen Grandezza, die ihren
bezeichnenden Ausdruck in den schwülstigen Allongeperücken und den die
Gestalt erhöhenden Stöckelschuhen fand.
Aus dem Geiste dieser vornehm tuenden Zeit heraus bildete André Le
Nôtre den regelmäßigen französischen Garten zum architektonischen um.
Das Haus, das Schloß, war der Brennpunkt seines Gartens und sollte
möglichst von allen Hauptpunkten der ausgedehnten Anlage sichtbar
sein; andererseits sollte vom Schloß aus der ganze Garten überblickt
werden können. Um dies leichter zu ermöglichen, wurde es auch in der
Ebene auf eine erhöhte Terrasse von gewaltigen Dimensionen gebaut,
wodurch es frei aus dem Garten herausgehoben wurde. Dasselbe Ziel
verfolgte die Hervorhebung der Mittelperspektive auf das Schloß
und vom Schlosse aus. Die von der Mitte des Schlosses ausgehende
Hauptallee durchschnitt den Garten seiner ganzen Länge nach und war mit
hohen geschnittenen Baumwänden eingefaßt. Längliche Wasserbecken in
derselben Richtung unterbrachen sie. In dieser Perspektive schweifte
nun der Blick über eine Fülle von Wasserbecken mit Springbrunnen
in die Ferne, und umgekehrt bot sich vom Ende des Gartens, ja von
weither gesehen, das Schloß auf seiner Terrasse eindrucksvoll dar.
Außer dieser Mittelperspektive wurden überall, kreuz und quer durch
den Garten, andere Durchblicke angelegt und damit das eintönige
Schema der schachbrettartigen Aufteilung der Fläche durchbrochen. Um
möglichst Abwechslung zu bringen, wurde jede dieser Nebenperspektiven,
deren meist mehrere strahlenförmig von einem Punkte ausgingen, mit
einem point de vue, einer Fontäne, einer Statue, einem kleinen
Gartenhäuschen oder etwas Ähnlichem ausgestattet. Die abgelegenen
Gartenpartien wurden von hohen Heckenwänden, meist geschnittenen
Hainbuchen, umgeben und ihr Inneres mit Baumwuchs erfüllt, was
den Eindruck hervorrief, als seien alle den Garten durchquerenden
Perspektiven mit hohen grünen Kulissen umstellt. Zwischen diesen
stilisierten Anlagen waren, damit neben der strengen Form auch die
spielende Phantasie ihr Recht bewahre, allerlei Labyrinthe und
Irrgänge, Grotten, Naturtheater und verschieden ausgestattete Plätze
mit Lusthäusern aus Gitterwänden oder Springbrunnen und plastischen
Gruppen jeder Art zerstreut. Der ganze Garten war nach italienischem
Muster mit Statuen der antiken Götter- und Halbgötterwelt belebt, die
frei oder in nischenartigen Vertiefungen der Heckenwände aufgestellt
waren und mit ihrem Weiß das eintönige Grün des[S. 413] Hintergrundes
unterbrachen. Noch mehr als im italienischen Garten war das Wasser
zur Mitwirkung herangezogen. War es dort das lebendige, in Kaskaden
herabrauschende und in Fontänen aufsprudelnde Wasser gewesen, so waren
es hier ausgedehnte Wasserbecken, die an sich schon durch die Masse
wirkten, gleichfalls belebt von Springbrunnen, welche aus plastischen
Gruppen hervorschossen, und hintereinanderstehenden Wasserstürzen.
Als ein Hauptstück des Gartens breitete sich unmittelbar vor dem
Schlosse das Blumenparterre in Gestalt von Blumenteppichen aus,
wie es schon der ältere französische Garten, gleich demjenigen der
italienischen Renaissance, besaß. Um ihre Zeichnung gehörig zur Geltung
zu bringen, beschränkte man sich ebenso wie in Italien nicht auf
Blumen, die nicht ausreichten, als die Muster feiner und zierlicher
wurden, sondern man verwendete dazu Rasen und geschnittenen Buchs und
füllte die Zwischenräume zwischen den einzelnen Figuren mit gefärbtem
Sand, mit Ziegelmehl oder Kohlenstaub. In der Mitte der Blumenbeete
waren die hohen Ziergewächse, wie Sonnenblumen und Malven, gruppiert
und wurden von immer niedrigeren eingefaßt. Für den Frühling wurden
Tulpen, Hyazinthen und Narzissen in schachbrettförmiger Anordnung auf
die Beete gepflanzt, um nach dem Verblühen durch anderen Blumenflor
abgelöst zu werden. Selten fehlte auch die Orangerie, die meist ein
besonderes Parterre an geschützter Stelle bildete, an welche sich die
zum Überwintern nötigen Kalthäuser anschlossen. Hier standen in Reihen
südliche Gewächse in Kübeln, wie Orangen, Zitronen, Myrten und Lorbeer.
Aber ihre Verwendung war durchaus nicht auf die Orangerie beschränkt,
sie begleiteten vielmehr auch die Linien des Parterres und umgaben
die Wasserbecken. In diesen großartigen Anlagen, die durchaus keine
bürgerlichen Hausgärten waren, sondern den Bedürfnissen von Königen
und Herren mit großer Hofhaltung entsprachen, dienten als Schauplätze
glänzender Feste, ihre Boskets und cabinets de verdure waren
der Ort für die arkadischen Schäferspiele der Hofgesellschaft. Ihre
Kosten waren derart, daß sie nur entstehen konnten, wo den Launen eines
absoluten Herrn unbeschränkte Mittel zur Verfügung standen, die durch
rücksichtslose Besteuerung der Untertanen beschafft wurden.
Nächst Versailles war einer der schönsten von Le Nôtre angelegten
Gärten derjenige von Marly, von dessen wundervollen Wasserwerken uns
alte Kupferstiche ein gutes Bild geben. Der Garten von Groß-Trianon
war kleiner und einfacher. Auch den Garten von St. Cloud[S. 414] baute Le
Nôtre um und legte an der ziemlich steilen Talwand der Seine die
berühmten Wasserwerke an. Der Garten von Chantilly kam an Ausdehnung
demjenigen von Versailles gleich; er hatte einen Kanal von 3 km
Länge, der 80 m breit war, während derjenige von Versailles
bei 1600 m Länge nur 60 m Breite besaß. Auch die Gärten
von St. Germain, Meudon und Fontainebleau baute er um und machte die
Pläne zu zahlreichen auswärtigen Gärten; denn wie das Zeremoniell und
die Sitten der Versailler Hofhaltung überall in Europa Nachahmung
fanden, so war auch der Versailler Garten das vielbewunderte Muster
für die übrigen Höfe, die es in allem dem „Sonnenkönige“ gleichtun
wollten. Gärten dieser Art schossen sozusagen wie Pilze aus dem Boden
hervor. Wir lernen sie wie die französischen am besten durch die
Kupferstiche kennen, in denen die berühmtesten Gärten der damaligen
Zeit abgebildet und beschrieben wurden. Da ist z. B. in England der
Garten von Hamptoncourt, in Rußland derjenige von Peterhof, in Schweden
derjenige von Drottningholm bei Stockholm. Die meisten Nachahmer fand
aber der französische Garten, wie andere französische Dinge auch,
in Deutschland, wo alle die zahllosen größeren und kleineren, bis
zu den kleinsten Höfen, die sich, so gut oder so schlecht es ging,
nach französischem Muster einzurichten suchten, eine Nachahmung des
Versailler Gartens zur Erhöhung ihres Glanzes für unbedingt notwendig
hielten. Von den vielen deutschen Anlagen dieser Art sind vor allem
die Gärten von Schönbrunn bei Wien, Nymphenburg und Schleißheim
bei München, Schwetzingen bei Heidelberg, Wilhelmshöhe bei Kassel,
dessen Kaskadenanlage allerdings eine Nachahmung derjenigen der Villa
Aldobrandini in Frascati bei Rom ist, dann in Hannover, Charlottenburg
usw. zu nennen. Auch die geistlichen Fürsten wollten nicht hinter den
weltlichen zurückbleiben; davon zeugen die Gärten der Fürstbischöfe von
Salzburg (Hellbrunn und Mirabellgarten), Olmütz zu Kremster, Würzburg
und Mainz. Einer der spätesten französischen Gärten war auch die jetzt
ganz veränderte Schöpfung Friedrichs des Großen in Sanssouci, die
bezeichnend für die Vorliebe des großen Königs für alles Französische
ist.
Le Nôtres Nachfolger suchten den Mangel großer Verhältnisse in ihren
Anlagen durch die Bereicherung der Einzelheiten zu ersetzen. Die als
Fortsetzung der Räume des Hauses gedachten, von glatt geschnittenen,
hohen Laubwänden umschlossenen Gartenräume des klassischen Le
Nôtreschen Stils erschienen ihnen langweilig, und so gaben sie den
langen Heckenwänden die bewegten Formen der Steinarchitektur, was sehr
unnatürlich aussah. Man versah sie mit Säulen, Pfeilern und[S. 415] Gesimsen,
man schnitt Tür- und Fensteröffnungen in sie hinein, bekrönte sie mit
Kugeln und Obelisken, alles aus dem lebendigen Grün geschnitten. Die
Laubengänge bildete man in Form von Kreuzgewölben oder gab ihnen aus
Laubwerk geschnittene Dächer. Damit nicht genug, ahmte man schließlich
ganze Gebäude, ja selbst Ruinen aus Heckenwerk nach. Mit dieser Unnatur
hielt die künstliche Behandlung der Buchs- und Eibenpflanzungen
Schritt, indem man von der Wiedergabe einfacher stereometrischer Körper
zu derjenigen von Tier- und Menschenfiguren, ja zu ganzen aus solchen
Figuren gebildeten bewegten Szenen überging. Je kleiner der Garten war,
um so mehr ging er in solchen Künsteleien auf und um so unnatürlicher
erschien er.
Die unausbleibliche Reaktion gegen diese Ausartung einer in ihren
Anfängen groß und ernst angelegten Kunstweise ging von England aus.
In diesem Lande, das durch seine Inselnatur vor den kriegerischen
Einfällen der Nachbarn geschützt war und sich schon seit dem 14.
Jahrhundert geordneter sozialer Zustände erfreute, hatte die
Kulturentwicklung keine Unterbrechung erfahren, und der zunehmende
Seehandel brachte dauernden Wohlstand und teilweise sogar bedeutenden
Reichtum weiter Kreise. Zu einer Zeit, da auf dem mitteleuropäischen
Festlande Adel und Bürger noch hinter ihren Mauern saßen, konnte der
englische Lord schon seine Burg, den keep, verlassen und sich
ein bequemes Haus inmitten seines Gutsbezirkes bauen. Namentlich in
dem glücklichen Zeitalter der Königin Elisabeth von 1558 bis 1603
füllte sich das Land, das seit der Eroberung durch die Normannen
im 11. Jahrhundert das Übergewicht über die Städte erlangt hatte,
mit prächtigen Landsitzen, deren Gärten sich allerdings im großen
und ganzen nicht allzusehr von den gleichzeitigen in Frankreich und
Deutschland unterschieden. Die Einteilung in rechteckige Felder,
die Laubengänge und Irrgärten, die Wasserbecken und Springbrunnen
waren wie diejenigen der mitteleuropäischen Gärten. Dagegen spielte
bei ihm die terrassenförmige Anlage eine größere Rolle, vielleicht
als eine Folge der hügeligen englischen Landschaft, vielleicht
aber auch auf italienische Einflüsse zurückzuführen. Ferner hatte
der englische Garten eine ausgeprägte Vorliebe für beschnittene
Buchs- und Eibenpflanzungen, die wohl durch die Kenntnis des hierin
gleichgearteten holländischen Gartens verstärkt wurde, zumal zur Zeit
der Königin Elisabeth eine starke holländische Einwanderung stattfand.
Dieser Einfluß wurde naturgemäß mit dem Erscheinen Wilhelms von Oranien
in England und während seiner Regierung verstärkt.
Der holländische Garten war recht eigentlich, vermöge der Natur[S. 416] des
Landes, ein Garten der Ebene mit schachbrettartiger Einteilung der
von geradegeschnittenen Hecken umgebenen Felder. Da nun die kleinen
Landsitze, die sie aufwiesen, sich meist an den die holländischen
Provinzen in großer Zahl durchschneidenden Kanälen hinzogen, waren
sie von dorther reich mit geradlinigen Wasseradern durchzogen, ohne
Kaskaden und hohe Fontänen aufzuweisen. Selbst für die wenigen und
spärlich fließenden Springbrunnen war man auf Maschinen angewiesen,
die durch Wind- oder Pferdekraft in Bewegung gesetzt werden mußten.
Schon durch die meist geringe Größe der Gärten begünstigt, waren alle
seine Teile in kleinem Maßstabe gehalten, wodurch etwas Kleinliches,
Langweiliges, jeden großen Zuges, wie er z. B. durch Terrassenanlagen
in die Gärten hätte hineingelegt werden können, Bares in sie
hineingelangte. Die peinliche Ordnung und Sauberkeit seiner Wohnung
übertrug der Holländer in seinen Garten, dessen Baum- und Strauchwerk
stets unter der Schere gehalten, ja mit Vorliebe zum Ausschneiden
künstlicher Figuren benutzt wurde. Manchmal wurden sogar die Baumstämme
weiß angestrichen, um sie schöner und sauberer erscheinen zu lassen.
Die häufige Verwendung von künstlich gezogenen Zwergobstbäumen in
Kübeln und Töpfen, wie die Aufstellung von Muscheln, Korallenstücken,
Porzellanfiguren und anderen solchen Dingen, die der lebhafte Handel
des aufblühenden Landes in Menge aus fremden Ländern herbeibrachte,
war ein Ausfluß derselben Neigung. Was aber den holländischen Garten
vor allem auszeichnete, das war sein reicher Blumenflor. Es war wohl
eben jener Hang zum Kleinen und Zierlichen, der sich in der Freude
des Holländers an der Schönheit und Farbenpracht der einzelnen Blume
äußerte, namentlich der Tulpen und Hyazinthen, die in immer neuen
Farbenvariationen und Formen zu ziehen der die Gartenkunst völlig
beherrschende Ehrgeiz der Holländer wurde.
Tafel 137.

Der Rundtempel Monopteros im Englischen Garten in München.
❏
GRÖSSERES BILD
Tafel 138.

Der chinesische Turm im Englischen Garten in München.
❏
GRÖSSERES BILD
Tafel 140.

Ein Tempelteich bei Tokio mit der blaublütigen heiligen Lotosblume aus
Indien (Nelumbium speciosum).
❏
GRÖSSERES BILD
Trotz seiner Absonderlichkeiten übte der holländische Garten im 16.
und 17. Jahrhundert einen nicht geringen Einfluß auf die Gartenkunst
der übrigen Länder Mitteleuropas, namentlich auch auf England und
Deutschland aus. Es mag das wohl mit daran gelegen haben, daß
holländische Gärtner einen guten Ruf genossen, den sie sich in der
Baum- und Blumenzucht ihrer Heimat erworben hatten. Wir merken diesen
Einfluß heute noch in manchen absonderlichen Zieraten kleiner Gärten,
an der Verwendung von Muscheln und ähnlichen Dingen zum Einfassen
von Beeten, an glänzenden Glaskugeln und beschnittenen Bäumen und
Sträuchern. Als dann der französische Garten Le Nôtres[S. 417] sich dem
holländischen und englischen Geschmack unterwarf, da begegnete diese
Vorliebe seinem beschnittenen Buschwerk, und bald wurden darin wahre
Orgien gefeiert, aus den Bäumen und Sträuchern die bizarrsten Formen zu
schneiden, nicht bloß Nachbildungen von Tier- und Menschengestalten,
sondern auch die mannigfaltigsten frei erfundenen phantastischen
Gebilde. Schon zu Beginn des 17. Jahrhunderts hatte der geniale
Reformator auf dem Gebiete der Wissenschaften und zugleich Staatsmann
Francis Bacon (1561–1626) — seit 1619 Lordkanzler und Baron von
Verulam in einer Schrift „Essay on the gardens“ sich gegen die
geschmacklosen, aus Buchs und Eibe geschnittenen Figuren ausgesprochen,
die nur für Kinder paßten, und hatte Grundsätze aufgestellt, nach denen
der Garten anzuordnen sei. Derselbe solle aus drei Teilen bestehen,
von denen die beiden ersten nicht wesentlich von dem damals Üblichen
abwichen, während der dritte Teil eine Wildnis sein sollte. Es war dies
also schon ein deutlicher Anklang an den späteren Landschaftsgarten.
In der Folge erhoben sich immer mehr Stimmen gegen den herrschenden
Gartengeschmack. Sie trafen zusammen mit den Vorboten jener sentimental
romantischen Epoche, die auf das verschnörkelte, im Zeremoniell
erstarrte Zeitalter Ludwigs XIV. folgte. In England leitete Milton mit
seinem „verlorenen Paradies“ (zuerst gedruckt 1667), in Frankreich
Rousseau mit seinem „Emile“ (1761), in Deutschland Albrecht von Haller,
Kleist und Geßner mit ihren Naturdichtungen diese Periode ein, alle
predigten die Rückkehr zur Natur. Von diesem Standpunkte aus ging man
dem herrschenden französischen Garten zu Leibe, in welchem man in
seinem damaligen englischen Zustande allerdings ein Muster von Unnatur
erblicken konnte. Der englische Dichter Pope (1688–1744) verspottete
seine Baum- und Wasserkünsteleien; er und der englische Philosoph
Addison (1672–1719) waren unter den Ersten, die in der Praxis völlig
mit dem herrschenden Gartengeschmack brachen. Letzterer legte seinen
eigenen Garten nach dem philosophisch von ihm begründeten Grundsatze:
„Nachahmung der Natur“ an. Nach seiner eigenen Beschreibung sollte
sein Garten den Eindruck einer von selbst entstandenen Wildnis machen.
Küchengewächse und Blumen standen durcheinander wie wildwachsend auf
den Gartenplätzen; Feld- und Gartengewächse, Obst- und andere Bäume
wuchsen gemischt und eine Quelle war als Bach in vielen Windungen und
Verzweigungen durch den Garten geleitet.
Bei dieser absonderlichen Art der Naturnachahmung kam nichts
Vernünftiges heraus. Den ersten Schritt zu einer neuen Gartenkunst[S. 418]
tat im zweiten Viertel des 18. Jahrhunderts William Kent, der als
Landschaftsmaler sein Auge für die besonderen Reize der englischen
Natur geschärft hatte. Diese Naturschönheiten im Garten darzustellen,
also ein künstlerisch schönes Landschaftsbild mit dem Wechsel grüner,
vom Wasser belebter Wiesenflächen mit Baumgruppen und Gehölzen zu
schaffen, war sein Ziel. Dadurch mußte jede gerade Linie aus dem Garten
verschwinden, und um ihn mit der Umgebung zu verbinden und in Einklang
zu bringen, fielen auch die umgrenzenden Mauern und wurden durch Gräben
ersetzt. So sollte unter allen Umständen die Täuschung aufrechterhalten
werden, daß man sich nicht in einem Gebilde von Menschenhand, sondern
in der freien Natur befinde. Diese an sich gesunde Richtung artete
nun bald zur widerlichen Manier aus, als der phantasielose und nicht
das geringste Verständnis für malerische Naturschönheit besitzende
Gärtner des Königs in Hamptoncourt, Brown, sie in seiner Art in die
Praxis umsetzte. Als gesuchter Landschaftsgärtner gestaltete er um die
Mitte des 18. Jahrhunderts mit seinen Schülern die alten Gartenanlagen
Englands der Reihe nach um, durch seine armselige, handwerksmäßige
Manier jene verwüstend und ihren reizvollen alten Baumwuchs zerstörend.
Spott und Ärger über dieses Treiben konnten nicht ausbleiben. Der
vielgereiste Architekt William Chambers klagte, wie die Axt oft an
einem Tage das Wachstum eines Jahrhunderts vernichte, wie tausende
ehrwürdiger Bäume, ja ganze Wälder weggeschlagen würden, um schlechtem
Grase und einigen amerikanischen Kräutern Platz zu machen. Er
beschreibt sehr anschaulich die neuen Anlagen: wenn man sie betreten
habe, erblicke man ein weites grünes Feld, worauf in geringen Abständen
Bäume wachsen, umgeben mit einer verworrenen Einfassung von Gesträuchen
und Bäumen. Ein in regelmäßiger S-Form geschlängelter Fußweg
winde sich zwischen Einfassungen von Gebüsch hindurch. Auf der andern
Seite des Gartens erblicke man genau dasselbe, was man vorher gesehen
habe. Nirgends biete sich Schatten, und wenn der Wanderer ermüdet
und aus Mangel an Erquickung sich entschließe, nichts mehr zu sehen,
so bleibe ihm doch nur die Wahl, den Weg weiter bis zum Ausgange zu
verfolgen oder umzukehren und den langweiligen Weg noch einmal zu
machen.
William Chambers war in China gewesen und seine in den Jahren 1757
und 1772 herausgegebenen zwei Bücher über chinesische Gebäude und
Gärten erregten nicht nur in England, sondern auch in Frankreich und
Deutschland, wo sie in Übersetzungen erschienen, unge[S. 419]heures Aufsehen.
Ohnehin fanden damals, unter der Herrschaft des Rokoko, Erzeugnisse
und Formen des chinesischen Kunstgewerbes in Europa weite Verbreitung.
Gegenüber der Eintönigkeit des damaligen Landschaftsgartens konnten
die Schilderungen, die Chambers in seinen Büchern vom chinesischen
Garten gab, ihren Eindruck nicht verfehlen. Dieser letztere war im
Gegensatz zum neuen englischen Garten sehr abwechslungsreich und
bildete eine Vereinigung aller möglichen landschaftlichen Szenerien,
wie zu Eingang geschildert wurde. Nach seinem Vorbilde errichtete
man Berge, türmte Felsen auf, über die das Wasser in rauschenden
Fällen herabstürzte, bildete Inseln, die man mit Brücken verband,
baute griechische Tempel, chinesische Pagoden, ägyptische Pyramiden,
türkische Moscheen mit Minarets. Um alles recht natürlich zu machen,
kostümierte man die Dienerschaft so, wie es der Stil der einzelnen
Gebäude verlangte. Da die führenden Geister der Zeit, wie Rousseau,
die Rückkehr zum einfachsten Leben, zum Urzustande der Menschheit
predigten, so errichtete man auch ländliche Gebäude und vor allem mit
Baumrinde bekleidete Einsiedeleien, die Eremitagen, die den rechten
Hintergrund für die Schäferspiele hergeben sollten, mit denen man in
seidenen Hirtengewändern und mit bebänderten Hirtenstäben dem Rufe nach
Natürlichkeit Folge zu leisten glaubte.
Das Ganze fand reichliche Nahrung an einem besonderen Zuge der Zeit, an
der Empfindsamkeit, an dem Verlangen nach Rührung, an der Sucht, große
Gefühle zu haben, wovon die ganze damalige Zeit erfüllt war. Man denke
nur an Werthers Leiden von Goethe. Auch der Garten sollte bestimmte
Empfindungen wecken, sollte nach dem Prinzip der Abwechslung mit seinen
einzelnen Teilen verschieden auf die menschliche Seele wirken. In
Deutschland wurde das alles mit bekannter Gründlichkeit in ein System
gebracht. Der Kieler Philosoph Hirschfeld gab in den Jahren 1777–1782
ein fünfbändiges Werk: Theorie der Gartenkunst heraus. Er dachte sich
den Garten als eine Anstalt, Bewegungen der Seele zu erregen wie
Vergnügen, Wonne, Schwermut, Erstaunen, Andacht, Ehrfurcht, Ruhe,
Frieden, und demgemäß unterschied er in ihm Teile, die solche seelische
Empfindungen auslösen sollten. Dem Anmutigen und Heitern sollte das
Erhabene oder Melancholische, dem Lieblichen und Sanften das Wilde oder
Romantische folgen. Eine Überraschung sollte die andere ablösen und
dadurch den Eindruck der Szenerien steigern. Dazu hatte man auch noch
andere Mittel, die zur Anwendung gelangten. Man erbaute Tempel, die der
Freundschaft, der Liebe, der Einsamkeit, der Tugend[S. 420] gewidmet waren.
Um menschliche Großtaten auf sich einwirken zu lassen, errichtete man
berühmten Männern, Helden, Dichtern, Gelehrten, Philosophen im Garten
Monumente. Die Schauer der Wehmut, denen man sich nur allzugern hingab,
weckte man an einsamen Stellen des Gartens durch Grabdenkmäler, durch
den Genius des Todes mit gesenkter Fackel, durch epheubewachsene
Sarkophage und von Trauerweiden beschattete Urnen. Da man gleichwohl
das Gefühl hatte, daß alles dies nicht ausreiche, um den gewünschten
Effekt zu erzielen, suchte man die nötige Stimmung durch Inschriften zu
erzeugen. Überall waren gereimte oder ungereimte Sprüche, meist Zitate
aus lateinischen und einheimischen Dichtungen, angebracht, in denen die
Natur mit bestimmten seelischen Erregungen in Einklang gebracht wurde.
Den Klassizismus löste die Periode der Romantik ab, und neue
Grundsätze wurden für den Bau der Gärten aufgestellt. Besonders
brachte der englische Gärtner Repton von 1794 an den Gartenbau auf
einen besseren Weg, indem er die Forderung aufstellte, daß der Boden,
auf dem der Garten angelegt werden soll, nach seiner natürlichen
Beschaffenheit zu benützen sei, womit er die künstlichen Berge, Seen
und dergleichen verwarf. Auch trennte er die nächste Umgebung des
Hauses, den pleasureground, von der weiteren Umgebung, dem
Park, und forderte für ersteren eine architektonische Ausbildung unter
Wiedereinführung der blumengeschmückten Terrasse. Mit Repton schließt
die Entwicklung des englischen Landschaftsgartens ab; er fand keine
größeren Nachfolger, und seine Grundsätze blieben während des ganzen
19. Jahrhunderts herrschend. Wer heute dieses Land bereist, wird in
manchen Gegenden, wo die Landwirtschaft fast völlig durch die großen
Landsitze zurückgedrängt ist, den Eindruck bekommen, als ob das ganze
Land ein großer Park sei, so dicht reihen sich die einzelnen Anlagen
aneinander. Immer ist es dasselbe Bild: Wiesen, Waldstücke, Baumgruppen
und Einzelbäume, dazwischen die sanftgewundenen Bäche und Flüsse. Diese
in verschönertem Bilde sich zeigende typische englische Landschaft
suchte man seit dem Beginne des 19. Jahrhunderts auf dem Kontinente
nachzuahmen, auch da, wo der Charakter der Gegend ein ganz anderer war,
also bei Befolgung der englischen Grundsätze ein durchaus anderes Bild
sich hätte ergeben müssen. Ein Landschaftsgarten in der Lüneburger
Heide z. B. würde einen ganz andern Charakter zeigen müssen, als ein
Landschaftsgarten im Harz. In diesen Fehler verfielen auch die ersten
Nachahmer des Reptonschen Gartens in Deutschland zu Beginn des 19.
Jahrhunderts, so von Sckell,[S. 421] dessen Hauptwerk der englische Garten in
München ist. Erst Fürst von Pückler (1785–1871) betrat in Deutschland
den richtigen Weg. Unter dem Eindruck der großen englischen Anlagen,
die er selbst studiert hatte, schuf er in den Jahren 1816–1845 den
Park der ihm gehörenden Standesherrschaft Muskau in Schlesien um und
gab 1834 eine Schrift über Landschaftsgärtnerei heraus, worin er seine
Anschauung begründete. Er unterscheidet vor allem scharf zwischen dem
Garten, der nach der Weise der älteren Gartenkunst eine Fortsetzung des
Hauses sein sollte, und dem Park in der weiteren Umgebung des Hauses,
der stets dem Charakter des Landes und des Klimas angepaßt sein müsse.
Nach diesen Grundsätzen schuf er aus Muskau eine mustergültige Anlage,
einen Park, der aus wirklichen, natürlichen Wäldern, Wiesen, Gewässern,
Hügeln und Tälern besteht. Unter seiner Mitwirkung entstanden in
der Folge eine große Anzahl fürstlicher Gärten, die heute zu unsern
schönsten Anlagen zählen, so z. B. diejenigen von Babelsberg und
Potsdam.
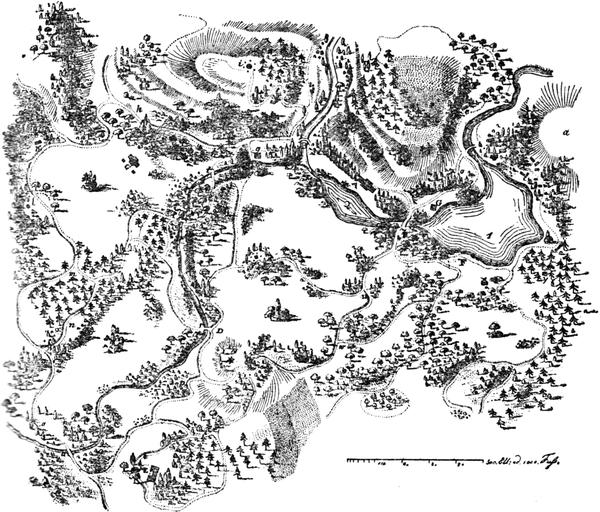
Bild 75. Plan einer englischen Gartenanlage.
(Nach einem Stich von 1802.)
[S. 422]
Fast gleichzeitig mit ihm war als ausübender Gartenkünstler der
spätere Generaldirektor der königlich preußischen Gärten Peter Joseph
Lenné tätig. In den Jahren von 1816–1866 schuf er ganz in dem vom
Fürsten Pückler geforderten Sinne um Potsdam herum die Schloßgärten
von Babelsberg, Klein-Glienicke und Sanssouci. Inmitten dieser reich
verschönerten Landschaft aber legte er 1825 im Vereine mit dem großen
Architekten Schinkel den Garten der lieblichen Villa Charlottenhof an,
die dem damaligen Kronprinzen, dem nachmaligen Könige Friedrich Wilhelm
IV., gehörte. Schinkel hatte das Haus nach Art einer altrömischen Villa
entworfen, und dem mußte sich der Garten anpassen. So entstand denn
hier ein überaus reizvoller Garten mit Terrassen, regelmäßig geordneten
Blumenbeeten, Laubengängen, Fontänen und Teichen. Nach der Beschreibung
des jüngeren Plinius, die wir zu Eingang gaben, wurde sogar ein
römischer Hippodrom angelegt. Die schon bei Lenné hervortretende
Neigung zum regelmäßigen architektonischen Garten entwickelten seine
Nachfolger weiter, wie z. B. der regelmäßige Königsplatz am Tiergarten
in Berlin beweist. Sie erwachte aber auch an andern Orten Deutschlands,
so in München, wo im Jahre 1862 von Effner das ausgedehnte Parterre im
französischen Garten des Schleißheimer Schlosses im Auftrage Ludwigs I.
wieder herstellte. Im Garten des Schlosses Linderhof in den bayrischen
Voralpen schuf dann Ludwig II. eine Anlage ganz italienischen
Charakters mit Terrassen, die sich vom Schlosse zu einem großen, in
Marmor gefaßten Wasserbecken senken, dessen Wasser in Kaskaden und
Fontänen, begleitet von Marmortreppen, hinter dem Schlosse von der
Berglehne herabströmt.
Zu einem Abschluß und zur theoretischen Begründung des neuen
Gartenbaustils, dem heute mehr oder weniger alle Gartenkünstler folgen,
brachte es erst der frühere königliche Hofgärtner in Sanssouci und
spätere städtische Gartenbaudirektor von Berlin, Gustav Meyer, dessen
berühmteste Schöpfungen der Marlygarten bei der Friedrichskirche in
Potsdam, der Friedrichs- und der Humboldtshain bei Berlin, der Bremer
Stadtpark usw. sind. Wie der Hausgarten zum Privatpark, so verhält sich
zum Stadtpark der öffentliche gartenmäßig geschmückte Platz im Innern
der Stadt. Auch er, der ganz von Häusern umgeben ist, hat sich nach
der neueren künstlerischen Anschauung den Gesetzen der Architektur
zu unterwerfen; doch kommen hier vor allem die Verkehrsrücksichten
in Betracht, denen sich die Anlage anzupassen hat. Ihn schmücken vor
allem Teppichbeete und Gruppen von Zierpflanzen, deren die moderne
Gartenkunst eine Menge besitzt.
[S. 423]
Dadurch, daß man erkannt hat, welch große Bedeutung sowohl in
ethischer, als sanitarischer Beziehung der Gartenkunst zukommt,
hat man vor allem die durch die Beseitigung der Bollwerke um die
Städte zur Bepflanzung freigewordenen Plätze zur Herstellung von
Gartenanlagen benutzt, die den Erholung suchenden Städtern einen
angenehmen Aufenthalt darbieten. In den neueren Stadtteilen sucht man
von vornherein schattige Alleen und durch die Gärtnerkunst geschmückte
Anlagen zu schaffen, die mit ihrem frischen Grün und den bunten Farben
der in ihnen gepflanzten Blumen dem Auge eine wohltuende Abwechslung im
Einerlei der Häusermassen verschaffen. Und wie im öffentlichen Leben,
so ist auch in die Häuslichkeit der minder Bemittelten die Freude an
Pflanzengrün und Blütenschmuck immer mehr eingedrungen, besonders
seitdem der Jugend in der Schule die Liebe und das Verständnis zur
Pflanze zugleich mit einer Anleitung zu deren Pflege und Aufzucht
vermittelt wird. Um aber auch einen Wettstreit unter den Erwachsenen
hervorzurufen, durchwandern in vielen Städten die Mitglieder gewisser
Kommissionen die Straßen, um den am schönsten geschmückten Balkonen und
Fenstern Preise und Belobungen zu erteilen.
In den Großstädten sucht man immer mehr auf die Dächer der Häuser
ein Stückchen Natur zu bringen, indem man Blumen auf ihnen ansiedelt
und ganze Gärten darauf schafft. Schon in den großen Städten des
Altertums haben sich die ärmeren Leute, denen kein Stückchen Land zum
Bepflanzen zuteil geworden war, mit solchen Dachgärten beholfen, wie
uns die alten Schriftsteller berichten. Besonders liebte man Reblauben,
pergulae genannt, anzulegen, welche die Terrasse oder den Garten
an der Wohnung anmutig beschatteten. Selbst größere Bäume wurden in
großen Tonkübeln in solcher Menge gezogen, daß bei manchen Autoren von
förmlichen Lusthainen auf den Dächern der großen Städte des Altertums
die Rede ist. Durch Pumpen hinaufgeleitetes Wasser sprang aus dem
marmornen Becken eines Springbrunnens, floß dann vielfach in geräumige
Fischbehälter und diente, rund um das Haus geleitet, zur Sicherung
desselben bei Feuersgefahr. Und wer zu arm für solchen Aufwand war, dem
mußten wie bei uns einige in den Fenstern seiner Wohnung in irdenen
Töpfen gezogene Blütenpflanzen genügen. Der sarkastische, unter Nero
aus Bilbilis in Spanien nach Rom gekommene und ums Jahr 102 verstorbene
römische Epigrammdichter Martialis ließ in einem uns erhaltenen
Gedichte einen seiner Gönner wissen: „Der Garten, lieber Lupus, den
du mir unter der Stadt geschenkt hast, ist sehr klein, fast kleiner[S. 424]
als das Gärtchen in meinem Fenster.“ Und daß dieser Schmeichler und
Günstling verschiedener Kaiser lange Zeit kärglich genug lebte, bezeugt
eine Stelle aus einem anderen seiner Poeme, worin er sagt: „Mein
Stübchen, guter Freund, ist im Winter eisig kalt und hat nicht einmal
einen ganzen Fensterladen; selbst Boreas (der Nordwind) würde sich für
eine solche Wohnung bedanken. Besser als ich sind deine Obstkulturen
daran; diese stehen hinter Scheiben von Marienglas (Glimmer), und
freundlich scheint von Süden die Sonne hinein.“
Wie einst die prachtliebenden Tyrannen der reichen griechischen
Handelsstadt Siziliens Syrakus, wollten auch die prunksüchtigen
Kaiser des weltbeherrschenden alten Rom Gärten sogar auf ihren großen
Lustschiffen haben. So ließ schon der spätere Bundesgenosse der Römer,
Hieron II., der von 269–215 v. Chr. über Syrakus herrschte, auf
seinem Prachtschiff einen ganzen schwimmenden Garten mit Lusthäusern,
Pergolen, Blumenrabatten, Schwimmbassins und Ringplatz anlegen. Diesen
Luxus suchten die römischen Kaiser noch zu übertrumpfen. So berichtet
uns der Geheimschreiber des Kaisers Hadrian, Suetonius (70–145
n. Chr.), von dem nach den Soldatenstiefelchen, die er als Kind im Lager
trug, Caligula genannten dritten römischen Kaiser, Gajus Cäsar, Sohn
des Germanikus und der Agrippina, der von 37–41 n. Chr. herrschte,
daß er sich Schiffe mit zehn Reihen von Ruderbänken übereinander
bauen ließ. Dieselben waren auf das Köstlichste eingerichtet und mit
Kunstgegenständen aus Gold und Edelsteinen reich geschmückt. Die
Segel waren buntfarbig, und große Bäder aus Marmor, Säulenhallen und
prunkvolle Speisesäle waren vorhanden. Weinstöcke und Obstbäume aller
Art standen in Menge auf dem Verdeck. Unter diesen lagerte sich der
Kaiser mit seinem Gefolge und fuhr unter schallender Musik den Küsten
Kampaniens entlang. Bekanntlich sind neuerdings prächtige Überreste
zweier solcher luxuriös eingerichteter altrömischer Kaiserschiffe
von 76 beziehungsweise 64 m Länge, die den prunkvollen Festen
dieses Kaisers und vielleicht auch schon seines Vorgängers Tiberius als
Hintergrund dienten, aus dem Nemisee nördlich von Rom gefischt worden.
Schon sie geben uns einen Begriff von der kostbaren Einrichtung dieser
Riesenschiffe, zu deren Hebung man eine zeitweilige Trockenlegung des
Sees plant, da man zahlreiche wertvolle Kunstgegenstände in ihnen zu
finden hofft.
Schon auf niederer Kulturstufe muß sich der Mensch an den bunten
Farben und am Wohlgeruche der Blumen mancherlei Art erfreut haben,
die ihm je und je auf seinen Wanderungen entgegentraten. Wenn sie
ihm auch nicht Nutzen gewähren konnten, es sei denn als Arznei, so
befriedigten sie wenigstens sein erwachendes ästhetisches Empfinden.
Deshalb pflückte er sie gelegentlich, um sich damit zu schmücken. So
bekränzen sich die leichtlebigen Bewohner der Samoainseln nicht bloß zu
festlichen Anlässen, sondern tagtäglich Haupt und Brust mit Girlanden
wohlriechender Blumen, was einen sehr hübschen Anblick gewährt.
Begreiflicherweise mußten solche Stämme sehr bald darauf verfallen,
solche Blütenpflanzen in der Nähe ihrer Wohnungen zu ziehen, damit sie
jederzeit den begehrten Schmuck zur Verfügung hatten.
Von den ältesten Blumengärten der Menschheit wissen wir nichts; denn,
ganz abgesehen davon, daß damals die Schrift noch nicht erfunden war,
hätte es niemand der Mühe wert erachtet, uns davon Kunde zu geben.
Das erste Volk, von dem wir Kunde haben, daß es sich gewisser Blumen
erfreute und diese teilweise auch anpflanzte, um sie in genügender
Menge zur Hand zu haben, war das uralte Kulturvolk der Ägypter, das der
weißen und blauen Seerose des Nils (Nymphaea lotus
und coerulea) ein besonderes Interesse, ja als Kinder des
lebenspendenden, heiligen Stromes geradezu Verehrung entgegenbrachte.
Nil und weiße Seerose — von den alten Ägyptern suschin, von den
Griechen jedoch lōtós geheißen — gehörten nach seinem Empfinden
zusammen wie Mutter und Kind, eines ohne das andere undenkbar. Wenn
der heilige Strom nach den starken Regen in seinem äquatorialen
Quellgebiet anzuschwellen begann, erwachte der im Schlamme desselben
wurzelnde Lotos zu neuem Leben; wenn der[S. 426] Strom das Land weithin mit
seinem Fruchtbarkeit spendenden Naß überschwemmte, stand die Pflanze
in voller Blüte, und wenn er langsam zu sinken begann, so reiften ihre
Früchte heran, deren Samen der Bevölkerung eine willkommene Speise
darboten und als Nahrungsmittel eine wichtige Rolle spielten. So
berichtet uns der Vater der griechischen Geschichtschreibung, Herodot
aus Halikarnaß an der kleinasiatischen Küste (484–424 v. Chr.), der
Ägypten selbst bereiste, von der weißen Seerose: „Im Nil wachsen,
wenn er die Felder überschwemmt, viele Lilien (krínon), welche
die Ägypter lōtós heißen. Deren mohnkapselartigen Früchte
sammeln die Leute, dörren sie an der Sonne, zermahlen dann deren
Samen und backen mit Hilfe des Feuers Brot daraus. Auch die Wurzel
ist eßbar und schmeckt nicht übel; sie ist rundlich und von der
Größe einer Quitte. Außer diesem Lotos haben die Ägypter noch andere
im Wasser wachsende Lilien, deren Frucht einer Wespenwabe gleicht,
worin Samen, so groß wie Olivenkerne, in Menge sitzen; man ißt sie
frisch und gedörrt.“ Mit diesen letzteren meint Herodot die erst
kurz vor seiner Zeit in Ägypten eingeführte rosenrote indische
Seerose (Nelumbium speciosum), deren Blüten wenigstens ein
Drittel größer als diejenigen unserer weißen Seerose sind und einen
angenehmen Anisduft aushauchen. Sie ist in Indien heimisch, wo sie
als padma in Sage und Kult der Inder dieselbe Rolle, wie der
heilige Lotos bei den Ägyptern spielt. Auf ihr, die der zweite Gott der
indischen Göttertrias (Trimurti), Wischnu, als er auf der Milchstraße
das Universum durchschwamm, um die Welt zu erschaffen, als Symbol
der entstehenden Erde aus seinem Nabel hervorgehen ließ, ist dessen
Gemahlin Lakschmi, die Göttin der Liebe, die Tochter des Weltmeers
und der Nacht, schwimmend gedacht. In der eben erschlossenen Blüte
sitzt sie in ihrem unvergleichlichen Liebreiz, wie später der zum Gott
erhobene Königssohn Siddharta aus dem Geschlecht der Sakja — daher
auch Sakjamuni, d. h. Einsiedler der Sakja genannt, besser aber unter
dem Ehrennamen Buddha „der Erleuchtete“ bekannt (623–543 v. Chr.) — in
ihr sinnend als der Weisheit Fülle von seinen zahlreichen Anhängern,
den Buddhisten, dargestellt wurde. Deshalb rufen ihn seine Anhänger
tagtäglich unter der stehenden Formel: om mani padme hum, d. h.
„du Juwel in der Lotosblume“ an, ein Gebet, das in zahllosen Tempeln,
wie auf den Gebetsmühlen der Tibeter geschrieben steht und in dem sich
die Religion der gedankenlosen Menge niedergeschlagen hat. Auf einem
schwimmenden Blatte der padma ist auch Brahma, der erste Gott
der indischen[S. 427] Götterdreiheit, der Ursprung aller Wesen, zu dem sie
auch zurückkehren, in der für die Inder charakteristischen Weise mit
gekreuzten Beinen sitzend gedacht. Diese heilige Pflanze ist dem Inder
das Symbol des sich stets erneuernden Lebens, das sichtbare Zeichen der
ungeschwächten Schöpfungskraft der Götter, der Inbegriff alles Schönen
und Lieblichen; mit ihren Blättern und Blüten schmückt er heute noch
wie vor Jahrtausenden die Tempel und Altäre seiner Gottheiten.
Dieser heilige indische Lotos, deren der Brause einer Gießkanne
ähnliche Früchte in ihren nach oben zu offenen Fächern vom Volke grün
oder getrocknet gerne verspeiste Samen von der Größe von Olivenkernen
enthalten, gelangte in der ersten Hälfte des letzten vorchristlichen
Jahrhunderts aus dem Gebiet des Ganges und Indus nach Persien und
eroberte sich erst ums Jahr 500 v. Chr. das Heimatrecht in den
Gewässern Ägyptens. Hier wurde er in der hellenistisch-römischen Zeit
als Zier- und Nutzpflanze im ganzen Lande viel angebaut, war aber
schon im 10. Jahrhundert n. Chr. wieder aus dem Lande verschwunden. Er
war also dem alten Ägypten fremd, und die weiße einheimische Seerose
(Nymphaea lotos), die heute noch mit der himmelblauen Verwandten
in den Wässern des Niltals wächst und zur Zeit der Nilüberschwemmung
ihre hübschen Blüten entfaltet, nach deren Zahl der Fellache den
kommenden Jahressegen abschätzt, war die heilige Pflanze der Ägypter,
das Symbol des Nils selbst und zugleich das hieroglyphische Wortbild
für das ganze Land Kemi, d. h. Ägypten. Ihre Blüte galt als Sinnbild
der Lebensfülle und des Überflusses, war das Zeichen der Zahl 1000,
mit welcher der Ägypter den Begriff der Menge und des Segens verband.
Sie war den Gottheiten Osiris, Isis, deren Sohn Horus, wie auch
Hathor, der von den Griechen mit ihrer Aphrodite identifizierten
Göttin der Liebe und des Lebensgenusses, heilig und wurde von diesen
als Diadem getragen. Osiris, der ägyptische Gott der schaffenden
Kraft des Lichts und der gleicherweise Leben spendenden Feuchtigkeit,
das allverehrte Prinzip des Guten und Schönen, der von seinem Bruder
Seth, dem Dämon des Dürre und Mißwachs erzeugenden Glutwindes der
Wüste, getötet wurde, um dann in der Unterwelt über die Geister der
Verstorbenen zu herrschen, war auf einem Lotosblatt thronend gedacht.
Er wie seine Gemahlin Isis, das weibliche, empfangende und gebärende
Prinzip, waren mit Lotosblumen geschmückt. Letztere wird mit Vorliebe,
den Nilschlüssel, das Zeichen der erschlossenen Fruchtbarkeit, in
der Rechten, in einem Papyrusnachen über die prangenden Blütenkelche
der heiligen Pflanze[S. 428] gleitend dargestellt, während ihr Sohn Horus
(ägyptisch Har), der die dem Leben feindliche Dunkelheit und Dürre
überwindende Lichtgott, der Rächer seines Vaters Osiris an dessen
Mörder Seth, sich beim Schwinden der Nacht in einer halbgeöffneten
Lotosblüte als das Symbol der neu aufwachenden Sonne aus den Fluten
des Weltmeers erhebt. Wie er, seine Eltern und seine Amme Hathor,
die Göttin des Ehesegens und Freundin der Kinderwelt, waren auch die
ägyptischen Königinnen mit den Blüten der heiligen Lotospflanze als
ihrer schönsten Zier geschmückt.
Keine andere Pflanze, selbst nicht der in seiner Wurzelknolle ebenfalls
eine angenehme Speise darbietende Papyrus, auch ein Geschenk des Nils
und in der Hieroglyphik das Zeichen des Nordens, wo er in den Sümpfen
des Deltas in Menge wuchs, spielte im täglichen Leben des Ägypters als
Zier- und Opferblume eine so wichtige Rolle und hat seine ganze Kunst,
die Architektur, Skulptur und Malerei so weitgehend beeinflußt, wie
der heilige Lotos. Auf allen Darstellungen aus dem Leben der alten
Ägypter begegnen wir ihm, wo auch immer sich jemand auf oder am Wasser
beschäftigt, wo Opfertische gedeckt sind, wo Gesellschaften gegeben
werden. Wenn reichgeschmückte vornehme Damen beisammensitzen und
Sängern oder Lautenspielern zuhören oder Tänzerinnen zusehen, stehen
Blumenvasen mit Lotosblüten auf den Tischen und halten sie Lotosblüten
in den Händen. Von flüchtigen Skizzen bis aufs Feinste ausgeführte
Darstellungen wechseln die Lotosbilder durch die mehrtausendjährige
Geschichte Altägyptens. Und zwar war bis zum alten Reich ums Jahr
3000 v. Chr. speziell die weiße Lotosblume die heilige, die auch zur
Verzierung der Tempel bei Festen, wie auch zum Schmücken der Sarkophage
in Girlanden benutzt wurde. Von da an gewann der blaue Lotos — von
den Ägyptern sarpat genannt — die Überhand über den weißen und
war im mittleren und neuen Reiche die fast ausschließlich benutzte,
bis erst wieder zur Ptolemäer- und Kaiserzeit (333 vor bis 362
n. Chr.) die weiße Lotosblume einigermaßen zu Ehren kam. Wie bei uns seit
alter Zeit die Rose, so war die Blüte des Lotos im alten Ägypten die
Königin der Blumen, die man überall antraf, die auf allen Märkten zu
kaufen war und an deren Farbe und zimtartigem Duft man sich in frohen
Tagen erfreute. Sie war auch das bevorzugte Geschenk der Liebenden und
wurde als Amulett aus Holz oder gebranntem Ton auf der Brust getragen.
Wie eintretenden Gästen als Zeichen des Willkomms eine einzelne Blüte
oder ein Strauß derselben von Dienern oder Dienerinnen[S. 429] überreicht
wurde, so prangte sie im schwarzen Haar der sorgfältig frisierten Dame.
Im neuen Reiche (1580–1205 v. Chr.) war es in feinen Kreisen Sitte,
zu Gastmählern Geladenen einen Kranz aus Lotosblüten um den Hals zu
hängen und ihr Haupt mit Blumengewinden zu zieren, aus denen eine
halberschlossene Lotosblüte über die Stirne herabhing.
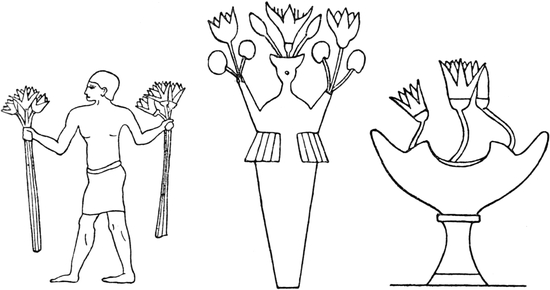
Bild 76–78. Altägyptische Darstellungen von Lotosblumen.
Links ein Diener mit abgeschnittenen Blütenstengeln, in der Mitte und
rechts Vasen mit Lotosblüten. (Nach Lepsius und Woenig.)
Bei keinem Opfer fehlte die heilige Pflanze, das Attribut der höchsten
Gottheiten. Weizenähren oder Lotosblüten in den Händen sehen wir die
mächtigen Herrscher sich den Götterbildern opfernd nahen und die
Götter sich gegenseitig beschenken. Und einst selbst eine „reine, in
den Strahlen der Sonne leuchtende, heilige Lotosblume im Garten des
Sonnengottes Ra“ zu werden, war, wie in den Totengebeten steht, der
sehnlichste Wunsch eines jeden Ägypters. Mehrere der in der Totenstadt
westlich von Theben aufgefundenen Königsmumien fanden sich noch mit
Kranzresten geschmückt, in denen sie vorherrscht. So war die noch im
Tode Ehrfurcht gebietende Mumie des großen Ramses II. der 19. Dynastie
(1292–1225 v. Chr.) mit Gewinden aus Blättern des von alters her der
Isis geheiligten Baumes Mimusops schimperi, des „Lebensbaumes“
mit in Form und Farbe den Hagebutten nicht unähnlichen Früchten
mit dünnem Überzug von mehligem, wohlschmeckendem Fruchtfleisch,
abwechselnd mit den blauen Blumenblättern des Lotos verflochten. Und
zwar wurden diese Blumengewinde dem beigegebenen Totenbuche zufolge
bei einer zur Zeit der 21. oder 22. Dynastie (1090[S. 430] bis 745 v. Chr.)
vorgenommenen prunkvollen neuen Bestattung um die Mumie des großen
Toten geschlungen.
Von anderen altägyptischen Gartenblumen sind uns nur spärliche
Reste erhalten geblieben. So fanden sich in einem die Brust der
Mumie des Königs Amenhotep II. aus der 18. Dynastie (1580–1547
v. Chr.) bedeckenden Blumengewinde Reste des arabischen Jasmins,
der feigenblätterigen Malve und einer blauen Ritterspornart, die
in Westasien heimisch sind und im Niltal in Gärten gezogen worden
sein müssen. Zwischen ihnen hingen gelbe Blütentrauben der im Lande
selbst wachsenden Nilakazie und eines andern Schmetterlingsblütlers
(Sesbania aegyptiaca) mit rotgelben Blüten. In den
Weidenlaubgewinden der Prinzessin Nsi-Chonsu, der Tochter des
Tont-hont-huti der 22. Dynastie (945–745 v. Chr.) fanden sich neben
Blüten der asiatischen Kornblume diejenigen einer in Ägypten nur im
April blühenden Komposite, eines Bitterkrautes, die uns sogar von
der Jahreszeit der Schmückung dieser Leiche genaue Kunde geben. In
einem Grabe der 20. Dynastie (1200–1090 v. Chr.) lagen die Blüten und
vollständig geschwärzten Blätter der Pfefferminze. Mehrfach haben sich
auch bei Mumien dieser und späterer Perioden Überreste der hochgelben
Blüte einer Komposite, der kretischen Wucherblume, neben denjenigen des
rotblühenden Schotenweiderichs gefunden.
Neben Girlanden sind auch Blumensträuße in größerer Zahl in den
Katakomben der Totenstadt von Theben gefunden worden. Sie lagen in den
Sarkophagen auf den Mumien, zwischen diese und die innere Sargwand
eingezwängt. Diese Sträuße, aus Feld- und Gartenblumen, Wedeln der
Dattelpalme (altägyptisch utu genannt) und verschiedenartigen
Laubblättern gefertigt, sind länglich, ähren- oder zapfenförmig und
kurz oder lang gestielt. Sie wurden in der Weise hergestellt, daß
man die Blumen und Blätter um einen kürzeren oder längeren Stab
mit Baststreifen umwickelte. Auch die Holzstiele der Sträuße waren
häufig kunstvoll mit Bast umflochten. Noch heutigentags werden die
Blumensträuße in Ägypten, wie im ganzen Orient, auf diese Weise
gebunden.
Wie zierlich geflochtene Hals- und Brustkränze trugen die alten
Ägypter, wie wir aus zahlreichen Darstellungen von Festen und Gelagen
besonders auf den Köpfen der Sängerinnen und Tänzerinnen bemerken,
auch mancherlei Stirnkränze. Zu allen Festen und Gelagen gehörten im
alten Ägypten nicht nur eine Ausschmückung der betreffenden Räume mit
blumengezierten Girlanden und auf den Tischen[S. 431] aufgestellten Blumen
in zierlichen Alabastervasen oder Krügen von gebranntem Ton mit einem
bis drei engen Hälsen, in denen auf den bildlichen Darstellungen noch
die hineingesteckten Blumen zu erkennen sind, sondern vor allem auch
Blumengewinde um Haupt, Hals und Brust, mit denen der Gastgeber seine
Gäste schmückte. Eine Korridorinschrift am großen Tempel der Hathor
in Denderah, welche die ausgelassene Techufeier zu Ehren der Göttin
zum Gegenstand hat, lautet: „Die Erde ist in Freude. Die Einwohner
von Denderah sind trunken von Wein, ein Kranz von Blumen ist auf
ihren Häuptern.“ Überhaupt sind die alten Ägypter nicht die düstern,
vom Gedanken an den Tod beherrschten Menschen gewesen, als die wir
sie wegen der weitgehenden Fürsorge für das Leben nach dem Tode zu
betrachten gewohnt sind. Sie waren vielmehr ein recht lebenslustiges
Volk, als welches sie uns bereits Herodot, der älteste griechische
Geschichtschreiber (484–424 v. Chr.), aus eigener Anschauung schildert.
Feste wurden viel gefeiert, und an ihnen ging es sehr hoch her.
Der Bedarf an Kränzen war demnach ein großer und das Kranzwinden
galt im Lande als geachtete Kunst, die gut lohnte. Der römische
Schriftsteller Plinius (23–79 n. Chr.) erwähnt unter den von den
ägyptischen Kranzwindern mit Vorliebe benutzten Blumen den brennend
roten alexandrinischen Amarant, dessen hahnenkammartig ausgebreitete
Blumenähre jedenfalls eine prächtige Zierde für Kränze abgab.
Eingehendere Nachrichten über die Bedeutung der Kränze im Altertum
haben uns verschiedene griechische Schriftsteller überliefert. So
berichtet der um 200 n. Chr. in Alexandreia und Rom lebende griechische
Grammatiker Athenaios aus Naukratis in Ägypten in seiner Schrift
Deipnosophistai: „Es ist eine alte Sitte, den Gästen vor dem Nachtisch
Kränze und Salben herumzugeben. — Hellanikos erzählt, daß Amasis,
welcher ursprünglich ein Mensch aus gemeinem Stande war (er stürzte den
König Hophra, regierte von 570–526 v. Chr., begünstigte den Verkehr
mit den Griechen, denen er die Stadt Naukratis überließ, und war ein
Freund des Tyrannen Polykrates von Samos), durch einen Kranz König von
Ägypten geworden sei. Er hatte nämlich den Kranz aus den prächtigsten
Frühlingsblumen geflochten und dem damaligen Könige Ägyptens, Patarmis,
gesandt, als dieser seinen Geburtstag feierte. Dieser freute sich
sehr über den herrlichen Kranz, lud den Amasis zur Tafel, behandelte
ihn seitdem als Freund und sandte ihn einstmals mit einem Heer gegen
rebellische Truppen. Diese wählten aber den Amasis als König.“
[S. 432]
Dieser Autor bespricht eingehend die verschiedenen Arten von Kränzen,
die man zu seiner Zeit trug, aus Lotosklee, wie ihn schon der jonische
Lyriker Anakreon (550–478 v. Chr.) schildert, aus Dill, wie ihn die
griechische Dichterin Sappho aus Mytilene auf Lesbos (um 600 v. Chr.)
beschreibt, aus andern wohlriechenden Kräutern, wie Majoran, Thymian,
Salbei, Seifenkraut, dann aus Lorbeer, Myrte und verschiedenen
wohlriechenden Blumen. „Im schönen Alexandreia gibt es auch Kränze,
die man (zu Ehren des schönen Lieblings des Kaisers Hadrian, Antinoos
aus Bithynien, der sich im Jahre 130 als Opfer für den Kaiser unweit
Besa in den Nil stürzte und ertrank, worauf der Kaiser sein Andenken
vielfach feierte und auch ein Sternbild in der Milchstraße dicht
beim Adler nach ihm benannte) Antinoeios nennt; sie werden aus der
ägyptischen Seerose (lōtós) angefertigt. Diese Blume wächst in
Sümpfen und zeigt sich in der Mitte des Sommers. Sie kommt in zwei
Farben vor, entweder rosa, und dann nennt man den Kranz eigentlich
Antinoéios stéphanos, oder himmelblau, und dann heißt der
Kranz lṓtinos stéphanos.“ — Ein ägyptischer Dichter namens
Pankrates hatte den Einfall, dem römischen Kaiser Hadrian (76–138
n. Chr.), als er in Alexandreia war, die rosenfarbene Seerose zu zeigen,
sie für ein Wunder auszugeben und zu sagen, sie sei aus dem Blute des
maurusischen Löwen entsprossen, den Hadrian in Libyen, nicht sehr
weit von Alexandreia, auf einer Jagd mit eigener Hand erlegt hatte.
Dieser Löwe war ein ungeheures Tier und hatte lange so arg in Libyen
gehaust, daß ein Teil des Landes von den Bewohnern hatte verlassen
werden müssen. Hadrian fand seinen Spaß an der Erfindung des Pankrates
und befahl, daß er auf Staatskosten im Museion leben solle. — In dem
von Pankrates dem Hadrian übergebenen Gedicht kam auch folgende Stelle
vor: „Ehe die Blume des Antinoos (der Lotos) von der Erde erzeugt war,
dienten behaarter Feldthymian, weiße Lilie, purpurrote Hyazinthe und
Blätter des weißen Schwalbenkrauts nebst Rosen, die sich beim Zephyr
des Frühlings öffnen, zu Kränzen.“
Athenaios fügt dem hinzu, daß es auch Sitte sei, die Türen derjenigen,
die man liebt, mit Kränzen zu schmücken. Homer habe den Gebrauch von
Kränzen noch nicht erwähnt, er müsse bei den Griechen erst späteren
Ursprungs sein. Später sei er sehr häufig getragen worden. Anakreon
spreche von Myrtenkränzen, die mit Rosen durchzogen waren, und
Theopompos erzählt im dritten Buch seiner Hellenika, die Ägypter hätten
dem Agesilaos, als er in ihr Land kam, unter andern[S. 433] Geschenken auch
Papyros zu Kränzen geschickt. Die Sybariten stellten oft öffentliche
Schmausereien an und ehrten diejenigen, die die größten Beiträge dazu
lieferten, mit goldenen Kränzen; ja sie bekränzten auch diejenigen
Köche, die die Speise am delikatesten zubereiteten. — „Bei dem großen
Feste, das Ptolemaios Philadelphos (der Gründer des Museions und der
Bibliothek in Alexandreia, regierte 285–247 v. Chr.) zu Alexandreia
in der Mitte des Winters gab, war sein Prachtzelt von Lorbeer, Myrte
und andern Bäumen umschattet und der ganze Boden mit Blumen aller
Art bestreut. Ägypten bringt nämlich sowohl durch sein mildes Klima,
als durch die Kunst seiner Gärtner zu jeder Jahreszeit Blumen im
Überfluß hervor, so daß man z. B. Rosen, Levkojen usw. zu jeder Zeit
in beliebiger Menge haben kann. Bei dieser Gelegenheit war in einer
Jahreszeit, da in einer andern Stadt kaum zu einem Kranze Blumen
aufzutreiben gewesen wären, bei diesem Feste in Alexandreia Überfluß
an Blumenkränzen für die ungeheure Menge der Festgäste, und der Boden
war so dick mit Blumen bestreut, daß er wirklich einer göttlichen
Wiese glich. Bei dem feierlichen Umzug, der bei dieser Gelegenheit
abgehalten wurde, kam auch alles zur Schau, was sich auf die Geschichte
der einzelnen Gottheiten bezog. Im Gefolge des Bacchos erschienen
40 Satyrn, um deren Lampen von Gold strahlende Efeublätter gewunden
waren. Viktorienbilder trugen Räucherpfannen von 6 Ellen Länge, die
mit Efeuranken und goldenen Zweigen umgeben waren. Ein Altar von 6
Ellen folgte, geschmückt mit goldenem Efeulaub und einem Kranze von
goldenem Weinlaub. Dem Altare folgten 120 Knaben, in Purpur gekleidet
und Weihrauch, Myrrhe und Safran in goldenen Gefäßen tragend. Nach
ihnen kamen 40 Satyrn, die mit goldenen Efeukränzen geschmückt waren
und einen großen, aus goldenen Reb- und Efeuranken bestehenden Kranz
trugen. Ihnen folgte ein ausgezeichnet großes und stattliches, reich
mit Gold geschmücktes Weib, das in der einen Hand einen Kranz aus Myxa,
in der andern einen Stab aus Dattelpalmenholz trug. Hinter ihr gingen
wieder Viktorien mit Räucherpfannen, die mit goldenen Efeugirlanden
geschmückt waren, und Satyrn mit goldenen Efeukränzen einher. Ihnen
folgte ein von 180 Menschen gezogener Wagen, der die Bildsäule des
Bacchos trug; diese goß aus einem goldenen Becher Wein und hatte neben
sich ein großes Weingefäß und eine Räucherpfanne mit zwei Schalen, die
mit Zimtkassia und Safran gefüllt waren. Über dem Bacchos wölbte sich
eine Laube, die aus Efeu, Weinrebe und allerlei Bäumen[S. 434] gebildet war.
Rings hingen auch Kränze, Bänder und mit Efeu und Reblaub umwundene
Stäbe. Hinter diesem Wagen gingen Bacchantinnen einher mit fliegendem
Haar, mit Schlangen oder Eichenlaub, Reben- und Efeuzweigen bekränzt.
Dann folgte ein von 300 Mann gezogener Wagen, 20 Ellen lang und 16
breit; auf ihm stand eine mit Trauben gefüllte Kelter, die 24 Ellen
lang und 14 Ellen breit war. 60 Satyrn traten die Trauben und sangen
unter Flötenspiel ein Kelterlied; dabei floß der Most auf den ganzen
Weg hin. Der nachfolgende von 60 Mann gezogene Wagen war 25 Ellen
lang und 14 Ellen breit, und trug einen ungeheuren, aus Pantherfellen
genähten Schlauch, aus welchem auf den ganzen Weg allmählich
auslaufender Wein floß usw. usw.“
Das Tragen von goldenen Kränzen galt im Altertum als besonders
feierlich und wird uns ziemlich häufig angegeben. So erzählt Athenaios
an einer andern Stelle: „Bei einem feierlichen Umzuge, den der König
von Syrien, Antiochos der Tolle (im 2. Jahrhundert v. Chr.) hielt,
befanden sich 3000 leicht bewaffnete, in Purpur gekleidete, mit
goldenen Kränzen geschmückte Kilikier, 2000 Reiter in Purpurkleidern,
von denen die meisten goldene Kränze trugen, und hinter den Soldaten
folgten 800 Jünglinge mit goldenen Kränzen.“
Im gewöhnlichen Leben waren Kränze von allerlei bunten und
wohlriechenden Blumen die gebräuchlichsten. Dabei sagt uns das
Onomastikon des Pollux: „Die Blumen, welche man zu Kränzen verwendet,
sind Rosen, Veilchen, Lilien, Minze, Anemonen, Feldthymian, Safran,
Hyazinthen, gelbe Strohblumen, rotgelbe Taglilie, grauer Thymian,
Königskerze, Nadelkerbel, Narzissen, Steinklee, Hundskamille, Kamille
und andere Blumen, die entweder schön oder wohlriechend sind.“ So sagt
ein nicht genannter Dichter: „Hier schicke ich dir einen Kranz, den ich
mit eigenen Händen aus schönen Blumen gewunden habe, aus Lilien, Rosen,
Anemonen, Narzissen und blauen Veilchen.“ Ein anderer singt: „Ich will
Levkojen, zarte Myrten, Narzissen und leuchtende Lilien winden, ich
will süßduftenden Safran, purpurrote Hyazinthen und liebliche Rosen
winden, und damit das lockige Haar der Heliodora bekränzen.“
Die Sitte, sich bei Festen zu bekränzen, übernahmen dann die Römer
von den Griechen. Der ältere Plinius (23–79 n. Chr.) schreibt darüber
in seiner Naturgeschichte. „Anfangs kannte das römische Volk nur
Kränze, die durch Kriegstaten erworben wurden; jetzt aber hat es mehr
Arten von Kränzen als alle andern Völker zusammen. Und[S. 435] zwar werden
zumeist Blumen dazu verwendet, die die Natur nur für Tage erschuf.
Einst hat das römische Volk nur einen Scipio, der den Beinamen Serapio
führte, mit Blumen geehrt. Er starb als Tribun und war beim Volke sehr
beliebt. Da er kein Vermögen hinterließ, so besorgte das Volk auf
eigene Kosten das Begräbnis, indem jeder das Seinige dazu beitrug, und
warf ihm überall, wo der Leichenzug vorbeiging, Blumen zu. Während in
Athen Jünglinge noch vor der Mittagsstunde die Versammlungen weiser
Männer mit einem Kranze auf dem Kopfe besuchten, herrschte in solchen
Dingen bei den Römern stets große Strenge. So wurde beispielsweise im
zweiten punischen Kriege (218–201 v. Chr.) der Geldwechsler Lucius
Fulvius kraft eines Senatsbeschlusses ins Gefängnis geführt und erst
am Ende des Krieges wieder in Freiheit gesetzt, als er sich unterfing,
bei hellem Tage aus seiner Bude mit einem Rosenkranze auf dem Kopfe
auf das Forum hinauszusehen. Auch den Publius Munatius ließen die
Triumvirn fesseln und ins Gefängnis abführen, als er von der Bildsäule
des Marsyas einen Blumenkranz nahm und sich aufsetzte. Er bat zwar
die Tribunen, ihm beizustehen; doch taten diese keinen Einspruch. —
Unter allen Kränzen aus Blumen haben diejenigen aus Rosen den größten
Vorzug, und zwar legt man denen den höchsten Wert bei, die nur aus
zusammengehefteten Rosenblättern bestehen. Heute aber nimmt man den
Stoff zu Kränzen aus Indien oder aus Ländern, die jenseits von Indien
liegen. Für die herrlichsten gelten die aus Nardenblättern, oder
die mit bunten, von wohlriechenden Salben triefenden Seidenstoffen
durchflochtenen. So weit geht jetzt die Verschwendung der Weiber!“
„In Sicyon wetteiferte die Kranzflechterin Glycera durch immer schönere
natürliche Kränze mit dem Maler Pausias, der ihre Kränze malte, so
daß Natur und Kunst sich gegenseitig zu übertreffen suchten. Auf dem
berühmten Gemälde, das Die Kranzflechterin (stephanoplocos)
heißt, und noch heutigentags vorhanden ist, hat er die Glycera
gemalt. Dies geschah nach der hundertsten Olympiade (um 380 v. Chr.).
— Wie man nun einmal angefangen hatte, Blumen in die Kränze zu
flechten, wurden auch die Winterkränze Mode, deren Blumen, weil dann
die Jahreszeit keine natürlichen liefert, aus künstlich gefärbten
Hornspänen bestehen. In Rom schlich sich auch allmählich für die
Kränze, wegen ihres zarten Wesens, der Name corolla, und
dann der Name corollarium für Kränze aus vergoldetem oder
versilbertem Kupferblech ein. — Zuerst ließ sich der reiche Crassus
(der wegen seines[S. 436] ungeheuren Reichtums von 30 Millionen Mark den
Beinamen dives „der Reiche“ führende Triumvir, geboren 115
v. Chr., besiegte als Prätor 72 den Sklavenaufstand unter Spartacus,
ward 70 mit Pompejus Konsul, schloß sich dann an Cäsar an und bildete
60 mit diesem und Pompejus das 1. Triumvirat, ward 55 zum zweitenmal
Konsul, ging als Prokonsul nach Syrien und ward 53 nach der Niederlage
bei Carrhae gegen die Parther hinterlistig getötet) die Blätter aus
Gold nachbilden und verschenkte die daraus verfertigten Kränze bei den
Spielen, die er gab. Es kamen dann noch zur Erhöhung der Schönheit der
Kränze Bänder hinzu; an den etruskischen durften nur goldene Bänder
angebracht werden. Lange Zeit hindurch waren sie einfach; erst Publius
Claudius Pulcher ließ sie in getriebener Arbeit darstellen und brachte
sogar am Baste, womit die Kränze gewunden waren, Goldblättchen an.“
„Zwei griechische Ärzte, Mnesitheos und Kallimachos, haben eigens über
die Kränze geschrieben, die dem Kopfe und somit der Gesundheit schaden.
Bei Wein und Fröhlichkeit kann der Blumenduft schaden, ohne daß man
daran denkt. — Daß aber auch absichtlich durch die Kränze, die man bei
Gastmählern zu tragen pflegt, Unheil gestiftet werden kann, ersieht
man aus folgendem Beispiel: Vor der Schlacht bei Actium (Stadt und
Vorgebirge Aktion an der Westküste Griechenlands, südlich vom Eingang
des Ambrakischen Golfes, wo Octavianus — der spätere Augustus — am 2.
September 31 v. Chr. durch seinen Seesieg über Antonius und Kleopatra
die Alleinherrschaft gewann) begann Antonius den Verdacht zu fassen,
Kleopatra möchte einmal den Versuch machen, ihn durch Gift aus dem
Wege zu räumen, und genoß nichts mehr, bevor es von andern gekostet
war. Dies merkte nun die Königin. Bei einer lustigen Mahlzeit setzte
sie sich einen Kranz auf, dessen Blumen sie mit Gift bestrichen hatte,
und tat im Laufe des muntern Gesprächs den Vorschlag, die Blumen des
Kranzes zu zerpflücken und mitzutrinken. Antonius ahnte nichts Böses,
ließ die Blumen in seinen Becher werfen, setzte an und wollte trinken.
Da hielt Kleopatra schnell die Hand vor und sagte: „Sieh, Antonius, du
denkst dich dadurch zu schützen, daß du alle deine Speisen und Getränke
erst kosten lässest; aber das würde dir alles nicht helfen, wenn ich
nicht wüßte, daß ich ohne dich nicht leben kann.“ Sie ließ nun, um zu
beweisen, wie sie über Tod und Leben gebiete, einen Menschen aus dem
Gefängnis kommen und befahl ihm, aus dem Becher zu trinken. Er tat’s
und sank auf der Stelle nieder.“
[S. 437]
Derselbe Plinius sagt, daß in alten Zeiten nur Göttern Kränze
gegeben worden seien; später sollen auch die Opfernden zu Ehren der
Götter Kränze auf ihr Haupt gesetzt und zugleich die Opfertiere
bekränzt haben. Dann seien sie auch bei den heiligen Kampfspielen in
Gebrauch gekommen, wurden aber eigentlich nicht dem Sieger, sondern
dessen Vaterland zugesprochen. Solche Siegeskränze pflege man als
Weihgeschenke in den Tempeln aufzuhängen. — Der ums Jahr 1000
n. Chr. lebende Suidas gibt dem Empfinden der antiken Welt Ausdruck,
wenn er sagt: „Den Toten gab man einen Kranz, weil sie den Kampf des
Lebens bestanden hatten.“ In diesem Sinne erzählt Valerius Maximus
vom karthagischen Feldherrn Hannibal, er habe den römischen Feldherrn
Marcus Marcellus, als er im Lande der Bruttier kämpfend gefallen
war, mit einem Lorbeerkranze schmücken und standesgemäß begraben
lassen. Auch der Scheiterhaufen, auf dem die Leiche verbrannt wurde,
pflegte mit Blumen, Weihrauch und anderem kostbarem Räucherwerk und
wohlriechenden Essenzen bestreut zu werden. War der Leichnam verbrannt,
so löschte man die glimmende Asche mit Wein, füllte sie in eine Urne
und stellte sie in einem Grabmal an der Heerstraße auf.
In der Biographie des Feldherrn des Achäischen Bundes, Philopömen, der
183 v. Chr., als er von den Messeniern gefangen genommen wurde, den
Giftbecher trinken mußte, sagt Plutarch, daß bei dessen Beerdigung
der Sohn des achäischen Feldherrn, Polybios, die Aschenurne trug, die
aber vor der Menge der Bänder und Kränze kaum zu sehen war. In den
Grabschriften der Heroen des um 309 in Burdigala (Bordeaux) geborenen
und nach 393 verstorbenen römischen Dichters Ausonius, der Christ und
Erzieher des Kaisers Gratian war, wird der Besucher aufgefordert:
„Besprenge die Gebeine mit Wein und lieblich duftendem Nardenöl,
füge purpurfarbige Rosen und Balsam hinzu.“ Der Dichter Properz
(45–22 v. Chr.) singt in einer seiner Elegien: „Wäre ich gestorben
und legte jemand meine Gebeine in zarte Rosenblätter, so würde mir
die Erde leicht sein.“ Sein Zeitgenosse Tibull (43 vor bis 20
n. Chr.) aber meint: „In schwarzem Trauergewande mögen sie meine Gebeine
sammeln, sie mit Wein und dann mit Milch abwaschen, sie mit Tüchern
wieder abtrocknen, in ein Marmorgefäß tun und die Zwischenräume mit
morgenländischen Gewürzen füllen.“ Gerade diese letztere Sitte muß bei
den Vornehmen Roms zu Beginn der Kaiserzeit sehr beliebt gewesen sein.
So beschwört der produktivste und phantasiereichste aller römischen
Dichter, Ovid,[S. 438] der im Jahre 7 n. Chr. 50jährig von Augustus wegen
einer Skandalaffäre mit dessen Tochter Julia nach Tomi am Schwarzen
Meer verbannt wurde und 17 daselbst starb, seinen besten Freund mit den
Worten: „Bin ich tot, so lege meine Gebeine mit Blättern und Pulver von
amomum (den aus Indien bezogenen Kardamomen) in eine kleine Urne
und bestatte sie in der Vorstadt Roms.“
Auch die Gräber wurden in der Antike mit Vorliebe durch Blumen
geschmückt. Schon Sophokles (497–406 v. Chr.) läßt in seiner Elektra
sagen: „Als ich an das alte Grab des Vaters kam, sah ich, daß auf die
Mitte frische Milch gegossen und der Rand rings mit Blumen aller Art
belegt war.“ In der Äneis Vergils (70–19 v. Chr.) läßt der Dichter
den Äneas, als er das Grab seines Vaters Anchises wieder besuchte,
zwei Becher Wein, dann zwei mit frischer Milch und zwei mit heiligem
Blute ausgießen und purpurfarbige Blumen darauf streuen; und an
einer andern Stelle jenes Epos, das den Ahnherrn des julischen
Geschlechts verherrlichen sollte, heißt es: „Streut mit vollen Händen
Lilien und purpurne Blüten auf das Grab!“ Tibull sagt in einer
seiner Elegien: „Bist du gut gewesen, so werden Tränen bei deiner
Bestattung fließen und werden deine alten Freunde jährlich deinen
Grabeshügel mit Blumengirlanden schmücken und sagen: „Schlummre sanft
den Todesschlummer!“ Selbst von dem Scheusal Nero weiß sein Biograph
Suetonius zu melden, daß es doch Leute gab, die noch viele Jahre lang
sein Grab mit Blumen schmückten.“
Bei diesem zweifellos großen Bedarf an Blumen, der uns nach den
Berichten der Schriftsteller des Altertums im ganzen Bereich der
hellenisch-römischen Kultur entgegentritt, ist es sehr merkwürdig,
daß so überaus selten von Blumengärten, die doch überall in der Nähe
der Städte vorhanden gewesen sein müssen, die Rede ist. Nur der
prosaische Cato (234–149 v. Chr.) rät in seiner Schrift über den
Landbau: „Wer einen Garten bei der Stadt hat, der ziehe Kranzblumen
aller Art.“ Schon der Vater der griechischen Botanik, der Schüler des
großen Aristoteles, Theophrast (390–286 v. Chr.), zog in seinem durch
die Freigebigkeit seines Kollegen Demetrios Phalereus, der von 318
bis 307 Athen verwaltete und für kurze Zeit dessen Blüte herstellte,
unterhaltenen Garten in Athen auch allerlei Blumen, wie Veilchen,
Nelken und Klebnelken, von denen er sagt, daß sie zur Ausschmückung von
Kränzen verwendet werden. Und der ältere Plinius weiß uns zu melden:
„Um die Pflanzen kennen zu lernen, bin ich bei Antonius Castor in die
Lehre gegangen, der zu unserer Zeit in dieser Wissen[S. 439]schaft das größte
Ansehen genoß. Ich besuchte ihn sehr oft in seinem Gärtchen, in welchem
er die meisten Pflanzen zog. Dabei war er schon über hundert Jahre
alt, hatte nie eine Krankheit gehabt und durch sein hohes Alter weder
an seinem Gedächtnisse, noch an seiner körperlichen Munterkeit eine
Abnahme erfahren.“
Wie wir aus einigen literarischen Angaben und Darstellungen auf
Vasen wissen, pflegten die Griechen der klassischen Zeit mit Erde
gefüllte, meist mit Henkeln versehene irdene Töpfe mit allerlei rasch
aufsprießenden Pflänzchen zu besäen. Wenn sie dann grün bewachsen
waren, trug man sie am Adonisfeste im feierlichen Zuge daher. Mit
diesen rasch dahinwelkenden „Adonisgärtlein“ wollte man den frühen
Tod des Jünglings andeuten, der ein Sinnbild des südlichen Sommers
darstellte, in welchem alles Grün unter der Glut der erbarmungslosen
Sonne allzuschnell dahinstirbt. Dieser Adonis war eigentlich ein
syrischer Naturgott, ein Abbild der nach kurzer Blüte immer wieder
ersterbenden Vegetation. Nach griechischem Mythos war er der Sohn
des Kypriers Kinyras und dessen Tochter Myrrha und wurde aus einem
Myrrhenbaum geboren, in welchen letztere verwandelt worden war.
Er erwuchs zu einem wunderschönen Jüngling, in den Aphrodite, die
Liebesgöttin, und Persephone, die Beherrscherin der Unterwelt, die
mit Bewilligung ihres Vaters Zeus zwei Drittel des Jahres bei ihrer
Mutter Demeter, der Erdgöttin, auf der Oberwelt zubringen durfte, sich
gleicherweise verliebten. Als er dann auf der Jagd von einem Eber
getötet wurde, stritten beide Göttinnen um seinen Besitz. Da entschied
Vater Zeus, daß er abwechselnd bei der ersteren auf der Oberwelt und
bei der letzteren in der Unterwelt leben sollte.
Wie schon bei den ältesten Ägyptern und Babyloniern wurden auch
bei den Griechen und Römern allerlei fremdländische, gegen die
klimatischen Verhältnisse empfindliche Pflanzen in Töpfen gezogen, die
man über die kälteste Zeit zum Schutze in die Häuser stellen konnte.
So schreibt Theophrast in seiner Pflanzengeschichte: „Die Stabwurz
(abrótonon) wird öfters in Blumentöpfe (óstrakon)
gepflanzt wie die Adonisgärten im Sommer.“ In späterer Zeit baute
man zum Zwecke des Überwinterns gegen Kälte empfindlicher Pflanzen
eigentliche, mit Glimmerplatten statt wie bei uns mit Glas gedeckte
Treibhäuser. So berichtet uns der witzige Epigrammendichter Martial,
40–102 n. Chr., daß man hinter Scheiben von „durchsichtigem Edelstein“
feinere Obstsorten vor der Winterkälte schütze; er dagegen habe in
seinem Stübchen nicht einmal einen ganzen Fensterladen und müsse dann
beim[S. 440] eisigen Nordwind nicht übel frieren. Und in der wahrscheinlich
ums Jahr 912 n. Chr. veranstalteten, Geoponika genannten Sammlung
von Auszügen guter alter griechischer Schriften über die Land-
und Gartenwirtschaft steht zu lesen: „Frühzeitige Rosen nennt man
diejenigen, die in Körben oder Töpfen gezogen und wie Kürbisse
oder Gurken behandelt werden (d. h. im Winter bei kaltem Wetter in
sonnigen, mit Glimmer gedeckten Räumen geschützt, bei mildem aber ins
Freie getragen werden). Im Freien stehende treibt man, wenn man will,
dadurch, daß man zwei Hände breit um sie herum einen Graben zieht und
täglich zweimal Wasser in diesen gießt.“
Als in den Wirren der Völkerwanderung die antike Kultur zu Grunde
gegangen war und nur noch in Byzanz eine länger dauernde, den Arabern,
nicht aber den Christen des Abendlandes zugute kommende Nachblüte
erlebte, ging auch die künstliche Zucht und das Treiben von Blumen
in Europa verloren. Erst mit dem Erwachen der Geister in der Neuzeit
kam sie, vom Morgenlande beeinflußt, bei uns in Flor. Der erste,
der die Treiberei von Blumen in größerem Maßstabe in Mitteleuropa
ausübte und zur Modesache bei den Vornehmen erhob, war der berühmte
Gärtner Ludwigs XIV., La Quintinie, der dafür sorgte, daß sein Herr
und Gebieter, der ein großer Blumenfreund war, stets in den Räumen
seines Schlosses irgend welche Blütenpflanzen, besonders Rosen, Tulpen,
Hyazinthen, Narzissen und Anemonen besaß. In der Folge ist dieser
Zweig der gärtnerischen Tätigkeit in hohem Maße gepflegt und mit allem
Raffinement ausgebildet worden.
Mit dieser gärtnerischen Kunstfertigkeit hängt auch die Einführung
neuer Blumenarten und die Züchtung neuer Sorten aus denselben und
den schon vorhandenen zusammen. Diese Zucht neuer Zierblumen ist
im wesentlichen eine Errungenschaft der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts. Sie ist der Ausfluß des Strebens der Handelsgärtner,
immer neue Formen hervorzubringen, um damit bei dem danach
lüsternen Publikum ein gutes Geschäft machen zu können. Für gewisse
seltene Formen und Neuheiten werden von den reichen Blumenfreunden
tatsächlich Unsummen bezahlt, und der große Gewinn treibt die Züchter
zu fortgesetzten Anstrengungen an, etwas Seltenes oder noch nie
Dagewesenes auf den Markt zu bringen. Das Hauptmittel dabei bildet das
Warmhaus, das die Kultur von Blumen und Ziergewächsen von der örtlichen
Lage unabhängig macht und die Vereinigung aller möglichen Pflanzen
gestattet, mit denen dann experimentiert wird.
[S. 441]
Am häufigsten tritt in der Kultur, zunächst schon durch die bessere
Ernährung bedingt, eine Vergrößerung der Blüte ein. Solche Riesenformen
kehren aber bei der Weiterkultur, wenn sie nicht sehr kräftig ernährt
werden, leicht zur Stammform zurück. Nicht selten sind Änderungen
der Farbe, doch beschränken sie sich gewöhnlich auf einen bestimmten
Farbenkreis. So variiert Blau (durch Hinzutreten einer Säure zu dem
betreffenden Farbstoff) in Violett oder Rosa und schließlich Weiß,
Blutrot in Rosa oder Weiß, Zinnoberrot in Orange und Gelb, Violett
in Blau und Weiß, seltener in Rosa, Gelb fast nur in Weiß, Weiß
meist gar nicht oder allenfalls in Zartrosa oder Zartblau. Neben den
Farbenvariationen treten gefüllte Formen auf, indem sich Staubblätter
in Blumenblätter verwandeln. Diese beiden Veränderungen der Farbe und
die Füllung oder Petalodie (von pétalon Blumenblatt) der
Blumen hängen nun ebenfalls vielfach mit Ernährungsursachen zusammen.
So füllen sich beispielsweise vielfach die Blüten der Levkojen, wenn
man die betreffenden Pflanzen eine Zeitlang kümmerlich ernährt. In
den weitaus meisten Fällen aber lassen sich solche Veränderungen
nicht erzwingen, sondern treten spontan, ohne für uns erkennbare
Ursache auf. Der Mensch muß sie abwarten und entdecken; dann aber
kann er großen Gewinn daraus ziehen. Da solche neue Varietäten ihre
besonderen neuen Eigentümlichkeiten auf ihre Nachkommen vererben, hat
der Mensch nichts anderes zu tun, als diese, wenn er sie zufällig fand,
weiter zu züchten. Dieses merkwürdige, für uns völlig unerklärliche
Auftreten neuer, bis dahin nicht existierender Formen bezeichnet man
als Mutationen oder Sprungvariationen. Das älteste,
historisch beglaubigte Beispiel einer solchen Sprungvariation ist das
schlitzblättrige Schillkraut, das jetzt schon über 300 Jahre bekannt
ist. Eine der jüngsten dagegen ist die Erdbeere ohne Ausläufer.
Vilmorin fand sie in einem einzigen Exemplar unter einer Aussaat der
gewöhnlichen Erdbeere. Solche neue Formen sind je und je aufgetreten,
nur nahm man davon keine Notiz, bis in der Gegenwart die Wissenschaft
die allgemeine Aufmerksamkeit auf diese Tatsache lenkte. In dieser
Beziehung waren die Beobachtungen des holländischen Botanikers Hugo
de Vries bahnbrechend, die er an solchen neuen Sprungvarietäten einer
aus Nordamerika bei uns eingeführten gelbblühenden Nachtkerzenart
(Oenothera lamarckiana) machte. Über diese und andere bisher an
Mutationen festgestellten Beobachtungen und die daraus zu ziehenden
Schlüsse habe ich eingehend auf S. 464–471 des zweiten Bandes meiner
gemeinverständlichen Entwicklungsgeschichte des[S. 442] Naturganzen, betitelt
„Vom Nebelfleck zum Menschen“[3], berichtet, so daß ich Interessenten
darauf verweise.
Solche Sprungvarietäten und seltene, neue, wilde Arten nun hat der
Pflanzenzüchter unter Beobachtung gewisser Vorsichtsmaßregeln zu
kultivieren, bis er eine für den Verkauf genügende Menge Samen,
Wurzelknollen oder Zwiebeln besitzt. Dieses Ziel ist dann meist in 4–5
Jahren erreicht. In der Regel ist aber seine Aufgabe durchaus nicht
so einfach. Er muß in vielen Fällen erst ungünstige Eigenschaften der
neuen Arten ausmerzen und durch andere, bessere ersetzen. In anderen
Fällen ist es überhaupt nur eine einzige Eigenschaft, durch die sich
die neue Art auszeichnet, dann gilt es, diese auf die schon bekannten
alten Sorten zu übertragen. Dies geschieht durch Kreuzung oder
Hybridisation, wie der technische Ausdruck lautet. Das Ergebnis
ist eine Nachkommenschaft von Bastarden oder Hybriden,
die wie die Kinder verschieden gearteter Eltern die Mischung der
mütterlichen und väterlichen Eigenschaften in verschiedenem Grade
zeigen. In der ersten Generation sind sie noch einförmig. Der
ganze Reichtum der Formenfülle bricht erst bei weiteren Kreuzungen
hervor. Der Züchter setzt die Kreuzung so lange fort, bis die von
ihm gewünschte Kombination von Eigenschaften erreicht ist. Ist dies
geschehen, so sucht man sie samenbeständig zu machen. Dies gelingt oft
durch wiederholte Inzucht. Je länger die Inzucht fortgesetzt wird,
um so größer wird die Samenbeständigkeit. Dieser Weg muß bei den
Pflanzen, die nur einmal blühen und Frucht tragen und dann absterben,
in den meisten Fällen eingeschlagen werden. Bei allen Pflanzen,
die erst nach mehreren Jahren zur Blüte gelangen, also sehr vielen
Stauden und Holzgewächsen, wählt man die vegetative Vermehrung. Jede
aus einem Steckling oder Edelreis der neuen Form erwachsene Pflanze
zeigt genau dieselben Eigenschaften wie die Mutterpflanze, von der sie
stammt. Hierauf beruht die Vermehrung unserer meisten Obstarten, der
Kartoffeln, Georginen, Canna-, Coleusarten usw. Manche Pflanzen, wie
Blattbegonien, Gloxinien, Peperonien u. dergl., lassen sich auch ganz
einfach durch abgeschnittene Blätter vermehren, die im Boden alsbald
Wurzel fassen.
Noch viel mehr als der höchst zufälligen und selten eintretenden[S. 443]
Mutation verdanken wir es der planmäßigen Hybridisation, daß wir
heute über eine solch ungeahnte Menge von Zierblumen, die noch nie
in der Vorzeit existiert haben, sondern erst in unserer Zeit aus oft
sehr unscheinbaren, einheimischen oder ausländischen Stammformen
hervorgezaubert wurden, besitzen. Wir werden im folgenden sehen, wie
überaus bescheiden und begrenzt der Besitz an Zierpflanzen bei den
Kulturvölkern des Altertums war, und wie unermeßlich dagegen die
Blumenfülle ist, über die wir heute verfügen. Alle Weltteile haben
ihren Tribut geliefert, um unsere Gärten und Gewächshäuser damit zu
füllen und unser Auge mit deren Farben- und Formenreichtum, wie unsere
Nase mit ihren teilweise herrlichen Düften zu erfreuen.
Beginnen wir nun mit der Betrachtung und kulturgeschichtlichen
Würdigung der wichtigsten Zierpflanzen des Menschen, unter denen schon
im Altertum die Rose als die vornehmste galt. Wie wir dies heute
noch tun, betrachteten die alten Kulturvölker Vorderasiens, wie auch
die Griechen und Römer, die Rose als die Königin der Blumen. Dieser
Anschauung gibt Achilles Tatius beredten Ausdruck, wenn er sagt: „Wenn
Zeus der Blumenwelt eine Königin hätte geben wollen, so hätte er die
Rose dazu gemacht; denn sie ist die Zierde der Erde, der Stolz der
Pflanzenwelt, die Krone der Blumen, der Purpur der Wiesen, der Abglanz
des Schönen. Sie ist der Liebe voll und steht im Dienste der Aphrodite;
sie prangt mit duftenden Blüten und wiegt sich auf beweglichem Laube,
das sich des fächelnden Zephyrs erfreut.“ Sie war aber nicht blos
das Symbol der Liebesgöttin und ihr geweiht, sondern soll nach alter
griechischer Sage direkt von deren Blut die rote Farbe erhalten haben.
So sagt uns ein ungenannter griechischer Dichter in den Geoponika: „Die
Rose, so erzählt man, war ursprünglich weiß und geruchlos. Einst ritzte
Aphrodite ihren Fuß an einem Rosenstachel und von dem hervorquellenden
Blute der Göttin nahm die Rose ihre rote Farbe und den Wohlgeruch an.“
Diese also von der Liebesgöttin selbst gefärbte Blumenkönigin kam
mit der weißen Lilie erst nach dem ersten Viertel des letzten
vorchristlichen Jahrtausends von Westasien her nach Griechenland.
Die griechischen Bezeichnungen vródon und leírion
dafür sind Entlehnungen der Sprache Irans. Und wie die Namen, so
stammen auch die Pflanzen selbst aus dem Hochlande von Persien, wo
aus einer nahe Verwandten der in Südeuropa wachsenden wohlriechenden
Provencerose (Rosa gallica) mit fünf weißen bis
rosenroten Blumenblättern durch Umwandlung fast aller Staubblätter
in Blumenblätter die als[S. 444] Centifolie, d. h. Hundertblumenblättrige,
bezeichnete gefüllte Form hervorging. Weil diese Füllung auf Kosten der
Möglichkeit Samen tragen zu können geschah, so können diese Edelrosen
nicht gesät werden, sondern müssen auf vegetativem Wege vermehrt und
fortgepflanzt werden. Dies geschieht meist durch Okulieren, d. h.
Einsetzen einer Knospe („Auge“) der edeln Pflanze auf einen Wildling.
Als hochstämmige Wildlinge dienen in erster Linie die ein- oder
zweijährigen Stämmchen der einheimischen Hundsrose (Rosa
canina), die selbst zur Züchtung von Edelrosen nicht verwendet wird.
Jedenfalls waren aber die Centifolien der Alten noch lange nicht in dem
Maße gefüllt, wie sie es heute sind. Gleichwohl haben sie dieselben in
hohem Maße entzückt. In den homerischen Epen erscheinen sie mit der
Lilie als der Inbegriff des Wunderbaren und Göttlichen. Die Pflanzen
selbst scheint der Dichter derselben überhaupt noch nicht gekannt
zu haben; er nennt sie, oder besser gesagt, gewisse Eigenschaften
von ihnen, wenn er etwas unbestimmt Herrliches ausdrücken will. So
bezeichnet er die Morgenröte als rosenfingerig, und Aphrodite salbt
den Leichnam des ihr sympathischen Hektor mit rosenduftendem, d. h.
besonders herrlich duftendem Öl. Ajax soll eine lilienzarte Haut
besitzen, die Hektor mit seinem Speer durchbohren will. Auch bei dem
im 8. vorchristlichen Jahrhundert in Böotien lebenden griechischen
Dichter Hesiod war es nicht anders. In seiner Theogonie spricht er von
zwei rosenarmigen Töchtern des Meergottes Nereus und bezeichnet die
Stimmen der Musen und Zikaden als Lilienstimmen, aber was Rosen und
Lilien tatsächlich sind, ist ihm völlig dunkel geblieben. Wie hätte er
auch diese Blumen kennen sollen, wenn noch in einem von der Forschung
in die Mitte des 7. vorchristlichen Jahrhunderts gesetzten Hymnus
des alteleusinischen Demeterdienstes erzählt wird, wie Persephone,
die Tochter des Zeus und der Erdgöttin Demeter, auf der Wiese mit
ihren Gespielinnen gespielt und außer Veilchen, Krokos, Hyazinthen
und Schwertlilien auch Rosen (nicht vom Strauch gebrochen und nicht
mit Stacheln bewehrt, wie wirkliche Rosen, sondern Phantasierosen)
gepflückt habe und die Wunderblume Narkissos „— ein Wunder zu sehen
für Menschen und Götter — die sich mit hundert Häuptern aus der Wurzel
erhebt, deren Duft Himmel, Meer und Erde erfreut“ (also ebenfalls
nicht die wirkliche, sondern eine Phantasienarzisse, die, wie der Name
bezeugt, der mit dem Wort Narkose zusammenhängt, eine exotische Blume
mit berauschendem Dufte bezeichnen sollte). An einer späteren Stelle
desselben Hymnus erzählt Persephone ihrer Mutter, wie[S. 445] sie auf einer
reizenden Wiese gespielt und „Kelche der Rosen und Lilien — ein Wunder
zu schauen“ gepflückt habe. Dieser Zusatz des Wunderbaren erhebt ja
an sich schon diese Blumen ins Fabelhafte, Unglaubliche, noch nie
Geschaute.
In einem Fragment des um ein Menschenalter älteren griechischen
Lyrikers Archilochos von Paros (um 700 v. Chr.), der aber weiter
in der Welt herumgekommen zu sein scheint als der Verfasser jener
eleusinischen Tempelpoesie und außer den Ägäischen Inseln auch
Thrakien und Lydien kannte, tritt uns erst unverkennbar die Kenntnis
des Rosenstrauches entgegen, dessen schöne Blüte (rodḗs te kalón
anthós) der Dichter neben dem Myrtenzweig als Schmuck des Mädchens,
ohne Zweifel seiner Geliebten, der Neobule, erwähnt. Hundert Jahre
später war die Rose ein Liebling der Dichterin Sappho aus Mitylene
auf der Insel Lesbos (um 600 v. Chr.), von der sie häufig gepriesen
und als Gleichnis schöner Mädchen herangezogen wurde. Nach ihr hat
der lebensfrohe Lyriker Anakreon aus Teos in Ionien (550–478
v. Chr.), der in Samos und Athen lebte, sie vielfach in seinen Gedichten
verherrlicht. Er sagt von dieser Blume: „Mit schönblühenden Rosen
bekränzt wollen wir trinken. Die Rose ist die herrlichste Blume; sie
ist bei den Göttern beliebt; mit ihr bekränzt sich der Sohn Kytherens
(der Liebesgott Eros — bei den Römern Amor genannt), wenn er mit den
Grazien tanzt. So will auch ich mit Rosen bekränzt tanzen.“
Von da an finden wir die Rose neben der Lilie als beliebten
Blumenschmuck eingebürgert und bei keinem griechischen Feste fehlend.
Zweifellos war sie aus der Landschaft Phrygien im mittleren Kleinasien
über Thrakien und Makedonien nach Griechenland eingewandert. Das
nyseische Gefilde, auf dem Persephone nach dem homerischen Hymnus Rosen
und Lilien pflückt, ist nach den Angaben in der Ilias in Thrakien zu
denken, und der Name einer ihrer Gespielinnen, Rhodope, ist zugleich
derjenige des thrakischen Gebirges, in welches jene Nymphe verwandelt
sein sollte. Und Herodot aus der dorischen Stadt Halikarnassos an der
kleinasiatischen Küste südlich von Milet (484–424 v. Chr.) sagt: „In
einer Landschaft Makedoniens liegen die sogenannten Gärten des Midas,
des Sohnes des Gordios (eines phrygischen Königs und der Kybele, dem
Dionysos den Wunsch gewährte, daß alles, was er berühre, sich in Gold
verwandle, von welcher lästigen Wohltat er sich dann durch ein Bad im
Flusse Paktolos befreite, der seitdem Gold führt). In diesem Garten
wachsen die Rosen wild, jede hat 60 Blätter, und sie riechen besser als
andere Rosen.“ Gleicherweise drückt sich der[S. 446] bei Athenaios erwähnte
alexandrinische Dichter Nikander im zweiten Buche seiner Georgika aus,
wenn er sagt: „Midas von Odonien (einer Landschaft in Thrakien) erzog,
nachdem er die Herrschaft von Asis (in Kleinasien) verlassen, zuerst in
den Gärten von Emathia (einer Landschaft in Makedonien) die Rosen, die
mit 60 Blumenblättern umsäumt sind.“ Schon diese bei ihm und Herodot
hervorgehobene altbabylonische Zahl 60 weist auf die Herkunft dieses
Mythos aus Asien, woher mit dem Dienst der Aphrodite und des Gottes des
Natursegens Dionysos auch die ihnen geweihte Blume zu den Griechen kam.
Noch der pflanzenkundige Schüler des großen Aristoteles, Theophrast
(390–286 v. Chr.), schreibt in seiner Pflanzengeschichte, daß die
meisten reichgefüllten Rosen, die er bereits hekatonphylla, d.
h. hundertblätterig — identisch mit dem römischen centifolia
— nennt, in der Gegend von Philippi in Makedonien wachsen. An der
diesbezüglichen Stelle teilt er uns sein ganzes Wissen über diese
Pflanze mit: „Es gibt verschiedene Arten von Rosen (ródon);
sie haben mehr oder weniger Blumenblätter (phýllon), sind mehr
oder weniger rauh oder glatt, an Farbe und Wohlgeruch verschieden.
Die meisten sind fünfblätterig; es gibt aber auch zwölf- bis
zwanzigblätterige, ja die Zahl der Blumenblätter soll bis auf hundert
steigen, und solche nennt man hekatonphylla. Die meisten
Hekatonphyllen wachsen um Philippi, wohin man sie vom (benachbarten)
Pangaiosgebirge, woselbst sie in Menge vorkommen, verpflanzt hat. —
Im allgemeinen richtet sich bei den Rosen die Schönheit der Farben und
der Wohlgeruch nach dem Standort; jedoch kann auf demselben Boden der
Geruch verschieden sein. Den besten Geruch haben die Rosen von Kyrene
(in Nordafrika zwischen Tripolis und Ägypten); daher wird dort die
kostbarste Rosensalbe (mýron) gemacht. Man kann den Rosenstrauch
(rodōniá) auch durch Samen vermehren; dieser liegt unter der
Blüte in der Frucht (mélōn, eigentlich Apfel) und ist mit Wolle
umgeben. Da aber das Wachstum aus den Samen sehr langsam vor sich
geht, so pflegt man die Rosen durch Stecklinge zu vermehren. Übrigens
trägt der Rosenstrauch schönere Blumen, wenn man ihn abgebrannt oder
abgeschnitten hat; dagegen treibt er wilde Schößlinge, wenn man ihn
nach Belieben wachsen läßt. Auch durch oftmaliges Verpflanzen werden
seine Blumen schöner. Die wilden (ágrios) Rosen haben rauhere
Zweige und Blätter, weniger stark gefärbte und kleinere Blüten.“
Die ältesten Babylonier haben so wenig wie die übrigen
vorderasiatischen Völker und die Ägypter der älteren Zeit die Rose
gekannt.[S. 447] Erst bei den jüngeren Assyriern tritt sie uns als viel
gebrauchtes Ornament, nämlich stilisiert als Rosette, entgegen, und bei
den jüngern Babyloniern, wie sie uns der griechische Geschichtschreiber
Herodot aus eigener Anschauung um die Mitte des 5. vorchristlichen
Jahrhunderts schildert, hatte sie auch erst durch Vermittlung ihrer
persisch-medischen Überwinder Eingang gefunden. So schreibt er im
ersten Buche seines Geschichtswerks: „Jeder Babylonier trägt auf
seinem Stock das Bild entweder eines Apfels oder einer Rose oder einer
Lilie oder eines Adlers oder irgend eines andern Gegenstandes.“ Auch
die alten Hebräer zur Zeit Salomos (993–953 v. Chr.), der in seinen
wohlgepflegten Gärten eine Menge aus dem Auslande eingeführter neuer
Kulturpflanzen ziehen ließ und sich an seinem prunkhaften Hofe gern mit
einer so schönen Blume geschmückt hätte, wenn er es hätte tun können,
kannten die Rose, dieses herrliche Geschenk Irans, noch nicht. Wenn
Luther, der Auslegung der Rabbinen folgend, das hebräische susan
mit Rose übersetzt, so ist dies ein heute vollständig klargelegter
Irrtum; es bedeutet vielmehr Lilie, und zwar nicht sowohl die weiße,
sondern die farbige Feuerlilie oder noch wahrscheinlicher eine überall
in Palästina wildwachsende, ebenfalls glockenförmige Blüten besitzende
Kaiserkrone. Dahin sind die Stellen zu berichtigen, wie z. B. bei
dem (im 8. Jahrhundert v. Chr. lebenden) Hosea, wo es in den bisher
gebräuchlichen Bibelübersetzungen heißt: „Ich will Israel wie ein Tau
sein, daß er soll blühen wie eine Rose“, oder an mehreren Stellen des
nicht lange nach der Salomonischen Zeit gedichteten Hohen Liedes,
wie: „Ich bin eine Blume zu Saron und eine Rose im Tal“, oder: „wie
eine Rose unter den Dornen, so ist meine Freundin unter den Töchtern“
usw. Erst den Verfassern der schon in die griechische Zeit fallenden
Apokryphen war die Rose bekannt. Nach allem scheint diese Zierpflanze
von dem im Jahre 536 aus dem Exil in Babylon, wohin sie Nebukadnezar
nach der Zerstörung Jerusalems 586 geführt hatte, auf Grund der vom
Perserkönige Kyros erteilten Erlaubnis nach Palästina zurückgekehrten,
etwa 42000 Juden nach Syrien gebracht worden zu sein. Demgemäß wird sie
zuerst in den nach dieser Zeit verfaßten Büchern der Weisheit und Jesus
Sirach erwähnt.
Auch nirgends in den altägyptischen Inschriften und Papyri wird die
Rose angeführt. Auch Herodot, der Ägypten aus eigener Anschauung
kannte, erwähnt wohl die Lotosblume, die er als Lilie des Nils
bezeichnet, aber nicht die Rose als Zierpflanze Ägyptens. Erst etwa
ums Jahr 600 v. Chr. kam die Rose wahrscheinlich von Syrien[S. 448] her und
nicht durch Griechen, die allerdings der Handel schon damals zu den
Nilmündungen führte, wo ihnen dann König Amasis II. (570 bis 526
v. Chr.), der Freund des Polykrates von Samos, die Stadt Naukratis
überließ, nach dem Niltal, wo sie in der Folge besonders in der
Landschaft Arsinoe, dem heutigen Fajum, viel angepflanzt wurde. Zur
Zeit der Herrschaft der Ptolemäer (323–30 v. Chr.) und der Römer war
diese Landschaft bei allen Völkern des Mittelmeerbeckens wegen ihrer
Wein- und Rosengärten berühmt. Schon Theophrast berichtet, daß die
Rosen und Veilchen Ägyptens, die wie alle Blumen des Landes, außer der
Myrte, geruchlos sein sollten, um zwei Monate früher blühen als in
Griechenland. Diesen Umstand benutzten die üppigen Einwohner Roms zur
Kaiserzeit, um sich zu einer Zeit, da es noch keine blühenden Rosen im
eigenen Lande gab, welche von dort kommen zu lassen. So sagt Martial
(40–102 n. Chr.), der unter Nero aus seinem Vaterlande Spanien nach Rom
kam, in einem seiner Epigramme: „Im Winter schickt der Nil Rosen nach
Rom, aber mehr und schönere sendet Paestum (die griechische Pflanzstadt
Poseidonia in Unteritalien, dessen verhältnismäßig noch gut erhaltener
Poseidontempel aus Abbildungen genugsam bekannt ist).“ Diesen Tatsachen
entsprechend hat man erst in den der griechisch-römischen Periode
angehörenden Gräbern der Nekropole von Hawara im Fajum Überreste
der Rose gefunden, für die es auch keine einheimische ägyptische
Bezeichnung gab. In demotischen Texten findet sich dafür der Name
uartu, der semitischer Herkunft zu sein scheint, da er sich als
uard im Arabischen wiederfindet. Dies würde für einen Import
der Rose durch semitische und nicht griechische Vermittlung sprechen.
Bekanntlich hat der Ägyptologe Georg Ebers diese Bezeichnung der Rose
als Name der Heldin seines Romanes Uarda benutzt.
Nach Unteritalien kam die orientalische Gartenrose schon früh mit den
ihre Kolonien daselbst gründenden Griechen. In ihrer Gesellschaft
befand sich jedenfalls auch die morgenländische weiße Lilie, deren
griechischer Name leírion in das lateinische lilium, und
der griechische Pluralis róda in rosa verwandelt wurde.
Im späteren Italien hat diese heilige Blume der Aphrodite-Venus bei
den Festen der Vornehmen eine sehr bedeutende Rolle gespielt. Schon
der Redner Cicero (106–43 v. Chr.) nennt die Rose da, wo er ein Leben
voll Üppigkeit bezeichnen will. Und es war in der Tat orientalische
Ausschweifung, wenn, wie Athenaios (um 200 n. Chr.) uns berichtet,
Kleopatra in Kilikien, wohin sie dem Marcus Antonius, um ihn für sich
zu ge[S. 449]winnen, entgegengezogen war, diesen in Speisezimmern bewirtete,
deren Boden eine Elle hoch mit Rosen bedeckt war. Damit man sich nicht
in ihnen mit den Füßen verfing, war über sie ein feines Netz gezogen.
Die Kosten für diese kleine Überraschung betrugen ein Talent, d. h.
4500 Mark. Derselbe Athenaios berichtet von dem im 4. Jahrhundert
v. Chr. über Syrakus herrschenden grausamen Tyrannen Dionysios, daß er
die Fußböden seines Palastes mit Feldthymian und Rosen bedecken ließ
und sich dann darauf herumwälzte, um in Wohlgerüchen zu schwelgen. Es
war eine Nachahmung der üppigen Sitten bithynischer Fürsten, wenn sich
der römische Beamte Gajus Verres, der von 73–71 v. Chr. Statthalter
von Sizilien war und während seiner dortigen Amtsführung nicht weniger
als 40 Millionen Sesterzien, d. h. 6 Millionen Mark erpreßte, weswegen
er im Jahre 70 angeklagt wurde, wobei Cicero als Anwalt der Bewohner
Siziliens seine berühmten Verrinischen Reden hielt, den für die
Begriffe der Römer der damaligen Zeit ganz unerhörten Luxus leistete,
mit Rosen bekränzt in seiner Sänfte auf Rosenkissen zu ruhen und
dabei ein mit Rosen gefülltes Netzchen an die Nase zu halten. Die
diesbezügliche Stelle in der Rede Ciceros gegen Verres lautet wörtlich:
„Als unser Feldherr Verres seine Residenz in Syrakus aufgeschlagen
hatte, ließ er sich, sobald es Rosen gab, in einer Sänfte herumtragen,
in welcher das Polster mit Rosen ausgestopft war; dabei hatte er einen
Kranz von Rosen auf dem Kopfe und einen andern solchen um den Hals, und
vor die Nase hielt er sich ein aus ganz zarten Leinfäden gestricktes,
engmaschiges, mit Rosen gefülltes Netzchen.“
Solche Verschwendung wurde noch bei weitem von den an Größenwahn
leidenden Cäsaren Roms übertrumpft. Berichtet doch Spartianus von
dem römischen Kaiser Aelius Verus, dem Adoptivsohn des Antoninus
Pius, der 161 von Mark Aurel zum Mitregenten erhoben wurde und 169 zu
Altinum in Venetien starb, er habe auf einem Bett geschlafen, das mit
Rosenblättern gefüllt war, denen das Weiße, also der Nagel, genommen
worden war. „Seine Decke bestand aus Lilien und sein Körper war mit
persischen Salben parfümiert. Von ebenso gereinigten Rosenblättern und
von Lilien ließ er oft die Polster machen, worauf beim Schmause die
Gäste lagen, desgleichen auch die Tische selbst.“ Es handelt sich also
hier um mit Rosen- und Lilienblättern gefüllte Kissen, die gelegentlich
auch von anderen üppigen Kaisern benutzt wurden, wenn es sich um
besonderen Pomp bei festlichen Anlässen handelte. So berichtet uns der
Geschichtschreiber Aelius Lampri[S. 450]dius in seiner Biographie des Kaisers
Heliogabalus (der auf Anstiften seiner Großmutter Julia Maesa, der
Schwägerin des Kaisers Septimius Severus, 218 17jährig als Oberpriester
des Gottes Elagabal, dessen Namen er annahm — er hieß eigentlich
Avitus Bassianus — in Emesa in Syrien von den syrischen Legionen zum
Kaiser ausgerufen wurde, 219 in Rom einzog, wohin er den orgiastischen
Dienst seines syrischen Gottes verpflanzte und wo er schwelgerisch
und wollüstig lebte, bis er 222 von den Prätorianern ermordet wurde):
„Kaiser Heliogabalus speiste öfter auf Kissen, die mit Rosen(blättern)
gefüllt waren, hatte mit Rosen(blättern) ausgestopfte Betten und
spazierte in Säulenhallen, deren Boden mit Rosen bedeckt war. Er
wechselte auch mit der Blume und gebrauchte statt der Rosen Lilien,
Veilchen, Hyazinthen oder Narzissen. Er füllte auch Bassins mit Rosen-
oder Wermutwein, badete sich darin, trank sich dabei an dem Wein, worin
er saß, voll und lud zugleich das Volk ein mitzutrinken.“
Von Kaiser Gallienus (253 Mitregent seines Vaters Valerianus, von 260
an Alleinherrscher, bis er 268 in Mailand ermordet wurde) berichtet
uns Trebellius Pollio: „Kaiser Gallienus baute öfter im Frühjahr ganze
Villen von Rosen und Burgen aus Obst, bewahrte Trauben drei Jahre lang
auf, traktierte seine Freunde mit Melonen und setzte ihnen in Monaten,
in welchen eigentlich keine zu haben waren, frische Feigen und andere
Obstarten vor.“
Sich mit Rosen zu umgeben galt bei den Machthabern des Altertums als
ein Zeichen fürstlichen Prunkes. So berichtet Florus von dem syrischen
Könige Antiochos III., dem Großen, der seine Herrschaft über Kleinasien
auszudehnen suchte und infolge davon 192 mit den Römern in Krieg geriet
und nach zwei unglücklich verlaufenen Schlachten 190 ganz Kleinasien
diesseits des Taurus an jene abtreten mußte: „Als Antiochus, König von
Syrien, gegen die Römer Krieg führte, hatte er sich zur Winterszeit
auf Euboea gelagert; seine Zelte bestanden aus Gold und Seide, von
allen Seiten waren Rosen herbeigeschafft und Flötenspieler sorgten
für gute Unterhaltung.“ In diesem Bericht und in anderen ähnlichen
Inhalts besteht das Luxuriöse gerade darin, im Winter Rosen haben zu
wollen, wenn sonst niemand welche hatte. Dazu wurden sie entweder
in mit Marienglas gedeckten Kästen getrieben, wie uns dies Martial
in einem Epigramm für Rosen und Lilien mitteilt und auch Palladius
im 4. Jahrhundert n. Chr. noch erwähnt, oder aus wärmeren Gegenden,
besonders Nordafrika, bezogen. Auch Süditalien, wo, wie in Paestum
nach der Angabe des Dichters[S. 451] Vergil in seiner Georgica die Rosen
zweimal Blüten trugen, lieferte solchen Leuten, die sich nach der
Bezeichnung des Seneca, des Erziehers und Leiters des jugendlichen
Nero (2–65 n. Chr.), in einer seiner Episteln „durch naturwidrige
Mittel im Winter Rosen zu verschaffen suchen“, das Gewünschte. Hier
wurden die Rosen nach der Angabe des Plinius (23–79 n. Chr.) in der
Weise vorzeitig zum Blühen gebracht, daß man „einen Fuß von der Wurzel
des Stockes entfernt einen Graben zog und in diesen warmes Wasser
goß“. Dasselbe empfiehlt auch drei Jahrhunderte später Palladius,
der rät, zweimal täglich warmes Wasser hineinzugießen. Auf solche
Weise war es den Herren der Welt möglich, wie der jüngere Claudius
Mamertinus in seinem Panegyricus Juliani, d. h. der Lobschrift
über den Kaiser Julianus Apostata (361–363), sagt, an den Tafeln bei
ihren Gastmählern „wunderbare Vögel und Fische aus fernen Meeren,
Obstsorten, die zu ganz anderer Zeit reifen, Schnee im Sommer, Rosen
im Winter beim Schmause zu verbrauchen“. Daß solche Extravaganzen
nicht billig zu stehen kamen, ist sehr wohl begreiflich. Doch in Rom,
das so viele andere Völker ausgeraubt hatte, gab es genug sehr reiche
Leute, die sich diese Vergnügungen leisten konnten. So berichtet der
römische Geschichtschreiber Suetonius (70–140 n. Chr.), der einstige
Geheimschreiber des Kaisers Hadrian, daß bei einer Festlichkeit, die
ein Freund des Kaisers Nero (geboren 37, regierte von 54–68 n. Chr.)
mitten im Winter gab, die Beschaffung der Rosen allein die Kleinigkeit
von 4 Millionen Sesterzien = 600000 Mark kostete.
Diese nun einmal zum Lebensgenuß gehörende schöne Blume zierte auch
die Liebenden, um so mehr, weil sie das Sinnbild der Liebesgöttin
selbst war. Wie die Reichen beim Schmause in Rosen lagen, schenkte der
Liebende seiner Geliebten die Blume Aphrodites. Schon beim römischen
Komödiendichter Plautus (254–184 v. Chr.) treffen wir als liebkosende
Anrede den Ausdruck rosa, mea rosa, meine Rose. Wie das
Haupt der Tänzerin, der Flötenspielerin und des weinschenkenden Knaben
von einem Rosenkranze umwunden war, bekränzte der Trinkende sich selbst
und seinen Becher mit der Dionysos selbst geheiligten Blumenzier. Von
Anakreon im 6. vorchristlichen Jahrhundert an tönt uns bei den Lyrikern
immer wieder als Ausdruck ausgelassener Lebensfreude die Aufforderung
entgegen: Laßt uns mit schönblühenden Rosen bekränzen und trinken! Vom
Griechen lernte der Römer, so daß bald auch bei ihm Sinnentaumel und
Rosen zusammengehörten. So singt Martial: „Wenn der Sorgenlöser rast,[S. 452]
wenn die Rose herrscht, wenn die Haare feucht sind vom Taumel, dann...“
Und wie Dionysos, der Gott des Natursegens, zugleich auch der Führer
und Herrscher der Abgeschiedenen war, so schmückte man auch die Toten
und deren Gräber mit Rosen. Wie der Lorbeer Ruhm, so bedeutete die Rose
Liebe und Verehrung, und beides wollten die Einwohner von Cremona dem
Kaiser Vitellius bezeugen, als er, nachdem sein Heer bei jener Stadt
im Herbst 69 von den Legionen Vespasians geschlagen worden war, das
Schlachtfeld besichtigte. „Da“, so sagt uns der Geschichtschreiber
Tacitus, „bestreuten die Cremonenser seinen Weg mit Lorbeer und Rosen,
errichteten ihm Altäre und brachten ihm Opfer dar.“
Auch zu wohlriechenden Essenzen und Salben fand die Rose vielfach
Verwendung. So findet Plinius, daß kein Land so passend sei zur
Bereitung wohlriechender Salben, als Ägypten und dann Campanien wegen
seines Überflusses an Rosen. Derselbe Autor gibt an, daß aus Rosen
das Rosenöl (oleum rhodinum) bereitet werde, worunter aber
nicht das von uns verstandene Produkt zu verstehen ist; denn die Kunst
der Destillation war dem Altertum noch unbekannt. Palladius im 4.
Jahrhundert n. Chr. sagt uns, wie solches bereitet wurde: „Um Rosenöl
(oleum roseum) zu bekommen, braucht man auf 1 Pfund Olivenöl
1 Unze gereinigte Rosenblätter und hängt die Mischung 7 Tage lang
in Sonnen- und Mondenschein.“ Sehr beliebt war auch der Rosenhonig
und der Rosenwein, deren Herstellung uns derselbe Autor in folgender
Weise schildert: „Rosenhonig (rhodomeli) entsteht, wenn man
Rosensaft mit Honig mischt und die Masse 40 Tage an die Sonne hängt.
— Der Rosenwein (vinum rosatum) ist ein Wein, in welchem 30
Tage lang Rosenblätter gelegen haben und der alsdann einen Zusatz
von Honig erhält.“ Plinius aber rät den Rosenwein in der Weise zu
bereiten, „daß man zerstoßene Rosenblätter in einem Leinwandsäckchen
drei Monate in Most liegen läßt. Man preßt auch die Blumenblätter
entweder für sich samt den Nägeln (unguis, d. h. den farblosen
Blumenblattstielen), oder man legt sie, nachdem man die Nägel
abgeschnitten hat, in Öl oder Wein, läßt sie so an der Sonne stehen
und sondert sie dann durch Pressen von der Flüssigkeit. Einige fügen
auch Salz bei. Man nimmt auch recht gut riechenden Blumenblättern die
Nägel, zerreibt sie, preßt sie in dichter Leinwand aus und kocht den
Saft bei gelindem Feuer bis zur Honigdicke ein.“ Auch Rosenplätzchen
(rodís), die uns der griechische Arzt Dioskurides um die
Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. erwähnt, waren beliebt, und sein[S. 453]
150 Jahre später in dem üppigen Alexandreia lebender Volksgenosse
Athenaios empfiehlt als Leckerbissen: „Es gibt eine herrlich duftende
Speise, welche rodoniá heißt. Um sie zu bereiten, mischt man
Rosenblätter, die im Mörser zerrieben sind, Gehirn von Hühnern und
Schweinen, Eidotter, Olivenöl, Fischsülze, Pfeffer, Wein, reibt alles
gut durcheinander und kocht bei gelindem Feuer.“
Plinius schreibt der Rose zusammenziehende und kühlende Eigenschaften
zu. Er sagt von ihr in seiner Naturgeschichte: „Von den Blumen unserer
Gärten werden fast nur Rosen und Veilchen zu Kränzen verwendet. Aber
noch mehr Rosen als zu Kränzen werden zu anderen Zwecken gebraucht.
Man legt sie in Öl, was schon zur Zeit Trojas geschehen ist; man
verbraucht sie zu Salben; auch werden sie zu Pflastern und Augenmitteln
verwendet; sie würzen die Speisen und solche Würze schadet nicht.
Unsere Gärtner geben den Rosen aus Praeneste (in Latium) und aus
Campanien den Vorzug; andere rühmen die milesischen (von Milet an der
kleinasiatischen Küste), welche die glühendste Farbe, aber nicht über
12 Blumenblätter haben. Überhaupt unterscheidet man die Rosen nach der
Menge der Blumenblätter, nach Farbe und Geruch und danach, daß sie mehr
rauh oder glatt sind. Die kleinste Zahl der Blumenblätter ist 5; es
gibt aber auch welche mit mehr, und selbst eine mit 100 Blumenblättern
(centifolia), sie wächst in Campanien und bei Philippi (in
Mazedonien), zeichnet sich aber nicht durch Wohlgeruch aus. Caepio,
der unter Kaiser Tiberius schrieb, daß man die Centifolie nicht zu
Kränzen verwende, sie höchstens an den Enden solcher anbringe, da sie
sich weder durch ihren Geruch, noch durch Schönheit empfehle. Die in
der Cyrenaika (zwischen Tripolis und Ägypten) heimischen Rosen riechen
am besten und geben daher die beste Salbe. Die Rosen zu Karthago und
in Spanien blühen den ganzen Winter hindurch. Nur eine Rosenart wird
gepfropft, nämlich die blasse, stachelige mit 5 Blumenblättern.“ Und
Palladius empfiehlt: „Um Rosenknospen lange frisch zu erhalten, macht
man in ein grünes, stehendes Pfeilrohr (canna = Arundo
donax) von der Seite einen Spalt, schiebt die Knospe hinein und
läßt das Rohr sich wieder schließen. Zur Zeit, da man die Knospe wieder
haben will, schneidet man das Rohr durch. Manche tun auch Rosen in
einen weder ausgepichten, noch glasierten Topf, schließen ihn gut und
vergraben ihn unter freiem Himmel.“
Bei solchem großen Bedarf an Rosen ist es begreiflich, daß die Rosen
sehr häufig neben anderen Blumen in den Gärten der Griechen[S. 454] und
Römer gezogen wurden und vielfach von stationären und wandernden
Blumenhändlern feilgeboten wurden. Schon Varro empfiehlt in der
republikanischen Zeit Roms als vorteilhaft für solche, die in der
Nähe der Stadt ein Grundstück besitzen, Veilchen- und Rosengärten
(violaria ac rosaria) anzulegen. Wie solche zu behandeln seien,
erklärt Palladius. „Im Februar werden die Rosenbeete (rosarium)
angelegt, und zwar durch Stecklinge (virgultum) oder durch
Samen. Nicht die gelben Blütenteile (also die Staubbeutel) mitten in
der Rose sind die Samen, diese stecken vielmehr in den birnförmigen
Beeren, deren Reife man daran erkennt, daß sie braun und weich werden.
Alte Rosenbeete werden im Februar behackt und alle dürren Zweige an den
Sträuchern werden dann abgeschnitten. An leere Stellen pflanzt man aus
Stecklingen gezogene junge Stöcke. — An warmen Stellen kann man die
Rosenbeete auch im November anlegen. Hat man nicht Reiser genug, um
Stecklinge zu machen, so schneidet man Zweige ab, legt sie wie Ableger
(propago) in die Erde und hilft mit Dünger und Wasser nach.“ Und
in den Geoponika rät ein griechischer Autor: „Will man Rosen haben,
die früh blühen, so setzt man sie in Blumentöpfe, stellt diese in der
kalten Jahreszeit bei Kälte in ein sonniges Zimmer, bei Sonnenschein
und warmem Wetter aber ins Freie, wie man es mit den Kürbissen und
Gurken macht. Hält man Rosen, die sich eben öffnen, in Schwefeldampf,
so werden sie augenblicklich weiß.“
Wie die Rose das Sinnbild der blühenden Jugend, der Liebe und
Fruchtbarkeit war, so galt sie den Römern auch, weil die zahlreichen
Blumenblätter das Innere verhüllen, als Zeichen der Verschwiegenheit
und wurde deshalb in den Speisesälen über der Tafel aufgehängt
und bei Trinkgelagen in Kränzen um die Becher gewunden, um vor
Plauderhaftigkeit in der Weinseligkeit zu warnen. Eine Nachahmung
dieses altrömischen Brauches war es, wenn der mönchisch strenge Papst
Hadrian VI. (1522–1523), der auf die Abstellung der kirchlichen
Mißbräuche und Zurückführung des römischen Hofs auf apostolische
Einfachheit bedacht war, als Symbol der Verschwiegenheit Rosen an den
Beichtstühlen anbringen ließ. Der bekannte Ausdruck: sub rosa
(unter der Rose, d. h. im Vertrauen) hat hierin den Grund seiner
Entstehung.
Bei der Christianisierung des sich zersetzenden Römerreiches zog mit
dem Eindringen der neuen Religion die sogenannte Arkandisziplin, d. h.
Geheimlehre, welche die von den heidnischen Mysterien herüber[S. 455]genommene
Praxis, Taufe, Abendmahl, Salbung, Glaubensbekenntnis und Herrengebet
vor den Nichtgetauften geheim zu halten gebot, auch die Rose in ihren
symbolisierenden Kreis, indem sie das rote Blut Christi und rote
Rosen in Wechselbeziehung zueinander treten ließ, wie verschiedene
Katakombenbilder andeuten. Rosen und Rosenkränze wurden zu Symbolen
des Martyriums und dienten den die Gedenktage solcher Feiernden
zum Ausschmücken der Martyrergräber. Da mit der Erklärung des
Christentums als Staatsreligion durch Konstantin im Jahre 323 die
heidnischen Kulte unter christlichem Gewande weiterbestanden, so ging
die Rose von dem Dienste der Isis mit dem Horusknaben auf dem Arm
in denjenigen der gleicherweiser dargestellten und verehrten Maria
mit dem Jesusknaben auf dem Arm über. Als Himmelskönigin wurde Maria
durch die Rose symbolisiert (rosa mystica) und diese Blume
— einst der Aphrodite-Isis heilig — wurde die Marienblume par
excellence, mit der man die Marienbilder im Marienmonat, dem Mai,
vorzugsweise schmückte und über die sich die Dichter des Mittelalters
in überschwenglichen Allegorien ergingen. In vielen Legenden wird sie
gefeiert und dient öfter als Veranlassung zur Gründung einer Kirche
oder Kapelle. Man denke nur an die berühmte Sage, die sich an den
uralten Rosenstock von Hildesheim knüpft. In anderen Fällen wird sie
als Liebeszeichen der Himmelskönigin vom Himmel auf die Erde gesandt,
und dieser zu Ehren wird auch die bei Buddhisten und Muhammedanern
gebräuchliche Gebetschnur, als deren Vorgänger sich christliche Mönche
und Einsiedler zum Abzählen ihrer Gebete und Psalmen loser kleiner
Steinchen bedienten, Rosenkranz genannt.
Im Mittelalter, wo so viele Kulturen zugrunde gingen, blieben doch
Rose und Lilie als besonders der Himmelsmutter geweihte und mit ihr
in Zusammenhang gebrachte Blumen, die zudem verhältnismäßig leicht
zu ziehen waren, in den Gärten Mitteleuropas gewöhnlich. Die Dichter
dieser Zeit, denen keine große Auswahl solcher Blumen für ihre
Schilderungen zu Gebote standen, sprechen öfter von diesen beiden
Edelblumen, die die himmlische Anmut und Reinheit der heiligen
Jungfrau darstellen sollten. Und wie gotische Kirchen sich mit
steinernen mystischen Rosen schmückten, so pflegte auf den Bildern
der Verkündigung der Erzengel Gabriel den schlanken Lilienstengel
zu tragen, deren weiße Blüten aber charakteristischerweise nur
Blumenkelche ohne Staubfäden — zur Versinnbildlichung der unbefleckten
Empfängnis — aufweisen.
[S. 456]
Auch in die Wappensprache jener infolge des starken Vorherrschens
der Analphabeten bildlich denkenden Zeit gingen beide Blumen über.
Wie drei Lilien, die angeblich aus Lanzenspitzen hervorgegangen sein
sollten, seit 1150 das königliche Wappen und das Sinnbild des legitimen
Königtums Frankreich waren, die auch der Jeanne d’Arc, der Jungfrau
von Orleans, bei ihrer Erhebung in den Adelstand durch Karl VII. am
17. Juli 1492 verliehen wurden, so bildete im 15. Jahrhundert die rote
und die weiße Rose das Abzeichen der Parteigänger der Häuser Lancaster
und York in den Wirren, die bei der Schwäche des Königtums in England
wüteten.
Auch auf Münzen erscheint die Rose nicht selten; ferner gewann sie
als geheimnisvolles Symbol der mittelalterlichen Bauhütten eine große
Bedeutung, die sich bei den Freimaurern bis auf den heutigen Tag
erhielt. In den Kelchblättern der Rosenknospe ist nämlich deutlich
das Pentagramm oder der Drudenfuß, das wahrscheinlich von den alten
Ägyptern übernommene geheime Erkennungszeichen der Pythagoräer, das
auch bei den Kelten als Druidenfuß ein heiliges Zeichen war und auf
alten gallischen Münzen nicht selten abgebildet ist, in der spiraligen
Aufeinanderfolge der einzelnen Blätter zu erkennen. Die geometrischen
Proportionen desselben bezeichneten die Jünger der Baukunst seit dem
hohen Altertum als göttliche Proportionen oder goldenen Schnitt, weil
alle ästhetisch schöne Baukunst von den altägyptischen Tempeln bis zu
den gotischen Domen des Mittelalters bewußt oder unbewußt in deren
Gesetzen wurzelt. Am häufigsten sind sie im Grundriß des Hauptschiffes
und in der Fassadengliederung zu erkennen.
Wie bei den Kulturvölkern des Altertums wurden auch bei den
Deutschen und den anderen europäischen Völkern des Mittelalters als
Frühlingsfeier Rosenfeste in sogenannten Rosengärten gefeiert; es waren
dies von Rosenhecken umgebene Plätze, in denen die Festfeiernden mit
Rosen geschmückt zusammenkamen. Solche Rosengärten gab es bei allen
größeren Städten, in Worms sogar zwei. Und da später statt rosa
mehrfach die Bezeichnung flos campi benutzt wird, so läßt
sich daraus schließen, daß sich die Rosengärten allgemein als mit
Blumen eingefaßte Plätze zur Abhaltung von Volksfesten umschreiben
lassen. Schon der altdeutsche Sänger sagt: „Diu rôse ist diu schoenste
under aller blüete“, daher ist auch jener höchst anspruchslosen
Zeit der Rosengarten der schönste unter allen Gärten, mit dem die
herrlichsten Dinge verglichen werden. Bei dieser großen Beliebtheit und
Volkstümlichkeit[S. 457] der Rosengärten ist es kein Wunder, daß sie dann auch
in Sage und Dichtung eine nicht unwichtige Rolle spielten. Es sei hier
nur an den zu Ende des 13. Jahrhunderts von einem ritterlichen Sänger
gedichteten „Kleinen Rosengarten“, der die Kämpfe Dietrichs von Bern
(des Ostgotenkönigs Theoderich des Großen, der 489 Odoaker bei Verona
besiegte und deshalb in der Sage als Dietrich von Bern weiterlebt)
mit dem Zwergkönig Laurin und dessen Zaubergarten schildert, und
an den von demselben Verfasser stammenden „Rosengarten von Worms“
erinnert, welch letzterer, der neben Rosen auch andere schöne Blumen
trug, vom Nibelungenhelden Siegfried mit elf anderen Helden für die
von ihm in Liebe umworbene Kriemhild, der Tochter des Königs Giebich
von Worms, bewacht wurde. Auch bei den festlichen Veranstaltungen
der Ritterzeit, besonders des 14. Jahrhunderts, spielte die Rose mit
anderen Blumen eine große Rolle. In diesem kriegerischen Zeitalter
wurden mit Vorliebe, wie wir auch auf zeitgenössischen Malereien und
Elfenbeinschnitzereien sehen, von festlich geschmückten Damen eine
für diesen besondern Zweck erbaute sogenannte Minneburg verteidigt,
die dann von den Herren eingenommen werden mußte. Als Wurfgeschosse
dienten allerlei Blumen, besonders Rosen, dann kleine Früchte,
Kuchen und andere Leckereien, statt siedenden Wassers wurden Parfüms
herabgegossen, bis endlich die Ritter unter einem Blumenregen die Burg
erstürmten und die Damen gefangen nahmen.
Die bei den Römern noch in spätester Zeit gefeierten Rosenfeste,
rosaria oder rosalia genannt, bei welchen man an
verschiedenen Tagen des Mai und Juni die Gräber mit Rosen schmückte und
gemeinsame Mahlzeiten abhielt, bei denen den Teilnehmern Rosen als die
Gabe der Jahreszeit verabreicht wurden, erhielten sich in Illyrien und
auf der Donauhalbinsel als rusalia weiter, und aus diesem mit
Pfingsten in Zusammenhang gebrachten Frühlingsfest entwickelte sich bei
den Serben, Slowenen, Weiß- und Kleinrussen, in ähnlicher Weise auch
bei den Walachen und Albanesen das fröhliche Naturfest rusalija.
Bei diesem wurde dann in Mißverstehung des ursprünglichen Sinnes des
von rosa her genannten Festes die Sage von Russalky geheißenen
überirdischen weiblichen Wesen abgeleitet, die um diese Zeit Feld und
Wald beleben und Fruchtbarkeit spenden sollen.
Mit diesem römischen Rosenfeste hängt auch die im Frühling, am vierten
Fastensonntage, dem Sonntage Lätare, vom Papst in feierlichem weißem
Gewande in Gegenwart des Kardinalkollegiums in[S. 458] einer mit Rosen
geschmückten Kapelle am Altare geweihte goldene Rose, die hernach
als segenbringend an Fürsten und Fürstinnen, auch Kirchen und Städte
verschenkt wurde. Er tauchte sie zuerst in Balsam, bestreute sie dann
mit Weihrauch, besprengte sie mit Weihwasser und betete indessen
zu Christus als der Blume des Feldes und zu Maria als der Lilie
des Tales. Als besondere Auszeichnung erhielt unter anderen auch
Kurfürst Friedrich der Weise von Sachsen kurz vor der Einführung der
Reformation, ebenso in jüngster Zeit die wahnsinnige Kaiserin Charlotte
von Mexiko und die bei aller Lasterhaftigkeit höchst bigotte Königin
Isabella II. von Spanien die goldene Rose. Nachrichten über diesen
Gebrauch, der auf altrömische Vorstellungen von der Bedeutung der
Rose als Symbol des Lebens und der Vergänglichkeit zurückgeht, gehen
bis ins 11. Jahrhundert, in die Zeit Leos XI., zurück. Dann werden
in der katholischen Kirche als weiterer Überrest der altrömischen
rosalia bis auf den heutigen Tag am Pfingstsonntage, den
pascha rosata (italienisch domenica de rosa), Rosen von
der Höhe der Kirche auf den Boden herabgelassen.
Bei solch großer Bedeutung, die der Rose in Volkssitte und Religion
zukam, kann es uns nicht wundern, daß ihre von den Römern durch
Vermittlung der Klöster übernommene Kultur auch in den trüben Zeiten
des Mittelalters in Europa erhalten blieb und mancherorts sogar die
Kunst des Treibens derselben geübt wurde. So berichtet uns der Chronist
Johann von Beka von einem am 6. Januar 1249 vom gelehrten Dominikaner
Albertus, wegen seiner ausgedehnten Gelehrsamkeit Magnus, der Große,
zubenannt (1193–1280), in Köln Wilhelm von Holland gegebenen großen
Bankett, an welchem „durch wahrhaft magische Kunst“ — wie sich der
erstaunte Berichterstatter ausdrückt — blühende Rosen zu sehen
waren. Wenn diese Blume auch späterhin bei allen Völkern Europas die
wohlverdiente Wertschätzung genoß, so spielt sie doch im Leben des
an bunten Farben und Wohlgerüchen sich ganz besonders erfreuenden
Orientalen eine noch viel wichtigere Rolle. Speziell in ihrer alten
Heimat Persien blüht sie beinahe das ganze Jahr hindurch in köstlicher
Fülle und in herrlich duftenden gefüllten Sorten, die bei den auch dort
noch seit alter Zeit gefeierten Frühlingsfesten eine wichtige Rolle
spielen. Wie haben die persischen Dichter seit dem Firdûsi, d. h. der
Himmlische, genannten Abul Kâsim Mançûr (940–1020) bis heute die Rose
als Königin der Blumen immer wieder gefeiert und die Liebe zwischen
ihr und der Nachtigall (einer Bülbül genannten Kurzfußdrossel aus der
Gattung Pycnonotus[S. 459] und nicht unsere einheimische Nachtigall)
besungen. Welche Wichtigkeit kommt ihr nicht zur Herstellung des dort
allgemein beliebten Rosenzuckerwerks und der köstlichen Rosenessenz zu,
welch letztere persische Ärzte im 9. Jahrhundert zuerst destillierten.
Ersteres, das wie im ganzen Orient, so auch in der Türkei und in
Griechenland durch Einlegen der wohlriechenden Rosenblätter in Zucker
gewonnen wird, ist der volkstümlichste Leckerbissen, während mit Honig
gekochte Rosenblätter in Limonaden das beliebteste Volksgetränk der
muhammedanischen Welt bilden.
Der Gesandte des deutschen Kaisers Ferdinand II. am türkischen Hofe
in Konstantinopel, Ghislenius Busbequius, erzählt im ersten, 1554
geschriebenen Briefe aus jener Stadt, die Türken dulden nicht, daß ein
Rosenblatt auf der Erde liege, denn sie glauben, die Rose sei aus den
Schweißtropfen hervorgegangen, die Muhammed auf seiner nächtlichen
Himmelfahrt vergoß — also die alte, nur islamisierte und ins
Prosaische übertragene Adonissage! Auf dem angeblichen Grabe des von
den schiitischen Persern verehrten 4. Kalifen Ali ben Abu Taleb, dem
treuesten Gefährten Muhammeds und Gemahl seiner Tochter Fatime, der 656
nach Othmans Ermordung zum Beherrscher der Gläubigen erhoben, aber 661
in Kufa ermordet wurde, bei Messar in der Nähe des heutigen Belch —
früher Bactra — sah der Reisende Vambéry die wunderwirkenden roten,
angeblich aus dessen Blut hervorgesprossenen Rosen (güli surch),
die ihm in der Tat an Geruch und Farbe alle andern zu übertreffen
schienen und die, weil sie nach der islamitischen Lokalsage nirgends
anderswo gedeihen sollen, auch nirgends angepflanzt werden.
Diese aus Persien stammende und im Altertum über die Mittelmeerländer
verbreitete Centifolie, von der bisher ausschließlich die Rede war,
ist diejenige Unterart der in Südeuropa und Westasien heimischen
Provencerose (Rosa gallica), die hier im Altertum und
Mittelalter ausschließlich bekannt war. Nun wurde in der Folge die
Centifolie vielfach mit der Provencerose gekreuzt und ergab die
ältesten Rosenhybriden der Ziergärten des Menschen. Eine uralte
Gartenrose ging auch durch Kreuzung der Centifolie mit der Hundsrose
hervor; es ist dies die Damascenerrose, die uns wohl schon im
Altertum als zweimal blühend gerühmte Rose von Paestum entgegentritt.
Wie die Centifolie 1332 aus Persien zunächst nach Südeuropa gelangte,
so brachte der französische Ritter Robert von Brie schon vorher, zur
Zeit der Kreuzzüge, die Damascenerrose nach seinem Schloß Provins in[S. 460]
der Champagne, wo sie kultiviert und durch Ableger weiter verbreitet
wurde.
Alle diese Rosen der älteren Gärten empfehlen sich durch
Widerstandskraft und Frosthärte von selbst, blühen aber nur einmal im
Jahre. Diesem Übelstand wurde erst in der Neuzeit abgeholfen durch das
Aufkommen der „Remontant“-Rosen, die auf verschiedene, sehr lange Zeit
blühende ostasiatische Arten zurückzuführen sind. Durch die Einführung
dieser hochkultivierten prächtigen ostasiatischen Rosenarten nahm erst
die Rosenkultur den großen Aufschwung, der diese Pflanze heute noch
mehr als früher zum bevorzugten Liebling zahlreicher Blumenfreunde
machte. Und zwar ist die indische Rose (Rosa indica)
die Ursprungsform der prächtigen ostasiatischen Rosen, die besonders
in China und Japan seit sehr alter Zeit kultiviert werden, frühe nach
Indien kamen und um 1698 aus China auch in unsere Gärten gelangten.
Zu ihnen gehören die Bengalrosen, die Teerosen und die
Monatsrosen. Letztere werden meist niedrig gehalten und sind zur
Einfassung von Rabatten, wie auch in Töpfen gezogen als Stubenpflanzen
beliebt und besitzen mehr flatterige, weniger gefüllte, hellrosa
Blüten. Bemerkenswerte Formen unter ihnen sind die Hermosa und die
Zwergröschen. Eine echte Edelrose ist die von Rosa chinensis
abstammende Teerose, deren Kreuzung mit der Provencerose die
Bourbonenrose, die Gloire de Dijon und Malmaison (nach
der Besitzung der rosenfreundlichen Gattin Napoleons I., Josephine,
so genannt), wie auch die La France, die bevorzugte Rose der
deutschen Kaiserin, hervorgehen ließ. Letztere, die erst 1868 in den
Handel gelangte, will, wie so manche andere, nur durch Ableger auf
ungeschlechtlichem Wege sich fortpflanzende Form, schon jetzt nicht
mehr recht gedeihen. Alle diese prächtigen Rosen, zu denen auch die
angenehm duftende, gelbblühende Marschall Niel gehört, besitzen die
vorzügliche Eigenschaft, zu „remontieren“, d. h. nicht die Periode des
Blühens auf eine kurze Zeit zu beschränken, sondern ihre prächtigen
Blüten Wochen und Monate hindurch unausgesetzt zu entfalten. Sie
verdanken diese Eigenschaft der Einwirkung der indischen Rose, welche
überhaupt keiner Winterruhe bedarf und deshalb auch zur Kultur in den
Tropen empfohlen werden kann. Da aber die Stammart ein Kind der Tropen
ist, so müssen diese gegen Kälte empfindlichen Rosensorten im Winter
sorgfältig vor dem Erfrieren geschützt werden.
Schon in England, aber noch viel häufiger in Südeuropa, besonders
der Riviera, begegnet uns die in Südwestchina (Yün-nan) heimische[S. 461]
kletternde, stachellose Banksrose (Rosa banksiae) mit
halbgefüllten hellgelben oder weißen Blüten und kleinen Früchten.
In unsern Gewächshäusern ist es nicht möglich, sie in so prächtiger
Entfaltung wie beispielsweise an der Riviera zu erhalten. Auch die
eigentlichen Kletterrosen mit kleinen weißen oder rosenroten
Blüten in Büscheln sind in China und Japan heimisch. Zu ihnen gehört
vor allem die japanische Büschelrose (Rosa multiflora),
die mit ihren pyramidenförmigen, reichblühenden Rispen in vielen
Farben und Formen unsere Lauben und Hauswände zieren. Die in
dunkelroten, kleinblütigen Büscheln blühende Crimson Rambler
dagegen stammt von der Prärierose des östlichen Nordamerika. Sie
dauert auch in unserem Klima gut aus und ist eine sehr anspruchslose,
reichblühende Pflanze, die deshalb sehr häufig bei uns angetroffen
wird. Von Abessinien bis Yünnan in Südwestchina heimisch ist die in den
Mittelmeerländern verwilderte Bisamrose (Rosa moschata)
mit weißen, angenehm nach Moschus duftenden, kleinen Blüten in großen
Endrispen. Sie wird neuerdings auch bei uns kultiviert, muß aber
gegen Kälte geschützt werden. Ähnlich wie die schwarze Johannisbeere
leicht nach Wanzen riechen dagegen die dottergelben Blüten der von
Kleinasien bis Afghanistan heimischen, ebenfalls im Mittelmeergebiet
häufig verwilderten gelben Rose (Rosa lutea), die mit den
ostasiatischen Teerosen in keinerlei verwandtschaftlicher Beziehung
steht. Eine ähnliche Blütenfülle und denselben Duft entwickelt die
wahrscheinlich nur als eine Abart dieser aufzufassende zweifarbige
Kapuzinerrose (Rosa bicolor), deren Blumenblätter außen
gelb, innen aber scharlachrot gefärbt sind. Die Zimtrose
(Rosa cinnamomea) mit rosa bis karminroten Blüten und braunroten
Zweigen ist auf den Gebirgen Mittel- und Südeuropas heimisch, während
die auch bei uns als Fruchtstrauch kultivierte „Kaiserin des Nordens“
mit rundlichplatten, großen, roten Früchten in Nordasien zu Hause ist.
Es ist dies ein Abkömmling der durch ihre Frosthärte ausgezeichneten
chinesischen Runzelrose (Rosa rugosa), die sich durch
kräftiges, etwas runzliges Laubwerk auszeichnet, von dem sich die
großen dunkelpurpurroten Blüten ebenso prächtig abheben, wie im
Herbste die hochroten, kleinen Äpfeln nahekommenden Früchte, deren
Kelchblätter nicht einschrumpfen, sondern frisch und grün stehen
bleiben. Japan eigentümlich ist die Chamäleonrose, so genannt,
weil sie ihre Farbe wechselt. Im Schatten ist sie weiß, im Lichte
dagegen rot. Bei Nacht nimmt sie eine wachsartig weiße Farbe an.
Dies geschieht nicht auf einmal, sondern die Blüten wechseln durch[S. 462]
einen blauen Ton schnell zum blassen Rosa, um schließlich wachsweiß
zu werden. Bringt man die Rose dann wieder an das helle Sonnenlicht,
so nimmt sie sehr rasch wieder ihre Scharlach- oder Päonienfarbe an.
Die reizende Moosrose aber ist ein Abkömmling der Centifolie,
wie die französische oder Essigrose mit gefüllten und
halbgefüllten, wohlriechenden, roten Blüten, die man zur Herstellung
von Rosenbonbons und Rosenlikör verwendet, ein solcher der Provencerose
ist. Wie man bei uns gelegentlich die Marschall Niel-Rose wegen ihres
feinen Duftes zur Herstellung von Bowle benutzt, so wird die herrlich
duftende morgenländische Centifolie zur Herstellung des kühlenden
Scherbets, d. h. arabisch Trank, wovon das italienische sorbetto
stammt, verwendet. Ihr gehören auch die Ölrosen von Kasanlik an, aus
denen das Rosenöl dargestellt wird. Aus zerstampften Rosenblättern
fertigt man in der Türkei mit Zusatz von Gummi schwarze Perlen an, und
schwach eingesalzene Rosenblätter finden in der Schnupftabakfabrikation
Verwendung.
Im Winter versorgt uns die Riviera mit Rosen, wie mit andern Blumen.
So führt Deutschland von dort jährlich für 3 Millionen Mark ein,
führt aber andererseits für 15 Millionen Mark veredelte Rosenpflanzen
aus. Überhaupt hat die Rosenzucht für die Gärtnerei eine sehr große
Bedeutung. Die Rosen variieren ungemein leicht und bis 1850 hat man
Neuheiten unter denselben fast nur durch Sammeln und Vermehren der
spontan entstandenen Sprungvarietäten gewonnen. Eine solche ist
beispielsweise die aus der Centifolie hervorgegangene Moosrose und
die Bourbonrose. Bei allen Pflanzen entstehen solche neue Formen
unvermittelt und zufällig. Der Mensch kann sie nicht erzeugen, nur
entdecken. Er kann dann allerdings nachträglich durch Kreuzung mit
einer verwandten Art, die gewisse, der Sprungvarietät abgehende Vorzüge
besitzt, diese seinen Wünschen entsprechend zu vervollkommnen suchen.
Die Kreuzung setzt er so lange fort, bis die gewünschte Kombination von
Eigenschaften bei seinen Pfleglingen eingetreten ist. Auf solche Weise
sind die meisten Neuheiten geschaffen worden, deren die Rosenzüchter in
ihren Katalogen insgesamt etwa 4000 aufzählen.
Noch der 1560 in Basel geborene und von 1588 bis zu seinem Tode 1624
als Professor der Botanik und Medizin daselbst wirkende gelehrte
Pflanzenkenner und Schöpfer der binären Nomenklatur, Kaspar Bauhin,
unterschied außer 19 wilden bloß 17 zahme Rosenarten. In solch
ungeahnter Fülle hat sich also seither unser Besitztum an Kultur[S. 463]rosen,
besonders seit der Einführung der ostasiatischen hochgezüchteten
Sorten, vermehrt. Und zwar kam zuerst 1780 die Bengalrose von niedrigem
Wuchs aus Kanton zu uns, dann 1807 die Banksrose aus Japan und China
und erst 1825 die hochstämmige Teerose ebenfalls von dorther. Die
neue Zeit vermehrte dieses Material durch Einführung weiterer neuer
Sorten und durch systematische Kreuzung. In Frankreich erreichte die
Rosenkultur durch Kaiserin Josephine in den Gärten ihres Schlosses
Malmaison und den wissenschaftlichen Begleiter Alexanders von Humboldt
auf seiner berühmten südamerikanischen Reise, den Botaniker Bonpland,
seit 1800 ihre höchste Entwicklung. In England geschah dies durch
verschiedene Privatpersonen, besonders in der Grafschaft Hertford. In
Deutschland war die Rosensammlung des kurfürstlichen Gartens in Kassel
berühmt; auch die Rosenau bei Koburg und die Pfaueninsel bei Potsdam
wiesen bedeutende Rosenkulturen auf. Die bedeutendste Rosensammlung
findet sich zurzeit im Schloßgarten zu Friedrichshof bei Kronberg im
Taunus, in denjenigen des Schlosses Monrepos bei Geisenheim am Rhein
und des Schlosses Königstein unweit von Homburg vor der Höhe.
Die Vermehrung der Edelrosen geschieht in der Weise, daß man ein Auge
auf einen Wildling der Hundsrose (Rosa canina) überträgt,
und zwar am Wurzelhals, wenn man Buschrosen ziehen will, sonst aber
auf einem niedrigen, mittelhohen oder hohen Stamm. Auch durch Ableger,
Wurzelschnittlinge, Ausläufer und Stecklinge werden die Rosen vermehrt.
Sie können unter Umständen ein Leben von mehreren hundert Jahren
erreichen. So galt der mit seinen Ausläufern 6,5 m hohe und
7,5 m breite Rosenstrauch auf dem Friedhof an der Außenmauer der
Apsis des Domes von Hildesheim schon im 17. Jahrhundert als uralt. Nach
Alexander von Humboldts „Ansichten der Natur“ wird dieses Rosenstocks
vermutlich schon im 11. Jahrhundert Erwähnung getan, und zwar durch
die Haushaltungsregister des Doms, in denen Ausgaben für die Pflege
eines Rosenstocks verzeichnet sind. Er ist über der Erde 50 cm
dick. Im Garten der Marineverwaltung von Toulon steht ein von Bonpland
eingesandter, 1813 gepflanzter Banksrosenstock, der heute über dem
Boden 90 cm Umfang hat und mit seinen Zweigen eine 25 m
breite und 6–8 m hohe Mauer bedeckt und während seiner Blütezeit
im April und Mai oft 25000 Blüten zu gleicher Zeit aufweist. Der größte
Rosenstock Europas befindet sich aber im Wehrleschen Garten in Freiburg
im Breisgau. Dieser, ein Wildstamm, wurde von seinem Besitzer im Jahre
1881 mit einer[S. 464] Teerose okuliert. Diese Veredlung machte gleich gute
Fortschritte und trug im folgenden Jahre bereits 27 Blüten. Vor einem
Jahrzehnt hatte der Baum einen Flächenraum von 88 qm erreicht
und trug 7400 Blüten. Ein Jahr später entwickelte er 8000 Blüten; zwei
Jahre später nahm er schon einen Flächenraum von 89 qm ein und
besaß über 10000 Blüten. Heute wird diese Zahl noch weit überschritten.
Der 1,10 m hohe Stamm besitzt einen Umfang von 34 cm. Das
an Draht gezogene Zweigwerk bildet eine große Laube.
Auch in China, das uns so herrliche Kulturrosen lieferte, wurde die
Rose seit dem hohen Altertum aus den einheimischen Wildlingen als
bevorzugte Gartenblume gezogen. Die Chinesen exportieren große Mengen
Rosenwasser, machen auch Riechkissen und Rosenbutter. In den Gärten des
chinesischen Kaisers werden Rosen in solcher Menge gezogen, daß die
daraus gewonnene Essenz jährlich gegen 100000 Mark einträgt. Aber nur
die kaiserliche Familie und die Mandarinen dürfen sich dieses Parfüms
bedienen.
Nächst der Rose ist die weiße Lilie (Lilium candidum)
eine der vornehmsten und geschätztesten Zierpflanzen. Diese auf
1 m hohem Stengel 5–20 reinweiße Blüten mit 5 langgestielten, in
große gelbe Antheren endigende Staubfäden tragende Pflanze wächst im
östlichen Mittelmeergebiet bis Persien und zum nördlichen Kaukasus
wild, verwildert auch sehr leicht und wurde ebenfalls in Westasien
zuerst vom Menschen in den Gärten kultiviert. Sie wird schon in den
ältesten auf uns gekommenen Gesängen der Perser und Syrier hoch
gefeiert und galt wegen der schneeweißen Farbe ihrer Blüten als das
Sinnbild der Unschuld und Reinheit. Wir sahen bereits, daß die im Alten
Testament als schuschan bezeichnete Blütenpflanze nicht die
Rose, sondern eine Lilienart, und zwar nicht sowohl die weiße, als eine
farbige Lilie, wahrscheinlich die ebenfalls glockige Blüten aufweisende
Kaiserkrone bedeutet. Mit dieser Bezeichnung einer auf dem Felde
wildwachsenden Lilie hängt auch der Name der persischen Hauptstadt
Susa zusammen; und zwar bedeutete dieses persische susan
höchstwahrscheinlich die weiße Lilie, nach der die Stadt genannt wurde.
Spricht doch noch der griechische Arzt Dioskurides im 1. Jahrhundert
n. Chr. von einer Liliensalbe (chrísma leírinon), „die auch die von
Susa stammende (súsinon) genannt wird“, und meint damit bestimmt
eine aus der weißen Lilie hergestellte wohlriechende Salbe. Wenn nun
in der Bibelübersetzung Luthers steht, daß die Baumeister den Säulen
und deren Kapitälen die Gestalt von Lilienstengeln mit deren Blüten
gaben, so ist dies dahin zu berich[S. 465]tigen, daß damit die auch von den
Griechen als Lilie (leírion) bezeichnete weiße Lotosblume, die
heilige Blume des Nils, verstanden war, die die phönikischen Baumeister
in Nachahmung der ägyptischen Vorbilder an den Stützen des reich mit
Gebälk aus Zedernholz vom Libanon ausgestatteten Tempels Jahves in
Jerusalem darstellten.
Tafel 141.

Die Wasserrose des Amazonenstromes (victoria regia) im
Botanischen Garten von Buitenzorg auf Java.
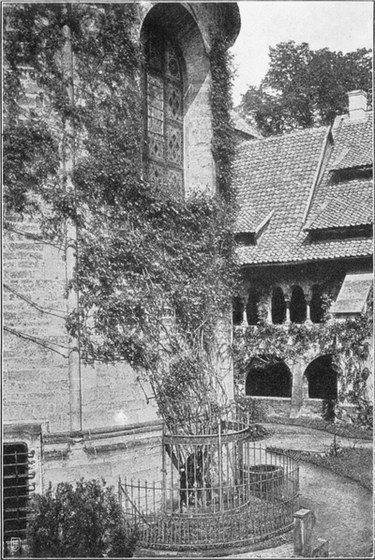
Der „tausendjährige“ Rosenstock am Hildesheimer Dom.
Tafel 142.

Eine Tulpenanpflanzung in Hillegom (Holland).

Eine Hyazinthenanpflanzung in Hillegom (Holland).
Bei den alten Griechen erwähnt schon Homer die weiße Lilie als
leírion mit dem schmückenden Beiwort tháuma idésthai,
d. h. ein Wunder zu sehen, und nennt die als besonders schön weiß zu
bezeichnende Haut des Helden Ajax als leírios, d. h. weiß wie
die Lilie. Wie die orientalische gefüllte rote Rose der Liebesgöttin
Aphrodite-Venus, so war die hehre weiße Lilie bei den Griechen und
den später von jenen hochgradig beeinflußten Römern der Hera-Juno,
der Gattin des höchsten der Götter, Zeus-Jupiter, heilig. Ein in den
Geoponika uns überlieferter griechischer Mythos tut uns kund, daß diese
Blume aus der Milch der Himmelsfürstin hervorgegangen sei. Es heißt
dort nämlich: „Als Alkmene (die Tochter des Königs Elektryon von Mykene
und Gemahlin des Amphitryon, Enkels des Perseus und Sohnes des Alkaios,
Königs von Tiryns) den Herakles — den sie von Zeus empfing — geboren
hatte, welcher eigentlich sterblich war, wollte ihm Zeus (sein Vater)
die Unsterblichkeit verleihen und legte ihn zu diesem Zwecke heimlich
an die Brust der schlafenden Hera. Der Knabe trank sich da tüchtig
satt, aber wie er abließ, floß noch Milch in Strömen aus, und was davon
an den Himmel kam, bildete dort die Milchstraße, was aber auf die Erde
lief, das brachte die Lilie hervor, die demnach die milchweiße Farbe
trägt.“
Im alten Griechenland wurde im Gegensatz zur einheimischen wilden
Lilie, die krínon hieß, die aus dem Orient dahin gelangte
weiße Lilie als leírion bezeichnet. Der griechische
Komödiendichter Aristophanes (455–387 v. Chr.) erwähnt aus ersterer
hergestellte Kränze, letztere dagegen beschreibt Theophrast in seiner
Pflanzengeschichte. Von den Griechen Unteritaliens lernten dann
die Römer die weiße Gartenlilie des Orients kennen, wobei sie das
griechische leírion sich als lilium mundgerecht machten.
In einer der Eklogen Virgils (70–19 v. Chr.) trägt der altitalische
Wald- und Feldgott Silvanus einen Kranz von (vermutlich bunten wilden)
Lilien, und an einer Stelle der Aeneis summen die Bienen um weiße
Lilien (candidum lilium). Bei Columella werden weiße Lilien
für die Bienen in Gärten gezogen, und in einer Elegie läßt Properz
(45–22 v. Chr) das Wohlwollen der Nymphen durch weiße Lilien gewinnen.
Plinius schreibt über sie: „Fast[S. 466] so edel wie die Rose ist die Lilie,
die ebenso zur Herstellung von Salbe und Öl benutzt wird; letztere
heißt lirinon. Die Lilie beginnt in der Zeit zu blühen, da
die Rosen in voller Blüte stehen, und gewährt dann, zwischen ihnen
stehend, einen herrlichen Anblick. Der Stengel, auf dem die Blume
steht, hat oft drei Ellen Höhe, die Blume selbst aber steht auf einem
schwachen Stiele, der nicht imstande ist, sie aufrecht zu tragen. Sie
ist blendend weiß, auswendig gestreift, am Grunde schmal, nach außen
allmählich becherförmig erweitert, mit zurückgebogenen Rändern. Der
Stempel (pilum) ist dünn, die Staubgefäße (stamina)
haben die Farbe des Safrans (crocus). Der Geruch des Kelches
(calyx) ist von demjenigen der Staubgefäße etwas verschieden:
bei Bereitung der Salbe und des Öles werden aber auch die Blätter nicht
verachtet.“
Wie die Lilie nach griechischem Vorbild der Juno heilig war, galt
sie den Römern auch als Sinnbild der Hoffnung und in der Kaiserzeit
als Emblem des Thronfolgers. Auf einigen römischen Münzen, die
solchen Thronfolgern galten, findet sich auf der Rückseite eine Lilie
abgebildet mit der Umschrift: spes populi romani (Hoffnung
des römischen Volkes). Die ältere antike Auffassung, die in dieser
reinweißen Blume ein Symbol der Reinheit und Unschuld sah, übernahm
dann die christliche Kirche, die die schöne, feierliche Blume der
Himmelskönigin Maria als Sinnbild ihrer reinen, unbefleckten Empfängnis
in die Hand gab. Später bemächtigte sich der Aberglaube dieser Blume
und ließ sie aus den Gräbern unschuldig Hingerichteter hervorwachsen.
Allgemein herrschte im Mittelalter der Glaube, daß der Mönch, der eine
Lilie in seinem Chorstuhle fand, drei Tage hernach sterben müsse. Ein
hochbegabter Abt der Benediktinerabtei Corvey an der Weser wurde,
wie eine Chronik meldet, durch einen solchen Fund in so gewaltigen
Schrecken versetzt, daß er den Tod davontrug. Sein Nachfolger bekannte
sich in seiner letzten Beichte schuldig, die Lilie selbst hingelegt zu
haben, um sich die angesehene Stellung seines Opfers zu verschaffen.
Wie in der Geschichte Englands die rote und weiße Rose, so spielte
in Frankreichs Geschichte die Lilie eine bedeutende Rolle. Nach der
Legende überreichte ein Engel dem Frankenkönig Chlodwig aus dem
Geschlechte der Merovinger, der 16jährig seinem Vater Childerich als
König der salischen Franken im heutigen Belgien folgte, 486 durch
den Sieg bei Soissons über den römischen Statthalter Syagrius das
Seinegebiet eroberte und 496 die Alamannen schlug, als er darauf mit
3000 Franken in Reims zum Christentume übertrat, einen Lilienstengel.
Später waren — seit 1150 nachweisbar — vermutlich aus[S. 467] Lanzenspitzen
zu stilisierten Blumen umgewandelte Lilien das königliche Wappen
Frankreichs, das von da an durch die ganze Geschichte Frankreichs
als Symbol des legitimen Königtums eine wichtige Rolle spielte, und
zwar waren es seit Karl VI. (1380–1422) deren in der Regel drei,
während vorher ihre Zahl unbestimmt gewesen war. Nicht nur in Wappen
und Siegel, auch auf Szepter, Kronenreifen, in Stickereien auf den
Gewändern der Könige und auf Wappenröcken der Herolde erschienen die
berühmten fleurs de lis. Und nach dem Aussterben der Kapetinger
mit Karl IV. im Jahre 1328 hielt die Seitenlinie der Valois bis zur
Hinrichtung Ludwigs XVI. und dann von 1815–1830 die Bourbonen die drei
Lilien als königliches Abzeichen bei.
Daß eine solche schon in ihrem stolzen Aussehen wahrhaft königliche
Blume auch sonst ohne sinnbildliche Bedeutung dekorativ eine große
Rolle spielte und auf allerlei Geweben, besonders Tapeten, nachgebildet
wurde, ist selbstverständlich. Außerdem wurden von mehreren Regenten
auch Lilienorden gestiftet, so z. B. um 1413 von Ferdinand, König von
Arragonien, 1546 vom Papste Paul III. (Alexander Farnese, geb. 1468,
regierte von 1534–1549, bestätigte den Jesuitenorden, ordnete 1542
eine allgemeine Inquisition zur Unterdrückung des Protestantismus an,
eröffnete 1445 das bis 1563 dauernde Konzil von Trient, war ein Gönner
der Künstler und Literaten), und zuletzt 1814 von dem nach dem Sturze
Napoleons I. zum Könige erhobenen Ludwig XVIII. Die Anhänger der mit
ihm zur Herrschaft gelangenden Bourbonen trugen die Lilien als Protest
gegen das Veilchen, womit sich die Getreuen des gestürzten Korsen
kenntlich machten.
Wie im Altertum war auch im Mittelalter die Lilie neben der Rose der
Stolz der europäischen Gärten; während aber letztere in der Neuzeit
seit der Einführung der edlen ostasiatischen Schwestern durch Kreuzung
und Variation eine große Fülle verschiedener Sorten bildete, hat sich
die Lilie unverändert in ihrem alten Adel erhalten und bildet den
vornehmsten Repräsentanten der Zierblumen des ländlichen Gartens,
während sie in den Städten eher zurücktrat und erst neuerdings wieder
neben ihren seither eingeführten farbenprächtigen ostasiatischen
Schwestern einige Bedeutung erlangte. Schon im Altertum hören wir
einige Stimmen, die von bunten Lilien reden. So sagt Dioskurides im
1. Jahrhundert n. Chr.: „Manche behaupten, es gebe auch purpurfarbige
Lilien,“ damit soll wohl eine Abart der weißen Lilie verstanden sein,
die er selbst noch nie sah. Wie eine solche erzeugt werden könne,
sagen uns die Geoponika, in denen es heißt: „Florentinus behauptet,[S. 468]
man könne die Lilien rot färben, wenn man zwischen die Schuppen der
Zwiebel die Farbe streue, welche cinnabari heißt (damit ist das
Drachenblut genannte dunkelrote Harz des Drachenbaums der Insel Sokotra
gemeint). Mit anderen Farben kann man die Lilie anders färben.“ Ein
anderes Rezept dazu gibt ein anderer griechischer Schriftsteller in
diesem Sammelwerke: „Will man Lilien von Purpurfarbe haben, so reißt
man 10 oder 12 blühende Lilienstengel aus und hängt sie in Rauch. Aus
ihnen wachsen kleine, zwiebelförmige Wurzeln hervor. Ist dann die Zeit
des Pflanzens da, so legt man den Stengel in Hefe von rotem Wein, bis
sie durch und durch rot sind. Nun pflanzt man sie in Erde und begießt
sie gehörig mit Hefe. Die aus solchen Stengeln wachsenden Lilien blühen
rot.“ Dieses phantastische Verfahren gibt dann Plinius als erwiesene
Tatsache wieder. Palladius (um 380 v. Chr.) schreibt: „Im Februar
bringt man die Lilienzwiebeln in die Erde, oder behackt sie, wenn sie
schon darin sind, mit großer Sorgfalt, damit die jungen Zwiebeln nicht
verletzt werden. Diese kann man später von der Mutterzwiebel ablösen,
verpflanzen und auf solche Weise neue Lilienbeete (lilietum)
erzielen.“ Nach Dioskurides wurden Lilienblätter auf Schlangenbiß- und
Brandwunden und mit Essig auf Quetschwunden gelegt und die gebratene
und mit allerlei anderen Stoffen vermischte Wurzel zu Heilzwecken
verschiedener Art benutzt; daneben war das Lilienöl als Arznei berühmt
und erhielt sich bis in die Gegenwart beim Volke in Ansehen. Ein
Rezept dazu gibt uns Palladius: „Um Lilienöl (oleum liliaceum)
zu bereiten, gießt man 1 Pfund Olivenöl auf 10 Lilienblüten, die sich
in einem Glase befinden, und stellt dieses 40 Tage an die Sonne.“ Ein
Konservierungsmittel für Lilien teilt uns ein Grieche in der Geoponika
mit: „Um Lilien das ganze Jahr hindurch frisch zu erhalten, verfährt
man folgendermaßen: Man pflückt die Blüten, ehe sie sich öffnen, samt
den Blütenstielen und legt sie in neue, irdene, nicht ausgepichte
Töpfe, deckt diese zu, und so bleiben die Blüten das ganze Jahr frisch.
So oft man welche brauchen will, nimmt man sie heraus, setzt sie der
Sonne aus, und sie öffnen sich, sobald sie warm werden.“
Im frühen Mittelalter wurde die Lilie, wie auch die Rose, mehr als
Arzneipflanze zur medizinischen Verwendung, denn als Zierpflanze
in den Gärten Mitteleuropas angepflanzt. Das besondere Lob der
Schönheit, das ihr der 849 verstorbene fränkische Mönch Walahfrid
Strabo spendet, als er sie im Klostergarten wachsen sah, beweist
aber, daß neben der Nützlichkeit auch die Freude an deren Schönheit
für die[S. 469] Kultur dieser Pflanze maßgebend war. Im späteren Mittelalter
bedienten sich die Ritter gerne der Gilgen oder Ilgen, wie damals
die Lilien im deutschen Sprachgebiet genannt wurden, als Zier, und
auch beim Volke waren sie beliebt, bis im Laufe der Neuzeit nach und
nach das Interesse an ihnen abnahm und sie infolgedessen nur noch
selten angepflanzt wurden. Erst in unserer Zeit ist wiederum eine
erhöhte Wertschätzung dieser prächtigen Zierpflanze, die nicht bloß
den schlichten Bauerngärten, sondern auch den schönen Parkanlagen der
Vornehmen sehr wohl ansteht, eingetreten. Dazu trug ganz wesentlich
die Einführung der nicht minder schönen ostasiatischen Lilien bei.
Eine erste Auswahl solcher brachte der 1796 in Würzburg geborene und
1866 in München gestorbene Arzt Philipp Franz von Siebold, der 1822
als Sanitätsoffizier in holländischen Diensten nach Batavia ging und
von 1823–1830 und abermals von 1859–1862 sich in Japan aufhielt, aus
letzterem Lande nach Europa. Unter diesen ist vor allem die auch
als Königin aller Lilien bezeichnete japanische Goldlilie
(Lilium auratum) zu nennen, die wie die weiße westasiatische
Lilie 1 m hoch wird und bis 26 cm große, perlweiße,
wohlriechende Blüten mit rotbraun bis purpurn punktierten und dem
Mittelnerv entlang, goldgelb gebänderten Blumenblättern besitzt.
Auch sie wird heute wie die weiße Lilie in mehreren Varietäten
bei uns kultiviert. Ebenso die prächtige Lilie (Lilium
speciosum) aus Japan mit 0,6–1 m hohem Stengel, eirunden
Blättern und sehr großen, überhängenden, mit zurückgeschlagenen
rosenroten Blumenblättern gezierten, nach Vanille riechenden Blüten
und die getigerte Lilie (Lilium tigrinum) aus China und
Japan, die an der Spitze des 2 m hohen Stengels zahlreiche
feuerrote, schwarzpunktierte Blüten in pyramidenförmiger Rispe trägt.
Von den feuchten Bergwäldern des Himalaja in 2000–3000 m
Höhe stammt die Riesenlilie (Lilium giganteum) mit
2–3,6 m hohem Stengel, gestielten, herzförmigen Blättern und
weißlichgrünen, innen schwach purpurgeflammten, höchst wohlriechenden
Blüten, während die dem einheimischen Türkenbund sehr nahe stehende
Lilium superbum mit 2 m hohem Stengel und scharlachroten
Blüten aus Nordamerika zu uns kam. Von Sibirien erhielten wir die
Prachtlilie (Lilium pomponium — seitdem Plinius
eine gewisse Birnensorte nach einem gewissen Pomponius benannte,
pflegte man überhaupt schöne Früchte und auch Blumen pomponisch zu
nennen) mit einfarbigen, mennig- bis scharlachroten Blüten. Ihr
in bezug auf Gestalt und Farbe der Blüte sehr ähnlich ist die im
Orient und in Kleinasien heimische Scharlachlilie (Lilium[S. 470]
chalcedonicum), die Frank-Leunis für die eigentliche krínon
Theophrasts und die hēmerokallís des Dioskurides hält.
Jedenfalls scheinen die alten Griechen sie gekannt und gelegentlich
auch in ihren Gärten angepflanzt zu haben. Neben allen diesen werden
aber auch bescheidenere Lilienarten bei uns angepflanzt, so die aus dem
Piemont zu uns gekommene Feuerlilie (Lilium croceum) und
der in Laubwäldern Mitteleuropas wachsende Türkenbund (Lilium
martagon) — so genannt weil seine Blüte mit den zurückgeschlagenen
Blumenblattzipfeln an einen türkischen Turban erinnert. Alle diese
verschiedenen Zierlilien werden bei uns besonders in Südfrankreich und
den englischen Scillyinseln im Ärmelkanal, in Nordamerika hauptsächlich
in Südkarolina und auf den Bermudasinseln im großen kultiviert, um von
dort aus die Zwiebeln in den Handel zu bringen. Noch viel mehr als hier
werden aber die schönen farbigen Zierlilien in Japan angepflanzt, von
wo aus jährlich über 5 Millionen Zwiebeln derselben ausgeführt werden.
Eine der schönsten Zierpflanzen Ostindiens, speziell Malabars, ist die
auch bei uns in Gewächshäusern gezogene rankende Prachtlilie
(Gloriosa superba), während die aus Südrußland und der Tartarei
eingeführte Zahnlilie (Erythronium dens canis) —
so genannt, weil die Zwiebeln in 3–4 Zähne gespalten sind — auch
bei uns eine nicht selten angetroffene Gartenzierpflanze ist. Die
Zwiebeln der letzteren Art dienen den Tartaren als Nahrungsmittel
und Aphrodisiacum, werden in Rußland auch als Mittel gegen
Eingeweidewürmer und Fallsucht verwendet.
In Persien, Afghanistan und Kaschmir heimisch ist die häufig in unseren
Gärten angetroffene Kaiserkrone (Fritillaria imperialis,
ersteres Wort stammt von fritillus, Knobelbecher, aus dem
die Würfel geworfen werden), die zu Anfang des 16. Jahrhunderts von
Persien nach Konstantinopel und 1570 durch Vermittlung des deutschen
Gesandten am türkischen Hofe Gislenius Busbequius in die kaiserlichen
Gärten zu Wien eingeführt wurde, von wo aus sie sich bald in fast
allen Gärten Mitteleuropas einbürgerte. Sie wird bis 1,2 m hoch
und trägt unter einem Schopfe grüner Blätter hängende gelblich- bis
bräunlichrote Blüten in Büscheln. Sie wird in vielen Varietäten mit
gelben, orangefarbenen bis feuerroten Blüten kultiviert und blüht im
ersten Frühling, wenn noch wenig andere Blüten zu finden sind. Die
Zwiebeln werden alle drei Jahre verpflanzt. Sie sind stärkemehlreich,
riechen höchst unangenehm, sind sehr scharf, selbst giftig, und wurden
früher auch arzneilich benutzt. Sie sind nach dem Kochen genießbar,
indem[S. 471] dadurch der scharfe Stoff sich verflüchtigt. Seit einiger Zeit
wird sie besonders in Frankreich zur Stärkegewinnung kultiviert. Von
1 Hektar soll man 6300 kg Stärkemehl erhalten. Der reichlich
von den Blüten zur Anlockung der die Befruchtung besorgenden Insekten
ausgeschiedene Honigsaft soll brechenerregend wirken. Die ihr nah
verwandte schwarze Lilie (Fritillaria kamtschatcensis)
mit schwarzpurpurnen Blüten wächst in Ostsibirien, Kamtschatka, Japan
und dem westlichen Nordamerika. Für die Bewohner Ostsibiriens und
Kamtschatkas sind ihre rundlichen, stärkemehlreichen Zwiebeln ein
wichtiges Nahrungsmittel. Zu dem Zwecke werden sie den Sommer über
mühsam auf den Grasfluren eingesammelt, weil die Pflanze nie gesellig
wächst; jedoch gewährt ihnen dabei die Tätigkeit der Kamtschatkaratten
oder Sammelmäuse (Hypudaeus oeconomus) große Erleichterung,
weil sie in ihren Vorratskammern vorzüglich diese Zwiebeln als
Winterproviant anhäufen, die dann der Mensch für sich in Anspruch nimmt.
Als letzte Verwandte ist noch die Brettspiel- oder
Schachblume, in Norddeutschland Kibitzei genannt (Fritillaria
meleagris — letzteres Wort heißt Perlhuhn, wegen der ähnlich
gescheckten Zeichnung der Blüte), zu nennen, die in Mitteleuropa bis
Norwegen und Südrußland sehr zerstreut auf feuchten Wiesen wächst.
Die 30–40 cm hoch werdende Pflanze treibt 1–2 hängende
Blüten mit roten und weißlichen viereckigen Flecken und wird in
verschiedenen Varietäten: weiß, gelb, gefleckt, rot, purpurrot,
schwarz, braungefleckt und aschgrau als Zierpflanze gezogen. Schon
Kaspar Bauhin (1560–1624), der von seiner Doktorpromotion im Jahre 1581
an als Botaniker in seiner Vaterstadt Basel wirkte und von 1614 an an
Stelle des verstorbenen Felix Platter als Stadtarzt und Professor der
Anatomie und Botanik daselbst amtete, kannte früh- und spätblühende
Spielarten der Schachblume. Diese muß also schon recht früh in die
Gärten übergesiedelt und in Kulturpflege genommen worden sein.
In dieselbe Familie der Liliazeen gehören auch die Tulpen, die
ihren Namen vom türkischen tulbend, d. h. Turban, erhielten.
So nannten die Türken die Gartentulpe, die wir von ihnen bekamen.
Von den etwa 50 Arten, die von Mittel- und Südeuropa bis Japan am
zahlreichsten wildwachsend angetroffen werden, ist bei uns die 25
bis 50 cm hohe gelbe Tulpe (Tulipa silvestris)
heimisch, die früher auf Waldwiesen häufig war und jetzt vielfach
in Obstgärten und Weinbergen in Menge angetroffen wird. Sie hat
als Kulturpflanze keinerlei Bedeutung erlangt, wohl aber die
Gartentulpe, die ein durch Kultur[S. 472] veredelter Abkömmling der
in den Steppen am Kaspischen Meer, im Gebiet des Don und in der
Krim heimischen Tulipa suaveolens mit sehr kurzem Stengel
und roten, am oberen Ende gelben, wohlriechenden Blüten ist. Unsere
Gartentulpe (Tulipa gesneriana, so genannt weil sie vom Züricher
Naturforscher Konrad Gesner 1559 zuerst beschrieben wurde) ist aber
keine einheitliche Art, sondern ein Sammelbegriff für zahlreiche in den
Gärten kultivierte Tulpensorten der verschiedensten, zum größten Teil
unbekannten Herkunft. Dem vorhin bei der Einführung der Kaiserkrone in
die Gärten Mitteleuropas erwähnten Gislenius Busbequius, dem Gesandten
Kaiser Ferdinands I. am türkischen Hofe in Konstantinopel, verdanken
wir die Einführung der türkischen Gartentulpe — wohl der Tulipa
suaveolens — im Abendlande. Im Frühjahr 1554 sah er auf einem
Ritte zwischen Adrianopel und Konstantinopel die von den Türken in
mehreren Arten in Gärten kultivierte rotgelbe Tulpe zusammen mit
Narzissen und Hyazinthen blühen. Sie gefiel ihm so gut, daß er sich
alsbald Samen von ihr zu verschaffen suchte. Dies gelang ihm auch nach
einiger Mühe, und diesen sandte er nun an einen Freund in Deutschland,
dessen Name uns unbekannt ist. Auch dessen Wohnort kennen wir nicht;
wir wissen nur, daß der Züricher Naturforscher und Arzt Konrad Gesner
(1516–1565) die damals neu in Europa eingeführte Zierpflanze im April
1559 in Augsburg blühen sah und sie als erster Abendländer beschrieb.
Im Jahre 1573 erhielt sie der Botaniker Clusius (Charles de l’Ecluse,
geb. 1526 in Arras, 1573–1587 Hofbotaniker in Wien, von 1593 bis zu
seinem Tode 1609 Professor in Leiden) und kultivierte sie als große
Rarität in den kaiserlichen Gärten Wiens. Auch von Leiden aus war er
für die Verbreitung dieser schönen neuen Blumenart sehr tätig. Diese
war aber schon lange vor ihm nach den Niederlanden gekommen; denn wir
wissen, daß sie schon ums Jahr 1570 in Mecheln blühte und damals bei
den Holländern freudige Bewunderung gefunden hatte. 1577 kam sie nach
England und eroberte sich im Laufe der nächsten Jahrzehnte ganz Mittel-
und Westeuropa.
Bevor wir uns weiter mit dem Triumphzuge der Gartentulpe durch das
Abendland beschäftigen, ist es am Platze, hier einige Worte über
die Türken, die sie uns mit der Kaiserkrone und den Hyazinthen
verschafften, und ihre Freude an Blumen zu sagen. Schon der
französische Reisende Belon spricht mit Bewunderung von den Gärten,
die er 1558 in der Türkei sah. Er sagt darüber: „Es gibt kein Volk,
das mehr die Blumen als Zierde liebt und sie höher schätzt, als die[S. 473]
Türken; dabei würdigen sie weniger deren Geruch, als besonders deren
Formen und Farben. Sie tragen mehrere Arten derselben in den Falten
ihres Turbans mit sich, ja, die Handwerker haben bei der Arbeit
Blumen von verschiedenen Farben in Wassergefäßen vor sich stehen. Das
Gartenwesen ist bei ihnen so gut als bei uns in großem Ansehen und sie
scheuen keine Kosten, sich fremde Bäume und Pflanzen zu verschaffen,
besonders solche, die schöne Blüten besitzen.“ Ähnlich drückt sich
Gislenius Busbequius aus, der von 1550 an als deutscher Gesandter
in Konstantinopel weilte, und fügt dem hinzu, daß die Türken häufig
Blumen verschenken und, obwohl geizig in andern Dingen, viel Geld
dafür ausgeben. Außer Rosen, Flieder, Veilchen, Anemonen, Lilien und
Hyazinthen zögen sie mit Vorliebe Tulpen. In jedem Frühjahre feierten
sie ein Tulpen- oder Lampenfest, indem sie den Tulpenflor abends mit
verschieden gefärbten Lampions beleuchteten. Einmal habe ein Großvezier
den Einfall gehabt, lebende Schildkröten zu Trägern seiner Lampen zu
verwenden; diese wandelnden Leuchter zwischen den blühenden Tulpen- und
Hyazinthenbeeten müssen allerdings dem Feste einen eigenartigen Reiz
verliehen haben.
Das türkische Erbe der Tulpen- und Hyazinthenverehrung traten die
Holländer an, die außer der Freude am Kleinen, Zierlichen besonders
die Farbenpracht der einzelnen Blüten schätzten. Und das Bestreben,
diese in immer neuen Farben und Formen zu züchten, beherrschte bei
ihnen vollständig die Gartenkunst. Diese sonst so nüchternen und ruhig
abwägenden Leute wurden bald von einer geradezu leidenschaftlichen
Begeisterung für diese schönen türkischen Ziergewächse ergriffen.
Schon lange vorher waren sie ja große Blumenfreunde gewesen. Der
französische Botaniker Lobel — nach welchem die schönen Lobelien den
Namen erhielten — betont in der Vorrede seiner 1576 erschienenen
Histoire des plantes die Liebhaberei der Vlämen für die Blumen
schon während der Kreuzzüge und zur Zeit der reichen, prunkliebenden
burgundischen Herzöge. Als dann die Holländer deren Erbe antraten,
brachten sie von ihren ausgedehnten Handelsreisen aus der Levante und
beiden Indien verschiedene Blumensorten mit nach Hause und zogen sie
mit Erfolg in ihren Gewächshäusern. Lobel urteilt, daß sie besser als
irgend eine andere Nation die exotischen Pflanzen zu behandeln wüßten,
so daß man in ihren Gärten mehr seltene Gewächse finde als im ganzen
übrigen Europa. Leider seien dann durch die Bürgerkriege und den Kampf
der protestantisch gewordenen Bewohner gegen das sie bedrückende
katholische Haus Habsburg viele der[S. 474] schönsten Gärten zerstört und die
Blumenkultur vielfach vernachlässigt worden.
Vorbildlich wirkte später in Holland der 1577 angelegte botanische
Garten der Universitätsstadt Leiden, in welchem als erstem in Europa
1599 ein Gewächshaus für ausländische Pflanzen angelegt wurde. Im Jahre
1633 enthielt das Pflanzenverzeichnis des dortigen botanischen Gartens
bereits 1104 Arten. Damals beschäftigten sich Magistratspersonen,
Gelehrte und wohlhabende Bürger der verschiedensten Berufszweige
mit Vorliebe damit, durch Einführung neuer Pflanzen die Botanik und
besonders die Blumenzucht zu fördern. Kein Kauffahrteischiff verließ,
wie ein damaliger Gelehrter bemerkt, einen holländischen Hafen, dessen
Kapitän nicht dazu verpflichtet wurde, von allen Orten, an denen er
landete, Samen, Wurzelknollen und, wenn möglich, auch lebende Pflanzen
mit nach Holland zu bringen. Die angesehensten Bürger Hollands
zeichneten sich besonders durch oft recht kostspielige Bepflanzung
ihrer Gärten mit ausländischen Gewächsen aus, und es war ihnen eine
Freude, Ableger davon dem botanischen Garten in Leiden zu schenken.
Dieser Garten enthielt, als der berühmte Hermann Boerhave (geb. 1668
in Voorhout bei Leiden, seit 1709 Professor der Medizin und Botanik,
später auch der Chemie in Leiden bis zu seinem 1738 erfolgten Tode)
dort als Lehrer wirkte und alles tat, um ihn zu mehren, bereits 6000
Pflanzenarten. Dieser Gelehrte gab zuerst den Fenstern der Treibhäuser
eine schiefe Lage, indem so, wie er sagte, die größte Menge von
Sonnenstrahlen Einlaß finden konnte. In diesem für ganz Europa als
Vorbild dienenden Garten wurden übrigens zuerst zu Anfang des 18.
Jahrhunderts Pelargonien (Geranien) vom Kap der Guten Hoffnung und
andere ausländische Zierpflanzen, die bald die Gunst auch der Laien
erlangten, eingeführt und zu Zierpflanzen mit größeren Blüten gezüchtet.
Als zu Anfang des 17. Jahrhunderts in Holland zuerst aus den
orientalischen Gartentulpen gefüllte gezogen wurden, brach eine neue
Ära in der niederländischen Blumenzucht an. Im Jahre 1629 zählte der
Engländer Parkinson bereits 140 Spielarten von Tulpen auf, die dort
kultiviert wurden. Bald brach in Holland eine eigentliche Tulpomanie
aus, deren Hauptsitz das diese Zierpflanze vor allem züchtende Harlem
war und hier in den Jahren 1634–1640 ihren Gipfel erreichte. Diese
Tulpenliebhabersucht, die auf einmal in Tulpenzwiebeln das höchste,
kostbarste Gut der Erde sah, ergriff Hoch und Niedrig, Arm und Reich.
Fabelhafte Preise wurden für neu auftauchende[S. 475] Spielarten bezahlt, so
daß ein wahrer Taumel die sonst so kaltblütigen Holländer ergriff.
Jedermann spekulierte in Tulpen und ganze Vermögen wechselten ihre
Besitzer. Durch die Tulpe Van Eyck wurde ein blutarmer Handelsgehilfe
zum mehrfachen Millionär. Eine einzige blühbare Zwiebel der Sorte
Semper Augustus brachte dem glücklichen Besitzer 13000 und eine
solche von Admiral Erckhuizen 6000 holländische Gulden ein, während
eine solche von Admiral Lietkens bis 5000 Gulden eintrug. Eine Zwiebel
der Marke Vive le roi wurde gegen 2 Lasten Weizen, 4 Lasten
Roggen, 4 fette Ochsen, 8 Ferkel, 12 Schafe, 2 Oxthoft (= 450 Liter)
Wein, 4 Tonnen Achtguldenbier, 2 Tonnen Butter, 1000 Pfund Käse, 1
Bündel Kleider und einen goldenen Becher eingetauscht. Im Jahre 1637
wurden nach Hirschfeld laut vorgelegtem Register in der kleinen Stadt
Alkmar zugunsten des Waisenstifts 120 Tulpen mit ihren Brutknollen für
9000 Gulden verkauft und ein einziges Exemplar der Sorte „Vizekönig“
trug 4203 Gulden ein. In Anbetracht des damaligen Geldwertes sind das
ungeheure Summen; denn zu jener Zeit galt ein Gulden in Holland so
viel, daß man damit 1 Bushel (= 36 Liter) Weizen kaufen konnte. Ganze
Vermögen wurden in Tulpen angelegt, so daß manche Reiche in ihren
Tulpenbeeten mehr als 500 klassifizierte Varietäten besaßen. Erst als
die Behörde 1637 ein Gesetz gegen das schwindelhafte Gebaren vieler
Tulpenhändler erließ, verlor sich nach und nach dieses Tulpenfieber
und wurde die Zucht dieser Zierblume, von der man später über 1000
Spielarten unterschied, in normale, gesunde Bahnen gelenkt.
Unsere Gartentulpen entstammen also mehreren Kreuzungsprodukten,
die allerdings nicht näher bekannt sind. Der wichtigste Grundstamm
derselben bildet jedenfalls die vorgenannte, in den Steppen Südrußlands
und Westasiens heimische Tulipa suaveolens, von der auch direkt
mehrere Varietäten, zum Teil mit gefüllten Blüten gezüchtet wurden.
Eine der beliebtesten Formen derselben ist die bekannte Duc van
Toll. Andere, im Orient wildwachsende Arten gelangten durch
Kauffahrer nach Italien und Südfrankreich, wo sie sich teilweise
einbürgerten und verwilderten, unter ihnen vor allem Tulipa
clusiana, die 1606 von Konstantinopel nach Florenz kam und von
hier nach Südfrankreich weitergegeben wurde. Von ihr und von der aus
der Türkei eingeführten Tulipa turcica, wie auch von der in
Südfrankreich, Italien und Kleinasien gedeihenden Tulipa praecox
zog man die verschiedensten Varietäten. Von Tulipa turcica
speziell stammen die monströsen[S. 476] Perroquetten oder Papageitulpen
mit sehr großen Blumen von schöner gelber und roter Farbe mit weit
abstehenden, zerrissenen und gefransten Blumenblättern. Auch die
Tulipa greigi aus Turkestan mit bräunlich gefleckten Blättern
und purpur- oder scharlachroten, am Grunde schwarzen Blumenblättern
ist mehrfach zur Kreuzung herbeigezogen worden. Durch Hybridisation
dieser Wildlinge mit den bereits vorhandenen Arten von Gartentulpen
und der letzteren wieder unter sich sind seit 1800 die verschiedenen,
in der Färbung von Violett- bis Blutrot durch alle Schattierung von
Gelb ins Weiße spielenden, ein- oder mehrfarbigen bis gefleckten
„Neutulpen“ entstanden. Unter diesen unterscheidet man gegenwärtig
als Hauptvarietäten Früh- und Spätsorten. Erstere, die Frühtulpen,
mit kürzerem Stengel, blühen an einem warmen Standorte schon im April
oder noch früher und lassen sich gut treiben. Unter den Spät- oder
Landtulpen — so genannt, weil ihre Zwiebeln kaum je in Töpfe, sondern
direkt ins Gartenland gepflanzt werden — unterscheidet man einfarbige
oder Muttertulpen (couleurs), buntfarbige oder gebrochene
(parangons), und unter diesen wiederum Bizarden mit gelbem und
Flamandes mit weißem Blütengrund. Violette Flamandes heißen mit einem
holländischen Namen bijbloemen, rote dagegen nach den Franzosen
roses. Die gefüllt blühenden Varietäten werden von den Blumisten
den einfachen Sorten nachgesetzt und meist zu Teppichbeeten und Gruppen
benutzt. Die Kultur der Tulpen stimmt im wesentlichen mit derjenigen
der Hyazinthen, die alsbald besprochen werden soll, überein. Die zur
Erlangung neuer Spielarten aus Samen gezogenen Tulpen blühen meist
erst im 7. Jahre, während die aus Zwiebeln gezogenen dies im 3., ja
teilweise schon im 2. Jahre tun.
Südeuropäische Gartenzierpflanzen sind die gelbe Taglilie
(Haemerocallis flava) mit reingelber Blumenkrone, wie auch deren
Abarten, die H. fulva mit rotgelben und H. alba mit
weißen Blüten. Schon Theophrast und Dioskurides nennen sie unter der
Bezeichnung hēmerocallís und sagen, daß namentlich ihre Zwiebel
arzneilich gebraucht werde. Noch viel mehr war dies im Altertum mit der
Meerzwiebel (Scilla maritima) der Fall, die nach diesen
beiden Autoren roh und noch häufiger, in Teig oder Lehm gehüllt, auf
glühenden Kohlen gebraten oder in Wasser oder Honig gekocht als Medizin
gegessen wurde. Außerdem diente sie zur Schärfung des Essigs. Plinius
beschreibt in seiner Naturgeschichte ausführlich die Herstellung des
Meerzwiebelessigs, der auch als Arznei genossen wurde. Er sagt von
ihm: „Er macht[S. 477] die Augen hell, ist bei Magenschmerz und Seitenstechen
heilsam, wenn man alle zwei Tage davon einnimmt. Übrigens ist er so
stark, daß man von ihm auf kurze Zeit halb ohnmächtig werden kann, wenn
man davon trinkt.“ Dieses an den Küsten des Mittelländischen wie auch
des Atlantischen Meeres wachsende Zwiebelgewächs wurde schon von den
alten Ägyptern arzneilich verwendet und hieß bei ihnen askili,
woraus später das arabische askil hervorging, während die
Griechen es skílla und die Römer nach ihnen scilla
nannten. Im Altertum pflanzte man diese Zwiebelart auf Gräber und
hing sie als Amulett vor die Türe, um vor Zauber und namentlich
Vergiftung geschützt zu sein. In Arkadien pflegten die Landleute die
Bilder des Wald- und Weidegottes Pan bei dessen Festen mit Meerzwiebel
zu bewerfen. In welch hohem Ansehen diese Pflanze im Altertume als
Arzneimittel stand, beweist auch die Stelle des Plinius, worin gesagt
wird: „Unter den Zwiebeln (bulbus) steht die Meerzwiebel
(scilla), obgleich sie nur als Heilmittel und zur Schärfung des
Essigs dient, in höchstem Ansehen. Sie zeichnet sich durch Größe und
scharfen Geschmack aus und wächst vorzugsweise auf den balearischen
Inseln, auf Ebusus (der Insel Iviza) und in Spanien. Der Philosoph
Pythagoras hat ein Buch über diese Pflanze geschrieben, in welchem
er ihre Heilkräfte zusammenstellt.“ Später wurde sie besonders durch
die Klöster verbreitet; auch Karl der Große hieß sie in seinen Gärten
anpflanzen. Das ganze Mittelalter hindurch bis in die Gegenwart wurde
sie bei uns in Töpfen gezogen, um als geschätztes Heilmittel zu dienen.
Es gibt wohl kaum ein besseres Bauernhaus, in welchem sie nicht zu
finden wäre. Hier fristet sie mit ihren faust- bis kindskopfgroßen
Zwiebeln zwischen den blühenden Geranien und Nelken auf den Gesimsen
vor den Fenstern ein beschauliches Dasein. Durch ihre harntreibende
Wirkung findet sie besonders bei der Behandlung von Wassersucht
Verwendung, während die zerquetschten und dann schleimigen Blätter auf
Wunden gelegt werden. Von ihren näheren Verwandten hat einzig die an
bewaldeten Orten Süddeutschlands häufige, in Norddeutschland dagegen
seltene Scilla bifolia wegen ihrer schönen blauen bis violetten
Blüten besonders zur Einfassung von Blumenbeeten in unsern Gärten
Eingang gefunden.
Eine weit größere Rolle als diese bescheidene Frühlingsbotin spielt
in der modernen Blumenzucht die Gartenhyazinthe (Hyacinthus
orientalis), die wie die Tulpe von den Türken aus den Gärten von
Bagdad und Aleppo nach Konstantinopel gebracht wurde und von da[S. 478] um die
Mitte des 16. Jahrhunderts nach Mitteleuropa gelangte. Die Stammform
derselben ist in den Steppen Westasiens heimisch und gelangte schon
im Altertum nach Kleinasien und Griechenland, wo sie verwilderte. Bei
den alten Griechen bedeutete sie die Blume der Trauer, die ihren Namen
nach der Sage von einem schönen spartanischen Jünglinge, dem Sohne
des Königs Amyklas von Lakonien, einem Lieblinge Apollons, erhielt,
der sich mit ihm gerne in Wettkämpfe einließ. Zephyros (der Westwind)
gönnte dem jungen Manne nicht die Gunst des Gottes, die er
vielmehr gerne besessen hätte, und beim Diskuswerfen lenkte er die
schwere Scheibe aus Erz so, daß sie den Kopf des Hyakinthos traf und
ihn tötete. Darüber war Apollon sehr betrübt. Wohl verstand er sich
auf die Heilkunst, aber über den Tod war ihm keine Macht gegeben. Um
wenigstens das Andenken an seinen Liebling der Nachwelt zu erhalten,
ließ er aus dessen Blut die würzig duftende Hyazinthe erstehen, deren
dunkelblaue Farbe Trauer bedeutet. Später war die hyákinthos
auch der Demeter ein Zeichen der Klage und der Trauer um ihre vom
Gotte der Unterwelt geraubte Tochter Proserpina. Doch wird sie bei den
alten Schriftstellern kaum je genannt. Der Grieche Pollux erwähnt sie
einmal in seinem Onomastikon als eine zu Kränzen verwendete Blume,
mit der sich vornehmlich junge Mädchen als Zeichen der Trauer beim
Verluste ihrer Gespielin bei deren Hochzeit schmückten. Und der Römer
Columella nennt die hyacinthus als die Blaue, in der Farbe
des Himmels Leuchtende, von der er auch eine weiße Abart als die
schneeige (niveus) erwähnt. Jedenfalls wurde sie im Altertum
nur ausnahmsweise als Gartenpflanze, höchstens etwa auf Gräbern
wegen des ihr anhaftenden Beigeschmacks der Trauer, kultiviert. Dem
Morgenlande verdanken wir ihre Zucht. Von den Arabern erhielten sie die
Türken, die sie gerne in ihren Gärten anpflanzten. Um die Mitte des
16. Jahrhunderts gelangte sie aus Konstantinopel nach dem Abendlande,
wo sie noch weiter veredelt wurde und die violenblaue Farbe der
Blumenblätter in Purpur, Karmin, Rosa, Dunkelblau bis fast Schwarz,
ferner in Weiß, Gelb und selbst Orange verwandelte. In Holland, wo sie
besondere Pflege gefunden hatte, verdrängte sie sogar mit der Zeit
ihre Schwester, die vormals so vergötterte Tulpe. Besonders in Harlem
wurde sie im großen gezogen und aus ihr durch immer weitergeführte
Kreuzung neue Spielarten geschaffen, die für teures Geld ihren Besitzer
wechselten. Außer einfachen erzielte man auch zwei- und dreifach
gefüllte Hyazinthen von großartiger Pracht. Sie galten für wenigstens[S. 479]
so wertvoll als die schönen und seltenen Tulpensorten, und wenn eine
neu auftauchende Varietät ihren Namen erhalten sollte, gab es ein
feierliches Tauffest, zu dem außer den Verwandten und Nachbarn auch die
Bewohner der Umgegend eingeladen wurden und bei dem es hoch herging.
Man konnte sich solches leisten; denn trotz der hohen Spesen war das
Geschäft infolge der sehr hohen für neue Arten bezahlten Preise sehr
einträglich.
Die erste Konkurrenz erwuchs der holländischen Hyazinthenkultur in
Berlin, dessen Sandboden diese Zucht in hohem Maße begünstigte. Der aus
Frankreich eingewanderte Kunstgärtner David veranstaltete hier 1740
die erste bedeutendere Tulpenausstellung und brachte dadurch diese
Blume in der Hauptstadt Preußens in Mode. Die in der napoleonischen
Zeit über Mitteleuropa hereinbrechenden kriegerischen und politischen
Ereignisse lenkten aber die Aufmerksamkeit des Publikums wieder
davon ab, doch erwachte sie nach den Freiheitskriegen von neuem. Die
Nachkommen Davids, seine Söhne Peter und David, unterhielten in der
Kommandantenstraße in Berlin prächtige Hyazinthenkulturen, die zu den
meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Berlins gehörten. Den Höhepunkt
erreichte hier die Hyazinthenzucht im Jahre 1830. Vor dem Schlesischen
Tor breitete sich ein 24 Morgen umfassendes Blumenparadies aus, in
welchem unter anderen Zwiebelgewächsen 4½ Millionen Hyazinthen
gezogen wurden. Ungezählte Scharen Neugieriger kamen zur Zeit der Blüte
herbei, um dieses wirklich sehenswerte Farbenwunder zu bestaunen.
Bis zum Jahre 1860 war sonst die Kultur der für den Handel gezogenen
Tulpen- und Hyazinthenzwiebeln fast ganz auf das Gebiet von Harlem
in Holland konzentriert. Hier wachsen diese schönen, genügsamen
Kinder der westasiatischen Steppe vorzüglich im Sandboden unmittelbar
hinter den Dünen. Jeder Gärtner spezialisiert sich begreiflicherweise
für eine gewisse Zahl von Typen, wodurch eine große Regelmäßigkeit
in der Produktion der Zwiebeln gewährleistet wird. Unbestritten
werden vor allem die Hyazinthen aus Harlem bezogen, wo man über 300
Spielarten derselben züchtet. Man zählt gegenwärtig in Holland mehr
als 2000 Blumenzwiebelzüchter und etwa 150 Exporthäuser, die diese
als Winterflor in Töpfen oder als erste Bepflanzung der Gartenbeete
sehr geschätzte Handelsware nach allen Weltteilen versenden. Jedes
Frühjahr gibt es öffentliche Versteigerungen in den Hyazinthen-
und Tulpenfeldern selbst. Außerdem wird wöchentlich einmal eine
Spezialbörse dafür in Harlem abgehalten. Die Blumenzwiebel[S. 480]kulturen
nehmen eine Oberfläche von etwa 3500 Hektaren ein und der Wert der
während der Saison exportierten Blumenzwiebeln erreicht 16 Millionen
Mark, was einem Bruttoertrag von beinahe 4800 Mark pro Hektar der
Kultur entspricht. 40 Prozent des Produkts wandern nach England;
Deutschland und Österreich nehmen 25 Prozent, die Vereinigten Staaten
18, die Nordländer, vor allem Dänemark, Schweden und Norwegen 9,
Frankreich und die übrigen latinischen Länder kaum 5 Prozent davon.
Die Vermehrung der holländischen Blumenzwiebeln, also der Hyazinthen
und Tulpen, erfolgt auf ungeschlechtlichem Wege durch Pflanzen der
Brutzwiebeln, von denen erstere mehrere, letztere dagegen meist nur
eine produzieren. Die Vermehrung durch Samen erfolgt, weil sehr langsam
vor sich gehend, nur, um die alten Varietäten zu regenerieren oder neue
zu erzielen. Während eine unverletzte Hyazinthenzwiebel nur eine kleine
Zahl Brutzwiebeln — zwischen 1–6 oder höchstens 8, oft aber auch gar
keine — bildet, liefert eine verletzte um die Verletzungsstellen herum
deren zahlreiche. Deshalb macht man zur Vermehrung der Blumenzwiebeln
gewöhnlich vier Schnitte durch den untern Teil derselben oder höhlt
ihn aus. Letzteres Verfahren liefert nämlich weitaus am meisten
Brutzwiebeln, während man vermittelst des Kreuzschnittes durch den
Zwiebelboden weniger, dafür aber, weil sie besser ernährt werden,
größere erhält, die sich rascher entwickeln und schneller zum Blühen
gelangen, nämlich meist schon ein Jahr nach der Verletzung der
Mutterzwiebel. Diese Operation wird meist im Juni vorgenommen, wenn
die Zwiebeln, die im Frühling blühten, aus dem Boden herausgenommen
werden, um erst wieder im Herbst ausgepflanzt zu werden. Früher
trocknete man sie einfach an der Sonne; jetzt aber setzt man sie nach
dem Einschneiden ihres Bodens der Luft aus, nachdem man sie mit Asche
oder Kalk bestäubt hat, wodurch die Wunden alsbald heilen. Sie werden
an einem luftigen Orte aufbewahrt und bilden an den Schnittstellen
bis zu 40 Brutzwiebeln. Im Oktober oder November pflanzt man die
Zwiebeln mit den Brutzwiebeln wie die gewöhnlichen Hyazinthenzwiebeln
in Erde, die das Jahr vorher mit Kuhmist gedüngt wurde. Viele dieser
Brutzwiebeln bilden im folgenden Jahre Blätter. Im Juni werden sie mit
den Mutterzwiebeln dem Boden entnommen, von letzteren abgelöst und
von der anhaftenden Erde gereinigt, getrocknet und an einem luftigen
Orte aufbewahrt. Im Oktober werden sie wieder wie gewöhnliche Zwiebeln
gepflanzt. Erst nach dem dritten Pflanzen erreichen sie eine[S. 481] genügende
Größe, um im folgenden Jahre blühen zu können. Als solche kommen sie
dann zum Verkauf.
Von den Verwandten der Gartenhyazinthe werden auch die auf Kulturboden
wie Äckern und Weinbergen bei uns wildwachsenden perlblütige
und Trauben-Bisamhyazinthe (Muscari botryoides und
racemosum) mit nach Moschus beziehungsweise Pflaumenduft
riechenden, einfachen blauen Traubenblüten gelegentlich als
Zierpflanzen in den Gärten kultiviert. Noch beliebter als diese, weil
schöner blühend, ist die aus China stammende eiblätterige Funkie
(Funkia ovata), mit gestielten, breiteiförmigen Blättern und
hellrosenroten Blüten. Ihr nahe steht die aus Südasien, besonders
Ceylon und Java stammende Tuberose (Polyanthes tuberosa)
— Tuberose, d. h. die Knollenwurzelige (von tubera Knollen)
genannt —, deren 10–20 in langgestielter, endständiger Traube
stehenden wohlriechenden, weißen Blüten besonders in Südfrankreich, wie
übrigens auch die Hyazinthen, zur Parfümgewinnung gepflanzt werden.
In Amerika, wohin sie früh gelangte, ist sie zum Liebling besonders
der Bewohner Perus geworden, die mit ihr vorzugsweise die Altäre in
den Kirchen schmücken, während die Damen sich mit Sträußen von ihr
versehen, um möglichst oft daran riechen zu können.
Als Topfzierpflanze ist bei uns auch die der vorigen ähnliche
doldenblütige Schmucklilie oder blaue Liebesblume
(Agapanthus umbellatus) — von agápē Liebe und
ánthos Blume — mit reicher Dolde von blauen Blüten auf 0,6 bis
1 m hohem Schafte vom Kap der Guten Hoffnung beliebt, während
das wohlriechende Maiglöckchen (Convallaria majalis)
mit seiner zierlichen Traube überhängender, weißer Blüten zu unseren
beliebtesten Frühlingsgartenpflanzen gehört. Als sehr frühblühende
Pflanze wird sie besonders in Berlin wie der Flieder getrieben und
die blühbaren Keime überallhin in die Blumengeschäfte versandt. Ihre
getrockneten Blüten bilden den Hauptbestandteil des Nießpulvers
und geben mit den gepulverten Samen der Roßkastanie den bekannten
„Schneeberger“ Schnupftabak, so genannt, weil er zu Schneeberg im
Königreich Sachsen zuerst bereitet wurde.
Auch der in Südeuropa heimische ästige Asphodill (Asphodelus
ramosus) wird wie sein Verwandter, der gelbe Asphodill
(A. luteus) in manchen Gärten gezogen. Ersterer, der an
der Küste überall auf Wiesen üppig wächst, wurde als Sinnbild der
Trauer von den alten Griechen auf die Gräber gesetzt und seine
Wurzelknollen, die nach Porphyrius auch der Philosoph Pythagoras
gerne gegessen haben soll, für[S. 482] die bevorzugte Speise der Geister der
Abgeschiedenen gehalten. Nach verschiedenen Stellen in der Odyssee
wandeln nach homerischer Anschauung die Geister der Verstorbenen in der
Unterwelt auf Asphodillwiesen (asphodēlós leimṓn), auf denen
von ihnen auch große Jagden abgehalten werden sollen. Plinius sagt
von ihm: „Der asphodelus soll ein vorzügliches Mittel gegen
Vergiftungsversuche sein, wenn man ihn vor dem Tore der Villa pflanzt.
Man ißt den Samen und die Wurzel, nachdem man sie geröstet hat, was
bei der letzteren in der Asche geschieht, worauf man Salz und Öl
hinzufügt und sie auch noch mit Feigen zusammenstampft; es ist dies ein
Gericht, das Hesiodus (der im 8. Jahrhundert v. Chr. in Böotien lebende
griechische Dichter) für vorzüglich wohlschmeckend hält. Seine Wurzel
gleicht einer mittelgroßen Kohlrübe (napus), und keine Pflanze
hat mehr Knollen (bulbus), denn es sind deren oft 80 zu gleicher
Zeit vorhanden. Es ist eine Erfahrungstatsache, daß mit Gerstengrütze
gekochte Asphodelusknollen abgezehrten und schwindsüchtigen Leuten
sehr gut bekommen und daß sie, mit Mehl zusammengeknetet, ein sehr
gesundes Brot geben. Nikander braucht Stengel, Samen und Knollen gegen
den Biß von Schlangen und Skorpionen, legt sie auch als Schutzmittel
gegen die genannten Tiere unter das Kopfkissen. In Kampanien gehen
die Schnecken dem Stengel dieser Pflanze eifrig nach und saugen ihn
aus. Man heilt übrigens mit asphodelus eine Menge Krankheiten,
verjagt und tötet auch die Mäuse damit, indem man mit ihm deren Löcher
verstopft.“ Nach Hesiod dienten die Wurzelknollen des Asphodill trotz
ihres scharfen Geschmackes den alten Pelasgern als Speise und lieferten
in Verbindung mit Malven ein „köstliches Gericht“ (wörtlich eine
königliche Speise), während Theophrast (im 4. Jahrhundert v. Chr.)
sagt, daß sie nur von Armen gegessen werden. Der Asphodill diente
im Altertum auch als Schutzmittel gegen Zauberei und wurde bei den
mittelalterlichen Ärzten zu einem der sieben Kräuter der Planeten
erhoben, auf welche besonders Saturn einen Einfluß ausüben und ihm
die Eigenschaft erteilen sollte, jeden, der ein Stück der Pflanze bei
sich trage, vor bösen Geistern zu schützen. Noch heute dienen die
Wurzeln zur Bereitung eines nahrhaften Mehles, das aus dem Orient, wo
die Pflanze sehr gemein ist, in den Handel gebracht wird. Wegen des
reichen Gehaltes an einer schleimigen, klebenden Substanz verwenden
die Buchbinder, Schuster und Sattler Toskanas und anderer Gegenden
Italiens die gepulverten Wurzeln als Kleister. Die goldgelbe, deshalb
auch Goldwurz genannte Wurzelknolle des gelben Asphodills diente[S. 483]
früher äußerlich als Amulett und innerlich als harntreibendes Mittel,
während sie neuerdings besonders in Algerien zur Zuckerfabrikation
und Schnapsbereitung dient. Auf den Höhen des Libanons dagegen
wächst der Asphodelus kotschyi (nach dem österreichischen,
1866 in Wien verstorbenen Botaniker Theodor Kotschy, der Syrien
bereiste und sie zuerst beschrieb, so genannt), dessen stärkemehl-
und gummireichen Wurzeln als nurtoak im Orient an Stelle von
Salep (Orchideenwurzelknollen) häufig Verwendung finden. Der deutsche
Reisende Strelack ernährte sich und seine Begleiter auf der zweiten
Reise durch Syrien vier Tage lang damit und brachte 1863 gegen
11000 kg derselben mit nach Deutschland, um das daraus gewonnene Mehl
als neues, billiges Nahrungsmittel in den Handel zu bringen.
Als Dekorationspflanze für Treppenaufgänge, Säulenhallen und in
Blumenbeeten dient die Flachslilie, der neuseeländische
Flachs (Phormium tenax), so genannt, weil ihre Blätter zur
Gewinnung einer äußerst zähen Faser gewonnen werden. Sie wurde von
Solander und J. Banks, den Begleitern von James Cook auf dessen erster
Reise um die Welt (1768–1771), in Neuseeland entdeckt, wo sie weite
Strecken bedeckt. Ihre Wurzelknolle ist wegen des Gehaltes an einem
sehr bittern Stoff nicht eßbar und dient den Maorimüttern dazu, ihre
Brustwarzen damit einzureiben, wenn sie ihre Kinder entwöhnen wollen.
Beliebte Treibhauszierpflanzen sind dagegen die wegen ihrer zwischen
Palmen und Lilien in der Mitte stehenden Tracht als Palmlilien
bezeichneten Yuccas, die sämtlich amerikanischen Ursprungs sind.
Namentlich wird die 1–1,3 m hohe, schöne Palmlilie
(Yucca gloriosa) aus Peru in verschiedenen Formen mit oft
bunten Blättern in großen Töpfen gezogen. Sie treibt umfangreiche,
rispige Ähren von prächtigen, hängenden, weißen Blüten. Ihre
Wurzelknollen werden von den Indianern zu Mehl zerrieben und zu Brot
verbacken; die Blätter dagegen liefern einen Faserstoff. Wichtiger
ist derjenige der in Virginien heimischen fadigen Palmlilie
(Yucca filamentosa). Deren Blattfäden werden in ihrer Heimat zur
Herstellung von Geweben und Stricken benutzt. Gleicherweise verwendet
man die der in Westindien und Mexiko heimischen aloeblätterigen
Prachtlilie (Yucca aloifolia), deren Blüten als Gemüse
verzehrt werden und deren Blätter in Mexiko zur Herstellung von Papier
dienen, während aus der Blattoberhaut künstliche Blumen verfertigt
werden. Alle Yuccaarten werden durch bestimmte kleine, meist weißlich
gefärbte Motten in der Weise befruchtet,[S. 484] daß sie den Pollen in die
ausgehöhlte Narbe der Blüte stopfen, damit die aus den daraufgelegten
Eiern sich entwickelnden Räupchen die zur Erhaltung der Art nötige
Nahrung finden. Wenn sie auch später einen Teil der sich entwickelnden
Samen verzehren, so hat dies nichts zu bedeuten, da die Pflanze auch
so über genügend Sämlinge verfügt, so daß der Dienst dieses Tierchens,
ohne den sie aussterben müßte, nicht zu teuer belohnt ist. Weil
diese kleinen Motten in Europa fehlen, tragen die bei uns gezogenen
Yuccaarten, auch wenn sie noch so schön blühen, niemals Samen.
Im Altertum spielte auch die rauhe Stechwinde (Smilax
aspera) — rauh, wegen der Stacheln an Stengeln und Blättern
genannt — als Arznei- und Zierpflanze eine gewisse Rolle, während eine
amerikanische Verwandte die offizinelle Sarsaparillwurzel liefert.
Diese südeuropäische Schlingpflanze, welche in Italien und Griechenland
bis 16 m hoch, namentlich an den Platanen hinaufklettert,
besitzt wohlriechende, weiße Blüten, die bei den alten Griechen mit
Efeu zusammen bei den Dionysosfesten zu Kränzen gewunden wurden. Nach
alter Sage sollte das Gewächs durch Verwandlung der Nymphe Smilax
entstanden sein, welche aus unerwiderter Liebe zu dem Jüngling Krokos
starb. Theophrast beschreibt sie ausführlich als smílax,
Dioskurides sagt: „Der rauhe Smilax (smílax tracheía) wird als
ein wichtiges Mittel gegen Gifte gebraucht,“ und Plinius schreibt
über sie: „Der smilax stammt ursprünglich aus Kilikien, ist
in Griechenland häufig, hat kleine, nicht ausgeschnittene, übrigens
denen des Efeu ähnliche Blätter. Die Blüten sind weiß und riechen
wie Lilien. Er ist bei allen Opfern und Kränzen ein Unglückszeichen,
weil er Trauer bedeuten soll, indem ein unglückliches Mädchen namens
Smilax in diesen Strauch verwandelt wurde. Der großen Masse des Volkes
ist dieser Umstand nicht bekannt; es entheiligt daher seine Feste oft
dadurch, daß es ihn statt des Efeus verwendet, wiewohl doch eigentlich
jedermann wissen sollte, daß die Dichter dem Vater Bacchus und dem
Silenus (nach griechischer Sage Sohn des Hermes oder Pan, Erzieher
und Gefährte des Bakchos, wird in der Kunst als dickbäuchiger Alter
mit Glatzkopf, Stumpfnase und Ziegenohren mit einem Weinschlauch
dargestellt) Efeukränze zuschrieben. Aus dem Holze des smilax
macht man auch Schreibtäfelchen; dieses hat die Eigentümlichkeit, daß
es, ans Ohr gehalten, einen leisen Ton von sich gibt.“ An einer andern
Stelle sagt dieser Autor: „Werden Blätter zu Kränzen verwendet, so sind
es vorzugsweise diejenigen des smilax und des Efeus.“ Noch[S. 485]
jetzt sind weit mehr als die Blüten die kugeligen, roten Früchte dieser
Stechwinde in Griechenland eine Zierde fast aller Blumensträuße und
dienen den jungen Damen, in die Haare geflochten, als schöner Kopfputz.
Als Arznei dagegen diente bei den alten Griechen und Römern der
stechende Mäusedorn (Ruscus aculeatus), ein
30–60 cm hoher, immergrüner Strauch mit blattförmigen, in einen
Stachel auslaufenden grünen Zweigen, auf deren Mitte die 3–5 grünlichen
Blüten stehen. Während aus dieser Pflanze in Italien häufig Besen
gemacht werden, wird sie bei uns nicht selten als Zierpflanze in Gärten
gepflanzt. Früher war sie als harntreibendes Mittel gebräuchlich.
Theophrast erwähnt sie als alexandrinischer Lorbeer und Dioskurides,
wegen ihrer Ähnlichkeit mit dem Myrtenstrauch, als wilde Myrte
(myrsínē agría). Er sagt von ihr: „Sie dient als Arznei, auch
verspeist man die jungen Sprossen als Gemüse; sie schmecken etwas
bitter.“ Plinius aber schreibt von ihr: „Der alexandrinische Lorbeer
wächst in größter Menge am Ida und bei Heraklea am Pontus, aber nur auf
dem Gebirge. Er dient der Kunstgärtnerei und zum Kranzflechten; die
Wurzel dient als Heilmittel.“
Auch der in den Mittelmeerländern wildwachsende gemeine Tamus
(Tamus communis) mit kugeligen, roten Früchten war bei den Alten
offizinell. Dioskurides bezeichnet ihn als „wilde Rebe“ und sagt von
ihm: „Wurzel und Früchte dienen als Arznei, die jungen Sprossen als
Speise.“ Soweit die Liliazeen.
Unter den Amaryllideen sind das Schneeglöckchen (Galanthus
nivalis), das auf Bergwiesen Süddeutschlands wild wächst und
bisweilen verwildert auch in Obstgärten angetroffen wird, und die
Frühlingsknotenblume (Leucojum vernum, — ersteres
Wort kommt aus dem Griechischen leukón íon, d. h. weißes
Veilchen), die in schattigen Laubwäldern Süd- und Mitteldeutschlands,
sehr selten in Norddeutschland angetroffen wird, beliebte
Frühlingsgartenzierpflanzen. Ihre Zwiebeln sind brechenerregend
und giftig, während die viel giftigeren der nahe verwandten
südafrikanischen Buphone toxicaria den Buschmännern einen
Bestandteil ihres gefürchteten Pfeilgiftes liefern.
Was die Lilien für die Alte Welt bedeuten, das sind gewissermaßen
die Amaryllisarten der Neuen. Diese Pflanzenfamilie hat ihren
Namen von der vom römischen Dichter Vergil (70–19 v. Chr.) in seinen
Hirtengedichten besungenen Hirtin oder Nymphe Amaryllis, einer
griechischen Bezeichnung, die die Glänzende, Leuchtende bedeutet.
Diese amerikanischen Lilien verdienen denn auch in der Tat wegen[S. 486]
ihrer schönen Blüten diesen sie auszeichnenden Namen. Unter ihnen
ist besonders Amaryllis formosissima zu nennen, die in ihrem
Vaterlande Südamerika oft ganze Ebenen bedeckt und zur Zeit der Blüte
einen wundervollen Anblick gewährt. Wegen ihrer großen, gelbroten, aber
duftlosen Blüten wird sie nebst den übrigen Arten und zahlreichen,
sehr verschieden gefärbten Bastarden häufig bei uns in Töpfen
kultiviert. Durch mannigfache Kreuzungen der Wildlinge wurden von
englischen, deutschen, holländischen und amerikanischen Gärtnern wahre
Wunderblumen gezüchtet. Die hauptsächlichste Stammutter der modernen,
im Herbste blühenden Sorten ist die schon im Jahre 1777 von den Ufern
der Batafogobai nach Europa eingeführten Amaryllis reticulata,
während die im Winter und Frühling blühenden Sorten von anderen Arten
abstammen. Die aus Westindien stammende Amaryllis belladonna mit
sehr giftiger Zwiebel hat Dolden von zart rosafarbigen Blüten, während
die gerade zu Weihnachten blühende Amaryllis tettaui feuerrote
Blüten besitzt. Die übrigen, zu Ausgang des Winters und im Frühling
blühenden Formen wechseln vom zartesten Rosa bis zum dunkelsten Rot.
Weiße Formen sind sehr selten und werden, obschon sie noch unvollkommen
in der Form sind, beinahe mit Gold aufgewogen. Zu den schönsten
Zwiebelgewächsen aus der Gattung der Amaryllideen gehören auch die
Eucharisarten, von denen Eucharis amazonica und candida
bei uns vielfach gezogen werden.
Häufig gezogene Gartenzierpflanzen sind ferner die Narzissen,
von denen die gelbe oder gemeine Narzisse (Narcissus
pseudonarcissus) mit langer, glockiger, am Rande welliger,
goldgelber Krone an der blaßgelben Blüte — die jonquille der
Franzosen — auf Bergwiesen wild wächst und manchenorts verwildert
ist. Auf Bergwiesen Griechenlands, Norditaliens und der Schweiz — z.
B. am Nordufer des Genfersees bei Les Avants — wächst dagegen die
echte Narzisse (Narcissus poeticus) mit weißer Blüte und
sehr kurzer, schüsselförmiger Krone mit feingekerbtem, scharlachrotem
Rande in Menge wild, während die ebenfalls höchst wohlriechende
Tazette (Narcissus tazetta) in Griechenland, an der
Riviera und in Südspanien in feuchten Niederungen und die späte
Narzisse (Narcissus serotinus) in mittleren Lagen Südeuropas
heimisch ist. Beide letztgenannte Arten tragen mehrere Blüten auf einem
Stengel, sind weiß und höchst wohlriechend; letztere unterscheidet
sich von der ersteren wesentlich dadurch, daß sie regelmäßig im
Herbste blüht. Tazetta ist das Verkleinerungswort des italienischen
tazza für Tasse, Schale und wurde dieser Narzissenart wegen der
Ähnlichkeit[S. 487] ihrer Blüte mit einem Täßchen gegeben. Sie wurde durch
Clusius (1526–1609) 1565 am Fuße des Berges von Gibraltar und die
Jonquille mit gelben Blüten und langer, gelber Krone ebenfalls von ihm
auf den Wiesen bei Cadix und Sevilla gefunden und dann in unsere Gärten
eingeführt. In Südfrankreich bereitet man aus den wohlriechenden Blüten
der Narzissen und Tazetten feine Parfüms.
Unter Narzisse verstanden die alten Griechen und Römer die echte und
die späte Narzisse. Nárkissos hieß nach der griechischen, uns
in den Geoponika und durch Ovids Metamorphosen erhaltenen Sage ein
schöner Jüngling, der sich durstend an einer Quelle lagerte, dabei
im Wasserspiegel sein Bild sah, von dessen Schönheit bezaubert er es
umarmen wollte, dabei ins Wasser fiel und ertrank. Die mitleidigen
Götter sollen ihn dafür in jene schöne Blume verwandelt haben.
Theophrast meint offenbar die späte Narzisse, wenn er schreibt: „Der
nárkissos wird von vielen auch leírion (Lilie) genannt.
Er trägt wie die Lilie eine weiße Blume auf dem Stengel und erzeugt
in einer häutigen Hülle eine große, schwarze, längliche Frucht. Fällt
diese ab, so wächst aus ihr eine neue Pflanze; man sammelt sie aber
auch absichtlich zum Kultivieren oder pflanzt die Wurzel. Diese ist
fleischig, rund und groß. Die Blüte erscheint erst spät, nach dem
Aufgang des Arkturos und zur Zeit der Herbst-Nachtgleiche.“ Auch Vergil
spricht von ihr, wenn er in seiner Georgica sagt: „Gern möchte ich
die üppig prangenden Gärten besingen, die zweimal im Jahre blühenden
Rosenbeete (rosarium) in Paestum, die bewässerten Endivien
(intybum), den am Ufer grünenden Sellerie (apium), die
sich im Grase dahinschlängelnde Gurke (cucumis) mit ihren
schwellenden Früchten, die spät in reichlicher Fülle blühende Narzisse,
die gebogenen Acanthusblätter, den bleichen Efeu, die den Strand
liebenden Myrten.“
Dioskurides dagegen meint mit seiner Beschreibung offenbar die echte
Narzisse, von der er sagt, daß sie am schönsten auf den Gebirgen
wachse und wohlriechend sei. Die gekochte zwiebelartige Wurzel bewirke
Erbrechen, werde aber mit Honig zusammengerieben auf Brandwunden gelegt
und sonst als Arznei gebraucht. Das aus ihr für den arzneilichen
Gebrauch mit Kalmus, Myrrhe und wohlriechendem Wein hergestellte
Narzissenöl werde zu arzneilichem Gebrauche bereitet, verursache
aber Kopfweh. — Wegen des roten Saums der Blütenkrone wurde diese
Narzisse von Vergil als purpureus narcissus und von Plinius
als purpureum lilium bezeichnet. Letzterer schreibt in seiner
Naturgeschichte: „Es gibt auch purpurfarbige Lilien, deren Stengel
zu[S. 488]weilen doppelt, deren Wurzel eine einzige große Zwiebel ist; man
nennt sie narcissus. Die eine Art hat eine weiße Blüte mit
purpurfarbigem Becher (calyx). Sie unterscheidet sich dadurch
von den eigentlichen Lilien, daß sie nur an der Wurzel Blätter hat.
Die besten Narzissen wachsen auf den Gebirgen Lykiens. Bei einer
dritten Art ist alles ebenso, nur der Becher ist krautartig. (?) Alle
blühen spät, nämlich nach dem Aufgang des Arkturus und während der
Herbst-Nachtgleiche.“ Letztere Behauptung hat er kurzweg dem Theophrast
nachgeschrieben, der dies nur von der späten Narzisse aussagt. Ein
Grieche bemerkt in den Geoponika, daß die Narzisse aus der Zwiebel
gezogen werde.
Unter den Irideen oder Schwertliliengewächsen sind vor
allem die Schwertlilien selbst zu nennen. Unter ihnen haben
wir die überall in stehenden Gewässern Europas wildwachsende,
0,6–1 m hohe gelbe Schwertlilie (Iris pseudacorus, d. h.
falscher Acorus, weil sie vor der Blütezeit mit dem Kalmus Ähnlichkeit
hat). Sie hat große, gelbe Blüten und einen kurzen, innen rötlichen,
ausdauernden Wurzelstock mit scharfem Saft, der früher als falscher
Kalmus oder Gilgenwurzel (Gilge ist die im Mittelalter gebräuchliche
Bezeichnung für Lilie) benutzt wurde. Dann die bis 1 m hohe
blaue oder deutsche Schwertlilie (Iris germanica)
mit dunkelblauen Blüten. Sie hat ihre Heimat im Mittelmeergebiet und
wurde jedenfalls schon von den Römern über die Alpen gebracht, wuchs
vermutlich auch in den Gärtlein der mittelalterlichen Burgen, und ist
nicht nur an Orten, wo solche standen, sondern auch sonst an sonnigen
Abhängen und felsigen Örtlichkeiten, an denen es ihr warm genug ist,
völlig verwildert. Sie zählt von alters her zu den beliebtesten
Gartenpflanzen, ist bei aller Anspruchslosigkeit äußerst dankbar und
hat sich infolgedessen überall leicht eingebürgert. Auch in England
wurde sie vor dem Jahre 1597 angepflanzt. Sie hat mit der Zeit
zahlreiche Spielarten mit dunkelvioletten, bläulichweißen, hellgelben
und andern Blumenblättern hervorgehen lassen und findet vielfach zur
Ausschmückung von Böschungen Verwendung.
Tafel 143.
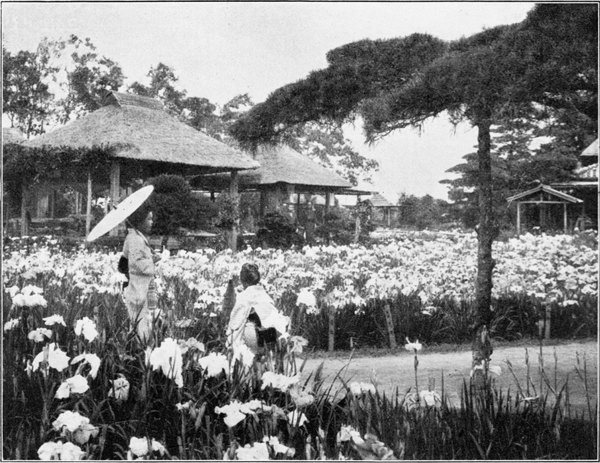
Beet verschiedenfarbiger Schwertlilien in einem
japanischen Garten bei Tokio.

Eine Chrysanthemum-Ausstellung im kaiserl. Palast
in Tokio.
Tafel 144.

Unter einer blühenden japanischen Glycine.

Mit Blumen geschmückte japanische Sänfte.
Ebenfalls in Südeuropa wie auch im Orient heimisch ist die
bleiche Schwertlilie (Iris pallida) mit blaßvioletten,
wohlriechenden Blüten und die florentinische Schwertlilie
(Iris florentina) mit weißen, an der Basis braun geaderten,
wohlriechenden Blüten. Der knollige Wurzelstock dieser drei Arten
kommt als angenehm duftende „Veilchenwurzel“ in den Handel. Zu dessen
Gewinnung werden besonders die blaue und bleiche Schwertlilie in
Italien, speziell in Tos[S. 489]kana um Florenz herum, auf Hügeln oder an
Bergabhängen zwischen Weinbergen kultiviert. Nach drei Jahren wird der
fleischige Wurzelstock geschnitten, geschält, gereinigt und an der
Sonne getrocknet. Dadurch bekommt der frisch widerlich riechende und
scharf bitter schmeckende Wurzelstock einen angenehmen veilchenartigen
Geruch und milden Geschmack. Sein riechendes Prinzip Iron ist identisch
mit dem Jonon der Veilchenblüten. Es ist also der Name Veilchenwurzel
sehr wohl angebracht. Sie diente früher als Amulett gegen die Pest,
während man jetzt aus ihr Rosenkränze und kleine Schmucksachen
schnitzt, Stäbchen zum Daraufbeißen für zahnende Kinder schneidet und
sie zur Herstellung von Zahnpulver, Brusttee, Pulver zum Bestreuen von
Pillen und Aromatisieren von Haarpudern verwendet. Im Orient dient
der gepulverte Wurzelstock zum Schminken, indem die darin enthaltenen
spitzigen Kristallnadeln von kleesaurem Kalk beim Reiben die Haut für
kurze Zeit entzündlich röten. Aus den Abfällen der Wurzel destilliert
man ein ätherisches Öl.
Schon bei den alten Griechen und Römern fand die Veilchenwurzel
arzneiliche Verwendung. Theophrast sagt von ihr: „Es gibt eine
wohlriechende íris, die in Illyrien besser ist als in
Makedonien; in Thrakien und kälteren Ländern hat sie gar keinen Geruch.
— Die Heilpflanzenverkäufer und Wurzelgräber geben die Vorschrift, man
solle beim Ausgraben der wilden Iris einen aus Mehl von Sommerweizen
und Honig gebackenen Kuchen der Erde zur Belohnung geben; man solle
ferner drei Kreise mit einem zweischneidigen Schwerte beschreiben, das
zuerst abgeschnittene Stück der Wurzel in die Höhe halten und dann
erst das übrige ausgraben.“ Dioskurides teilt mit, daß die Pflanze den
sonst dem personifizierten Regenbogen zukommenden Namen Iris von der
Vielfarbigkeit ihrer Blüten erhielt, „die entweder weiß oder blaßgelb
oder quittengelb oder purpurfarbig oder blau sind. Die wohlriechenden
Wurzeln werden zerschnitten, im Schatten getrocknet und, an Fäden
aufgereiht, aufbewahrt. Die beste Iriswurzel kommt aus Illyrien und
Makedonien, und von dieser sind diejenigen die besten, die dicht, zäh,
blaßgelb, sehr wohlriechend und von brennendem Geschmack sind, auch
müssen sie, während sie gestampft werden, Nießen erregen. Die libysche
ist kraftloser, weiß, von bitterem Geschmack. Alle werden, wenn sie
altern, von Würmern durchfressen, riechen aber dann noch besser; man
gebraucht sie gegen vielerlei Leiden.“ Auch Plinius bespricht die Iris
in seiner Naturgeschichte ausführlich und sagt, die beste Iriswurzel
wachse in Illyrien, nicht an der Küste,[S. 490] sondern im Innern; ihr
nahe komme die makedonische und zuletzt komme die afrikanische, die
die größte ist und am bittersten schmeckt. „Auch die pisidische ist
brauchbar. Leute, welche Iriswurzeln sammeln, begießen sie drei Monate
vorher mit Honigwasser, um durch diese Opfer die Erde zu versöhnen.
Dann ziehen sie um die Iris mit der Spitze eines Schwertes einen
dreifachen Kreis und, haben sie dieselbe herausgenommen, so heben sie
sie sogleich zum Himmel empor. Sie ist von Natur hitzig und erzeugt
beim Anfassen eine Art Brandflecken. Früher wurde das beste Irisöl
(irinum) auf der Insel Leukas und in Elis bereitet, wo man die
Iris seit langer Zeit zu diesem Zwecke anpflanzt. Jetzt bekommt man
auch vortreffliches aus Pamphylien, Kilikien und aus dem Norden. —
Man bindet den Kindern zum Schutz gegen Krankheit eine Iriswurzel um,
vorzüglich, wenn sie Zähne bekommen oder am Husten leiden; auch kaut
man die Wurzel, um den Geruch des Atems zu verbessern, braucht sie
ferner gegen viele Übel. Beim Sammeln wird die Vorschrift beobachtet,
daß man sie mit der linken Hand ausreißt und dabei sagt, welchen
Menschen und welche Krankheit man damit heilen will. Die Kräutersammler
verfahren übrigens beim Sammeln der Iris und einiger anderer Pflanzen,
z. B. des Wegerichs (plantago), ganz heimtückisch. Sie
behalten nämlich einen Teil der Pflanze zurück und graben ihn wieder
am Fundorte ein, wenn sie schlecht bezahlt werden, gewiß, um so die
Krankheit, welche durch die Pflanze geheilt wurde, wieder zum Ausbruch
zu bringen.“ Endlich wird in den Geoponika gesagt: „Die illyrische
Iris wird vom Januar bis zum April in Gärten gezogen, indem man
Wurzelsprossen von alten Stämmen trennt und einpflanzt.“
Neben diesen werden noch viele andere Arten von Schwertlilien in
unseren Gärten gezogen, so die ebenfalls aus den Mittelmeerländern
zu uns gekommene bunte Schwertlilie (Iris variegata)
mit gelben, dunkelviolett geaderten Blüten, die englische
Schwertlilie (Iris anglica) mit wohlriechenden, weißen
Blüten, an deren Grunde sich blaue oder purpurrote Flammen und Flecken
befinden, die ähnlich gezeichnete, nur noch farbenreichere spanische
Schwertlilie (Iris hispanica), die Zwergschwertlilie
(Iris pumila) mit niedrigem Stengel und dunkelvioletten Blüten,
die in zahlreichen Varietäten besonders zur Einfassung von Blumenbeeten
verwendet werden. Ferner die sibirische Schwertlilie (Iris
sibirica) mit schmalen Blättern und hellblauen, violett geaderten
Blüten, die auch in mehreren Varietäten besonders in feuchtem Boden
kultiviert wird. Gleichfalls viel Wasser verlangt[S. 491] die prächtige,
große Blüten besitzende Iris laevigata aus Sibirien und
Japan und die Iris kämpferi aus Japan, die eine besondere
Ähnlichkeit mit unserer gelben Schwertlilie aufweist. Beide wurden in
verschiedenen Varietäten bei uns eingeführt und können, da sie auch
bei uns winterhart sind, zur Einfassung von Teichen und Wasserläufen
sehr empfohlen werden. Im Jahre 1830 kam aus Persien die düstere,
fast schwarzblühende Iris susiana und später aus dem Kaukasus
die Iris iberica zu uns. Alle diese Schwertlilienarten lieben
die Sonne, die für ihr reichliches Blühen unerläßlich ist. Neben
den bunteren Schwestern behauptet immer noch die mit am reichsten
blühende, in ihren Ansprüchen äußerst bescheidene deutsche Schwertlilie
eine wichtige Stellung unter dem Schwertlilienflor. In den alten
Sorten ziert sie die prunkvollen Herrschaftsgärten so gut wie die
bescheidenen Bauerngärtchen, in denen sie neben Rose und weißer Lilie
zum althergebrachten eisernen Bestande gehört. Besonders schön macht
sie sich in einer größeren Gruppe im grünen Rasen oder am Gebüschrande.
An die Irisarten schließen sich als deren nächste Verwandte die
Gladiolen an, von denen die meisten Arten in Südafrika heimisch
sind. Ihr wichtigster südeuropäischer Vertreter ist die Siegwurz
(Gladiolus communis), die 1 m hoch wird mit purpurroten,
weißen oder fleischfarbigen Blüten. Siegwurz heißt sie, weil ihr
süßlicher, schwach veilchenartig riechender Zwiebelknollen unter dem
Namen Siegwurz oder Allermannsharnisch zum Heilen von Wunden und
besonders als Amulett gegen Verwundung besonders von den Soldaten
getragen wurde. Die wichtigsten, der abgeschnitten zu Bucketts und als
Einzelpflanzen in Vasen höchst beliebten modernen bunten Spielarten
stammen von Gladiolus cardinalis mit scharlachroten Blüten und
Gladiolus psittacinus mit scharlachroten und gelben Blüten.
Beide stammen aus Südafrika und ergaben durch Kreuzung eine große Zahl
von Hybriden. Eine solche, besonders reichblühende und farbenprächtige
Varietät sind die von Van Houten in Gent gezüchteten Genter
Gladiolen, die zunächst, als von wärmeliebenden Eltern stammend,
noch nicht bei uns winterhart waren, bis sie es durch Kreuzung mit
einer von William Bull 1870 eingeführten winterharten Varietät
aus Natal wurden. Sie waren aber gleichwohl wegen verschiedener
Schönheitsfehler noch minderwertig und konnten deshalb nicht direkt als
Zierpflanzen verwendet werden. Dies war erst möglich, als Lemoine in
Nancy durch Kreuzung dieser Hybriden mit der schönen südafrikanischen
Gladiolus sandersi, die nicht nur winterharten, sondern auch
buntgefärbten Nancyer Gla[S. 492]diolen mit auffallend großen,
punktierten Blumenblättern züchtete. Sie können nun im freien Lande
kultiviert werden, ohne daß ihre Knollen herausgenommen und wie noch
diejenigen der Genter Gladiolen in frostfreiem Raume überwintert werden
müssen.
Der eßbare Schwertel (Gladiolus edulis) in Südafrika
hat eine fast zusammengesetzte Blütenähre mit schönen Blüten und
eßbaren Zwiebelknollen. Die Zwiebeln des als Feldunkraut unter
Getreide in Südeuropa häufig anzutreffenden Gladiolus segetum
mit 4 cm langen purpurroten, rachenförmigen Blüten — dem
Xíphion der alten Griechen und dem gladiolus der alten
Römer, beides „Schwertchen“ wegen der schwertförmigen Gestalt der
aufrechtstehenden Blätter bedeutend — diente im Altertum als Arznei
und wurde zu Theophrasts Zeit mit Mehl verbacken gegessen. Plinius
sagt von ihr: „Man gräbt sie vor der Ernte aus und trocknet sie zum
Arzneigebrauch im Schatten.“
Wegen ihren bunten Farben als Gartenzierpflanzen sehr beliebte
Frühlingsblumen sind die in über 30 Spielarten gezogenen
Crocusarten, die zumeist Abkömmlinge des auf Bergwiesen
Südeuropas wildwachsenden Frühlingssafrans (Crocus
vernus) sind. Schon bei Homer wird der Crocus erwähnt, indem
es in der Ilias heißt: „Als Zeus sich auf dem Berge Ida lagerte,
ließ die Erde unter ihm frisches Gras, betauten lotós-Klee,
krókos und hyákinthos dicht und weich emporwachsen.“
Varro schreibt: „Im Herbste pflanzt man im Garten Lilien und Crocus“,
und Vergil in seiner Georgika: „Abends kehren die arbeitssamen
Bienen zum Stocke zurück; ihre Beine sind belastet mit Pollen vom
Thymian, auch suchen sie Nahrung am Erdbeerbaum (arbutus) an
den grauen Weiden (salix), an casia (wahrscheinlich
einer Daphne-[Seidelbast-]Art), rötlichem Crocus, fetten Linden
(tilia), rostbraunen Hyazinthen.“ Columella schreibt in seinem
Buche über Landbau: „In den Gärten suchen die Bienen Nahrung an weißen
Lilien, auch pflanzt man für sie Zwiebelknollen von korykischem und
sizilischem Crocus (Safran).“ Auf der Balkanhalbinsel, wo meist
Crocus sativus, der Safran, zur Gewinnung der Blütennarben
kultiviert wird, werden seine Knollen roh und geröstet gegessen, wie in
den Steppen Westasiens diejenigen der dort wildwachsenden weißen Lilie.
Solche eßbare Zwiebeln haben auch Ixia bulbifera und I.
crocata, schönblühende Verwandte des Crocus, von denen bei uns
über 20 Arten, meist vom Kap der Guten Hoffnung, in den mannigfachsten
Farben kultiviert werden, dann der bermudische Schweinsrüssel
(Sisyrinchium bermudianum), eine beliebte Gartenpflanze von
den Bermudas[S. 493]inseln mit violettblauen, im Schlunde gelben Blüten
und Haemodorum panniculatum Australiens, dessen blutrote,
scharfe Zwiebeln von den Eingeborenen geröstet gerne verspeist
werden. Endlich ist noch als letzte der Amaryllideen die rote
Tigerlilie Mexikos zu nennen, die nach dem gelehrten Jesuiten Giov.
Battista Ferrari (1584–1653), der auch mehreres über Botanik schrieb,
Ferraria tigrina genannt wurde. Wegen ihrer prachtvollen, innen
scharlachroten, schwarzrot getigerten oder marmorierten Blüten wird sie
nicht selten in Gewächshäusern gezogen.
Unter den Liliazeen sind noch die in 16 Arten im Kapland, in Ostafrika
und in Madagaskar heimischen Tritomaarten zu nennen, von denen
mehrere wegen ihren schönen Blütenähren bei uns als Zierpflanzen
kultiviert werden, zum Teil auch im freien Lande aushalten. Besonders
die über 1 m hohe Tritoma uvaria mit 30 cm
langer Ähre scharlachroter, zuletzt gelber Blüten wird in vielen
Varietäten kultiviert. Ebenso schöne Gartenzierpflanzen haben die
Tradescantien geliefert. Es sind dies auf Amerika beschränkte
krautartige Pflanzen mit oft rispig zusammengestellten Blüten in
kurzen Trugdolden, von denen besonders häufig die Tradescantia
virginica aus den südlichen Vereinigten Staaten und aus Mexiko mit
violettblauen Blüten, weil winterhart, in unseren Gärten angetroffen
wird. Viel empfindlicher ist Tr. discolor aus Brasilien mit
weißen Blüten, die als Topfpflanze im Zimmer gezogen wird. Als
Ampelpflanzen dienen dagegen T. guianensis mit langen, hängenden
Zweigen und selten erscheinenden weißen Blüten und die ihr ähnliche,
nur etwas empfindlichere T. zebrina mit braunen, silberigweiß
gestreiften Blättern.
Ebenfalls aus dem tropischen und subtropischen Amerika kamen die
verschiedenen Cannaarten als beliebte Blattdekorationspflanzen,
die in Töpfen im Kalthause überwintern und im Frühjahr zu Gruppen
ins freie Land gesetzt werden, zu uns. Die älteste, schon im Jahre
1570 in Europa eingeführte und am meisten gepflanzte Art ist die
1,5–2,5 m hohe Canna indica mit roten Blüten, deren
erbsengroße, schwarze, harte Samen zu Rosenkränzen und Halsbändern
benutzt werden. Zu ihr kamen erst im 19. Jahrhundert auch gelbe und
buntgefärbte Arten, von denen der Blumenzüchter Crozy in Lyon (Depart.
Hyères) die wichtigsten seit dem Jahre 1875 einführte. Diese wurden
untereinander gekreuzt, so daß eine Menge von Spielarten vorhanden
sind. Die Wurzelstöcke müssen frostfrei überwintert werden. Im Garten
gedeihen sie besonders in sehr nahrhafter, lockerer Erde auf einer[S. 494]
meterhohen Unterlage von Pferdemist bei reichlicher Bewässerung. Aus
dem Wurzelstock der westindischen, in Peru Adeira genannten Canna
edulis, die im nördlichen Südamerika, besonders Brasilien, aber
auch sonst in den Tropen kultiviert wird, bereitet man das westindische
Arrowroot. Auch von anderen Arten wird der Wurzelstock als Gemüse
gegessen. Mit den verschiedenen Cannaarten wird meist die Rizinusstaude
und werden einige kleine Bananen, wie die seit 1829 aus Südchina in
unsere Gewächshäuser eingeführte Musa cavendishi (so genannt
nach dem Londoner Chemiker Henry Cavendish, 1731 bis 1810, der 1777
das Wasserstoffgas entdeckte) in Gruppen angepflanzt. Nur wenig über
1 m hoch wird die von Südafrika in unsere Warmhäuser eingeführte
Strelitzia reginae mit eigentümlich vogelartigen, blaugelben
Blüten.
Dann werden von den drei am Kap der Guten Hoffnung heimischen Arten
der Amaryllideengattung Clivia, Zwiebelgewächsen mit langen,
rinnenförmigen Blättern und glocken- oder röhrenförmigen Blüten, in
Dolden auf starken Schäften, Clivia miniata mit mennigroten
Blüten und C. nobilis mit scharlachroten Blüten, beide in
mehreren Varietäten im Gewächshaus wie im Zimmer kultiviert.
Als weitaus aristokratischste Mitglieder sind endlich unter den
Monokotylen die Orchideen zu nennen, die in bezug auf
Mannigfaltigkeit und absonderliche Gestaltung und Färbung der Blüten
im Pflanzenreich ganz einzigartig dastehen. Sie erhielten ihren Namen
vom griechischen órchis, was Hoden bedeutet, weil die damit
zunächst bezeichneten Erdorchideen der Gattung Orchis an dieses
Organ erinnernde doppelte Wurzelknollen besitzen, von denen die eine
jeweilen für das nächstfolgende Jahr angelegt wird. Schon im Altertum
wurden diese Knollen vom Menschen gesammelt und gegessen. Wegen ihrer
hodenartigen Gestalt glaubte man, daß ihr Genuß die sexuelle Potenz
beeinflusse. So schreibt schon Theophrast im 4. vorchristlichen
Jahrhundert: „Die órchis hat zwei Wurzelknollen, einen großen
und einen kleinen; der große soll sexuell kräftig machen, wenn man ihn
in Milch von einer auf den Bergen weidenden Ziege kocht, der kleine
soll aber die Kraft mindern.“ Dioskurides im 1. Jahrhundert n. Chr.
schreibt: „Die órchis hat ihre Blätter an der Erde um den
Stengel; dieser wird eine Spanne hoch und trägt purpurrote Blüten. Die
Wurzel ist knollig, länglich, doppelt, olivenförmig; die eine steht
höher, die andere tiefer. Diese ist voll, jene weich und runzlig. Sie
werden zum Verspeisen gekocht. Die Pflanze wächst in steinigem und
sandigem Boden.“ Noch[S. 495] heute werden die Knollen von verschiedenen
Orchisarten gesammelt und getrocknet, um als Salep oder
Geilwurz in den Handel zu kommen. Das Wort Salep ist aus der
arabischen Bezeichnung für diese Doppelknollen chusjata sslalab,
d. h. Fuchshoden verstümmelt. Bei allen polygamen Orientalen steht
diese Speise als angeblich die sexuellen Funktionen beförderndes Mittel
in hohem Ansehen und wird von vielen derselben mit Honig gekocht
regelmäßig zum Frühstück gegessen.
Von Erdorchideen finden wir am häufigsten verschiedene der in
schattigen Bergwäldern Asiens, Europas und Nordamerikas auf kalkreichem
Humusboden wachsenden Frauenschuharten in Gärten angepflanzt. So
zumeist den europäischen Frauenschuh (Cypripedium calceolus),
der bis nach Ostsibirien vorkommt und in Deutschland besonders in
Buchenwäldern auf Kalkboden vorkommt. Von anderen, noch prächtigeren
Arten, die als dankbar blühende und leicht zu erhaltende Zierpflanzen
im Zimmer kultiviert werden, sind zu nennen Cypripedium venustum
aus Neapel mit hellgefleckten Blättern, schönen rötlichgrünen,
purpurrötlichen und blaßbraun gezeichneten Blüten und C.
barbatum in Südindien und auf Java mit schwärzlichgrün, netzartig
gezeichneten Blättern und schönen, violett und weißgefärbten Blüten.
Gleich den Erdorchideen legen auch die als Überpflanzen (Epiphyten)
auf Bäumen der dichten, feuchten Wälder der Tropen lebenden
Baumorchideen, die ihre Nahrung und die zum Wachstum nötige
Feuchtigkeit vermittelst mehr oder weniger langer, weißer Luftwurzeln
aus der umgebenden Luft schöpfen, solche Reservestoffbehälter an.
Wie sie durch ihren buntfarbigen Blütenschmuck in Gesellschaft mit
den leuchtenden Blüten der Schlingpflanzen dem Urwald der heißen
Landstriche ihren besonderen Reiz verleihen, haben sie sich durch ihre
aparte Schönheit die Liebe vieler vornehmer Blumenfreunde erworben und
sind besonders beim Geburts- und Geldadel Englands zu eigentlichen
Modepflanzen geworden, für deren Kultur besondere Gewächshäuser
erstellt werden. Auch werden einzelne seltene Arten um ein Vielfaches
ihres Gewichtes mit Gold aufgewogen. Um diese verführerische
Blumenkönigin der von Malaria durchseuchten, von reißenden Tieren und
feindlich gesinnten Menschen bevölkerten Baumwildnis der Tropen zu
erlangen, sind schon unzählige, von den großen Orchideenimporteuren
ausgesandte Europäer in den Tod gegangen. Das gefährliche Geschäft des
Orchideensammelns im Urwald hat für die kühnen Menschen, die sich damit
abgeben, einen besonderen Reiz, sonst würden sie nicht ihr Leben wagen;
außerdem ist es eine sehr lohnende Arbeit und ein höchst einträgliches
Ge[S. 496]schäft. Da ein solcher Mann seinen Auftraggeber nahezu 60000 Mark
jährlich kostet, und damit dessen Arbeit noch nicht einmal bezahlt
ist, kann es uns nicht wundern, daß es nur wenige Orchideenimporteure
gibt. Die vier bedeutendsten derselben leben in St. Albans in
England, in New Jersey in den Vereinigten Staaten, in Paris und in
Berlin. Die englische Firma besitzt ungefähr 15 Sammler in den dafür
einträglichsten Gebieten, nämlich in Mexiko, Venezuela, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Columbia, Brasilien, Bolivia, Peru, Neuguinea,
Holländisch-Indien, besonders Java und Sumatra, dann Borneo, Birma,
Assam und in den Gegenden am Fuße des Himalaja.
Wenn auch die Orchideen über die ganze Erde verbreitet sind, so
nimmt ihre Zahl nach dem Äquator hin bedeutend zu, und der heißen
Zone gehören alle Baumorchideen mit den mannigfaltigsten, größten
und schönsten Blüten an. Bis in die Neuzeit kannten die Europäer
nur die Erdorchideen mit weniger auffallenden Blüten. Schon die
Väter der Botanik beschäftigten sich eingehend mit ihnen, und manche
Tierähnlichkeit der schon unter ihnen auftretenden bizarren Blüten
verführte zu dem wunderlichsten Aberglauben. Mit der Entdeckung
Indiens und der Neuen Welt traten erst die tropischen Orchideen in
den Gesichtskreis der diese Länder zu Handelszwecken aufsuchenden
Europäer. Da diese Pflanzen keinen praktischen Nutzen gewährten, nahmen
die Krieger und Kaufleute, die die Tropenländer zuerst betraten,
keinerlei Notiz von ihnen. Als erster erwähnte der große französische
Arzt und Botaniker Clusius (Charles de l’Ecluse, 1526 in Arras in
Nordfrankreich geboren und 1609 als Botanikprofessor in Leiden in den
Niederlanden gestorben) die Frucht der Vanille, als dem einzigen dem
Menschen Nutzen gewährenden Produkt der Orchideen im Jahre 1605. Erst
am Ausgange des 17. Jahrhunderts kamen Beschreibungen und Abbildungen
tropischer Baumorchideen nach Europa. Karl von Linné, der Begründer der
modernen Botanik (1707–1778), kannte 1764 nur insgesamt 102, meist der
gemäßigten Zone angehörende Orchideenarten und nur 30 Baumorchideen.
Der Berliner Botaniker Karl Ludwig Willdenow (1765–1812), der
bedeutendste Systematiker seiner Zeit, beschrieb 1805 391 Arten mit
140 Epiphyten. In seinem 1830–1840 erschienenen Hauptwerk beschrieb
der Engländer Lindley bereits gegen 2000 Arten, unter denen sich fast
1000 Baumorchideen befanden, und 1880 schätzte de Puydt die Zahl aller
bekannten Orchideen auf 6000! So sehr hat sich unser Gesichtskreis
in diesem Gebiet erweitert. Dennoch kennen wir noch lange nicht alle
überhaupt auf der Welt existierenden[S. 497] Orchideenarten, von denen sich
viele ganz hoch im Astwerk der Tropenbäume verstecken, so daß man sie
erst erlangt, wenn man aufs Geratewohl Bäume fällt und sie von den
höchsten Ästen jener ablöst.
Tafel 145.

Gruppe verschiedener Orchideen, zusammengestellt von der
Orchideengärtnerei von Otto Beyrodt in Marienfelde b. Berlin.
❏
GRÖSSERES BILD
Was die Kultur der tropischen Orchideen betrifft, so gelang es erst
am Ausgange des 18. Jahrhunderts einige Epidendronarten in einem
europäischen Treibhause zu ziehen. Im Jahre 1813 kultivierte man in
dem weltberühmten botanischen Garten von Kew bei London nicht mehr als
40 Orchideenarten. In den 1830er Jahren befanden sich Orchideen in
Privatgärten Hamburgs und Dresdens, und 1851 kultivierte man im Garten
des Grafen Thun schon gegen 500 tropische Arten derselben. Bald wurden
an den verschiedensten Orten eigene Orchideenhäuser gebaut, und vor
etwa 40 Jahren begann das Populärwerden dieser Zucht bei den Vornehmen
besonders Englands. Gegenwärtig schätzt man die Zahl der kultivierten
Orchideenarten auf etwa 2000. Dabei hat die Liebhaberei für diese
eigenartig zierlichen Blütenpflanzen eine erstaunliche Höhe erreicht
und werden einzelne derselben mit Zehntausenden von Mark bezahlt.
Unglaublich mannigfaltig ist wie die ganze Form, so auch die Gestalt
und Farbe der verschiedenen Orchideenblüten. Manche der letzteren sehen
aus wie gewisse Insekten, Kraken, Vögel, besonders Pinguine, dann
kleine Gnomen usw.
In Mittelamerika wächst die San Espiridoorchidee, die ihren Namen
und eine sich daran anschließende fast abgöttische Verehrung bei den
bigotten Spaniern in ihrer Heimat davon erhielt, daß ihre zierliche
Blüte an eine herabschwebende weiße Taube erinnert, in Gestalt welcher
der heilige Geist sich auf Christus bei seiner Taufe im Jordan
herabgesenkt haben soll. Von den winzigsten, zu lang herabhängenden
Trauben vereinigten Blüten gibt es alle Übergänge zu solchen, die so
groß sind wie zwei zusammengelegte Männerhände, von weißen, einfachen
bis zu den in den leuchtendsten, buntesten Farben gefärbten, von
duftlosen bis zu solchen, die weithin einen fast betäubenden Wohlgeruch
aushauchen. Dabei sind die Orchideenblüten noch mehr als diejenigen der
anderen Blütenpflanzen dem Besuche ganz spezieller Insekten angepaßt;
und daß solche Besucher sie an ihren oft sehr versteckten Standorten
finden und die Befruchtung der Blüten vornehmen können, sind sie mit
einer im übrigen Pflanzenreich meist beispiellosen Dauerhaftigkeit der
vielfach sehr dicken, mit wachsglänzender Oberfläche versehenen Blüten
begabt, so daß sie unter Umständen viele Wochen warten können, bis
endlich das zur Vornahme der Be[S. 498]fruchtung erwartete Insekt erscheint
und dieselbe vornimmt. Gerade diese Dauerhaftigkeit ihrer wunderbaren
Blüten macht sie zu besonderen Lieblingen aller Blumenfreunde, die sich
den Luxus einer solchen Kultur leisten können.
Der hohe Preis der für viele dieser Orchideen bezahlt wird, findet
sehr leicht seine Erklärung in der oft äußerst schwierigen und mit
Lebensgefahr verbundenen Beschaffung derselben; denn kaum eine andere
Beschäftigung bringt so viel Mühen und Abenteuer mit sich als diejenige
eines Orchideensammlers. Nur gesunde, intelligente, kühne und dabei im
Verkehr mit den Eingeborenen höchst diplomatisch handelnde, sprach-
und lebensgewandte Männer eignen sich zu diesem schweren, aber schönen
und gutbezahlten Beruf. Die besten unter ihnen sind die Deutschen, die
alle nach einem gewissen, bewährten System arbeiten und an Ort und
Stelle zahlreiche Eingeborene in ihren Dienst nehmen, ohne die sie
nur wenig ausrichten würden. Es ist eine überaus schwierige Sache,
den Standort seltener Orchideen, die sich so hoch in den Wipfeln
angesiedelt haben, daß man sie vom Boden aus überhaupt nicht zu sehen
vermag, auszukundschaften. Und ist dies endlich gelungen, so beginnt
erst die Mühe des Sammlers; denn, um sie zu erlangen, muß er oft
mächtige Urwaldstämme mit der Axt umhauen lassen, bis er endlich zum
heißerstrebten Ziele gelangt.
So wurde festgestellt, daß für drei Exemplare des schönen, durchaus
nicht seltenen Odontoglossum mindestens ein solcher Baum mühsam
gefällt werden muß. Wieviel Urwaldriesen haben schon ihr Leben lassen
müssen, um die zahlreichen Orchideensorten von oft sehr beschränkter
Verbreitung in unsere Orchideenhäuser zu liefern! Und sind endlich die
Orchideen glücklich erlangt, so heißt es, sie durch kunstgerechtes,
vorsichtiges Trocknen überhaupt versandfähig machen. Diese Prozedur
nimmt oft viele Wochen in Anspruch. Wenn dadurch alle austreibbare
Feuchtigkeit aus ihnen entwichen ist, werden sie in luftdurchlässige
Behälter gepackt und müssen auf den Köpfen von Menschen oft viele
Tagereisen weit über reißende Ströme und bodenlose Sümpfe, durch
gefährliche Dschungeln und schwer passierbare Gebirge mühsam
transportiert werden, bis sie auf die Eisenbahn gebracht und dann in
Schiffe verladen werden, und so die Reise nach ihrem Bestimmungsorte
antreten können. Wie vor Feuchtigkeit müssen sie gleicherweise auch
vor zu großer Hitze und vor Licht geschützt werden. Und hat man auch
alle diese Bedingungen sorgsam erfüllt, so ist es gleichwohl möglich,
daß schließlich die meisten oder gar alle Exemplare unter[S. 499]wegs Schaden
gelitten haben und zugrunde gegangen sind, so daß alle Arbeit und
alle Auslagen umsonst waren. Für solche Verluste kann der Sammler
natürlich nicht verantwortlich gemacht werden; sie gehören eben zum
selbstverständlichen Geschäftsrisiko, der oft viele Tausende von Mark
beträgt und deshalb diese wunderbaren Erzeugnisse der Tropen so teuer
macht.
Wie manche durch ihre Größe ausgezeichnete Diamanten, haben gewisse
Orchideen ihre eigene, vielfach höchst interessante Geschichte
aufzuweisen, die über ganze Menschenschicksale entschied und nicht
selten den Kühnen, die sie für die Bewunderung der Kultureuropäer
zu erobern suchten, den Tod brachte. Manche derselben sind an ganz
bestimmte Standorte und Höhenlagen, andere wieder an kleinere
Bezirke des Vorkommens gebunden, sterben leicht vollständig aus und
verschwinden vom Schauplatz, und an ihrer Stelle erscheinen dann
plötzlich zum Erstaunen der Blumenfreunde neue, bis dahin gänzlich
unbekannte Orchideenarten.
Ein Kenner, Oliver Bartlett, schreibt in bezug auf die Gewinnung
solcher seltener Orchideenarten: „Vor einigen Jahren bot eine Firma
in St. Albans ihrem Vertreter in Kalkutta die Summe von 1000 Pfund
(also 20000 Mark) für die Beschaffung eines blühenden Exemplars von
Cypripedium fairrieanum, von welchem ein Forscher eine einzelne
Art zufällig entdeckt hatte. Diesen hatte ein wilder Volksstamm auf dem
abgeschlossenen Gebiet von Bhutan ergriffen und gezwungen, an ihren
Kämpfen teilzunehmen, bei denen er schließlich den Tod fand. Noch
tragischer ist das Ende des berühmten französischen Orchideensammlers
Leon Humblot. Er ging vor einigen Jahren mit seinem Bruder und sechs
französischen Landsleuten nach Madagaskar. Sie alle waren engagiert,
um Insekten aller Art, Schmetterlinge, Vögel und Orchideen zu sammeln.
Humblot, der eine völlig unbekannte Gegend durchforschte, hatte das
Unglück, eine Ladung Vogelschrot in ein Götzenbild der Eingeborenen
zu schießen, worauf die erzürnten Priester des Stammes ihn mit Öl
begossen, anzündeten und lebendig verbrannten.“
Eine weniger tragische Geschichte weist die berühmte Cattleya
skinneri auf, die eine hervorragend schöne, fleckenlose Blüte
aufweist. Ihre Heimat ist Costarica, wo sie ursprünglich von
Jesuitenpatres entdeckt wurde, die sie schleunigst auf die Dächer ihrer
Kirchen verpflanzten; diese bedeckt sie nun zur Zeit der Blüte mit
ihren reizenden, schneeigen Blüten.
[S. 500]
Auch die Cattleya labiata hat ihre Geschichte. Sie war die
erste ihrer Art, die, wie man vermutete, aus dem brasilianischen
Organgebirge bei Rio de Janeiro stammend, in Europa eingeführt wurde.
Plötzlich ging die Kenntnis ihres Standortes verloren, und da keine
neuen Exemplare eingeführt werden konnten, wurde sie, selbst unter
der geschicktesten Pflege, ganz außerordentlich selten. Verschiedene
kostspielige Expeditionen wurden nach Brasilien und den angrenzenden
Ländern gesandt, doch wurden nur andere wertvolle Cattleyas, nicht aber
sie entdeckt. So fanden z. B. Arnold die Cattleya gaskelliana im
schwer zugänglichen Carribogebirge und Seydl die herrliche Cattleya
laurentiana. Jahre danach sandte der Forscher Bungeroth eine
Pflanze in die Heimat, die er als eine neue Abart mit dem Namen
Cattleya warroqueana bezeichnete, und die sich dann schließlich
als die langgesuchte Cattleya labiata erwies.
Ein deutscher Orchideensammler, der dem Ufer des gewaltigen Flyflusses
in Neuguinea entlang ging, stieß plötzlich auf eine papuanische
Begräbnisstätte, auf welcher die gewaltige, hochrotblühende Orchidee
mit dem Übernamen „Elefantenmotte“ in üppiger Fülle zwischen Knochen
und Schädeln wucherte. Als er sich daran machte, einige derselben
auszugraben, widersetzten sich die ihn begleitenden Eingeborenen
aufs energischste gegen solches nach ihrem Glauben frevelhaftes und
gefährliches Vorhaben. Erst nach langen Unterhandlungen und durch
Geschenke an Baumwollstoff, Kupferdraht und Perlen vermochte er die
abergläubischen Eingeborenen dazu zu bringen, ihn ungestört gewähren zu
lassen. Als diese Orchideen in London zur Versteigerung kamen, war ein
Exemplar derselben am meisten begehrt, das mit seinen prächtigen Blüten
aus der Augenhöhle eines menschlichen Schädels herauswuchs. Diese
Orchidee wurde für 120 Pfund (= 2400 Mark) verkauft.
Den Wert neu eingetroffener Orchideen kann auch der beste Kenner nicht
genau beurteilen. So durchstreifte eines Tages ein gewisser Herr
Harvey, ein begüterter Advokat aus Liverpool, die Treibhäuser von Herrn
Frederick Sander, als er plötzlich auf ein Exemplar der Laelia
anceps stieß, welche das Merkzeichen auf der Knolle viel höher
trug, als dies sonst üblich ist. Da Herr Harvey schon viel von den
„Launen“ der Orchideen gesehen und gehört hatte, kaufte er die Pflanze
sofort für 48 Schilling (ebensoviel Mark), und in einer der späteren
Saisons verkaufte er sie wiederum an Herrn Sander um den Preis von 200
Pfund Sterling (= 4000 Mark). Sie hatte Blüten getrieben, die einzig in
ihrer Art waren.
[S. 501]
Ein anderes Mal erhielt Herr Sander eine große Anzahl von
Cypripedium insigne und bemerkte unter den Pflanzen eine, die
statt der typischen braunen Blütenstengel solche von hellgelber Farbe
aufwies. Er stellte die Pflanze besonders, und als sie zum Blühen kam,
trieb sie Blumen von einem herrlichen Goldgelb — es war eine neue
Spielart einer sehr kostbaren Sorte.
Wenn eine solche Abart einzig in ihrer Art und als das Produkt einer
von der Natur selbst herbeigeführten Kreuzung dasteht, so wird sie
niemals ergiebig sein; denn die Blüten können nicht, wie dies sonst
üblich ist, mit dem Blütenstaub anderer Blüten befruchtet werden, und
das einzige Mittel, sie zu vermehren, besteht darin, das Original zu
teilen.
Für eine einzige Orchidee sind schon 2080 englische Pfund (gleich 41600
Mark) angeboten und abgelehnt worden, und 100 Pfund (gleich 2000 Mark)
sind für einen mikroskopisch kleinen Fleck Blütenstaub zum Bastardieren
bezahlt worden. In Privatgeschäften wurden von wohlhabenden Amateuren
1200 Pfund Sterling (24000 Mark) für ein Exemplar einer besonderen
Gattung und 700 Pfund Sterling (14000 Mark) für ein Duplikat oder eine
geteilte Pflanze bezahlt.
In den großen Treibhäusern bemüht man sich soviel wie möglich die
Bedingungen zu erfüllen, die zum Gedeihen der einzelnen Spielarten
unerläßlich sind. So muß man beispielsweise ein Gewächshaus, in
welchem Orchideen aus dem heißen Borneo kultiviert werden, fast noch
einmal so warm halten als ein anderes, in welchem Orchideen aus
den Hochtälern Mexikos und den luftigen Abhängen der Kordilleren
Südamerikas untergebracht sind. In einem dritten Treibhaus muß die
Luft mit Tabakrauch erfüllt sein. Ein großer europäischer Händler
empfängt jährlich 2 Millionen Pflanzen; dabei ist man so unsicher in
bezug auf ihr Fortkommen, daß sie auf der Versteigerung meist ohne
Garantie verkauft werden. Selbstverständlich sind so kostbare Pflanzen
auf die mannigfaltigste Weise miteinander gekreuzt worden und haben
sehr wertvolle Blendlinge ergeben. Man hat schon Bastarde von ihnen
erzielt, in welchen drei verschiedene Gattungen vertreten sind. Darin
hat sich der bereits erwähnte deutsche Gärtner Friedrich Sander,
der in St. Albans bei London und in Brügge in Belgien gärtnerische
Riesenbetriebe besitzt und seiner reichen Orchideengeschäfte wegen
in England allgemein als Orchideenkönig bekannt ist, hervorgetan.
So hat er u. a. zwei durch seinen Sammler Godseff in Neuguinea und
Neukaledonien gesammelte Acalyphaarten miteinander gekreuzt und[S. 502]
damit wunderbar schöne Hybriden erzielt, deren erste schon im April
1898 auf der großen internationalen Gartenbauausstellung zu Gent in
Belgien allgemeines Aufsehen erregte. Die Blüten haben bis 50 cm
lange Schwänze, sind zuerst grünlichweiß und gehen dann in Rosa und
Orangerot, bei manchen auch in Gelb über. Sie sind, wie übrigens viele
andere Orchideen, besonders auch dadurch wertvoll, daß ihre Blütezeit
sehr lange währt.
Von den Ranunkelgewächsen sind von den bei uns einheimischen nur wenige
als Zierpflanzen in unsere Gärten aufgenommen worden. Unter ihnen
ist die auf Wiesen auch in Deutschland wachsende Trollblume
(Trollius europaeus) mit großen, geschlossenen, gelben Blüten zu
nennen, die wie ihre nordasiatische Verwandte (T. asiaticus) und
andere Arten als Zierpflanzen in Gärten kultiviert wird. Die weitaus
schönste der altweltlichen Ranunkeln ist die in Südeuropa heimische
Pfingstrose (Paeonia officinalis) mit unterirdischem,
knollig verdicktem Wurzelstock, 30–60 cm hohem Stengel und
5 cm im Durchmesser haltenden karminroten Blüten. Sie wird in
zahlreichen Varietäten von Purpur bis Weiß meist in gefüllten Formen in
Gärten kultiviert. Wurzel und Samen wurden früher arzneilich benutzt.
Die Blumenblätter verwendet man wegen ihrer Farbe zu Räucherungen. Im
Altertum galt sie als Schutzmittel gegen die Neckereien der Faune, d.
h. der als „Wohlwollenden“ bezeichneten guten Geister der Fluren und
Felder, die nach dem Volksglauben namentlich dem Vieh Fruchtbarkeit
und Schutz gegen die Wölfe verliehen. Sie wurde von den alten Griechen
paiōnía und von den Römern, die sie durch jene kennen lernten,
paeonia genannt. Noch mehr als ihre wurden aber von ihnen
die Wurzeln der in den Mittelmeerländern heimischen korallensamigen
Pfingstrose (Paeonia corallina) arzneilich besonders gegen
Gicht gebraucht, weshalb die rosenrot blühende Pflanze auch Gichtrose
genannt wird. Bei deren Gewinnung mußten gewisse Riten geübt werden.
Gegen die gebräuchlichste, das Ausgraben bei Nacht, wendet sich schon
der pflanzenkundige Grieche Theophrast im 4. Jahrhundert v. Chr. indem
er sagt: „Es wird aber wohl ohne Grund vorgeschrieben, man solle die
Päonie (paiōnía), welche auch glykysídē heißt, bei Nacht
ausgraben; denn wenn man bei Tage danach grübe und dabei von einem
Specht gesehen würde, so erlitte man Unglück.“ Ihre roten Samen wurden
als Amulett getragen und sollten, auf Fäden gereiht und um den Hals
befestigt, Kindern das Zahnen erleichtern, weshalb sie beim Volke
Zahnkorallen heißen. Neben der offizinellen Pfingstrose Süd[S. 503]europas
werden auch die schmalblättrige Pfingstrose (Paeonia tenuifolia)
aus Südrußland mit tiefroten Blüten und die weißblühende Pfingstrose
(P. albiflora) aus Südsibirien, dem Himalaja und Japan, wie
auch die 1–2 m hohe baumartige Pfingstrose (P. moutan —
letzteres ist ihr chinesischer Name) mit 5–10blätteriger Blumenkrone
in zahlreichen, auch gefüllten Varietäten bei uns als Zierpflanzen
kultiviert. Letztere, die in China und Japan hochgezüchtet wurde,
eignet sich besonders zu Einzelpflanzungen in Rasen, verlangt aber
Winterschutz. Ihre stechend aromatische Wurzelrinde wird in Japan
arzneilich viel gebraucht.
Scharf giftig ist der blaue oder echte Eisenhut oder
Sturmhut (Aconitum napellus), so genannt nach der
helmartigen Form seiner hübschen Blüten. Anderswo heißt er Mönchskappe,
in Norwegen Tor- oder Tyrhialm, d. h. Helm der Kriegsgötter Tor oder
Tyr. Akṓniton, d. h. auf felsigem Boden (im Gebirge) wachsende
Pflanze, nannten sie die Griechen, und nach den Metamorphosen des
römischen Dichters Ovid (43 v. bis 7 n. Chr.) soll sie aus dem Geifer
des Höllenhundes Cerberus entstanden sein, als dieser von Herkules aus
der Unterwelt heraufgeschleppt wurde. Ihre giftige Wurzel wurde schon
im Altertum zum Vertilgen von Raubtieren, denen sie im Köder gegeben
wurde, benutzt, daneben auch als Arzneimittel gegen Gicht, Rheumatismus
und Lungenkrankheiten gegeben. Als offizinelle Pflanze kam sie dann
im Mittelalter in die Bauerngärten und hat sich hier das Bürgerrecht
erworben. Ebenso verhält es sich mit dem Rittersporn,
dessen südeuropäische, blau oder weißblühende Abart (Delphinium
staphisagria), die staphís agría der Griechen, ebenfalls
arzneiliche Verwendung fand. Ihre scharfschmeckenden, schwarzgelblichen
Samen dienten gepulvert und mit Olivenöl vermischt, wie uns der
griechische Arzt Dioskurides berichtet, zum Vertilgen von Läusen
und Krätze. Deshalb wurden sie von den Römern pedicularia
(von pediculus Laus) und bei uns Läuserittersporn genannt.
Meist werden in unseren Gärten der in den Gebirgen Mitteleuropas
wachsende hohe Rittersporn (Delphinium intermedium), dann der
aus dem Orient stammende Gartenrittersporn (D. ajacis, nach
dem homerischen Helden Ajax so genannt, weil die Pflanze aus dessen
Blut hervorgewachsen sein soll, nachdem er sich aus Unmut, im Streite
mit Odysseus besiegt worden zu sein, selbst den Tod gab) und der
aus Nordamerika zu uns gebrachte dreifingerige Rittersporn (D.
exaltatum) kultiviert.
Beliebte Gartenzierpflanzen sind auch die einheimische gemeine
Akelei mit blauen und die kanadische Akelei
mit scharlachroten[S. 504] Blüten (Aquilegia vulgaris und
canadensis). Letztere stammt aus den östlichen Vereinigten
Staaten und Kanada. Beide werden auch in gefüllten Spielarten gezogen.
Ihrem Safte wohnen betäubende Eigenschaften inne; doch werden sie
nicht medizinisch verwendet. Dies ist jedoch beim Schwarzkümmel
(Nigella sativa) der Fall, der aus Südeuropa als Heilpflanze
zu uns kam und nach den Verordnungen Karls des Großen in den Gärten
seiner Meierhöfe angebaut werden sollte. Wie damals wurden schon
im Altertum seine wohlschmeckenden Samen ins Brot geknetet. Die
Pflanze hieß bei den Griechen melánthion und bei den Römern
git und wurde gegen mancherlei Übel gebraucht. Gleicherweise
stammt aus den Mittelmeerländern die ihr nahe verwandte Jungfer im
Grünen oder Gretel im Busch (Nigella damascena),
die häufig in Bauerngärten gefunden wird, wie auch die verschiedenen
Adonisröschen (Adonis flammea u. a.). Oft auch finden
sich in Stadtgärten zur Einfassung der Blumenbeete oder an Felspartien
die blauen, selten roten oder weißen Leberblümchen (Hepatica
triloba), die den Vorzug haben, zu unsern ersten Frühlingsboten zu
gehören. Wegen ihrer leberförmigen Blätter wurde die Pflanze früher als
Heilmittel gegen Leberleiden verwendet.
Von den eigentlichen Anemonen ist vor allem die Gartenanemone
(Anemone coronaria) zu nennen, die in Südeuropa und im Orient
heimisch ist und große, dunkelrote oder weiße Blüten besitzt. Schon der
griechische Arzt Dioskurides unterschied die wilde anemṓnē von
der zahmen, in Gärten gepflanzten und sagt, letztere habe scharlachrote
Blüten, während die wilde weiße oder purpurrote Blüten besitze. „Beide
dienen als Arznei.“ Dem fügt sein Zeitgenosse Plinius bei, daß die
Anemonen (anemone) außerdem zu Kränzen dienen, wie auch die
Adonisröschen (adonion, von Adonis autumnalis). In der
Gegenwart werden die Gartenanemonen in zahlreichen Varietäten mit
großen dunkelroten, blauen oder weißen Blüten, namentlich in Holland
als Zierpflanzen kultiviert. Ihr Wurzelstock wird nach dem Verblühen
aus der Erde genommen und bis zum Frühjahr trocken aufbewahrt.
Ebenfalls als Zierpflanzen geschätzt sind: die Sternanemone (Anemone
hortensis) aus Istrien und Italien, die Anemone fulgens
mit scharlachroten Blüten aus dem Mittelmeergebiet, die Pfauenanemone
aus Südfrankreich mit großen, aus 10–12 lanzettförmigen, spitzen,
schmalen, feurig karminroten Blumenblättern bestehenden Blüten, dann
von ausländischen die japanische Anemone mit rosa und weißen Blüten,
deren bekanntester Abkömmling die prächtige Honorine Joubert ist, und
be[S. 505]sonders die großblütigen, in satten Farben von Rot bis Violett und
Weiß prangenden Himalajaanemonen, die die Zierde unserer Gärten bilden
und leicht zu ziehen sind.
An die Ranunkeln schließen sich die Mohnblütigen an, unter denen neben
Klatschrose und Schlafmohn in den mannigfaltigsten
Farben und mit gefüllten Blüten besonders der morgenländische Mohn
(Papaver orientale) als Zierpflanze unserer Gärten kultiviert
wird. Letzterer trägt auf dem bis 1 m hohen, borstigen Stengel
nur eine bis 13 cm im Durchmesser haltende scharlachrote, oft im
Grunde mit schwarzblauem Kreuze bezeichnete Blüte. Bescheidener als sie
sind die ebenfalls als Zierpflanzen kultivierten Nachtviolen,
die eigentliche Nachtviole (Hesperis tristis) mit
schmutziggelben, purpurrot geaderten Blüten, die abends herrlich duften
— sie wird in Südeuropa wegen der als treffliches Viehfutter dienenden
Blätter und ölreichen Samen angebaut — und die Gartennachtviole oder
Matronale (H. matronalis) — von den Gärtnern auch Viola
matronalis, d. h. Frauenveilchen, genannt —, deren rote, lila oder
weiße, wohlriechende Blüten häufig gefüllt sind. Vielfach ist sie aus
den Gärten entwichen und verwildert.
Diesen nahe verwandt sind die Levkojen, die ihren Namen vom
griechischen leukóion, d. h. Weißveilchen (leukós
weiß und íon Veilchen), ableiten. Unter dieser Bezeichnung
verstanden die alten Griechen die an den Mittelmeerküsten wild
wachsende Winterlevkoje (Matthiola — nach dem 1500 in
Siena geborenen und 1577 in Trient gestorbenen kaiserlichen Leibarzt
in Wien Peter Andreas Matthiolus so genannt — incana, d. h.
die weißlichgraue), die wegen ihrer wohlriechenden Blüten geschätzt
wurde. Theophrast im 4. Jahrhundert v. Chr. sagt von ihr: „Die Leukoje
(leukóion) erscheint von den schöneren Blumen zuerst, und
zwar schon im Winter, wenn die Luft mild ist. Sie dauert gewöhnlich
drei Jahre, wird im Alter kleiner und bringt dann weißere Blumen
hervor.“ Vergil (70–19 v. Chr.) bezeichnet sie in einer seiner Eclogen
als paliens viola, d. h. bleiche Viole, und Dioskurides im
1. Jahrhundert n. Chr. sagt von ihr: „Die Levkoje ist allgemein
bekannt, sie hat verschieden gefärbte, weiße, gelbe, blaue und
purpurrote Blüten. Die gelbblütige ist als Arznei im Gebrauch.“ Ebenso
mannigfaltig gefärbt sind die Blüten der etwas größeren, gleichfalls in
Südeuropa heimischen Sommerlevkoje (Matthiola annua), die
einjährig ist und wegen ihrer schönen, wohlriechenden Blüten eine der
beliebtesten Topfpflanzen bildet. Außer Sommer- und Winterlevkojen in
mehreren Klassen unterscheidet man auch mehrjährige Levkojen, von denen
manche[S. 506] Sorten mehr als zwei Jahre dauern und strauchartig werden,
dabei jedoch an Schönheit verlieren. Man zieht sie deshalb jedes Jahr
neu heran und behandelt sie wie zweijährige. Die Levkojenkultur ist ein
wichtiger Zweig der Handelsgärtnerei und wird besonders in Erfurt stark
betrieben.
Die gelbe Viole (viola) der Alten, von der die antiken Dichter,
so besonders Ovid und Vergil, häufig sprechen, die in besonderen
Feldern (violaria) kultiviert wurde und zu Kränzen gewunden auf
den Markt kam, ist unser Goldlack (Cheiranthus cheiri
— letzteres Wort, das auch in der ersten Hälfte des Gattungsnamens
enthalten ist, ist die arabische Bezeichnung der Pflanze, die „Kraut
mit wohlriechenden Blüten“ bedeutet). Die Stammpflanze findet man an
steinigen Stellen der Küsten Griechenlands häufig wild. Sie wurde wegen
ihrer wohlriechenden Blüten sehr frühe in die Gärten herübergenommen
und bildet bis auf den heutigen Tag eine beim gemeinen Volke sehr
beliebte Zierpflanze. Ursprünglich nur mit braunen und violetten Blüten
begabt, hat man aus ihr sehr verschieden gefärbte Varietäten, auch mit
gefüllten Blüten, erzielt. Mit den Levkojen wurde sie auf eine sehr
hohe Stufe blumistischer Vollkommenheit gebracht und nimmt unter allen
Sommerblumen eine sehr wichtige Stellung ein. Auch sie wird besonders
in Erfurt angepflanzt.
Zum Unterschied vom weißen Veilchen, der Levkoje, nannten die alten
Griechen das wohlriechende Veilchen (Viola odorata)
schwarzes Veilchen (mélan íon). In den Geoponika sagt ein
griechischer Autor: „Das Veilchen (íon) hat seinen Namen Ion
daher bekommen, daß die Erde es zu Ehren der von Zeus geliebten
Jungfrau Io erschuf.“ Bei den Hellenen war es das Symbol der jährlich
wieder auflebenden Erde und der jungen Freundschaft. Nach der Sage
wurde die Tochter des Atlas, als sie sich vor Apollon verbarg, in
ein Veilchen verwandelt. Mit Veilchen und Rosmarin wurden im Mai die
Bildnisse der Hausgötter geschmückt und verzierten die Bacchantinnen
ihre Thyrsosstäbe. Unter allen Griechen hatten die Athener eine
besondere Vorliebe für diese Blume. Mit Veilchen bekränzten sie sich
und mit Veilchenwasser parfümierten sie sich; deshalb hieß die Stadt
bei den Alten „das veilchenduftende Athen“. Um dem großen Bedarf zu
genügen, wurden Veilchen in der Umgebung Athens im großen kultiviert.
Theophrast (im 4. Jahrhundert v. Chr.) sagt: „Das Veilchen blüht, wenn
es gut gepflegt wird, das ganze Jahr hindurch.“ Der Komödiendichter
Aristophanes (455–387 v. Chr.) sagt an einer Stelle seiner Acharner:[S. 507]
„Früher nannte man die Athener veilchenbekränzt (iostéphanos).“
Außer Varro (116–27 v. Chr.) spricht Vergil (70–19 v. Chr.) von
Veilchenbeeten (violarium), und letzterer sagt, sie müssen
naß gehalten werden. Columella im 1. Jahrhundert n. Chr. schreibt:
„Veilchen (viola) werden auf gut gedüngtem und gegrabenem
Boden gezogen. Man setzt Pflanzen vom vorigen Jahre in fußweite
Gruben vor Anfang März. Übrigens sät man den Veilchensamen entweder
im Frühjahr oder im Herbst.“ Sein Zeitgenosse Plinius sagt in seiner
Naturgeschichte: „Das purpurne Veilchen (viola purpurea) wächst
an sonnigen und magern Stellen wild, wird aber auch in Gärten aus
Pflanzen gezogen. Man setzt Veilchenkränze gegen Rausch und Schwere
des Kopfes auf.“ Wie in den reichen Griechenstädten, wurde auch im Rom
der Cäsaren gelegentlich ein großer Luxus wie mit anderen, so auch
mit diesen Blumen getrieben. So berichtet Älius Lampridius in seiner
Biographie des Heliogabalus (geb. 201, regierte 218–222): „Kaiser
Heliogabalus ließ manchmal zum Spaß über Gäste, die bei ihm schmausten,
Veilchen (viola) und andere Blumen in solcher Menge schütten,
daß mehrere sich aus der Masse nicht herausarbeiten konnten und
erstickten.“
Im Mittelalter wurde das bescheidene Veilchen zwar gelegentlich
von Dichtern erwähnt, doch spielte es als Gartenpflanze eine sehr
unbedeutende Rolle. In der Neuzeit hat besonders Napoleons I. erste
Gattin Josephine es als ihre Lieblingsblume und ihren bevorzugten
Schmuck zu Ehren gezogen. Bei ihrer Hochzeit im Jahre 1796 mit dem
genialen, um 6 Jahre jüngeren Korsen, genügte ihr ein Veilchenstrauß,
und mit Veilchen war ihr Hochzeitsrock bestickt. Zu jeder Wiederkehr
dieses glücklichen Tages wünschte sie sich Veilchen als Festgeschenk
aus ihres Mannes Hand, und selbst im Donner der Schlachten vergaß
dieser nicht, für die Erfüllung dieses Wunsches zu sorgen, auch
dann, als er die Kaiserkrone trug. Als jedoch 1809 das bittere Wort
der Scheidung ausgesprochen war und die zu solch unerhörtem Glanze
emporgestiegene Tochter des einstigen Kapitäns von Martinique aus
Staatsraison der österreichischen Prinzessin Marie Luise weichen mußte,
blieben die Veilchen von Bonapartes Hand aus. Und als die gedemütigte
Frau am 29. Mai 1814 in Malmaison starb, lag auf ihrem Sarge im
Gartensaal unter Rosen und Zypressen ein frischer Veilchenstrauß
auf weißseidenem Kissen. 60 Jahre später schmückte Josephinens
Lieblingsblume, die inzwischen zum Sinnbild der Napoleoniden geworden
war, in unzähligen prachtvollen Sträußen und Kränzen ein[S. 508] anderes
Totenlager in Cambdenhouse zu Chiselhurst als letztes Lebewohl, das
dem dritten Napoleon von seinen Anhängern aus Frankreich nachgerufen
wurde. Das Veilchen war auch ein Liebling Goethes, der sich im Frühjahr
auf seinen Spaziergängen in Weimars Umgebung gern mit ihm schmückte.
Stets trug der Dichterfürst Veilchensamen bei sich, um ihn zu Seiten
des Wegs auszustreuen; und die Erde erwies sich dankbar für die Gabe
des Poeten und ließ den bescheidenen Frühlingsboten überall, wo er
gestreut ward, aufsprießen, damit sich die Vorübergehenden an ihm
erfreuen konnten. Zu der einfachen Sorte gewann man im Laufe des 19.
Jahrhunderts auch gefüllte und immerblühende Arten, ebenso solche mit
roten und weißen Blüten. Auch praktischen Zwecken wurden sie dienstbar
gemacht. Man benutzt sie zur Bereitung von Veilchensirup, Creme, Gelee,
Gefrorenem, feinem Backwerk, auch werden sie überzuckert gegessen und
in der Parfümerie verwendet. Doch wird das meiste Veilchenparfüm nicht
aus ihnen, sondern aus der Veilchenwurzel — der früher besprochenen
Schwertlilie — gewonnen.
Aus dem zwei- bis dreifarbigen Ackerveilchen (Viola bicolor
und tricolor), das auf Äckern und Brachen gemein ist, hat
die Kunst zuerst der englischen Gärtner die äußerst mannigfaltig
gefärbten, großblütigen, fast das ganze Jahr hindurch blühenden
Stiefmütterchen oder Pensées gezogen, die mit
ihren zahllosen Spielarten einen nicht unbedeutenden Handelsartikel
der Kunstgärtner bilden. Das dreifarbige wilde Stiefmütterchen
(Viola tricolor) mit mannigfach variierenden Blüten, bei
denen alle oder nur die oberen Blumenblätter violett oder blaßblau
und die übrigen oder alle gelb sind, findet sich in ganz Europa,
Nordafrika, Kleinasien, Sibirien und Nordamerika. Seine Kultur als
Gartenzierpflanze kam erst im 19. Jahrhundert in England auf. Man
kultiviert jetzt sehr großblütige Varietäten, auch Bastarde mit
Viola altaica, Viola lutea, dem gelben Veilchen, das
auf Galmeiboden variiert, und Viola cornuta als beliebte
Gartenstiefmütterchen und unterscheidet grundfarbige, gestreifte,
weißrandige, goldrandige, fünffleckige (Odier), Cassier-, Riesen-
oder Trimardeau-Pensées. Diese Samtveilchen spielen in
England und Frankreich dieselbe Rolle wie das Vergißmeinnicht in
Deutschland und dienen besonders zum Schmucke der Gräber. Alle diese
hochkultivierten, großblütigen Formen hat natürlich weder das Altertum,
noch das Mittelalter gekannt; es sind ganz moderne Neuschöpfungen der
Gärtnerkunst, die uns beweisen, wie Großes durch Zuchtwahl und Kreuzung
geleistet werden kann. Die[S. 509] im Umriß dreieckige Blume der Stammpflanze
mit leuchtend gelbem, von schwarzen Strahlen durchzogenem Saftmal galt
im Mittelalter als Symbol der Dreieinigkeit. Seit dem 16. Jahrhundert
wird das Kraut des wilden Stiefmütterchens bei Hautausschlägen
verwendet, sei es zu Umschlägen, sei es innerlich als Tee. Da es
nachgewiesenermaßen Salizylsäure enthält, ist dies durchaus zweckmäßig
und recht wirksam.
Eine neuerdings in Mode gekommene Warmhaus- und Zimmerpflanze,
die wie die Gloxinien kultiviert wird und sich leicht durch
Blattstecklinge fortpflanzen läßt, ist das zu den Gesnerazeen
gehörende Usambaraveilchen (Saintpaulia ionantha),
eine in Felsspalten der Usambaraberge in Deutsch-Ostafrika
wachsende, ausdauernde, niedrige Pflanze mit dicken, fleischigen
Blättern und blauvioletten Blüten mit dottergelben Staubgefäßen.
Von den eigentlichen Gesnerien — nach dem schweizerischen
Naturforscher Konrad Gesner in Zürich (1516 bis 1565) so genannt
— mit knolligen Wurzelstöcken, gezahnten Blättern und meist sehr
schönen, scharlachroten, röhrenförmigen, fünflappigen Blüten,
sämtlich im tropischen Südamerika, besonders in Brasilien heimisch,
werden verschiedene, so vor allem Gesnera magnifica und
cardinalis in mehreren Varietäten, in Warmhäusern und auch
im Zimmer kultiviert. Ebenso werden von der Gesnerazeengattung
Achimenes mit 25 Arten mit meist roten bis violetten Blüten im
tropischen Amerika mehrere, wie besonders A. grandiflora mit
purpurnen oder violetten Blüten, A. mexicana mit großen blauen
oder purpurroten Blüten, A. amabilis und tubiflora
mit violetten Blüten bei uns in Warmhäusern ähnlich den ihnen nahe
verwandten Gloxinien kultiviert. Durch Kreuzungen sind aus ihnen
verschiedene dankbare Gartenpflanzen erzielt worden.
Den Gesnerazeen nahe stehen die Akanthazeen oder Bärenklaugewächse,
von denen der südeuropäische echte Bärenklau (Acanthus
mollis) dadurch bekannt ist, daß die malerische Form seiner
50 cm langen und 16–26 cm breiten, buchtiggelappten und
gezähnten Blätter dem genialen griechischen Bildhauer Kallimachos das
Motiv zum Schmucke des korinthischen Kapitäls gaben. Er wurde schon
im Altertum zur Einfassung der Gartenbeete benutzt. Vergil sagt: „Der
Akanthus bildet eine Zierde der Gärten;“ ähnlich drückt sich der ältere
Plinius aus, der dazu bemerkt, er werde an den Rand erhabener Beete
gepflanzt. Wurzel und Blätter dienten als Arznei. Eine in den Tropen
der Alten Welt, namentlich in Afrika, heimische Gattung der Akanthazeen
sind die Thunbergien, von denen viele Arten mit[S. 510] violetten oder
blauen Blüten bei uns in Warmhäusern kultiviert werden. Thunbergia
alata aus Südostafrika dagegen kann einjährig in freiem Lande
kultiviert werden. Sie klettert 1,5 m hoch und hat gelbe,
schwarzgefleckte Blüten.
Unter den Resedagewächsen ist außer dem an Ackerrändern und auf
Schutthalden verbreiteten gelben Wau (Reseda lutea) der
Färberwau (Reseda luteola) mit kleinen, gelblichweißen
Blüten in Mitteleuropa heimisch. Letzterer wurde schon von den
neolithischen Pfahlbauern zum Gelbfärben benutzt und zu diesem Zwecke
im Altertum und Mittelalter angepflanzt. Heute wird er zu diesem
Zwecke nur noch in England und Holland kultiviert. Der als Topf-
und Gartenzierpflanze häufig kultivierte wohlriechende Wau oder
die Gartenreseda (Reseda odorata) ist ein Import aus
Nordafrika. Sie erschien plötzlich um die Mitte des 18. Jahrhunderts
und verbreitete sich innerhalb weniger Dezennien durch ganz Europa
und überall, wohin europäische Kultur vorgedrungen ist. Die Zeichen
ihrer großen Beliebtheit finden sich in der französischen Bezeichnung
mignonette, das als miglionet ins Italienische, als
miñoneta ins Spanische und auch ins Englische überging. Ihre
so geheimnisvolle Herkunft wurde erst 1887 durch die botanische
Forschungsreise von Taubert nach der Cyrenaica, der sie dort
wildwachsend fand, aufgeklärt. Wegen ihres Wohlgeruches wurde sie
teilweise schon von den alten Ägyptern, besonders aber von den dort
heimischen Arabern zu Totenkränzen benutzt. Der französische Arzt
N. Granger, der 1733 nach dem Orient ging und 1737 in Basra starb,
sandte Samen der wohlriechenden Reseda, die er in der Cyrenaica
gesammelt hatte, an die Direktion des Jardin du roi, des
heutigen Jardin des plantes in Paris. Von jenem Garten aus,
wo sie zuerst in Europa gepflanzt wurde, verbreitete sie sich über
die botanischen Gärten Europas. 1753 war sie aber noch nicht nach
Upsala gelangt, sonst hätte sie Carl von Linné in der ersten Ausgabe
seiner Species plantarum erwähnt. Allmählich fand sie auch in
Privatgärten Aufnahme und erlangte trotz ihrer Unansehnlichkeit wegen
des lieblichen Geruches ihrer Blüten, der langen Blütezeit und der
leichten Kultur weite Verbreitung. Es existieren von ihr zahlreiche,
wenn auch wenig vom Typus abweichende Spielarten. Bei der Destillation
liefern die Resedenblüten 0,002 Prozent dunkles, festes ätherisches Öl.
Für praktische Zwecke destilliert man 1 kg Geraniol (Geraniumöl)
mit 500 kg frischen Resedenblüten und bringt das Produkt als
Resedageraniol in den Handel.
[S. 511]
Die in allen Teilen durch einen reichen Gehalt an ätherischem Öl
starkriechende Gartenraute (Ruta graveolens) wurde
schon im Altertum als beliebtes Gewürz und magenstärkendes, Blähungen
vertreibendes Heilmittel gepflanzt. Der Geruch des Krautes ist
den Katzen und Ratten zuwider. Sie hieß schon bei den Griechen
rúta und bei den Römern im Gegensatz zur wilden Raute ruta
hortensis, d. h. Gartenraute. Der griechische Arzt Dioskurides
schreibt in seiner Arzneimittellehre: „Die Bergraute und überhaupt die
wilde Raute wirkt viel heftiger als die Gartenraute, ist deshalb zum
Essen unbrauchbar, kann, in Menge genossen, sogar töten. Am besten
ist diejenige Gartenraute, die neben Feigen wächst. Die Gartenraute
wird als Gewürz und auch sehr vielfach als Arznei verwendet.“ Durch
Vermittlung der Klöster kam dann diese Heilpflanze in die Bauerngärten
nördlich der Alpen, wo sie sich teilweise bis auf unsere Tage erhielt
und stellenweise auch verwilderte.
Während die zahlreichen einheimischen und ausländischen
Geraniumarten oder Storchschnabelgewächse nur ganz ausnahmsweise
in besonders großblütigen Arten zu Gartenzierpflanzen erhoben wurden,
war dies in hohem Maße bei den vom Kap der Guten Hoffnung zu uns
gekommenen Pelargonien oder Kranichschnäbeln der Fall. Fast alle
175 Arten derselben sind auf Südafrika beschränkt. Da viele derselben
durch prächtige Blüten, wohlriechende, schöngezeichnete Blätter, den
anhaltenden Blütenreichtum und leichte Kultur ausgezeichnet sind,
ist es kein Wunder, daß sie zu Anfang des 19. Jahrhunderts allgemein
beliebte Modeblumen wurden, die meist in Töpfen gezogen wurden. Später
wurden sie meist wieder von Kakteen, Camellien und anderen Neuheiten
verdrängt, sind aber seit einigen Dezennien durch zahllose, besonders
von England eingeführte großblütige Spielarten und Hybriden wieder
beliebter geworden. In den Bauernhäusern haben sie sich mit den Nelken
die alte Gunst bewahrt. Die strauchartigen unter ihnen sind sehr
leicht zu kultivieren, während die krautartigen mit Knollenwurzel eine
sorgfältige Behandlung erheischen.
Die Mutterpflanze unserer meist rotblühenden Pelargonien, die vom
Volke gewöhnlich als Geranien bezeichnet werden, ist das in Südafrika
heimische, in Südspanien verwilderte Pelargonium inquinans mit
strauchigem, dickem, fleischigem Stengel, kreisrund nierenförmigen,
etwas gekerbten, gleich dem Stengel filzig schmierigen Blättern und
leuchtend scharlachroten Blüten in langgestielten Dolden. Neben ihm ist
auch das als „Brennende Liebe“ bezeichnete Pelargonium zonale[S. 512]
mit langgestielten Dolden mit rosaroten Blüten die Mutterpflanze
vieler Gartenpelargonien. Das Zitronengeranium (Pelargonium
odoratissimum) mit kleinen, weißen Blüten und das Rosengeranium
(P. roseum), eine Abart des raspelblätterigen Geraniums (P.
radula), die 1,6 m hoch wird und hellrote Blüten besitzt,
werden besonders in Frankreich, Spanien, Algerien und auf der Insel
Réunion zur Gewinnung des angenehm rosenartig riechenden, farblosen
bis grünlichen ätherischen Geraniumöls im großen kultiviert. Das darin
wirksame Prinzip, das Geraniol, ist, wie früher gesagt, identisch
mit dem Rhodinol, dem ätherischen Öl der Rosen. Es dient außer zu
Parfüms — auch zum Parfümieren des Schnupftabaks — hauptsächlich als
Surrogat und zum Verfälschen des Rosenöls, wird aber selbst wieder mit
dem ätherischen Lemongrasöl von Andropogon schoenanthus u. a.
verfälscht.
Vom blumistischen Standpunkte aus unterscheidet man: 1. Die sehr
großblumigen englischen Pelargonien, die meist von P.
grandiflorum und P. quinquevulnerum abstammen. Sie sind
teilweise auch französischen Ursprungs und umfassen außerdem die für
die Topfkultur sehr geeigneten Odierpelargonien (nach ihrem Züchter,
dem Franzosen Odier, so genannt) mit 40–60 cm hohem, holzigem
Stamm und großen, fünffleckigen Blumen. Ihnen ähnlich sind die
Diadempelargonien. 2. Die Fancy- (vom englischen fancy,
Einbildungskraft, Phantasie) oder Phantasiepelargonien von
niedrigem Wuchs, mit zahlreichen zierlichen Blumen von unregelmäßiger
Form, aber lebhafter Zeichnung. Sie wurden meist in Frankreich
gezüchtet. 3. Die Scharlachpelargonien, die aus den erwähnten
P. zonale und inquinans gezüchtet wurden. Sie sind
meist von robustem Wuchs, mit einförmigen, nur mit einem Auge
versehenen oder anders gerandeten, roten, rosenroten, lachsroten oder
weißen Blüten, einfach, gefüllt und buntblätterig. Zu ihnen gehören
die Nosegay- oder Straußpelargonien mit sehr großen Blütendolden.
Die Mutterpflanze der Efeupelargonien (oder Efeugeranien),
von denen einige mit niederliegenden Stengeln als Ampel- und
Balkonpflanzen kultiviert werden, ist das strauchige, fast 1 m
hohe Pelargonium peltatum mit ziemlich großen, blaßroten, auch
weiß und roten Blüten. Die ersten Pelargonien wurden 1690 vom Kap
nach Europa gebracht. Ihre Kultur zur Gewinnung von ätherischem Öl
begann 1847 in Frankreich und wurde später in Algerien eingeführt. In
Spanien kultiviert man sie besonders um Valencia und Almeria. Seit
Ende der 1880er Jahre liefert die französische Insel Réunion nächst
Algerien das meiste Geraniumöl.[S. 513] Die knollige Wurzel des ebenfalls
südafrikanischen Pelargonium triste ist eßbar.
Tafel 147.

Anlegung eines Nutz- und Ziergartens durch die Schuljugend in der
Gartenstadt Port Sunlight (Südengland).
(Nach Berlepsch-Valendas, Die Gartenstadt München-Perlach.)
❏
GRÖSSERES BILD
Tafel 149.

Blumengarten in Verbindung mit einem Gemüsegarten in Port Sunlight.
❏
GRÖSSERES BILD
Ebenso werden die knolligen Wurzeln der mittelamerikanischen
Sauerkleearten Oxalis tuberosa und esculenta
gegessen. Zu diesem Zwecke werden diese Pflanzen in ihrer Heimat
angebaut, wie auch der dickstengelige Sauerklee (Oxalis
crassicaulis), dessen in Aussehen und Geschmack unsern Kartoffeln
ähnliche Wurzelknollen verspeist werden, während die Blätter als Salat
dienen. Die dicken Stengel sind reich an oxalsaurem Kalk, der aus
dem ausgepreßten Safte derselben in Kristallen aufschießt. Die ganze
Pflanze dient auch zu Rabatteneinfassungen. Gleicherweise enthält das
Kraut des gemeinen Sauerklees (Oxalis acetosella) viel
Oxalsäure, das früher daraus gewonnen wurde und als Sauerkleesalz in
den Handel kam. Zu 1 kg desselben waren 150 kg Blätter
nötig. Neuerdings wird dieses künstlich hergestellt. Die Blätter des
Sauerklees werden indessen wie Sauerampfer zu Salat benutzt. Sie
standen früher als heraldische Pflanze im Wappen der Irländer. Als
shamrock wurde die Pflanze von englischen Dichtern häufig
besungen. Alljährlich am 17. März, am Tage des heiligen Patricius
(Patrik), des Schutzpatrons von Irland, wird ein Sauerkleeblatt von
jedem patriotischen Irländer im Knopfloch oder am Hut getragen, da
jener Schutzheilige des Landes durch dieses Sinnbild den Iren das
Geheimnis der heiligen Dreifaltigkeit erklärt haben soll. Mit der
Ausrottung der Wälder auf dieser Insel wurde auch der nur in Wäldern
wachsende Sauerklee ausgerottet und der kriechende Klee (Trifolium
repens) erschien durch die Kultur. Deshalb werden nun die Blätter
dieser Pflanze an Stelle derjenigen des Sauerklees als shamrock
getragen und vielfach für das echte Nationalabzeichen der Irländer
gehalten.
Von den Malvengewächsen sind die Moschus- und Rosenmalve
(Malva moschata und alcea), beide mit rosenroten,
erstere ausnahmsweise auch mit weißen Blüten, zu Gartenzierpflanzen
erhoben worden. Die wilde oder Roßmalve (Malva
silvestris), auch Käsepappel genannt, mit hellpurpurnen, dunkler
gestreiften Blüten, die beim Kochen ihres Krautes eine schleimige
Lösung liefert, wird seit dem frühen Altertum äußerlich zu erweichenden
Umschlägen und innerlich zu Gurgelwässern und als beruhigendes Mittel
gebraucht. Außerdem wird sie auch als Gemüse angepflanzt. Schon
der griechische Dichter Hesiod erwähnt sie unter der Bezeichnung
maláchē als eßbar. Dioskurides im 1. Jahrhundert n. Chr.
sagt in seiner Arzneimittellehre:[S. 514] „Die im Garten gezogene Malve
(maláchē) paßt besser zur Speise als die wilde. Man braucht
die Pflanze auch äußerlich und innerlich als Heilmittel.“ Palladius
(um 380 n. Chr.), der sie, wie schon der ältere Plinius, malva
nennt, rät, sie im Oktober zu säen und sagt, daß man sie auch im
Februar säen könne. Sie liebe einen fetten, feuchten, gedüngten
Boden. „Haben die Pflänzchen 4–5 Blätter, so versetzt man sie; denn
ist sie größer, so wächst sie nicht leicht an. Sie schmeckt übrigens
besser, wenn sie nicht versetzt wird. Man kann sie dadurch zwingen,
nicht emporzuschießen, daß man auf ihre Spitze ein Steinchen oder
Erdklümpchen legt. Sie gedeiht am besten, wenn sie fleißig gehackt
wird, wobei man aber ihre Wurzeln nicht berühren darf.“
Von der in Syrien heimischen krausen Malve (Malva crispa)
wird der Bast des Stengels als Gespinstmaterial gebraucht, ebenso von
der ostindischen Hanfrose (Hibiscus cannabinus), einer
einjährigen, krautigen Pflanze, welche in ihrer Heimat seit alter Zeit
in ausgedehntem Maße kultiviert wird und den weißlichen, geschmeidigen,
weichen, dem Flachs ähnlichen Gambohanf liefert. Auch der
veränderliche Eibisch (Hibiscus mutabilis), dessen schöne
Blüten morgens beim Aufblühen weiß, mittags rosenrot und abends beim
Verblühen purpurrot sind, liefert einen guten Bast. Blätter und Blüten
werden in China und Ostindien als Heilmittel benutzt. Die Pflanze wird
in Südspanien kultiviert.
Ebenfalls strauchartig ist der chinesische Roseneibisch
(Hibiscus rosa chinensis), der gleich dem vorigen in Ostindien
und China als schöne Zierpflanze kultiviert wird. Seine großen, stark
variierenden Blüten dienen dazu, Kopfhaare, Augenbrauen und auch Schuhe
schön schwarz zu färben. Auch sein Bast wird technisch verwendet. Der
syrische Eibisch (Hibiscus syriacus), ein Strauch von
1,5–3 m Höhe mit 8 cm breiten, violetten, roten oder
weißen, im Grunde schwarzroten Blüten, ist bei uns eine beliebte, im
Freien unter Bedeckung überwinternde Zierpflanze. Winterhärter ist
der noch häufiger in Gärten angetroffene, aus Südeuropa stammende
Stundeneibisch (Hibiscus trionum), dessen zarte Blüten
sich zu bestimmten Tageszeiten öffnen und nur wenige Stunden offen
bleiben. Wegen dieser Eigentümlichkeit wird er auch Stundenblume oder
Wetterrose genannt.
Der arzneilich von uns gebrauchte gemeine Eibisch (Althaea
officinalis) mit bis 1,25 m hohem, aufrechtem Stengel,
beiderseits weichfilzigen Blättern und weißen, ins Rötliche spielenden
Blüten wächst auf feuchten Wiesen, besonders auf Salzboden, wild und
wird in Mittel[S. 515]deutschland im großen kultiviert. Er stand wegen seiner
Heilkraft seit den ältesten Zeiten bei den europäischen Völkern in
hohem Ansehen. Schon der griechische Pflanzenkenner Theophrast im 4.
Jahrhundert v. Chr. erwähnt ihn als althaía, Vergil (70–19
v. Chr.) in einer seiner Eclogen als hibiscus. Der griechische
Arzt Dioskurides schreibt von ihm: „Die althaía heißt auch
ibískos, ihre Blätter sind rund, flaumig; die Blüte ist rosa,
der Stamm zwei Ellen hoch, die Wurzel schleimig, inwendig weiß. Die
Pflanze leistet, innerlich und äußerlich angewendet, treffliche Dienste
und heißt eben deswegen althaía (von althaínein heilen).“
Noch heute sind Blätter und Blüten, besonders aber die Wurzel wegen
ihres Schleims offizinell.
Ein beliebtes Hausmittel bei Bronchitis mit Husten zur leichteren
Lösung des Schleims und Beförderung des Auswurfs ist die aus einer
Abkochung der Eibischwurzel mit Eiweiß, arabischem Gummi und Zucker
hergestellte Eibischpaste oder weiße Lakritze. Bei Landleuten ist
auch die gelbe Eibischsalbe als Heilmittel sehr beliebt. Eine aus dem
Orient in unsere Gärten gekommene und als beliebte Zierpflanze in den
mannigfaltigsten Farben darin kultivierte Malvenart ist die 2,5 bis
3,8 m hohe Stockmalve oder Stockrose (Althaea
rosea) mit einer langen, aufrechten Ähre von ursprünglich roten
bis weißen Blüten. Letztere enthalten sehr viel Schleim und werden,
wie diejenigen des gemeinen Eibischs, zu schleimlösenden Medizinen
gebraucht. Besonders aber dienen die Blumenblätter der als schwarze
Malve bezeichneten schwärzlich blühenden Spielart zum Färben, speziell
zum Rotfärben des Weins. Jetzt geschieht dies noch mehr als mit dem
Safte der Heidelbeeren; deshalb sind sie von den Weinhändlern sehr
gesucht. Aus diesem Grunde breitet sich die Kultur der schwarzen
Malve immer mehr aus. Besonders groß ist ihr Verbrauch zum Färben
von Zuckerwaren in der Türkei. Die Bastfasern der Stengel können zur
Papierfabrikation verwendet werden.
Zu den Malven gehören auch die Staudenpappeln (Lavatera),
deren 20 Arten meist im Mittelmeergebiet heimisch sind. Mehrere
derselben dienen als Zierpflanzen, so Lavatera olbia, ein
schöner 2–2,5 m hoher Halbstrauch mit purpur- bis rosaroten
Blüten, der auf den Inseln Südfrankreichs zur Umzäunung der Gärten
benutzt wird, bei uns aber im Kalthaus überwintert werden muß; dann
die schöne, 1,25–2 m hohe Sommerpappel (Lavatera
trimestris) mit rosenroten, dunkler geäderten oder weißen
Blüten und die ausdauernde Lavatera arborea mit 4 cm
im Durchmesser haltenden purpurroten Blüten. Sie wächst[S. 516] in den
Mittelmeerländern und auf den Kanaren und eignet sich zur Anpflanzung
auf Rasenplätzen; doch muß sie bei uns im Kalthaus überwintert werden.
Außer als Küchengewächs findet sich wegen seiner großen Blätter sehr
häufig Rheum undulatum, der Rhabarber mit am Rande
welligen Blättern, als Zierpflanze in Anlagen angebaut. Die saftigen,
dicken Blattstiele geben mit Zucker gekocht ein treffliches Kompott.
In Schlesien wie in England wird die Pflanze auch zur Weinbereitung
angepflanzt. Nahe verwandt damit ist der Amarant oder die
Samtblume. Von ihnen sind beliebte Gartenzierpflanzen: der aus
Persien stammende rote Fuchsschwanz (Amarantus caudatus),
der oft über und über rot ist, mit sehr langer, schlaff überhängender,
hellroter Blütenähre. Dann der aus Ostindien zu uns gekommene
dreifarbige Fuchsschwanz (Amarantus tricolor) mit grün,
gelb und hochrot gefärbten Blättern. Der mehlreiche Fuchsschwanz
(A. frumentaceus) liefert ein stärkemehlreiches, als wichtiges
Nahrungsmittel verbackenes Samenmehl und wird deshalb in Ostindien
im großen angebaut. In Brasilien dagegen dient als Gemüse und in
Westindien als Heilmittel Amarantus melancholicus, dessen rote
Spielart als Dekorationspflanze in Gärten sehr beliebt ist. Nicht
minder häufig treffen wir in Gärten den in Mittelamerika heimischen
blutroten Fuchsschwanz (A. sanguineus) mit sehr langer,
aufrechter, blutroter Rispenähre. Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts
ist der auf bebautem Boden und auf Schutt angetroffene rauhhaarige
Fuchsschwanz (A. retroflexus) aus Amerika zu uns eingewandert.
Von den Glockenblumen (Campanula) wird der einjährige
Frauenspiegel (C. speculum) in mehreren Varietäten als
Zierpflanze kultiviert. Von den zweijährigen zieht man ebenso das
Marienveilchen (C. media) aus Südeuropa mit großen,
blauen, auch rosaroten und weißen, traubig oder rispig angeordneten
Blüten, nicht selten mit mehreren Kronen, auch kronenartigem Kelch und
eßbarer Wurzel, und C. pyramidalis aus den Mittelmeerländern
mit noch größeren Blüten in straußförmiger Rispe. Von den ausdauernden
Arten eignet sich die von den Gebirgen Mitteleuropas stammende
rasenartige C. caespitosa mit hellblauen Blüten in Trauben zur
Verschönerung künstlicher Felsenpartien und zu Einfassungen, ebenso die
aus europäischen Gebirgen genommene zierliche C. pusilla mit
überhängenden, hellblauen Blüten. Auch die in fast ganz Europa, wie
auch in Sibirien heimische C. persicifolia mit wenigen, aber
schönen, großen, blauen Blüten wird[S. 517] als Zierpflanze gezogen, während
die zweijährige C. rapunculus aus den Wäldern Europas wegen
ihrer fleischigen, wohlschmeckenden Wurzel in Frankreich und England
als Gemüse gepflanzt wird.
Sehr zahlreiche Zierpflanzen für Garten- und Topfkultur hat die Familie
der Nelken geliefert, deren wilde Vertreter die Poesie unserer
Wiesen bilden. Sie sind vorzugsweise in der gemäßigten, ja teilweise
in der kalten Zone und in höheren Gebirgsregionen heimisch. Bei den
Kulturvölkern des Altertums spielten sie als Gartenpflanzen keinerlei
Rolle. Der Gattungsname Dianthus (verkürzt aus dem Griechischen
Diós ánthos Zeusblume), den Karl von Linné den Nelken im
engeren Sinne verlieh, war schon den Alten bekannt. So spricht der
Grieche Theophrast im 4. Jahrhundert v. Chr. von ihr als einer zu
Kränzen beliebten Blume, und der Grammatiker Athenaios um 200 n. Chr.
überliefert uns ein Fragment des Dichters Nikandros, in welchem von
der wohlriechenden Zeusblume (enôdēs Diós ánthos) die Rede ist.
Damit dürfte wohl die strauchartige Baumnelke (Dianthus
arboreus), welche an den felsigen Küsten des Ägäischen Meeres wild
wächst, gemeint sein.
Jedenfalls haben die Griechen und Römer unsere klassische
Gartennelke (Dianthus caryophyllaceus — letzteres Wort
bedeutet Nußblatt) nicht gekannt. Die Stammpflanze derselben ist im
Mittelmeergebiet heimisch, wächst an felsigen Stellen und hat einzeln
stehende, höchst angenehm gewürzhaft riechende Blüten und treibt
zahlreiche ästige, verlängerte Stengel. Sie variiert in der Färbung
der Blüten ganz außerordentlich und wurde in der Neuzeit in allen nur
erdenkbaren Farbenvarietäten gezüchtet. Diese heute so außerordentlich
beliebte Zierblume wurde im muhammedanischen Orient zur Kulturpflanze
erhoben und kam im 13. Jahrhundert durch Kreuzfahrer von dort nach
Mitteleuropa. In einer noch wenig hochgezüchteten, fünfblättrigen
Form finden wir sie in der Hand des „Mannes mit der Nelke“ von Jan
van Eyck (zwischen 1430 und 1440 in Brügge gemalt, jetzt in Berlin)
als eine für die damalige Zeit moderne Blume dargestellt, während sie
in dem ebenfalls in Berlin befindlichen, 1532 entstandenen Ölgemälde
des deutschen Kaufmanns Georg Gisse im Stahlhof in London von Hans
Holbein dem Jüngeren, wo deren drei in einer durchsichtigen Glasvase
mit zwei Henkeln stehen, schon in mehreren Nuancen von Rot in teilweise
gefüllten Exemplaren zu sehen sind. In dem noch später entstandenen
Porträt des englischen Edelmannes Simon George aus Cornwall von
demselben Maler (jetzt im Städtischen Museum zu[S. 518] Frankfurt a. M.)
ist in der rechten Hand des mit hübschem Barett geschmückten Mannes
eine ungefüllte rote Nelke mit fünf ziemlich großen Blumenblättern
dargestellt. Damals müssen die einfachen, ungefüllten Nelken in
dunkleren und helleren Tönungen von Rot die fast ausschließlich in
Europa gezogenen Nelken gewesen sein.
In Frankreich begann die Nelkenzucht schon seit der Zeit Ludwigs
IX. des Heiligen (geb. 1215, folgte seinem Vater 1226 unter der
Vormundschaft seiner Mutter Blanca von Kastilien, unternahm 1248
einen Kreuzzug, von dem er gegen ein Lösegeld von 100000 Mark Silber
von den Sarazenen in Ägypten mit seinen Brüdern Karl und Alfons 1254
nach Frankreich zurückkehrte, unternahm im Juli 1270 einen Zug gegen
Tunis, auf welchem er am 25. August 1270 im Lager von Tunis starb).
Aber erst im 17. Jahrhundert war die Kultur dieser Gartenpflanze
in Mitteleuropa zu einiger Blüte gelangt. Der erste, von dem wir
wissen, daß er die Gartennelke leidenschaftlich liebte, war Ludwig II.
von Bourbon, Prinz von Condé, der große Condé genannt (1621–1668),
einer der hervorragendsten französischen Feldherren in den Kriegen
des 17. Jahrhunderts. Ihm zu Ehren trugen seine Soldaten, die er in
der Schlacht bei Rocroi am 19. Mai 1645 zu ruhmreichem Siege über
die Spanier, und am 3. August desselben Jahres zum Sieg über den
bayerischen General Mercy bei Allersheim geführt hatte, die Nelke als
Sinnbild der Tapferkeit und Unerschrockenheit. Zur Zeit der großen
französischen Revolution von 1793 war die rote Gartennelke, von der
bisher allein die Rede war und die wohl bis dahin allein gezüchtet
wurde, das Emblem der in stolzer Todesverachtung das Schaffot
besteigenden Royalisten. Wie sie heute die Blume des Volkes ist, war
sie damals noch die Blume der Aristokratie, wie in Frankreich, so
auch in England und den übrigen Kulturstaaten Europas. Bei den Briten
heißt der ganze Farbenbegriff Rot nach der roten Nelke pink.
Erst später wurde sie beim Volke populär und wurde bei ihm die
Blume der Liebe. Zuletzt spielte sie eine vorübergehende Rolle als
Erkennungsmittel der Anhänger des revanchelustigen französischen
Generals Boulanger, der dann, als er seinen ehrgeizigen Plan scheitern
sah, sich in Belgien am Grabe seiner einstigen Geliebten erschoß.
Mit Vorliebe trägt der Torrero die rote Nelke als Kampfesschmuck und
weiht sie nach erlangtem Sieg über seinen spitzgehörnten Feind der Dame
seines Herzens. Wenn die junge Spanierin in Begleitung ihrer Duenna,
d. h. Hüterin, nach der Messe aus der Kirche tritt, richtet[S. 519] sich der
erste Blick ihres verstohlen draußen auf sie wartenden Amorosos auf
die Nelke, die auf einen Moment unter der graziös gelüfteten Mantilla
sichtbar wird. Die Farbe der Nelke bezeichnet ihm die Stunde, zu der
er die Angebetete ungestört sprechen kann. Auch bei anderen Romanen
wird ihr solch stumme Liebesbotschaft anvertraut, wie der Hyazinthe
bei den Türkinnen. Die Italienerin weiht vor dem Muttergottesbilde
am Kreuzweg den für ihren Geliebten bestimmten Nelkenstrauß durch
inbrünstiges Gebet und steckt ihn jenem als Schutz- und Gedenkzeichen
zu, bevor er mit den beladenen Maultieren den gefahrvollen Weg über
das Gebirge antritt. Auch der rote Nelkenstrauß am Hute des „Jagers“
gibt von der guten Aufnahme bei seinem „Dearndel“ Bescheid. Diese
selbst trägt Sonntags beim Kirchgang eines ihrer blutroten „Nagerle“
auf ihrem „Betbüchel“ als schönste Zier. Von Bauernhaus zu Bauernhaus
und von Pfarre zu Pfarre werden Nelkensenker getauscht und wird
so die schöne Blume, der besondere Liebling der Landbevölkerung,
überallhin verbreitet. In den Alpen heißt es, man soll die Nelken
beim Glockenklang säen, dann werden sie reich gefüllt. Überall ist
sie neben den als Geranien bezeichneten, in allen Farbennuancen
von Rot leuchtenden Pelargonien in Töpfen auf den Fenstersimsen
der Bauernhäuser zu finden und ist hier gleichsam das Symbol des
glücklichen Zusammenlebens und häuslichen Friedens. Und je höher man
ins Gebirge steigt, um so herrlicher leuchten die bunten Farben dieser
Wunderblume. So sind die Engadiner Nelken wegen der Intensität ihres
Kolorits und der Größe ihrer Blüten weltberühmt; auch die Blüten von
14: 9 cm Durchmesser aufweisenden, meist lachsrosa gefärbten
Harznelken erfreuen sich besonderer Beliebtheit.
Das Wort Nelke ist aus Nägelein, Nägelken — wie sie heute noch beim
Volke heißt — verkürzt. Ursprünglich bezeichnete man damit die
Gewürznägelein wegen ihrer Ähnlichkeit mit Nägeln; und als die Blume
aus dem Oriente bei uns eingeführt wurde, übertrug man diesen Namen
auf die ähnliche Nagelgestalt und nicht minder aromatischen Geruch
aufweisende Blütenpflanze. Gegen die Mitte des 19. Jahrhunderts
machte der Lyoner Gärtner Léon Lille die Nelkenkultur zu seiner
Spezialität und von da an wurde die Zucht dieser schönen Blume auch von
zahlreichen anderen Gärtnern mit besonderem Eifer betrieben, so daß
es heute gegen 2000 Varietäten der Nelke gibt. Am beliebtesten sind
die Remontantnelken, d. h. solche, die nach dem Hauptflor an
neugebildeten Trieben nochmals blühen.
Ebenfalls als Gartenzierpflanze sehr geschätzt ist die leider duftlose[S. 520]
chinesische Nelke (Dianthus chinensis), eine, wie
schon der Name sagt, aus China zu uns gekommene, hochgezüchtete,
ein- oder zweijährige Pflanze mit prachtvollen, bis 8 cm im
Durchmesser haltenden, in allen Nuancen von Rot, Purpur, Schwarzrot
und Weiß leuchtenden, außerordentlich zierlich gezeichneten,
sowohl einfachen als gefüllten Blüten. Die schönste derselben ist
die von einem russischen Gärtner eingeführte D. heddewigi
(Dianthus chinensis imperialis), eine ungefüllte Art mit
fünf ganz zerschlissenen, karminroten Blumenblättern mit weißen
Saftmalen und schwärzlicher Zone. Die in Südosteuropa heimische,
ausdauernde Federnelke (D. plumarius) mit 2–5 sehr
wohlriechenden, weißen oder blaßroten Blüten, die auch in gefüllten
Spielarten vorkommen, wird häufig zur Einfassung von Blumenbeeten
benutzt. Auch die Studenten- oder Bartnelke (D.
barbatus), eine rosenrot blühende süddeutsche Alpenpflanze, und
ihre Spielart mit breiteren Blättern (D. latifolius) sind
beliebte Gartenzierpflanzen. Nur ausnahmsweise kultiviert werden
dagegen die auf feuchten Waldwiesen ziemlich selten angetroffene
Prachtfedernelke (D. superbus) mit fein zerschlitzten,
blaßlila oder blaß rosenroten Blumenblättern, die nach dem botanischen
Schriftsteller und Reisenden Joh. Franz Suegier genannte Dianthus
seguieri in Süd- und Mitteldeutschland und die zu Ehren der beiden
Naturforscher Joh. Karthauser († 1777) und Friedrich Karthauser (†
1796) getaufte Karthäusernelke (D. carthusianorum), die
ebenfalls blutrot, nur mit drei dunkleren Purpurstreifen durchzogen
ist. Einige dieser Nelken, besonders die Gartennelke, dienten früher
als Heilmittel.
Von den 10 Arten Lichtnelken (Lychnis, nach der
Theophrastischen Bezeichnung lychnís d. h. Leuchte), die in
der Alten Welt, vornehmlich in Sibirien, wachsen, ist die
50–80 cm hoch werdende „brennende Liebe“ oder Feuernelke
(Lychnis chalcedonica) mit scharlachroten Blüten und
zweiteiligen Blumenblättern aus Westsibirien, Mittel- und Südrußland
zu nennen. Sie wird auch in Varietäten mit fleischfarbenen und weißen,
auch gefüllten Blüten bei uns als Rabattpflanze gezogen. Ihre Wurzel
enthält Saponin und wird wie die Seifenwurzel zum Waschen gebraucht.
Auch die Kranzlichtnelke (L. coronaria) mit an die
Kornrade erinnernden purpurroten Blüten und ungeteilten Blättern
aus Südosteuropa wird bei uns häufig als Zierpflanze kultiviert.
Ebenso dienen die 20–30 cm hohe L. fulgens aus Sibirien
mit lebhaft roten, vierteiligen Blumenblättern, L. haageana
aus Japan, wohl nur eine Kulturform der vorigen, mit orangeroten,
rosenroten oder weißen Blüten, L. grandiflora aus Japan mit
sehr[S. 521] großen, scharlachroten, ungeteilten Blumenblättern und L.
sieboldi, ebenfalls aus Japan, mit noch größeren, weißen Blüten als
auch bei uns sehr geschätzte Gartenzierpflanzen.
Von Abendlichtnelken (Melandryum) werden M. album
mit weißen, seltener rötlichen Blüten aus Mittel- und Nordeuropa, wie
auch Sibirien und die im arktischen Gebiete wachsende M. rubrum
mit hellpurpurnen Blüten, auch in gefüllten Formen als Zierpflanzen
kultiviert. Ebenso wird von Pechnelken (Viscaria)
besonders V. viscosa aus Mittel-, Nordeuropa, dem Kaukasus und
Westsibirien mit roten Blüten in mehreren Varietäten, auch gefüllt,
gezogen. Von den Klebnelken der Gattung Silene werden
besonders das einjährige Marienröschen (S. armeria) aus
Mitteleuropa, das aber auch nach Nordamerika, Brasilien und Ostindien
verschleppt wurde, mit karminroten Blüten in großen Doldentrauben,
dann die im Mittelmeergebiet heimische S. pendula mit rosaroten
Blüten in mehreren Varietäten als Zierpflanzen kultiviert. Sie dienen
namentlich auch zu Einfassungen auf Teppichbeeten und Felsgruppen. Für
letztere eignet sich besonders die niedrige, rotblühende, arktische
und hochalpine stengellose Klebnelke (S. acaulis). Endlich
werden auch verschiedene Arten der Gattung Statice, deutsch
Strandnelken genannt, weil sie meist in Küstengegenden oder
Salzsteppen heimisch sind, aus Süd- und Osteuropa, von den Kanarischen
Inseln und aus Mittelasien als Zierpflanzen kultiviert. Ihre ährigen
oder traubigen Blütenstände dienen in der Blumenbinderei, werden auch
getrocknet für Dauersträuße benutzt.
Bei den alten Griechen und Römern wurde das Seifenkraut
(Saponaria officinalis) an Stelle der fehlenden Seife verwendet
und zu diesem Zwecke auch kultiviert. Es enthält besonders in den
Wurzeln das Glykosid Saponin, das in Wasser wie Seife schäumt. Die
Griechen nannten es strúthion. Theophrast sagt von ihm, es
habe eine schöne, aber geruchlose Blume. Columella gibt an, daß die
Schafe vor der Schur mit der Wurzel desselben gewaschen wurden, und
Dioskurides meint: „Das Seifenkraut, das die Walker zur Reinigung der
Wolle gebrauchen, ist allgemein bekannt. Seine Wurzel besitzt Schärfe
und Heilkraft.“ Sein Zeitgenosse Plinius sagt: „Das Seifenkraut
(herba lanaria) hat eine große Wurzel, die man in Stücke
schneidet und zum Waschen der Wolle benutzt; diese wird dadurch
außerordentlich weiß und weich. Man kultiviert sie eigens zu diesem
Zwecke.“ Ihre Wichtigkeit verlor sich, als die in Germanien erfundene
Seife den Römern bekannt wurde und ihre Stelle einnahm.
[S. 522]
Die fleischigen Portulakarten mit gelben oder roten Blüten,
die sehr kurze Zeit blühen und sich dann wie eine Gallerte auflösen,
haben vielsamige Fruchtkapseln, die sich mit einem Deckelchen
(portula, Türchen) öffnen. Daher der Name. Die mehr als 20 Arten
derselben wachsen in den Tropen und Subtropen der Alten, besonders
aber der Neuen Welt. Der in den Mittelmeerländern heimische gemeine
Portulak (Portulaca oleracea) mit kleinen, gelben oder
gelblichweißen Blüten wird in Gärten in mehreren Spielarten als P.
sativa kultiviert. Die jungen, sehr saftigen Blätter werden als
Zutat zu Salat oder Suppenkraut gegessen, auch mit Essig eingemacht.
Früher wurden Kraut und Same arzneilich benutzt. Die Pflanze hieß bei
den Griechen andráchnē. Dioskurides sagt von ihr, sie werde als
Speise genossen und gegen alle Übel gebraucht. Mehrere Arten werden
als Zierpflanzen angebaut, so besonders die einjährige Portulaca
grandiflora aus Brasilien mit hellpurpur- oder karminroten,
weißen oder gelben, auch gefüllten Blüten. Sie ist unter dem Namen
„Portulakröschen“ bekannt.
Verschiedene Mauerpfefferarten der Gattung Sedum werden
in Gärten kultiviert, so vor allem der weiße Mauerpfeffer (Sedum
album) aus den Mittelmeergegenden, dessen Kraut früher medizinisch
verwendet wurde. Jetzt noch dienen die zarten Blätter als Salat und
Suppenwürze. Dasselbe geschieht mit dem großen Gartentripmadam
(S. anacampseros) mit purpurroten oder weißen Blüten. Die
Stengel dieser Pflanze werden in Spalten der Häuser gesteckt und
dienen als Orakel für das Glück und die Lebensdauer junger Ehepaare
oder der Familienglieder. Auch der Felsenpfeffer (S.
reflexum) wird hier und da kultiviert und in derselben Weise
benutzt. Die an sonnigen Plätzen Südeuropas bis Kleinasiens wachsende
Schmerwurzel (S. maximum) mit 30–60 cm hohem,
aufrechtem Stengel mit weißen, grünlichgelben oder roten Blüten
wird noch heute arzneilich gebraucht. Zahlreiche ausländische Arten
werden als Zierpflanzen kultiviert, so vor allem die prächtige, 1830
von v. Siebold aus Japan eingeführte S. sieboldi. Sedum
japonicum mit blaugrünen, rotgesäumten Blättern und roten Blüten
verwendet man als Ampelpflanze oder zur Einfassung in Gärten. Auch
das in Sibirien heimische Sedum crassifolium mit roten Blüten
in gedrängter Rispe, dessen Blätter von den Kalmücken als Teesurrogat
gebraucht werden, wird bei uns häufig in Gärten gezogen.
Wie der scharfe Mauerpfeffer (Sedum acre) als kleines
aeí[S. 523]zōon (d. h. immerlebend), wurde die gemeine Hauswurz
(Sempervivum tectorum) als großes aeízōon schon im
Altertum auf Dächern zur Abhaltung des Blitzes gepflanzt. Daneben wurde
sie nach Plinius als Zierpflanze auch in irdenen Töpfen gezogen und
ihr aus den zerquetschten Blättern gewonnener Saft nach Dioskurides
als kühlendes, zusammenziehendes Mittel auf Brandwunden gelegt. Karl
der Große befahl die Anpflanzung der Hauswurz auf seinen Gütern.
So wurde sie, auch mit Hilfe der Klöster, in Mitteleuropa populär
und spielte bis in die Gegenwart in der ländlichen Arzneikunde eine
wichtige Rolle, indem der aus ihr gepreßte Saft gegen Halsentzündungen,
wunde Brustwarzen, Bienenstiche und Brandwunden verwendet wurde. Zur
Hexensalbe mußten die Blätter des „Donnerkrautes“ am Donnerstage
gepflückt werden.
Von den Steinbrechen (Saxifraga) dient die in den
Pyrenäen und in Irland heimische Saxifraga umbrosa mit weiß,
gelb und rot punktierten Blüten in länglichen Rispen ebenfalls zur
Einfassung in Gärten, während die aus China und Japan stammende S.
sarmentosa mit rotbehaarten Blättern und weißen oder blaßroten
Blüten sich als Zierpflanze häufig in Zimmern und Gewächshäusern findet.
Die Primeln oder Schlüsselblumen sind meist
Hochgebirgsbewohner. Die Mehrzahl der etwa 140 Arten wächst in Europa
und Asien, wenige kommen in Nordamerika vor und bilden auch hier den
ersten Frühlingsschmuck der Bergwiesen, weshalb sie überhaupt ihren
Namen erhielten. Primula, das Verkleinerungswort des weiblichen
prima, bedeutet nämlich der kleine Erstling. Diese Bezeichnung
bekam die Pflanze, weil sie mit dem Veilchen als erster Bote des
Lenzes erscheint und als solcher die Gemüter der aus der winterlichen
Enge in die ergrünenden Fluren Hinausziehenden doppelt erfreut. Im
Deutschen erhielt sie den Namen Schlüsselblume, weil sie als die erste
Frühlingsblume den Himmel gleichsam erschließt. Als Heilmittel war
seit dem Altertum besonders die arzneiliche Schlüsselblume
(Primula officinalis) mit gelben Blüten sehr hochgeschätzt.
Daraus bereiteter Tee galt als sehr nervenstärkend und heilsam gegen
Krämpfe, Nervenzufälle und Gemütsverstimmung. Schon die später heilig
gesprochene Hildegard, Äbtissin des Klosters Rupertsberg bei Bingen
im 12. Jahrhundert, pries den hymelsloszel (Himmelschlüssel)
wegen seiner Heilkraft. Außer solcher sollte er aber auch noch das
Vermögen besitzen, den Zugang zu verborgenen Schätzen zu erschließen.
Er hieß deshalb auch Marien- oder Petersschlüssel. Bis in unsere Zeit
wurden wenigstens die Blüten[S. 524] arzneilich und die Wurzel als Niesmittel
gebraucht. Mit ihr wurde auch die gelbblühende Primula elatior
von den Wiesen und Rainen in die Gärten verpflanzt und in Kulturpflege
genommen. Beide Pflanzen werden jetzt in mehreren gelb, rot, braun,
auch gefüllt blühenden Varietäten als Zierpflanzen kultiviert, ebenso
die Hybriden oder Bastarde derselben mit Primula acaulis.
Letztere mit sehr kurzgestielter Dolde und fünf safrangelben
Flecken auf dem flachen Saum der hellgelben Blumenblätter wächst im
Mittelmeergebiet und in Mitteleuropa. Bei manchen Varietäten entwickelt
sich der Kelch in der Form und Farbe der Blumenkrone, so daß zwei
gleiche Blumen ineinander zu stecken scheinen.
Noch beliebter als die Primeln waren im vergangenen Jahrhundert,
während welchem sie sehr viel gepflanzte, spielartenreiche Modeblumen
waren, die in der Gegenwart stark an Beliebtheit eingebüßt haben, die
Aurikeln, die ihren Namen von der ohrförmigen Gestalt ihrer
Blätter erhielten. Früher hieß man sie auricula ursi, d. h.
Bärenöhrchen. Die Ausgangsform der Gartenaurikeln ist die auf Torfboden
und an Felsen der Voralpen und Alpen, wie auch des Schwarzwalds
wachsende Primula auricula mit mehlig bestäubten Blättern und
schwefelgelben, wohlriechenden Blüten mit flachem Saum. Diese traf
der Botaniker und Arzt Clusius (Charles de l’Ecluse, 1526 bis 1609),
damals Hofbotaniker in Wien im Jahre 1582 im Gschnitztal südlich
von Innsbruck und nahm sie mit sich nach Wien und 1593 bei seinem
Wegzuge nach Leiden. Zugleich mit ihr führte Clusius die rotblühende
Primula pubescens, die als ein Bastard der vorigen mit
Primula hirsuta anzusehen ist und bei Innsbruck wächst, in die
Gärten ein. In der Mitte des 17. Jahrhunderts wurden beide Primelarten
besonders in Belgien, Holland, England und Deutschland in mehreren
Farbenvarietäten mit Vorliebe gezogen. In der Folge aber verschwand die
beständigere P. auricula wieder vollständig aus den Gärten und
P. pubescens war ausschließlich der Ausgangspunkt der mächtig
aufblühenden Aurikelzucht, die in den letzten Jahrzehnten des 17.
Jahrhunderts ihren Höhepunkt erreichte. Unter den über 1000 Spielarten
unterscheidet man einfarbige, zweifarbige (Dublettenaurikeln),
mehrfarbige (Bizardaurikeln) und verschiedenfarbige Aurikeln
(Picottaurikeln). Eine holländische Art heißt Luiker, d. h.
Lütticher. Englische Sorten werden als „gepuderte“ unterschieden, weil
sie eine starke Bestäubung der Oberfläche mit Wachskügelchen aufweisen.
Wichtiger als die einheimischen sind aber gegenwärtig die
ostasia[S. 525]tischen Aurikeln, vor allem die Primula chinensis
aus Südchina mit Dolden sehr großer, hell lilafarbiger, rosenroter
oder weißer Blüten. Obschon sie erst im Jahre 1824 von China nach
England kam, zählt sie heute sehr viele Spielarten mit weißen und
roten, einfachen und gefüllten Blüten. Sie ist als Zimmer- und
Gewächshauspflanze gleich wertvoll, blüht das ganze Jahr hindurch
und liefert gutes Material für Buketts, was sehr wichtig ist.
Besonders die weißen, gefüllten Blüten sind für die Blumenbinderei
von großer Bedeutung. Ebenso stammt die sehr reichblühende Primula
obconica aus China; sie ist dadurch allgemeiner bekannt geworden,
daß die Drüsenhaare an der Oberfläche der Blätter eine gelblichgrüne
Flüssigkeit ausscheiden, die bei Berührung der Pflanze empfindliche
Hautentzündung mit beträchtlich gestörtem Allgemeinbefinden verursacht.
Es scheint bei gewissen Individuen eine besondere Disposition vorhanden
zu sein; oft tritt die Erkrankung erst mehrere Stunden oder Tage nach
der Berührung der Pflanze ein. Auch Primula cortusoides aus
dem Osthimalaja und aus Jün-nan, wie auch Pr. japonica werden
in mehreren Spielarten in unseren Gärten kultiviert. Nicht minder
geschätzte Winterblüher als die chinesische lieferte die nach ihr
eingeführte Himalajaprimel, die mit den ostasiatischen und europäischen
Arten mehrfach gekreuzt wurde. Gelegentlich werden auch der blaue
Speik (Primula glutinosa) mit violetten, wohlriechenden
Blüten mit abstehendem Saum, der in den Zentralalpen auf Urgestein
zu finden ist, und die zierliche, im hohen Norden heimische, als
Relikt der Eiszeit auf feuchten Alpenwiesen und auf Torfboden des
norddeutschen Tieflandes — aber auch in der Magelhaensstraße —
angetroffene mehlig bestäubte Primel (Primula farinosa)
mit fleischroten oder violetten Blüten mit gelbem Schlunde in Töpfen
angepflanzt oder in Gärten gehalten. Gelegentlich geschieht dies auch
mit der Alpensoldanelle (Soldanella alpina) mit ihren
zierlichen bläulichen oder violetten Blütenglöckchen mit gefranstem
Saume.
Eine weitere, sehr geschätzte Zierpflanze der Alpen und Voralpen
ist das Alpenveilchen (Cyclamen europaeum), wegen
seiner plattkuchenförmigen, fleischigen Knolle auch Erdscheibe
genannt. Letztere schmeckt in frischem Zustande brennend scharf und
enthält das Alkaloid Cyclamin, das, in den Magen gebracht, heftiges
Erbrechen bewirkt und ins Blut eingespritzt tötet. Früher wurden die
Wurzelknollen als drastisches Purgiermittel benutzt; sie verlieren
aber durch Kochen oder Braten in Asche ihre Schärfe und werden deshalb
von den Russen[S. 526] gegessen. Die Wildschweine sollen sie gerne und ohne
Nachteil fressen, deshalb wird das Cyclamen auch Saubrot genannt. Das
im einheimischen Gebirge wachsende südeuropäische Cyclamen war unter
dem Namen kykláminon schon bei den alten Griechen bekannt und
seine Wurzelknolle wurde als Heilmittel und zu Zauberei benutzt.
Plinius, der sie selbst in Anlehnung an die griechische Bezeichnung
cyclaminon nennt, sagt, sie werde von den Römern Erdknollen
(tuber terrae) genannt, wachse im Schatten, habe purpurrote
Blüten und eine breite, einer Rübe ähnliche Wurzel mit schwarzer Rinde.
Sie diene gegen Schlangenbiß. „Sie sollte bei allen Häusern gezogen
werden, wenn es wahr ist, daß da, wo sie steht, kein Zaubermittel
wirkt, weswegen sie auch Amulett (amuletum) heißt. Wein, worin
sie liegt, soll sogleich berauschen. Die Wurzel wird zerschnitten und
getrocknet oder bis zur Honigdicke eingekocht und aufbewahrt.“ Wie die
einheimische Art wird auch das persische Alpenveilchen (Cyclamen
persicum) aus Vorderasien mit weißen, im Schlunde roten Blüten viel
in Töpfen gezogen und ist durch Kulturpflege zu Formen mit sehr großen
Blättern und Blüten in allen Nuancen von Rot neben Weiß gezüchtet
worden. Dadurch, daß es im Winter zum Blühen gebracht werden kann
und lange Zeit hindurch im Flor steht, ist es eine der am häufigsten
angetroffenen Topfpflanzen der Städter geworden. Durch Kreuzung des
bunt gezeichneten efeublätterigen Alpenveilchens mit kleinen Blüten
mit dem persischen Alpenveilchen mit weit schöneren, größeren Blüten
wurden Hybriden erzeugt, die die hübschen Blätter der ersteren neben
den schönen Blüten der letzteren aufweisen.
Ebenfalls als Blatt- und Zierpflanzen sehr beliebt und deshalb häufig
in Töpfen kultiviert angetroffen werden die Begonien oder
Schiefblätter. Von den über 400 Vertretern der in den Tropen
wachsenden Familie haben sehr viele prachtvoll gefärbte Blätter,
wachsen sehr schnell und lassen sich sehr leicht aus Stecklingen
ziehen. Legt man nämlich ein von ihnen abgeschnittenes Blatt auf
feuchte Erde, so wachsen aus allen Stellen, an denen die Blattnerven
verletzt wurden, junge Pflänzchen hervor. Unter den vielen bei uns in
Gewächshäusern und als Zimmerpflanzen gezogenen Arten unterscheidet
man 1. Blattbegonien, die wegen ihrer prachtvoll gefärbten,
teilweise sehr bunten Blätter gehalten werden. Sie sind seit dem Anfang
der 1850er Jahre höchst beliebt geworden und stammen hauptsächlich von
dem ostindischen Königsschiefblatt (Begonium rex), dessen große,
dunkelgrüne Blätter ein breites Silberband mit gleichgefärbten Flecken
aufweisen. Es wurde[S. 527] mit anderen Formen aus den Tropen der Alten Welt
gekreuzt und ergab zahlreiche schöne Spielarten. 2. Blüten- oder
Knollenbegonien, die sämtlich aus Südamerika stammen und in
bezug auf Effekt, Blütenfülle und Blütendauer mit den außerordentlich
effektvollen Scharlachpelargonien wetteifern. Die wichtigsten
Stammformen sind Begonia boliviensis mit leuchtendroten Blüten
aus Bolivia, B. veitchi und davisi aus Peru und B.
froebeli aus Venezuela. Die Blüten der durch Kreuzung dieser
untereinander erhaltenen Blendlinge variieren von Weiß und sattem
Gelb bis zum dunkelsten Rot, auch gibt es gefüllte Formen. Von den
immergrünen, strauch- oder halbstrauchartigen Begonien werden mehrere
Arten besonders aus Brasilien wegen ihrer Monate hindurch und mehrfach
im Winter erscheinenden Blüten kultiviert.
Südamerika lieferte uns auch die häufig als Zierpflanze, besonders
als Schlingpflanze zur Bekleidung von Lauben gezogene vielblumige
Feuerbohne (Phaseolus multiflorus), die weiße oder hochrote
Blüten und eßbare Samen hervorbringt. Beliebte Gartenzierpflanzen
liefern auch die verschiedenen Wicken, vor allem die in
Südeuropa heimische wohlriechende Wicke (Lathyrus
odoratus) mit sehr großen, rot und violetten oder rot und weißen,
wohlriechenden Blüten. Sie blüht fast den ganzen Sommer hindurch
und eignet sich vorzüglich zur Verzierung niedriger Geländer. Dann
die nordafrikanische Wicke (Lathyrus tingitanus) mit
großen, einfarbigen, violetten oder dunkelpurpurnen Blüten, die
griechische Wicke (L. climenum) aus Griechenland und
Kleinasien mit blauen Blüten, an denen nur die Fahne rot ist, die
Bukettwicke (L. latifolius) mit einer Traube von großen,
purpur- bis rosenroten Blüten, die großblütige Wicke (L.
grandiflorus) mit besonders großen, aber schwach wohlriechenden,
purpurroten Blüten, beide aus Südeuropa. Alle diese werden in mehreren
Varietäten kultiviert.
Die Gattung der Winden (Convolvulus) mit trichterförmigen
Blüten ist in den Gärten besonders durch die nichtwindende
dreifarbige Winde (C. tricolor) aus dem Mittelmeergebiet
mit himmelblauen, im Grunde gelben, in der Mitte weißen Blüten, dann
durch C. mauretanicus mit ebenfalls himmelblauen und durch C.
dahurica mit rosenroten Blüten vertreten. Verwandt damit sind die
schlingenden Mina lobata und M. lex aus Mexiko mit gelb
und rot gefärbten Blüten in langgestielten, gabeligen Blütenständen,
die ebenfalls bei uns als Zierpflanzen kultiviert werden.
[S. 528]
Ebensolche windende Kräuter sind die in 24 Arten ausschließlich
im wärmeren Mittel- und Südamerika heimischen Wunderblumen
(Mirabilis) mit großen, in der Nacht geöffneten Blüten. Unter
ihnen werden die 60–120 cm hohe Mirabilis longiflora mit
sehr langohrigen, weißen, am Schlund purpurnen, sehr wohlriechenden
Blüten aus den Bergen Mexikos und die ebendort heimische M.
jalapa, die falsche Jalape, mit schönen roten, gelben oder weißen,
oder auch in diesen Farben gestreiften und gesprenkelten, geruchlosen
Blüten in zahlreichen Varietäten bei uns kultiviert. Die Wurzel wirkt
abführend und wurde früher wie die offizinelle Jalape verwendet.
Zur Gattung der Boretschgewächse gehört außerdem der als Gewürz
und geschätzte Bienenweide in nicht nur dunkel- bis hellblauen,
sondern auch roten und weißen Formen gezogene gemeine Boretsch
(Borago officinalis), das in der gemäßigten Zone der Alten Welt
in 30 Arten wachsende Vergißmeinnicht oder Mäuseohr
(Myosotis); unter diesen ist das bei uns auf feuchten Wiesen und
an Bächen wachsende gemeine Vergißmeinnicht (Myosotis palustris)
mit in der Knospe rötlichen, später himmelblauen Blüten mit gelbem
Schlund ein sehr beliebtes, auch in Gärten angepflanztes Blümchen.
Neben ihm werden die zweijährige, mitteleuropäische M. silvatica
mit der Abart M. alpestris mit rauhhaarigen Stengeln und
himmelblauen Blüten und noch manche andere kultiviert. Das strahlendste
Blau haben die Blüten von M. azorica. Blendlinge von ihr mit
M. alpestris sind die M. semperflorens mit sehr langer
Blütezeit und andere Formen, wie „Elise Fonrobert“. Ebenso werden
von Hundszungen der Gattung Cynoglossum purpurrote,
himmelblaue und weiße Arten in Gärten gezogen.
In der Bukett- und Kranzbinderei, besonders für Gräberschmuck viel
verwendet werden die Immortellen, wie der französische Name
sagt „unvergängliche“ Blumen, aus der Familie der Kompositen oder
Korbblütler mit trockenhäutigen Blumenhüllblättern, die lange Zeit
nach dem Abschneiden ihre Form und ihr frisches Aussehen bewahren.
Im Deutschen bezeichnet man sie meist als Strohblumen, weil
sie trocken wie Stroh erscheinen. Durch diese völlig trockenhäutigen
Hüllblätter sind sie wie das ihnen sehr nahestehende, neuerdings
ebenfalls als Zierpflanze kultivierte Edelweiß (Gnaphalium
leontopodium) und andere filzige Kräuter, mit diesem die Wärme
schlecht leitenden Überzug gegen zu starke Verdunstung an ihren
von heißer Sonne beschienenen felsigen Standorten geschützt. Die
wichtigste derselben ist die[S. 529] in ganz Südeuropa auf sonnigen, trockenen
Felsabhängen wachsende gemeine oder gelbe Strohblume oder
Gold-Immortelle (Helichrysum stoechas) mit am Rande —
ebenfalls zum Schutze gegen zu starke Verdunstung — zurückgerollten,
gerieben wohlriechenden Blättern und goldgelben Blüten. Wegen
letzteren nannten sie die alten Griechen helichrýsos, d. h.
Sonnengold. Sie, wie auch die Römer, verwandten sie vielfach zum Winden
von sehr dauerhaften Kränzen und als Arznei. Der griechische Arzt
Dioskurides (im 1. Jahrhundert n. Chr.) schreibt: „Die Gold-Immortelle
(helíchrysos) wird auch chrysánthemon (d. h. Goldblume)
und amáranton (d. h. die Unverwelkliche) genannt und dient zur
Bekränzung von Götterbildern. Sie wächst an trockenen, felsigen Stellen
und hat trockenen Trauben ähnliche, goldgelbe, runde Blüten. Man
gebraucht sie als Arznei, legt sie auch zwischen die Kleider, um diese
vor fressendem Gewürm zu schützen.“ Ähnlich meldet sein Zeitgenosse,
der ältere Plinius: „Die goldglänzenden, büschelweise hängenden Blüten
der Gold-Immortelle (helichrysos) welken nie und dienen zur
Bekränzung der Götterbilder. Namentlich hat Ptolemäus, König von
Ägypten, diese sehr sorgfältig damit geschmückt.“ 400 Jahre vor ihm
schrieb Theophrast. „Es gibt Quacksalber, welche behaupten, man erlange
einen guten Ruf, wenn man sich mit der Gold-Immortelle bekränzt und
sich dabei mit Salbe aus einem Gefäß von gediegenem Gold einreibt. Jene
Pflanze hat aber eine goldfarbene Blume, ein weißliches Blatt, einen
weißlichen, harten Stengel und eine oberflächliche, dünne Wurzel.“
In seinen Idyllen sagt der um 280 v. Chr. lebende Dichter Theokrit
aus Syrakus, der bedeutendste Dichter der alexandrinischen Periode,
ein Meister der dann von Bion und Moschos und später von Vergil
nachgeahmten bukolischen Poesie, d. h. der poetischen Darstellung des
Hirtenslebens: „Der Becher ist mit Efeu und Gold-Immortellen bekränzt“,
und „Ihr Haar war goldiger als Gold-Immortellen, ihre Brust glänzender
als der Mond“. Auch der Dichter Nikander spricht von ihr.
Zu dieser einen, im Altertum ausschließlich gebräuchlichen Strohblume
(Helichrysum orientale) kamen in neuerer Zeit eine Menge
anderer hinzu, so die auf den Inseln des indischen Archipels
heimische französische Immortelle, so genannt, weil sie besonders
in der Provence, dann in Erfurt kultiviert wird. Man gebraucht
diese Strohblume wie alle übrigen, auch gefärbt. Ebenso benutzt man
die Malmaison-Immortelle (Helichrysum bracteatum) und H.
macranthum mit größeren Blüten. Beide stammen aus Australien und
werden vielfach kultiviert.
[S. 530]
Zu den Immortellen rechnet man außerdem die südeuropäische
Papierblume (Xeranthemum annuum) mit weißen und
violetten Blüten, welch letztere mit Säuren lebhaft rot gebeizt
werden; dann das australische Acroclinium roseum mit rosenroten
und weißen und die ebenfalls australische Rodanthe manglesii
mit karminroten Blumenblättern und gelber Scheibe. Ferner das vom
Kap der Guten Hoffnung stammende Helipterum speciosissimum
mit weiß und braunen, und H. corymbiflorum mit roten Blüten,
die weißköpfige, geflügelte Sandimmortelle aus Australien und die
ostindische Gomphrena globosa mit roten (rote Immortelle)
und weißen Blüten. Weiter wird auch Anaphalis margaritacea
mit weißfilzigem Stengel, unterseits filzigen, lineallanzettlichen
Blättern und weißen Blüten als virginische Immortelle zu Trockenbuketts
benutzt. Endlich werden auch die verschiedensten Disteln, vor allem
die Silberdistel (Carlina acaulis) und die Karden
(Dipsacus) als Trockenblumen verwendet.
Sehr groß ist die Zahl der Kompositen, die zu Gartenzierpflanzen
erhoben wurden. Die wichtigsten derselben sind: die aus Südeuropa
stammende rote und weiße Spornblume (Centranthus), die
samtartig schwarzrote Knopfblume (Scabiosa atropurpurea),
die neben der violetten S. columbaria und purpurnen S.
lucida kultiviert wird, dann die ebenfalls aus Südeuropa zu uns
gekommene goldgelbe Ringelblume (Calendula officinalis),
deren Kraut zum Gelbfärben der Butter und deren Blüten zur Verfälschung
des Safrans dienen. Auch von den Kreuzkräutern (Senecio)
werden verschiedene Arten als Gartenzierpflanzen kultiviert, so
Senecio cruentus mit purpurnen Strahlen- und gleichgefärbten
oder gelben Scheibenblüten von den Kanarien in zahlreichen Varietäten
mit großen, sehr verschiedenfarbigen Blüten als Zimmerpflanze, dann
S. elegans mit weißen oder roten Blüten aus Afrika ebenfalls
in mehreren Varietäten, S. kämpferi aus Japan und S.
giesebrechti als sehr dekorativer hoher Strauch aus Mexiko für das
Kalthaus.
Großer Beliebtheit erfreuen sich die sehr nahe mit diesen verwandten
Cinerarien oder Aschenkräuter, die wegen der Aschenfarbe
der Unterseite der Blätter mancher Arten so genannt werden. Die
Bastardcinerarien der Gärtner haben unten meist weißfilzige Blätter
und bunte, purpurne, violette und weiße Blüten. Wegen der Schönheit
und Farbenfülle der letzteren gehören sie zu den beliebtesten
Topfzierpflanzen. Beliebt sind auch die auf steinigen, sonnigen Plätzen
wachsenden Katzenpfötchen (Antennaria) mit weißen
oder purpurroten Blüten,[S. 531] ferner die stattliche Sonnenblume
(Helianthus annnus), welche 1569 aus ihrer Heimat Mexiko nach
Europa kam, und vor allem die ebendaher stammende verschiedenfarbige
Dahlie. Diese nach dem schwedischen Botaniker Dr. Dahl, der
1787 zu Abo starb, so benannte, aber von Willdenow nach der älteren,
von Thunberg dem berühmten Reisenden und Botanikprofessor Georgi in St.
Petersburg zu Ehren gegebene Benennung (Georgina variabilis) in
Georgine umgetaufte Zierpflanze mit knollig verdickter Wurzel,
1,5–1,8 m hohem Stengel und seltener einfachen, meist gefüllten
Blüten wurde zuerst ums Jahr 1784 durch Vincent Cervantes, Professor
und Direktor des botanischen Gartens in Mexiko, an den spanischen Mönch
und Vorsteher des botanischen Gartens Cavanilles nach Madrid gesandt.
Dieser beschrieb sie 1791 als Dahlia pinnata (mit gefiederten
Blättern). Da aber der Name Dahlia von Thunberg bereits an eine andere
Pflanze vergeben war, nannte man sie nach dem Vorschlage von Willdenow
Georgina. Von Spanien aus verbreitete sich die prächtig blühende
Gartenpflanze nach allen Kulturländern der Alten Welt, kam 1787 nach
England, 1804 durch Alexander von Humboldt, der Samen aus Mexiko nach
Berlin sandte, nach Deutschland, wo im Berliner Botanischen Garten
zahlreiche Farbenvarietäten aus ihr gezüchtet wurden. Doch kannte man
die Georginen um 1800 schon in Dresden. Die erste gefüllte Georgine zog
1808 der Garteninspektor Hartwig in Karlsruhe, und 1824 begann Deegen
in Köstritz seine erfolgreichen Kulturen.
Weil die Georgine im Herbst bis zum Eintritt des ersten Frostes,
der allerdings das Laub derselben zum Absterben bringt, so daß sie
schwärzlich, wie verbrüht erscheint, ihre zahlreichen prächtigen Blüten
entfaltet, zu einer Zeit also, da die meisten anderen Gartenblumen
bereits verblüht haben, ist sie eine Lieblingspflanze unserer Gärten
geworden, mit der man in manchen Gegenden einen großen Kultus treibt,
indem man zur Zeit ihrer Blüte Georginenfeste arrangiert, bei denen
die Lokale mit den abgeschnittenen Blüten ausgeschmückt und aus den
verschiedenen Farben große Tableaus zusammengestellt werden. Von
den 9 Arten, die sämtlich auf der mexikanischen Hochebene heimisch
sind, ist Georgina variabilis die Stammpflanze von über 2000
Varietäten. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts war man bemüht,
möglichst volle, prall gefüllte Blumen in den verschiedensten Farben
zu erzielen. Man unterschied nach der Form der Blüten: anemonenblütige
mit großen Strahlenblüten und kleinen, in Form einer Halbkugel
geordneten Scheibenblüten — heute werden sie nur noch selten gezogen
—,[S. 532] dann kugelblütige mit zahlreichen, gleichgeformten, sich nach
hinten zurücklegenden Blüten, flachblütige mit gleichgeformten,
flach ausgebreiteten, in der Regel zurückgebogenen Blumenblättern,
röhrenblütige mit röhrigen und ohrblütige mit ohrförmigen
Blumenblättern. Sie treten in allen Farbennuancen vom zartesten Weiß
bis zum intensivsten Gelb und zum dunkelsten Schwarzpurpur auf.
Die Liliputgeorginen haben sehr kleine, reizend geformte Blüten,
die Zwerggeorginen sind von niedrigem, zwerghaftem Wuchs und zur
Topfkultur geeignet. Seit Anfang der 1870er Jahre sind wieder einfach
blühende Spielarten unter dem Namen Dahlien in mannigfachen Farben und
Zeichnungen beliebt geworden, daneben auch die Kaktusdahlien, deren
Blüten von dem streng symmetrischen Bau der älteren gefüllten Dahlien
wesentlich abweichen und sich durch spitze, strahlige, nadelartige,
gewundene, namentlich aber gelockte Blüten auszeichnen. Sie haben
seit einigen Jahren die alten Georginensorten fast vollständig
verdrängt. Diese Abart der Georginen stellt eine typische, durch
Mutation plötzlich von selbst entstandene Sprungvarietät dar. Der alte
Georginenzüchter van den Berg in Jutphaas (Holland) verdankt sie einem
Zufall. Er hatte sich von einem Geschäftsfreund in Mexiko eine größere
Sendung mexikanischer Knollen, Wurzelstöcke und Zwiebeln kommen lassen.
Die Sendung war aber unterwegs bis auf eine einzige Knolle verdorben.
Nur diese trieb aus — es war die Kaktusdahlie mit Blüten, die in
dieser Form in Mexiko selbst ganz unbekannt ist.
In bezug auf Größe und Form der Knollen, der Belaubung und namentlich
der Blüten, die wie bei allen anderen Kompositen dadurch gefüllt
werden, daß auch die Scheibenblüten wie die Strahlenblüten eine
farbige, zungenförmige Blumenkrone ausbilden, weichen die verschiedenen
Georginen so sehr untereinander ab, daß man kaum irgendwo in Gärten
die typische Form auffinden kann. Die zahllosen, mit dem Untergange
der Knollen wieder verschwindenden Spielarten entstanden und entstehen
durch künstliche Befruchtung und namentlich durch Samenzucht, die
alljährlich neue Varietäten liefert, die nie den vorjährigen ganz
gleich sind. Die gegen Kälte sehr empfindlichen Knollen müssen vor dem
Eintritt des Frostes aus der Erde genommen und im Keller überwintert
werden. Im Frühjahr, sobald keine Nachtfröste mehr zu fürchten sind,
werden sie 5 cm tief ausgepflanzt. Die Vermehrung geschieht
durch Teilung der Knollen oder durch Stecklinge, die man von den mit
überflüssigen Keimen versehenen Knollen ablöst, sobald sie etwa
10 cm lang geworden sind. Neue Spielarten erzielt[S. 533] man aus Samen,
den man von den ersten Blüten besonders schöner Varietäten sammelt. Die
Wurzelknollen enthalten reichlich Inulin, eine dem Stärkemehl ähnliche
Substanz der Kompositenwurzeln, die sich in heißem Wasser löst, beim
Erkalten wieder ausscheidet und, mit Schwefelsäure zusammengebracht,
Zucker gibt. Aus diesem Grunde dienen die Dahlienknollen in ihrer
Heimat Mexiko als geschätztes Nahrungsmittel.
Sehr zahlreiche Zierpflanzen hat die artenreiche Familie der
Astern geliefert, deren Blüten neben den Georginen den Schmuck
unserer Gärten zur Herbstzeit, da sonst wenig andere Blumen mehr zu
sehen sind, bilden. Von den über 200 meist der nördlichen Erdhälfte,
und zwar vorzugsweise Nordamerika angehörenden Asterarten sind
verschiedene vom Menschen in Pflege genommen worden und haben sich im
Laufe der Zeit zu prächtigen Kulturpflanzen entwickelt. So finden wir
nicht nur die auf sonnigen, felsigen Hügeln Süd- und Mitteleuropas
wildwachsende blaue Aster (Aster amellus), sondern auch
die in Nordasien und den höheren Gebirgen Mitteleuropas heimische
violette Aster (Aster alpinus) seit langem in Gärten
angepflanzt. Von ersterer spricht bereits der römische Dichter Vergil
in augusteischer Zeit, indem er in seiner Georgica sagt: „Auf den
Wiesen steht die Blume amellus, welche in dichter Menge wächst.
Sie ist goldgelb und von dunkelvioletten Blumenblättchen umgeben,
hat einen scharfen Geschmack und dient zu Kränzen. Ihre in Wein
gekochte Wurzel dient als Arznei für kranke Bienen.“ Letzteres sagt
auch Columella und fügt hinzu, daß die Blumen des amellus den
Bienen angenehm seien. Die Griechen — so Dioskurides — nannten sie
astḗr, und in Anlehnung daran spricht auch Plinius in seiner
Naturgeschichte von ihr als aster. Außer diesen beiden sind
auch die am Meeresstrand und auf Salzboden gedeihende lilafarbene
Strandaster (Aster tripolium) mit gelber Blütenscheibe
und mehrere andere ausdauernde Arten namentlich Nordamerikas als
Herbstastern in Gärten beliebt und teilweise auch verwildert. Mit
prächtigen, verschiedenfarbigen Strahlenblüten versehen sind die in
China und Japan heimischen Gartenastern (von Callistephus
chinensis), die sich von unseren Astern durch stark laubblätterige
äußere Hüllblätter unterscheiden und in etwa 60 gefüllten Formen
in 6700 Farbenvarietäten als die wichtigsten aller einjährigen
Gartenpflanzen kultiviert werden. Die ersten Vertreter dieser
hauptsächlich vom uralten Kulturvolke der Chinesen hochgezüchteten
Formen, die von jenen mit Vorliebe auf den[S. 534] Kunstgegenständen aus
Porzellan und Seide dargestellt werden, kamen zu Ende des 18.
Jahrhunderts durch den Jesuiten d’Incarville aus China nach Frankreich,
um von hier aus durch Europa verbreitet zu werden. Sie sind bei uns die
weitaus verbreitetsten Astern.
Sehr nahe Verwandte der Astern, die vielfach zu ihnen gerechnet
werden, sind die Wucherblumen, die in den Goldastern oder
Chrysanthemen höchst wertvolle und neuerdings auch bei uns sich
zunehmender Beliebtheit erfreuende Zierblumen hervorgebracht haben. Ihr
bescheidenster Vertreter ist die ausdauernde große Gänseblume
oder Marienblume (Chrysanthemum leucanthemum) mit
weißen Strahlen- und gelben Scheibenblüten, die in Europa auf Wiesen
und Rainen gemein ist und schon früh in die Gärten verpflanzt wurde.
Mit den Europäern wanderte sie in andere Erdteile und bürgerte sich
in Nordamerika, wie auch in Neuseeland ein. Ihre zarten Sprosse
werden in Italien als Salat gegessen; ihre Blüten dagegen werden
wie diejenigen der ihr nahe verwandten Bertramwurz oder
Mutterkrautkamille (Chrysanthemum parthenium) arzneilich
verwendet. Beide werden in vielen Varietäten als Zierpflanzen
kultiviert, letztere besonders auch in Formen mit goldgelben Blättern
zur Bepflanzung von Teppichbeeten. Andere Arten dieser Familie
liefern das Insektenpulver, so besonders die beiden mit rosa- oder
fleischfarbenen Strahlenblüten versehenen Chrysanthemum roseum
und marschalli im Kaukasus, in Armenien und Nordpersien. Das
ebenfalls in Persien heimische Chrysanthemum cinerariaefolium
mit sehr kleinen, gelben Scheibenblüten und weißgelblichen
Strahlenblüten wird, wie auch das dalmatinische Chrysanthemum
roseum in zahlreichen Spielarten bei uns kultiviert; ebenso das
nordafrikanische Chrysanthemum carinatum mit schwarzroten bis
braunvioletten Scheiben- und weißen Strahlenblüten. Sie variiert in
den mannigfaltigsten Farben und stellt eine der ausgezeichnetsten
Florblüten dar. Ebenso ist das südeuropäische Chrysanthemum
coronarium mit gelber Blütenscheibe und gelbem Strahl bei uns eine
beliebte Gartenzierpflanze. Auch die Strauch-Marguerite der
Kanaren (Chrysanthemum frutescens) wird in hohen und zwerghaften
Formen, weiß- und gelbblühend bei uns im Kalthaus kultiviert und im
Winter in großer Menge aus dem Süden eingeführt.
Nicht nur als Zierpflanze, sondern auch als Küchengewürz und
Arzneimittel gegen Würmer wird die in Südeuropa heimische
Frauenminze (Chrysanthemum balsamita) mit balsamisch
riechenden Blättern und gelben Blüten in unseren Gärten angepflanzt.
Schon von Karl[S. 535] dem Großen wurde sie als Costus hortensis,
d. h. Gartenkostus, zum Anbau empfohlen und ihres würzigen Geruches
wegen im Mittelalter an Stelle des Hopfens als Bierwürze verwendet.
Jetzt dient sie vielfach auch zur Herstellung von Totenkränzen und
anderem Gräberschmuck. Blumistisch sehr viel wertvoller ist das
ausdauernde Herbstchrysanthemum, die indische Goldaster
(Chrysanthemum indicum), die noch mehr als bei den Südasiaten
bei den Ostasiaten, zumal den Japanern, zur nationalen Lieblingsblume
wurde. Schon lange vor dem Beginn der christlichen Zeitrechnung
wurde sie im Lande der aufgehenden Sonne in den zahlreichsten
Farbenvarietäten mit weißen, gelben, orangefarbenen, braunen,
roten, schwarzpurpurnen und zweifarbigen Blüten kultiviert. Dabei
unterscheidet man einfache Sorten, röhrenblütige, zungengefüllte,
anemonenblütige und Pomponchrysanthemen. Sowohl in ihrer Stammform, dem
einfachen Herbstchrysanthemum (japanisch nogiku), als seinen
hochgezüchteten Kulturvarietäten (japanisch kiku) spielt es wie
heute, so bereits in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung in
der Poesie und Malerei der Japaner eine sehr große Rolle. Nach der
Aussage der Japaner erreichte diese Blumenzüchtung im 16. Jahrhundert
ihren Höhepunkt. Ein aus jener Zeit stammendes Gemälde aus dem Besitze
der Familie Takatsukasa, auf welchem ein Chrysanthemumgarten in Kioto
dargestellt ist, erregte auf der letzten Pariser Weltausstellung
vom Jahre 1900 allgemeine Bewunderung. Noch heute werden im
ganzen Inselreich diese Blumen in tausenden von Spielarten in den
mannigfaltigsten künstlichen Formen und Zusammenstellungen, die
menschliche und Tiergestalten bis zu 10 m Höhe, ja historische
und dramatische Begebenheiten, Darstellungen aus Märchen usw.
wiedergeben, gezüchtet, und am 9. September feiert das ganze Volk das
Fest der Kiku, die zum Sinnbilde langen Lebens wurde.
Die meisten Varietäten dieser Zierpflanze in seinem Garten zu besitzen,
kann sich außer dem japanischen Kaiser angeblich noch der sehr reiche
Graf Okuma in Tokio rühmen. Sonst sehen es die Liebhaber der Kiku,
deren Zahl Legion ist, darauf ab, eine ihnen besonders zusagende Form
in möglichst eigenartiger Ausbildung zu erlangen. Als Beispiel für die
Mühe, die auf die Zucht neuer Rassen verwendet wird, soll hier erwähnt
werden, daß der Züchter Hayashi jedes Jahr 30000 Chrysanthemen der
Sorte ennichi-giku, bei der es darauf ankommt, möglichst bizarr
gestaltete Blüten zu erzielen, kultiviert, unter denen sich höchstens
5 Exemplare finden, die seinen Anforderungen entsprechen[S. 536] und zur
Nachzucht verwendet werden. Zu möglichster Größe herangezüchtet ist
das Riesenchrysanthemum Zukuri, das über tausend Blumen tragen kann;
das Gegenstück dazu bildet die Zwergpflanze bonsai-zukuri.
Hironishi ist eine ungefüllte Rasse, deren Blumen nur 16
Blumenblätter enthalten dürfen. Es ist dies die Kaiserblume, von der
das Chrysanthemumwappen der kaiserlichen Familie abgeleitet ist. Die
ipon-zukuri ist eine Rasse mit nur einer Achse und nur einer
Blüte.
Schon im Jahre 1688 kultivierte man in Holland 6 aus Ostasien
eingeführte Spielarten von Chrysanthemen, aber erst hundert Jahre
später fand die Pflanze größere Verbreitung in Europa und wird seit
1826, wo dies in Toulon zuerst geschah, auch bei uns aus Samen
gezüchtet. In neuerer Zeit wurde sie namentlich in England, dann auch
in Deutschland zu großer Vollkommenheit gebracht; doch werden noch
immer viele Varietäten aus Japan und China eingeführt. Obwohl wir es
hierin noch lange nicht mit den Japanern aufnehmen können, so besitzen
wir bereits eine Menge von Spielarten derselben mit weißen, gelben,
orangefarbenen, braunen, roten, schwärzlich purpurfarbigen, auch
zweifarbigen Blüten mit den verschiedensten Formen der Blumenkrone und
ihrer einzelnen Blätter. Alle diese wunderbaren Abänderungen erzielen
die Züchter teils durch künstliche Auslese, teils durch Hybridation
oder Kreuzung und durch zufällig auftretende Mutationen. Die
wunderbaren, riesigen Blumen, die neuerdings auf Ausstellungen und in
Schaufenstern der Blumenläden unser Staunen erregen, gehören nicht, wie
man glauben könnte, einer besonderen Art an, sondern es sind anormale
Blütenstände, „Überblumen“, die durch eine eigene Kulturmethode erzeugt
werden. Man bringt die Chrysanthemen zu diesem Zwecke in ein Kalthaus,
wo sie ganz dicht am Fenster aufgestellt werden. An jeder Pflanze
läßt man nur wenige Blätter und schneidet die Blütenknospen gleich
nach ihrem Erscheinen bis auf eine einzige ab. Unter der Einwirkung
der sehr starken Düngung nimmt dann diese, mehr als sonst üblich
ernährte Blume einen riesigen Umfang an, der mitunter sogar demjenigen
eines Menschenkopfes gleichkommt. Dabei hängen die stark verlängerten
Blumenblätter, die zu lang sind, um sich selbst aufrecht halten zu
können, in graziösen Linien herunter und verleihen diesen Blüten einen
absonderlichen Ausdruck, der sehr dem modernen Geschmacke entspricht.
Das Straußenfederchrysanthemum mit bewimperten Blättern ist wie die
Kaktusdahlie eine vor einigen Jahren in einem einzigen Exemplare[S. 537] beim
Blumenzüchter Alphonse Hardy aufgetretene Sprungvarietät, die sich
infolge ihres absonderlichen Aussehens rasch einbürgerte.
Von weiteren bemerkenswerten Kompositen, die als Gartenzierpflanzen
kultiviert werden, ist die Flockenblume (Centaurea)
zu nennen, deren 470 Arten meist im Mittelmeergebiet heimisch sind.
Unsere blaue Kornblume oder Cyane — vom griechischen
kýanos blau so genannt — (Centaurea cyanus) ist ein
Sommergewächs aus Sizilien, das mit dem Klatschmohn (Papaver
rhoeas) als Ackerunkraut wahrscheinlich schon zur Pfahlbauzeit
mit dem Getreide nach Mitteleuropa verbreitet wurde. Diese einstige
Lieblingsblume Kaiser Wilhelms I., die als solche bei dessen Lebzeiten
sich besonderer Gunst in ganz Deutschland erfreute, wird heute in
Arten mit mannigfach gefärbten Blüten als Zierpflanze in Gärten
kultiviert. Auch die auf Kalkbergen und Gebirgswiesen wachsende
Bergflockenblume (Centaurea montana) mit größeren
himmelblauen, in der Mitte purpurrötlichen Blüten und die 2 m
und darüber hoch werdende Centaurea atropurpurea werden als
Zierpflanzen gezogen. Aus dem Orient und dem östlichen Mittelmeergebiet
kam die Bisamflockenblume (Centaurea moschata) mit
großen, weißen oder violett gefärbten, schwach nach Bisam (Moschus)
riechenden Blüten zu uns, ebenso die Centaurea orientalis,
während die Centaurea ragusina mit fein zerschlitztem,
weißfilzigem Laub und gelben Blüten aus Dalmatien stammt. Die niedrige,
ebenfalls weißfilzige Centaurea candidissima wird gerne zu
Teppichbeeten verwendet, während die Centaurea macrocephala
mit 90 cm hohem Stengel und goldgelben Blüten von 9 cm
Durchmesser mehr als Einzelpflanze auf Rasen kultiviert wird.
Aus dem südlichen Nordamerika kam die schöne Zinnie (Zinnia
elegans) als prächtige einjährige Gartenzierpflanze zu uns.
Ihren Namen erhielt sie nach Joh. Gottfried Zinn (1727–1759), der zu
Schwabach bei Nürnberg geboren wurde und als Professor der Medizin in
Göttingen starb. Er gab eine Beschreibung der um jene Universitätsstadt
wachsenden Pflanzen heraus. Die 12 Arten Zinnia wachsen in
Mexiko, Arizona und Texas. Die Zinnia elegans wird
60–80 cm hoch, hat gegenständige Blätter, große Blütenköpfe mit
kleinen, gelben Scheibenblüten und großen, gelben Strahlenblüten. Sie
wird in vielen Varietäten mit goldgelben, purpur- und scharlachroten,
rosa, reinweißen, gestreiften, einfachen, gefüllten und krausen Blüten
bis zu Riesenformen kultiviert. Ebenso Z. haageana und ein
Bastard zwischen beiden, Z. darwini, von dem wieder mehrere
Spielarten gezüchtet wurden.
[S. 538]
Ebenfalls aus Nordamerika stammt das zweifarbige Schöngesicht
(Calliopsis bicolor), das in unseren Gärten wegen seiner
goldgelben bis braunen Strahlenblüten als schönblühende Zierpflanze
allgemein beliebt ist. Desgleichen verhält es sich mit der
nordamerikanischen geschlitzten Rudbeckie (Rudbeckia
laciniosa) mit bräunlicher Scheibe und abstehenden, gelben
Strahlenblüten. Sie wurde von Karl von Linné nach dessen Lehrer und
Freund Hans Rudbeck, Professor der Botanik in Upsala in Schweden,
wo er 1660 geboren wurde und 1740 starb, genannt. Auch Silphium
perfoliatum mit gelben Blüten ist eine aus Nordamerika stammende
Gartenzierpflanze, die teilweise verwildert ist, wie die von
ebendorther stammende Meerambrosie (Ambrosia maritima).
Letztere erhielt von Linné diesen Namen wegen ihres angenehmen Geruchs,
der an die Ambrosia, die Nahrung der unsterblichen Götter, erinnern
sollte, erstere dagegen von dem berühmten Heilmittel und Gemüse
sílphion, das die Griechen aus Kyrene in Nordafrika bezogen und
das eine mit dem Stinkasant verwandte Doldenpflanze und keine Komposite
wie diese war.
Von den etwa 100 im wärmeren Amerika, besonders zahlreich in
Mittelamerika, wachsenden Steviaarten werden ebenfalls mehrere,
so die purpurrote Stevia purpurea, die weiße S. serrata
und die fleischfarbige S. ivaefolia bei uns in Gärten kultiviert
und liefern ein beliebtes Material für die Blumenbinderei. Von den fast
ausschließlich nordamerikanischen Goldruten (Solidago)
wird besonders die kanadische Goldrute (Solidago canadensis),
die in ihrer Heimat gegen den Biß der Klapperschlangen gebraucht wird
und deshalb Klapperschlangenkraut heißt, nebst einigen anderen Arten
als Zierpflanze kultiviert, findet sich aber auch mehrfach bei uns
verwildert.
Aus dem wärmeren Amerika, wo sie in 20 Arten vertreten sind, stammen
auch die Toten- oder Samtblumen (Tagetes) mit
zierlichen Köpfchen von gelben und orangefarbenen Blüten. Besonders
Tagetes patula und T. erecta, die beide einander
sehr ähnlich sind und stark aromatisch riechen, werden in mehreren
Varietäten als Gartenpflanzen kultiviert. Man kennt sie in Europa
seit dem 16. Jahrhundert. Sehr schöne Gartenpflanzen sind auch T.
signata und T. lucida.
Selbst das überall auf unsern Wiesen wachsende gemeine
Gänseblümchen oder Tausendschönchen (Bellis
perennis) mit gelben Scheiben- und weißen oder roten Zungenblüten,
das früher namentlich vom Landvolke als Heilmittel gegen Auszehrung
gebraucht wurde, ist vom Menschen in Kulturpflege genommen worden und
wird besonders[S. 539] in der rotblühenden einfachen oder gefüllten Spielart
mit teilweise sehr großen Blüten zur Einfassung von Gartenbeeten und
als Topfpflanze in Blumenfenstern gezogen. Seinen deutschen Namen
erhielt es davon, daß es besonders häufig auf Feldern wächst, auf
denen Gänse zur Weide getrieben werden, und weil es gerne von diesen
gefressen wird. Tausendschönchen heißt es nach dem lateinischen
bellis, das von bellus schön herrührt und etwa mit
Schönchen übersetzt werden darf. Schon der ältere Plinius (23–29
n. Chr.) erwähnt es in seiner Naturgeschichte und schreibt von ihm: „Das
Gänseblümchen (bellis) wächst auf Wiesen; die Blüte ist weiß und
spielt ins Rötliche.“
Eine der ältesten und wichtigsten Arzneipflanzen, die heute noch
keinem Bauerngarten fehlt, ist die echte Kamille (Matricaria
chamomilla) mit gelber Blütenscheibe und weißem Strahl. Sie hat
ihren griechischen Namen chamaimélon (von chamai niedrig
und mélon Apfel), woraus dann das lateinische chamomilla
entstand, nach dem älteren Plinius vom apfelartigen Geruch ihrer
Blüten. Letztere werden getrocknet in den Apotheken, wie auch in fast
allen Haushaltungen gehalten, um in Krankheitsfällen Verwendung zu
finden. Sie besitzen einen angenehmen, etwas kampferähnlichen Geruch,
den sie dem himmelblau gefärbten, ätherischen Kamillenöl verdanken, dem
krampfwidrige, beruhigende Eigenschaften innewohnen. Außerdem enthalten
sie Salizylsäure, wodurch sie antiseptisch wirken. Ausschließlich
Zierblume ist dagegen die Matricaria coccinea mit scharlachroten
Blüten.
Endlich werden noch von Kompositen verschiedene Kugeldisteln,
so Echinops sphaerocephalus mit weißen und E. ritro
mit blauen, metallisch glänzenden Blütenköpfen aus Südeuropa und
Vorderasien, wie auch allerlei Gaillardien kultiviert. Von den
12 Arten der letzteren sind 11 in Nordamerika und 1 in Südamerika
heimisch. Von Gaillardia pulchella wird die var. pieta
in mehreren Formen als Zierpflanze kultiviert. Sie ist 1–2jährig,
40–50 cm hoch, mit in ihrer größeren Hälfte purpurroten, an der
Spitze goldgelben, dreizähnigen Strahlenblüten und schwarzpurpurnen
Scheibenblüten. Gaillardia aristata in Nordamerika ist
ausdauernd und eignet sich für Rabatten.
Von den zahlreichen Wolfsmilchgewächsen wird die im Mittelmeergebiet
heimische, 60–90 cm hohe kreuzblättrige Wolfsmilch
(Euphorbia lathyris) mit sehr großer Blütendolde viel in
Gärten kultiviert. Schon Karl der Große befahl sie in den Gärten der
kaiserlichen[S. 540] Domänen anzupflanzen. Dann wurde sie besonders von den
Mönchen in den Klostergärten als wichtiges Heilmittel gezogen. Ihre
Samen wurden nämlich im Mittelalter allgemein und werden im südlichen
Frankreich vom Volke heute noch unter dem Namen Purgierkörner als
Abführmittel gebraucht neben der Wurzel der Zypressenwolfsmilch
(Euphorbia cyparissias), die den Namen Bauernrhabarber
führt. Letztere wird in Südfrankreich und Rußland noch heute häufig
angewendet. Als eigentliche Zierpflanzen sind dagegen in unsere Gärten
eingeführt worden: Euphorbia fulgens, ein in Mexiko heimischer
Strauch mit leuchtendroten Blüten, E. pulcherrima aus Mexiko und
Mittelamerika mit später etwas verholzten Stengeln und unscheinbaren
Blüten, die von einer bis 25 cm im Durchmesser haltenden Rosette
scharlachroter Brakteen (Deckblätter) umschlossen sind, sowie E.
splendens aus Madagaskar mit lederigen, glatten Blättern und
scharlachroten Blüten.
Aus Ostindien kam die Gartenbalsamine (Impatiens
balsamina) zu uns, die in den verschiedenfarbigsten Spielarten
als Zwerg-, Rosen- und Camellienbalsamine kultiviert wird. Aus
Zentralafrika dagegen wurden die Impatiens holsti und
die noch reicher blühende Impatiens sultani eingeführt,
die häufig neben dem ebendorther bezogenen Usambaraveilchen in
den Blumenläden anzutreffen sind. Aus Südafrika kam das meist
als Kalla bezeichnete Aronsgewächs mit bis 1 m
langen, herzförmigen Blättern und großer, weißer, tütenförmiger
Blütenscheide zu uns, die als Richardia oder, nach dem 1797
zu Dolce bei Verona geborenen späteren Physikprofessor Francesco
Zantedeschi, der verschiedene botanische Arbeiten verfaßte, als
Zantedeschia aethiopica bezeichnet wird. Die Benennung Kalla
stammt von Plinius, der zwei ganz verschiedene Pflanzen, die man
als gefleckten Aronstab und Färberochsenzunge deutet, calla
oder calsa nannte. Wegen ihrer schönen Blätter und Blüten
ist die Kalla bei uns häufig auf Blumentischen als Topfzierpflanze
anzutreffen, wie auch der aus Mittelamerika stammende, viel kleinere
Blütenschweif (Anthurium) mit dunkelgrünen Blättern
und scharlachroter Kolbenscheide, der Dr. Scherzer zu Ehren,
welcher sie im Hochland von Guatemala gesammelt hatte, den Beinamen
scherzerianum erhielt. Außer dieser mittelamerikanischen Art,
welche außer in Guatemala auch in Costarica gefunden wird, werden
von den etwa 200 Arten dieses Aronsgewächses aus dem tropischen
Amerika verschiedene andere in unsern Gewächshäusern kultiviert, so
Anthurium leuconeuron, magnificum, andreanum und
pedato-radia[S. 541]tum. Durch Bastardierung wurden mehrere neue Arten
erhalten, die prächtige, teilweise bei guter Pflege auch im Zimmer
gedeihende Blattpflanzen bilden.
Eine beliebte Zimmerpflanze ist auch die zur Familie der Asklepiadazeen
gehörende kletternde Wachsblume oder Asklepia (Hoya
carnosa) aus Ostindien und China mit glänzenden, fleischigen
Blättern und großen Dolden blaßrötlicher, oben samtartig filziger,
sehr wohlriechender Blüten, die förmlich vom ausgeschiedenen Nektar
tropfen. Als zarteste aller Schlingpflanzen wird aber in Gärten zu
verschiedenen Bekleidungen der aus Nordamerika stammende klimmende
Erdrauch, Fumaria — oder (nach dem nordamerikanischen
Namen) Adlumia — cirrosa gezogen, während die
ebenfalls aus der Neuen Welt zu uns gekommene Cobaea scandens
mit anfänglich grünen, dann violetten, glockenförmigen Blumen als
reichblühendes einjähriges Schlinggewächs sehr häufig angetroffen
wird. Sie bildet in ihrer Heimat Mexiko prächtige Girlanden von einem
Strauch oder Baum zum andern. Ebenfalls aus Mexiko erhielten wir die
rot- oder violettblühende Maurandia semperflorens, die gleicherweise
zur Bekleidung von Lauben und Wänden gezogen wird. Demselben Zwecke
dient die dieser sehr ähnliche rotblühende Kletterpflanze aus Mexiko
Lophospermum scandens. Eine der schönsten Ampelpflanzen dagegen
ist die aus Ostasien stammende einjährige Torenia asiatica mit
lang herabhängenden Stengeln.
Schon 1753 wurde von Karl von Linné der aus Nordchina zu uns gekommene
Doppelsporn (Dicentra spectabilis) als Fumaria
spectabilis beschrieben, aber erst etwa 1848 in unsere Gärten
verpflanzt. Diese 0,5–0,6 m hohe Gartenzierpflanze mit
rosenroten, herzförmigen, hängenden Blüten in schlanken Trauben
erfreute sich bald großer Beliebtheit und wurde mit verschiedenen,
von ihrer Form hergenommenen Namen, wie Jungfernherz, flammendes
oder hängendes Herz, bezeichnet. Ihre zweite botanische Benennung
Diclytra ist durch einen Druckfehler aus Dielytra,
was „mit doppelter Hülle“ — wegen der Form der Blüte — bedeutet,
entstanden. Sie gedeiht auch in Sibirien. Die 14 übrigen Arten
der Gattung wachsen in Mittel-, Nord- und Ostasien, wie auch in
Nordamerika. Aus letzterem Lande kamen die dunkelrosarote Dexinia
purpurea und D. formosa zu uns. Beide halten im Freien aus,
während die gelbblühende Dexinia chrysantha aus Kalifornien
frostfrei überwintert werden muß.
Ein wunderhübsches, außer zur Verdeckung von Mauern auch[S. 542]
als allerliebste Ampelpflanze gezogenes Pflänzchen ist das
Zymbelkraut (Linaria cymbalaria) — wegen der
zymbelförmigen Form der Blätter so genannt. Es ist aus Südeuropa bei
uns eingewandert, wie auch das dort auf Felsen und altem Gemäuer
wachsende große Löwenmaul (Antirrhinum majus) mit
dichten Trauben heller oder dunkler purpurroter, seltener weißer
Blüten mit meist gelbem Gaumen. Es wird in zahlreichen Spielarten in
den verschiedensten Farbenschattierungen, auch als Zwergform in unsern
Gärten gezogen und gelangte mit den europäischen Auswanderern nach
Nordamerika, wo es heute an vielen Orten verwildert angetroffen wird.
Auch verschiedene Arten von Fingerhut (Digitalis) haben
ihren Weg in unsere Gärten gefunden, so der purpurrötliche, blaßgelbe
und weiße.
Aus Amerika kamen die der letzteren verwandten Gauklerblumen
(Mimulus — Diminitivum des griechischen mímos Gaukler,
Gebärdekünstler, wegen der Form der Blumenkrone so genannt) zu
uns und sind sehr geschätzte Zierpflanzen. Die wichtigsten sind:
Mimulus cardinalis aus Kalifornien mit dunkelrot gefleckten oder
gestreiften, über der Unterlippe gelbgebarteten Blumen, Mimulus
luteus, vom südwestlichen Nordamerika bis nach Chile vorkommend,
mit 3 cm langen, reingelben, bisweilen im Schlund und auf
den Lappen des Saums purpurrot punktierten oder gefleckten Blüten,
M. moschatus aus Oregon, Peru und Chile mit gelben, auf dem
Gaumen gebarteten, fein braun punktierten, nach Moschus riechenden
Blumen. Außer diesen werden noch andere Arten in vielen Varietäten
und Blendlingen als Garten- und Zimmerpflanzen kultiviert. Unter
dem Namen Mimulus duplex finden sich in Gärten Varietäten
verschiedener Arten mit blumenkronenartigem Kelch, z. B. M. cupreus
calycanthemus, d. h. die kupferne, kelchblumige Gauklerblume.
Auch die Salbeiarten haben verschiedene Zierpflanzen geliefert.
Schon seit dem Altertum wurde die als Arzneipflanze und Küchengewürz
in Südeuropa auf sonnigen Bergen wildwachsende Gartensalbei
(Salvia officinalis) in Gärten angepflanzt. Es ist dies ein bis
1 m hoher Halbstrauch mit angenehm riechenden, grauweißlichen
Blättern und blauen, auch roten und weißen Blüten. Aus in Dalmatien
gezogenen Pflanzen gewinnt man ein gelbliches, ätherisches Öl, das
verschieden verwendet wird. Die Römer, die sie salvia, d. h.
Heilkraut nannten und arzneilich wie auch die Griechen verwendeten,
brachten sie über die Alpen.
In den Verordnungen Karls des Großen über die in seinen[S. 543] Gärten zu
kultivierenden Pflanzen findet sich auch die Salbei, die das ganze
Mittelalter hindurch und teilweise heute noch als Küchengewürz, zu
Gurgelwasser und gegen Nachtschweiße eine wichtige Rolle spielte.
Stark betäubend riecht die ihr nahe verwandte Muskatellersalbei
(Salvia sclarea), ein in Südeuropa und im Orient heimisches
zweijähriges Gewächs mit bläulichweißen Blüten zwischen weißen
Deckblättern, das bei uns häufig in Gärten gezogen wird und in
Westdeutschland hier und da verwildert ist. Man setzt Kraut und
Blätter dem Wein zu, um ihm Muskatellergeschmack zu geben. Mit Zucker
und Hefe der Gärung unterworfen, gewinnt man aus ihm in England den
clary wine. Stark gewürzhaft riecht auch die im östlichen
Mittelmeergebiet heimische Salvia pomifera, ein Strauch mit
graufilzigen Blättern und auf der Unterlippe weißgefleckten Blüten.
Infolge des Stiches einer Gallwespe entstehen an ihren jungen Trieben
graue, runde, fleischige Auswüchse von 5 cm Durchmesser, die
sehr angenehm gewürzhaft schmecken. Auch geben die Stengel mit Blättern
und Blüten einen in Griechenland beliebten Tee. Viele andere Arten,
wie Salvia coccinea aus Florida mit scharlachroten Blüten in
sechsblumigen Quirlen, S. cyaniflora mit dunkelkornblumenblauen,
quirlständigen Blüten in fast fußlangen Ähren, S. fulgens mit
scharlachroten, 5 cm langen Blüten, beide aus dem Süden der
Union, S. patens aus Mexiko, S. splendens aus Brasilien
mit leuchtend ponceauroten Blüten und Brakteen in langen Ähren, S.
argentea vom Parnaß mit großen, langwollig weißbehaarten, auf
dem Boden liegenden Blättern u. a. werden bei uns als Zierpflanzen
kultiviert.
Hübsche Zierpflanzen lieferte die in 90 Arten im tropischen und
subtropischen Afrika heimische Labiatenfamilie Coleus. Von
ihr werden eine große Zahl buntblätteriger Spielarten kultiviert,
die sich besonders von C. scutellarioides in Ostindien und
dessen Formen pectinatus, verschaffelti, blumei,
atropurpurea u. a. ableiten. Manche Sorten derselben lassen sich
nur in Gewächshäusern und Zimmern ziehen, andere dagegen können im
Sommer ausgepflanzt werden.
Weiter sind von den Lippenblütigen die aus Chile stammende buchtige
Trompetenzunge (Salpiglossis sinuata) zu nennen. Diese bis
1,3 m hohe Zierpflanze mit schönen Blüten wird in zahlreichen
Spielarten in Töpfen gezogen und in Gruppen ins freie Land verpflanzt.
Nordamerikanischen Ursprungs sind die ausdauernde Pentastemon
grandiflorus mit verschieden gefärbten, schönen Blüten in traubigen
Rispen und die glatte Schildblume mit roten oder weißen,[S. 544]
in dichten Ähren stehenden Blumen. Die Wurzel der letzteren wirkt
abführend und wird in ihrer Heimat, wie die sehr bittern Blätter, als
Heilmittel gebraucht.
In Asien und Europa heimisch sind die häufig als Zierpflanzen
in Gärten gezogenen Wollkräuter, unter denen die
großblumige oder gemeine und die kleinblumige oder
echte Königskerze (Verbascum thapsiforme und V.
thapsus) die gebräuchlichsten sind. Unter thápsos oder
thápsia verstanden die alten Griechen eine zum Gelbfärben
benutzte Doldenpflanze (Thapsia garganica), während die
Königskerze bei ihnen phlómos hieß. Der ältere Plinius sagt
in seiner Naturgeschichte: „Die Königskerze (verbascum) heißt
bei den Griechen phlómos. Geschwollene Drüsen heilt man so
damit, daß man sie, samt der Wurzel zerstoßen, mit Wein benetzt und
in das Blatt gewickelt in Asche warm macht und sie noch warm auflegt.
Es gibt Leute, die versichern aus eigener Erfahrung, dieses Mittel
wirke am besten, wenn eine Jungfrau es nüchtern dem Nüchternen
auflege, es mit der oberen Handfläche berühre und dabei sage: ‚Apollo
sagt, jedes Übel werde gehemmt, dem eine Jungfrau entgegentritt.’
Sie muß sodann die Hand umwenden, dreimal so sprechen, und beide
müssen dreimal ausspucken.“ Auch sein Zeitgenosse Dioskurides, der
eine weiße und schwarze Königskerze (phlómos) unterscheidet,
sagt, daß sie gegen verschiedene Krankheiten gebraucht werde. Die
alten Griechen benutzten die wolligen Blätter mehrerer Arten als
Lampendocht oder tauchten die ganze Pflanze in Pech, um sie als Fackel
zu gebrauchen; daher der Name phlómos. Der Flaum der Blätter,
der aus baumförmig verzweigten Haaren besteht, diente früher als
Zunder. Im Volksglauben der Deutschen war die Königskerze das Symbol
der Königswürde. Die Jungfrau Maria wird vielfach ihren Blütenstand,
gewöhnlich Himmelbrand genannt, in der Hand haltend dargestellt. Ihre
süßlich-schleimig schmeckenden Blüten bilden heute noch einen wichtigen
Zusatz zu allen Brustteearten und werden vom Volke zu Tee angebrüht
gegen Bronchitis und leichte Fieberanfälle gebraucht. Gleicherweise
werden die Blätter des großen Wegerichs (Plantago major),
aus denen man Hustenzeltchen fabriziert, gegen Luftröhrenkatarrh
verwendet. Von dem auf Sandboden in Deutschland wachsenden Sandwegerich
(Plantago arenaria) werden die Samenschalen wegen ihres großen
Schleimgehalts von Wäscherinnen zum Stärken von Wäsche, wie auch in der
Färberei und Kattundruckerei und zur Appretur von Lodenstoffen benutzt.
[S. 545]
Auch mehrere Arten von Ehrenpreis (Veronica),
Sommergewächse, Stauden und immergrüne Kalthaussträucher, letztere von
exotischer Herkunft, werden als Zierpflanzen kultiviert. Die Gattung
hat ihren Namen von der frommen Frau (angeblich mit dem griechischen
Namen Berenike, woraus die mittelalterlichen Lateiner, die diese Sage
ausbildeten, Veronika machten) in Jerusalem, die Jesus auf seinem
Todesgang ihr Kopftuch zum Abtrocknen von Schweiß und Blut darreichte
und zum Lohn dafür auf dem zurückgereichten Tuch den Abdruck seines
Antlitzes erhielt.
Als alte Arzneipflanze wird auch das an allen Teilen stark gewürzhaft
riechende und schmeckende Liebstöckel (Levisticum
officinale) mit grünlichgelben Doldenblüten in Bauerngärten
angepflanzt. Es stammt aus den Gebirgen Südeuropas, wird bis 2 m
hoch und wurde schon im Altertum in Gärten gezogen. Es hieß bei den
alten Römern ligusticum, woraus sich die deutsche Bezeichnung
Liebstöckel bildete. Plinius sagt von ihm: „Das ligusticum
wächst in Ligurien und hat davon den Namen. Übrigens wird es überall
in Gärten gezogen, heißt auch panax (d. h. Allheilmittel).“
Außerdem wurde es in Südeuropa als Einmachgewürz benutzt. Columella im
1. Jahrhundert n. Chr. sagt von ihm, daß es nebst andern gewürzhaften
Kräutern für die Küche eingemacht werde. Karl der Große empfahl dessen
Anbau in den kaiserlichen Gärten. Im Mittelalter wurde es häufig
angewandt und war damals in allen Gewürz- und Arzneigärten angepflanzt,
ist aber heute ziemlich außer Gebrauch gekommen.
Ein ähnliches Küchengewürz und Arzneimittel war den Alten das
Bohnenkraut (Satureja hortensis), das bei den Griechen
thýmbra, bei den Römern satureja hieß. Es wurde und
wird ebenfalls in Gärten gezogen und schmeckt dann milder als die
wildwachsende Pflanze. Auch dieses Kraut ließ Karl der Große in
seinen Gärten anpflanzen. Vom Mittelalter bis heute spielte es als
Bohnenkraut beim Einmachen von Gartenbohnen eine gewisse Rolle.
Wichtiger ist die Gartenmelisse (Melissa officinalis),
die ebenfalls aus Südeuropa zu uns kam und, seit sie durch die Mönche
in die mitteleuropäischen Gärten eingeführt wurde, wegen des angenehmen
Geruchs der ganzen Pflanze als Zier- und Heilpflanze überall angebaut
wird. Aus ihr wird das in der Wirkung dem Pfefferminzöl ähnliche
ätherische Melissenöl und Melissenwasser gewonnen; außerdem ist sie der
Hauptbestandteil der species resolventes, d. h. des zerteilenden
Tees, und des früher berühmten, von den Karmelitermönchen als Geheimnis
ausgegebenen Karmeliter[S. 546]wassers. Auch sie wurde von den alten Griechen
und Römern arzneilich gebraucht; da aber unsere Gartenmelisse nur auf
den Gebirgen Südeuropas vorkommt, gebrauchten sie gewöhnlich die in den
Ebenen wachsende Melissa altissima. Sie hieß bei den Griechen
melissóphyllon und bei den Römern apiastrum. Ebenso wurde
der an felsigen Stellen Südeuropas wachsende Ysop (Hyssopus
officinalis) arzneilich gebraucht. Columella sagt, daß man aus ihm
auch einen Würzwein mache. Heute noch wird diese an allen Teilen stark
gewürzhaft riechende Pflanze in Bauerngärten angepflanzt.
Ein auch bei uns allgemein kultivierter, einst hochgeschätzter Strauch
ist der in Südeuropa heimische, 1–1,3 m hohe, immergrüne
gemeine Rosmarin (Rosmarinus officinalis) mit schmalen,
lederigen, am Rande zurückgerollten, unterseits weißfilzigen, stark
balsamisch-kampferartig riechenden Blättern und blauen Lippenblüten.
Die Pflanze wächst in Griechenland und Italien wild, wird aber auch
in Gärten gehalten. Bei den alten Griechen hieß sie libanōtís
(von líbanos Weihrauch, wegen des aromatischen Geruches ihrer
Blätter) und wurden mit Rosen und Veilchen viel zu Kränzen benutzt; die
Römer dagegen nannten sie ros marinus oder ros maris, was
wahrscheinlich aus dem griechischen róps (niedriges Gesträuch)
und mýrinos (balsamisch) abzuleiten ist. Nach Dioskurides wurde
der Rosmarin auch als Arznei verwendet; er soll nach ihm erwärmende
Eigenschaften haben. Ein Grieche erzählt in den Geoponika über die
Entstehung dieses wohlriechenden Strauches: „Es lebte einmal ein
Jüngling namens Libanos, der die Götter fromm verehrte, und den
neidische Menschen eben deswegen töteten. Da aber brachte die Erde
zur Ehre der Götter eine Pflanze hervor, welche nach dem Namen des
Ermordeten dendrolíbanon (Baumweihrauch, wie der Rosmarin
außer libanōtís von den Griechen genannt wurde) genannt wird.
Die Götter freuen sich mehr, wenn man ihnen einen Kranz von diesem
Baumweihrauch (Rosmarin) weiht, als wenn man ihnen einen solchen von
Gold aufsetzt.“ Außer den Götterbildern pflegten bei den Römern auch
die Bildsäulen der Laren mit Rosmarin bekränzt zu werden. Karl der
Große empfahl, ihn in seinen Gärten zu pflanzen. Noch heute tragen
nach uralter Sitte die Landleute, die diese Pflanze stets in ihren
Gärten ziehen, bei Leichenbegängnissen statt der älteren Zitrone einen
Rosmarinzweig in der Hand. Schöne, aus Nordamerika zu uns gebrachte,
höchst aromatisch duftende, großblütige Verwandte des Rosmarins sind
die in Gärten kultivierten Monardaarten (M. dydima und
M. fistulosa), die man in ihrem Vaterlande auch als Heil[S. 547]mittel
gebraucht. Ihren Namen erhielten sie von dem mehrfach erwähnten
spanischen Arzt Nikolaus Monardes in Sevilla (1493–1578).
Eine uralte Heilpflanze der europäischen Völker, die früher als
Universalmittel gegen viele Krankheiten galt, ist die ebenfalls zu
den Lippenblütlern gehörende gemeine Verbene (Verbena
officinalis) mit blauen Blüten in rispigen Ähren. Sie wächst häufig
an Wegen und Dorfstraßen und galt schon den alten Ägyptern, die sie
als der Heilgöttin Isis geweihte Pflanze betrachteten, für heilig.
Unter verbena, das sich bei den alten römischen Schriftstellern
häufig findet, verstanden die alten Römer allgemein ein bei sakralen
Handlungen wie Opfern, Bündnissen und Kriegserklärungen gebrauchtes
Kraut. Der alte Grammatiker Acro sagt uns darüber: „Verbenen sind alle
Pflanzen, die bei festlichen Gelegenheiten zur Bekränzung der Altäre
gebraucht werden. Das Wort hat ursprünglich herbenae (von
herba Kraut) geheißen, ist aber durch veränderte Aussprache des
h in verbenae übergegangen, wie man auch statt Heneti
Veneti (Venetier) und statt hesperus vesperus (Abendstern)
sagt.“ In diesem Sinne sagt Horaz (65–8 v. Chr.) in der neunten Ode
des vierten Buches: „Mein Altar ist mit Verbenen geschmückt, und
ein Lamm soll geopfert werden.“ Ähnlich schreibt Vergil (70–19
v. Chr.) in seiner achten Ecloge: „Verbrenne Verbenen und Weihrauch!“
Dazu bemerkt der um 380 n. Chr. lebende Servius: „Verbenen sind
immergrüne, wohlriechende Zweige. Andere sagen, es seien überhaupt
zu heiligen Handlungen dienende Zweige. Noch andere meinen, darunter
seien vornehmlich Ölzweige zu verstehen; andere beziehen es auf den
Rosmarin. Immer kommts aber darauf hinaus, daß es grüne Zweige sind.“
An einer anderen Stelle sagt derselbe Servius zu Vergils Äneide Buch
12, Vers 120, wo erzählt wird, Äneas habe mit Turnus ein feierliches
Bündnis schließen wollen und dabei seien die daran Beteiligten mit
verbena bekränzt gewesen: „Verbena bedeutet an sich ein
heiliges Kraut (herba sacra), namentlich, wie viele glauben,
den Rosmarin (rosmarinus), den man (mit der griechischen
Bezeichnung) libanotis nennt, wenn es nämlich von der heiligen
Stelle des Kapitols genommen wurde, und die Fetialen und der pater
patratus (beides Bezeichnungen für die im Namen des Staats
dergleichen Verhandlungen führenden Priester) sich damit bekränzten,
wenn sie Bündnisse schließen oder Krieg ankündigen wollten.“ Statt
verbena wird öfter auch der Ausdruck sagmina gebraucht.
So erzählt Livius in I, 24, 4, daß der römische Fetial Marcus Valerius
bei Abschließung des Bündnisses zwischen dem Könige Tullus (Hostilius,
3. römischen[S. 548] König, regierte von 672–640 v. Chr.) und den Albanern
„sagmina, nämlich reine Kräuter“ aus der Burg geholt habe, und
daß der Fetial alsdannn den Spurius Fusius zu seinem Gehilfen (pater
patratus, wörtlich gevaterter Vater) erwählte, indem er dessen
Haupt und Haar mit der verbena berührte. Der ältere Plinius
sagt: „Von jeher haben sich die Römer der sagmina bedient, wo
es sich um religiöse Feierlichkeiten handelte, durch die dem Staate
aufgeholfen werden sollte, zugleich auch bedienten sie sich bei Opfern
und Gesandtschaften der verbenae. Jedenfalls bedeuten beide
Wörter dasselbe, nämlich ein samt dem daran haftenden Erdballen auf der
Burg (dem Kapitol) ausgerissenes Kraut, und immer hieß einer der an
die Feinde geschickten Gesandten verbenarius.“ Und Festus gibt
über sagmen folgende Erklärung ab: „Sagmina heißen die
verbenae, d. h. reinen Pflanzen, welche an einem heiligen Orte
vom Konsul, Prätor oder von abreisenden Gesandten, welche ein Bündnis
schließen oder Krieg verkünden wollen, geholt waren.“ Nach Stellen
aus Vergil und Horaz wurden Verbenen auch bei der Venus dargebrachten
Opfern gebraucht.
Zum Unterschied zu der heiligen verbena benennt Plinius
unsere gemeine Verbene (Verbena officinalis), die beim
Volk — wohl wegen ihrer starken vermeintlichen Wirkung als Heil-
und Zauberkraut — Eisenkraut heißt, als verbenaca,
während sie die Griechen als peristereón hýptios oder heilige
Pflanze (hierá botánē) oder Zeusohr (Diós ēlakátē),
erigénion, chamailýkon, sideritís, kurítis,
persephónion, kallésis, hippársion oder
dēmétrias bezeichneten. Schon diese zahlreichen Benennungen
beweisen uns die hohe Achtung, die das Eisenkraut bei den Kulturvölkern
am Mittelmeer genoß. Auch bei den Kelten galt das Eisenkraut als
heilig und wurde unter feierlichem Ritual beim Opfer dargebracht.
Als Zierpflanzen sind von den 80 meist amerikanischen Arten zu
nennen: Verbena chamaedrifolia, ein Halbstrauch mit leuchtend
scharlachroten Blüten aus Argentinien und Südbrasilien, der 1829
durch Pater Feuille in die europäischen Gärten eingeführt wurde, dann
Verbena teucrioides aus Brasilien mit weißen oder rötlichen,
wohlriechenden Blüten. Ihre Blendlinge mit der vorigen Art bezeichnet
man als Verbena hybrida. Sie sind es, die in unseren Gärten
als Zierpflanzen gezogen werden und wichtige Florblumen darstellen.
Sie haben ähnlich den Aurikeln ein weißes Auge und werden in allen
Farben kultiviert. Auch Kreuzungen dieser mit der argentinischen
Verbena tenera sind wichtig. Die gestreiften italienischen
Spielarten stammen aus Kreuzungen von Verbena pulchella[S. 549] mit
V. incisa, die beide ebenfalls aus Argentinien zu uns kamen. Die
Gartenverbenen sind ungemein veränderlich, doch hat man unter ihnen
auch zahlreiche samenbeständige Farbenvarietäten.
Verwandt mit diesen Gartenverbenen ist die ebenfalls südamerikanische
Aloysia citriodora, ein 0,6–1,2 m hoher Strauch mit nach
Zitronen riechenden Blättern, die in seiner Heimat als Heilmittel
gebraucht werden. Bei uns wird er wegen derselben in Töpfen gezogen.
Ebenso ist die ihr verwandte duftende Volkmarie (so genannt nach
dem Präsidenten der Kaiserlichen Akademie, dem Naturforscher Joh. Georg
Volkmar aus Nürnberg, 1616–1693) (Clerodendron fragrans), eine
etwas filzige Topfpflanze aus Japan mit fast herzförmigen, gezähnten
Blättern, wegen der weißlichen oder rötlichen, wohlriechenden Blüten
bei uns als Zimmerpflanze beliebt.
Nahe verwandt mit dem Oleander, der im nächsten Abschnitte
besprochen werden soll, ist das in den Laubwäldern Europas bis nach
Norddeutschland wildwachsende kleine Immergrün (Vinca
minor), dessen zahlreiche nichtblühende Stengel niedergestreckt
und reich beblättert sind und Wurzeln schlagen, während die blühenden
aufrecht stehen. Die Blüten sind langgestreckt, blau, bei einigen
Spielarten weiß, violett, rot, purpurn, einfach oder gefüllt. Noch
schöner ist das in allen Teilen größere Immergrün (V.
major) mit kürzern Blütenstielen und hellblauen Blumen. Eine
seiner Spielarten hat goldgelb gezeichnete Blätter, eine Varietät, die
es übrigens auch vom kleinen Immergrün gibt. Beide Arten benutzt man
vorzugsweise zur Ausschmückung schattiger und feuchter Stellen des
Gartens, wo aus Lichtmangel keine anderen Pflanzen gedeihen, außerdem
als Schmuck von Gräbern. Alle diese Arten blühen schon vom März an bis
zum Juni und oft noch einmal im Herbst. Man vermehrt sie durch Teilung
der Stöcke und durch Ausläufer, die sich häufig schon bewurzelt finden.
Eine meist in Gewächshäusern kultivierte, ausdauernde Art der Antillen
ist Vinca rosea mit langröhrigen, dunkelrosenroten, im Schlunde
purpurnen Blumen.
Ein südasiatischer Strauch ist der in Gärten Südeuropas häufig
kultivierte Jasmin (Jasminum grandiflorum), der seinen
Namen vom persischen jâasman oder jasmin hat. Seine
langen, biegsamen Äste sind als Pfeifenröhren, namentlich in der
Türkei, sehr beliebt. Die wohlriechenden weißen Blüten waren früher
als Arznei gebräuchlich, werden jetzt aber nur noch als Parfüm, sowie
zur Bereitung des in der Parfümerie geschätzten ätherischen Jasminöls
gebraucht, indem man[S. 550] sie mit dem zu Pomade beliebten Behenöl von
Moringa oleifera übergießt. Ein im Orient, in Süd- und Ostasien
häufig angepflanzter Zierstrauch ist der in Ostindien heimische
arabische Jasmin oder Sambac (Jasminum sambac),
dessen blaße Blüten wie bei allen Nachtblumen erst nach Sonnenuntergang
einen starken Wohlgeruch aushauchen, weshalb sie als Opfer und zum
Ausstreuen in Tempeln, wie auch zum Parfümieren des chinesischen Tees
dienen. Aus ihnen wird aber ebenfalls ein ätherisches Jasminöl und ein
dem Rosenwasser ähnliches Wasser dargestellt. Mit den orangefarbenen
Blumenkronröhren färbt man in Ostindien statt des Safrans Speisen und
andere Gegenstände gelb. In derselben Weise werden die gelben Blüten
des ihm verwandten ostindischen Trauerstrauchs (Nyctanthes
arbor tristis) verwendet.
Als wilder Jasmin oder wohlriechender Pfeifenstrauch wird
der aus China und Japan zu uns gekommene Philadelphus coronarius
mit starkriechenden, einfachen und gefüllten, grünlichweißen Blüten
und gefüllten Blättern kultiviert und ist auch stellenweise um Dörfer
herum verwildert. Seine geraden Schosse dienen zu Pfeifenröhren
und die Blüten zum Extrahieren des Parfüms. Auch Philadelphus
satsumi aus Japan, P. latifolius, pubescens und
gordonianus aus Nordamerika werden in unsern Parks gezogen. Dem
wohlriechenden Pfeifenstrauch ähnliche Blüten hat der sehr ästige,
1 bis 2 m hohe japanische Zierstrauch, die rauhblätterige
Deutzie (so genannt nach dem Amsterdamer Ratsherrn Joh. Deutz,
dem Förderer von Thunbergs botanischen Reisen), Deutzia scabra,
die in unsern Anlagen zu finden ist, während die dieser ähnliche,
aber kleinere zierliche Deutzie (D. gracilis) als frühblühende
Topfpflanze bei uns beliebt ist.
Ebenfalls in Japan und im nördlichen China heimisch ist die mit den
vorigen verwandte Hortensie (Hydrangea hortensis), ein
bis 1 m hoher Strauch mit ursprünglich rosenroten Blüten in oft
30 cm im Durchmesser haltenden Trugdolden. Die „gefüllte“, d.
h. nur mit großen, unfruchtbaren Blüten versehene Abart wurde 1788 in
den berühmten, 1730 gegründeten botanischen Garten in Kew bei London
eingeführt und erhielt ihren Namen vom englischen Botaniker Commerson,
der sie 1767 in China entdeckte, nach seiner Freundin, Frau Hortense
Lapeaute, die ihren Gemahl, der als Astronom mit ihm zusammen an der
Bougainvilleschen Expedition teilnahm, begleitete. Die einfachblühende
Form mit fruchtbaren Blüten wurde erst in neuester Zeit eingeführt.
Die rotblühende Form kann man durch Zusatz von[S. 551] Eisen und Alaun in
eine blaublühende verwandeln. Zu diesem Zwecke setzt man dem Wasser,
mit dem man die in Töpfen gezogene Pflanze begießt, 5 g
Eisen-Ammoniakalaun auf 1 Liter Wasser oder etwas Eisenvitriol bei.
Die Gärtner pflegen der Erde schon beim Einpflanzen im August etwas
Eisenfeilspäne — etwa 15 g auf 1 Liter Erde — beizugeben.
Am besten dient hierzu eisenhaltige Erlenbruch- oder Sumpfmoorerde;
in solcher entwickelt die Hortensie beständig blaue Blüten. Sie
findet sich auch in Japan und entsteht bei uns zuweilen von selbst.
Hydrangea paniculata, ein Strauch mit weißlichen, später
rötlichen, unfruchtbaren Blüten, wächst in Japan und auf Sachalin und
wird bei uns besonders in großblumigen Varietäten als winterharter
Zierstrauch angepflanzt, wie auch die weißblütige nordamerikanische
baumartige Hortensie (Hydrangea arborescens), die in
Virginien zu Hause ist und 3 m hoch wird. Die Blätter von H.
thunbergi dienen den Japanern zum Tee, der von ihnen wegen des
Wohlgeschmacks Himmelstee genannt wird.
Die Erikazeen mit etwa 420 Arten wachsen in Europa besonders
im Mittelmeergebiet, am reichsten aber im Kapland, und zwar fast
ausschließlich in der Nähe der Westküste. Von den einheimischen Arten
werden außer dem Alpenheidekraut, der fleischroten Heide
(Erica carnea), auch einige Verwandte derselben in Gärten
gezogen. Den Namen erhielt die Pflanzengattung vom griechischen
ereíkē, womit von den Alten die südeuropäische baumartige
Heide (Erica arborea) wegen ihrer brüchigen Äste (von
ereíkein brechen) bezeichnet wurde. Dioskurides schreibt in
seiner Arzneimittellehre: „Die Baumheide (ereíkē) ist ein
buschiger Baum, der Tamariske ähnlich, aber weit kleiner. Aus ihren
Blüten holen die Bienen einen Honig, der gar nicht beliebt ist.“ Sein
Zeitgenosse, der ältere Plinius, sagt: „Erice nennen die Griechen
einen Strauch, der der Tamariske ähnlich, wie Rosmarin gefärbt ist,
fast ebensolche Blätter hat und die Schlangen verscheuchen soll.“
Diese Baumheide wird 10 m hoch, hat kleine, fast kugelige, in
Trauben vereinigte, wohlriechende Blüten, überzieht in manchen Gegenden
Griechenlands weite Strecken und liefert namentlich den Bienen in
Attika eine Hauptnahrung; doch hat der von diesen Pflanzen gesammelte
Honig (eríka-méli, Heidehonig) einen eigentümlichen Geruch zum
Unterschied des beliebten und teuren, schon im Altertum berühmten Honig
des Berges Hymettos, der vorzüglich von Rosmarinus und Thymus
capitatus von Bienen gesammelt wird. Das fleisch- bis ziegelrote
maserwüchsige Wurzelholz der auf den Ka[S. 552]naren bis 20 m hoch
werdenden Baumheide, das besonders aus Spanien, Südfrankreich und
Korsika ausgeführt wird, wird zu Schnitz- und Dreharbeiten, besonders
aber zu Pfeifenköpfen verwendet. Außer den einheimischen werden
neuerdings besonders viele Erika-Arten vom Kap der Guten Hoffnung als
Zierpflanzen kultiviert. Sie fordern eine besondere Behandlung in den
sogenannten „Kaphäusern“ und zeichnen sich durch große Zierlichkeit
aus. Ihre mannigfach geformten Blüten zeigen das reinste Weiß, zartes
Rosa, feuriges Rot, Purpur, seltener Gelb und Grün. Winterharte
europäische Arten, wie die Sumpfheide (Erica tetralix)
und E. ciliaris aus Südwesteuropa, besonders aber Erica
carnea aus Südeuropa, ein zeitiger Frühjahrsblüher mit weißen
oder roten Blüten, kultiviert man im Garten am Rande von Gebüschen,
als Einfassungen und auf Moorbeeten. In Australien und Ozeanien sind
die Erika-Arten durch die Epakridazeen vertreten, von denen ebenfalls
zahlreiche zur Zierde in unseren Gärten gezogen werden. Manche von
ihnen haben eßbare Früchte, von denen die der Styphelia sapida
am meisten geschätzt werden.
Zu den Erikazeen gehören auch die Rhododendren oder
Alpenrosen. Wörtlich übersetzt heißt das griechische
rhododéndron Rosenbaum, wegen der rosenroten Blüten. Im
Altertume verstand man unter dieser Bezeichnung den ebenfalls
rotblütigen Oleander (Nerium oleander). Öfter findet man in
unseren Gärten die rostblätterige Alpenrose (Rhododendron
ferrugineum), die Königin der Alpenpflanzen, angesiedelt. Als
Schneerose ist sie schon viel besungen worden und dient den Älplern
als beliebter Schmuck. Auch zieren damit die Bergwanderer ihre
Hüte. Häufiger als sie werden ausländische Arten als Zierpflanzen
in Gärten und Gewächshäusern kultiviert, so vor allem die aus den
Bergen Kleinasiens zu uns gekommene pontische Alpenrose
(Rh. ponticum) mit mattvioletten Blüten, die kaukasische
Alpenrose (Rh. caucasicum) mit großen, blaßgelben
Blüten aus dem Kaukasus, die goldblütige Alpenrose (Rh.
chrysanthum) mit goldgelben Blüten aus Sibirien. Sehr zahlreiche
baumartige Rhododendren wachsen an den Abhängen des Himalaja, so die
baumartige Alpenrose (Rh. arboreum), die in Höhen von
1600–3300 m vorkommt und in ihrer Heimat, von Kaschmir bis
Nepal, 6–9 m hoch wird. Sie hat große, dunkelrote Blüten,
wird aber in verschiedenen Abänderungen in den Gärten gezogen. Die
Unterfläche der Blätter dieser Art ist mit einer süßen, zuckerartigen
Masse überzogen, die bisweilen in durchsichtigen Tropfen hinabhängt
und von den Gebirgsbewohnern Indiens[S. 553] gegessen wird. Die eigentliche
Alpenrose des Himalaja ist aber Rh. dalhousianum (der Lady
Dalhouse zu Ehren benannt), die wohlriechende, weiße oder rosafarbene
Blüten von 13 cm Umfang mit dem feinsten Aroma erzeugt, welche
ohne Unterbrechung 2–3 Monate aufeinander folgen. Sie findet sich im
Sikkim-Himalaja in einer Höhe von 1600–2600 m, während Rh.
nivale daselbst nur an der Grenze des ewigen Schnees gedeiht. Aus
Nordamerika stammen Rhododendron maximum, die der pontischen
gleicht, aber höher wird, mit zart fleischroten bis fast weißen,
innen gelb und grün gefleckten Blüten und Rh. catawbiense mit
dunkelroten Blüten. Alle diese Arten wurden untereinander gekreuzt und
haben sehr viele Blendlinge geliefert, die teilweise wundervolle Blüten
aufweisen und den Stolz unserer Gewächshäuser bilden.
Ähnlich verhält es sich mit den den Rhododendren verwandten
Azaleen, so genannt nach dem griechischen azaléos
trocken, dürr, weil sie meist an dürren Orten wachsen. Auch sie sind
wie jene sämtlich Hochgebirgspflanzen, die in zahlreichen Spielarten
und Kreuzungsprodukten mit den Rhododendren einen wichtigen Teil
unseres Frühlingsflors ausmachen. Die 40 Arten derselben wachsen in
Nordamerika, Ostasien und eine einzige im Kaukasus. Die prachtvollsten
Sorten kamen ums Jahr 1800 aus China zu uns, unter welchen Azalea
indica mit roten Blüten, die dort seit alter Zeit als beliebte
Zierpflanze kultiviert wird, die Stammmutter der meisten Spielarten ist
und in zahlreichen Varietäten und Blendlingen in unsern Kalthäusern
kultiviert wird. Sie ist wahrscheinlich auf vier Arten zurückzuführen
und wird in bezug auf Blütenreichtum, Glanz und Farbenpracht der Blumen
von keiner anderen Pflanzengattung übertroffen. Alle von der indischen
Art abstammenden Azaleen haben meist 10 Staubgefäße und bleibende
Blätter, weshalb sie auch zur Familie der Rhododendren gezählt
werden. Alle übrigen, die pontischen, japanischen und amerikanischen
Arten haben nur 5 Staubgefäße und abfallende Blätter. Die ersteren
erfrieren bei uns im Freien, können also nur in Kalthäusern gezogen
werden, während letztere unsere Winter im allgemeinen ertragen und
mit nur leichtem Schutz im Freien ausdauern. Am frühesten, nämlich
schon seit 1793, wurde bei uns die in den Gebirgen des nördlichen
Kleinasien heimische pontische Azalee (A. pontica)
eingeführt. Es ist dies ein 1–2 m hoher Strauch mit großen,
goldgelben, wohlriechenden Blüten. Der Nektar ihrer Blüten ist
sehr stark narkotisch, so daß der von ihm gesammelte Honig betäubt
und selbst Raserei zur Folge[S. 554] hat, wie schon die zehntausend
Griechen, die unter Xenophons Führung im Jahre 400 v. Chr. den
berühmten Rückzug aus Mesopotamien über das armenische Hochland nach
Trapezunt am Schwarzen Meere machten, an sich erfuhren. Außer ihr
werden bei uns im Freien meist die amerikanischen Arten: Azalea
punicea, mucronata, amoena, calendulacea,
arborescens und viscosa, wie auch deren Kreuzungsprodukte
gezogen.
Ein anderer, wegen seiner wundervollen Blüten bei uns als Topfpflanze,
aber schon in wärmeren Lagen Norditaliens und Südfrankreichs im
Freien gezogener Zierstrauch, der aus Ostasien zu uns kam, ist die
Camellie oder japanische Rose. Diese mit den Teegewächsen
die Familie der Ternströmiazeen (nach dem Schweden C. Ternström, der
China durchforschen wollte, aber 1745 vor Erreichung dieses Zieles
starb, so genannt) bildende Pflanze erhielt nach dem Abbé Berlese in
Paris, dem Verfasser einer Monographie der Camellien, ihren Namen von
Karl von Linné nach dem Jesuiten Georg Josef Kamell (Camellius),
der als gelernter Apotheker in Manilla auf den Philippinen 1639
allerlei Pflanzen, die medizinisch von Wichtigkeit sein könnten,
sammelte. Die Camellien sind dem Teestrauche ähnliche Sträucher im
Himalaja, in Cochinchina, China und Japan. Die prächtigste Art ist die
Camellia (oder Thea) japonica, ein 12–15 m
hoher Strauch mit lederartigen, immergrünen Blättern und reichlich
erscheinenden, endständigen, stiellosen, großen, roten Blüten, die sich
leicht füllen. Sie wird in Japan in Hecken und in China als Zierpflanze
angebaut. Aus ihren braunen Samen wird dort ein dem Olivenöl ähnliches
Öl gepreßt, das als Heilmittel und zum Hausgebrauch benutzt wird. Sie
wurde 1739 von Lord Petre von Japan nach England gebracht und hier mit
der erst gegen das Ende des 18. Jahrhunderts in Europa eingeführten
chinesischen Art vielfach gekreuzt. Man zieht heute von ihr mehrere
hundert prachtvolle Varietäten mit roten, rosenroten, weißen und
weißgestreiften, gesprenkelten oder gefleckten Blüten. Sie blühen bei
uns in Gewächshäusern von Februar bis April, doch bringt man viele
Sorten durch künstliches Antreiben schon im Oktober und November zur
Blüte. Bei sorgfältiger Pflege gedeiht sie auch im Zimmer, erträgt aber
sehr schlecht einen Wechsel des Standortes, da in solchem Falle die
Blüten regelmäßig abfallen. Die in China und Japan einheimische, in
letzterem Lande sasankua genannte kleinere, zartere Verwandte,
Camellia sasankua mit stumpferen, weicheren Blättern und
kleineren Blüten, wird in ihrer Heimat häufig kultiviert. Nicht nur
werden ihre[S. 555] wohlriechenden, weißen Blüten vielfach dem chinesischen
Tee beigemengt, um ihn zu parfümieren, sondern auch die getrockneten
Blätter unter die Teeblätter gemischt, desgleichen für sich allein als
Tee benutzt. Mit einer Abkochung derselben waschen die Japanerinnen ihr
Haar, und aus den Samen gewinnt man ein geschätztes, wohlriechendes Öl.
In Nepal wird Camellia kissi mit stark wohlriechenden Blüten
ebenfalls als Teesurrogat verwendet und liefert aus den Samen ein
gutes Öl. Nach den japanischen Camellien gelangte dann auch aus China
die reichblühende Camellia reticulata mit breiten Blättern und
großen Blüten zu uns und lieferte durch Kreuzung mit jenen zahlreiche
Blendlinge mit schönen, bunten Blüten.
Unter den Nachtschattengewächsen sind einige Stechapfelarten
als Zierpflanzen von Bedeutung, so die Datura metel mit nachts
sich öffnenden zarten, weißen, fast wie Lilien riechenden Blüten.
Sie wächst im Mittelmeergebiet, in Afrika und Südasien und wird in
Indien, Persien und Arabien zur Bereitung von Berauschungsmitteln mit
Haschisch, Opium und Gewürzen verwendet. Datura fastuosa (d.
h. die schöne, stolze) mit großen, weißen, bisweilen außen violetten,
auch gefüllten, wohlriechenden Blüten in Ost- und Südasien, dem
malaiischen Archipel und dem tropischen Afrika wird in Indien und China
wie der Stechapfel bei uns benutzt und als Zierpflanze kultiviert. Sie
wird auch bei uns in Töpfen gezogen, muß aber frostfrei überwintert
werden. Gleicherweise ist dies mit Datura suaveolens (d. h. der
angenehm riechenden) und der 3–4 m hohen D. arborea (d.
h. der baumartigen) der Fall, die beide in Chile und Peru heimisch
sind und große, hängende, weiße, besonders gegen Abend wohlriechende
Blüten besitzen. Ebensolche hängende, große, aber statt weiße von der
Basis bis zur Mitte gelbe, in der oberen Hälfte jedoch mattrote, mit
blutroten Streifen durchzogene Blüten weist die ebenfalls strauch- oder
baumartige D. sanguinea in Peru auf. Aus deren Blüten bereiteten
sich die Peruaner, wie wir bereits erfuhren, einen berauschenden Trank,
den einst die Priester des Sonnentempels in Sagamossa, dem peruanischen
Orakelsitze, tranken, um sich mit den Geistern der Verstorbenen in
Verbindung zu setzen. Deshalb wird die Pflanze heute noch von den
Peruanern yerba de huaca, d. h. Gräberpflanze, genannt. Von
Nachtschattengewächsen werden auch manche Arten des Tabaks
als Zierpflanzen kultiviert, so Nicotiana tabacum var. purpurea
latissima und die 3 m hoch werdende N. glauca aus
Mexiko, ferner N. longiflora und affinis, letztere mit
großen, wohlriechenden Blüten, beide aus Chile,[S. 556] die gewaltige N.
tomentosa aus Peru und die N. wigandioides mit 1 m
langen und 60 cm breiten Blättern aus Venezuela.
Ebenfalls südamerikanischer Herkunft sind die bei uns als
Gartenzierpflanzen so beliebten Fuchsien, die nach dem von
Karl V. geadelten Schwaben Leonhard Fuchs (1501–1565) so genannt
wurden. Dieser war zuerst Schullehrer in seinem Geburtsorte Wemding
in Schwaben, erwarb sich dann als Arzt und Botaniker großen Ruf
und starb als Professor der Medizin in Tübingen. Neben Otto
Brunsfeld und Hieronymus Bock (genannt Tragus) war er der Begründer
der vaterländischen Pflanzenkunde und gab die damals besten
Pflanzenabbildungen heraus. Sein in Basel gedrucktes New Kreuterbuch
besaß einst großes Ansehen, so daß es noch 1643 neu aufgelegt wurde.
Die Fuchsien sind Sträucher oder kleine Bäume mit vorherrschend
roten Blüten mit gefärbtem Kelch, vier Blumenblättern und kleinen,
fleischigen, vielsamigen, dunklen Beeren. Über 60 Arten derselben
finden sich in den Gebirgen von Mexiko bis zum Süden von Chile in
Höhen von 1000–3000 m, wenige auf den Antillen, in Guiana und
Brasilien, auch in Neuseeland. Der französische Botaniker Charles
Plumier beschrieb 1703 die erste Fuchsia, die als F. coccinea
1788 in die europäischen Gärten eingeführt wurde. Seit dem Anfang
des 19. Jahrhunderts sind mehrere Arten in Kultur, und gegenwärtig
zählt man mehr als 800 Hybriden und Spielarten derselben. Die
hauptsächlichsten Stammeltern der jetzigen Fuchsien sind außer F.
coccinea mit dünnen, purpurrötlichen Ästen, kleinen Blüten mit
scharlachrotem Kelch, violettblauer Blumenkrone und lang hervorragenden
Staubfäden F. fulgens mit mennigroten, F. globosa mit
prächtigen, scharlachroten und F. gracilis mit kleineren,
aber sehr zahlreichen, karminroten Blüten — alle drei aus Mexiko
— und F. corymbiflora aus Peru mit 13 cm langen
Blüten mit karminrotem Kelch und scharlachroter Blumenkrone. Lange
Zeit war die Größe der Blume die geschätzteste Eigenschaft dieser
beinahe prächtigsten Blütenpflanzen der Gewächshäuser, dann kamen die
Sorten mit weißlicher Kelchröhre und gefärbter Blumenkrone, später
gestreiftblumige Sorten, darauf gefüllte und fast gleichzeitig Fuchsien
mit sehr dunkler Blumenkrone und zurückgeschlagenen Kelchblättern,
endlich die Sorten mit roten Kelchen und weißer Blumenkrone auf.
Bemerkenswert sind noch F. serratifolia aus Peru mit dunkelroten
Ästen und roten Blüten, die in unserem Winter — dem Sommer ihrer
Heimat — erscheinen, und F. microphylla aus Mexiko mit sehr
kleinen Blättern und Blüten. Die[S. 557] Beeren mehrerer Arten werden in
Südamerika, mit Zucker eingemacht, gegessen, von andern dient das Holz
zum Schwarzfärben. Die Fuchsien wachsen leicht und willig, blühen sehr
reichlich und gedeihen am besten, wenn man sie an einem luftigen,
kühlen, nur eben frostfreien, wenn möglich etwas hellen Raum bei
spärlichster Bewässerung überwintert.
Nahe verwandt mit den Fuchsien sind die Weidenröschen
(Epilobium), deren großblütige Formen als Zierpflanzen in den
Gärten gezogen werden, wie auch die bis 1 m hohe gemeine
Nachtkerze (Oenothera biennis), deren schwefelgelbe Blüten
sich abends öffnen und am folgenden Morgen welken. Sie wächst bei uns
auch wild auf feuchtem Sandboden an Flußufern, stammt aus Virginien
in Nordamerika und soll sich seit 1614 von Padua aus über Europa als
Zierpflanze verbreitet haben. Durch große, wohlriechende, gelbe,
abends zwischen 7 und 8 Uhr sich erschließende Blüten ist Oenothera
grandiflora ausgezeichnet, die wie die vorige auch kultiviert wird,
um deren rötliche, in der Farbe Schinken ähnliche Wurzeln in Scheiben
geschnitten im Winter wie Sellerie als Salat oder auch mit Fleischbrühe
als Gemüse zu essen.
Wie in Peru und Chile die leuchtend rotgelben Amaryllideen, sind
dort auch die meist violett getüpfelten Gauklerblumen
(Mimulus), von denen bereits die Rede war, zu Hause. Von dort
stammen auch die Pantoffelblumen (Calceolaria), deren
prächtig gelbe oder orangefarbene Blütenbüschel die Felsabhänge an den
Füßen der Kordilleren schmücken. Sie gehören mit dem Fingerhut in die
Familie der Scrophulariazeen und weisen 134 Arten vorzugsweise auf den
Anden Südamerikas, in Peru und Chile, einzelne bis Mexiko und zwei in
Neuseeland auf. In Chile speziell sind sie in fast 70 Arten bekannt und
haben sich den verschiedenartigsten Lebensverhältnissen in Gebirg und
Ebene angepaßt. O. Bürger schreibt über sie: „Die weithin leuchtenden
großen, vollen Blütenbüschel der in Peru und Chile beheimateten
Pantoffelblumen (Calceolaria) tragen wie wenig andere Pflanzen
zum Schmuck der chilenischen Landschaft bei: am Rande der Bäche, an
den Felsen und Hängen, welche die Wege begleiten, auf den heißen
Steinhalden oder auch zwischen dem trockenen Geröll der Flußläufe,
wo kaum ein Halm sprießt, haben sie Wurzel gefaßt. Und es ist ein
farbenfreudiges Geschlecht. Freilich in der großen Mehrzahl bevorzugen
sie Gelb oder Orange, aber andere glänzen mit purpurnen und noch andere
mit weißen Pantöffelchen, wie aus Atlas. Bei den Ein[S. 558]geborenen sind sie
sehr beliebt und sie sammeln große Sträuße der topatopa oder
capachito, wie sie in ihrer Sprache heißen, um das Zimmer damit
zu schmücken. Leider verwelken sie aber sehr rasch.“
Ebenfalls im tropischen Amerika heimisch sind die Gloxinien,
deren wundervolle, farbenprächtige Blüten die Zierde unserer
Gewächshäuser bilden. Diese Gattung aus der Familie der Gesnerazeen
hat ihren Namen nach dem Straßburger Botaniker P. B. Gloxin, der
1785 botanische Beobachtungen veröffentlichte, und besteht aus
ausdauernden Kräutern mit knollenartigem Wurzelstock, saftigem Stengel,
gegenständigen, einfachen Blättern, einzeln oder gebüschelt stehenden,
großen, langgestielten, glockenförmigen Blüten mit ausgebreitetem,
ungleich fünflappigem Saum. Die sechs Arten sind von Mexiko bis
Brasilien und Peru zu Hause. Von ihnen werden vorzugsweise die
Gloxinia speciosa von Brasilien und Hybriden von dieser und
Gloxinia maculata mit aufrechten, horizontalen oder hängenden,
vielfach im Innern getüpfelten blauen, roten oder weißen Blüten aus
Brasilien kultiviert. Diese prachtvollsten aller Florblumen gedeihen
aber auch gut im Zimmer. Zum Winter ziehen sie ein und die Knollen
können trocken aufbewahrt werden. Jedes Blatt entwickelt an dem der
Quere nach abgeschnittenen Blattstiel, aber auch, wenn man es auf Erde
befestigt, an allen durchschnittenen Blattnerven Knöllchen, so daß man
von einem großen Blatt deren fünfzig erzeugen kann. Übrigens werden
unter dem Namen Gloxinien auch zahlreiche Formen und Farbenspielarten
der brasilischen Sinningia speciosa, auch Kreuzungen derselben
mit den eigentlichen Gloxinien, bei uns kultiviert.
Gleicherweise südamerikanischen Ursprungs sind die Petunien,
nach petun, der brasilianischen Bezeichnung für den nahe mit
ihnen verwandten Tabak, mit dem man diese Pflanzenart wegen der
Ähnlichkeit der Blätter verwechselte, so genannt. Diese Gattung der
Solanazeen oder Nachtschattengewächse umfaßt mit klebrigen Drüsenhaaren
besetzte niedere Kräuter mit großen, vielfarbigen Blüten und
vielsamigen Kapseln. Die 14 Arten kommen ausschließlich in Südamerika,
speziell in Südbrasilien und Argentinien vor und wurden erst seit 1824
in Europa bekannt. Durch Kreuzung von Petunia nyctaginiflora,
einem Sommergewächs im Gebiete des La Platastromes mit weißen, und
von Petunia violacea, einem Sommergewächs in Argentinien,
Montevideo und Chile mit leuchtend dunkelkarminroten, im Schlund
schwarzvioletten, gestreiften Blüten hat man eine Menge schöner, auch
gefüllter Varietäten und Blendlinge (Petunia hybrida, P.
grandiflora)[S. 559] erzeugt, die sich vorzüglich zur Bepflanzung von
Gruppen auf Rasenflächen, auch zur Kultur in Töpfen eignen und häufig
zu sehen sind.
Weiter hat uns Südamerika mit der spanischen oder
Kapuzinerkresse (Tropaeolum) beschenkt. Von den 35
ausschließlich dort vorkommenden Arten dieser Gattung brachten die
Spanier zuerst Tropaeolum minus 1575 aus Peru nach Spanien,
während die größere Art, Tropaeolum majus, erst 1684 von dorther
nach der Iberischen Halbinsel kam, von wo aus sie schon 1686 nach
England gelangte. Alte Berichte tun uns kund, wie groß das Entzücken
der Blumenfreunde jener Zeit über die Einführung dieser schönen,
reich blühenden und anspruchslosen einjährigen Staudenpflanzen war.
Besonders Tropaeolum majus findet sich jetzt als eine der
gemeinsten Florblumen in zahlreichen Varietäten in unseren Gärten. Am
meist kletternden Stengel finden sich bei ihr schildförmige Blätter
und große, gelbe, orange- bis purpurbraune Blüten, die geruchlos sind.
Doch riecht und schmeckt die ganze Pflanze durch ein ätherisches Öl
kressenartig, was ihr zu ihrem Namen verhalf. Sie wird als Salat
gegessen; die Blütenknospen und die unreifen Früchte werden auch in
Essig und Salz eingelegt und wie Kapern gebraucht. Daher wird sie oft
„unechte Kaper“ genannt. Durch Kreuzung dieser Art mit dem ähnlichen
Tropaeolum minus werden zahlreiche Varietäten, auch Zwergformen,
gewonnen. Tropaeolum tuberosum mit knolligem Wurzelstock und
vierlappigen Blättern wird in ihrer Heimat Peru der genießbaren Knollen
wegen kultiviert und gedeiht auch bei uns. Tropaeolum lobbianum
aus Kolumbien mit leuchtend kapuzinerroten Blüten klettert 3–4 m
hoch, dauert in Gewächshäusern aus und blüht dort auch im Winter.
Tropaeolum pentaphyllum aus Montevideo hat scharlachrote Blüten
mit spitzen, grünen Kelchzipfeln und hält bei uns im Freien aus. Die
kletternde Kanarienvogelrebe (Tropaeolum aduncum) mit
schwefelgelben Blüten und zerschlitzten Blumenblättern eignet sich
besonders zur Bekleidung hoher Wände.
Wie die Kapuzinerkresse stammt auch die Feuerbohne (Phaseolus
multiflorus) mit feuerroten bis weißen Blüten aus Peru, wo sie
schon von den Inkas zur Gewinnung der Samen als Speise kultiviert
wurde. Wie die Samen der gemeinen Schminkbohne fanden sie sich als
Totenbeigabe in den Gräbern der Peruaner. Bei uns wird sie nicht
sowohl als Nutz-, sondern vorwiegend als Zierpflanze kultiviert und
dient vorzugsweise zum Hinaufspinnen und zum Bekleiden von Lauben. Der
französische Arzt und Botaniker Clusius (Charles de[S. 560] l’Ecluse, geb.
1526 in Arras, 1573–1587 Hofbotaniker in Wien, seit 1593 Professor der
Botanik in Leiden, wo er 1609 starb) sah die Feuerbohne mit purpurnen
Blüten zuerst 1564 in einem Kloster zu Lissabon und bekam dort auch
Feuerbohnensamen aus Brasilien zum Geschenk. Diese brachte er nach der
Rückkehr in seiner Heimat zum Wachsen; sie blühten blaßrot. Die daraus
erzielten Samen schenkte er an Freunde weiter, die sie wiederum als
interessante Novität in ihren Gärten pflanzten. So verbreitete sich
diese schönblühende Kletterpflanze wie die übrigen südamerikanischen
Eßbohnenarten als „welsche“ (spanische) oder „Stangenbohnen“ immer
weiter unter den Völkern Europas.
Rein amerikanische Bäume und Sträucher mit ansehnlichen Blüten in
rispigen Blütenständen sind die Jasmintrompeten (Tecoma),
eine Gattung der Bignoniazeen, die von Mexiko bis Argentinien,
zumeist aber in Brasilien heimisch ist. Ihnen nahe verwandt sind die
beiden kletternden Campsisarten, von denen C. radicans mit
scharlachroten Blüten den östlichen Vereinigten Staaten von Illinois
bis Florida und C. grandiflora mit größeren, mattfarbigen Blüten
aus Japan bei uns an warmen Mauern angepflanzt werden. In Mittel- und
Südamerika, besonders auf den Berghöhen Chiles und Perus wachsen die
81 Arten Loasa, von denen L. lateritia mit gelbroten Blüten
aus Chile bei uns in Gärten, an Lauben usw. kultiviert wird. L.
urens mit gelben Blüten stammt aus Peru, ist einjährig und wird in
ähnlicher Weise verwendet. Im westlichen Nord- und Südamerika dagegen,
besonders in Kalifornien, sind die in etwa 20 Arten vorkommenden
Godetien heimisch. Es sind einjährige Pflanzen mit großen, roten
oder weißen Blüten in beblätterten Trauben oder Ähren. Mehrere Arten
derselben, wie besonders Godetia amoena, romanzowii und
whitneyi werden in verschiedenen Varietäten als Zierpflanzen
kultiviert.
In Peru und Ekuador ist der Vanillenheliotrop (Heliotropium
peruvianum) heimisch, ein bis 2 m hoher Zierstrauch,
der wegen des köstlichen Vanillegeruchs seiner Blüten sehr beliebt
ist und in mehreren Spielarten mit weißen, hell- oder dunkelblauen
Blüten kultiviert wird. In Südfrankreich bereitet man aus seinen
Blüten die für die Parfümerie wichtige Heliotropessenz, doch wird
der Heliotropgeruch sehr oft auch durch Mischung von Vanille mit
Orangenblüten, Rosen und Bittermandelöl, ebenso mit Piperonal
nachgeahmt. Außer ihm wird das ebenfalls südamerikanische
Heliotropium corymbosum mit größeren Blättern und dunkleren,
narzissenhaft duftenden Blüten in unseren Gärten kultiviert. Der mit
dem Vanillenheliotrop sehr nahe verwandte,[S. 561] ebenfalls in Südamerika
heimische Strauch Tournefortia heliotropioides dagegen wird in
Treibhäusern gezogen.
Ebenfalls südamerikanischer Herkunft sind die Passionsblumen
(Passiflora), die in etwa 250 Arten in ihrer Heimat den Schmuck
der Wälder bilden. Sie klettern dort von Baum zu Baum und entfalten
dabei ihre schönen, vielfach wohlriechenden Blüten, die meist angenehm
schmeckende Früchte hervorgehen lassen. Die erste Passionsblume, die
nach Europa kam, war die fleischfarbige Passiflora incarnata,
die ein Jesuit 1609 nach Bologna brachte. Im Jahre 1625 kam sie nebst
der weißen P. coerulea mit blauem Fadenkranz unter dem Namen
„amerikanische Clematis“ nach Rom. In einem 1633 erschienenen Buch:
de florum cultura gab ihr der 1653 in Siena verstorbene Jesuit
J. B. Ferrari den Namen Passiflora, indem er die Blütenteile der
P. coerulea mit den Marterwerkzeugen Christi verglich. Die drei
Narben sollten die Nägel, mit der die Kreuzigung vorgenommen wurde, der
rotbesprengte Fadenkranz die Dornenkrone, der gestielte Fruchtknoten
den Kelch, die fünf Staubbeutel die Wunden, die dreilappigen Blätter
die Lanze, die Ranken die Geißeln, die weiße Farbe der Blumenblätter
die Unschuld des Erlösers darstellen. Daß die fromme Einbildungskraft
in den verschiedenen Teilen der seltsamen Blüte die Attribute des
Leidens Christi dargestellt fand, machte diese Zierpflanze im
katholischen Südeuropa, wo sie gut fortkam, bald so populär, daß sie
hier, wie in ihrer Heimat Peru und Brasilien, viel gepflanzt wurde,
um so mehr, da sie 5 cm lange, eiförmige, orangegelbe, eßbare
Beeren lieferte. Als eigentliche Fruchtpflanze wird in Südamerika
die vierkantige Passionsblume (P. quadrangularis) wie
der Weinstock an Spalieren gezogen. Ihre 11 cm im Durchmesser
haltenden, vanilleartig riechenden Blüten mit weißen, purpurn und
violett gescheckten Blumenblättern lassen gänseeigroße, rötliche
Früchte hervorgehen, deren breiiges, süßliches Fruchtmark gerne
gegessen, als Heilmittel und zur Herstellung von wohlschmeckenden
Getränken verwendet wird. Wegen der Ähnlichkeit der Früchte mit
Granaten wird diese, wie überhaupt alle Passionsblumen, im Spanischen
granadilla genannt. Noch größere, ebenfalls häufig gegessene
purpurne Früchte hat die eßbare Granadilla (P. edulis) in
Peru.
Ausschließlich amerikanisch sind auch die den Myrten verwandten
157 Cupheaarten, von denen mehrere bei uns als Zierpflanzen
kultiviert werden. Aus Mexiko stammen die 0,5 m hohe
Cuphea silenoídes, eine der schönsten Gartenpflanzen, und
C. platycentra mit scharlachroten, röhrenförmigen Blüten. Von
dorther stammt auch die unseren[S. 562] Steinbrechen verwandte Echeveria
metallica mit sehr großen, runden, schön metallisch gefärbten
Blüten, die in Gärten zu Einfassungen und Teppichbeeten sehr beliebt
ist, wie auch Cotyledon gibbiflora und secunda
mit prächtigen, roten Blüten. Ihnen nahe verwandt sind die als
Topfzierpflanzen bei uns gehaltenen Crassula coccinea
mit großen, scharlachroten, wohlriechenden Blüten, und C.
arborescens, beide vom Kap der Guten Hoffnung.
Von Kalifornien bis Mexiko wachsen in 10 Arten die zu den Mohngewächsen
gehörenden Eschscholzien, so genannt nach dem 1793 in Dorpat
geborenen und 1831 als Professor der Medizin gestorbenen Joh.
Friedr. Eschscholtz, der 1815 und 1823 Kotzebue als Arzt auf dessen
Entdeckungsreisen begleitete. Diese dem Mohn verwandten Pflanzen sind
durch einen verwachsenblätterigen Kelch ausgezeichnet, der, über
seinem Grunde umschnitten, in Form einer geschnäbelten Mütze abfällt.
Häufig findet man in unseren Gärten die 30 cm hohe E.
californica mit großen, glänzendgelben, im Grunde orangefarbigen
Blüten; sie ist sehr dankbar, vom Sommer bis in den Herbst blühend und
ausdauernd, erfriert zwar bei uns, sät sich aber von selbst aus und
verbreitet sich dabei sehr leicht. Sie enthält mehrere Alkaloide und
wird in ihrer Heimat als schlafmachendes und schmerzstillendes Mittel
benutzt.
Eine Amerikanerin ist auch die bei uns beliebte Flammenblume
(Phlox, wegen der leuchtenden Blüten so, d. h. Flammenfeuer,
genannt). Von den 30 nordamerikanischen Arten werden mehrere wegen
ihrer schönen, vorherrschend roten Blüten in zahlreichen Spielarten und
Blendlingen als eine Hauptzierde unserer Gärten kultiviert. Phlox
drummondi (nach dem englischen Naturforscher James L. Drummond,
der 1826 Nordamerika bereiste und 1835 auf Kuba starb, so genannt)
aus Texas mit lilafarbigen, am Schlunde dunkelpurpurrot gefleckten,
auch hell- und dunkelpurpurroten oder rosenroten und weißen Blüten
ist einjährig, und wurde 1835 von Drummond im Garten von Kew bei
London eingeführt, von wo aus sie bald nach dem Kontinent verbreitet
wurde und hier überall willige Aufnahme fand, da sie reich blüht,
ausdauernd und winterhart ist. Dieselben Vorzüge besitzt der 1 m
hohe Staudenphlox (Ph. paniculata) aus Nordamerika mit
ursprünglich hellilafarbenen Blüten in großen Doldentrauben. Er wird
wie die ebenso hohe Ph. divaricata und die übrigen Phloxarten in
vielen Varietäten in den prächtigsten Farben und Zeichnungen, auch in
wohlriechenden Formen gezogen. Unter ihnen eignen sich die niedrigen
Phlox procumbens und reptans besonders zu Einfassungen.
[S. 563]
Eine einjährige, 30–60 cm hohe Zierpflanze unserer Gärten aus
dem westlichen Nordamerika, die auch bei uns verwilderte, ist die
großblütige Collomie (Collomia grandiflora) mit rötlichen
Blüten. Eine ebenso beliebte nordamerikanische Zierpflanze ist das
ausgezeichnete Hainschönchen (Nemophila insignis) mit
kornblumenblauen, seltener weißen Blüten aus Kalifornien, während
die ihr nahe verwandte himmelblaue Wasserwinde (Hydrolea
azurea) eine hübsche, kleine Treibhauspflanze aus Mexiko ist.
Verwandt mit dem südamerikanischen Chinabaum sind die
Bouvardien, kleinwüchsige Sträucher oder Kräuter mit
präsentiertellerförmigen, weißen, gelbroten oder roten, besonders
am Abend sehr wohlriechenden Blüten. Mehrere von den in Mexiko und
Mittelamerika heimischen Arten werden als Garten- und Zimmerpflanzen
kultiviert, so besonders die langblütige Bouvardia (B.
longiflora) mit langen, weißen, abends herrlich duftenden Blüten,
die in ihrer Heimat Zentralamerika als Flor de San Juan (d. h.
Johannesblume) sehr beliebt ist.
Aronsgewächse des tropischen Südamerika sind die Caladiumarten,
von denen Caladium bicolor aus dem Gebiet des Amazonenstromes
mit pfeilförmigen Blättern, die einen großen rötlichen Fleck in der
Mitte aufweisen, und C. picturatum nebst deren Hybriden die
zahlreichen buntblätterigen Caladien lieferten, die als Zierpflanzen
in Warmhäusern gezogen werden. Im entwickelten Zustande halten sie
bei guter Pflege einige Zeit im Zimmer aus. Alle 10 Arten haben
scharfschmeckende Blätter und Knollen, wegen der letzteren werden
manche Arten in ihrer Heimat als Nährpflanzen kultiviert. Besonders
zahlreich ist auch die Pfeffergattung Peperomia in Amerika
vertreten. Von P. scandens von Peru bis zu den Antillen, P.
elliptica auf den Maskarenen, östlich von Madagaskar, und P.
maculosa in Peru und auf San Domingo werden die scharfschmeckenden
Blätter wie Betel gekaut. Mehrere Arten, wie P. marmorata und
P. arifolia, kultiviert man als Blattpflanzen im Warmhaus und
Zimmer.
Eine ausschließlich amerikanische Pflanzengruppe sind endlich
auch die Kakteen, dickfleischige Gewächse, die wegen ihrer
wunderlichen Gestalt und schönen Blumen sich in der Gegenwart bei
uns besonderer Beliebtheit erfreuen. Sie sind Produkte der Anpassung
der Pflanze an die regenarme Wüste, Erzeugnisse der heißglühenden
Sonne in einem fast niederschlagsfreien Gebiet, wo mit jedem Tropfen
Wasser gegeizt werden muß. Ihr ganzer Leib besteht aus dem zu einem
Wasserreservoir verdickten Stengel, an welchem die Blätter zu spitzen[S. 564]
Stacheln geworden sind, die manchmal sich auch zu weißen, lufthaltigen
Haaren verdünnen wie beim Greisenhaupt. Neben der wechselvollen, an
Monstruositäten reichen Körperform liegt ein Hauptreiz der Kakteen in
ihren wundervollen Blüten, die es an Schönheit mit jeder andern im
Pflanzenreiche aufnehmen können. Während manche Kakteen nur selten
und erst im hohen Alter blühen, zeichnen sich andere durch einen
stattlichen Blütenflor aus. Besonders große und schöne Blumen treffen
wir bei den Säulenkakteen, namentlich bei denjenigen, die am Gestein
emporklettern; unter ihnen ist ja die „Königin der Nacht“ durch ihre
herrlichen, fein duftenden, leider nur eine Nacht über offenen Blüten
berühmt. Auch die zarten, köstlichen Blüten der andern Kakteen, die
bei den Säulenkakteen, Fackeldisteln und Igelkakteen meist weiß, bei
andern gelb und bei den Phyllokakteen in allen Nuancen von Rot gefärbt
sind, dauern oft nur wenige Stunden und im besten Falle einige Tage,
im Gegensatz zu den oft viele Wochen ausdauernden Orchideenblüten.
Bei einzelnen Arten, wie etwa bei Echinopsis eyriesii, ist der
Vorgang des Blühens ein so kurzer, daß sich das Entfalten und Verwelken
der Blüten geradezu mit den Augen verfolgen läßt. Doch haben es die
Kakteenzüchter in neuerer Zeit verstanden, durch Kreuzbefruchtung
von rasch verblühenden Arten mit den länger blühenden Phyllokakteen
herrliche Bastarde, sogenannte Hybriden, zu erlangen, die zu den
hervorragendsten Blütenpflanzen überhaupt gehören, so z. B. den
herrlichen Phyllocactus pfersdorffii.
Weil durchweg alle Kakteen in Verbindung mit großer Anspruchslosigkeit
eine außerordentliche Lebensfähigkeit besitzen, eignen sie sich ganz
besonders zur Zimmerkultur, wie sie bei uns gewöhnlich betrieben
wird. Deshalb werden in Europa zahlreiche Vertreter der etwa 900
ausschließlich dem warmen Amerika angehörenden Arten gezogen, da sie
bei aller Leichtigkeit der Kultur durch ihre interessanten exotischen
Formen und die prächtigen Blüten erfreuen. Wenn sie auch als Kinder
des Lichts die Sonne lieben und große Hitze ertragen, aber auch
erhebliche Mengen des oft genug verweigerten Wassers verlangen, so
ist es falsch, in ihnen Pflanzen zu sehen, die zu ihrem Gedeihen
unbedingt eine Backofentemperatur nötig haben. Ja, umfangreiche ältere
Exemplare mancher Arten haben sich bei uns so eingewöhnt, daß sie im
Winter ungedeckt im Freien aushalten, ohne Schaden zu nehmen. Von
wirklichen Kulturschwierigkeiten ist übrigens bei den Kakteen kaum die
Rede. Sie lassen sich mühelos durch Stecklinge, wie auch durch Samen
vermehren. Sind sie in letzterem Falle einmal dem[S. 565] Keimlingsstadium
entwachsen, dann sind selten noch Verluste zu befürchten. Allerdings
muß in der Kultur derselben bei uns die Wasserzufuhr regelmäßiger als
in ihrer Heimat erfolgen. Zudem nimmt man an ihnen vielfach Pfropfung
und Veredelung vor, um langsam wachsende Pflanzen zu kräftigerer
Entwicklung zu bringen und selten blühende Arten zur Entfaltung
ihrer Blumen zu veranlassen. Stets aber müssen sie die schöne,
frostfreie Jahreszeit im Freien zubringen, wenn sie gut gedeihen
sollen, und bedürfen der künstlichen Befruchtung, um keimfähige
Samen hervorzubringen, da bei uns die Insekten fehlen, die in ihrer
Heimat die künstliche Übertragung des Blütenstaubes auf die Narben
vollziehen. Unter den Krankheiten der Kakteen ist die Kaktusfäule
am verderblichsten. Als Schutzmittel dagegen muß man für reichliche
Zuführung von Luft und Licht und für angemessene Bewässerung sorgen.
Das Endziel der Kakteenpflege ist für uns die Erzielung von schönen
Blüten. Und man kann unbedenklich sagen, daß dieses Bestreben lohnend
ist; denn an Schönheit der Form, Größe und Farbenpracht vermögen,
wie gesagt, die Kakteenblüten mit allen Blüten des Pflanzenreichs zu
wetteifern. Die Nuancen der meist radförmigen oder trichterförmigen
Blüten sind durchweg leuchtend und überaus kräftig, dabei doch niemals
grell und scharf. Reinweiß, Schwefelgelb, Hochgelb, Dunkelrosa,
Scharlachrot und Orange herrscht vor. Dabei sind durch Kreuzung
zahlreiche Zwischenformen entstanden. So erscheinen mehrere Farben
der Skala an ein und derselben Blüte, aber niemals hart nebeneinander
gesetzt, sondern in Flammenform oder in zarter Verreibung und Tönung
ineinander übergehend. Die Prunkhaftesten und dabei doch wieder
zartesten in der Farbe sind die Blattkakteen, jene Epiphyllum-
und Phyllokaktusarten, die in den deutschen Häusern gewöhnlich um
Weihnachten ihre Blüten entfalten.
Der Deutsche mit seinem lebhaften Sinn für das Farbenfrohe, Leuchtende,
sah in diesen Blattkakteen, von denen besonders die Phyllokaktus in
etwa 12 Arten aus Mittel- und Südamerika, speziell aus Brasilien bei
uns eingeführt wurden, sogleich einen neuen geeigneten Schmuck seiner
Fenster, neben den von ihm bis dahin bevorzugten Geranien, Begonien
und großblütigen, gefüllten Nelken. Dieser Blumenliebe, namentlich der
Landbewohner, haben wir es zu danken, wenn wir bei unsern sommerlichen
Wanderungen durch die Dörfer neben jenen älteren auch diese in reichem
Maße antreffen.
Da man nun mit Recht vermuten kann, daß sich die Bauern[S. 566]frauen mit
ihrer Kakteenpflege wohl kaum so viel Mühe geben, wie ihre Gatten
und Brüder beim Kartoffelbau, so läßt sich schon hieraus unschwer
schließen, daß die Pflege der akklimatisierten Amerikaner nicht
allzuschwer sein kann. Auch hier gilt, wie übrigens bei allen
Blütenpflanzen, durch vielfache Experimente begründete Regel, daß
möglichste Vernachlässigung und Schlechtgehaltenwerden der Stöcke sie
eher zu reichlichem Blühen bringt als sorgfältige Pflege und Hegung.
Die Gärtnereien haben die Sache von der praktischen Seite aufgefaßt.
Wiederum waren es namentlich die Phyllokakteen, die in Kreuzungen
und neuen Formen die Farbenskala fast erschöpften, — allerdings
ohne jemals Blau hervorzubringen. „John Baker“, „Franceschi“, „Jules
Simon“, „Wrayi“ usw. gehen vom prachtvollsten Gelb und Rot bis zum
Kompromiß beider Farben, bis zur Halbblutorangefarbe von „Victoria“.
Die Erzeugung dieser neuen Arten ist ein ganz besonderes Kapitel
gärtnerischer Kunst, und man ist sehr auf dem Holzweg mit der Annahme,
daß solche praktisch verwertbare Kreuzung nur ein Kinderspiel sei.
Häufig kommt erst nach hundert Fehlschlägen ein Erfolg und auch dann
oft nur ein halber.
Merkwürdig bei diesen Blattkakteen ist, daß sie ähnlich wie die
Camellien mit ihren Blüten gewissermaßen eine Art sensiblen Empfindens
zeigen. Rückt man nämlich ein mit Blütenknospen bedecktes Epiphyllum
vom Fenster ab und gibt ihm nur eine leichte Drehung, so kann man
in neun von zehn Fällen darauf rechnen, daß der Blütenansatz binnen
wenigen Tagen abfällt, womit leider die Herrlichkeit für ein volles
Jahr vorbei ist. In ihrer Heimat sind diese Blattkakteen nicht am
Boden, sondern als Epiphyten auf Bäumen wachsende Überpflanzen, die mit
ihren hübschen Blüten im Verein mit den in nicht minder leuchtenden
Farben prangenden Lianenblüten den schönsten Schmuck der Urwaldbäume
des tropischen Amerika bilden.
[S. 567]
XXX.
Die Zierbäume und Ziersträucher.
Die ältesten Baumbestände unserer Parks reichen in die Zeit zurück, da
die herrschaftlichen Landsitze ganz Mitteleuropas nach dem Beispiele
des Gartens von Versailles mit geraden Baumalleen durchzogen waren.
Damals mußten sich die Bäume der Schere beugen und ihre Kronen in
regelmäßige, geometrische Formen, meist Vierecke oder Kugeln, bringen
lassen. Gegen diese Unnatur erfolgte nun, wie wir im Abschnitt über die
Geschichte des Ziergartens erfuhren, von England aus durch den Einfluß
ostasiatischer Gartenkunst eine Reaktion, die im „englischen Garten“
die Rückkehr zu den Formen der natürlichen Landschaft sah. Während bis
dahin die Baum- und Straucharten dem heimischen Bestande entnommen
worden waren, ging man zugleich dazu über, auch einige südeuropäische
Vertreter der Pflanzenwelt, vor allem Platane, Roßkastanie, Flieder
und Goldregen in den Parkanlagen anzusiedeln. Dazu kamen mit der Zeit
zahlreiche amerikanische Gäste aus einem ausgedehnten Waldgebiet mit
vielen sehr schönen Formen mit dem mitteleuropäischen ähnlichen Klima.
Bereits im Jahre 1636 waren gegen 50 kanadisch-virginische Bäume und
Sträucher aus den französischen Kolonialgebieten Nordamerikas im
Pariser Jardin des plantes angesiedelt. Und bei den regelmäßigen
Verbindungen mit jenen konnte es nicht fehlen, daß die kleinen und
großen Parkbesitzer immer mehr der fremden, interessanten Typen
zusammenzubringen suchten. Für Deutschland gewannen die Anlagen in
Harbke und Tegel in der Mark Brandenburg eine führende Stellung. Hier
hatte man, von vorzugsweise praktischen Gesichtspunkten ausgehend,
um der überhandnehmenden Holznot zu steuern, die Verwendung der
fremden Bäume im heimischen Forstbetrieb versucht. Dabei zog man aus
den Erfahrungen Nutzen, die Freiherr von Wangenheim als Offizier des
1776 vom Kurfürsten Friedrich II. von Hessen-Kassel an die[S. 568] Engländer
zum Kampfe gegen die nordamerikanische Union verkauften hessischen
Feldjägerkorps — im ganzen waren es 22000 Mann, für die jener elende
Monarch zur Bestreitung seiner Mätressenwirtschaft 21276778 Taler
„Blutgeld“ einstrich — bis zum Jahre 1784 an Ort und Stelle zu sammeln
Gelegenheit hatte. In jener Zeit entstanden die Pflanzungen fremder
Baumarten, die heute durch ihre Größe in den Parks von Wilhelmshöhe
bei Kassel, von Schwetzingen bei Heidelberg, Wörlitz bei Dessau im
Anhaltischen und anderwärts unsere Bewunderung erregen. Dem 19.
Jahrhundert blieb es vorbehalten, die Baumschätze des westlichen,
pazifischen Teiles von Nordamerika aufzuschließen und endlich auch
die wertvollen Bestandteile der ostasiatischen Baumvegetation sich
anzueignen. So wurden in den letzten Jahrzehnten besonders japanische
und mandschurische Arten in stets steigender Zahl bei uns eingeführt.
Alle in unsern Parkanlagen angesiedelten Bäume stammen aus einem der
großen Waldgebiete der nördlichen gemäßigten Zone, also Mitteleuropa
vom Kaukasus bis zu den Gebirgen Spaniens, vom atlantischen und von
diesem wesentlich verschiedenen pazifischen Teile von Nordamerika
und Ostasien. Die übrigen Teile der Erde und vor allem die ganze
südliche Erdhälfte haben nur ganz wenige und unbedeutende Arten
geliefert. Sprechen wir aber von der Einführung fremder Baumarten
nach Deutschland, so dürfen wir nicht vergessen, daß auch von den
heimischen Arten nicht wenige importiert sind. So ist die Lärche
nur in den Alpen heimisch und wurde von da nach den Niederungen
gebracht. Auch die Weißtanne ist im größten Teile Norddeutschlands
erst künstlich angesiedelt worden, und der Buchs tritt nach seiner
natürlichen Verbreitung nur am Hörnli bei Basel und an der oberen Mosel
auf deutsches Gebiet über. Die Stechpalme gedeiht bloß im Bereiche des
atlantischen Klimas.
Natürlich müssen bei der Einbürgerung fremder Arten vor allem die
klimatischen Verhältnisse in Berücksichtigung gezogen werden, wobei
vor allem die Länge und Intensität des winterlichen Frostes, die frühe
oder späte Jahreszeit, in welcher die zum Austreiben der Blätter
oder Sprosse nötigen Temperaturen erreicht werden, dann die Höhe der
sommerlichen Temperaturen während der Vegetationsmonate und schließlich
die Regenmengen während derselben maßgebend sind.
Mit die wichtigsten Zierbäume unserer Parks sind die
Nadelhölzer, unter denen die Tannen und Fichten
am häufigsten angetroffen werden. Neben der Weißtanne (Abies
pectinata) ist die[S. 569] 14 Tage später austreibende, durch ihre
schöne, im Freistande länger aushaltende Beastung ausgezeichnete,
nach ihrem Entdecker benannte Nordmannstanne (Abies
nordmanniana) aus dem Kaukasus zu nennen. Dann die kilikische
Weißtanne (A. cilicica) aus dem Taurus, die weniger
frostempfindlich ist als die griechische und spanische
Tanne (A. cephalonica und pinsapo), welche nur in
frostfreien, geschützten Lagen gedeihen und durch ihren regelmäßigen
Wuchs das Auge erfreuen. Eine der schönsten nordamerikanischen Arten
ist die mattgrüne, durch ihre Frosthärte und ihre Raschwüchsigkeit
in der Jugend beliebte Koloradotanne (A. concolor).
Gleichfalls sehr lange, aber unten hellere Nadeln als oben besitzt
die ebenfalls bei uns eingeführte kalifornische Küstentanne
(A. grandis), die in ihrer Heimat 90 m hoch wird und
damit die höchste aller Tannen ist. Sehr viel niedriger, manchmal nur
strauchartig sind die Balsamtannen, die den für die Mikroskopie
wichtigen Kanadabalsam liefern. Besonders trifft man die atlantische
Balsamtanne (A. balsamea) als Parkbaum nicht selten, während
die ostasiatischen Tannen bis jetzt nur wenig Eingang in unsere Gärten
fanden. Die bei uns am häufigsten angetroffene Vertreterin der in
Nordamerika und in Ostasien heimischen Hemlockstannen der der
Abies nahe verwandten Gattung Tsuga ist die kanadische
Schierlingstanne (Tsuga canadensis). Dichter benadelt
und raschwüchsiger, aber gegen Frost weniger widerstandsfähig ist
die westliche Schierlingstanne (T. mertensiana). Eine
der schönsten und forstlich wertvollsten Errungenschaften aber ist
die in ihrem Aussehen der Fichte ähnliche, nach dem schottischen
Botaniker Douglas benannte Douglastanne (Pseudotsuga
douglasii), deren Nadeln beim Trocknen nicht abfallen, darin also
den Tannen gleichen, während die Fruchtzapfen sich nicht entblättern
wie bei diesen, sondern wie bei den Fichten als Ganzes abfallen. Ihre
Rinde ist von zahlreichen Harzbeulen blasig aufgetrieben. Dieser
wichtigste Waldbaum Nordamerikas ist grün und zeichnet sich durch große
Raschwüchsigkeit gegenüber der blaugefärbten Kolorado-Douglasie
(P. glauca) aus, die aber frosthärter ist. Im Süden ihres
Verbreitungsgebietes ist letztere geradezu bläulichweiß, so daß sie mit
der ebenfalls im Felsengebirge heimischen blauen Form der Stechfichte
(Picea pungens var. glauca) als Zierbaum in Wettbewerb tritt.
Zahlreicher und für unsere Parks von größerer Bedeutung sind die
Fichten, unter denen die gemeine Fichte oder Rottanne
(Picea excelsa) die verbreitetste ist. Sie ist mit Unrecht
wegen ihrer steifen[S. 570] Langweiligkeit verschrien, da sie in zahllosen
Spielarten, wie Hänge-, Trauer-, Schlangen-, Säulen- und Zwergfichten,
auftritt. Sie kann bis 60 m hoch werden und bei einem Alter von
700–800 Jahren einen Stammdurchmesser von 2 m erlangen. An sehr
trockenen Standorten bildet sie Kümmerformen, die durch niedrigen,
langsamen Wuchs und kurze Benadlung ausgezeichnet sind. Zweige solcher
ähneln dann der aus Kleinasien stammenden Sapindusfichte (P.
orientalis), die von allen Fichtenarten die kleinsten, höchstens
1 cm langen Nadeln besitzt. Sie wird 30 m hoch und bildet
im Taurus und Kaukasus ausgedehnte Bestände. An den Zweigen und Zapfen
scheidet sie häufig als Sapindustränen bezeichnete Harztropfen aus.
Von europäischen Formen sind noch die von Skandinavien durch ganz
Nordasien heimische Altaifichte (P. obovata) und die
auf den Bergen des Balkans heimische, dort omorika genannte
Omorikafichte (P. omorica) zu nennen. Letztere hat
einen sehr schlanken Wuchs, wird bis 40 m hoch und zeichnet
sich ganz besonders durch ihre merkwürdig geringe Empfindlichkeit
gegen Beschädigung durch die giftigen Gase, speziell die schweflige
Säure, des Steinkohlenrauchs aus, was sie für alle Parks um unsere
schlotreichen Städte mit ihren zahlreichen Fabrikanlagen doppelt
wertvoll macht.
Als Zierhölzer so wichtig wie als Nutzhölzer sind die amerikanischen
Fichten, von denen die blaugrün erscheinende, bis 50 m hohe
Weißfichte (P. alba) aus dem östlichen Nordamerika von
Kanada bis Nordkarolina und die etwa 25 m hohe, dunkelgrüne
Schwarzfichte (P. nigra) mit schwärzlicher Rinde, die im
östlichen Nordamerika ausgedehnte Wälder bildet, um 1700 nach Europa
gelangten. Etwas später, nämlich erst seit 1755 hier eingeführt, ist
die bis 20 m hohe frischgrüne Rotfichte (P. rubra)
mit rötlichem Holz, die im nordöstlichen Nordamerika heimisch ist
und an der Hudsonsbai in buschigen Zwergformen die nördliche Grenze
des Baumwuchses erreicht. Leichter an den scharfstechenden, sparrig
abstehenden, blauen oder silbergrauen Nadeln kenntlich ist die erst
1863 ebenfalls aus Nordamerika zu uns gebrachte Stechfichte
(P. pungens). Sie wächst im Felsengebirge zwischen 2000
und 2800 m Höhe und hat sich als zweifellos schönste
unserer Koniferen besonders in der als Blaufichte (var.
glauca) bezeichneten Varietät mit durch einen Wachsüberzug als
Verdunstungsschutz bläulichweißen Nadeln sehr rasch in unsern Gärten
verbreitet. Derselben prächtigen Färbung wegen wird auch die als
Silberfichte (var. argentea) bezeichnete Varietät der
Engelmannsfichte (P. engel[S. 571]manni) als Zierbaum unserer
Gärten geschätzt. Seltener wird in unseren Parks die im pazifischen
Nordamerika — auch auf der Insel Sitka im Territorium von Alaska
— heimische Sitkafichte (P. sitchensis) angetroffen.
Endlich ist auch seit 1861 die außerordentlich schöne, bis 40 m
hoch werdende Picea alcockiana mit dunkelgrünen, unterseits
bläulichgrünen Nadeln, die wie alle vorigen ein sehr gutes Nutzholz
liefert, aus Japan bei uns eingeführt worden.
Während bei den bisher besprochenen Koniferengattungen die Nadeln
stets einzeln an den Zweigen sitzen, ist dies bei den Kiefern
(Pinus) nur in den allerersten Lebensjahren des Baumes der Fall.
Alle späteren Zweige, die weiterwachsenden Langtriebe, tragen nur
häutige Schuppen, in deren Achseln die langen Nadeln zu 2–5 an fast
ganz zurückgebildeten Kurztrieben sitzen. In der heimischen Baumwelt
sind die zweinadeligen Kiefern vor allem durch die bis 40 m
hohe gemeine Kiefer oder Föhre (Pinus silvestris)
vertreten. Diese besitzt unter den europäischen Nadelholzgewächsen die
weiteste Verbreitung und gedeiht am besten auf tiefgründigem, humosem
Sandboden. Dann durch die in Südeuropa verbreitete Schwarzkiefer
(P. laricio), die in den österreichischen Alpen in der Abart
der österreichischen Kiefer (P. nigricans) vertreten
ist, und die subalpine Knieholzkiefer oder Legföhre
(P. montana), die in den Alpen von 1400–2000 m Höhe
weite Flächen bedeckt und einen energischen Schutz gegen Lawinen
und Erdrutsche bildet. Dagegen stehen je 5 Nadeln beisammen bei
der im Hochgebirge heimischen Arve oder Zirbelkiefer
(P. cembra) und bei der aus Nordamerika zu uns gelangten
Weymouthskiefer (P. strobus), einem Baume mit grauer,
glatter Rinde und regelmäßiger, kegelförmiger Krone. Sie bildet im
atlantischen Nordamerika große Wälder und erhielt ihren Namen daher,
daß sie im Jahre 1705 durch Lord Weymouth aus den Neuenglandstaaten
nach Europa gebracht wurde. Dank ihrer weichen, seidenglänzenden
Benadlung ist sie jetzt überall bei uns als Zierbaum sehr beliebt. Im
pazifischen Teil Nordamerikas ist sie durch die ihr sehr ähnliche,
aber in unseren Gärten nur selten angetroffene Gebirgsstrobus
(P. monticola) vertreten. Ihr sehr ähnlich ist die im Himalaja
heimische Tränenkiefer (P. excelsa) so genannt, weil
deren Zweigspitzen und besonders die großen, bis 25 cm langen
Zapfen meist mit tränenartigen Harztropfen besetzt sind. Mit ihr
trifft man in Gärten weiterhin die vielfach nur als örtliche Varietät
der vorigen angesehene rumelische Strobus (P. peuce)
mit kürzeren, steifen Nadeln und kürzeren Zapfen an. Außerdem finden
wir nicht[S. 572] selten die größte Kiefernart, nämlich die kalifornische
Zuckerkiefer (P. lambertiana) mit 40 cm langen
Zapfen und die nur wenig von ihr unterschiedene Goyokiefer
(P. pentaphylla) in unsern Parks angepflanzt. Sonst kommen von
den etwa 80 bekannten Kiefernarten nur noch wenige für unsere Gärten
in Betracht, so die nordamerikanischen Strauchkiefer (P.
banksiana), die wegen ihrer großen Anspruchslosigkeit an den Boden
eine der wichtigsten forstlichen Einführungen und aus dem gleichen
Grund auch für den Park, besonders bei Neuanlagen auf Schutt und
Ödland, sehr wertvoll ist. Dreinadlige Kiefern sind in den Parks selten
anzutreffen. Unter ihnen ist die nur in milden Lagen fortkommende
Gelbkiefer (P. ponderosa) aus dem pazifischen Nordamerika
wegen ihres üppigen Wuchses und der prächtigen, bis 25 cm langen
Nadeln auch bei uns sehr geschätzt.
Wie unter den Kiefern die vorgenannte Arve, ein an der
Waldgrenze in den Alpen wachsende, aber stark im Rückgang begriffene
Nadelholzart, wegen ihrer dichten Benadlung und ihres regelmäßigen
Jugendwachstums ein sehr beliebter Zierbaum unserer Gärten wurde,
ist die gleichfalls aus den Alpen stammende Lärche (Larix
europaea), trotzdem auch sie ein echter Gebirgsbaum ist, in den
Parks der Niederungen angesiedelt worden und gedeiht hier ganz gut. Sie
liebt einen steinigen, tiefgründigen Boden und gedeiht nicht auf zu
nassem oder trockenem Boden. Aber erst in einem rauhen Klima entfaltet
sie ihre ganze Schönheit. Von den acht anderen Lärchenarten, die bei
uns im Freien aushalten, ist ihrer dekorativen Wirkung wegen die aus
Japan kommende zartschuppige oder Hondolärche (L.
leptolepis) besonders beliebt. Infolge eines zarten Wachsüberzuges
zur Einschränkung der Wasserverdunstung erscheinen ihre Nadeln blaugrün
und gehen im Herbst in Violett über; ihre jungen Triebe sind rotbraun,
während sie bei der europäischen Lärche graugelb sind. Nur in der
Blütezeit ist ohne weiteres die im Amurgebiet und im Kamtschatka
heimische sibirische Lärche (L. dahurica) zu erkennen,
und zwar an der grünen Farbe ihrer weiblichen Blüten, die bei allen
anderen Arten karminrot gefärbt sind. Die 30 m hohe zierliche
Larix pendula aus dem atlantischen und die 40–80 m hohe
schlanke Larix occidentalis aus dem pazifischen Gebiete von
Nordamerika werden nur ganz ausnahmsweise bei uns angepflanzt.
Mit den Cedern zusammen tragen die Lärchen nur einzelne Nadeln an ihren
Trieben; dann erst bilden sich an diesen Langtrieben seitlich knopfige
Kurztriebe, an denen die Nadeln zu Büscheln gedrängt[S. 573] stehen. Während
die Nadeln aber bei den Lärchen weich und zart sind, da sie nur ein
Jahr auszudauern brauchen, weil diese Baumart regelmäßig im Herbst ihre
dann schön goldgelb gefärbten Nadeln abwirft, sind sie bei den Cedern,
weil bleibend, starr und stechend. Von den drei immergrünen Cederarten
steht die Libanonceder (Cedrus libani) den Lärchen am
nächsten und unterscheidet sich von ihnen außer durch die bleibenden
Nadeln durch ihre äußere Erscheinung und die kugelige, aufrechte
Zapfenform. Sie trägt in der Jugend einen überhängenden Wipfel, bildet
aber im Alter eine prächtig aufgebaute schirmförmige Krone. Dieser
Baum, der einst auf allen Gebirgen Syriens und Kleinasiens prächtige
Bestände bildete, ist jetzt in seiner Heimat fast ausgerottet, gedeiht
aber als Parkbaum in Deutschland nur in sehr milden, luftfeuchten
Lagen. Eher noch als sie gedeiht bei uns die im nordafrikanischen
Atlasgebirge heimische Atlasceder (Cedrus atlantica),
die sich leicht an ihrem stets aufrechten Gipfel erkennen läßt.
Schwer dagegen kommt bei uns die in Nepal und sonst am Südabhang des
Himalajagebirges heimische Himalaja- oder Deodarceder
(Cedrus deodara, letzteres ist die indische Bezeichnung, die
Gottesbaum bedeutet) von pyramidenförmiger Tracht mit nicht hängenden
Zweigen bei uns fort.
Mißbräuchlicherweise werden auch anders geartete Nadelhölzer als Cedern
bezeichnet, so die in ihrer Heimat sugi genannte japanische
Kryptomerie (Cryptomeria japonica), die, seitdem sie
Fortune 1844 in Europa einführte, hier und da in unseren Gärten
kultiviert wird und auch unsere Winter im Freien aushält. Obschon sie
mit den echten Cedern keinerlei Ähnlichkeit besitzt, ihre Benadlung
viel eher an die im Zimmer in Töpfen oder im Warmhaus häufig gezogene
Norfolk-Araukarie (Araucaria excelsa) erinnert, ist sie
bei uns als „japanische Ceder“ im Handel. Sie ist das wichtigste,
in vielen Formen gezogene Nutzholz Japans, das in prächtigen alten
Exemplaren die heiligen Haine und die Tempel ziert und, wie in ihrer
Heimat, so auch in unseren Gärten meist durch Stecklinge vermehrt wird.
Das Gegenstück zu diesem altertümlichen Nadelholz Ostasiens bildet
in Kalifornien die nicht minder altmodische Riesensequoie
oder die zu Ehren des britischen Feldherrn Arthur Wellesley,
Herzog von Wellington (1769–1852), Wellingtonie genannte
Sequoia gigantea. Beide sind, wie auch die immergrüne
Sequoie (S. sempervirens) im Gebirge Kaliforniens und die
im südlichen atlantischen Nordamerika heimische Sumpf- oder
Eibencypresse (Taxodium distichum) Reste[S. 574] einer im
Tertiär weitverbreiteten Nadelholzgattung, die heute bis auf diese
wenigen Vertreter ausgestorben ist. Die in einem kleinen Bezirke
in Calaveras County in Kalifornien in 1500 m Höhe auf der
Sierra Nevada wachsenden Riesensequoien wurden 1850 vom britischen
Botaniker Lobb bekanntgemacht. Sie erreichen bei einem Durchmesser
von 10 m am Fuß des Stammes eine Höhe von 120 m und
sind nach den australischen Eukalypten die höchsten Bäume der Erde,
die ein Alter von 4000 Jahre erreichen können. Um die letzten ihres
Stammes vor Vernichtung zu schützen, ist das Gebiet, auf dem sie
wachsen, zum unantastbaren Nationalpark erklärt worden. Die kleinen,
eiförmigen Zapfen enthalten fast nie keimfähige Samen. Deshalb erfolgt
ihre Vermehrung wie diejenige der japanischen Kryptomerien in der
Regel durch Stecklinge. In unseren Parkanlagen begegnen wir ihnen als
streng kegelförmig gewachsenen Bäumen mit unten dickem, nach oben hin
aber rasch sich verschmälerndem Stamm. Die pfriemenähnlichen Nadeln
erinnern ganz an diejenigen der Kryptomerien, stehen aber allseitig
um den Trieb, während sie bei jenen sich in fünf Zeilen darum herum
ordnen. Bei der auch bei uns angepflanzten virginischen Sumpfcypresse
stehen die zarten, eibenähnlichen Nadeln an den Langtrieben einzeln,
an den Kurztrieben dagegen kammartig in zwei dichte Reihen geordnet.
Das auffallendste aber ist, daß im Herbst mit den Nadeln zugleich
auch die Kurztriebe abgeworfen werden. Die Sumpfcypresse, die in
ihrer Heimat in den Sümpfen wächst und darin zur Atmungsmöglichkeit
der Wurzeln eigentümlich geknickte, über das Wasser emporragende
Pneumatophoren bildet, verlangt bei uns im kälteren Klima einen
trockeneren Standort, um der Frostgefahr zu entgehen, und bildet in
diesem Falle natürlich auch keine geknickten Atemwurzeln, wie sie es
in ihrer Heimat tut. Erreicht auch dieser Baum an seinen natürlichen
Standorten mit einem Stammumfang von 10 m bei einer Höhe von
36 m ein ebenfalls mehrtausendjähriges Alter, so wird er darin von
der mexikanischen Eibencypresse (Taxodium mexicanum),
die nicht auf sumpfigem, sondern mäßig feuchtem Boden wächst, noch
übertroffen. So ist in Tule bei Oaxaca in Mexiko noch ein Mitglied
dieser Pflanzenfamilie am Leben, dem A. Decandolle ein Alter von 6000
Jahren beimißt. Jedenfalls ist dieser auf beifolgender Tafel nach einer
Originalaufnahme wiedergegebene Baum, dessen Stamm 1 m hoch über
dem Boden gemessen 31 m Umfang besitzt, während die 35 m
hohe Krone fast 100 m umspannt, das älteste Glied der heutigen
Schöpfung und erscheint schon dadurch ehrwürdig. Hat er doch alles[S. 575]
erlebt, was wir kurzlebige Menschen die Weltgeschichte nennen. Als
die mächtigen Pharaonen der 4. Dynastie ihre gewaltigen Grabdenkmäler
in Form der steinernen Pyramiden von Gise bauten, besaß dieser
Methusalem unter den Pflanzen bereits das respektable Alter von 1300
Jahren. Als die Neolithiker Mitteleuropas von Süden her mit den ersten
Metallschmucksachen und -Geräten bekanntgemacht wurden, war er schon
über 2000 Jahre alt. Und wenn wir alle, die wir heute uns des Lebens
freuen, nicht mehr sein werden, so wird dieser noch sehr lebenskräftige
Pflanzengreis weiterblühen und gedeihen. Was hat er nicht schon alles
erlebt und was wird er noch alles erleben, bis auch er einst zugrunde
geht!
Die echte Cypresse (Cupressus sempervirens), deren
charakteristische Gestalt sich jedem Italienfahrer unauslöschlich
eingeprägt hat, vermag mit alleiniger Ausnahme der besonders mild
gelegenen Bodenseeinsel Mainau und ihrer Umgebung nirgends in
Deutschland jahrelang ungeschädigt im Freien auszuhalten. Dieses
außerordentlich stimmungsvolle, für die heutigen Mittelmeerländer
geradezu charakteristische Kind des warmen Südens ist ein 20 und mehr
Meter hoher Baum von spitz kegelförmigem Wuchs, der aber auch in einer
Abart mit sich seitwärts ausbreitenden Ästen vorkommt, mit dunkelgrünen
Blättern und 2–3 cm langen Fruchtzapfen. Es ist die bekannteste
der 12 Cypressenarten, die im Mittelmeergebiet, im gemäßigten Asien, in
Nordamerika und Mexiko zu Hause sind. Die Cypresse ist von den Bergen
des nördlichen Persien und dem Libanon bis nach Griechenland heimisch
und findet sich meist in Höhen von 600 bis 1400 m über dem
Meer. Dabei soll sie ein Alter von über 2000 Jahren erreichen können
und erzeugt ein harzreiches, außerordentlich dauerhaftes Holz, das
mancherlei Verwendung findet. Sie hieß bei den Assyriern burâsu,
bei den Phönikiern berût, und wahrscheinlich davon abgeleitet,
bei den Griechen kypárissos. Überall bei den Semiten war sie
seit Alters der heilige Baum der Astarte-Aphrodite, so daß diese
gelegentlich auch baalat berût, d. h. Göttin der Cypresse,
genannt wird. Mit der Verbreitung des Astartekultes durch die Phönikier
gelangte sie mit der Taube, die das heilige Tier der Göttin war, immer
weiter westlich überall dahin, wo jene Kolonien gründeten.
Durchaus falsch ist die übrigens sehr ansprechende Darlegung von
Victor Hehn, wonach die Cypresse von einem Ursitz auf dem Gebirge
von Busi westlich von Herat in Afghanistan, wie ihn Alexander von
Humboldt annimmt, im Gefolge des iranischen Lichtdienstes weiter[S. 576]
nach Westen verbreitet worden sein soll. In ihrer schlanken,
obeliskenartigen Gestalt soll die Zendreligion das Bild der heiligen,
zum Himmel aufstrebenden Flamme gesehen haben, und deshalb soll sie
vor den Feuertempeln und in den Höfen der Paläste gepflanzt worden
sein. Ebensowenig hat sie der Insel Cypern den Namen gegeben. Ihre
Beziehungen zur orientalischen Göttin der Fruchtbarkeit sind sehr viel
älter als ihre Verehrung bei den feueranbetenden Persern.
Aus ihrem duftenden, der Zeit und dem Wurmfraß widerstehenden Holze
— schon Theophrast (im 4. Jahrhundert v. Chr.) nennt es: von Natur
unverwüstlich — schnitzte man mit Vorliebe nicht nur Götterbilder
von außerordentlicher Dauer, sondern verfertigte allerlei Hausgerät
und baute daraus vor allem Schiffe. Schon in Homers Odyssee wird der
Baum genannt, indem erwähnt wird, daß um die Grotte der Kalypso Erlen,
Schwarzpappeln und wohlriechende Cypressen standen, und weiterhin:
als Odysseus als Bettler verkleidet nach seiner Heimatinsel Ithaka
zurückkehrte, setzte er sich auf die eschene Türschwelle und lehnte
sich an die cypressene Türstütze. Zahlreich waren die Xóana, d.
h. die aus Holz geschnitzten ältesten Götterbilder in den griechischen
Heiligtümern — bevor die noch dauerhafteren aus Stein, besonders
Marmor, aufkamen — und auch die Türen in denselben aus Cypressenholz.
Aus Cypressenholz bestand auch die älteste Athletenstatue, die
Pausanias im 2. Jahrhundert n. Chr. im Olympia noch stehen sah. Sie
stellte den vor dem Jahre 540 v. Chr. lebenden Ägineten Praxidamas
dar, war von jenem in den heiligen Hain der Altis gestiftet worden und
hatte sich besser erhalten, als eine andere, etwas spätere, die aus
Feigenholz gearbeitet war. Ebenso bildeten die Römer ihre ältesten
Götterbilder mit Vorliebe aus Cypressenholz.
Tafel 151.

Die mexikanische Eibenzypresse (Taxodium mexicanum) von Tule bei
Oaxaca in Mexiko, das wohl älteste Glied unserer heutigen Schöpfung.
(Nach Photogramm von W. G. Bremer in Oaxaca.)
❏
GRÖSSERES BILD
Tafel 152.
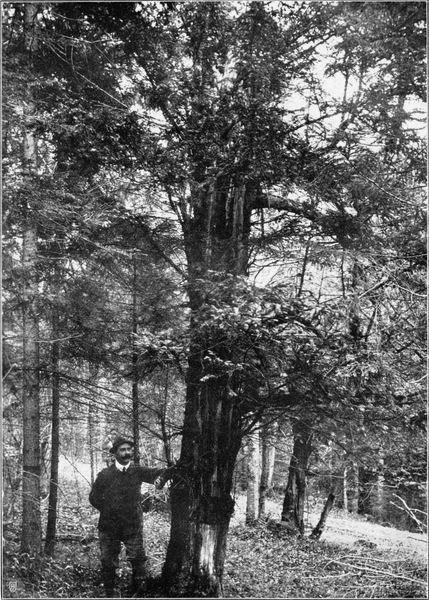
Eine alte Eibe in der Nähe von Paterzell bei Weilheim in Oberbayern in
einem Bestand von etwa 400 großen Exemplaren.
❏
GRÖSSERES BILD
Tafel 153.

Zwei Zypressen inmitten von mit Mauern umgebenen Olivenhainen bei
Rovigno in Istrien.

Hain von Steineichen, bekannt als „Bosco sacro“,
in der römischen Campagna.
Tafel 154.

Pyramidenpappeln als Zierbäume vor der Villa Stuck in München.
❏
GRÖSSERES BILD
Wie die Phönikier haben auch die alten Griechen ihre Schiffe
vorzugsweise aus dem unverwüstlichen Cypressenholz gebaut, wie Plato
sagt: „Es ist ein rechtes Glück, wenn ein Staat weder Cypressen, noch
anderes zum Schiffsbau taugliches Holz hat, weil die Schiffahrt keinen
Segen bringt.“ Und der griechische Geschichtschreiber Diodor berichtet
vom König Antigonos, dem „Einäugigen“, dem Feldherrn Alexanders des
Großen (384–301 v. Chr., erhielt 323 bei der Teilung von dessen
Reich Großphrygien, Lykien und Pamphylien, führte aus Ehrgeiz und
Eroberungslust viele Kriege gegen die übrigen Diadochen, in denen er
Kleinasien und Syrien eroberte, nahm 306 mit seinem Sohn Demetrios
Poliorketes, d. h. dem „Städtebelagerer“, den Königstitel an und verlor
in der Schlacht bei Ipsos in Phrygien gegen Kassandros, Lysimachos[S. 577]
und Seleukos Reich und Leben), er habe zur Bekämpfung seiner über große
Flotten gebietenden Gegner, den einstigen Mitfeldherrn Alexanders, 8000
Mann mit dem Fällen von Cedern, Pinien und Cypressen auf dem Libanon
beschäftigt. Tausend Paar Lasttiere sollen das Holz zur Küste getragen
haben, wo von werkkundigen Zimmerleuten Schiffe daraus gebaut wurden.
Auch Gedenktafeln und Särge wurden mit Vorliebe aus dem dauerhaften
Cypressenholz verfertigt. So sagt Plato, daß die Landlose der Bürger in
den Tempeln auf cypressenen Gedenktafeln für die Nachwelt verzeichnet
werden sollten, und schreibt der griechische Geschichtschreiber
Thukydides. „Bei den Athenern ist es Sitte, die Gebeine der in einer
Schlacht Gefallenen erst öffentlich zur Schau zu stellen und sie dann
in Särgen zu begraben, die aus Cypressenholz gemacht sind.“ Nach
demselben Autor umschlossen cypressene Schreine, je einer für eine
Phyle (Stamm, d. h. durch Abstammung von einem Stammvater
verbundenen Teil eines Volkes, deren es seit Kleisthenes, dem Haupt der
Alkmäoniden, 510 v. Chr., 10 gab, welche wiederum in Demen eingeteilt
waren), die in die Erde zu bergenden Gebeine bei jener 430 zu Athen
gefeierten öffentlichen Bestattung der für das Vaterland Gefallenen
zu Beginn des peloponnesischen Krieges, bei welcher Perikles, der
schon das Jahr darauf von der Pest hinweggerafft wurde, seine berühmte
Rede zur Verherrlichung Athens hielt. Und was vor dem Zerstörtwerden
durch Insekten und deren Larven beschützt werden sollte, das wurde bei
den Griechen, wie auch später bei den Römern in cypressene Kästchen
eingeschlossen, so bei Horaz die Manuskripte der von ihm gedichteten
Lieder.
Wo immer der Kult der phönikischen Astarte Eingang fand, da wurden
Cypressenhaine vor deren Heiligtümern errichtet. So kam die Cypresse
durch die Vermittlung der süditalischen Griechen zu den Römern. Plinius
schreibt in seiner Naturgeschichte über sie: „Die Cypresse ist ein
ausländischer Baum, der anfangs nur mit großer Mühe gezogen wurde.“
Cato, der sie die Tarentinische nennt, weil sie von dorther in das
römische Gebiet gekommen ist, spricht über sie weitläufiger als über
alle andern Bäume. Ihr Vaterland ist Kreta. Dort entsteht überall, wo
jemand den Boden auflockert, durch Naturkraft ein Cypressenwald. (Ihre
kleinen Samen haben auf jeder Seite einen als Fallschirm dienenden
häutigen Rand, womit sie leicht vom Winde in die Weite getragen und
so in der Ferne angesät werden.) Auf den Gebirgen Kretas, dem Ida und
den Weißen Bergen, wächst sie auch da, wo der Boden nicht bearbeitet
ist, neben dem ewigen[S. 578] Schnee, was allerdings wunderbar ist, da sie
viel Wärme verlangt und in bezug auf den Boden sehr spröde tut. Sie
wächst sehr langsam, gewährt nicht den geringsten Nutzen (nämlich
an Früchten), hat widerliche (d. h. nicht wohlschmeckende) Früchte,
bittere Blätter, einen betäubenden Geruch, keinen angenehmen Schatten
(weil er infolge der Höhe des Baumes nur schmal ist), lockeres Holz.
Die Cypresse ist dem Gott Dis (Gott der Unterwelt) geweiht und wird
deshalb (in Gestalt von in Kübeln gepflanzten Exemplaren) an die Türe
der Häuser gestellt, in welchen sich ein Sterbefall ereignet hat. Ihr
säulenförmiger Wuchs empfiehlt sie zur Abwechslung mit Pinienalleen;
jetzt beschneidet man sie auch so, daß sie mauerdichte Zäune gibt, auch
bringt man sie durch Beschneiden dahin, daß sie Jagden, Flotten und
andere Bilder vorstellt, welche mit ihren zarten, kurzen, immergrünen
Blättern bekleidet sind.
Es gibt zwei Arten von Cypressen: Die eine, die man die weibliche
nennt, wächst dicht und säulenförmig (es ist dies die zu Eingang
erwähnte var. pyramidalis von Cupressus sempervirens),
die andere heißt die männliche und breitet ihre Äste seitwärts aus
(var. horizontalis), sie wird beschnitten und dient auch als
Stütze für Weinstöcke. Beiden Arten schneidet man auch die Seitenäste
weg und zieht sie auf diese Weise zu Stangen und Pfählen, welche, wenn
der Stamm 13jährig ist, Stück für Stück einen Denar (= 60 Pfennige)
kosten. Es geht daraus hervor, daß ein solcher Cypressenwald sehr
einträglich ist; daher nannten die Alten solche Pflanzungen die
„Aussteuer ihrer Töchter“. Noch heutigen Tags heißt übrigens die
Cypresse nach Fee wegen dieses Brauches auf Kreta „Aussteuer der
Tochter“ und wird in größerer Anzahl bei der Geburt eines Kindes
gepflanzt, wie man in Frankreich bei solchem Anlasse einige hundert
Pappeln pflanzt und sie zu dessen Gunsten verkauft, wenn es erwachsen
ist, oder in der Südsee einige Brotfruchtbäume setzt, die das alleinige
Eigentum des neuen Familienmitgliedes bilden. Auch bei uns pflanzt
mancher Bauer jedem seiner Kinder bei deren Geburt einen oder einige
Obstbäume, deren Ertrag ausschließlich dem betreffenden Individuum
gehört.
Auch die Grenzen der Grundstücke wurden mit Vorliebe durch solche
nur wenig Schatten verbreitende Cypressen bepflanzt. So schreibt
der gelehrte Varro (116–27 v. Chr.): „Die Grenze der Grundstücke
(fundus) werden oft durch Bäume bezeichnet, damit kein Streit
entsteht. Manche Leute pflanzen zu diesem Zwecke Pinien, was meine Frau
im Sabinerlande tun ließ, andere Cypressen, wie ich auf meinen[S. 579] Gütern
am Fuße des Vesuv, andere Ulmen, wie häufig im Crustumenischen zu sehen
ist.“
Als den Gottheiten der Unterwelt geweihter Baum wurde die Cypresse
zunächst bei den vornehmen Römern, wie heute noch im Orient und
in Südeuropa von Griechenland bis Spanien, als Totenbaum auf die
Gräber gepflanzt. So war sie bei den Dichtern der augusteischen Zeit
der typische Baum der Trauer, mit dessen Zweigen Leichenaltar und
Scheiterhaufen besteckt wurden. So läßt Vergil in der Aeneis auf dem
Grabe des Polydorus einen großen Erdhügel aufschütten, mit dunklen
Florbinden umwundene Altäre bauen und daneben schwarze Cypressen
pflanzen. Weiterhin läßt er bei der Bestattung des Misenus von den
Trojanern einen ungeheuren Scheiterhaufen aus harzigem Kien- und
Eichenholz bauen, dessen Seiten mit schwarzem (Cypressen-)Laube
bedecken und davor als Zeichen der Trauer Cypressen aufstellen.
Dazu sagen Festus und Servius gleicherweise: es sei römische Sitte,
Cypressen oder Cypressenzweige vor die Haustüre der Toten zu stellen,
weil diese Bäume absterben, sobald sie gefällt sind, so wie der
Mensch, wenn er einmal gestorben ist, nicht wieder zum Leben gelangt.
Auch Lucanus sagt: „Die Cypresse ist das Zeichen der Trauer“, und
Statius schreibt in seiner Thebais: „Das Lager des Toten wird aus
Zweigen der traurigen Cypresse geflochten. Auf das Geflecht wird eine
Lage Stroh gelegt, auf diese eine Lage von Grasgirlanden, dann eine
Schicht bunter, dem Flammentode gewidmeter Blumen und diese werden
mit morgenländischem Weihrauch und Zimt (cinnamum) belegt.“
Bei Horaz wird die „trauerverkündende Cypresse“ als Totenbaum gerne
im Gegensatz zum Genuß der heiteren Gegenwart gestellt. In einer
seiner Oden heißt es: „Im Tode mußt du alles, was dir auf Erden teuer
ist, verlassen und von den Bäumen, die du gepflegt, folgt dir nur die
verhaßte Cypresse.“
In den Metamorphosen des Ovid wird die Entstehung der Cypresse in
folgender Weise erklärt: Ein Knabe, den Apollo liebte, hatte das
Unglück, unversehens einen den Nymphen geheiligten, prächtigen Hirsch
zu töten; untröstlich darüber, flehte er die Götter an, ihn wenigstens
in Ewigkeit trauern zu lassen. Deshalb wurde er durch das Mitleid der
Götter in einen Cypressenbaum verwandelt, der den schlanken Wipfel
hoch zum Himmel erhebt, von den Göttern betrauert und zugleich das
Unglück der Menschen betrauernd. Daß später alles, was irgendwie mit
der Cypresse zusammenhing und von ihr abstammte, die vornehmen Römer an
den Tod erinnerte und ihnen deshalb un[S. 580]angenehm war, beweist auch die
Erzählung des Geschichtschreibers Älius Spartianus in seiner Biographie
des römischen Kaisers Lucius Septimius Severus (der, 193 von den
pannonischen Legionen zum Cäsar ausgerufen und vom Senat anerkannt, die
Prätorianer auflöste, 195 den Gegenkaiser Pescennius Niger bei Kyzikos,
196 den andern Gegenkaiser Clodius Albinus bei Lyon schlug, gegen die
Parther zu Felde zog, 203 nach Rom zurückkehrte, 208 nach Britannien
ging und 211 in Eboracum — der Stadt York in England — starb): „Dem
Kaiser Severus begegnete kurz vor seinem Tode ein Neger, der zugleich
als Soldat und als Hanswurst diente, mit einem Cypressenkranze auf
dem Kopfe. Der Kaiser erschrak über die böse Bedeutung, die in der
schwarzen Farbe des Menschen und in der Cypresse lag, und befahl, den
Menschen sogleich aus seiner Nähe zu entfernen.“
Trotz aller Pflege von seiten des Menschen gedeiht die Cypresse auch
in Italien lange nicht so, wie in ihrer orientalischen Heimat. Als
nie recht eingebürgerter Fremdling bildet sie in diesem Lande keine
eigentlichen Haine, sondern steht meist einsam oder in kleinen Gruppen,
mit Vorliebe auf den Friedhöfen; nicht selten wird sie als Alleebaum
gepflanzt, wobei sie auch dann ihr düsteres und zugleich feierliches
Gepräge nicht verleugnen kann. Wie in der Ebene von Neapel der Blick
besonders häufig auf Pinien fällt, so im Arnotale auf Cypressen,
die der sonst heiteren Landschaft einen düsteren Akzent verleihen.
Wer aber den Baum in seiner feierlichen Schönheit bewundern will,
der muß nach dem Orient gehen, wo er die schönsten und höchsten
Exemplare auf den alten Friedhöfen der Türken findet, so schon in
Skutari, der asiatischen Seite von Konstantinopel, aber noch viel
majestätischer in Smyrna oder Brussa. Schon Plinius und Dioskurides,
beide im 1. Jahrhundert n. Chr., sagen, daß die verschiedenen Teile
der Cypressen als Heilmittel benutzt wurden. Auch bei den arabischen
Ärzten war dies der Fall, und in duftende Cypressenwälder schickten
sie die Brustkranken, damit diese durch den harzigen Geruch der dort
eingeatmeten Luft Genesung fänden.
Von anderen Cypressenarten, die auch in Südeuropa gepflanzt werden,
verdienen noch Erwähnung: die blaugrüne Cypresse (Cupressus
pendula) aus Mexiko, die eine ziemlich durchsichtige, hell
blaugrüne Pyramide bildet, dann die gleicherweise aus höheren Lagen
Mexikos stammende Weihrauchcypresse (C. thurifera),
ein hoher Baum mit abstehenden Haupt- und Nebenästen. Sie gleicht
erwachsen[S. 581] einem Lebensbaum (Thuja), hat grüne Fruchtzapfen
und schwitzt ein wohlriechendes, in ihrer Heimat wie Weihrauch zu
Räucherungen benutztes Harz aus. Dann die Trauercypresse (C.
pendula), ein ziemlich hoher Baum mit ausgebreiteter Krone,
überhängenden Ästen und mehrkugeligen Zapfen aus China: er wird dort
und auch in Nordostindien auf Gräber gepflanzt und kam 1848 nach Europa.
Fälschlicherweise wird bei uns oft der gemeine Lebensbaum
(Thuja occidentalis) Cypresse genannt. Dieses
nordostamerikanische Nadelholz, dessen flache, unterseits hellgrüne
Zweige im Winter infolge einer teilweisen Umwandlung des Chlorophylls
oder Blattgrüns eine braungelbe Mißfärbung annehmen, kam schon 1566
nach Europa, und zwar zuerst nach Frankreich, als der moralisch
schwache Karl IX. von 1560–1574 das Land beherrschte. Es hat sich
vollständig bei uns eingelebt und wird sehr häufig in Anlagen
gepflanzt. Auch im Walde werden neuerdings Lebensbäume zu pflanzen
versucht, doch ist dies mehr mit der pazifischen Art, dem in seiner
Heimat 50 m Höhe erreichenden Riesenlebensbaum (Thuja
gigantea) der Fall, dessen aromatisch riechende, unterseits
hellgrau gefärbte Zweige sich im Winter nur wenig verfärben.
In Anlagen finden wir außerdem die nordamerikanische Thuja
plicata und die den Lebensbäumen nahe verwandte, im Wuchse nur
schlanker, cypressenartiger gestaltete kalifornische Heyderie
(Libocedrus decurrens), deren gewöhnliche, auch in der
lateinischen Benennung — von líbos Flüssigkeit, Wasser
und kédros Ceder — sich bekundender Name „Flußceder“ als
irreführend besser nicht gebraucht wird.
Schon seit längerer Zeit in Gärten und Friedhöfen verbreitet ist
auch der chinesische Lebensbaum (Biota orientalis —
vom griechischen biotḗ Leben, weil immergrün), dessen Zweige
unterseits kleine helle Flecken tragen. Der Baum ist sofort daran zu
erkennen, daß seine Zweige durchweg steil aufgerichtet stehen; deshalb,
weil sie nicht ausgebreitet liegen, sind sie nur sehr undeutlich in
eine dunklere Ober- und in eine hellere Unterseite geschieden. Auch
die blaubereiften, aus sechs dicken Fruchtschuppen gebildeten Zapfen
sind dadurch charakterisiert, daß sie außen eine rinnenartige Öldrüse
tragen, während sie bei den nordamerikanischen Lebensbäumen kugelig
erhöht sind.
Auch die Halb- oder Lebensbaumcypressen
(Chamaecyparis) werden von den Gärtnern fälschlicherweise
als Cypressen bezeichnet. Tragen sie auch eine ähnliche Benadlung,
so können sie gleichwohl in der Schönheit des Wuchses nicht mit den
echten Cypressen wetteifern. Im Unterschied von diesen sind die Zweige
der Halbcypressen[S. 582] nicht gleichseitig vierkantig, sondern flach,
mit deutlich verschiedener, meist auch anders gefärbter Ober- und
Unterseite. Die verbreitetste, nicht nur in unseren Anlagen, sondern
auch im deutschen Walde eine ziemliche Rolle spielende Art, ist die aus
dem pazifischen Nordamerika zu uns gebrachte, nach dem schottischen
Gärtner Lawson benannte Lawsoncypresse (Ch. lawsoniana),
die an ihrem stark überhängenden Gipfeltriebe sofort von den anderen
Arten zu unterscheiden ist. Weit verbreitet ist auch die auf beiden
Seiten der Zweige fast gleichmäßig dunkelgrüne, an der Nutkabucht in
Nordwestamerika heimische Nutkacypresse (Ch. nutkaensis),
ebenso zwei japanische Arten: die durch schräg abstehende,
scharfspitzige Kantenblätter ausgezeichnete Sawaracypresse
(Ch. pisifera), die in mehreren Formen gezüchtet wird, und
die durch einwärtsgebogene, stumpfe Kantenblätter charakterisierte
stumpfblättrige Halbcypresse (Ch. obtusa). Alle
diese Halbcypressen mit erwachsen schuppenartiger Belaubung tragen
in ihrer Jugend weiche, pfriemenartige Nadeln. Nun gelang es der
gärtnerischen Zucht, solche Jugendzweige als Stecklinge zu verwerten,
und daraus Pflanzen heranzuziehen, die auch im Alter nur nadelförmige
Primärblätter tragen. Solche Formen mit dauernd beibehaltenem
Jugendkleid, die früher als besondere Gattung Retinispora
angesehen wurden, sind heute noch unter diesem irrigen Namen im
Handel. So ist Retinispora plumosa einfach die das Jugendkleid
beibehaltende Form der Sawacypresse (Ch. pisifera).
Aus der großen Zahl der cypressenartigen, oft schwer zu
unterscheidenden Nadelhölzer ist noch eine durch ihre oben
glänzendgrüne, unten aber bläulichweiße Färbung der Triebe
gekennzeichnete Art zu nennen, nämlich die in Japan große Wälder
bildende Hiba (Thujopsis dolabrata), die, weil vollkommen
winterhart und gegen Beschattung wenig empfindlich, sogar für den
deutschen Wald empfohlen wird. Sie liefert ein sehr dauerhaftes Holz.
Von allen bisher genannten Nadelhölzern trennt die
Wacholderarten der fleischige Bau der Zapfen, deren Schuppen bei
der Reife völlig verwachsen und deshalb ganz den Eindruck einer Beere
machen. Von den etwa 30 Arten der nördlichen Halbkugel sind in unseren
Parkanlagen nur wenige zu finden, da die meisten bei uns nur in ganz
milden Lagen zu gedeihen vermögen. Aber auch unsere einheimische Art,
der gemeine Wacholder (Juniperus communis), der in den
Sagen und in der Volksheilkunde unserer heidnischen Vorfahren eine so
große Rolle spielte, ist selten in Kultur zu treffen. Am häufig[S. 583]sten
findet sich noch der im Hochgebirge und im Polargebiet wachsende
Zwergwacholder (J. nana), der mit seinen zur Ausnützung
der durch Sonnenbestrahlung erzeugten Bodenwärme und zum Schutz durch
Schnee niederliegenden Ästen und den dichtgedrängten, weicheren und
kürzeren Nadeln gern als Gartenschmuck verwendet wird. Ebenso wird
der ähnlich auf der Erde liegende nordamerikanische Wacholder
(J. prostrata), dann der schuppige Wacholder (J.
squamata) vom Himalaja und J. sphaerica mit kugeligen Beeren
aus China gelegentlich in unseren Gärten kultiviert.
Bisweilen findet sich in unseren Anlagen auch der in Südeuropa
heimische Baumwacholder (J. excelsa), der nebst dem
im östlichen Mittelmeergebiet, besonders in Syrien und Phönikien
heimischen, in der Erscheinung der Cypresse ähnlichen, ebenfalls
baumartigen Cedernwacholder (J. phoenicea) die Ceder der
Alten bildete, deren rötliches, wohlriechendes Holz als „der Verwesung
widerstehend“, wie schon Theophrast im 4. Jahrhundert v. Chr. sagt,
mit Vorliebe als Werkholz benutzt wurde, während sie den gemeinen
Wacholder als „kleine Ceder“ (kédros mikrá) bezeichneten.
Nach Homers Ilias war das Bettgestell des Königs der Troer, Priamos,
aus solchem Wacholderholz gefertigt (kédrinos) und duftete
lieblich. Nach der Odyssee aber brannte in der Wohnung der Nymphe
Kalypso, Tochter des Atlas, die den auf die von ihr bewohnte Insel
Ogygia verschlagenen Odysseus 7 Jahre lang festhielt, ein Feuer
von Baumwacholder (kédros) und Lebensbaum (thýon von
thýein opfern, weil sein Holz beim Opfer verbrannt wurde)
und verbreitete weithin über die Insel Wohlgeruch. Rings um die
Wohnung der Nymphe standen Erlen (klḗthrē), Schwarzpappeln
(aígeiros) und wohlriechende Cypressen (kypárissos). Auf den
Bäumen nisteten Käuzchen (skṓps), Falken (írēx) und
Rabenkrähen (korṓnē). In Vergils Äneis erleuchtete die in
der Odyssee als Tochter des Sonnengottes Helios und der Okeanide
(Meerjungfrau) Perseis genannte, auf der Insel Aeaea hausende
Zauberin Kirke, die die Gefährten des Odysseus in Schweine verwandelt
hatte, nachts ihren stolzen Palast mit wohlriechendem Wacholderholz
(odorata cedrus). Nach demselben Epos standen in der alten Burg
des Königs Latinus in Latium (in Mittelitalien am Tyrrhenischen Meer
zwischen den Flüssen Tiber und Liris — jetzt Garigliano — gelegen)
der Reihe nach die aus Wacholderholz (cedrus) geschnitzten
Bilder der Ahnen. Nach Plinius wuchsen die besten Cedernwacholder
(cedrus) auf Kreta, in Syrien und in Afrika. „Das Holz
(materia), das mit Cedernwacholderöl (cedri oleum)[S. 584]
getränkt ist, wird weder von Würmern, noch von Fäulnis angegriffen.
Der Baumwacholder (juniperus) hat dieselben guten Eigenschaften
wie der cedrus. Er wird in Spanien und insbesondere im Lande
der Vaccäer sehr groß und sein Kernholz ist noch dichter als dasjenige
des cedrus. Sein Holz hat ewige Dauer; deshalb macht man aus
ihm gerne Götterbilder. So z. B. ist der zu Rom in einem Tempel
aufgestellte sosianische Apollo, der von Seleucia (in Syrien) gebracht
wurde, aus Cedernholz (cedrinus est, in diesem Fall ist
jedenfalls das echte Cedernholz der Libanonceder gemeint). — Aus den
Beeren des Baumwacholders bereiteter Wein (vinum e junipero)
wird von Ärzten denjenigen als besonders wohltuend empfohlen, welche
durch Waffenübungen oder Reiten ermüdet sind.“ Noch heute werden die
aromatisch riechenden Beeren dieses mittelländischen Wacholders, wie
im Orient diejenigen des Bauchwacholders, statt unserer schwarzen
Wacholderbeeren, in Apotheken wie im Haushalte gebraucht. Der
griechische Arzt Galenos im 2. Jahrhundert n. Chr. sagt von ihnen:
„Die Wacholderbeeren heißen arkeuthís, haben einige Schärfe,
sind etwas süß, haben auch etwas Zusammenziehendes und Gewürzhaftes.
Sie erwärmen, reinigen Leber und Nieren, verdünnen die dicken, zähen
Säfte und werden deshalb den Gesundheitsmitteln zugesetzt. Viel
Nahrung gewähren sie dem Körper nicht. In allzu großer Menge fallen
sie dem Magen beschwerlich und verursachen Kopfschmerzen.“ Plinius
sagt, man gebe sie gegen Blähungen, Fieber und Husten, lege sie auch
auf Geschwülste und salbe sich mit Öl, in welchem sie zerrieben
wurden, um vor Schlangenbiß sicher zu sein. Ein sicheres Mittel,
um Schlangen zu vertreiben, sei, Sägemehl von Baumwacholder an die
Orte zu streuen, wo sich welche befinden. Daß dieses Mittel probat
ist, wollen wir schon glauben; denn wir wissen, daß die Schlangen
ein empfindliches Geruchsorgan besitzen und dieser starkriechenden
Masse wie allen intensiven Gerüchen aus dem Wege gehen. So ist es
ein vielerprobtes Mittel der Neger an der schlangenreichen Küste von
Liberia, sich beim Passieren von daran besonders reichen Strecken vor
dem Gebissenwerden durch diese Reptilien zu schützen, indem sie sich
Füße und Unterschenkel mit Knoblauch einreiben.
Von dem in den östlichen Mittelmeergegenden heimischen
Weihrauchwacholder (J. thurifera) wird das Harz als
schlechter oder arabischer Weihrauch in den Handel gebracht und
aus dessen Holz, wie auch aus demjenigen des verwandten lykischen
Wacholders (J. lycia) in Kleinasien, ein in der Tierarzneikunde
gebräuchliches Wacholderholz-[S. 585] oder Kadeöl destilliert. In unseren
Parks werden diese Arten kaum angetroffen. Dagegen wird von alters
her wegen seiner offizinellen Eigenschaften der an den Nord- und
Südabhängen der Alpen und Pyrenäen heimische strauchartige Sade-
oder Sevenbaum (J. sabina) gezogen. Schon der griechische
Arzt Dioskurides im 1. Jahrhundert n. Chr. erwähnt ihn als bradý
(von bradýs langsam, weil er sehr langsam in die Höhe wächst).
Er kommt in Griechenland zur Seltenheit auf den nördlichen, höheren
Gebirgen vor, hieß bei den Italienern im Mittelalter sabina,
woher er den wissenschaftlichen Beinamen erhielt. Früher wurden am
Feste von Marie-Krautweihen an manchen Orten nebst anderen grünen
Pflanzen auch Sevenzweige geweiht, die das abergläubige Volk zur
Abhaltung des Teufels und der Hexen in den Wohnungen aufhing und
für heilsam gegen alle möglichen Übel hielt. Es wird auch eine
buntblätterige Abart als Zierpflanze gezogen, doch soll dieser Strauch
wegen seiner großen Giftigkeit, die schon Todesfälle bewirkte, und weil
er als Abtreibungsmittel gerne benützt wird, nicht in öffentlichen
Anlagen gehalten werden.
Den seinigen sehr ähnlich, nur nicht so unangenehm harzig
riechend, sind die Zweige des virginischen Wacholders oder
Sadebaums (J. virginiana), der um 1664 aus dem östlichen
Nordamerika in Deutschland als Zierbaum eingeführt wurde. Während
er bei uns niedergedrückt, strauchartig bleibt, bildet er in seiner
Heimat stattliche Bäume, deren wohlriechendes, rotbraunes Holz trotz
seiner Leichtigkeit sehr dauerhaft ist und kaum je vom Wurmfraß
leidet. Es wird deshalb zu Schiffsplanken, Schindeln und allerlei
Möbeln, besonders aber zu Zigarrenkisten und zur Umkleidung von
Bleistiften benutzt. Der Bleistiftfabrikant Faber in Stein bei Nürnberg
führt jährlich viele tausend Kubikmeter davon ein und pflanzt auch
den Baum für sich bei Fürth in größerem Maßstab. Ebenso wird er im
Braunschweigischen mit Erfolg angepflanzt. Außer dem virginischen
liefert auch der auf den Bermudasinseln heimische Juniperus
bermudiana einen großen Teil des amerikanischen Bleistiftholzes,
das als „rotes Cedernholz“ in den Handel gelangt.
Noch mehr als die fleischige Frucht des Wacholders weicht die
prächtig rote, seltener gelbe Scheinbeere der Eibe
(Taxus) von der sonst üblichen Zapfenform der Koniferenfrucht
ab; doch weisen die einzeln stehenden, vorn spitzen Nadeln auf
ihre Familienzusammengehörigkeit mit jenen. Die 6–9 m hoch
werdende gemeine Eibe (Taxus baccata) findet sich in
Gebirgswäldern Europas, Asiens und Nord[S. 586]amerikas, ist aber im deutschen
Walde fast ausgestorben. In Park und Garten dagegen, wo sie unter
Schutz steht, ist sie eine der bekanntesten Erscheinungen. Sie wächst
sehr langsam, leidet nicht unter starker Beschattung und besitzt ein
für Nadelhölzer ganz erstaunliches Ausschlagsvermögen, so daß sie
sich leicht durch Stecklinge vermehren und zu Hecken und Figuren
nach Belieben zuschneiden läßt. Allerdings enthalten ihre Nadeln,
wie auch die hellvioletten Samen ein giftiges Alkaloid, das Taxin,
das besonders für Pferde, aber auch für Ziegen und Schafe gefährlich
ist. Der Samenmantel dagegen wird von den Amseln und anderen Vögeln
gerne verzehrt; dabei besorgen diese die Weiterverbreitung der Samen,
die erst in zwei oder drei Jahren keimen. Die Eibe ist das einzige
Nadelholz, das vollständig harzfrei ist. Männliche und weibliche Blüten
wachsen bei ihr meist getrennt auf verschiedenen Individuen; doch kommt
es nicht selten vor, daß ein Stock, der jahrelang nur einerlei Blüten
trug, plötzlich beiderlei Blüten hervorbringt. In alten Exemplaren wird
die Eibe baumförmig und erreicht dann eine Höhe von 10–15 m.
Bei dem geringen Dickenwachstum deuten so große Eibenbäume, die dann
Stämme von 1 m Durchmesser aufweisen, auf ein Alter von über
1000 Jahren. Im Park von Hamptoncourt bei London kennt man solche
Bäume, deren Alter von über 1000 Jahren historisch beglaubigt ist.
Ein Eibenbaum bei Katholisch-Hennersdorf in Schlesien wird auf 1400
Jahre geschätzt und gilt für den ältesten Baum Deutschlands. Noch
älter ist die Eibe auf dem Friedhofe zu Braburn in England, die man —
jedenfalls übertrieben — für 3000jährig ausgibt. Größere Eibenbestände
sind außer auf der Tucheler Heide, wo gegen 1000 Bäume grünen, nur
noch im bayrischen Allgäu vorhanden. Kleinere Haine von ebenfalls sehr
alten Eiben findet man bei Treseburg im Bodetal im Harz, dann auf
dem Veronikaberge bei Ilmenau, in einem Forstrevier der rauhen Röhn
bei Dermbach im Großherzogtum Weimar, wo gegen 400 sehr alte Bäume
vorhanden sind. In Süddeutschland ist neuerdings auf einen Eibenhain in
der Nähe von Paterzell bei Weilheim südlich von München mit teilweise
über 1000jährigen, bis 18 m hohen Exemplaren durch Dr. F.
Kollmann aufmerksam gemacht worden.
In den Mittelmeerländern wächst die Eibe als Strauch nur spärlich
auf höheren Gebirgen. Sie galt den Alten als ein Baum des Todes, so
daß sogar schon ein längerer Aufenthalt unter ihrem Schatten für
lebensgefährlich angesehen wurde. Deshalb warnt Dioskurides, in
ihrem Schatten zu schlafen. Lucanus und Silius Italicus nennen die
Eibe[S. 587] als einen den Göttern der Unterwelt geweihten Baum; deshalb
bekränzte man sich mit ihr als Zeichen der Trauer. Die Griechen nannten
sie smílax, die Römer dagegen taxus. Zahlreiche Völker, so
schon die neolithischen Pfahlbauern an den Ufern der Schweizerseen,
bedienten sich der Eibenzweige zur Herstellung von Bogen und zu anderen
außerordentlich dauerhaften Geräten. Im Mittelalter verfertigte
man besonders die Armbrustbogen daraus. Schwarz gebeizt ist ihr
rötlichbraunes Holz kaum vom Ebenholze zu unterscheiden. Nach Plinius
sollten aus Eibenholz verfertigte Weinbecher den Tod bringen, wie man
in Gallien bemerkt habe. Cäsar schreibt in seinem Berichte über den
Krieg in Gallien: „Als Cäsar den Ambiorix besiegt hatte, tötete sich
Kativolcus, der über die eine Hälfte der Eburonen regierte, durch das
Gift der Eibe. Dieser Baum ist in Gallien und Germanien häufig.“ Nach
demselben Autor sollen manche Volksstämme der Gallier mit Eibensaft
vergiftete Lanzenspitzen benutzt haben. Heute noch wird eine Abkochung
aus Zweigen von ihm, wie aus solchen des Sadebaums, beim Volke zum
Fruchtabtreiben verwendet.
Von Ostasien, besonders Japan, kamen die den Eiben ähnlichen, nach
den zu 2–3 in Köpfchen zusammenstehenden weiblichen Blüten als
Kopfeiben (Cephalotaxus) bezeichnete Ziersträucher zu
uns. Sie gedeihen aber nur in milden Lagen. Die gebräuchlichsten Arten
derselben sind C. harringtonia, zu Ehren des Earl von Harrington
in Elvaston-Castle, der sie zuerst anpflanzte, so bezeichnet, und
C. fortunei. Ebenfalls ostasiatischen Ursprungs ist der häufig
in unseren Parkanlagen zu treffende Gingkobaum (Gingko
biloba nach Linné, neuerdings aber gewöhnlich als Salisburia
— nach Richard Anton Salisbury — adiantifolia bezeichnet). Er
wird in Japan ginkyo geheißen und wurde um 1750 von dorther in
Europa eingeführt. Nach Belaubung, Verzweigung und Ausschlagsfähigkeit
würde man ihn für ein Laubholz halten; der Bau des harzfreien Holzes
aber und der Blüten weist ihn zu den eibenartigen Nadelhölzern, während
die höchst merkwürdige Befruchtung der letzteren, von der im 2. Band
meiner gemeinverständlichen Entwicklungsgeschichte des Naturganzen nach
den neuesten Forschungsergebnissen: Vom Nebelfleck zum Menschen[4] auf
Seite 258 eingehend die Rede war, große Ähnlichkeit mit derjenigen
der Palm[S. 588]farne hat. Ist er doch neben diesen der einzige unter allen
Gymnospermen, der noch Spermatozoïden wie die niederen Farne erzeugt.
Und an einen Farn, das Frauenhaar (Adiantum capillus veneris)
erinnert auch der fächerförmige Bau und die Nervatur der Blätter,
die an den nichtblühenden Zweigen zweilappig sind und im Herbste
sämtlich abgeworfen werden, und zwar an den weiblichen Bäumen — der
Gingko ist nämlich zweihäusig — später als an den männlichen. Die
Blätter der blühenden Zweige sind ungeteilt, die der Stockausschläge
dagegen mehrspaltig-viellappig. Der Baum entspricht also der bei den
Laubhölzern in weitem Umfang geltenden Regel, wonach die Blätter der
Blütenzweige einfacher, die der Stockausschläge dagegen größer und
reicher gegliedert sind als die übrigen Blätter. Die männlichen Blüten
sind gestielte Kätzchen, welche zahlreiche Staubblätter mit je zwei
an der Spitze sitzenden Pollensäckchen tragen. Die weiblichen Blüten
sind länger gestielt und weisen am Ende meist zwei becherförmige
Fruchtblätter auf, die mit je einer aufrechten Samenanlage besetzt
sind. Die einer gelben oder grünlichen, großen Kirsche ähnliche Frucht
besitzt einen von einem umfangreichen, harzreichen Fruchtfleisch
umschlossenen zweikantigen, steinharten Kern, dessen Samen geröstet in
China als Nahrungsmittel dient.

Bild 79. I Zweig mit Blättern und Blüten des männlichen Gingkobaumes
(Salisburia adiantifolia), III ein einzelnes Staubblatt mit zwei
Pollenfächern, II weiblicher Blütenstand mit einigen jungen Früchten.
In seiner Heimat China und Japan ist der Gingko ein heiliger Baum,
der fast nur in den Hainen um die Tempel angepflanzt wird. Wild wird
er nur noch an wenigen Stellen in den Bergen der gegenüber der Insel
Formosa gelegenen chinesischen Provinz Fo-kien gefunden. Er ist
der letzte noch erhaltene Vertreter einer Pflanzengattung, die zur
mittleren Tertiärzeit auch in Europa lebte und sich seit dem Beginne
der mesozoischen Zeit kaum mehr veränderte. Was die Brückenechse
(Hatteria) in der Zoologie, das ist der Gingko in der Botanik —
ein höchst interessantes lebendes Fossil!
Wie die Brückenechse eine Brücke zwischen den Alt- und Neuechsen
bildet, so führt der altertümliche Gingko ganz unmerklich von[S. 589] den
altmodischen Nadelhölzern hinüber zu den Laubbäumen, als deren
ersten Vertreter wir die Buche (Fagus) besprechen wollen.
Von der gemeinen oder Rotbuche (Fagus silvatica)
werden in den Gartenanlagen mehrere Varietäten kultiviert, unter denen
die Blutbuche (var. purpurea) mit dunkelbraunroten
Blättern die bekannteste ist und prächtige Kontraste hervorbringt.
Von besonderem Interesse ist der bei der Blutbuche zuerst gelungene
Nachweis, daß eine solche zufällig entstandene Bildungsabweichung,
wie das rote Laub, eine samenbeständige, vererbliche Eigenschaft
sein kann. Als Heckenpflanze wertvoll ist die Weißbuche
(Carpinus betulus), die auch auf schlechtem Boden und im
Schatten gedeiht. Durch ihre große Ausschlagsfähigkeit ist sie wie
geschaffen für regelmäßiges Beschneiden und schützt ihre Umgebung im
Winter gegen Wind und Schnee, indem ihr dürres Laub zum großen Teil
erst im Frühjahr abfällt. Neben ihr wird auch nicht selten die ihr sehr
ähnliche südeuropäische Hopfenbuche (Ostrya carpinifolia)
kultiviert, so genannt, weil die Fruchthüllen sackartig die Nüßchen
umschließen, so daß das Ganze an eine Hopfenfrucht erinnert.
Auch die Eiche (Quercus) ist ein beliebter Gartenbaum.
Außer den einheimischen Arten ist besonders die ungarische Eiche
(Q. hungarica) und die ebenfalls südeuropäische Zerreiche
(Q. cerris) wegen ihres schöngeformten Laubes beliebt. Durch
ihre prächtigrote Herbstfärbung sind einige bei uns eingeführte
nordamerikanische Arten ausgezeichnet, so vor allem die Roteiche
(Q. rubra) mit spitzgelappten Blättern, die in ihren Blättern
kaum mehr eine Verwandtschaft mit den Blattformen der einheimischen
Eichen aufweist.
Nicht selten trifft man als Parkbaum die Edelkastanie
(Castanea vesca), die bei uns keine Früchte mehr zeitigt.
Von weiteren Kätzchenblütlern ist der Nußbaum (Juglans
regia) zu nennen, der prächtige Kronen bildet; doch tritt sein
Zierwert gegenüber seiner Bedeutung als Fruchtbaum sehr zurück.
Dies trifft bei den nordamerikanischen Arten nicht zu, von denen
der Schwarznußbaum (J. nigra) schon 1629 in Europa
angepflanzt wurde. Seine sehr harten, schwarzen Nüsse stecken in einer
fast runden, gelblichgrünen Hülle. Sie sind sehr ölreich, werden aber
kaum je gegessen. Mehr in die Länge gezogene schwarze Nüsse besitzt
in klebrig behaarter grüner Schale die ebenfalls nordamerikanische
Graunuß (J. cinerea), die klimatisch noch härter als die
übrigen Nußarten ist, aber einen etwas geringeren Holzwert besitzt.
Wenig Verbreitung haben dagegen bei uns die Hickoryarten
gefunden,[S. 590] von denen die weiße Hickorynuß (Hicoria ovata)
noch die bekannteste ist; sie ist aber besonders in der Jugend sehr
frostempfindlich und gedeiht nur an sehr geschützten Standorten.
Mit der heimischen Haselnuß (Corylus avellana) wird
auch die stattliche türkische Haselnuß oder Baumhasel
(C. colurna) aus Kleinasien und die von ebendort stammende
Lambertsnuß (C. tubulosa), deren Früchte in der
röhrenförmigen Hülle fast verschwinden, in verschiedenen Zierformen
gezogen. Das bald schlitzblättrige, bald dunkelpurpurne Laub macht
die Hasel zum Schmuckstrauch, dem der große Vorzug zukommt, auch im
Schatten anderer Bäume als Unterholz prächtig zu gedeihen.
Von weiteren Kätzchenblütlern sind die Erlen und Birken
zu nennen. Den ersteren kommt, abgesehen von einigen Formen der
Rot- oder Schwarzerle (Alnus glutinosa), für Park
und Garten nur eine untergeordnete Bedeutung zu. Die Birken dagegen,
vor allem die durch ihren prächtigen, weißen Stamm und ihre zierlichen,
herabhängenden Zweige ausgezeichnete Weißbirke (Betula
verrucosa), die nicht nur ihrer hübschen Erscheinung wegen,
sondern auch weil sie sehr genügsam und raschwüchsig ist, verdienen
die weiteste Verbreitung auch in kleineren Hausgärten. Von fremden
Arten ragt durch ihre schöne Kronenbildung die nordamerikanische
Papierbirke (B. papyracea) hervor, aus deren leicht
ablösbarer Borkenhaut in ihrer Heimat eine Art Papier gemacht wird.
Ihr ähnlich ist die europäische Hänge- oder Trauerbirke
(B. pendula), die ebenfalls sehr hübsch ist und äußerst
dekorativ wirkt.
An Schnellwüchsigkeit werden die Birken von Weiden und
Pappeln übertroffen, die denn auch wichtige Gartenbäume liefern.
Von den mannigfachen Weidenarten ist die Weißweide (Salix
alba) häufig anzutreffen; auf den Friedhöfen dagegen hat sich die
Trauerweide (S. babylonica) als Sinnbild der Trauer
eingebürgert. Dieser 3–7 m hohe Baum mit überhängenden Ästen
und Zweigen stammt aus Japan und China und kam vor 200 Jahren nach
dem Orient und von da zu uns. Doch besitzen wir von ihm nur weibliche
Bäume, weil alle unsere Exemplare von einem und demselben weiblichen
Steckreise abstammen, das zu Beginn des 18. Jahrhunderts aus dem
Orient nach Europa gebracht wurde. Die Trauerweide wächst nicht in
Babylonien und ist nicht der Baum, unter welchem die Juden während
ihrer babylonischen Gefangenschaft ihre Harfen aufhingen und trauerten.
Dieser im 137. Psalm als garab bezeichnete Baum war vielmehr
eine[S. 591] Pappel (Populus euphratica). Berühmt ist die ebenfalls
weibliche Trauerweide, die das Grab Napoleons I. auf St. Helena
beschattete.
Ein prächtiger Zierbaum unserer Gärten ist die in Südeuropa und
Westasien heimische Silberpappel (Populus alba), die
wegen ihrer silberweißen, filzig behaarten Blätter so genannt wird.
Unangenehm kann sie nur dadurch werden, daß sie nach der Fruchtreife
die in weiße Flugwolle gehüllten Samen weithin verbreitet. Doch
läßt sich dieser Nachteil dadurch umgehen, daß man nur männliche
Exemplare derselben pflanzt. Ebenso schnellwüchsig ist die an feuchten
Waldrändern und Bachufern in ganz Europa heimische Schwarzpappel
(P. nigra), die ihre mächtigen Äste weithin ausstreckt,
während die an denselben Standorten wachsende Zitterpappel
oder Espe (P. tremula) nur ein zierlich feines Astwerk
entwickelt. Vielleicht ein Bastard dieser beiden ist die aus dem
Orient zu uns gekommene graue Pappel (P. canescens),
die ebenfalls als Zierbaum beliebt ist. Wahrscheinlich nur eine
besondere Wuchsform der Schwarzpappel ist die zur Zeit Napoleons
I. überall als Straßeneinfassung gepflanzte Pyramidenpappel
(P. pyramidalis), die nicht von den Ufern des Mississippi, wie
es in allen Lehrbüchern steht, sondern aus Persien zu Ende des 17.
Jahrhunderts zuerst in einem Exemplar nach Warschau kam. Zu Beginn des
18. Jahrhunderts gelangte der Baum nach Oberitalien. Um 1740 wurde
ein männliches Exemplar aus der Lombardei in den Garten nach Wörlitz
gebracht, von wo aus die Pyramidenpappel sich in weitere fürstliche
Anlagen Deutschlands verbreitete. Da alle andern Exemplare in
Mitteleuropa Ableger dieses einen Baumes sind, ist es kein Wunder, daß
sie ausnahmslos männlich sind und die Art infolge der ausschließlichen
Fortpflanzung durch Steckreiser schon bedeutend an Lebensenergie
eingebüßt hat. Dieser in Zentralasien heimische und in Nordindien
von alters her angepflanzte Baum wurde seit seiner Einführung in
Mitteleuropa vor etwa hundert Jahren überall den Flüssen und Straßen
entlang als volkstümlichster Alleebaum kultiviert, bis zu Ausgang des
19. Jahrhunderts der Wechsel der Mode seine Herrschaft brach. Daß er
an den Landstraßen Obst- und andern Bäumen weichen mußte, dazu trug
vor allem der Umstand bei, daß er außerordentlich flache, über
35 m weit streichende Wurzeln bildet, die die angrenzenden Felder
stark aussogen und nicht selten auch die Schotterdecken der Straßen
in Unordnung brachten. Außerdem erreicht er kein hohes Alter, wird
bald häßlich wipfeldürr und bot allerlei Ungeziefer Unterschlupf,
wahrscheinlich alles nur Folgen der Schwächung der Pflanze[S. 592] durch die
fortwährende vegetative Vermehrung. In ganz Deutschland kennt man nur
acht nachträglich eingeführte weibliche Pyramidenpappeln, die sich
zur Bildung von Samen zur Fortpflanzung auf geschlechtlichem Wege zur
Rassenaufbesserung eignen würden.
Von den verschiedenen fremden Pappelarten übertrifft die in mehreren
Formen eingeführte kanadische Pappel (P. canadensis)
an Raschwüchsigkeit alle einheimischen Holzarten. Sie ähnelt
außerordentlich der Schwarzpappel, hat nur zum Unterschiede von ihr
mehr in die Höhe strebende Äste und dreieckige, am Grunde gerade
abgeschnittene Blätter. Sie bildet eine längliche Krone, erreicht auf
gutem Boden schon in 30 Jahren eine Höhe von 30 m und wurde im
18. Jahrhundert aus Nordamerika nach Frankreich gebracht, von wo aus
sie sich schnell durch ganz Europa verbreitete. Da sie viel höheren
Holzertrag als die Schwarzpappel gewährt, hat sie letztere bei uns
stark zurückgedrängt. Schon wegen ihrer Raschwüchsigkeit ist sie für
Alleen und Parkanlagen sehr zu empfehlen.
Aus dem Orient kam die nach ihrer an die Weiden erinnernden
Blattform so genannte schmalblätterige Ölweide (Elaeagnus
angustifolia) zu uns. Dieser 3–6,5 m hohe Baumstrauch wird
seiner lanzettlichen, unterseits silberweißen Blätter wegen ziemlich
häufig in unsern Parkanlagen angepflanzt. Die unscheinbaren, inwendig
gelblichen, stark duftenden Blüten sind eine gute Bienenweide und
die süßlichen, mehligen Früchte können gegessen werden und werden
deshalb in Griechenland und Vorderasien gesammelt. Infolge ihrer
dekorativen Erscheinung sind auch die noch hellere nordamerikanische
Silberölweide (E. argentea) und die doldige Ölweide
(E. umbellata) aus Japan als Ziersträucher sehr beliebt. Das
gleiche ist mit den verwandten graublätterigen Shepherdien
(nach John Shepherd, der in den 1820er Jahren Inspektor des
botanischen Gartens zu Liverpool war, so genannt) der Fall. Es sind
dies Shepherdia canadensis und argentea, welche beide
aus Nordamerika stammen. In dieselbe Familie gehört auch der an
der Ost- und Nordsee und auf den Flußgebieten des Alpenvorlandes
heimische Sanddorn (Hippophaë rhamnoides), ein bis
3 m hoher, sparrig verästelter Strauch mit schmalen, unten
ebenfalls silberweißen Blättern und goldgelben, braunpunktierten,
beerenähnlichen Früchten, der undurchdringliche Hecken liefert und zur
Befestigung von Dünen und Dämmen benutzt wird. Das schöne Holz dient zu
Drechslerarbeiten, Blätter und Holz dienen zum Gelb- und Braunfärben.
Die sauer schmeckenden Beeren werden in nördlichen[S. 593] Ländern an
Fischbrühen gegessen, auch bereiten sich die Finnländer ein Mus daraus.
Aus Südeuropa kam der Bocksdorn oder dornige Jasmin
(Lycium europaeum) zu uns. Es ist dies ein bis 2,5 m
hoher Strauch mit überhängenden Zweigen, die wie beim Sanddorn in
Dornen auslaufen. Er hat nachtschattenartige, rotviolette Blüten, wie
der ihm ähnliche, ebenfalls im Mittelmeergebiet heimische gemeine
Bocksdorn (L. barbarum), nur daß seine Staubfäden nicht
wie bei diesem hervorragen. Beide werden als Ziersträucher zu Hecken
und niederen Wandverkleidungen verwendet und sind in manchen Gegenden
Deutschlands so sehr verwildert, daß es schwer fällt, sie dort nicht
für einheimisch zu halten. Ebenfalls ein Südeuropäer, der schon in
Südtirol wildwachsend angetroffen wird und überall in unsern Anlagen
gefunden wird, ist der Judasbaum (Cercis siliquastrum)
— so geheißen, weil sich der Sage nach der Verräter Judas, genannt
Ischariot, d. h. Mann von Kariot, daran gehängt haben soll —
dessen schlanke Zweige sich im Mai mit den büscheligen, rosaroten,
wohlriechenden Schmetterlingsblüten schmücken, kurz nachdem sich die
einfachen, rundlichen Blätter entfaltet haben. Die 10–16 cm
langen, braunen Hülsenfrüchte, die man auch als falsches Johannisbrot
bezeichnet, bleiben bis tief in den Winter hinein an den Zweigen
hängen. Sie werden nicht gegessen, wohl aber die angenehm scharf
schmeckenden Blüten, die man gerne als Würze verwendet. Der Baum ist im
Morgenlande sehr gemein.
Nahe mit ihm verwandt ist die dreidornige Gleditschie
(Gleditschia triacanthos) — nach dem 1714 zu Leipzig
geborenen und 1786 zu Berlin als Aufseher des botanischen Gartens
gestorbenen Joh. Theodor Gleditsch so genannt — ein in unseren
Anlagen kultivierter, 9–12 m hoher Baum mit paarig gefiederten
Blättern und kleinen, grünlichen, in kurzen Ähren stehenden Blüten.
Sie ist stark bedornt, indem sich regelmäßig oberhalb der Blattachseln
besondere Nebensprossen in Form brauner Dornen mit zwei Nebendornen
bilden. Bei manchen Bäumen sind Äste und Stamm förmlich mit solchen
gespickt, während neben ihnen eine Form ohne alle Dornenbildung als für
den Garten angenehmer gezogen wird. Aus dessen scharfbewehrten Zweigen
soll die Dornenkrone Christi bestanden haben, weswegen der Baum auch
Christusdorn genannt wird. Doch ist der Baum in Nordamerika zu Hause
und kam erst im 18. Jahrhundert in die Alte Welt. Da er rasch wächst
und nur geringe Ansprüche an den Boden stellt, findet er neuerdings
vielfach auch als Straßenbaum Ver[S. 594]wendung. Daneben wird eine Form mit
hängenden Zweigen in unseren Anlagen kultiviert. Das süßliche Mark der
großen, braunen, leicht gedrehten, flachen Hülsen dient der Jugend als
Leckerbissen, während man es in Nordamerika als Arzneimittel verwendet
und einen süßen Met daraus bereitet.
Seltener trifft man den ebenfalls nordamerikanischen, 6–10 m
hohen, Schusserbaum (Gymnocladus canadensis), dessen
Samen so rund sind, daß sie mit den Schussen oder Gluckern, den
kleinen Spielkugeln, der Kinder verwechselt werden können. Er besitzt
doppeltgefiederte Blätter und blüht in weißen Trauben. Die Rinde dient
in seiner Heimat zum Waschen, da sie Seifenstoff enthält, und aus den
Samen bereitet man in Kentucky ein Kaffeesurrogat.
Ebenfalls bei uns als Gartenzierbaum, auch in einer Form mit hängenden
Ästen, wird die ostasiatische Sophora japonica gepflanzt. Es
ist dies ein der gemeinen Robinie ähnlicher Baum Chinas und Japans mit
einfachen Fiederblättern, licht gelbgrünen Schmetterlingsblüten, aus
denen in seiner Heimat eine gelbe Farbe zum Färben gewonnen wird, und
perlschnurartigen Hülsen, die ihm den deutschen Namen Schnurbaum
verschafften. Nahe verwandt mit ihm ist die ebenfalls als Zierbaum
unserer Anlagen gezogene gelbe Vergilie (Cladrastis
lutea) — nach dem römischen Dichter Publius Vergilius Maro so
genannt — aus Nordamerika mit unpaarig gefiederten Blättern und in
Trauben stehenden gelben Blüten.
Überall bei uns wegen des schnellen Wachstums und der jasminähnlich
riechenden, honigreichen, weißen Schmetterlingsblüten in langgestielten
Trauben als Zierpflanze in Anlagen, aber auch als Nutzbaum auf
Eisenbahndämmen und Schutthalden, die sie mit seinem ausgedehnten
Wurzelsystem festzuhalten vermag, wird die gemeine Robinie
oder falsche Akazie (Robinia pseudacacia) gezogen. Sie
erhielt ihren Namen vom Gärtner Heinrichs IV. und dessen Nachfolgers
Ludwig XIII., Jean Robin, der diesen Baum im Jahre 1600 aus Virginien
nach Frankreich brachte. Ein später, 1635, von seinem Sohne Vespasian
Robin gepflanztes Exemplar steht jetzt noch im botanischen Garten
in Paris in voller Kraft. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts kam dieser
nordamerikanische Fremdling nach Deutschland, wo sich besonders
Friedrich der Große (regierte von 1740–1786) für seine Verbreitung
verwendete. Doch erfüllte er nicht die auf ihn als Nutzbaum gesetzte
Hoffnung, obschon sein gelbliches, oft rötlich geadertes, ziemlich
hartes Holz zähe, sehr widerstandsfähig und leicht polierbar ist und
zu feinen[S. 595] Tischler- und Drechslerarbeiten dient. Zudem ist der bis
25 m hohe Baum sehr genügsam, wenig empfindlich und zur Befestigung
von Dämmen und Flußufern sehr geeignet. Das Holz liefert eine ebenso
schöne gelbe Farbe als das Quercitronholz, die Rinde dient zum Gerben,
die durch je ein scharfes Dornenpaar in den Achseln geschützten Blätter
kann man als Viehfutter verwenden und die Samen geben ein fettes Öl.
Unter den verschiedenen, durch Kultur entstandenen Spielarten des vom
Volke auch als „Silberregen“ bezeichneten Baumes ist die unbewehrte
Robinie (R. inermis) mit fast glatten Ästen und die
Kugelrobinie (R. umbraculifera) mit kurzen, unter der
Blättermasse zusammengedrängten Zweigen hervorzuheben. Der falsche Name
Akazie hat sich so sehr für diese Baumart eingebürgert, daß sie
meist unter diesem bekannt ist. Und doch hat sie mit den echten Akazien
fast keine Ähnlichkeit. Diese in warmen Gegenden lebenden artenreichen
Bäume, die u. a. den arabischen Gummi und den Katechu liefern, kommen
bei uns im Freien nicht fort, werden aber im Gewächshaus und als
Zimmerpflanzen in manchen Arten gezogen. Im Vorfrühling werden die
mit goldgelben, kugeligen Blüten geschmückten Zweige verschiedener
australischer Akazienarten in Menge von der Riviera bei uns eingeführt,
aber — um den Wirrwarr noch größer zu machen — als „Mimosen“
verkauft. Die richtige Mimose oder Sinnpflanze (Mimosa
pudica) ist ein in Brasilien heimischer Schmetterlingsblütler,
dessen zarte, gefiederte Blättchen so überaus empfindlich sind, daß sie
bei der geringsten Berührung zusammenklappen, wobei die Blattstiele
sich senken. Es ist dies also eine Stellung, die sie bei den ersten
sie treffenden Regentropfen und im Schlafe zum Schutz gegen den Tau
einnehmen. Erst wenn die Pflanze sich völlig beruhigt hat, richten
sich die Blattstiele wieder auf und legen sich die Fiederblättchen
auseinander. Diese zierliche, krautartige Pflanze ist in vielen
Gegenden der Tropen, so namentlich in Ostindien verwildert und zu einem
förmlichen Unkraut geworden, dessen man sich kaum mehr zu erwehren
vermag.
Unter den echten Akazien ist die wahrscheinlich aus Westindien
stammende, jetzt in den wärmeren Gegenden aller Weltteile gepflanzte
Acacia farnesiana zu nennen, die bei uns als Topfpflanze
kultiviert wird, in Südeuropa jedoch im Freien gedeiht und häufig
in den Gärten Italiens, Griechenlands und Spaniens anzutreffen ist.
Dieser dornige Strauch mit doppeltgefiederten Blättern und gelben,
langgestielten Blütenköpfchen wird wegen des köstlichen veilchenartigen
Duftes der letzteren auch in Südfrankreich und an der Riviera gezogen,
um die fälschlich[S. 596] als Kassienblüten bezeichneten Blüten in der
Bukettbinderei und Parfümerie zu benutzen. Ihren Namen hat sie davon,
daß sie in Europa zuerst im Garten der Villa Farnese in Rom angepflanzt
wurde.
Wie bei der Mimose sind übrigens auch bei der gemeinen Robinie die
Blätter in gewisser Beziehung reizbar. Ihre gewöhnlich, um das Licht
möglichst auszunutzen, flach ausgebreiteten Fiederblättchen stellen
sich bei zu starker Beleuchtung senkrecht, mit der Kante gegen das
Licht, so daß die Verdunstung in denselben herabgesetzt wird. Bei
kühler Witterung und abends, wenn die Sonne untergegangen ist, senken
sie sich nach unten und legen sich gewißermaßen, um sich gegenseitig
zu erwärmen, leicht gegeneinander. Steigt bei andauernder Hitze
der Wasserverbrauch in bedrohlichem Maße, so wirft der Baum, wie
übrigens noch verschiedene andere Pflanzen unter solchen Umständen zur
Verringerung der Transpirationsfläche, einen Teil seiner Blätter ab.
Gleich ihr kamen ebenfalls aus Nordamerika, und zwar Südkarolina, die
bis 25 m hohe klebrige Robinie (R. viscosa) mit
klebrigen Drüsenhaaren an Zweigen und Hülsen und rötlichen Blüten, und
die borstige Robinie (R. hispida), deren Äste und Zweige
dicht mit braunen Stachelborsten überzogen sind, mit größeren rosaroten
Blüten, zu uns.
Wichtiger noch als die Robinien sind für unsere Gärten der
Goldregen (Cytisus laburnum), ein mitunter baumartig
werdender Strauch, der in Südfrankreich und längs des Südfußes der
Alpen bis nach Ungarn wild wächst. Er ist unstreitig einer unserer
schönsten Blütensträucher und wird deshalb allgemein in den Gärten
und öffentlichen Anlagen angepflanzt, obschon er in fast allen
Teilen, namentlich aber in den kugeligen schwarzen Samen ein Cytisin
genanntes, Erbrechen erregendes und stark die Gedärme reizendes,
abführendes Alkaloid enthält, das in großen Dosen selbst den Tod
herbeiführen kann. Deshalb sollten Kinder unbedingt auf die Giftigkeit
des Strauches aufmerksam gemacht werden. Die geruchlosen, goldgelben,
hängenden Blütentrauben gleichen in der Form denjenigen der gemeinen
Robinie, dagegen sind die Blätter nicht gefiedert, sondern kleeartig
dreigeteilt. Das dunkelbraun bis schwarz gefärbte Kernholz wird an
Stelle von Ebenholz verwendet und deshalb falsches Ebenholz genannt.
In Norditalien, Kärnten und Kroatien wächst der purpurne
Goldregen (Cytisus purpureus) als ein niedriger Strauch
mit meist unbehaarten Blättern und seitenständigen roten Blüten. Auch
er wird als Zierstrauch kultiviert und ist, besonders auf den Stamm
des eigent[S. 597]lichen Goldregens gepfropft, ein schöner Kronbaum. An
einem solchen Pfropflinge fand der Pflanzenzüchter Adam in Vitry bei
Paris an der Verwachsungsstelle beider einen Trieb, der ein richtiger
vegetativer Bastard war und ohne ein Produkt geschlechtlicher Kreuzung
zu sein, in allen seinen Merkmalen die Mitte zwischen seinen Eltern
hielt. Das Entstehen solcher Pfropfbastarde ist eine sehr seltene
Erscheinung und verdient deshalb hier genannt zu werden.
Wie der Goldregen sind verschiedene seiner Verwandten, so die süd- und
mitteleuropäischen Geißklee- und Ginsterarten, in den
Garten geholt worden. Der Geißklee- oder Bohnenstrauch
(C. arboreus) wurde in seiner Heimat am Mittelmeer seiner
dreizähligen, kleeähnlichen, ein treffliches Futter für Ziegen, Schafe
und Rinder bildenden Blätter wegen schon im Altertum kultiviert. Nach
den römischen Autoren sollte er besonders auf die Milchabsonderung
günstig wirken, so daß selbst säugende menschliche Mütter gerne
eine Abkochung seiner Blätter mit Wein vermischt zur Förderung der
Milchabsonderung genossen. Der Ackerbauschriftsteller Columella und
der gelehrte Naturkundige Plinius um die Mitte des 1. Jahrhunderts
n. Chr. verwundern sich beide darüber, weshalb diese für die Viehzucht so
nützliche Futterpflanze nicht noch häufiger in Italien gepflanzt werde.
Acht Monate lang liefere der Baum den Tieren grünes Futter und den Rest
des Jahres noch gute Nahrung in getrockneter Gestalt. Nicht bloß dem
eigentlichen Vieh, auch den Hühnern sei er zuträglich und seine Blüten
bildeten eine treffliche Bienenweide. Dabei mache seine Kultur nur
geringe Kosten, da er sich mit dem magersten Boden begnüge und lange
Trockenzeiten ertrage. Man köpfte ihn und zog ihn niedrig, benutzte
also vorzugsweise den immer erneuten Stockausschlag. In der modernen
Landwirtschaft der Mittelmeerländer bildet der Strauch keine Rolle
mehr, ist aber wie der dieselben Landstriche Südeuropas bewohnende
kopfblütige Bohnenstrauch (Cytisus capitatus) eine
geschätzte Zierde unserer Gärten geworden.
Ein vereinzelt schon in Süddeutschland wildwachsender
Schmetterlingsblütler ist der nicht sowohl durch seine wenig
zahlreichen braungelben Blüten, als vielmehr durch seine an
Fischblasen erinnernden häutigen Hülsen auffallende, 3–5 m
hohe gemeine Blasenstrauch (Colutea arborescens).
Die Hülse, an deren Innenwand die Samen hängen, wird nämlich durch
die von der Pflanze ausgeschiedene sauerstoffreiche Luft zu einer
Blase prall aufgetrieben, die nach der Reife vom Wind entführt wird,
bis sie, allmählich zerreißend, die Samen[S. 598] entläßt und so für die
Ausbreitung der Art sorgt. Die Knaben pflegen sie mit starkem Knall zu
zerdrücken. Die jungen Triebe färben gelb, die Blätter führen wie die
Sennesblätter ab und dienen deshalb auch zu deren Verfälschung. Als
Gartenzierstrauch kam aus Vorderasien der etwas kleinere, nur
1,5–3 m hohe blutrote Blasenstrauch mit Trauben schmutzig
blutroter Blüten und an der Spitze klaffenden Fruchtblasen zu uns,
während der verwandte, 2–3 m hohe silberweiße Salzstrauch
(Halimodendron argenteum) mit seidenhaarigen Fiederblättern
und schönen, fleischroten bis lilafarbenen Blüten wegen der letzteren
aus den Salzsteppen am Irtisch in Westsibirien in unseren Anlagen
angesiedelt wurde. Ebenso kamen aus Sibirien der strauchartige
und der baumartige Erbsenbaum (Caragana frutescens und
arborescens) zu uns. Der erstere wird bis 2 m, der
letztere bis 5 m hoch. Beide haben gelbe Blüten und werden, weil
anspruchslos, häufig gepflanzt und besonders zu Hecken verwendet. Aus
den Blättern kann man eine blaue Farbe gewinnen, und die erbsenartigen
Samen sind als Geflügelfutter verwendbar. Von ihnen gibt es auch eine
hängende und eine buntblätterige Varietät.
Ab und zu trifft man in Ziergärten auch noch andere
schmetterlingsblütige Sträucher, doch hat sich keiner derselben auch
nur annähernd eine solche Beliebtheit erworben, wie der über 7 m
lange Schlingstrauch Chinas, die unter dem Namen Glycine
bekannte Wistaria chinensis, die jetzt den Namen Kraunhia
floribunda führt. An nach Süden gerichteten, einigermaßen
geschützten Wänden hält sie sogar den norddeutschen Winter im Freien
aus und schmückt im Frühjahr die von ihr bekleideten Hausfassaden
und Lauben mit der Pracht ihrer blaßvioletten, duftenden Blüten.
Von dieser, kletternde Sträucher umfassenden Leguminosengattung mit
unpaarig gefiederten Blättern und ziemlich langgestielten blauen,
selten weißen Blüten in endständigen nickenden oder hängenden, lockeren
Trauben und langen, gestielten Hülsen gibt es vier Arten in China,
Japan und dem östlichen Nordamerika. Die bei uns meist gepflanzte
chinesische Glycine stammt aus der Mongolei und China, wurde dort und
dann besonders in Japan viel zur Zierde kultiviert und kam von dort
zu uns. Sie besitzt in der Jugend seidenartig behaarte Blätter und
klettert bis 30 m hoch. Kraunhia frutescens aus Virginia,
Illinois und Louisiana ist in allen Teilen kleiner als die vorige,
blüht später und besitzt wohlriechende Blüten. Sie ist empfindlicher
gegen Kälte als vorige Art und wird in mehreren Varietäten kultiviert.
Eine Varietät, Kr. magnifica, blüht[S. 599] noch reicher als die
Stammart und hat bläulichviolette Blüten mit gelbem Fleck.
Früher sehr beliebte kletternde Sträucher mit meist matt gefärbten,
aber in der Abenddämmerung weithin einen herrlichen Duft aushauchenden
Blüten sind die Loniceren aus der Gattung der Geißblattgewächse.
Von den über 100 Arten sind fast alle auf der Nordhalbkugel heimisch,
und zwar am zahlreichsten im östlichen Asien und im Gebiet des
Himalaja. Das gemeine oder nördliche Geißblatt (Lonicera
periclymenum) ist ein Schlingstrauch Südeuropas, Westasiens und
Nordafrikas mit meist außen roten, innen gelben Blüten und roten
Beeren. Es ist in Blattform und Blütenfarbe sehr veränderlich und
wird in Gärten zum Überziehen von Lauben und Wänden usw. benutzt.
In Südeuropa bis zum Kaukasus wächst das südliche Geißblatt
(L. caprifolium) mit in der Farbe wechselnden, 5 cm
langen Blüten. Auch das nordamerikanische immergrüne Geißblatt (L.
sempervirens) mit glänzend dunkelgrünen Blättern und prachtvoll
scharlachroten Blüten mit sehr langer Röhre wird häufig bei uns
kultiviert. Lonicera brachypoda aus Japan wird besonders in der
Abart mit goldgelb geaderten Blättern zum Beziehen kleiner Beete und
Gitter, auch als Ampelpflanze gezogen.
Die nichtwindenden Geißblattarten bezeichnet man gewöhnlich als
Heckenkirschen, weil die paarig verwachsenden roten Früchte
einigermaßen an Kirschen erinnern. Unter ihnen werden als Ziersträucher
kultiviert: die bis 2,5 m hohe gemeine Heckenkirsche
oder Beinweide (Lonicera xylosteum), mit eirunden,
behaarten, besonders auf der Unterseite graugrünen Blättern,
weißen, sich später gelb färbenden Blüten und roten Beeren, dann
die tatarische Heckenkirsche (L. tatarica), ein
2,5–3 m hoher buschiger Strauch mit unbehaarten, hellgrünen Blättern,
schönen rosenroten Blüten und roten Beeren aus Mittel- und Südrußland
und Sibirien, ferner L. nigra mit rötlichweißen Blüten und
schwarzen Beeren, und L. alpigena mit purpurnen Blüten und roten
Beeren, beide aus den Gebirgen Mitteleuropas. Auch die kanadische
Heckenkirsche (L. canadensis) und die durch große,
schönfarbige Blüten ausgezeichnete L. ledebouri findet man nicht
selten in Ziergärten kultiviert. Doch ist die Anpflanzung von Loniceren
in der Nähe von Obstgärten nicht ratsam, weil in ihren Früchten die
Larve der Kirschfliege lebt. Von der gemeinen Heckenkirsche wird das
knochenharte Holz (Beinholz) zu Peitschenstöcken, Pfeifenröhren, früher
auch zu Ladestöcken und Stricknadeln verarbeitet.
[S. 600]
Eine nahe Verwandte der Geißblattarten ist die als Zierstrauch
häufig angepflanzte, 1 m hohe Diervillea canadensis
mit eiförmigen, zugespitzten, gesägten Blättern und traubigen,
gelben, im Juni hervorbrechenden Blüten. Sie hat ihren Namen davon,
daß sie der französische Arzt Dierville, ein Freund des Botanikers
Tournefort, diesem 1708 von Kanada aus nach Paris sandte. Vom April
und Mai an bis in den August blühen dagegen die bis 1,3 m
hohen Weigelien, deren rotblühende Formen meist auf die
nordchinesische Weigelie (Diervillea florida) zurückzuführen
sind. Die nach dem Greifswalder Botanikprofessor Chr. Ehrenfried Weigel
(1748–1831) genannten Sträucher haben längliche Blätter und meist
rosarote, angenehm duftende, kelchförmige Blüten, derentwegen sie bei
uns eingeführt wurde und häufig in Gärten anzutreffen ist.
Verwandt mit ihnen ist die Schneebeere (Symphoricarpus
racemosus) ein allgemein bekannter nordamerikanischer Zierstrauch
von 1,5 m Höhe, mit unscheinbaren, fleischroten Blüten und
kirschgroßen, weißen Beeren, welche in dichten Knäueln den ganzen
Winter über an den Zweigen stehen bleiben. Da die eiförmigen Blätter
viel Schatten ertragen und der Strauch sehr leicht gedeiht, wird er
häufig zur Ausfüllung von Lücken und dunkeln Ecken verwendet.
Eine ähnliche Genügsamkeit in bezug auf Licht und Boden zeigt der
ebenso häufig angepflanzte einheimische schwarze Holunder
(Sambucus nigra), der mit dem ihm nahe verwandten
gemeinen Schneeball (Viburnum opulus) und dem
wolligen Schneeball (V. lantana) als Zierstrauch in
unsere Gärten wanderte. Ebenso ist der in den Mittelmeerländern
heimische Laurus tinus, der Gärtner- oder
Bastardlorbeer (V. tinus) bei uns als Topfpflanze
allgemein beliebt. Während bei der wilden Form des Schneeballs nur der
äußerste Kranz der Blütendolde aus sterilen Schaublüten zur Anlockung
der Insekten besteht, wird bei ihrer Kulturform die ganze Blütendolde
aus geschlechtslosen, blassen Schaublüten gebildet, so daß der
Blütenstand sich schneeballähnlich präsentiert, was dem Strauche den
Namen gab. Die roten oder schwarzen Beeren dieser Sträucher sind eine
beliebte Speise der Vögel, die für die Verbreitung der Art sorgen.
Aus Ostasien und Nordamerika kamen die Pfeifensträucher
(Philadelphus) zu uns. Von diesen ist der im 16. Jahrhundert aus
China und Japan bei uns eingeführte wohlriechende Pfeifenstrauch
oder wilde Jasmin (Ph. coronarius) mit starkriechenden,
teils einfachen, teils gefüllten weißen Blüten in Büscheln, die am
häufigsten[S. 601] angetroffene Art. Auch Ph. satsumi ist verbreitet,
doch sind diese ostasiatischen Arten in neuerer Zeit mehr durch
nordamerikanische Arten, wie Ph. latifolius pubescens und
gordonianus verdrängt worden. Den Namen Pfeifenstrauch
führen sie von den schlanken, geraden Schößlingen, aus denen man
durch Entfernung des Markes Pfeifenröhren macht. Wegen des starken
Blütendufts wird der wohlriechende Pfeifenstrauch teilweise auch zur
Parfümgewinnung angepflanzt.
Nahe verwandt mit ihnen sind die nach dem Amsterdamer Ratsherrn
Johann Deutz, der botanische Forschungsreisen förderte, genannten
Deutzien mit ähnlichen, nur etwas kleineren und geruchlosen
Blüten. Diese Ziersträucher sind japanischen Ursprungs und gehören zu
den dankbarsten Sommerblühern unserer Gärten. Durch Kreuzung sind aus
ihnen verschiedene Gartenformen, meist mit gefüllten Blüten, gezogen
worden. Die gewöhnlichste ist die 1–2 m hohe gekerbte
Deutzie (D. crenata), deren rauhe Blätter zum Polieren
dienen, und die häufig als frühblühende Topfpflanze gezogene, kleinere
zierliche Deutzie (D. gracilis), die schon im Mai über
und über mit aufrecht gestellten weißen Blütentrauben bedeckt ist.
Noch frühere Blüher sind die ihnen verwandtschaftlich nahestehenden
Johannisbeeren (Ribes), unter denen zwei
nordamerikanische Formen als Ziersträucher die bescheideneren
einheimischen Arten verdrängten. Es sind dies die blutrot und goldgelb
blühende Johannisbeere (R. sanguineum und aureum).
Von ersterer, die 1787 vom schottischen Botaniker Menzies an der
amerikanischen Nordwestküste entdeckt wurde, aber erst 1826 in
Gärten Europas Aufnahme fand, hängen die schon im April noch vor der
Entwicklung der Blätter hervorbrechenden purpurroten Blütentrauben,
während die goldgelben geruchlosen oder wohlriechenden Blütentrauben
der letzteren, die 1806 westlich vom Felsengebirge in Nordamerika
entdeckt und 1812 in unsere Gärten verpflanzt wurde, mehr aufrecht
gestellt sind. Sie hat insofern große Bedeutung erlangt, als sie
die Pfropfunterlage für die hochstämmig gezogenen Stachel- und
Johannisbeersträucher liefert. Beide Arten haben durch Kreuzung einen
interessanten Bastard hervorgebracht.
Einen ähnlichen traubigen Blüten- beziehungsweise Fruchtstand wie die
Johannisbeeren haben die Sauerdornarten (Berberis).
Vom gemeinen Sauerdorn (B. vulgaris) gibt es mehrere
Gartenformen, die sich teilweise durch weißbuntes oder dunkelrotes
Laubwerk auszeichnen. Da aber unser Sauerdorn auf seinen Blättern
die Zwischen[S. 602]form eines gefürchteten Getreiderostpilzes beherbergt,
vermeidet man, ihn in der Nachbarschaft von Getreidefeldern
anzupflanzen. Daher trifft man an seiner Stelle vielfach ausländische,
teilweise immergrüne Arten.
Glänzende, dunkle, immergrüne Blätter haben auch die nach dem
amerikanischen Botaniker Bernhard Mac Mahon genannten, aus
Nordamerika in unsere Gärten gelangten Mahonien, von denen
M. aquifolium mit der Stechpalme ähnlichen Blättern, gelben
Blüten und schwarzpurpurnen, blaubereiften Beeren die verbreitetste
ist. Ebenso häufig begegnen wir dem ebenfalls aus Nordamerika zu uns
gekommenen Gewürzstrauch Calycanthus floridus, einer
2–2,5 m hohen Gartenzierpflanze mit braunroten, besonders beim
Welken starkriechenden Blüten, aus denen bei uns nur selten Früchte
hervorgehen. Aus Ostasien bezogen wir den seltener zu findenden
Calycanthus occidentalis.
Diese auch in Wurzel und Rinde aromatisch-kampferartig duftenden
Sträucher sind die nächsten Verwandten der Lorbeergewächse,
unter denen der 5–6,5 m hohe, immergrüne edle Lorbeer
(Laurus nobilis) seines schönen Laubes wegen als Kalthauspflanze
nicht selten gezogen wird. Dieser in Südeuropa häufig kultivierte
Baumstrauch ist in den Mittelmeerländern heimisch und wurde nicht erst
in geschichtlicher Zeit aus Vorderasien hierher verpflanzt, wie V.
Hehn irrtümlicherweise annahm. Seine ästige Krone trägt glänzendgrüne,
lederartige Blätter, gelblichweiße Blüten und bläulichschwarze,
eiförmige, einsamige Früchte. Letztere schmecken aromatisch bitter und
werden in der Volksmedizin zur Stärkung des Magens, als Räuchermittel
und in der Veterinärpraxis verwendet. Durch Auskochen und Pressen
gewinnt man aus ihnen das grüne, stark gewürzhaft riechende, bei
gewöhnlicher Temperatur schmalzartige Lorbeeröl, das man zum Salben
bei Entzündung und zum Vertreiben der Fliegen benutzt. Ebenso
werden die gewürzhaft riechenden und schmeckenden Blätter seit dem
höchsten Altertum arzneilich verwendet, dienen gegenwärtig aber
nur als Küchengewürz, zu Essigen und Likören und zum Verpacken von
Lakritzenstangen. Sie kommen aus Italien, Frankreich und Spanien in den
Handel. In den Mittelmeerländern wird der Lorbeer vielfach kultiviert
und findet sich als Zierpflanze auch bei uns, muß aber im Kalthaus
überwintert werden.
Wegen des scharfaromatischen Geruchs seiner Blätter und Früchte wurde
er frühe schon als eine mit besonderen Kräften begabte Pflanze[S. 603]
angesehen. Der Duft seiner Zweige sollte vor ansteckenden Krankheiten
und Verzauberung schützen. So suchte, wie berichtet wird, der
furchtsame Kaiser Commodus, der von 180 bis 192 n. Chr. regierte
und schließlich am 31. Dezember jenes Jahres auf Anstiften seiner
Geliebten Marcia erdrosselt wurde, in einem Lorbeerhaine Rettung, wenn
die Pest im Anzuge war. Kränze von Lorbeer legte man Wahnsinnigen um
Schläfe und Hals, in der Annahme, sie dadurch besänftigen zu können.
Lorbeerfrüchte und -Blätter genossen die Priester, wenn sie weissagen
sollten, und Lorbeerzweige trugen die Propheten, wenn sie eine Stadt
betraten. Der Lorbeer sühnte das vergossene Blut; deshalb reinigten
die römischen Legionen gleich nach dem Siege sich, ihre Waffen und
Feldzeichen mit Lorbeer. Dadurch wurde der Lorbeerzweig zur Trophäe,
zum Symbol des Sieges und zum Verkünder der glücklich vollbrachten
Waffentat. Der Lorbeerkranz schmückte die Stirne der siegenden Helden
und mit ihm wurden die Fasces, d. h. das zum Auspeitschen dienende
Rutenbündel der ihn begleitenden Lictoren oder öffentlichen Diener der
mit der Macht des Imperiums bekleideten höchsten Magistrate umwunden.
Lorbeergeschmückt (laureatus vom lat. laurea Lorbeer)
folgten die Soldaten dem Wagen des triumphierenden Feldherrn bei
seinem Einzuge in Rom, um gleichsam von Mord und Totschlag gereinigt
in die Stadt einzuziehen. Später erklärte man, die Ursache, weshalb
der Triumphierende sich mit Lorbeer schmücke, liege darin, daß der
Lorbeer seinen Namen vom lateinischen laus Ruhm habe und einst
laudus hieß, was natürlich unrichtig ist.
Von der römischen Zeit an blieb der Lorbeer stets ein Abzeichen des
Ruhmes bis in unsere Tage, da junge Doktoren mit beerentragenden
Lorbeerzweigen geschmückt wurden, woher das Wort Baccalaureus sich
ableitet. Die reinigende Kraft des Lorbeers veranlaßte dessen
Verwendung zu Räucherungen wie auch zu Weihwedeln. Im Altertum
besprengte sich der Strenggläubige beim Eintritt wie beim Ausgang aus
dem Tempel mit dem Lorbeerzweig, der zuvor in Weihwasser getaucht
worden war; gern nahm er auch beim Herausgehen ein Lorbeerblatt vom
Sprengwedel in den Mund. Die römisch-katholische Kirche übernahm dann
allerdings diesen Gebrauch nicht aus dem römischen Heidentum, sondern
bevorzugte als Sprengwedel einen Strauß des dem Majoran verwandten
Lippenblütlers Ysop (Origanum smyrnaeum), eines im
östlichen Mittelmeergebiet häufig angetroffenen Halbstrauches, den
sie zu demselben Zwecke von den Juden übernahm. Sonst gilt[S. 604] bei
uns als Ysop ein anderer, durch reichen Gehalt an ätherischem Öl
aromatisch riechender halbstrauchartiger Lippenblütler (Hyssopus
officinalis) aus Südeuropa, der teils als Zierpflanze, teils als
Gewürzkraut häufig auch in Deutschland kultiviert wird und hin und
wieder an sonnigen Schutthalden, namentlich in der Umgebung alter
Burgen, verwildert angetroffen wird. Das Kraut wurde arzneilich
namentlich gegen Magenleiden verwendet, weshalb die Pflanze heute noch
besonders in Bauerngärten häufig angepflanzt gefunden wird.
Der von den Griechen dáphnē genannte Lorbeerbaum war, weil er
durch den Duft seiner Blätter Moder und Verwesung verscheuchen sollte,
dem Apollon geweiht, der aus einer Personifikation der die Seuche
sendenden und daher auch von dieser befreienden Sonnenglut allmählich
zum Gott der Sühne für sittliche Befleckung und Erkrankung geworden
war. Die Sage meldet, daß, als der Sohn Agamemnons, Orestes, um sich
vom Blut der von ihm mit ihrem Buhlen Ägisthos in Mykenä erschlagenen
Mutter Klytaimnestra zu sühnen, sich mit seinem Freunde Pylades auf
Apollons Geheiß nach Taurien begab, das Bild der Artemis zu holen,
und dort von seiner als Priesterin waltenden Schwester Iphigeneia
nach Landesbrauch mit seinem Freunde geopfert werden sollte, er
von ihr erkannt und gerettet wurde. An seiner Stelle sei dann ein
anderes Sühnopfer der Göttin dargebracht worden, und, als die Reste
desselben im Boden vergraben wurden, sei aus ihnen der Lorbeerbaum
hervorgesproßt. Apollon soll, als er nach der Erlegung des die Gegend
um Delphi am Fuße des Berges Parnaß hausenden Drachen Python selbst
der Sühne bedurfte, auf Befehl des Zeus sich im Tal Tempe gebadet,
sich mit Lorbeer bekränzt und auch einen Lorbeerzweig in seine Rechte
genommen haben und sei so nach Delphi gezogen, wo er das dortige
Orakel übernahm. In der Folge hat sich der Lorbeer mit dem Kult des
Apollon als diesem Gotte heilige Pflanze überallhin verbreitet, wo
jenem reinigenden, sühnenden Gotte Heiligtümer errichtet wurden. Bei
allen gottesdienstlichen Handlungen des Apollonkultes wurden Zweige
von ihm symbolisch verwendet, und er verlieh dem im Dienste des
Gottes stehenden Seher die Kraft, Verborgenes zu schauen und den um
ein Orakel Bittenden die Zukunft zu enthüllen. So ward der Lorbeer
auch das Abzeichen des im Dienste des Gottes zur Begleitung der Leier
seine Lieder singenden Sängers und, da der Gott der Anführer der neun
Musen war, auch aller mit diesen zusammenhängenden Künste. Und wie zur
Corona triumphalis geflochtene Lorbeerzweige die Stirne des[S. 605]
Siegers schmückten, so zierte der Lorbeerkranz auch den im Dienste der
Musen sich auszeichnenden Dichter oder Künstler.
Der Lorbeer brennt, nach Plinius, nur widerwillig und zeigt dies
durch sein Knistern an. Der feuerabwehrenden Kraft des Lorbeers wurde
es zugeschrieben, daß bei dem großen Brande Roms unter den Konsuln
Spurius Postumius und Piso, als die Regia in Flammen stand, das
Sacrarium, d. h. der Tempel des Apollo, unversehrt blieb, weil
ein Lorbeer vor ihm stand. Dann aber war es gerade das Lorbeerholz
wegen seiner Härte, das nach Theophrastos und demselben Plinius
als Quirl zum Erzeugen des Feuers durch Reiben diente, während als
Unterlage, auf der gerieben wurde, das weiche Holz des Efeus oder
des Wegdorns (Rhamnus) benutzt wurde. Ein reines Feuer zu den
Opfern der Griechen und Römer durfte nur der Reibung zweier wie dieser
glückbringender Hölzer entstammen, während man in späterer Zeit es
vorzog, das reine Feuer zum Gottesdienste mit Hilfe von Brenngläsern,
vielfach aus Bergkristall, oder von metallischen Hohlspiegeln zu
gewinnen. Der Lorbeer sollte auch die Blitze abwehren. Um vor
dieser Gefahr beschützt zu sein, bekränzte sich der abergläubische
Kaiser Tiberius, der Schwiegersohn und seit dem Jahre 4 n. Chr.
auch Adoptivsohn des Augustus, der nach dessen Tode im Jahre 14 zur
Herrschaft gelangte und bis zum Jahre 37 n. Chr. regierte, wie der
Geschichtschreiber Suetonius berichtet, mit Lorbeer, wenn ein Gewitter
am Himmel nahte. Solche Vorstellungen wurden durch die vielfach
gemachten Erfahrungen geweckt, daß nicht alle Bäume gleichmäßig vom
Blitze getroffen werden. Auch bei uns schlägt der Blitz fast niemals in
Walnußbäume und Buchen, am häufigsten aber in Eichen, welch letztere
deshalb von den alten Germanen dem Donnergotte geheiligt waren. Es
hängt dies mit der elektrischen Leitungsfähigkeit des Holzkörpers
zusammen, das bei den einzelnen Baumarten eine ganz verschiedene ist.
Ionesco hat auf Grund von genauen Untersuchungen festgestellt, daß
tatsächlich Bäume, die zur Jahreszeit der Gewitter verhältnismäßig
viel fettes Öl, wie auch der Lorbeer, in ihrem Holzkörper führen, dem
Blitzschlag am wenigsten ausgesetzt sind. Abgestorbene Äste an einem
Baume erhöhen für denselben die Blitzgefahr.
Wie der Lorbeer dem Apollon, so war die gemeine Myrte (Myrtus
communis) bei den Griechen als Symbol der Jugend und Schönheit
der Liebesgöttin Aphrodite geweiht und wurde um ihre Heiligtümer
herum angepflanzt und bei ihren Festen und den Eleusinien[S. 606] vielfach
als Schmuck getragen. Schon von den alten Persern wurde sie bei
gottesdienstlichen Handlungen benutzt und galt deshalb bei ihnen als
heilige Pflanze. Sie ist ein immergrüner, 2–4 m hoher Strauch
oder kleines Bäumchen mit lanzettförmigen, wohlriechenden Blättern,
weißen, seltener auch rötlichen oder gefüllten Blüten und schwarzen,
aromatischen Beeren, die früher, bevor man den Pfeffer kannte, als
Gewürz und Arznei dienten. Bei den Römern gab es einen mit diesen
Beeren bereiteten Leckerbissen, der myrtatum hieß; vielfach
wurde, wie Columella berichtet, damit gewürzter Wein getrunken. Die
Myrte ist im ganzen Mittelmeergebiet heimisch und wächst hier mit
Vorliebe auf sumpfigem Boden. Der griechischen Sage zufolge soll sie,
die von den Hellenen myrsínē genannt wurde, in Attika entstanden
sein. Hier liebte einst Aphrodite eine schöne und mutige Jungfrau,
und als diese starb, schuf die Göttin zu ihrem Andenken die Myrte.
Seither ist sie das Ehrenabzeichen jungfräulicher Bräute bei ihrem
Hochzeitsfeste, ein Brauch, der sich bis auf unsere Tage erhielt.
Schon im Altertum wurden auch Myrtenwunder mit der Aphrodite, wie im
Mittelalter Rosenwunder mit der Gottesmutter Maria in Zusammenhang
gebracht. So schreibt der um 200 n. Chr. in Alexandreia und Rom lebende
griechische Grammatiker Athenaios aus Naukratis in Ägypten in seinen
Deipnosophistai, in denen er uns wichtige Nachrichten über das
Leben und die Sitten der alten Griechen überlieferte: „In dem Buche des
aus Naukratis stammenden Polycharmos, das von der Aphrodite handelt,
habe ich über den sogenannten Naukratitenkranz Aufschluß erhalten.
Dort heißt es: In der 23. Olympiade (im 7. Jahrhundert v. Chr. um 686)
reiste Herostratos, Bürger von Naukratis, in die Fremde, kam weit
umher und kaufte zu Paphos auf Cypern ein Bild der Aphrodite, das eine
Spanne hoch und uralt war, um es mit nach Naukratis zu nehmen. Auf der
Rückreise, als das Schiff in die Nähe Ägyptens kam, trat plötzlich
ein solches Unwetter ein, daß man das Land nicht mehr sehen konnte,
und keiner von der Bemannung des Schiffes wußte, wo er war. In der
Not nahmen sie alle ihre Zuflucht zum kleinen Bilde der Aphrodite
und flehten um Rettung. Da ließ die Göttin plötzlich auf dem ganzen
Schiff Myrten emporwachsen, und das Schiff füllte sich mit Wohlgeruch,
während die Mannschaft eben noch in Verzweiflung gewesen war, an
Seekrankheit stark gelitten und entsetzlich gespieen hatte. Mit einem
Male hörte das Erbrechen auf, die Sonne zeigte sich wieder,[S. 607] und das
Schiff gelangte glücklich nach Naukratis. Dort sprang Herostratos mit
dem Bilde der Göttin und mit Zweigen von Myrten ans Land, opferte der
Aphrodite, berief seine Verwandten und Freunde in den Tempel selbst zum
Gastmahl, gab jedem Gaste einen Myrtenkranz und nannte einen solchen:
Naukratitenkranz.“ Der jonische Dichter Anakreon, der in Samos und
Athen lebte (550–478 v. Chr.), spricht von mit Rosen durchflochtenen
Myrtenkränzen, die man bereits zu seiner Zeit zu Ehren der Aphrodite
trug.
Wie der Lorbeerkranz bei den Römern als Sühne für einen blutigen
Sieg getragen wurde, so zogen in Rom mit dem Myrtenkranze geschmückt
diejenigen Feldherrn ein, denen statt eines Triumphes eine Ovation
zukam. Dies war der Fall, wenn der Sieg mit wenig Blutvergießen oder
über verächtliche Feinde, wie Sklaven und Seeräuber, erfochten wurde.
Als Marcus Crassus im Jahre 71 v. Chr. die unter Spartacus fechtenden
Sklaven, die durch zahlreiche Zuzüge, besonders aus Fechterschulen,
ein Heer von 120000 Mann zusammenbrachten, besiegt und die den Kampf
Überlebenden sämtlich gekreuzigt hatte, erlangte er als besondere
Gunst vom Senat die Erlaubnis, bei seiner Ovation einen Lorbeerkranz
statt des Myrtenkranzes zu tragen. Marcus Valerius dagegen trug
infolge eines Gelübdes bei seinem Triumph in Rom neben dem Lorbeer-
auch einen Myrtenkranz. Und zwar wurde wie zu Vermählungen, so auch zu
Ovationen die kleinblätterige, kultivierte Myrte verwendet, während
man die großblätterige als die gewöhnliche Form der wildwachsenden
Pflanze zu Kränzen und Girlanden für Verstorbene verwendete, weshalb
sie auch Totenmyrte hieß. Die erbsengroßen Beeren der kleinblätterigen
peruanischen Myrte sind zuckersüß und wohlschmeckend und werden
ebenso gegessen wie die schmackhaften Beeren der Lumamyrte
in Chile und Peru. Die Beeren und Blüten der zentralamerikanischen
Myrtus caryophyllus kommen als mexikanisches Piment in den
Handel.
Im Südwesten Mitteleuropas sind die Stechpalme (Ilex
aquifolium) und der Buchs (Buxus sempervirens) zu
Hause. Beide erreichen in Deutschland selten große Stärke. Der erstere
ist besonders im Winter, wenn die leuchtend roten Beeren reif sind,
ein so dekorativer Strauch, daß es sehr begreiflich ist, wenn er in
verschiedenen Spielarten in unseren Gärten gezogen wird. Letzterer
ist in einer stets beschnittenen Zwergform zur Einfassung der Wege in
Gärten sehr beliebt. In Südeuropa dagegen wächst der Buchs zu einem
6–8 m hohen Baum, dessen äußerst schweres, hartes Holz seit
der neolithischen[S. 608] Zeit zu Kämmen, Flöten, Kreiseln, Büchsen usw.
verarbeitet wurde. Unser Wort Büchse heißt: aus Buchsholz hergestellt.
Das deutsche Buchs kommt vom lateinischen buxus, das seinerseits
wieder vom griechischen pýxos sich ableitet. Pýxis hieß
bei den alten Griechen Büchse (aus Buchsbaum). Schon bei Homer wird
in der Ilias erzählt, daß das Joch der Maultiere des troischen Königs
Priamos aus Buchsholz (pýxinon zygón) hergestellt und mit
schönen Ringen geziert gewesen sei. Der römische Dichter Ovid (43 vor
bis 7 n. Chr.) spricht vom Triller der Buchsflöte und vom Buchskamme,
mit dem das Haar gekämmt werde, während Vergil (70–19 v. Chr.) vom
flott unter den Peitschenhieben herumtanzenden Kreisel aus Buchsholz
(volubile buxum) redet. Auch Claudianus spricht von der
Buchsflöte, die ein Sterbelied stöhne, wenn er sie blase, und Columella
sagt, daß bei der Käsebereitung der geronnene Käsestoff in eine Form
aus Buchsholz gespannt werde. Der ältere Plinius nennt das Buchsholz
als wegen seiner Härte hochgeschätzt, aber schlecht brennend und nur
geringwertige Kohlen gebend. Der auf den Pyrenäen häufig wachsende Baum
werde auf Korsika am dicksten, aber seine Blüten machen dort den Honig
bitter. Er sei in den Gärten veredelt worden, lasse sich zu dichten
Wänden ziehen und gut beschneiden. Martialis und Firmicus sprechen wie
der jüngere Plinius vom Buchsbaum, der in den römischen Gärten zu den
verschiedensten Gestalten, besonders von großen Tieren, beschnitten
wurde. Noch heute wird das harte Holz als das brauchbarste Material zu
Holzschnitten, zu Blasinstrumenten, wie Flöten und Klarinetten, wie
auch zu Dosen und Kämmen verarbeitet. Die Blätter wurden früher als
gelindes Abführmittel gebraucht.
Verwandt mit dem Buchs sind die Rauschbeeren (Empetrum),
von denen der nur 0,3–0,5 m hohe schwarze oder
Alpenrausch (E. nigrum) eins der vorzüglichsten
torfbildenden Gewächse ist und vielfach zur Einfassung von sogenannten
Moorbeeten in Gärten Verwendung findet. Dieser hochnordische Strauch
wächst als Relikt der Eiszeit auf Moor- und Torfboden Norddeutschlands
und der höheren Gebirge bis Grönland und steigt in den Alpen bis
2300 m Höhe. Den Namen hat er davon, daß die saftigen, aber sauer
schmeckenden Beeren im Übermaß genossen berauschen und Schwindel
erregen sollen. Von den Nordvölkern werden sie roh und als Mus gerne
gegessen und dienen auch zur Bereitung eines Getränks.
Von den Kreuzdornarten (Rhamnus) kam der immergrüne
Wegdorn (Rh. alaternus, mit letzterem Namen nennt ihn
der ältere[S. 609] Plinius, indem seine Blätter und Beeren im Altertum als
Heilmittel dienten) aus Südeuropa in unsere Gärten, während der
einheimische gemeine Wegdorn (Rh. carthartica) zu Hecken
benutzt wird, den Bienen Nahrung und den Menschen ein treffliches,
hartes Holz zu Drechsler- und Tischlerarbeiten liefert. Die noch
grünen Früchte dienen zum Gelbfärben, die reifen schwarzen dagegen,
wie auch diejenigen des Faulbaums (Rh. frangula), als
Abführmittel. Von letzterem ist die innere Rinde als Laxans offizinell,
während das Holz zu Schuhstiften, feinen Drechsler- und Tischlerwaren
dient und die beste Kohle zu Schießpulver bildet. Die Samenkerne
liefern ein gutes Brennöl. Der bis 2,5 m hohe Faulbaum ist ein
beliebter Zierstrauch in Anlagen, wo man außerdem auch die höchstens
2 m hohe Rh. alpina von den Alpen und süddeutschen
Gebirgen, sowie die ähnliche, aber größere Rh. grandifolia aus
Persien und dem Kaukasus kultiviert. In Italien wird der im Orient
und in Südeuropa heimische gemeine Stechdorn (Paliurus
aculeatus) seiner starken Dornen wegen häufig zu Hecken, bei uns
aber wie die verwandte Säckelblume (Ceanothus americanus)
aus den Vereinigten Staaten als Gartenzierstrauch angepflanzt. Aus den
Zweigen des nur in Palästina im Jordantale und am Toten Meer heimischen
Judendorns (Zizyphus spina Christi) — von den Arabern
nebeg genannt — soll die Dornenkrone Christi geflochten gewesen
sein.
Der Stechpalme steht auch die wirtelblütige Winterbeere
(Prinus verticillatus), ein 1–2 m hoher Strauch aus
Virginien mit in Wirteln gestellten, weißlichen Blüten nahe. Er wird
wie die ebenfalls nordamerikanische P. glabra besonders an
feuchten Standorten unserer Lustgärten gepflanzt. Als Gebüschpflanzen
unserer Parks finden wir außer den einheimischen Arten: dem gemeinen
Spindelbaum oder Pfaffenhütchen (Evonymus europaeus)
Mitteleuropas, dem größeren, bis 5 m hohen breitblätterigen
Spindelbaum (E. latifolius) aus den süddeutschen Kalk- und
Voralpen und dem nur bis 2 m hohen warzigen Spindelbaum
(E. verrucosus) — so genannt, weil seine Äste dicht mit
Korkwarzen besetzt sind — aus den Gebirgswäldern des östlichen
Deutschland besonders auch den japanischen Spindelbaum (E.
japonicus) mit immergrünen, elliptischen Blättern angepflanzt.
Alle haben schön rot bis gelb gefärbte, heftig abführende und
Brechen erregende Früchte und ein hellgelbes, zu Drechslerwaren und
Schnitzwerk, zu Schusternägeln und besonders Zahnstochern beliebtes
Holz, das verkohlt auch zur Herstellung von Schießpulver dient und
die beste Zeichenkohle liefert. Besonders dient solchen Zwecken der
gemeine Spindel[S. 610]baum, der auch zu Hecken gezogen wird, und von dem eine
Varietät mit hängenden Zweigen als Zierstrauch dient. Dem Spindelbaum
sehr nahe steht die in Gebirgswäldern Süddeutschlands heimische
gemeine Pimpernuß (Staphylea pinnata), ein 3–6 m
hoher Strauch mit gefiederten Blättern und weißlichen, hängenden
Blütentrauben, die ebenfalls bei uns in Anlagen kultiviert wird. Das
feste Holz dient gleicherweise zu Drechslerarbeiten, die Früchte wirken
gelinde abführend und die Samen enthalten ein gutes Brennöl. Sehr nahe
damit verwandt ist der nordamerikanische kletternde Baumwürger
(Celastrus scandens), ein 2–5 m hoher Schlingstrauch,
der als Zierpflanze in unseren Gärten vornehmlich zu Lauben und
Wandbekleidungen dient.
Ebenfalls aus Nordamerika kam die als „wilder Wein“ allgemein
bekannte Jungfernrebe (Ampelopsis quinquefolia) zu
uns, deren fünfzähliges Laubwerk mit seiner prächtigen, blutroten
Herbstfärbung in unserer einheimischen Pflanzenwelt einzigartig dasteht
und deshalb sehr häufig zur Bekleidung von Mauern und schattigen
Lauben benutzt wird. Zu seiner Befestigung an der Unterlage dienen zu
verholzenden Ranken ausgebildete Seitenzweige, deren Aufgabe darin
besteht, geeignete Stützen aufzusuchen, zu umwickeln und dann durch
korkzieherartige Einrollung den Hauptzweig nachzuziehen. Vermag
aber eine solche Pflanze, etwa an einem glatten Baumstamm, keinen
Stützpunkt zu finden, so findet in der Weise eine Anpassung statt,
daß sich die Tastspitzen der Ranken zu Saugscheiben verbreitern,
die an der glattesten Unterlage sich anzupressen und fest zu haften
vermögen. Solche Haftscheiben werden von manchen Arten des wilden
Weins sogar regelmäßig gebildet. Solche „selbstklimmende“ Formen sind
zur Bekleidung von Hauswänden und Mauern ganz besonders geeignet. Als
solche findet besonders die aus Ostasien zu uns gekommene, ebenfalls
im Spätherbst, vor dem Blätterfall, herrlich rot sich färbende
dreispitzige Jungfernrebe (A. tricuspidata) — auch in
der Abart A. veitchi — mit dreigelappten Blättern neuerdings
weite Verbreitung.
An die Jungfernreben schließen sich als einheimische Lianen die zu
den Hahnenfußgewächsen gehörenden Waldreben (Clematis)
an, die in verschiedenen importierten großblütigen Formen prächtige
Gartenzierpflanzen zur Bekleidung von Wänden und zum Überziehen von
Lauben bilden. Während die mitteleuropäische gemeine Waldrebe
(Cl. vitalba) ganz bescheidene grüngelbe Blüten hat, besitzen
schon die südeuropäischen Arten viel größere und farbenprächtigere
Blüten. Von ihnen hat die italienische Waldrebe (Cl.
viticella), die in vielen Varietäten zur[S. 611] Bekleidung von Lauben
und Wänden bei uns gepflanzt wird, einzeln stehende, langgestielte,
blauviolette Blüten, die in einer Abart purpurrot sind, während eine
andere, ebenfalls im Mittelmeergebiet heimische Art fast weiße, nur
schwach riechende Blüten aufweist. Die glockenblütige Waldrebe
(Cl. viorna) ist in Nordamerika bis Mexiko heimisch,
rankt 3–4 m empor und besitzt außen purpurviolette, innen
grünlichgelbe, 2,6 cm lange glockenförmige Blüten, während die
als Schlingstrauch nicht minder beliebte Clematis coccinea aus
Texas eine Unterart derselben mit zinnoberroten glockenförmigen Blüten
darstellt. Ebenfalls nordamerikanischen Ursprungs sind die bis zu
2 m hoch rankende Clematis flammula, die von Juli bis
Oktober ihre milchweißen, nach Orangenduft riechenden Blüten entfaltet,
die ebenso hohe, von Juli bis in den Herbst hinein große weiße, rote,
violette und blaue Blüten entwickelnde Cl. jackmanni und die
bis 15 cm große, halbgefüllte weiße, leicht lila gefärbte,
angenehm duftende Blüten entfaltende Cl. fortunei. 3–4 m
hoch ranken die ebenfalls nordamerikanische Cl. campaniflora,
die von Juli bis August bläuliche bis lilaweiße überhängende
glockenförmige Blüten entwickelt, die japanische Cl. lanuginosa
mit großen herzförmigen Blättern und hellblauen Blüten von 16 cm
Durchmesser und die ebenfalls aus Japan stammende Cl. patens
mit schönen blauen Blüten von 8 cm Durchmesser. Während alle
vorgenannten bei uns des Winterschutzes bedürfen, hält letztere den
Winter Süddeutschlands sehr wohl im Freien aus. Alle diese Arten wie
auch die japanische Cl. florida hat man untereinander und mit
der italienischen Waldrebe (Cl. viticella) gekreuzt und damit
viele neue Formen mit sehr großen, prachtvoll gefärbten Blüten gewonnen.
Durch ihre Genügsamkeit und Winterhärte ausgezeichnet ist die ebenfalls
als Gartenzierpflanze zur Bekleidung von Lauben beliebte gemeine
Alpenrebe (Atragene alpina), die in den süddeutschen Alpen
und Voralpen heimisch ist und nur kleine violette oder weiße Blüten
aufweist.
Ein ebenfalls sehr beliebter windender Zierstrauch unserer Gärten ist
der aus dem südlichen Nordamerika zu uns gekommene und zur Bekleidung
von Lauben häufig angewandte Pfeifenstrauch (Aristolochia
sipho), ein naher Verwandter unserer an Zäunen und in Gärten als
Unkraut aus Südeuropa eingewanderten gemeinen Osterluzei (A.
clematitis). Sie trägt große, runde, schattenspendende Blätter und
wie Tabakspfeifen gekrümmte bräunlichgrüne Fallenblüten, die durch
ihren Aasgeruch kleine Fliegen zur Befruchtung anlocken und sie erst[S. 612]
wieder entlassen, wenn sie sich mit dem nach der Befruchtung der
Stempelblüten ausstäubenden Pollen beladen haben. Sie ist verwandt mit
den in Warmhäusern gezogenen Nepenthazeen oder Kannensträuchern aus dem
tropischen Südasien und Indonesien, die mit verdauendem Saft gefüllte
Fallgruben an den entsprechend umgewandelten Spitzen der Blätter
besitzen und die darin erbeuteten Insekten wie die Tiere in ihrem Magen
verdauen.
Ein mit gruppenweise zusammengestellten kurzen, zu Haftorganen sich
umbildenden Luftwurzeln bis 16 m hoch kletternder immergrüner
Strauch ist der häufig in Europa und Asien an Bäumen und Mauern in bis
zu armdicken Stämmen emporsteigende Efeu (Hedera helix),
in alten Schriften wegen seiner immergrünen Blätter auch Ewigheu
genannt. Daraus oder aus dem daneben gebräuchlichen Eibenheu hat sich
das deutsche Efeu gebildet. Bei den alten Griechen hieß die Pflanze
kissós, bei den Römern hedera und diente, als dem Gotte
des Weins und des Natursegens, Dionysos-Bacchus, geweiht, zu Kränzen
bei Festgelagen und zur Umwindung des mit einem Pinienzapfen gekrönten
Thyrsosstabes. Um den reichen Bedarf danach zu decken, wurde der Efeu
im Altertum gepflanzt, und zwar rät Columella hochwachsenden Efeu
(orthocissus) und gemeinen Efeu (edera) in der letzten
Hälfte des Februar zu pflanzen. Alle Teile der Pflanze, auch das nur
in südlichen Gegenden ausfließende Harz, wurden arzneilich benutzt.
Der ältere Plinius wundert sich über die ihr erwiesenen Ehre, daß
man sie als beliebtestes Kranzmaterial verwende, „da sie den Bäumen
schadet, Grabmäler und Mauern sprengt und den Schlangen einen kühlen
Zufluchtsort bietet.“ Diese noch heute weitverbreitete Meinung ist
aber unrichtig, da durch den Efeu niemals gesunde Mauern zerstört
werden können, er vielmehr die Unterlage vor Verwitterung schützt. Nur
da, wo sich seine Stämmchen durch bereits bestehende Fugen drängen,
vermag er, wie alle Holzpflanzen, im Laufe der Zeit durch sein geradezu
unwiderstehliches Dickenwachstum Steine auseinander zu sprengen. Der
eigentlich dem Dionysos geweihte heilige Efeu war ursprünglich der im
Orient heimische und mit dem Kulte des Gottes nach Südeuropa gelangte
goldfrüchtige Efeu (H. chrysocarpa), ein sonst wie
der gemeine Efeu benutzter Strauch, der sich statt durch bereifte,
schwarze, wie unser Efeu, durch goldgelbe Beeren auszeichnet und
vornehmlich zur Bekränzung der Dichter diente. Auch bei ihnen blühen
nur ältere Stämme.
Nahe Verwandte des Efeus sind die Aralien, von denen die in[S. 613]
China heimische Aralia edulis dort und in Japan kultiviert wird,
um die Wurzel und jungen Stengel als angenehmes Gemüse zu essen. Die
japanische Aralie (A. japonica) ist eine der schönsten
Freiland-Dekorationspflanzen, muß aber Winters eingebunden werden.
Auch A. spinosa ist ein hervorragendes Blattziergewächs, das
im Warmhause kultiviert und Sommers im Freien gehalten wird. Ebenso
A. papyrifera, ein 2–4 m hoher Strauch Chinas, dessen
bis 17 cm dicker Stamm in seinem spiralig in dünne Blättchen
geschnittenen Mark das samtweiche Reispapier liefert, das erst
1804 von Dr. Livingstone von China nach England gebracht wurde.
Wegen ihrer noch vor dem Hervorbrechen der Blätter erscheinenden
großen weißen, außen rot überhauchten Blüten sind die Magnolien
sehr beliebte Gartenzierbäume. Sie haben ihren Namen nach dem
Botanikprofessor Pierre Magnol in Montpellier (1638–1745). Die
Stammformen der am meisten gezüchteten Arten sind hauptsächlich zwei
ostasiatische Arten, die angenehm duftende, rein weiße Magnolia
yulan und die geruchlose, rote Magnolia obovata. Später erst
kamen die nordamerikanischen Magnolien zu uns, die aber weniger beliebt
als die vorgenannten sind, obschon sie frosthärter sind, weil sich ihre
Blüten erst nach dem Aufbrechen der großen ovalen Blätter entfalten.
Doch ist ihr vorzügliches Holz für die Möbelindustrie von einiger
Bedeutung. Neuerdings wird sogar eine Art, die japanische Ho-Magnolie
(M. hypoleuca), als Nutzholz zur Anpflanzung im deutschen Walde
empfohlen.
Nahe verwandt mit den Magnolien ist der ebenfalls seines Holzes
wegen wichtige nordamerikanische Tulpenbaum (Liriodendron
tulipifera), der, wie die mächtigen Stämme unserer Parks beweisen,
schon früh — und zwar aus Virginien — zu uns kam. Die tulpenähnlichen
rotgelben Glockenblüten treten erst an älteren Exemplaren auf und sind
daher meist weniger bekannt als die auffallend geformten Blätter.
Letztere tragen an den Aderwinkeln ihrer Unterseite in der Art der
von unsern Linden her bekannten Milbenhäuschen,[5] deren zahlreiche
Bewohner nächtlicherweile die Reinigung der Blattoberfläche besorgen.
Sehr häufig begegnet man in unseren Ziergärten der 1796 in Europa
eingeführten strauchartigen japanischen Scheinquitte
(Chae[S. 614]nomeles japonica), deren büschelweise vereinigte
scharlachrote Blüten im ersten Frühjahr zwischen dem spärlichen Grün
der häufig bedornten Zweige hervorschauen. Bei uns bilden sich die
Früchte nur in heißen Sommern aus und sind ungenießbar, während sie in
Japan zu Konfekt eingekocht, zur Herstellung von Gelee und einer Art
Likör benutzt werden. Andere Arten von als Zierbäume zu uns gebrachten
wilden Quitten blühen blaßrot oder mennigfarben. Noch entzückender ist
der aus China zu uns gekommene dreilappige Pfirsich (Prunus
triloba), der auch Mandelaprikose oder Röschenmandel genannt wird.
An schlanken, fast unverzweigten Ruten des meist in hohen Stämmchen
gezogenen Strauches erscheinen zuerst in dichten Reihen die zart
rosafarbenen, meist gefüllten und daher kleinen Röschen vergleichbaren
Blüten und erst nach deren Verblühen die länglichen, gesägten Blätter.
Selten trifft man bei uns die echte Mandel (Amygdalus
communis), die nur in besonders geschützten Lagen ihre Früchte
reifen läßt. Häufig dagegen ist die von Ungarn bis Südsibirien
heimische Zwergmandel (A. nana), ein kleiner Strauch
mit lanzettlichen, feingesägten Blättern und dicht an den vorjährigen
Zweigen gedrängten, kleinen Rosablüten, denen zuliebe sie vielfach in
Gärten gepflanzt wird.
Auch unsere beiden als Obstbäume gezüchteten Kirschenarten, die
Süß- und Sauerkirsche (Prunus avium und P.
cerasus) haben in Formen mit weißen, gefüllten Blüten prächtige
Zierbäume für unsere Parks geliefert. Dabei können die Blumenblätter
teilweise vergrünen, d. h. wieder das Aussehen von Laubblättern
annehmen, aus denen sie sich ja stammesgeschichtlich entwickelt
haben. Weniger der weißen, rosaüberhauchten Blüten, als ihres
schönen Laubwerkes wegen wird eine rotblätterige Form der
Kirschpflaume (P. cerasifera var. pissardi) bei uns
gepflanzt. Während die Blätter der gewöhnlichen Kirschbaumarten nur
bei der Entwicklung im Frühjahr zum Zwecke der Wärmesteigerung und als
Schutz gegen zu grelle Besonnung durch Einlagerung des in saurer Lösung
roten Anthocyans prächtig braunrot gefärbt sind, behalten diejenigen
dieser Art diese Verfärbung den ganzen Sommer über. Solche einmal
entstandene Varietäten werden auf vegetativem Wege durch Pfropfung
vermehrt, können aber gelegentlich, wie besonders bei der Blutbuche
beobachtet wurde, auch durch Samen weitergezüchtet werden, indem der
Samen eines rotblätterigen Baums zu einem großen Teile rotblätterige
Pflänzlinge liefert.
Wie die einheimische Traubenkirsche und Steinweichsel
(P. pa[S. 615]dus und P. mahaleb) wird neuerdings vielfach auch
die aus Virginien in Nordamerika bei uns eingeführte spätblühende
Traubenkirsche (P. serotina) kultiviert. Sie unterscheidet
sich von unserer einheimischen Form durch lorbeerähnliche, glänzende
Belaubung und aufrechte Blütentrauben. Außer der bereits erwähnten
flammendrot blühenden Scheinquitte hat uns Ostasien in seinem
Blütenapfel (Malus floribunda) und dessen Verwandten
einige der schönsten Blütensträucher des Frühjahrs geschenkt. Europa
selbst bietet in verschiedenen Formen der Mehlbeeren (Sorbus
aria und suecica), vor allem aber in deren Bastardbildungen
mit Vogelbeere (S. aucuparia) und Elsbeere
(S. torminalis) hübsche Zierbäume. Die Vogelbeere oder gemeine
Eberesche, die sich im Herbst mit den von den Vögeln bevorzugten
prächtigroten Früchtebüscheln schmückt, ist wegen ihres schönen
Aussehens und raschen Wuchses in Parks und als Alleebaum sehr beliebt
und wird auch in einer Varietät mit hängenden Ästen als Trauerbaum
gezogen. Das weißlich oder bräunlich geaderte, gegen den Kern zu oft
dunkler geflammte, ziemlich harte, feine Holz nimmt gute Politur an und
ist deshalb von Tischlern und Drechslern gesucht. Mit Vogelbeerzweigen
besteckte man früher am Walpurgisabend (1. Mai) die Stalltüren, um
Hexen abzuhalten. Auch peitschte man am nächsten Morgen die Kühe mit
diesen Zweigen, damit sie reichlicher Milch gäben. In Mecklenburg
war das Quitzern, d. h. das Schlagen mit den Zweigen des als Quitz
bezeichneten Mehlbeerbaums, noch im 18. Jahrhundert Sitte. Dabei mußte
der Gequitzte dem, der ihn quitzte, ein Geschenk geben.
Auch die beiden Weißdornarten (Crataegus oxyacantha
und C. monogyna) sind sowohl in der wilden Form, zu Hecken
und Einfriedigungen zugeschnitten, als besonders mit gefüllten roten
Blüten als Hochstamm gezogen in Park und Garten beliebt. Dieser
rotblühende Weißdorn wird häufig als „Rotdorn“ bezeichnet. Von Rot-
und Weißdorn hat man in den Gärten eine Varietät mit hängenden
Zweigen und eine solche mit gescheckten Blättern gezüchtet. Von
den zahlreichen fremden Arten ist besonders der aus dem östlichen
Nordamerika zu uns gekommene scharlachfrüchtige Weißdorn (C.
coccinea) mit großen, rundlich gesägten Blättern beliebt, ebenso
der virginische Hahnensporn-Weißdorn (C. crusgalli) und
die gleichfalls von Kanada bis Karolina gemeinen C. glandulosa,
prunifolia, rotundifolia, salicifolia,
punctata, grandiflora u. a., während C. sanguinea
aus Sibirien, C. nigra aus Ungarn und C. melanocarpa
aus dem[S. 616] Orient zu uns kamen. Ebenfalls wird der mit mispelgroßen,
glänzend roten oder gelben, eßbaren Früchten versehene und deshalb
in Vorderasien und in den Mittelmeerländern häufig kultivierte
Azarol-Weißdorn (C. azarolus) mit weißen Blüten häufig in
unsern Gärten als Zierpflanze gezogen. Alle Weißdornarten haben nach
ihrem Weichwerden im Oktober nicht nur von den Vögeln begehrte, sondern
auch von den Kindern gerne gegessene, inwendig gelbe, mehlige Früchte
und ein hartes, von Drechslern gesuchtes Holz. Da aber viele Insekten
auf ihnen leben, die gerne von ihnen auf die Obstbäume übergehen, so
sollten sie nicht in der Nähe der letzteren gepflanzt werden.
Außer der süddeutschen gemeinen Zwerg- oder Steinmispel
(Cotoneaster vulgaris) und der filzigen Steinmispel
(C. tomentosa), beide mit rosenroten Blüten und prächtigroten
Früchten, werden auch die aus Nordeuropa und Sibirien bei uns
eingeführte schwarzfrüchtige Zwergmispel (C. nigra),
die aus dem Orient stammende doldentraubige Zwergmispel
(C. racemiflora) mit roten Früchten, der bei uns im Winter
schutzbedürftige südeuropäische immergrüne Feuerdorn (C.
pyracantha — nach der schon von Dioskurides genannten Bezeichnung
pyrákantha, d. h. Feuerdorn) mit weißen Blüten und den Winter
über hängenbleibenden feuerroten Früchten, wie auch die immergrüne,
rotfrüchtige rundblätterige Zwergmispel (C. rotundifolia)
aus dem Himalaja in unsern Gärten und Anlagen als Ziersträucher
gepflanzt. Weiße Blüten, wie alle zuletzt genannten, haben auch die
gleicherweise wie jene in unsern Parks gezogenen Felsenmispeln
(Aronia), von denen die laubarme gemeine Felsenmispel
(A. rotundifolia) mit haselnußgroßen, schwarzblauen, rundlichen
Früchten und die kanadische Felsenmispel (A. canadensis)
angenehm schmeckende Früchte liefern, welche besonders in Frankreich
als amélanches häufig gegessen werden.
Von den Rosenblütlern sind ferner die meist weiß, seltener rot
blühenden Spiersträucher (Spiraea) zu nennen, von denen
gegen 50 Arten und zahllose Kreuzungen dieser anspruchslosen Sträucher
bei uns angepflanzt werden, obschon sich ihre Blüten weder durch
Farbenpracht, noch durch Wohlgeruch auszeichnen. Als Gartenzierpflanzen
und zu Hecken beliebt sind der 1–2 m hohe rosenrot, aber
auch weiß blühende weidenblättrige Spierstrauch (Spiraea
salicifolia), und der weißblühende gamanderblätterige
Spierstrauch (S. chamaedryfolia), beide aus Sibirien,
dann der hainbuchenblätterige (S. carpinifolia),
der schneeballblätterige (S. opulifolia), der
doldentrau[S. 617]bige (S. corymbosa), der rotblühende
filzblätterige (S. tomentosa), alle aus dem östlichen
Nordamerika, der Douglasische (S. douglasii) aus dem
westlichen Nordamerika, der hübsche pflaumenblätterige (S.
prunifolia) mit roten und der dreilappige und prächtige
Spierstrauch (S. trilobata und callosa) aus Ostasien,
speziell Japan, beide mit weißen Blüten. Die meisten dieser Formen
trifft man nicht selten verwildert auch außerhalb der Gärten an.
Statt der einfachen, meist gezähnten Blätter der Spiräen besitzen
die Fiederspieren (Sorbaria) gefiederte Blätter. Die
am häufigsten angepflanzte Form derselben ist die 2–2,6 m
hohe vogelbeerblätterige Fiederspiere (S. sorbifolia)
mit bis 30 cm langer pyramidaler Rispe von weißen Blüten aus
Sibirien und Nordchina. Ebenfalls aus Ostasien kam die bis 2 m
hohe japanische Kerrie (Kerria japonica) — zu Ehren
des englischen Gärtners Kerr so genannt, der zu Anfang des vorigen
Jahrhunderts nach China und Japan reiste und viele Pflanzen von da
in Europa einführte — als Zierstrauch zu uns und wird wegen ihrer
schönen, goldgelben, fast immer gefüllten, vom Frühling bis zum Herbst
fortblühenden Blüten und der geringen Pflege, die sie verlangt, fast
überall in den Gärten angepflanzt. Da die Blüten nach Form und Farbe
sehr an diejenige der Hahnenfüße (Ranunculus) erinnern, wird
das Ziergewächs auch als Ranunkelstrauch oder japanische Honigrose
bezeichnet. Nahe mit diesen verwandt ist die auch bei uns als
Rasenzierstrauch kultivierte, nach dem deutschen Arzte Arnold Gillen,
der 1627 ein lateinisches Botanikbuch in Kassel herausgab, genannte
dreiblätterige Gillenie (Gillenia trifoliata) aus dem
östlichen Nordamerika.
Von ebendort stammt der bei uns häufig in Anlagen zu treffende und
schon fast verwilderte, bis 5 m hohe Hirschkolben-Sumach
oder nordamerikanische Essigbaum (Rhus typhina), so
genannt, weil seine sauren roten Früchte zur Verstärkung des Essigs
dienen. Seine weitreichenden, mit ihrem braunen Filz an ein im Bast
stehendes Hirschgeweih erinnernden Schößlinge und Wurzelausläufer sind
außerordentlich zäh und schlagen immer wieder aus. Das schöngefiederte,
sattgrüne Laub nimmt im Herbste wie dasjenige der gleichfalls aus
dem östlichen Nordamerika stammenden Jungfernrebe und zahlreicher
anderer Pflanzen jenes Erdteils eine prachtvolle rote Färbung an. Das
Holz dient als Nutzholz, und in seiner Heimat werden die Blätter zum
Gerben benutzt. Ebenfalls in Nordamerika heimisch ist der glatte
Sumach (Rh. glabra), dessen Fiedern unterseits nicht fein
be[S. 618]haart, sondern glatt sind. Seine Rinde wird in den Vereinigten
Staaten zum Gerben benutzt. Ihm ähnlich, aber in allen Teilen kleiner,
ist der in den Mittelmeerländern heimische Gerber-Sumach (Rh.
coriaria), dessen zu Pulver zerkleinerte Zweige und Blätter unter
dem Namen Schmack in den Handel gelangen und zum Gerben der
Häute und Schwarzfärben dienen. In Spanien wird damit das Saffian- und
Korduanleder bereitet, dessen Herstellung die christlichen Spanier
von den Arabern übernahmen. Schon die alten Griechen, namentlich die
Bewohner von Megara, gerbten mit seinem Holze Leder und färbten Wolle
goldgelb. Außerdem benützten sie die säuerlich schmeckenden, ebenfalls
gerbstoffhaltigen Beeren zum Stopfen bei Durchfall und als Gewürz,
besonders zu Fleischspeisen.
Seiner Giftigkeit wegen gefürchtet und dennoch nicht selten zur
Bekleidung von Lauben angepflanzt wird der Giftsumach (Rh.
toxicodendron). Er ist ein ebenfalls aus Nordamerika stammender
Kletterstrauch mit dreizähligen Blättern und kleinen, grünlichen
Blütenrispen. Alle Teile desselben enthalten einen gelblichweißen,
an der Luft schwarz werdenden Milchsaft, der bei der Berührung eine
Hautentzündung hervorruft, bei empfindlichen Personen sogar Schwindel-
und Krampfanfälle erzeugt. Ähnlich giftig ist der gleichfalls an der
Luft schwarzwerdende Saft des früher besprochenen ostasiatischen
Firnis-Sumachs (Rh. vernificera), aus dem die Japaner
ihren berühmten Lack herstellen. Aus den Früchten des in China und
Japan heimischen Wachs-Sumachs (Rh. succedanea) wird das
in großen Mengen aus Japan exportierte Japanwachs hergestellt, während
vom ebenfalls in Ostasien heimischen geflügelten Sumach (Rh.
semialata) die durch Blattläuse (Aphis chinensis) erzeugten,
langgezogenen, blasenförmigen Gallen gewonnen werden. Von diesen, als
Gerbmaterial wichtigen, chinesischen Galläpfel erfuhren wir bereits,
daß sie seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts einen wichtigen
Handelsartikel bilden und in Menge aus China ausgeführt werden. Auch
diese Sumachart ist in unsere Gärten eingeführt worden und an den
eleganten, großen Blättern zu erkennen, deren Spindel etwas geflügelt
ist.
Viel gepflanzt wird bei uns auch der in Südeuropa und im Orient bis
nach China heimische Perückenstrauch (Rh. cotinus),
dessen lockere Rispen von grüngelben Blüten zur Fruchtzeit die
Blütenstiele außerordentlich verlängern und aus den unfruchtbaren
Blüten zahlreiche rotbraune Wollfäden hervorsprossen lassen, so daß
der Fruchtstand wie eine wildzerzauste Perücke auf dem Strauche sitzt.
Theo[S. 619]phrast nennt ihn kokkygéa und Plinius in Anlehnung an die
griechische Bezeichnung coccygia. Die gerbstoffreiche Rinde
und die Blätter dienten schon im Altertum zum Gerben und das Holz zum
Gelbfärben von Leder zu Gürteln und Schuhen. Noch heute wird es als
ungarisches Gelbholz oder Fisetholz zum Fournieren und Gelbfärben
gebraucht.
Nahe verwandt mit den Sumacharten ist der ostindische Tintenbaum
(Semecarpus anacardium), welcher in seinen Früchten die
ostindischen Elefantenläuse liefert, die unreif zur Herstellung einer
unverlöschlichen schwarzen Tinte und eines Firnis, reif dagegen zur
Heilung von Hautkrankheiten benutzt werden. In der ganzen Gattung
sind scharfe Stoffe sehr verbreitet und zum Teil von so gefährlicher
Wirkung, daß man z. B. sich während des Regens fürchtet, unter
einen Baum von Semecarpus heterophylla zu treten, weil die
davon abfließenden Tropfen auf der Haut Entzündung hervorrufen. Am
allerbösartigsten in dieser Beziehung ist der an den Flußmündungen
des malaiischen Archipels nicht seltene Renghasbaum (Gluta
rhengas), der Arbeitern, die ihn zu fällen versuchen, mit seinem
Safte geradezu lebensgefährliche Geschwüre verursacht, so daß ihn in
seiner Heimat kein Mensch anrührt, geschweige denn verletzt.
Mit den verschiedenen Sumacharten, speziell dem amerikanischen
Essigbaum, wird vielfach wegen der Ähnlichkeit der Blätter der
ebenfalls in unseren Parkanlagen als Schattenbaum angepflanzte
südchinesische Götterbaum (Ailanthus glandulosa)
verwechselt. In seiner Heimat heißt er wegen der Höhe von
16–19 m Götter- oder Himmelsbaum. Er wäre einer unserer wertvollsten
Parkbäume, wenn er nicht gar zu leicht das Opfer strenger Winter würde.
Die Pflanze besitzt ein außerordentlich rasches Wachstum und läßt sich,
so lange sie jung ist, in rohem, frisch aufgeschlossenem Boden leicht
versetzen, ist also für Neuanlagen von Gärten wie geschaffen. Dabei
sind die großen, rotüberlaufenen Fruchtstände im Herbst ein prächtiger
Schmuck, so unscheinbar auch die gelbgrünen, im Juli in dichten Rispen
erscheinenden Blüten sind. Neben den gewöhnlichen zwitterigen Bäumen
gibt es auch getrenntgeschlechtige, so daß nicht alle blühenden Bäume
auch Früchte tragen können. Die ölreichen Samen sitzen in der Mitte
eines schraubig gedrehten, zungenförmigen Flugblattes und werden durch
den Wind verbreitet. In China lebt auf diesem Baume die Raupe des
prächtigen, großen Ailanthus-Spinners (Saturnia cynthia), welche
in zwei Ernten jährlich so viel Seidenmaterial liefert, daß es dort
seit[S. 620] Jahrhunderten zur Herstellung von Kleidern vewendet wird. Die
Raupe ernährt sich von den bis 1 m langen gefiederten Blättern
und wurde zur Seidengewinnung mit seinem Nährbaum auch in Südfrankreich
und Algerien eingeführt. Ab und zu kann der Schmetterling auch bei uns
angetroffen werden.
Ein ebenfalls sehr schöner, 10–15 m hoher, sehr rasch
wachsender, aber wegen seiner Empfindlichkeit gegen Frost nur an
geschützten Stellen vorkommender und auch da nur selten blühender
ostasiatischer Baum ist der japanische Kaiserbaum (Pawlonia
imperialis — nach Anna Pawlona, der Tochter des russischen
Kaisers Paul I. und Gemahlin Wilhelms II., Königs der Niederlande,
so genannt). Er besitzt große, langgestielte, ganzrandige, behaarte
Blätter und aufrecht gestellte Rispen von großen, hell blauvioletten,
angenehm duftenden Blüten. Drei kleeförmig geordnete Blätter desselben
bilden das japanische Kaiserwappen. Das leichte Holz findet vielfache
Verwendung, und aus dem Samen gewinnt man ein Öl, das in Japan zur
Herstellung gewisser durchsichtiger Papiersorten dient.
Dem ostasiatischen Ailanthus sehr nahe verwandt ist der aus dem
südlichen Nordamerika stammende und bei uns als Gartenzierstrauch
beliebte gemeine Lederbaum (Ptelea trifoliata). Dieser
bis 5 m hohe Strauch mit dreizähligen Blättern, die beim Reiben
unangenehm riechen, bildet kreisrunde Flügelfrüchte aus, die an
diejenigen der Flatterulme erinnern.
Wegen noch größerer Frostempfindlichkeit bei uns in Töpfen kultiviert
und den Winter über im Keller oder Kalthaus aufgestellt wird der in
allen Teilen einen bitteren, giftigen Saft enthaltende Oleander
oder Rosenlorbeerbaum (Nerium oleander). Diese, dem
Immergrün (Vinca) nahe verwandte, beliebte Schmuckpflanze
unserer Wohnungen und Gärten ist ein in den warmen Mittelmeerländern
wildwachsender, sehr leicht durch Stecklinge zu vermehrender
baumartiger Strauch, der von seiner in die Augen fallenden Eigenschaft,
die Wasserläufe und kiesigen Rinnen oder Schluchten, in denen sich
nur vorübergehend die Wildbäche nach heftigem Regen gegen das Meer
hinabwälzen, zu begleiten und einzufassen, von den Griechen den Namen
nérion, von nerós fließend — es sei hier nur an Nereus,
den Wassergott, und die Nereiden, die Göttinnen des flüssigen Elements
erinnert —, erhielt. Diese Bezeichnung übernahmen dann die Römer.
Trotz dieses bevorzugten Standortes ist aber der Oleander durchaus
keine eigentliche Wasserpflanze und ersteigt auch die steinigen Halden
der Berge, an[S. 621] denen oft Nebel lagern. Merkwürdig ist, daß die Alten
bis auf Plinius und Dioskurides die so charakteristische Pflanze der
südlichen Landschaft nicht nannten, so daß V. Hehn auf die falsche
Vermutung kam, der Oleander sei in der Zeit zwischen Theophrast (†
286 v. Chr.) und dem Ende der römischen Republik (das auf den 2.
September 31 v. Chr. durch den Sieg von Cäsar Octavianus, seit 27
v. Chr. Augustus beigenannt, über Antonius und Kleopatra fällt) vermutlich
aus dem pontischen Gebirge zuerst nach Griechenland und von da später
auch nach Rom gekommen. Es ist dies offenbar eine Verwechslung mit
der pontischen Alpenrose (Rhodondendron ponticum), denn der
von den Griechen auch als rhododéndron, d. h. Rosenbaum oder
rhododáphnē, d. h. Rosenlorbeer, bezeichnete Oleander kommt im
pontischen Gebirge überhaupt nicht wild vor.
In der römischen Kaiserzeit war der Rosenlorbeer bei den Ärzten
und dem Volke in Italien so bekannt und als Gift gefürchtet wie
heute, wo er in Süditalien amazzo l’asino, d. h. Eselmörder,
heißt. Der aus Kilikien gebürtige Arzt Dioskurides sagt in seiner
Arzneimittellehre: „Der bekannte Strauch nérion oder
rhododáphnē oder rhododéndron, der längere und dickere
Blätter hat als der Mandelbaum — hier folgt die weitere Beschreibung
— wächst in Paradiesen (vom persischen pardes, d. h. Park) und
in Ufergegenden und an den Flüssen. Seine Blüten und Blätter wirken
schädlich auf Hunde, Esel, Maultiere und die meisten Vierfüßler; den
Menschen aber sind sie, mit Wein getrunken, heilsam gegen den Biß von
Tieren, besonders wenn man Raute hinzumengt. Kleinere Tiere aber, wie
Ziegen und Schafe, sterben, wenn sie einen Aufguß davon trinken.“
Palladius, der im 4. Jahrhundert n. Chr. ein noch im Mittelalter
vielfach benutztes Werk über den Landbau in 14 Büchern schrieb, erwähnt
ihn als Mittel die Mäuse damit zu vertilgen, indem man deren Gänge und
Löcher mit Blättern dieses Baumes verstopft.
Während der Oleander in Südeuropa eine Höhe von 5, ja selbst 7 und
8 m erreicht, sieht man ihn in Deutschland in den Kübeln kaum
über 3 m hoch werden. Die von Juni bis September erscheinenden
duftlosen Blüten sind bei der wildwachsenden Pflanze karminrot, doch
hat man aus Samen zahlreiche Spielarten mit einfachen und gefüllten,
verschieden nuancierten roten und weißen Blumen gezogen. Aus Indien
stammt der wohlriechende Oleander (N. odoratum), der
längere und schmälere Blätter von frischem Grün und sehr angenehm
duftende größere, weiße, rosenrote oder fleischfarbene Blüten mit[S. 622]
purpurnen Linien in der Röhre besitzt. Die gelb blühenden Varietäten
sind empfindlicher als diese und deshalb auch weniger bei uns
verbreitet. Der in Ostindien wachsende Färberoleander (N.
tinctorium) liefert eine Art Indigo.
Ebenfalls ein Mitglied der immergrünen, mediterranen Strauchvegetation,
der wegen seiner schönen Belaubung häufig auch als Zierstrauch
kultiviert wird, bei uns aber über den Winter im Kalthaus
untergebracht werden muß, ist der zu den Erikazeen gehörende gemeine
Erdbeerstrauch (Arbutus unedo), dessen erdbeerähnliche,
aber etwas fade schmeckenden Früchte vom gelehrten römischen
Schriftsteller Varro (116–27 v. Chr.) mit Eicheln, Brombeeren und
Holzäpfeln zu den Nahrungsmitteln der Urzeit, also zu denen, die
die jungfräuliche Erde dem Menschen von selbst darbot, gerechnet
wurde. Jetzt, da man bessere Früchte in Menge besitzt, verschmäht
man seine 2–2,5 cm dicken, scharlachroten Früchte trotz ihres
säuerlich-süßen Geschmacks, sowohl in Griechenland als auch in
Italien und überläßt sie den Vögeln, für die sie ja ursprünglich von
der Pflanze bestimmt waren; nur in Spanien, wo der schöne Strauch
namentlich in der Sierra Morena häufig zu finden ist, werden sie
zahlreich auf den Markt gebracht. In sehr großer Menge genossen, sollen
sie betäubend wirken und Kopfschmerzen verursachen. Sie enthalten
ziemlich viel Zucker und können auch zur Branntweinfabrikation benutzt
werden. Der stattliche Strauch oder kleine Baum von 3–5 m
Höhe, mit rotberindeten Zweigen und großen, lederartigen, denjenigen
des Lorbeers ähnlichen, immergrünen Blättern und hängenden Trauben
von weißen oder rosenroten Blüten findet sich in ganz Europa wild
und wird wie sein Verwandter, der in Griechenland und im Orient
heimische Arbutus andrachne, in wärmeren Gegenden in Gärten
kultiviert. Letztere Art fällt durch ihren glatten, rötlichen Stamm
auf. Die lateinische Bezeichnung arbutus hängt wohl nicht
mit arbor Baum, sondern mit einer noch im althochdeutschen
ertberi (Erdbeere) erhaltenen indogermanischen Benennung der
Frucht nach ihrer Ähnlichkeit mit der Erdbeere zusammen.
Auch die trockene, sonnige Standorte liebenden Ginsterpflanzen
sind in den Macchien reich vertreten. Verwandt mit dem
Gaspeldorn (Ulex europaeus), der als englischer Ginster
(jetzt broom genannt) dem englischen Königsgeschlecht der
Plantagenet — von planta genista Ginsterpflanze — seinen Namen
gab, und dem Besenstrauch (Sarothamnus vulgaris), welche
beide prächtig gelb gefärbte Blütentrauben hervorbringen, mit denen sie
einen wirklichen Schmuck mancher sonst[S. 623] an Vegetation armer Gegenden
bilden, sind die früher besprochenen Cytisusarten, zu denen unser
Goldregen gehört.
Ebenso typische Repräsentanten der mediterranen Strauchvegetation sind
die bis 1,6 m hoch werdenden Cistrosen (Cistus),
von den alten Griechen kístos und in Anlehnung daran von den
Römern cistus genannt. Sie besitzen an reichverzweigten Ästen
bräunlichgrüne, klebrige Blätter und weiße bis rosenrote Blüten mit
zahlreichen gelben Staubfäden. Gepflückt welken sie äußerst rasch, doch
entfalten sich an Zweigen, die man ins Wasser steckt, alsbald neue
Blüten. Diese aromatisch duftenden Ciststräucher tragen nicht wenig
dazu bei, den Macchien ihren charakteristischen Geruch zu verleihen,
den die Schiffer, z. B. in der Nähe von Korsika, im offenen Meer schon
aus weiter Ferne riechen zu können angeben. Nach diesem würzigen Duft
seiner Heimatinsel sehnte sich auch Napoleon I. auf St. Helena vor
seinem Ende zurück. Das Gummiharz, das die Ciststräucher ausschwitzen,
war unter dem Namen ladanum oder labdanum früher ein
berühmtes, von orientalischen und griechischen Ärzten vielbenutztes
Heilmittel. Heute wird es nur noch zum Räuchern verwendet. An den
Wurzeln der Cistrosen schmarotzt die brennend gelbrote, große Blüten
ohne Blätter entwickelnde Rafflesiazee Cytisus hypocystis, der
nördlichste Vertreter der sonst auf die Tropen beschränkten Familie,
die in der auf Sumatra heimischen und von Elefanten verbreiteten
Rafflesia Arnoldi die größte Blüte der Welt mit 1 m
Durchmesser hervorbringt.
Ebenfalls sehr häufig in den Macchien ist die Mastixpistazie
(Pistacia lentiscus), die hier nur als Strauch auftritt,
während sie unter anderen Bedingungen, vor allem freistehend, zu
einem etwa 4,5 m hohen Baume emporwächst. Sie hat dunkelgrüne,
paarig gefiederte, lederartig zähe, oben glänzende Blätter, die
sich durch einen harzigen Geruch auszeichnen, und in roten Trauben
beieinanderstehende kleine Blüten. Die Frucht ist eine kugelige,
schwärzliche Steinfrucht. Als ein Hauptbestandteil der immergrünen
Macchien ist sie im ganzen Mittelmeergebiet heimisch und wird vielfach
kultiviert, so besonders im nördlichen Teile der Insel Chios, wo
durch Einschnitte in den Stamm und die Zweige der aus kleinen, weißen
oder gelben, durchscheinenden, in der Hitze wohlriechenden Körnern
bestehende Mastix gewonnen wird. Seinen Namen, im Griechischen
mastíchē (von mastázo ich kaue) hat er von der im Orient
von alters her besonders bei den Frauen gebräuchlichen Sitte, ihn zur
Kurzweil zu kauen, wie es die Nordamerikaner mit ihrem gum tun.
Er erweicht nämlich im Munde und[S. 624] soll das Zahnfleisch stärken und
den Atem parfümieren. Jährlich kommen etwa 500000 kg Mastix
im Werte von einer halben Million Mark in den Handel; bei uns findet
er vornehmlich zur Bereitung von Räucherpulver, Firnissen und Lacken
Verwendung. Das harte Holz dient zur Anfertigung von Zahnstochern und
Einlegearbeiten, aus den Blättern bereitet man in Algerien einen als
lentisque bezeichneten Gerbstoff und aus den Samen preßt man Öl.
Mit der Mastixpistazie ist die Terpentinpistazie (Pistacia
terebinthus) verwandt. Auch sie ist durch das ganze
Mittelmeergebiet verbreitet, entfernt sich aber mehr von der Küste
als die vorige Art und wird in Tirol noch bei Bozen angetroffen.
Sie wächst auf trockenen, sonnigen Hügeln, ist in den Macchien
gewöhnlich strauchartig, wird aber sonst zu einem kleinen Baum und
trägt auffallende, unpaarig gefiederte Blätter, große, aus zahlreichen
Blüten zusammengesetzte Trauben und kleine, dunkelrote Früchte. Durch
Einschnitte in die Rinde liefert sie den cyprischen Terpentin oder den
Terpentin von Chios, ein feines, flüssiges Harz, das besonders früher
als ein geschätztes Heilmittel verwendet wurde. An den Enden der Äste
entstehen durch die Stiche einer Blattlaus (Aphis pistaciae)
große bockshornartig gestaltete, dickwandige, harte, grünrote,
harzreiche Gallen, die 60 Prozent Gerbsäure und 15 Prozent Gallussäure
enthalten. Früher wurden auch sie als Medikament benutzt, doch dienen
sie heute fast nur noch zum Färben von Seide und Wein. Aus den angenehm
bitteren Samen, die in Griechenland heute noch als kokonetza
gegessen werden, preßt man ein fettes Öl.
Schon die Jugend der alten Perser wurde angehalten, im freien Felde
zu leben und sich von Terebinthenfrüchten, Eicheln und wilden Birnen
zu ernähren. Als der Mederkönig Astyages auf dem Throne sitzend sah,
wie sein Heer von den Scharen des Cyrus geschlagen wurde, rief er
entsetzt aus: „Wehe uns, wie tapfer sind diese terebinthenessenden
Perser.“ In Syrien und Palästina wird die Terpentinpistazie zu einem
stattlichen Baum, dem in den ältesten Zeiten göttliche Ehren gespendet
wurden. Schon Abraham schlug sein Zelt unter den Terebinthen Mamre zu
Hebron auf und baute dem Herrn daselbst einen Altar. Dort erschien
ihm der Herr und gab ihm seine Verheißung, er werde trotz des hohen
Alters der Sarah einen Sohn bekommen und ein großes Volk werde aus
ihm hervorgehen, das werde gesegnet sein unter allen Völkern. Die
Stätte, wo der Hain Mamre gestanden, wurde noch viele Jahrhunderte
nach Abrahams[S. 625] Tod als geweihter Ort verehrt, an welchem man Opfer
darbrachte und wo die Umwohner Markt abhielten. Eine andere heilige
Terebinthe war die des Jakob zu Sichem, unter der zu Josuas Zeit die
Bundeslade stand und von Josua ein steinerner Altar errichtet wurde.
Dort versammelten sich noch zur Zeit der Richter alle Männer von Sichem
und erhoben Abimelech zum König. Auch zu Gideon kam der Engel des Herrn
unter einer Terebinthe zu Ophra, und Gideon baute daselbst einen neuen
Altar, nachdem er die hölzerne Bildsäule der Aschera der Midianiter
umgehauen hatte. Endlich hat auch die Terebinthe zu Jabes historische
Berühmtheit durch ihre Erwähnung im Alten Testamente erlangt. In
späterer Zeit, als der Jahvekultus geistiger geworden war, stießen sich
die Propheten besonders an diesem sonst heidnischen Baumkult speziell
der Terebinthe, unter der auch die Toten — es sei hier nur an Rebekkas
Amme Debora erinnert — mit Vorliebe begraben wurden.
Während diese wärmeliebenden Kinder des Südens nicht zu uns gelangten,
ist die gemeine Roßkastanie (Aesculus hippocastanum)
einer unserer häufigsten Parkbäume geworden. Aesculus oder
esculus (vom lateinischen edere essen) hieß bei den alten
Römern die immergrüne Speiseeiche (Quercus aesculus), welchen
Namen Karl von Linné auf diesen, den Alten unbekannten Baum übertrug.
Hippokástanon, d. h. Pferdekastanie, nannte er sie, weil die
denjenigen der eßbaren Kastanie (Castanea vesca) ähnlichen Samen
von den Türken, gemahlen und unter das Futter vermengt, ihren Pferden
gegen Husten und Dämpfigsein (Schweratmen infolge Lungenemphysem)
mit gutem Erfolg gegeben werden sollen. Trotz der Ähnlichkeit der
Früchte hat aber die Roßkastanie, die zu den Sapindazeen oder
Seifenbaumgewächsen gehört, keinerlei Verwandtschaft mit der
Eßkastanie, die mit Eiche und Rotbuche die Familie der Fagazeen bildet.
Dieser 19–25 m hohe Baum mit den bekannten 5–7zählig gefingerten
Blättern und weißen, rot und gelb gefleckten Blüten hat, wie erst
neuerdings nachgewiesen werden konnte, seine Heimat in den Gebirgen
von Nordgriechenland, Thessalien und Epirus unterhalb der Tannenregion
in einer Meereshöhe von 1000–1300 m und wächst auch in der
Berglandschaft von Imeretien im Kaukasus wild. Die Türken brachten ihn
ums Jahr 1557 nach Konstantinopel, von wo 1576 der österreichische
Gesandte Freiherr von Ungnad die ersten Früchte nach Wien sandte.
Dort pflanzte Clusius die Roßkastanie zuerst im kaiserlichen Garten
und beschrieb Matthiolus die Pflanze als Castanea equina, auch
bildete er[S. 626] einen Fruchtzweig derselben ab. Erst um 1616 gelangte der
Baum von Konstantinopel nach Frankreich, von wo er sich, wie auch aus
Wien, über ganz Mitteleuropa verbreitete und so gemein wurde, daß er
hier heute der häufigste Schatten- und Alleebaum ist. Um die Mitte
des 19. Jahrhunderts wurde er auch in Nordamerika angesiedelt und
fand hier ebenfalls weite Verbreitung, da er sehr rasch wächst, durch
seine weit ausgebreitete, dichte Krone ausgiebigen Schatten spendet,
durch seine prächtigen Blütenkerzen im Frühjahr das Auge erfreut und
im Herbst die großen, glänzendbraunen Samen liefert, die 60 Prozent
Nährstoffe, darunter 40 Prozent Stärkemehl enthalten. Trotzdem haben
sie als menschliches Nahrungsmittel bis jetzt keine Verwendung
gefunden, da sie durch einen ziemlichen Gehalt an Saponin unangenehm
schmecken. Dieser kann nun durch Behandeln mit Alkohol entfernt werden,
wodurch man ein wertvolles Nährpräparat beziehungsweise Stärkemehl zur
Spiritusfabrikation gewinnt. Unverändert bilden sie ein treffliches
Viehfutter, das durch den Gerbstoffreichtum der Schale ein treffliches
Gegenmittel für die unvermeidlichen Folgen der Fütterung mit
Grünfutter bildet. Sie lassen sich leicht aufbewahren, indem man sie
an einem luftigen Ort gut trocken hält; doch dürfen sie nicht zu hoch
aufeinander liegen, da sie dann schwer trocknen und leicht schimmeln.
Die hart gewordene Frucht läßt man vor dem Verfüttern 24 Stunden in
Wasser aufquellen, wodurch ihre Bitterkeit teilweise verschwindet. Aus
den rohen Samen kann man einen trefflichen Kleister für Buchbinder
und Tapezierer bereiten, der den Vorteil hat, wegen seiner Bitterkeit
vor der Einnistung von Insekten geschützt zu sein. Aus den zu Kohle
verbrannten Schalen gewinnt man eine ganz schöne schwarze Farbe. Die
Blüten sind eine sehr ergiebige Bienenweide; das gelblichweiße oder
rötliche, weiche und schwammige Holz dagegen ist wenig als Werkholz
geschätzt, da es grobfaserig ist und leicht fault. Trotz ihrer langen
Züchtung hat die Roßkastanie keine nennenswerten Spielarten oder
Kulturformen hervorgebracht.
Kleiner als sie und mit röhrigem statt glockigem Kelch, mit
zusammengeneigten statt wie bei jener ausgebreiteten Blumenblättern
ist die schmutzigrot blühende rote Pawie (Pawia rubra),
ein aus dem südwestlichen Nordamerika bei uns eingeführter Zierbaum
von nur 4–7 m Höhe und glatter brauner statt stacheliger grüner
Samenkapsel. Letztere sind gleich den Blättern und Samen giftig
und deshalb unbrauchbar als Viehfutter, was bei der altweltlichen
Roßkastanie nicht der Fall ist. Mit ihren zerriebenen und zu einem
Teige geformten[S. 627] Früchten betäubt man beim Fischfang die Fische. Die
zerstoßene und gekochte Wurzel und Rinde enthält viel Saponin und
wird in Amerika statt Seife zum Waschen von Wollzeug gebraucht. Ihren
Namen erhielt sie zu Ehren des um die Mitte des 17. Jahrhunderts als
Professor der Botanik in Leiden verstorbenen Peter Paw. Sie wird bei
uns recht selten angepflanzt und bildet nur selten größere Bäume. Sehr
häufig dagegen treffen wir in den Gärten und Anlagen die rotblühende
Kastanie (Aesculus carnea), ein Kreuzungsprodukt der
altweltlichen Roßkastanie mit der neuweltlichen Pawie. Der Bastard hält
in seinen Merkmalen so ziemlich die Mitte zwischen seinen Eltern inne.
Seine rote Blumenkrone ist nicht ausgebreitet wie bei der Roßkastanie,
sondern leicht zusammengeneigt und die bräunlichgrüne Fruchthülle nur
spärlich bestachelt. Er wird größer als die Pawie, wenn auch nicht so
groß wie die Roßkastanie; er wächst nicht so schnell wie letztere,
blüht auch 2–3 Wochen später als diese. Da die rotblühende Kastanie
durch Pfropfung auf den jungen Stamm der gemeinen Roßkastanie vermehrt
wird, aber weniger in die Dicke wächst als diese, so entsteht meist
eine sehr auffallende Stammform, indem sich dieser an der Pfropfstelle
plötzlich verschmälert, eine Erscheinung, die man nicht selten auch bei
Obstbäumen, besonders Apfelbäumen — aus derselben Ursache entstanden
— beobachtet.
Etwas größer als die rote Pawie wird die gelbblühende Pawie
(Pawia lutea) mit langen gelben Blumenblättern und
unbehaarten Staubbeuteln, während die glattblätterige Pawie
(P. glabra) mit kurzen gelben Blumenblättern und behaarten
Staubbeuteln kleinwüchsig ist. Diese sind ebenfalls Bewohner des
südwestlichen Nordamerika und lassen sich am Laube nur schwer
voneinander unterscheiden. Durch schlankere Form der glatten Blättchen
zeichnet sich bloß die strauchartige kleinblütige Roßkastanie
(Aesculus parviflora) aus den Bergwäldern des östlichen
Nordamerika aus. Sie blüht später als die andern Arten und an den erst
im Sommer erscheinenden auffallend langen und schmalen Blütenrispen
treten die Staubfäden weit aus den großen, weißen Blüten heraus.
An allgemeiner Beliebtheit als prächtiger Schattenbaum wetteifert mit
der Roßkastanie die Platane. Sie wächst rasch, bildet einen
mächtigen Stamm mit kraftvoll ausgestreckten Ästen und hellgrünen,
gelappten, handnervigen Blättern, die, wie diejenigen der Roßkastanie,
im Herbst abgeworfen werden. Sie vereinigt die Schnellwüchsigkeit
der Pappel mit dem Brennwert der Buche, weshalb es sich empfiehlt,[S. 628]
sie besonders als Alleebaum anzupflanzen. Die dunkle, in beständiger
Erneuerung begriffene Borke des Stammes blättert fortwährend in
regellosen Stücken ab, so daß die jüngere, hellgefärbte Rinde zutage
tritt und der Stamm malerisch gefleckt erscheint. Unscheinbar hängen
die kleinen gelben männlichen und tiefroten weiblichen Blüten getrennt
am Baume, bevor die Blätter zum Vorschein kommen. Aus letzteren gehen
zu beinahe nußgroßen Kugeln vereinigte Früchte hervor, die noch im
Winter am Baume pendeln. Aus ihnen lösen sich die mit zarten Flughaaren
versehenen Früchte ab, um vom Winde verbreitet zu werden. Da der Baum
sich leicht in den Ästen zurückschneiden läßt, wird er vielfach stark
gescheitelt. Wer aber nur die mißhandelten, durch übermäßiges Stutzen
nieder und breit gehaltenen Bäume, wie sie vielfach vor den Gasthäusern
und in den Biergärten zu sehen sind, kennt, der ahnt nicht, welche
Schönheit die Platane da entfaltet, wo man ihr frei und unbehindert
ihre breit ausladenden Äste aus dem schlanken Stamme herauszustrecken
erlaubt.
Das Geschlecht der mit den Feigen-, Brotfrucht- und Ulmenbäumen zu
den Nesselgewächsen gehörenden Platanen besaß zur Tertiärzeit mit den
ihnen sehr nahe verwandten Liquidambarbäumen eine viel ausgedehntere
Verbreitung als heute. Während des mittleren und oberen Tertiärs
waren sie durch ganz Europa, Nordasien und Nordamerika bis weit
über den Polarkreis hinaus verbreitet und wuchsen sogar in Grönland
und auf Spitzbergen. Vom spättertiären Platanus aceroides
dürften die beiden heute noch existierenden und in der Kulturwelt
angepflanzten, 10–20 m hohen Platanenarten stammen: die
morgenländische Platane (Pl. orientalis) der Alten
Welt und die abendländische Platane (Pl. occidentalis)
von Nordamerika. Erstere hat stärker gelappte Blätter mit grünen
Blattstielen und ein mehr in die Breite wachsendes Astwerk, während
letztere nur schwach gelappte, unterseits flaumhaarige Blätter mit
braunen Blattstielen besitzt und ihre Zweige mehr aufrecht stellt.
Da die neuweltliche Platane die Winterkälte viel besser erträgt
als die dagegen weit empfindlichere altweltliche, wird sie in
Mitteleuropa häufiger als jene angepflanzt. Doch ist die bei uns fast
ausschließlich gepflanzte Form das Kreuzungsprodukt beider Arten,
die ahornblätterige Platane (Pl. acerifolia), die der
amerikanischen Form näher steht und wie diese winterhart ist. Ihre
Vermehrung erfolgt stets durch Stecklinge.
Die morgenländische Platane findet sich an Gebirgsbächen in Wäldern
unterhalb der Cedernregion bis zu 1600 m Höhe vom Hima[S. 629]laja
bis Griechenland und Makedonien, auch auf Zypern, dem südlichen
Anatolien und Persien. Sie hieß bei den Griechen plátanos,
von platýs breit, weil sie ihre Äste weit ausreckt. Schon in
der Ilias wird sie erwähnt. Als nämlich die Griechen sich mit ihren
Schiffen in der Stadt Aulis am Euripos in Böotien zum Zuge nach Troja
sammelten, da lagerten sie sich „an einer Quelle unter einer schönen
Platane.“ Nach Homer erwähnt dann der Dichter Theognis aus Megara um
560 v. Chr. einen Platanenhain in Lakonien, der an einem Teiche stand,
mit dessen Wasser ein Winzer seine Reben tränkte. Durch ihre Größe
und durch ihr Alter ehrwürdige Exemplare galten den Umwohnern als
heilig. Solche heilige Platanen werden uns von alten Schriftstellern
aus Lykien und Karien in Kleinasien erwähnt. Eine ähnliche Sitte muß
auch in Persien geherrscht haben; denn Herodot berichtet uns vom
persischen Großkönig Xerxes, daß, als er auf seinem Kriegszuge gegen
Griechenland 485 v. Chr. auf dem von Phrygien nach der Hauptstadt von
Lydien, Sardes, führenden Wege eine prächtige Platane traf, „er ihr
einen goldenen Schmuck schenkte und einen besonderen Wächter für sie
einsetzte.“ Bis in unsere Zeit findet man in Persien, Kleinasien und
Griechenland solche ehrwürdige alte Platanen von einer Höhe von
30 m und einem Stammumfang bis 16 m, deren ausgehöhlter
Stamm Hirten und Jägern zu vorübergehendem Aufenthalte dient. Auch
der Grieche Pausanias, der im 2. Jahrhundert n. Chr. den Bädeker des
Altertums schrieb, weiß auf seiner Wanderung durch Griechenland und
Kleinasien hin und wieder von solchen Riesenplatanen zu erzählen, die
noch mit der Heroenzeit in Verbindung gebracht wurden. So berichtet
er von der bei Kaphyai in Arkadien wachsenden hohen und herrlichen
Menelais, so genannt, weil sie, nach der Sage der Umwohner, vom Könige
Menelaos selbst vor der Abfahrt nach Troja an der betreffenden Quelle
gepflanzt worden sein soll. Und beim Flusse Pieros bei Pharai in Achaja
sah er Platanen von solcher Größe, daß man in der Höhlung der Stämme
einen Schmaus halten und nach Belieben darin auch schlafen konnte.
Der griechische Pflanzenkundige Theophrast im 4. Jahrhundert v. Chr.
sagt: „In Griechenland wächst die Platane an einigen Stellen sehr
häufig. Am Adriatischen Meere dagegen sollen kleine Platanen wachsen,
ausgenommen beim Heiligtum des Diomedes (auf der Insel Diomedea an der
apulischen Küste). In ganz Italien soll der Baum selten sein, obgleich
es reich an Flüssen ist; das dortige Klima ist ihm nicht günstig. Der
ältere Dionysios (431–367 v. Chr.), der Tyrann,[S. 630] hatte einige Platanen
in einen Garten bei Rhegion (das er 387 erobert hatte) gepflanzt, wo
man sie jetzt in der Ringschule sieht; aber sie wollen trotz aller
Pflege nicht recht gedeihen. Auf Kreta soll bei Gortyna eine Platane
stehen, welche ihr Laub nicht abwirft, während alle benachbarten es
abwerfen. Eine ähnliche soll auf Zypern stehen.“
Zweifellos ist die Platane durch Griechen zuerst nach Unteritalien
und von da später nach Mittelitalien zu den Römern gekommen, die
zugleich mit dem Baum deren griechische Benennung übernahmen. Zu
Ende der römischen Republik war es eine Liebhaberei der Vornehmen,
raschwüchsige Platanen in den Gärten ihrer Villen anzupflanzen und
sie, statt mit Wasser, mit Wein zu begießen, da ein Aberglaube solchen
Trank den Fremdlingen heilsam erklärte. So wird beispielsweise vom
berühmten Redner Hortensius berichtet, er habe einmal bei einer
Gerichtsverhandlung seinen Kollegen Cicero gebeten, mit ihm die Reihe
im Reden zu tauschen, da er notwendig auf seine Villa nach Tuskulum
hinaus müsse, um seine Platane eigenhändig mit Wein zu begießen. Mit
Vorliebe ruhte man in der Kaiserzeit im Schatten solcher liebevoll
aufgezogener Platanen und gab sich, wie die römischen Dichter es
mehrfach besangen, der Ruhe und dem Genusse des Weines hin. So
bezeichnet Ovid die Platane als einen dem Lebensgenuß dienenden Baum,
und Horaz empfindet es als eine Entweihung des heiligen Bodens,
die fruchtspendende Erde statt mit einem nützlichen Obstbaum mit
solch einem nutzlosen Schönheitsbaum zu bepflanzen. Auch Plinius
bemerkt in seiner Naturgeschichte: „Die Platane (platanus)
ist wunderbarerweise nur ihres Schattens wegen aus weiter Ferne zu
uns verpflanzt worden. Erst wurde sie über das Ionische Meer auf die
Insel des Diomedes gebracht, um des Helden Grab zu beschatten; von da
gelangte sie nach Sizilien und von dort endlich nach Italien. Jetzt
steht sie sogar im Lande der Moriner (am belgisch-französischen Strand
— doch ist dies wohl eine Verwechslung mit dem nordischen Ahorn,
den Plinius selbst den gallischen oder weißen Ahorn nennt), also auf
zinspflichtigem Boden, so daß auch ihr Schatten versteuert werden muß.
— Die Platanen sind jetzt zu so hohen Ehren gekommen, daß sie nun
sogar mit reinem Wein begossen werden. Die Erfahrung lehrte, daß der
Wein den Wurzeln gut bekam, und so hat man sie denn in der Kunst des
Weintrinkens unterrichtet.
In früherer Zeit waren die Platanen der Akademie in Athen berühmt,
deren 33 Ellen lange Wurzeln noch über die Zweige hinausgingen. Jetzt
ist eine Platane in Lykien berühmt. Sie steht bei einer[S. 631] lieblichen,
kühlen Quelle, neben einer Straße. Ihr Inneres gleicht einem Hause;
denn sie ist hohl und ihre Höhlung mißt 81 Fuß. Ihr Wipfel gleicht
einem Haine, ihre langen Äste gleichen Bäumen und werfen ihre Schatten
weithin über die Felder. Ihre Höhlung ähnelt einer Felsengrotte,
enthält auch rings eine Bank von bemoostem Tuffstein. Sie ist so
wunderbar, daß Licinius Mutianus, der dreimal Konsul und noch neulich
Legat in Lykien war, für die Nachwelt die Bemerkung hinterließ, er
habe mit 18 Begleitern im Baume einen Schmaus abgehalten. Zu Polstern
habe man das Laub des Baumes genommen. Vor jedem Windhauch war die
Gesellschaft sicher. Dann habe er noch im Baume geruht und sei da
besser aufgehoben gewesen, als in Sälen mit schimmernden Marmorwänden,
bunten Gemälden und vergoldeten Prachtdecken.
Zu Gortyna auf der Insel Kreta steht eine Platane, die in griechischen
und lateinischen Schriften besprochen wird; unter ihr soll nach
der Sage selbst Jupiter einst geruht haben. Sie besitzt die
Eigentümlichkeit, ihre Blätter nie zu verlieren. Junge Platanen, die
man von ihr auf Kreta zog, haben diesen Fehler ihres Stammbaumes
beibehalten; denn es ist ja ein Vorzug jedes Baumes, wenn er im Winter
die Sonnenstrahlen durchläßt. Unter der Regierung des Kaisers Claudius
(41–54 n. Chr.) hat Aeterninus, der Freigelassene des Marcellus, diese
Platanensorte auf seine Güter bei Rom verpflanzt. Diese ausländischen
Wunder stehen noch jetzt in Italien neben anderen, die in diesem Lande
selbst durch Kunst erzeugt wurden. — Durch eigentümliche Fortpflanzung
und Beschneidung zwingt man die Platanen zu unglückseligen
Verkrüppelungen. Ganze solche Krüppelwälder stammen von ihrem Erfinder,
dem Ritter Gajus Matius, einem Freunde des Kaisers Augustus.“
Heute wäre der Ahorn noch vor der Roßkastanie dazu berufen, als
Alleebaum im Innern der Städte die bisher dazu bevorzugten Linden zu
verdrängen, die gegen die zahlreichen sie treffenden Schädigungen
besonders empfindlich sind und deshalb sehr leicht eingehen, wenn
sie nicht von alters her standen und schon stark genug waren, um den
modernen Gefahren, besonders den Ausströmungen von Leuchtgas, zu
trotzen. Wie wenige der zahlreichen Lindenalleen und Gruppen alter
Linden bleiben am Leben, wenn die wachsende Stadt sie erreicht.
Nicht nur ist die Linde (Tilia) dem Deutschen durch
Sage und Sitte teuer, sondern auch wegen ihres schnellen Wachstums,
ihrem dichten Schatten und dem angenehmen Duft ihrer Blüten. Sie
bildet bei uns[S. 632] keine reinen Waldbestände, sondern findet sich auch
im Walde immer nur einzeln; dagegen wächst sie in den russischen
Ostseeprovinzen in größeren Beständen. Überall in Deutschland
ist die kleinblätterige oder Winterlinde (Tilia
parvifolia) mit beiderseits kahlen, unterseits meergrünen, schon
Mitte Mai ausschlagenden Blättern und einem größeren Blütenreichtum
die gemeinere, während die schon anfangs Mai ihr Laub hervortreibende
großblätterige oder Sommerlinde (T. grandifolia)
mit unterseits kurzbehaarten, beiderseits grünen Blättern und weniger
zahlreichen Blüten häufiger angepflanzt wird, da sie eine größere
Stärke und ein höheres Alter erreicht. Die guten Eigenschaften beider,
Blattgröße und Blütenreichtum, vereinigt ein durch Kreuzung beider
Arten gezogener Bastard, noch mehr aber eine andere Gartenform, die
als Kreuzung zwischen Winterlinde und der besonders großblätterigen
nordamerikanischen Schwarzlinde (T. americana) aus Kanada
aufzufassen ist. Größere Bedeutung hat von fremden Arten außer der
abendländischen Silberlinde (T. alba) aus Nordamerika
mit auf der Unterseite schwachbehaarten Blättern und großen Blüten
hauptsächlich die in Ungarn, der Türkei, in Griechenland und Kleinasien
heimische morgenländische Silberlinde (T. argentea), die
philýra der alten Griechen, von der Plinius sagt, daß man sie
zum Binden von Kränzen gebrauche und seit alter Zeit in Ehren halte.
Der niedere Baum ist durch seine wunderbar regelmäßige, eiförmige
Krone von unterseits dicht weißfilzigen Blättern ein ganz besonderer
Parkschmuck und hat zudem den Vorzug, erst anfangs Mai zu blühen, wenn
die einheimischen Linden schon längst verblüht haben. Er verlängert
also die Herrlichkeit der Lindenblüte um einen vollen Monat, was nicht
nur der Naturfreund, sondern auch der Imker zu schätzen weiß. Die nicht
selten gepflanzte grüne Linde (T. euchlora) aus dem
Orient ähnelt der Winterlinde, trägt aber größere, nicht rostfarbene
Bärtchen in den Aderwinkeln wie sie, sondern graue Haare und bleibt im
Herbste länger grün.
Statt der Linden werden in den Straßen unserer Städte, wie auch auf
Dorfplätzen vielfach Ulmen oder Rüstern (Ulmus,
aus dem Keltischen elm) angepflanzt. Wenn ihnen auch der Reiz
des Blütenduftes fehlt, so sind sie dafür widerstandsfähiger gegen
die Gefahren der Großstadt; doch dürfen sie nicht zu nahe an die
Häuserreihen angepflanzt werden, da ihre Wurzeln mit Vorliebe in die
Grundmauern dringen und da eine bedeutende Sprengwirkung ausüben
können. Leider werden deren Blätter sehr häufig von Blattläusen
besiedelt und[S. 633] durch allerlei Gallen verunstaltet. Von unseren
heimischen Arten ist die Feldulme (Ulmus campestris)
mit kurz zugespitzten, eiförmigen Blättern weniger verbreitet als
die Bergulme (U. montana) mit verkehrteiförmigen, lang
zugespitzten Blättern. Beide bilden mancherlei Spielarten, von denen
besonders die hängenden Formen für kleine Gärten sehr geeignet sind,
in denen sie mit ihrer dichten, nach allen Seiten überhängenden
Schirmkrone jede künstliche Laube überflüssig machen. Daneben finden
sich Formen mit streng pyramidenförmigem Wuchse, bei andern ist
das Laub dunkelrot oder weißgefleckt oder eigenartig gekräuselt.
Bei den alten Griechen hieß die auch in Südeuropa noch gedeihende
Feldulme pteléa, bei den Römern dagegen ulmus, und
wurde hauptsächlich gepflanzt, um den Weinreben als Stütze zu dienen.
Mit Ulmenstöcken peitschten die Alten ihre Sklaven, wenn sie sich
etwas hatten zuschulden kommen lassen. Ihr Holz, das in bezug auf
Dauerhaftigkeit dem Eichenholze kaum nachsteht, eignet sich vorzüglich
als Bau- und Werkmaterial. Da es sich nicht wirft, wurden aus ihm
nach Theophrast besonders Türen angefertigt. Columella unterscheidet
außer der inländischen eine gallische Ulme, die er atinia nennt und
vorzugsweise anzupflanzen rät, da sie üppiger als die italienische
wachse und ihr Laub vom Rindvieh viel lieber gefressen werde. Deshalb
diente sie den Alten als wichtigster Futterbaum und wurde als solcher
nie aus Samen gezogen, sondern durch Wurzelsprossen vermehrt. Außer
den altweltlichen Ulmen werden in unsern Anlagen auch noch einige
amerikanische Arten, wie Ulmus americana und fulva,
angepflanzt. Zu ihnen kam neuerdings die japanische Ulme
(Zelkowa keaki), die ein treffliches Nutzholz liefert. Sie
ist daran erkenntlich, daß ihr scharf gezacktes Laub im Herbst sich
prächtig rot färbt und so einen überaus malerischen Anblick gewährt.
Den Ulmen nahe verwandt ist die als Zierstrauch bei uns angepflanzte
hainbuchenblätterige Planere (Planera carpinifolia),
nach dem Erfurter Professor Joh. Jakob Planer (1743–1789) so
genannt. Sie ist im Kaukasus heimisch, gleicht den Ulmen, hat aber
ungeflügelte Samen. Ebenso wird in unsern Anlagen der winterharte
nordamerikanische Zürgelbaum (Celtis occidentalis)
kultiviert, der sich von den echten Ulmen hauptsächlich durch seine
Früchte unterscheidet. Diese sind kirschenähnliche, orange- bis
braunrotgefärbte, säuerlich schmeckende Steinfrüchte. Größere,
schwarze, süßliche Früchte hat der ihm sonst ähnliche nordafrikanische,
auch noch in Südeuropa wildwachsende gemeine Zürgelbaum
(C. australis), der in Oberitalien und Süd[S. 634]tirol nicht selten
angetroffen wird, zumal sein festes Holz von der Landbevölkerung zu
Peitschenstöcken und Blasinstrumenten begehrt wird; bei uns gedeiht er
aber nur in den wärmeren Lagen.
Gleichfalls in Südeuropa regelmäßig angebaut, um das Laub den
Seidenraupen zu verfüttern, wird der ostasiatische weiße
Maulbeerbaum (Morus alba). Bei uns wird er neben dem
westasiatischen schwarzen Maulbeerbaum (M. nigra) mit
schwarzvioletten statt wie bei jenen weißen, süßlich sauer schmeckenden
Früchten als Zierbaum in Parks angepflanzt, kommt aber auch nur in
wärmeren Lagen fort. Ebenso verhält es sich mit dem aus dem südlichen
Nordamerika als Zierbaum bei uns eingeführten amerikanischen
Amberbaum (Liquidambar styraciflua) mit handförmig gelappten
Blättern. In seiner Heimat liefert er durch Auskochen der zerkleinerten
Zweige den zu Ofenlack und Räucherkerzen verwendeten weißen Liquidambar.
Sehr beliebte Parkpflanzen sind auch die verschiedenen
Ahornarten (Acer), deren doppelte Flügelfrucht die Kinder
als Nasenreiter benutzen. Sie sind am nächsten mit den Roßkastanien
verwandt und besitzen verschieden gelappte Blätter. Mehr in der Ebene
und auf niedrigem Gebirge bis zu einer Höhe von 1100 m wächst
der spitzblätterige Ahorn (Acer platanoides), auch
deutscher Zuckerahorn genannt, da sein Frühjahrssaft Zucker
gibt, dessen Gewinnung indessen nicht lohnt. Er ist ein allgemein
beliebter Alleebaum, der im Harze bis zu 450 m hinaufgeht und
hier die Nordgrenze seiner Verbreitung in Deutschland erreicht. Dagegen
ist der ebenfalls 20–25 m Höhe erreichende Bergahorn
(Acer pseudoplatanus) ein echter Gebirgsbaum, der auf den
Alpen bis 1600 m gefunden wird, nördlich bis Dänemark und
Gothland geht und bei uns als einer der schönsten Bäume in Parkanlagen
kultiviert wird. Sein Saft enthält ebenfalls Zucker, der aber nicht
ausgebeutet wird. Sein hartes, weißes Holz mit vielen bräunlichen
Spiegeln nimmt sehr leicht Politur an und ist als Werkholz geschätzter
als das mehr gelbliche, weniger feine des spitzblätterigen Ahorns. Von
ihm sind mehrere Spielarten mit weißgescheckten, gelb panachierten
und dunkelroten Blättern vorhanden. Letztere Form ist nicht zu
verwechseln mit dem ebenfalls bei uns kultivierten nordamerikanischen
Rotahorn (A. rubrum), der den Namen von den schon im
April vor dem Erscheinen der dreispitzigen grünen Blätter erscheinenden
roten Blüten erhielt. Als Ziersträucher pflanzt man den oft nur
3 und nur ausnahmsweise 10 m hoch werdenden einheimischen
Feldahorn (A. campestre) und den nur 2,5–3 m hohen
südfranzösischen[S. 635] Ahorn (A. monspessulanum, d. h. von
Montpellier), der an felsigen Orten am Mittelrhein wild wächst.
Sehr häufig findet sich bei uns auch der 1734 durch Collinson zuerst
nach England gebrachte und von da auf den europäischen Kontinent
herübergekommene nordamerikanische Zuckerahorn (A.
saccharinum), der seinen Namen davon hat, daß sein Frühjahrssaft
auf Zucker verarbeitet wird. Er hat unserm Spitzahorn ähnliche, nur
unten statt glatte grüne, leicht behaarte, bläulichgrüne Blätter, die
im Herbst eine prachtvolle orangerote Färbung annehmen, woran der
Baum leicht zu erkennen ist. Trotz seiner Schönheit und Winterhärte
hat aber dieser Zuckerahorn bei uns nicht die Verbreitung gefunden,
die er verdient, wohl weil ihm frühzeitig schon in dem nicht minder
prächtigen, ebenfalls bereits im 18. Jahrhundert aus Nordamerika
bei uns eingeführten Silberahorn (A. dasycarpum)
mit außerordentlich zierlichem, tiefeingeschnittenem, unterseits
silberhaarigem Laub ein gefährlicher Mitbewerber entstand. Auch unsere
Mistel (Viscum album) hat bereits von dem schönen
Fremdling Besitz ergriffen, ja, sie ist auf wenigen Bäumen so häufig
wie auf dem Silberahorn. Er hat eben ein sehr weiches Holz, so daß er
wegen des geringen Holzwertes nicht für den Anbau im Walde in Betracht
kommt, während der Zuckerahorn dafür vielfach empfohlen wird.
Auch der nordamerikanische, ebenfalls zur Zuckergewinnung benutzte
schwarze Ahorn (A. nigrum) ist häufig in unsern Anlagen
zu treffen; ebenso der strauchartige, in ganz Rußland, besonders an
der Wolga, wildwachsende tatarische Ahorn (A. tataricum)
mit herzförmigen, gesägten Blättern und lange nach diesen in dichten
Rispen hervorbrechenden weißen Blüten, die unsern Ahornarten ähnliche
rote Früchte hervorgehen lassen, und der sich durch dreiteilige Blätter
mit langem Mittellappen von ihm unterscheidende mandschurische
Ahorn (A. ginnala). Südeuropa lieferte uns die ebenfalls
strauchartigen Acer italicum und A. creticum. Diese
nannten die Griechen sphéndamnos, während die Römer unter
acer wohl den noch in Norditalien vorkommenden Spitz- und
Bergahorn verstanden. Aus dem lateinischen Eigenschaftsworte
acernum (ahornen) soll die deutsche Bezeichnung Ahorn entstanden
sein.
Am meisten vom Ahorntypus weichen die Blätter des ebenfalls aus
Nordamerika in unsere Anlagen gebrachten, bis 12 m hohen
zweihäusigen Eschenahorns (Acer negundo) ab. Sie sind
3–5zählig gefiedert, haben aber gleichwohl keine besondere Ähnlichkeit
mit dem[S. 636] Eschenblatte. Dieser Baum wird in seiner Heimat nächst
dem Zuckerahorn am meisten zur Zuckergewinnung benutzt und weist
verschiedene Spielarten mit weißbunten und gelbbunten Blättern auf.
Diese panachierten Formen werden bei uns noch viel häufiger als die
normale Form des Eschenahorns kultiviert. Die kronenlosen Blüten
erscheinen lange vor dem Ausbruch der Blätter, und die in langen,
schlaffen Trauben herabhängenden Doppelfrüchte sind sehr klein und ihre
Flügel krümmen sich so weit gegeneinander, daß sie sich am freien Ende
nahezu berühren.
Prächtige Zierbäume unserer Anlagen bilden auch die verschiedenen
Arten von Eschen (Fraxinus). Die in feuchtem Humus-,
nicht aber auf Sandboden gedeihende gemeine Esche (Fraxinus
excelsior), die melía der Griechen und der fraxinus
der Römer, spielt in der nordischen Mythologie eine große Rolle. Sie
ist der mit seinen weitreichenden Wurzeln alles umfassende Weltenbaum
Ygdrasil, und der altgermanischen Sage nach ging aus ihr der Mann
hervor, während aus der Erle das Weib entstand. Bei den alten Deutschen
hieß nach der Esche ask der allgemein benutzte (eschene) Speer
asks. Noch im Mittelalter pflanzte man in der Nähe der Burgen
Eschen an, um aus ihrem Holze Lanzenschäfte, Streitaxtstiele und
andere Waffenteile und Geräte anzufertigen. Schon in der Ilias ist der
eschene Speerschaft der vorzugsweise gebräuchliche. Da ihr Laub vom
Vieh, besonders von Schafen und Ziegen, gerne gefressen wird, pflanzte
man sie nach Columella bei den Römern in besondern Plantagen an. Außer
der gewöhnlichen Form werden in unsern Gärten verschiedene Zierformen
derselben gezogen; so die Traueresche mit im Bogen abwärts
gekrümmten Seitenästen. Sie wird häufig in der Weise verwertet, daß
solche Hängezweige auf einen 2–3 m hohen Stamm gepfropft werden,
so daß mit der Zeit eine dichte, nach allen Seiten gleichmäßig abwärts
gewölbte Schirmlaube entsteht, für die ein weiteres Höhenwachstum
natürlich ausgeschlossen ist. Dann die Goldesche mit goldgelb
gescheckten, die Krausesche mit faltig gekräuselten Blättern,
eine einfachblätterige Spielart mit der eiförmigen, ungeteilten Urform
des Blattes mit allen Übergängen zum fiederteiligen Eschenblatte und
eine solche mit weißgescheckten Blättern.
Von fremden Eschen begegnen wir am häufigsten der auch in unsern
Wald eingeführten Weißesche (Fraxinus americana), die
durch rostbraune Knospen und gelbliche Triebe kenntlich ist, der
pennsylvanischen oder Rotesche (Fr. pennsylvanica)
und der Schwarzesche[S. 637] (Fr. nigra), alle drei aus dem
atlantischen Gebiete Nordamerikas. Ebenso finden wir als Zierbaum in
unsern Anlagen die 6–9 m hohe südeuropäische Blumen-
oder Mannaesche (Fr. ornus) mit dreipaarig gefiederten
Blättern und unverkümmerten, sondern als Kelch und Blumenkrone
vierspaltig ausgebildeten weißen oder rötlichen Blüten. Aus ihrer Rinde
fließt durch das Anstechen der Mannazikade, am häufigsten aber durch
täglich ausgeführte Kreuzschnitte ein süßer, an der Luft erhärtender
Saft, der getrocknet den Mannazucker liefert, welcher in großer Menge
von Südeuropa, besonders von Sizilien und Kalabrien, wo der Baum
in großen Plantagen angebaut ist, in den Handel gebracht wird, um
besonders als gelindes Abführmittel für Kinder zu dienen.
Nahe mit den Eschen verwandt sind die Forsythien, der Jasmin und der
Flieder. Die erstgenannten haben ihren Namen vom englischen Botaniker
W. A. Forsyth, der 1791 über Krankheiten der Bäume und 1802 über die
Kultur der Obstbäume schrieb, und stammen aus China und Japan. Die bei
uns häufigste Art ist die zu Frühjahrsbeginn, oft schon im März, ihre
großen, vierzipfligen, gelben Blüten vor dem Ausbrechen der einfachen,
leichtgesägten Blätter hervortreibende hängende Forsythia
(F. suspensa) mit anfangs aufstrebenden, später überhängenden
braunen Zweigen. Seltener ist die gegen Kälterückschläge empfindlichere
grüne Forsythie (F. viridissima) mit grünen Zweigen, an
denen die Blätter fast gleichzeitig mit den ebenfalls gelben Blüten
erscheinen. Wie sie stammt auch als weiterer Frühblüher der mit ihr
verwandte gelbe Jasmin (Jasminum nudiflorum), den man
in geschützten Lagen häufig mit ihr zusammen antrifft, aus China.
Dessen grüne, vierkantige Zweige schmiegen sich gern an Mauern und
Zäune an. Die dreiteiligen Blättchen brechen erst hervor, wenn die an
Schlüsselblumen erinnernden gelben Röhrenblüten verblüht haben.
Ähnliche, nur viel kleinere, dafür aber viel zahlreichere, in
Rispen vereinigte, sehr wohlriechende, meist violette Blüten
hat der gemeine Flieder (Syringa vulgaris), auch
türkischer oder spanischer Flieder und nach der
türkischen Benennung der Pflanze lilas auch Lila genannt.
Dieser 3–7 m hohe Strauch mit herzförmigen Blättern und den
schönen, angenehm duftenden „Lilablütensträußen“ stammt aus Vorderasien
und ist schon so lange in Kultur, daß von ihm eine Menge auch weiß und
rötlich blühender Varietäten gezüchtet wurden. Ja, es gibt von ihm
sogar eine gefüllte Form, die der Gärtner Lemoine in Nancy zuerst in
den Handel brachte; dieselbe stammt von[S. 638] einem ungefüllten Flieder und
entstand als Sprungvarietät im Garten eines Privatmannes in Luxemburg,
von dem sie Lemoine erwarb. Dieser im modernen Park wie im altmodischen
Bauerngarten gleich beliebte Zierstrauch stammt von einem Exemplar,
das Ghislenius Busbequius, der Gesandte Kaiser Ferdinands I., 1560
aus der Türkei zuerst nach Wien brachte. Seitdem ein französischer
Gärtner in Vaugirard bei Paris vor 60 Jahren durch Zufall fand, daß
sich beim Flieder leicht die winterliche Ruhezeit abkürzen läßt, so daß
er schon im Winter wieder zum Blühen gebracht werden kann, wird er in
ausgedehntem Maße „getrieben“. Hierzu dient entweder vorübergehendes
Betäuben durch Ätherisieren, d. h. Einwirkenlassen von Ätherdämpfen,
oder eine genau abgestimmte Hitzewirkung, meist ein Bad in warmem
Wasser. Jetzt ist die Fliedertreiberei besonders in Frankreich sehr
ausgedehnt. So bringt beispielsweise eine einzige Gärtnerei bei Paris
von Mitte November bis zum Mai 100000 Fliederpflanzen zum Treiben. Zur
Anzucht dieser gewaltigen Pflanzenmasse dient eine Baumschule von 80
Hektaren, in welcher die Stecklinge bis zum 5. bis 9. Jahre gezogen
werden. Dann kommen die Fliederbüsche in ausgedehnte Treibhäuser, wo
sie bei 28–30° C. zuerst im Dunkeln gehalten werden. Man läßt
an jedem Zweig nur 2–4 Blütenknospen und 2 Blattknospen stehen und
entfernt alle übrigen Knospen, damit der Saft die Blüten und Blätter
der stehenbleibenden Knospen möglichst kräftig ernähre. Nach 20 Tagen
sind die reinweißen Blüten erschlossen, strömen einen köstlichen
Wohlgeruch aus und können in der an Blumen so armen Winterszeit zu
guten Preisen verkauft werden. Auch in Südfrankreich und an den
übrigen Orten der Parfümgewinnung wird der Flieder zur Gewinnung des
Blütenduftes im großen angepflanzt. Dabei dient die daraus gewonnene
Fliederessenz häufig als Ersatz der Tuberosenessenz.
Auch im Freien hat man mehrfach beobachtet, daß Fliederbüsche, die im
Herbst, etwa bei einer Feuersbrunst, großer Hitze ausgesetzt waren,
soweit sie dadurch nicht zerstört wurden, bald darauf wieder zu treiben
und zu blühen begannen. Frühblühend und zum Treiben verwendbar ist auch
der sonst zartere persische Flieder (Syringa persica),
an dessen mit schmaleren Blättern besetzten Zweigen sich mehr lockere,
duftigere Blütenbüschel wiegen. Vom chinesischen Flieder (S.
chinensis), dessen reichblühende Zweige sich unter der Last der
dichten, schwach duftenden Blüten zur Erde neigen, steht nicht fest,
ob er nicht nur eine Gartenform, ein Kreuzungsprodukt darstellt.
Wäh[S. 639]rend alle diese frühblühenden Fliederarten durch glatte, unbehaarte
Blätter ausgezeichnet sind, gibt es auch späterblühende Arten mit
behaarten Blättern, die uns noch im Juli mit ihrem Blütenschmuck
erfreuen. Zu ihnen gehört der wohlriechende Emodi-Flieder
(S. emodi), so genannt nach seiner Heimat, dem Distrikt Emodi
im westlichen Himalaja. Er trägt länglichlanzettliche Blätter, deren
weißliche Unterseite die zum Teil rauhbehaarten Blattnerven deutlich
hervortreten läßt. Ferner der in Siebenbürgen vorkommende, nach seiner
Entdeckerin, der ungarischen Freifrau Rosalie von Josika, benannte
Josika-Flieder (S. josikea) mit bewimperten Blättern und
sehr langen, dunkelvioletten Blütenrispen.
In der heimischen Pflanzenwelt ist dem Flieder am nächsten verwandt
der wenigstens in Süddeutschland wildwachsende Liguster,
auch Rainweide genannt (Ligustrum vulgare), der im
Juni in weißen Rispen blüht und als „Tintenbeeren“ bezeichnete
schwarze, beerenähnliche Steinfrüchte hervorgehen läßt. Wie diese
werden verschiedene fremde Arten, so besonders die sehr reichblühende
japanische Rainweide (L. ibota), gerne zu Hecken benutzt,
da sie sich leicht schneiden lassen, ihr grünes Laub zum Teil im
Winter behalten und durch ihren dichten Wuchs den Vögeln vollkommene
Nistplätze, daneben in ihren Beeren auch Futter spenden.
Ein beliebter Gartenzierstrauch ist endlich auch die Tamariske
(Tamarix), die myríkē der Griechen und Römer, die nach
Plinius — von manchen für einerlei mit der tamarice gehalten —
beim Volke als Unglücksbaum galt, „weil sie nichts trägt und nirgends
gepflanzt wird“. Viel häufiger als die 1–2,5 m hohe, buschige
deutsche Tamariske (Myricaria germanica) mit kleinen
rosenroten Blüten in langen Ähren an den Zweigenden, deren Samen von
den Bergbächen in die Ebene herabgeschwemmt wird, so daß sie neben
dem bereits besprochenen Sanddorn (Hippophaē rhamnoides) ein
häufiger Gast auf den Flußgeschieben des Alpenvorlandes ist, wird die
in Südeuropa an feuchten Plätzen häufige französische Tamariske
(Tamarix gallica) zur Verzierung von Strauchgruppen in Gärten
gepflanzt. Ihre fein zerteilten, überaus zarten Blätter trugen ihr den
begründeten Namen „Federstrauch“ ein. Wenn sie blüht, stehen die in
außerordentlich dichten Ähren hervorbrechenden kleinen, blaßvioletten
Blüten so gehäuft, daß darunter das Grüne der Blätter vollkommen
verschwindet.
Nachdem wir nun die um ihrer Schönheit willen gewürdigten[S. 640]
Ziersträucher einer eingehenden Besprechung unterzogen haben,
wollen wir noch kurz die nützlichen unter denselben würdigen, die
in ihren Früchten nicht nur den Vögeln, sondern auch dem Menschen
eine willkommene Speise darbieten. Unter ihnen ist zunächst der
Holunder (Sambucus nigra) zu nennen, von den Griechen
aktḗ, von den Römern sambucus genannt. Er war schon
im frühesten Altertum eine bekannte und geschätzte Heilpflanze,
deren Blüten als schweißtreibender Tee und deren schwarze Beeren als
Hustenmittel genossen werden. Daneben sind letztere vielfach auch, so
besonders in Norddeutschland, ein beliebtes Genußmittel geworden. Die
Früchte des Zwergholunders (Sambucus ebulus) sind nur
in vorgeschichtlicher Zeit, so von den anspruchslosen Pfahlbauern der
neolithischen Zeit, zusammen mit den Beeren des gemeinen Holunders als
Obst genossen worden, doch waren sie nebst andern Teilen der Pflanze
schon im Altertum als Heilmittel geschätzt. Bei Dioskurides um die
Mitte des 1. christlichen Jahrhunderts heißt er chamaiáktē,
d. h. niederer Holunder, bei den Römern ebulus und bei den
Deutschen atich, das sich später in Attich verwandelte. Seine
Beeren sollen nach dem schweizerischen Botaniker Oswald Heer, der die
Samenkerne in neolithischen Pfahlbauten der Ostschweiz fand, schon
von den Pfahlbauern am Ende der Steinzeit zum Färben mit einem hellen
Blau verwendet worden sein. Jedenfalls wurden sie, wie diejenigen des
gemeinen Holunders, noch im klassischen Altertum zum Färben benutzt.
So sagt Theophrast, daß der weinfarbige Saft der unreif rötlichen,
reif aber schwarzen Beeren des Holunders den Leuten dazu dient, um
sich Hände und Kopf zu färben. Nach Plinius dienten sie besonders
zum Färben der Kopfhaare, und in einer Ekloge Vergils heißt es: „Das
Gesicht des Gottes Pan war mit den blutigen Beeren des Zwergholunders
(ebulus) gefärbt.“
Die Berberitze (Berberis vulgaris) wird zum erstenmal
im Drogenverzeichnis des Platearius aus dem 12. Jahrhundert erwähnt;
ihr Name scheint arabischen Ursprungs zu sein. Im 16. Jahrhundert
erfreute sie sich großer Beliebtheit und wurde aus ihren Beeren in
Frankreich und Deutschland ein Wein gemacht. Der Brombeerstrauch
(Rubus fruticosus), dessen Früchte ein beliebtes Kompott geben
und von jeher vom Menschen gerne gegessen wurden, hieß bei den Griechen
bátos, bei den Römern dagegen rubus und seine Frucht
wegen deren Ähnlichkeit mit der Maulbeere morum. Dioskurides und
Plinius sagen, daß der Brombeerstrauch den Menschen die eßbaren Früchte
liefere,[S. 641] die, wie auch die Blätter, zu Heilzwecken gebraucht werden.
Und Palladius im 4. Jahrhundert n. Chr. schreibt: „Im September sammelt
man Brombeeren, preßt ihren Saft aus, läßt ihn etwas gären, mischt
dann ein Drittel Honig hinzu und kocht die Mischung bis zur Honigdicke
ein.“ Wie im Altertum wurden auch im Mittelalter neben den Früchten
die Blätter und jungen Schößlinge der Brombeere als Arznei benutzt. In
Karls des Großen Capitulare de villis vom Jahre 812 wird ein mit
Honig und Gewürzen bereiteter Brombeerwein als moratum erwähnt,
der ebenso wie das aus Maulbeeren hergestellte gleichlautende Getränk
das ganze Mittelalter hindurch in Klöstern wie in Bürgerhäusern gerne
getrunken wurde. In den lateinischen Glossen des Abtes Caesarius von
Heisterbach im Siebengebirge bei Bonn aus dem 13. Jahrhundert heißt es:
„Unsere Leute werden gehalten, Brombeeren zu sammeln zur Bereitung des
Moratum für Feierlichkeiten, kranke Klosterbrüder und hohen Besuch.“
Im Altertum wie im Mittelalter wurde sprachlich nicht zwischen
Brombeere und Himbeere unterschieden. Der griechische Arzt Dioskurides
nennt beide bátos und unterscheidet letztere von der ersteren
durch den Zusatz idaía, weil sie in Menge auf dem (Berge) Ida
wachse. Er sagt von den beiden: „Der Himbeerstrauch ist viel zarter als
der Brombeerstrauch, hat nur kleine Stacheln und findet sich auch ganz
ohne Stacheln (was übrigens auch jetzt noch der Fall ist). Man benutzt
beide Sträucher in derselben Weise.“ Nach dem griechischen Beispiele
nannten auch die Römer (z. B. Plinius) die Himbeere im Gegensatz
zur Brombeere rubus idaeus. Die Himbeere (Rubus
idaeus), aus deren Früchten ebenfalls ein wohlschmeckender
Beerenwein gekeltert werden kann, wurde teilweise schon im Mittelalter
in Klostergärten angepflanzt. Vom 16. Jahrhundert an wurde sie dann
auch sehr häufig in den Gärten der Bürgersleute kultiviert. Der im
Jahre 1560 in Basel als Sohn eines Refugianten aus Amiens in der
Picardie geborene Kaspar Bauhin sagt in einem 1598 in Frankfurt a. Main
erschienenen Werke botanischen Inhalts, daß die Himbeere in Böhmen aus
den Wäldern in die Gärten verpflanzt sei, und Clusius unterscheidet
in seiner 1610 in Antwerpen erschienenen Geschichte seltener Pflanzen
rote und weiße (gelbe) Himbeeren. Zu unserer einheimischen kam im 19.
Jahrhundert die kanadische Himbeere (R. odoratus), deren
große, rote, in Doldentrauben gehäufte Blüten mit leichtem Wohlgeruch
flache, rötliche Früchte hervorgehen lassen, die aber zum Essen keinen
besonderen Genuß gewähren. Deshalb wird der mit[S. 642] großen, mehrlappigen
Blättern besetzte Strauch bei uns nur als Zierpflanze kultiviert.
Die Erdbeere (Fragaria vesca) finden wir zum erstenmal
bei Ovid und Vergil im 1. Jahrhundert v. Chr. als fragum
erwähnt. Plinius der Ältere vergleicht die Frucht mit derjenigen
des Erdbeerbaums (unedo) und sagt, daß beide sich durch ihre
Substanz unterscheiden. Nutzpflanze war sie auch im Mittelalter nicht
bloß ihrer Früchte, sondern auch der Blätter wegen, die vielfach als
Heilmittel benutzt wurden. Kulturpflanze aber wurde sie erst im 16.
Jahrhundert. In einem 1537 in Basel erschienenen botanischen Werke
erzählt Ruellius, daß die Erdbeere in die Gärten verpflanzt werde,
damit sie größere Früchte gebe, und daß dabei die roten Früchte sich
teilweise in weiße umgeändert hätten. Ähnliche Angaben finden sich
auch bei den deutschen Vätern der Botanik. Bei Elsholtz 1690 werden
noch dieselben Varietäten der Walderdbeere als Gartenpflanzen genannt,
ebenso bei Weinmann in Regensburg 1737. Es hat also lange gedauert,
bevor amerikanische Erdbeeren nach Deutschland gelangten; denn
nach Alphonse de Candolle wurde die frühreife nordamerikanische
Erdbeere (Fragaria virginiana) mit großen, fast kugeligen,
tiefgrubigen, scharlachroten Früchten aus Virginien erst 1629 in
englische und die chilenische Erdbeere (F. chilensis)
mit den größten Früchten unter allen Erdbeerarten 1715 in französische
Gärten eingeführt. Letztere Art wurde zuerst am Musé d’histoire
naturelle in Paris gepflanzt und von da verbreitete sie sich nach
England, Deutschland und den übrigen Ländern Europas. Bastardformen
beider hat dann die europäische Gartenkultur in den Ananaserdbeeren
hervorgebracht, deren große, wohlschmeckende Früchte heute in solchen
Mengen auf den Markt kommen, daß sich auch der Unbemittelte an ihnen
für wenig Geld erlaben kann.
Über die chilenischen Erdbeeren schreibt Professor Otto Bürger in
seinem 1909 erschienenen Buche: Acht Lehr- und Wanderjahre in Chile:
„Die erste Frucht des Frühlings ist die Erdbeere. Ende Oktober
bis in den Dezember hinein hört man schon früh morgens die Frutilleros,
die Erdbeerenverkäufer, welche von Renca und Conchali kommen, ihre
Ware, die in zwei Körben aus rohen Häuten über einem Maultiere hängt,
ausrufen: „la frutilla, la frutilla“ oder „el frutillero,
el frutillero; compra la frutilla!“ Und dann kann man 100
Mammuterdbeeren anfänglich für 60–50 (1 Mark bis 85 Pfennige), später
für 40–30 Centavos (68–51 Pfennige) erstehen.“
[S. 643]
„Die Frutilla (Fragaria chilensis) ist eine einheimische Art, in
den mittleren und südlichen Provinzen, vornehmlich in der Vorkordillere
von Nuble und im Bereich der Küste von Concepción bis zum Rio Palena
und vielleicht bis zur Magelhaensstraße verbreitet. Die Erdbeere ist
das einzige chilenische Gewächs, welches wegen seiner Früchte nach
Europa verpflanzt wurde. Dem französischen Gelehrten und Reisenden
Frezier gebührt solches Verdienst. Er nahm im Jahre 1712 oder 1713
fünf Pflänzchen von Concepción mit, von denen er aber zwei dem Kapitän
seines Schiffes als Vergütung für das zum Begießen erforderliche
süße Wasser zu belassen hatte. Die übrigen drei brachte er nach
Frankreich, und sie riefen alle jene großen Kulturen ins Leben, welche
es bis 1820 gab; dann erst gestattete die größere Handelsfreiheit
einen Nachschub (Cl. Gay, Agricultura, Bd. 2, S. 113–114).
Nachdem sich die chilenische Erdbeere in Europa veredelt hatte und
zu riesigen Dimensionen gezüchtet worden war, wurde sie wiederum
nach Chile verschifft und gab hier jenen ausgedehnten Erdbeerchacras
(chacra, aus der indianischen Quetschuasprache Perus entnommener
Ausdruck für kleines Landgut) den Ursprung, wie sie bereits in der
Mitte des vorigen Jahrhunderts um Santiago herum bestanden. Namentlich
von Kindern wird noch eine kleine Sorte als fresa angeboten, die
der Chilene gern zur Bowle nimmt — er braut sich ein solches Getränk
aus zerquetschten Erdbeeren und Weißwein. Diese stammt von der gemeinen
europäischen Erdbeere ab, die 1830 nach Chile eingeführt wurde.“ Von
den über 400 Erdbeerarten, die von unseren Gärtnern durch Kreuzungen
und Kulturpflege erzielt wurden, ist außer den vorgenannten besonders
auch die großblumige oder Ananaserdbeere (Fragaria
grandiflora) aus Surinam mit großen, scharlachroten, verschieden
geformten, meist breiter als hohen, unregelmäßigen, oft fast gelappten
Scheinbeeren zur Bastardierung benutzt worden.
Die rote Johannisbeere (Ribes rubrum) war den Griechen
und Römern unbekannt. In Griechenland wächst dieser Strauch überhaupt
nicht und in Italien nur auf den Gebirgen im Norden des Landes und
dort auch nur spärlich. Sonst ist diese Pflanze in ganz Mittel- und
Nordeuropa, in Skandinavien, Nordrußland und Sibirien, wie auch auf dem
Himalaja heimisch. Der Johannisbeerstrauch soll angeblich durch die
Normannen nach Frankreich, von da nach Spanien und der Schweiz gekommen
sein, was aber sicher unrichtig ist. In den Schriften des Mittelalters
wird die Johannisbeere vor dem 15. Jahrhundert nicht erwähnt. Überhaupt
hat man in Mitteleuropa, wie Lauen[S. 644]stein feststellte, bis zur ersten
Hälfte des 13. Jahrhunderts noch keinerlei Beerensträucher kultiviert,
dafür sammelte man die wildwachsenden Beeren. Erst zu Beginn des 15.
Jahrhunderts wird die Johannisbeere zum erstenmal in einem Manuskript
genannt, das die Glosse „ribes sunt Johannesdrübel“ enthält.
Noch in den Jahren 1484 und 1494 wird sie in einem Mainzer und Passauer
Herbar als sant johans trublin sehr mangelhaft abgebildet. Der
aus den zerdrückten Früchten ausgepreßte Saft wurde zu Sirupdicke
eingekocht und gegen Magenleiden und Fieber gegeben. Noch im Jahre
1557 wurde sie in England nicht kultiviert, da sie nicht auf der Liste
der damals dort angebauten Beerenobstarten figuriert, und selbst im
Jahre 1597 war sie in Frankreich eine Seltenheit und besaß noch keinen
Eigennamen. Sie wurde damals dort als groseille d’outremer
bezeichnet, wie sie jetzt noch in Genf raisin de mare und im
Kanton Solothurn in der Schweiz Meertrübli genannt wird, indem man sich
einbildete, sie sei übers Meer in die betreffenden Gegenden gekommen,
was sicher unrichtig ist. Nur das eine läßt sich aus solchen Ausdrücken
erkennen, daß die Johannisbeere als etwas Fremdes, von auswärts
Importiertes in diese Länder kam.
Der Name ribes, den die Pflanze in den Arzneibüchern des 16.
Jahrhunderts erhielt, beruht auf einer Verwechslung. Die Araber
benutzten nämlich unter dieser Bezeichnung eine auf den Gebirgen
Syriens wachsende Rhabarberart (Rheum ribes), die in Europa
vollständig fehlt, als geschätztes Heilmittel. Der Arzt Serapion,
der im 13. Jahrhundert in Spanien oder Marokko gelebt haben soll,
weiß noch, daß der echte ribes in Syrien wächst, aber er
sagt, daß einige Autoren den Sauerampfer, acetosa, darunter
verständen. Der Arzt Mattheus Sylvaticus führt außer Sauerampfer auch
noch coccus als Surrogat des echten ribes der Araber
an. Letzteres sind aber die Kermeskörner, die durch den Stich der
Kermesschildlaus (Coccus ilicis) hervorgerufenen Auswüchse
der in Südeuropa und im Orient einheimischen Kermeseiche (Quercus
coccifera), die als rote, runde, etwas säuerliche Kermeskörner
bis vor etwa hundert Jahren in den Apotheken gebräuchlich waren
und deren frischer Saft mit Zucker eingekocht als Alchermeskonfekt
feilgeboten wurde. Beim weiteren Suchen nach der arabischen Heilpflanze
ribes kam man dazu, die Beeren des Johannisbeerstrauches in
Nordeuropa arzneilich zu verwenden und der Pflanze diesen Namen
zu geben, der ihm als ribs im Dänischen und rips im
Schwedischen bis auf den heutigen Tag verblieb.
[S. 645]
Gegen das Ende des 14. Jahrhunderts kam der Johannisbeerstrauch zuerst
in Süddeutschland in Kultur, indem seine Beeren medizinische Verwendung
fanden. Hier reift er schon um Johanni (24. Juni) und wurde deshalb in
Verbindung mit seiner Ähnlichkeit mit den Trauben als sant johannis
trübelin bezeichnet. In dem 1539 zum erstenmal in Straßburg
herausgegebenen „Kreuterbuch“ des Hieronymus Bock heißt es von ihm:
„Das holdselige beumlin, daz die wolschmeckende rohte Johanns Treublein
bringet, würt fast inn den Lustgärten gepflantzet.“ Von hier aus hat
sich die Kultur des Beerenobstes nach Westen und Norden verbreitet.
In Norddeutschland finden wir es zum erstenmal im niederdeutschen
„Gaerde der suntheit“, Lübeck 1492, wo es Ribes und Sunte Johansdruuen
genannt wird. Von Frankreich, wo die Johannisbeere zuerst in einem
1536 in Basel gedruckten dreibändigen lateinischen Werke von J.
Ruellius erwähnt wird, kam sie nach Belgien und Holland und von da nach
England. Gegen das Ende des 16. Jahrhunderts kannte man verschiedene
Kulturrassen der Johannisbeere, und C. Clusius erhielt im Jahre 1589
aus Amsterdam eine vermutlich in England gezüchtete weißbeerige Form,
die vorher nicht bekannt war.
Im 16. Jahrhundert, als man überall bestrebt war, neue Pflanzen
in die Gärten aufzunehmen, hat man die Johannisbeere zuerst nach
Italien gebracht. In einem 1561 in Straßburg gedruckten lateinischen
Werke des Zürchers Konrad Gesner wird erwähnt, daß in Florenz eine
rote Johannisbeere vorkomme mit haselnußgroßen Früchten von sehr
saurem Geschmack. Heutigentags wird die Johannisbeere in Italien so
gut wie gar nicht kultiviert, denn sie gedeiht dort sehr schlecht.
Das gleiche ist in Griechenland der Fall, wo die Früchte tá
phrangkostáphyla, d. h. Frankentrauben, genannt werden. Da nun die
Griechen alle Westeuropäer Franken nennen, so gibt dieser Name an,
woher die Johannisbeere nach Griechenland gelangte.
Die schwarze Johannisbeere (Ribes nigrum), gleich der
vorigen mit Blütentrauben versehen, von ihr aber durch schwarze Beeren
verschieden, war im Altertum den Griechen und Römern ebensowenig als
die rote Johannisbeere bekannt. Sie hat wie diese ihre Heimat weiter
nördlich in Mittel- und Nordeuropa, durch ganz Sibirien bis zum Amur
und im Westhimalaja und wächst in feuchten Wäldern. Erst in der zweiten
Hälfte des 16. Jahrhunderts wurde man auf sie aufmerksam, zunächst wohl
durch ihre Ähnlichkeit mit der roten Johannisbeere. Aber die Früchte,
die einen entschiedenen Geschmack nach Wanzen[S. 646] haben, fand man zunächst
durchaus nicht angenehm. Erst später gewöhnte man sich daran und
viele fanden ihn sogar höchst angenehm, so daß man seine Früchte wie
diejenigen der roten Johannisbeere zu Konfitüre und Gelee einmachte.
R. Dodonaeus gibt in seiner 1583 zuerst erschienenen Botanik eine gute
Abbildung von ihr, sagt aber, daß sie nur selten in Gärten angebaut
werde. Le Grand d’Aussy berichtet in seinem 1782 veröffentlichten
Buche Histoire de la vie privée des Français, daß der von ihm
cassis genannte Strauch seit kaum 40 Jahren in den Gärten
Frankreichs gepflanzt werde, und zwar nur infolge einer Broschüre, die
dieser Pflanze alle nur erdenkbaren guten Eigenschaften andichtete.
Aus seinen Früchten wird ein beliebter, sehr wohlschmeckender Likör
bereitet.
Wie die rote und schwarze Johannisbeere ist die Stachelbeere
(Ribes grossularia) im gemäßigten und nördlichen Europa und
im sibirischen Waldgebiet bis zur Mandschurei und Nordchina, ebenso
im westlichen Himalaja und auf dem Atlasgebirge einheimisch. Die
Griechen und Römer kannten sie nicht, auch nicht in wildem Zustande.
Der Strauch wird zuerst in einem Psalmenbuch des 12. Jahrhunderts
als groiselier zur Bezeichnung eines Dornenstrauchs und die
Frucht vom Trouvère (= dem provenzalischen Troubadour) Rutebeuf im
13. Jahrhundert als groiselle erwähnt. Die Umstände, unter
denen dies geschieht, sind aber solcher Art, daß diese Bezeichnung
nach den Ausführungen von Fischer-Benzon eher auf den Weißdorn als
auf die Stachelbeere zu beziehen sind. Jedenfalls kann in diesen
beiden Fällen nur eine wildwachsende Pflanze gemeint sein. Die erste
unzweideutige Erwähnung des Stachelbeerstrauchs finden wir im bereits
erwähnten, 1536 in Basel gedruckten lateinischen Buche von J. Ruellius,
der darin von ihr folgendes sagt: „Die Beere des dornigen Strauches
wird im unreifen Zustande wegen einer nicht unangenehmen Säure statt
saurer Trauben zu Saucen oder Suppen benutzt. Da sie gleichsam das
Aussehen einer Feige (grossulus) aufweist, nennt das Volk
den Strauch grossularia (groseillier) und die Frucht
grossula (groseille). Nach erlangter Reife wird die Beere
so süß, daß sie gegessen werden kann; dennoch wird sie bei üppigen
Mahlzeiten verschmäht, wohl aber von schwangeren Frauen begehrt.“
Weiter sagt er, daß die Stachelbeere in den Gärten häufig zu finden
sei. Da er 1474 geboren wurde, so reicht seine Erinnerung bis in das
15. Jahrhundert zurück, und wir müssen annehmen, daß er sie allerdings
in sehr wenig veredelter Form schon als Kind kannte. In Deutschland
erwähnen sie zuerst Hiero[S. 647]nymus Bock 1539 und Konrad Gesner 1542 als
noch wenig bekannte Gartenpflanze. Sie nennen sie Grosselbeere und
grossularis und empfehlen sie in erster Linie als Heckenpflanze.
Erst gegen das Ende des 16. Jahrhunderts war die Kultur der
Stachelbeere in Deutschland ziemlich allgemein geworden und erzog man
bald bessere, großfrüchtige Sorten. Im Jahre 1589 erhielt der Franzose
Carolus Clusius, Botanikprofessor in Leiden, von Carolus de Tassis,
Bürgermeister von Amsterdam, eine aus England erhaltene Stachelbeere
mit roten Früchten und 1514 sah er im Garten zu Leiden eine Sorte mit
dunkelroten Früchten, während er vorher nur grüne Stachelbeeren mit
größeren Früchten als die wilden Arten gekannt hatte. Das eine steht
fest, daß die Stachelbeere als Kulturpflanze von Westen nach Osten
und Norden wanderte. In Leiden gedeiht sie schlecht, noch schlechter
als die Johannisbeere. Das französische groseillier und
groseille bezeichnete ursprünglich den Stachelbeerstrauch und
seine Frucht, während die Johannisbeere durch die Zusätze rouge
und d’outre mer von ihm unterschieden wurde, heute bedeutet es
die Johannisbeere, von der man die Stachelbeere als grosseille à
maquereaux unterscheidet. Gegenwärtig werden als reife Speisebeeren
die zum Teil taubeneigroßen Formen bevorzugt, welche ursprünglich in
England gezüchtet wurden und gern hochstämmig gezogen werden. Hierzu
pfropft man die Stachel- wie die Johannisbeeren auf Stämmchen der
früher besprochenen, 1812 aus Nordamerika in unsere Gärten verpflanzten
goldgelb blühenden Johannisbeere (Ribes aureum). Mehrere
amerikanische Stachelbeersträucher werden bei uns als Ziersträucher
kultiviert.
Wie Johannis- und Stachelbeere hat der Mensch auch die Himbeer- und
Brombeerstaude in Pflege genommen und durch Kulturauslese bedeutend
veredelt, während Heidel- und Preißelbeeren nach wie vor nur im
wilden Zustande bekannt sind und noch immer wie in der Urzeit dem
Menschen reichen Ertrag liefern. Die Heidelbeere (Vaccinium
myrtillus) durchzieht den Waldboden mit ihren unterirdischen
braunen Sprossen wie ein dichtes Netzwerk, treibt grüne, kantige
Stengel, deren jeweilige Triebspitze bald das Wachstum einstellt,
während seitlich unter ihr ein neuer Trieb abzweigt. Dadurch
erhalten die beblätterten Stengel ihre eigenartige Verzweigung.
Die rötlichgrünen, kugeligen Blüten hängen einzeln an den Ästchen
und lassen nach der Befruchtung durch Insekten jene wohlbekannten
schwarzblauen, dunkel bereiften Beeren hervorgehen, die vermöge der
Färbekraft ihres dunkelroten Saftes vielfach der „Rotwein“fabrikation[S. 648]
dienen. Die eiförmigen, dünnen Blätter der Heidelbeere fallen im
Herbste ab, während dies bei den lederigen Blättern der immergrünen
Preißelbeere (V. vitis idaea) nicht der Fall ist.
Letztere ist nicht nur im Walde zu Hause, wie erstere, sondern bedeckt
auch weite Strecken auf dürrem Heideboden. Ihre rötlichweißen,
glockigen Blüten drängen sich in Trauben am Triebende zusammen. Die
leuchtendroten Beeren reifen erst nach den Heidelbeeren und werden
weniger frisch verwendet als diese, um so mehr aber in eingemachtem
Zustande.
Seltener ist die auf Moorboden wachsende Rauschbeere oder
Sumpfheidelbeere (V. uliginosum), deren große, schwarze,
hellbereifte Früchte ebenfalls eßbar, aber von fadem Geschmack, wenn
auch nicht berauschend sind, wie man früher fälschlicherweise glaubte,
weshalb man sie Rauschbeeren nannte. Sie sind indessen narkotisch
und bewirken, in Menge genossen, Kopfschmerzen und Erbrechen. Die
Pflanze mit viel größeren und kantigen, braunroten Zweigen wie bei
der Heidelbeere und bläulichgrünen, ganzrandigen Blättern, trägt
viel zur Torfbildung bei. Die Moosbeere (V. oxycoccos)
dagegen, die besonders auf den mit Torfmoos überzogenen Moorgründen
der Hochmoore gedeiht, ist ein kleines Sträuchlein mit fadenförmigem
Stengel, zierlichen, immergrünen Blättchen und an langem Stiele
nickenden rosenroten Blüten. Die roten, erst nach einem Froste
genießbaren Beeren sind nur für Nordeuropa, wo die Pflanze häufig
vorkommt, wichtig und werden wie die Preißelbeeren eingemacht. Eine
größere Bedeutung hat neuerdings die in Nordamerika einheimische,
unserer Moosbeere sehr ähnliche, nur größere Kronsbeere (V.
macrocarpum) erlangt, welche ihrer genießbaren Früchte wegen auch
bei uns zum Anbau auf Torfboden empfohlen worden ist. In ihrer Heimat
hat man sie, die man dort cranberry nennt, auf feuchtem Gelände in
größerem Maße angepflanzt. Sie gibt dort reiche Erträge an Beeren,
die größer und billiger als die Preißelbeeren sind. Viel kürzere Zeit
sind zwei Brombeerarten in Kultur, nämlich die nordamerikanische
Loganbeere, die 4–6 cm lange rotbraune Früchte von
angenehmem Geschmack liefert, und die japanische Weinbeere,
die hellrote, von einem rotbraun behaarten Kelch eingeschlossene,
wohlschmeckende Beeren von der Größe einer Himbeere liefert. Auch
um die Veredelung des Beerenobstes hat sich der Amerikaner Luther
Burbank in Kalifornien in hohem Maße verdient gemacht. Welch große
volkswirtschaftliche Bedeutung die einheimischen Waldbeeren besitzen
und welchen Verdienst sie der sie meist kostenlos einsammelnden ärmeren
Bevölkerung bringen,[S. 649] kann man aus der Angabe ermessen, daß der
Ertrag daran in besonders guten Jahren für das Gebiet einer einzigen
Oberförsterei bis 100000 Mark betragen kann.
Tafel 155.

Johannisbeer-Anpflanzung, teils buschig, teils hochstämmig gezogen, mit
dazwischen gepflanzten Erdbeeren.
(Anlage der Konservenfabrik Lenzburg.)
❏
GRÖSSERES BILD
Tafel 156.

Zierbäume und Sträucher des Botanischen Gartens zu München. Im
Hintergrund der Glaspalast.
❏
GRÖSSERES BILD
Von weiteren Beerenfrüchten sind endlich noch diejenigen der
Mistel (Viscum album) zu nennen, deren zähschleimiger
Inhalt bei uns zur Herstellung von Vogelleim benutzt wird, während
in Südeuropa hierzu derjenige der Riemenblume (Loranthus
europaeus) dient. Dieser Schmarotzer wächst vorzugsweise auf
Eichenarten und Kastanien. Schon im Altertum wurden die Beeren des
Loranthus, der bei den Griechen ixía und bei den Römern
viscum hieß, in dieser Weise verwendet, weshalb der Vogelleim
selbst bei jenen íxos und bei diesen viscum hieß. So
schreibt Dioskurides: „Der beste Vogelleim wird von der runden Frucht
eines Strauches bereitet, der auf der Eiche wächst und dessen Blätter
dem Buchsbaum (pýxos) ähnlich sind. Die Frucht wird zerstoßen,
dann gewaschen und in Wasser gekocht. Manche stellen den Vogelleim auch
kurzweg durch Kauen der Frucht her.“ Sein Zeitgenosse Plinius drückt
sich ihn ähnlicher Weise aus. Er sagt: „Der beste Vogelleim kommt vom
viscum der Steineiche (robur). Diese werden zur Erntezeit
gesammelt, wenn sie noch unreif sind; denn bei später folgenden
Regengüssen wachsen sie zwar noch, aber der Leimstoff nimmt ab. Man
trocknet sie, zerstößt sie in einem Holzmörser und kocht sie in Wasser,
bis nichts mehr obenauf schwimmt. Die zähe Masse wird dann, bevor sie
zum Vogelfang verwendet wird, mit Nußöl zusammengeknetet. Sie wird auch
zu erweichenden Pflastern verwendet. Manche glauben, das viscum
werde durch religiöse Einwirkung kräftiger, wenn man es nämlich bei
Neumond und ohne Eisen anzuwenden von der Steineiche sammle. Es sei
dann auch in andern Fällen wirksam, vorausgesetzt, daß es die Erde
nicht berührt habe.“
Daß diese Schmarotzer nur auf Bäumen und nicht auf der Erde gedeihen,
hat schon die Gelehrten des Altertums beschäftigt. Interessant ist, daß
schon Theophrast im 4. Jahrhundert v. Chr. von der Verbreitung dieser
Misteln wußte, daß sie durch Vögel (vorzugsweise von der Misteldrossel)
bewirkt wird. Er schreibt in seiner Pflanzengeschichte: „Jedenfalls ist
es ein Wunder, daß die Ixia-Arten, welche doch eine tüchtige Frucht
haben, durchaus nicht in der Erde keimen. Sie wachsen nur auf Bäumen
und entstehen jeweilen aus Samen, die von Vögeln verschluckt worden und
mit deren Kot auf die Bäume gekommen sind. Manche Eichen tragen sowohl
die Riemenblume (ixía)[S. 650] als die Mistel (hýphear), und
zwar wächst erstere auf der Nordseite und letztere auf der Südseite des
Baumes.“
Die Mistel ist neuerdings dadurch sehr interessant geworden, daß
verschiedene, äußerlich nicht unterscheidbare Rassen von ihr
festgestellt wurden, die jeweilen nur auf bestimmten Baumarten
gedeihen. So geht die auf unsern Apfelbäumen und Schwarzpappeln
verbreitete Form wohl auf andere Laubhölzer, am seltensten auf
Eichen, nicht aber auf Nadelhölzer über, während die Tannenmistel
ausschließlich auf der Weißtanne wächst, Kiefern und Fichten dagegen
gemeinsam eine dritte Form zu besitzen scheinen. Daß die mitten im
Winter in den kahlen Baumkronen grünenden Büsche in der Mythologie
und im Volksglauben unserer Vorfahren eine gewisse Rolle spielten,
ist sehr begreiflich. Nach der germanischen Sage wurde der lichte
Gott des Sommers, Baldur, vom blinden Wintergott Hödur durch einen
Mistelpfeil getötet. Es ist dies der strahlende Sonnengott, der
im Winter von der Macht der Finsternis dahingerafft wird, um im
Frühling aufs neue in jugendlicher Pracht zu erstehen. Und daß dies
der Fall sein werde, dafür bietet der Mistelzweig Gewähr, den man
in Nachahmung angelsächsischer Sitte am Julfest neuerdings auch bei
uns bei der Wintersonnenwende in den Wohnungen aufhängt; denn der
gabelige Mistelzweig ist das Symbol der Wiederbelebung der erloschenen
Sonnenkraft, die nach altem Volksglauben in der Mistel allein lebendig
bleibt, wie schon äußerlich ihr Weitergrünen auf den im Winter wie
erstorben ihrer Blätter beraubt dastehenden Laubbäumen beweist.
Daher rührt die allheilende und belebende Kraft desselben gegen alle
Übel. Am Tage von Baldurs Neugeburt, wenn die größte Sonnenschwäche
vorüber ist, am Julfest oder am Neujahr, sammelte man feierlich die
„Allheilende“, um die Wohnung während der Festzeit damit zu schmücken
und zu weihen. Ähnliche mythologische Beziehungen haben unzweifelhaft
auch zu der außerordentlichen Verehrung Veranlassung gegeben, die
die Mistel bei den keltischen Volksstämmen genoß. Ihre Priester, die
Druiden, berichtet Plinius, kennen nichts Heiligeres als die Mistel
und ehren auch den Baum, auf dem sie wächst, namentlich wenn es eine
Eiche ist. Dies ist aber nur äußerst selten der Fall. Hatte man nun
ausnahmsweise eine solche auf dem dem Donnergotte heiligen Eichbaum
entdeckt, so wurde sie mit großer Feierlichkeit am sechsten Tage nach
dem Neumond zu Jahresbeginn eingeholt. Nachdem man unter dem heiligen
Baum die gehörigen Opfer dargebracht und die Festmahlzeit veranstaltet
hatte, bestieg der in weiße Gewandung gekleidete[S. 651] oberste Druide den
Baum, schnitt mit einer goldenen Sichel die Mistel ab und warf sie
in seinen Mantel. Diese von den Kelten die „Alles heilende“ genannte
Pflanze durfte den Boden nicht berühren und half dann angeblich gegen
alle Leiden, wurde nach Plinius insbesondere zur Heilung der Epilepsie
verwendet. Derselbe römische Autor bezeichnet das Neujahrsfest als
den Hauptsammeltag für die Mistel, und in Frankreich hat sich noch
in manchen Gegenden die uralte Sitte erhalten, daß Kinder am Neujahr
mit einem Mistelbusch von Haus zu Haus laufen und mit dem Ruf:
Aguillaneuf (entstanden aus: au gui l’an neuf) Eßwaren
und ein Geldgeschenk verlangen. In Deutschland scheint der Ruf „Guthyl“
und das Neujahrs-„Anklopfen“ mit grünen Ruten dem zu entsprechen. Zum
Schluß soll noch die Eigentümlichkeit erwähnt werden, daß auf den
faulenden Stengeln der Mistel ein besonderer Pilz (Tubercularia
visci) und auf den Blüten ein bestimmter Blattfloh (Psylla
visci) lebt.
Eines der wichtigsten Rohprodukte des Pflanzenreiches, das auf allen
Gebieten menschlicher Tätigkeit die mannigfaltigste Verwendung
findet, ist das Holz. Aus ihm hat sich der tertiäre Urmensch neben
den aufgelesenen Steinen seine ersten Werkzeuge und Waffen zur
Unterstützung und Verlängerung seiner Arme gemacht, bevor er sich noch
Geräte aus Feuerstein herzustellen begann. Und je höher er später
in der Kultur fortschritt und je mehr er zum Herren der Erde wurde,
um so größere Bedeutung gewann für ihn das Holz als unentbehrliches
Rohmaterial für alle Bedürfnisse des täglichen Lebens, zu allerlei
Hantierung und zum Brennen.
Unter den mannigfaltigen Holzarten, die ihm in verschiedenen Gegenden
und zu verschiedenen Zeiten in wechselnder Menge und Beschaffenheit
zu Gebote standen, wußte er dabei für die verschiedenen Zwecke eine
Auswahl zu treffen, indem er bald die Eigenschaften der verschiedenen
Holzarten kennen lernte. Dabei stand ihm gerade in unserm Kontinent
gegenüber Ostasien und besonders Nordamerika eine sehr geringe Auswahl
von Holzarten zur Verfügung. So setzen kaum 40 einheimische Baumarten
den Wald des nördlichen Europa zusammen, den Wald der Vereinigten
Staaten dagegen 400. Die Zahl der Eichenarten ist in Europa ganz
außerordentlich gering, in den Vereinigten Staaten und in Mexiko
dagegen recht groß; die Zahl der Kiefernarten beträgt in Europa 10, in
Nordamerika aber 40; selbst Kanada weist noch 15 Nadelhölzer auf.
Aber nicht bloß sind im nordamerikanischen Wald fast alle Baumgattungen
des europäischen Waldes in einer größeren Artenzahl vertreten, so
Eichen und Eschen in 13 Arten, Ahorne in 8 Arten, Birken in 7 Arten,
Ulmen und Nußbäume in je 5 Arten usw., sondern es sind in ihm eine
große Zahl von Gattungen vorhanden, die dem euro[S. 653]päischen Walde
vollkommen fremd sind, darunter die Hickorybäume (Carya) mit
9 weitverbreiteten Arten, die Magnolien mit 7, die Platanen mit 3,
die Catalpa mit 2 Arten, der Tulpenbaum (Liriodendron), der
Sassafras, die Sequoia mit 2 Arten, die Douglastanne und verschiedene
andere. Die beiden zuletzt genannten Gattungen, ebenso wie die
Riesentanne (Abies gigantea), die Riesenceder (Thuja
gigantea), die Zuckerkiefer (Pinus lambertiana) mit
ihren vielfach über 100 m emporragenden und mehrere Meter
dicken Stämmen veranschaulichen zugleich am besten, zu welcher
Riesenhaftigkeit sich der nordamerikanische Baumwuchs nicht nur in
Kalifornien und Oregon, sondern auch im appalachischen Osten gestaltet,
wo die Weiß- und Roteichen (Quercus alba und Q. rubra),
die Magnolien (M. grandiflora), die Kastanien (Castanea
americana), die Platanen und Pappeln vielfach gewaltige
Baumgestalten darstellen.
Noch artenreicher als selbst das appalachische Gebiet an der
atlantischen Seite Nordamerikas ist das asiatische Florenreich,
das zudem eine auffallende Ähnlichkeit mit ersterem zeigt; hat es
doch nicht weniger als 250 Arten in 65 Gattungen mit jenem gemein.
Beide Florenreiche aber stehen dem tertiären Florenreiche Europas
zum größten Teil ziemlich nahe. Zur Tertiärzeit wuchsen nämlich
in Europa Riesencedern, Sumpfcypressen, Storax- und Walnußbäume,
Liquidambar, Tulpenbäume, Catalpa und Sassafras, die vor der von
Norden her vordringenden Vereisung im südlichen Teil Nordamerikas eine
Zuflucht fanden und am Leben blieben, während sie bei uns vernichtet
wurden, und zwar ganz wesentlich infolge der ostwestlich gerichteten
Gebirge, die ein Entweichen nach dem Süden über den Wall der Alpen und
Karpaten nicht erlaubten. Auch ein Entweichen nach Osten war durch die
Verbindung des Kaspischen Meeres mit dem Mittelmeere verhindert. So
war ein Zurückweichen und ein Wiederkehren wie in Nordamerika weder im
Süden, noch im Osten Europas möglich.
Als die niederschlagsreichen, kalten Winter der Eiszeit nachließen und
die letzte Vereisung wich, drangen in Europa von Süden nach Norden
Bäume ein, die geringere Wärmemengen als die einstigen tertiären
zur Vollendung ihrer Vegetationsperiode verlangen. So war nach den
Ablagerungen in den Torfmooren die Kiefernperiode die älteste
Waldperiode der mittel- und nordeuropäischen Länder. Nur in Dänemark
scheint der Kiefernperiode eine ganz kurze Übergangszeit mit Espen
und Birken vorausgegangen zu sein. Mit dem Wärmerwerden des Klimas
folgten der Kiefer die Eiche nebst Spitzahorn, Esche,[S. 654] Mistel und
Efeu und gelangten in der jüngeren Ankyluszeit, während noch die
Landbrücke zwischen Jütland und Schonen bestand, auch nach Schweden.
In diese Eichenzeit fällt die frühneolithische Stufe der
Kjökkenmöddinger mit ihren Abfallhaufen von Meereskonchylien, die
zu einer Zeit entstanden sein müssen, als das Meer an der Ostsee
noch salziger und wärmer war als heute. Auf diese wärmere Eichenzeit
folgte mit der Entstehung der vom Meere erfüllten Litorinasenkung
eine Klimaverschlechterung, welche zur Folge hatte, daß zunächst die
Fichte und dann die Buche immer weiter nach Norden
rückten. In diese Zeit fällt die ältere nordische Steinzeit. Während
der jüngeren Stein- und Bronzezeit war der häufigste Nadelholzbaum der
Schweiz die Weißtanne, die wir neben viel Eichen und besonders
auch Buchen, seltener Kiefern, als hauptsächlichstes Nutzholz der
Pfahlbauzeit antreffen.
Damals so wenig als in früherer prähistorischer Zeit war übrigens
Mitteleuropa von einem geschlossenen Urwalde bedeckt, vielmehr
waren die Wälder in großem Umfange von Steppengebieten, Mooren,
Heiden und andern waldfreien Flächen durchzogen. Und gerade die
Steppenstriche waren für die älteste menschliche Siedelungsgeschichte
von hervorragender Wichtigkeit, denn die ältesten Ansiedler folgten
durchweg bei der Besiedelung des Landes den waldfreien Strecken.
Erst in dem Maße als später die Bevölkerungsdichte zunahm und
leistungsfähige Metallwerkzeuge zum Roden und dann Verbrennen des
Waldes aufkamen, wurde mit der zunehmenden Waldvernichtung begonnen,
die selbst heute noch nicht überall zum Stillstand gekommen ist.
Viel schlimmer als einst unsere Vorfahren haben neuerdings die
Nordamerikaner mit dem Walde, dem größten Reichtum ihres Landes,
gehaust. Weite Gebiete der Vereinigten Staaten sind durch den größten
Raubbau des einst sie bedeckenden Waldes verlustig gegangen, was auch
direkt durch Klimaverschlechterung für die Einwohner fühlbar wurde.
In Florida, Georgia und Carolina wurden von den Terpentinausbeutern
die Wälder der Küstenkiefer, welche unter einer maßvolleren Methode
jahrhundertelang die beste Einnahmequelle für die Bevölkerung der
Südwestküste hätte bilden können, in einer Weise ausgeraubt, daß
9⁄10
des Terpentingehaltes jedes Baumes weggeworfen und der ausgeraubte
Baum gefällt und seinem Schicksal überlassen wurde, bis das ganze
Land verödet war. In derselben Weise sind die schier endlosen
Pinienwälder von Wisconsin und Michigan, die ausgedehnten Gebiete der
weißen Rieseneiche im westlichen Ohio, Indiana, Illinois,[S. 655] Kentucky,
Missouri und Arkansas und die unvergleichlichen Wälder der schwarzen
Walnuß, welche die Ländereien von Indiana und Illinois bedeckte,
vernichtet worden. Aus einer jungen Weißeiche stellte man eine einzige
Eisenbahnschwelle her und ließ den Rest verfaulen. Das beste Holz war
in solchem Überflusse vorhanden, daß es völlig wertlos schien. Und so
wirtschaftete der rücksichtslose Amerikaner gedankenlos weiter, bis
das Holz begann selten zu werden; da erst dachte man daran, die Wälder
zu schützen. Ginge nun der Raubbau in der bisherigen Weise weiter, so
würde in etwas mehr als 25 Jahren Amerika keine Wälder mehr besitzen.
Man hat ausgerechnet, daß das Land infolge Schwindens der Wälder mehr
als 100 Quadratmeilen fruchtbaren Boden jährlich durch Austrocknung
verliert. In genauem Verhältnis zum Raubbau der angrenzenden Wälder
vermindern sich die Wassermassen des Mississippi; denn die Wälder sind
es, die die rasche Verdunstung des gefallenen Regens verhindern und
überhaupt die Niederschläge veranlassen oder wenigstens begünstigen.
Nimmt man die Wälder fort, so nimmt man den Flüssen ihre Nahrungsmittel
weg, wenigstens das, was ihnen Nahrung mittelbar zuführt.
Was nicht die Gier nach Gewinn am Walde sündigte, das
verschuldete in der Union der grenzenlose Leichtsinn und die
Schlechtigkeit der Holzarbeiter, Jäger und Abenteurer, denen jedes
Verantwortlichkeitsgefühl abgeht. Unfreiwillig oder freiwillig
gelegt, entflammt sich alljährlich in der Trockenzeit, bald hier,
bald dort der unheimliche Waldbrand, nimmt durch die Lässigkeit der
spärlichen Einwohner meist ungeheure Dimensionen an und vernichtet das
Baumwachstum vieler Jahrzehnte. In den letzten 20 Jahren sind durch
Waldbrände in den Vereinigten Staaten etwa 2000 Menschen umgekommen
und ist für verschiedene Milliarden Mark Materialschaden erwachsen.
Der jährliche Durchschnittsverlust an Holz durch solche Waldbrände
läßt sich auf etwa 100 Millionen Mark schätzen. Der Waldbrand des
Jahres 1910, von dem in den Zeitungen zu lesen war, hat hunderte von
Menschenleben, zahlreiche Ortschaften, 8 Städte und Wälder im Wert von
50 Millionen Mark zerstört. Er war klein zu nennen gegenüber demjenigen
von 1908, der herrliche Wälder in einer Längenausdehnung von
300 km im Werte von 400 Millionen Mark zerstörte, oder gar gegenüber
demjenigen von 1871, der für über 8 Milliarden Mark, d. h. mehr als der
zehnjährige Holzverbrauch des Landes beträgt, Wald vernichtete.
Zu den Waldbränden kommen noch die gewöhnlichen Feuersbrünste, die
jedes Jahr für nahezu 1000 Millionen Mark Gebäude[S. 656] und Einrichtungen in
den Vereinigten Staaten zerstören. Natürlich nimmt diese Zerstörung das
Kapital der Wälder in entsprechendem Maße in Anspruch. Dazu kommt der
stetig wachsende Verbrauch von Holzpapier, der ausgedehnten Waldungen
das Leben kostet. Die zahlreichen Zeitungen allein verschlingen
jährlich etwa 3000 Millionen kg Holz. Die Menge des jährlich
in der Union geschlagenen Holzes ist schon jetzt dreimal größer als
der jährliche natürliche Zuwachs. So hat man ausgerechnet, daß das
unermeßlich erscheinende Kapital, das die Union in ihren Waldungen
besaß, schon in einem oder spätestens zwei Generationen aufgebraucht
sein wird, wenn nicht vorher dem unsinnigen Holzkonsum Halt geboten
wird.
Während das Holz für unsere Altvordern außer dem Verbrennungswert noch
einen gewissen Wert als Bau- und Werkmaterial besaß, ist in unserer
Zeit seine Verwendungsmöglichkeit ins Ungeheure gestiegen; denn wir
machen nicht nur Papier damit, aus welchem ganze Häuser und selbst
Eisenbahnräder hergestellt werden, sondern wir verfertigen daraus sogar
Kunstseide, die immer weitere Verwendung findet. Welche Wertsteigerung
dabei das Holz erfährt, können wir aus einer diesbezüglichen
Zusammenstellung ersehen. Ein Raummeter Holz wiegt nach O. N. Witt
400–500 kg und kostet im Walde 3 Mark. Derselbe Raummeter,
als Brennholz an Ort und Stelle befördert, erhöht seinen Wert auf 6
Mark. Durch Kochen mit Soda oder Sulfitlauge lassen sich aus dem Holze
etwa 150 kg Zellstoffasern isolieren; da 100 kg davon
einen Wert von 15–20 Mark besitzen, läßt sich der Nutzungswert des
Raummeters auf etwa 30 Mark schätzen. Wandelt man die Zellstoffaser
durch dünnes Ausbreiten auf der Papiermaschine zu Papier um, so ergibt
sich ein Wert für die Zellulose des angewandten Raummeters Holz von
40–60 Mark. Verspinnt man die Zellstoffaser zu Zellstoffgarn für
Jute- und Baumwollersatz, so erzielt man Verkaufswerte von 50–100
Mark. Überführt man die Zellstoffaser durch Lösen in einer Mischung
von Kupferoxyd und Ammoniak (Salmiakgeist) und Pressen durch feine
Düsen in eine Säurelösung, in der sie sofort zu einem feinen Faden
erstarrt, in künstliche Seide, so kommt man zu einem Werte von 3000
Mark pro Kubikmeter. Und gewinnt man schließlich ein für spezielle
Zwecke ganz besonders wertvolles Produkt künstlicher Seide daraus,
so stellt sich der Wert auf den angewandten Raummeter Holz, der also
ursprünglich 3 Mark wert war, auf reichlich 5000 Mark. Diese Kunstseide
wird hauptsächlich zur Herstellung von Spitzen, Borden, Bändern und
Quasten verwendet.[S. 657] Auch für Krawatten- und Möbelstoffe, Vorhänge
und Tapeten bildet die Kunstseide ein ausgezeichnetes Material, das
in immer steigendem Maße in den Handel gelangt. Schon heute wird die
Gesamtwelterzeugung dieser jungen Industrie auf 5 Millionen kg
— allerdings gegen etwa 50 Millionen kg Naturseide —
geschätzt. Allein Deutschland verbraucht etwa 1,5 Millionen kg
im Jahresdurchschnitt, und das Inland war 1909 imstande, Kunstseide im
Betrage von etwa 10 Millionen Mark an das Ausland abzugeben.
In bezug auf Holzertrag sind die Nadelhölzer die ausgiebigsten
und werden daher vielfach in Waldgebieten, die früher ausschließlich
Laubwälder trugen, in ausgedehnter Weise angebaut. Ihr Holz ist viel
einfacher gebaut als dasjenige der Laubbäume; Gefäße fehlen ihm
ganz, doch enthalten die meisten Arten besondere Harzgänge, die beim
Eröffnen durch Einschnitte in der Richtung des Stammes das balsamartige
Terpentin liefern. Die Lärche wird hierzu im Frühjahr nahe
dem Boden angebohrt, das Bohrloch durch einen Zapfen verschlossen
und im Herbst entleert. Bei der Tanne sammelt sich das Terpentin in
Harzhöhlen der Rinde an und fließt nach Öffnung der Beulen ab. In
Österreich gewinnt man auf den Stamm jährlich 2 kg Terpentin,
in Westfrankreich etwa 3,6 kg. Von starken Fichten, besonders
alleinstehenden, auf deren Erhaltung es nicht ankommt, kann man bis
40 kg Terpentin gewinnen. In Frankreich werden Bäume im Alter von
20–40 Jahren 20–40 Jahre hindurch, kräftigere Individuen noch längere
Zeit, auf Terpentin ausgebeutet. Meist wird dort die Strandkiefer
(Pinus maritima) dazu verwendet. Das deutsche Terpentin gewinnt
man von der Kiefer (Pinus silvestris) und Fichte (Picea
excelsa), das Straßburger Terpentin von der Weißtanne (Abies
pectinata), das venezianische Terpentin in Südösterreich von
der Lärche (Larix europaea), das amerikanische Terpentin
hauptsächlich von Pinus australis, P. palustris und
P. taeda und den Kanadabalsam von der Balsamtanne (Abies
balsamea und fraseri). Letzterer unterscheidet sich vom
gewöhnlichen Terpentin vor allem durch seine starke Lichtbrechung,
weshalb er besonders zur Einbettung mikroskopischer Präparate dient.
Eine weitere wichtige Nutzung der Nadelhölzer ist die Gewinnung von
Holzteer, die in folgender Weise von Fichten gewonnen wird: Die
betreffenden Stämme werden im Juni von Ästen und Rinde bis zum Holz in
der Höhe von etwa 2,5 m befreit. Nur an der nördlichen Seite der
Baumstämme wird ein etwa 5 cm breites Band der Rinde gelassen,
um den Baum am Leben zu erhalten. Man läßt den Baum[S. 658] 2–5 Jahre so
stehen, worauf die Rinde in derselben Weise von den Stämmen abgeschält
wird, doch etwa 1,5 m höher, so daß die Stämme jetzt 4 m
hoch kahl sind, mit Ausnahme des Bandes der nördlichen Seite. Wiederum
läßt man den Baum 2 Jahre so stehen. Dabei bedeckt sich der kahle Teil
der Stämme mit einer dicken Lage von Harz. Dann schneidet man den an
der nördlichen Seite gelassenen Rindenstreifen los. Die Bäume werden
im Oktober oder November gefällt und das so behandelte Holz zum Meiler
gebracht, wo es etwa 1,8 m hoch aufgestapelt wird. Hierauf wird
das Holz der Länge nach gespalten und nach dem Trocknen im kommenden
Sommer in Teermeilern unter Luftabschluß verbrannt. Ist dann in 4–5
Tagen das Brennen beendet, so sind bei der trockenen Destillation etwa
7500 Liter Teer von dunkelbrauner Farbe und sirupartiger Konsistenz
ausgeflossen. Er wirkt durch seinen Gehalt an Kreosot fäulniswidrig und
dient daher zum Anstreichen von allem der Feuchtigkeit ausgesetztem
Holz und Tauwerk. Bei der fraktionierten Destillation gibt er zuerst
leichte, dann schwere Teeröle, zuletzt Kreosot und als Rückstand
Pech ab, womit die Schiffe kalfatert werden. Birkenholzteer dient
zur Bereitung von Juchtenleder. Aus Torf- und Braunkohlenteer
bereitet man Leuchtöle, Schmieröle und Paraffin. Der übelriechende,
schwarze Steinkohlenteer gibt bei der Destillation zuerst leichte
Kohlenwasserstoffe (Benzol, Toluol usw.) ab, die, mit Schwefelsäure
und Natronlauge gereinigt und rektifiziert, als Benzin in den Handel
kommen. Bei weiterem Erhitzen erhält man die leichten Teeröle, die
hauptsächlich zur Darstellung der Anilinfarben, als Leuchtöle und zum
Lösen des Kautschuks dienen, dann schwere Teeröle, die zum Imprägnieren
des Holzes und als Schmieröle dienen. Aus ihnen wird die Karbolsäure
isoliert. Weiterhin werden wiederum Kohlenwasserstoffe gewonnen, die
als Schmieröle verwendet werden. Aus ihnen isoliert man auch Naphthalin
und Anthracen, die Farbstoffe und einige pharmazeutische Produkte
liefern. Der Destillationsrückstand ist das Steinkohlenpech, das als
Asphaltsurrogat und zu Firnissen dient. In Europa werden jährlich über
700 Millionen kg Teer verarbeitet, wovon über die Hälfte allein
in England. Wird Teer bei unzureichendem Luftzutritt verbrannt, so
scheidet sich viel Kohlenstoff ab, der als Ruß benutzt wird. Der
Teer ist seit dem Altertum bekannt und gebräuchlich. Der ältere Plinius
berichtet eingehend über die Herstellung und Verwendung desselben, den
er pix liquida nennt.
Zur Erzeugung intensiver Hitze überall da, wo Rauch- und[S. 659]
Flammenbildung vermieden werden muß, z. B. im Schmiedefeuer, beim
Erhitzen von Gegenständen, wie Bügeleisen, im Zimmer usw. benutzt man
Holzkohle, die ein weiteres wichtiges Produkt der Holzausbeutung
ist. Sie wird durch Erhitzen von Holz bei Luftabschluß gewonnen.
Bei dem aus dem Altertum stammenden Meilerbetrieb wird das Holz
in annähernd halbkugelförmigen Haufen, Meiler genannt, in großen
Scheiten regelmäßig um drei in der Mitte errichtete Pfähle aufgesetzt
und mit einer Decke von Rasen, Erde und Kohlenklein bedeckt. Unter
dieser Decke entzündet man das Holz und leitet die Verbrennung bei
sorgsam geregeltem, sparsamem Luftzutritt in der Weise, daß nicht
mehr Holz verbrennt, als erforderlich ist, um die gesamte Holzmasse
auf die Verkohlungstemperatur zu erhitzen. Im wesentlichen sollen
nur die aus dem erhitzten Holze sich entwickelnden Gase oder Dämpfe
verbrennen. Ist die Verkohlung vollendet, was man an der Farbe des
entweichenden Rauches erkennt, so läßt man den Meiler abkühlen und
nimmt ihn auseinander. Runde oder eckige gemauerte Meileröfen gestatten
eine leichtere, vollständigere Gewinnung der Nebenprodukte, wie Teer
und Holzessig, die beim Meilerbetrieb verloren gehen, liefern aber
geringere Ausbeute und weniger gute Kohle. Eine bessere Leitung
des Verkohlungsprozesses erreicht man bei Anwendung von Retorten.
Hierbei gewinnt man „destillierte“ Kohle, wie sie besonders für die
Schießpulverfabrikation erforderlich ist.
Das bei uns in Süddeutschland und der Schweiz weitaus populärste
Nadelholz ist die gemeine Fichte oder Rottanne (Picea
excelsa). Sie ist eine der schönsten und ergiebigsten Waldbäume,
die bei einem Alter von 700–800 Jahren eine Höhe von 64 m bei
einem Stammdurchmesser von über 2 m an der Basis erreichen
kann. Am rötlichbraunen Stamm mit pyramidenförmig spitzer Krone hängen
die unteren langen Hauptäste fast herab oder sind niedergebogen,
während die kürzeren oberen kräftiger und aufgerichtet sind. Die
15–25 mm langen, geraden oder schwachgekrümmten, zweischneidig
vierseitigen, spitzen, dunkelgrünen Nadeln bleiben bis zum 7. Jahre
stehen und fallen im Gegensatz zu denjenigen der Weiß- oder Edeltanne
beim Trocknen des Zweiges ab. Die (männlichen) Staubblüten sitzen zu
eiförmigen gelben, bei der Fichte im Gegensatz zur Weißtanne allmählich
rot werdenden Knäueln hoch oben am Ende starker Äste zwischen den
Nadeln der letztjährigen Triebe, bei der Fichte mehr vereinzelt, bei
der Weißtanne zahlreicher. Wenn sie im Mai den gelben Blütenstaub
entlassen, weht ihn der Wind zwischen die Schuppen der bei der Fichte[S. 660]
roten bis dunkelvioletten, bei der Weißtanne dagegen grünlichgelben
(weiblichen) Samenblüten. Nach der Befruchtung schließen sich die
geöffneten Zäpfchen der letzteren, senken sich nach abwärts und
öffnen sich erst im Oktober, wenn der Same voll ausgereift ist und
sie braun geworden sind, wieder, um die geflügelten Samen durch den
Wind verbreiten zu lassen. Doch fliegen sie meist erst im folgenden
Jahre aus, wonach erst die leeren Zapfen als Ganzes abfallen. Bei der
Weißtanne dagegen bleiben die Fruchtzäpfchen aufrecht auf ihren Zweigen
stehen; zwischen den einzelnen, breiten Schuppen wachsen die Enden
der Deckblätter (Brakteen) zierlich heraus, und im September, nach
der Reife, öffnet sich der Zapfen nicht, sondern er entblättert sich
allmählich und verliert seine graubraunen Schuppen, bis zuletzt nur die
kahle Spindel übrig bleibt. Wer also einen richtigen Tannenzapfen der
Weißtanne zu haben begehrt, der muß warten, bis etwa ein Baum vor der
Samenreife gefällt wird oder der Sturm einige Äste mit Fruchtzapfen
herunterreißt. Samenjahre kehren bei der Fichte durchschnittlich alle
fünf Jahre wieder. Dabei bleibt der Samen 3–5 Jahre keimfähig. Auch
im Alter erreicht die Fichte wie die Lärche nie eine eigentliche
Kronenabwölbung. Sie wächst ziemlich schnell, hört aber in der Ebene
mit 60–80 Jahren auf zu wachsen; im Gebirge dagegen wächst sie weiter
und wird nicht selten 400–600 Jahre alt.
Die Fichte ist nämlich mehr ein Baum des Gebirges als der Ebene, geht
nach Norden nicht so weit als die genügsamere Kiefer, liebt einen
frischen, steinigen, humusreichen, nicht zu flachgrundigen Boden und
viel Bodenfeuchtigkeit, da sie ausgiebig Wasser verdunsten läßt.
Während sie erst in Nordostdeutschland, besonders in der Niederlausitz,
in Schlesien, Ostpreußen und jenseits der Weichsel in die Niederungen
steigt, ist sie mehr südlich und westlich durchaus ein Gebirgsbaum.
Im deutschen Mittelgebirge ist sie der herrschende Baum. Auch im
deutsch-österreichischen Bergland hat sie bedeutende Massenverbreitung
und dringt bis in die italienischen Alpen und in Frankreich bis zu den
Pyrenäen vor. In Serbien erreicht sie etwa bei 43° nördlicher Breite
ihre Südgrenze, geht aber durch Südsibirien östlich bis zum Amurlande.
In den Alpen steigt sie bis in die Legföhrenregion hinauf, höher als
die Kiefer, reicht aber in Lappland nicht über den 69. Grad hinaus,
während die Kiefer hier bis zum äußersten Saum der Wälder reicht. In
Westdeutschland, Belgien, den Niederlanden und den britischen Inseln
war sie ursprünglich nicht heimisch, sondern wurde hier erst seit 1780
zur Aufforstung großer Ödflächen eingeführt. Sie eignet[S. 661] sich nämlich
vorzüglich dazu, verödeten und verwilderten Boden rasch zu decken und
zu verbessern. Sie ist eine der zähesten Waldbaumarten, ganz besonders
dazu geeignet, auf kümmerlichen Standorten den Kampf ums Dasein mit
Erfolg zu beginnen und, wenn auch nicht siegreich zu beenden, so
doch nicht zu unterliegen und als energischer Pionier der nächsten
Generation von Bäumen eine bessere Stätte zu bereiten.
Man bewirtschaftet die Fichtenbestände meist in 70–100jährigem
Umtriebe. In Norddeutschland verjüngt man wegen der Sturmgefährlichkeit
in kleinen Kahlschlägen, in denen der herrschenden Windrichtung
entgegen fortgeschritten wird. Im mittleren und südlichen Deutschland
ist man aber bei der „Fichten-Dunkelschlagwirtschaft“ geblieben.
Wegen des Rüsselkäfers läßt man das zu bebauende Land ein Jahr ruhen.
Dann pflanzt man die drei- oder vierjährigen, in Saatbeeten erzogenen
Pflänzchen in das Kulturfeld, und zwar je 3 oder 4 Exemplare zusammen.
Man mischt sie auch zweckmäßig mit Buchen und Tannen, aber nicht mit
Kiefern oder Eichen. Bei 100jährigem Umtriebe rechnet man auf den
mittleren Fichtenstandorten ungefähr 6 Festmeter vom einzelnen Baum.
Kaum eine andere Holzart ist zur Massenerzeugung so geeignet und
liefert ein so günstiges Resultat als die Fichte. Das weiche Holz
schwindet stark und ist außer als Brennstofferzeuger besonders als
Bau- und Werkholz beliebt. Die Rinde nicht zu alter Bäume dient zum
Gerben. Erzeugung und Verbrauch dieser Materialien lassen sich nicht
überblicken.
Im Gegensatz zur flachbewurzelten Fichte läßt die Weiß- oder
Edeltanne (Abies pectinata) ihre Wurzeln tief in
den Boden eindringen und ist dadurch sturmfest; auch ist sie dem
Schneebruch und Insektenschäden weniger ausgesetzt als jene. Sie
kann 10–15 Jahre von andern Bäumen unterdrückt stehen und gedeiht,
freigestellt, dennoch gut. Sie erholt sich leicht, wenn sie jung vom
Wild beschädigt wird, und ihre verlorene Spitze ersetzt sie sofort
durch eine oder zwei andere. Ihre glatte, graue, innen braune,
ziemlich dicke Rinde ist an den Stellen, an denen sich Terpentin
ansammelt, beulenartig aufgetrieben. An dem bis über 45 m hoch
werdenden Stamm stehen die Haupt- und Seitenäste zu drei bis sechs
quirlförmig horizontal ausgebreitet. Die 13–26 mm langen,
2 mm breiten, flachen Nadeln mit stumpfer, eingekerbter Spitze
sind oben glänzend dunkelgrün mit vertiefter Mittellinie, unten
dagegen blaugrau mit zwei deutlichen, aus je einer Reihe weißer
Punkte — den Spaltöffnungen — gebildeten[S. 662] Längslinien. Sie starren
nur an den aufrechten Gipfeltrieben rings um den Trieb herum, an
den Seitenzweigen ordnen sie sich kammförmig zu beiden Seiten des
Triebes, so daß sämtliche Nadeln ihre blattgrünreiche Oberseite dem
Lichte zuwenden. Auf die Eigentümlichkeiten der Fruchtbildung wurde
bereits hingewiesen. Da die Fruchtzapfen bei der Reife, wenn der Samen
ausfällt, verblättern, werden sie für die Forstnutzung im September
gepflückt. Die junge Pflanze erscheint zeitig im Frühjahr, oder 3–4
Wochen nach der Frühjahrssaat mit 4–8 Keimblättern, die sich von
denjenigen der Fichte durch ihre breitere, flachere Form unterscheiden.
Sie wird im ersten Jahre etwa 2,6 cm, im zweiten 5,2 cm
hoch. Der Zuwachs ist auf die Dicke des Stämmchens und auf ein oder
zwei Seitenästchen gerichtet, die sich in horizontaler Richtung über
den Boden hin verbreiten. Das Längenwachstum aber ist in dieser Zeit
sehr unbedeutend. Im 14. oder 15. Jahre hat die junge Weißtanne erst
eine Höhe von 15–60 cm erreicht, während die viel schneller
wachsende Fichte in dieser Zeit bedeutend größer geworden ist. Bis zum
100. Jahre wächst nun die Weißtanne jährlich um etwa 30 cm, von
da an weniger. Vom 30. Jahre an beginnt sie Früchte zu tragen. Auch sie
kann 400 bis 600 Jahre alt werden und eine Höhe von 63 m bei
einem Umfang von gegen 6 m erreichen.
Die Weißtanne fordert wie die Rotbuche einen höheren Feuchtegrad der
Atmosphäre und gemäßigtere Temperatur als die Fichte. Sie liebt daher
im Gebirge vorzugsweise die westlichen und nördlichen Einhänge. Den
besten Weißtannenboden liefern die feldspatreichen Urgebirgsarten,
Granit und Gneis, ferner tonreiche Schiefer und Konglomerate. Der
Boden muß tiefgründig und humusreich sein. Als Waldbaum gehört
sie den höheren Stufen des mitteleuropäischen Berglandes und den
südosteuropäischen Gebirgslandschaften meist in einer Höhe von
800–1200 m über Meer im mittleren, von 1200–1700 m im
südlichen Europa an. Zur höchsten Vollkommenheit gedeiht sie nur
im „Bestandsschluß“, da sie einen erheblichen Schneedruck erträgt
und in der Jugend des Schutzes durch Altstämme bedarf. Wird sie in
reinen Beständen angepflanzt, so gehört ein Umtrieb von 140 bis 160
Jahren dazu. Häufiger mischt man sie unter Buchen und Fichten. Die
Tannenbestände werden am besten in frostfrei liegenden Samenschlägen
verjüngt. Man sät wegen der Frostgefahr und des Mäusefraßes im Frühjahr
und bedeckt die Samen höchstens 0,8 cm tief mit Erde. Sind die
Pflänzlinge 2 Jahre alt, so werden sie umgepflanzt,[S. 663] werden aber erst
mit 6 Jahren an ihren definitiven Standort gebracht. Verwendet man
Wildlinge, so sind sie mit Ballen einzusetzen.
Aus der Weißtanne gewinnt man das beste Terpentin von hellgelber Farbe,
mit zitronenartigem Geruch und einem Gehalt von 34 bis 35 Prozent
Terpentinöl. Das weiße, leicht spaltbare Holz steht im Verbrennungswert
um 0,2 niedriger als dasjenige der Fichte, dagegen um 0,14 höher als
dasjenige der Kiefer und um 0,16 höher als dasjenige der Rotbuche. Es
gibt ein treffliches Bauholz, das an Dauer, Tragkraft und Elastizität
ein wenig hinter dem Fichtenholz zurücksteht und darin ungefähr dem
Kiefernholz gleichkommt. Es wird besonders zu Span- und Schnitzholz,
zu Schachteln, Siebrändern, Böttcherarbeiten und gedrechselten Waren
sehr geschätzt. Da die Stämme, soweit sie astrein sind, ziemlich
gleichstark bleiben, eignen sie sich vorzüglich zu Mastbäumen. Das Holz
junger Stämme gibt die besten Resonanzböden für Musikinstrumente. Meist
benutzt man junge Weißtannen mit farbigen Bändern geziert zu Maibäumen
und beim Aufpflanzen auf den Giebel neu aufgerichteter Häuser, ebenso
als Weihnachtsbaum, da diese Baumart vor den Fichten den Vorzug hat,
beim Trocknen die Nadeln nicht zu verlieren. Schon die alten Germanen
schmückten beim Julfest ihre Behausung mit Tannenzweigen als Symbol
der Unvergänglichkeit des Naturlebens. Dieses heidnische Julfest wurde
nach der Einführung des Christentums zum Weihnachtsfest umgedeutet, das
aber erst seit der Mitte des 17. Jahrhunderts durch einen geschmückten
Weihnachtsbaum mit angezündeten Kerzchen gefeiert wird. Der erste
nachweisbare Weihnachtsbaum brannte in Straßburg.
In Skandinavien, Nord- und Ostrußland und ganz Nordasien ist die
Altaifichte (Picea obovata) heimisch, während im
Morgenlande die Sapindusfichte (P. orientalis) als ein
30 m hoher Baum mit dichter, feiner Verzweigung, sehr gedrängt
stehenden, kurzen, glänzend dunkelgrünen Nadeln und harzreichem Holz
auf dem Taurus und Kaukasus dichte Wälder bildet. In Serbien, Bosnien,
Montenegro und Bulgarien bildete die über 40 m hoch werdende
Omorikafichte (P. omorika) von sehr schlankem Wuchs, mit
silberweißen Streifen auf der Unterseite der glänzend dunkelgrünen
Nadeln große Wälder, ist aber heute durch anhaltende Raubwirtschaft
auf wenige Standorte beschränkt. Diese, wie auch die im Kaukasus und
im pontischen Gebirge heimische Nordmanns-Weißtanne (Abies
nordmanniana) mit schwärzlichgrauer Rinde, unterseits bläulichweiß
gestreiften Nadeln und sehr großen, mit Harz bedeckten Fruchtzapfen,
die in Griechenland heimische[S. 664] griechische Tanne (A.
cephalonica) mit spitzen Nadeln, die schöne, über 60 m
hoch werdende spanische Tanne (A. pinsapo), die in den
Gebirgen Südspaniens und Nordafrikas noch Bestände bildet, und die
sibirische Tanne (A. sibirica) werden bei uns kultiviert.
Desgleichen kultiviert man von amerikanischen, die in ihrer Heimat
eine große Bedeutung als Nutzhölzer haben, die Schwarzfichte
(Picea nigra), einen etwa 25 m hohen Baum mit
schwärzlicher Rinde, dunkelgrünen, durch die weißlichen Spaltöffnungen
blaugrün erscheinenden Nadeln und 3 cm langen, in der Jugend
schön violetten Zapfen. Sie bildet mit der Rotfichte (P.
rubra), einem bis 20 m hohen Baum mit rötlichem Holz und
frischgrünen Nadeln, und der Weißfichte (P. alba), einem
25–30 m hohen Baum mit graugrünen, blaugrün erscheinenden Nadeln
und 3–4 cm langen Zapfen im nordöstlichen Nordamerika größere
Bestände. Ihr Holz ist dauerhafter als das der beiden zuletzt genannten
Arten.
Während in unsern Mittelgebirgen die mehr wärmeliebende Tanne die
tieferen Lagen, die meist auch besseren Untergrund haben, einnimmt,
und die Fichte höher hinaufsteigt, vermögen beide nicht auf sonnigen,
trockenen Hängen oder auf schlechtem, steinigem Boden zu gedeihen.
Dagegen tut dies die Kiefer oder Föhre (Pinus
silvestris), die ihre Wurzeln tief durch die engsten Felsspalten
zu zwängen versteht und wie im kargen Felsboden, so auch im magersten
Sandboden fortzukommen vermag. Nicht weniger als ⅖ der gesamten
Waldfläche Deutschlands, besonders die von der letzten Eiszeit
herrührenden sandigen Gebiete des Nordostens, sind mit ihr bestanden.
Durch sie ist es überhaupt für den Menschen möglich geworden, die
unfruchtbaren Sand-, Heide- und Moorgegenden Norddeutschlands zu
besiedeln. Im Naturwald kommt die Kiefer nur auf ganz nahrungsarmem
Boden rein vor. Überall auf den mittleren und besseren Bodenarten
sind die Bestände mit Eichen, Birken und Buchen durchsprengt. Von
den Grenzen Italiens bis Lappland wird sie gefunden und reicht von
Frankreich bis nach Sibirien. Sie gedeiht im hohen Norden Rußlands
noch, wo kein Baum mehr fortkommt, und geht in Norwegen bis zum 70.
Grad nördlicher Breite, wo die nördlichsten Kiefernwaldungen der Erde
sind. In Südeuropa wächst sie nur auf Gebirgen; in Griechenland,
namentlich auf den Gebirgen Makedoniens, wird sie in über
2000 m Höhe, wie an der Baumgrenze im Norden, strauchartig. Der
25–33 m hohe Baum bildet nach erreichtem Höhenwachstum seine
zuvor pyramidenförmige Krone schirmförmig aus. Der[S. 665] 0,6–1,2 m
dicke Stamm ist mit dicker, längsrissiger Borke bedeckt, die unten
schwarzgrau, weiter oben rotbraun und zu oberst leuchtend braungelb
gefärbt ist. Im freien Stande ist sie der Länge nach mit Ästen besetzt
und blüht vom 15. Jahre an, während sie in geschlossenen Beständen
bis hoch hinauf die infolge Lichtmangels abgestorbenen Äste abwirft,
nur eine unbedeutende, lockere Krone bildet und erst vom 50. Jahre an
blüht. Durch die tief in den Boden eindringenden Wurzeln ist die Kiefer
sturmfester als die nur ein oberflächliches Wurzelwerk ausbildende
Fichte, leidet aber an ihrer weit ausgreifenden, fast kuppelförmig
gewölbten Krone mehr durch Schneedruck als jene. Die Nadeln der
Kiefer sind länger und dünner als diejenigen der Fichte und Tanne,
2,5 bis fast 8 cm lang, matt blaugrün, sind im Querschnitt
halbkreisförmig und kommen, mit der abgeflachten Seite gegeneinander
gestellt, zu je zweien aus einer häutigen Scheide, die eigentlich ein
stark verkürzter Seitentrieb ist. Sie werden im Alter dunkler grün,
sind von mehreren Harzgängen durchzogen und fallen im Herbst des
dritten oder vierten Jahres ab. An der Spitze der hellgrünen, jungen
Triebe erscheinen im April und Mai gestielte, kugelige Zäpfchen von
bräunlichroter Farbe, die Samenblüten, während am Grund anderer die
reich mit goldgelbem Pollen gefüllten grünen, männlichen Blütenkätzchen
hervorbrechen. Dieser ergießt sich so reichlich, um vom Winde auf die
weiblichen Blüten getragen zu werden, daß er nach einem Gewitterregen
die Oberfläche von Wasserrinnen und Gräben dicht überzieht; so ist
es begreiflich, daß man einst, bevor man die Natur dieses Überzuges
erkannt hatte, die Fabel vom Schwefelregen erfinden konnte. Die Zapfen
der Kiefer sind erst im Spätherbst des zweiten Jahres ausgereift, sie
sind dann mattgrau, eiförmig, öffnen sich aber erst im März des dritten
Jahres durch Auseinanderweichen der holzigen Fruchtblätter, um die nach
oben in einen langen, häutigen Flügel auslaufenden Samen vom Winde
entführen zu lassen. Aber auch wenn sie geleert sind, bleiben sie noch
lange am Baume hängen, bis sie der Wind abreißt. Dann werden sie als
„Kienäpfel“ vielfach gesammelt und geben ein gutes Brennmaterial.
Die junge Kiefer braucht zu ihrem Gedeihen reichliche Belichtung und
ist deshalb mit sehr raschem Jugendwachstum ausgestattet, das ihr
erlaubt, sich bald über die langsamer wachsenden Holzarten ihrer
Umgebung hinauszuheben. Dabei kommt der regelmäßige Aufbau der
jährlichen Astquirle besonders klar zum Ausdruck, zumal die Kiefer
niemals Ästchen zwischen den Quirlen entwickelt. Auch ihre lichte[S. 666]
Zweigstellung weist darauf hin, daß sie mehr Sonne und Licht bedarf als
Tanne und Fichte. Da in diesem Falle der Stamm besonders der Erwärmung
ausgesetzt ist, kann ihm die dicke Schutzborke, durch die sich die
Licht liebenden Hölzer im allgemeinen von den Schatten ertragenden
Baumarten unterscheiden, nur von Vorteil sein. Um junge Kiefernpflanzen
zu erzielen, sät man den Samen in Rillen und verpflanzt in der Regel
die einjährigen, seltener die zweijährigen Pflänzchen in die Bestände,
die vierjährigen müssen, wenn sie nicht eingehen sollen, sorgfältig mit
Ballen versehen sein. In Mischbeständen bleibt die Kiefer gesunder als
in reinen Beständen. Sie wächst in der ersten Hälfte ihres Lebens viel
schneller als in der zweiten, vom 50. bis 80. Lebensjahre wächst sie
langsamer, aber gleichmäßiger fort und erreicht ein Alter von ungefähr
300 Jahren. Das gelbliche bis rötlichweiße Holz besonders der nicht
zu rasch aufgeschossenen Stämme ist infolge seines Harzreichtums sehr
dauerhaft und deshalb besonders zu Erd- und Wasserbauten viel begehrt.
Früher wurden mit Vorliebe Schiffsmasten aus ihm hergestellt, während
man es neuerdings mehr zu Eisenbahnschwellen und zur Holzpflasterung
verwendet. Besonders gut eignet sich dazu das engringige skandinavische
Kiefernholz, während als Zimmerholz dasjenige der amerikanischen
Kiefern, besonders das pitchpine, vorgezogen wird. Aus dem
harzreichen Stockholze gewann man früher mehr als heute Kienöl und
Kienruß; außerdem liefert die Kiefer Terpentin, Teer und Pech, die
Rinde Gerbstoff. Die gallertartige, süße Borke wird in Schweden roh und
zubereitet gerne gegessen. Die Kiefer hat besonders unter den Insekten
eine große Anzahl gefährlicher Feinde, unter denen der Kiefernspinner,
die Nonne, die Kieferneule, der Kiefernspanner, der große und kleine
Kiefernrüsselkäfer, die große und kleine Kiefernblattwespe und der
Kiefernmarkkäfer zu nennen sind.
Im Gebirge ist die Kiefer durch die Bergkiefer, auch
Knieholzkiefer oder Legföhre, Latsche genannt
(Pinus montana früher P. pumilio) vertreten. Sie ist
außerordentlich anpassungsfähig an die verschiedensten Standorte,
wechselt dementsprechend außerordentlich in bezug auf Wuchs, Form
und Aussehen, so daß schon Sachkenntnis dazu gehört, sie unter allen
Umständen zu erkennen. In der baumlosen Hochgebirgsregion — in den
Alpen von 1400–2000 m Höhe — überzieht sie als niederes,
dem Boden angedrücktes Knieholz sehr weite Flächen und bildet einen
vortrefflichen Schutz gegen Lawinengefahr, da sie, wegen ihrer
großen Biegsamkeit den Schneedruck aushaltend,[S. 667] große Schneemassen
festzuhalten vermag. Andererseits gedeiht sie auch im lockeren
Flugsande der Dünen, wo sie, besonders in Dänemark, zur Festhaltung des
Sandes angepflanzt wird. Zu ihren natürlichen Standorten gehören auch
die ausgedehnten Hochmoore des Alpenvorlandes, wo sie bald strauchartig
ihre Äste bogenförmig vom Boden erhebt, bald als aufrechter, bis
15 m Höhe erreichender Baum mit Kiefern und Birken vermischt kleine
Bestände bildet. Diese letztere Form wird auch als „Spirke“ bezeichnet,
während bei der eigentlichen Legföhre der Stamm dem Boden anliegt und
erst gegen die Spitze zu sich allmählich aufrichtet, um der Sonne
entgegenzustreben.
Alle Formen der Bergkiefer unterscheiden sich von der gemeinen Kiefer
durch eine nach Stärke und Färbung viel mehr an die Fichte als an die
Kiefer erinnernde Borke, durch gedrungenen Wuchs, durch dauerhaftere,
dunkelgrüne, kürzere und dickere Nadeln und kleine nicht mattgraue,
sondern glänzend braune, nach dem Aufspringen fast kugelige Zapfen. Das
dichte, feine Holz dient zu Drechslerarbeiten und Schnitzereien; auch
gewinnt man aus ihm statt Terpentinöl das besonders zu Inhalationen bei
Bronchitis beliebte Latschenöl, das ein altes Volksheilmittel ist und
besonders in Bayern und Tirol viel angewandt wird.
Vom Wienerwald bis Sizilien, von Südspanien bis nach Kleinasien
findet sich, zumeist in Korsika, im Apennin und in Bithynien, die der
gemeinen Kiefer ähnliche, aber mit grauschwarzer Borke und dunklen,
grünen Nadeln versehene, 30–38 m hohe Schwarzkiefer
(Pinus laricio) mit pyramidenförmiger Krone, die sich erst im
Alter wölbt. Sie ist der schon mehrfach in der Ilias als peúkē
genannte Baum, der schon bei den alten Griechen zur Terpentin- und
Harzgewinnung ausgebeutet wurde. Das harzreiche Holz wurde, weil nicht
faulend, besonders zu Pfählen, dann aber auch zur Herstellung von
Fackeln verwendet. Die Fackelmacher bildeten im alten Griechenland
ein besonderes Gewerbe. In derselben Weise wurde sie bei den Römern
ausgebeutet. Heute wird sie besonders in Frankreich zur Harzgewinnung
kultiviert, wie in den österreichischen Alpen ihre Abart, die
österreichische Kiefer (Pinus nigricans). Bei uns wird
neuerdings die aus Österreich eingeführte Schwarzkiefer infolge ihrer
überaus großen Genügsamkeit in bezug auf den Boden zur Aufforstung
von Ödland verwendet; doch kann sich ihr Holz an Güte mit demjenigen
unserer gemeinen Kiefer nicht messen.
Ebenfalls zur Harznutzung wird die in Südeuropa und Klein[S. 668]asien im
Gebirge nahe der Meeresküste häufig angetroffene Strandkiefer
(P. maritima) benützt. Im Westen von Algerien bildet sie
noch ausgedehnte Wälder. Der schöne, 25–30 m hohe Baum mit
pyramidenförmiger Krone, langen, dunkelgrünen, etwas gekrümmten
Nadeln und braunen Zapfen ist in fast alle am Meere gelegene Länder
eingeführt worden. Vornehmlich aber der Terpentingewinnung dient
die als Terpentinkiefer (P. pinaster) bezeichnete
Abart derselben. Der sehr hoch werdende Baum hat einen grauschwarzen
Stamm, sehr rauhe Äste mit ziemlich dicken, lebhaft grünen Nadeln
und grauen Zapfen und wird auf dem dürren Heideboden der Landes in
Südwestfrankreich im großen zur Terpentingewinnung kultiviert. Ihr
wurde von der Wissenschaft die Bezeichnung der alten Römer für Kiefer,
pinaster, gegeben.
Den lateinischen Namen pinus dagegen erhielt von den Römern
die in Südeuropa heimische Pinienkiefer oder Pinie
(Pinus pinea), ein 12–16 m hoher Baum mit malerischer
Schirmkrone, 13–20 cm langen Nadeln mit 11–13 cm langen
Zapfen mit eßbaren Samen, Piniennüsse oder, nach dem italienischen
pignoli, als Pignolen bezeichnet. Er bildet heute noch
stellenweise in Griechenland und Italien Wälder, von denen der Pineta
genannte Pinienwald bei Ravenna der bekannteste ist. (Taf. 97.) Der
ältere Plinius gibt uns eine eingehende Beschreibung der Kultur der
Pflanze, von der der Dichter Vergil sagt: „Die Pinie (pinus)
ist der schönste Baum der Gärten, die Esche (fraxinus) der
schönste Baum der Wälder, die Pappel (populus) der schönste der
Flüsse, die Tanne (abies) aber der schönste der Hochgebirge.“
Das häufigste und nützlichste Nadelholz Griechenlands aber war die von
den alten Hellenen pítys genannte Aleppokiefer (Pinus
haleppensis) mit 7–9 cm langen, fadenförmigen Nadeln und
8–10 cm langen, übergebogenen, kegelförmigen Zapfen. Mit
letzterem, der auch von der gemeinen Pinie genommen wurde, war der mit
Efeu und Weinlaub umwundene Thyrsosstab der Bacchanten gekrönt, weil
mit dem von diesem Baume gewonnenen Harz der Wein zur Konservierung
„resiniert“, d. h. geharzt wurde. Mit einem Kranze aus seinen Zweigen
wurden die Sieger der dem Meergotte Poseidon zu Ehren alle zwei Jahre
abgehaltenen Isthmischen Spiele an der den Peloponnes mit dem übrigen
Griechenland verbindenden Meerenge von Korinth geschmückt. Seine
Stämme lieferten den Griechen außer Harz und Terpentin das beste
Schiffsbauholz.
Von nordamerikanischen Kiefern, die eine über ihr Vaterland[S. 669]
hinausgehende Bedeutung erlangt haben, ist die hauptsächlich das
amerikanische Terpentin liefernde Weihrauchkiefer (Pinus
taeda) mit fast weihrauchartigem Harz, dann die ebenfalls
im atlantischen Gebiet der Union ausgedehnte Wälder bildende
Pechkiefer (P. rigida), ferner die Terpentinkiefer
(P. palustris) zu nennen, deren gelbrotes Holz als
pitchpine wegen des verhältnismäßigen billigen Preises in großer
Menge bei uns eingeführt und besonders zu Fußböden, Vertäfelungen,
Innenausstattung von Trambahnwagen, seltener zu Möbeln Verwendung
findet. Unter demselben Namen wird auch das Holz der auf dem
Felsengebirge noch in großen Beständen vorkommenden Gelbkiefer
(P. ponderosa) in den Handel gebracht, während das ebenfalls
gelbe Holz der in den Südstaaten der Union und in Mexiko wachsenden
Besenkiefer (P. australis) als yellow pine reiche
Verwendung findet. Auch sie liefert viel Harz und Pech sowie Terpentin.
Noch größer als sie werden Coulters- und Sabines-Kiefer
(P. coulteri und P. sabineana), die wie die vorigen als
Zier- und Nutzbäume bei uns kultiviert werden. Die größte Bedeutung
kommt aber als Zier- und Nutzholz der schlanken Weymouthskiefer
(P. strobus) aus dem atlantischen Gebiet Nordamerikas zu, die
seit 1705, als sie Lord Weymouth nach Europa brachte, das Bürgerrecht
bei uns erworben hat. Sie besitzt 10–16 cm lange, hellgrüne,
fein geriefte Nadeln und langgestreckte, großschuppige Fruchtzapfen.
Sie ist durch ihr rasches Wachstum ausgezeichnet und liefert ein
weißes, geradfaseriges Holz, das bei uns hauptsächlich zu Kisten,
Rolläden usw. verarbeitet wird.
Noch weit größer als sie wird die 80–96 m Höhe bei einem
Stammdurchmesser von 4,8 m erreichende kalifornische
Riesenkiefer (P. lambertiana), die durch blaugraue,
10–13 cm lange, am Rande fein gezähnelte Nadeln ausgezeichnet
ist. Bei ihr entspringen wie bei der Weymouthskiefer und den
folgenden Kieferarten einschließlich der Arve die Nadeln zu 5 aus
einer Scheide. Nur etwa 38 m hoch mit 8–10 cm langen,
gekielt dreikantigen Nadeln und 40 cm langen Zapfen wird die im
Süden der Union und in Mexiko wachsende Acahuitfichte (P.
ayacahuitle) — bei den alten Mexikanern ayaquahuitl genannt
—, deren Holz außerordentlich harzreich ist und aus deren Zapfen ein
klares, wohlriechendes Terpentin tropft, das in seiner Heimat vielfach
Verwendung findet.
Wie die Pinie eßbare, als Zirbelnüsse bezeichnete Samen, hat auch die
Zirbelkiefer oder Arve (P. cembra) genießbare
Früchte. Dieser stattliche Baum mit 10–13 cm langen, steifen,
dreikantigen[S. 670] Nadeln und 8–10 cm langen, eiförmigen Zapfen ist
bei uns ein ausgesprochener Bewohner des Hochgebirges, der bis an die
Baumgrenze (über 2000 m) hinansteigt und hier dem Wanderer als
eine prächtige Erscheinung entgegentritt. Leider ist aber dieser Baum
in den Alpen entschieden im Rückgang begriffen, da er den erfolgreichen
Wettbewerb lebenskräftigerer Arten nicht aushält. In den Karpaten
steigt er tiefer hinab als in den Alpen und bildet in Sibirien auf
dem flachen Lande ausgedehnte Wälder. Auf den Gebirgen Asiens und
im äußersten Nordosten Sibiriens bildet die Arve eine der Legföhre
entsprechende, als Legarve bezeichnete Form. Diese nordische Arve ist
durch gewisse biologische Unterschiede von der alpin-karpatischen
verschieden, sie keimt und wächst rascher, wird höher
(35–42 m, während sie im ersteren Gebiet sehr selten 20 m
hoch wird und nie über 24 m hinausgeht), ist mit einem Wort
noch lebenskräftiger als die mehr im Süden vorkommende. Ihr rötlich
gelbes Holz dient mit Vorliebe zum Bau der Alphütten, zur Vertäfelung
der Zimmer der Gebirgsbewohner (z. B. im Engadin) und liefert wegen
seiner Gleichmäßigkeit ein vortreffliches, viel benutztes Material zu
Schnitzarbeiten.
Gleicherweise ein Hochgebirgsbewohner wie die Arve, aber ein solcher,
der im Gegensatz zu jener von seinem ursprünglichen Wohngebiet
hinabstieg und vom Menschen weithin auch in den Niederungen angesiedelt
wurde, ist die Lärche (Larix decidua), die insofern von
allen europäischen Nadelhölzern eine Ausnahmestellung einnimmt, als
sie nicht immergrün ist, sondern im Herbst regelmäßig ihre Nadeln
abwirft. Diese müssen also viel zarter gebaut sein, als die der
übrigen Nadelhölzer. Sie sind nur 2,5 cm lang und stehen an den
jungen Trieben einzeln in spiraliger Anordnung; im zweiten Jahr aber
bilden sich kurze, knopfförmige Seitentriebe, an denen die Nadeln,
zu 15–30 vereinigt, hellgrüne Büschel bilden. Sowohl die hängenden,
gelben Pollenblüten, als die aufrechten, roten Fruchtblüten bilden
sich an älteren Zweigen, und die 4 cm langen, eiförmigen Zapfen
bleiben mehrere Jahre am Baum; die Samen aber werden an dem auf die
Blüte folgenden Frühjahr daraus entlassen. Die ursprüngliche Heimat
dieses 25–45 m hohen Baumes mit anfangs gelbbrauner, später
grauer, rauher, rissiger Rinde ist Nordrußland und Sibirien, von wo
sie zur Eiszeit mit der weniger anpassungsfähigen Arve nach Süden
kam und mit dem Wärmerwerden des Klimas sich wiederum nach Norden
und auf die kühlen Gebirgslagen zurückzog. Im Flachlande leidet
sie sehr durch einen Pilz (Peziza willkommi), der krebsige
Wucherungen am[S. 671] Holze hervorruft, und durch die Lärchenminiermotte
(Coleophora laricinella), deren Larve die Nadeln ausfrißt. Wenn
sie trotzdem immer wieder bei uns angepflanzt wird, so ist daran die
hervorragende Güte ihres im Kern auffallend braunroten Holzes schuld,
das seiner Festigkeit und durch seinen reichen Harzgehalt bedingten
außerordentlichen Dauerhaftigkeit wegen ein vortreffliches Bauholz
liefert. Die junge Rinde wird als Gerbmaterial derjenigen der Fichte
vorgezogen, und durch tiefe Bohrlöcher wird der hauptsächlich im
Kernholz enthaltende „venezianische“ Terpentin in den Südtälern der
Alpen, vorzugsweise um Meran, Bozen und Triest, gewonnen. Von der im
mitteleuropäischen Gebirge wachsenden Lärche ist die sibirische
Lärche (L. dahurica) nur durch die nicht überhängenden
Zweige, durch die weniger zahlreich gebüschelten Nadeln und durch
die am Rande etwas eingebogenen Zapfenschuppen verschieden. In Japan
wächst die zartschuppige Lärche (L. leptolepis), während
im westlichen Nordamerika die 40 bis 80 m hohe Larix
occidentalis von schlankem Wuchs und festem Holz ausgedehnte
Waldungen bildet. Im östlichen Nordamerika dagegen bildet von Virginien
bis Kanada die zierliche, leicht bezweigte Larix pendula von
30 m Höhe große Bestände und liefert ein gutes Nutzholz.
Mit der Lärche verwandt und hauptsächlich durch auch im Winter
bleibende Nadeln und größere, 9 cm lange, mehrere Jahre
zur Reife bedürfende Fruchtzapfen, sowie ihre schirmförmige Krone
verschieden ist die Ceder (Larix cedrus). Die bekannteste
Art ist die auch als Cedrus libani bezeichnete Libanonceder, die
einst auf allen Gebirgen Syriens und Kleinasiens ausgedehnte Waldungen
bildete, welche aber im Laufe der Zeit bis auf geringe Reste dem
Menschen zum Opfer fielen, da ihre mächtigen Stämme ein treffliches
Bau- und Schiffsholz abgaben, das sehr gesucht war und weithin
ausgeführt wurde. Das Cedernholz, das schon im Gesetze des Moses als
Opfergabe genannt wird, ist das weißeste und am wenigsten harzhaltige
unter allen Nadelhölzern; es ist sehr geradfaserig und deshalb leicht
spaltbar. Noch zur Zeit des Königs Hiram von Tyrus (1001–967
v. Chr.), des Freundes und Bundesgenossen der jüdischen Könige David und
Salomo, war der ganze Libanon, wie der Antilibanon, das Taurus- und
Amanusgebirge von ausgedehnten Cedernwäldern bedeckt, aus denen die
umliegenden Fürsten das nötige Bau- und Schiffsholz holen ließen. Schon
der altbabylonische Priesterkönig Gudea von Lagasch ließ nach den uns
erhaltenen Inschriften um 2000 v. Chr. Cedernholz zur Bedachung seines
Tempels vom Amanusgebirge an der Küste des Mittelmeers holen.[S. 672] Dasselbe
berichten uns mehr als 1000 Jahre später die großen Assyrerkönige. In
der Bibel wird erzählt, wie König Salomo das Gebälk zu dem von ihm
erbauten herrlichen Tempel Jahves in Jerusalem von den Cedernhainen des
Libanons beschaffen ließ.
Wie im holzarmen Mesopotamien war auch in Ägypten die Ceder das die
größten Balken liefernde Nutzholz. Die hier vorkommenden Baumarten,
die Sykomore, Dattelpalme, Akazie und Tamariske gaben ein für größere
Bauobjekte durchaus ungeeignetes Material, und so wurde schon zur Zeit
des alten Reiches Cedernholz aus Syrien und Ebenholz aus Nubien auf den
großen, zum Transport von Getreide und Vieh dienenden Lastschiffen nach
Ägypten zum Bau der großen Tempel eingeführt. Auch zur Herstellung der
größeren Fahrzeuge wurde mit Vorliebe Cedernholz benutzt. Daraus war
nicht nur das jetzt im Fieldmuseum in Chicago befindliche, 9 m
lange, 2 m breite und 1,2 m tiefe Totenschiff des von
1887–1849 v. Chr. regierenden Sesostris III. aus der 12. Dynastie
gemacht — es stammt aus seiner Ziegelpyramide bei Daschur —, sondern
auch die großen Handels- und Kriegsschiffe, mit denen bereits die
Könige des alten Reichs bis weit ins Mittel- und Rote Meer hinausfahren
ließen, um allerlei kostbare Erzeugnisse zu holen oder Kriege zu
führen. So besaß schon Snofru, der Erbauer der ältesten Pyramide
(2930–2906 v. Chr.), Flußschiffe von 50 m Länge, und sein
Vorgänger, der letzte König der 3. Dynastie, trieb bereits einen regen
Handel mit dem Norden und entsandte eine Flotte von 40 Schiffen nach
der phönikischen Küste, um von den Abhängen des Libanon Cedernbalken
für seine Bauten in Memphis zu holen.
Tafel 157.

Gruppe von Libanon-Zedern im kilikischen Taurus. (Nach einer in der
Sammlung des Botan. Institutes der Universität Wien befindlichen
Photogr. von W. Stehe, Mersina.)

Momentaufnahme der Fällung der Mammutkiefer (Sequoia
gigantea) „Mark Twain“ in Kalifornien. Der im folgenden Bilde
dargestellte Querschnitt der Stammbasis desselben ist im American
Museum of National History in New York aufgestellt (nach Sherwood).
Tafel 158.
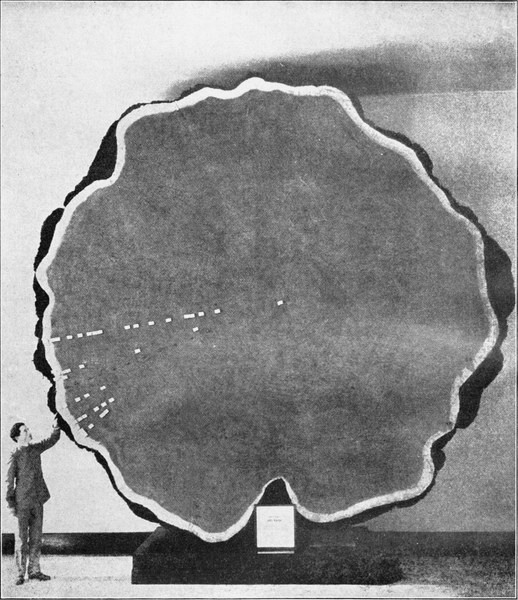
Querschnitt durch die im Jahre 1891 gefällte Mammutkiefer „Mark Twain“,
deren Alter sich nach den Jahresringen auf 1341 Jahre bestimmen läßt.
Dieser Baum begann demnach sein Dasein im Jahre 550 n. Chr., als
Kaiser Justinian I. das Reich der als Arianer für ihn den Athanasianer
ketzerischen Ostgoten in Italien durch den Obereunuchen Narses mit
starker Heeresmacht zerstören ließ. Die oberste Reihe von Karten gibt
die wichtigsten Daten der Weltgeschichte von diesem Jahre an wieder,
die folgende die Geschichte der Philosophie, die dritte dunklere Reihe
die Aufeinanderfolge der Jahrhunderte, die vierte die Entwicklung der
Biologie, die fünfte diejenige der vergleichenden Anatomie, die sechste
(eine einzige Karte) die Begründung der Paläontologie, die siebente die
Entwicklung der Embryologie (nach Sherwood).
❏
GRÖSSERES BILD
Weiter entnehmen wir auf uns gekommenen Inschriften von Amenemhet I.
aus der 12. Dynastie, der von 2000–1970 v. Chr. regierte, daß er auf
einem Feldzuge nilaufwärts nach Aethiopien 20 große Cedernschiffe
mit sich führte. Später erfahren wir von Thutmosis IV. aus der 18.
Dynastie, der von 1420–1411 über Ägypten herrschte, daß er aus dem
von ihm eroberten Syrien eine Ladung Cedernholz für die heilige
Barke des Gottes Amon nach Theben mitbrachte. Ferner wird uns durch
inschriftliche Urkunden von Ramses III. aus der 20. Dynastie, der
von 1198–1167 v. Chr. regierte, bezeugt, daß er, wie seine mächtigen
Vorgänger besonders der 18. und 19. Dynastie, zahlreiche große
seetüchtige Schiffe bis nach Cypern und dem Land Punt in Südarabien
beziehungsweise Ostafrika sandte, um die Erzeugnisse jener Länder gegen
einheimische Waren umzutauschen. Damals besaßen auch die mächtigen,
mit ungeheurem Besitze und einem ent[S. 673]sprechenden Einkommen von
den siegreich aus ihren Feldzügen nach Vorderasien und Aethiopien
zurückkehrenden Pharaonen ausgestatteten Priesterschaften der großen
Tempel des Amon, Ra und Ptah je ihre eigenen Flotten auf dem Mittelmeer
und im Roten Meer, welche die Erzeugnisse von Phönikien, Syrien und
Punt in die Schatzkammern der betreffenden Gottheiten lieferten. Ramses
III. spricht in einer Tempelinschrift von einer von ihm gestifteten
heiligen Barke des thebanischen Amon von mehr als 67 m Länge,
die aus ungeheuren Cedernbalken vom Libanon auf seinen Werften gebaut
worden war.
Auch die Phöniker und Chethiter verwendeten das Cedernholz viel, wie
zu Bauten und Schiffen, so auch zur Herstellung großer Götterbilder.
So erbeutete der ägyptische König Thutmosis III., wie uns in einer
Inschrift seines daraufhin errichteten Tempels bezeugt ist, nach
seinem ruhmvollen Siege vor Megiddo am Ostabfall des Karmel über
das Heer der vorderasiatischen Verbündeten unter dem Oberbefehl des
Königs von Kadesch am 14. Mai 1479 v. Chr. außer 924 Kriegswagen,
2238 Pferden und 202 Waffenrüstungen auch das prachtvolle Zelt des
Königs von Kadesch mit dessen reicher Einrichtung, darunter sein
Königszepter, eine silberne Statue — wahrscheinlich die seines
Gottes — und eine Statue von ihm selbst aus Cedernholz, mit Gold und
Lapislazuli verziert, sowie ungeheure Mengen an Gold und Silber. Der
Grieche Theophrast kennt die Ceder Syriens und sagt, daß deren Holz
zu Schiffen mit drei Reihen von Ruderbänken übereinander verwendet
werde: „Auf den Gebirgen Syriens wachsen gewaltig hohe und dicke Cedern
(kédros); es gibt einzelne, die von drei Männern nicht umspannt
werden können, und in den Parks werden sie noch größer und schöner.“
Der ältere Plinius berichtet: „Die Könige von Ägypten und Syrien
sollen in Ermanglung von Tannen (abies) Cedern zu ihren Flotten
verwendet haben. Die größte davon soll auf der Insel Cypern gestanden
haben; Demetrius ließ sie zu einem Schiffe verwenden, das 11 Reihen
von Ruderbänken übereinander besaß; sie war 130 Fuß hoch und so dick,
daß sie gerade von drei Mann umspannt zu werden vermochte.“ Wie das
Dach des Dianatempels zu Ephesus, ruhten auch diejenigen zahlreicher
großer Tempel der hellenistischen und christlichen Zeit im Orient, so
beispielsweise der Kirche, die die Mutter Kaiser Konstantins des Großen
(274–337 n. Chr.), Helena, über dem Heiligen Grab erbauen ließ, auf
mächtigen Cedernbalken.
Bei allen Kulturvölkern des Altertums war das Cedernholz durch seine
Unverwüstlichkeit bekannt und überaus geschätzt. Deshalb ver[S. 674]wendete
man es mit Vorliebe zur Herstellung von Götterbildern, von Särgen und
Kisten, zum Aufbewahren von kostbaren Gegenständen, besonders auch
Schriftrollen. So spricht der römische Dichter Horaz von carmina
linenda cedro im Sinne von der Unsterblichkeit werte Gedichte, und
Pausanias im 2. Jahrhundert n. Chr. berichtet: „In Olympia befindet
sich ein berühmter Kasten aus Cedernholz; er ist mit Bildern bedeckt,
die teils aus Gold und Elfenbein, teils aus dem Cedernholze selbst
gearbeitet sind. In diesem Kasten ist Kypselos, der später König von
Korinth wurde (657–629 v. Chr.), als Kind von seiner Mutter versteckt
worden, als er von seinen Feinden überall gesucht wurde.“ Heute kommt
das syrische Cedernholz kaum mehr in den Handel, wohl aber dasjenige
der im nordafrikanischen Atlasgebirge heimischen Atlasceder
(Cedrus atlantica) und der am Südabhang des Himalaja wachsenden
Deodarceder (Cedrus deodara), die sich nur wenig von der
Libanonceder unterscheiden. Wie alle Cedernarten besitzen auch sie ein
leichtes, weiches, sehr wohlriechendes Holz von hell braunrötlicher
Farbe und sehr großer Dauer; soll es doch selbst von den gefürchteten
Termiten nicht angegriffen werden. Es findet für viele Zwecke,
namentlich zu Furnieren, Galanterie- und Drechslerarbeiten Verwendung.
Aus ihm werden auch die Rennbote gebaut, die zu den berühmten
Wettfahrten auf der Themse zwischen auserwählten Mannschaften der
Universitäten Cambridge und Oxford im Gebrauch stehen.
Die alten Griechen bezeichneten mit dem Worte kédros auch
noch andere kostbare Nadelhölzer, die sich durch stark balsamischen
Geruch ihres Holzes auszeichneten, und stellten sich aus ihnen
mottensichere Kisten zur Aufbewahrung ihrer Wollkleider her. Darunter
war vor allem dasjenige einer heute noch im westlichen Nordafrika,
auf dem Atlasgebirge und seinen Vorbergen, wachsenden stattlichen
Cypressenart, die wir bei der Besprechung des Sandaraks im Abschnitt
über Harze als Sandarakcypresse (Callitris quadrivalvis)
kennen lernten, in hohem Ansehen. Durch die Griechen Süditaliens
wurden die Römer mit diesem kostbaren Holze bekannt, wobei sie aus
dem griechischen kédros das lateinische citrus machten.
Außer durch seine Unverwüstlichkeit war es vor allem durch seine
prächtige Maserung berühmt und wurde zur Herstellung von Luxusmöbeln
und zum Furnieren gebraucht. Letzteres besteht darin, daß man
minderwertige Hölzer (Blindhölzer) mit dünngeschnittenen Blättern
(Furnieren) wertvollerer Holzarten überkleidet. Als Blindhölzer dienen
weichere, wenig arbeitende und sich werfende Hölzer, wie Fichte,
Tanne, magere Kiefer, Linde, vornehmlich aber die[S. 675] verschiedenen
Pappel- und Weidenarten. Das Furnieren ist nicht sowohl aus Gründen der
Billigkeit so beliebt, sondern aus Zweckmäßigkeit, weil dadurch dem
Werfen und Reißen entgegengewirkt wird. Zudem sind die am schönsten
gemaserten und gewellten Holzarten zur Verwendung in massiven Stücken
unbrauchbar, können aber auf diese Weise leicht verwendet werden. Diese
Kunst des Furnierens ist übrigens keine Errungenschaft der Neuzeit,
sondern wurde schon bei den Kulturvölkern des Altertums, besonders
bei den Griechen und Römern geübt. So schreibt der ältere Plinius in
seiner Naturgeschichte: „Zu dünnen Platten, womit man anderes Holz
überzieht, verwendet man vorzugsweise das Holz der (schönmaserigen)
Citrum-Cypresse (eben der Sandarakcypresse), der Terpentinpistazie,
der Ahornarten, des Buchsbaums, der Stechpalme, der Ilexeiche, der
Holunderwurzel, der Pappel; auch die Erle liefert, wie Lebensbaum
(Thuja) und Ahorn Knorren zum Furnieren.“
Im 4. Jahrhundert v. Chr. erwähnt der pflanzenkundige Theophrast die
Sandarakcypresse als thýon. Der Baum gleiche in allen Teilen
der wilden, jetzt auf Kreta, Bithynien und Persien wachsenden Cypresse
mit seitwärts ausgebreiteten Ästen (Cupressus expansa) und
wachse im Gebiet von Kyrene und beim Tempel des Amon. „In großer Menge
stand der Baum früher da, wo jetzt die Stadt steht, auch sollen dort
noch einige alte Dächer von ihm gebaut sein. Sein Holz widersteht der
Fäulnis für immer, und besonders die Wurzel ist gemasert; man macht
aus ihr die herrlichsten Kunstwerke.“ Spätere Schriftsteller bemerken,
daß das schön gemaserte Holz vorzugsweise zu Tischplatten, die weithin
Liebhaber fanden, und andern schönen Möbeln verwendet wurde. So
erzählt uns der römische Dichter Lucanus, der Neffe Senecas (39–65
n. Chr.): „Kleopatra (68–30 v. Chr.) besaß große, scheibenförmige,
aus den Wäldern des Atlas stammende Tische“, und in seiner Geschichte
Roms berichtet der uns 19 v. Chr. geborene Vellejus Paterculus, der
als praefectus equitum (Reiteroberst) Tiberius auf dessen
Feldzügen in Germanien und Pannonien begleitete: „Julius Cäsar (100–44
v. Chr.) hat, als er über Gallien triumphierte, gallische Geräte aus
citrus, als die Hauptmerkwürdigkeit dieses Landes zur Schau
tragen lassen“. Damals (51 v. Chr.) müssen solche Möbel in Rom noch
selten gewesen sein, sonst hätte Cäsar nicht damit prunken können.
Späterhin allerdings haben auch die Vornehmen Roms solche kostbare
Möbel, besonders Tische, aus dem Holz der Cypresse des Atlas gerne in
ihren Häusern aufgestellt und damit ihren Reichtum kund gegeben; denn
sie waren, wie wir gleich hören werden, außer[S. 676]ordentlich teuer und
nur für sehr Reiche erschwingbar. Die Schriftsteller der römischen
Kaiserzeit erwähnen diese Citrusmöbel sehr häufig, so der witzige
römische Epigrammendichter Martialis (um 40 n. Chr. zu Bilbilis in
Spanien geboren, kam unter Nero nach Rom, Schmeichler und Günstling
der Kaiser, starb um 102) nicht weniger als 8 Stellen seiner auf uns
gekommenen Gedichte, die sämtlich bezeugen, welchen hohen Wert die
Römer seiner Zeit auf diese Citrusmöbel legten. Unter ihnen waren
besonders die Tische beliebt, denen man vielfach Füße von Elfenbein
gab. Der östliche Teil des Atlasgebirges scheint schon damals von den
großen dazu erforderlichen Exemplaren der Callitriscypresse völlig
beraubt gewesen zu sein, so daß man sich solches Rohmaterial aus den
fernen Wäldern Maurusiens, auch Mauretanien genannt, kommen lassen
mußte. Deshalb schreibt der vorhin erwähnte Geschichtschreiber Lucanus
(39–65 n. Chr.): „In die Wälder des entlegenen Maurusien sind die
römischen Äxte eingedrungen, und dort werden für die Römer Tische
geholt.“ Und der um 25 n. Chr. gestorbene weitgereiste griechische
Geograph Strabon aus Amasia am Pontos sagt in seiner Geographika:
„Maurusien ist ein gesegnetes Land, hat nur wenig Einöden, dagegen
einen Reichtum an Flüssen und Seen. Namentlich liefert es den Römern
die größten Tische aus einem Stück, die auch herrlich bunt sind.“
Am ausführlichsten spricht sich der gelehrte ältere Plinius (geb. 23
n. Chr. in Como, bekleidete unter Nero und Vespasian mehrere höhere
Zivil- und Militärämter, war zuletzt Befehlshaber der Flotte bei
Misenum und kam als solcher, als er dem bedrohten Pompeji zu Hilfe
kommen wollte, 79 beim Ausbruch des Vesuvs um) über den Citrusbaum
aus. Er schreibt in seiner Naturgeschichte darüber: „Der Citrus ist
bei Leuten, welche die Pracht lieben, außerordentlich beliebt. Er
kommt aus dem Atlasgebirge, das noch sehr wenig bekannt ist, obgleich
schon öfter römische Feldherren dahin vorgedrungen sind und sich 5
römische Kolonien in dieser Provinz befinden. Besonders häufig findet
er sich noch in Maurusien. Aus seinem Holz werden Tische gemacht,
nach deren Besitz die römischen Männer ebenso unsinnig gierig sind,
wie die römischen Frauen nach Perlen. Es ist noch jetzt ein solcher
Tisch vorhanden, den Cicero (106–43 v. Chr.) zu jener Zeit, da das
Geld (in Rom) noch gar nicht im Überfluß vorhanden war, mit einer
Million Sesterzien (= 150000 Mark) bezahlte. Es wird auch ein anderer
erwähnt, der dem Gallus Asinius gehörte und 1100000 Sesterzien (165000
Mark) kostete. Es sind ferner zwei vom[S. 677] Könige Juba (II., der von
Kaiser Augustus einen Teil des von seinem Vater Juba I. im Jahre 46
v. Chr. nach der Schlacht bei Thapsus, in welcher er sich das Leben
nahm, verlorenen Reiches Numidien zurück erhielt) versteigert worden,
von denen der eine 1200000 Sesterzien (= 180000 Mark), der andere
etwas weniger kostete. Noch kürzlich ist ein solcher Tisch, der von
den Cethegen stammte und 1400000 Sesterzien (= 210000 Mark) gekostet
hatte, durch eine Feuersbrunst verloren gegangen. Für einen solchen
Preis könnte man die schönsten Landgüter kaufen. Der größte bis
jetzt bekannte Tisch von Citrusholz stammt vom mauretanischen Könige
Ptolemäus; er ist aus zwei Halbkreisen zusammengesetzt, hat 4½ Fuß
Durchmesser und ¼ Fuß Dicke. Das wunderbarste an ihm ist der Umstand,
daß er so zusammengefügt ist, daß man davon durchaus keine Spur sieht.
Ein anderer derartiger Tisch, welcher von einem Freigelassenen des
Kaisers Tiberius den Namen hat, besteht aus einem einzigen Stücke,
ist fast 4 Fuß breit und ½ Fuß dick. Derjenige, den Kaiser Tiberius
selbst besaß, hatte 4 Fuß 2¼ Zoll Durchmesser, jedoch nur 1½ Zoll
Dicke. Solche Prachttische werden aus dem angeschwollenen Wurzelstock
gemacht und um so höher geschätzt, wenn dieses unter der Erde gewachsen
ist. Dergleichen Wurzelmasern sind seltener als die am Stamm oder an
Ästen. Übrigens sind alle diese Masern eigentlich ein Erzeugnis des
fehlerhaften Wachstums dieser Bäume, deren Dicke man natürlich nach
diesen Querschnitten beurteilen kann.
Die Hauptschönheit dieser Tische besteht darin, daß die Masern
wie gekräuseltes Geäder oder kleine Wirbel aussehen. Bildet das
Geäder in die Länge gezogene Streifen, so heißt das Holz getigert
(tigrinus), besteht es aber aus geschlossenen Wirbeln, so
heißt es gepanthert (pantherinus). Manches Citrusholz ist auch
wellenförmig gekräuselt und wird um so höher geschätzt, je mehr die
Figuren den Augen des Pfauenschweifs ähneln. Nächst diesen gemaserten
Holzarten steht dasjenige im höchsten Preise, das wie dicht mit Körnern
besät aussieht; man nennt dieses gebient (apiatus). Bei all
diesen Sorten kommt es übrigens vorzugsweise auf die Schönheit der
Farbe an. Hierzulande gefällt diejenige am besten, die wie Met aussieht
und glänzende Adern hat.
Auch auf die Größe des Stammes kommt viel an, und man liebt die Tische,
die aus einem einzigen großen Stück bestehen, jedoch auch solche,
die aus mehreren Stücken von großen Stämmen zusammengesetzt sind.
Fehlerhaft sind diejenigen Citrustriebe, die nicht gemasert sind,[S. 678]
sondern wie gewöhnliches Holz aussehen, ferner wenn Spältchen oder
haarförmige Ritzchen vorhanden sind, wie das durch Einwirkung von
Hitze und Wind leicht vorkommt. Fehlerhaft ist ferner ein schwarzer,
muränenartiger Streifen, überhaupt jede schwarze oder sonst unangenehme
Farbe.
Die Barbaren bestreichen die frisch gefällten Stämme mit Wachs und
vergraben sie in die Erde; die Kunsttischler dagegen legen sie
wiederholt 7 Tage lang auf Getreidehaufen und nehmen sie dann wieder
7 Tage herunter, wodurch sie merkwürdig viel an Gewicht verlieren.
Neulich ist man durch Schiffbrüche auf die Entdeckung gekommen, daß
auch dieses Holz durch Seewasser austrocknet und so dicht, hart und
unverwüstlich wird, wie auf keine andere Weise. Reibt man solche
Tische mit trockener Hand, besonders nach dem Bade, so fördert das
ihre Schönheit. Wein schadet ihnen nicht und man gebraucht sie
besonders gern bei Tischgelagen. Die Citrusbäume sind, was Stamm,
Blätter und Geruch anbetrifft, der wilden Cypresse ähnlich. Der Berg
im diesseitigen Mauretanien, der sonst das berühmteste Citrusholz
lieferte, jetzt aber erschöpft ist, heißt Ankorarius.“ Da, wo es
heimisch und in größerer Menge zu haben ist, wird das Holz der
Cypressen, wie auch der Lebensbäume (Thuja), das von Farbe
im Kern meist graubraun, sehr leicht, weich, und von aromatischem
Geruch ist, wegen seiner Dauerhaftigkeit gern zu feineren Schreiner-,
Drechsler- und Schnitzarbeiten verwendet.
Von außereuropäischen Nadelhölzern liefert die in sumpfigen
Flußniederungen der Südoststaaten der nordamerikanischen Union
wachsende Sumpfcypresse (Taxodium distichum) ein sehr
wichtiges Nutzholz. Es ist braun, leicht, weich, sehr tragkräftig
und außerordentlich dauerhaft und wird in Deutschland vielfach zu
Decken- und Wandvertäfelungen gebraucht. Noch riesenhafter als
sie werden die in Kalifornien heimischen Wellingtonien
(Sequoia giganta), die eine Höhe von über 100 m bei
einem Stammdurchmesser bis zu 16 m und einem nachweisbaren
Alter von über 4000 Jahren erreichen, somit zu den ältesten und
höchsten Bäumen der Erde zählen. Bei diesen Riesen erscheint das
Innere, vor Jahrtausenden gebildete Holz noch so absolut gesund, als
wäre es erst vor wenigen Jahren entstanden. Von dieser Baumgattung
kommt vornehmlich das Holz der Sequoia sempervirens als
redwood oder „amerikanisches Rotholz“ nach Europa. Es besitzt
einen lebhaften roten Kern, ist leicht, weich, hat sehr enge,
scharf gezeichnete Jahresringe und ist ebenfalls durch große Dauer
ausgezeichnet.[S. 679] Wegen seiner Politurfähigkeit ist es besonders zu
Vertäfelungen, Deckenkonstruktionen usw. beliebt, wird aber auch
vielfach zu Bleistiftfassungen verwendet. Zu letzteren dient aber
in der Regel, wie wir im vorhergehenden Abschnitt sahen, das trotz
seiner Leichtigkeit sehr dauerhafte und kaum je vom Wurm angegriffene
rotbraune, wohlriechende Holz des virginischen Wacholders
(Juniperus virginiana), das auch mit Vorliebe zur Herstellung
von Zigarrenkistchen benutzt wird.
Als falsches „Cedernholz“, Cedrelen- oder
Zigarrenkistchenholz kommt aus Mittelamerika ein wohlriechendes,
rotbraunes Holz nach Europa, das in der Struktur dem Mahagoniholz
sehr nahe kommt, aber von Cedrela odorata stammt. Es ist
dies ein den Mahagonibäumen sehr nahe verwandter, mit jenen in die
Familie der Terebinthen oder Balsamgewächse gehörender hoher Baum
des brasilianischen und mittelamerikanischen Urwaldes mit 3–5paarig
gefiederten Blättern. Es kommt als westindisches oder spanisches
Cedernholz oder Cedrelate, d. h. Cedertanne (vom griechischen
kédros Ceder und eláté Tanne) in den Handel, ist leichter
und weicher als Mahagoni und wird hauptsächlich zu Kisten für Zigarren,
Zucker und Gewürze verwendet. Britisch-Honduras allein führt davon für
150000 Mark jährlich aus. Doch kann der heutige Bedarf nicht mehr mit
Cedrelenholz gedeckt werden, so daß einheimische Arten wie Erle und
Rotbuche dafür eintreten müssen.
Aus Australien kommt unter dem Namen „Pinkosknollen“ nicht
selten ein Holz auf den europäischen Markt, das von rotgelber bis
dunkelroter Farbe, schwer, sehr zähe und harzreich ist, sich aber nach
allen Richtungen gut bearbeiten läßt, daher ein vorzügliches Material
für Drechsler und Holzschnitzer bildet. Die Abstammung ist noch
unbekannt; doch sind es wahrscheinlich die Ast- und Wurzelknoten einer
Schmucktanne.
Von allen Laubhölzern Europas liefert die Eiche (Quercus)
das in fast allen Gewerben am meisten gebrauchte Holz, da es unser
bestes und dauerhaftestes Nutzholz ist, gleich vorzüglich im Hoch-
und Wasserbau, wie auch als Möbelholz. Und wenn die Eiche nicht so
langsamwüchsig und so anspruchsvoll an den Boden wäre, würden die
Eichenwälder heute noch so verbreitet sein, wie im Mittelalter. Da
die Eiche sehr lichtbedürftig ist, bildet sie allein nur lichte
Wälder, in denen reichlich Unterwuchs, auch Gras, gedeiht. Sie war
also der geeignetste Baum für die Waldweide, die vor Einführung der
Stallfütterung für Mitteleuropa außerordentlich wichtig war. Außerdem
bot sie den[S. 680] Schweineherden in ihren nahrhaften Früchten neben den
Bucheckern das beste Mastfutter, eine Nutzung, die einst viel wichtiger
war, als der Wert des damals noch im Überfluß vorhandenen Holzes.
Durch die Ausdehnung der Landwirtschaft seit 1750 sind inzwischen
viele frühere Eichenböden an die Landwirtschaft übergegangen, und die
mehrhundertjährigen Eichenbestände, wie sie z. B. noch im Spessart
stehen, stellen ein riesiges Vermögen dar. Man kultiviert die Eiche
als Hochwald mit 120–180jährigem Umtriebe oder als Oberholz des
Mittelwaldes, daneben aber auch im Niederwaldbetrieb von meist
15–20jährigem Umtrieb als Eichenschälwälder zur Gewinnung von
Eichenrinde.
Die malerische Gestalt alter Eichen, die als mächtige Riesen ihre
Nachbarn weit überragen und mit ihren knorrigen Ästen Wind und Wetter
Jahrhunderte hindurch Trotz geboten haben, lassen die Verehrung
begreifen, die nicht nur die Deutschen, sondern auch andere Völker
diesem Baume zollten. Schon in Homers Ilias heißt es, die Eiche sei
dem Zeus geheiligt, und in der Ilias wird erzählt, daß man im ältesten
griechischen Orakelsitze Dodona „den Willen des Göttervaters Zeus
aus dem Rauschen einer hochwipfligen Eiche (drýs) höre.“ Auch
in Italien war die Eiche dem Jupiter fulgurator, wie bei den
Germanen dem Donnergotte Thor, geweiht, weil der Blitz mit Vorliebe
in solche hochragende Eichen schlug, während er andere Bäume, wie
beispielsweise die Buche, ganz verschonte. In heiligen Eichenhainen
opferten die alten Kelten und Germanen und hielten dort ihre
Opferschmäuse ab. Unter einer großen Eiche, der Mahleiche, versammelte
sich die Sippe zu Beratungen, und, wie bei den Römern die Bürgerkrone
(corona civica), die einem Bürger verliehen wurde, wenn er einen
andern Bürger in der Schlacht gerettet hatte, aus Eichenlaub gewunden
war, so war der Kranz aus Eichenlaub bei den alten Deutschen eine
Auszeichnung, die heute noch in dauerhafter Nachahmung bei Freischießen
an die besten Schützen verliehen wird. Auch bei den slavischen
Volksstämmen hielt man die Eiche für heilig und gebrauchte nur
Eichenholz zu Opferfeuern. Als dann das Christentum nach Deutschland
und in die Länder der Ostsee drang, wurden zur Ausrottung der
heidnischen Opfergebräuche viele alte heilige Eichen umgehauen. So soll
insbesondere eine heilige Eiche bei Geismar in Hessen berühmt gewesen
sein, die vom angelsächsischen Apostel der Deutschen, Bonifazius
(eigentlich Winfried 680–755), gefällt wurde. Im Mittelalter spielte
das Eichenlaub in der gotischen Ornamentik eine wichtige Rolle.
Die etwa 200 Eichenarten sind vorwiegend in Nordamerika und[S. 681]
Westasien heimisch. Man unterscheidet bei ihnen je nach der Zeit der
Fruchtreife zwei Hauptgruppen, nämlich Eichen mit im ersten Jahre
reifenden Früchten und solche, deren Früchte erst im zweiten Jahre
reifen. Erstere sind die verbreitesten, und unter ihnen unterscheidet
man wiederum Arten mit im Herbst fallenden Blättern und immergrünen
Blättern. Unter den altweltlichen Eichen mit im Herbst fallenden
Blättern unterscheiden wir als nur ganz abgesprengte Posten der
zahlreichen Eichenfamilie die beiden wichtigsten bei uns wachsenden
Arten nach der Beschaffenheit der weiblichen Blüten als Stiel-
und Traubeneiche, wenn diese, wie bei der letzteren, in kleinen
traubenförmigen Knäueln dicht an der Spitze des neuen Triebes, oder,
wie bei der ersteren, vereinzelt an einem besonderen Stiele sitzen. Die
Stiel- oder Sommereiche (Quercus pedunculata) ist
ein bis 57 m hoch werdender Baum mit kurzgestielten Blättern.
Der Stamm ist während der ersten 50 Jahre glatt, bildet aber im höheren
Alter eine rissige Borke. Die Krone ist nie dicht und wird von vielfach
gekrümmten und geknickten Ästen und Zweigen gebildet. Die Pfahlwurzel
dringt bis 2,5 m tief in den Boden, außerdem treibt der Stamm
zahlreiche Seitenwurzeln, die ihn außerordentlich fest verankern. Am
besten gedeiht die Stieleiche auf fruchtbarem, lockerem Auboden der
Ebene, wächst aber noch in lehmigem, frischem Sandboden, während sie in
höheren Lagen der Traubeneiche weicht. Sie findet sich in ganz Europa
und Westasien, bildet in Ungarn und Kroatien ausgedehnte Wälder und im
russischen Tiefland einen breiten Waldgürtel zwischen dem Finnischen
Meerbusen und der Steppengrenze. Wie nach Norden geht sie im Osten über
die Buche, doch nicht über den Ural hinaus. Sie fordert zur Belaubung
eine etwas höhere Temperatur — nämlich 11–12 Grad Celsius — als die
Buche, verliert aber im Herbst die Blätter erst, wenn die tägliche
Wärme tiefer gesunken ist als zu Anfang der Vegetationsperiode. In
den Alpen geht sie etwa bis 1000 m. In Deutschland kommen
die schönsten, wenn auch niemals ganz reinen Stieleichenwälder in
der fruchtbaren mitteldeutschen Ebene und am Niederrhein vor. Die
Stieleiche wird bis 2000 Jahre alt und weist häufigere Samenjahre
als die Buche auf. Ihr Holz hat sehr breite und dicke Markstrahlen,
sogenannte Spiegel, d. h. Streifen, in denen die Gefäße radiär zum
Mark verlaufen, ist sehr dauerhaft und dient in der Technik als sehr
geschätztes Bau-, Nutz- und Werkholz. Besonders gern wird es zu Möbeln
und Furnieren, und das Holz der slovenischen Stieleiche als bestes
Faßholz verwendet. Unter[S. 682] Wasser wird es dunkler, fester, schwerer.
Stämme, die sehr lange unter Wasser lagen, sind als Wasser- oder
Mooreichenholz zur Herstellung von Möbeln sehr geschätzt. Man lagert
deshalb auch absichtlich Eichenholz mehrere Jahre unter Wasser, beizt
freilich auch frisches Eichenholz, um es dem Wassereichenholz ähnlich
zu machen. Als Brenn- und Kohlenholz steht es dem Buchenholze etwas
nach. Die Rinde wird wegen des großen Gehaltes an Gerbstoff als
wichtiges Gerbmaterial benutzt. Aus demselben Grunde werden auch die
infolge ihres Gerbstoffgehaltes zusammenziehend schmeckenden Eicheln zu
Eichelkaffee und Eichelkakao verarbeitet. In der Kultur befinden sich
zahlreiche Varietäten der Stieleiche.
Ihr gegenüber bleibt die Trauben- oder Wintereiche
(Quercus sessiliflora), die man wegen ihres härteren Holzes
auch als Steineiche bezeichnet, niedriger, gedrungener. Sie hat
langgestielte Blätter, wird nur 30–40 m hoch, erreicht kein so
hohes Alter und verbreitet sich nicht so weit nach Osten und Norden
als die vorige, geht auch in unsern Gebirgen nicht über 700 m
Höhe. Beide ertragen bis -31 Grad Celsius Kälte und öffnen zuletzt von
unsern Waldbäumen die Knospen. Dabei entfalten sie gleichzeitig Blätter
und Blüten, und zwar die Traubeneiche meist 10–14 Tage später als die
Stieleiche. Auch von ihr werden mehrere Varietäten angepflanzt.
In Süddeutschland kommt vereinzelt die in Südeuropa heimische, östlich
bis zum Kaspischen Meer reichende, in besonderem Formenreichtum in
Ungarn und Siebenbürgen wachsende weichhaarige Eiche (Q.
lanuginosa) vor, so genannt, weil ihre Blätter in der Jugend
auf beiden Flächen grau behaart sind, später aber kahl werden. Sie
bleibt kleiner als unsere Eichen. Noch kleiner, meist strauchartig,
ist die in Rumelien, Griechenland, Cypern und Persien heimische
Galleiche (Q. infectoria), die zu den Eichen mit im
zweiten Jahre reifenden Früchten gehört. Sie ist sehr buschig, wird
2 m hoch und liefert an den kurzgestielten Blättern die durch
die Gallwespe (Cynips gallae tinctoriae) erzeugten,
1,5–2,5 cm im Durchmesser haltenden Galläpfel, während die ihr sehr
ähnliche südeuropäische Kermeseiche (Q. coccifera) in
den durch die Kermesschildlaus (Coccus ilicis) hervorgerufenen
erbsengroßen, braunroten, mit rotem Safte gefüllten Kermeskörnern
einen ebenfalls wichtigen Handelsartikel erzeugt. Ihre Wurzelrinde
wird wie die weniger wertvolle Stammrinde zum Gerben benutzt. Sie
gehört zu den Eichen mit immergrünen Blättern, desgleichen die in den
Küstenländern Südeuropas wachsende immergrüne Eiche (Q.
ilex), die[S. 683] außer gutem Nutzholz eßbare Früchte hervorbringt.
Sie ist die drýs der alten Griechen, eine Bezeichnung, die
von drýssein einzäunen herrührt. Noch heute wird ihr Holz in
Griechenland zum Umzäunen der Schäferhürden benutzt. Auch die Früchte
der ebenfalls in den Mittelmeerländern heimischen langfrüchtigen
Eiche (Q. ballota) und der Speiseeiche (Q.
esculus) — der phēgós der alten Griechen von phágein
essen — werden noch heute wie im Altertum roh und geröstet gegessen.
Die Rinde dieser sparrigen, 2,5–3,8 m hohen Eichen wird
gleicherweise zum Gerben benutzt.
Bedeutend wichtiger als diese ist die Korkeiche (Quercus
suber), ein 10–12, höchstenfalls bei einem Stammdurchmesser von
0,8–1 m 16 m Höhe erreichender und etwa 200 Jahre alt
werdender, immergrüner Baum des westlichen Teils des Mittelmeergebiets,
der noch in Istrien und Thessalien, aber nicht mehr weiter östlich wild
vorkommt. Die Nordgrenze seiner Verbreitung fällt mit der Linie einer
mittleren Jahreswärme von +13,5 Grad Celsius zusammen. Er verlangt
ein warmes oder doch gemäßigtes Klima; daher steigt er nirgends hoch
ins Gebirge. In Spanien, Portugal und Südfrankreich wird er bis zu
500 m, in Algier und Marokko bis zu 1000 m Meereshöhe
angetroffen. Ein lebhafter Luftwechsel und eine Fülle von Licht ist
ihm sehr zuträglich, daher zieht er die Abhänge den Ebenen und die
Küste dem Binnenlande vor. Dabei ist eine Südlage seinem Wachstum
am günstigsten; doch hindert auch eine andere Lage sein Gedeihen
durchaus nicht, vorausgesetzt, daß die übrigen Wachstumsbedingungen
erfüllt sind. In wildem Zustande soll der Baum nach den Angaben eines
erfahrenen französischen Forstmannes nur auf Granit- oder Schieferboden
angetroffen werden. Tatsächlich bildet er auf solchem Boden die beste
Rinde. Jedenfalls darf der Boden nicht kalkreich und nicht sumpfig oder
gar brackig sein. Wie schon aus den klimatischen Verhältnissen seines
Verbreitungsgebietes hervorgeht, stellt er in bezug auf Boden- und
Luftfeuchtigkeit recht bescheidene Ansprüche, liefert aber auf feuchtem
Boden eine für technische Zwecke unbrauchbare Rinde.
Heute wird der Baum, dessen teilweise recht süße Eicheln eine sehr
gute Schweinemast bilden — so wird der Wohlgeschmack der berühmten
Schinken von Bayonne auf die Mästung der Schweine mit den Früchten der
Korkeiche zurückgeführt, während in Spanien diejenigen der immergrünen
Eiche (Quercus ilex) zur Schweinemast vorgezogen werden — zum
Zwecke der Korkgewinnung in seiner Heimat vielfach[S. 684] angepflanzt und
wurde neuerdings auch in den Südstaaten und an der atlantischen Küste
südwärts von Virginien eingeführt. Die Anpflanzung erfolgt durch Legen
der frisch gereiften Eicheln, was meist im Herbst geschieht. Da die
jungen Bäumchen die ersten Jahre hindurch beschattet werden müssen,
benutzt man dazu Reben, die zu gleicher Zeit in Reihen gepflanzt
werden. Die Bodenbearbeitung, die für die Reben unerläßlich ist und
sich durch deren Erträgnisse lohnt, kommt auch den jungen Korkeichen
zugute. Mit dem 20. Jahr sind letztere so weit gediehen, daß die Reben
durch deren Beschattung leiden und deshalb ausgerottet werden müssen.
Zu dieser Zeit sind die Korkeichen ertragsfähig geworden und bleiben es
ununterbrochen bis wenigstens zum 150. Jahr. Dann leben sie zwar noch
fort, aber mit ihrer Rindenproduktion geht es scharf bergab, so daß sie
dann bei geregeltem Forstbetrieb umgehauen werden.
Bis zum 4. Jahre sind Stamm und Äste mit der glatten Oberhaut bedeckt.
Diese wird dann durch den sich von da an bildenden Korkmantel
gesprengt. Läßt man diesen natürlichen Korkmantel bestehen, so bleibt
er dünn, brüchig und für technische Zwecke unbrauchbar. Er wird
deshalb, sobald der Stamm eine Dicke von 5–10 cm erreicht
hat, mit Messern und Hacken entfernt, ein Vorgang, den man im
Hauptproduktionsgebiet des Korkes, in Algerien, als démasclage
bezeichnet. Diese erste Rinde hat einen sehr geringen Handelswert und
wandert gewöhnlich in die Gerbereien. Die vom Baume neugebildete Rinde
erreicht eine bedeutendere Dicke als die erstgebildete und besteht aus
weicheren, gleichmäßigen Korkelementen. Mit jeder folgenden Ernte wird
die Qualität des Korkes besser.
Nach etwa 8–10 Jahren ist die Korkschicht so mächtig — etwa
5–20 cm dick — geworden, daß sie geschält wird, und dies kann am
Stamm in regelmäßigen Intervallen von 8–9 Jahren, an den Hauptästen
von 10–12 und an den kleinen Ästen von 16–20 Jahren wiederholt werden.
Um eine natürlich wertvollere dickere Rinde zu erhalten, die zur
Herstellung von Champagnerpfropfen geeignet ist, wartet man auch am
Stamm 10, 12, ja 18 Jahre mit der Abschälung der Korkrinde. Diese geht
in der Weise vor sich, daß im Juni oder Juli, wenn der Saftfluß des
Baumes in lebhaftem Gange ist, der Stamm in weiten Abständen am Fuß und
unter den Hauptästen mit einer am Stielende keilförmig zugeschärften
Axt geringelt wird. Diese Ringschnitte werden bei dünneren Stämmen
durch zwei, bei dickeren durch drei bis vier Längsschnitte miteinander
verbunden. Diese Arbeit[S. 685] wird mit der größten Vorsicht ausgeführt, denn
nur die tote Borke, nicht der lebende Bast darf dabei angeschnitten
werden. Dann wird die Rinde mit Hilfe des Beiles gelöst, an der
Außenseite gereinigt, indem man die Epidermis abschabt und eine Rinde
nach der andern, oder auch mehrere nebeneinander mit ihrer Hohlseite
nach unten über eine mit glühenden Kohlen gefüllte Grube legt und
mit Steinen oder Holz beschwert, damit sie flach werden. Sobald sie
angekohlt sind, werden sie auf die andere Seite gelegt, damit auch
diese, aber in geringerem Grade, angekohlt werde. Das Ankohlen gibt dem
Kork das, was die Stopfenschneider „Nerv“ nennen; es bewirkt ferner ein
Schließen der Poren, welche sonst Feuchtigkeit aufnehmen und damit den
Kork untauglich zur Verwendung als Stopfen machen würden. Zu stark darf
aber die Rinde nicht angekohlt werden, da sie sonst ihre Elastizität
verliert. Ist sie dagegen zu wenig angekohlt, dann ist sie nicht fest
genug für das Messer des Korkschneiders. Seltener wird die Rinde vor
dem Ankohlen in Wassergruben geworfen und mit großen Steinen beschwert,
bis sie platt geworden sind. Die geringwertige Korkrinde, welche nicht
für die Stopfenschneidereien bestimmt ist, wird einfach auf Haufen an
der Luft getrocknet. Nach zwei Monaten haben sie ein Fünftel ihres
Gewichtes verloren und werden dann als verkäuflich betrachtet, während
die angekohlten Rindenstücke sofort nach der Behandlung mit Feuer auf
beiden Seiten oberflächlich mit rauhen Tüchern gereinigt und auf Haufen
gesetzt werden, bis die benachrichtigten Käufer erscheinen und sie
übernehmen.
Sofort nach der Aberntung werden zwei Längsschnitte, zuweilen auch
drei oder vier in den Bast gemacht, soweit er entblößt ist. Dies
geschieht, um zu verhüten, daß die sich bildende neue Rinde an der
Oberfläche berstet. Doch dürfen die Schnitte niemals an der Nordseite
gemacht werden. Wenn die Korkeiche auf einmal geschält wird, bildet
sich ihre neue Rinde langsamer, sie wird aber von besserer Qualität,
als wenn sie abteilungsweise in Pausen geschält würde. Wenn die Rinde
nicht abgeschält wird, so verliert sie nach einer gewissen Zeit ihre
Brauchbarkeit. Dieser wertlose Zustand kündigt sich durch Risse und
Löcher an, die immer zahlreicher werden, bis die Rinde im 50. oder 60.
Lebensjahre gleich derjenigen anderer Bäume in kleinen Stücken abfällt.
Solange die Korkeiche lebt, fällt ihre Rinde niemals insgesamt oder
in großen Streifen ab, wie manchmal behauptet wird. Wäre dem so, dann
würde die Korkeiche eine in dieser Hinsicht einzig stehende Ausnahme in
der Pflanzenwelt bilden.
[S. 686]
Alle erstgeschälte Rinde ist, wie gesagt, zur Verwendung als Kork
wertlos und muß zu einem Spottgeld hauptsächlich als Gerbmaterial
verkauft werden. Auch wenn Korkeichen ein reifes Alter erlangt haben,
ohne daß sie abgeerntet werden, und sie sollen fortan ausgenutzt
werden, so ist ihre Rinde ebensowenig wert als diejenige junger Bäume.
Erst durch das Geschältwerden wird sie in der Weise verändert, daß sie
sich als Kork verwenden läßt, und zwar wird die Qualität des Korkes,
wie gesagt, mit jeder folgenden Ernte besser.
Die in verschiedener Weise zu Ballen vereinigte Korkrinde kommt in
verschiedenen Qualitäten in den Handel. Die beste ist elastisch, weder
holzig, noch löcherig und von rötlicher Farbe. Die gelb gefärbte ist
geringwertiger, am schlechtesten aber ist die weiße. Kork, der Risse
hat, wird als Ausschuß betrachtet; ebenfalls solcher, der weich und
schlaff ist. Letzteres ist gewöhnlich ein untrügliches Zeichen dafür,
daß er auf feuchtem Boden erzeugt wurde.
Ein in gutem Zustande gehaltener Korkeichenwald liefert in jedem 10.
Jahr eine Ernte, die zu zwei Dritteln aus ordinärem und Bastardkork
und zu einem Drittel aus zur Stopfenfabrikation brauchbarem dickem und
dünnem Kork von 5–20 cm Dicke besteht. Die Korkrinde enthält so
viel Gerbsäure wie die beste Rinde anderer Eichen; aus diesem Grunde
färben sich eisenhaltige Flüssigkeiten, die in Berührung mit dem Kork
kommen, durch Bildung von gerbsaurem Eisen mit der Zeit schwärzlich.
Die spanischen Gerber, namentlich diejenigen von Cadix, verwenden
Korkrinden mit Vorliebe zum Gerben; doch wird sie ihnen nur in sehr
beschränktem Maße zugänglich gemacht. Es ist begreiflicherweise viel
einträglicher, die Korkeichen zur Korkgewinnung als zu Lohschlägen
zu verwenden. Nach einer zuverlässigen französischen Quelle werfen
so benutzte Korkeichenwälder eine viermal höhere Rente ab als andere
Eichenwälder. Während die Jungfernernte von einem Baume nur etwa
5 kg Kork liefert, beträgt die Ernte von einem vollkräftigen Baum
einschließlich der Äste 100–150 kg. Der Durchschnittspreis
für 100 kg Kork schwankt zwischen 170 und 180 Mark. Die
Gesamtkorkproduktion der Welt läßt sich nicht genau feststellen; doch
ist das sicher, daß es sich dabei um einen Wert von gegen 100 Millionen
Mark handelt. Verbraucht doch England allein für weit über 20 Millionen
Mark dieses für die moderne Kultur ganz unentbehrlichen Rohmaterials
jährlich, Deutschland und Frankreich nicht viel weniger.
Die Korkrinde wird hauptsächlich zur Herstellung von Flaschen[S. 687]korken
verwendet, die früher allgemein mit der Hand, neuerdings aber
vorzugsweise mit Maschinen geschnitten werden. Der Verlust an Material
ist dabei ein sehr großer und beträgt bis zu 60 Prozent. Doch finden
auch die Abfälle Verwendung, so besonders zur Herstellung von Linoleum
und vielen andern technischen Erzeugnissen, wie Umhüllungsmassen von
Dampfröhren, Amboßunterlagen, Stoßkissen auf Schiffen, Schwimmgürteln
usw. Außer Korkstöpseln werden auch Korksohlen, Korkjacken,
Schwimmer von Fischernetzen und Angelhaken und dergleichen aus Kork
hergestellt. Der beste Kork, der ausschließlich zur Herstellung von
Champagnerkorken benutzt wird, kommt aus den spanischen Provinzen
Catalonien und Andalusien in den Handel. Er darf beim Einpressen
in die Flaschenmündung keine Haarrisse bekommen, durch welche die
Kohlensäure entweichen könnte, und muß so elastisch sein, daß er selbst
nach jahrelangem Gebrauch, mit Wasser gekocht, seine ursprüngliche
zylindrische Gestalt und seinen ursprünglichen Umfang wieder erhält. Er
kann bis zu 60 Jahre im Dienst aushalten.
Der Kork ist ein Artikel, den schon die alten Ägypter, Griechen und
Römer kannten und zu verschiedenen Zwecken verwandten. So benutzten ihn
die erstgenannten zur Herstellung von Särgen, die letzteren dagegen zu
Bienenstöcken, wie uns Varro mitteilt, der im 1. Jahrhundert v. Chr.
schreibt: „Die besten Bienenstöcke sind die aus Rinde (cortex)
gemachten.“ Unter dem lateinischen cortex, das zunächst Rinde im
allgemeinen bedeutet, ist in diesem Falle vorzugsweise die Rinde der
Korkeiche zu verstehen. Aus dem lateinischen cortex ist dann
unser deutsches Wort Kork entstanden. Obschon die Korkeiche nicht mehr
in Griechenland wächst, beschreibt sie Theophrast im 4. Jahrhundert
v. Chr. allerdings nur vom Hörensagen und deshalb nicht ganz richtig.
Er sagt von ihr: „Die Korkeiche (phellós) wächst in Tyrrhenien
(Etrurien), hat einen einfachen Stamm, wenig Äste, ist hoch und hat
festes Holz. Die Rinde ist sehr dick, zerrissen wie bei der Pinie
(pítys), jedoch in größere Stücke gespalten. Das Blatt ist wie
bei der Esche (melíē), dick und länger (damit meint er wohl die
einzelnen Blättchen des Eschenblattes). Der Baum ist nicht immergrün
(tatsächlich sind die Blätter der Korkeiche immergrün), sondern läßt
die Blätter fallen. Die Frucht ist eichelartig wie diejenige der
Ariaeiche (aría). Man schält die Rinde ab und behauptet, sie
müsse ganz abgeschält werden, sonst leide der Baum. Diese ersetzt
sich in etwa drei Jahren.“ Besonders wurde die schon von Theophrast
hervorgehobene[S. 688] Fähigkeit des Schwimmens auf dem Wasser als die
schätzenswerteste Eigenschaft dieses Produktes ausgenutzt. So erzählt
Plinius, daß der Kork, den er als suber bezeichnet, von den
Fischern als Schwimmer für ihre Netze und sonst allgemein als Bojen für
die Anker der Schiffe benutzt werde.
Mögen nun auch die Völker des Altertums den Kork zu den verschiedensten
Zwecken benutzt haben, so ist doch das eine sicher, daß sie ihn nicht
wie wir zum Stopfen brauchten. Erstens hatten sie keine enghalsigen
Flaschen wie wir im Gebrauch, wozu er sich in erster Linie eignet, und
für die später von den Römern Galliens von den keltischen Einwohnern
des Landes angenommenen Holzfässer aus Dauben war ein hölzerner Spund
das gegebene Verschlußmaterial. Die Vorratsgefäße der Alten waren
große amphorenartige Tonkrüge, von den Griechen píthos, von den
Römern dolium genannt, die mit Deckeln aus demselben Material
mit Zuhilfenahme einer dicht verschließenden Masse wie mit Wasser
angerührtem Lehm oder gebranntem Gips, auch mit einem Kitt aus Harz,
Kreide und Öl luftdicht verschlossen wurden. Wurde der Deckel nicht
luftdicht verschlossen, damit man jeweilen vom Vorrate seinen Bedarf
zu holen vermochte, so wurde die Verdunstung durch Aufgießen einer
Schicht Öl, also in der Regel Olivenöl, z. B. auf Wein, verhindert,
wie wir dies noch auf den Chianti- und anderen Weinflaschen Italiens
sehen. Erst als die enghalsigen Glasflaschen aufkamen, die vor dem 15.
Jahrhundert nirgends in Europa erwähnt werden, fand der Kork seit dem
17. Jahrhundert zur Herstellung von Pfropfen zum Verschließen derselben
zunehmende Verbreitung und bald allgemeine Verwendung, nachdem auch
hier vorher Wachs- und Holzpfropfen zu deren Verschluß gedient
hatten. Dank seiner Wasserdichtigkeit, Elastizität, Dauerhaftigkeit
und Leichtigkeit hat sich der Kork nunmehr den Kulturvölkern der
ganzen Erde vollkommen unentbehrlich gemacht und wird auch in seiner
herrschenden Stellung nicht so leicht von einem andern Stoffe verdrängt
werden können. Allerdings ist dem Korkstopfen im letzten Jahrzehnt
ein nicht zu unterschätzender Konkurrent entstanden in dem bekannten
Patentverschluß mit Gummidichtung, der namentlich bei Bierflaschen
fast allgemeine Verwendung findet und den Vorteil bietet, daß die
Flasche ohne Zuhilfenahme einer Korkmaschine verschlossen und ohne
weiteres geöffnet werden kann. Diese Leichtigkeit, den Verschluß zu
öffnen, hat aber auch ihre Schattenseiten, zu denen sich noch andere
Nachteile gesellen, so daß gleichwohl für sehr viele Zwecke der
Flaschenverschluß durch Kork dauernd beibehalten[S. 689] wird. Was durch
diesen Patentverschluß, der auch für die Flaschen zum Sterilisieren
der Kindermilch allgemeine Aufnahme gefunden hat, der Korkrinde an
Absatz verloren geht, wird reichlich ersetzt durch die von Jahr zu
Jahr steigende Verwertung gemahlener Korkrinde zur Herstellung des
Linoleums. Dieser Stoff wird als Fußbodenbelag, der leicht zu reinigen
ist und sonst viele Vorteile bietet, sich immer mehr die Wertschätzung
aller Schichten der Bevölkerung erobern und bald in jeder Wohnung zu
finden sein.
Tafel 159.

Korkeiche (Quercus suber) bei Cannes an der Riviera.
(Nach einer in der Sammlung des Botan. Institutes der Universität Wien
befindlichen Photographie.)
❏
GRÖSSERES BILD
Vor allem wird die Champagnerfabrikation sich voraussichtlich noch
lange des Korkzapfens als unvergleichlich wertvollem Verschlußmaterial
ihres Produktes bedienen. Hat doch die Einführung desselben in Europa
überhaupt erst die Champagnerfabrikation möglich gemacht. Der Erfinder
des Champagners, der Benediktinermönch Dom Pérignon (1636–1715),
Pater Kellermeister in der Abtei von Hautvilliers in der Champagne,
war zugleich der Erfinder des Champagnerkorkes, der ihm den unbedingt
erforderlichen festen Verschluß zur Zurückhaltung der sich bildenden
Kohlensäure verbürgte.
Von neuweltlichen Eichen mit im ersten Jahre reifenden Früchten und im
Herbst abfallenden Blättern ist die wegen ihrer grauweißen, in breiten,
dünnen Stücken sich ablösenden Rinde als Weißeiche (white
oak — Quercus alba) bezeichnete Art zu nennen. Der schöne,
bis 25 m hohe Baum bildet in den Vereinigten Staaten ausgedehnte
Wälder und liefert viel Gerbrinde. Seine Blätter verfärben sich nicht
im Herbst. Auch die großfrüchtige Eiche (Q. macrocarpa)
mit mildschmeckenden Früchten und die Kastanieneiche (Q.
prinus) sind in Nordamerika sehr verbreitet und liefern zum Gerben
sehr geschätzte Rinden. Zu den Eichen mit im zweiten Jahre reifenden
Früchten haben wir in der Neuen Welt die auf der Westseite Nordamerikas
heimische weidenblätterige Eiche (Q. phellos). Der
etwa 20 m hohe Baum hat der Silberweide ähnliche Blätter.
Ebenfalls im westlichen Nordamerika gedeiht an feuchten Stellen die
Wassereiche (Q. nigra). Im östlichen Teil Nordamerikas
dagegen wachsen die Färbereiche (Q. tinctoria), die ihr
ähnliche Scharlacheiche (Q. coccinea) mit braunroten
Blättern, die sich im Herbst scharlachrot verfärben. Sie bildet in
den Vereinigten Staaten große Wälder und ihr Holz wird vielfach nach
England ausgeführt. Ferner die nach der prächtigen scharlachroten
Verfärbung ihrer Blätter so genannte Roteiche (Q. rubra),
die vom Huronensee bis Florida und Texas in ausgedehnten Beständen
wächst und wegen ihrer Raschwüchsigkeit auch in unsere Forsten
eingeführt wurde. An feuchten[S. 690] Stellen gedeiht dort die ebenfalls sehr
schnellwüchsige Sumpfeiche (Q. palustris), die, wie alle
vorgenannten, viel Gerbrinde liefert. In Südeuropa bis Syrien dagegen
wachsen von den Eichen mit im zweiten Jahre reifenden Früchten die
Zerreiche (Q. cerris), ein großer Baum mit ungemein
festem, hartem Holz, eßbaren Früchten und gerbstoffreicher, zum
Gerben dienender Rinde, und in Rumelien, Griechenland und Kleinasien
die ebenfalls bis 19 m hohe Knopperneiche (Q.
vallonea), deren schuppige, 3–4,5 cm im Durchmesser haltende
Fruchtbecher als Valonen in den Handel kommen und zum Gerben und
Schwarzfärben dienen.
Wie die Eichen gehören die Buchen (Fagus) in die
Familie der Cupuliferen oder Näpfchenfrüchtler. Unter ihnen ist die
gemeine Buche oder Rotbuche (Fagus silvatica)
der schönste und für uns wichtigste Vertreter der Gattung. Dieser
stattliche Baum, dessen glatter Stamm mit hellsilbergrauer Rinde
emporstrebt, um hoch oben die volle Besonnung verlangenden grünen
Blätter an zierlichen Ästen auszubreiten, bildet den von den Dichtern
viel besungenen „grünen Waldesdom“ und soll die Anregung zur gotischen
Bauart gegeben haben. Die Buche ist der Hauptrepräsentant des deutschen
Laubholzwaldes und gedeiht am besten in nicht zu feuchtem, aber auch
nicht zu trockenem, kalkhaltigem Hügel- und Bergland, bildet aber auch
auf dem frischen, humösen Sandboden der norddeutschen Ebene mächtige
Bestände. Im sandigen Flachlande hat sie allgemein den Nadelhölzern
weichen müssen; nur vereinzelt und deshalb vom Naturfreund doppelt
geschätzt ragen dort die Buchenwälder wie Oasen aus dem Einerlei
der Kiefern. Der Buchenhochwald bedeckt in ganz Deutschland rund 15
Prozent der gesamten Waldfläche. Die Buche eignet sich forstlich
für den Hoch-, Mittel- und Niederwaldbetrieb. Das weißliche bis
braunrötliche, harte, dichte, schwere, gut spaltbare, aber wenig
elastische, stark schwindende und arbeitende Holz weist zahlreiche wie
Atlas glänzende Spiegel als Reservestoffbehälter des Holzkörpers auf
und verstockt leicht im Wechsel von Nässe und Trockenheit, ist aber
stets im Wasser oder stets im Trocknen ziemlich dauerhaft. Absolut
unbrauchbar ist es zur Verwendung im Freien, dagegen wird es von Wagner
und Drechsler, wie auch zum inneren Ausbau unserer Häuser vielfach
verwendet. In heißem Wasserdampf erweicht, wird es biegsam und dient
zur Herstellung gebogener Möbel. Österreich-Ungarn besitzt etwa 40
Fabriken zur Herstellung solcher gebogener Möbel, denen 350000 Hektar
Buchenwaldungen das Material liefern, die 35000 Menschen be[S. 691]schäftigen
und gegen 230000 Meterzentner gebogener „Wiener Möbel“ jährlich
exportieren. Deutschland besitzt nur wenige solcher Fabriken, da das
Buchenholz hier weit schwieriger zu haben ist und die Arbeitslöhne
teurer als in Österreich-Ungarn sind. Imprägniert dient Buchenholz
neben dem dafür weit besseren Eichenholz zu Eisenbahnschwellen, gebeizt
und gefärbt als Zigarrenkistenholz. Es liefert ein vorzügliches
Brennholz, dessen Wert als solches aber durch die Einführung der
Steinkohle als üblichstem Heizmaterial bedeutend herabgesetzt wurde.
Es gibt auch die besten Holzkohlen und dient zur Darstellung von
Holzessig und künstlichem Indigo. Die chemische Fabrik Laufach im
Spessart verwendet zur Holzessigfabrikation jährlich etwa 25000 Ster
Spessarter Buchenholz. Endlich liefert es auch den vortrefflichen
Buchenholzteer mit reichem Gehalt an Kreosot, der meist daraus gewonnen
wird. Der Gehalt des Buchenholzrauches an Kreosot ist es, der als
viel angewandtes Konservierungsmittel beim Räuchern von Schinken und
Würsten dient. Die gerbstoffhaltige Buchenrinde kann als Lohe beim
Gerben benutzt werden: die Buchenholzasche gibt die beste Pottasche und
Lauge zum Waschen. Die ölreichen Buchennüsse (Bucheln oder Bucheckern)
bilden nicht nur eine treffliche Schweinemast, sondern liefern auch
dem Menschen ein gutes Speiseöl. Nicht im Öl, wohl aber in den Häuten
und im zurückbleibenden Kern der Nüsse ist ein Fagin genanntes Gift
enthalten, das in größeren Dosen, namentlich bei Kühen und Pferden,
lähmend auf das Rückenmark und die Atmung wirkt.
Die im Herbste abfallenden eiförmigen, in der Jugend weißhaarig
bewimperten, glatten, leicht gewellten Blätter geben eine gute Streu
für den Waldboden. Sie brauchen zu ihrer Verwesung etwa drei Jahre und
bilden dann eine schwärzliche, von Pilzfäden durchzogene Modermasse,
die von zahllosen Regenwürmern und anderen kleinen Tieren gefressen
und verarbeitet wird. An ihrer Auflösung und chemischen Umsetzung
arbeiten auch zahlreiche Fadenpilze und Bakterien. Die so zugerichtete
Bodenschicht, der Humus, ist der Nährboden für die höheren Pflanzen,
für deren Ansiedlungsmöglichkeit die Buche mit ihren abfallenden
Blättern einen wichtigen Faktor bildet. In milden, warmen Lagen
gewinnen die das Laub schnell zersetzenden Bakterien die Oberhand
und reiche Humusböden schaffen üppiges Gedeihen für Feld und Wald.
Bei allzuviel Sonne und zuviel Niederschlägen, wenn ihnen der Boden
ungeschützt preisgegeben ist, wird ihr Wachstum gehemmt, nur Fadenpilze
vermehren sich weiter und durchziehen die[S. 692] oberen Schichten, mit deren
Zersetzung sie aber allein nicht fertig werden. So entsteht fester,
saurer „Rohhumus“, den die Regenwürmer nicht mehr zu verzehren und
in ihrem Darmkanal durchzuarbeiten vermögen, und der einst stämmige
Hochwald wird zu unfruchtbarem Heide- und Moorland. Gegen diese
Gefahren ist gerade die Buche eine treffliche Pionierin und ihr
reichliches Laub ist besonders im Nadelwald ein vortreffliches Material
für die Humusbildung. Dabei vermag ihr an der Spitze fein verästeltes
und mit zarten Pilzfäden, die ihr zur Gewinnung des Stickstoffs
behilflich sind, umsponnenes Wurzelwerk überallhin durch den Boden zu
dringen und die zum Gedeihen und Wachstum nötige Nahrung zu schöpfen.[6]
Auch die Buche erträgt wie Stiel- und Traubeneiche bis 31° C.
Kälte. Sie findet sich hauptsächlich in Mitteleuropa, geht westwärts
bis Mittelspanien und Nordportugal, südlich bis Sizilien und Apulien,
östlich bis zum Kaukasus. Hier überall ist sie ein entschiedener
Gebirgsbaum, der je südlicher, um so höher hinangeht. Am Ätna steigt
sie bis 1880 m, in den bayrischen Alpen bis 1300 m, in
den norddeutschen Gebirgen aber bis etwa 650 m. In Norwegen
findet sie sich bis zum 59.° nördlicher Breite. Ihre nördliche Grenze
berührt die schwedische Westküste von Gothenburg, geht an der Ostküste
nur bis Kolmar bei 57° und durchschneidet fast geradlinig den Kontinent
von Königsberg aus über Polen bis Podolien und zur Krim. Jenseits
dieser Linie würde die Vegetationsperiode auf weniger als fünf Monate
beschränkt werden, was die Buche nicht verträgt.
Im Frühjahr zersprengt das Keimpflänzchen die Buchennuß, streckt
zuerst das Würzelchen heraus und sucht sich im Boden zu befestigen und
Nahrung und Wasser daraus zu holen. Das Öl der zwei zusammengefalteten
Keimblätter verwandelt sich zunächst in Zucker und allmählich in neue
Pflanzensubstanz. Sobald die Wurzel hinreichend lang ist, entfalten
sich die Keimblätter, werfen die sie einzwängende Schale ab, breiten
sich aus und werden grün, um mit Hilfe des Chlorophylls neuen Zucker
zu bereiten. Bis zum 6. Jahre wächst die Buche langsam, dann aber
streckt sie sich bedeutend und nimmt jährlich 16–24 cm an Länge
zu. Vor dem 60. Jahre blüht sie selten. Die Blüten finden sich an
heurigen Trieben und entfalten sich gleichzeitig[S. 693] mit dem Ausbruch
des Laubes. Seitensprosse haben fast nur langgestielte, hängende,
kugelige, männliche Blütenstände in Form von Kätzchen, der Gipfeltrieb
trägt männliche und weibliche Blüten, wobei wiederum die männlichen
am unteren, die weiblichen dagegen am oberen Teil des Sprosses sich
befinden. Mit 120–150 Jahren vollendet die Buche gewöhnlich ihr
Wachstum und kann dann bei 0,9–1,25 m Stammdurchmesser über
30 m hoch sein. Sie liebt volle, geschlossene Bestände und
gedeiht nur, wenn der Boden vollständig gedeckt ist. Sie war einst
mit der Eiche im ganzen westlichen und in ausgedehnten Waldgebieten
des südlichen und mittleren Deutschland der herrschende Baum. Seit
1780 ist sie aber vielfach den rascher wachsenden und früher einen
nutzbaren Holzertrag liefernden Nadelhölzern gewichen. Die Begründung
von Beständen erfolgt unter dem Schatten der den Samen abwerfenden
Mutterbäume. Man erzieht die Buchen leicht in Saatbeeten und verpflanzt
sie drei- bis vierjährig zu mehreren zusammen ins Freie, wo sie
aber gegen Sonnenbrand geschützt werden müssen. Gegenwärtig erzieht
man nicht reine Buchen-, sondern aus Eichen, Buchen, Ahorn, Eschen
usw. gemischte Bestände, in welchen die Buche den Boden schützt
und ihn durch reichlichen Blattfall verbessert, daneben auch die
genannten Nutzholzarten durch kräftigen Bestandsschluß zu günstiger
Stammausbildung zwingt. Die Buche ist auch wichtig als Bodenschutz oder
Treibholz im älteren Eichen- und Kiefernbestand und gibt bis 10 Prozent
der gesamten Holzmasse als Nutzholz. In guten Jahren sammelt man pro
Hektar etwa 100 Scheffel Buchnüsse im 120jährigen Betrieb.
Eine sehr große Anzahl Insekten und Pilze leben auf der Buche, doch
lange nicht so viel als auf der Eiche, die darin weitaus an erster
Stelle unter allen Holzgewächsen steht. Obgleich die Rotbuche nicht im
alten Griechenland vorkam, kannte sie doch Theophrast als oxýa.
Auf den Gebirgen Norditaliens wuchs sie dagegen häufig und wird von den
römischen Autoren mehrfach als fagus erwähnt, eine Bezeichnung,
die aus Verwechslung von der griechischen Bezeichnung phēgós
für Speiseeiche (von phágein essen) abzuleiten ist. Macrobius
rechnet die Buche zu den glücklichen Bäumen (felices arbores),
weil man aus ihrem Holze Opfergeschirre mache. Bei den alten Germanen
war die Buche der Göttin des Herdes und der Ehe, Freya, geweiht. In
Nordamerika und Japan wird die Buche durch verschiedene nahe Verwandte
vertreten, die wir hier übergehen können.
Ebenfalls zu den Kätzchenträgern gehört die Hain- oder
Weiß[S. 694]buche (Carpinus betulus), von den vorgenannten
Cupuliferen durch das Auftreten einer falschen, aus einem Blatte
gebildeten cupula ausgezeichnet. Sie ist am nächsten mit den
Haselnußarten verwandt. Mit der Rotbuche hat sie wenig Merkmale
gemein, außer daß der Stamm bei beiden dieselbe glatte, silberweiße
Rinde mit fehlender Borke aufweist. Beide Baumarten wollen im
Schatten des Waldes leben und aufwachsen. Müssen sie trotzdem sich
in freiem Stande entwickeln, so schützen sie sich durch tief bis zum
Boden herabreichendes Astwerk gegen die allzu warm scheinende Sonne.
Besonders auf alten Weideplätzen stehen oft solche prächtige, rings
beastete „Weidebuchen“. Ist aber der Baum im Bestand erwachsen und
wird er plötzlich durch eine Lichtung der Sonne ausgesetzt, ohne daß
er Zeit hat, sich allmählich daran zu gewöhnen, so wird die Rinde auf
der Sonnenseite gar bald schwarz und brandig, sie stirbt und löst sich
ab und der Baum geht an sogenanntem „Rindenbrand“ langsam zugrunde.
Der bis 6 m hohe Stamm ist selten gerade, sondern mehr oder
weniger eckig, durch tiefe Furchen der Länge nach eingeschnitten, mit
deutlichen, den Stamm spiralig umziehenden Längswülsten, wie man sagt
„spannrückig“, zudem oft mit starken Beulen und Buckeln versehen. Schon
bei 2–3 m Höhe teilt sich der Stamm in starke Äste und setzt
sich nach der Astteilung zwar gerade, aber nur schwach fort. Alte Bäume
zeigen Astlöcher mit tiefen Aushöhlungen und weisen einen wunderlich
gekrümmten Astbau auf. Die Belaubung ist infolge der feinen Verzweigung
dicht. Die Krone bildet an jüngeren, kräftig wachsenden Bäumen eine
breite, stumpfe Pyramide mit so vielen tiefeckigen Einschnitten, als
Hauptäste vom Stamme ausgehen. Mit zunehmendem Alter krümmen sich die
Zweige infolge der schweren, fast alljährlichen Fruchtlast abwärts,
welchem Drucke endlich auch die Äste folgen, und so mildert sich die
vorher etwas starre Form der Krone durch Abrundung der Spitzen und
Ausgleichung der Einschnitte.
Gleichzeitig mit dem Ausbruch der Blätter erscheinen im April und
Mai die männlichen und weiblichen Blütenstände. Die Frucht ist eine
sehr hartschalige, flache Nuß mit Längsrippen. Die Früchte fallen im
November und später, nach den Blättern, wie Kreisel sich drehend zu
Boden. Die Hainbuche wächst in der Jugend lange buschig und trägt
frühzeitig und reichlich Samen. Sie ist unempfindlich gegen Frost
und periodische Überschwemmungen und hat wenig von Krankheiten zu
leiden. Sie erträgt viel Schatten und dient daher als Bodenschutzholz
in lichten Eichenwaldungen. Im Niederwaldbetrieb ist die Hainbuche[S. 695]
durch ihre bedeutende Ausschlagsfähigkeit von Wert; auch ist sie, weil
sie den Schnitt gut erträgt, zur Anlage von Hecken geeignet. Sie kann
ein Alter von 300–400 Jahren erreichen, steht aber im Massenertrage
von Holz der Rotbuche weit nach. Ihr gelblichweißes Holz ist sehr
schwer, hart und schwierig zu spalten und zu bearbeiten, arbeitet
stark und besitzt nur im Trockenen lange Dauer. Es ist ein gutes
Werkholz zur Herstellung von Hobelkästen, Kammrädern in Mühlen,
Maschinenbestandteilen usw., überhaupt von allem, was Reibung und Stoß
auszuhalten hat. An Brennkraft kommt es demjenigen der Rotbuche gleich,
gibt auch gute Kohlen und reichlich Pottasche. Die Rinde kann zum
Gerben benutzt werden, die Blätter geben Ziegen, Schafen und Pferden
ein gutes Futter.
Die Hainbuche war den alten Griechen und Römern nicht bekannt,
wohl aber die bei ihnen wachsende Hopfenbuche (Carpinus
ostrya) — ostrýa von den Griechen und carpinus
von den Römern genannt. Cato preist deren Holz als das beste zur
Herstellung von Ölpressen. Die Festigkeit und Zähigkeit des Holzes der
Hainbuche hat die Redensart vom „hanebüchenen Mann“ entstehen lassen,
der aber oft auch „hanebüchen grob“ sein kann. In Ostpreußen sollen
einzelne Hainbuchen einen Stammumfang von 5 m besitzen. Eine
selbständige Art ist die orientalische Hainbuche (Carpinus
orientalis), während die amerikanische Hainbuche (C.
americana) bei uns als Zierpflanze kultiviert wird.
Der als Fruchtbaum aus dem warmen Süden zu uns gekommene Nußbaum
(Juglans regia) hat ein hochgeschätztes braunes Holz, das mit
Vorliebe zu Möbeln, Gewehrschäften, Drechsler- und Bildhauerarbeiten
verwendet wird. Es ist gleichmäßig schwer und hart, leicht zu
bearbeiten und polierfähig, schwindet aber stark und ist nur im
Trockenen dauerhaft. Der Nußbaum liefert auch das meiste Furnierholz.
Die Wurzelstöcke, welche gleichfalls zu Furnieren geschnitten werden,
besitzen oft eine herrliche Maserung. Die getrockneten Schalen der
grünen Nüsse enthalten einen zum Braunbeizen vielverwendeten Farbstoff,
die Nuß- oder Körnerbeize. Sein ausgezeichnetes Holz hätte dem Nußbaum
den Weg in den Wald geöffnet, wenn nicht seine große Empfindlichkeit
hindernd im Wege stünde. An seine Stelle tritt deshalb im Wald vielfach
die aus Nordamerika stammende, weniger empfindliche Schwarznuß
(Juglans nigra), die ebenso wie die Graunuß (J.
cinerea) wegen ihres schönen, gleichmäßig rotbraunen Holzes
besonders zur Herstellung von Möbeln hochgeschätzt ist und dem Holz
der[S. 696] einheimischen Walnuß vorgezogen wird. Ein hervorragend zähes und
elastisches Holz, das für den Wagenbau große Bedeutung erlangt hat,
liefert die ebenfalls aus Nordamerika in verschiedenen Arten in unsere
Wälder verbrachte Hickorynuß (besonders Carya alba). Von
allen dreien, die durch ihre Fiederblätter gekennzeichnet sind, bedarf
sie bei uns allerdings der größten Pflege.
Ein vortreffliches Bau-, Werk- und Faßholz liefert die
Edelkastanie (Castanea vesca), die aber bei uns nur im
Rheintal am Fuß des Schwarzwaldes und der Vogesen in wärmeren Lagen, wo
der Weinstock und feinere Obstarten gezogen werden, gedeiht. Hier wird
sie im Niederwaldbetrieb bewirtschaftet, um aus den jungen Schößlingen
sehr brauchbare Rebstecken zu gewinnen. Ihr Holz besitzt fast alle
Eigenschaften, wie auch die Farbe des Eichenholzes, ist jedoch durch
das Fehlen der mit freiem Auge deutlich sichtbaren Markstrahlen sofort
von jenem zu unterscheiden. Im Gegensatz zum Holze der Edelkastanie
ist dasjenige der Roßkastanie (Aesculus hippocastanum)
von nur geringem Werte, da es leicht, schwammig, weich und von sehr
geringer Dauer ist, namentlich in der Nässe rasch fault. Andererseits
reißt und wirft es sich wenig, nimmt Farbe und Politur gut an und wird
nicht von Würmern heimgesucht. Es wird von Drechslern und Tischlern
ähnlich wie das Lindenholz verwendet, kann auch zu Holzschuhen
verarbeitet werden. Sonst wird für letztere das weiche Linden- und noch
häufiger Erlenholz verwendet.
Auch die Erlen (Alnus), von denen es 14 Arten auf
der nördlichen Halbkugel gibt, sind Kätzchenblütler und dadurch
bemerkenswert, daß sie wie die Schmetterlingsblütler in Symbiose mit
Rhizobien genannten Knöllchenbakterien leben, die an den Wurzeln
orangefarbene, knollenförmige Auswüchse erzeugen. Indem diese Bakterien
den Stickstoff der im Boden enthaltenen Luft binden und in salpeter-
und schließlich salpetrigsaure Verbindungen überführen, leisten sie
der Erle außerordentlich wichtige Dienste zur Gewinnung dieses für
ihr Gedeihen so notwendigen Nährmaterials. Mit Hilfe dieser kleinen
Wohltäter vermögen diese Bäume auf stickstoffarmem Boden gut zu
gedeihen und durch Stickstoffanreicherung diesen zu verbessern. Von
den vier deutschen Erlenarten ist die an Bachufern und in feuchten
Niederungen wachsende Schwarzerle (Alnus glutinosa) die
häufigste. Sie bildet ihren schlanken, dunkeln Stamm von 4–25 m
Höhe bis zum Gipfel aus und trägt an den schräg abstehenden Ästen
die im ersten Frühjahr sich entfaltenden männlichen und weiblichen
Blütenstände. Aus[S. 697] den weiblichen Kätzchen gehen eine Menge brauner
Zäpfchen hervor, aus denen im Winter die ungeflügelten Samennüßchen
ausfallen. Die Blätter sind glänzend dunkelgrün, fühlen sich klebrig
an und sind an der Spitze stark abgestumpft im Gegensatz zu den
zugespitzten, weichhaarigen, niemals klebrigen Blätter der Weiß-
oder Grauerle (Alnus incana), die im übrigen der
Schwarzerle sehr ähnlich ist. Sie hat ihren Namen von der glänzend
silbergrauen, glatten Rinde, wächst meist strauchartig, erreicht aber
als Baum eine Höhe von 10 m. Sie liebt weniger nassen humosen
Boden als die vorige, gedeiht auch an Berghängen und auf Gebirgskämmen.
Sie spielt in der nordischen Mythologie eine große Rolle: aus ihr
soll die Frau hervorgegangen sein, während aus der Esche der Mann
hervorging. Varietäten beider Arten werden als Ziergehölze kultiviert.
Beide Erlenarten sind durch ganz Europa verbreitet, doch steigt die
Weißerle im Gebirge höher hinauf als ihre Verwandte und geht auch
weiter nach Norden, was ihr den Namen „nordische Erle“ eintrug. Die
weichhaarige Erle (A. pubescens) ist wahrscheinlich
ein Bastard dieser beiden Arten. Ihre Rinde ist graubraun und ihre
mehr stumpfen Blätter sind nur zu äußerst spitz auslaufend. Eine
besonders auf Granit in der Knieholzregion des Gebirges, namentlich
der Alpen, des Schwarzwaldes, des Jura und Böhmerwaldes, wachsende
strauchartige, sich am Boden schmiegende Art ist die Grünerle
(A. viridis), die, was ihre Verwertung betrifft, nur als
Brennholz in Betracht kommt. Alle Erlen verfügen über ein starkes
Ausschlagsvermögen, indem sie nach dem Verlust von Ästen aus
„schlafenden“ Knospen neue hervorzubringen und so Schädigungen leicht
auszugleichen vermögen. Das Holz der Schwarzerle ist frisch gelbrot,
trocken rostrot, das der Grauerle dagegen heller und das der Grünerle
weiß. Es ist leicht, weich und fest, aber ziemlich grob, leicht
brüchig und wenig elastisch. Es verträgt keinen Wechsel, ist aber im
Wasser dauerhaft und wird deshalb außer zum Brennen hauptsächlich als
Wasserbauholz verwendet. Außerdem dient es zum Schnitzen und Drechseln,
wird zu Bürsten und Zigarrenkistchen verarbeitet und in Nachahmung von
Mahagoni und Ebenholz gebeizt, auch zu Galanteriewaren, Pfeifenköpfchen
usw. verwendet.
Neben Haselnuß und Erle gehören die ihnen nahe verwandten Weiden
und Pappeln zu den ersten Verkündern des Frühlings, indem
sie wie jene sehr früh ihre schon im Herbst unter der Knospenhülle
ziemlich weit entwickelten Blüten hervortreten lassen. Beide Arten[S. 698] von
Kätzchenträgern sind zweihäusig, indem jedes Individuum entweder nur
männliche oder nur weibliche Blüten hervorbringt. In Europa, Mittel-
und Nordasien bis China und Japan heimisch und teilweise in Nordamerika
verwildert sind Silber-, Schwarz- und Zitterpappel. Die Silber-
oder Weißpappel (Populus alba), die sich in unseren
Anlagen neben der Schwarzpappel in wundervollen, 28–30 m
hohen Exemplaren findet, hat auf der Unterseite weißfilzige, an den
jungen Trieben handförmig gelappte, an den älteren Zweigen rundlich
eiförmige Blätter. Ihr Holz ist sehr geschätzt, da es sich wegen
seines gleichmäßigen Baues sehr wenig verzieht und deshalb vorzügliche
Reißbretter liefert. Ähnlich ist dasjenige der Schwarzpappel
(P. nigra), die wir hauptsächlich im lockeren, feuchten Boden
der Flußufer und an feuchten Waldrändern, aber auch häufig in Anlagen
angepflanzt treffen. Sie ist die aígeiros der alten Griechen,
die siebenmal in der Odyssee und einmal in der Ilias genannt wird,
während die Weißpappel bei diesen acherōís hieß. Ein Scholiast,
d. h. Grammatiker des Altertums, erklärt letzteren Namen daher, daß
Herakles den Baum aus der Unterwelt, dem achérōn, an die
Oberwelt gebracht habe. In Anlehnung an diesen Mythus nennt der
römische Dichter Vergil in seinen Eklogen die Pappel (populus)
dem Herkules, den Weinstock aber dem Bacchus angenehm. Diese Sage von
der Herkunft aus der Unterwelt rührt von der düsteren Rinde her, die
schon sehr früh eine dicke, schwärzliche Borke bildet, im Gegensatz
zu der lange glatt bleibenden Rinde der Zitterpappel oder
Espe (P. tremula). Dieser in feuchten Laubwäldern und
an Bächen häufige, bis in die Alpen und auf den Brocken hinaufgehende
Baum ist dadurch bekannt und sprichwörtlich, daß seine an einem
dünnen, langen, seitlich abgeplatteten Stiel sitzenden rundlichen,
gebuchteten Blätter beim geringsten Lufthauch zittern. Während er
sich bei uns vorzugsweise in den Flußniederungen angesiedelt findet,
bildet er in Ostpreußen und Rußland als Waldbaum reine Bestände und
erreicht eine Höhe von 20 m. Er ist der kerkís der
alten Griechen, findet sich aber in Griechenland sehr selten. Sein
grauweißes, glänzendes, eine glattere Bearbeitung als dasjenige der
vorgenannten Arten erlaubendes, weiches Holz wird besonders zur
Herstellung von Zündhölzchen und Zündholzschachteln, daneben auch in
der Holzstofffabrikation verwendet.
Vielleicht nur ein Bastard von Zitter- und Silberpappel ist die
im Orient heimische, nicht selten in unsern Anlagen kultivierte
Graupappel (P. canescens), die 20–30 m hoch wird,
während die bis[S. 699] 35 m hoch wachsende Pyramidenpappel
(P. pyramidalis) mit purpurnen Kätzchen und steilaufstrebenden
Ästchen, die dem Baum eine säulenförmige Gestalt verleihen,
wahrscheinlich nur eine Abart der Schwarzpappel ist. Wenn wir von
Pappeln sprechen, so meinen wir sie. Dennoch ist sie kein Kind unserer
Heimat, sondern hat ihre Heimat in Zentralasien; sie kam zu Beginn des
18. Jahrhunderts von Persien nach Europa und gelangte im Jahre 1740 in
einem männlichen Exemplar aus Norditalien in den Garten nach Wörlitz.
Bis auf acht erst viel später eingeführte weibliche Exemplare stammen
alle deutschen Pyramidenpappeln, die seit der napoleonischen Zeit sich
reihenweise den Flüssen und Landstraßen Mitteleuropas entlangziehen und
der Landschaft ein äußerst charakteristisches Gepräge verleihen, von
diesem einen männlichen Baume ab und wurden durch Stecklinge
erzielt. In den Boden gesteckte abgeschnittene Zweige schlagen sehr
leicht Wurzel. Wahrscheinlich ist diese ungeschlechtliche Vermehrung
in Verbindung mit der Senkung des Grundwasserspiegels infolge
Regulierung der Wasserläufe der Grund des in letzter Zeit häufig zu
bemerkenden frühzeitigen Absterbens der Pyramidenpappeln. Dieses
beginnt mit Wipfeldürre und läßt schließlich den ganzen Baum eingehen.
Neuerdings pflanzt man außer der etwas kleineren Balsampappel
(P. balsamifera) besonders die ebenfalls aus Nordamerika
zu uns gebrachte, bis 20 m hohe kanadische Pappel
(P. monilifera). Beide sind außerordentlich raschwüchsig und
liefern dabei vielseitig brauchbares Holz, sind daher nicht bloß als
Zierpflanzen, sondern auch für die Forstwirtschaft von Bedeutung. Alle
Pappelhölzer sind leicht, weich, wenig werfend und liefern deshalb
vorzügliches Blindholz für furnierte Möbel und Packkisten, sind auch
treffliche Papierstofflieferanten. Nur ganz im Trockenen lassen sie
sich längere Zeit unzersetzt aufbewahren, im Wasser faulen sie rasch.
Dieselbe geringe Bedeutung wie das Pappelholz besitzt auch im
allgemeinen das Holz der Weiden (Salix), das ebenfalls
sehr weich und leicht, wenig fest und dauerhaft ist, also als Bauholz
gleicherweise unbrauchbar ist. Die Farbe des Kernholzes ist rötlich,
braun- oder rötlichgelb. Es wird wie das Pappelholz vorzugsweise
als Blindholz, dann zu Packkisten, Spielwaren usw. verwendet. Von
den 160 Weidenarten finden sich gegen 50 in Deutschland. Um sie
alle auseinander zu halten, braucht es ein besonderes Studium. Eine
der bekanntesten derselben ist die von allen Weiden zuerst blühende
Salweide (Salix caprea), die in Mittel- und Nordeuropa,
wie auch in Nordasien heimisch[S. 700] ist. Ihre Zweige sind es, die unser
katholisches Volk an Stelle der in unserem Klima fehlenden Palmzweige
am Palmsonntag zur Weihe bringt, weshalb diese Weidenart auch Palmweide
heißt. Nach altgermanischem Glauben schirmen ihre Zweige das Haus,
in welchem sie aufbewahrt werden, gegen Zauber, Hexenspuk und böse
Geister. Dieser heute noch beim Volke geltende Glaube ist ein Nachklang
aus germanischer Vorzeit, in der die Weiden mit der Geisterwelt der
Verstorbenen in Zusammenhang gebracht wurden.
Neben der Salweide wird besonders auch die Weißweide (Salix
alba) mit fein behaarten, schmalen Blättern den Bächen und Wegen
entlang als „Kopfweide“ gezogen, d. h. der Stamm wird in bequem
erreichbarer Höhe, etwa an der Gabelungsstelle von Leitästen, geköpft.
Die dann aus der Wundstelle hervorbrechenden dünnen, schmiegsamen Ruten
werden als beliebtes Flechtmaterial für Körbe und andere geflochtenen
Gegenstände verwendet, während das Holz des Stammes als Nutz- oder
Brennholz dient. Die weiße Weide galt im Altertum als Symbol der
Keuschheit, weshalb die Frauen in Hellas bei den Thesmophorien ihr
Lager mit unfruchtbaren Zweigen von männlichen Bäumen dieser Weidenart
bestreuten. Es war dies ein zu Anfang November, nach der Bestellung
der Wintersaat zu Ehren der Demeter thesmóphoros, d. h. der
Gesetze gebenden Göttin der fruchtbaren mütterlichen Erde gefeiertes
Fest. Diese galt als die Gründerin des Ackerbaus, der bürgerlichen
Gesellschaft und der rechtmäßigen Ehe und ihr Fest wurde von den Frauen
unter strengem Ausschluß der Männer gefeiert.
Während die Zweige der Bruch- oder Knackweide (S.
fragilis) sehr leicht brüchig sind und deshalb nur als Brennholz
Verwendung finden, sind die dottergelben Zweige der nur deretwegen
angepflanzten Dotterweide (S. vitellina), weil durch
besondere Zähigkeit ausgezeichnet, als Material zum Binden sehr
geeignet. Ebenfalls zum Binden und zur Korbflechterei sehr geeignet
ist die Band- oder Korbweide (S. viminalis),
die in Europa und Nordasien sehr gemein ist und häufig an fließenden
und stehenden Gewässern angebaut wird. Sie hat eine grünlichgelbe
Zweigrinde und sehr lange, zugespitzte, unterseits weißhaarig glänzende
Blätter. Sie besitzt ein sehr kräftiges Ausschlagsvermögen, so daß die
Korbruten jährlich geerntet werden können. Um Reifstäbe für Bandholz
um Fässer und Kübel zu erhalten, sind dagegen 3–6 Jahre nötig. Ihr
weit ausstreichendes Wurzelwerk macht Bandweidenpflanzungen zur
Befestigung von Uferböschungen vorzüglich ge[S. 701]eignet. Noch besser als
sie erträgt den jährlichen Schnitt eine Bastardform zwischen ihr und
der Purpurweide (S. purpurea), so genannt wegen ihrer
purpurnen, statt wie sonst gelben Staubbeutel. Auch sie wird an
feuchten Stellen und Ufern häufig angebaut, ebenso die aus Rußland
bei uns eingeführte kaspische Weide (S. acutifolia)
und die feine Flechtware liefernde einheimische Mandelweide
(S. amygdalina), so genannt nach ihrem an die Mandelblätter
erinnerndem, unterseits bläulichweiß bereiftem Laubwerk. Auch von
diesen gibt es verschiedene in Kultur stehende Bastarde. Alle diese
werden ausschließlich durch Stecklinge vermehrt, da sich abgeschnittene
und in den Boden gesteckte Zweige sehr rasch bewurzeln und es zu
langwierig wäre, diese Weidenpflanzen aus Samen zu ziehen.
Besonders in Nieder-Österreich, im Neckartal und in Holland werden
diese Weiden für die Flechtindustrie im großen gezüchtet und liefern
als Nebenprodukt eine zum Gerben geeignete Rinde mit einem mittleren
Gerbstoffgehalt von 8 Prozent, außerdem zum Flechten von Matten und
Taschen und zum Drehen von Stricken dienenden Bast. Das leichte,
weiche Weidenholz dient im Oderbruch zum Schnitzen von Holzschuhen und
wird sonst viel benutzt, auch zum Brennen von Kohle. Nach Theophrast
gaben die alten Griechen dem leichten Weidenholz zu Schilden den
Vorzug. Derselbe Autor sagt in seiner Pflanzengeschichte, daß die
Weide (itéa) am Wasser wachse und in vielen Arten vorkomme,
doch seien die Ruten der Purpurweide schöner und besser zu Flechtwerk
als diejenigen der weißen Weide. Die Griechen und besonders die Römer
pflanzten die Weiden in bedeutender Menge zu den verschiedensten
Zwecken. Nach Plinius hielt der ältere Cato die Weidenzucht für einen
der wichtigsten Teile der Landwirtschaft und nannte die Weide die
nützlichste aller Wassergewächse. Er schreibt: „Es gibt verschiedene
Arten von Weiden (salix). Die einen liefern Stangen für
Weinberge und in ihrer Rinde Material zum Binden; andere geben Ruten,
welche durch ihre Biegsamkeit und Zähigkeit zum Binden tauglich sind;
andere liefern zarte Ruten zu feinem Flechtwerk, wieder andere starke
Ruten zu Körben und anderem Gebrauch in der Landwirtschaft. Werden die
Weidenruten durch Schälen weiß und behandelt man sie sorgfältig, so
geben sie Körbe, die nachgiebiger sind, als wenn sie aus Leder gemacht
wären, liefern auch die besten Lehnstühle. Geköpfte Weiden treiben neue
Äste, und diese wachsen sogar aus den Köpfen um so dichter. Jedenfalls
ist die Weide ein Baum, dessen Anpflanzung bei geringen Kosten einen
sicheren, auch von jeder Witterung[S. 702] unabhängigen Ertrag gibt.“ Sehr
ausführlich behandelt sein Zeitgenosse Columella die Weidenkultur durch
Stecklinge, die, bevor sich noch die Blattknospen geöffnet haben,
in 2,5 Fuß tief umgegrabenem feuchten Boden je zwei Fuß auseinander
gepflanzt werden sollten. In den ersten drei Jahren lockere man in den
Weidenpflanzungen den Boden öfters durch Graben auf, später genüge
es, solches dreimal jährlich zu tun. Bei Unterlassung dieser Pflege
verkümmerten die Weiden bald.
Heute ist die Kultur und Verarbeitung von Korbweiden zu Korb- und
Stuhlarbeiten eine sehr ausgedehnte und beschäftigt viele Tausende von
Menschen. Deshalb verdienen sie noch häufiger, als dies geschieht,
angepflanzt zu werden, da die Flechtreiser in manchen Gegenden
Deutschlands noch vom Auslande bezogen werden müssen. Die Flechtruten
müssen einjährig, 1,3–2,8 m lang, gerade, möglichst dick und
ohne Knoten und Abzweigungen sein. Sie werden um die Mitte August
geschnitten und dann entweder noch mit der Rinde oder vorteilhafter
schon entrindet (weiß) in den Handel gebracht, indem man sie vorher
in Wasser gelegt und dann durch eine mit der Hand zusammengepreßte
Holzklammer gezogen hat, um die als Bast bezeichnete Rinde von ihnen
zu entfernen. Letztere wird zum Gerben benutzt. Die Ruten aber dienen
weiß oder gefärbt zum Flechten. Durch das Abschneiden der jährigen
Triebe schwillt das obere Ende der Kulturweiden unverhältnismäßig
an und wird als Kopf bezeichnet; häufig bersten sie oben und faulen
durch den eindringenden Regen. Nicht geköpfte Baumweiden, namentlich
Bruch- und Weißweiden, können etwa 150 Jahre alt werden und dienen
dann in 10–15jährigem Umtriebe und als Kopfholz in 1–2jährigem Abhiebe
zu Brennholz. Das Weidenlaub dient heute noch, wie im Altertum, auch
getrocknet, als gutes Viehfutter und die Bienen, welche die Ursache
der so häufigen Verbastardierung der Weiden sind, finden in den
frühblühenden Weidenarten eine wertvolle Nahrung. Als Zierbaum steht
die Trauerweide (Salix pendula) obenan. Dieser
3–7 m hohe Baum mit überhängenden Ästen und Zweigen stammt aus Japan
und China, kam vor 200 Jahren nach dem Orient und von da zu uns, aber
nur in einem weiblichen Exemplar, so daß alle unseren, aus Stecklingen
gezogenen Trauerweiden weiblich sind. Er wird bei uns vorzugsweise als
Trauerbaum kultiviert.
Ebenfalls zu den Amentazeen oder Kätzchenbäumen gehören die
Birken (Betula, aus dem betulla der Römer), die
in 35 Arten die[S. 703] Nordhemisphäre in der gemäßigten und kalten Zone
bewohnen und die nördlichsten Holzpflanzen überhaupt repräsentieren.
Außerordentlich malerisch ist der Anblick der nordischen Birkenwälder.
Auf hohen, schlanken, bis zu einer Höhe von 18 m kaum eine
Spur von Astbildung zeigenden, blendend weißen Stämmen wiegt sich
eine leichte Krone von zarten, hängenden Blättern. Dabei ist der
Boden mit einem weichen Teppich von Moos und Flechten bedeckt,
zwischen denen, soweit das Licht eindringen kann, eine blaße, dem
Edelweiß naheverwandte Immortelle (Gnaphalium dioicum) üppig
emporsprießt. Ähnlich den ihnen nahestehenden Erlen bilden auch
die Birken die männlichen, zu zweit am Ende der Zweige hängenden
Kätzchen schon im Vorwinter aus; die zarten, grünlichen Kätzchen der
Fruchtblüten aber erscheinen erst im Frühjahr und ragen seitwärts oder
aufrecht an kleinen Seitentrieben hervor. Im Herbst fallen dann die
nunmehr hängenden Samenkätzchen auseinander und überlassen dem Wind,
wie die Befruchtung, so auch die Ausbreitung der gelben, geflügelten
Samenkörnchen, die oft weithin den Boden bedecken. Oft werden sie
vom Winde auf weite Strecken fort und bedeutend hoch in die Luft
gewirbelt. Deshalb trifft man nicht selten junge Birken hoch oben auf
Felsenspitzen, auf Mauern von Ruinen und auf Dächern; sie können da,
wenn man sie gewähren läßt, recht groß werden, da die Birke von allen
Bäumen die kleinste Wurzelverbreitung besitzt und auch im freien Stand
mit einer kleinen Menge Erde vorlieb nimmt.
Sämtliche drei Baumbirken, die zu den Nutzhölzern gehören, wachsen in
Deutschland. Der nördlichste Baum Europas, der bis in die Nähe des
Nordkaps unter 71 Grad nördlicher Breite geht, ist die Warzen-
oder Weißbirke (Betula verrucosa), ein 20–25 m
hoher Baum Mittel- und Nordeuropas, der östlich bis Kamtschatka geht
und auch in ganz Nordasien außerordentlich verbreitet ist. Bei uns
in Mitteleuropa häufiger als diese mehr nordische Weißbirke ist die
wahrscheinlich nur eine Abart derselben bildende Hänge- oder
Trauerbirke (B. pendula), deren dünne Äste im Gegensatz
zur vorigen weit herabhängen. Diese liebt einen sandigen, etwas
lehmigen Boden, findet sich bei uns in kleinen Hainen und wird in
Gartenanlagen angepflanzt, häufig auch im Mischwald und als Gesträuch
im Buschwald, kommt auch auf Hochmooren vor. Sonst ist auf sumpfigen,
moorigen Stellen und in feuchten Feldern die Haar- oder
Ruchbirke (B. pubescens) heimisch, die als mäßig hoher
Baum oder noch häufiger, namentlich in höheren Lagen, strauchartig
in den Alpen und den mit[S. 704]teldeutschen Gebirgen bis an die Baumgrenze
geht, in Norddeutschland aber auch in der Ebene wächst. Während, wie
die Blätter, auch die jungen Triebe der erstgenannten beiden gemeinen
Birken kahl, höchstens von Wachsausschwitzungen rauh und warzig sind,
sind diese bei der Haarbirke in der Jugend mit einem dichten, weichen
Haarfilze überzogen, der im erwachsenen Zustande ganz schwindet oder
nur auf die bärtigen Aderwinkel der Unterseite der Blätter beschränkt
bleibt. Die Rinde von Weiß- und Hängebirke ist reinweiß, während sie
bei der Haarbirke etwas ins Graue geht. Dafür behält letztere ihre
glatte, in papierdünnen Bändern sich ablösende Rinde bis ins Alter
am ganzen Stamm, während Weiß- und Hängebirke im höheren Alter am
unteren Stammteil eine dicke, tiefrissige Borke von schwärzlicher
Farbe und außerordentlicher Härte bilden. Da die Borke einen Schutz
gegen Erwärmung und Verdunstung bildet, ist es begreiflich, daß die
auf nassem Boden wachsende Haarbirke dieses Schutzes weniger bedarf
als jene. Die Form der ziemlich dünnen, langgestielten Blätter sind
bei Weiß- und Hängebirke dreieckig bis rautenförmig, bei der Haarbirke
dagegen mehr oval.
Alle drei Birkenarten sind, besonders in der Jugend, sehr raschwüchsig
und vermögen bei ihrer leichten Verbreitungsfähigkeit durch den Wind im
Wald entstandene Lücken schnell auszufüllen. Dabei können aber Weiß-
und Hängebirke durch das Hin- und Herpeitschen ihrer warzenbedeckten,
lang herabhängenden Zweige im Winde die Nachbarpflanzen ziemlich
belästigen, während die Zweige der Haarbirke sperriger und weniger
hängend sind. Sie wird deshalb als Mischholz vorzugsweise zwischen
Nadelbäume gepflanzt, da es wegen dieses Umsichschlagens der Zweige
im Winde selten ein Laubbaum in ihrer Nachbarschaft aushält. Auch
als Oberholz im Mittelwald und als Schutzbäume leisten die Birken
gute Dienste. Sie bedürfen nur wenig Sonnenwärme, um ihr Wachstum zu
beginnen, belauben sich schon, wenn die Tageswärme über 7° C.
steigt, und verlieren ihre Blätter im Herbst, wenn dieser Wärmegrad
nicht mehr erreicht wird. Dies befähigt sie, wenigstens zu Sträuchern
verkrüppelt, bis zu den baumlosen Polarländern vorzudringen. Sie
gedeihen am besten in frischen, nicht zu windigen Lagen auf feuchten,
humusreichen Sandböden. Ihre Polargrenze stimmt mit derjenigen der
Nadelhölzer nahe überein. Man erzieht die Birken leicht und sicher
durch Pflanzung zwei- bis fünfjähriger Pflänzlinge, welche aus den
Schlägen genommen werden, wo sie aus angeflogenem Samen von selbst
wachsen.
[S. 705]
Die Weißbirken bilden östlich der Weichsel ausgedehnte reine
Bestände. Ihr Anbau in Deutschland datiert erst aus dem Beginne des
19. Jahrhundert, als man die durch lange Mißwirtschaft ermüdeten und
verödeten Waldbestände wieder aufzufrischen suchte. Jetzt werden
sie als Nutzholz häufig gepflanzt. Ihr dichtes, feines, sehr zähes,
gelblichweißes Holz bildet keinen Kern, besitzt geringe Härte,
arbeitet stark und wird in feuchter Luft sehr schnell morsch. Es dient
hauptsächlich zu Leiterbäumen, Felgen, Deichseln, Zahnrädern und zu
groben Schnitzwaren, wie Trögen, Holzschuhen usw.; als Brennholz
rechnet man es zu den Harthölzern. Es brennt hell, gibt viel Hitze und,
wie auch die daraus gebrannte Kohle, ein beständig lebhaftes Feuer.
Die Ruten liefern das Material zu unsern gewöhnlichen braunen Besen,
werden auch zu Strafruten, zu Dachreisig und als Wieden zum Binden
gebraucht. Oft werden die Birken speziell zur Gewinnung von Reisig
angepflanzt und die Bäume dann geschneitelt, d. h. die einzelnen Äste
werden abgehauen, um ähnlich wie bei Kopfweiden jährlich die Schößlinge
ernten zu können. Die harzreiche weiße Rinde ist fast unverweslich, man
legt sie unter die Schwellen und Balken, die feucht oder auf Steinen
zu liegen kommen, und benutzt sie zur Unterlage der Rasendächer, auch
stellt man Körbe, Schnupf- und Tabaksdosen daraus her. Wegen ihres
hohen Gerbstoffgehaltes wird sie auch zum Gerben benutzt. In Rußland
wird aus der Birkenrinde und Birkenwurzel durch trockene Destillation
der Birkenteer gewonnen, der zur Bereitung des Juchtenleders dient,
dem er den eigentümlichen Geruch verleiht. Die Blätter dienen als
Schaffutter, sind als harntreibendes Mittel beliebt und geben mit
Alaun eine grüne Farbe, das Schüttgrün, und mit Kreide das Schüttgelb.
Birkenknospen geben Birk- und Auerhühnern ein angenehmes Futter und
den Finnländern einen beliebten Tee. Alte Stämme liefern beim Anbohren
im Frühjahr einen durch 2 Prozent Traubenzucker süßen Saft, der zur
Bereitung von Birkenwein und Birkenbier verwendet wird. Ein aus dem
Stamm gewonnenes Harz dient in Rußland gegen Gicht und scheint schon
in vorgeschichtlicher Zeit als Amulett zu gleichem Zwecke benutzt
worden zu sein. Gemasertes Birkenholz gibt schönes Furnierholz, das
meist unter dem Namen „schwedische Birke“ im Handel ist. Der bei
der Verbrennung des Holzes entstehende Ruß findet zur Bereitung von
Buchdruckerschwärze und Malerfarben Verwendung. Aus der Asche gewinnt
man eine gute Pottasche. Zu Pfingsten abgehauene Birken werden als
„Maien“ vor die Häuser, Kirchen und selbst in die Stuben[S. 706] gesetzt.
Dieser Gebrauch ist ein Nachklang des Frühlingsfestes der alten
Germanen. Daß die Birke bei diesen in hohem Ansehen stand, beweist,
daß der zweite Buchstabe der Runenschrift b seinen Namen
biârkan von der Birke hatte. Nach altem Volksglauben reiten die
Hexen auf einem Birkenbesen zum Blocksberg. Die bis in unsere Zeit bei
Studenten beliebten, „Birkenmaier“ genannten Becher aus Birkenstämmen
mit der Rinde bildeten die Trinkgefäße der alten Germanen. Da die Birke
in Griechenland, wie überhaupt im südöstlichen Europa, nicht wächst,
kannten die Griechen diesen Baum nicht, wohl aber die Römer, die ihre
fasces genannten Strafruten außer aus Ulmenzweigen gelegentlich
auch aus Birkenreisig herstellten. Sie kommt in Norditalien noch auf
der Nordseite hoher Berge wild vor. Der ältere Plinius schreibt in
seiner Naturgeschichte: „Der Spierlingsbaum (sorbus) und die
Birke (betulla) lieben einen kalten Standort. Die Birke ist
eigentlich ein gallischer Baum; ihre Rinde ist blendend weiß und dabei
sehr dünn. Die Obrigkeiten gebrauchen ihre Ruten zum Strafen; sie
dienen auch zu Reifen und Korbrippen. In Gallien kocht man aus Birken
auch Teer (bitumen).“
Außer den besprochenen Baumbirken wächst als Vertreter der im
Hochgebirge heimischen Strauchbirken auf den Mooren Norddeutschlands
und auf den kalten Hochmooren Bayerns, wie der Alpen die
Strauchbirke (Betula humilis), während ebenfalls als
Relikt der Eiszeit auf den Alpen und auf den höchsten Mooren des
Riesengebirges, des Erzgebirges und des Harzes die Zwergbirke
(B. nana) als ein fast kriechender Strauch von höchstens
1 m Höhe mit selten über fingerdick werdendem Stämmchen gedeiht.
In ihrer eigentlichen Heimat Nordeuropa, Nordasien und Kanada kann
sie gelegentlich 6 m Höhe erreichen, während sie in Grönland
und auf Spitzbergen sehr klein bleibt. Aus ihren feinen Wurzelfasern
verfertigen die Lappländer ganz schöne Decken.
In Kanada und in den nördlichen Staaten der Union, aber auch in
Sibirien und Japan wächst als ein bis 25 m hoher Baum mit
weißen, in dünnen Häuten sich ablösender Rinde die Papierbirke
(B. papyracea), aus deren Gesamtrinde man sehr leichte und
dennoch dauerhafte Boote (canoes) verfertigt. Ebenfalls in
Nordamerika, und zwar im östlichen Teile jenes Kontinents sind die
weißbuchenblätterige Birke (B. carpinifolia) mit
bräunlichgelber bis dunkelbrauner, selten hellgrauer Rinde, die
20 m hohe Schwarz- und Gelbbirke (B. nigra und
lutea) mit schon sehr bald rissiger, schwarzer beziehungsweise
gelber[S. 707] Rinde und die Zuckerbirke (B. lenta) zu Hause,
werden aber oft in unseren Anlagen als Zierbäume kultiviert. Die
Zuckerbirke wird 24 m hoch und besitzt eine braunschwarze, in
dicken, breiten Stücken sich ablösende Rinde von gewürzhaftem und süßem
Geschmack, weshalb sie den Indianern als Kaumittel und zur Bereitung
erfrischender Getränke dient. Sie liefert bei der Destillation ein
ätherisches Öl, das als Gaultheria- oder Wintergrünöl
in den Handel gelangt. In Japan und in der Mandschurei sind die
pappelblätterige Birke (B. populifolia) und die
ulmenblätterige Birke (B. ulmifolia) zu Hause, während im
Himalaja die zur Anfertigung von Papier dienende Bhojpatra- oder
Churjibirke (B. utilis) mit brauner Stammrinde heimisch
ist. Damit wären die wichtigsten Birkenarten aufgezählt.
Ihres Holzwertes wegen verdienen auch die bei uns meist nur als
Zierbäume gepflanzten Platanenarten (Platanus) Beachtung.
Das ziemlich feine, feste, harte und gut polierbare Holz dieser
Kernbäume ist von zahlreichen ansehnlichen Markstrahlen durchsetzt
und in Farbe und Eigenschaften unserem Rotbuchenholz sehr ähnlich.
Wie dieses ist es des lästigen Arbeitens wegen in massiver Verwendung
zu besseren Möbeln wenig brauchbar, wohl aber zu Furnieren, sowie zu
Galanterie- und Drechslerwaren, ist aber weniger haltbar als jenes.
Die überall bei uns verbreitete, durch Stecklinge vermehrte Art ist
die ahornblätterige Platane (Platanus acerifolia), ein
Kreuzungsprodukt der wetterhärteren nordamerikanischen und griechischen
Platane (Pl. occidentalis und orientalis). Ihre großen
Blätter sind dem Ahornlaub ähnlich handförmig gelappt und der schlanke
Stamm stößt fortwährend die Borke in unregelmäßigen, dünnen Schuppen
ab, so daß der Schaft glatt bleibt und gelblich gefleckt erscheint.
Vielseitiges Nutzholz liefern die Ahornarten (Acer),
von denen wir den Bergahorn (Acer pseudoplatanus), den
Spitzahorn (A. platanoides) und den Feldahorn oder
Maßholder (A. campestre) unterscheiden. Die handförmig
fünflappigen Blätter erinnern beim Bergahorn durch ihre abgerundeten
Ecken lebhaft an das Weinlaub, während sie beim Spitzahorn scharf
ausgezogene Spitzen besitzen und etwas denjenigen der Platane ähneln.
Während letzterer die abwärts hängenden Blütentrauben erst nach der
Entfaltung der Blätter entwickelt, läßt ersterer seine aufrechten
gelben Blütendolden schon im April und Mai leuchten. Die Früchte
sind einsamige Nüßchen, die je zu zweit miteinander verwachsen sind
und sich in lange grüne Flügel fortsetzen, damit sie der Wind in
spiraliger Bahn um sich selbst wirbelnd davon[S. 708]trage. Diese Flügel
der Doppelfrucht stehen beim Bergahorn in spitzem Winkel zusammen,
beim Spitzahorn dagegen bilden sie einen stumpfen Winkel und beim
Feldahorn, bei dem die Früchte filzig behaart sind, stehen sie
wagrecht auseinander. Bei letzterem, der nur selten zum stattlichen
Baum heranwächst und uns in der Regel nur als Buschwerk am Waldrand
und in Feldhölzern entgegentritt, sind die ebenfalls fünflappigen
Blätter kleiner als bei den andern beiden Arten, die Lappen der
letzteren sind abgerundet und ziemlich ganzrandig. Wie der Name schon
sagt, ist der Bergahorn ein echter Gebirgsbaum, der in den Alpen bis
1600 m hoch steigt und nördlich bis Dänemark und Gothland
geht; der Spitzahorn, der ebenfalls 20–25 m hoch wird, steigt
weniger hoch, geht aber weiter nach Osten und Norden als ersterer.
Das Holz dieser Ahornarten ist gelblichweiß, beim Feldahorn meist
ins Rötliche übergehend, mittelschwer, mäßig hart, sehr fein mit
oft kaum sichtbaren Jahresringen, glatt zu bearbeiten und leicht
polierbar; vermöge seiner Eigenschaft, nur mäßig zu schwinden und
zu reißen, ist es für furnierte und massive Möbel, Tischplatten und
zur Herstellung musikalischer Instrumente vorzüglich geeignet. Es
ist auch ein gutes Drechslerholz und findet in der Hausindustrie zu
Schnitzwaren, Küchengeräten, Laubsägearbeiten und Schuhmacherleisten
vielseitige Verwendung. Seine Dauerhaftigkeit ist aber nur im Trockenen
eine gute; doch wird es hier, wenn nicht luftig gehalten, gern von
Würmern angegangen. Der Ahornmaser ist sehr schön, ebenso das wellige
(flammige) Holz, das meist dem Spitzahorn eigen ist und an alten
Stämmen durch Welligwerden der Jahresringe, entsprechend den Rissen der
rötlichbraunen Borke, entsteht. Trotzdem das Holz des Feldahorns seiner
schönen Maserung wegen sehr gesucht ist, wird der Baum seines langsamen
Wuchses wegen nicht im Hochwald angepflanzt, dagegen sichert ihm seine
Ausschlagsfähigkeit im Niederwaldbetrieb einen Platz. Der besonders
im Frühjahr stark zuckerhaltige Saft der Ahornarten wird bei uns kaum
genutzt, wohl aber in Nordamerika, wo der im Herbst ein orangefarbenes
Laubwerk aufweisende Zuckerahorn (A. saccharinum) zu
Hause ist und vorzugsweise dazu verwendet wird. Dieser Baum ist als
durchaus winterhart auch in unsere Wälder eingeführt worden, spielt
aber darin noch keine nennenswerte Rolle. Noch weniger ist dies beim
ebenfalls aus Nordamerika bei uns eingeführten Silberahorn
(A. dasycarpum) der Fall, dessen zierliches, scharf
eingeschnittenes Laubwerk ihn als Park- und Straßenbaum empfiehlt.
Als solcher ist er besonders in Süddeutschland eingebürgert, ferner
der gleichfalls[S. 709] nordamerikanische Eschenahorn (Acer
negundo), so genannt wegen seiner unpaarig gefiederten Blätter.
Außer diesen ist er an seinen lange vor dem Ausbruch des Laubes
erscheinenden, hängenden Blütenbüscheln und den kleinen, mit den
Flügeln sich berührenden Doppelfrüchten erkenntlich. Auch er wird wie
der gleicherweise nordamerikanische Schwarz- und Rotahorn
(A. nigrum und rubrum) in seiner Heimat zur Gewinnung von
Ahornzucker angezapft und ist eine Zierde unserer Anlagen und Alleen.
Die Spielart des Eschenahorns mit weißbunten und gelbbunten Blättern
wird als die Krone unserer panachiertblätterigen Bäume angesehen. Zu
den schönsten Schmuckhölzern zählt eine Maserbildung des Ahorns, die
besonders häufig und in großer Schönheit am amerikanischen Zuckerahorn
auftritt und unter dem Namen „Vogelaugenmaser“ als Furnierholz die
höchsten Preise erzielt. Da die Maserbildung für gewöhnlich nur in den
äußeren Stammschichten auftritt, erfolgt das Schneiden der Furniere
durch Abschälen um den Stamm. Grau gebeizt sind diese Furniere unter
dem Namen „Maple“ im Handel.
Von den 39 in der gemäßigten und subtropischen Zone der Nordhemisphäre,
besonders in Nordamerika, Ostasien und dem Mittelmeergebiet, heimischen
Eschen (Fraxinus) ist die bei uns vorkommende gemeine
Esche (Fraxinus excelsior, d. h. die hochragende) einer
unserer schönsten Waldbäume mit hohem, schlankem Stamm, in der Jugend
hellgrauer, glatter, im Alter braungrauer, rauher, durch quere
Borkenrisse ausgezeichneter Rinde, großen, schwarzen Knospen an den
glatten, graugrünen Trieben, mit 3–6paarigen Fiederblättern und vor
dem Laub erscheinenden, nackten, d. h. kronenlosen Zwitterblüten, die
mit ihren roten bis violetten Staubgefäßen in dichten Büscheln an den
alten Trieben sitzen und nach der Befruchtung in einen zungenförmigen,
deutlich geaderten Flügel auslaufende längliche Früchte hervorgehen
lassen. Als große Seltenheit trifft man auch Eschen mit ungefiederten,
höchstens am Grunde gelappten Blättern, die als Rückbildung zur
ursprünglichen, einfachen Form angesehen werden müssen. Ist die
Gipfelknospe eines Triebes durch Frost oder Insekten zerstört worden,
so übernehmen zwei gleichstarke Seitenknospen die Führung und
verursachen eine typische Zwieselbildung.
Die gemeine Esche findet sich in ganz Europa bis 60° nördlicher Breite,
ebenso in Nordasien und im Orient in feuchten Wäldern, dann an Fluß-
und Bachufern. Sie gedeiht noch in Sümpfen, nicht aber auf Sandboden,
erreicht eine Höhe von 40 m und steigt in den Alpen[S. 710] bis
1200 m hinauf. Sie verlangt frischen, fruchtbaren Boden, kann aber
dank ihres außerordentlich weit verzweigten Wurzelsystems, das überall
das versinkende Oberflächenwasser aufzunehmen vermag, auch auf lockeren
Schutthalden von Kalkgebirgen, wie z. B. auf der Schwäbischen Alp und
im Schweizer Jura, fortkommen. Die Wurzel dringt nicht weit in den
Boden, breitet sich aber nach allen Seiten weit aus, so daß sie den
Boden dennoch von aller in ihm enthaltenen Feuchtigkeit auszusaugen
vermag. Außer Bodenfeuchtigkeit braucht sie Licht, ist aber gegen
Frost und Hitze empfindlich. Sie meidet daher wie den Sandboden, so
auch die rauheren Gebirgslagen. Man pflanzt sie in Laubholzbeständen
an, kultiviert sie aber am häufigsten im Niederwaldbetrieb. Ihr von
jungen Bäumen weißes, von älteren dagegen bräunlichgelbes, mit breiten
Jahresringen, aber feinen Spiegeln versehenes Holz ist dicht, hart,
sehr zähe und elastisch, gut spaltbar, nicht leicht reißend und sehr
tragfähig. Diese Eigenschaften machen es zur Herstellung von Axt- und
Hammerstielen, von Drechsler- und Wagnerarbeiten, landwirtschaftlichen
Werkzeugen, Turn- und Sportgeräten, besonders Schneeschuhen und
Schlitten, aber auch als Tischlerholz vorzüglich geeignet. Vornehmlich
geschätzt ist der ungarische Eschenmaser von alten Stämmen mit welligem
Verlauf der Holzfasern. Furniere mit solchem Maser werden mit 10–12
Mark pro Quadratmeter bezahlt. Im Brennwert rangiert das Eschenholz
dicht hinter dem Eichenholz. Das Laub wird von Schafen und Ziegen gerne
gefressen und ist ein gutes Viehfutter, das als solches besonders in
Steiermark und Kärnten, aber auch in den grasarmen Mittelmeerländern
viel benutzt wird. Wie das junge Eschenholz auch zu Faßreifen, werden
die jungen Triebe zu Lanzenschäften, Peitschenstielen usw. verwendet.
Schon Homer, der allerdings von der weiter im Süden wachsenden
Blumen- oder Mannaesche (Fraxinus ornus) als
melíē in Ilias und Odyssee mehrfach spricht — die gemeine
Esche wächst nur auf den Gebirgen Makedoniens und am Südabhang der
Alpen — sagt von der Esche, sie wachse in Gebirgstälern und diene
zu Speerschäften, Türschwellen und -Pfosten. Auch die Römer haben
diese im Auge, wenn sie von fraxinus sprechen. So sagt der
Ackerbauschriftsteller Columella: „Die Esche gibt ein Laub, das Schafen
und Ziegen sehr angenehm und auch für Rindvieh recht brauchbar ist. Man
zieht sie deswegen in eigenen Pflanzungen.“ Sein Zeitgenosse Plinius
aber schreibt in seiner Naturgeschichte: „Die Esche wurde ihres Holzes
wegen geschaffen. Ihr Wuchs ist hoch und schlank; ihre Blätter sind
gefiedert (pinnatus). Sie ist durch Homer und des[S. 711] Achilles
Lanze berühmt geworden. Das Holz ist jedenfalls zu vielerlei Gebrauch
gut. Das Holz der auf dem Ida in der Landschaft Troas wachsenden Eschen
ist dem Cedernholze so ähnlich, daß es kaum davon unterschieden werden
kann, wenn es geschält ist. Griechische Schriftsteller behaupten,
Eschenlaub sei Pferden und Maultieren tödlich; in Italien ist dies
jedenfalls nicht der Fall. Dagegen ist der aus ihnen gepreßte Saft,
getrunken und auf die schwellende Bißwunde gelegt, das beste Mittel
gegen Schlangengift. Die Wirkung ist so groß, daß jede Schlange den
Eschenbaum von weitem flieht und seinen Schatten selbst dann meidet,
wenn er früh und abends am längsten ist. Ich habe selbst gesehen, daß
eine Schlange, welche in einen Kreis zwischen Eschenblätter und Feuer
gelegt wurde, sich lieber ins Feuer stürzte, als die Blätter berührte.
Es ist eine große Wohltat der Natur, daß die Eschen früher blühen, als
die Schlangen erscheinen, und daß sie nicht eher die Blätter abwerfen,
als bis die Schlangen zur Winterruhe gegangen sind.“ Natürlich ist dies
Aberglaube, wie er in damaliger Zeit selbst bei den Gebildetsten weit
verbreitet war. Die Blumen- oder Mannaesche, von der hier die Rede ist,
findet sich in Bergwäldern Südeuropas, waldbildend namentlich im Karst,
in Kroatien, Slavonien, Dalmatien und im Orient und wird besonders in
Sizilien kultiviert, da sie durch im Frühjahr in ihre Rinde gemachte
Einschnitte die Manna als einen süßen, an der Luft erhärtenden
Saft liefert. Bei uns findet sie sich nur als Zierholz angepflanzt. Sie
ist ein buschiger kleiner Baum oder Strauch, dessen Blüten grüne Kelch-
und weiße Kronblätter tragen.
Von der gemeinen Esche, die in der germanischen und nordischen
Mythologie eine bedeutende Rolle spielt — man denke nur an die
Weltesche Ygdrasil und die Abstammung des Mannes von der Esche,
während die Frau aus der Erle hervorging — kultiviert man als
Zierbäume verschiedene Abarten, wie die einblätterige Esche,
die Trauer- oder Hängeesche, die Goldesche
mit rötlichgelber Rinde usw. In Parkanlagen werden auch mehrere
nordamerikanische Arten, wie die Weiß-, Rot-,
Schwarz- und Blauesche angepflanzt. Unter ihnen ist
besonders die Weißesche (Fraxinus americana), weil viel
frosthärter und später als die gemeine Esche austreibend, neuerdings
auch in einzelnen Versuchspflanzungen als Waldbaum bei uns angesiedelt
worden. Auf einer Esche (Fraxinus chinensis) in Südchina und
Annam wird die Wachsschildlaus (Coccus pe-la) gezüchtet, die das
chinesische Wachs liefert.
Der Baum, der am innigsten mit dem deutschen Volksleben ver[S. 712]wachsen
ist, ist die Linde (Tilia). Sie galt den alten Germanen
und Slaven als heiliger Baum und war der weiblichen Gottheit Herka
oder Frau Holle, bei den Slaven der Liebesgöttin Krasopani geweiht. In
Sitte und Sage spielt sie eine sehr wichtige Rolle. Wie heute noch alle
Volksfeste sich unter der alten Dorflinde abspielen, so kamen unsere
Vorfahren mit Vorliebe unter ehrwürdigen Lindenbäumen zusammen. So gibt
es in Deutschland noch viele Gerichts-, Vehm-, Blut-, Geisterlinden
usw. An Gerichtsstätten standen wenigstens drei, meist aber sieben
Linden. Das in der Regel am Hauptbaume befestigte roh geschnitzte
Götterbild hieß Wigbild, woraus später Weichbild, im Sinne von Grenze
des Gerichts, später Stadtgrund, entstand. Berühmt ist namentlich die
altehrwürdige Vehmlinde bei Dortmund. Auf Burgen und in Klöstern war
die Linde Hausbaum. Dort wurde der Gast im Sommer bewirtet, dort wurde
erzählt, gezecht, gespielt und der fahrende Spielmann oder Sänger
angehört. Wie auf den Burgen war die Linde auch im Kloster der Baum
der Erholung und als solcher meist am Brunnen gepflanzt. Weil der
Baum als Bildstock für Marien- und Heiligenbilder benützt zu werden
pflegte, wurde er wie diese selbst mit dem Nimbus der Heiligkeit und
Wundertätigkeit umgeben, zu dem man nicht selten Wallfahrten unternahm.
Am meisten beschäftigen sich Lindensagen mit der Mutter Gottes als der
Nachfolgerin der heidnischen Herka oder Frau Holle. Außer religiösem
Aberglauben hat die Volksmeinung, wonach der Blitz nicht in Linden
einschlagen soll, viel dazu beigetragen, daß häufig Linden an Feldwege
und auf Viehtriften zum Schutze der Hirten und Feldarbeiter gepflanzt
wurden. Auch zum Verbrennen der Toten wurde, wie uns die Kohlenreste
alter Grabhügel beweisen, mit Vorliebe Lindenholz als dasjenige eines
heiligen Baumes genommen. Zahlreiche Ortschaftsnamen weisen auf die
Linde, so vor allem auch Leipzig, das Lindenstadt bedeutet. Der Name
ist aus dem slavischen Worte Lipsk entstanden, das aus lipa
Linde gebildet ist. Die berühmteste Linde Deutschlands ist die zu
Neustadt am Kocher in Württemberg, von welcher die Stadt auch Neustadt
an der Linde heißt. Sie hat an ihrem Fuße 12 m Umfang. Ihre
mächtigen Äste wurden schon im Jahre 1392 durch 60 steinerne Säulen
gestützt, und ein Gedicht von 1408 sagt: „Vor dem Thor eine Linde
staht, die 67 Säulen hat.“ Im Jahre 1831 wurden diese Stützsäulen auf
166 vermehrt. Ein abgebrochener Ast gab 7 Klafter Holz. Diese Linde
muß gegen 800 Jahre alt sein. Die stärkste Linde Deutschlands ist aber
diejenige auf der Burg zu Nürnberg, welche bei nur 18 m Höhe
einen Stammumfang[S. 713] von 14 m aufweist. Ihr Stamm ist so weit
hohl, daß man durch ihn wie durch ein Tor zu Pferde hindurchreiten
kann. Sie ist wohl über 800 Jahre alt. Unter der Schirmfläche der
Linde zu Vilsen im Hannoverschen versammeln sich jeden Sonntag 13
Gemeinden zum Gottesdienst. Unter der Linde von Augustusburg, die einen
Stammumfang von 12 m besitzt, hatten einst 120 Speisetische
Platz. Vom Kurfürsten August von Sachsen, der das Schloß Augustusburg
baute, existieren noch viele Verordnungen, die mit: „Gegeben unter
der Linde“ unterzeichnet sind. In alten Linden, die in der Nähe von
Kirchen stehen, findet man zuweilen noch eiserne Ringe und Klammern.
Diese dienten einst als Klammern für diejenigen, die hier öffentlich
Kirchenbuße zu leisten hatten.
Man unterscheidet bei uns zwei Arten von Linden: Die
kleinblätterige oder Winterlinde (Tilia
parvifolia) und großblätterige oder Sommerlinde
(T. grandifolia). Letztere ist in Deutschland weniger verbreitet
als erstere. Beide haben eine weitverzweigte, tiefgehende Wurzel,
einen kräftigen Stamm mit im Alter ziemlich dicker, graubrauner
oder schwarzgrauer, rissiger Rinde. Die Innenrinde liefert einen
trefflichen Bast. Die Äste beginnen schon tief unten am Stamm und
breiten sich ringsum nach allen Seiten hin aus. Die unteren halten sich
fast wagrecht; je weiter nach oben, desto mehr streben auch die Äste
aufwärts. An den wagrecht ausgebreiteten oder niederhängenden Zweigen
stehen die rundlichen, zugespitzten, scharf gesägten und am Grunde
ausgeschnittenen Blätter, die bei der Winterlinde kleiner, oberseits
dunkelgrün, unterseits blaugrün und kahl sind, während sie bei der
anfangs Mai, statt wie die vorige Mitte Mai, ausschlagenden Sommerlinde
unterseits hellgrün und kurz behaart sind. In den Winkeln der
Blattnerven der Unterseite stehen als Acarodomatien oder Milbenhäuschen
kleine Haarbüschel, die bei der Winterlinde rostfarbig, bei der
Sommerlinde dagegen gelblichweiß sind. Die gelblichen Zwitterblüten
hängen in Trugdolden geordnet an langem, mit zungenförmigem Deckblatte
verwachsenem Stiele zu 5–7 bei der Winterlinde und zu 2–3 an der 14
Tage später, d. h. Ende Juni bis Mitte Juli blühenden Sommerlinde. Sie
liefern einen als Hausmittel vielgebrauchten Tee. Die filzig behaarten
Nußfrüchtchen benutzen das gemeinsame Deckblatt als Flugapparat,
bleiben aber, besonders bei der später reifenden Winterlinde, oft bis
zum Frühjahr am Baume. Die Keimung erfolgt wie bei manchen anderen
Bäumen erst im zweiten Frühjahr. Die zwei Keimblätter sind handförmig
geteilt, im Gegensatz zu der sonst[S. 714] gültigen Regel, nach der sie
einfacher geformt sind als das spätere Laubblatt. Die zweijährigen
Pflänzlinge werden umgepflanzt: damit sie recht erstarken, empfiehlt
es sich, sie etwa im fünften Jahre ein zweites Mal im Pflanzbeet
umzulegen. Die Linde zeigt von Jugend an ein freudiges Wachstum und
bildet einen anfangs fast immer walzenrunden, glänzend bräunlichen, mit
weißlichen Warzen überstreuten Stamm, der schon in geringer Höhe Äste
ausstreckt, welche sich gern flach ausbreiten. Die Krone wölbt sich
frühzeitig ab und wird mit dem Alter immer dichter und umfangreicher.
Die tiefgreifende und sich weithin verzweigende Wurzel befähigt die
Linde den stärksten Stürmen zu trotzen.
Die Winterlinde bevorzugt den frischen, feuchten Waldboden der niederen
Vorberge und Ebenen, während die Sommerlinde auch in trockeneren Lagen
wächst. Beide gedeihen schlecht im Nassen. Sie bilden bei uns keine
reinen Waldbestände wie in den russischen Ostseeprovinzen, sondern
finden sich immer nur einzeln in Wäldern, werden bis 30 m
hoch und erreichen ein tausendjähriges Alter. Die Winterlinde ist
in Deutschland überall die gemeinere, die Sommerlinde dagegen wird
häufiger angepflanzt und geht auch höher in die Gebirge. Wegen ihres
schnellen Wuchses, ihres dichten Schattens und angenehmen Geruches
der Blüten sind sie als Alleebäume beliebt. Ihr rasches Wachstum,
die Fähigkeit vom Stamm und der Wurzel wieder auszuschlagen und
gleich der Buche den Boden zu verbessern, machen sie auch forstlich
wichtig. In 8–10 Jahren sind sie als Reißholz, in 20–25 Jahren als
Schlagholz und in 60–80 Jahren als Bauholz verwendbar. Doch legt der
Forstmann wenig Wert auf Linden, weil der Brennwert ihres Holzes
nur ein Drittel desjenigen des Buchenholzes beträgt und die Linde
gleichwohl denselben Boden fordert, wie die edleren Harthölzer. Das
weißlichgelbe bis rötlichweiße, feine, weiche, gut zu bearbeitende und,
wenn richtig getrocknet, wenig arbeitende Holz eignet sich vermöge
der Eigenschaft, sich in jeder Richtung schnitzen, drehen und hobeln
zu lassen, vorzüglich als Bildhauer- und Modellschreinermaterial.
Namentlich werden Heiligenbilder aus Lindenholz geschnitzt, weshalb
es früher als „Heiligenholz“ bezeichnet wurde. Noch mehr dient es zum
Schnitzen von Spielwaren, Löffeln, Wurfschaufeln usw., zu Reißbrettern,
massiven Möbeln, die besonders in Rußland sehr beliebt sind, und als
Blindholz für furnierte Arbeiten. Dauer behält das dem Wurmfraß nur
wenig ausgesetzte Holz bloß im Trockenen, für freie Lagen dagegen,
in denen es dem Wechsel unterworfen ist,[S. 715] ist es unbrauchbar. Die
festen, leichten Lindenkohlen dienen als Reißkohle zum Zeichnen,
zur Fabrikation von Schießpulver, Zahnpulver und Räucherkerzen.
In Rußland und Westamerika benutzt man mit Maschinen geschnittene
Lindenholzfasern als Füllmaterial für Bettmatratzen fürs gemeine Volk.
Die Rinde verwendet man in Rußland zu Schlittenkörben, Wagen, Kisten
und zum Dachdecken. Der innere Bast wird im Mai von 20–30 jährigen
Stangenhölzern in Streifen von 6–9 cm Breite abgeschält, wie
Flachs in Wasser gerottet, im Oktober dann durch Klopfen und Waschen
von den leichter zersetzbaren Bestandteilen befreit, so daß nur
die ein feines Maschennetz bildenden, sehr dickwandigen Bastzellen
zurückbleiben, worauf man die einzelnen Jahreslagen voneinander trennt.
In Rußland, das den meisten Lindenbast liefert, verfertigt man daraus
Körbe, Decken, Stricke, Siebe, besonders aber die zum Verpacken von
Waren dienenden Bastmatten; man verwendet ihn auch zum Anbinden von
Blumen. Ein Baum von 10 m Höhe und 30–40 cm Stammumfang
liefert 45 kg Bast, für 10–12 Matten ausreichend. Rußland
liefert jährlich 14 Millionen Stück Matten. Die herrlich duftenden
Lindenblüten erfreuen nicht nur den Menschen, sondern liefern eine
treffliche Bienenweide und einen vielbenutzten schweißtreibenden Tee,
auch das offizinelle Lindenblütenwasser. In trockenen Jahren schwitzen
die Blätter, auch ohne daß Blattläuse im Spiele sind, den Honigtau als
eine süße, klebrige, bald an der Luft verdickende Flüssigkeit aus,
welche ihnen das Aussehen gibt, als seien sie mit Firnis überstrichen.
Nach einigen Tagen wird diese Ausschwitzung teerartig und schwarz,
dabei werden die Blätter ganz schlaff. Da sich leicht Schmarotzerpilze
darauf entwickeln, wenn der Honigtau nicht bald vom Regen abgewaschen
wird, so ist er für die Pflanze schädlich.
Auf den griechischen Gebirgen wächst die von Ungarn bis Westasien
heimische morgenländische Silberlinde (Tilia argentea)
mit an der Oberseite matten, unterseits aber dicht weißfilzigen
Blättern. Sie ist die phílyra der Griechen, die Theophrast
beschreibt. Sie ist jedenfalls auch der Baum, den die Römer als
tilia bezeichneten; denn die Winter- und Sommerlinde kommen
als Südgrenze ihrer Verbreitung nur noch auf den Bergen Norditaliens
vor. Plinius schreibt von ihr: „Man unterscheidet bei den Linden
(tilia) männliche und weibliche Bäume. Der Saft der Blätter und
Rinde ist süß, aber die Frucht rührt kein Tier an. Zwischen Rinde und
Holz liegt ein häutiges Gewebe, der Bast, aus welchem man Bänder macht,
die tiliae heißen[S. 716] die feinsten nennt man philyrae,
braucht sie zum Binden von Kränzen und hält sie seit alter Zeit in
Ehren. Das Holz ist dem Wurmfraß nicht unterworfen, mäßig hoch, aber
nützlich. Die Blätter dienen als Arznei.“ Außer dieser morgenländischen
wird auch die abendländische Silberlinde (Tilia alba) aus
Nordamerika mit auf der Unterseite schwach filzig behaarten Blättern
und großen Blüten neben der von ebendort stammenden Schwarzlinde
(T. americana) in Anlagen gepflanzt, doch nur ausnahmsweise bei
uns als Nutzholz gezogen.
Sehr beliebte Alleebäume sind auch die Ulmen oder Rüstern
(Ulmus), deren Zweige lange, starre Ruten bilden, die mit zwei
Reihen gleichlaufender Kurztriebe, an ihrem jüngsten Teile mit ebenso
laufenden eiförmigen, scharf zugespitzten und gesägten Blättern besetzt
sind. Leider sind letztere sehr oft von Blattläusen dicht besetzt und
unterseits eingerollt, auch häufig durch Gallen verunstaltet. Abgesehen
von diesen Nachteilen gehören die Ulmen zu den schönsten Zierbäumen und
wachsen unter günstigen Umständen sehr rasch. Ihr ziemlich schweres,
hartes, schwer spaltbares, aber glattes, elastisches, zähbiegsames,
im Splint gelblichweißes, im Kern hellbraunes bis dunkelrotbraunes,
oft fleckiges und maseriges Holz gehört mit zu den festesten und
dauerhaftesten Holzarten, sowohl bei Verwendung im Trockenen, als
auch im Freien und unter Wasser. Es ist ein ausgezeichnetes Wagner-
und ein in neuerer Zeit auch viel verwendetes Möbelholz; doch ist es
seiner schwierigen Bearbeitung wegen bei den Tischlern nicht besonders
beliebt. Da es in der Dauer dem Eichenholze kaum nachsteht und auch
dem Wurmfraße fast gar nicht ausgesetzt ist, eignet es sich besonders
zu Bau- und Werkholz, ist auch der auffälligen Maserung wegen zu
feinen Furnieren sehr gesucht, liefert ferner gute Kohlen. Das Holz
gibt Pottasche; die getrockneten und frischen Blätter geben ein gutes
Schaffutter. Die jüngere Rinde dient zum Gerben und Gelbfärben. Am
häufigsten ist bei uns die Feldulme (Ulmus campestris),
ein bis 30 m hoher, ein Alter von mehreren hundert Jahren
erreichender Baum, der im Gebirge bis 800 m hoch steigt und
sich von Nordafrika durch Europa bis Sibirien und Kleinasien findet.
Man kultiviert ihn in zahlreichen Varietäten. Noch höher steigt die
Bergulme (U. montana), bei der die Flughaut statt am
oberen Rande der Frucht in der Mitte derselben liegt. Bei beiden
sitzen die Früchte dicht am Zweige, bei der Flatterulme (U.
effusa), die in Wäldern und Vorhölzern von Gebirgsgegenden
wächst und bei uns häufig in der Nähe von Ortschaften angepflanzt
wird, flattern sie an einem langen Stil und tragen[S. 717] außerdem am Rand
einen feinen Wimperkranz. Letztere nimmt mit ärmeren Böden als die
beiden erstgenannten vorlieb und ist vornehmlich im Flachland zu
Hause. In neuester Zeit werden aber die meisten Anpflanzungen von der
Waldulme (U. scabra) gemacht, die in Europa und Nordasien
bis zum Amur heimisch ist.
Auch das Holz der schon im Jahre 1600 aus Virginien nach Frankreich
gebrachten nordamerikanischen gemeinen Robinie oder falschen
Akazie (Robinia pseudacacia) wäre ein vorzügliches Bau- und
Konstruktionsholz und würde jedenfalls auch als Wagner-, Drechsler-
und Möbelholz benutzt, wenn es in größerer Menge zur Verfügung stände.
Der Kern zeigt ein gelb- bis rötlichbraunes Holz, das schwer, hart,
elastisch, zähe und schwierig zu bearbeiten ist, aber eine große
Festigkeit und sehr große Dauer besitzt. Wenn sich diese Holzart in
unsern Gegenden überhaupt gehalten hat, so ist daran nur ihre große
Anspruchslosigkeit an die Bodenverhältnisse schuld, nicht aber der
Mensch, der zu ihrer Verbreitung nur wenig getan hat und sie nur selten
rationell zu großen Bäumen zieht, sondern sie stets noch jung abholzt,
um sie zu Rebstöcken und Stützen anderer Pflanzen zu verwerten.
Dem Ulmen- und Akazienholz sehr ähnlich ist dasjenige der
Maulbeerbäume (Morus). Es ist sehr hart, schwer,
dauerhaft und wird in der verschiedensten Weise, in Südeuropa und Asien
auch als Faß- und Schiffsbauholz, zu Straßenpflaster und Hafenbauten
verwendet. Ebenso hart und fest, doch leider stark reißend und
sich werfend ist das Holz der verschiedenen Sorbusarten. Dasjenige
des Vogelbeerbaums (Sorbus aucuparia) liefert ein
vorzügliches Holz für den Wagner, auch für Drechsler und Holzschnitzer,
während dasjenige von Spierling (S. domestica) und
Mehlbeerbaum (S. aria) besonders für Maschinenbauer,
Formstecher und Instrumentenmacher hohen Gebrauchswert besitzt. Auch
unsere Obstbäume liefern vorzügliche und vielseitig verwendbare
Hölzer. Das Holz des Birnbaums ist schwer, dicht und hart,
sehr fein und im Trockenen dauerhaft, es wirft sich zudem wenig und
nimmt eine vorzügliche Politur an. Es ist deshalb ein hochgeschätztes
Schreinerholz, das besonders schwarz gebeizt als Ebenholzimitation
für feine Möbel viel verwendet wird, ferner ein gutes Drechsler- und
vorzügliches Schnitzholz, vornehmlich für den Holzschneider bildet,
der es als Surrogat für das seltenere und teurere Buchsbaumholz in
Verwendung nimmt; deshalb wird das Birnbaumholz auch als „deutscher
Buchsbaum“ bezeichnet. Das Holz des[S. 718] Apfelbaums ist zwar
härter und fester, aber weniger beliebt, da es sich stärker wirft und
reißt. Man verwendet es mit Vorliebe für Werkzeuge. Das rötlichweiße
Kirschbaumholz ist mäßig hart und schwer, sehr fein, gut zu
beizen und zu polieren, schwindet aber sehr stark. Gut getrocknet
ist es ein schönes, in neuerer Zeit wieder sehr beliebtes Möbel-
und Drechslerholz. Das rotbraune Holz der Pflaumen- und
Zwetschenbäume ist auch sehr fein, hart und ausgezeichnet
polierbar, aber sehr spröde und stark reißend. Es wird vornehmlich
für feine Kunstschreiner-, namentlich aber für Drechsler- und
Holzschnitzarbeiten verwendet.
Sehr schwer, fest, hart und zähe ist auch das Holz von
Kornelkirsche, Hartriegel und Weißdorn; man
verwendet es zu kleineren Dreharbeiten, Hammerstielen, Radkämmen,
Spazier- und Regenschirmstöcken. Ein sehr brauchbares Wagner- und
Drechslerholz liefert der schwarze Holunder. Aus seinen
Wurzelstöcken, die häufig schönes Maserholz besitzen, werden mit
Vorliebe Pfeifenköpfe geschnitzt. Zu letzterem Zwecke werden
namentlich auch die Wurzelstöcke der in Südfrankreich und auf Korsika
vorkommenden Baumheide (Erica carnea), die unter dem
Namen Bruyèremaser im Handel sind, benutzt. Vorteilhafte Verwendung zu
feineren Drechsler- und Einlegearbeiten, Zahnstochern und dergleichen
findet das, wenn zur richtigen Zeit gefällt, schön gelbe, ziemlich
harte, feine und leicht zu schneidende Holz des Spindelbaums
oder Pfaffenhütchenstrauchs (Euonymus europaeus). Ein
unübertreffliches Material für Räder, Wagendeichseln, besonders aber
Peitschenstöcke liefert der in Südeuropa wachsende Zürgelbaum
(Celtis australis), dessen Holz demjenigen der ihm sehr nahe
verwandten Ulme ähnelt, aber zäher und elastischer als dieses ist.
Auch der gemeine Flieder (Syringa vulgaris), die
Stechpalme (Ilex aquifolium), die Berberitze
(Berberis vulgaris), der Goldregen (Cytisus
laburnum) und der Essigbaum (Rhus coriaria) liefern
vorzügliches Holz für kleinere Drechsler- und Kunstschreinerarbeiten.
Neben all diesen heimischen Holzarten werden eine Menge
außereuropäischer Hölzer als Schmuckhölzer bei uns eingeführt, um
zu Klaviergehäusen, Salonmöbeln, Billardtischen usw. verarbeitet
zu werden. Unter ihnen ist wohl das Ebenholz, das seit
ältester Zeit im Gebrauch stehende und teilweise wertvollste aller
Schmuckhölzer. Unter diesem Namen faßt man eine Menge schwerer,
dunkler und äußerst harter Hölzer von hoher Politurfähigkeit, aber
großer Sprödigkeit zusammen, die von verschiedenen in den wärmeren bis
tropischen Re[S. 719]gionen gedeihenden Bäumen der Gattung Diospyros
abstammen. Das gebräuchlichste derselben ist dasjenige des indischen
Ebenholzbaums (Diospyros ebenaster), eines Baumes aus der
Familie der Ebenazeen mit bis 26 cm langen wechselständigen
Blättern, achselständigen, auch aus altem Holze entspringenden,
gelblichweißen oder grünlichen Blüten in Trugdolden und bis
10 cm langen olivengrünen, als „Mehläpfel“ bezeichneten eßbaren
Früchten mit gelbem, schleimigem, säuerlichem Fleisch. Der in Vorder-
und Hinterindien, wie auch im indischen Archipel sehr verbreitete Baum
wird auf Mauritius kultiviert und ist neuerdings auch im tropischen
Amerika eingeführt worden. Er liefert einen Teil des indischen
Ebenholzes, besonders des Ceylonebenholzes. Das Splintholz junger Bäume
ist weißlich und hin und wieder mit weißen, nach dem Kerne hin sich
vermehrenden schwärzlichen Adern durchzogen. Bei alten Bäumen jedoch
ist das Weiße kaum fingerdick, alles übrige ist schwarz und von so
gleichmäßiger Textur, daß man die Spiegel und Jahresringe nicht leicht
bemerkt. Dadurch und durch die größere Schwere unterscheidet sich
das echte Ebenholz leicht von schwarzgebeizten hiesigen Holzarten,
namentlich vom Eichenholz.
Neben dem indischen gibt es auch afrikanisches Ebenholz, von dem
das Madagaskarebenholz von D. haplostylis mit weißem
Splint und tief blauschwarzem Kern als das schönste gilt. Das
Sansibar-, Kamerun- und Makassarebenholz von
verschiedenen anderen Diospyrosarten ist weniger schön, von oft grauer
bis braunschwarzer Farbe. Ein reh- bis kaffeebraunes, oft regellos
schwarz gestreiftes, wie mit Tinte übergossenes, aber schönes und
seltenes Holz ist unter dem Namen buntes oder streifiges
Ebenholz, auch Koromandelebenholz von D. hirsuta,
so genannt, weil es zumeist von der Koromandelküste in Ostindien
ausgeführt wird, im Handel. Alle diese Ebenhölzer kommen in Stämmen von
oft gewaltiger Größe zu uns, gehören zu den schönsten und teuersten
Schmuckhölzern und waren das geschätzteste Holz des Altertums. Schon
im Alten Testament wird es als Luxusholz erwähnt. Im 5. Jahrhundert
schreibt der griechische Geschichtschreiber Herodot: „Die Abgaben,
welche die an Ägypten grenzenden Neger dem Perserkönig Dareios alle
zwei Jahre entrichteten und noch entrichten, bestehen in Gold,
200 Stämmen Ebenholz (ébenos), 5 Negerknaben und 50 großen
Elefantenzähnen. Überhaupt ist das Negerland reich an Gold, Elefanten
und Ebenholz.“ Strabon und Plinius sagen, daß in dem südlich von
Ägypten gelegenen Negerland die Wälder nebst Palmen vorzüglich aus
Ebenholzbäumen bestehen.[S. 720] Des letzteren Zeitgenosse, der griechische
Arzt Dioskurides, schreibt in seiner Arzneimittellehre: „Für das beste
Ebenholz gilt das aus dem Negerland stammende schwarze, aderlose, das
so glatt ist wie poliertes Horn und, zerbrochen, wie eine dichte Masse
erscheint. Gekaut schmeckt es beißend und schwach zusammenziehend. Auf
Kohlen gelegt brennt es mit Wohlgeruch und ohne Rauch. Frisch ans Feuer
gebracht, brennt es wegen seines Ölgehaltes an; an einem Wetzstein
gerieben, wird es blaßgelblich. Es gibt auch indisches Ebenholz,
das weiße und gelbliche Striche und Flecken hat, aber das schwarze
(afrikanische) ist besser. Manche Leute verkaufen Holz vom Maulbeerbaum
oder von Mimosen als Ebenholz, weil es durch seine Ähnlichkeit täuscht.
Das Ebenholz wird gegen einige Krankheiten in Anwendung gebracht.“
Der Grieche Strabon und der Römer Vergil nennen Indien als die Heimat
des schwarzen Ebenholzes, das im Lateinischen in Anlehnung an das
Griechische ebenum hieß, woraus dann die deutsche Bezeichnung
hervorging. Ersterer fügt hinzu, daß sich die Inder ihren Körper mit
glatten Walzen von Ebenholz zu streichen pflegen, weil sie das für
gesund halten, und Theophrast sagt in seiner Pflanzenkunde: „Ein
eigentümlicher Baum Indiens ist der Ebenholzbaum (ebénē).
Übrigens gibt es davon zwei Arten, wovon die seltenere mit glattem
Stamm (der echte Ebenholzbaum) schönes, die häufige, ein Strauch,
schlechtes Holz liefert. Die schöne Farbe des Ebenholzes ist von Natur
vorhanden und erscheint nicht erst beim Aufbewahren.“
Tafel 163.

Lindenallee am Kanal vor dem Nymphenburger Schloß bei München.
❏
GRÖSSERES BILD
Tafel 164.

Ein gefällter Mahagonistamm in den Urwäldern von Zentralamerika.
❏
GRÖSSERES BILD
Tafel 165.

(Copyright by Underwood & Underwood.)
Eisenholzbäume am Isthmus von Tehuantepec in Mexiko.
Im Vordergrund eingeborene Fruchtverkäufer.

Junger Tiekbaum (Tectona grandis) im Botan.
Garten von Buitenzorg auf Java. (Nach einer in der Sammlung des Botan.
Institutes der Universität Wien befindlichen Photogr. von C. Lang.)
Tafel 166.
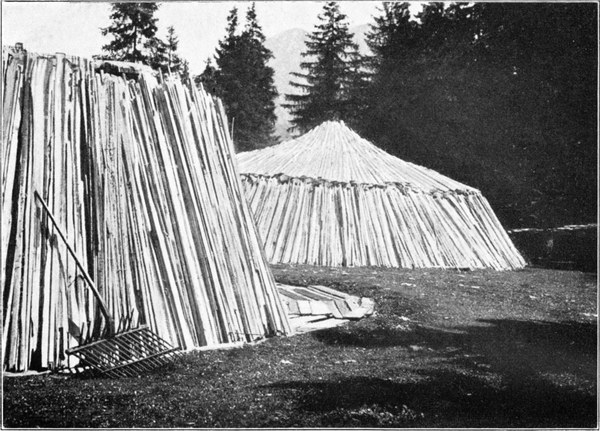
(Nach Phot. von H. Dopfer.)
Kohlenmeiler vor der Verkohlung.

(Nach Phot. von H. Dopfer.)
Torfstich am Schluifelder Moos bei München.
Als grünes Ebenholz kommt neuerdings ein sehr hartes und
schweres Holz in dünnen Stämmchen aus Südamerika nach Europa.
Es stammt von Bignonia leucoxylon und besitzt in frisch
geschnittenem Zustand eine bräunliche Farbe mit einem Stich ins
Grüne, der sich aber an der Luft etwas verliert. Trotz seiner Härte
ist es gut schneidbar und kann wie das echte Ebenholz, jedoch nur
für kleinere Gegenstände, verwendet werden. Unter demselben Namen
oder als Grünherzholz kommt ein Holz von Britisch-Guinea
in großen, roh behauenen Blöcken auf den Markt. Es stammt von
Nectandra rodiaei und wird meist zur Stockfabrikation und im
Schiffbau verwendet. Für Möbel- und Schreinerarbeiten ist es nicht
nur seiner großen Härte wegen, sondern vor allem, weil es den Leim
schlecht hält, ungeeignet. Ein sehr wertvolles Holz zu Kunstschreiner-
und Drechslerarbeiten, Fächern, Parkettböden (z. B. im Schloß
Herrenchiemsee) ist das blaue Ebenholz oder Veilchenholz.
Es stammt von der südaustralischen Acacia homalophylla,
ist dunkelblaubraun bis olivengrün und beson[S. 721]ders im frischen
Zustande durch den Veilchengeruch ausgezeichnet. Ebenso beliebt als
Kunstholz für Drechsler, Holzbildhauer, Parketböden und die Stock- und
Bürstenindustrie ist das im frischen Schnitt unscheinbar rötlichgraue,
unangenehm riechende, an der Luft aber durch Sauerstoffaufnahme
sich schön violett bis blutrot färbende violette Ebenholz,
Purpur- oder Amarantholz. Es ist hart, sehr schwer und
stammt von südamerikanischen und westindischen Bäumen, wie Copaifera
bracteata und Machaereum violaceum. Als rotes oder
braunes Ebenholz, auch Grenadille- oder Kongoholz
kommen rötliche bis kaffeebraune, sehr schwere und harte, aber
elastische und schöne Politur annehmende Hölzer meist aus Afrika zu
uns, die zumeist von Dalbergia melanoxylon stammen.
Unter Eisenholz versteht man eine Menge sehr harter,
mit gewöhnlichen Äxten nicht angreifbarer Hölzer verschiedener
botanischer Abstammung, welche von Ostindien, Australien, der
Südsee und von Madagaskar nach Europa gelangen und besonders in der
Kunsttischlerei und Drechslerei Verwendung finden. Das wichtigste
derselben ist dasjenige des in feuchten Wäldern Ostindiens wild
wachsenden Eisenholzbaums (Mesua ferrea), dessen
Blüten auch getrocknet veilchenartig riechen und in der Parfümerie
verwendet werden. Ebenfalls dunkelrot bis schokoladebraun mit
oft tiefschwarzen Adern, schwer, hart und gut polierbar ist das
amerikanische Palisander- oder Jakarandaholz, das von
verschiedenen Bäumen des nördlichen Südamerika und Mittelamerikas
stammt. Als Stammpflanze des echten Palisanderholzes gilt Jacaranda
brasiliana, ein schöner Baum mit doppelt gefiederten Blättern,
unterseits wolligfilzigen Fiederchen, mit großen Blüten in lockeren
Rispen und rundlichen, zusammengedrückten Kapseln mit geflügelten
Samen. Das Holz zählt zu den edelsten Kunsthölzern und liefert
vornehmlich Furnierholz zu Luxusmöbeln, Klavierkästen, Billardtischen
u. dgl. m.
Als Möbel- und Kunstschreinerholz unbrauchbar, aber für Kegelkugeln,
zu Lagern an Maschinen, die eine starke Reibung auszuhalten haben,
zu Tischen für Gerber usw. sehr geschätzt ist das Guajakholz,
von dem bereits im Abschnitt für Arzneipflanzen die Rede war. Sehr
wertvolle Zierhölzer sind die Rosenhölzer, die von verschiedenen
Bäumen des Tropenwaldes stammen. Sie haben diesen Namen teils von
ihrer rosenroten Farbe, die von hellrosa oder fleischrot bis tief
karminrot wechselt, teils von dem kräftigen und angenehm rosenähnlichen
Geruche. Interessant ist die Tatsache, daß die Farbe aller stark[S. 722]
riechender Rosenhölzer im Lichte verblaßt, während die geruchlosen, zu
denen vornehmlich das ostindische Rosenholz von Dalbergia
latifolia zählt, meist lichtecht und deshalb zu Möbeln besser
geeignet ist. Das echte Rosenholz stammt von der von Brasilien
bis Peru heimischen Physocalymna scaberrima, einem 6–8 m
hohen Baum mit gegenständigen Blättern und großen Blütentrauben, die
schon zur Zeit der Entlaubung erscheinen. Es ist sehr hart, dicht und
schwer mit rosen- bis tief karminroten Streifen.
Rothölzer sind auch das Pernambuk- oder echte Brasilholz
von dem im nördlichen Südamerika und auf den Antillen einheimischen
bestachelten Schmetterlingsblütler Caesalpinia echinata, ferner
das ostindische Rotholz von der verwandten Caesalpinia
sappan, deren beste Sorte aus Siam in den Handel kommt (es
ist in Europa schon zu Anfang des 14. Jahrhunderts als lignum
presillum nachweisbar), das afrikanische Rotholz, Cambal-
oder Camwoodholz von Baphia nitida, einem 12–16 m hohen
Schmetterlingsblütler in Sierra Leone, und das ostindische rote
Sandel- oder Kaliaturholz von Pterocarpus santalinus.
Alle diese Arten besitzen ein Holz mit teilweise angenehmem Geruch und
zeigen auf der frischen Schnittfläche gelbrote bis intensiv rote Farbe,
die jedoch durch Einwirkung der Luft hell- bis dunkelrot, ja selbst
bräunlichschwarz wird. Außer Nutzhölzer sind sie vor allem Farbhölzer.
Die Caesalpiniaarten enthalten den durch Oxydation sich bildenden
Farbstoff Brasileïn, welcher zum Rot- und Violettbeizen dient, während
beim ostindischen roten Sandelholz der rote Farbstoff Santalin wirksam
ist, der mit verschiedenen Metallsalzen rote bis braune Farbbeizen
liefert; beide werden heute vielfach durch Anilinfarben ersetzt.
Ein ähnliches Farbholz ist das Campesche- oder Blauholz
von der zentralamerikanischen Caesalpiniazee Haematoxylon
campechianum, von dem, wie vom Pernambuk- oder Brasilholz, bereits
auf Seite 127 die Rede war. Es ist ein hartes, feines, schwer zu
bearbeitendes, doch gut polierbares Holz von angenehmem Geruch im
frischen Schnitte und kräftig blutroter Farbe, die an der Luft violett
bis schwärzlich wird. Als Werkholz verwendet man es zu Drechsler- und
Galanteriewaren, wie auch zu Violinbögen. Die Hauptmasse jedoch wird in
den Fabenfabriken verraspelt, um den blauen Farbstoff, das Hämatoxylin
zu gewinnen, das sich in Alkalien mit violetter Farbe löst und außer
als Kernfärbungsmittel in der mikroskopischen Technik hauptsächlich zum
Schwarzfärben dient.
[S. 723]
Ebenfalls in Zentralamerika heimisch ist das echte Gelbholz
oder der Fustik, der vom Färbermaulbeerbaum (Machusa
tinctoria) stammt und den gelben Farbstoff Morin enthält, der
heute noch trotz der Konkurrenz der Anilinfarben mit Vorteil zu
gelben, braunen und olivengrünen Beizen dient. Als ungarisches
Gelbholz oder Fiset kommt dagegen das Holz des Färbersumachs
oder Perückenbaums (Rhus cotinus) zur Verwendung. Es
enthält denselben gelben Farbstoff wie die Quercitronrinde der
nordamerikanischen Färbereiche (Quercus tinctoria), das
Quercitrin. Ohne extrahierbaren Farbstoff gelb gefärbt und deshalb oft
fälschlicherweise Gelbholz genannt ist das gelbe Sandelholz,
das von dem in Ostindien heimischen Sandelbaum (Santalum album)
stammt. Es ist gelblich, stellenweise rötlich und besitzt einen
starken, angenehmen Geruch durch das in ihm enthaltene und durch
Destillation daraus gewonnene offizinelle Sandelöl.
Zu den bekanntesten, schon seit Anfang des 18. Jahrhunderts in Europa
verwendeten ausländischen Hölzern gehört das Mahagoniholz,
das von verschiedenen, nur im tropischen Amerika vertretenen
25–30 m hohen Bäumen der nach dem Leibarzte der Kaiserin Maria
Theresia Gerard van Swieten (1700 zu Leiden geboren, starb in Wien
1772) Swietenia genannten Meliazeengattung aus der Familie
der Terebinthen oder Balsamgewächse stammt. Das frische Holz ist
gelbrot bis bräunlich, färbt sich aber mit der Zeit dunkelbraun
bis fast schwarz. Es ist schwer und hart und bildet auch wegen des
geringsten Schwindens unter allen technisch verwendeten Hölzern
ein hochgeschätztes Möbel-, Kunstschreiner- und Furnierholz. Die
wichtigste Art ist die in Westindien und im tropischen Amerika in
einer verhältnismäßig schmalen Zone zwischen dem 11. und 23. Grad
nördlicher Breite heimische Swietenia mahagoni, die bei einem
Stammdurchmesser von 4 m bis 33 m hoch wird. Der Baum
besitzt einen weit ausgebreiteten, dicht belaubten Wipfel, trägt paarig
gefiederte Blätter, kleine, gelblichweiße Blüten in achselständigen
Rispen mit beinahe faustgroßen, braunen, holzigen Kapseln mit
zahlreichen flachen Samen. Er wächst außerordentlich langsam und soll
seine volle Größe erst im Alter von 200 Jahren erreichen. Man findet
den Baum nirgends in geschlossenen Beständen, vielmehr steht er einzeln
als ein Riese unter den anderen Bäumen des tropischen Waldes. Fünf
Mahagonibäume auf den Hektar gelten schon als ein dichtes Vorkommen;
meist sind die Bäume noch spärlicher verteilt. Das Fällen derselben
wird von Juni bis Januar vorgenommen, und zwar verlegt man wegen der
drücken[S. 724]den Hitze, welche tagsüber herrscht, die Arbeit gern auf die
mondhellen Nachtstunden. Die gefällten Stämme werden vierkantig behauen
und auf Ochsen- oder Maultierkarren dem nächsten Wasserlaufe zugeführt,
wo sie entweder einzeln oder zu Flößen verbunden nach dem Meere geflößt
werden. Während sie aber im Süßwasser ohne Schaden beliebig lange
verbleiben können, muß ihr Aufenthalt im Meerwasser so kurz als möglich
sein, da sie darin leicht vom Bohrwurm angegriffen werden. Zur Ausfuhr
kommen in der Regel nur die besten und größten Stämme, die kleineren
Stücke und die Abfälle verarbeitet man an Ort und Stelle.
Die erste Bekanntschaft mit dem Mahagoniholz machten die Europäer bald
nach der Entdeckung Amerikas. Schon zur Zeit des Fernando Cortez und
seiner Begleiter soll das Holz zum Bau von Schiffen benutzt worden
sein. Ebenso verwendete es der britische Seefahrer Walter Raleigh
in Westindien zur Ausbesserung seiner Fahrzeuge. In unbearbeitetem
Zustande gelangte es erst zu Anfang des 18. Jahrhunderts als Ballast
eines von Westindien zurückkehrenden Schiffes nach England. Der
Schiffskapitän schenkte die großen Blöcke seinem Bruder, einem
angesehenen Arzte in London, der sie lange Zeit unbenutzt in seinem
Hof lagern hatte, bis seine Gattin durch den Schreiner Wollaston
einen Kasten daraus verfertigen ließ. Dieser gefiel so gut, daß der
Doktor sofort noch einen Schreibtisch für sich daraus herstellen
ließ. Die schöne Farbe und glänzende Politur des Möbels ließen in der
Herzogin von Buckingham den Wunsch aufkommen, für sich auch solche
zu bestellen. Es war dies im Jahre 1724. Die Nachfrage nach diesem
ausländischen Zierholz nahm dann in der Folge langsam zu, so daß
schon im Jahre 1773 allein aus Jamaika 520000 Kubikfuß davon nach
England eingeführt wurden. Da es damals noch sehr selten war, sahen
sich die Tischler schon aus Sparsamkeitsgründen dazu gezwungen, es
fast nur als Furnierholz zu gebrauchen. Besonders schöne Stücke
desselben erzielen heute noch recht hohe Preise; so bezahlte eine
Pianofortefabrik vor nicht sehr langer Zeit für einen einzigen, in
drei Blöcke zerschnittenen Mahagonifurnierstamm die ansehnliche Summe
von 60000 Mark. Besonders geschätzt ist das geflammte, sogenannte
Pyramidenmahagoni. Es kommt in verschiedener Qualität aus Kuba, Mexiko
und Zentralamerika zu uns. Britisch-Honduras führt jährlich für gegen 3
Millionen Mark davon aus. Als weißes Mahagoni wird das Holz des
in Westindien heimischen Acajoubaums (Anacardium occidentale)
verwendet, während das afrikanische[S. 725] Mahagoni von verschiedenen
Khajaarten aus Westafrika gewonnen wird. Das australische oder
Bastardmahagoni dagegen stammt von verschiedenen Eucalyptusarten
Australiens. Diese bis zu 150 m erreichenden Bäume, die somit zu
den höchsten Bäumen der Erde zählen, haben ein rotbraunes, sehr hartes
und dauerhaftes, von Insekten nicht angegangenes Holz. In Südeuropa
wird wegen seiner Schnellwüchsigkeit und der aromatischen Ausdünstung
seiner Blätter seit der Einführung durch Ramel im Jahre 1856 der
blaue Gummibaum (Eucalyptus globulus) angepflanzt, der
1792 von Labillardière in Tasmanien entdeckt wurde, eine Höhe von
110 m erreicht und ein vorzügliches Bauholz liefert, das mit Vorteil
zum Schiffsbau dient, da es im Wasser nicht leicht fault. Durch die
Fähigkeit, auch auf sumpfigem Boden schnell zu wachsen und zu dessen
Entwässerung beizutragen, soll der Baum günstig zur Bekämpfung des
Wechselfiebers wirken. Ein aus ihm hergestelltes ätherisches Öl wird
vielfach in der Medizin verwendet.
Eines der wertvollsten Zierhölzer für Drechsler und zur Herstellung
von Einlegearbeiten ist das schön rötlichbraune Schlangen- oder
Tigerholz, so genannt, weil es einer Schlangenhaut ähnlich, mit
größeren und kleineren dunkelbraunen Flecken gezeichnet ist. Es ist
sehr hart, dicht und schwer und kostet pro 100 kg wenigstens
1600 Mark. Es kommt in mittelstarken Stämmchen von Nordbrasilien und
Guiana in den Handel und wird zur Anfertigung von Spazierstöcken,
Geigenbogen, Furnieren und eingelegten Arbeiten benutzt. Ob es von der
Morazee Brosimum aubletti, von der Leguminose Machaerium
schomburgki oder von einem andern Baum stammt, ist ungewiß.
Ebensowenig sind die Bäume bekannt, die das Ferolia- oder
Satinholz liefern, das aus Ost- und Westindien zu uns gelangt.
Mit Rücksicht auf die Farbe unterscheidet man gelbes, rotes und braunes
Satinholz. Letzteres ist am häufigsten und wird als „Nußsatin“ für
Möbel fast allgemein verwendet. Es ist leicht, weich, von mattbrauner
Farbe und unserem Nußholz sehr ähnlich, doch von feinerem Gefüge,
während das gelbe Satinholz schwer, hart, wunderschön atlasglänzend
und in manchen Arten auch wohlriechend ist. Mit diesem letzteren
wird vielfach das Zitronenholz (von Citrus medica)
verwechselt, das in neuerer Zeit wegen seiner schönen gelben Farbe und
seidenartig geflammten Struktur ein sehr beliebtes Furnierholz für
Möbel geworden ist.
Ein sehr schönes und wertvolles Zierholz kommt unter dem Namen
Königsholz von Sumatra und Java, aber auch aus Westindien,
namentlich Jamaika, nach Europa. Es stammt vom Tembesu[S. 726]baume (Fagrea
peregrina), doch werden noch verschiedene andere Arten als
Königshölzer bezeichnet. Der Name stammt daher, daß die Häuptlinge
der betreffenden Gegenden den Handel mit diesen Holzsorten als ihr
Monopol betrachten. Ihre Farbe ist violett bis schwarzbraun, oft mit
rötlichen Adern durchzogen. Aus dem tropischen Amerika kommt das
kaffeebraune, mit dunkleren, unregelmäßig verteilten Längsstreifen
schön gezeichnete Ziricota- oder echte Zebraholz, ferner
das tief rötlichbraune mit teils helleren, teils dunkleren, oft auch
welligen Tupfen gezeichnete Patridge- oder Rebhuhnholz,
sowie das im frischen Schnitte lebhaft gelbrote, später braunrot
werdende, äußerst schwere und harte Kokoboloholz in den Handel.
Die Abstammung aller dieser drei Hölzer ist ungewiß. Sie dienen
hauptsächlich für Einlegearbeiten, als Bürstenhölzer und für die
Stockindustrie.
Ein wegen seiner prächtig hellroten Farbe für Möbel, Einlegearbeiten
usw. sehr geschätztes Holz ist das aus Indien und von den Sundainseln
stammende Padukholz von Pterocarpus macrocarpus,
während das aus dem tropischen Amerika kommende Panakoko-
oder Pferdefleischholz von Robinia tomentosa, so
genannt, weil es frischem Pferdefleisch ähnlich bräunlich mit roten
oder grünschwarzen Schattierungen ist, hauptsächlich zu Geigenbögen,
Einlegearbeiten, sowie in der Stockindustrie Verwendung findet.
Als das wichtigste Holz für den Schiffbau muß das im tropischen Asien
heimische Tiekholz bezeichnet werden, das einen bedeutenden
Handelsartikel bildet. Es ist hell braunrot mit starkem, an Kautschuk
erinnerndem Geruch. Weil manche Sorten äußerlich unserem Eichenholze
ähnlich sind, wird es auch als „indisches Eichenholz“ bezeichnet. Es
ist aber dauerhafter als dieses und hat vor ihm den Vorzug, daß es
von Insekten nicht angegangen wird und vor allem auch dadurch, daß
mit ihm in Verbindung gebrachte eiserne Nägel, Schrauben, Bolzen usw.
nicht rosten, was beim Eichenholz nicht vermieden werden kann. Daneben
ist es außerordentlich fest und schwindet kaum. Der echte Tiekbaum
(Tectona grandis, aus der malabarischen Bezeichnung tekka
für diesen Baum entstanden) ist ein in Ostindien, Hinterindien von
Birma bis Malakka, und auf Java heimischer, sehr großer Baum mit
gegenständigen, großen, eiförmigen, unterseits weißfilzigen Blättern,
weißen Lippenblüten in großen, endständigen Rispen und im vergrößerten
Kelch eingeschlossenen, haselnußgroßen Früchten. Er gedeiht am besten
auf trockenem Waldboden, meidet aber die immergrünen Bergwälder, wie
auch das Meeresufer und steigt in den Ge[S. 727]birgen bis zu 1300 m
empor, gedeiht aber schon bei 1000 m Meereshöhe nicht mehr so
gut wie am Fuße der Gebirge. Auf angeschwemmtem Boden erreicht er
in 80 Jahren, im Gebirge dagegen kaum vor 200 Jahren seine höchste
Entwicklung. Der Stammumfang mißt dann bis 7 m und die großen
Äste stehen bis 30 m über dem Boden. Der Baum wird seines Holzes
halber viel kultiviert und ist auch auf Sumatra, Cochinchina und in
Südchina eingeführt worden. Sehr ausgedehnt sind die Tiekwälder in
Birma und Siam. Gewöhnlich fällt man die Bäume zwischen dem 40. und
60. Jahr, wenn sie eine Höhe von 17–20 m und eine Stammstärke
von 1 m erreicht haben. Um recht trockenes Holz zu erhalten,
ringelt man in Indien am untern Teil des Stammes Rinde und Splintholz
ab und läßt den schnell absterbenden Baum zwei Jahre lang stehen.
Da aber dadurch das Rissigwerden des Holzes begünstigt wird, ist
diese Methode neuerdings auf Malabar verlassen worden. Das Holz wird
in Indien vielfach benutzt, aber auch in großen Mengen nach Europa
und Nordamerika eingeführt, wo es außer als Schiffbauholz zu großen
Konstruktionen und zum Bau von Eisenbahnwagen verwendet wird. Es
enthält in frischem Zustande ein Öl, das in Indien häufig das Leinöl
ersetzt. Die Rinde benützt man zum Gerben, mit den Blättern färbt man
Seide und Baumwolle purpurrot, auch dienen sie wie die Blüten als
Heilmittel.
Ein sehr leichtes und weiches Holz kommt von Nordamerika in großer
Menge nach Europa und findet hier hauptsächlich als Blindholz für
furnierte Arbeiten, dann zu Wagenkastendecken und als Füllungen im
Wagenbau, wie auch zu leichten Möbeln ausgedehnte Verwendung. Es ist
dies das amerikanische Pappelholz oder white wood, das
von dem auch bei uns als Zierbaum angepflanzten nordamerikanischen
Tulpenbaum (Liriodendron tulipifera) stammt. Auch
das Holz des in China heimischen Kampferbaums (Laurus
camphora) findet außer zur Kampfergewinnung wegen seiner schön
blaßrötlichen Farbe, vornehmlich in gemaserten Stücken, als Furnierholz
vielseitige Benutzung.
Die Palmenhölzer, deren Farbe im Querschnitt gewöhnlich einen
hellbräunlichen Grundton mit einer Menge kleiner, tiefschwarzer Punkte
zeigt, die wie Fliegenkot aussehen, finden meist nur als Furnierhölzer
zu Einlegearbeiten Verwendung. Damit hätten wir die für uns in Betracht
kommenden Nutzhölzer erschöpft.
[S. 728]
XXXII.
Die Nutzpflanzen der Wüste.
Nicht nur die mit atmosphärischen Niederschlägen gesegneten Gebiete
der Erde haben ihre Nutzpflanzen, sondern auch die niederschlagsarmen
und infolge ihrer Trockenheit allem Leben so feindlichen Wüsten.
Und in diesen Wüsten sind solche begreiflicherweise von Tieren und
Menschen, die ihnen begegnen, doppelt geschätzt. Nun sind alle
Wüstenpflanzen vor allem darauf angewiesen, möglichst haushälterisch
mit dem ihnen so spärlich zu Gebote stehenden Wasser umzugehen. Deshalb
haben sie alle stark das Wasser verdunstenden Organe, so namentlich
die Blätter, vielfach ganz abgeschafft oder doch bis auf kleine,
bedeutungslose Schüppchen reduziert und haben außerdem, sei es in
den unterirdischen Zwiebelknollen, wie bei den Lilienarten, sei es
im oberirdischen Stamm, wie bei den sämtlich in Amerika heimischen
Kakteen, teilweise sehr umfangreiche Wasserspeicher angelegt, während
bei den altweltlichen, fast ausschließlich in Afrika vorkommenden
Euphorbiazeen oder Wolfsmilchgewächsen und Aloëarten der Stamm auf
ein Minimum reduziert ist und dafür die fleischigen Blätter zu Wasser
aufspeichernden Organen geworden sind. In diesen schwammigen Geweben,
die als Wasserreservoire dienen, ist das Wasser, um es nach Möglichkeit
zurückzubehalten, an einen dicken, gallertartigen Schleim gebunden.
Die ganze Pflanze ist von einer lederartigen, festen Oberhaut umgeben,
die die Atmungsöffnungen auf das geringste Maß vermindert hat, um dem
angesammelten Wasser keinen Durchlaß zu gewähren. Außerdem schränken
Haare, Stacheln und Wachsüberzüge die Verdunstung fast bis zur
Unmöglichkeit ein.
Tafel 167.

(Nach Photogr. von O. B. Waite in Mexiko.)
Säulenkaktus (Cereus) als Wegeinfassung auf dem Hochlande von
Anahuac in Mexiko.
❏
GRÖSSERES BILD
Tafel 168.

(Nach Photogr. von Dr. H. Roß.)
Typische Kakteenlandschaft in den Bergen östlich
von Tehuacan in Mexiko.
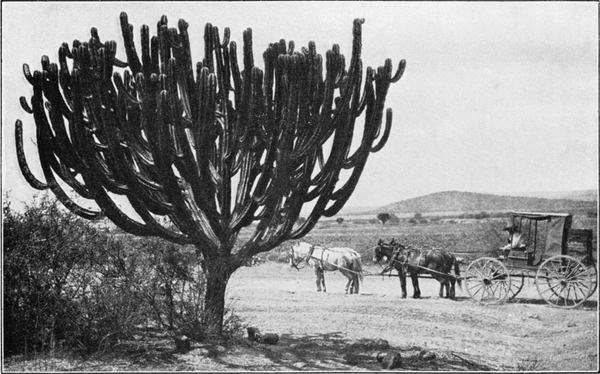
(Nach Photogr. von O. B. Waite.)
Baumartig verzweigter Säulenkaktus
(Cereus) am Wege von Oaxaca nach Mitla
in Mexiko.
Die Kakteen sind der Typus solcher Wüstenpflanzen. Sie sind
lebende Wasserreservoire in der trockenen Wüste und deshalb für
ihre wasserlosen Standorte so überaus bedeutsam. Die Hauptmasse
eines jeden besteht aus an Schleim gebundenem Wasser, was ihnen in
den[S. 729] wasserfreien Gegenden, auf die sie beschränkt sind, für Tiere
und Menschen die größte Wichtigkeit verleiht. In Mexiko und in den
mittel- und südamerikanischen Bergländern entscheiden sie durch ihr
Vorhandensein oder ihre Abwesenheit geradezu über Leben und Tod. Und
was dort der Mensch mit seinem langen Buschmesser, dem machete,
bewirkt, nämlich die zu ihrem Schutze an der Pflanze haftenden
Stacheln abschlagen, um sie ergreifen und essen zu können, das erzielt
das Maultier mit seinen Hufen. Mit derselben Leidenschaft, wie bei
uns die Esel den Spuren der Disteln folgen, so geben sich dort die
Maultiere mit wahrer Virtuosität dem Sport des „Kaktusschlagens“
hin, um in der wasserlosen Gegend zum allzu verlockenden saftigen
Bissen zu gelangen. Allerdings werden sie dabei nur zu oft zu
Krüppeln, indem die eisenharten, langen Stacheln tief in den Huf der
Tiere eindringen, so daß viele dieser Einhufer mit gelähmten Beinen
herumhumpeln. Nichtsdestoweniger müssen sie meist mit Gewalt von ihrer
leidenschaftlichen Begierde nach dem leckeren Mahle abgehalten werden.
Für den Menschen gibt es zwar angenehmere Getränke als den schleimigen,
kühlen Saft der Kakteen; nichtsdestoweniger hat dieser klebrige Trunk
verschmachtende Reisende, ja, ganze Expeditionen oft genug vom Tode des
Verdurstens gerettet.
Außer durch ihr saftiges Mark sind die Kakteen auch durch ihre Früchte
Tieren und Menschen in der Wüste nützlich. Unter diesen Kakteenfrüchten
sind am bekanntesten diejenigen des von den Mexikanern Tuna genannten
Tuna-Feigenkaktus (Opuntia tuna). Sie sind bis apfelgroß,
hellrot, angenehm säuerlich und werden nach Entfernung der dicken,
stacheligen Schale frisch oder gedörrt in Menge vom Menschen gegessen;
aus den unreifen Früchten gewinnt man durch Kochen ein an Apfelmus
erinnerndes Kompott. Einige Indianerstämme rösten auch die saftigen,
süßen Stengel, bevor sie sie essen. Ein naher Verwandter von ihm ist
der gemeine Feigenkaktus (Opuntia ficus indica), der
bald nach der Entdeckung Amerikas von den Spaniern nach ihrer Heimat
gebracht wurde und sich von da über das ganze Mittelmeergebiet,
Nordafrika und Westasien verbreitete und dem Menschen ein geschätztes
Obst liefert.
Die weitaus wohlschmeckendsten Früchte unter allen Kakteen besitzt
aber der in Westindien heimische Cereus triangularis. Man nennt
sie Erdbeerbirnen, da sie an beide Früchte erinnern. Sie haben
die Größe eines Gänseeis und sind außen und innen scharlachrot. Der
in Mexiko heimische, 6–13 m hohe und 0,6–1,3 m dicke
Riesenkaktus[S. 730] (Cereus giganteus) besitzt birnenförmige,
grünlichgelbe Früchte in der Nähe des Wipfels, die innen schön rot
und schmackhaft sind und viele kleine, schwarze Samen enthalten.
Ihre Schale ist weichfaserig, saftig und süß. Für die Indianer sind
die Früchte, die in bezug auf Geschmack an Feigen erinnern, nur viel
saftiger sind, wahre Leckerbissen, mit denen sie sich als einziger
Nahrungsquelle begnügen, solange sie solche haben können. Das Mark
der Früchte wird von ihnen in luftdicht verschlossenen irdenen Töpfen
konserviert, auch wird daraus ein klarer, lichtbrauner Sirup gepreßt.
Noch besser als die Früchte des Riesenkaktus sollen nach dem Urteil
der Mexikaner diejenigen des Thurberschen Kaktus (Cereus
thurberi) schmecken, die ebenfalls in großen Mengen von ihnen
gegessen werden. Sie sind etwa hühnereigroß und mit langen, schwarzen
Stacheln besetzt. Sobald sie reif sind, was an ihrer rötlichen Farbe
erkennbar ist, fallen die Stacheln ab, die Schalen bersten und lassen
reichlich ein rotes, saftiges Mark, mit kleinen, schwarzen Samen
durchsetzt, zutage treten. Dieser, wegen seiner süßen Früchte von den
Mexikanern pitahaja dolce genannte Kaktus wird 5,5–6 m
hoch und 15–20 cm dick und wird nach den Begriffen der Indianer
und Mexikaner kultiviert, d. h. diese streuen den Samen der von ihnen
gegessenen Früchte irgendwohin und überlassen das übrige der Natur.
Auch aus dem saftigen, süßen Fruchtfleisch dieser Kaktusart läßt sich
ein feiner Sirup gewinnen.
Ebenso nützlich ist der Seeigelkaktus (Echinocactus
wislizeni), der bei einem Durchmesser von 0,5 m nur
3 m hoch wird. Das Stengelmark dieses von den Mexikanern
visnaga genannten, sehr stark bestachelten Kaktus schmeckt
im Innern angenehm säuerlich und den Durst löschend, wenn es gekaut
wird, während das Mark der Früchte sauer ist und deshalb nur selten
als Speise dient; dagegen wird aus den kleinen schwarzen Samen durch
Mahlen ein schmackhaftes Mehl bereitet. Die Reisenden in den Wüsten
des nördlichen Mexiko und südlichen Arizona sind höchst erfreut, wenn
sie ihm begegnen, da sie bei ihm ihren Durst auf angenehme Weise zu
löschen vermögen. Fast alle an beiden Seiten der Wüstenwege wachsenden
Seeigelkaktusse zeigen große Löcher, die von den durstigen Reisenden
gebohrt wurden. Einzelne Abschnitte des Stammes werden als Kochgeschirr
benutzt. Wenn ein wandernder Indianer sich ein Mahl zu bereiten
wünscht, sucht er einen großen Echinokaktus, haut ein etwa 1 m
langes Stammstück ab und höhlt es zu einem Troge aus. In diesen wirft
er den[S. 731] weichen Markkern, welchen er bei der Aushöhlung gewann, und was
er sonst Genießbares an Wurzeln oder Fleisch besitzt und fügt Wasser
hinzu. Dann erhitzt er einen Feldstein im offenen Feuer so stark wie
möglich und wirft ihn in den Trog. Ist der Stein abgekühlt, so wird
er abermals erwärmt und ein zweites Mal in den Trog geworfen. Das
genügt gewöhnlich zum Durchkochen der Masse; nur selten ist eine dritte
Erwärmung des Steines notwendig.
Die Papajoindianer schälen die Rinde mit den Stacheln vom Stamm
dieses Kaktus ab ohne ihn umzuhauen, lassen ihn einige Tage der
Sonne ausgesetzt, spalten dann den Stamm, um den weichen Markkern zu
gewinnen, den sie in Stücke schneiden und in dem aus den Früchten des
Riesen- und Thurberkaktus bereiteten Sirup kochen. Wenn diese Stücke
getrocknet sind, sollen sie einen Geschmack wie Zitronat besitzen.
Der in Zentralamerika heimische Melonenkaktus (Melocactus
communis), der eine 30–60 cm hohe, runde oder ovale,
längsgefurchte Masse bildet, wird in Zeiten der Dürre besonders
vom Vieh aufgesucht, das ihn mit den Hörnern von den Stacheln zu
befreien und aufzubrechen sucht, um sich am saftigen Stamme zu laben.
Seine angenehm säuerlich schmeckenden Beeren werden nicht bloß in
Zentralamerika, sondern auch in Westindien häufig gegessen.
Alle Sorten von Kakteen dienen dem Vieh als Futter. Auf den großen
Hazienden des nordwestlichen Mexiko wäre auf dem grasarmen Boden die
als einzig lohnender Zweig der Landwirtschaft betriebene Viehzucht
nicht möglich, wenn die Kakteen nicht wären, die die Rinder, Pferde
und Maultiere geradezu am Leben erhalten. Und auch getrocknet
dienen die Stämme als Nutz- und Brennholz, das nicht nur gegen alle
Witterungseinflüsse unempfindlich, sondern auch so überaus leicht ist,
daß ein Maultier die zehnfache Menge desselben an Stelle gewöhnlichen
Holzes tragen kann.
Endlich hat einst zur Blütezeit der Cochenillezucht eine bestimmte
Art derselben, die Nopalea coccinellifera in Mexiko, dem
Dorado aller Kakteen, und in der Folge auch in anderen Tropenländern,
wo diese lukrative Industrie eingeführt wurde, als Nährpflanze der
Cochenilleschildlaus eine große wirtschaftliche Bedeutung gehabt;
gehört doch das aus jenen Läusen gewonnene Karmin auch heute noch zu
den edelsten Farbstoffen. Dadurch aber, daß die billigen Anilinfarben
mit ihm in Konkurrenz traten, wurde der Cochenillekarmin als nicht mehr
konkurrenzfähig in den Hintergrund gedrängt.
[S. 732]
Da doch die verschiedenen Kakteen für alle wasserarmen und daher
für eine andere Vegetation als diese ungeeigneten Gegenden so
überaus wertvoll sind, ist es sehr zu verwundern, daß man sie nicht
eigentlich durch systematische Züchtung zu verbessern suchte. Den
ersten vielverheißenden Anfang dazu hat neuerdings der berühmte
Pflanzenzüchter Luther Burbank in Santa Rosa in Kalifornien gemacht,
dem es gelang, eine stachellose, großstengelige und überaus saftige
Abart der Opuntie zu züchten, die sich außerordentlich einfach,
durch Stecken eines Stückchens des fleischigen Stengels in den
Boden, fortpflanzen läßt und außerdem ebenfalls stachellose, sehr
wohlschmeckende und nahrhafte, feigengroße, rötliche Früchte zeitigt.
Ein solches Zuchtprodukt ist für die Menschheit von unschätzbarem
Wert, da es ihr auch die sterilsten Wüsten zu besiedeln gestattet.
Erst mit einer solchen Nutzpflanze, die auch ohne Bewässerung gedeiht,
kann sie sich mit ihren Haustieren in den ihr bisher verschlossenen
Gebieten festsetzen und so weite Länderstrecken der Kultur erschließen,
die bisher lebenfeindliche Öde und Wildnis waren. Durch solche
Neuerungen ist der Menschheit, mag sie sich noch so sehr vermehren,
auf unübersehbare Zeiten hinaus Raum genug zur Ausdehnung auf unserem
Planeten gegeben. Welch herrliche Gärten werden dann die unendlichen,
bisher toten Wüsten der Erde sein, wenn der Mensch auch die Sonnenwärme
sich als Energiequelle dienstbar gemacht und überall durch Staubecken
oder Pumpen Wasser zu seinen leiblichen und industriellen Bedürfnissen,
wie auch zum Tränken seiner Haustiere und Nutzpflanzen, die desselben
zu ihrer Existenz bedürfen, zur Verfügung haben wird!
Außer den Kakteen gibt es noch viele andere wenig bekannte
Wüstenpflanzen, die schon heute in ihrer unveredelten, wilden Form
dem Menschen von teilweise recht großem Nutzen sind. Es seien hier
nur einige der wichtigsten kurz angeführt. So wächst im Gebiet der
Kakteen, speziell auch in Mexiko, die noch auf trockenem, sandigem
Boden gedeihende Yucca baccata, von den Spaniern bayonett
genannt. Sie liefert alle Jahre 1–6 Früchte, die in reifem Zustande in
Form und Größe Bananen ähneln. Deren Farbe ist grünlichgelb und das
Fruchtfleisch, in welchem große, schwarze Samen eingebettet sind, ist
süß und schmackhaft. Ihre unreifen Früchte werden wie Kartoffeln in der
Asche geröstet. Die kurz vor dem Aufbrechen gepflückten Blütenknospen
werden ebenfalls geröstet und in diesem Zustande als Leckerbissen
betrachtet. Aus den Blättern wird ein grober, aber sehr dauerhafter
Faserstoff gewonnen.
[S. 733]
Von dem Werte der auf dürrem, vulkanischem Boden Mexikos, Arizonas
und Südkaliforniens wachsenden Agaven, die von den Mexikanern
im großen kultiviert werden, ist an anderer Stelle bereits die Rede
gewesen. An ihnen ist mancherlei nutzbar. Die Wurzeln werden geröstet
genossen. In Wasser gekocht gibt die frisch geschnittene, kopfgroße
Blütenstengelknospe einen guten Sirup und ein sehr angenehmes Gericht.
Meist wird sie aber vor dem Ausbrechen vertieft abgeschnitten und der
sich reichlich in die Höhlung ergießende Zuckersaft gesammelt, um durch
Vergärung eine Art Wein, den Pulque, das Nationalgetränk der Mexikaner,
daraus zu gewinnen.
In den westlichen Steppen Nordamerikas wächst die Kama
(Camassia esculenta), deren walnußgroße Zwiebelknollen von
den Indianern sehr geschätzt sind, da sie wie Kartoffeln, nur süßer
schmecken. Ihr Zuckergehalt muß ein beträchtlicher sein, da sie
zerstampft und in Wasser gekocht einen guten Sirup liefern. Noch vor
kaum mehr als einem Menschenalter hat diese bevorzugte Speise der
Indianer im Staate Idaho zu einem blutigen Kriege, dem berüchtigten
Kamakriege, geführt. Das Vieh der Ansiedler vernichtete diese Pflanze,
welche sie, die Indianer, für ihren Lebensunterhalt nicht entbehren
könnten. So lautete wenigstens die Begründung der Kriegserklärung gegen
die Weißen. Aber auch die Blaßgesichter essen die Kamawurzel gern; denn
nicht wenige Farmer lassen zur Erntezeit dieser Knollen im Juni und
Juli von ihren Kindern Vorräte für die Küche sammeln.
Sehr geschätzt in den Wüsten um den Salzsee von Utah sind die
walnußgroßen, äußerst schmackhaften Wurzelknollen der als wilder
Sago bezeichneten Liliazee Calochortus luteus, die von
den Indianern eifrig ausgegraben und gesammelt werden. Deren Kinder
schätzen sie um des süßlichen Geschmackes willen wie Zuckerzeug. Als
die Mormonen, die sich selbst „Heilige des Jüngsten Tages“ nennen, von
ihren „heidnischen“ Nachbarn im Staate Illinois fortwährend befehdet,
1847 nach Westen über das Felsengebirge auswanderten, um sich in dem
später als Utah in die Union aufgenommenen Territorium am großen
Salzsee eine neue Heimat zu gründen, die sie der Wüste abringen mußten,
da bildeten diese Wurzeln im ersten Jahre ihres dortigen Aufenthaltes
einen sehr wichtigen Bestandteil ihrer Nahrung. Was das Manna der Wüste
den nach dem Lande Kanaan ziehenden Juden war, das wurde der wilde
Sago den unter dem Präsidenten Brigham Young (1801–1877) das Land der
Verheißung suchenden Mormonen.
Eine andere ausdauernde Lilienart, die in Nordamerika und Texas[S. 734]
weite Strecken steiniger, unfruchtbarer Hügelhänge hauptsächlich in
Erhebungen von 150–200 m mit ihren hellgrünen, 0,9–1,2 m
langen, schmalen Blättern bedeckt, ist der Sotol (Dasylirion
texanum). Alle 3–4 Jahre treibt er einen saftigen, zuckerreichen,
starken Blütenstengel bis zu 3 m Höhe empor. Dieser ist das
für den Menschen Wertvollste an der Pflanze, da er vorzugsweise zu
Schaffutter, aber auch zur Nahrung des Menschen dient. Der Schäfer,
der seine Herde auf eine Sotolweide führt, geht ihr mit dem langen
Haumesser, machete genannt, voraus und spaltet die Stengelköpfe,
deren weiches, saftiges Mark von den Schafen gerne gefressen wird. Nach
einiger Vertrautheit mit diesem Futter wissen sich die Schafe selber
zu helfen; sie warten die Vorbereitung ihres Hirten nicht ab, sondern
zerreißen selbst die Blätter des Sotol und dringen nagend in den
Stengelkopf ein. Dieses Futter ist nahrhaft und zugleich durstlöschend,
so daß es überflüssig wird, die Schafe, die sich von diesem Futter
ernähren, zur Tränke zu führen. Während der heißen Monate wird der
Sotol in seinem Verbreitungsgebiet als das wertvollste Schaffutter
betrachtet. Jedenfalls würde ohne sein Vorhandensein die Ernährung des
gegenwärtigen bedeutenden Schafbestandes in jenen sonst so dürren und
pflanzenarmen Gegenden nicht möglich sein.
Die Mexikaner verspeisen die jungen Stengelköpfe des Sotol gekocht
oder geröstet. Die letztere Zubereitung ist weitaus die beliebteste
und geschieht in folgender Weise: Es wird ein Loch gegraben, das 6–8
Köpfe aufnehmen kann, und mit einem darin angezündeten und längere
Zeit unterhaltenen Feuer gründlich erhitzt. Alsdann wird das Feuer
herausgeschaufelt, bis auf ein Bett glühender Kohlen, auf das die Köpfe
geworfen und mit Erde bedeckt werden. Nach 10–12 Stunden sind sie
gar. Sie haben dann ein braunes, saftiges Aussehen und schmecken ganz
angenehm süßlich.
Nach diesem Bratprozeß können die zuckerreichen Köpfe auch zur
Destillation eines als Sotolmescal bezeichneten Branntweins benutzt
werden, was sehr häufig geschieht. Dieser ist sehr stark, hat einen
eigentümlichen durchdringenden Geruch und ist bei den niederen
Volksklassen Mexikos sehr beliebt. Er wird etwa für 1¼ Mark per
Liter ausgeschenkt und berauscht sehr schnell, was als ein Vorzug
angesehen wird. Endlich kann aus den Blättern des Sotol ein grober
Faserstoff gewonnen werden, der zur Herstellung von allerlei Flechtwerk
und Seilen dient.
Die fleischigen, als Wasser- und Reservenahrungsbehälter dienen[S. 735]den
Wurzeln der verschiedensten Wüstenpflanzen liefern dem Menschen wie
den Tieren eine willkommene Nahrung, so auf den trockenen Plätzen
der nordamerikanischen Steppen die hühnereidicke, zarte, weiße,
stärkemehlreiche, einen angenehmen süßlichen, an Rüben erinnernden
Geschmack besitzende Wurzel der Brotwurzel genannten Psoralea
esculenta und die zarte, spindelförmige Wurzel einer von den
Indianern yampah genannten Umbellifere, die von den
Shoshone- und Schlangenindianern geradezu als die beste Nahrung aus dem
Pflanzenreiche betrachtet wird. Sie bildet bei mehreren nordwestlichen
Indianerstämmen einen geschätzten Handelsartikel und wird auch von den
weißen Bewohnern dieser Gegenden als Suppenwürze benutzt.
Die Nez Percés-Indianer sammeln die saftigen, fingergroßen Wurzeln
der an den öden Gebirgsabhängen des östlichen Oregon wachsenden
Umbellifere Carum gairdneri, um sie wie Kartoffeln zu kochen.
Sie schmecken dann sehr angenehm rahmartig. Übrigens haben auch wir
eine in der Rheingegend als Unkraut gemeine Kümmelart, den knolligen
Kümmel oder die Erdkastanie (Carum bulbocastanum),
deren bis 5 cm dicke Wurzelknollen kastanienähnlich schmecken
und gekocht, gebraten und als Salat gegessen werden. Besonders
in der Moldau-Walachei sind sie eine sehr geschätzte und viel
gesammelte Nahrung, deren Anbau sich sehr lohnen würde. Dieselben
Indianer Oregons sammeln auch die schwarzen Wurzeln einer andern auf
dürrem, vulkanischem Erdreich wachsenden Umbellifere, Oenanthe
sarmentosa, einer nahen Verwandten unseres Roßkümmels (Oenanthe
phellandrium), um sie geröstet zu verspeisen. Beim Kochen berstet
sie und zeigt einen weißen, stärkemehlartigen Inhalt. Sie schmeckt
süß, rahmartig und gilt deshalb bei den Indianern als ein Leckerbissen
ersten Ranges.
Ferner sammeln die Indianer die Wurzeln der in der Südhälfte des
Felsengebirges und im Wasatchgebirge vorkommenden Umbellifere
Peucedanum ambiguum, die von den Weißen als Biskuitwurzel
bezeichnet wird. Die Pflanze wächst auf so dürren Gehängen, daß sie
nicht einmal dürftiges Gras hervorbringen. Die Wurzeln werden im
Mai, zur Zeit der Blüte, gegraben und sind so außerordentlich reich
an Stärkemehl, daß dieses auch ohne Mahlen beim Trocknen förmlich
herausfällt. Es ist sehr weiß und angenehm zu essen, besitzt einen
milden Selleriegeschmack und hält sich viele Monate hindurch.
Ebenso sammeln sie die großen, spindelförmigen Wurzeln der in öden
Gebirgsgegenden Kaliforniens wachsenden weißblühenden Portulakart
Lewisia[S. 736] rediviva, die als sehr nahrhaft gilt und auch für den
Winterbedarf getrocknet wird.
Eine andere Knollenpflanze der dürren Gegenden von Neu-Mexiko, Arizona
und Kalifornien, die tiefe Sandansammlungen weithin bedeckt, ist eine
von den Spaniern als canaigre bezeichnete Sauerampferart,
Rumex hymenosepalus. Die dunkelbraunen, im Durchschnitt
zitronengelben, batatenähnlichen Knollen von 10–20 cm Länge und
2–5 cm Dicke schmecken stark zusammenziehend durch einen Gehalt
von 9,6 Prozent Gerbsäure und können deshalb auch zum Gerben verwendet
werden. Dieser Gerbstoffreichtum macht sie allerdings für den Menschen
nur im Notfalle eßbar.
In diesen dürren Gegenden bieten auch allerlei wildwachsende Samen eine
erwünschte Speise. So gedeiht an den trockenen, felsigen Hängen der
Gebirgswüsten von Mexiko, Kalifornien und Arizona bis zu 2700 m
Höhe eine nur unter günstigen Verhältnissen 9 m Höhe erreichende
Fichte (Pinus edulis), die von der spanisch redenden Bevölkerung
piñon, von der amerikanischen jedoch Nußfichte genannt
wird, weil ihre bohnengroßen, öligen Samen in Menge gesammelt und als
vortreffliche Speise wie Nüsse gegessen werden. Sie haben einen süßen,
angenehmen Geschmack, der durch Rösten bedeutend verfeinert wird. Sie
dienen auch vielfach zur Gewinnung eines guten Speiseöles, dessen
Überschuß über den Selbstgebrauch einen nicht unwichtigen örtlichen
Handelsartikel bildet. Nur hat es den einen Nachteil, bald ranzig
zu werden. Das leichte und weiche, aber sehr dauerhafte Holz dient
vorzugsweise zur Bereitung geschätzter Kohlen.
Auch die sehr eiweiß- und mehlreichen Samen eines in den Wüsten
von Utah, Colorado, Arizona und Nordamerika an tiefgelegenen
sandigen Stellen wachsenden strauchartigen Hülsenfrüchtlers, der
Schraubenbohne (Prosopis strombulifera), von der spanisch
redenden Bevölkerung tornilla genannt, werden gesammelt und
geben gekocht eine ausgezeichnete, selbst vom verwöhnten Weißen gern
gegessene Grütze. Wegen dieser Samen schätzen die Indianer diesen
Bohnenstrauch hoch, und auch viele Soldaten der Union halten ihn in
dankbarem Andenken; denn auf den strapaziösen Kriegszügen gegen die
Indianer in der trostlosen Wildnis, die seine Heimat bildet, hat er es
ihnen ermöglicht, nicht nur Feuer anzuzünden, sondern hat auch ihren
erschöpften, hungrigen Pferden und Maultieren in den Blättern und mehr
noch in den Samen eine wohltätige Labung geboten. Alles Vieh frißt
diese Bohnen, selbst wenn es in gutem Futterstande gehalten wird und
sonst genug[S. 737] zu fressen hat, mit augenscheinlicher Begierde; deshalb
dürfte auch dieser Strauch sich zur Besiedelung sandiger Wüsten eignen.
Ein noch viel weiter südlich, nämlich vom Coloradofluß bis nach Chile
vorkommender und bei einiger Pflege einen bis 12 m hohen Baum
bildender Verwandter dieses Bohnenstrauches ist der Mesquite
(Prosopis juliflora). Mit seiner runden Krone und seinen
dornenbewehrten Ästen erinnert er lebhaft an unsere, übrigens derselben
Familie angehörende Akazie. An den trockenen Hügelhängen seiner Heimat
wächst er oft als einziger Vertreter der Pflanzenwelt so weit das
Auge reicht und läßt im Juni und Juli seine 15–20 cm langen,
flachen, etwas gekrümmten und zwischen den Samenkörnern eingeschnürten
Schoten in ganzen Büscheln reifen. Diese enthalten, wie diejenigen der
verwandten Tamarinde, ein süßes, schwach säuerliches Fruchtfleisch,
das nicht weniger als 26 Prozent Traubenzucker enthält und, grob
zerstoßen und mit Wasser übergossen, zur Herstellung eines nahrhaften
und erquickenden Aufgusses dient. Um ihren angenehm schmeckenden Atole
zu bereiten, verfahren die Mexikaner etwas anders. Zunächst kochen sie
die Schoten in Wasser, dann ersetzen sie das warme Wasser durch kaltes,
zerquetschen die Schoten in demselben und seihen nach einiger Zeit die
Flüssigkeit ab. Durch Stehenlassen kann man die zuckerreiche Abkochung
in alkoholische Gärung bringen und erhält dadurch ein berauschendes
Getränk, das viele Liebhaber findet.
Die reifen Schoten, die gerne vom Vieh aufgesucht und gefressen
werden, sind sehr der Entwicklung von Maden ausgesetzt, so daß die
Mexikaner und Indianer keine andere Abwehr dieser lästigen Gäste
kennen, als die gesammelten Schoten samt den Bohnen sofort in einem
Mörser zu feinem Mehl zu zerstoßen und dasselbe möglichst gut
verschlossen aufzubewahren, bis sie es zum Backen eines groben Brotes
gebrauchen wollen. Die Maden sind jedenfalls schon bei der Ernte in
den Schoten, worein sie wohl durch eine Art Kleinschmetterling gelegt
worden sind, vorhanden und werden durch das Mahlen getötet und so in
ihrer weiteren Entwicklung zerstört. So erklärt es sich, daß sich
das so gewonnene Mehl viel länger als die Schoten aufbewahren läßt.
Übrigens ist den Indianern das Auftreten der Maden durchaus nicht
unlieb, denn sie sehen in ihnen einen erwünschten Nahrungszuwachs; nur
die kultivierten Mexikaner denken anders und treffen entsprechende
Vorkehrungen. Diese Schoten bilden begreiflicherweise eine wichtige
Nahrung für die Indianer und mexikanischen Mischlinge, wie für ihre
Pferde und Maultiere. Auch die Unionssoldaten haben sie auf ihren[S. 738]
Kriegszügen gegen die Indianer als Pferdefutter schätzen gelernt,
und ein mit Vermessungen betrauter Offizier der Vereinigten Staaten
ging in seinem Bericht an das Kriegssekretariat sogar so weit, zu
behaupten, der Erfolg seiner Expedition wäre ohne das Vorhandensein der
Mesquiteschoten überhaupt nicht möglich gewesen.
Das läßt uns den ungeheuren Wert des Mesquite für die Bewohner der
unfruchtbarsten Gegenden seines Verbreitungsgebietes begreifen. Diese
wüßten wohl kaum, wie sie sich ohne ihn durchs Leben schlagen sollten.
Ratlos würden sie sich auch nach Brennmaterial umsehen, wenn er nicht
vorhanden wäre; denn solches wird an vielen Orten ausschließlich vom
Mesquite geliefert. Und welch treffliches Brennmaterial bietet er
nicht! Beim Verbrennen seines Holzes strömt eine Hitze aus wie aus
Steinkohlen. Für die Kohlenbrennerei wird schwerlich ein besseres Holz
aufzufinden sein als das seinige. Zudem liefert er, wenn die Stämme
eine genügende Dicke erreicht haben, ein für die Möbeltischlerei sehr
gesuchtes Werkholz, dessen Kernholz gelbrot bis purpurn leuchtet und
scharf gegen den fahlgelben Splint absticht. Beide nehmen eine schöne
Politur an, was ihren Wert als Nutzholz erhöht. Außerdem ist es so
hart, daß es verschiedenen mexikanischen Städten zur Pflasterung der
Straßen dient und sich dabei sehr bewährt hat.
Vom Mai bis September schwitzt ein bernsteingelber Gummi aus den
Mesquitestämmen, das wie arabischer Gummi schmeckt, sich leicht in
drei Teilen Wasser auflöst und dann einen guten Klebstoff bildet, der
den arabischen Gummi völlig ersetzt. Von diesem unterscheidet er sich
chemisch dadurch, daß er nicht wie jener von essigsaurem Blei gefällt
wird und damit einen weißen Niederschlag gibt. Je älter der Stamm
und je dicker und geborstener die Rinde ist, um so reichlicher ist
die Ausschwitzung von Gummi, der auch aus allen Astlöchern sickert.
Ein großer Baum liefert eine Ernte von etwa 120 g; doch kann
dieselbe bis auf 400 g erhöht werden. Als Mesquite- oder
Sonoragummi wird er zu etwa 10000 kg jährlich hauptsächlich nach
Mexiko exportiert, wo ihn viele Apotheken als Ersatz des arabischen
Gummis führen.
Auch die an Erbsen erinnernden braunen Samen eines andern, zu den
Leguminosen gehörenden Baumes, des Eisenholzes (Olneya
tesota), der an öden, felsigen Stellen in den wasserärmsten
Gegenden des nordwestlichen Mexiko und in Arizona wächst, werden von
den Indianern roh und geröstet gegessen. In letzterem Zustande sollen
sie[S. 739] wie Erdnüsse schmecken. Das Stammholz liefert gutes Brennmaterial
und eignet sich zur Anfertigung von allerlei Geräten. Schon um dieser
Eigenschaft willen verdient der Baum Beachtung zur Nutzbarmachung von
Wüsten.
Ein anderes nicht unwichtiges Wüstengewächs ist die die öden, sandigen
Strecken von Texas und Arizona bewohnende, 0,6–1,8 m hohe
strauchartige Zwergpflaume (Prunus fasciculata), deren
karminrote, süße, etwas größer als die der Schlehe werdenden Früchte
sowohl frisch als gedörrt und zu Mus verarbeitet gerne gegessen werden.
Wenn sie zu reifen beginnen, wandern die Indianer von weit her zur
Ernte herbei, um möglichst große Vorräte von ihnen einzuheimsen.
Endlich ist noch als ein höchst zierliches Blumenkind der
nordamerikanischen Wüste die Coloradolilie (Hesperocallis
undulata) zu erwähnen, deren 3–5 cm dicke Wurzelknollen
30 cm tief in der Erde ruhen, bis ein alle 10–12 Jahre eintretender
gründlicherer Regen sie aus ihrem Scheintod zu neuem Leben erweckt.
Dann treiben sie aus dem nackten, schattenlosen Sande je einen
60–90 cm langen, mit dunkelgrünen, tiefgekerbten Blättern umkränzten
Blütenstengel, der im Laufe von wenigen Wochen 30 bis 40 aus 6 weißen
Blumenblättern mit einer grünlichpurpurnen Mittelrippe bestehende Blüte
hervortreibt. Milchweiß, wenn sie sich öffnen, werden sie im Laufe
des Tages perlweiß und am Abend — der Zeit ihrer größten Schönheit
— halb durchsichtig. Die märchenschönen Glocken schließen sich um
Mitternacht, um dann abzusterben und jüngeren Geschwistern Platz zu
machen, die am frühen Morgen in entzückender Jugendfrische aus den
gesprengten Knospen hervortreten. Eine große Pflanze treibt 5–6 Blüten
im Tage, die vom Augenblicke ihrer Entfaltung an, zumal am Abend,
einen starken, süßen Duft ausströmen lassen. Daher hat man dieser
Gattung den Namen Hesperocallis, d. h. Abendschön, gegeben. Nach der
Befruchtung zeitigen die Blüten eine 3 cm lange, mit schwarzen
Samen dichtgefüllte Kapsel. Besonders wenn die Mesquiteschoten knapp
sind, graben die Indianer eifrig nach den Wurzelknollen der in ihrer
Sprache ethulia genannten Blume, um sie als willkommene Speise
zu verzehren.
Wenn nun allein die nordmexikanische Wüste eine solche Menge
nutzbarer Pflanzen beherbergt, die es verdienten, vom Menschen in
anderen, dieselben ungünstigen Lebensbedingungen aufweisenden Wüsten
angesiedelt zu werden, so kann man sich denken, was für wertvolles
Pflanzenmaterial die verschiedenen Wüstengebiete der Erde zusammen[S. 740]
darbieten. Es sei hier beispielsweise nur an die südafrikanische
Kalahariwüste erinnert, auf der nach den ersten Schauern der kurzen
Regenzeit eine ihre Ranken weithin über den Wüstensand treibende
Cucurbitazee, die Zamamelone (Cucumis zama), eine
Verwandte unserer aus Wüsten desselben Erdteils Afrika stammenden
Wassermelone, hervorsprießt. Bald erscheinen an ihr gelbe Blüten, aus
denen außerordentlich saftige Früchte von der Größe eines Straußeneis
hervorgehen. Diese dienen Tieren und Menschen als willkommene Nahrung
und besonders auch durstlöschendes Mittel, das ihnen das fehlende
Wasser ersetzt. Den Buschmännern, jenen zwergartigen, gelbhäutigen,
unstet dem Wilde als ihrer Hauptnahrung nachwandernden Jägern der
weiten Kalahari, ist diese wilde Wassermelone, die nach einer guten
Regenzeit strichweise die wasserarme Steppe bedeckt, neben den saftigen
Wurzeln verschiedener Pflanzen die wichtigste pflanzliche Nahrung, die
sie eifrig aufsuchen und von der sie Depots im Boden anlegen, um sie
sich bei ihrer Rückkehr von der Jagd zu sichern. In Zeiten, da sie
nicht zu haben sind, vergraben die Buschmänner mit Wasser gefüllte
Straußeneier als Reservewasserbehälter in den Sand, um sich damit zur
Zeit der Dürre vor dem Verdursten zu schützen.
Im Norden der Kalahari wächst eine von den Betschuanen — wie diese
behaupten — dort eingeführte süßliche Melone, von ihnen
mangotan genannt, die ihnen mühelos Stillung des Hungers,
wie des Durstes gewährt. Sollen solche Melonen, an denen der Mensch
durch künstliche Zucht noch größere und wohlschmeckendere Früchte zu
erzielen vermöchte, planmäßig angebaut, nicht die Wüste bewohnbarer
machen helfen? Man sollte denken, daß die Zeit nicht mehr fern ist,
da solche Schätze der Natur von dem sich über immer weitere Gebiete
der Erde ausbreitenden Menschen willig in Kulturpflege genommen und
durch systematische Veredlung noch nutzbarer gemacht werden dürften.
Denn wir sind noch lange nicht am Ende der menschlichen Entwicklung
angelangt. Wir befinden uns vielmehr erst am Anfange derselben und
unsere Nachkommen werden weiterführen, was wir und unsere Vorfahren
begonnen haben, bis die ganze Erde mit allen ihren Wüsten dem Leben und
der menschlichen Kultur erobert ist.
Außer diesen Melonen dienen noch mancherlei andere Pflanzen dem
Menschen, der diese dürren, pflanzenarmen Gebiete jagend durchstreift,
zur Nahrung. So graben die Buschmänner und Betschuanen besonders nach
den schmackhaften Zwiebeln von Ixias und anderen Lilienarten. Diese
bilden neben dem fleischigen Kern der gewaltigen,[S. 741] sehr tiefgehenden
Wurzel des Elefantenfußes (Testudinaria elephantipes) und dem
stärkemehlreichen Mark des Palmfarns Zamia einen Hauptbestandteil ihrer
Nahrung.
In den Wüsten Nordafrikas und Westasiens gedeiht ein kleiner, dorniger
Baum von abschreckendem Aussehen aus der Familie der Simarubazeen aus
der engeren Verwandtschaft der Terebinthe und des Weihrauchbaums.
Dieser von den Arabern Zachun genannte Balanites
aegyptiaca mit einpaarig gefiederten Blättern, grünlichweißen
Blüten und walnußgroßen, im reifen Zustande grünlichen, ölreichen
Früchten wehrt sich so tapfer wie irgend ein anderes Wüstengewächs
gegen die verheerenden Sandstürme, die mit ihrem Gluthauch alles
Lebendige zu verschlingen drohen. Seine Früchte waren schon von den
alten Ägyptern, denen doch besseres Obst als Nahrungsmittel zu Gebote
stand, geschätzt und wurden von ihnen ihren Toten als Speise für das
Geisterreich mitgegeben. Als solche hat man sie öfter in Gräbern der
12. Dynastie (2000–1788 v. Chr.) im Gräberfelde von Kahun und in
anderen Nekropolen des mittleren Reichs gefunden. Aus den Samen pressen
die Araber heute noch ein Öl, dem sie heilende Wirkung zuschreiben. Aus
dem Verkaufe dieses Öls an die Reisenden, zumal an die Pilger, machen
die in Palästina wohnenden Araber ein einträgliches Geschäft. Und das
sehr harte Holz des Zachuns wird von den Drechslern Jerusalems zu den
verschiedensten Gegenständen, hauptsächlich aber zu Spazierstöcken
verarbeitet.
In den Wüsten der Mongolei wächst der Sulchir (Agriophyllum
gobicum), ein kaum 1 m Höhe erreichender, stacheliger
Strauch, der auf kahlem Flugsande gedeiht, im August blüht und im
September seinen Samen reifen läßt. Dieser letztere ist das Korn der
Wüstennomaden, der „Segen der Wüste“. In regenreichen Jahren ergibt er
eine gute Ernte, in trockenen dagegen verkommt der Strauch und dann
hungert der Mongole. Die Sulchirernte ist höchst einfach: Die Früchte
werden gesammelt und die Samen auf einer von Sand freien, lehmigen
Bodenfläche ausgedroschen. Dann werden letztere geröstet, durch
Stampfen in Holzmörsern von den Hülsen befreit, in Handmühlen gemahlen
und geben ein ziemlich schmackhaftes Mehl, das mit Backsteintee
zusammen gekocht wird und dem Mongolen als willkommene Speise dient.
Dieselbe zentralasiatische Wüste bewohnt der 3–4 m hohe, bis
15 cm dicke Saxaulstrauch, der vereinzelt im kahlen Sande
gedeiht. Er besitzt keine Blätter und schattenlos streckt er seine
langen Zweige[S. 742] aus, und doch baut der Mongole neben ihm seine Jurte
auf, um hinter ihm Schutz gegen die eisigen Winterstürme, wie gegen den
sengenden Sonnenbrand zu suchen. Im Frühling bedeckt sich der Saxaul
mit kleinen, gelben Blüten, aber seine Samen sind nur für Tiere, nicht
für den Menschen genießbar. Dagegen ist sein hartes, sprödes Holz außer
dem getrockneten Mist seiner Haustiere das einzige Brennmaterial, das
dem Nomaden zur Verfügung steht, um seinen geliebten tsamba zu
kochen.
Ebenso widerstandsfähig gegen Hitze und Dürre, wie auch den eisigen
Frost des Winters ist die die Wüsten Zentralasiens und Südostrußlands
bewohnende Wüstenweide (Salix acutifolia). Auch sie
gewährt dem Menschen keinen anderen Nutzen, als daß sie ihm Brennholz
liefert. Aus ihren Zweigen kann allerlei Flechtwerk hergestellt werden.
Sie eignet sich besonders zur Humusbildung auf magerstem Boden,
wodurch derselbe für anspruchsvollere Gewächse vorbereitet wird. Auf
fruchtbarem Boden entwickelt sie sich zu einem schönen, stattlichen
Baum.
In den Wüsten Australiens sind als Holzerzeuger sehr nützlich die
verschiedenen Eukalyptusbäume, die ihre Wurzeln außerordentlich
tief in den Boden hinabsenken, um ihm alle Feuchtigkeit zu entnehmen,
andererseits aber auch eine ganz außerordentliche Größe erreichen, wie
sie selbst nicht von den kalifornischen Mammutfichten, den Giganten
der Pflanzenwelt, erreicht wird. Wie die neben ihnen wachsenden
Akazien liefern sie außer Brennholz auch gutes Bau- und Werkholz, das
vorteilhaft zur Kohlen- und Teerbrennerei Verwendung findet. Aus den
Blättern läßt sich das wohlriechende Eukalyptusöl destillieren, das zur
Lackbereitung und in der Parfümerie dient.
Jedenfalls würden sich außer den hier genannten noch verschiedene
andere Wüstenpflanzen zum Anbau bei der ersten Besiedelung von
Wüsten durch den Menschen empfehlen. Einmal gepflanzt würden diese
wetterharten, der lebenfeindlichen Umgebung durch zahllose Generationen
angepaßten Pioniere aus der Pflanzenwelt ohne Mithilfe des Menschen
gedeihen und ihm ausgedehnte Gebiete der Erde, die heute öde Flächen
sind, dem Leben und der Kultur erobern helfen.
[S. 743]
XXXIII.
Die Feinde der Nutzpflanzen.
Nur ausnahmsweise und gelegentlich ist in den vorangegangenen
Abschnitten auch von manchen verderblichen Krankheiten der Nutzpflanzen
die Rede gewesen. Unsere Betrachtung wäre unvollständig, wenn wir
zum Schlusse nicht anführen wollten, daß gerade die in der Regel in
ganz unnatürlicher, einseitiger Anhäufung unter oft ungünstigen,
ihren natürlichen Standorten und Lebensbedingungen durchaus nicht
entsprechenden Lebensverhältnissen auf einem in seiner Zusammensetzung
ungeeigneten, vielfach ausgesogenen Boden angebauten und meist durch
vielhundertjährige Kultur von seiten des Menschen verweichlichten
Nutzpflanzen Krankheiten unendlich viel leichter anheimfallen als ihre
robusten, unter den natürlichen Lebensbedingungen lebenden Wildlinge
gebliebenen Verwandten. Dabei ist zu bedenken, daß durch ungünstige
klimatische oder Bodenverhältnisse in Verbindung mit mangelhafter
Pflege durch den Menschen die verschiedenen Krankheitserreger viel
größere Bedeutung für die Kulturpflanzen gewinnen als für die übrigen,
in ihren natürlichen, ihren Bedürfnissen angepaßten Verhältnissen
lebenden Pflanzen. So kann es uns nicht wundern, daß, je länger eine
Nutzpflanze in menschlicher Pflege steht und je höher kultiviert sie
ist, sie um so zahlreicheren Erkrankungen ausgesetzt ist und von um so
mehr tierischen und pflanzlichen Feinden bedroht wird.
Wie für die Menschen und die Tiere sind auch für die Kulturpflanzen
winzige Pilze die gefährlichsten Krankheitserreger. So entstehen
schwere Schädigungen unserer Getreideernten, ja völliger Mißwachs
dieser für uns Menschen so wichtigen Brotfrüchte besonders durch die
Brandpilze, die die Ähren und Körner unter Umwandlung in eine
schwärzliche Masse vernichten, dann durch mancherlei Rostpilze,
die die Blätter und Halme abtöten und dadurch die Fruchtbildung
ver[S. 744]unmöglichen, ferner durch den Mutterkornpilz, der sich in
der Ähre an Stelle des Kornes entwickelt, außerdem durch eine Reihe
erst neuerdings aufgefundener Blattpilze, die die grünen Blätter
besonders des Weizens befallen und vorzeitig abtöten, endlich auch die
jüngst entdeckten Pilze, der „Roggenhalmbrecher“ und „Weizenhalmtöter“,
die sich im untersten Grunde des Halmes und in den Wurzeln entwickeln
und dadurch den wertvollen Getreidepflanzen vorzeitigen Tod bringen.
So haben unsere wichtigsten Körnerfrüchte, wie Weizen, Gerste und
Hafer, außer unter besonderen Arten von Flugbrand, deren Sporen
nach Auszehrung der Fruchtanlage in der Blüte in braunen Massen
ausstäuben, um immer wieder dieselbe Getreideart, niemals aber eine
andere zu befallen, noch unter anderen spezifischen Brandarten zu
leiden, so der Weizen durch den Steinbrand, die Gerste durch
den Hart- oder Schwarzbrand und der Hafer durch den
gedeckten Haferbrand, alles nicht zur Blütezeit der betreffenden
Getreidearten ausstäubenden und umherfliegenden Brandarten, sondern
solchen, die den Keimling anstecken und erst beim Dreschen ihre
schwärzlichen Sporenmassen frei werden lassen, um an gesunde Körner zu
gelangen. Diesen haften sie äußerlich an und gelangen, falls solches
Korn zur Saat benützt wird, mit dem Getreidekeimling zum Austreiben,
wobei sie ihre Schläuche in ihn eindringen lassen und mit ihm wachsen,
bis sie ihn zugrunde gerichtet haben. Diese letzteren Brandarten
bekämpft man durch sogenanntes Beizen des Saatgutes mit Kupfersalzen,
Formalin und heißem Wasser. Die ersteren dagegen können nur durch
rechtzeitiges tägliches Entfernen der den Flugbrand in den Blüten
aufweisenden Exemplare oder noch besser durch isolierte Züchtung
brandfreier Getreidestämme vermieden werden.
Verschiedene Rostpilze schädigen den Mais, den Klee, die
Bohnen und Erbsen und weisen denselben Wirtswechsel wie die früher
besprochenen Getreiderostarten auf. So gedeihen die Wintersporen
des Erbsenrostes nur auf den Blättern der Cypressenwolfsmilch, um
regelmäßig ihre Sommersporen auf den Erbsen zu entwickeln. Die
Wintersporen des orangeroten Becherrostes der Stachelbeeren gedeihen
nur auf der Unterseite der Blätter der scharfen Segge, wo sie schwarze
Sporenhäufchen bilden. Der ebenfalls orangerote Gitterrost, der die
Blätter des Birnbaumes befällt, erzeugt rotgelbe Gallertklumpen
ausschließlich an Stamm und Zweigen des Sadebaumes (Juniperus
sabina). Zwei gefürchtete Getreideschädlinge, der wahre Rost
und der Kronenrost, entwickeln ihre Wintersporen ausschließlich,
der erstere auf den[S. 745] Blättern der Ackerochsenzunge, der letztere auf
denjenigen des Faulbaums. Und so geht es ins Endlose, ohne daß wir bis
jetzt von den meisten solchen Rostpilzen den Gang der Entwicklung und
den Zwischenwirt überhaupt erkannt hätten.
Den Blättern und Früchten der Apfel- und Birnbäume sind die Schorf-
und Fusicladiumpilze gefährlich. Die Moniliakrankheit verdirbt die
Blüten und jungen Triebe der Kirschbäume, der Gnomoniapilz bewirkt die
Seuche und das Abfallen ihrer Blätter wie auch das Verderben ihrer
Früchte. Verschiedene Kulturpflanzen leiden unter dem Mehltau, unter
ihnen besonders der Weinstock; dabei bildet sich ein weißer, dünner
Überzug auf braunwerdenden Flecken der Blätter und jungen Weinbeeren.
An letzteren stirbt dadurch die Haut ab, noch ehe die Frucht die Hälfte
ihrer normalen Größe erlangt hat und zerreißt bei weiterer Ausdehnung
des Beerenfleisches, so daß die Beere abstirbt und verfault. Der weiße
Überzug besteht aus dem echten Mehltaupilz (Oidium tuckeri),
dessen Sporen vom Regen und Wind auf benachbarte Blätter und Trauben
weiter verbreitet werden, wo sie bei Vorhandensein von Feuchtigkeit
leicht keimen. Regenreiche Jahre begünstigen die Ausbreitung dieser
Krankheit, die seit 1845 von England durch Frankreich nach Südeuropa,
der Schweiz und Deutschland wanderte und sehr großen Schaden
anrichtete. Man bekämpft die Krankheit erfolgreich durch Schwefeln,
d. h. Überpudern der Weinstöcke mit Schwefelblumen, wodurch der Pilz
getötet und gesunde Pflanzen geschützt werden. Der falsche Mehltau
dagegen wird von Peronospora viticola hervorgerufen. Der
Pilz zeigt sich nur auf der Unterseite der Blätter als weißer Filz,
während auf der Oberseite rundliche, braune Flecken entstehen. Die
Krankheit trat zuerst in Amerika auf, wurde hernach in Frankreich
und dann in andern Ländern Europas beobachtet und hat seitdem große
Verheerungen angerichtet. Sie wird durch Bespritzen der Reben zur Zeit
der Rebenblüte und 4–6 Wochen später noch einmal mit 1–1,5 kg
Kupfervitriol und 2–2,5 kg gelöschtem Kalk in 100 Liter Wasser
erfolgreich bekämpft. Der Pinselschimmel (Penicillium glaucum)
verdirbt den Most, weshalb die von ihm befallenen, eine schmutzige,
hellgrüne bis gelbliche Färbung zeigenden faulen Beeren vor dem
Keltern der Trauben entfernt werden müssen. Nicht ungünstig dagegen
ist die durch Peziza funckeliana hervorgerufene Edelfäule
der Trauben, indem dieser Pilz in den Beeren mehr Säure als Zucker
verzehrt, wodurch ein stärkerer Wein entsteht. Dieser Pilz ruft
aber nur bei wenigen Traubensorten, deren Bukett er erzeugt, solch
gutartige[S. 746] Veränderungen hervor, so namentlich beim Riesling, dessen
Bukett er zwar zerstört, dafür aber ein anderes, dem Sherry ähnliches
erzeugt. Alte Weinkenner am Rhein behaupten, daß man erst im Jahre 1822
gelernt habe, aus edelfaulen Trauben die feurigen, edlen Weine des
Rhein- und Moselgaues zu bereiten. In jenem Jahre war der Sommer dem
Weinstock außerordentlich günstig, so daß schon gegen Ende September
eine Überzeitigung eintrat und gelesen werden mußte. Da dann die
Weinbauern nicht auf eine so frühe Ernte vorbereitet waren, wurde meist
eine „faule Brühe“ gelesen, die aber einen so guten Wein lieferte,
daß man diese Edelfäule später künstlich herbeiführte. Auch die
Phytophthorakrankheit der Kartoffeln, die Blätter und Knollen dieser
wichtigen Nutzpflanze zum Absterben bringt, ist Mitte des vorigen
Jahrhunderts aus Nordamerika zu uns gekommen.
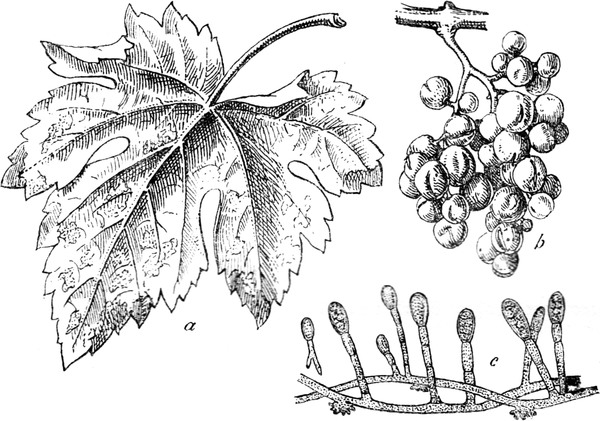
Bild 80. Echter Mehltau des Weinstocks
(Oidium tuckeri).
a ein vom Pilze befallenes Rebenblatt,
b eine von ihm zerstörte Traube,
c der Pilz selbst (stark vergrößert).
Außer diesen die grünen Teile der Pflanze angreifenden Pilzen gibt
es eine Menge anderer, die die Wurzeln befallen und dadurch die
Pflanze zum Absterben bringen. Solche Wurzeltöter bedrohen besonders
die verschiedenen in Kultur befindlichen Leguminosen. Aber[S. 747] noch
weit mehr als durch pflanzliche sind besonders die Wurzeln durch
tierische Feinde bedroht. Diese bestehen ebenfalls meist
aus winzigen Lebewesen, vorzugsweise aus der Familie der Würmer,
Milben und Insekten. Unter den letzteren, die meist ziemliche Größe
aufweisen, gibt es manche, die sich nicht auf bestimmte Pflanzen
beschränken, sondern sämtlichen Gewächsen schädlich werden können.
Dazu gehören z. B. die Maikäfer, deren Larven als Engerlinge drei bis
vier, ja in Ostpreußen sogar fünf Jahre im Boden leben und hier den
Wurzeln fast aller Pflanzen gefährlich sind, ferner die schmalen,
gelben Drahtwürmer, die Larven des Saatschnellkäfers, die die Wurzeln
besonders der Getreidearten, Kartoffeln und Gemüsepflanzen zerfressen,
wie auch die verschiedenen Erdraupen, auf die wir hier nicht näher
eintreten können.

Bild 81. Falscher Mehltau des Weinstocks
(Peronospora viticola).
a davon
befallene Traube mit kranken Beeren, b aus
einer Atmungsöffnung der Unterseite des Blattes hervorgewachsene
gestielte Sporenträger des Pilzes, deren Sporen teilweise schon vom
Winde verweht wurden.
Unendlich viel größer als die Zahl dieser allgemeinen Schädlinge
ist diejenige solcher tierischer Schädlinge, die immer nur auf
eine bestimmte Nährpflanze angewiesen sind und ihr durch ihre
große Menge ebenso arg zuzusetzen vermögen wie die verschiedenen
speziellen Krankheitspilze. Für die Getreidearten sind die Larven des
unübersehbaren Heers der Kornkäfer, deren man jetzt schon über 10000
Arten unterscheidet, dann Frit- und andere Fliegen, ferner Blasenfüße,
allerlei Halmwespen und Zwergzikaden gefährlich, für die Zucker-
und Futterrüben außer zahlreichen Insekten besonders Rundwürmer.
Eines der gefährlichsten Würmchen dieser letzteren Art ist neben dem
Rübenälchen das Weizenälchen, welches das sogenannte Gichtigwerden
und den Faulbrand des Weizens hervorruft und dadurch oft gewaltigen
Schaden[S. 748] anrichtet. Diese sind so zählebig, daß sie selbst nach zwanzig
und mehr Jahren völliger Austrocknung nach Befeuchten wieder aufleben.
Naturgemäß tritt der durch sie hervorgerufene Faulbrand in nassen
Jahren stärker als in trockenen auf. Zum Schutze gegen sie müssen alle
gichtischen Körner des Weizens am besten durch Verbrennen vernichtet
werden und darf zum Aussäen nur gesundes, in einer halbprozentigen
Kupfervitriollösung gebeiztes Saatgut verwendet werden.
Die Kleefelder werden durch das Stockälchen, die Bohnen, Erbsen
und andere Leguminosen durch Blattläuse, der Raps durch einen
Glanzkäfer schwer geschädigt. Sehr groß ist die Zahl der Obstfeinde
im Tierreiche. Die Raupen gewisser Schmetterlinge, wie die des
Frostspanners, des Schwammspinners usw., zerstören das Laub und
damit auch den Ertrag der Obstbäume. Blüten und Blätter werden
verdorben durch den Apfelblütenstecher, durch die Larven mehrerer
Wickler, die das Madigwerden und das Abfallen der Äpfel und Birnen
verursachen, durch die Kirschenfliege, die die Maden in den Kirschen
erzeugt, und dergleichen kleine Insekten mehr. Die Blutläuse sind
für die Apfelbaumstämme wie die verschiedenen Schildläuse für andere
Obstbaumarten von der größten Gefährlichkeit. Ein schrecklicher Gegner
ist dem Weinstock die aus Amerika eingeschleppte, zuerst im Jahre 1863
in Europa bemerkte, seitdem aber in allen Weingegenden verbreitete
Reblaus, die von 1869 an innerhalb acht Jahren in Frankreich allein
den dritten Teil des gesamten mit Reben bepflanzten Areals vernichtete
und dadurch dem Nationalvermögen dieses Landes nach durchaus nicht
übertriebener Schätzung einen ersten Schaden von wenigstens 13
Milliarden Franken verursachte. Der seit ihrem Auftreten in diesem
Lande verursachte Gesamtschaden wird auf mehr als 20 Milliarden Franken
geschätzt. Auch der Traubenwickler ist für den Rebbau eine große
Kalamität; denn der sogenannte Heu- oder Sauerwurm, das Räupchen dieses
Schmetterlings, zerstört namentlich in feuchten Jahren die Blüten und
zarten jungen Beeren der Rebe.
Großen Schaden verursachen auch zahllose Blattkäfer und Blattflöhe.
Unter den ersteren ist besonders der in Nordamerika heimische
Kolorado-Kartoffelkäfer berüchtigt, der sich seit etwa vierzig Jahren
über das ganze Land ausgebreitet hat und oft einen Ausfall von 30
Prozent und mehr der Kartoffelernte bewirkte, ja manchenorts so
zahlreich auftrat, daß die durch ihn angerichteten Verwüstungen den
Menschen zwangen, den Anbau der Kartoffeln zeitweise ganz einzustellen.
Trotzdem er durch amerikanische Saatkartoffeln nach Europa verschleppt[S. 749]
wurde, hat er sich glücklicherweise bei uns nicht einbürgern können, da
ihm offenbar das Klima hier nicht behagt.
Es ist völlig unmöglich, dem geneigten Leser auch nur einen
annähernden Begriff von der Zahl der tierischen Schmarotzer zu geben,
die neben den pflanzlichen Krankheitserregern unsere verschiedenen
Kulturpflanzen bedrohen. Es genüge, hier als Beispiel nur die
Baumwollstaude anzuführen, an der die praktischen, für die Erkenntnis
der Schädlinge der Kulturpflanzen äußerst verdienten Nordamerikaner
außer 30 verschiedenen Pilzkrankheiten nicht weniger als 470 Tierarten
gelegentlich oder ausschließlich schmarotzen. Unter diesen befinden
sich drei Schädiger ersten Ranges, nämlich die Baumwollraupe, die
Kapselraupe und der mexikanische Kapselkäfer. Sie alle vermehren
sich in fabelhafter Weise und richten da, wo sie auftreten, großen
Schaden an. Bedenkt man, daß eine einzige die Räupchen hervorbringende
Motte wenigstens 500 Eier legt, die sich im Laufe eines Sommers in
fünf Generationen zu unzählbaren Millionen fortpflanzen, so begreift
man, daß der Mensch völlig außerstande wäre, seine verschiedenen
Kulturpflanzen gegen ihre zahllosen Schädiger in erfolgreicher Weise zu
schützen, wenn nicht jeder der letzteren wenigstens einen Spezialfeind
in der niederen Tierwelt besäße, der ihm das Leben sauer macht. Im
Bunde mit diesen seinen Freunden und Bundesgenossen führt der Herr
der Schöpfung einen unausgesetzten Kampf gegen das große Heer der
Schädlinge und bedient sich dabei der verschiedensten Hilfsmittel,
unter denen das Spritzen mit ätzenden, giftigen Stoffen und die
Fangkulturen in erster Linie stehen. Unter den letzteren versteht man
gewisse zwischen den Hauptkulturen gesetzte Pflanzungen, die sich
früher entwickeln als diese und die nur zum Zwecke angelegt werden,
um die tierischen Schädlinge anzulocken und dann mit diesen zusammen
vertilgt zu werden. So benutzt man beispielsweise bei der Baumwolle
dazu eine frühreifende Maisart, die auf schmalen Beeten zwischen den
Baumwollfeldern angepflanzt wird.
Endlich werden auch manche tierische Schmarotzer durch ihre natürlichen
Feinde zu bekämpfen gesucht. So wird seit einigen Jahren der
Kapselkäfer der Baumwolle in Amerika durch eine rote Ameise bekämpft,
die man in Massen züchtet und auf den Baumwollfeldern ansiedelt.
In neuester Zeit hat man auf Java die sogenannte Kakaowanze, die
die Kakaobäume vernichtet und den Ertrag der betreffenden Plantagen
auf Jahre hinaus zerstört, in ähnlicher Weise und mit gutem Erfolg
mit Hilfe einer schwarzen Ameise zu bekämpfen gesucht, die sich[S. 750]
als Vernichterin jener Schmarotzerin vorzüglich bewährt hat. Die
Nester dieser Ameise werden in Kisten aus Blech gefaßt und in den
Kakaobäumen aufgehängt. Von hier aus beginnen die Ameisen alsbald ihr
Vernichtungswerk und töten rasch die gefürchteten Wanzen.
Sehr leistungsfähige staatliche Insektenzuchtinstitute besitzen
besonders die Vereinigten Staaten von Nordamerika. Unter ihnen
ist dasjenige von Sakramento in Kalifornien das bekannteste, das
alljährlich große Lieferungen an Private besorgt. So hat dieses
Institut beispielsweise im vergangenen Monat April nach den
Zeitungsberichten 52 Millionen Marienkäfer in Gewicht von
1000 kg in besonderen Eisenbahnwagen nach den Melonenfeldern
von Imperial Valley in Kalifornien spediert, wo ihnen die Aufgabe
zufällt, Blattläuse und Insekten aller Art zu vertilgen, die die
Melonenpflanzungen verheeren.
Der beste Schutz gegen die Schädlinge ist und bleibt aber die peinlich
sorgfältige Pflege der Kulturpflanzen und ein tadellos gesundes
Saatgut, soweit die Vermehrung durch Aussäen des Samens bewerkstelligt
wird. Auch müssen bei der Einführung von Setzlingen nicht nur der
Stamm und die Zweige, sondern vor allem auch die Wurzeln mit allen
ihren Ausläufern genau auf die Anwesenheit von Schmarotzern untersucht
werden. Hätte man dies getan, so wäre beispielsweise auch die in
Amerika bei den viel kräftigeren einheimischen Reben nur geringen
Schaden anrichtende Reblaus nicht nach Europa eingeschleppt worden und
hätten die gewaltigen Verluste, die hier die Rebbau treibenden Länder
erleiden mußten, vermieden werden können.
Die weitaus wichtigsten Gehilfen des Menschen sind aber die
Vögel, die infolge ihres beinahe unersättlichen Hungers —
die Folge ihres äußerst raschen Stoffwechsels und ihrer maximalen
Lebensintensität — die größten Feinde der meisten Schädlinge unserer
Nutzpflanzen sind. Haben wir mit der einseitigen Anpflanzung weiter
Gebiete mit denselben zu unserem Nutzen gezogenen Pflanzenarten auch
die Schädlinge derselben in einer Weise, wie dies in der freien Natur,
wo aber auch keine solche Anhäufung derselben Pflanzenart vorkommt,
sondern überall gemischte Bestände vorhanden sind, unmöglich ist,
sich vermehren lassen, so liegt es in unserem eigenen Interesse,
auch die Zahl ihrer Feinde, der Vögel, möglichst zu vermehren.
Statt daß man dies tat und diesen unseren größten Wohltätern durch
Vogelschutzmaßregeln und Bieten von Nistgelegenheiten zu ungestörtem
Brüten die Möglichkeit einer Existenz und der ausgiebigsten Vermehrung
verschaffte, hat man sie in der grausamsten und kurzsichtigsten
Weise aus[S. 751] Roheit, aus Leckerei und Modetorheit verfolgt und in der
unglaublichsten Weise dezimiert. Damit hat sich die Kulturmenschheit
leider nur ins eigene Fleisch geschnitten. Erst dann, wenn sie dies
eingesehen hat und danach handelt, wird dieser Übelstand sich bessern
und statt Fluch Segen hervorgehen. Wenn der Mensch durch seine
Kultur das Gleichgewicht in der Natur gestört hat, so ist es seine
absolute Pflicht, diese Störung nach Möglichkeit wieder auszugleichen.
Hat er die einseitige Verbreitung der Kulturpflanzen bewirkt, so
muß er auch vor allem die Feinde der künstlich heraufgeschraubten
Kulturpflanzenvernichter künstlich heraufschrauben, d. h. so viel
er kann die Vögel vermehren. Dies soll nicht nur durch möglichst
weitgehenden Vogelschutz, sondern vor allem auch durch Darbieten von
künstlichen Nistgelegenheiten zum ungestörten Brüten geschehen. Was wir
in unseren Kulturländereien nötig haben, das sind dazwischen errichtete
dornige „Nistgehölze“, durch die das Raubzeug und zugleich das größte
Raubtier, der unkultivierte Mensch, am Beunruhigen der brütenden
Wohltäter und dem Ausnehmen ihrer Nester verhindert werden.
Überall, wo solches bisher geschehen ist, hat es die reichsten Früchte
getragen und der Land- und Forstwirtschaft den größten Nutzen gebracht.
Dafür sei nur ein Beispiel unter vielen angeführt. So schreibt der
verdiente deutsche Vorkämpfer des Vogelschutzes, Freiherr B. von
Berlepsch: „Als im Frühjahr 1905 der gesamte, mehrere Quadratmeilen
große, südlich von Eisenach gelegene Hainichwald gänzlich vom
Eichenwickler (Tortrix viridana) kahlgefressen war, blieb mein
Wald, der durch über 2000 daselbst aufgehängte Nistkästen einen reichen
Meisenbestand aufweist, völlig davon verschont. Er hob sich von
den umliegenden Waldungen tatsächlich wie eine grüne Oase ab. Erst etwa
einen halben Kilometer jenseits der Grenze machten sich die ersten
Spuren des Fraßes bemerkbar, nach weiterem halben Kilometer war er aber
bereits in vollem Umfange eingetreten. Ein deutliches Zeichen, wie weit
die Meisen und Genossen während des Winters, überhaupt außerhalb der
Brutzeit, gestrichen waren.“ Gleiche Beobachtungen bei den Verwüstungen
der Raupe desselben Schmetterlings wurden auch in großherzoglich
hessischen Forsten gemacht, in denen ebenfalls der Vogelschutz seit
einiger Zeit betrieben wird.
Aber nicht nur von Insekten, die unseren Kulturen schädlich sind
und sie zugrunde richten, auch von solchen, die uns selbst lästig
fallen, befreien uns die Vögel. Ungezählte Massen von Stubenfliegen,
die Verbreiter verschiedener menschlicher Krankheiten, fangen die
Schwalben[S. 752] ab, die unermüdlich gerade ihre Hauptbrutstätten, die
Ställe und Düngerhaufen, nach ihnen abfliegen. Sie dezimieren auch die
lästigen Stechmücken, in Süddeutschland Schnaken genannt, wie die im
Wasser lebenden oder darin, wie die Enten, ihre Nahrung suchenden Tiere
ihrer Brut nachstellen und uns so nützen.
Welchen Nutzen beispielsweise die verschiedenen Wildhühner ihren
Standorten erweisen, daß können wir aus Beobachtungen von ihren
gezähmten Verwandten, den Haushühnern, schließen. So wurden in einem
Versuche von Professor Eckstein (Prometheus, 1908) Hühner in einen vom
Kiefernspanner (Bupalus piniarius) befallenen Wald getrieben,
damit sie die unter dem Moos auf dem Boden überwinternden Puppen
auffräßen. Da zeigte es sich, daß jedes Huhn täglich etwa 4500 Puppen
dieses schlimmen Forstschädlings verzehrte, und die Nachsuche ergab,
daß auf dem Geviertmeter, der vorher 25–140 Puppen enthalten hatte,
nach dem Absuchen durch die Hühner nur noch 2–3 dieser schädlichen
Schmetterlingspuppen vorhanden waren.
Sehr groß ist auch der Nutzen der mäusefressenden Vögel, vor allem
des Turmfalken, der verschiedenen Bussarde und Eulen, die sich, wie
ausgedehnte Untersuchungen des Mageninhaltes geschossener Tiere
bewiesen, zu 90 Prozent von diesen den Kornfrüchten und zahlreichen
andern Kulturpflanzen des Menschen so überaus schädlichen Nagern
ernähren. Jedenfalls sollte noch mehr als bisher von jedem Menschen der
Ausspruch beherzigt werden:
„Die Tiere schützen
Heißt, dem Menschen nützen!“
- Abies 568, 661.
- Acanthus mollis 509.
- Acer 634, 707.
- Aconitum napellus 290, 503.
- Aesculus 626.
- Agathis australis 197.
- Agave rigida 56, 733.
- Ahorn 634, 707.
- Akazie (falsche) 595, 717.
- — (Gummi) 320.
- Akelei 503.
- Alantwurzel 284.
- Alkanna 122.
- Aloe 236, 341.
- Alraun 278.
- Amaryllis 486.
- Ambra 199, 259.
- Ampelopsis 610.
- Anchusa tinctoria 123.
- Anemone 504.
- Aralie 612.
- Arbutus unedo 622.
- Areca catechu 144, 374.
- Arnika 286.
- Artemisia absinthium 296.
- Arve 571, 669.
- Ärzte (ägyptische) 268.
- Asa foetida 326.
- Asphodelus 481.
- Astarte 577.
- Aster 533.
- Aurikel 524.
- Azaleen 552.
- Baldrian 285.
- Balsam 231, 329.
- Balsamine 540.
- Bambus 85.
- Bärenklau 509.
- Bast 66.
- Battikfärberei 117.
- Baumwolle 93.
- Baumwollspinnerei 101.
- Bdellium 230, 329.
- Begonie 527.
- Belladonna 289.
- Bellis perennis 538.
- Benzoëharz 334.
- Bernstein 199.
- Bernsteinlack 204.
- Bibergeil 259.
- Bilsenkraut 288.
- Birke 700.
- Blauholzbaum 127, 722.
- Blumenkränze 430.
- Blumenzwiebeln 480.
- Boehmeria tenacissima 64.
- Bohnenkraut 545.
- Boretsch 528.
- Brache 4.
- Brandpilz 743.
- Brasilholz 127, 722.
- Brechnuß 361.
- Brennessel 65.
- Brombeere 640.
- Buche 589, 690.
- Buchs (Buxus) 607.
- Caesalpina echinata 127, 722.
- Calceolaria 557.
- Camellie 554.
- Campanula 516.
- Campescheholz 127, 722.
- Cananga odorata 258.
- Canna 493.
- Cannabis sativa 52.
- Carludovica palmata 73.
- Carthamus tinctorius 139.
- Carum 735.
- Cascara sagrada 303.
- Castilloa elastica 180.
- Ceder 671.
- Cedrela odorata 679.
- Ceiba pentandra 67.
- Cereus 729.
- Chamaecyparis 581.
- Chelidonium 272.
- Chinarinde 351.
- Chromgerberei 154.
- Chrysanthemum 535.
- Cistrosen 623.
- Clematis 610.
- Cochenille 126.
- Colombowurzel 347.
- Coloradokäfer 749.
- Coloradolilie 739.
- Condurango 351.
- Convolvulus 527.
- Corchorus capsularis 63.
- Coriaria myrtifolia 148.
- Crocus sativus 138.
- — vernus 492.
- Curare 362.
- Curcuma 137.
- Cyclamen 525.
- Cyperus papyrus 74.
- Cypresse 575, 674.
- Cypripedium 495.
- Cytisus laburnum etc. 596.
- Dahlie 531.
- Dammarharz 192.
- Datura 288, 555.
- Der el Bahri 221.
- Dianthus 517.
- Digitalis 289, 542.
- Dividivi 147.
- Dracaena draco 143.
- Drachenblut 143.
- Dreifelderwirtschaft 3.
- Drogen 282.
- Ebenholz 718.
- Efeu 612.
- Eibe 585.
- Eibencypresse 574.
- Eibisch 285, 514.
- Eiche 679.
- Eichenrinde 149.
- Eisenholz 721, 738.
- Eisenhut 290, 503.
- Elaeagnus 592.
- Elemiharz 191, 233.
- Engelwurz 291.
- Enzian 290.
- Erdbeere 642.
- Erika 551.
- Erle 590, 696.
- Esche 636, 709.
- Esparsette 24.
- Espartogras 59, 83.
- Eukalyptus 742.
- Euphorbium 324.
- Evonymus 609.
- Fagus 589, 690.
- Färberdistel 139.
- Färberei 114.
- Färbereiche 136.
- Färberochsenzunge 123.
- Farnwurzel 291.
- Fichte 659.
- Ficus elastica 178.
- Fingerhut 289.
- Firnis 193.
- Flachs 33.
- Flieder 637.
- Föhre 665.
- Fraxinus 636, 709.
- Fritillaria 470.
- Fuchsie 556.
- Galläpfel 151, 156.
- Gallustinten 158.
- Gartenkunst 381.
- Geilwurz 295.
- Geißblatt 599.
- Gelbholz 723.
- Gelbwurzel 137.
- Gelsemium 348.
- Georgine 531.
- Gerberei 153.
- Gesnerazeen 509.
- Gingko 587.
- Gladiolen 491.
- Gleditschia 593.
- Glockenblume 516.
- Glycine 598.
- Glycyrrhiza glabra 317.
- Goldlack 506.
- Goldregen 596.
- Gossypium barbadense 94.
- Grabschmuck 579.
- Guajakholz 338.
- Gummi arabicum 320.
- Gummigutt 136, 316.
- Guttapercha 181.
- Haematoxylon campechianum 127.
- Halfa 59, 83.
- Hanf 52.
- Haselstrauch 277, 590.
- Hatschepsut 221.
- Hauswurz 523.
- Henna 123.
- Herbstzeitlose 287.
- Hevea brasiliensis 167.
- Hibiscus 285, 514.
- Holzkohle 659.
- Holzteer 372, 657.
- Honigklee 25.
- Hortensie 550.
- Hyazinthen 473.
- Hybridisation 442.
- Hydrastis 349.
- Hypericum perforatum 274.
- Imhotep 263.
- Immergrün 549.
- Indigo 128, 130.
- Indigo, künstlicher 133.
- Ipecacuanha 344.
- Irideen 488.
- Isatis tinctoria 113, 128.
- Jalapenwurzel 309.
- Jasmin 549, 593, 600.
- Johannisbeeren 601, 643.
- Johanniskraut 274.
- Judasbaum 593.
- Jungfernrebe 610.
- Juniperus 583, 679.
- Jute 63.
- Kakteen 563, 728.
- Kalabarbohne 364.
- Kamille 290, 539.
- Kampfer 237.
- Kapok 67.
- Kapuzinerkresse 559.
- Kastanie 696.
- Katechu 144, 335.
- Kattun 107.
- Kaugummi 184.
- Kaurikopal 197.
- Kautschuk 162.
- Kermeseiche 125.
- Kickxia elastica 175.
- Kiefer 571, 665.
- Kino 336.
- Klee 27.
- Knabenkraut 276.
- Koka 366.
- Kokosnußfaser 71.
- Königskerze 544.
- Kopaivbalsam 332.
- Kopallack 194.
- Korkeiche 683.
- Kornblume 537.
- Kränze 433.
- Krapp 120.
- Krotonöl 316.
- Kubebenpfeffer 333.
- Kühn, Julius 8.
- Kusso 373.
- Lacke, japanische 208.
- Larix 572, 670.
- Lathyrus 23.
- Laurus 602.
- Lebensbaum 581.
- Lederfabrikation 153.
- Lein 32.
- Levisticum 545.
- Levkojen 505.
- Lilie 469.
- Linde 632, 712.
- Linum 32.
- Lonicera 599.
- Lorbeer 602.
- Lotosblume 425.
- Lupine 21.
- Luzerne 18.
- Lyceum europaeum 593.
- Lychnis 520.
- Magnolie 613.
- Mahagoni 723.
- Maiglöckchen 481.
- Malven 513.
- Mandragora 279.
- Mangabeira 171.
- Mangroven 149.
- Manilahanf 54.
- Mastix 190, 623.
- Maulbeerbaum 717.
- Mäusedorn 485.
- Medicago 18.
- Mehltau 746.
- Mekkabalsam 230, 329.
- Melilotus 25.
- Melisse 293, 545.
- Melone 740.
- Mesquite 737.
- Mimosa pudica 595.
- Mistel 277, 649.
- Mohn 299, 505.
- Moschus 259.
- Musa textilis 54.
- Mutterkorn 294.
- Myrrhe 211, 327.
- Myrte 605.
- Nachtkerze 557.
- Nachtviole 505.
- Nadelhölzer 657.
- Narde 261.
- Narzisse 486.
- Nelke 517.
- Nelumbium speciosum 426.
- Nesseltuch 65.
- Nießwurz 287.
- Nußbaum 695.
- Nußfichte 736.
- Nymphaea lotus 425.
- Oleander 620.
- Opium 299.
- Opopanax 325.
- Opuntie 729.
- Orchideen 494.
- Orth Alb. 10.
- Oxalis tuberosa 513.
- Paeonia 502.
- Palaquium gutta 181.
- Panamapalme 73.
- Papaver somniferum 299.
- Papierfabrikation 80.
- Pappel 591, 698.
- Papyrus 74.
- Paradies 387.
- Parfümfabrikation 248.
- Passifloren 561.
- Patschuli 257.
- Pawlonia 620.
- Pelargonien 511.
- Pernambukholz 127, 722.
- Perubalsam 330.
- Petunie 558.
- Pfefferminze 292.
- Pfriemengras 58.
- Phaseolus 560.
- Phlox 562.
- Phormium tenax 483.
- Piassave 69.
- Picea 569, 659.
- Pilze 743.
- Pinus 571, 665.
- Pistacia lentiscus 190, 623.
- — therebinthus 189, 624.
- Platane 628, 707.
- Podophyllin 341.
- Populus 591, 699.
- Portulak 522.
- Primula 523.
- Prosopis 736.
- Prunus 614.
- Punt 220.
- Purpur 114, 135.
- Quassiaholz 340.
- Quebracho 395.
- Quendel 239.
- Quercusarten 681.
- Quercus coccifera 125.
- — tinctoria 136.
- Quillaia 350.
- Ramie 64.
- Raphiapalme 70.
- Ratanhiawurzel 336.
- Raute 273.
- Renntierflechte 298.
- Reseda 510.
- Rhabarber 305, 516.
- Rhamnus 608.
- Rheum officinale 305.
- — undulatum 516.
- Rhododendron 552.
- Rhus 617.
- Ribes 602, 644.
- Rizinusöl 303.
- Robinia 594, 717.
- Röhrenkassie 315.
- Rosen 444.
- Rosenholzbaum 722.
- Rosenöl 252, 452.
- Rosmarin 293, 546.
- Roßkastanie 625.
- Rostpilz 744.
- Rotang 89.
- Rotholz 127, 722.
- Rubia tinctorum 120.
- Rubus 641.
- Runen 278.
- Ruscus aculeatus 485.
- Ruta graveolens 511.
- Sabadill 375.
- Sabäer 219, 231.
- Safran 138.
- — als Zierblume 492.
- Sago, wilder 733.
- Salbei 542.
- Salben 241.
- Salepknolle 295.
- Salix 699.
- Salomo 224, 274.
- Salomonssiegel 275.
- Sambucus 600, 640.
- Sandarak 193.
- Sandarakcypresse 674.
- Sandelholz 236.
- Sandelholzöl 334.
- Saponaria 521.
- Sarsaparillwurzel 337.
- Sauerklee 513.
- Scammonium 340.
- Schellack 205.
- Schellkraut 272.
- Schminke 160.
- Schneeglöckchen 485.
- Schraubenbohne 736.
- Schwertlilie 488.
- Scilla 476.
- Secale cornutum 294.
- Seegras 60.
- Seerose 425.
- Seidenbaumwolle 67.
- Seifenkraut 521.
- Senegawurzel 350.
- Senf 376.
- Sennesblätter 313.
- Shepherdie 592.
- Siegwurz 276.
- Simarubarinde 360.
- Sisalhanf 56.
- Smilax aspera 484.
- Sotol 734.
- Springwurz 274.
- Stechapfel 288, 555.
- Stechwinde 484.
- Stiefmütterchen 508.
- Strophantus 363.
- Strychnin 361.
- Styrax 234, 334.
- Sumach 148, 617.
- Sumatrakampfer 237.
- Sumpfcypresse 678.
- Süßholz 317.
- Tamarinde 314.
- Tamariske 639.
- Tanghinpflanze 364.
- Tannen 569, 654.
- Tausendguldenkraut 296.
- Taxus 585.
- Tectona grandis 726.
- Terpentin 187, 371, 657.
- Teufelsdreck 326.
- Thaer, Albr. 6.
- Theriak 261, 302.
- Thuja 581.
- Thymian 293.
- Tiekholz 726.
- Tollkirsche 289.
- Tolubalsam 331.
- Tonkabohne 260.
- Tradescantien 493.
- Tragantgummi 319.
- Trollblume 502.
- Tropacolum 559.
- Tuberose 481.
- Tulpe 471.
- Tulpenbaum 613.
- Türkenbund 470.
- Ulme 633, 716.
- Vanillin 260.
- Veilchen 506.
- Verbascum 544.
- Verbenen 547.
- Veronica 545.
- Versailles 413.
- Viola odorata 506.
- Wacholder 278, 583, 679.
- Waid 113, 128.
- Waidbau 656.
- Weide 699.
- Weihrauch 210, 214, 327.
- Wermut 296.
- Wiesenkultur 14.
- Wiesenplatterbse 23.
- Wohlgerüche 240.
- Wurmsamen 292.
- Ylang-Ylang 258.
- Yucca gloriosa 483.
- Zinnia 537.