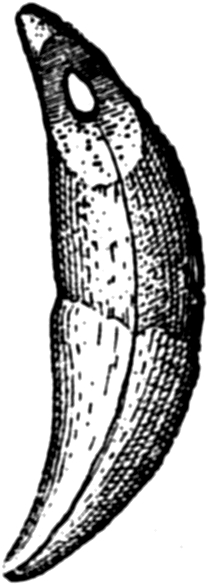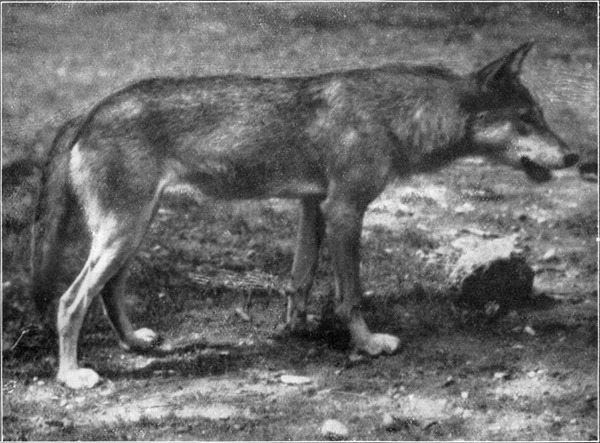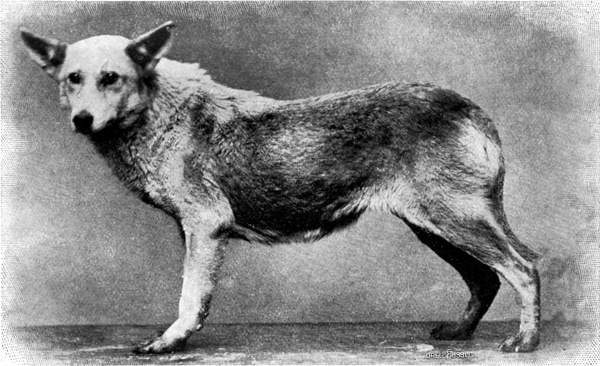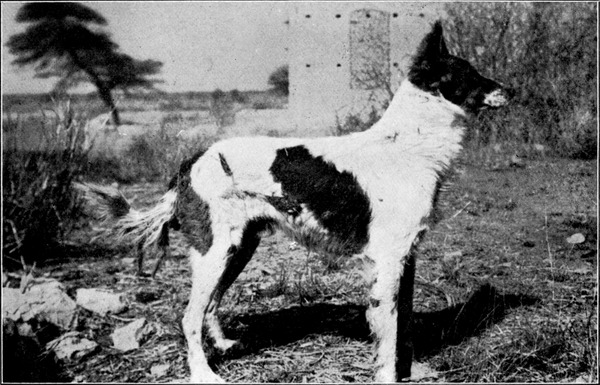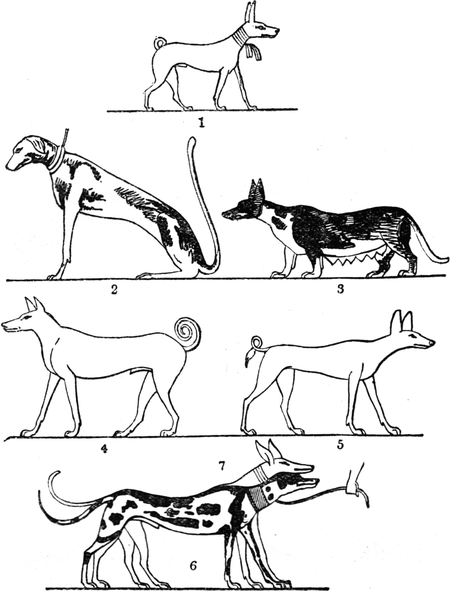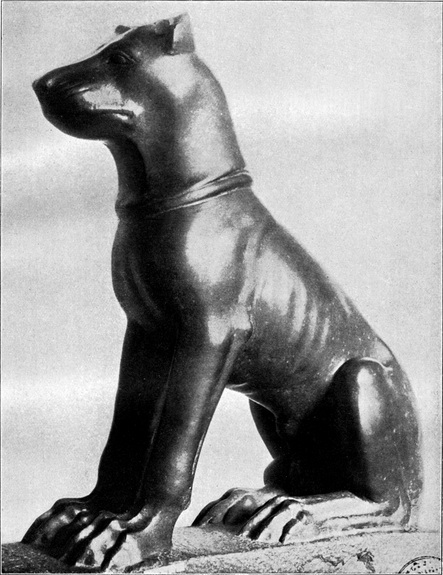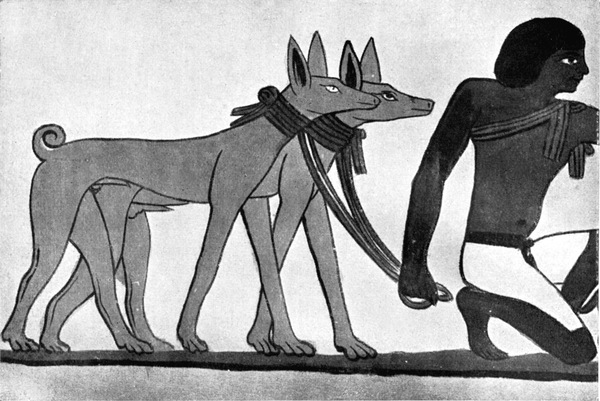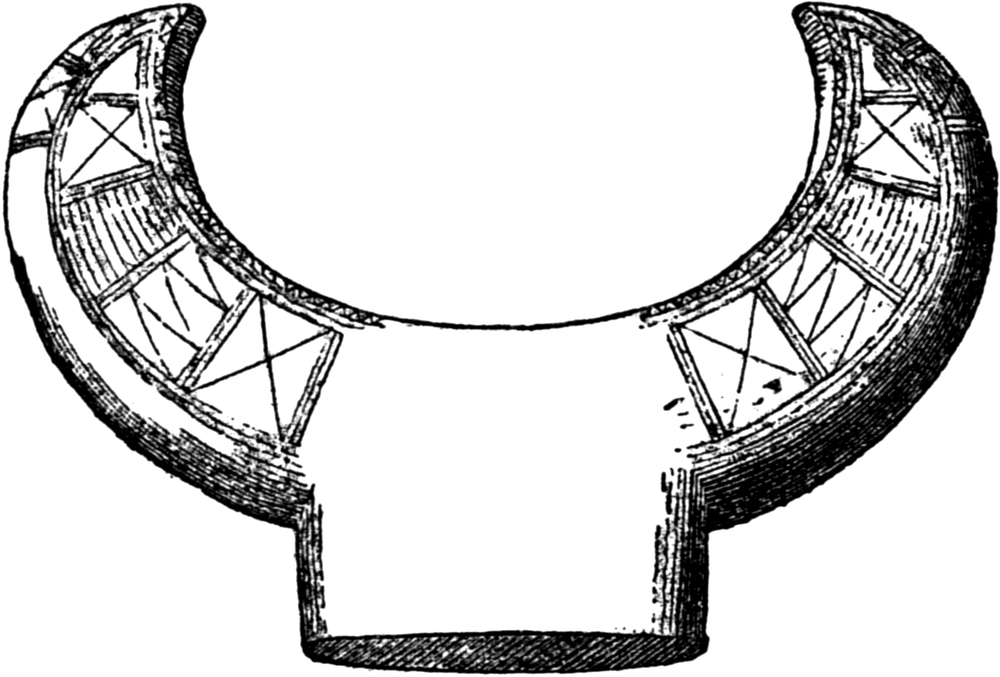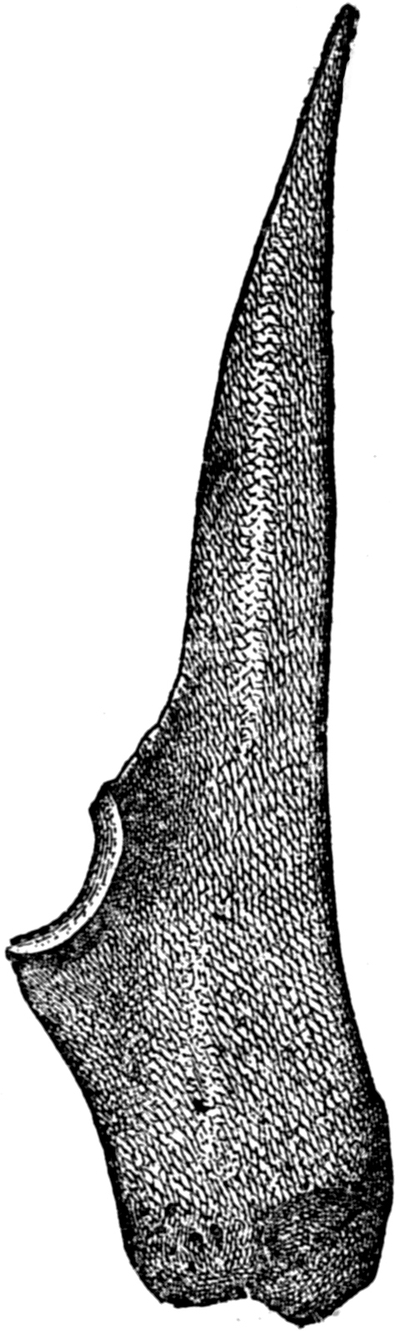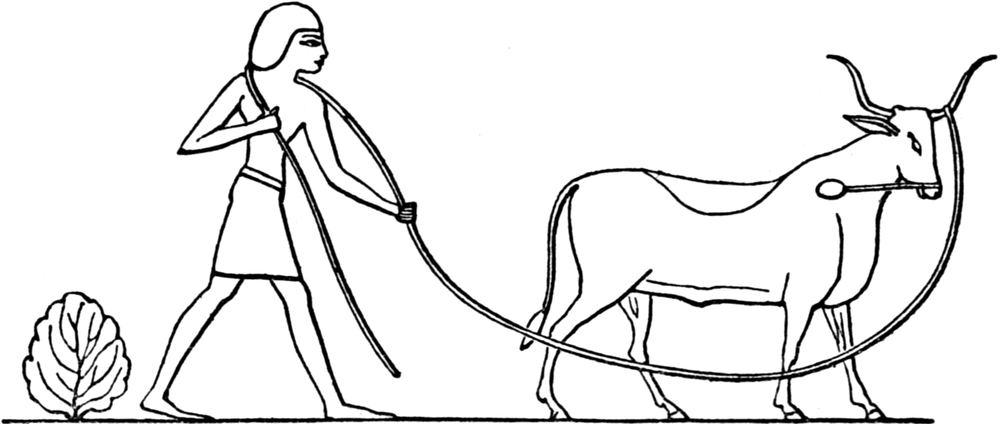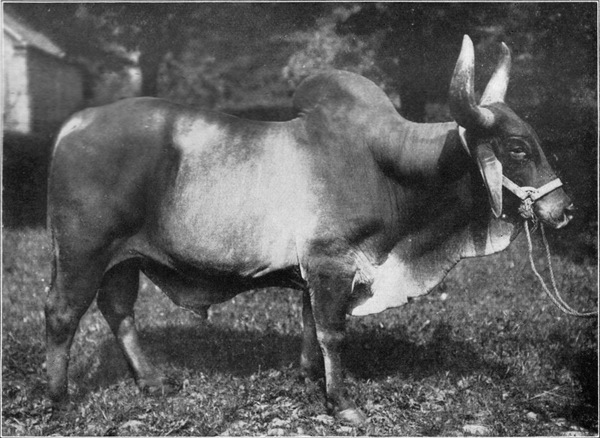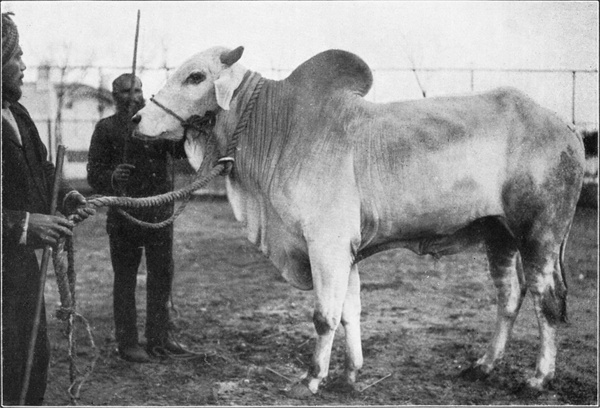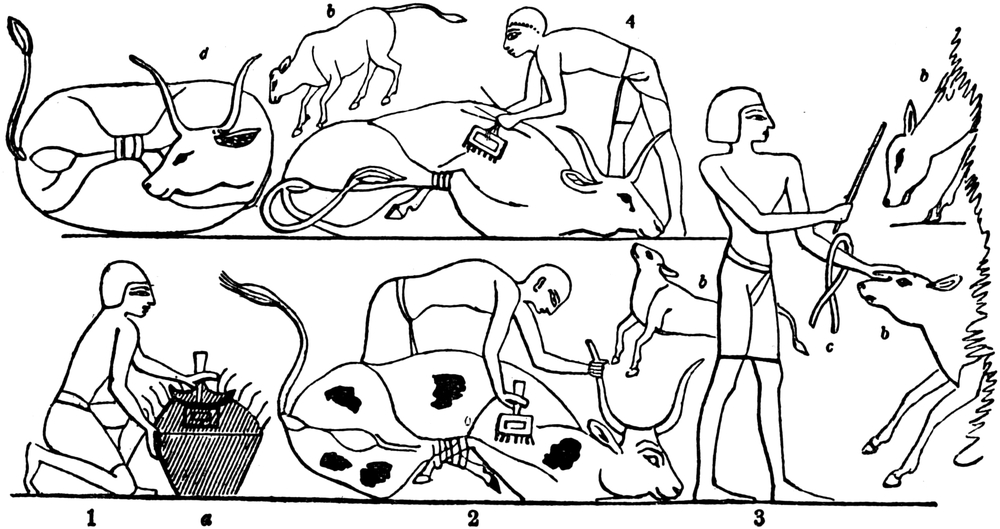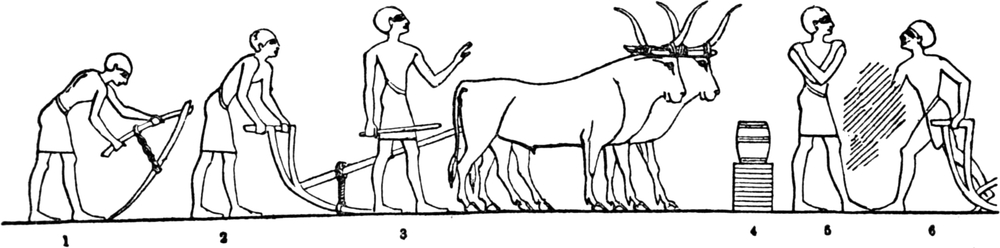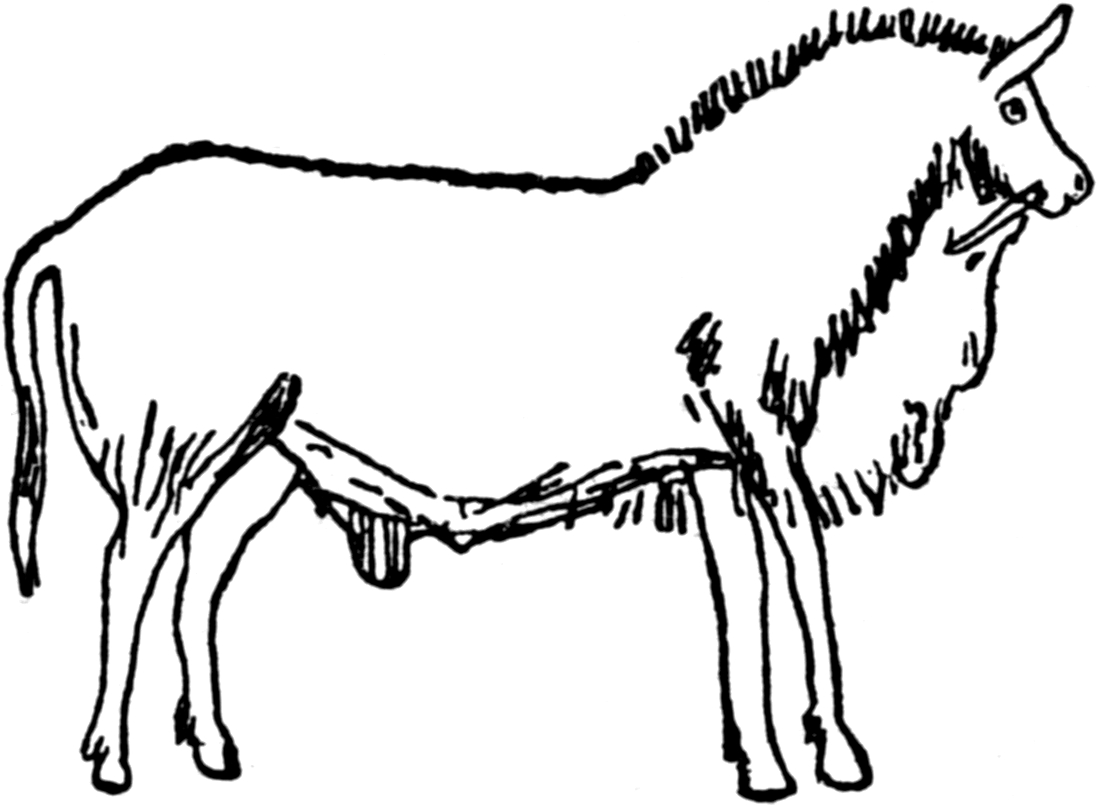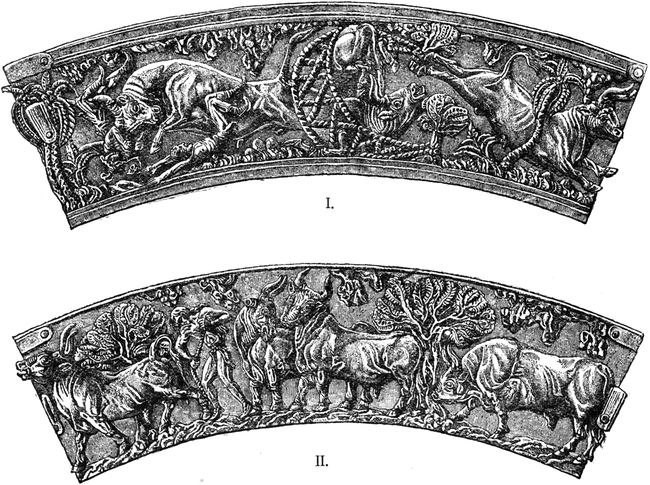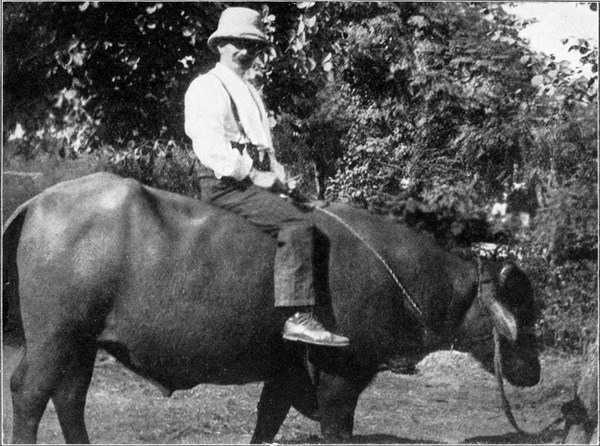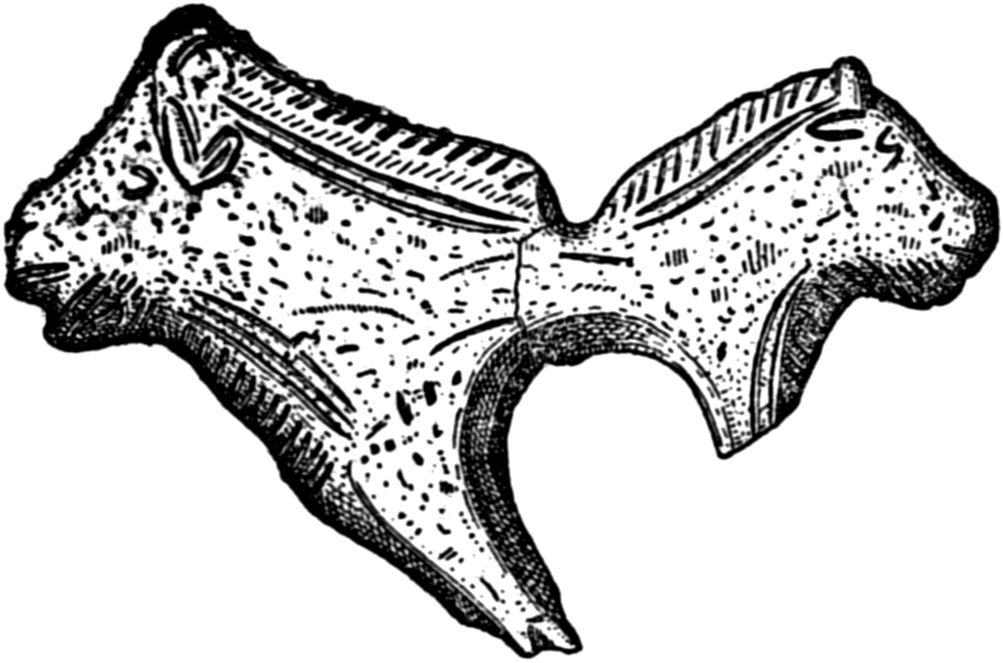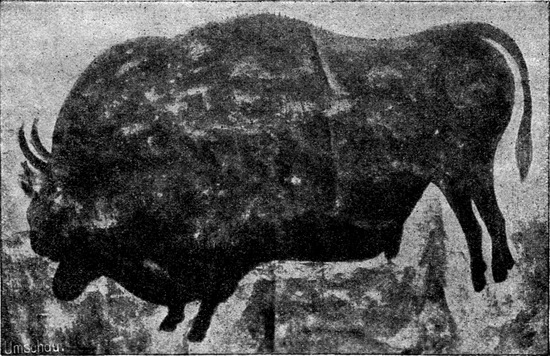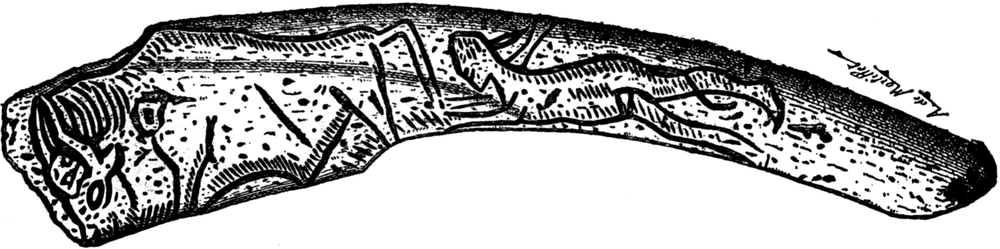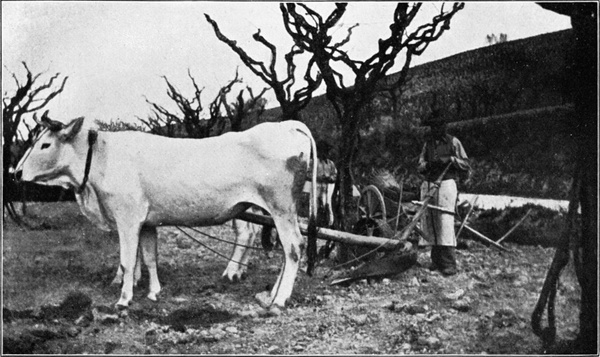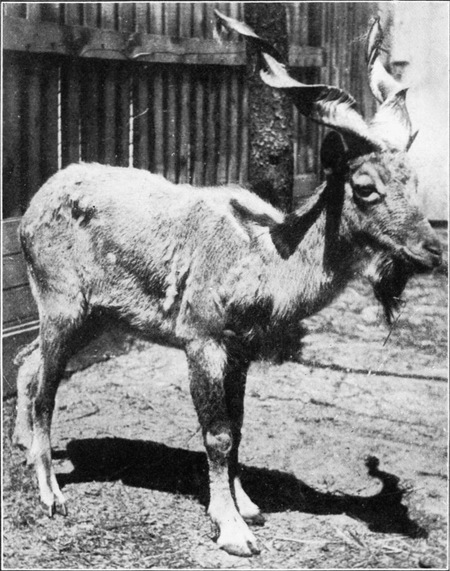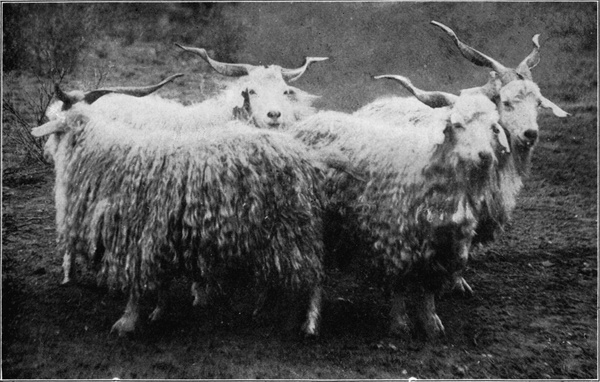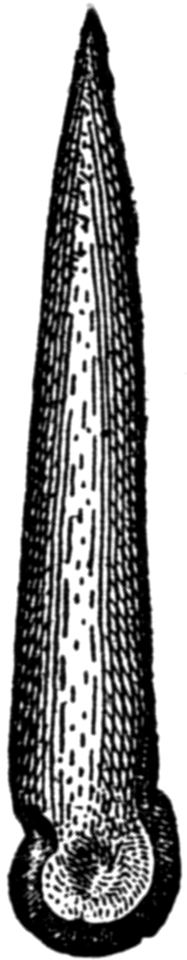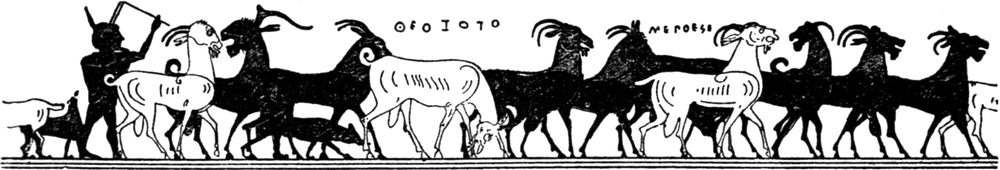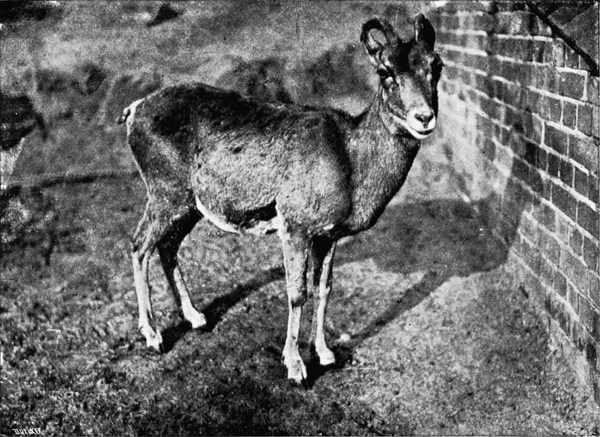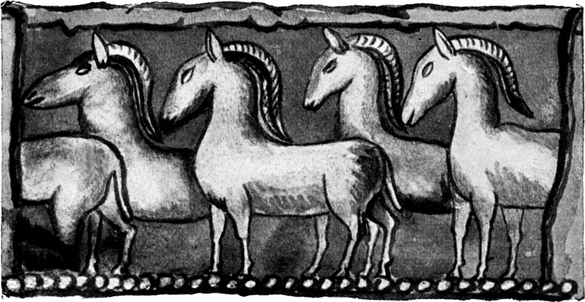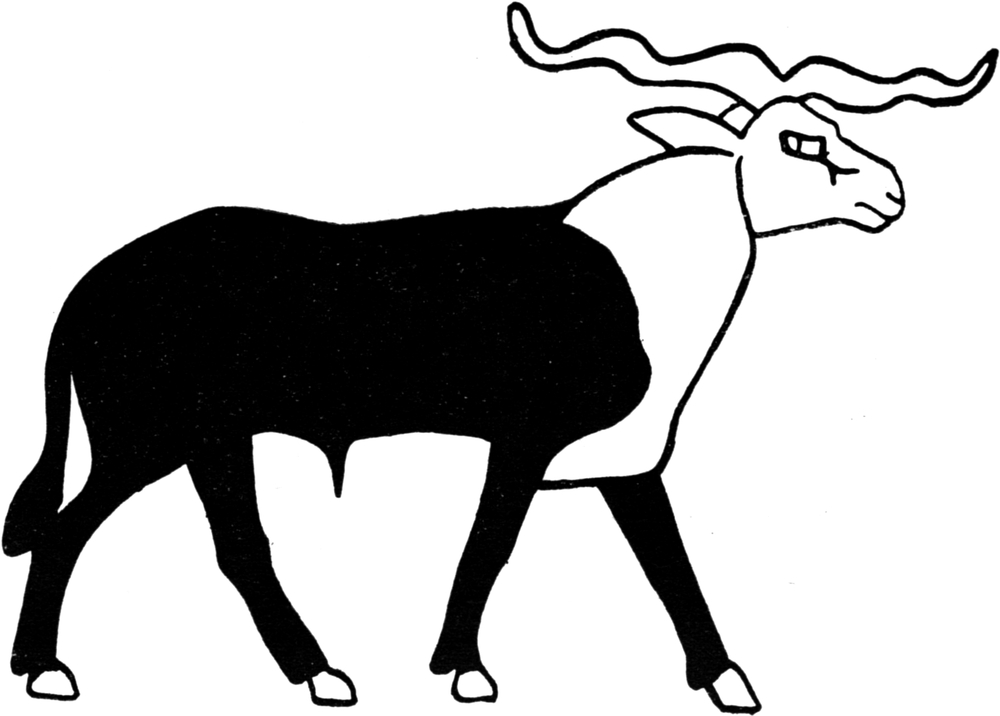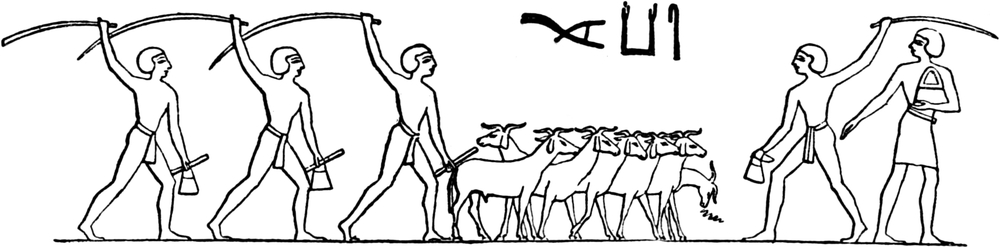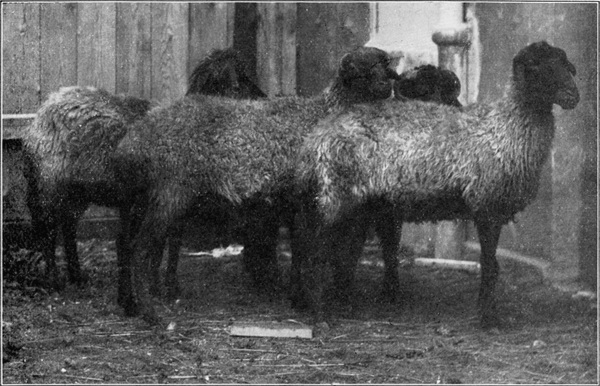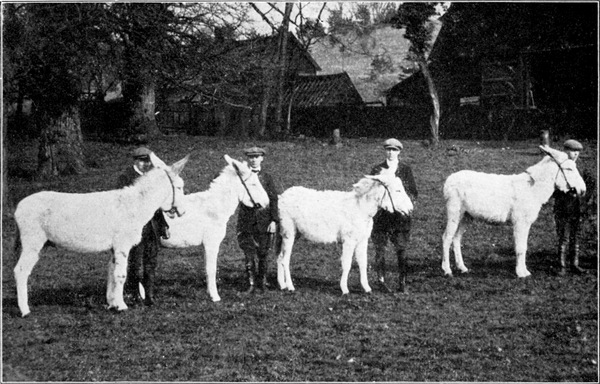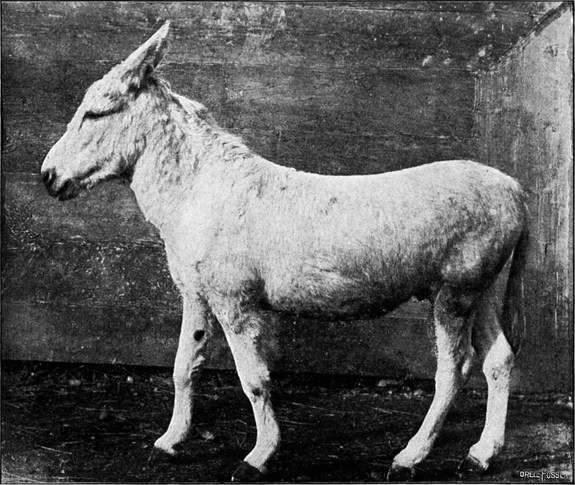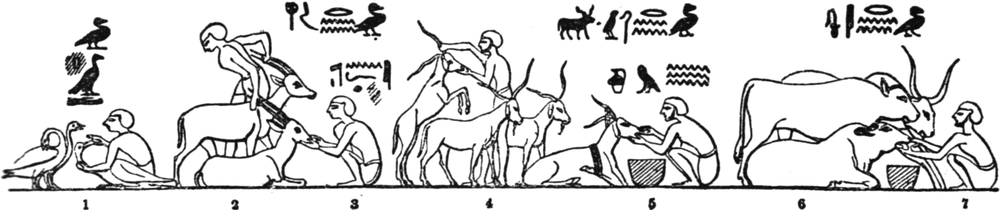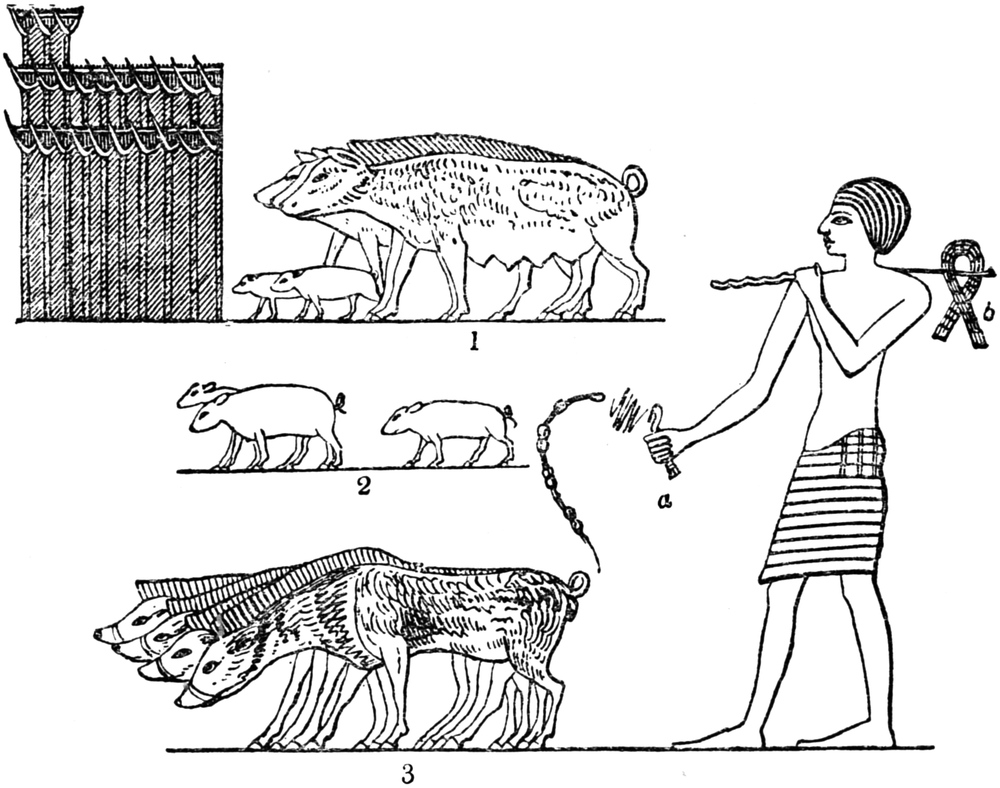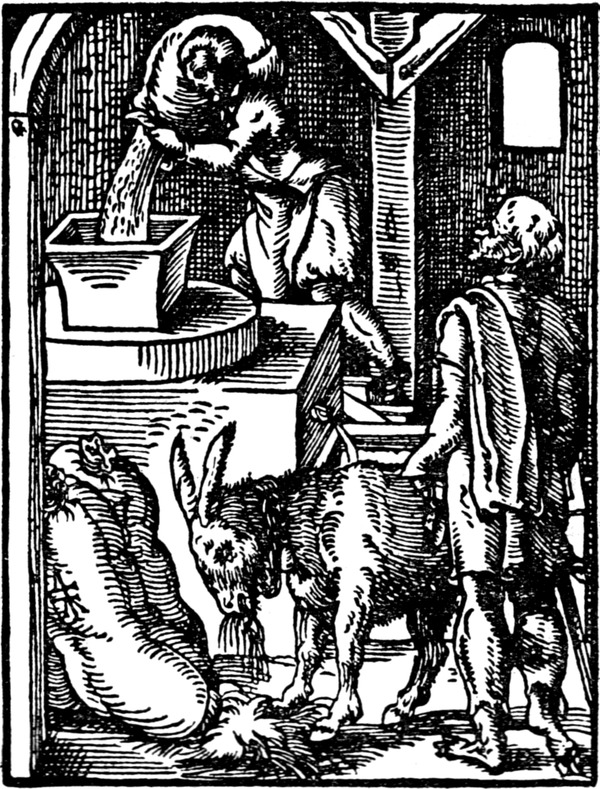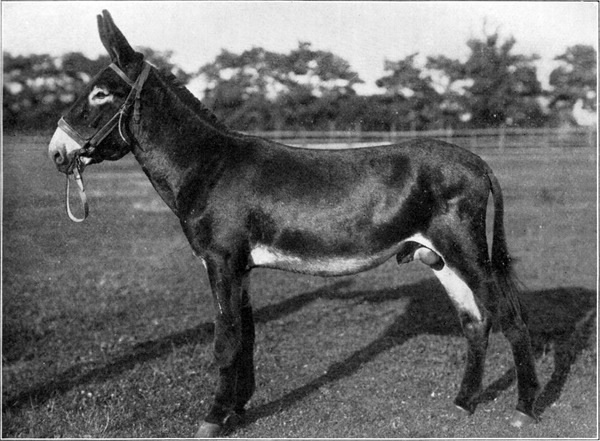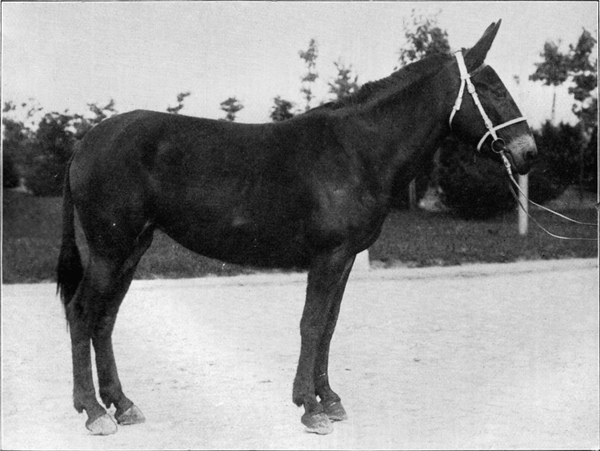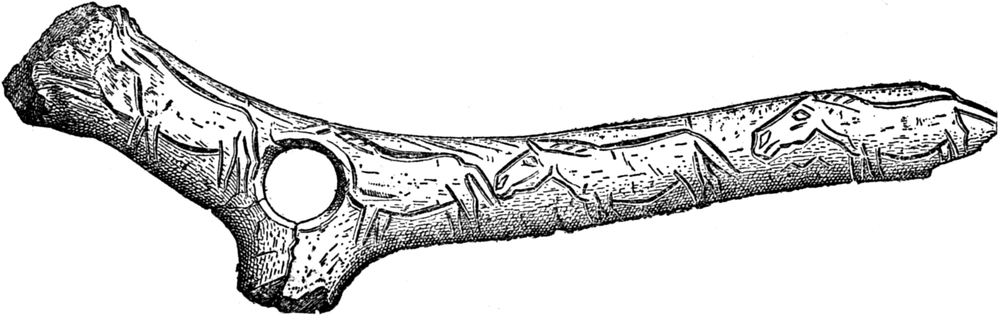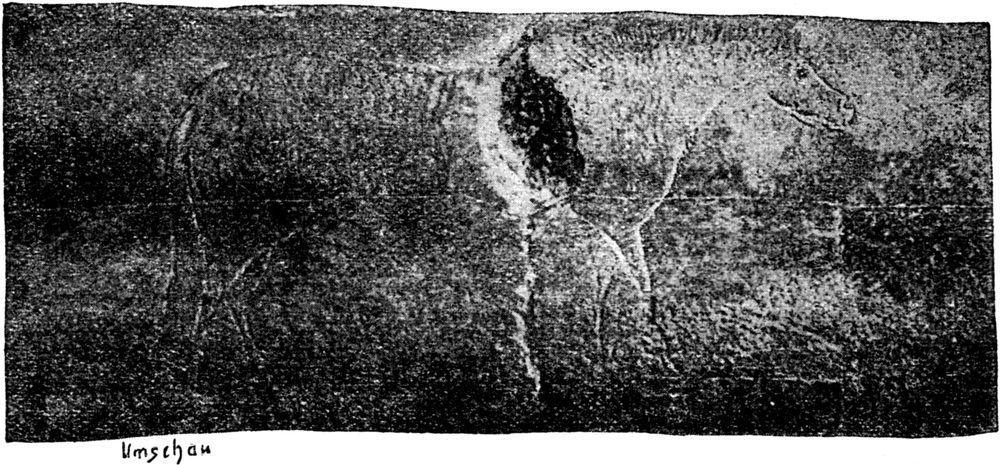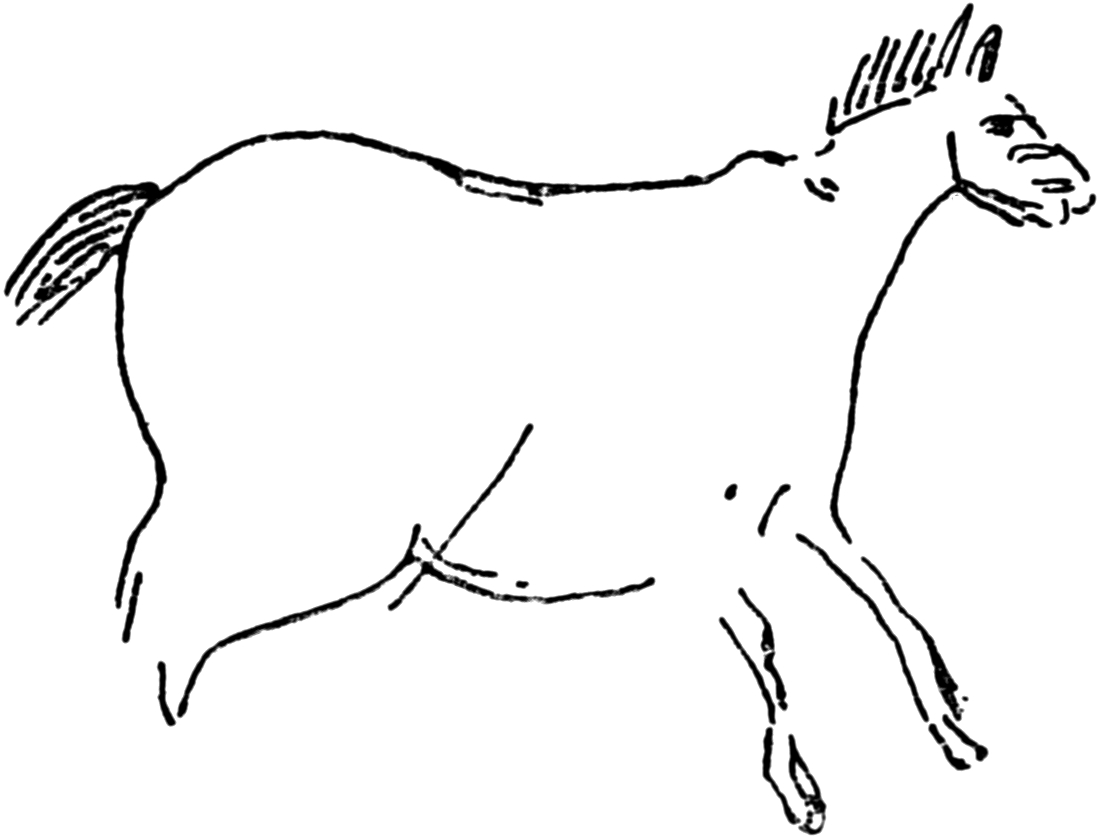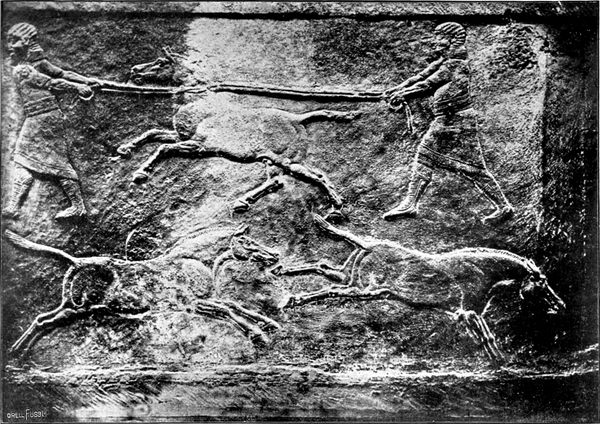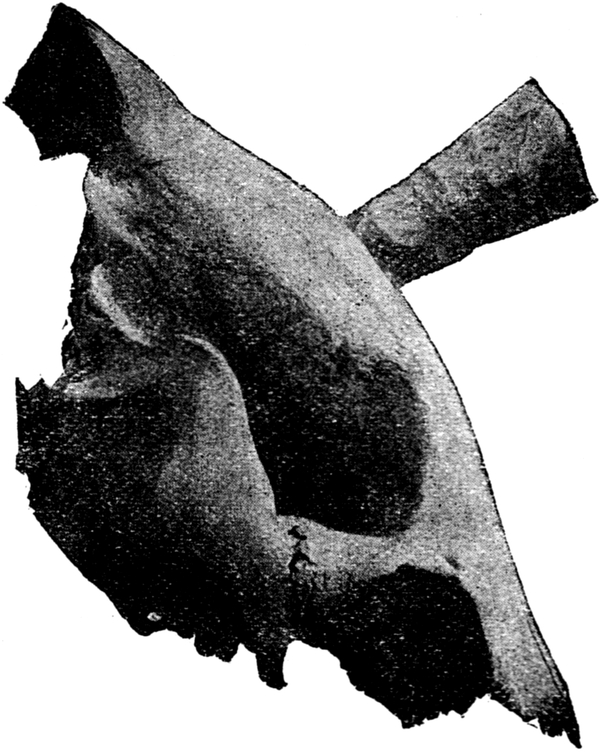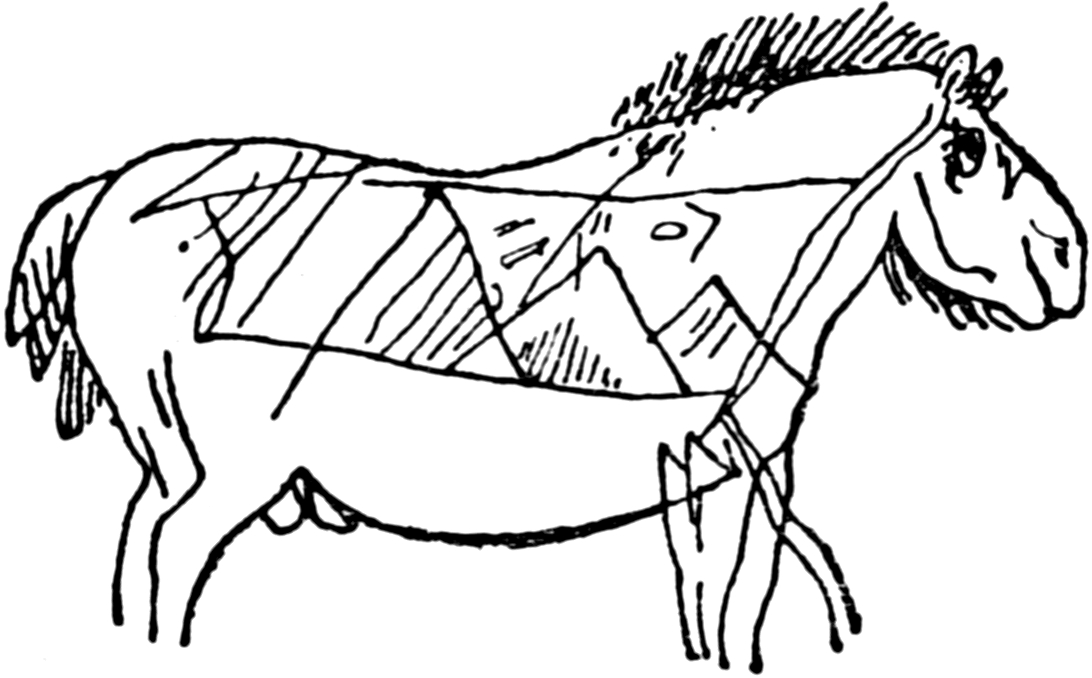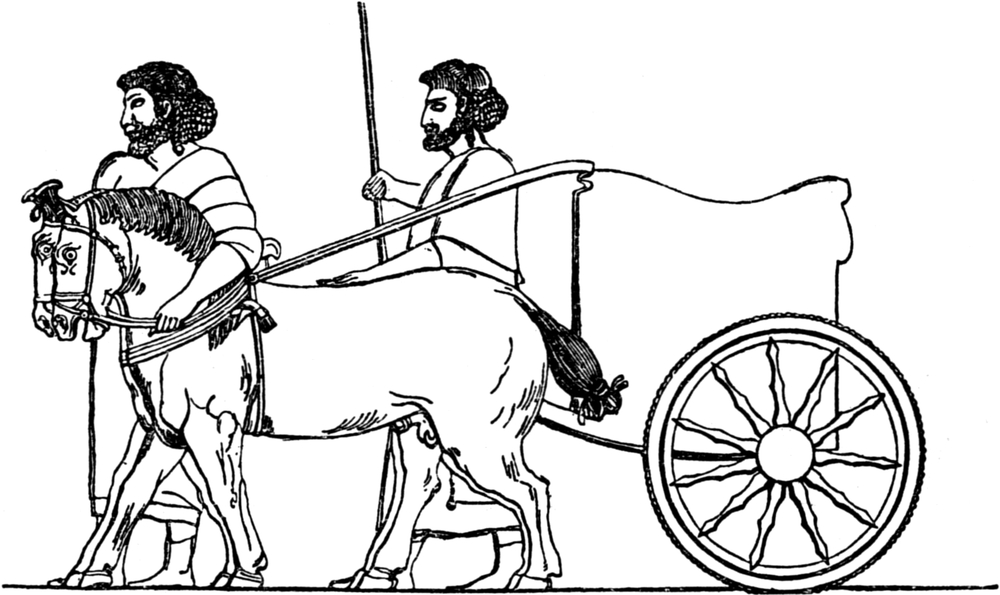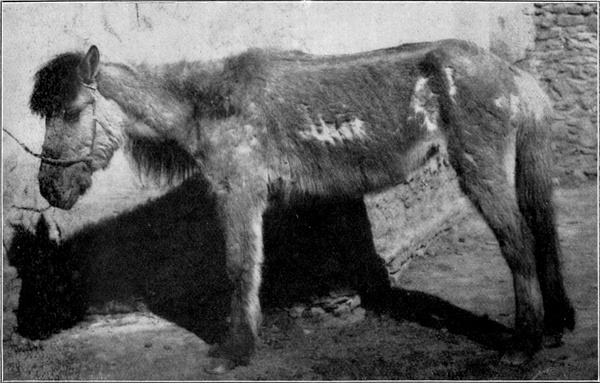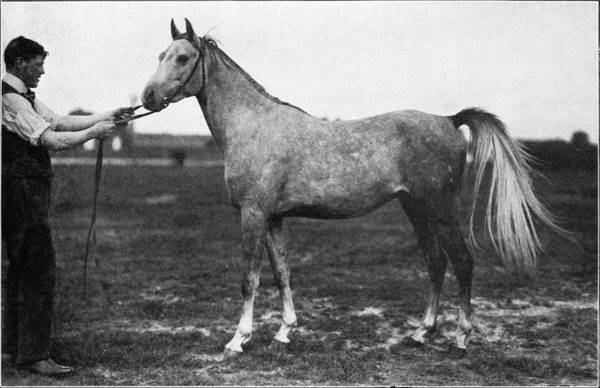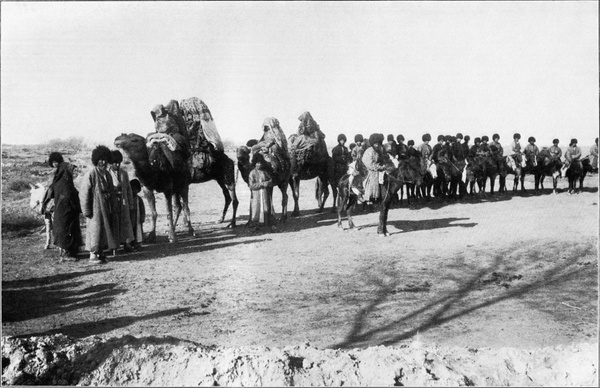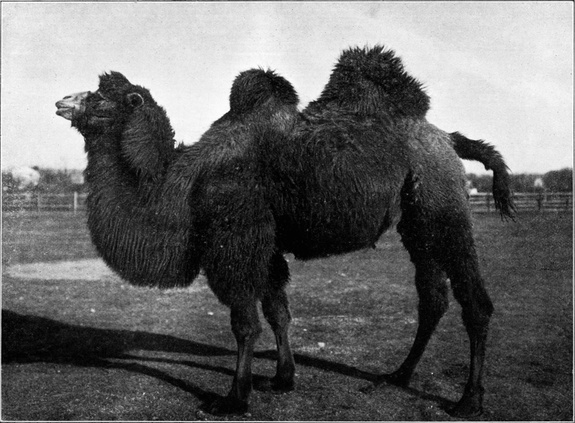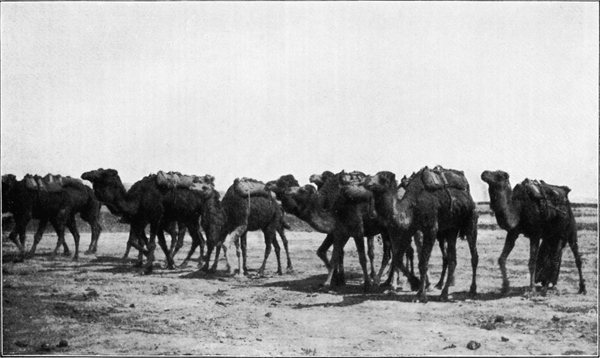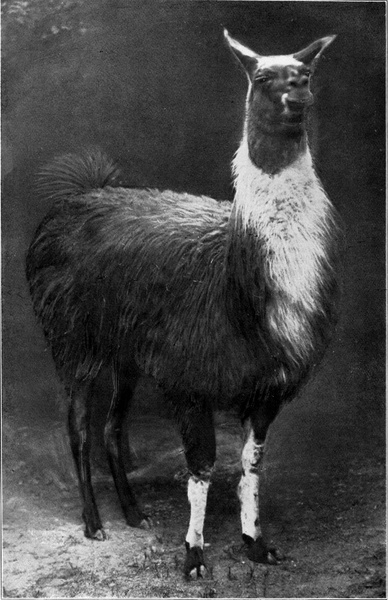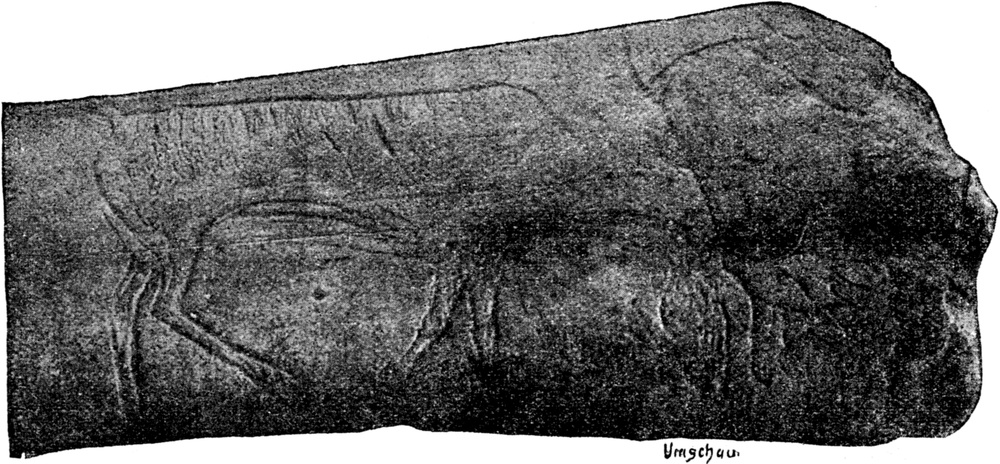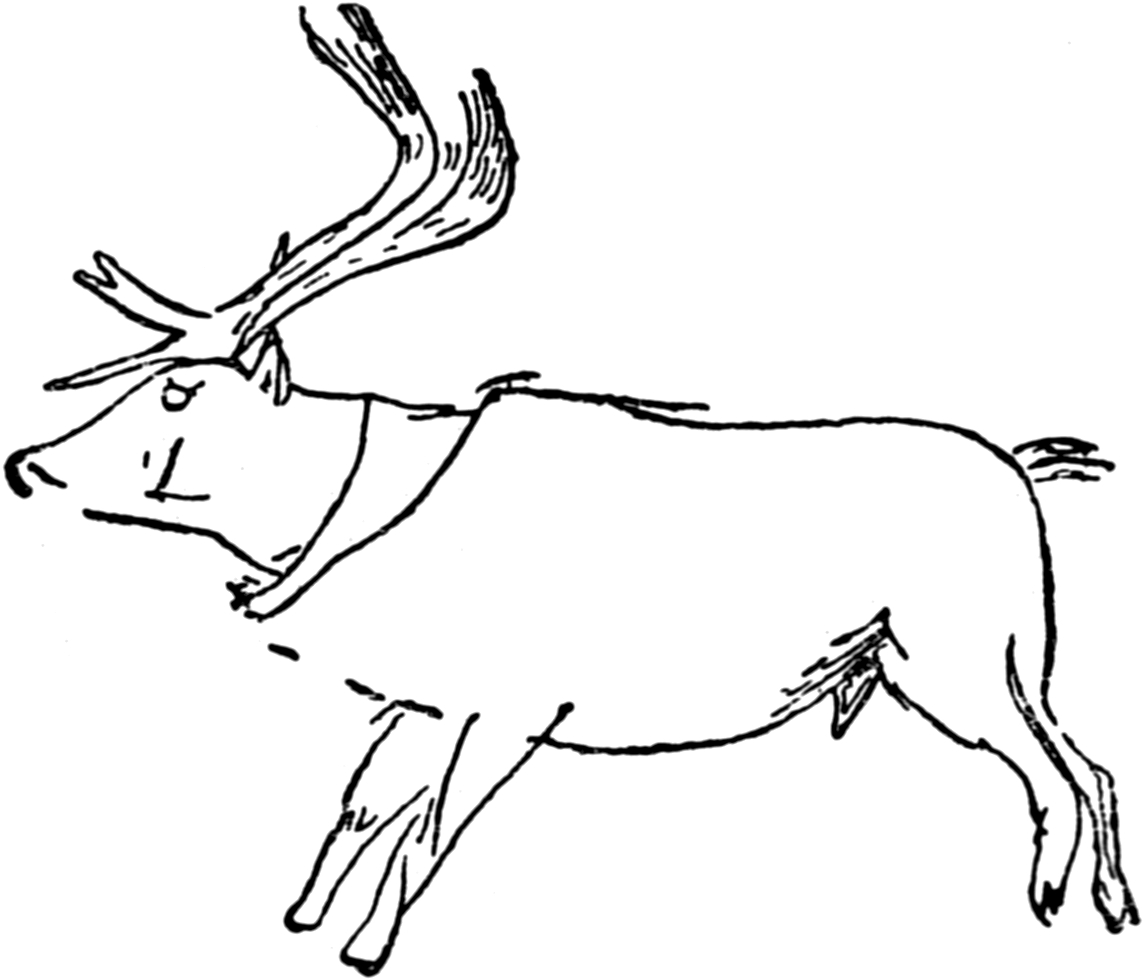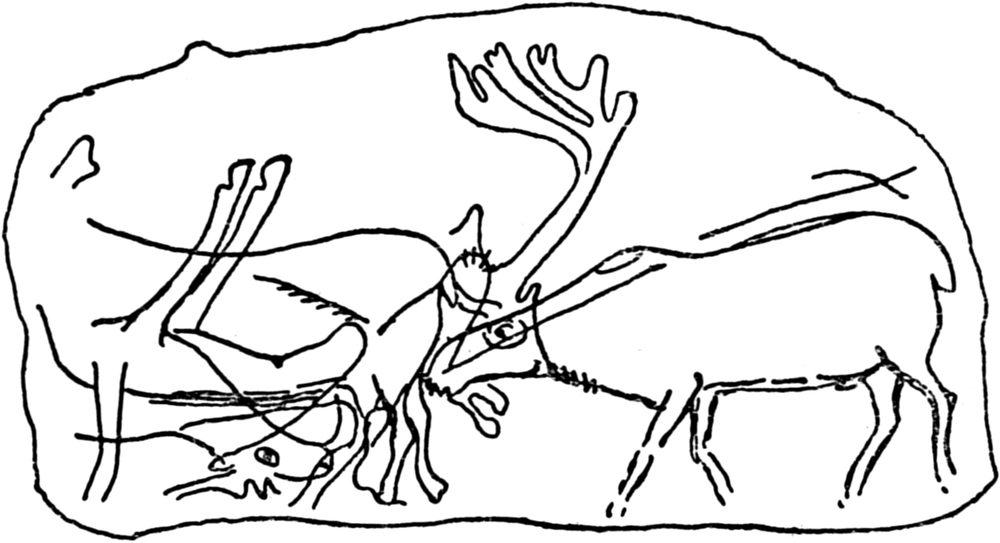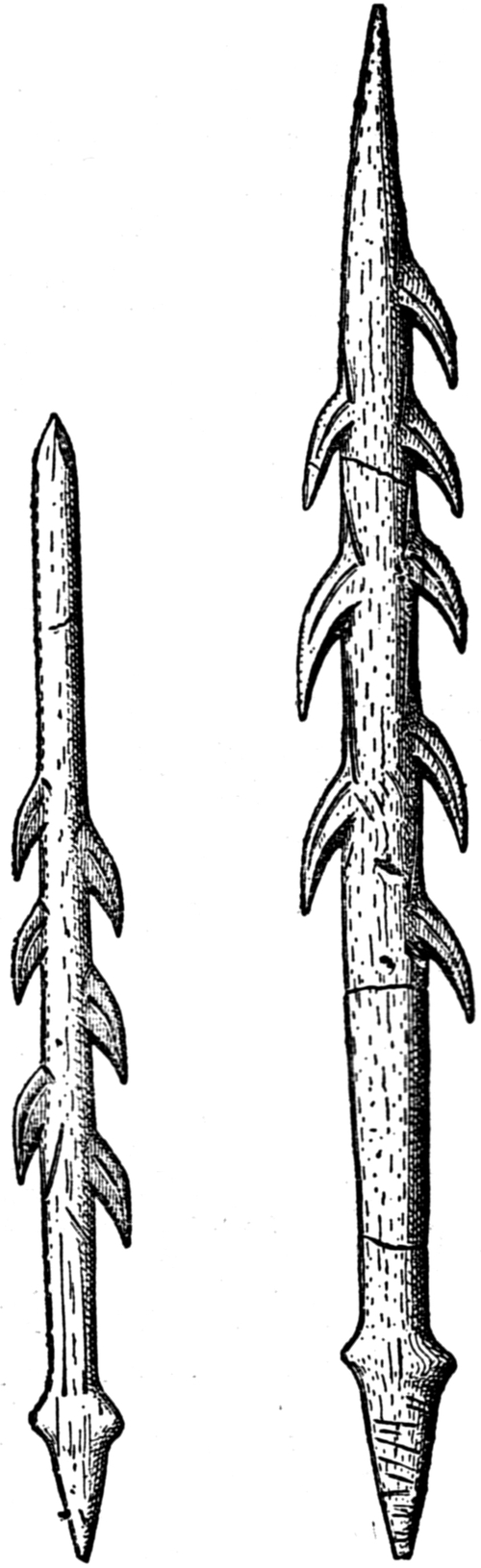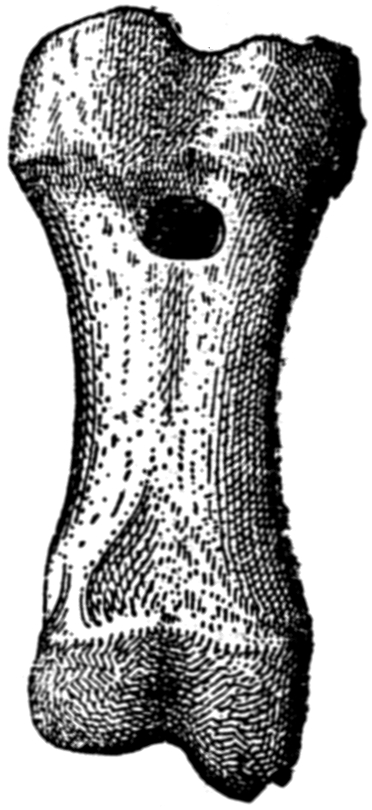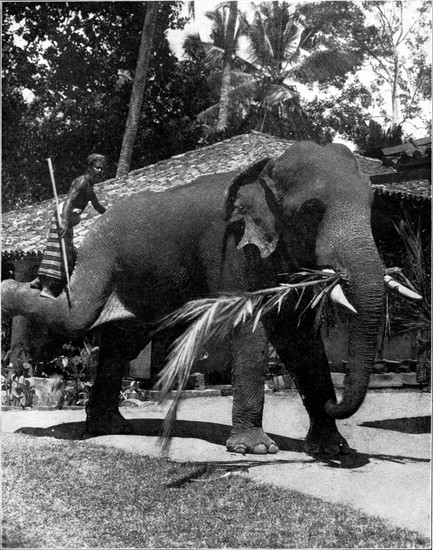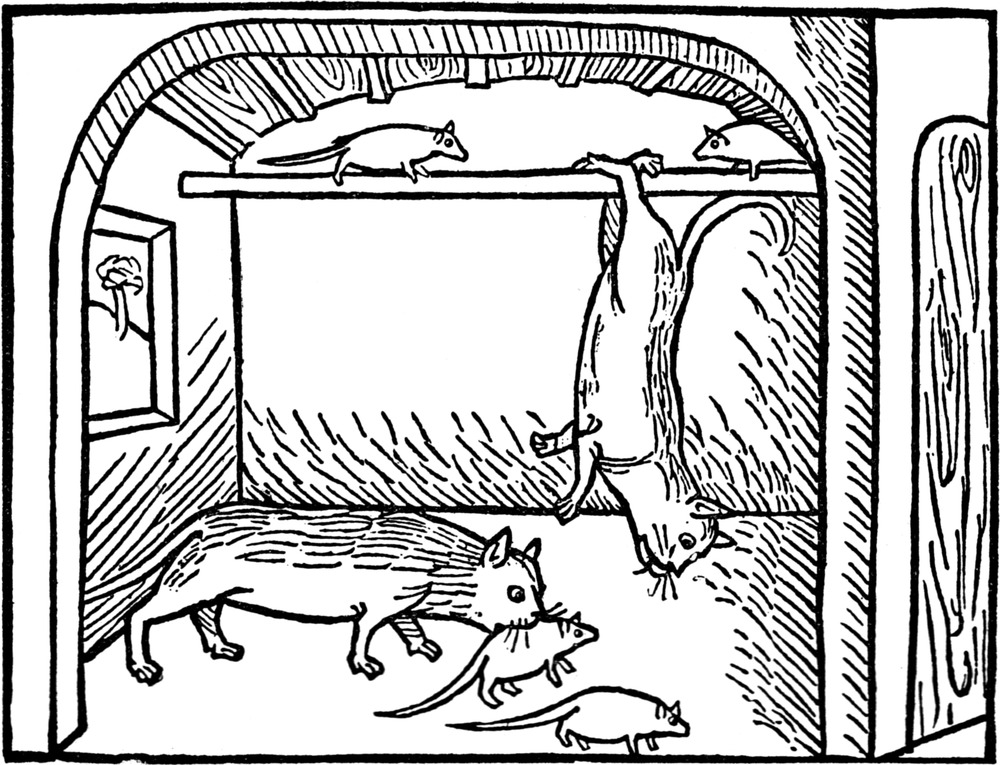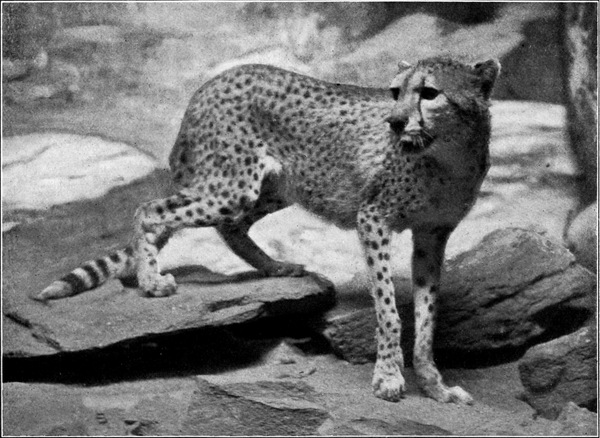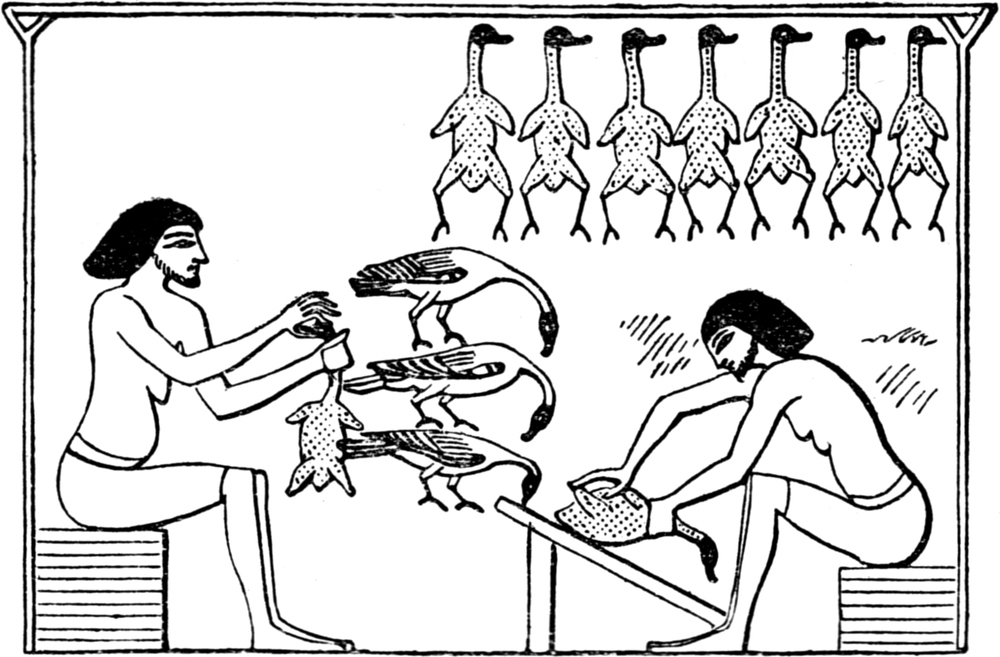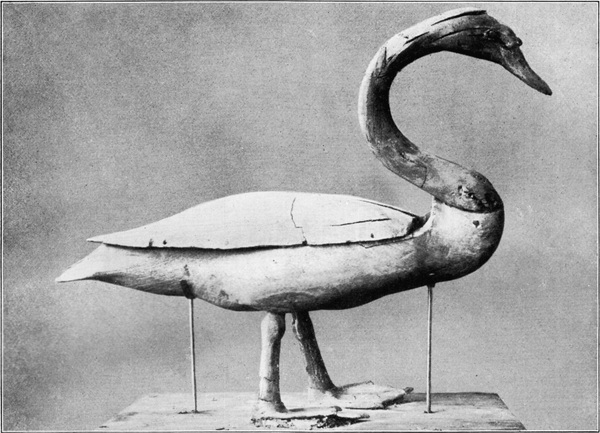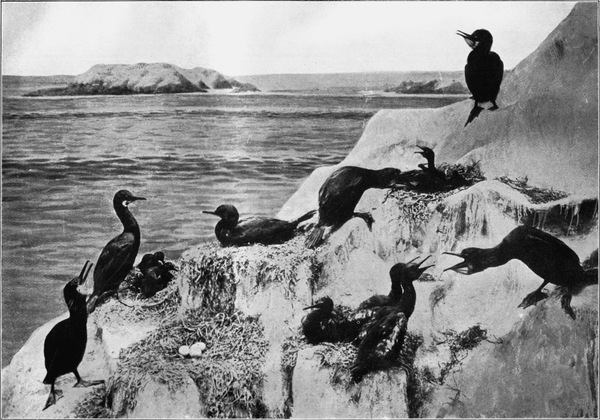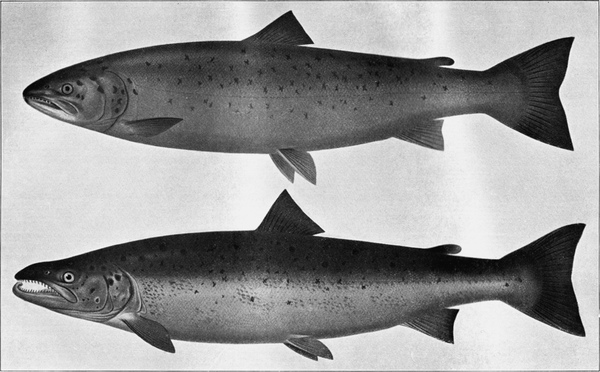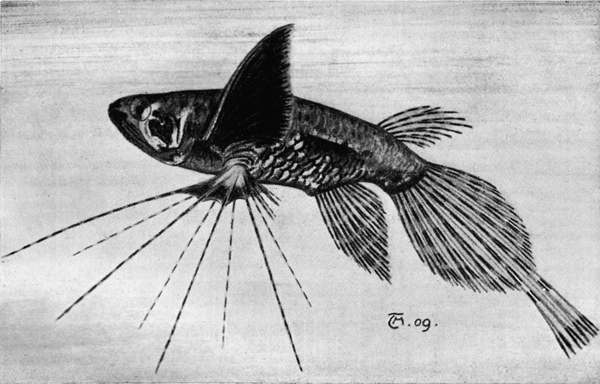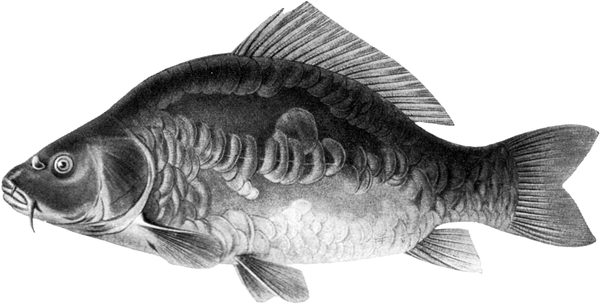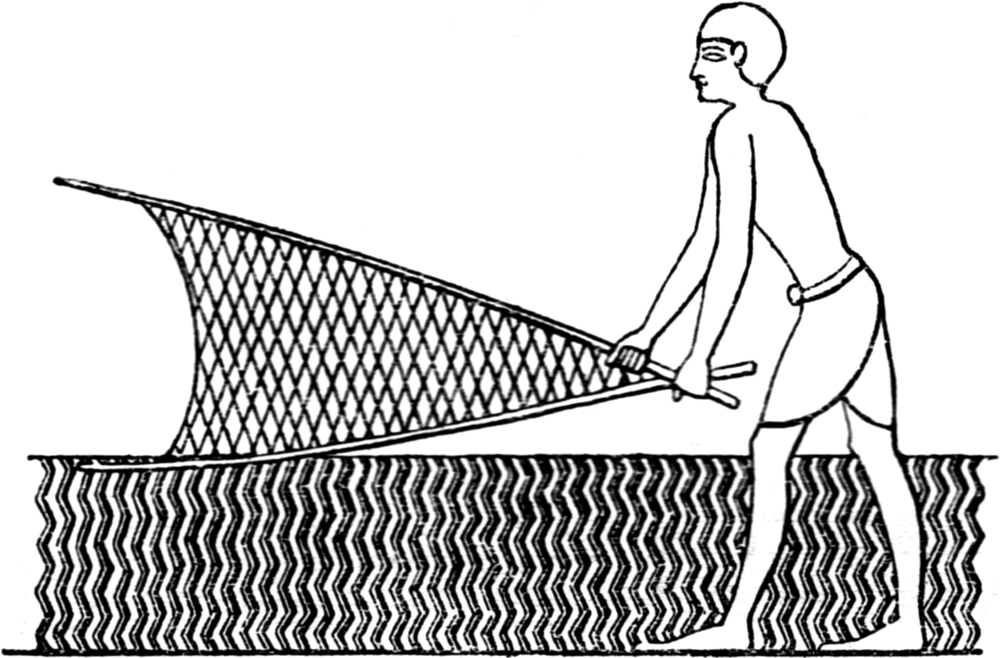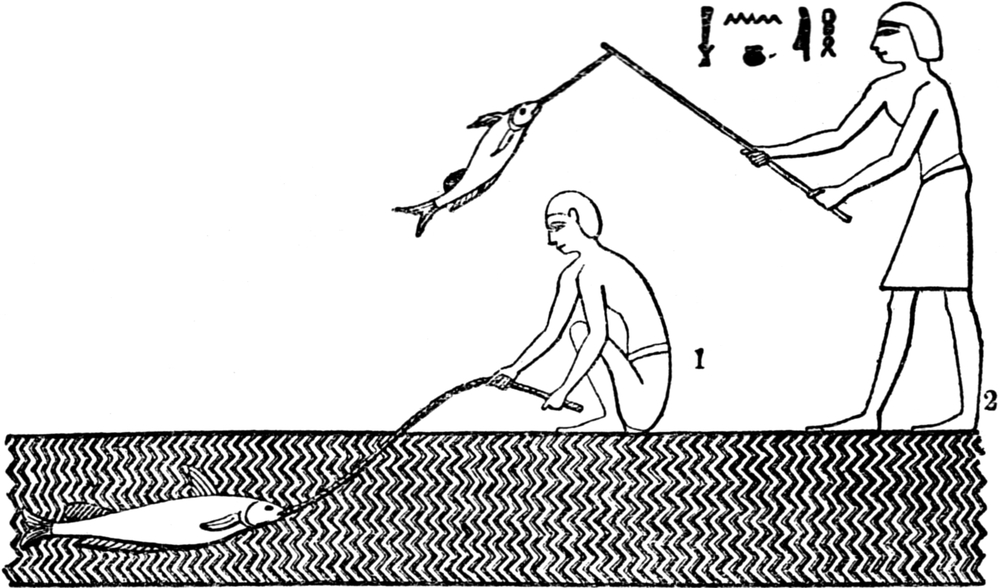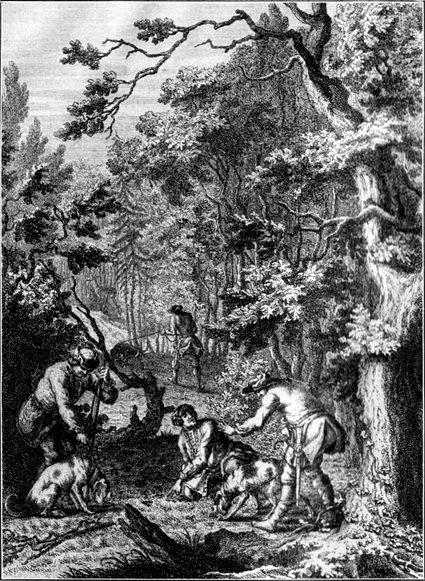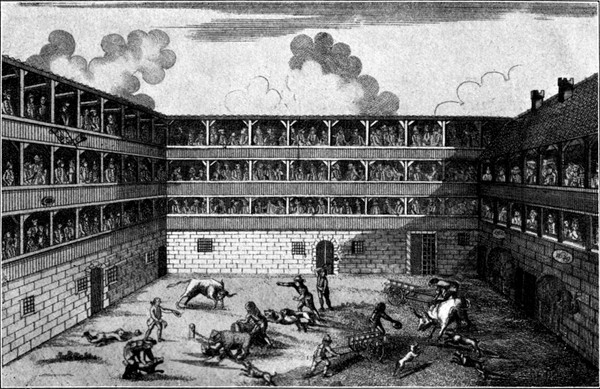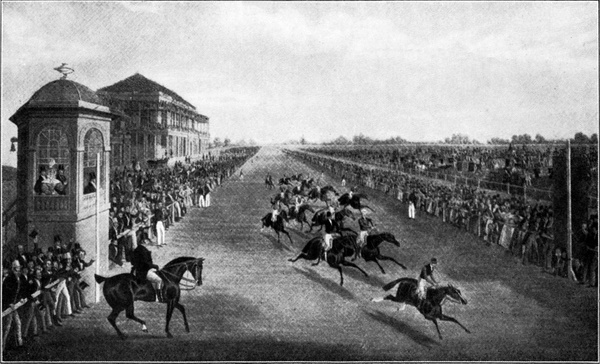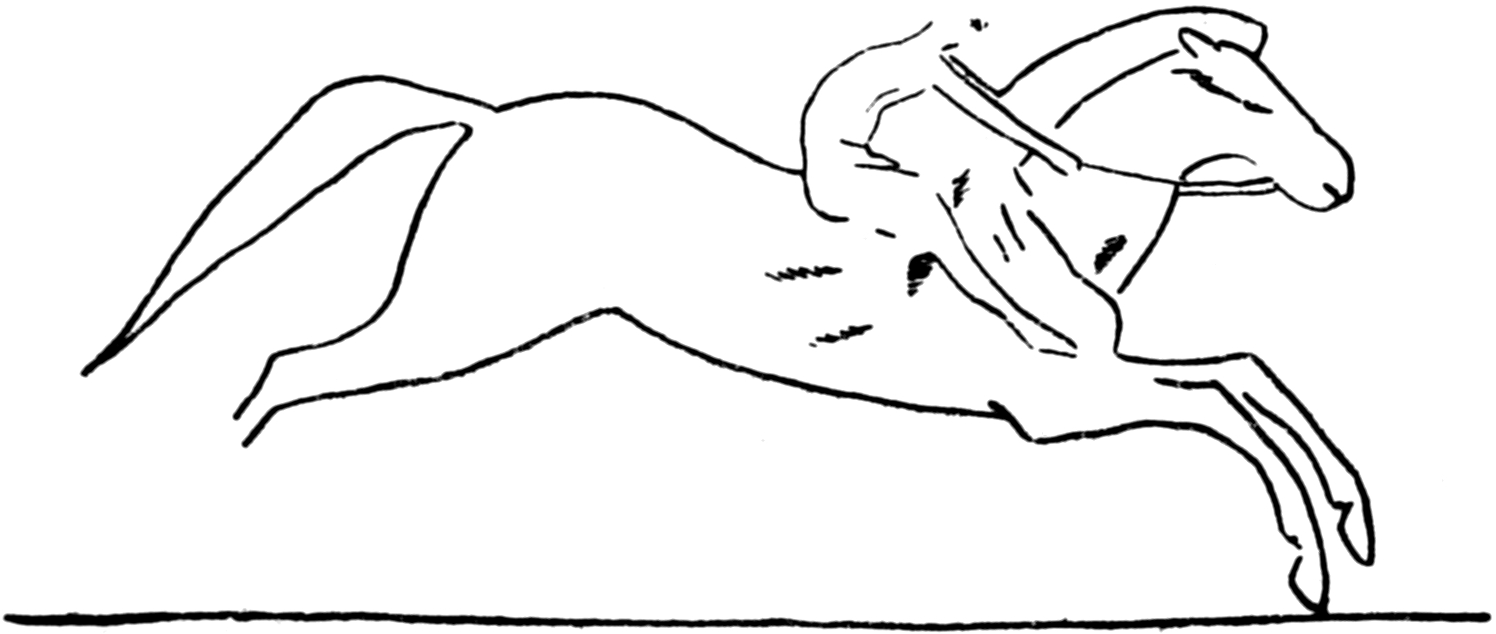Anmerkungen zur Transkription
Der vorliegende Text wurde anhand der 1912 erschienenen
Buchausgabe so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben.
Typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert;
Rechtschreibvarianten wurden nicht vereinheitlicht, sofern die
Verständlichkeit des Textes dadurch nicht berührt wird. Fremdwörter
und Transliterationen (vorwiegend aus dem Griechischen) wurden weder
korrigiert noch vereinheitlicht.
Die Abbildungen wurden gegebenenfalls zwischen die
Absätze verschoben, um den Textfluss nicht zu beeinträchtigen. Einige
Bildtafeln enthalten mehrere Abbildungen.
Die gedruckte Fassung wurde in einer Frakturschrift
gesetzt, in der die Großbuchstaben I und J identisch sind; die Auswahl
in der vorliegenden Ausgabe erfolgte daher mitunter willkürlich. Im
Sachregister wird nunmehr zwischen den
Begriffen mit den Anfangsbuchstaben I und J unterschieden, was im
Original nicht möglich war.
Abhängig von der im jeweiligen Lesegerät installierten
Schriftart können die im Original gesperrt
gedruckten Passagen gesperrt, in serifenloser Schrift, oder aber sowohl
serifenlos als auch gesperrt erscheinen.
Kulturgeschichte der
Nutztiere
Die Erde und die Kultur
Die Eroberung und Nutzbarmachung
der Erde durch den Menschen
In Verbindung mit Fachgelehrten
gemeinverständlich dargestellt von
Dr. Ludwig
Reinhardt
Bd. III
Kulturgeschichte der Nutztiere
München 1911
Verlag von Ernst
Reinhardt
Kulturgeschichte der Nutztiere
von
Dr. Ludwig
Reinhardt
Mit 67 Abbildungen im Text und 70
Kunstdrucktafeln
München 1912
Verlag von Ernst
Reinhardt
Alle Rechte vorbehalten
Roßberg’sche Buchdruckerei, Leipzig.
Vorwort.
Im Jahre 1862, also vor genau 50 Jahren, wurde die auf
wissenschaftlicher, nämlich vergleichend-anatomischer Grundlage
beruhende Haustierkunde von meinem ehemaligen Lehrer, Professor
Ludwig Rütimeyer in Basel, durch die Publikation seiner
berühmten „Fauna der Schweizer Pfahlbauten“ begründet. Zehn Jahre
vorher, bei Gelegenheit eines ungewöhnlich niedrigen Wasserstandes
des Zürichsees, waren bei Meilen die ersten Reste von Pfahlbauten
entdeckt worden, denen sich in rascher Folge andere Fundstellen an den
übrigen Voralpenseen anschlossen. An Hand des umfangreichen, ihm zur
Bestimmung überwiesenen Knochenmaterials konnte Rütimeyer die Zahl
der von den Neolithikern der Schweiz gehaltenen Haustiere bestimmen
und in unzweifelhafter Weise an ihrem Knochenbau die Merkmale der
Haustierschaft gegenüber dem Wildstande feststellen. Woher sie aber
kamen und welchen Ursprungs sie waren, auch welche Beziehungen sie
zu den Haustieren der geschichtlichen Europäer hatten, das vermochte
er allerdings nicht herauszubringen, weil das damals hierfür nötige
wissenschaftliche Material fehlte. Doch haben sich in der Folge
verschiedene seiner Vermutungen bestätigt. Was er kühn begonnen,
führten bedeutende Männer wie Theodor Studer, Konrad Keller, Hermann
von Nathusius, Alfred Nehring, Jeitteles, Woldrich u. a. weiter.
Und wenn wir auch noch weit davon entfernt sind, die Geschichte
der Herkunft, der Abstammung und Wanderung der Haustiere durch die
Jahrhunderte genau zu kennen, so haben wir doch so viel erreicht, daß
wir wenigstens die Grundzüge derselben ziemlich klar zu überblicken
vermögen. Den Stand unseres heutigen Wissens darüber im Zusammenhange
zu geben und das Interesse weiterer Kreise, die sich bis jetzt diesem
wichtigen Tatsachenmaterial gegenüber gleichgültig verhielten, zu
wecken, soll der Hauptzweck dieses Buches sein, das dem Titel gemäß
außer den eigentlichen Haustieren auch alle Nutztiere des Menschen in
den Kreis seiner Betrachtung einbezieht. Wie bei der zuvor publizierten
Kulturgeschichte der Nutzpflanzen wurden besonders die literarischen
Zeugnisse des Altertums als für uns wichtig gewürdigt. Dabei wurde
wiederum mit derselben Sorgfalt für die Beschaffung von gutem, noch
nirgends publiziertem Illustrationsmaterial als einem wesentlichen
Bestandteil des hier in Betracht kommenden Urkundenmaterials gesorgt.
Möge das Buch dieselbe freundliche Aufnahme wie seine Vorgänger finden.
Basel, im November 1911.
Dr. Ludwig
Reinhardt.
Inhalt.
12.
Kaninchen und Meerschweinchen
15.
Perlhuhn, Pfau, Fasan und Truthuhn
16.
Gans, Ente und Schwan
18.
Die Sing- und Ziervögel
21.
Die Nutztiere unter den Wirbellosen
24.
Die Geschichte der Jagd
25.
Die wichtigsten Jagdtiere
26.
Nützliche wilde Vögel
27.
Pelz-, Schmuckfedern und Schildpattlieferanten
Tafelverzeichnis.
Unter den Nutztieren des Menschen sind weitaus die wichtigsten seine
Haustiere, an die zunächst jeder denkt, wenn von solchen die
Rede ist. Ohne diese Nutztiere wäre es ihm vollkommen unmöglich
gewesen, die Kulturhöhe zu erreichen, auf der wir ihn heute angelangt
sehen. Welche bedeutende Rolle sie im Haushalte des Menschen spielen,
ist genugsam bekannt, so daß wir hier nicht näher darauf einzugehen
brauchen. Es genüge ein kurzer Überblick über die Verbreitung der
Haustiere auf der Erde. So hat das Ackerbauministerium der Vereinigten
Staaten kürzlich eine Statistik aufgestellt, wonach man die
Haussäugetiere der gesamten Erde auf anderthalb Milliarden schätzt;
davon sind 580 Millionen Schafe, 95 Millionen Pferde, 9 Millionen Esel,
2 Millionen Kamele, 21 Millionen Büffel, 100 Millionen Ziegen, 150
Millionen Schweine und 900000 Renntiere. Dabei besitzen die Vereinigten
Staaten von Nordamerika die größte Anzahl von Schweinen, nämlich 50
Millionen, und Pferden (25 Millionen). In bezug auf die Zahl der Pferde
werden sie beinahe von Rußland eingeholt. Für die Schafzucht kommt an
erster Stelle Australien mit 88 Millionen, dann Argentinien und an
dritter Stelle die Vereinigten Staaten mit 57 Millionen. Die Hälfte
aller Maulesel der Erde gehört den Vereinigten Staaten und ein Drittel
aller Ziegen wird in Indien angetroffen. Diesem Lande gehört auch die
erste Stelle in bezug auf den Besitz von Großvieh mit 70 Millionen
Zebus oder Buckelochsen. Die Zahl der kleineren Nutztiere, vor allem
der Hühner, Enten, Gänse, Tauben festzustellen, ist vollkommen
unmöglich, geht aber jedenfalls in die vielen Milliarden.
Im folgenden wollen wir nun in der chronologischen Reihenfolge, wie
sie unter die Botmäßigkeit des Menschen gelangten, die Zähmung der
verschiedenen Haustiere und die Geschichte ihrer Verbreitung über die
Erde vor unserem geistigen Auge entrollen. Den Anfang dabei[S. 2] macht der
Hund, der weitaus der älteste Genosse des Menschen aus dem Tierreich
ist, und infolge dieser überaus langen Domestikation auch am meisten
intellektuell vom Umgange mit seinem ihm geistig so sehr überlegenen
Herrn profitiert hat.
Die ältesten Nutztiere des Menschen waren alle diejenigen, die ihm
in ihrem Fleisch zur Speise und in ihrem Felle als Wärmeschutz gegen
die Unbill der Witterung, besonders die Winterkälte, dienten. So
lange der Mensch als Jäger genug Beutetiere zur Verfügung hatte, kam
es ihm durchaus nicht in den Sinn, sich etwa gefangene Beute als
lebenden Proviant zu reservieren und in eingehegten Bezirken zu seiner
Disposition zu halten. Und wenn er auch einmal ein junges Tier, das in
seine Gewalt geriet, lebend nach Hause brachte und es angebunden oder
in irgend welchem Verschlag gefangen hielt, so tat er dies nicht aus
Nützlichkeitsgründen, sondern zu seinem und seiner Kinder Vergnügen.
So halten die südamerikanischen Indianer und andere Jägerstämme auf
niederer Kulturstufe nicht selten die verschiedensten Tiere um ihre
Wohnstätten herum in Gefangenschaft, aus dem einfachen Grunde, weil sie
ihnen Unterhaltung bieten. Sie wollen durchaus keinen Nutzen von ihnen
ziehen und halten sie als große Kinder bloß zu ihrem Vergnügen.
In der Regel pflanzen sich solche gefangene Tiere überhaupt nicht
fort, so daß schon dadurch keine Kontinuität in der Gefangenhaltung,
die zur Haustierschaft hätte führen können, möglich ist. Und pflanzen
sie sich auch ausnahmsweise fort, so fehlt dem Menschen dennoch
zunächst die Erkenntnis, daß in der Zähmung dieser oder jener Tierart
ein wirtschaftlicher Fortschritt liegen könne. Er erstrebt von diesen
Genossen überhaupt keinen Nutzen, sondern nur Unterhaltung; und als
er weiterhin dazu kam, auch einen Nutzen aus ihnen ziehen zu wollen,
war es meist nicht der für uns Menschen einzig in Betracht kommende
materielle Nutzen, der sie ihm angenehm machte, sondern ein ideeller
Nutzen als nützliche Vermittler zwischen ihm und der von ihm so
gefürchteten, ihn überall umgebend gedachten Geisterwelt. So sind, wie
wir bald sehen werden, verschiedene, und zwar die ältesten Haustiere,
zunächst aus solchen Gründen der Geisterfurcht, also des Aberglaubens,
wie wir es auffassen, in ein innigeres Verhältnis zum Menschen
getreten.
Der unstet als Jäger lebende paläolithische Mensch hat noch keinerlei
Haustiere sein eigen genannt; erst zu Beginn der jüngeren Steinzeit
gelangte der Mensch in den Besitz von solchen. Unter diesen ist weitaus
das älteste der Hund, der uns in Europa zum erstenmal zu Beginn
der neolithischen Zeit, vor etwa 12000 Jahren in sehr loser Verbindung
mit dem Menschen, der an den Küsten der Ostsee in den Muschelhaufen
die Abfälle seiner Nahrung anhäufte, entgegentritt. Dieser Hund der
frühneolithischen Muschelesser an den Küsten des nordischen Meeres,
speziell Dänemarks, war zum größten Teil noch ein Wildhund, und zwar
ein zutraulicher Schakal, der sich freiwillig dem Menschen anschloß,
um an der von ihm übriggelassenen Beute den knurrenden Magen zu füllen
und sich in der warmen Asche der von ihm verlassenen Lagerfeuer zu
wärmen. Junge dieses wenig scheuen und überaus gesellig veranlagten
Wildhundes wurden gelegentlich gefangen und an den Lagerplatz der Horde
gebracht, um hier als Spielzeug und Gefährten der heranwachsenden
Jugend freiwillig Futter und ein warmes Plätzchen am Feuer zu
erhalten. Von den Erwachsenen werden besonders die mitleidvollen
Weiber diese drolligen Wesen gehätschelt und, wie dies heute noch sehr
häufig bei kulturell niedrig stehenden Menschen vorkommt, die der
Mutterbrust entbehrenden allzu jungen, hilflosen Gäste an ihrer Brust
gesäugt haben. Durch solchen überaus engen Verkehr mit dem Menschen
faßte der Wildling bald Zutrauen zu ihm und trat in ein besonderes
Freundschaftsverhältnis zu den Kindern und Weibern, die sich seiner
freundlich annahmen, während die Männer diese neuen Familienglieder
häufig genug mit Fußtritten und Prügeln regaliert haben werden.
Letztere sorgten auch sonst dafür, daß es ihm nicht zu wohl wurde in
ihrer Mitte, und schlugen ihn häufig genug tot, besonders in Zeiten, da
die Muschellese, der Fischfang oder die Jagd aus irgend welchen Gründen
unergiebig war und[S. 4] der grimmige Hunger sich bei ihnen geltend machte.
An verschiedenen auf uns gekommenen Bruchstücken von Hundeschädeln
aus den dänischen Kjökkenmöddings oder Muschelabfallhaufen können
wir erkennen, daß sie mit Holzknütteln eingeschlagen und dann weiter
aufgebrochen wurden, um außer dem Fleisch, das als Speise diente, auch
das warme Gehirn als besondere Delikatesse dieser Menschen zu verzehren.
Daß es diesem die größte Ähnlichkeit mit dem Schakal aufweisenden
Wildhunde bei diesen unkultivierten Muschelessern im Ostseegebiet in
jeder Beziehung schlecht genug ging, das beweist schon sein stark
verkümmertes Knochengerüst. Es muß schon eine rührende Anhänglichkeit
gewesen sein, daß dieses durch Hunger und Entbehrungen der schlimmsten
Art herabgekommene Geschöpf bei solch schlechter Behandlung es in
der wenig verlockenden Gesellschaft dieser rohen Menschen aushielt
und es nicht vorzog, das ungebundene Leben der viel besser genährten
freien Verwandten zu führen. Es liegt eben im gesellig lebenden
Hundegeschlechte eine überaus treue Anhänglichkeit an die Umgebung, der
die Einzelindividuen durch Aufnahme und Gewöhnung in jugendlichem Alter
angepaßt wurden. Das können wir heute noch in den zoologischen Gärten
beobachten, wo wir häufig genug sehen, wie sich jung eingefangene
und unter einigermaßen guter Behandlung frei aufgezogene Schakale
oder Wölfe mit Freudensprüngen, schweifwedelnd, den Körper zur Seite
gekrümmt, sich an den Pfleger herandrängen und dessen Hand liebkosen.
Mit vollem Recht schreibt der erfahrene Tierzüchter, Dr. Heck,
der Direktor des Berliner Zoologischen Gartens über den Hund: „Wer
wissen will, woher unser liebenswertestes Haustier, das nicht bloß
seines körperlichen Nutzens halber vom Menschen unterjocht worden ist,
sondern sich ihm freiwillig, von ganzem Herzen und mit ganzer Seele
zu eigen gegeben hat: der Hund, stammt, der komme mit mir bei meinem
mächtigen rumänischen Wolfsrüden vorbei und beobachte ihn, wenn ich nur
mit den Fingern schnalze oder gar ein paar freundliche Worte mit ihm
spreche! Die Liebe zum Menschen steht diesen Tieren auf dem Gesicht
geschrieben, sie ist ihnen angeboren.“
Daß diese halbzahmen Hunde der Muschelesser Dänemarks dem Menschen
außer als Fleisch- und Pelzlieferanten irgend welchen Nutzen gewährten,
oder von ihm gar zum Aufspüren der Beute auf der Jagd verwendet wurden,
ist zweifellos ganz ausgeschlossen. Jedenfalls blieben sie vorzugsweise
in Gesellschaft der Frauen und Kinder an den Lagerplätzen und erhielten
dort von jenen, die ihnen in erster Linie freundlich gesinnt waren,
allerlei unvollständig abgenagte Knochen und sonstige[S. 5] Speiseabfälle
zu essen. Diese Aufmerksamkeiten belohnten sie durch ihre Wachsamkeit.
Mit einem außerordentlich feinen Geruchssinn und scharfem Gehör
ausgestattet, meldeten sie alle sich dem Lagerplatze nähernden Menschen
und Tiere lange bevor die dort weilenden Menschen ihrer gewahr wurden.
Diese ihre Dienste waren besonders in der dunkeln, unheimlichen Nacht,
in der ein Überfall durch bösgesinnte Menschen und wilde Tiere doppelt
zu befürchten war, von größtem Vorteile für ihre menschlichen Genossen,
da sie im Gegensatz zu diesen, in einen sehr tiefen Schlaf verfallenden
Wesen nur einen äußerst leichten Schlaf besitzen, durch das geringste
Geräusch erwachen und dann ihre Umgebung durch Lautgeben auf allfällige
Ruhestörer aufmerksam machen.
Wie die Wildhunde werden auch sie noch geheult haben statt zu bellen,
wie dies übrigens viele, nur sehr unvollständig domestizierte Hunde
von Naturvölkern und auch die herrenlosen, mit dem Islam, der den Hund
als unreines Tier verachtet, bis nach Europa gebrachten Pariahunde
des Orients, wie überhaupt alle verwilderten und aus der Botmäßigkeit
des Menschen entlaufenen Hunde heute noch tun. Erst später haben sie
das sie als Haustiere kennzeichnende Bellen gelernt, „was“ — wie der
vorgenannte Dr. Heck sich ausdrückt — „so im Hundeblut drin
liegen muß, daß selbst manche zahme Vollblutwölfe und Schakale es sich
angewöhnen!“ Jedenfalls besaßen sie auch noch wie ihre wilden Vorfahren
Stehohren und einen hochgetragenen, noch nicht geringelten Schwanz
und haben wie sie und ihre Verwandten, Wolf und Fuchs, beim Traben
„geschnürt“, d. h. die vier Füße bei gerade in der Bewegungsrichtung
gehaltenem Körper in eine gerade Linie hintereinander gesetzt, und zwar
immer einen Hinterfuß in die Spur eines Vorderfußes derselben Seite.
Später dagegen gewöhnte sich der Hund als Genosse des Menschen an zu
„schränken“, d. h. beim Trabe den Körper schief zur Bewegungsrichtung
zu stellen und Vorder- und Hinterfuß derselben Seite schief
nebeneinander zu setzen. Auch in seinem anatomischen Bau nahm der Hund
als Haustier gewisse Eigentümlichkeiten und Merkmale an, die ihn von
seinen wilden Verwandten unterscheiden, von denen wir hier nur den
verhältnismäßig starken Stirnabsatz erwähnen wollen.
So weit wir dies nachweisen können, ist der afrikanisch-südasiatische
graue Schakal, der nachts, zu Meuten vereinigt, die
Ansiedelungen des Menschen nach Aas und eßbaren Abfällen aller
Art absucht und den Schafen und Lämmern sehr gefährlich wird, der
älteste vom[S. 6] Menschen zu seinem Gesellschafter erhobene Wildhund. Als
Verzehrer von Leichen nahm er, nach dem auf niedriger Kulturstufe
allgemein verbreiteten Glauben, mit dem Fleisch und den Eingeweiden
auch die Seele des betreffenden Wesens in sich auf. Durch dieses
Beherbergen eines Geistes wurde er von selbst zu einem Geistwesen,
einem Fetischtier erhoben, das dem Menschen von größtem Nutzen sein
konnte, wenn er es gut behandelte. So galt noch den alten Ägyptern der
Schakal als Wüstengott Anubis, der über die in der westlich vom Niltal
gelegenen Wüste beerdigten Toten Wache hielt, für heilig und nahm man
eingefangene Exemplare dieser Wildhundgattung in Pflege und Wartung.
Dies geschah auch anderwärts, und so mußte sich unwillkürlich aus
diesem in Größe und Aussehen, besonders aber in der Kopfbildung mitten
zwischen Fuchs und Wolf stehenden Wildhunde mit der Zeit ein Haustier
entwickeln.
Das Gekläff dieser futterneidischen Tiere, welche schon in frühester
Vorzeit wie heute noch die Niederlassungen des Menschen nächtlicher
Weile umschwärmten, um dort etwas aufzustöbern, mit dem sie ihren
allzeit regen Hunger stillen konnten, warnte den Menschen vor einem
Überfall durch übelgesinnte Menschen oder Raubtiere irgend welcher Art.
Ja, scheinbar ganz unmotiviert ausgestoßen, sollte es nach dem Glauben
aller auf niedriger Kulturstufe lebender Stämme, ihm den Besuch der
die Lebenden allseitig umgebend gedachten Geister der Abgeschiedenen
anzeigen. Wenn sie auch der Mensch selbst nicht sah, so glaubte er
nichtsdestoweniger felsenfest an deren Vorhandensein und wunderte sich
durchaus nicht darüber, daß diese Wildhunde als Leichenesser und damit
als mit Geistwesen beseelt erachteten Tiere solche sahen, er dagegen
nicht.
Diese überaus unheimliche, aber höchst wichtige Eigenschaft, besonders
die nächtlichen Unholde aller Art erspähen zu können und von ihrem,
dem Menschen unsichtbaren Vorhandensein durch Heulen und später Bellen
Kunde geben zu können, war wohl die älteste Nutzungseigenschaft, die
der Hund dem Menschen bot. So wurde er für ihn mit der Zeit nicht nur
ein wohlgelittener Begleiter, sondern geradezu ein sich immer mehr
unentbehrlich machender Genosse, der ihm die trefflichsten Dienste
leisten konnte wie kein anderes Wesen.
Diese höchste Wertschätzung des Hundes spricht schon zu Ende des 2.
vorchristlichen Jahrtausends das altpersische Gesetzbuch aus, das
von diesem Tiere geradezu behauptet, durch seinen Verstand bestehe
die Welt. Wer eine solche uns ganz paradox erscheinende Behauptung[S. 7]
aufstellt, muß schon gute Gründe dazu haben; nur ein Volk, dem der
Hund ein unentbehrlicher Begleiter und Freund geworden war, konnte
einen solchen Ausspruch tun. Diesem damals noch vorzugsweise Viehzucht
treibenden arischen Volksstamme, dessen Vorfahren einst an der Ostsee
gehaust hatten, waren außer dem gleicherweise wie der Hund die
Unholdgeister der Nacht vertreibenden Feuer später auch der aus Indien
bezogene Hahn schützende Fetische, deren Stimme, nächtlicherweile als
Zeugnis der Wachsamkeit und des Kampfesmutes erhoben, die Erlösung von
den dunkeln Sorgen der Nacht ankündigte. Das altpersische Gesetzbuch
Bun-Dehesch sagt auch vom Hahn, wie vom Hunde, seine Stimme zerstöre
das Böse; dadurch sei er den Dämonen und Zauberern feind, ein
Gehilfe des Hundes. Er solle Wache halten über die Welt, als ob kein
Herden- und kein Haushund (also schon damals wurden in Persien zwei
verschiedene Arten von Haushunden unterschieden!) erschaffen worden.
Das Gesetz sage: wenn Hund und Hahn gegen die Unholde streiten, so
entkräften sie dieselben, die sonst Menschen und Vieh plagen. Und
deshalb sage man: durch den Hund und den Hahn würden alle Feinde des
Guten überwunden.
Noch der altgriechische Dichter Homer gibt zu Beginn des letzten
vorchristlichen Jahrtausends für den damals allgemein verbreiteten
Glauben Zeugnis, daß der Hund als Wächter am Herdfeuer die bösen
Unholdgeister, die, Übles sinnend, lautlos durch das Dunkel der Nacht
schleichen, durch sein Gebell verscheuche. Und als später aus diesen
Ahnengeistern vergöttlichte Wesen wurden, so verblieb dem Hund auch
dann noch die Fähigkeit sie zu sehen und als solche zu erkennen, wo der
Mensch mit seinen stumpfen Augen nichts sah. So wird beispielsweise
in der Odyssee erzählt, wie Pallas Athene den Menschen unsichtbar in
Ithaka erschien. Weder Odysseus, noch sein Sohn Telemachos bemerkten
irgend etwas von ihrem Erscheinen:
„Denn nicht allen sichtbar erscheinen die seligen Götter;
Nur die Hunde sahen sie und bellten nicht, sondern entflohen
Winselnd und zitternd vor ihr nach der andern Seite des Hofes.“
Diese uralte Vorstellung lebt im Volksglauben heute noch fort. So
bedeutet beim Landvolke das nächtliche Heulen des Hundes einen
Todesfall in der betreffenden Richtung, d. h. der Hund sieht
vermeintlich die Annäherung des Geistes, der als Todesursache
betrachtet wird, und zeigt dies dem Menschen, der solches nicht zu
sehen vermag, auf seine Weise an.
[S. 8]
Als eigentliches Haustier tritt uns der Hund in Europa zuerst bei den
neolithischen Pfahlbauern entgegen, und zwar zunächst nur in einer
einzigen, aber weit verbreiteten Form. Es ist dies der Torfhund
(Canis familiaris palustris), so bezeichnet, weil man seine
Knochen mit der übrigen Hinterlassenschaft dieser neolithischen
Volksstämme von den Humussäuren der Moorerde durchtränkt und so aufs
beste konserviert in den heute meist vertorften ehemaligen Seegründen
findet. Dieses Tier, das uns bereits, wenn auch mehr als gelittener
Kommensale oder Tischgenosse, denn als eigentlicher Freund und
Begleiter der ältesten Neolithiker der Kjökkenmöddingszeit in den
Ufergebieten an der Ost- und Nordsee entgegentritt, war ziemlich klein,
bot das Aussehen eines Spitzes mit kurzen, aber kräftigen Beinen und
langem, jedenfalls buschig behaartem Schweif. Der zwischen 13 und
15 cm Länge schwankende Schädel zeigt eine gefällige Rundung
der Gehirnkapsel, deren Kämme nur schwach entwickelt sind, außerdem
eine relativ starke Bezahnung und ein auffallend enges Nasenrohr, wie
solches dem Schakal eigentümlich ist. Diese Tatsache in Verbindung mit
der andern, daß die Pfahlbauspitze in den Niederlassungen der älteren
Steinzeit durch ganz Europa hindurch eine auffallende Einförmigkeit
aufweisen, deutet mit Sicherheit darauf hin, daß der in Westasien
heimische kaukasische Schakal die Ursprungsform dieses ältesten
Haushundes war.
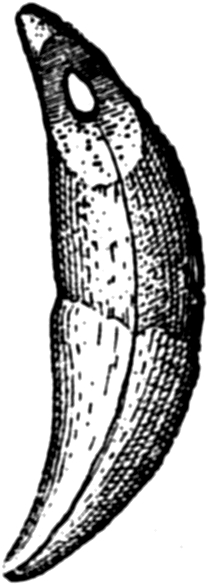
Bild 1. Als Amulett getragener, und deshalb zum
Aufhängenkönnen an der Wurzel durchbohrter Eckzahn eines Hundes aus dem
Pfahlbau von Wangen am Bodensee (2⁄3 nat. Größe).
Diesem altertümlichen Torfhund der ältesten Neolithiker Europas am
nächsten steht von noch heute gehaltenen Hunden der im Mittel 40
cm große, gelbweiß, gelbrot bis graubraun gefärbte, kurzhaarige,
nur bellende und nicht beißende Battahund, der uns durch
die Schilderungen des Baslers Max Siber zuerst eingehender bekannt
wurde. Die Battas sind durch die Malaien von den Küsten verdrängte,
ab und zu noch Menschenfraß ausübende, auch am Lande in richtigen
Pfahlhäusern wohnende Stämme, die außer gute Jäger und namentlich
Fallen- und Schlingensteller auch bereits erfahrene Viehzüchter und
leidliche Hackbauern sind, ganz so wie die Pfahlbauern Mitteleuropas in
neolithischer Zeit. Mitten zwischen den schwarzen Schweinen, Ziegen,
Büffeln, Hühnern und Menschen lebt in deren mit Palisaden umgebenen
Ansiedlungen, Kampongs genannt, der kleine Battahund, der durch und[S. 9]
durch Haushund ist und das Vorrecht genießt, als einziges Tier mit dem
Menschen zusammen in den Hütten selbst zu übernachten. Der vorgenannte
Basler schreibt über den kleinen Spitzhund der Battas, er genieße zwar
von seiten seines Herrn wenig Freundlichkeit, habe jedoch von allen
in Kampong friedlich nebeneinander hausenden Tieren das Vorrecht, in
den Räumen der hohen Pfahlbauhäuser neben seinem Herrn zu wohnen.
„Er gehört wie die Hühner, Ziegen und Schweine zum Departement der
Frau, der er auch anhänglicher ist als dem Manne und an die man sich
auch wenden muß, wenn man einen der Hunde erwerben oder zu Eßzwecken
präparieren lassen will. Die Dienste des Hundes sind mannigfach,
sein vornehmster ist der als Wachhund. In dieser Hinsicht ist der
immer wache, scharf hörende Spitz den Battas bei ihren unaufhörlichen
Fehden und den dabei häufigen nächtlichen Überfällen der Kampongs von
unerhörtem Wert. Manch Battamädchen, manche Battafrau wurde durch des
Hundes rechtzeitig erschallendes heftiges Gebell vor der Gefangenschaft
und dem damit verbundenen Verkauf in die Sklaverei gerettet, mancher
Krieger entrann dadurch dem Tod oder der Gefangennahme, die mit dem
eventuellen Schicksal verbunden ist, gemästet und aufgefressen zu
werden. Ferner leistet er leidliche Dienste als Jagdhund, indem er
teils in Meuten als Treibhund, teils als Leithund zur Bestätigung
des Hirsches und zum darauf folgenden Treiben desselben in angelegte
Schlingen und Netze benutzt wird. Ferner ist er von großem Wert für die
hühnerzüchtende Battafrau, da er Tag und Nacht um die Reisfeldhäuser,
bei denen die Mehrzahl der Hühner gehalten wird, herumlungernd einen
guten Schutz gegen den Hühnerräuber ‚Mussang‘ (eine Art Zibetkatze)
und die im Battaland allerdings seltenen Leguane bildet. Doch, last
not least, ist seiner auch als Nahrungsmittel zu gedenken, indem
er an gewissen Orten geradezu für Speisezwecke gezogen wird. Er
bildet nicht nur ein gesundes, wohlschmeckendes Nahrungsmittel, das
im fleischarmen Lande nicht zu unterschätzen ist, sondern auch eine
gewisse Erwerbsquelle für den Züchter, da junge Hunde im Preise ebenso
hoch stehen wie Hühner, bald erwachsen aber bedeutend teurer sind als
solche. Auf der Speisekarte der Battas figuriert nach den Angaben
eines Raiafürsten der Hund an dritter Stelle. Am wenigsten geschätzt
ist Huhn, mehr Hirsch, dann Hund, dann Babi oder Schweinebraten, als
allerbestes aber gilt Menschenfleisch, vertraute mir der alte Sünder
mit schmunzelndem Gesicht.“
Sieber ließ sich wiederholt Hundebraten in einheimischer Zubereitung[S. 10]
servieren und fand es in der Mitte stehend zwischen Hühner- und
Kalbfleisch; es sei weiß und saftig, ohne fett zu sein. Auch die
Battahunde fressen gerne davon, während europäische Hunde sich mit
allen Zeichen des Abscheus von solchem Fraße abwenden. Entsetzt
schrecken diese Spitzhunde vor dem Europäer zurück und weichen heulend
seiner Fährte aus. „Wo nicht eigentliche Fütterung mit Reis, Mais,
Gemüse, Früchten oder Fleischabfällen stattfindet, nährt sich der
Battahund von den Abfällen der kargen Mahlzeit der Frau, aber auch von
den Käfern, Schnecken, Mäusen und sonstigen kleinen Tieren, die er
unterwegs fängt, sowie von den Brocken und Knochen, die ihm bei der
Mahlzeit der Männer zugeworfen werden, ja selbst von Exkrementen. Wo
viele Hunde sind, da hat er schlechte Zeiten, denn seine Herren haben
gewöhnlich auch nicht viel; wo wenige gehalten werden, gedeiht er gut,
wird dick und groß, bekommt ein prächtig glänzendes Fell und einen
munteren Charakter.“
„Wie bereits gesagt, gehört der Hund zum Departement der Frau. Wenn er
nicht dazu bestimmt ist, in deren Abwesenheit das Haus zu hüten, so
ist er ihr ständiger Begleiter auf Schritt und Tritt. Morgens früh,
vor Tagesanbruch, sitzt er schon neben der armen Frau, die den Männern
den Reis stampfen muß, auf dem erhöhten Gestell, auf dem sie dieses
Geschäft ausführt, sorgsam jedes Körnchen aufschnappend, das nebenaus
fällt, und in der ausgeschütteten Spreu nach solchen Körnern suchend,
hier wie überall erbitterte Gefechte mit den frechen Hühnern führend,
die ihm den Reis unter der Nase wegzustehlen suchen. Er begleitet die
Frau zum Bade, getreulich am Ufer bei den Kleidern bleibend, während
die Frau (Herrin kann man nicht sagen, denn solch ein armes Battaweib
hat in keiner Beziehung etwas von einer Herrin) sich im Flusse kühlt.
Im Kampong des Battafürsten von Bander passierten, während wir eben im
sogenannten Rathaus, dessen Veranda nach dem Weiberbadeplatz schaut,
mit dem Häuptling unterhandelten, an 30 seiner Nebenweiber, meist
Kriegsgefangene oder durch Schulden in Sklaverei geratene Mädchen,
vorbei, um nach dem Ablegen aller Kleider im nahen Fluß zu baden. Jede
war begleitet von einem oder mehreren ihrer Hunde, die sich am Ufer in
langer Reihe neben die Kleider (Sarongs) der Weiber setzten, um diese
zu bewachen, bis jene das Bad wieder verließen.
Ebenso begleitet der Hund die Frau zur Arbeit in den Ladang (das
Haus, in welchem die Bewohner der kleinen, mitten im Tschungel[S. 11]
geöffneten Kulturfläche bis zur Ernte hausen) und ins Reisfeld, durch
rechtzeitiges Bellen sie auf die Annäherung jedes Fremden aufmerksam
machend.“
Die Battawohnungen sind 2–5 m über dem Boden errichtet; zu ihnen
führen sehr steil gestellte Leitern mit 40–60 cm auseinander
stehenden Sprossen. Diese lernen die Hunde erklettern, um in die
Wohnungen zu gelangen, in denen sie sich mit Vorliebe aufhalten. Die
jungen Hunde legen sich mit Vorliebe in die heiße Asche und weisen
von dieser ihrer Gewohnheit sehr häufig versengte Haare und größere
Brandwunden auf.
Kräftiger als dieser Spitz der Battas auf Sumatra, auf dessen
Lebensweise wir näher eingingen, weil er uns wichtige Fingerzeige für
diejenige des Spitzhundes der ältesten Pfahlbauern in Mitteleuropa
gibt, ist der ostasiatische Tschau — besser Kau
ausgesprochen —, der Lieblingshund der Chinesen, der ebenfalls zu
Nahrungszwecken gehalten und gemästet wird. Dieses schwarz bis rotbraun
gefärbte Tier mit kurzer, dichter Behaarung hat einen langgestreckten
Körper auf ziemlich kurzen Beinen, eine plumpe, dicke Schnauze und
aufrecht stehende Ohren. Eine Abart desselben von geringer Größe und
mit kurzen Beinen ist der als Luxushund in China und Japan gehaltene
zierliche Dschin. Seine seidenartige lange Behaarung ist schwarz
mit Weiß untermischt. Er ist als eine hochgezüchtete Mopsform des
Spitzes aufzufassen, an dessen Schädel die Nasenwurzel eingeknickt und
die Kiefer so nach oben verschoben sind, daß die oberen Schneidezähne
fast horizontal stehen und die Nasenöffnung nach oben zu liegt. Dieser
in seiner Heimat hochgeschätzte Luxushund ist bei uns nicht leicht
fortzubringen, da es ihm in Mitteleuropa zu kalt ist.
Dem alten Torfhund oder Pfahlbauspitz stehen auch die nordasiatischen
Spitzhunde sehr nahe, der graue mit Schwarz gemischte
Tungusenspitz, der weißlichgraue Samojedenspitz und die
als einziges, für sie höchst wichtiges, ja geradezu unentbehrliches
Haustier gehaltenen spitzartigen Hunde der zirkumpolaren Völker,
die man in ihrer Gesamtheit als Eskimohunde bezeichnet. Es
sind dies keine reinen Schakalabkömmlinge mehr, sondern vielfach
Kreuzungsprodukte derselben mit dem arktischen Wolf. Peary bezeichnet
sie als derbe, prächtige Tiere, ohne deren Mithilfe er niemals den
Nordpol erreicht hätte. „Es mag größere Hunde geben als sie und
hübschere. Andere Hunde mögen auch ebensogut arbeiten oder ebenso
schnell und weit[S. 12] laufen, wenn sie gut gefüttert sind, aber es gibt
keinen Hund in der Welt, der so lange in niedrigsten Temperaturen ohne
Nahrung arbeiten kann. Die männlichen Hunde wiegen durchschnittlich 34
bis 45 kg, die weiblichen sind etwas leichter. Ihre besonderen
Merkmale sind: spitze Schnauze, große Breite zwischen den Augen, scharf
gespitzte Ohren, sehr dickes, pelziges Fell, kräftige, stark muskulöse
Beine und buschiger Schwanz, der Rute des Fuchses sehr ähnlich. Es gibt
nur eine Rasse von Eskimohunden, aber sie sind verschieden gezeichnet,
schwarz, weiß, grau, gelb, braun und gesprenkelt. Trotzdem sie von den
armen Eingeborenen sehr vernachlässigt und außerordentlich schlecht
gehalten werden, sind sie ihren Herren gehorsam wie unsere Hunde zu
Hause. Ihre Nahrung ist Fleisch und nur Fleisch. Von anderer Nahrung
können sie nicht leben. Statt Wasser zu saufen, fressen sie Schnee. Sie
bleiben im Freien, gleichgültig welche Jahreszeit es ist. Sommer wie
Winter werden sie beim Zelt oder dem Iglu (der Schneehütte) irgendwo
angebunden. Frei herumstreifen dürfen sie nicht, damit sie nicht
fortlaufen. Manchmal wird ein besonderer Liebling oder eine Hündin,
die Junge hat, zeitweise in das Iglu genommen. Sind die Kleinen aber
nur einen Monat alt, so sind sie schon so hart, daß sie dem strengen
Winterwetter standhalten können.“
Diese Hunde, die eine Schulterhöhe von 50–60 cm aufweisen,
sind den nordischen Völkern als Lasttiere und zum Schlittenziehen
durchaus unentbehrlich. Mit einer Last von 10–15 kg beladen,
begleiten sie ihre Herren, wenn diese zu ihren langdauernden Jagdzügen
aufbrechen. Zu 6, 8 oder 10 Stück vermittelst eines an einen höchst
einfachen Kumt befestigten und zwischen den Hinterbeinen durchgezogenen
Riemens werden sie an leichte, niedere Schlitten gespannt, welche
300–400 kg zu tragen vermögen, und durchlaufen mit ihnen
unter günstigen Umständen bis 50, und bei leichter Last bis 80
km im Tag. Spüren sie unterwegs ein Wild auf, so rennen sie
ihm, ausgehungert wie sie sind, rasend nach, verwirren dabei oder
bei gelegentlichen Beißereien ihre Riemen, so daß auch die mit Macht
geschwungene Peitsche des Schlittenführers keine Ordnung mehr in den
Haufen zu bringen vermag. Es bleibt nichts anderes übrig, als das zu
einem undurchdringlichen Knäuel gewordene Gespann, in welchem alles
knurrt, bellt, beißt und durcheinander wütet, nach Möglichkeit zum
Halten zu bringen, die Tiere aus der Verschlingung zu lösen und von
neuem einzuspannen. Natürlich kann bei solch ungestümer Fahrt von einer
Lenkung des Schlittens nach unseren Begriffen von seiten des Menschen[S. 13]
keine Rede sein. So gut es eben geht, weist man den Leithunden durch
Peitschenhiebe den Weg, den sie nicht gehen sollen.
Diese genügsamen, abgehärteten Schlittenhunde sind nicht nur den
grönländischen Eskimos und den kanadischen Pelzjägern, sondern auch
allen nordasiatischen Volksstämmen als Zugtiere völlig unentbehrlich.
Tungusen, Samojeden, Tschuktschen, Kamdschadalen und wie sie sonst
heißen mögen, fallen geradezu in Hungersnot, wenn ihnen ihre Hunde
durch eine Seuche hinweggerafft werden, weil sie ohne diese sich
weder das nötige Brennholz verschaffen, noch dem sie ausschließlich
ernährenden Fischfang und der Jagd, auch der für sie höchst wichtigen
Pelzjagd, genügend obliegen können. Über die Hunde, die einzigen
Haustiere der Kamtschadalen, schreibt der alte Steller: „Ohne diese
Hunde kann jemand hier so wenig leben wie an andern Orten ohne Pferd
und Rindvieh. Die kamtschatkischen Hunde sind verschiedenfarbig,
hauptsächlich aber dreierlei: weiß, schwarz und wolfsgrau, dabei
sehr dicht- und langhaarig. Sie ernähren sich von alten Fischen.
Vom Frühjahr bis in den späten Herbst bekümmert man sich nicht im
geringsten um sie, sondern sie gehen allenthalben frei herum, lauern
den ganzen Tag an den Flüssen auf Fische, welche sie sehr behende und
artig zu fangen wissen. Wenn sie Fische genug haben, so fressen sie,
wie die Bären, nur allein den Kopf davon; das andere lassen sie liegen.
Im Oktober sammelt jeder seine Hunde und bindet sie an den Pfeilern
der Wohnung an. Dann läßt man sie weidlich hungern, damit sie sich des
Fettes entledigen, zum Laufen geschickt und nicht engbrüstig werden
mögen, und alsdann geht mit dem ersten Schnee ihre Not an, so daß
man sie Tag und Nacht mit gräßlichem Geheul und Wehklagen ihr Elend
bejammern hört. Ihre Kost im Winter ist zweifach. Zur Ergötzung und
Stärkung dienen stinkende Fische, welche man in Gruben verwahrt und
versäuern läßt. Das andere Futter besteht in trockenen Speisen von
verschimmelten und an der Luft getrockneten Fischen. Damit füttert man
sie des Morgens, um ihnen unterwegs Mut zu machen.
Man kann sich nicht genug über die Stärke der Hunde verwundern.
Gewöhnlich spannt man nur vier an einen Schlitten; diese ziehen drei
erwachsene Menschen mit 11⁄2 Pud (24,5 kg) Ladung behende fort.
Auf vier Hunde ist die gewöhnliche Ladung 5–6 Pud (82–98 kg).
Ungeachtet nun die Reise mit Hunden sehr beschwerlich und gefährlich
ist, und man fast mehr entkräftet wird, als wenn man zu Fuß ginge, und
man bei dem Hundeführen und Fahren so müd[S. 14] wie ein Hund selber wird,
so hat man doch dabei diesen Vorteil, daß man über die unwegsamsten
Stellen damit von einem Ort zum andern kommen kann, wohin man weder mit
Pferden, noch, wegen des tiefen Schnees, sonst zu Fuß kommen könnte.
Der andere Hauptnutzen der Hunde, weshalb sie auch häufig gehalten
werden, ist, daß man sowohl den abgelebten Schlittenhunden als den
zur Fahrt untauglichen die Häute abnimmt und zweierlei Kleider daraus
macht, welche in dem ganzen Lande von großem Nutzen und von großem
Werte sind.“
Eine ähnliche Lebensweise wie diese kamtschadalischen und überhaupt
nordasiatischen Hunde führen diejenigen Islands, die dort in
übergroßer Zahl (auf fünf Menschen drei Hunde!) untätig herumlungern,
zu gewissen Jahreszeiten aber beim Trieb der Schaf- und Pferdeherden
doch wesentliche Dienste leisten. Verwandt damit ist auch der Spitz
der skandinavischen Lappen und westrussischen Finnen, der sogenannte
Elchhund, und der russisch-sibirische Laika, d. h.
Beller, die beide, ähnlich wie unsere Bracken, zum Aufstöbern und
Treiben des Wildes dienen.
Ein etwas veränderter, vor allem durch bessere Ernährung kräftiger
gewordener Abkömmling des alten Torfhundes der neolithischen
Mitteleuropäer, der noch zur Römerzeit am Rhein und in Helvetien (so in
Vindonissa) lebte, ist unser einheimischer Spitz, dessen etwas
grobes Fell weiß, grau, schakalfarbig, gelb oder ganz schwarz ist.
Dank seiner außerordentlichen Wachsamkeit, die kein Geräusch und keine
fremde Erscheinung unbeachtet läßt, ist er der Haus- und Wachthund
in des Wortes eigentlichster Bedeutung. Tag und Nacht hütet er mit
derselben Aufmerksamkeit den Hof oder das Fuhrwerk seines Herrn, das
er nie verläßt, um sich wie andere Hunde gerne herumzutreiben. Mit
wütendem Gekläff und seine scharfen Zähne weisend empfängt er jeden
Fremdling, der ihm verdächtig erscheint. Als die beste Rasse gilt der
Pommer, weil er bei unwandelbarer Treue und Anhänglichkeit besonders
aufmerksam und lebhaft ist, dabei weder Regen, noch Kälte scheut, ja
gewöhnlich im Hause oder Hofe dort am liebsten zu liegen pflegt, wo der
Wind am stärksten pfeift. Nur als Kettenhunde taugen die Spitze infolge
ihres großen Dranges zur Freiheit nicht. Unter ihnen gibt es auch
Zwergformen, die besonders in England als Schoßhündchen der Modedamen
sehr beliebt sind und bei einem Gewicht von nur 1,26 kg bis 1800
Mark kosten.
Ein noch weitergehend veränderter Abkömmling des Torfhundes[S. 15] ist der
dem Spitz an Wachsamkeit und Mut kaum nachgebende Pinscher,
ein höchst munteres, kluges und jagdfreudiges Tier, dessen besondere
Liebhaberei es ist, Mäusen, Ratten und Erde aufwühlenden Maulwürfen
nachzuspüren und sie zu verfolgen. Die Mäuse und Ratten frißt er bis
zu seiner Sättigung, die übrigen wirft er weg; die Maulwürfe dagegen
frißt er nicht, sondern begräbt sie. Wie der Spitz zum ländlichen
Gehöft gehört, pflegt der Pinscher im bürgerlichen Wohnhaus gehalten
zu werden, obschon er wegen seiner steten Unruhe dem Herrn oft mehr
Verdruß als Freude macht. Aus diesem Grunde eignet er sich mehr für
Leute, welche reiten oder mit schnellen Pferden fahren; denn am
allerliebsten begleitet der Pinscher seinen Herrn, wenn er tüchtig
rennen und laufen muß. Doch selbst bei den schnellsten Ritten hat er
immer noch Zeit, bald hier, bald dort ein Mauseloch zu untersuchen oder
einen Maulwurf beim Auswerfen seiner Haufen zu stören. Die Nase hoch
gegen den Wind getragen, späht er nach allen Seiten hin, und wo etwas
raschelt, naht er sich vorsichtig und leise, um Beute zu machen. In
England wird er mit Vorliebe zur Abhaltung von Rattenjagden benutzt,
wobei es allerdings ohne oft recht hohe Wetten der Teilnehmer nicht
abgeht. Auch von ihm gibt es Zwergformen, häßliche, aber muntere und
unterhaltende Tiere, die höchst zutraulich und anhänglich an ihre Herrn
sind und gleichfalls zur Rattenjagd, außerdem auch zur Kaninchen- oder
Wachteljagd verwendet werden.
Der heute beliebteste Abkömmling des Pinscherstammes ist der durch die
Engländer überall eingeführte und populär gewordene Foxterrier,
der jetzt auch in Deutschland überall angetroffen wird. Übersprudelnd
von Temperament, ist er von einer Beiß- und Rauflust ohnegleichen, die
sich in Ermangelung von Besserem an Teppichen, Gardinen, Tischdecken
und Möbelüberzügen Luft macht. Wie von der deutschen Jägerei der
Dachshund, wurde er von der englischen zum Aufsuchen von Fuchs und
Dachs in ihren Erdbauen verwendet. Terrier, altenglisch terrar,
heißt so viel wie Erdhund. Für die Arbeit in der Erde wurde auch
diese kurzhaarige Pinscherart gezüchtet und besaß schon vor einigen
Jahrhunderten einen gewissen Ruf. Als dann die Fuchsjagd zum reinen
Sport der Vornehmen wurde, sanken diese in der Erde wühlenden Hunde
zu nebensächlichen Handlangern für diese herab, die den unterirdisch
verschlieften Fuchs wieder hervorzutreiben hatten. Von diesen Terriers
wurde zuerst der Name Foxterrier gebraucht und dann in der Folge auf
die ganze Sippe übertragen.
[S. 16]
Seine Hauptbedeutung hat aber der Foxterrier längst als Luxushund
erlangt, ebenso die übrigen Terrierformen Englands, die man bei uns
kaum kennt. Einige davon, wie der kleine, langleibige, kurzbeinige
Yorkshireterrier mit prächtigem Seidenhaar, sind besonders bei
den Damen als Schoßhunde beliebt.
Andere Schakalabkömmlinge, die der hier besprochenen Spitzhundgruppe
nahestehen, sind die West- und Südasien, den indomalaiischen Archipel
bis zu den Philippinen, dann Neuguinea, Australien und Neuseeland,
aber auch Nord- und Mittelafrika und Madagaskar bewohnenden
Pariahunde. Sie wurden von den Engländern so genannt, weil sie
kaum oder nur schlecht domestizierte Hunde von häßlichem Aussehen sind,
die als herrenlose Geschöpfe in der Nähe der menschlichen Wohnungen
leben, um sich vom Wegwurfe des Menschen kümmerlich genug zu ernähren.
Tagsüber liegen sie faul oder schlafend in der Sonne, um wie ihre
Ahnen, die Schakale, gegen Abend lebhaft zu werden und auf Eßbares
irgend welcher Art zu fahnden. Wie die Schakale machen sie sich des
Nachts in orientalischen Städten durch ihr Geheul sehr unangenehm
bemerkbar, indem sie bei den nicht daran Gewöhnten keinen rechten
Schlaf aufkommen lassen. Sie haben einen schlanken Leib, ziemlich hohe
Beine, einen schmalen Kopf mit zugespitzter Schnauze und aufrecht
stehenden Ohren. Das Gesicht verrät nur geringe Intelligenz. Der
lange, nicht gedrehte Schwanz wird bald hängend getragen, bald ist er
gekrümmt. Die Behaarung ist meist kurz und von rostroter oder fahler
Färbung, ähnlich dem Schakal. Auch der Schädelbau zeigt Ähnlichkeit mit
diesem, und zwar am meisten mit dem indischen Schakal.
Tafel 1.
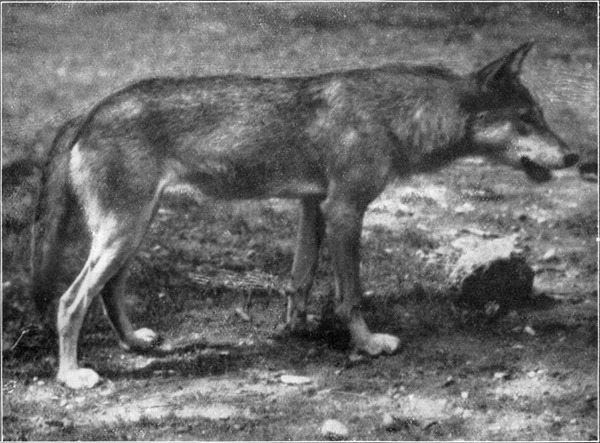
Wolf im Tierpark Hellabrunn zu München.
(Nach einer Photographie von M. Obergaßner.)
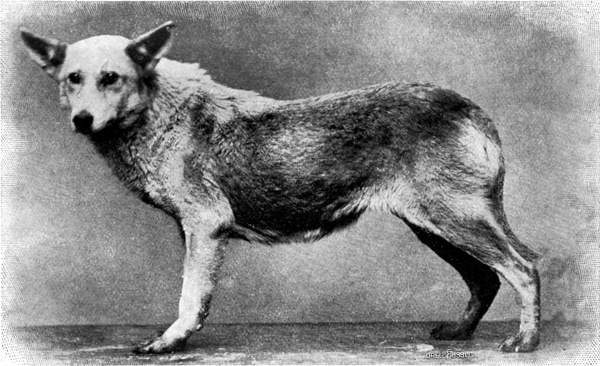
Pariahund vom weißen Nil.
(Nach Keller, Die Abstammung der ältesten Haustiere.)
Tafel 2.

Eskimohunde in Nordgrönland.
(Nach einer Photographie von Dr. Arnold Heim.)
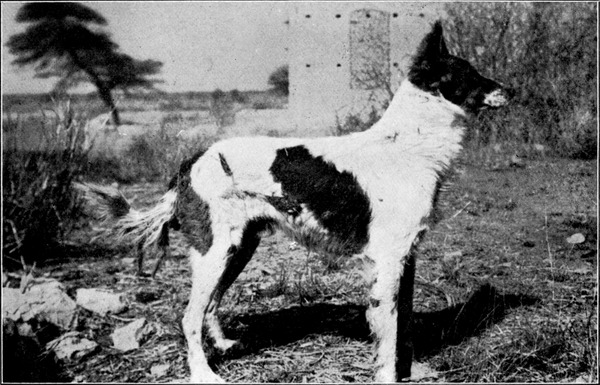
Schottischer Schäferhund in Deutschsüdwestafrika.
(Nach einer Photographie im Besitz der deutschen Kolonialschule in
Witzenhausen.)
Wie heute noch allgemein im Orient besorgte dieser Pariahund hier
schon in der Urzeit neben den Hausschweinen die Straßenreinigung.
In altbabylonischen Texten wird er als kalbu siguu, d. h.
umherschweifender Hund bezeichnet, der manchenorts den Schafherden
lästig wurde, weil er sich zur Stillung seines übermächtigen Hungers
an die jungen Schafe heranmachte. Da er sich für gewöhnlich von Aas
ernährte, mied man ihn so viel als möglich als unheimliches Geistwesen
und schützte sich vor seinem, wie man glaubte, krankmachendem
Einflusse durch das Tragen von Amuletten, die, wie die Labartu,
selbst hundeköpfig, sonst menschenähnlich, an der einen Brust ein
Schwein, an der andern einen Hund, oder wie die Daua an beiden
Brüsten Hunde säugend dargestellt wurden. Vielfach hing man sich auch
Hundenachahmungen um. Alle Krankheitsdämonen wurden hundegestaltig[S. 17]
dargestellt. So begreifen wir, wie bei den Semiten und durch sie bei
allen Völkern des Morgenlandes der Hund eine verachtete Stellung
einnahm, auch dann, als höher gezüchtete Formen desselben eingeführt
wurden.
Wie die west- und südasiatischen Pariahunde, deren südlichster Zweig
als Dingo schon in frühvorgeschichtlicher Zeit mit den dem
altdravidischen Volkselemente Südasiens nahe verwandten Australiern
in Australien einwanderte und hier in der Folge wiederum gänzlich
verwilderte, vom ebenfalls in rostroter Färbung vorkommenden
indischen Schakal abstammen, ist dies auch bei den meisten nord- und
mittelafrikanischen Pariahunden der Fall. Dagegen leben im Nilgebiet
und weiter westlich in Nordafrika Formen, die im Schädelbau stark von
jenen abweichen und offenbar vom nubischen Schakalwolf (Canis
anthus) abstammen. Der breite Kopf mit großen, aufrechtstehenden
Ohren, der selbst im weiblichen Geschlecht stark entwickelte
Scheitelkamm, die aufgetriebene, breite Stirn und der derbe,
kräftige Schnauzenteil stimmen vollkommen mit diesem überein. Auch
physiologische Gründe sprechen für diese Ableitung, so vor allem die
Gewohnheit beider, im Boden Löcher zu graben und Aas hervorzuscharren.
Bei den südafrikanischen Pariahunden dagegen scheint der dort
einheimische Schabrackenschakal (Canis mesomelas) der
eigentliche Stammvater zu sein.
Wie die kleineren, spitzartigen Haushunde vom Schakal, so stammen
alle größeren vom Wolf in seinen verschiedenen Abarten ab. Der
älteste dieser Wolfsabkömmlinge ist der in spätneolithischer Zeit in
Mitteleuropa auftretende Canis familiaris inostranzewi, von
Anutschin nach Inostranzew so genannt, der die Überreste desselben
zusammen mit denjenigen des Torfhunds in Kulturschichten der jüngeren
Steinzeit Rußlands am Ladogasee zuerst entdeckte. Später wurde er
dann auch in Pfahlbauten des Neuenburger- (Font) und Bielersees (an
der Schüß) mit einigen Kupfergegenständen gefunden. Dieser an Größe
einem mittleren Fleischerhunde entsprechende Hund besaß einen durchaus
wolfähnlichen Schädel von 17,7 cm Länge und näherte sich sehr
dem in Nordrußland und Sibirien verbreiteten, bereits besprochenen
Eskimohund, von dem wir konstatierten, daß er eine starke Blutmischung
mit dem nordischen Wolfe aufweise. Gegenüber dem Schädel des Torfhundes
erscheint der seinige langgestreckt, niedrig, mit stark entwickelter
Scheitelleiste und überhaupt ausgeprägten Muskelansätzen. Von der
breiten Stirne setzt sich der lang ausgezogene, vorn sich verjüngende
Gesichtsteil deutlich ab.
[S. 18]
Durch die Kreuzung dieses wolfähnlichen Hundes mit dem Pfahlbauspitz
von Schakalabstammung entstand der Aschenhund, so genannt,
weil seine Überreste vom Archäologen Grafen von Wurmbrand zuerst in
Aschenschichten bei Weikersdorf in Niederösterreich gefunden wurden.
Woldrich beschrieb sie im Jahre 1877 und nannte das Tier Canis
familiaris intermedius. Weitere Überreste desselben fanden sich in
Pulka und Ploscha in Böhmen. Mit einer Basilarlänge von 16,4 cm
steht sein Schädel in der Mitte zwischen dem größeren wolfartigen Hund
der Bronzezeit und dem kleineren Torfhund und war durch die bedeutende
Stirnbreite und die Kürze der Schnauze ausgezeichnet.
Von diesem eigentlichen Jagdhund der Bronzezeit, der uns in einer
bereits hängeohrigen, also hochgezüchteten Form auf einer Platte mit
Tierdarstellungen von Hierokanopolis in Ägypten aus vorpharaonischer
Zeit Antilopen und Steinböcke jagend entgegentritt, stammen die
Laufhunde sowie die Vorstehhunde mit ihren verschiedenen Unterrassen
ab. Und zwar schließt sich nach den eingehenden Untersuchungen
von Prof. Theodor Studer in Bern der Schädel des schweizerischen
Laufhundes in seiner Gestalt direkt an denjenigen des
Aschenhundes an, dessen wesentliche Merkmale er bis in alle Details
wiederholt, nur ist die Schädelhöhle bei ihm bedeutend geräumiger
geworden, als Zeichen, daß er inzwischen bedeutend an Intelligenz
zugenommen hat. Die Schädellängen schwanken zwischen 16,2 und 18,4
cm. Die größte Ähnlichkeit mit demjenigen des Canis
intermedius zeigt der Schädel eines Laufhundes aus der helvetischen
Station La Tène am Neuenburger See aus vorrömischer Zeit. Er stammt
aus Kulturschichten, die neben zahlreichen eisernen Waffen und Geräten
nebst bronzenen Schmuckgegenständen und Utensilien zahlreiche Knochen
von Haustieren, wie Pferden, Rindern und Schweinen, lieferten. Schon
bei ihm ist die Schädelkapsel etwas geräumiger, die Schläfenenge
weniger eingeschnürt und die Stirne breiter und seitlich mehr gewölbt
als beim Aschenhund, ein Prozeß, der sich im Laufe der Zeit noch
steigerte bis zu den heutigen Laufhunden.
Schon in der Ilias ist vom Laufhund die Rede, der den Hirsch oder die
Hirschkuh und deren Junges durch Täler und Schluchten verfolgt. Ein
solcher Laufhund war der treue Argos, der einst zur Jagd auf wilde
Ziegen, Rehe und Hasen gedient und das Aufspüren des Wildes trefflich
verstanden hatte; kein Wild sei ihm je entkommen, wird in der Ilias
von ihm gesagt. In der Folge hielten ihn die[S. 19] Griechen und Römer, aber
auch die Völker nördlich der Alpen. So waren zur Zeit des Julius Cäsar
die Gallier durch ihre Laufhunde berühmt, die sich vortrefflich zum
Aufspüren und Verfolgen der Beute bei der Jagd bewährten. Bei ihnen
waren besonders die nach dem gallischen Stamme der Segusier zwischen
Saône, Rhone und Allier von den Römern als segusii bezeichneten
Hunde hoch geschätzt. Nach den Schilderungen der alten Schriftsteller
Ovid, Plinius und Gratius waren es rauhhaarige Tiere, die nicht nur bei
den Römern, sondern nach dem Berichte von Flavius Arrianus im Jahre 130
n. Chr. auch in Griechenland Aufnahme fanden. Noch bis in das 6. und
7. Jahrhundert werden sie als segusii angeführt, später aber
erhielten sie nach ihrer hauptsächlichen Züchtung in der französischen
Landschaft Bresse die Bezeichnung chiens de Bresse. Doch waren
neben ihnen schon in römischer Zeit glatthaarige Laufhunde sehr
verbreitet, wie uns verschiedene antike Darstellungen zeigen. Daß bei
den Galliern verschiedene Rassen von Laufhunden vorkamen, beweist
ein im Jahre 1735 in den Ruinen des alten Aventicum (Avenches), der
Hauptstadt des römischen Helvetien, aufgefundenes Mosaik, das leider in
den Stürmen der Revolutionszeit 1798 zugrunde ging; doch besitzt das
historische Museum in Bern die 1794 in Farben ausgeführte Originalkopie
von Ingenieur Ritter, der im Auftrage der Berner Regierung damals die
in Avenches zutage geförderten Altertümer untersuchte und kopierte.
Wir sehen darauf, wie der wahrscheinlich helvetische Besitzer seine
geliebten Jagdhunde und sein bevorzugtes Wild neben einer durchaus
nicht dazu passenden Darstellung des auf dem Pegasus reitenden Perseus,
Tubabläsern, Bären und Delphinen wiedergeben ließ. Zu oberst springt
ein glatthaariger, langgestreckter Hund von graugelblicher Färbung,
in dem wir unschwer einen Hirschhund erkennen, einer Hirschkuh nach.
Darunter verfolgt ein großer Laufhund, weiß mit braunen Platten
mit hoher, stumpfer Schnauze — M. Siber vergleicht ihn mit dem
dreifarbigen Berner Laufhund —, ein nicht mehr erhaltenes Wild. Im
dritten Feld verfolgt ein schwerer, breitköpfiger und untersetzter
Jagdhund einen Eber, im vierten läuft ein kleiner, gefleckter
Jagdhund, in welchem M. Siber den Hasenhund par excellence, den
gewöhnlichen weiß und gelben Schweizer Laufhund sieht, einem Hasen
nach. Also muß schon im 1. Jahrhundert n. Chr. der von uns als Laufhund
bezeichnete eigentliche Jagdhund bei den Helvetiern in einer ganzen
Anzahl dem verschiedenen Wilde, das er verfolgen sollte, angepaßte
Rassen zerfallen gewesen sein.
[S. 20]
Auch bei den Germanen scheinen Laufhunde unter dem Namen segusu,
seusii, seuces — wohl von Gallien importiert —, ferner
Bracken (braccones) in kleineren und größeren Formen vorgekommen
zu sein. Sie alle werden in den alamannischen und bajuvarischen
Volksgesetzen, die etwa um 700 n. Chr. verfaßt wurden, erwähnt.
Eine besonders wichtige Rolle spielte bei den alten Deutschen der
Leitihund (Leithund), dessen Verletzung mit den schwersten
Strafen bedroht wurde. Nach der Abbildung Ridingers war dies ein
stämmiger, mittelgroßer Hund mit untersetztem Körperbau, breiter Brust,
starkem, breitstirnigem Kopf und hoher Schnauze, mit langem, breitem
Behang, glatthaarig, vom Aussehen eines plumpen Laufhundes. Derselbe
wurde bei der Jagd an der Leine geführt und erhielt seinen Namen
davon, daß er den Jäger, den Spuren des Wildes folgend, zum Jagdobjekt
leitete. Diese Rasse, die anscheinend zu Anfang des 19. Jahrhunderts
ausstarb, war schon zu Anfang des Mittelalters bei den germanischen
Völkern aus den gewöhnlichen, laut jagenden Treibhunden als bestimmte,
selbständige Rasse hervorgegangen. Später diente er dazu, einen ganz
bestimmten jagdbaren Hirsch auf der Vorsuche vor der eigentlichen Jagd
auszumachen und auf einem bestimmten Standorte zu bestätigen.
Wie die Laufhunde auf primitiver Stufe verbliebene Jagdhunde sind,
die dem aufgespürten Wilde laut bellend nachsetzen, so sind die
Vorstehhunde eine weit höher gezüchtete Form des alten
Jagdhundes. Dieser darf nicht mehr seine alte Raubtiernatur zum
Vorschein kommen lassen, sondern muß allen seinen angeborenen
Instinkten entgegen das von ihm durch sein feines Geruchsorgan
aufgestöberte Wild durch unbewegliches Stillsitzen vor ihm, den Kopf
nach ihm hingewendet, das Hinterteil etwas gesenkt und einen Vorderlauf
erhoben, dem Jäger anzeigen. Dieses „Vorstehen“ ist tatsächlich auch
die einzige Arbeit des modernen Setters und Pointers, die, wie der Name
schon andeutet, in England aus dem altspanischen Vorstehhund in teils
kurzhaarigen, teils langhaarigen Formen hochgezüchtet wurden.
Das deutsche Gegenstück zu diesen glänzenden englischen Virtuosen, dem
besten Gehilfen des sportmäßigen shooting, ist der kurzhaarige
deutsche Vorstehhund, der beste Freund und Genosse des deutschen
Weidmannes. Schon im 15. und 16. Jahrhundert besaß man in Deutschland
kurzhaarige Vorstehhunde zur Habicht- und Falkenbeize auf Feldhühner
und Hasen. Die ältesten Feuergewehrjäger des 17. Jahrhunderts, die
mit ihren schwerfälligen „Schroth-Büxen“ nur[S. 21] auf ruhende oder
langsam sich bewegende Ziele zu schießen vermochten, verwendeten
diese Jagdhunde wesentlich nur zum Apportieren. Erst nachdem durch
die französische Erfindung des Feuersteinschlosses und selbsttätigen
Pulverpfannendeckels das Gewehr genügend verbessert war und damit die
Periode der Schießjagd ihren Anfang nahm, kam im 18. Jahrhundert der
Vorstehhund bei den fürstlichen Jägern wieder zu Ehren und verdrängte
bei diesen den bis dahin üblichen „englischen“ Hatzhund. Bei den regen
Verbindungen des Fürstenhauses von Hannover mit England kann es nicht
verwundern, daß dann der deutsche Vorstehhund mit dem hochgezüchteten
englischen Typus verbessert wurde, bis schließlich unsere
unübertrefflichen vielseitigen Gebrauchshunde hervorgingen, die
zu den verschiedensten jagdlichen Verrichtungen verwendet werden können.
Einem glatthaarigen Vorstehhund ähnelt an Größe und Gestalt der
Schweißhund der deutschen Weidmänner. Die kräftig gebauten,
lohbraun bis fahlgelb gefärbten Tiere mit schwärzlichem Anflug an
Schnauze und Ohren besitzen einen breiten, wenig gewölbten Kopf. Die
Lippen der stumpfen Schnauze fallen breit über und bilden im Mundwinkel
eine starke Falte; die breitlappigen Ohren sind mittellang und unten
abgerundet. Er ist ein kaum zu entbehrender Gehilfe bei Ausübung
der Jagd auf Hochwild, indem er die Fährte angeschossener Tiere zu
verfolgen hat. An der Leine gehalten, führt er bei der Nachsuche den
Jäger still durch Busch und Wald zu der Stelle, wo das weidwunde Tier
sich niedergelegt hat. Ist er freigelassen und hat er das Wild verendet
gefunden, so „verbellt er es tot“, ist dieses aber noch flüchtig
geworden, so hetzt er es laut und stellt es, bis der Herr herankommt
und die Jagd mit einem Fangschuß beendet.
Nicht zu verwechseln mit diesem wichtigen Jagdgehilfen ist der
Hirschhund, der sich durch sein scharfes Spürvermögen und seine
außerordentliche Schnelligkeit auszeichnet. Gegenwärtig befinden
sich nur noch wenige im Besitz des englischen Königs. Früher war
dieses Tier ein wichtiges Inventarstück am britischen Hofe, das bei
den großen Hirschhetzen, an denen besonders Georg III. als
leidenschaftlicher Liebhaber dieses Sportes oft persönlich teilnahm,
eine sehr wichtige Rolle als Parforcehund spielte. Nicht selten hetzte
man mit solchem Eifer, daß von den 100 berittenen Jägern, die anfangs
hinter dem Hirsche dreinritten, zuletzt nur noch 10 oder 20 übrig
waren, wenn das flüchtige Wild von der Meute der Hirschhunde gepackt
wurde. Man durchritt dabei in Windeseile unglaubliche Entfernungen und
setzte die[S. 22] Jagd oft so lange fort, bis ein großer Teil der Pferde und
selbst viele Hunde dabei zugrunde gingen.
Diese Hirschhunde waren namentlich bei den alten keltischen
Völkerschaften als Jagdhunde sehr verbreitet und wurden noch im
Mittelalter auf dem mitteleuropäischen Festlande viel gehalten.
Nach dem bereits erwähnten Berner Professor Th. Studer sind sie
die wenig veränderten Nachkommen des als Canis familiaris
leineri bezeichneten Wolfabkömmlings, dessen Überreste bisher
in einem einzigen Exemplar im neolithischen Pfahlbau von Bodmann am
Überlinger See gefunden und nach dem nunmehr verstorbenen Direktor
des Rosgartenmuseums in Konstanz, Dr. Leiner, von Studer so
genannt wurden. Die Eigentümlichkeit dieser Rasse besteht in einer
langgestreckten, gewölbten Hirnkapsel mit mäßig entwickelter, gerader
Scheitelleiste an dem an der Basis gemessen 20 cm langen
Schädel. Die stumpf abgerundete Schnauze ist vor den Eckzähnen noch
3,5 cm breit. In seiner schlanken Form erinnert der Schädel an
den des Windhundes und in seiner geraden Profillinie an den gleich
zu besprechenden Bronzehund. Das unvermittelte Auftreten dieses
Tieres weist auf den zunehmenden Handelsverkehr jener Gegenden mit
dem Süden, von wo es zweifelsohne eingeführt wurde. Sein Entdecker
wies nämlich nach, daß es jedenfalls auf den indischen Wolf
(Canis pallipes) zurückgeht, der viel kleiner ist als der
europäische Wolf, nämlich bei einer Schulterhöhe von 65 cm
nur eine Gesamtlänge von 130 cm erreicht, wovon übrigens
40 cm auf den Schwanz entfallen. Von Indien aus erstreckt
sich sein Verbreitungsgebiet bis nach Ostpersien. Sein gewöhnlicher
Aufenthaltsort scheint das offene Gelände zu sein, während er das
Waldgebiet möglichst meidet. Nach den Angaben der Eingeborenen haben
die indischen Wölfe die Gewohnheit, weidende Antilopen oder Schafe
nach einer günstigen Fangstelle zu treiben, was einen Fingerzeig dafür
gibt, wie bei seinen gezähmten Nachkommen dieser Instinkt zum Bewachen
und Zusammentreiben von Herdetieren durch zielbewußte Erziehung weiter
ausgebildet wurde. Jeitteles nimmt Persien als den Ort der ersten
Domestikation des indischen Wolfes an. Von dort kam dann dieses Tier
nach seiner Zähmung als Haustier über Kleinasien und der Donau entlang
ins Herz von Europa, um hier bald neben dem Torfhund recht beliebt zu
werden.
Von dieser südlichen Haushundrasse leitet sich zweifellos der
Bronzehund ab, den Jeitteles 1872 in einer vorgeschichtlichen
Ablagerung der Stadt Olmütz entdeckte und unter dem Namen Canis[S. 23]
familiaris matris optimae — seiner Mutter zu Ehren so genannt —
beschrieb. In der Folge entdeckte man diesen an neun verschiedenen
Orten Mitteleuropas in Kulturresten der Bronzezeit, so daß man
annehmen darf, daß er zur Bronzezeit neben dem kleineren Torfspitz
von Schakalabstammung ziemlich verbreitet war. Sein Schädel von
durchschnittlich 18 cm Basislänge hat eine weniger gewölbte
Hirnkapsel und eine längere und spitzere Schnauze als derjenige des
Torfhundes. Diesen Canis familiaris matris optimae möchte
neuerdings M. Hilzheimer in Stuttgart von einem kleinen Wolf ableiten,
der nach seinen Untersuchungen Südschweden und die gegenüberliegenden
Küstenländer Rußlands bewohnte. Damit stimmt überein, daß Th.
Studer in Bern diesen von einem Hund ableiten will, der in einer
jungsteinzeitlichen Ablagerung Nordwestrußlands gefunden und von ihm
Canis putiatini genannt wurde. Was nun die Funktion der beiden
Haushunde Mitteleuropas zur Bronzezeit betrifft, so nimmt Naumann an,
daß der Torfspitz damals wie früher mehr zum Bewachen des Hauses, der
Bronzehund dagegen mehr zum Bewachen und Hüten der Herden, besonders
von Schafen, benutzt wurde. Letzteres ist sehr wohl möglich, um so
mehr die Großviehhaltung zur Zeit der Bronzekultur gegenüber der
Kleinviehzucht entschieden zurücktrat und besonders die Aufzucht des
Schafes zur Gewinnung der damals zuerst in größerer Menge beliebt
werdenden Wollkleidung einen großen Umfang annahm.
Jedenfalls sind unsere Schäferhunde die direkten Abkömmlinge
des Bronzehundes. In allen Formen des Schädelbaues stimmen sie mit
denjenigen des Bronzehundes vollkommen überein. Allerdings ist der
Schäferhund, wie wir ihn heute kennen, kaum 200 Jahre alt. Seine
Ausbildung begann erst mit der Ausrottung des Wolfes. Bis dahin war
seine Stelle vom hatzhundähnlichen, mit Stachelhalsband bewehrten
„Schafrüden“ eingenommen worden, der nur das Raubzeug, also vor
allem den Wolf, abzuhalten hatte, gewöhnlich aber vom Hirten am
Stricke geführt wurde, während dieser seine Herde selbst hütete
und, die Schalmei oder den Dudelsack blasend, vor ihr herging. Als
dann in England zuerst der Wolf ausgerottet wurde, entwickelte sich
dort aus den klugen und wetterharten wolfähnlichen Landhundschlägen
ein Schäferhund in unserem Sinne, dessen sich dann die Liebhaber
bemächtigten, um aus ihm schließlich den hochedlen Rassenhund
zu züchten, der uns heute im Collie oder schottischen
Schäferhund entgegentritt. Wie der englische ist dann später
auch der deutsche Schäferhund aus wolfähnlichen Landhunden
herausgezüchtet worden;[S. 24] nur wurde er nicht so verfeinert, um nicht
zu sagen überfeinert, sondern blieb ein derber, wetterharter und
genügsamer Gesell.
Aus kleinen Schäferhundformen ging schließlich im Mittelalter der
Pudel hervor, der Artist unter den Hunden. Er erscheint
nach Studer zuerst in den Abbildungen der geduldigen Griselda von
Pinturicchio als solcher. Seine Ursprungsform ist der Hirtenhund
früherer Zeiten, der alte „Schafbudel“, der früher auch als Jagdhund
verwendet wurde. Vermutlich hat er im Laufe der Zeit eine ziemliche
Beimischung von Blut des vom Canis familiaris intermedius der
Bronzezeit abstammenden Jagdhundes erhalten, da er früher viel für
die Jagd, besonders die Wasserjagd, verwendet wurde. Später wurde
er dann dank seiner Intelligenz und Gelehrigkeit zum persönlichen
Gesellschafter, Begleit- und Stubenhund erhoben und durch zielbewußte
Zucht zu einer Kulturrasse von besonderer Ausprägung erhoben. Wo
dies zuerst geschah, wird schwer zu entscheiden sein. Die ersten
Darstellungen desselben beziehen sich auf Burgund. In jener Zeit des
Mittelalters war der Jagdsport so allgemein und der Austausch der
tierischen Jagdgehilfen so international — man denke nur an den
massenhaften Bezug von nordischen Jagdfalken aus Island und Grönland,
die für ganz Europa den Bedarf deckten —, daß es fast unmöglich sein
wird, festzustellen, wo eine bestimmte Rasse zuerst erzeugt wurde.
In Deutschland sollen größere Pudelformen erst im 16. Jahrhundert
aufgetreten sein.
Sowohl mit Rücksicht auf ihren Körperbau als ihre geistige Eigenart
bilden unter allen Hunden die Windhunde die am schärfsten
umschriebene Rassengruppe. Der schlanke, zierliche Körper mit schmalen,
hoch hinaufgezogenen Lenden und geräumiger Brust ruht auf hohen,
sehnigen Gliedmaßen und trägt einen fein gebauten Kopf mit lang
vorgezogener Schnauze, indem der Gesichtsschädel stark verlängert,
dabei schmal und hoch ist, so daß die Lückenzähne auseinandergerückt
sind. Die aufrecht gestellten Ohren sind an der Spitze gewöhnlich
umgebogen. Der lange, dünne Schwanz wird hängend getragen und ist
bisweilen am Ende nach oben gekrümmt. Die Behaarung ist in der Regel
sehr kurz und dicht anliegend. Nur in den mehr nach dem kalten Norden
gelegenen Wohngebieten entwickelt sich als Wärmeschutz ein längeres
Grannenhaar.
Diese kurze Behaarung, die in unserem kühlen Klima leicht Veranlassung
zum Frieren gibt, deutet auf die Herkunft der Windhunde aus dem Süden,
und zwar weist das unruhige, ungemein bewegliche Wesen und das leichte
Orientierungsvermögen, das ihnen eigentümlich[S. 25] ist, wie auch der
schlanke Bau mit der stark entwickelten Brust mit geräumigen Lungen auf
die tropische Steppe als ursprünglichem Wohngebiet dieser Tiere. Dort
sind ja auch die ähnlich gebauten Antilopen zu Hause.
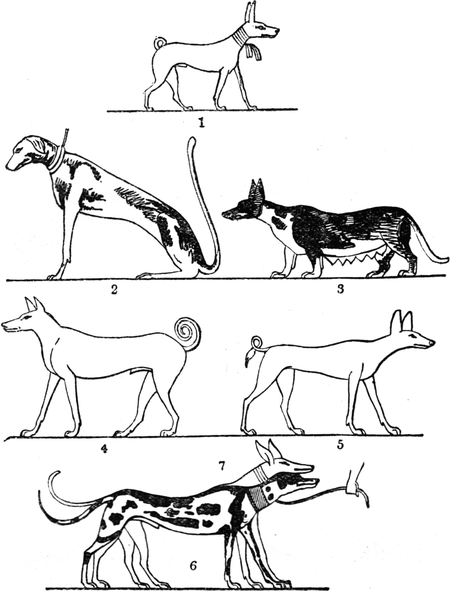
Bild 2. Darstellungen verschiedener Hunderassen auf
altägyptischen Denkmälern.
(Nach den Wandmalereien zusammengestellt von Wilkinson.)
2 u. 6 Jagdhunde mit Hängeohren als Beweis einer weitgehenden
Einwirkung der Domestikation, 3 Weibchen einer dachshundartigen Rasse,
1, 4, 5 u. 7 Windhunde.
In Europa erscheinen die dieser Rasse angehörenden zahmen Hunde spät.
Noch zur Bronzezeit fehlten sie hier gänzlich. Auch in Asien vermissen
wir sie in den ältesten für uns nachweisbaren Kulturperioden, so auch
in der altbabylonischen Zeit. Im alten Ägypten dagegen finden wir schon
zur Zeit der 4. Dynastie (2930–2750 v. Chr.) neben dem[S. 26] auch hier die
ursprünglich verbreitete Hunderasse darstellenden Torfhund, dem Spitz
von Schakalabstammung, einen hochbeinigen, glatthaarigen, stehohrigen
Windhund auf den alten Grabdenkmälern abgebildet. Die aufrechtstehenden
Ohren weisen darauf hin, daß die Domestikation noch nicht allzusehr auf
ihn eingewirkt hatte. Zuerst vermutete der Pariser Zoologe Geoffroy St.
Hilaire und nach ihm der Züricher Konrad Keller, daß der langbeinige,
spitzschnauzige abessinische Wolf (Canis simensis) der
Stammvater des altägyptischen Windhundes sei. Er sei schon zu Ende
des 4. vorchristlichen Jahrtausends irgendwo in Nubien gezähmt und
zum Haustier erhoben worden. Dem entgegen machen die meisten Autoren
geltend, daß die Windhunde, die uns allerdings in Ägypten zuerst
entgegentreten, nicht einheitlichen Stammes sein können, daß die
größeren und kleineren Formen verschiedenen Ursprungs seien. Letztere
stammen zweifellos aus dem Niltal; doch meint neuerdings M. Hilzheimer,
daß nicht der abessinische Wolf, sondern eine auffallend schlanke
Schakalart, Canis lupaster, der Ausgangspunkt dieser Rasse sei.
Dieser Schakal sei dem schakalköpfig dargestellten altägyptischen Gotte
Anubis, dem Geleiter und Schützer der Toten, heilig gewesen, und man
habe in Assiut Schädel bei Hundemumien gefunden, die denjenigen dieses
schlanken Schakals außerordentlich ähneln. Diese aus Nubien stammenden
kleineren Windhunde der Ägypter werden auf den Grabdenkmälern mit
dünnem, teilweise geringeltem Schwanze abgebildet. Sie wurden dann
durch die Phönikier nach Syrien gebracht und gelangten von da wohl
über Kleinasien zu den Griechen, dann auch nach Mittelitalien zu den
Etruskern und später durch die Römer in die Länder nördlich der Alpen.
Die größeren Windhunde dagegen führt M. Hilzheimer auf einen
im Nordwesten des Schwarzen Meeres heimischen hochgestellten
Steppenwolf zurück, der vom Menschen gezähmt und zu seinem
Jagdgehilfen erhoben wurde. Noch heute ist er als solcher für die Jagd
in der Steppe unentbehrlich. Auf diesen Wolf sei der als Barsoi
bezeichnete langhaarige russische Windhund, wie auch die gleichfalls
für die Jagd benutzten großen Windhunde, der persische Tasi und
der durch ganz Nordafrika verbreitete Slughi, zurückzuführen.
Der westlichste Vertreter derselben ist der englische Greyhound,
der in ganz ähnlicher Gestalt schon auf etruskischen Grabdenkmälern
erscheint. Also muß diese Windhundart schon frühe aus Westasien nach
Südeuropa gelangt sein.
Der älteste stehohrige Windhund Altägyptens ist aus ganz Nord[S. 27]afrika
verschwunden. Nach Keller hat er sich nur noch auf den Balearen östlich
von Spanien im Ibizahund erhalten, so genannt, weil er nach den
Kennern von der Insel Ibiza stammt, wohin er wohl von Nordafrika her
durch die Karthager gebracht wurde. Auf die Frage, weshalb sich der
Pharaonenwindhund ganz abseits vom Niltal auf den spanischen Inseln
des Mittelmeeres bis heute erhalten konnte, während er sonst überall
verschwand, antwortet Keller: „Es ist das Kaninchen, das uns diesen
alten Windhund gerettet hat. Die Balearen waren schon im Altertum ihres
Kaninchenreichtums wegen berühmt. Die dort angesiedelten römischen
Kolonisten wandten sich, wie Plinius berichtet, an ihr Mutterland,
damit dieses Soldaten schicke, um die Kaninchenplage zu beseitigen.
Aber viel wirksamer erwiesen sich die von den Pityusen eingeführten
Ibizahunde, die dem schädlichen Nager mit großem Geschick zu Leibe
gehen. Dieser ausgesprochene Jagdinstinkt hat sich vererbt, und wir
erfahren ja durch das bekannte Gemälde, das Prisse d’Avennes unter
dem Titel ‚Rückkehr von der Jagd‘ aus der Nekropole von Theben
veröffentlicht hat, daß die altägyptischen Windhunde zur Jagd auf Hasen
verwendet wurden.“
Derselbe Autor hat, wie 1906 den Ibizahund auf den Balearen, so später
auf der Insel Mallorka auch einen stehohrigen dachsartigen Hund, wie er
im alten Ägypten gezüchtet wurde, gefunden. Diesen führt er, wie alle
Dachshunde überhaupt, auf den altägyptischen Windhund zurück,
der durch vererbte Rachitis die ihm eigentümlichen kurzen, gekrümmten
Beine erhielt. Nun sind allerdings schon im 3. vorchristlichen
Jahrtausend niedrige, langgestreckte, stehohrige Hunde unter dem Namen
trqu, was etwa Feuriger, Heißer bedeutet, zur Jagd gebraucht
worden. Doch ist es durchaus nicht sicher, wie Keller annimmt, daß
unser deutscher Teckel auf diesen zurückgeführt werden darf.
Leider ist die Geschichte dieses letzteren durchaus noch im dunkeln.
Heute haben die Dachshunde, die den feinen Spürsinn der Jagdhunde
besitzen, daneben sehr intelligent und bei der Jagd äußerst ausdauernd
sind, als Zeichen einer uralten Kultur typische Hängeohren.
Weit besser geklärt als die Geschichte der Wind- und Dachshunde ist
diejenige der Doggen. Kann man erstere ihrem geistigen Wesen
nach als Sanguiniker bezeichnen, so sind letztere mehr die Choleriker
unter den Hunden. Ihr vehementer Angriff ist zu fürchten und zeugt von
bissigem Wesen, das dem Feinde gefährlich wird; aber dem eigenen Herrn
gegenüber sind sie fügsam und treu. Auch im Körperbau sind sie in ihrer
massigen Erscheinung das reine Gegenstück zu den zier[S. 28]lichen, schlanken
Windhunden. Ihre gedrungene Gestalt mit ungemein kräftiger Muskulatur
trägt einen schwergebauten Schädel mit relativ langem Gehirn- und
kurzem, breitem Schnauzenteil. Am Kopf erscheinen die Ohren hoch
angesetzt und am verkürzten Gesichtsteil legt sich die Haut gern in
Falten, welche in den Lippen schlaff herabhängen. Auch die Augenlider
sind vielfach schlaff und kehren unten die rote, nackte Bindehaut
heraus, was dem Gesicht einen eigentümlichen Ausdruck verleiht. An den
kurzen Hals schließt sich eine breite Brust an, die Weichen sind wenig
hoch aufgezogen, die Beine mittelhoch und mit kräftiger Muskulatur
versehen. Ursprünglich war die Körperbehaarung lang, fast zottig, als
Beweis, daß diese Hunderasse von einer in einem kalten Klima lebenden
Wolfsart abstammt. Auch der Schwanz war buschig. Doch sind später aus
diesen langhaarigen auch kurzhaarige Doggen entstanden, deren Schwanz
auch nur kurz behaart ist.
Im vorgeschichtlichen Europa und im alten Ägypten fehlen diese
gewaltigen Hunde vollständig, dagegen treffen wir sie schon in
kurzhaarigen Formen in Vorderasien bei den alten Assyriern in der
ersten Hälfte des letzten Jahrtausends v. Chr. an. Und zwar scheinen
die Assyrier diese Hunde aus Indien erhalten zu haben, das sie
seinerseits aus dem Hochlande von Tibet bezog. Nach Prof. Konrad
Keller ist zweiffellos der auffallend große, schwarze Tibetwolf
(Canis niger) der Stammvater dieser mächtigen, ebenfalls
zottig schwarz behaarten Hunde, die im warmen Indien und Vorderasien
ihre lange Behaarung bald verloren und kurzhaarig wurden. Der große,
schwarze Wolf — den Sclater 1874 zuerst als reichlich 1 m
langen Wildhund beschrieb —, der im durchschnittlich Mont Blanc-Höhe
aufweisenden Hochlande von Tibet neben dem gemeinen grauen Wolfe
vorkommt, ist in den kräftig bemuskelten Beinen auffallend tief
gestellt, hat an Hals und Brust eine auffallend lange Behaarung von
schwarzer Farbe, alles Merkmale die auch die Tibetdoggen aufweisen,
nur daß diese neben dem schwarzen Haarkleid häufig einen weißen
Bruststern und weiße Pfoten aufweisen. Von den Abkömmlingen dieser
Hunderassen waren nach den vorliegenden literarischen Quellen auch die
altassyrischen Doggen und die von diesen abzuleitenden Molosserhunde
der Griechen und später der Römer vorwiegend schwarz, teils einfarbig,
teils auch mit weißen Flecken. Die späteren davon abweichenden
Färbungen sind offenbar erst sekundär erworben worden.
Die großen Tibetdoggen sind heute noch in Europa wenig bekannt.
Die ältesten Angaben über dieselben findet man in der chinesischen
Lite[S. 29]ratur, nämlich im Schu-king, demzufolge 1121 v. Chr. ein
Tibethund, der auf die Menschenjagd dressiert war, als Geschenk an den
Kaiser von China gelangte. Heute bringen tibetische Händler solche
häufig nach dem chinesischen Reich. Nach Europa gelangte die erste
Kunde von diesen gewaltigen Tibethunden zu Ende des 13. Jahrhunderts
durch den Venezianer Marco Polo, der erzählte, daß er die Größe
eines Esels erreiche und zur Jagd auf wilde Ochsen (Yaks) verwendet
werde. Fünf Jahrhunderte hindurch hörte man nichts mehr von ihm, bis
der Engländer Samuel Turner um 1800 auf einer Gesandschaftsreise im
Auftrage der Ostindischen Kompanie nach Tibet diese starken Hunde von
70–80 cm Schulterhöhe antraf, die er als bösartig bezeichnet.
Nach ihm gab Bryan Hodgson eine genauere Beschreibung von ihnen. Er
bezeichnet die Hunde von Tibets Hauptstadt Lhassa als die schönsten;
sie seien von schwarzer Farbe mit braunen Beinen. Nach Hooker wird
diese Dogge bei den Karawanen der Tibeter vielfach zum Lasttragen
benützt. Diese Rasse, die nur vereinzelt über Tibet hinausgeht und
z. B. in den Vorbergen des Himalajas vereinzelt angetroffen wird, steht
schon durch die ziemlich wenig verkürzte Schnauze der Stammform am
nächsten.
Die Geschichte der Doggen ist kurz folgende: Der Bildungsherd, in
welchem durch Zähmung des großen, schwarzen Tibetwolfes die ältesten
Doggen hervorgingen, ist Tibet. Von hier drangen diese durch ihre
Stärke geschätzten Nutztiere nach Nepal und Indien, vereinzelt auch
nach China vor. Von Indien aus gelangten sie frühe nach Persien und
von da bereits in einer kurzhaarigen Form in der ersten Hälfte des
letzten vorchristlichen Jahrtausends nach Assyrien und Babylonien,
wo wir sie mehrfach als Jagdhunde, teils an einem Riemen geführt,
teils frei dahinstürmend, abgebildet finden. So finden wir eine
höchst charakteristische Darstellung der assyrischen Dogge auf einer
Topfscherbe aus Birs Nimrud. Noch viel wahrheitsgetreuer sind die auch
künstlerisch viel höher stehenden Basreliefs von dem aus dem Jahre
668 v. Chr. stammenden Palast Asurbanipals in Kujundschik, die nun
ebenfalls im Britischen Museum sind. Auf der einen Darstellung sehen
wir den Auszug zur Jagd. Einige Jäger schreiten mit den Fangnetzen
voran; ihnen folgen andere, eine kampfbegierig vorwärtsstürmende
Dogge an der Leine führend. Auf der andern erblicken wir, wie vier
bissige Doggen mit kräftigen Halsbändern ein Wildpferd anfallen und es
niederzureißen versuchen.
Später erwähnt Herodot um die Mitte des 5. vorchristlichen
Jahr[S. 30]hunderts, ein Satrap von Babylon habe die Einkünfte von vier
Städten auf den Unterhalt solcher Hunde verwendet, was auf eine größere
Zahl derselben schließen läßt. Zu seiner Zeit gab es ähnlich große
Hunde auch in Epirus, wohin sie nach Keller aus den Euphratländern
durch den Zug des Xerxes gekommen sein sollen. Nachschübe dieser
Doggen erfolgten durch den Eroberungszug Alexanders des Großen nach
Indien, indem dieser makedonische König ihm vom Könige Porus und
andern indischen Fürsten geschenkte gewaltige Hunde nach seiner Heimat
Makedonien sandte. Über die Leistungsfähigkeit dieser indischen
Hunde, die nur Tibeter gewesen sein können, erzählt der römische
Geschichtschreiber Curtius Rufus auf griechische Quellen gestützt
folgendes: Nach Überschreitung des Hydaspes und nach Besiegung
des Porus kam Alexander ins Gebiet des Königs Sopites. „In diesem
Lande gibt es sehr vortreffliche Jagdhunde, die, wie man sagt, beim
Anblick eines Wildes sogleich zu bellen aufhören und besonders für
die Löwenhatz sehr gut sind. Um Alexander davon zum Augenzeugen zu
machen, ließ Sopites einen außerordentlich großen Löwen bringen und
ihn bloß von vier Hunden hetzen, die sogleich den Löwen anpackten. Ein
Hatzknecht nahm hierauf einen dieser Hunde, die am Löwen hingen, bei
einem Bein und suchte ihn loszureißen. Als er nicht loslassen wollte,
hieb er ihm dieses ab. Da er aber auch dies nicht beachtete, hieb er
ihm ein zweites Bein ab, und, weil er noch immer den Löwen festhielt,
schnitt er ihm ein Glied nach dem andern vom Rumpfe, und trotzdem hielt
der Hund, obschon inzwischen tot, noch den Löwen mit den Zähnen fest.
So hitzig sind diese Tiere von Natur auf die Jagd!“
Etwas abweichend von diesem Berichte erzählt der griechische
Geschichtschreiber Diodorus Siculus zur Zeit Cäsars und Augustus: „Der
indische König Sopites kam aus seiner Residenz dem Alexander entgegen,
bewirtete dessen Soldaten einige Tage hindurch aufs glänzendste und
schenkte ihm außer vielen andern wertvollen Dingen 150 Hunde von
außerordentlicher Größe und Stärke. Um nun eine Probe von ihren
Heldentaten zu geben, ließ er vor Alexander einen großen Löwen in
ein Gehege bringen, und ließ dann auch zwei der schwächlichsten der
geschenkten Hunde hinein. Diesen war der Löwe überlegen. Jetzt wurden
noch zwei andere Hunde hineingelassen, und bald hatten die vier Hunde
den Löwen so gepackt, daß sie ihn überwältigten. Darauf schickte
Sopites einen Mann ins Gehege, der ein großes Messer trug, um einem der
Hunde das rechte Bein abzuschneiden. Als Alexander das sah, schrie er
voll Entsetzen auf, und Leute seiner[S. 31] Leibwache eilten hin, dem Inder
Einhalt zu gebieten. Sopites aber versprach dem Alexander, er wolle ihm
drei andere Hunde für den einen geben; und so schnitt denn der Inder
dem Hunde ganz langsam das Bein ab, ohne daß dieser sich muckste. Er
hielt im Gegenteil den Löwen mit seinen Zähnen so lange fest, bis er
sich verblutet hatte und starb.“ Nebenbei bemerkt kommt es auch heute
nicht selten bei Sauhatzen vor, daß sich Hunde so fest in das Beutetier
verbeißen, daß sie von selbst nicht wieder loskommen können. Für diesen
Fall muß der Hatzmeister dem Hunde einen stets bei sich geführten
fußlangen Holzknebel von der Seite in den Mund schieben, indem er
diesen behutsam öffnet.
Einen weiteren Bericht über die außerordentliche Leistungsfähigkeit
dieser indischen Doggen hat uns der ältere Plinius in seiner
Naturgeschichte überliefert. Er schreibt nämlich: „Als Alexander (der
Große) nach Indien zog, hatte ihm der König von Albanien einen Hund
von ungeheurer Größe geschenkt. Das gewaltige Tier gefiel ihm, und er
ließ erst Bären, dann Eber und endlich Antilopen zu ihm; aber der Hund
blieb ruhig liegen und blickte sie mit Verachtung an. Erbittert über
dessen Faulheit ließ ihn der Eroberer töten. Dies erfuhr der König von
Albanien und sandte ihm einen anderen, mit der Aufforderung, ihn nicht
an schwachen Tieren, sondern an Löwen und Elefanten zu versuchen; er
habe nur zwei solcher Hunde gehabt und dieses sei der letzte. Ohne
sich lange zu besinnen, ließ Alexander einen Löwen los; diesen machte
der Hund augenblicklich nieder. Darauf befahl er, einen Elefanten
vorzuführen, und nie sah er ein Schauspiel mit größerem Vergnügen
an als das, das sich ihm jetzt darbot: Der Hund sträubte alle seine
Haare, bellte furchtbar donnernd, erhob sich, sprang bald links, bald
rechts gegen den Feind, bedrängte ihn und wich wieder zurück, benutzte
jede Blöße, die er sich gab, sicherte sich selbst vor dessen Stößen
und brachte es so weit, daß der Elefant vom immerwährenden Umdrehen
schwindelig niederstürzte, so daß bei seinem Falle die Erde erdröhnte.“
Jedenfalls waren diese indischen Hunde von einer den Griechen bis dahin
für unmöglich gehaltenen Tapferkeit und Stärke.
In Griechenland erfreuten sich die großen epirotischen Hunde neben
den lakonischen von ägyptischer Windhundabstammung, die zur Jagd
dienten, und den vom westasiatischen Schakal stammenden Spitzhunden,
die als getreue Wächter des Hauses gehalten wurden, in der klassischen
Zeit der größten Wertschätzung. Der 389 v. Chr. verstorbene attische
Dichter Aristophanes berichtet, daß die starken epirotischen Hunde von[S. 32]
fürsorglichen Ehemännern zur Hut der Frauengemächer benutzt wurden. Wie
grimmig diese dreingeschaut haben müssen, beweist die Tatsache, daß der
finsterblickende Höllenhund Kerberos von den Dichtern zum Stammvater
der epirotischen Zuchten erklärt wurde.
Von den Griechen erhielten dann die Römer die hochgeschätzte
epirotische Dogge, die sie Molosser (canis molossus)
nannten. Eine eingehende Beschreibung des Tieres gibt der römische
Ackerbauschriftsteller Columella um die Mitte des 1. Jahrhunderts n.
Chr., und hebt den mächtigen Kopf des Tieres hervor. Diesen gewaltigen
Hund, den sie mit Vorliebe bei den blutigen Tierhetzen im Amphitheater
verwendeten und mit dem sie gewiß bei den Helvetiern und Germanen
Aufsehen erregten, brachten die Römer zu Beginn der christlichen
Zeitrechnung auch in ihre Kolonien nördlich der Alpen. So fand man vor
einem Jahrzehnt im römischen Standlager von Vindonissa (dem heutigen
Windisch am Zusammenfluß von Aare und Reuß) auf mehreren offenbar an
Ort und Stelle hergestellten Tonlämpchen ein vollständiges Hundebild,
das gut auf den antiken Molosser paßt. Es stellt einen sehr kräftig
gebauten, hängeohrigen Hund dar, dessen Kopf eine dicke Schnauze
aufweist. Der Körper erscheint langhaarig und der starkbehaarte Schwanz
erinnert lebhaft an denjenigen unserer Bernhardinerhunde. Bemerkenswert
und ebenfalls für den Doggencharakter sprechend ist der Umstand, daß an
der Hinterpfote eine deutliche Wolfsklaue gezeichnet ist. Später kam
eben dort auch ein wohlerhaltener Molosserschädel zum Vorschein, der
nun in der Landwirtschaftlichen Sammlung in Zürich aufbewahrt wird.
Tafel 3.

„Vor dem Hunde wird gewarnt.“
Mosaik aus einem Hausflur in Pompeji.

Tonlampe mit Molosserhund aus Vindonissa.
(Nach Keller, Die Abstammung der ältesten Haustiere.)
Tafel 4.

Jäger des Assyrerkönigs Assurbanipal (668–626 v. Chr.) mit
Jagdhunden und Fangnetzen.
(Nach einer Photographie von Mansell & Cie. in London.)
⇒
GRÖSSERES BILD
Tafel 5.
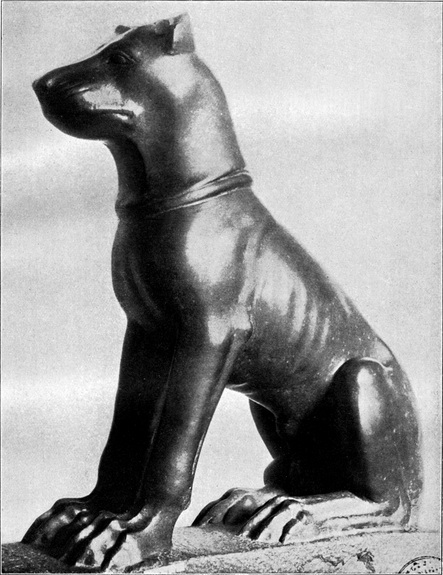
Darstellung eines altägyptischen Hundes der Windhundrasse.
Im Museum des Louvre.
⇒
GRÖSSERES BILD
Tafel 6.
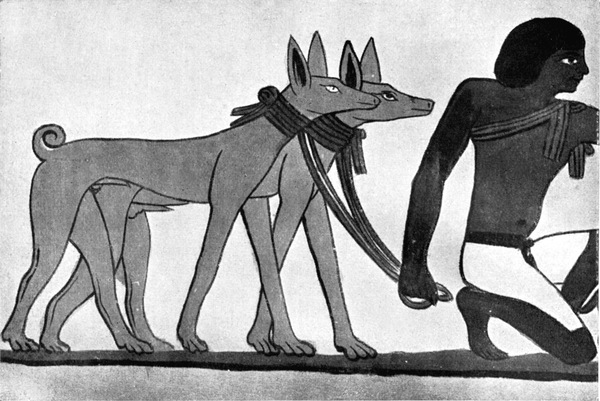
Altägyptische Windhunde.
Aus dem Ti-Grab in Sakkarah. 5. Dynastie, 2750–2625 v. Chr.
(Nach Konrad Keller.)

Die Hündin von Gabii. Römische Marmorfigur im Louvre zu
Paris.
Daß nun bei dem wiederholten Import einzelne Exemplare des Molossers
in verschiedene entlegene Alpentäler Helvetiens gelangten und hier
vor Kreuzung mit anderen Rassen und damit vor Vernichtung bewahrt
blieben, ist weiter nicht wunderbar. Ebenso begreiflich ist es, daß sie
hier vortrefflich gediehen. Boten doch die Alpenländer Verhältnisse,
die klimatisch denen ihrer Urheimat in Tibet sehr ähnlich sind. So
wurde in den abgeschiedenen Hochtälern der Alpen die alte Rasse
weitergezüchtet und lieferte die in den Alpen und Voralpen gehaltenen
Sennenhunde von ziemlich primitivem Charakter. Durch sorgfältige
Reinzucht aber ging aus diesem Material der nach dem Hospiz des
großen St. Bernhard benannte edle Bernhardinerhund hervor,
der seiner vortrefflichen Eigenschaften wegen unter allen Doggen am
höchsten geschätzt wird. Dort, auf dem Simplon- und Gotthardhospiz,
auf der Grimsel usw., wurde der durch guten Spürsinn ausgezeichnete
Hund,[S. 33] dessen Gutmütigkeit und Treue fast sprichwörtlich geworden
ist, zum Aufsuchen verirrter Wanderer benutzt. Der berühmteste aller
Hospizhunde war Barry vom Hospiz auf dem Großen St. Bernhard, der im
ganzen 44 Personen das Leben gerettet hat und nunmehr ausgestopft im
Naturhistorischen Museum zu Bern zu sehen ist.
Gegenüber dem von den Römern in das Alpenland importierten Molosser
ist der Schädel wie der ganze Körper des Bernhardinerhundes größer,
was wohl als Folge der besseren Haltung und Pflege durch den Menschen,
unterstützt von dem ihm sehr zusagenden Hochgebirgsklima, erklärt
werden kann. Von diesem prächtigen Hunde sind aus den früheren
Jahrhunderten in der Schweiz keine schriftlichen Mitteilungen auf uns
gekommen, weil er offenbar dort so bekannt war, daß man ihn nicht zu
erwähnen brauchte; nur als Helmzier und als Wappen schweizerischer
Edelleute tritt uns sein prächtiger Kopf entgegen. Im schweizerischen
Landesmuseum in Zürich befindet sich eine Wappenrolle aus dem 14.
Jahrhundert mit zahlreichen Bernhardinern, die uns den Beweis liefern,
daß die schönen Hunde besonders beim Adel gehalten wurden. Noch
heute lassen sich manche seiner Zuchten von den Hunden der Grafen de
Rougemont, de Pourtalès, von Graffenried, von Judd usw. ableiten.
Später kamen sie dann im schweizerischen Tiefland in Vergessenheit,
wurden aber nicht nur auf dem Hospiz des Großen St. Bernhard in von den
Mönchen für ihre menschenfreundlichen Zwecke geschenkten und rasserein
gehaltenen Exemplaren, sondern auch auf anderen Alpenpässen und in
vielen Alpentälern gezüchtet.
Die ersten, die in der Neuzeit die Bedeutung dieses Hundes erkannten,
waren die Engländer. Sie lernten ihn, wie wir zuerst aus dem Jahre
1778 erfahren, auf dem Hospiz des St. Bernhard kennen und exportierten
ihn schon in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts nach England.
Hier tauften sie ihn holy breed, d. h. heilige Zucht. Da ihn
ein allerdings verdienter Nimbus umgab, wurde aus verständlichen
Gründen der von einem Heiligenschein umschwebte Name Bernhardiner
der am schärfsten ausgeprägten und berühmtesten Familie der gesamten
Rasse beigelegt. Im Jahre 1863 wurde zum erstenmal in England ein
Bernhardiner prämiiert. Offenbar wurde er zunächst in der Absicht, die
einheimischen Mastiffs zu verbessern, nach England eingeführt. Später
wurde er auch direkt gezüchtet, so daß er dort heute einen besonderen,
von dem schweizerischen abweichenden Rassentypus darstellt.
[S. 34]
Durch die Erfolge der Engländer, dann auch Franzosen und Deutschen
aufmerksam geworden, begannen einige Schweizer Züchter, an ihrer
Spitze Schuhmacher in Holligen bei Bern, in letzter Stunde bestes
Zuchtmaterial vor der Auswanderung nach dem Auslande zu retten und
treffliche einheimische Rassen hochzuzüchten, die die früheren weit
übertreffen. Und zwar wird eine kurz- und langhaarige Bernhardinerrasse
gezüchtet, deren getrennter Bestand sich bis zum Anfang des vorigen
Jahrhunderts zurückverfolgen läßt. In der Ebene wird dem langhaarigen
Typus der Vorzug gegeben, während die Hospizmönche den kurzhaarigen
ziehen, dessen Behaarung sehr dicht ist. Der letztere besitzt bei
einer Schulterhöhe von 70 cm beim Rüden und von 65 cm
bei der Hündin einen in richtigem Verhältnis zum kräftigen Körper
stehenden Kopf mit verhältnismäßig schwachem Gebiß. Der Hals wird steil
getragen, ist im übrigen kurz und breit, der Rücken gerade, der Bauch
weit aufgezogen. Die weiblichen Tiere sind feiner als die männlichen
gebaut. Bei den langhaarigen Bernhardinern ist der Körper gestreckter,
die Brust etwas tiefer, der Schwanz lang und etwas buschig behaart. Die
Behaarung ist schlicht oder leicht gewellt und stimmt in der Färbung
(weiß mit rotgelb) mit dem vorigen Typus überein. Gekräuseltes oder
stark gelocktes Haar gilt als fehlerhaft. Erst in neuerer Zeit sind die
großen Formen des Bernhardiners gezüchtet worden.
In bezug auf äußere Erscheinung schließen sich auch die
Neufundländer eng an die Tibethunde an. Sie erreichen eine
Schulterhöhe von 63–69 cm, sind kräftig gebaut, mit breitem,
langem Kopfe, etwas verdickter Schnauze, ziemlich hohen, starken Beinen
und sehr dichter Behaarung von äußerst feinen, weichen, tiefschwarz
bis rotbraun gefärbten Haaren. Die Behaarung des Kopfes ist kurz, am
übrigen Körper, auch am Schwanz buschig. Die Zehen der breiten Pfoten
sind durch Bindehäute verbunden, so daß das Tier gewandt und ausdauernd
zu schwimmen vermag. Es schwimmt leidenschaftlich gern und mit der
größten Leichtigkeit, taucht wie ein Wassertier und kann stundenlang im
Wasser aushalten. Schon oft wurden durch den Neufundländer Menschen vor
dem Tode durch Ertrinken gerettet. Mit größter Treue und Anhänglichkeit
verbindet er bedeutenden Verstand und außerordentliche Gelehrigkeit,
ist sehr gutmütig, sanft und dankbar für empfangene Wohltaten. Die
Stammrasse ist in England gezüchtet worden und scheint mit der Insel
Neufundland, die ihr den Namen gab, gar nichts zu tun zu haben. So
wenig wie im Jahre[S. 35] 1622, als die Engländer nach jener Insel gelangten,
ist später dieser Hundetypus dort einheimisch gewesen. Wie er aber
in England gezüchtet wurde, das konnte bis jetzt nicht in Erfahrung
gebracht werden.
Schlanker gebaut, mit höheren Beinen und weniger plumpem Kopf als die
echten Doggen sind die deutschen und dänischen Doggen,
die vermutlich Kreuzungsprodukte von großen Windhunden mit echten
Doggen darstellen; denn in Gestalt und Eigenschaften halten sie die
Mitte zwischen beiden inne. Namentlich die deutschen Doggen bieten
in edlen Vertretern eine wahrhaft wunderbare Vereinigung an sich
widerstreitender Eigenschaften dar, nämlich Größe und Flüchtigkeit mit
Kraft und Eleganz. Wie schon der selbstverständlich vom englischen
dog sich ableitende deutsche Name Dogge beweist, so führt auch die
Geschichte der deutschen Dogge wie diejenige der edlen Jagdhunde auf
die „englischen Hunde“ zurück, die seit dem Anfang des 16. Jahrhunderts
von den jagdliebenden deutschen Fürsten und Adligen besonders für
die Sauhatz von England importiert wurden. Im 17. Jahrhundert wurden
sie auch in Deutschland gezüchtet, hießen aber noch zu Beginn des
vorigen Jahrhunderts bei uns „englische Hunde“ zum Unterschied von den
leichteren, spitzschnauzigen „Rüden“ einheimischen Schlages, die, unter
die Bevölkerung verteilt, von dieser auf höheren Befehl unterhalten und
während der Jagdzeit den Herren zur Verfügung gestellt werden mußten.
Zu großen Meuten vereinigt, hatten diese ungefügigen, bissigen Köter
die Wildschweine rege zu machen und zu treiben, während die größeren
und schwereren englischen Hunde, die Doggen, durch gepolsterte, mit
Fischbein gesteifte „Jacken“ geschützt, bei den Herrenjägern blieben
und, auf ein bestimmtes Stück losgelassen, dieses an den Ohren fingen
und festhielten, bis es mit der „Saufeder“ gestochen und so getötet
war. Dafür waren sie auch die Lieblinge ihrer hohen Herren, mit denen
besonders auserwählte Exemplare der Gattung als „Leib- und Kammerhunde“
immer zusammen sein und sogar das Schlafgemach teilen durften. Als
sie dann später durch Umgestaltung der Jagd bei dieser überflüssig
wurden, wandte sich die Liebhaberei ihnen zu und züchtete aus ihnen
herrliche Tiere, die mit Recht den Stolz ihres Besitzers darstellen.
Die lichtgelbe Färbung mancher deutscher Doggen ist jedenfalls auf den
Einfluß des Windhundblutes zurückzuführen.
Den Übergang zu ausgesprochen schweren und breitköpfigen Doggenformen
bildet die echte dänische Dogge, so genannt, weil sie seit etwa
50 Jahren mit einer gewissen Vorliebe in Dänemark gezüchtet wird,[S. 36]
zumal in Gestalt des gelben, schwarz maskierten Broholmers. Auch dieser
ist von englischer Abstammung und wurde in seiner ursprünglichen Heimat
im englischen Mastiff zu einem wahren Klotz von Hund gezüchtet,
der dank seiner Größe und Stärke einen geradezu unüberwindlichen
Schutzbegleiter darstellt. Solche Schutz- und Kampfhunde hat es ja
bereits im Altertum, wenn auch nicht in solchen gewaltigen Ausmaßen,
gegeben. Man denke nur an die Hunde der Zimbern und Teutonen, die mit
den Weibern die Wagenburg der Auswanderer aufs getreuste bewachten und
mit denen die Römer nach Besiegung der Männer in offener Schlacht noch
einen harten Strauß zu bestehen hatten.
Ebenfalls Produkte englischer Zucht sind die dem Mastiff nahe stehenden
Bullenbeißer, deren ausgezeichnetste Rassen heute noch in Irland
hervorgebracht werden. Zu ihrer Stärke und Entschlossenheit besitzen
sie einen geradezu unglaublichen Mut, so daß sie sich zu schwerer und
gefährlicher Jagd, wie auch zu Kämpfen mit wilden Tieren besonders
eignen. Ihre geistigen Fähigkeiten sind nicht so ausgezeichnet wie die
der übrigen gescheiten Hunde, keineswegs aber so tiefstehend, als man
gemeinhin glaubt; denn jeder Bullenbeißer gewöhnt sich leicht an den
Menschen und opfert ohne Bedenken sein Leben für ihn. Er eignet sich
vortrefflich zum Bewachen des Hauses und verteidigt das ihm Anvertraute
mit wirklich beispiellosem Mute. Als Reisebegleiter in gefährlichen,
einsamen Gegenden ist er gar nicht zu ersetzen. Man erzählt, daß
er seinen Herrn gegen fünf bis sechs Räuber mit dem besten Erfolge
verteidigte, und kennt Geschichten, in denen er als Sieger aus solchen
ungleichen Kämpfen hervorging, trotz unzähliger Wunden, welche er
dabei erhielt. Auch als Wächter bei Rinderherden wird er verwendet und
versteht es, selbst den wildesten Stier zu bändigen, indem er sich
alsbald in die Oberlippe seines großen Gegners einbeißt und so lange
dort fest hängt, bis der Riese sich der Übermacht des Hundes gefügt
hat. Auch zum Kampfe gegen große Raubtiere, wie Bären, Wölfe usw., läßt
er sich abrichten. Früher waren Tierhetzen sehr beliebt, indem solche
Hunde gegen gefangene Bären oder wilde Stiere in Bären- oder Hetzgärten
genannten geschlossenen Räumen gehetzt wurden und das Volk sich an
dem beispiellosen Mute dieser verhältnismäßig kleinen Hunde ergötzte.
In England spitzten sich diese öffentlichen, gegen Eintrittsgeld
zugänglichen Schaustellungen später so zu, daß gegen einen angeseilten
Stier nur ein einziger, kleiner Hund losgelassen wurde, der ihn an der
Nase zu fassen hatte.
[S. 37]
Auf dem plumpen, kräftigen Körper des Bullenbeißers sitzt auf kurzem,
dickem Hals der dicke, runde, hinten sehr breite, zwischen den Augen
eingesenkte Kopf mit stumpfer, aufgeworfener Schnauze. Infolge der
starken Verkürzung des mittleren Teiles der Oberlippe und Nase
hat sich die Gesichtshaut in Falten gelegt und sind die vorderen
Zähne unbedeckt, während die Lippen seitlich davon überhängen und
von Geifer triefen. In den extremsten Fällen ist der Hund zu einer
wahren Karikatur gezüchtet worden, die in ihrer Vierschrötigkeit und
grinsenden Mine mehr Mitleid als Freude erweckt.
Eine große Bullenbeißerrasse richtete man früher dazu ab, Menschen
einzufangen, niederzuwerfen und sogar umzubringen. Schon bei der
Eroberung Mexikos wandten die Spanier derartige Hunde als Mitkämpfer
und Aufspürer gegen die Indianer an. Unter ihnen war besonders
Beçerillo berühmt, dessen Kühnheit und Klugheit außerordentlich waren.
Er wurde unter allen seinen Genossen ausgezeichnet und erhielt doppelt
so viel Futter als die übrigen. Beim Angriff pflegte er sich in die
dichtesten Haufen der Indianer zu stürzen, diese beim Arme zu fassen
und sie so gefangen wegzuführen. Gehorchten sie, so tat ihnen der
Hund weiter nichts, weigerten sie sich aber, mit ihm zu gehen, so riß
er sie augenblicklich zu Boden und würgte sie. Indianer, welche sich
unterworfen hatten, wußte er genau von Feinden zu unterscheiden und
berührte sie nie. Noch im Jahre 1798 benutzte man solche „Bluthunde“
zum Fangen von Menschen, und zwar waren es nicht Spanier, sondern
Engländer, welche mit ihnen die Menschenjagd betrieben.
Die deutsche Bulldogge ist der Boxer, der noch nicht zu solchem
Zerrbild wie the old english bulldog überzüchtet wurde. Auch
er hat eine breite Brust und einen muskulösen Körper, aber sein Kopf
ist nicht so extrem verkürzt, so daß er seine Kiefer vortrefflich
zum Beißen verwenden kann. Ungemein bissig und herrschsüchtig,
ordnet er sich seinem Herrn gegenüber unter und zeigt ihm Treue und
Anhänglichkeit; doch muß er diesen vollkommen kennen gelernt und
erfahren haben, daß dessen geistige Energie seine leibliche Kraft
unter allen Umständen unterjochen kann und sich unbedingten Gehorsam
zu erzwingen versteht. Was der Boxer einmal gefaßt hat, läßt er so
leicht nicht wieder los. Hat man ihn in einen Stock oder in ein Tuch
beißen lassen, so kann man ihn an diesem Gegenstande in die Höhe
heben, auf den Rücken werfen oder andere Dinge mit ihm vornehmen, ohne
daß er sein Gebiß öffnet. Es gibt von ihm auch Zwergformen, die[S. 38] uns
zum Mopse hinleiten. Dieser ist ein Bullenbeißer im kleinen,
mit ganz eigentümlich abgestumpfter Schnauze und schraubenförmig
gerolltem Schwanz. Auch zeigt er das mißtrauische, mürrische Wesen der
Bulldoggen, wurde aber dennoch früher gerne von alten Jungfern mit
großer Zärtlichkeit gehätschelt und als Schoßhund gehalten, wobei er
eine oft sprichwörtliche Fettleibigkeit entwickelte. Diese einst sehr
verbreitete Form ist jetzt fast ausgestorben; dagegen sind neuerdings
edlere Rassen dieses Luxushundes aufgekommen, die sich wiederum großer
Beliebtheit erfreuen, obschon auch sie launenhaft und im ganzen wenig
angenehme Gesellschafter des Menschen sind.
Wie in den Alpen kommen auch in den Abruzzen, bei den Basken in den
Pyrenäen und bei den Albanesen in Nordgriechenland große Hunde vor,
die zweifellos in verwandtschaftlicher Beziehung zum alten Molosser
stehen, aber Kreuzungsprodukte mit anderen Hunden sind. Überhaupt sind
im Laufe der Jahrhunderte so viele Kreuzungen bei den Gebrauchshunden
vorgekommen, daß sich ihre Abstammung im einzelnen nie mehr feststellen
läßt.
Neuerdings will Hilzheimer die Doggen von einem im mittleren Schweden
heimischen mächtigen, dickköpfigen und kurzköpfigen Wolf mit starkem
Stirnabsatz ableiten. Diese Annahme ist jedoch nicht genügend
begründet, um die ältere, viel wahrscheinlichere zu verdrängen.
Immerhin darf zugegeben werden, daß ein solcher starker nordischer
Wolf den Ausgangspunkt der von den eigentlichen Doggen zu trennenden
Hirtenhunde bildet, denen im Gegensatz zu den Schäferhunden,
die die Herde hüten, nur die Bewachung der Herde gegen den Angriff
starker Raubtiere oder böswilliger Menschen obliegt. Sie zeichnen
sich gegenüber den Doggen durch kaum verkürzte Schnauze und geringen
Stirnabsatz aus. Sie sind langhaarig, weiß, grau oder braun gefärbt,
vielfach auch gescheckt, und kommen in verschiedenen Ländern Europas in
typischen Vertretern vor. Früher aber waren sie, solange es reißende
Tiere von den Herden abzuhalten gab, weit verbreiteter als heute, da
sie sich nur noch in zerstreuten Inseln vorfinden. Nach Hilzheimer
soll Blut von diesem nordischen Wolfe auch in den Pudel übergegangen
sein, dem früher besprochenen Abkömmlinge des Schäferhundes, der
wahrscheinlich auch Blut vom Laufhunde in sich aufgenommen hat.
Wie in der Alten Welt so sind auch in der Neuen durch Zähmung
verschiedener Wildhunde Haushunde von den Indianern gewonnen worden,
soweit sie sich über die primitive Stufe der Sammler und[S. 39] Jäger
erhoben hatten und zu einiger Ansässigkeit als Hackbauern gelangt
waren. So fanden die Europäer bei ihrer Ankunft bei verschiedenen
Volksstämmen zahme Hunde. Alle Indianersprachen an der Westküste von
Südamerika hatten eigene Bezeichnungen für den Hund, und der spanische
Geschichtschreiber Garcilasso de la Vega berichtet, daß in der ältesten
Zeit das Volk der Huanca, bevor es noch von den Inkas unterjocht wurde,
ein Hundebild anbetete und leidenschaftlich gerne Hundefleisch aß. Der
St. Galler J. J. von Tschudi fand als Beweis der Urexistenz des Hundes
in Peru in alten, vorkolumbischen Gräbern Skelette und Mumien von
Hunden, welche meist quer vor den Füßen der mitbestatteten sitzenden
Menschenkadaver lagen. Identisch mit diesen Mumienhunden ist der heute
noch in den Ansiedelungen des Gebirges der Anden bei den Hirten und in
den Indianerhütten verbreitete Inkahund, der als ein bissiges,
einen besonderen Widerwillen gegen die Europäer zeigendes Tier von
ziemlich kleiner Gestalt mit rauhem Pelz von dunkelockergelber Farbe,
am Bauch und auf der Innenseite der Beine heller, geschildert wird. Der
zierliche Kopf ist scharf zugespitzt, die Ohren sind aufrecht, spitz
und klein, der Schwanz ist stark behaart und gerollt. Auf Grund der
Gräberfunde besonders von Ancon vermochte Alfred Nehring nachzuweisen,
daß schon bei den alten Inkas drei verschiedene Rassen des Inkahundes
gezüchtet wurden, die als Wacht-, Hirten- und Jagdhunde Verwendung
fanden, und daß der Stammvater dieser südamerikanischen Hundeart der
nordamerikanische Wolf (Canis occidentalis) war. Es ist
also dieser Hund mit dem Volk von Norden her nach Süden eingewandert
und kam auch in den Tropen in den kühlen Höhenlagen recht gut fort.
Interessant ist, daß das recht hoch kultivierte Volk der alten Peruaner
bereits Rassenzucht trieb und aus dem ursprünglichen Wolfshunde, den
verschiedenen Zwecken, zu denen er verwendet wurde, entsprechend, eine
schäferhundartige, eine dachshundartig durch erblich gewordene Rachitis
verkümmerte und eine bulldoggähnliche mit verkürztem Oberkiefer
züchtete.
Von demselben nordamerikanischen Wolfe stammt der ihm sehr ähnelnde
Hund der Indianer Nordamerikas ab. Diese verbessern ihre Zuchten von
Zeit zu Zeit durch Kreuzung mit Wölfen, wobei die Halbzuchtwölfe im
allgemeinen leicht zähmbar sind. Der eigentümliche Hasenindianerhund
mit kurzem Gesicht und kurzen Läufen ist dem Präriewolf
(Canis latrans) nahe verwandt und wurde zweifellos durch Zähmung
aus diesem gewonnen.
[S. 40]
In Südamerika gibt es Hunde, die dem Maikong (Canis
cancrivorus) gleichen und jedenfalls auch von ihm abstammen. Die
Kreuzung derselben mit der wilden Stammart kommt häufig vor.
Auf den westindischen Inseln, in Mexiko und an den Küsten des
nördlichen Südamerika lebt ein kleiner, fuchsartiger Hund, dessen
schwärzlicher bis dunkelgrauer Körper fast haarlos ist. Es ist dies der
Karaibenhund, den schon Kolumbus bei seiner Ankunft antraf und
der von den Altmexikanern Xoloitzcuintli genannt wurde. Sein Stammvater
ist eine kleine Schakalart der Antillen, die durch spezielle Zucht ihr
Haarkleid im warmen Klima mehr und mehr reduzierte. Wichtig sind den
Feuerländern ihre Hunde, da sie ihnen beim Fang der Seeotter helfen.
Darwin sagt daher von ihnen, „sie wollten in der Not lieber ihre alten
Weiber als ihre Hunde töten und essen“. Übrigens wußten auch diese
niedrig stehenden Wilden die Vorzüge der europäischen Hunde zu schätzen
und trachteten danach, sie mit den größten Opfern anzuschaffen.
Mit dem Vordringen der Europäer nach der Neuen Welt gelangten
selbstverständlich auch die verschiedensten altweltlichen Hunde dahin
und fühlten sich dort sehr bald heimisch. Dabei mischten sie sich
vielfach mit den vorgefundenen zahmen Hunden und gaben zu den buntesten
Mischrassen Veranlassung. Solche unentwirrbare Kreuzungsprodukte
gibt es ja auch in der Alten Welt genug. Sie gehen immer wieder,
meist ungewollt, hervor und machen sich überall, oft unliebsam genug,
bemerkbar; doch wird von den Kennern stets das reine Blut diesen
Mischlingen vorgezogen werden.
Schon bei den Schriftstellern des Altertums finden wir gelegentlich
Geschichten, die uns die hohe Wertschätzung des Hundes als Haustier und
Gefährten des Menschen beweisen, die auch zeigen, wie sich dieses Tier
oft für seinen Herrn opferte und ihm Treue über den Tod hinaus hielt.
So berichtet u. a. der ältere Plinius in seiner Naturgeschichte: „Man
erzählt von einem Hunde, der für seinen Herrn gegen Räuber kämpfte
und, obgleich selbst schwer verwundet, dessen Leichnam doch nicht
verließ, sondern gegen Vögel und Raubtiere verteidigte. Einen König
der Garamanten holten 200 Hunde aus der Verbannung zurück und schlugen
dessen Widersacher in die Flucht. Die Kolophonier und Kastabalenser
hielten ganze Meuten von Hunden, die im Kriege die erste Schlachtreihe
bildeten und sich nie feig erwiesen; sie waren die treusten
Hilfstruppen und dienten ohne Sold. Als die Zimbern erschlagen waren,
verteidigten noch Hunde ihre auf Wagen stehenden[S. 41] Zelte. Als der Lycier
Jason getötet war, wollte sein Hund nicht mehr fressen und hungerte
sich zu Tode. Ein Hund, den Duris (ein griechischer Schriftsteller
aus Samos zur Zeit des Ptolemäos II. Philadelphos, 285–247 vor
Chr.) Hyrkanus nennt, stürzte sich in die Flammen, als König Lysimachus
verbrannt wurde. Dasselbe tat der Hund des Königs Hiero. Bei uns wurde
Volcatius, ein Edelmann, der zu Pferd von seinem Landhaus zurückkehrte,
als er abends von einem Räuber angefallen wurde, durch seinen Hund
verteidigt; ebenso der Senator Coelius, als er zu Placentia (dem
heutigen Piacenza) krank lag und von Bewaffneten überfallen wurde. Erst
als der Hund erschlagen war, erhielt er eine Wunde. Über alles erhaben
ist aber folgender Zug, der zu unserer Zeit in den Jahrbüchern des
römischen Volkes, als Appius Junius und Publius Silius Konsuln waren,
aufgezeichnet wurde: Als Titius Sabinus samt seinen Sklaven wegen des
an Nero, dem Sohn des Germanicus, begangenen Mordes zum Tode verurteilt
war, konnte der Hund eines dieser Unglücklichen nicht vom Gefängnis
weggetrieben werden, verließ auch dessen Leiche nicht, als sie auf die
Straße geworfen wurde, heulte kläglich und trug, als einer aus der
versammelten Volksmenge ihm ein Stück Fleisch hinwarf, dieses zum Munde
seines toten Herrn. Als dann die Leiche in den Tiber geworfen wurde,
schwamm er mit ihr und suchte sie über Wasser zu erhalten, während das
Volk am Ufer seine Treue bewunderte.
Der Hund ist das einzige Tier, das seinen Herrn kennt, Bekannte von
Unbekannten unterscheidet, auf seinen Namen hört und seine Hausgenossen
schon an der Stimme kennt. Die längsten Wege finden sie wieder, wenn
sie sie einmal gemacht haben, und überhaupt ist ihr Gedächtnis nach dem
des Menschen das beste. Wenn sie auch noch so wütend sind, kann man
ihnen doch Einhalt tun, wenn man sich auf die Erde niedersetzt (was
nach Schatter tatsächlich von Erfolg begleitet ist). Der Mensch hat an
ihnen schon viele nützliche Eigenschaften aufgefunden; am nützlichsten
werden sie aber durch ihren Eifer und ihren Spürsinn auf der Jagd. Sie
suchen und verfolgen die Fährte des Wildes, ziehen den Jäger an der
Leine hinter sich her, zeigen das Wild heimlich und schweigend, indem
sie zuerst mit dem Schwanze, dann mit der Schnauze ein Zeichen geben.
Selbst alt, blind und schwach leisten sie noch Dienste, indem man sie
auf dem Arm trägt und durch den Geruch das Lager des Wildes aufsuchen
läßt.
Die Hündin bekommt zweimal jährlich Junge. Dieselben werden blind
geboren und werden um so später sehend, je reichlicher sie gesäugt[S. 42]
werden, doch nie vor dem 7. oder 21. Tage. Die Weibchen von der
ersten Hecke sollen die Eigenschaft haben, Faune (Waldgeister) sehen
zu können. Unter den Jungen ist dasjenige das beste, das zuletzt zu
sehen beginnt oder das die Mutter zuerst ins Lager trägt. (Noch heute
gilt dieser Glaube bei manchen Hundeliebhabern. Diese nehmen der
Hündin die Jungen, legen sie in einiger Entfernung nieder und halten
das für das beste, das von ihr zuerst ins Lager zurückgetragen wird.)
Die Alten hielten saugende junge Hunde für eine so reine Speise, daß
sie dieselben sogar den Göttern als Sühnopfer darbrachten. Noch jetzt
opfert man der Göttin Genita Mana ein Hündchen und trägt, wenn die
Götter bewirtet werden sollen, Hundefleisch auf. Man glaubt auch, daß
Hundeblut das beste Mittel gegen Pfeilgift ist.“
Der um die Mitte des ersten christlichen Jahrhunderts von Spanien nach
Rom gekommene Ackerbauschriftsteller Columella schreibt in seinem
Buch über den Landbau: „Der Hund liebt seinen Herrn mehr als irgend
ein anderer Diener, ist ein treuer Begleiter, unbestechlicher und
unermüdlicher Wächter und beharrlicher Rächer.
Der Wachthund für ein Landhaus muß sehr groß sein, gewaltig und laut
bellen, so daß er nicht bloß durch seinen Anblick, sondern auch durch
seine Donnerstimme den Dieb erschreckt. Man wähle dafür einen solchen
mit einfacher Farbe, am besten schwarzer. Bei Tage fürchtet sich der
Dieb mehr vor dem schwarzen Hund, bei Nacht sieht er ihn nicht und wird
leichter von ihm gepackt. Der Hund des Hirten soll dagegen weiß sein,
damit er bei Tag und Nacht leicht vom wilden Tiere unterschieden werden
könne, also beim Kampf von seinem Herrn nicht so leicht verwundet
werde. Der Wachthund des Landhauses soll ferner weder zu sanft sein,
denn sonst schmeichelt er selbst den Spitzbuben, noch allzuscharf,
sonst ist er selbst den Hausbewohnern gefährlich. Die Hauptsache bleibt
immer, daß er wachsam ist, sich nicht herumtreibt, keinen falschen
Lärm macht, sondern nur dann anschlägt, wenn er sicher etwas Fremdes
merkt. Der Hirtenhund soll so stark sein, daß er den angreifenden Wolf
bekämpfen, und so schnell sein, daß er den fliehenden einholen und
ihm die Beute abjagen kann. — Die Hauptnahrung der Hunde ist Brot,
am besten aus Gerste gebackenes. Den Wacht- und Hirtenhunden gebe man
zweisilbige Namen. Für Männchen paßt z. B. Skylax, Ferox, Laco, Celer,
für Weibchen Spude, Alke, Rome, Lupa, Cerva, Tigris.“
Der Grieche Arrian im 2. Jahrhundert n. Chr. rühmt in einem längeren
Passus seine kluge, anhängliche und schnelle Hündin Horme,[S. 43] die er
geradezu als göttlich bezeichnet; sie nehme es bisweilen mit vier Hasen
auf. Sie sei immer guter Laune, verlasse ihn und seinen Jagdgefährten
Megillos nie und gebe ihnen alle ihre Wünsche zu verstehen. Seitdem sie
einmal die Peitsche zu kosten bekommen habe, ducke sie sich gleich,
wenn man die Peitsche nur nenne, komme schmeichelnd herbei, springe an
einem in die Höhe und höre nicht eher mit ihren Liebkosungen auf, als
bis man wieder freundlich mit ihr tue.
Schon im Altertum wurden die Hunde auf verschiedene Weise dressiert
und zu Kunststücken abgerichtet. So erzählt der griechische
Geschichtschreiber Plutarch: „Folgendes habe ich mit eigenen Augen
gesehen. In Rom war ein Tausendkünstler, der im Theater des Marcellus
einen merkwürdig dressierten Hund zeigte. Dieser führte erst allerlei
Kunststückchen aus und sollte zuletzt zum Schein Gift bekommen, davon
betäubt werden und sterben. Er nahm also das Brot, worin das Gift
verborgen sein sollte, an, fraß es auf, begann dann zu zittern, zu
wanken, senkte den Kopf, als ob er ihm zu schwer würde, legte sich
endlich, streckte sich, schien tot zu sein, ließ sich hin und her
schleppen und tragen, ohne sich zu regen. Endlich rührte er sich wieder
ein wenig, dann allmählich mehr, tat wie wenn er aus tiefem Schlafe
erwache, hob den Kopf, sah er sich um und ging endlich freundlich
wedelnd zu dem, der ihn rief. Alle Zuschauer waren gerührt; unter ihnen
befand sich auch der alte Kaiser Vespasian.“
Älius Spartianus schreibt, daß der römische Kaiser Hadrian Pferde
und Hunde so lieb hatte, daß er ihnen Grabdenkmäler setzen ließ, was
ja auch heute von den Reichen vielfach geübt wird, so daß um die
Städte London und Paris geradezu Hundefriedhöfe entstanden sind. Der
Geschichtschreiber Lampridius berichtet, daß der römische Kaiser
Heliogabal seine Hunde mit Gänselebern fütterte, auch vier große Hunde
vor seinen Wagen spannte und mit ihnen in seiner königlichen Wohnung
und auf seinen Landgütern herumkutschierte. Wie im Leben, so spielte
der Hund auch in den Sprichwörtern der Alten eine wichtige Rolle; doch
würde es uns zu weit führen, darauf einzutreten. Die schon damals bei
diesem Tiere auftretende Tollwut wurde nach dem Arzte Celsus am besten
so behandelt, daß man das Gift mit Schröpfköpfen herauszog, die Wunde
dann brannte oder, wenn die Stelle dazu nicht passend schien, mit
Ätzmitteln behandelte. Nachher ließ man die Gebissenen schwitzen und
gab ihm drei Tage hindurch tüchtig starken Wein zu trinken. Lauter
törichte Sympathiemittel gibt dagegen Plinius an.
[S. 44]
Heute ist die Tollwut dank der scharfen staatlichen Kontrolle auf ein
Minimum eingeschränkt und kann zudem nach Übertragung durch Biß eines
tollen Hundes auf den Menschen dank der wertvollen Entdeckung von Louis
Pasteur in fast allen Fällen leicht geheilt werden, ohne daß sie zum
Ausbruch gelangt. Jedenfalls ist sie für den Menschen weit weniger
gefährlich und verhängnisvoll als der winzige, nur 4 mm lang
werdende Hundebandwurm (Taenia echinococcus), dessen Finne eine
ganz bedeutende Größe aufweisen kann. Aus seinen Eiern entwickelt
sich nämlich der von stecknadelkopf- bis kindskopfgroße Hülsenwurm
(Echinococcus), der sich in den verschiedensten Organen des
Menschen, am häufigsten aber in der Leber festsetzen und die schwersten
Erkrankungen, ja selbst den Tod herbeiführen kann. Überhaupt gilt für
alle Hundefreunde wegen ihres großen Parasitenreichtums, der unter
Umständen für den Menschen sehr verhängnisvoll sein kann, der alte
vielfach in Mosaik an der Türschwelle angebrachte römische Zuruf:
cave canem, d. h. hüte dich vor dem Hund! allerdings in anderem
Sinne als einst. Man sei freundlich, aber nicht zu intim mit ihm,
da man solches vielleicht mit langem Siechtum und Tod zu büßen hat.
Lieber als einen rasselosen Köter mit allen möglichen Untugenden halte
man sich einen gut gezogenen wertvollen Rassehund, der geistige und
körperliche Vorzüge besitzt, die dem Bastard versagt sind. Es gibt ja
deren, die allen möglichen Ansprüchen, sei es solchen der Jagd, des
Schutzes, sei es denen des Land- oder beengteren Stadtlebens sehr gut
angepaßt sind und sich darin seit vielen Generationen bewährt haben.
Andere Wildhunde als die hier aufgezählten sind nicht dauernde
Gesellschafter des Menschen geworden. Es hätte dies aber sehr wohl der
Fall sein können, da auch solche, jung eingefangen und vom Menschen gut
behandelt und gezähmt, sich an den Umgang mit diesem leicht gewöhnen.
Wie heute noch in Syrien, Ägypten und Nordafrika wurden schon bei den
alten Ägyptern jung eingefangene wilde Schakale wie Haushunde
erzogen und so direkt in die Haustierschaft übergeführt. In den
Grabgemälden des alten Reiches in der ersten Hälfte des 3. Jahrtausends
v. Chr. ist mehrfach dargestellt, wie gezähmte Schakale die Stelle von
Haushunden bei dem noch als lebend dargestellten Grabinhaber einnehmen
oder sich als gute Freunde unter dessen Hunde mischen. In einer
Darstellung eines Grabes zu Beni Hassan aus der 12. Dynastie (2000–1788
v. Chr.) sieht man einen solchen gezähmten Schakal sogar an der Jagd
teilnehmen. Solche direkte[S. 45] Überführungen aus dem wilden in den
gezähmten Zustand sind aber schon damals eben solche Ausnahmen gewesen,
wie in unserer Zeit die Zähmung eines jung eingefangenen Wolfes zum
Freunde und Begleiter seines Herrn.
Selbst der Hyänenhund (Canis pictus), jener heute
noch vom südlichen Nubien an in großen Teilen Afrikas vorkommende
Wildhund mit buschigem Schwanz und weißen bis ockerfarbigen, stets
schwarz umsäumten Flecken auf kurz- und glatthaarigem Fell, wurde
von den alten Ägyptern in den Haustierstand übergeführt, ohne sich
allerdings längere Zeit darin zu erhalten. Dieser in hohem Grade
anziehende Steppenhund, der in Meuten bis zu 60 Stück mit ungeheurer
Ausdauer allerlei Wild, besonders Antilopen jagt, so daß selbst die
größten Tiere ermatten und von ihm überwältigt werden, wird von Brehm
als für die Zähmung vielversprechendes Raubtier bezeichnet, das
einen vortrefflichen Spürhund abgeben würde. Georg Schweinfurth sah
in einer Seriba im Bongolande ein in hohem Grade gezähmtes Stück,
das seinem Herrn gegenüber die Folgsamkeit eines Hundes an den Tag
legte. Brehm, der einige derselben gefangen hielt, bezeichnet sie als
ungestüm mutwillig mit einem unbezähmbaren Drang zum Beißen. Er ist
ungemein regsam und lebhaft und frißt vom erwürgten Wild fast nur
die Eingeweide. Seine Vorzüge für die Antilopen- und Gazellenjagd
veranlaßte schon die Ägypter des alten Reiches (2980 bis 2475 v. Chr.)
ihn vielfach unter ihrer Meute von Jagdhunden zu halten. An den Wänden
zahlreicher Gräber finden wir ihn als gezähmtes Tier nebst andern
Jagdhunden abgebildet, so in denjenigen des Nub hotep und des Ran ken
der 4. Dynastie (2930–2750 v. Chr.), dann des Aseskef ank und des Pta
hotep der 5. Dynastie (2750 bis 2625 v. Chr.). In des letzteren Grabe
in Sakkara sehen wir die Jagddiener des Verstorbenen mit der gemachten
Beute von der Jagd zurückkehren. An ihrer Seite sehen wir als Chef
derselben einen als Num hotep bezeichneten Mann mit zwei Windhunden und
zwei Hyänenhunden an der Leine schreiten, bereit, sie auf allfällig
angetroffenes Wild loszulassen. In demselben Grab des Pta hotep, das
uns den Hyänenhund gezähmt und im Dienste des Menschen zeigt, sehen
wir an der gegenüberliegenden Wand den wilden Hyänenhund mitten unter
Antilopen in der Steppe lebend und von Windhunden angegriffen. Man
sieht, daß der Künstler die Szene nach eigener Anschauung wiedergegeben
hat. Später wurde weder im mittleren noch im neuen Reiche je wieder der
Hyänenhund, sei es wild oder gezähmt,[S. 46] abgebildet, so daß wir annehmen
dürfen, daß er damals weder als Haustier gehalten wurde, noch auch in
den Gegenden, in denen die Großen des Reichs zu jagen pflegten, wild
vorkam. Er muß sich damals schon mit der Abnahme der Antilopenherden
weiter südlich gehalten haben; denn auch der Römer Pomponius Mela,
der dieses Tier unter der Bezeichnung lycaon genau beschreibt,
kennt ihn nur aus Äthiopien. Heute trifft man ihn erst in den obersten
Nilländern und von da an südwärts bis zum Kap der Guten Hoffnung.
[S. 47]
II. Rind und Büffel.
Wie der Hund, so ist auch das Rind zunächst nicht aus Nutzungsgründen,
sondern infolge abergläubiger Vorstellungen vom Menschen unterjocht
und in seinen Dienst genommen worden, um dann, als man später seinen
Nutzwert erkannte und auszubeuten begann, vorbildlich für die Zähmung
der übrigen Haustiere zu werden. Die Gewinnung eines so großen, starken
Tieres, wie es das Rind ist, war durchaus nichts Einfaches und sich
von selbst Verstehendes. Alte, entwickelte Individuen dieser Tierart
gefangen zu halten und gar zur Fortpflanzung zu bringen, ist schon
für uns unmöglich, wie viel mehr für den in seinen Vorstellungen,
Erfahrungen und Hilfsmitteln so sehr beschränkten vorgeschichtlichen
Menschen der jüngeren Steinzeit!
Ohne Zweifel haben sich die meisten alt, etwa in Fanggruben gefangenen
Tiere, wenn sie ausnahmsweise nicht sofort als willkommene Beute zur
Fleischgewinnung getötet und verspeist wurden, einfach totgerast. An
eine Fortzucht wäre bei Tieren solcher Art, die am Leben blieben, in
keiner Weise zu denken gewesen. Junge Tiere dagegen, die am leichtesten
lebend zu bekommen und zu zähmen gewesen wären, konnte man ohne fremde
Milch nicht am Leben erhalten. Da es nun an dieser völlig gebrach
und die weiblichen Tiere, abgesehen von ihrer selbstverständlichen
Unfruchtbarkeit in der Gefangenschaft und der dadurch bedingten
Milchlosigkeit, auch nicht zum Melken oder zum Zulassen fremder Kälber
an ihr Euter zu bringen waren, so konnte auch nicht durch solche in
jugendlichem Alter gefangene Kälber an eine Zähmung dieses starken
Wiederkäuers gedacht werden.
Für die erste Gefangenhaltung, Eingewöhnung und Züchtung des Rindes
waren andere Gründe maßgebend als diejenigen der Nutzung für sich
selbst. Solche der allertriftigsten Art waren aber religiöse, auf
die der verstorbene Alfred Nehring in Berlin vom Katheder aus und[S. 48]
Eduard Hahn in seinem Haustierbuche vollständig überzeugend hinwiesen,
so daß wir jedenfalls hierin das tatsächliche Motiv der Gewinnung
des Rindes als Haustier zu erblicken haben. Ihr Gedankengang ist
folgender: Eine uralte, hier nicht näher zu verknüpfende Anschauung,
die ich bei Besprechung des Mondkultus in meinem Werke: Der Mensch
zur Eiszeit in Europa und seine Kulturentwicklung bis zum Ende der
Steinzeit eingehend gewürdigt habe, schreibt bei allen Völkern auf
niedriger Kulturstufe, so auch bei denjenigen des südasiatischen und
westasiatisch-europäischen Kulturkreises, dem die hier in Betracht
kommenden Stämme angehörten, dem Mond einen weitgehenden Einfluß auf
Wachstum und Gedeihen aller Lebewesen aus Pflanzen- und Tierwelt mit
Einschluß des Menschen zu. Von jeher hat er durch seinen schwankenden
Lauf in Verbindung mit seinem den Primitiven unerklärlichen
Gestaltwechsel von der feinsten Sichel bis zum glänzenden Vollmond
die Aufmerksamkeit des Menschen viel eher auf sich gezogen und sie zu
Grübeleien aller Art veranlaßt, als die täglich in derselben Gestalt
ihre Bahn am Himmel zurücklegende Sonne. War diese ihm in ihrer
machtvollen, Hitze bis zur Dürre erzeugenden Erscheinung das männliche
Prinzip, so war ihm der in sanftem Lichte strahlende Mond, der mit dem
Tau und dem Regen der Erde und allem auf ihr Lebenden Fruchtbarkeit
spendete und ein für den Ackerbauer wichtiger Zeitmesser war, das
weibliche Prinzip — auch bei den alten Germanen trotz des später
vertauschten Geschlechts. Schon auf niedriger Kulturstufe mußte es
dem Menschen auffallen, daß die Menstruation des Weibes, die wir im
Deutschen als monatliche Reinigung bezeichnen, wie die Schwangerschaft
und Fruchtbarkeit überhaupt völlig in Verbindung mit dem Mondlaufe
stand, von jenem geheimnisvollen Gestirn geregelt und also auch — nach
primitiver Anschauung — bedingt wurde.
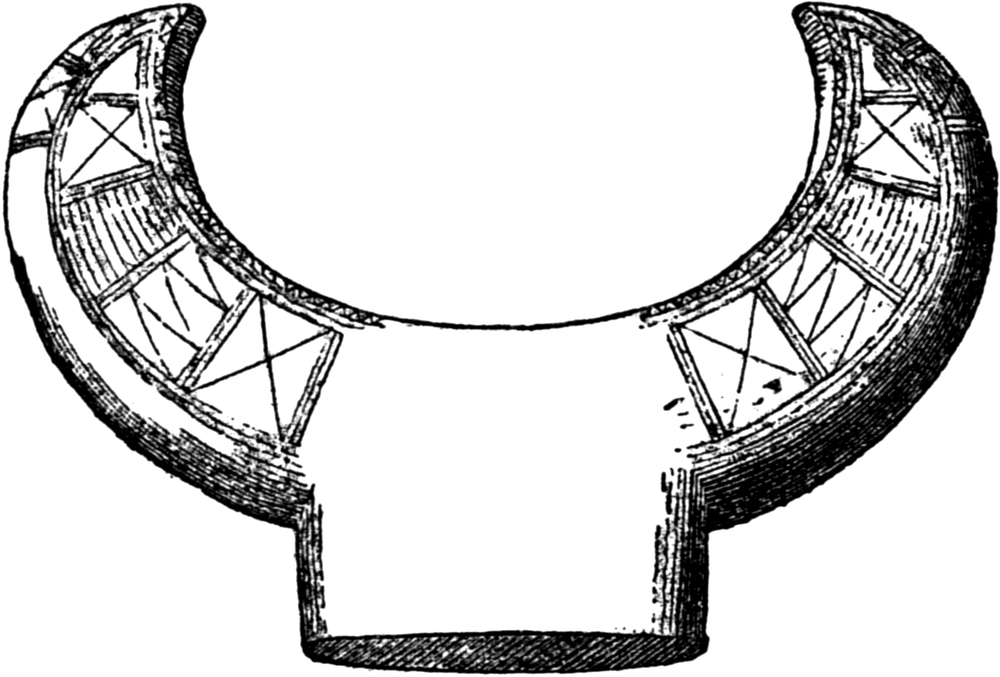
Bild 3. Idol in Mondgestalt mit einfachen geradlinigen
Ornamenten, sogenanntes „Mondhorn“, vom Ebersberg, aus einer Station
der Bronzezeit am Irchel im Kanton Zürich.
Was nun die Darstellung dieses vergöttlichten Wesens der Fruchtbarkeit
anbetrifft, so hat man von jeher den Mond als Sichel im Gegensatz zur
als Scheibe und später als scheibenförmiges Rad dargestellten Sonne
abgebildet. Diese Sichelgestalt des Mondes wiesen in auffallender Form
die gerade abstehenden Hörner des Wildrindes auf. Aus diesem Grunde
war es naheliegend, ja nach der Denkweise aller Menschen auf niedriger
Kulturstufe geradezu selbstverständlich, daß eine engere Beziehung
zwischen dem Wildrinde und der Mondgöttin bestand und ersteres zum
heiligen Tiere der letzteren erklärt wurde. Heischte nun die Göttin
Opfer, damit sie dem Hackbauern und seiner[S. 49] Frau Fruchtbarkeit spende
und seine Feldfrüchte gedeihen lasse, so war offenbar dasjenige des
ihr durch die Sichelgestalt der Hörner engverbundenen und ihr heiligen
Tieres ihr weitaus das liebste. Deshalb brachte man es dar, um sich
ihr Wohlgefallen und ihren Schutz zu erringen. Am allernotwendigsten
waren diese Opfer zur Zeit der schreckhaften Mondfinsternisse, wenn
die so überaus wichtige, ja unersetzliche Göttin der Fruchtbarkeit von
irgend welchen bösen Dämonen verschlungen zu werden drohte. Wie nun
heute noch die Chinesen bei solchen Fällen mit allen ihnen überhaupt
zur Verfügung stehenden Instrumenten einen gewaltigen Lärm verursachen,
um diese vermeintlichen bösen Dämonen zu vertreiben, so glaubten die
Stämme des südasiatischen Kulturkreises dieses Ziel der Befreiung der
Fruchtbarkeitsgöttin aus der Gewalt böser Mächte, die sich durch die
sonst ganz unerklärliche Verfinsterung dokumentierte, noch besser durch
schleuniges Opfer eines Exemplars der ihr heiligen Tiere zu erreichen.
Da aber lag die Schwierigkeit! Man wußte nicht von vornherein,
wann solche Zustände des Überfalls, der Schwäche und Krankheit der
Mondgöttin eintraten. Es war dies nur in ganz ungleichen, unbestimmten
Zwischenräumen der Fall, und dann, wenn es am nötigsten war, hatte man
just kein frischerbeutetes Wildrind zum Opfer bereit, konnte somit der
bedrängten Göttin nicht beistehen, ihr nicht helfen und verscherzte
damit ihr Wohlwollen. In der Urzeit war überhaupt kein Gebot für den
bequemen und arbeitsscheuen Menschen so dringend als eine Kultpflicht,
der er sich durchaus nicht entziehen konnte, wenn ihm überhaupt an
seiner und der Seinigen Existenz gelegen war. Es galt also, da die
Mondfinsternisse ganz plötzlich eintraten, sich nicht auf den Ertrag
der Jagd zu verlassen, sondern die Opfertiere für alle Fälle vorrätig
zu halten, um im Falle der Not sie zum unerläßlichen Opfer bei der Hand
zu haben. Das erreichte man am einfachsten dadurch, daß man kleine
Herden des Wildrindes in durch in den Boden geschlagene Holz[S. 50]pfähle
eingezäunte Reviere trieb und sie dort in halber Gefangenschaft hielt,
in der sie sich innerhalb des gewohnten Familienverbandes ruhig
fortpflanzten.
Auf diese Weise war der schwierige Übergang des Wildlings vom
Freileben zur Knechtschaft des Menschen ein unmerklicher geworden und
konnte allmählich zur Gewinnung des Rindes als Haustier führen. Von
frühester Jugend an häufiger mit dem Menschen in Berührung kommend,
gewöhnte es sich nach und nach an diesen und seinen Geruch, der ihm
im wilden Zustande Schrecken einflößte. Als der Gottheit geweihtem,
heiligem Tiere ließ man ihm innerhalb der Umhegung volle Freiheit
und suchte es nicht nur vor allfälligen Feinden, sondern auch, wenn
nötig, vor Futtermangel zu schützen. Solcher Dienst von seiten des ihm
wohlwollenden Menschen wurde von ihm bald dankbar empfunden. An den
Verkehr mit dem Menschen immer mehr gewöhnt, ließ es sich schließlich
mit zunehmendem Zahmwerden berühren, ja schließlich sogar melken; doch
wurde die Milch als Produkt des ihr heiligen Tieres der Mondgöttin
geopfert und erst sehr viel später riskierte der Mensch das zunächst
wohl als strafbaren Frevel empfundene Wagnis, dieses geheiligte Produkt
selbst zu genießen. Er trotzte kühn dem Zorne der Gottheit, um sich
vielleicht mit dem Genusse dieses heiligen Kultobjektes direkt, ohne
Vermittlung jener, einen Vorteil irgend welcher Art, besonders aber die
Fruchtbarkeit betreffend, zu erringen. So wurde die Milch, indem der
Mensch die Scheu vor diesem heiligen Produkt immer mehr ablegte, von
einem Opfertranke schließlich ein geschätzter Haustrank, den man sich
auch zu nichtrituellen Zwecken zu verschaffen versuchte.
Durch gegenseitige Gewöhnung aneinander zog sich das Band der
Freundschaft zwischen Rind und Mensch immer enger, bis schließlich
das von der Mutter entwöhnte Kalb, durch Anbieten von Salz zum
Lecken angezogen, in engere Verbindung mit seinem Herrn trat und
langsam der eigentlichen Zähmung unterworfen wurde. Solch heiliges
Tier wurde selbstverständlich nur als Opfer an die bedrängte oder um
Hilfe angerufene Mondgottheit geschlachtet und dessen Fleisch nur als
Opferspeise auch vom Menschen gegessen. Je mehr aber die Domestikation
dieses Tieres fortschritt und sich sein Nützlichkeitsverhältnis dem
Menschen gegenüber offenbarte, um so schwerer entschloß sich letzterer,
solch nützliches Tier der Gottheit zu opfern. Es konnte ihr anderweitig
im Leben noch mehr als mit seinem Tode dienen, indem es beispielsweise
das heilige Kultgerät der Fruchtbarkeit spendenden Göttin,[S. 51] ihr Idol in
Kuhhorngestalt, auf dem mit massiven Rädern versehenen Wagen bei dem zu
ihren Ehren abgehaltenen festlichen Umzuge zog. Dazu wurden zunächst
die größeren Kälber und später von den geschlechtsreifen Tieren nur
die fügsameren Kühe verwendet. Der unbotmäßige starke Stier konnte
dazu nicht in Betracht kommen, schon weil man zu schwach war, ihn bei
solcher Dienstleistung zu bändigen und in seiner Gewalt zu behalten.
Zudem konnte er nach weitverbreitetem Glauben primitiver Völker nur
als Kastrat Diener einer weiblichen Gottheit werden. So wurde das
Tier, um zum Gottesdiener gemacht und als solcher bei den Umzügen bei
Gelegenheit der Feste der Mondgöttin zum Ziehen von deren heiligem
Wagen mit dem Kultbild verwendet werden zu können, durch Abschneiden
der Hoden — was sich ja sehr leicht bewerkstelligen ließ — entmannt.
Die Folgen dieses Eingriffs machten sich bald bemerkbar durch
Verleihung einer sanfteren Gemütsart und Neigung zu Fettwerden, was
die Mastfähigkeit erleichterte, alles Eigenschaften, deren Auftreten
der Mensch als Nachwirkungen jener Operation nicht voraussehen und so
zielbewußt herbeiführen konnte.
Als Kastrat, d. h. geschlechtslos gemachtes Wesen, war nun der
Ochse der vorzugsweise, ja später ausschließlich der Göttin
geweihte Diener, während ihm gegenüber auch die Kuh als Geschlechtstier
zurücktrat. Ein grausam-wollüstiger Zug haftet nun einmal dem Dienste
der Fruchtbarkeitsgöttin an und verlangte wie vom menschlichen Diener,
der sich ihr völlig geweiht hatte, auch von dem von jenem ihr geweihten
Tiere die freiwillige beziehungsweise erzwungene Geschlechtslosigkeit,
von ihren Dienerinnen aber, die nicht kastriert zu werden vermochten,
wenigstens das Zölibat, wenn nicht die Prostitution, d. h. das sich
anderen Preisgeben im Dienste der Göttin der Liebe und Fruchtbarkeit,
wie dies in den semitischen Kulten Vorderasiens allgemein üblich
war und in Südasien, speziell Indien, heute noch üblich ist. Bis in
die Gegenwart haftet den Kastraten ein Beigeschmack von Heiligkeit
an. So sind es Eunuchen, die seit der ältesten Zeit den zum Fetisch
erhobenen Meteorstein der Kaaba in Mekka und das Grab des Propheten
Mohammed in Medina hüten. Eunuchen sind es, die nicht nur den Harems
der mohammedanischen Großen vorstehen, sondern auch den Dienst in
den Gemächern des „Sohnes des Himmels“ in Peking besorgen und in der
Privatkapelle des „Heiligen Vaters“ in Rom singen.
Eine noch viel größere Bedeutung als der Wagen mit dem heiligen[S. 52]
Kultbild der Göttin der Fruchtbarkeit erlangte als heiliges Gerät im
Dienste der Mondgottheit der Pflug. Viel ausgiebiger als mit der von
beiden Händen geführten Hacke ließ sich mit dem hakenförmig gekrümmten
Holze mit später erz- beziehungsweise eisenbewehrter Spitze der Boden
zur Aufnahme der Ackerfrucht aufreißen. Dieser Pflug wurde zunächst von
kriegsgefangenen Knechten, dann aber noch erfolgreicher durch den zum
Diener der Fruchtbarkeitsgöttin gemachten Ochsen gezogen. Er war ein
heiliges Werkzeug, mit dem man den Schoß der Allmutter Erde aufriß,
um sie zur Fruchtbarkeit zu zwingen, wie das Pflügen eine heilige
Handlung, die wie vor vielen Jahrtausenden, so heute noch vom Kaiser
von China, vom feierlichsten Zeremoniell umgeben, zur Eröffnung des
Ackerbaues seiner Untertanen vor allem Volke vollzogen wird. Wie die
Heiligkeit des Gerätes, so zieht sich die Heiligkeit des Gottesdieners
durch die ganze menschliche Kulturgeschichte. Bei vielen Völkern, so
in den meisten Gebieten Asiens, ist heute noch der den Pflug ziehende
Ochse ein Tier, dessen Fleisch nicht gegessen wird. Wie die Chinesen,
Inder und Westasiaten, hatte noch der gebildete Römer Cicero die
Anschauung, das Rind sei zum Pflügen und nicht zum Gegessenwerden da;
und Die Chrysostomus berichtet, daß in Cypern derjenige, der einen
Pflugochsen getötet hatte, als Mörder mit dem Tode bestraft wurde. Wie
bei den Juden, so wurde auch bei den alten Griechen ursprünglich die
Tötung eines Ochsen bestraft. Gleicherweise war sie bei den nüchternen
Römern verpönt, weil der Ochse ein Genosse des Mannes und ein Diener
der Ceres sei. Der Grieche Plutarch bekennt, daß er es nicht über sich
bringe, einen im Dienst alt gewordenen Ochsen auch nur zu verkaufen.
Erst nach und nach schwand wenigstens bei einem Teil der Menschen das
Vorurteil der Heiligkeit und Unantastbarkeit des Gottesdieners und
wurde der Ochse als Mastvieh ebensogut in Benutzung von Seite des
Menschen gezogen wie die milchende Kuh, deren Milch nicht mehr Opfer,
sondern profanes Genußmittel war.
In der hier angegebenen Weise muß das Rind schon vor etwa 10000 Jahren
als Genosse des Menschen gewonnen worden sein, und zwar zuerst in
Südasien, das überhaupt die meisten Wildrinder beherbergt, die für die
Domestikation von Seite des Menschen in Frage kommen. Zuerst hat der
Baseler Zoologe Ludwig Rütimeyer, auf genaue vergleichend anatomische
Untersuchungen des ihm zur Verfügung gestellten Materials gestützt,
nachgewiesen, daß das älteste Hausrind der Neolithiker Mitteleuropas,
die Torfkuh der Pfahl[S. 53]bauern — wie der bereits besprochene
Torfhund so genannt, weil ihre Überreste in den inzwischen meist
vertorften Kulturschichten jener vorgeschichtlichen Periode der
Pfahlbaubewohner gefunden werden —, nicht von einem einheimischen
Wildrinde gezähmt wurde, sondern als fremder Import von Süden her zu
den Stämmen Mitteleuropas in der jüngeren Steinzeit gelangte. Afrika
kommt wegen Mangel an entsprechenden Wildrindern nicht in Betracht,
sondern nur Südasien. Von den hier lebenden Wildrindern fällt der
Yak (Bos gruniens) als Stammvater des ältesten Hausrindes
wegen allzustarken Abweichungen im anatomischen Bau, wie auch wegen der
14 Rippenpaare, die er im Gegensatz zu den 13 des Hausrindes besitzt,
außer Betracht. Zudem ist dieses Tier ein ausgesprochener Bewohner des
Hochgebirges, dessen kaltem Klima und eisigen Stürmen entsprechend,
er das zottige Pelzkleid trägt. Als solches vermag es sich dem heißen
Tieflande durchaus nicht anzupassen. Gegen einen Zusammenhang mit dem
indischen Gayal oder Stirnrind (Bos frontalis)
spricht außer den ebenfalls 14 Rippenpaaren die gewaltige Ausdehnung
der Stirnfläche des letzteren und die abweichende Gestalt und Richtung
des Gehörns. Auch dieses ist übrigens ein Bergtier, das im Gebirge
östlich vom Brahmaputra bis nach Birma hinein in Herden lebt, fast so
geschickt wie der Yak klettert, gern das Wasser aufsucht und sich vor
der drückenden Mittagshitze in die dichtesten Wälder zurückzieht, wo es
wiederkäuend im Schatten ruht.
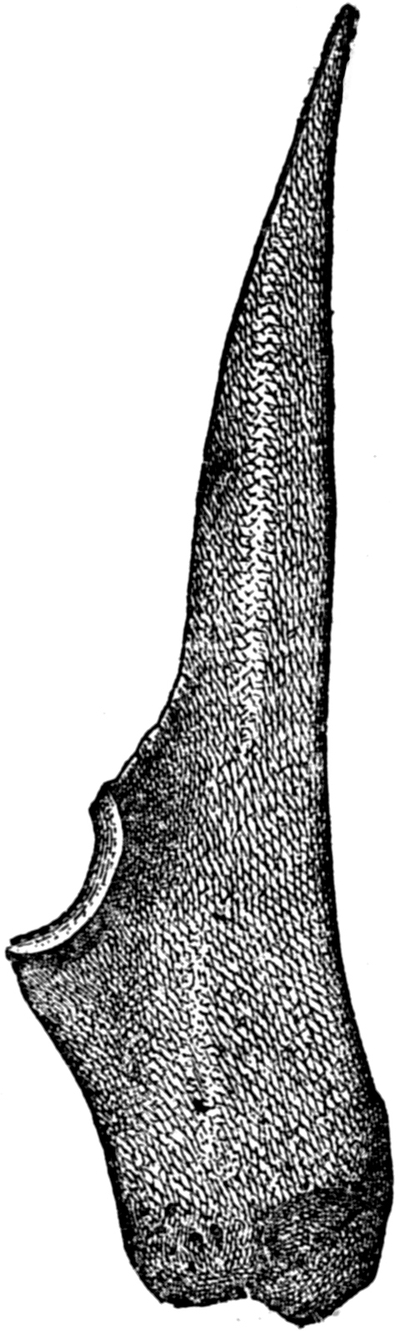
Bild 4. Ein aus der Elle einer Torfkuh gespitzter, sehr
gut in die Hand passender Dolch aus einem neolithischen Pfahlbau der
Schweiz. (1⁄3
nat. Größe.)
Auch der Gaur oder das Dschungelrind (Bos gaurus),
das den undurchdringlichen Buschwald ganz Südasiens vom Himalaja bis in
die indonesische Inselwelt bewohnt, kommt, obschon es 13 Rippenpaare
besitzt, aus anatomischen Gründen als Stammvater des Hausrindes nicht
in Betracht. Sein Schädel verbreitert sich nach oben zu, statt sich wie
bei diesem in dieser Richtung zu verschmälern; auch ist er im Stirnteil
auffallend konkav. Hinter dieser Konkavität erhebt sich ein mächtiger
Stirnwulst, der beim Stier einer schiefen Wand ver[S. 54]gleichbar ist, beim
weiblichen Tier allerdings etwas niedriger, aber immer noch recht hoch
ist.
Der Banteng der Malaien oder das Sundarind (Bos
sondaicus) dagegen erfüllt nach den eingehenden Untersuchungen von
Prof. Konrad Keller in Zürich und anderen Zoologen alle Bedingungen
dazu, so daß wir ihn mit Sicherheit als Stammvater des ältesten
Hausrindes ansprechen können. Der ganze Schädelbau, die eigentümliche
Beschaffenheit der Hornzapfen, die bei beiden wie wurmstichiges Holz
aussehen, die Gestaltung und Richtung des Gehörnes, die 13 Rippen usw.
deuten mit aller Bestimmtheit darauf, daß irgendwo im südlichsten
Asien der Banteng gezähmt und aus ihm die ältesten Hausrinder gewonnen
wurden, bei denen sich der Gesichtsteil mit der Zeit etwas verkürzte.
Dem scheuen, am liebsten in wasserreichen bis moorigen Waldesteilen
seinen Stand nehmenden und deshalb vorzugsweise flache Bergtäler
mit langsam strömenden Flüssen bewohnenden Banteng steht in
allen körperlichen Merkmalen von allen Hausrindern das indische
Zeburind am nächsten. Dieses ist offenkundig ein domestizierter
Banteng. Die anatomische Übereinstimmung beider ist auffallend. Beim
Zeburind wie bei der Bantengkuh ist der Schädel lang und schmal,
das Gehörn nach hinten ausgelegt, die Stirn seitlich abfallend, die
Schläfengrube breit und flach, sind die Augenhöhlen fast gar nicht
hervortretend, ist der Nasenast des Zwischenkiefers kurz und sind die
Backenzähne schief gestellt. Brehm sagt in seinem Tierleben, „daß
erwachsene Bantengs sich nicht zähmen lassen, Kälber desselben hingegen
sich in der Gefangenschaft leicht an den Menschen gewöhnen und völlig
zu Haustieren werden, da das Wesen des Tieres sanfter und milder zu
sein scheint als das aller übrigen bekannten Wildrinder.“
Der wilde Banteng ist ein verhältnismäßig leicht gebautes Rind von
braunroter bis kastanienbrauner Farbe bei den Kühen und jungen
Stieren, dagegen schwarz bei alten Stieren. Weiß dagegen sind bei
beiden Geschlechtern die untern Enden der Beine bis oberhalb der
Knie- und Hackengelenke, ein großer ovaler Bezirk auf der Hinterseite
der Schenkel, ein Streifen an der Innenseite der Beine, die Lippen
und die Innenseite der Ohren. Bei den Kälbern, deren Beine in ihrer
ganzen Ausdehnung außen kastanienbraun gefärbt sind, trägt der Rücken
einen dunkeln Längsstreifen. Die Schulterhöhe eines ausgewachsenen
Stieres beträgt 1,6–1,7 m, die Körperlänge etwa 2,6 m und
die Schwanzlänge 0,9 m. Die bei jungen Tieren walzigen, bei[S. 55]
ausgewachsenen an der Wurzel abgeflachten Hörner richten sich zuerst
nach außen und oben, aber gegen die Spitze zu etwas nach rückwärts und
innen. Seine Nahrung besteht hauptsächlich aus Gras. Gewöhnlich frißt
es von vormittags 9 bis nachmittags 4 Uhr und geht dann trinken. Nachts
legt es sich zum Ruhen nieder. Es meidet angebaute Gegenden so viel
als möglich, stellt sich aber gelegentlich auf Äckern mit junger Saat
zum Weiden ein. Es lebt meist in kleinen Herden von 5 oder 6 bis 20
Stück, die von einem großen Bullen geführt werden. Alte Stiere sollen
sich gerne von der Herde trennen und einsiedlerisch leben. Werden diese
verwundet, so greifen sie den Menschen, den sie sonst fliehen, ohne
Zaudern an.
In diesem Banteng oder Sundarind hat nun der Südasiate nicht bloß das
gefügigste, sondern auch das schönste Wildrind zum bildsamen Haustier
herangezogen und damit alle weitere Haustiergewinnung vorbereitet.
Dieser südasiatische Stamm der Hausrinder hat sich dann, weil sein
großer Nutzen einleuchtete, sehr bald über weite Gebiete ausgedehnt.
In der ostasiatischen Inselwelt reicht es bis Bali und Lombok, weiter
nördlich bis China und Japan; hier überall macht ihm heute der später
domestizierte Hausbüffel starke Konkurrenz. Nach Westen zu treffen
wir ihn zuerst in Persien und Mesopotamien, dann auch sehr früh schon
im Niltal an, wo uns auf einer der noch der neolithischen Negadazeit
angehörenden skulptierten Schieferplatte von Giseh (s. Tafel),
und noch deutlicher auf einer gleichzeitigen Platte im Louvre das
charakteristische bantengähnliche Hausrind der ältesten nachweisbaren
Zeit Ägyptens entgegentritt. Als Büffelfigur, sagt Keller, könne dieses
Bild schon der Kopfbildung wegen nicht aufgefaßt werden. „Der Stier auf
der Platte des Louvre zeigt vielmehr im Verlauf des Gehörns, in der
auffallenden Stirnbreite und in der Kürze der Schnauze die typischen
Kennzeichen eines alten Bantengstiers. Wir sind daher zu der Annahme
gezwungen, daß das Hausrind der frühägyptischen, vorpharaonischen Zeit
der Bantengstammform noch sehr nahe stand.“
Vom Niltal aus hat sich dieses Hausrind südasiatischer Herkunft
weiter südlich zu den Hamiten verbreitet, die lange Zeit allein von
den außerägyptischen Afrikanern in seinem Besitze waren. Erst später
haben es dann die intelligenteren Stämme der Negerbevölkerung in Süd-
und Westafrika übernommen. Madagaskar mit seiner starken Rinderzucht
hat das Tier von Ostafrika her erhalten. Von Äthiopien gelangte
schon vor der Zeit des alten Reiches im 4. Jahrtausend v. Chr. ein
großgehörnter Rinderschlag von Bantengabstammung, der heute nur[S. 56] noch
in Zentralafrika gefunden wird, nach Ägypten, wo er bald mit Vorliebe
gezüchtet wurde. Dieser buckellose Schlag, aus dem meist der heilige
Apis (altägyptisch hapi) genommen wurde, besaß ein ungewöhnlich
langes, leier- oder halbmondförmiges oder auch gerade nach oben außen
gerichtetes Gehörn und war von weißer, schwarz- oder rotbunter Färbung.
Der nach Älian dem Mondgotte heilige Apis war nach Herodot schwarz,
trug auf der Stirne ein weißes Viereck, auf dem Rücken das Bild eines
Adlers, am Schwanz zweierlei Haare und auf der Zunge einen Käfer. Diese
Färbung wird noch häufig beim Duxerschlag, namentlich aber bei den
Eringerschlägen des südlichen Wallis angetroffen.
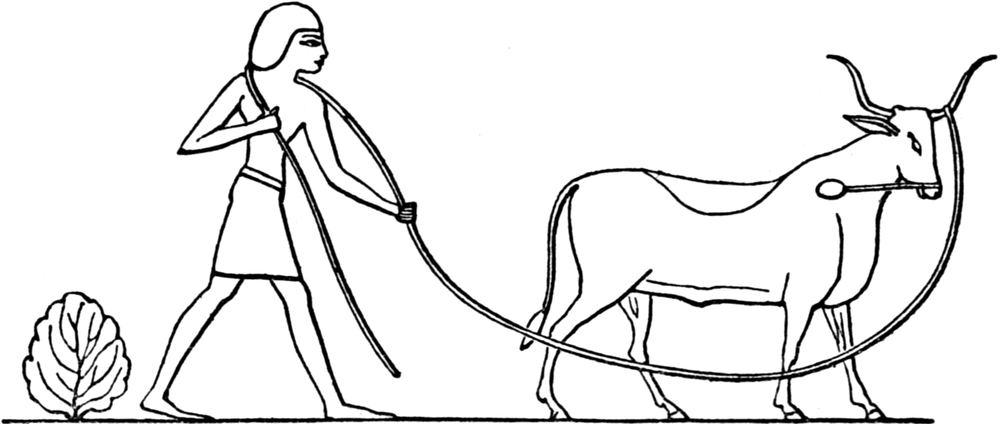
Bild 5. Einfangen eines wild gewordenen Rindes mit einem
bolaartigen Wurfseil im alten Ägypten. (Nach Wilkinson.)
Tafel 7.

Banteng (Bos sondaicus).
(Nach Keller, Die Abstammung der ältesten Haustiere.)
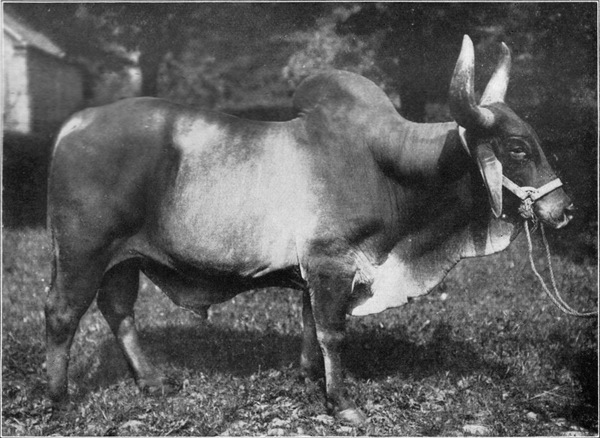
Guzerat-Zebubulle, von Karl Hagenbeck in Stellingen
importiert.
Tafel 8.

Herde von Guzerat-Zeburindern aus dem Besitz eines indischen Fürsten.
(Nach einer Photographie von Karl Hagenbeck.)
⇒
GRÖSSERES BILD
Tafel 9.

Luxusgespann von Guzerat-Zebuochsen eines indischen Fürsten
mit reicher Ausstattung.
(Nach einer Photographie von Karl Hagenbeck.)
⇒
GRÖSSERES BILD
Tafel 10.
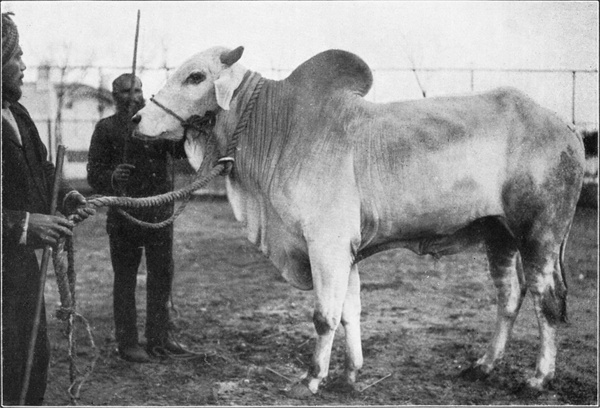
Hissar-Zebubulle, von Karl Hagenbecks Tierpark importiert.

Stier. Griechische Marmorfigur im britischen Museum zu
London.
Neben Langhornrindern wurde schon im alten Reiche (2980 bis 2475 v.
Chr) eine hornlose Rasse gehalten. Daß diese nicht gerade selten war,
geht nach Erman aus der Angabe hervor, daß auf dem Gute des Chefre
noch neben 835 Langhornrindern 220 hornlose Rinder vorhanden waren.
Gleicherweise sind uns Darstellungen von Höckerrindern, wie sie uns
in typischer Gestalt im indischen Zebu entgegentreten, schon in
Abbildungen des alten Reiches erhalten geblieben. Diese Zeburasse,
die sich am deutlichsten in Südasien ausprägte, hat einen Fettbuckel
entwickelt und eine lang herabhängende dünne Wamme am Hals. Das meist
kurze, höchstens mittellange Gehörn verläuft in der Flucht der Stirn
nach hinten. Das Ohr hängt meist stark herab. Die Farbe ist weiß,
grau, gelb, rotbraun oder gescheckt. Neben gewaltigen Schlägen kommen
auch zwergartige vor. Diesem indischen Zebu steht das ostafrikanische
Buckelrind am nächsten, das am reinsten im Sangarind Abessiniens
vertreten ist. Es hat sich heute vom abessinischen Hochland aus bis
zum oberen Nil und zum Tschadsee aus[S. 57]gebreitet. Das Gehörn ist bei
ihm größer als beim nahe verwandten indischen Zebu, im allgemeinen
leierförmig und nicht mehr so stark nach hinten ausgelegt, sondern
aufgerichtet. Der schlanke, hochgestellte Körper weist dieselben
Farben wie das indische Zebu auf. Es spielt als Zug- und Fleischtier
eine große Rolle, doch ist sein Milchertrag ein geringer. Aus ihm ist
offenbar als besondere Zuchtrasse das Langhornrind hervorgegangen,
das schon im alten Ägypten eine wichtige Rolle spielte, aber,
weil wirtschaftlich nicht hervorragend, im Laufe der Zeit stark
zurückging, in Ägypten ganz ausstarb und heute nach dem Innern Afrikas
zurückgedrängt wurde. Es findet sich heute im Seengebiet bei den
ackerbauenden Kolonien abessinischer Abstammung als Watussirind; doch
gibt es Bestände von ihm auch in Südabessinien. Es ist mittelgroß,
einfarbig kastanienbraun oder dunkelbraunfleckig und hat ein über
meterlang werdendes Gehörn von der Gestalt desjenigen des Sanga. Im
neuen Reich Ägyptens (1580–1205 v. Chr.) tritt dieses Langhornrind
zurück und dafür tritt ein kurzhörniges, meist buckelloses Rind
offenkundig südasiatischer Bantengabstammung in den Vordergrund. Auf
einem in Wasserfarben ausgeführten Wandgemälde in Theben aus der Zeit
der 18. Dynastie (1580–1350 v. Chr.) bemerkt man einzelne gefleckte
Exemplare mit Kennzeichen, die nur dem Zebu eigentümlich sind.

Bild 6. Äthiopische Prinzessin in einem von Ochsen einer
hornlosen Rasse gezogenen Wagen. (Nach Wilkinson.)
Auch in Mesopotamien ist das älteste Hausrind ein unverkenn[S. 58]barer
Bantengabkömmling. Das auf einem sehr alten chaldäischen Siegelzylinder
bereits vor den Pflug gespannt dargestellte Rind gleicht vollkommen
einem kleinen indischen Hausrind. Aus der assyrischen Zeit treffen
wir häufigere und bessere Darstellungen des Hausrindes. Auf einem
Quarzzylinder, dessen Reproduktion Layard gibt, ist ein typisches,
langhörniges Zeburind mit umfangreichem Fettbuckel und starker Wamme
säugend dargestellt. Das auf den Skulpturen der Königspaläste häufig
abgebildete Beutevieh wird stets mit gewölbtem Rücken oder mit
eigentlichem Fettbuckel wiedergegeben, so daß auch dessen Abstammung
von indischem Blute außer Zweifel steht. Nirgends begegnet uns eine
Rinderart, die auf Abstammung des jedenfalls auch in Vorderasien einst
lebenden Urs (Bos primigenius) hindeutet.

Bild 7. Altägyptische Darstellung zweier miteinander
kämpfender Stiere, die von Hirten getrennt werden. (Nach Wilkinson.)
An der Peripherie des Areals, das die ältesten Hausrinder von
Bantengabstammung bewohnen, d. h. im äußersten Osten Asiens, wie auf
Bali und Lombok, dann in Westasien, Nordafrika und vor allem in Europa,
begegnen wir einem kleinen, zierlich gebauten Rinderschlage von meist
dunkler Färbung, mit kleinem, nach außen und aufwärts gebogenem Gehörn,
zwischen den vortretenden Augenhöhlen eingesenkter Stirn und feiner
Schnauze. Das Hinterhaupt erhebt sich bei ihm in einen deutlichen,
steil abfallenden Höcker und seine Ecken sind nur ganz ausnahmsweise
wie beim Zebu — so beim sardinischen Hausrind — zu Hornstielen
ausgezogen. Das ist der Schlag, den wir überall in den Kulturschichten
der neolithischen und späteren Bewohner[S. 59] Europas, so auch in den
Pfahlbauten in den Seen und Torfmooren um die Alpen herum begegnen,
wie er sich auch in der Urzeit in Mesopotamien und Ägypten nachweisen
läßt. Es ist dies das bereits erwähnte Torfrind der Pfahlbauern,
das in der Vorzeit überall in Europa als Haustier gehalten wurde und
wahrscheinlich teils schon der Milchgewinnung diente, teils auch den
Pflug zog, wie uns verschiedene Felsenzeichnungen von Nordafrika bis
Skandinavien aus der Metallzeit zeigen. Rütimeyer nannte diese Rasse,
die er aus den Überresten der Pfahlbauten der Schweiz kennen lernte,
Kurzhornrind (Bos brachyceros), während der englische
vergleichende Anatom Richard Owen sie als Langstirnrind (Bos
longifrons) bezeichnete.
Dieses zierliche Hausrind mit zarten Gliedern und langem, schmalem
Schädel mit breiter Stirne, die über die Hälfte der Schädellänge mißt,
tritt uns von Anfang an in Europa in ihren charakteristischen, alle
Zebumerkmale außer dem Fetthöcker aufweisenden anatomischen Merkmalen
und Eigenschaften entgegen, so daß wir mit Bestimmtheit von ihm sagen
können, daß es vollkommen domestiziert hier eingeführt wurde, und
zwar nach Konrad Keller vorzugsweise aus Nordafrika. Er stützt sich
dabei nicht bloß auf die Tatsache, daß sich eine dem alten Torfrind
ganz nahe stehende Rasse hier bis nach Marokko hinein auffallend rein
erhielt, sondern besonders darauf, daß die Annäherung des afrikanischen
Zeburindes an unsere europäischen Braunviehschläge um so größer ist,
je mehr man in Afrika nach Norden hin vorschreitet. Schon Nubien
besitzt eine feinköpfige und kurzhornige Rasse, die dem algerischen und
marokkanischen Rind auffallend nahe steht. Außerdem haben die kleinen
beweglichen Zeburinder noch eine zweite direktere Wanderstraße aus
ihrer Heimat Südasien nach Europa eingeschlagen, die über Mesopotamien,
Kleinasien und durch die Donauländer ins Herz unseres Kontinentes
führte. Keller hielt diesen direkten Import aus Asien für sekundär
und nicht sehr ausgiebig, was wir nicht ganz unterschreiben möchten,
da alle übrigen Kulturerrungenschaften der europäischen Neolithiker
viel mehr nach Westasien als nach Nordafrika hinweisen. Jedenfalls
hat der rege Handelsverkehr der Mittelmeerländer schon frühe wichtige
Erzeugnisse Nordafrikas, zumal Ägyptens, nach Norden gebracht. Der
bevorzugte Weg wird dabei aus dem Niltal über die ägäische Inselwelt
nach dem Schwarzen Meer und von da donauaufwärts gegangen sein.
Überreste dieses Torfrindes von Bantengabstammung haben sich in den
Braunviehschlägen der Zentralalpen ziemlich rein, am reinsten[S. 60] um
das Gotthardmassiv herum beim sogenannten Schwyzervieh, erhalten.
Die Haarfärbung wechselt vom dunkeln Braun bis zum hellen Mäusegrau.
Als Rassekennzeichen gilt das dunkle Flotz- oder Rehmaul mit heller
Umrahmung und ein heller, als Aalstrich bezeichneter Rückenstreifen.
Diese Merkmale finden sich auch bei ostasiatischen und indischen
Rindern. Auch ist der als Spiegel bezeichnete umfangreiche weiße Fleck
am Hinterteil des Banteng als ein Rückschlag in Gestalt einer heller
gefärbten Stelle am Hinterbacken nicht selten bei den einfarbigen
braunen Kühen um das Gotthardmassiv herum zu sehen. In Südeuropa gehört
dazu das dunkle sardinische, illyrische und albanesische Rind, im Osten
das weitverbreitete polnische Rotvieh, das sich auch über das nördliche
Rußland ausdehnt und im Nordwesten das hochgezüchtete und seiner
Milchergiebigkeit wegen berühmte Jersey- oder Kanalrind.
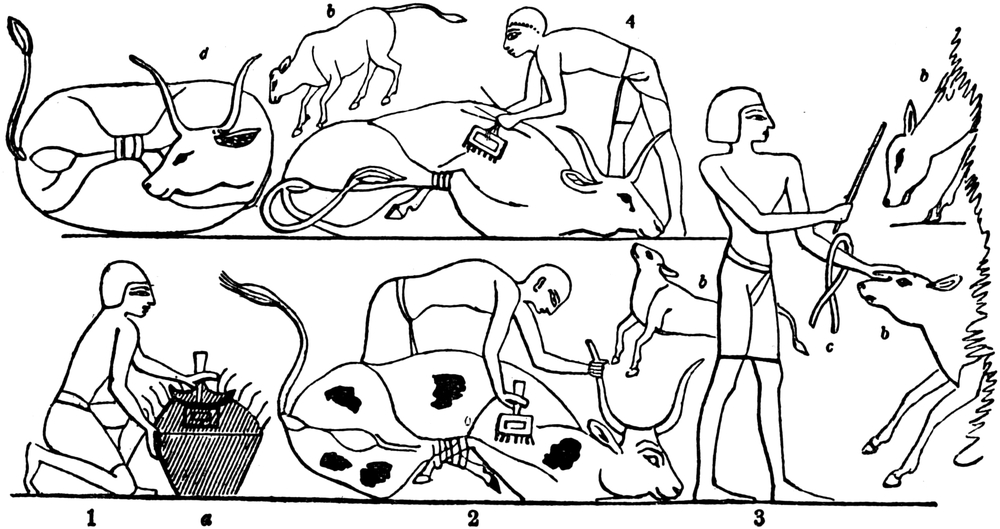
Bild 8. Rinder im alten Ägypten werden mit einem
eingebrannten Eigentumsstempel versehen.
1. Das Eisen wird glühend gemacht, 2. u. 4. die gefesselten Rinder
werden gebrannt. (Nach Wilkinson.)
Diese kleinen Rinder haben, wie auch das Zebu, von dem sie sich
ableiten — man denke nur an das hornlose altägyptische, das heutige
Somalirind, die Rinder von Unjoro und Berta — schon sehr frühe auch
hornlose Formen hervorgebracht, die sich bereits in der neolithischen
Pfahlbauzeit nachweisen lassen. Hornlose Rinder sollen auch die Skythen
besessen haben. Jetzt sind sie außer in Zentralafrika, wo die meisten[S. 61]
Rinder hornlos und ohne Fettbuckel sind, hauptsächlich über Nordeuropa
verbreitet, so in Nordrußland, Skandinavien, Island, Schottland,
England, Wales und sporadisch in Oldenburg. Auch in Irland scheint
diese Rasse früher sehr verbreitet gewesen zu sein, da man in alten
Ansiedelungen viele ungehörnte Schädel derselben fand. Die Haarfarbe
dieses hornlosen Viehs ist vorzugsweise weiß, doch kommen auch
gelbrote, braunrote und schwarze Nuancen vor.
Mit der Kurzhornrasse von Zebuabstammung, dem Torfrind, eng verwandt
und durch künstliche Züchtung offenbar auf europäischem Boden
entstanden, ist das durch auffallende Kürze des Kopfes ausgezeichnete
Kurzkopfrind (Bos brachycephalus). Bei ihm ist die Stirne
zwischen den Augen sehr breit und unten stark eingezogen, das drehrunde
Gehörn ist stark, oft sehr groß und leierförmig, meist weiß mit
schwarzer Spitze. Die Haarfarbe ist braun bis gelb, selbst weiß und rot
bis schwarz, häufig mit weißem Abzeichen. Wie beim Braunvieh läßt sich
bei dunkeln Varietäten häufig eine weiße Einfassung des Flotzmaules,
eine weiße Innenseite des Ohres und ein ebenso gefärbter Aalstrich auf
dem Rücken erkennen.
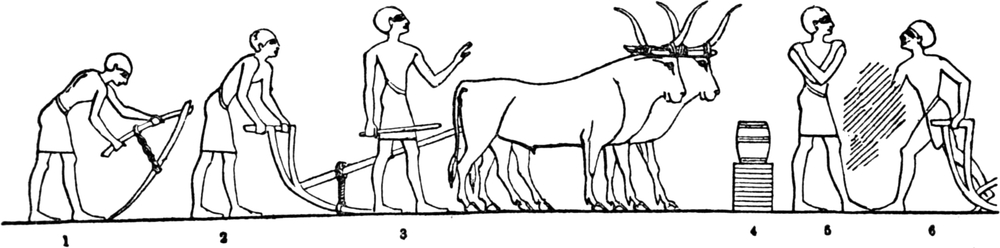
Bild 9. Pflügen mit einem Ochsengespann im alten
Ägypten. (Nach Wilkinson.)
Nach Keller tauchen die Kurzkopfrinder zuerst auf dem Boden Italiens
auf und wurden dann vermutlich durch römische Kolonisten nach Norden
gebracht. Er glaubt, sie ließen sich ihrer Abstammung nach auf das
altägyptische Langhornrind zurückführen und seien wahrscheinlich schon
in vorgeschichtlicher Zeit nach Europa gelangt und hier umgezüchtet
worden. Diese Ansicht kann nach den bisher bekannt gewordenen
Tatsachen nicht aufrecht erhalten werden. Das Kurzkopfrind war schon
in vorgeschichtlicher Zeit, nämlich zu Ende des 3. Jahrtausends v.
Chr., nördlich der Alpen an den Schweizerseen zu finden. Dürst glaubt
es bereits auf babylonischen Siegelzylindern aus dem Beginne des 3.
vorchristlichen Jahrtausends nachweisen zu können. Auch im alten
Ägypten wurde es bereits gehalten, ebenso in Arabien[S. 62] und Nordafrika,
wo man teilweise Knochenüberreste von ihm fand. In Südeuropa muß es
im letzten Jahrtausend v. Chr. allgemein verbreitet gewesen sein. Die
Reste desselben aus der helvetisch-römischen Zeit in Vindonissa und
Aquae weisen auf ein sehr stattliches Tier hin, wie es sich heute noch
im Südwesten von Europa auf der iberischen Halbinsel in stärkster
Entwicklung vorfindet. In Deutschland gehört dazu das ebenfalls
stattliche Rind des bayerischen Allgäu. Kleiner ist das gleicherweise
hierher gehörende Eringerrind aus dem südlichen Wallis, das meist
einfarbig, schwarz oder dunkelbraun mit rötlichem Anflug gezüchtet
wird. Verwandt damit ist der Zillertaler, der Pustertaler und der Duxer
Schlag, dann der Voigtländer und der Egerländer Schlag, das Devonrind
in den englischen Grafschaften Devonshire, Sussex und Hereford, wie
auch das Rind der Kanalinseln (Jersey u. a.). Noch näher scheint der
Urrasse das Albanesenrind zu stehen. Jedenfalls hat sich diese uralte
Rinderrasse am besten in den entlegenen Gebirgstälern erhalten und
stellt so gewissermaßen die Gebirgsform des Rindes dar.
Zu diesen Rindern von südasiatischer Abstammung kommen meist
großgehörnte Formen von schwerem Körperbau, die anatomisch
durchaus nicht auf den Banteng, sondern auf den Ur (Bos
primigenius) zurückzuführen sind. Dieses neben dem Wisent
(Bison europaeus) seit der diluvialen Zeit bei uns lebende
Wildrind war teilweise größer als unsere Hausrinder und besaß einen
Schädel von auffallend geradlinigem Umriß, mit schief nach vorn
gerichteten Augenhöhlen und schief aufsteigendem Unterkieferast.
Der Gesichtsschädel zeigt eine verhältnismäßig starke Entwicklung;
die Stirnbeine sind flach und stoßen in rechtem Winkel mit der
Hinterhauptsfläche zusammen. Das mächtige Gehörn besaß im ganzen
Leierform, wandte sich zuerst nach außen, dann nach innen oben mit
aufwärts gerichteten Spitzen. Während sich also bei ihm das ziemlich
lange Gehörn gegeneinander krümmte, war es beim Wisent nicht nur
kürzer, sondern auch nach einwärts und rückwärts gekrümmt. Dabei besaß
letzteres einen dreieckigen Kopf, starke Mähne und abfallenden Rücken,
während der Ur, dem Hausrinde ähnlich, einen länglichen Kopf, keine
Mähne und einen geraden Rücken besaß. Außerdem war es schwarz und nicht
dunkelbraun wie jenes gefärbt.
Das Verbreitungsgebiet des Ur erstreckte sich außer durch ganz
Europa, wo er sich am längsten im nördlichen Rußland erhielt, auch
über ganz Nordasien bis zum Altaigebirge und reichte nach Süden bis
zum Bergland von Armenien und Nordbabylonien. Die Assyrier[S. 63] kannten
ihn sehr wohl unter dem Namen rimu, was identisch mit dem
biblischen reem ist. Nach einem Relief des um 884 v. Chr. durch
Asurnasirpal erbauten Nordwestpalastes in Nimrud, auf welchem dieser
König einem Ur das Messer ins Genick stößt, bildete dieses gewaltige
Tier damals noch ein geschätztes Jagdobjekt für die Fürsten von Assur.
Auf dieser Darstellung hat der Künstler, der dieses Tier genau gekannt
haben muß, nicht nur das starke Gehörn, sondern auch den schief
aufsteigenden Unterkieferast in sehr naturgetreuer Weise dargestellt,
so daß wir unverkennbar einen Ur — früher auch Auerochse genannt
— vor uns haben. Daß diese Tiere damals noch in größerer Menge in
Nordbabylonien vorkamen, beweist die Tatsache, daß dieser König nach
einer Inschrift auf einer Jagd deren nicht weniger als fünfzig erlegte
und acht gefangen nahm. Diese letzteren werden im Wildparke des Königs
Aufnahme gefunden haben. Auch anderweitig berichten uns assyrische
Texte, daß junge Ure gefangengenommen und in der Gefangenschaft
weitergezüchtet wurden. So scheint in Nordbabylonien der Ur zuerst
gezähmt und für den Haustierstand in der Obhut des Menschen vorbereitet
worden zu sein. Dies geschah zweifellos schon weit früher als zu Beginn
des letzten Jahrtausends v. Chr., da wir urähnlichen Rindern schon
auf den ältesten babylonischen Siegelzylindern und in Form prächtig
modellierter Köpfe aus Bronze, die noch in die sumerische Zeit ins
dritte Jahrtausend v. Chr. zurückreichen, begegnen. Dabei scheinen die
Assyrier offenkundig diese gezähmten Rinder von Urabstammung zu opfern
bevorzugt zu haben. Wenigstens werden sie in ihrer charakteristischen
Erscheinung bei assyrischen Opferszenen, z. B. am Palast von Balawat,
dargestellt, während wir unter den ebendort abgebildeten Rindern als
Tribut fremder Völker ganz anders gekrümmte Hörner finden, die stark an
ägyptische Darstellungen erinnern. Letztere waren zweifellos Hausrinder
von Bantengabstammung.
Aus geschichtlicher Zeit haben wir mehrfache Zeugnisse über das
Vorhandensein dieses mächtigen Wildrindes in Europa, so von Julius
Cäsar, der in seinem Buche über den gallischen Krieg schreibt, daß im
hercynischen Wald — worunter jener römische Autor das Waldgebirge
Mitteldeutschlands vom Rhein bis zu den Karpaten verstand — ein
urus genanntes Wildrind lebe, das äußerlich einem Stier
gleiche, aber an Größe nur wenig hinter dem Elefanten zurückstehe. Mit
letzterer Angabe hatten ihm seine germanischen Gewährsmänner einen
„Bären aufgebunden“, wie sie ihm auch sagten, die Beine des Elches
(alces) seien stocksteif und hätten keine Gelenke. „Deshalb
legen sich die Tiere,[S. 64] wenn sie ruhen wollen, nicht nieder, können auch
nicht wieder aufstehen, wenn sie zufällig hinfallen. Um zu schlafen,
lehnen sie sich also an Bäume. Solche Plätze merken sich die Jäger,
machen heimlich einen Einschnitt in jeden Baum, so daß er an sich
stehen bleibt, aber umfällt, wenn sich das Tier daranlehnt.“ Noch manch
anderes solch altdeutsches Jägerlatein hat der große römische Stratege
und kluge Staatsmann als baare Münze entgegengenommen.
Nach Cäsar spricht dessen Zeitgenosse Vergil im zweiten Gesang
seiner Verherrlichung des Landbaues vom Ur, indem er sagt, man solle
die Weinberge einzäunen, damit das Vieh (pecus) ihnen nicht
schädlich werde. Darunter zählt er außer den Schafen und dem Jungvieh
die Rehe und die wilden Ure aus den Wäldern (silvestres uri).
Das Landgut, das dieser Darstellung zugrunde liegt, war höchst
wahrscheinlich des Dichters eigenes, das väterliche Gut in Andes bei
Mantua, in welchem er am 15. Oktober 70 v. Chr. geboren wurde. Also
müssen noch im letzten vorchristlichen Jahrhundert die Ure von den
dichten Wäldern an den Vorbergen der Alpen weit in die lombardische
Ebene hinein gewechselt sein. Im dritten Gesang wird von Vergil eine
schwere Seuche, anscheinend Milzbrand, geschildert, die den ganzen
Viehstand der Krainer Alpen vernichtet hatte. Als danach das Fest der
Göttermutter herankam, hatte man keine Ochsen (boves), um mit
ihnen den Prozessionswagen der Göttin zu bespannen, und mußte statt
ihrer (kastrierte) Ure nehmen (Vers 531). Also muß es damals neben
den wilden auch zahme Ure gegeben haben, die man als eine besondere
Tiergattung vom Rindvieh unterschied. Allem nach scheinen auch diese
zahmen Ure seuchenfester als die echten Rinder gewesen zu sein. Das
mag mit ein Grund gewesen sein, daß in der Folge in manchen Gegenden
Südosteuropas das Vieh vom Primigeniusstamme, also vom Ur abgeleitet,
die Oberhand über die älteren, gegen Seuchen empfindlicheren Rassen von
Bantengabstammung gewann.
Tafel 11.

Der Assyrerkönig Assurnasirpal auf der Urjagd.
Ein Ur ist mit Pfeilen erlegt, ein anderer, wohl in Netzen gefangen,
wird vom König lebend eingebracht.
(Nach einer Photographie von Mansell & Cie. in London.)
⇒
GRÖSSERES BILD
Tafel 12.

Zuchtstier „Walo“, der Schwyzerrasse angehörig, auf der
Gutswirtschaft der Maggi-Gesellschaft in Kempttal.
⇒
GRÖSSERES BILD
Tafel 13.

Mehrfach prämiierte Kuh der Schwyzerrasse auf der
Gutswirtschaft der Maggi-Gesellschaft in Kempttal.
⇒
GRÖSSERES BILD
Tafel 14.

Wisent aus dem Kaukasus im Zoologischen Garten von Berlin.

Amerikanischer Bison im Zoologischen Garten von Berlin.
(Beide nach einer Photographie der Neuen photogr. Gesellschaft in Steglitz.)
Im 1. Jahrhundert n. Chr. schreibt dann der ältere Plinius in seiner
Naturgeschichte: „Germanien ist durch das Vorhandensein von zwei
Arten wilder Rinder merkwürdig, nämlich durch den mit einer Mähne
geschmückten Bison (Wisent) und den Ur, der sich durch Kraft und
Schnelligkeit auszeichnet.“ Tacitus weiß in seinen Annalen von einem
römischen Steuerbeamten zu berichten, der die Friesen dadurch zum
Aufstand trieb, daß er ihnen für die Entrichtung ihres in Ochsenfellen
bestehenden Tributs Urfelle als Muster vorschrieb. Solche in größerer
Menge zu beschaffen mochte ihnen schwer fallen. Wie[S. 65] Plinius
spricht auch das Nibelungenlied von zwei in Germanien hausenden
Wildrindern, dem Wisent und dem Ur. Letzterer wurde noch im 10.
Jahrhundert in der Umgebung des Klosters St. Gallen gejagt und sein
Fleisch an der Klostertafel nebst dem des Bibers und anderer dort heute
längst ausgerotteter Tiere verspeist, wie wir den Benediktionen oder
Tischgebeten des dort lebenden und 973 verstorbenen Mönches Ekkehard
I. entnehmen können. Nach Alfred Nehring wurde in Bromberg ein
aus dem 12. oder 13. Jahrhundert stammender Urstierschädel aufgefunden,
der auf der Stirne noch Spuren von drei Lanzenstichen aufweist, als
Beweis dafür, daß er um jene Zeit dort noch gejagt wurde. Noch ums Jahr
1550 erhielt der österreichische Gesandte und Freiherr von Heberstain
auf einer diplomatischen Reise nach dem Königreiche Polen in Masovien
vom König Sigismund August von Polen einen dort getöteten Ur als
Geschenk. Das Tier war damals freilich nicht mehr zahlreich, sondern
auf einen kleinen Bestand in Masovien zusammengeschmolzen. Später
erhielt der Züricher Zoologe Konrad Geßner von einem seiner Schüler,
Schneeberger, und von Johann Bonar zuverlässige Nachrichten über den
in Polen lebenden und dort Thur genannten Ur und berichtete darüber
1560. Zuletzt hat August Wrzesniowski in einer 1878 in der Zeitschrift
für wissenschaftliche Zoologie veröffentlichten Arbeit an Hand der
polnischen Quellen nachgewiesen, daß schon im 13. Jahrhundert die Jagd
auf den „Thur“ ein ausschließliches Vorrecht der Herzoge von Masovien
war, er bereits im 16. Jahrhundert selten zu werden begann und nur noch
in den Forsten von Jaktorowka (etwa 55 km westlich von Warschau)
vorkam. Hier wurde er zuletzt, wie heute der Wisent im urwaldähnlichen
Riesenforste von Bjelowjesha im russisch-litauischen Bezirke Grodno,
förmlich gehegt und über die noch vorhandenen Exemplare Buch geführt.
1564 zählte man nur noch 30 und 1599 24 Stück. 1602 ging der Bestand
auf 4 Thure zurück und 1627 starb die letzte Urkuh.
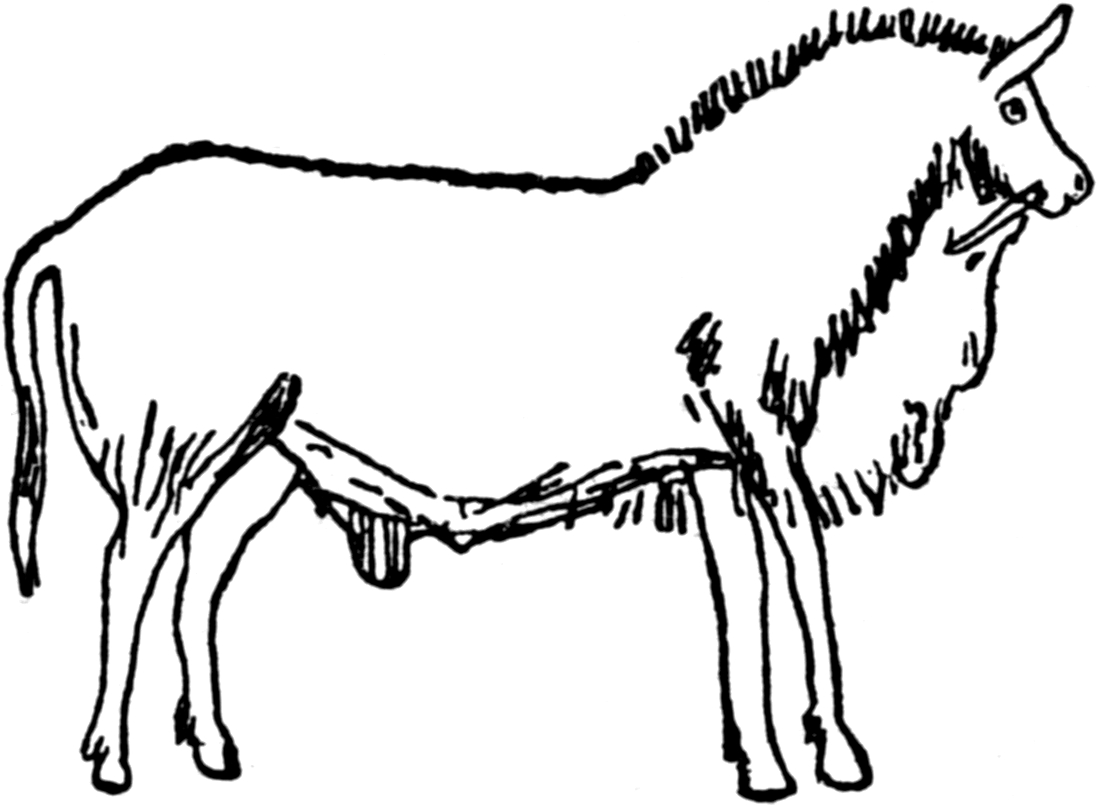
Bild 10. Zeichnung eines Urstiers aus der Höhle von
Combarelles. Breite der Originalzeichnung 90 cm.
(Nach Capitan und Breuil.)
Außer verschiedenem Skelettmaterial aus Torfmooren — so einem nahezu
vollständigen Skelett, das 1887 am Schwielochsee im Kreise Lübben in
der Niederlausitz aufgefunden wurde und sich jetzt im Mu[S. 66]seum der
Landwirtschaftlichen Hochschule in Berlin befindet — besitzen wir
auch noch leidliche Bilder von diesem gewaltigen Wildrinde Europas.
Heberstain, der letzte Zeuge, der den Ur noch sah, ließ eine Abbildung
herstellen, die durch Konrad Geßner in weiteren Kreisen bekannt wurde.
Daneben existiert noch ein vom Engländer Hamilton Smith bei einem
Augsburger Kunst- und Antiquitätenhändler entdecktes Urstierbild, das
im ersten Viertel des 16. Jahrhunderts in Öl auf Holz gemalt wurde,
1827 in Griffiths „Animal Kingdom“ zur Veröffentlichung gelangte und
seither im Original verschollen ist. Eine weit bessere Darstellung gibt
das bereits erwähnte alte Jagdbild vom Palaste des assyrischen Königs
Asurnasirpal aus dem Beginn des 9. Jahrhunderts v. Chr., besonders
aber die aus bester mykenischer Zeit Griechenlands, aus der Mitte
des zweiten Jahrtausends vor Chr. stammenden Rinderfiguren auf den
Goldbechern von Vaphio, dem alten Amyklai. Es sind dies die weitaus
besten Urbilder, die wir besitzen. Diese in einem prähistorischen
Kuppelgrab 1888 gefundenen beiden Goldbecher, die offenbar aus der
gleichen Werkstätte hervorgingen, zeigen in einem Basrelief den Fang
und die Zähmung des wilden Urs. Der eine Becher (I) stellt
dar, wie ein Ur sich in einem von starken Stricken verfertigten
Netze fängt und dabei überkugelt, während zwei andere in gestrecktem
Galopp aus dem Bereiche des Netzes flüchten, wobei der eine zwei
sich ihm entgegenstellende, mit Wams und Hosen bekleidete Männer
über den Haufen rennt, den einen derselben auf die Hörner nimmt und
davonschleudert. Der andere (auf Tafel II) stellt vier gezähmte
Ure, drei Männchen und ein Weibchen dar, welch letzteres sein Haupt in
Profilstellung dem ihm zunächst stehenden Stier zuwendet. Davor steht
ein mit Wams und Hosen bekleideter Mann, der einen laut aufbrüllenden
Urstier mit einem dicken Strick am linken Hinterbein gefesselt hält.
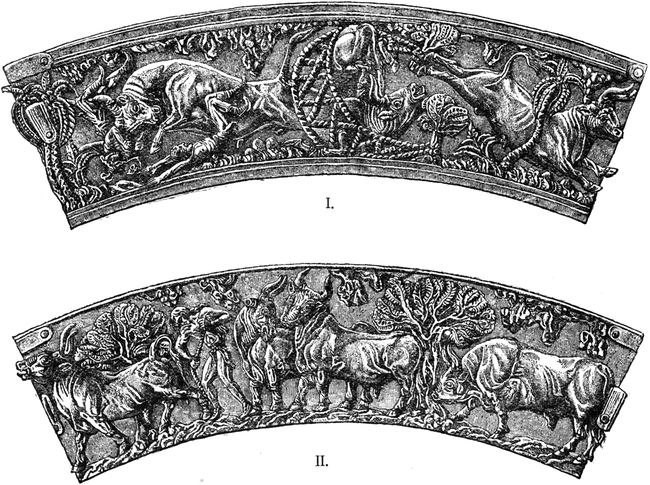
Bild 11 u. 12. Darstellungen in getriebener Arbeit auf den
beiden massiv goldenen Bechern aus dem Kuppelgrabe von Vaphio, dem alten
Amyklai, aus bester mykenischer Zeit (Mitte des 2. vorchristlichen
Jahrtausends) aufgerollt, um das Einfangen und die Zähmung des Wildrindes der
Primigeniusrasse zu zeigen.
Diese unschätzbar wichtigen Darstellungen von überaus hohem
künstlerischem Wert zeigen uns, wie in vorgeschichtlicher Zeit
neben dem von Südasien gezähmt eingeführten Torfrind das stärkere
einheimische Wildrind gefangen und unter des Menschen Botmäßigkeit
gebracht wurde, um aus ihm ein nützliches Haustier zu machen. Wie
dies noch nach der Mitte des zweiten vorchristlichen Jahrtausends
in Griechenland geschah, was uns der Becher von Vaphio beweist,
dessen Darstellung nur von einem Manne geschaffen worden sein kann,
der persönlich beim Fange dieses Wildrindes mit Hilfe von starken
Jagdnetzen zugegen war und den Vorgang aus eigener Anschauung, nicht
nur vom[S. 67] Hörensagen schildert, so ist dies wahrscheinlich schon mehr
als tausend Jahre früher in Nordeuropa, außerdem auch in Westasien,
speziell Nordbabylonien, und vielleicht an anderen Orten gemacht
worden und hat zur Gewinnung eines sehr kräftigen Rinderschlages
geführt, das uns, dem Wildrinde noch recht nahestehend, bereits in den
jüngeren Pfahlbauten entgegentritt. Diesem gezähmten Primigeniusrind
des vorgeschichtlichen Europa, das uns weder in Asien östlich von
Mesopotamien, noch in Afrika entgegentritt, steht von heute lebenden
das großhörnige schottische Hochlandrind von schwärzlicher bis
grauer Haarfärbung am nächsten. Ferner das ebenfalls großhörnige
weiße eng[S. 68]lische Parkrind, das schon bei den alten Kelten in hohem
Ansehen stand. Berichten doch die etwa aus dem 11. Jahrhundert
stammenden Gedichte des angeblichen gälischen Barden Ossian, des
Sohnes König Fingals, aus dem 3. Jahrhundert n. Chr., daß zwei
Häuptlinge wegen eines weißen Stieres in eine erbitterte Fehde
gerieten, die erst mit dem Tode des einen beigelegt wurde. Ebenfalls
ein Primigenius-Abkömmling ist das in gleicher Weise wie die vorigen
einfarbige, großhörnige, überaus wetterharte und genügsame, aber nur
geringe Milchergiebigkeit und Mastfähigkeit aufweisende Steppenrind
Podoliens und Südrußlands. Als „graues Steppenrind“ finden wir es in
Ungarn und in der römischen Campagna. Dieses silbergraue Vieh der
römischen Campagna wurde nicht erst, wie man noch vor kurzem annahm,
durch die Langobarden in Mittelitalien eingeführt, sondern ist hier
schon in vorgeschichtlicher Zeit nachweisbar. So finden wir es deutlich
auf der der La Tènezeit angehörenden Situla (Eimer) aus der Certosa
von Bologna noch mit vorwärts zeigendem Gehörn dargestellt, als
Beweis dafür, daß dieses Rind dem Ur sehr nahestand und nur geringe
Veränderungen infolge von Domestikation aufwies. Über die Niederungen
Rußlands finden wir das Steppenrind von Primigeniusabstammung durch
ganz Sibirien, aber nicht mehr überall in reiner Rasse. So weist
beispielsweise das Kirgisenrind eine beträchtliche Beimischung von
Zebublut zum Primigeniusblut auf. Solche Kreuzungen wurden jedenfalls
bereits in vorgeschichtlicher Zeit in ausgedehntem Maße vorgenommen,
wozu die einheimischen Hausrinder genugsam Gelegenheit gaben. Nicht
selten werden aber auch die zahmen Ure auf der Weide von wilden
Urstieren belegt worden sein, wie es heute noch in Hinterindien häufig
genug vorkommt, daß zahme Zebukühe von wilden Bantengstieren befruchtet
werden, was die Malaien als eine willkommene Blutauffrischung gerne
sehen.
Von Mischungsprodukten zwischen Torfrind und Primigeniusabkömmlingen
sind wohl die meisten spurlos untergegangen und andere sind durch
künstliche Züchtigung stark umgebildet worden. Eine solche durch
Umzüchtung aus der älteren Primigeniusrasse ohne bedeutende
Torfrindblutbeimischung hervorgegangene Rinderart ist nach L. Rütimeyer
das von Nilsson als Frontosusrasse bezeichnete Großstirnrind
(Bos frontosus), das zur Bronzezeit neben dem kleinen,
zierlichen Torfrind zuerst in Nordeuropa, und zwar in Südschweden
auftritt. Von da drang es erst sehr spät weiter nach Süden vor, um
allerdings nur eine sehr lokale Verbreitung zu erlangen. Diese Rasse,
die auch[S. 69] noch recht schwer, wie das reine Primigeniusrind, werden
kann, zeigt einen Schädel mit unregelmäßigem Umrisse, zwischen den
Augen verbreiteter Stirne, dachiger Hinterstirn, gestielten Hornzapfen
und gewölbten Augenhöhlen. Die Färbung ist rot- oder schwarzscheckig
mit scharf begrenzten Flecken; der Nasenspiegel ist fleischfarben. Noch
jetzt wird diese Rasse im südlichen Schweden gehalten und hat die einst
in England weitverbreitete, jetzt aber dort verschwundene Langhornrasse
aus sich hervorgehen lassen, deren letzte Reste sich in Südschweden in
dem Vieh der Insel Gotland erhielten.
Wichtiger als sie ist das durch kurze Hörner und schwarze oder
rotscheckige Farbe ausgezeichnete Marschrind der Nordseeküste, zu dem
auch das holländische Rind gehört. Es ist durch seine Milchergiebigkeit
berühmt und scheint hier bis ins Altertum zurückzugehen. Wir wissen
wenigstens, daß schon zur Zeit der Römer am Niederrhein ein ähnlich
großes Rind gezogen wurde. Die größte Bedeutung aber erlangte das
Großstirnrind in der Westschweiz im hochgezüchteten rotscheckigen
Simmentaler- und im schwarzscheckigen, neuerdings stark im Rückgang
begriffenen Freiburger Schlag. Dieses ebenfalls überaus milchergiebige
schweizerische Fleckvieh, das bis zum Bodensee verbreitet ist, scheint
erst zur Zeit der Völkerwanderung in Mitteleuropa eingewandert zu sein
und kam nach Keller vermutlich mit den vom Niederrhein gekommenen
Burgundern nach der Westschweiz. Nicht nur in den westschweizerischen
Pfahlbauten, sondern auch in den helvetisch-römischen Niederlassungen
der Schweiz, z. B. in Vindonissa, fehlen alle Spuren von ihm
vollständig. Keller meint, diese Tatsache sei sehr schwerwiegend; denn
die Römer, die beispielsweise in Vindonissa eine starke Besatzung
zu unterhalten hatten, würden ohne Zweifel vorgezogen haben, die
milchreichen Fleckviehrinder aus der Westschweiz zu holen, falls
solche damals vorhanden gewesen wären, statt die schweren, wenig
Milch liefernden Kurzkopfrinder aus dem Süden über die Alpenpässe in
Helvetien einzuführen, da das kleine einheimische Torfrind den Bedarf
nicht deckte.
Derselbe Autor meint in seinem Werke über die Abstammung der ältesten
Haustiere: „Über das Verhältnis der Freiburger Schwarzflecken zum
rotbunten Simmentaler Schlag müssen noch eingehendere anatomische
Untersuchungen angestellt werden. Sie gehören zwar nach den
osteologischen Merkmalen zur Frontosusrasse, dagegen ist das
Gehörn steiler aufgerichtet und nach meiner Beobachtung häufig
primigeniusähnlich. Daher die Behauptung, daß das Freiburger Vieh
Ein[S. 70]wirkungen von niederländischem Vieh erhalten habe. Andere
vermuten eine Vermischung mit Braunvieh. Leider war es mir bei dem
starken Rückgang dieses Schlages bisher nicht möglich, ausreichende
Schädelserien zu beschaffen, wie denn überhaupt die Erwerbung von
Haustiermaterial auf kaum glaubliche Schwierigkeiten stößt.“
Das ziemlich verwahrloste Rind Sibiriens repräsentiert nach den
Untersuchungen von Okulitsch einen unvermischten Primigeniustypus. Die
Färbung desselben ist vorwiegend rot; doch gibt es in der Umgebung
von Tomsk auch graue Rinder dieses Schlages. Die Milchergiebigkeit
der sibirischen Kühe ist gering; dennoch ermöglicht der bedeutende
Viehstand eine starke Ausfuhr von Produkten der Milchwirtschaft. So
wurden schon im Jahre 1901 27 Millionen kg Tafelbutter von
Sibirien nach Europa exportiert und seither hat sich diese Ausfuhr
durch bessere Bahntransporte bedeutend erhöht. Der Regierungsbezirk
Tomsk allein weist einen Rinderbestand von gegen 2 Millionen Stück auf.
Alle weiter südlich in Asien gehaltenen Rinder sind dagegen Abkömmlinge
des gezähmten Banteng, so auch diejenigen Chinas, die oft sehr
klein sind und manchmal einen Fetthöcker aufweisen. Sie werden dort
vorzugsweise zum Pflügen benutzt, ihre Milch überhaupt nicht und das
Fleisch wenig genossen. Ebenso gering ist die wirtschaftliche Rolle des
Rindes in Japan, wo es als Reit- und Lasttier dient und die wenigen
im Lande verkehrenden Wagen zieht. Einen schönen Rinderschlag besitzt
Korea, dessen Bewohner wohl dessen Fleisch, nicht aber die Milch
genießen.
Wie die meisten Nutztiere hat Amerika auch das Rind durch die
Vermittlung der Europäer erhalten. Auf seiner zweiten Reise brachte
es Kolumbus 1493 nach San Domingo, von wo es sich rasch über die
Antillen verbreitete. Hier verwilderte es teilweise und lieferte in
dem an der Luft und über dem Feuer getrockneten Fleisch, der carne
secca, und in den Häuten bald das hauptsächlichste Ausfuhrprodukt
dieser Inseln. Von diesen verwilderten Rinderherden lebend bildete
sich im 16. Jahrhundert aus Franzosen und Engländern an der Westküste
von San Domingo der Freibeuterstaat der Flibustier — entweder aus
dem Worte freebooters, d. h. Freibeuter, oder aus fly
boaters, d. h. auf rasch fahrenden Schiffen Segelnde entstanden —,
die den das Monopol des amerikanischen Handels besitzenden spanischen
Schiffen auflauerten und sie ausplünderten. Als diese durch Zuzug
von allerlei Abenteurern und der Hefe aller Nationen zu Anfang des
17. Jahrhunderts zu einer[S. 71] furchtbaren Macht in den westindischen
Gewässern geworden waren, die, bald von der einen, bald von der
andern Regierung begünstigt oder gar in Sold genommen, später nicht
nur gegen die Spanier, sondern gegen alle Besitzenden kämpften, sahen
sich die europäischen Staaten genötigt, gegen diese bedrohliche Macht
einzuschreiten. Vor allem gründete Frankreich, da sich ein großer Teil
der Flibustier aus Franzosen zusammensetzte, in diesem westlichen Teil
von San Domingo eine Kolonie, die bald durch ausgezeichnete Gouverneure
zur Blüte gelangte. Mit dieser Gründung verloren die wilden Rinder der
Insel bald ihre Bedeutung; doch exportiert der spanische Teil immer
noch stark Fleisch und Häute derselben nach der jetzt dort errichteten
Negerrepublik.
Ums Jahr 1525 gelangte das Rind nach Mexiko, wo sich seine Zucht an den
grasreichen östlichen Abhängen der Anden stark ausbreitete. Neuerdings
haben sich dort auch edlere europäische Rassen, wie die Holländer und
das hellfarbige, meist rotfleckige, kurzhörnige Vieh der englischen
Grafschaft Durham, eingebürgert.
Mittelamerika hatte im 17. Jahrhundert eine starke Viehzucht in
Honduras. Auch Kolumbien erhielt im 16. Jahrhundert sein Vieh von den
westindischen Inseln. In die Grassteppen von Venezuela brachte es
Christobal Rodriguez 1548. Hier gedieh es vortrefflich und verwilderte
bald. So begegnete schon der sogenannte Tyrann Aguirre 1560 in der
Nähe von Valencia wilden Rinderherden. Um 1800 führte Venezuela ohne
die zahlreichen geschmuggelten etwa 170000 Rinderhäute jährlich aus.
Von der Kapverdeninsel San Vincente aus brachten die Portugiesen das
Rind 1581 nach Brasilien, wo es sich der brasilianischen Indolenz
entsprechend recht langsam von der Küste nach dem Innern ausbreitete.
Nach den Angaben von Southeys Geschichte von Brasilien kam es erst
1720 nach Goyaz, 1739 nach Matto Grosso und 1788 in das Gebiet des
oberen Amazonenstroms. Gegenwärtig besitzen die Provinzen Minas
Geraes, Matto Grosso, San Paulo und Rio Grande do Sul eine ausgedehnte
Viehwirtschaft. Wiederholt sind Zebus aus Indien als Zuchtmaterial
in Matto Grosso eingeführt worden, und Bastarde derselben mit den
aus Europa eingeführten Rassen sind stark verbreitet. Durch großes
Gehörn ist die ursprünglich in San Paulo heimische Franqueirorasse
ausgezeichnet. Nur in Minas Geraes wird Milchwirtschaft getrieben
und ein grober, schlechter Käse gewonnen, der nur im Lande selbst
gebraucht werden kann. Der Brasilianer ißt diesen Käse gern mit
eingedicktem Zuckerrohrsaft zusammen, ähnlich[S. 72] wie die Helden Homers
eine Mischung von Honig, Käse und Wein tranken. Sonst wird überall
in Brasilien das Vieh bloß zur Gewinnung von Häuten und Hörnern für
den Export nach Europa und zur Herstellung von getrocknetem Fleisch
für den einheimischen Verbrauch gehalten. Dies war auch in den Pampas
Argentiniens der Fall, wo vom 17. Jahrhundert an große halbwilde
Viehherden vorhanden waren. Diese nahmen ihren Ursprung von 7 Kühen
und einem Stier, die Kapitän Juan de Salazar 1546 von Andalusien nach
Südbrasilien brachte, von wo aus sie ein gewisser Gaeta in seinem
Auftrage über Land nach Paraguay trieb. Er entledigte sich dieser
schwierigen Aufgabe vorzüglich und erhielt als Belohnung eine von den
Kühen geschenkt, was für ihn jedenfalls einen sehr wertvollen Besitz
darstellte.
Von Paraguay drang das Rind bald südwärts in die Pampas von Argentinien
vor, von wo schon 1580 die erste Ladung Häute von dem damals eben
gegründeten Buenos Aires nach Spanien ausgeführt wurde. Hier vermochte
es in der Steppe überall leicht zu verwildern, während in den mehr
waldigen Gebieten Paraguays dies wegen des Vorkommens einer sehr
lästigen Aasfliege, die ihre Eier in jede Wunde legt, nicht möglich
war. Da für diese Fliegen der Nabelstrang des neugeborenen Kalbes eine
sehr willkommene Ablagestelle für die Eier bot, die eine Entzündung
und schließlich den Tod des Kalbes herbeiführten, so gingen jeweilen
alle Kälber zugrunde, bei denen nicht menschliche Hilfe fürsorgend
eintrat. So weit also der Bezirk dieser Fliege reichte, gab es keine
wilden Rinder. Im Süden aber, wo sie im offenen Graslande fehlte,
vermehrten sich die halbwilden Viehherden dermaßen, daß das einzelne
Stück fast wertlos und im 18. Jahrhundert nach Dobrizhoffer für
einen Real, d. h. etwa fünf Groschen zu haben war. So wurden sie
nur zur Gewinnung der Haut und etwa noch der Zunge als Delikatesse
getötet, und nur ausnahmsweise das saftigste Fleisch von den Lenden
zur Gewinnung von carne secca verwendet. Um diesen Reichtum
wenigstens einigermaßen auszubeuten, wurde im vorigen Jahrhundert an
der Küste nördlich von Buenos Aires, in Fray Bentos, die Liebigsche
Fleischextraktfabrik eingerichtet, die heute noch das meiste Fleisch
auf dieses ihr Spezialprodukt hin verarbeitet, daneben aber auch
konserviertes Fleisch, Fett und Knochen gewinnt, die sie mit den Häuten
auf den europäischen Markt bringt. Neuerdings suchen die Kulturstaaten
Europas mit dem Fleischüberfluß Argentiniens die Fleischnot in
ihrem eigenen Lande zu bekämpfen, und dies mit bestem Erfolge. In
besonderen Schiffen mit Kühlräumen wird das[S. 73] Fleisch gefroren, wie
das schon seit längerer Zeit von Australien nach England gebrachte
Schaffleisch, aus Argentinien zu uns gebracht und findet überall willig
Absatz. Jedenfalls ist Argentinien mit seinen grasreichen Ebenen vor
andern Ländern dazu berufen, in der Viehhaltung eine führende Rolle
zu spielen. Auch in Chile hat es einst eine bedeutende Rinderzucht
gegeben. So fand v. Tschudi noch 1858 in Santiago das Straßenpflaster
aus den Hüftknochen von Rindern gebildet, die man mit den Gelenkköpfen
nach oben gesetzt hatte. Auch in Peru und Bolivien ist die wilde oder
halbwilde Zucht jedenfalls die wichtigste. Milch geben die Kühe nur
wenige Tassen voll, und auch das nur kurze Zeit. Bei den Indianern ist
keine Neigung zur Haltung des Rindes vorhanden. Letzteres tritt demnach
gegen Patagonien hin, wo die weiße Bevölkerung mehr oder weniger
aufhört, zurück. Auf den Falklandinseln ist es verwildert.
In Nordamerika ist das erste Vieh zu Ende des 16. Jahrhunderts von
England an die Ostküste nach Virginien gekommen. 1624 brachten es
die Puritaner nach Plymouth in Massachusetts und ein Jahr später die
Holländer nach dem von ihnen auf der Manhattaninsel an der Mündung
des Hudson gegründeten Neu-Amsterdam, dem heutigen New York, mit.
Diese guten Rassen wurden später mit dem wegen der bequemen Verbindung
billigeren spanischen Vieh aus Westindien gekreuzt. Mit den Weißen
verbreitete es sich westwärts, während schon früh vor seiner Ankunft
mexikanisches Vieh nach Texas und Kalifornien gelangt war. Kanada besaß
ursprünglich das Bretagnerind, das die Franzosen 1608 einführten.
Was die heutige Rinderhaltung in den Vereinigten Staaten anbetrifft,
so geht die Züchtungspraxis der Amerikaner darauf aus, einzelne
ausschließliche Leistungen der Tiere zu bevorzugen; daher werden
die hervorragendsten englischen Fleischrassen und die europäischen
Milchrassen stark bevorzugt. Von letzteren wurden außer südenglischen
Rindern besonders das friesische, dann das Schweizer Braunvieh
eingeführt. Dieses hat nun mehr und mehr das früher ausschließlich
gezogene Texasvieh spanischer Abstammung, das seinerseits wiederum sich
vom hochbeinigen, langhörnigen iberischen Rinde ableitet, auch in den
Südstaaten der Union verdrängt.
Im Jahre 1788 wurde das Rind von den Engländern nach Australien
eingeführt, wo jetzt Queensland die stärksten Bestände aufweist. Auch
Neuseeland mit seinen weidereichen Alpen hat eine starke Rinderzucht.
Dort gibt es über 11⁄2 Millionen Rinder; daher ist die[S. 74] Ausfuhr an
Butter und Käse bedeutend. Auch in Ozeanien ist das Rind auf den
meisten Inseln eingeführt, spielt aber meist eine sehr untergeordnete
Rolle im Haushalte des Menschen. Stellenweise, wie z. B. auf der Insel
Tinian, ist es verwildert.
Außer in Syrien und Kleinasien wird das Rind in ausgedehnten
Gebieten Afrikas als Last- und Reittier verwendet. Schon Herodot
erwähnt Lastochsen aus Nordafrika und Älian hornlose Reitochsen aus
Mysien. Wie die Kirgisen, Kalmücken und viele Kurden, so reiten die
Gallastämme, die Einwohner von Wadai, von Angola und Südafrika auf
besonders dressierten Reitochsen, die in allen Gangarten gehen
und in schwierigem Terrain durch kein anderes Tier zu ersetzen sind.
Ohne sie könnte man die ausgedehnten Handels- und Jagdzüge durch die
streckenweise oft gänzlich wasser- und futterlosen Einöden gar nicht
unternehmen.
So sehr sein geistiges Wesen im allgemeinen durch die Knechtschaft
und Bevormundung durch den Menschen abgenommen hat, so ist das Rind,
besonders wenn es in Freiheit aufwächst, nicht so stumpfsinnig wie
unsere in Ställen aufgewachsenen Individuen. Sie lassen sich unschwer
zu allerlei Kunststücken abrichten. So berichtet schon der ältere
Plinius in seiner Naturgeschichte: „Ich habe Ochsen gesehen, welche auf
Befehl kämpften, auf die Hörner fielen und wieder aufstanden, sich auf
die Erde legten und wegtragen ließen, und sogar auf schnellrennenden
Wagen wie Kutscher standen. — Zur Zeit unserer Vorfahren kam oft das
Wunderzeichen vor, daß Ochsen sprachen; wurde dies angezeigt, so mußte
die Senatsversammlung unter freiem Himmel gehalten werden.“ Wie einst
der Apis im alten Ägypten, ist heute noch das Rind im allgemeinen dem
Hindu ein heiliges Tier, so daß er lieber verhungern würde als auch
nur Rindfleisch anrühren. Die Europäer sind ihm geradezu verächtlich,
daß sie dieses für ihn unantastbare Tier schlachten und sein Fleisch
verzehren. Als nützliches Haustier stand es noch bei den Kulturvölkern
des Altertums in hohem Ansehen. So schreibt der gelehrte Römer Varro
im letzten Jahrhundert v. Chr.: „Das Rindvieh dient dem Menschen beim
Landbau, dient der Göttin Ceres, wurde daher seit Menschengedenken
unter den Schutz der Gesetze gestellt und in Attika, wie im Peloponnes,
wurde derjenige sogar mit dem Tode bestraft, der ein Stück Rindvieh
mutwilligerweise getötet hatte.“ Und Plinius sagt: „Der Ochse ist
unser Gefährte bei der Arbeit und beim Ackerbau und stand bei unsern
Vorfahren in solchen Ehren, daß man ein Beispiel hat, wo ein Mann aus
dem Volke zur Verbannung ver[S. 75]urteilt wurde, weil er auf seinem Landgut
einen Zugochsen geschlachtet hatte, bloß weil einer seiner Vertrauten,
ein frecher Bursche, behauptet hatte, er habe noch keine Kaldaunen
gegessen.“
Das Rind ist schon im zweiten Jahre seines Lebens fortpflanzungsfähig.
Die Tragzeit währt in der Regel 285 Tage. Das Kalb erhebt sich bald
nach seiner Geburt und saugt schon am ersten Tage an seiner Mutter,
die es liebevoll beleckt und seine Entfernung durch Brüllen beklagt.
Die Lebensdauer scheint 25 Jahre nicht zu übersteigen. Außer grünen
Pflanzenteilen werden auch Früchte aller Art nebst Wurzelgemüsen und
Knollengewächsen, besonders Möhren und Kartoffeln, sehr gern von ihm
gefressen; dabei ist ihm das Lecken von Salz Bedürfnis. Alle seine
Teile werden vom Menschen verwendet, so daß es mit Recht als das
einträglichste aller Haustiere gilt.
Bei der Besprechung der Rinder dürfte es am Platze sein, einige
Bemerkungen über die Viehzucht unserer Vorfahren in der ältesten,
geschichtlich nachweisbaren Zeit mitzuteilen. Neben dem Wald und
den Äckern gab es bei den Germanen nach der Völkerwanderungszeit
ausgedehnte Wiesen, die nach Urkunden des 8. Jahrhunderts bis zu 130
und mehr Fuder Heu lieferten. Die Wiesen wurden im Frühjahr gehegt.
Wer zu dieser Zeit sein Vieh darauf trieb und dadurch den Graswuchs
verhinderte, der ward nach den Volksgesetzen der Westgoten nach seinem
Stande verschieden bestraft. Bei den Langobarden konnte der Eigentümer
einer Wiese, der auf derselben ein oder mehrere Schweine antraf, eines
ohne Ersatz totschlagen. Wer eines anderen Wiese mähte, verlor nach dem
Gesetz der salischen Franken seine Arbeit und bezahlte 15 Solidi Buße.
Das war eine sehr strenge Bestrafung, da man damals mit einem Solidus,
einem Goldschilling, eine Kuh zu kaufen vermochte. Ebensoviel Buße
bezahlte er, wenn er das gemähte Gras nach Hause trug; fuhr er es aber
heim, so mußte er 45 Solidi Strafe erlegen.
Damals war die Viehzucht noch nicht so ausgedehnt, daß sie den
Wirtschaftsbedürfnissen angemessen gewesen wäre. Im Jahre 755 befanden
sich auf einem ziemlich ansehnlichen Hofe 4 Zugstuten, 30 Schafe und
20 Schweine. Doch war das Rindvieh das wichtigste Besitztum des freien
Mannes, der Stolz und Reichtum des Bauern, wie schon Tacitus in seiner
Germania sagt: es sei der einzige Reichtum des Germanen. Dies hat
sich auch in der Sprache ausgeprägt. Wie lateinisch pecunia
Geld zu pecus Vieh gehört, so bezeichnet Schatz im Gotischen
das Vieh, fê (Vieh) im Altnordischen und Süddeutschen[S. 76] die
Habe; aus fê wurde später Fening und schließlich Pfennig.
„Habe“ oder „Ware“ bedeutete in den deutschen Mundarten Vieh, wie
manchenorts, z. B. im Berngebiet, „Speise“ Käse. Alles Vieh wurde in
alter Zeit weit mehr geweidet als heute, da die Stallfütterung sich
vollständig eingebürgert hat. Der ältere Plinius lobt die germanischen
Weiden, und noch im Mittelalter bot die Allmende Raum genug zum
Weidgange des Viehes der Dorfgenossen. Der Gemeindehirt ist in den
alten Dorfordnungen eine sehr wichtige Person. Da aber die Menge und
die Güte des Futters, sowie die Paarung geeigneter Zuchttiere bei der
freien Weide nicht in dem Maße wie heute, vielfach überhaupt gar nicht
garantiert werden konnte, so vermochte man in jenen frühen Zeiten
keine großen oder sonst wertvollen Schläge zu erzielen. So sagt schon
Cäsar von den Germanen: „Sie brauchen keine eingeführten Zugtiere
(Pferde), aber die bei ihnen geborenen, die klein und häßlich sind,
bringen sie durch tägliche Übungen zu den größten Leistungen“, und
Tacitus berichtet: „Auch das Rind hat (bei den Germanen) nicht seinen
Stirnschmuck (Hörner), man erfreut sich nur an der Zahl desselben.“
Damals war das Vieh der Germanen durch schlechte Pflege und starke
Inzucht unansehnlich, wie noch heute in abgelegenen Riedgegenden
kleines Vieh, von kaum mehr als 1 m Höhe gehalten wird. Das
Skelett einer zahmen Kuh, das in dem vorgeschichtlichen Torfmoor von
Schussenried in Schwaben gefunden wurde, ist nicht größer als ein
großer Hund und hat winzige Hörner.
Eine Viehherde hieß bei den Franken sonesti; die einzelnen
Individuen derselben wurden nebst etwaigen Pferden, Schafen und
Schweinen, jedes mit einer Schelle behängt, unter Aufsicht eines Hirten
zusammen ausgetrieben. Durch das Klingeln der Glöckchen konnte man im
weitläufigen Bruch oder bei der beliebten Waldhütung das Entlaufen
der Tiere besser verhindern, entlaufene auch leichter wieder finden
und zur Herde zurücktreiben. Die deutschen Volksrechte bestraften
das Entwenden dieser Klingeln sehr hart. So bestimmte das Gesetz der
salischen Franken für die Entwendung einer Schelle (skella) von
einem Pferde wie von einer Sau 15 Solidi Strafe, 3 aber von anderem
Vieh. Wer bei den Burgundern von einem Pferd oder Ochsen die Glocke
entwendete, der mußte sie durch ein Pferd oder einen Ochsen ersetzen,
die von derselben Beschaffenheit waren als jene, an denen er sich
verging. Dies war die Strafe des Freien, der Leibeigene dagegen wurde
gehörig durchgebläut, so daß er solches sein Lebtag nie mehr tat.
Bei den Langobarden wurden 6 Solidi für die[S. 77] entwendete Pferde- oder
Rindschelle erlegt; die Westgoten bestraften dasselbe Vergehen mit 1
Solidus.
Zudem war das Vieh damals gezeichnet, damit es sein Eigentümer
jederzeit aus der Herde herausfinden und als sein Eigentum in Besitz
nehmen konnte. Beim Vieh wurden besondere Hirtenhunde zur Abwehr des
Wolfes und anderer Raubtiere gehalten; wer einen solchen tötete, gab
nach dem Volksrechte der Friesen 1, bei anderen Stämmen bis 4 Solidi
Buße. Die Hirten hatten großes Recht; wer einen solchen erschlug, mußte
bei den Alamannen 40 Solidi Strafe entrichten. Wer ihn mißhandelte,
indem er ihn schlug, während ihn zwei andere hielten, bezahlte 9
Solidi. Die Hütung geschah entweder privat oder gemeinschaftlich.
Es gab Freie, die sich eigene Hirten hielten; sonst stellten die
Sippengenossen gewöhnlich einen Unfreien dazu an, ihr Vieh gemeinsam
auf der Weide zu hüten. Während der ganzen guten Jahreszeit war
das Vieh auf der Weide und wurde nur im Winter, wenn es wegen des
hohen Schnees kein Futter mehr fand, im Stalle von dem im Sommer
eingebrachten Heu gefüttert.
Die Fürsorge der Karolinger, besonders Karls des Großen, für die Kultur
des Landes zeigt sich auch in den Vorschriften für den Viehstand ihrer
Güter. So befahl Karl der Große, auf allen seinen Gütern Milchkühe
zu halten und von der Milch auch Butter und Käse zu bereiten. So gab
es nach einem uns erhaltenen Verzeichnis auf seinem Gute Stefanswerd
20 Kühe, 1 Stier, 61 Stück Jungvieh (animalia minora) und 5
Kälber. Auf seinem Gute Asnapium hatte er 50 Kühe mit Kälbern, 20
Stück Jungvieh (juvencus), 38 jährige Kälber und 3 Stiere,
in Grisenwiler dagegen 30 Kühe mit Kälbern, 3 Stiere und 10 Stück
Jungvieh stehen; auf einem anderen kleinen Gute hatte er 6 Kühe mit
Kälbern und 8 Stück Jungvieh. Aus diesem Verzeichnis und nach allem,
was wir sonst noch erfahren, dürfen wir schließen, daß die Kälber
damals sehr lange bei ihren Müttern verblieben, wahrscheinlich bis
sie die Kuh selbst absetzte. Die Kühe selbst wurden nicht nur zur
Milchgewinnung, sondern auch zum Ziehen gebraucht, und zwar nicht
bloß von den kleinen Leuten, sondern auch auf den großen Gütern. Daß
Kaiser Karl bei der Bereitung von Butter und Käse auf seinen Gütern
Reinlichkeit verlangte, beweist, daß man es damit nicht sehr genau
nahm. Die Butter hieß damals noch mit einem altdeutschen Worte Schmeer
oder Anken. Ein Stück Brot „beschmeeren“ — woraus später allgemein
beschmieren wurde — heißt also, es mit Butter bestreichen. Da man
schon in jener Zeit[S. 78] begann, den Untertanen, wenn nur irgend möglich,
Dienste und Abgaben aufzubürden, so nötigten die Grundherren sie
später in einigen Gegenden, herrschaftliche Kühe den Winter über zur
Fütterung zu übernehmen. So mußte beispielsweise das Stift Lorch solche
Kühe überwintern. Oft wurden die Zehnten in Käse bezahlt. So bekam der
Abt von Fulda von drei Alpen, die ihm gehörten und auf die das Vieh
zur Sömmerung getrieben wurde, als Entgelt je 3000 Käse, die für die
Klosterwirtschaft sehr erwünscht waren. Im Laufe der Jahrhunderte ging
dann die Viehwirtschaft hervor, wie wir sie heute noch kennen und auf
die einzutreten ganz überflüssig ist.
Außer dem eigentlichen Rind sind aber noch andere Vertreter der
Rinderfamilie vom Menschen gezähmt und in Pflege genommen worden.
Von diesen soll nun noch die Rede sein. Ein naher Verwandter des
Hausrindes ist der schon zu Eingang erwähnte Gayal oder das
Stirnrind (Bos frontalis). Dieses Wildrind ist in
beiden Geschlechtern bis zu den Knien braun, im untern Teil der
Beine weiß oder gelblich, hat kurze Gliedmaßen, einen kurzen Kopf
mit außerordentlich breiter Stirn und fast gerade nach auswärts
gerichtetem Gehörn. Die Eingeborenenstämme südlich und nördlich vom
Tal des Assam in Hinterindien fangen nicht nur Kälber desselben, um
sie einzugewöhnen, sondern halten es schon so lange in gezähmtem
Zustand als Haustier, daß es als Folge weitgehender Beeinflussung
durch Domestikation in ziemlich vielen Exemplaren ganz weiß, andere
wenigstens fleckig gefärbt sind. Die Herden zahmer Gayals werden von
den Indochinesen des Fleisches wegen gehalten; auch soll teilweise ihre
Milch genossen werden. Die Tiere, die weder zur Bearbeitung des Bodens,
noch zum Tragen von Lasten verwendet zu werden scheinen, streifen,
um zu fressen, während des Tages unbeaufsichtigt im Walde umher und
kehren abends ins Gehöft ihres Besitzers zurück. Sie vermischen sich
zuzeiten ungehindert mit dem neben ihm gehaltenen indischen Buckelrind,
dem Zebu. Merkwürdigerweise sind von den aus dieser Kreuzung
hervorgegangenen Bastarden nur die weiblichen Exemplare fruchtbar,
nicht aber die männlichen, während bei den anderen Kreuzungsprodukten
zwischen verschiedenen Rinderarten die männlichen und weiblichen
Bastarde gleicherweise in der Regel unbegrenzt fruchtbar sind.
Auch der Gaur oder das Dschungelrind (Bos gaurus),
dessen Verbreitungsgebiet von Vorderindien bis Siam und Cochinchina im
Osten und die Halbinsel von Malakka im Süden reicht, ist in etlichen
Berggegenden zwischen Assam und Birma gezähmt und wird als Haus[S. 79]tier
gehalten, obschon alle in Indien zu Züchtungszwecken eingefangenen
Gaurkälber eingingen und keines das dritte Lebensjahr erreichte.
Dieser Gaur scheint das größte lebende Rind zu sein und erreicht in
den Stieren 1,8 m Schulterhöhe bei einer Körperlänge von 2,9
m. Die vordere Rückenhälfte trägt einen hohen Kamm, die Ohren
sind klein, die Hörner an der Wurzel ziemlich stark zusammengedrückt,
auf ihrer ganzen Länge gebogen und mit der Spitze nach innen und etwas
nach rückwärts gerichtet. Beim Stier sind sie 50–60 cm lang. Das
kurzbehaarte Fell ist bei jungen Männchen und Weibchen braun, bei alten
Männchen dagegen schwarz. Die untern Teile sind ziemlich heller und
die Beine vom Knie und vom Hackengelenk an bis zu den verhältnismäßig
kleinen Hufen weiß. Die Kälber tragen einen schwarzen Längsstreifen auf
dem Rücken. In den Berggegenden, die es bewohnt, hält es sich an den
Wald und die hohen Grasbestände. Seine Lebensweise deckt sich fast ganz
mit der beim Banteng geschilderten. Es klettert ausgezeichnet und hat
hierzu trefflich geeignete kurze Beine.
Viel wichtiger als diese beiden Wildrinder ist eine dritte Art für
den Menschen geworden. Es ist dies der in seinen ältesten Vertretern
erdgeschichtlich schon im Pliocän auftretende Büffel
(Bubalus). Von den beiden heute noch lebenden Arten ist
nicht der wilde Schwarz- oder Kaffernbüffel (Bubalus caffer)
Afrikas, sondern der südasiatische Büffel (Bubalus arni)
vom Menschen in vorgeschichtlicher Zeit gezähmt und zum nützlichen
Haustier erhoben worden, das von den Indern Arni, von den Malaien
Hinterindiens dagegen Kerabau genannt wird. In Insulindien besonders
ist er nachträglich wieder verwildert, da er sich dort der Aufsicht
von seiten des Menschen zu entziehen wußte. Die Domestikation dieses
weitaus kühnsten und wildesten unter den indischen Wildrindern
erfolgte bedeutend später als diejenige des weit gutmütigeren Banteng.
Dieser Wildbüffel bewohnt heute noch die sumpfigen Rohrwälder und die
dicht mit hohem Gras bewachsenen Ebenen des Brahmaputra und Ganges
vom Ostende von Assam bis nach Tirhut im Westen und diejenigen der
östlichen Zentralprovinzen Indiens. Er ist ein besonders im Alter
dünnbehaartes, am ganzen Körper dunkelgraues, fast schwarzes, an den
Beinen jedoch meist heller gefärbtes massig gebautes Rind mit kräftig
behörntem Kopf auf gedrungenem Hals, etwas gestrecktem Rumpf, dicken
und kurzen Beinen und großen, für die Fortbewegung auf sumpfigem Boden
breit ausladenden Hufen. Der niedrig getragene Kopf ist gestreckt und
flachstirnig und trägt sehr große, schwarze, im Querschnitt dreieckige,
in[S. 80] einer Ebene zuerst auf- und auswärts, dann nach innen und vorn, von
der Gesichtsebene aus etwas nach rückwärts gebogene Hörner, die der
Krümmung entlang gemessen 2 m lang werden können. In Oberassam
findet sich eine nicht bloß durch die fahlere Färbung, sondern auch
durch die Form des Schädels abweichende Unterart.
Dem Wildbüffel sagen heiße, sumpfige oder wasserreiche Gegenden am
besten zu, denn er ist ein großer Wasserfreund, der vortrefflich
schwimmt und sich so gebärdet, als ob das Wasser sein eigentliches
Lebenselement sei. Auf dem festen Lande erscheint er in allen seinen
Bewegungen schwerfälliger als im Wasser, in dem er sich tagsüber
während der größten Hitze mit Vorliebe aufhält und, darin liegend,
nur einen Teil des Kopfes herausstreckt. Nachts und am frühen Morgen
weidet er, bricht gern in Pflanzungen ein und richtet darin bedeutende
Verwüstungen an. Sein Wesen wird als mürrisch und unzuverlässig
geschildert; er ist voll Mut und Angriffslust und läßt dann seine
tiefdröhnende Stimme erschallen. Die Paarungszeit fällt in den Herbst;
dann lösen sich die sonst bis zu 50 Stück zählenden Herden in kleinere
Trupps auf, die je ein Stier um sich versammelt. Etwa 10 Monate nach
der Paarung, also im Sommer, wirft die Kuh 1–2 Kälber, die sie sorgsam
gegen alle Angriffe wilder Tiere behütet. Der Wildbüffel ist keineswegs
scheu, scheint auch die Nachbarschaft des Menschen nicht zu meiden. Oft
nimmt eine Herde oder ein einzelner Stier von einem Felde Besitz, von
dem dessen Eigentümer zurückgetrieben wird. Angegriffen und besonders
verwundet, stellen sie den Gegner und suchen ihn mit ihren gewaltigen
Hörnern niederzurennen.
Wann und wie der indische Wildbüffel zuerst gezähmt wurde, ist völlig
unbekannt. Jedenfalls geschah dies irgendwo in Südasien, wo nach der
Domestikation des Banteng die seinige nahe lag. Dabei veränderte sich
sein Charakter in einer für den Menschen sehr günstigen Weise. Ist der
Wildbüffel sehr kampflustig, weil er sich selbst dem Tiger überlegen
fühlt, so ist er im zahmen Zustande seinen Bekannten gegenüber überaus
sanftmütig und anhänglich und läßt sich sogar von einem Kinde lenken.
Nur fremden Leuten und Tieren gegenüber zeigt er sich feindlich und
beweist dann einen großen Mut. Nach wie vor ist ihm das Wasser ein
überaus wichtiges Lebenselement, auf das er nur ungern verzichtet und
das er immer wieder zur Kühlung aufsucht.
Tafel 15.

Büffel von Singhalesen auf Ceylon zum Pflügen eines
Reisfeldes benützt.
⇒
GRÖSSERES BILD
Tafel 16.
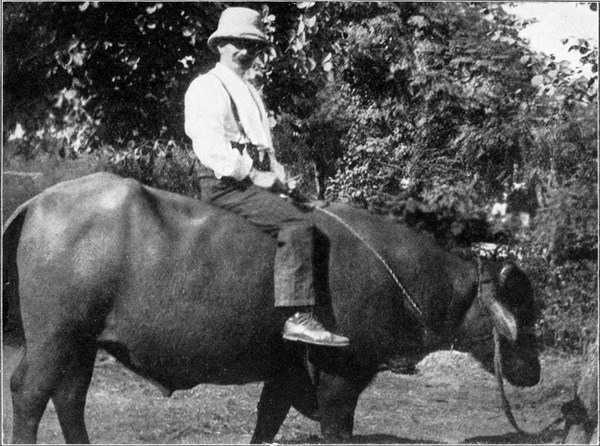
Hagenbecks Reisender in Indien auf einem Milchbüffel reitend.

Yak oder Grunzochse im Zoologischen Garten von Berlin.
(Nach einer Photographie der Neuen photogr. Gesellschaft in Steglitz.)
Die älteste unzweifelhafte Darstellung des Büffels hat sich uns
auf einigen altbabylonischen Siegelzylindern aus dem Anfang des 3.
vorchristlichen Jahrhunderts erhalten. Auf dem einen derselben sehen[S. 81]
wir einen langbärtigen Mann, offenbar eine Gottheit, der in einer
irdenen Schüssel einem Büffel Wasser zum Trinken darreicht. Daß es
sich wirklich um einen Büffel und nicht um ein schlecht gezeichnetes
Rind handelt, geht sicher aus dem Verlauf der nach hinten gelegten
quergerippten Hörner hervor. Dieselben typischen Büffelhörner
treffen wir auf einer anderen Darstellung eines altbabylonischen
Siegelzylinders, der etwa vom Jahre 2800 v. Chr. stammt. Wir sehen
darauf zwei langbärtige Männer, offenbar auch Gottheiten, von denen der
eine mit einem aufgerichteten Löwen, der andere mit einem gleichfalls
aufgerichteten Büffel mit typischem Gehörn ringt. Dabei wird der
Büffel mit der linken Hand am linken Horn und mit der rechten Hand am
rechten Vorderfuß gepackt und letzteres umgeknickt, um das Tier zu
Fall zu bringen. Daß der Büffel wie auf diesen, so auch auf andern
mythologischen Bildern im Kampfe mit Göttern dargestellt wird, beweist
zum mindesten, daß er im Kulte gewisser Gottheiten eine Rolle spielte
und als solcher vielleicht in halber Zähmung gelegentlich vom Menschen
in der Nähe von Tempeln gehalten wurde. Daß er völlig gezähmt war und
als Haustier diente, ist ausgeschlossen, denn wir fänden sonst mehr
Spuren von seiner Gegenwart. Ebenso wurde der Wildbüffel im ältesten
Ägypten nachgewiesen, sowohl in bildlichen Darstellungen, als auch in
Knochenresten, aber ein eigentliches Haustier war er hier ebenfalls
nicht. Jedenfalls reichte einst sein Verbreitungsgebiet von Südasien
über Westasien bis nach Europa hinein. So fand man Überreste eines
Wildbüffels (Bubalus pallasi) in Diluvialschichten bei Danzig.
Aber in ganz Westasien wie auch im Niltal wurde er vom Menschen
ausgerottet, bevor er domestiziert worden war.
In Vorderasien treffen wir in der Folge keine Spur mehr von ihm, bis
Alexander und seine Begleiter ihn auf ihrem Siegeszuge als Haustier
zuerst in Persien, dann auch in Indien antrafen. Aber auch damals
blieb den Kulturvölkern am Mittelmeer die Erwerbung dieses Nutztieres
verschlossen. Erst die Muhamedaner brachten ihn nach Palästina und
Ägypten. Im Jahre 723 begegnete der heilige Willibald im Jordantal,
in dem sie heute noch wichtige Haustiere sind, die ersten Büffel, von
deren Vorhandensein man bis dahin im Abendland keine Ahnung gehabt
hatte. Dieser Priester, der durch Süditalien und Sizilien gereist war,
traf diese dort nirgends, weil man sie damals noch nicht eingeführt
hatte, und war nicht wenig erstaunt, sie in Palästina zu finden. In
Ägypten, das früher besonders reich an Rindern[S. 82] gewesen sein muß, die
später weitgehend durch die aus dem Süden dahin gebrachte Rinderpest
dezimiert wurden, vermehrte sich der Büffel stark und gelangte von
dort durch die Araber nach Sizilien und Süditalien, von wo aus er sich
langsam weiter nördlich in die sumpfige Campagna di Roma verbreitete.
Ums Jahr 1200 war er im Kaiserreich Bulgarien, etwa dem heutigen
Mazedonien entsprechend, häufig anzutreffen und kam von da nach dem
eigentlichen Bulgarien und den Tiefländern der Donau, um sich jenem
Strom entlang bis Ungarn und Siebenbürgen auszudehnen, wo sie wie
unsere Rinder in erster Linie als Milchvieh gehalten werden. Doch geben
sie durchschnittlich nur halb so viel Milch wie unser Alpenrindvieh.
Bringt es das Siebenbürger Rind auf 1600–1900 Liter und die sich dort
immer mehr einbürgernden Freiburger, Simmentaler und Pinzgauer Kühe auf
2000 Liter im Jahr, so liefert der beste Milchbüffel in dieser Zeit
nur 1000 Liter, die allerdings wegen des weit größeren Fettgehaltes
von 7–8, bei altmelkenden Tieren sogar 10–12 Prozent gegenüber von
3–5 Prozent der Kuhmilch doppelt so teuer als jene verkauft wird.
Auch in die Moldau-Walachei und die Krim gelangte der Hausbüffel und
fand dort in den wasserreichen, noch ziemlich warmen Niederungen ihm
zusagende Lebensbedingungen. Trotz des heißen Klimas fehlte ihm aber
in Nordafrika westlich vom Niltal das für ihn zum Baden nötige Wasser,
so daß er hier nicht heimisch werden konnte. Und weil er infolgedessen
nicht nach dem südlichen Spanien und nach Portugal gelangte, erreichte
er auch Amerika nicht, und die Vorschläge, ihn hier einzuführen, sind
bis jetzt unbeachtet geblieben.
Noch größere Bedeutung als im Westen hat er im Osten Asiens erlangt,
wo er bis nach Japan und über die Philippinen hinaus gelangte und
sich über ganz Indonesien ausbreitete, und zwar in der von Malaien
bewohnten ost- und südasiatischen Inselwelt in einer schiefer- bis
hellbläulichgrauen, sehr spärlich behaarten Zuchtrasse mit sehr langen,
im Bogen nach hinten gerichteten, auf der Oberseite stark abgeflachten
Hörnern. Hier überall in den heißen, sumpfigen Niederungen hat er
weit größere Bedeutung als das Hausrind von Bantengabstammung erlangt
und ist der getreue Gehilfe des Menschen beim Ackerbau geworden.
Seine Neigung für das Sumpfleben machte ihn besonders beim Reisbau
verwendbar, der in diesen Gegenden eine überaus wichtige Rolle spielt.
Nur in den trockenen Gebieten, die seinem Gedeihen nicht besonders
zuträglich sind, und im Nordosten von Asien tritt das gegen Kälte
weniger empfindliche Rind wieder stärker[S. 83] auf. Im ganzen Gebiet des
Reisbaues ist er in seinem ureigenen Element und zieht den primitiven
Pflug durch den von dem darauf geleiteten Wasser aufgeweichten
schlammigen Boden der Reisfelder. Bei den Bisayern tritt er auch
den gesäten Reis in den nassen Schlamm. Seine Milch wird hier kaum
je gewonnen, obwohl sie eine vorzügliche Speise bildet, die, wie in
Südeuropa, auch in ganz Süd- und Westasien sehr geschätzt wird, obschon
sie einen moschusartigen Geruch besitzt. Die aus ihr bereitete Butter
ist weiß und schmeckt ganz rein, entbehrt aber des feinen Aromas,
das eine gute Kuhbutter auszeichnet. Das Fleisch alter Büffel ist im
gekochten Zustande heller als das Rindfleisch, dabei grobfaserig, hart
und weniger schmackhaft als jenes. Dagegen schmeckt das Fleisch der
Büffelkälber sehr gut und wird von manchen Leuten sogar dem Fleisch
der Rindkälber vorgezogen. Sehr geschätzt ist das Fell, das ein
vorzügliches Leder liefert.
Wegen seiner ungeheuren Kraft, die bei einem Büffelochsen von 149
cm Höhe und 652 kg Körpergewicht auf 875 kg
bestimmt wurde, hat der Büffel überall in seinem Verbreitungsgebiet
besonders als Zugtier eine große Bedeutung erlangt. Er zieht
tatsächlich auch auf schlechten Wegen Lasten, die man ihm kaum zutrauen
dürfte. Nur ein Übelstand ist dabei in Kauf zu nehmen, nämlich seine
vom Wildzustande beibehaltene Störrigkeit. Noch mehr als dem ruhigeren
Asiaten offenbart er dem lebhaften Europäer gegenüber immer noch
einen Rest seiner ursprünglichen Wildheit. Fremde greift er direkt an
oder weicht ihnen in blinder Furcht aus und richtet dabei durch sein
Ungestüm nicht selten allerlei Unheil an. Man hat also ihm gegenüber
stets etwas auf der Hut zu sein. Eine ausgezeichnete Tugend des Büffels
ist dagegen seine wirklich beispielslose Genügsamkeit, indem er
hartes Schilf und andere Sumpfpflanzen, welche jedes andere Geschöpf
verschmäht, mit demselben Behagen frißt, als ob er die leckerste Speise
genösse. Unangenehm kann er durch seine Neigung werden, sich im Schlamm
der Pfützen zu wälzen und sich dabei mit einer ihm vor der Peinigung
durch die Stechfliegen schützenden Schlammschicht zu bedecken.
Der Büffel ist ein schweigsames Geschöpf. Wenn er behaglich im
kühlenden Wasserbade ruht, läßt er nie seine Stimme hören. Auch während
er weidet oder arbeitet geht er still und ruhig seines Weges. Nur in
Wut versetzte Stiere und Kühe, welche säugende Kälber haben, geben
Laute von sich, die ein Mittelding zwischen dem Brüllen des Rindes und
dem Grunzen des Schweines sind. In den nördlicheren[S. 84] Gegenden paart
sich der Büffel, sich selbst überlassen, im April und Mai; 10 Monate
nach der Paarung wird das Junge geboren, das von der Mutter zärtlich
geliebt und mit Eifer beschützt wird. Im 4. oder 5. Jahr ist der Büffel
erwachsen und erreicht dann ein Gewicht von über 700 kg. Sein
Alter bringt er auf 18–20 Jahre. Außer zum Ziehen von Lastwagen und
zur Feldarbeit dient er vielfach auch, besonders bei den Malaien, zum
Reiten, in Birma auch zu Kampfspielen, da dort aus religiösen Gründen
die Hahnenkämpfe verboten sind. Jedenfalls gehört er zu den Haustieren,
die ihr Verbreitungsgebiet noch bedeutend auszudehnen vermögen. Vor
allem verdient er in den heißen, feuchten Niederungen Amerikas und
Afrikas eingeführt zu werden. So sollte Deutschland mit dem guten
Beispiel vorangehen und ihn in seinen afrikanischen Kolonien einführen,
wo er ganz gute Daseinsbedingungen fände. Schon Emin Pascha bemühte
sich als Gouverneur der Äquatorialprovinz, freilich vergeblich, Büffel
nach seiner Residenz Lado zu bekommen. Es wäre auch zu empfehlen,
Kreuzungen mit dem afrikanischen Wildbüffel vorzunehmen und Versuche
mit der Zähmung des letzteren zu machen, die sehr wohl auf Erfolg
rechnen dürften.
Von weiteren Wildrindern, die einst zur Zähmung durch den Menschen
in Frage gekommen wären, sind noch der nordamerikanische Bison und
der europäische Wisent zu nennen. Diese sind aber heute bereits
durch menschliche Unvernunft bis auf unbedeutende, gehegte Reste
ausgerottet. Einst lebte der Bison (Bison americanus),
der buffalo der Amerikaner, in ungeheurer Menge auf den
Prärien Nordamerikas zwischen dem Alleghany- und dem Felsengebirge.
Die Gesamtheit einer Büffelherde zerfiel in zahlreiche Trupps, die
unter der Leitung eines eigenen Stieres weideten und mit großer
Regelmäßigkeit von den saftigen Weideplätzen zu den Flüssen, an denen
sie ihren Durst löschten und badeten, hin und her wechselten, wobei
sie ähnlich wie unsere Hausrinder auf den Alpweiden geradlinige Pfade,
die „Büffelpfade“, austraten. Alljährlich unternahmen sie oft weite
Wanderungen, indem sie in kleineren Herden vom Juli an südwärts zogen,
um den grimmigen Schneestürmen des Nordens auszuweichen, mit Beginn
des Frühjahrs aber sich wieder nordwärts wandten. Ihr schlimmster
Feind war der Mensch. Solange sie es nur mit dem zwar berittenen,
aber sonst für sie nicht allzu gefährlichen Indianer zu tun hatten,
der nur so viel von ihnen erlegte, als er zu seinem und der Seinen
Lebensunterhalte bedurfte, nahm ihre Zahl nicht nennens[S. 85]wert ab. Erst
als der Weiße erschien, seine Eisenbahnen durch die Prärie fahren ließ
und mit seinem weitreichenden Präzisionsgewehr sinnlos Hunderttausende
dieser Wildrinder abschoß, um höchstens das zottige Fell zur Bereitung
von Leder oder die Zunge als Delikatesse zu verwenden, waren ihre Tage
gezählt. Reißend nahm ihre Zahl ab, und die amerikanische Regierung
ließ dies ruhig gewähren, mit der unbegreiflichen Begründung, sie
könnten den Betrieb der großen Pazifikbahn stören! Von den ungezählten
Millionen, die noch bei der Errichtung dieser Bahn lebten, gab es 1889
nur noch etwas über 1000 amerikanische Büffel, welche inzwischen in
der Reservation des Yellowstone-Park bis auf wenige Hunderte, die die
starke Inzucht zudem bedeutend degenerieren ließ, zusammenschrumpften.
Auch diejenigen in den Reservationen von Wichita und Montana schmolzen
bis auf wenige Hunderte zusammen. Neuerdings hat sich indessen
wieder eine Vermehrung erzielen lassen, so daß rund 1000 in den
Vereinigten Staaten und 600 Stück in Kanada vom Menschen gehegt
leben. Sie vermehren sich nur langsam, doch ist das Aussterben dieser
interessanten Tierart noch nicht so bald zu erwarten. Immerhin sind
durch die Ausrottung des wilden Bisons die davon lebenden Indianer,
ihrer Nahrungsquelle beraubt, zu Kostgängern des Staates geworden,
statt sich wie früher selbst zu ernähren!
Ein Glück ist es, daß viele zoologische Gärten Europas sich
amerikanische Büffel anschafften, so lange sie billig zu haben waren.
Sie pflanzen sich glücklicherweise auch in der Gefangenschaft leicht
fort, so daß noch auf längere Zeit Exemplare dieses gewaltigsten aller
Rinderarten als Schaustücke ersten Ranges in unseren Tiergärten zu
sehen sein werden. Bereits sind mehrfach Kreuzungen zwischen Bison und
Hausrind mit Erfolg vorgenommen worden, in Europa zu wissenschaftlichen
Zwecken, in Amerika dagegen anscheinend auch in der Absicht, ein
besonders wetterhartes und dabei milchergiebiges Weiderind zu erzielen.
Inwieweit diese Hoffnungen sich erfüllen werden, wird die Zukunft
lehren.
Nicht so glücklich, in zahlreichen Tiergärten den auf den Aussterbeetat
gesetzten nordamerikanischen Bison zu beherbergen, sind wir mit dem
europäischen, dem Wisent (Bison europaeus), daran.
Dieser ist etwas kleiner wie jener und hat einen weniger gewaltigen
Nackenbuckel, ähnelt ihm aber sonst. Er besitzt nur 14, statt wie
der amerikanische Bison 15 Rippenpaare. Dazu sind seine Beine höher
und schlanker und die Hörner schöner als bei seinem amerikanischen
Ver[S. 86]wandten ausgebildet, bei beiden Geschlechtern in ziemlich gleicher
Entwicklung nach außen oben und schließlich einwärts gekrümmt. Wenn
er auch neuerdings immer mehr durch Inzucht an Größe abgenommen hat,
so stellt er ein recht stattliches Tier dar, das bei 1,7 m
Schulterhöhe und 3 m Länge bis 700 kg schwer wird.
Dagegen war ein im Jahre 1555 in Preußen erlegter Wisentstier 7 Fuß
hoch, 13 Fuß lang und dabei 19 Zentner 5 Pfund schwer. Merklich kleiner
und zierlicher gebaut, auch mit kleinerer Mähne und schwächerem Gehörn
als der Stier ist die Wisentkuh.
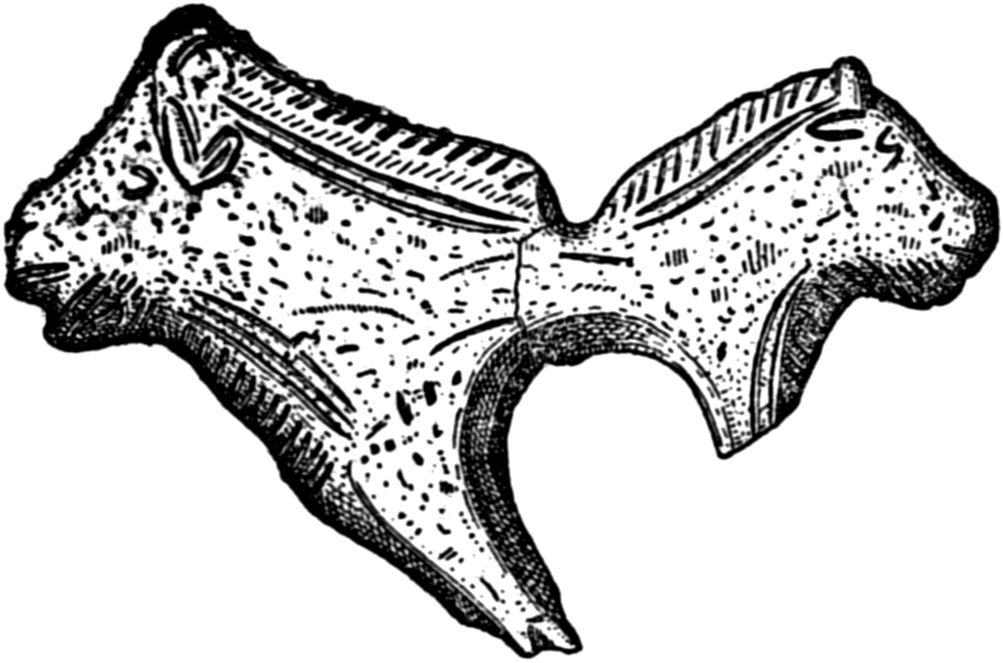
Bild 13. Oberes Ende eines an der Durchlochungsstelle
abgebrochenen Zierstabes aus Renntierhorn aus dem Lagerplatz der Renntier- und
Mammutjäger der frühen Nacheiszeit von Laugerie basse mit Köpfen eines männlichen
und weiblichen Büffels (Wisent). 1⁄3 natürl. Größe.
Im Sommer und Herbst lebt der Wisent in kleinen Trupps von 15–20 Stück
an feuchten Orten des Waldes, gewöhnlich im Dickicht versteckt, nur im
Winter zieht er höher gelegenes und trockenes Gehölz vor. Jede einzelne
Herde hat ihren festen Standort und kehrt immer wieder dahin zurück.
Nur alte Stiere leben, wie auch bei den übrigen Wildrindern, einsam für
sich. Am liebsten weiden die Tiere in den Morgen- und Abendstunden,
wobei sie verschiedene Gräser, Blätter, Knospen und Baumrinde
fressen. Sie schälen gern die Bäume ab, soweit sie reichen können.
Ihr Lieblingsbaum scheint die Esche zu sein, deren saftige Rinde sie
jeder anderen bevorzugen. Ihr Gang ist ein rascher Schritt, der Lauf
ein schwerer, aber schnell fördernder Galopp, wobei der Kopf zu Boden
gesenkt, der Schwanz emporgehoben und ausgestreckt wird. Durch Sumpf
und Wasser waten und schwimmen sie mit Leichtigkeit. Während jüngere
Tiere muntere, lebhafte und verhältnismäßig gutmütige Tiere sind,
erscheinen ältere Tiere, zumal Stiere, als ernste, leicht reizbare und
jähzornige Wesen, mit denen nicht gut Streit anzufangen ist. Die Brunst
fällt auf den August bis September. Während derselben kämpfen die
Stiere untereinander um den Besitz der Weibchen. Neun Monate nach der
Paarung, im Mai oder Anfang Juni, kalben die Kühe, nachdem sie sich von
der Herde abgesondert und in ungestörter Wildnis einen geeigneten Platz
aufgesucht haben, wo sie sich und ihr Kalb während der ersten Tage vor
den Genossen verbergen. Jetzt sind sie für jedes Wesen, das sich ihnen
nähert,[S. 87] gefährlich, indem sie zum Schutze des Jungen ohne Besinnen
jeden Gegner angehen. Die Kälber sind anmutige Tiere, die nur sehr
langsam wachsen, wahrscheinlich erst im 8. oder 9. Jahre ihre volle
Größe erlangt haben und 30–40 Jahre alt werden.
Die ältesten Darstellungen des Wisent, die wir besitzen, rühren von
den dieses Wild mit besonderem Eifer jagenden Eiszeitjägern des
Solutréen und Magdalénien her. In großer Zahl finden sie sich nicht nur
in Umrissen, sondern teilweise auch in bunten, mit den drei Farben:
Rot, Braun und Schwarz gemalten Bildern in den nordspanischen und
südfranzösischen Höhlen abgebildet. In großer Menge muß dieses Wildrind
in der späteren Diluvialzeit neben dem Wildpferd in Europa gelebt haben
und war, nach der Menge der von ihm herrührenden Knochen, eines der
wichtigsten Beutetiere des Menschen. Auch die alten Germanen jagten es
noch häufig und bereiteten aus seinem Gehörn Trinkgefäße, wie dies bis
in unsere Tage im Kaukasus, wo sich dieses Wild in die Gegenwart in
einigen Herden erhielt, geschieht. So dienten bei einem Gastmahl, daß
ein kaukasischer Fürst dem russischen General Rosen zu Ehren gab, 50–70
mit Silber ausgelegte Wisenthörner als Trinkbecher.
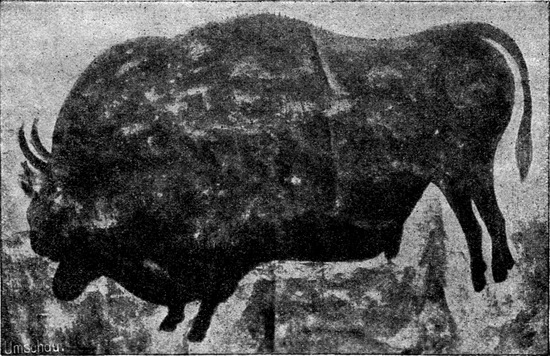
Bild 14. Von Jägern der frühen Nacheiszeit in rotbrauner
Farbe gemalter Büffel (Wisent) aus der Höhle von Font-de-Gaume in Südfrankreich.
(1⁄12 natürl. Größe.)
Die Schriftsteller des Altertums erwähnen mehrfach den Bison. So
schreibt der ältere Plinius in seiner Naturgeschichte, wie bereits[S. 88]
erwähnt: „Germanien ist durch das Vorhandensein von zwei Arten wilder
Rinder merkwürdig, nämlich durch den mit einer Mähne geschmückten
Bison (Wisent) und den Ur, der sich durch Kraft und Schnelligkeit
auszeichnet.“ Und der griechische Schriftsteller Oppianos spricht um
200 n. Chr. vom Wisent als einem entsetzlichen, in Thrakien lebenden,
einem Ochsen ähnlichen Tiere, das eine Mähne wie der Löwe, und
spitzige, krumme Hörner habe, mit denen es Menschen und wilde Tiere
hoch emporschleudere. Seine Zunge sei sehr rauh, wie eine Feile,
so daß sie die Haut durch Lecken aufreißen könne. Ferner sagt der
Grieche Pausanias ums Jahr 150 n. Chr., sie seien von allen Tieren
am schwersten zu fangen, denn kein Netz sei stark genug, sie zu
halten. „Die Jagd auf sie wird demnach auf folgende Weise angestellt:
Die Jäger bedecken eine Höhe, vor der sich ein Graben hinzieht, mit
frischabgezogenen oder alten, geölten und dadurch schlüpfrig gemachten
Häuten. Auf beiden Seiten davon wird ein starker Zaun errichtet. Dann
treiben sie zu Pferd die Bisons an diesen Ort, woselbst sie auf den
Häuten ausgleiten, sich überschlagen und in den Graben rollen. Dort
werden sie binnen vier oder fünf Tagen vor Hunger matt. Will man sie
dann etwa zahm machen, so bringt man ihnen Fichtenzapfen, weil sie
anfangs kein anderes Futter nehmen. Endlich können sie gebunden und
fortgeführt werden. — Der päonische König Dropion hat einen ehernen
Bisonkopf nach Delphi geschickt.“
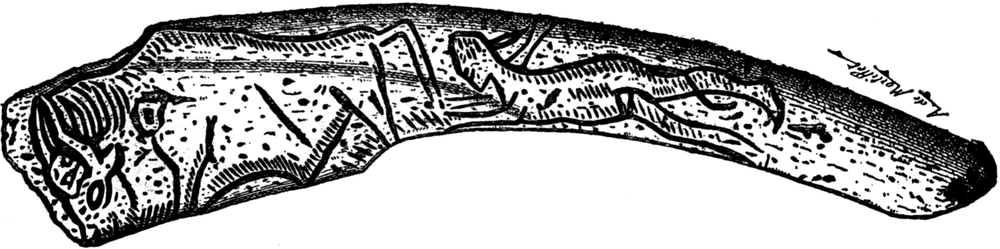
Bild 15. Jagdbild der frühen Nacheiszeit, worauf ein
Mann auf allen Vieren kriechend einen ruhig äsenden Büffelbullen anschleicht
und im Begriffe steht, einen Wurfspeer gegen ihn zu schleudern. Der die Waffe
werfende Arm ist sehr ungeschickt angebracht, wie auch die menschliche Gestalt
recht steif wiedergegeben ist, ein Beweis dafür, daß der Zeichner viel größere
Übung in der Darstellung von Tieren als von Menschen besaß. Aus dem abri von
Laugerie basse in der Dordogne, Südwestfrankreich. (4⁄9 natürl. Größe.)
Im Nibelungenlied wird neben dem Ur der Wisent als Jagdbeute des
Helden Siegfried genannt, als er im Wasgenwalde, den Vogesen westlich
von Worms, jagte. Zu Karls des Großen Zeit fand er sich[S. 89] noch häufig
im Harze und im Sachsenlande. Nach den Benediktionen des Mönches
Ekkehard I. muß er im 10. Jahrhundert noch ziemlich häufig auf
den Tisch des Klosters St. Gallen gekommen sein. Noch verschiedene
Ortsnamen in der Schweiz zeugen von seiner einstigen Anwesenheit in
diesem Lande, so z. B. das Dorf Wiesendangen bei Winterthur, das in den
ältesten Berichten der Chroniken als Wisonteswangun, d. h. Wisentanger
angeführt wird. Gleicherweise haben wir in Süddeutschland Ortsnamen
wie Wiesensteig (in mittelalterlichen Urkunden als Wisontessteiga) und
Urach d. h. am Flüßchen des Ur. Ums Jahr 1373 lebte er noch ziemlich
häufig in Pommern, im 15. Jahrhundert in Preußen, im 16. in Litauen
und Polen, wo sich die Könige und Großen seine Erhaltung angelegen
sein ließen, indem sie ihn, dort Zubr genannt, in besondern Wildparks
hielten und nur selten einige Stücke einfingen, um sie als Geschenke an
fremde Höfe zu benutzen. Eine allgemeine Seuche vernichtete am Anfang
des 18. Jahrhunderts den größten Teil dieser Herden. In Ostpreußen
wurde das letzte Exemplar zwischen Tilsit und Labiau im Jahre 1755 von
einem Wilddieb erlegt. Die letzte Herde von einigen hundert Stück lebt,
vom russischen Kaiser sorgfältig gehegt, in dem 200 qkm großen
unberührten Forste von Bjelowjesha im russisch-litauischen Bezirke
Grodno. Von dort wurden von den früheren Kaisern, zuletzt von Alexander
II., einige Paare an zoologische Gärten, meist nach Deutschland,
abgegeben, wo sie sich leicht fortpflanzen. So besitzt der Berliner
zoologische Garten einige Stück, und auch dem Fürsten Pleß gelang es,
in seinem oberschlesischen Reviere Meserzitz einen kleinen Bestand
heranzuhegen, so daß sogar auf den deutschen Geweihausstellungen noch
ausgestopfte Wisentköpfe und Schädel erscheinen. Außerdem schweifen
nach Dr. Heck im Kaukasus noch einige vereinzelte Wisenttrupps
umher; doch wandern sie so unstet, daß man sie in den letzten Jahren
nicht mehr sah. Das Schicksal dieses Tieres ist auch im Forste von
Bjelowjesha besiegelt; denn der Petersburger Säugetierforscher Büchner
ist auf Grund eingehender Studien zum fatalen Ergebnisse gekommen,
daß diese Tierart langsam, aber sicher, ihrem Erlöschen entgegengeht,
nachdem ihr Vorkommen einmal so zerstreut und vereinzelt geworden
ist, daß die Entartung infolge der Inzucht (Kleinheit der Tiere,
Unfruchtbarkeit des weiblichen Geschlechts und Schwächlichkeit der
Jungen) sich notwendigerweise immer stärker geltend machen muß.
Dann wird Europa sein stolzestes Wild verloren haben, ohne daß ihm
die Möglichkeit geboten war, der Domestikation durch den Menschen
unterworfen worden zu sein.
[S. 90]
Vom Menschen dagegen gezähmt und zu einem außerordentlich nützlichen
Haustiere erhoben wurde der Yak oder Grunzochse
(Bos grunniens), der seiner kalten Heimat gemäß durch eine
lange Behaarung, besonders am Bauche, die ihm beim Ruhen gleichsam
als wärmendes Bett dient, ausgezeichnet ist. Von allen Rindern
unterscheidet er sich auch dadurch, daß er einen vollständig
gleichmäßig langbehaarten Schweif wie ein Pferd hat. Er bewohnt die
Hochländer Tibets zwischen 4000 und 6000 m und vermag dank
seines langen, dichten, schwarzen Haarkleides die rasenden Schneestürme
seiner unwirtlichen Heimat zu überstehen. In alten Männchen wird er
4,25 m lang bei einer Höhe von 1,9 m und einem Gewicht
von 600 kg, während alte Kühe kaum über 2,8 m Länge bei
1,6 m Höhe erreichen. Die Kühe bilden im Sommer, wenn sie in
die grasigen Niederungen steigen, Herden von 10 bis 100 Stück, die
von Männchen angeführt werden. Deren Mitglieder fressen zur Nachtzeit
und am frühen Morgen, ziehen sich aber am Tage meist auf eine steile,
öde Berglehne zurück, wo sie wiederkäuend viele Stunden ruhen. Alte
Stiere, die meist einzeln oder nur in kleinen Gesellschaften von 3 bis
4 Stück angetroffen werden, lieben Ruheplätze mit weiter Umschau, um
sich beizeiten vor Feinden zurückziehen zu können. Nur alle zwei Jahre
bekommt die Kuh, neun Monate nach der Paarung, ein Kalb, das sie über
ein Jahr lang säugt. Erst im 6. oder 8. Jahre ist es erwachsen und
erreicht ein Alter von 25 Jahren.
Mit außerordentlicher Sicherheit bewegt sich der Yak auf dem
schwierigsten Terrain, strauchelt, obschon schwer gebaut, nie und
arbeitet sich mit großer Gewandtheit durch tiefe Schneemassen hindurch,
wobei er den Kopf gleichsam als Schneepflug benützt. Seine Intelligenz
ist nur schwach entwickelt. Verwundet nimmt er ungescheut den Jäger an
und wird ihm mit seinen 80–90 cm langen Hörnern sehr gefährlich.
Deshalb fürchten ihn die Tibeter gleich einem Ungeheuer, gehen ihm
gern aus dem Wege und feuern, wenn sie sich wirklich zur Jagd auf
ihn entschließen, nur aus sicherem Verstecke und gemeinschaftlich,
ihrer 8–12. Sein Fleisch wird vom Engländer Kinloch als saftig und
ausgezeichnet gerühmt; Zunge und Markknochen desselben bezeichnet er
geradezu als Leckerbissen. Aber mehr noch als das Wildbret schätzt
man in seiner baumlosen Heimat den Mist des Yaks, der getrocknet den
einzigen in jenen kahlen Höhen zur Verfügung stehenden Brennstoff
darstellt.
Die früheste Erwähnung des Yaks treffen wir bei dem zu Beginn[S. 91] des
3. Jahrhunderts n. Chr. in Rom lebenden Claudius Älianus an, der in
seinem Werk über die Tiere sagt, daß die Inder ihren Königen nebst
andern Tieren auch wilde Rinder darbringen, welche schwarz sind,
aber weiße Schwänze haben, die zu Fliegenwedeln dienen. Tatsächlich
bilden die Yakschwänze die von altersher vielberühmten Kriegszeichen
der „Roßschweife“, die die Türken bis vor Wien trugen, und heute
noch eine kostbare Trophäe sind, mit der sich besonders türkische
Würdenträger zieren. Man stellt daraus außer Standarten besonders auch
Pferdeschmuck her. Der römische Dichter Martial berichtet, daß die
vornehmen römischen Damen unter Kaiser Domitian, dem zweiten Sohne
Vespasians, der nach seines Bruders Titus’ Tode von 81 bis 96 n. Chr.
regierte, daraus hergestellte äußerst kostbare Fliegenwedel benutzten.
Damals wußte man noch, daß diese Haare vom Schwanze einer asiatischen
Rinderart stammen, eine Kunde, die sich später völlig verlor.
Wann der Yak gezähmt wurde, entzieht sich unserer Kenntnis. Es muß
dies aber schon vor längerer Zeit geschehen sein, da wie bei so vielen
andern Haustieren sich bei ihm infolge Einwirkung der Domestikation
bereits ein weitgehender Leucismus entwickelt hat, so daß rein
schwarze zahme Yaks sehr selten geworden sind. Gewöhnlich zeigen auch
diejenigen, welche den wilden am meisten ähneln, weiße Stellen. Meist
sind sie ganz weiß, vielfach auch hornlos; außerdem trifft man braune,
rote und gescheckte an. Der gezähmte Yak ist durchgehends kleiner als
der wilde. Man hat schon durch Kreuzung mit andern Rinderarten mehrere
Rassen von Bastarden gezüchtet. Hier und da sind die zahmen Yaks wieder
verwildert und haben dann ihre schwarze Urfärbung wieder angenommen.
Auch die zahmen Herden gedeihen nur in kalten, hochgelegenen
Gebirgsteilen und gehen bei großer Wärme zugrunde, ertragen dagegen
Kälte mit Gleichmut.
In Tibet und der Mongolei weiden die Yakherden fast ohne jede
Aufsicht; den ganzen Tag tummeln sie sich auf den Weideplätzen umher
und werden nur über Nacht zu den Zelten ihrer Besitzer getrieben.
Selbst gezähmt behält der Yak stets einen gewissen Grad von Wildheit,
der sich vornehmlich durch Angriffslust gegen Fremde äußert. Gegen
seine Bekannten benimmt er sich ziemlich freundschaftlich, läßt sich
berühren, reinigen und vermittelst eines durch seine Nase gezogenen
Ringes an einem Stricke leiten. Er dient hauptsächlich als Lasttier,
daneben aber auch vielfach als Reittier. Über die unwegsamsten Pässe
der Hochgebirge trägt er Lasten von 120–150 kg und vermittelt
den[S. 92] Verkehr zwischen Tibet und China, der Mongolei und Nordindien. Nur
auf sehr klippenreichen Pfaden ist er als Lasttier nicht zu gebrauchen,
da dann seine schwere Last ihn hindert, über höhere Felsen zu springen.
Im Westen reicht das Verbreitungsgebiet des gezähmten Yaks bis zur
Bucharei, im Nordosten bis in die Mongolei und zu den nordöstlichen
Nebenflüssen des Yang-tse-kiang. Auch in Südostsibirien werden
vereinzelte Yaks gehalten. Als Gebirgstier fühlt es sich in Höhen unter
2000 m nur wenig behaglich; sonst gedeiht es auch ohne jegliche
Pflege und ist äußerst genügsam. Die außerordentlich fette Milch gilt
als sehr wohlschmeckend und ist überaus gesucht. Um den Milchertrag zu
vermehren, hat man ihn mit dem Hausrind von Zebuabstammung gekreuzt.
Solche Kreuzungsprodukte sollen am Südabhange des Himalaja zahlreich
vorkommen und fruchtbar sein; dagegen scheinen die aus denselben
wirtschaftlichen Gründen gezüchteten Bastarde mit dem Primigeniusrind
Sibiriens unfruchtbar zu sein. Außer Milch und Fleisch werden auch die
langen Haare verwertet, indem man sie zu groben Geweben verarbeitet.
Sehr geschätzt sind die Schwanzhaare wie bei den Türkvölkern, so auch
in China, wo sie zu mannigfachem Putz Verwendung finden. Der Yak ist
schon so lange domestiziert, daß es bei ihm außer gefleckten und
leucistischen sogar hornlose Rassen gibt.
Erst spät ist dieses Haustier der innerasiatischen Hochländer in Europa
näher bekannt geworden. Die ersten Yaks, zwölf an der Zahl, die nach
Europa gelangten, erhielt im Frühjahr 1854 die Ménagerie du Musée
d’histoire naturelle in Paris. Da sie sich gut akklimatisierten
und auch Nachkommen erzeugten, erhielten von Paris aus zahlreiche
Tiergärten dieses Schaustück, das sich in unserm Klima besser hielt,
als man hoffen durfte. Gleichwohl war die einst gehegte Hoffnung
aussichtlos, den Yak als wertvolles und leistungsfähiges Haustier in
unsern Gebirgsgegenden einzubürgern; denn hier liegen die Verhältnisse
anders als in seinem Stammlande. Unsere Alpen und höheren Gebirge
werden durch Rinder und Ziegen hinreichend ausgenutzt und der Verkehr
mit Saumtieren ist mit der Entwicklung besserer Verkehrsmittel
wesentlich eingeschränkt, so daß die Einführung des Yaks vom
Standpunkte des Nutzens aus ganz zwecklos ist. Anders verhält es sich,
wenn wir ihn als Luxustier in den von Fremden stark besuchten Gegenden
einführen wollten, zumal ja die Tierwelt des Gebirges zum Bedauern
jedes Freundes der Natur mehr und mehr verarmt. Da wären diese wie
Gemsen kletternden Tiere eine prächtige[S. 93] Staffage und könnten noch
als Last- und Reittiere Verwendung finden. Gar mancher Fremde fände
es wohl ganz nett, einmal einen Yak statt eines prosaischen Maultiers
zu besteigen, um sich in verkehrsarmen Gegenden in die hehre Bergwelt
hinauftransportieren zu lassen. Wer weiß, vielleicht ist die Zeit nicht
mehr fern, da ein unternehmender Hotelier auf den Gedanken verfällt
und damit ein neues Zugmittel für das nach allem Neuen begierigen
Publikum beschafft, das sich in der Folge weitgehender Beliebtheit
erfreuen dürfte. Schon im Jahre 1850 versuchte man ihn in der Auvergne
anzusiedeln; doch hielt er sich hier nicht auf die Dauer, weil der
betreffende Privatunternehmer bald das Interesse an dieser Zucht
verlor.
Nachdem das Rind zum Haustier des Menschen erhoben worden war, kam
als weiteres Nutztier die Ziege hinzu, bei deren Domestikation
sich jedenfalls auch religiöse Motive geltend machten. Eduard Hahn
macht in seinem Buch über die Haustiere und ihre Beziehungen zur
Wirtschaft des Menschen die Bemerkung, durch die ganze Ethnologie
gehe die Anschauung, den Göttern sei das angenehmste Opfer dasjenige,
das am schwersten zu gewinnen sei und am schmerzlichsten entbehrt
werde. Bei den Assyriern und allen vorderasiatischen Völkern galt
allgemein das eben der Mutter entrissene junge Tier als das wertvollste
Opfer. Das Zicklein und die junge Antilope auf dem Arm des opfernden
Königs kehren bei jenen in der Darstellung immer wieder, so daß obige
Anschauungen als tief im Volksglauben eingewurzelt gelten können.
Dieser grausame Zug machte vor dem Menschen selbst nicht halt, insofern
man in schwierigen Lagen nicht zögerte, seine eigenen Kinder zu opfern.
Man denke nur an das Molochopfer der Phönikier, die Opferung Isaaks
durch Abraham, die allerdings durch göttliche Vermittlung abgewehrt
und durch das Opfer eines Ziegenbockes abgelöst wurde. Daß solche
Opfer insbesondere von erstgeborenen Söhnen als der Gottheit besonders
wohlgefällige Darbringungen galten, beweisen verschiedene Tatsachen aus
der morgenländischen Geschichte, von denen nur diejenige des um 850
v. Chr. lebenden Königs Mesa von Moab genannt sei, der uns in seinem
einst in seiner Residenz Daibon aufgerichteten Altarstein, der 1868
vom Franzosen Ganneau aufgefunden wurde und jetzt sich im Louvre in
Paris befindet, das älteste bis jetzt bekannt gewordene Schriftdenkmal
semitischer Buchstabenschrift hinterlassen hat. Er berichtet darin, daß
er den Israeliten die Stadt Nebo weggenommen habe und alle Bewohner,
insgesamt 7000 Personen,[S. 95] tötete. Als er später von den Israeliten in
seiner Hauptstadt belagert wurde und in arge Bedrängnis kam, opferte
er, um seinen drohenden Untergang abzuwenden, auf der Stadtmauer im
Angesicht der Feinde seinen ältesten Sohn.
Ebenso verbreitet als das Kindesopfer war die später von milder
denkenden Generationen aufgebrachte Vorstellung, daß es die Gottheit
ebenso sehr freue, wenn man das ihr gefällige Opfer, statt es zu
schlachten, ihr weihe durch Freilassen in ihrem heiligen Tempelbezirke.
So erzählt Älian, die Koptiten in Ägypten hätten die weiblichen
Wildziegen, die sie gefangen, der Göttin geweiht, d. h. sie in deren
heiligem Bezirke ausgesetzt, die Männchen dagegen geschlachtet. War
einmal ein solch kleiner Bestand besonders weiblicher Tiere vorhanden,
von denen wohl eine größere Zahl trächtig war, so waren sie, wie auch
die von ihnen in der Gefangenschaft geborenen Jungen, als der Gottheit
geweihte Tiere deren Eigentum, das der Mensch unter allen Umständen
respektierte. So gewöhnten sie sich an den Menschen, der ihnen je und
je Futter darbot und dafür sorgte, daß sie sich in der für sie kaum
merkbaren Gefangenschaft ruhig vermehrten. Je nach Bedarf holte er sich
dann ein Zicklein als Opfer für die betreffende Gottheit, der die Herde
gehörte. Auch die Milch der Mutter wurde zu sakralen Zwecken verwendet
und sank erst auf einer späteren, praktischer denkenden Stufe zum
Gebrauchsgegenstand des täglichen Lebens herab. Ebenso wurde außer dem
Fleisch, das nach und nach auch zu profanen Zwecken verwendet wurde,
das lange Haar dieses Tieres zur Herstellung allerlei grober Gewebe,
besonders der Zeltdecken des Nomaden, wie auch von Kleidern verwendet,
da es viel wetterbeständiger ist und weniger Wasser aufsaugt als die
Schafwolle.
Die Stammutter der ältest domestizierten Ziegen ist die im Hügel-
und Bergland von Südwestasien heimische Bezoarziege (Capra
aegagrus), an der H. Pohlig beobachten konnte, welch hohe
Empfänglichkeit sie für den Anschluß an den Menschen besitzt. In
Djulfa sah er eine Wildziege mit ihren beiden Jungen sich in einem
Gehöft einnisten und sich so an diese neue Umgebung gewöhnen, daß sie
von ihren Ausflügen pünktlich zur Fütterungszeit zurückkehrten. Das
Verbreitungsgebiet dieser Wildziege erstreckt sich von Afghanistan und
Beludschistan über die Gebirge Persiens, Syriens und Kleinasiens bis
nach Griechenland, wo sie einst so gemein war, daß sie den Ägäischen
Inseln (vom griechischen aix, Stamm aig, die Ziege) den
Namen gab. Bevor sie der Mensch dort ausrottete, müssen sie auf den
Küstenbergen[S. 96] des griechischen Meeres sehr gemein gewesen sein, wie
etwa auf der Kyklopeninsel, von der es in Homers Odyssee heißt:
„Der Ziegen unendliche Menge durchstreift sie,
Wilden Geschlechts, weil nimmer ein Pfad der Menschen sie scheuchet.“
Daß sie damals vom Menschen eifrig gejagt wurden, ist begreiflich. So
wird in der Ilias geschildert, wie der Schütze ihr auf dem Anstand
auflauert, bis das Tier aus dem Felsenversteck hervortritt. Alsbald
trifft es der Pfeil von unten in die Brust, so daß es sich überschlägt
und die Felsen hinunterfällt. Sein Fleisch wird als willkommene Beute
gegessen und das mächtige Gehörn zu einem starken Bogen verarbeitet.
Die Bezoarziege ist merklich größer als unsere von ihm abstammende
Hausziege, die ihr übrigens besonders in der der Wildform noch sehr
nahestehenden kräftig gebauten gemsfarbigen Varietät noch sehr ähnlich
sieht. In beiden Geschlechtern besitzt die zahme wie die wilde Form
einen starken Bart und ein unregelmäßig geknotetes, vorn scharf
gekantetes, hinten gerundetes, sichelförmig nach hinten gekrümmtes,
gegen die Spitze zu etwas zusammenstrebendes Gehörn, das beim Bock viel
stärker als beim Weibchen entwickelt ist. Bei ihm erreicht es nämlich
eine Länge von über 130 cm bei einem Umfang von nur 17–18
cm; bei der auch sonst kleineren Geis sind sie nicht nur viel
kleiner, sondern auch nur schwach nach rückwärts gekrümmt. Sie stehen
bei ihr am Grunde auch weiter auseinander als beim Bock. Im Winter ist
der Pelz der Bezoarziege, der in kalten Klimaten weiches Unterhaar
erhält, bräunlichgrau, im Sommer dagegen gelblich- oder rötlichbraun.
Die Unterseite des Rumpfes und die Innenseite der Schenkel ist
weißlich oder weiß. Alte Böcke sind blasser und am Hinterhals, auf
den Schultern, an der Kehle und auf der Vorderseite der Beine mit
Ausnahme der Kniee braun und weisen einen schwarzen Rückenstreifen auf,
der bis zum Schwanz verläuft und ziemlich scharf abgegrenzt ist. Es
sind dies alles Merkmale, die sich, wie auch die aufrecht gestellten
Ohren, bei der ebenfalls ausgezeichnet kletternden gezähmten Bergziege
in derselben Weise wiederfinden. Die Länge des ausgewachsenen Bockes
beträgt bei der Bezoarziege etwa 1,5 m bei einer Schulterhöhe
von 95 cm.
Tafel 17.
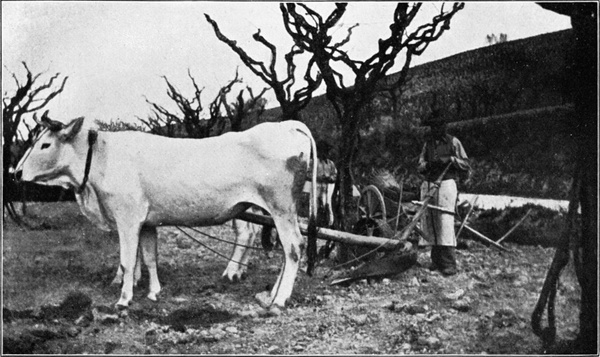
(Phot. von E.
Reinhardt.)
Toskanisches Hausrind vor einen Holzpflug mit Metallspitze gespannt.

Kirgisisches Rindergespann vor einem primitiven Pflug.
Tafel 18.

Altägyptisches Relief des Alten Reiches aus Sakkarah (6.
Dynastie, 2625–2475 v. Chr.) mit Darstellung einer Vogeljagd links und einer
Ziegenherde mit ihrem Hirten rechts.
⇒
GRÖSSERES BILD
Tafel 19.

Von dem Assyrerkönig Tiglatpilesar III. auf einem syrischen
Feldzug erbeutete Herden (8. Jahrhundert v. Chr.)
Oben links: Gefesselte Gefangene. Oben rechts: Eroberte Schafe und Ziegen. Unten:
Anblick einer befestigten Stadt mit Dattelpalme und Sturmbock, im Hintergrund ein
assyrischer Schreiber, der die erbeuteten Schafe und Ziegen aufschreibt. Im
Vordergrund Ochsenkarren mit gefangenen Frauen und Kindern.
⇒
GRÖSSERES BILD
Tafel 20.
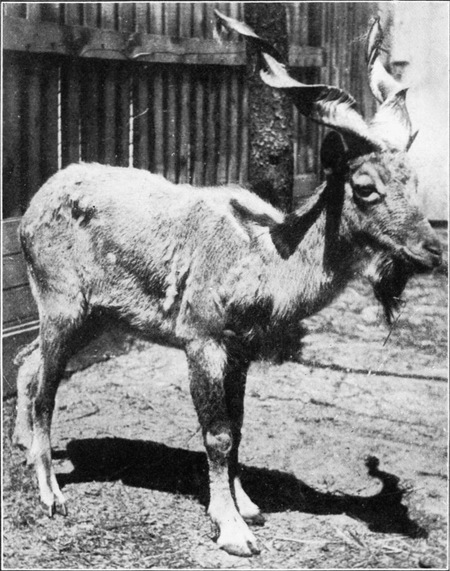
(Copyright by M.
Koch, Berlin.)
Schraubenziege oder Markhor.
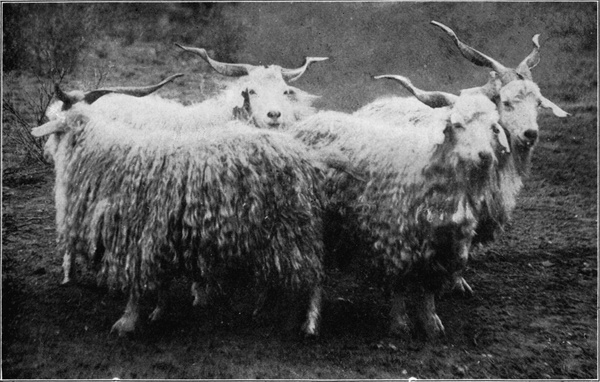
(Copyright by M.
Koch, Berlin.)
Angoraziegen.
Die Bezoarziege bewohnt mit Vorliebe wüste, felsige Berge, wo
sich ihre verschieden großen Herden gern an die Klippen und
Schluchten[S. 97] halten. Sie ist sehr lebendig, klettert und springt mit
bewundernswerter Sicherheit von einem Felsenkamm zum andern und scheint
steile Felsenabhänge kaum zu beachten. Rasch und sicher läuft sie auf
schwierigen Graten dahin und faßt sichern Stand auf dem kleinsten
Felsvorsprunge, der sich ihr darbietet. Während der Paarungszeit, im
November, kämpfen die Böcke hartnäckig und gewaltig um die Weibchen,
die dann nach der Belegung im April oder Mai die Jungen zur Welt
bringen, und zwar die jüngeren Ziegen eins oder zwei, die älteren stets
zwei, nicht allzuselten auch drei. Diese folgen der Mutter sofort
nach der Geburt, vom dritten Tage ihres Lebens an selbst auf den
schwierigsten Pfaden, wachsen rasch heran und sind jederzeit zu Scherz
und Spiel bereit.
Den Wildziegen wird von seiten des Menschen eifrig nachgestellt, da
ihr Fleisch einen ausgezeichnet schmackhaften Braten liefert, der an
Rehbraten erinnert und ebenso zart und mürbe wie letzterer ist. Es wird
entweder frisch genossen oder, in lange, schmale Streifen geschnitten,
an der Luft getrocknet, um es später verwenden zu können. Das im Winter
erbeutete langhaarige Fell wird von den Orientalen mit Vorliebe als
Gebetteppich benutzt und, weil man seinen scharfen Geruch angenehm
findet, hoch geschätzt. Das kurzhaarige Sommerfell wird zu Schläuchen
verwendet, die im Morgenland allgemein als Behälter für Wein oder
Wasser an Stelle unserer dort unbekannten Holzfässer dienen, und das
Gehörn zu Pulverhörnern, Säbelgriffen usw. verarbeitet.
Ihren Namen hat übrigens die Bezoarziege von dem früher auch bei
uns berühmten, heute noch überall in Westasien bis Persien als eine
Gegengabe gegen Gift geschätzten und als eine Arznei für viele
Krankheiten betrachteten, gelegentlich in ihren Eingeweiden gefundenen
Steine, dem Bezoarstein. Dieser stellt einen Gallenstein dar und
war den alten Schriftstellern unter dem Namen Pasen bekannt, welche
Bezeichnung offenbar aus Pasang hervorging, einer der männlichen
Bezoarziege in Persien beigelegten Bezeichnung.
Der älteste und wichtigste Bildungsherd der zahmen Ziege aus
der Bezoarziege ist jedenfalls Westasien, das ja von sehr alten
Kulturvölkern bewohnt war, die am ehesten imstande waren, die
Domestikation vorzunehmen. Überall treffen wir sie bei diesen seit
der jüngeren Steinzeit als Haustier an. In Mesopotamien wurde sie
zur assyrischen Zeit vielfach abgebildet. Daß sie damals schon sehr
lange im Haustierstande verweilt haben muß, geht daraus hervor, daß
sie bereits hängeohrig[S. 98] war. Im alten Ägypten erscheint sie ebenfalls
häufig in bildlicher Darstellung. Wir sehen sie die zum Holzfällen
ausziehenden Arbeiter begleiten und die Blätter der gefällten Sykomoren
und anderer Bäume abfressen. Sie wird stets mit einem Bart und der Bock
mit einem stattlichen Gehörn abgebildet. Etwa einmal wird ein Zicklein
geschlachtet, an den Hinterbeinen am Geäst eines Baumes aufgehängt und
mit dem Messer zerlegt, um einen willkommenen Braten zu liefern. Die
Ziegenzucht muß im alten Ägypten einen großen Umfang besessen haben und
trat weit vor die Schafzucht, was wir sehr wohl begreifen, wenn wir
bedenken, daß die Bewohner des heißen Ägypten vom Beginn des dritten
vorchristlichen Jahrtausends an nicht mehr Wollkleider, sondern die
viel leichteren und angenehmeren weißen Linnenkleider trugen. Aus dem
mittleren Reiche besitzen wir ein Dokument, worin einem Gutsherrn von
seinem Oberschreiber 5023 Stück Vieh als Besitzstand angemeldet werden,
worunter sich nur 924 Schafe, dagegen 2234 Ziegen und der Rest Rinder
befinden.
Sagenhafte Überlieferungen, die weit vor die homerische Zeit
zurückreichen, sprechen von einem Ziegenvolke, das von Kleinasien
hervordrang und überall, wo es erschien, Angst und Schrecken
verbreitete. Schälen wir den Grundgedanken der Sage aus der
mythologischen Umhüllung heraus, so wird das wohl heißen, daß
Griechenland die Hausziege in grauer Vorzeit von Westasien her
erhielt. Hier wie überall sonst in den Mittelmeerländern hat sie als
Begleiterscheinung einer primitiven Kultur willige Aufnahme und weite
Verbreitung gefunden und in der Folge durch ihre Genäschigkeit und
ausgesprochene Vorliebe für die Knospen und jungen Triebe von holzigen
Gewächsen in Verbindung mit der Sorglosigkeit des sie haltenden
Menschen als Verderberin des aufsproßenden jungen Waldes eine leider
sehr verhängnisvolle Rolle gespielt.
In einer durch schlechte Haltung verkümmerten, kleinen Form treffen
wir die Hausziege auch bei den neolithischen Pfahlbauern Mitteleuropas
eingebürgert. Schon L. Rütimeyer wies darauf hin, daß in den Überresten
der ältesten Pfahlbauten Ziegenreste viel häufiger als Reste des
Schafes vorkommen, während dann mit dem Kulturaufschwung in der
Bronzezeit das Verhältnis ein umgekehrtes wurde, d. h. die Ziegenzucht
gegenüber der Schafzucht bedeutend zurücktrat, gleichzeitig aber auch
die damals gehaltenen Ziegenrassen durch bessere Lebenshaltung größer
und stattlicher erscheinen. Dieses Verhältnis in der Zucht beider
Haustiere änderte sich hier auch in der Folge nicht.[S. 99] Wenn es auch noch
zur Zeit Kaiser Karls des Großen viel Ziegen bei den Franken gab, so
waren sie doch ziemlich weniger zahlreich als die Schafe. Dies drückt
sich auch in dem uns erhaltenen Gesetzbuch der salischen Franken aus,
laut dem das Schaf an Zahl die Ziege bedeutend überwog.
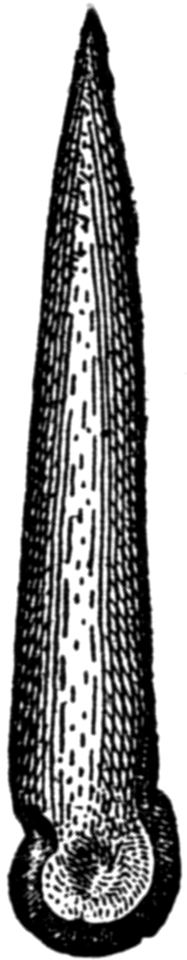
Bild 16. Ein zum Durchbohren der Felle gebrauchter
Pfriemen der neolithischen Pfahlbauern der Schweiz, der aus dem
Laufbein einer als Haustier gehaltenen Ziege verfertigt wurde. Auch
Dolche wurden aus solchen Knochen hergestellt. (4⁄9 natürl. Größe.)
Bei den alten Griechen und Römern war die Ziege als Nutztier fast so
beliebt als das Rind. Sie wurde besonders von der ärmeren Bevölkerung
als Milch- und Fleischlieferant gehalten, wie sie ja heute noch die
„Kuh des armen Mannes“ ist und als solche immer mehr zu Ehren gezogen
zu werden verdient. Besonders in der älteren griechischen Zeit war die
Ziegenzucht stark verbreitet. Zahlreiche uralte Namen, Abbildungen
auf Münzen und die häufige Erwähnung in Sagen und in den homerischen
Gesängen beweisen, daß ihr in älterer Zeit eine weit größere Bedeutung
zukam, als später in der klassischen Zeit, da sich die Schafzucht wegen
der Gewinnung der Wolle mehr in den Vordergrund drängte. Gleichwohl
wurde sie auch dann noch häufig besonders von den Ärmeren gehalten und
deren Milch nebst den Zicklein auf den Markt gebracht. Überall wurde
die Ziegenmilch auch von der städtischen Bevölkerung gern genossen und
aus dem Überschuß Käse bereitet. Der aus Spanien nach Rom gekommene
römische Ackerbauschriftsteller Columella schreibt um die Mitte des
ersten christlichen Jahrhunderts über das Halten von Ziegen: „Den
Ziegenbock (caper) und die Ziege (capella) hält man für
vorzüglich gut, wenn an ihrem Halse zwei sogenannte Glöckchen hängen
und wenn der Kopf klein ist. Man sieht es auch gern, wenn das Haar
glänzend und lang ist, so daß man es scheren und Mäntel für Soldaten
und Matrosen daraus anfertigen kann. Es ist besser, wenn das Ziegenvieh
keine Hörner hat, weil es mit ihnen nur Schaden anrichtet. Es bekommt
oft Zwillinge, auch Drillinge. Zur Zucht wählt man vorzugsweise das
stärkste Zicklein von Zwillingen, behandelt es im übrigen wie die
Schaflämmer. Die Mutterziegen schafft man im achten Jahre ab. —
Der Ziegenhirt muß ein rüstiger, ausdauernder Mann sein, der[S. 100] mit
Behendigkeit über Felsen klettert, durch Wildnis und Dorngebüsch
hindurchgeht, denn das Ziegenvieh ist rasch und kühn. Kann man die
Ziegenmilch nicht frisch zur Stadt schaffen, so verwandelt man sie in
Käse. Für den Handel macht man diesen von ganz frischer Milch, die man
durch Lab (aus zerkleinerten Mägen) von Schaf- oder Ziegenlämmern zum
Gerinnen bringt. Man setzt sie in die Nähe des Feuers, so daß sie warm,
aber nicht heiß wird, gießt sie, sobald die Käseteile festgeworden sind
und sich ausgeschieden haben, in dicht geflochtene Körbe und läßt die
Molken ablaufen, was man noch durch aufgelegte Gewichte befördert. Dann
nimmt man die Käse aus den Körben, bestreut sie mit pulverisiertem Salz
und preßt sie nochmals. Dies geschieht 9 Tage hindurch, dann wäscht
man sie mit reinem Wasser, legt sie an einen schattigen Platz so auf
Horden, daß einer den andern nicht berührt, und bewahrt sie später,
wenn sie mäßig trocken sind, an einem vor Luftzug gesicherten Orte auf.“
Columellas Zeitgenosse Plinius sagt in seiner Naturgeschichte, daß die
Ziege in seltenen Fällen sogar 4 Zicklein bekomme und im Negerland 11,
anderwärts aber meist nur 8 Jahre alt werde. „Kranke Augen kurieren
sich die Ziegen selbst, indem sie eine Binsenspitze hineinstechen
und sich so zur Ader lassen; die Böcke dagegen stechen sich einen
Brombeerstachel hinein. — Mutianus erzählt ein merkwürdiges, von ihm
selbst erlebtes Beispiel von der Klugheit dieser Tiere. Es begegneten
sich nämlich zwei auf einer sehr schmalen Brücke, und da sie weder
umeinander herum, noch zurück konnten, indem der Pfad zu eng und unter
ihm ein brausender Waldbach war, der sie zu verschlingen drohte, so
legte sich die eine nieder und die andere schritt über sie hinweg.
— Nicht alle Ziegen haben Hörner; allein wenn sie da sind, kann man
das Alter an der Zahl der Knoten erkennen. Die ungehörnten geben mehr
Milch. Man sagt, die Ziegen sehen nachts so gut wie am Tage, und Leute,
die am Abend schlecht sehen, müssen sich daher durch den Genuß von
Ziegenleber heilen. In Cilicien und um die Syrten werden die Ziegen
geschoren. Wenn die Sonne sich gesenkt hat, sollen sie sich auf der
Weide so lagern, daß sie einander nicht ansehen, zu andern Tageszeiten
aber so, daß sie sich ansehen, und zwar familienweise. Alle haben am
Kinn einen Bart, und wenn man eine am Barte faßt und fortzieht, so
sieht die ganze Herde staunend zu. Ihr Biß ist den Bäumen verderblich.
Den Olivenbaum machen sie schon durch bloßes Lecken unfruchtbar und
werden deshalb der Minerva nicht geopfert.“
[S. 101]
In seinem Buche über die Landwirtschaft schreibt der gelehrte Marcus
Terentius Varro (116–27 v. Chr.), selbst Besitzer schöner Landgüter:
„In den Gesetzen über die Kolonien steht geschrieben: Niemand soll
Ziegen (capra) da weiden lassen, wo junge Bäume oder Sträucher
stehen. An Saaten aller Art, namentlich aber an jungen Weinstöcken und
Ölbäumen, können Ziegen gefährlichen Schaden anrichten. Um nun die
Beeinträchtigung des Rebbaues durch sie zu sühnen, werden dem Gotte
Bacchus, der den Weinbau erfunden, Ziegenböcke geopfert; der Minerva
aber opfert man kein Ziegenvieh, weil es ihr wegen des Schadens, den
es den Ölbäumen verursacht, verhaßt ist. Nur einmal im Jahre wird
auf der Burg in Athen der Minerva eine Ziege geopfert, außerdem darf
sich dort keine sehen lassen.“ Weiterhin bemerkt er, daß die Ziegen
wie die Schafe in Herden von 50 bis 100 Stück gehütet werden, „doch
haben sie die Eigenschaft, daß sie lieber in Wäldern und auf Bergen
weiden als auf Wiesen; denn sie knuspern gern an Holzgewächsen. In
einem großen Teile Phrygiens werden die Ziegen geschoren, weil sie
lange Haare haben, und man verfertigt dort aus ihnen die sogenannten
cilicischen Kleider. In Cilicien soll man zuerst die Ziegen geschoren
haben.“ Schon Aristoteles im 4. Jahrhundert v. Chr. sagt in seiner
Tiergeschichte, in Lycien schere man die Ziegen gerade wie anderwärts
die Schafe, und Älian schreibt ca. 200 n. Chr.: „Tut man Ziegen zu
einer Schafherde, so gehen sie voran und führen dieselbe. Orthagoras
sagt in seinen Indischen Erzählungen, im Dorfe Koytha würden die Ziegen
mit getrockneten Fischen gefüttert.“ Jedenfalls lassen sich diese
Tiere unschwer an Fleischnahrung gewöhnen. So werden sie wie auch die
Kühe auf Island vielfach mit getrockneten Fischen gefüttert. Daß die
Ziegenhaare als Gespinstmaterial lange nicht so geschätzt waren als
die Schafwolle, beweist die übrigens auch in den Episteln des Horaz
vorkommende Redensart: über Ziegenhaare zanken im Sinne von: über Dinge
zanken, die dessen nicht wert sind.
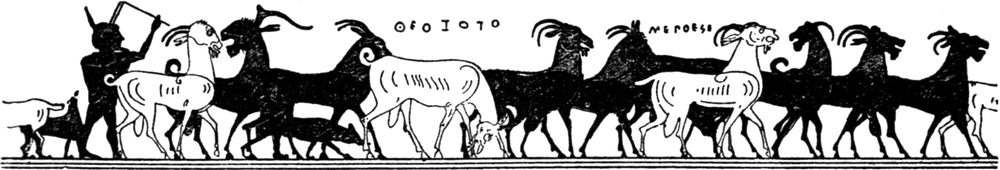
Bild 17. Von einem Hirten mit zwei Hunden getriebene
Ziegenherde von einem altgriechischen (böotischen) Henkelbecher des
Theozotos. (Im Louvre.)
[S. 102]
Das lange Verweilen im Haustierstande hatte schon damals zu
verschiedenen Rassen geführt und auch hornlose Arten hervorgehen
lassen. So tritt zur Römerzeit neben der altangesessenen kleinen
Hausziege noch eine zweite Form auf, die in den Kolonien der
Nordschweiz mehrfach Reste hinterließ und offenbar ziemlich
verbreitet war. Es ist dies eine zweifellos aus dem Mittelmeergebiet
stammende, durch bessere Lebenshaltung größere Ziege von gleichfalls
Bezoarziegenabstammung, mit bedeutend stärkeren Hörnern. Auch zeigen
die Hornzapfen im Verlauf und in der Oberflächenbeschaffenheit
deutliche Unterschiede, die sich auch späterhin genau verfolgen lassen.
Sie begegnet uns außer auf altgriechischen Münzen in bildlichen
Darstellungen, z. B. einer großen Silberpfanne aus Vindonissa
von zweifellos römischer Arbeit in Gestalt einer großhörnigen,
langbehaarten Ziege, die dann besonders zahlreich in Begleitung
römischer Kultur in das Gebiet nördlich der Alpen eindrang. Hier hat
sie sich wie der Molosserhund und das kurzköpfige Rind, die sich
zum Bernhardinerhund und zum Eringerrind umgestalteten, als ein
Relikt aus der Römerzeit ziemlich rein in den entlegenen Tälern des
Oberwallis in der schwarzhalsigen Walliserziege erhalten,
die ein ausgesprochenes Gebirgstier ist. Der kräftig gebaute Körper
trägt in beiden Geschlechtern im Vorderkörper eine tiefschwarze, im
Hinterkörper eine schneeweiße Behaarung, wobei die beiden Farben hinter
der Schulter in senkrechter, scharfer Begrenzung zusammenstoßen. Die
Klauen der Vorderfüße sind schwarz, diejenigen der Hinterfüße dagegen
weiß. Der Rücken ist vollkommen gerade, der Hals und der Kopf kurz, die
Stirne breit. Neuerdings wird diese Rasse vom Oberwallis aus stark nach
Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich verbreitet.
Durch Zucht bedeutend weniger verändert und der Wildform noch recht
nahe stehend ist die gemsfarbige Ziege von mittlerer Größe,
dabei von kräftigem Bau. Ihr ganzer Körper ist mit kurzen, gemsfarbenen
Haaren bedeckt, die auf dem Rücken und an den Schenkeln mitunter länger
werden. Außer dem schwarzen Rückenstreifen sind Gesicht, Vorderbrust
und Schultern ebenfalls dunkler gefärbt als der übrige Körper. Sie ist
vorzugsweise eine äußerst geschickt kletternde Bergziege, die in den
Zentralalpen sehr verbreitet ist, aber auch in anderen Gebirgsgegenden
Europas, so in den Pyrenäen, in Süditalien, Griechenland, Bosnien und
den Balkanländern, gehalten wird.
Während diese beiden Ziegenrassen der Wildform ähnliche Hörner tragen,
ist die hornlose Ziege als Kulturrasse offenbar aus der vorigen[S. 103]
hervorgegangen, und zwar schon im frühesten Altertum, da sie bereits
von den alten Griechen und Römern gehalten wurde und als besonders
milchergiebig galt. Diese zielbewußte Wegzüchtung des Gehörns ist hier
wie beim Rind sehr wohl begreiflich; denn dem Menschen mußten die
Hörner als Werkzeuge zu Zerstörung und Angriff bald unbequem sein,
und außerdem wollte er den Organismus des von ihm vor allen Gefahren
beschützten Haustiers vor aller Ausgabe von unnützem Bildungsstoff
bewahren. Der mittelgroße Körper dieser hornlosen Ziege weist
regelmäßige Formen auf mit verhältnismäßig langem Kopf, breiter Stirn
und aufrechten oder etwas hängenden Ohren. An ihrem Halse kommen häufig
glöckchenartige Anhängsel vor, die, wie wir hörten, bereits Columella
erwähnt. Die Behaarung ist fein, am Rücken und Schenkel verlängert;
die Färbung wechselt von Hellbraun bis zu Weiß. Stirn und Nasenrücken
sind meist hellbraun, auch kommt ein dunkler Rückenstreifen vor. Diese
Rasse ist in den schweizerischen Bergländern stark verbreitet. Am
geschätztesten ist die Toggenburger Ziege von brauner Färbung,
die aber als Rückschlagserscheinung bisweilen ein feines Gehörn
besitzt. Dieser Schlag gilt als sehr milchergiebig und wird aus dem
St. Galler Oberland stark nach Baden, Bayern, Sachsen und Holland
exportiert. Die ebenfalls hornlose Saanenziege ist rein weiß
oder gelblichweiß mit gleichfarbenem Flotzmaul und kommt in kurz- und
langhaarigen Abarten vor. Sie stammt vom Oberlauf des Flüßchens Saane
im Obersimmental (Berner Oberland) und hat sich über die ganze Schweiz
verbreitet, da sie durchschnittlich 4 Liter Milch täglich gibt. Auch
sie wird viel nach dem Auslande zur Aufbesserung der heruntergekommenen
Stallziege oder zur Reinzucht exportiert. So wird sie in Reinzucht vom
Ziegenzuchtverein in Pfungstadt gezogen und an Liebhaber in Deutschland
verkauft.
Alle diese europäischen Rassen werden hauptsächlich der Milchnutzung
wegen gehalten und verdienen in der Tat als Milchlieferanten der
ärmeren Bevölkerung die weiteste Verbreitung. Da, wo sie das ganze Jahr
im Stall bleiben und ohne sachgemäße Pflege behandelt werden, sind sie,
besonders im Tiefland, weitgehend degeneriert. In den Mittelgebirgen
dagegen, z. B. im Harz, wo sie wenigstens im Sommer auf die Weide
getrieben werden, haben sich mit dem freieren, naturgemäßeren Leben
schon bessere Schläge erhalten. Da aber, wo sie, wie in der Schweiz,
den größten Teil des Jahres im Freien zubringen und im Gebirge, ihrem
Lebenselement, herumklettern können und man ihrer Zucht von jeher
größere Aufmerksamkeit schenkte, da treffen wir[S. 104] die weitaus edelsten,
milchergiebigsten Rassen, die zur Reinzucht oder zur Auffrischung der
verkommenen Schläge des Tieflandes die weiteste Verbreitung verdienen.
Das hat man auch überall in Deutschland erkannt und handelt danach.
Wenn es gelänge, durch Verbesserung des in Deutschland vorhandenen
Ziegenmaterials von etwa 3 Millionen Stück einen Mehrertrag von auch
nur einem halben Liter Milch pro Exemplar und Tag zu erzielen, so
würde damit das Nationalvermögen in Deutschland nach Ulrich um nicht
weniger als 30 Millionen Mark jährlich erhöht. Deshalb sollten nicht
nur Private, sondern vor allem auch die Kommunen und der Staat zur
Veredlung dieses so nützlichen Haustieres das ihrige beitragen.
Mit vollem Recht schreibt der Direktor des Berliner Zoologischen
Gartens, Dr. Heck, im Tierreich: „In unserem Vaterland und den
anderen europäischen Ländern ist die Ziege zwar überall zahlreich
vorhanden, aber was sachgemäße Züchtung und Behandlung anlangt,
neben dem Geflügel entschieden das am meisten vernachlässigte
Haustier. In unserer zünftigen Landwirtschaft sieht man sie nicht
so recht für voll an; die ‚Kuh des armen Mannes‘ nennt man sie halb
scherzweise, halb verächtlich. Ich möchte aber diesen Spottnamen
vielmehr als einen Ehrennamen in Anspruch nehmen: Kann es denn etwas
Wichtigeres geben als ein milchergiebiges und billig zu haltendes
Haustier für den kleinen Mann, den kleinen Bauer, den Handwerker
und Tagelöhner auf dem Dorfe, den Fabrikarbeiter in der Vorstadt?!
Gerade heutzutage, wo durch den Zustrom nach den Städten immer größere
Massen des Volkes ins Proletariertum hinabsinken, das kein Heim
mehr hat und nichts mehr sein Eigen nennt! Wie wohl täte die fette
Ziegenmilch dem hohläugigen Armenkinde der Großstadt, das seinen
Hunger notdürftig mit minderwertiger Abfallsnahrung stillen muß! Das
ist freilich nicht zu verwundern, daß unter der ‚Pflege‘ der Armut
bei kargem Futter, in schlecht verwahrtem Stall aus der Hausziege die
fast sprichwörtliche ‚magere Zicke‘ wurde, deren Haltung kaum mehr
lohnt; um so verdienstlicher ist es aber, wenn seit einigen Jahren
landwirtschaftliche (Gräfin v. Mirbach-Sorquitten) und industrielle
Kreise (meine Landsleute Dettweiler und Ulrich) die Bedeutung der Ziege
für das Volkswohl erkannt und ihre Verbesserung energisch in die Hand
genommen haben.“
Verhältnismäßig selten wird in Deutschland die Ziegenmilch zu Butter
und Käse verarbeitet. Letzterer wird in Altenburg und anderswo,
besonders auch in der Schweiz, in bis tellergroßen Scheiben von
Finger[S. 105]dicke auf den Markt gebracht und mit Kümmel und Salz gewürzt
gegessen. Die bei der Gerinnung des Käsestoffs ablaufende zucker-
und nährsalzreiche grünlichgelbe Flüssigkeit, die Molke, wird noch
vielfach als Heilmittel für Brustkranke verwendet. Erwachsen kommt
die Ziege als Schlachttier wenig in Betracht, obschon die Haut ein
vorzügliches Leder für Damenschuhe und feinere Sattlerarbeiten
liefert und die Därme für Saiten von Musikinstrumenten sehr gesucht
sind. Schon Karl der Große befahl den Verwaltern seiner Güter, nicht
bloß Herden von Milchziegen, sondern auch von Böcken zu halten,
deren Hörner und Felle ihm abgeliefert werden sollten. Damals wurde
auch das Fleisch der Böcke gern gegessen, teils frisch, teils aber
geräuchert. Besonders aber dienten und dienen heute noch die Zicklein,
soweit man sie nicht aufziehen will, als leckerer Braten. Außer dem
trefflichen Fleisch liefern sie das beste Material für die Herstellung
von Glacéhandschuhen, für die allein aus der Schweiz nach Frankreich,
wo in Grenoble — dem alten Gratianopolis — in der Dauphinée das
Hauptzentrum für diesen Fabrikationszweig besteht, jährlich etwa 300000
Stück ausgeführt werden. Die Ziegenhaare werden nur noch ausnahmsweise
verarbeitet, dagegen dienen Ziegenfelle den Hirten auf Korsika und
Sardinien als Bekleidung.
Überhaupt ist die Hausziege am stärksten im gebirgigen Südeuropa von
Spanien bis Griechenland und Zypern vertreten und ist ihre Zucht
hier in manchen Gegenden wichtiger als die Schafzucht. Auch in den
Gebirgstälern der östlichen Karpathen, in Siebenbürgen, in den
österreichischen, schweizerischen und französischen Alpen ist die Ziege
ein gemeines Haustier. Nach Fankhauser beträgt in der Schweiz die Zahl
der Stallziegen etwa 180000, der Herdgeißen, die täglich ausgetrieben
werden, 164000 Stück und der während des Sommers in den Alpen
gesömmerten Ziegen ungefähr 65000 Stück. In Süd- und Mitteldeutschland
hat die Ziegenzucht in neuerer Zeit eine Zunahme erfahren, während sie
in Nordeuropa in Abnahme begriffen ist. Ganz unbedeutend ist sie in
England, etwas mehr in Schottland, reich dagegen in Irland vertreten.
In Frankreich läßt sich ein Rückgang ihrer Zucht feststellen, mit
Ausnahme der südlichen Departemente. In ganz Europa werden reichlich 20
Millionen Ziegen gehalten.
Wie in Europa finden sich die Ziegen von Bezoarabstammung auch in
Nordafrika und Westasien. Im tropischen Afrika sind sie zu einer
Kümmerform degeneriert, die wir als Zwergziege vom äußersten
Osten bis zur Westküste in verschiedenen Schlägen antreffen. Einzelne
der[S. 106]selben, wie besonders diejenigen Westafrikas, erinnern in ihrer
Färbung ganz an unsere gemsfarbige Ziege. Ihre dem heißen Klima
entsprechende kurze Behaarung ist rotbraun mit schwarzem Rückenstreifen
und dunkler Schulterbinde; andere neigen stark zu Leucismus, wie die
blendend weiße Somaliziege, die aber als Erbstück der Stammform
sehr häufig einen schwarzen Rückenstreifen sowie eine über die Stirn
und zwei über die Augen verlaufende dunkle Binden beibehalten hat.
Alle diese Zwergziegen sind kurzbeinig und gehörnt, doch bleibt das
Gehörn stets kurz. Ebenfalls ein kurzes, nach hinten und außen in
einem Halbbogen verlaufendes Gehörn mit meist scharfer vorderer Kante
hat die gleichfalls von der Bezoarziege stammende Mamberziege
Westasiens, deren Ausgangspunkt vermutlich Syrien ist, von wo aus deren
Zucht sich über den Orient verbreitete. Sie unterscheidet sich von
allen anderen Ziegenrassen durch die ungeheuer langen Hängeohren, die
die Kopflänge um das Doppelte übertreffen. Der gestreckte Kopf ist in
der Stirngegend sanft gewölbt, der Hals ziemlich lang, der Leib von
stattlicher Größe und hochgestellt. Die Behaarung erscheint am Kopf
kurz, am übrigen Körper sehr lang, zottig und seidenartig glänzend.
Die Färbung ist einförmig weiß, auch gelbbraun oder schwarz. Das
Verbreitungsgebiet dieser Ziegenrasse, die offenbar schon sehr alt
sein muß, da sie bereits Aristoteles bekannt war, erstreckt sich vom
Mittelmeer bis nach Persien und Mittelasien hinein. Hier grenzt an sie
eine andere, meist kleinere Ziegenrasse, die sich durch lange Behaarung
und schraubenartiges Gehörn auszeichnet und sich damit als Abkömmling
einer in den Bergen Afghanistans und Kaschmirs lebenden Wildziege, der
Schraubenziege oder des Markhor (Capra falconeri)
erweist. Es ist dies ein Gebirgstier von der Größe eines Steinbocks mit
gerade verlaufendem, korkzieherartig gedrehtem, zweikantigem Gehörn,
das eine Länge von 1,5 m erreicht und bei gewissen Varietäten
nach hinten und außen gebogen ist. Das fahlbraune Haarkleid ist auf dem
Rücken und am Vorderkörper stark verlängert. Ungleich den Steinböcken,
die sich an die schwer zugänglichen Felsenlabyrinthe des Gebirges
halten, liebt der Markhor Wälder mit felsigem Boden, in denen er sich
so viel wie möglich versteckt; nur gelegentlich kommt er auf offenes
Gelände hinaus. Wie andere Ziegen, gleich denen er in Herden lebt,
hält er sich mit Vorliebe an steilen Felsklippen auf. In Afghanistan,
wo Wälder meistens fehlen, wird er in steinigen Schluchten und an
steilen Berglehnen gefunden, von wo ihn nur starker Schneefall den
Tälern zutreibt. Er klettert vortrefflich und sein Weibchen[S. 107] bringt
im Mai-Juni 1 oder 2 Junge zur Welt. Wiederholt hat sich der Markhor
erfolgreich mit Hausziegen gepaart. Sein Verbreitungsgebiet erstreckte
sich früher wahrscheinlich weiter nach Westen und reichte vielleicht
bis zu den Bergen im Osten von Persien. Am frühesten tritt uns ein
Abkömmling dieser innerasiatischen Wildziege in einem in Nordbabylonien
ausgegrabenen Bronzekopf aus dem Anfang des zweiten vorchristlichen
Jahrtausends entgegen. Auch aus späterer Zeit sind Darstellungen oft
langhaariger Ziegen mit langem, schraubenartig gewundenem, geradem
Gehörn und Bart auf uns gekommen, so auf Bildern aus der ersten Hälfte
des letzten vorchristlichen Jahrtausends, auf denen assyrische Krieger
sie als Beute vor sich hertreiben. Durch ihre Schlappohren und die
geringe Größe erweisen sie sich als weitgehend durch Domestikation
veränderte Haustiere.
Diese Hausziege von Markhorabstammung drang dann mit der Zeit nach
Syrien und Ägypten vor, erhielt sich aber hier nicht rein, sondern
wurde weitgehend mit der Mamberziege gekreuzt. Diese Kreuzungsprodukte,
die sich teilweise durch Mopskopf und außerordentlich lange Ohren
auszeichnen, so daß letztere gelegentlich gestutzt werden müssen, damit
sie die Tiere nicht am Weiden hindern, sind heute von Ägypten über ganz
Vorder- und Mittelasien verbreitet.
In reiner Form hat sich die Hausziege von Markhorabstammung nur in
der Kaschmirziege erhalten, die die eigentliche Hausziege
Innerasiens ist. Auch sie ist gegenüber ihrem freilebenden Stammvater
bedeutend kleiner geworden. Sie ist ein gefällig gebautes Tier von
beinahe 1,5 m Gesamtlänge und 60 cm Schulterhöhe mit
einer ihrer kalten Heimat Tibet entsprechenden dichten Behaarung. Ein
langes, feines Grannenhaar überdeckt die kurze, flaumartig weiche
Wolle. Die Färbung wechselt, ist oft einfach weiß, gelb, braun oder
schwarz; häufig sind die Kopfseiten, der Hals und Kehlbart schwarz,
die übrigen Teile des Körpers aber silberweiß. Der gestreckte Leib
ist dick; der kurze Kopf trägt nicht sehr lange hängende Ohren und
in beiden Geschlechtern Hörner, die beim Männchen sehr lang und wie
bei der Stammform schraubenförmig gedreht sind, von der Wurzel an
auseinanderweichen und in schiefer Richtung auf- und rückwärts, beim
Weibchen dagegen fast gerade verlaufen. Ihr Stammland ist das Hochland
von Tibet von Ladak bis Lhassa. Von da an reicht ihr Verbreitungsgebiet
über Buchara bis zum Lande der Kirgisen einerseits und bis in die
Mongolei andererseits. Neuerdings wurde sie auch in das Gebiet der
Südabhänge des Himalaja nach Bengalen eingeführt. In Kaschmir[S. 108] selbst
lebt sie nicht, sondern dort wird nur ihre aus Tibet stammende Wolle zu
den feinen Kaschmirschals verarbeitet, die einst Weltruf besaßen und
früher als ein äußerst gesuchter Handelsartikel in Menge exportiert
wurden. Unter der Herrschaft des Großmoguls sollen 40000 Schalwebereien
in Kaschmir bestanden haben. Doch sank dieser wichtige Erwerbszweig im
Laufe des vergangenen Jahrhunderts so sehr herab, daß viele tausend
Menschen, denen die Weberei ihren Lebensunterhalt verschaffte, aus
Mangel an Arbeit aus dem Lande auswanderten.
Höchst schädigend auf diese Industrie wirkte die Tatsache, daß
Frankreich vor etwa hundert Jahren die Fabrikation dieser feinen
Wollwaren bei sich einführte. Der französische Arzt Bernier, der im
Jahre 1664 im Geleite des Großmoguls Kaschmir bereiste, erfuhr als
erster Europäer, daß zwei Ziegenarten, eine wild lebende und eine
gezähmte, solche Wolle liefern. Ein einzelnes Tier liefert 0,3–0,4
kg brauchbaren Wollflaums. Am gesuchtesten ist das reine Weiß,
das in der Tat den Glanz und die Schönheit der Seide besitzt.
Als Ternaux zu Beginn des 18. Jahrhunderts die Schalweberei in
Frankreich einführte, kam er auf den Gedanken, statt der teuren
Kaschmirwolle die Kaschmirziegen selbst zu beschaffen. Zur Erreichung
dieses Zweckes bot sich ihm ein gewisser Jaubert an, der sich 1818 nach
Odessa einschiffte. Hier erfuhr er, daß die Nomadenstämme zwischen
Astrachan und Orenburg Kaschmirziegen hielten; er reiste zu ihnen,
überzeugte sich durch genaue Untersuchung des Flaums von der Echtheit
der Tiere und kaufte 1300 Stück an. Diese Herde brachte er nach Kaffa
in der Krim, schiffte sich mit ihr ein und landete im April 1819 in
Marseille. Aber nur 400 Stück der Herde hatten die lange, beschwerliche
Seereise ausgehalten, und diese waren so angegriffen, daß man wenig
Hoffnung hatte, Nachzucht von ihnen zu erhalten. Namentlich die Böcke
hatten sehr stark gelitten und gingen in der Folge auch tatsächlich
ein. Glücklicherweise sandten darauf fast zu gleicher Zeit die
französischen Naturforscher Diard und Duvaucel einen kräftigen Bock
der Kaschmirziege, den sie in Indien zum Geschenk erhalten hatten, an
den Tiergarten zu Paris. Er wurde der Stammvater all der zahlreichen
Kaschmirziegen, welche gegenwärtig in Frankreich leben und diesem Lande
jährlich 16 Millionen Mark einbringen. Von Frankreich aus kam dann die
Kaschmirziege auch nach Österreich und Württemberg; doch erhielt sich
leider hier die Nachzucht nicht.
Eine hochgezüchtete Form der langhaarigen Mamberziege, die,[S. 109] wie wir
sahen, weitgehend Blut der Kaschmirziege in sich aufnahm, ist die
Angoraziege, ein schönes, großes Tier von gedrungenem Körperbau,
mit starken Beinen, kurzem Hals und Kopf, mit Hängeohren, aber nicht
korkzieherartig gewundenem Gehörn, wie sie es als teilweiser Abkömmling
der Kaschmirziege tragen könnte. Beide Geschlechter tragen Hörner. Die
des Bockes sind scharf gekantet und hinten stumpf zugespitzt, stehen
gewöhnlich wagrecht vom Kopfe ab und bilden eine weite, doppelte
Schraubenwindung, deren Spitze sich nach aufwärts richtet. Das Weibchen
trägt kleinere, schwächere, einfach gebogene, runde Hörner. Nur das
Gesicht, die Ohren und der unterste Teil der Beine sind mit kurzen,
glatt anliegenden Haaren bedeckt; der übrige Körper trägt eine überaus
reichliche, dichte, feine, weiche, seidenartig glänzende, lockig
gekräuselte Behaarung von meist gleichmäßiger weißer Farbe. Selten
zeigen sich auf dem weißen Grunde dunkle Flecken. Im Sommer fällt das
Vlies in großen Flocken aus, wächst aber sehr rasch nach. Französische
Züchter fanden, daß ein Vlies zwischen 1,25 und 2,5 kg wiegt.
Ihren Namen trägt diese Ziegenrasse nach der kleinen Stadt Angora im
türkischen Paschalik Anadoli in Kleinasien, der schon im Altertum
hochberühmten Stadt Ankyra. Ihre Heimatsgegend ist trocken und heiß
im Sommer, jedoch sehr kalt im Winter, obwohl dieser nur 3–4 Monate
dauert. Erst wenn es keine Nahrung mehr auf den Bergen gibt, bringt
man die Ziegen in schlechte Ställe; das ganze übrige Jahr müssen sie
auf der Weide verweilen. Sie sind höchst empfindlich, obwohl die
schlechte Behandlung nicht dazu beiträgt, sie zu verweichlichen. Reine,
trockene Luft ist zu ihrem Gedeihen eine unumgänglich notwendige
Bedingung. Während der heißen Jahreszeit wäscht und kämmt man das Vlies
allmonatlich mehrere Male, um seine Schönheit zu erhalten. Die Zahl
der in Anatolien gehaltenen Angoraziegen wird auf eine halbe Million
geschätzt. Auf einen Bock kommen etwa 100 Ziegen und darüber. Angora
allein liefert fast 1 Million kg Wolle, die einem Wert von 3,8
Millionen Mark entsprechen. Ein Teil davon wird im Lande selbst zur
Herstellung starker Stoffe für die Männer und feinerer für die Frauen,
sowie auch zu Strümpfen und Handschuhen verarbeitet, alles übrige geht
nach England. Man hat beobachtet, daß die Feinheit des Mohairs, wie man
diese Art Wolle bezeichnet, mit dem Alter seiner Erzeuger abnimmt.
Die erste Notiz, die auf Angoraziegen deutet, findet sich bei dem
Venezianer Barbaro, der 1471 diese Ziegen bei Sert östlich von
Diarbekr[S. 110] in Kleinasien antraf. Dort benutzte man deren Haare zur
Verfertigung eines feinen Wolltuchs, des Camelots, dessen Name
andeutet, daß es ursprünglich aus Kamelwolle hergestellt wurde. Dann
hat Bellon um 1580 diese weiße Wollziege in der Nähe von Konia,
dem alten Iconium, gesehen und erzählt 1589 in seinem in Antwerpen
erschienenen lateinischen Werke, daß sie noch nicht geschoren, sondern
nach dem älteren Verfahren gerupft werde. 1598 sah sie der deutsche
Harant auf Zypern und sagt, daß es damals schon welche in Böhmen gab.
Es scheinen dies nach Ed. Hahn die 1575 nach Wien gekommenen „Schafe
von Anguri“ gewesen zu sein, deren Zucht dann in den Kriegswirren
des folgenden Jahrhunderts unterging. Im 18. Jahrhundert hat sie
dann ein Mitglied der fürstlichen Familie von Lichtenstein wieder
eingeführt. 1725 hatten die Holländer sie am Kap der Guten Hoffnung zu
akklimatisieren versucht; 1740 hatte man sie in Schweden, 1771 in der
Pfalz und 1788 in Holland, England, Venezien usw. Zu derselben Zeit
bemühte sich Buffon um ihre Einführung in Frankreich, und in Südrußland
waren sie damals nach Pallas sogar sehr häufig. Aber alle diese
Kulturen verschwanden später wieder spurlos, teils durch Entartung der
Zuchttiere, teils aber auch weil die technische Verwendbarkeit der
Haare nicht den hohen auf sie gestellten Erwartungen entsprach.
Weniger edle Zuchten der Angoraziege als im trockenen Hochland findet
man an anderen Orten Kleinasiens bis in die Tartarei. Deren ebenfalls
feines, langes Haar wird regelmäßig geschoren und hauptsächlich nach
Konstantinopel ausgeführt und in europäischen Fabriken verwoben. Eine
Abart davon wird in Persien von den dort häufig gehaltenen großen,
schwarzen oder gefleckten Ziegen gewonnen, deren Wolle regelmäßig
geschoren und zu Teppichen verarbeitet wird. Die Bergvölker verwenden
zur Bereitung der von ihren Frauen gewebten Teppiche das Haar der
sogenannten Murgüsziege. In ganz Innerasien wird, wie oben
gesagt, die Kaschmirziege gehalten, deren langes Haar dort einen
wichtigen Handelsartikel bildet. In Tibet und in der Mongolei dient
das Tier auch als Transportmittel, indem man die Herden, mit Salz oder
einem andern Handelsartikel beladen, langsam weitertreibt. Nach Norden
hin verschwindet es und bildet bei den russischen Bauern in Sibirien
nur eine untergeordnete Rolle, ist dagegen in den Kaukasusländern stark
verbreitet. Seit dem Ende der 1880er Jahre gelangen als „japanische
Ziegenfelle“ ziemlich große Felle der langhaarigen Mongolenziege
über China zu uns.
[S. 111]
Wie in Afrika ist die Ziege auch in Südasien ein wichtiges Haustier. In
manchen Gegenden Ostindiens, wie besonders an der Malabarküste und bei
den Malaien der Sundainseln, trifft man eine eigentümliche Ziegenrasse
mit schafartigem Kopf, die von allen übrigen Rassen abweicht. Diese
hat jedenfalls ziemlich viel Blut vom Tahr (Hemitragus
jemlaicus) in sich, einer stattlichen, im Äußeren der echten Ziege
sehr ähnlichen Halbziege, die im Himalaja in Höhen von 2000–2300
m lebt, aber in einer Abart auch auf den Blauen Bergen vorkommt.
Dieses die hochgelegenen Bergwälder seiner Heimat bewohnende Tier
erreicht eine Schulterhöhe von 0,9–1,0 m und eine Körperlänge
von 1,45 m. Es hat einen langen Kopf mit schmalem, geradem
Gesicht und schwach quergerunzelte, stark zusammengedrückte 0,3–0,38
m lange Hörner, die sich von der Wurzel an auseinander und stark
nach rückwärts krümmen, an der Spitze jedoch einander etwas nähern.
Es ist am Kopfe kürzer, am Körper länger behaart und trägt als alter
Bock eine zottige Halsmähne. Die dunkelbraune Färbung geht im Gesicht
und an der Vorderseite der Gliedmaßen fast in Schwarz über, auch läuft
ein dunkles Längsband über den Rücken. Junge Tiere sind graubraun.
Gleich den echten Ziegen bildet auch der Tahr Herden, in denen sich
die im Winter paarenden Tiere, deren Weibchen im Juni oder Juli in der
Regel je ein Junges werfen, den größten Teil des Jahres über nach den
Geschlechtern getrennt halten. Da er sich leicht mit der Hausziege
paart und, wie mehrfache Versuche ergaben, unschwer zu zähmen ist,
ist das Auftreten von Bastarden, die zu neuer Rassenbildung führten,
durchaus verständlich. Ein solches Produkt ist die von Ostindien bis
Celebes gehaltene Malaienziege, ein hochbeiniges Tier mit
entschieden schafartigem Kopf, breiten, hängenden Ohren und einem mäßig
langen, im Bogen sich nach hinten wendenden, auffallend dicken Gehörn
mit gerundeten Kanten. Die Querwülste der Hornscheiden erscheinen
regelmäßig, breit und niedrig. Der wie derjenige des Tahr dunkelbraune,
kurzbehaarte Kopf mit schwarzer Stirnbinde und kastanienbraunen,
schwarz eingefaßten Ohren trägt lichtgelbbraune Augen, während der Leib
schwarz oder schiefergrau gefärbt und bald kurz, bald lang und zottig
behaart ist. Derselben Rasse gehört offenbar auch die kreuzhörnige
Ziege von Tibet an, bei welcher sich die Hornspitzen nach innen
wenden.
Amerika hat seine Ziegen durch die Europäer erhalten, und zwar waren
Spanier und Portugiesen, dann Engländer und Franzosen an deren Import
beteiligt. Erstere haben sie aus ihrer Heimat nach Süd[S. 112]amerika,
letztere dagegen nach Nordamerika gebracht. Nach Garcilasso kamen
sie bereits 1544 nach Peru. Bedeutend früher waren sie in Mexiko
eingeführt, das heute besonders in den nördlichen Staaten Ziegen in
großer Zahl züchtet, um deren an der Luft getrocknetes Fleisch und
Felle in den Handel zu bringen. In den Vereinigten Staaten ist die
Ziegenzucht beschränkt, doch hat sich neuerdings in Kalifornien die
Angorazucht eingebürgert. Auf den Antillen wird neben der von den
Spaniern importierten gemeinen Hausziege auch die von den Negersklaven
aus Westafrika mitgebrachte Zwergziege, die dem Tropenklima gut
angepaßt ist, gehalten. Ebenso ist es in Brasilien, wo die Zwergziege,
wie ihre westafrikanische Stammutter, kurzgehörnt ist und glatt
anliegendes gelbrotes Haar besitzt mit einem über den Rücken
verlaufenden schwarzen Streifen. Peru hat auffallenderweise heute nur
wenig Ziegen, dagegen sind sie in den gebirgigen Teilen Chiles und
Argentiniens zahlreich und hat dort die Verwertung von deren Fleisch
und Fellen einen ziemlichen Umfang angenommen.
Australien hat sein Ziegenmaterial erst zu Ende des 18. Jahrhunderts,
um 1788, zuerst aus Europa, dann aus Südasien erhalten; neuerdings
hat man dort auch Versuche mit der Einbürgerung der Kaschmir- und
Angoraziege gemacht, die im gebirgigen Südwesten von Erfolg begleitet
waren. Sehr gut eingelebt hat sich die Angoraziege in Neuseeland, deren
Bergweiden ihr vortrefflich zusagen. In den letzten Jahren hat sich der
Export ihrer Wolle aus jenem Lande bedeutend gehoben.
Da sich die Ziege gegenüber dem Schaf durch größere Selbständigkeit
auszeichnet, ist es erklärlich, daß sie sich gern selbständig macht
und dann verwildert. Als geschickt kletterndes Gebirgstier weiß sie
sich dabei geschickt den Verfolgungen von seiten des Menschen zu
entziehen. So gab es schon im Altertum wie heute noch verschiedene
schwach oder gar nicht von Menschen bewohnte Inseln im Mittelmeer und
im Persischen Meerbusen, ebenso manche Gebirgsgegenden des Festlandes,
die von solchen verwilderten Ziegen bewohnt waren. So spricht Varro
von wilden Ziegen der Insel Samothrake, wie auch von den Gebirgen
von Fiscellum und Tetrica in Italien, die zweifellos nur verwilderte
Hausziegen und keine wildlebenden Bezoarziegen waren. Verschiedene der
ägäischen Inseln und der Italien umsäumenden Eilande bargen schon im
Altertum solche verwilderte Ziegen; von andern, die ihren Namen davon
erhielten, wie Capreae (das heutige Capri) und Capraria (das heutige
Capreja bei Sardinien), sind sie heute verschwunden. Auch[S. 113] die von
Garibaldi nach seiner Internierung 1867 zurückgelassenen Ziegen traf
Heinrich v. Maltzan schon nach kurzer Zeit verwildert. Die meisten
wilden Ziegen von allen Mittelmeerinseln hat die nicht beständig von
Menschen bewohnte kleine Insel Tavolara bei Sardinien, auf der nach
Cetti bei Jagden im 18. Jahrhundert bis 500 Stück erlegt wurden. Auch
in Irland und Wales verwilderten in manchen Gebirgsgegenden Ziegen, die
dann in wenigen Generationen viel größere Hörner als ihre zahmen Ahnen
erhielten.
Von den afrikanischen Inseln sind eine ganze Reihe mit verwilderten
Ziegen besetzt. Die ältesten sind wohl diejenigen von Teneriffe, wo
sie die Flanken des Vulkanberges bewohnen und die dunkelbraune Farbe
des dortigen Gesteins angenommen haben. Von Fuerteventura, einer
andern der Kanaren, erwähnt sie J. v. Minutoli. Älteren Datums sind
auch die verwilderten Ziegen der Kapverden, die schon im Jahre 1576
sehr zahlreich waren. Der Naturforscher der Challengerexpedition,
Moseley, traf sie auf St. Vincent; auch dort hatten sie die Farbe des
umgebenden Gesteins angenommen und waren rotbraun geworden. Bald nach
der Entdeckung setzten Portugiesen — vielleicht 1509 Fernan Lopez —
Ziegen auf St. Helena aus, wo sie sich sehr rasch vermehrten, so daß
ein Einsiedler im 16. Jahrhundert deren jährlich etwa 500 schoß, um
von ihrem Fleisch zu leben, während er die Felle an ankehrende Segler
verkaufte. Thomas Herbert erzählt 1627, daß sie durch die beständigen
Nachstellungen von seiten des Menschen ungemein scheu und vorsichtig
geworden waren und, wie ihre wilden Vorfahren, Wachen ausstellten.
Zweifellos haben sie neben den verwilderten Schweinen das meiste dazu
beigetragen, nachdem diese Insel des einst sie bedeckenden Waldes
vom Menschen beraubt war, durch beständiges Abnagen der Knospen und
jungen Triebe den jungen Nachwuchs zu zerstören, so daß kein Baumwuchs
mehr aufkam und das Eiland zu dem öden Felsen wurde, als der er uns
heute entgegentritt. Auch Tristan da Cunha, Inaccessible, Mauritius,
Réunion (schon 1691 bei der Anwesenheit Leguats), die kleine verlassene
Inselgruppe Amsterdam und St. Paul, wie auch Sokotra bergen in den
Gebirgen des Innern verwilderte Ziegen, die vollkommene Wildfärbung
mit Ausmerzung aller hellen Töne angenommen haben. Gleicherweise gibt
es in der Inselwelt der Südsee da und dort verwilderte Ziegen, so
u. a. am Mauna Loa auf Hawaii, noch von Vancouver herrührend. Besonders
bekannt sind die verwilderten Ziegen auf der Insel Juan Fernandez
durch Defoes Robinson geworden. Diese waren von Juan Fernandez[S. 114] selbst
bei der Entdeckung der Insel im Jahre 1563 ausgesetzt worden. Durch
diese Wildziegen bot die Insel in der Folge allen möglichen Piraten-
und Kaperschiffen eine bequeme Ruhe- und Verproviantierungsstation;
so haben sie auch dem Urrobinson Alexander Selkirk, dem Seefahrer
Dampier und andern Fleisch geliefert. Im 17. Jahrhundert sollen
französische Seeräuber dort sogar einen regelrechten Herdenbetrieb
eingerichtet haben. Um den Piraten diese angenehme Fleischversorgung
abzuschneiden, setzte die spanische Regierung 1675 Hunde auf der Insel
aus, die sich aber nicht bewährten; denn die Ziegen flüchteten sich
in die unzugänglichsten Teile der Insel, wohin ihnen die Hunde nicht
folgen konnten. Als dann die Hunde durch Nahrungsmangel umgekommen
waren, vermehrten sich die Ziegen wieder ungestört. Sie sollen
lange, weiche Haare besitzen. Auch auf der Schwesterinsel Masa fuera
gibt es verwilderte Ziegen. Auf den Galapagos sind sie, durch die
dort vorhandenen wilden Hunde beschränkt, nur gering an Zahl. Auf
den Falklandsinseln, wo es wilde Pferde und wilde Rinder gibt, die
aus einer von Argentinien ausgesandten verunglückten Kolonisation
hervorgingen, fehlen wilde Ziegen, da die Spanier bei der Besiedelung
der Insel offenbar keine solchen mitgebracht hatten.
Da die Ziege durch ihre besondere Neigung zu Knospen und jungen Trieben
von Holzgewächsen überall dem Waldnachwuchse verhängnisvoll wird, sah
sich schon 1567 das Parlament von Grenoble gezwungen, in einem großen
Bezirk der Dauphinée das Halten der Ziegen ganz zu verbieten. Doch war
diese Maßregel undurchführbar, da die Leute dort eben einfach nicht
ohne die Ziege und deren Milch leben können. So ging die Waldzerstörung
ruhig weiter, bis die ganze Gegend zu jener kahlen, alles Kulturlandes
baren Felswildnis wurde, die zu verhängnisvollen Überschwemmungen und
Murbrüchen Veranlassung gab. Auch in Italien, Istrien, Griechenland,
Kreta, Zypern, Kleinasien und Syrien, die einst reichbewaldete
Gebiete waren, ist der Baumwuchs durch die Sorglosigkeit des Menschen
verschwunden. Und wenn auch da, wo infolgedessen der Humus nicht
weggeschwemmt wurde, neuer Wald wachsen könnte, kommt er überall dort
nicht auf, wo die Ziegen weiden und die jungen Baumpflanzen zugrunde
richten.
Außer den drei genannten ist keine der andern, übrigens auf die
gebirgigen Gegenden der Alten Welt beschränkten Wildziegen gezähmt und
in den Dienst des Menschen gestellt worden. Einzig der Steinbock
(Capra ibex), der in unsern Alpen auszusterben droht, ist mit
der Hausziege gekreuzt worden, um sein Dahinschwinden aufzuhalten.[S. 115]
Alle Steinbockarten der europäischen wie der asiatischen Gebirge haben
als echte Hochgebirgstiere ihren Ausgang von Hochasien genommen, wo
der sibirische Steinbock (Capra sibirica) der Stammform
wohl am nächsten steht. Sein Verbreitungsgebiet erstreckt sich über
das sämtliche Hochgebirge Zentralasiens von Sibirien bis zum Himalaja.
Das Steinwild bildet Rudel von verschiedener Stärke, zu denen sich die
alten Böcke nur während der Paarungszeit gesellen, während sie den
übrigen Teil des Jahres ein einsiedlerisches Leben führen. Die Ziegen
und Jungen leben zu allen Jahreszeiten in einem niedrigeren Gürtel
als die Böcke, bei denen der Trieb nach der Höhe so ausgeprägt ist,
daß sie nur Nahrungsmangel und grimmige Kälte zwingen kann, tiefer
herabzusteigen. Mit bewunderungswürdiger Leichtigkeit und geradezu
unverständlicher Sicherheit klettern sie über die steilen Felswände und
springen über tiefe Abgründe von einer Klippe zur andern.
Früher, als es noch Steinböcke in unsern Alpen gab, paarten sie
sich nicht selten freiwillig mit den auf den Alpenweiden grasenden
Hausziegen. Die so erzielten Bastarde werden bald äußerst wilde,
zudringliche Tiere, die dem Menschen keine Ruhe lassen, bis er sich
ihrer auf irgend welche Weise entledigt. Aber selbst das Aussetzen
dieser starken Tiere hat seine großen Schwierigkeiten. Echte
Alpensteinböcke gibt es nur noch in einem vom Könige von Italien
gehegten savoyischen Revier zwischen Monte Rosa und Mont Blanc. Nach
den Kulturüberresten der Pfahlbauzeit lebte er damals noch in den
Voralpen. Zur Römerzeit konnten noch hundert und mehr auf einmal für
die Kampfspiele der Arena lebendig gefangen werden. So berichtet Julius
Capitolinus, daß Kaiser Gordian im Jahre 242 für die Jagdspiele 200
Steinböcke (ibex) aus den Alpen nach Rom schaffte, und bei
Flavius Vopiscus lesen wir, daß Kaiser Probus (reg. 276–282) zu den
Jagdspielen zahlreiche Steinböcke nach Italiens Hauptstadt befördern
ließ. Durch die rücksichtslose Jagd seit Erfindung der weitreichenden
Schießgewehre ist dieses edle Wild heute fast überall ausgerottet
worden. Seit hundert Jahren ist es in der Schweiz erloschen; in
Salzburg und Tirol verschwand es noch ein Jahrhundert früher.
Wohl bald nach der Ziege trat das Schaf in den Haustierstand
des Menschen ein, überflügelte dann aber im Laufe der Zeit jene an
wirtschaftlicher Bedeutung weit. Vielerorts ist es dem Gebirge, in dem
seine Ahnen einst heimisch waren, getreu geblieben und erscheint dort
meist in Gesellschaft der Ziege. Daneben hat es in der Gefolgschaft des
Menschen in ungeheuren Scharen die trockenen Steppengebiete vornehmlich
der Alten Welt bevölkert und ist hier zu einem eminenten Faktor im
Haushalte des Menschen geworden, von dem sein Dasein in vielen Fällen
geradezu abhängt. Daß der Erwerb dieses überaus genügsamen Haustieres
schon in recht früher Vorzeit stattgefunden haben muß, dafür sprechen
außer der weiten geographischen Verbreitung zu Beginn der historischen
Periode die Spaltung in zahlreiche, stark voneinander abweichende
Rassen und vor allem die völlige Umgestaltung des geistigen Charakters,
die durch Vererbung so sehr gefestigt ist, daß keinerlei Rückschlag
in die psychische Regsamkeit der wilden Ahnen möglich erscheint. So
sehr hat es infolge der vielhundertjährigen Bevormundung durch den
Menschen im Gegensatz zur Ziege alle eigene Initiative eingebüßt, daß
es sein willenloses Werkzeug geworden ist. Wir begreifen daher, wenn
Brehm seinen Charakter in folgender Weise schildert: „Das Hausschaf
ist ein ruhiges, geduldiges, sanftmütiges, einfältiges, knechtisches,
willenloses, furchtsames und feiges, kurzum ein langweiliges Geschöpf.
Besondere Eigenschaften vermag man ihm kaum zuzusprechen; einen
Charakter hat es nicht. Es begreift und lernt nichts, weiß sich
deshalb auch allein nicht zu helfen. Nähme es der eigennützige Mensch
nicht unter seinen ganz besonderen Schutz, es würde in kürzester Zeit
aufhören zu sein. Seine Furchtsamkeit ist lächerlich, seine Feigheit
erbärmlich. Jedes unbekannte Geräusch macht die ganze Herde stutzig,
Blitz und Donner, Sturm und[S. 117] Unwetter überhaupt bringen sie gänzlich
aus der Fassung und vereiteln nicht selten die größten Anstrengungen
des Menschen.“
In den Steppen von Rußland und Asien haben die Hirten oft viel zu
leiden. Bei Schneegestöber und Sturm zerstreuen sich die Herden, rennen
wie unsinnig in die Steppe hinaus, stürzen sich in Gewässer, selbst in
das Meer, bleiben dumm an einer und derselben Stelle stehen, lassen
sich widerstandslos einschneien und erfrieren, ohne daß sie daran
dächten, irgendwie vor dem Wetter sich zu sichern oder auch nur nach
Nahrung umherzuspähen. Zuweilen gehen Tausende an einem Tage zugrunde.
Auch in Rußland benutzt man die Ziege, um die Schafe zu führen; allein
selbst sie ist nicht immer imstande, dem dummen Tiere die nötige
Leitung angedeihen zu lassen. Beim Gewitter drängen sie sich dicht
zusammen und sind nicht von der Stelle zu bringen. „Schlägt der Blitz
in den Klumpen,“ sagt Lenz, „so werden gleich viele getötet; kommt
Feuer im Stalle aus, so laufen die Schafe nicht hinaus und rennen wohl
gar ins Feuer. Ich habe einmal einen großen, abgebrannten Stall voll
von gebratenen Schafen gesehen; man hatte trotz aller Mühe nur wenige
retten können.“ Das beste Mittel, Schafe aus ihrem brennenden Stalle
zu retten, bleibt immer, sie durch die ihnen bekannten Schäferhunde
herausjagen zu lassen.
In gewissem Grade bekundet freilich auch das Schaf geistige Befähigung.
Es lernt seinen Pfleger kennen, folgt seinem Rufe und zeigt sich
einigermaßen gehorsam gegen ihn, scheint Sinn für Musik zu haben, hört
mindestens aufmerksam dem Gedudel des Hirten zu, empfindet und merkt
auch Veränderungen der Witterung vorher. Diese Unselbständigkeit des
Schafes hat auch zur Folge, daß es niemals, sich selbst überlassen,
wie die Ziege verwildert, sondern stets hilflos zugrunde geht. Seine
grenzenlose Dummheit trug auch schuld daran, daß früher, solange
es auch bei uns welche gab, Wölfe so schlimm unter diesen Tieren
hausten, wenn sie einmal eine Schafherde überfielen oder die Hürden
durchbrachen. Diesen Stumpfsinn muß es schon vor 2000 Jahren besessen
haben; denn Plinius sagt in seiner Naturgeschichte: „Das Schafvieh ist
ausgezeichnet dumm. Scheut sich die Herde irgendwohin zu gehen, so
braucht man nur eins am Horne hinzuziehen, so folgen die andern alsbald
nach.“
Das Schaf liebt trockene und hochgelegene Gegenden mehr als niedere und
feuchte. Am besten gedeiht es, wenn es verschiedenerlei getrocknete
Pflanzen haben kann. Getreidefütterung macht es zu fett und schadet
der Güte der Wolle. Salz liebt es sehr, und frisches Trink[S. 118]wasser ist
ihm ein unentbehrliches Bedürfnis. Die alten Römer ließen ihre Schafe
zwischen Mai und Juni zur Paarung; in unsern nördlicheren Breiten
geschieht dies von September bis Oktober. Dann werden die Lämmer, weil
das Schaf 144–150 Tage trächtig geht, in der zweiten Hälfte des Februar
geworfen und bekommen bald gutes, frisches Futter. Gewöhnlich bringt
das Mutterschaf nur ein einziges Lamm zur Welt; zwei Junge sind schon
ziemlich, drei sehr selten. Anfangs müssen die kleinen Tiere sorgfältig
gegen Witterungseinflüsse geschützt werden, später dürfen sie mit auf
die Weide gehen. Im ersten Lebensmonat brechen die Milchzähne durch,
im sechsten Monat stellt sich der erste bleibende Backenzahn ein, im
zweiten Lebensjahre fallen die beiden Milchschneidezähne aus und werden
durch bleibende ersetzt; erst im fünften Jahre werden die vorderen
Milchbackenzähne gewechselt und ist damit das Zahnen beendet. Das
Schaf kann 14 Jahre alt werden, doch fallen ihm schon im 9. oder 10.
Jahre die meisten Zähne aus, wodurch es unbrauchbar wird, weshalb es
dann so rasch als möglich gemästet und geschlachtet werden muß. Alle
Schafrassen lassen sich leicht untereinander kreuzen und pflanzen
sich ohne Schwierigkeit fort; deshalb läßt sich das Schaf leicht
veredeln. Es ist Wollieferant, aber auch hervorragendes Fleischtier
geworden, selbst als Milchtier hat es an manchen Orten eine gewisse
Bedeutung erlangt; daneben wird es auch zum Tragen von Lasten benutzt.
In einzelnen Kulturkreisen, besonders da, wo eine Abneigung gegen das
Schwein vorhanden ist, wird es speziell auf Fett gezüchtet. In diese
letzte Kategorie gehören die bei allen Nomaden Asiens und Afrikas so
beliebten Fettschwanz- und Fettsteißschafe.
Erst neuerdings ist einige Klarheit in die Herkunft der verschiedenen
Schafrassen gekommen, die aus vier Quellen, nämlich einer
nordostafrikanischen, einer westasiatischen, einer zentralasiatischen
und einer südeuropäischen hervorgingen. Der Bildungsherd der ganzen
Schafgruppe, die sich in geologisch gesprochen erst neuerer Zeit vom
Stamme der Antilopen abzweigte, liegt offenbar in Asien, von wo sich
die einzelnen Glieder über die gebirgigen Teile von Asien, Europa und
das westliche Nordamerika verbreiteten. Alle Wildschafe sind echte
Gebirgstiere, die sich nur in bedeutenden Höhen wohlzufühlen scheinen
und teilweise über die Schneegrenze emporsteigen. Als solche sind
sie geistig begabt, sie schätzen die Gefahr ab und verteidigen sich
mit Mut. Die meisten derselben lassen sich, jung eingefangen, ohne
Mühe zähmen und behalten ihre Munterkeit wenigstens durch einige
Geschlechter bei,[S. 119] pflanzen sich auch regelmäßig in der Gefangenschaft
fort. An Leute, die sich viel mit ihnen abgeben, schließen sie sich
innig an, folgen ihrem Rufe, nehmen gern Liebkosungen an und können
einen so hohen Grad von Zähmung erlangen, daß sie mit andern Haustieren
auf die Weide gesandt werden dürfen, ohne solch günstige Gelegenheit
zur Erlangung ihrer Freiheit zu benützen. Ihr Haarkleid ist ein nicht
sehr langes, etwas grobes Grannenhaar, unter welchem im Herbst zum
Schutze gegen die Kälte ein Wollkleid hervorsproßt, das im Frühjahr in
Fetzen und Flocken abgelöst und durch Schütteln des Tieres entfernt
wird. Unter dem Einfluß der künstlichen Züchtung hat sich bei den
Hausschafen ein dauerndes, vliesartiges Wollkleid entwickelt, das
den Wildschafen, aber auch gelegentlich zahmen Schafen fehlt. Ihr
Schädel erscheint an der Stirn abgeflacht und trägt ein im Querschnitt
dreikantiges Gehörn, das spiralig verläuft und bei den Böcken stark,
bei den Weibchen nur schwach oder gar nicht ausgebildet ist. Das Euter
der letzteren ist vierzitzig.
In Mitteleuropa erscheint das Hausschaf bereits in neolithischer Zeit,
und zwar in einer merkwürdig kleinen Art, mit einer Schädelbildung
und Hörnern, die mehr ziegenartig sind und an unsere heutigen
Halbschafe erinnern. Es ist dies das Torfschaf (Ovis aries
palustris), nach dem Finden seiner Überreste in den meist in
vertorftes Gelände eingebetteten Pfahlbauüberresten so genannt. Schon
L. Rütimeyer fiel es auf, daß seine Reste in den ältesten Pfahlbauten
noch spärlich sind und erst später häufiger werden. Diese Tatsache
konnte Th. Studer bestätigen. Erst mit der Bronzeperiode macht sich ein
entschiedener Aufschwung der Schafzucht bemerkbar, indem damals zum
erstenmal statt der althergebrachten Fell- und Pelzkleidung leichtere
und angenehmer zu tragende Wollkleider bei den Bewohnern Mitteleuropas
aufkamen, unter denen man allerdings ein grobgewebtes leinenes Hemd zu
tragen pflegte.
Das Torfschaf der Neolithiker Mitteleuropas war ein kleines, fast
zwergartiges Schaf mit feinen, schlanken Extremitäten, langgestrecktem,
schmalem Schädel, wenig gewölbter Stirnfläche und zweikantigen
ziegenartigen Hörnchen. Die Augenhöhlen traten verhältnismäßig wenig
vor. Im Jahre 1862 machte dann L. Rütimeyer die überraschende Tatsache
bekannt, daß das Torfschaf der Pfahlbauern noch nicht ganz erloschen
sei, sondern in einem direkten und nur wenig abgeänderten, aber jetzt
im Aussterben begriffenen Abkömmling in dem Bündner- oder
Nalpserschaf weiterlebe. In dem vom Weltverkehr[S. 120] abgelegenen
Bündner Oberlande hat sich dieses lebende Überbleibsel der schon
längst abgelaufenen Pfahlbauzeit, nebst den Nachkommen des sonst
überall verschwundenen Torfschweines der Neolithiker, bis auf unsere
Tage erhalten. Die osteologische Übereinstimmung der Schädel beider
Schafarten ist in der Tat eine höchst frappante. Die wichtigsten,
wohl durch Domestikationsveränderungen zu erklärenden Abweichungen
bestehen in einer ziemlich deutlichen Wölbung der Stirn und in einem
weniger steilen Abfall des Hinterhauptes. Die knöchernen Hornzapfen
sind bei beiden identisch, doch scheint das darauf gewachsene Gehörn
beim Nalpserschaf etwas kleiner geworden zu sein. Die Ohren sind bei
letzterem abstehend, verhältnismäßig klein, aber sehr beweglich. Das
Wollkleid ist dicht, aber wenig lang, so daß der Wollertrag ungünstig
ausfällt. Die vorherrschende Färbung desselben ist silbergrau,
eisengrau, dunkelbraun bis ganz schwarz. Dunkle Exemplare haben häufig
einen weißen Kopfstern und weiße Abzeichen an Schwanz und Füßen.
Der durch fortgesetzte planmäßige Zuchtwahl bei den übrigen moderneren
Schafrassen erzielte Leucismus ist also bei diesem noch nicht erreicht
worden. Das durchschnittliche Lebendgewicht desselben beträgt 28
kg. Der geistige Charakter der Tiere nähert sich als überaus
altertümliches Merkmal demjenigen der Ziege. An Lebhaftigkeit in den
Bewegungen, an Zutraulichkeit und natürlicher Intelligenz übertrifft
diese Rasse alle andern Schafrassen. Während Rütimeyer noch Herden
derselben aus den Nalpser Alpen erwähnt, hatte C. Keller 40 Jahre
später (im Sommer 1900) Mühe, in Disentis noch ein gutes Exemplar
reiner Rasse aufzutreiben. Am meisten soll diese Rasse zurzeit noch
in den Vriner Alpen angetroffen werden, geht aber auch dort ein, da
sie nach den Mitteilungen des bündnerischen Alpinspektors Solèr in
Vrin gegenwärtig stark mit Walliserschafen gekreuzt wird. Nur wenige
Ställe wiesen 1902 noch reines Blut auf. Keller hat damals noch eine
kleine Kolonie reinrassiger Tiere beziehen können, die gegenwärtig
im Tierpark des Sihlwaldes bei Zürich angesiedelt sind. Eine zweite
Kolonie dieser letzten Mohikaner hat man in Flims untergebracht, um
auch in Bünden noch eine Zuchtfamilie zu erhalten. Übrigens sollen auch
einzelne primitive Schafrassen Irlands Zusammenhänge mit dem alten
Torfschaf aufweisen. Auch wäre es möglich, in den abgelegenen Bergen
Albaniens noch Überreste dieser sonst überall als an Wolle quantitativ
und qualitativ minderwertigen und deshalb abgeschafften Schafrasse
zu finden, worauf hiermit etwaige Reisende aufmerksam gemacht werden
sollen.
Tafel 21.

Mähnenschaf im Tierpark Hellabrunn zu München.
(Nach einer Photographie von M. Obergaßner.)

(Copyright by M.
Koch, Berlin.)
Muflon.
Tafel 22.

Schieferplatte der vorhistorischen Negadazeit Ägyptens im
Museum von Gizeh, oben mit Darstellungen eines bantengartigen Hausrindes,
darunter von Eseln mit dem Schulterkreuz und zu unterst von sehr altertümlichen
Hausschafen, die schon durch die noch vorhandene Halsmähne als Abkömmlinge des
Mähnenschafes gekennzeichnet sind.
⇒
GRÖSSERES BILD
Tafel 23.

Altägyptische Darstellungen von Stieren und Widdern aus
Sakkarah, 26. Dynastie, 663–526 v. Chr.
⇒
GRÖSSERES BILD
Tafel 24.
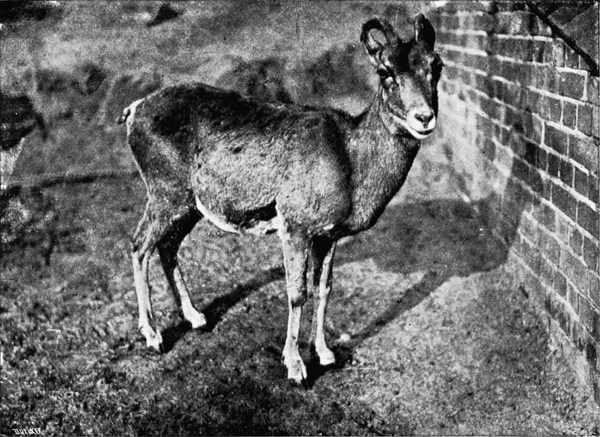
Steppenschaf (Ovis arkal)
(Nach Keller, Die Abstammung der ältesten Haustiere.)
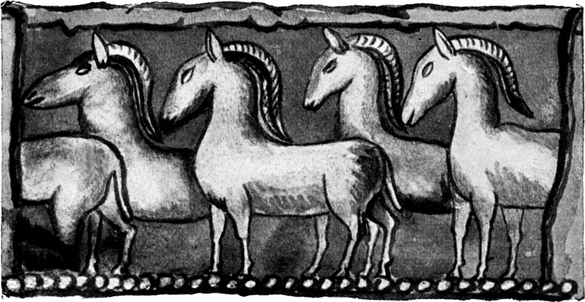
Mykenische Schafe auf einer Elfenbeinschnitzerei von Menidi.
(Nach Perrot und Chippiez.)
[S. 121]
Schon Rütimeyer hatte die Abstammung des Torfschafes vom
nordafrikanischen Mähnenschaf (Ovis tragelaphus)
vermutet, aber sein Material war noch zu dürftig, um diesen Beweis
zu erbringen. Namentlich fehlten ihm die vermittelnden Glieder,
die nun der Züricher Zoologe Prof. Konrad Keller so glücklich war,
aufzufinden. Wir wissen nun, daß tatsächlich das Mähnenschaf der
wichtigste Stammvater des neolithischen Torfschafes ist. Es verdient
daher hier an erster Stelle besprochen zu werden. Es ist das äußerlich
ziegenähnlichste Wildschaf, das über das ganze nordafrikanische Gebirge
verbreitet zu sein scheint. Es ist ein stattliches Tier von oft über 90
cm Schulterhöhe und mit trefflicher Schutzfärbung den gelblichen
Kalkfelsen seiner Heimatberge angepaßt. Es hält sich hier immer an der
der Wüste zugewandten Seite auf. Mehrere Tage kommt es ohne Wasser aus.
Da es aber schließlich gezwungen ist, von Zeit zu Zeit zur Tränke zu
gehen, alle Tränken jedoch von den Beduinen mit ihren Ziegenherden in
Anspruch genommen werden, hat es, um zum Ziele zu kommen, die Kunst
des Versteckens in ungewöhnlichem Grade ausgebildet. Die arabischen
Beduinen, die es oft genug hören, ohne es zu sehen, nennen es Arni,
wir dagegen gaben ihm den Namen Mähnenschaf, weil das sonst kurze,
graugelbe, bei alten Böcken dunklere, schwärzlich gesprenkelte Fell vom
Kinne ab sich zu einer im männlichen Geschlecht schließlich bis zur
Erde herabwallenden, im weiblichen dagegen nur schwach ausgebildeten
Vorderhalsmähne entwickelt. Verlängerte Haarbüschel hängen auch an
den Vorderläufen vom Ellbogen herab. Daher der französische Name
mouflon à manchettes. Die meisten von uns kennen dieses Tier aus
den zoologischen Gärten, in denen es sich gut halten läßt und leicht
fortpflanzt! Nicht nur das geradlinige Profil, das dunkelgefärbte,
verhältnismäßig hochstrebende Gehörn und der gerade ausgestreckte,
flache, unterseits nackte, oben büschelförmig behaarte Schwanz geben
ihm, besonders im weiblichen Geschlecht, etwas Ziegenartiges, sondern
es fehlen ihm auch wie bei diesen im Gegensatz zu den übrigen Schafen
Tränengruben und Tränendrüsen.
Bereits im Jahre 1561 beschrieb Cajus Britannicus das Mähnenschaf,
dessen Fell ihm aus Mauretanien gebracht worden war. Erst im 19.
Jahrhundert erwähnten es wieder Pennaut und später Geoffroy. Letzterer
fand es in der Nähe von Kairo im Gebirge auf; andere Forscher
beobachteten es am oberen Nil und in Abessinien. Am häufigsten scheint
es noch im Atlas aufzutreten. Der Franzose Buvey schreibt über
dieses Tier: „Das Mähnenschaf wird im südlichen Algerien[S. 122] von den
Einheimischen im allgemeinen Arni genannt. Unzweifelhaft wird es in den
höheren Teilen des Gebirges, im marokkanischen Atlas, noch häufiger
sein als in Algerien, da Abgeschiedenheit vom menschlichen Verkehr,
welche jenen Teil des Gebirges auszeichnet, einem Wiederkäuer nur
zusagen kann.
Das Mähnenschaf liebt die höchsten Felsengrate der Gebirge, zu denen
man bloß durch ein Wirrsal zerklüfteter Stein- und Geröllmassen
gelangen kann; deshalb ist seine Jagd eine höchst mühselige, ja oft
gefährliche. Dazu kommt, daß sie nicht viel Gewinn verspricht; denn es
lebt meist einzeln, und nur zur Paarungszeit, welche in den November
fällt, sammeln sich mehrere Schafe und dann auch die Böcke, halten
einige Zeit zusammen und gehen hierauf wieder auseinander ihres Weges.
Die Araber sind große Liebhaber des Fleisches dieser Wildschafe. Das
Fleisch steht dem des Hirsches sehr nahe. Aus den Fellen bereiten die
Araber Fußdecken; die Haut wird hier und da gegerbt und zu Saffian
verwendet.
Obwohl das Mähnenschaf zu den selteneren Tieren gezählt werden muß,
wird es doch manchmal jung von den Gebirgsbewohnern in Schlingen
gefangen und dann gewöhnlich gegen eine geringe Summe an die
Befehlshaber der zunächstliegenden Militärstationen abgegeben. Im
Garten des Gesellschaftshauses zu Biskra befand sich ein solches
junges Tier, das an einer 5 m hohen Mauer, der Umzäunung seines
Aufenthaltsortes, mit wenigen, fast senkrechten Sätzen emporsprang,
als ob es auf ebener Erde dahinliefe, und sich dann auf dem kaum
handbreiten First so sicher hielt, daß man glauben mußte, es sei völlig
vertraut da oben.“
Irgendwo in Oberägypten muß in frühneolithischer Zeit dieses
Mähnenschaf gezähmt und in den Haustierstand erhoben worden sein.
Eine Schieferplatte des Museums von Gizeh aus der vorägyptischen
Negadazeit aus der Mitte des vierten vorchristlichen Jahrtausends
zeigt neben Rind und Esel starkgehörnte Hausschafe, die nach Keller
wegen der noch vorhandenen Halsmähne ihrer Herkunft nach direkt auf
das Mähnenschaf zurückweisen. Dieses Hausschaf der Negadazeit leitet
direkt zum ältesten Hausschaf der Ägypter des Alten Reiches (2980 bis
2475 v. Chr.) über, das auch in späterer Zeit, so in Gräbern von Beni
Hassan aus der 12. Dynastie (2000–1788 v. Chr.) mehrfach abgebildet
wird. Damals, zur Zeit des Mittleren Reiches (2160–1788 v. Chr.) kommen
bereits drei verschiedene Schläge dieser alten Rasse nebeneinander vor.
Erst im Neuen Reich (1580–1205 v. Chr.), da an die[S. 123] Stelle der früheren
Abgeschlossenheit infolge der wiederholten Feldzüge und ausgiebiger
Handelsverbindungen eine regere Fühlung mit den vorderasiatischen
Kulturreichen begann, wanderte eine neue asiatische Schafrasse in
Ägypten ein, die nach und nach, wohl infolge der Gewinnung von mehr und
besserer Wolle, die Oberhand gewann und die älteren Schafrassen von
Mähnenschafabstammung verdrängte. Die damals mit großer Kunstfertigkeit
in harten Stein gehauenen Widder, die in ganzen Reihen vor den
Tempeln (z. B. von Karnak bei Theben) aufgestellt wurden und von
beiden Seiten die Prozessionsstraße einfaßten, sind zweifellos diesen
höher gezüchteten und deshalb höher geschätzten neuen asiatischen
Abkömmlingen nachgebildet.
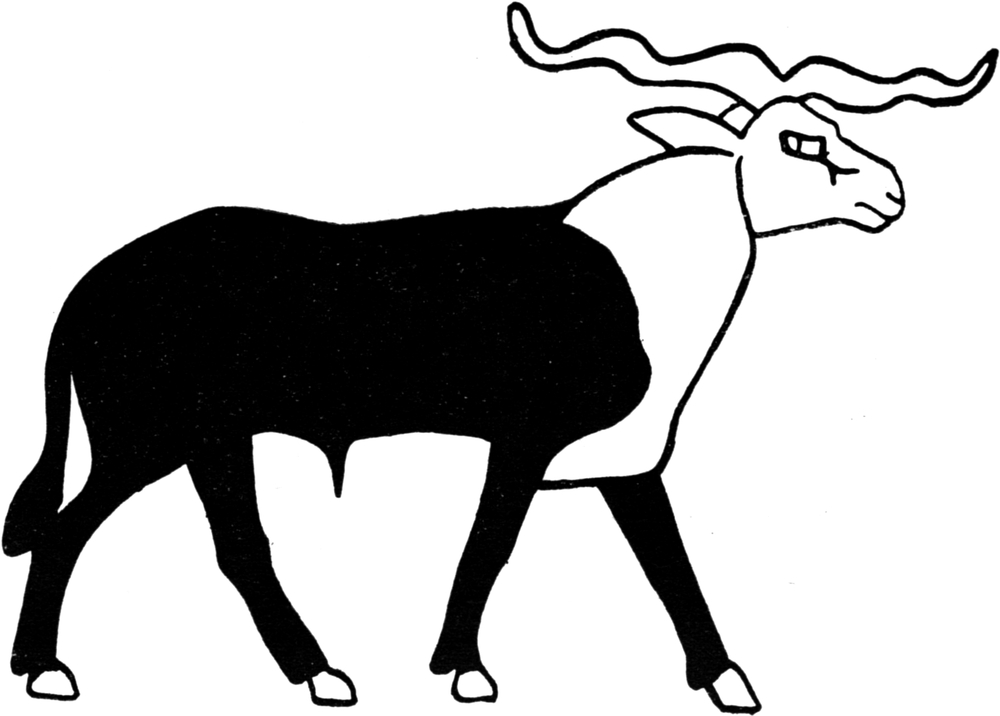
Bild 18. Altägyptisches Hausschaf des alten Reichs.
(Nach Darstellungen in Beni Hassan.)
Von Ägypten aus kam teils durch Überfälle und damit verbundenem
Raub, teils durch Tauschhandel das altägyptische Schaf von
Mähnenschafabstammung nach dem Innern Arabiens, wo es heute noch bei
den konservativen Beduinen wenig verändert als Nedjeschaf
gehalten wird, dann über Syrien und Kleinasien oder durch den
regen Schiffsverkehr direkt zu den Vorläufern der Träger der alten
Inselkultur des griechischen Archipels, den Mykenäern oder Minoern,
die im zweiten vorchristlichen Jahrtausend eine sehr hohe, weitgehend
von den Kulturen Vorderasiens und Ägyptens beeinflußte Kultur besaßen.
Wir wissen heute aus verschiedenen Funden von Schafdarstellungen aus[S. 124]
dieser mykenischen Zeit, daß die Träger der späteren Inselkultur
ein dem Torfschaf der Mitteleuropäer sehr ähnliches Hausschaf mit
ziegenartigem Gehörn besaßen und dieses dank ihren Handelsverbindungen
sehr frühe an die verschiedenen Stämme Europas weitergaben. So ist in
einer Zeit, die vielleicht vor diejenige des Alten Reiches in Ägypten
fällt, das ziegenähnliche Hausschaf des Niltals bis zu den noch länger
in der Steinzeit verharrenden Stämmen Mitteleuropas gelangt.
Auf einer mykenischen Elfenbeinschnitzerei, die 1879 in einem aus
der Zeit jener alten Inselkultur stammenden Kuppelgrabe von Menidi
in Attika gefunden wurde, sind sehr langköpfige zahme Schafe mit
ziemlich langem Schwanz und ziegenartig zweikantigem, hinter dem
Hals gebogenem, starkem Gehörn abgebildet, die durchaus afrikanische
Mähnenschafabstammung verraten. Ganz dieselbe eigentümliche Bildung
zeigen vier Schafköpfe, die in einen in Vaphio ausgegrabenen Amethyst
aus mykenischer Zeit eingraviert sind. Es kann also durchaus kein
Zweifel obwalten, daß die Schafrasse der Mykenäer vom Niltale, mit dem
sie rege Handelsverbindungen unterhielten, stammte. Von dort gelangte
diese zu den weiter nördlich wohnenden Stämmen, nachdem sie irgendwo
mit Schafrassen asiatischer Abstammung gekreuzt war, was ja bei deren
höherer Leistungsfähigkeit sehr nahelag.
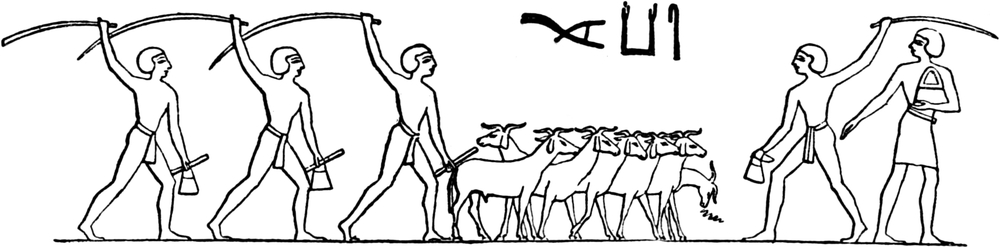
Bild 19. Nach der Aussaat über den Acker getriebene
Schafe im alten Ägypten. Diese sollten mit ihren Füßen die Samenkörner
in den Boden treten.
(Nach Wilkinson.)
Schon um die Mitte des zweiten vorchristlichen Jahrtausends wurde auch
dieses Haustier neben dem andern Vieh in größeren Herden im gebirgigen
Griechenland gehalten. In der Ilias spielen die Bergweiden mit den
Scharen braunroter Rinder, weißer oder schwarzer Schafe und den „sich
weit ausbreitenden Herden der meckernden Ziegen“ eine so wichtige
Rolle, daß die Herrensöhne selbst als Oberaufseher dahin gesandt
werden. Auf einer solchen Bergweide sprach Alexandros (Paris) den
drei aufeinander eifersüchtigen Göttinnen das berühmte Urteil, das[S. 125]
seinem Volke so verderblich werden sollte. In der Verkleidung eines
Herrensohnes, der die Herden des Vaters beaufsichtigt, tritt Athene
dem heimkehrenden Odysseus entgegen. Auf der Bergweide weidet nach dem
homerischen Epos das Vieh tagsüber von bewaffneten Hirten und starken
Hunden bewacht. Mit einem Stabe, den er wirft, verhindert der Hirt, daß
sich die Tiere zu sehr zerstreuen. Am Abend werden die Herden in feste
Pferche oder Ställe eingetrieben. Dort werden wie die Kühe und Ziegen,
auch die Schafe gemolken, und in der Höhle des Zyklopen ist nach der
Beschreibung des Odyssee eine regelrechte Käserei eingerichtet, in der
die Milch seiner Schafe verwertet wird. Außerdem ist an den Schafen
das Fleisch und vor allem die Wolle wertvoll. Damals war der Löwe
noch mehr als der Wolf der Feind der Viehzucht, mit dem manch harter
Kampf ausgefochten wurde. Auch der schleichende Panther wurde den
Herden gefährlich und mit Hilfe einer Hundemeute wurden auch auf ihn
Treibjagden abgehalten.
Während das nordafrikanische Mähnenschaf, die Stammform der Rasse,
ein stattliches Tier von 1,55 m Länge darstellt, ist das
im Bündnerschaf uns mehr oder weniger rein erhaltene Torfschaf
der Neolithiker durchschnittlich nur 0,84 m lang. Diese
Verkleinerung der Rasse ist wohl Folge der schlechten Haltung und nicht
in dem Sinne zu deuten, wie es Keller tut, der sagt: „Wir dürfen aber
annehmen, daß die Auslese die kleinen Tiere begünstigte, weil sie für
die Wanderung günstiger waren. Andere Schafrassen zeigen ja auch starke
Größenunterschiede, asiatische und afrikanische Rinder weisen neben
Riesenformen auch eigentliche Zwergformen auf.“
Der wichtigste Unterschied im Schädelbau des Mähnenschafes und des
davon abzuleitenden Torf- beziehungsweise Bündnerschafes besteht darin,
daß letzteres eine, wenn auch seichte Tränengrube besitzt, die ersterem
völlig abgeht. Diese Eigentümlichkeit kann nur dadurch erklärt werden,
daß das Torf- und das davon abstammende Bündnerschaf auf ihrem Wege
vom Niltal nach Mitteleuropa etwas Blut der alsbald zu besprechenden
Hausschafe von asiatischer Abstammung erhielt, die alle dadurch
gekennzeichnet, daß sie wie ihr wilder Stammvater eine Tränengrube
besitzen. Sonst steht die allgemeine Bildung des Schädels beim Torf-
und Bündnerschaf wegen ihres ziegenartigen Charakters dem Mähnenschaf
viel näher als irgend einem echten Wildschaf, nur die Stirnbeine sind
beim Mähnenschaf flach, beim Torf- und Bündnerschaf dagegen gewölbt,
was entweder Folge der Domestikation oder der Kreuzung mit asiatischen
Schafrassen sein kann. Wie das[S. 126] Mähnenschaf das langgeschwänzteste
Wildschaf ist, ist auch das Torf- wie das Bündnerschaf langschwänzig.
Von dem zum Teil hängeohrigen altägyptischen Hausschaf von
Mähnenschafabstammung sind nur wenig veränderte Nachkommen im von
den Nubierstämmen am oberen Nil, vorzugsweise den Dinkas, gehaltenen
Dinkaschaf noch am Leben. Dieses trägt noch als Reminiszenz an
seinen Ahnen einen mähnenartig an Hals und Vorderbrust herabfallenden
Haarmantel; der übrige Körper ist kurz behaart, wie auch der lange,
dürre Schwanz. Sein Gehörn ist durchaus ziegenartig, indem die kurzen,
kräftigen Hörnchen sich dem Hals entlang scharf nach hinten wenden, um
eine halbmondförmige Krümmung zu beschreiben. Die Färbung ist meist
rein weiß, teilweise auch rotbraun oder weiß und schwarz gefleckt.
Georg Schweinfurth fand dieses Schaf außer bei den Dinkas auch bei den
Nuër und Schilluknegern.
Ein anderer Abkömmling des altägyptischen Hausschafes ist das ebenfalls
stark bemähnte und vorwiegend weiß gefärbte Fezzan- oder
libysche Schaf. Dessen dürrer Schwanz trägt am Ende wie sein
Ahnherr, das Mähnenschaf, eine an einen Kuhschwanz erinnernde große
Quaste.
Ganz den Charakter des altägyptischen Schafes, wie es uns an den
Wänden der Grabkammern und als hieroglyphisches Zeichen abgebildet
entgegentritt, weist das in den Gegenden am oberen Lauf des Niger
lebende Nigerschaf. Dieses ist hochbeinig, besitzt einen Kopf
mit Hängeohren und kleinen Ziegenhörnern und trägt ebenfalls am
Vorderkörper an die Mähne des Mähnenschafs und der davon abstammenden
ältesten Hausschafe Ägyptens erinnernde verlängerte Haare. Abkömmlinge
von ihm verbreiteten sich bis nach Senegambien und dem Golf von Guinea.
Zweifellos enthalten auch die Senegalschafe, dann das
hochbeinige, hängeohrige Guineaschaf, das Kongoschaf
und das kropfige Angolaschaf oder Zunu vorzugsweise
Mähnenschafblut, das aber mehr oder weniger stark mit solchem vom
Fettschwanzschaf asiatischer Abstammung gemischt ist.
Der Stammvater dieses Fettschwanzschafes, das jetzt durch ganz
Nordafrika, von Ägypten bis Marokko, verbreitet ist und vom Niltal aus
nach Abessinien und zu den Somalis gelangte, wie aller asiatischer
Hausschafe überhaupt, ist das transkaspische Steppenschaf
oder der Arkal (Ovis arkal), der schon in sehr früher
Zeit in Westasien zum Haustier erhoben wurde. Er ist kleiner als
das Mähnenschaf, aber[S. 127] größer als das alsbald zu besprechende
südeuropäische Muflon (Ovis musimon), von dem sich die
Heidschnucken und Marschschafe ableiten. So sind denn die von jenem
abstammenden langschwänzigen Hausschafe durchschnittlich größer als die
von letzterem hervorgegangenen kurzschwänzigen. Am Schädel des Arkal
ist wie an demjenigen der Hausschafe asiatischer Abkunft die Stirne
schmal, die Hornzapfen liegen weiter auseinander wie beim Muflon, das
dreikantige Gehörn ist hellfarbig, regelmäßig gewulstet und zwischen
den starken Wulsten tief eingeschnitten, also mit dem Merinogehörn am
meisten übereinstimmend. Die Tränengruben erscheinen tiefer als bei
irgend einer andern Art. Die Augenhöhlen treten röhrenförmig hervor
und sind mit ihrer Achse schief nach vorn gerichtet, ein Merkmal, das
besonders beim chinesischen Schaf auffällt, das allerdings vorzugsweise
ein Argaliabkömmling ist.
Im Gegensatz zu den meisten anderen Wildschafen Asiens ist der Arkal
kein Hochgebirgstier; er bewohnt vielmehr die niederen Vorberge
und geht selbst bis zur Küste des Kaspischen Meeres herab, dessen
Wasserspiegel bekanntlich unter dem Niveau des Mittelmeeres liegt.
Mehr als alle anderen Wildschafe lebt er in größeren Herden von 60 bis
100, gelegentlich auch 200 Stück; vereinzelte Stücke werden nur selten
angetroffen. Es ist ein wenig scheues, gutmütiges Tier, das sich leicht
jagen und fangen läßt. Kein Wunder also, daß sich der Mensch schon früh
seiner bemächtigte. Von ihm hochgezüchtete Fettschwanzschafe
treten uns schon auf Reliefdarstellungen des 8. Jahrhunderts v. Chr.
entgegen, so auf einer Platte aus der Zeit Tiglatpilesars II.
um 745 v. Chr., die uns aus einer eroberten jüdischen Stadt durch
Soldaten weggetriebene Schafe mit ansehnlichem Fettschwanz und
kleinen Arkalhörnern zeigt. Solche Schafe, deren Hauptkennzeichen der
mittellange, dicke und sehr breite Fettschwanz bildet, kannte schon
der griechische Geschichtschreiber Herodot im 5. vorchristlichen
Jahrhundert. Er schreibt nämlich: „In Arabien gibt es ganz wunderliche
Schafe. Die eine Rasse hat Schwänze von drei Ellen Länge (= 1,5
m), so daß man den Schwanz eines jeden Schafes auf ein Wägelchen
binden muß, damit er nicht auf der Erde hinschleife, sich da abreibe
und verwunde. Die andere Rasse hat Schwänze, welche eine Elle breit
werden.“ Er meint damit in starker Übertreibung die beiden heute noch
in ganz Westasien gehaltenen Fettschwanz- und Fettsteißschafe. Diesen
beiden Schafarten wurden starke Fettansammlungen im Unterhautzellgewebe
des Hinterteils angezüchtet, die bis 20 kg Gewicht erlangen
können. Die asiatischen Nomaden, denen im Gegensatz zu den Acker[S. 128]bauern
die Haltung des Schweines als Fettspender in der Steppe unmöglich war,
verlegten sich schon sehr früh darauf, bei Schafen von Arkalabstammung
solche Fettwucherungen zu unterstützen. So erlangten sie das
Fettschwanzschaf, das nach Osten bis Turkestan reicht. Dort greifen sie
vielfach in das Gebiet der alsbald zu besprechenden Fettsteißschafe
über und liefern in den jungen Tieren das als Astrachan, Krimmer oder
Persianer geschätzte Pelzwerk. Dieses wird besonders von den Lämmern
der Karakulrasse gewonnen, die in Chiwa, Buchara und westlich davon bis
Astrachan gehalten wird.
Die Rassen des Fettschwanzschafes mit mittellangem Schwanz, bei denen
der Schwanz höchstens bis zu den Hacken reicht, finden wir auf den
vorhin erwähnten assyrischen Darstellungen des 8. vorchristlichen
Jahrhunderts nie mit einem konvexen, sondern mit einem geraden Profil,
ja auf dem im Berliner Museum befindlichen Feldlager unter Sanherib,
der 705 v. Chr. seinem Vater Sargon als König von Assyrien folgte und
bis 681 regierte, da er von seinen eigenen Söhnen ermordet wurde,
finden wir deren Profillinie sogar etwas konkav. Diese gerade bis
konkave Profillinie, die wir bei allen Wildschafen treffen, zeigt an,
daß das erst mit einem unbedeutenden Fettschwanz versehene Schaf dem
wilden Vorfahren noch recht nahestand. Erst als die Domestikation
stärker eingewirkt hatte, wurde das Gesichtsprofil, wohl als Folge
des Schwächerwerdens des Gehörns, konvex, Verhältnisse, die wir in
gleicher Weise auch bei den Ziegen beobachten. Auch die Hörner, die
vorwiegend beim Widder vorkommen und dem Weibchen gewöhnlich fehlen,
deuten mit Sicherheit auf die Abstammung dieser Tiere vom Arkal, das
als Steppenschaf der Domestikation weit leichter zugänglich war als
eines der Hochgebirgsschafe. Die Hörner des Fettschwanzschafes sind
kurz und halbmondförmig nach hinten und nach der Seite gekrümmt.
Von den hierher gehörenden Rassen unterscheidet man das meist hell
gefärbte, kurzwollige, bucharische Fettschwanzschaf, das von den
Kirgisen und Tataren gehalten wird. Es kommt auch noch in Syrien und
Palästina vor. Sein Fettschwanz erreicht hier teilweise einen solchen
Umfang, daß er, wie Russel aus Syrien berichtet, am untern Ende durch
dünne Brettchen, die gelegentlich mit Rädchen versehen sind, gegen
Verletzungen geschützt wird. So konnte die schon von Herodot gemeldete
Sage aufkommen, der Schwanz der morgenländischen Schafe sei so schwer,
daß er auf Wägelchen gebunden werden müsse, damit sich die Tiere nicht
beim Nachschleifen desselben verletzen. In Ägypten wird es durch das
bis Abessinien verbreitete[S. 129] ägyptische Fettschwanzschaf mit
ziemlich großem Kopf, langen und breiten Hängeohren und nur auf den
Widder beschränktem Gehörn abgelöst. Beim tunesischen und algerischen
Fettschwanzschaf ist der bis zum Fersengelenk reichende, tiefangesetzte
Schwanz nur in seinem oberen Teil mit Fett durchwachsen, gegen die
Spitze hin aber normal. Außer in ganz Nord- und Ostafrika hat sich
dieses Fettschwanzschaf auch in Südafrika eingebürgert.
Tafel 25.

Assyrische Fettschwanzschafe aus der Zeit Tiglatpilesars,
um 745 v. Chr.
(Nach Keller, die Abstammung der ältesten Haustiere.)
⇒
GRÖSSERES BILD
Tafel 26.

Kirgisische Fettschwanzschafe mit ausfallender Winterwolle,
von Karl Hagenbeck in Stellingen importiert.
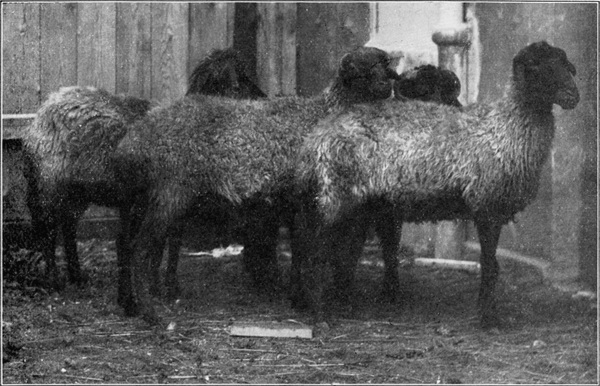
Karakulschafe, von Karl Hagenbeck aus Buchara importiert.
Tafel 27.

Kampf von Widdern des Fettschwanzschafes vor dem Khan
von Chiwa.

Fettschwanzschaf in Chiwa.
Tafel 29.
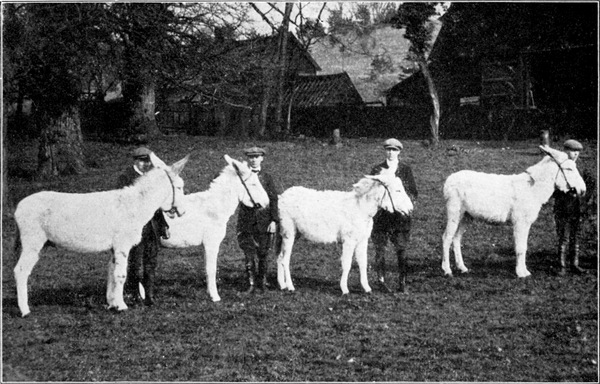
In England gezogene weiße orientalische Eselhengste, von
Karl Hagenbeck importiert.
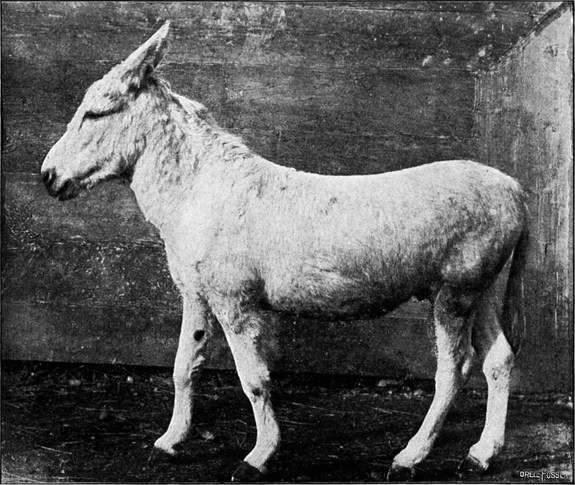
Ägyptischer Hausesel der Onagerrasse.
(Nach Aufnahme von Professor Keller in Die Abstammung der ältesten Haustiere.)
Tafel 30.

Grauer abessinischer Esel mit deutlich sichtbarem
Schulterkreuz und zebraartiger Querstreifung an den Beinen.
(Aus Karl Hagenbecks Tierpark in Stellingen.)

Sartenfamilie auf einer säugenden Eselin in Turkestan.
(Nach einer Photographie von Arndt Thorer.)
Beim anatolischen und syrischen Fettschwanzschaf ist der Fettschwanz
sehr lang und in der Höhe des Sprunggelenkes nach oben gekrümmt.
Diese werden in Kleinasien und Syrien am häufigsten gehalten und
haben vereinzelte Ausläufer bis nach Südeuropa gesandt, so nach der
Balkanhalbinsel, Süditalien und neuerdings (von Algier aus) auch nach
einigen Landstrichen des südlichen Frankreich. Das höchstgezüchtete
Fettschwanzschaf ist das persische, das von ansehnlicher Größe, aber
nicht sehr hoch gebaut ist. Das Vlies ist ziemlich dicht, mit mäßig
langer, gewellter Wolle, die sich nicht zum Versponnenwerden eignet
und deshalb auch kaum je technisch verwendet wird. Die Färbung ist
schmutzigweiß, silbergrau, braunschwarz, oft auch scheckig. Das
bogenförmige Gehörn ist von lichter Farbe, nicht groß, aber in beiden
Geschlechtern vorhanden. Der Fettschwanz ist sehr umfangreich, erreicht
nicht selten den vierten Teil des Gesamtgewichts und wird dann zur
unbequemen Last für das Tier.
Ebenfalls langschwänzig, wie ursprünglich alle Schafe von
Arkalabstammung, aber statt auf Fett- auf Wollnutzung gezüchtet,
ist das westasiatische Wollschaf, der Wolleerzeuger par
excellence, dessen Produkt schon im Altertum berühmt war.
Bereits zu Beginn des letzten vorchristlichen Jahrtausends trieben
die Phönikier einen schwunghaften Handel mit feinen und dazu noch
prächtig, meist mit Purpur gefärbten Wollstoffen, für die die
Küstenstämme Kleinasiens und Griechenlands willige Abnehmer waren.
Wie vordem in Syrien und Mesopotamien wurde später dieses Wollschaf
namentlich in Kleinasien gezüchtet und dessen Wolle vorzugsweise
über Milet nach Griechenland ausgeführt. Die griechische Sage läßt
ja im Argonautenzuge das goldene Vlies, d. h. wohl den gelbwolligen
Träger desselben, in Kolchis, am östlichen Ufer des Schwarzen Meeres,
holen. Dort muß es also schon früh Schafrassen mit besonders feiner
Wolle gegeben haben, nach deren Besitz man in Griechenland lüstern
war. Später fand über Samos ein lebhafter Import von hochgezüchteten
kleinasiatischen Wollschafen nach Griechenland statt, wo in der Folge
die Zuchtrassen von[S. 130] Epirus und Attika einen bedeutenden Ruf erlangten.
Über Großgriechenland (Sizilien und Süditalien) gelangten diese edlen
Wollschafe asiatischer Abstammung zu den Römern, die sie weiter nach
Westen und Norden brachten. In der Folge überflügelte die iberische
Halbinsel mit ihren trockenen, der Schafzucht besonders günstigen
Hochsteppen in der Schafzucht und Wollverarbeitung alle übrigen
Mittelmeerländer, und Corduba, das heutige Cordova, wurde das Zentrum
der Wollindustrie. Hier züchtete man nach und nach aus dem asiatischen
Blute das Edelschaf, das unter dem Namen Merinoschaf weltberühmt
wurde.
Das gemeine Landschaf Spaniens ist das Churraschaf von Arkalabstammung,
neben dem schon im Altertum eine Abart mit besonders feiner Wolle
— wohl aus Kleinasien importiert — gehalten wurde. Bereits der 66
n. Chr. gestorbene Grieche Strabon berichtet in seinem Werke über
Geographie: „Spanien erzeugt für den Handel herrliche Wolle, feine
Gewänder, und die dortigen Schafböcke werden teuer bezahlt.“ Im
Mittelalter, unter der maurischen Herrschaft, die die Landwirtschaft
so überaus förderte, wurden die Herden dieser Wollschafe noch mehr
veredelt. Später nahmen sich die Großgrundbesitzer und klösterlichen
Verwaltungen der blühenden Schafzucht an. Sie erhielten unter
Ferdinand V., dem Katholischen (geb. 1469, regierte 1479–1516),
weitgehende Privilegien und taten sich zu Mesta genannten Verbänden
zusammen, die sich selbst dem Privatbesitz gegenüber allerlei Rechte
anmaßten, so vor allem dasjenige, ohne Entschädigung an die Eigentümer
die Weidewege für die Wanderschafe über fremden Grund und Boden zu
bestimmen. Solches nehmen sie laut altem Herkommen bis auf den heutigen
Tag für sich in Anspruch. Übrigens hören wir bereits von römischen
Schriftstellern, daß es wie in Spanien, so auch in Italien Wanderherden
gab, die den Sommer im Gebirge und den Winter in der Ebene zubrachten
und dabei Rechte freien Durchzugs besaßen.
Den Winter verbringen die Wanderherden der Merinoschafe meist in
der Estremadura, daneben auch in Andalusien und Neukastilien.
Im Sommer ziehen sie nordwärts nach Altkastilien, Leon, Burgos
usw. Dieses Wanderleben, an dem nur die edlen Zuchten teilnehmen,
wirkt höchst vorteilhaft auf den Gesundheitszustand dieser Schafe
ein. Die minderwertigen Zuchten gleicher Abstammung, wie z. B.
das weitverbreitete, grobwollige Churraschaf, genießen keine
Weideberechtigung und sind daher Standschafe geworden.
Das Wort Merino ist dem Spanischen entlehnt und bezeichnete
ur[S. 131]sprünglich einen vom König eingesetzten Richter, der in seinem
Bezirk große Machtbefugnisse ausübte; insbesondere war er ein
Weiderichter, der allerlei Anstände zu schlichten hatte, wenn die
Hirten mit ihren Wanderschafen (oviejos transhumantes) von
einer Gegend zur andern zogen. Er war also eine Art Schirmherr der
Schafherden und sein Name wurde später kurzweg auf die Wanderschafe
selbst übertragen. Die Merinoschafe sind mittelgroße Tiere mit
starkem, im Schnauzenteil abgestumpftem Kopf. Das Gehörn ist kräftig
entwickelt, schraubenförmig gewunden, dem Kopfe anliegend und mit
starken Querwülsten versehen. Die Tränengruben sind tief, die Ohren
schmal und zugespitzt, der Hals an der Kehle kropfartig verdickt, der
Körper in den Beinen niedriggestellt. Das starke Wollvlies ist äußerst
dicht und besteht aus Büscheln fein gekräuselter Wolle, die durch eine
Ausschwitzung von Wollfett (Lanolin) verklebt sind.

Bild 20. Der Tuchscherer.
(Nach einem Holzschnitt von Jost Ammann.)
Diese das ganze Jahr im Freien zubringenden Tiere werden während des
Weidebetriebs im Mai und Juni geschoren, nachher mit dem Stempel des
Eigentümers versehen und zum Schutze der Haut mit einer ockerhaltigen
Salbe bestrichen. Die Wolle wird sortiert, in besondern Waschanstalten
gewaschen und das Wollfett daraus ausgezogen. Seit dem Beginne des 18.
Jahrhunderts breiteten sich die spanischen Merinos nach verschiedenen
europäischen und später auch außereuropäischen Ländern aus, wobei
das Produkt Spaniens zum Teil überholt wurde und berühmte Zuchten
entstanden, wie die Rambouillets, Elektorals und Negrettis. Den
Anfang damit machte Frankreich, indem 1706 eine kleine Zuchtherde
durch Dauberton nach Montbard in Burgund gelangte. Weit wichtiger
war der 1753 vollzogene Im[S. 132]port von 400 Merinos zur Errichtung der
Zuchtherde von Rambouillet. Der Transport der Tiere zu Fuß auf dem
Landwege von Altkastilien nach ihrem Bestimmungsorte dauerte volle
41⁄2 Monate. Weiter wurde dann im Departement de l’Aisne der höchst
wertvolle Stamm der Mauchampschafe mit langer, seidenartiger Wolle
herangezüchtet. Im Jahre 1800 gab es in Frankreich bereits über
5000 dieser feinhaarigen Wollschafe. In Deutschland führte zuerst
Sachsen das spanische Edelschaf ein; der erste Transport, bestehend
aus 92 Böcken und 128 Mutterschafen, langte 1765 an. Dem Kurfürsten
Friedrich August zu Ehren erhielten die sächsischen Merinos den Namen
Elektoralschafe. In Preußen erfolgte die Einfuhr 1785. Österreich
gründete 1772 in der Nähe von Fiume eine Pflanzschule spanischer
Schafe; spätere Bezüge gelangten nach Mähren und Ungarn und waren
Veranlassung einer intensiven Zucht. Gleichzeitig führte sie Italien
und 1802 Rußland über Odessa nach dem Steppengebiet im Süden ein. Doch
hatte im letzteren Lande bereits Peter der Große um 1715 deutsche
Schafe zur Verbesserung der Wolle der russischen Schafe kommen lassen.
Schweden hatte die Merinos schon 1753 eingeführt; doch mißglückte der
Versuch völlig, sie in jenem Lande anzusiedeln. Noch großartiger als
hier entwickelte sich die Merinozucht in Steppenländern außerhalb
Europas, besonders in Australien, wo das Schaf, das heute dort das
wichtigste Haustier bildet, erst im Jahre 1788 eingeführt wurde. In
diesem Lande wurde in der Folge die Schafzucht die Grundbedingung des
ganzen ökonomischen Aufschwungs des Landes, trug aber zugleich zum
raschen Verschwinden der Ureinwohner viel bei. Letztere konnten nämlich
in ihren kommunistischen Anschauungen nicht begreifen, daß sie kein
Recht an den Schafen hätten, die doch die ihnen bis dahin zur Nahrung
dienenden Kängurus verdrängten. So begann, als diese sich zur Stillung
des Hungers an den Herden vergriffen, ein mit aller Scheußlichkeit
geführter Vernichtungskrieg gegen sie, die bald zur Ausrottung der
ganzen Rasse aus den Schafzucht treibenden Gegenden führte. Auf den
ausgedehnten grasreichen Weideflächen gediehen die eingeführten Schafe
so gut, daß der europäische Wollmarkt vom australischen Produkte
förmlich überschwemmt wurde. Auch auf Neuseeland nahm die Merinozucht
große Ausdehnung an. Ihr einziger Feind hier ist der mit dem Schwanz
50 cm lange Nestorpapagei, der sich bald daran gewöhnte, den
Schafen große Wunden beizubringen, die vom Schmerz gepeinigten Tiere
so lange zu quälen, bis sie eingingen,[S. 133] und dann von ihrem Fleische zu
fressen, besonders aber deren Nierenfett herauszuholen.
Im Kaplande bürgerte sich die Merinozucht schon 1782 durch Vermittlung
der Holländer ein. In England schlug die Einbürgerung dieser Schafrasse
trotz mehrfacher Versuche fehl. Es scheint, daß das dortige Klima für
sie zu feucht ist; denn die Merinoschafe verlangen trockene Luft und
gedeihen in Steppen am besten. Auf den Sandwichinseln kommen sie nur
mäßig fort, vorzüglich dagegen im Westen der Vereinigten Staaten,
in Argentinien und Uruguay, wo gewaltige Herden dieser geschätzten
Wollerzeuger weiden.
Ein weniger hochgezüchtetes Edelschaf asiatischer Abstammung als
das Merino ist das der Stammform desselben noch recht nahestehende
Sardenschaf, das sich auf der Insel Sardinien in einer
starken Kolonie erhielt und augenscheinlich eine sehr alte Form des
Hausschafes darstellt. Ebenfalls weniger veredelte Abkömmlinge des
asiatischen Wollschafes von Arkalabstammung sind die langschwänzigen
Zackelschafe, die in beiden Geschlechtern bald merinoartig
gewundene, bald in langgezogener Spirale abstehende Hörner tragen. Von
letzteren, die man als Zackenhörner bezeichnet, haben sie den Namen
Zackelschafe erhalten. Dieser eigenartige Stamm mit grober Wolle nahm
seinen Ausgangspunkt von Südosteuropa. Die wichtigsten Wohngebiete
desselben sind Kreta, Mazedonien und die übrigen Balkanländer, das
Donaugebiet bis nach Ungarn und Siebenbürgen. Das kretische Zackelschaf
ist ziemlich groß mit kräftigen Beinen und vorwiegend schmutzigweißer
Haarfarbe. Die Spitzen des in Spiraltouren nach rückwärts aufstehenden
Gehörns stehen weit auseinander. Ähnlich gebaut, aber etwas kleiner und
mit beinahe wagrecht auseinander stehenden Schraubenhörnern versehen,
die beim Widder länger als beim Mutterschaf sind, ist das ungarische
Zackelschaf. Sein Fleisch gilt als sehr schmackhaft. Die grobe
Wolle wird zu Teppichen, Decken und groben Zeugen verarbeitet. Die
gegerbte Haut liefert ein weiches Leder. Nahe verwandt mit ihm ist das
mazedonische Zackelschaf.
Abkömmlinge der osteuropäischen Zackelschafe drangen früher auch nach
Westeuropa vor. Sie spielten unter den früheren wirtschaftlichen
Verhältnissen eine gewisse Rolle, sind aber gegenwärtig meist stark im
Rückgang begriffen. Dahin gehören das jetzt selten gewordene bayerische
Zaupelschaf, das pommersche und hannoversche Landschaf
und als westlichster Ausläufer das englische Norfolkschaf, das
früher wegen[S. 134] seiner Genügsamkeit eine große Verbreitung besaß. Diesen
Zackelschafen nahe verwandt ist das in der Bergregion des Oberwallis
stark verbreitete, ganz schwarze oder schwarz und weiß gefleckte
Walliserschaf. Es erinnert an das Norfolkschaf. Sein ziemlich
starkes Gehörn ist spiralig ausgezogen und von dunkler Färbung; neben
behörnten kommen aber auch hornlose Individuen vor. Ein Abkömmling
dieses Walliserschafes ist das hornlose Frutigerschaf im Berner
Oberland.
Ein diesem Formenkreis zugehörender starker Seitenzweig von hornlosen
langschwänzigen Schafen umfaßt das stattliche, meist hängeohrige
Bergamaskerschaf, daß in den nach Süden mündenden Tälern des
mittleren Alpengebietes gehalten und auf den hohen Alpweiden gesömmert
wird, dann das diesem ähnliche paduanische und steirische Schaf.
Entferntere Ausläufer sind das südfranzösische und englische
Bergschaf, dann das Rhön- und Thüringer Schaf.
Mit Schafen dieser asiatischen Arkalabstammung haben wir es stets zu
tun da, wo bei den alten Schriftstellern von Schafen überhaupt die Rede
ist. Von ihm schreibt der römische landwirtschaftliche Schriftsteller
Columella um die Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr.: „Das Schaf ist
ein äußerst nützliches Tier, es gibt uns Kleidung, Käse, Milch und
verschiedene Gerichte. Am besten ist die weiße Wolle, weil man sie
beliebig färben kann.“ Sein Zeitgenosse Plinius bemerkt: „Großen Wert
hat das Schaf als Opfertier und wegen des Gebrauchs, den wir von seiner
Wolle machen. Es gibt zwei Hauptrassen: die eine ist weichlicher und
wird mit einer Decke belegt, welche man in bester Sorte aus Arabien
bezieht, die andere Art ist die gemeine. In Syrien gibt es Schafe
mit ellenlangen Schwänzen.“ Damit meint er die schon damals dort
gehaltenen Fettschwanzschafe. Der drei Menschenalter vor diesen lebende
gelehrte Römer Varro sagt: „Die tarentinischen und attischen Schafe
haben eine wertvolle Wolle und werden mit Pelzen bedeckt, damit sie
nicht schmutzig werden. Nach der Schur wird das Schaf mit Wein und Öl
gesalbt, wozu einige auch weißes Wachs und Schweineschmalz nehmen.
Wunden, die das Tier bei der Schur bekommt, werden mit Teer bestrichen.
Es gibt auch Leute, welche die Schafe nicht scheren, sondern rupfen,
was früher allgemein üblich war.“ In der Tat ist das Ausrupfen der
Wolle die von Völkern auf primitiver Kulturstufe stets geübte Sitte,
die wir auch den Pfahlbauleuten der späteren Steinzeit zuschreiben
dürfen. Womit sonst als mit den Fingern hätten sich diese die Wolle
ihrer noch wenig[S. 135] hochgezüchteten Schafe holen können! Heute noch wird
allgemein von den Arabern die Kamelwolle mit den Händen ausgerupft und
nie mit der Schere entfernt. Der zu Beginn des 3. Jahrhunderts n. Chr.
lebende griechische Schriftsteller Älian berichtet: „Die lydischen und
mazedonischen Schafe sollen mit Fischen gefüttert und von dieser Kost
fett werden.“ Wir haben früher gesehen, daß solches Futter heute noch
auf Island an die sonst ausschließlich Gras fressenden Haustiere des
Menschen verfüttert wird.
Nachdem einmal die Schafzucht in den Mittelmeerländern volkstümlich
geworden und ihr Nutzen klar erkannt worden war, kann es uns
nicht wundern, daß hier später auch das einheimische Wildmaterial
der Domestikation umerzogen wurde, um daraus neue Schafrassen
heranzuziehen. Dazu diente das einst sämtliche Bergländer Südeuropas
und der angrenzenden Inseln bewohnende Muflon (Ovis
musimon). Dieses kleinste aller Wildschafe ist der Stammvater der
heute nach dem Norden von Europa gedrängten kleinen, kurzschwänzigen
Hausschafe. Einst auch in Südeuropa gehalten, wurde es hier später
vollständig durch die leistungsfähigeren Hausschafe von asiatischer
Arkalabstammung verdrängt. Das Muflon kommt in Cypern bis zur Höhe
von 2000 m vor, ist auf Sardinien noch vorhanden und lebte
vor kurzem auch in Korsika. Er wird einschließlich des höchstens
10 cm langen Schwanzes 1,25 m lang, am Widerrist 70
cm hoch und 40–50 kg schwer. Er ist gedrungen gebaut,
in der Rückenlinie dunkelbraun, sonst braunrot gefärbt; dabei spielt
der Kopf ins Aschgraue. Das Gehörn des Bockes ist stark und in einer
Länge von 65 cm nach außen hinten und zuletzt nach innen unten
gebogen; es ist an der Wurzel sehr dick, im Querschnitt dreieckig. Das
merklich kleinere Weibchen unterscheidet sich durch seine mehr ins
Fahle spielende Färbung sowie durch das Fehlen oder seltene Vorkommen
des Gehörns vom Bock.
Wie der Arkal lebt das Muflon im Gegensatz zum Mähnenschaf in Rudeln,
deren Leitung ein alter, starker Bock übernimmt. Diese Rudel erwählen
sich die höchsten Berggipfel zum Aufenthalt und nehmen hier an
schroffen, fast unzugänglichen Felswänden ihren Stand. Wie bei andern
gesellig lebenden Wiederkäuern halten stets einige Stück sorgfältig
Umschau, um die Genossen bei der Wahrnehmung eines verdächtigen
Gegenstandes sofort zu warnen und mit ihnen flüchtig zu werden. Zur
Paarungszeit trennen sich die Rudel in kleine, aus einem Bock und
mehreren Schafen bestehende Trupps,[S. 136] welche der leitende Widder erst
durch tapfer durchgefochtene Kämpfe sich erworben hat. Das Schaf bringt
im April oder Mai 1–2 Junge zur Welt, die der Mutter schon nach wenigen
Tagen auf den halsbrecherischsten Pfaden mit der größten Sicherheit
folgen und bald ebenso gewandt wie sie klettern. Alle Bewegungen des
Muflon sind schnell, gewandt und sicher. Erwachsene Tiere vermag man
kaum je zu fangen, junge nur dann, wenn man ihre Mutter weggeschossen
hat. Sie gewöhnen sich bald an ihren Pfleger, sind anhänglich an ihn,
bewahren ein munteres, ja mutwilliges Wesen, zeigen aber nur eine
geringe Intelligenz.
Noch im Altertum muß dieses Wildschaf auf den Gebirgen Südeuropas
recht häufig gewesen sein; denn Julius Capitolinus berichtet, daß
Kaiser Gordian im Jahre 238 n. Chr. 100 wilde Schafe zu den Jagdspielen
nach Rom brachte. Von Kaiser Probus, der von 276 bis 282 n. Chr.
regierte, meldet Flavius Vopiscus, daß er so viel wilde Schafe als er
auftreiben konnte, nach Rom kommen ließ. Schon früh wurde es irgendwo
im östlichen Mittelmeergebiet gezähmt, wozu wohl die hier bereits
gehaltenen ältesten Hausschafe von Mähnenschafabstammung die Anregung
gaben. Schon zur Bronzezeit tauchen, zunächst allerdings noch spärlich,
großgehörnte Hausschafe in den Pfahlbauten nördlich der Alpen auf,
welche durch ihr großes Gehörn und die in ihrem Bau mit denjenigen
des Muflon übereinstimmenden Hornzapfen ihre Herkunft von diesem
südeuropäischen Wildschafe beweisen. Gegen das Ende der Bronzezeit
erscheinen dann auch hornlose Hausschafe in der Schweiz, welche im
Süden von gehörnten Muflonabkömmlingen gezüchtet worden waren. In der
helvetisch-römischen Niederlassung von Vindonissa fanden sich beide
Schafarten nebeneinander vor. In der Folge aber wurden sie hier wie
auch das ältere Torfschaf von den von den Römern eingeführten, mehr und
feinere Wolle liefernden Schafen asiatischer Abstammung verdrängt. Nur
im Norden erhielten sie sich teilweise in eigentlichen Kümmerformen
mit seit der Römerzeit bedeutend verkleinertem Gehörn. Es sind dies
die nur einen halben Meter hoch werdenden, schwarz, braun oder grau
gefärbten Heideschafe, die Heidschnucken, die als äußerst
genügsame Rasse in Gebieten mit primitiver Wirtschaft, namentlich in
der norddeutschen Heide bis nach Oldenburg und Ostfriesland, gehalten
werden. Nahe verwandt mit ihm sind das die Bergländer Skandinaviens
bewohnende skandinavische Schaf, das finnische Schaf
und das bis nach Sibirien hineinreichende nordrussische Schaf,
dann das Hebriden-,[S. 137] Faröer- und Shetlandschaf.
Das letztere ist bald klein gehörnt, bald hornlos. Sein Fleisch bildet
neben Fischen die Hauptnahrung der Bewohner jener rauhen Eilande. Der
westliche Ausläufer ist das isländische Schaf, dessen Herden ein
elendes Dasein fristen und vielfach mit getrockneten Fischen ernährt
werden. Der Wollertrag ist bei all diesen Zwergformen ein geringer.
Im Gegensatz zu diesen überaus genügsamen Heideschafen stehen die
ebenfalls vom Muflon abstammenden Marschschafe, die fette Weide
beanspruchen und auf mageren Triften nur schlecht gedeihen. Ihre
bessere Ernährung macht sich in einer bedeutenderen Größe und großen
Fruchtbarkeit geltend. Ihre Haarfarbe ist schmutzig gelblichweiß,
rötlichbraun oder einfarbig schwarz. Das Hauptmerkmal bildet neben dem
kurzen Schwanz ihre vollkommene Hornlosigkeit. Außer Fleisch und Wolle,
die zu Strickgarn und gröberen Stoffen, wie Teppichen und dergleichen
verarbeitet wird, liefern sie auch Milch, welche zur Käsebereitung
dient. Es sind Vertreter der schon in der Bronzezeit aus dem Süden
nördlich der Alpen eingewanderten hornlosen Schafe, die in den
Marschen Nordwestdeutschlands, Hollands, Belgiens und Nordfrankreichs
heimisch wurden, weiter im Süden aber wie die übrigen Hausschafe von
Muflonabstammung von asiatischen Rassen verdrängt wurden. Es sind
dies die friesischen, holländischen, belgischen und nordfranzösischen
Schafe. Unter letzteren ist besonders das Roquefortschaf
bekannt, das den berühmten Schafkäse dieses Namens liefert. Dieser
wird in Roquefort, im französischen Departement Aveyron, in der Weise
gewonnen, daß man die zum Gerinnen gebrachte Schafmilch mit von einer
spezifischen Schimmelsorte bewachsenem Brote vermischt. Dieses Brot
wird eigens für die Käsebereitung aus einer Mischung von Weizen- und
Gerstenmehl mit Sauerteig hergestellt und der betreffende Schimmelpilz
darauf zur Ansiedelung gebracht. Der damit hergestellte Schafkäse reift
dann in 30–40 Tagen in Felsenhöhlen, wobei er sich mit einer dicken
Schimmelschicht bedeckt. Diese wird von Zeit zu Zeit entfernt. Diese
Fabrikation ist schon recht alt und wird bereits aus der zweiten Hälfte
des 9. Jahrhunderts erwähnt.
Außer den drei genannten Wildschafen ist endlich noch ein weiteres
Wildschaf vom Menschen domestiziert worden. Es ist dies das
zentralasiatische Argali (Ovis argali), von den Mongolen
so genannt, ein gewaltiges Tier von der Größe eines dreivierteljährigen
Kalbes, das die spärlich bewaldeten Bergzüge Innerasiens nördlich vom
Hochlande Tibets vom Alatau bis zum Altai und von Akmolinsk im Westen
bis[S. 138] zum Südostrande der mongolischen Hochebene im Osten in einer
Höhe von 600–1000 m bewohnt. Es besitzt ein mächtiges, von der
Wurzel an mit ringsumlaufenden wellenförmigen Wülsten bedecktes Gehörn,
das sich nach hinten außen wendet. Dichtstehende wellige Grannen
nebst feinen, kurzen Wollhaaren bilden das überall sehr gleichmäßige,
jeglicher Mähne entbehrende Haarkleid, dessen vorherrschende Färbung,
ein mattes Fahlgrau, im Gesicht, an Schenkeln wie am Hinterbauch in
ein merklich dunkleres Bräunlichgrau, im Vorderteil der Schnauze, auf
dem breiten Spiegel am Steiß, in der untern Hälfte der Beine aber in
Gräulichweiß übergeht. Es meidet feuchte, waldbedeckte Gebirge und
größere Höhen, lebt das ganze Jahr über etwa auf demselben Gebiete
und wechselt höchstens von einem Bergzuge zum andern. Bis gegen die
Paarungszeit leben Böcke und Schafe getrennt, letztere zu 3–5, erstere
meist einzeln. Kurz vor der Paarungszeit vereinigen sie sich zu kleinen
Herden von 10, höchstens 15 Stück. Während des Sommers frißt das
Argali alle Pflanzen, die auch dem Hausschafe behagen, während des
Winters begnügt es sich mit Flechten, Moos und getrocknetem Gras, die
der Wind auf den Graten durch Wegfegen des Schnees bloßgelegt hat.
Wählerischer als in der Äsung zeigt es sich beim Trinken, da es stets
zu bestimmten Quellen kommt; auch salzige Stellen werden zum Lecken
oft besucht. Solange der Schnee nicht allzudicht liegt, kümmert es
der Winter wenig, denn sein dichtes Fell schützt es gegen die Unbill
der Witterung. Seine Sinne sind ausgezeichnet entwickelt. In seinem
Wesen spricht sich Bedachtsamkeit und Selbstbewußtsein aus; es ist
neugierig, wenig scheu, zeigt sich aber überall sehr vorsichtig, wo es
durch wiederholte Verfolgung von seiten des Menschen gewitzigt wurde
und seine heimtückische Art kennen lernte. Die Jagd darauf ist durchaus
nicht leicht. Sein Fleisch ist trotz seines strengen Beigeschmacks
wohlschmeckend und wird von den Mongolen und Kirgisen sehr geschätzt.
Bei solchen Vorzügen ist es kein Wunder, daß sich der Mensch schon
früh auch dieses Wildschafes bemächtigte, um es der Domestikation
zu unterwerfen. Es ist der Stammvater der großhörnigen Schafe,
die in Zentralasien innerhalb der Verbreitungszone des Argali als
Schlachttiere und Wollspender besonders auf der Salzsteppe gehalten
werden. Dabei hat sich im Haustierstande das Gehörn verkleinert. Noch
am wenigsten ist dies der Fall bei den Hausschafen Russisch-Turkestans,
mehr dagegen bei denen Tibets und der Südabhänge des Himalaja von
Kumaon bis Sikkim. Bei diesen tragen beide[S. 139] Geschlechter Hörner, und
zwar stoßen sie wie beim Argali auf der Stirne fast zusammen; dabei
sind sie nach außen hin um den Kopf gewunden und noch reich mit
Querwülsten versehen in derselben Weise wie beim Argali.
Durch spezielle Züchtung zur Vermehrung des den Hirtenvölkern so
wertvollen Fettes, dessen sie sich zum Braten der Mehlspeise und des
Reises bedienten, entwickelten sich aus ihnen im Laufe der Zeit die
Fettsteißschafe. Da der Schwanz bei ihnen im Gegensatz zu
den Abkömmlingen des Arkal zu kurz war, um ihn zur Fettablagerung
heranzuziehen, wurde der Steiß dazu ausersehen. Hier bildet die
Fettmasse zwei gewölbte Kissen, die ansehnliche Größe erreichen können.
Auch dieses Schaf besitzt wie die andern Rassen von Argaliabstammung
in beiden Geschlechtern spiralig um den Kopf gewundene Hörner mit
Querwülsten, die aber bei manchen hochgezüchteten Rassen schon
ziemlich klein geworden, ja teilweise bei den Weibchen ganz in Wegfall
gekommen sind. Es ist dies speziell beim Tatarenschaf der
Fall, das vom Ostrand des Schwarzen Meeres bis zum Baikalsee das am
häufigsten gehaltene Schaf ist und den Hauptreichtum der dortigen
Steppenvölker bildet. Bei den Kirgisen gilt noch heute die uralte
Sitte, das einjährige Lamm als Tauscheinheit zu betrachten, wie bei den
alten Römern vor dem Aufkommen der Münzen durch die Vermittlung der
süditalischen Griechen das Kleinvieh (pecus) die Werteinheit
bildete, woher noch der spätere Ausdruck pecunia für Geld,
Vermögen herrührt.
Beim Tatarenschaf ist der Kopf gestreckt, der Nasenrücken nur wenig
gewölbt und die Ohren sind als Zeichen längerer Domestikation durch
Degeneration der sie aufrichtenden Muskeln hängend geworden. Die Widder
sind stärker behörnt als die Mutterschafe, die stets kleinhörnig sind,
wenn sie überhaupt noch, was sehr häufig der Fall ist, Hörner besitzen
und nicht völlig hornlos geworden sind. Der Fettklumpen am Steiß ist
sehr umfangreich und gleicht zwei miteinander verwachsenen Halbkugeln,
zwischen denen ein ganz kurzer Schwanzstummel hervorragt. Die Haarfarbe
ist meist weiß, seltener rotbraun oder schwarz. Die filzige Wolle
ist kurz und grob und zum Versponnenwerden ungeeignet. Östlich vom
Baikalsee und der Mongolei schließt sich an das Tatarenschaf das
ebenfalls vom Argali abzuleitende, aber als Zeichen einer sehr hoch
getriebenen Zucht bereits völlig hornlos gewordene chinesische
Schaf, das allerdings nur einen schwach entwickelten Fettsteiß
besitzt, da seine Züchter als Ackerbauer im Sesam[S. 140] und in manchen auf
Öl angebauten Retticharten genugsam pflanzliches Fett zur Verfügung
hatten, so daß sie auf die Gewinnung tierischen Fettes kein besonderes
Gewicht legten.
Von seiner zentralasiatischen Heimat hat sich das Fettsteißschaf von
Argaliabstammung auch weithin nach Süden verbreitet, so nach Persien
und Arabien. Von letzterem Lande verbreitete es sich in die Länder
am oberen Nil bis in das Gebiet der Dinkas, die es ebenfalls halten,
und in die Somaliländer, wo es überall in Menge gezüchtet wird. Es
ist wie das chinesische Schaf als hochgezüchtetes Hausschaf in beiden
Geschlechtern völlig hornlos geworden und fast stets von weißer Farbe
mit tiefschwarzem Kopf und Hals. In der Gegend von Massaua fand C.
Keller neben schwarzköpfigen Schafen auch braungefärbte und gefleckte
Tiere. Häufig pflegt man ihnen die Ohren bis auf einen kurzen Stumpf
abzuschneiden. Es hat gleichfalls keine verspinnbare Wolle, sondern ein
straffes, glattanliegendes Grannenhaar. Für die es haltenden Stämme
ist es fast ausschließlich Fleischlieferant; daneben bilden die Häute
einen nicht unwichtigen Exportartikel. Bei Abmagerung verschwindet der
überhaupt schwach entwickelte herzförmige Fettsteiß fast vollständig.
Auch Südafrika besitzt Fettsteißschafe; ebenso der ostafrikanische
Archipel, doch sind sie dort nicht zahlreich. Im Innern von Madagaskar
findet man sie bei den Howas, aber in einer degenerierten Rasse, deren
Fleisch trocken ist. An der Küste dieser großen Insel scheinen sie
nicht zu gedeihen. Von Persien aus nach Osten nehmen sie rasch an
Menge ab und erreichen nicht mehr Indien, das als von vorzugsweise
Ackerbauern bewohnt und mit einem heißen Klima ausgestattet, geringen
Bedarf an tierischem Fett besaß. In Birma wurden sie erst 1855
eingeführt, sind jedoch dort nicht von Bedeutung geworden.
Wenn wir Europäer uns auch keine Fettsteißschafe wünschen, so wäre
es doch sehr angezeigt, wenn ein Tierzüchter wie Herr Falz-Fein in
seinem großen Tierpark Askania Nova auf der südrussischen Steppe oder
ein Tierimportgeschäft wie dasjenige Hagenbecks in Stellingen bei
Hamburg den Argali aus seiner Gebirgsheimat zu Zuchtzwecken in Europa
einführen würde. Es würde sich außer zur selbständigen Zucht besonders
zur Kreuzung mit den teilweise durch Inzucht degenerierten Hausschafen
sehr eignen. So hat man in solcher Weise das leichter zu erlangende
Muflon mehrfach zur Bastardierung mit Hausschafen verwendet. Beide
Wildschafarten wären auch, wie das in derselben Weise zu benützende
zentralasiatische Wildschaf Ovis poli (nach dem Venezianer[S. 141]
Marco Polo so genannt) und andere Wildschafe teils aus Asien, teils aus
Nordamerika zur Akklimatisation zum Zwecke der Belebung der Alpen und
Voralpen geeignet und böten zudem dem Jäger ein willkommenes Wildpret.
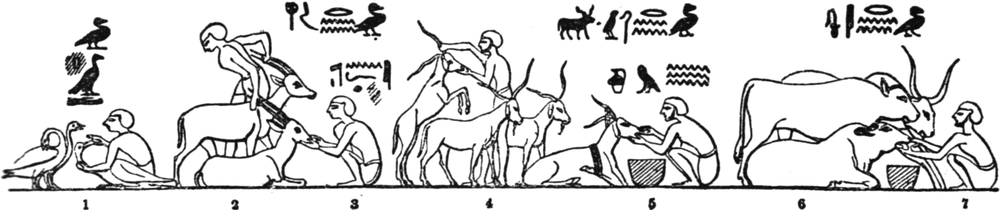
Bild 21. Altägyptische Tierärzte, kranke Haustiere behandelnd.
1. Fütterung kranker Gänse. 2. Behandlung von zwei zahmen Säbelantilopen durch
den Priester Nechta. 4. Behandlung kranker Ziegen. Das Vorderbein ist
festgebunden, damit das Tier stillhält. 7. Kranke Rinder erhalten Medizin.
(Nach Wilkinson.)
Von andern Horntieren aus der Familie der Paarzeher kämen
zur Domestikation von seiten des Menschen noch verschiedene
Antilopen in Betracht, von denen tatsächlich auch verschiedene
Vertreter von den alten Ägyptern zu Haustieren erhoben wurden, deren
Zucht aber später wieder vollkommen verloren ging. So finden wir in
Grabmalereien des Alten Reiches, der 4., 5. und 6. Dynastie (2980–2475
v. Chr.), neben Ziege und Schaf auch den einheimischen Steinbock
(Capra sinaitica), die Gazelle (Antilope dorcas),
die Säbelantilope oder Steppenkuh (Oryx leucoryx)
und den Wasserbock (Kobus ellipsiprymnus) in des Menschen
Hegung und Pflege. Nach den begleitenden Inschriften müssen diese
damals auf den Gütern der Fürsten große Herden gebildet haben und mit
Schafen, Rindern und Ziegen zusammen geweidet haben. Zur Zeit der 12.
Dynastie, während des Mittleren Reiches (2160–1788 v. Chr.), bildete
nur noch eine der drei Antilopenarten, die Säbelantilope, von Hirten
bewachte Herden, während die beiden andern samt dem Steinbocke wieder
wie in Urzeiten als Wild gejagt wurden. Und wieder ein Jahrtausend
später, zur Zeit des Neuen Reiches (1580 bis 1205 v. Chr.), war
auch diese letzte Gazellenart in Ägypten aus der Zucht von seiten
des Menschen verschwunden, und blieben fortan von Paarzehern außer
Rindern nur Schafe und Ziegen als Haus- und Nutztiere der Bewohner
des Nillandes zurück. Der französische Archäologe François Lenormant
meint in seinem Buche: Les premières civilisations, dessen
erster Teil die vorhistorische Archäologie Ägyptens[S. 142] betrifft, daß
der Einfall der Hyksos- oder Schasu-Beduinen (um 1650 v. Chr.) dieser
nationalägyptischen Zucht ein Ende bereitet habe. Es ist dies höchst
wahrscheinlich und dieses Ereignis nicht nur, wie Julius Lippert in
seiner Kulturgeschichte der Menschheit (Bd. 1 S. 503) glaubt, der
Schlußmoment in einem ganz natürlichen Ausleseprozeß; denn es ist nicht
einzusehen, weshalb diese Tiere nicht fernerhin in des Menschen Hegung
und Pflege hätten bleiben können.
Dieser Autor schreibt daran anschließend: „Wir dürfen uns diese älteste
Art ‚Zähmung‘ großer Herden, die niemals die freie Weide verließen,
nicht anders vorstellen, als etwa die Hegung des Wildes in unseren
‚Tiergärten‘, nur daß die großen Besitzer etwa die gegen die Wüste hin
offene Grenze ihres Geheges durch ein Überwachen mit Hirten und Hunden
abschlossen, während gegen das fruchtbare Land hin Wassergräben die
Grenze bildeten. Welche Verwendung solche zur Güterbegrenzung fanden,
das bezeugt unter anderem die ägyptische Vorstellung vom Jenseits,
das nicht ohne solche Begrenzung gedacht werden konnte. Nach der
Wüste hin mochten aber den Hirten natürliche Terrainverhältnisse zu
Hilfe gekommen sein, abgesehen davon, daß die oasenartig gelegenen
Weiden selbst Anziehungspunkte für die wilden Herden der Grasfresser
bildeten. Darstellungen von Jagdszenen zeigen uns, wie die so von
Hunden zusammengedrängten Tiere lebendig ergriffen wurden, während man
andere durch die Fangleine zu Falle brachte. Während sich dieser Stufe
von Hegung noch eine große Anzahl von Weidetieren willig anbequemte,
mußte bei einer näheren Heranziehung an das stabile Haus des Menschen
immer mehr Gattungen ausscheiden, während Schaf und Ziege als die
ausgesiebten Arten auch dann noch zurückblieben.“
Was die Darstellungen an den Grabwänden der Vornehmen aus der 4. und 5.
Dynastie anbetrifft, so finden wir also die Säbelantilope (altägyptisch
mut genannt), die Gazelle (altägyptisch kehes) und den
Wasserbock (altägyptisch nutu) mit dem noch heute auf dem
Gebirge zwischen Niltal und Rotem Meer besonders in Mittelägypten
vorkommenden Steinbock (altägyptisch naâ) vollkommen
domestiziert auf den Gütern der Großen des Reichs angesiedelt. Daß sie
sich als echte Haustiere auch in der Gefangenschaft fortpflanzten,
beweist schon die Szene aus dem Grabe des Nub hotep aus der 4. Dynastie
der großen Pyramidenerbauer von Giseh (2930–1750 v. Chr.), die zeigt,
wie mitten in der Herde eine Gazelle ihr Junges an ihrem Euter trinken
läßt, dann die verschiedenen Darstellungen, in denen die Hirten auf
ihren[S. 143] Armen oder auf ihren Schultern die Antilopenjungen wie junge
Kälber, Zicklein und Lämmer tragen. Im Grabe des Ma nefer der 5.
Dynastie (2750–2625 v. Chr.) in Sakkara sehen wir, wie Hirten außer
den Säbelantilopen, Gazellen, Wasserböcken und ägyptischen Steinböcken
auch Springböcke (Antilope euchore) — altägyptisch
schekes genannt — herbeitreiben, um sie von den Schreibern
notieren zu lassen. Es ist dies die einzige Darstellung dieser Antilope
im Stande der Hegung; denn auf allen andern Bildern wird sie stets nur
als von den Windhunden der Ägypter verfolgtes Wild dargestellt. Diese
Antilopenart muß also nur ganz vorübergehend in des Menschen Zucht
gestanden haben.
Welchen Umfang diese Antilopenzucht in Ägypten in der ersten Hälfte
des dritten vorchristlichen Jahrtausends angenommen hatte, beweist
die Inschrift auf dem Grabe des Sabu in Sakkara aus der 6. Dynastie
(2625–2475 v. Chr.), in welcher als Besitztum des Verstorbenen 1235
Rinder und 1220 Kälber der für gewöhnlich dargestellten langhörnigen
Rasse, 1360 Rinder und 1138 Kälber der kurzhörnigen Rasse, 405 Rinder
einer besonderen, seltenen Rasse nebst 1308 Säbelantilopen, 1135
Gazellen und 1244 Wasserböcke angegeben sind.
Ein Basrelief des Grabes des Itefa in Sakkara aus der 5. Dynastie
stellt, wie leicht zu erkennen ist und zudem durch eine begleitende
Inschrift erläutert wird, die Mästung der Säbelantilope, des
Wasserbocks und des Rindes dar, indem den betreffenden Tieren durch
einen Knecht ein besonders nahrhafter Mehlteig mit der Hand ins Maul
gestrichen wird.
In den Grabdarstellungen des Mittleren Reiches (11. und 12. Dynastie,
2160–1788 v. Chr.) findet sich, wie gesagt, keine Spur mehr von der
Zucht der Gazelle und des Wasserbocks. Diese Tiere finden sich nur
noch als Jagdwild dargestellt. Einzig die Säbelantilope findet sich
noch in größeren Herden gezähmt. In den berühmten Grabmälern von Beni
Hassan aus der 12. Dynastie (2000–1788 v. Chr.) sehen wir die Herden
dieser Antilopenart durch ihre Hirten geführt neben Herden von Rindern,
Schafen und Ziegen. Im Grabe des Num hotep, dem schönsten von allen,
hat der Künstler ebenfalls das Mästen der Säbelantilopen durch den mit
der Hand ins Maul gestrichenen Mehlteig dargestellt, neben solchem von
Rindern, Ziegen und Gänsen vermittelst desselben Verfahrens.
Erst in den Grabmalereien des Neuen Reiches (18. u. 19. Dynastie,[S. 144]
1580–1205 v. Chr.) ist auch die Haltung von Säbelantilopen völlig
aufgegeben worden und finden wir darin auch dieses Wild nur vom
Menschen mit Hilfe von Windhunden aller Art gejagt.
Leider ist später nie mehr ein Domestikationsversuch mit diesen
und andern Gazellen gemacht worden. Und weiter südlich hat der auf
niedriger Kulturstufe stehengebliebene Neger niemals an solche
Errungenschaften gedacht. Selbst die Europäer taten es nicht, als sie
sich am Kap der Guten Hoffnung festsetzten. Da schossen die Buren
mit ihren weittragenden Flinten vielfach zwecklos jene gewaltigen
Antilopenherden zusammen, denen sie zu gewissen Jahreszeiten auf
deren Wanderungen begegneten. Unter ihnen wird die Kuhantilope
(Bubalis caama), das Hartebeest der Buren oder Kama der
Betschuanen, wenn von Jugend an unter menschlicher Pflege stehend,
ungemein zahm und folgt ihrem Pfleger auf dem Fuß. Erst erwachsen zeigt
sich insbesondere bei den Böcken die Rauflust ihres Geschlechts.
Besonders geeignet und recht eigentlich dazu prädestiniert, vom
Menschen in Zucht genommen zu werden, ist die gewaltige, am Widerrist
bis gegen 2 m Höhe und ein Gewicht von 1000 kg
erreichende Elenantilope (Buselaphus oreas). Nach den
übereinstimmenden Berichten der Reisenden sollen diese Tiere auf weite
Entfernungen kaum von den Zeburindern zu unterscheiden sein, weil auch
die Stellungen und Bewegungen der ruhenden und grasenden Tiergestalten
ganz dieselben sind. Nach Holub soll zwar der Kaffernstamm der
Matabeles Herden zahmer Elenantilopen besessen haben; doch ist dies
nur eine vorübergehende Zucht gewesen, die keine weiteren Folgen
zeitigte. Jedenfalls sollte unbedingt auch von europäischer Seite der
Versuch der Zähmung dieser größten aller Antilopen gemacht werden,
bevor sie vom Erdboden verschwindet; denn sie besitzt auch erwachsen,
im Gegensatz zu den rauflustigen Kuhantilopen, einen recht gutmütigen,
sanften Charakter und pflanzt sich auch in der Gefangenschaft ohne alle
Schwierigkeiten fort. Ihr Fleisch wird als ganz vorzüglich gerühmt.
Ausschließlich zur Gewinnung von Fleisch und Fett hat der Mensch das
Wildschwein in den Haustierstand erhoben. Während der wandernde Nomade
hierzu in erster Linie das Schaf mit den ihm am Schwanz oder am Steiß
angezüchteten Fettmassen benutzte, hielt sich der ansässige Ackerbauer
an das von ihm leichter zu haltende Schwein. In den sumpfigen
Waldstrecken muß der Mensch gar häufig dem Wildschwein begegnet sein
und es, wie uns schon die paläolithischen Darstellungen desselben
an den Wänden von Höhlen Nordspaniens und Südfrankreichs beweisen,
mit Vorliebe erlegt und gegessen haben. Aber nicht das europäische,
sondern das südasiatische Wildschwein ist zuerst in menschliche Pflege
genommen und zur Würde eines Haustieres erhoben worden. Dies geschah
wohl einfach so, daß eines selbständigen Lebens ohne Muttermilch
fähige ältere Frischlinge nach Tötung der Mutter gefangen und in
eingehegte Plätze gesperrt wurden, um sie großzuziehen und gelegentlich
bei Nahrungsmangel infolge Unergiebigkeit der Jagd zu verspeisen.
Südostasien ist der weitaus älteste Herd der Schweinezucht, die jetzt
noch dort eine wichtige Rolle spielt. Dort wurde das einheimische
Wildschwein in Pflege genommen. Es ist dies das Bindenschwein
(Sus vittatus), so genannt, weil es eine von der Wange über
den Hals verlaufende weiße Binde aufweist, ein Überbleibsel der aus
dunkeln Längsstreifen bestehenden Zeichnung der älteren Schweine,
die sich noch im Jugendkleide auch unseres erwachsen nicht mehr
gestreiften europäischen Wildschweins zeigt. Dieses Bindenschwein wird
jetzt hauptsächlich auf Java, Sumatra und Borneo gefunden, war aber
einst höchstwahrscheinlich auch in Hinterindien verbreitet. Von dort
kam es gezähmt schon sehr früh nach China, wo es bereits im vierten
Jahrtausend v. Chr. in Menge gezüchtet wurde; ebenso nach Indien und
Westasien, von wo es bereits zu Beginn des dritten vorchristlichen
Jahrtausends nach Ägypten vor[S. 146]gedrungen war. So hat Flinders Petri aus
der 1. Dynastie (3400 bis 3200 v. Chr.) eine recht gute Umrißzeichnung
des Schweins in Oberägypten gefunden, das offenbar gemästet war
und wie die indischen Schweine Stehohren besitzt. Von da an fehlen
bildliche Darstellungen des altägyptischen Hausschweins bis zur Zeit
des Neuen Reiches (18. und 19. Dynastie, 1580–1205 v. Chr.), so daß
man früher glaubte, das Schwein sei erst zur Zeit der 18. Dynastie
ins Niltal eingeführt worden. Dies ist aber durchaus falsch. Von der
ältesten Königszeit an wurden Schweine in Ägypten gehalten und, wie
uns griechische Schriftsteller mitteilen, zum Eintreten der Saat in
den frisch gepflügten und geeggten Acker benutzt; doch galten sie
dem Ägypter, wohl weil sie gelegentlich auch Aas verzehrten, als
unreine Tiere, und so hütete man sich eben, sie an den Wänden der
Tempel und Grabkammern abzubilden. So berichtet der zu Beginn des 2.
Jahrhunderts n. Chr. lebende Claudius Älianus in seinem griechisch
geschriebenen Werk über die Tiere: „Das Schwein ist so gefräßig, daß
es weder seine eigenen Jungen, noch menschliche Leichen verschont;
deshalb verabscheuen es die Ägypter. Der Ägypter Manetho, ein Mann
(Priester) von hoher Weisheit, behauptet auch, daß man aussätzig wird,
wenn man Schweinemilch genießt.“ Lange vor ihm schrieb der griechische
Geschichtschreiber Herodot, der im 5. Jahrhundert v. Chr. Ägypten
selbst bereiste: „Bei den Ägyptern gilt das Schwein für ein unreines
Tier. Wird jemand zufällig von einem solchen am Kleide berührt, so
geht er gleich an den Fluß und wäscht sich. Unter allen eingeborenen
Ägyptern sind die Schweinehirten die einzigen, die in keinen Tempel
gehen dürfen; auch kann ein Schweinehirt in Ägypten nur die Tochter
eines Schweinehirten heiraten, weil ihm kein anderer seine Tochter
gibt. Keiner Gottheit opfern die Ägypter ein Schwein, mit Ausnahme
der Mondgöttin und dem Bacchos, und zwar bei Vollmond. Das Schwein,
das diesen Gottheiten geopfert wird, wird noch an demselben Tage
gegessen. Arme Leute, welche kein wirkliches Schwein haben, backen
eins aus Teig und opfern es.“ Herodot sah selbst, wie die Schweine im
Nildelta zum Einstampfen der Saat verwendet wurden. Bei einem Tiere,
das so verachtet war, daß diejenigen, die sich mit dessen Aufzucht
befaßten, nicht einmal einen Tempel betreten durften, um ihn nicht zu
verunreinigen, ist es kein Wunder, daß es in der älteren Zeit nicht
an heiligen Bauten dargestellt wurde. Erst zur Zeit der 18. Dynastie
war man so freidenkend geworden, daß man in Grabdenkmälern jener Zeit
in Theben dieses Borstentier[S. 147] wie die übrigen Herdentiere darstellte.
Aber auch damals werden nur die Ärmsten in Ägypten das Fleisch dieses
verachteten Tieres gegessen haben.
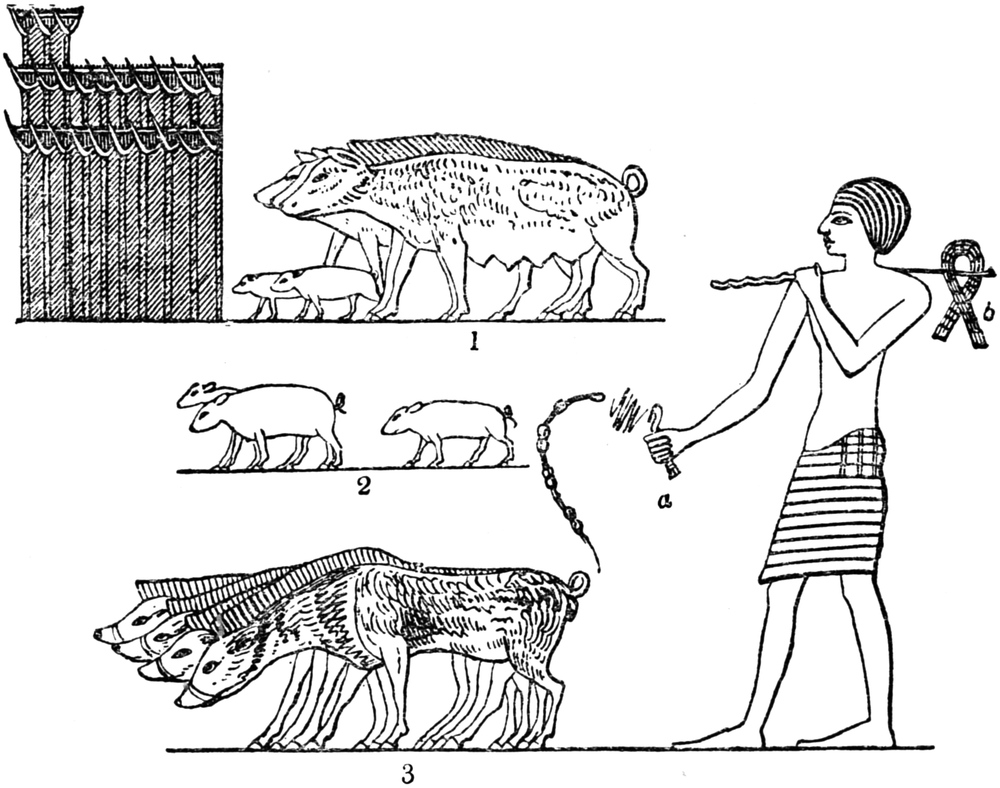
Bild 22. Altägyptische Darstellungen von Schweinen aus der
Zeit des Neuen Reichs. 1. Ein Mutterschwein mit Jungen. 2. Ferkel. 3. Eber,
a geknotete Peitsche, mit welcher die Schweine auf
die Weide getrieben wurden. (Nach Wilkinson.)
Anders als in Ägypten stand es im alten Griechenland und Rom, wo das
Wildschwein im Gegensatz zum Niltal, wo es in geschichtlicher Zeit
ausgerottet war, häufig vorkam, viel gejagt und sein Fleisch gern
gegessen wurde. Dementsprechend war auch das Fleisch des Hausschweines
als Speise geschätzt. Schon bei Homer ist vielfach von Herden des
zahmen Hausschweins die Rede und war der Stand der Schweinehirten
durchaus nicht verachtet, sonst wäre dem Sauhirten des Odysseus auf
Ithaka mit Namen Eumaios sicher nicht der Ehrentitel des „Göttlichen“
gegeben worden. Nach dem Urteile der gebildetsten Griechen hatte
die Schweinezucht viele Vorteile für sich. So schreibt der berühmte
Aristoteles im 4. Jahrhundert v. Chr.: „Von allen Tieren gewöhnt sich
das Schwein am leichtesten an jedes Futter, wird auch am schnellsten
groß und dick. In 60 Tagen kann man es ausmästen. Wer sich mit der Mast
beschäftigt, füttert die Schweine die drei ersten Tage mager, dann
werden sie bei gutem Futter desto schneller fett, wie meist alle Tiere,
die recht ausgehungert sind. Das Fettwerden[S. 148] wird durch Ruhe befördert
und geht beim Schwein schneller vor sich, wenn es sich im Schlamm
wälzen kann. Dieses Tier kämpft selbst gegen den Wolf.“
Wie bei den Griechen wurde auch bei den Römern eine ausgedehnte
Schweinezucht getrieben und dieses Haustier mit Vorliebe als Opfer
geschlachtet. Der gelehrte Varro (116–27 v. Chr.) meint sogar —
allerdings durchaus falsch — die griechische Bezeichnung hys
habe ursprünglich thys gelautet und daher komme das Verbum
thýein opfern. Er fährt dann fort: „Schweine scheinen die ersten
Opfertiere gewesen zu sein. Beim Anfang der Ernte, beim Schließen von
Bündnissen, bei Hochzeiten werden Schweine geopfert.
Der Sage nach hat die Natur das Schwein geschaffen, daß es verschmaust
werden soll, auch hat sie ihm, da sie es nicht von vornherein einsalzen
wollte, die Seele statt des Salzes gegeben, um sein Fleisch, solange
es lebt, vor Fäulnis zu schützen. Die besten Speckseiten und Schinken
kommen aus Gallien nach Rom. Cato sagt, daß in Gallien die Schweine
so fett werden, daß sie weder stehen noch gehen können und auf Wagen
fortgeschafft werden müssen, wenn sie an einen anderen Ort sollen. Der
Spanier Attilius, ein durchaus rechtlicher Mann, sagte mir, daß ihm der
Senator Volumnius von einem in Lusitanien (Portugal) geschlachteten
Schwein ein Stück Fleisch mit zwei Rippen zusandte, das 23 Pfund wog;
die Dicke des Specks habe von der Haut bis zu den Knochen 1 Fuß 3
Zoll betragen. Es hat mir auch jemand gesagt, er habe in Arkadien ein
Schwein gesehen, das sich vor Fett nicht rühren konnte, und in dessen
Speck eine Maus nistete. Das soll auch anderwärts vorgekommen sein.
Für das Schweinevieh paßt eine sumpfige Weide am besten; denn es hat
seinen Gefallen an Wasser und Schlamm. Das Hauptfutter besteht aus
Eicheln, Bohnen, Gerste und anderem Getreide, davon wird es fett und
wohlschmeckend. Im Sommer treibt man es früh auf die Weide, bevor
die große Hitze eintritt, mittags bringt man es im Schatten und bei
Wasser unter, abends läßt man es abermals weiden. Im Winter treibt man
es nicht eher aus, als bis Reif und Eis weggetaut sind. Die ersten
Jungen bekommt man von den Sauen, wenn sie zwei, die letzten, wenn sie
sieben Jahre alt sind. Man läßt die Ferkel (porculi) zwei Monate
bei der Alten und trennt sie dann, zu welcher Zeit sie schon fressen
können, von ihr. Die im Winter geborenen sind klein, werden auch
schlecht gesäugt, weil die Alte dann wenig Milch hat und die Ferkel
ihr aus Hunger die Euter wund[S. 149] beißen. Man gibt der Sau mit ihren
Ferkeln einen eigenen Koben. Dieser wird gehörig rein gehalten und
öfters nachgesehen, ob die Alte ein Junges totgedrückt hat. Sie bekommt
übrigens zweimal jährlich Junge. Um die Milch zu vermehren, muß sie
gut gefüttert werden, namentlich mit eingeweichter Gerste. Solange die
Jungen saugen, heißen sie lactentes. Die Saugschweinchen sind
vom 10. Tage an zu Opfern tauglich und heißen deshalb sacres.
Abgesetzte Saugschweine heißen delici oder gewöhnlicher
nefrendes, weil sie noch keine Bohnen kauen (frendere)
können. Porcus ist ein altgriechisches Wort. Jetzt sagen die
Griechen choíros. Die Sau (scrofa oder varro) muß,
wenn sie säugt, täglich zweimal getränkt werden. Eigentlich muß sie so
viel Junge bekommen, als sie Euterstriche hat. Bekommt sie weniger, so
taugt sie nicht zur Zucht; bekommt sie mehr, so weissagt sie dadurch
Wunderdinge. Das älteste bekannte Beispiel dieser Art stammt von der
Sau des Äneas, welche 30 weiße Ferkel bekam. Die Prophezeiung traf ein,
indem 30 Jahre später die Lavinienser die Stadt Alba gründeten. Noch
jetzt findet man in Lavinium die Bildnisse der 30 Ferkel in Bronze
aufgestellt und die Sau selbst wird, gut eingesalzen, von den Priestern
gezeigt.
Die Schweine werden vom Schweinehirten gewöhnt, alles nach dem Klang
des Hirtenhorns zu tun. So z. B. stößt er ins Horn, wenn er sie aus
den Ställen läßt, wenn er sie im Walde zusammenruft usw. Die Herde
alter Schweine kann aus 100 bis 150 Stück, diejenige junger aus doppelt
soviel bestehen.“
Der ältere Plinius schreibt: „Wenn Schweine ihre Jungen fressen, so
sieht man das nicht als schlimme Vorbedeutung an. Das Ferkel gibt am 5.
Tage ein reines Opfer, das Lamm am 8., das Kalb am 30. Das Schwein ist
überaus dumm, doch kennt man auch ein Beispiel, daß gestohlene Schweine
die Stimme ihres Herrn erkannten, das Schiff, auf das die Räuber sie
gebracht, versenkten, indem sie auf der einen Seite das Übergewicht
gaben, und dann zurückschwammen; auch lernen die Anführer der Herde den
Markt und die Häuser finden. Die Kunst, bei Sauen eine große Leber wie
bei Gänsen zu erzeugen, ist eine Erfindung des Marcus Apicius (eines
berühmten Feinschmeckers, der auch ein Kochbuch für die feine Küche
schrieb) und besteht darin, daß man sie mit trockenen Feigen tüchtig
füttert und mästet, ihnen dann Met zu trinken gibt und sie plötzlich
tötet. Kern anderes Tier liefert Speisen von verschiedenerem Geschmack
für die Küche; denn wenn von anderen Tieren jedes nur einerlei
Geschmack hat, so hat das[S. 150] Schwein dagegen fünfzigerlei, weswegen auch
durch mancherlei Gesetze den Zensoren einzelne Teile, wie Euter, Kopf
usw., bei Gastmählern verboten sind; aber freilich kehrt sich nicht
jeder an solche Gesetze.“ Die Feinschmecker Roms begnügten sich aber
in der Regel nicht mit dem gewöhnlichen Schweinefleisch, das auch
gesalzen und geräuchert wurde, wie dies heute noch geschieht, sondern
ließen sich mit Vorliebe solches aus Sardinien kommen, von wo aus große
Schweinezüchter (suarii), die zur Kaiserzeit besondere Rechte
erlangt hatten, den Markt mit besonders feiner Ware versorgten.
Welcher Tafelluxus im kaiserlichen Rom und im üppigen Alexandreia
herrschte, zeigen uns folgende Tatsachen. Petronius meldet: „Die
Tafel war gedeckt: ein ganzer gebratener Eber ward aufgetragen. Das
Jagdmesser wurde erhoben und in des Ebers Bauch gestoßen, — da flogen
zur Belustigung der Gäste aus der Wunde Drosseln hervor.“ Der um 220 n.
Chr. in Alexandreia lebende Grieche Athenaios erzählt, wie bei einem
Gastmahle eine silberne, reichvergoldete große Schüssel auf die Tafel
kam, auf der ein erwachsenes Schwein gebraten auf dem Rücken lag und
seine Beine zum Himmel streckte. Als sein Bauch mit einem Schnitte
geöffnet ward, fand sichs, daß es mit gebratenen Drosseln, anderen
kleinen Vögeln, Austern usw. gefüllt und in die Zwischenräume Eidotter
gebracht war.
Ein anderes Mal ward ein Schwein aufgetragen, an dem mit Aufwand
großer Kunst die eine Hälfte gebraten, die andere gekocht war. Alle
bewunderten dies Gericht. Drob freute sich der Koch, nahm eine stolze
Miene an und fragte: Na, wer von euch kann angeben, wie das Tier
geschlachtet und wie sein Bauch mit tausend herrlichen Leckerbissen
gefüllt ist? Er enthält Drosseln, andere kleine Vögel, gehacktes
Schweinefleisch, Eidotter, Hühner, gepfefferte Fleischklößchen usw. Der
Schriftsteller Macrobius sagt, daß diese mit kleinen Tieren gefüllten
Schweine von den Kennern in Anlehnung an das sagenhafte trojanische
Pferd Trojanische genannt wurden.
Der Geschichtschreiber Älius Lampridius berichtet in seiner Biographie
des Alexander Severus (222–235 n. Chr.), dieser Kaiser pflegte sich
während der Mittagstafel damit zu belustigen, daß er spielende
Spanferkel oder kämpfende Rebhühner oder hin und her fliegende Vögel
betrachtete. Seine Vogelhäuser enthielten Pfauen, Fasane, Haushühner,
Enten, Rebhühner und eine Unzahl Tauben. Als unter seiner Regierung
das römische Volk sich über eine Fleischteuerung beklagte, habe
er Erkundigungen eingezogen und erfahren, daß es vorzüglich an[S. 151]
Schweine- und Rindfleisch fehlte. Da gab er den Befehl: Niemand dürfe
eine säugende Sau, ein saugendes Ferkel, eine alte oder junge Kuh
schlachten. Da sei schon in zwei Jahren Fleisch in Menge und wohlfeil
zu haben gewesen.
Nicht selten sind uns bildliche Darstellungen des Schweins aus
römischer Zeit erhalten geblieben, die, wie beispielsweise das
prächtige Basrelief vom großen Staatsaltar auf dem Forum Romanum, eine
durch weitgehende Zucht kurzköpfige, sehr mastfähige Rasse mit runden
Formen zeigen. Deren Beziehungen zum indischen Hausschwein sollen nach
C. Keller recht deutlich ausgeprägt sein. Noch heute ist das asiatische
Blut im Hausschwein der römischen Kampagna unverkennbar. Dieselbe
Schweinerasse wurde nach Überresten in Herculanum und Pompeji zur Zeit
von deren Untergang gehalten; eine in Portici gefundene Bronzestatuette
bringt deren Merkmale sehr charakteristisch zum Ausdruck.
Bei den alten Germanen war die Schweinezucht sehr beliebt, da dieses
Tier nach dem Pferd den beliebtesten Braten lieferte und deshalb gern
geopfert wurde. Unter den Karolingern wurde es viel gehalten. So
schärfte Karl der Große seinen Verwaltern ein, diese Tiere in möglichst
großer Zahl auf seinen Landgütern zu halten. So finden wir in den
Verzeichnissen der Königshöfe eine große Zahl derselben, so in Asnapium
260 große und 100 kleine Schweine, daneben 5 Eber, in Grisenweiler 150
große und 100 kleine Schweine. Sie wurden in die Wälder zur Eichel- und
Buchenmast getrieben. Außer eingesalzenem Fleisch, besonders Schinken
und Speck, wurden auch Würste beim Schweineschlachten im Frühwinter
hergestellt. Schon im 12. Jahrhundert begannen westfälische Schweine
und Schinken berühmt zu werden. Noch das ganze Mittelalter hindurch
wurden wilde Eber auf zahme Sauen gesetzt, um eine bessere Zucht zu
erlangen.
Das älteste Hausschwein der vorgeschichtlichen Völker Süd- und
Mitteleuropas war nach den auf uns gekommenen Schädelüberresten nicht
ein Abkömmling des gezähmten einheimischen Wildschweins, sondern,
wie die genau vorgenommenen vergleichend anatomischen Feststellungen
beweisen, ein solcher des südasiatischen Bindenschweins. In den
ältesten Pfahlbauten und Landniederlassungen Mitteleuropas der
neolithischen Zeit fehlte dieses zahme Hausschwein südasiatischer
Herkunft noch durchaus. Es tritt uns erst in einer späteren Zeit
der neolithischen Kultur in Überbleibseln entgegen und wurde dann
namentlich in der Bronzezeit in steigender Menge gehalten. Es ist
dies das[S. 152] Torfschwein (Sus scrofa palustris), von L.
Rütimeyer so genannt, weil uns eben seine Reste, wie diejenigen
der ältesten Haustiere überhaupt, vorzugsweise in den inzwischen
vertorften Seegründen, wo einst die Pfahlbauniederlassungen gestanden
hatten, entgegentreten. Es war ein zierlich gebautes Tier von mäßiger
Größe, das sich in seinem Schädelbau durchaus von demjenigen des
einheimischen Wildschweins entfernt, aber nahe Beziehungen zu dem
des südindischen Bindenschweins aufweist. Da man es damals nicht in
Stallungen bannte, sondern ähnlich wie das Hausschwein der Malaien
der indonesischen Inselwelt ziemlich frei umherlaufen ließ, wich sein
Schädel vom Wildschweincharakter nur wenig ab. Daher glaubte Rütimeyer
zunächst, daß das Torfschwein ursprünglich wild bei uns gelebt habe.
Doch kam er später von dieser Annahme zurück, und heute wissen wir mit
Bestimmtheit, daß sein Stammvater das südindische Bindenschwein war.
Bei letzterem ist, wie beim Torfschwein, der Schädel verhältnismäßig
kurz, breit und hoch, die Tränenbeine sind kurz und hoch, nähern sich
also der quadratischen Form; der knöcherne Gaumen scheint nach vorn
verbreitert, so daß die vorderen Backenzähne stark auseinandergedrängt
werden. Demgegenüber ist der Schädel des europäischen Wildschweins
und der erst später von ihm gewonnenen Hausschweine niedrig, schmal
und langgestreckt. Die Tränenbeine sind lang und niedrig, also mehr
rechteckig, der knöcherne Gaumen ist nach vorn nicht verbreitert, so
daß die Backenzähne annähernd parallel zueinander stehen.
Bei allen Schweinen aber ist die Wildform im Bau des Schädels von der
Kulturform verschieden. Erstere wühlt im Boden nach eßbaren Knollen und
Wurzeln, letztere hat sich dies in der Gefangenschaft fast abgewöhnt;
infolgedessen ist ihr Schädel im Profil nicht mehr gerade, sondern
zwischen Stirn und Nase eingeknickt. Die fächerförmige Schuppe des
Hinterhauptbeins ist nicht mehr wie beim Wildschwein nach hinten
gerichtet, sondern steigt mit der Stirn- und Scheitelgegend mehr oder
weniger senkrecht empor. Während der jugendliche Wildschweinschädel
anfänglich den indifferenten Typus des Säugetierschädels wiederholt,
wird er später gestreckt und erhält scharf ausgeprägte Knochenleisten,
im Gegensatz zu demjenigen des zahmen Schweins, bei dem die
Nackenmuskulatur durch Nichtgebrauch schwächer wird und der Eckzahn an
Größe abnimmt.
Dieses Torfschwein kam zweifellos über Westasien aus seiner
südindischen Heimat nach Europa, wenn wir nicht annehmen wollen, daß
sich sein Verbreitungsgebiet einst bis nach Westasien erstreckte, wo[S. 153]
es dann hätte gezähmt werden können. Genaueres wissen wir über diese
Wanderung nicht. Wir wissen nur, daß das Hausschwein im Altertum auch
in Mesopotamien gehalten wurde. So ist uns aus der assyrischen Zeit
in Kujundschick das Bild eines Mutterschweins mit Ferkeln erhalten
geblieben. Im Gegensatz zu Layard, der darin eine Wildsau erblicken zu
müssen meinte, glaubt Keller aus dem feinen, verhältnismäßig kurzen
Kopf darin einen Abkömmling des südindischen Bindenschweins erkennen
zu dürfen. Allerdings hat später der ganze semitische Kulturkreis das
Schwein als Haustier abgelehnt, so daß es in der Folge aus Westasien,
soweit semitische Stämme zu finden waren, verschwand. Anders bei den
Ariern, denen der Schweinebraten, gleichgültig ob vom wilden oder
zahmen Schwein, ein Festessen war. So verspeisen die Helden in Wallhall
täglich den göttlichen Eber Särimni, der täglich wiederum neu ersteht,
um sich von den Asen verspeisen zu lassen. So war es auch schon bei
den Mitteleuropäern zu Ende der Stein- und zu Beginn der Bronzezeit.
Diese liebten außer dem ihnen noch reichlich zur Verfügung stehenden
Wildschweinbraten auch etwa solchen vom Hausschwein, besonders
nachdem es von der Eichelmast im Herbste recht fett geworden war, zu
verzehren und sich aus dem Überschuß durch Einsalzen und Räuchern
Winterproviant zuzulegen. Da nun das halb wild gehaltene Torfschwein
nicht selten Gelegenheit bekam, sich mit wilden Ebern zu begatten, so
entstand bald eine größere Mischrasse. Schon Plinius meldet in seiner
Naturgeschichte: „Das zahme Schwein paart sich sehr leicht mit dem
Wildschwein.“ Diese Tatsache war also schon im Altertum, wo sich bei
der großen Häufigkeit der Wildsauen viel mehr Gelegenheit zu solchen
Beobachtungen bot als heute, allgemein bekannt.
Erst ganz am Schluß der neolithischen Zeit kam in Mitteleuropa ein
kräftigeres und größeres Hausschwein auf, das offenbar ein mehr oder
weniger reiner Abkömmling des einheimischen Wildschweins war; denn
was lag näher, als einmal dieses größere Tier nicht bloß zur Kreuzung
mit dem kleineren Torfschwein, sondern zur Reinzucht zu verwenden.
Das Wildmaterial lag ja gleichsam vor der Tür und wird oft genug in
halberwachsenen Frischlingen der Wildsau lebend in die Niederlassungen
der Steinzeitjäger gebracht worden sein. Von der Metallzeit an wurde
dann in Mitteleuropa das Torfschwein asiatischer Abstammung immer
mehr vom leistungsfähigeren Hausschwein europäischer Zucht aus dem
einheimischen Wildschwein verdrängt. Doch war es noch während der
helvetisch-römischen Zeit in der Schweiz[S. 154] stark verbreitet. So gehören
von den in der Römerkolonie Vindonissa aufgefundenen Resten 28
Knochenstücke ihm an, während das europäische Landschwein nur durch 10
solche vertreten war. Noch am meisten Torfschweinblut weist das alte
Bündnerschwein auf. Auch die Hausschweine in den entlegenen
Tälern um das Gotthardgebiet herum, im Tessin und oberen Wallis, stehen
dem alten Torfschweintypus nahe, während in den südlichen Tälern des
Wallis ein schwarzes oder fuchsrotes Schwein gehalten wird, das nach
der Kopfform ein unverkennbares Kreuzungsprodukt des Torfschweins mit
dem Landschwein von europäischer Abstammung ist.
In den romanischen Ländern südlich der Alpen, vor allem in ganz
Italien, Spanien und Portugal, wird das schwach behaarte romanische
Schwein von meist dunkler Farbe, mit kurzem Kopf, längerem Rüssel
als beim indischen Schwein und geradlinigem, breitem Rücken gezüchtet,
das ebenfalls neben asiatischem auch reichlich europäisches Blut
enthält. Noch mehr asiatisches als europäisches Blut besitzt das durch
seine krause Behaarung ausgezeichnete kraushaarige Schwein von
dunkler Farbe mit kurzem Rumpf, kantigem Rücken und etwas spitzem
Gesicht, das hauptsächlich über Ungarn und die anstoßenden Balkanländer
verbreitet ist.
Je mehr wir nun in Europa nach Norden gehen, um so reiner tritt das
europäische Blut auf. Diese Hausschweine europäischer Abstammung
besitzen statt des verhältnismäßig breiten, ebenen Rückens einen
erhöhten „Karpfenrücken“ infolge des seitlich zusammengedrückten
Rumpfes. Statt der breiten Brust besitzen sie eine flachrippige Brust.
Statt des in der Nasengegend eingesenkten Kopfes mit kurzem Rüssel
haben sie eine gestreckte, oft völlig wildschweinähnliche Schnauze.
Die Beine sind verhältnismäßig hoch. Es ist dies das europäische
Hausschwein, von dem eine Unterart mit großen, hängenden Ohren
und schmälerer Stirn und eine solche mit kurzen aufrecht gestellten
Ohren und breiter Stirn unterschieden wird. In Norddeutschland und
Dänemark scheint ursprünglich das Torfschwein gefehlt zu haben und
nur das europäische Blut gehalten worden zu sein. Die prähistorischen
Knochenreste weisen auf eine durch kümmerliche Haltung sehr klein
gewordene Rasse hin. Überhaupt hat das Schwein im allgemeinen seit
seiner Überführung in den Haustierstand an Größe abgenommen, offenbar
deshalb, weil die freie Natur günstigere Entwicklungsbedingungen
darbietet als die Knechtschaft unter dem Menschen. Erst die moderne[S. 155]
rationelle Tierzucht hat durch Darbietung besserer Lebensbedingungen
die Größe wieder zu steigern vermocht.
Das der südostasiatischen Wildform noch am nächsten stehende, weil
immer wieder durch Kreuzung mit jener aufgefrischte asiatische
Hausschwein kommt in mehr primitiven, meist sehr mastfähigen
Schlägen im ganzen östlichen Asien vor, so von der Mongolei durch
ganz China, Annam, Siam und Hinterindien bis zu den Sundainseln und
nach Neuguinea einerseits und Indien und Ostafrika andererseits. Es
ist das das weitaus wichtigste Zuchtgebiet zahmer Schweine, indem es
sowohl bei den mongolischen und malaiischen, wie auch den Papuastämmen
das bei weitem wertvollste und oft einzige Haustier neben dem Hunde
ist. Sein Fleisch und sein Fett sind für diese Stämme, soweit sie
nicht an der Küste leben und viel Seetiere genießen, die wichtigsten
animalischen Lebensmittel. Obenan steht das gewaltige China, wo die
Schweinezucht gegen 6000 Jahre alt ist. Dabei hat Nordchina eine
primitivere, meist schwarzgefärbte Rasse, während Südchina höher
gezüchtete Kulturschweine von meist weißer Farbe besitzt. Im Norden
ist die Haltung dieses Haustieres eine wenig sorgfältige. Hier leben
die Schweine ohne Schutz im Freien und sind selbst in dem recht rauhen
Winter aller Unbill der Witterung preisgegeben. Daraus erklärt sich das
Vorhandensein auffallend dichter und langer Behaarung als Wärmeschutz
der ursprünglich aus einem warmen Klima stammenden Tierart. Die überall
auf dem Lande gezüchteten Schweine werden meistens nach den Städten
verkauft, wo der Bedarf an Schweinefleisch ein sehr großer ist, indem
der wohlhabende Chinese nicht nur kein Opfer ohne dieses begeht,
sondern auch bei allen festlichen Gelegenheiten seine Familienglieder
und Freunde damit bewirtet.
In der Mandschurei ist die Schweinezucht besonders in der mittleren
Provinz Kirin entwickelt. Dieselbe Rasse wird auch in den Amurländern
gehalten und geht bis nach Sibirien hinein. Doch tritt in letzterem
Lande die Schweinezucht schon aus klimatischen Gründen gegenüber der
Schafzucht zurück. Auffallenderweise besitzt Japan sehr wenig Schweine.
Die Zucht dieses Haustieres ist in jenem Lande stark vernachlässigt und
auf eine einzige Provinz, Kangoschima, beschränkt. Sehr blühend ist
sie dagegen in ganz Hinterindien, auf den Philippinen und Sundainseln,
wo überall das Schweinefleisch ein wichtiges Nahrungsmittel bildet.
In Neuguinea ist das Schwein neben dem Hund das einzige Haustier, das
überall in der Umgebung der Dörfer ziemlich[S. 156] frei gehalten wird, so
daß es vielfach verwildert ist. Seine Nahrung besteht hier vorwiegend
in Taroknollen. Auch Indien hat vorwiegend dunkelgefärbte Schweine,
die in Schläge mit kurzen, aufrechtstehenden und in solche mit großen,
herabhängenden Ohren zerfallen.
Im ganzen mittleren und westlichen Asien ist, soweit der Islam
vordrang, das Schwein als unrein verpönt und deshalb die einst auch
hier im Altertum betriebene Schweinezucht verdrängt worden. Hier ist
an seiner Stelle überall das Schaf, das von dem Fluche Muhammeds nicht
getroffen wurde, der Lieferant von tierischem Fett und Fleisch. Wie
die Ostasiaten und Malaien Schweinefleisch zu ihrem Reis essen — nach
der nicht unwahrscheinlichen Sage soll Buddha an einer Überladung des
Magens mit Schweinebraten seinen Tod geholt haben — so genießen die
Westasiaten Hammelfleisch zu ihrem Palaw genannten Reisgericht. Aber
das war im Altertum noch nicht so. Um die Zeit der Entstehung des
Christentums war das Schwein noch nicht aus Westasien verschwunden. Das
beweist die bekannte Legende von den Schweinen der Gaddarener, in die
die unreinen Geister fuhren. Immerhin haben die Semiten im allgemeinen,
nicht nur die Juden, die solchen Abscheu wie so manches andere aus
der Zeit ihrer Gefangenschaft in Ägypten hätten entlehnen können, das
Schwein als unrein verpönt. Und diese Ächtung des Schweins hat in der
Folge auch die aus dem Orient zu den Griechen und Römern gekommenen
Kulte begleitet. So wurden der aus der semitischen Ischtar-Astarte
hervorgegangenen Aphrodite auch in Griechenland keine Schweine
geopfert, so wenig als der jener entsprechenden Venus in Rom.
Wie sehr die Muhammedaner das Schwein scheuen, geht aus der drolligen
Geschichte hervor, die der, um ungefährdet im Orient reisen und
selbst die allen Ungläubigen streng verbotenen heiligen Stätten in
Mekka und Medina besuchen zu können, zum Islam übergetretene Baseler
Burckhardt (Scheik Ibrahim) in seinem Buche: Reisen in Arabien (Weimar
1830) erzählt. In Dschidda, der Hafenstadt Mekkas, war — wohl einem
christlichen Schiffer entlaufen — ein Schwein ans Land gekommen
und führte in der Nähe des Marktes ein freudenvolles Dasein, weil
die Marktleute lieber ihre Waren im Stiche ließen und sie dem Tiere
Satans preisgaben, als sich durch die Berührung mit demselben zu
verunreinigen. Alle ihre Flüche und Drohungen störten natürlich das
biedere Borstentier sehr wenig. Im ganzen Gebiete des Islam dürfen
auch die Christen nur ausnahmsweise Schweine halten. So ziehen die
Armenier in der Türkei und in Persien gern wild[S. 157]gefangene Frischlinge
auf, um sie fett werden zu lassen und dann zu schlachten und zu
verspeisen. Nur in den Marställen der Großen wird, um die „böse Luft“,
alle Verhexung und etwaige Krankheitserreger in seinen unreinen Leib
abzuleiten, gern ein Schwein gehalten, wie noch vor gar nicht langer
Zeit bei den Christen für solche Zwecke ein Ziegenbock gehalten wurde.
Letzteres ist eine Reminiszenz an den Ziegenbock der Israeliten, der
am Versöhnungstage mit allen Sünden des Volkes beladen in die Wüste
getrieben und sich selbst überlassen wurde. Daher stammt unsere
Bezeichnung Sündenbock.
Welch seltsame Form das Bewußtsein der eigenen Größe annehmen kann,
schreibt Ed. Hahn in seinem Buche über die Haustiere und ihre
Beziehungen zur Wirtschaft des Menschen (Leipzig 1896), beweist, daß
die Venezianer am Ausgang des 15. Jahrhunderts eine ansehnliche Summe
dafür ausgaben, daß sie in ihrer Faktorei in Alexandrien ein Schwein
halten durften; einmal ärgerten sie damit die Ungläubigen, allerdings
für ihr gutes Geld, und dann bewiesen sie den andern Christen ihre
ungeheure Überlegenheit durch diesen sonderbaren Vertreter des Löwen
von San Marco.
In Ägypten wird heute das Schwein nur von den christlichen Kopten
gehalten. In ganz Nordafrika befaßt sich natürlich auch nur das
christliche Element mit dessen Zucht. In den oberen Nilländern wurde
es von den Negern übernommen; besonders in Sennar halten es die
Eingeborenen, um dessen wohlschmeckendes Fleisch zu essen. In Ostafrika
fehlt es natürlich im mohammedanischen Somaliland vollständig,
dagegen trifft man Schweine indischer Abstammung in Mozambique. Auch
auf Madagaskar wurde es offenbar unter dem Einfluß der Araber an
der Westküste verdrängt; so züchten es die Sakalaven nicht. Dagegen
findet man im Innern der Insel, im Gebiet der Howas, eine kleine,
schwarze Rasse. Auf den Maskarenen und auf der Insel Réunion ist die
Schweinezucht auf die bergigen Gegenden beschränkt. In ganz Inner-
und Westafrika ist das Schwein nur selten anzutreffen, außer in den
Küstengegenden von Angola, wo es von den Portugiesen eingeführt wurde.
In Natal wurde es 1825 eingebürgert.
In Europa hat das Schwein nur in ganz kleinen Bezirken, wo einst
Mohammedaner herrschten, an Wichtigkeit verloren, so in Griechenland.
In Italien, Südfrankreich und Nordspanien ist es im Gebiet der
Eichen- und Kastanienwälder das wichtigste Nutztier des Menschen;
ebenso in Sardinien und Sizilien. Eine erhebliche Schweinezucht weist
Mittelitalien auf, dann Spanien in der Estramadura, verschiedene
Pro[S. 158]vinzen Portugals und Südwestfrankreich im Gebiete der Garonne. Die
wichtigsten Produktionsländer für Schweine, welche davon stark nach
Westeuropa exportieren, sind Serbien und Ungarn. In Süddeutschland
findet man die intensivste Zucht in Bayern; dort wird die große
wildschweinähnliche, in der vordern Körperhälfte weiße, in der
hintern dagegen meist rote Landrasse noch in starker Verbreitung
angetroffen. In Deutschland sind die nordischen Marschen relativ arm
an Hausschweinen, reicher dagegen Westfalen, Hannover, Braunschweig,
Thüringen und Sachsen. Meist sind in Deutschland wie in der Schweiz,
in Belgien, Holland und Nordeuropa die einheimischen Rassen durch
hochgezüchtete englische Rassen verdrängt worden. Nachdem nämlich schon
um 1740 durch die schwedisch-ostindische Gesellschaft Mastschweine
besonderer Güte aus Südchina zur Hebung des einheimischen Schweins
durch Kreuzung nach Schweden eingeführt worden waren, nahm die
englisch-ostindische Gesellschaft zu Beginn des vorigen Jahrhunderts
diese Bestrebungen im großen Maßstabe auf. So wurden in England durch
Kreuzung mit hochgezüchteten chinesischen Rassen die weltberühmten
edlen Schläge gezüchtet, welche später in allen Kulturländern
eingeführt wurden und hier nach und nach die weniger leistungsfähigen
einheimischen Schläge verdrängten. Damit hat das asiatische Schwein
einen vollständigen Sieg über die Hausschweine europäischen Blutes
erlangt. Die wichtigsten Schläge desselben werden als Yorkshire,
Berkshire, Suffolk und Leicester bezeichnet, lassen aber keine scharfe
Grenze zwischen sich ziehen. Der Körperumriß nähert sich bei ihnen
einem Rechteck, die Beine sind fein gebaut und kurz. Das Gesicht
ist extrem verkürzt und die Gegend zwischen Nase und Stirn stark
eingeknickt. Es gibt kurz- und langohrige, kleine und große Schläge.
Die Färbung kann schwarz, rotgelb, weiß oder bunt sein. Die größte
Schweinezucht weist Yorkshire und Westmoreland auf. Auch Irland besitzt
große Zuchten, weniger dagegen Schottland. Außer nach Belgien, das
besonders in der Provinz Lüttich englisches Blut züchtet, kam dieses
besonders nach Nordamerika, wo seine Zucht heute eine der wichtigsten
nationalen Industrien der Vereinigten Staaten bildet. Dort kamen ihm
zunächst die zahlreichen Nüsse und Eicheln des Waldes zugute, während
jetzt der größte Teil der Schweine des Westens mit Mais gefüttert wird.
Welchen Umfang die Schweinezucht in den Staaten der Union angenommen
hat, beweist am besten die Tatsache, daß die Zahl der Schweine, die im
Jahre 1860 etwa 30 Millionen betrug, sich heute mehr als verdoppelt
hat. Nach H. Moos wird die[S. 159] Zucht überall nach demselben Muster
betrieben. Es werden vorwiegend schwarze, frühreife Schläge gehalten;
unter ihnen ist am verbreitetsten das Poland-Chinaschwein und nachher
die Berkshirerasse. Das Zuchtmaterial wird sorgfältig ausgewählt. Meist
werden junge Tiere im Alter von 7–10 Monaten im Gewicht von 90–140
kg geschlachtet, nachdem sie außer Mais besonders auch Klee
erhielten. Die größten Schlächtereien besitzt Chicago.
Mehr nach dem Süden zu tritt die Schweinezucht in Amerika in den
Hintergrund. Schon in Mexiko ist sie sehr gering und in Südamerika nur
in Brasilien da von erheblicher Bedeutung, wo deutsche Ansiedlungen
sich befinden. In Argentinien ist sie seit längerer Zeit stark im
Niedergang begriffen. Einige Zeit hindurch hatte eine ziemlich rege
Ausfuhr von dort nach Brasilien bestanden; sie hörte dann bald auf. Es
fehlt eben jenem Gebiet an einem rationellen Betrieb der Schweinezucht,
ohne den die Konkurrenz mit Amerika nicht aufzunehmen ist. Übrigens
gelangte das Hausschwein spanischer Rasse schon 1493 durch Kolumbus
auf die Antillen und verbreitete sich von da mit der spanischen
Kolonisation nach dem amerikanischen Festlande, wo es noch heute
vielfach angetroffen wird.
Australien, das erst im 18. Jahrhundert das Hausschwein durch die
Engländer eingeführt erhielt, besitzt heute sehr gute englische Rassen,
vor allem die Berkshires, welche vortrefflich gedeihen und zu einer
ausgedehnten Zucht Veranlassung gaben. Da im Lande selbst der Konsum
an Schweinefleisch nicht sehr groß ist, werden die Produkte meist zum
Export gebracht. Neuseeland besitzt ziemlich starke Zuchten, so daß
auch jenes Land schon eine ausgedehnte Ausfuhr von Schweinefleisch nach
Europa betreibt.
Der neueste Import aus Japan ist das Maskenschwein, das 1861
durch den Tierhändler Jamrach, den Konkurrenten von Hagenbeck, in
zoologischen Gärten Deutschlands eingeführt wurde. Es steht dem
chinesischen Hausschwein nahe, besitzt aber auffallend große Ohren und
durch starke Verkürzung des Oberkiefers ein faltiges Gesicht, daher
sein Name. Es ist aber nicht japanischen, sondern indischen Ursprungs,
und zwar eine besondere Art des großohrigen, indischen Schweins.
Da das Hausschwein bei Völkern auf primitiver Kulturstufe ein
halbwildes Leben führt, ist es kein Wunder, daß es sich öfter
der Aufsicht des Menschen entzieht und völlig verwildert. Solche
verwilderte Hausschweine sind in Süd- und Ostasien nichts seltenes und
lassen sich[S. 160] auf den verschiedensten Gebieten der Erde, besonders auf
Inseln, wo sie keine größeren Feinde haben, nachweisen. Dabei nehmen
sie schon nach wenigen Generationen ganz oder teilweise das Aussehen
der wilden Stammform an. In Europa kommen verwilderte Hausschweine auf
Sardinien und den Kykladen vor; weiter finden sich solche im oberen
Nilgebiet, auf den Kanaren, Tristan da Cunha, Réunion und St. Helena.
Auf letzterer Insel gab es nach Cavendish schon 1588 welche; Tavernier
traf deren noch 1649 an. Neben den vielen verwilderten Ziegen trugen
sie wesentlich dazu bei, den jung aufsprossenden Wald zu zerstören. Auf
Jamaika, St. Domingo, St. Thomas und anderen westindischen Inseln gibt
es solche, wahrscheinlich aus den Resten der spanischen Kolonisation
herrührend. Auch in Venezuela, Brasilien, Paraguay und Peru gibt es
verwilderte Schweine verschiedener Art, teils schwarze mit stehenden
Ohren, teils heller gefärbte mit den Hängeohren ihrer chinesischen
Vorfahren. Auf den Bermudas, den Galapagos, den Andamanen, Nikobaren
und zahlreichen Inseln Melanesiens, Mikronesiens und Polynesiens sind
ebenfalls verwilderte Hausschweine anzutreffen. Auf Neuseeland gibt
es solche, die die konkave Form des Gesichts ihrer chinesischen Ahnen
beibehielten.
Schwein und Huhn sind die einzigen Tiere, bei denen die Operation der
Kastration zur Mast in größerem Umfang auch beim weiblichen Geschlecht
vorgenommen wird. Im Altertum begnügte man sich, wie Columella
berichtet, in solchen Fällen zur Verhinderung einer Befruchtung
die Scheide narbig zu verschließen; erst im Mittelalter wurde die
Beseitigung der Eierstöcke vorgenommen. Solche Tiere nannte man dann
Nonnen. Ein solcher Schweineschneider in Ungarn war es, der es als
erster wagte, bei seiner Tochter, die nicht auf natürlichem Wege
niederzukommen vermochte, den Kaiserschnitt durch Eröffnung des Bauches
und der Gebärmutter vorzunehmen. Dabei rettete er Mutter und Kind das
Leben. Erst hernach haben dann die Ärzte diese Operation vorzunehmen
gewagt.
Weit früher als das Pferd hat sich der Mensch den Esel gezähmt, nicht
um sein Fleisch oder seine Milch oder sein Haarkleid zu benutzen,
sondern um ihn als Transporttier zu verwenden. Als das Rind schon
längst Haustier geworden war und an den Pflug, wie auch an den Wagen
gespannt wurde, kam man noch nicht auf den Gedanken, auf ihm Lasten
fortzubewegen. Dazu diente im ältesten Ägypten der Esel, der allerdings
ausschließlich als Last- und noch nicht als Zugtier benutzt wurde.
Außer den Lasten transportierte man auch die unbehilflichen Mitglieder
der Familie, wie etwa Weiber und Kinder, auf dem Esel, den der Mann
dann führte. Er selbst bestieg ihn nicht, um als Reiter mit größerer
Geschwindigkeit das Land zu durchstreifen. Dies geschah erst, als
der vornehmere und anspruchsvollere Vetter des Esels, das Pferd, vom
Menschen domestiziert wurde und dann freilich seinem bescheidenem
Verwandten den Rang ablief und weit ausgedehntere Verbreitung fand.
Aber im hamitisch-semitischen Kulturkreis ist der Esel bis heute in
hoher Wertschätzung geblieben; nur in Südeuropa, wo er sich ebenfalls
stark einbürgerte, sank er zum verachteten und mißhandelten Geschöpf
herab, dem man seine sprichwörtliche Starrköpfigkeit als Dummheit
auslegt.
Die ältesten Spuren zahmer Esel, die uns bis heute bekannt geworden
sind, lassen sich im Niltal nachweisen und reichen dort bis in die
urägyptische Zeit, die um die Mitte des vierten Jahrtausends v.
Chr. zu setzende Negadaperiode, zurück. So besitzen wir auf einer
bereits früher erwähnten Schieferplatte des Museums in Giseh aus
der Negadazeit, die de Morgan zuerst veröffentlichte, treffliche
Abbildungen des Esels. Er ist dort in einer ganzen Reihe von
Tieren mit großen, aufrechtstehenden Ohren neben dem Hausrind von
Bantengabstammung und dem Hausschaf von Mähnenschafdescendenz
dargestellt in der Form des gewöhnlichen Hausesels mit schwarzem
Schulterkreuz, das[S. 162] auf allen Figuren deutlich erkennbar ist.
Schon während des Alten Reichs in der ersten Hälfte des dritten
vorchristlichen Jahrtausends war die Zucht des Esels in Ägypten
eine stark ausgedehnte. Im Grabe des Chafra ank in Giseh aus der 4.
Dynastie (2930–2750 v. Chr.), der Zeit der großen Pyramidenerbauer,
eines hohen Würdenträgers unter der Regierung des Chefren, berichtet
ein Oberschreiber seinem Herrn, er besitze einen Viehstand von nicht
weniger als 5023 Stück, darunter 760 Esel. In anderen Gräbern derselben
Periode wird, vermutlich mit etwas Übertreibung, gemeldet, daß die
Besitzer über mehr als tausend, ja Tausende von Eseln verfügten.
Zur Zeit der ältesten Dynastien wird der Esel häufig auf den
Grabwänden dargestellt, da sich das bürgerliche Leben ohne ihn gar
nicht vorstellen ließ. Er wurde ausschließlich als Lasttier, daneben
etwa noch wie Schafe und Rinder zum Dreschen auf der Tenne, d. h.
zum Austreten der Körner der Feldfrüchte mit den Hufen verwendet.
Doch diente er daneben bereits als Reittier, doch nicht in der Weise,
daß sich die Ägypter auf seinen Rücken setzten, sondern so, daß ein
Reitsessel zwischen zwei Eseln befestigt wurde, um darin die über
Land reisende vornehme Person aufzunehmen. Erst als zur Zeit des
Neuen Reiches (um 1580 v. Chr.) infolge der regen Beziehungen mit
den Völkern Vorderasiens das Pferd als wertvolles Kriegsinstrument,
das den Schlachtwagen zog, nach dem Nillande kam und hier unter den
kriegerischen Pharaonen der 18. und 19. Dynastie in Menge gezüchtet
wurde, trat der Esel gegenüber dieser neuen Erwerbung etwas in
den Hintergrund, um allerdings später wieder seine Vorherrschaft
anzutreten, die er in jenem Lande bis heute zu behaupten vermochte.
Woher bezogen nun die vorpharaonischen Ägypter der Negadaperiode
den Hausesel? Zweifellos aus Nubien, wo der ostafrikanische
Steppenesel (Asinus taeniopus) von hamitischen
Volksstämmen, wahrscheinlich den Vorfahren der heutigen Galla,
gezähmt und damit in den Haustierstand übergeführt worden war. Der
Steppenesel findet sich heute noch in den Steppen Obernubiens, am
häufigsten in den Ebenen von Barka und um den Atbara, den Hauptzufluß
des Nils. Sein Verbreitungsgebiet erstreckt sich aber bis an die Küste
des Roten Meeres. Wie bei allen Steppentieren ist Geselligkeit ein
Grundzug seines Wesens. Das ausnehmend scheue und vorsichtige Tier
lebt in kleinen Rudeln, wobei eine Herde von 10–15 Stuten von einem
Hengst geführt, bewacht und verteidigt wird. Als Mittelglied zwischen
seinen streifenlosen, asiatischen Verwandten und den afrikanischen
Tigerpferden sind[S. 163] seine Füße leicht — von unten nach oben in
abnehmender Stärke — gestreift und zieht sich dem Rücken entlang
vom Schwanz bis zur Schulter ein schwarzes Band, das sich hier in
zwei gegen die Seitenbuge hin verlaufende Arme teilt. Es ist dies das
vorgenannte Rückenkreuz, das sich bei seinen gezähmten Nachkommen noch
teilweise erhielt. Außerordentlich stark ausgesprochen war es noch nach
der Abbildung bei den Hauseseln der Negadazeit, die also dem Stammvater
noch hochgradig ähnlich gesehen haben müssen, ja, kaum von ihm
abwichen, was also eine sehr junge Zucht bedeutet. Diese Negadahausesel
haben auch die typische Kopfbildung und die aufrechtgestellten, großen
Ohren des ostafrikanischen Steppenesels, von dem wildeingefangene Tiere
bis auf den heutigen Tag je und je zur Veredlung der Eselzucht in ihrer
Heimat verwendet werden. Wie vermutlich schon die alten Ägypter gaben
die alten Römer große Summen für diese Veredelung aus, was die Araber
jetzt noch tun. Deshalb haben sie auch ein so edles Eselmaterial,
demgegenüber unser durch Inzucht und Vernachlässigung herabgekommenes
Eselmaterial keinen Vergleich aushält.
Vom Niltal her wurden schon sehr früh die Juden und übrigen Semiten
Vorderasiens mit dem Hausesel bekannt, der, wie in Ägypten, so auch
bei ihnen eine sehr geachtete Stellung einnahm. Er diente auch
hier zum Tragen von Lasten aller Art. So sehen wir auf einer der
Wandmalereien des Grabes von Num hotep in Beni Hassan unter einem der
ersten Könige der 12. Dynastie (2000–1788 v. Chr.) die Einwanderung
eines semitischen Stammes von Hirten in das Land Gosen am Delta. Diese
Nomaden werden darauf als Aamu bezeichnet und wandern mit ihren Herden
nach Unterägypten ein, als einzige Lasttiere Esel mit großen Ohren
mit sich führend, auf denen sie alle ihre Habe und die kleinen, des
Gehens unfähigen Kinder aufgeladen haben. Überall im Alten Testament
ist an Stelle des Pferdes der Esel der treue Begleiter des Vieh
hütenden Nomaden. Von den Zeiten Abrahams an war es der Stolz des
Oberhauptes der Familie, zahlreiche Esel neben den Schafen und Rindern
zu besitzen, und später, als dies aufkam, alle seine Söhne auf Eseln
beritten zu sehen. Nach demselben Grundsatze, an dem heute noch der
Japaner speziell in bezug auf das pflügende Rind streng festhält,
sollte das Arbeitstier nicht zugleich auch zur Nahrung dienen. Deshalb
enthielten sich die Juden ausdrücklich des Fleisches vom Esel, was
ursprünglich nicht alle semitischen Stämme getan zu haben scheinen.
Ja, wahrscheinlich haben auch die vorpharaonischen Bewohner Ägyptens
gelegentlich den zahmen[S. 164] Esel geschlachtet und als willkommene Speise
verwendet. Aber die Juden enthielten sich nicht nur des Schlachtens von
Eseln, sondern lösten sogar nach dem Gesetz die dem Tode verfallene
Erstgeburt desselben wie diejenige des Menschen durch das Opfern eines
Schafes ab.
Über Syrien und Kleinasien kam der Hausesel zu Beginn des letzten
vorchristlichen Jahrtausends in die Balkanhalbinsel, wo er vermutlich
asnas hieß, und von da zuerst zu den Griechen als ónos
und später auch als asinus zu den Römern. In der homerischen
Zeit, da Viehzucht und Ackerbau vorherrschten, war der Esel noch
nicht das gebräuchliche Lasttier, sondern ein durch seine Seltenheit
wertvolles Zuchttier, das zur Gewinnung der damals schon geschätzten
Maultiere diente. Nur an einer zweifellos später eingeschobenen Stelle
der Ilias wird er in einem Gleichnisse erwähnt. In der ältesten, sich
an Homer anschließenden griechischen Lyrik wird er als Zuchttier
erwähnt, das viel zu kostbar war, um der Feld- und Hausarbeit zu
dienen. In einem Fragmente des Lyrikers Archilochos von Paros (um 700
v. Chr.) wird von einem Menschen gesagt, daß ihm das Glied anschwoll,
wie das des mit Korn gefütterten Zuchtesels aus Priene (einer Stadt
der kleinasiatischen Küste nördlich von Milet). Auch Simonides von
Amorgos, der jüngere Zeitgenosse des Archilochos, kennt den Esel nur
als Zuchttier und legt in einem Gedicht einigen Weibern dessen Art bei,
die träge, gefräßig und geil sei. Erst der Dichter Tyrtaios aus Attika
um 684 v. Chr. spricht vom Esel als Lasttier, das die Kornfrucht vom
Acker nach Hause tragen müsse.
Im Gegensatz zu dem als Beschäler der Pferdestute gehaltenen
Eselhengst war bei den ältesten Griechen das von einem solchen mit
einer Pferdestute erzeugte Maultier als hemíonos,
d. h. Halbesel, oder oreús, d. h. Bergtier, das eigentliche
Arbeitstier, sowohl bei der Feldbestellung als im Geschirr vor
dem Wagen und beim Schleppen von Lasten; deshalb wird es gern als
vielduldend und mühselig bezeichnet. Schon weil es stärker war als
der Esel wurde es diesem vorgezogen, wie Theognis (der um 560 v. Chr.
lebende Dichter aus Megara) ausdrücklich bezeugt. Nach Homer stammte
das Maultier von den Enetern, einem paphlagonischen Volke aus dem
pontischen, d. h. gegen das Schwarze Meere zu gelegenen Kleinasien,
her. An einer andern Stelle der Ilias hatten die Bewohner von Mysien
dem König Priamos von Ilion Maultiere geschenkt nach dem 24. Buche,
Vers 277:
„Schirrten die Maultiere an, starkhufige, kräftig zur Arbeit,
Welche die Myser dem Greise verehrt als edle Geschenke.“
[S. 165]
In einem Fragment des jonischen Dichters Anakreon (550–478 v. Chr.)
werden die Myser geradezu als Erfinder der Maultierzucht durch Kreuzung
von Eselhengsten mit Pferdestuten bezeichnet. Schon im Alten Testament
bei Ezechiel (596 v. Chr.) wird die Landschaft Thogarma, d. h. Armenien
oder Kappadozien als diejenige bezeichnet, die die besten Maulesel
lieferte. Den Israeliten selbst verbot das Gesetz diese Zucht. Noch
später hören wir mehrfach, so bei Aristoteles, Plutarch und Plinius,
die Maultiere Kappadoziens und Galatiens als besonders edle Zucht
rühmen; von den ersteren wird berichtet, sie seien fruchtbar, also
unter besonders günstige Naturverhältnisse gestellt.
Merkwürdig ist bei dieser Wertschätzung des Maultiers als Ersatz des
Esels, daß, vielleicht durch semitische Anschauungen beeinflußt, seit
der mythischen Zeit in Elis im Peloponnes das Verbot bestand, Maultiere
im Lande selbst zu erzeugen. So soll der König von Pisa in Elis,
Oinomaos, der Sohn des Meergottes Poseidon und Vater der Hippodameia,
deren Freier er hinterlistig beim Wettfahren tötete, bis er von
Pelops durch List überwunden wurde, einen Fluch über diese Zeugung
ausgesprochen haben, und seither brachten die Eleer ihre Stuten außer
Landes, um sie dort von Eseln belegen zu lassen, wie uns Herodot und
Pausanias gleicherweise bezeugen. Vielleicht, meint V. Hehn, war in
diesem elischen Brauch nur die durch Religion festgehaltene Anschauung
der ältesten Zeit aufbewahrt, da es in Griechenland keine anderen als
vom Orient eingeführte Maultiere gab und das Volksgefühl sich gegen
solche widernatürliche Mischung noch sträubte. Auch in Homers Odyssee
wird vom Bewohner Ithakas Naëmon gesagt, er besitze in dem weidereichen
Elis zwölf Stuten mit den dazu gehörigen Maultierfüllen. Von einem
Eselhengste aber ist dort nirgends die Rede. Gemäß der Bedeutung des
Wortes oreús, d. h. Bergtier für Maultier, wird in der Ilias
an einer Stelle geschildert, wie das Maultier mühsam Balken und
Schiffsbauholz aus den Bergen hinabgeschleppt habe, an einer andern,
wie die Männer mit Äxten, Seilen und Maultieren in das bewaldete
Idagebirge hinaufziehen, um Holz für den Scheiterhaufen von Achills
Freund Patroklos zu holen; wie dann nach dem Fällen und Zerkleinern der
Bäume die Last den Maultieren aufgebunden wird, die sie dann stampfend
in die Ebene hinabtragen.
Dieselbe Wertschätzung des Maultiers wie bei den Griechen finden wir
auch bei den Römern. So sagt beispielsweise der ältere Plinius in
seiner Naturgeschichte: „Das Maultier (mulus) ist zur Arbeit
ganz[S. 166] ausgezeichnet gut.“ Daneben waren aber auch die Esel in hoher
Achtung; denn derselbe Autor sagt an einer anderen Stelle von diesem
Tiere: „Der Gewinn, welchen man aus Eseln zieht, übertrifft den der
fruchtbarsten Landgüter.“ Des Plinius Zeitgenosse Columella sagt
rühmend von ihm: „Der gemeine Esel (asellus) ist mit geringem
Futter, wie Blättern, Dornen, Zweigen, Spreu usw. zufrieden, braucht
auch nur geringe Pflege, hält Prügel und Mangel aus, wird selten krank
und erträgt die Arbeit leicht. Auf dem Lande ist er ganz unentbehrlich,
weil er die Mühle treiben und allerlei Gegenstände in die Stadt und von
da zurücktragen muß.“
Hundert Jahre vor diesen beiden schreibt der gelehrte Varro: „Was
die zahmen Esel betrifft, so werden in Griechenland die arkadischen
sehr geschätzt, in Italien dagegen die von Reate, und ich weiß einen
Fall, wo ein solcher mit 60000 Sesterzien (= 9000 Mark) bezahlt wurde
und in Rom ein Viergespann von Eseln mit 400000 Sesterzien (= 60000
Mark).“ Weiter meint er: „Der Wildesel, der herdenweise in Phrygien und
Lykaonien lebt — offenbar ist hier vom später zu besprechenden Onager
die Rede, dessen Verbreitungsgebiet sich damals westlich noch bis dort
erstreckt zu haben scheint — kann man leicht zähmen, den zahmen Esel
aber nicht in einen wilden umschaffen. Man braucht den Wildesel gern
zur Zucht. Das Junge des zahmen Esels läßt man im ersten Jahre ganz
bei seiner Mutter, im zweiten nur bei Nacht, jedoch so, daß beide
angebunden sind; im dritten wird es zu seiner Arbeit dressiert. Die
meisten werden gebraucht, um die Mühle zu drehen, oder zum Tragen und
Fahren, in leichtem Boden auch zum Pflügen. Kaufleute halten auch ganze
Herden, um Öl, Wein, Getreide usw. zu transportieren.“ Jung wurden
sie auch verspeist. So schreibt Plinius in seiner Naturgeschichte,
Maecenas, der reiche Freund des Kaisers Augustus, habe die Mode
aufgebracht, junge Esel zu essen. Derselbe Autor berichtet: „Die
Eselsmilch soll die Haut weiß machen; deshalb führte Poppaea, die
Gemahlin Neros, immer 500 milchende Eselinnen mit sich und badete in
deren Milch.“
Seit dem Altertum hat sich der Esel als wichtigstes Arbeitstier
überall in den Mittelmeerländern unentbehrlich gemacht, ist aber durch
schlechte Haltung immer kleiner und unansehnlicher geworden. Dabei
hat er eine mattere, aschgraue Farbe und schlaffere Ohren bekommen.
Oken sagt von ihm: „Der zahme Esel ist durch die lange Mißhandlung so
sehr heruntergekommen, daß er seinen Stammeltern fast gar[S. 167] nicht mehr
gleicht. Der Mut hat sich bei ihm in Widerspenstigkeit verwandelt, die
Hurtigkeit in Langsamkeit, die Lebhaftigkeit in Trägheit, die Klugheit
in Dummheit, die Liebe zur Freiheit in Geduld, der Mut in Ertragung der
Prügel.“ Tatsächlich ist an diesem treuen Arbeitstiere des Menschen
im Laufe der Jahrhunderte unsäglich viel gesündigt worden, daher sein
widerstrebender, eigensinniger Charakter!
Gemäß seiner Herkunft aus einer heißen Steppe fühlt er sich um so
wohler, je wärmer und trockener das Land ist. Feuchtigkeit und Kälte
verträgt er viel weniger als das hierin weniger empfindliche Pferd.
Schon Plinius sagt: „Kälte kann dieses Tier (der Esel) nicht gut
vertragen.“ In bezug auf Futter ist er durchaus nicht wählerisch und
begnügt sich mit sehr geringen Mengen davon. Brehm sagt von ihm:
„Gras und Heu, welches eine wohlerzogene Kuh mit Abscheu verratendem
Schnauben liegen läßt und das Pferd unwillig verschmäht, sind ihm
noch Leckerbissen: er nimmt selbst mit Disteln, dornigen Sträuchern
und Kräutern vorlieb. Bloß in der Wahl des Getränkes ist er sorgsam,
denn er rührt kein Wasser an, welches trübe ist; salzig, brackig
darf, rein muß es sein. In Wüsten hat man oft sehr große
Not mit dem Esel, weil er, alles Durstes ungeachtet, nicht von dem
trüben Schlauchwasser trinken will.“
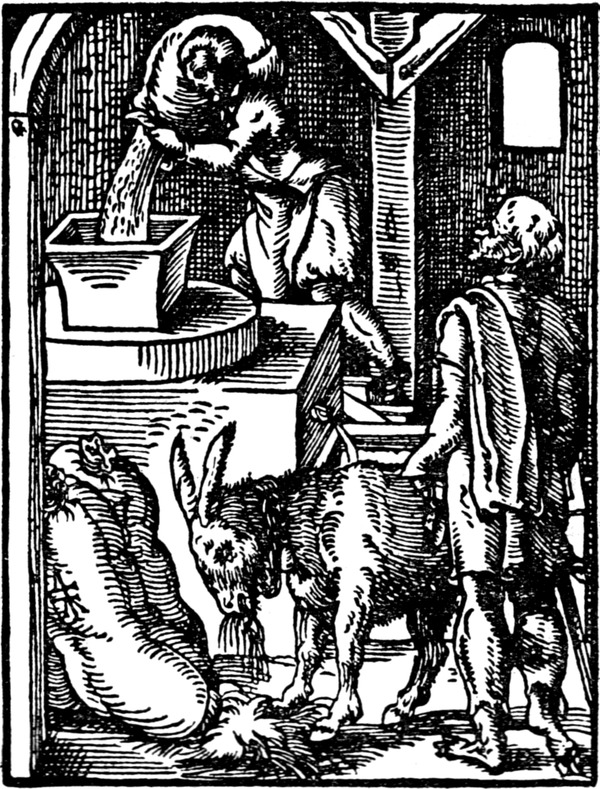
Bild 23. Altdeutscher Mülleresel.
(Nach einem Holzschnitt von Jost Ammann.)
Die Paarungszeit des Esels fällt in die letzten Frühlings- und ersten
Sommermonate. Etwa 11 Monate nach der Paarung wirft die Eselin ein
— höchst selten zwei — vollkommen ausgebildetes, sehendes Junges,
das sie mit großer Zärtlichkeit ableckt und das ihr sofort zu folgen
vermag. Schon eine halbe Stunde nach der Geburt bietet ihm seine Mutter
das Euter dar, das ihm die nächste Nahrung spendet.[S. 168] Nach 5–6 Monaten
kann das Eselsfüllen entwöhnt werden, folgt aber noch lange seiner
Mutter auf allen Wegen nach. Es ist ein überaus munteres, lebhaftes
Tier, das die possierlichsten Sprünge ausführt. Schon im zweiten Jahre
ist es erwachsen; aber erst im dritten Jahre erreicht es seine volle
Kraft, um selbst bei harter Arbeit ein Alter von über 30 Jahren zu
erreichen.
Im Volksleben Mitteleuropas spielte der Esel nur als Mülleresel, der
die Säcke nach und von der Mühle trug, eine beschränkte Rolle und
wurde nie das volkstümliche Haustier wie in Südeuropa oder gar im
Orient. Er kam einst im Mittelalter vorzugsweise durch die Mönchsorden
nach Deutschland in die Klöster, um hier als Lasttier verwendet zu
werden. So erlaubte z. B. Herzog Konrad I. von Urach 1263
den Franziskanern in Freiburg im Breisgau „mit drei Eseln aus dem
Herzogenwald Holz zu holen.“ Aus den Klöstern ging er dann später
teilweise zu den Laien über. Aber im allgemeinen kam er im Laufe der
Zeit als schlecht gefüttertes und fast ungepflegtes Arbeitstier des
kleinen, armen Mannes zu einem blöden Jammerwesen herunter und wurde so
für den Volksmund zum sprichwörtlichen Vertreter der Dummheit. Nicht
viel besser erging es dem Esel in den Mittelmeerländern, obwohl er
dort viel zahlreicher gehalten wird und zum geradezu unentbehrlichen
Gehilfen des Menschen, speziell des Gartenbauers, wurde. Auch hier
ist das Leben des armen „Packesels“ eine Kette von Anstrengungen,
Leiden und Entbehrungen gepaart mit zahlreichen Mißhandlungen. Erst im
Morgenlande sehen wir aus diesem Proletarier unter den Haustieren des
Abendlandes einen mit weit größerer Sorgfalt als bei uns behandelten
Diener und Genossen des Menschen werden, der es sogar zu einigem Adel
der äußeren Erscheinung, wie des Charakters bringt. Brehm schreibt in
seinem bekannten Tierleben: „Der nordische Esel ist, wie allbekannt,
ein träger, eigensinniger, oft störrischer Gesell, welcher allgemein,
wenn auch mit Unrecht, als Sinnbild der Einfalt und Dummheit gilt, der
südliche Esel dagegen, zumal der ägyptische, ein schönes, lebendiges,
außerordentlich fleißiges und ausdauerndes Geschöpf, welches in seinen
Leistungen gar nicht weit hinter dem Pferde zurücksteht, ja es in
mancher Hinsicht noch übertrifft. Ihn behandelt man auch mit weit
größerer Sorgfalt als den unsrigen. In vielen Gegenden des Morgenlandes
hält man die besten Rassen so rein wie die des edelsten Pferdes,
füttert die Tiere sehr gut, plagt sie in der Jugend nicht so viel und
kann deshalb von den erwachsenen Dienste verlangen, welche unser[S. 169] Esel
gar nicht zu leisten imstande sein würde. Man hat vollkommen recht,
viele Sorgfalt auf die Zucht des Esels zu verwenden; denn er ist dort
Haustier im vollsten Sinne des Wortes: er findet sich im Palast des
Reichsten wie in der Hütte des Ärmsten und ist der unentbehrlichste
Diener, welchen der Südländer kennt. Schon in Griechenland und Spanien
trifft man sehr schöne Esel, obgleich sie noch weit hinter den im
Morgenlande, zumal in Persien, Turkmenien und Ägypten gebräuchlichen
zurückstehen. Der griechische und der spanische Esel kommen einem
kleinen Maultier an Größe gleich; ihr Haar ist glatt und weich, die
Mähne ziemlich, die Schwanzquaste verhältnismäßig sehr lang; die Ohren
sind lang, aber fein gebaut, die Augen glänzend. Große Ausdauer, ein
leichter, fördernder Gang und ein sanfter Galopp stempeln diese Esel zu
unübertrefflichen Reittieren.“
Noch weit schöner als diese Esel von ostafrikanischer Abstammung
sind die arabischen Esel, zumal diejenigen, welche in Jemen gezogen
werden. Es gibt zwei Rassen, eine große, mutige, rasche, zum Reiten
höchst geeignete, und eine kleine, schwächere, welche gewöhnlich zum
Lasttragen benutzt wird. Der große Esel ist wahrscheinlich durch
Kreuzung mit dem Onager und seinen Nachkommen veredelt worden. Ganz
ähnliche Rassen finden sich in Persien und Ägypten, wo man viel Geld
für einen guten Esel ausgibt. Ein allen Anforderungen entsprechender
Reitesel steht höher im Preis als ein mittelmäßiges Pferd, und es ist
gar nicht selten, daß man bis 1500 Mark unseres Geldes für ihn bezahlt.
„Etwas Nutzbareres und Braveres von einer Kreatur als dieser Esel“,
sagt Bogumil Goltz, „ist nicht denkbar. Der größte Kerl wirft sich auf
ein Exemplar, welches oft nicht größer als ein Kalb von sechs Wochen
ist, und setzt es in Galopp. Diese schwach gebauten Tiere gehen einen
trefflichen Paß; wo sie aber die Kräfte hernehmen, stundenlang einen
ausgewachsenen Menschen selbst bei großer Hitze im Trab und Galopp
herumzuschleppen, das scheint mir fast über die Natur hinaus in die
Eselsmysterien zu gehen.“ Man verschneidet den Reiteseln das Haar sehr
sorgsam und kurz am ganzen Körper, während man es an den Schenkeln in
seiner vollen Länge stehen läßt; dort werden dann noch allerlei Figuren
und Schnörkel eingeschnitten, und die Tiere erhalten dadurch ein ganz
eigentümliches Aussehen.
Weiter nach dem Innern, wo das nützliche Geschöpf ebenfalls als
Haustier gehalten wird, sieht man wenige edle Esel, und auch diese
werden erst eingeführt.
[S. 170]
Die hier erwähnte hochgeschätzte, edlere Eselrasse, welche größer,
von schlankerer Gestalt und feineren Gliedmaßen, mit kürzeren Ohren,
isabellfarben bis weiß ist und wegen ihrer Gutartigkeit und Lenksamkeit
häufig von vornehmen Damen geritten wird, ist tatsächlich kein
Abkömmling des afrikanischen Steppenesels, von dem die gewöhnlichen
Eselrassen abstammen, sondern des westasiatischen Steppenesels,
des Onager der Alten (Asinus onager), der auch in der
Bibel mehrfach erwähnt wird. Dieses von Syrien über Arabien, Persien
bis Indien verbreitete Tier ist merklich kleiner als der die Steppen
Zentralasiens nördlich von Tibet in kleinen, äußerst scheuen Herden
bewohnende edelste Wildesel, der Kulan der Kirgisen oder
Dschiggetai, d. h. zu deutsch Langohr der Mongolen, der mit dem
Schwanz 2,5 m lang wird bei einer Höhe am Widerrist von 1,3–1,5
m, aber doch größer und feingliedriger als der gemeine Esel.
Sein Kopf ist verhältnismäßig noch höher und größer als beim Kulan, die
dicken Lippen sind bis an den Rand mit steifen, borstigen Haaren dicht
bekleidet, die Ohren ziemlich lang, jedoch kürzer als beim Esel. Die
vorherrschende Färbung ist ein silberiges Weiß, das auf der Oberseite
des Kopfes, an den Seitenflächen des Halses und des Rumpfes, sowie an
den Hüften in ein blasses Isabellgelb übergeht. Am Seitenbug zieht
sich ein weißer Streifen von Handbreite herab. Ein zweiter Streifen
verläuft längs des ganzen Rückens und an der Hinterseite der Schenkel;
in seiner Mitte liegt der kaffeebraun gefärbte Riemen. Die Behaarung
ist seidenartiger und weicher als beim Pferde, im Sommer äußerst glatt
und zart, im Winter wolliger.
Der Onager ist äußerst scheu, vorsichtig und schnellfüßig, so daß ihm
in offener Steppe gar nicht beizukommen ist. Er lebt in kleinen, aus
Stuten und Füllen beiderlei Geschlechts bestehenden Herden, die von
einem Haupthengst geführt werden. Er ist außerordentlich genügsam und
kommt höchstens jeden zweiten Tag zur Tränke, weshalb der Anstand auf
ihn meist vergeblich ist. Salzhaltige Pflanzen, wie sie die Salzsteppe
seiner Heimat in Menge hervorbringt, sind seine angenehmste Nahrung.
Salziges Wasser liebt er mehr als süßes, jedoch muß es rein sein; denn
trübes trinkt er nie.
Schon im frühen Altertum wurde dieses Wildpferd in Vorderasien gefangen
und gezähmt, um dem Menschen dienstbar zu sein. So haben ihn schon
die Sumerer in Mesopotamien zum Kriegführen verwendet, lange bevor
das Pferd aus Innerasien zu ihnen gelangte. Als aber letzteres im
Zweistromland Aufnahme gefunden hatte, ver[S. 171]drängte es für diesen
Zweck den älteren Esel. So finden wir unter den Kriegsszenen der
Assyrer stets nur das Pferd als Zugtier am zweirädrigen Kriegswagen
abgebildet, während der als Lasttier hauptsächlich landwirtschaftlichen
Zwecken dienende Esel hier fehlt. Dagegen findet sich das Einfangen
des Wildesels gelegentlich auf den Jagddarstellungen. Eine solche
besitzen wir beispielsweise auf dem Basrelief einer Marmorplatte aus
dem etwa 668 v. Chr. gebauten Palast des Asurbanipal in Kujundschik.
Hier hat der assyrische Künstler eine Jagdszene wiedergegeben, die an
packender Naturtreue den besten Leistungen der antiken Tierdarstellung
an die Seite zu stellen ist. Zwei mit bis zu den Knien reichenden
befransten Gewändern bekleidete Männer mit hohen Sandalen und wellig
gescheiteltem Haupthaar ohne Bart führen zwischen sich an Stricken
einen mit dem Lasso gefangenen jungen Onagerhengst, während darunter
zwei wilde Onager in eiligstem Lauf, der eine mit den Hinterbeinen wild
um sich schlagend, in entgegengesetzter Richtung davoneilen. Der ganze
Körperbau, die Bildung des Kopfes und Halses mit der kurzen Mähne,
dann vor allem der an der Spitze mit Haarquaste versehene Eselsschwanz
weisen mit Bestimmtheit auf den westasiatischen Onager und nicht auf
das Wildpferd, wie Konrad Keller darzutun versucht. Solche Wildlinge
wurden wohl auch zur Auffrischung der einheimischen Eselzucht verwendet.
Noch weit später sind je und je wilde Onager in Westasien gefangen
worden, müssen also damals in der dortigen Steppe noch in namhaften
Herden gelebt haben. So wurden sie auch wiederholt zur Kaiserzeit bei
den großen Zirkusspielen in Rom vorgeführt und allerlei Raubtiere auf
sie gehetzt. So schreibt Julius Capitolinus in seiner Biographie des
Gordian, der 238, 80 Jahre alt, mit seinem Sohne zum Kaiser ausgerufen
wurde, sich aber 36 Tage nachher, als letzterer vor Karthago geschlagen
ward und fiel, tötete, er habe, als er unter Caracalla und Alexander
Severus Konsul war, einmal bei den von ihm gegebenen Jagdspielen im
Zirkus Maximus in Rom 30 Wildesel — wohl ein seltsames Schauspiel für
die sonst so verwöhnten Römer — auftreten lassen. Noch seltener gab
es dort das ebenso flüchtige Tigerpferd Afrikas, das Zebra, von den
Römern hippotigris genannt, zu sehen. So berichtet ein anderer
römischer Schriftsteller, daß Kaiser Caracalla im Jahre 211 neben
Tiger, Elefant und Nashorn auch einen Hippotigris auftreten ließ und
eigenhändig tötete.
Schon frühe, wenn auch bedeutend später als der afrikanische[S. 172]
Steppenesel, ist dieser südwestasiatische Steppenesel, jung eingefangen
und an des Menschen Gegenwart und Pflege gewöhnt, zum Haustiere
desselben geworden. Doch wurde er in seiner Heimat nicht so regelmäßig
wie der Hausesel bei den Ägyptern und den mit diesem in der Folge
beschenkten Völkern gehalten, so daß sich wohl erst spät eine
eigentliche Zucht ausbildete. So berichtet der Vater der griechischen
Geschichtsschreibung, Herodot, daß die 580 im Heere des Xerxes, bei
seinem Zuge gegen Griechenland, befindlichen Inder Streitwagen führten,
die teils mit Pferden, teils mit Wildeseln (ónos ágrios, eben
dem Onager) bespannt waren. Von eben diesem Onager, der damals noch
häufiger als heute angetroffen wurde, berichtet Xenophon vom Jahre
401 v. Chr. von seiner Expedition zugunsten des Cyrus: „Als Cyrus der
Jüngere durch Arabien, im Westen des Euphrats, hinzog, kam er durch
eine ganz unabsehbare Ebene, woselbst es sehr viele Wildesel gab. Diese
liefen viel schneller als Pferde und konnten nur gefangen werden, indem
Reiter sich in großen Entfernungen voneinander aufstellten und so im
Jagen wechselten. Das Wildpret dieser Tiere glich dem des Hirsches, war
aber zarter.“
Dieser westasiatische Hausesel ist gemäß seiner Abstammung vom Onager
nicht grau, wie der sich vom afrikanischen Steppenesel ableitende
Hausesel, sondern weiß oder isabellfarben und viel größer als jener.
Ja, sie geben dem Pferd an Größe nicht viel nach. Am meisten werden
sie in Südostarabien gezogen und kommen dann als Maskatesel in
den Handel. Man trifft sie außer in Arabien besonders viel in Persien
und Mesopotamien als Reittiere verwendet, da sie nicht nur stark
gebaut, sondern, im Gegensatz zum störrischen Wesen ihres afrikanischen
Vetters, lenksam und dabei ausdauernd sind. In Mesopotamien (Bagdad)
kommen sie neben dem gewöhnlichen Lastesel häufig auf den Markt und
gelten dort 25 türkische Pfund (= 560 Mark). Die besten Zuchten stammen
aus Nedje in Zentralarabien. Als schöne und edle Rassetiere werden
sie mit Vorliebe von den vornehmen und reichen Orientalen gehalten,
die sich solchen Luxus leisten können. Das gemeine Volk aber begnügt
sich mit dem weniger edlen Grautier, dem Abkömmling des afrikanischen
Steppenesels, der sich allein als Arbeitstier über größere Gebiete der
Erde verbreitet hat. Wie seit dem frühesten Altertum spielt letzterer
heute noch in Ägypten als Reit- und Transporttier der Eingeborenen
eine wichtige Rolle und gehört überall, besonders in den Städten,
zur Staffage des Straßenlebens. Durch ganz Afrika hat er bei den
hamo-semitischen Stämmen die größte Ver[S. 173]breitung gefunden, während
ihn die Neger ablehnten. Im äußersten Osten, in den Somaliländern,
ist er lediglich Lasttier, das den Karawanen folgt. Doch wird er dort
nicht gerade zahlreich gehalten, da in den dortigen Steppenländern das
Kamel leistungsfähiger ist. Auch in Abessinien wird er in den höheren
Lagen ziemlich viel als Lasttier verwendet, aber auch ausgiebig zur
Maultierzucht benutzt. Die am weitesten nach Innerafrika vorgeschobenen
Hamiten, die Gallas und die Massai, halten zahme Esel in großer Zahl.
Es sind kräftige, graue Tiere mit scharfgezeichnetem Schulterkreuz.
Vom oberen Niltal hat sich das Tier stark nach den Haussaländern
verbreitet, wo es ebenfalls vorzugsweise als Lasttier benutzt wird.
Ebenso ist es in Südafrika häufig, da es gegen gewisse hier umgehende
Krankheiten, besonders die Tsetse, widerstandsfähiger als das Pferd
ist. Die ersten Esel kamen bereits 1689 aus Persien nach dem Kap und
wurden in der Folge vorwiegend durch die Buren weiter nördlich bis zum
Sambesi verbreitet.
In Arabien, Mesopotamien, Persien und Afghanistan wird neben dem
großen, hellen Hausesel von Onagerabstammung sein kleiner, grauer,
afrikanischer Verwandter ebenfalls häufig gehalten. Große, auffallend
stark gebaute Esel von vorwiegend Onagerblut findet man bei den
Turkmenen. In der Mongolei und Mandschurei besteht eine starke
Eselzucht, die von ihrem Überschuß vielfach an chinesische Kleinhändler
abgibt. Doch ist der Esel in China so unwichtig, daß er nicht einmal
nach Japan kam, wo man nur das Pferd verwendet. In Indochina und
Indonesien fehlt er ganz. In Ostindien findet man ihn nur selten,
z. B. in Cotschin, wo sich Araber aufhalten. Kleinasien dagegen besitzt
wie ganz Westasien eine Menge von Eseln, doch überwiegend Grautiere
von ziemlich elender Erscheinung, weil sie schlecht gehalten werden.
Auch in Griechenland finden wir den Esel häufig, weniger dagegen in
den Balkanländern. Bedeutende Eselzuchten weist Süditalien auf. Auf
Sizilien und der Insel Pantellaria wird eine stattliche Rasse gehalten,
während die Esel Sardiniens sehr klein sind. In Südfrankreich dient der
Esel vorzugsweise zur Maultierzucht, die auch in Spanien und Portugal
eine sehr wichtige Rolle spielt. Daneben wird aber auch der Esel auf
der Iberischen Halbinsel viel verwendet; ja man kann sagen, daß das
Grautier neben Ägypten und Westasien hier am häufigsten gezüchtet
wird. Von Spanien aus wurde der Esel im 16. Jahrhundert in Amerika
eingebürgert, ist aber hier stark vernachlässigt. Seine Hauptbedeutung
beruht hier in der[S. 174] Maultierzucht. Der erste Esel, den Garcilasso
auf der Hochebene von Peru sah, war dazu bestimmt. In Australien
ist seine wirtschaftliche Bedeutung, wie auch in Mitteleuropa, ohne
Belang geblieben. Früher wurde er in der Westschweiz häufig gehalten,
besonders in den Kantonen Genf und Waadt. Neuerdings ist er wesentlich
durch die Bemühungen der Tierschutzvereine in verschiedenen Städten
Deutschlands als Zugtier eingebürgert worden. Im Norden besitzt Irland
stellenweise, z. B. in Connaught, eine starke Eselzucht. Auch in
England, wo er früher nahezu fehlte, wird er jetzt häufig, wenigstens
im Süden, als Zugtier von den Kleinhändlern gehalten.
Es ist schon mehrfach von den Kreuzungsprodukten von Esel und Pferd
die Rede gewesen, die schon im frühen Altertum in Westasien und den
Mittelmeerländern eine wichtige Rolle spielten und heute noch besonders
in den romanischen Ländern sehr zahlreich gehalten werden. Dabei
unterscheidet man den Maulesel (lat. hinnus) als Produkt
der Kreuzung von Pferdehengst mit Eselstute und das Maultier
(lat. mulus) als dasjenige von Eselhengst mit Pferdestute. In
beiden Fällen schlägt der Bastard mehr nach der Mutter aus. So gleicht
der Maulesel mehr dem Esel, sieht aber wegen des relativ schweren
Rumpfes in Verbindung mit schwachen Gliedmaßen unschön aus und ist nie
zu größerer Bedeutung gelangt. Man findet ihn heute nur sporadisch,
so besonders in Abessinien, Nubien, Marokko, auf den Balearen, in
Sizilien und Istrien. Dagegen war er im Altertum in manchen Gegenden
nicht gar selten zu finden, so in Assyrien, wo er im Dienste der
Haus- und Landwirtschaft als Lasttier wie der Esel gebraucht wurde.
Zu sehr großer Bedeutung gelangte dagegen das Maultier, das mehr dem
Pferde gleicht, viel leistungsfähiger ist, und mit seinen kleinen,
zierlicheren Hufen ein weit besserer Bergsteiger ist als das Pferd
und deshalb besonders viel als Saumtier gehalten wird. Von ihm werden
weit mehr Männchen als Weibchen geboren. Sie sind in der Regel, aber
durchaus nicht in allen Fällen unfruchtbar, wie man gemeinhin glaubt,
nur ist ihr Geschlechtstrieb bedeutend herabgesetzt. Dabei sollen sie
sehr alt werden, viel älter als beide Eltern. Auch im Charakter ist die
mütterliche Abstammung maßgebend. So halten sich nach Dobrizhoffer die
Maulesel zu den Eseln, die Maultiere jedoch zu den Pferden. Deshalb
führt im romanischen Südamerika jede tropa Maultiere ein Pferd,
die madrinha, mit der Schelle als Leittier. Nebenbei bemerkt
kommt natürlich die Benennung Maulesel und Maultier vom lateinischen
mulus.
[S. 175]
Wie kam nun der Mensch dazu, eine solche auf den ersten Blick
unnatürliche und sonst bei den Haustieren durchaus nicht gebräuchliche
Bastardierung zwischen Esel und Pferd vorzunehmen? Darauf läßt sich
keine bestimmte Antwort geben. Eduard Hahn hat sie bereits mit dem
Eindringen des Pferdes selbst aus Hochasien nach Westen in Verbindung
bringen zu dürfen geglaubt. Als das erste Reitervolk aus Innerasien
nach den Kulturländern im Süden und Westen vorstieß, werden die
Bewohner vor solch ungewohntem Anblick in denselben Schrecken geraten
sein wie die alten Griechen, die aus solcher Reminiszenz ihre Sage
von den Kentauren schufen, die halb Mensch halb Tier (Pferd) sein
sollten. Vielleicht, ja wahrscheinlich, daß dieses Volk statt der
wilden, ungestümen Hengste nur die sanfteren Stuten ritt, wie dies
die Araber aus altgeheiligter Sitte heute noch tun. Zur Begründung
dieser Gewohnheit sagen sie, wenn sie einmal einen nächtlichen Überfall
machten und es wäre ein Hengst dabei, so könnte er, wenn er die
Anwesenheit der Stuten im Lager röche, wiehern und dadurch die Feinde
alarmieren. Dies soll unter allen Umständen vermieden werden! Ritt
nun der ungläubige Araber nur Stuten, so ritt schon aus nationalem
Gegensatz der gläubige Spanier nur Hengste. Wo Spanier in Südamerika
leben, gilt es heute noch für eine Schande, die kaum ein Neger auf sich
lädt, eine Stute zu besteigen.
Wie vielleicht jenes alte Reitervolk, das aus Innerasien hervorbrach,
ritten nach dem Zeugnisse des Römers Trebellius Pollio die Skythen nur
Stuten, indem man vermutlich die überschüssigen Hengste, die nicht zur
Zucht gebraucht wurden, als Opfertiere schlachtete.
Fingen nun die betreffenden Westasiaten, die von diesem Reitervolke
heimgesucht wurden, die ihrer Reiter entledigten Stuten, so konnte
es nicht ausbleiben, daß diese mit dem hier bereits als Haustier
gehaltenen Esel zusammengesperrt wurden, wobei sich Gelegenheit zur
Bastardierung von selbst ergab. So etwa ist der Ursprung der in
Westasien sehr alten Maultierzucht zu erklären.
Als man dann später die Vorteile dieser Bastardierung inne geworden
war, pflegte man sie neben der Pferdezucht auszuüben. Nur manche
Völker, wie beispielsweise die Juden, lehnten sie als ungehörig ab.
So verbot das Gesetz den Juden, wie jede Bastardierung überhaupt,
so auch diese. Bei den alten Persern waren die Maultiere ebenso
gebräuchliche als beliebte Arbeitstiere wie bei den ältesten Griechen.
Wir haben bereits gesehen, welche Verbreitung die Maultiere bereits in
homerischer Zeit hatten und wie die Esel damals nur[S. 176] als Beschäler der
Pferdestuten, also als Zuchttiere für die Maultiergewinnung benutzt
wurden. Nicht anders scheint es bei den Mykenäern und dem ganzen
illyrischen Kulturkreis zur Mitte des zweiten vorgeschichtlichen
Jahrtausends gewesen zu sein, indem hier nach den Abbildungen das
Maultier neben dem Pferd zum Ziehen der zweiräderigen Wagen und daneben
auch zum Reiten ohne Schabracke und Sattel oder Bügel benutzt wurde. Im
Heere der Perser spielten die Maultiere wie die Esel zur Beförderung
der Bagage eine wichtige Rolle. So meldet uns der griechische
Geschichtschreiber Herodot: „Als der Perserkönig Darius (im Jahre 513
v. Chr.) über die Donau gegangen war, um gegen die Skythen Krieg zu
führen, zeigte sichs bald, daß die feindliche Reiterei der seinigen
weit überlegen war. Indessen fand sichs, daß die Perser an den Eseln
und Maultieren, welche in ihrem Lager waren, mächtige Bundesgenossen
hatten; denn die skythischen Pferde nahmen vor ihnen Reißaus, weil sie
dergleichen nie gesehen hatten, und fürchteten sich nicht bloß vor
ihrem Anblick, sondern auch vor ihrer Stimme.
Als endlich Darius doch in Not geriet, blieb ihm nichts übrig, als sich
zurückzuziehen, und dabei brauchte er folgende List: wie es Nacht war,
ließ er die Esel im Lager anbinden und Feuer anmachen. Darauf zog er
heimlich mit dem Heer von dannen, während die Skythen sicher glaubten,
er wäre noch da; denn sie hörten die Esel laut schreien. Diese Tiere
schrieen aber deswegen, weil ihre Herren weggegangen waren.“
Tafel 31.
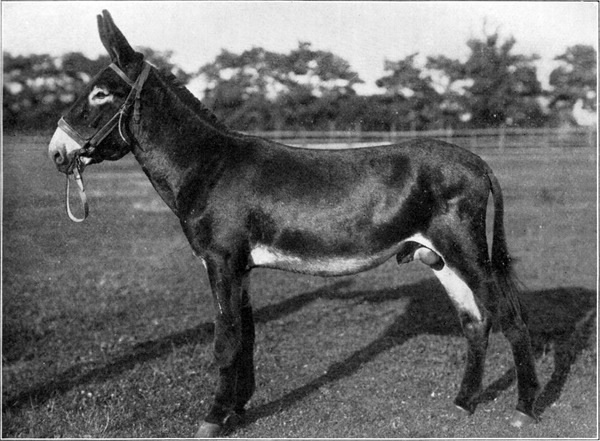
Für die Maultierzucht verwendeter, sehr schwerer
italienischer Eselhengst. Größe 1,54 m Stockmaß,
dreijährig.
(Aus Karl Hagenbecks Tierpark in Stellingen.)
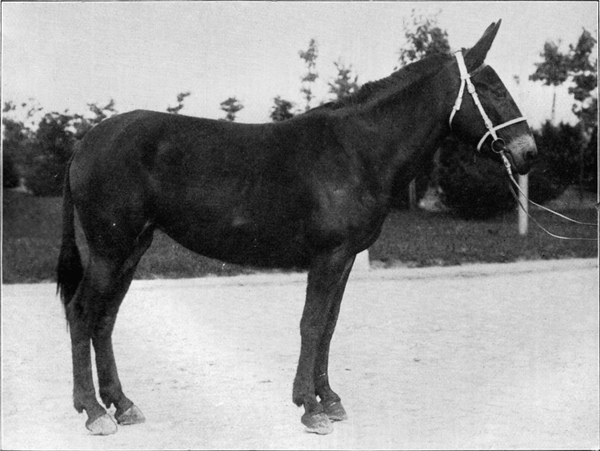
Großes Arbeitsmaultier, von Karl Hagenbeck aus Nordamerika
importiert. Größe 1,80 m Stockmaß.
Tafel 32.

Zebroid von Karl Hagenbecks Tierpark in Stellingen.
Vater Zebrahengst, Mutter Pferdestute.

Grevy-Zebras in Karl Hagenbecks Tierpark in Stellingen.
Tafel 33.

Zebrastute mit Zebroidenfohlen (Vater Pferd) in
Deutsch-Ostafrika.
(Nach einer Photographie der deutschen Kolonialschule in Witzenhausen.)

Ein Paar eingefahrener verschiedenartiger Zebras mit der
Familie Hagenbeck im Tierpark in Stellingen.
Tafel 34.

Weidende Zebraherde in der ostafrikanischen Massaisteppe am
Fuße des Kilimandscharo.
(Nach unretuschierter Naturaufnahme von Karl G. Schillings aus seinem Buche
„Mit Blitzlicht und Büchse“.)
⇒
GRÖSSERES BILD
Wie bei den alten Griechen, so hat auch bei den Römern das Maultier als
nützliches Arbeitswesen weite Verbreitung gefunden. Hat doch seine fast
aufgehobene Geschlechtlichkeit im Verein mit seinem leistungsfähigen
Körper, der die Stärke des Pferdes mit der Zähigkeit, Ausdauer und
Genügsamkeit des Esels verbindet, es bis auf den heutigen Tag überall
in den von der altrömischen Kultur befruchteten romanischen Ländern
zu besonderer Wertschätzung geführt. Schon der ältere Plinius sagt in
seiner Naturgeschichte: „Das Maultier ist zur Arbeit ganz ausgezeichnet
gut, der Maulesel dagegen ist unlenksam und unbändig faul. In der
Regel bekommen Maultiere und Maulesel keine Jungen; doch geschieht
es allerdings mitunter und dann hat man es immer für ein Zeichen
bevorstehenden Unglücks gehalten.“ Dieser Aberglaube ist von den Römern
auf die Romanen übergegangen. So berichtet Bollaert, daß eine der
besten Silberminen bei Iquique ihren Ertrag einstellte, als ein weißes
Maultier ein Junges warf. In ganz[S. 177] Südamerika hat man einen solchen
Schrecken vor diesen Maultiergeburten, daß schon in verschiedenen
Fällen Mutter und Kind gleich auf einen Scheiterhaufen gebracht und
verbrannt worden sein sollen. Wie Älian berichtet, benutzten die
Römer, besonders zum Ziehen von Reisewagen, Stuten oder Maultiere.
Diese waren dann bei den Vornehmen vielfach kostbar beschlagen und
mit bunten Bändern geschmückt. So berichtet Plinius von Kaiser Neros
Gemahlin Poppaea, sie habe die Hufe ihrer Maultiere mit Gold beschlagen
lassen. Und Sueton schreibt: „Wenn Kaiser Nero eine Reise machte, so
hatte er immer wenigstens tausend Staatskarossen bei sich; die Hufe
der vorgespannten Maultiere waren mit Silber beschlagen, die Kutscher
waren in kanusinische Wolle gekleidet.“ Varro rühmt den Mut dieser
Tiere, indem er sagt: „Die Maultiere sind von Natur mutig, und mir ist
ein Beispiel bekannt, wo sich ein Wolf an eine Herde von Maultieren
schlich, diese ihn aber umringten und mit den Hufen totschlugen.“
Heute noch wird in den Gebirgsländern Südeuropas, besonders in Italien
und Spanien, dann in Österreich und der Schweiz — hier besonders im
Kanton Wallis —, das Maultier zum Befördern von Lasten als Saumtier,
oder an den zweiräderigen Wagen angespannt, dem Pferde vorgezogen.
Seine Genügsamkeit, seine große Ausdauer und die selbst auf dem
schwierigsten Terrain sichere Gangart — alles Erbstücke vom Esel
— in Verbindung mit der durch die vom Pferd ererbte Körpergröße
ermöglichten größeren Leistungsfähigkeit beim Lastentragen machen es
den Gebirgsbewohnern geradezu unentbehrlich. Deshalb wird es auch zum
Befördern der Gebirgsartillerie dem Pferde vorgezogen. Auf eine hohe
Stufe ist die Maultierzucht in Südfrankreich gelangt, wo Poitou und
Deux Sèvres einen starken Export betreiben. Außer in den romanischen
Ländern trifft man diese Zucht nur noch in Irland häufiger. Auf
asiatischem Boden hat Persien ausgezeichnete Maultiere; auch Nordchina
ist in dieser Richtung hervorragend. In Nordafrika züchten Algerien
und Ägypten diesen Bastard in größerer Zahl, am berühmtesten ist aber
das gebirgige Abessinien durch seine Maultierzucht. Sie wird dort
dadurch erleichtert, daß einmal der dortige Pferdeschlag nicht sehr
groß ist und die Abneigung des Pferdes gegen den niedern Verwandten
dadurch verringert wird, daß Pferd und Esel von Jugend auf zusammen
aufgezogen werden. In der Neuen Welt hat die Maultierzucht namentlich
im spanischen Südamerika außerordentliche Verbreitung gefunden. So
wurden früher nicht weniger als 80000 Stück jährlich von Argentinien
nach Peru[S. 178] exportiert. Auch in Mexiko und den Südstaaten der Union hat
die Maultierzucht zunehmende Bedeutung erlangt.
Wie der Wildesel würde auch das Zebra (Equus zebra) ein
geeignetes Objekt für die Domestikation von seiten des Menschen sein.
Durch die unablässigen Verfolgungen von Seiten des Menschen ist seine
Verbreitung eine sehr beschränkte geworden. Früher war es ein gemeines
Tier der afrikanischen Steppe, das in Herden bis zu 100 Stück lebte,
die einzelnen Arten streng voneinander gesondert, aber sich gern
unter Antilopen und Strauße mengend. Da ihr Gesicht, wie bei allen
Pferden, weniger gut ausgebildet ist, während ihr Geruch vorzüglich
ist, kam ihnen die Symbiose mit den gut sehenden, außerordentlich
wachsamen Straußen sehr zugute. Letztere ihrerseits fraßen gern die im
Zebradung lebenden großen Mistkäfer. Eine ähnliche Lebensgemeinschaft
zu gegenseitiger Förderung besteht in Südamerika zwischen Hirschen und
Nandus, im Kaukasus zwischen Steinböcken und Berghühnern.
Die Zebras sind wie die Wildesel typische Steppentiere, die sich aber
im Gegensatz zu jenen nie allzuweit vom Wasser entfernen, da es ihnen
bei der sehr harten, vielfach salzhaltigen Nahrung ein Bedürfnis ist,
täglich zu trinken. Wie alle diese Tiere benutzen sie gewöhnlich die
Nacht, um oft über weite Strecken zum Wasser zu gelangen, an dem sie
ihren Durst zu stillen vermögen. Früher galt das Zebra für zu wild,
um gezähmt werden zu können. Doch ist diese vorgefaßte Meinung durch
den praktischen Erfolg widerlegt worden. So gibt es nicht nur in
Deutsch-Ostafrika, sondern selbst in London als Zugtiere dressierte
Zebras, die ihren Dienst vortrefflich tun. In letzterer Stadt fährt
Baron W. von Rothschild im dichtesten Straßengewühl mit vier Zebras
so glatt und flott wie mit dem besten Viererzug aus Pferden. Da das
Zebra unter der Tsetsekrankheit nicht leidet, ist es dazu berufen, in
weiten Gebieten Afrikas als Zugtier das Pferd zu ersetzen, das dort
nicht gehalten werden kann, da es regelmäßig daran erliegt. Zum Reiten
ist es allerdings zu schwach. Von allen Zebraarten hätte nur das
Grevyzebra (Equus grevyi) die erforderliche Größe und Kraft,
um ein brauchbares Reittier abzugeben. Da sich die Zebras sehr leicht
mit Pferd und Esel kreuzen lassen, scheint eine solche Kreuzung von
großer Bedeutung, da die daraus resultierenden Bastarde, die man als
Zebroide bezeichnet, sehr leistungsfähig sind und gegenüber dem
Maultier unverkennbare Vorzüge aufweisen, so daß sie diesem vielleicht
in Bälde den Rang streitig machen werden. Verschiedene Gestüte haben[S. 179]
sehr günstige Erfahrungen mit diesen Tieren gemacht, die durch ihre
mehr pferdeähnliche Erscheinung in Verbindung mit der Zebrazeichnung
recht stattliche Luxustiere sind. Außer Schnelligkeit und Ausdauer
wird ihnen große Gelehrigkeit nachgerühmt. An Muskelstärke übertreffen
diese Zebroide die Maultiere und lassen die Störrigkeit der letzteren
ganz vermissen; außerdem sind sie weniger scheu. Jedenfalls haben
diese Tiere eine bedeutende Zukunft, da sie eine besonders gute
Rassenmischung darzustellen scheinen.
Erst längere Zeit nach dem ostafrikanischen Wildesel ist irgendwo in
Zentralasien das flüchtige Wildpferd (Equus caballus)
vom Menschen gezähmt und zunächst als ausschließliches Werkzeug des
Krieges benützt worden. Einst hat es nicht nur in Asien, sondern
überall auch in Europa Wildpferde gegeben. Wie der nordamerikanische
Bison die ausgedehnten Prärien und der europäische Wisent den
Wald bewohnte, so war offenbar auch das europäische Wildpferd in
frühgeschichtlicher Zeit mehr ein Waldtier, während es von Rußland
an ein ausgesprochenes Steppentier wie einst in der Diluvialzeit
geblieben war. In verschiedenen Epochen der Eiszeit hat neben dem
Wildbüffel das Wildpferd das wichtigste Nahrungstier des Menschen
gebildet, dessen Knochen sich an manchen einstigen Lagerplätzen des
Diluvialmenschen zu mächtigen Abfallhaufen auftürmten. So findet sich
an der Fundstelle von Solutré bei Mâcon nördlich von Lyon im Rhonetal
eine gegen 4000 qm bedeckende Schicht von 0,5–2,3 m
Mächtigkeit, bestehend fast ausschließlich aus Knochen des diluvialen
Wildpferdes, das damals in zahlreichen Herden das Rhonetal bewohnt
haben muß und trotz seiner Flüchtigkeit dem primitiven Jäger zahlreich
zur Beute fiel. Die Gesamtzahl der auf jenem einzigen Platze einst vom
Eiszeitmenschen verspeisten Wildpferde schätzt Toussaint auf wenigstens
40000, andere auf etwa 100000, meist vier- bis siebenjährige, also
im besten Fleischzustand erbeutete Tiere. Dieses heute in Europa
ausgestorbene diluviale Wildpferd, von dem sich auch mehrfach
treffliche Zeichnungen von der Hand des Eiszeitjägers der jüngsten
Phase der älteren Steinzeit an den Höhlenwänden, auf Steinplatten und
auf allerlei Knochenstücken erhielten, besaß einen größeren Kopf,
stärkere Zähne und kräftigere Kiefer als das heute lebende Pferd, war
aber, wie man an einem aus Bruchstücken zusammengesetzten Skelett im
Naturhistorischen Museum in Lyon sehen kann, ziemlich groß und schlank
gebaut. Auch[S. 181] die Fundstelle von La Micoque im Vézèretal unweit von
Laugerie haute birgt eine gewaltige Menge von Knochen dieses Tieres,
dessen Röhrenknochen stets aufgeschlagen wurden, um das Markfett, nach
dem jene Leute sehr lüstern waren, noch lebenswarm auszusaugen.
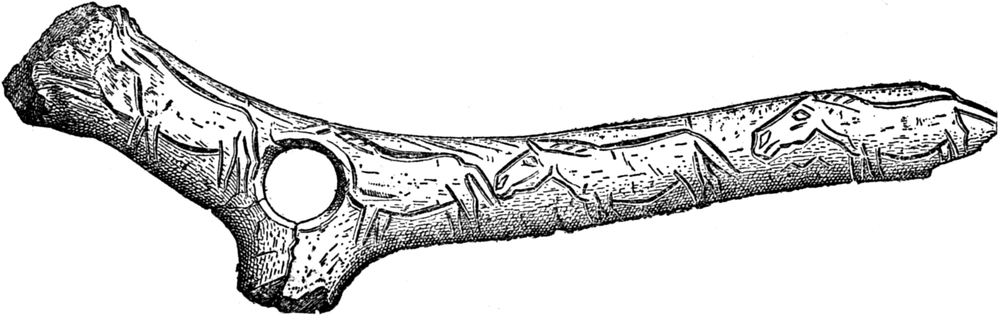
Bild 24. Darstellung von Wildpferden auf einem Zierstab
der Magdalénienjäger Südfrankreichs aus Renntierhorn.
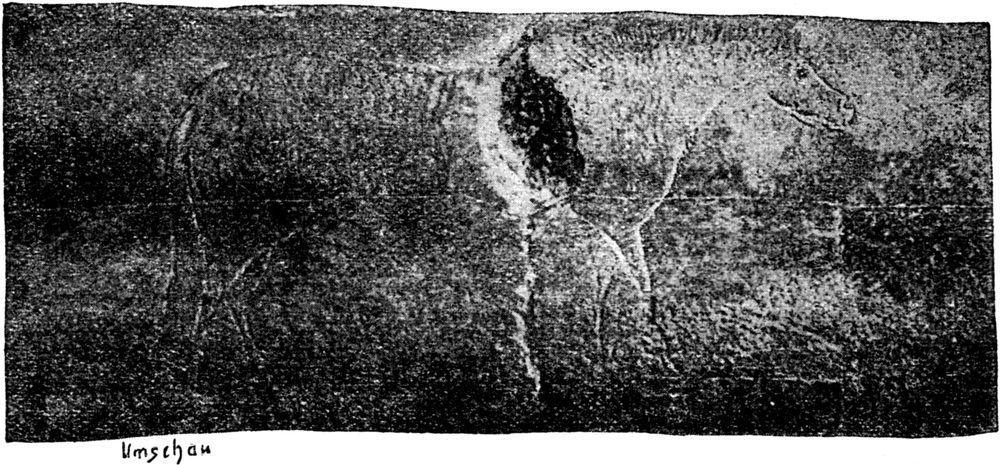
Bild 25. Darstellung eines Wildpferdes — meist als
Steppenesel aufgefaßt — mit übertrieben langem Körper und allzu kleinem
Kopf aus dem Keßlerloch bei Thaingen. (Nach Photogramm von
Dr. Nüesch.)
In späterer Zeit ist das Wildpferd infolge der fortgesetzten
Verfolgungen zunächst in Süd- und Mitteleuropa immer seltener
geworden, wenn auch noch der Römer Varro aus der ersten Hälfte des
letzten vorchristlichen Jahrhunderts schreibt: „In mehreren Gegenden
des westlichen Spanien gibt es wilde Pferde.“ Im Speisezettel der
Neolithiker hat es keine nennenswerte Rolle mehr gespielt, wenn es auch
noch hier und da erlegt wurde. Nur in Nordeuropa gab es noch lange
Zeit in entlegenen Waldgebieten, wo sie vor Ausrottung von seiten des
Menschen geschützt waren, solche. Dies war auch in Schweden der Fall,
wo Sjörgren im November 1900 bei Ingelstad einen Pferde[S. 182]schädel aus der
jüngeren Steinzeit fand, in dem noch, wie auf den Abbildungen 28 und
29 zu sehen ist, die abgebrochene Klinge eines Steinmessers steckte.
Das Alter des Pferdes dürfte auf zwei Jahre anzuschlagen sein, und, da
man ein so junges Tier, wäre es gezähmt gewesen, gewiß nicht als Opfer
vermutlich an den Kriegsgott geschlachtet hätte, so läßt dies auf eine
Wildform schließen. Von Schriftstellern des Altertums schreibt der
ältere Plinius, wohl auf verbürgte Nachrichten gestützt: „Im Norden
findet man Herden von wilden Pferden.“ Auch Strabon berichtet, daß in
den Alpen, wie wilde Stiere, so auch wilde Pferde lebten. Vermutlich
stammten die 30 wilden Pferde, die nach Julius Capitolinus der Kaiser
Gordianus für die Jagdspiele im Circus maximus nach Rom schaffen
ließ, von dort oder aus Spanien. Später meldet Venantius Fortunatus,
daß in den Ardennen oder Vogesen neben dem Bären, Hirsch und Eber auch
wilde Pferde gejagt wurden. Der langobardische Geschichtschreiber
Paulus Diaconus im 9. Jahrhundert v. Chr. sagt, daß es den Bewohnern
Italiens ein Wunder gewesen sei, als sie unter dem Könige Agilulf
dorthin gebrachte „Waldpferde“ und Wisente sahen. Am längsten gab es
diese Tiere weiter nördlich in Deutschland, das noch von ausgedehnten
Waldungen bedeckt war, in denen diese Tiere eine Zuflucht fanden. So
aßen nach Hieronymus die deutschen Volksstämme der Quaden und Vandalen,
wie auch die weiter östlich wohnenden Sarmaten das Fleisch wilder
Pferde, das ihnen dann die christlichen Priester bei der Einführung des
Christentums strengstens untersagten. Der Apostel der Deutschen, der
heilige Winfried oder Bonifacius, der den 5. Juni 755 bei Dokkum in
Friesland den Märtyrertod starb, scheint dies in manchen Fällen noch
gestattet zu haben; da aber solche Mahlzeiten stets mit heidnischen
Opfern an den Gott Wodan verbunden waren, so verbot der Papst in Rom
bald solche Abgötterei. Schon Papst Gregor III. schrieb um 732
an Bonifacius: „Du hast einigen erlaubt, das Fleisch von wilden Pferden
zu essen, den meisten auch das von zahmen. Von nun an, heiligster
Bruder, gestatte dies auf keine Weise mehr.“
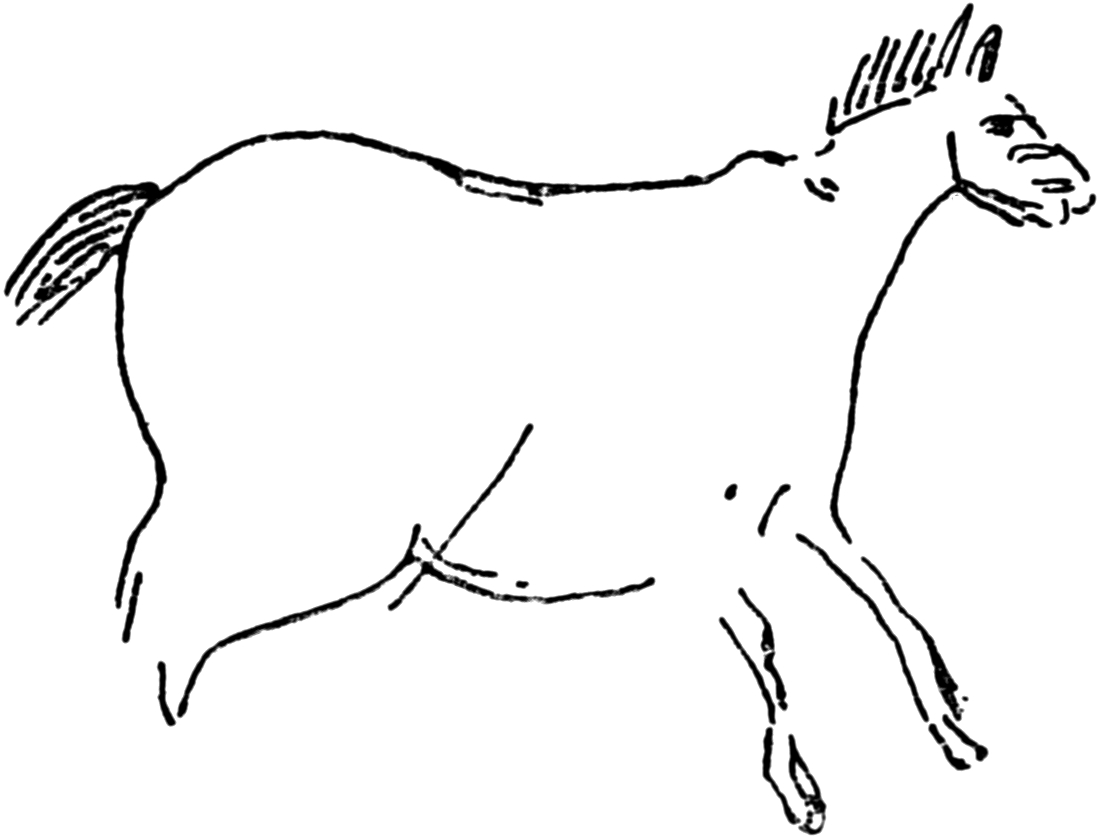
Bild 26. Darstellung eines Wildpferdes aus diluvialer
Zeit in der Höhle von La Mouthe in der Dordogne. (Nach Emile Rivière.)
[S. 183]
In den Benediktionen oder Segenssprüchen zu den beim gemeinsamen Mahle
aufgetragenen Speisen des Mönches Ekkehard IV., magister
scholarum ums Jahr 1000, ist auch von wilden Pferden die Rede,
die gelegentlich im waldigen Gürtel um die Einöde des Klosters St.
Gallen erlegt wurden und deren ausdrücklich als „süß“ bezeichnetes
Fleisch dann auf die Klostertafel gelangte. Vielleicht ist der
„grimme Schelch“ des Nibelungenliedes, den Siegfried im Wasgenwald
erlegte, ein Wildpferdhengst (mit beschälen zusammenhängend) gewesen.
In der Weingartner Liederhandschrift spricht Winsbeke in Strophe 46
die Erfahrung aus: „Ein Füllen in einer wilden Herde Pferde wird,
eingefangen, eher zahm, als daß ein ungeratener Mensch in seinem
Innern Scham empfinden lerne.“ Im Sachsenspiegel bestimmt eine Glosse,
daß bei der Zuweisung der fahrenden Habe einer Frau wilde Pferde,
die man nicht immer in Hut behalte, nicht zu rechnen seien. In einer
westfälischen Urkunde vom Jahre 1316 wird einem gewissen Hermann die
Fischerei im ganzen Walde und die wilden Pferde samt der Jagd in
jenem Wildforst zugeteilt. 1316 kamen im Münsterschen wilde Pferde
vor, die dem zustanden, der den Wildbann inne hatte. Noch ums Jahr
1593 lebten im entlegenen Gebirgsteile der Vogesen wilde Pferde, wie
der Elsässer Helisäus Rößlin schreibt. „Diese Wildpferde sind in
ihrer Art viel wilder und scheuer, dann in vielen Landen die Hirsch,
auch viel schwerer und mühsamlicher zu fangen, ebensowohl in Garnen
als die Hirsch, so sie aber zahm gemachet, das doch mit viel Müh und
Arbeit geschehen muß, sind es die allerbesten Pferde, spanischen und
türkischen Pferden gleich, in vielen Stücken ihnen aber fürgehen und
härter seind, dieweil sie sonderlich der Kälte gewohnet und rauhes
Futter, im Gang aber und in den Füßen fest, sicher und gewiß seind,
weil der Berg und Felsen, gleich wie die Gemsen, gewohnet.“ Diese
Wildpferde der Vogesen müssen noch bis ins 17. Jahrhundert gelebt
haben; denn wir erfahren, daß 1616 drei Wildpferdschützen von der Stadt
Kaiserslautern angestellt wurden, um die Felder der Bürgerschaft vor
Schaden durch jene zu bewahren.
Noch viel länger als hier hielt sich das Wildpferd in den ausgedehnten
Waldgebieten von Norddeutschland, Polen und Rußland. So kamen nach
Erasmus Stella noch im Anfang des 16. Jahrhunderts wilde Pferde in
Preußen vor. Das Land der Pommern wird zur Zeit des Bischofs Otto
von Bamberg in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts als reich an
Wild aller Art, auch Wildpferden und Wisenten,[S. 184] angegeben. Im Jahre
1132 brachte der Herzog Sobieslaus von Böhmen von einem Feldzuge nach
Schlesien eine Anzahl wilder Pferde heim. Nach Töppen jagte man zur
Zeit der Deutschordensritter wilde Pferde wie anderes Wild vornehmlich
um ihrer Häute willen. Noch Herzog Albrecht erließ um 1543 ein Mandat
an den Hauptmann zu Lyck, in welchem er ihm befahl, für die Erhaltung
der „wilden Rosse“ zu sorgen. Auch für Polen und Litauen gehen die
Hinweisungen auf das Pferd als Jagdtier bis tief ins 17. Jahrhundert
hinauf. Für Rußland haben wir einen Bericht von Wladimir Monomach, dem
von 1053–1125 lebenden Fürsten von Tschernigow, der in seiner für die
Söhne verfaßten Lebensbeschreibung von sich selbst erzählt: „Aber in
Tschernigow tat ich dies: ich fing und fesselte eigenhändig 10–20 wilde
Pferde lebendig, und als ich längs des Flusses Roßj ritt, fing ich mit
den Händen ebensolche wilde Pferde.“
Diese herrenlosen wilden Pferde sind nicht mit den noch lange in
Europa gehaltenen „wilden Gestüten“ zu verwechseln, die ihre Besitzer
hatten und nicht abgeschossen werden durften. Diese halbwilden Pferde
lebten das ganze Jahr über im Freien, ohne daß sie sich einer irgend
nennenswerten Fürsorge zu erfreuen gehabt hätten. Das letzte dieser
wilden Gestüte bestand in Deutschland im Duisburger Walde und wurde
erst von Napoleon I. aufgelöst.
Wenn nun auch Europa keine wilden Pferde mehr besitzt, so leben
doch in den weiten Steppen Südrußlands verwilderte Pferde, die alle
Eigenschaften wilder Tiere aufweisen und von Tataren und Kosaken auch
als solche angesehen werden. Es sind dies die Tarpane, kleine
Pferde mit dünnen, aber kräftigen Beinen, ziemlich langem und dünnem
Halse, verhältnismäßig dickem Kopfe, spitzigen, nach vorwärts geneigten
Ohren und kleinen, lebhaften Augen. Ihre Behaarung ist im Sommer
kurz, gelbbraun, im Winter lang, heller bis fast weiß, wobei sich am
Kinn eine Art Bart bildet. Die kurze, dichte, gekräuselte Mähne und
der mittellange Schwanz sehen dunkler aus als der Körper. Schecken
kommen niemals, Rappen nur sehr selten vor. Sie bewohnen in größeren
Herden die ungeheure Steppe und wandern von Ort zu Ort, indem sie
außerordentlich aufmerksam mit weit geöffneten Nüstern und gespitzten
Ohren sichern und so beizeiten jeder Gefahr zu entgehen wissen. Die
Herde zerfällt in kleinere Gesellschaften von Stuten und Fohlen, die
von einem Hengste beherrscht und geführt werden. Er sorgt für deren
Sicherheit und treibt sie bei der geringsten Gefahr zu wilder Flucht
an. Gegen hungrig umherschleichende Wölfe geht er[S. 185] mutig wiehernd vor
und schlägt sie mit seinen Vorderhufen zu Boden. Der Tarpan ist schwer
zu zähmen. Seine Wildheit und Stärke spotten sogar der Künste der
pferdekundigen Mongolen. Er schadet den pferdehaltenden Völkern durch
Wegführen der freiweidenden Stuten und wird deshalb mit Eifer verfolgt.
Tafel 35.
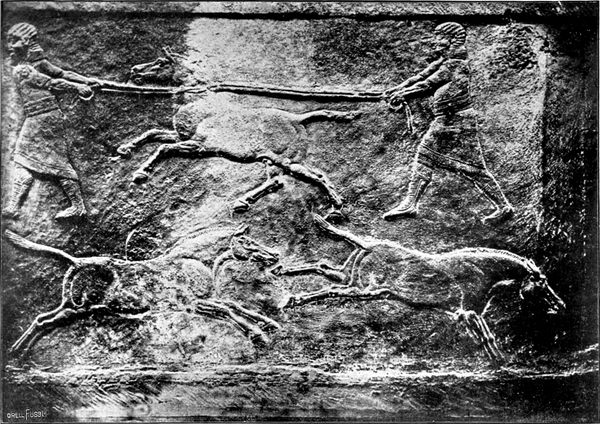
Assyrische Darstellung einer Jagd auf Onager (nach Keller auf
Przewalskis Wildpferd) am Palast des Assurbanipal in Kujundschik, etwa
668 v. Chr.
(Nach Keller, Die Abstammung der ältesten Haustiere.)

(Copyright by M.
Koch, Berlin.)
Przewalskis Wildpferd.
Tafel 36.

Der Assyrerkönig Assurbanipal (668–626 v. Chr.) in einem von
drei Pferden gezogenen Streitwagen auf der Löwenjagd. (Nach einer
Photographie von Mansell & Cie. in London.)
⇒
GRÖSSERES BILD
Dieselben Charaktereigenschaften zeigen auch die anderswo, namentlich
in Argentinien verwilderten Pferde, die als Cimarrones in großen Herden
die Pampas bewohnen. Nach Azara sollen sie von fünf bis acht bei der
Aufgabe der 1535 gegründeten Stadt Buenos Aires zurückgebliebenen
und sich selbst überlassenen Hauspferden stammen. Als im Jahre 1580
derselbe Platz wieder besiedelt wurde, fand man bereits eine Menge
verwilderter Pferde vor, die aus diesen zurückgelassenen hervorgegangen
waren. Dies ist der Ursprung der unzählbaren Pferdescharen, die sich in
der Folge am Rio de la Plata (dem Silberstrom) herrenlos umhertrieben
und von denen jeder nach Belieben einfangen und für sich gebrauchen
konnte. Die Indianer der Pampas machen Jagd auf sie, um ihr Fleisch zu
essen. Sie fangen auch manche, um sie zu zähmen und als Reittiere zu
gebrauchen, wie sie es den Weißen absahen. Die Spanier jedoch machen
kaum mehr Gebrauch von ihnen. Höchst selten fängt man einen Wildling,
um ihn zu zähmen. Die in Paraguay vorkommenden Pferde sind zwar nicht
herrenlos, leben aber beinahe so frei wie diese, indem sie ebenfalls
das ganze Jahr unter freiem Himmel zubringen. Alle acht Tage treibt
man sie zusammen, damit sie sich nicht versprengen, untersucht ihre
Wunden, bestreicht sie mit Lehm und schneidet ihnen alle drei Jahre die
Mähne und den Schwanz ab, um das Roßhaar zu verkaufen. An Veredelung
derselben denkt niemand.
Rengger schreibt über sie: „Gewöhnlich leben die Pferde truppweise in
einem bestimmten Gebiet, an welches sie von Jugend auf gewöhnt worden
sind. Jedem Hengste gibt man 12–18 Stuten, welche er zusammenhält und
gegen fremde Hengste verteidigt. Die Füllen leben mit ihren Müttern
bis ins dritte oder vierte Jahr. Diese zeigen für jene, solange sie
noch saugen, große Anhänglichkeit und verteidigen sie zuweilen sogar
gegen den Jaguar. Wenn die Pferde etwas über zwei oder drei Jahre alt
sind, wählt man unter den jungen Hengsten einen aus, teilt ihm junge
Stuten zu und gewöhnt ihn mit denselben in einem besonderen Gebiete zu
weiden. Alle Pferde, die zu einem Trupp gehören, mischen sich nie unter
andere und halten so fest zusammen, daß es schwer hält, ein weidendes
Tier von den übrigen zu[S. 186] trennen. Werden sie miteinander vermengt,
z. B. beim Zusammentreiben aller Pferde einer Meierei, so finden sie sich
nachher gleich wieder auf. Die Tiere zeigen übrigens nicht allein für
ihre Gefährten, sondern auch für ihre Weiden große Anhänglichkeit.
Ich habe welche gesehen, die aus einer Entfernung von 80 Stunden auf
die altgewohnten Plätze zurückgekehrt waren. Um so sonderbarer ist
die Erscheinung, daß zuweilen die Pferde ganzer Gegenden aufbrechen
und entweder einzeln oder haufenweise davonrennen. Dies geschieht
hauptsächlich, wenn nach trockener Witterung plötzlich starker Regen
fällt, und wahrscheinlich aus Furcht vor dem Hagel, welcher nicht
selten das erste Gewitter begleitet.
Die Sinne dieser fast wild lebenden Tiere scheinen schärfer zu sein
als die europäischer Pferde. Ihr Gehör ist äußerst fein; bei Nacht
verraten sie durch Bewegungen der Ohren, daß sie das leiseste, dem
Reiter vollkommen unhörbare Geräusch vernommen haben. Ihr Gesicht ist,
wie bei allen Pferden, ziemlich schwach; aber sie erlangen durch ihr
Freileben große Übung, die Gegenstände aus bedeutender Entfernung zu
unterscheiden. Vermittelst ihres Geruchsinnes machen sie sich mit ihrer
Umgebung bekannt. Sie beriechen alles, was ihnen fremd erscheint. Durch
diesen Sinn lernen sie ihren Reiter, das Reitzeug, den Schuppen, in dem
sie gesattelt werden, usw. kennen, durch ihn wissen sie in sumpfigen
Gegenden die bodenlosen Stellen auszumitteln, durch ihn finden sie in
dunkler Nacht oder bei dichtem Nebel den Weg nach ihrem Wohnorte oder
nach ihrer Weide. Gute Pferde beriechen ihren Reiter im Augenblicke,
wenn er aufsteigt, und ich habe solche gesehen, welche denselben gar
nicht aufsteigen ließen oder sich seiner Leitung widersetzten, wenn er
nicht einen Poncho oder Mantel mit sich führte, wie ihn die Landleute,
welche die Pferde bändigen und zureiten, immer tragen. Auf größere
Entfernung hin wittern sie freilich nicht. Ich habe selten ein Pferd
gesehen, welches einen Jaguar auf 50 Schritte gewittert hätte. Sie
machen daher in den bewohnten Gegenden von Paraguay die häufigste Beute
dieses Raubtieres aus.“
Das Leben der verwilderten Pferde in den weiter nach Norden hin
gelegenen Llanos hat Alexander von Humboldt aus eigener Anschauung
meisterhaft geschildert. Diese Herden werden viel von den Indianern
nicht nur des Fleisches und der Häute wegen verfolgt, sondern auch um
sie zu fangen und als Reittiere zu verwenden. Dabei quälen sie die mit
dem Lasso eingefangenen jungen Tiere so lange, bis sie durch Hunger und
Durst klein beigeben und den Menschen auf[S. 187]sitzen lassen. Überall ist
bei den Rothäuten der Pferdediebstahl ein für ehrenvoll angesehener
Beruf, dem sie sich mit Eifer hingeben.
Bau und Eigenart des Pferdes weisen auf die weite Steppe als die
ursprüngliche Heimat dieses Schnelläufers hin. Und zwar hat nicht
sowohl das Fluchtvermögen vor etwaigen Feinden, als die Notwendigkeit,
in Trockenzeiten weite Strecken von einem nicht ausgetrockneten
Tümpel zum andern zurücklegen zu müssen, wie bei den Wildeseln
auch beim Wildpferd aus der ursprünglich vorhandenen Fünfzehigkeit
die Stelzenfüßigkeit eines einzigen, des mittleren Zehens bewirkt.
Diese Einhufer sind die Endglieder einer einseitigen Entwicklung zur
Erlangung möglichst großer Schnelligkeit. So ist auch das einzige
heute noch lebende Wildpferd im eigentlichen Sinne des Wortes — und
nicht nur ein verwildertes Pferd — das von dem russischen Reisenden
Przewalski 1879 in Innerasien entdeckte Przewalskische Pferd.
Während seines Aufenthaltes im Militärposten von Saisan erhielt er das
Fell und den Schädel eines wilden Pferdes, das die Kirgisen in der
Sandwüste Kanabo erlegt hatten. Das Exemplar gelangte in den Besitz des
Museums der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg
und wurde von Poljakow unter dem Namen Equus przewalski als
neue Art beschrieben. Alles deutet mit Sicherheit darauf hin, daß wir
es hier mit einer echten Wildform und nicht wie beim Tarpan mit einem
verwilderten Hauspferd zu tun haben. Dieses Wildpferd haben seither
auch andere europäische Reisende in der Dsungarei, d. h. den Wüsten
zwischen Altai und Tianschangebirge, beobachtet und teilweise in
lebenden jungen Exemplaren nach Europa gebracht. So vermochte Büchner
1899 zehn Fohlen, die von säugenden zahmen Mongolenstuten genährt
wurden, mit ihren Pflegemüttern nach Südrußland zu bringen, wo sie im
großen Wildpark von Falz-Fein in Askania nova akklimatisiert wurden.
Später hat dann der unternehmende Tierhändler Karl Hagenbeck in
Stellingen bei Hamburg ebenfalls durch eine eigene, sehr kostspielige
Expedition über ein Dutzend Wildpferdfohlen aus der Dsungarei zu holen
vermocht, um damit in Deutschland vielversprechende Zuchtversuche zu
machen.
Das Przewalskische Pferd — von den Kirgisen Kertag, von den Mongolen
Taki genannt — lebt in Herden von 5–15 Stück unter Anführung eines
alten Hengstes. Seine Statur ist klein, fast ponyartig; es ist mit
einem zottigen Haarpelz von hellgraubrauner Farbe bedeckt, das an
den Beinen vom Knie an bis zu den Hufen dunkler wird. Die Ohren
sind kurz, die dunkle Mähne ist im Gegensatz zu[S. 188] demjenigen des
domestizierten Pferdes aufgerichtet, ferner fehlt ein Stirnschopf und
die Schweifwurzel ist kürzer behaart. Übrigens besteht die kurze Mähne
aus zweierlei Haar, einem äußeren paarigen Streifen von graubrauner
Farbe an jeder Seite und einem mittleren schwarzen, der sich als
sogenannter Aalstreifen über den Rücken fortsetzt. Ebenso ist der
Schweif zweifarbig. Der kürzer behaarte Teil, die Schweifwurzel, ist
graubraun wie der Körper, der übrige Teil des Schweifes aber schwarz
gefärbt. Eine solche Färbungsverschiedenheit von Mähne und Schweif
findet sich als Rückschlag in einen früheren Zustand nur ganz selten
bei Hauspferden.
Dieses Wildpferd hat offenbar schon der durch Sibirien reisende
Deutsch-Russe Pallas gekannt. Er beschrieb es unter dem Namen Equus
equiferus. Der Russe Tscherski, der neuerdings eine genaue
Untersuchung des von Przewalski aufgebrachten Originalschädels vornahm,
betonte, daß man es hier mit einem den echten Pferden zugehörenden Tier
zu tun hat. Der Hirnteil erreicht eine Breite, die über dem Mittel der
Vertreter orientalischer Pferde steht, die Stirnknochen erscheinen
flach und die Nasenbeine verschmälern sich langsam nach vorn, also
nicht plötzlich wie beim Esel. Der Schädel steht seinem ganzen Bau
nach demjenigen des russischen Pferdes am nächsten. Seither hat auch
Tichomiroff durch erneuerte Untersuchungen festgestellt, daß dieses
zweifellos wilde und nicht nur verwilderte Pferd, das früher wohl
weit über Innerasien verbreitet war, tatsächlich dem Hauspferd sehr
nahesteht. Wir haben in ihm die Stammquelle der zuerst domestizierten
asiatischen Pferde zu erblicken.
Zweifellos ist irgendwo in Zentralasien, vermutlich von einem
turanischen Volke, ein dem Przewalskischen nahestehendes Wildpferd,
jung eingefangen und gezähmt, zum Gehilfen des Menschen erhoben und an
seine Gegenwart gewöhnt worden. Von den weiten Ebenen Turans kam es
zu Ende des vierten vorchristlichen Jahrtausends nach dem Berglande
Iran und von da nach Mesopotamien, wo es kennzeichnenderweise den
Namen „Esel des Ostens“ oder „Esel des Berglandes“ erhielt. Da dort
der Onager als Wildling heimisch und zudem der Esel als Haustier
bekannt war, benannte man diesen Verwandten einfach nach ihm mit einem
unterscheidenden Beinamen. Wie in Babylonien war es um 2000 v. Chr.
auch in Indien bekannt. Auch in China ist seine Einfuhr eine sehr alte;
wenigstens verwendete man es nach den Angaben des Schuking schon etwa
2000 Jahre vor Beginn der christlichen Zeitrechnung.
[S. 189]
Als vornehmstes Werkzeug des Krieges wurde es im Zweistromland bei
den kriegerischen Assyriern, nach der Fülle der auf uns gekommenen
Pferdedarstellungen zu schließen, in großer Menge gezogen. Meist
begegnet uns auf den altassyrischen Monumenten ein langschweifiges
Pferd, daneben eine andere Rasse mit kurzem Schweif und nackter Rübe.
Außer zum Reiten diente es vornehmlich zum Ziehen des zweiräderigen
Kriegswagens, auf welchem fechtend die Schwerbewaffneten in den
Kampf zogen. Außer dem mächtigen König von Assur benutzten auch
seine Generale und Unterführer den von einem Wagenlenker geleiteten
Kriegswagen bei ihren Feldzügen. Offenbar war der zweiräderige Wagen
bei den Assyriern viel populärer als das Reiten auf dem Pferde, ohne
Bügel, nur auf einer Decke sitzend.
Im alten Reiche Ägyptens war das Pferd völlig unbekannt; als Last-
und Arbeitstier wurde damals ausschließlich der Esel gehalten. Nicht
anders war es noch im Mittleren Reich (2160–1788 v. Chr.). Erst
im 17. Jahrhundert, um 1680 v. Chr., scheinen die Hyksos — oder
Schasu(beduinen), wie sie von den Ägyptern genannt werden — das
Pferd aus Westasien, wo es überall Eingang gefunden hatte, nach dem
bis dahin ziemlich abgeschlossenen Niltal gebracht zu haben. Hier
bürgerte es sich rasch ein und erscheint dann von der 18. Dynastie an
(1580–1350 v. Chr.) unter den Tutmosis und Amenophis, dann namentlich
in der 19. Dynastie (1350–1205 v. Chr.) unter den Ramses und Sethos
als hochgeschätztes Haustier, dem von den Großen sorgfältige Pflege
angediehen lassen wurde. Mit dem asiatischen Kriegswagen wurde das
Tier, nach asiatischer Weise daran angespannt, zum Ziehen desselben
verwendet. Die ägyptische Bezeichnung sus für Pferd ist ein
semitisches Wort und die ägyptische Benennung des Streitwagens ist
ebensosehr semitisch und dem Hebräischen fast vollständig gleich.
Nach den spärlichen Stellen im Alten Testament, da vom Pferde und von
dem von ihm gezogenen Kriegswagen die Rede ist, sind dies Attribute
der kriegerischen Nachbarn und Feinde des Volkes Israel, an denen es
keinen Teil hat. Als Haus- und Herdentier der altjüdischen Patriarchen
erscheint es durchaus nicht und nimmt auch an den Wanderungen und
Kämpfen der Juden keinen Anteil. Bei ihnen wie bei den Ismaeliten
oder Arabern ist es zuerst der Esel und später das Kamel, auf dem sie
reiten. In Übereinstimmung damit berichtet Herodot von den im Heere
des Xerxes weilenden Arabern: „Die Araber waren alle auf Kamelen
beritten, die den Pferden an Schnelligkeit nicht nachgaben.“ Auch nach
Strabor gab es im Glücklichen Arabien keine Pferde, noch Maultiere;[S. 190]
denn er schreibt: „An Haus- und Herdetieren ist dort Überfluß, wenn
man Pferde, Maultiere und Schweine ausnimmt.“ Ähnlich sagt er vom
Lande der Nabatäer: „Pferde sind in dem Lande keine; deren Stelle in
der Dienstleistung vertreten die Kamele.“ Dabei war dieser Autor, der
Freund und Genosse des Älius Gallus, des Feldherrn, der die große
mißlungene Expedition nach Arabien gemacht hatte, über diese Halbinsel
so genau wie nur sonst jemand in damaliger Zeit unterrichtet. Noch
in der Schlacht bei Magnesia, in der er 190 v. Chr. zum zweitenmal
den Römern erlag, führte Antiochus der Große, wie einst Xerxes, auf
Dromedaren berittene Araber ins Gefecht.
Anders war es in Ägypten zur Zeit des Neuen Reiches (1580 bis 1205 v.
Chr.). Hier diente das Pferd nur ganz ausnahmsweise zum Reiten, ganz
gewöhnlich aber, schön aufgezäumt und mit einem wallenden Busche von
Straußenfedern geziert, zum Ziehen des leichten Kriegswagens, auf
dem der Pharao mit seinen Offizieren in die Schlacht zog. Da kämpfte
man in den in Westasien geführten Schlachten Wagen gegen Wagen, Mann
gegen Mann. Offenbar wurde auf die Pflege der Pferde große Sorgfalt
verwendet und viel Gewicht auf gute Rasse gelegt. Der Kutscher war
eine wichtige Person im vornehmen Hause, und selbst Prinzen leiteten
am Hofe das Gespann, das zwei Pferde zählte. Die Leibpferde erhielten
schöne Namen. So wird uns auf den Darstellungen der Feldzüge der
verschiedenen Pharaonen an den Tempelwänden jeweilen genau angegeben,
wie die Pferde hießen, die in dieser oder jener Schlacht das reich
ausgestattete Gespann des Königs zogen. Auf diese Weise wissen wir vom
Tempel in Theben, daß das Lieblingsgespann Ramses II. (1292–1225
v. Chr.) „Sieg zu Theben“ und „Zufriedene Nura“ hieß. Es waren dies
die beiden Pferde, die eben jenen König im Jahre 1280 aus der großen
Gefahr retteten, als er mit geringer Begleitung dem Gros seines Heeres
vorauseilend bei der Stadt Kadesch am Orontes in einen Hinterhalt der
Chetiter unter ihrem König Mutallu gefallen war und jede Hoffnung,
heil aus der mißlichen Lage zu entrinnen, vergebens schien. Zum Dank
ließ dann der König, wie uns im Schlachtenbericht des Pentaur erzählt
wird, diesem seinem Gespann künftighin ganz ausnahmsweise sorgsame
Behandlung zuteil werden. Das Kriegsgespann Ramses III. (1198
bis 1167 v. Chr.) trug die Namen: „Ammon siegt mit Macht“ und „Geliebt
von Ammon“. Nach den bildlichen Darstellungen sind es außerordentlich
edle, feurige Tiere von feinem Gliederbau und ziemlicher Größe mit
langer, flatternder Mähne und prächtigem Schweif, der[S. 192] vielfach in der
Mitte geknotet wurde, damit er nicht am Boden schleife. Als bevorzugte
Nahrung erhielten sie statt Hafer, wie bei uns, Gerste, die bis auf
den heutigen Tag in den Mittelmeerländern ihre alte Bedeutung als
Pferdekraftmittel behielt.

Bild 27. König Sethos I. von Ägypten (regierte
von 1313–1292 v. Chr.) auf dem Kriegswagen gegen die Cheta in
Vorderasien kämpfend dargestellt. (Nach Wilkinson.)
⇒
GRÖSSERES BILD
Während die Ägypter neben den auf Kriegswagen kämpfenden Elitetruppen
keine auf Pferden berittene Mannschaft besaßen, ist es interessant
zu sehen, daß auf den zahlreichen Schlachtenbildern des 16. und 15.
Jahrhunderts v. Chr., als Ägypten seine Macht weit nach Westasien
ausdehnte, die Chetiter zwar auch vorzugsweise auf Kriegswagen
kämpften, daneben aber auch, im Gegensatz zu den Ägyptern, teilweise
auf Pferden ritten. So scheint in der Schlacht von Kadesch, in der
Ramses II. das ägyptische Heer befehligte, ein berittener
Chetiter mit einem Bogen bewaffnet und ein anderer, ebenfalls zu
Pferd, eine Infanterieabteilung anzuführen. An einer Wand des großen
Reichstempels von Karnak in Theben sehen wir mitten unter den
Kanaanitern, die gegen die Stadt Askalon (im Text Askalunu genannt)
flüchten, noch einen auf einem Pferde sitzend dargestellt. Auch
die Assyrier (Rotennu) machen auf diesen Darstellungen neben dem
Kriegswagen vielfach vom Pferde auch zum Reiten Gebrauch. In zwei
Darstellungen aus der Zeit der 18. Dynastie, unter Tutmes III.
(1480–1447 v. Chr.) und Tutankhamen, sehen wir Assyrier dem Pharao
als Tribut wertvolle Rassepferde überbringen. Auch die Einwohner des
Libanon (Lemenu genannt) kennen neben den Kriegswagen Reiter.
Damals besaß aber kein anderes Volk Afrikas außer den Ägyptern das
Pferd. Auf allen kriegerischen Darstellungen kämpfen sowohl die Neger
Äthiopiens, als auch die blonden Libyer (Lebu) stets zu Fuß und
besitzen außer Rindern und Schafen, die man durch die siegreichen
Ägypter fortgeführt werden sieht, keine Pferde. Das war allerdings
um die Mitte des letzten Jahrtausends v. Chr. anders; denn Herodot
berichtet uns, daß die Libyer von den Ufern des Tritonsees gewöhnlich
auf von vier Pferden gezogenen Kriegswagen kämpften. Es wäre merkwürdig
gewesen, wenn nicht mit der Zeit auch die Nachbarvölker dieses edle
Tier und das zu ihm gehörende Gerät, den leichten, zweiräderigen
Streitwagen, von den Ägyptern übernommen hätten. Erfahren wir doch,
daß das libysche Volk der Maschuasch schon zur Zeit Ramses III.
(1198–1167 v. Chr.) neben dem Esel auch schon das Pferd als Haustier
besaß, da dieser König nach einer ihm beigebrachten Niederlage laut
einer auf uns gekommenen Inschrift 183 Pferde und Esel von ihm
erbeutete.
[S. 193]
In der zweiten Hälfte des vorletzten vorchristlichen Jahrtausends
hatte die Pferdezucht in Ägypten größere Ausdehnung erlangt, so daß
die westasiatischen Kulturvölker ihr edelstes Pferdematerial von dort
importierten. Zur Zeit des Königs Salomo, der von 993–953 v. Chr.
regierte, bezog der König von Israel viele Pferde seines prunkvollen
Hofhaltes und seiner Armee aus Ägypten und machte nebenbei noch ein
gutes Geschäft damit, indem er dieses vielbegehrte Material an die
Könige der Aramäer und Chetiter weiterverkaufte.
Damals waren in Ägypten die Gestüte königliches Eigentum, dem die
Könige große Aufmerksamkeit schenkten. In Dschebel Barkal (dem alten
Nepata) fand Mariette eine merkwürdige Stele, auf der erzählt wird,
wie ums Jahr 745 v. Chr. der äthiopische König Pianki Meriamen das
damals von zahlreichen, aufeinander eifersüchtigen kleinen Fürsten
beherrschte Ägypten eroberte. Aus der Schilderung erfahren wir unter
anderem, daß die Aufzucht des Pferdes für den Export damals eine der
wichtigsten Einnahmequellen des Landes war. Jeder der zahlreichen
Teilkönige besaß einen Marstall und ein Gestüt, dessen beste Pferde er
dem damals siegreich vordringenden Könige der Äthiopier anzubieten sich
beeilte. Letzterer nahm diese Geschenke stets wohlwollend in Empfang.
Seine erste Sorge, wenn er wiederum ein neues Teilreich erobert hatte,
war, in höchst eigener Person die königlichen Marställe und Gestüte zu
besichtigen. In einer Stadt, Hermopolis in Mittelägypten, fand er diese
Etablissemente vernachlässigt und die Pferde schlecht gehalten. Da
geriet er in großen Zorn und rief aus: Bei meinem Leben, bei der Liebe
des Gottes Re, der den Atem meiner Nase erneuert, es gibt in meinen
Augen keinen größeren Fehler, als meine Pferde hungern zu lassen!
Bei solcher Wertschätzung der ägyptischen Pferdezucht kann es uns
nicht wundern, daß 80 Jahre später, im Jahre 665, als der assyrische
König Asurbanipal die ägyptische Residenzstadt Theben einnahm und
plündern ließ, er vor allem in dem uns noch erhaltenen Beuteverzeichnis
in Keilinschrift, das das Britische Museum besitzt, „große Pferde“
erwähnt. Diese Bezeichnung verdient besonders gewürdigt zu werden, denn
sie schließt sich an die dieselbe Tatsache bezeugenden Darstellungen
an den Tempelwänden zur Zeit der jüngeren Dynastien Ägyptens an,
woraus hervorgeht, daß sich mit der Zeit in Ägypten eine besondere
Pferderasse gebildet hatte, die größer und stärker war als die in
Syrien und Babylonien gezüchtete. Es ist zweifellos diejenige Rasse,
die sich unverändert in Dongolah, im Innern, erhielt[S. 194] und den mit
Wattepanzern aus Baumwolle für Pferde und Mensch umgebenen Reitern als
hochgeschätztes Kriegsmittel dient.
Durch die Handelsbeziehungen mit Ägypten und Vorderasien hat auch das
alte Kulturvolk der Mykenäer auf Kreta und den Ländern am Ägäischen
Meer schon vor der Mitte des vorletzten Jahrtausends v. Chr. das Pferd
und den von ihm gezogenen zweiräderigen Kriegswagen kennen gelernt und
übernommen. So treffen wir schon in den ältesten Partien der Ilias, die
teilweise noch Erinnerungen an jene älteste Kulturblüte Griechenlands
wach erhält, das Pferd und den Kriegswagen als geschätzte Artikel
erwähnt. Sie erwähnt auch in erster Linie der Held Achilleus, wenn er
von der ägyptischen Hauptstadt spricht:
„Theben, die hunderttorige Stadt, es fahren aus jedem
Tor zweihundert Männer heraus mit Rossen und Wagen.“ —
Unter diesen Wagen sind natürlich ausschließlich Kriegswagen gemeint.
Auf einer frühmykenischen Grabstele aus Agamemnons einstiger Residenz,
dem „goldreichen Mykene“, sehen wir in ungeschickter, roher Darstellung
einen Mann auf einem von zwei Pferden bespannten leichten Streitwagen
dahinfahren. Und überall in der Ilias ist bei den Kämpfen zwischen
den Griechen und Troern vor Ilions Veste vom feurigen Renner und
dem von ihm gezogenen Streitwagen die Rede, auf dem die Helden in
die „männermordende Feldschlacht“ zogen, nachdem sie sich „zum
Kampfe gegürtet“, d. h. das bis zu den Knien reichende Hemd mit ganz
kurzen Ärmeln, den Chiton, damit er nicht die Bewegungen hindere,
hinaufgenommen und mit einem Ledergürtel in dieser Stellung fixiert
hatten. Dann hatten sie die ledernen Beinschienen angezogen, die
zum Schutze der Schienbeine vor dem Anschlagen des gewaltigen, den
ganzen Mann bis zum Kinn vor den feindlichen Geschossen deckenden
Lederschildes dagegen dienten. Dieser ursprünglich von einer ganzen,
bis 50 kg wiegenden Rindshaut, später aus mehreren solchen
hergestellte Schild war in der Mitte zum besseren Schutze eingezogen
und daran waren zwei Querspreizen befestigt, an denen man ihn halten
konnte. Für gewöhnlich geschah dies aber nicht, wie es mit dem erst
später aufgekommenen kleinen Rundschild geschah, sondern der Schild
wurde an einem Tragriemen getragen, der auf der nackten rechten
Schulter auflag. Auf der Brust und auf dem Rücken kreuzte sich der
letztere mit dem Riemen, der auf der linken Schulter auflag und an
welchem auf der rechten Seite das Schwert getragen wurde. Beim Gehen
trug man den Riesenschild auf dem Rücken, im Kampfe dagegen vor sich;
beim Rückzuge nahm man[S. 195] ihn wieder auf den Rücken. Welches Gewicht
diese Riesenschilde gelegentlich gehabt haben müssen, kann man sich
vorstellen, wenn man in der Ilias vom siebenhäutigen Schilde des
starken Priamossohnes Hektor liest.
Bei solcher schweren Bürde waren die Helden gezwungen, in einem
zweiräderigen Streitwagen, in welchem sie den gewaltigen Schild vor
sich hinstellen konnten, in die Schlacht zu fahren. Dort angekommen,
kämpften sie stets zu Fuß, Mann gegen Mann, und nicht vom Wagen herab
wie die Vorderasiaten und Ägypter. In der Ilias sind nur fünf, und
zwar alles nachweisbar späte Stellen, in welchen auch von den Griechen
von dem mit zwei flinken Pferden bespannten Wagen herab gekämpft wird.
Auch zum Fliehen bediente man sich wiederum des Wagens, indem der außer
Schußweite auf den Ausgang des Einzelkampfes wartende Wagenlenker bei
Bedrängnis seines Herrn rasch herbeieilte, um ihn aufzunehmen und in
Sicherheit zu bringen. Bei Homer haben nur die Bogenschützen keine
Schilde und fahren deshalb nie. Ja, ein Held, der zwölf Wagen und die
dazu gehörenden prächtigen Doppelgespanne sein Eigen nannte, ließ
diese seine Habe vorsichtigerweise zu Hause und kämpfte zu Fuß als
Bogenschütze.
Der Panzer ist dem homerischen Epos durchaus fremd und war bei dem
vorhin beschriebenen gewaltigen Schilde durchaus unnötig, ganz
abgesehen davon, daß er den Mann, der am schweren Schilde genug zu
schleppen hatte, noch unnötig beschwert hätte. Selbst der Kriegsgott
Ares trug nach der Schilderung in der Ilias keinen Panzer. Die einzige
Bewaffnung der Helden wie auch ihres Anführers ist außer dem Helm
von Leder, vielfach mit Eberzähnen überstickt, wie solche in einem
Volksgrabe von Mykenä gefunden wurden, und dem vorgenannten großen
Schild der mäßig lange Wurfspeer und das kurze Schwert an der rechten
Seite. Wer unbeschildet war, trug Pfeil und Bogen. Wer aber als
„Schwerbewaffneter“ in den Kampf zog, ließ sich, wenn er es irgendwie
vermochte, auf dem Streitwagen dahin führen. So begreifen wir die
Notwendigkeit der homerischen Helden, einen Streitwagen zu führen, und
fühlen mit dem Dichter, der das edle Pferd als Liebling und Begleiter
der Krieger in prächtigen Schilderungen verherrlicht, wie etwa in der
folgenden:
„Gleich wie das Roß, das lang im Stall sich genährt an der Krippe,
Seine Fessel zerreißt und stampfenden Hufs durch die Ebne
Rennt, sich zu baden gewohnt in dem schön hinwallenden Strome,
[S. 196]
Strotzend von Kraft; hoch trägt es das Haupt und umher an den Schultern
Flattern die Mähnen empor. Im Gefühl der eigenen Schönheit
Tragen die Schenkel es leicht zur gewohnten Weide der Stuten, —
So schritt Priamos Sohn von Pergamons Veste hernieder,
Paris im leuchtenden Waffenglanz, der Sonne vergleichbar,
Freudig und stolz, rasch trugen die Schenkel ihn —“
In der klassischen Zeit Griechenlands waren die großen,
schweren Schilde, wie auch die Streitwagen zum Transporte der
„schwerbewaffneten“ Helden außer Gebrauch gekommen; dafür führte man
am linken Arm getragene kleine Rundschilde und einen Panzer, wenn man
zu Fuß ging, keinen Panzer dagegen, wenn man zu Pferde kämpfte. In
letzterem Falle ritt man ohne Sattel und Bügel auf dem Pferderücken,
dem man höchstens etwa eine Decke auflegte. Jeder von uns kennt ja
die Art des Reitens der Griechen und später auch der Römer an den
mancherlei auf uns gekommenen antiken Darstellungen von Reitern, in
erster Linie von der herrlichen Darstellung reitender junger Athener
am Panathenäenzuge auf dem berühmten Friese des Parthenon und an den
mancherlei Grabdenkmälern in Germanien verstorbener römischer Soldaten.
Schon der griechische Feldherr und Staatsmann Xenophon schrieb zu
Beginn des 4. Jahrhunderts v. Chr. ein Werk über die Reitkunst. Darin
ist von den Regeln die Rede, nach welchen man die Güte eines Pferdes
beurteilen, es dressieren und reiten soll, fernerhin ist angegeben, wie
Roß und Mann angetan sein und wie Speer und Schwert gebraucht werden
sollen.
Das berühmteste aller Pferde von Griechen, die nebenbei bemerkt
ausnahmslos von edler asiatischer Zucht waren, war das Leibroß
Alexanders des Großen (356–323 v. Chr.), Bukephalos, d. h. Stierkopf,
mit Namen. Nach den Angaben in der Naturgeschichte des älteren Plinius
soll Alexanders Vater Philippos es ihm, als er noch ganz jung war, aus
der Herde des Pharsaliers Philonikos um den Preis von 13 Talenten,
d. h. 45000 Mark, gekauft haben, weil es ihm so wohl gefiel. „Obgleich
dieses Pferd für gewöhnlich jeden Reiter aufnahm, so litt es doch, wenn
es mit dem königlichen Schmucke geziert war, keinen als Alexander.
Vorzügliche Dienste leistete es in Schlachten: bei der Belagerung
von Theben (im Jahre 335) ließ es, obgleich schwer verwundet, den
König doch nicht auf ein anderes steigen.“ Später gab es noch andere
Beweise seiner Klugheit und Anhänglichkeit,[S. 197] begleitete seinen Herrn
bis nach Indien und als es einige Zeit nach der Schlacht gegen König
Porus „entweder an seinen Wunden oder an Altersschwäche starb,“ wie
sich der Geschichtschreiber Plutarch ausdrückt, „betrauerte Alexander
dasselbe wie einen Freund und baute ihm zu Ehren am Hydaspes die Stadt
Bukephaleia. — Er soll auch einem seiner Hunde, welcher Peritas hieß,
zu Ehren eine Stadt gebaut haben.“
Nach demselben Plinius soll wie Alexanders, so auch Julius Cäsars
Pferd keinen andern Reiter auf sich gelitten haben. Dieses Pferd
soll Menschenfüßen ähnliche Vorderfüße besessen haben, „was auch an
seiner vor dem Venustempel aufgestellten Bildsäule ausgedrückt ist“.
Er meint damit wohl die unschönen langen Hufe, die lange im Stall
stehende Pferde bekommen. Daß nun der stolze Diktator Cäsar einen
solchen minderwertigen Gaul gehabt haben soll, ist kaum anzunehmen,
noch weniger, daß er sich mit einem solchen Klepper auf einer Bildsäule
verewigt habe.
Noch vieles sonst weiß dieser Autor von Pferden zu sagen, von dem
wir Einiges hier mitteilen möchten. Er schreibt: „Als vorzüglich
werden die skythischen Pferde gerühmt. Als ein Anführer der Skythen
in einem Zweikampfe getötet worden war, wurde sein Feind, da er ihm
die Waffen abnehmen wollte, von dessen Pferd durch Biß und Hufschlag
niedergemacht. Die Gelehrigkeit der Pferde ist so groß, daß alle Pferde
der sybaritischen Reiterei nach dem Takte der Musik zu tanzen gewöhnt
waren. — Die Pferde haben ein Vorgefühl von bevorstehenden Schlachten,
trauern über ihren verlorenen Herrn und vergießen zuweilen Tränen der
Sehnsucht. Als König Nikomedes getötet worden war, hungerte sich sein
Pferd zu Tode. Phylarchus erzählt, daß, als der Galater Centaretus
das Pferd des in der Schlacht gefallenen Antiochus siegestrunken
bestiegen hatte, das edle Tier sich unwillig in die Zügel gelegt und in
einen Abgrund gestürzt habe, so daß beide zerschmetterten. Philistus
schreibt, das Pferd des Dionysius sei von diesem im Schlamme steckend
verlassen worden, habe sich wieder herausgearbeitet, sei den Spuren
seines Herrn nachgezogen, unterwegs habe sich ein Bienenschwarm an
seine Mähne gehängt. Durch diese gute Vorbedeutung ermutigt, habe sich
Dionysius dann der Herrschaft bemächtigt.
Die unbeschreibliche Klugheit der Pferde lernen diejenigen schätzen,
welche reitend den Speer werfen, denn sie unterstützen des Reiters
Anstrengung durch die Stellung ihres Körpers. Die auf der Erde[S. 198]
liegenden Speere heben sie auf und reichen sie dem Reiter. (Plinius,
ein tüchtiger Reitergeneral, schrieb ein besonderes Buch „über die
Kunst des Kavalleristen, den Speer zu werfen“.) — Die in der Rennbahn
zum Wettlauf Angeschirrten zeigen deutlich, daß sie die Mahnungen
verstehen und den Ruhm zu schätzen wissen. Bei den Säkularspielen des
Kaisers Claudius wurde beim Wettlauf ein Wagenlenker namens Corax
(Rabe) vom Wagen geschleudert; aber seine Pferde kamen allen zuvor,
versperrten den einen den Weg, warfen andere um, kurz taten alles,
was sie unter der Leitung eines geschickten Wagenlenkers hätten tun
können, und standen zur Beschämung der Menschen zuerst am Ziele. — Für
eine wichtige Vorbedeutung galt es bei unsern Voreltern, daß Pferde
von einem Wagen, von welchem der Fuhrmann herabgestürzt war, als ob
er noch daraufstände, aufs Kapitol und dreimal um den Tempel liefen;
aber noch wichtiger schien es, als Pferde mit Kränzen und Palmzweigen
von Veji aufs Kapitol gerannt kamen. nachdem Ratumenna, der dort im
Wettlaufe gesiegt hatte, vom Wagen gestürzt war. Das Tor, durch das
sie hereinkamen, heißt seitdem das Ratumennische. Wenn die Sarmaten
(ein Nomadenvolk im Norden des Schwarzen Meeres) eine weite Reise
unternehmen wollen, so bereiten sie die Pferde tags zuvor durch Fasten
darauf vor, geben ihnen auch nur wenig zu saufen und reiten dann ohne
auszuruhen 150000 Schritte weit. — Hengste können 50 Jahre alt werden;
Stuten aber sterben früher. Hengste wachsen bis ins 6., Stuten bis ins
5. Jahr.“ Umgekehrt wie Plinius schreibt Aristoteles: „Der Hengst wird
35, die Stute über 40 Jahre; ja, es ist schon einmal ein Pferd 75 Jahre
alt geworden.“
Welche Bedeutung die Pferde schon bei den Griechen, besonders aber bei
den Römern bei den Rennen zu Wagen und unter dem Reiter erlangt hatten,
ist aus mancherlei Angaben von Schriftstellern zu ersehen. So berichtet
Pausanias (der Bädeker des Altertums, dem wir wertvolle Nachrichten
über verschiedene Kultstätten und der darin aufgestellten Weihgeschenke
verdanken, er lebte im 2. Jahrhundert n. Chr.): „In der 66. Olympiade
gewann Kleosthenes zu Olympia den Preis im Wagenrennen und stellte dann
in Olympia den betreffenden Wagen nebst seiner eigenen Bildsäule und
der seines Wagenlenkers und seiner Pferde auf. Es sind auch die Namen
der Pferde (bei den Wettrennen mit Wagen in der Rennbahn fuhr man stets
mit einem Viergespann): Phönix, Korax, Knacias und Samos, angemerkt.
Auf dem Wagen steht die Aufschrift: „Kleosthenes aus Epidamnos hat[S. 199]
mit Rossen im schönen Wettkampfe des Zeus gesiegt.“ — Der Korinthier
Phidolas hatte nach Olympia einen Wettrenner mit Namen Aura gebracht.
Dieser warf gleich beim Beginn des Laufes seinen Reiter ab, lief aber
doch ganz regelmäßig weiter und gewann den Preis. Phidolas bekam die
Erlaubnis, die Bildsäule seines Pferdes zu Olympia aufzustellen“.
Bei den Griechen wurden berühmte Pferde nicht nur im Leben, sondern
auch nach dem Tode ausgezeichnet und mit Denkmälern geehrt. So schreibt
Herodot: „Der Athener Kimon, Vater des Miltiades, siegte zu Olympia
dreimal mit dem Viergespann. Das Grab Kimons steht vor Athen an der
Hohlen Straße, ihm gegenüber das Grabmal seiner vier siegreichen Rosse.
Nur die Rosse des Lakoniers Euagoras haben es jenen gleichgetan.“ Aber
erst zur römischen Kaiserzeit wurde die Pferdeverehrung auf die Spitze
getrieben. So berichtet uns der Geschichtschreiber Dio Cassius: „Kaiser
Caligula hatte ein Pferd namens Incitatus (d. h. der Angespornte),
das mit ihm speiste, die Gerste aus einer goldenen Schüssel fraß, den
Wein aus goldenen Pokalen trank. Bei diesem Pferd pflegte der Kaiser
zu schwören; auch wollte er es zum Konsul ernennen, aber der Tod
vereitelte dieses Plänchen. — Der Kaiser baute sich auch selbst einen
Tempel, bestellte seine Gemahlin, sein Pferd und mehrere reiche Leute
zu Priestern und ließ sich täglich Vögel von delikatem Geschmack und
teurem Preise opfern. — Kaiser Nero hatte eine merkwürdige Liebhaberei
für Wettrennen. Waren ausgezeichnete Renner da, so ließ er sie einen
prachtvollen Staatsrock anziehen und ihnen regelmäßigen Gehalt
bezahlen. Dadurch kam es bald dahin, daß die Besitzer solcher Pferde
und deren Stallknechte so übermütig wurden, daß sie sich sogar gegen
Generäle und Konsuln flegelhaft benahmen. Der General Aulus Fabricius
wußte sich aber zu helfen und rächte sich damit, daß er Wagen mit
Hunden bespannte. — Kaiser Hadrian war ein sehr eifriger Jäger, brach
einmal auf der Jagd das Schlüsselbein und ward lahm, ließ aber seinem
Jagdpferde namens Borysthenes, als es gestorben war, eine Denksäule
mit einer Aufschrift setzen. — Kaiser Commodus hatte einen Wettrenner
gern, der Pertinax hieß. Als dieser einmal gesiegt hatte, schrieen
die Leute: ‚Pertinax ist Sieger!‘ Als das Pferd alt wurde, ließ ihm
Commodus die Hufe vergolden, eine vergoldete Schabracke auflegen und
befahl, es in den Zirkus zu führen. Als es da erschien, schrieen
die Leute: ‚Da kommt Pertinax!‘ Dies waren die Vorbedeutungen, die
anzeigten, daß der Ligurier Pertinax nach der Ermordung des Commodus
Kaiser werden[S. 200] mußte“. Julius Capitolinus berichtet: „Kaiser Verus
trug stets das goldene Bild seines Pferdes namens Volucer bei sich. Er
fütterte das Tier mit Rosinen, Nuß- und Mandelkernen, er schmückte es
mit purpurfarbigen Schabracken und errichtete ihm, als es gestorben
war, auf dem Vatikan ein Grabmal“ und Älius Lampridius meldet: „Kaiser
Heliogabalus fütterte seine Pferde mit Rosinen, die er aus Apamea in
Phrygien bezog“.
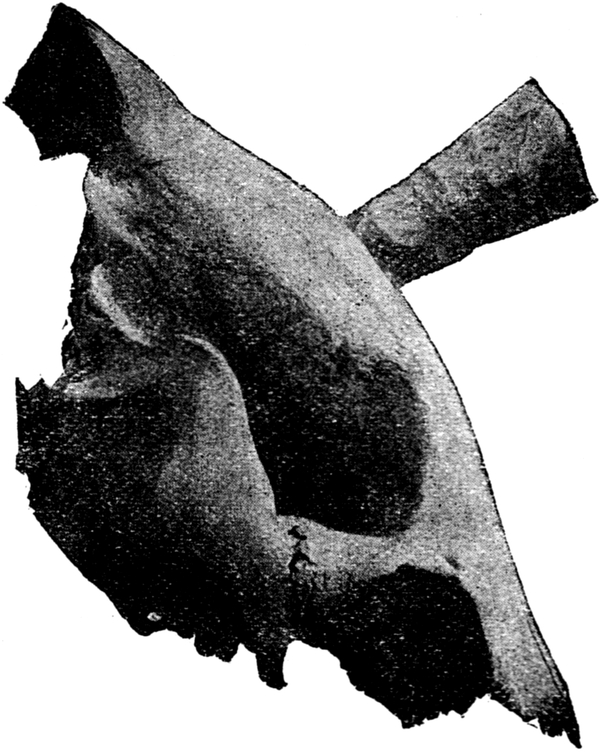
Bild 28. Ein im Jahre 1900 in Schonen, Südschweden,
an einem vorgeschichtlichen Opferplatz ausgegrabener Pferdeschädel
mit noch in der Stirne steckendem abgebrochenem Steindolch in
Seitenansicht. (Nach Gunnar Andersson.)
Nach Älian sollen die Oreïten und Adraster (indische Völker) ihre
Pferde mit Fischen gefüttert haben, ebenso die Kelten. Wir sahen
bereits bei der Besprechung des Rindes, daß man tatsächlich in
grasarmen Gegenden, so z. B. auf der Insel Island, zu einem solchen
Hilfsmittel griff und es an manchen Orten heute noch tut. Auch
scheinen die indogermanischen Stämme bis in die historische Zeit das
Pferdefleisch als besonderen Leckerbissen geliebt zu haben. Bei den
alten Germanen galt es als vornehmstes Opfer, ein Pferd zu schlachten
und dessen Fleisch beim Göttermahle zu verspeisen. Daß sich die
Gottheit besser des Opfers erinnere, wurde der abgefleischte und
des Gehirns entleerte Schädel gern am Dachfirst befestigt. Da nun
das Pferdefleischessen stets mit heidnischen Opfern verbunden war,
wurde dasselbe als minderwertig und unrein erklärt. Als alles dies
nichts fruchtete, wurde von Rom aus die Todesstrafe darauf gesetzt.
So vermochte man mit vieler Mühe den alten Deutschen die Freude am
Pferdefleischgenusse zu verleiden, so daß heute, da die Gründe, die zu
dessen Verbot führten, hinfällig geworden sind, die Tierschutzvereine
die größte Mühe haben, das damals dem Volke beigebrachte Vorurteil
zu beseitigen. Auch die Römer opferten jährlich im Oktober auf dem
Marsfelde dem Mars ein Pferd. Dieses hieß beim Volke das Oktoberpferd.
Ferner opferten die Massageten, Parther und Skythen ihrer[S. 201] obersten
Gottheit Pferde, ebenso die Perser. Strabon berichtet, daß Alexander
der Große in Pasargadä, der alten Residenzstadt der Perserkönige, das
Grabmal des Cyrus von Magiern bewacht fand, denen täglich ein Schaf und
monatlich ein Pferd zur Nahrung verabreicht wurde. Neben dem Fleisch
haben nur die Steppenvölker Südrußlands und Asiens auch die Milch der
Pferde genossen, und zwar stellten sie mit Vorliebe daraus ein von den
Kirgisen als Kumis bezeichnetes berauschendes Getränk her. Bei den
Germanen war dies nicht der Brauch, wohl aber bei den Litauern und
Esten, die solche Sitte von den südöstlichen Nachbarn angenommen hatten.

Bild 29. Der in der vorhergehenden Abbildung dargestellte
Pferdeschädel mit Steindolch in Rückansicht. Die ganze Form und Bearbeitung des
Dolches beweist, daß er der jüngeren schwedischen Steinzeit angehört. Die Art und
Weise, wie der Dolch in den Schädel hineingetrieben ist, zeigt, daß dies von
geübter Hand und mit großer Kraft zu Lebzeiten des bei irgend welchem Götterfeste
geopferten Tieres geschah; denn er ist, ohne den Schädelknochen auch nur im
geringsten zu splittern, 4,7 cm tief ins Gehirn
gedrungen und muß augenblicklich tödlich gewirkt haben.
Bei den Germanen und den mit ihnen verwandten Wenden hatte das Pferd
eine besondere sakrale Bedeutung, indem es, besonders in weißgefärbten
Exemplaren, als dem Kriegsgott heiliges Tier galt, das man ihm zu
Ehren in dessen heiligen Hainen in halber Freiheit hielt, in der
Annahme, daß sich der Gott ebensosehr als der Mensch an solchem
Besitz erfreuen werde. Überreste von dieser uralten Sitte lassen sich
mehrfach in Ortsbezeichnungen nachweisen. So rührt das Mecklenburgische
Schwerin vom wendischen Worte Zuarin, das Tiergarten bedeutet, her.
Gemeint damit ist aber nicht ein Wildpark für das Jagdvergnügen der
Vornehmen, sondern ein heiliger Hain, in welchem das dem slavischen
Kriegsgotte Swantewit geheiligte Tier, das Pferd, gezüchtet wurde.
Solche Pferdezucht in eingehegten heiligen Bezirken läßt sich auch für
Deutschland nachweisen und hielt sich auch[S. 202] nach der Einführung des
Christentums für profane Zwecke im Gebrauch. So hat Stuttgart, d. h.
Stutengarten, seinen Namen von dem Gestüt, das Kaiser Ottos I.
Sohn Liutolf im Jahre 949 in den dortigen Waldungen anlegte.
Die Pferde der Germanen, die von den aus dem Süden und Osten
eingeführten orientalischen Pferden abstammten, waren nach den
Schilderungen der Römer nur unscheinbare, aber äußerst leistungsfähige
und gut dressierte Tiere. So berichtet Julius Cäsar darüber: „Die
Pferde der Germanen sind häßlich, jedoch durch die tägliche Übung sehr
ausdauernd. In der Schlacht springen die germanischen Reiter oft vom
Pferde, kämpfen zu Fuß und ziehen sich, wenn es sein muß, wieder zu
ihren Pferden zurück; denn diese sind gewohnt, die bestimmte Stelle
nicht zu verlassen. Sie reiten ohne Decke auf dem bloßen Pferde.“
Vielfach war den Reitern als willkommener Kampfgenosse auch ein
Unberittener beigegeben, der sich beim Traben oder Galoppieren an
der Pferdemähne hielt, um folgen zu können. Solchermaßen schildert
uns Cäsar das Heer des germanischen Fürsten Ariovist, das aus 6000
Reitern und ebensoviel Fußkämpfern bestand. Nach Dio Cassius galten
die Bataver, am Unterlaufe des Rheins, als die besten Reiter unter
den Germanen, die bewaffnet mit ihren Pferden sogar über den Rhein
schwammen, was den Römern einigermaßen imponiert haben muß.
Am berühmtesten von allen Pferden Deutschlands waren im frühen
Mittelalter die thüringischen. König Hermanfried schenkte dem
Frankenfürsten Theoderich, aus dessen Familie er die Amelberg freite,
nach Landessitte mehrere weiße Pferde, wie Hochzeitspferde sein sollen.
Diese sollen besonders angenehm zum Reiten gewesen sein, „man schien
auf denselben zu ruhen,“ so sanft gingen sie. Sie wurden natürlich von
ihren Herrn mit besonderen Namen benannt, die uns teilweise erhalten
sind. So nannte Attila sein Lieblingspferd Löwe, ein anderes Leibpferd
Dunkelbraun. Ihr Preis war ein verhältnismäßig hoher, so daß als
Zugtier für die Landwirtschaft das Rind vorgezogen wurde. Galt doch
in einer Urkunde von 884 ein Pferd 10 Solidi, d. h. so viel als 10
Kühe. Karl der Große verbesserte die Stutereien seiner Güter. Eine
solche hieß stuot und stand unter einem mareskalk,
d. h. Pferdeknecht. Dieser gehörte an den fürstlichen und bischöflichen
Hofhaltungen zu den vornehmsten Ministerialen oder hörigen
Dienstmannen, denen stets ein eigenes Pferd für ihren Dienst zustand.
Die Pferde wurden zur Arbeit stets beschlagen, und die Hengste,
damit sie ihr feu[S. 203]riges Temperament mäßigen sollten, verschnitten.
Im 12. Jahrhundert erhielt das Stift Fulda noch 20 ungelernte Pferde
geschenkt. Wenn ein einzelner Mann so viel Pferde wegschenken kann, so
läßt dies vermuten, daß er eine ziemlich ausgedehnte Zucht gehabt haben
muß. Im Laufe des Mittelalters hat dann die Pferdezucht eine stetige
Verbesserung erfahren, bis sie sehr leistungsfähige Tiere lieferte.
Das Hauspferd asiatischer Abstammung erschien nach den Funden in
Pfahlbauten schon zu Ende der jüngeren Steinzeit in Mitteleuropa in
einzelnen, allerdings noch seltenen Exemplaren, die jedenfalls als
wichtige Kriegsgehilfen sehr geschätzt waren. Erst in den Stationen
der Bronzezeit erscheint es häufiger, um erst in der Römerzeit in
Helvetien größere Verbreitung zu finden, wie wir aus den Überresten
beispielsweise der römisch-helvetischen Kolonie Vindonissa ersehen. Es
war wie alle orientalischen Pferde, von denen bis jetzt die Rede war,
leicht gebaut und besaß zierliche Gliedmaßen mit hohen zylindrischen
Hufen und einem feingezeichneten, im Profil mehr oder weniger konkaven
Kopf. Das trockene, d. h. wenig fleischige Gesicht trat bei ihm
gegenüber dem Hirnschädel zurück. Die Kruppe fiel nach hinten wenig
ab und die Schweifwurzel lag in der Verlängerung der Rückenlinie. Nun
finden wir zur Römerzeit in Helvetien neben dieser graziösen, auch
eine plumpere Rasse mit massigen Formen, einem schwergebauten Kopf
und kräftigen Gliedmaßen, mit flachen Hufen und starker Haarbildung
darüber. Das fleischige Gesicht ist im Verhältnis zum Hinterteil des
Schädels stark in die Länge gezogen. Das Schädelprofil erscheint bei
ihm, statt konvex wie beim vorigen, deutlich konkav, d. h. geramst. Die
Kruppe fällt steil ab und die Schweifwurzel springt aus der Rückenlinie
heraus. Zu diesen anatomischen Merkmalen kommen noch Unterschiede der
Bezahnung. So besteht bei diesem plumper gebauten Pferd ein durch die
ungewöhnlich starke Entwicklung des Gesichtsteils bedingtes mehr in die
Längegezogensein der Backenzähne. Dabei zeigen sie eine kompliziertere
Faltung des Schmelzüberzuges als die zierlichere orientalische Rasse.
Während nun das im Schädelbau sich mehr dem Esel nähernde
orientalische oder warmblütige Pferd den Ahnherrn aller
schnellfüßigen Reit- und Wagenpferde darstellt, ist dieses plumpere,
aber kräftigere okzidentale oder kaltblütige Pferd der
Stammvater des schweren deutschen Karrengauls, dessen Vorfahren die
mit schwerer Rüstung für Mensch und Tier bewehrten mittelalterlichen
Ritter trugen, dann des flandrischen, normannischen und luxemburgischen
Karrengauls,[S. 204] die sämtlich vorzügliche Arbeitspferde sind. Mit
ihrer breiten Brust und dem starken Körper repräsentieren sie den
herkulischen Pferdetypus. Dieser ging aus dem einheimischen kräftigeren
Wildpferde Europas hervor, das zu zähmen und in den menschlichen Dienst
zu stellen sehr nahe lag, nachdem man einmal an dem aus dem Morgenlande
hier eingeführten leichteren Hauspferde den Nutzen dieses Tieres
erkannt hatte.
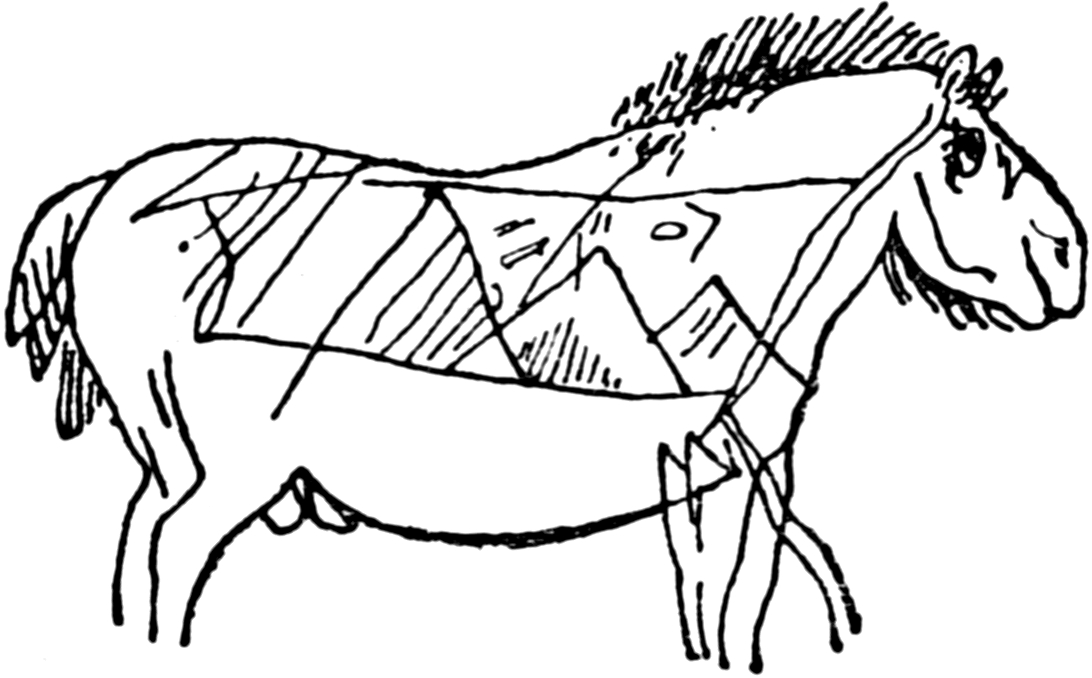
Bild 30. Darstellung eines Wildpferdhengstes des
schwereren Schlages aus der Höhle von Combarelles mit allerlei zeltartigen
Figuren beschrieben, die fälschlicherweise manche Forscher annehmen ließen, es
liege hier ein halbgezähmtes Tier vor, das mit einer Decke versehen sei.
Breite der Originalzeichnung 1 m.
(Nach Capitan und Breuil.)
Schon unter den diluvialen Wildpferden Europas lassen sich zwei Arten
unterscheiden, nämlich eine kleinere, leichte, die mehr im Süden
wohnte, und eine größere, derbere, die mehr im Norden lebte. Letztere
wurde besonders von Nehring genauer untersucht. Wie in Europa war es
sicher auch in Asien. Dort ist nun allerdings das zierlichere, mehr
im Süden lebende warmblütige Pferd zuerst gezähmt und in des Menschen
Dienst gestellt worden. Es hat sich dann im Laufe der Jahrhunderte in
verschiedene Schläge gespalten. Aber neben ihm gab es nach Norden zu
auch eine schwere, kaltblütige Art, die unabhängig vom okzidentalen
Pferde Europas gezähmt und in den Haustierstand übergeführt wurde.
Dieses schwere Pferd mit allen Kennzeichen der kaltblütigen
Rassengruppe, nur mit einigen Abweichungen im Schweifansatz, wie sie
für das Przewalskische Pferd typisch sind, ist in Mittelasien schon
frühe der Zähmung unterworfen und in den menschlichen Dienst gestellt
worden. So tritt es uns in typischer Weise, durch seine Kleinheit sich
als durch Zucht noch wenig verändertes Przewalski-Wildpferd zu erkennen
gebend, auf einem altpersischen Relief von Persepolis entgegen. Dort
dient es, reich geschirrt, zwei bärtigen Fürsten in langer Gewandung
und mit teils helm-, teils tiaraartiger Kopfbedeckung zum Reiten. Auch
die mit dem Przewalski-Pferd trefflich übereinstimmende Kleinheit
dieses Tieres tritt auf diesen Reiterbildnissen wie auf anderen Bildern
dieser Zeit, in denen die Tiere wie auf unserer Abbildung an einen
Kriegswagen angespannt geführt werden, deutlich hervor. In letzterem
Falle werden die Tiere[S. 205] in der Weise geführt, daß der Führer den
Arm über den Rücken legt und so mit der Hand den Zügel der von ihm
abgewandten Seite hält.
Wenn nun Krämer zeigte, daß nach der Schweiz, speziell Vindonissa, erst
die Römer schwere Pferde einführten, so können sie diese ganz gut aus
Asien bezogen haben; denn damals gab es nicht nur in Persien, sondern
auch in Kleinasien solche schwere, kaltblütige Schläge. So findet sich
beispielsweise auf einer Münze der kleinasiatischen Stadt Larissa die
charakteristische Darstellung eines kaltblütigen Pferdes. Diese Rasse
scheinen die Römer zur Berittenmachung ihrer schwerbewaffneten Reiterei
bevorzugt zu haben und führten sie deshalb bei sich ein. Durch Kreuzung
mit dieser wurde in der Folge das kleinere leichte Pferd, das über alle
Mittelmeerländer verbreitet war, etwas größer und stärker.
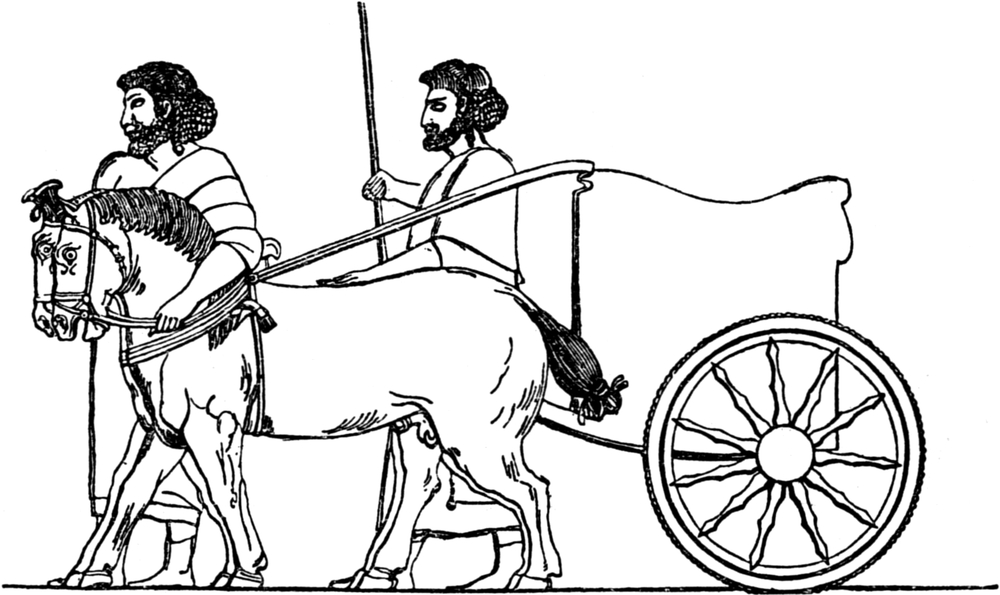
Bild 31. Altpersischer Kriegswagen von kleinen Pferden eines
schweren Schlages gezogen auf einem Relief in Persepolis. (Nach Sir Porter.)
Sicher war das Hauspferd Europas zur Bronzezeit ein Abkömmling der
zierlichen warmblütigen asiatischen Rasse, wurde dann aber auch aus
dem massenhaft vorkommenden einheimischen Wildmaterial gezogen; denn
anders ist es nicht erklärlich, daß die Gallier schon im Jahre 280 v.
Chr. bei ihrem Einfall in Griechenland 60000 Reiter ins Feld stellen
konnten. Da dieser Volksstamm schon früher eine tüchtige Reiterei bei
sich ausgebildet hatte, kann es uns nicht wundern, daß sie in späterer
Zeit eine besondere Schutzgöttin der Pferde, namens Epona, verehrten.
Aus der ganzen Hinterlassenschaft der keltischen[S. 206] Volksstämme läßt sich
ersehen, daß sie schon lange bevor sie mit der römischen Kultur bekannt
wurden, eine ausgebildete Pferdezucht trieben. Ihre Zuchtprodukte
wurden dann an die Nachbarn verhandelt. So kam das keltische Pferd auch
nach Spanien, das ebenfalls schon vor der Einnahme durch die Römer eine
blühende Pferdezucht besaß. Von Spanien aus drang dieses Pferd nach
Nordafrika vor; denn Publius Vegetius sagt ausdrücklich, daß die Pferde
der römischen Provinz Afrika (dem heutigen Algerien) spanischen Blutes
seien.
Was die warmblütigen orientalischen Pferde anbetrifft, so ist heute
der edelste Vertreter derselben der Araber, der in reinster
Rasse vorzugsweise in der Nedjed genannten unwirtlichen Hochebene
Mittelarabiens gezogen wird und mit Recht den höchsten Stolz seines
Besitzers ausmacht. Die Araber unterscheiden viele Familien ihrer
Pferde, über die sie genaue Stammbäume führen, und jeder Stamm rühmt
sich im Besitze einer besonders guten Rasse zu sein. Im ganzen
unterscheidet man 21 Blutstämme oder Familien, von denen die 5
vornehmsten unter dem Namen „Khamsa“ zusammengefaßt werden. Sie sollen
angeblich von den 5 Stuten Salomos abstammen.
Wie überaus hoch der Araber diese hochedeln Tiere, die ja tatsächlich
seinen wichtigsten Besitz ausmachen, schätzt, das beweisen die
Lobeserhebungen, die er ihnen spendet: „Sage mir nicht, daß dieses Tier
mein Pferd ist; sage, daß es mein Sohn ist! Es läuft schneller als der
Sturmwind, schneller noch, als der Blick über die Ebene schweift. Es
ist rein wie das Gold. Sein Auge ist klar und so scharf, daß es ein
Härchen im Dunkeln sieht. Es erreicht die Gazelle im Laufe. Zu dem
Adler sagt es: Ich eile wie du dahin! Wenn es das Jauchzen der Mädchen
vernimmt, wiehert es vor Freude, und an dem Pfeifen der Kugeln erhebt
sich sein Herz. Aus der Hand der Frauen erbettelt es sich Almosen, den
Feind dagegen schlägt es mit den Hufen ins Gesicht. Wenn es laufen
kann nach Herzenslust, vergießt es Tränen aus seinen Augen. Ihm gilt
es gleich, ob der Himmel rein ist oder der Sturmwind das Licht der
Sonne mit Staub verhüllt; denn es ist ein edles Roß, das das Wüten
des Sturmes verachtet. In dieser Welt gibt es kein zweites, das ihm
gleicht. Schnell wie eine Schwalbe eilt es dahin. So leicht ist es,
daß es auf der Brust deiner Geliebten tanzen könnte, ohne sie zu
belästigen. Sein Schritt ist so sanft, daß du im vollsten Laufe eine
Tasse Kaffee auf seinem Rücken trinken kannst, ohne einen Tropfen zu
verschütten. Es versteht alles wie ein Sohn Adams, nur daß ihm die
Sprache fehlt.“
[S. 207]
Dem durch gute Lungen ausgezeichneten arabischen Pferd kommt seine
Genügsamkeit sehr zu statten; denn es wird von seinem Herrn, der selber
nicht viel besitzt, recht knapp gehalten. Mit 18 Monaten beginnt
seine Erziehung, indem ein Knabe es zu reiten versucht. Im dritten
Lebensjahre legt man ihm den Sattel auf und sucht nach und nach alle
seine Kräfte und Fähigkeiten zu entwickeln. Erst wenn es das 7. Jahr
erreicht hat, sieht man es als erzogen an, und deshalb sagt das
arabische Sprichwort: „Sieben Jahre für meinen Bruder, sieben Jahre
für mich und sieben Jahre für meinen Feind.“ Dieser Araber ging im
Laufe des Mittelalters aus dem schon im Altertum berühmten persischen
Pferde hervor und steht in näherer Beziehung zum nordafrikanischen
Berberpferde, von dem die Mauren in Spanien einst die besten Zuchten
hatten. Sein Blut kreist in allen edeln Reit- und Wagenpferden
europäischer Rasse, vor allem auch im englischen Vollblut, über das wir
hier einiges Authentische mitteilen möchten.
Zunächst ist festzustellen, daß die bis jetzt herrschende, auf die
Zeugnisse der klassischen Schriftsteller gestützte Annahme, daß
Arabien im Altertum fast nur Kamele und keine Pferde gezogen habe,
nicht ganz richtig ist. Schon sehr früh gab es dort auch Pferde, die
von den Siegern annektiert und mitgenommen wurden. So zählt Flavius
Josephus unter der arabischen Beute des von 668–626 über Assyrien
herrschenden Königs Asurbanipal ausdrücklich auch Pferde auf. Außerdem
wird auf himjaritischen Inschriften öfter das Pferd erwähnt, auch
sind zwei Bronzestatuetten von solchen bekannt. In den Ruinen von
Nâ-it im Gebiete der Haschid sind nach dem Bericht des arabischen
Schriftstellers Al-Hamdani mehrfach Darstellungen von Pferden
gefunden worden. Doch hat die Aufzucht einer edleren Pferderasse
erst im Mittelalter durch die Mohammedaner stattgefunden, die auf
ihren Feldzügen großes Gewicht auf eine gute Reiterei legten. Zur
Zucht verwandten sie das damals am höchsten gezüchtete, nämlich das
persische Pferd, das schon im Altertum durch seine Leistungsfähigkeit
berühmt war. Die Griechen erstaunten, als sie im persischen Reiche
den auf schnellfüßigen Pferden durch Berittene besorgten, trefflich
funktionierenden Meldedienst und das auf gut unterhaltenen Straßen
vorzüglich eingerichtete Postwesen kennen lernten. Neben den persischen
waren auch die vorderasiatischen Pferde hochgeschätzt. So ließ König
Salomo Zuchtpferde aus Kilikien und Kappadokien holen, und König
Philipp von Makedonien begann seine Stammzucht, der sein Sohn Alexander
die treffliche Reiterei verdankte, angeblich mit 20000 skythischen
Stuten.
[S. 208]
Auch die Griechen suchten schon früh möglichst rasche und
ausdauernde Pferde zu züchten. Dies geschah wie heute auf Grund von
Leistungsprüfungen, und zwar in bezug auf Geschwindigkeit und Ausdauer.
Dazu dienten in erster Linie die olympischen, pythischen, nemeischen
und isthmischen Spiele, bei welchen sowohl Wagenrennen als Rennen
unter den Reitern abgehalten wurden. Letztere waren noch wichtiger
als die ersteren, und man hatte Jockeis und Herrenreiter, auch Geld-
und Ehrenpreise wie heute. Ein Rennen zu gewinnen galt als höchste
Ehre und man kann sich deshalb vorstellen, mit welchem Eifer die
Zucht rascher Pferde betrieben wurde. Schon damals war das Rennpferd
durchaus verschieden vom Pferd der Landeszucht. Es wird mehrfach mit
seinen typischen Merkmalen abgebildet, so beispielsweise auch auf einer
ums Jahr 450 v. Chr., also um die Zeit der Erbauung des Parthenon,
hergestellten griechischen Vase. Auf ihr sehen wir die Pfosten der
Rennbahn, den Zielrichter mit der Schärpe, den leichtgewinnenden
Sieger, der den noch heute typischen Fehler macht, sich am Ziel
umzusehen, während der zweite und dritte ein sog. Finish mit der
Peitsche reiten. Die hier dargestellten Rennpferde sind länger im Hals,
haben andere Schulter und Kruppe als die gewöhnlichen Reitpferde,
die uns auf dem Parthenonfries entgegentreten und waren zweifellos
orientalischen Ursprungs.
Tafel 37.

Anschirren eines Rennwagens, darunter ein Tierfries. Von
einer jüngeren attischen Vase in Berlin.
(Nach Gerhard, Auserlesene Vasenbilder.)
⇒
GRÖSSERES BILD
Tafel 38.

Griechische Jünglinge zu Pferd am Panathenäenfestzug vom
Friese des Parthenon.
(Nach einer Photographie von Mansell & Cie. in London.)
⇒
GRÖSSERES BILD
Tafel 39.

Ausgewachsenes Shetlandpony neben einer gewöhnlichen
Hausziege in Karl Hagenbecks Tierpark in Stellingen.
⇒
GRÖSSERES BILD
Tafel 40.
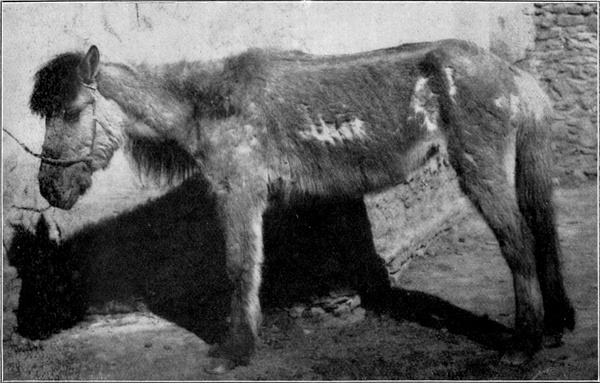
Ungepflegtes Mongolenpferd, wie es in halbwilden Herden im
Westen Chinas lebt. Durch Pflege läßt sich daraus ein zwar kleiner, aber sehr
ausdauernder Schlag gewinnen. (Nach Photographie von Buchmann in Tayanfu.)
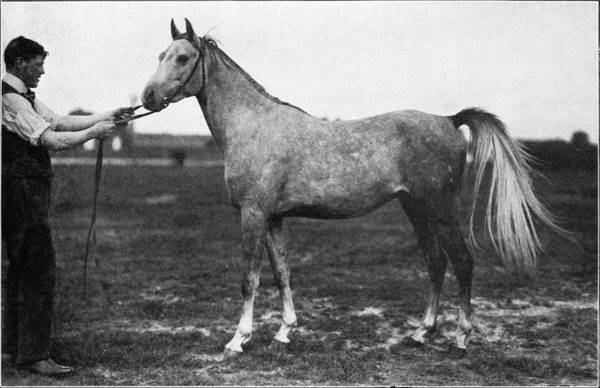
In Deutschland gezogener Araberhengst von Karl Hagenbecks
Tierpark in Stellingen.
Von den Griechen übernahmen dann die Römer die Freude an den Wettrennen
und die Hochschätzung der Rennpferde. Letztere brachten sie auch in
ihre Kolonien. So hielt beispielsweise Kaiser Severus, der von 206–210
in England weilte, mit von Rom dahin importierten Pferden ein Rennen
im York ab. Aber auch an zahlreichen andern Orten Englands gab es
damals schon Rennen mit hochgezüchteten Pferden, so z. B. in Chester,
wo noch ein Teil der antiken Rennbahn erhalten ist. Seitdem blieben
die Rennen in jenem Lande ein nationaler Sport; aber von einer Zucht
zu Rennzwecken war damals und das ganze Mittelalter hindurch keine
Rede. Wenn auch öfter edle Pferde, namentlich zur Zeit der Kreuzzüge,
ins Land gebracht wurden, so blieb man dort im Laufe der Jahrhunderte
doch nur bei einem mäßig geschwinden Pferd, dem galloway.
Das Bestreben, dieses kleine und nur mäßig leistungsfähige Pferd zu
verbessern, war der Anlaß, daß man im 17. Jahrhundert anfing, in
erheblichem Maße orientalische Pferde einzuführen. Von besonderer
Wichtigkeit war ein Import von 30–40 orientalischen Stuten, den
„royal mares“, die Karl II. etwa 1670 einführte. Im
Laufe des 17. und zu Anfang des 18. Jahr[S. 209]hunderts führte man
zudem nicht weniger als 26 orientalische Hengste in England ein,
um die Zucht aufzufrischen. Von diesen war Darley Arabian nach dem
bedeutendsten deutschen Rennstallbesitzer, Arthur von Weinberg, der
wichtigste Stammvater, den etwa 90 Prozent aller heutigen Vollblüter
zu ihrem Ahnen haben sollen. Nach ihm kommt an Bedeutung der 1728
importierte Godolphin Arabian, den ein Engländer in Paris vor einem
Wasserwagen entdeckte und der im Beginn der englischen Vollblutzucht
eine große Rolle spielte. Mit dem Import dieser Hengste beginnt das
erste Aufzeichnen der Stammbäume im großen Gestütsbuch. Doch war
zunächst noch von keiner systematischen Zucht die Rede. Die einzige
Richtschnur war damals, daß für die Stuten der Vater, für die Hengste
aber die Mutter in erster Linie maßgebend sei. Man wollte Rennen
gewinnen und züchtete unbekümmert um Theorien stets von den besten,
d. h. raschesten Pferden. So konzentrierte sich im Gegensatz zu
den Ratschlägen der Theoretiker die Zucht auf eine immer geringer
werdende Zahl von männlichen Linien, bis schließlich fast nur eine
einzige Linie übrigblieb. Wie die heutigen Vollblutpferde auf wenige
Hengste, so gehen sie, wie zuerst deutsche Forscher feststellten, zum
größten Teil auf fünf Stuten zurück. Sie sind trotz der weitgehenden
Inzucht außerordentlich leistungsfähig, haben eine Verlängerung von
Oberarm- und Oberschenkelknochen zur möglichst raschen Fortbewegung
erhalten und sind sehr frühreif. Während die Vollblutpferde schon mit
18 Monaten geritten werden und zweijährig Rennen laufen, kann man das
Halbblutpferd, z. B. die Remonten der Kavallerie, meist erst vierjährig
überhaupt anreiten.
Das arabische, wie auch das mit ihm nahe verwandte maurisch-berberische
Pferd wurde wie in England, so auch auf dem Kontinent mit leichten
und schweren einheimischen Schlägen gekreuzt und dadurch die
verschiedensten Gebrauchspferde erhalten, die je nachdem zum
Reiten, Fahren oder Ziehen besonders geeignet sind. Näher auf die
Abstammungsverhältnisse und die Eigentümlichkeiten der verschiedenen
Pferderassen einzugehen, verbietet schon der beschränkte Rahmen dieses
Buches. Es sei hier nur bemerkt, daß in Europa die Pferdezucht in den
weiten Steppen des Ostens am bedeutendsten ist. So besitzt Rußland
zahlreiche starke Gestüte in den Steppen am Don und am rechten Ufer
der untern Wolga. Das russische Pferd ist klein, aber äußerst genügsam
und ausdauernd. Auch in Ungarn und Siebenbürgen werden viele und gute
Pferde für den Export gezüchtet. In Galizien, in der Bukowina und in
der südöstlichen Steiermark findet sich gleicherweise ein[S. 210] leichter
Schlag, während die weiter nördlich und östlich davon gelegenen
Länder kräftigere Arbeitstiere ziehen, in denen reichlich Blut des
schweren okzidentalen Pferdes beigemischt ist. In Hannover, Holstein
und Mecklenburg werden viele edle Reitpferde gezogen. Dänemark
züchtet die besten in Jütland. Skandinavien, Wales, Schottland, die
Shettlandsinseln und Island besitzen ponyartige kleine Schläge, die im
Winter einen langen, krausen Haarpelz erhalten. Belgien, die Normandie
und gewisse Gegenden Englands züchten mit Vorliebe schwere, kaltblütige
Arbeitspferde. In Spanien wird vorzugsweise das aus Nordafrika
eingeführte Berberpferd gezogen. Die besten Gestüte besitzt Andalusien.
Die europäischen Mittelmeerländer sind wenig reich an Pferden, weil
Esel und Maultier dort stark verbreitet sind. Besonders in Griechenland
ist die im Altertum blühende Pferdezucht in argen Verfall geraten.
Italien besitzt nur lokal ein erhebliches Pferdematerial. Die schönste
Rasse findet sich in der römischen Campagna, wo die Wagenpferde der
Kardinäle und Patrizier gezüchtet werden. Den größten Pferdereichtum
trifft man in Sardinien an. Nach Cetti ist dort das Pferd vielfach
verwildert, soll angeblich nicht mehr zu bändigen sein und wird
vielfach erlegt, hauptsächlich um das Fell zu gewinnen. Es haust hier
namentlich in den ausgedehnten Waldungen im Innern.
Bald nach ihrer Entdeckung erhielt die Neue Welt das Pferd durch
die Spanier, und zwar waren es Andalusier, die dort, speziell in
Mexiko, eingeführt wurden. Doch sind sie nach und nach entartet und
vielfach verwildert. Indessen sind heute die verwilderten Herden bis
auf einzelne in Patagonien lebende Trupps auf einen 1865 erlassenen
Befehl der Regierung hin vernichtet worden, da sie nicht nur die Weiden
beeinträchtigten, sondern vielfach auch die zahmen Pferde entführten.
Gegenwärtig nehmen die Vereinigten Staaten von Nordamerika den
bedeutendsten Rang in der Pferdezucht ein. Berühmt ist die neuerdings
aufgekommene Traberzucht, deren Grundstock das amerikanische Vollblut
bildet.
In Australien wurde die Pferdezucht ebenfalls erst von den Europäern
eingeführt. Das Material stammt aus England, der Kapkolonie und von
den Sundainseln. In Indonesien werden mehr kleine Schläge gezüchtet,
ebenso in Oberbirma und Südindien. In Nordwestindien wird viel ein dem
Afghanenpferde verwandter Schlag gehalten. In China zieht hauptsächlich
die Mandschurei Pferde, auf deren Haltung aber wenig Sorgfalt verwendet
wird. Japan züchtete[S. 211] früher im Norden der Hauptinsel einen kräftigen
Schlag; neuerdings wurden besonders europäische und amerikanische
Rassen importiert.
Am zahlreichsten wird das Pferd in Innerasien gezüchtet. In Turkestan
ist es das wichtigste, unentbehrlichste Haustier, das von jedermann
gehalten wird. Persien hat drei verschiedene edle Schläge, einen
kleineren im Gebirge und größere in den Ebenen. Die edelste Zucht von
persisch-arabischem Blut trifft man in Schiras. Klein und unansehnlich,
aber äußerst leistungsfähig ist das Kirgisenpferd, das auch von den
Kalmücken und andern Mongolenstämmen in großen Mengen gehalten und
auch zur Milchgewinnung benutzt wird. In Afrika, das einst seinen
Pferdebestand Asien entlehnte, werden besonders im Norden und Osten
viel Pferde gezogen. Ägypten, Abessinien, die Somaliländer und der
Sudan besitzen verdorbene arabische Schläge, die als Reittiere ungemein
leistungsfähig sind und Wassermangel vielfach besser als andere
Schläge ertragen. Das zähe Gallapferd findet beim abessinischen Heere
ausgiebige Verwendung. In Südafrika werden besonders in der Kapkolonie
und in Transvaal kleine, sehr ausdauernde Pferde gezüchtet. Überall in
den Tropenländern, wo das Klima zu feucht ist, hält es sich schlecht,
deshalb haben die Portugiesen in ihren afrikanischen Kolonien den
Reitstier eingeführt.
[S. 212]
VIII. Das Kamel.
Die Kameliden sind der älteste Zweig der Wiederkäuer, der sich
schon im Miozän von der Gesamtfamilie trennte, bevor sich bei ihren
Vertretern Hörner oder Geweihe ausgebildet hatten. Sie sind die
einzigen Wiederkäuer, die noch im Oberkiefer Schneidezähne — im
ganzen vier — besitzen. Mit den ältesten Pferden entwickelten sie
sich in Nordamerika, wo während der jüngeren Tertiärzeit die reichste
Entfaltung derselben nachweisbar ist. Doch erlosch dort die Gruppe
mit dem Eintritt der Eiszeit, während die Kamele nach Asien und die
Schafkamele oder Lamas nach Südamerika auswanderten, wo sie sich auf
den Höhen der Anden erhielten.
Noch heute lebt ein winziger Überrest der Kamele in ihrer
ursprünglichen Wildheit in der innerasiatischen Wüste in der Dsungarei,
ebendort, wo auch die letzten Wildpferde zu finden sind. Schon der
russische Reisende Przewalski hatte von ihrem Vorkommen im Gebiet des
Lob Nor, d. h. im westlichen Teil der Wüste Gobi, berichtet. Doch erhob
man damals dagegen den Einwand, es möchten dies einzelne entlaufene
und verwilderte Kamele gewesen sein. Indessen hat dann später der
schwedische Reisende Sven Hedin auf Grund eigener Beobachtung das
Vorkommen von eigentlichen Wildkamelen in jenen menschenleeren Einöden
festgestellt. In einem Brief aus Obdal vom Juni 1900 schreibt dieser
Autor in der Umschau: „In der Gegend, die wir durchwanderten, kamen
wilde Kamele in großer Anzahl vor, und wir sahen und beobachteten sie
täglich durch unsere Ferngläser. Sie halten sich längs des Fußes der
Berge und in der Wüste auf, begeben sich aber von Zeit zu Zeit zu den
schirmenden Quellen, um zu trinken und zu grasen. Es gewährt einen
herrlichen Anblick, wenn man eine solche Herde, nachdem man ihr den
Wind abgefangen, unvermutet überrascht. Die Karawane mußte, während
unsere Jäger sich an die Tiere heranschlichen, in solchen Fällen immer
Halt machen. Einige der Kamele[S. 213] standen gewöhnlich aufgerichtet als
Späher da, während die andern sich in liegender Stellung ausruhten.
Bei Jardang Bulak schoß der Kosake Tjernoff ein prächtiges Kamel, bei
Altimisch Bulak unser Führer Abdu Rehim ein anderes. Ich meinerseits
zog es vor, mit einem starken Fernrohr bewaffnet, ihre Bewegungen zu
beobachten. Es liegt ein märchenhafter Glanz über diesen gewaltigen,
stattlichen Tieren, an deren Existenz die Gelehrten bis in die neueste
Zeit hinein gezweifelt haben. Es erweckte mein Staunen, daß wir diese
Tiere immer nur in den unwirtlichsten, sterilsten und wasserärmsten
Wüsten antrafen, wo wir mit unsern zahmen Kamelen Gefahr liefen,
vor Durst umzukommen; und doch finden sie nur in solcher Umgebung
ihr Fortkommen und sind so scheu, daß sie, wenn sie in meilenweiter
Entfernung eine Karawane wittern, tage- und nächtelang fliehen und man
nur aus den frischen Spuren ersehen kann, daß sie erst ganz kürzlich
aufgebrochen waren.
Wunderschön ist auch der Anblick einer durch unsere Annäherung oder
vielmehr durch einen Büchsenschuß erschreckten fliehenden Herde. Sie
sehen sich nicht um, sie fliehen bloß und sie fliegen über die Wüste
dahin wie der Wind und verschwinden in einigen Minuten am Horizonte,
um erst wieder Halt zu machen, wenn sie sich ganz sicher fühlen, weit,
weit hinten im Sande.
Es gibt sowohl Mongolen als Muhammedaner, welche nur von der Jagd
auf wilde Kamele im Kurruktag und den weiter östlich davon gelegenen
Gegenden leben. Diese Jäger sind mit den Gewohnheiten und dem Leben
der wilden Kamele durch und durch vertraut. Sie jagen die Weibchen nur
während der Brunstzeit, wo die Männchen mörderische Gefechte um ihre
Gunst ausfechten. Der Stärkste ist der Herrscher und kann mitunter mit
5–6 Weibchen umherwandern, während die Besiegten, die fürchterliche
Wunden davontragen und denen oft große Stücke Fleisch an den Seiten
herausgerissen sind, einsam und verschmäht in der Wüste leben und sich
den Familienherden nicht zu nahen wagen, wahrscheinlich aber doch der
Hoffnung auf Glück das nächste Mal leben. Die Wüste gewinnt durch ihr
Erscheinen bedeutend an Leben, und die Männer werden ganz wild, sobald
der Ruf erschallt: „java tuga“ (wilde Kamele)!
Einer unserer Jäger verfolgte einmal ein großes schwarzes Männchen,
das einen Schuß in das Bein erhalten hatte, aber in südlicher Richtung
weiterhinkte, volle zwanzig Stunden lang und kam müde und durstig
zurück, ohne daß es ihm gelungen war, das Tier wieder[S. 214] in Schußweite zu
bekommen. Wie sonderbar ist doch die Welt, in der diese Tiere leben,
und doch müssen sie das Gefühl haben, daß außerhalb ihrer friedlichen
Fluren der Feind lauert, denn sonst würden sie nicht eine so stark
ausgeprägte Furcht vor den Menschen hegen. Ihre einzige Gesellschaft
ist der Buran, der schwarze Sturm, der in dieser Gegend unumschränkt
herrscht und mit dem auch wir in intime Beziehung gerieten.“
Diese von der südlichen Dsungarei durch Ostturkestan und Nordtibet
verbreiteten wilden Kamele schützen sich wie ihre gezähmten Abkömmlinge
vor diesen fürchterlichen Sandstürmen, indem sie ihre Nasenlöcher
hermetisch verschließen. Sie besitzen zwei Höcker, wie die von ihnen
in direkter Linie abstammenden, in Ost- und Mittelasien als Haustiere
lebenden baktrischen Kamele oder Trampeltiere, nur sind sie kleiner
als die vom Menschen gezüchteten Höcker. Diese sind, wie der Buckel
des Zebus, Ansammlungen von Reservefett, die bei den gezähmten Formen
ein Gewicht von 2–5 kg erlangen. Diese Höcker lassen sich durch
Mästung wie beim Höckerrind zu extremen Dimensionen steigern, können
aber durch längere Zeit fortgesetzte Anstrengung bei knapper Nahrung
in wenigen Wochen zum Verschwinden gebracht werden. Das weiter durch
Kultur veränderte einhöckerige Kamel oder Dromedar, das sich von seinem
Ursprungslande Zentralasien am weitesten westlich nach Afrika hinein
entfernte, ist artlich durchaus nicht von diesem zweihöckerigen Kamel
oder Trampeltier verschieden. So hat es, wie Lombardini in Pisa 1879
nachwies, während des Fötallebens ebenfalls die Anlage zu zwei Höckern,
die sich aber noch im Mutterleibe zu einem einzigen vereinigen. Für die
Abstammungsgeschichte ist diese Tatsache von größter Wichtigkeit, indem
wir so mit einer einzigen wilden Stammform auskommen, das zweihöckerige
Kamel als die ursprünglichere zahme Rasse und davon das Dromedar als
jüngere Zuchtrasse ableiten können.
Auch physiologische Gründe sprechen für die Zusammengehörigkeit beider
Hauptrassen, indem sich das zwei- und einhöckerige Kamel leicht
kreuzen lassen und fruchtbare Bastarde liefern, bei denen sich die
Zweihöckerigkeit in ausgesprochener Weise geltend macht. Gleicherweise
stimmen die geistigen Eigenschaften bei den Tierarten auffallend
miteinander überein. Beide Formen sind wenig begabt, wie es die tiefe
Stellung der Familie im Stammbaum der Wiederkäuer mit sich bringt;
beide zeigen neben Indifferenz, Dummheit und störrischem Wesen eine
auffallend geringe Anhänglichkeit an den Menschen. Immerhin ist das[S. 215]
Trampeltier als die ursprünglichere Form gutartiger als das Dromedar,
läßt sich leichter einfangen und gehorcht seinem Herrn williger.
Beide Tierarten gedeihen nicht auf üppiger Weide, sondern verlangen im
Gegenteil dürre Steppenpflanzen, welche anderen Tieren kaum genügen
würden, besonders aber Salzpflanzen. Dabei ist das Trampeltier noch
bedürfnisloser als das Dromedar und frißt die bittersten und salzigsten
Wüstenkräuter, die von den übrigen Steppentieren durchaus verschmäht
werden. Dazu saufen sie selbst das äußerst salzhaltige Wasser der
Steppe, das kein anderes Tier anrührt, und sind überhaupt auch darin
höchst bedürfnislos. Aristoteles schreibt sogar von ihnen: „Die Kamele
saufen lieber trübes als reines Wasser, und trüben es, wenn sie es
rein vorfinden, erst absichtlich, wenn sie saufen wollen. Übrigens
können sie recht gut vier Tage ohne Getränk aushalten, nehmen aber auch
nachher desto mehr zu sich. Sie leben meist 30 Jahre, zuweilen auch bis
hundert.“
Irgendwo in seiner zentralasiatischen Heimat ist das zweihöckerige
Kamel, das Trampeltier (Camelus bactrianus) in
vorgeschichtlicher Zeit vom Menschen gezähmt und in den Haustierstand
übergeführt worden. Bis auf den heutigen Tag ist es ausschließlich
auf Innerasien beschränkt und ist zu den Mongolen Ostasiens und nach
dem südlichen Sibirien vorgedrungen. Hier überall bis tief nach China
hinein ist es dem Menschen eines der nützlichsten Haustiere, das
vorzugsweise als Lasttier, seltener zum Ziehen des Wagens und des
Pfluges verwendet wird. Außer seiner Arbeitskraft verwendet man Fleisch
und Fell und nutzt seine Milch und seine Haare aus. Mit ihm durchzieht
man die wasserlosen Wüstenstrecken, in denen Pferde nicht zu gebrauchen
sind und ihre Dienste versagen würden. Mit ihm erklimmt man Gebirge bis
über 4000 m Höhe, in denen nur noch der Yak aushält. Brehm sagt
von ihm: „Das Pferd ist der Genosse, das Trampeltier der Diener des
Steppenbewohners.“
Derselbe Autor bemerkt: „Ein kräftiges Trampeltier legt mit 220
kg, ein sehr starkes mit noch 50 kg mehr täglich 30–40
km, mit der Hälfte der Last aber im Trabe fast das Doppelte
zurück, vermag im Sommer 2 oder 3, im Winter 5–8 Tage zu dursten, halb
so lange ohne Beschwerde zu hungern und beansprucht bei längeren Reisen
nur alle 6–8 Tage eine Rast von 24 Stunden Dauer. In der Kirgisensteppe
wird es übrigens nicht ausschließlich als Lasttier, sondern einzeln wie
paarweise auch als Zugtier verwendet und tritt auf Flugsandstrecken
sogar an Stelle der Postpferde.“ Doch geht es[S. 216] nur im Schritt und stößt
dabei vielfach unwillige Laute aus, die einem auf die Dauer unangenehm
werden.
Auf der Oberseite des Nackens haben die Trampeltiere, wie die von ihnen
abstammenden Kamele, zwei Paar dichtstehender Drüsen, die beim Männchen
in der Brunstzeit eine dunkle Schmiere absondern und dann die ganze
Nackenmähne besudeln. Die Begattung wird vollzogen, indem sich das
Weibchen, durch einige derb kneifende Bisse von seiten des Männchens in
Hals, Höcker und Beine veranlaßt, wie sonst zur Belastung niederkniet.
Das nach 12 Monate währender Tragzeit im Frühling geborene Junge von 30
cm Höhe entwickelt sich, von der Mutter an ihrem vierzitzigen
Euter ein volles Jahr lang ernährt, rasch. Schon im zweiten Jahre
beginnt man mit seiner Abrichtung, indem man dem Füllen die Nase
durchsticht und ihm durch die so entstandene Öffnung den Zaumpflock
durchsteckt. Im dritten Jahre wird es zu kurzen Ritten, im vierten zum
Tragen leichter Lasten benutzt. Im fünften Jahre gilt es als erwachsen
und arbeitsfähig und kann bei guter Behandlung bis zum 25. Jahre
Dienste tun.
Tafel 41.
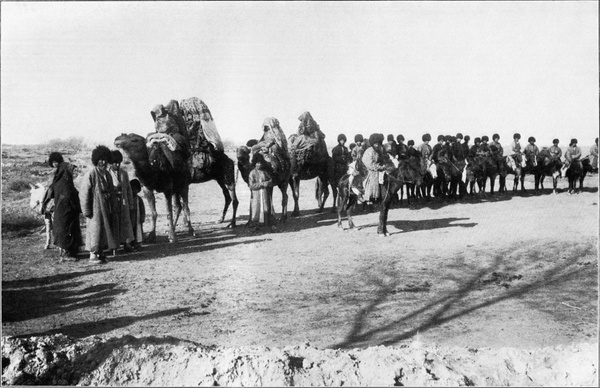
Kamele und Pferde in einem Hochzeitszug der Teke-Turkmenen.
⇒
GRÖSSERES BILD
Tafel 42.
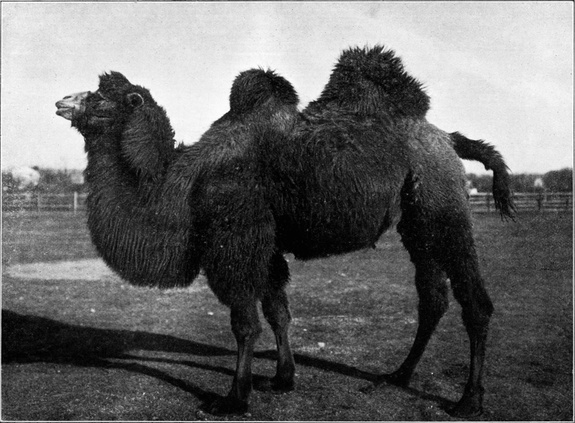
Zweihöckeriges Kamel, sog. Trampeltier, aus Turkestan, von
Karl Hagenbeck in Stellingen importiert.
⇒
GRÖSSERES BILD
Tafel 44.
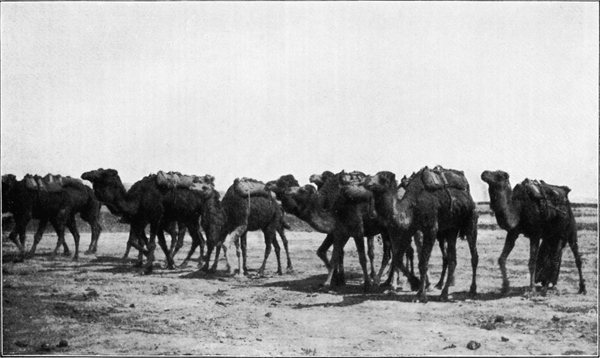
Kamelkarawane in Biskra. (Nach einer Photographie von
Dr. H. von Baeyer.)

Kirgisen auf dem Marsch; rechts dahinter eine Jurte.
Wie in Zentalasien und der Mongolei spielt das Trampeltier auch in
China eine wichtige Rolle im Karawanenverkehr. Im südwestlichen
Sibirien wird dasselbe seit der raschen Entwicklung der Landwirtschaft
häufig vor den Pflug gespannt. Über den Ostrand Asiens vermochte es
nicht vorzudringen, weil für die Küsten- und Inselgebiete der Büffel
besser paßt. Während des chinesisch-japanischen Krieges wurde es
zahlreich in China angekauft und nach Japan eingeführt; da man aber
nichts mit ihm anzufangen wußte, verschwand es wieder von dort. Nach
Westen ist das Trampeltier über Persien nach Mesopotamien und bis
zum Kaukasus vorgedrungen, kommt auch sporadisch in Südrußland vor.
In einer Grenzzone, die vom nördlichen Kleinasien durch Persien,
Afghanistan und Beludschistan bis nach Indien reicht, findet sich das
Trampeltier mit dem Dromedar zusammen. Südlich von dieser Mischzone
findet sich überall ausschließlich das einhöckerige Kamel oder
Dromedar (Camelus dromedarius), das als südliche, mehr
wärmeliebende Abart von Syrien und Arabien aus in ganz Nordafrika
die ausschließliche Herrschaft erlangte. In Arabien, Ägypten und
Nubien wird seine Zucht stark betrieben, ebenso bei den Somalis und
Gallas. Nach Süden ist es bis Sansibar, in Nordafrika bis Marokko
und die Kanarischen Inseln vorgedrungen. Es ist das Gimel der alten
Juden oder das Djemmel der Araber, aus welch letzterem die Griechen
kámēlos machten, das dann als camelus[S. 217] zu den Römern
gelangte. Der aus Sizilien gebürtige griechische Geschichtschreiber
Diodoros sagt: „Arabien besitzt viele und vorzügliche Kamele, auch
von der zweihöckerigen Rasse. Die Kamele sind den Einwohnern sehr
nützlich, indem sie durch Milch und Fleisch treffliche Nahrung bieten
und Menschen und Lasten tragen. Die leicht und schlankgebauten sind
schnell und können durch wasserlose Wüsten große Tagesmärsche machen.
Sie tragen auch im Kriege zwei Bogenschützen, wovon der eine nach vorn,
der andere nach hinten gewendet sitzt. — Dromedare (vom griechischen
dromeín, laufen) nennt man die schnellen Kamele, die in einem
Tage beinahe 1500 Stadien (= 277 km) zurücklegen können.“ Und
sein Volksgenosse Strabon schreibt: „Die in Zelten wohnenden Araber der
dürren Wüste zwischen Mesopotamien und Coelesyrien bauen wenig Land
oder gar keins an, haben aber Herden von allerlei Vieh, besonders von
Kamelen“, und an einer andern Stelle: „Alexander der Große sandte Leute
auf Dromedaren nach Ekbatana, welche in 11 Tagen den 30–40 gewöhnliche
Tagereisen betragenden Weg zurücklegten.“
Älian berichtet: „Die Kamele am Kaspischen Meere sind zahllos,
tragen viele, sehr weiche Haare, welche der feinsten Schafwolle
nicht nachstehen. Priester und reiche Leute tragen daraus gefertigte
Kleider.“ Der griechische Geschichtschreiber Herodot erwähnt sie
mehrfach; so schreibt er: „Die Araber in der Armee des Xerxes (die
580 v. Chr. nach Griechenland zog) hatten sämtlich Kamele, die an
Schnelligkeit den Pferden nicht nachstanden.“ — „Als Xerxes nach
Griechenland gegangen war und nach Therma zog, fielen Löwen seine
Kamele an.“ Weiter meldet er, wie Cyrus sich listigerweise die
Unkenntnis dieser Tierart bei seinen Gegnern zu Nutzen machte: „Als
Cyrus vor Sardes rückte, stellte sich ihm Krösus in der Ebene mit
einer trefflichen Reiterei entgegen. Cyrus errang jedoch auf folgende
Weise den Sieg: Vor seiner Armee stellte er alle Kamele, welche die
Bagage des Heeres trugen, auf, nachdem er ihnen die Last abgenommen und
bewehrte Männer hatte aufsitzen lassen. Hinter den Kamelen ordnete er
die Fußsoldaten und hinter diesen die Reiter. Er sah voraus, daß die
Pferde im Heere des Krösus, welche noch keine Kamele gesehen hatten,
sich vor diesen Tieren fürchten würden. Die List gelang: denn die
lydischen Pferde ergriffen gleich beim Zusammentreffen die Flucht,
wodurch sich der Sieg für Cyrus entschied.“
Auch die Bewohner Roms bekamen zur Kaiserzeit gelegentlich
morgenländische Kamele zu sehen; so erwähnt Suetonius in seiner[S. 218]
Biographie des Kaisers Nero: „Kaiser Nero gab Spiele aller Art und
zeigte bei denen im Zirkus auch Wagen, vor die vier Kamele gespannt
waren.“ Das war damals noch etwas Neues. Erst der extravagante, in
Syrien aufgewachsene Kaiser Heliogabalus (218–222 n. Chr.) ließ dieses
in Italien als Wunder angestaunte Tier in größerer Menge dahin bringen,
ja sogar als Rarität schlachten. Sein Biograph Älius Lampridius
berichtet: „Heliogabalus schaffte sich 600 Wagen mit Kamelen an und
sagte, das sei gar nicht viel; der König von Persien halte sich ja
zehntausend Kamele. Er ließ sich auch öfter ein Gericht zubereiten, das
aus Kamelfersen, aus von lebenden Hühnern abgeschnittenen Kämmen und
aus Zungen von Pfauen und Nachtigallen bestand, weil man sagte, solch
ein Gericht schütze vor Epilepsie. Überhaupt tischte er nicht selten
Kamelbraten auf.“
Aus dem irgendwo in Innerasien schon in vorgeschichtlicher Zeit aus dem
wilden Kamel gewonnenen Trampeltier ist durch einseitige Weiterzüchtung
das Dromedar gewonnen worden. Beide Kamelrassen gelangten bereits
scharf in ihren Sonderheiten ausgeprägt verhältnismäßig spät nach
Westasien, wo sie uns erst zu Beginn des letzten Jahrtausends v.
Chr. in Assyrien entgegentreten. So finden wir auf dem berühmten
schwarzen Obelisken von Nimrud im Britischen Museum in London, wie
dem assyrischen Könige Salmanassar II. (860 bis 825 v. Chr.),
der den größten Teil Syriens eroberte und in Kalach einen prächtigen
Palast erbaute, ein recht naturgetreu dargestelltes zweihöckeriges
Kamel als Tribut gebracht wird. Dann ist uns in Kujundschik, wie auch
in Nimrud die Darstellung je eines beladenen einhöckerigen Kameles
erhalten geblieben. In Niniveh fand Place ein Basrelief aus dem 7.
vorchristlichen Jahrhundert, auf dem ein assyrischer Bogenschütze auf
einem Dromedar reitend dargestellt ist.
In den jüngeren Epochen der jüdischen Geschichte wird uns mehrfach
von südarabischen Karawanenzügen berichtet, die aus Tragkamelen
bestanden. Es war dies zu einer Zeit, da die Juden selbst noch keine
solchen besaßen, sondern sich ausschließlich der Esel zum Lastentragen
bedienten. Nach Ägypten kam das Kamel von Syrien aus erst im 4.
Jahrhundert v. Chr., wie Adolf Erman feststellte. Erst von jener
Zeit an lassen sich Terrakotten mit Kameldarstellungen und Urkunden
über Verkäufe dieser Tiere in Ägypten nachweisen. Plinius berichtet,
daß zu seiner Zeit, also um die Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr.,
eine Karawanenverbindung von Koptos am oberen Nil nach Berenike am
Roten Meer mit Kamelen bestand. Später schildert Philostratus einen[S. 219]
Touristenverkehr nach den Pyramiden mit Kamelen. Aber erst Ammianus
Marcellinus weiß 353 von räuberischen Wüstenbewohnern zu berichten, die
mit ihren Kamelen bis zu den Nilkatarakten hin schweiften.
Sehr langsam drang das Kamel im Altertum vom Niltal weiter westlich
über Nordafrika vor. Erst im sogenannten afrikanischen Krieg, den
Cäsar gegen die Pompejaner und den mit ihnen verbündeten König Juba
von Numidien führte, wird berichtet, daß nach der Niederlage von
Thapsus im Jahre 48 v. Chr. 24 Kamele mit dem Throne jenes Königs
erbeutet wurden. Während der friedlichen Kaiserzeit wird sich das Kamel
weiter über Nordafrika verbreitet haben. So wird auf den bildlichen
Darstellungen des heiligen Menas, eines Offiziers aus Ägypten, der
296 während der Diocletianischen Christenverfolgung den Märtyrertod
erlitt und Gegenstand eines speziellen Kultes in der Oase von Mariût
auf der Karawanenstraße zwischen Karthago und Alexandrien wurde, stets
das Kamel dargestellt. Erst kürzlich sind dessen Heiligtümer vom
Frankfurter Archäologen Karl Kaufmann ausgegraben worden. Jedenfalls
fand das germanische Volk der Vandalen, als es 439 unter Geiserich
von Spanien nach Afrika übersetzte, ziemliche Herden von Kamelen
bei den Nomadenstämmen um das Atlasgebirge. Eine neue Zuwanderung
nomadisierender Elemente fand mit den Arabern von Osten her statt,
die jedenfalls auch Kamele mitbrachten und der Zucht dieses Tieres in
Nordafrika besondere Aufmerksamkeit schenkten.
Ist das Kamel auch ein ausgesprochenes Wüstentier und jetzt das einzige
Transportmittel, das für die Wüste Sahara in Betracht kommt, so ist es
gleichwohl bei den Stämmen im Innern nicht häufig, sondern wird nur von
den Beduinen der Randsteppen in größeren Herden gehalten. Es gedeiht
nur in einem heißen, trockenen Klima und wird in den verschiedensten
Rassen gezüchtet, in großen, schweren Formen, die mehr zum Tragen
schwerer Lasten bis zu 400 kg geeignet sind, und in zierlichen,
schlanken, leichten Reitkamelen, den Meharis. Das Heimatszentrum der
letzteren ist Arabien, das heute noch die schnellsten Läufer liefert,
dasjenige der letzteren dagegen Ägypten.
Südlich vom Wüstengürtel der Sahara hat das Kamel keine größere
Verbreitung erlangt. Auch in Südeuropa gedeiht es nur an einigen
wenigen Orten, so in der auf einer Ebene bei Pisa gelegenen
Kamelstüterei von San Rossore, wo 1810 40, 1841 41 und später etwa 200
Kamele lebten. Von diesen stammt die Mehrzahl der auf[S. 220] den Jahrmärkten
bei uns gezeigten Tiere. Dort wurden sie 1622 von Ferdinand II.
von Toskana und ein zweites Mal 1738 eingeführt. Der Versuch, das Kamel
in Sizilien einzuführen und dort als Lasttier in den Schwefelbergwerken
zu gebrauchen, scheiterte an der Feuchtigkeit des Klimas. In Spanien
scheint es besser zu gedeihen.
Gleich nach der Eroberung Perus suchte man das Kamel auch hier
einzuführen. So sah Garcilasso um 1550 kleine Herden, die Juan de
Reinaga eingeführt hatte; sie hatten damals wenig oder keine Jungen.
1570 sah dann Acosta neu von den Kanaren eingeführte Tiere. Um 1750
versuchte man sie auf Jamaika einzuführen. Als man sie aber hatte,
wußte man nichts mit ihnen anzufangen. 1800 traf A. v. Humboldt Kamele
von den Kanaren in Venezuela. Um 1845 gab es Kamele in Bolivien. Doch
kamen sie hier überall herunter, weil ihnen der Feuchtigkeitsgehalt der
Luft zu groß war. Auch in Nordamerika konnten sie sich auf die Dauer
nicht halten. So führte im Jahre 1856 die Regierung der Vereinigten
Staaten 57 aus Smyrna bezogene Dromedare in Texas, Arizona und
Neumexiko ein, die während des nordamerikanischen Bürgerkriegs sämtlich
in die Hände der Konföderierten fielen. Von ihnen wurden sie zur
Beförderung der Post gebraucht und legten im Tag angeblich bis gegen
200 km zurück. Zu den beim Friedensschluß noch lebenden und von
der Regierung der Vereinigten Staaten wieder übernommenen Tieren wurden
1866 neu eingeführte gesellt, die mit den alten zu Züchtungszwecken
über Arizona und Texas verteilt wurden. Da jedoch viele starben und der
Versuch, das Dromedar in Nordamerika zu züchten, mißglückte, ließ man
die Überlebenden laufen, und es scheint, daß in den wilden Gegenden von
Kalifornien und Arizona noch heute welche leben; diese führen im Laufe
des Jahres weite Wanderungen aus. In Australien hat sich das Dromedar
besser eingebürgert und bei der Erforschung der inneraustralischen
Wüsten sehr große Dienste geleistet. Die erst vor drei Jahrzehnten aus
Afghanistan eingeführten Tiere werden gegenwärtig in Westaustralien
stark benutzt. Die deutsche Regierung führte sie beim letzten Aufstand
der Bastardhottentotten auch in ihrer südwestafrikanischen Kolonie ein,
wo sie sich bis heute gut erhielten und trefflich bewährten.
Außer in Arabien und Mesopotamien wird auch in Persien, Afghanistan,
Beludschistan und in den Somaliländern die Kamelzucht sehr stark
betrieben. Das Reitkamel vermag 16 Stunden lang zu traben und legt
dabei bequem eine Entfernung von 140 km zurück.[S. 221] Ordentlich
gefüttert und getränkt vermag es ohne Rasttag dazwischen 3–4 Tage
solche Anstrengung auszuhalten. Die Lastkamele aber durchmessen mit
einer bis 250 kg schweren Last in 12 Stunden bis 50 km.
Außer durch ihre Arbeit nützen die Kamele auch durch ihre dicke, fette
Milch, die bei den Beduinen besonders an Pferdefüllen verfüttert,
sonst auch vom Menschen genossen wird. Die jungen Tiere dienen als
Fleischlieferanten. Die ausgehende Wolle dient zur Herstellung von
Tuch und Stricken, aus den elfenbeinharten Knochen werden allerlei
Drechslerwaren angefertigt. In der Wüste ist ihr Dünger das einzige
dem Menschen zur Verfügung stehende Brennmaterial. Nach Denham und
Clapperton haben die Kamele der Tibbukuriere kleine Körbe unter
dem Schwanze. Mit dem darin angesammelten Dünger kochten dann die
Reiter abends ihren Kaffee. Der Schweiß der Kamele ist so salzig, daß
die Schafe und Ziegen ihn lecken. Ein junges oder schwaches Kamel
kostet manchmal nur 30 Mark, während ein gutes Lastkamel mit 90 und
ein Reitdromedar mit 200–300 Mark unseres Geldes bezahlt wird. Die
geschätztesten Tiere werden in der Nedjed genannten unwirtlichen
Hochebene Mittelarabiens gezüchtet und weithin exportiert.
Die südamerikanischen Schafkamele (Auchenia, d. h. Halstier),
welche gleichsam eine Miniaturausgabe der stattlichen altweltlichen
Kamele darstellen, sind in zwei Formen, dem Lama und
Alpaca, zu Haustieren gemacht worden. Und zwar gehören sie zu
den wenigen Arten, welche von den Indianern aus eigener Initiative
gezähmt wurden. Damit hat dann der Mensch Gebirgsregionen der Kultur
erschlossen, die ohne diese Gehilfen auf die Dauer nicht zu bewohnen
gewesen wären. Deshalb begreifen wir sehr wohl, daß sie in ihrer
Heimat eine Kultbedeutung erlangt hatten. Wie die ältesten spanischen
Chronisten berichten, verwendete man sie zu Totenopfern und aß ihr
Fleisch zur Versöhnung des betreffenden abgeschiedenen Geistes.
So findet man Köpfe und sonstige Knochenüberreste dieser Tiere in
vorspanischen Gräbern von Peru.
Noch heute leben zwei Arten von Schafkamelen in vollkommen wildem
Zustande, nämlich das Guanaco (Auchenia huanaco) und
das Vicuña (Auchenia vicuña). Beide bewohnen, wie
auch die aus ihnen gezähmten Nachkommen, das Lama und Alpaca, das
Hochgebirge der Anden vom Feuerland bis zum nördlichen Peru. Das
Guanaco ist namentlich im südlichen Teile des Gebirges häufig. Es lebt
gesellig in Rudeln, die gewöhnlich aus zahlreichen, von einem Männchen
angeführten Weibchen bestehen. Die Männchen erreichen die Größe eines
Edelhirsches, die Weibchen sind kleiner. Beide sind von einem ziemlich
langen, aber lockern Pelz von schmutzig rotbrauner, an Brust und Bauch
weißlicher Farbe bedeckt, das aus kürzerem, feinerem Wollhaar und
dünnerem, längerem Grannenhaar besteht. Der dünne lange Hals ist nach
vorn gekrümmt und trägt einen seitlich zusammengedrückten Kopf. Die
raschen und lebhaften Tiere klettern sehr gut und laufen gemsenartig
an den steilsten Gehängen und Abstürzen dahin, selbst da, wo der
geübteste Bergsteiger nicht Fuß fassen kann.[S. 223] Dabei hält der leitende
Hengst einige Schritt vom Rudel entfernt Wache, während seine Herde
unbekümmert weidet. Bei der geringsten Gefahr stößt er ein lautes,
wieherndes Blöken aus, worauf alle Tiere den Kopf erheben, scharf nach
allen Seiten ausschauen und sich dann rasch zur Flucht wenden.
Kleiner und zierlicher als das Guanaco, auch weniger weit verbreitet,
ist das Vicuña mit dem durch seine Feinheit berühmten ockerfarbigen
Vließ und den langen, weißen Schulterbüscheln. Es steigt weniger hoch
als jenes und weidet mit Vorliebe auf den Grasmatten der Anden. Da
es weiche Sohlen hat, zieht es sich, auch verfolgt, niemals auf die
steinigen Halden zurück. Im Februar wirft jedes Weibchen ein Junges,
das schon gleich nach der Geburt eine große Schnelligkeit und Ausdauer
entwickelt, also mit seiner Mutter leicht zu fliehen vermag. Als
Weibchen bleibt es, auch erwachsen, bei der Herde; als Männchen jedoch
wird es durch Beißen und Schlagen fortgetrieben und vereinigt sich dann
mit seinesgleichen zu einem besonderen Rudel.
Jung eingefangen lassen sich Guanaco und Vicuña leicht zähmen und
schließen sich bald zutraulich an ihren Pfleger. Mit zunehmendem
Alter aber werden sie tückisch und speien dann den Menschen bei jeder
Gelegenheit an, was gerade keine angenehme Gewohnheit ist. Zudem
gebärden sie sich unbändig und sind nicht zur Paarung zu bringen.
Gleichwohl sind die Guanacos schon in vorgeschichtlicher Zeit von den
Indianern auf den Anden Perus gezähmt und in den Dienst des Menschen
gestellt worden. Da nun die kurze und straffe Wolle des wilden Guanaco
minderwertig ist, stellte man ihm viel weniger nach als dem äußerst
feinwolligen Vicuña, das von den Europäern planlos abgeschossen
wurde, so daß es stark dezimiert erscheint und seine Wolle kaum mehr
zu haben ist. Man stellte einst daraus wertvolle Decken her, die,
weil ungefärbt, niemals bleichten. Aus der französischen Bezeichnung
des Tieres bildete sich die auch im Deutschen übliche Benennung
vigogne für solche Gewebe. Die sehr teure echte Vigognewolle
dient jetzt bei uns hauptsächlich dazu, der Oberfläche unserer feinen
Filzhüte ihren seidigen Glanz zu verleihen.
Den Gegensatz zu diesen Wildformen bilden das Lama und das Alpaca, die
nur in zahmem Zustande bekannt sind. Ersteres ist durch Domestikation
aus dem Guanaco hervorgegangen, letzteres dagegen ist wahrscheinlich
ein Kreuzungsprodukt beider Arten, das besonders zur Erlangung einer
feinen Wolle gezüchtet wurde. Wahrscheinlich hat es[S. 224] aber weit mehr
Lama- als Vicuñablut, so daß es manche Autoren als eine zu speziellen
Zwecken verändertes Lama betrachten. Ganz sicher läßt sich indessen
die Abstammung nicht bestimmen, da beide Formen sich beim Eindringen
der Spanier in Südamerika als fertige Züchtungsprodukte vorfanden.
1541 gab Pedro de Cieza, dann wiederum 1615 Antonio de Herrera eine
gute Beschreibung der beiden zahmen Schafkamele mit ihren besonderen
Eigenarten.
Bei den alten Peruanern spielten Lama und Alpaca im Leben eine wichtige
Rolle. Die Zähmung beider Haustierarten wurde von ihnen in das früheste
Zeitalter menschlichen Daseins verlegt, als noch Halbgötter auf Erden
lebten. Und zwar geschah sie zunächst auch nicht aus praktischen
Gründen, sondern aus Gründen des Kultes, um nicht etwa in Notfällen in
Verlegenheit wegen Opfertieren zu kommen.
Überall im Lande trafen die Spanier große Herden dieser Tiere an, die
die wichtigsten Nutztiere der Peruaner bildeten, indem sie dieselben
nicht nur zum Transport über die hohen Pässe der Anden benutzten,
sondern auch Fleisch, Fell und Haare derselben verwendeten.
Das Lama, eigentlich Llama (Auchenia lama), wird heute
noch wie einst vorzugsweise in Peru gefunden und gedeiht am besten
in der verdünnten Luft der Hochebenen. Es wird etwas größer als das
Guanaco, aus dem es hervorging, und zeichnet sich durch Schwielen
an der Brust und an der Vorderseite der Handwurzelgelenke aus. Als
altes Haustier tritt es in den verschiedensten Farbenvarietäten auf:
weiß, gescheckt, fuchsrot und dunkelbraun bis schwarz. Auch schwankt
die Wolle bei den verschiedenen Abarten in bezug auf Länge, Dichte
und Feinheit. Am kürzesten behaart sind die Arbeitstiere, von denen
nur die Männchen zum Tragen von Lasten verwendet werden, während die
Weibchen außer zur Zucht zur Fleisch- und etwa noch zur Milchgewinnung
benutzt werden. Mit einer Warenlast von 50 kg und darüber
beladen marschiert, von einem Treiber geleitet, ein Tier hinter dem
andern sichern Schrittes an den steilsten Abhängen vorbei über die
höchsten Pässe der Kordilleren. Stevensohn schreibt: „Nichts sieht
schöner aus als ein Zug dieser Tiere, wenn sie mit ihrer etwa einen
Zentner schweren Ladung auf dem Rücken, eins hinter dem andern in der
größten Ordnung einherschreiten, angeführt von dem Leittiere, welches
mit einem geschmackvoll verzierten Halfter, einem Glöckchen und einer
Fahne auf dem Kopfe geschmückt ist. So ziehen sie die schneebedeckten
Gipfel der Kordilleren oder den Seiten der Gebirge entlang, auf Wegen,
auf denen selbst Pferde oder Maultiere[S. 225] schwerlich fortkommen
möchten; dabei sind sie so gehorsam, daß ihre Treiber weder Peitsche
noch Stachel bedürfen, um sie zu lenken und vorwärts zu treiben. Ruhig
und ohne anzuhalten schreiten sie ihrem Ziele zu.“ Ihr Mist wird von
den Indianern gesammelt und überall als das fast ausschließliche
Brennmaterial auf den Markt gebracht. Das Einsammeln desselben wird
dadurch erleichtert, daß die Lamas, wie auch ihre Verwandten, die
Gewohnheit haben, für die Ablagerung ihrer Exkremente gemeinsame Plätze
aufzusuchen. Zum Reiten wurde das Lama niemals verwendet, da es dazu
zu schwach ist. Seine grobe Wolle spielt als Gespinnstmaterial keine
bedeutende Rolle. Dazu wird vielmehr das lange, feine Vließ der zweiten
domestizierten Form, des Alpacas, verwendet.
Tafel 45.
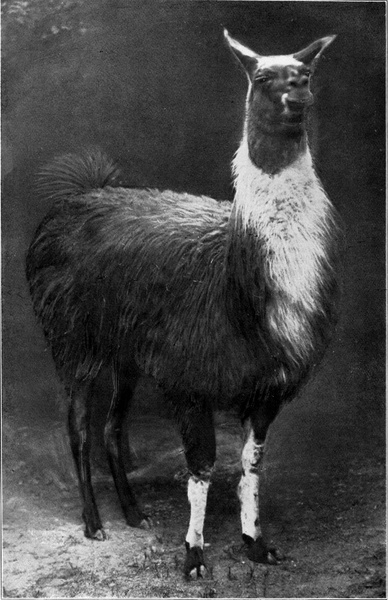
Lama im Tierpark Hellabrunn zu München.
(Nach einer Photographie von M. Obergaßner.)
⇒
GRÖSSERES BILD
Tafel 46.

(Copyright
Underwood & Underwood in London.)
Norwegische Renntierherde in Hardanger, mißtrauisch die Ankunft von
Fremden abwartend.
⇒
GRÖSSERES BILD
Das Alpaca oder Paco (Auchenia pacos) ist kleiner
und gedrungener als das Lama und gleicht äußerlich einem Schafe, hat
aber einen längeren Hals und einen zierlicheren Kopf. Sein langes
und ausnehmend weiches Vließ erreicht an den Seiten des Rumpfes eine
Länge von 10–12 cm. Die Färbung ist meistens ganz schwarz
oder ganz weiß; es gibt aber von ihm wie vom Lama buntscheckige
Individuen. Die Alpacazucht wird besonders auf den Hochebenen des
südlichen Peru und nördlichen Bolivia stark betrieben, geht aber nicht
so weit hinunter wie die Zucht des Lamas. Hier leben diese Tiere in
halbzahmem Zustande in großen Herden in 4000–5000 m Höhe das
ganze Jahr über im Freien. Zur Gewinnung ihrer sehr geschätzten Wolle
werden sie gewöhnlich nur alle zwei Jahre geschoren. Dazu treibt man
sie in der warmen Jahreszeit in die Hütten, wobei sie sich allerdings
sehr störrisch benehmen. Wird ein Tier von der Herde getrennt, so
wirft es sich auf die Erde und ist weder durch Schmeichelei, noch
durch Schläge zu bewegen, wieder aufzustehen. Einzelne können nur
dadurch fortgeschafft werden, daß man sie den Herden von Lamas und
Schafen beigesellt. Aus ihrer Wolle werden seit uralter Zeit Decken,
Mäntel und Kleiderstoffe verfertigt. Sehr schön gemusterte Proben
der altperuanischen Textilkunst besitzt namentlich das Berliner
Völkermuseum. Doch züchtet man das Alpaca außer der Wolle wegen auch
zur Gewinnung des höchst schmackhaften Fleisches. Zum Lasttragen wird
es nicht verwendet, wozu es auch etwas zu schwach wäre.
Wiederholt hat man versucht, Lamas und Alpacas auch außerhalb ihrer
hochgelegenen Heimat zu akklimatisieren; doch schlugen bis jetzt alle
diesbezüglichen Versuche fehl. So werden sie nur etwa in zoologischen
Gärten gehalten. Das erste Lama, das man in Europa zu[S. 226] sehen bekam, war
noch vor der Eroberung Perus durch Pizarro, als er bei Karl V.
um Hilfe bat, gezeigt worden. Im Jahre 1643 sollte Admiral Brouwer
bei seiner mißglückten Expedition gegen Chile das Vicuña im damals
holländischen Nordbrasilien einführen. 1799 hatte man weiße Vicuñas
nach Buenos Aires gebracht; 1808 sah Bory de St. Vincent einen kleinen
Lamabestand in Cadiz. Das waren wohl die Tiere, die Karl IV.
hatte kommen lassen. Dann schenkte auch Kaiserin Josephine welche;
aber alle diese Ansiedelungsversuche verliefen völlig erfolglos.
In Australien hat man, nachdem 1852 der erste Versuch verunglückt
war, 1856 256 Tiere meist gemischten Blutes angesiedelt, aber trotz
der ausgesetzten Prämie von 250000 Franken kein Glück damit gehabt;
ebensowenig in Kuba trotz anfänglichen Gelingens. Teilweise ist eine
als Caracha bezeichnete ansteckende Krankheit daran schuld, die
besonders die Alpacas ergreift und an ihnen eiternde Wunden an den
Vorderbeinen und den Geschlechtsteilen hervorruft, woran sie häufig
eingehen.
Alpaca und Lama können leicht miteinander gekreuzt werden. Die
Mischlinge, die unter dem Namen Guarizos oder Machorras bekannt sind,
bieten aber durchaus keine Vorteile vor jenen. Als Lasttiere lassen sie
sich ebensowenig gebrauchen als die Alpacas; auch erben sie die feine
Wolle der letzteren nicht. Übrigens findet das Lama in Peru seit der
Einführung des Maultiers und des Pferdes viel weniger Verwendung als
Lasttier im Vergleich zu früher, da es noch ausschließlich als solches
verwendet wurde. Zur Zeit der spanischen Eroberung gab es namentlich
im südlichen Peru ungeheure Herden davon. Damals wurden nicht selten
Züge von 500 oder selbst 1000 Stück angetroffen, alle mit Silberbarren
beladen und unter Obhut weniger Männer ihres Weges ziehend. Für die
Wegschaffung der Minenerzeugnisse von Potosi sollen zu jener Zeit
allein über 300000 Lamas gebraucht worden sein. Der Spanier Acosta
berichtet darüber: „Ich habe mich oft gewundert, diese Schafherden mit
2000–3000 Silberbarren, welche über 300000 Dukaten wert sind, beladen
zu sehen, ohne eine andere Begleitung als einige Indianer, welche die
Schafe leiten, beladen und abladen, und dabei höchstens noch einige
Spanier. Sie schlafen alle Nächte mitten im Felde, und dennoch hat
man auf diesem langen Wege noch nie etwas verloren; so groß ist die
Sicherheit in Peru. An Ruheplätzen, wo es Quellen und Weiden gibt,
laden die Führer sie ab, schlagen Zelte auf, kochen und fühlen sich,
ungeachtet der langen Reise, wohl. Erfordert diese nur einen Tag, so
tragen jene[S. 227] Schafe 8 Arrobas (92 kg) und gehen damit 8–10
Leguas (29 bis 36 km); das müssen jedoch bloß diejenigen tun,
welche den armen, durch Peru wandernden Soldaten gehören. Alle diese
Tiere lieben die kalte Luft und finden sich wohl im Gebirge, sterben
aber in Ebenen wegen der Hitze. Bisweilen sind sie ganz mit Eis und
Reif bedeckt und bleiben doch gesund. Die kurzhaarigen geben oft
Veranlassung zum Lachen. Manchmal halten sie plötzlich auf dem Wege an,
richten den Hals in die Höhe, sehen die Leute sehr aufmerksam an und
bleiben lange Zeit unbeweglich, ohne Furcht oder Unzufriedenheit zu
zeigen. Ein anderes Mal werden sie plötzlich scheu und rennen mit ihrer
Ladung auf die höchsten Felsen, so daß man sie herunterschießen muß, um
die Silberbarren nicht zu verlieren.“ Meyer schlägt die Wichtigkeit des
Lamas für die Peruaner ebenso hoch an wie die des Renntieres, von dem
alsbald die Rede sein wird, für die Lappländer.
Neuerdings beabsichtigt die preußische Regierung, das überaus genügsame
Tier, dessen Fleisch einen sehr zarten Geschmack besitzt, in den
sonstwie wenig brauchbaren Ländereien, so zunächst auf der Lüneburger
Heide, einzuführen. Ob ihr die Akklimatisation gelingen wird, ist
allerdings höchst fraglich, da diese Tiere im Tiefland nicht gedeihen.
[S. 228]
X. Das Renntier.
Im Renntier (Rangifer tarandus), einem der jüngst
erworbenen Haussäugetiere, das nur sehr oberflächlich gezähmt ist und
sich noch weitgehender Freiheit und Selbständigkeit erfreut, haben
wir den einzigen Vertreter der Familie der Hirsche vor uns, den der
Mensch in seine Abhängigkeit brachte. Den Übergang von den eigentlichen
Hirschen zum Renntier bildet der in den menschenleeren Einöden
Nordchinas lebende Milu der Chinesen oder Davidshirsch
(Elaphurus davidianus) der Europäer, so genannt, weil ihn 1865
der französische Missionar David durch einen Blick über die Mauer
des kaiserlichen Wildparks bei Peking entdeckte. Dort wird dieses
äußerst scheue und seltene Tier zum Vergnügen des Kaisers von China
und seines Hofes in Gehegen gehalten. Durch die Vermittlung des
damaligen deutschen Gesandten in Peking, v. Brandt, kamen von dort zwei
Hirsche und ein Tier als außerordentliche Seltenheit in den Berliner
Zoologischen Garten und von da auch in denjenigen von Köln. In seinem
ganzen Bau, besonders der Füße, aber auch des Gehörns, erinnert der
Milu viel mehr an das Renntier als an den Hirsch und läßt wie dieser
bei jedem Schritt ein eigentümliches Knistern in den Fußgelenken hören,
was sonst den Hirschen nicht zukommt.
Die geweihtragenden Wiederkäuer eigneten sich im allgemeinen deswegen
nicht zur Domestikation, weil sie ausgesprochene Waldbewohner sind
und sich deshalb zum dauernden Aufenthalt im offenen Lande nicht
recht verwenden lassen. Davon macht nur das Renntier eine Ausnahme;
denn schon im Wildzustande meidet es den Wald und bewohnt heute im
Norden jenen Gürtel, der sich zwischen der Waldzone und dem Eismeer
ausdehnt und den man als Tundra oder Moossteppe bezeichnet. Hier lebt
es vorzugsweise von der Renntierflechte. Damit es nun mit seinen Füßen
im moorigen Boden der Tundra nicht zu weit einsinke, besitzen die
niedrigen, kräftigen Beine[S. 229] breit ausladende Hufe und bis auf den Boden
hinabreichende Afterklauen. Auf dem dicken, wenig aufgerichteten Hals
sitzt der nach vorn nur wenig verschmälerte Kopf mit dem ausnahmsweise
in beiden Geschlechtern entwickelten, bei den Weibchen nur kleineren,
zackigen Geweih. Das dunkelbraune Sommerkleid ist weniger dicht und
lang als das grauweiße Winterkleid, das sehr warmhält und seinen Träger
vor der großen Kälte seiner Heimat schützt. Der Vorderhals trägt eine
bis zur Brust herabreichende Mähne.
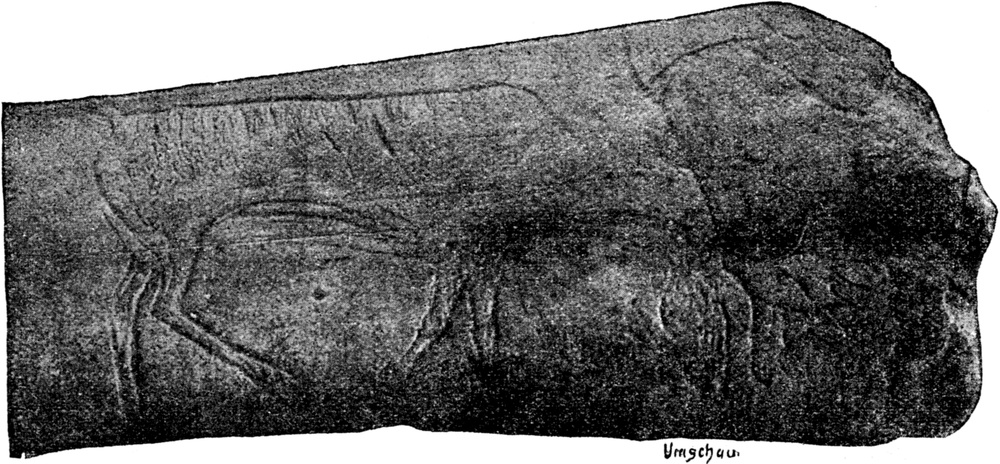
Bild 32. Darstellung eines weidenden Renntierweibchens
auf dem aus Renntierhorn verfertigten Bruchstück eines Kommandostabes aus dem
Keßlerloch bei Thaingen. (Nach Photogramm von Dr.
Nüesch.)
Das wilde Renn lebt durchschnittlich nördlich vom 60. bis zum 80.
Breitengrad der Alten wie auch der Neuen Welt. Die nordamerikanische
Form ist nur etwas größer und dunkler gefärbt und wird als
Karibu bezeichnet. Von ihm leben im Tundrengebiet Nordamerikas
und in Grönland stattliche Herden bis zu 200 Stück, denen die Indianer
stark nachstellen, die sie mit Pfeil oder Gewehr erlegen oder in
Hürden aus Buschwerk treiben, um sie nachher mit Speer und Keule
niederzuschlagen. Das altweltliche Renn, von dem man das größere
„Waldrenn“ vom kleineren „Tundrarenn“ unterscheidet, die beide
domestiziert wurden, lebt noch in großer Zahl wild auf Spitzbergen.
Auf Island wurde es im Jahre 1770 eingeführt, ist dort vollständig
verwildert und hat sich bereits in namhafter Zahl über alle Gebirge der
Insel verbreitet. Es liebt die Geselligkeit überaus und lebt in Herden
von 200–300 Stück, die gern wandern, so im Sommer, um der Mückenplage
zu entgehen, nach den höheren, kühler gelegenen Gebieten,[S. 230] im Winter
dagegen nach den weniger hoch mit Schnee bedeckten Niederungen. Es
wittert ausgezeichnet, ist scheu und vorsichtig, wo es unter den
Verfolgungen des Menschen zu leiden hat, kommt aber vertrauensvoll an
Kühe und Pferde heran, die in seinem Gebiete weiden, mischt sich auch
da, wo es Zahme seiner Art gibt, gern unter diese, obschon es recht
wohl weiß, daß es nicht mit seinesgleichen zu tun hat. Hieraus geht
hervor, daß die Furcht und Scheu vor dem Menschen die Folge der bösen
Erfahrung ist, die es mit ihm gemacht hat, daß es also kein dummes Tier
sein kann. Ende September ist die Brunst und Mitte April wird das Junge
geworfen und längere Zeit von seiner Mutter gesäugt.
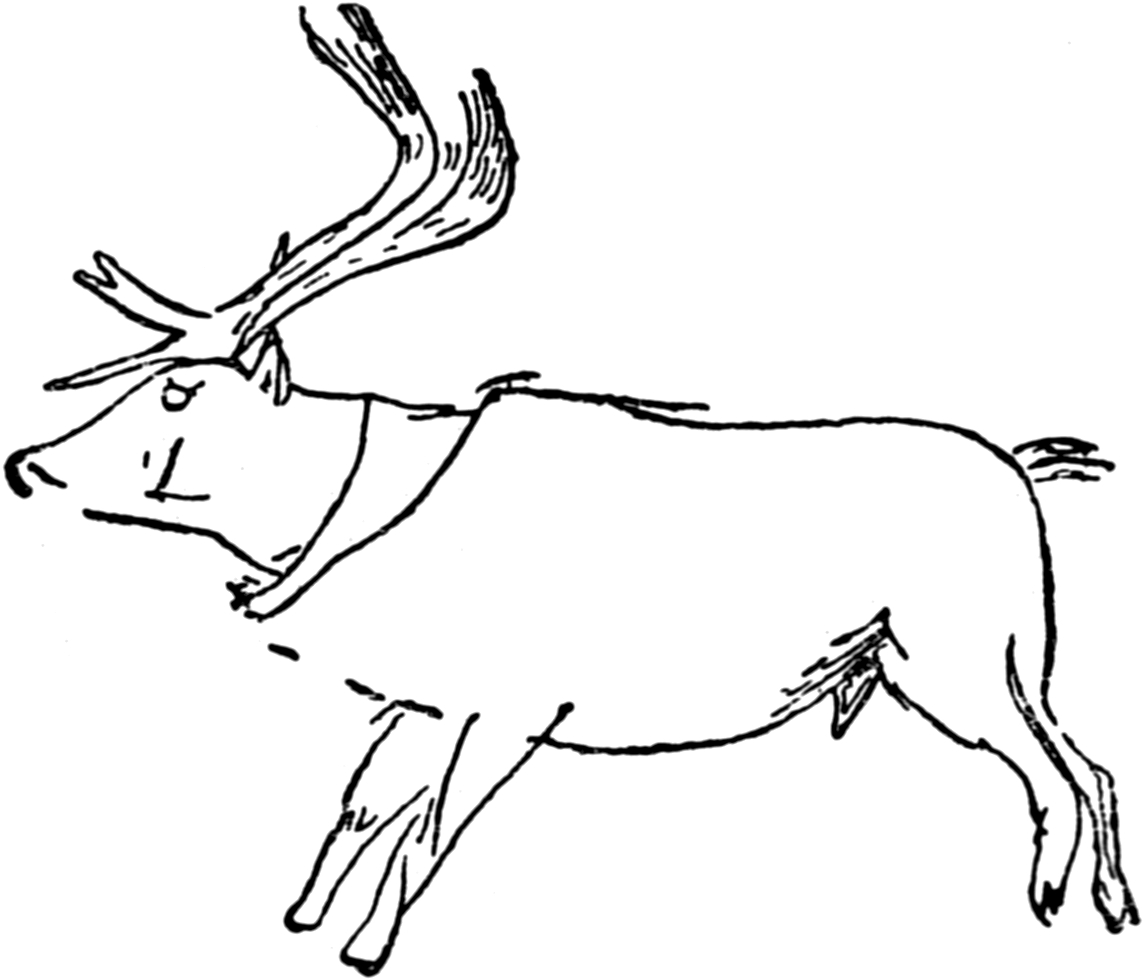
Bild 33. Darstellung eines Renntiermännchens aus der
Höhle von Combarelles, stark verkleinert.
(Nach Capitan und Breuil.)
Der europäische Diluvialjäger lebte vorzugsweise vom Renntier, das
damals während der Kälteperiode bis gegen das Mittelmeer hinunter in
großen Herden lebte und dem Menschen das weitaus wichtigste Beutetier
war. Um es leichter in seine Gewalt zu bringen, zeichnete er es unter
Murmeln von Zaubersprüchen, wie dies heute noch manche auf derselben
Kulturstufe lebende Jägerstämme tun, an die Wände der Höhlen, die er
bewohnte, und an allerlei Gegenstände seines Besitzes, wohl auch die
aus gegerbtem Renntierfell bestehenden Zeltwände auf Stangen. Dabei
galt der Glaube, daß, je naturgetreuer das Tier dargestellt werde, es
um so sicherer in des Menschen Gewalt gelange. Außer dem Fell, das
ihm seine Kleidung und Zeltumhüllung, wie auch Riemen und Schlingen
aller Art lieferte, wurden nicht nur das Fleisch und alle Eingeweide
vom hungrigen Renntierjäger verzehrt, sondern auch das Geweih und die
Knochen des Tieres als bald noch wichtigeres Werkzeugmaterial als
der Feuerstein benutzt. So war die ganze Kultur der Magdalénienjäger
der frühen Nacheiszeit ganz wesentlich auf die Erbeutung des damals
ausschließlich wildlebenden und durchaus noch nicht vom Menschen
in Herden vereinigten Renntiers gegründet, wie solches heute noch
von den auf der reinen Jägerstufe verbliebenen Indianern Kanadas
und noch höherer Breiten geübt wird. Auch diese leben, wie King
berichtet, fast ausschließlich[S. 231] vom Renn. Sie erlegen das Wild auf
seinen Wanderungen mit der Feuerwaffe, fangen es in Schlingen, töten
es beim Durchschwimmen der Flüsse mit Wurfspeeren, graben tiefe, mit
dünnem Astwerk und Laub verdeckte Fallgruben oder errichten an den
Furten, die sie durchschreiten müssen, zwei aufeinander zulaufende
Zäune aus Stecken, die da und dort schmale Lücken lassen. In eine jede
solche Lücke legen sie eine Schlinge. Wenn das Rudel zwischen die
Zäune getrieben wird, fangen sich einzelne Individuen, die seitlich
durchbrechen wollen, darin und werden abgestochen. Das Fleisch essen
sie roh und braten und räuchern den nicht sofort zu bewältigenden
Rest am Feuer. Aus den Geweihen und Knochen verfertigen sie ihre
verschiedenen Knochenwerkzeuge, vor allem die Fischspeere und Angeln.
Mit den gespaltenen Schienbeinen und anderen Teilen schaben sie,
wie das Fleisch von den Knochen, so Fett und Haar von den Häuten
ab, und mit Renntiergehirn reiben sie das Innere der Felle ein, um
sie geschmeidig zu machen. Das durch Räuchern mit feuchtem Holze
konservierte Leder alter Tiere hängen sie um ihre Zeltstangen, während
sie aus dem pelzartig weichen Fell jüngerer Tiere ihre Kleidung
herstellen, die sie mit Nadeln aus Renntierhorn vermittelst Sehnenfäden
vom Renntier nähen. Vom Kopf bis zu den Füßen sind sie in Renntierpelze
gehüllt, werfen ein weichgegerbtes Renntierfell auf den Schnee, decken
sich mit einem andern solchen zu und sind so imstande, der grimmigsten
Kälte Trotz zu bieten. Kein Teil des Renntiers bleibt von ihnen
unbenutzt, nicht einmal der aus aufgeweichten und halb aufgelösten
Renntierflechten bestehende Mageninhalt, der mit Blut vermischt ein
ihnen höchst schmackhaft vorkommendes Gericht liefert, von dem sie nur
ihren besten Freunden anbieten.
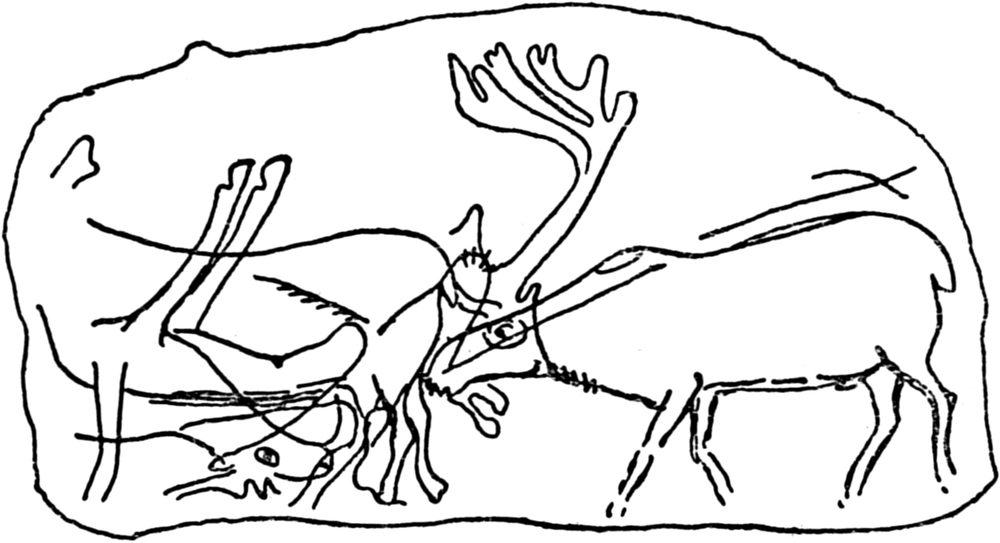
Bild 34. Von Magdalénienjägern auf ein Knochenstück
eingeritzte Renntiere, worunter ein Männchen ein Weibchen beschnüffelnd, aus dem
abri von La Madeleine in der Dordogne.
(Etwa natürl. Größe.)
Das wilde Renntier hat aber auch noch andere Feinde als den Menschen.
Der gefährlichste von ihnen ist der Wolf, der stets, besonders im
Winter, die Rudel umlagert. In Norwegen mußten die Renntierzuchten,
welche man auf den südlichen Gebirgen anlegen wollte, der[S. 232] Wölfe wegen
aufgegeben werden. Auch Vielfraß, Luchs und Bär stellen den Renntieren
nach. Sonst setzen ihm hauptsächlich die Mückenschwärme stark zu und
peinigen es im Sommer auf höchst unangenehme Weise.
Jung eingefangene Renntiere werden bald zahm. „Man würde sich aber“,
sagt Brehm, „einen falschen Begriff machen, wenn man die Renntiere,
was die Zähmung anlangt, den in den Hausstand übergegangenen Tieren
gleichstellen wollte. Nicht einmal die Nachkommen derjenigen, welche
seit undenklichen Zeiten in der Gefangenschaft leben, sind so zahm wie
unsere Haustiere, sondern befinden sich immer noch in einem Zustande
von Halbwildheit. Nur Lappen und deren Hunde sind imstande, solche
Herden zu leiten und zu beherrschen.“

Bild 35. Aus Renntierhorn geschnitzter Dolch eines
Magdalénienjägers, dessen Griff ein Renntier darstellt, das, um die Hand beim
Fassen der Waffe nicht zu behindern, die Schnauze erhebt und sein Gehörn in den
Rücken drückt. Aus dem gleichen Grunde sind seine Vorderfüße unter den Bauch
gebogen, als ob es davonspringen wolle. Aus dem südfranzösischen
abri von Laugerie basse in der Dordogne.
(1⁄3 natürl. Größe.)
Das Renntier ist sehr spät vom Menschen zum Haustier erhoben worden
und ist im ganzen jetzt noch recht mangelhaft domestiziert. Wann dies
geschah, läßt sich nicht mehr bestimmen; doch kann dies vor nicht viel
mehr als 500 Jahren geschehen sein. Nach Frijs in Christiania waren
die Lappen im Norden Skandinaviens im 9. Jahrhundert noch Fischer und
Jäger, die außer dem Hund noch keinerlei Nutztiere besaßen und das
Renn nur als Wild kannten. Erst im 16. Jahrhundert gibt uns Olaus
Magnus Kenntnis von zahmen Renntieren, die in ihrem Besitze waren.
Julius Lippert hält es für wahrscheinlich, daß die Renntierzucht von
Skandinavien ausging, während sie Eduard Hahn in ihrem Ursprung nach
Nordasien verlegt und der Meinung ist, sie habe sich später von dort
nach Westen ausgedehnt. Uns scheint diese letztere Annahme die allein
richtige, da dort sicher die Renntierzucht eine ältere ist als in
Nordeuropa.
Für die am Nordrande der Alten Welt lebenden Fischervölker, für deren
Lebensweise der Hund zwar wichtig, aber nicht ausreichend[S. 233] war,
wurde der Erwerb des Renns als Haustier von unschätzbarem Werte.
Es war das einzige Wildmaterial, das ihnen für die Gewinnung eines
nützlichen Haustiers zu Gebote stand, und so wurde es herdenweise
in Pflege und Aufsicht genommen und trat dadurch in lose Verbindung
mit dem Menschen, den es bis dahin als seinen ärgsten Feind geflohen
hatte. Die Unterordnung unter das menschliche Joch ist aber heute
noch eine sehr bedingte. Wohl werden die Herden durch wachsame Hunde
zusammengehalten, indessen wenden sie sich doch dahin, wo es ihnen
gerade paßt und die Weide günstig ist. Der Besitzer kann seine Tiere
nicht beeinflussen und nach seinem Willen lenken, sondern er muß ihnen
einfach folgen, wohin sie ihn führen. Günstig für ihn ist es, daß die
Renntiere ein ausgeprägtes Herdenbewußtsein haben und stets geschlossen
gehen, so daß sie sich nicht zerstreuen, was ihm das Hüten wesentlich
erleichtert. Das Melkgeschäft ist durchaus keine Annehmlichkeit, da
die störrischen Tiere beständig durchgehen wollen und nur mit einem
Strick zum Ausharren bei diesem Geschäfte festgehalten werden können.
Die Renntiermilch ist, wenn sie auch neben dem süßen einen starken
Beigeschmack hat, sehr fettreich und nahrhaft; doch ist der Milchertrag
gering.

Bild 36 und 37. Dolchgriff aus Renntierhorn, einen
Renntierkopf, und ein ebensolcher aus Mammutelfenbein, ein nur scheinbar
liegendes Renntier darstellend, beide aus der Höhle von Bruniquel in
Westfrankreich, jetzt im Britischen Museum in London. (1⁄3 natürl. Größe.)
Die von den Nomaden des Nordens zusammengehaltenen Renntierherden
halten sich jahraus jahrein im Freien auf, da selbstverständlich
Unterkunftsräume für so ausgedehnte Herden fehlen. Bei starkem
Schneefall geraten sie allerdings in Not und gehen vielfach an
Nahrungsmangel und Entkräftung zugrunde, so außerordentlich genügsam
sie auch an sich sein mögen, indem sie sich von selbst aus dem Schnee
hervorgescharrten Renntierflechten ernähren und als Flüssigkeitszufuhr
den Schnee im Munde zergehen lassen.
Außer den Lappen geben sich auch die Finnen und zahlreiche sibirische
Volksstämme mit der Zucht des Renntiers ab, das das Ein und alles,
der Inbegriff von Glück und Reichtum dieser Menschen bildet. Mit
Mitleid schaut der Fjeldlappe, der eigentliche Renntier[S. 234]züchter, auf
seine Volksgenossen herab, die das Nomadenleben aufgegeben und sich
entweder als Fischer an Gewässern niedergelassen oder gar als Diener
an Skandinavier verdingt haben. Er allein dünkt sich diesem gegenüber
ein freier Mann zu sein; er kennt nichts Höheres als sein „Meer“, wie
er eine größere Renntierherde zu nennen pflegt. Immerhin gehört eine
beträchtliche Zahl von Renntieren dazu, um den Lappen und seine Familie
zu ernähren. Erst etwa 200 sollen ausreichen, um ihn selbständig zu
machen. Wer weniger sein eigen nennt, pflegt sich an einen reicheren
Besitzer anzuschließen und dafür in ein Dienstverhältnis zu ihm zu
treten. Eine Herde von etwa 500 Renntieren bedeutet Wohlhabenheit,
die viele Lappen erreicht haben. Nur wenige bringen es zu einem in
ihren Augen fabelhaften Reichtum von 2000–3000 Stück. Man berechnet
die Gesamtzahl der den Lappen Norwegens gehörenden Renntiere auf rund
80000, in die sich 1200 Besitzer teilen sollen. Die Renntierlappen
leben ganz nomadisch, indem sie sich gewöhnten, ihren Herdentieren zu
folgen. Im Sommer ziehen sie mit ihnen hinauf zu den großen baumlosen
Fjeldern (Hochflächen), wo diese am leichtesten ihre Nahrung finden
und der sehr lästigen Mückenplage entweichen können. Im Winter dagegen
wandern sie mit ihnen in die waldreicheren Regionen hinab, die weniger
den rauhen Stürmen ausgesetzt sind. Dank ihrer breitausladenden Hufe
können die Renntiere ebensogut über die sumpfigen Stellen wie über die
Schneedecke hinweggehen und sogar an den Halden herumklettern. Ihre
Fährten erinnern weit mehr an die einer Kuh als eines Hirsches.
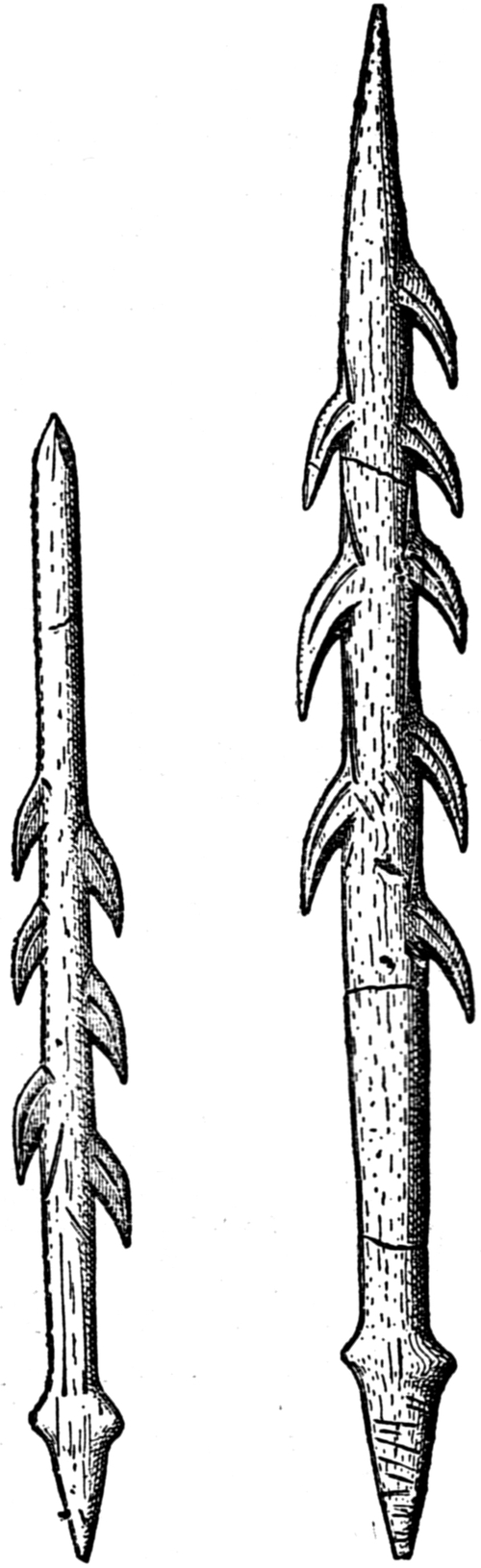
Bild 38 und 39. Zwei Harpunen des Magdalénienjägers aus
Renntierhorn mit Giftrinnen aus Südfrankreich. (4⁄9 natürl. Größe.)
Eine Renntierherde bietet ein höchst eigentümliches Schauspiel. Die
Renntiere gehen geschlossen wie die Schafe, aber mit behenden,[S. 235]
federnden Schritten und so rasch, wie sonst keins unserer Haustiere.
Ihnen nach wandelt der Besitzer mit seinen Hunden, die eifrig bestrebt
sind, die Herde zusammenzuhalten. Durch ihr Hin- und Herlaufen und
durch ihr ewiges Blöken erinnern die Renntiere an Schafe, obgleich ihr
Lautgeben mehr ein Grunzen genannt werden muß. Bei weitem die meisten,
die in Herden gehalten werden, sind sehr klein und man sieht unter
Hunderten nur sehr wenig starkgebaute, große Tiere. Dabei fällt die
Unregelmäßigkeit ihrer Geweihe unangenehm auf.
Mancherlei Seuchen richten oft arge Verheerungen unter den Renntieren
an. Außerdem trägt das rauhe Klima das seinige dazu bei, daß sich
die Herden nicht so vermehren, wie es, der Fruchtbarkeit des Renns
angemessen, der Fall sein könnte. Junge und zarte Kälber erliegen
der Kälte oder leiden unter den heftigen Schneestürmen, so daß sie,
vollkommen ermattet, der Herde nicht mehr folgen können und zugrunde
gehen. Ältere Tiere können bei besonders tiefem Schnee nicht mehr
hinreichende Nahrung finden. So können schneereiche Winter zuvor für
reich geltende Lappen geradezu arm machen, so daß sie sich erst in
vielen Jahren von ihrem Schaden erholen können.
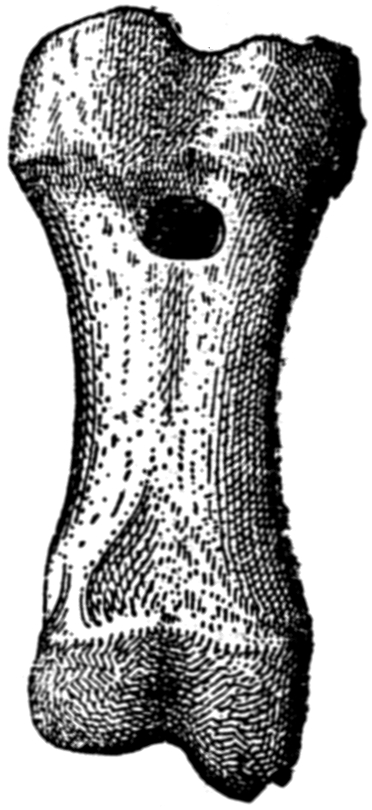
Bild 40. Pfeife der Magdalénienjäger
aus der Höhle von Bruniquel in Westfrankreich, nördlich der Dordogne. (2⁄3 nat.
Größe.) An der dünnsten Stelle einer Renntierphalange ist mit einem
Steinmesserchen ein Loch gebohrt worden, welches beim Anblasen einen scharfen,
hohen Ton hören läßt.
Alles am Renntier wird von diesen Leuten benutzt, nicht bloß die Milch
und der daraus bereitete wohlschmeckende Käse, das Fleisch und das
Blut, sondern auch jeder einzelne Teil des Leibes. Aus dem weichen
Fell besonders der Renntierkälber verfertigt man warme Pelzröcke und
Pelzstiefel; die Sehnen benutzt man zu Zwirn, die Gedärme zu Stricken.
Wie zur Renntierzeit werden auch heute noch aus Horn und Knochen
allerlei Gerätschaften, besonders Fischhaken und Angeln hergestellt.
Außerdem wird das Tier zum Tragen der Gerätschaften, besonders der
Zeltbestandteile und Effekten seines Besitzers verwendet. In Lappland
benutzt man das Renn hauptsächlich zum Fahren, weniger zum Lasttragen,
weil ihm letzteres, des schwachen Kreuzes wegen, sehr beschwerlich
fällt. Nur die Tungusen reiten auch auf den stärksten Rennhirschen,
indem sie einen kleinen Sattel ge[S. 236]rade über die Schulterblätter
legen und sich mit abstehenden Beinen daraufsetzen. Auf diese Weise
reiten sie selbst über Moorgebiete, in die Pferde und Menschen tief
einsinken müßten, mit erstaunlicher Sicherheit hinweg. Der Korjäke
dagegen fährt im Renntierschlitten und Wettfahrten gehören zu seinem
Hauptvergnügen. Weder zum Fahren, noch zum Reiten werden die Tiere
besonders abgerichtet, sondern man nimmt dazu ohne viel Umstände ein
beliebiges, starkes Tier aus der Herde und schirrt es zum Ziehen des
bootartigen Schlittens oder zur Aufnahme des kunstlosen Sattels an. Ein
gutes Renntier legt mit dem Schlitten in einer Stunde etwa 10 km
zurück und zieht 120–140 kg, wird aber gewöhnlich viel geringer
belastet. Schont man solche Zugtiere, indem man sie nur morgens und
abends einige Stunden ziehen, mittags und nachts aber weiden läßt,
so kann man erstaunlich große Strecken zurücklegen, ohne sie zu
übermüden. Doch ist auf die Dauer der Zughund leistungsfähiger als sie;
deshalb haben die Kamtschadalen im Gegensatz zu ihren Nachbarn, den
Korjäken, ihre Hunde zum Ziehen der Schlitten nicht mit dem Renntier
vertauscht. Auch die Giljaken im Mündungsgebiet des Amur sind vom
Renntiergespann wieder zum Hundeschlitten, als dem leistungsfähigeren
Fortbewegungsmittel, zurückgekehrt. Allerdings muß man den Hunden für
Nahrung sorgen, während das Renntier sich sein Futter selbst sucht.
Außer im Norden von Skandinavien ist das Renntier in Finnland stark
verbreitet. In Rußland ist das Gouvernement Archangelsk am reichsten
daran; auch die Gouvernemente Perm und Orenburg besitzen noch starke
Bestände davon. Durch ganz Sibirien haben die Nomadenstämme der
Samojeden, Ostjaken, Tungusen, Tschuktschen und wie sie sonst heißen
mögen, große Herden von Renntieren, von denen sie neben der Jagd
auf die wilden Renntiere leben. Als Proviant wird Renntierfleisch
getrocknet; solchergestalt läßt es sich lange Zeit aufbewahren ohne zu
faulen. In neuester Zeit hat man versucht, von Sibirien aus Renntiere
in Alaska einzubürgern, um die soziale Lage der dortigen Einwohner zu
heben. Ob dieser Versuch tatsächlich geglückt ist, steht dahin; doch
wird dies wohl der Fall sein, da dieses Tier keine Schwierigkeiten bei
der Haltung macht.
Da das Renntier erst so kurze Zeit im Haustierstande ist, hat es
sich noch nicht in verschiedene Rassen spalten können. Immerhin sind
bei der zahmen Art, abgesehen von der geringeren Größe, der größeren
Häßlichkeit und der unregelmäßigen Bildung des Geweihs,[S. 237] das auch
später abgeworfen wird, bereits kleine Farbenunterschiede bemerkbar.
Bei vielen ist die Färbung des Felles schon ziemlich rein weiß, bei
anderen scheckig geworden. Das wohlschmeckende Wildbret des Renns ist
bei uns so beliebt geworden, daß es im Winter von Skandinavien aus
regelmäßig auf unseren Markt gelangt und willige Abnehmer findet.
[S. 238]
XI. Der Elefant.
Die letzten spärlichen Stammhalter einer einst durch zahlreiche Arten
vertretenen Säugetiergattung sind die Rüsseltiere, unter denen die
Elefanten die wichtigsten und für den Menschen nützlichsten
sind. Schon seit dem hohen Altertum gezähmt und zum Nutztier des
Menschen abgerichtet, sind sie indessen bis jetzt nie eigentlich
zu Haustieren geworden, indem sie sich in der Gefangenschaft nur
ausnahmsweise fortpflanzen.
Wenn wir von zahmen Elefanten sprechen, so verstehen wir darunter stets
den etwas kleineren und mit kleinen Ohren versehenen indischen
Elefanten (Elephas indicus), der ein ausgesprochenes
Waldtier ist und die mit Wäldern bedeckten Teile von Vorderindien,
Ceylon, Assam, Birma, Siam, Cochinchina, der Halbinsel Malakka
und Sumatra bewohnt, aber auch in Borneo vorkommt, wo er indessen
vielleicht nur eingeführt ist. Er ist fast haarlos, abgesehen von einer
Reihe langer, grober Haare am Schwanzende, von dunkelgrauer Farbe und
trägt an den Vorderfüßen 5, an den Hinterfüßen dagegen nur 4 Hufe.
Weibchen werden meist bloß 2,4 m, Männchen durchschnittlich
2,7 m hoch, können aber bis 3,6 m Höhe und über 3000
kg Gewicht erlangen. Die Stoßzähne sind wurzellose Schneidezähne
mit Emailüberzug, der nicht wesentlich härter ist als die innere
Elfenbeinmasse. Sie wachsen ruckweise und bestehen aus dütenartig
ineinander gesteckten einzelnen Schichten von Dentin. Beim Männchen
sind sie stärker ausgebildet als beim Weibchen und dienen als Hebel zum
Abbrechen von Zweigen und Entwurzeln von kleineren Bäumen, von deren
Laub die Tiere sich ernähren. Gelegentlich können sie nicht nur beim
Weibchen, sondern auch beim Männchen fehlen. Von den oben und unten
nach und nach hervorbrechenden 6 Backenzähnen jeder Kieferhälfte sind
meist nur 4 im Gebrauch, je einer oben und unten.[S. 239] Sie bestehen aus
einer Anzahl sich selbständig entwickelnder, erst nachträglich durch
Zement zusammengekitteter Platten, innen aus Dentin und außen aus
Schmelz bestehend; und zwar ist der erste aus 4, der zweite aus 8, der
dritte aus 12, der vierte gleichfalls aus 12, der fünfte aus 16 und
der sechste aus 24 Querplatten zusammengesetzt. Die einzelnen Zähne
sind weniger groß als beim afrikanischen Elefanten, weil seine Nahrung
weicher ist. Sie besteht nämlich hauptsächlich aus verschiedenen Arten
von Gräsern und Blättern, jungen Bambusschößlingen, aus Stengeln und
Blättern wilder Bananen und aus den kleinen Blättern, den weichen
Zweigen und der Rinde bestimmter Baum-, namentlich Feigenarten. Von
einem ausgewachsenen Tiere werden täglich große Mengen von Nahrung,
nämlich 300–350 kg, verzehrt. Dagegen trinken die Elefanten in
der Regel nur zweimal am Tage, nämlich vor Sonnenuntergang und nach
Sonnenaufgang. Sowohl das Wasser als auch die Nahrung führen sie mit
dem Rüssel zum Munde, der ein überaus muskulöses Organ ist und aus
über 35000 einzelnen Muskelbündelchen besteht, nämlich von in Reihen
hintereinander geordneten Längs- und in Bogen verlaufenden Quermuskeln.
Er ist beim indischen Elefanten länger als beim afrikanischen, etwa
von der halben Körperlänge, und trägt vorn an der Spitze einen
fingerartigen, äußerst nervenreichen Fortsatz, mit dem er die feinsten
Gegenstände vom Boden aufzugreifen vermag. Die Augen sind auffallend
klein und das Sehvermögen gering, das Gehör mäßig, aber der Geruch
außerordentlich fein entwickelt.
Gewöhnlich lebt der indische Elefant in Herden von 30–50 Stück
verschiedener Größe und beiderlei Geschlechts. Dabei gehören im
allgemeinen alle Stücke einer Herde zu derselben Familie, sind also
nahe miteinander verwandt. Verschiedene Herden vermischen sich nämlich
nicht miteinander, obschon versprengte Weibchen und junge Männchen
auch leicht in eine fremde Herde aufgenommen werden. Nur alte,
griesgrämige Männchen leben gern für sich allein und können dann sehr
bösartig werden. Der Anführer der Herde ist merkwürdigerweise stets
ein Weibchen. Im allgemeinen sind alle Elefanten trotz ihrer Größe
und Kraft furchtsame und schreckhafte Tiere, die dem Menschen, ihrem
größten Feinde, sorgfältig aus dem Wege gehen. Abgesehen von den von
den Engländern in Indien als rogues bezeichneten einzellebenden
Männchen hat man sich besonders vor Weibchen mit Jungen zu hüten.
Greift ein Elefant an, so benutzt er dabei die Füße und, falls es ein
Männchen ist, seine Stoßzähne, nicht aber seinen Rüssel, den er[S. 240] beim
Angriff vielmehr fest zusammenrollt. Den geworfenen Gegner zertrampelt
er meistens.
Den größten Teil des Tages und der Nacht streicht der Elefant umher um
zu fressen, ruht ungefähr von 9 oder 10 Uhr morgens bis nachmittags
3 Uhr und zum zweiten Male etwa von 11 Uhr abends bis 3 Uhr morgens.
Beim Weiden zerstreut sich die Herde etwas, aber schnell sammeln sich
ihre Mitglieder, sobald sie beunruhigt werden. Zum Schlafen legt sich
der indische Elefant gleich andern Säugetieren nieder, während der
afrikanische, der auch die Sonnenhitze besser erträgt, stets stehend
schläft. In vielen Gegenden unternehmen die Elefanten zu bestimmten
Jahreszeiten Wanderungen von beträchtlicher Ausdehnung, hauptsächlich
wohl des Futters wegen, zum Teil aber auch, um gewissen, ihnen
lästig fallenden Insekten aus dem Wege zu gehen. Bei den Wanderungen
marschieren die Tiere im Gänsemarsch hintereinander; kommen sie bei
warmem Wetter an Wasser, so baden sie, wälzen sich auch gern im
Schlamme. Sind sie erhitzt, so spritzen sie mit dem Rüssel Wasser über
ihren Körper. Können sie solches nicht haben, so benetzen sie ihren
Rücken mit Speichel, werfen auch Erde und Blätter zur Kühlung darauf.
Tafel 47.
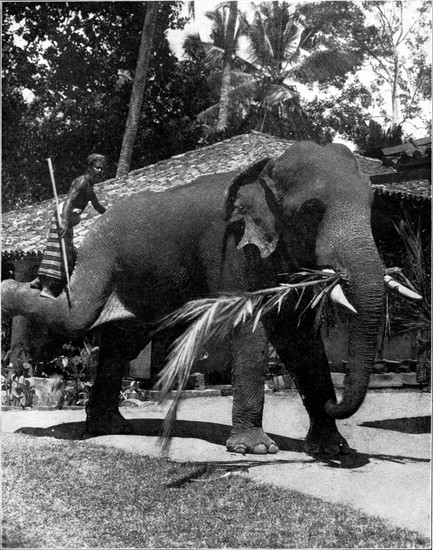
(Copyright
Underwood & Underwood in London.)
Indischer Elefant in Ceylon, seinem Lenker oder Mahaut den Fuß zum Besteigen
hinhaltend.
⇒
GRÖSSERES BILD
Tafel 48.

Junger ostafrikanischer Elefant.

Zwei erlegte ostafrikanische Elefanten mit großen Stoßzähnen.
(Beide Bilder nach einer im Besitz der deutschen Kolonialschule in Witzenhausen
befindlichen Photographie.)
Wenn auch die geistigen Fähigkeiten des Elefanten meist überschätzt
werden, so ist gleichwohl zuzugeben, daß er außerordentlich gelehrig,
klug und gehorsam ist, und dies in so hohem Grade, daß sich kein
anderes ausgewachsenes Säugetier auch nur halbwegs so leicht zähmen
läßt wie er. Seine sehr lange Entwicklungszeit von 25 und mehr Jahren
und sein Leben in engstem Familienverbande, durch das die Jungen
nicht bloß das Lernen, sondern auch die Alten das Lehren so gewohnt
werden, daß sie es auch in der Gefangenschaft nicht lassen können,
begünstigen in hohem Maße seine Dressurfähigkeit. Diese Neigung zum
Bevormunden ist auch der Hauptgrund, weshalb die zahmen Elefanten so
gern bei der Bändigung der wilden helfen. Wie Jäger sagt, steckt ihnen
das Schulmeistern im Blute. Wenn nun auch der Elefant außerordentlich
zahm ist und auf jeden Wink seines Führers gehorcht, so pflanzt er
sich gleichwohl in der Gefangenschaft, wenigstens in Britisch-Indien,
nur selten fort; doch soll die Elefantenzucht mit zahmen Weibchen
in Teilen von Birma und Siam etwas ganz gewöhnliches sein. Sogar in
Menagerien und Tiergärten pflanzt er sich gelegentlich fort, so bekam
eine Elefantenkuh im bekannten Tiergarten von Schönbrunn bei Wien
zweimal Junge, die gut gediehen. Der Elefantenbulle ist etwa im 20.
Jahre fortpflanzungsfähig, wenn[S. 241] er auch erst mit 25 ausgewachsen
ist und erst im 35. Jahre seine Vollkraft erreicht. Seiner langsamen
Entwicklung entsprechend, wird er 100–150 Jahre alt. Die Weibchen
bringen ihr erstes Kalb ungefähr im Alter von 16 Jahren zur Welt und
weitere Junge in Zwischenräumen von durchschnittlich 2,5 Jahren.
Die Tragzeit beträgt 201⁄2 Monate. Meist im Herbst wird das eine
Junge geboren, das bei der Geburt 85 cm hoch und ungefähr 100
kg schwer ist und mit seinem Munde, nicht aber mit dem dann noch
dünnen, kurzen und wenig beweglichen Rüssel, der dabei zurückgelegt
wird, an den beiden an der Brust befindlichen Zitzen seiner Mutter
saugt. Nur in seltenen Ausnahmefällen werden Zwillinge geboren. Hat
ein Weibchen geworfen, so verbleibt die ganze Herde, der es angehört,
rücksichtsvoll ein paar Tage an der Stelle, da solches geschah.
Überhaupt leben die Mitglieder einer Herde äußerst friedlich zusammen.
Nur bei der an keine Periode oder Jahreszeit gebundenen Brunst sind die
Tiere leicht reizbar und können Streit miteinander bekommen, oder, wenn
sie gezähmt im Dienste des Menschen stehen, wütend werden, besonders
die Männchen, bei denen dann, wie übrigens auch bei den Weibchen, aus
einer kleinen, zwischen Auge und Ohr gelegenen Schläfendrüse eine ölige
Substanz herausfließt. Es ist dies ein sexuelles Reizmittel von für die
menschlichen Nasen kaum merklichem Geruch, das aber für die so sehr
viel feineren Geruchsorgane jener Tiere stark wirkt.
Da die indischen Elefanten so leicht gezähmt werden können, hat man
sich gar nie die Mühe genommen, sie systematisch zu züchten und in
der Gefangenschaft zur Fortpflanzung zu bringen. Weil sie überaus
langsam wachsen und bis zu ihrem leistungsfähigen Alter sehr viel
Futter verbrauchen, das der Mensch ihnen geben muß, ist es sehr viel
einfacher, sie sich in der Wildheit fortpflanzen und verköstigen zu
lassen, bis sie ein für den Dienst beim Menschen taugliches Alter
erlangt haben, und sie dann zu fangen. Dazu treibt man eine oder einige
Herden durch eine lärmende und schießende Treiberkette in eine aus
Baumstämmen hergestellte Einfriedigung, eine sogenannte Keddah. Hier
fängt und entfernt man die zum Behalten gewünschten Exemplare mit Hilfe
zahmer Elefanten und läßt die übrigen laufen. Die gefangenen Individuen
werden an starke Bäume angebunden, durch Entzug von Nahrung und Trank,
wie auch der Gelegenheit zu Baden mürbe gemacht, dann zwischen zwei
zahmen Elefanten zur Tränke und zum Bad und bald auch zur Arbeit
geführt, wobei sie sich trotz ihrer Stärke ziemlich rasch unter die
geistige Gewalt des Menschen beugen und[S. 242] seinem Willen gehorchen. Die
Südasiaten sind Meister in der Kunst wilde Elefanten mit Hilfe von
zahmen zu fangen und zu zähmen. Außer dem Fang in Einfriedigungen,
in die die durch unmenschlichen Lärm erschreckten Tiere herdenweise
getrieben werden, betreibt man den Einzelfang. Entweder sucht man
wilde Elefanten vor dem Wind auf schnellen zahmen einzuholen und mit
Schlingen zu fesseln, oder man folgt großen Männchen, auf die man es
besonders abgesehen hat, mit zahmen Weibchen und bindet ihnen, wenn sie
schlafen, die Hinterbeine zusammen.
In Indien, wie auf Ceylon gibt es eine besondere Kaste von
Einzelfängern, die mit wunderbarem Scharfsinn und großer Tapferkeit
erwachsene Elefanten beschleichen, um ihnen die zuvor an einem
starken Baum befestigte zähe Schlinge aus Hirsch- oder Büffelhaut um
eines der Hinterbeine zu legen, sie so zu fangen und durch Hunger
zur Zähmung mürbe zu machen. Überall in Südasien halten die Fürsten
zahlreiche zahme Reitelefanten, die aus solchen Wildlingen gezähmt und
zu nützlichen Tieren des Menschen dressiert wurden. Für feierliche
Prunkaufzüge und zu Jagden auf den Königstiger, den Wildbüffel und
andere gefährliche Tiere im Dschungel sind sie sehr beliebt und
fast unentbehrlich. Für die feierlichen Prozessionen werden in den
indischen Tempeln sogenannte Tempelelefanten gehalten. In Hinterindien
werden sie besonders zum Transport von gefällten und zugehauenen
Baumstämmen, besonders des Tiekholzes, verwendet, auch dienen sie dort
und in Vorderindien zum Ziehen von Wagen und schweren Geschützen.
Die Engländer haben ganze Batterien von Positionsartillerie, die mit
Elefanten bespannt und sehr leistungsfähig sind. Denn trotz ihrer
plumpen Gestalt entwickeln diese Tiere eine große Gewandtheit beim
Erklimmen steiler Abhänge. Auch im Wasser sind sie außerordentlich
gewandt wie wenige Landvierfüßler. Sie schwimmen zwar nicht eben
schnell, legen in der Stunde vielleicht kaum 2 km zurück, können
dafür aber 6 Stunden und darüber ohne zu ruhen fortschwimmen. Albinos
von hellerer Färbung und roten Augen werden in Siam heilig gehalten und
in einem kostbaren Stalle in der Hauptstadt vom Herrscher gefüttert.
Der „weiße Elefant“ ist zum Wappentier jenes Reiches erhoben worden.
Hat jemand einen solchen ausgekundschaftet, so wird er unter großem
Aufwand des Hofes und der buddhistischen Priesterschaft gefangen und in
einen besonderen Tempel nach der Hauptstadt Bangkok gebracht, wo er von
den Gläubigen mit Leckerbissen gefüttert wird und ein sehr gutes Leben
führt.[S. 243] Und wer der Untertanen ein solches heiliges Tier, dem hohe
Ehren zuteil werden, auskundschaftet und dem Könige von Siam oder einem
seiner Statthalter meldet, der wird von seinem Herrscher für diese
Meldung wahrhaft königlich belohnt.
Etwas verschieden vom indischen ist der afrikanische Elefant
(Elephas africanus), der sich auf den ersten Blick von jenem
durch seine gewaltigen, in der Ruhelage die Schultern vollständig
bedeckenden Ohren unterscheidet. Diese werden bei Erregung des Tieres
mit ihren Flächen senkrecht zum Kopfe gestellt und geben dabei ihrem
Träger ein höchst sonderbares Aussehen. Der afrikanische Elefant ist
erwachsen größer und schwerer als der indische, hat einen krummen
Karpfenrücken, einen ebenso kurzen aber gleichwohl sehr beweglichen
Hals und 28 statt wie dieser 27 Schwanzwirbel, dennoch aber einen
kürzeren Schwanz. Die Füße sind verhältnismäßig länger und dünner,
dadurch ist der plumpe Körper höher gestellt. Die Schulterhöhe
erreicht 4–5 m, das Gewicht bis 4000 kg und darüber.
Am verhältnismäßig kleineren Kopfe ist die Stirne flacher, das Auge
größer, der Rüssel kürzer, dünner und flach, dessen Haut auf der
Oberseite in scharfe, nach vorn gerichtete Falten gelegt, die Spitze,
statt mit nur einem fingerartigen Fortsatz am Vorderrand der Öffnung,
mit zwei gleichgroßen Fortsätzen versehen, wovon der eine in der Mitte
des Vorder-, der andere in der des Hinterrandes steht. Die Stoßzähne
des afrikanischen Elefanten, die bei den Elefanten von Nord- und
Ostabessinien zu fehlen oder wenigstens sehr klein zu sein scheinen,
sonst aber nicht bloß beim Männchen, sondern auch beim Weibchen gut
entwickelt sind, sind größer als die des indischen Elefanten. Während
der, soviel man weiß, längste bekannte Stoßzahn eines indischen
Elefanten 2,44 m Länge und ein Gewicht von 45 kg hatte,
betrug die Länge eines der größten bekannt gewordenen Stoßzähne eines
afrikanischen Elefanten 6,33 m und das Gewicht 82,5 kg.
Durchschnittlich beträgt das Gewicht der beiden Stoßzähne eines
ausgewachsenen männlichen afrikanischen Elefanten nur 70 kg. Im
Jahre 1874 wurde jedoch in London ein einzelner Stoßzahn verkauft, der
94 kg wog. Doch sind nach Schillings Zähne von über 50 kg
Gewicht selten. Solche stammen dann stets von Männchen, während
Weibchen selten schwerere als 15 bis im Maximum 20 kg Gewicht
besitzen. Ein Unikum waren nach demselben Autor die im Jahre 1898
von einem gewerbsmäßigen schwarzen Elefantenjäger am Kilimandscharo
gewonnenen Zähne eines schon fast greisenhaften Bullen, die[S. 244] zusammen
etwa 225 kg gewogen haben sollen. Beide Zähne gelangten auf den
Elfenbeinmarkt in Sansibar und wurden nach Amerika verkauft.
Wie die Stoßzähne sind auch die Backenzähne des afrikanischen Elefanten
gewaltiger als diejenigen des indischen Verwandten, weil dessen Nahrung
viel gröber und härter ist und viel größere Anforderungen an das Gebiß
stellt. Unter ihnen ist der erste aus 3, der zweite aus 6, der dritte
gleich dem vierten aus 7, der fünfte aus 8 und der sechste und letzte
aus 10 Platten zusammengesetzt, die sich von dem die Backenzähne des
indischen Elefanten zusammensetzenden Platten durch ihren auf der
Kaufläche sichtbaren rautenförmigen Querschnitt unterscheiden. Zudem
ist der Körper des afrikanischen Elefanten kräftiger behaart und die
Färbung eine dunklere als bei jenem. Während die Vorderfüße 5 Hufe
tragen, besitzen die Hinterfüße nicht 4 wie beim indischen, sondern
bloß 3 Hufe.
Der afrikanische Elefant ist stärker und lebendiger als sein indischer
Vetter. Seine Bewegungen sind rascher und beim Erklimmen abschüssiger
Hänge zeigt er sich ebenso geschickt. Er steigt am Kilimandscharo bis
zu 3000 m und im Hochland von Abessinien bis 2400 m
empor, ist kein so ausschließliches Waldtier wie sein indischer
Gattungsgenosse, findet sich im Sudan oft sehr weit vom Walde entfernt
auf trockenen, mit verdorrtem Grase bestandenen Ebenen und erträgt
die Hitze viel besser als jener. Nach C. G. Schillings ist sein
eigentlicher Aufenthaltsort nicht der schattige, kühle Hochwald,
sondern vielmehr da, wo er sich nicht allzusehr verfolgt weiß, und
namentlich in der Regenzeit die Baumsteppe, sonst aber die dichten
Bestände von außerordentlich hohem Gras und schilfbestandene Flußufer.
Seine Nahrung besteht nie aus Gräsern — nur Prof. Volkens hat in
Höhenlagen zwischen 2000 und 3000 m am Kilimandscharo Reste von
Schilf in den Elefantenlosungen gefunden — sondern ausschließlich aus
Baumzweigen, Rinden und Früchten aller Art. Baumzweige, die er in der
Dicke des Handgelenks eines Mannes abreißt, durchkaut er und speit
die holzigen Fasern wieder aus, während er den nahrhaften weichen
Bast hinunterschluckt. In den Mimosenwäldern entwurzelt er mit Hilfe
seiner Stoßzähne die meist nur 5–6 m hohen Bäume, um deren
Rinde und Zweige, auch die Wurzeln, weniger die Blätter zu fressen.
Der vorgenannte Schillings hat beobachtet, daß er mit Vorliebe mehrere
Arten von Sanseverien aufnimmt, deren ausgekaute Stengel er aber
wieder fallen läßt, so daß sie, von der Sonne bald weiß ge[S. 245]bleicht,
weithin auf dem Steppenboden sichtbar sind. Da sie einen erheblichen
Wassergehalt besitzen, dienen sie ihm als einen, wenn auch notdürftigen
Ersatz für das dort weithin fehlende Wasser. In Südost- und Südafrika
benutzt er seine Stoßzähne gern zum Ausgraben von Wurzelknollen und
Zwiebeln. Man sieht dort große Strecken des sandigen Bodens von ihnen
gleichsam umgepflügt.
Der afrikanische Elefant scheint gleicherweise wie sein indischer
Verwandter ein ziemlich starkes Wasserbedürfnis zu haben und trinkt
täglich wenigstens einmal. Im Gegensatz zu jenem schläft er nie
am Boden liegend, sondern stets nur stehend, in schattigen Hainen
verborgen, und zwar während der heißesten Stunden des Tages. Gewöhnlich
lebt er nur in kleinen, aus je einer Familie, und zwar aus jungen
Männchen, Weibchen und Kälbern bestehenden Gesellschaften. Die alten
Männchen leben einzeln, paarweise oder in kleinen Gesellschaften
für sich, scheinen sich aber bei Wanderungen den übrigen Tieren
anzuschließen. Solche Wanderungen, wozu sich gelegentlich Hunderte
von Elefanten in kleinen Trupps zusammenfinden, scheinen vorwiegend
aus Nahrungsmangel, dann auch zur Erlangung einer zu gewissen Zeiten
reifenden Nahrung unternommen zu werden. Während Gesicht und Gehör
verhältnismäßig schlecht entwickelt sind, ist sein Geruch fast noch
besser als bei seinem indischen Verwandten ausgebildet. So kann er
bei günstigem Winde einen Menschen schon aus sehr weiter Entfernung
wahrnehmen und läuft dann erschreckt in größter Eile davon, um
manchmal erst nach etlichen Stunden haltzumachen. Gern stellt sich
der europäische Jäger bei der Elefantentränke auf den Anstand, um
das vorsichtige Wild zu erlegen. Wo sich aber keine Gelegenheit dazu
bietet, schießt er den Elefanten auch gern vom Pferde. Im ganzen ist
aber die Jagd auf den afrikanischen Elefanten nicht bloß schwieriger,
sondern auch gefährlicher als diejenige auf den indischen, da dieses
Tier entschieden wilder und mehr zu einem Angriff geneigt ist als
jener; und zwar scheinen die alten Weibchen gefährlicher als die
Männchen zu sein und nicht selten sogar ungereizt anzugreifen.
Vor der Einführung der Feuerwaffen wurden die Elefanten in manchen
Teilen Afrikas, besonders im Süden und Südosten, nur selten
angegriffen. Nur gelegentlich taten sich die Eingeborenen zusammen, um
sie vor dem Winde anzugreifen und sie durch Hunderte von Speerwürfen
und den dadurch verursachten Blutverlust allmählich zu Tode zu quälen.
Durch Speerwürfe tötet man auch in Mittelafrika die in Fallgruben,
manchmal zu zweien gefangenen Elefanten.[S. 246] War das 3–4 m hohe
Gras der Steppe während der heißen Jahreszeit so trocken geworden,
daß es, angezündet, lichterloh brannte, umgab man auch gern eine
dazu ersehene kleine Elefantenherde mit einem etliche Kilometer im
Durchmesser haltenden Kreise von Feuer, dessen Inneres sich durch
die Ausdehnung des Feuers allmählich verkleinerte und schließlich
die Elefanten, die von der Angst getrieben bald dahin, bald dorthin
zu entfliehen suchten, sich aber nach allen Seiten vom Feuer umgeben
sahen, auf einem kleinen Fleck vereinigte. Dann stürzten sich die
von prasselnden Flammen und Tausenden wild schreienden Eingeborenen
umgebenen, durch gesteigerte Furcht sinnlos gewordenen Tiere,
halberstickt durch den dicken Rauch, verzweifelt durch das Feuer,
an dessen Außenrand sie, verbrannt und geblendet, unbarmherzig von
den Speeren der blutdürstigen Wilden empfangen wurden. Hundert und
mehr der großen Tiere sollen früher gelegentlich bei einer einzigen
solchen Jagd getötet worden sein. Viele Eingeborenenstämme betrieben
die Elefantenjagd auch aus dem Hinterhalte mit vergifteten Pfeilen.
Andere, besonders in Westafrika, flochten aus armdicken holzigen
Schlingpflanzen ein netzartiges Gehege um einen bestimmten Waldbezirk
und jagten die Elefantenherden hinein. Wenn nun die Tiere unschlüssig
vor dem verschlungenen Zaun aus Rankenwerk stehen blieben, so
schleuderten die Neger von den benachbarten Bäumen, auf denen sie
sich postiert hatten, hunderte von Lanzen in den Leib der stärksten
und größten Tiere, bis diese schließlich, vom Blutverlust geschwächt,
zusammenbrachen. Gebräuchlicher war es indessen bei derartigen
Waldjagden, ein solches Zaunwerk in weitem Halbkreise herzurichten
und die zufällig hineingegangenen oder hineingetriebenen Elefanten
möglichst schnell vollständig zu umhegen. Ringsum wurden dann Wachen
aufgestellt und Feuer angezündet, um die der Umzäunung sich nähernden
Tiere zurückzuscheuchen. Obwohl selbst der kleinste Elefant die lockere
und schwache Einhegung ohne weiteres durchbrechen und den schlecht
bewaffneten Eingeborenen entrinnen könnte, wagen die gefangenen
doch nicht zu entfliehen. Sie werden dann von den geduldig um sie
herumlagernden und zuwartenden Jägern zu Tode gehungert, gespeert und
im Zustande äußerster Entkräftung endlich umgebracht. Ihr Fleisch wird
als Leckerbissen gern gegessen und das gewonnene Elfenbein zu allerlei
Schmuck verarbeitet.
Die Hamram-Araber des Sudan pflegen die Elefanten zu Pferd zu jagen.
Drei oder vier berittene Jäger trennen dabei einen Stoßzahnträger
von seinen Genossen und folgen ihm so lange, bis das er[S. 247]müdete Tier
sich gegen den Jäger wendet, der sofort davongaloppiert und von dem
dicht hinter ihm herlaufenden Elefanten verfolgt wird. Diesem aber
reiten zwei andere Jäger so schnell sie können nach. Haben sie den
Elefanten erreicht, so ergreift der eine die Zügel des Pferdes seines
Genossen. Der andere springt sofort ab und durchschneidet flink mit
einem einzigen Hiebe seines großen Schwertes die Achillessehne des
Elefanten, wodurch das zum Gehen auf drei Beinen unfähige gewaltige
Tier sofort zum Stehen gebracht und seinen Angreifern überantwortet
wird. In ähnlicher Weise pflegten die Eingeborenen Maschonalands
früher Elefanten zu jagen, nur daß sie zu Fuß waren und anstatt des
Schwerts eine breite Axt gebrauchten. Mit dieser schlichen sie sich
an den schlafenden Elefanten hinan, um eine seiner Achillessehnen
zu durchhauen. Bei andern Eingeborenenstämmen im Stromgebiet des
Sambesi ist es üblich, dem Elefanten von einem über einen seiner am
häufigsten benutzten Pfade hängenden Baumast aus einen mit einem
Holzklotz beschwerten starken Speer in den Rücken zu stoßen. Der damit
getroffene Elefant rast, den schweren Speer im Rücken, davon, stößt
damit an verschiedene Äste und Zweige an, vergrößert dadurch die schon
allein durch das Gewicht des Speeres immer tiefer werdende Wunde und
sinkt, vom Blutverlust erschöpft, schließlich zu Boden, wo ihm die
in angemessener Entfernung insgeheim nachfolgenden Wilden den Garaus
machen, sich an seinem Fleisch, das sie sehr lieben, sättigen und ihn
der auch von ihnen zur Herstellung von allerlei Schmuck geschätzten
Stoßzähne berauben. Anderswo, z. B. in gewissen Gebieten von Äquatoria,
erbeutet man den Elefanten vermittelst eines aufgehängten beschwerten
Fallspeers, der, falls die durch den Tritt des unter dem Speer
hindurchgehenden Elefanten in Tätigkeit gesetzte Fallvorrichtung gut
gerichtet ist, zwischen Schädel und Halswirbelsäule eindringt, den hier
gelegenen Teil des Zentralnervensystems durchschneidet und den wie vom
Blitz getroffenen Elefanten sofort im Todeskampfe zu Boden sinken läßt.
Während sich die Eingeborenen Afrikas ganz gut auf die Jagd des
Elefanten verstehen, wissen diese zur Zähmung von Tieren überhaupt
ungeschickten Leute den Elefanten weder zu fangen, noch gar
abzurichten. Der Fang der afrikanischen Elefanten kann aber schließlich
nicht viel schwerer sein als der des seit uralten Zeiten als
Arbeitstier gebrauchten indischen, und nach dem Benehmen gefangener
Elefanten, z. B. des großen Jumbo im Londoner Zoologischen Garten, zu
urteilen, sind sie ebenso leicht zähmbar und nicht minder gelehrig[S. 248]
als ihre indischen Vettern. So wissen wir, daß die nordafrikanischen
Kulturvölker des Altertums den einheimischen Elefanten ebenso zähmten
wie die Indier den ihrigen, und daß die Karthager zweifellos solche
afrikanische Elefanten auf ihren Kriegszügen benützten. So dürfen
wir auch annehmen, daß die 37 Kriegselefanten, die der berühmte
karthagische Feldherr Hannibal im zweiten punischen Kriege im
Sommer 218 v. Chr. von Spanien aus über die Pyrenäen und Alpen nach
Norditalien führte, solche Afrikaner waren.
Früher war das Verbreitungsgebiet des afrikanischen Elefanten ein
sehr viel größeres als heute, da er auf den südlich von der Wüste
Sahara gelegenen Teil von Afrika beschränkt ist und auch hier durch
die unsinnigen Verfolgungen von seiten der Elfenbeinjäger an vielen
Orten ausgerottet wurde. Er kam im Altertum außer in ganz Nordafrika
auch in Westasien und Südeuropa, besonders auf Sizilien und Spanien
vor. Wir wissen aus sicher datierbaren geschichtlichen Urkunden,
daß er in manchen Gebieten Westasiens bis ums Jahr 1000 v. Chr.
gejagt wurde. So melden uns die Königsannalen im Allerheiligsten des
Ammontempels zu Karnak, der einstigen ägyptischen Hauptstadt Theben,
daß König Thutmosis III. (1480–1447), der seine Eroberungszüge
bis weit nach Vorderasien ausdehnte, im Lande Naharina, d. h.
Stromland (zwischen den Oberläufen von Euphrat und Tigris) bei der
Stadt Nij am Euphrat unterhalb von Karkemisch nicht weniger als 120
Elefanten erlegte. Dabei geriet allerdings der Pharao selbst einmal
in Lebensgefahr, indem eines der Tiere wütend gegen ihn eindrang und
ihn wohl zweifellos zerstampft hätte, wenn nicht der Feldhauptmann
Amenemhab seinem Gebieter zu Hilfe geeilt wäre und dem Angreifer mit
dem Schwerte den Rüssel abgehauen hätte. Später hat auch der mächtige
assyrische König Tiglathpileser I. noch ums Jahr 1120 v. Chr.,
wie er uns auf Inschriften meldet, in derselben westlich von Assyrien
gelegenen Landschaft der Elefantenjagd obgelegen.
Einst gab es auch im Nilland selbst Elefanten, wie wir aus der einen
solchen darstellenden Hieroglyphe ab entnehmen können. Früher wurde
aber dieses Tier durch die immer dichter sich ansiedelnden Menschen aus
dem Niltale verdrängt. Man jagte es damals schon fast ausschließlich
zur Erlangung des Elfenbeins, das seit der vorgeschichtlichen Zeit
als Ausgangsmaterial für allerlei Schmuck und Geräte wie in Asien, so
auch in Afrika eine große Rolle spielte. Um es zu gewinnen, jagte man
erbarmungslos die sonst so gutmütigen[S. 249] und friedlich beisammenlebenden
Tiere, so daß der Elefant weithin ausgerottet wurde. Heute ist er
auch aus ganz Südafrika verschwunden, wo er einst ebenfalls sehr
häufig war. In den weniger besuchten Gegenden von Matebeleland, von
Nordostmaschonaland und in den undurchdringlichen Urwäldern der
Küstenniederungen an der Sofalabucht leben zwar noch einige zerstreute
Elefantenherden; sonst gibt es südwärts vom Sambesi heute keine
Elefanten mehr. An der Westseite von Südafrika mag es vielleicht in dem
dem Kunene und Okawango benachbarten äußersten Nordosten von Owamboland
noch etliche Elefanten geben, aber höchstens Männchen ohne Stoßzähne
oder Weibchen. Die letzte Elefantenherde am Botlebi und am Ngamisee
wurde 1889 von den Betschuanen völlig vernichtet, und die im Anfang der
1890er Jahre noch ziemlich zahlreich zwischen den Flüssen Sambesi und
Chobi lebenden Elefanten mögen gegenwärtig schon alle oder doch der
Hauptsache nach den Angriffen der Barotse erlegen sein. In Ostafrika
sind Elefanten am Kilimandscharo noch ziemlich häufig. Am längsten
mögen sie sich in etlichen Gegenden von Innerafrika halten. Aber wenn
keine wirksamen Gesetze zum Schutze der freilebenden afrikanischen
Elefanten erlassen werden, wird man schließlich nur noch hier und
da einige von Regierungs wegen geschützte Elefantenherden treffen,
wie es heute schon etliche im östlichen Kaplande gibt. Dort ist es
den Behörden dank scharfer Erlasse seit dem Jahre 1830 gelungen, in
den Zitzikamma- und Knysnawäldern einige solche zu erhalten. Die
fortschreitende Inzucht wird dann dafür sorgen, daß dieser ehrwürdige
Riese vielleicht noch vor Ende des begonnenen Jahrhunderts ganz
ausgerottet sein wird.
Afrika, wo nicht die Weißen mit ihren fürchterlichen
Explosivgeschossen, sondern die Eingeborenen mit ihren gewöhnlichen
Flinten das Hauptvernichtungswerk am Elefanten vollführen und weitaus
das meiste Elfenbein in den Handel bringen, liefert heute noch fast
ausschließlich das von uns außer zu allerlei Zier an Geräten und
Spazierstöcken, zu Knöpfen und Messergriffen, besonders aber zu
Billardkugeln verwendeten rezenten Elfenbeins, nämlich nach einer
für die Jahre 1879/83 aufgestellten Übersicht jährlich von den im
Durchschnitt in den Handel gelangenden 868000 kg nicht weniger
als 848000 kg, während Ceylon und Sumatra zusammen nur 2000
kg, Hinterindien 7000 kg und Vorderindien 11000 kg
abgab. Nach C. G. Schillings wurde der Antwerpener Elfenbeinmarkt
allein gegen das letzte Jahrzehnt durchschnittlich mit den Zähnen
von gegen 18500 Elefanten[S. 250] jährlich versorgt, in den Jahren 1888 bis
1902 aber 3212700 kg Elfenbein dort eingeführt, während das
durchschnittliche Zahngewicht etwa 8,5 kg pro Zahn betrug
und das Gesamtquantum fast ausschließlich vom Kongogebiet stammte.
„Im Jahre 1902 aber wurden allein in Antwerpen 322300 kg
Elfenbein verkauft!! In ähnlicher Höhe bewegt sich die Einfuhr an
den übrigen hauptsächlichsten Elfenbeinhandelsplätzen der Welt, und
diese Ziffern geben uns ein treues, wenn auch unsäglich trauriges
Bild der Vernichtung des edlen Tieres. Ungeheuer sind die an einigen
Handelsplätzen aufgestapelten Elfenbeinvorräte. Ihre späteren
Eigentümer werden in kürzester Zeit — wenn erst einmal die von
ihnen sehnlichst erstrebte vollkommene Ausrottung des afrikanischen
Elefanten erreicht ist — diese Ware rapid im Preise heraufschrauben
und zweifelsohne das heute nicht mehr sehr beliebte Elfenbein wieder
als Modeartikel einzuführen wissen. — Alle diese Elefanten wurden
hingeschlachtet nur ihres Elfenbeins halber. Es spricht der hoch
entwickelten Technik unserer Zeit Hohn, daß sie nicht vermocht hat,
ein Surrogat zu finden, welches Elfenbein (speziell zu Billardkugeln)
gleichwertig zu ersetzen vermag. Ein glückliches Schicksal hat den
indischen Elefanten vor dieser Vernichtung bewahrt, weil die weiblichen
Tiere des asiatischen Elefanten kein oder nur sehr wenig Elfenbein
tragen, und auch die Bullen nur selten eine starke Stoßzahnentwicklung
zeigen.“ Nachdem die Baumsteppe ihr Elefantenmaterial größtenteils
eingebüßt hat, muß der dichte Wald, der mit seinem für den Menschen
fast undurchdringlichen Unterholz diesem Riesen noch den meisten Schutz
gewährt, zur Erlangung solcher Beute aufgesucht werden. Hier sind die
Urwälder des Kongogebiets noch am besten mit diesem Edelwilde versehen,
so daß die Eisenbahn des Kongogebiets nach statistischen Feststellungen
allein im Betriebsjahre 1907/08 307000 kg und 1908/09 381000
kg Elfenbein beförderte. Das bedeutet einen Abschuß von 40000
Elefanten!
Bei den südasiatischen Kulturvölkern, speziell in Indien, spielte
der gezähmte Elefant schon im hohen Altertum eine wichtige Rolle als
Luxustier, das besonders auch zur Kriegsführung verwendet wurde. Die
Griechen lernten ihn unter Alexander dem Großen auf ihrem Zuge nach
Indien im Jahre 327 v. Chr. kennen. So schreibt Diodorus Siculus: „Als
Alexander der Große in Indien eindrang, fand er jenseits des Flusses
Aornos einen indischen Fürsten, der 20000 Soldaten und 15 Elefanten
bei sich hatte. Dieser ward aber von seinen eigenen Leuten ermordet,
sein Kopf zum König gebracht und dieser bekam nun[S. 251] auch die Elefanten,
welche im Lande herumirrten, in seine Gewalt. — Jenseits des Indus
stellte sich ihm der indische König Poros entgegen, welcher 50000 Mann
Fußvolk, gegen 3000 Berittene, über 1000 Streitwagen und 130 Elefanten
hatte. Wie es zur Schlacht kam, stellte er die Elefanten in vorderster
Reihe auf, einen jeden für sich, vom andern entfernt, und füllte
die Zwischenräume mit schwerbewaffnetem Fußvolk aus. Die Elefanten
zertraten, was sich ihnen entgegensetzte, mit den Füßen samt Waffen
und Knochen; andere hoben die Makedonier mit dem Rüssel hoch empor und
schmetterten sie dann gegen den Erdboden, andere spießten sie mit den
Zähnen auf. Die Makedonier hielten aber tapfer stand, brachten den
Elefanten eine Menge Wunden bei und jagten sie auf ihre eigene Armee
zurück, die dadurch in entsetzliche Verwirrung geriet. Poros ritt
selbst auf einem Elefanten, sammelte deren rasch noch 40, die den Mut
und die Geistesgegenwart nicht verloren hatten und focht tapfer, bis
er, von vielen Wunden bedeckt, samt seinem Elefanten ohnmächtig zu
Boden sank. Alexander erbeutete in dieser Schlacht 80 Elefanten.“
Von diesen indischen Elefanten, die damals zum erstenmal in den
Gesichtskreis der Europäer traten, berichtet der Grieche Strabon:
„In Indien ist es keinem Privatmanne erlaubt, ein Pferd oder einen
Elefanten zu halten; denn beides gilt für königliches Vorrecht. Die
Elefantenjagd wird in Indien folgendermaßen betrieben: Man umgibt
einen großen Platz mit einem breiten Graben und läßt nur einen
schmalen Eingang frei. Auf den Platz werden 3–4 zahme Weibchen getan.
Bei Nacht gehen dann auch einzelne wilde Elefanten hinein und hinter
diesen wird das Tor leise zugeschlossen. Nun macht man die wilden
durch Hunger matt, führt dann die stärksten zahmen hinein, um jene zu
bekämpfen. Sind sie nun ganz kraftlos, so schleichen sich die mutigsten
Führer unter den Leib der zahmen Elefanten und fesseln den wilden
die Beine. Sie werden dann in einen Stall gebracht und mit dem Hals
an eine starke Säule gebunden. Allmählich werden sie zahm und lernen
dem Wort, dem Gesang und dem Zimbelschlag gehorchen. Von Natur sind
sie sanft und klug. Es ist schon vorgekommen, daß sie ihre im Kampfe
gefallenen Führer aufgehoben und aus der Schlacht getragen, daß sie
ihre lebenden Führer, die sich unter ihnen verborgen hatten, verteidigt
und gerettet, ja daß sie ihren Führer, den sie im Zorn umgebracht,
tief betrauert haben, so daß einzelne, wie man sagt, in solchem Falle
sich zu Tode hungerten.“ — „Vom Weibchen wird das Junge 6 Jahre lang
gesäugt. Das Alter dieser[S. 252] Tiere erstreckt sich bis auf 200 Jahre. Ihre
Augenkrankheiten sucht man durch Kuhmilch zu kurieren, ihre meisten
Krankheiten mit rotem Wein, ihre Wunden mit Butter, ihre Geschwüre
mit Schweinefleisch. Onesikritos und andere sagen, die indischen
Elefanten seien größer und stärker als die libyschen. Mit ihrem Rüssel
reißen die Elefanten Brustwehren ein und Bäume aus. Sie lassen sich
abrichten, Steine nach einem Ziele zu werfen, mit Waffen zu fechten;
auch schwimmen sie vortrefflich. — Der König von Indien hält seine
Jagden in Tiergärten ab, reitet dabei auf einem Elefanten und die
bewaffneten Weiber, welche seine Leibgarde bilden, folgen ihm im Wagen
oder auf Pferden oder auf Elefanten nach. — Auf jedem Elefanten sitzen
drei Bogenschützen und ein Führer (Kornak), auf jedem Streitwagen zwei
Streiter und ein Wagenlenker.“
Auch sonst weiß uns der griechische Geograph Strabon viel von
Elefanten zu berichten, so daß Maurusien (das westliche Algerien
und Marokko) außer Schlangen, Antilopen, Affen, Löwen und Panthern
auch viel Elefanten habe und das maurusische Fußvolk Schilde von
Elefantenhaut trage. In Arabien wohnten in der Nähe der Stadt Saba
die „Elefantenesser.“ „Sie lauern den Elefanten auf und hauen ihnen
die Sehnen durch. Auch schießen sie die Tiere mit Pfeilen, die in
Schlangengalle getaucht sind. Der Bogen wird von zwei Männern gehalten
und der dritte schießt den Pfeil ab. Andere machen Einschnitte in
die Bäume, an welche sich die Elefanten anzulehnen pflegen, wenn sie
ausruhen. Kommt nun das Tier und lehnt sich an, so fällt es um, kann
aber nicht aufstehen, weil die Beine nur einen Knochen ohne Gelenk
haben“. Daß solche Fabeln damals noch von den gebildeten Griechen
geglaubt wurden, beweist, daß diese noch wenig Elefanten gesehen hatten
und dieses Tier mehr vom Hörensagen kannten.
Nach der Rückkehr der Makedonier vom Feldzuge nach Indien unter ihrem
Könige Alexander erzählten sie den Griechen von ihren Erlebnissen
daselbst und von den großen Elefanten jenes Landes. So erfuhr auch
Aristoteles von ihnen und beschreibt sie in seiner Naturgeschichte
ziemlich getreu. Er sagt, daß sie mit dem Munde, ohne Beihilfe
der Nase, stöhnende Töne, mit dem Rüssel aber trompetenartige
hervorbringen, daß das Elefantenweibchen im 12. Jahre das erste Junge
bekomme, das bei der Geburt die Größe eines 2–3 Monate alten Kalbes
habe, gleich sehen und gehen könne und mit dem Munde, nicht mit dem
Rüssel, an seiner Mutter sauge. „Unter allen wilden Tieren ist der
Elefant der zahmste und sanftmütigste. Er lernt auch[S. 253] vielerlei,
namentlich, daß er vor Königen die Kniee beugt. Man glaubt, daß er 100
oder 200 Jahre alt wird. Winter und Kälte kann er nicht gut vertragen.
Er lebt in der Nähe der Flüsse, jedoch nicht im Wasser, aber er watet
durch Flüsse, wenn er nur seinen Rüssel über das Wasser emporstrecken
kann; denn mit dem Rüssel atmet er.“
„Die Elefanten kämpfen wütend miteinander und stoßen sich mit den
Zähnen. Der Besiegte wird völlig unterjocht und fürchtet sich dann
sehr vor der bloßen Stimme des Siegers. An Mut sind die Elefanten sehr
verschieden. Die Inder brauchen die Männchen und Weibchen zum Kriege,
obgleich die letzteren kleiner und weniger mutig sind. Mit den Zähnen
kann der Elefant Mauern einstoßen. Palmen biegt er mit der Stirne
nieder und tritt sie dann vollends zu Boden. Bei der Elefantenjagd
besteigt man gezähmte, die recht mutig sind, verfolgt die wilden und,
wenn man sie erreicht, läßt man sie von den zahmen so lange schlagen,
bis sie entkräftet sind. Dann springt ein Jäger auf sie und lenkt sie
mit dem Stachel. Sie werden bald zahm und gehorsam. Solange man auf
ihnen sitzt, sind sie allemal ruhig; manche aber werden wild, sobald
man abgestiegen ist. Solchen bindet man die Vorderfüße mit Stricken,
damit sie sie nicht viel rühren können.“
Die ersten gezähmten indischen Elefanten brachte Alexander der Große
von seinem indischen Feldzuge mit nach Vorderasien und von da an
spielten sie in den Kriegen seiner Nachfolger, der Diadochen, eine
gewisse Rolle. So berichtet Curtius: „Nach dem Tode Alexanders des
Großen wurde das makedonische Fußvolk von Meleager, die Reiterei nebst
den Elefanten von Perdikkas kommandiert. Der letztere warf etwa 300
Anhänger des Meleager im Angesicht des ganzen Heeres den Elefanten vor
und ließ sie sämtlich von den Tieren zertreten. Dies war der Anfang
der dann folgenden makedonischen Bürgerkriege.“ Und Diodorus Siculus
meldet: „Als sich nach Alexanders Tode dessen Feldherrn befehdeten,
hatte sich Demetrios bei Alt-Gaza in Syrien gelagert; Ptolemäos und
Seleukos boten ihm daselbst eine Schlacht an. Demetrios stellte vor
seinem Heere 34 Elefanten auf. Seine Gegner stellten diesen aber Pfähle
entgegen, die mit eisernen Spitzen versehen und mit Ketten verbunden
waren. Lange war der Kampf unentschieden. Da bekamen die Elefanten des
Demetrios das Zeichen zum Angriff, schritten kühn gegen den Feind,
konnten aber nicht weiter, als sie an die Pfähle kamen. Ihre indischen
Führer wurden alsbald von Schützen, die hinter den Pfählen standen,
erschossen, die Elefanten selbst gerieten[S. 254] in die Hand der Feinde und
das Heer des Demetrios mußte das Schlachtfeld räumen.“ Derselbe Autor
erzählt dann später, daß diese Elefanten unter ihrem neuen Herrn und
unter der Leitung frisch von Indien bezogenen Kornaks an verschiedenen
späteren Schlachten teilnahmen. „Auch der Feldherr Polysperchon
verwandte einen Teil derselben bei der Belagerung von Megalopolis in
Arkadien. Da er dabei mit seiner Mannschaft nicht gleich zum Ziele
gelangte, so beschloß er, den Eingang in die Stadt durch Elefanten zu
erzwingen. Damis, der Kommandant der Stadt, erfuhr den Plan und traf
heimlich Gegenanstalten. Er sammelte eine Menge Türen, ließ lange,
spitzige Nägel durch sie hindurchschlagen, dann mit diesen Türen den
Eingang zur Stadt pflastern und die Nägel leicht mit Erde zudecken. Zu
beiden Seiten dieses Stachelwegs stellte er Schützen und Geschütze auf.
Als nun die Elefanten kamen, traten sie in die Nägel und wußten sich
nicht zu helfen, wurden samt ihren indischen Führern auch von zahllosen
Pfeilen getroffen, so daß sie teils zusammenbrachen, teils gegen ihre
eigenen Leute rückwärts rannten.“
Von diesen indischen Elefanten, die begreiflicherweise überall,
wohin sie kamen, großes Aufsehen erregten, wissen auch andere
Geschichtschreiber allerlei Denkwürdiges zu erzählen. So berichtet
Älian: „Als Antigonos Megara belagerte, befand sich in seinem Heere ein
Elefantenweibchen namens Nikaia, dem die Frau des Wärters ihr Kind,
als es 30 Tage alt war, zu Schutz und Wartung übergab. Nikaia gewann
das Kind so lieb, daß sie sich immer freute, wenn das Kind anwesend
war, daß sie die Fliegen von ihm abwehrte, was mit einem belaubten
Zweige geschah, den sie in den Rüssel nahm, daß sie keine Nahrung zu
sich nahm, solange sie das Kind nicht bei sich hatte. Sie bewegte auch
dessen Wiege, wenn es schrie, wie eine Wärterin.“ Derselbe Autor sagt,
daß die Elefanten der Insel Taprobane (Ceylon) größer und stärker als
die des Festlandes seien, auch für klüger gelten. „Man bringt auch
welche zu Schiff und schafft sie außer Landes. Will man zahme Elefanten
auf ein Schiff bringen, so täuscht man sie dadurch, daß man es mit
frischen Zweigen und anderem Grün schmückt und belegt; sie denken dann,
da sei frischer Boden, und gehen darauf. — Das eigentliche Getränk der
Elefanten ist Wasser, die für den Krieg bestimmten bekommen aber auch
Wein zu trinken, der aus Reis und Zuckerrohr (Arrak) bereitet wird. Das
Tier hat auch seine Freude an wohlriechenden Blumen, wird auf Wiesen
getrieben, sammelt die besten und wirft sie in einen Korb, den der
Wärter hinhält. Hat es sich[S. 255] dann gebadet, so verlangt es, wenn es aus
dem Wasser kommt, zuerst nach seinen Blumen, und bringt man sie nicht,
so schreit und fastet es, bis sie doch kommen. Auch seine Krippe und
seinen Ruheplatz bestreut es gern mit Blumen.“ Nur vor dem Schweine
fürchte es sich: „Als die Stadt Megara von Antipater hart bedrängt
wurde, beschmierten die Bewohner der Stadt Schweine mit Pech, setzten
sie in Brand und trieben sie gegen die Feinde. Sie schrien entsetzlich
und jagten wie rasend auf die Elefanten los. Diese wurden durch diesen
unerwarteten Angriff wie verrückt, und so entstand eine entsetzliche
Verwirrung.“ In Indien begleite der Elefant überall den König und
bewache ihn: „Geht der indische König aus, um Recht zu sprechen, so
wirft sich der erste Elefant anbetend vor ihm nieder und macht dann
kriegerische Bewegungen, um zu zeigen, daß er sich auch darauf gut
versteht. Übrigens halten 24 Elefanten beim Könige Wache und werden
regelmäßig abgelöst. Sie sind im Wachen zuverlässiger als Menschen.“
Der griechische Geschichtschreiber und Geograph Pausanias sagt in
seiner zwischen 160 und 180 n. Chr. geschriebenen Periegesis: „Wie
Alexander der erste Europäer war, der Elefanten besaß — er hatte
sie dem König Poros abgenommen —, so war Pyrrhos der erste Grieche,
welcher gegen die Römer über das Meer zog. Seine Elefanten hatte er im
Kampfe gegen den Demetrios (einen der Feldherrn Alexanders) gewonnen.“
Dieser König von Epirus, der, 301 von den Epiroten vertrieben, mit
Hilfe des Königs Ptolemäos von Ägypten seine Herrschaft wieder erlangt
hatte, war damals von den Tarentinern, also ebenfalls Griechen, gegen
die Römer zu Hilfe gerufen worden, schlug diese auch 280 bei Herakleia
und 279 bei Asculum in Apulien, erlitt aber dabei selbst große
Verluste, so daß seither der Ausdruck Pyrrhossieg sprichwörtlich wurde.
Damals sahen die Römer zum erstenmal diese berühmten Kriegshelfer
der Griechen, über die sie sehr erstaunten. Der ältere Plinius sagt
hierüber in seiner Naturgeschichte: „Die ersten Elefanten sah Italien
im Kriege gegen den Pyrrhus und nannte sie lukanische Ochsen, weil
man sie zuerst im Lukanerlande erblickte. Sieben Jahre später sah man
schon welche zu Rom bei einem Triumphe, und im Jahre 502 nach Roms
Erbauung (251 v. Chr.) sah man hier schon eine ganze Menge, die Lucius
Metellus in Sizilien den Karthagern abgenommen hatte. 142, oder nach
andern 140, wurden auf Flößen übergeschifft, welche man auf Reihen von
Fässern gelegt hatte. Verrius berichtet, sie hätten in der Rennbahn ein
Kampfspiel geben müssen und wären mit Spießen erstochen worden, weil
man sie weder füttern noch[S. 256] verschenken wollte. Lucius Piso dagegen
sagt, sie wären bloß in der Rennbahn von gedungenen Leuten mit stumpfen
Spießen herumgejagt worden, um den Römern die Furcht vor ihnen zu
benehmen; was aber dann aus ihnen geworden ist, erwähnt er nicht.“
Von diesen indischen Elefanten der Pyrrhos weiß sein Biograph Plutarch
mancherlei zu erzählen: „Als Pyrrhos bei den Städten Pandosia und
Herakleia, am Flusse Siris, dem römischen Heere eine Schlacht lieferte,
brachte er durch seine Elefanten die Feinde in Unordnung und errang den
Sieg. — Um ihre Gefangenen für Geld auszulösen, schickten dann die
Römer eine Gesandtschaft an Pyrrhos. Den Gajus Fabricius, einen der
Gesandten, den man ihm sehr rühmte, nahm er freundlich auf, beschloß
aber, seinen Mut auf eine harte Probe zu stellen. Er lud ihn zur
Audienz, ließ aber vorher seinen größten Elefanten in voller Rüstung
hinter einem Vorhange verbergen. Wie sich nun Fabricius nichts Böses
versah, fiel plötzlich der Vorhang, der Elefant trat mit entsetzlichem
Brüllen vor, hob drohend seinen Rüssel über den Fabricius; aber dieser
wandte sich ganz gelassen um und sagte lächelnd zu Pyrrhos: „Vor diesem
Elefanten fürchte ich mich nicht.“ — In der Schlacht bei Asculum
mußten die Römer ebenfalls der Gewalt der Elefanten weichen. Auch
bei Beneventum wurden die Römer von den Elefanten der Pyrrhos hart
mitgenommen, trieben sie aber doch endlich mit Pfeilen und Wurfspießen
zurück, errangen einen ruhmvollen Sieg und Pyrrhos mußte Italien
verlassen. — Späterhin unternahm Pyrrhos einen Kriegszug gegen Argos.
Er drang heimlich bei Nacht in die Stadt, deren Tor ihm Aristeas
öffnete, und besetzte den Marktplatz. Im Tore hatte er, weil es nicht
hoch genug war, seinen Elefanten die Türme müssen abnehmen lassen,
wobei es ohne Lärm und Zeitverlust nicht abging, so daß die Besatzung
der Stadt eilig die festesten Plätze besetzte. Daraufhin kam es in den
Straßen zu einem mörderischen Kampfe. Pyrrhos mußte weichen, seine
Leute gerieten am Tor furchtbar ins Gedränge und in Verwirrung. Gerade
im Tor lag der größte von Pyrrhos’ Elefanten, schrie entsetzlich und
versperrte den Rückweg. Währenddem suchte ein anderer Elefant, welcher
Nikon hieß, seinen Führer, welcher schwer verwundet heruntergefallen
war. Das Tier rannte wie unsinnig umher und warf Freund und Feind über
den Haufen. Endlich fand er den Führer, hob ihn mit dem Rüssel und den
Zähnen empor, stürzte sich mitten unter die Leute des Pyrrhos, so daß
sich diese in der engen Straße zu einer dichten, ganz unbehilflichen
Masse zusammendrängten, in der jeder von seinen Nach[S. 257]barn gestoßen,
niedergeworfen und verwundet wurde, während auch die Feinde von allen
Seiten schossen und warfen. Endlich wollte Pyrrhos der Verwirrung ein
Ende machen, stürzte hoch zu Roß mitten unter die Feinde; aber ein
armes, altes Weib, das auf dem Dache stand, warf ihm einen Ziegelstein
aufs Genick, worauf er ohnmächtig niedersank. Die Feinde packten ihn
und hieben ihm den Kopf ab.“ Es war dies im Jahre 272 v. Chr.
Was in der Folge aus den indischen Elefanten Alexanders des Großen
geworden ist, wissen wir nicht. Aber jetzt traten auch die größten
Nebenbuhler Roms in der Herrschaft über das Mittelmeer, die Karthager,
auf, und auch diese kämpften mit Vorliebe mit Elefanten, die sie
aber jedenfalls nicht aus Indien bezogen, sondern aus einheimischem
Materiale gezähmt hatten. In allen größeren Schlachten, die sie in der
Folge den Römern lieferten, traten sie in Aktion und ein Teil derselben
machte, wie früher erwähnt, Hannibals berühmten Zug von Spanien nach
Norditalien über die Pyrenäen und die Alpen mit; dabei kamen aber alle
teils unterwegs, teils in den Schlachten in Oberitalien um. Von einem
dieser afrikanischen Kriegselefanten der Karthager teilt uns Plinius
folgende Episode mit: „Berühmt ist der Kampf eines Römers gegen einen
Elefanten, als Hannibal die römischen Gefangenen gegeneinander zu
fechten zwang. Den einzigen, welcher dabei mit dem Leben davonkam,
warf er einem Elefanten vor, versprach ihm aber die Freiheit, wenn
er siegen würde. Der Römer schlug sich allein auf dem Schauplatz mit
dem Elefanten und machte ihn zum großen Ärger der Karthager glücklich
nieder. Hannibal ließ nun zwar den Sieger frei, schickte ihm aber
Reiter nach, die ihn niederhauen sollten, damit er nicht durch die
Erzählung seiner Tat die Elefanten (bei seinen Landsleuten) verächtlich
machen könne.“
Von diesen afrikanischen Kriegselefanten der Karthager berichtet uns
der römische Geschichtschreiber Livius: „Als Hannibal (im Sommer
218) durch Gallien nach Italien zog, brachte er seine Elefanten
folgendermaßen über die Rhone: Er baute eine Fähre von 100 Fuß
Länge und 50 Fuß Breite, ließ sie mit Erde bedecken; so gingen die
Elefanten, als wären sie auf festem Boden, darauf. Die Fähre wurde
dann von Ruderschiffen aufs jenseitige Ufer gezogen. Sowie die Fähre
auf dem Wasser zu schwanken begann, wurden die Elefanten unruhig, die
meisten drängten sich in der Mitte zusammen, einige wurden aber wild,
stürzten sich ins Wasser und warfen dabei ihre Führer ab, gelangten
aber doch auch ans jenseitige Ufer.“ — „Hasdrubal, der Bruder des[S. 258]
Hannibal, war diesem (im Jahre 207) zu Hilfe über die Alpen gezogen
und lieferte den römischen Konsuln Claudius und Livius eine Schlacht.
Seine Elefanten brachten anfangs die Römer in Unordnung; als aber der
Kampf und Lärm zunahm, verloren sie die Geistesgegenwart, rannten
zwischen beiden Heeren hin und her und wurden meist, damit sie ihrer
eigenen Armee nicht schaden könnten, von ihren Führern getötet. Diese
hatten nämlich einen scharfen Stahlmeißel, den sie dem Tiere, wenn es
gefährlich wurde, mit einem Hammerschlag zwischen den Kopf und den
vordersten Halswirbel trieben, worauf es augenblicklich niedersank.“
Es war dies in der Schlacht am Metaurus, wo Hasdrubal Sieg und Leben
verlor. — „Bei Zama (südwestlich von Karthago, wo Hannibal im Jahre
202 von Scipio, der davon den Ehrenbeinamen Africanus erhielt) besiegt
wurde, hatte Hannibal vor seinem Heere 80 Elefanten aufgestellt;
so viele hatte er früher in keiner Schlacht gehabt. Als aber die
Schlacht begann und die römischen Trompeten und Signalhörner ihnen
entgegenschmetterten, wandten sich die Elefanten größtenteils gegen ihr
eigenes Heer, und auch die wenigen, welche grimmig unter den Römern zu
hausen begannen, wurden endlich zurückgetrieben.“
Erst Mithridates VI., der Große, König von Pontos, der 120
seinem Vater folgte und im Jahre 88 ganz Kleinasien eroberte, wo er
alle Römer, 80000 an der Zahl, ermorden ließ, dann in drei langen
Kriegen mit zäher Ausdauer gegen das immer mächtiger werdende Rom
ankämpfte, um schließlich doch zu unterliegen, hat wieder Elefanten,
die er sich aus Indien kommen ließ, gegen die Römer geführt. In der
Folge kamen nicht selten diese Tiere, teilweise als Kriegsbeute, nach
der Stadt Rom, wo sie zur Belustigung des Volkes im Zirkus auftreten
und gegen allerlei Gegner kämpfen mußten. Im Bürgerkriege zwischen
Julius Cäsar und seinen Mitbewerbern spielten sie dann ebenfalls eine
Rolle. So schreibt Cäsar selbst in seiner Schilderung des Krieges in
der Provinz Afrika, dem heutigen Tunis, daß, als er nach Besiegung
des Pompejus bei Pharsalos im Jahre 48 den Krieg in Afrika gegen die
Pompejaner unter Scipio fortsetzte, dieser bei seinem Heere außer
seinen eignen (etwa 60) 30 zweifellos afrikanische Elefanten hatte,
die ihm König Juba nebst einer größeren Truppenmacht zur Verfügung
gestellt hatte. Jeder dieser Elefanten habe, wenn es zum Kampfe ging,
einen Turm getragen. Diese Elefanten seien aber noch nicht eingeübt
gewesen; deshalb suchte Scipio sie noch besser einzuüben, indem er sie
in Schlachtreihe aufstellen und von seinen[S. 259] eigenen Leuten mit Steinen
bombardieren ließ. Nahmen sie daraufhin Reißaus, so standen hinter
ihnen ebenfalls Leute, die sie mit noch größeren Steinen traktierten.
Er bemerkt, daß dieser Versuch zur Abrichtung keinen großen Wert
gehabt habe, indem sie sich in der Schlacht dann doch nicht bewährten.
Überhaupt bedürfe der Elefant für den Krieg einer Dressur von vielen
Jahren und bleibe auch dann noch seiner Armee gefährlich. Als dann
Cäsar merkte, daß sich seine Leute vor den Elefanten fürchteten,
ließ er sogleich Elefanten aus Italien kommen, „damit sich die Leute
und Pferde an solche große Bestien gewöhnen könnten. Er ließ diesen
auch ihre volle Rüstung anlegen, zeigte die Stellen, wo ihnen mit
Waffen beizukommen war, und ließ mit Speeren, an deren Spitze ein
Ball steckte, nach ihnen werfen. — In der Entscheidungsschlacht
bei Thapsus (46 v. Chr.) wurden Scipios Elefanten durch Pfeile und
geschleuderte Steine schnell zum Weichen gebracht, stürzten sich auf
ihre eigenen Leute, traten sie nieder und flüchteten ins Lager. Bei
dieser Gelegenheit zeigte ein Veteran der fünften Legion großartigen
Mut. Ein verwundeter Elefant hatte in seiner Wut einen waffenlosen
Markedenter angefallen, niedergeworfen, zertreten und machte dabei mit
drohend gehobenem Rüssel ein gellendes Geschrei. Der Veteran wollte
dem unglückseligen Markedenter zu Hilfe eilen; aber der Elefant ließ
von der Leiche ab, packte den neuen Feind mit dem Rüssel und hob ihn
hoch in die Luft. Dieser hieb und schnitt aber mit seinem Schwerte so
kräftig auf den Rüssel los, daß ihn der Elefant, der den Schmerz nicht
ertragen konnte, fallen ließ und die Flucht ergriff. — Die Zahl der
Elefanten, die Cäsar bei Thapsus erbeutete, betrug 86.“
In seiner Naturgeschichte berichtet Plinius: „Schon in den Gefechten
gegen Pyrrhos brachte man in Erfahrung, daß man den Rüssel der
Elefanten leicht abhauen kann. Fenestella erzählt, daß die ersten
Elefanten in der Rennbahn zu Rom im Jahre 655 der Stadt (98 v. Chr.),
als Claudius Pulcher Ädil war, gekämpft haben; 20 Jahre später, als
Lucius und Marcus Lucullus Ädilen waren, kämpften sie gegen Stiere.
Während des zweiten Konsulats des Pompejus (55 v. Chr.) kämpften 20
Elefanten zur Einweihung des Venustempels gegen Gätuler (Nomadenvolk in
Nordafrika), die mit Wurfspeeren bewaffnet waren. Einer der Elefanten
zeichnete sich dabei vorzüglich durch Tapferkeit aus: seine Beine waren
durchbohrt, da kroch er auf den Knien gegen die feindlichen Massen,
riß ihnen die Schilde weg und warf sie hoch in die Luft. Ein anderer
dagegen wurde durch[S. 260] einen einzigen Wurf getötet, indem der Speer
durchs Auge ins Gehirn drang. Obgleich der Platz mit eisernen Gittern
umgeben war, so versetzten sie doch das Volk in große Angst, indem sie
mit Macht durchzubrechen versuchten. Deshalb umgab auch späterhin der
Diktator Cäsar, als er ein ähnliches Schauspiel geben wollte, den Platz
mit Wassergräben. Die erwähnten Elefanten des Pompejus verloren endlich
die Hoffnung, entrinnen zu können, und suchten nun in einer Stellung,
die sich nicht begreifen läßt, jammernd und weinend das Mitleid des
Volkes zu erregen. Das Volk wurde durch den Ausdruck ihrer Verzweiflung
so gerührt, daß alle einmütig sich jammernd erhoben und, ohne darauf
zu achten, daß Pompejus ihnen zu Ehren das prachtvolle Schauspiel
gegeben hatte, ihn mit Verwünschungen überhäuften, deren Folgen auch
bald genug eintraten. (Es ist dies eine Anspielung auf seine Niederlage
in Pharsalos am 9. August 48 und seine Ermordung am 29. September
desselben Jahres in Ägypten.)
Späterhin ließ der Diktator Cäsar 20 Elefanten gegen 500 Fußgänger
kämpfen, und ein anderes Mal ebensoviel, auf denen Türme standen, aus
denen zusammen 60 Kämpfer gegen 500 Fußgänger und ebensoviel Reiter
fochten. Unter den Kaisern Claudius und Nero mußten die Fechter ihr
Meisterstück zeigen, indem sie einzeln gegen Elefanten kämpften.
Dieses mutige Tier ist andererseits aber auch sehr gutmütig gegen
schwächere und schiebt, z. B. in einer Viehherde, was ihm begegnet, mit
dem Rüssel zur Seite, um es nicht unversehens zu zertreten. Schaden
tut der Elefant nur, wenn er gereizt wird. In der Wildnis gehen sie
herdenweise, nie gern allein. Werden sie von Reitern umringt, so nehmen
sie die Schwachen, Matten oder Verwundeten in die Mitte und fechten,
als ob es nach bestimmten Kriegsregeln geschähe. Sind sie gefangen, so
werden sie durch Gerstensaft leicht gezähmt.
In Indien werden die Elefanten gefangen, indem man auf einem
gezähmten ausreitet und von diesem einen einzelnen oder von der Herde
weggetriebenen wilden schlagen läßt; ist dieser davon ermattet, so
steigt man auf ihn und lenkt ihn ebenso wie den zahmen. In Afrika
fängt man sie in Gruben; doch wenn einer hineinfällt, so kommen gleich
die andern zu Hilfe, werfen Äste und Erdmassen hinein und suchen ihn,
wenn möglich, herauszuziehen. Früherhin fing man sie, um sie als
Haustiere zu benutzen, indem man die Herden in eigens dazu bereitete
Schluchten ohne Ausgang trieb und sie dort durch Hunger bändigte.
Nahmen sie einen hingehaltenen Zweig an, so war das ein Zeichen[S. 261]
ihrer Unterwürfigkeit. Jetzt erlegt man sie der Zähne wegen und zielt
nach ihren Füßen, weil diese leicht verwundbar sind. Die Troglodyten
(Höhlenbewohner), welche neben den Negern wohnen, leben nur von dieser
Jagd. Sie besteigen am Wege der Elefanten stehende Bäume, passen dem
letzten von der Herde auf, fassen mit der Linken den Schwanz, schlingen
die Beine um den linken Schenkel und, indem sie so hängen, zerhauen
sie dem Tiere die eine Kniekehle mit einem scharfen Beile, springen
herab und zerhauen ihm mit der größten Geschwindigkeit auch noch die
andere. Manche bedienen sich eines weniger gefährlichen, aber nicht so
gewissen Mittels: In einiger Entfernung halten kraftvolle Jünglinge
einen ungeheuren Bogen, andere spannen ihn mit großer Anstrengung an,
schießen dann damit ihre Speere auf die vorübergehenden ab und folgen
dann der blutigen Spur. Die weiblichen Elefanten sind viel feiger
als die männlichen. Manchmal werden sie rasend, und man bändigt sie
dann durch Hunger und Prügel, wobei man sie durch andere Elefanten
fesseln läßt. In Indien hält man ganze Herden davon, wie bei uns die
Kuhherden. Gezähmte Elefanten werden zum Kriege verwendet, tragen
mit Soldaten besetzte Türme und entscheiden im Morgenlande meistens
die Schlachten. Sie werfen Schlachtreihen nieder und zerstampfen die
Bewaffneten. Sind sie verwundet oder in Furcht versetzt, so weichen
sie immer zurück und fügen ihrer eigenen Partei oft ebensoviel
Schaden zu als dem Feinde. Das geringste Grunzen oder Quieksen eines
Schweins kann sie erschrecken. Die afrikanischen Elefanten fürchten
sich vor den indischen, letztere sind auch größer.“ Dies mag für die
nordafrikanischen richtig sein, nicht aber für die südlich der Sahara
lebenden. Tatsächlich war die Elefantenrasse der Mittelmeerländer
kleiner als selbst die indischen Elefanten sind, und gab es einst
auf den Inseln des Mittelmeers, z. B. auf Malta, eine eigentliche
Zwergrasse, von der mehrfach Skelettknochen ausgegraben wurden.
Unzählige falsche und wahre Angaben durcheinander erzählt Plinius in
seiner Naturgeschichte über den Elefanten. So sagt er, daß er 200–300
Jahre leben könne, im 60. Jahre aber am kräftigsten sei; daß die
Elefanten gern an Flüssen leben, obschon sie nicht schwimmen können;
daß sie am liebsten Baumfrüchte, besonders solche von Palmen, aber auch
Erde und selbst Steine fräßen. „Sie kauen mit dem Munde, atmen, trinken
und riechen aber mit dem Rüssel. Kein Tier scheuen sie so sehr als die
Maus, lassen auch das Futter liegen, das von einer solchen berührt
wurde. Große Not haben sie, wenn ihnen beim[S. 262] Saufen ein Blutegel in den
Rüssel kommt; dieser saugt sich hier fest und bewirkt unerträgliche
Schmerzen. Am Rücken ist ihre Haut am härtesten, am Bauche dagegen
weich. Sie haben keine Haarbedeckung und können nicht einmal mit dem
Schwanze die Fliegen abwehren, von denen sie trotz ihrer gewaltigen
Größe geplagt werden. Ihr Geruch zieht die Fliegen an. Ihre Haut hat
tiefe Runzeln; die Fliegen setzen sich in die Vertiefungen. Aber
plötzlich zieht sich die Haut zusammen und erdrückt die lästigen Gäste.
Das Elfenbein hat einen großen Wert und wird besonders für Bildsäulen
der Götter gesucht. Auch der Rüssel gewährt Leckermäulern eine
angenehme Speise, vielleicht nur deswegen, weil sie sich einbilden,
Elfenbein zu schmausen. Polybius berichtet, auf die Aussage des Königs
Gulussa gestützt, daß man im äußersten Afrika die Elefantenzähne in
Wohnungen als Pfosten benutzt und sie bei Umzäumungen statt der Pfähle
einsetzt.“
In Indien seien die größten Elefanten, die mit ungeheuer großen
Drachen in Feindschaft leben. Ihr kaltes Blut locke bei der Hitze die
Drachen an, die sich im Wasser des Flusses, an welchem der Elefant
zur Tränke komme, verbergen und ihm auflauern. Sobald er zu trinken
beginne, stürzen sie sich auf ihn, umschlingen seinen Rüssel und
beißen ihn ins Ohr, weil dieser Teil allein mit dem Rüssel nicht
verteidigt werden kann. Die Drachen sind so groß, daß sie den ganzen
Elefanten aussaugen können; dieser stürzt dann, alles Blutes beraubt,
zu Boden und erdrückt im Fallen den betrunkenen Feind. „Der Elefant
ist das größte und an Klugheit dem Menschen zunächststehende Tier. Er
versteht die Landessprache, gehorcht den Befehlen, ist seiner Pflichten
eingedenk, sucht sich Liebe und Ruhm zu erwerben, ja, was selbst bei
Menschen selten vorkommt, er ist brav, vorsichtig, gerecht und verehrt
die Sterne, die Sonne und den Mond. Man erzählt, daß in Mauretanien
(Marokko) ganze Herden von Elefanten beim Erscheinen des Neumonds in
den Fluß hinabsteigen, sich dort feierlich reinigen, den Mond begrüßen
und dann wieder in die Wälder zurückkehren, indem sie die ermatteten
Jungen vor sich hertragen. Auch die religiösen Gebräuche der Menschen
scheinen sie zu kennen; denn sie besteigen kein Schiff, bis ihnen der
Kapitän durch einen Eid die Rückkehr zugesichert hat. Man hat kranke
Elefanten gesehen, die sich auf den Rücken legten und Gras gen Himmel
warfen, als ob sie ihr Gebet durch die Fürsprache der Erde unterstützen
wollten. Sie lernen übrigens ihre Knie vor Königen beugen und Kränze
darreichen. In Indien braucht man die Kleinen zum Ackern. In Rom wurden
sie zum erstenmal[S. 263] vor den Wagen gespannt, als Pompejus der Große über
Afrika triumphierte. Bei den Fechterspielen des Germanicus machten
sie einige tölpelhafte Bewegungen, als ob sie tanzten. Sie lernten
nun häufig Waffen in die Luft werfen, gleich Fechtern miteinander
kämpfen, Tänze ausführen und endlich sogar auf Seilen gehen, wobei
oft vier einen fünften in der Sänfte trugen. Auch sah man sie sich
in Speisesälen, die voller Gäste waren, zu Tische legen, ohne einen
Menschen zu berühren.
Es ist eine ausgemachte Sache, daß ein Elefant, der die Sache nicht
recht begreifen konnte und öfters Prügel bekam, des Nachts seine
Künste eingeübt hat. Es ist schon bewundernswert, daß die Elefanten
aufwärts auf Seilen gehen lernen, aber daß sie auch abwärts gehen,
ist noch merkwürdiger. Mutianus, der dreimal Konsul war, erzählt, daß
ein solcher sogar griechische Buchstaben gelernt und folgende Worte
geschrieben habe: ‚Ich selbst habe dies geschrieben und erbeutete
keltische Waffen geweiht‘; auch habe er selbst gesehen, daß diejenigen,
welche zu Puteoli ausgeschifft wurden, rückwärts ans Land gingen, um
sich über die Länge der Brücke zu täuschen, die vom Lande zum Schiffe
führte und der sie nicht recht trauten.
Sie wissen recht gut, daß man ihnen der Stoßzähne wegen nachstellt,
daher vergraben sie die, welche durch Zufall oder im Alter ausfallen.
(Die Tatsache, daß bisweilen fossile Elefantenstoßzähne im Boden
gefunden werden, wird Plinius zu dieser Annahme geführt haben.) Jene
Zähne allein geben das Elfenbein; aber soweit sie im Fleische verborgen
stecken, sind sie nicht besser als Knochen (d. h. innen hohl und nicht
massiv wie vorn). Um ihre Stoßzähne sind sie sehr besorgt; die Spitze
des einen schonen sie, um ihn als Waffe benutzen zu können, den andern
brauchen sie, um Wurzeln aus dem Boden zu wühlen, Mauern einzustoßen
und dergleichen mehr. Werden sie von Jägern umringt, so stellen sie
diejenigen in die erste Schlachtreihe, welche die kleinsten Zähne
haben, damit man glauben soll, die Beute sei nicht der Mühe wert;
ermatten sie im Kampfe, so zerstoßen sie die Zähne an Bäumen und lassen
sie gleichsam als Lösegeld zurück.
Es ist wunderbar, daß die meisten Tiere wissen, weshalb man ihnen
nachstellt und wovor sie sich zu hüten haben. Begegnet ein Elefant in
der Einsamkeit einem harmlos herumwandelnden Menschen, so soll er ihm
freundlich und gefällig den Weg zeigen; bemerkt er aber den Fußtritt
eines Menschen eher als den Menschen selbst, so bleibt er stehen,
wittert, blickt umher, schnaubt vor Wut, zertritt aber[S. 264] die Fußspur
nicht, sondern hebt sie aus, gibt sie dem nächsten, dieser wieder
dem nächsten usw., worauf die Herde eine Schwenkung vollführt und in
Schlachtordnung aufmarschiert.
Stets gehen die Elefanten herdenweise, und zwar geht der älteste voran,
während der dem Alter nach folgende den Nachtrab bildet. Wollen sie
durch einen Fluß setzen, so schicken sie die kleinsten voran, weil die
Großen durch ihre Schwere das Flußbett vertiefen würden. Als König
Antiochus einen Fluß durchschreiten wollte, weigerte sich der Elefant,
der bis dahin den Zug geführt hatte und Ajax hieß, voranzugehen. Da
wurde bekanntgemacht, derjenige solle künftig der Anführer sein, der
zuerst hinüberginge; und siehe da, der Elefant Patroklus schritt
hindurch, und ward deshalb mit silbernem Kopfschmuck, den sie sehr
lieben, geziert und zum Anführer gewählt. Der frühere Anführer aber
wollte seine Schande nicht überleben und hungerte sich zu Tode.
Überhaupt wissen sie sehr gut, was rühmlich und was schimpflich ist.
Kämpfen sie gegeneinander, so reicht der Besiegte dem Sieger Erde und
Gras dar (wie dies bei den Menschen des Altertums Sitte war, wodurch
sich der Betreffende für überwunden erklärte) und flieht dann schon vor
dessen Stimme.
Die Elefanten leben in treuer Ehe und man findet also bei ihnen die
verderblichen Wettkämpfe nicht, welche andere Tiere um die Weibchen
vollführen. Sie haben bisweilen eine große Zuneigung zu bestimmten
Menschen, wie denn z. B. einer in Ägypten eine Blumenhändlerin geliebt
haben soll. Ein anderer liebte den Jüngling Menander im Heere des
Ptolemäus und fastete aus Sehnsucht, so oft der Jüngling abwesend war.
Juba erzählt auch von einer Salbenhändlerin, die von einem Elefanten
geliebt wurde. Alle zeigten ihre Liebe durch unbeholfene Liebkosungen,
freuten sich beim Wiedersehen und bewahrten Geschenke, welche sie
bekamen, auf, um sie ihrem Lieblinge darzubringen.
Daß sie Gedächtnis haben, zeigte sich deutlich in einem Falle, wo
ein Elefant seinen Führer, den er seit langen Jahren nicht gesehen,
sogleich wieder erkannte. Daß sie wissen, was Unrecht ist, zeigte sich
dagegen in folgendem Falle: Als König Bokchus 30 Menschen hatte an
Pfähle binden lassen und ihnen 30 Elefanten gegenübergestellt hatte,
welche sie zerfleischen sollten, so konnten die Elefanten doch nicht
dazu gebracht werden, dem Tyrannen den Willen zu tun, obschon sie von
zwischen den Pfählen aufgestellten Leuten gereizt wurden.“
Schon zu Ende der Republik sah man nicht selten Elefanten bei
Prunkzügen einhermarschieren, um dem Volk zu imponieren und ihm[S. 265]
eine interessante Augenweide zu bereiten. So berichtet der römische
Geschichtschreiber Suetonius: „Als Julius Cäsar über Gallien
triumphierte (im Jahre 51), stieg er beim Schein der Fackeln aufs
Kapitol, indem 40 Elefanten, zu seiner Linken und Rechten verteilt, die
Leuchter trugen.“ Das war damals ein ganz ungewohntes Schauspiel, mit
dem Cäsar jedenfalls großes Aufsehen erregte, worauf es ihm ja ankam.
Auch später wurde der Elefant gelegentlich von römischen Kaisern und
Triumphatoren bei ihrem feierlichen Einzuge in Rom und als Auszeichnung
auch sonst zum Ziehen von Prunkwagen verwendet. So eröffneten nach
Flavius Vopiscus beim Triumph des Kaisers Aurelianus über Zenobia,
die Herrscherin von Palmyra, im Jahre 274 n. Chr. 20 Elefanten den
Zug. Als Mesitheus, der Feldherr Kaiser Gordians III. (238–244), im
Jahre 242 einen glänzenden Sieg über die mächtigen Perser erfochten
hatte, erkannte der Senat in Rom dem Gordian Elefantenviergespanne zu,
womit er triumphieren könne, und dem Mesitheus ein Pferdeviergespann.
Das war damals eine besondere Ehrung. Der Geschichtschreiber Julius
Capitolinus, der uns dies berichtet, fügt dem bei, es habe damals
in Rom 32 Elefanten gegeben, die ständig bei feierlichen Aufzügen
zu sehen waren. Hatte doch schon Kaiser Heliogabalus (218–222) nach
seinem Biographen Älius Lampridius vier Wagen, an deren jeden er vier
Elefanten spannte. So sei er auf dem Vatikan herumgefahren und habe
zuvor zu diesem Zwecke den Platz erst ebnen lassen.
Im Zirkus wurden öfter Elefanten gezeigt, die mit anderen Tieren
kämpfen oder allerlei Kunststücke, die sie gelernt hatten, vorführen
mußten. So mußte der Elefant sich besonders mit dem Nashorn messen und
sich, wenn möglich, von ihm den Bauch aufschlitzen lassen. Seneca,
der Lehrer Neros, schreibt in einer seiner philosophischen Schriften:
„Lucius Sulla ließ zuerst im Zirkus Löwen kämpfen, die nicht angebunden
waren, Pompejus 18 Elephanten; Metellus führte, als er die Karthager
in Sizilien besiegt hatte, im Triumphe 120 gefangene Elefanten auf.“
Gelegentlich ließ sich selbst ein Kaiser herab, um einen dieser Riesen
vor allem Volke zu fällen. So schreibt Älius Lampridius in seiner
Biographie des Commodus, des Sohnes Marc Aurels und der Faustina,
der jenem 180 n. Chr. auf dem Throne folgte, alle nur erdenkbaren
Laster besaß, wollüstig, grausam und feig war, Ämter und Ehrenstellen
an die Meistbietenden verkaufte, den Staatsschatz durch unsinnige
Verschwendung erschöpfte, die Regierung des Reichs Günstlingen überließ
und schließlich am 31. Dezember 192 auf An[S. 266]stiften seiner Geliebten
Marcia, erst 31jährig, erdrosselt wurde: „Kaiser Commodus war ungeheuer
stark und fand ein besonderes Vergnügen daran, bei den öffentlichen
Spielen gegen Gladiatoren und gegen wilde Tiere zu kämpfen, ja er
tötete bei solcher Gelegenheit selbst mehrere Elefanten.“ Indische und
afrikanische Elefanten traten nicht selten als Künstler auf, schrieben
in Sand, gingen auf einem schräg gestellten Seile auf und ab. Acht
derselben trugen zu viert auf einer Sänfte einen anderen, tanzten nach
dem Takte, speisten von prächtig besetzter Tafel aus kostbarem Geschirr
mit Beobachtung der feinen Sitte und des Anstandes und vollführten
zahlreiche andere Künste. Der griechische Schriftsteller Oppianos
schrieb ums Jahr 200 n. Chr.: „Der Elefant ist das größte Landtier und
sieht aus wie ein Berg oder eine gewitterschwere Wolke. Seine Nase ist
ungeheuer lang und schlank und dient ihm als Hand. Im wilden Zustande
ist er grimmig, gezähmt dagegen sanft und menschenfreundlich. Wenn er
dazu abgerichtet ist, schreitet er nach dem Takte des Flötenspiels bald
langsam, bald schnell, wie tanzend, einher. Als Germanicus Cäsar (der
Adoptivsohn des Kaisers Tiberius) den Römern Schauspiele gab, waren von
Elefanten, die man in Rom hielt, Junge gezogen worden und diese nahm
ein tüchtiger Lehrmeister in Unterricht. Sie wurden an Flötenspiel,
Trommelschlag und Gesang gewöhnt und lernten die Glieder bewegen, wie
wenn sie tanzten. Als nun der Tag der Schauspiele erschien, traten
sie, zwölf an Zahl, mit bunten Tanzkleidern geschmückt, auf, gingen
mit zierlichen Schritten einher, wiegten dabei den Leib recht fein
hinüber und herüber, formierten auf Befehl des Meisters eine Linie,
einen Kreis, schwenkten rechts und links. Sie streuten Blumen umher,
ließen sich auf schöne Kissen, die für sie hingelegt waren, nieder,
fraßen mit großer Bescheidenheit von Tischen, die aus kostbarem Holz
der Sandarakzypresse (citrum, aus dem Atlasgebirge bezogen) und
aus Elfenbein angefertigt waren, und tranken bescheiden aus goldenen
und silbernen Bechern. Ich habe auch selbst einen Elefanten gesehen,
der mit dem Rüssel römische Buchstaben ganz regelmäßig auf eine Tafel
schrieb; dabei führte ihm jedoch der Meister den Rüssel.“
Auch der griechische Schriftsteller Plutarch (50–120 n. Chr.) schreibt:
„Auf dem Theater führen die Elefanten sehr künstliche Stücke auf.
Es ist auch neulich vorgekommen, daß einer, der das zu Lernende
nicht recht begreifen konnte, es von selbst bei Nacht einübte.
(Weshalb sollte nicht dieses Tier gelegentlich für sich selbst die
ihm beigebrachten Kunststücke ausführen?) In Rom wurde einmal einer
von Knaben geneckt[S. 267] und in den Rüssel gestochen. Er ergriff einen
derselben, hob ihn hoch empor, tat, als wolle er ihn zerschmettern,
setzte ihn dann aber ruhig wieder hin, weil er dachte, jener hätte
schon an der ausgestandenen Angst genug. Nach Jubas Angabe decken die
Jäger die Gruben, worin sie Elefanten fangen wollen, mit Reisig und
Erde zu. Ist aber einer hineingefallen, so füllen die anderen die Grube
so weit, daß er wieder herauskann. Er schreibt auch, daß die Elefanten
Gelübde tun und mit aufgehobenem Rüssel die Sonne anbeten.“ Sueton
schreibt: „Bei den Spielen, die Nero gab, ritt ein allgemein bekannter
römischer Ritter auf einem Elefanten, der auf einem ausgespannten Seile
ging,“ und ferner: „Kaiser Galba (der im Juni 68 von den gallischen
Legionen gegen Nero zum Kaiser erhoben, aber schon am 15. Januar 69 von
den wegen seiner Knauserigkeit erzürnten Prätorianern getötet wurde)
zeigte bei den Spielen Elefanten, welche auf Seilen gingen.“ Selbst
als Opfer wurden sie bei besonders wichtigen Anlässen den Göttern
dargebracht. Gelegentlich wurden solche nur gelobt und in Wirklichkeit
durch Nachahmungen ersetzt, da die Originale den Opfernden denn doch zu
kostbar sein mochten. So schreibt Älian: „Als Ptolemäos Philopator den
Antiochos besiegt hatte, veranstaltete er eine prachtvolle Opferfeier
und wollte auch dem Gotte Helios vier herrliche Elefanten als Zeichen
seiner großen Verehrung darbringen. Daraufhin träumte aber Ptolemäos,
dem Gotte schiene das Opfer befremdlich und unangenehm. Er weihte ihm
also, statt der vier wirklichen Elefanten, vier aus Erz gegossene.“
Nach den Berichten der alten Autoren müssen die orientalischen Fürsten
im Altertum noch mehr Elefanten als heute besessen haben; sie waren
eben damals noch nicht so dezimiert und konnten leichter gefangen
werden. Plinius berichtet darüber: „Am Ganges hat der König der
Kalinger, dessen Hauptstadt Protalis ist, 60000 Mann Fußvolk, 1000
Mann zu Pferde, 700 Elefanten, die alle stets schlagfertig sind. Es
gibt daselbst eine eigene Menschenkaste, die sich mit Fang und Zähmung
des Elefanten beschäftigt. Mit diesen Tieren pflügen sie, auf ihnen
reiten sie, mit ihnen kämpfen sie fürs Vaterland. — Der König der
Thaluter hält 50000 Mann Infanterie, 4000 Mann Kavallerie und 400
Kriegselefanten. — Das Volk der Andarer hat 30 mit Mauern und Türmen
befestigte Städte, stellt 100000 Mann Infanterie, 2000 Mann Kavallerie
und 1000 Elefanten. — Das mächtigste Volk in ganz Indien sind die
Prasier, deren große und reiche Hauptstadt Palibothra heißt. Ihrem
Könige dienen 600000 Mann Infanterie,[S. 268] 30000 Mann Kavallerie und 9000
Elefanten; diese ganze Macht wird Tag für Tag besoldet. — Am Indus
hält der König der Megaller 500 Elefanten; — die Asmarer, in deren
Land es auch von Tigern wimmelt, haben 30000 Mann Infanterie, 800
Reiter und 300 Elefanten. — Die Orater haben nur 10 Elefanten, aber
viel Fußvolk. — Die Suaratarater unterhalten im Vertrauen auf ihre
eigene Tapferkeit gar keine Elefanten. Der König der Horaker unterhält
150000 Mann Infanterie, 5000 Mann Kavallerie und 1600 Elefanten.
— Der König der Charmer hat 60 Elefanten. — Das Volk der Pander,
das einzige in Indien, das stets von einer Königin beherrscht wird,
stellt 150000 Mann Infanterie und 500 Elefanten.“ — Woher Plinius
diese Zahlenangabe hatte, ist uns unbekannt. Sind sie auch jedenfalls
stark übertrieben, so ist doch kein Zweifel darüber möglich, daß die
indischen Fürsten damals sich in der Kriegsführung wesentlich auf ihre
Elefanten verließen und große Scharen davon unterhielten. Aus dem
8. und 9. Jahrhundert n. Chr. wissen wir, daß die indischen Fürsten
2000 bis 3000 Kriegselefanten zur Verfügung hatten. Der Venetianer
Marco Polo, der, erst 15jährig, mit seinem Vater Niccolo und seinem
Oheim Maffeo Polo 1271 zu dem Tatarenchan Kublai nach Zentralasien
reiste, meldet, dieser habe 5000 Elefanten besessen, die er zum Kriege
gebrauchte. Im 16. Jahrhundert besaß der Großmogul Akbar, d. h. der
sehr Große (eigentlich hieß er Dschelal eddin Muhammed), der mächtige
Herrscher über Hindustan, ein Nachkomme Timurs, der von 1556–1608
regierte, nach den Angaben seines Vesirs Abul Fazl 6000 Elefanten. Der
mächtige Schah Jehangir soll ihrer 12000 und seine Vasallen zusammen
40000 besessen haben. Im 17. Jahrhundert fand Tavernier, daß der zu
Gehanabad residierende Großmogul 500 Elefanten zum Lasttragen und 80
zum Kriege benutzte. Seit der allgemeinen Verbreitung der Feuerwaffen
wurde aber der Elefant, der sich vor jenen fürchtet, immer weniger zu
Kriegszwecken benutzt und ist heute in Indien mehr ein Luxustier, das
wesentlich nur noch zur Jagd und bei festlichen Aufzügen Verwendung
findet. In Hinterindien dagegen wird es in ausgedehntem Maße als
Arbeitstier beim Transport der schweren Stämme von Tiek- und anderem
Nutzholz verwendet.

Bild 41. Darstellung eines Mammuts durch einen Jäger der
frühen Nacheiszeit in der südfranzösischen Höhle von Combarelles.
(1⁄19 natürl. Größe.)
[S. 269]
Während früher der rezente Elefant ausschließlicher Lieferant des
seit dem hohen Altertum zu Schnitzereien und Geräten aller Art sehr
beliebten Elfenbeins war, kommen in neuerer Zeit mit der Erschließung
des noch vielfach von der letzten Eiszeit her vereisten nordöstlichen
Sibirien auch die gewaltigen Stoßzähne des ausgestorbenen Mammut
(Elephas primigenius) als fossiles Elfenbein in den Handel.
Der russische Reisende Middendorf schätzte die Zahl aller seit der
Besiedelung durch die Russen von dort ausgeführter Mammutstoßzähne
als von etwa 20000 Tieren stammend. Jährlich kommen wenigstens 100
Paar Stoßzähne in den Handel. Dabei sind sie noch so gut erhalten,
daß kein Unterschied darin bemerkbar ist, ob das Elfenbein rezent
oder fossil ist. Mit diesem fossilen Elfenbein aus dem hohen Norden
Asiens allein werden wir auszukommen haben, wenn einmal der Elefant
als Wildling ausgerottet sein wird und die letzten Exemplare desselben
in völligem Dienste des Menschen oder in einigen Reservationen unter
menschlichem Schutze das Gnadenbrot bekommen werden. Diesen fossilen
Elefanten hat der Mensch der frühen Nacheiszeit in Europa ausgerottet,
indem er ihn nicht sowohl wegen seiner gewaltigen Stoßzähne, als wegen
seines Fleisches aufs eifrigste verfolgte und jedenfalls bei seiner
armseligen Bewaffnung vorzugsweise in Fallgruben fing und mit Werfen
von großen Steinen tötete. Neben dem Knochen und Horn des Renntiers war
das Elfenbein des Mammuts ein viel verwendetes Werkzeugmaterial des
diluvialen Jägers, das uns in den Überresten seiner Lagerplätze nicht
selten entgegentritt.

Bild 42. Oberes Ende eines durchlochten
Zierstabs aus Renntierhorn aus dem Lagerplatz der Mammutjäger der frühen
Nacheiszeit von La Madeleine mit dem Kopfe eines Mammuts.

Bild 43 und 44. Aus einem Mammutstoßzahn geschnitztes
Amulett der Magdalénienjäger mit einem kleinen, jetzt durchgebrochenen
Aufhängeloch an der Spitze. Auf der Vorder- und Rückseite ist je eine
Saigaantilope mit auffallend langem Gehörn dargestellt. Aus der südfranzösischen
Höhle von Mas d’Azil am Nordfuße der Pyrenäen. (1⁄3 natürl. Größe.)
[S. 270]
XII. Kaninchen und
Meerschweinchen.
Eine ebenfalls junge Erwerbung wie das Renntier ist das
Kaninchen (Lepus cuniculus), das sich durch weit
geringere Größe, schlankeren Bau, kürzeren Kopf, kürzere Ohren
und kürzere Hinterbeine vom eigentlichen Hasen unterscheidet. Es
ist gegenwärtig über ganz Süd- und Mitteleuropa verbreitet und an
manchen Orten recht gemein. Am zahlreichsten trifft man es in den
Mittelmeergegenden, obgleich man dort keine Schonzeit kennt und es das
ganze Jahr hindurch verfolgt. Besonders zahlreich muß es im östlichen
Teil des Mittelmeergebiets gelebt haben, da die alten Schriftsteller
Spanien als seine Heimat bezeichnen. In England und in manchen von
dessen Kolonien wurde es der Jagdlust zuliebe in verschiedene Gegenden
verpflanzt und anfangs sehr hochgehalten. Noch im Jahre 1309 war es
dort so selten, daß ein wildes Kaninchen ebensoviel als ein Ferkel
kostete. In Nordeuropa ist es ihm schon zu kalt; so hat man bis jetzt
vergeblich versucht, es in Rußland und Schweden einzubürgern.
Das wilde Kaninchen verlangt hügelige, sandige Gegenden, die von
niederem Gebüsch bedeckt sind, in dem es sich verstecken kann. In
den lockern Boden gräbt es sich am liebsten an sonnigen Stellen und
in Gesellschaft einen einfachen Bau, bestehend aus einer ziemlich
tiefliegenden Kammer und in einem Winkel dazu gebogenen Röhren, von
denen eine jede wiederum mehrere Ausgänge hat. Jedes Paar hat seine
eigene Wohnung und duldet kein anderes Tier darin. Mit scharfen Sinnen
ausgestattet, ist das Kaninchen äußerst vorsichtig, lebt fast den
ganzen Tag in seiner Höhle und rückt erst gegen Abend auf Äsung aus,
indem es lange sichert, bevor es den Bau verläßt. Bemerkt es Gefahr,
so warnt es seine Gefährten durch starkes Aufschlagen der Hinterfüße
auf die Erde, und alle eilen so rasch als möglich in ihren Bau zurück
oder suchen sonst ein Schlupfloch zu finden. Wie die Häsin geht das
Kaninchen 30 Tage schwanger und setzt bis zum Ok[S. 271]tober alle 5 Wochen
4–12 Junge in einer besonderen Kammer, die es vorher mit der Wolle von
seinem Bauche reichlich ausgefüttert hat. Einige Tage hindurch sind
die Kleinen blind, doch rasch entwickeln sich ihre körperlichen und
geistigen Fähigkeiten, so daß sie schon nach dem nächsten Satze der
Pflege der um sie sehr besorgten Mutter entraten können. Sie erreichen
erst im 12. Monat ihr völliges Wachstum, sind aber in warmen Ländern
schon im fünften, in kalten im achten Monate fortpflanzungsfähig.
Durch diese ihre ungeheure Fruchtbarkeit sind die Kaninchen noch
schädlicher als die Hasen, indem sie mit Vorliebe Baumrinden abnagen,
wodurch oft ganze Pflanzungen eingehen. Wo sie sich vor Verfolgungen
sicher wissen, werden sie ungemein frech und vertreiben durch ihr
unruhiges Wesen das andere Wild, vor allem Hasen und Rehe. In Gegenden,
die zu ihrer Entwicklung günstig sind, können sie zu einer wirklichen
Landplage werden und die Bewirtschaftung des Bodens außerordentlich
benachteiligen. Wenn sie einmal die Oberhand gewonnen haben, sind
sie kaum mehr zu beseitigen. So haben sie sich in manchen Gegenden,
so namentlich in Spanien und auf den Balearen, schon im Altertum so
stark vermehrt, daß man auf Maßnahmen zu ihrer Zurückdrängung sann.
Der griechische Geschichtschreiber Strabon im 2. Jahrhundert n. Chr.
schreibt: „In Spanien gibt es wenige schädliche Tiere mit Ausnahme
der den Boden durchwühlenden Häschen, welche von einigen Kaninchen
genannt werden. Sie zerstören die Pflanzungen und Saaten und sind
bis Massalia (dem heutigen Marseille) und auch über die Inseln
verbreitet. Die Bewohner der gymnesischen Inseln (Balearen) sollen
einmal eine Gesandtschaft nach Rom geschickt und um eine andere Insel
gebeten haben, weil sie über die Menge der Kaninchen nicht mehr Herr
werden konnten.“ An einer anderen Stelle sagt dieser Autor: „Auf den
gymnesischen Inseln sollen die Kaninchen nicht ursprünglich heimisch
sein, sondern von einem Pärchen stammen, das von der Küste dahin
gebracht wurde. Sie haben in der Folge Bäume und Häuser so unterwühlt,
daß sie umstürzten. Jetzt weiß man ihre Zahl so weit zu beschränken,
daß die Felder bebaut werden können. Übrigens verfolgt man sie mit
Frettchen, die man in ihre Höhlen schickt.“
Nach allem scheinen die Griechen das Kaninchen ursprünglich nicht
gekannt zu haben, sonst hätten sie einen besonderen Namen zu seiner
Bezeichnung gehabt. Sie lernten es erst von Westen her kennen und
nannten es nach dem lateinischen cuniculus kóniklos oder
nach dem[S. 272] lateinischen lepus lebērís. Über diese Kaninchen, die
den Römern sehr wohl bekannt waren, schreibt der ältere Plinius: „In
Spanien und auf den balearischen Inseln, wo die Kaninchen ungeheuren
Schaden anrichten, so daß man sich von dort aus einst vom Kaiser
Augustus militärische Hilfe gegen diese Tiere erbat, bereitet man deren
aus dem Nest genommene Junge als Leckerbissen zu. Der Kaninchenjagd
wegen schätzt man dort die Frettchen sehr hoch. Man läßt sie in den
unterirdischen, mit vielen Röhren versehenen Bau; die Bewohner fliehen
dann eilig heraus und werden gefangen.“ Auf den Pityusen, damals Ebuso
genannt, gab es im Gegensatz zu den Balearen, wo sie also nach Strabon
in einem einzigen Pärchen von der spanischen Küste eingeführt wurden,
keine Kaninchen, wie uns Plinius berichtet, dagegen waren sie nach dem
griechischen Geschichtschreiber Polybios auf Korsika vorhanden; er
nennt sie kýniklos.
Im Gegensatz zum Hasen, der bei den Römern häufig auf den Tisch kam
— nach Lampridius soll Kaiser Alexander Severus täglich Hasenbraten
gegessen haben — war das Kaninchen, wenigstens in Italien nur wenig
als Speise gebräuchlich. Einzig Martial, freilich ein Spanier von
Geburt, führt es mit einigen charakteristischen Versen unter den
Küchenartikeln auf. Von einem Halten des Kaninchens als Haustier ist
selbst in Spanien, das dieses Tier als für das Land charakteristisch
auf einigen Münzen der römischen Kaiserzeit abbildete, im Altertum
nirgends die Rede. Sie mag frühestens zu Beginn des Mittelalters in
Südwesteuropa ihren Anfang genommen haben und nahm erst im späteren
Mittelalter einen größeren Aufschwung, der hauptsächlich den Klöstern
zu verdanken ist. So ließ sich der Abt Wibald von Corvey 1149 zwei
männliche und zwei weibliche Kaninchen aus Frankreich kommen. Später
begann man auch an den weltlichen Höfen Kaninchen in Gehegen zu
halten, um den Damen ein müheloses Jagdvergnügen zu gewähren. Da man
dabei die Schädlichkeit des Kaninchens kennen lernte, das das andere
Wild verjagte, hörte man mit diesem Sport bald auf und begnügte sich,
das genügsame Tier auf Inseln anzusiedeln, wo seiner unbegrenzten
Vermehrung einigermaßen gesteuert werden konnte. So waren Kaninchen
überall auf den Italien umgebenden Inseln vorhanden. Zur Zeit der
fränkischen Herrschaft wurden sie auch auf den Kykladen, d. h. den
Inseln des Ägäischen Meeres, angesiedelt, wo sie heute noch auf den
Inseln vorkommen, auf denen es keine Hasen gibt. Nur auf der größeren
Insel Andros hat es sich so mit seinem Vetter in das Gebiet geteilt,
daß die[S. 273] Kaninchen den einen und die Hasen den anderen Teil der Insel
bewohnen. Nach Olivier gibt es auch bei Konstantinopel im Marmarameer
eine Kanincheninsel. Im Jahre 1407 hielt man schon Kaninchen auf der
nach ihnen genannten Insel im Schwerinersee. 1684 erfahren wir, daß
sie ein Rostocker Ratsherr auf den Dünen Warnemündes ausgesetzt hatte,
aber erst nachträglich an den von ihnen angerichteten Verwüstungen sah,
welche Dummheit er damit gemacht hatte. Noch im 16. Jahrhundert kannte
man weder im Rheinland, noch in Mitteldeutschland wilde Kaninchen,
dagegen kannte sie Schwenckfeld 1603 zahm und in den Häusern gehalten.
1612 sah sie der Nürnberger Paul Hetzner auf einem Kaninchenwerder der
Königin Elisabeth von England als Merkwürdigkeit. Seit 1596 leben sie
auf Helgoland und seit 1699 auf den ostfriesischen Inseln.
Eine besondere Bedeutung erlangten die Kaninchen als leicht
zu transportierende Nahrung für den Menschen im Zeitalter der
Entdeckungen. Um allfälligen Schiffbrüchigen ihre Existenz zu
erleichtern, setzten die schiffahrenden Portugiesen auf kleineren
und größeren Inseln, die sie ohne Tiere antrafen, außer Ziegen auch
Kaninchen aus. Schon Perestrello, der erste Besiedler der Insel
Porto Santo in der Nähe von Madeira, brachte 1418 hierher Kaninchen
mit, die sich aber, da Feinde fehlten, in wenigen Jahrzehnten derart
vermehrt hatten und solche Verwüstungen auf der Insel anrichteten, daß
die Ansiedler zum Aufgeben ihrer Niederlassungen gezwungen wurden.
Im Laufe der Zeit bildete sich hier eine Lokalrasse aus, die um die
Hälfte kleiner und im Pelz oben rötlich und unten blaßgrau wurde.
Sonst kehren die wilden Kaninchen meist zur ursprünglichen grauen
Färbung ihrer Ahnen zurück. Auch auf Teneriffe kommen wilde Kaninchen
vor; sie sind gleichfalls klein und sehr scheu, graben keine Löcher,
was im vulkanischen Boden auch nicht möglich wäre, sondern wohnen in
den Spalten zwischen den Lavablöcken. Weiterhin leben welche auf St.
Helena, Ascension, dann auf Jamaika und den Falklandinseln.
In der Äquatorialprovinz Afrikas suchte Emin Pascha vor einem
Menschenalter Kaninchen einzuführen. In Südafrika haben die
vorsichtigen Holländer ihre Einführung auf dem Festland durch strenge
Strafbestimmungen zu verhindern gewußt. Nur auf den kleinen Inseln in
der Hafenbucht der Kapstadt wurden sie angesiedelt. In Batavia wollten
sie 1726 nicht recht gedeihen, da es ihnen wohl zu warm war. Dagegen
haben sie neuerdings in den Kulturrassen als Haustier in Japan großen
Beifall gefunden. Ganz schlimme Erfahrungen machte man[S. 274] mit den wilden
Kaninchen in Australien und Neuseeland, wo sie unbedachterweise zur
Frönung der Jagdlust ausgesetzt wurden. Bald wurden sie hier zu einer
fürchterlichen Landplage, indem sie die Weideplätze der Kühe und Schafe
kahl fraßen. Schon im Jahre 1885 gab die Regierung von Neusüdwales etwa
15 Millionen Mark aus, um dem Übel zu wehren; doch vergebens. Gift,
Schlingen, Frettchen, Hermeline, Mangusten und andere Raubtiere, die
eingeführt wurden, nützten nichts. Diese Tiere vermehrten sich zwar,
hielten sich aber nicht an Kaninchen, sondern an das Hausgeflügel
der Ansiedler, so daß sie selbst eine fast ebenso schlimme Plage als
die Kaninchen wurden. Selbst der Versuch, eine ansteckende Krankheit
unter den Kaninchen zu verbreiten, nützte nichts. Deshalb bleibt die
Vertilgung der Kaninchen nach wie vor besonderen Kaninchenfängern
vorbehalten, die das Land in Gesellschaften durchziehen und bald hier,
bald dort ihr Lager aufschlagen. Um neue Einwanderungen von Kaninchen
in die von ihnen gesäuberten Gegenden zu verhindern und bis jetzt
kaninchenfreie Ländereien vor ihrer Einwanderung zu verschonen, hat
man meilenweite Einfriedigungen aus Drahtnetzen gezogen, unter denen
eine im Auftrage der Regierung der Kolonie Viktoria errichtete über
1120 km lang ist. Bis jetzt ist es freilich noch in keiner
australischen Kolonie gelungen, der Plage Herr zu werden. An vielen
Orten ist der Boden ganz unterwühlt von den Nagern, an andern ist der
Wald durch sie eingegangen.
Ebenso wie in Australien spielt unter den in Neuseeland eingeführten
Tieren das dort vor etwa 45 Jahren eingeführte Kaninchen eine äußerst
verhängnisvolle Rolle. Es hat sich in manchen Gegenden Neuseelands so
stark vermehrt, daß man sogar gedacht hat, ihm diese Gegenden ganz
preiszugeben. Auch in verschiedenen Gegenden Südamerikas wurden sie
eingeführt, doch vermehrten sie sich hier nirgends im Übermaß, da
sie die natürlichen Feinde in Schranken hielten. In Mexiko und Peru
scheinen sie ziemlich häufig zu sein.
Das Wildbret des Kaninchens ist weiß und wohlschmeckend. Die feinen
Haare des Pelzes werden wie diejenigen des Hasen zur Herstellung
von Filzhüten verwendet. In der römischen Kaiserzeit stopfte man
damit Kissen, bis man von den als Barbaren verachteten Germanen die
Verwendung der Daunenfedern der Gans zu diesem Zwecke kennen lernte.
Die Domestikation hat beim Kaninchen eine Reihe von Veränderungen
hervorgerufen, auf die schon Darwin aufmerksam machte.[S. 275] Vor allem
haben die Hauskaninchen bedeutend an Gewicht zugenommen; während das
wilde Kaninchen ein Gewicht von höchstens 2 kg besitzt, gibt
es zahme Rassen, deren Vertreter 5–6 kg schwer werden. Dies
wurde erzielt durch Zufuhr reichlicher, nahrhafter Kost in Verbindung
mit wenig Körperbewegung und infolge der fortgesetzten Zuchtwahl
der schwersten Individuen. Dann hat die Länge und Breite der Ohren
durch künstliche Züchtung enorm zugenommen, so daß sie infolge ihres
erheblichen Gewichtes nicht mehr aufrecht getragen werden können,
sondern hängend geworden sind. Bei den größeren Rassen hat der
Schädel an Länge zugenommen, aber nicht im richtigen Verhältnis zur
Längenzunahme des Körpers. Auch manche Schädelteile weisen erhebliche
Veränderungen auf gegenüber denjenigen der wildlebenden Vertreter.
Im richtigen Verhältnis zum vergrößerten Körpergewicht sind die
Extremitäten kräftiger geworden, haben aber durch Mangel an gehöriger
Körperbewegung nicht im richtigen Verhältnis an Länge zugenommen. Die
ursprünglich graue Färbung ist verschieden geworden, teils ist sie in
Braun, Schwarz, Weiß oder Scheckfärbung übergegangen.
Beim Angora- oder Seidenkaninchen ist ein sehr
reichlicher, weicher Pelz von seidenartigem Glanze erzielt worden, der
hoch im Preise steht. Es soll ursprünglich in Kleinasien gezüchtet
worden sein und kam am Ende des 18. Jahrhunderts nach Europa. Es ist
sehr zart und verlangt eine sorgfältige Pflege. Meist wird es einfärbig
weiß gezüchtet; doch gibt es auch schwarze, gelbe und graue Sorten.
Das Silberkaninchen gehört zu den kleineren Schlägen. Sein
Gewicht beträgt 2,5 bis 3,5 kg. Auf dem rundlichen Kopfe
sitzen die aufrechtstehenden Ohren an der Wurzel nahe bei einander.
Die Färbung ist gewöhnlich grau mit einem silberähnlichen Anflug;
auch blaue, braune und gelbe Nuancen kommen vor. Das Fell spielt
als Handelsartikel eine nicht unerhebliche Rolle und wird von den
Kürschnern zu Pelzwerk verarbeitet. Ihm nahe steht das graue bis
schneeweiße russische Kaninchen, dessen Nasen, Ohren, Pfoten und
Schwanz allein schwarz sind. Es besitzt eine herabhängende Wamme am
Hals. Aus seinem Pelz werden Hermelinpelzimitationen hergestellt.
Ein kurzhaariger Schlag mit langgestrecktem Körper und kurzen,
aufrechtstehenden Ohren, von Farbe schwarz und weiß gescheckt, ist
das englische Scheckenkaninchen. Ein noch bunter geschecktes
Kaninchen, dessen Fell außer Schwarz und Weiß auch Gelb in buntester
Mischung aufweist, ist neuerdings als „japanisches Kaninchen[S. 276]“
importiert worden, ohne indessen bisher eine weitere Verbreitung
gefunden zu haben. In Frankreich und England wird besonders das
Widderkaninchen (lapin bélier) gezüchtet. Es verdankt
seinen Namen dem stark geramsten Kopf, der ungemein lange und schlaff
herabhängende Ohren besitzt. Es erreicht ein Gewicht von 5–6 kg
und besitzt ein wohlschmeckendes, zartes Fleisch, weshalb es viel
gezüchtet wird. Sein Fell ist kurzhaarig und schwarz, grau, weiß, gelb
oder blau, auch gescheckt.
Das Kaninchen hat man auch schon mit dem Feldhasen zu kreuzen vermocht.
Die so erhaltenen Bastarde nennt man Leporiden. Sie haben
nach W. Hochstetter eine große Ähnlichkeit mit dem Feldhasen, sind
hasengrau mit rostgelbem Nacken, tragen schwärzlich geränderte Ohren
und sind fruchtbarer als alle reinen Kaninchenrassen. Ihr Fleisch ist
sehr wohlschmeckend, und bereits nach sechs Monaten erreichen sie ein
Gewicht von 3–4 kg.
Die Kaninchen sind die einzigen Nagetiere, die wirtschaftlich für
uns von Bedeutung geworden sind. Als leicht zu erlangende Warmblüter
dienen sie mit Meerschweinchen, Ratten und Mäusen sehr oft zu
Einimpfungs- und Vivisektionsversuchen, können deshalb mit Recht
auch als „Märtyrer der Wissenschaft“ bezeichnet werden. Unter diesen
spielt jedoch das Meerschweinchen (Cavia cobaya) als
Versuchstier der Physiologen und Bakteriologen die weitaus erste
Rolle, da es sehr fruchtbar und leicht zu halten ist. Wenn es auch
vielfach bei uns zum Vergnügen gehalten wird, so hat es doch bei
uns keinen praktischen Nutzen gefunden. Allerdings in seiner alten
Heimat Südamerika ist es von den alten Peruanern, wie seinerzeit
das Kaninchen in Europa, der Fleischnutzung wegen gezüchtet und zum
Haustier erhoben worden. Im altperuanischen Gräberfeld von Ancon fand
man nicht selten Überreste von offenbar einst als Haustier gehaltenen
Meerschweinchen, die nach Nehring sowohl äußerlich in der Färbung, wie
auch durch ihren anatomischen Bau in der Mitte stehen zwischen der
wilden Art Südamerikas und dem zahmen Meerschweinchen der Gegenwart.
Die altperuanischen Hausmeerschweinchen besaßen, wenn auch schon
als offenkundiges Haustiermerkmal Weiß auftrat, im allgemeinen noch
immer die dunkelbraune, fein gesprenkelte „Wildfarbe“, die durch
verschiedenfarbige Ringelung der einzelnen Haare entsteht. Daneben
hatten sie die schlankere, schärfer umrissene Schnauze und das festere
Gefüge des Schädels, das sich besonders in dem keilförmigen Einspringen
der Nasenbeine in die Stirnbeine ausspricht. Diese Unterschiede mögen[S. 277]
wohl auf veränderte Lebensbedingungen zurückzuführen sein. Jedenfalls
waren sie bei den alten Peruanern noch nicht in so strenger Haft
gehalten wie die heutigen Nachkommen und lebten wohl noch ziemlich frei
in und um die Hütten der Eingeborenen herum.
Diese mehr einfarbigen, schlanken, spitzschnauzigen Vorfahren unseres
heutigen weißbunten, fettleibigen und dickköpfigen Meerschweinchens
stellen also Mittelglieder zwischen letzterem und der noch heute
in Peru wildlebenden Stammform Cavia cutleri dar. Außer als
Nahrung benutzten die alten Peruaner sie auch als Opfer für die
Götter. Nach Rengger zähmen die Indianer in Paraguay noch heute die
dem wilden Meerschweinchen Perus entsprechende Form der Ostabhänge der
Anden, die Cavia aperea, und diese pflanzt sich auch in der
losen Gefangenschaft, in der sie gehalten wird, leicht fort. Im Laufe
des 16. Jahrhunderts kam dann das peruanische Hausmeerschweinchen
durch die Spanier wohl nur als Spielerei nach Europa. Speziell den
Holländern ist dessen Einführung nach Mitteleuropa zu verdanken.
In der Schweiz erwähnt es 1554 zuerst der Züricher Naturforscher
Konrad Geßner (1516–1565). Doch war es damals in Mitteleuropa noch
recht selten. Weil es übers Meer zu ihnen gekommen war und in
seiner kurzbeinigen Dickleibigkeit einem Schweinchen glich, nannten
es die Deutschen Meerschweinchen, während es die Engländer als
guinea-pig bezeichneten. Die Färbung ist sehr verschieden.
So berichtet schon der Leibarzt der reichen Fugger in Augsburg
in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, Munzinger, von ganz
weißen und ganz braunen Meerschweinchen. Jetzt sind die meisten
Formen schwarz, rotgelb und weiß gefleckt; ein Teil ist ganz weiß
mit roten Augen. Es sind dies also richtige Albinos. Neben diesen
kurzhaarigen Rassen gibt es auch eine sehr langhaarige unter der
Bezeichnung Angorameerschweinchen. Bildet ihre Behaarung an
verschiedenen Körperstellen eigentümliche Wirbel, so spricht man von
Struppmeerschweinchen.
In seinem Benehmen ist das Meerschweinchen ein Mittelwesen zwischen
Kaninchen und Mäusen. Sein Lauf setzt sich aus einer Reihe kurzer
Sprünge zusammen und ist keineswegs sehr schnell. Fühlen sie sich wohl,
so lassen sie eine Art sanften Murmelns vernehmen; erschreckt quieken
sie wie die Schweine. Bei uns werfen die Weibchen 2 bis 3 mal im Jahre
2–3, auch 4 oder 5, in heißen Ländern sogar 6–7 Junge. Diese werden in
einem hochentwickelten Zustand mit offenen Augen geboren und laufen
schon nach wenigen Stunden hinter[S. 278] der Mutter her. Sie werden nur etwa
14 Tage lang von der Mutter gesäugt und während dieser Zeit liebevoll
behandelt. Vom zweiten Tage an fressen sie neben der Muttermilch auch
Grünes und sind vom Ablauf der 4. Woche an selbständig. Nach 5–6
Monaten sind sie fortpflanzungsfähig und haben schon nach 8–9 Monaten
ihre vollkommene Größe erreicht. Bei guter Behandlung können sie ihr
Leben auf 6–8 Jahre bringen. Sie sind der Wärme bedürftig und müssen an
einem trockenen Ort gehalten werden. Gegen rauhe und kalte Witterung
sind sie sehr empfindlich und gehen dann leicht zugrunde. Wenn man sich
viel mit ihnen abgibt, werden sie ungemein zahm und zutraulich, obwohl
sie ihre Furchtsamkeit nie gänzlich ablegen und bei ihren geringen
geistigen Fähigkeiten selten dahin gelangen, den Wärter von andern zu
unterscheiden. Im ganzen bleiben sie stumpfsinnig und wenig anhänglich.
Nur in Oberschlesien ißt man sie wie in ihrer Heimat Peru.
Endlich ist noch von der zahmen Hausmaus (Mus musculus
domesticus) zu reden, die in Ostasien zum Haustier erhoben wurde
und neuerdings auch bei uns in den verschiedensten Zeichnungs- und
Färbungsformen gezüchtet wird. Nach ihrer Herkunft werden sie als
chinesische und japanische Ziermäuse unterschieden. Die
chinesischen Mäuse, die in ihrer Heimat auch vom Menschen gegessen
werden, unterscheiden sich von unserer wilden Hausmaus und von der
gewöhnlichen weißen Maus nur durch die Färbung und Zeichnung und
zerfallen in eine große Anzahl Rassen. Es gibt einfarbig schwarze,
dann solche mit ganz kleinen weißen Abzeichen an verschiedenen
Körperstellen, ferner schwarz- und weißgescheckte, einfarbig graue,
grau- und weißgescheckte, braune, braun- und weißgescheckte, hell-
und dunkelgelbe und gelbgescheckte Mäuse. Alle diese haben meist
schwarze Augen; nur gelbe Mäuse kommen auch mit roten Augen vor.
Sonst finden sich letztere regelmäßig bei den noch nicht aufgezählten
Rassen, den fahlen, den fahl- und weißgescheckten und den blauen
Mäusen, deren Färbung von Aschgrau bis Mohnblau wechselt. Diese blauen
Mäuse unterscheiden sich von den fahlen dadurch, daß ein gelblicher,
bräunlicher oder rötlicher Farbenton bei ihnen fehlt. Zu ihnen gesellen
sich blaue Mäuse mit wenig bis viel Weiß und endlich die schon seit
langer Zeit in Europa gezüchteten einfarbig weißen Mäuse mit roten
Augen. Übergänge zwischen den aufgezählten Rassen finden sich nur
selten. Als Übergänge zwischen fahlen und gelben Mäusen kann man die
gelben Mäuse mit roten Augen betrachten. Sonst kommen nur Über[S. 279]gänge
zwischen grauen und gelben Mäusen vor, nämlich graue Mäuse mit Gelb
und gelbe Mäuse mit Grau meliert. Andere Übergänge hat man trotz
zahlloser Züchtungsversuche nicht erhalten, und vor allem ist es auch
nie gelungen, Mäuse zu züchten, die gleich den meisten Meerschweinchen
dreifarbig gescheckt sind.
Nicht minder wunderbare Züchtungsprodukte haben die Japaner aus der
gemeinen Hausmaus zu machen verstanden. Die japanischen Ziermäuse
unterscheiden sich von den chinesischen durch geringere Körpergröße,
zierlichere Formen, namentlich spitzen Kopf, vor allem aber durch die
merkwürdige Eigenschaft, daß sie, wenn sie irgend ein Ziel erreichen
wollen, nicht geradewegs darauf losgehen, sondern schwankenden Ganges
hin und her wackeln, wobei sie häufig in eine drehende Bewegung
geraten, ja nicht selten auf einem Fleck so schnell herumwirbeln, daß
man Kopf- und Schwanzende nicht mehr voneinander unterscheiden kann.
Sie lieben es auch, um die runden Futternäpfe im Kreise herumzulaufen
und um Pflöcke, die man auf dem Boden ihres Käfigs befestigt hat,
herumzutanzen. Oft führen zwei zusammen einen Wirbeltanz aus. Diese
sogenannten japanischen Tanzmäuse zieht man in ihrer Heimat
gewöhnlich in zwei Rassen, nämlich in schwarzweißem und blauweißem
Kleide. Bei beiden Rassen überwiegt das Weiß, und Schwarz und Blau
sind jeweilen am Kopfende angehäuft. Nur selten erhält man auch fahl
und weiß gescheckte Tanzmäuse. In Frankfurt a. M. ist es indessen
neuerdings gelungen, zahlreiche verschiedenartige Tanzmäuse zu züchten,
und nach den dort angestellten Vererbungsversuchen lassen sich die
Tanzmäuse in denselben 19 verschiedenen Färbungs- und Zeichnungsformen
züchten, wie die chinesischen Mäuse, so daß es im Ganzen 38
verschiedene Hauptrassen von Ziermäusen gibt. Dazu kommen noch einige,
allerdings sehr seltene Übergänge zwischen verschiedenen Rassen.
Dieselbe Züchtungsarbeit hat man in Ostasien teilweise auch der
Wanderratte angedeihen lassen. Sie kommt weiß, schwarz oder braun
gescheckt vor, ist aber viel weniger mannigfaltig gefärbt als die
Ziermäuse. Am meisten wird die japanische Tanzratte gehalten,
die durch ihr Benehmen an die japanischen Tanzmäuse erinnert. Sie wird
gelegentlich auch vom Menschen verspeist, was sehr begreiflich ist,
da an ihr gewiß mehr Fleisch enthalten ist als an den Mäusen, die
demselben Zwecke dienen.
[S. 280]
XIII. Die Katze.
Die Hauskatze, die als geborener Einzeljäger sich bis auf den heutigen
Tag auch als Haustier eine sehr selbständige Stellung als Genosse des
Menschen bewahrt hat und infolgedessen auch dem Einfluß der künstlichen
Züchtung so gut wie gar nicht unterliegt, ist kein Abkömmling unserer
europäischen Wildkatze (Felis catus), wie man noch in der
ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts annahm, sondern stammt
von der von Rüppel in Nubien entdeckten Falbkatze (Felis
maniculata), die in vorgeschichtlicher Zeit irgendwo im oberen
Nilgebiet zum Haustier erhoben wurde. Es ist dies ein fahlgelb bis
fahlgraues Tier, an Hinterkopf und Rücken rötlicher, mit weißem Bauch
und verwaschenen, schmalen, schwarzen Querbinden am Rumpf, die an
den Beinen deutlich hervortreten. Der Pelz ist an einigen Stellen
schwarz gesprenkelt; der Schwanz endet in eine schwarze Spitze, davor
hat er drei schwarze Ringe. Charakteristisch ist der Sohlenfleck,
d. h. die schwarze Färbung der Hinterseite der Hinterfüße von der
Pfote bis zum Hacken. Diese Färbung macht sich auch bei den gezähmten
Vertretern sehr leicht geltend und kommt niemals bei der europäischen
Wildkatze vor. Ferner ist bei den Hauskatzen wie bei deren Stammutter,
der Falbkatze, der Schwanz gleichmäßig zugespitzt und nicht am Ende
verdickt wie bei der europäischen Wildkatze, die auch nie schwarze
Sohlen aufweist. Dann wies der Engländer Hamilton nach, daß sich bei
den Hauskatzen die Stirne mit zunehmendem Alter verflacht, während
sie bei der europäischen Wildkatze höher wird. Alle diese Tatsachen
sprechen in demselben Sinne, daß eben die Hauskatze ein Abkömmling der
afrikanischen Falbkatze und nicht der europäischen Wildkatze ist.

Bild 45. Links der Ammonspriester Mutsa (3), Vorsteher des
kgl. Schatzes, mit seiner Schwester Bati (4), einer Jungfrau des Ammon, und
seinem Sohne User (2) mit dem Wurfholz (Bumerang) auf der Entenjagd, rechts
derselbe Fische speerend. Im Dickicht ein Ichneumon, der einen jungen Vogel aus
dem Nest reißt, im Boot links eine gezähmte Katze, die scheinbar bittet, ins
Dickicht gelassen zu werden. Auf diesem Wandgemälde der 18. Dynastie weist die
Hauskatze noch die schmalen schwarzen Querbinden ihrer Stammutter, der Falbkatze,
auf. (Nach Wilkinson.)
⇒
GRÖSSERES BILD
Wenn nun also die Hauskatze nicht von der europäischen Wildkatze
abstammt, ist es nicht zu verwundern, daß sie im vorgeschichtlichen
Europa durchaus fehlt; auch die älteren Griechen und Römer[S. 282] kannten
sie noch nicht. Ihre Rolle als Mäusevertilger besorgten bei ihnen
Wiesel und Iltis, die beide gezähmt gehalten wurden. Ebenso wird die
Katze nirgends in der Bibel erwähnt; auch im vedischen Zeitalter
Indiens war sie durchaus unbekannt. Aus allen diesen Gründen muß
die noch von W. Schuster vertretene ältere Ansicht, wonach unsere
Hauskatze von der Wildkatze abstammt, absolut verlassen werden, wenn
auch zuzugeben ist, daß da und dort durch gelegentliche Paarung von
Hauskatzen mit Wildkatzen Blut von letzterer in manche Stämme der
Hauskatze gelangte. Ganz abgesehen von der großen Schwierigkeit der
Zähmung der überaus wilden europäischen Wildkatze weicht auch der
anatomische Bau der Hauskatze in vielen Einzelheiten vollkommen
von demjenigen jener ab, stimmt aber sehr genau mit demjenigen der
nubischen Falbkatze überein. Nach François Lenormant kam die Hauskatze
als bereits gezähmtes Tier mit dem Hunde von Dongola erst zur Zeit des
Mittleren Reiches nach der Eroberung des Landes Kusch in Nubien durch
die Ägypter nach Ägypten und wird mit jenem zuerst auf Grabdenkmälern
der 12. Dynastie (2000–1788 v. Chr.) in Beni Hassan abgebildet. Dagegen
will neuerdings Konrad Keller sie schon zur Zeit der 6. Dynastie
(2750–2625 v. Chr.) in einem Grabgemälde von Sakkarah mit einem
Halsband, also dem Attribut eines Hausgenossen, abgebildet gefunden
haben. Genaueres darüber gibt er aber nicht an.
Bei den alten Ägyptern wurde ihre Zucht in der Folge sehr populär;
denn die Katze, von ihnen nach ihrer Lautäußerung mau genannt,
wurde als Jagdgehilfe und eifriger Bekämpfer von Ratten und Schlangen
von ihnen in hohem Maße geschätzt. So finden wir auf verschiedenen
Grabgemälden der 18. Dynastie (1580–1350 v. Chr.) von Kurnah, die
Sir Gardner Wilkinson publizierte, Ägypter in leichten Booten im
Schilfdickicht Jagd auf Wasservögel machen, wobei ihnen zahme Katzen
das vom Bumerang betäubte Wild durch geschicktes Schleichen zwischen
den Sumpfpflanzen holen. Wo also der Hund nicht zu gebrauchen war,
trat die Katze in ihr Recht und leistete dem Menschen gute Dienste.
Als Rattenvertilgerin finden wir die Katze aus leicht verständlichen
Gründen nirgends dargestellt; aber daß sie als solche fungierte,
beweist der berühmte satyrische Papyrus von Turin, in welchem die
Darstellungen der glorreichen Siege Ramses III. (1198–1167 v.
Chr.) der 19. Dynastie an den Wänden des von ihm errichteten Tempels
in Medinet Abu in der Weise karikiert wurden, daß der auf seinem
Kriegswagen stolz einherfahrende König und seine[S. 283] Leute in Form von
Ratten, die Feinde dagegen, die Chethiter, in Gestalt von Katzen
dargestellt wurden. In einer Darstellung des Totenbuches aus dem Neuen
Reiche finden wir eine unter einem Baume sitzende Katze abgebildet,
die unter der einen Vordertatze einen Schlangenkopf hält. Tatsächlich
jagt die Hauskatze ebenso gern selbst die gefährlichsten Giftschlangen
als die Mäuse und Ratten. Dadurch mag sie sich bei den Ägyptern, jenen
ausgesprochenen Ackerbauern, denen die die Kornvorräte brandschatzenden
Nagetiere, wie auch die giftige Schlangenbrut äußerst lästig fielen,
sehr bald in hohe Gunst gebracht haben. Da sie andere Tiere verspeiste
und damit deren Seelen in sich aufnahm, sah man in ihr ein Geistwesen
verkörpert, dem als solchem so gut eine Kultpflege zukam, als dem die
Umgebung der menschlichen Wohnungen von Aas reinigenden Ibis oder
Schakal. Wie diese wurde sie in der Folge zu einem heiligen Tiere
gestempelt, das als guter Geist gern im Hause gehalten wurde, weil es
durch seine göttlichen Eigenschaften Segen in dasselbe brachte. Ihr
Tod versetzte die altägyptische Familie in Trauer, die man äußerlich
durch Abrasieren der Augenbrauen bekundete. Der Unglückliche, der
freiwillig oder unfreiwillig einer Katze das Leben raubte, war
verloren. So schreibt der griechische Geschichtschreiber Diodoros, mit
dem Beinamen Siculus, über Ägypten: „Wer dort irgend ein heiliges Tier
absichtlich ums Leben bringt, wird zum Tode verurteilt. Wer aber eine
Katze oder einen Ibis umbringt, muß sterben, wenn er auch die Sünde
ohne es zu wollen beging; das Volk läuft zusammen und behandelt, oft
ohne Verurteilung, den Missetäter aufs grausamste. Sieht also jemand
ein totes heiliges Tier, so bleibt er, um nicht in falschen Verdacht
zu kommen, von ferne stehen, schreit, wehklagt und beteuert, daß er es
schon tot gefunden habe. — Die abergläubische Verehrung der heiligen
Tiere ist bei den Ägyptern tief und unwandelbar festgewurzelt. In der
Zeit, da der König Ptolemäus (XI, 81–51 v. Chr.), von den Römern
noch nicht für einen Freund erklärt war und sich das ägyptische Volk
auf alle mögliche Weise bemühte, den sich in ihrem Lande aufhaltenden
Römern gefällig zu sein und aus Furcht vor Rom jede Gelegenheit zu
Beschwerden vermied, da kam der Fall vor, daß ein Römer eine Katze ums
Leben brachte. Alsbald rottete sich das Volk wütend gegen ihn zusammen,
und, obgleich er den Mord gar nicht mit Vorsatz begangen, konnten
doch weder die Bitten des vom Könige hingesandten Beamten, noch die
Furcht vor Rom den unglücklichen Katzenmörder vom Tode erretten. —
Finden die Ägypter auf ihren[S. 284] Kriegszügen in fremdem Lande tote Katzen
oder Habichte, so sind sie betrübt und nehmen die Tiere mit sich nach
Hause.“ An einer anderen Stelle berichtet derselbe Autor: „Den Katzen
und Ichneumons brocken die Ägypter Brot in Milch, locken sie herbei
und setzen es ihnen vor, oder sie füttern sie mit zerschnittenen
Nilfischen. In ähnlicher Weise füttern sie auch die übrigen heiligen
Tiere. Die eigentlichen Wärter jener Tiere tun groß mit ihrem wichtigen
Götzendienst; sie tragen auch besondere Abzeichen, und wenn sie durch
Dörfer und Städte gehen, so verbeugt sich jedermann ehrfurchtsvoll
vor ihnen. Stirbt ein heiliges Tier, so wickeln sie es in feine
Leinwand, schlagen sich jammernd die Brust und bringen es in die zum
Einbalsamieren bestimmten Häuser. Ist es dort mit Zedernöl und andern
guten Dingen, die einen guten Geruch geben und vor Verwesung schützen,
durchdrungen, so wird es in einem heiligen Sarge bestattet.“
Auch Herodot, der selbst in Ägypten war und die Sitten der Ägypter aus
eigener Anschauung kannte, schreibt: „Die Katzen in Ägypten lieben
ihre Jungen sehr, aber sie werden ihnen oft von den Katern geraubt.
Entsteht irgendwo eine Feuersbrunst, so kümmern sich die Ägypter nicht
ums Feuer, sondern um ihre Katzen. Sie stellen sich um diese herum
und halten Wache; aber die Katzen entwischen ihnen doch oft, springen
auch über sie hinweg und stürzen sich in die Flammen. Geschieht dies,
so kommt über die Ägypter große Trauer. Stirbt eine Katze, so scheren
sich alle Bewohner des Hauses ihre Augenbrauen ab; stirbt aber ein
Hund, dann scheren sie sich den ganzen Kopf ab. Die toten Katzen werden
in heilige Gemächer geschafft, einbalsamiert und dann in der Stadt
Bubastis beigesetzt. Die Hunde und Ichneumons werden in der Stadt,
in der sie starben, in heiligen Grüften bestattet, die Spitzmäuse
und Ibisse aber in Hermopolis. Die Bären, welche jedoch selten sind,
und die Wölfe, welche nicht viel größer sind als Füchse, werden da
begraben, wo sie gerade liegen.“
Die Angaben dieser beiden Autoren betreffend das Einbalsamieren der
verstorbenen Katzen und das darauffolgende Bestatten in besonderen
„heiligen Grüften“ sind durch das Auffinden von eigentlichen
Katzenfriedhöfen in Bubastis und Beni Hassan bestätigt worden. Hier
wurden sorgfältig einbalsamierte und mit Leinenbändern umwickelte
Katzenmumien in Menge gefunden. Der bedeutendste Kultort für die
Katzen war die Stadt Bubastis, im östlichen Delta, die ihren Namen
(ägyptisch Pe Bast = Ort der Bast) von der dort verehrten Göttin
Bast erhielt, die mit einem Katzenkopfe dargestellt wurde. Es ist
dies eigentlich[S. 285] die Göttin Sekhet, die Gemahlin des Ptah, des großen
Gottes von Memphis, die ursprünglich löwenköpfig und erst seit dem
Bekanntwerden der Katze in Unterägypten katzenköpfig abgebildet wurde.
Die Griechen stellten sie später ihrer Artemis gleich.
Wenn nun auch mit dem Untergang des alten Ägypten die Heiligkeit der
Hauskatze im Niltal dahin fiel, so sind doch Spuren derselben hier bis
auf unsere Zeit nachzuweisen. Noch heute glaubt man in Ägypten, daß
die Katze Glück bringen könne; sie wird von den dortigen Haremsdamen
verhätschelt und mit Ohrringen geschmückt. In Oberägypten gilt sie
heute noch als heilig und unverletzlich; sie ist dort nach Klunzinger
ebenso geehrt als die Hunde verachtet. In Kairo vermachte der Sultan Ez
Zahir Beibars einen Garten nördlich der Stadt zum Besten der Katzen.
Derselbe wurde dann verkauft, aber zurückerworben und dient heute
noch zur Erhaltung herrenloser Katzen; daneben besteht in jener Stadt
ein förmliches Katzenspital. Außerdem sind wiederholt Legate zu deren
Fütterung ausgesetzt worden. Diese Hochhaltung der Katze im heutigen
Ägypten wird mit der Vorliebe des Propheten Mohammed für diese Tiere
motiviert. Dieser soll einst, um ein in seinem weiten Ärmel liegendes
Kätzchen nicht in seinem Schlafe zu stören, denselben beim Aufstehen
abgeschnitten haben. Überhaupt ist der Morgenländer durchschnittlich
sehr rücksichtsvoll gegen seine Mitgeschöpfe. So erzählt ein deutscher
Edelmann, der im Mittelalter das Morgenland durchwanderte, von einem
Soldaten, der sich neben dem schönsten Schatten seufzend von der
Mittagssonne peinigen ließ, weil er das in seinem Schoß eingeschlafene
Kätzchen nicht stören wollte.
Wie sich aus den Mumien ergibt, war die Gesamtfarbe der altägyptischen
Hauskatze noch ganz der der Falbkatze ähnlich. Nach Keller trifft man
solche Färbung noch heute häufig bei den Hauskatzen in den Küstenorten
des Roten Meeres. Auch das Knochengerüst beider Arten entspricht
einander vollkommen. Jedenfalls hat sich hier in ihrem natürlichen
Verbreitungsgebiet die Falbkatze je und je mit der Hauskatze gepaart
und so zur Auffrischung des Blutes beigetragen. Aber auch die Wildform
selbst mag da und dort später wiederholt gezähmt worden sein, wie dies
heute noch bei den Niam-Niam der Fall ist, die die Falbkatze fangen und
sie in kurzer Zeit an die Wohnung gewöhnt haben, so daß sie ihnen nicht
mehr entläuft, sondern sich, mit Mäusefang beschäftigt, in deren Nähe
verweilt. Diese Beobachtung von G. Schweinfurth bestätigte C. Keller,
indem ihm auf seiner Reise[S. 286] in Nubien wiederholt gezähmte Exemplare der
wilden Falbkatze angeboten wurden. Er schreibt ferner: „Am mittleren
Webi in den Somaliländern konnte ich gezähmte Falbkatzen in den Dörfern
antreffen, die ich vorher in Ogadeen nirgends vorfand. Sie dienen dazu,
die Getreideschuppen gegen die schädlichen Nager zu schützen. Übrigens
richten die Somalifrauen auch ihre Knaben in origineller Weise zum
Mäusefang ab und, wie ich mich überzeugt habe, entwickeln diese ein
großes Geschick. Diese Tatsache liefert vielleicht die Erklärung für
das lokale Fehlen der Hauskatze in manchen Gebieten Ostafrikas.“
Vom Niltal verbreitete sich die Hauskatze im Altertum nur langsam
nach Syrien, Persien und von da nach Indien. Bei den Indern galt die
weiße Katze als das Symbol des Mondes, der die grauen Mäuse, d. h. die
Schatten der Nacht vertreibt. In China wird die Katze zum erstenmal
im 6. Jahrhundert v. Chr. erwähnt. Ein Bekanntwerden der Griechen mit
der ägyptischen Katze läßt sich vor dem 5. Jahrhundert v. Chr. nicht
nachweisen und war auch da nur vereinzelt. So berichtete Herodot
seinen Landsleuten von der hohen Wertschätzung dieses Tieres in ihrer
ägyptischen Heimat. Im 4. Jahrhundert v. Chr. wurde die Katze in den
griechischen Kolonien Süditaliens in einzelnen Exemplaren von Kyrene
her eingebürgert; doch vermochte sie auch hier nicht den älteren
Vorläufer, das Wiesel, zu verdrängen. Bei den Römern fand sie erst
um 100 v. Chr. Eingang. Bei ihnen hatte das Wort felis zuerst
den Edelmarder, dann die Wildkatze und, von ihr übertragen, zuletzt
die Hauskatze bezeichnet. Zu Beginn der christlichen Zeitrechnung
treffen wir sie immer noch nur vereinzelt als Haustier bei den alten
Römern. Der ältere Plinius kennt und beschreibt sie unter dem Namen
tigris: „Die Katzen schleichen ganz still und leise, wenn sie
ein Vögelchen haschen wollen; den Mäusen lauern sie heimlich auf
und springen dann plötzlich auf sie los. Ihren Kot bedecken sie mit
zusammengerscharrter Erde, damit er ihre Anwesenheit nicht verrate.“
Seine Zeitgenossen Columella und Seneca raten die Hühner vor ihnen
zu hüten. Dies rät Palladius um 380 n. Chr. dadurch zu tun, daß man
letzteren ein Stückchen Raute unter den rechten Flügel bindet. Er
sagt, daß man sich Katzen zum Wegfangen der Maulwürfe halte. Von
allen Geschichtschreibern erwähnt sie nur Dio Cassius einmal, indem
er in der Biographie des Tiberius sagt: „Während Sejanus zur Zeit,
da Tiberius regierte (14–37), noch allmächtig war, kamen einmal eine
Menge Gratulanten zu ihm und das Sopha, auf das sie sich setzten,
brach zusammen; dann lief dem[S. 287] Sejanus, als er aus dem Hause ging,
eine Katze über den Weg. Hierdurch ward ihm, vor dem sich damals
alles beugte, Verderben prophezeit.“ Auch ist ihre Darstellung bisher
nur ein einziges Mal auf einem römischen Mosaik gefunden. Jedenfalls
spielte die Katze im antiken Haushalt neben dem hier früher als
Mäusefänger gebräuchlichen Frettchen eine sehr bescheidene Rolle.
Erst vom 4. Jahrhundert n. Chr. an wurde das bis dahin noch häufig
gehaltene Hauswiesel ganz von der Katze verdrängt, die damals einen
besonderen Namen, nämlich catus erhielt, woraus später im
Vulgärlatein catta, und daraus im Italienischen gatta,
im Französischen chat, im Deutschen dagegen Katze wurde. Die
römische Bezeichnung catus aber, die bei den Byzantinern
als katós gebräuchlich war, stammt aus dem syrischen Worte
katô, das seinerseits wiederum mit dem nordafrikanischen
gâda und kadiska zusammenhängt. So sehen wir auch in der
Terminologie den Weg angedeutet, den das Tier in der Tat aus dem Niltal
über Syrien und das Römerreich bis ins Herz Europas nahm.
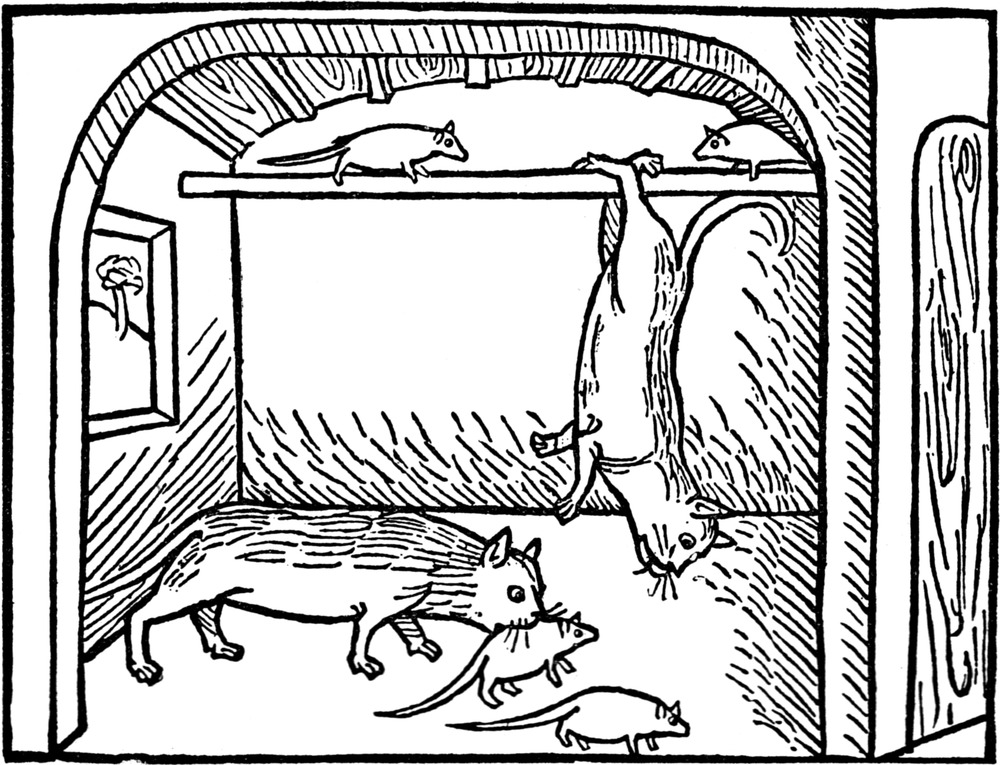
Bild 46. Katze und Maus. Holzschnitt zu den Fabeln des
Äsop. (Gedruckt 1475 von Joh. Zainer in Ulm.)
Zur späteren ausgiebigen Verbreitung der Katze durch die Länder[S. 288] am
Mittelmeer und in Europa trug wesentlich das christliche Mönchtum
bei, das ja in Ägypten seinen Anfang nahm und sich dort sehr bald mit
der Hauskatze befreundet hatte. So berichtet uns Johannes Diaconus im
Leben des heiligen Gregor (um 600), ein Eremit habe, durch die Predigt
dieses großen Mannes gerührt, seinen einzigen Schatz auf Erden, seine
Katze, opfern wollen. Aus dem Mittelalter findet sich die Angabe,
daß die Mönche eines Klosters auf Zypern Katzen gezogen hätten, um
die Schlangen zu bekämpfen. Damit an diesen frommen Orten die Kater
nicht ihren sinnlichen Lüsten frönten, verschnitt man gewöhnlich die
Klosterkatzen. Es ist dies dasselbe Bestreben, das nicht nur Frauen,
sondern überhaupt weibliche Tiere vom heiligen Berge Athos mit seinen
zahlreichen Mönchsklöstern aufs strengste fernzuhalten sucht.
Noch im 10. Jahrhundert war die Katze in Mitteleuropa recht selten; so
mußte damals in Sachsen und Wales derjenige, der eine solche getötet
hatte, als Strafe so viel Getreide entrichten, daß das am Schwanze
aufgehängte und mit der Schnauze den Boden berührende Tier von diesem
vollständig bedeckt ward. Damals wird es wohl nur gelbe und braune
Katzen in Europa gegeben haben.
Um 1620 fand dann der Italiener Pietro della Valle in Chorasan sehr
schöne langhaarige Katzen, von denen er ein Paar mit nach Europa
brachte. Es sind dies vielleicht die Vorläufer der Angorakatze,
die besonders in Persien und Kleinasien gehalten wird, aber aus
Innerasien stammt. Die dichte und lange Behaarung, die blau, blaugrau,
schwarz, bunt oder einfarbig weiß ist, will der russische Forscher
Pallas der Kreuzung mit der ziemlich langhaarigen asiatischen
Steppenkatze (Felis manul) zuschreiben. Da die Wildkatzen sich
überall gelegentlich mit den einheimischen Hauskatzen paaren, ist dies
sehr wahrscheinlich; doch könnte schließlich auch die gewöhnliche
Hauskatze unter der Einwirkung des rauhen Gebirgsklimas Innerasiens
eine längere Behaarung erhalten und diese an ihre Nachkommen vererbt
haben.
Tafel 49.

Altägyptische Hauskatzen mit Mäusen in einer Fabel des
satirischen Papyrus des Neuen Reichs
(18. bis 19. Dynastie, 1580–1205 v. Chr.).
⇒
GRÖSSERES BILD
Tafel 50.
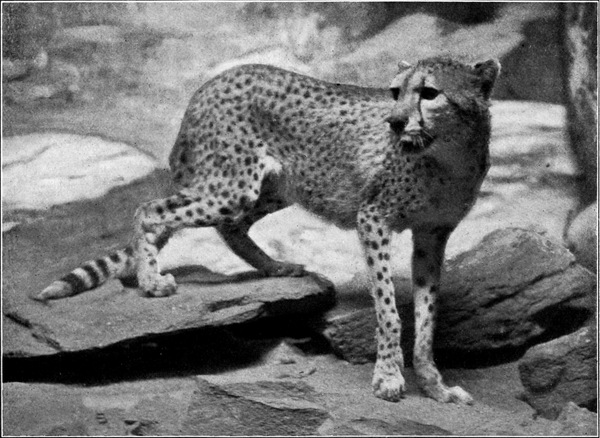
(Copyright by M.
Koch, Berlin.)
Gepard oder Jagdleopard.

(Copyright by M.
Koch, Berlin.)
Frettchenfamilie vor einem Kaninchenbau.
Die europäische gemeine Hauskatze ist also ein mehr oder
weniger reiner Abkömmling der nubischen Falbkatze, die sich in ihrer
primitivsten Erscheinung in Ostafrika und in den Ländergebieten am
Roten Meer erhielt. Die dort angetroffene Hauskatze stimmt ganz
auffallend mit der wilden Falbkatze überein; sie ist nämlich fahlgelb
oder fahlgrau mit rötlichem Anflug, die Nasengegend rostrot mit
dunklerer Einfassung. Der Fuß ist bis zur Ferse unterseits schwarz[S. 289]
behaart; auch zeigt der Pelz mehr oder weniger deutlich dunkle Flecke.
Die Bauchseite ist heller, der Körper schmächtig gebaut, der Schwanz
lang und wenig voll. Diese Katze steht der altägyptischen Hauskatze
sehr nahe, die stets gelblich, von hellgelb bis dunkelbraun wechselnd,
gefärbt war. Die Ohren mancher Exemplare erscheinen auffallend groß
und zugleich an der Spitze mit einem kleinen Haarbüschel versehen.
Dies beweist eine Kreuzung der ägyptischen Hauskatze mit dem
alsbald zu besprechenden Sumpfluchs (Felis chaus).
Die betreffenden Bastarde unterscheiden sich von den Hauskatzen von
reiner Abstammung von der Falbkatze außerdem durch die gedrungene
und größere Gestalt, das dunkelgefleckte Fell und den langhaarigen
Schwanz. Dieses Kreuzungsprodukt wurde, wie verschiedene Bilder
beweisen, auch zur Vogeljagd abgerichtet. Doch scheint in ihnen das
Blut der Falbkatze überwogen zu haben. Die kräftige Gestalt auch
dieser Katzen zeugt davon, daß sie schon damals in Ägypten nicht in
engem Gewahrsam, sondern in voller Freiheit wie heute noch aufwuchsen.
In dieser altertümlichen Gestalt hat sich die Hauskatze in Europa
einzig auf der Insel Sardinien erhalten, wo sie jedoch verwildert ist
und als Rückschlagserscheinung kleine, schwarze Ohrpinsel zeigt. Die
europäischen Hauskatzen weisen schon weitere Veränderungen auf und
variieren stark in der Körperfärbung. Es gibt unter ihnen wildfarbene,
graugestreifte, gefleckte, mausgraue, schwarze und weiße Spielarten.
Die sogenannte Zypernkatze, die durch ihre schwarze Streifung
auf gelblichgrauem Grunde stark an unsere Wildkatze erinnert, muß
wie die andern wildfarbenen, gestreiften und gefleckten Hauskatzen
stark Blut der europäischen Wildkatze aufgenommen haben, die sich
besonders früher, da sie häufiger war, oft mit der Hauskatze zu
paaren Gelegenheit hatte. Weit seltener als die Zypernkatzen sind
die gelbgrauen Katzen ohne schwarze Zeichnung am Kopf, Rumpf und
Schwanz, nur mit zwei schwarzen Querbändern an den Vorderbeinen.
Ihnen schließen sich die gelbschwarzen Katzen an, die auf gelblichem
Grunde unregelmäßige, an den Rändern verwaschene, ziemlich kleine
schwarze Flecken ohne Beimischung von Weiß zeigen. Meist sind diese
weiblichen Geschlechts und die zugehörigen Männchen sandfarben. Doch
können auch Weibchen sandfarben sein, und Katzen, die auf sandfarbenem
oder gelbschwarzem Grunde weiß gescheckt sind, finden sich in
beiden Geschlechtern nicht selten. Ziemlich lang und weichhaarig
grau mit schwarzen Lippen und Fußsohlen sind die sogenannten
Karthäuserkatzen. Weiße Katzen haben entweder gewöhnliche
Katzen- oder rein[S. 290] blaue Augen. Dabei kann nun das eine Auge blau und
das andere von gewöhnlicher Färbung sein. Sind beide Augen blau, so ist
die weiße Katze meist taub. Schwarze Katzen haben meist gelbe Augen.
Stummelschwänzig oder nahezu schwanzlos ist die Katze der Insel
Man zwischen England und Island. Dazu hat sie einen großen Kopf
und unverhältnismäßig lange und starke Hinterbeine. Sie ist eine
unermüdliche Springerin und Kletterin und stellt den Vögeln viel
mehr nach als andere Hauskatzen. Die Färbung ist verschieden. Bei
der Kreuzung mit der gewöhnlichen Hauskatze sind die Nachkommen
teils kurzschwänzig, teils schwanzlos. Über die Entstehung dieser
eigentümlichen Rasse ist nichts Näheres bekannt geworden. Sie
wird wohl plötzlich durch Mutation hervorgegangen sein. Wie
unter den europäischen gibt es auch unter den asiatischen Katzen
stummelschwänzige, so besonders in China und Japan. In Siam, Birma
und auf der Halbinsel Malakka lebt die malaische Haus-
oder Knotenschwanzkatze, deren Schwanz nur die halbe Länge
gewöhnlicher Hauskatzenschwänze hat und oft infolge einer Mißbildung
der Knochen zu einem festen Knoten verdickt ist. Diese Anomalie ist
angeboren und wird vererbt.
Die chinesische Hauskatze besitzt ein seidenweiches, langes
Haar von lichtgelber bis weißer Farbe. Unter dem Einflusse der
Domestikation ist sie wie so viele andere Haustiere hängeohrig
geworden. Sie wird in China viel gezüchtet, um nach vorhergehender
Mästung geschlachtet und als beliebte Speise verzehrt zu werden. Sie
scheint stark Blut der asiatischen Wildkatze in sich aufgenommen zu
haben. Auch in Südwestindien, speziell in Kotschin, wird die Hauskatze
häufig gegessen, wie übrigens auch in Frankreich, wo deren Fleisch
regelrecht auf den Markt gelangt. Die schönste und edelste aller Katzen
aber ist die Siamkatze, die außer in ihrer Heimat auch in China
und Japan als Luxustier gehalten wird, dort sehr hoch im Preise steht
und nur selten nach Europa gelangt. Die frischgeworfenen Jungen sind
blendendweiß mit roten Augen, also eigentliche Albinos, die aber später
durch Pigmentbildung sich verfärben. Der dichte, kurzhaarige Pelz wird
dann silbergrau bis schokoladebraun, mit schwärzlichem Gesicht, ebenso
werden die Füße, Schwanzspitze und Ohrspitzen schwarz. Die Augen sind
blau. Ihre Abstammung ist unbekannt. In reiner Rasse ist sie nur aus
dem Palaste des Königs von Siam zu bekommen, der allein das Vorrecht
besitzt, sie zu halten. Sie ist geistig hochbegabt und sehr zutraulich,
was schon auf ein sehr altes, inniges Zusammenleben mit dem[S. 291] Menschen
hinweist. Die gewellten oder gefleckten Hauskatzen Indiens scheinen
Kreuzungsformen der Hauskatze mit der indischen Wüstenkatze zu sein.
Überall, wo der Mensch unter der Mäuseplage zu leiden hatte, hat er die
Hauskatze kommen lassen, so der Konquistador Almagro, der nach Herrera
dem Italiener Montenegro, der die erste Katze nach Peru brachte, dafür
600 Pesos (= 2634 Mark) gab. Dort werden sie heute zur Unterhaltung
der verschiedenen Madonnen in die Kirche gelassen, indem die
betreffenden Besitzerinnen glauben, jene werden sich für eine solche
Liebenswürdigkeit erkenntlich erzeigen und ihnen ihre Wünsche eher
erfüllen. In Bolivia sind heute gemästete Katzen ein Lieblingsgericht
der vorwiegend indianischen Bevölkerung. Auch bei der ersten
Besiedelung des Goldlandes von Cuyabá am Paraguay um 1745 wurde für
die erste, zur Beseitigung der Mäuseplage kommen gelassene Hauskatze
nicht weniger als ein Pfund Gold bezahlt. Als Missionar Sagard bei
seiner Abreise 1626 dem Huronenhäuptling eine Katze schenkte, nahm
dieser sie mit großem Dank entgegen. Als in Neuseeland um 1855 die
Ratten verheerend auftraten, wurde 1857 eine ganze Schiffsladung Katzen
dahin eingeführt. Im 14. Jahrhundert soll Whittington, einer der ersten
Handelsfürsten Englands, den Grund seines großen Vermögens dadurch
gelegt haben, daß er seine Katze einem westafrikanischen Häuptling
abtrat, der derselben wegen der Mäuse stark bedurfte. Dort sind die
Katzen heute gemein; an der Goldküste wurden sie nach Bosmann auch
gegessen. Nach Nachtigal verehrten die Heiden des alten Negerlandes Dar
Fur eine weiße Katze, wie nach dem älteren Plinius in der Stadt Rhadata
eine goldene Katze angebetet wurde. Jedenfalls ist mit dem alten
Kulttier auch die Heiligkeit desselben gewandert. So treffen wir selbst
in den Vorstellungen unseres Volkes noch Spuren davon. So soll die
Katze, wenn sie ihre Pfoten vor dem Fenster säubert, Besuch ankündigen,
d. h. der in ihr wohnend gedachte, die Zukunft vorausschauende Geist
soll diesen erblicken und damit anmelden. Ferner wird der Glaube noch
häufig angetroffen, daß, wer die Hauskatze nicht gut füttert, einen
schlechten Hochzeitstag erlebt. Nach dem deutschen Volksmärchen steht
die schwarze Katze stets mit dem Bösen im Bunde; deshalb ist sie auch
die unzertrennliche Begleiterin der Hexe. Wohl durch diese Stellung
als Kulttier während vieler Generationen hat die Katze mit der Zeit
etwas Eigenwilliges und Aristokratisches angenommen. Wenn sie auch
nicht mehr so unzuverlässig ist wie die gezähmte Wildkatze, so ist sie[S. 292]
doch nicht so gutmütig wie der Hund. Ohne gerade falsch zu sein, wie
man gern behauptet, läßt sie sich schon durch geringe Behelligung zum
Kratzen und Beißen verleiten. Im allgemeinen ist die Katze schon als
Einzeljäger viel selbständiger als der Hund und läßt sich vom Menschen
nicht alles bieten. Leicht entzieht sie sich ihm durch Flucht, kehrt
aber später gern wieder ins Haus und in ihr gewohntes Lager zurück.
Neben der Katze hatten die Ägypter des Mittleren Reiches auch den
Sumpfluchs (Felis chaus) gezähmt, der bisweilen den
vornehmen Jäger auf der Jagd im Sumpfe begleitete und die von ihm mit
dem bumerangartigen Wurfgeschoß getroffenen Vögel apportieren mußte.
Dieser wurde, wie bereits erwähnt, gelegentlich mit der Hauskatze
gekreuzt, doch lassen sich keine tiefergehenden Einwirkungen von ihm
auf die altägyptische Hauskatze nachweisen. Auch er galt dem Ägypter
als heiliges Tier und wurde in Beni Hassan mehrfach mumifiziert
vorgefunden.
Zur Zeit des Neuen Reiches gab es am ägyptischen Hofe auch gezähmte
Löwen, die den Herrscher umgaben und ihn sogar in die Schlacht
begleiteten. So ist an einer der Tempelwände von Karnak König Ramses
II. (1292–1225 v. Chr.) auf seinem Streitwagen mitten in der
Schlacht dargestellt, und um ihn kämpfte mit derselben Bravour wie
er sein „Leiblöwe“, von dem es im Bericht über jene Schlacht gegen
die Chethiter heißt: „Der große Löwe, der seinen Wagen begleitete,
kämpfte zugleich mit ihm; die Wut ließ alle seine Glieder erzittern
und wer sich ihm näherte, den schlug er zu Boden.“ An einem der Pylone
von Luksor sehen wir denselben Herrscher auf dem gleichen Feldzuge im
Lager ruhend. Vor seinem Zelt ruht an einer Kette der Löwe, von einem
mit einer Keule bewaffneten Hüter bewacht; denn so zahm er auch war,
so konnte man ihm doch im Lager nicht trauen. Mit demselben äußeren
Symbol seiner Herrschermacht, dem gezähmten Löwen, umgab sich auch
sein Nachfolger, Ramses III. (1198–1167 v. Chr.). Auf einem
Basrelief am Palast von Medinet Abu ist er auf seinem Streitwagen
fahrend dargestellt und vor ihm marschiert ein Löwe neben den beiden
Wagenpferden. Zur Jagd allerdings konnte der Löwe nicht verwendet
werden. Es ist zweifellos ein Irrtum, wenn Sir Gardner Wilkinson
nach einer Grabmalerei von Beni Hassan aus der Zeit des Mittleren
Reiches, der 12. Dynastie (nämlich 2000 bis 1788 v. Chr.), auf welcher
eine Löwin mitten unter andern Tieren einen Steinbock überfallen und
niedergeschlagen hat, während sich ein Jäger mit Pfeil und Bogen in
der Hand der Gruppe nähert, aus dieser[S. 293] Zusammenstellung schließen
zu dürfen glaubt, es sei dies eine zur Jagd dressierte zahme Löwin.
Allerdings scheint im alten Indien dieses Bravourstück geleistet
worden zu sein; denn der griechische Schriftsteller Älian berichtet:
„In Indien gibt es gewaltig große Löwen, die entsetzlich grimmig sind
und eine schwarze Mähne besitzen. Jung aufgezogen können sie aber so
zahm werden, daß man sie zur Jagd auf Rehe, Hirsche, Wildschweine,
Stiere und wilde Esel benutzen kann.“ In diesem Falle scheint der Autor
wirklich Löwen und nicht, wie Lenormant glaubt, Geparde gemeint zu
haben.
Auch später war am persischen und römischen Hofe zeitweise der gezähmte
Löwe als Begleiter des Monarchen anzutreffen. So schreibt Dio Cassius:
„Der römische Kaiser Antoninus Caracalla (212–217) hielt sich mehrere
zahme Löwen und hatte sie immer bei sich. Am liebsten hatte er den
einen, den er Acinaces nannte und oft vor allen Leuten küßte. Dieser
pflegte mit ihm zu speisen und sich auf seinem Ruhebette zu lagern. Ehe
der Kaiser ermordet wurde, wollte ihn der Löwe vor der Gefahr warnen
und hielt ihn, als er ausgehen wollte, am Kleide so fest, daß dieses
sogar zerriß, aber Antoninus achtete der Warnung nicht.“ Und Älius
Lampridius berichtet: „Der römische Kaiser Heliogabalus (218–222) hielt
sich zahme Löwen und Leoparden und hatte seinen Spaß mit ihnen. Die
Zähne und Krallen waren ihnen kurz und stumpf gemacht. Bisweilen, wenn
er ein Gastmahl gab, ließ er beim Nachtisch die Bestien eintreten und
neben den Gästen Platz nehmen und lachte sich über die Angst seiner
Freunde halb tot. Er fütterte auch seine Löwen und Leoparden oft mit
Papageien und Fasanen. — Er fand auch großes Vergnügen daran, seine
Gäste abends betrunken zu machen, brachte sie dann in einen Saal und
schloß sie ein; dann ließ er Löwen, Leoparden und Bären hinein, deren
Zähne und Krallen abgestumpft waren. Die meisten Gäste starben, wenn
sie aufwachten und die Ungeheuer sahen, vor Schreck. — Er ließ auch
Löwen vor seinen Wagen spannen und sagte, er sei die Göttin Cybele“,
die man sich mit einem Löwengespann fahrend vorstellte.
Auch der Tiger war schon im Altertume teilweise gezähmt.
So schreibt der griechische Geschichtschreiber Älian: „Unter den
Geschenken, welche die Inder ihrem Könige bringen, sind auch zahme
Tiger.“ Dann berichtet der ältere Plinius in seiner Naturgeschichte:
„Pompejus der Große hat zu Rom den ersten zahmen Tiger in einem
Käfig gezeigt, Kaiser Claudius aber vier zu gleicher Zeit.“ Und der
römische Geschichtschreiber Lampridius bemerkt: „Kaiser Heliogabalus
spannte[S. 294] Tiger vor den Wagen und sagte, er sei Bacchus.“ Der Tiger
war bekanntlich das Attribut des aus dem Morgenlande, und zwar dem
fernen Indien, über Kleinasien zu den Griechen gekommenen Gottes der
ausgelassenen Lebensfreude und Fruchtbarkeit des Bodens, nämlich
Bacchus. Er ließ sich der Sage nach auch im Abendlande von den Tigern
Indiens ziehen und behing sich mit dem Tigerfell, an dessen Stelle erst
später das Leopardenfell trat. Ähnlichen Zeitvertreib wie Heliogabalus
hatte sich übrigens schon Kaiser Vespasians Sohn Titus als Kronprinz
geleistet, bis er dann mit der Übernahme der Regierung löblicherweise
eine ernste Lebensführung begann. Sonst haben diese großen Katzenarten
nur als Prunkstücke für einzelne Vornehme oder Herrscher eine Rolle
gespielt, nie jedoch praktische Bedeutung für den Menschen erlangt.
Anders ist dies mit dem Gepard der Fall, welcher schon im hohen
Altertum im Morgenlande zum Jagdgehilfen des Menschen abgerichtet
wurde. So treffen wir ihn mehrfach an der Kette geführt als Begleiter
des vornehmen Jägers auf Wandgemälden des alten Ägypten; doch gelangte
er als gezähmter Genosse des Menschen nie zu den Griechen und Römern;
wenigstens ist uns nichts davon überliefert. Dagegen hat er im Orient
bis auf den heutigen Tag eine bedeutende Rolle als Jagdgehilfe des
Menschen gespielt, so daß er hier eine eingehende Besprechung verdient.
Von Afrika aus, wo er sich in verschiedenen Unterarten fast über
den ganzen Erdteil ausdehnt, erstreckt sich das Verbreitungsgebiet
des Geparden über ganz Westasien bis Indien. Der am ganzen Körper
getüpfelte asiatische Gepard oder Tschita (Cynailurus
guttatus) ist schlanker und hochbeiniger als der mit weißem Bauch,
ohne Fleckenzeichnung daran versehene afrikanische Gepard
oder Fahhad der Araber (C. guttatus). Letzterer wird
auch gelegentlich für die Jagd dressiert und ist die gewöhnlich in
den Menagerien und Tiergärten angetroffene Art. Aber der eigentliche
„Jagdleopard“ ist der asiatische Gepard, der gezähmt ein
wichtiges Zubehör des Hofstaates indischer Fürsten bildet. Dieses
Tier, von der Größe eines Leoparden, nur viel schlanker und höher
gestellt, ist in eigenartiger und weitgehender Weise dem Leben in der
Steppe angepaßt. Sein Körper trägt die charakteristische gelbbräunliche
Wüstenfärbung mit kleinen, runden, innen nicht helleren schwarzen
Flecken und ist durch die hohen Beine und den schlanken Leib zum
außerordentlich schnellen Verfolgen seiner Beutetiere befähigt.
Letztere bilden in Indien die Schwarz[S. 295]bockantilopen (Antilope
cervicapra), die viel in unsern zoologischen Gärten gehalten und
gezüchtet werden und meist unter dem Namen Hirschziegenantilopen
bekannt sind. In der Nachbarschaft der Ebenen, auf denen diese
Antilopen weiden, hält sich der Gepard auf niedrigen Felsenhügeln auf
und beschleicht von hier aus mit außerordentlichem Geschick gegen
den Wind und jede Unebenheit des Bodens, Gebüsch und dergleichen als
Deckung benutzend, seine Beute. Hat er sich ihr auf 150–200 Schritte
genähert, so schießt er in gewaltigen Sätzen unglaublich schnell auf
sie los und hat sie bald eingeholt. Mit gewaltigen Tatzenhieben schlägt
er die Antilope zu Boden und tötet sie durch einen Biß in die Kehle.
Gelingt es ihm nicht, das Wild nach 400–600 Schritten einzuholen, so
läßt er von der Jagd ab, da er diese außerordentliche Schnelligkeit,
die ihn beim Laufen auf kurze Strecken als schnellstes aller Säugetiere
erscheinen läßt, nicht längere Zeit entwickeln kann.
Der Gepard jagt paar- oder familienweise. Seine Zähmung und Abrichtung
zur Jagd ist eine sehr einfache und wird von Angehörigen einer
besonderen Kaste vollzogen. Er wird in der Weise gefangen, daß rund um
einen besonderen Baum, um den sich diese Tiere zum Spiele zu versammeln
und an welchem sie ihre Krallen zu schärfen pflegen, Schlingen aus
getrockneten Antilopensehnen mit Pflöcken auf dem Boden befestigt
werden. Kommen die Tiere bei Sonnenuntergang zu dem betreffenden, an
seinen Kratzspuren erkennbaren Baum, so fangen sie sich leicht in
den geschickt angebrachten Schlingen. Die in der Nähe auf der Lauer
liegenden Inder eilen alsbald herbei, werfen eine Wolldecke über sie,
binden ihnen die Beine zusammen und fahren sie auf dem inzwischen
herangekommenen Ochsenfuhrwerk in das Dorf, wo die Frauen und Kinder
dazu beordert werden, den ganzen Tag über bei den frischgefangenen
Tieren zu verweilen und sich laut miteinander zu unterhalten, um die
Geparde dadurch an die menschliche Stimme zu gewöhnen. Haben sie sich
daran gewöhnt, so werden sie an einen Baum oder eine Hütte möglichst
nahe an einem belebten Ort angekettet, damit sie fortwährend Menschen
sehen und sich an ihren Anblick gewöhnen. Dann beginnt die verschiedene
Stufen durchlaufende Abrichtung der Geparde, die in etwa sechs Monaten
beendet ist. Dabei sind die Tiere so sanft und gelehrig wie Hunde
geworden, nehmen zutraulich die Liebkosungen des Menschen entgegen,
sind selbst Fremden gegenüber gutmütig, glätten beim Streicheln ihr
Fell an ihren Freunden, nach Art der Hauskatzen schnurrend. Gewöhnlich[S. 296]
hält man die zahmen Jagdleoparden vor dem Haus mit einer Kette an der
Wand befestigt, auf einer Eingeborenenbettstelle, nicht aber in einem
Käfig.
Nur erwachsen gefangene Geparde werden in Indien zur Jagd abgerichtet;
denn die indischen Schikaris oder Gepardjäger halten mit Recht dafür,
daß nur solche, die von ihren Eltern in der Wildnis das Jagen erlernt
haben, gute Jäger in der Gefangenschaft abgeben. Will man mit dem
gezähmten und abgerichteten Geparde jagen, so setzt man ihm eine ihn
am Sehen hindernde Kappe aus Leder auf, bindet eine Schnur an einen
um seinen Hals oder um seine Weichen gehenden Lederriemen, setzt ihn
auf ein Ochsenfuhrwerk und fährt mit ihm so nahe als möglich in die
Nachbarschaft von Antilopen, die sich vor gewöhnlichen Landwagen,
die sie täglich sehen, nicht fürchten und deshalb leicht eine starke
Annäherung eines solchen Gefährtes erlauben. So kann sich ein Karren
bis auf 200 Schritte einem Rudel Antilopen nähern. Alsbald nimmt
der Jäger dem Jagdleoparden die Kappe vom Kopf und läßt ihn los. Je
nach der Entfernung von den Antilopen eilt er dann entweder ohne
weiteres auf sie zu, oder er schleicht sich, indem er die Unebenheiten
des Bodens mit Vorteil benutzt, so weit an sie heran, daß er einen
erfolgreichen Überfall unternehmen kann. Ist ein Antilopenbock in
der Herde, so ergreift der Gepard gewöhnlich diesen, wahrscheinlich
aber nur deswegen, weil der Bock als Führer des Rudels am weitesten
zurückbleibt. Der Jagdleopard stürzt sich auf die Antilope und soll
sie dadurch, daß er mit einer Pranke von unten an ihre Beine schlägt,
zu Falle bringen, worauf er das gefallene Tier an der Kehle ergreift
und so lange festhält, bis der Jäger herangekommen ist. Darauf
durchschneidet dieser mit seinem Jagdmesser die Kehle der Antilope,
sammelt etwas von ihrem Blut in die mitgenommene Freßschüssel des
Jagdleoparden und gibt es diesem, der es eifrig aufleckt, zu trinken,
wobei er ihm in einem geeigneten Augenblick die Kappe wieder über den
Kopf zieht, um ihn alsbald wieder zur Jagd zu verwenden; denn ein
guter Jagdleopard soll manchmal nicht weniger als vier Böcke an einem
einzigen Morgen erbeuten.
In ganz Indien ist der gezähmte Gepard ein geschätzter Jagdgehilfe des
Menschen. An den Höfen der indischen Fürsten wird er in großer Menge,
bis hundert Stück, gehalten, was allerdings ein sehr kostspieliges
Vergnügen bedeutet, da dessen Unterhalt und Wartung durch ein ganzes
Heer von Wärtern und Jägern, die ungefähr die[S. 297] geachtete Stellung der
Falkner bei uns im Mittelalter bekleiden, große Summen verschlingt.
Der reichste von allen indischen Fürsten, der Großmogul von Delhi,
soll bis zu tausend Geparde auf seinen Jagdzügen mit sich geführt
haben. Der Schah von Persien läßt sie sich aus Arabien kommen und
hält sie in einem besonderen Hause. Im Jahre 1474 sah der Italiener
Guiseppe Barbaro beim Fürsten von Armenien etwa hundert Stück
Jagdleoparden. Früher kamen gelegentlich solche Jagdleoparden als
Geschenke orientalischer Fürsten auch an europäische Höfe. So erhielt
beispielsweise der deutsche Kaiser Leopold I. um 1680 vom
türkischen Sultan zwei abgerichtete Jagdleoparden, mit denen er oftmals
jagte. Da aber diese Tiere sehr der Wärme bedürfen, so sind sie bei uns
recht hinfällig und kurzlebig, dauern aber in ihrer heißen Heimat sehr
lange aus.
Wie außerordentlich zahm und zutraulich der Gepard wird, das bezeugt
Brehm, der selbst einen solchen besaß und dreist wagen durfte, ihn
an einem Stricke durch die Straßen seiner Heimatstadt zu führen.
Solange er es nur mit Menschen zu tun hatte, ging er ihm stets ruhig
zur Seite; nur wenn er Hunden begegnete, zeigte er eine große Unruhe
und wäre gern gegen sie losgesprungen. Das war das einzige Tier, das
ihn in Aufregung brachte. In seinem Tierleben schreibt Brehm von ihm:
„Daß die Zähmung nicht schwierig sein kann, wird jedem klar, der einen
Gepard in der Gefangenschaft gesehen hat. Ich glaube nicht zuviel zu
sagen, wenn ich behaupte, daß es in der ganzen Katzenfamilie kein so
gemütliches Geschöpf gibt wie unseren Jagdleoparden, und bezweifle,
daß irgend eine Wildkatze so zahm wird wie er. Gemütlichkeit ist der
Grundzug des Wesens unseres Tieres. Dem angebundenen Gepard fällt
es gar nicht ein, den leichten Strick zu zerbeißen, an den man ihn
gefesselt hat. Er denkt nie daran, dem etwas zuleide zu tun, der sich
mit ihm beschäftigt, und man darf ohne Bedenken dreist zu ihm hingehen
und ihn streicheln und liebkosen. Scheinbar gleichmütig nimmt er solche
Liebkosungen an, und das höchste, was man erlangen kann, ist, daß er
etwas beschleunigter spinnt als gewöhnlich. Solange er nämlich wach
ist, schnurrt er ununterbrochen nach Katzenart, nur etwas tiefer und
lauter. Oft steht er stundenlang unbeweglich da, sieht träumerisch
starr nach einer Richtung und spinnt dabei höchst behaglich. In solchen
Augenblicken dürfen Hühner, Tauben, Sperlinge, Ziegen und Schafe an ihm
vorbeigehen, er würdigt sie kaum eines Blickes. Nur andere Raubtiere
stören seine[S. 298] Träumerei und Gemütlichkeit. Ein vorüberschleichender
Hund regt ihn sichtlich auf: das Spinnen unterbleibt augenblicklich,
er äugt scharf nach dem gewöhnlich etwas verlegenen Hunde, spitzt
die Ohren und versucht wohl auch, einige kühne Sprünge zu machen,
um ihn zu erreichen.“ Soweit dies bekannt ist, hat er sich aber in
der Gefangenschaft noch nicht fortgepflanzt, ist also noch nicht zum
eigentlichen Haustier des Menschen geworden.
Weiter sind von Raubtieren Wiesel und Frettchen bei
den Griechen und Römern gezähmt und zum Mäusevertilgen in ihren
Wohnungen gehalten worden, lange bevor die Katze aus Ägypten zu ihnen
gebracht wurde. Besonders letzteres, das Frettchen, war ein häufig
angetroffenes, sehr beliebtes Haustier. Es hieß bei den Griechen
iktis und bei den Römern mustela. Das Frett
(Mustela furo) ist nichts anderes als der durch Gefangenschaft
und Zähmung kleiner und zugleich albinotisch gewordene Abkömmling
des Iltis. Es ist weiß bis semmelgelb, am Leibe 45 cm und am
Schwanze 13 cm lang. Nur wenige sehen dunkler und dann echt
iltisartig aus. Es ist weniger lebhaft als sein wilder Verwandter,
steht ihm aber an Blutgier und Raublust nicht nach. Sein Zähmungsherd
scheint in Nordafrika gewesen zu sein, und zwar wurde es dort nicht
nur gegen Mäuse, sondern besonders auch gegen Kaninchen losgelassen,
die es aus ihrem Bau heraustrieb. So schreibt Strabon: „In Turdetanien
(einer spanischen Landschaft) bedient man sich der Frettchen aus
Libyen, um die Kaninchen zu jagen. Man schickt sie mit einem Maulkorb
in die Löcher; so ziehen sie die Kaninchen entweder mit den Krallen
heraus oder jagen sie empor, so daß sie von den Leuten gefangen werden
können.“ Schon lange vorher schrieb Aristoteles, es gleiche an Gestalt,
weißer Farbe des Bauches und Bosheit den Wieseln (galé), könne
jedoch außerordentlich zahm gemacht werden. Es gehe gern über die
Bienenstöcke und nasche Honig, hasche aber auch gern Vögel, wie die
Katze. Aus Spanien kam dann das Frett zu uns, um bei der Kaninchenjagd
zu dienen. Dabei legt man ihm, damit es sich nicht am Blut seines
Opfers berausche, auch heute noch einen Maulkorb an; früher war
man so roh, ihm den Mund zusammenzunähen, damit es solches nicht
tue und dann im Kaninchenbau bleibe, so daß der Jäger lange warten
kann, bis es zum Bau herauskommt. In England benutzt man es viel als
Rattenjäger, doch muß es dazu besonders erzogen werden, indem man es
zuerst nur mit jungen Ratten kämpfen[S. 299] läßt. Später wächst dann sein
Mut, so daß es schließlich in einer Stunde bis 50 Ratten in einem 2–3
qm großen Raum zu töten vermag. Durch Kreuzung mit dem Iltis zum
Zwecke der Blutauffrischung entstehen die „wildfarbigen“ sogenannten
Iltisfrettchen, welche etwas stärker sind als das eigentliche
Frettchen. Stets muß das Frettchen in Käfigen gehalten werden, da
es der Anhänglichkeit an Haus und Hof entbehrt, durch die sich die
eigentlichen Haustiere auszeichnen. Es wird jetzt namentlich zur Jagd
auf Kaninchen gezüchtet, ist sehr empfindlich gegen Kälte, aber gleich
vielen anderen Haustieren fruchtbarer als die Stammart, indem das
Weibchen 5–10 Junge wirft, und zwar zweimal im Jahr.
Zweifellos ist von allen Vögeln das Huhn von der weitaus größten
wirtschaftlichen Bedeutung für den Menschen geworden. Heute ist es
in zahlreichen Rassen über die ganze Welt verbreitet und findet sich
in dem elendesten Negerdörfchen Zentralafrikas ebensogut wie in den
entlegensten Eingeborenenniederlassungen Amerikas und Indonesiens. Das
war aber nicht von jeher so. Der vorgeschichtliche Europäer kannte
dieses Haustier so wenig als die alten Ägypter, Inder und Morgenländer
überhaupt. Nirgends treffen wir bei ihnen irgend welche Spuren von der
Anwesenheit dieses Vogels, der sich sonst sehr wohl bemerkbar gemacht
haben würde. Im Alten Testament wird er nirgends erwähnt; erst im Neuen
tritt er uns beispielsweise bei Petri Verleugnung des Herrn entgegen.
Das Huhn ist jedenfalls schon im zweiten Jahrtausend v. Chr. irgendwo
in Südasien vermutlich von einem Malaienstamme durch Zähmung des
dort einheimischen Bankivahuhns (Gallus ferrugineus)
als Haustier gewonnen worden. Von seinem ältesten Domestikationsherd
Südasien breitete es sich langsam nach allen Seiten hin aus und wurde
schon ums Jahr 1400 v. Chr. nach China eingeführt. Nach Westasien
gelangte es erst viel später. So hat es Layard zuerst auf einem
altbabylonischen Siegelzylinder aus dem 6. bis 7. Jahrhundert v. Chr.
abgebildet gefunden. Auf diesem steht ein Priester in Opferkleidung
vor einem größeren und einem kleineren Altar, auf welch letzterem sich
ein Hahn befindet. Auf einer ebenfalls aus derselben Zeit stammenden
babylonischen Gemme sehen wir eine geflügelte Gottheit in betender
Stellung vor einem Hahne auf einem Altar. Beide Male erscheint der
Hahn von Osten, und über beiden Abbildungen schwebt ein Halbmond,
wahrscheinlich als Zeichen der schwindenden Nacht. Im alten Ägypten ist
jedenfalls das Hühnchen, das die Hieroglyphe u dar[S. 301]stellt, nicht
das Junge eines Haushuhns, sondern dasjenige eines Wildhuhns, und zwar
vermutlich eines Steinhuhns.
Homer kannte das Huhn noch nicht, denn er erwähnt es nirgends in seinen
Epen. Zum erstenmal spricht von ihm der griechische Dichter Theognis in
der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts v. Chr. Aber erst um die Zeit
der Perserkriege finden wir bei den Dichtern Epicharmos, Simonides,
Äschylos und Pindar den Hahn unter dem stolzen Namen aléktōr,
d. h. Abwehrer, Kämpfer, als bekannten Genossen des Menschen. Die
griechischen Dichter vergleichen den Kampf der Hähne desselben Hofes
untereinander mit dem Streite der Menschen. In den Eumeniden des
Äschylos warnt Athene vor dem Bürgerkrieg, als dem zwecklosen Kampf
zwischen zwei Hähnen gleichend. Ebenso vergleicht Pindar in seinem 12.
olympischen Liede den ruhmlosen Sieg in der Vaterstadt mit demjenigen
des Hahnes auf dem Hofe.
Bei den griechischen Komikern heißt der Hahn stets der „persische
Vogel“, weil er durch die Vermittlung der Perser nach Griechenland kam.
Seine hohe Wertschätzung bei den alten Persern erfuhren wir bereits bei
der Besprechung des Hundes. Dort wurde gesagt, daß der Hahn, wie der
Hund, der Feind der Dämonen und Zauberer sei. Er solle Wache halten
über die Welt, als sei kein Hund zum Beschützen der Herden und der
Häuser vorhanden. Wenn der Hund mit dem Hahn gegen den bösen Feind
kämpfen, so entkräften sie ihn, der sonst Menschen und Vieh plage.
Daher heiße es, durch ihn werden alle Feinde des Guten überwunden,
seine Stimme zerstöre das Böse. Wo sich nun ein Perser niederließ,
sorgte er so sicher für einen Hahn, als er die Frühgebete und
Reinigungen beim Sonnenaufgang, die ihm seine Religion gebot, vornahm.
Soweit also die Grenzen der persischen Herrschaft sich erstreckten,
ward auch der Hahn, als leicht übertragbares Fetischtier, das durch
seine Stimme die bösen Geister vertrieb, mitgenommen. So kam das Tier
auch nach Kleinasien und zu den Griechen an den Küsten des Ägäischen
Meeres, die ihn mehrmals auch auf ihren Münzen abbildeten. Seine
vormalige Heiligkeit erhielt sich auch bei ihnen insofern, als sie sich
zunächst scheuten, ihn oder die Eier des Huhnes zu essen. Bald aber
ward der Hahn ein Opfertier, das man besonders dem Heilgotte Asklepios
nach erlangter Genesung opferte. So befahl auch der Philosoph Sokrates,
bevor er den Schierlingsbecher trank, man solle dem Asklepios einen
Hahn opfern; er sei dann durch den Tod genesen. Auch zu mannigfaltigem
Zauberspuk benutzte man in Griechenland den Hahn. So schreibt
Pausanias:[S. 302] „Wenn bei Mehtana im Gebiet von Trözen der Südwestwind
aus dem Saronischen Meerbusen auf die ausschlagenden Weinstöcke weht,
so vertrocknen diese leicht. Um diesem Übel vorzubeugen, packen zwei
Männer einen Hahn, der ganz weiße Flügel hat, reißen ihn entzwei
und jeder läuft mit seiner Hälfte um den Weinberg herum. Da, wo sie
dann zusammentreffen, vergraben sie die Stücke.“ Hier ist also schon
von partiellem Leucismus beim Hahne als einem Zeichen weitgehender
Beeinflussung durch Domestikation die Rede.
Viel länger bewahrte das Huhn seinen sakralen Charakter bei den Römern,
die es durch Vermittlung der süditalischen Griechen kennen gelernt
hatten. Diese betrachteten es als einen Vogel, der von einem göttlichen
Geiste beseelt war, mit der Fähigkeit, die Zukunft vorauszuschauen.
So wandte man denn überall da, wo ein einzelner die Verantwortung
nicht zu tragen wünschte und ein „Augurium“, eine Weissagung aus dem
Fluge gewisser wilder Vögel nicht gerade zu haben war, die Sache aber
doch zur Entscheidung drängte, ein künstliches „Auspicium“ an, das
man auspicium ex tripudiis nannte. So stellte denn, so oft man
dessen bedurfte, der pullarius oder Hühnerwärter die Vögel durch
Vorstreuen von Futter auf die Probe. Fraßen sie gierig, so war das ein
günstiges Zeichen für die geplante Unternehmung. Unlust dagegen würde,
so müssen wir ergänzen, auf eine Beängstigung des weiter in die Zukunft
schauenden Geistes in den Fetischtieren schließen lassen.
Zahllos sind die Beispiele, in welchen die Annahme oder Ablehnung
einer Schlacht von seiten der Römer auf das Verhalten der mitgeführten
heiligen Hühner abgestellt wurde. Dabei ist der Standpunkt, den die
verschiedenen römischen Schriftsteller dieser Tatsache gegenüber
einnehmen, ein sehr verschiedener. Die jüngeren, freier denkenden
sind erstaunt darüber, daß die wichtigsten Staatsgeschäfte, die
entscheidendsten Schlachten von Hühnern geleitet und entschieden,
die Weltbeherrscher von Hühnern beherrscht würden. Die älteren,
konservativer denkenden Naturen aber stoßen sich durchaus nicht daran,
sondern meinen, wie Cicero in seinem Werke de divinatione
schreibt: „Bei der Beobachtung der von den heiligen Hühnern ausgehenden
Prophezeiungen (auspicium) verfuhren unsere Vorfahren
gewissenhafter als wir. Der Hühnerprophet (auspex) wählte
zum Gehilfen einen Mann, der selbst ein vollkommener Vogelprophet
(augur) war und demnach genau wußte, was ‚heilige Stille‘
bedeutet. In unserer Zeit kann jeder ohne weiteres bei der heiligen
Handlung als Gehilfe dienen.[S. 303]“ Dann berichtet er ausführlich in Rede
und Gegenrede, wie bei der Handlung verfahren wird. Er meint, daß dabei
nicht mehr mit der Aufmerksamkeit wie früher vorgegangen werde und das
Fressen oder Nichtfressen der Hühner in die Hand des Hühnerwärters
(pullarius) gegeben sei. Er sagt nämlich: „Übrigens ist es nicht
zu leugnen, daß bei einer solchen Art zu prophezeien die Vögel doch
nicht so ohne weiteres als Diener und Propheten Jupiters betrachtet
werden sollten, da sie ja beim Fressen nicht nach dem Willen Jupiters,
sondern nach dem Willen des Hühnerwärters handeln, der sie vorher nach
Belieben in ihrem Käfige längere oder kürzere Zeit fasten läßt.“
Wenn die heiligen Hühner (pulli) so gierig fraßen, daß das schon
im Schnabel befindliche Futter auf die Erde zurückfiel, so wurde das
als eine besonders gute Vorbedeutung aufgefaßt. Es hieß dies bei den
Römern tripudium und sollte nach Cicero von terripudium
= terripavium, quia terram pavit abzuleiten sein. Dann schreibt
dieser Autor: „Im zweiten punischen Kriege (218–201 v. Chr.) hat der
römische Staat dadurch entsetzlichen Schaden gelitten, daß Gajus
Flaminius nicht auf Warnungszeichen achten wollte. Einstmals fütterte
der Priester, der die der Armee beigegebenen heiligen Hühner besorgte,
diese Tiere, um durch die Art und Weise, wie sie fräßen, die Zukunft zu
erforschen, und tat dann den Ausspruch, die Schlacht müsse verschoben
werden. Darauf fragte Flaminius (der Oberfeldherr), was dann geschehen
sollte, wenn die Tiere wieder nicht fressen wollten? Der Priester
antwortete: Dann müsse man eben wieder zuwarten. Hierauf antwortete
Flaminius: Das wäre doch eine schöne Geschichte, wenn ich nur dann auf
den Feind losgehen dürfte, wenn meine Hühner hungrig sind, aber mich
ruhig verhalten müßte, wenn meine Hühner satt sind.“
Allerdings waren nicht alle Feldherren so nachgiebig, daß sie eine
ihnen günstig scheinende Schlacht vom Fressen oder Nichtfressen der
im Heere mitgeführten heiligen Hühner abhängig machen wollten. So
ging einer einmal radikal vor, hatte es aber schwer zu büßen, als die
gegen den Willen der heiligen Hühner unternommene Schlacht ungünstig
verlief. Es war dies Publius Claudius. Über jenen Fall schreibt
Valerius Maximus: „Als Publius Claudius im ersten punischen Kriege
eine Seeschlacht liefern wollte, verkündete ihm der Hühnerwärter, die
heiligen Hühner wollten nicht aus dem Käfig heraus und nicht fressen.
Da gab Claudius den Befehl, sie ins Meer zu werfen und sagte: Wollen
sie nicht fressen, so sollen sie saufen! Er verlor[S. 304] aber die Schlacht
und ward vom Volke verurteilt.“ Derselbe Autor berichtet in einem
anderen Falle: „Als der Konsul Gajus Hostilius Mancinus im Begriffe
war, nach Spanien abzugehen und in Lavinium opfern wollte, huschten die
heiligen Hühner aus ihrem Käfig in den Wald und verschwanden daselbst
spurlos. Infolgedessen verlor er dann eine Schlacht.“
Der römische Geschichtschreiber Livius weiß allerlei solche
Hühnergeschichten vom Diktator Lucius Papirius Cursor zu erzählen.
Als er gegen die Samniten zog, machte ihn der Hühnerwärter darauf
aufmerksam, daß die Hühner kein Glück prophezeit hätten. Da eilte
er nach Rom, um die Hühner abermals zu befragen, befahl aber seinem
Reiteroberst (magister equitum) Quintus Fabius Maximus
Rullianus, während seiner Abwesenheit keine Schlacht zu liefern.
Dieser benutzte aber doch eine Gelegenheit, erfocht einen glänzenden
Sieg, geriet aber darüber mit dem Diktator in einen Streit, der fast
zu offenem Aufruhr Veranlassung gab. „Diese letztere dem römischen
Staate drohende Gefahr war also eigentlich von den Hühnern gemeint und
prophezeit worden,“ meint dazu Livius. Also sollten die Hühner in jedem
Falle recht behalten.
An einer anderen Stelle schreibt dieser Autor: „Als später Papirius
den Samniten bei Luceria gegenüberstand, kamen Gesandte von Tarent,
wollten beiden Parteien befehlen, die Waffen niederzulegen, und drohten
auch noch gar, sie wollten derjenigen Partei, die ihrem Willen nicht
gehorche, entgegentreten. Wie nun die Gesandten den Papirius verlassen
hatten, rüstete sich dieser sogleich zur Schlacht, versäumte aber
auch nicht, seine Hühner zu befragen. Gerade wie er damit beschäftigt
war, kamen die Tarentiner zu ihm und Papirius verkündigte ihnen: Ihr
Tarentiner, die Hühner meines Hühnerwärters verkünden mir den Sieg, und
so werde ich mit Hilfe der Götter sofort den Feind angreifen! Er tat
das wirklich, siegte mit Leichtigkeit und machte große Beute.“
„Ein anderes Mal stand Papirius den Samniten bei Aquilonia gegenüber.
Sie hatten ein gewaltiges Heer; aber Papirius begeisterte seine
Soldaten durch eine Rede so sehr, daß sie laut eine Schlacht forderten.
Papirius befahl nun in aller Stille seinem Hühnerwärter, die heiligen
Hühner zu befragen. Dieser tat es; doch die Hühner wollten nicht
fressen. Aber der Hühnerwärter war so begeistert für die zu schlagende
Schlacht, daß es ihm auf eine Lüge nicht ankam und er dem Konsul
meldete, die Hühner hätten Heil und Segen prophezeit. Voller Freude gab
nun Papirius das Zeichen zum Aufbruch.[S. 305] Aber unterwegs begann unter
den Hühnerwärtern ein Zank über die Hühnerprophezeiung. Die Reiter
hörten den Disput mit an und meldeten die bedenkliche Sache dem Konsul.
Dieser tat den Ausspruch: Wenn ein Vogelprophet lügt, so trifft ihn
allein alles aus der Lüge entstehende Unglück. Mir und dem römischen
Volke ist nur Glück prophezeit worden, also munter vorwärts! Er befahl
nun, die Hühnerwärter in die erste Schlachtlinie zu stellen. Der erste
feindliche Speer streckte den lügnerischen Hühnerwärter nieder und
der Konsul rief mit lauter Stimme: Die Götter stehen uns bei, das
schuldige Haupt ist bestraft! Wie er dies sagte, krächzte ihm ein
Rabe laut entgegen. Er begrüßte dieses günstige Zeichen mit Freuden,
befahl den Trompetern, das Zeichen zum allgemeinen Angriff zu geben und
erfocht einen ruhmvollen Sieg. Er verdankte diesen teils der Klugheit,
mit der er das prophezeite Unglück auf das Haupt des Hühnerwärters
abwälzte, teils auch dem Umstande, daß er im entscheidenden Augenblick
dem Jupiter einen Becher Wein versprach, wenn die Feinde durch seine
Hilfe geschlagen würden.“ Diese Erklärung des Plinius kennzeichnet ihn
vollkommen in seinen Anschauungen. Er war ebensogut wie Livius ein Kind
seiner Zeit. Damals dachten eben alle Römer so wie er.
Eine begeisterte Beschreibung des Hahnes liefert der ältere Plinius
in seiner Naturgeschichte in folgenden Worten: „Ruhmbegierig ist der
Vogel, der in der Nacht für uns wacht, der vor Anbruch des Morgens
den Menschen weckt und zur Arbeit ruft. Er kennt die Sterne und kräht
(canet = singt) am Tage jedesmal, wenn drei Stunden verflossen
sind. Mit der Sonne geht er schlafen und ruft gegen Morgen den Menschen
zu neuen Sorgen und Arbeiten wach. Ehe er kräht, schlägt er mit den
Flügeln. Er ist herrschsüchtig und ein jeder führt auf seinem Hofe
das Regiment. Sie kämpfen untereinander um die Herrschaft, als ob
sie wüßten, daß sie zu diesem Zwecke die Waffen an den Füßen trügen,
und hören nicht eher auf, als bis einer tot auf dem Platze liegt.
Der Sieger kräht gleich auf dem Schlachtfelde und verkündet dadurch
seine Heldentat. Der Besiegte verkriecht sich stillschweigend und
grämt sich über die verlorene Herrschaft. Der gemeinste Hahn schreitet
übermütig einher, trägt sein gekröntes Haupt hoch und stolz, schaut
oft gen Himmel, was kein anderer Vogel tut, und hebt auch seinen
sichelförmigen Schwanz empor. Er flößt daher dem mutigsten Tiere, dem
Löwen, Schrecken ein. Manche Hähne werden zu Krieg und Schlacht geboren
und bringen selbst ihrem Vaterlande Ruhm und Ehre, so die Hähne von
Rhodus und Tanagra. Nach diesen sind[S. 306] die berühmtesten die von Melos
und Chalcis. Der Hahn ist der Ehre wert, die ihm selbst die römischen
Konsuln erweisen. Sein mehr oder weniger begieriges Fressen gibt die
wichtigsten Aufschlüsse über dem römischen Staate bevorstehendes Glück
oder Unglück. Täglich regiert er unsere Obrigkeiten oder verschließt
und öffnet ihnen ihr eigenes Haus. Er befiehlt den römischen Konsuln
vorzurücken oder stehen zu bleiben, befiehlt oder verbietet Schlachten;
er hat alle auf Erden erfochtenen Siege im voraus verkündet, beherrscht
die Beherrscher der Welt und ist, als Opfer dargebracht, ein herrliches
Mittel, die Gunst der Götter zu erhalten. Kräht er zu ungewohnter
Zeit oder des Abends, so deutet er auf wichtige Begebenheiten hin.
Als die Böotier jenen berühmten Sieg über die Lakedämonier erfochten,
hatten es die Hähne dadurch vorausverkündet, daß sie die ganze Nacht
krähten. Da der Hahn nicht kräht, wenn er besiegt ist, so war die
Deutung zweifelhaft.“ Plinius geht so weit, daß er dem Hühnervolke
sogar sonst rein menschliche Eigenschaften, wie den Besitz von Religion
und Sprache, beilegt. So sagt er: „Auch die Haushühner (villares
gallinae) haben ihre Religion: Sobald sie nämlich ein Ei gelegt
haben, schütteln sie sich und nehmen eine Zeremonie vor, indem sie um
das Ei ein Grashälmchen herumtragen.“ Es kommt nämlich öfter vor, daß
sich die Hühner nach dem Eierlegen schütteln, daß sie dann Hälmchen mit
dem Schnabel fassen und sie neben und hinter sich legen, ohne Zweifel,
weil sich dann die angeborene Neigung zum Nestbau regt. Plinius
betrachtet diese Eigenschaft poetisch als Zeremonie, wie sie damals bei
den Menschen gebräuchlich war und purificare und lustrare
genannt wurde. Was das Vermögen der Sprache anbetrifft, sagt er: „In
den Jahrbüchern ist aufgezeichnet, daß unter dem Konsulat des Marcus
Lepidus und Quintus Catulus ein Haushahn auf dem Landsitze des Galerius
gesprochen hat; dies ist aber auch, so viel mir bekannt, das einzige
Beispiel der Art.“
Weiterhin sagt Plinius: „Zu religiösen Zwecken hält man Hähne und
Hühner mit gelben Füßen und gelbem Schnabel nicht für rein, zu geheimen
Opfern die schwarzen. Es gibt auch Zwerge unter den Hühnern, und zwar
fruchtbare, was bei andern Vögeln nicht der Fall ist.“ Natürlich war
man in der Kaiserzeit, zu der ja Plinius lebte, nicht mehr so von
der Heiligkeit dieses Vogels eingenommen, daß man sich, wie noch zur
älteren Zeit der Republik, scheute, sein Fleisch zu profanen Zwecken
zu essen; als Opferfleisch war es ja schon früher gegessen worden.
Damals kamen gemästete Hühner — richtige Pou[S. 307]larden, nur daß zu jener
Zeit die Kastration derselben noch nicht geübt wurde — sehr häufig
auf den Tisch der reichen Römer. Aber sehr alt kann diese Sitte zu
jener Zeit noch nicht gewesen sein. Plinius schreibt nämlich in seiner
Naturgeschichte folgendes darüber: „Die Bewohner der Insel Delos haben
sich zuerst mit Mästung der Hühner beschäftigt und seitdem sind die
Menschen so albern, daß sie Vögel schnabulieren wollen, die in ihrem
eigenen Fett gebraten wurden. In den alten Gesetzen über Schmausereien
finde ich ein elf Jahre vor dem Beginn des dritten punischen Krieges
(also im Jahre 160 v. Chr.) vom Konsul Gajus Fannius gegebenes, daß bei
einem Gastmahl kein Vogel außer einer einzigen Henne aufgetragen und
diese nicht gemästet sein dürfe. Diese Bestimmung ist später in allen
Gesetzen wiederholt worden, aber man hat sie recht listig zu umgehen
gewußt, indem man statt der Hühner Hähne mit Speisen mästete, die mit
Milch getränkt waren, worauf sie weit besser schmecken. Man darf zur
Mast nicht alle Hühner nehmen, sondern nur die, deren Halshaut fett
ist.“
Mancherlei weiß Plinius von den Hühnereiern zu berichten. Er sagt,
daß, wenn Hühner keinen Hahn haben, die Eier unfruchtbar, kleiner,
von schlechterem Geschmack und flüssiger als die guten (befruchteten)
seien. Man nenne sie Windeier, weil manche Leute glauben, sie seien
vom Winde (Zephyr) erzeugt. Manche Hühner legen lauter Eier mit
doppeltem Dotter „und brüten aus solchen auch manchmal Zwillinge aus,
wie Cornelius Celsus schreibt. Andere aber behaupten, es kröchen nie
Zwillinge aus. Es ist am besten, die zum Brüten bestimmten Eier nicht
über 10 Tage alt werden zu lassen, alte oder gar zu frische sind
unfruchtbar. Man muß eine ungleiche Zahl unterlegen. Wenn man sie am
vierten Tage nach Beginn des Brütens mit den Fingern (an einem dunklen
Orte) gegen das Licht hält und sie rein und durchsichtig sind, so sind
sie unfruchtbar und müssen durch andere ersetzt werden. Man kann sie
auch im Wasser probieren, denn die leeren schwimmen dann, und man muß
die vollen, welche sinken, zum Brüten unterlegen. Schütteln darf man
die Eier nicht, denn es kann sich darin kein Junges mehr erzeugen,
wenn die Lebensgefäße untereinander geworfen sind. Wenn es während
des Brütens donnert, so gehen die Eier zugrunde; dasselbe geschieht
auch, wenn ein Falke in der Nähe schreit. — Selbst Menschen können
Eier ausbrüten. Als Julia Augusta (die Tochter des Kaisers Augustus)
mit Kaiser Tiberius Nero vermählt worden war und wünschte, ihr erstes
Kind möchte ein Sohn sein, so brütete sie an ihrem Busen ein Ei aus.
Mußte sie es[S. 308] einmal weglegen, so gab sie es ihrer Amme, damit es
nicht erkalten könne. Sie glaubte von dem auskriechenden Küchlein
eine Vorbedeutung entnehmen zu können, ob ihr Kind ein Sohn oder
eine Tochter sein werde. Es soll auch richtig eingetroffen sein. Von
daher kommt vielleicht die neulich gemachte Erfindung, daß man Eier
an einem warmen Orte auf Spreu legt, durch Feuer mäßig erwärmt und
zuweilen wendet, wobei die Küchlein am bestimmten Tage auskriechen.
(Also kannten die Römer der Kaiserzeit bereits einen Brutapparat für
Hausgeflügel.) — Ein sonderbares Schauspiel hat man, wenn eine Henne
Enteneier ausgebrütet hat. Erst bewundert sie die Kleinen und will sie
nicht recht anerkennen, bald aber ruft sie dieselben sorgsam zusammen
und, wenn sie sich nun, von einem innern Triebe geleitet, ins Wasser
stürzen, so läuft sie jammernd am Ufer herum.“
Bei der kampfesfrohen, streitsüchtigen Natur der Hähne ist es kein
Wunder, daß schon sehr frühe auch bei den Griechen Hahnenkämpfe
als öffentliche Volksbelustigungen aufkamen. So schreibt Plinius: „Zu
Pergamum (in Kleinasien) werden jährlich öffentliche Hahnenkämpfe
abgehalten.“ Daß er solches in seiner Naturgeschichte erwähnt, beweist,
daß diese Sitte um die Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. bei den
Römern noch nicht üblich war. Was für Gründe etwa zur Einrichtung von
Hahnenkämpfen bei den Griechen maßgebend waren, darüber schreibt der
griechische Geschichtschreiber Älian: „Als die Athener die Perser
besiegt hatten, bestimmten sie einen Tag, an welchem im Schauspielhause
öffentliche Hahnenkämpfe abgehalten werden sollten. Die Veranlassung
dazu war folgende: Als Themistokles mit dem Heere auszog, sah er in der
Nähe des Zuges zwei Hähne, die miteinander kämpften. Er ließ sogleich
das Heer Halt machen und redete es so an: „Diese Hähne kämpfen nicht
für ihr Vaterland, nicht für ihre Götter, für die Gräber ihrer Väter,
nicht für Ruhm, für Freiheit, für ihre Kinder, sondern jeder von ihnen
kämpft nur, um zu siegen.“ Diese Rede begeisterte die Soldaten, sie
fochten mit kühnem Mute und der Feldherr wünschte, durch die Abhaltung
jährlicher Hahnenkämpfe das Andenken an den Sieg zu erhalten und den
Keim für neue Siege zu legen.“
Nach Varro waren die Hähne von Tanagra, Medien und Chalcis zum Kampfe
besonders brauchbar. Er nennt sie sehr schön, aber die betreffenden
Hühner weniger fruchtbar als die italienischen. Letztere hatte man gern
so gefärbt, daß Schwanz und Flügel schwarz, das übrige Gefieder aber
bräunlich war. „Will man auf einem Landhause[S. 309] 200 Stück Haushühner
halten, so gibt man ihnen einen besonderen Stall, zäunt den Platz
davor, auf dem auch Sand zum Bade liegen muß, ein und hält ihnen einen
eigenen Wärter. Will man die Eier für die Küche aufbewahren, so reibt
man sie mit gepulvertem Salz oder legt sie drei Stunden in Salzwasser,
trocknet sie und bedeckt sie mit Kleie oder Spreu. Sollen Haushühner
gemästet werden, so sperrt man sie an einem lauen, dunkeln Orte ein
und nudelt sie mit Gerstenabkochung. So oft sie genudelt werden, wird
ihnen auch der Kopf, wenn es nötig ist, von Läusen gereinigt. In 25
Tagen müssen sie fett sein. Manche machen sie auch in 20 Tagen fett und
erzeugen ein zartes Fleisch, indem sie sie mit Weizenbrot füttern, das
in einer Mischung von Wasser und Wein aufgeweicht wurde.“
In seinem Buche über den Landbau gibt Columella ausführliche Anleitung
über die Anlage des Hühnerhofes, die Pflege der Hühner, das Brüten
und die Aufzucht der Küchlein. Diese entspricht in ihren Grundzügen
vollständig den heutigen; nur daß dabei noch allerlei heute aufgegebene
sympathische Mittel angewandt wurden, um sie vor Erkrankung und aller
sonstiger Gefährdung zu beschützen. Er rät, den Hühnerstall neben der
Küche oder neben dem Backofen anzubringen, so daß der Rauch in ihn
hineindringen könne; denn dieser sei den Hühnern sehr gedeihlich. Er
hält die dunkeln Hühner für empfehlenswerter als die hellen. „Die
weißen Haushühner sind meist weichlich, weniger lebhaft, auch meist
nicht sonderlich fruchtbar im Legen. Sie werden auch, weil sie aus
großer Ferne in die Augen fallen, leicht von Raubvögeln erbeutet.
Die Zwerghühner sind nur für den Liebhaber, der sie wegen ihrer
geringen Größe schätzt. Übrigens bringen sie nicht den Gewinn, wie
die gemeinen großen Haushühner; auch sind die Zwerghähne entsetzlich
zänkisch gegen die großen Hähne, so daß man sich oft genötigt sieht,
ihnen einen ledernen Gurt um den Leib zu legen, durch den die Füße
gesteckt und die Kampfgelüste gemindert werden.“ Nach den um 200 n.
Chr. lebenden Athenäus waren Zwerghühner besonders in Athen beliebt.
Pausanias sagt, daß in Tanagra zwei Arten von Hühnern gehalten werden:
1. kampfesstarke, 2. die Amselhühner, so genannt, weil sie (wie die
Amseln) rabenschwarz sind und auf der Schnabelspitze kleine, weiße
Flecken haben. Kamm und Kammlappen seien bei ihnen rot wie Anemonen. Er
meint damit die in Griechenland heimische Anemone pavonina mit
scharlachroten Blüten.
Die schönen Rassen des asiatischen Haushuhns bezogen die Römer von
den Griechen; so waren besonders die Hühner von Delos, Rhodos[S. 310] und
Melos durch ihre Größe und fleißiges Eierlegen berühmt und gesucht.
Mit den römischen Kolonisten kamen diese auch in die Gebiete nördlich
der Alpen. So fanden sich Reste von Haushühnern mehrfach im Wegwurf
der helvetisch-römischen Kolonie Vindonissa und anderwärts. Aus dem
römischen pullus Huhn wurde das französische poule. Doch
hatten die Kelten und Germanen schon vor der römischen Invasion das
Haushuhn besessen und eine besondere Bezeichnung dafür, ganz unabhängig
von der römischen. Der Hahn hieß gotisch hana, althochdeutsch
hano, angelsächsisch hona, das Huhn gotisch hôn.
Das deutsche hana ging dann bei den benachbarten Finnen in
kana über. Alles deutet darauf hin, daß das Huhn als Haustier
selbständig von Südosten nach Mittel- und Nordeuropa gelangte, soweit
es ihm nicht zu kalt war. Und auch hier drang es überall als etwas
Fetischhaftes, Heiliges, das zwar nicht selbst, höchstens dessen Eier
gegessen werden durften, ein. So sagt Julius Cäsar, der um die Mitte
des letzten vorchristlichen Jahrhunderts an der Südküste Englands
landete, von den dortigen keltischen Einwohnern, sie hätten zwar das
Haushuhn, aber sie fänden es eine Sünde (nefas), das Tier zu
essen, ebenso die Gans und den Hasen. Noch im Mittelalter, als das Huhn
längst zum Speise- und Provianttier degradiert war, wohnte dem Hahn
im Glauben der Leute noch eine große Zauberkraft inne. So sagt der
mittelalterliche Bischof Burchard von Worms, man solle nachts nicht
vor dem Hahnenrufe das Haus verlassen, weil die unreinen Geister vor
diesem Rufe mehr Macht zu schaden hätten als nachher und weil der Hahn
mit seinem Schrei jene besser zu vertreiben und zu bändigen vermöge
als selbst das Kreuzeszeichen. Es ist dies die Weiterleitung desselben
Fetischgedankens, den wir schon bei den alten Persern antrafen und der
uns in der griechischen Benennung des aléktõr, d. h. Abwehrer,
Kämpfer, entgegentrat. Noch in Shakespeares Hamlet sagt Horatio: „Ich
habe gehört, daß der Hahn, der die Trompete des Morgens ist, mit heller
Stimme den Gott des Tages weckt und daß bei seinem warnenden Ruf alle
die Geister, die in Wasser und Feuer, in Luft oder Erde schweifen und
irren, jeder an seinen Ort zurückschlüpfen.“
Auch die slavischen Pommern verehrten den Hahn und fielen anbetend
vor ihm nieder; bei den Litauern wurde bei der Beziehung eines neuen
Hauses Hahn und Henne zuerst ins Haus gelassen. Diese Exemplare
galten dann als unantastbar, wurden gehegt und niemals geschlachtet
und gegessen. In diesem Falle sehen wir, wie sich mit der Zeit das
praktische Moment mit dem religiösen abfand. Als man sich[S. 311] erlaubte,
das Huhn zu essen, haftete die Beschränkung des Nichtessendürfens nur
noch an einzelnen auserlesenen Individuen. Bei den verschiedensten
Völkern begegnet uns noch später in gewissen, am Althergebrachten
hängenden Kreisen solche Enthaltung vom Genusse von Hühnerfleisch. Wie
im altindischen Gesetzbuch war auch den Teilnehmern an den Mysterien
in Eleusis das Essen von Hühnerfleisch verboten, weil diese Tiere den
Erdgottheiten, der Persephone und Demeter, geweiht waren. Bei den
Römern wurde der Vogel der Lichtgottheit, der dessen Kommen verkündet,
bei Nacht der Nachtgöttin geopfert. Im Mittelalter begegnen uns bei
den verschiedensten Völkern Hahnenopfer. Bei den Wenden in der Altmark
war es noch in christlicher Zeit Sitte, einen Hahn auf ihr Malzeichen
zu setzen, wie A. Kuhn uns in den märkischen Sagen berichtet.
Gleicherweise haben es die Deutschen aus der Heidenzeit übernommen,
das Bild des Hahnes über dem Kreuze auf Dächern und Kirchtürmen
anzubringen. Jenes ist älter als dieses; beider Zweck aber ist, die
bösen Geister, die ja auch das Christentum nicht leugnet, sondern nur
in ihrem Ursprunge anders erklärt, aus dem Kreise der menschlichen
Ansiedelungen fernzuhalten.
Im Mittelalter, als die Scheu vor dem Essen dieses altheiligen Tieres
gewichen war, war die Hühnerzucht durch ganz Mitteleuropa ein sehr
wichtiger Kulturfaktor, dem besonders die Klöster Vorschub leisteten.
So war es vornehmlich ein fürsorglicher Bischof namens Martinus,
der im Eierlegen leistungsfähige Hühnerrassen aus Italien nach
Deutschland und Frankreich sandte, wo sie in den Klöstern Verbreitung
fanden und von da an deren Hörige und Zinsbauern abgegeben wurden.
Wie wir aus den mittelalterlichen Zinsregistern der Gutsherrschaften
entnehmen können, bildeten Hühner und Eier für die Herrschaften das
Haupterträgnis ganzer Güter und oft den einzigen Wirtschaftsbestand der
ärmeren Klasse, lebende Hühner in großen Käfigen aus Holz zugleich den
beliebtesten Proviant für Heereszüge und größere Menschenansammlungen.
Schon der vorsorgliche Kaiser Karl der Große hatte befohlen, daß auf
seinen größeren Gütern 100 Hühner und 30 Gänse, auf seinen kleineren
wenigstens 50 Hühner und 12 Gänse gehalten und im Herbst, soweit sie
geschlachtet wurden, gemästet werden sollten. Auch späterhin traf man
sie überall auf den Bauernhöfen, wo sie frei herumliefen und sie sich
vom Abfall der Körner, Samen aller Art und kleinem Gewürm und Insekten
ernährten. Als einst Bischof Meinward von Hildesheim auf einen solchen
Hof kam, wo er keine Hühner bemerkte, tadelte er die Wirtin darob. Als
sie sich mit[S. 312] Futtermangel entschuldigte, gab er ihr den Rat, sie solle
sie ihr Futter selbst suchen lassen. Das befolgte sie nun und hatte
beim nächsten Besuche des Bischofs eine ordentliche Hühnerschar, so daß
er sie belobte und beschenkte.
Bis auf den heutigen Tag spielt das Huhn überall in der Kleinwirtschaft
eine wichtige Rolle, besonders in den Ländern, in denen sich die
Bodenwirtschaft dem Gartenbau nähert, während es dort, wo die
Landwirtschaft überwiegend Großbetrieb ist, weniger geschätzt wird.
Letzteres ist beispielsweise in England der Fall, das seinen hohen
Eierbedarf vom Kontinente her deckt. Auch Deutschland kann seinen
eigenen Bedarf nicht selbst decken. Von der Hühnerzucht in Deutschland
meint Eduard Hahn: „Schlimm steht es mit der deutschen Zucht; trotzdem
in letzter Zeit viel geredet und geschrieben worden ist, will das
echte deutsche Huhn, das allen Anforderungen entsprechen soll, immer
noch nicht erscheinen. Unsere Hühnerologen, wie sie sich ernstlich
nach einem Schwankwort nennen, sind Liebhaber und züchten Spanier,
Franzosen, Italiener, Chinesen und andere, die für unser Klima nicht
passen, und die Hühner auf unsern Bauernhöfen sind ein kümmerliches
Gemengsel aus allen möglichen Rassen, die weder in Eiern noch Fleisch
leisten, was man von ihnen verlangen kann, freilich auch nur geringe
Pflege verlangen und erhalten. Ausnahmen sind bei uns selten; so will
ich die Hamburger Hühner nennen, die in den Gartendistrikten des „alten
Landes“ gezogen werden, sonst aber muß Frankreich und in neuerer Zeit
vielfach Italien unsern Bedarf an feinerem Geflügel decken helfen. Die
Eier aber, die unsere Großstädte bei der gesteigerten Lebenshaltung
immer mehr brauchen, kommen aus Galizien und Russisch-Polen zu uns.
Auch hier ist das Huhn kein Beweis eines extensiven Betriebes, sondern
das Produkt einer nachlässigen extensiven Wirtschaft, die zu Gelde
machen muß, was sich zu Gelde machen läßt. Daß auch diese Zucht im
Rückgang ist, beweisen die Eier, die rapide kleiner werden.“
Welch große volkswirtschaftliche Bedeutung die Hühnereier als
Nahrungsmittel erlangt haben, ergibt eine von Professor Sonndorfer
von der Wiener Handelsakademie aufgestellte Statistik, wonach England
im letzten Jahre 2265 Millionen Stück im Werte von 180 Millionen
Franken einführte. In demselben Zeitraum importierten: Deutschland
2454 Millionen Stück im Werte von 185 Millionen Franken, Frankreich
205 Millionen Stück im Werte von 15 Millionen Franken und die Schweiz
188 Millionen Stück im Werte von 141⁄2[S. 313] Millionen Franken. Frankreich
produziert seinen Bedarf größtenteils selbst, während Deutschland,
England und die Schweiz hauptsächlich auf den Import angewiesen sind.
Die Hauptmenge Eier erzeugen die Agrarstaaten. So exportierte im
Jahre 1907 Rußland 2833 Millionen Stück im Werte von 148 Millionen
Franken, Österreich-Ungarn 966 Millionen, Dänemark 294 Millionen, die
Balkanstaaten 580 Millionen und Italien 511 Millionen Stück.
Nach Südamerika kam das Huhn schon 1493 bei der zweiten Reise des
Kolumbus. Die Indianer müssen dies leicht zu haltende Haustier
gern aufgenommen und rasch verbreitet haben; denn schon 1530 fand
es Federmann am Oberlauf des Amazonenstroms. Auch nach Mittel- und
Nordamerika kam das Huhn mit den verschiedenen europäischen Kolonisten.
Nach Garcilasso wollte es sich nur in dem hochgelegenen Cuzko nicht
fortpflanzen. Vom Niltal aus verbreitete sich das Huhn über ganz
Afrika, wo es überall von den Negern gern aufgenommen wurde. Teilweise
kam es als Proviant der indischen Segelschiffe direkt aus Indien nach
Ostafrika und verbreitete sich von der Küste nach dem Innern. In Indien
und Hinterindien bis nach China und den Philippinen ist das Tier als
Sportobjekt sehr geschätzt. Hier stehen überall die Kampfhähne hoch
im Preise und dienen, wie im Mittelalter in Europa, zu den beliebten
Volksbelustigungen, deren Reiz noch durch Wetten erhöht zu werden
pflegt. Weitaus am grausamsten sind diese Hahnenkämpfe bei den Malaien
Indonesiens, besonders der Philippinen, indem den kämpfenden Hähnen
scharf geschliffene Stahlklingen an den Sporn gebunden werden, mit
denen der Gegner erstochen wird. Oft erliegen beide Gegner dieser
fürchterlichen Waffe.
Eduard Hahn nimmt an, daß der Hahn zunächst nicht aus Nutzungs-,
sondern aus Sportgründen, dann auch als eine Art Weckeruhr vom Menschen
gezähmt wurde. „In die Gefangenschaft übergeführte Hühner pflanzten
sich nicht fort, legten keine Eier und waren also völlig nutzlos. Aus
diesem Grunde sind sie also nicht gehalten worden und ihre anfängliche
Gefangenschaft und spätere Zucht ist sicher nicht deshalb erfolgt. Die
Eier, das wesentliche Produkt unseres heutigen Huhnes, erreichten erst
im weiteren Verlauf der Zucht eine so große Zahl, daß sie dem Menschen
zugute kamen; für den Beginn der Zucht müssen wir nach einem andern
Grunde suchen. Da ist es nun natürlich schlimm, wenn nicht ein
Grund, sondern gleich zwei, und zwar sehr abweichende Gründe, zu Gebote
stehen, wie das beim Huhn der Fall[S. 314] ist. Beide schließen sich nicht
aus, immerhin decken sie sich keineswegs, und, was besonders schlimm
ist, das Ursprungsgebiet beider Hypothesen deckt sich mit dem Urgebiet
des wilden Huhnes und beide sondern sich doch geographisch. Wie sollen
wir uns entscheiden? Wurde unser Huhn auf indobaktrischem Boden als
Uhr ein Haustier (nach F. Spiegel, Eranische Altertumskunde wurde der
Hahn von Tahmuhrath dazu eingeführt) oder auf malaiischem Boden zum
Kampfhuhn erzogen? Eine dieser beiden seltsamen Verwendungsweisen ist
für mich der Ursprung der Zucht des Huhnes, vielleicht ist aber das
Kampfhuhn bei den Malaien das ältere und ursprünglichere gewesen, weil
die Verbindungen zwischen den einzelnen polynesischen Inseln doch nach
allem, was wir wissen, keine sehr häufigen waren.“ Uns will letzteres
auch bedünken. So möchten wir unbedingt annehmen, daß der Kampfhahn die
ältere Zucht ist, und daß der Hahn als Wecker erst später, und zwar
besonders bei den Iraniern Bedeutung gewann. Über letztere Tatsache
sagt Hahn: „Ebenso fremdartig (wie der Kampfhahn) berührt uns moderne
Menschen der Hahn als Uhr; wir können uns eigentlich kaum vorstellen,
wie es Menschen geben kann, die nie wissen, was die Glocke geschlagen
hat; freilich müssen wir neidisch bekennen, daß dem Glücklichen
keine Stunde schlägt. Trotzdem gab es natürlich auch auf niedrigen
Kulturstufen bereits Lebenslagen, in denen Zeitbestimmungen nötig
waren. Am Tage reicht die Sonne aus, aber wie soll z. B. eine Karawane,
die möglichst die kühlen Stunden des jungen Tages genießen will,
erfahren, wann man mit dem langwierigen Packen der Kamele beginnen muß?
Da trat nun aufs glücklichste eine Eigenschaft des Hahnes ein. Es ist
seltsam genug, daß der Hahn um Mitternacht kräht; die Dämmerung morgens
und abends begrüßen ja eine ganze Reihe Tiere mit ihren Tönen, aber
gerade die Mitternacht wohl nur der Hahn. Es ist selbstverständlich,
daß eine so auffallende und nützliche Eigenschaft dem Hahn eine feste
mythologische Stellung von hohem Rang verschaffte; sein Abbild steht
bekanntlich noch heutzutage auf der Spitze unserer Kirchtürme. Wie
es scheint, wurde auf persisch-baktrischem Boden diese Eigenschaft
entdeckt und so der Hahn und späterhin das Huhn gezähmt. Auf die Diener
Ahuramazdas mußte ja das Betragen des Vogels einen tiefen Eindruck
machen. War er doch gewissermaßen der Herold des Lichts. Und wenn nun
gar erst ein weißer Hahn mit dem feuerfarbenen Kamm dieses Amt übte!
So wurde der weiße Hahn der Repräsentant der lichten Tagesgottheiten,
das schwarze Huhn geriet ebenso selbstverständlich in Beziehung zu den[S. 315]
Gottheiten der Nacht. Bei der leichten Zucht und schnellen Vermehrung
wurde dann das Huhn sehr bald das gewöhnliche Opfertier des kleinen
Mannes; wo der Reiche Ochsen, Schafe und Schweine spendete, kam der
Arme, wie Sokrates, mit einem Hahn aus. — Die Verwendung des Hahns
als Ersatz der Uhr ist ungemein weit verbreitet und vielleicht noch
weiter, wie jetzt bekannt, wenn man darauf achtet. In Abessinien sind
Hähne die Kirchenuhr; als Uhren schätzen sie die Kaffern und ebenso
traf sie Bastian in Birma. Endlich nahmen sie die Spanier hauptsächlich
als Uhren nach Amerika und deshalb fiel es ihnen (wie Oviedo in seiner
Historia de las Indias berichtet) auf, daß sie nicht mehr so
pünktlich krähen wollten. — Im Altertum war man gewöhnt, sich nach der
Stimme des Hahnes zu richten, zumal die Römer wie die Griechen ihre
bürgerliche Tätigkeit sehr früh begannen, so daß das Haus schon vor
dem Beginne der Dämmerung rege war. Deshalb sagt Plinius vom Hahn, daß
ihn die Natur geschaffen habe, um die Sterblichen zur Arbeit zu rufen
und ihren Schlaf zu brechen. So gewann der Hahn für das bürgerliche
Leben damals eine große Bedeutung. Eine Redensart, die bei vielen
Dichtern und auch sonst wiederkehrt, erklärt uns das; man unterschied
die Tätigkeit des Friedens und des Krieges einfach so: im Frieden
beginnt der Tag mit dem ersten Hahnenschrei, im Kriege mit dem ersten
Trompetenstoß. Da es auch später im kirchlichen Dienst sehr nötig war,
eine gewisse Einteilung der Nacht zu haben, so mußte auch hier unser
Haushahn herhalten; zog eine noch so kleine Mönchskolonne aus, um
eine neue Niederlassung zu gründen, so nahm sie einen Hahn mit, wie
wir einen Regulator zur notwendigen Wohnungseinrichtung rechnen. Im
Orient hat der Hahn diese Stellung wahrscheinlich heute noch. Es wird
wenigstens erwähnt, daß große Karawanen gewöhnlich einen recht schönen
Hahn mit sich führen, dessen Krähen den Aufbruch der Reisenden regelt.
Im Okzident ist der Hahn durch die Schlaguhren verdrängt worden, welche
ja schon verhältnismäßig früh (um 1100) vorkommen.“
In China und Japan spielt die Hühnerzucht eine wichtige Rolle. Dort
sind eine große Anzahl ausgezeichneter Rassen erzogen worden, die dann
nach dem englischen Opiumkrieg in den 1840er Jahren zu uns nach Europa
gebracht wurden, so vor allem die Bramaputras und Cochinchinas. Mit
den Malaien wanderte das Huhn über die mikronesische Inselwelt, doch
gelangte es nicht nach Neuseeland. Dorthin und nach Australien wurde es
erst durch die Europäer gebracht.
[S. 316]
Bevor wir nun näher auf die verschiedenen Hühnerrassen eingehen,
wollen wir kurz die Stammform derselben, das Bankivahuhn
(Gallus ferrugineus), in seinen Hauptmerkmalen würdigen.
Es ist ein Waldvogel, der morgens und abends, aber auch tagsüber
oft beim Suchen der Nahrung auf Äckern angetroffen wird. Sein
Verbreitungsgebiet ist das größte von allen Wildhühnern und reicht
nach Armand David von Kaschmir und den Vorbergen des Hindukusch bis
nach der Insel Hainan, Cochinchina und über die Halbinsel von Malakka
bis nach Sumatra. Auf Java und den östlich davon gelegenen Inseln,
auch auf den Philippinen, ist es wahrscheinlich eingeführt worden.
Es hat im männlichen Geschlecht einen gezackten Kamm und am Schnabel
jeweilen einen Fleischlappen, trägt schmale, lange, einen Kragen
bildende Halsfedern, ist am Nacken und am Hals goldgelb schimmernd,
am Oberkörper purpurbraun, am Unterkörper schwarz gefärbt; die Brust
schillert grün, die Schwanzfedern sind lang, schwarz, die mittleren
schillernd wie beim Haushahn. Im weiblichen Geschlecht ist die
Farbe am Nacken schwarz mit blaß gelbbraunen Federsäumen, auf der
Oberseite hellbraun mit feinen schwarzen Wellenlinien, am Oberkopf
und auf der Unterseite rotbraun. Der Ruf des Hahn ist kein Kikeriki
wie bei seinem gezähmten Abkömmling, sondern ein kurzes Kikeri. Die
übrigen Laute sind, wie auch beim Weibchen, ganz ähnlich demjenigen
des Haushuhns. Das Huhn brütet im Frühjahr und legt 5–6, zuweilen
auch 9–11 blaß lehmgelbe Eier in einer gewöhnlich mit Gras und
abgestorbenen Blättern ausgekleideten Bodenmulde. Die Hähne sind
besonders zur Brutzeit außerordentlich kampfeslustig. Nach Hutton
lassen sich junge Bankivahühner, wenn sie auch im Anfang wild sind,
leicht zähmen. Auf den Philippinen, wo die Hahnenkämpfe sehr beliebt
sind, scheinen wilde Hähne oft in Gefangenschaft gehalten zu werden, um
dann bei den Kampfspielen zu dienen. Dies gibt uns einen Fingerzeig,
daß wohl die Benutzung der Kampfeslust der Hähne zu Hahnenkämpfen
das erste Motiv der Domestikation des Bankivahuhns innerhalb des
malaiischen Verbreitungsgebiets in Südasien war. Überhaupt scheinen
die östlichen Varietäten des Bankivahuhnes viel leichter zähmbar zu
sein als die westlichen in Indien, weshalb Darwin mit gutem Grunde an
die Möglichkeit dachte, daß das Huhn zuerst von Malaien domestiziert
wurde. Die Kreuzung desselben mit unserem Haushuhn gelingt leicht
und die Bastarde sind unter sich unbegrenzt fruchtbar und geben mit
anderen Hühnern, so mit Bantamhühnern, reichliche Nachkommenschaft.
Die Bastarde von andern südasiatischen[S. 317] Wildhühnern dagegen, wie dem
Gallus sonnerati, G. stanleyi und G. varius
sind, als sicherer Beweis einer entfernteren Verwandtschaft, stets
unfruchtbar. Übrigens lassen schon Abweichungen im Gefieder und
namentlich eine durchaus verschiedene Stimme alle diese Wildhühner
als Stammformen unserer zahmen Hühner nicht zu. Wenn verschiedene
Rassen unserer Haushühner miteinander gekreuzt werden, so schlagen sie
gern in die Färbung der wilden Stammform, des Bankivahuhns, zurück.
So erzog Darwin einen Hahn, der ein Bastard einer weißen Seidenhenne
mit einem dunkelgrünen spanischen Hahn war und dem wilden Bankivahahn
außerordentlich glich. Endlich kann als weiterer Beweis für die
Abstammung des Haushuhns vom Bankivahuhn angeführt werden, daß W.
Elliot in Pegu Haushennen antraf, die von den wilden Bankivahennen
nicht unterschieden zu werden vermochten. Es ist dies also eine ganz
primitive Rasse, die sich hier noch erhielt, während sie sonst überall
auch in der Färbung durch die Domestikation weitgehend verändert wurden.
Da das Bankivahuhn schon im Wildzustande eine ausgesprochene Neigung
besitzt, Varietäten zu bilden, und dadurch, sich den verschiedensten
Lebensbedingungen anpassend, in den verschiedenen Ländern seines großen
Verbreitungsgebietes sich in zahlreiche Lokalrassen spaltete, darf
es nicht überraschen, daß auch die seit alter Zeit geübte künstliche
Züchtung eine ganze Reihe von zahmen Hühnerrassen hervorgebracht
hat. Im allgemeinen ist bei hochgezüchteten Rassen der Unterschied
in der Färbung beider Geschlechter verringert. Dabei sind teils
Riesen-, teils Zwergformen hervorgegangen, die wir in besonders
ausgesprochenem Maße bei den ostasiatischen Kulturrassen antreffen.
Zwerghühner können eine in allen Proportionen den gewöhnlichen
Hühnern gleichende Form darstellen. Es kann aber auch die Größe des
Körpers gewahrt bleiben, so daß nur die Beine verkürzt werden, wie
dies bei den kurzbeinigen Krüpern der Fall ist. Da diese
Tiere infolgedessen nur wenig ausgiebig scharren können, kann man
sie in Gärten frei laufen lassen. Bei manchen Hühnern, wie bei der
Cochinchinarasse, sind die Federn vermehrt und bedecken
den ganzen Lauf, bei andern ist das Federkleid rückgebildet, wie
bei den Chittagongs, die eine nackte Kehle haben, und den
Nackthalshühnern, oder die Federn sind haarähnlich geworden,
wie bei den Strupp- oder Seidenhühnern. Bei manchen,
wie beim japanischen Phönixhuhn, sind die Schwanzfedern ins
Ungeheuere verlängert, beim Kluthuhn dagegen sind sie ganz in
Wegfall gekommen. Der Verlust geht bei[S. 318] diesen sogar so weit, daß
ihnen überhaupt das den Schwanz tragende Knochenstück fehlt. Selbst
der Kamm, das wichtigste unterscheidende Merkmal der wilden Hühner,
ist mannigfachen Veränderungen ausgesetzt gewesen, verschwand bei den
Haubenhühnern sogar vollkommen und wurde durch eine Federhaube
ersetzt. Zwei Haushuhnrassen haben sogar statt vier fünf Zehen erlangt,
indem bei ihnen der als atavistische Mißbildung zuerst aufgetretene
überzählige fünfte Zehe in der Zucht erblich wurde.
Aber außer in der Form ist das Huhn auch physiologisch weitgehend durch
die Zucht beeinflußt worden. So ist vor allem seine Legefähigkeit enorm
gesteigert. Während die wilde Stammform, sobald sie erwachsen ist,
was nach einem Jahre der Fall ist, wie wir sahen, höchstens 11 Eier
legt, soll einer der besten Leger, aber dadurch ein schlechter Brüter,
nämlich die auch bei uns viel gehaltene italienische Rasse
bis zu 120 Eier im Jahre legen. Nach der Vermutung von Baldamus ist
diese hochgezüchtete Rasse sehr alt und geht nicht nur auf die Hühner
der Römer und Griechen zurück, sondern reicht in ihren Anfängen
bis zum Beginn des letzten vorchristlichen Jahrtausends zurück. So
zeigen Darstellungen auf assyrischen Siegelzylindern in Umrissen und
Proportionen große Ähnlichkeit mit dem italienischen Huhn.
Am nächsten stehen der wilden Stammform die eleganten
Kampfhühner, die nur eine geringe Einwirkung der Domestikation
zeigen. Der auffallend schlanke Körper zeigt vielfach Unterschiede
in der Färbung. Am Kopf sind die Fleischlappen und der Kamm klein,
der Hals ist beim Hahne lang, die Halsfedern kurz. Die Schenkel sind
lang und kräftig, die Sporne lang und scharf. Die Hähne werden zu
Hahnenkämpfen verwendet, die Hennen sind schlechte Legerinnen. Ihnen
nahe stehen die Malaienhühner, die ebenfalls hochgestellt sind
und lange, orangegelbe Beine haben. Sie sind ebenso streitsüchtig
wie die vorigen und die Hennen schlechte Eierlegerinnen. Sie kommen
in rotbraunen, weißen und schwarzen Farbenvarietäten vor und werden
ebenfalls mehr zum Luxus als für praktische Zwecke gehalten. Während
sie einen kurzen Schwanz besitzen, ist derjenige der bereits erwähnten
Phönixhühner ganz außerordentlich verlängert, so daß er stark
am Boden schleift. Er erreicht eine Länge von nicht weniger als 2
m und mehr. Damit er nicht beschädigt werde, hält man diese
Hühner auf hochgelegenen Stangen. Sie sind ein spezielles Zuchtprodukt
Japans und kamen erst vor kurzem als Merkwürdigkeit nach Europa. Dem
Äußeren nach gleichen sie den gewöhnlichen Landhühnern, die
wenig[S. 319] hochgezüchtet sind und in der Form und Färbung der wilden
Stammart noch ziemlich nahe stehen. Aus ihnen sind in den verschiedenen
Ländern spezielle Rassen gezüchtet worden. Unter ihnen sind zu nennen
die spanische Rasse von stolzer Haltung, mit weißem Gesicht,
mit langen Kehllappen und großem, gezacktem Kamm. Das Gefieder dieses
Huhnes ist bei den reinrassigen Vögeln schwarz mit grünem Schiller.
Sie sind im Hühnerhofe sehr geschätzt, weil sie viele und große Eier
legen. Ihnen nahe stehen die Minorcas mit scharlachrotem Gesicht
und sehr großem Kamm, ferner die diesen gleichenden Anconas
mit gesperberter Federzeichnung und die Andalusier mit rotem
Gesicht, schwarzem Hals und dunkelschieferblauem Gefieder.
Sehr stattlich ist die englische Dorkingrasse, welche sich
zur Fleischnutzung sehr empfiehlt und gute Brüter liefert. Das volle
Gefieder kann dunkel, gesperbert, silbergrau oder weiß sein. Die Brust
erscheint breit. Das Gewicht geht bei der Henne bis zu 4 kg,
beim Hahn bis zu 5 kg. Ein sehr zartes, weißes Fleisch haben
auch die Hamburger Hühner, deren Zucht stark verbreitet ist.
Sie besitzen einen nach hinten spitz auslaufenden Rosenkamm, weiße
Ohrlappen, einen hornfarbigen Schnabel und blaue Beine. Dazu besitzt
der Hahn im Schwanze lange Sichelfedern. Nach der Färbung unterscheidet
man grünschillernde, schwarze Silbersprenkel,
Goldlack und Silberlack. Die Hennen gelten als gute
Eierlegerinnen, sind aber zum Brüten schlecht.
In Siebenbürgen werden die Nackthalshühner gezüchtet, die
durch ihren roten, von Federn entblößten Hals wie gerupft aussehen.
Manche Züchter führen diese Eigentümlichkeit auf eine Kreuzung mit dem
Truthahn zurück, was aber zweifellos unrichtig, ja unmöglich ist. Sie
sind ziemlich groß, schwarz gesperbert oder weiß mit einem einfachen
Kamm. Eine schöne französische Rasse sind die nach dem Dorfe La
Flèche genannten La Flèche-Hühner von glänzend
schwarzem Gefieder, rotem Gesicht mit langen Kehllappen und weißem
Ohrfleck. Weil sich der niedrige Kamm in zwei lange, hörnchenartige
Zapfen spaltet, nennt man sie auch poules cornette. Die
Haubenhühner besitzen an Stelle des zurückgebildeten Kammes
einen Schopf von aufrechtstehenden, mit den Spitzen überfallenden
Kopffedern. Zu ihnen gehören die in Frankreich und Deutschland vielfach
gezüchteten schwarzen Crève-cœur-Hühner, die neben dem
Federschopf noch zwei aufrechte Kammspitzen von roter Farbe aufweisen.
Dann die stattlichen schwarz und weiß gescheckten Houdanhühner,
die neben der starken Haube[S. 320] einen Kamm mit gezackten Blättern
besitzen. Diese stattlichen Tiere, deren Füße wie diejenigen der
englischen Dorkings fünf Zehen besitzen, sind sehr mastfähig und werden
besonders im Departement Seine et Oise gezogen. Eine starke Vollhaube
und dazu noch Bärte besitzen die goldbraunen oder silberweißen
Paduaner, die aber wenig mastfähig und schlechte Brüter sind.
Rein schwarz mit weißer Haube sind die Holländer, die an Stelle
des Bartes lange rote Kehllappen tragen. Der Kamm ist ganz klein und
fehlt bei den reinrassigen Tieren.
Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts aus China bei uns eingeführte
Rassen sind die großen Cochinchina-Hühner mit rundem, vollem
Körper und breiter Brust. Der Kopf ist klein mit schwach entwickeltem,
aufrechtstehendem Kamm. Die Flügel sind kurz, die dicken Beine sind an
der Außenseite bis zu den Zehen hinunter befiedert. Der Schwanz ist
auch beim Hahn recht kurz. Die Färbung ist meist gelb, doch kann sie
auch schwarz, weiß, rebhuhnartig oder gesperbert sein. Sie besitzen
ein vortreffliches Fleisch und sind gute Brüter. Sehr nahe verwandt
damit sind die Brahmaputrahühner, die sich eigentlich nur
durch die erbsenförmige Gestalt des Kammes unterscheiden. Ebenfalls
ostasiatischen Ursprungs sind die Seidenhühner, die ihren Namen
vom feinen, haarartigen Federkleide haben. Im Körperumriß ähneln
sie den Cochinchinas; auch ihre Flügel sind auffallend kurz, so daß
sie durchaus nicht fliegen können. Zu dem reinweißen Federkleide
kontrastiert die blauschwarze Farbe der Beinhaut. Sie sind gegen Nässe
empfindlich. Ihre Eier sind blaßgelb.
Aus Japan stammen die Zwerghühner oder Bantams, die nicht
viel größer als Tauben werden. Sie sind schwarz, weiß oder gesperbert
und machen sich durch ihr munteres Wesen beliebt. Wirtschaftlich
spielen sie eine unbedeutende Rolle. Weit mehr geschätzt ist das
neuerdings bei uns eingeführte Yokohamahuhn. Aus Nordostasien
kamen die Langshans zu uns. Durch Kreuzung verschiedener
alter Rassen erzielten die Amerikaner diverse neue, unter denen
die Brahmas, Plymouth-Rocks und Wyandottes
eine weitere Verbreitung bei uns erlangten. Die neuerdings durch
die unternehmungslustigen Engländer auf den Markt gebrachten
Orpingtonhühner sind noch nicht zu einer festen Rasse geworden.
Die Hauptaufgabe der Hühnerzucht ist das Heranzüchten eines guten
Landhuhns, das während seines ganzen, etwa 6 Jahre dauernden Lebens,
die meisten allerdings in den vier ersten Jahren, 500 bis[S. 321] 600
Eier legt und daneben noch als Fleischlieferant zu gebrauchen ist.
Unter den deutschen Nutzhühnern spielt gegenwärtig das in Westfalen
heimische Lakenfelderhuhn und das Ramelsloherhuhn aus der
Lüneburger Heide eine Hauptrolle. Sobald die Hühner mit dem Eierlegen
nachzulassen beginnen, mästet und schlachtet man sie, so daß sie dann
noch als Fleischlieferanten von Nutzen sind.
[S. 322]
XV. Perlhuhn, Pfau,
Fasan und Truthuhn.
Von weiteren domestizierten Hühnervögeln ist das Perlhuhn
(Numida meleagris) zu nennen, das in Westafrika bis Marokko
heimisch ist. Es hat seinen lateinischen Namen meleagris von
Meleager, dem Sohne des kalydonischen Königs Oineus, der auf der
berühmten kalydonischen Eberjagd umkam. Darüber waren seine Schwestern
ganz untröstlich und wurden durch das Mitleid der Götter in Vögel
verwandelt. Da die auf schiefergrauem Grunde stehenden perlenartigen
Tropfen an Tränen erinnerten, sollten sie die Tränen der Schwestern
des Meleager bedeuten. Diese Vögel sollten nach Plinius auf dem Grabe
des Meleager gehalten werden und dort zu Ehren des Toten kämpfen, wie
in der Vorzeit zu Ehren Verstorbener abgehaltene Kampfspiele durch
Menschen üblich waren.
Die Perlhühner bewohnen mit Büschen bestandene Gegenden bis zu 3000
m Höhe. Da, wo sie häufig sind, bemerkt man sie bald, indem
sie morgens und abends ihre durch unser zahmes Perlhuhn wohlbekannte
trompetenartige Stimme vernehmen lassen. Sie wohnen in Familien
von 16–20 Stück beieinander, sind sehr scheu und schlüpfen bei der
geringsten Beunruhigung ins schützende Gebüsch. Mit Vorliebe schlafen
sie auf hohen Bäumen an Flußufern. Im Frühjahr brüten sie ein Gelege
von 5–8 schmutzig gelblichweißen Eiern aus. Die Küchlein gleichen
im Flaumkleide jungen Fasanen, wachsen rasch heran und folgen, wenn
sie die halbe Größe der Eltern erreicht haben, diesen auf allen
Streifereien und bäumen dann nachts regelmäßig mit ihnen.
Nach Brehm lassen sich Perlhühner leichter eingewöhnen als irgend
ein anderes Wildhuhn, werden aber nicht leicht und kaum jemals
vollständig zahm, schreiten auch nur dann in der Gefangenschaft zur
Fortpflanzung, wenn sie weiten Spielraum haben. Dagegen kann man
gefangene bald so weit gewöhnen, daß sie in Haus und Hof umher[S. 323]laufen,
ohne ans Entweichen zu denken. Sie sind zänkisch, liegen mit Haus-
und Truthühnern beständig im Streite, werden so bösartig, daß sie
erwachsene Hähne und Kinder angreifen. Sie erfreuen durch ihre
unermüdliche Beweglichkeit, ihr hübsches Gefieder und die sonderbaren
Stellungen und Bewegungen, die sie beim Laufen einnehmen. Beim Brüten
sind sie wenig eifrig und können keine Kälte ertragen.
Von Westafrika wurden sie im 18. Jahrhundert durch Negersklaven auf
den Antillen eingeführt, wo sie sich vollkommen eingewöhnten und
verwilderten. Dabei wurden sie hier kleiner und dunkler. Schon vor
bald sieben Menschenaltern war es auf Jamaika häufig; jetzt ist es
dort wie auch im östlichen Kuba so gemein, daß es unter Umständen
zur Landplage wird. Schon im Altertum wurde es bei den Griechen und
Römern als Haustier gehalten, verschwand aber nach dem Untergange des
Römerreichs wieder aus Europa, um erst wieder im 15. Jahrhundert von
den Portugiesen aus Angola hier eingeführt zu werden. Seither sind sie
besonders in den Mittelmeerländern, wo es ihnen warm genug ist, so weit
domestiziert worden, daß sie gleich dem Pfau begonnen haben, wenigstens
in der Färbung abzuändern. Unter den gewöhnlichen Perlhühnern mit
weißen Tupfen auf schiefergrauem Grunde kommen nämlich silber- und
blaugraue und, wie bei den Pfauen, auch weiße Tiere vor. Wie bei den
weißen Pfauen das Auge der zum Rad ausgebreiteten Schwanzfedern, so ist
bei den weißen Perlhühnern die ursprüngliche Tüpfelung noch deutlich
erkennbar.
Im Altertum scheint das Perlhuhn als Fetischtier von Nordafrika nach
Griechenland gekommen zu sein. Nach dem Schüler des Aristoteles, Klytos
von Milet, wurden auf der kleinen, von den Milesiern kolonisierten
Insel Leros um den Tempel der Artemis heilige Perlhühner aus Afrika
gehalten. Dabei wird nirgends gesagt, wie sie dahin gekommen und
weshalb sie der jungfräulichen Göttin geweiht waren. Noch Älian
behauptete, kein Raubvogel wage die lerischen heiligen Hühner
anzugreifen. Auch auf der Akropolis scheinen nach Suidas Perlhühner
gehalten worden zu sein. Zu den Römern kamen sie zur Zeit der punischen
Kriege aus Numidien unter dem Namen numidische oder afrikanische
Vögel. Noch zu Varros Zeit im letzten Jahrhundert v. Chr. waren sie
in Italien sehr selten und teuer. Gleichwohl begann man schon damals
diese kostbaren Tiere, eben weil sie eine Rarität waren, zu essen.
Dieser Autor sagt nämlich: „Die afrikanischen Hühner, welche man
meleagrides nennt, sind erst neulich für[S. 324] die Schmausereien
der Leckermäuler in Gebrauch gekommen, aber noch teuer, weil selten.“
Der Spötter Martial macht sich in einem Epigramm darüber lustig, daß
Hannibal, der Barbar, seinen Landsmann, den Vogel aus Numidien, nicht
aß. Der verrückte Kaiser Caligula ließ sie sich opfern. Nach Pausanias
wurden sie auch in Phokis bei Tithorea zweimal im Jahre im Tempel der
Isis neben Gänsen geopfert.
Nachdem die Portugiesen die Perlhühner wieder in Europa eingeführt
hatten, sah sie Volaterranus vor 1500 beim Kardinal San Clemente.
Der Züricher Konrad Geßner bildete den Vogel in seinen Icones
animalium 1563 zuerst ab und bemerkt dazu, es sei ein fremder
wilder Hahn aus Afrika und der Berberei, den er von seinem Freunde
Cajus, einem englischen Arzte, erhielt. In Frankreich war er damals
schon öfter als poule de Guinée in den Hühnerhöfen zu sehen. Der
Vogel ist so leicht zu halten, daß er auch in seinem ursprünglichen
Verbreitungsgebiet vielfach gezähmt wird. So traf Staudinger am Niger
solche, die durch ihre weiße Farbe verrieten, daß sie schon längere
Zeit domestiziert waren. Da sie sich leicht versetzen lassen, sind
sie im Laufe der Zeit auf eine Reihe von Inseln gekommen und dort
verwildert, so auf den Kapverden, auf Ascension und St. Helena. Daß sie
auch auf zahlreichen Inseln und Inselchen der Antillen verwilderten,
wurde bereits mitgeteilt. Sie wurden in Amerika kleiner und erhielten
schwarze Füße in Verbindung mit weißem Bauch, weißem Rücken und
Flügelspitzen. Im milden England gelang es noch, sie verwildern zu
lassen. Dies würde wohl auch in den milderen Gegenden Deutschlands
möglich sein. Hier überall, wo es ihnen nicht zu kalt ist, eignen sie
sich vortrefflich als Hausgeflügel. Sobald sie die ersten Tage hinter
sich haben, sind sie gar nicht weichlich und auch im Futter durchaus
nicht anspruchsvoll; dabei lassen sie sich leicht mästen, liefern ein
gutes Fleisch und schmackhafte Eier.
Häufiger als das Perlhuhn wird der Pfau (Pavo cristatus)
in unseren Hühnerhöfen angetroffen, wo er wegen seiner Schönheit auch
mehr ein Luxus- denn ein Nutzvogel ist. Seine Heimat ist Ostindien und
Ceylon. Dort bewohnt er lichte Waldungen mit Vorliebe bergiger Gegenden
mit dichtem Unterwuchs; ebensogern hält er sich in Pflanzungen auf,
die ihm Deckung gewähren und einzelne hohe, zur Nachtruhe geeignete
Bäume haben. In vielen Gegenden Indiens gilt er wegen seines prächtigen
Gefieders als heilig und unverletzlich und seine Tötung wird von den
Eingeborenen als ein Verbrechen angesehen, das[S. 325] jeden, der sich solches
zuschulden kommen läßt, gelegentlich in Lebensgefahr bringt. In der
Nähe vieler Hindutempel pflegen sich zahlreiche Herden von halbwilden
Pfauen aufzuhalten, deren Pflege mit zu den Obliegenheiten der Priester
gehört. Dabei werden sie sich des ihnen hier gewährten Schutzes bald
bewußt und zeigen, wenigstens dem Hindu gegenüber, kaum größere Scheu
als diejenigen, die auf dem Hühnerhofe heranwuchsen.
Wo sie ungestört sind, halten sich die wilden Pfauen am Tage in Trupps
von 30 bis 40 Stück meist auf dem Boden auf, um in den Vormittags-
und Abendstunden zur Nahrungssuche auf die Waldblößen oder Felder
herauszukommen. Verfolgt suchen sich die Tiere so lange als möglich
laufend zu retten und, erst wenn sie einen gewissen Vorsprung erreicht
haben, entschließen sie sich zum Fluge, der rauschend und schwerfällig
vor sich geht. Sie bäumen dann so bald als möglich und verbergen
sich mit ihrem grünen Gefieder im dichten Blättergewirr, wo sie sich
wohlgeborgen wissen. Von Raubtieren scheuen sie besonders den Tiger,
dessen Anschleichen sie weithin durch lautes Geschrei kundgeben. Sie
fressen wie unsere Hühner sowohl tierische als pflanzliche Nahrung
und brüten nach der Regenzeit im April, nachdem die Männchen ihr
prächtiges Hochzeitskleid mit dem schillernden, beim Liebeswerben zur
Schau ausgebreiteten Schweife erhalten haben. Ihrer Schönheit sich
wohl bewußt, paradieren sie damit vor den Weibchen, um deren Gunst zu
erlangen. Das meist auf einer erhöhten Stelle, einem Busche im Walde,
errichtete Nest besteht aus dünnen Ästchen und trockenen Blättern
und ist ebenso liederlich gebaut, als dasjenige anderer Hühnervögel.
Das Gelege zählt 4 bis 15 Eier, die vom Weibchen mit großem Eifer
ausgebrütet und nur im Notfalle verlassen werden. Das unscheinbare
Jugendkleid, das die Jungen zu ihrem Schutze mit dem Weibchen teilen,
legen die Männchen erst nach dem zweiten Lebensjahre ab, um im dritten
ihre volle Schönheit zu erlangen und zur Paarung zu schreiten.
Auf seinem Eroberungszuge nach Indien erblickte Alexander der Große mit
seinen Gefährten als erster Europäer den wilden Pfau in seiner Heimat
am Indus. Er war von der Schönheit des ihm bis dahin unbekannten Vogels
so entzückt, daß er nach dem Berichte des Älian jeden, der ihn zum
Opfer schlachten wollte, mit den schwersten Strafen bedrohte. Er soll
nach der Sage auch einige dieser Vögel auf dem Rückzuge aus Indien mit
sich genommen haben. Sehr viel früher war er gelegentlich schon als
seltener Ziervogel an einige vorder[S. 326]asiatische Höfe gelangt, so auch
nach Jerusalem, wo ihn Salomo als wertvolles Prunkstück hielt. Heißt
es doch 1. Könige 10, 22, daß diesem König in einem edomitischen Hafen
am Nordende des Roten Meeres von phönikischen Seeleuten ausgerüstete
und bemannte Schiffe nach dreijähriger Abwesenheit neben Gold,
Silber, Elfenbein und Affen auch Pfauen aus Ophir brachten, das wir
in Ostafrika zu suchen haben. Dorthin muß der schöne indische Vogel
durch den Monsun zur Überfahrt benutzende indische Segler damals schon
als Tauschware gebracht worden sein, da er daselbst nicht einheimisch
ist. Er heißt im Hebräischen tukkijîm, was mit dem tamulischen
togei zusammenhängen dürfte.
Aus dem semitischen Vorderasien, wo der Pfau als seltenes und durch die
vielen Augen seines Schweifes mit den Sternen und den dort herrschend
gedachten Überirdischen in Verbindung gebrachtes Fetischwesen in
den Tempelhöfen der höchsten weiblichen Gottheit gehalten wurde,
kam er dann durch die Vermittlung der Phönikier zu den Griechen als
ta(v)ós, um später dann von ihnen als pavo an die Römer
weitergegeben zu werden. Der erste Ort auf griechischem Boden, von dem
wir wissen, daß dort Pfauen als heilige Tiere gehalten wurden, ist der
Heratempel von Samos. Hera ist offenkundig die mit der phönikischen
Astarte identifizierte Himmelsgöttin, deren Kult sich der merkwürdige
Sternenvogel ganz natürlich anschloß. Ein sich von selbst ergebender
Mythus war es denn auch, daß der allschauende Argos, der die Mondgöttin
Jo zu bewachen hatte, nach seiner Tötung durch den Argeiphontes sich in
den Pfau verwandelt haben soll. So stolz waren die Bewohner der Insel
Samos auf die heiligen Pfauen in ihrem Heratempel, den Herodot für den
größten aller griechischen Tempel seiner Zeit erklärte, daß sie das
Tier auf ihre Münzen prägten. Zu des Polykrates Zeit, der von 535 bis
522 v. Chr. Tyrann von Samos war und einen Seestaat von ziemlich großer
Ausdehnung gegründet hatte, war er aber noch nicht dort, sonst hätten
die Hofdichter Ibykos und Anakreon ihn wohl einmal in ihren Gedichten
genannt. Auch nach Athen würde der Ruf des Vogels und er selbst wohl
früher gedrungen sein. Wir finden ihn nämlich erst nach der Mitte des
fünften vorchristlichen Jahrhunderts in jener Stadt, und zwar als
höchste Merkwürdigkeit und außerordentliche Seltenheit. Es war dies
zur Zeit des Perikles, da Leute von weither kamen, um dieses Wunder
zu sehen. Vielleicht haben die Athener bei der Unterwerfung der Insel
Samos unter ihre Oberhoheit im Jahre 440 den schönen Vogel vom Heraion
nach Athen entführt, obschon der Geschicht[S. 327]schreiber Thukydides nur von
Auslieferung der Schiffe und Bezahlung der Kriegskosten spricht.
In einer seiner Schriften berichtet der Redner Antiphon von einem
reichen Vogelzüchter in Athen namens Demos, Sohn des Pyrilampes, der
Pfauen in seinem Hühnerhofe hielt. Von weither, vom Peloponnes und aus
Thessalien, kamen die Leute, um diese Vögel zu bewundern und sich, wenn
möglich, Eier von ihnen zu beschaffen. Jeden Monat einmal, am Tage
des Neumondes, wurden alle zugelassen, an den andern Tagen dagegen
niemand. „Und das“ — setzt Antiphon hinzu — „geht nun schon mehr als
30 Jahre so fort.“ Nach Plutarch soll schon der Vater Pyrilampes aus
seiner Vogelzucht den Weibern, die sein Freund Perikles zu gewinnen
wünschte, unbemerkt Pfauen zugewandt haben. Doch, meint Antiphon, es
gehe nicht an, die Vögel in der Stadt zu verbreiten, weil sie dem
Besitzer davonfliegen. Wollte sie aber jemand stutzen, so würde er
ihnen alle Schönheit nehmen; denn diese besteht in den Federn und nicht
im Körper. Daher seien sie so lange eine Seltenheit geblieben, daß
man ein Paar derselben mit 10000 Drachmen (etwa 8000 Mark) bezahle.
Bei so hohem dafür bezahlten Preise begreifen wir den Ausspruch des
griechischen Dichters Anaxandrides der mittleren Komödie, daß es
Wahnsinn sei, Pfauen im Hause aufzuziehen und Summen dafür aufzuwenden,
die zum Ankaufe von Kunstwerken ausreichen würden. Erst im Laufe des
vierten vorchristlichen Jahrhunderts wurden die Pfauen häufiger in
Athen und deshalb weniger kostbar, so daß gegen das Ende desselben der
Komödiendichter Antiphanes — ohne Zweifel mit starker Übertreibung —
sagen konnte: „Sonst war es etwas Großes, auch nur ein paar Pfauen zu
besitzen; jetzt aber sind sie häufiger als die Wachteln.“ Aristoteles
schildert ihn als einen neidischen und eitlen Vogel, der gegen 25
Jahre lebe, aber seine schönen Federn erst im dritten Jahre bekomme,
auch dann erst niste. Er brüte des Jahres nur einmal, und zwar 30
Tage oder etwas mehr. Er lege 12 oder etwas weniger Eier, und zwar in
Zwischenräumen von zwei bis drei Tagen.
Als die Griechen in Begleitung Alexanders des Großen in das Innere
Asiens vordrangen, scheinen sie, wie Diodor uns berichtet, in
Babylonien zahlreichen Pfauen begegnet zu sein. Der Vogel war also
hier schon gemein, so daß wir begreifen, wie ihn einzelne griechische
Schriftsteller als „medischen Vogel“ bezeichnen konnten. Gewiß ist
Victor Hehn im Unrecht, wenn er meint, der Pfau sei erst durch
die Griechen über Westasien verbreitet worden, da die asiatischen
Pfauen[S. 328]namen alle dem Griechischen entlehnt seien. Vielmehr ist, wie
wir oben sahen, das Umgekehrte der Fall; die Griechen erhielten ihn aus
Kleinasien über die Insel Samos, und aus den Städten Großgriechenlands
lernten ihn dann die Römer kennen. Zu Ende der Republik war der Pfau
den Römern kein allzuseltener Vogel mehr, denn Varro (116–27 v. Chr.)
schreibt in seinem Buche über die Landwirtschaft: „Erst in unserer
Zeit hat man angefangen, ganze Herden von Pfauen zu halten. So z. B.
soll Marcus Aufidius Luco jährlich 60000 Sesterzien (= 9000 Mark) aus
seiner Pfauenzucht lösen. Sieht man auf den Nutzen, so hält man mehr
Weibchen, sieht man aber nur auf die Pracht, so hält man mehr Männchen.
Auf der Insel Samos und auf Planasia (jetzt Pianosa an der Westküste
Etruriens, südlich von Elba, damals Ilva genannt) soll es wilde Pfauen
geben. Unter allen Vögeln gebührt dem Pfau der Preis der Schönheit.
Sie fressen allerlei Getreide, besonders Gerste. Man läßt die Eier von
Pfauenhennen oder von Haushühnern ausbrüten, hat auch für die Jungen
eigene Pfauenhäuser, die in Verschläge geteilt sind, reinlich gehalten
werden und vor sich einen sonnigen Platz haben, wo die Tierchen bei
gutem Wetter gefüttert werden. Den ersten jungen Pfau hat Quintus
Hortensius (ein ausgezeichneter Redner zu Varros Zeit) für die Tafel
braten lassen, als er seinen Antrittsschmaus als Augur hielt. Darauf
folgten viele seinem Beispiele und der Preis stieg dermaßen an, daß
ein Pfauenei mit 5 Denaren (= 3 Mark) und ein Pfau selbst wohl mit 50
Denaren (= 30 Mark) bezahlt wird.“
Selbstverständlich mußte bei den Römern zu Ende der Republik und zur
Kaiserzeit ein Tier wie der Pfau, das schon in Athen der Üppigkeit
gedient hatte, in umso höherem Maße in Aufnahme kommen, als der
römische Luxus und Reichtum den attischen hinter sich ließ. Obschon
das Fleisch, wenigstens der älteren Pfauen, gerade kein Leckerbissen
ist, so fand doch das gegebene Beispiel, schon weil die Sache teuer
war, bei den Protzen allgemeine Nachahmung. Schon Cicero (106–43 v.
Chr.) schreibt in einem Briefe: „Ich habe mir eine Kühnheit erlaubt
und sogar dem Hirtius ein Diner gegeben, doch ohne Pfauenbraten.“ Und
der Dichter Horaz spottet in einer seiner Satiren: „Wird ein Pfau
aufgetragen und daneben ein Huhn, so greift alles nach dem Pfau. Und
warum das? Weil der seltene Vogel Goldes wert ist und ein prächtiges
Gefieder ausbreitet, als wenn dadurch dem Geschmack geholfen wäre.“
In der Kaiserzeit wird wohl kein größeres Prunkmahl ohne Pfauenbraten
abgehalten worden sein. Ja, wer es[S. 329] ganz üppig geben wollte, der gab
nur Gehirn von Pfauen. So berichtet Sueton von Vitellius als er 69 n.
Chr., zum Kaiser ausgerufen, in Rom einzog: „Beim Ankunftsschmause,
der dem Kaiser Vitellius von seinem Bruder gegeben wurde, betrug die
Zahl der aufgetragenen ausgesuchten Fische 2000, die der Vögel 7000.
Einen noch größeren Schmaus gab er selbst, als er eine ungeheuer große
Schüssel einweihte, die er den „Schild der Minerva“ nannte. Sie war
bedeckt von untereinander gemischten Lebern von Papageifischen, Gehirn
von Fasanen und Pfauen, Zungen von Flamingos, Milch von Muränen; das
alles hatten Kriegsschiffe vom östlichen und westlichen Ende des
Mittelmeeres zusammenbringen müssen.“
Diesen übertrumpften noch die späteren Kaiser. So meldet der
Geschichtschreiber Älius Lampridius vom üppigen Kaiser Heliogabalus:
„Kaiser Heliogabalus ließ öfter ein Gericht auftragen, das aus
Kamelfersen, aus Kämmen, die lebendigen Hähnen abgeschnitten waren,
aus Zungen von Pfauen und Nachtigallen bestand. Er gab auch seinen
Palastdienern ungeheuere Schmausereien, wobei die Eingeweide des
Rotbartfisches, Gehirn von Flamingos, Rebhuhneier, Köpfe von Papageien,
Fasanen und Pfauen die Hauptrolle spielten. Seine Hunde fütterte
er mit Gänselebern.“ Außer zum Essen dienten die Pfauen auch als
Schmuck der Gärten der Vornehmen und ihre Federn zu Fliegenwedeln. So
spricht der Dichter Martial vom muscarium pavonium, und der
Geschichtschreiber Dio Cassius berichtet: „Als Severus Kaiser geworden
war (im Jahre 193), hielt er für seinen ermordeten Vorgänger Pertinax
mit großem Gepränge ein Totenamt. Dessen aus Wachs angefertigtes Bild
lag auf einem prachtvollen, mit Purpur und Goldstickerei bedeckten
Paradebett und neben ihm stand ein Knabe, der die Fliegen, als ob der
Verewigte ruhte, mit einem Wedel aus Pfauenfedern abwehrte.“
Bei solcher Wertschätzung des Pfaues ist es kein Wunder, daß er zur
römischen Kaiserzeit in größerer Menge besonders auf Inseln, auf denen
er sich frei bewegen konnte, gezüchtet wurde. Die Vorteile solcher
von Wasser umgebener Pfaueninseln setzt Columella folgendermaßen
auseinander: „Auf kleinen, waldigen Inseln sind die Pfauen leicht zu
ziehen; sie fliegen von da nicht weg, weil sie überhaupt nicht weit
fliegen. Sie sind da vor Dieben und Raubtieren sicher, man kann sie
frei herumgehen und selbst brüten lassen, wobei sie sich auch das
meiste Futter selbst suchen und nur täglich einmal zu bestimmter Zeit
gerufen und mit etwas Gerste gefüttert werden. Auf dem festen[S. 330] Lande
umgibt man eigene, mit Wald bestandene Grasplätze für sie mit Mauern
und Ställen und rechnet auf je fünf Weibchen ein Männchen. Die Eier
legt man hier gewöhnlich Haushühnern unter, und die Pfauhenne kann,
wenn sie nicht selbst brütet, jährlich 11 bis 12 Eier legen. Geht das
brütende Haushuhn vom Neste, so wendet man die Eier, weil das Huhn
sie wegen ihrer Größe nicht gut selbst wenden kann. Um das Wenden zu
überwachen, bezeichnet man die Eier auf einer Seite mit Tinte; denn
es kommt auch vor, daß ein Haushuhn sie selbst wendet.“ Dann gibt es
genaue Anweisung über die Aufzucht und Fütterung der Pfauen.
Die Römer brachten den Pfau in die Länder nördlich der Alpen,
wo wir Darstellungen von ihm, beispielsweise auf Lampen der
römisch-helvetischen Ansiedelung von Vindonissa, antreffen. Aus dem
lateinischen pavo wurde das französische paon und das
deutsche Pfau. Doch wird seine Zucht erst im Mittelalter von Italien
her nach Deutschland gedrungen sein. Hier diente er ebenfalls als
Prunkvogel, und mit seinen schönen Federn zierten sich Ritter und
vornehme Frauen, indem sie dieselben auf ihren Kopfbedeckungen und
als Garnituren um den Hals anbrachten. Auch noch im Mittelalter
pflegte man bei feierlichen Essen einen gebratenen Pfau im Schmuck
seines nachträglich wieder auf ihn gesteckten Gefieders auf den Tisch
zu bringen. Gewöhnlich trug ihn die Dame des Hauses selbst unter
Trompetenschall auf silberner oder vergoldeter Schüssel und der
Herr zerlegte ihn, wie dies im Lanzelot König Artus seinen um die
Tafel versammelten Rittern tut. Erst zur Zeit der Renaissance kam
dieser Gebrauch allmählich ab, und später wurde der Pfau durch den
Truthahn verdrängt, der ein schmackhafteres Fleisch besitzt. Daß das
Pfauenfleisch bereits in der späteren Römerzeit von seinem Nimbus
eingebüßt hatte, beweist die Behauptung des heiligen Augustinus, daß
es kaum verweslich sei. Er erzählt, er habe selbst einen Versuch damit
angestellt und nach 30 Tagen sei das Fleisch noch unverwest gewesen,
ja es sei ein Jahr lang so aufbewahrt worden. Im 11. Jahrhundert meint
dann die heilige Hildegard, Äbtissin vom Kloster Rupertsberg bei
Bingen, wer einen gesunden Magen habe, der könne solches am Ende schon
verdauen.
Heute wird der Pfau noch immer in herrschaftlichen Gärten als Ziervogel
gehalten; doch tritt seine geringe Fruchtbarkeit seiner Ausbreitung
hindernd in den Weg. Als Folge der Haustierhaltung hat sich auch
bei ihm der Leucismus geltend gemacht; doch gibt es außer weißen
auch dunklere Pfauenarten. Da er sehr selbständig ist, ver[S. 331]wildert
er leicht. So ist er namentlich auf Inseln, speziell in Westindien,
verwildert. Dapper sagt in seiner 1671 in Amsterdam erschienenen
Beschreibung Afrikas, daß die Könige von Kongo und Angola die Pfauen
als Regal betrachteten und jeden, der auch nur eine Feder von ihnen
stahl, mit dem Tode bestraften oder als Sklaven verkauften. Eine
ähnliche Wertschätzung erfuhr der Vogel bei den Süd- und Ostasiaten.
So ist der Thron des persischen Schahs wie derjenige des Kaisers von
China über und über mit Pfauenfedern verziert. Mandarinen tragen am
Knopfe ihrer Kopfbedeckung die Pfauenfeder als eine der höchsten
Auszeichnungen, und in Kambodja bezeichnet die Pfauenfeder den
Edelmann. Auch in der Kunst der Orientalen spielt die Pfauenfeder eine
wichtige Rolle und hat vielfach in der Ornamentik Eingang gefunden, wie
übrigens auch bei uns. In unsern Herrschaftsgärten trifft man heute den
schönen, aber mit einer häßlichen Stimme begabten Vogel nur selten an;
denn er ist gegenwärtig etwas aus der Mode gekommen.
Lange nicht so herrlich gefiedert, aber nützlicher als der Pfau ist
der ihm sehr nahe verwandte Fasan (Phasianus colchicus),
im Gegensatz zu den verschiedenen andern asiatischen Arten auch
Edelfasan genannt. Er hat seinen Namen von der griechischen
Bezeichnung phasianós, d. h. Vogel vom sagenberühmten Flusse
Phasis in Kolchis, dem Lande der zauberkundigen Medeia, in welchem die
Helden der Vorzeit unter Anführung des Jason auf dem schnellen Schiffe
Argo das goldene Vließ holten. Von dort her erhielten ihn die Griechen,
um ihn später unter demselben Namen an die Römer weiterzugeben. In
Griechenland tritt er uns in einer Komödie des Aristophanes ums
Jahr 420 v. Chr. zum erstenmal als kostbarer Luxusvogel entgegen,
hat aber in der Folge bei ihnen als Nutztier keine bedeutende Rolle
gespielt. Eine wichtigere Rolle spielte er bei den alten Römern, bei
denen er nach Plinius in Gehegen in großer Zahl gezogen wurde, um bei
den prunkvollen Gastmählern als kostbarer Leckerbissen zu dienen.
Dazu mästete man ihn nach Palladius 30 Tage lang mit einem mit Öl
angefeuchteten Brei aus Weizen- oder Gerstenmehl und sperrte ihn
während dieser Zeit ein, damit er durch geringe Bewegungsmöglichkeit
recht viel Fett ansetze.
Schon damals wurden die Fasaneneier mit Vorliebe von Haushühnern
ausgebrütet, wie dies heute noch bei uns geschieht. Der Satiriker
Martial erwähnt den Fasan als Leckerbissen der Vornehmen, und Älius
Lampridius sagt in seiner Biographie des Kaisers Helioga[S. 332]balus, dieser
habe an jedem Tage eine bestimmte Speise genossen, so einmal nur
Fasanen oder junge Hähne, oder nur eine Fischart, oder nur Schweine-
oder Straußenbraten, oder nur eine Obstart oder eine Kuchensorte
oder nur Milchspeisen. Zur Zeit der Völkerwanderung erhielt sich der
geschätzte Vogel in den Villen der Römer, wo ihn die Germanen kennen
lernten. In der Folge wurde er von manchen Fürsten, so von Karl dem
Großen, dann auch von einigen der reicheren Klöster als Luxusvogel
übernommen. So kam er nach den Benediktionen des Mönches Ekkehard
bisweilen auf die Tafel der St. Galler Mönche. Im Jahre 1130 sollen
ihn die Cluniacenser in Frankreich gehalten haben; 1299 wird er in
England erwähnt. 1333 gab es Gehege von ihm in Hessen und anderwärts
in Süddeutschland; doch war er damals noch recht selten. Erst von der
Mitte des 16. Jahrhunderts an erlaubte die zunehmende Territorialhoheit
den Fürsten, die Fasanen im freien Walde so zu schützen, daß man sie
aus den Gehegen entlassen konnte. Mit dem zunehmenden Prunke der
Fürstenhöfe wurde dieser Vogel immer häufiger gehalten, bis zur Zeit
Ludwigs XIV. jeder kleine Hof seine Fasanerie haben zu müssen
glaubte. Hatte der Sonnenkönig die kleine Insel Pourquerolles an der
Küste der Provence zum Fasanengehege bestimmt, so machte der 1759 auf
den spanischen Thron erhobene König Karl II. von Neapel aus der
ganzen Insel Procida einen Fasanenbezirk, in welchem die Haltung von
Katzen strengstens verboten war. Erst als sich daraufhin die Mäuse
und Ratten so sehr vermehrten, daß die Kinder in der Wiege vor ihnen
nicht mehr sicher waren, hob der König dieses Verbot wieder auf. Sein
Nachfolger, Ferdinand IV. (1758–1832), erging sich gern auf der
Fasanenjagd. Er war ein so ausgezeichneter Schütze, daß er auch ohne
Repetiergewehr in einer Stunde bis 300 Fasanen erlegt haben soll.
Während der Fasan in Süddeutschland und Österreich in der Folge
vollkommen verwilderte, wird er in Norddeutschland halbzahm in Gehegen
gehalten. Auch in Südrußland lebt er häufig wild, schon seltener
dagegen in Italien und sehr selten in Spanien; auch in Griechenland,
wo er früher gemein war, geht er seiner Ausrottung entgegen. Seine
ursprüngliche Heimat waren die Küstenländer des Kaspischen Meeres
und Westasien, während der Königs- und Goldfasan in
China und der der Lady Amherst, die ihn zuerst nach Europa brachte,
zu Ehren benannte Amherstfasan in der Mongolei und in
Transbaikalien beheimatet ist. In Südchina und dem Hochlande von[S. 333]
Tibet ist der Diamantfasan zu Hause, ebenso in Südchina der
Silberfasan, der im 17. Jahrhundert zum erstenmal lebend nach
Europa gelangte. Wie der Goldfasan, der Kinki, d. h. das Goldhuhn
der Chinesen, wird auch der Silberfasan sehr häufig in China und
Japan zahm gehalten. Auch bei uns gedeihen beide bei einfacher Pflege
ausgezeichnet, sind aber wegen ihrer auffallenden Färbung wenig dazu
geeignet, in unsern Waldungen ausgesetzt zu werden, da die bunte
Tracht der Männchen sie dem Raubzeuge mehr aussetzt, als das weit
bescheidenere Kleid des westasiatischen Edelfasans.
Alle Fasanen meiden geschlossenen Hochwald und bevorzugen von
Fruchtfeldern oder Wiesen umgebene Haine oder Buschwerk, in welchem sie
Schutz finden können. Während des ganzen Tages treiben sie sich auf
dem Boden umher, schleichen nahrungsuchend von einem Busch zum andern
und suchen sich erst mit Einbruch der Nacht einen geeigneten Baum zum
Schlafen auf. Ihre Intelligenz ist eine geringe und sie sind leicht
aus der Fassung zu bringen, so daß sie häufig ihrer Dummheit zum Opfer
fallen. Diese ihre geistige Beschränktheit tut ihrer Vermehrung und
Ausbreitung erheblichen Abbruch. Gegen Artgenossen zeigen sie sich
wenig liebenswürdig; sie sind vielmehr ungesellig und unverträglich.
Zwei Hähne kämpfen, sowie sie zusammenkommen, mit Erbitterung, bis die
Federn davonfliegen und Blut fließt; ja der eine bringt den andern um,
wenn er dazu imstande ist.
Die Ende März einsetzende Paarungszeit macht den sonst schweigsamen
Vogel ein häßliches Gekrähe ausstoßen, mit dem er laut etwaige
Nebenbuhler herausfordert. Nach der Paarung sucht sich die Henne ein
stilles Plätzchen unter dichtem Gebüsch auf, wo sie in eine mit dürren
Blättern belegte, von ihr ausgekratzte seichte Vertiefung im Boden
in Zwischenräumen von je zwei Tagen ihre 8–12 gelblich-graugrünen
Eier legt und nach Vollendung des Geleges eifrig bebrütet. Sie sitzt
so fest, daß sie den gefährlichsten Feind sehr nahe kommen läßt, bis
sie sich zum Davonlaufen entschließt, nachdem sie das Gelege leicht
mit Niststoffen bedeckt hat, um es unkenntlich zu machen. Nach 25–26
Tagen schlüpfen die Jungen aus, die bald von der Mutter zur Äsung vom
Neste weggeführt werden und schon nach 12 Tagen so weit sind, daß
sie ein wenig flattern können. Wenn sie dann Wachtelgröße erreicht
haben, bäumen sie abends regelmäßig mit den Alten. Bis in den Herbst
hinein halten sich die Jungen bei der Mutter auf, dann trennen sich
zuerst die Hähne und gegen das Frühjahr hin auch die Hennen, die
nunmehr fortpflanzungsfähig geworden[S. 334] sind, von ihr. Sie haben viele
Feinde und unterliegen bei uns weit eher als alle ihre Verwandten
Witterungseinflüssen. Die Fasanen lassen sich leicht untereinander
und mit dem ihnen nahe verwandten Haushuhn kreuzen. Somit haben wir
die Aussicht, durch kunstgemäße Bastardierung und Fortzucht der
Bastarde noch eine ganze Reihe schöner Schmuckvögel aus dem Geschlecht
der Fasanen zu erhalten, die dazu berufen sind, einmal unsere von
Wildhühnern verödeten Landschaften zu beleben und den Augen erfreuliche
Bilder zu spenden. Während der gemeine Fasan sich schon seit dem 14.
Jahrhundert von den Rheinniederungen aus als Jagdwild über Süd- und
Mitteldeutschland verbreitete, aber erst spät nach Norden gelangte —
er wird in Preußen erst 1678 als Jagdwild erwähnt —, bürgerte sich der
schöne Königsfasan erst neuerdings auf den Donauinseln bei Wien und in
Frankreich ein.
Der prächtige Goldfasan ist vermutlich der sagenhafte Vogel
Phoinix der alten Griechen; wenigstens paßt die zuerst von
Herodot gegebene Beschreibung desselben am besten auf diesen Vogel,
der wohl schon im frühen Altertum in einzelnen Exemplaren aus Ostasien
durch Vermittlung indischer Schiffer an die Küsten des Roten Meeres
und zu den Ägyptern gelangte. Nach Oppian sollte er in Indien leben
und nie von Menschen verfolgt werden. Er lebe sehr lange, fühle er
sich aber altersschwach, so baue er sich auf einer Felsenspitze aus
dürrem Reisig einen Scheiterhaufen und lege sich darauf. Von der Sonne
entzündet, verbrenne dann der Scheiterhaufen samt dem Vogel und statt
des toten steige ein junger Phönix aus den Flammen hervor. Nach dem
älteren Plinius soll der in Arabien lebende Phönix die Größe eines
Adlers erreichen, am Halse mit Goldfarbe glänzen, übrigens purpurfarbig
sein und im Schwanze himmelblaue und rosenrote Federn haben; sein Kopf
soll oben mit einem Federbusch, unten mit Kammlappen geziert sein.
Unter den Römern sei der Gelehrte Senator Manilius der erste gewesen,
der genauere Nachrichten über diesen Vogel gab. Zur Zeit des Kaisers
Claudius im Jahre 34 n. Chr. sei einer nach Rom gebracht und öffentlich
dem Volke gezeigt worden; doch galt er nicht für echt, da er Gerste,
Weizen und Brot fraß und eines gewöhnlichen Todes starb, ohne vorher
sein berühmtes Nest gebaut zu haben. Der römische Geschichtschreiber
Tacitus meldet, daß vor diesem einer zur Zeit des Sesostris (Senwosret
III., 1887–1849 v. Chr., der das nördliche Nubien unterwarf und
für sich die Stufenpyramide von Dahschûr erbaute), ein anderer zur
Zeit des Amasis (Ahmose, 570 bis[S. 335] 526 v. Chr.), ein dritter zur Zeit
des Ptolemäus III. (Euergetes, 247 bis 221 v. Chr.) nach der
Sonnenstadt Heliopolis in Ägypten geflogen und jeweilen von einer Menge
neugieriger Vögel begleitet und bewundert worden sei. Jedenfalls sei
es eine ausgemachte Sache, daß dieser Vogel sich bisweilen in Ägypten
sehen lasse. Später schrieb dann der im 4. Jahrhundert n. Chr. lebende
Lactantius ein eigenes Gedicht über den Phönix, dessen Gestalt zwischen
Pfau und gemeinem Fasan in der Mitte stehe und dessen Gang leicht,
rasch und voll königlichen Anstandes sei.
Unbekannt war den Alten selbstverständlich das erst nach der
Entdeckung Amerikas durch spanische Vermittlung nach Europa gelangte
Truthuhn oder der Puter (Meleagris gallopavo).
Neben dem Kakao und der Cochenille verdanken wir den alten
Mexikanern die Zähmung des dort und im Süden der Vereinigten Staaten
einheimischen Truthuhns, das bei ihnen und den weiter südlich wohnenden
Mayastämmen neben dem zahmen Hund die Hauptquelle für Fleischnahrung
bildete. Das Truthuhn lebt heute noch, soweit es nicht in dichter
besiedelten Gegenden ausgerottet wurde, in den Wäldern des südlichen
Nordamerika. Einst war es besonders in den Staaten Ohio, Kentucky,
Illinois, Arkansas und Alabama sehr häufig. Die beste Schilderung des
freilebenden Tieres verdanken wir dem nordamerikanischen Ornithologen
John James Audubon (1780–1851). Dieser schreibt von ihm, daß es
zeitweilig in großen Gesellschaften lebe und unregelmäßige Wanderungen
antrete, indem es tagsüber nahrungsuchend auf dem Boden fortlaufe,
nachts aber auf hohen Bäumen raste. Gegen den Oktober hin, wenn noch
wenige von den Baumsamen hinabgefallen seien, reisten die Truthühner
dem Tieflande des Ohio und Mississippi zu, wo sie mehr Äsung fänden. In
nahrungsreichen Gegenden pflegten sie sich in kleinere Gesellschaften
zu zerteilen. Wenn sie sich, von der Wanderung ermattet, Bauernfarmen
näherten, mischten sie sich gern unter den Hühnerstand. Im Frühjahre
fände die Paarung statt, wobei die Männchen die uns allen bekannten
Werbungstänze, von den schnell aufeinanderfolgenden rollenden Tönen
begleitet, aufführten. Das Nest bestehe aus einer seichten, liederlich
mit Federn ausgekleideten Vertiefung im Boden; das Gelege bestehe aus
15–20 auf dunkelrauchgelbem Grunde rotpunktierten Eiern, die von der
Henne mit Ausdauer bebrütet würden. Falls diese das Nest verlasse,
decke sie die Eier sorgsam mit trockenen Blättern zu, so daß es
schwer sei, überhaupt ein Nest aufzufinden, wenn man nicht gerade die
brütende[S. 336] Mutter davon aufscheuche. Zuweilen geschehe es, daß mehrere
Hennen in ein gemeinsames Nest legten und es zusammen bebrüteten.
Die Jungen seien schon nach 14 Tagen befähigt, mit den Alten abends
aufzubäumen.
Der Truthahn wird besonders gern während der Balz, die er zuweilen
auf Bäumen abhält, erlegt. Häufig werden die dummen Tiere in Fallen
gefangen, in die man Mais als Lockspeise gestreut hat. Ihr Fleisch ist
in ihrer Heimat sehr beliebt. Der erste Europäer, der das Truthuhn
erwähnt, ist der Spanier Oviedo, der in seiner Geschichte Indiens
schreibt: „In Neuspanien gibt es sehr große und schmackhafte Pfauen,
von welchen viele nach den Inseln und die Provinz Castilia de Oro
geschafft worden sind und daselbst in den Häusern der Christen ernährt
werden. Die Hennen sehen unansehnlich aus, die Hähne aber sind schön,
schlagen auch oft ein Rad, obgleich sie keinen so großen Schweif
haben als die Pfauen in Spanien.“ Um 1523 soll der Erzbischof von
San Domingo, Alessandro Geraldini, das erste Paar Truthühner nach
Rom gesandt haben. Als „indische Hühner“ haben sie sich in der Folge
langsam verbreitet, waren aber 1557 noch so selten und kostbar, daß der
Rat von Venedig bestimmte, auf welche Tafel sie kommen dürften und auf
welche nicht. 1571 wurden sie nach Konrad von Heresbach in ziemlicher
Zahl am Niederrhein gezogen. Schon 1560 hatte man bei einer großen
Hochzeit zu Arnstadt 150 Stück; 1561 bezahlten die reichen Fugger in
Augsburg zwei erwachsene Truthähne mit 31⁄2 Gulden und zwei junge
Hähne mit 2 Gulden per Stück.
Nach England sollen die ersten Truthühner 1524, nach Deutschland 1534
gekommen sein. Gleichzeitig gelangten sie auch nach Frankreich. Nach
Pennant soll 1585 der Truthahn urkundlich zuerst auf einem englischen
Weihnachtstisch erschienen sein. In der Folge gewann er hier als
beliebtester Weihnachtsbraten eine große Bedeutung. Merkwürdigerweise
gab man ihm hier den Namen turkey im Sinne von „weither
gebrachtes Huhn“. Die Türken selbst, die das Truthuhn verhältnismäßig
früh erhielten, nannten es „Frankenhuhn“, weil sie es von den Franken,
den Christen Europas, erhielten. Im Jahre 1625 wollte es in Kairo noch
nicht gedeihen; jetzt hat es dort die Gans als Festbraten verdrängt. Es
heißt hier Maltahuhn. Nach Persien brachte es der französische Reisende
Tavernier. In Indien gedeiht es nicht recht und bleibt klein, ebenso
auf Malakka und Java, wo es sich manchmal überhaupt nicht fortpflanzt.
Um 1870 waren sie in[S. 337] Annam neu eingeführt. In China werden sie nur
als Rarität gehalten und nicht benutzt. An der Küste von Oberguinea
traf sie Bosmann 1705 auf den Gehöften der Europäer, doch sind sie
nicht in den Besitzstand der Neger übergegangen. Die Indianer des
nördlichen Südamerika dagegen hatten von den mittelamerikanischen
Kulturvölkern, speziell dem Stamme der Mayas, das Truthuhn übernommen;
so traf es 1860 der englische Naturforscher Bates im Besitze der
Indianer am Amazonenstrom. Schon seit langer Zeit hatten diese allerlei
einheimische Waldhühner, so den Hokko und die Penelope,
in ihren Hütten gezähmt gehalten. Doch geschah dies nur zum Vergnügen,
ohne irgend welchen Nutzen aus ihren Pfleglingen zu ziehen. Aber zur
Fortpflanzung in der Gefangenschaft und zur eigentlichen Haustierschaft
gelangten sie nie. Man kann daraus schließen, daß es keineswegs leicht
ist, aus einem ohne Schwierigkeit zähmbaren und vielgehaltenen Tier ein
Haustier zu machen.
Die in der Kultur hoch gestiegenen Azteken Mexikos und Mayastämme
Yucatans hatten das Truthuhn jedenfalls schon lange vor der
Einwanderung der Europäer gezähmt. Dies beweist, daß die ersten Spanier
in deren Besitz schon durch fortgesetzte Inzucht zu Leucismus gelangte
weiße Truthühner antrafen. Die europäischen Ansiedler Nordamerikas, die
jedenfalls ihre Truthühner aus ihrer alten Heimat, besonders England,
mitgebracht hatten, legten ihren Truthennen mit Vorliebe die Eier der
wilden unter, um dann mit den Jungen der wilden Zucht das Blut ihrer
zahmen aufzufrischen. Überhaupt scheint das Truthuhn verhältnismäßig
leicht zähmbar zu sein und auch leicht zu verwildern. So ist es im
vergangenen Jahrhundert mehrfach in englischen Parks verwildert, ebenso
in Deutschland. Darwin fand nahezu verwilderte Truthühner am Parana in
Südamerika. Vielleicht hat sich das Truthuhn mit dem Pfau, nicht aber
mit dem Haushuhn gekreuzt, wie einzelne Berichte melden. Neuerdings
sucht man es als Jagdvogel bei uns einzuführen, was wohl keine
Schwierigkeiten haben wird, da es sich leicht akklimatisiert.
[S. 338]
XVI. Gans, Ente und Schwan.
Die in den Haustierstand übergetretenen Schwimmvögel gehören alle
der Familie der Zahnschnäbler oder Entenvögel an, die ebenso wie die
bereits besprochenen Hühnervögel vielfach erhebliche Unterschiede
in der Färbung des Gefieders beider Geschlechter erkennen lassen,
besonders was die Wildenten betrifft. Ihre geistige Begabung wird
vielfach zu niedrig angeschlagen, so daß die Bezeichnung „dumme
Gans“ geradezu sprichwörtlich geworden ist. Jedenfalls ist sie
durchschnittlich höher als bei den übrigen Schwimmvögeln. Nur die
gezähmten Vertreter derselben haben durch jahrhundertlange Bevormundung
durch den Menschen von der Intelligenz ihrer freien Ahnen erheblich
eingebüßt. Allen Mitgliedern der Sippe ist große Geselligkeit und
eine ausgesprochene Fürsorge für die Brut eigen. Soweit sie sich dem
Menschen anschlossen, verlangen sie auch im Haustierstande die Nähe
von Teichen oder langsam fließenden Wasserläufen, um sich darauf zu
tummeln, zu baden und nach allerlei kleinem Getier und pflanzlichen
Stoffen zu gründeln.

Bild 47. Jagd auf Wildenten und anderes Wassergeflügel
mit dem Wurfstock (Bumerang). (Nach Wilkinson.)
Hinter dem Herrn steht dessen Gattin und davor das Töchterchen, das
seinen Vater auf die Gans vor ihm aufmerksam macht. Zu oberst stürzt
eine Wildgans, vom Wurfholz getroffen, herunter.
Von ihnen trat die Wildgans als die verhältnismäßig am leichtesten
zähmbare zuerst in die Abhängigkeit des Menschen, und zwar begegnen
wir ihr im wasserreichen Ägypten zuerst als Haustier. Dort hatte man
schon sehr früh außer der Gans auch Reiher und Kraniche eingefangen und
nach Stutzung der Flügel eingehegt in kleinen, von Hirten getriebenen
Herden gehalten. Dann haben auch die Griechen und Römer der späteren
Zeit nicht nur Kraniche gefangen, um sie als geschätzten Braten
zu essen, sondern auch zuvor in besonderen Gehegen gemästet. So klagt
Plutarch über die Grausamkeit mancher Leute, die den zum Mästen
eingesperrten Kranichen und Schwänen die Augenlider zusammennähen.
Schon Platon erwähnt Anstalten zum Füttern von Gänsen und Kranichen.
Später berichtet der Römer Varro zu Ende der Republik, daß Sejus eine
Villa besitze, auf der[S. 339] große Herden von Gänsen, Hühnern, Tauben,
Kranichen, Pfauen, Siebenschläfern, Fischen, Wildschweinen und anderem
Wild gehalten würden, wodurch er ein jährliches Einkommen von 50000
Sesterzien (= 7500 Mark) erziele. Noch lange erhielt sich in Italien
die Vorliebe für Kranichbraten, zu dessen kunstgerechter Zubereitung
der Feinschmecker Apicius die nötige Anweisung gab. Reiher
wurden von den Römern der Kaiserzeit kaum gegessen, wohl aber
Störche. So sagt Horaz in einer seiner Satiren, der Storch sei
in seinem Neste sicher gewesen, bis man durch einen gewesenen Prätor
erfuhr, daß er vortrefflich schmeckt. Nach Porphyrio war es Asinius
Sempronius Rufus, der die Sitte einführte, junge Störche zu essen.
Auch Flamingos waren bei den[S. 340] römischen Feinschmeckern beliebt.
So berichtet Plinius, der Erzschwelger Apicius habe die Römer darauf
aufmerksam gemacht, daß die dicke Zunge des Flamingo vortrefflich
schmeckt. Martialis erwähnt sie als Leckerbissen für Leckermäuler, und
Suetonius berichtet: „Kaiser Vitellius war im Essen ganz unmäßig und
ließ, nebst anderen Leckerbissen, auch Flamingozungen auftischen.“ Nach
Älius Lampridius ließ der schwelgerische Kaiser Heliogabalus bei seinen
großen Schmausereien auch Gehirn von Flamingos auftragen.
Alle diese Wasservögel sind aber nie gezüchtet oder gar zu Haustieren
erhoben worden. Nur die Gans wurde es, und zwar waren nach den auf
uns gekommenen Darstellungen an den Wänden der altägyptischen Gräber
diese Gänse im Alten Reich viel schlanker und zierlicher als die
plumpen Gestalten unserer hochgezüchteten jetzigen Gänse. In einem
altägyptischen Gau war der Erdgott Keb mit der ihm heiligen Gans über
dem Kopfe dargestellt und wurde „der große Gackerer“ genannt. Den
alten Ägyptern war das Gänseei das Symbol des Welteies, aus dem die
ganze Schöpfung hervorgegangen sein sollte. Die Eier des von ihnen
gezähmten Tieres aßen sie wohl deshalb nicht, doch spielte der Braten
von erlegten wilden, wie auch später von zahmen Gänsen eine bedeutende
Rolle im Leben der Ägypter; denn unter den Opferspeisen, die den
vornehmen Toten dargebracht wurden, steht solcher mit an erster Stelle.
Die Stammform dieser altägyptischen Gans war nun nicht diejenige
unserer europäischen Gänse, von der alsbald die Rede sein wird, sondern
die die afrikanischen Gewässer bewohnende, durch ihre auffallend
schöne Zeichnung ausgezeichnete Nilgans (Chenalopex
aegyptiacus). Sie besucht von Afrika und Syrien aus ziemlich
regelmäßig Südeuropa, aber nur ausnahmsweise Deutschland. Sie vertritt
die Gattung der Baumgänse und kennzeichnet sich durch ihre schlanke
Gestalt, den dünnen Hals, großen Kopf, kurzen Schnabel, die hohen
Füße, die breiten Flügel und das prachtvolle Gefieder. Kopfseiten
und Vorderhals sind gelblichweiß und fein gesprenkelt; ein Fleck um
das Auge, der Hinterhals und ein breiter Gürtel am Mittelhals sind
rostbraun, das Gefieder der Oberseite grau und schwarz, das der
Unterseite fahlgelb, weiß und schwarz quergewellt, die Mitte der Brust
und des Bauches lichter, erstere durch einen großen, rundlichen,
zimtbraunen Flecken geschmückt, die Steißfedern schön rostgelb, die
Flügeldecken weiß, gegen die Spitze zu schwarz, prachtvoll metallisch
schimmernd, die Schwingenspitzen und Steuerfedern glänzend schwarz.
[S. 341]
Der schöne Vogel bewohnt ganz Afrika, besonders soweit es mit einem
Waldsaum eingefaßte Ströme besitzt, da er am liebsten im Walde und auf
Bäumen nistet. Im nördlichen Nilgebiet bilden Inseln und Sandbänke
im Strom seinen bevorzugten Aufenthalt. Von ihnen aus fliegt er
dann auf die Felder hinaus, um daselbst zu äsen. Er ist überaus
vorsichtig, scheu und mißtrauisch, daneben aber auch streitsüchtig mit
Geschlechtsgenossen.
Die Zähmung der einheimischen Nilgans wurde schon sehr früh von den
alten Ägyptern bewerkstelligt, so daß sie zweifellos als der älteste im
Niltal domestizierte Vogel anzusehen ist. Schon auf den Grabgemälden
des Alten Reiches (2980–2475 v. Chr.) sehen wir Bäuerinnen Gänse dieser
Art auf den Markt oder in den Tempel zum Opfer bringen. Auf anderen
sehen wir, wie Nilgänse gestopft werden, um sie fett zu machen, oder
wie an einem Bratspieß in glühender Asche Gänsebraten kunstgerecht
hergestellt wird. Erst im Neuen Reich (1580–1205 v. Chr.) wird dazu ein
über dem Feuer stehender Metallkessel verwendet, wobei der Küchenjunge
zum Umwenden des Bratens sich einer großen zweizinkigen Gabel bedient.
Wir sehen auch Geflügelhändler sie gerupft in ihrem Laden feilbieten,
dessen Wand eine ganze Reihe dieser gemästeten Vögel birgt, die fein
säuberlich ausgenommen waren und durch ihre appetitliche Auslage zum
Kaufen einluden.
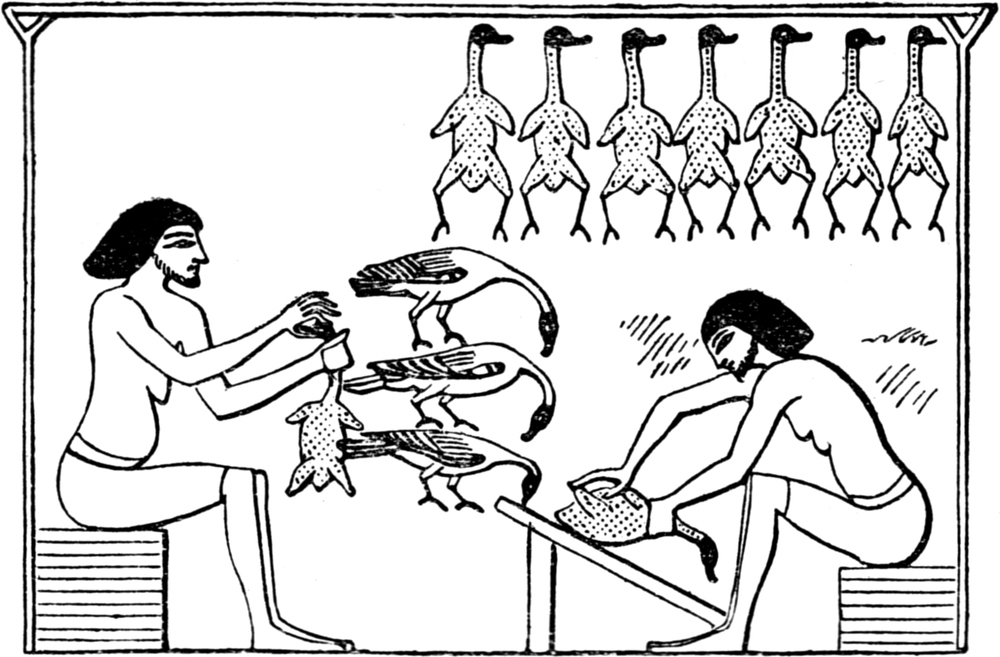
Bild 48. Geflügelladen im alten Ägypten mit teilweise
gemästeten Gänsen.
(Nach Wilkinson.)
Wie hoch die Zucht der Nilgans im Neuen Reiche Ägyptens entwickelt war,
zeigt uns ein im Britischen Museum in London auf[S. 342]bewahrtes Gräberbild
aus Theben, auf dem ganze Herden von Gänsen und ganze Körbe voll
geschlachteter Leiber derselben einem hohen Beamten vorgeführt werden.
Dabei werden die sich herandrängenden Gänsehirten von den Aufsehern
zur Ruhe gewiesen. Auf diesem, wie auf den anderen altägyptischen
Bildern, ist die Darstellung der Nilgans ungemein naturgetreu.
Merkwürdigerweise ist diese Zucht, die über 2000 Jahre hindurch von der
größten wirtschaftlichen Bedeutung für Ägypten war, späterhin spurlos
verschwunden. Weder im Niltal noch sonstwo in Afrika läßt sich irgend
welche Spur der Erhaltung dieser einstigen Gänsezucht nachweisen. In
Europa wurde sie gelegentlich wieder aufzunehmen versucht; doch wurde
die Nilgans nicht mehr in den Haustierstand erhoben, sondern sie wird
nur gelegentlich als Ziervogel gehalten. Nach J. Geoffroy St. Hilaire
ist 1839 in Frankreich die Aufzucht dieses Tieres mit gutem Erfolg
gelungen. Die gezüchteten Exemplare nahmen nach und nach an Größe zu
und die Befiederung wurde etwas heller. Gleichzeitig gelang es von 1844
an, die Brutzeit zweckmäßig zu verschieben, indem die Eiablage vom
Ende Dezember oder Anfang Januar bis 1846 in den März und später in
den April hinausgeschoben wurde. Leider wurde dieser vielversprechende
Versuch nicht weitergeführt und die Zucht der Nilgans aufgegeben,
bevor sie wiederum zum wirklichen Hausvogel, wie sie es einst im alten
Ägypten gewesen, geworden war.

Bild 49. Gänsebraterei im alten Ägypten.
a) Zerkleinerte Gänse in einem Kessel,
d) Sieden in einem Kessel,
f) Braten von Gänsen am Spieß. (Nach Wilkinson.)
[S. 343]
Außer der Nilgans scheinen die Ägypter noch drei andere Arten von
Wildgänsen gezähmt und mit gestutzten Flügeln in Herden gehalten zu
haben. Dies dürfen wir vor allem nach dem berühmten Wandgemälde des
Alten Reiches, das unter dem Namen die „Gänse von Meidum“ bekannt ist,
schließen. Darauf sehen wir nach Gaillard und Lortet weidende Graugänse
(Anser cinereus), dann Bläßgänse (Anser albifrons) und
Rothalsgänse (Branta ruficollis). Immerhin war diese Zucht nur
sehr vereinzelt und ohne volkswirtschaftliche Bedeutung, da sie sehr
bald aufgegeben wurde.
Die Stammform unserer Hausgans ist nicht die afrikanische
Nilgans, sondern die in Europa und Nordasien heimische, auf dem
Rücken bräunlichgraue, auf der Unterseite gelblichgraue, spärlich und
unregelmäßig gefleckte Grau- oder Märzgans (Anser
cinereus). Sie gehört mehr den gemäßigten Gegenden als dem hohen
Norden an und ist die einzige der bei uns vorkommenden Arten, die
in Deutschland brütet. Hier erscheint sie schon Ende Februar oder
Anfang März, also noch vor der eigentlichen Schneeschmelze in kleinen
Gesellschaften, um, wie dies wenigstens früher der Fall war, an allen
größeren stehenden Gewässern in schwer zugänglichem Schilfdickicht
oder mit Gesträuchern und hohem Gras bewachsenen Inseln zu brüten und
nach Beendigung der Mauser Ende Juli wieder nach Süden abzuziehen,
wo sie den Winter verbringt. Treu halten die Familien zusammen. Die
im Gegensatz zu den überaus schwerfällig gewordenen Hausgänsen viel
rascher und zierlicher sich bewegenden, gut und ausdauernd fliegenden,
gewandt schwimmenden und bei großer Gefahr in gewisse Tiefe tauchenden
wilden Graugänse beweisen einen scharfen Verstand und zeigen sich sehr
vorsichtig und mißtrauisch. Nur die Hausgänse erfreuen sich, als ob
sie die nahe Verwandtschaft herausfühlten, ihrer Zuneigung, indem sie
sich diesen auf den Weideplätzen oft nähern, ja einzeln sich nicht
selten unter diese mischen. In die aus allerlei Stengeln und Halmen
von Schilf, Rohr oder Binsen unordentlich und locker hergestellten
und mit einer dicken Daunenlage ausgepolsterten Nester legen die
jüngeren Weibchen 5–6, die älteren dagegen 7–14 durchaus denen der
Hausgans gleichende, glattschalige, glanzlose, etwas grobkörnige
Eier von grünlichweißer oder trübgelblicher Färbung. Am 28. Tage der
Bebrütung entschlüpfen die Jungen, werden noch etwa einen Tag lang im
Nest festgehalten, dann auf das Wasser geführt und zum Futtersuchen
angeleitet. Später werden Wiesen und Felder zum Äsen aufgesucht.
Abends kehrt alt und jung noch zum Nest[S. 344] zurück. Nach ungefähr zwei
Wochen wird dieses für die inzwischen heranwachsenden Jungen zu klein
und letztere nehmen bald hier, bald dort, dicht neben der Mutter
hingekauert, ihre Schlafstelle ein.
Jung eingefangene Graugänse werden bald zahm, doch verleugnen sie,
sobald sie erwachsen sind, so wenig als die von Hausgänsen erbrüteten
und erzogenen Wildgänse, ihren Freiheitsdrang und Wandertrieb. Sie
beginnen zu fliegen und ziehen, wenn man sie nicht gewaltsam zurückhält
und ihnen die Flügel stutzt, im Herbst mit anderen Wildgänsen nach
Süden. Zuweilen geschieht es, daß einzelne zurückkommen und das Gehöft,
in welchem sie großgezogen wurden, wieder aufsuchen; aber sie gehören
doch zu den Ausnahmen. Von vier im Hause erbrüteten und erwachsenen
wilden Graugänsen, die Boie beobachtete, entzogen sich nach und nach
drei der Obhut ihrer Pfleger; eine aber kehrte im nächsten Frühling
und in der Folge noch 13 Jahre lang zu dem Gut zurück, auf welchem man
sie aufgezogen hatte, bis sie endlich ausblieb, also wohl ihren Tod
gefunden haben mußte. Sie stellte sich in den 13 Jahren nie früher als
den 1. und nie später als den 4. April, also mehrere Wochen später als
die übrigen Gänse ein, zeigte sich auf dem Hofe sehr zahm, außerhalb
aber ebenso scheu als die wilden ihresgleichen, kam in den ersten
Wochen nach ihrer Rückkunft gewöhnlich morgens und abends, um sich
Futter zu holen, blieb auch wohl eine halbe bis eine ganze Stunde, flog
dann jedoch immer wieder zurück, und zwar sofort dem nahen See zu, so
daß man auf die Vermutung geriet, sie möge dort ihr Nest haben. Von der
Zeit an, in welcher die wilden Gänse Junge auszubringen pflegen, blieb
sie länger auf dem Hof, und später hielt sie sich beständig dort auf.
Abends 10 Uhr erhob sie sich regelmäßig und flog stets in derselben
Richtung davon, dem See zu.
Das Wildbret der alten Graugänse ist zwar hart und zähe, dasjenige der
Jungen dagegen zart und außerordentlich schmackhaft. So ist es kein
Wunder, daß die Tiere von alters her vom Menschen erbeutet wurden, um
als willkommene Nahrung zu dienen. Wie wir Überreste dieser Wildgänse
unter den Speiseabfällen der frühneolithischen Kjökkenmöddings der
Muschelesser Dänemarks antreffen, so begegnen wir ihnen, wenn auch
allerdings selten, in denjenigen der Pfahlbauzeit. Doch gezähmt kannten
die vorgeschichtlichen Europäer die Gans durchaus nicht, obwohl ihr
gleichende Vögel nebst Rinderköpfen auf einem bei Frankfurt an der Oder
gefundenen heiligen Wagen der Bronzezeit dargestellt sind. Letztere
waren der Gottheit geweihte wilde Tiere.[S. 345] Im alten Babylonien finden
wir Gewichte in Gestalt eines Schwimmvogels, der vermutlich ebenfalls
eine Gans darstellt. In Indien, wo der Vogel Henza eine wichtige
mythologische Rolle spielt, hat man mehrfach Gänsefiguren in Gräbern
gefunden, so daß man annehmen darf, daß diesem Vogel in den religiösen
Anschauungen der dortigen Bewohner eine gewisse Bedeutung zukam. In
Birma sind nach Yule heute noch Gewichte in Gebrauch, von denen die
Eingeborenen wissen, daß sie Gänse darstellen. Daraus schließt Eduard
Hahn, daß die Gänsezucht im alten Babylonien wie in Ägypten in Blüte
gestanden haben muß und von dort weiter östlich verbreitet wurde.
Es ist dies wohl möglich, ja wahrscheinlich, weil dort viele Kanäle
diesen Wasservögeln Gelegenheit zum Baden und Tauchen gewährten.
Doch haben die solcher Wasseransammlungen entbehrenden Juden diesen
Nutzvogel weder von dort noch von Ägypten her übernehmen können. In den
heiligen Schriften der Juden wird die Gans nirgends erwähnt; erst seit
dem Mittelalter ist bei den nach Europa gekommenen und hier häuslich
niedergelassenen Juden der Genuß von Gänsefleisch und von Gänsefett
zum Schmälzen des Rindfleisches, da ihr Gesetz die Verwendung von
Rinderfett oder Butter zu letzterem verbietet, sehr beliebt geworden.
Dagegen hielten bereits die Griechen des homerischen Zeitalters zahme
Gänse in kleinen Herden. Im Hofe des Königs Menalaos von Sparta, dem
Bruder des mächtigen Herrschers des „goldreichen Mykene“, Agamemnon,
gab es schon, wie uns im 15. Gesang der Odyssee berichtet wird,
die „sehr große, gemästete, weiße Gans“, auf welche ein Raubvogel
hinabstößt. Diese kennzeichnenden Beiwörter legen Zeugnis dafür ab,
daß wir es hier mit einem sehr alten, schon längst in der menschlichen
Zucht und Pflege befindlichen Tiere zu tun haben, bei dem sich der bei
Haustieren so weit verbreitete Leucismus schon vollkommen ausgebildet
hatte. Wahrscheinlich hatten die alten Griechen die weiße Hausgans von
Norden her erhalten. Da die wilde Stammform in Südeuropa nicht brütet,
sondern im Herbst mit bereits erwachsenen Jungen in das Gebiet des
Mittelmeeres fliegt, so ist sie wohl in ihrem südlichsten Brutbezirk,
in Mitteleuropa, irgendwo von vermutlich indogermanischen Stämmen in
die Haustierschaft gebracht worden. Hier konnten leicht nach Tötung der
Mutter erbeutete junge Wildgänse in des Menschen Pflege herangezogen
und später durch Brechen der Flügel vor dem Davonfliegen beim
Größerwerden bewahrt werden.
[S. 346]
Bei den Griechen galt die Gans für einen lieblichen Vogel, dessen
Schönheit bewundert wurde und der zu Geschenken an geliebte Knaben
und Mädchen diente. Als Ziervogel erscheint sie auch im 19. Gesang
der Odyssee, wo von Penelope, der treuen, von Freiern viel umworbenen
Gattin des Odysseus, als sie ihrem unbekannten, in Bettlergestalt ihr
gegenübersitzenden Gemahl ihren Traum erzählt, gesagt wird, sie besitze
— nicht draußen bei der Ökonomie, sondern bei der Wohnung — 20 Gänse,
die anzusehen ihr Freude mache. Diese ausdrücklich hervorgehobene Zahl
scheint offenbar einen nicht unbedeutenden Reichtum darzustellen.
Nach späterer griechischer Vorstellung sind Gänse wachsame Hüterinnen
des Hauses. So war auf dem Grabe einer guten Hausfrau unter andern
Emblemen eine Gans abgebildet, um die Wachsamkeit der Verstorbenen
hervorzuheben. In der bekannten Fabel des aus Kleinasien gebürtigen
Äsopos ist von der Gans die Rede, die goldene Eier legt. Hier erscheint
also dieses Tier genau in der Stellung wie bei uns das Huhn, in
China aber die Ente, die dort zur Eierlegerin herangezüchtet wurde.
Aristoteles berichtet von der Gans, daß sie 30 Tage brütet und der
Gänserich ihr dabei nicht helfe. Sonst fließen die literarischen
Quellen über dieses Tier bei den Griechen nur spärlich.
Sehr viel häufiger finden wir dagegen die Gans bei den Römern erwähnt,
bei denen sie als Nutztier eine erhebliche Bedeutung besaß. Der
römische Ackerbauschriftsteller Columella im 1. Jahrhundert n. Chr.
schreibt von ihr in seinem Buche über Landwirtschaft: „Die Gans wird
vom Landmann sehr gern gehegt und gepflegt, weil man sich mit ihr
nicht viel Mühe zu geben braucht und weil sie sorgfältiger wacht als
ein Hund; denn sie verrät durch ihr Geschrei den Spitzbuben ganz
sicher, wie sie denn einmal durch ihre Wachsamkeit das Kapitol (vor dem
Überfall durch die Gallier oder Kelten) gerettet hat. Zur Gänsezucht
gehört übrigens Wasser und viel Gras; auf Saatfeldern darf sie nicht
weiden, denn sie reißt da die zarten Pflänzchen ab. Sie liefert nicht
bloß Junge, sondern auch Federn, die man jährlich zweimal, im Frühling
und Herbst, ausrupfen kann. Auf drei Gänse hält man einen Gänserich.
Gewöhnlich beschränkt man die Zahl der Gänse auf wenige. Will man aber
ganze Herden davon halten, so muß man einen See oder Teich oder Fluß
für sie haben. Man baut dann für sie allein einen Hof, umgibt ihn mit
einer neun Fuß hohen Mauer, diese an der Innenseite mit einem Gang, der
ein Dach hat und eine Wohnung für den Wärter enthält. Rings im Gange
werden für einzelne Gänse[S. 347] steinerne Verschläge gebaut, wovon jeder
drei Fuß im Geviert mißt und eine feste Türe hat.
Außer dem Wasser müssen die Gänse auch Wiesen haben, ferner müssen
Äcker für sie bestimmt sein, welche mit Wicken, Klee, sogenanntem
griechischem Heu (Bockshornklee), vorzüglich aber mit Salat und einer
Art Zichorie, welche die Griechen seris nennen, besät sind; denn
diese weichen Blätter fressen die Gänse besonders gern und sie bekommen
den Jungen vortrefflich. Man hält womöglich nur weiße Gänse, da sie die
besten sind. Das Brüten beginnt im Februar oder März. Läßt man eine
Gans nicht brüten, so legt sie jährlich zu drei verschiedenen Zeiten
Eier, erst fünf, dann vier, dann drei. Man läßt die Eier am liebsten
von Haushühnern ausbrüten, auch die Jungen von diesen oder von den
Gänsen selbst führen. Zur Legezeit muß man gut auf die Gänse aufpassen
und diejenigen, bei welchen man das erste reife Ei fühlt, einsperren,
bis sie gelegt haben. Hat man das beim ersten Ei getan, so sucht dann
die Gans für jedes andere dasselbe Nest wieder auf. Einem Haushuhn darf
man nur drei bis höchstens fünf Gänseeier unterlegen, der Gans selbst 7
bis 15. Unter das Neststroh muß man Nesseln mischen; dadurch beugt man
vor, daß später die jungen Gänschen nicht sterben, wenn sie von Nesseln
gestochen werden. Gewöhnlich kriechen die Gänschen am 30. Tage aus dem
Ei, bei warmem Wetter auch früher. Wie bei andern jungen Tieren, so muß
auch bei den Gänschen dafür gesorgt werden, daß sie keine Natter, keine
Otter, keine Katze, kein Wiesel anhauchen kann, geschieht es doch,
so sind die zarten Wesen unrettbar verloren.“ Selbstverständlich ist
letzteres eine abergläubische Ansicht, wie solche bei den Römern wie
bei den andern Völkern des Altertums sehr zahlreich verbreitet waren.
Es gab damals bei den Römern, wie uns der gelehrte Varro zu Ende der
Republik berichtet, eigentliche Gänsezüchtereien, die man mit dem
griechischen Worte chēnoboskeíon bezeichnete. „Scipio Metellus
und Marcus“, fährt dieser Autor fort, „besitzen große Gänseherden.
Sejus schaffte große und weiße an; er hoffte von ihnen eine ebensolche
Nachkommenschaft zu ziehen. Es gibt auch eine bunte (graue) Gänserasse,
die man die wilde nennt, die sich nicht gern mit zahmen zusammentut
und nicht leicht zahm wird. Man füttert sie mit der speziell für sie
angepflanzten seris oder mit Gerste oder anderem Getreide oder
gemischtem Futter. Zur Mast nimmt man Junge von 4 bis 6 Monaten, sperrt
sie in einen Verschlag, gibt ihnen eine mit Wasser naßgemachte Mischung
von Gerstengraupen und Mehl, so daß sie sich[S. 348] täglich dreimal sättigen
können, und nach dem Fressen reichlich zu saufen. Auf solche Weise
müssen sie in drei Monaten fett sein. So oft sie gefressen haben, wird
ihr Verschlag gereinigt; denn sie verlangen, daß er rein sei.“
Schon bei den Feinschmeckern des alten Rom galt die Leber gemästeter
Gänse als Leckerbissen. So schreibt der Dichter Horaz in einer
seiner Satiren: „Um eine delikate, große Gänseleber auftischen zu
können, werden die Tiere mit Feigen gemästet.“ Juvenal sagt: „Die
Leber der Gans wird so groß wie die Gans selbst“, und Martial ruft
einmal aus: „Da, sieh, eine Gänseleber, die größer ist als eine große
Gans! Woher stammt denn diese?“ Der ältere Plinius bemerkt in seiner
Naturgeschichte: „Die Römer sind pfiffiger (als die Griechen) und
schätzen die Gänse weniger wegen ihrer Liebe zur Philosophie als wegen
ihrer wohlschmeckenden Leber. Werden sie gemästet, so wird die Leber
außerordentlich groß und nimmt an Umfang noch zu, wenn man sie in eine
Mischung von Milch und Honig legt. Es ist eine wichtige Frage, wer
zuerst diese köstliche Entdeckung gemacht hat, ob der Konsular Scipio
Metellus oder dessen Zeitgenosse, der Ritter Marcus Sejus. Das ist
dagegen unbestreitbar, daß Messalinus Cotta, Sohn des Redners Messala,
die Erfindung gemacht hat, Gänsefüße zu rösten und nebst Hahnenkämmen
einzumachen.“
Im ersten Jahrhundert n. Chr. lernten die Römer noch ein weiteres
neues Produkt durch die Germanen kennen, nämlich die Daunen als
überaus weiches und angenehmes Polstermaterial. Die Kulturvölker
des Mittelmeers hatten vorher augenscheinlich diese Verwendung noch
nicht gekannt. Wollte man weich sitzen oder liegen, so mußte man
eben mehrere Decken oder Felle aufeinander legen. Im verweichlichten
Orient kamen dann Hasenhaare und Rebhuhnfedern als Polstermaterial für
Kissen auf, und als der aus Syrien stammende Kaiser Heliogabalus diese
morgenländische Sitte nach Rom verpflanzte, unterläßt es sein Biograph
Lampridius nicht, diese luxuriöse Neuerung anzuführen. Da lehrten
die Feldzüge nach Germanien, besonders am Niederrhein, die Römer die
Gänsedaunen als ein ganz besonders feines Polstermaterial kennen, und
sie benutzten sie als solches gern. Der vorhin erwähnte ältere Plinius
schreibt in seiner Naturgeschichte: „Einen andern Vorteil (als die
Leber) zieht man aus den Federn der weißen Gänse. An manchen Orten
rupft man sie zweimal des Jahres und sie bekommen doch wieder neue
Federn. Der weichste Flaum sitzt der Haut am nächsten, der beste aber
kommt aus Germanien. Die[S. 349] dortigen Gänse sind weiß, klein, heißen gant
(Gans) und das Pfund ihrer Federn kostet 5 Denare (= 3 Mark). Daher
kommt es, daß die Offiziere der dort stehenden römischen Hilfstruppen
so oft angeklagt werden, ganze Kohorten auf die Gänsejagd statt auf
die Wache zu schicken. So sehr sind wir nun schon verweichlicht, daß
sogar Männer kaum schlafen können, wenn ihr Kopf nicht auf einem Kissen
aus Gänseflaum ruht.“ Bis auf den heutigen Tag ist ja das Schlafen
in Federbetten eine mehr nordische Sitte geblieben, die den in einem
wärmeren Klima lebenden Südländern nicht zusagte, sonst hätten die
Römer am Ende auch diese Gewohnheit den Germanen am Niederrhein
entlehnt.
Dagegen kannte das Altertum noch nicht den Gebrauch der Gänsefeder
zum Schreiben, die bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts in ganz Europa
dazu üblich war. Es benutzte dafür das Schreibrohr, den Kalamós
der Griechen, den die Römer als calamus übernahmen, der dann
später als Kelâm zu den Arabern gelangte und von ihnen bis auf
den heutigen Tag gebraucht wird. Erst der Anonymus Valesii, zur Zeit
des Ostgotenkönigs Theodorich, erwähnt als Schreibinstrument auch die
penna, d. h. Feder, die mit Vorliebe von den Flügeln der Gans
genommen wurde. Dann erwähnen Isidorus Hispalensis, der als Bischof von
Sevilla in der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts n. Chr. lebte, ebenso
der um 670 n. Chr. lebende Paulus von Ägina Gänsefedern zum Schreiben.
Von da an war sie in ganz Europa bis in die Neuzeit im Gebrauche.
Wegen ihrer Wachsamkeit wurden im Altertum auf dem Kapitol neben Hunden
auch Gänse gehalten. Letztere waren nach Livius und Diodorus Siculus
der Juno geweiht und weckten die eingeschlafenen Schildwachen, als
einst Gallier das Kapitol belagerten und heimlich bei Nacht am Felsen
hinaufkletterten. Zum Dank für jene Rettung vor Überfall wurden nach
Servius „jährlich am selbigen Tage mit Gold und Purpur geschmückte
Gänse auf Sänften in Rom zur Schau herumgetragen, während die Hunde,
die den Feind nicht verraten hatten, ans Kreuz geschlagen wurden“.
Nach Plinius war es die erste Sorge der Zensoren, einen Vertrag mit
den Leuten zu schließen, welche die Fütterung der heiligen Gänse auf
dem Kapitol übernehmen wollen. Derselbe Autor sagt dann auch: „Die
Gans verliebt sich mitunter in Menschen; so ist der Knabe Ägius zu
Olenus von einer solchen und von einer andern Glauce, die Spielerin
der Kithara am Hofe des Königs Ptolemäus, geliebt worden. Die Gänse
scheinen sogar für[S. 350] Weisheit empfänglich zu sein, denn es bezeugte
eine dem Philosophen Lakydes eine solche Anhänglichkeit, daß sie ihn
nirgends, weder auf der Straße, noch im Bade, weder bei Nacht, noch bei
Tag verließ.“ Solche Beispiele ließen sich auch aus der Gegenwart in
größerer Zahl anführen.
Bei den Kelten und Germanen war die Gans in einer kleineren, weniger
hochgezüchteten Art schon vor ihrem Bekanntwerden mit der römischen
Kultur vorhanden. Wir erwähnten vorhin den Passus bei Plinius, der von
der Gesuchtheit der Daunen der germanischen Gänse als Polstermaterial
für die Kopfkissen der Römer berichtet. So hat auch Gudrun in der Edda
ihre Gänse auf dem Hof, und diese schrieen hell auf, als ihre Herrin am
Leichnam Sigurds laut jammerte:
Und hell aufschrieen
Die zierlichen Vögel,
Im Hofe die Gänse,
Die Gudrun zog.
Nachdem sie im Herbste fett geworden waren, wurden sie, da man sie
nicht vollzählig überwintern konnte, zum größten Teil geschlachtet und
dem Gotte Thor zu Ehren gegessen. Als der heilige Martin den letzteren
bei der Christianisierung der Germanen ablöste, verspeiste man sie dem
letzteren zum Gedächtnis. Noch heute ist bei uns die Martinsgans in
Ehren. In Norddeutschland wird die gerupfte und ausgenommene Gans wie
das Schweinefleisch seit alter Zeit geräuchert, um sie so in den Winter
hinein aufbewahren zu können.
Die Veränderungen, die unsere Hausgans gegenüber der Wildgans erlitt,
sind eigentlich unbedeutend. Ihr Gang ist infolge des erhöhten
Gewichtes schwerfälliger geworden und ihre Flugfähigkeit hat sich
bedeutend vermindert, der Rumpf wurde etwas tiefer gestellt und der
Schwanz kürzer als bei der Graugans. Auch die Färbung wurde bei den
grau gebliebenen Schlägen einfacher in der Zeichnung. Eine solche graue
Art von bedeutender Schwere ist die Toulouser Gans, die oben
dunkelgrau und unten hellgrau ist, mit fleischfarbenem Schnabel. Eine
kleine Varietät derselben mit struppigen, gekräuselten oder gelockten
Federn, deren dünner Schaft eine zerschlissene Fahne besitzt, ist die
Sebastopol- oder Struppgans. Die meisten europäischen
Abarten besitzen als Folge des durch Domestikation weit gediehenen
Leucismus ein rein weißes Gefieder, einen gelbroten Schnabel, hellblaue
Iris und orangefarbene Füße, so die Emdener Gans und die durch
ihre Größe ausgezeichnete pommersche Gans.
Mit den Europäern haben die Hausgänse sich auch in die von[S. 351] jenen
kolonisierten Länder verbreitet, so besonders nach Nordamerika.
Dieses Land hat aus seinem reichen Bestand von wilden Gänsen in der
Folge ebenfalls eine zur Domestikation geliefert. Es ist dies die
Kanadagans (Anas canadensis), deren von wild lebenden
Tieren ausgenommene Eier mehrfach von Hausgänsen europäischen Ursprungs
ausgebrütet wurden. So war es nicht schwer Zuchtmaterial von ihr
zu erhalten. Doch gelang es nur, wenn diese Tiere ganz jung waren,
sie untereinander fortzupflanzen. Für die Volkswirtschaft hat aber
das Tier, das keine Vorzüge vor der Hausgans europäischen Ursprungs
darbietet, durchaus keine Bedeutung erlangt und wird in seiner Heimat,
wie auch bei uns, meist nur als Ziervogel auf größeren Teichen
gehalten. Da niemand auf seine Fortpflanzung achtete, wird es immer
wieder erloschen sein, um dann später gelegentlich neu aufzutauchen.
So erwähnt es schon Willoughby 1676 als im Besitze König Jakobs
I. befindlich. Bald danach berichtet Edwards, daß sich der Vogel
in der Gefangenschaft fortgepflanzt habe. In neuerer Zeit scheint
dies öfter vorzukommen. Doch ist dies alles aus obengenannten Gründen
bedeutungslos geblieben. Der Vogel hat eben keinen praktischen Wert für
die Züchter.
Ganz anders steht es mit der chinesischen Gans, die von der
ostasiatischen wilden Höcker- oder Schwanengans (Anas
cycnoides) abstammt, aber sich von ihr dadurch unterscheidet, daß
ihr jede Spur eines Höckers an der Schnabelwurzel fehlt, den besonders
das Männchen der wilden Art sehr ausgeprägt zeigt. Sonst ähnelt der
wilde Vogel in der Färbung unserer Märzgans. Der zahme Vogel zeigt
aber meist die auch von der domestizierten Märzgans angenommene weiße
Farbe; dabei weist das Männchen oft noch eine Art Kehlsack auf. Die
chinesische Hausgans nimmt in ihrer Heimat China, weniger in Japan,
ungefähr die Stellung der Hausgans bei uns ein. Hier geht, besonders im
Süden, die Ente bedeutend an Wichtigkeit vor. Schon im 16. Jahrhundert
wurde sie von den Portugiesen unter dem Namen spanische Gans oder —
nach dem Wege über Afrika — Guineagans nach Europa gebracht. Doch
hat sie hier nicht die Verbreitung gefunden, die sie verdient. Nur in
Rußland, besonders im Süden, war sie schon im 18. Jahrhundert recht
verbreitet. Sie war dahin auf dem Karawanenwege gelangt, wurde hier
aber in der Folge stark mit der europäischen Hausgans gekreuzt, so daß
die Vögel durchgängig gemischten Blutes sind. Hier benutzt man sie mit
Vorliebe zu den Gänsekämpfen, die besonders dadurch possierlich werden,
daß jedem der kämpfenden[S. 352] Männchen das Weibchen sekundiert. Neuerdings
ist die chinesische Gans auch mit der kanadischen gekreuzt worden.
Viel später als die Erwerbung der Gans als Haustier erfolgte
diejenige der Ente, die erst in historischer Zeit domestiziert
wurde, und zwar wie die Gans sowohl in Europa, als auch in China in
durchaus selbständiger Weise. Die alten Ägypter, Assyrer, Inder und
homerischen Griechen besaßen sie so wenig als die älteren Römer. Erst
vom Ende des 2. vorchristlichen Jahrhunderts an scheinen sie die
Römer und dann auch die Griechen mit andern Schwimmvögeln zusammen
in besonderen Teichen gehalten zu haben. So schreibt der römische
Ackerbauschriftsteller Columella etwa um 60 n. Chr.: „Im Entenpark
hält man Enten (anas), Knäkenten (querquedula),
Kriekenten (boscas), Wasserhühner und ähnliche Wasservögel.
Das Ganze umgibt man mit einer 15 Fuß hohen Mauer, deckt es mit einem
weitmaschigen Netz (damit keiner der Insassen hinaus und kein Raubvogel
hinein könne, sagt an einer ähnlichen Stelle Varro), gräbt in der
Mitte einen Teich von zwei Fuß Tiefe, der immer frisches Wasser erhält
und dessen Ufer allmählich abwärtsgehen und mit Mörtel ausgestrichen
sind. Rings am Ufer hin ist der Boden des Teiches gepflastert, in der
Mitte dagegen besteht er aus Erde und ist daselbst mit Wasserpflanzen
besetzt, unter welchen sich die Vögel verbergen können. Der Platz
außerhalb des Teiches ist mit Gras bewachsen. Zum Nisten sind am Fuße
der Mauer je einen Fuß ins Geviert haltende Zellen aus Stein gebaut,
die von Buchs- und Myrtenbäumchen beschattet werden. Das Futter wird
in einen besonderen flachen Wasserkanal geworfen. Am liebsten fressen
sie die Körner der verschiedenen Hirsearten, aber auch Gerste. Hat man
Eicheln und Weintrester, so gibt man auch diese. Ebenso sind Abgänge
von Fischen, Krebse und kleine Wassertiere dienlich. Das Eierlegen
beginnt im März. Zu dieser Zeit wirft man Hälmchen hin, aus denen sie
ihre Nester bauen. Übrigens verfahren manche Leute beim Anlegen eines
Entenparks so: sie lassen an Sümpfen Eier von wilden Enten sammeln
und diese von Haushühnern ausbrüten. Solche nisten dann leicht in der
Gefangenschaft, alt eingefangene dagegen nicht gern.“ Dieses letztere
Verfahren, die Eier wilder Enten zu sammeln und sie durch Haushühner
ausbrüten zu lassen, beweist, daß damals die Domestikation dieses
Vogels erst im Gange war; auch muß die Flugfähigkeit desselben noch
nicht vermindert gewesen sein, daß man Netze über die Ententeiche
spannte.
Tafel 51.
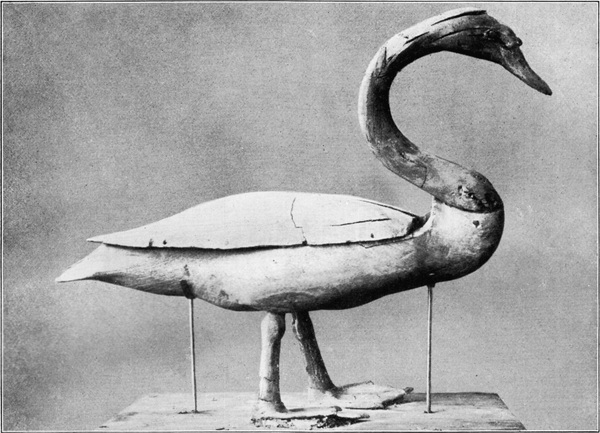
Schwan aus Daschur. Altägyptische Holzschnitzerei aus der
Zeit der 12. Dynastie (2000–1788 v. Chr.).

Altägyptische Wildgänse. Wandmalerei in Meidum aus dem
Anfang des Alten Reichs (3. bis 4. Dynastie, 2980–2750 v. Chr.).
Tafel 52.

(Copyright by M.
Koch, Berlin.)
Rechts Männchen und links Weibchen der Stockente.

(Copyright by M.
Koch, Berlin.)
Wilde Truthühner.
[S. 353]
Wie die Gans muß auch die Ente irgendwo in Mitteleuropa von
germanischen Stämmen in Pflege genommen worden sein; noch in späterer
Zeit sagt der Bischof Isidor von Sevilla, daß die bevorzugte
Zuchtrasse der Enten eine deutsche sei. Sie hieß althochdeutsch
anut, angelsächsisch ened, altnordisch önd,
lateinisch anas, anatis, griechisch nēssa (wohl
aus nētia), sanskrit âti (für anti). Diese
gemeinsame indogermanische Bezeichnung bezieht sich natürlich auf die
Wildente und nicht auf die gezähmte. Nur erstere war dem Urvolke vor
seiner Zerstreuung bekannt. Die Wildente, welche die Stammform unserer
Hausente bildet, ist die Stockente (Anas boscas), deren
Verbreitungsgebiet ganz Europa und Nordafrika, dann Asien und Amerika
bis Mexiko umfaßt. Vom Norden wandert sie im Herbst nach dem wärmeren
Süden, bleibt aber schon in Süddeutschland oft auch im Winter innerhalb
ihres Brutgebiets wohnen. Sie liebt als Aufenthaltsort schilf- oder
riedbedeckte Seen und Teiche, in denen sie sich verbergen kann, nicht
aber offene Gewässer. Ihre Lebensweise gleicht durchaus derjenigen
ihrer Nachkommin, der Hausente, nur ist sie in allen ihren Bewegungen
gewandter als diese. Zum Nestbau sucht sie eine ruhige, trockene Stelle
unter Gebüsch oder andern Pflanzen aus und legt in das kunstlose Nest
8–16 längliche, hart- und glattschalige grauweiße Eier, die von denen
der Hausente nicht unterschieden werden können. Die Jungen werden nach
dem Ausschlüpfen noch einen Tag im Neste erwärmt und sodann dem Wasser
zugeführt. Die ganze Pflege übernimmt die Mutter; der buntgefärbte
Vater kümmert sich nicht mehr um sein Weibchen, sobald es zu brüten
beginnt, sondern verläßt es, um mit seinesgleichen in Gesellschaften
sich bald hier, bald dort umherzutreiben. Da das Wildbret der Stockente
vorzüglich ist, wird von jeher eifrig auf sie Jagd gemacht. Und als
man die in bezug auf Fleischmenge ausgiebigere Gans gezähmt hatte, lag
es nahe, auch die Wildente aus junger Brut oder Hausgänsen unterlegten
Eiern zu gewinnen.
Trotzdem die Ente kürzere Zeit Haustier ist als die Gans, haben
sich von ihr mehr Varietäten gebildet, als von letzterer. Indessen
betreffen die Abänderungen weniger die Körperform als die Färbung
des Gefieders. Die Neigung zu Weiß- und Schwarzfärbung macht sich
bei ihr stark geltend; doch kommen bei allen zahmen Entenvarietäten
Individuen mit Wildentenfärbung vor. Der Stockente im Gefieder am
ähnlichsten ist die namentlich in der Normandie rein fortgezüchtete
Rouenente. Sie kommt auch in weißer Färbung vor und[S. 354] erreicht
ein bedeutendes Gewicht. Rein weiß oder fahlgelb ist die durch eine
Haube auf dem Kopfe ausgezeichnete Kaiserente, die bei guter
Fütterung ein Gewicht von 3,5–4 kg erreicht. Rein weiß ist die
Aelesburyente, die in großartigem Maßstabe in der englischen
Grafschaft Buckingham gezüchtet wird und ihres schmackhaften Fleisches
und der feinen Federn wegen auf dem Markt in London sehr gesucht ist.
Weiß mit gelblichem Anflug ist die auch bei uns öfter gezüchtete
Pekingente. Diese chinesische Hausente wurde selbständig in
Ostasien von der dort heimischen Wildente gewonnen, und zwar scheint
bei den Chinesen die Entenzucht weit älter als in Europa zu sein. Sie
wird von ihnen an den Ufern der Flüsse, Kanäle und Stauseen seit alter
Zeit in großem Maßstabe mit außerordentlicher Sorgfalt betrieben. Die
überaus interessante Zucht, bei welcher gewöhnlich zehn Enten auf
einen Enterich gehalten werden, wird größtenteils an Bord ausgedienter
Schiffe geübt. Das ganze Schiff ist mit den Käfigen der Enten besetzt,
die im ganzen nur wenig Futter erhalten und deshalb wesentlich darauf
angewiesen sind, ihre Nahrung im Wasser und an den Ufern zu suchen.
Je nachdem nun die Nahrung reichlicher zu Gebote steht, wechselt der
schwimmende Stall seinen Ankerplatz. Dabei wird bei den Pfleglingen
strengste Disziplin geübt, indem beim abendlichen Gongsignal, das die
Enten in ihre Ställe zurückruft, die zuerst heimkehrenden Enten Reis
als Belohnung, die letzten dagegen Hiebe mit dem Bambusstab erhalten.
Dabei haben die Chinesen zur Erleichterung ihrer Entenzucht selbständig
eine Methode zur künstlichen Ausbrütung der Eier gefunden. Diese wird
in besondern Anstalten in der Weise ausgeübt, daß man Spreu erwärmt
und mit Enteneiern in große Korbe bringt, die auf Etagen gelegt und in
besondern Räumen mit heißer Asche oder Kohlentöpfen erwärmt werden.
Überall in Südchina wird dieses Brutgeschäft im großen betrieben
und werden die herangezogenen Enten an Händler verkauft, welche oft
Hunderte derselben in den vorgenannten Entenschiffen halten und die
erwachsenen Vögel an Lebensmittelverkäufer absetzen. Sowohl die
vornehmeren Chinesen, als auch die niedern Volksklassen konsumieren das
Entenfleisch mit Vorliebe, sei es frisch, sei es eingesalzen oder an
der Luft getrocknet. Mit letzterer Konservierungsmethode beschäftigen
sich größere Etablissements, die die volkreichen Städte mit diesem
beliebten Nahrungsmittel versorgen. Daneben werden auch sehr viel
Enteneier, wie bei uns die Hühnereier, gegessen, meist aber erst, wenn
sie durch längeres Liegen in Salzwasser innerlich ganz schwarz geworden
sind[S. 355] und pikant schmecken. Tatsächlich sollen die so präparierten
Enteneier auch für den europäischen Geschmack sehr angenehm sein.
Auch die japanische Ente ist in hohem Maße auf Eierertrag
gezüchtet worden und legt 80–90 Eier jährlich. Sie ist in der Färbung
wildentenartig, gleicht der Rouenente und eignet sich auch wegen ihrer
Größe und Widerstandsfähigkeit zur Zucht. Sie kam 1878 nach Europa.
Die in den Männchen prächtig geschmückte ostasiatische
Mandarinenente (Aix galericulata) wird in China öfter
gezähmt gehalten, ist aber dort noch nicht zum Haustier geworden. Bei
uns ist sie mit andern buntgefärbten Arten eine Zierde der Zoologischen
Gärten und wird so nach und nach völlig domestiziert werden. Dies
ist auch mit der in den Männchen wunderschön gefärbten, über ganz
Nordamerika verbreiteten Brautente (Lampronessa sponsa)
der Fall, die sich auf unsern Weihern fest eingebürgert hat. Sie
vereinigt in sich alle Eigenschaften, die einem Schwimmvogel unsere
Zuneigung gewinnen können. An die Gefangenschaft gewöhnt sie sich
schneller als irgend eine andere Ente; selbst die alt Eingefangenen
lernen sich bald in die veränderten Verhältnisse fügen, in ihrem Wärter
den wohlwollenden Pfleger erkennen, lassen sich bereits nach kurzer
Haft herbeilocken und können eher als andere zum Aus- und Einfliegen
gewöhnt werden, pflanzen sich auch regelmäßig in der Gefangenschaft
fort, sobald ihnen nur eine passende Gelegenheit dazu geboten wird. Da
ihr Wildbret vom September an bis zum Eintritt des Winters köstlich
ist, wird ihr überall in ihrer Heimat nachgestellt und kommt sie dort
zu Tausenden auf den Markt. Als Parkvogel verdient sie den Vorzug vor
sämtlichen fremdländischen Verwandten nicht bloß deshalb, weil sie alle
an Schönheit übertrifft, sondern auch, weil sie sich leichter als alle
andern zur Fortpflanzung bringen läßt.
Im Gegensatz zu diesen ist eine andere amerikanische Ente schon seit
längerer Zeit zum Haustier geworden. Es ist die südamerikanische
Moschusente (Cairma moschata), die in wasserreichen
Gebieten von Brasilien bis Paraguay stark verbreitet ist. Das Männchen
ist oberseits bräunlichschwarz, Hals und Kopf dunkelgrün, Flügel und
Schwanz metallischgrün, ein Teil der Flügeldeckfedern weiß. Um das
Auge ist die Haut nackt und mit roten Warzen bedeckt. Das Weibchen
ist ähnlich, aber weniger lebhaft gefärbt. Ihre Körpergröße ist sehr
bedeutend, so daß ihre zahmen Abkömmlinge 70–85 cm lang werden
und ein Körpergewicht von 5 kg erreichen. In ihrer Heimat wird
die Moschusente ihres wohlschmeckenden Fleisches und der weichen
Daunen[S. 356] wegen sehr geschätzt. Sie wird dort schon seit langem, noch
vor der Entdeckung des Landes durch die Weißen, gezähmt gehalten. Sie
war nach Garcilasso de la Vega bei den alten Peruanern unter dem Namen
Nunjuma als Hausente bekannt und gibt beim Fressen einen eigentümlichen
schmatzenden Ton von sich. Von den Peruanern hatten sie auch die
nördlicher wohnenden Kulturvölker übernommen. So traf sie Kolumbus auf
seiner zweiten Reise bei den Eingeborenen von Haiti an, darunter auch,
zum Zeichen einer intensiven Domestikation, bereits weiße Exemplare.
Heute ist die Färbung bei fast allen zahmen Moschusenten weiß geworden
mit einem roten Warzenhof ums Auge, einem fleischroten Schnabel und
orangegelben Füßen. Von Südamerika aus hat sie sich am Kongo, am
Euphrat, in Indonesien und Europa eingebürgert, doch wird sie in
letzterem Lande, wo sie „türkische Ente“ heißt, nicht rein gezüchtet,
sondern gewöhnlich zur Kreuzung mit größeren Hausenten verwendet. Die
Bastarde erhalten die Mittelgröße zwischen beiden Eltern, wachsen
sehr schnell und sind gut mastfähig. Entgegen früheren Annahmen sind
sie fruchtbar, neigen aber zur Wildheit. Besonders empfohlen werden
zur Kreuzung Rouen-, Peking- und Aylesburyenten. Da die Moschusente
sich besonders für die Tropen eignet, hat sie für jene Gegenden eine
große Zukunft. Bei den Malaien Südasiens ist bereits die chinesische
Ente eingebürgert und wird vielfach in großen Herden gehalten, um
als willkommene Abwechslung zum Schweinefleisch zu dienen. Als große
canne de la Guinée erwähnt sie P. Belon bereits 1555 in seiner
Histoire des oiseaux. Schon damals war sie in Frankreich nicht
selten, muß also sehr früh durch die Spanier nach Europa gebracht
worden sein. Hier wurde sie aber mehr als Zier- denn als Nutzgeflügel
gehalten.
Von den Entenvögeln ist wenigstens als halbes Haustier noch der
Schwan zu erwähnen. Der zahme Schwan unserer Weiher, der nur als
Schmuckvogel gehalten wird, wobei ihm der Mensch bloß Gelegenheit zur
Fortpflanzung bietet, ist der Höckerschwan (Cycnus olor),
der noch in Norddeutschland, dann in Nordeuropa und Nordasien als
wilder Vogel lebt. Er ist in beiden Geschlechtern rein weiß mit
gestrecktem Leib und langem, schlankem Hals, mit rotem, an der Basis
durch einen schwarzen Höcker ausgezeichnetem Schnabel. Das Weibchen ist
etwas kleiner als das Männchen, die Jungen sind eigentlich graubraun
gefärbt, können aber durch fortschreitenden Leucismus auch schon weiß
erscheinen. Gedrungener als der Höckerschwan mit kürzerem, dickerem
Hals und höckerlosem gelbem Schnabel ist der[S. 357] Singschwan
(Cycnus musicus), während der ebenfalls in Europa und Nordasien
lebende Zwergschwan (Cycnus bewicki) noch kleiner ist und
einen dünnen Hals hat.
Erfreut der Höckerschwan durch die Zierlichkeit seiner Gestalt und
die Anmut seiner Bewegungen, so hat der Singschwan durch seine laute,
verhältnismäßig wohlklingende Stimme von jeher die Phantasie des
Volkes beschäftigt, wenn er im Herbst nach Süden zum Überwintern und
im Frühling nach Norden zur Fortpflanzung zog. Welche Rolle spielt
nicht der Schwan in der Sage und im Märchen der Deutschen! Auch die
alten Griechen, die ihn kýknos, und die Römer, die ihn nach
jenen cycnus oder olor nannten, sprachen viel von ihm und
alle ihre Dichter erwähnen rühmend seinen Gesang, wenn auch wohl meist
nur vom Hörensagen. In Homers Ilias wird das in glänzender Rüstung
zum Kampfe aufziehende Heer der Griechen mit den Scharen von Gänsen,
Kranichen und langhalsigen Schwänen verglichen, „wenn diese mit lautem
Geschrei sich auf den Wiesen am Flusse Kaystros (in Lydien, mündet bei
Ephesus ins Meer) niederlassen.“ Der Schwan war dem Apollon heilig.
So heißt es schon in einem altgriechischen, Homer zugeschriebenen
Hymnus: „O Phöbus, dir singt der Schwan am Ufer des Flusses Peneios (in
Thessalien) laut ein Loblied; Dir singe auch ich, der Sänger, indem ich
meine Kithara anschlage, früh und spät ein preisendes Lied.“ Hesiod
schildert, wie auf dem Schilde des Herakles der Okeanos abgebildet
war, auf dessen Wogen lautsingende Schwäne schwammen, während unter
ihnen die Fische spielten. In Äschylos’ Agamemnon heißt es: „Der Schwan
singt sein eigenes Leichenlied“ und in Euripides’ Elektra: „Der junge
Singschwan ruft am Wasser des Flusses seinen in der Schlinge gefangenen
sterbenden Vater.“ Bekannter ist die Stelle aus Platons Phädon, an
der es heißt: „Als Sokrates zum Sterben kam, unterredete er sich mit
seinen Schülern und sagte unter anderem: ‚Denkt ihr denn, daß ich den
Tod zu fürchten habe? Denkt ihr, daß ich weniger vom künftigen Leben
weiß als die Schwäne? Diese singen zwar oft, aber wenn sie fühlen,
daß der Tod ihnen nahe ist, dann singen sie gerade am meisten, weil
sie sich freuen, daß sie zu dem Gotte gehen, dessen Diener sie sind.
Leute, die sich vor dem Sterben fürchten, legen freilich die Sache ganz
falsch aus und behaupten, die Schwäne sängen vor ihrem Tode vor Jammer.
Diese Leute sollten doch wissen, daß kein Vogel vor Jammer singt,
z. B. wenn er hungert oder friert. Auch diejenigen stellen eine verkehrte
Behauptung auf, welche sagen,[S. 358] die Nachtigall, die Schwalbe, der
Wiedehopf sängen vor Jammer. Ich glaube jedoch, daß sie ebensowenig vor
Jammer singen als die Schwäne. Die letzteren sind offenbar Propheten
des Apollon, kennen im voraus das Glück, das ihnen in der Unterwelt
zuteil wird und singen deswegen, ehe sie den Weg antreten, freudiger
als zuvor. Ich denke nun, daß ich wie die Schwäne ein Priester des
Gottes bin, und denke, daß ich von ihm die Wahrsagekunst so gut gelernt
habe, als jene Vögel, und daß ich ebenso freudig als sie das Leben
lassen muß.‘“
Von diesem Volksglauben rührt die bei späteren griechischen
und römischen Schriftstellern angetroffene, auch noch von uns
sprichwörtlich gebrauchte Redensart vom „Schwanengesang“ als der
letzten Äußerung eines Menschen vor seinem Tode her, so bei Cicero,
Ovid, Martial, Dio Chrysostomus und andern. Bei den Römern galt der
Schwan als der Vogel der Liebesgöttin Venus, die auf einem von Schwänen
gezogenen Wagen einherfahrend gedacht wurde, so bei Horaz, Silius
Italicus, Statius und andern. Martial rät seiner Geliebten, sanft auf
Schwanenflaum zu ruhen, wenn sie müde sei. Demnach wurde der Flaum
auch dieses Tieres, wie derjenige der Gans, zur Polsterung von Kissen
verwendet. Von Schwanenbraten spricht der alexandrinische Grieche
Athenaios um 200 n. Chr. Allerdings mied man in der Regel das Fleisch
dieses halb für heilig gehaltenen Vogels. So schreibt Plutarch: „Will
man durchaus Fleisch des Schwanes essen, so mißhandle man wenigstens
die Tiere nicht vorher, sondern töte sie mit Bedauern. Es gibt Leute,
welche Kranichen und Schwänen die Augenlider zusammennähen und sie
dann im Dunkeln mästen.“ In allen diesen Fällen ist stets von wilden
Schwänen die Rede, da der Vogel im Altertum nirgends als Haustier
gehalten wurde.
Auch im Mittelalter wurde der wilde Schwan häufig als Speise benutzt.
Die heilige Hildegard im 12. Jahrhundert rühmt sein Fleisch als heilsam
gegen den Aussatz. Man begann ihn damals auf Teichen in halber Freiheit
zu halten; doch durften dies vielfach nur Könige und vornehme Leute
tun, da solches damals zu den Regalien gehörte. Reste einer solchen
Auffassung haben sich an manchen Orten bis in die Gegenwart erhalten;
so sind sämtliche Schwäne auf der Themse wie auf der Havel und Spree
königliches Eigentum. Im Mittelalter gehörte der Schwan, wie der Pfau,
zu den feierlichen Schaugerichten der Prunktafel an Höfen. Außerdem
muß ihm eine gewisse abergläubische Verehrung gezollt worden sein; so
wissen wir, daß König Eduard [S. 359]I. von England 1307 „bei Gott und
den Schwänen“ schwur, er werde sich an seinem Erbfeinde Robert Bruce
rächen.
Heute noch gilt ein Schwanenbraten als außerordentliche Delikatesse
und wird in England, wo er am Königshofe ständiger Weihnachtsbraten
ist, zu bedeutsamen Geschenken verwendet. So beschenkt der Herzog
von Norfolk, der „erste Peer Englands“, seine besten Freunde damit.
In der Hauptstadt seiner Grafschaft Norfolk, dem alten Bischofssitz
Norwich, hat er nebst dem Bischof, dem Abt des St. Benethospitals und
der Norwicher Schwanenkorporation das alleinige Recht, Schwäne auf den
öffentlichen Gewässern zu halten. Jeder dieser Eigentümer hat eine
besondere, sorgfältig gebuchte Hausmarke, die den Schwänen auf den
Oberschnabel eingeschnitten wird. Der Schwan vermehrt sich dort gut
und ist widerstandsfähig. Man hat ein Schwanenpaar beobachtet, das in
fünf Jahren 85 Eier erzeugte und von diesen 82 Kücken durchbrachte.
Das Aussuchen der zur Mast geeigneten Jungen wird von den Insassen des
St. Benethospitals besorgt und man nimmt nur so viel Tiere, als von
den Besitzern bestellt werden; denn diese haben für das Stück 1 Pfund
Sterling (= 20 Mark) Mastgeld zu entrichten. Die jungen Tiere schmecken
am besten gerade um die Zeit, wo sie fliegen können. In dieser Zeit
werden sie geschlachtet, haben dann ein Lebendgewicht von wenigstens 16
kg und schmecken wirklich gut.
Wie wir den Höckerschwan, halten die Russen nach Pallas gern den
Singschwan als Ziervogel auf ihren Teichen. Die Nordamerikaner haben
den Schwan von Europa erhalten. Dagegen erhielten wir um die Mitte
der 1850er Jahre vom Süden Südamerikas den Schwarzhalsschwan
(Cycnus nigricollis), der sich wie der Singschwan benimmt,
jedoch nur selten seine schwache Stimme erschallen läßt. Er hat
sich mehrfach in unsern Tiergärten fortgepflanzt. Ebenso verhält
es sich mit dem am ganzen Gefieder bis auf die weißen Hand- und
einen Teil der Armschwingen bräunlichschwarzen Schwarz- oder
Trauerschwan (Cycnus atratus), der in den 1820er Jahren
zum erstenmal nach Europa, und zwar England, kam und sich dort auf
dem Landgute Sir Herons auch fortpflanzte und im ganzen 45 Junge
aufbrachte. Von jenen scheinen die meisten der in den Zoologischen
Gärten und bei Privaten gehaltenen Exemplare abzustammen. Seit dem
Jahre 1698 kennt man übrigens den Schwarzschwan, den auch Cook an
der von ihm besuchten Küste Südaustraliens und Tasmaniens auf den
Süßwasseransammlungen antraf. In den weniger besuchten[S. 360] Gegenden
des Innern soll er, soweit dort Wasser anzutreffen ist, in großer
Menge vorkommen. Für unsere Weiher eignet er sich so gut als die
übrigen Schwäne. Die Strenge des nordischen Winters ficht ihn wenig
an und seine Nahrungsansprüche sind bescheiden. In der Gefangenschaft
pflanzt er sich regelmäßig fort. In seinem Benehmen mahnt er an die
stummen Verwandten, doch ist er schreilustiger; besonders gegen die
Paarungszeit hin läßt er seine trompetenartige, dumpfe Stimme oft
vernehmen.
[S. 361]
XVII. Die Taube.
Wie die verschiedenen einheimischen Entenvögel, so haben auch die
verschiedenen einheimischen Wildtauben von jeher als Wildbret die
Beachtung des Menschen gefunden. Unter ihnen ist die Felsentaube
(Columba livia) die Stammform sämtlicher Haustauben. Sie
hieß bei den alten Griechen peleiás, und der Pluralis
peleiádes diente diesen zur Bezeichnung der Sternwolke des
Siebengestirns, die ihnen wie ein Schwarm wilder Felsentauben vorkam.
Daraus ist dann unsere Bezeichnung Pleiaden entstanden. Häufig spricht
Homer von peleiádes, worunter er stets wilde Tauben versteht.
Sie sind ihm das Sinnbild des Flüchtigen und Furchtsamen. So entzieht
sich Artemis der Göttermutter Hera, die ihr den Köcher geraubt hat:
„Weinend aber entfloh sie zur Seite sofort, wie die Taube,
Die vom Habicht verfolgt in den Spalt des zerklüfteten Felsens
Schlüpft — nicht wars ihr beschieden des Räubers Beute zu werden.“
Hektor flieht vor Achilleus wie die „scheue, flüchtige“ Taube vor dem
Falken:
„Wie im Gebirge der Falk, der geschwindeste unter den Vögeln,
Leicht im Schwunge des Flugs der schüchternen Taube sich nachstürzt.
Seitwärts flüchtet sie bang; dicht hinter ihr stürmt er beständig
Nach mit hellem Geschrei und brennt vor Begier sie zu fangen.“
Auch im Sagenkreis der Argonauten erscheint die Taube als der
schnellste Vogel. Das Schiff Argo war, wie der Name sagt, wunderbar
schnell, und als es auf seiner Fahrt zwischen zwei zusammenschlagenden
Felsen hindurchfahren sollte, sandten die Schiffer auf den Rat des
greisen Sehers Phineas zuvor eine Taube aus; wenn diese unverletzt
hindurchflog, hofften die Helden ebenfalls unversehrt durchzukommen. So
verderblich seien diese Felsen, heißt es in der Odyssee,[S. 362] daß selbst
die geschwinden Tauben ihnen nicht immer entgehen und Vater Zeus, dem
sie Ambrosia bringen, die verlorenen durch andere ersetzen muß. Daß
nun die Schiffer Tauben bei sich hatten, um sie von ihrem Schiffe
aus fliegen zu lassen, beweist, daß man also schon im hohen Altertum
solche gefangene und noch nicht gezähmte Tiere zur Bestimmung des
nächstgelegenen Landes oder als Opfer mit sich nahm. Solches taten wie
die Griechen so auch die Phönikier, wie wir u. a. auch aus der später
zu würdigenden Tatsache von den weißen Tauben auf der Flotte der Perser
unter Xerxes wissen, die nach deren Scheitern am Vorgebirge Athos
freikamen und von den Anwohnern eingefangen wurden.
In der Ilias wird das böotische Thisbe und das lakedämonische Messe
als taubenreich, wie bei Äschylos die Insel Salamis als taubennährend,
bezeichnet. Bei den Spielen bei der Beerdigung seines Freundes
Patroklos läßt Achilleus eine lebendige, an die Spitze des Mastbaums
gebundene Taube als Ziel aufstellen. Nach diesem schießt zuerst der
gefeierte Bogenschütze Teukros; da er aber vergessen hatte, dem Apollon
sein Gelübde zu tun, trifft er nur die Schnur, und die nun befreite
Taube strebt kreisend zum Himmel empor. Da ergreift Meriones schnell
den Bogen, betet und holt den flüchtigen Vogel mit dem Pfeil aus der
Höhe herunter.
Außer der Felsentaube peleiás unterschieden die alten Griechen
von Wildtauben noch die Hohltaube oinás, die Ringeltaube
pháps und die Turteltaube trygṓn, während sie die später
erhaltene Haustaube als peristerá bezeichneten. Demgemäß nannten
sie das Taubenhaus peristereṓn oder peristerotropheíon,
wie uns der gelehrte Varro berichtet. Dieser Name der Haustaube tritt
uns erst in der späteren attischen Sprache entgegen, während die Dorier
fortfuhren, peleiás zu sagen. Wie kamen nun die Griechen zu diesem
Haustier, das erst gegen das Ende des 5. vorchristlichen Jahrhunderts
in Athen eine gewöhnliche Erscheinung wurde?
Die wilde Felsentaube ist in Westasien in Verbindung mit dem Kult der
Liebesgöttin allmählich in die Abhängigkeit des Menschen geraten und
zum Haustier erhoben worden. Bevor wir uns klar zu machen suchen,
wo dies vermutlich geschah, wollen wir das freilebende Tier in
seinen Lebensgewohnheiten kennen lernen. Die Felsentaube bewohnt die
Felsküsten der Mittelmeerländer und ganz Westasien, von Kleinasien
und Syrien bis Indien und China; sie geht tief nach Afrika hinein bis
Abessinien und reicht östlich bis zu den Kapverdischen Inseln[S. 363] im Süden
und Schottland im Norden. Auf diesem ungeheuren Gebiet hat sie als
Ausdruck ihrer Anpassungsfähigkeit eine große Anzahl von Lokalformen
gebildet, wodurch sich die Spaltung in zahlreiche Rassen nach ihrer
Domestikation begreifen läßt. Überall in ihrem Verbreitungsgebiet ist
sie Standvogel und nistet stets in dunkeln Felslöchern, niemals auf
Bäumen, wie Hohl-, Ringel- und Turteltauben. In Färbung des Gefieders,
Lebensweise und Betragen weicht die Felsentaube wenig von unserer
primitiven Haustaube, der sogenannten Feldtaube, ab. Sie ist auf der
Oberseite hell aschgrau, auf der Unterseite mohnblau, der Kopf hell
schieferblau, der Hals bis zur Brust dunkel schieferfarben, oben hell
blaugrün, unten purpurfarben schillernd. Die Lendengegend ist weiß;
doch ist dieses Merkmal nicht so konstant wie die beiden ziemlich
breiten schwarzen Querbinden auf den Flügeln. Die Flügel sind aschgrau,
der Schwanz ist dunkel mohnblau, am Ende schwarz; die äußersten
Federn desselben sind weiß. Das Auge ist schwefelgelb, der Schnabel
schwarz, an der Wurzel lichtblau, der Fuß dunkel blaurot. Die beiden
Geschlechter sind in der Färbung wenig verschieden, die Jungen aber
dunkler als die Alten.
Die Felsentaube ist gewandter, namentlich behender im Fluge als ihre
domestizierten Abkömmlinge, die Feldtauben, und sehr menschenscheu. Sie
geht nickend, fliegt klatschend ab, durchmißt mit pfeifendem Geräusch
etwa 100 km in der Stunde, steigt gern empor und kreist oft
längere Zeit in dicht geschlossenen Schwärmen; denn sie liebt die
Geselligkeit im Gegensatz zu der nur in einzelnen Pärchen lebenden
und nie sich zu größeren Schwärmen zusammenfindenden baumbewohnenden
Ringel-, Hohl- und Turteltauben. Beim Nahrungsuchen läuft sie
stundenlang auf dem Boden herum; beim Trinken watet sie bisweilen ein
bischen ins Wasser hinein. Sie lebt von allerlei Sämereien und nistet
dreimal im Jahre. Mit Beginn des Frühlings wirbt der Tauber sehr eifrig
rucksend unter allerlei Bücklingen und Drehungen um ein Weibchen, dem
er die größte Zärtlichkeit bekundet, während er gegen andere Genossen
zänkisch und unverträglich ist. Erwidert sie seine Gefühle und ist
damit die Ehe zustandegekommen, so sammelt er allerlei trockene
Pflanzenstengel und dürre Halme, mit denen die Täubin das Nest baut, in
das sie zwei glattschalige, rein weiße Eier legt. Beide Geschlechter
brüten, die Täubin von 3 Uhr nachmittags bis 10 Uhr vormittags
ununterbrochen, der Täuberich dagegen in den übrigen Stunden. Nachts
schläft letzterer in der Nähe des Nestes, immer bereit, die Gattin zu
beschützen, und duldet nicht ein[S. 364]mal, daß sich ihr eine andere Taube
nähert. Nach 16–18 Tagen schlüpfen die äußerst unbehilflichen, blinden
Jungen aus, die in der ersten Zeit von beiden Eltern mit dem im Kropfe
gebildeten Futterbrei ernährt werden, um dann später erweichte, endlich
härtere Sämereien nebst Steinchen als Reibemittel für den muskulösen
Kaumagen zu erhalten. Schon nach vier Wochen sind sie erwachsen,
schwärmen mit den Alten aus, machen sich in wenigen Tagen selbständig,
und die Eltern schreiten alsbald zur folgenden Brut. Jung aus dem Neste
genommene Felsentauben benehmen sich ganz wie Feldtauben, befreunden
sich mit dem Menschen, sind aber nicht so untertänig wie Haustauben.
Da es zahlreiche Rassen der Haustaube gibt, die im einzelnen sehr
starke Abweichungen in der äußeren Erscheinung erkennen lassen, so
war unter den Züchtern früher die Annahme allgemein verbreitet, daß
mehrere wilde Stammarten angenommen werden müssen. Indessen haben die
umfassenden Untersuchungen von Charles Darwin diese Frage endgiltig
gelöst und festgestellt, daß sie alle von der Felsentaube abstammen,
die schon im Freileben so veränderlich ist, daß man, wie gesagt,
mehrere geographische Rassen von ihr unterscheidet. Er führt eine
Reihe von Gründen an, die ausschlaggebend für die Abstammung aller
unserer Taubenrassen von der Felsentaube sprechen. Wenn auch unsere
Haustauben in Einzelehe leben, haben sie wie die wilde Stammart einen
starken Hang zur sozialen Lebensweise, vermeiden es wie diese auf
Bäume zu fliegen oder gar ihre Nester auf denselben anzulegen, sondern
verlangen vielmehr für ihre Nistplätze halbdunkle, unzugängliche Orte.
Alle Haustauben betragen sich wie die Felsentaube und legen wie diese
je zwei Eier. Bei allen Rassen derselben treten gelegentlich mohnblau
wie die Wildform gefärbte Individuen mit dem charakteristischen
Metallschimmer am Halse und den schwarzen Flügelbinden auf. Darwin
hat ausgedehnte Kreuzungsversuche bei verschiedenen Haustaubenrassen
gemacht und dabei häufig bei den Nachkommen schwarze Flügelbinden
auftreten sehen, auch wenn die Zuchttiere keine Spur davon erkennen
ließen. Durch Kreuzung mancher Schläge, die durchaus kein Blau in
ihrem Gefieder besaßen, erhielt er Nachkommen von blauer Färbung
und Zeichnung, die als vollständige Rückschläge in die Felsentaube
erschienen. Die Felsentaube kreuzt sich fruchtbar mit den
Haustaubenschlägen und letztere kreuzen sich unter sich, was ebenfalls
für die Felsentaube als gemeinsame Ausgangsform hindeutet. Schon bei
den wilden Felsentauben tritt gelegentlich Leu[S. 365]cismus auf, der dann bei
manchen der vom Menschen gezüchteten Schläge überwiegt.
Dieses Auftreten der weißen Farbe hält Ed. Hahn für sehr wichtig,
indem Tauben dadurch zuerst die Aufmerksamkeit, den Schutz und später
die Pflege des Menschen erworben haben sollen. Er sagt in seinem
Buch über die Haustiere und deren Beziehungen zum Menschen: „Bei
keinem Tier ist es so deutlich, daß seine Einführung mit religiösen
Momenten zusammenhängt, und bei keinem Tier lassen sich so leicht die
ursprünglichen Bedingungen der Einführung feststellen. Grotten und
Felshöhlen, aus denen vielleicht noch ein starker Quell entspringt,
gehören zu den ursprünglichsten Heiligtümern; dies sind Stellen, die
die Taube mit besonderer Vorliebe bewohnt, und so scheu sie sonst ist,
oft mit merkwürdiger Nichtachtung des menschlichen Verkehrs auch trotz
aller Störungen innebehält. Jede Gottheit nimmt die Tiere, die sich
ihr freiwillig anvertrauen, in ihren Schutz. Fanden sich nun einmal
unter den Tauben einige Albinos, so war die weiße, lichtglänzende
Verkörperung der Gottheit von selbst gegeben, und daß die Taube mit
ihrer äußerst verliebten Natur der Göttin der Liebe geweiht wurde, ist
ebenso selbstverständlich. Ich glaube sogar sagen zu können, daß die
Taubengestalt in so alter Zeit sich mit der Vorstellung, unter der man
sich die Gottheit des weiblichen Prinzips verkörpert dachte, verband,
daß sie von sehr bedeutendem Einfluß auf die Ausgestaltung dieses
weiblichen Prinzips selbst gewesen ist; bekanntlich wurde Semiramis,
die nur eine spezialisierte Form der großen Göttin darstellt, aus
einem großen Ei am Ufer des Euphrat von den Tauben ausgebrütet (Diodor
II, c. 4; später flog sie als Taube gen Himmel, c.
20). Schon in ältester Zeit hat die Taube sich als heiliger Vogel der
Göttermutter durch den ganzen Orient verbreitet. Die Phönizier brachten
sie so weit sie den Kult ihrer Götter trugen, z. B. nach dem Berge Eryx
in Sizilien, und mit der Leichtigkeit, mit der sich der heilige Vogel
wieder an anderen Stellen festsetzte, gab er dann seinerseits Grund
zu neuen Heiligtümern der Venus. An eine Benutzung des Vogels, etwa
zur Speise, war in solchen Fällen natürlich nicht zu denken, stand er
doch unter dem unmittelbaren Schutz der Göttin. Erst sehr viel später
lernte man den Vogel auch als Braten schätzen; hier waren es wohl die
Römer zuerst. Doch ging die Idee des Zusammenhangs des Vogels mit der
Venus nicht gleich ganz verloren; das beweist uns Martial (der in einer
seiner Xenien sagt: ‚Nicht soll diesen Vogel essen, wer geil zu sein
begehrt‘).“
[S. 366]
In der dargestellten Weise mag irgendwo in Westasien die wilde
Felsentaube vor allem in gewissen albinotischen Individuen als heiliges
Tier der großen Göttin der Liebe und Fruchtbarkeit unverletzlich
erklärt und dann sogar in menschliche Pflege genommen worden sein,
bis sie sich schließlich an ihre Beschützer gewöhnte und zum Haustier
wurde. Und was zunächst nur einigen auserwählten Individuen zuteil
wurde, das erstreckte sich später auf das ganze Geschlecht, so daß die
Felsentaube überhaupt für ein unverletzliches, heiliges Tier galt. So
war seit den ältesten geschichtlichen Zeiten die Felsentaube der großen
Göttermutter und Göttin der Liebe und Fruchtbarkeit, Astarte, heilig
und wurde überall in Vorderasien bei ihren Tempeln in größeren Scharen
gehegt. Auch mag da und dort ein Taubenpärchen in den Höhlen, die als
älteste Kultorte dienten, später auch an dunkeln Orten der Steintempel
genistet und sich so an den Umgang mit dem Menschen gewöhnt haben. Dies
gab vielleicht dem betreffenden Kultorte ein besonderes Ansehen, so
daß dann künstlich von den Priestern Tauben dort angesiedelt wurden,
wodurch die Zähmung beschleunigt wurde.
Als der Grieche Xenophon im Jahre 400 v. Chr. im Heere des jüngeren
Cyrus mit anderen griechischen Söldnern Syrien durchzog, fand er, daß
die Einwohner die Fische und Tauben als göttliche Wesen verehrten und
ihnen kein Leid anzutun wagten. Nach Pseudo-Lucian waren in Hierapolis
oder Bambyce die Tauben so heilig, daß niemand eine derselben auch nur
zu berühren wagte. Wenn dies jemandem wider Willen widerfuhr, dann
trug er für den ganzen Tag den Fluch des Verbrechens; „daher leben
auch,“ fügt der Verfasser hinzu, „die Tauben mit den Menschen ganz
als Genossen, treten in deren Häuser ein und besetzen weit und breit
den Erdboden.“ Ganz dasselbe berichtet der Jude Philo von Askalon,
wo auch ein berühmter Tempel der Göttin Astarte — der Aphrodite
uraniḗ. wie die Griechen sich ausdrückten — war. Er schreibt
nämlich: „Ich fand dort eine unzählige Menge Tauben auf den Straßen und
in jedem Hause, und als ich nach der Ursache fragte, erwiderte man mir,
es bestehe ein altes religiöses Verbot, die Tauben zu fangen und zu
profanen Zwecken zu verwenden. Dadurch ist das Tier so zahm geworden,
daß es nicht bloß unter dem Dache lebt, sondern ein Tischgenosse des
Menschen ist und dreisten Mutwillen treibt.“
Als der Dienst der semitischen Göttin Astarte durch die der Schiffahrt
kundigen Vertreter dieses Stammes weiter westlich im Mittelmeer
verbreitet wurde, zog selbstverständlich ihr heiliges Tier, die zahme[S. 367]
Taube, mit und wurde an ihren Heiligtümern in halber Wildheit gehalten,
wie dies heute noch überall im Orient auch unter den Mohammedanern der
Fall ist. Allgemein bekannt sind die Tauben der Göttin in Paphos auf
Zypern, die paphiae columbae der Römer, die im Tempel ein- und
ausflogen, ja sich selbst auf das Bild der Göttin setzten. Von Zypern
gelangte der Dienst dieser orientalischen Liebesgöttin schon vor der
Mitte des zweiten vorchristlichen Jahrtausends zu den die Küsten des
Ägäischen Meeres und die Inseln nebst Kreta bewohnenden Mykenäern. Dort
sind ihre auf uns gekommenen Darstellungen stets von Tauben umgeben. So
fand man im dritten Grabe der Burg von Mykenä zwei einst auf Kleider
genähte Goldbleche mit dem Bildnis einer jedenfalls sie darstellenden
weiblichen Gottheit, auf deren Haupt eine Taube sitzt. Im einen fliegt
außerdem von jedem Arme eine Taube aus. Fünf andere Goldbleche aus dem
3. und 5. Grabe stellen ein von Tauben umgebenes Gebäude dar, das wohl
an den Astarte-Aphroditetempel von Paphos erinnern soll. Dann sind auf
einem elfenbeineren Spiegelgriff aus mykenischer Zeit zwei weibliche
Gottheiten dargestellt, von denen jede eine Taube mit ausgebreiteten
Flügeln und ausgestrecktem Hals auf dem einen Arm hält.
Zu Beginn des letzten vorchristlichen Jahrtausends waren es besonders
die Phönikier, die zugleich mit ihrer Kolonisation den Astartekult und
die damit zusammenhängende Pflege ihres heiligen Tieres verbreiteten.
So brachten sie denselben u. a. auch nach ihrer Pflanzstadt Korinth.
Allerdings ist später im Kulte der Aphrodite der Griechen zunächst vom
heiligen Tiere ihrer phönikisch-semitischen Vertreterin keine Rede; es
muß nicht direkt mit jenen von ihnen übernommen worden sein. Auch in
den alten homerischen Hymnen auf sie finden sich die Tauben als ihr
heilige Tiere nicht erwähnt. Es wird dort berichtet, wie die Göttin
ihren duftenden Tempel auf der Insel Zypern betritt, wie sie von den
Chariten mit dem unsterblichen Öle gesalbt, mit herrlichen Gewändern
bekleidet und mit goldenem Geschmeide geschmückt wird und sich dann,
Zypern verlassend, hoch durch die Wolken nach dem quellenreichen Ida
schwingt.
Die älteste Erscheinung der Haustaube stammt, wie schon Darwin
festzustellen vermochte, aus der Zeit der 5. ägyptischen Dynastie (2750
bis 2625 v. Chr.) zur Zeit des Alten Reiches. Damals wurde sie schon
auf manchen Gehöften in Scharen gehalten und vom Menschen gefüttert.
Im Alten Testament wird sie zur Zeit des Exils (586–536 v. Chr.)[S. 368] im
Pseudo-Jesaias 60, 8 angeführt. Nach Ohnefalsch-Richter hat man auch,
besonders auf Zypern, hoch ins letzte vorchristliche Jahrtausend
hinaufreichende Abbildungen kleiner Tempel und Kapellen ausgegraben,
die wie die heutigen Bauernwohnhäuser in Syrien und Ägypten als
Taubenschläge eingerichtet sind. Alles dies beweist das hohe Alter der
Taubenzucht in der Ostecke des Mittelmeers.
Von dorther gelangte die Haustaube jedenfalls schon vor dem 5.
Jahrhundert v. Chr. zu den Griechen. Wenn nun der griechische
Geschichtschreiber Charon von Lampsakos, der Vorgänger des Herodot, in
seinen Persiká schreibt: „Zu der Zeit, da die persische Seemacht unter
Mardonios (492 v. Chr.) — zwei Jahre vor der Schlacht bei Marathon
— bei der Umschiffung des Vorgebirges Athos zugrunde ging, seien
zuerst die weißen Tauben im Lande erschienen,“ so will er damit nicht
sagen, wie die meisten Autoren schließen, damals sei die Haustaube
überhaupt zum erstenmal nach Griechenland gekommen, sondern er meint
damit offenbar nur Haustauben edler Rasse, die wir wohl mit dem Kulte
der orientalischen Liebesgöttin in Verbindung setzen dürfen. Noch viel
später lesen wir bei einigen griechischen Schriftstellern von der
„weißen Taube Aphrodites“. Es haben sich also beim Schiffbruche der
persischen Flotte am Berge Athos zahme weiße Tauben des Astartedienstes
aus den scheiternden Fahrzeugen ans Land gerettet und fielen den
Einwohnern in die Hände, die diese auffallenden Gäste hegten und
an ihre Landsleute weitergaben. Ein halbes Jahrhundert später war
unter den Athenern, die mit Thrakien in lebhaftem politischem und
Handelsverkehr standen, die zahme, — wohl vielfach weiße — Taube
unter dem Namen peristerá, der vielleicht aus jener nördlichen Gegend
stammt, ein verbreitetes Haustier, das gelegentlich, wie im Orient,
zu schnellen Botschaften gebraucht wurde. So sandte der um diese Zeit
lebende Äginet Taurosthenes seinem Vater durch eine Taube Botschaft
von seinem Siege in Olympia, und diese soll noch an demselben Tage
nach Ägina gelangt sein. Die wörtliche Schilderung dieses Vorgangs
erzählt uns Älian folgendermaßen: „Als Taurosthenes von Ägina den
Sieg zu Olympia errang, gelangte die Nachricht von seinem Glücke noch
selbigen Tags an seinen Vater nach Ägina. Er hatte nämlich eine Taube
mitgenommen, deren Junge noch im Nest saßen, und ließ sie, sowie er
gesiegt hatte, mit einem angehängten roten Läppchen davonfliegen.“ Als
der Aphrodite heilige Vögel wurden sie dieser Göttin als Weihgeschenke
dargebracht, um ihre Tempel in halber Freiheit gehalten und dort
regelmäßig gefüttert. Nach den Dar[S. 369]stellungen auf Münzen muß besonders
Sikyon eine Hauptstätte des Aphroditekultes, wie auch der Taubenzucht
gewesen sein.
Nach Italien kam die Taube durch die Vermittlung der süditalischen
Griechen, nachdem diese wohl durch den auf die Phönikier zurückgehenden
Tempel von Eryx in Sizilien zuerst Bekanntschaft mit jenem heiligen
Vogel gemacht hatten. Zog nun die dort verehrte Göttin Astarte an
einem bestimmten Tage des Jahres nach Afrika fort, so sollten ihr
nach Älian alle Tauben dorthin folgen. „Sind neun Tage verflossen, so
sieht man, wie die Leute behaupten, eine wunderschöne purpurfarbige
Taube von Libyen aus über das Meer nach Eryx fliegen und dieser folgt
dann eine ganze Wolke gewöhnlicher Tauben. Ist der Zug angelangt, so
wird (wie bei ihrem Auszug das Abschiedsfest) ein anderes Fest, das
Rückkehrfest, gefeiert.“ In der Zeit zwischen beiden mochten wohl
die Tempeltauben durch die Priester in ihren Kammern verschlossen
gehalten werden. Den Vogel nannten die sizilischen Griechen, als sie
ihn an jenem uralten phönikischen Heiligtum an der Nordwestspitze
Siziliens kennen lernten, kólymbos, woraus dann die Römer
columbus oder columba machten. In Italien wurde die zahme
Taube dann allmählich bekannt und ihre Zucht in Angriff genommen. Der
gelehrte Römer Varro zu Ende der Republik sagt, daß sie sonst ohne
Unterschied mit columba Männchen und Weibchen der Haustaube
bezeichnet hätten und erst später, da der Vogel bei ihnen gewöhnlich
ward, columbus von columba (als Männchen und Weibchen)
unterschieden. Er unterscheidet genau zwischen der Feldtaube — dem
halbwilden Abkömmlinge der Felsentaube — und der zahmen Haustaube,
und beschreibt Taubenhäuser, in denen bis 5000 Stück gehalten wurden.
„Man pflegt zwei Arten von Tauben zu halten: die Feldtaube, welche
andere auch Felsentaube nennen. Sie ist scheu, wohnt in den Türmen und
andern hohen Teilen des Landhauses und fliegt von da nach Belieben
auf das Feld, um sich ihr Futter selbst zu suchen. Dann Haustauben,
die zutraulicher sind und sich mit dem zu Hause gereichten Futter
begnügen. Diese sind meist weiß, während die Feldtauben nirgends
weißes Gefieder haben. Es paaren sich auch beide Arten von Tauben
miteinander, wodurch eine dritte Sorte entsteht. Das Taubenhaus hat
eine gewölbte Decke, eine enge Tür und mit Netzwerk überzogene Fenster,
durch welche Licht einfällt, aber weder eine Schlange noch sonstiges
Ungeziefer eindringen kann. Die Innenwände macht man glatt, ebenso die
Außenwände, damit weder Mäuse noch Eidechsen hinein können; denn die
Tauben sind sehr furchtsamer[S. 370] Natur. Für jedes Paar wird eine besondere
Zelle hergestellt, inwendig drei Spannen breit und lang mit einem zwei
Spannen langen Brett am Eingang. Es muß reines Wasser ins Taubenhaus
fließen, das zum Trinken und Baden dient; denn diese Vögel sind sehr
reinlich. Auch muß der Taubenwärter das Haus in jedem Monat mehrmals
fegen. Der Taubenmist ist von großem Wert für die Landwirtschaft und
wird für den besten gehalten. Der Wärter muß auch die kranken Tauben
kurieren, die gestorbenen beseitigen und die zum Verkaufe passenden
jungen herausnehmen; dann muß er die Habichte wegfangen, indem er ein
Tier, nach welchem dieser Raubvogel zu stoßen pflegt, anbindet und
Leimruten so um dasselbe steckt, daß sie sich über ihm wölben.
Ihr Futter bekommen die Tauben in Trögen, welche im Innern des
Taubenhauses an den Wänden stehen und von außen durch Röhren gefüllt
werden. Sie fressen gern Hirse, Weizen, Gerste, Erbsen, Bohnen, Linsen.
Kauft man Tauben, so müssen sie das richtige Alter haben und die Zahl
der Männchen muß der der Weibchen gleich sein. Kein Tier übertrifft die
Taube an Fruchtbarkeit. Innerhalb 40 Tagen legt, brütet und erzieht
sie ihre Brut von jeweilen zwei Jungen, und das geht das ganze Jahr
hindurch. Wer junge Tauben zum Verkaufe mästet, sperrt sie ab, sobald
sie ganz befiedert sind, und stopft sie dann mit gekautem Weißbrot;
diese Fütterung geschieht im Sommer täglich drei-, im Winter nur
zweimal. Will man die Jungen im Neste von den Alten mästen lassen, so
zerbricht man ihnen die Beine und gibt reichliches Futter. Das Paar
alter, schöner Tauben kann in Rom gewöhnlich für 200 Sesterzien (= 30
Mark) verkauft werden; ein ganz ausgezeichnetes Paar kostet auch bis
1000 Sesterzien (= 150 Mark). Als neulich ein Kaufmann ein solches Paar
vom Ritter Lucius Axius kaufen wollte, antwortete dieser, sie wären
unter 400 Denaren (= 240 Mark) nicht feil.“
Sehr ausführlich schildert der ältere Plinius in seiner Naturgeschichte
die Haustaube und deren Lebensgewohnheiten. Am Schlusse seiner
Ausführungen sagt er: „Es gibt viele, die vor lauter Taubenliebhaberei
wie verrückt sind. Sie erbauen ihnen Türme auf ihren Dächern und
wissen von einer jeden nachzuweisen, woher sie stammt und wie edel
ihre Abkunft ist. Schon vor dem pompejanischen Bürgerkriege (49 und 48
v. Chr.) verkaufte der römische Ritter Lucius Axius einzelne Paare,
wie Varro erzählt, für 400 Denare (= 240 Mark). In Kampanien sind sie
vorzüglich groß, und dieses Land ist in dieser[S. 371] Hinsicht berühmt. Die
Tauben sind auch schon in wichtigen Angelegenheiten als Botschafter
gebraucht worden, wie denn z. B. Decimus Brutus, als er in Mutina (dem
heutigen Modena) belagert wurde, ihnen Briefe an den Beinen befestigte
und sie ins Lager der Konsuln schickte. Was konnte da dem Antonius
sein Wall, seine Wachsamkeit, der durch Netze gesperrte Fluß helfen,
da der Bote durch die Luft flog?“ Übrigens sei hier bemerkt, daß man
im Altertum gelegentlich auch Schwalben statt wie hier Haustauben
zu raschen Überbringerinnen von Botschaften auf große Entfernungen
benutzte. So schreibt der ältere Plinius in seiner Naturgeschichte:
„Cäcinna, ein Ritter aus Volaterra, der zu öffentlichen Wettrennen
bestimmte Wagen besaß, pflegte Schwalben mit nach Rom zu nehmen,
bestrich sie, wenn er gesiegt hatte, mit der Farbe des Sieges (rot),
ließ sie fliegen und sie überbrachten, indem sie ihrem Neste zueilten,
bald seinen Freunden die Botschaft. Auch erzählt Fabius Pictor in
seinen Jahrbüchern, daß man, als eine römische Besatzung von den
Ligustinern belagert wurde, ihm eine von den Jungen genommene Schwalbe
zuschickte, damit er ein Fädchen an ihre Füße binden und durch Knoten
die Zahl der Tage angeben könne, nach deren Verlauf er zum Entsatze da
sein würde. Die Besatzung sollte dann einen Ausfall machen.“
Auch allerlei Aberglauben knüpfte sich bei den Römern an die Taube, wie
an zahlreiche andere Vögel; so berichtet Dio Cassius: „Dem Macrinus
wurde der Verlust der Schlacht und sein darauf erfolgender Tod dadurch
prophezeit, daß, während sein erster Brief, worin er verkündete,
Kaiser geworden zu sein, im Senat vorgelesen wurde, eine Taube sich
auf seine Bildsäule, die in dem Versammlungssaale stand, niederließ.“
Als großer Tierfreund hat besonders der Vetter, Adoptivsohn und
Nachfolger des Heliogabalus, einer der besten Fürsten seiner Zeit,
Alexander Severus, der 222 14jährig die Regierung antrat, 231 siegreich
gegen den Perserkönig Artaxerxes focht und 235 unweit von Mainz von
aufrührerischen Soldaten ermordet wurde, große Geflügelhöfe und
Tausende von Tauben gehalten. So berichtet der Geschichtschreiber Älius
Lampridius von ihm: „Nach Heliogabals Tod übernahm ein herrlicher
Mann, Alexander Severus, die Regierung des Römischen Reichs. Dieser
duldete während der Mahlzeit die bei den Römern üblichen Unterhaltungen
durchaus nicht, sondern hatte Spaß daran, wie kleine Hündchen und
Kätzchen mit Spanferkelchen spielten und Vögel um ihn herumflogen.
Überhaupt waren die Vögel seine Hauptfreude. Er hatte eigene Anstalten
für Pfauen, Fasanen, Haus[S. 372]hühner, Enten, Rebhühner, die größten aber
für Tauben, deren er 20000 gehabt haben soll. Um nun dem Staate nicht
durch die Fütterung der ungeheuren Menge von Geflügel lästig zu fallen,
mußten seine Angestellten die Eier, die Küchlein, die jungen Tauben
verkaufen und von dem daraus gelösten Gelde das Futter kaufen.“
Aus diesen Stellen kann man entnehmen, wie populär auch bei den Römern
der späteren Kaiserzeit die Taubenzucht war. Noch ums Jahr 400 n. Chr.
spricht Palladius von Taubentürmen, die man auf dem Herrenhause baue
und so einrichte, daß alle Nester inwendig seien. Dabei müßten alle
Eingänge so klein sein, daß sich kein Raubvogel hineinwage. Dabei
weiß er noch allerlei von uns allerdings sehr skeptisch aufgenommene
Ratschläge zu erteilen, so sagt er: „Um die Tauben vor Wieseln zu
sichern, wirft ein Mann ganz heimlich, ohne daß es jemand sieht,
einen blattlosen Dornbusch oder einen Haufen altes Spartgras in das
Taubenhaus. Um sie vor dem Tode zu schützen und damit sie nicht in
andere Taubenschläge übersiedeln, hängt man in alle Eingänge etwas von
dem Strick, mit dem ein Mensch gehängt wurde. Die Tauben bringen sogar
noch fremde mit, wenn man sie fleißig mit Kümmel füttert.“ Heute rät
man zu letzterem Zwecke Anisöl in die Taubenschläge zu bringen, für das
die Tauben tatsächlich eine große Vorliebe hegen.
Auch bei den Römern, die als Realisten sich nicht scheuten, die Tauben
trotz ihrer althergebrachten Heiligkeit zu verspeisen, waren sie der
Liebesgöttin Venus geweiht. Man dachte sich ihren Wagen von weißen
Tauben gezogen, wie schon die Griechen erzählten. Es sei hier nur
an die Ode an Aphrodite erinnert, die die berühmteste Dichterin des
Altertums, die aus vornehmem lesbischem Geschlechte stammende Sappho zu
Beginn des 6. vorchristlichen Jahrhunderts verfaßte und die in Geibels
Nachdichtung folgendermaßen beginnt:
„Die du thronst auf Blumen, o schaumgeborene,
Tochter Zeus, listsinnende, hör mich rufen,
Nicht in Schmerz und bitterer Qual, o Göttin,
Laß mich erliegen.
Sondern huldvoll neige dich mir, wenn jemals
Du mein Flehn willfährigen Ohrs vernommen,
Wenn du je, zur Hilfe bereit, des Vaters
Halle verlassen.
[S. 373]
Raschen Flugs auf goldenem Wagen zog dich
Durch die Luft dein Taubengespann, und abwärts
Floß von ihm der Fittiche Schatten dunkelnd
Über den Erdgrund.
So dem Blitz gleich stiegst du herab und fragtest,
Sel’ge, mit unsterblichem Antlitz lächelnd:
‚Welch ein Gram verzehrt dir das Herz, warum doch
Riefst du mich, Sappho?‘“
Wie bei den Griechen diente auch bei den ihnen so vieles entlehnenden
Römern der Name Taube, wie Spätzchen und Häschen, als Kosewort;
so heißt es bei Plautus u. a.: mea columba. Eine besondere
Rolle spielte dann die Taube in der christlichen Kirche. Man findet
sie in den ältesten christlichen Katakomben Roms häufig abgebildet.
Als reiner, frommer Vogel diente sie früh als Ausdruck der neuen
Religion und der damit verbundenen Seelenstimmung, und man glaubte,
daß beim Tode des Gläubigen sich dessen Seele als Taube zum Himmel
hinaufschwinge, wie einst in ihrer Gestalt der heilige Geist auf die
Erde herniederkam. Als der Frankenkönig Chlodwig im Jahre 496 nach
Besiegung der Alamannen mit 3000 Franken in Reims zum Christentum
übertrat und sich taufen ließ, brachte eine Taube dem Bischof Remigius,
wie Hinkmar im Leben des Heiligen erzählt, das Ölfläschchen zu dessen
Salbung vom Himmel herab. Seit der Zeit der Kirchenväter herrschte ein
allgemeiner Glaube in der Christenheit, daß die Taube keine Galle habe
und deshalb so sanft und ohne Falsch sei; daher kommt es, daß schon der
St. Galler Mönch Ekkehard in seinen Benediktionen, den Tischgebeten,
den heiligen Geist bittet, sein Tier, die „Taube ohne Galle“ für das
Verspeisen zu segnen. Gleicherweise preist Walter von der Vogelweide
die schöne, sanfte Griechin Irene von Byzanz, die Gemahlin des am 21.
Juni 1208 von Otto von Wittelsbach in Bamberg ermordeten deutschen
Königs Philipp von Schwaben, als ein rôs âne dorn, ein tûbe sunder
gallen.
Wie der Papst besonders verdienten Christen die goldene Tugendrose
verschenkte, so verlieh er ihnen auch als Auszeichnung gelegentlich
das Bild der Taube, das Symbol des heiligen Geistes. Den Germanen war
einst, wie allen Indogermanen, die graue wilde Taube ein düsteres
Geschick und den Tod ansagender Vogel. Nicht anders war es bei den
Römern, bei denen, wie wir sahen, durch das Herbeifliegen[S. 374] einer
Haustaube der bevorstehende Tod des Kaisers Macrinus angekündigt
worden sein soll. Ihr trat nun, wie dem Heidentum das Christentum, die
anmutige und zärtliche, zutraulich mit dem Menschen lebende und aus
seiner Hand das Futter nehmende weiße, fremdländische Taube gegenüber,
in deren Gestalt der heilige Geist auf die Erde gekommen sein sollte.
Schon letztere Tatsache gab ihr einen Heiligenschein und machte sie
in Anknüpfung an altorientalische Vorstellungen zu einem Gegenstand
religiöser Verehrung. So werden in Moskau und den übrigen Städten
des weiten Rußland Scharen von meist weißen Tauben von den Gläubigen
unterhalten und ernährt, und einen der heiligen Vögel zu töten, zu
rupfen und zu essen wäre eine große Sünde und würde dem Täter übel
bekommen — ganz wie einst zur Zeit Xenophons und Philos in Hierapolis
und Askalon. Noch heute wohnen auf den Kuppeln der Markuskirche und auf
dem Dache des Dogenpalastes im halbgriechischen Venedig Schwärme von
Tauben, die, von niemandem beunruhigt, auf dem Markusplatz ihr Wesen
treiben und zur bestimmten Stunde auf öffentliche Kosten ihr Futter
gestreut erhalten.
In den beiden letztgenannten Städten sind schon bedeutende
orientalische Einflüsse bemerkbar. Im heutigen, mohammedanischen
Morgenland hat die Taube durch die Jahrhunderte den Stempel der
Heiligkeit bewahrt und wird als Gegenstand religiöser Verehrung in
halbwildem Zustande um die Moscheen gehalten. Schon im frühen Altertum
geschah dies, wie wir sahen, in den Tempeln der Liebesgöttin. Aber auch
sonst stand die Taube in einem gewissen Verhältnisse zum Menschen.
Wie in der Genesis erscheint im altbabylonischen Sintflutbericht
die Taube (samâmu-summatu) neben dem Raben als Sendling
Schamaschnapischtims, des babylonischen Noah, um das nächste Land
auszukundschaften. Auf solche Weise haben auch die alten Phönikier und
Griechen, wenn sie sich ausnahmsweise einmal aus der Sehweite der Küste
entfernten, durch das Aussenden von Tauben das nächste Land erkundet,
wie dies die nordischen Wikinge mit gefangen gehaltenen Raben machten.
Auch anderwärts wird die Taube in Keilinschriften erwähnt; so heißt es
auf einer Tontafel medizinischen Inhalts: „Die Krankheit des Kopfes
fliege davon, wie eine Taube in ihren Schlag.“
Wie in Mesopotamien und Syrien wurde auch im alten Ägypten die
Felsentaube als Haustier gehalten. Schon zur Zeit der ältesten
Dynastien finden wir sie, wie erwähnt, unter dem Hausgeflügel
abgebildet, doch trat ihre Zucht damals gegenüber derjenigen der dort[S. 375]
einheimischen Nilgans stark zurück. So ist auf einem Grabe eine vom
Menschen gefütterte Schar Tauben dargestellt. Auf einem andern heißt
es zwar: „Die Taube holt sich Futter“, während daneben steht: „Die
Gans wird gefüttert“ und „die Ente erhält zu Fressen.“ Mit dieser
sich selbst das Futter holenden Taube ist sehr gut die Feldtaube
charakterisiert, die heute noch im Niltale, wie im Morgenlande
überhaupt, in halbwildem Zustande auf alten ruhigen Gebäuden, Tempeln
und in für sie errichteten Türmen gehalten wird. Zum Nisten dienen ihr
hoch übereinandergeschichtete eiförmige Töpfe, die mit Nilschlamm oder
Mörtel miteinander verbunden wurden. Jeder Topf ist an dem nach außen
gekehrten Ende etwas durchbrochen, um Luft und Licht durchzulassen. Der
Eingang für die Taube befindet sich aber an der innern Seite. Von hier
aus wird auch alljährlich der angesammelte Mist als das einzige von den
Tieren Benutzte zusammengekratzt, um als wertvoller Dünger besonders
für die Melonenkulturen verwendet zu werden. Dieser Taubendünger ist
für den Orientalen deshalb so wertvoll, weil in dem holzarmen Lande
der Mist der pflanzenfressenden Haustiere als Brennmaterial benutzt
wird. Der verstorbene Ägyptologe Brugsch Pascha berichtet von seiner
Reise nach Persien, daß die berühmten Melonen von Isfahan in Persien
wesentlich dem reichlichen Taubendünger, den sie erhalten, ihre
Vorzüglichkeit verdanken. Schon im Altertume gab es übrigens da, wo wir
solchen noch heute begegnen, derartige Taubentürme. So werden sie schon
im Alten Testament bei Pseudo-Jesaias 60, 8 erwähnt, der sagt: „Wer
sind die, welche fliegen wie die Wolken und wie die Tauben in ihren
Wohnkammern?“ Auch auf der späteren Königsburg in Jerusalem, die im
Jahre 70 n. Chr. im allgemeinen Brande unterging, waren nach Josephus
„viele Türme mit zahmen Tauben.“
Nach der Sage wurde die Taube für die Mohammedaner deshalb ein heiliger
Vogel, weil eine solche, die sich durch seinen Eintritt in die Höhle,
in der sie brütete, nicht stören ließ, den Propheten Mohammed auf
seiner Flucht vor der Gefangennahme durch die ausgesandten Häscher
schützte. Deshalb wird sie überall in der mohammedanischen Welt in
halber Wildheit gehalten, ohne irgend welchen Nutzen aus ihr zu ziehen.
Einzig ihr Mist wird, wie oben gesagt, als Düngmittel verwendet.
Von den ebenfalls halbwilden, auf öffentliche Kosten oder von den
Gläubigen ernährten Tauben des Kreml in Moskau und der Markuskirche
in Venedig wird nicht einmal dieser verwendet. Ebenso ist es in den
mohammedanischen Moscheen und in den siamesischen[S. 376] Pagoden. „Taube der
Moschee“ zu heißen, ist ein lobendes Prädikat für einen frommen Moslem.
In Indien und China hat sich ohne allen europäischen Einfluß schon
in alter Zeit eine namhafte Taubenliebhaberei entwickelt, die früh
zur Züchtung verschiedener Kulturrassen führte. So wird vom mächtigen
Eroberer mohammedanischen Glaubens, dem Großmogul Akbar dem Großen,
der von 1556 bis 1605 regierte, berichtet, daß er sich persönlich mit
ihrer Zucht abgab und an seinem Hofe über 20000 Tauben hielt. Um seine
Arten zu vermehren, ließ er sich von den Herrschern in Iran und Turan
seltene Rassen senden. So besaß er schließlich bereits 17 verschiedene
Taubenrassen. In Syrien soll es heute noch mehr Taubenfreunde und
-Züchter geben als selbst in England, das in der Zucht dieses
Haustieres Großes geleistet hat. Auch die Chinesen haben Freude an
der Taube und halten sie gern. Dabei schützen sie ihre Taubenschwärme
durch das Anbringen kleiner Pfeifen aus Bambus, die dann beim Fliegen
durch schwirrende Töne die Raubvögel abhalten sollen. Dieser Gebrauch
ist auch bei den Japanern üblich, die dieses Haustier, wie so vieles
andere, von den Chinesen übernahmen.
Während auch die Ostasiaten als Feinschmecker junge Tauben gern essen,
tun dies die christlichen Abessinier nicht aus religiöser Scheu, da
die Taube als Sinnbild des heiligen Geistes bei ihnen als heiliges
Tier gilt. Man findet sie deshalb in jenem Lande häufig in der noch
dort geübten byzantinischen Kunst abgebildet. Die abessinischen Juden
müssen für ihre vorgeschriebenen Opfer wilde Tauben fangen, wie das
in der älteren Zeit im Judentum auch bei den Turteltauben der Fall
war. Auch in den Haussaländern ist sie geschützt wie in allen dem
Islam huldigenden Ländern. Durch die Araber wurde sie dann den Negern
Ostafrikas gebracht, die sie teilweise willig annahmen. So werden sie
in Unjamwesi in großen Schlägen aus Rindenschachteln gehalten, worunter
auch viele weiße. Bis zum Jahre 1883 hatten sie sich bis in das Herz
des schwarzen Kontinents, zum Flusse Lulua, verbreitet.
Mit den Europäern gelangte die Taube natürlich auch nach Amerika und
Australien, wo sie vollständig eingebürgert wurde. An zahllosen Stellen
ist die Taube verwildert und hat mehr oder weniger die Färbung ihrer
wilden Vorfahren angenommen, so besonders in den Mittelmeerländern
und auf vielen ozeanischen Inseln. Auf den Azoren flossen bei den
verwilderten Tauben die weißen Flügelbinden zusammen. Das gab den
Ornithologen Gelegenheit, eine neue Unter[S. 377]art aufzustellen, wie deren
durch künstliche Auslese und zielbewußte Zucht zahlreiche durch den
Menschen willkürlich geschaffen wurden.
Schon im Altertum entstanden die Stammformen der meisten heutigen
Taubenrassen im Morgenlande, um dann nach dem Abendlande verbreitet zu
werden. So war schon im Mittelalter die Zahl der in Europa bekannten
Taubenrassen beträchtlich. Man züchtete damals bereits in den
Niederlanden eigene Rassen, zu denen durch die Einfuhr aus dem Orient
stets neue hinzukamen. Von den Niederlanden, die im 15. Jahrhundert
das kultivierteste Volk Mitteleuropas besaßen, verbreitete sich die
Taubenzucht im 16. Jahrhundert über Deutschland, England, Frankreich
und die diesen benachbarten Länder. Schon vor dem Jahre 1600 waren
die Hauptrassen unserer Haustaube vorhanden; seither gingen einzelne
wieder verloren, während andere eine Umbildung erfuhren. In seiner
Ornithologie führt der Italiener Ulysses Aldrovandi die um 1600 in
Europa gezüchteten Taubenrassen auf, die damals immer noch vorzugsweise
in den Niederlanden gezüchtet wurden. Es gab dort besondere Vereine von
Taubenzüchtern, die Anregungen in diesem Wirtschaftszweige zu geben
bestrebt waren. Trotz der einheimischen Zucht hat aber die Einführung
orientalischer Taubenrassen noch nicht aufgehört; denn wie früher ist
noch immer das Morgenland das Hauptzuchtgebiet der Taube.
Von der in Westasien zuerst gezähmten Felsentaube sind so zahlreiche
Rassen hervorgegangen, daß es schwer hält, sie alle einzureihen. Der
wilden Stammform am nächsten stehen die im wesentlichen nur durch ihre
Färbung und Zeichnung von ihr verschiedenen Feldtauben, deren
Hauptverbreitungsgebiet das westliche Europa ist. Sie haben in ihrer
Lebensweise eine gewisse Unabhängigkeit bewahrt, indem sie von ihrem
Nistplatze aus aufs Feld fliegen, um ihr Futter selbst zu suchen. Nur
im Winter werden sie gefüttert. In der Regel sind sie glattköpfig,
d. h. ohne Haube, und ohne Federhosen an den Beinen. Als Nutzvögel stehen
sie wegen ihrem Fleischwert obenan.
An die Feldtauben schließen sich die zahlreichen Spiel- oder
Farbentauben an, die durch eigenartige Färbungen und Zeichnungen
von konstantem Charakter ausgezeichnet sind. Die meisten von ihnen
gehen wie die Feldtauben aufs Feld; doch ist ihre Abhängigkeit vom
Menschen größer. Man unterscheidet bei ihnen Lerchen-, Star- und
Storchtauben, Schwalben- und Gimpeltauben, Weißschwänze, Weißschläge,
Farbenbrüster, Latztauben, Mohren- und andere Farbenköpfe. Die in
mehreren Farbenvarietäten auftretende Eistaube besitzt[S. 378] ein wie
bereift erscheinendes hell lichtblaues Gefieder. Die gelbliche bis
bräunlichrote Mondtaube ist durch eine halbmondförmige Zeichnung auf
der Brust charakterisiert. Nahe mit ihr verwandt ist die fahlgelbe Elbe
oder Schweizertaube. Die Maskentaube ist ganz weiß mit dunklem Schwanz
und halbmaskenartigem Stirnfleck. Dabei ist der Kopf glatt oder mit
Haube versehen, die Beine sind glatt oder befiedert.
Die Trommeltauben weichen im Äußeren nicht auffallend von
den Feldtauben ab, sie zeichnen sich aber durch ihre Stimme aus,
die kein abgesetztes Rucksen, wie die anderer Tauben, sondern ein
fortgesetztes Fortrollen ist, wobei das stillsitzende Tier den Kropf
etwas aufbläht und mit den Flügeln zittert. Manche Trommeltauben sind
am Kopf mit einer Haube und an der Schnabelbasis mit einer Federnelke
geziert. Die Füße sind glatt oder befiedert. Die Färbung ist sehr
verschieden. Häufig erscheint die Zeichnung gescheckt, auch blau,
wie bei der Altenburger Trommeltaube, die besonders in Sachsen sehr
beliebt ist. Als der beste Trommler gilt die etwas schwerfällig gebaute
russische Trommeltaube, die meist einfarbig schwarz mit stahlblauem,
bronzeschimmerndem Halse ist und am großen Kopf Muschelhaube und
Federnelke trägt, welch letztere Augen und Schnabel bedeckt.
Bei den Lockentauben erscheint das Gefieder gelockt oder
struppig. Das Gefieder ist weich und flaumig und die Deckfedern sind
nicht abgerundet, sondern in eine Spitze auslaufend, welche zu einer
Locke umgebogen ist. Das Gefieder ist blau bis fahlrot; der Kopf bald
glatt, bald mit Haube versehen und die Beine nackt oder befiedert. Am
stärksten gelockt ist die österreichische Lockentaube. Weniger hoch
sind die Locken bei der holländischen Lockentaube, die fast stets eine
Muschelhaube besitzt.
Die Perückentauben sind Tauben mit kurzem, kleinem Kopf, flacher
Stirn und eigentümlicher Perücke oder Kapuze, die in der Weise zustande
kommt, daß die verlängerten Federn unten am Hals regelmäßig gescheitelt
sind, so daß ein Teil die Schultern bedeckt, die Hauptmasse aber sich
nach vorn und oben richtet, so daß sie den Kopf hinten vollständig
umschließen. Diese Perücke ist eine übermäßige Weiterentwicklung
der Kopfhaube, die wir bei vielen Formen antreffen. Sie sind teils
einfarbig blau oder weiß, teils „gemöncht“, indem aus der roten,
gelben oder schwarzen Grundfarbe der weiße Kopf hervorsticht. Flügel
und Schwanz weisen ebenfalls weiße Federn auf. Im allgemeinen sind
die Vertreter dieser Rasse durch die gesättigten Töne[S. 379] der Grundfarbe
bemerkenswert. Das Wesen dieser Vögel ist auffallend ruhig; sie fliegen
nur wenig umher.
Eine kleine, zierliche Rasse, die bei den Taubenliebhabern stark
bevorzugt wird und ein sehr weites Verbreitungsgebiet besitzt, sind
die Mövchen. Der kleine Kopf mit kurzem Schnabel ist bald
glatt, bald behaubt. Vom Kinn verläuft ein faltiger Kehlsack gegen die
Brust und der Vorderhals ist mit strahlig angeordneten, abstehenden
Federn verziert. Von den zahlreichen Varietäten sind hervorzuheben:
das deutsche Schildmövchen mit spitzer Haube, Schildzeichnung und
etwas schleppenden Flügeln, dann die durch schöne Haltung, gewölbte
Brust, hohe Beine und etwas aufgerichteten Schwanz ausgezeichneten
italienischen Mövchen. Die milchblaue Varietät derselben gilt als
besonders schön. Sehr geschätzt sind neben den ägyptischen auch
die chinesischen Mövchen, die um die Mitte des 19. Jahrhunderts in
Europa eingeführt wurden, deren eigentliche Heimat aber nicht sicher
ermittelt werden konnte, jedenfalls aber irgendwo in Asien zu suchen
ist. Hals und Brust tragen bei dieser Spielart eine sehr umfangreiche
Federrosette; außerdem ist oben am Hals noch eine deutliche Krawatte,
welche den Kopf umgibt. Die kurzschnäbligen und mit befiederten Füßen
versehenen Satinetten oder Atlasmövchen besitzen eine weiße Grundfarbe
mit braunroten, schwarz umsäumten Flügeldeckfedern. Sie gehören mit zu
den schönsten Tauben und sollen aus dem Orient stammen.
Eine ebenfalls alte Rasse von offenbar ostasiatischer Abstammung
sind die nach ihrem pfauenartig aufgerichteten Schwanz so genannten
Pfauentauben, die schon vor dem Jahre 1600 in Indien gehalten
wurden. Während normalerweise die Zahl der Schwanzfedern bei der
Taube 12 beträgt, ist sie bei den heute noch in Asien gezüchteten
Pfauentauben auf 14 bis 24, bei den in Europa gezüchteten jedoch auf 28
bis 40 gesteigert worden. Diese sind breit, am Bürzel in 2 bis 3 Reihen
angeordnet und werden fächerförmig aufgerichtet getragen, während die
Flügel hängen, so daß sie unter den Schwanz zu liegen kommen, ohne
sich zu kreuzen. Der lange Hals ist gebogen, so daß der Kopf weit nach
hinten zu liegen kommt. Das Gefieder ist verschieden gefärbt, häufig
einfarbig blau, weiß oder schwarz.
Die auffallende Gestalt schätzt man an den Kropf- und Huhntauben. Die
Kropftauben haben einen gestreckten Körper mit langen Federn
meist auch an den Beinen und Füßen. Sie sind durch die Fähigkeit
ausgezeichnet, den Schlund enorm aufzublasen und ihn be[S. 380]liebig lange in
diesem Zustande erhalten zu können. Auch sie sind offenbar aus Asien
zu uns gelangt, sind aber schon lange in Europa eingebürgert, da sie
bereits Aldrovandi im Jahre 1600 erwähnt. Als Stammform der besonders
in Zentraleuropa und in den Küstenländern der Nord- und Ostsee, nicht
aber in den Mittelmeerländern stark verbreiteten Kropftauben gilt die
deutsche Kropftaube, die eine bedeutende Körpergröße erlangt und deren
Kropf beständig sehr stark aufgeblasen ist. Die hauptsächlich in der
Normandie, dann auch im übrigen Nordfrankreich gehaltene französische
Kropftaube hat einen fast kugeligen, vom Rumpf abgesetzten Kropf und
lange Beine. Ihr Gefieder ist häufig einfarbig weiß, blau oder gelb,
auch fahlrot mit braunen Binden. Dagegen niedriggestellt in den Beinen
und überhaupt zwergartig ist die holländische Ballonkropftaube, deren
Kopf wie bei den Pfauentauben zurückgebogen ist. Deren ballonartiger
Kropf nimmt im aufgeblasenen Zustande die Hälfte der Taube ein. In der
äußeren Haltung und Bewegung dem Huhn ähnlich, auch durch bedeutende
Größe ausgezeichnet, sind die Huhntauben. Am gedrungenen, vorn
gerundeten Rumpf mit kurzen Flügeln und kleinem, aufrecht getragenem
Schwanz sitzt auf langem, kräftigem, gebogenem Hals der stets
unbehaubte Kopf mit kurzem Schnabel. Ihr Steiß ist dicht mit Flaum
besetzt. Diese Taubenart ist der Pfauentaube nahe verwandt und stammt
vermutlich wie die letztere aus Ostasien. Eine typische Rasse ist die
Maltesertaube, die in Vorderindien stark gezüchtet wird und dort
heimisch ist, vermutlich aber über Malta zu uns gelangte. Ihre äußere
Erscheinung ist etwas vierschrötig, die Brust voll und der sehr kurze
Schwanz steil aufgerichtet. Ihr nahe verwandt ist der Epaulettenscheck,
ebenfalls ein Produkt südasiatischer Zucht, das ziemlich früh nach
Europa gelangte. In Italien wurde sie unter dem Namen Tronfo bekannt.
Sie trägt meist dunkles Gefieder mit weißer Zeichnung an Kopf und
Flügeln.
Ebenfalls südasiatischer Herkunft sind die Tümmler- oder
Purzlertauben, so genannt, weil sie die seltsame Gewohnheit
angenommen haben, sich während des Fluges durch die Luft rückwärts zu
überschlagen. Daneben gibt es auch solche Typen, die auf dem Boden
purzeln. Ein guter Tümmler überschlägt sich schon beim Aufsteigen und
führt seine eigentümliche Bewegung in der Weise aus, daß er die Flügel
über dem Rücken zusammenschlägt, sich rückwärts überwirft und dann
mit einem kräftigen Flügelschlag wieder in die frühere Flugrichtung
einlenkt. Auch beim Kreisen wird das Purzeln aus[S. 381]geführt, doch zeigt
der Vogel seine Kunst nur bei Wohlbefinden. In der Mauser oder in
entkräftetem Zustande versagt er, ebenso an fremdem Ort, bis er sich
genügend eingelebt hat. Ganz gute Vögel tümmeln zwei- bis dreimal
in rascher Aufeinanderfolge. Meist sind die Tümmler von geringer
Körpergröße mit kleinem, zierlichem Kopf und langem, mittellangem
oder kurzem Kopf und befiederten oder glatten Füßen. Hinsichtlich der
Zeichnung sind Weißschwanz-, Elster- und Scheckzeichnung häufiger
als bei anderen Rassen. Von charakteristischen Tümmlern mögen die
gehaubten Kalotten und Nönnchen, die preußischen Weißkopftümmler, die
Kopenhagener Elstern, die englischen Baldheads, die kurzschnäbeligen
Barttümmler und die Königsberger Mohrenkopftümmler hervorgehoben werden.
Die Warzentauben sind kräftig gebaute, meist einfarbige Tauben
mit einer warzenartigen Wucherung an der Schnabelbasis und oft auch
noch am Augenring. Der Kopf ist in der Regel ohne Haube, die Füße sind
glatt, die Farben gesättigt, doch die Neigung zu Gefiederzeichnung
gering. Die Rasse stammt aus dem Orient und die einzelnen Schläge
werden häufig unter dem Sammelnamen „türkische Tauben“ zusammengefaßt.
Sie heißen auch Bagdette, weil sie in Bagdad zuerst gezüchtet worden
sein sollen oder wenigstens von dort zu uns kamen. Von den bekannteren
Schlägen ist zunächst die französische Bagdette zu nennen. Bei ihr
ist der gedrungene Körper mit knapp anliegendem blauem, weißem oder
geschecktem Gefieder bedeckt. Die Haltung ist aufrecht. Der starke
Schnabel ist etwas gekrümmt, die rosenrote Schnabelwarze ist sehr
umfangreich. Die kräftigen Beine sind karminrot. Trotz dem Namen
wird diese Rasse in Frankreich selten gehalten. Auch die Nürnberger
Bagdette ist wenig verbreitet. Der glatte Kopf trägt einen langen,
stark gekrümmten Schnabel, an dessen Basis ein mäßig umfangreicher
Warzenhöcker sitzt. Zu den geschätztesten englischen Zuchttauben gehört
die englische Bagdette oder Carrier. Die Stammrasse ist im Orient weit
verbreitet und wurde vor etwa 200 Jahren in Europa importiert und von
englischen Züchtern veredelt. Die Färbung ist schwarz, braun, blau oder
weiß, der Schnabel lang und gerade, die Schnabelwarze enorm, bis zur
Größe einer Walnuß entwickelt, daneben sind die warzigen Augenringe
sehr umfangreich. Die Indianer- oder Berbertaube ist schwarz, braun
oder gelb, selten blau befiedert, der Schnabel kurz, das große Auge mit
weißer Iris von einem mächtigen, rotgefärbten Warzenring umgeben. Auch
sie stammt aus dem Orient und wurde von Nordafrika aus nach England,
Holland und Deutsch[S. 382]land eingeführt. Durch Pinselhaare am Hals ist
die in Italien stark verbreitete römische Taube ausgezeichnet. Diese
wird wegen ihrer bedeutenden Größe auch Riesentaube genannt. Zu dieser
Gruppe gehören auch die Korallenaugen, die Syrier, Kurdistaner und
andere, deren Name schon auf die orientalische Herkunft hinweist.
Ebenfalls aus dem Morgenlande wurden die Brieftauben
bei uns eingeführt, die triebartig stets zu ihrem heimatlichen
Schlage zurückkehrt und denselben auch dank ihrem hochentwickelten
Orientierungsvermögen auf sehr große Entfernungen hin mit Sicherheit
findet, wobei sie per Minute einen Kilometer zurücklegt. Selbst
längere Internierung an einem fremden Orte schränkt ihren Heimatstrieb
nicht ein; so vermag sie selbst nach sechs Monaten wieder ihren
heimatlichen Schlag zu finden. Diese Eigenschaft, die durch ihre
außerordentlich scharfen Sinne bedingt wird, hat ihr eine wichtige
Rolle im Kriegsdienst gesichert, weil sie, wenigstens vor der Zeit
der drahtlosen Telegraphie, oft das einzige Mittel zur Besorgung des
Nachrichtendienstes bot. Auch von der hohen See aus kann sie Meldungen
nach dem Lande überbringen. In wichtigen Fällen wird man, wenn sie
zum Depeschendienst verwendet wird, mehrere Brieftauben mit denselben
Nachrichten, die man in leichten Federspulen an der Schwanzbasis
befestigt, absenden, da Raubvögel gelegentlich solche Tauben wegfangen
und man so sicherer ist, seinen Zweck zu erreichen. Neuerdings hat
man sie auch zu photographischen Aufnahmen des feindlichen Geländes
benutzt, indem man ihr einen leichten Photographenapparat mit
selbsttätigem Belichter um die Brust hing. Von den in Europa weiter
gezüchteten Schlägen sind am bekanntesten und geschätztesten die
Antwerpener, Lütticher und Brüsseler Brieftaube. Ihr Gefieder ist
vorwiegend blau mit dunkeln Flügelbinden.
Außer der Felsentaube ist nur noch eine Taubenart, eine
Lachtaube (Columba risoria), ebenfalls in Asien zu einem
Hausvogel erhoben worden. Indessen gibt es außer den Hauslachtauben,
die den wilden Lachtauben sehr ähneln und die große Mehrzahl bilden,
nur noch weiße Lachtauben; aber auch sie tragen das schwarze Genickband
des wilden Stammes. Der Leucismus dieser Vögel beweist, daß sie
schon längere Zeit in des Menschen Pflege sein müssen. Erst im 17.
Jahrhundert kamen sie aus China oder Indien nach Europa, wo sie jedoch
nur beschränkte Verbreitung fanden. In ihrer Heimat Asien aber scheinen
sie ihres angenehmen Wesens wegen vielerorts gezüchtet zu werden. Der
Lieblingsaufenthalt dieser Vögel sind dürre[S. 383] Steppen, in denen sie ihr
Lachen und Girren aus fast jedem Busche hören lassen. Doch haben sie
sich trotz ihrer angeborenen Scheu teilweise auch schon an den Menschen
gewöhnt. So genießen Lachtauben in Konstantinopel das Privilegium, von
jeder Kornladung ihren Tribut in Anspruch nehmen zu dürfen.
Von den übrigen Taubenarten ist keine einzige in Abhängigkeit vom
Menschen geraten. Zwar haben schon die alten Römer wilde Ringel- und
Turteltauben gefangen und gemästet, um sie als leckeren Braten zu
verzehren; aber zu Haustieren sind sie damals nicht erhoben worden.
Seit der ältesten Zeit haben die Dichter die durch Vorderasien und das
gemäßigte Europa verbreitete Turteltaube (Columba turtur)
wegen ihres klangvollen Rucksens und der ehelichen Zärtlichkeit, mit
der Männchen und Weibchen aneinander hängen, besungen. Weil sie auch
leicht zu fangen und in Gefangenschaft zu erhalten war, ist sie auch
zu allen Zeiten und überall vielfach gehalten worden; aber sie scheint
sich in der Gefangenschaft nicht fortgepflanzt zu haben, so daß sich
ihrer Haustierwerdung erhebliche Schwierigkeiten entgegenstellten. In
halber Freiheit aber pflanzt sie sich willig fort, und so haben sie
schon die alten Römer gehalten. So berichtet Varro in der ersten Hälfte
des letzten Jahrhunderts v. Chr.: „Für Turteltauben baut man auch ein
besonderes, demjenigen für Haustauben bestimmten ähnliches Gebäude,
gibt ihnen aber offene Nester und füttert sie mit trockenem Weizen. Sie
ziehen zur Erntezeit viele Junge und diese lassen sich schnell mästen.“
[S. 384]
XVIII. Die Sing- und
Ziervögel.
Ihres lieblichen Gesanges wegen hat der Mensch je und je Vögel seiner
Umgebung mit Schlingen oder in Fallen gefangen, um sie in kunstlos
aus Stäbchen geflochtenen Bauern in seiner Behausung aufzustellen,
damit sie ihn durch ihr munteres Wesen und ihr wohllautendes
Liebeswerben erfreuten. Von allen Finkenarten, die zu diesem
Zwecke am häufigsten in Gefangenschaft gehalten werden, ist nur der
Kanarienvogel (Serinus canarius) zu einem eigentlichen
Haustier geworden, indem er sich nicht nur regelmäßig in der
Gefangenschaft fortpflanzt, sondern auch verschiedene Spielarten
hervorgebracht hat. Seine Heimat sind, wie der Name schon andeutet,
die Kanarischen Inseln westlich von Afrika, wo diese unserm Girlitz am
nächsten verwandte Finkenart gezähmt und zum Haustier gemacht wurde.
Der auch in seiner Heimat von Spaniern und Portugiesen canario
genannte Vogel ist merklich kleiner und schlanker als derjenige, der
in Europa gezähmt gehalten wird, und kommt noch häufig in denjenigen
Teilen der Kanaren vor, die noch nicht ganz abgeholzt sind; denn
sein bevorzugter Standort sind Bäume, in deren Laub er sich vermöge
seiner Färbung geborgen weiß. Beim erwachsenen Männchen ist die Farbe
vorwiegend Gelbgrün untermischt mit Aschgrau, nur die Brust ist
nach hinten zu heller, gelblicher und der Bauch weißlich. Auch die
schwarzgrauen Schwanzfedern sind weißlich gesäumt. Der Augenring ist
dunkelbraun, Schnabel und Füße sind dagegen bräunlich fleischfarben.
Die Nahrung besteht fast ausschließlich aus Pflanzenstoffen, allerlei
Samen, zarten Blättern und saftigen Früchten, namentlich Feigen. Wasser
zum Trinken und Baden ist ihm unbedingtes Bedürfnis. Sein Flug gleicht
demjenigen des Hänflings. Er ist etwas wellenförmig und geht meist nur
von Baum zu Baum. Mit Vorliebe baut er sein Nest im März auf jungen
Bäumen in über 2 m Höhe, um darein fünf blaß meergrüne Eier mit
rötlichbraunen Flecken zu legen. Während das Weib[S. 385]chen brütet, sitzt
das Männchen in seiner Nähe, am liebsten hoch oben auf einem noch
unbelaubten Baum, um seinen von demjenigen des zahmen Kanarienvogels
wenig verschiedenen Gesang erschallen zu lassen. Die Brutzeit dauert
13 Tage; dabei werden drei bis vier Bruten jährlich großgezogen. Die
Jungen bleiben im Nest, bis sie vollständig befiedert sind und werden
noch eine Zeitlang nach dem Ausfliegen von beiden Eltern, namentlich
aber vom Vater, aufs sorgsamste aus dem Kropfe gefüttert.
Der Fang der wilden Kanarienvögel ist sehr leicht; besonders die jungen
gehen fast in jede Falle, sobald nur ein Lockvogel ihrer Art daneben
steht. Auf den Kanaren bedient man sich gewöhnlich zu ihrem Fange
eines Schlagbauers, der in der Mitte einen Käfig mit dem Lockvogel und
seitlich davon je eine Falle mit aufstellbarem Trittholz besitzt. Er
wird in baumreicher Gegend in der Nähe von Wasser aufgestellt und fängt
am ergiebigsten morgens. In der Gefangenschaft sind die Vögel unruhig
und brauchen längere Zeit, ehe sie die ihnen angeborene Wildheit
abgelegt haben. Sperrt man sie in engen Käfigen zu mehreren zusammen,
so zerstoßen sie sich leicht das Gefieder. Sie sind sehr gesellig und
schnäbeln sich gern untereinander. Die jungen Männchen geben sich
durch fortgesetztes lautes Zwitschern zu erkennen. Doch sind die Vögel
außerordentlich empfindlich und gehen leicht an Krämpfen ein.
Bald nach der Eroberung der Kanaren durch die Spanier im Jahre 1478
wurde der Kanarienvogel von den Siegern in großer Zahl nach ihrer
Heimat eingeführt. So war er in Spanien schon in der ersten Hälfte
des 16. Jahrhunderts ein beliebter Hausgenosse. Nach der Bezeichnung
Zuckerinseln, die man den Kanaren wegen des bald aus ihnen mit
ausgezeichnetem Erfolg betriebenen Anbaues von Zuckerrohr gab, hieß
der von dort kommende Vogel, den vermutlich bereits die dortigen
Ureinwohner, die Guanchen, gezähmt hatten, bei den Spaniern zunächst
„Zuckervogel“. Als solcher wird er 1555 zum erstenmal vom Züricher
Konrad Geßner, nicht aber vom Pariser Zoologen Pierre Bellon erwähnt.
Seiner Verbreitung nach Italien soll ein Schiffbruch bei der Insel
Elba Vorschub geleistet haben. Bis dahin hatten nämlich die Spanier
nur männliche Vögel ausgeführt, die sie in eigenen Zuchten zogen. Da
scheiterte um die Mitte des 17. Jahrhunderts ein spanisches Schiff bei
Elba mit einer Kanarienvogelhecke. Die Vögel entkamen, verwilderten auf
der Insel und bildeten so einen Stamm, von dem aus Europa mit Vögeln
versehen wurde, so daß[S. 386] das Monopol der Spanier aufhörte. Immerhin war
er dank seiner Seltenheit noch lange Zeit recht teuer, so daß sich
nur die besser Situierten diesen Fremdling aus dem warmen Süden, der
sich in Mitteleuropa recht wohlfühlte und gut gedieh, leisten konnten.
So ließen sich vornehme Damen gern mit diesem Vogel auf der Hand
abkonterfeien.
Selbstverständlich war dieser hübsche Singvogel sehr bald den Spaniern
in ihre neuweltlichen Kolonien gefolgt. So war er nach Garcilaso de
Vega schon 1556 in Kuzko, im Hochlande von Peru, und 1600 sogar in
Ostindien zu finden. In letzterem Lande mußte man den Käfig mit dem
Vogel über eine Schale mit Wasser setzen, um ihn vor den Angriffen der
Termiten zu schützen. Um die Mitte des 17. Jahrhunderts zog man den
Kanarienvogel schon recht häufig in Deutschland. Horst in Frankfurt am
Main berichtet 1669, daß man ihn gern mit dem Stieglitz kreuze. Dabei
lokalisierte sich die Zucht mehr und mehr auf bestimmte Gegenden.
War es zuerst Spanien, dann Italien gewesen, das die Kulturwelt mit
Kanarienvögeln versorgt hatte, so übernahm dieses Geschäft im 18.
Jahrhundert das tirolische Städtchen Imst, das von 1776 an einen regen
Handel damit nach den Kulturländern Mitteleuropas trieb. Im Jahre
1782 konnten beispielsweise von dort 1600 wertvolle Sänger allein
nach England exportiert werden, abgesehen von den zahlreichen andern,
die nach Deutschland, Rußland, Österreich und bis nach Konstantinopel
gingen. Erst im 19. Jahrhundert wurde diese blühende Zucht durch
diejenige im Harz verdrängt, die heute alle Welt mit ihren Zuchtvögeln
versorgt. Die besten Sänger kommen von Andreasberg und Zellerfeld,
die deren jährlich für etwa 280000 Mark exportieren. Dort werden in
fast allen Häusern als Nebenbeschäftigung Kanarienvögel gezüchtet und
zu Sängern ausgebildet, indem sie stets nur den Gesang der besten
Vorsänger zu hören bekommen. Alle minderwertigen oder fehlerhaften
Sänger werden außer Hörweite der jungen Zöglinge gehalten, so daß sie
deren Gesang nicht annehmen können, sondern sich ausschließlich an den
besten Vorbildern schulen. Ein guter Harzer Sänger ist mit dem dazu
gehörenden Weibchen nicht unter 80–120 Mark zu haben.
Nach Tirol beteiligten sich auch die lange von den Spaniern
beherrschten Niederlande am Handel mit Kanarienvögeln, und bereits
gegen das Ende des 16. Jahrhunderts wurde dort eine besondere bunte
Rasse gezogen, deren Aufzucht später auch in gewissen Bezirken Englands
aufkam. Von diesen „bunten“ Kanarienvögeln, die heute[S. 387] noch von
Holland, Belgien und England in den Handel gelangen, gilt ein Paar
120–160 Mark. Unter ihnen gibt es auch verschiedene barocke Formen,
bei denen die auf Kopf, Brust und Schultern befindlichen Federn zu
allerlei krausen Gebilden umgeändert wurden. Zoologisch variiert der
Kanarienvogel sonst hauptsächlich in der Größe, wenig in der Farbe. Bei
ihm ist das ursprünglich vorwiegend gelbgrüne bis braune Federkleid
durch Entfärbung statt weiß hell- bis dunkelgelb geworden. Schon
Isidore Geoffroy St. Hilaire sprach es 1757 aus, daß der Flavismus,
wie er sich ausdrückt, den Leucismus der ursprünglich grünlichen Vögel
bilde. Daneben gibt es auch bei ihm gelegentlich einen Albinismus mit
weißen Federn und roten Augen. Solche weiße Kanarienvögel erwähnt schon
Adanson aus Frankreich ums Jahr 1750; aber die Züchter ziehen sie nicht
auf, weil sie für die Zucht zu schwächlich sind. Außerdem gibt es auch
pigmentreiche schwarze Formen. Doch ist viel fremdes Blut in unsere
Kanarienstämme gekommen, da sie seit geraumer Zeit mit Stieglitz,
Zeisig und andern Finken, in Italien besonders mit dem Hänfling
gekreuzt wurden. Dabei sind die Bastarde meist fruchtbar. Heute ist
der Kanarienvogel als geschätzter Sänger und dabei leicht zu haltender
Stubenvogel über die ganze zivilisierte Welt verbreitet. Schon 1870 war
er auf dem chinesischen und bald nachher auch auf dem japanischen Markt
zu haben, obschon von jenen Völkern gern auch nicht minder lieblich
singende einheimische Finken in engen Vogelbauern zur Unterhaltung
gehalten werden.
Außer den Finken sind es besonders Drosseln, welche gern vom
Menschen in Gefangenschaft gehalten werden. Da sie, statt wie jene
Körnerfresser zu sein, Kerbtierfresser sind, war ihre Erhaltung in
der Obhut des Menschen bedeutend schwieriger, so daß es kein Wunder
ist, daß bis heute keine einzige Drosselart zum eigentlichen Haustier
erhoben wurde. Gleichwohl sollen sie hier eine kurze Würdigung
finden, da sie nicht bloß häufige Gesellschafter des Menschen sind,
sondern auch als Leckerbissen für ihn eine gewisse Rolle spielen. In
letzterer Beziehung ist besonders die Wacholderdrossel oder
der Krammets- (zusammengezogen aus Kranewits-) Vogel
(Turdus pilaris) wegen ihres Fleisches sehr geschätzt. Sie
hat ihren Namen von den Wacholder- oder Krammetsbeeren, die sie wie
die übrigen Drosseln gern frißt und wovon ihr Fleisch einen würzigen
Geschmack erhält. Sie ist ein echter Waldvogel und nistet nicht bloß
im höchsten Norden Europas und Asiens, sondern auch in gemäßigteren
Gegenden, wie[S. 388] Mitteleuropa. Den Winter über zieht sie wie die
übrigen Drosseln nach den Mittelmeerländern und Nordafrika. Sie war
es in erster Linie, welche die Römer unter dem Drosselnamen turdus
bezeichneten und gern aßen. So sagt der witzige Spötter Martial
(42–102 n. Chr.), der gern die Großen umschmeichelte, um von ihnen
zur Tafel geladen zu werden, in einem seiner Xenien, auf Deutsch
Gastgeschenke, d. h. Epigramme, die als Aufschriften zu den an den
Saturnalien verteilten Gastgeschenken gedacht waren: „Fette Drosseln
sind mir lieber als andere Leckerbissen.“ An einer anderen Stelle meint
er: „Ein Kranz von Drosseln gefällt mir besser als ein aus Rosen und
Narden geflochtener“, und fernerhin: „Unter den Vögeln gebührt der
Drossel, unter den vierfüßigen Tieren dem Hasen der Preis.“ Auch der
Feinschmecker Horaz (65–8 v. Chr.), der sich durch alle „Rehrücken
der Saison“ aß und das Genießen zur Kunst ausbildete, so daß er sich
selbst humorvoll als „ein fettes Schweinchen aus der Herde Epikurs“
bezeichnet, meint in einer seiner Episteln: „Nichts ist besser als
die Drossel.“ Die frisch Gefangenen wurden für die Feinschmecker
noch besonders gemästet. So schreibt Plinius um die Mitte des 1.
Jahrhunderts n. Chr. in seiner Naturgeschichte: „Cornelius Nepos,
der unter dem Kaiser Augustus lebte, schrieb, man habe erst kürzlich
angefangen, Drosseln zu mästen. Dazu bemerkt er, nach seinem Geschmack
geben (junge) Störche ein besseres Gericht als Kraniche. In unserer
Zeit wird der Kranich als Leckerbissen geschätzt, den Storch aber will
niemand anrühren.“
Sein Zeitgenosse Columella berichtet: „Auf Drosseln verwendet man viel
Mühe und Geld. Sind sie frisch gefangen, so muß man zahme zu ihnen
tun, die ihnen Gesellschaft leisten, sie aufheitern und im Fressen und
Saufen mit gutem Beispiel vorangehen. In den Vogelhäusern, die sie
bewohnen, sind Sitzstangen für sie angebracht, jedoch nicht höher, als
daß man sie bequem erreichen kann. Das Futter wird, damit es reinlicher
bleibt, so gestellt, daß keine Stange darüber ist; es wird im Überfluß
gereicht und besteht aus einer Mischung von zerstampften Feigen mit
Mehl. Manche geben dieses Futter, nachdem sie es vorher gekaut haben.
Aber bei einer großen Zahl von Vögeln unterläßt man dies lieber; denn
Leute, die zum Kauen gemietet werden, verlangen zu hohen Tagelohn
und verschlucken auch von der süßen Speise zu viel. Viele geben den
Drosseln auch Samen und Beeren, die sie im Freien gern fressen. Das
Wasser wird wie bei Hühnern in Gefäßen hingestellt.“
[S. 389]
In seinem Buche über die Landwirtschaft schreibt der gelehrte Varro
(116–27 v. Chr.) eingehend über die von den reichen Römern seiner Zeit
angelegten Vogelhäuser (aviarium von avis, Vogel). Er
sagt darüber: „Unsere Vorfahren hatten vorzugsweise zwei Arten von
Vogelbehältern; am Erdboden befand sich der Hühnerhof, in welchem
Hühner gehalten wurden und Ertrag von Eiern und Küchlein gaben. In
der Höhe stand der Taubenschlag. Heutzutage nennt man einen Behälter
Ornithon (nach dem griechischen órnis — Stamm, ornith
— Vogel), und diese werden mitunter von Gutsbesitzern, die gern gute
Bissen verzehren, so angelegt, daß nur die für Pfauen und Drosseln
(wohl besonders Krammetsvögel) bestimmten größer sind, als ehemals
die ganzen Landhäuser. — Lucullus hatte ein großes Vogelhaus, in
das er einen Speisesaal so hineinbaute, daß er während des Schmauses
und während gebratene Vögel aufgetragen wurden, auch die lebendigen
herumfliegen sah.
Übrigens soll hier ein solches Vogelhaus beschrieben werden, das nicht
dazu bestimmt ist, in ihm Vögel zu verschmausen, sondern aus ihm Vögel
zum Verschmausen und zum Verkaufen zu nehmen. Man baut das Haus so
groß, daß einige tausend Drosseln und Amseln drin Platz haben, setzt
auch wohl andere Vögel hinein, die gut bezahlt werden, wie Ortolane
und Wachteln. Die Tür muß niedrig und schmal sein. Die Fenster sind
so angelegt, daß die Gefangenen nirgends Bäume oder freie Vögel sehen
können; denn ein solcher Anblick erregt in ihnen die Sehnsucht nach
Freiheit und macht sie mager. Es darf überhaupt ins ganze Vogelhaus
nur so viel Licht fallen, daß die Vögel ihren Sitz, ihr Futter und ihr
Wasser sehen können. Es ist ferner alles so einzurichten, daß weder
Mäuse noch andere gefährliche Tiere hinein können. Zum Sitzen sind
entweder überall an den Wänden Stäbe angebracht oder Stangen lehnen
schräg an die Wand und sind stufenweise mit Querstäben verbunden. Auf
dem Boden ist ferner ein Wasserbehälter aufgestellt. Die Fütterung
besteht vorzugsweise aus Kügelchen, die aus einem aus Feigen und Mehl
bereiteten Teig bestehen. An das beschriebene Haus ist ein kleines,
helles angebaut, in das man die Vögel treibt, die geschlachtet werden
sollen. Beim Schlachten selbst wird die Tür, durch welche die Vögel
hereinkommen, geschlossen; denn die noch lebenden dürfen es nicht
sehen.“ Auch Vogelhändler besaßen solche Vogelhäuser. So bemerkt
derselbe Autor: „Die Stadtmetzger haben eigene Vogelbehälter und mieten
auch welche auf dem Lande.“ Und fernerhin sagt er: „Aus dem Vogelhaus
einer[S. 390] Villa bei der Stadt Reate wurden einst in einem Jahre 5000
Drosseln (Krammetsvögel) zu je 3 Denaren (= 1,80 Mark) genommen, so daß
dieses Vogelhaus allein mehr eintrug als manches schöne Landhaus.“
In seiner Naturgeschichte berichtet Plinius: „Vogelhäuser hat zuerst
der römische Ritter Marcus Laenius Strabo angelegt und alle möglichen
Vögel darin eingesperrt. Seitdem ist die Sitte, Tiere, denen die Natur
den freien Himmel angewiesen hat, in den Kerker zu sperren, allgemein
geworden. Der Schauspieler Äsopus ließ einmal eine Schüssel auftragen,
deren Inhalt auf 100000 Sesterzien (= 15000 Mark) geschätzt wurde; sie
war nämlich mit gebratenen Vögeln gefüllt, welche sich durch Gesang
oder durch Sprechen menschlicher Worte ausgezeichnet hatten und von
denen jeder 6000 Sesterzien (= 900 Mark) gekostet hatte. Äsopus hielt
es für ein großes Vergnügen, diese Tierchen zu essen, welche gleichsam
Menschen waren, weil sie sangen und sprachen, und bedachte nicht, daß
er erst durch Singen und Sprechen seine Reichtümer erworben hatte.
Über seinen Sohn durfte er sich wenigstens nicht beklagen; denn dieser
verschlang sogar Perlen (wie Kleopatra bei der Bewirtung des Antonius
in Essig aufgelöst)“. Dieser Äsop, der tragische Rollen ausgezeichnet
gut spielte und damit sein Vermögen gemacht hatte, war ein Zeitgenosse
und Freund Ciceros (106–43 v. Chr.). Trotz seiner Verschwendung
hinterließ er seinem Sohne ein ungeheures Vermögen, das dieser in
derselben Weise, wie sein Vater, durchbrachte. So berichtet Valerius
Maximus von ihm: „Der Sohn des Schauspielers Äsopus war ein toller
Verschwender; so kaufte er z. B. ausgezeichnet gut singende Vögel
zu ungeheuren Preisen und ließ sie für sich und seine Gäste braten.
Dazu gab er Getränke, worin sich die kostbarsten Perlen, in Essig
aufgelöst, befanden.“ Wie wir Papageien, so richteten die Römer Stare
und ausnahmsweise auch Drosseln zum Sprechen ab. So berichtet Plinius,
daß Agrippina, die Gemahlin des Kaisers Claudius (geb. 9 v. Chr. in
Lyon, ward 41 n. Chr. nach Caligulas Ermordung von den Prätorianern
zum Kaiser ausgerufen, wurde 54 durch seine zweite Gemahlin Agrippina
mit einem Schwammgericht vergiftet), eine zum Sprechen abgerichtete
Drossel besaß, was früherhin unerhört gewesen sei. Nebst solchen
dressierten Vögeln sah man nach Varro in Rom gelegentlich auch
Papageien, weiße Amseln und ähnliche Merkwürdigkeiten. Solche
Drosselalbinos sollten nach dem Bädecker des Altertums, Pausanias, im
2. Jahrhundert n. Chr. auf dem Berge Kyllene im Peloponnes vorkommen.[S. 391]
Nach dem älteren Plinius soll eine weiße Nachtigall „eine
große Seltenheit“ für 6000 Sesterzien (= 900 Mark) verkauft worden
sein, um sie der vorgenannten Agrippina, zweiten Gemahlin des Kaisers
Claudius, zum Geschenk zu machen. Bei dieser Gelegenheit bemerkt er
in seiner Naturgeschichte: „Durch ihre Vorzüge (im Gesang) sind die
Nachtigallen (luscinia) so teuer wie Sklaven geworden, ja
teurer als ehemals die Waffenträger waren. Man hat oft welche gesehen,
die auf Befehl sangen und, indem sie miteinander abwechselten, ein
Konzert gaben, so wie man auch Menschen gehört hat, welche in ein aus
Rohr gemachtes Querpfeifchen, worin sich Wasser befand, durch ein
Loch bliesen, und indem sie die Zunge etwas vorhielten, den Gesang
der Nachtigall täuschend nachahmten. — Während ich dies schreibe,
besitzen die kaiserlichen Prinzen einen Star und Nachtigallen, welche
die griechische und lateinische Sprache lernen, täglich gründlicher
studieren und immer etwas Neues und mehr Zusammenhängendes sprechen.
Wenn sie lernen, sind sie ganz abgeschieden und hören nur die Stimme
dessen, der ihnen die Worte vorsagt und ihnen dabei mit Leckerbissen
schmeichelt.“ Älian schreibt: „Charmis aus Massalia (dem heutigen
Marseille) sagt, die Nachtigall sei ruhmbegierig, singe in der
Einsamkeit ganz einfach, in der Gefangenschaft und vor Zuhörern aber
kunstreich und schmelzende Melodien wirbelnd.“ Dem fügt er später
von sich aus hinzu: „Wenn eine erwachsene Nachtigall gefangen und
eingesperrt wird, so will sie weder fressen noch singen; daher
behalten die Liebhaber von den gefangenen nur die jungen und lassen
die älteren wieder frei.“ Von diesen Vögeln sagt Oppian: „Die Natur
hat den Nachtigallen einen wunderlieblichen Gesang gegeben. Sie
verpflegen auch diejenigen ihrer Jungen, welche musikalisches Talent
zeigen, aufs allerbeste, hacken dagegen die stummen tot. Sie impfen
auch ihren Jungen eine so große Liebe zur Freiheit ein, daß sie in der
Gefangenschaft nie einen Laut von sich geben.“ Letzteres ist allerdings
eine Behauptung, die nicht widerlegt zu werden braucht und wohl auch im
Altertum nur wenige Nachbeter hatte.
Außer den vorhin erwähnten wurden auch andere Vögel im Rom der Cäsaren
zum Sprechen dressiert, so vor allem auch Raben, Elstern
und Eichelhäher. So schreibt Plinius: „Die Elster ist weniger
berühmt als der Papagei, weil sie nicht ausländisch ist, spricht aber
noch ausdrucksvoller. Die Worte, welche sie spricht, hat sie ordentlich
lieb. Sie lernt nicht bloß, sondern lernt auch mit Freuden, und man
bemerkt, wie sie für sich mit Eifer, Anstrengung und Nachdenken
studiert. Es[S. 392] ist eine bekannte Sache, daß Elstern gestorben sind,
weil es ihnen unmöglich war, ein Wort auszusprechen. Sie vergessen
auch Worte, wenn sie dieselben nicht öfters hören, versinken dann in
Nachdenken und werden ganz entzückt, wenn sie währenddem das vergessene
Wort zufällig wieder hören. Sie haben eine ziemlich breite Zunge und so
alle Vögel, welche die menschliche Stimme nachahmen lernen, was jedoch
die meisten tun.“
Später fährt er fort: „Auch den Raben gebührt Ehre; denn wir werden
sogleich sehen, in welchem Grade sie sich die Gunst des römischen
Volkes zu erringen wußten. Unter der Herrschaft des Tiberius flog ein
junger Rabe aus einem Neste, das auf dem Kastortempel stand, in die
gegenüberliegende Werkstatt eines Schusters und wurde von diesem mit
Ehrfurcht aufgenommen. Hier lernte er bald sprechen, flog jeden Morgen
auf die Rednerbühne, wendete sich dem Markte zu und grüßte namentlich
den Kaiser Tiberius, dann den Germanicus und Drusus und bald darauf das
vorbeigehende Volk, worauf er in seine Schusterwerkstatt zurückkehrte.
So erntete er mehrere Jahre lang Bewunderung. Endlich schlug ihn der
zunächstwohnende Schuster tot, entweder aus Neid oder, wie er zum
Schein behauptete, aus Rachsucht, weil er ihm einen Klecks auf einen
Schuh gemacht hatte. Über die Ermordung seines Lieblings ward das Volk
so aufgebracht, daß es den Schuster erst wegjagte, dann sogar totschlug
und dem Vogel ein überaus feierliches Leichenbegängnis bereitete. Die
Bahre wurde von zwei Mohren getragen; ein Flötenspieler ging voraus
und Kränze aller Art wurden bis zum Scheiterhaufen getragen, welcher
rechts an der Appischen Straße errichtet war. Das Genie eines Vogels
schien also dem römischen Volke ein hinlänglicher Grund zu einem
feierlichen Leichenbegängnis und zur Ermordung eines römischen Bürgers
in derselben Stadt, in der kein Mensch dem Begräbnis der vornehmsten
Leute beigewohnt hatte und niemand den Tod des Scipio Ämilianus, der
Karthago und Numantia zerstört, gerächt hatte. Dies geschah unter dem
Konsulat des Marcus Servilius und Gajus Cestius am 28. März. Auch
während ich dies schreibe, besitzt ein römischer Ritter in Rom eine
Krähe aus Baetica (Südspanien), die sich durch dunkelschwarze Farbe
auszeichnet, mehrere zusammenhängende Worte ausspricht und immer neue
dazu lernt. Neuerdings hat man auch vom Kraterus Monoceros gesprochen,
der in der ericenischen Gegend Asiens mit Hilfe der Kolkraben jagt. Er
trägt sie in den Wald, dort suchen sie und jagen das Wild, und weil
es oft geschieht, so schließen sich[S. 393] selbst wilde Raben der Jagd an.
Einige Schriftsteller erwähnen auch, daß ein Rabe bei großem Durste
Steine in ein tiefes Gefäß warf, worin sich Regenwasser befand, das er
sonst nicht hätte erreichen können, und es dadurch so weit in die Höhe
trieb, daß er sich satttrinken konnte.“
Von einem Eichelhäher berichtet der griechische Geschichtschreiber
Plutarch folgendes: „Viele Römer und Griechen sind Zeugen folgenden
Vorfalls: Auf dem sogenannten Griechischen Markt in Rom wohnte
ein Barbier, der einen Eichelhäher besaß, welcher mit wunderbarer
Geschicklichkeit die Stimme der Menschen, der Tiere und die Töne der
Instrumente, und zwar ganz aus freiem Antrieb, nachahmte. Einst wurde
ein reicher Mann begraben. Der Leichenzug ging mit Trompetenschall über
den Griechischen Markt. Die Trompeten bliesen ganz vorzüglich schön
und verweilten ziemlich lange auf dem Platze. Von diesem Augenblick an
war der Häher plötzlich still und stumm. Man faßte den Argwohn, der
Vogel sei von einem andern Barbier, der auf ihn neidisch war, behext
worden. Andere meinten jedoch, der Trompetenschall sei dem Tiere zu
stark gewesen; daher sei es von jener Zeit an verblüfft. Alle diese
Vermutungen waren aber falsch. Der Vogel studierte in aller Stille
für sich, übte in Gedanken die Trompetenmusik ein und ließ sie dann
plötzlich in ihrer Vollkommenheit hören.“
Sonst galten schon im Altertum die Papageien als die besten
Nachahmer der menschlichen Sprache. So schreibt der Grieche Älian:
„In Indien gibt es sehr viele Papageien (psittakós), aber kein
Inder ißt einen solchen Vogel; denn die Brahmanen halten ihn für
den heiligsten, weil er die menschliche Sprache am geschicktesten
nachahmt.“ Aristoteles und Plinius berichten, der Papagei stamme aus
Indien und ahme die menschliche Stimme nach. Letzterer fügt hinzu, er
werde durch den Genuß von Wein lustig und führe ordentliche Gespräche.
„Er begrüßt den Kaiser und spricht die Worte nach, die er hört. Sein
Kopf ist so hart wie sein Schnabel. Soll er sprechen lernen, so schlägt
man ihm mit einem eisernen Stäbchen auf den Kopf, weil er sonst die
Schläge nicht spürt.“ Wir haben noch ein nettes Gedicht auf den Tod
eines Papageien von Ovid und ein ähnliches von Statius.
Was für Papageien dies waren, wird sich wohl nicht so leicht
feststellen lassen. Jedenfalls kannten weder die Ägypter, noch
Babylonier, noch die älteren Griechen irgend welche Papageien. Erst
auf dem Zuge Alexanders des Großen nach Indien lernten letztere diesen
Vogel als gezähmten Hausgenossen des Menschen kennen und brachten[S. 394]
die ersten solchen nach Griechenland mit. Aber erst in der römischen
Kaiserzeit wurden diese Vögel etwas häufiger von Indien her importiert.
Doch hat schon der strenge Zensor Marcus Porcius Cato (234 bis 149 v.
Chr.) sich darüber beklagt, daß sogar römische Männer mit diesen Tieren
in der Öffentlichkeit erschienen. „O unglückliches Rom“, rief er aus,
„in welche Zeiten sind wir verfallen, da die Weiber Hunde auf ihrem
Schoße ernähren und die Männer Papageien auf der Hand tragen!“ Man
setzte sie ihrer Kostbarkeit entsprechend in silberne und elfenbeinerne
Käfige und ließ sie von besonderen Lehrern unterrichten, die ihnen vor
allem das Wort „Cäsar“ beizubringen hatten. Der Preis eines sprechenden
Sittichs überstieg oft den Wert eines Sklaven. Der halb verrückte
Kaiser Heliogabalus glaubte seinen Gästen nichts Köstlicheres vorsetzen
zu können als Papageiköpfe. Was diese bei der Kostbarkeit der seltenen
Vögel gekostet haben werden, das kann man sich leicht ausmalen. Um
die Zeit der Kreuzzüge kamen dann aus dem Morgenlande auch Papageien
nach Mitteleuropa, um in den Käfigen reicher Adeliger und Städter zur
Kurzweil gehalten und gelegentlich auch zum Sprechen abgerichtet zu
werden. Erst im 15. Jahrhundert kam mit den Fahrten der Portugiesen
nach Westafrika der von der Goldküste bis nach Benguela heimische
Graupapagei (Psittacus erithacus), der gelehrigste
aller Papageien, direkt nach Europa. Hier bewohnt der aschgraue Vogel
mit scharlachrotem Schwanz, dessen Verbreitungsgebiet mit demjenigen
der Ölpalme zusammenfällt, in Scharen die Wälder und wird überall
von den Eingeborenen gefangen, gezähmt und zum Sprechen abgerichtet,
auch als Tauschgegenstand oder Handelsware verwertet. Er ist einer
der beliebtesten aller Stubenvögel und verdient die Gunst, die er
genießt; denn er besitzt Sanftmut, Gelehrigkeit und Anhänglichkeit
an seinen Herrn, die Bewunderung erregen. Sein Ruhm wird sozusagen
in allen Sprachen verkündet, von ihm ist in zahlreichen Schulbüchern
und in allen Naturgeschichten manches Interessante zu lesen. Schon
Levaillant erzählt ausführlich von einem dieser Papageien, der in der
Gefangenschaft eines Kaufmanns in Amsterdam lebte, und rühmt die guten
Eigenschaften des Vogels. Er schreibt: „Karl, so hieß dieser Papagei,
sprach fast so gut wie Cicero; denn ich würde einen ganzen Band mit
den schönen Redensarten anfüllen können, die er hören ließ und die er
mir, ohne eine Silbe zu vergessen, wiederholte. Dem Befehle gehorsam,
brachte er die Nachtmütze und die Pantoffeln seines Herrn und rief
die Magd herbei, wenn man sie im Zimmer brauchte.[S. 395] Sein bevorzugter
Aufenthalt war der Kaufladen, und hier erwies er sich nützlich; denn er
schrie, wenn in Abwesenheit seines Herrn ein Fremder eintrat, so lange,
bis jemand herbeikam. Er hatte ein vortreffliches Gedächtnis und lernte
ganze Sätze und Redensarten des Holländischen vollkommen genau. Erst im
60. Jahre seiner Gefangenschaft wurde sein Gedächtnis schwach und er
vergaß täglich einen Teil von dem, was er schon konnte. Er wiederholte
nie mehr als die Hälfte einer Redensart, indem er selbst die Worte
versetzte oder die eines Satzes mit denen eines andern mischte.“
Vielleicht der ausgezeichnetste aller Graupapageien lebte jahrelang
in Wien und Salzburg und starb nach dem Tode seines letzten Herrn aus
Sehnsucht nach ihm. Wer über die hohe Intelligenz und das verblüffende
Sprachverständnis dieses Jako genannten Vogels Näheres zu erfahren
wünscht, der lese den betreffenden Abschnitt in Brehms Tierleben
nach. Er wird dort noch weitere solche, für ein Tier ganz unglaublich
klingende Geschichten finden, die von durchaus glaubwürdigen Autoren
berichtet werden.
In den feuchten Niederungen des Amazonenstroms und seiner Zuflüsse
werden die größten Vertreter der dort vorzugsweise heimischen
Keilschwanzsittiche, die prächtig buntgefärbten Araras, von
den Indianern in und um ihre Hütten gezähmt gehalten. Es geschah dies
schon lange vor der Ankunft der Weißen in diesem Lande. Schomburgk
berichtet, daß die Indianer noch heutigentags die Papageien frei
fliegen lassen, ohne ihnen die Flügel zu stutzen. „Ich sah mehrere“,
schreibt er, „die sich des Morgens unter die Flüge der wilden mischten,
die über das Dorf hinwegflogen und bei der Rückkehr am Abend sich
wieder auf die Hütte ihres Herrn niederließen.“ Nach diesem Autor
gehören zu den indianischen Niederlassungen im Walde die Papageien,
wie zu unsern Bauernhöfen die Hühner. „Auffallend ist die Zuneigung
der zahmen Papageien und Affen gegen Kinder. Ich habe selten einen
Kreis spielender Indianerkinder bemerkt, dem sich nicht auch Affen und
Papageien beigesellt gehabt hätten. Diese lernen bald alle Stimmen
ihrer Umgebung nachahmen, das Krähen der Hähne, das Bellen der Hunde,
das Weinen und Lachen der Kinder usw.“ Manche lernen sogar die
Indianersprache sprechen und bringen es darin zu großer Vollkommenheit.
Bekannt ist die Geschichte jenes sprechenden Papageis in einer der
Niederlassungen an einem Zuflusse des Orinoko, von dem Alexander
von Humboldt berichtet. Er war alt und sprach die Sprache eines
ausgestorbenen Indianerstamms, so daß ihn niemand[S. 396] mehr verstand. In
der Tat ein rührendes Bild der Vergänglichkeit alles Irdischen!
Von allen Papageien ist nur der Wellensittich (Melopsittacus
undulatus) zum eigentlichen Haustier des Menschen geworden,
indem er sich seit 57 Jahren in der Gefangenschaft des Menschen
ohne großen Nachschub aus seiner Heimat enorm vermehrt hat und hier
bereits bedeutende Farbenvarietäten zeigt. Bald wiegen die gelben,
bald die grünen, bald die blauen Farbentöne seines ursprünglich sehr
gemischten, allerdings vorwiegend grüngelben Farbenkleides vor, ja
es gibt nach Ed. Hahn schon welche, bei denen das ihnen ursprünglich
fremde Weiß eine ziemliche Rolle spielt und die selbst rote Augen
haben, also eigentliche Albinos sind. Erst im Jahre 1794 lernte man
in Europa diesen kleinen Papagei kennen, der in großen Scharen die
mit Gras bewachsenen Ebenen von Inneraustralien bewohnt und sich hier
von den Samen der Gräser ernährt. Als der Ornithologe Gould zu Anfang
Dezember die Ebene des Innern Australiens besuchte, sah er sich von
Wellensittichen umgeben und beschloß längere Zeit an derselben Stelle
zu verweilen, um ihre Sitten und Gewohnheiten zu beobachten. Sie
erschienen in Flügen von 20 bis 100 Stück in der Nähe einer kleinen
Wasserlache, um zu trinken, und flogen von hier zu regelmäßigen Zeiten
nach den Ebenen hinaus, um dort die Grassämereien, ihre ausschließliche
Nahrung, aufzunehmen. Am häufigsten kamen sie frühmorgens und abends
vor dem Dunkelwerden zum Wasser. Während der größten Tageshitze saßen
sie bewegungslos unter den Blättern der Gummibäume, deren Höhlungen
damals von brütenden Paaren bewohnt wurden. Solange sie ruhig auf den
Bäumen saßen, waren sie schwer zu entdecken; erst wenn sie zur Tränke
fliegen wollten, sammelten sie sich in Scharen und setzten sich auf die
abgestorbenen oder zum Wasser niederhängenden Zweige der Gummibäume.
Ihre Bewegungen sind wundervoll, ihr Flug ist gerade und falkenartig
schnell, den andern Papageien kaum ähnelnd, der Gang auf dem Boden
verhältnismäßig gut, ihr Klettern im Gezweige wenigstens nicht
ungeschickt. Im Fluge lassen sie eine kreischende Stimme vernehmen.
Im Sitzen unterhalten sich die sehr geselligen Vögel mit kosendem
Gezwitscher. Wenn sie abends zur Tränke eilen, werden sie in Menge in
großen Beutelnetzen gefangen, in rohe Kistenkäfige gesperrt und so
den Händlern übermittelt. Aufmerksamere Vogelhändler setzen sie zur
Weiterbeförderung in Australien gesellschaftsweise in kleine Käfige,
deren Sitzstangen wie Treppenstufen hinter- und übereinander[S. 397] liegen,
damit auf möglichst wenig Raum die größtmöglichste Zahl von Vögeln
Platz finden kann.
Der Wellensittich gehört in der Gefangenschaft nicht zu denjenigen
Papageien, die aus Trauer über den Verlust ihres Gefährten oft
dahinwelken und sterben, verlangt aber Gesellschaft, und zwar natürlich
am liebsten die des entgegengesetzten Geschlechts seiner eigenen Art.
Im Notfall findet er auch in einem verschiedenartigen kleinen Papagei
einen Ersatz. Niemals aber behandelt er einen andersartigen Vogel mit
jener liebenswürdigen Zärtlichkeit, welche er gegen seinesgleichen an
den Tag legt. Es ist deshalb notwendig, ihn immer paarweise zu halten;
erst dann gibt er seine ganze Liebenswürdigkeit, die ihm sofort die
Gunst des Menschen erwarb, kund. Er ist äußerst genügsam im Futter
und nimmt in Ermangelung der Grassamen seiner australischen Heimat
mit Hirse, Kanariensamen und Hanf vorlieb; daneben frißt er gern
grüne Pflanzenblätter, verschmäht zunächst Früchte, läßt sich aber
mit der Zeit auch daran gewöhnen. Er wird mit seiner sanften Stimme
dem Menschen niemals lästig wie andere Papageien, die einem mit ihrem
nicht unterdrückbaren Bedürfnis nach Gekreisch oft genug zur Last
fallen und auf die Nerven gehen. Er unterhält mit seinem plaudernden
Gezwitscher, lernt auch ein Liedchen und in einzelnen Fällen sogar
Worte nachsprechen.
Paarweise gehaltene Wellensittiche, denen man Nistgelegenheit in
einem hohlen Stamm verschafft, schreiten auch in der Gefangenschaft
fast ausnahmslos zur Fortpflanzung. Das Männchen ist das Muster von
einem Gatten, das sich ausschließlich mit seinem erwählten und nie
mit andern Weibchen abgibt, die etwa zugleich in demselben Raume sein
mögen. Gleicherweise ist das Weibchen das Muster einer Mutter; es baut
ausschließlich das Nest aus, bebrütet darin seine 4–8 weißen Eichen,
die es in Zwischenräumen von zwei Tagen legt, eifrig während 16–20
Tagen und atzt die Jungen, die etwa 30–35 Tage im Neste verweilen und
letzteres erst dann verlassen, wenn sie ganz befiedert sind. Derweil
wird das Weibchen vom Männchen gefüttert, das ihm zugleich, auf einem
Zweige vor der Öffnung des Nestes sitzend, seine schönsten Lieder
vorsingt. Wenn die erste Brut selbständig geworden ist, schreitet das
Pärchen alsbald zur zweiten, ja zur dritten und selbst zur vierten vor.
Ums Jahr 1848 wurde er durch die Beschreibung des Ornithologen Gould
in seinem Buche Birds of Australia in weiteren Kreisen bekannt
und scheint bald nach England gekommen zu sein. 1854 pflanzte er sich
nach Delon in England und Frankreich in[S. 398] Käfigen fort und wurde seit
1855 auch in Berlin gezogen. Damals nannten ihn die Händler nach seinem
lateinischen Artnamen den „Undulatus“. Als aber die spanische Tänzerin
Pepita von sich reden machte und geradezu einen Begeisterungstaumel
hervorrief, hielten es die Händler für vorteilhaft, von ihm als
„Andalusier“ zu reden, eine Bezeichnung, die sich allerdings, weil
vollkommen unberechtigt, bald wieder verlor. Eine Zeitlang schien es,
als sei ihm neben dem Kanarienvogel eine größere Rolle als Stubenvogel
bestimmt; doch ist er neuerdings gegenüber dem letztgenannten mehr
und mehr in den Hintergrund getreten. Auch nach Neuseeland wurde er
eingeführt und verwilderte dort, wie gelegentlich auch bei uns.
Neben den Wellensittichen gehören die ebenfalls Australien, daneben
auch Ozeanien bewohnenden Kakadus zu den liebenswürdigsten
Papageien, die sich gern und innig mit dem Menschen befreunden
und dankbar seine Liebe erwidern. Ihre geistige Begabung ist
außerordentlich entwickelt und ihre Neugier ebenso groß wie ihr
Gedächtnis, so daß sie empfangene Beleidigungen schwer oder gar nicht
vergessen. In bezug auf Gelehrigkeit wetteifern sie mit den begabtesten
aller Papageien, den Jakos oder westafrikanischen Graupapageien, lernen
bald mit Fertigkeit verschiedene Worte sagen und in sinngebender
Weise verbinden und lassen sich zu allerlei Kunststücken abrichten.
Ihre natürliche Stimme ist ein abscheuliches Kreischen, mit dem sie
in ihrer Heimat von den Kronen hoher Bäume, ihrem Nachtquartier, die
aufsteigende Sonne begrüßen. Dann fliegen sie zu ihren Futterplätzen,
um Früchte und Sämereien zu naschen. Auch sie leben gesellig in großen
Scharen und nisten in Baumhöhlen. Des Schadens wegen, den sie den
menschlichen Kulturen verursachen, werden sie in ihrer Heimat eifrig
verfolgt und zu Hunderten erlegt und ihr Fleisch, weil ziemlich
wohlschmeckend, gegessen. Namentlich wird die aus ihnen bereitete Suppe
sehr gerühmt. Sie lassen sich leicht fangen und dauern auch in Europa
in der Gefangenschaft viele Jahre lang aus. Man kennt Beispiele, daß
ein Exemplar dieser Vogelart länger als 70 Jahre im Käfig lebte. Ihre
Erhaltung erfordert wenig Mühe; denn sie gewöhnen sich nach und nach an
alles, was der Mensch ißt.
Als eigentlicher Schädling für die Schafzucht hat sich der in
Neuseeland heimische, ziemlich große, olivengrüne Gebirgspapagei
(Nestor notabllis), der Kea der Eingeborenen, erwiesen.
Der in einem zwischen 1500 und 2000 m Höhe gelegenen Gürtel
lebende Vogel hat sich angewöhnt, sich in den wolligen Rücken der
Schafe einzukrallen[S. 399] und mit seinem scharfen Hakenschnabel ganze
Löcher darein zu bohren, um sich so Fleisch, das ihm sehr zu schmecken
scheint, zu verschaffen. Viele dieser dummen Vierfüßler, die sich der
Angriffe dieser frechen Burschen nicht zu erwehren vermochten, gingen
infolge davon ein, so daß die Ansiedler diese lästigen Quälgeister
ihrer Herden eifrig zu verfolgen und abzuschießen begannen. Jetzt haben
sie sich gewöhnt, ihre gemeinschaftlichen Raubzüge nachts zu machen und
müssen sich vielfach mit dem Abfall geschlachteter Schafe oder mit Aas
begnügen.
[S. 400]
XIX. Kormoran und Strauß.
Der Kormoran ist als Haustier ausschließlich eine Errungenschaft der
chinesischen Kultur. Die Betriebsamkeit und die Geduld dieses alten
Kulturvolkes hat damit einen Vogel zum nützlichen Gehilfen des Menschen
gemacht, der bei uns als gefährlicher Konkurrent von jeher eifrig
verfolgt wird und im wesentlichen in Mitteleuropa auf dem Aussterbeetat
steht. Freilich wären auch unsere durch die gedankenloseste
Raubwirtschaft und die Verunreinigung der Flüsse durch die giftigen
Abwässer der chemischen Fabriken an Fischen verarmten Gewässer kein
günstiges Gebiet für die Tätigkeit dieses ausgezeichneten Fischfängers,
der sich uns bisher nur als Fischräuber verhaßt gemacht hat.
Der Kormoran (Phalacrocorax carbo), auch Baumscharbe oder
Wasserrabe genannt, ist ein sehr gefräßiger und deshalb vom Menschen
überaus gehaßter Fischräuber. Vom mittleren Europa an trifft man ihn in
ganz Mittelasien und Nordamerika, von hier aus bis Westindien, von dort
aus bis Südasien wandernd. Er bewohnt je nach Gelegenheit die kahle
Meeresküste und die bewaldeten Ufer der Binnengewässer; dabei scheut er
sich gar nicht, in unmittelbarer Nähe von Ortschaften, ja gelegentlich
in diesen selbst, z. B. auf Kirchtürmen, sich anzusiedeln. Er liebt
die Geselligkeit und hält sich deshalb in größeren oder kleineren
Scharen mit seinen Artgenossen zusammen, nistet auch gewöhnlich in
größeren Gesellschaften auf Bäumen, hohen Felsen, in Gebüschen oder
im Schilf. Dabei kehren die Vögel mit großer Zähigkeit zu ihren alten
Brutplätzen zurück, so lange sie nicht gewaltsam davon vertrieben
werden. Gern nimmt der Kormoran von den verlassenen Nestern anderer
Vögel, so besonders von Reiher- und Krähennestern, Besitz, um so
mühelos die erste Unterlage für sein eigenes Nest zu erhalten, das aus
Pfanzenstoffen errichtet und inwendig immer naß[S. 401] und sehr schmutzig
ist. Zweimal im Jahre werden 3–4 Junge aus den grünlichweißen Eiern
ausgebrütet und großgezogen.
Tafel 53.
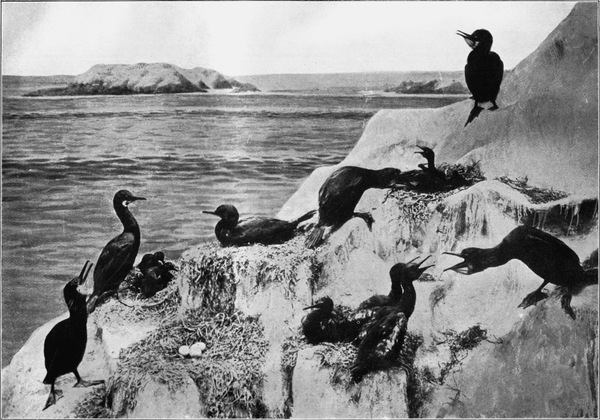
(Copyright by M.
Koch, Berlin.)
Kormorane auf einem Felsen bei Monterey in Kalifornien.
⇒
GRÖSSERES BILD
Tafel 54.

Eingefahrener Strauß auf Karl Hagenbecks Straußenfarm in
Stellingen.
⇒
GRÖSSERES BILD
Der Kormoran ist 81 cm lang und der Hauptsache nach glänzend
grünschwarz gefärbt, an Rücken und Flügeln kupferbraun, die Backen
weiß, Schnabel und Füße schwarz. Er schweift außer der Brutzeit gern
umher, ist auf dem Lande sehr schwerfällig, fliegt auch nicht besonders
gut, zeigt sich aber im Wasser äußerst beweglich und flink. Mit
geräuschlosem Ruck taucht er in bedeutende Tiefen und kann wenigstens
zwei Minuten unter Wasser bleiben, wobei er mehr oder weniger tief
hunderte von Metern zurückzulegen vermag. Pfeilschnell schießt er auf
der Jagd nach Fischen mit weitausholenden Flügelschlägen so gewandt
unter Wasser dahin, daß ihm auch der flinkste Schuppenträger nicht
zu entgehen vermag. Aus einer Tiefe von 40 m holt er Schollen
vom Meeresgrunde herauf, und Fische bis zu 7 cm Breite und 30
cm Länge, Aale, die er besonders liebt, selbst wenn sie 60
cm lang sind, verschlingt er mit Leichtigkeit.
Der vorsichtige, am Brutplatze zwar minder scheue Vogel, entzieht sich
jeder nahenden Gefahr. Kann er nicht tauchen, so erhebt er sich über
Schußweite in die Luft. Am liebsten aber verschwindet er bei Verfolgung
im Wasser, streckt, um rasch zu atmen, nur Kopf und Hals etwas über die
Oberfläche und verschwindet alsbald wieder in der Tiefe, wo er sich
geborgen fühlt, bis die Gefahr verschwunden ist. Gegen andere Vögel ist
er heimtückisch und sucht gern ihre Nester auszurauben oder gar die
alten Vögel wegzuschnappen. So sah man im früheren Zoologischen Garten
in Wien die Kormorane sich der Länge nach aufs Wasser legen und die
hart am Wasserspiegel auf Insekten jagenden Schwalben mit beispielloser
Gewandtheit wegfangen, ohne jemals fehlzugreifen.
Während der Morgenstunden fischen sie mit regem Eifer; nachmittags
pflegen sie der Ruhe und der Verdauung. Gegen Abend unternehmen sie
nochmals einen Fischzug und gegen Sonnenuntergang gehen sie schlafen.
Dabei wählen sie im Binnenlande zur Nachtruhe hohe Bäume, an der
Meeresküste dagegen hohe felsige Inseln, die ihnen Umschau nach allen
Seiten gewähren. Von ihnen bewohnte Inseln erkennt man schon von
weitem an dem weißen Kotüberzug, mit dem die Vögel sie bedeckt haben,
und sie würden schließlich auch bei uns zu Guanolagern werden, hätten
wir in unsern Breiten weniger Regen und die tropische Sonne, die den
Vogeldünger unter dem Himmel Perus rasch trocknet. Bei ihrer ungemeinen
Gefräßigkeit und[S. 402] raschen Verdauung ist der Kot sehr ausgiebig. Sie
fressen solange sie können und stürzen selbst mit gefülltem Magen auf
eine Beute, wenn sie ihnen gerade vor die Augen kommt. Weil sie bei
solchen Eigenschaften der Fischerei sehr bedeutenden Schaden zufügen,
können sie in Ländern, in denen der Mensch zur Herrschaft gelangte,
nicht geduldet werden. Sie werden deshalb überall in zivilisierten
Ländern als gefährliche Fischräuber verfolgt. Nur vorübergehend
sind einzelne Exemplare der Gattung im 17. Jahrhundert an den Höfen
Englands und Frankreichs zum Erbeuten von Fischen zahm gehalten worden,
wie für die Reiherbeize Falken gehalten wurden. Dazu benutzte man
jedenfalls jung aus dem Nest genommene Tiere; und zwar gaben vielleicht
Jesuitenmissionare, die in China solche Verwendung kennen gelernt
hatten, Veranlassung zu solchem Sporte, da diese gezähmten Kormorane
ausdrücklich als aus dem katholischen Flandern bezogen erwähnt werden.
So berichtet Pennant, daß König Karl I. von England, der von
1625–1649 regierte, einen Mr. Wood als master of the corvorants
hielt. Dieser habe die Kormorane so gezähmt, daß er sie ganz wie
Falken habe gebrauchen können. Um 1628 sah dann Puteus als Sekretär
des Kardinals Barberini in Fontainebleau am Hofe Ludwigs XIII.
solche Tiere, die vom König von England als Geschenk an seinen Schwager
dahin gelangt waren. Jedenfalls ist die Verwendung des Kormorans in
Europa damals ganz vereinzelt geblieben und haben sich die Vögel nicht
in der Gefangenschaft fortgepflanzt, sind also nicht zu Haustieren
geworden, wie dies seit alter Zeit in China der Fall ist.
Über die Kormoranzucht der Chinesen hat uns der französische Missionar
Armand David 1875 eingehend berichtet. Dort ist dieser Vogel
vollständig Haustier geworden und pflanzt sich in der Gefangenschaft
regelmäßig fort; doch läßt man gewöhnlich die von den Weibchen gelegten
Eier durch Hühner ausbrüten. Die Jungen werden schon beizeiten mit
auf das Wasser genommen und sorgsam unterrichtet, so daß sie bald auf
den Befehl ihres Herrn ins Wasser tauchen, um die erhaschte Beute
nach oben zu bringen und sie ins Boot zu apportieren. Ein um den Hals
gelegter lederner Ring verhindert den Kormoran am Hinunterschlingen des
erbeuteten Fisches. So schwimmt er auf das Boot seines Herrn zu, wo ihm
seine Beute sofort abgenommen wird. Zur Belohnung wird ihm nach Abnahme
des Halsrings etwas Bohnenteig als das übliche Futter verabreicht.
Hierauf läßt man den Vogel am Rande des Bootes kurze Zeit ruhen und
schickt ihn dann wieder[S. 403] an die Arbeit. Lässige Vögel werden bestraft,
wie fleißige am Schlusse des Fischens einen Fisch zum Fressen erhalten.
Wie groß muß noch der Reichtum der chinesischen Gewässer an Fischen
sein, daß sich ein solches Verfahren so gut rentiert, daß ein gezähmter
Kormoran den für chinesische Verhältnisse sehr hohen Preis von 12000
Käsch (= 30 Mark) einträgt. Übrigens haben die Japaner den Chinesen
den Fischfang mit Kormoranen abgeguckt und wenden ihn gelegentlich
ebenfalls in ihren fischreichen Gewässern an. Da der treffliche
Vogelkenner Naumann mit gutem Grund den Kormoran als schwer zu zähmen
und bissig bezeichnet, ist die große Geduld und Ausdauer der Chinesen
bei der Gewinnung dieses Haustiers doppelt anzuerkennen. Für uns aber
sind die Zeiten endgültig vorbei, da ein solcher Gehilfe des Menschen
existenzberechtigt wäre; denn wie lange müßte der arme Geselle in den
meisten unserer Gewässer tauchen, bis er endlich ein paar Gründlinge
oder Weißfische aufgetrieben hätte!
Dagegen hat die Kulturmenschheit noch in elfter Stunde einen anderen
Vogel zu zähmen verstanden, der an zahlreichen Orten seines einstigen
Verbreitungsgebietes bereits ausgerottet ist und nur noch in einigen
Steppen Südafrikas häufiger angetroffen wird. Es ist dies der
afrikanische Strauß (Struthio camelus), der einst auch
die Steppen Westasiens wie sämtliche des schwarzen Erdteils bewohnte.
So sah Xenophon in der vorderasiatischen Steppe wilde Strauße, die von
den sie verfolgenden Reitern nicht eingeholt zu werden vermochten, und
Diodoros Siculus berichtet von Straußen in Arabien, die mit solcher
Gewalt Steine mit ihren Füßen gegen ihre Verfolger schleudern, daß
letztere oft schwer getroffen werden. Damit meint er die bei ihrem
schnellen Laufe unabsichtlich nach hinten fliegenden Steine. Wie dieser
schreibt auch der ältere Plinius, er sei so dumm, daß er sich geborgen
glaube, wenn er nur den Kopf in einen Busch gesteckt habe. Man suche
seine Eier als etwas Kostbares auf und gebrauche die Schale derselben
wegen ihrer Größe zu Gefäßen. Mit den Federn der Strauße verziere man
die Helme. Älian sagt: „Der Strauß legt viele Eier, bebrütet aber nur
die fruchtbaren, legt dagegen die unfruchtbaren gleich auf die Seite
und setzt sie später den ausgekrochenen Jungen als Futter hin.“ Aus
Libyen und Mauretanien, also Nordafrika, das schon längst keine Strauße
mehr besitzt, kamen diese Tiere auch zu den Zirkusspielen nach Rom.
So ließ Kaiser Gordianus nach Julius Capitolinus bei den Jagdspielen
nebst vielen anderen Tieren auch 300 mit Mennige rot gefärbte Strauße
auftreten, die ausdrücklich als aus[S. 404] Mauretanien stammend bezeichnet
werden. Bei den Jagdspielen, die Kaiser Probus in Rom gab, erschienen
unter anderen wilden Tieren gar 1000 Strauße „und wurden dem Volke
preisgegeben.“ Und Älius Lampridius berichtet von Kaiser Heliogabalus,
daß er einmal bei einem Schmause die Köpfe von 600 Straußen auftragen
ließ, deren Gehirn verzehrt werden sollte. „Mehrmals gab er auch bei
Gastereien Straußen- und Kamelbraten und behauptete, den Juden sei
vorgeschrieben, solche Braten zu verzehren.“ Wenn damals der Strauß in
solcher Menge gefangen und nach Rom gebracht wurde, ist es kein Wunder,
daß diese Tiere mit der Zeit dann gänzlich aus Nordafrika verschwanden.
Gewöhnlich lebt der Strauß in Gesellschaften von 10–20 Stück, in
Südafrika gern mit Antilopen-, besonders Gnu- und Hartebeestherden
vergesellschaftet. Mit hocherhobenem Kopf vermag er mit seinen
außerordentlich scharfsichtigen Augen überaus weit zu sehen und ist
so ein willkommener Warner für die wohl mit gutem Geruch, aber nur
mit mäßig scharfen Augen begabten Antilopen. Er liebt das Wasser und
sucht es zum Trinken und Baden gern auf. Wenn es sein muß, kann er
dasselbe aber auch lange entbehren, macht auch keine weiten Wege, um
es aufzusuchen. Außer Kraut, Früchten und Sämereien aller Art frißt er
gelegentlich auch kleine Tiere, schlingt auch Steine, die zum Zerreiben
der harten Pflanzennahrung im kräftigen Muskelmagen dienen sollen,
hinunter.
Während junge Strauße schweigsam sind, stoßen die alten Männchen meist
am frühen Morgen ein Gebrüll aus, kämpfen zur Fortpflanzungszeit auch
mit Schnabel und Füßen miteinander, um eine Anzahl Weibchen für sich
zu gewinnen. Durch allerlei tanzende Balzbewegungen vermag jedes meist
drei bis vier Weibchen an sich zu fesseln. Diese legen nun ihre Eier
in ein einziges, nur aus einer vom Männchen in den Sandboden gewühlten
Mulde bestehendes Nest, das oft 20 Eier enthält und von anderen,
nicht zum Ausbrüten, sondern als Nahrung für die ausgeschlüpften
Jungen dienenden Eiern umgeben zu sein scheint. Die dickschaligen,
glatten, mit Poren zum Atmen für die Jungen versehenen gelblichweißen
Eier werden fast ausschließlich vom Männchen bebrütet, das während
der ganzen Nacht daraufsitzt und auch während des Tages sie nur zur
Nahrungsaufnahme für kurze Zeit verläßt. Nur in ganz heißen Gegenden
überläßt es sie während des Tages, mit Sand bedeckt, sich selbst. Nach
etwa 50 Tagen entschlüpfen ihnen die Jungen, die alsbald vom sorgsam
um sie bemühten Vater in Obhut genommen und gefüttert werden. Sie
sind zunächst[S. 405] von stachelartigen Horngebilden umgeben, die nach zwei
Monaten dem grauen Federkleide Platz machen, das bei den Weibchen nur
wenig verändert das ganze Leben hindurch bestehen bleibt, während bei
den Männchen vom zweiten Jahre an alle kleinen Federn des Rumpfes
kohlschwarz, die langen Flügel- und Schwanzfedern aber blendend weiß
werden. Diese gekräuselten Federn sind ein sehr beliebter Schmuck schon
der unkultivierten Wilden, ganz besonders aber des danach lüsternen
Kulturmenschen.
Das hauptsächlichste Ziel der Jagd des Straußes sind diese Federn, die
überall willige Abnehmer finden. Ihr Preis ist je nach dem Wechsel
der Mode erheblichen Schwankungen unterworfen, ist aber dadurch
bedeutend im Wert hinuntergegangen, daß der Vogel jetzt auch gezähmt
gehalten wird und ihm die Federn abgeschnitten werden können, ohne
daß er, wie früher der wilde, getötet zu werden braucht. Einst wurde
die Straußenjagd zur Gewinnung der Federn von den berittenen Beduinen
Nordafrikas mit Leidenschaft betrieben und galt als eine der edelsten
Vergnügungen, umsomehr sie sehr schwierig war und ein Zusammenarbeiten
mehrerer Jäger erforderte. Diese zogen auf flüchtigen Pferden oder
Reitkamelen in die Steppe hinaus, wobei ihnen in einiger Entfernung
Wasser in Schläuchen tragende Lastkamele folgten. Die Treiber dieser
letzteren hatten sich auch während der Jagd in möglichster Nähe der
Verfolger zu halten. Sobald die Jäger einen Trupp Strauße trafen,
suchten sie ein Männchen von der Herde zu trennen und ritten im
gestreckten Galopp hinter ihm her. Während einer von ihnen dem Vogel
auf allen Krümmungen seines Laufes folgt, sucht ein anderer diese
abzuschneiden, übernimmt, wenn es ihm gelang, die Rolle des ersteren
und läßt diesen die kürzere Strecke durchreiten. So wechseln sie
miteinander ab, bis sie den mit möglichster Schnelligkeit dahineilenden
Strauß ermüdet haben. Gewöhnlich sind sie schon nach Verlauf einer
Stunde dicht hinter ihm her, zwingen ihre Reittiere, meist Pferde, zu
einer letzten Anstrengung und versetzen dem Vogel schließlich einen
heftigen Streich über den Hals oder auf den Kopf, der ihn sofort zu
Boden streckt. Unmittelbar nach dem Falle des Wildes springt der Jäger
vom Pferde, schneidet ihm unter Hersagen des üblichen — da allerdings
sehr unpassenden — Spruches: „Im Namen Allahs, des Allbarmherzigen!
Gott ist groß!“ die Halsschlagader durch und steckt, um Beschmutzung
der Federn durch das Blut zu verhüten, den Nagel der großen Zehe eines
Fußes in die Wunde. Nachdem sich der Strauß verblutet hat, zieht ihm
der Jäger[S. 406] das Fell ab, dreht es um und benutzt es gleich als Sack,
um in ihm die Schmuckfedern aufzubewahren. Vom Fleische schneidet er
so viel ab als er braucht, um seinen Hunger zu stillen; das Übrige
hängt er an einen Baum zum Trocknen und für etwa vorüberziehende
Wanderer auf. Mittlerweile sind die Kamele mit dem Wasser nachgekommen
und die Jäger erquicken sich und ihre Pferde nach der anstrengenden,
heißen Jagd mit dem kühlenden Naß, ruhen einige Stunden aus und kehren
alsbald mit ihrer Beute beladen nach Hause zurück. Hier sortieren sie
die Federn nach ihrer Güte, binden die kostbaren weißen, deren ein
vollkommen ausgebildeter Strauß höchstens 14 besitzt, in einzelne
Bündel zusammen und bewahren sie zu gelegentlichem Verkauf in ihren
Zelten auf. Der Händler muß, um die Federn zu bekommen, sich selbst
zum Jäger begeben und erlangt von diesem die gesuchte Ware erst nach
längeren Verhandlungen. Man begreift diese Zurückhaltung sehr wohl,
wenn man bedenkt, daß alle Fürsten und Regierungsbeamten Nordafrikas
noch heute, wie zur Zeit der alten Ägypter, von ihren Untertanen
Straußenfedern als Königstribut verlangen und sich kein Gewissen daraus
machen, diesen durch ihre Unterbeamten gewaltsam eintreiben zu lassen.
Der Beduine vermutet daher in jedem, der ihn nach Federn fragt, einen
Abgesandten seines Oberherrn und rückt mit seinem Schatze erst dann
heraus, wenn er sich durch eingehendes Ausforschen von den reellen
Absichten des Käufers überzeugt hat.
In der Kulturgeschichte der Menschheit hat die Straußenfeder seit der
ältesten Zeit eine so wichtige Rolle gespielt, daß wir hier etwas näher
darauf eintreten müssen. Schon die Naturvölker Afrikas schmückten sich
einst und schmücken sich heute noch damit. Auf einer höheren Stufe
waren es vornehmlich die Häuptlinge, die sich ihre Abzeichen daraus
schufen, worunter auch aus ihnen zusammengesetzte, an langen Stielen
getragene Fächer waren. Im alten Ägypten war eine Straußenfeder das
Abzeichen von Maat, der Göttin der Wahrheit und Gerechtigkeit, der
Gemahlin von Thot, dem Gotte der Zeit, der Geschichte, Schrift, Magie
und des Mondes. Das Bild der Göttin Maat, die eine Straußenfeder als
Zier auf dem Kopfe trug, war das kostbarste Weihgeschenk für die
Götter; der Oberrichter trug es an einer Kette um den Hals. In der
Folge bedeutete die Straußenfeder in der Hieroglyphik Wahrheit und
Gerechtigkeit. Als später die Abzeichen der verschiedenen Rangklassen
im Zeremoniell am Hofe durch Übereinkommen fixiert waren, war die
Straußenfeder das Symbol des[S. 407] Fürsten und das Tragen derselben
nur diesen und den Prinzen königlichen Geblüts gestattet. Diese
Straußenfedergezierten sind auf den Monumenten als „Fächerträger zur
Linken des Königs“ bezeichnet. Auch die Prinzessinnen trugen Fächer
aus Straußenfedern. So wurde im Grabe der Königin Aa hotep (um 1703 v.
Chr.) ein solcher aus vergoldetem Holz gefunden, an dessen Halbkreis
noch die Löcher zu sehen sind, in denen die inzwischen zu Staub
aufgelösten Straußenfedern steckten, die einst den Wedel bildeten.
Auch am persischen Hofe spielte der Staatsfächer mit Straußenfedern
eine große Rolle. Gleicherweise zierten sich die vornehmen Griechinnen
und Römerinnen mit Straußenfedern, wie die Männer sie als Schmuck
gelegentlich auf ihre Helme steckten.

Bild 50. Links gefangener Strauß, rechts ein Mann mit
Federn und Eiern vom Strauß. (Nach Wilkinson.)
Im Mittelalter war die Straußenfeder aus Nubien über den Orient
nach Europa gekommen, blieb aber zunächst zu teuer, als daß sich
weitere Kreise mit ihr zu schmücken vermocht hätten. Erst am Ende des
Mittelalters wurde dieser Artikel häufiger auf den Markt gebracht, so
daß er weitere Verbreitung und Anwendung fand. Seit dem Anfang des
15. Jahrhunderts liebten es die vornehmen Kavaliere des in Europa
tonangebenden, an Reichtum und der damit in Zusammenhang stehenden
Prachtentfaltung alle andern überstrahlenden burgundischen Hofes,
3–4 Federn zunächst des Reihers als aigrette vorn an der Kappe oder
am Stirnband zu befestigen. Als dann auf ihre höfische Zierlichkeit
und Eleganz der schwerfällige Prunk des Ritters aus der Zeit
Kaiser Maximilians folgte, wurde die zierliche[S. 408] Aigrette durch den
wallenden Federbusch aus Straußenfedern ersetzt. Aber nicht nur der
adelige Ritter, sondern auch der gewöhnliche Landsknecht suchte mit
diesem teuren Schmucke zu prunken. Bald fand er auch Eingang in der
wohlhabenden Bürgerschaft, so daß die Obrigkeit es für nötig fand,
Gesetze gegen diesen unerhörten Luxus zu erlassen. So wurde in einer
Kleiderordnung einer reichen Stadt am Rhein aus dem 16. Jahrhundert
den Handwerkern das Tragen von Straußenfedern auf ihrem Barett als
übertriebene Verschwendung gänzlich untersagt.
In der Folge nahm diese Straußenfedermanie in Europa ziemlich ab. In
Deutschland sorgte die Not des 30jährigen Krieges dafür, daß den Leuten
solcher Tand gleichgültig wurde. Als dann Spanien in der zweiten Hälfte
des 16. Jahrhunderts die Welt beherrschte, wurde die Strenge seiner
Etikette und die Form seiner Kleidung tonangebend für die vornehmen
Kreise. Bald trugen die Damen und Herren nur noch die kleine toque,
welche höchstens noch ein kleiner Federstutz garnierte. Als dann
Europa nach dem Tode Philipps II. (1598) die steife Grandezza
Spaniens abgeschüttelt hatte, stülpte sich der französische Ritter den
respondent genannten ungeheuren Filzhut auf seine jetzt absichtlich
ungepflegten Locken; diesen schmückte er mit einigen kühn aufgesteckten
Straußenfedern. Von da an herrschte das ganze 17. Jahrhundert hindurch
in verschiedenen Variationen der mit Straußenfedern gezierte große
Filzhut. Am üppigen Hofe des Sonnenkönigs umhüllte die Straußenfeder
wieder in verschwenderischer Fülle den Hut des Elegants, wie den Helm
des Offiziers. Erst mit dem Beginne des Rokoko änderte sich dieses
Verhältnis, indem jetzt die Damen siegreich das Feld behaupteten und
ihre zu immer gewaltigerer Höhe emporgetürmte Coiffüre mit wallenden
Straußenfedern krönten.
Seit dem Ende des 16. Jahrhunderts wurde die Straußenfeder auch
zu höfischen Festdekorationen gebraucht, so zur Ausschmückung des
Thronbaldachins und später auch der Prunkbetten des Rokoko. Sie
erschien damals als ein unumgängliches Erfordernis der feierlichen
Aufmachung, der Galamontur und des Paradekleides. Wie zum erstenmal
der Stifter König Friedrich I., so trägt heute noch der König
von Preußen als Großmeister des hohen Ordens vom Schwarzen Adler einen
Hut mit vier Reihen übereinandergetürmter weißer Straußenfedern.
Einen ähnlichen Federbusch trägt nicht nur der Vorsitzende, sondern
tragen auch die Ritter des 1730 gestifteten englischen Bath-Ordens,
wie auch die Mitglieder des höchsten englischen Ordens über[S. 409]haupt, des
Hosenbandordens. Daß auch die strenge Empirezeit nicht ohne diesen
pompösen Schmuck auskommen konnte, sobald es sich um die höchste
Prachtentfaltung handelte, ersieht man aus dem Kupferstich des kleinen
Krönungsornats Napoleons I., dessen berühmter Dreispitz hier
unter einer Wolke duftiger weißer Straußenfedern fast verschwindet.
Bis dahin hatte Europa den Bedarf an dieser kostbaren Ware mit seiner
Einfuhr aus Afrika decken können. Genuesische und französische Schiffe
hatten schon im ausgehenden Mittelalter den Import derselben aus
der Berberei und der Sahara vermittelt. Im 17. Jahrhundert wurden
dann Ägypten und Syrien wichtige Ausfuhrländer für diese teilweise
auch aus Arabien bezogene wertvolle Ware. Die jahrhundertelang in
der schonungslosesten Weise zur Erbeutung der Federn betriebene
Straußenjagd ließ aber trotz der Fruchtbarkeit des Riesenvogels mehr
und mehr in empfindlicher Weise nach, so daß Livorno und Wien, die
von alters her die Stapelplätze für die Straußenfedern gewesen waren,
zu Beginn des 19. Jahrhunderts die verlangten Mengen derselben nicht
mehr liefern konnten. Als ums Jahr 1830 wieder große Hüte getragen
wurden, zahlte man schon 40 Mark für eine hübsche Feder. Wie Gold- und
Silberschmuck waren sie eine Zeitlang die beliebtesten Brautgeschenke
und wurden in großer Menge verbraucht.
Einen Umschwung brachte erst die um die Mitte des vorigen Jahrhunderts
angeregte künstliche Straußenzucht. Um dem fortwährenden Rückgang des
wertvollen Tieres zu steuern, stellte auf Anregung des Genfer Arztes
Gosset der Pariser Kaufmann Chagot der société d’acclimatisation
eine Summe von 2000 Franken zur Verfügung, um dieses Tier künstlich
zu züchten. Vom Jahre 1857 an wurde dieser Gedanke von Hardy mit
Ausdauer verfolgt und es gelang ihm, in Algier die Strauße zum Brüten
zu bringen, so daß er bereits 1860 die zweite Generation zu erziehen
vermochte. Gleichzeitig wurden auf Anregung des Fürsten Demidoff in San
Donato bei Florenz Zuchtversuche mit Straußen vorgenommen und hatten
Erfolg. Dabei ergab sich die bemerkenswerte Tatsache, daß das Weibchen
in einem Falle das Brutgeschäft vollständig dem Männchen überließ,
das andere Mal abwechselnd mit diesem brütete. Aus zwei Bruten gingen
von 1859 bis 1860 acht Nachkommen hervor. Gleicherweise wurden im
Tiergarten von Marseille durch Suquet Strauße gezüchtet; auch in
Grenoble und Marseille erlangte man günstige Resultate, so daß es sich
nur noch um eine Übertragung der Versuche in die Praxis handeln konnte.
[S. 410]
Nachdem 1866 die künstliche Ausbrütung der Straußeneier geglückt
war, ging die Sache rasch vorwärts. In Algier freilich, wo die
ersten Versuche stattfanden, vermochte sich die Straußenzucht nicht
einzubürgern; dagegen hatten die Farmer im Kaplande überraschende
Resultate. Schüttelte man auch dort anfänglich die Köpfe über den
Versuch, Strauße zu züchten, so kamen doch einzelne Farmer dadurch zu
Vermögen. Die Straußenfarmen wuchsen bald wie Pilze aus dem Boden, und
die Kaufpreise der Vögel stiegen rasch in die Höhe. Während noch im
Jahre 1865 im Kaplande nicht mehr als 80 zahme Strauße gezählt wurden,
hielt man zehn Jahre später schon 21751 Stück. Im Jahre 1886 schätzte
man den dortigen Bestand an gezähmten Straußen auf 150000 Stück und
später stieg er gar auf 200000 Stück, so daß man sehr wohl begreift,
wie heute die Straußenzucht einen der wichtigsten Erwerbszweige
Südafrikas bildet, soweit es von Europäern bevölkert ist. Vom Jahre
1865–1885 hob sich die Ausfuhr von 1500 auf 90000 kg Federn
jährlich, was einen Wert von etwa 20 Millionen Mark darstellt. In
neuerer Zeit ist der Preis der Federn und damit auch der Vögel stark
gesunken; doch ist die Straußenzucht gleichwohl immer noch lohnend.
Die allzugroße Inzucht der Tiere scheint aber die Qualität der Federn
verschlechtert zu haben, so daß eine nicht künstlich verstärkte Feder
heute tatsächlich eine Seltenheit geworden ist. Eine Auffrischung der
Zuchten mit Wildmaterial ist wegen des starken Rückganges freilebender
Strauße bedeutend erschwert.
Kleinere Farmer lassen die Strauße den Tag über im Felde herumlaufen
und treiben sie abends in die Gehöfte, wie es übrigens die Somali
schon vor den Europäern machten, um die Straußenfedern leichter als
durch die mühevolle Jagd auf jene so überaus schnellaufenden Tiere
zu erlangen. Viel häufiger als solche kleine sind große Zuchten,
in denen etwa 100 Vögel auf einem Raum von 250 ha, von
Drahtzäunen oder Steinmauern umgrenzt, gehalten werden. Die Nahrung
besteht aus Gras und Laubwerk; daneben wird auch Mais verfüttert. Die
Straußenhenne legt im dortigen Frühjahr im Laufe von 14 Tagen 12–16
ihrer elfenbeinfarbenen, dickschaligen Eier, deren Ausbrütung, wie wir
sahen, fast ausschließlich das Männchen besorgt. Sie wird aber auch
sehr häufig im Incubator genannten Brutapparat vorgenommen, wodurch
eine gleichmäßigere Erwärmung und infolgedessen auch eine größere Zahl
von ausschlüpfenden Jungen erzielt wird. Im Laufe des Jahres erfolgen
2–3 Bruten, so daß die Vermehrung eine sehr starke ist. Im Brutapparat
bedarf das Ei zu seiner[S. 411] völligen Bebrütung durchschnittlich 43 Tage.
Die Jungen werden mit kleingeschnittenem Grünfutter, besonders Luzerne,
dann in Wasser eingeweichter Brotkrume und Kleie aufgezogen, was einige
Vorsicht und in der ersten Zeit Trennung von den Alten erfordert, da
diese gegen die auf diese Weise gewonnenen Jungen sehr bösartig zu
sein pflegen. Sobald die Tiere drei Jahre alt sind, werden ihnen zum
erstenmal Federn entnommen, nicht ausgerissen, sondern an der Wurzel
mit der Schere abgeschnitten. Der Stumpf fällt dann aus und an seiner
Stelle entwickelt sich eine neue Feder. Alle acht bis zehn Monate wird
dieser Prozeß, bei welchem man die Vögel vielfach in ein bewegliches
Holzgestell einspannt, wiederholt, und 15 Jahre lang kann man bei einem
gesunden Tier auf Rentabilität rechnen. Bei einem jährlichen Unterhalt
von 80 Mark pro Vogel erzielt man eine Ernte von 1 kg Federn im
Werte von 260–1200 Mark. Es ist dies also eine sehr schöne Verzinsung
des Anlagekapitals.
Die Straußenzucht gedeiht nur in Steppengegenden und sandigen Gebieten.
Der Wind hat wenig Einfluß auf das Wohlbefinden der Tiere; dagegen
sind die Strauße sehr empfindlich gegen Nässe und Kälte. Starke
Verheerungen richten leicht übertragbare Wurmparasiten unter ihnen
an. Es wird angegeben, daß die jungen Strauße mit Vorliebe Exkremente
von Trappen und Feldhühnern aufpicken und auf diese Weise die Keime
von parasitischen Würmern in sich aufnehmen, die sie im wilden
Zustande nicht in sich haben. Ferner brechen sich die Tiere in ihrer
Ungeschicklichkeit leicht die Fußknochen und gehen dann meist zugrunde.
Noch schlimmer aber ist es, daß der Absatz des Produktes ganz von
den Launen der unberechenbaren Mode abhängt und die Preise mit dem
zunehmenden Angebot sinken.
Trotzdem die Kapregierung einen hohen Ausfuhrzoll auf lebende
Vögel und Eier festsetzte, hat sich die Straußenzucht, außer der
blühenden Zucht von Matarieh bei Kairo in Ägypten, auch außerhalb
Afrikas eingebürgert, vor allem in Kalifornien und Argentinien. Auch
Neuseeland züchtet diesen Schmuckvogel mit Erfolg; in Australien
dagegen vermochte er bis jetzt nicht zu gedeihen. Seit kurzem ist man
auch in Deutsch-Südwestafrika dem Beispiele der Engländer gefolgt. So
ist in Otjkondo ein Gebiet von 8200 ha ganz für die Aufzucht
dieser Vögel reserviert worden. Da diese, wenn sie rationell betrieben
wird, nur einen Verlust von 10 Prozent verursacht und die Vögel sehr
fruchtbar sind, d. h. zwei- bis dreimal jährlich 10–16 Eier legen, so
kann die Zucht sehr lukrativ sein.
[S. 412]
XX. Die Nutzfische.
Noch mehr als für die fluß- und seenbewohnenden Binnenländer ist
für die Küstenbewohner der Fischfang eine wichtige Erwerbs- und
Nahrungsquelle. Und mit dem immer besser eingerichteten Versand der
Fische sind auch die meisten Städte im Innern vorzüglich mit diesem
ebenso nahrhaften als billigen Nahrungsmittel versorgt, das in den
weitesten Schichten der Bevölkerung eine zunehmende Bedeutung gewinnt.
Nach vielen Milliarden Mark belaufen sich die Werte, die von den
verschiedenen Völkern dem Meere, der Mutter alles Lebens, in Form von
Fischen entnommen werden. So hat auch in Deutschland nicht nur die
Küsten-, sondern besonders auch die Hochseefischerei immer größere
Bedeutung erlangt, nachdem hierin England vorbildlich vorangegangen
war. Vom überreichen Erntesegen, der lange Zeit vorzugsweise den
Briten zufloß, kommt nun ein stets wachsender Teil auch den Deutschen
zugute. Werden doch jährlich allein für 40 Millionen Mark Heringe nach
Deutschland eingeführt.
Unter den zahlreichen Meerfischen haben besonders die Schellfische mit
Einschluß der Kabeljaus oder Dorsche, daneben die Heringe durch ihr
gehäuftes Auftreten in der Laichzeit in manchen Gegenden eine große
Bedeutung erlangt. Diese suchen seichtere Stellen des Meeres zur Ablage
ihrer Eier auf und werden dann in großen Netzen in Menge gefangen,
teilweise auch mit der Grundschnur erbeutet, die etwa 2000 m
Länge hat und gegen 1200 Angelschnüre mit köderbewehrten Haken besitzt.
Letztere wird ausgeworfen und alle sechs Stunden emporgeholt, der Fang
ausgelöst, die verbrauchten Köder ersetzt und die Schnur neu gelegt.
Währenddem beschäftigen sich die Fischer mit Handangeln, von denen sie
je eine in die Hand nehmen, rasch emporziehen, wenn sie merken, daß
sich etwas gefangen hat, und sofort wieder in die Tiefe versenken.
Letzteres geschieht besonders beim Schellfisch, Kabeljau
und Merlan (Gadus morrhua, aeglefinus und[S. 413]
merlangus), von denen ein Mann täglich 300 bis 400 Stück zu
erbeuten vermag. Am besten schmecken alle diese Fische frisch verzehrt.
Durch das Trocknen verlieren sie an Geschmack, doch bleibt bei ihrer
ungeheuren Menge gleichwohl nichts anderes übrig, als den größten Teil
auf diese Weise zu konservieren, außerdem eine beträchtliche Menge
davon in Fässern einzusalzen.
Der Kabeljau — jung Dorsch genannt — bewohnt den nördlichen
Teil des Atlantischen Ozeans und die angrenzenden Gebiete des
Eismeeres, hat seine Hauptverbreitung zwischen dem 50. und 75.
Breitegrad, kommt nicht südlicher als im 40. Breitegrad vor, wird 1–1,5
m lang und bis 40 kg schwer. Zur Laichzeit zieht er in
gewaltigen Zügen, die über 100 km breit und 30 km lang
sein können, dicht gedrängt an die zur Eiablage geeigneten flachen
Stellen des Meeres, an den Lofoten, dann an der Doggerbank in der
Nordsee (dogg heißt im Altholländischen der Kabeljau), besonders
aber an der Neufundlandbank, wo allein alljährlich etwa 1300 Millionen
Kilogramm Kabeljaus gefangen werden. Die Neufundlandbank ist heute noch
die wichtigste Fangstelle des Kabeljaus und wurde seit Anfang des 16.
Jahrhunderts von Engländern, Holländern, Franzosen, Portugiesen und
Spaniern aufgesucht und fleißig ausgebeutet. Schon im Jahre 1615 waren
250 englische Schiffe dort beschäftigt. Heute sind es deren 1800 mit
17000 Matrosen, während die Amerikaner noch mehr senden, um den hier
gebotenen Reichtum aus dem Meere zu schöpfen. Die meisten Kabeljaus
werden mit beköderten Angeln an der Grundschnur oder an Angelschnüren,
die von den Booten herabhängen, gefangen und sofort geköpft und
ausgenommen. Sie werden dann meist halbiert und die einzelnen Teile
auf Stangen getrocknet. So liefern sie den „Stockfisch“, während sie
mit Salz bestreut und auf Felsen getrocknet als „Klippfisch“, und
in Fässern eingesalzen als „Laberdan“ in den Handel gelangen. Beim
Ausweiden der Fische kommt die Leber in ein besonderes Faß, der Rogen
in ein anderes, die übrigen Eingeweide werden als Köder verwendet. Die
abgeschnittenen Köpfe dienen vielfach als Viehfutter. Die Lebern läßt
man in großen Bottichen stehen und in Zersetzung übergehen, wobei sich
in ihnen ein Öl an der Oberfläche sammelt. Es ist dies der Lebertran,
der von Zeit zu Zeit abgeschöpft, durch Seihen gereinigt und, seiner
Güte entsprechend, in verschiedene Fässer gefüllt wird. Am besten ist
natürlich der wenige Tage nach Beginn der Fäulnis gewonnene Lebertran,
am schlechtesten der Rest, den man durch Auskochen erlangt.
[S. 414]
Kein Meerfisch gewöhnt sich rascher an die Gefangenschaft auch in
engem Raum, keiner geht leichter ans Futter, keiner frißt mehr und
wächst rascher als der Kabeljau. Nur muß das Wasser seines Beckens
kühl gehalten werden, da er, wie gesagt, ein nordischer Fisch ist.
Geschieht dies und reicht man ihm genügend Nahrung, so gedeiht er
nicht nur vortrefflich, sondern dauert auch mehrere Jahre selbst in
einem offenbar für ihn zu engen Gewahrsam aus. In neuerer Zeit hat die
Fischkommission der Vereinigten Staaten von Nordamerika den Versuch
unternommen, mit Hilfe der künstlichen Fischzucht den Kabeljau, der im
nordatlantischen Gebiete heimisch ist, auch in südlicheren Gebieten,
z. B. in der Chesapeakebai, heimisch zu machen.
Noch mehr als der stattliche Kabeljau und seine Verwandten ist der
Hering (Clupea harengus) ein Speisefisch des Volkes,
der, auch dem Dürftigsten noch käuflich, in gar vielen Haushaltungen,
besonders der nordischen Länder Europas, die Stelle des zu teuer
gewordenen Fleisches vertreten muß. Von ihm werden jährlich über 10
Milliarden Stück gefangen, von denen Deutschland etwa 500 Millionen
Stück konsumiert, während die nordischen Völker weit mehr verbrauchen.
Bei ihnen ist er vielfach mit Brot zusammen die tägliche Nahrung.
Dieser nur 30 cm lange, stark zusammengedrückte Fisch lebt
weder wie die vorgenannten vorzugsweise im Polarmeere, noch macht er
wie diese weite Reisen. Er bewohnt vielmehr die Tiefen der Meere, an
deren Küsten er laicht, wird dort zu allen Zeiten vereinzelt gefangen,
namentlich mit solchen Gerätschaften, die in größere Tiefen reichen,
und steigt nur zur Laichzeit aus diesen Tiefen empor, um der Küste
zuzusteuern, an der er seine Eier wie die vorigen zur Winterszeit
absetzt.
Betrachtet man eine Tiefenkarte der Nordsee, so überzeugt man sich
leicht von der Tatsache, daß Großbritannien auf einer geräumigen
Hochebene liegt, die nirgends tiefer als 200 m ist, so
daß bei einer Senkung des Meeresspiegels um diesen Betrag ganz
Großbritannien in das europäische Festland einbezogen wäre. Diese
Untiefe der Nordsee stellt, außer den Westküsten Großbritanniens und
Skandinaviens, den Laichplatz des Herings dar, wohin außer den Scharen
fortpflanzungslustiger Individuen alljährlich auch große Heere noch
nicht völlig erwachsener sogenannter Jungfern- oder, wie die Holländer
sagen, Matjesheringe aus der heimatlichen Tiefe emporsteigen. Der von
kleinen Spaltfußkrebsen lebende Fisch macht an der Küste Norwegens vom
Februar bis April seine Laichzüge. In der dem Laichen vorausgehenden
Zeit entwickeln sich bei ihm Rogen und Milch als wasser[S. 415]reiche und
deshalb leichtere Stoffe so stark auf Kosten von Fett und Eiweiß der
Muskulatur, daß das Gewicht des Fisches geringer wird und er sich
getrieben fühlt, um seine Gleichgewichtslage wieder herzustellen,
Plätze aufzusuchen, an denen die Temperatur höher und daher das
spezifische Gewicht des Wassers geringer ist. Danach richten sie ihre
Wanderungen und wählen deshalb nicht immer dieselben Laichplätze.
Die älteren Heringe laichen früher als die jüngeren und beginnen
damit teilweise schon im Herbst, und zwar vermutlich an denselben
Stellen, an denen sie geboren wurden. Doch können verschiedene
Ursachen, wie Witterungseinflüsse und Strömungsänderungen, bewirken,
daß sie in manchen Jahren an bestimmten Orten, an denen sie früher in
Masse erschienen, gänzlich ausbleiben; ebenso zeigen sie sich gegen
Veränderungen ihrer Laichplätze höchst empfindlich, meiden insbesondere
solche Plätze oft jahrelang, an denen der Überzug von Tangen zerstört
oder ihrer zu viele weggefangen wurden. Doch sind die Ursachen, welche
Richtung und Ziele der Heringswanderungen bestimmen und zeitweilig
ändern, noch nicht völlig erkannt. Immerhin scheint es heute schon
zweifellos, daß innerhalb gewisser großer Zeiträume die Heringszüge
sich von den bis dahin regelmäßig besuchten Gebieten ab- und anderen
zuwenden.
Erscheinen irgendwo die Heringe zum Laichen, so treiben sie sich
zwei bis drei Tage hindurch nahe der Oberfläche des Meeres umher,
drängen sich, namentlich bei stürmischem Wetter, zu dichten Haufen,
eilen vorwärts und lassen währenddem die Eier ins Wasser fallen,
die gleichzeitig von dem von den männlichen Fischen entlassenen
Samen befruchtet werden. Dabei werden sie von zahlreichen Feinden
verfolgt und dezimiert. Solange sie sich in den oberen Wasserschichten
umhertreiben, nähren sich alle hier lebenden Raubfische, alle
Meervögel, besonders Möwen, und fast sämtliche Meersäugetiere
ausschließlich von ihnen. So erkennen die Norweger ihre Ankunft an
den sich um sie sammelnden Zahnwalen. Aber alle Verluste, die die
zahlreichen Räuber der See den Heringszügen zufügen, sind verschwindend
gegenüber denjenigen, die der Mensch ihnen mit seinen großen Netzen
beibringt. Um die Heringe im großen zu fangen, bedient man sich der
sogenannten Driftnetze, die 40 m lang und 10 m tief
sind. Größere Fischerboote führen bisweilen so viele dieser Netze mit
sich, daß sie auf 2,5 qkm das Wasser bestellen können. Gegen
Abend werden die Netze eingesenkt, mit Gewichten teilweise in die
Tiefe gezogen, teilweise aber[S. 416] durch Korkstücke und leere Fässer oben
gehalten, so daß sie je nach der Meerestiefe höher oder niedriger zu
stehen kommen. Die Maschen sind genau so weit, daß ein junger Hering
durchzuschlüpfen vermag, während der erwachsene beim Bestreben, sich
durchzuzwängen, mit den Kiemendeckeln darin hängen bleibt und so
gefangen wird. Mit Tagesgrauen beginnt man die Netze auszulösen und
schafft dann die gefangenen Fische so eilig als möglich an den Strand
und in den Arbeitsraum des Einsalzers, da sie um so besser werden,
je eher sie ins Salz kommen. Hier werden sie alsbald ausgenommen und
gelangen, mit Salz bestreut und in Tonnen festgepreßt, zum Versand.
Sichere Kunde von der Heringsfischerei reicht bis ins frühe Mittelalter
zurück. Altenglische Urkunden erwähnen sie und alte Gesetze regeln sie.
Bis zu Ende des 14. Jahrhunderts befand sich die Fischerei, obschon
sie damals durchaus nicht unbedeutend war, erst in den Anfängen. Da
lernte man den Fisch durch Einsalzen vor dem Verderben zu schützen
und so transportfähig zu machen. Dadurch erst gewann der Hering
als Volksnahrungsmittel die allergrößte Bedeutung. Zuerst waren es
die Holländer, die den Heringsfang in großartiger Weise betrieben;
später nahmen auch die Hanseaten und Norweger an ihm teil. Erst seit
200 Jahren begannen die Briten eine größere Anzahl Schiffe auf den
Heringsfang auszusenden und überflügelten darin bald alle anderen
Völker Europas. Da aber der Wanderzug der Fische sich nicht im voraus
feststellen läßt, so spielt der Zufall eine große Rolle dabei, ob man
Erfolg hat oder nicht. In der Gefangenschaft geht der erwachsene Hering
in wenigen Stunden, der junge in wenigen Tagen ein, so daß von einer
künstlichen Aufzucht bei ihnen niemals die Rede sein kann.
Die nächste Verwandte des Herings ist die Sprotte (Clupea
sprottus), die nur 15 cm lang wird. Sie lebt wie jener
in bedeutender Meerestiefe und erscheint alljährlich im Frühling in
unermeßlichen Scharen in der Nähe der Küste, um zu laichen. Zu ihrem
Fange wendet man entsprechend feinmaschige Netze an. An der britischen
Küste, wie auch an derjenigen der Ostsee wird diese Fischerei stark
betrieben. Geräuchert kommen sie von Eckernförde aus als „Kieler
Sprotten“, in Salz eingemacht dagegen aus Norwegen unter dem Namen
„Anchovis“ (franz. anchois) in den Handel.
Etwas größer, nämlich 20–25 cm lang, ist die Sardine
(Clupea sardina), die vom Süden Englands längs der ganzen
französischen und nordspanischen Küste bis Portugal bald in tieferem,
bald in[S. 417] seichterem Wasser vorkommt, sehr gefräßig ist und vorzugsweise
von kleinen Garneelen lebt, die sie am Meeresboden aufnimmt, um damit
den Magen prall zu füllen. Sie laicht vorzugsweise in den Herbstmonaten
und wird dann in großen Mengen gefangen, doch wird sie zumeist
außerhalb der Laichzeit mit dem Grundnetz erbeutet. Viele derselben
werden eingesalzen, die große Mehrzahl aber, nachdem sie kürzer oder
länger in der Sülze gelegen, in Öl gekocht, mit diesem in kleinen
Blechbüchsen eingeschlossen und als Sardinen in den Handel gebracht.
Etwas kleiner, nämlich nur 15 cm lang, d. h. so groß wie die
Sprotte, wird die Sardelle oder der echte Anchovis
(Engraulis encrasicholus). Dieser an der Oberseite
bräunlichblaue Fisch bewohnt besonders das Mittelländische Meer, ist
aber durch die Meerenge von Gibraltar längs der europäischen Küste bis
in den nördlichen Teil der Nordsee, ja sogar in die Ostsee gedrungen.
Für die nördlichen Teile des Verbreitungsgebietes hat der Fang dieses
geschätzten Fisches keine besondere Bedeutung, wohl aber in den
südlichen Gegenden. Schon in der Bretagne bringt die Sardellenfischerei
Millionen ein. Im Mittelländischen Meer zählt das Fischchen zu den
geschätztesten Speisefischen. Es lebt in tieferen Schichten und kommt
an die Küsten zum Laichen, wobei es in so dichten Scharen auftritt, daß
oft mit einem einzigen Zuge mit dem Netz viele Tausend aus dem Wasser
gehoben werden. Schon die Alten schätzten es hoch. In Aristophanes
„Rittern“ wird uns ein Wursthändler vorgeführt, der durch den billigen
Verkauf dieses Speisefisches, zu dem er gratis die Zukost an Zwiebeln
gab, besondere Popularität erlangte. Aber nicht nur die Armen, auch
die Reichen Griechenlands aßen den Fisch gern, besonders in siedendem
Olivenöl zubereitet. Der Grieche Oppianos schreibt in seinem um 200 n.
Chr. in Hexametern verfaßten Gedicht über den Fischfang: „Die Sardellen
(engraulis) sind furchtsame, schwache Fische, welche von anderen
hart verfolgt werden und sich daher, um sicherer zu sein, in so dichte
Scharen zusammendrängen, daß sie oft Schiffe in ihrem Laufe, Ruder in
ihrem Schlage hemmen. Die Massen sind so dicht, daß man sie nicht mit
dem Beile auseinander zu hauen vermag und daß man mit der Hand so viele
nehmen kann als man will. Die Fischer ziehen sie mit Netzen heraus
und man sieht oft große Haufen derselben, die den Strand bedecken.“
Man schneidet ihnen nach dem Fange die Köpfe ab, nimmt die Eingeweide
heraus und salzt sie oder macht sie in Olivenöl ein. In ersterem Falle
kommen sie als „Sardellen“, in letzterem dagegen als „Anchovis“ in den
Handel.
[S. 418]
Ebenfalls im Mittelmeer heimisch und von da der Küste entlang nach
Norden vorgedrungen sind die Rotbarben (Mullus), von
denen vor allem der Rotbart (Mullus barbatus), ein 30–40
cm langer karminroter Fisch mit gelben Flossen, von den Alten
überaus geschätzt war. Nach Plinius, der von ihm bemerkt, daß er in
Fischbehältern nicht gedeiht, soll der Konsular Asinius Celer zur Zeit
des Kaisers Caligula einen solchen für 8000 Sesterzien (= 1200 Mark)
gekauft haben und fügt bei: „Sonst klagte man darüber, daß Köche teurer
seien als Pferde; jetzt kostet ein Koch soviel wie ein Triumph, ein
Fisch soviel wie ein Koch, und fast kein Mensch wird so hoch geschätzt
wie ein Koch, obgleich seine Hauptkunst darin besteht, seinen Herrn
durch Kochen um Hab und Gut zu bringen.“ Seneca erzählt in einer seiner
Episteln, Kaiser Tiberius habe einen 41⁄2 Pfund schweren Rotbart auf
den Markt geschickt und dafür von Publius Octavius 5000 Sesterzien (=
750 Mark) erhalten. Martial sagt, ein reicher Römer habe einen Sklaven
für 1300 Sesterzien (= 195 Mark) verkauft und für diese Summe einen
4 Pfund schweren Rotbart eingehandelt. Juvenal berichtet, es habe
jemand einen 6 Pfund schweren Rotbart für 6000 Sesterzien (= 900 Mark)
gekauft, und Älius Lampridius erzählt, der verschwenderische Kaiser
Heliogabalus habe Schmausereien gegeben, bei denen ungeheure Massen
von Eingeweiden der Rotbärte aufgetragen wurden, auch habe er ganze
Schüsseln und Teller, die nur mit Bartfäden der Rotbärte gefüllt waren,
aufgetischt.
In größeren Wassertiefen leben die Makrelen (Scomber),
die ebenfalls bei den Alten als Speisefische sehr geschätzt waren. Ihr
köstliches Fleisch muß so rasch als möglich gegessen werden. Eine sehr
pikante Sauce, garum genannt, gewannen die Römer durch Faulenlassen
von deren Fleisch, nebst Blut und Eingeweiden. Riesenmakrelen sind
die Thunfische (Thynnus), die für die Bewohner der
Mittelmeerküsten von besonderer Bedeutung sind. Sie erreichen 3–4
m Länge und ein Gewicht von 300–400 kg und werden ihres
wohlschmeckenden Fleisches wegen eifrig verfolgt. Ihre wahre Heimat ist
das Mittelländische Meer, während sie im Atlantischen Ozean spärlicher
vorkommen und durch andere Arten ersetzt werden. Zwar behauptete man
im Altertum und glauben die Fischer heute noch, daß sie alljährlich
in Menge vom Weltmeere aus durch die Meerenge von Gibraltar nach
dem Mittelländischen Meere ziehen. So schreibt der vorhin genannte
Oppian: „Die Thunfische kommen vom Weltmeer ins Mittelländische, wenn
sie im Frühjahr Eier legen wollen. Sie gehen[S. 419] erst an Spanien, dann
an Gallien und Sizilien hin. Zu dieser Zeit werden Wächter auf die
Felsen am Strande gestellt, welche den Zug und die Zahl der kommenden
Fische beobachten. Sehen sie die Scharen herannahen, so werden die
Netze gestellt, welche Kammern bilden, die mit Vorhallen und Eingängen
versehen sind. In diese dringen dann die Thunfische in Menge ein und
gewähren einen überreichen Fang.“ Nur muß diese Anschauung von der
Herkunft der Thunfische aus dem Atlantischen Ozean dahin abgeändert
werden, daß sie für gewöhnlich in größeren Tiefen des offenen
Mittelländischen Meeres leben und sich erst gegen die Laichzeit den
Küsten nähern. Statt wagrechte Wanderungen, wie man früher glaubte,
vollführen sie vorzugsweise senkrechte, um sich in den flacheren
Gewässern der Küste zu tummeln. Hier hält er allerdings — vermutlich
durch unterseeische Täler bewogen — bestimmte Straßen ein, in denen
er oft in Herden von Tausenden fortzieht, um sich im Frühling im
seichten Wasser der Küste fortzupflanzen. Seit dem frühesten Altertum
sind gewisse Fangplätze durch ihre Ergiebigkeit berühmt. Dort wird
der Fang der Thunfische durch dieselben gekammerten Netze, wie sie
vorhin aus dem Jahre 200 nach Chr. beschrieben wurden, bewerkstelligt.
Sobald die auf erhabenen Stellen beobachtenden Wächter die Ankunft der
Thunfische melden, stechen eine Menge bereit gehaltener Boote in die
See, bilden unter Befehl eines Anführers einen weiten Halbmond, werfen
ihre tonnare genannten Fangnetze, wahrhaftige Gebäude aus Stricken und
Maschen aus und schließen die Fische ein. Indem sie den Kreis mehr
und mehr verengern, zwingen sie die Thunfische, gegen das Land hin zu
schwimmen. Im seichten Wasser breitet man dann das letzte Netz aus
und zieht es mit allen innerhalb desselben befindlichen Thunfischen
ans Land, um sie alle abzustechen, so daß sich das Meer weithin mit
ihrem Blute rotfärbt. Die Ausbeute wird oft an Ausländer, die sich
als Käufer eingefunden haben, frisch verkauft und von diesen in
Tonnen eingesalzen. Von den Einheimischen wird der Thunfisch vielfach
auch gekocht, in Öl konserviert und so in den Handel gebracht. Jedem
Italienfahrer ist solcher tonno in oleo, der ganz gut schmeckt,
sehr wohl bekannt.
Für die Nordsee sehr wichtig sind die am liebsten im Sande der Flachsee
halb in den Boden eingegraben auf Beute lauernden Flachfische
oder Seitenschwimmer, die verschiedenen Arten von
Schollen, Flundern, Seezungen, Heil- und
Steinbutte. In der Fähigkeit, sich zu verstecken, werden sie in
hohem Maße durch die Begabung ge[S. 420]fördert, die eine pigmentierte und
mit beiden Augen versehene Seite je nach der Farbe des Untergrundes
verschieden zu färben. Sie laichen im Frühling und Vorsommer zwischen
Tangen, an die sie die Eier mit Vorliebe festkleben. Ihr sehr
wohlschmeckendes Fleisch zeichnet sich durch seine große Haltbarkeit
aus und wird deshalb weithin verschickt. Außer englischen sind es
besonders holländische und dänische Fischer, die sich mit deren Fang
abgeben und sie besonders nach London verhandeln. Sie lassen sich wie
im Meerwasser, so auch im Süßwasser lange Zeit halten, haben überhaupt
eine außerordentliche Lebenszähigkeit.
Besonders geschätzt war bei den alten Römern das Fleisch eines
Aalfisches, der Muräne (Muraena helena), die sie in
eingedämmten Meeresarmen oder Salzwasserteichen hielten, um stets den
nötigen Bedarf für ihre Schwelgereien bei der Hand zu haben. Plinius
berichtet über sie in seiner Naturgeschichte: „Bloß für Muränen
bestimmte Fischteiche hat zuerst Gajus Hirrius angelegt; aus diesen
lieh er dem Diktator Cäsar zu den Triumphschmausereien 6000 Muränen
unter der Bedingung, daß er ebensoviel zurückerhalte; denn für Gold
und andere Kostbarkeiten waren sie ihm nicht feil. Kurz darauf wurde
sein Landgut verkauft, und der Preis desselben betrug wegen der darauf
befindlichen Fischteiche 4 Millionen Sesterzien (= 600000 Mark). Von da
an begann man mit einzelnen Individuen dieser Fischart Liebhaberei zu
treiben. Bei Bauli in der Nähe (des damals sehr beliebten Badeortes)
von Bajae hatte der Redner Hortensius einen Fischteich, worin sich eine
Muräne befand, die er so liebte, daß er sie nach ihrem Tode beweint
haben soll. Auf demselben Landsitze schmückte Antonia, die Tochter des
Drusus, eine geliebte Muräne mit Ohrringen, und manche Leute gingen nur
nach Bauli, um das berühmte Tier zu sehen.“ Später, um 220 n. Chr.,
berichtet Älian: „Berühmt ist die Muräne des Crassus, welche Ohrringe
und mit Steinen besetzte Halsbänder trug, auf den Ruf des Crassus
herbeikam und ihm aus der Hand fraß. Sie wurde nach ihrem Tode von ihm
beweint und begraben.“
Bekannt ist, daß diese gierigen Raubfische gelegentlich mit
Menschenfleisch gefüttert wurden. So erzählt Plinius: „Die Gefräßigkeit
der Muränen hat dem römischen Ritter Vedius Pollio, einem Freunde des
Kaisers Augustus, Gelegenheit zur Erfindung einer neuen Grausamkeit
gegeben; denn er ließ in die mit diesen Fischen besetzten Teiche
verurteilte Sklaven werfen, nicht weil er sie von Löwen, Tigern und
der[S. 421]gleichen nicht hätte zerfleischen lassen können, sondern weil er
sein Vergnügen daran fand, zuzusehen, wie der ganze Mensch zu gleicher
Zeit von allen Seiten her durch Feinde zerfleischt wurde, das andere
Raubtiere nicht gewähren konnten.“ In zahlreichen Lesebüchern wird die
Geschichte erzählt, wie er in Gegenwart des bei ihm zu Gast weilenden
Kaisers Augustus einen Sklaven, der ein kostbares murrhinisches Gefäß
zerbrach, als Strafe dafür mit dem Ausdrucke: ad muraenas d. h.
zu den Muränen! lebend diesen Tieren vorwerfen ließ. Vorzüglich sollten
sie nach Plinius wütend werden, wenn man ihnen Essig zu schmecken gab.
Wie für Muränen hatten die Römer auch für andere von ihnen wegen ihres
wohlschmeckenden Fleisches geliebte Meerfische besondere Teiche, die
oft mit großem Aufwand hergestellt wurden. So berichtet der vorgenannte
Plinius: „Zu derselben Zeit, da Sergius Orata die Austernparks erfand,
erfand Licinius Muraena die Fischteiche, und berühmte Männer, wie
Philippus und Hortensius, haben ihn darin nachgeahmt. Lucullus ließ
sogar bei Neapel einen Berg mit größeren Kosten, als er auf sein
Landgut verwendet hatte, abtragen und leitete das Meerwasser ins Land,
weshalb ihn Pompejus der Große den römischen Xerxes nannte. Nach seinem
Tode wurden die dort befindlichen Fische für 4 Millionen Sesterzien
(= 600000 Mark) verkauft.“ Daß es den in solchen Fischteichen
installierten Fischen vorzüglich erging und sie gelegentlich ein sehr
hohes Alter erreichten, können wir aus einer Notiz desselben Autors
entnehmen, worin es heißt: „Wie alt ein Fisch werden kann, das haben
wir erst neulich an einem merkwürdigen Beispiel gesehen. Pausilypum
ist ein nicht weit von Neapel gelegenes kampanisches Landhaus. Dort
wurde von Vedius Pollio ein Fisch in Cäsars Fischteiche gesetzt, der,
wie Annäus Seneca schreibt, erst 60 Jahre später starb, während zwei
ebenso alte derselben Art noch lebten.“ In solchen Teichen zu fischen
war ein besonderes Vergnügen der vornehmen Herrn. Dazu wurden oft
auserlesen kostbare Geräte gebraucht. So fischte Kaiser Nero nach den
Angaben seines Biographen Suetonius mit Netzen, deren Fäden purpur- und
scharlachfarbig und mit Gold verziert waren. Außer mit Netzen fischte
man im Altertum nach Oppian auch mit dem an einer Rute an einer Schnur
aus Pferdehaar befestigten Angelhaken, dem Dreizack und durch Anbringen
von Reusen. Durch letztere wurden besonders auch Aale gefangen. So
schreibt Aristoteles: „Um Aale zu fangen, setzt man ein irdenes Gefäß
mit Pökelfleisch hin und befestigt an dessen Mündung[S. 422] eine Reuse. Mit
dem Geruch von gebratenem Fett kann man alle Fische leicht anlocken.“
Von den Aalen (énchelys der Griechen und anguilla
der Römer) blieb die Fortpflanzung bis in unsere Tage unbekannt.
Aristoteles ließ sie aus Regenwürmern entstehen, welche sich von selbst
aus Schlamm und feuchter Erde erzeugen und fügt zur Bekräftigung seiner
Aussage bei: „Man hat auch gesehen, wie sich Aale von Regenwürmern
loslösten, teils werden sie auch bei Zerreißung derselben sichtbar.“
Spätere Autoren sahen Eingeweidewürmer der Aale für die junge Brut
an. Heute wissen wir, daß alle Süßwasseraale Weibchen sind, die in
allen Gewässern Europas vom 64.-65. Grade nördlicher Breite, auch
im Mittelländischen Meer, nicht aber in den Zuflüssen des Schwarzen
und Kaspischen Meeres, also auch nicht in der Donau, vorkommen. Sie
lieben vor allem tiefes Wasser mit schlammigem Grunde und liegen den
Winter über im Schlamme verborgen, bis sie wieder mit Beginn der
warmen Jahreszeit ihr bewegliches Räuberleben aufnehmen. Sie wachsen
sehr rasch, haben in 2–3 Jahren eine Länge von 50–60 cm, in
4–5 dagegen eine solche von 70–80 cm und ein Gewicht von 1,5
kg und darüber erreicht. Ihre Geschlechtsreife erlangen sie
aber nur im Meere. Alle Weibchen, die in geschlossenen Gewässern
leben und deshalb nicht ins Meer gelangen können, wachsen bis zu 1,5
m Länge bei einem Gewicht von 10 kg heran und sterben
schließlich, ohne sich fortgepflanzt zu haben. Die in offenen Gewässern
lebenden Weibchen dagegen wandern, sobald sie erwachsen sind, in
stürmischen Herbstnächten in Trupps von 20–40 Stück flußabwärts dem
Meere zu, wo die bedeutend kleineren, nur etwa 40 cm langen
männlichen Aale, die zeitlebens an den Meeresküsten verbleiben, ihrer
harren. Gemeinsam ziehen dann beide Geschlechter langsam der Tiefsee
zu, wobei ihre bis dahin unentwickelten Geschlechtsdrüsen auswachsen
und sie für das Dunkel der Meerestiefe geeignete große Augen von 1
cm Durchmesser erhalten. Hier pflanzen sie sich fort und sterben
dann vermutlich ab, wenigstens kehren sie nicht mehr an die Küsten
zurück. Die junge Aalbrut steigt im Frühjahr aus der Meerestiefe
von 1000 m und mehr allmählich gegen die Küsten, wobei die
durchsichtigen, schmalen Larven, die man früher als Leptocephalen,
d. h. Schmalköpfe, beschrieb und für eine besondere Tierart hielt, weil
sie den eigentlichen Aalen vollkommen unähnlich sind, schließlich
Aalgestalt erhalten. Weil diese Aallarven um so kleiner sind, je
weiter nach Süden sie im Atlantischen Ozean gefischt werden — die
kleinsten fing man südlich von den Azoren —[S. 423] glaubt Hjort annehmen
zu dürfen, daß die Laichplätze des Aales im südlichen, zentralen
Teil des Mittelländischen Ozeans sich finden und die Aallarven durch
Meeresströmungen und schließlich den Golfstrom an unsere Küsten
geführt werden. Im April und Mai wandern dann die jungen Weibchen
dicht aneinandergeschmiegt in langem Zuge, kein Hindernis achtend, ins
Süßwasser ein. Sie überkriechen Wehre und Stromschnellen, überwinden
sogar den Rheinfall bei Schaffhausen, was für diese Tierchen in
Anbetracht der Höhe des Falles eine erstaunliche Leistung ist, um
überall ins Quellgebiet der Flüsse zu gelangen. Im Verlaufe von 4–5
Jahren wachsen sie dann aus und vollziehen dann ihren Abstieg ins Meer
und die Tiefsee.
Überall wird auf dem Festlande die Aalfischerei eifrig betrieben,
da das Fleisch dieser Tiere äußerst wohlschmeckend ist und frisch,
geräuchert oder eingemacht einen nicht unwichtigen Handelsartikel
bildet. Von Holland aus wird speziell London mit dieser Ware versehen.
In Oberitalien sind in den Lagunen von Comacchio an der Pomündung
große Aalfischereien, die jährlich über 1 Million kg dieses
fetten Fischfleisches liefern. Zum Zwecke des Aalfanges sind dort ganze
Systeme von Schleusen, Kanälen und Rinnen angelegt. Diese letzteren,
die mit kleinen Querleisten versehen und innen mit Kies und Sand belegt
sind, dienen der Einwanderung der Aale, die dann, wenn sie erwachsen
zum Meere zurückwandern, abgefischt werden.
Umgekehrt wie beim Aal, der seine Heimat in der Tiefsee hat und sich
wenigstens in den weiblichen Vertretern im Süßwasser großfrißt, verhält
es sich mit dem Lachs oder Salm (Salmo salar), der
von seiner einstigen Heimat, dem Süßwasser, sich an die Meeresküste
begibt, um hier zu erwachsen, wobei er bis 1,5 m lang und 45
kg schwer wird. An dem im Meere reichgedeckten Tisch frißt er
sich rasch groß, um zur Fortpflanzung im Herbst in seinen Heimatfluß
zurückzuwandern und an sandigen Stellen der Quellzuflüsse zu laichen.
Wie die Eier des Aals für ihre Entwicklung die Ruhe der Tiefsee
verlangen, so ist umgekehrt bewegtes kaltes Wasser die Vorbedingung
für die normale Entwicklung der Lachsbrut. Ihm zuliebe legen deshalb
diese Wanderfische mit Aufwand einer Unsumme von Kraft den weiten Weg
vom Meer in das Quellgebiet der heimatlichen Ströme zurück, dabei
die größten Widerstände, wie Wehren und Wasserfälle, zu überwinden
suchend. Die paar Monate, die sie im Süßwasser verweilen, fressen sie
überhaupt nicht und benutzen das Fleisch besonders ihrer Seitenmuskeln
zur Bildung der Geschlechtsprodukte, die im Oktober und November[S. 424] zur
Ablage reif sind. Zum Laichen sucht das stets von mehreren Männchen
begleitete Weibchen seichte Stellen mit reinem Sand- und Kiesgrund
auf. Oft sind diese Stellen an den Quellbächen so wasserarm, daß darin
nicht einmal die Rückenflossen der laichenden Tiere ganz vom Wasser
bespült werden. In verschiedene mit dem Schwanz aufgewühlte flache
Mulden legt das Weibchen die alsbald von den Männchen besamten und
dadurch befruchteten Eier, die dann leicht mit Kies oder Sand bedeckt
werden. Nach Beendigung des Laichgeschäftes wandern die Lachse, von der
bedeutenden Kraftabgabe stark abgemagert, mit weichem, weißem Fleisch
zum Meere zurück. In diesem geringwertigen Zustande bezeichnet man sie
im Rhein als Lachs, während sie dort im frischgemästeten Stadium vor
der Ausbildung der Geschlechtsprodukte mit festem, rötlichem Fleisch
als „Salm“ bezeichnet werden. Abwärts matt und willenlos sich mehr von
der Strömung treiben lassend als eigentlich schwimmend, erreichen sie
das Meer, um sich darin nach so langem Fasten durch reichliches Fressen
wieder festes, rötliches Fleisch anzumästen. Im Laufe des Sommers
haben sie sich wieder so weit gekräftigt und Reservematerial für die
spätere Ausbildung der Geschlechtsprodukte in ihren Seitenmuskeln
aufgespeichert, daß sie abermals zur Fortpflanzung in die Quellflüsse
aufzusteigen vermögen. Hier wächst die Brut rasch heran, um im
zweiten Jahre, wenn die jungen Lachse bis 0,5 m lang geworden
sind, ihren Eltern nach dem Meere zu folgen. Bevor sie sich in die
salzige Flut begeben, halten sie sich in großen Scharen wochenlang
an den Flußmündungen auf und gehen erst allmählich vom Brackwasser
ins Salzwasser des Meeres über. Dieser gewiß für das weichhäutige
Tier nicht gleichgültige Übergang vom Süß- ins Salzwasser wurde für
diesen einst in den kalten Flüssen des Nordens heimischen Fisch
durch die starke Aussüßung der den Flußmündungen zunächstliegenden
Meeresabschnitte durch die gewaltigen Schmelzwässer der Eiszeit
erleichtert und damit die Änderung seiner Lebensweise angebahnt und
überhaupt ermöglicht.
Der Fang der Lachse geschieht in der verschiedensten Weise mit
mancherlei Garnen, in großen eisernen Reusen und Lachsfallen und durch
Speeren der durch Feuer herbeigezogenen Fische vom Boote aus. Früher
war dieser ausgezeichnete Speisefisch so häufig, daß er ein billiges
Volksnahrungsmittel bildete. Ja, er war so gemein auf den Tischen der
Bürgerhäuser, daß in den Städten am Rhein, z. B. in Basel, sich die
Mägde im Mittelalter ausbedangen, nicht mehr als[S. 425] sechsmal in der
Woche Salm essen zu müssen. Heute wäre man froh, wenn er billiger zu
bekommen wäre. Daß dies in diesen Gebieten nicht mehr geschieht, dafür
sorgen die mit Dampf betriebenen Fischereien der Holländer an den
Rheinmündungen, die den größten Teil der Salme direkt beim Einwandern
in den Fluß im besten Ernährungsstadium abfangen. Was nützt es auch
unter diesen Umständen, künstlich ausgebrütete Junglachse in die
Oberläufe des Rheins auszusetzen, wenn andere die Früchte all dieser
Bemühungen einheimsen! Nichtsdestoweniger hat in vielen Flüssen diese
künstliche Versorgung mit Lachsbrut gute Erfolge erzielt, so daß der
Fang dieses Edelfisches neuerdings wieder ausgiebiger geworden ist,
zumal wenn freundnachbarliche Abkommen sein zu ausgiebiges Wegfangen
schon an den Flußmündungen verhindern. In Nordamerika ist der Lachs
durch nahe Verwandte, im Gebiete der in den Stillen Ozean mündenden
Flüsse durch die schöngefärbte Regenbogenforelle vertreten, die
neuerdings auch bei uns mit Erfolg eingeführt wurde. Dort und in den
Flüssen Sibiriens spielen die Lachse volkswirtschaftlich eine große
Rolle und werden von einigen Orten der Weststaaten der Union in Menge
zur Herstellung einer geschätzten Fischkonserve verwendet.
Im Donaugebiet vertritt die Stelle des Lachses ein naher Verwandter,
der Huchen (Salmo hucho), der eine Länge von 1,5–2
m bei einem Gewicht von 20–50 kg erreicht. Im Gegensatz
zu jenem geht er aber nicht ins Meer, um sich dort großzufüttern,
sondern bleibt im Hauptstrom, um von Ende März bis Mai zum Laichen
in die Quellflüsse und Bäche hinaufzusteigen. Wie der Lachs sucht er
seichte, kiesige Stellen auf, wühlt dort mit dem Schwanz seichte Gruben
auf und ist während des Eierlegens so mit sich selbst beschäftigt, daß
man mit einem Kahne über ihn hinwegfahren kann, ohne ihn zu verjagen.
Sein weißliches Fleisch steht an Wohlgeschmack demjenigen des Lachses
merklich nach. Der Fang geschieht mit großen Garnen oder mit der Angel,
auch sticht man ihn, wenn er ruhig in der Tiefe steht. Da er weniger
kaltes Gebirgswasser als der Lachs zu seinem Gedeihen bedarf und in
Teichen, die beständigen Zufluß haben, gut gedeiht, würde er sich im
Gegensatz zu jenem Wanderer für die Teichwirtschaft eignen, wäre er
nicht ein so gefräßiger Raubfisch und erläge er nicht so leicht einer
bei Fischen häufigen Hautkrankheit.
Neben dem Lachs spielen auch die andern zeitlebens im Süßwasser
verbleibenden Verwandten, die verschiedenen Forellenarten,
eine wichtige Rolle beim Ertrag der einheimischen Gewässer. Noch
mehr[S. 426] als der Lachs werden sie, besonders die Bachforelle
(Salmo fario), in den verschiedenen Fischzuchtanstalten zu
Jungbrut erzogen und dann in die verschiedenen Bäche, die man wieder
zu bevölkern sucht, ausgesetzt. Vielfach werden sie auch in besonderen
Teichen mit kühlem Quellwasser durch Füttern mit gehackter Leber und
Lunge zu verkaufsfähigen „Portionenfischen“ von 250 g Gewicht
auferzogen. Dabei ist man bestrebt, durch künstliche Zuchtwahl eine
möglichst raschwüchsige Rasse zu erhalten, die schon in zwei statt wie
bisher meist erst in drei Jahren die gewünschte Größe erreicht. Ließe
man sie länger leben, so würden sie schließlich ein Gewicht von 5–10
kg und darüber erreichen. Solche Riesen sind aber in unsern
Gewässern äußerst selten, da sie bei ihrer enormen Freßgier viel früher
dem Menschen zur Beute fallen.
Da die Bachforelle klares, sauerstoffreiches fließendes Wasser liebt,
findet sie sich in allen Gebirgswässern bis zum Alpengürtel hinauf. Sie
laicht von Mitte Oktober bis zu Anfang Dezember in seichtem Wasser auf
Kiesgrund oder hinter größeren Steinen, da, wo eine rasche Strömung
sich bemerkbar macht, in eine seichte, durch lebhafte Bewegungen mit
dem Schwanze erzeugte Vertiefung und bedeckt nachher die gleich nach
dem Legen vom Männchen befruchteten Eier durch weitere Bewegungen mit
dem Schwanze mit Sand und feinem Kies, um sie dann ihrem Schicksal zu
überlassen. Nach ungefähr sechs Wochen entschlüpfen die Jungen der
Eihülle, verweilen mehr oder weniger regungslos auf der Brutstätte, bis
sie ihren angehängten Dottersack aufgezehrt haben und ein Bedürfnis
nach Nahrungszufuhr verspüren, dem sie zunächst durch kleine und später
durch immer größere Wassertiere zu genügen suchen.
Viel größer als die Bachforelle wird die Seeforelle (Salmo
lacustris), von der gelegentlich gewaltige Riesen gefangen werden.
Während Forellen gelegentlich auch sehr groß werden — so hat man nach
einem Zeitungsbericht als die größten bisher in europäischen Gewässern
beobachteten in der Etsch bei Meran zwei Exemplare gefangen, von denen
das größere 99 cm lang war und 32 Pfund wog, das kleinere immer
noch 27 Pfund schwer war — ist dies bei der Seeforelle weit häufiger
der Fall. So hat Prof. Lunel in Genf solche aus dem Genfer See gesehen,
die 15 kg Gewicht und 110 cm Länge besaßen. Im Museum von
Genf wird das Skelett einer Seeforelle aufbewahrt, die 131 cm
lang ist und im Leben jedenfalls bedeutend über 15 kg gewogen
haben muß. Ein anderer Genfer Gelehrter, Jurina, schrieb[S. 427] 1815, daß
seit Beginn des 18. Jahrhunderts keine Seeforellen von einem Gewicht
über 17,6 kg gefangen worden seien. Er gibt gleichzeitig
das Maximalgewicht dieser Tiere zu 19,8 kg an. Gregor von
Tours spricht von bis 1 Zentner schweren Forellen, und der Züricher
Naturforscher J. J. Wagner meldet in seiner Historia naturalis
helvetica curiosa von 1680, daß Anno 1663 eine 62 Pfund schwere
Forelle von Genf nach Amsterdam verschickt wurde. Vor wenigen Jahren
wurde eine 40pfündige Forelle von Fischern bei St. Gingolph im Genfer
See gefangen. Allerdings gehören heute Exemplare von annähernd 30 Pfund
auch im Genfer See zu den Seltenheiten. Auch die Seeforelle steigt
im Herbst zum Laichen aus den Seen in die betreffenden Quellflüsse
hinauf. Ihr Fang ist bedeutend und ihr Fleisch wird sehr geschätzt. Ihr
ähnlich ist die Lachsforelle (Salmo trutta), die noch
etwas größer, nämlich statt 80 cm bis 1 m Länge und ein
Gewicht von 15 kg erreicht. Sie geht wie der Lachs ins Meer, um
dort heranzuwachsen und dann im Frühsommer in die Flüsse aufzusteigen,
um darin im November und Dezember zu laichen. Da sie nicht so weit
flußaufwärts geht wie der Lachs, wird sie im Oberlauf der Ströme nicht
mehr angetroffen.
Ein Relikt der Eiszeit ist der Saibling oder die
Rotforelle (Salmo salvelinus) der Gebirgsseen, die in
der Regel nicht einmal während der Laichzeit in den einmündenden
Flüssen emporsteigt und wie die Renken oder Blaufelchen
(Coregonus wartmanni) mit nicht minder geschätztem Fleisch
sich in den tiefen Gründen der betreffenden Seen aufhält, um sich im
November zu seichteren Uferstellen zu erheben und ihren Laich dort
abzusetzen, wobei sie dann durch Fischen mit Netzen gefangen wird.
In denselben Seen, die die Blaufelchen beherbergen, lebt die
Bodenrenke (Coregonus fera), die größer als jene, nämlich
60 cm lang wird und ein Gewicht von über 3 kg erreicht.
Sie gehört zu den besten Süßwasserfischen und ist um so wichtiger,
als sie das ganze Jahr hindurch, selbst mitten im Winter, wenn die
Blaufelchen nicht zu haben sind, gefischt werden kann. Man fängt sie
im Winter mit Garnen, im Sommer aber an der Angel; doch stirbt sie,
sobald sie aus dem Wasser gezogen wird. Ein mit ihr fast identischer,
die Tiefen der großen Seen Norddeutschlands bewohnender Salmonide
ist die Maräne (Coregonus maraena), die zum Laichen
Mitte November nach den seichten Stellen unweit der Ufer kommt und
hauptsächlich im Winter mit großen Netzen gefangen wird. Auch diese
Fische sterben[S. 428] außerhalb des Wassers sofort ab, lassen sich aber
doch, in Eis verpackt, ziemlich weit versenden oder werden, wie die
Bodenrenke, eingesalzen und geräuchert in den Handel gebracht.
Am tiefsten unter allen Renken, nämlich wenigstens in 70–90
m Tiefe, lebt in unsern Seen der Kilch (Coregonus
hiemalis), auch Kropffelchen genannt, weil diesem kleinen,
höchstens 40 cm lang werdenden Fisch beim Heraufgezogenwerden
im Netz aus so großer Tiefe die von mehr als 7,5 auf 1 Atmosphäre
versetzte Schwimmblase so stark ausgedehnt wird, daß er trommelsüchtig
wird. Nur gegen Ende September kommt er in höhere Schichten, um hier zu
laichen.
Eine für gewöhnlich im Meere lebende Renke, die im Mai aus der Nord-
und Ostsee in die Flüsse hinaufsteigt, um darin zu laichen, ist
der bis 60 cm lange und 1 kg schwere Schnäpel
(Coregonus oxyrhynchus), im Rhein, wo er früher häufig war, aber
jetzt sehr selten geworden ist, Maifisch genannt. Er steigt
aber lange nicht so weit in die Ströme hinauf als der Lachs und kehrt
gleich nach dem erst von September bis Dezember erfolgenden Laichen ins
Meer zurück. Dahin folgen ihm auch die Jungen, wenn sie 8 cm
Länge erreicht haben, und kehren nach erlangter Reife zur Fortpflanzung
wieder in diejenigen Flüsse hinauf, in denen sie ihre Jugend
verbrachten. Ihr zartes, schmackhaftes Fleisch wird sehr geschätzt und
frisch wie eingesalzen und geräuchert gegessen. Dieser Fisch bildet in
ganz Norddeutschland einen wichtigen Gegenstand des Fanges.
In denselben Gewässern wie die Forelle, obschon sie ein weniger großes
Sauerstoffbedürfnis als diese hat, findet sich in allen Flüssen
des nördlichen Europa und Asiens die schön rot gefärbte, bis 60
cm lange und 1,5 kg schwere Äsche (Thymallus
vulgaris). Ähnlich der Forelle schwimmt sie ungemein rasch und
springt nach vorüberfliegenden Kerfen über den Wasserspiegel empor, so
daß sie gleich jener mit der künstlichen Fliege an der Angel gefangen
werden kann. Sie laicht im April und Mai, wobei die Tiere auf sandigem
Grunde wie ihre Verwandten mit der Schwanzflosse seichte Gruben
auswerfen, die nach der Ablage des Laichs wieder mit Sand zugedeckt
werden. Ihr Fleisch wird dem der Forelle an Güte gleichgeschätzt, ist
aber weniger haltbar als jenes, weshalb sie weniger auf den Markt
gebracht wird, auch bis jetzt nicht zur Zucht in Fischteichen benutzt
wurde, obschon sie sich so gut als die Forelle dazu eignen würde.
Gleich dem Lachs und Schnäpel aus der Familie der Salmoniden treibt es
der zur überaus altertümlichen Familie der Schmelzschupper[S. 429] gehörende
Stör (Accipenser sturio), der 2–6 m lang wird und
im Atlantischen Ozean, in der Nord- und Ostsee und im Mittelländischen
Meer, wie auch an der Ostküste Nordamerikas, nicht aber im Schwarzen
Meer in mittleren Tiefen lebt, um sich von den verschiedensten
Kleintieren zu ernähren, die er vermittelst seiner spitzen Schnauze aus
dem Schlamme aufwühlt und mit den vorstreckbaren Lippen erfaßt. Erst
zur Laichzeit im Frühjahr kommt er in höhere Wasserschichten herauf
und zieht von da den Flußmündungen zu, in welche er eindringt und
weit aufwärts schwimmt, um im Quellgebiet zu laichen und dann alsbald
wieder dem Meere zuzustreben. Im Schwarzen und Kaspischen Meer und
deren Zuflüssen wird der Stör durch die beiden nahe verwandten Arten,
den Sterlet (Accipenser ruthenus) und den Hausen
(Acc. huso) ersetzt. Ersterer wird selten größer als 1 m
lang bei einem Gewicht von 12 kg, während letzterer — von den
Russen belúga genannt — bis 15 m lang und 1000–1600 kg
schwer wird. Weil ihr Fleisch, besonders das des Sterlet, sehr
wohlschmeckend ist, wird von jeher eifrig Jagd auf sie gemacht.
Plinius sagt in seiner Naturgeschichte, die Störe seien bei den alten
Griechen und Römern überaus geschätzt gewesen, wurden aber zu seiner
Zeit wenig geachtet, obwohl sie selten seien. Nach dem Griechen
Athenaios, um 200 n. Chr., kostete ein Fisch dieser Art 1000 attische
Drachmen (= 7500 Mark), was ein unerhörter Preis ist. Man aß ihn
unter Flötenspiel, wobei nicht nur die Gäste, sondern auch die Diener
bekränzt waren. In Deutschland hat der Störfang nur noch geringe
Bedeutung. An der Elbe und Weser erbeutet man jährlich höchstens
einige tausend Störe, auch in der unteren Donau, die früher Ungarn
und Österreich mit Störfleisch und Kaviar versorgte, empfindet man
schwer die Folgen der bisherigen sinnlosen Fischerei, so daß eine
Schonzeit eingeräumt werden sollte, damit sich der Fisch wieder erholen
kann. Noch sehr ausgiebig ist der Störfang in Rußland, wo an allen
in das Schwarze und Kaspische Meer einmündenden Flüssen Fangplätze
liegen, die jährlich über 4 Millionen Rubel eintragen. Außer dem
wohlschmeckenden Fleisch gewinnt man aus den Eiern Kaviar und
aus der Schwimmblase einen trefflichen Leim. Den besten Kaviar liefern
die kleineren Arten. Die Eierstöcke, aus welchen man Kaviar gewinnen
will, werden zuerst mit Ruten gepeitscht und dann durch Siebe gedrückt,
um die Eier von den sie umgebenden Häuten des Eierstocks zu lösen.
Dann werden sie gesalzen, wobei das Salz mit den Händen in die Masse
hineingeknetet wird. In Fässern ver[S. 430]packt, kommt dann der Kaviar in
den Handel, um wegen seiner Güte überall willige Abnehmer zu finden.
Der Name Kaviar kommt übrigens von der italienischen Bezeichnung für
den ähnlich eingesalzen genossenen Rogen des Thunfischs caviale
und wurde auf den eingesalzenen Rogen der Störarten übertragen, der
russisch ikrá genannt wird.
Unter den Edelfischen nehmen die verschiedenen Karpfenarten
eine wichtige Stellung im Haushalte des Menschen ein. Der
Teichkarpfen (Cyprinus carpio), der bei uns dank den
Fastengeboten der katholischen Kirche ganz wesentlich durch die
Bemühungen der Klostergeistlichen geradezu zu einem Haustier erhoben
wurde und in allerlei Farben- und Schuppenvarietäten in besonderen
Teichen gezüchtet wird, war ursprünglich dem Kaspischen und Schwarzen
Meer und deren Zuflüssen eigentümlich. Er findet sich dort und weiter
gegen Mittelasien hinein noch in beträchtlicher Menge wild, während
er in den Gewässern Europas westlich und nördlich davon offenkundig
eingeführt ist und in ihnen teilweise verwilderte. In seiner Heimat
hält er ebensogut wie im Süßwasser auch in den salzreichsten
Sümpfen aus. Im Sommer trifft man ihn vorzugsweise in den seichten
Küstengewässern; im Herbst steigt er dann vom Meere aus die Flüsse
hinauf, um hier zu überwintern. Seine hauptsächlichste Nahrung besteht
vorwiegend aus allerlei kleinem Getier, besonders Würmern, daneben auch
aus vermodernden Pflanzenstoffen. Er laicht am liebsten in stehendem
oder ruhigfließendem Wasser mit schlammigem Grund und gedeiht nur
dann, wenn das von ihm bewohnte Wasser viel den Strahlen der Sonne
ausgesetzt ist und Zuflüsse weichen Wassers hat. Bei genügender Nahrung
wird er schon im dritten Lebensjahre fortpflanzungsfähig. Sobald er
sein Hochzeitskleid anlegt, wird er wanderlustig und versucht, soweit
es ihm möglich ist, flußaufwärts zu steigen und überwindet dabei
bedeutende Schwierigkeiten. Zum Laichen sucht er mit Wasserpflanzen
dicht bewachsene Stellen aus, und zwar legt das Weibchen im fünften
Jahre bereits gegen 300000 Eier; später kann sich diese Anzahl noch
verdoppeln. Er erreicht die Länge von 1 bis 1,5 m und ein
Gewicht von 15–20 kg.
Die erste sichere Erwähnung des Karpfens finden wir bei Kassiodor,
dem Geheimschreiber des großen Ostgotenkönigs Theodorich (475 bis
526), der in einem scharfen Rundschreiben an die verschiedenen
Provinzialstatthalter ihnen vorwirft, sie sorgten durchaus nicht
angemessen dafür, daß des Königs Tisch auch königlich beschickt
werde. Die Stelle lautet wörtlich: „Der Privatmann mag essen, was ihm
die[S. 431] Gelegenheit bietet; auf fürstliche Tafeln aber gehören seltene
Delikatessen, wie z. B. der in der Donau lebende Fisch carpa.“
Vermutlich wird dieser Fisch auch in den im mittelalterlichen Latein
vivaria genannten Süßwasserteichen mit Fischen der Landgüter
Karls des Großen in erster Linie gehalten worden sein. Jedenfalls
ist in einem Glossar des 10. Jahrhunderts mehrfach von ihm als
karpho die Rede. Im 13. Jahrhundert spricht der Geistliche
Vincentius von Beauvais im Speculum naturale vom Fisch
corpera, womit nur der Karpfen gemeint sein kann, und der Mönch
Cäsarius von Heisterbach sagt in seinen Dialogi miraculorum,
„Bruder Simon habe den Teufel gesehen und dieser habe Helm und Panzer
getragen, beide mit Schuppen, wie die des Fisches carpo.“ Olaus
Magnus sagt um 1530 ausdrücklich, es gebe im Norden keine Karpfen außer
vom Menschen eingeführte und in künstlichen Teichen gehaltene. In
Schweden würden sie wie die Karauschen auch mit eingeweichten Erbsen
und dergleichen gefüttert.
Überall bei Neugründungen von Klöstern sorgte man dafür, daß die Patres
für die Fastentage einen wohlgefüllten Karpfenteich zur Verfügung
hatten. So ist dieser Fisch durch menschliche Hilfe überall durch
Europa gewandert und in der Folge an vielen Orten verwildert. Besondere
Wichtigkeit hatte die Karpfenzucht schon im 15. Jahrhundert in Böhmen,
Polen und Holstein erlangt. Nach dem Zeugnis des Johannes Dubravius,
Bischofs von Olmütz, trieb man in Polen den Luxus so weit, daß man in
der Nähe der Karpfenteiche besondere Eishäuser besaß, um das Wasser
derselben bei zu großer Erhitzung kühlen zu können. Daß solches
geschah, beweist, daß neben den Karpfen wohl auch Forellen, die nur
in kaltem Wasser gedeihen, darin gehalten wurden. Wenn Bock in seiner
1782 in Dessau erschienenen Naturgeschichte Ost- und Westpreußens
berichtet, daß erst Kurt von Nostiz 1589 den Fisch nach Ostpreußen
gebracht habe, so kann es sich wohl nur um eine lokale Neueinführung
handeln; denn Voigt spricht schon um 1440 von Karpfenteichen in jenem
Lande. Eher will Ed. Hahn die Möglichkeit zugeben, daß der dänische
Staatsmann und große Ökonom Peter Oxe den Karpfen von Deutschland aus
in Dänemark einführte. Der Fisch geht auch jetzt kaum über Südschweden
hinaus, wird auch nur im Süden Norwegens angetroffen, wo er infolge
der ungünstigen Lebensbedingungen überhaupt kleiner bleibt. Jedenfalls
ist auch die vielfach zitierte Angabe falsch, daß der Karpfen erst
1514 durch Leonard Mascall von Plumstead nach England gekommen sei.[S. 432]
Während allerdings der Dichter Chaucer in seinen um 1375 geschriebenen
Canterbury tales nur breme and luce in stew, also Brassen
und Hechte im Vorratsteiche kennt, so kommt der Karpfen schon 1504
bei Bischof Washam unter Heinrich VII. vor. Nach Irland sollen
die Karpfen durch Jakob I., den despotischen, dabei schwachen
und eitlen Sohn Maria Stuarts und Darnleys (geboren 1566, nach der
erzwungenen Abdankung seiner Mutter 1567 zum König von Schottland
gekrönt, von 1603–1625 König von England) gekommen sein. In Schottland
gedeihen sie nicht recht und bleiben oft unfruchtbar, jedenfalls
infolge des zu kalten Wassers. Deshalb werden sie in jenem Lande
noch heute nur selten gehalten. Erst in der zweiten Hälfte des 15.
Jahrhunderts kam der Karpfen nach Frankreich und Spanien, wo er als
willkommene, leicht zu haltende Fastenspeise in dem klerikalen Lande
bald größere Bedeutung erlangte.
Am Schwarzen und Kaspischen Meer findet sich der Karpfen, wie gesagt,
immer noch zahlreich; er ist aber dort, trotz den Bemühungen Peters
des Großen (geb. 1672, reg. 1676–1725), wild geblieben und wird vom
Menschen nicht gezüchtet. Auch nach dem Innern Rußlands hat er sich
nicht als Zuchtfisch verbreitet. Hingegen wird er in Ungarn und
Galizien vielfach gezogen. In den 1840er Jahren wurde er von Frankreich
her nach den Neu-Englandstaaten Nordamerikas gebracht, als der dort
ursprünglich vorhandene Fischreichtum durch die den Amerikanern leider
bisher eigentümliche Raubwirtschaft arg gelitten hatte und man sich
nach leicht zu haltenden Ersatzfischen umsah. Nach Kalifornien kam
er erst 1872 und wird dort mit Vorliebe verwendet, um die riesigen
Staubecken für die Bewässerungs- und Bergwerksanlagen mit Nutzfischen
zu bevölkern. Nach dem katholischen Südamerika kam er viel früher, hat
sich aber infolge der Indolenz der Bevölkerung nur an wenigen Orten
eingebürgert. Neuerdings ist er wieder mehrfach eingeführt worden,
so auch in Chile und Argentinien. Allerdings sollen die sogenannten
Karpfen der Musterfarm der argentinischen Republik nach Philippi in die
braune Urform zurückgeschlagene Goldfische, also Karauschen und nicht
echte Karpfen sein.
Tafel 55.
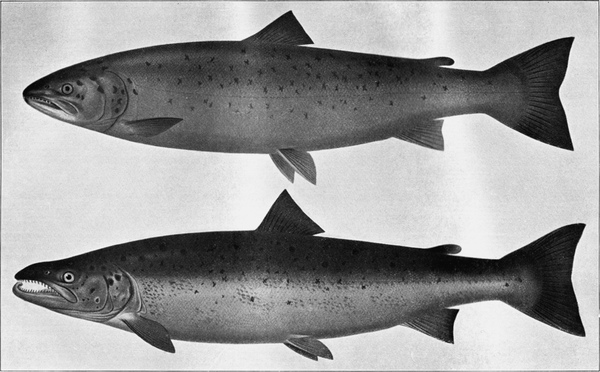
Der Lachs (Trutta salar). Oben
das Weibchen, unten das Männchen.
(Nach Prof. B. Hofer, Die Süßwasserfische Mitteleuropas.)
⇒
GRÖSSERES BILD
Tafel 56.

Der Hecht (Esox lucius).

Der Flußbarsch (Perca fluviatilis).
(Unretuschierte Naturaufnahmen von W. B. Johnson.)
Tafel 57.

Der Aal (Anguilla vulgaris).
(Unretuschierte Naturaufnahme von W. B. und S. C. Johnson.)
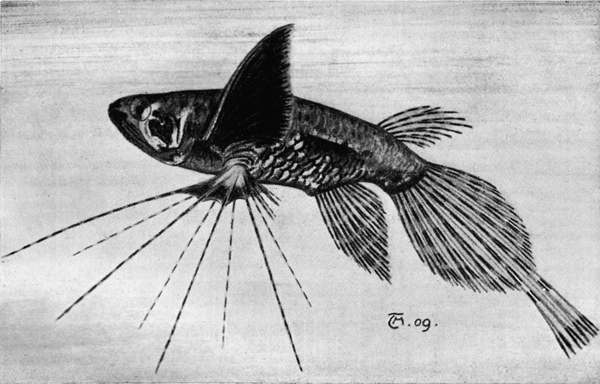
Der Schmetterlingsfisch (Pantodon
buchholzi), ein beliebter Zierfisch unserer Aquarien.
(Aus den Blättern für Aquarien- und Terrarienkunde.)
Tafel 58.

Der Stör (Accipenser sturio).
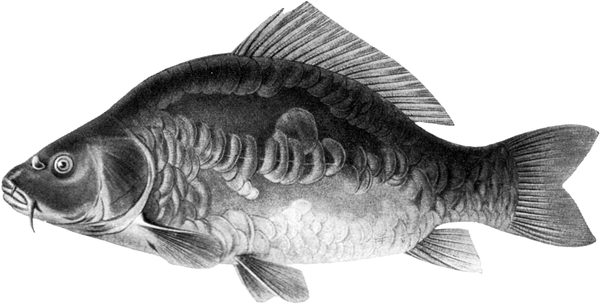
Der Spiegelkarpfen (Cyprinus carpio).

Abfischen eines künstlich angelegten Karpfenteiches in
Böhmen.
Im Herbst werden die seichten Gewässer abgelassen, so daß die
Karpfen gezwungen sind, sich an der tiefsten Stelle zu sammeln. Dort können sie
leicht gefangen werden. Die großen werden als Speisefische verkauft, die kleinen
in sogenannten Hälterteichen überwintert.
Bei uns und in den Gewässern Nordamerikas, wie auch anderer
Kulturländer, in denen sich Europäer in größerer Zahl niederließen,
wird der Karpfen heute als einer der beliebtesten Speisefische
in großer Menge gezüchtet. Da man erkannt hat, daß er um so
wohlschmeckender ist, je rascher er wächst, so haben die Fischzüchter,
nach dem Vorgange des Schlesiers Dubisch, ein Verfahren gefunden, nach
welchem[S. 433] die Karpfen in kürzester Zeit den höchsten Nutzungswert
erreichen. Dabei wird die Karpfenbrut schon eine Woche nach dem
Ausschlüpfen aus den Eiern mit feinen Gazenetzen aus dem sogenannten
Streichteich herausgefischt und in besondere Teiche gebracht, die
Streckteiche heißen. In ihnen gibt man etwa 25000 der winzigen
Fischchen auf einen Hektar Wasserfläche. Schon nach vier Wochen werden
die Fische aus diesem Wasser herausgenommen und in geringerer Zahl —
etwa 1000 Stück pro Hektar — in andere Teiche übertragen, in denen
sie bis zum folgenden Frühjahr bleiben, um dann wieder umgesetzt zu
werden, und zwar 500 Stück pro Hektar. Nachdem sie hier ein ganzes Jahr
verblieben sind, kommen sie in den letzten Teich, den Abwachsteich, in
welchem man nur 200 Stück auf den Hektar rechnet. Aus diesem Teiche
werden sie im Herbst als marktfähige Ware herausgefischt, und zwar
wiegen sie dann durchschnittlich 1 kg und darüber. Sie bringen
also einen ziemlichen Ertrag, da der Preis für sie etwa 2 Mark pro
kg beträgt. Durch die fortgesetzte Züchtung sind verschiedene
Spielarten des Fisches entstanden, so der Lederkarpfen, der gar keine
Schuppen mehr trägt, der Spiegelkarpfen, der an jeder Körperseite nur
eine Reihe sehr großer Schuppen besitzt, dann der durch einen rötlichen
Schimmer und lachsfarbenes Fleisch ausgezeichnete Goldkarpfen, der
Blaukarpfen u. a. In den Gewässern von Schwaben, Bayern und Böhmen wird
mit Vorliebe die als Karpfenkönigin bezeichnete Abart, im Donaugebiet
und den ungarischen Seen dagegen der Spitzkarpfen gezogen.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde der Karpfen auch in
Australien angesiedelt. Schon längst ist er dagegen ist in Ostasien
heimisch, und zwar als uraltes einheimisches Zuchtprodukt der Chinesen,
von dem, wie von der Karausche, mehrere buntfarbige Kulturrassen
existieren. Die Fischzucht in Teichen ist in China uralt und wird schon
im Schi-king, d. h. dem Buch der Lieder, einer von Konfutse (550–478
v. Chr.) veranstalteten Sammlung von Liedern, die teilweise in das 18.
Jahrhundert v. Chr. zurückreichen, erwähnt. Genauere Aufzeichnungen
über die Art der Fischzucht sind allerdings auch in den Annalen dieses
uralten Kulturvolkes erst späteren Datums. So wird uns als der älteste
Fischzüchter Tao-tsu-kung genannt. Dieser lebte im 5. Jahrhundert
v. Chr. und verfuhr dabei folgendermaßen. Er grub einen Teich, der
die Größe eines Morgens (gegen 30 Ar) besaß und neun kleine Eilande
umfaßte. Darein setzte er 20 Karpfenweibchen von 3 Fuß Länge und 4
Karpfenmännchen gleicher Größe[S. 434] aus, und zwar im März. Ein Jahr darauf
waren schon 5000 Fische von einem, 10000 von zwei und 15000 von drei
Fuß Länge im Teiche. Im dritten Jahre hatte sich ihre Zahl bereits
verzehn- und verzwanzigfacht. Die neun Inselchen, die der Fischzüchter
Tao-tsu-kung im Teiche gebaut hatte, sollten den Fischen vortäuschen,
sie befänden sich in einem großen Meere und schwämmen an Festländern
vorbei. Noch heute werden Karpfen und andere Süßwasserfische in Menge
in China gezüchtet. Man füttert die Brut mit Eidotter, feingestoßener
Kleie und pulverisierten Bohnen. Wenn die Fische eine bestimmte Größe
erreicht haben, werden sie in flache Teiche gesetzt, deren Ufer von
ganz bestimmten Bäumen und Sträuchern bepflanzt werden. So glaubt man
beispielsweise, daß der am Morgen nach kühler Nacht von den Blättern
der Platane in den Teich tropfende Tau von heilsamer Wirkung für
das Fischvolk sei. Mancher Europäer, der im Innern und besonders im
Süden Chinas einen idyllisch gelegenen und von prächtigen Bäumen und
Sträuchern eingefaßten Fischteich bewundert, spendet dem Schönheitssinn
der naturfrohen Chinesen unwillkürlich Lob, ohne zu wissen, daß die
reizvolle Umgebung des Teiches nur abergläubischen Gründen ihre
Entstehung verdankt.
Ebenso alt oder vielleicht noch älter als der Teichkarpfen ist in
China die Teichkarausche, die man als hochgezüchteten Zierfisch
auch bei uns unter dem Namen Gold- oder Silberfisch
(Carassius auratus) eingeführt hat. Für die Deutschen gab
zuerst Kämpfer in seiner 1777 herausgegebenen Beschreibung Japans
eine Schilderung dieses von den Japanern King-jo genannten, meist
roten, am Schwanze aber leuchtend goldgelben Zierfisches, der in Japan
und China viel in Teichen gehalten und gewissermaßen als Haustier
betrachtet wird. Er ist aber nicht in Japan, sondern in dem viel
früher zu hoher Kulturblüte emporgestiegenen China zum Kulturfisch
erhoben und nicht nur in bunten Farben, sondern auch in den bizarrsten
Formen mit gedrängtem Körper, dickem Kopf, weit hervorquellenden
großen Glotzaugen und stark verlängerten und verbreiterten Flossen
gezüchtet worden. Meist wird die Provinz Tsche-Kiang am östlichsten
Zipfel Chinas, südlich vom Jang-tse-kiang und der Stadt Schang-hai,
als Ursprungsgebiet der chinesischen Karauschenzucht angesehen,
seitdem der Holländer Nieuhof in seiner 1665 in Amsterdam publizierten
beschryving von Sina bei Gelegenheit der Gesandtschaft an den Kaiser
von China, an der er teilnahm, solche Behauptung aufgestellt hat.
Doch ist dies keineswegs sicher. Wir wissen nur, daß sie am frühesten
im eigentlichen Herzen[S. 435] Chinas gezüchtet wurden; und zwar finden wir
sie nach chinesischen Quellen zuerst im Jahre 540 n. Chr. erwähnt.
Ums Jahr 960 war ihre Zucht im ganzen Reiche der Mitte verbreitet
und gelangte dank den regen Kulturbeziehungen frühe auch nach dem
Sonnenaufgangslande Nippon, d. h. Japan, wo sie bald ebenso populär als
in ihrer ursprünglichen Heimat wurde. Die schätzenswerte Eigenschaft
der Karauschen, in sehr kleinen Wasserbecken gut zu gedeihen und
darin sogar zur Fortpflanzung zu schreiten, begünstigte ganz
wesentlich ihre rasche Ausbreitung und ihre Haltung in den von den
Japanern so geliebten Miniaturgärtchen in vielfach geradezu winzigen
Wasserbehältern.
Nach Brehm gelangte der Goldfisch aus China wahrscheinlich zuerst
nach Portugal und verbreitete sich, nachdem er hier eingebürgert war,
allmählich weiter über Europa. Das Jahr der Einführung desselben wird
von den Schriftstellern verschieden angegeben. Einzelne nennen 1611,
andere 1691, wieder andere 1728. Diese Zahlen wären sehr wohl möglich,
da sich die Portugiesen schon um 1522 um Makao festsetzten und in regen
Tauschverkehr mit den Chinesen traten. Da lag es ja sehr nahe, diesen
leicht in kleinen Behältern in wenig durchlüftetem Wasser zu haltenden
Zierfisch auf ihren Schiffen weithin zu befördern. Eduard Hahn aber ist
in seinem Haustierbuche anderer Meinung. Er hält die von Markus Bloch
in seiner 1782 erschienenen Naturgeschichte der Fische Deutschlands
angegebene Jahreszahl 1611 als Termin der Einführung nach Europa für
einen Druckfehler, statt des richtigeren 1691. Die Zahl 1611 sei auch
viel zu früh für die Ankunft des Goldfisches in Europa; denn bei der
langsamen und mühseligen Schiffahrt, wie sie damals bestand, sei wohl
an einen Transport von China bis Europa ohne Zwischenstation nicht zu
denken. Als eine solche Zwischenstation ergebe sich naturgemäß Batavia,
dessen reiche chinesische Kaufleute es ebenso wie die Holländer, die
sich 1594 nach Verdrängung der seit 1579 dort ansässig gewordenen
Portugiesen auf Java festsetzten, allerdings erst 1677 bedeutende
Gebiete des Landes eroberten und schließlich die ganze Insel unter
ihre Botmäßigkeit brachten, liebten, sich mit dem Glanze und Luxus
ihrer einheimischen Kultur zu umgeben. In seinem 1726 in Dordrecht
erschienenen Buche über Niederländisch Indien erwähnt Valentijn den
Fisch als in Batavia gezogen. Die nächsten Stationen von dort her
auf dem Wege nach Europa seien wohl Mauritius und dann St. Helena
gewesen. Von hier seien dann nach Pennant die ersten Goldfische 1691
nach England gekommen; doch scheinen sie sich hier nicht fortgepflanzt
zu haben.[S. 436] Nachher kamen sie von dorther öfter nach England, so nach
Petiverius mehrfach zwischen 1711 und 1718. Die ersten Goldfische, die
zur Fortpflanzung zu bringen waren, gelangten 1728 nach London, wohin
sie eines der Schiffe des damaligen Lordmajors, Sir Decker, brachte.
Auch von diesen Fischen wird ausdrücklich bezeugt, sie seien von St.
Helena gekommen. Diese Goldfische scheinen dann den ersten Grundstock
des englischen und später auch des allgemein europäischen Bestandes
abgegeben zu haben.
Die Goldfische, die in der Folge durch Decker in England verteilt
wurden, dann durch seine Vermittlung auch nach seiner Heimat Holland,
z. B. in den berühmten Cliffordschen Garten in der Universitätsstadt
Leiden, an dem einst Karl von Linné seine ersten botanischen Studien
gemacht hatte, gelangten, schritten an ihrem neuen Wohnorte ganz
ausnahmsweise zur Fortpflanzung. Nur diejenigen, die ein naturkundiger
Arzt in Harlem bekommen hatte, pflanzten sich anfangs spärlich, dann
aber reichlicher fort. Von ihm erhielt Baster in Harlem 1758 junge
Goldfische, die er mit großer Sorgfalt großzog. Als er 1775 starb,
verkaufte die Witwe den Bestand um einen hohen Preis; denn diese Tiere
waren damals noch sehr selten und kaum bei Privatleuten zu finden.
Deshalb glaubte auch die französisch-ostindische Handelsgesellschaft
ein wertvolles Geschenk zu machen, als sie der allmächtigen Maitresse
Ludwigs XV. von Frankreich, der Marquise de Pompadour, um
1760 einige Goldfische überreichen ließ. Diese Fische scheinen aus
dem botanischen Garten gekommen zu sein, den die Compagnie in ihrem
Hafenplatz Lorient im Departement Morbihan in der Bretagne besaß.
Allmählich verbreiteten sich ihre Nachkommen über Frankreich und die
angrenzenden Länder des europäischen Kontinents.
Nach der wissenschaftlichen Beschreibung, die Linné von ihnen gab,
scheinen die ersten Goldfische, die nach Leiden gelangten, sogenannte
Straußschwänze gewesen zu sein. Auch die Fische Basters gehörten zu
dieser Rasse, die in der Folge bald in ganz Holland Mode wurde. Um 1750
sagt der Engländer Edwards in seiner Geschichte der Vögel, daß alle aus
St. Helena nach Europa fahrenden Schiffe Goldfische mit sich führen.
1749 bezog die schwedisch-ostindische Compagnie eine Sendung lebender
Goldfische aus Kanton. Damals waren sie nicht nur in Schweden, sondern
selbst in England noch eine solche Neuigkeit, daß Naturforscher,
wie Gilbert White, der Verfasser einer sehr guten Naturgeschichte,
stundenlang vor sie hinsitzen konnten, um sie zu beobachten. Noch
John Bell of Antermony hatte sie, als er 1763[S. 437] seinen Reisebericht in
Glasgow publizierte, nur in China gesehen, wo er 1720 gewesen war.
1808 sah sie der französische Naturforscher Bory de St. Vincent bei
Gelegenheit der Besetzung Spaniens durch die Franzosen in einem Teiche
des Schlosses Alcazar bei Sevilla. Sonst sind keine Nachrichten über
diesen Zierfisch aus früherer Zeit aus jenem Lande auf uns gekommen.
Gegenwärtig hat sich der Goldfisch über die ganze Erde verbreitet,
soweit sie von gebildeten Menschen bewohnt wird. Überall ist er in
den warmen Teilen der gemäßigten Zone wirklich heimisch geworden und
an vielen Orten verwildert, besonders auf Inseln, auf denen ihm nur
eine schwache Konkurrenz an Süßwasserfischen gegenüberstand. So bildet
er heute den wichtigsten Süßwasserfisch auf den Azoren und belebt in
großer Zahl die Gewässer von Madeira, Réunion und Mauritius; dann ist
er auch in Algerien, Portugal, auf Java, den Philippinen und Hawaii
verwildert. Hier ist er überall mehr oder weniger goldig gefärbt
geblieben; nur in Chile, wo er ebenfalls verwilderte, ist er in die
braune Urform zurückgeschlagen.
In ihrer Heimat China ist der Goldfisch durchaus nicht bloß Zierfisch,
sondern vor allem auch Nutzfisch, der eine respektable Größe erreicht
und sehr wohlschmeckendes Fleisch aufweist. So berichtet der Franzose
Courcy in seinem 1867 in Paris erschienenen Buche: „Das Reich der
Mitte“ von bis 10 Pfund schweren Goldfischen. Bei uns werden sie in
größeren Teichen nur 25–30, höchstens 40 cm lang, während sie
in kleinen Behältern ganz winzig bleiben. Sie werden in letzteren
mit Semmelkrumen oder Oblatenstücken und zerriebenen Ameisenpuppen
gefüttert, doch darf die Menge derselben nur ganz gering sein,
da ein Übermaß von Futter einen selbst diesen genügsamen Fischen
unerträglichen Schleim erzeugt. Bei sorgfältiger Pflege gewöhnen sie
sich bald an den Menschen und sind schließlich so weit zu bringen wie
in ihrer Heimat China, wo sie gelegentlich das vorgehaltene Futter aus
der Hand nehmen.
Der Stammvater des Goldfisches ist die chinesische Karausche,
ein dem nahe verwandten Karpfen ähnelnder Fisch von dunkelbrauner
Farbe. Diese ihre Abstammung bekunden sämtliche Varietäten des
Goldfisches, indem sie stets als Reminiscenz an die Färbung der Ahnen
in der Jugend dunkelbraun gefärbt sind und erst später die durch Zucht
erzielte definitive Färbung erlangen, die bald goldgelb und metallisch
glänzend, bald schön rot, bald schwarz und gelb oder schwarz und rot,
auch rot und silberweiß gescheckt, manchmal auch ganz silber[S. 438]weiß
oder schwarz ist. Die Goldfarbe entspricht einer der Stufen zwischen
dem Leucismus und Melanismus und kommt durch Zuchtauslese außer beim
Goldfisch auch bei andern Fischen vor, so bei Schleie und Orfe, die
dann als Goldschleie und Goldorfe unterschieden werden. Letztere sind
nun allerdings als erst kürzlich in Zucht genommene Varietäten lange
nicht so schön gefärbt wie der Goldfisch; doch wird letzterer einst,
als die Chinesen begannen ihn in Zucht zu nehmen, auch nicht schöner
gefärbt gewesen sein.
Auch der bedeutendste Fischkenner unserer Zeit, Dr. Günther
in London, ist der Ansicht, daß der Goldfisch eine durch Zucht
fixierte Farbenvarietät der chinesischen Karausche ist, die von
unserer europäischen Karausche (Carassius carassius)
kaum verschieden ist. Solche goldfarbige Varietäten kommen auch bei
unserer Karausche vor, die von Europa über ganz Mittel- und Nordasien
verbreitet ist. Der deutsch-russische Reisende Pallas erwähnt eine
solche goldfarbige Varietät aus der Steppe am Ural. Wahrscheinlich
würde also auch aus unserer Karausche, deren Farbe oft wechselt und
häufig sehr bunt ist, sich mit der Zeit eine ganze Reihe hübscher
Abarten ziehen lassen, wenn man sich darauf verlegen wollte. Bei
uns begnügt man sich eben mit ihrer Zucht als Speisefisch, da sie
außerordentlich genügsam ist und auch noch in moderigem Wasser gedeiht,
wo die Karpfenzucht ganz unmöglich ist, weil das Fleisch des Karpfens
dadurch fast ungenießbar wird. Solches Wasser schadet dem Geschmack des
Fleisches der Karausche durchaus nicht.
Die Karausche liebt schon im Wildzustand stehendes Wasser, namentlich
Seen mit versumpften Ufern und Altwässer, wie man die vom aktiven Strom
abgetrennten Flußarme nennt. Sie kommt aber auch in Teichen, Sümpfen
und Mooren vor, ist überhaupt befähigt, in dem verschiedenartigsten und
unreinsten Wasser auszuhalten und bei der schmutzigsten, schlammigsten
Nahrung zu gedeihen. Sie nährt sich wie der Karpfen hauptsächlich von
Würmern, Larven, faulenden Pflanzenstoffen und Schlamm, hält sich
dementsprechend fast stets am Grunde auf, verweilt hier auch während
der kalten Jahreszeit in Erstarrung, kann sogar in Eis einfrieren
und wieder aufleben. Sie hat überhaupt ein sehr zähes Leben, kann
stundenlang außer Wasser leben und läßt sich, in Schnee oder feuchtes
Laub verpackt, in jeder Jahreszeit weithin versenden. Nur während der
Laichzeit, die in Südeuropa in den Juni, in Nordeuropa dagegen in
den Juli fällt, erscheint sie öfter an der Oberfläche des Wassers,
insbesondere an seichten, mit[S. 439] Pflanzen bewachsenen Stellen, tummelt
sich hier in Scharen umher und spielt, mit den Lippen schmatzend, an
der Oberfläche, bis das Eierlegen beginnt. Obschon das Weibchen nur
gegen 100000 Eier legt, vermehrt sich die Karausche stark und wird mit
Erfolg nicht nur in moderigen Teichen, sondern auch in Forellenteichen
gezüchtet, in denen sie als Futter für diese Raubfische dient.
Sehr geschätzt ist die Karausche besonders in Rußland, wo sie alle
Steppengewässer in großer Menge bevölkert und von den Umwohnern als
willkommene Speise genossen wird. Sie läßt sich mit dem Karpfen kreuzen
und liefert dann die Karpfkarausche (Cyprinus kollari),
die aber keine besonderen Vorzüge vor den Stammeltern hat und deshalb
nur selten gezogen wird.
Wie der Karpfen ist auch die ihm verwandte kleinschuppige
Schleie (Tinca tinca), die eine Länge von 70 cm
und ein Gewicht von 3–4, in seltenen Fällen wohl auch 5–6 kg
erreicht, ihres zarten, wohlschmeckenden Fleisches wegen als
Speisefisch sehr geschätzt. Sie gehört unter den europäischen
Karpfenarten zu den verbreitetsten und bewohnt den größten Teil
Europas, überall zu den gemeinsten Teichfischen gehörend. Auch sie
ist mehr ein Fisch der Ebenen, obschon sie bis zu 1000 m Höhe
emporsteigt. Sie liebt Flüsse weniger als stehende Gewässer und unter
diesen Seen, Teiche und Sümpfe mit schlammigem oder lehmigem Grund mit
spärlichem Röhricht. In den Flüssen zieht sie sich stets nach solchen
Stellen zurück, in denen das Wasser langsam fließt und ziemlich viel
Schlamm abgesetzt hat; denn aus ihm bezieht sie ihre Nahrung. Ganz
besonders soll sie in abgebauten und mit Wasser angefüllten Lehmgruben
gedeihen. Träge hält sie sich fast beständig nahe dem Boden auf und
steigt bloß bei sehr gutem Wetter und während der Fortpflanzungszeit
an die Oberfläche herauf. Wie der Schlammbeißer findet sie sich
noch in Gewässern wohl, in denen andere Fische und selbst Karpfen
absterben, weil ihr Sauerstoffbedarf außerordentlich gering ist. Sie
liebt wie alle andern Karpfenarten warmes Wasser und frißt wie diese
allerlei Gewürm und vermodernde Pflanzenstoffe mit der darin lebenden
Kleintierwelt. Ihre Laichzeit fällt von Mai bis Juli, wobei ein etwa
2 kg schweres Weibchen 300000 Eier legt. Die Vermehrung ist
also eine sehr starke. Die Jungen wachsen ziemlich schnell heran,
doch vergehen immerhin meist 4 Jahre, bevor sie fortpflanzungsfähig
werden. Ihr Fleisch erzielt kaum einen höheren Preis als dasjenige der
Karausche, übertrifft aber das der letzteren unzweifelhaft an Güte.
Weil nun die Schleie, die sich während des Winters nach Art anderer
Familienverwandten in[S. 440] den Schlamm einwühlt, um die kalte Jahreszeit in
einem halb bewußtlosen Zustande zu verbringen zu den anspruchslosesten
Fischen des Erdballs zählt, eignet sie sich — abgesehen vom Aal —
wie kein anderer Fisch zur Besetzung sumpfiger, sonst höchstens der
geringwertigen Karausche preisgegebener Gewässer. Schon aus diesem
Grunde verdient ihre Zucht die wärmste Empfehlung. Von ihr züchtet man
in einzelnen Gegenden, besonders in Böhmen und Oberschlesien, eine
prachtvolle Spielart, die unbedingt zu den schönsten aller europäischen
Fische gezählt werden muß. Es ist dies die vorhin erwähnte Goldschleie.
Außer der Schleie eignet sich unter den Karpfenarten vor allem auch
die Barbe (Barbus vulgaris), die das Gebiet aller
deutschen Ströme bevölkert, insofern zur Teichwirtschaft, als sie den
Hecht im Karpfenteich ersetzt, d. h. die trägen Karpfen aufrüttelt
und durch den dadurch bei ihnen angeregten Stoffwechsel günstig auf
deren Entwicklung wirkt. Sie erreicht eine Länge von 60–70 cm
und ein Gewicht von 4–5 kg, ist gestreckt gebaut und durch die
vier als Tastorgane dienenden Bartfäden an der oberen Kinnlade des
unterständigen Maules ausgezeichnet. Sie meidet stehendes Wasser, sucht
dagegen strömendes Wasser mit sandigem oder kiesigem Untergrund auf.
Während des Sommers hält sie sich gern zwischen Wasserpflanzen auf,
am Tage mehr ruhend, nachts dagegen Futter suchend, das aus Würmern,
kleinen Fischen, Schlamm und winzigen Tieren aller Art besteht. Sobald
die Wasserpflanzen im Herbste absterben, an denen sie ihr Futter
sucht, begibt sie sich an tiefere Stellen im Flusse und sucht sich
hier Zufluchtsorte unter und an Steinen, in Höhlungen und dergleichen,
wühlt sich auch wohl am Uferrande ein. Hier hält sie, oft haufenweise
angesammelt, eine Art Winterschlaf. Zur Zeit der Fortpflanzung, die in
die Monate Mai und Juni fällt, bilden die Barben Züge von hundert und
mehr Stück, die in langer Reihe hintereinander herschwimmen, so daß
die alten Weibchen den Zug eröffnen, die alten Männchen ihnen folgen,
minder alte sich ihnen anreihen und die Jungen den Schluß bilden.
Durch ihre Massenversammlungen zur Laichzeit gibt auch die Nase
(Chondrostoma nasus) Veranlassung zu reichem Fang. Sie
bevölkert im Donau- und Rheingebiet fast alle Seen, lebt meist
gesellig und hält sich fast stets am Grunde auf, sich von Pflanzen,
namentlich Wasseralgen aller Art, ernährend, die sie mit den harten
Kieferrändern leicht von der Unterlage abzulösen vermag. Um sich
fortzupflanzen, zieht sie[S. 441] im April und Mai in Scharen vom Hauptstrom
in die Nebenflüsse und von diesen in die Bäche. Hier legt sie die Eier
an kiesigen Stellen ab, über die das Wasser rasch hinwegströmt. Ihr
Fleisch ist seines Grätenreichtums wegen nicht sonderlich geschätzt.
Einer unserer häufigsten Flußfische ist der Barsch (Perca
fluviatilis), dessen gedrungener, seitlich zusammengedrückter,
gelber bis grünlicher Leib mit 5–9 vom Rücken gegen den Bauch
verlaufenden dunkeln Querbinden versehen ist. Seine Länge übersteigt
bei uns selten 25 cm, das Gewicht 1 kg; doch kommen in
manchen Seen Stücke von 1,5 bis 2 kg Gewicht vor. Er ist überall
im Norden der Alten Welt verbreitet und gedeiht am besten in Seen mit
klarem Wasser; doch fehlt er auch Flüssen und tiefen Bächen nicht, geht
auch ins Brackwasser und selbst in schwach salzige Meeresteile, wie
beispielsweise die Ostsee. In den Flüssen zieht er die Uferseiten und
die Stellen mit geringerem Strome der Mitte und dem lebhaften Strome
vor, ist auch fähig, in den Seen in größere Tiefen, von etwa 80–100
m, hinabzusteigen und dort zu leben, so daß ihm, mit dem Netz
von dort heraufgezogen, infolge des verminderten Luftdrucks durch
Ausdehnung der Schwimmblase der umgestülpte Magen blasenförmig zum
Munde hervorquillt. Mit Vorliebe jagt er zu kleinen Trupps vereinigt,
lauert auch gern in Höhlungen des Ufers auf seine Beute. Seine Freßgier
ist so groß, daß er nach jedem Köder schnappt und, auch gefangen,
bald das Futter aus der Hand seines Pflegers nimmt. Er läßt sich sehr
leicht fangen, dauert auch außerhalb des Wassers längere Zeit aus, läßt
sich daher weit versenden, wenn er nur unterwegs von Zeit zu Zeit zur
Erfrischung in Wasser getaucht wird. Auch hält er sich Tage und Wochen
im engen Fischkasten, was ein weiterer Vorzug ist. Aus der Haut der
zum Essen nicht geschätzten jüngeren Fische wird ein der Hausenblase
ähnlicher, sehr haltbarer Leim bereitet; die älteren Fische dagegen
dienen als wohlschmeckende Speise. Seine Laichzeit fällt von März bis
Mai. Im dritten Lebensjahre, wenn er eine Länge von etwa 15 cm
erreicht hat, ist er bereits fortpflanzungsfähig und legt bis zu 300000
Eier. Doch vermehrt er sich gleichwohl nicht in größerer Zahl, da
Fische und Wasservögel zahlreiche Eier fressen, auch die jungen Fische
zahlreichen Feinden ausgesetzt sind.
Den Barsch übertrifft an Wohlgeschmack bedeutend sein Verwandter, der
durch ein köstliches schneeweißes Fleisch ausgezeichnete Zander
(Lucioperca sandra), der die Ströme und größeren Flüsse
Nordost- und Mitteleuropas, in Norddeutschland die Elbe-, Oder-
und[S. 442] Weichselgebiete und benachbarten Seen, in Mitteleuropa das
Donaugebiet bewohnt, dagegen dem Rhein- und Wesergebiet, ebenso ganz
Westeuropa fehlt, auch innerhalb seines Verbreitungsgebietes alle
schnellfließenden Flüßchen meidet. Er liebt langsamfließende Gewässer,
in deren Tiefe er sich für gewöhnlich aufhält, und erscheint nur
während der zwischen die Monate April und Juni fallenden Laichzeit
an seichteren, mit Wasserpflanzen bewachsenen Uferstellen, um hier
seine Eier zu legen. Als ein außerordentlich raubgieriger Fisch, der
alle kleineren Fische auffrißt und seine eigene Brut nicht verschont,
wächst er ungemein schnell und erreicht im ersten Jahre bereits ein
Gewicht von 0,75, im zweiten ein solches von 1 kg. Auch seine
Vermehrung ist eine bedeutende. Sein Fleisch ist wie bei allen Fischen
am besten und fettesten vor der Laichzeit, also im Herbst und Winter,
muß aber frisch zubereitet werden, da es geräuchert oder gesalzen sehr
an Schmackhaftigkeit verliert. An der unteren Elbe wird es demjenigen
des Lachses gleichgeschätzt und ist fast eben so teuer. Im Rhein- und
Wesergebiet, wo er, wie gesagt, ursprünglich nicht heimisch war, ist
er in den letzten Jahren mit so gutem Erfolge eingesetzt worden, daß
der Zanderfang für die dortigen Fischer heute schon ein bedeutender
Faktor geworden ist. In größeren, an schlecht schmeckenden Weißfischen,
Plötzen, Rotaugen, Stinten, Gründlingen und anderen minderwertigen
Fischen, die ihm zur Nahrung dienen könnten, reichen Gewässern,
kleineren Seen oder Teichen würde sich die auf die Zucht gerade dieses
Fisches verwandte Mühe reichlich lohnen.
Ebenfalls sehr empfehlenswert für die Teichwirtschaft ist der den
beiden vorigen verwandte, nur 25 cm lang und 250 g
schwer werdende Kaulbarsch (Acerina cernua), der überall
in Deutschland gefunden wird, nur im Oberrheingebiet fehlt, weil er
den Rheinfall von Schaffhausen nicht zu überwinden vermag. Seine
Lebensweise ähnelt derjenigen des Flußbarsches. Er zieht klare, tiefe
Seen seichteren Gewässern vor, besucht aber letztere während der
Laichzeit im April und Mai und wandert dann gewöhnlich truppweise,
während er sich sonst mehr einzeln hält. In den Flüssen und Bächen
verweilt er bis gegen den Herbst hin; zum Aufenthalt im Winter aber
wählt er sich tiefere Gewässer und kehrt deshalb wieder zu den Seen
zurück. Seine Nahrung besteht aus kleinen Fischen, Würmern und Kerfen.
Der Laich wird auf Steinen abgesetzt. Seinen Fang betreibt man mit der
durch einen Regenwurm geköderten Angel oder mit feinmaschigen Netzen.
Sein Fleisch wird als sehr schmackhaft geschätzt.
[S. 443]
Ihres köstlichen Fleisches wegen wird, wie die verschiedenen
Karpfenarten, auch die Schmerle oder Bartgrundel
(Nemachilus barbatulus) in manchen Gegenden, so besonders in
Böhmen, in kleinen, reichlich mit Schafmist zur Entwicklung von ihr zur
Nahrung dienenden Kerbtierlarven beschickten Teichen gezüchtet. Sie
lebt darin lange Zeit und zeichnet sich durch ungeheure Gefräßigkeit
aus. Ihr Wohngebiet ist Mitteleuropa nördlich der Alpen und reicht im
Osten bis zum Ural. In Schweden wurde sie durch Friedrich I.,
der von 1751 bis 1771 regierte, aus Deutschland eingeführt. Sie hält
sich besonders in Flüssen und Bächen mit raschfließendem Wasser auf
und verbirgt sich tagsüber unter hohlliegenden Steinen. Erst gegen
Sonnenuntergang beginnt ihre die ganze Nacht hindurch währende
Jagdzeit. Ihre Laichzeit fällt in die ersten Frühlingsmonate. Das
Männchen gräbt mit dem Schwanz ein Loch in den Sand, in welches das
Weibchen die Eier legt; dann hält es bis zum Ausschlüpfen der Jungen
Wacht am Neste.
Häufiger als die Schmerle findet man in Fischteichen den Hecht
(Esox lucius) angesiedelt, der nicht mit Unrecht der „Hai
der Binnengewässer“ genannt wird, da er der gefürchtetste Räuber
der europäischen Seen und Flüsse ist. Er scheint sich in seichtem,
sumpfigem Gewässer ebenso wohl zu fühlen wie in einem tiefen, klaren
See und erreicht gelegentlich eine Länge von 2 m und ein Gewicht
bis zu 35 kg. Wie ein Pfeil schießt er durch das Wasser auf
seine Beute zu, sobald er sie mit seinen scharfen Augen erspäht hat.
Seine Gefräßigkeit übertrifft die aller anderen Süßwasserfische. Dabei
ist ihm alles recht, von dem er glaubt, daß er es bewältigen könne, bis
hinauf zu größeren Vögeln und Säugetieren. Bei solcher Unersättlichkeit
ist es kein Wunder, daß das Wachstum dieser Tiere ungemein rasch ist
und sie im ersten Jahr 1 kg, im folgenden 2 kg, bei
genügender Nahrung sogar 4 und 5 kg an Gewicht erreichen. Ihre
Laichzeit fällt in den März und April. Die Eier werden auf seichten,
mit allerlei Wasserpflanzen bewachsenen Stellen abgelegt und sind schon
nach wenigen Tagen gezeitigt. Von den Jungen findet ein großer Teil im
Magen älterer Hechte sein Grab, ein anderer, kaum geringerer, fällt den
Geschwistern zum Opfer, die um so rascher heranwachsen, je mehr sie
Nahrung finden.
Im Altertum stand das Fleisch der Hechte bei Römern und Griechen nur
in geringem Ansehen. Nördlich der Alpen jedoch wurde es von jeher vom
Menschen sehr geschätzt und galt besonders in England für teilweise[S. 444]
noch besser als dasjenige des Lachses. Auch heute noch ist er als
Braten geschätzt und wird schon aus diesem Grunde, nicht nur des
Schadens wegen, den er anrichtet, eifrig verfolgt. Außer Netz und
Reuse wird besonders die Schmeißangel zu seinem Fange benutzt. Zur
Teichwirtschaft eignet er sich vorzüglich, vorausgesetzt, daß man ihn
da unterbringt, wo er nicht schaden kann, oder ihm genügenden Vorrat
an Fischen gewährt. Er verträgt hartes wie weiches Wasser, darf aber
nicht während der Laichzeit eingesetzt werden, weil er zu dieser Zeit
leicht absteht. Um die trägen Karpfen in Bewegung zu erhalten, wird er
in kleinen Exemplaren, die weiter nicht schaden, auch in Karpfenteichen
gehalten.
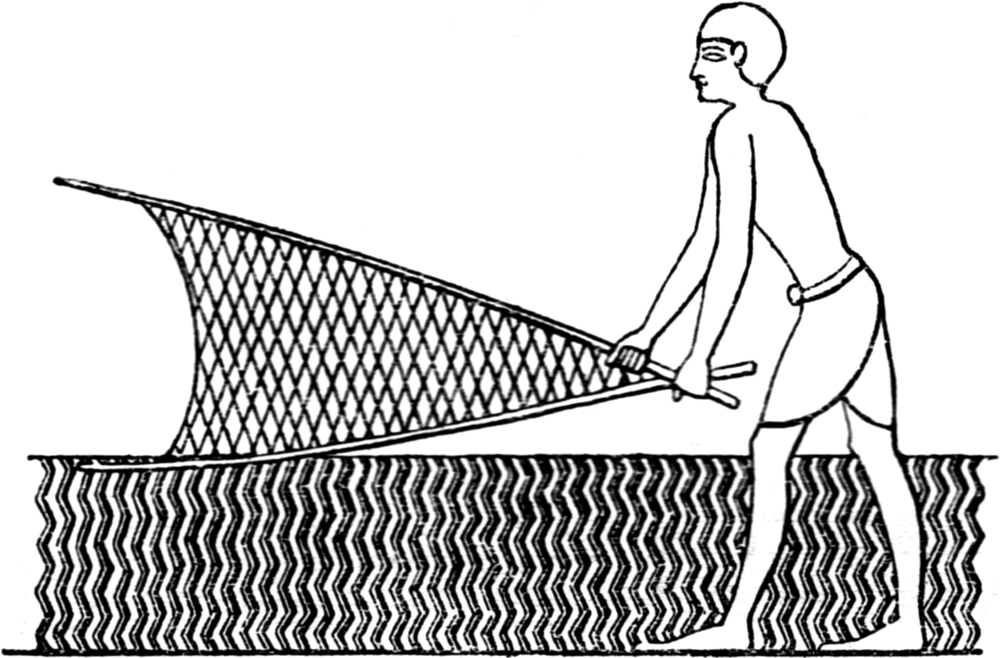
Bild 51. Ägypter mit dem Landungsnetz fischend.
Auf einem Grabgemälde in Theben. (Nach Wilkinson.)
Nicht in der Teichwirtschaft verwendet, aber gleichwohl meist gern
gegessen wird die Brachse (Abramis brama), die 50–70
cm Länge und ein Gewicht von 4–6 kg erreicht. Nördlich
der Alpen wird sie überall in den tieferen Süßwasseransammlungen, meist
in starken Gesellschaften, gefunden, wo sie den Sommer über im Schlamme
nach Nahrung wühlt. Um zu laichen, was stets zur Nachtzeit an seichten,
grasreichen Stellen in der Nähe des Ufers geschieht, vereinigt sie sich
im Frühjahr zu großen Zügen und wird dann in Menge gefangen. Wenige
Tage nach dem Abzuge der Fische wimmeln die seichten Uferstellen von
Millionen ausgeschlüpfter Jungen, die sich noch eine Zeitlang auf der
Stätte ihrer Geburt umhertreiben und dann ihren Eltern in die Tiefe der
Gewässer folgen.
Von den ihres minderwertigen Fleisches wegen nicht besonders
geschätzten Süßwasserfischen soll hier nicht die Rede sein. Nur die[S. 445]
Lauben- oder Weißfische (Alburnus) mögen noch
genannt werden, da man sie regelmäßig fängt, um sie als Köder für
andere Fische zu benutzen, und aus ihren feinzerstoßenen Schuppen eine
Masse gewinnt, die Glasperlen täuschend das Aussehen echter Perlen
zu geben vermag. Die letztere Erfindung wurde in der Mitte des 18.
Jahrhunderts von einem französischen Rosenkranzverfertiger gemacht
und lange geheimgehalten. Der ölartig dicke Saft kam als Essence
d’Orient in den Handel und wurde zum Bestreichen des Innern von
Glaskügelchen benutzt, die dann vollkommenen Perlglanz aufweisen. Zur
Gewinnung von 500 g Silberglanz sollen gegen 20000 Weißfische
nötig sein. Wegen ihrer unermüdlichen Regsamkeit und unterhaltenden
Spiellust eignen sich diese Fischchen vorzüglich, wie die Goldfische in
engerem Gewahrsam gehalten zu werden.
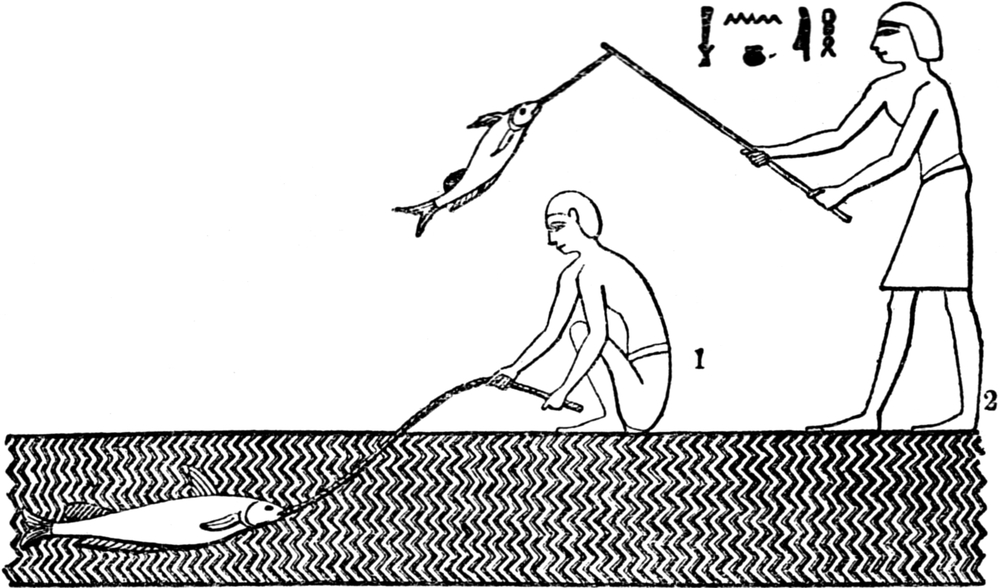
Bild 52. Fischer im alten Ägypten 1. mit der Grundangel,
2. mit der Angelrute fischend. (Nach Wilkinson.) Der hier gefangene
Fisch heißt shilbeh oder arabrab.
Hierzu verwendet man neuerdings bei uns mit Vorliebe die von den
Chinesen zur Kulturrasse erhobenen Großflosser (Polyacanthus
viridi-auratus), die von europäischen Liebhabern auch als
Paradiesfische bezeichnet werden. Es ist dies eine Art
Vieldorner mit gestrecktem und seitlich zusammengedrücktem Leib mit
sehr großer, halbmondförmiger, zweilappiger Schwanzflosse. Besonders
die Männchen sind bunt mit farbigen Querbinden geziert. Die Länge
beträgt bloß 8–9 cm. Über das Freileben dieses Zierfischchens
fehlt jede Kunde. Wir wissen nur, daß es in China schon recht lange
gezähmt worden sein muß und die Chinesen durch sein munteres Wesen
erfreute. Deshalb wird es in[S. 446] China allgemein gefangengehalten und
wie der Goldfisch behandelt, nur pflanzt es sich auch in engem Raume
viel leichter als letzterer fort und ist zudem durch seine Brutpflege
interessant. Das Männchen errichtet nämlich mit dem Mund aus von
Schleim überzogenen Luftblasen ein Nest, in das es die vom Weibchen
gelegten Eier trägt und sorgsam bewacht. Auch nach dem Ausschlüpfen
der Jungen hütet es dieselben mit derselben aufopfernden Fürsorge
wie das Stichlingsmännchen, das eine analoge Brutpflege in einem
Nest aus Pflanzenfasern ausübt. Erst wenn die Jungen seiner Hülfe
nicht mehr bedürfen, überläßt es dieselben ihrem Schicksal und frißt
sie auch gelegentlich, wie es das Weibchen zu tun pflegt, auf. Die
Jungen ernähren sich anfänglich vom Schleim des Schaumnestes, später
von kleinen Aufgußtierchen, dann von allerlei winzigem und zuletzt
größerem Gewürm wie die Eltern. Ein einziges Paar dieser Fische soll
in einem Sommer nicht weniger als sechsmal gelaicht und dabei jedesmal
400 bis 600 Junge erzielt, also zusammen 3000 Nachkommen ins Leben
gesetzt haben. Ihr überaus zierliches Wesen, ihre große Fruchtbarkeit
und ihre leichte Fortpflanzung in noch so kleinen Behältern empfehlen
sie allen Aquarienfreunden aufs wärmste, so daß sie berufen sind, zum
großen Teile, wenn nicht ganz, die viel langweiligeren Goldfische zu
verdrängen.
Von China kamen die Großflosser schon zu Ende des 18. Jahrhunderts in
Spiritus nach Europa. Erst 1867 werden die ersten lebenden Exemplare
in Berlin erwähnt, doch wird nicht mitgeteilt, ob sie sich dort auch
schon fortpflanzten. Im Jahre 1869 erhielt Dumeril eine Sendung dieser
Zierfische, die der französische Konsul Simon in Ningpo mit Sorgfalt
ausgesucht und gesandt hatte. Diese pflanzten sich anstandslos fort und
auf sie dürfte wohl die größte Zahl unserer europäischen Großflosser
zurückzuführen sein.
Zum Schlusse seien noch einige Bemerkungen über die Fischerei der
alten Deutschen beigefügt. Zunächst konnte jedermann da fischen, wo
es ihm beliebte, bis mit der Ausbildung des Privateigentums an Grund
und Boden auch das Recht der Fischerei, wie der Jagd, immer mehr unter
Bann getan wurde. Wer in solchen Banngewässern fischen wollte, mußte
eine Erlaubnis dazu vom betreffenden Besitzer haben. Der Fischfang
geschah vorzugsweise mit Reusen und Netzen verschiedener Art, von
welch letzteren die größte sagina, kleinere barsa und
tegum hießen, daneben auch mit Angeln, die im Mittelalter bei
uns Hamen genannt wurden. Man errichtete mit Pfählen und Ruten[S. 447]geflecht
dazwischen sogenannte Vennen (lat. venna), in denen sich die
Fische beim Stromaufwärtsschwimmen verfingen und keinen Ausweg mehr
fanden. Da die Errichtung und Unterhaltung solcher Vennen viel Holzwerk
erheischte, wurde bei Verleihung derselben durch Könige meist auch ein
Wäldchen geschenkt, so vom Frankenkönig Arnulf, dem Sohne Karlmanns
(regierte 887–899) an ein Kloster. Vor ihm erlaubte Karl der Große
777 dem Kloster Lorch zu ihrer Venne auf dem Rhein aus einem Walde,
der keine Fruchtbäume hatte, das nötige Holz zur Unterhaltung und
Ausbesserung derselben zu holen.
Außer der Fischerei wurde schon bei den alten Franken auch eine
Teichwirtschaft getrieben, indem vor allem die Klöster in Nachahmung
der römischen Vivarien ebenso genannte Fischteiche errichteten. Karl
der Große befahl seinen Verwaltern auf allen Höfen (villa)
Fischteiche zu halten und Fische für den Bedarf des Hofhaltes in
Holzkästen bereit zu halten. Nur was nicht gebraucht wurde, durfte
verkauft werden.

Bild 53. Fischer mit Netz und Reusen.
(Nach einem Holzschnitt von Jost Ammann 1539–1591).
Als mit der Zunahme der geistlichen Stiftungen die Zahl der zu den
kirchlichen Fasten eine Menge von Fischen gebrauchenden Mönche wuchs,
wurden von den Hörigen, die Fischfang trieben, die Abgaben in Gestalt
von Fischen gefordert; diese wurden meist frisch, seltener eingesalzen
oder geräuchert gegessen. Erst später wurden die Abgaben an Fischen
teilweise in Geld verwandelt. Mit der fortschreitenden Einschränkung
der natürlichen Freiheit gehörte der Fischfang im Mittelalter den
jeweiligen Grundbesitzern, die das Recht dazu gegen Entschädigung
verleihen oder verbieten konnten. Mit Vorliebe wurde von den Königen
und Fürsten das Recht des Fischens an Laien und Klöster verliehen;
solche Fischenzen oder Fischereien kommen in den Urkunden[S. 448] häufig
vor. Den Stadtbürgern wurde erlaubt, in dem zur Stadt gehörenden
Wasser zu ihrer eigenen Speise, aber nicht zum Verkaufe, mit einem
Hamen, ausnahmsweise auch mit Netzen, zu fischen. Unbefugte Fischerei
wurde sehr streng bestraft. Fische aus einem Teiche stehlen, war ein
größeres Verbrechen, als wenn solches aus gemeinem Wasser geschah;
denn solche Fische gehörten nach altem Rechte zum Besitzstand, weil
Arbeit darangewendet worden war. Nach dem berühmtesten Rechtsbuch des
Mittelalters, dem ums Jahr 1230 aufgezeichneten Sachsenrecht, dem
„Sachsenspiegel“, gab derjenige, der in gegrabenen Teichen fischte, 30
Solidi oder Goldschillinge im Goldwerte von etwa 10 Mark (tatsächlich
aber viel mehr) Strafe, d. h. zehnmal mehr als in gemeinem Wasser, und
ward zudem gepfändet, wenn man ihn in „handhafter Tat ergriff“.
[S. 449]
XXI. Die Nutztiere
unter den Wirbellosen.
Gegenüber der großen Menge von Fischen spielen die an Arten und
Individuen sehr viel spärlicheren Krebse als Speise des Menschen
eine sehr unbedeutende Rolle. Unter den Krabben ist eine Art
Bogenkrabbe (Carcinus maenas) die weitaus die gemeinste
der europäischen Meere. Große Mengen davon im Wert von 1⁄2 Million
Lire werden von Venedig aus, wo sie als Leckerbissen gelten, in
Fäßchen verpackt, nach dem Festlande ausgeführt. Ebenfalls zu vielen
Tausenden wird meist in großen, locker geflochtenen Körben die
große Meerspinne (Maja squinado) auf die Fischmärkte der
Küstenstädte am Mittelmeer zum Verkauf gebracht. Sie wird besonders
in den Garküchen für das niedere Volk zubereitet und bildet, in
ihrer eigenen Schale geröstet, eine schmackhafte Zukost zu Brot und
Wein. Von ihr wußte man im Altertum allerlei wunderbare Dinge zu
erzählen. Sie sollte außerordentlich klug und eine Musikfreundin sein.
Auf verschiedenen Münzen findet sie sich verewigt und prangte als
Halsschmuck der Diana von Ephesus.
Weniger häufig im Adriatischen und Mittelmeer, dafür aber um so
bekannter an den Nordseeküsten ist der große Taschenkrebs
(Cancer pagurus). Er zieht felsigen Grund dem sandigen Strande
vor und wird seines Wohlgeschmacks wegen namentlich in England viel
gefangen und verzehrt. Ebenfalls auf felsigem Grund lebt die gemeine
Languste (Palinurus vulgaris). Dieser in einzelnen
Riesenexemplaren 6–8 kg schwere Panzerkrebs ist im Mittelmeer
viel häufiger als der Hummer (Homarus vulgaris), welch
letzterer in der Nordsee seine eigentliche Heimat hat. Dort findet
er sich mit den Schollen und vielen anderen Meerestieren überall auf
der sandigen Doggerbank und der weiterhin Britannien mit Norwegen
verbindenden Untiefe, von welcher dann weiter nördlich ein jäher
Absturz in den Ozean erfolgt. Von den rund 6 Millionen Hummern,
die Nordeuropa jährlich ver[S. 450]braucht, werden weitaus die meisten in
England konsumiert. Vermittelst kleiner, schnellsegelnder Schiffe mit
doppeltem, als Hummerbehälter dienendem Boden werden von den drei
Millionen Stück, die jährlich an der Südwestküste Norwegens gefangen
werden, eine Million nach London geliefert. Bei Helgoland fängt man
jährlich 20–30000 Stück. Der Wert der jährlichen Ausbeute an der
Ostküste Schottlands stellt sich ungefähr auf 6 Millionen Mark. Wie
in London ist auch in Paris Hummer ein sehr beliebtes Gericht, das in
allen feineren Restaurants zu haben ist. Der weibliche Hummer legt über
12000 Eier und trägt dieselben bis unmittelbar vor dem Auskriechen der
Jungen am Hinterleib und seinen Anhängen angeheftet mit sich herum.
Auch späterhin flüchtet sich wenigstens ein Teil der Jungen unter den
Schwanz der Mutter, während die große Mehrzahl ausschwärmt und von
zahllosen Feinden dezimiert wird, so daß nur ein kleiner Bruchteil
derselben das fortpflanzungsfähige Alter erreicht.
Sein nächster Verwandter, der Flußkrebs (Astacus
fluviatilis), wird nur 20, in seltenen Fällen 25 cm lang und
pflanzt sich im Herbst fort, wobei die befruchteten Eier an die Haare
der mütterlichen Schwimmfüße festgeklebt werden. Erst im folgenden
Frühjahr oder zu Beginn des Sommers schlüpfen die Jungen aus, die dann
rasch heranwachsen, so daß sie am Ende des ersten Jahres schon 4,5
cm lang sind. Nach der ersten Häutung beginnen sie zwar ein
selbständiges Leben, kehren aber doch öfter schutzsuchend unter den
Schwanz der Mutter zurück. Erst nach der zweiten Häutung — etwa am 28.
Tage nach dem Ausschlüpfen — machen sie sich völlig selbständig und
zerstreuen sich nach und nach. Die Flußkrebse sind Allesfresser, sie
fressen auch frisches totes Fleisch, aber kein eigentliches Aas. Was
sie zu bewältigen vermögen, dient ihnen als willkommene Beute. Neben
tierischer Kost sind ihnen auch Wasserpflanzen, namentlich saftige
Wurzeln und Armleuchter, letztere wohl ihres Kalkgehaltes wegen, ein
Bedürfnis. In der Gefangenschaft lassen sie sich gern mit Mohrrüben
und Kürbisschnitzen füttern. Man unterscheidet unter ihnen den ruhiges
Wasser bevorzugenden Edelkrebs als eine Form der Niederungen und
den raschströmendes Wasser bevorzugenden Steinkrebs als Bewohner
der Berggegenden. Letzterer ist die einzige Art für die Iberische
Halbinsel und Britannien. Beide Arten können an geeigneten Orten
nebeneinander vorkommen. Eine dritte schmächtigere Form (Astacus
leptodactylus) bewohnt das Einzugsgebiet der in das Schwarze und
Kaspische Meer mündenden Ströme. Durch Kanalverbindungen mit[S. 451] der
Wolga und andern Flüssen ist er neuerdings in das Stromgebiet des
Finnischen und Weißen Meeres gelangt und beginnt dort den Edelkrebs zu
verdrängen. In Nordamerika befindet sich östlich vom Felsengebirge eine
verwandte Form, die ebenfalls gern gegessen wird. Bei uns ist heute der
Edelkrebs viel seltener als früher, da er in großer Menge alle Gewässer
bevölkerte und in großen Mengen gefangen und verspeist wurde. Seit aber
vor 35 Jahren die Krebspest von Frankreich her nach Deutschland kam
und im Laufe von 10 Jahren bis nach Rußland vordrang, wurde an vielen
Orten der gesamte Krebsbestand vernichtet, so daß viele Gewässer, die
früher reich an Krebsen waren, nunmehr völlig daran verödet sind. Statt
seiner wurde mehrfach der allerdings in bezug auf Wohlgeschmack des
Fleisches minderwertige, schmächtige galizische Krebs mit bedeutend
dünneren Scheren zur Wiederbevölkerung der Gewässer mit Krustentieren
in Deutschland eingeführt.
Die artenreichste Familie unter den langschwänzigen Zehnfüßlern sind
die Garneelen, von denen die beim Kochen farblos werdende
gewöhnliche, bräunliche Sandgarneele (Crangon vulgaris)
— die crevette der Franzosen und shrimp der Engländer
— und die beim Kochen rotwerdenden Granaten (Palaemon
serratus und P. squilla) — die sogenannten Krabben der
Ostseefischer — zum Verspeisen die beliebtesten sind. Sie werden an
den Küsten in oft von Pferden gezogenen feinmaschigen Schleifnetzen
mit länglichem Rahmen aus Eisen gefangen und korbweise auf den Markt
gebracht. Die meisten der so erbeuteten 8 cm und mehr langen
Garneelen sind Weibchen, die ihre Eier zwischen den Afterfüßen des
Hinterleibs tragen. Sie liegen ganz in Sand eingegraben vor Feinden
sicher und geraten ins Netz, indem die untere eiserne Lippe des
Schleppnetzes den Sand aufwühlt, in welchem sie ruhig liegen und auf
Beute lauern. In den Küstenstädten des Mittelmeers wird auch der
bis 18 cm lange gemeine Heuschreckenkrebs (Squilla
mantis) viel gefangen und verzehrt. Hier überall geben auch die
Kopffüßler oder Tintenfische als frutti di mare
eine geschätzte Speise für das gemeine Volk. Besonders beliebt sind die
gemeine Sepia (Sepia officinalis) und der Kalmar
(Loligo vulgaris), von denen die mittelgroßen Exemplare, weil
wohlschmeckender, den größeren vorgezogen werden. Sie wandern vielfach
mit den kleinen Fischen, von denen sie sich ernähren, und werden in
besonderen Fallen und Netzen gefangen.
An den Küsten des Mittelmeers werden auch allerlei
Meerschnecken[S. 452] wie auch alle Sorten von Landschnecken
gern verzehrt. Die Mitteleuropäer dagegen essen von den 1600 Arten
der auf dem europäischen Festlande lebenden Gattung Helix, den
Schnirkelschnecken, fast ausschließlich die Weinbergschnecke
(Helix pomatia). Sie ist die größte aller einheimischen
Landschnecken und ihr hellrötliches bis gelblichbraunes Gehäuse
erreicht eine Höhe bis zu 5 cm. Diese Tiere sind Zwitter und
befruchten sich gegenseitig. Ihre 60–80 johannisbeergroßen Eier legen
sie im Frühjahr haufenweise in Löcher, die sie in lockere, feuchte
Erde gewühlt haben und nach der Eiablage wieder zudecken, so daß das
Eiernest kaum gefunden werden kann. Die Entwicklung nimmt etwa 26 Tage
in Anspruch; dann kriechen die jungen Schnecken aus dem Boden hervor,
um sich vorzugsweise von weicher Pflanzenspeise zu ernähren. Doch
fressen sie gelegentlich auch tierische Kost, so das Fleisch etwa von
einem Wagen überfahrener oder von Menschen zertretener Genossinnen.
Dabei wachsen sie verhältnismäßig rasch heran und graben sich im
Herbst am liebsten unter einer Moosdecke 20–30 cm tief in
die lockere Erde ein und verschließen ihr Gehäuse mit einem soliden
Kalkdeckel. Letzterer ist porös und läßt die Luft für die übrigens
während des Winterschlafes stark herabgesetzte Atmung ungehindert
hindurchtreten. Wenn im April und Mai die zunehmende Bodenwärme die
Lebenstätigkeit des etwa 6 Monate im Winterschlaf verharrenden Tieres
aufs neue weckt, so wird der Deckel mit dem Fuß leicht abgestoßen. Nur
in diesem gedeckelten Winterzustande gilt die Weinbergschnecke als
ein tafelfähiger Leckerbissen. Da sie zum Aufbau ihres Kalkgehäuses
viel Kalk benötigt, findet sie sich nur in Gegenden, wo der Erdboden
genügend von diesem Stoff enthält. Sie lebt außer in Weinbergen auch in
Gärten, Hainen und lichten Laubwäldern mit viel Unterholz. Von alters
her wird sie zur Sommer- und Herbstzeit gesammelt, um in besonderen
Gehegen aus Brettern oder aus engem Drahtgeflecht mit Salat, Mohrrüben
und Fallobst mit Beigabe von Kalk gefüttert zu werden. Bei solchem
Futter wird sie besonders zart und fett. Berühmt in ganz Frankreich
und Süddeutschland sind wegen ihres Wohlgeschmacks die aus Burgund
bezogenen Schnecken. Hier ist die Zubereitung derselben in der
Schale à la bourgignonne sehr beliebt, so daß diese Tiere ein
eigentliches Volksgericht geworden sind.
Schon die reichen Römer zu Ende der Republik und zur Kaiserzeit, jene
Erzschlemmer, wußten die gemästeten Weinbergschnecken als leckere
Speise zu würdigen und zogen sie in besonderen Schnecken[S. 453]gärten. Der
gelehrte Varro beschreibt uns um die Mitte des letzten vorchristlichen
Jahrhunderts die Anlage und den Betrieb eines solchen Cocleariums. Es
sollte unter freiem Himmel liegen und von Wasser umgeben sein, weder
zu sonnig, noch zu stark dem Tau ausgesetzt sein. Hier wurden die
gesammelten Schnecken mit Kleie und mit Honig eingekochtem Weinmost
gemästet. Von besonderen Verkäufern wurden sie dann in den Straßen
ausgeboten und vom Volke gern gekauft. Nach Plinius legte Fulvius
Lupinus auf dem Gebiete von Tarquinii kurz vor dem Ausbruch des
Bürgerkrieges, den Cäsar 49 v. Chr. mit Pompejus zu führen begann, die
ersten Coclearien an. Er trennte die verschiedenen Schneckensorten
und erfand die Mästung derselben mit Mehl und mit Honig eingekochtem
Traubenmost. Nach Varro wurden in den verschiedenen Gebieten des
römischen Reichs verschiedene Schneckenarten gemästet. Er sagt, daß
die kleinen weißlichen aus der Umgebung von Reate im Sabinerlande (dem
heutigen Perugia), die großen aus Illyrien, die mittelgroßen aber aus
Afrika nach Rom gebracht und an vielen Orten auf großen, künstlich zu
einer Insel gemachten Strecken gezüchtet würden. Man mäste sie auch in
Töpfen, in die durch Löcher Luft eintreten gelassen werde; inwendig
seien diese mit Honigmost und Mehl ausgestrichen.
Von den Römern übernahmen im Mittelalter die Klöster die Zucht
von Weinbergschnecken als beliebte Fastenspeise und führten sie
nördlich von den Alpen ein. Aus den Klostergärten übernahmen später
auch Laien diese Zucht. So gab es später an verschiedenen Orten
Frankreichs, Süddeutschlands, der Schweiz und Österreichs größere
Schneckenzüchtereien, die die benachbarten Städte mit ihren Produkten
versorgten. Schneckenbauern in der Gegend von Ulm führten einst
jährlich über 4 Millionen gedeckelte Schnecken zu je 10000 Stück
im Winter auf der Donau hinunter bis jenseits Wien aus. Sie werden
meist in der Weise zubereitet, daß man sie in einem Salzsud kocht,
dabei quellen die Tiere stark auf, so daß das sie abschließende
Kalkdeckelchen von selbst abfällt. Die fast gargekochten Leiber lassen
sich dann leicht mit einer Gabel aus dem Gehäuse ziehen, werden geputzt
und zwei bis dreimal in warmem Wasser gewaschen, um allen Schleim
daraus zu entfernen. Mit Fleischbrühe und Wein weichgekocht, werden
sie fein gehackt, mit Petersilie und Sardellenbutter vermischt und
schließlich in die sauber geputzten Gehäuse gefüllt. Die auf solche
Weise zubereiteten Schnecken sollen wie Krebspastetchen eine wirkliche
Delikatesse sein. Von Paris aus werden sie in solcher Zubereitung
weithin exportiert[S. 454] und haben sich sogar in Norddeutschland, das sich
bisher gegen solche Leckerbissen ablehnend verhielt, viel Freunde
erworben. Während in Nordfrankreich Helix pomatia gezogen wird,
züchtet man in Südfrankreich vorzugsweise Helix aperta und H.
nemoralis, außer letzterer in Italien auch Helix pisana.
In Spanien dagegen ißt man Helix alonensis und lactea,
in Griechenland H. parnassea. Sie, wie auch die rotbraunen bis
schwarzen roten Wegschnecken (Limax rufus) ohne Gehäuse
werden zur Gewinnung einer sehr wohlschmeckenden Fleischbrühe gekocht,
die früher besonders Lungenleidenden als Heilmittel gegeben wurde.
Von den Schnecken haben sonst nur die Purpurschnecken
kulturgeschichtlich eine größere Bedeutung erlangt, indem sie im
Altertum zur Gewinnung der überaus geschätzten Purpurfarbe eine
sehr wichtige Rolle spielten. Es sind dies Vertreter der Gattungen
Murex und Purpura, die an den Küsten des Mittelmeers
auf felsigem Grunde sehr häufig vorkommen und an den Orten der
Purpurfabrikation, die in Phönikien ihren Ausgang nahm, in großen
Mengen gesammelt und verarbeitet wurden, so daß aus ihren weggeworfenen
Schalen mächtige Ablagerungen hervorgingen. Wie an der syrischen Küste
ließen sich auch an manchen Orten Griechenlands und Italiens einstige
Purpurfabriken an solchen Schalenhaufen nachweisen.
Die den Purpurfarbstoff liefernde kleine Drüse mündet in eine
Umschlagsfalte des Mantels und liefert ein anfänglich farbloses
Produkt, das an der Sonne zuerst gelb, dann grünlich und zuletzt
violett wird und um so dunkler, bis schwärzlich erscheint, je mehr
davon auf dem betreffenden Stoff aufgetragen und je länger er nachher
den Sonnenstrahlen ausgesetzt wurde. So hatte der geschickte Färber
alle Grade von einem matten bis dunkeln Violett in der Hand. Zur
Gewinnung von 1,5 g Purpursaft sind die Drüsen von nicht
weniger als 12000 Purpurschnecken nötig; so läßt es sich begreifen,
daß damit gefärbte Gewänder außerordentlich hoch zu stehen kamen
und nur den Fürsten und Reichen zugänglich waren. Noch zur Zeit des
Kaisers Diokletian im Jahre 301 n. Chr. kostete das Pfund der besten
Purpurwolle 950 Mark unseres Geldes. Und doch war die Farbe ein
ziemlich unreines, rotstichiges Violett, das sich in keiner Weise weder
an Glanz, noch an Echtheit der Färbung mit den modernen, synthetisch
gewonnenen Teerfarbstoffen vergleichen läßt. Übrigens dienten nach dem
römischen Dichter Martial die Purpurschnecken außer zum Färben auch
zum Essen. Sie wurden nach den antiken Autoren in mit Mies[S. 455]muscheln
beköderten kleinen Reusen gefangen, die kleinen Arten samt den Schalen,
die größeren dagegen ohne diese zerstampft, mit Wasser ausgelaugt
und auf mäßigem Feuer in bleiernen Gefäßen eingekocht. Je nach der
Mischung der verschiedenen Purpurschneckenextrakte wurden verschiedene
Nuancen erzielt. So schreibt Plinius in seiner Naturgeschichte: „Die
Purpurschnecke (buccinum) ist allein nicht brauchbar, weil
ihre Farbe nicht hält, wird sie aber mit dem Saft der Murexschnecke
(purpura) vermischt, so wird sie dauerhaft und gibt jener
dunkeln Farbe eine Beimischung, welche ein schönes Scharlachrot
hervorbringt. Je nach der Mischung beider wird die Farbe bald heller
bald dunkler. Um eine herrliche Amethystfarbe zu haben, nimmt man auf
50 Pfund Wolle 200 Pfund Purpurschnecke (buccinum) und 110
Pfund Murexschnecke (purpura). In Tyrus taucht man die Wolle
erst in Murex- und dann in Purpuraschneckensaft. Am beliebtesten ist
der tyrische Purpur, wenn er die Farbe geronnenen Blutes hat, von vorn
gesehen schwärzlich aussieht und von der Seite gesehen schimmert. Auch
Homer nennt das Blut purpurfarbig. — Färbt man bloß mit Murexschnecken
oder Purpuraschnecken, so setzt man Wasser und Menschenurin zu und
erlangt dadurch die beliebte blasse Farbe, welche desto schwächer ist,
je weniger durstig die Wolle war.“
Weiter sagt Plinius: „Das Kleid der römischen Konsuln und freigeborenen
Knaben wird mit einem Purpursaum geschmückt. Purpur unterscheidet den
Senator vom Ritter, versöhnt die Götter, gibt den Kleidern seinen
Glanz und mischt sich beim Triumphzuge unter das Gold.“ Von Anfang an
war der Purpur in Rom gebräuchlich; Romulus trug ihn an der trabea,
Tullus Hostilius an der praetexta (verschieden gestalteten
Röcken). Nepos Cornelius, der unter der Regierung des Augustus starb,
sagte: „Als ich noch jung war, schätzte man den veilchenfarbenen
Purpur am höchsten, wovon das Pfund 100 Denare (60–70 Mark) kostete,
bald darauf zog man den roten tarentinischen vor und später den
doppelgefärbten tyrischen, wovon man das Pfund nicht unter 1000 Denaren
(600–700 Mark) kaufen konnte. Der Ädil Publius Lenthulus Spinther,
der diesen tyrischen Purpur zuerst trug, wurde darob getadelt; jetzt
aber hat jedermann bei Schmausereien mit tyrischem Purpur gefärbtes
Tischzeug. Spinther war im Jahre 691 der Stadt (62 v. Chr.) Ädil,
(d. h. Hilfsbeamter der beiden Volkstribunen und als solcher mit der
Straßen- und Baupolizei, wie auch mit der Überwachung des Marktverkehrs
betraut), da Cicero Konsul war, und damals nannte man den tyrischen
Purpur doppelt gefärbt[S. 456] (dibapha) und betrachtete ihn als eine
sehr kostspielige Sache; jetzt aber ist jeder gute Purpur doppelt
gefärbt.“ Und Plutarch schreibt in seiner Biographie Alexanders des
Großen: „Als Alexander die Stadt Susa in Persien erobert hatte, fand er
daselbst Geld und Kostbarkeiten in unsäglicher Menge; dabei sollen auch
5000 Talente (= 301000 kg) hermionischen Purpurs (Hermione war
eine Stadt in Argolis) gewesen sein, den man 190 Jahre lang aufbewahrt
hatte und der noch so glänzend aussah, als ob er neu wäre.“
Jedenfalls hat die Wertschätzung des Purpurs von der syrischen Küste
aus schon im hohen Altertum ganz Vorderasien erobert, lange bevor die
Griechen durch die phönikischen Kaufleute mit ihm bekannt wurden und
die Bekanntschaft damit den Römern übermittelten. In Babylonien und
Assyrien war der purpurgefärbte Mantel das Abzeichen des Königs und
wurde als besondere Auszeichnung auch an Private verliehen, wie dies
Nebukadnezar (Nabûkuduriussur), der von 604–561 über Babylon
herrschte, nach Daniel 5, 16 dem Juden Daniel tun wollte. Wie im alten
Rom die purpurati die höchste Adelsklasse darstellten, haben,
durch sie beeinflußt, auch die Nachbarvölker von ihnen eingehandelte
Purpurgewänder als königliches Abzeichen benutzt. Erst mit dem
Untergang der antiken Kultur verlor sich im Abendlande mehr und mehr
die Kenntnis von der Bereitung des Purpurs. Nur im byzantinischen
Reiche blieb sie das ganze Mittelalter hindurch erhalten. Auch dort
durfte nur der Herrscher sich mit Purpurstoffen bekleiden, so daß der
Ausdruck den Purpur nehmen, wie bei den Römern der Kaiserzeit, so
viel als sich der Herrschaft bemächtigen bedeutete und der Beiname
Porphyrogenetos, d. h. der in Purpur Geborene, den bei der
Geburt schon mit der Kaiserwürde Bekleideten bezeichnete. Die letzte
Erwähnung von Purpurgewändern als Galatracht des basileus in
Byzanz datiert vom Jahre 1440, 13 Jahre vor der Eroberung durch die
Osmanen. Mit der Invasion der Türken ging auch im byzantinischen
Reiche die Kenntnis der Gewinnung des Purpurs verloren, bis in der
Neuzeit der französische Zoologe Lacaze-Duthiers durch Zufall sie
wieder entdeckte. Als er nämlich im Sommer 1858 im Hafen von Mahon
auf der spanischen Insel Menorca mit Hilfe eines Fischers allerlei
Seetiere aufsuchte, bemerkte er, daß sein Schiffer sein Hemd mit der
schleimigen Absonderung einer Meerschnecke, die sich alsbald als
Purpura haemastoma entpuppte, zeichnete. Die mit einem Stückchen
Holz aufgetragenen Buchstaben und Figuren erschienen bald gelblich
und der Fischer sagte,[S. 457] sie würden rot werden, sobald die Sonne eine
Zeitlang darauf geschienen habe. Der Zoologe ließ auch sein Hemd mit
diesem schleimigen Safte zeichnen und machte alsbald die Entdeckung,
daß bei der Einwirkung der Sonnenstrahlen sich ein höchst unangenehmer
durchdringender Geruch entwickelte und eine immer intensiver werdende
Violettfärbung auftrat. Dies war die Veranlassung zur Wiederentdeckung
der Herstellung des Purpurfarbstoffs, von dem wir heute wissen,
daß er aus Dibromindigo besteht, d. h. aus Indigo, in welchem zwei
Wasserstoffatome durch zwei Bromatome ersetzt sind. Außer Purpura
haemastoma ermittelte Lacaze-Duthier auch die im Mittelmeer sehr
gemeinen Murex brandaris und Murex trunculus als Träger
des Purpurfarbstoffs. Übrigens haben die nordamerikanischen Indianer
von sich aus, unabhängig von den Europäern, den Saft der einheimischen
Purpurschnecken zum Rotfärben benutzt. So färbten sie einst, wie
heute noch die Indianer von Tehuantepec, mit dem Safte von Purpura
patula ihre Frauenröcke purpurrot.

Bild 54. Der Tuchfärber.
(Nach einem Holzschnitt von Jost Ammann 1539–1591.)
Von den großen Meeresschnecken des Mittelmeers hat wahrscheinlich
die große Tonnenschnecke (Dolium galea) das Vorbild
für das Spiralornament der jonischen Säule gegeben. Als Prof.
Troschel bei seinen zoologischen Studien in Messina sie lebend zur
Untersuchung erhielt, ließ sie, gereizt, aus ihrem einen halben Fuß
weit ausgestülpten Rüssel einen Strahl einer wasserklaren Flüssigkeit
einen Fuß weit hervorspritzen. Zu seinem höchsten Erstaunen nahm
Troschel wahr, daß der Kalkstein des Fußbodens von der Flüssigkeit
stark aufbrauste, der vermeintliche Speichel also eine scharfe Säure
war. Die genaue chemische Untersuchung des von einer dicht neben der
Speicheldrüse[S. 458] gelegenen besonderen Drüse abgesonderten Saftes ergab
darin die Anwesenheit von 3–4 Prozent freier Schwefelsäure und 0,3
Prozent freier Salzsäure. Sie dient dem Tiere dazu, die Kalkgehäuse der
Schnecken und Muscheln, von denen sie sich ernährt, im Bereiche des
Mundes aufzulösen, damit sie dann mit der Zunge ins Innere eindringen
kann, um die Weichteile aufzufressen.
Die großen Tritonshörner dagegen, besonders das Tritonium
nodiferum des Mittelmeers, die buccina der alten Römer,
diente mit einer künstlich gemachten Öffnung an der Spitze der
gewundenen Schale, in welcher das Tier einst seinen Eingeweidesack
trug, als Kriegstrompete. Deshalb sagt der Dichter Vergil: „Die
buccina zwang schon die alten Quiriten zu den Waffen.“ Teilweise
schon im Altertum, mehr aber noch in der Rokokozeit, wurden ihre
Schalen nicht nur als Signaltrompete, sondern auch mit dem Delphin als
eigentliches dekorativ ausgestaltetes Attribut der Meeresgötter immer
wieder auf Statuen und Reliefs angebracht. Man gab ihnen später bei den
Deutschen, die sie zur Zierde als Nippsache in ihren besseren Stuben
aufstellten, den Namen Kinkhörner, weil sie kinken, d. h. klingen oder
sausen, wenn man ihre Mündung an die Ohren hält. Man wollte darin
das Brausen des Meeres hören. Dies ist natürlich unrichtig. Alle
Muschelschalen sind vielmehr natürliche Resonanzböden für bestimmte
schwache Geräusche, die sie so verstärken, daß sie uns hörbar werden.
Bei absoluter Stille lassen sie kein Brausen hören. Diese und andere
große Schneckenschalen dienen auch zum Einschneiden von allerlei
bildlichen Darstellungen oder zur Herstellung von Kameen, wobei durch
Benutzung verschieden gefärbter Schichten die Figuren eine andere
Farbe als der Grund erhalten. Mit prächtig perlmutterartig glänzenden
Stücken von Kreiselschnecken der Gattung Turbo stellen die
Chinesen allerlei Einlegearbeiten in ihre lackierten Möbel und Schränke
her, während bei uns die durch Interferenz schön irisierenden inneren
Schichten auch anderer Schneckenschalen und Muscheln, vor allem der
alsbald zu besprechenden Perlmuschel dazu benutzt werden, wie auch
zur Herstellung von Knöpfen, Zahlmarken usw. Die zum Schutze gegen
das Weggeschwemmtwerden von seiten der Brandung außerordentlich fest
an der felsigen Unterlage haftenden Napfschnecken der Gattung
Patella sind, wie auch manche der größeren Meeresschnecken,
ein nicht besonders wohlschmeckendes, aber von den ärmeren Klassen
der europäischen Küstenbewohner viel gesuchtes und gern gegessenes
Nahrungsmittel.
Außerordentliche volkswirtschaftliche Bedeutung besitzen unter
allen[S. 459] Meerschnecken heute nur die Porzellanschnecken in
ihrem wichtigsten Vertreter, der Kaurischnecke (Cypraea
moneta). Diese Schnecke mit 1,5–2 cm langer,
breiteiförmiger, weißlicher oder gelblicher Schale kommt in großen
Mengen auf den Malediven im Indischen Ozeane vor, wo sie, nach
älteren Angaben, zweimal im Monat, drei Tage nach Voll- und Neumond,
eingesammelt wird, um nach dem Ablaufenlassen der Weichteile die
Gehäuse teils nach Bengalen und Siam, vorzugsweise aber nach Afrika zu
verschiffen, wo sie als Schmuck und Münze zugleich dienen. In Indien,
wo sie als Verkehrsmittel seit dem 6. Jahrhundert n. Chr. nachweisbar
sind, gelten etwa 24–36, in Afrika etwa 6 Stück gleich einem deutschen
Pfennig, früher überall mehr wegen der größeren Transportkosten.
Der Hauptstapelplatz für den ausgedehnten afrikanischen Kaurihandel
ist Sansibar. Von dort und anderen Orten der Ostküste Afrikas gehen
seit vielen Jahrhunderten große Karawanen mit diesem Artikel, der
zugleich Geld und Ware ist, nach dem Innern des Kontinentes ab.
Ganze Schiffsladungen wiederum werden von europäischen Schiffen von
dort, besonders von Sansibar, abgeholt und an der Westküste gegen
die dortigen Produkte: Goldstaub, Elfenbein, Palmöl und neuerdings
auch Gummi eingetauscht, soweit die Stämme noch nicht den Gebrauch
der europäischen Münzen angenommen haben. In Gure hatten einst 700000
Stück den Wert von 990 Mark, also etwa 2120 denjenigen von 3 Mark,
und es beliefen sich die Einkünfte des Herrschers auf 30 Millionen
Kaurischneckenschalen. Ihr Wert ist natürlich dem Kurs unterworfen
und hängt von der Zufuhr und der Entfernung ab. Gewöhnlich sind sie
zu Hunderten auf Schnüre gereiht, um das Zahlgeschäft zu erleichtern.
An manchen Orten ist dies aber nicht Sitte und müssen die Tausende
einzeln abgezählt werden. Solange die Holländer Ceylon besaßen, war
diese Insel der wichtigste Stapelplatz für die Kauris, von wo sie
in Körben oder Ballen von je 12000 Stück oder für Guinea in Fässern
versandt wurden. Eine Zeitlang wurde vermittelst der Kauris der
ganze afrikanische Sklavenhandel betrieben, indem für 12000 Pfund
500–600 Sklaven eingekauft werden konnten. Gegen die Mitte des 18.
Jahrhunderts hatte sich der Preis bereits verdoppelt. Als dann aber
die Küstendistrikte Westafrikas mit dem Kaurigelde überschwemmt
waren, traten andere Tauschobjekte an dessen Stelle, und heute wird
überall in den Kolonialgebieten mit der betreffenden Münze bezahlt.
Noch Henry Stanley bestritt auf seiner berühmten ersten Reise quer
durch Afrika auf der Suche nach dem ver[S. 460]schollenen David Livingstone
mit 6 Kauris die Tageskost eines Trägers und erhielt von den kein
anderes Tauschmittel kennenden Eingeborenen für 3 ein Huhn und für 2
zehn Maiskolben. In Angola werden kleine, scheibenförmig geschnittene
Stückchen einer großen Landschnecke (Achatina monetaria) als
Geld verwendet, in Neuguinea die kleine Nassa camelus und
globosa, an der Nordwestküste Nordamerikas noch vor kurzem ein
Dentalium, das deshalb pretiosum heißt, und die große
Haliotis splendens; es gab eine Zeit, da man für ein einziges
Stück der letzteren im Binnenland ein Pferd bekommen konnte.
Keine andere Konchyliengattung genießt so alte und allgemeine
Beliebtheit als Schmuck des Menschen als die größeren Arten von marinen
Porzellanschnecken. In allen Erdgegenden, selbst bei unkultivierten
Völkern, trifft man sie vermöge ihres glänzenden, buntgefärbten Äußern
als Zierat der Wohnungen oder der Personen.
Als menschliche Speise übertreffen aber die Muscheln an
Bedeutung weit die Schneckenarten. Schon dem vorgeschichtlichen
Menschen Europas wie Südamerikas und anderer Küsten waren die am
Strande oder in wenig tiefen Meeresbuchten gesammelten Muscheln eine
willkommene Speise, die sie gern verzehrten. So treffen wir zu Beginn
der neolithischen Zeit an den Küsten Dänemarks eine vorzugsweise von
Muscheln lebende Bevölkerung, die uns ganze Hügel von weggeworfenen
Schalen mit ihren Herdstellen dazwischen hinterließ. Unter
Knochenresten der verschiedensten Landtiere und Hochseefische finden
sich darin besonders Schalen der Auster, Miesmuschel, Herzmuschel,
Gehäuse von allerlei Strandschnecken und anderen Weichtieren. Auch
späterhin haben die Küstenbewohner gern solche Muschelspeise gegessen,
wenn sie auch nicht die Schalen dieser Weichtiere zu derartigen Haufen
aufstapelten wie sie uns in den Kjökkenmöddings Dänemarks und den
Sambaquis Brasiliens entgegentreten.
Unter allen Muscheltieren ist heute noch die gemeine Auster
(Ostrea edulis) die geschätzteste zum Verspeisen. Sie kommt
an allen ihr zusagenden Küstengebieten, wo grober Sand oder Steine
liegen und kein Schlick sie zu überdecken und so zum Ersticken zu
bringen vermag, gesellig in sogenannten Austernbänken vor. Wie alle
Muscheln ist sie ein ausgesprochener Küstenbewohner, der im Flachwasser
von Diatomeen, Infusorien und kleinen Krebschen lebt, welche ihm die
Wimperströmung zuträgt. Trotz ihrer ausgiebigen Fortpflanzung vermehrt
sich die Auster nur schwach, weil die Jungen viel Feinden ausgesetzt
sind. Sie ist zwar zwitterig, doch reifen die Eier und Samen nicht
gleich[S. 461]zeitig, so daß gleichwohl keine Selbstbefruchtung eintreten
kann. Höchstens 30 Prozent, oft aber nur 10 Prozent der Austern sind
trächtig und ältere Exemplare liefern über 1 Million Eier. Die Zeit der
Fortpflanzung fällt in den Sommer. Die Jungen entwickeln sich zunächst
in der Mantelhöhle der Mutter und schwärmen später aus, um sich rasch
irgendwo festzusetzen. Am Ende des ersten Jahres messen sie etwa 3
cm, sind aber erst mit 4 bis 6 Jahren so groß, daß sie auf den
Markt gebracht werden können.
Nach Plinius hat zuerst der Römer Sergius Orata zur Zeit des Lucius
Crassus vor dem Marsischen Krieg (91–88 v. Chr.) im Gebiet von Bajae
Austernparks (ostrearum vivarium) errichtet. „Er zog aus
ihnen große Gewinne und behauptete, die lukrinischen Austern von der
kampanischen Küste seien die besten. Damals dienten freilich die Küsten
Britanniens den Römern noch nicht mit ihren Austern. Man holt jetzt
auch welche von Brundisium (dem heutigen Brindisi am Adriatischen Meer)
in die Austernteiche am Lukrinersee und mästet sie in letzterem nach
der langen Seereise. — Die Austern genießen bei reichen Leuten den
Vorzug vor anderen Speisen. Sie lieben das süße Wasser der sich ins
Meer ergießenden Ströme und sind in Farbe verschieden: rot in Spanien,
braun in Illyrien, schwarz an Fleisch und Schale zu Circeji. Für die
besten gelten allerwärts die derben, nicht durch ihren eigenen Schleim
schlüpfrigen; auch verlangt man, daß sie sich durch Dicke, nicht durch
Breite auszeichnen. Man liebt die auf festem Boden, nicht auf Schlamm
oder Sand gefundenen. Sie lassen sich auch leicht in fremde Gewässer
versetzen. Als Arznei sind die Austern sehr wichtig. Für den Magen sind
sie wahrhaft erquickend. Schwelger bedecken sie auch mit Schnee, um sie
kühler zu erhalten, und vermischen so gleichsam die Bergspitzen mit der
Meerestiefe. In ihrer Schale, geschlossen wie sie angekommen, gekocht,
wirken sie kräftig gegen den Schnupfen. Asche von Austerschalen dient
mit Honig gegen Geschwulst des Zäpfchens und der Mandeln.“
Außer den lukrinischen Austern aus der Umgebung von Neapel liebten
die Römer besonders auch diejenigen vom Golf von Tarent und von
Kyzikos in Mysien. Heute gelten in Italien außer den noch jetzt sehr
geschätzten tarentinischen die Triester Pfahl- und die venezianischen
Arsenalaustern als die besten Sorten. In Frankreich sind diejenigen
von Marennes und La Tremblade, in Belgien die von Ostende, in Holland
die seeländischen von Vlissingen und Middelburg besonders berühmt. In
England gelten außer den Austern aus den Zuchtteichen[S. 462] von Whitstable
diejenigen von Essex und die von Colchester kommenden sogenannten
Grünbärte (d. h. solche mit durch Einlagerung von winzigen Algen
grünen Kiemen) als die vorzüglichsten. In Norddeutschland werden
meist holsteinische oder Flensburger Austern von der Westküste,
der Strecke von Husum bis Tondern, verzehrt. Weniger schmackhaft
als sie sind die dickschaligen Austern von Helgoland, Friesland,
Schottland und Skandinavien. Außerdem werden sehr viele amerikanische
eingeführt. In der Ostsee gedeihen die Austern heute nicht mehr, da
ihnen das Meerwasser dort zu süß ist. Das Minimum von Salzgehalt, das
sie zu ihrer Existenz bedürfen, ist etwa 17 pro Mille. Am fettesten
und schmackhaftesten werden sie bei 20 bis 30 pro Mille, daher
man, abgesehen von denen des Mittelmeers, auch an den Küsten des
Atlantischen Ozeans und der Nordsee die beliebtesten Austern an Stellen
findet, wo der Salzgehalt des Meeres durch in die Buchten einmündende
Flüsse gemildert wird.
Seit der römischen Kaiserzeit scheint die Austernzucht nie ganz
verloren gegangen zu sein. Sie erhielt sich besonders bei den
Byzantinern am Hellespont und um Konstantinopel, aber auch im
Abendland, obschon uns aus dem Mittelalter nur wenige Nachrichten
darüber erhalten sind. Daß die Austernzucht auch im Westen Europas nie
ganz aufgehört hat, geht aus einem im Jahre 1375 erlassenen Gesetze
hervor, das verbot, Austernbrut zu einer anderen Zeit als im Mai zu
sammeln und zu versetzen. Besonders scheint die Hegung und Aufzucht
dieser Schaltiere in Teichen an der Themsemündung geübt worden zu
sein, da es sich fand, daß bei Milderung des Meerwassers durch mäßigen
Zutritt von Flußwasser die Austern den Kennern noch besser mundeten.
Diese Austernparks erfüllen einen doppelten Zweck, indem sie Mastställe
und Magazine zugleich sind. Man gibt darin der Brut Gelegenheit, sich
vor Feinden geschützt ruhig zu entwickeln. Es sind gewaltige, durch
Schleusen mit dem Meere verbundene gemauerte Bassins, in denen das
Wasser monatlich zweimal erneuert wird. Die Parks von Marennes und La
Tremblade werden nur zur Zeit der Springfluten, bei Neu- und Vollmond,
mit frischem Wasser versehen. Dreijährig kommen dann die Austern
zum Verkauf. So liefern die drei Parks von Ostende jährlich etwa 15
Millionen Austern. In den großen Städten werden sie mit Vorliebe von
den Reichen konsumiert, da sie immerhin kein billiges Essen sind.
Paris verbraucht deren jährlich etwa 75 Millionen und London gar 1
Milliarde. In den Städten der Vereinigten Staaten werden jährlich über
5 Milliarden gegessen[S. 463] und außerdem noch 120 Millionen nach Europa
abgegeben. In der Chesapeakebay, wo sich die größten Austernparks
finden, werden ganze Wagenladungen verdorbener Pfirsiche, mit denen man
sonst nichts anzufangen weiß, zu ihrer Fütterung ins Meer geworfen.
In Virginien gibt es zahlreiche Austernkonservenfabriken, die die
Vereinigten Staaten mit ihren Produkten versorgen.
Auch die mit der Auster nahe verwandte Kammmuschel
(Pecten) wird gern gegessen und besonders zu feinen Ragouts
verwendet, während sich mit ihren Schalen die aus dem Morgenlande
heimkehrenden Pilger Hut und Kleid zu schmücken pflegten. Ebenso
beliebt als Speise ist die eßbare Miesmuschel (Mytilus
edulis), die am besten in der Nordsee und den nordeuropäischen
Meeren gedeiht. Sie gehört zu den wenigen Meerestieren, die aus den
Meeren mit normalem Salzgehalt, wie aus der Nordsee, in die ziemlich
stark ausgesüßten Binnenmeere, wie die Ostsee, eindringt und hier
ganz gut gedeiht. Hier wird sie in manchen Gegenden ähnlich der
Auster gezüchtet. Hierzu benutzen die Fischer von Ellerbeck bei Kiel
abgehauene Bäume, mit Vorliebe Erlen, denen die feineren Zweige
abgeschnitten wurden. Sie spitzen sie unten zu und versenken sie mit
Hilfe eines Taues und einer Gabel in die Region des lebenden oder toten
Seegrases in 3,6–5,5 m Tiefe fest in den Grund. Das „Setzen“ der
Muschelbäume geschieht zu jeder Jahreszeit, herausgezogen werden sie
aber nur im Winter, am häufigsten auf dem Eise, da dann die Muscheln
am besten schmecken und ungefährlich sind, welch letzteres in wärmeren
Jahreszeiten nicht immer der Fall ist. Den Stand ihrer „Muschelpfähle“,
wie sie diese Bäume nennen, wissen die Fischer durch Merkzeichen am
Lande, die sie aus der Ferne fixieren, aufzufinden. Wenn sie über
einem Baum angekommen sind, treiben sie eine Stange in den Grund,
um den Kahn daran festzubinden; dann schlingen sie ein Tau um einen
Haken, führen dieses unter Wasser um den Stamm des Muschelbaums herum
und winden denselben damit in die Höhe. In ganzen Klumpen hängen dann
nebst anderen Meerestieren die Miesmuscheln daran, die sich mit vom Fuß
ausgeschiedenen Fäden, dem Byssus, an ihnen fest verankert haben, damit
sie nicht von der Strömung weggerissen werden. In der Kieler Bucht
werden jährlich wenigstens 1000 Muschelpfähle gesetzt und ebensoviel
gezogen, nachdem sie 3 bis 5 Jahre gestanden haben. Auf den Kieler
Markt kommen den Winter hindurch über 4 Millionen Stück solchermaßen
geernteter Miesmuscheln und finden willig Abnehmer, da sie recht gut
schmecken.
[S. 464]
Während die haarähnlichen Fäden, mit denen sich die Miesmuscheln am
Boden verankern, grob und steif sind, sind sie bei manchen Arten,
wie bei der langgestreckten Steckmuschel (Pinna) fein,
geschmeidig und seidenglänzend, so daß sie hier und da, allerdings
mehr als Kuriosität für die Fremden und nicht zum täglichen Gebrauch,
zu Geweben versponnen werden. So werden in Unteritalien, besonders
in Tarent und Reggio, fein anzufühlende goldbraune Handschuhe aus
solchen Byssusfäden gewoben. Eine solche Verwendung geht mindestens
bis in die späteren Zeiten des Römerreiches zurück, da schon der 220
n. Chr. verstorbene Kirchenvater Tertullian sie erwähnt. Zu diesem
Zwecke werden die in ruhigen Meerbusen mit Schlammgrund wenige Meter
tief in großen Mengen aufrecht beieinander sitzenden Steckmuscheln
mit einem eigenen Instrument gefischt. Es besteht aus zwei gebogenen,
an beiden Enden miteinander verbundenen dünnen Eisenstangen und
wird so an der Muschel herabgelassen, daß es an beiden Seiten des
breiteren Teiles derselben hinabgleitet und dann durch Drehung um einen
rechten Winkel dieselbe festhält und herauszieht. Früher wurde diese
Muschelseide besonders im Neapolitanischen hergestellt. Außer
zur Gewinnung des Byssus werden die Steckmuscheln, von denen Pinna
squamosa des Mittelmeers 56 cm lang wird, auch ihres
zwar weniger guten Fleisches wegen erbeutet. Schon die Alten hatten
beobachtet, daß die Steckmuschel in ihrer Mantelhöhle einen rundlichen
Krebs beherbergt, den sie — wie uns Plinius und Älian berichten
— Pinnotheres oder Pinnophylax, d. h. Wächter der
Steckmuschel (pinna) nannten. Dieser sollte in der Weise für die
Ernährung der blinden Muschel sorgen, daß er letztere, die ihre Schalen
öffnet, um ihren Fuß als Köder für Fische auszustrecken, kneift, wenn
sich einige Fischchen in sie hineinbegeben haben. Die Muschel schließe
dann ihre Schalen und verzehre gemeinsam mit ihrem Genossen, dem
Krebschen, die so gemachte Beute. Selbstverständlich ist dies ein, wenn
auch recht anmutig erdachtes, Märchen.
Die größte aller Muscheln ist die in den Korallenriffen des Indischen
Ozeans lebende Riesengienmuschel (Tridacna gigas), die
ein Gewicht von 100–200 kg erreicht, ohne die Schale allerdings
nur bis zu 10 kg schwer wird. Ihr Fleisch wird zum Essen
benutzt, ihre ungemein massiven Schalen mit gewulsteten Rippen aber
nicht selten in katholischen Kirchen als Weihwasserbecken aufgestellt
oder zu Wasch- oder Springbrunnenschalen benutzt. Jedenfalls fehlen
sie als imposante Schaustücke keinem größeren Museum mariner Tiere.
Weniger auf[S. 465]fallend aber kulturgeschichtlich unvergleichlich
wichtiger als sie ist die ebenfalls dem Indischen Ozean angehörende
echte Perlmuschel (Avicula margaritifera), deren bis 30
cm lange, rauhe, äußerlich meist von Moostierchen und Kalkalgen
überzogene, flache Schalen auf grünbraunem Grunde weiße Strahlen und
nach außen zu immer stärker werdende Schuppen tragen und mit einem
grünlichen grob-faserigen Byssus fest an der steinigen Unterlage
befestigt sind. Wie sie inwendig von einer unverhältnismäßig dicken
Perlmutterschicht bedeckt sind, so scheidet der dieselbe ausscheidende
Mantel auch um alle unter ihn gedrungene Fremdkörper, vornehmlich
Parasiten der verschiedensten Art, dieselbe Perlmuttermasse ab, wodurch
die in Sage und Geschichte so berühmten Perlen entstehen. Sie
liegen nicht immer frei zwischen Mantel und Schale, sondern sind häufig
mit letzterer verwachsen, haben auch oft statt der kugeligen eine
unregelmäßige Form. Außer der Gestalt bestimmen Größe, Farbe, Glanz
und die sogenannte Klarheit oder das Wasser ihren Wert. Wegen ihrer
Größe sind die sehr unregelmäßigen, eckigen Beulen- oder Brockenperlen,
wegen ihrer gleichmäßigen, schönen Rundung die Stückperlen teuer.
Was die Färbung betrifft, werden in Europa die weißen, auf Ceylon
die rosenfarbigen, im Orient die ins Gelbliche spielenden Perlen am
meisten geschätzt. Sind schöne Perlen auch noch groß, wie die größte
in Europa bekannt gewordene, die taubeneigroße Perle König Philipps
II. von Spanien, des Sohnes Kaiser Karls V. und Isabellas
von Portugal (1527–1598), so haben sie einen ungeheuren Wert. An Papst
Leo X., den zweiten Sohn Lorenzo il Magnificos von Medici, der
1513 Papst wurde und, um seinen Finanzen aufzuhelfen, den bekannten,
schließlich zur Reformation der Kirche führenden Ablaßhandel besonders
schamlos in Szene setzte, verkaufte ein Venezianer eine Perle für
264000 Mark unseres Geldes. Den Wert der großen Perle, die Kleopatra
in Essig aufgelöst trank, um dem Antonius zu imponieren, schätzte
man auf 11⁄2 Millionen Mark. Außer den schön runden Stück- und den
eckigen Brockenperlen unterscheidet man noch die auf einer Seite
flachen Kartenperlen und die nicht gut anbohrbaren, nur zur Einfassung
von Schmuckgegenständen dienenden Staubperlen. Man spricht auch von
Zahl-, Unzen- und Lotperlen und sortiert sie für den Handel durch 5–10
verschiedene Siebe mit engeren und weiteren Löchern. Außer den Perlen
werden auch die als Perlmutter in ganzen Schiffsladungen nach
Europa kommenden Schalen der Perlmuscheln vielfach zur Anfertigung von
Knöpfen, Messergriffschalen und dergleichen verwendet.[S. 466] 1 kg
derselben repräsentiert einen Wert von 3 Mark. Die schlechteren Stücke
werden in manchen Gegenden Südasiens gelegentlich auch als Dachziegel
verwendet. Aus dem Schloßband der Perlmuschel schneidet man den wie
Labradorstein schillernden Pfauenstein, der zur Herstellung von
allerlei Schmuck dient.
Die echte Perlmuschel ist an den Küsten des Indischen und Stillen
Ozeans weit verbreitet und lebt gesellig in Tiefen von 6–45 m,
am meisten zwischen 8 und 16 m, und wird, wo sie häufig ist
und erfahrungsgemäß öfters Perlen birgt, von Tauchern auf gut Glück
heraufgeholt. Diese können, durch lange Übung dazu befähigt, 2–3
Minuten unter Wasser bleiben. Sie tauchen, den Fuß durch eine Schlinge
mit einem schweren Stein gesteckt und mit einem Messer zur Abwehr der
Haie bewaffnet, wie auch von den Mantras — den Zaubersprüchen —
des mit hinausfahrenden Priesters begleitet, vom Boot aus ins Meer,
reißen oder schneiden die mit einem Byssus an den Grund gehefteten
Perlmuscheln ab, stecken deren etwa 50 in ein von ihnen über den
Nacken getragenes Netz, geben dann den Leuten im Taucherboot durch
Rütteln des an ihnen befestigten Strickes ein Zeichen, werden von
diesen heraufgezogen und beginnen die Arbeit nach kurzer Pause von
neuem. Etwa 40 bis 50mal können sie an einem Tage nacheinander auf den
Meeresgrund tauchen, dann aber sind sie so erschöpft, daß sie einer
längeren Ruhe zu ihrer Erholung bedürfen. Nicht selten werden sie bei
ihrem nicht ungefährlichen Berufe die Beute der gefürchteten Haifische
oder von den Sägehaien verletzt. Weit häufiger aber werden sie ein
Opfer ihrer ungesunden Lebensweise; denn nicht selten stürzt ihnen,
nachdem sie einige Male getaucht sind, ein Blutstrom aus Nase und
Mund. Sie leben während der Fischzeit von Datteln, Fischen und Reis,
den ihnen die Engländer liefern, und setzen sich während des Tauchens
nach Perlmuscheln ein Stück elastisches Horn über die Nasenöffnung,
welche dadurch fest zusammengehalten wird. Die gefischten Muscheln läßt
man, damit sie ihre Klappen öffnen und die Perlen herausgesucht werden
können, eine Zeitlang am Ufer faulen, was im Sommer bei einer Hitze
von oft 50° C. einen furchtbaren Gestank verursacht, so daß der
Aufenthalt an diesen sonst paradiesischen Gestaden nichts weniger als
ein Genuß ist. Oft findet man in 20 Muscheln nicht eine einzige Perle,
ausnahmsweise aber auch wohl 20 Perlen in einer einzigen Muschel.
Neuerdings hat man vorgeschlagen, die Röntgenstrahlen zur Prüfung
der frischgefischten Perlmuscheln auf Perlen zu verwenden und alle
perlenfreien ins Meer zu werfen,[S. 467] um sie gelegentlich später wieder auf
etwaige Bildung von Perlen zu untersuchen. Es ist dies natürlich eine
sehr rationelle und humane Neuerung, so daß die unzähligen Stücke, die
bisher nutzlos ihr Leben lassen mußten, geschont werden könnten.
Die Zeit der Perlenfischerei sind an den Küsten des Indischen Ozeans
die Monate März-April und August-September, weil alsdann in der Zeit
zwischen dem Ost- und Westmonsun Windstille zu herrschen pflegt, was
sowohl für die Sicherheit der die Taucher begleitenden Fahrzeuge, als
für das bessere Sehen unter Wasser von Wichtigkeit ist. In dieser
Zeit belebt sich der sonst so öde Strand der Perlmuschelgegenden
nicht nur durch die Perlenfischer selbst, sondern durch die
Lebensmittelverkäufer, Unterhändler und allerlei Gesindel, die in
der Regel noch einen sichereren Gewinn machen als die Perlenfischer
selbst, die miserabel bezahlt sind, nämlich außer einem kleinen Anteil
an den erbeuteten Muscheln nur 30 Cent (= 41 Pfennige) Lohn im Tag
erhalten. Die Taucher stehen im Dienst größerer Unternehmer, die an die
Regierung des Landes, an deren Küste sie fischen, entweder eine feste
Pachtsumme oder einen bestimmten Teil des Ertrages bezahlen. Dieser ist
sehr verschieden in den einzelnen Jahren. In der Regel wird dieselbe
Perlmuschelbank erst nach 5 bis 7 Jahren wieder befischt, um sie nicht
so sehr zu erschöpfen. Zuweilen werden vor Beginn der eigentlichen
Fischerei Proben genommen und da, wo 1000 Muscheln nicht Perlen im
Werte von 11⁄2–3 Mark ergeben, die Fischerei ganz unterlassen. Ein
anderthalbfach größerer Ertrag gilt schon für recht günstig.
Die wichtigsten Perlmuschelbänke liegen um die Dahlakinseln im Roten
Meer, um die Bahreininseln und die Insel Ormus im Persischen Meerbusen.
Von der letzteren sagt ein persisches Sprichwort: Wäre die Erde ein
Ring, so wäre Ormus der Edelstein darin. Gegen 30000 Menschen sollen
den Sommer hindurch im Persischen Meerbusen mit der Perlfischerei
beschäftigt sein und dabei einen Gesamtgewinn von jährlich etwa 80
Millionen Mark erzielen. Andere wichtige Perlmuschelbänke liegen an
der Westküste Ceylons, im Golf von Manaar in der Bai von Kondatschi
und in der Meerenge zwischen Ceylon und der Küste von Madura, an
der sogenannten Perlküste, wo die englische Regierung das Recht zur
Perlfischerei besitzt und regelmäßig ausübt. Dabei läßt sie jedes Jahr
nur bestimmte Perlbänke und diese erst wieder nach 6–7 Jahren absuchen
und erzielt einen jährlichen Gewinn von 1⁄2–4 Millionen Mark. Hier sind
die[S. 468] Perlbänke an die Ceylon Company of Pearl Fishers vermietet,
die die Tagesernte von Muscheln in Säcken von 1000 Stück gleich an
Ort und Stelle öffentlich versteigern lassen, während die Taucher
ihren Anteil in Partien von ungefähr 6 Muscheln auf dem Fischmarkt von
Colombo verhökern lassen. Bei den Auktionen erzielt der Sack von 1000
Austern durchschnittlich 30 Rupies (= 58 Mark). Sowie aber in einem
von diesen eine besonders kostbare Perle gefunden wurde, schnellen
die Preise der nächsten Säcke plötzlich in die Höhe und erzielen
zwischen 100 und 200 Rupies (= 192 und 386 Mark), bis der Eifer der
aus der ganzen Welt zusammengeströmten Perlenhändler verrauscht
ist. Die Muscheln der ersteigerten Säcke werden von den mehr oder
weniger glücklichen Besitzern sofort geöffnet und auf etwaige Perlen
untersucht. Diejenigen, die keine Perle enthalten, werden einfach
fortgeworfen.
Außer bei Ceylon wird auch bei den Suluinseln zwischen Borneo und
den Philippinen schon seit langem Perlfischerei getrieben, ebenso
neuerdings bei Japan, an einigen Stellen der Nordküste Australiens und
in Polynesien. In Amerika und an seinen tropischen Küsten, wo die echte
Perlmuschel des Indischen Ozeans durch eine ihr sehr nahe verwandte Art
vertreten ist, betreibt man im Meerbusen von Kalifornien, im Meerbusen
von Mexiko und an den Küsten Westindiens Perlfischerei, namentlich aber
bei den Perlasinseln im Meerbusen von Panama und bei der Karaibeninsel
Margarita, die Kolumbus so, d. h. Perleninsel benannte. Hier wurden sie
von den Indianern schon vor der ersten Ankunft der Europäer geschätzt
und gesammelt. So traf Kolumbus auf seiner dritten Reise 1498 in der
Nähe der Orinokomündungen Indianerinnen, welche Perlschnüre als Arm-
und Halsbänder trugen und gab der in der Nähe befindlichen Insel, an
deren Küste die Eingeborenen nach Perlen fischten, eben den Namen
Margarita. Ebenso erhielt Vasco Nuñez de Balboa 1513, da er als erster
Europäer am Golf von Darien die Landenge von Mittelamerika überstiegen
und den Stillen Ozean erreicht hatte, von einem dortigen Häuptling an
der Küste 240 Perlen als Geschenk. Später wurden die Halbinseln Guajiro
und San Marta, an der Mündung des Magdalenenstroms, sowie La Paz am
Meerbusen von Kalifornien berühmte Stellen für Perlfischerei. Die
„okzidentalischen“ Perlen sollen durchschnittlich größer, aber weniger
glänzend als die orientalischen sein.
Der Gebrauch der letzteren als Schmuck ging offenbar von Indien
aus, von wo bis in die späte römische Kaiserzeit nach dem Bericht
der[S. 469] griechischen und römischen Autoren die meisten Perlen in die
Mittelmeerländer gelangten. Im Heldengedichte Ramajána werden sie
als etwas Bekanntes mehrfach erwähnt. Von der Sanskritbezeichnung
dafür, mangara, dürfte sich die griechisch-lateinische
Bezeichnung margaros, später margarita, ableiten. Auch
das romanische Wort für Perlmutter, französisch nacre, stammt
von einem orientalischen Worte ab. Das hochdeutsche „Perle“ dagegen
ist wahrscheinlich ursprünglich nur eine vergleichende Bezeichnung,
vom lateinischen pirula, d. h. kleine Birne. Homer kannte die
Perlen und deren Verwendung als Schmuck noch nicht. In der griechischen
Literatur werden sie zuerst von Theophrast, einem Schüler des
Aristoteles, erwähnt, nachdem durch Alexanders des Großen Eroberungen
die Griechen mit dem Orient in engere und mit Indien zuerst in direkte
Verbindung gekommen waren. Nach Athenaios sagt Theophrast in seinem
Buche über die Steine folgendes über die Perle: „Unter den bewunderten
Steinen gehört auch die Perle; sie ist von Natur durchscheinend und
dient zu verschiedenartigen Halsbändern. Sie kommt aus Muscheln, welche
der Steckmuschel ähnlich, jedoch kleiner sind, und hat die Größe großer
Fischaugen.“
Androsthenes sagt in der Beschreibung seiner Schiffahrt entlang der
Küste Indiens: „Es gibt dort eine eigentümliche Muschel, welche die
Eingeborenen berberi nennen und aus welcher der Perlstein
(margarítis líthos) kommt. In Asien werden sie hoch geschätzt
und nach Persien und weiter hinauf verhandelt. Die Muschel sieht der
Kammuschel ähnlich, ist aber nicht gefurcht, sondern glatt und rauh;
sie hat auch die zwei ohrförmigen Hervorragungen nicht, welche die
Kammuschel hat, sondern nur eine. Die Perle entsteht im Fleische des
Tieres und ist entweder so goldfarbig, daß man sie vom Gold kaum
unterscheiden kann, oder silberfarbig, oder vollkommen weiß wie
(gekochte) Fischaugen.“
Chares von Mitylene schreibt im siebenten Buche der Geschichte
Alexanders: „Im Indischen Meere werden Muscheln gefangen, aus denen
man weiße Knöchelchen nimmt, die Perlen genannt und, an Schnüren
aufgereiht, zu Schmuck für Hals, Hände und Füße verwendet werden.
Sie werden in Persien, Medien und (Klein-) Asien höher geschätzt als
aus Gold gemachte.“ Isidoros von Charax in Susiana sagt in seiner
Beschreibung Parthiens: „Im Persischen Meere liegt eine Insel, woselbst
es sehr viele Perlen gibt. Deswegen befinden sich bei der Insel viele
aus Rohr geflochtene Kähne, aus welchen Taucher ins Meer springen, bis
zur Tiefe von 20 Ellen hinabsteigen und die[S. 470] Muscheln heraufbringen.
Die meisten und besten Perlen sollen in den Muscheln entstehen,
wenn Donnerschläge und Platzregen fallen. Im Winter verstecken sich
die Muscheln im Abgrund, im Sommer aber öffnen sie sich bei Nacht,
schwimmen hin und her, schließen aber bei Tag die Schalen. Diejenigen
aber, die an Klippen festwurzeln, erzeugen daselbst die Perlen. Die im
Abgrunde wohnenden Muscheln erzeugen die glänzendsten, reinsten und
größten Perlen; bei den herumschwimmenden und in der Höhe lebenden sind
sie dagegen an Größe und Farbe geringer.“
Sehr eingehend behandelt Plinius in seiner Naturgeschichte die Perlen.
Er sagt dort von ihr: „Unter allen Kostbarkeiten sind die Perlen
(margarita) das Kostbarste. Man bezieht sie vornehmlich aus dem
Indischen Meere, wo sie mitten unter den schrecklichen Seeungeheuern
gedeihen, von wo man sie aus jenem glühenden Himmelsstriche, mitten
durch so viel Länder und Meere, bis zu uns schafft. Die meisten werden
bei der Insel Taprobane (Ceylon) und Stoidis, sowie beim indischen
Vorgebirge Perimula (Kap Komorin) gefunden. Vorzüglich gelobt werden
diejenigen aus dem bei Arabien liegenden Persischen Meerbusen. Die
Entstehung und Fortpflanzung der Perlmuschel unterscheidet sich von
der der Auster nicht sehr bedeutend. Im Frühjahr öffnen sich die
Perlmuscheln, saugen den Tau ein, werden dadurch befruchtet, und Perlen
sind die daraus hervorgehende Frucht, deren Reinheit sich nach der
Reinheit des empfangenen Taues richtet. Geschah die Befruchtung bei
stürmischem Himmel, so werden die Perlen bleich; denn sie stammen vom
Himmel und nicht vom Meere, werden daher wolkig oder rein, je nachdem
der Himmel es war. Sättigen sich die Muscheln frühzeitig am Tau, so
werden die Perlen groß; blitzt es, so schließen sich die Muscheln, und
je länger sie dann fasten, um so kleiner werden die Perlen. Donnert
es aber noch dazu, so schließen sie sich im Schrecken ganz fest und
bringen nur eine hohle Blase statt einer Perle hervor. Vollkommene
Perlen bestehen aus vielfachen, gleichsam häutigen Lagen und bilden
sozusagen eine Schwiele, weshalb sie auch von Sachverständigen erst
gereinigt werden. Da sie den Himmel so sehr lieben, wunderts mich, daß
sie nicht auch mit der Sonne in freundschaftlicher Verbindung stehen;
denn von letzterer werden sie rot gefärbt und verlieren ihre weiße
Farbe gleich der menschlichen Haut. Das reinste Weiß zeigen daher
diejenigen, welche so tief im Meere stecken, daß die Sonnenstrahlen
sie nicht erreichen. Doch auch diese werden im Alter gelb und runzlich
und glänzen nur solange sie rund sind.[S. 471] Im Alter werden sie auch dick
und hängen so fest an der Muschelschale, daß man sie nur mit der Feile
trennen kann. Übrigens sind die Perlen im Wasser weich, werden aber
augenblicklich hart, wenn man sie herausnimmt.
Wenn die Perlmuschel die Hand des Menschen bemerkt, so schließt sie
sich und versteckt ihren Schatz, weil sie weiß, daß man danach strebt.
Packt sie die Hand zwischen ihren Schalen, so schneidet sie sie zur
gerechten Strafe ab; jedoch ist dies nicht die einzige Gefahr, welche
den Fischer bedroht; denn sie wohnt meist zwischen Klippen, und im
hohen Meere ist sie von Haifischen umgeben. Aber das alles kümmert die
Damen nicht, deren Ohren Perlen zieren. Manche Leute erzählen, die
Perlmuscheln haben gleich den Bienen einen König, der sich durch Alter
und Größe auszeichne und Nachstellungen äußerst schlau zu entgehen
wisse. Diesen König suchen die Taucher vor allem zu erhaschen, die
übrigen würden dann leicht in Netzen gefangen. Man tut sie dann in
irdene Gefäße, bestreut sie tüchtig mit Salz. Wenn dann das Fleisch
verfault ist, fallen die Perlen zu Boden.
Es ist gewiß, daß die Perlen durch den Gebrauch abgenutzt werden und
die Farben verlieren, wenn man sie nicht sorgfältig behandelt (Tatsache
ist, daß sie in häufiger Berührung mit der menschlichen Haut sich
besser halten als in den Schmuckkästchen aufbewahrt). Ihr Wert richtet
sich nach der hellen Farbe, nach Größe, Rundung, Glätte und Gewicht,
Dingen, die so selten vereinigt sind, daß man nie zwei ganz gleiche
Perlen findet. Auch in der Farbe zeigt sich ein großer Unterschied.
Im Roten Meere haben sie ein helleres Weiß, die indischen dagegen
sehen aus wie Marienglas, sind aber vorzüglich groß. Das größte Lob
für eine Perle ist, wenn man sie alaunfarbig nennen kann. Auch die
länglichen Perlen sind beliebt. Die Damen halten es für einen großen
Ruhm, an Fingern und Ohren Perlen zu tragen, welche die Gestalt einer
langen, unten dicken Birne haben. An jedes Ohr hängen sie deren sogar
zwei bis drei. Verschwendungssucht und üble Sitten haben auch für
dergleichen Schmuck eigene Namen erfunden; denn man nennt solche
Ohrgehänge Klappern (crotalia), weil sie ein für die Eitelkeit
ganz liebliches Geklapper hervorbringen. Selbst die Ärmeren wollen
jetzt solchen Schmuck, und ihre Frauen möchten auch auf der Straße ihre
Anwesenheit durch Perlengeklapper anzeigen. Ja sie zieren sogar ihre
Füße damit, und zwar nicht bloß die Schuhbänder, sondern die ganzen
Schuhe. Es ist ihnen nicht genug, Perlen zu tragen; sie wollen sogar
auf Perlen gehen und sie mit Füßen treten.
[S. 472]
Daß die Perlen eine dichte Masse bilden, sieht man daraus, daß sie
beim Fallen nicht zerbrechen. Nicht immer findet man sie mitten im
Fleische der Muschel, sondern bald hier, bald dort; ja, ich habe welche
schon ganz am Rande gesehen, als ob sie herausfallen wollten, und in
manchen Muscheln 4–5. Bis jetzt hat man nur sehr wenige gefunden, die
um ein Skrupel schwerer gewesen wären als zwei Lot (=35 g).
Auch in Britannien müssen Perlen, jedoch kleine und nicht sonderlich
schöngefärbte, wachsen, weil Julius Cäsar den Brustharnisch, den
er der Venus weihte, für eine aus britannischen Perlen gemachte
Seltenheit ausgab. (Es sind dies, wie wir alsbald sehen werden, von der
europäischen Flußperlmuschel gewonnene Perlen.)
Ich habe die Gemahlin des Kaisers Gajus (Caligula, dritter römischer
Kaiser 37–41 n. Chr.), Lollia Paulina, gesehen, wie sie bei einem ganz
gewöhnlichen Verlobungsschmause, wobei keineswegs ein großer Aufwand
an Pracht verlangt wurde, mit Smaragden und Perlen bedeckt war, die in
wechselnden Reihen schimmerten. Am ganzen Kopfe, auf den Haaren, der
Kopfbinde, den Ohren, dem Halse, dem Halsbande, den Fingern befanden
sich so viel, daß sich der Wert derselben auf 40 Millionen Sesterzien
(= 6 Millionen Mark) belief, was sie selbst aus ihren Quittungen zu
beweisen bereit war. Diese Herrlichkeiten waren nicht einmal Geschenke
des verschwenderischen Kaisers, sondern ererbte, durch Plünderung
der Provinzen zusammengescharrte Reichtümer. Das ist der Erfolg von
Räubereien und Geschenken, die Marcus Lollius schändlicherweise im
ganzen Orient von den Königen erpreßte, weswegen ihm Gajus Cäsar, der
Sohn des Augustus, die Freundschaft aufsagte, so daß er sich in der
Verzweiflung vergiftete. Das also hat er durch sein Leben und durch
seinen Tod erlangt, daß seine Enkelin mit einem 40 Millionen kostenden
Schmucke beim Scheine der Lichter glänzen konnte.
Nun wollen wir einmal den Schmuck des Curius und Fabricius (sehr
einfach lebender Römer der guten, alten Zeit) bei Triumphzügen und
ihre (sehr bescheidenen) Mahlzeiten einerseits und die schmausende
Lollia andererseits vergleichen. Wäre es nicht besser gewesen, sie
wären von ihren Triumphwagen hinuntergeworfen worden, als daß sie
für solche Nachkommen gesiegt hätten? — Doch das ist nicht einmal
das ärgste Beispiel der Verschwendung. Die zwei größten Perlen, die
man seit Menschengedenken gefunden hat, besaß Kleopatra, die letzte
ägyptische Königin; sie hatte sie von orientalischen Königen geerbt.
Als sie nun täglich von Antonius mit den ausgesuchtesten Leckerbissen
ge[S. 473]mästet wurde, spottete sie doch stolz, frech und übermütig über alle
seine Herrlichkeiten, und als er fragte, wie er denn noch kostbarere
Sachen herbeischaffen könne, gab sie die Antwort, sie wolle bei einer
einzigen Mahlzeit 10 Millionen Sesterzien (= 11⁄2 Millionen Mark)
vertun. Antonius hielt die Sache für unmöglich, war aber doch begierig,
zu erfahren, was sie tun würde. Es kam zur Wette. Am folgenden Tag,
dem Tage der Entscheidung, gab Kleopatra, um den Tag nicht ungenossen
vorübergehen zu lassen, ein glänzendes, übrigens ganz alltägliches
Mahl, und Antonius machte sich darüber lustig und fragte nach der
Rechnung. Das ist nur eine kleine Zugabe, antwortete Kleopatra; die
Mahlzeit wird den bestimmten Preis kosten, und ich selbst will allein
die 10 Millionen verschlucken. Sie befahl nun, den Nachtisch zu
bringen. Auf Befehl stellten die Diener nichts vor sie hin als eine
Schale mit Essig, dessen Säure die Perlen auflöst. Sie trug jenes
herrliche und wahrhaft einzige Geschenk der Natur als Ohrschmuck.
Während nun Antonius voller Erwartung dasaß, nahm sie die eine Perle
vom Ohr, warf sie in den Essig, und trank sie, nachdem sie sich
aufgelöst hatte (was allerdings nur sehr langsam vor sich gegangen sein
wird). Eben war sie im Begriff, mit der andern Perle (dem Ohrgehäng
der andern Seite) ebenso zu verfahren, als Lucius Plancus, der
Schiedsrichter bei dieser Wette, ihre Hand zurückhielt und den Antonius
für besiegt erklärte. Die damals gerettete Perle hat sich später
ebenfalls einen Namen gemacht; denn sie wurde nach der Gefangennahme
der Kleopatra in zwei Teile zerschnitten, deren jeder ein Ohr der Venus
(der angeblichen Ahnfrau des julischen Geschlechtes) im Pantheon zu Rom
geziert.
Doch Antonius und Kleopatra brauchen mit ihrer Verschwendung nicht so
gar groß zu tun; denn sie können sich darin kaum mit einem Schauspieler
messen. Dieser war Clodius, der Sohn des Tragikers Äsop und Erbe
seiner unermeßlichen Reichtümer. Dieser Clodius nahm noch vor der Zeit
des Antonius Perlen von großem Werte, löste sie auf und trank sie,
nicht, um in einer Wette zu siegen, sondern nur um zu wissen, wie sie
schmecken. Und wie sie ihm nun herrlich mundeten, gab er auch jedem
seiner Gäste eine zu verschlucken.“
Diese Sucht nach Perlengeschmeide, die Plinius an den Römerinnen seiner
Zeit (nach der Mitte des 1. Jahrh. n. Chr.) rügt, so daß sie diese Zier
nicht nur in den Ohren, sondern auch als Halsschmuck in 1–3 Reihen und
danach in Anlehnung an die betreffenden griechischen Bezeichnungen als
Mono-, Di- und Trilinum bezeichnet, dann sogar[S. 474] an den Schuhen trugen,
war durch Beeinflussung der Orientalen zuerst bei den alexandrinischen
Griechen aufgekommen und wurde bei den reichen Römern erst nach
den asiatischen Feldzügen des Pompejus Mode. Erst in der späteren
Kaiserzeit, wie auch bei den Byzantinern, wurde ein übermäßiger Luxus
damit getrieben, wie dies die morgenländischen Herrscher, speziell die
persischen und indischen, das ganze Mittelalter hindurch bis in die
Gegenwart taten, indem sie nicht nur die Kopfbedeckung und die ganze
Gewandung, sondern auch ihre Waffen und übrigen Gebrauchsgegenstände
mit Perlen wie auch Edelsteinen überzogen. Manche römische Kaiser
suchten allerdings dem Perlenluxus entgegenzutreten. So der
sittenstrenge Alexander Severus, von dem uns sein Biograph Älius
Lampridius folgende Geschichte berichtet: „Dem Kaiser Alexander Severus
brachte einstmals ein Gesandter für seine Gemahlin zwei ausgezeichnet
große und schwere Perlen zum Geschenk. Der Kaiser bot sie zum Verkauf
aus, und da sich kein Käufer dafür fand, so ließ er sie in die Ohren
der Venus (auf dem Kapitol) hängen und sagte: ‚Trüge die Kaiserin
solche Perlen, so würde sie andern Damen ein böses Beispiel geben,
indem sie Schmuck von so hohem Werte trüge, daß niemand ihn bezahlen
könnte.‘“
Der um 180 n. Chr. lebende griechische Sophist Claudius Älianus aus
Präneste erzählt uns mancherlei von der, wie er sich ausdrückt, „von
unverständigen Männern gepriesenen und von den Weibern bewunderten
Perle“ und fügt hinzu, daß durch den Perlenhandel gar manche Leute
reich geworden seien. Er nennt als Herkunftsort der besten Perlen das
Rote Meer und die Küste zwischen Ceylon und Indien. Dort würden die
Perlmuscheln, in denen die Perlen dadurch entstehen sollten, daß ein
Blitz in die geöffneten Muscheln leuchte, an heitern Tagen bei ruhigem
Meere mit großen Netzen gefischt. Sie schwämmen herdenweise umher und
hätten Führer, wie die Bienen ihre Könige haben. „Diese Führer sollen
sich durch Farbe und Größe auszeichnen. Ist nun ein solcher gefangen,
so fällt die ganze verwaiste Herde in die Hände des Tauchers; deswegen
sind letztere auf den Fang des Führers sehr erpicht. Solange der
Führer noch lebt, weiß er die Herde mit klugen Schwenkungen zu lenken
und zu retten; ist er aber verloren, so rührt sich die Herde nicht
vom Fleck, wie eine Schafherde, die ihren Hirten verloren hat. Die
gefangenen Muscheln werden, wie man sagt, in Fässern eingesalzen; wenn
dann das Fleisch verzehrt ist, bleiben die Perlen zurück. Man kann in
den größten Muscheln kleine Perlen finden und in den kleinen große.
Manche Muschel hat gar[S. 475] keine, manche nur eine; in vielen aber sind sie
zahlreich. Ja, man sagt, es können in einer Muschel 20 Perlen sein. Die
Perle wächst im Fleische der Muschel wie ein Dorn; öffnet also jemand
die Muschel, ehe sich Perlen in ihr erzeugt haben, so findet er keine.
Es ist auch bekannt, daß Perlmuscheln, denen man die Perlen genommen
hatte und die man wieder freiließ, neue erzeugten, als wüßten sie, daß
sie sich mit diesem Schatze loskaufen könnten. Die Perle gleicht einem
Steine und enthält in sich nicht die geringste Feuchtigkeit. Sie ist
von Natur glatt und rund. Will jemand eine Perle, deren Gestalt ihm
mißfällt, durch Kunst abändern, so gelingt dies nicht; sie wird rauh
und verrät dadurch den Betrug. Die ganz weißen und großen gelten für
die vollkommensten.“
Bis auf den heutigen Tag hat sich die Perle in der ganzen Kulturwelt
ihre Schätzung als Schmuckstein erhalten. Besonders Halsgeschmeide
von großen, gleichmäßig runden Stücken sind auch zu unserer Zeit sehr
beliebt. Berühmt ist der Perlenschmuck verschiedener europäischer Höfe,
auch derjenige der deutschen Kaiserin, die eine besondere Vorliebe
für Perlen hat. Manche dieser Geschmeide sind berühmt und haben ihre
Geschichte wie einzelne hervorragende Diamanten.
Das zunehmende Seltnerwerden der wertvollen Perlmuschel gab
Veranlassung, sie künstlich in abgeschlossenen Meeresbecken zu züchten
und ihr Fremdkörper unter den Mantelraum zu schieben, damit sie Perlen
daraus bilde. Die Erfolge sind nun auch ganz günstig. Schon lange vor
den Europäern haben die Chinesen sich mit der künstlichen Erzeugung
von Perlen und dem Überziehen von allerlei kleinen Figürchen mit
einem Perlmutterüberzug durch Schieben von Vorlagen zwischen Schale
und Mantel der bei ihnen heimischen Flußperlmuschel erfolgreich
bemüht. Auch bei uns stammt ein Teil der Perlen von der durch dicke
Schalen ausgezeichneten Flußperlmuschel (Margaritana
margaritifera). Sie lebt auf sandigem bis steinigem Boden klarer
Gebirgsbäche der nördlichen Hälfte Europas vom Böhmerwald, Fichtel-
und Erzgebirge an bis ans Eismeer, von den Flüssen des Ural bis zur
Westküste Irlands, und in den reißenden Bächen der Pyrenäen. Von
solchen Muscheln Britanniens brachte Julius Cäsar, wie wir hörten,
einen Perlenschmuck mit nach Rom, also muß die Ausbeutung der Perlen in
denselben von den Kelten schon vor Ankunft der Römer praktiziert worden
sein. Die deutschen Perlen werden in der Literatur zuerst 1514 erwähnt.
Gegenwärtig werden diese Flußperlen haupt[S. 476]sächlich im sächsischen
Vogtland und im Amtsbezirk Vilshofen in Niederbayern von Unternehmern,
die das Regal von der Regierung in Pacht genommen haben, ausgebeutet,
noch mehr aber in der Moldau zwischen Rosenberg und Moldautein. Hier
werden jährlich für 8000 bis 12000 Gulden Perlen gefischt, die als
böhmische Perlen in den Handel gelangen. Bei diesem Perlenfang werden
die lebenden Muscheln sorgfältig geöffnet und, wenn sie keine Perlen
enthalten, wieder möglichst unverletzt ins Wasser zurückversetzt.
Stellenweise rechnet man auf 100 Muscheln eine Perle, zuweilen findet
man auch bedeutend mehr, doch meist nur kleine von geringem Wert.
Äußere Unebenheiten und Unregelmäßigkeiten an der Schale geben einige
Hoffnung, eine Perle zu finden. Im allgemeinen ist der Ertrag nur ein
geringer, da die Flußperlen in der Regel weniger schönen Glanz haben
als die orientalischen, doch gibt es einzelne glänzende Ausnahmen;
solche findet man z. B. im Grünen Gewölbe in Dresden.
Auch in der Mandschurei und in China gibt es Flußmuscheln, welche
glänzende Perlen liefern. Die chinesischen werden schon in der
Geschichte eines der frühesten Kaiser, namens Yü, angeblich aus dem
22. Jahrhundert v. Chr., erwähnt. Schon seit vielen Jahrhunderten
sind in verschiedenen Gegenden der Provinz Tschekiang hunderte von
Familien damit beschäftigt, systematisch Perlen und perlartigen Schmuck
von den dort einheimischen Flußperlmuscheln zu gewinnen. Diese, die
Anodonta plicata, werden in großen Mengen gesammelt und die
größten Exemplare davon ausgesucht, um ihnen Körner oder Matrizen
aus der Schale der echten Meerperlmuschel oder aus Blei — letztere
stellen meist kleine Figürchen von Buddha in sitzender Stellung dar —
reihenweise unter den Mantelüberzug beider Schalen zu schieben. Durch
diese Fremdkörper gepeinigt, drückt sich das Tier krampfhaft an die
Schalen, und dadurch bleiben die Formen auf ihrem Platze. Hierauf legt
man die Muscheln eine nach der andern in 10–15 cm Abstand in
Kanäle oder Teiche in einer Tiefe von 0,7–1,7 m unter Wasser,
zuweilen 50000 Stück. Nach 10 Monaten bis 3 Jahren werden sie wieder
aufgefischt und die betreffenden Gegenstände, die sich inzwischen mit
einer ausgiebigen Perlmutterschicht überdeckt haben, herausgenommen, um
sie zu einem billigen Preise in den Handel zu bringen. Sie werden von
den Juwelieren zu Schmuck der verschiedensten Art verarbeitet und sind
durch ganz China sehr verbreitet.
Auch in den Flüssen Nordamerikas gibt es Perlmuscheln, deren Perlen von
den Eingeborenen lange vor der ersten Ankunft der Euro[S. 477]päer gesammelt
und als Schmuck getragen wurden. Solche fand Fernando Soto 1539 bei
seinen Zügen durch das heutige Florida, Georgia und Alabama im Besitze
der Eingeborenen und an ihren Kultstätten angehäuft. Weiße Perlen
liefern die Flußmuscheln Unio rectus und U. complanatus,
gelbe dagegen U. dromas. Außerdem gibt es auch fleischfarbene,
rote, purpurne und schwarze Flußperlen; himmelblaue aber sind seltene
Ausnahmen. Eine solche brachte in London 13200 Mark ein. Bereits im
vorigen Abschnitte wurde erwähnt, daß künstliche Perlen, die wie die
Nachahmungen von Edelsteinen sehr häufig getragen werden, aus hohlen
Glaskugeln gemacht werden, deren Innenwand mit einer aus den Schuppen
des Uklei (Alburnus lucidus), eines unseres gemeinsten
Süßwasserfisches aus der Sippe der Weißfische, bereiteten Masse
ausgekleidet wird.
Übrigens sei hier bemerkt, daß es auch Perlen pflanzlicher Abstammung
gibt, die von den Malaien, die sie als mestica bezeichnen, von
alters her als wertvolle Amulette an einer Halsschnur oder am
Waffengehänge getragen werden. Sie kommen im Holz der Kokospalme
und der Kasuarinenbäume, ferner in den Früchten der Brotfrucht und
Arekapalme vor. Die betreffenden, im Zellgewebe entstandenen Perlen
sind rund bis länglich und erreichen in seltenen Fällen die Größe eines
kleinen Taubeneies. Die meisten von ihnen sind weiß gefärbt, ohne
jedoch den Glanz der echten Perlen aus der Perlmuschel zu besitzen.
An einer Seite besitzen sehr viele derselben eine kleine leuchtende
Zone, ein „Sönnchen“, wie es der deutsche Gelehrte in holländischen
Diensten, Rumphius, der gegen Ende des 17. Jahrhunderts die Tier-
und Pflanzenwelt Indonesiens erforschte, sinnig nennt. Manche
Pflanzenperlen sind mehr gelblich oder bräunlich, ja bis schwärzlich.
Alle Mesticas funkeln im Dunkeln, wenn man sie, wie beim bekannten
Feuerschlagen, mit einem harten Steine zusammenschlägt. Es sind dies
Konkrementbildungen aus fast reiner Kieselsäure.
Weiterhin haben wir von den Menschen nützlichen Weichtieren die
Holothurien oder Seegurken zu nennen, die bei den
als Feinschmecker berühmten Chinesen wie die eßbaren Vogelnester
der Salangane als sehr gesuchte Leckerbissen teuer bezahlt
werden. In den malaiischen Meeren beschäftigen sich Tausende von
Fahrzeugen ausschließlich mit dem Fang der Seegurken, die, auf die
verschiedenste Weise zubereitet, unter dem Namen Trepang
(franz. biche de mer) nach China ausgeführt werden. Es sind
dies wurmartig verlängerte Stachelhäuter mit einer bis auf kleine
Reste zurückgebildeten Ver[S. 478]kalkung der Außenschicht. Sie benutzen zur
Fortbewegung nur drei Füßchenreihen wie die eßbare Seegurke
(Holothuria edulis), haben vom Wassergefäßsystem der Seeigel
nur die Fühler bewahrt und sind Zwitter. Die Geschlechtsdrüsen liegen
nicht radiär wie bei den übrigen Stachelhäutern, sondern sind als lange
Schläuche nur in einem der fünf Interradialräume vorhanden. Sie leben
im sandigen Schlamm des Meergrundes, wo sie von allerlei tierischer und
vegetabilischer Nahrung leben, die sie sich mit Hilfe ihrer Fühler zum
Munde führen.
Die Zahl der Seegurkenarten, die im Handel unterschieden werden, ist
eine ziemlich große, und ihre Namen wechseln je nach der Mundart der
chinesischen Stadt, wohin sie ausgeführt werden. Sie werden von den
Eingeborenen der Molukken, Philippinen, Neuguineas, ganz besonders
aber der Inseln des Stillen Ozeans in großen Mengen erbeutet und
für den Verkauf an die Händler präpariert, indem man sie zuerst
in Meerwasser kocht und dann auf hölzernen Gestellen an der Sonne
trocknet. Dabei schrumpfen sie gewaltig ein. In der Folge werden sie
zur vollständigen Auslaugung des Meerwassers noch einige Male in etwas
Süßwasser gedünstet und in großen, eigens dazu erbauten Schuppen an
rauchenden Feuern getrocknet. Erst kurze Zeit vor der Verladung in
die Schiffe werden sie, in Säcke verpackt, an die Händler verkauft,
die in kleinen Küstenfahrzeugen von selten mehr als 100–120 Tonnen
Gehalt die Ansiedelungen der Eingeborenen anlaufen, um von diesen den
Trepang gegen allerlei Tauschartikel einzuhandeln. Wollen die Chinesen
sie verspeisen, so reinigen sie den Trepang gründlich und lassen ihn
24–38 Stunden im Süßwasser aufquellen, wobei er eine schmutziggraue
Farbe annimmt. Nach mehrmaligem Waschen und sorgfältiger Entfernung
der Eingeweide werden sie in kleine Stückchen geschnitten und in
starkgewürzten Suppen oder mit verschiedenen anderen Speisen gegessen.
Sie erscheinen dann als milchig aussehende Gallertklumpen und sind sehr
leicht verdaulich. Sie sollen reizend auf die Genitalsphäre wirken,
weshalb sie von den sinnlich veranlagten Chinesen so überaus geschätzt
werden.
Auch von den an den Meeresküsten verbreiteten Seeigeln, so in
den Mittelmeergegenden von dem überall gemeinen Steinseeigel
(Echinus saxatilis), werden wenigstens die Geschlechtsdrüsen
als leckere Speise gern gegessen. Besonders schmackhaft sollen die
fünf gelben traubenförmigen Eierstöcke der Weibchen sein. Von ihnen
sollen allein in Marseille 100000 Dutzend auf den Markt gebracht und
das Dutzend zu 20–60 Centimes verkauft werden. Schon die alten Griechen
und[S. 479] Römer aßen die Seeigeleierstöcke gern und man fand Schalenreste
des eßbaren Seeigels (Echinus esculentus) in Küchen
des einst vom Vesuv verschütteten Pompeji. Diese Art erwähnt schon
Aristoteles unter dem Namen echínos als eßbar und sagt, daß
man von ihr die großen sogenannten Eier genieße. Älian um 180 n. Chr.
meint: „Der Seeigel bietet eine vorzüglich gesunde Speise und stärkt
den geschwächten Magen. Bestreicht man Leute, welche an Krätze leiden,
mit ihm, so werden sie geheilt; samt der Schale verbrannt, dient er zum
Reinigen der Wunden.“ Und Palladius um 380 n. Chr. sagt: „Den ganzen
Winter hindurch wird das Fleisch der Seeigel eingesalzen.“
Endlich haben wir noch die für den Menschen nützlichen Korallen
und Schwämme kurz zu erwähnen. Von ersteren kommt nur die
Edelkoralle (Corallium rubrum) in Betracht, deren
Vorkommen auf das Mittelmeer und das Adriatische Meer nördlich bis
Sebeniko, die Nordwestküste von Afrika und die Küsten der Kapverdischen
Inseln beschränkt ist. Sie lebt in Tiefen von 40–240 m, meistens
aber in solchen von 80–180 und ist gewöhnlich in abwärts gerichteter
Stellung an Felsen, namentlich an der Unterseite überhängender
Vorsprünge festgewachsen. Die mehr oder weniger verzweigten, bis zu
30 cm langen Stöcke besitzen ein rotes, rosenfarbenes bis fast
weißes Kalkskelett, in dessen roter bis orangefarbiger Rinde die
kleinen weißen, völlig in die Rinde zurückziehbaren Einzelindividuen
oder Polypen stecken. Die Stöcke tragen meist entweder nur männliche
oder nur weibliche, bloß ganz ausnahmsweise zwitterige Individuen. Ihre
wichtigsten Standorte liegen an der Küste von Algerien und Tunis, bei
den Balearen, bei Sardinien und Sizilien, wobei besonders von Torre del
Greco bei Neapel aus alljährlich hunderte von Barken zu dem mühseligen
Betrieb der Korallenfischerei hinausfahren. Die Fahrzeuge variieren von
6–12 Tonnen Gehalt und 4–12 Mann Besatzung; danach richtet sich auch
die Größe und Schwere des Gestells und Netzes, womit die Korallen vom
felsigen Grunde, an dem sie fest angewachsen sind, abgelöst werden.
Dieses besteht aus zwei übers Kreuz gelegten und stark verfestigten,
bis 3 m langen Balken, die an der Kreuzungsstelle mit einem
großen Steine oder besser noch mit einem Eisen beschwert werden.
Daran hängen 34–38 Bündel grobmaschiger Netze in Form von Beuteln
oder Wischern, wie sie auf Schiffen zum Reinigen des Bodens gebraucht
werden. Dieser an einem starken Seile befestigte Apparat wird nun vor
dem Winde geschleppt und je nach der Größe von Hand oder mit einer
auf dem[S. 480] Hinterteil des Fahrzeugs befindlichen Winde heraufgezogen
und auf den Grund gelassen. Da die Edelkorallen nur auf sehr unebenem
Felsboden, am liebsten unter Vorsprüngen, unter welche die Arme des
Kreuzes eindringen sollen, wachsen, so gehört das Festsitzen des
Schleppapparates zu den täglichen und stündlichen Vorkommnissen
und das fortwährende Flottmachen desselben zu den anstrengendsten
und aufreibendsten Arbeiten, zumal die Fischerei der Edelkoralle
unausgesetzt während der heißen Jahreszeit betrieben wird.
Die von den vorzugsweise italienischen Korallenfischern erbeuteten,
einen jährlichen Erlös von mehreren Millionen Franken darstellenden
Korallen werden zunächst von der dünnen lebendigen Rinde gereinigt,
nach der Farbe sortiert und namentlich in Neapel, Livorno und Genua,
aber auch in Marseille zu allerlei Schmuck verarbeitet. Die von den
Felsen abgerissenen, oft von Würmern und Schwämmen durchbohrten
Basisstücke kosten 5–20 Franken das kg. Der Preis der guten
Ware ohne solche Beschädigungen schwankt zwischen 45 und 70 Franken
das kg. Für das kg ausgewählter dicker und besonders
rosenrot gefärbter Stücke, die man als peau d’ange bezeichnet, werden
400, ja 500 und mehr Franken bezahlt. Die Stücke, welche entweder
nur bis zu einer gewissen Tiefe oder durch und durch schwarz sind
und als „schwarze Korallen“ gesondert zu 12–15 Franken das kg
verkauft werden, kommen nicht etwa von einer besondern Art, sondern
sind Edelkorallen, die einst abgerissen wurden, versanken und längere
Zeit vom Schlamm bedeckt in der Tiefe lagen, wobei die rote Farbe durch
einen chemischen Vorgang in eine schwarze verändert wurde. Im Indischen
Ozean und im Roten Meer gibt es aber eine von Hause aus mit schwarzem
Kalkskelett versehene Art Rindenkoralle. Es ist dies die schwarze
Koralle (Plexaura antipathes). Sie hat einen dickwurzeligen,
buschig verzweigten, schwarzen, nur an den dünnen Endreisern
braunroten, bis zu 35 cm hohen, an der knolligen Wurzel 3 bis 5
cm dicken Stock mit graugelber Rinde, der im Orient zu allerlei
Schmuckgegenständen verarbeitet, auch zu Amuletten als Schutz gegen
Verzauberung getragen wird. Schon Plinius kannte beide Arten, glaubte
aber irrtümlicherweise, daß die aus den Korallen gearbeiteten Perlen,
die man schon damals an Schnüren aufgereiht als Schmuck trug, Früchte
des am Meeresboden wachsenden Korallenstrauchs seien und erst an der
Luft von Weiß in Rot übergingen. Daß die Koralle ein Tier und keine
Pflanze sei, diese Erkenntnis blieb ja erst unserer Zeit vorbehalten.
Wenn auch bereits im Jahre 1723 von Peyhsonel ihre[S. 481] tierische Natur
erkannt wurde, so dauerte es doch bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts,
bis diese Tatsache allgemein anerkannt wurde.
Der römische Dichter Ovid gibt uns die landläufige Ansicht des
Altertums über diese Wesen in folgendem Ausspruche: „Die Koralle
ist, solange sie im Wasser lebt, ein weiches Kraut, wird aber im
Augenblicke hart, wie sie an die Luft kommt.“ Und Plinius schreibt
über sie in seiner Naturgeschichte: „Die Korallen des Roten Meeres
sind schwärzlich; die im Persischen Meer heißen jace. Die
beliebtesten Sorten finden sich im Gallischen Meerbusen bei den
Stöchadischen Inseln (jetzt Iles d’Hyières bei Marseille), im
Sizilischen Meere bei den Äolischen Inseln (im Norden Siziliens)
und bei Drepanum (dem heutigen Trapani, der bekannten Stadt an der
Westküste Siziliens); sie kommen auch bei Graviscä (an der etrurischen
Küste) und an der Küste Kampaniens bei Neapel vor. Die von Erythräa
(einer Stadt Kleinasiens gegenüber der Insel Chios) sind vorzüglich
rot, aber weich und daher wertlos. Die Korallen haben die Gestalt eines
Strauches und eine grüne Farbe. Ihre Beeren sind unter dem Wasser
schneeweiß und weich; herausgenommen werden sie sofort hart und rot
und gleichen an Ansehen und Größe den Früchten des Kornelkirschbaums.
Schon durch bloße Berührung sollen sie, wenn sie noch frisch am Stamme
hängen, zu Stein werden. Man fischt die Korallen mit Netzen oder haut
sie mit einem scharfen eisernen Werkzeug ab. Am liebsten hat man die
vollkommen roten und recht ästigen Korallenstämme, nur dürfen sie nicht
rauh oder mit Wurmgängen besetzt oder hohl sein oder vertiefte Stellen
haben. In Indien werden die Korallenbeeren so hoch geschätzt wie bei
uns die Perlen; ihre Priester halten sie, wenn sie getragen werden, für
ein Schutzmittel gegen Gefahren. Sie werden dort demnach als Schmuck
und Amulett zugleich getragen. Ehe man sie nach Indien zu verkaufen
wußte, schmückten die Gallier (Kelten) ihre Schwerter, Schilde und
Helme damit. Jetzt aber ist solcher Mangel an verkäuflichen Korallen,
daß man sie selbst da, wo sie gefunden werden, nur selten sieht. Man
hängt übrigens die kleinen Zweige den Kindern als Schutzmittel an,
braucht sie auch innerlich und äußerlich als Arznei.“ Jedenfalls sind
die Korallenhalsbänder unserer Kinder und Erwachsenen aus Amuletten
hervorgegangen, wie sie noch die gebildeten, aber sehr abergläubischen
Römer trugen. Noch Solinus schreibt: „Man arbeitet aus Korallen
mancherlei Schmuck; denn sie enthalten, wie Zoroastres (der Gesetzgeber
im medisch-baktrischen Reich, der Verfasser des Zend-Avesta) sagt, eine
heilsame Kraft. Gewöhnlich[S. 482] nennt man sie curalium, Metrodoros
(ein Schüler des athenischen Philosophen Epikur, der von 342–270 v.
Chr. lebte) nennt sie gorgonia und behauptet, sie widerständen
den Wirbelwinden und Blitzen.“ Noch viel üppiger als im Altertum
schossen im Mittelalter solche abergläubische Ansichten über die
Korallen ins Kraut; doch können wir hier nicht näher darauf eingehen.
Wenden wir uns vielmehr zu den Schwämmen.
Bei den Schwämmen, deren tierische Natur noch schwerer als bei
den Korallen nachzuweisen war, kommt als schon im Altertum wie
heute verwendetes Nutztier des Menschen einzig der allbekannte
Badeschwamm (Spongia usitatissima) in Betracht. Das
Netzwerk von elastischen Hornfasern, das wir als Schwamm benutzen, ist
ja nur das skelettartige Gerüst, das übrigbleibt, wenn man den frisch
aus dem Meere genommenen, wie die Koralle mit einem lebenden Überzuge
versehenen Schwamm so lange knetet und drückt, bis er von den die
Maschen ausfüllenden und die Poren und Auswurfsöffnungen bekleidenden
weichen Zellen befreit ist. Solche Hornschwämme finden sich in der
kalten Zone gar nicht. Auch in der nördlichen Hälfte der gemäßigten
Zone trifft man sie nur vereinzelt und verkümmert; dagegen ist schon
das Mittel- und Adriatische Meer reich an verschiedenen Sorten, von den
feinsten bis zu den gröbsten Schwämmen. Eine Einteilung derselben in
gute Arten ist sehr schwer. Die Schwammhändler nehmen nach der gröberen
oder feineren Beschaffenheit des elastischen Netzwerks 16 Sorten
nutzbarer Schwämme an, die von verschiedenen Gegenden des Mittelmeers
stammen.
Die durch ganz besondere Weichheit und häufige Becherform
ausgezeichnete, schön blaßgelbe Sorte des Badeschwamms wird an der
syrischen Küste erbeutet. Fünf andere Sorten der sog. éponge
fine werden im östlichen Teile des Mittelmeers, bei Tripolis und
an der Ostküste des Adriatischen Meeres in Tiefen von 2–180 m
gefischt. Sie sind etwas dunkler gelb und weniger fein als die
erstgenannte Sorte. Noch dunkler, nämlich dunkelbraungelb, und gröber
in der Textur ist der mehr flache und dichtere Zimokkaschwamm, der im
Griechischen Inselmeer, an der Küste der Berberei und in der Adria
gewonnen wird. Er wird im Handel als éponge dure bezeichnet.
Die éponge commune des Handels, die geringste Schwammsorte,
ist der einer andern Gattung angehörende gemeine Pferdeschwamm
(Hippospongia equina), der meist brotlaibförmig ist und
besonders von der afrikanischen Mittelmeerküste kommt.
[S. 483]
Im Griechischen Meere und an der Küste Syriens gewinnt man die Schwämme
aus einer Tiefe von 20–50 m durch Taucher, deren gewöhnlich
vier außer dem Gehilfen in einem Boote sind. An einem Seile, das der
Taucher in einer Hand hält, wird er, sobald er ein Zeichen gegeben
hat, schnell mit seiner in einem Netze geborgenen Beute zur Oberfläche
des Wassers emporgezogen. An der istrischen und dalmatinischen Küste
werden die oberflächlicher liegenden Schwämme nicht durch Taucher,
sondern von einem langsam fahrenden Boote aus mit einer langen
vierzinkigen Gabel, wie wir sie auf alten Bildwerken als Wahrzeichen
des Meergottes Neptun erblicken, vom Grunde heraufgeholt. In den
starken Barken, die während der guten Jahreszeit die zerrissene und
inselreiche Küste absuchen, befinden sich in der Regel nur zwei Mann.
Am Vorderdeck, der einen viereckigen Ausschnitt hat, stellt sich der
die Gabel führende Mann auf, um, über Bord gebeugt, den Oberkörper
sicher balancieren zu können. Der zweite Mann führt die Ruder, deren
Stützpunkte auf einem die Bordseite überragenden Balken liegen, wodurch
die notwendigen feinen Bewegungen des Bootes leichter und sicherer
werden. Während er nun das Boot hart am Felsenufer über einem Grunde
von 4–13 m Tiefe langsam dahintreibt, späht jener scharfen
Auges nach den durch ihre schwarze Farbe sich verratenden Schwämmen.
Am günstigsten ist natürlich der Fang bei völliger Windstille, da
dann die Schwämme am besten gesehen werden können. Bei mäßig bewegtem
Meer wird die Oberfläche des Wassers mit Öl geglättet. Zu diesem
Zwecke liegt stets auf der Spitze des Bootes ein Haufen glatter Kiesel
und daneben steht ein Gefäß mit Öl. Will nun der Schwammfischer die
unruhige Meeresoberfläche glätten, so taucht er einige der Steine mit
der Spitze in das Öl, meist Olivenöl, und wirft sie einzeln in einem
Halbkreise um sich. Alsbald breitet sich von den getroffenen Stellen
eine feine Ölschicht aus, die die kleinen Wellen besänftigt, so daß das
Auge nicht mehr durch die sich kreuzenden Brechungen und Spiegelungen
geblendet und im Sehen gestört wird. Der Schwammfischer muß aber die
Schwämme nicht bloß mit den Augen erspähen; da sie am liebsten unter
Felsenvorsprüngen gedeckt wachsen, muß er mit seiner 7–14 m
langen Gabel zwischen und wenn möglich unter die Felsen tasten und sie
nach dem Aufspießen durch Drehen der Gabel von der Unterlage loszulösen
versuchen. Kehren die Boote mit Beute beladen zurück, so werden die
Schwämme am Ufer so lange getreten, dann mit den Händen geknetet und
ausgedrückt und wiederholt gewaschen, bis die[S. 484] schwarze Oberhaut und
alle zwischen den Hornfasern gelegene lebende Substanz abgegangen ist.
Bevor sie in Gebrauch genommen werden können, müssen sie dann nochmals
in lauem süßem Wasser gereinigt werden. Der Sand, den man stets in den
gekauften Schwämmen findet und den man vor deren Ingebrauchnahme zu
entfernen hat, wird erst nachträglich zu betrügerischen Manipulationen
von den Händlern hineingetan, da die Schwämme nach Gewicht verkauft
werden. Zu diesem Zwecke werden die ganz rein aufgekauften Schwämme in
den Magazinen der Großhändler mit Sand durcheinandergeschaufelt, um
sie künstlich zu beschweren und so mehr daraus zu lösen. Ganz so wie
diese weniger feinen adriatischen Badeschwämme werden übrigens auch die
feinen syrischen und griechischen Schwämme von den dortigen Fischern
behandelt.
Es leuchtet ein, daß bei der in der oben geschilderten Weise
betriebenen Schwammfischerei der Fang immer weniger ergiebig wird. Es
ist daher ein großes Verdienst von Prof. Oskar Schmidt, daß er bei
seinen von 1863–1872 zur Hebung der Schwammfischerei an der Küste
Dalmatiens angestellten Studien dazu kam, die Schwämme künstlich zu
züchten. Bei der ungemein großen Regenerationsfähigkeit dieser Tiere
war das Verfahren ein sehr einfaches. Er zerschnitt den frischen
Badeschwamm in kleinere Stücke und befestigte diese auf hölzerne
Gestelle, die er an geschützten Orten ins Meer versenkte. Er hatte die
Freude, daß die Anlagen gut gediehen und die Schwämme vortrefflich
wuchsen. Leider scheiterte der Versuch trotzdem, da einmal unzählige
Pfahlwürmer das Holzwerk der Anlage zerstörten, andererseits aber die
Küstenbewohner und Schwammfischer selbst sich nicht nur vollkommen
gleichgültig gegen die Neuerung, die ihnen doch nur Nutzen bringen
sollte, verhielten, sondern sogar die Anlagen zu zerstören suchten.
So scheiterte in diesem Falle wie so oft das redlichste und Erfolg
versprechende Unternehmen an der Beschränktheit und Indolenz der
Menschen, die schließlich, wenn ihre Schwammgründe bei ihrer unsinnigen
Methode abgefischt sein werden, was in absehbarer Zeit der Fall sein
wird, doch zu der Neuerung der künstlichen Schwammzucht gezwungen sein
werden; denn trotz der außerordentlichen Vermehrung des Badeschwammes
werden die Schwämme immer seltener, da die unvernünftigen Fischer
schon im Frühjahr, wenn der Schwamm mit jungen, bald ausschwärmenden
Larven angefüllt ist, Schwämme stechen und auf diese Weise ungezählte
Millionen junger Tiere vernichten. Vielleicht wird man aber in späterer
Zukunft sich mit künst[S. 485]lichen Schwämmen aus porösem Gummi behelfen und
so nach und nach das natürliche Produkt entbehren können.
Neuerdings hat der Lyoner Physiologieprofessor Raphaël Dubois durch
seine vieljährigen Versuche in Tamaris der künstlichen Aufzucht von
Badeschwämmen neue Wege gewiesen. Da er mit dem Wachstum in kleine
Stücke geschnittener Schwämme, die er auf allerlei Gegenständen mit
einer Schnur befestigte und, vor zu greller Sonne geschützt, in 2–3
m Tiefe heranwachsen ließ, keine besonders günstigen Resultate
erzielte, begann er mit der Aufzucht der in großer Menge von den
Mutterschwämmen gewonnenen Larven, die von sehr gutem Erfolg war und
für die systematische Aufzucht besonders feiner Schwammarten große
Vorteile bietet, so daß wohl diesem Verfahren die Zukunft gehört.
Damit dürfte es nicht schwer fallen, die durch vieljährigen Fang von
Schwämmen entvölkerten Küsten wieder mit neuem gutem Material zu
bevölkern.
Schon das Altertum kannte die heute bei uns übliche Verwendung des
Badeschwammes bei den Mittelmeervölkern. Plinius berichtet uns, daß
er durch Taucher gewonnen werde, die Taucher aber großen Gefahren,
besonders von seiten der Haifische, ausgesetzt seien. Er schreibt
darüber wörtlich: „Den Tauchern, welche Badeschwämme am Meeresgrunde
holen, werden Haifische gefährlich, die sich oft in Menge einfinden.
Die Taucher erzählen, es zeige sich oft über ihrem Kopfe eine wie
ein flacher Fisch aussehende Wolke, welche sie niederdrücke und am
Auftauchen hindere; deshalb führten sie spitze Dolche bei sich, weil
die Wolke nicht Platz mache, wenn sie nicht durchstochen werde. Das
alles mag wohl nur Wirkung der Dunkelheit und Furcht sein; aber
jedenfalls setzt es mit den Haifischen einen harten Kampf ab und kann
man sich nur dadurch retten, daß man mutig auf sie losgeht und sie auf
diese Weise in Schrecken versetzt. In der Tiefe ist der Vorteil von
beiden Seiten gleich; kommt aber der Taucher an die Oberfläche, so ist
die Gefahr für ihn groß, weil er nun das Wasser verlassen will und
daher dem Haifisch nicht mehr entgegengehen kann. In diesem Falle muß
er sich ganz auf die Hilfe seiner Kameraden verlassen, welche ihn an
einem unter den Armen hindurchgezogenen Seil aufwärtsziehen. Sobald der
Kampf unter dem Wasser beginnt, schüttelt der Taucher mit der Linken
am Seile und zeigt dadurch die Gefahr an, seine Rechte aber kämpft
mit dem Dolche. Man zieht ihn nur langsam in die Höhe; sobald er aber
dem Schiffe nahe ist, muß er schnell durch einen starken Ruck auf das
Schiff geschleudert werden, sonst wird er[S. 486] doch noch verschlungen.
Oft wird er vom Ungeheuer noch aus der Luft geschnappt, wenn er sich
nicht in eine Kugel zusammenzieht. Aus dem Schiffe hält man zwar dem
Haifisch dreizackige Gabeln entgegen, allein er weiß ihnen pfiffig
genug auszuweichen, indem er sich unter dem Schiffe verbirgt und von
da aus, ohne sich einer Gefahr auszusetzen, angreift. Am sichersten
kann man übrigens da tauchen, wo man platte Fische sieht; denn wo diese
sind, findet man niemals Raubtiere. Deshalb werden die ersteren heilige
Fische genannt.“
Drei Menschenalter nach Plinius berichtet uns der griechische Sophist
Oppian über die Schwammfischerei: „Am schlimmsten sind diejenigen
Leute dran, die nach Badeschwämmen (spóngos) tauchen. Zu
ihrem Geschäfte bereiten sie sich dadurch vor, daß sie wenig essen
und trinken, wodurch der Atem freier wird, auch schlafen sie viel.
Bevor sie ans Werk gehen, bitten sie die Götter, ihnen Schutz gegen
gefährliche Seetiere zu verleihen. Sehen sie irgendwo den Kallichthys
(d. h. Schönfisch), so sind sie frohen Mutes und wissen, das kein
gefährliches Tier in der Nähe ist. Wollen sie tauchen, so haben sie ein
Seil um den Leib, in der linken ein Bleigewicht, in der rechten eine
Sichel, im Munde Öl. Das Blei bringt sie schnell auf den Grund, das Öl
spucken sie aus, wo sie einen Schwamm sehen; denn Öl macht das Wasser
durchsichtig. Die Schwämme sind an Felsen angewachsen. Der Taucher
schneidet eiligst ab, was er erreichen kann, zuckt dann schnell am
Seil, damit ihn die Kameraden wieder hinaufziehen. Kommt er glücklich
an die Oberfläche, so ist er doch vor Angst und Anstrengung ganz elend;
oft aber wird er in der Tiefe von den Ungeheuern verwundet oder ganz
zerrissen.“ Daß alle Autoren so einstimmig über die großen Gefahren
von seiten der Haie bei der Schwammfischerei berichten, beweist, daß
diese Tiere im Altertum in den Mittelmeergegenden viel häufiger waren
als heute, da man diesen gefährlichen Raubfischen mit allen Mitteln
entgegentritt und sie so viel als möglich auszurotten sucht.
Hier könnten noch die ausschließlich das Meer an der Oberfläche oder in
größeren Tiefen als Plankton lebenden einzelligen Radiolarien
erwähnt werden, deren Kieselschalen als Kieselgur oder
Infusorienerde als eine farblose oder gefärbte mehlartige Masse
oft mächtige Lager bildet wie in der Lüneburger Heide, am Vogelsberg
bei Franzensbad, in Ungarn, Toskana, Schweden, Finnland, Virginia usw.
Sie dient zur Bereitung von Dynamit, indem das Nitroglyzerin damit
getränkt wird, von Wasserglas, Ultramarin, von Tonwaren aller Art,
Papiermaché, Siegellack, zum Kitten, als Formsand und Poliermittel,[S. 487]
zur Umhüllung von Dampfkesseln und feuerfesten Schränken als schlechter
Wärmeleiter statt Asbest usw. In Schweden und Finnland wird sie sogar
dem Brote beigemischt. Bei vielen unkultivierten Völkern bildet sie
als eßbare Erde, rein oder mit andern Stoffen vermischt, eine
nicht nur in Zeiten von Hungersnot, sondern auch sonst beliebte Speise.
Es sei hier nur an die südamerikanischen Erdesser, die Otamaken,
erinnert, über die Alexander von Humboldt in seinem Buche: Reise in die
Äquinoktialgegenden des neuen Kontinents eingehend berichtet. Dort sind
alle bis dahin bekannten Erde essenden Stämme zusammengestellt, so daß
wir alle Interessenten darauf verweisen können. Zu dieser sind im Laufe
des 19. Jahrhunderts noch zahlreiche neue hinzugekommen, so daß wir
heute sagen können, daß diese Sitte fast über die ganze Erde verbreitet
ist und eine größere Rolle spielt, als man bis dahin glaubte. Außer
dem mageren Kieselgur werden auch die verschiedensten fetten Erden,
besonders Tonarten, mit Behagen und ohne irgend welche Nachteile
verspeist, vorausgesetzt, daß die Gesamternährung durch allzugroße
Zufuhr dieses natürlich nicht nahrhaften Balastes nicht leidet.
[S. 488]
XXII. Die Honigbiene.
Unter allen Insekten ist zweifellos die gemeine Honigbiene
(Apis mellifica) das weitaus nützlichste und seit Urzeiten
dem Menschen durch ihre süßen Vorräte von Honig dienstbar. Soweit
überhaupt historische Urkunden zurückreichen, wissen wir, daß alle
Völker von jeher den in hohlen Baumstämmen oder Felslöchern von wilden
Bienenkolonien zusammengetragenen Honig aufsuchten und als äußerst
geschätzte Speise oder — mit Wasser verdünnt — als überaus beliebtes
Getränk genossen. Von den heute noch auf niedriger Kulturstufe lebenden
Volksstämmen wissen wir, daß dem Naturmenschen der Begriff Honig den
höchsten denkbaren Gaumengenuß bedeutet, den er sich so häufig als
möglich zu verschaffen sucht. Alle Jägerstämme schauen auf ihren
Streifereien durch die Natur mit Eifer nach etwaigen Kolonien wilder
Bienen aus, und manche Stämme, wie z. B. die Australier, ergreifen gern
reich mit Pollen zum Neste zurückkehrende Bienen, um ihnen mit Harz
eine Flaumfeder anzukleben, so daß sie gerade noch wegfliegen können.
Den so gezeichneten Bienen folgen sie raschen Laufes, bis sie den
Bienenstock mit dem ersehnten Honigvorrat ausgekundschaftet haben. Dann
wird derselbe ausgeplündert und der Honig, wohl weil er konzentriert zu
süß ist und in größeren Mengen widersteht, mit Wasser in der Vertiefung
eines Felsens verdünnt und ausgetrunken. Blieb irgendwo eine solche
Honiglösung in Wasser in einem Gefäße stehen, so entstand von selbst
durch die hineingefallenen allgegenwärtigen Hefepilze das älteste
berauschende Getränk des Menschen, der Met, der bei allen Völkern der
Vorläufer von Bier und Wein war, wie wir im 15. Abschnitte des ersten
Bandes der Kulturgeschichte der Nutzpflanzen eingehend besprachen.
Wie dem Jäger ist auch dem Viehnomaden der Honig ein ersehntes Labsal,
und als das Höchste, was Jahve seinem Volke, den Kindern Israels, auf
ihrem vieljährigen Zuge durch die Wüste ver[S. 489]sprechen konnte, war ein
Land, in welchem „Milch und Honig“ fließt. Das sollten sie im Lande
Kanaan finden. Aber schon zur Zeit der großen Propheten Judas fanden
die Nachkommen dieser Viehzüchter israelitischen Stammes, daß ein
Land voll Honig ein Land der Unkultur sei. So war auch dem gebildeten
Griechen, wie wir in Platons Schrift Kritias lesen, ein Land voll
Honig ein Land der Wüste; denn vor der intensiveren Kultur durch den
Menschen flüchten sich die wilden Bienen gern in Einöden zurück, wo sie
ohne Beunruhigung durch jenen der unermüdlichen Arbeit zum Wohle ihres
Gemeinwesens obliegen können.
Nach den Veden und den Gesetzen Manus war der zunächst immer noch
von wilden Bienen gesammelte Honig bei den Indern nicht nur ein
wertvolles Geschenk für die Menschen untereinander, sondern auch
eine geschätzte Opfergabe für die Götter. Auf den Märkten des Landes
bildete er einen begehrten Handelsartikel, von dem die Könige, die
seit den ältesten Zeiten mit Honigwasser gesalbt wurden, den sechsten
Teil als ihnen gebührende Abgabe beanspruchten. Auch bei den alten
Babyloniern und Ägyptern fand der Honig als Tauschmittel, Opfergabe
und Arznei ausgiebige Verwendung. In der späteren Zeit mögen hier
überall die Bienen auch als Haustiere gehalten worden sein, indem man
gelegentlich einen Schwarm der wilden Biene abfing und in einem hohlen
Baum ansiedelte, um sich dann des von ihnen gesammelten Honigvorrats
zu bemächtigen. Gleicherweise liebten die alten Juden den Honig als
leckere Speise, doch verwandten sie ihn in der uns überlieferten Zeit
nicht als Opfergabe. Der Prophet Hesekiel berichtet uns, das die
Bewohner von Juda und Israel nebst Wein, Öl und Balsam auch Honig nach
der alten phönikischen Handelsstadt Tyrus brachten. Aus dem Talmud
erfahren wir, daß der Honig zu Geschenken beliebt war, um sich die
Gunst jemands zu erwerben. Man benutzte ihn bei den Juden wie bei den
zuvor genannten Völkern zur Verbesserung des Weines, zur Herstellung
von heilenden Salben und Heiltränken. Damals (um 200 n. Chr.) wurden
die Bienen jedenfalls schon gezüchtet; denn in der Mischna, dem
ersten Teile des Talmuds, finden wir verschiedene Angaben über die
Bienenwirtschaft und das Bienenrecht. Die Bienen wurden meist in aus
Stroh oder Rohr geflochtenen Körben gehalten und die Völker bei der
Entnahme des Honigs durch Räuchern getötet. An einer Stelle des Talmuds
wird sogar von einer Bienenwohnung gesprochen, die mit Fensterchen
versehen war.
[S. 490]
Auch in Arabien war der Honig von alters her als Genußmittel sehr
geschätzt. Im Koran heißt es von den Bienen: „Aus ihren Leibern kommt
eine Flüssigkeit, die verschieden an Farbe ist und Arznei für den
Menschen enthält.“ Nach der schon vor Muhammed geltenden Anschauung
der Araber fließt im Paradiese ein Fluß voll Honig. Muhammed selbst
teilte die Vorliebe seiner Landsleute für Süßigkeiten und pflegte gern
Honigwasser zu trinken. Frühe wurde dort auch der Honigbau eingeführt,
den schon der um 25 n. Chr. verstorbene griechische Geograph Strabon
aus Amasia in Pontos als in Arabien sehr ergiebig erwähnt.
In den homerischen Gedichten wird der Honig als beliebtes Genußmittel
der Helden erwähnt. Außer der direkten Anführung des Honigs in Ilias
und Odyssee werden ziemlich oft Vergleiche mit seiner Flüssigkeit
gemacht. So haben die Sirenen eine honigsüße Stimme, und Nestors Rede
fließt dahin süßer als Honig usw. Wie von Honig ist bei Homer von
Bienen die Rede, doch sind bei ihm stets wilde Bienen gemeint. So heißt
es im zweiten Buche der Ilias, daß die Achäer sich sammelten „wie die
Bienen aus einer Felsenhöhlung herausfliegen“. Damit ist deutlich
erkennbar ein frei in der Wildnis und nicht in einem Bienenstocke unter
der Obhut des Menschen stehender Schwarm gemeint. Von zahmen Bienen
spricht erst im 8. Jahrhundert v. Chr. der böotische Dichter Hesiod
an einer Stelle seiner Theogonie, wo er auch besondere Behälter aus
vermutlich ausgehöhlten Baumstämmen als Herberge von Bienenvölkern
erwähnt. Den späteren Griechen galt Aristaios, der angeblich die
Kultur des Ölbaums aufgebracht haben sollte und den die Nymphen die
Bienenpflege gelehrt hatten, als erster, der, um eine regelmäßige
Honiggewinnung zu erzielen, die Bienen in Stöcke einschloß, aus denen
er dann im Herbste die Honigwaben ausschnitt. Honig war angeblich
die erste Nahrung des Göttervaters Zeus gewesen, der dann in seiner
kretischen Heimat in einer Höhle des Berges Ida von der Ziege Amalthea
gesäugt wurde. Zum Dank für ihre Dienste wurde sie dann als Capella
unter die Gestirne versetzt, und eines ihrer Hörner gab Zeus den
Töchtern des Melisseus, die Alles, was sie wünschten, darin fanden.
Dieses Horn der kretischen Ziege Amalthea ist das Urbild des späteren
Füllhorns.
Bei allen Opferhandlungen der Griechen war Honig von großer Bedeutung.
Nach Platon opferte man in den ältesten Zeiten den Göttern mit Honig
bestrichene Früchte. Platons Schüler Aristoteles, der von 343 v. Chr.
an Lehrer Alexanders des Großen war, spricht[S. 491] sehr eingehend über
das Leben der Bienen, die unter mehreren Anführern (hégemṓn
— er meint damit die Bienenkönigin) leben sollten, die sich niemals
aus dem Stocke entfernen als wenn sie ausschwärmen. Dann scheinen
sich alle Bienen an sie heranzudrängen. „Will ein Stock schwärmen, so
hört man schon einige Tage lang vorher einen eigenen eintönigen Laut
(das „Tüten“), und zwei bis drei Tage lang fliegen nur wenige Bienen
(mélitta) um den Stock; ob aber unter diesen auch ein Anführer
ist, hat man noch nicht gesehen, weil dies nicht leicht zu beobachten
ist. Haben sie sich endlich versammelt, so fliegen sie aus und teilen
sich in Haufen, die sich an die einzelnen Anführer anschließen. Trifft
es sich, daß ein kleiner Haufen neben einen großen zu sitzen kommt, so
schließt er sich an diesen an und tötet den Anführer, dem er untreu
geworden ist, wenn er ihm folgt.“
Nach Aristoteles sind also die Anführer im Bienenstaate Männchen. Er
sagt von ihnen, sie übertreffen die Arbeitsbienen an Größe um die
Hälfte, besonders sei ihr Hinterleib doppelt so lang als bei jenen. Daß
aber seine Ansicht nicht allgemein geteilt wurde, geht aus dem Zusatze
hervor: „Manche nennen aber den Anführer Mutterbiene (mḗtēr) und
behaupten, daß, wenn sie nicht im Stocke sei, man zwar Drohnenbrut,
aber keine Arbeitsbienenbrut finde. Andere sagen, die Drohnen seien
Männchen, die Arbeitsbienen aber Weibchen. Die andern Bienen werden in
den Wachszellen erzeugt, die Anführer aber entstehen in Zellen, welche
größer sind und unten an den Waben hängen. Die Anführer besitzen zwar
einen Stachel, stechen aber nicht, weshalb sie Viele für stachellos
halten.“ Die Drohnen nennt er von allen am größten, aber stachellos
und faul. Er beschreibt das Leben und Treiben im Bienenstock so genau,
daß er unbedingt dasselbe aus eigener Anschauung gekannt haben muß. Er
schreibt über die Lebensweise der Bienen: „Bei Trockenheit beschäftigen
sich die Bienen mehr mit Einsammeln des Honigs, bei Regenwetter dagegen
mehr mit der Brut. Zuerst verfertigen sie die Waben, dann legen sie die
Brut in die Zellen, und zwar, wie einige sagen, mit dem Munde, und nun
erst tragen sie zur Ernährung im Sommer und Herbste Honig (méli)
ein. Der Herbsthonig ist der beste. Das Wachs sammeln sie aus Blumen,
das Vorwachs aber tragen sie aus den ausschwitzenden Säften der Bäume
zusammen; der Honig hingegen fällt aus der Luft nieder (er meint damit
den Honigtau und glaubt, wie der viel später lebende Plinius anführt,
daß auch der Nektar der Blüten vom Himmel herab in sie hineingefallen
sei), zumal beim Aufgang der Gestirne und beim[S. 492] Regenbogen. Der Honig
ist anfangs wie Wasser und einige Tage lang flüssig, nach 20 Tagen
aber wird er dick und ist dann auch süßer. Die Biene sammelt von allen
Blumen, welche einen Kelch haben, leckt auch an allen andern süßen
Dingen, beißt aber keine Früchte an. Wachs und Bienenbrot tragen sie
an den Schenkeln, Honig aber speien sie in die Zellen. Auf den Eiern
brüten sie wie die Vögel. Die Made liegt, solange sie noch klein ist,
schief in der Zelle; späterhin richtet sie sich auf, frißt und hängt
mit dem Wachse weiter nicht zusammen, so daß man sie herausnehmen kann.
Die Eier der Arbeitsbienen und Drohnen sind weiß, aus ihnen kommen
Maden; diese verwandeln sich in Arbeitsbienen und Drohnen. Die Eier
der Anführer aber sind rötlich und so zart wie dicker Honig, sie haben
sogleich den Umfang des aus ihnen hervorgehenden Tieres und verwandeln
sich, wie man sagt, nicht erst in eine Made, sondern gleich in eine
Biene. Die Puppe bekommt erst Füße und Flügel, wenn ihre Zelle durch
einen Deckel geschlossen ist; sobald sie aber Flügel hat, durchbricht
sie den Deckel und steigt heraus. Die Bienen leben sechs, einige auch
sieben Jahre; wenn daher ein Stock 9–10 Jahre bestanden hat, so hat
er sich gut gehalten. Ihre Nahrung besteht aus Honig und sogenanntem
Bienenbrot, welch letzteres aber von geringerem Werte und etwa so
süß wie Feigen ist. Den Bau der Waben zur Aufspeicherung der Nahrung
beginnen sie an der Decke des Stockes und führen dann deren viele auf
bis zum Boden herunter. Sowohl Honig- als Brutzellen haben nach beiden
Seiten hin eine Öffnung, weil, wie bei den Doppelbechern, in der Mitte
ein gemeinschaftlicher Boden ist. Einige behaupten, daß die Drohnen mit
den Arbeitsbienen gemeinschaftlich an den Waben bauen, jedoch keinen
Honig eintragen, sondern sich und ihre Jungen von jenen füttern lassen.
Meist bleiben die Drohnen im Stocke; wenn sie aber einmal ausfliegen,
so erheben sie sich in hellen Haufen gen Himmel, treiben sich im Kreise
herum und scheinen sich zu üben. Sind sie fertig, so kehren sie in den
Stock zurück und lassen sichs wohl sein. Die Anführer fliegen weder um
Futter zu suchen, noch aus andern Gründen; sie tun es nur, wenn der
Stock schwärmt. Wenn sich der Schwarm vom Anführer verloren hat, so
soll er ihm solange nachspüren, bis er ihn vermittelst des Geruches
wieder aufgefunden hat. Kann der Anführer nicht fliegen, so soll er
vom Schwarm getragen werden, und kommt er um, so soll auch der ganze
Schwarm verloren gehen; und hält er sich auch noch kurze Zeit, so
trägt er nur Wachs, aber keinen Honig mehr ein. Das Wachs sammeln die
Bienen, indem[S. 493] sie an den Blüten herumkriechen, mit den Vorderbeinen,
von da bringen sie es an die mittleren und von diesen wieder an die
Hinterbeine. Beladen mit der Beute fliegen sie dann fort und man sieht,
daß die Last sie drückt. Bei jedem Ausfluge besucht die Biene niemals
verschiedenartige Blüten, sondern fliegt nur z. B. von Veilchen zu
Veilchen. Im Stocke entledigen sie sich dann ihrer Bürde und werden
dabei jedesmal von 3 oder 4 andern bedient. Was diese ihnen abnehmen,
kann man nicht wohl sehen, sowie man auch noch nicht beobachtet hat,
wie sie es verarbeiten.“
Weiter sagt Aristoteles: „Unter den Bienen ist eine jede zu einer
bestimmten Arbeit angewiesen, so z. B. sammeln die einen von den Blüten
Honig, die andern holen Wasser und wieder andere bauen und glätten
die Waben. Wasser tragen sie, wenn die Brut gefüttert wird. Ist das
Wetter gut, so arbeiten sie rastlos, und selbst die Jungen beginnen,
wenn sie Nahrung haben, schon am dritten Tage nach dem Auskriechen die
Arbeit. Kräftige Stöcke haben das ganze Jahr Brut mit Ausnahme der 40
auf die Wintersonnenwende folgenden Tage. Sind die Jungen in den Zellen
herangewachsen, so setzen ihnen die Bienen nochmals Speise vor und
schließen dann die Zelle durch einen Deckel; diesen zerbrechen aber die
Jungen und kommen hervor, sobald sie stark genug sind. Alle Tierchen,
welche sich in Bienenstöcken erzeugen und das Wachs zerstören, werden
von guten Bienen herausgeschafft, von schlechten aber zu allgemeinem
Schaden geduldet. Überhaupt sind die Bienen sehr reinlich; tote
schaffen sie gleich aus dem Stock. Üble Gerüche und Wohlgerüche sind
ihnen zuwider; daher sind Leute, die sich parfümieren, ihren Stichen
ausgesetzt. Die Bienen kämpfen öfters gegeneinander, auch gegen Wespen.
Auswärts lassen sie sich zwar in keinen Streit irgend welcher Art ein,
aber bei ihrem Stocke erstechen sie alles, was sie überwältigen können.
Eine Biene, die gestochen hat, muß sterben, weil sie ihren Stachel
nicht ohne Verletzung der Eingeweide aus der Wunde zurückziehen kann;
drückt aber der Gestochene den Stachel sorgfältig heraus, so kann
sie am Leben bleiben. Selbst große Tiere können durch Bienenstiche
umkommen; sogar ein Pferd ist schon einmal daran gestorben. Am
wenigsten Neigung zum Zorn und zum Stechen haben die Anführer. Den
meisten Schaden fügen den Bienen die Wespen, Meisen, Schwalben und
Bienenfresser zu. Auch die Frösche lauern ihnen beim Wasser auf,
weswegen sie denn auch von den Bienenwärtern (melitturgós)
in den Gewässern, in welchen die Bienen trinken, verfolgt werden.[S. 494]
Wespen-, Schwalben- und Bienenfressernester zerstört man ebenfalls in
der Nähe der Bienenstöcke.“
Wir haben hier auszugsweise Aristoteles Meinung wiedergegeben, ohne
Richtigstellung der zahlreichen von ihm vertretenen Irrtümer, indem wir
annehmen, daß die Leser von sich aus dieselben korrigieren werden. Uns
lag nur daran zu zeigen, wie weit man damals schon in der Erkenntnis
des Bienenstaates und seiner Mitglieder gediehen war.
Aristoteles kennt und beschreibt aber auch die verschiedenen
Krankheiten der Bienenvölker, die Faulbrütigkeit und die Schädigungen
durch die Wachsmotte und den Bienenwolf. Er sagt, daß man beim
Schneiden der Honigwaben den Bienen noch welche als Winternahrung
übriglassen müsse, sonst stürben sie bei schlechtem Wetter an
Futtermangel, bei gutem aber flögen sie davon. Sturm und Regen merkten
sie im voraus; die Bienenwärter bemerkten es gleich, daß sie Unwetter
erwarten, wenn sie bei heiterem Himmel nicht fliegen wollen und zu
Hause bleiben. Wenn sie sich im Stocke klumpenweise zusammenhängen, so
sei dies ein Zeichen, daß sie schwärmen wollen. Sobald die Bienenwärter
solches bemerken, spritzen sie mit Honig eingekochten Traubensaft
in die Stöcke. Manche Bienenwärter bestreuen ihre Bienen mit Mehl,
um sie im Freien erkennen zu können. Tritt das Frühjahr spät ein,
entsteht Dürre oder fällt Mehltau, so machen die Bienen nur wenig Brut.
Er gibt genaue Anweisung über die beste Art der Einrichtung eines
Bienenstandes. Ein solcher dürfe weder im Sommer der großen Hitze, noch
im Winter der Kälte ausgesetzt sein. Eine vorzügliche Futterpflanze für
die Bienen sei der Thymian. Weil der Berg Hymettos in Attika reich an
Thymian war, galt der von dorther stammende Honig im ganzen Altertum
als besonders fein und gewürzhaft. In Attika soll es schon zur Zeit des
Perikles, um die Mitte des 5. vorchristlichen Jahrhunderts, etwa 20000
zahme Bienenvölker gegeben haben, was auf eine reiche Imkertätigkeit
der alten Griechen hinweist.
Auch die alten Römer trieben, wohl weitgehend von den Griechen
beeinflußt, ausgedehnte Bienenzucht. Der gelehrte Varro (116–27 v.
Chr.) schreibt in seinem Buche über den Landbau, er kenne einen Mann,
der seinen Bienenstand für eine Abgabe von jährlich 5000 Pfund Honig
verpachtet habe. Und ein Verwandter von ihm habe in Spanien zwei
Soldaten mit Namen Vejanus in seiner Armee gehabt, die von ihrem Vater
nur ein ganz kleines Gütchen geerbt hätten. Diese hätten[S. 495] ihre Wohnung
ganz mit Bienenstöcken umgeben und das Feld darum herum mit Thymian,
Melisse und anderem Bienenfutter bepflanzt, so daß sie in der Regel
jährlich 10000 Sesterzien (= 1500 Mark) aus dem Honig lösten. Er gibt
genaue Anweisung, wie ein Bienenstand, der tüchtige Einkünfte gewähren
soll, angelegt werden muß und rät als beste Bienenweide Thymian zu
pflanzen, der den besten und reichlichsten Honig gebe. Deswegen sei
auch der sizilische Honig der berühmteste, weil dort der Thymian gut
und häufig sei. Der Honig, der von verschiedenen Pflanzen gesammelt
werde, sei verschieden. Von den Blüten der Baumheide sei er flüssiger,
vom Rosmarin dicker, vom Feigenbaum komme ein schlecht schmeckender,
vom baumförmigen Schneckenklee ein guter, der beste aber vom Thymian.
Die Bienenstöcke stelle man meist aus in runder Gestalt geflochtenen
Weidenruten, die innen und außen mit Kuhmist verstrichen würden, oder
aus Holz oder Rinde her. Manche nehmen dazu hohle Baumstämme oder
große Tonkrüge. Am besten seien die aus Baumrinde gefertigten Stöcke,
am schlechtesten dagegen die irdenen, da durch sie Hitze und Kälte
am stärksten eindringe. Jeder Stock bekomme in seiner Mitte links
und rechts einen Eingang für die Bienen und habe oben einen Deckel,
damit man die Honigwaben herausnehmen könne. Im Bienenhaus stelle man
die Stöcke reihenweise nebeneinander, doch so, daß sie sich nicht
gegenseitig berühren. Man könne auch zwei oder drei Reihen übereinander
stellen, eine vierte aber würde beschwerlich sein, da man ohne Leiter
nicht gut zu ihr hinaufreiche. „Im Frühjahr und Sommer hat der
Bienenwärter (mellarius von mel Honig) jeden Stock etwa
dreimal monatlich zu untersuchen, wobei er ein wenig Rauch gibt und
Unreinigkeiten und Würmchen (Larven des Bienenwolfs und der Wachsmotte)
entfernt. Außerdem hat er darauf zu sehen, daß nicht mehrere Könige
(regulus, d. h. kleiner König oder Weisel) in einem Stocke
sind; denn sonst entsteht darin schädlicher Aufruhr. Manche behaupten,
es gäbe dreierlei Könige bei den Bienen, nämlich schwarze, rote und
bunte.“ Menekrates aber sagt, es gebe nur zweierlei, schwarze und
bunte. (Auch Aristoteles kannte deren nur zwei, eine rötliche Art, die
er für besser hielt, und eine dunkelfarbige und bunte.) „Die bunte Art
ist jedenfalls die beste, und so tut denn der Bienenwärter gut, den
schwarzen König zu töten, wenn er neben einem bunten im Stocke ist
und darin Unfug stiftet. Von den Arbeitsbienen sind diejenigen die
besten, welche klein, bunt und rund sind. Die Drohnen sind schwarz
und haben einen breiten Leib. — Beim Kauf hat der Käufer darauf[S. 496] zu
achten, ob die Bienen gesund oder krank sind. Gesunde Bienen schwärmen
fleißig, sind glänzend, bauen gleiche, glatte Waben. Die kränklichen
sind haarig, struppig, staubig; doch können auch gute Bienen bei
angestrengter Arbeit struppig und mager werden.
Da die Bienen nicht zu jeder Zeit auf Nahrung ausfliegen können,
füttert man sie in der bösen Zeit, damit sie nicht von bloßem Honig
zu leben brauchen oder die Stöcke verlassen. Das Futter besteht aus
Feigen, die mit Wasser gekocht und zu Klumpen geknetet sind. Andere
verfüttern Honigwasser (aqua mulsa), das sie in kleine Gefäße
tun, worin Wolle liegt; diese hindert die Bienen, nicht zuviel
zu saugen und ins Wasser zu stürzen. Manche stampfen getrocknete
Weinbeeren und Feigen, gießen mit Honig eingekochten Traubensaft darauf
und machen daraus Klümpchen. — Will man einen Bienenstock an eine
andere Stelle versetzen, so muß es mit Vorsicht und zur rechten Zeit
geschehen. Zum Versetzen ist der Frühling günstiger als der Winter,
denn in der kalten Jahreszeit verlassen die Bienen gern den neu
angewiesenen Standort. Ebenso entweichen sie gern, wenn man sie aus
einer reiche Nahrung bietenden Gegend in eine daran arme versetzt. Man
darf auch nicht sorglos verfahren, wenn man sie an einer Stelle, wo sie
bleiben sollen, aus einem Stock in einen anderen versetzt. Man muß dann
den neuen Stock für sie mit Melisse ausreiben, die sie sehr gern haben;
auch muß man mit Honig gefüllte Waben darein einsetzen, damit sie nicht
von vornherein Mangel leiden müssen.
Haben die Bienen sich stark vermehrt, so pflegen sie eine Kolonie
auszusenden. Man bemerkt ihre Absicht im voraus an zwei Zeichen: 1.
einige Tage lang hängen sie in einer traubenförmigen Masse am Flugloch;
2. wenn sie eben ausziehen wollen oder schon begonnen haben es zu
tun, summen sie heftig und der Lärm gleicht einigermaßen dem, welchen
eine Armee macht, wenn das Lager abgebrochen wird. Einige bilden die
Vorposten, fliegen im Angesicht des Stockes auf und nieder und warten
ab, ob der Schwarm sich in Bewegung setzt oder nicht. Sieht das der
Bienenwärter, so wirft er Staub nach ihnen, klingelt mit ehernen
Instrumenten und bringt sie dadurch wohin er will. Nicht weit vom alten
Stock bestreicht er einen neuen Stock mit Vorwachs und Melisse oder
anderen Dingen, die den Bienen angenehm sind. Haben sich nun die Bienen
angesetzt, so bringt der Bienenwärter einen Stock herbei, welcher
inwendig mit den genannten lockenden Dingen ausgestrichen ist, setzt
ihn in die Nähe des Schwarms, räuchert diesen ein wenig und zwingt ihn
so zum Einzug. Hat die[S. 497] neue Kolonie den Stock bezogen, so bleibt sie
gern darin und zieht auch dann nicht aus, wenn er ganz nahe an den
alten gestellt wird.
Ist der Stock schwer, so kann man ihm Honig entnehmen. Die mit Honig
gefüllten Zellen sind mit einem dünnen Wachsdeckel geschlossen. Einige
sagen, man müsse den Bienen 9⁄10 nehmen und 1⁄10 lassen, weil sie den
Stock verlassen, wenn man ihnen alles nimmt. Schneidet man die Stöcke
nicht alle Jahre oder wenigstens nicht zu stark aus, so sind die Bienen
fleißiger und tragen mehr ein. Die erste zum Schneiden der Bienenstöcke
(zur Honigernte) taugliche Zeit ist die, da die Vergilien (die Plejaden
oder das Siebengestirn) aufgehen, die zweite zu Ende des Sommers, die
dritte zur Zeit, da die Vergilien untergehen. Ist zu dieser Zeit der
Stock schwer, so nimmt man ihm doch nicht über 1⁄3 des Honigs und läßt
ihm 2⁄3 für den Winter. Sind Waben, die man den Bienen genommen, leer
oder schmutzig, so schneidet man solche Stellen mit dem Messer weg.
Ist ein Volk so schwach, daß es von anderen überwältigt wird, so
vereinigt man es heimlich mit einem stärkeren. Entstehen unter den
Bienen häufig Raufereien, so bespritze man sie mit Honigwasser, worauf
sie sich freundlich lecken, statt die Zänkerei fortzusetzen. Nimmt
man statt des Honigwassers flüssigen Honig, so lecken sie sich noch
eifriger und sind ganz entzückt über die herrliche Leckerei. Fliegen
sie spärlich aus dem Stock und bleibt ein Teil darin, so räuchert man
ihn etwas von unten und legt in seine Nähe wohlriechende Kräuter,
vorzüglich Melisse und Thymian. Vor allzu großer Hitze und Kälte hat
man den Stock sorgfältig zu beschützen. Sind die Bienen auf Nahrung
ausgeflogen und dabei plötzlich von einem Platzregen oder von Kälte
überfallen worden (was jedoch selten geschieht, da sie jedes Wetter im
voraus merken), so sammelt man sie und setzt sie an einen lauen Ort.
Bei gutem Wetter nimmt man sie aus diesem, bestreut sie mit warmer
Asche von Feigenholz, schüttelt sie, ohne sie mit der Hand zu berühren,
gelinde und bringt sie an die Sonne. Sind sie auf solche Weise warm
geworden, so leben sie wieder auf. Bringt man sie nun in die Nähe der
Stöcke, so kehren sie dann an ihre Arbeit und in ihre Wohnung zurück.“
Es ist erstaunlich, wie groß auch bei Barro die Erkenntnis in der
Beurteilung der Lebensweise der Bienen ist, wenn auch er, wie
Aristoteles, noch gar vielen Irrtümern huldigte, worunter auch dem,
daß die Bienen aus dem Aase von Rindern, wie die Wespen aus solchem
von Pferden und die Mistkäfer aus solchem von Eseln hervor[S. 498]gehen. Am
ausführlichsten behandelt der römische Dichter Vergil die vermeintliche
Entstehung der Bienen aus dem Aase von Rindvieh im 4. Buche seiner
Georgica, das mit seinen 566 Versen ganz den Bienen gewidmet ist. Er
sagt, daß wenn durch irgend ein Unglück der Bienenstand ausgestorben
sei und man keine bevölkerten Stöcke kaufen könne, so wende man die
höchst merkwürdige Kunst an, die der arkadische Hirt Aristäus erfunden
habe und die noch jetzt in Ägypten mit großem Gewinn angewendet werde.
Einem zweijährigen Stiere verstopfe man trotz allem Sträuben Mund und
Nase und prügle ihn so lange, bis, ohne daß die Haut verletzt wird,
inwendig alles zu Brei geschlagen sei. So lasse man den Kadaver ruhig
liegen, nachdem man ihm Thymian und Zimt untergelegt habe. Bald komme
das Innere desselben in Gärung, man sehe darin ein wunderbares Gewimmel
fußloser Tiere (Maden), bis zuletzt geflügelte Bienen hervorkämen und
die Menge wachse und ganze Wolken davon herumschwirren. Tatsächlich
sind das aber aus Eiern entstandene Schweißfliegen und keine Bienen.
Im ganzen Altertum war die Anschauung von solcher Urzeugung gang und
gäbe. Es sei hier nur an das uns allen geläufige Rätsel erinnert, das,
wie im 14. Kapitel des Buches der Richter erzählt wird, vom Helden
Simson bei seiner Hochzeit mit der Philisterin zu Thimnath den 30 um
ihn weilenden Gesellen aufgegeben wurde, wobei er ihnen 30 Hemden und
30 Festkleider versprach, falls sie es lösen sollten. Könnten sie es
aber nicht erraten, so sollten sie ihm 30 Hemden und 30 Festkleider
geben. Das Rätsel lautete: „Speise ging aus von dem Fresser und
Süßigkeit von dem Starken.“ Er meinte damit den Bienenschwarm im
Kadaver des jungen Löwen, den er einige Tage zuvor am Wege durch die
Weinberge zu Thimnath mit seinen starken Armen zerrissen hatte, „wie
man ein Böcklein zerreißet“. Dieser Bienenschwarm sollte aus dem Aase
des Löwen hervorgegangen sein und hatte bereits Honig gesammelt, den
Simson in die Hand nahm und von dem er unterwegs aß; „und er ging zu
seinem Vater und zu seiner Mutter und gab ihnen, daß sie auch aßen. Er
sagte ihnen aber nicht, daß er den Honig von des Löwen Aas genommen
hatte.“
Mehrfach berichten Livius in seiner Geschichte Roms und Cicero
in seinem Buche de divinatione von Wundern, die durch das
merkwürdige Verfliegen von Bienenschwärmen angezeigt worden seien. Es
galt als unglückbringend, wenn sich ein solcher vor einer geplanten
Unternehmung irgendwo einfand. So berichtet Livius: „Als die Römer[S. 499] am
Flusse Ticinus (dem heutigen Ticino) dem Hannibal gegenüberstanden,
war ihnen nicht ganz wohl zumute und ihre Furcht nahm zu, als ein
Wolf ins Lager drang und unversehrt wieder hinauslief, und als
sich ein Bienenschwarm auf einem Baume niederließ, der das Zelt
des Befehlshabers beschattete. Man suchte dem üblen Erfolg dieser
Unglückszeichen dadurch vorzubeugen, daß man den Göttern Sühnopfer
darbrachte. — Im Verlaufe desselben Krieges ereigneten sich zur
Zeit, da Quintus Fulvius und Appius Claudius Konsuln waren, neue
Wunderzeichen: In Campanien wurden zwei Tempel und einige Gräber vom
Blitze getroffen, zu Cumä benagten die Mäuse im Tempel des Jupiter das
Gold, zu Catinum ließ sich ein ungeheurer Bienenschwarm auf dem Markte
nieder, zu Caere flog ein Adler auf den Tempel des Jupiter. Wegen
dieser drohenden Zeichen wurde ein allgemeiner Bettag angesagt und
einige Tage lang mit ungünstigem Erfolge geopfert. Endlich verhießen
die Opfer Glück, und der Erfolg zeigte, daß das Unglück die Konsuln
traf, der Staat aber ohne Schaden davonkam.“ Nach dem griechischen
Geschichtschreiber Dio Cassius (155–229 n. Chr.) soll dem Pompejus
seine Niederlage bei Pharsalus im voraus verkündet worden sein, indem
Blitze in sein Lager schlugen, Bienen sich auf seine Fahnen setzten und
viele Opfertiere vor dem Altar die Flucht ergriffen. Die Niederlage,
die Varus im Jahre 14 n. Chr. in Germanien erlitt, sei den Römern durch
Zeichen prophezeit worden, indem der Blitz in den Tempel des Mars auf
dem Marsfeld schlug, viele Heuschrecken in die Stadt Rom flogen und
dort von den Schwalben weggeschnappt wurden und Bienen an römischen
Altären Wachszellen bauten. Auch des Kaisers Claudius Tod sei durch
einen Kometen, einen blutigen Regen, die freiwillige Öffnung des
Tempels des Jupiter Victor und auch dadurch voraus verkündet worden,
daß sich ein Bienenschwarm im Lager festsetzte. Und Plinius (23–79
n. Chr.) meint: „Bienenschwärme geben einzelnen Menschen und ganzen
Staaten wichtige Vorbedeutungen, wenn sie sich an Häuser oder Tempel
hängen, worauf schon oft schrecklicher Jammer erfolgt ist. Als Plato
noch ein Kind war, setzten sich Bienen auf seinen Mund und deuteten
dadurch auf das Liebliche seiner zukünftigen Beredsamkeit. Im Lager des
Feldherrn Drusus ließ sich ein Schwarm während der glücklichen Schlacht
von Arbalo (in Germanien) nieder, woraus man sehen kann, daß die
Wissenschaft der Zeichendeuter, welche eine solche Begebenheit immer
für ein Unglück erklärt, nicht untrüglich ist.“
Auch Plinius behandelt die Bienen sehr ausführlich in seiner[S. 500]
Naturgeschichte. Er sagt von ihnen: Wir müssen ihnen die höchste
Bewunderung zollen und ihnen den Vorzug vor allen Insekten geben,
sind sie doch die einzigen bloß um des Menschen willen geschaffenen.
Man braucht sich deshalb nicht zu wundern, wenn man hört, daß
manche Menschen ganz verliebt in ihre Bienen gewesen seien. So habe
Aristomachos von Soli sich 58 Jahre lang mit nichts anderem als mit
ihnen beschäftigt, und Philiskos aus Thasos habe mit seinen Bienen
einsam in einer Einöde gelebt. Beide haben über sie geschrieben. Dann
fährt er fort: „Den Winter über verbergen sich die Bienen, denn woher
sollten sie auch die Kräfte nehmen, um der Kälte, dem Schnee und den
Nordstürmen zu widerstehen? Aber ehe noch die Bohnen blühen, kommen
sie heraus, um zu arbeiten, und wenn das Wetter günstig ist, geht
kein Tag verloren. Zuerst bauen sie die Waben, dann erzeugen sie die
Brut, sammeln Honig und Wachs von den Blüten, wie auch Vorwachs aus
den klebrigen Abscheidungen der Bäume. Mit letzterem streichen sie
erst inwendig den Stock aus, und weil sie wohl wissen, daß ihr Honig
ein Leckerbissen ist, so mischen sie zur Abhaltung kleiner Schmarotzer
dem Vorwachse noch bittere Säfte bei. Mit derselben Masse verengern
sie auch den Eingang, wenn er allzu weit sein sollte. — Bei ihren
Geschäften beobachten die Bienen eine bestimmte Ordnung: Am Tage
steht eine Schildwache am Eingang; nachts ruhen sie, bis der Morgen
anbricht und bis eine durch zwei- oder dreimaliges Sumsen gleich einem
Trompeter das Zeichen zum Aufbruche gibt. Jetzt fliegen alle hinaus,
wenn ein heiterer Tag bevorsteht. Ist aber Wind und Regen in Aussicht,
so bleiben sie zu Hause, denn sie wissen im voraus, wie das Wetter
sich gestalten wird. Sind sie zur Arbeit ausgezogen, so tragen die
einen Blütenstaub mit den Füßen ein, andere Wasser im Munde und an
den Haaren, womit ihr ganzer Leib bedeckt ist. Die Jungen fliegen aus
und tragen ein, die Alten dagegen besorgen die häuslichen Arbeiten.
Diejenigen, welche Blütenstaub sammeln, bedienen sich der Vorderfüße,
welche behaart sind, und des Rüssels, um die Vorderfüße zu beladen, und
so kehren sie denn endlich, von der schweren Last gebeugt, nach Hause
zurück. Hier kommen ihnen sogleich drei bis vier entgegen und nehmen
ihnen die Last ab, denn auch im Stocke sind die Arbeiten verteilt. Die
einen bauen, die andern glätten, andere tragen den Baustoff herbei,
andere bereiten aus dem, was eingetragen wird, die Speisen; denn sie
halten gemeinschaftliche Mahlzeiten ab, damit die allgemeine Ordnung
der Geschäfte nicht gestört wird. Den Bau beginnen sie oben an der
Decke[S. 501] des Stockes und bauen nun die Waben abwärts so, daß dabei zwei
Wege offen bleiben, auf deren einem sie herbei-, auf dem andern aber
weggehen können. Die Waben hängen oben und auch ein wenig an der Seite
fest; bis auf den Boden aber gehen sie nicht herab. Bald haben sie eine
längliche, bald eine mehr runde Gestalt, wie es gerade die Form des
Stockes mit sich bringt. Wollen die Waben fallen, so setzen sie Stützen
darunter, wölben sie aber vom Boden aus so, daß ein Zugang für neue
Ausbesserung übrig bleibt. Etwa die drei ersten Zellenreihen bleiben
leer, damit nicht so leicht Diebe angelockt werden; die hintersten
werden am meisten mit Honig gefüllt, und deswegen schneidet man den
Stock auch von hinten aus.
Die Honig eintragenden Arbeitsbienen (gerula apis) sehen sehr
auf günstigen Wind; beginnt ein Sturm, so nehmen sie ein Steinchen als
Balast zu sich (wie schon Aristoteles geglaubt hatte), welches sie, wie
einige behaupten wollen, auf den Schultern tragen. Geht ihnen der Wind
entgegen, so fliegen sie an der Erde hin und weichen den Dornbüschen
aus. Man ist erstaunt, wenn man ihre Arbeit beobachtet. Die Faulen
werden getadelt, gestraft, ja sogar getötet. Sie sind äußerst reinlich.
Jeder Unrat, der sich irgendwo im Stocke vorfindet, wird sogleich
hinausgeschafft. Sobald der Abend kommt, nimmt allmählich der Lärm
im Stocke ab, bis endlich eine Biene herumfliegt und durch dasselbe
Sumsen, womit die Schar morgens geweckt wird, das Zeichen zur Ruhe
gibt, worauf alle augenblicklich schweigen.“
Auch Plinius glaubt, daß der Honig aus der Luft herabfalle. Er sagt
darüber: „Der Honig kommt aus der Luft, und zwar gegen Tagesanbruch,
weshalb man auch mit dem Erscheinen der Morgenröte die Blätter der
Bäume von Honig betaut findet und Menschen, die sich zufällig im
Freien aufhalten, ihre Kleider und Haare mit Honig gesalbt fühlen.
Mag nun der Himmel den Honigtau ausschwitzen, oder mögen ihn die
Sterne ausspucken, oder mag er eine Reinigung der Luft sein, so wäre
nur zu wünschen, daß er so rein, flüssig und echt sein möchte, wie er
anfänglich herabträufelt. So aber fällt er aus der unermeßlichen Höhe
herab, wird im Fallen durch schmutzige Beimischungen verunreinigt, vom
Hauche der Erde vergiftet, außerdem von den Blättern abgeleckt, in den
Magen der Bienen geschluckt, obendrein durch Blumensaft vermischt, im
Bienenstocke geknetet, und dennoch behält er noch ein gutes Teil seiner
himmlischen Eigenschaften bei.
„Der Honig ist immer da am besten, wo er in den Behältern der[S. 502] besten
Blumen aufbewahrt wird. Am berühmtesten sind in dieser Hinsicht der
Berg Hymettus in Attika, der (Berg) Hybla auf Sizilien und die Insel
Kalydna (bei Kleinasien). Anfangs ist der Honig flüssig wie Wasser,
gärt die ersten Tage wie Most und reinigt sich; am 20. beginnt er
dick zu werden. Bald überzieht er sich mit einer Haut, welche sich
aus dem durch Gärung entstehenden Schaume bildet. Der beste und am
wenigsten nach Laub schmeckende wird von den Blättern der Linden,
Eichen und der Rohrarten entnommen. Die Güte des Honigs hängt zwar von
der Beschaffenheit der Gegend ab; übrigens zeigt sich aber doch noch
ein Unterschied; denn z. B. im Lande der Peligner (in Italien) und in
Sizilien zeichnet sich das Wachs aus, in Kreta, Zypern und Afrika der
Honig, im Norden die Größe, so daß man in Germanien schon eine acht Fuß
lange Wabe gesehen hat, deren Höhlungen schwarz waren. Allerwärts gibt
es dreierlei Honig:
„1. Den Frühlingshonig, von Blüten gesammelt, deshalb auch
Blütenhonig genannt, den man nicht wegnehmen darf, weil sonst die Brut
nicht kräftig wird. Manche Bienenwärter nehmen aber gerade von diesem
den meisten, weil bald darauf, beim Aufgang der großen Gestirne, großer
Überfluß erfolgt. Übrigens sind im Sommer, wenn Thymian und Weinstock
zu blühen beginnen, die Zellen am besten gefüllt. Man muß aber beim
Schneiden der Stöcke eine gehörige Einteilung treffen; denn wenn man
zuviel Honig wegnimmt, so überlassen sich die Bienen der Verzweiflung,
sterben oder zerstreuen sich. Dagegen werden sie aber auch durch allzu
großen Vorrat faul und fressen dann reinen Honig statt Bienenbrot.
Vorsichtige Bienenwärter lassen ihnen daher von dieser Ernte den
zwölften Teil. Der Tag, an welchem diese Ernte gehalten wird, ist
gleichsam durch ein Naturgesetz bestimmt, und zwar ist es der 30. nach
dem Auszuge des Schwarms, also meist im Monat Mai.
„2. Den Sommerhonig, welchen man auch reifen Honig nennt,
indem er zur günstigsten Jahreszeit gesammelt wird, etwa 30 Tage nach
der Sonnenwende, während der Sirius glänzt. Dieser Honig würde die
herrlichste Gabe der Natur sein, wenn nicht der Betrug des Menschen
alles verschlechterte und verdürbe; denn was sich beim Aufgang der
Gestirne, vorzüglich deren vom obersten Range, oder beim Regenbogen,
wenn kein Platzregen folgt, sondern der Tau vom Sonnenstrahl erwärmt
wird, bildet, ist kein Honig, sondern ein himmlischer Balsam für die
Augen, für Geschwüre und für die Eingeweide. Sammelt man ihn beim
Aufgang des Sirius, wenn zufällig der Aufgang der[S. 503] Venus, des Jupiter
oder Merkur auf denselben Tag fällt, so ist seine Kraft, Menschen zu
heilen und selbst vom Tode zu erretten, nicht geringer als die des
göttlichen Nektars. Beim Vollmond ist die Honigernte reichlicher, bei
reinem Himmel aber fetter. Vorzüglich gut ist der rötliche, zumal für
Krankheiten des Ohres. Der vom Thymian gesammelte ist goldfarbig, von
köstlichem Geschmack und sehr geschätzt. Was sich in den Behältern
der Blumen bildet, ist fett, was vom Rosmarin kommt, ist dick. Honig,
welcher gerinnt, wird nicht gelobt. Honig von Thymian gerinnt nicht;
berührt man ihn, so zieht er sehr feine Fäden, und dies ist der beste
Beweis seiner Schwere. Trennt er sich leicht, so daß die Tropfen
fallen ohne Fäden zu ziehen, so gilt das für einen Beweis von geringem
Werte. Man verlangt ferner, daß der Honig wohlriechend, süßlichsauer,
klebrig und durchsichtig sei. Bei der Sommerernte soll man nach Cassius
Dionysius den Bienen den zehnten Teil lassen, wenn der Stock voll ist;
ist er es aber nicht, so soll man nach Verhältnis schneiden. Ist er
leer, so soll man ihn gar nicht anrühren. Diese Ernte hält man anfangs
Juli ab.
„3. Den wilden Honig, den man auch Heidehonig nennt und wenig
schätzt. Die Bienen sammeln ihn nach dem ersten Herbstregen, während im
Walde nur die Heide (Baumheide, Erica carnea) blüht, weswegen
er auch gleichsam sandig ist. Diesen Honig schneidet man im November,
und die Erfahrung lehrt, daß man davon den Bienen zwei Drittel und
jedenfalls den Teil der Waben lassen muß, der das Bienenbrot enthält.
Vom kürzesten Tage an bis zum Aufgang des großen Bären schlafen die
Bienen sechzig Tage lang, ohne Nahrung zu sich zu nehmen; von da an
bis zur Frühlingsnachtgleiche wachen sie zwar, da die Luft schon lauer
ist, bleiben aber gleichwohl im Stocke und zehren von den vorhandenen
Vorräten. In Italien schlafen sie bis zum Aufgang des Siebengestirns.
„Manche Bienenwärter wiegen beim Schneiden die Stöcke und bestimmen
dann, wieviel Honig darin bleiben soll. Auch gegen die Bienen muß man
billig sein; denn die Stöcke sollen aussterben, sobald man ungerecht
gegen sie handelt. Vorzüglich empfiehlt man denen, welche schneiden,
sich vorher zu baden und zu reinigen. Vor Dieben haben die Bienen
einen eigenen Aberwillen. Während man den Honig herausnimmt (nach dem
zu Anfang des 5. Jahrhunderts n. Chr. lebenden Nonnos schützte sich
der Bienenwärter dabei mit einem aus feinen Leinenfäden geflochtenen
schleierartigen Gewand, das ihn vom Kopf bis zu den Zehen verhüllte),
müssen die Bienen durch Rauch[S. 504] vertrieben sein, damit sie nicht wütend
werden oder auch selbst sich über den Honig hermachen. Gibt man ihnen
öfters Rauch, so werden sie arbeitsamer, durch allzuhäufigen aber
leiden sie und der Honig wird dann bei der leisesten Berührung des
Taues sauer.“
Über die Gewinnung des Wachses gibt Plinius ausführliche Auskunft
und sagt, das beste komme von Karthago. Am schönsten weiß werde es,
wenn man es nur einmal kocht. Man brauche es zu unzähligen Dingen und
färbe es auf verschiedene Weise; oft benütze man es auch, um Wände und
Waffen gegen Nässe zu schützen. Die besten Bienenstöcke mache man aus
Baumrinde, und zwar aus Kork der Korkeiche; die aus Ruten geflochtenen
seien nicht so gut. Viele ließen sie aus Marienglas herstellen, um die
Bienen bei der Arbeit beobachten zu können. Man stelle sie am besten
so auf, daß das Flugloch nach der Gegend gerichtet sei, wo die Sonne
während der Tag- und Nachtgleiche aufgehe. Im Winter müsse man sie
mit Stroh bedecken und oft räuchern, am besten mit Rindermist. Diesen
Rauch lieben die Bienen wegen der Verwandtschaft (bezieht sich auf
die vermeintliche Entstehung der Bienen aus totem Rindvieh) und er
tötet zugleich das Ungeziefer, von dem sie geplagt werden wie Spinnen,
Würmer (Larven des Bienenwolfs und der Wachsmotte) und Schmetterlinge
(Wachsmotte und Totenkopf), muntert dagegen die Bienen auf. Am
schlimmsten sind die Schmetterlinge; man kann sie aber im Frühjahr, zur
Zeit, da die Malve reift, nachts bei Neumond bei heiterem Himmel töten,
indem man Feuer vor den Bienenstöcken anzündet, in welches sie sich
dann hineinstürzen.“
Auch nach Plinius „leben die Bienen, wenn ihnen kein Unglück zustößt,
sehr lange, nämlich sieben Jahre. Nie sollen aber Bienenstöcke über
10 Jahre gedauert haben.“ Tatsächlich aber lebt nur die Königin, das
fruchtbare Weibchen, 3–5 Jahre, ist aber höchstens 3 Jahre recht
fruchtbar. Sie vermag nach den angestellten Versuchen jährlich 50
bis 60000 Eier zu legen, in den letzten Jahren bedeutend weniger.
Die unfruchtbaren Weibchen, die Arbeiterinnen, leben im Sommer nur
6–8 Wochen und sterben, von der rastlosen Arbeit verbraucht oder von
Bienenfeinden getötet. In der Haupttrachtzeit währt das Leben dieser
unermüdlichen Arbeiterinnen nur 6 Wochen. Das konstatierte man durch
Einführung der italienischen Bienen in Deutschland. Gibt man nämlich
einem deutschen Volke eine befruchtete italienische Königin, so ist
nach 6 Wochen bis auf vereinzelte Exemplare jenes völlig verschwunden
und durch ein Volk italienischer Bienen ersetzt. Nur die[S. 505] im August
und September ausgeschlüpften Arbeitsbienen leben, wenn der Stock
normal ist und ihnen nichts zustößt, bis in den April hinein, bis
eine neue Brut sie in der Arbeit abzulösen vermag. Ein starkes
Volk zählt im Sommer 30–80000 Arbeitsbienen. Die Drohnen genannten
Männchen aber, die dicker und länger als die Arbeitsbienen sind und im
Gegensatz zu sämtlichen Weibchen stachellos sind und nicht arbeiten,
auch von jenen leicht am dröhnenden Tone ihres Fluges erkannt werden
können, haben keine andere Aufgabe, als die jungen Königinnen, die
beim Schwärmen mit einem Teil des Bienenvolkes ausziehen, um eine
neue Kolonie zu gründen, zu befruchten. Sie entstehen im Frühjahr
aus unbefruchteten Eiern, während die Weibchen aus befruchteten
hervorgehen, im Falle sie Königinnen werden sollen, durch bessere
Ernährung ihre Geschlechtsorgane voll ausbilden, im Falle sie aber nur
Arbeiterinnen abgeben sollen, trotz der längeren Entwicklungsdauer von
3 Tagen gegenüber den Königinnen, in bezug auf ihre Geschlechtsorgane
verkümmern. Gegen Ende April erscheinen die ersten Drohnen, deren es
in einem starkgewordenen Volke über 1000 geben kann. Von diesen sind
nur einige wenige auserwählt, die jungen Königinnen beim Hochzeitsfluge
in der Luft zu begatten, wobei sie sofort sterben. Die befruchtete
Königin aber füllt dabei ihre Samentasche für die Zeit ihres Lebens
mit Samen, von dem sie willkürlich ein Samenfädchen zu dem den
Eileiter passierenden Ei gelangen läßt oder nicht. In ersterem Falle
entstehen daraus Weibchen, im letzteren dagegen Männchen. Deshalb
kann ein unbefruchtetes Weibchen durch Jungfernzeugung nur Männchen
hervorbringen, und man nennt in diesem Falle das betreffende Volk
drohnenbrütig. Die nicht beim Hochzeitsflug umgekommenen Drohnen aber
werden, sobald eine Trachtpause anbricht, als überflüssige Schmarotzer,
die nur bei warmem Sonnenschein und windstillem Wetter den Stock
zwischen 10 Uhr morgens und 4 Uhr nachmittags verlassen, um im Freien
hin und her zu fliegen, aber keinen Nektar oder andere Nahrung suchen,
sich aber am Nahrungsvorrat des Stockes sättigen, durch die Bienen von
den Honigvorräten weggedrängt, nicht mehr gefüttert und, wenn sie dem
Verhungern nahe sind, zum Stocke hinausgedrängt und ihrem Schicksal
überlassen oder umgebracht. Es ist dies die von Mitte August bis
Ende September sich alljährlich einmal ereignende „Drohnenschlacht“.
Pfarrer Schönfeld hat nun nachgewiesen, daß die Drohnen ohne
Futtersaftfütterung, d. h. ohne Zufuhr stickstoffhaltiger Nahrung,
nicht länger als drei Tage leben können. Sobald nun die Arbeits[S. 506]bienen
die Darreichung des Futtersaftes einstellen, ermatten die Drohnen schon
am zweiten Tage so sehr, daß sie sich leicht überwältigen lassen oder
von selbst an Entkräftung zugrunde gehen. Findet in einem Stocke keine
Drohnenschlacht statt, so ist der Stock weisellos, d. h. ohne Königin.
Sind im Sommer die Drohnen in einem Stocke zu zahlreich, so steckt
der Imker eine sogenannte Drohnenfalle ins Flugloch, um die müßigen
Honigfresser darin zu fangen. Die Arbeitsbienen, welche nicht so dick
sind, schlüpfen durch die Löcher hindurch, während dagegen die Drohnen
darin stecken bleiben.
In Beziehung auf die Fortpflanzung der Bienen sagt Plinius: „Wie sie
ihre Jungen erzeugen, ist eine wichtige und schwierige Aufgabe für
Gelehrte; denn man hat sie nie in der Paarung angetroffen. Viele Leute
sind der Meinung, sie entständen aus einer zu diesem Zwecke geeigneten
Zusammensetzung von Blütensäften. Andere glauben, es geschehe durch
Paarung des Königs mit den andern Bienen. Es befindet sich in jedem
Stock nur ein König; er ist weit größer als die andern Bienen
und soll das einzige Männchen sein. Ohne ihn soll es keine Brut geben,
und die übrigen Bienen sollen ihn wie Weibchen ihren Mann und nicht
wie ihren König begleiten. Das Vorkommen der Drohnen ist ein Beweis
gegen diese Behauptung; denn wie können von denselben Eltern teils
vollkommene, teils unvollkommene Wesen abstammen? Die erstere Meinung
würde wahrscheinlich sein, wenn nicht eine andere Schwierigkeit
dagegen spräche. Es entstehen nämlich zuweilen am äußersten Ende der
Wachstafeln größere Bienen, welche die übrigen vertreiben; man nennt
sie oestrus. (Ob hier Drohnen oder in den Stock eingedrungene
Raubbienen gemeint sind, ist ungewiß.) Aber wie könnten sie entstehen,
wenn die Bienen sich selbst erzeugten?
Gewiß ist, daß die Bienen wie Hühner brüten. Zuerst kriecht bei ihnen
ein kleines weißes Würmchen aus, der König aber hat gleich eine
Honigfarbe, als wäre er aus einer auserwählten Blume entstanden; auch
ist er nicht erst ein Würmchen, sondern gleich geflügelt. Reißt man
den Larven der andern Bienen den Kopf ab, so sind sie für ihre Mütter
ein wahrer Leckerbissen. Werden die Würmchen größer, so träufeln ihnen
die Bienen Speise ein und bebrüten sie, wobei sie ein starkes Gemurmel
erheben, wahrscheinlich um die zum Brüten erforderliche Wärme zu
bewirken. Endlich zersprengt jeder Wurm die Hülle, in welche er gleich
einem Ei in seiner Schale eingewickelt ist, und nun kriecht der ganze
Schwarm aus den Zellen[S. 507] hervor. Diese Tatsache ist bei Rom auf dem
Landgute eines Konsularen beobachtet worden, wo man aus durchsichtigem
Horn verfertigte Bienenstöcke aufgestellt hatte. Die Brut bedarf 45
Tage, bis sie zur Vollkommenheit gelangt ist. (In Wahrheit ist die
Zeit viel kürzer und bedarf eine Königin zu ihrer Entwicklung nur 15,
eine Arbeiterin 21 und eine Drohne 24 Tage.) Sind die Jungen glücklich
ausgekrochen, so arbeiten sie sogleich unter der Aufsicht ihrer
Mütter, und eine Schar junger Bienen begleitet den König. Es werden
mehrere Könige erzogen, damit es nicht daran fehlen kann. Sind sie
aber erwachsen, so werden die schlechtesten mit allgemeiner Zustimmung
getötet, damit sich der Schwarm nicht um ihretwillen teilt. Es gibt
zweierlei Art Könige, wovon die bessere Art schwarz und bunt ist. Alle
Könige haben stets eine sie auszeichnende Gestalt und sind doppelt
so groß als die übrigen Bienen; ihre Flügel sind kürzer, ihre Beine
gerade, ihr Anstand erhabener und auf der Stirn haben sie einen weißen
Fleck, der einem Diadem ähnlich sieht. Auch durch Glanz zeichnen sie
sich vor dem gemeinen Volke aus. Sie haben einen Stachel, aber sie
bedienen sich desselben nicht. Es ist wunderbar, welchen Gehorsam das
Volk seinem Könige erweist. Geht er herum, so zieht ein ganzer Schwarm
mit ihm, nimmt ihn in die Mitte, beschützt ihn und verhindert, daß man
ihn sehen kann. Während der übrigen Zeit, wenn das Volk arbeitet, geht
er im Stocke umher, besichtigt die Arbeiten, scheint zu ermahnen und
ist allein müßig. Um ihn herum sind einige Leibgardisten, die seine
Würde allerwärts aufrecht erhalten. Er verläßt den Stock nur, wenn ein
Schwarm ausziehen will. Dies bemerkt man schon lange vorher, indem
einige Tage lang sich inwendig ein geräuschvolles Murmeln hören läßt,
ein Zeichen, daß sie Vorbereitungen treffen und nur auf gutes Wetter
warten. Schneidet man dem König einen Flügel ab, so zieht der Schwarm
nicht aus. Sind sie aber ausgezogen, so drängt sich jede an den König
und will sich durch Diensteifer auszeichnen. Ist er müde, so stützen
sie ihn mit den Schultern; kann er nicht weiter, so tragen sie ihn
ganz. Ist eine Biene vor Ermattung zurückgeblieben oder hat sie sich
zufällig verirrt, so zieht sie dem Schwarme nach, indem sie dem Geruche
folgt. Wo sich die Hauptmacht niederläßt, da versammelt sich das ganze
Heer.“
Im Gegensatz zu den älteren Autoren war man also zu Plinius’ Zeit
glücklich dazu gelangt, statt mehrerer nur einen Anführer
in jedem normalen Bienenstocke anzunehmen. Über dieses Wissen ist
man das ganze Mittelalter hindurch nicht hinausgekommen. Erst im
17.[S. 508] Jahrhundert entdeckte dann der in Amsterdam erst 43 Jahre alt
verstorbene holländische Gelehrte Jan Swammerdam (1637–1680) durch
Sezieren der Bienen unter dem Vergrößerungsglas, wobei er deren
Eierstöcke und Eileiter fand, daß der bis dahin allgemein als Männchen
betrachtete, deshalb auch im Deutschen als der Weisel bezeichnete
Anführer oder König des Stockes tatsächlich ein Weibchen und der
Bienenstaat auf der Mutterschaft begründet sei.
Nach Swammerdam hat der Franzose R. A. de Réaumur die wissenschaftliche
Bienenkunde durch zahlreiche Beobachtungen und Versuche in seinem
Garten in Charenton gefördert. Noch weit mehr tat dies der 1750 in Genf
geborene François Huber, durch Réaumurs Experimente angeregt. Sein Werk
„Nouvelles observations sur les abeilles“, von dem der erste
Band im Jahre 1789 in Form von Briefen an einen andern Bienenforscher
Charles Bonnet erschien — der zweite folgte erst 25 Jahre später
— ist klassisch und enthält die Grundlage unseres heutigen Wissens
über die Bienen. In der Folge hat der 1811 in Lobkowitz in Schlesien
geborene katholische Pfarrer Johann Dzierzon die Bienenkunde am meisten
gefördert, indem er zuerst die jungfräuliche Zeugung, welche zur
Entstehung von Drohnen führt, bei den Bienen feststellte. Es geschah
dies auf seiner Pfarrei Karlsmarkt bei Brieg in Schlesien, wo er auch
1861 den ersten Kastenstock mit beweglichen Waben erfand, wodurch der
Imker erst befähigt wurde, seinen Anteil an der Honigernte zu gewinnen,
ohne nutzlos seine besten Völker zu vernichten und die Arbeit eines
ganzen Jahres in einem Augenblicke zu zerstören. Dieser zunächst noch
sehr unvollkommene Kastenstock wurde dann vom Amerikaner Langstroth
bedeutend vervollkommnet, indem er den eigentlichen beweglichen Rahmen
erfand, der zunächst in den Vereinigten Staaten weite Verbreitung fand
und außerordentliche Erfolge erzielte. Dann erfand Mehring, um den
Bienen Arbeit und Wachs, also auch viel Honig und Zeit zu ersparen,
die Herstellung von Kunstwaben, die sie alsbald benutzten und ihren
Bedürfnissen anpaßten. Und Major von Hruschka endlich konstruierte
die Honigschleuder, wodurch die Waben ihres Inhalts entleert werden
konnten, ohne zerstört werden zu müssen. Damit eröffnete sich eine neue
Periode der Bienenzucht, die erst die Biene zum eigentlichen Haustier
des Menschen erhob.
Kehren wir indessen von diesen allerdings äußerst wichtigen
theoretischen Betrachtungen zur Praxis zurück, wie sie die alten
Römer und Griechen betrieben. Plinius sagt in seiner Naturgeschichte,
daß[S. 509] auf jedem Landgute Bienenstände zu finden seien. Jedenfalls war
der Verbrauch von Honig und Wachs in den Kulturländern am Mittelmeer
bereits im Altertum ein sehr großer. Wissen wir doch vom griechischen
Geschichtschreiber Strabon, daß in Norditalien die einheimische
Erzeugung derselben nicht genügte, sondern daß diese Produkte von
verschiedenen Volksstämmen der Alpentäler, die sich dieselben von
Wildbienen verschafften, gegen Landesprodukte eingetauscht wurden. Erst
durch die Römer kam dann die Bienenzucht in die von ihnen unterjochten
Länder nördlich der Alpen.
Dort hatte die keltische und germanische Bevölkerung ausschließlich
den wilden Honig verwendet, um damit den als Getränk höchst beliebten
Met zu erzeugen, den schon der kühne griechische Seefahrer Pytheas
aus Massalia (dem heutigen Marseille), ein Zeitgenosse Alexanders
des Großen, der eine Entdeckungsreise in die Nordsee nach dem
Bernsteinlande machte, als ein an der Nordküste Germaniens gemeines
Getränk bezeichnet. Jedenfalls darf man annehmen, daß es im waldreichen
alten Germanien viele wilde Bienenvölker in den durch Spechte oder
Pilzinvasion hohlgewordenen Bäumen gab. So zeigen uns die Bestimmungen
der germanischen Volksrechte nach der Völkerwanderung, vom 5.-8.
Jahrhundert, daß unter den Nebennutzungen des Waldes die wilden Bienen
eine nicht unwichtige Rolle spielten. Nach den Gesetzen der Bajuvaren
gehörten nicht nur die wilden Bienen dem Waldeigentümer, sondern auch
ein Schwarm der damals schon gehaltenen Hausbienen, der sich verflogen
und in einen hohlen Baum verzogen hatte. Jedoch konnte der bisherige
Eigentümer eines solchen Schwarms mit Vorwissen des Waldeigentümers
versuchen, denselben durch Rauch oder Anschlagen gegen den Stamm, aber
ohne Schaden für den Baum, auszutreiben und wieder zu fassen. Tat
er dies ohne Vorwissen des Waldeigentümers mit Erfolg, so mußte er
auf Andringen des letzteren mit sechs Eideshelfern schwören, daß der
eingefangene Schwarm wirklich der seinige und ihm entflogen war. Bei
den Langobarden wurde es mit den wilden Bienen gehalten wie mit dem
Ausnehmen der Vögel. Nur im Gehege des Königs war das Ausbeuten eines
wilden Bienenstocks unbedingt verboten, während in einem sonstigen
Wald nur dann eine Bestrafung eintrat, wenn der Baum zum Beweis der
Entdeckung des Schwarmes bereits gezeichnet war. War aber der Baum
nicht gezeichnet, so konnte der Finder den Stock ungestraft ausnehmen
und mußte bloß, wenn der Waldeigentümer dazu kam, ihm den Honig
überlassen. Ähnliche Bestimmungen[S. 510] weist das Volksrecht der Westgoten
auf. Dieses schrieb vor, daß, wer immer einen Schwarm fand, es mochte
im eigenen Walde oder in Felsen und hohlen Bäumen des Gemeindewaldes
sein, er drei Zeichen, welche „Charaktere“ genannt werden, dort
anzubringen hatte, damit nicht durch ein einziges Betrug entstehen
könne. Wer ein fremdes Zeichen der Besitzergreifung verletzte, wenn
er es antraf, der mußte dem Geschädigten doppelten Ersatz leisten und
überdies 20 Streiche erdulden.
Die Bienenzucht der alten Germanen war wesentlich eine
Waldbienenzucht und wurde das Zeideln oder die
Zeidelweide genannt. Nach den zahlreichen auf uns gekommenen
Urkunden war sie sehr ausgebreitet und beruhte auf Gewohnheiten,
Verträgen und später Gesetzen, die niemand bei strenger Strafe
verletzen durfte. Überall in den Wäldern waren Zeidelbäume
eingerichtet, die als Privateigentum besonders gezeichnet waren. Wer
einen solchen ausbeutete, der bezahlte 6 Solidi (d. h. Goldschillinge
von etwa 12 Mark Metallwert, tatsächlich aber viel höher bewertet, da
man damals für einen solchen eine erwachsene Kuh kaufen konnte) Strafe.
Jeder Zeidler hatte ein eigenes Revier, in welchem er seine Bienen
hielt; dabei durfte er nicht seinem Nachbarn und dieser nicht ihm zu
nahe kommen. Wenn nun ein Schwarm sich in den Zeidelbezirk des Nachbars
verflogen hatte, so durfte ihm sein Eigentümer nach den Gesetzen der
Bajuvaren dahin folgen, mußte es aber dem Nachbar melden. Dann mußte
er die Bienen aus dem Baume, in dessen Höhlung sie sich festgesetzt
hatten, ausräuchern und dreimal mit umgekehrter Axt an den Baum
schlagen. Kamen sie dann heraus, so durfte er sie mitnehmen; was nicht
folgte, verblieb dem Nachbar.
Daneben wurde seit der Völkerwanderungszeit auch eifrig die
eigentliche von den Römern übernommene Hausbienenzucht getrieben. Man
hielt ordentliche Bienenhäuser (in den lat. Urkunden und Gesetzen
apile, aprarium, apiculare oder apicularium
genannt), die eingedeckt waren und verschlossen werden konnten. Doch
durften sie, wie auch einzelne Stöcke, nicht in den Dörfern und
Ansiedelungen gehalten werden, sondern mußten an abgelegene Orte
geschafft werden, damit sie nicht jemandem Schaden zufügten. Man hatte
dreierlei Arten von Bienenstöcken (vasculum), nämlich aus Holz,
aus Baumrinde oder von Ruten geflochten. Um die Schwärme im Wald oder
bei den Bienenhäusern zu fassen, standen stets dergleichen Behälter
bereit. Legte sich ein Schwarm bei Nachbars Bienenhaus in ein solches
Gefäß, so mußte[S. 511] es nach dem Volksrechte der Bayern diesem gemeldet und
versucht werden, ob der Schwarm herauszutreiben sei oder nicht. Doch
durfte das Gefäß nicht geöffnet werden. War es von Holz, so bewarf es
derjenige, dem der Schwarm fortgeflogen war, dreimal mit Erde, war es
aus Rinde oder Ruten, so schlug er dreimal mit der Faust darauf. Was
dann herausging, erhielt er wieder zu eigen, was zurückblieb, gehörte
dem Besitzer des Gefäßes.
Die Beraubung der Zeidelbäume, Bienenhäuser und Stöcke wurde streng
geahndet. Selbst der Versuch, etwas rauben zu wollen, wenn man auch
nichts erhielt, ward nach dem Volksrechte der Westgoten bitter
bestraft. Der Freie gab in solchem Falle 3 Solidi Strafe und erhielt
50 Prügel; wenn er aber etwas genommen hatte, so mußte er es neunfach
ersetzen und bekam noch die Schläge dazu. Der Leibeigene erhielt im
ersteren Falle 100 Hiebe, im letzteren dagegen mußte er den sechsfachen
Schadenersatz leisten. Bezahlte der Herr nicht für ihn, so mußte er ihn
dem Bestohlenen zum Eigentume ausliefern. Das Volksrecht der Sachsen
setzte, wie auf gewöhnlichen Diebstahl, so auch auf das Stehlen eines
Bienenstockes aus dem Verschluß die Todesstrafe; er ward aber nur
neunfach ersetzt, wenn er außer demselben im Freien gestanden hatte.
Wer bei den Langobarden aus einem Bienenhause ein oder mehrere Stöcke
stahl, der bezahlte 12 Solidi Strafe.
Unter der Herrschaft der Frankenkönige fand die Hausbienenzucht neben
der Zeidelweide zunehmende Bedeutung. Karl der Große bestimmte, daß auf
jedem seiner Güter ein erfahrener Bienenwärter zur rationellen Pflege
der dort gehaltenen Bienenvölker angestellt sein solle. In seinem Gute
Stefanswert befanden sich 17, in Grisenweiler sogar 50 Bienenstöcke.
Honig und Wachs mußten reinlich gewonnen und an die königliche
Hofhaltung abgeliefert werden. Von den Besitzern der Mansen und Hufen
wurde Honig und Wachs als Zins gegeben.
In dem Maße, als unter den sächsischen und fränkischen oder salischen
Kaisern im 10.-12. Jahrhundert die Wälder den Gemeinden entzogen
und unter Bann getan wurden, traten die vorher freien Zeidler
(cidelarii) in die Dienstbarkeit der Fürsten. So werden sie 990
in einer Urkunde Ottos II. nach den Manzipien als Dienstleute
angeführt, und 959 schenkte Otto der Große der Kirche zu Salzburg die
Ortschaft Grabestatt und die Zeidler daselbst. Mit der Übertragung
eines Bannforstes gingen auch die Zeidelweiden an den neuen Besitzer
über. So übergab 1025 Konrad II. an das Kloster Freising einige[S. 512]
Ländereien nebst Zubehör, worunter auch Zeidelweiden. Der Zins wurde in
Honig und Wachs abgeliefert. Ersterer hatte zur Herstellung des immer
noch sehr volkstümlichen Metes große Bedeutung, während letzterer seit
der Einführung des Christentums zur Verarbeitung zu Kerzen für die
Kirchen in immer größerer Menge gebraucht wurde. Allerdings hielten die
meisten Klöster eigene Bienenstände, oft in größerer Zahl. So kommen
beispielsweise im Verzeichnis der Schenkungen an das Kloster Fulda 40
Bienenstöcke (epiastrum) vor, welche ein einzelner Privatmann
dahin gestiftet hatte. Doch genügten meist deren Erträge nicht, um den
großen Bedarf der Kirche an Wachs zu decken. Deshalb suchten sich die
Klöster von ihren zinspflichtigen Leuten eine regelmäßige Lieferung
von Wachs zu sichern. Neben den Wachszinsen, deren Maß in den meisten
betreffenden Urkunden genau nach dem Gewichte bestimmt ist, wurde auch
eine entsprechende Abgabe an Honig und der Zehnten von den bevölkerten
Bienenstöcken, die Schwärme inbegriffen, gefordert.
Unter den Hohenstaufen im 12. und 13. Jahrhundert und den folgenden
Kaisern wurde in Deutschland die Zeidelweide neben der Hausbienenzucht
in reger Weise weiterbetrieben. In einer Urkunde von 1288 bekennt
eine Frau, daß sie vom Bischofe von Eichstätt die Bienennutzung
(fructus apium), welche gewöhnlich Cidelwaid genannt wird, aus
bloßer Gnade für die Lebenszeit in zwei Wäldern erhalten habe. Man
hatte zu diesem Behufe wie ehemals so damals und teilweise bis auf den
heutigen Tag besondere Bäume durch künstliches Aushöhlen eingerichtet.
Solche nannte man Beuten. Die Bienenschwärme, welche man in
den Wäldern fand, gehörten dem Gutsherrn und nicht dem, der sie fand.
In Frankreich hieß dieses Recht abeillage (in einer Urkunde
von 1311 als abellagium erwähnt). Über die Bienenfolge gab es
besondere Verordnungen. So bestimmten die Schonischen Gesetze von
1163, daß derjenige, dem seine Bienen in einen andern Wald flogen,
sie dort holen und auch diejenigen mitnehmen dürfe, die er daselbst
antraf, vorausgesetzt, daß sie niemand sonst ansprach; den Baum aber
durfte er ohne besondere Erlaubnis des Herrn nicht fällen. Nach dem
Schwabenspiegel (1276) durfte man noch nach drei Tagen seinen Bienen
folgen, wenn sie auf eines andern Baum, Zaun oder Haus flogen. Man
mußte aber den Eigentümer des Ortes mitnehmen, alsdann in seiner
Gegenwart daranschlagen und bekam diejenigen, welche herabfielen; die
andern aber gehörten jenem.
Zu Ende des Mittelalters gelangte die Imkerei in den deutschen[S. 513]
Landen zu höchster Blüte. In den dem Reich gehörenden Bannforsten
und auch sonst wurde noch eifriger als bis dahin die Zeidelweide
oder Waldbienenzucht getrieben, und die Zeidler taten sich neben
den Hausbienenzüchtern zu Genossenschaften zusammen, die manche
Privilegien genossen. Die bedeutendsten Zeidelplätze waren zu Muskau
und Hoyerswerda in der Oberlausitz, in der Kurmark, auf der großen
Görlitzer Heide, in Pommern und im Nürnberger Reichswald. Vom
Zeidlerwesen an letzterem Orte, wo die Einwohnerschaft der Umgegend
nach den diesbezüglichen Urkunden ausgedehnte Waldnutzungsrechte besaß,
haben wir ausführliche Kunde. Die Zeidelordnung Kaiser Karls IV.
vom Jahre 1350 bestätigte die Rechte der Zeidler im Laurenzer Wald und
gibt uns ein klares Bild von der Ausdehnung des bienenwirtschaftlichen
Betriebes der damaligen Zeit und der Bedeutung, welche man demselben
beilegte. Die Gerichtsbarkeit in „des Reiches Bienengarten“ stand unter
einem besonderen Zeidelmeister, dem die Besetzung der Zeidelgüter oblag
und der dafür zu sorgen hatte, daß dem Kaiser und Reich an seinem Gute
und Dienste nichts abgehe. Die Zeidler aber waren freie Leute und
freizügig. Jeder konnte von seinem Gute „abfahren“ (wegziehen), wenn
es ihm beliebte, und war beim Abgange dem Zeidelmeister nur 13 Heller
zu geben schuldig. Wollte dieser dieses Absagegeld nicht annehmen, so
konnte der Zeidler dasselbe auf die Übertür seines Hauses legen und als
ein Gerechter abfahren. Wer danach „auffuhr“, hatte dem Zeidelmeister
einen Schilling und einen Heller zu entrichten und dieser sich damit
zu begnügen. Die Zeidler hatten das Erbrecht an ihrem Gute und waren
allein befugt, im Bannforste Bienen zu halten. Niemand durfte, so weit
der „Bienkreis“ reichte, einen Schwarm aufheben. Wer einen „Peuten“
(Bienenbaum) umhieb, war dem Zeidelmeister 10 Pfund Heller und einen
Heller schuldig. Das nötige Holz bekamen die Zeidler umsonst aus dem
Reichswald und genossen manche Privilegien, so waren sie zollfrei
in allen Städten des Reichs, dafür aber mußten sie Kaiser und Reich
dienen „zwischen den vier Wäldern“, d. h. Böhmer-, Schwarz-, Thüringer-
und Scharnitzwald. Der Dienst sollte mit sechs Armbrüsten geschehen;
Pfeile, Wagen und Kost erhielten sie vom Reich. Außerdem hatte jeder
Zeidler dem Kaiser das herkömmliche Honiggeld zu geben. Ursprünglich
wurde zweifellos eine bestimmte Menge Honig abgeliefert.
Ähnlich wie im Laurenzer Wald war es im Sebalder Wald bei Nürnberg. In
einem Salbuche des 13. Jahrhunderts über die Reichsgüter bei Nürnberg
wird u. a. gesagt: „Das Amt Heroldsberg soll[S. 514] setzen dem Reich einen
Pingarten hintz dem Eynch, da 72 Immen inne seyen, die untötlich
seyen.“ Diese Stöcke waren also nur zur Zucht bestimmt und durften
nicht zur Honigentnahme getötet werden. Die aus ihnen hervorgehenden
Schwärme ließ man offenbar frei in den Wald fliegen, wo sie sich in die
vorbereiteten „gewipfelten und gelochten“ Bäume zogen. In verschiedenen
Urkunden jener Zeit ist von der Zeidelweide (sidelweide) und
von Zeidlern (cidelarius) die Rede. Wo keine Zeidelwirtschaft
bestand, teilten sich der Grundherr oder Waldeigentümer und der
Finder meist in das Erträgnis eines gefundenen wilden Bienenstockes.
Gelegentlich aber, so im Wildbanne von Altenaer an der Ahr, erhielt der
Finder eines wilden Biens denselben gegen Erlegen eines Geldbetrags
allein. Nach Aussage der Erbwildförster im Jahre 1617 mußte der Finder
eines herrenlosen Biens den Ort alsbald zeichnen und beim nächsten
Wildförster gegen Bezahlung von 9 Hellern „Urlaub heischen, den Bien
als sein eigen Gut abzuholen“, wogegen niemand etwas tun durfte, auch
der Waldeigentümer nicht.
Ihren Glanzpunkt erreichte die Zeidelweide im Zeitalter der
Zeidlerinnungen im 14. und 15. Jahrhundert. Damals gab es in allen
deutschen Gauen Bestimmungen in den Weistümern betreffs des Fundrechts
an den „imben“, d. h. an den in den Wald verflogenen Bienenschwärmen,
die sich in hohlen Baumstämmen eingenistet hatten. Diese hohlen Bäume,
in denen die sich selbst überlassenen Bienenschwärme sich ansiedelten,
gaben das Vorbild zu den im Mittelalter für die Hausbienen meist
gebräuchlichen Klotzbeuten. Diese bestanden aus einem ausgehöhlten
4–5 Fuß langen Baumstamm, der mit einem abnehmbaren Deckel und einem
Flugloche versehen war. Daneben mögen auch schon kunstlos aus Stroh
geflochtene Körbe verwendet worden sein, die später jene mehr und mehr
verdrängten. Als in späteren Zeiten die Wälder mehr und mehr ausgeholzt
und einem regelrechten Forstbetrieb unterworfen wurden, verkümmerte
nach und nach die Zeidelweide und die seit Jahrhunderten neben ihr
betriebene zahme oder Hausbienenzucht trat an ihre Stelle und wurde
gesetzlich geschützt. Wo aber ausgedehntere Waldstrecken dem neuen
Betriebe nicht unterworfen wurden, da blieben die alten Zeidelweiden
bestehen. Damals gab es gutbesuchte Honigmärkte in allen größeren
Städten, so besonders in Köln, Nürnberg, Breslau und Prag.
Seit dem 16. Jahrhundert machte sich in Mitteleuropa ein merklicher
Niedergang der Bienenzucht geltend, indem die Reformation[S. 515] viele
Klöster, welche bis dahin die Hüter so vieler Bienenstöcke gewesen
waren, verdrängte und die Kerzen in den Kirchen überflüssig machte.
Als später auch noch der verheerende Dreißigjährige Krieg ausbrach, da
war es begreiflich, daß in der allgemeinen Drangsal sehr zahlreiche
Bienenstöcke eingingen, da sie nicht mehr die nötige Pflege erhielten.
Ein weiteres ungünstiges Moment war das Aufkommen des Rohrzuckers, der
dem bis dahin als alleinigem Süßstoffe gebrauchten Honig durch seine
größere Billigkeit bedenkliche Konkurrenz machte und ihn bald zum
größten Teil in der Küche verdrängte. Kurze Zeit nach der Entdeckung
Amerikas war das ursprünglich in Südasien heimische Zuckerrohr dort
eingeführt worden und wurde durch die gleichfalls bald in großer Masse
aus Afrika importierten Negersklaven in solcher Menge angebaut, daß
der viel wohlfeiler zu produzierende und stärker süßende Rohrzucker so
billig zu haben war, daß der Honig bald als zu teuer in den Hintergrund
trat. Er wurde schon noch als Leckerbissen gegessen, aber zum Süßen
der Speisen, vor allem der verschiedenen Kuchen und süßen Platten,
fiel er gänzlich in Wegfall, und nur altertümliche Gebäckarten, wie
Lebkuchen, Leckerli usw., behielten ihn bei. Als dann zum Rohrzucker
noch die großartige Sirupfabrikation aus Kartoffeln und vollends noch
der billige Rübenzucker dazu kam, so war es um den Honig als Süßstoff
in den Haushaltungen vollends geschehen.
In Deutschland suchten die einsichtsvollen Fürsten, vor allem Friedrich
der Große, die sehr heruntergekommene Bienenzucht wieder zu heben.
Jener Preußenkönig zog in der Bienenzucht erfahrene Kolonisten aus
Polen und Preußen in die Mark Brandenburg und interessierte sich in der
Folge sehr auch für diesen Zweig der Landwirtschaft. Mehrfach spricht
er sich in Briefen erfreut über die Fortschritte der Imkerei in seinem
Lande aus, so unter anderem auch in einem Briefe an Voltaire vom 5.
Dezember 1775, in welchem er die bis dahin erfolgte Vermehrung der
Bienenvölker um ein Drittel hervorhebt. Um die Bienenzucht möglichst
zu schützen, verlieh er den Bienenzüchtern manche Erleichterungen und
legte einen hohen Einfuhrzoll auf den fremdländischen Rohrzucker.
In Österreich war die Kaiserin Maria Theresia in hohem Maße für die
Landwirtschaft besorgt und erließ am 8. April 1775 einen Schutzbrief
für die Bienenzüchter. In Süddeutschland und der Schweiz interessierte
man sich mehr und mehr in den ökonomischen Gesellschaften und
landwirtschaftlichen Vereinen für die Bienenzucht, die man immer
rationeller durchzuführen bestrebt[S. 516] war. Große Fortschritte darin
wurden erst seit der Einführung des Mobilbaues möglich. Haben darin
die praktisch veranlagten Nordamerikaner zuerst Großes geleistet,
so sind ihnen heute die Deutschen vollständig ebenbürtig geworden.
In allen deutschen Landen wird die Bienenzucht durch eine reiche
Vereinstätigkeit gefördert. Von größeren Vereinen oder vom Staate
angestellte Wanderlehrer halten an vielen Orten regelmäßige Kurse für
Anfänger ab. Daneben gibt es eigentliche Imkerschulen, von denen die
von Date, Eystrup in der Provinz Hannover und Durlach im Großherzogtum
Baden hervorzuheben sind. Österreich besitzt eine solche in Wien und
Ungarn in Gödöllö. Gegenwärtig gibt es über 3 Millionen Bienenvölker
in Deutschland. Von dem jährlichen Verbrauch von über 20 Millionen
kg Honig erzeugt Deutschland etwa 18 Millionen kg im Werte von
30 Millionen Mark.
Baron von Ehrenfels nannte die Bienenzucht mit vollem Recht die Poesie
der Landwirtschaft. Sie ist aber nicht nur das, sondern eine eminente
Förderin des Nationalwohlstandes und ihre Zucht ein wesentlicher Hebel
zur Veredlung und Bildung des Volkes. Neben dem großen materiellen
Nutzen gewährt sie Belehrung, Unterhaltung und Erholung nach des
Tages Arbeit; denn sie wird meist als Nebenbeschäftigung betrieben,
da sie nur einen geringen Aufwand an Zeit und Mühe beansprucht und
die meisten dabei erforderlichen Hantierungen in den Mußestunden
verrichtet werden können. Wer auch nur 25–50 Stöcke beweglichen
Baues hat, kann von denselben eine jährliche Einnahme von 150–300
Mark und darüber erzielen. Dabei ist der Stock durchschnittlich zu
5 kg Honigertrag und das kg zu 1.20 Mark gerechnet.
Guter Schleuderhonig wird aber gern mit 2 Mark und Wabenhonig mit 3
Mark bezahlt. Dabei ist nicht einmal die Einnahme für Wachs und etwa
verkaufte Schwärme oder Völker in Anrechnung gebracht, ebensowenig, daß
man nicht selten einem einzigen Stock 30 kg Honig und darüber
entnehmen kann. Tritt auch einmal ein Fehljahr ein, so hat das nichts
zu sagen, da ein einziges gutes Jahr nicht nur ein, sondern zwei
und drei schlechte Jahre einbringt. Dabei ist zu bedenken, daß die
Gewinnung von Honig und Wachs nicht einmal der größte Nutzen ist, den
wir von den Bienen haben, daß eigentlich der Vorteil, den wir daraus
ziehen, daß sie die Befruchtung sämtlicher Obstbaumblüten besorgen,
noch viel wichtiger ist. Wenn sie nicht im April und Mai von Baum zu
Baum und von Blüte zu Blüte flögen, um die Befruchtung zu vollziehen,
sollten wir sehen, wo unsere Obsternte bliebe. Überall, wo ein Natur-
und Tier[S. 517]freund einen Bienenstand errichtet, um sich eine angenehme
und zugleich nützliche, jedermann zu empfehlende Nebenbeschäftigung zu
verschaffen, sollten ihn die Nachbarn nicht scheel ansehen, sondern
als großen Wohltäter der ganzen Gegend und Beförderer des Obstbaues
mit Freuden begrüßen und ihm in seinem Unternehmen alle nur denkbaren
Erleichterungen verschaffen. Es gibt ja nicht nur im deutschen
Sprachgebiet, sondern in allen Kulturländern eine vortreffliche
Literatur über Bienenzucht und deren rationelle Handhabung, so daß sich
jedermann daraus Rat holen kann. Dann schließe er sich älteren Imkern
an, die ihm gern mit Rat und Tat an die Hand gehen werden, trete einem
Bienenzüchtervereine bei, aus dessen Zusammenkünften er reichen Gewinn
für die beste Art der Behandlung seiner Schützlinge empfangen wird.
Es kann nicht unsere Aufgabe sein, hier die Grundzüge der rationellen
Bienenzucht an Hand der Lebensweise der Bienen und der Einrichtung
ihres Staatshaushaltes, die als jedem Gebildeten geläufig vorausgesetzt
werden darf, zu geben. Wir möchten nur alle Interessenten auf das
von Ulrich Kramer, dem Präsidenten des Vereins schweizerischer
Bienenfreunde in Zürich, in dritter vermehrter Auflage herausgegebene,
reichillustrierte Buch: Die Rassenzucht der Schweizer Imker und die
amerikanischen Zuchtmethoden (für Deutschland und Österreich zu
beziehen durch die Buchhandlung Paul Watzel in Freiburg i. Breisgau).
Darin wird in allgemeinverständlicher Weise gezeigt, wie die
Weiselzucht der Zukunft sich gestalten soll. Jedenfalls hat sie schon
mit eintägigen Larven zu beginnen, die man nach amerikanischer Methode
in künstliche Weiselzellen bringt, oder noch besser durch Ausstechen
einzelner Brutzellen und Anfügen an die Wabenkanten der zu veredelnden
Stöcke; denn begreiflicherweise kommt es für die Erlangung guter
Bienenvölker vor allem auf die Gewinnung guter Königinnen an. Und diese
zu erlangen, hat man so völlig in der Hand. Wir haben nämlich außer den
Naturrassen auch verschiedene Kulturrassen der Honigbiene, auf die wir
noch kurz einzutreten haben. Sie werden durch Kreuzung verschiedener
Naturrassen gewonnen. Von letzteren haben wir anzuführen:
Die nordische oder deutsche Biene (Apis mellifica
im eigentlichen Sinne des Wortes). Sie ist dunkelbraun mit
gelblichbraunen Säumen an den Leibesringen und erscheint an älteren
haarlos gewordenen Exemplaren schwarz. Sie ist über ganz Mitteleuropa
verbreitet und geht nordwärts bis zum 60. Grad nördlicher Breite
(Helsingfors in Finnland). Sie findet sich aber auch in Nordspanien,
Dal[S. 518]matien, Griechenland, Kleinasien und Nordafrika, gelangte nach
dem Kap der Guten Hoffnung und Nordamerika, wo sie heute sehr
verbreitet ist. Sie ist fleißig und ausdauernd und liefert bei
guter Frühlingstracht 2–3 Schwärme. Eine Abart von ihr ist die
Heidebiene, die sich durch ihre große Schwarmlust auszeichnet,
aber geringeren Honigertrag liefert. Zur Beförderung des Brütens und
Schwärmens wird sie gern mit der vorigen gekreuzt. Eine andere Abart,
die in der Behaarung weißlicher als die nordische Biene ist und mehr
graue Hinterleibsringe hat, ist die Krainer Biene. Sie ist auch
sehr fruchtbar und schwarmlustig, bestiftet mehr Drohnenzellen als die
nordische und die italienische Biene, ist eine gute Honigsammlerin und
viel gutmütiger als die nordische und italienische Biene, so daß man
gewöhnlich ohne Rauch und Schleier mit ihr umgehen kann. Wegen ihrer
sanften Gemütsart ist sie besonders Anfängern zu empfehlen. Sie eignet
sich besonders zur Kreuzung, da, wo man den Bruttrieb zu steigern
begehrt.
Die italienische Biene (Apis ligustica). Sie ist so
groß wie die vorigen, aber heller gefärbt, und die beiden ersten
Hinterleibsringe sind bei ihr rotgelb. Ihr Verbreitungsgebiet ist
Italien von den Alpen bis Sizilien. Sie ist fruchtbarer als die
nordische Biene, beginnt im Frühjahr früher mit dem Eierlegen und
Schwärmen, stellt dafür die Vermehrung im Nachsommer auch eher ein.
Bei der Rückkehr von der Tracht verfliegt und verirrt sie sich öfter
als die schwarze Biene und ihre Völker sind um so schwächer, je heller
sie gefärbt sind. Im Auffinden neuer Honigquellen sind sie besser als
die nordischen Völker, auch sind sie sanfter und weniger stechlustig;
doch verteidigen sie ihren eigenen Stock mit viel Mut und Geschick.
Im Bruttrieb sind sie den schwarzen nordischen Bienen überlegen, im
Sammeltrieb mindestens ebenbürtig. Die durch Kreuzung von ihnen mit
den schwarzen nordischen Bienen entstandenen Bastardvölker übertreffen
in bezug auf Geruchsinn und Sammeltrieb, aber auch in Stechlust ihre
beiden Eltern. Die Einführung der italienischen Biene in Mitteleuropa
hat viel dazu beigetragen, die einheimische Bienenrasse durch
Blutauffrischung zu heben und zu verbessern. Ein Schweizer, Thomas
Konrad von Baldenstein auf Schloß Baldenstein in Graubünden, hat
die deutsche Imkerwelt zuerst auf die italienische Biene aufmerksam
gemacht, worauf der verdiente Pfarrer Dzierzon sie 1853 in Deutschland
einführte. Sie wurde durch die Europäer nach China gebracht und 1862
auch in Australien angesiedelt.
[S. 519]
Noch stechlustiger als sie sind die cyprische und syrische
Biene, die bei uns ebenfalls eingeführt wurden, aber sich wegen
dieser großen Stechlust nicht dauernd einzubürgern vermochten.
Ebenfalls ungeeignet für unsere Gegenden ist die über Ägypten,
Arabien, Syrien bis nach China verbreitete ägyptische Biene
(Apis fasciata), von kleiner Gestalt, mit rotem Schildchen und
weißer Behaarung. Sie ist im Gegensatz zu den vorigen wärmebedürftig
und hält bei uns den kalten Winter nicht aus. Ihr nahestehend, aber
an Brust und Hinterleib graugelb behaart, ist die mit Ausnahme von
Algerien und Ägypten über ganz Afrika verbreitete afrikanische
Biene (Apis adansoni). Sie ist nach Konrad Keller in den
Somaliländern, namentlich längs der Flüsse, häufig und wird wohl am
stärksten in Abessinien gezüchtet, das eine Menge Honig produziert und
Wachs nicht nur im Inland verwendet, sondern auch in ziemlicher Menge
ausführt. Ebenfalls kleiner als unsere nordische Biene, stark behaart
und einfarbig schwarz ist die auf der großen Insel Madagaskar und den
ihr vorgelagerten vulkanischen Eilanden Bourbon und Mauritius heimische
madagassische Biene (Apis unicolor). Außerdem beherbergt
Asien die drei vom Menschen in Kultur genommenen Bienenarten Apis
dorsata, A. florea und A. indica, die für uns nicht
in Betracht kommen, aber in Südasien von Wichtigkeit sind. In Kaschmir
und im Pandschab hält fast jeder Landwirt Bienenstöcke, welche er in
seine Wohnung einbaut.
Nordamerika entbehrte der stacheltragenden altweltlichen Honigbiene,
als die Europäer die Ostküste desselben besiedelten. Erst im Jahre 1675
wurde sie aus Europa dort eingeführt und in Newbury, (Massachusetts)
der erste Bienengarten eingerichtet. Unsere Honigbiene fühlte sich
in der Neuen Welt recht wohl, sie flog in entronnenen Schwärmen dem
Ansiedler immer weiter nach Westen voran, und die Indianer nannten sie
die „Fliege des weißen Mannes“. Im Jahre 1779 hatte sie den Mississippi
noch nicht überschritten, aber 1811 war sie bereits 900 km über
ihn hinaus in wildlebenden Völkern verbreitet. Heute gibt es in den
Vereinigten Staaten über 700000 Imker, und der Wert des jährlich von
ihnen geernteten Honigs beläuft sich auf etwa 80 Millionen Mark, der
des gesammelten Wachses dagegen beträgt 8 Millionen Mark. Kalifornien
erzeugt den besten Honig der Union, und als beste Biene wird die
Palästinabiene gerühmt, die im Jahre 1884 dort eingeführt wurde.
In Mittel- und Südamerika war wenigstens der Honig den Eingeborenen
vor der Ankunft der Spanier sehr wohl bekannt. In[S. 520] Mexiko fand man
in alten Ruinen aus der Zeit der Azteken mit ihm gefüllte hermetisch
verschlossene Gefäße. Er stammte von den in Mittel- und Südamerika
einheimischen stachellosen Bienen von den Gattungen Melipona und
Frigona. Diese Bienen, von den Einwanderern „angelicos“,
d. h. die engelgleichen, weil nicht stechend, genannt, liefern auch
heute noch einen großen Teil des in Mexiko gewonnenen Honigs. In
wirtschaftlicher Bedeutung werden sie aber mehr und mehr von der
europäischen Honigbiene verdrängt, die im letzten Jahrhundert überall,
auch in den Republiken Südamerikas, eingeführt wurde. Sie kam 1764
von dem damals noch spanischen Florida zuerst nach der Insel Kuba,
warf sich dort aber mit solcher Intensität als Zuckerräuber auf die
Siedereien von Rohrzucker, daß die Zuckerpflanzer sie alsbald in
ihrem Lande ausrotteten. Von Kuba aus kam sie durch die Spanier nach
Haiti, wo sie bald verwilderte. Erst 1839 kam sie nach Brasilien,
1848 nach Chile und 1857 nach Argentinien. Während die Bienenzucht
neuerdings in Brasilien so gewachsen ist, daß das Land Honig und Wachs
exportieren kann, wovon ein Teil auch nach Deutschland geht, liefert
seit einigen Jahrzehnten besonders Chile sehr viel davon. Das milde
Klima und der Reichtum des Landes an Honigpflanzen förderten die
Bienenzucht ungemein. Ein Bienenstock ergibt hier durchschnittlich 25
kg Honig jährlich; doch sind Fälle, in denen gegen 40 kg
gewonnen wurden, nicht selten. Von den 21⁄2 Millionen kg
Honig, die aus Chile exportiert werden, geht etwa die Hälfte nach
Deutschland. Die Insel Kuba, auf der erst neuerdings die Bienenzucht
wieder eingeführt wurde und mit größtem Erfolge betrieben wird, führt
gegen 11⁄2 Millionen kg Honig aus, von denen wiederum die
Hälfte nach Deutschland geht. So verzehren wir nicht so selten in
unseren Lebkuchen Honig, den die Bienen in fernen Ländern jenseits des
Atlantischen Ozeans eingetragen haben. Es ist dies kein Wunder; denn
von den 300 Millionen kg Honig, die jährlich auf der ganzen Welt
gewonnen werden, erzeugt Amerika mehr als die Hälfte. Im Jahre 1840
kam die Honigbiene nach Neuseeland. Schon vorher war sie in Australien
eingeführt worden, wo ihre Zucht von 1865 an einen besondern Aufschwung
nahm.
[S. 521]
XXIII. Der Seidenspinner.
Außer der Honigbiene kommt unter allen Insekten wirtschaftlich nur noch
der Maulbeer-Seidenspinner (Bombyx mori) als wichtiges
Nutztier des Menschen in Betracht. Und zwar steht er in Ostasien schon
so lange unter der Fürsorge des Menschen, daß er im Gegensatz zur Biene
sich im Laufe der Zeit zu einem echten Haustier umbildete und deutliche
Einwirkungen der Domestikation erkennen läßt. Ja, er ist unter der
Pflege des Menschen so unselbständig geworden, daß seine Raupe nicht
mehr ihr Futter selbst findet, wenn sie nicht von jenem daraufgesetzt
würde. Raupen, die im Freien aufgezogen werden und vom weißfrüchtigen
Maulbeerbaum (Morus alba), ihrer ausschließlichen Futterpflanze,
herunterfallen, finden den Weg zu den beblätterten Zweigen nicht
mehr. Sie klettern nicht wie andere Raupen den Stamm hinauf, um zu
ihrem Futter zu gelangen, sondern irren planlos umher und verhungern
schließlich. So sehr sind sie durch ungezählte Generationen hindurch
gewöhnt worden, von ihrem Pfleger auf die beblätterten Zweige gesetzt
zu werden, daß sie den angeborenen Instinkt der wildlebenden Vorfahren
verloren haben. Die lange Dauer der Domestikation und namentlich
die Aufzucht in geschlossenem Raume ist auch anderweitig nicht ohne
Einfluß auf den Seidenspinner gewesen. Das Geschlechtsstadium, der
Schmetterling, hat viel von seinem Flugvermögen eingebüßt; er schwirrt
mehr statt zu fliegen, während die meisten Verwandten sehr fluggewandt
sind. Neben größeren Formen sind auch Zwergformen gezüchtet worden
und solche mit einer doppelten Generation im Jahr, während das Tier
ursprünglich nur eine Generation jährlich aufwies. Auch zeigen die
Kokons sowohl in der Größe wie in der Färbung erhebliche Unterschiede;
es gibt unter ihnen weiße, goldgelbe und grüne Farbennuancen.
Der unscheinbare Falter von 4–5 cm Spannweite ist an Körper
und Flügeln schmutzigweiß mit drei gelbbraunen Wellenlinien über[S. 522]
letzteren und gekämmten schwarzen Fühlern in beiden Geschlechtern.
Die Vorderflügel erscheinen am Außenrand wie ausgeschnitten und haben
gegen die Spitze zu sichelartige Fortsätze. Die Neigung der Falter,
sich bald nach dem Ausschlüpfen aus der Puppe zu paaren, deutet
darauf hin, daß der kurzlebige Imagozustand lediglich die Aufgabe
hat, für die Erhaltung der Art zu sorgen. Nahrung wird in demselben
nicht aufgenommen, womit die geringe Entwicklung der Mundwerkzeuge im
engsten Zusammenhange steht. Das dickleibige, größere Weibchen läßt
sich unschwer vom schmächtigen Männchen unterscheiden. In ihm sind
die Eier in den paarigen, jederseits aus vier langen Eischläuchen
bestehenden Eierstöcken perlschnurartig aufgereiht. Im Herbst legt
das Weibchen durchschnittlich 500 mohnkorngroße Eier, von denen
1450 auf 1 g gehen. Sie sind erst strohgelb, verfärben sich
später und werden schiefergrau. In der Regel kommt jährlich nur eine
Generation zur Entwicklung. Aus den überwinterten Eiern schlüpfen im
Frühjahr, sobald der weißfrüchtige Maulbeerbaum junge Blätter treibt,
die kleinen nackten, anfangs dunkelbraunen, später weißlichgrauen
Raupen aus, welche am zweiten und dritten Ringe merklich aufgetrieben
sind und namentlich wegen ihres Hornes am Leibesende, am elften
Ringe, große Ähnlichkeit mit einer Schwärmerraupe haben. Sie verfügen
wie alle Raupen über einen sehr guten Appetit und fressen, wie die
Chinesen behaupten, an einem Tage das zwanzigfache ihres Gewichtes an
Maulbeerblättern. Man rechnet, daß 10000 Raupen während der 32 Tage
ihres Raupenlebens etwa 200 kg Maulbeerblätter verzehren. Die
Nahrung wird rasch umgesetzt und außer zum Wachstum zur Aufspeicherung
von Reservestoffen für die Verwandlung in den Falter verwendet. Die
rasch wachsende Raupe wechselt ihr Chitinkleid wiederholt, und bis zur
Verpuppung erfolgen fünf Häutungen. Die erste Häutung erfolgt nach
fünf, die zweite nach weiteren vier, die dritte nach weiteren sechs
und die vierte nach weiteren sieben Tagen. Die letzte Hülle wird erst
innerhalb des Gespinstes vor der Verpuppung abgestreift. Jedesmal vor
der Häutung setzt sie mit dem Fressen aus und gibt sich der Ruhe hin;
nach absolvierter Häutung beginnt sie wieder zu fressen und setzt diese
Arbeit so lange fort, bis ihr das Kleid zu eng geworden ist und sie
eines weiteren bedarf, was durch erneute Häutung bewerkstelligt wird.
Die Raupe des Seidenspinners ist wohl die vollendetste aller
Spinner. Die außerordentlich entwickelten Spinnschläuche liegen
neben dem Darm und bilden das Hauptorgan in der Leibeshöhle. Im[S. 523]
spinnreifen Zustande schimmern sie durch die dünne Chitindecke des
Leibes hindurch und erreichen im ausgestreckten Zustand eine Länge
von 3⁄4 m. Die fein ausgezogenen Spinnschläuche münden auf
der Unterlippe und ermöglichen es der Raupe aus ihrem zähflüssigen,
gelblichen Inhalt einen feinen Seidenfaden von etwa 3000 m
Länge zu spinnen. Derselbe ist völlig strukturlos und besteht aus 66
Prozent stickstoffhaltiger Seidensubstanz, Fibroin genannt, und 33
Prozent Bast, einer Sericin genannten leimartigen Substanz, die die
Farbe enthält und die Seide rauh, hart und steif macht. Beginnt die
Raupe das Gespinst anzulegen, so drückt sie die Unterlippe gegen eine
Unterlage, etwa einen dargereichten Zweig, und zieht mit eigentümlichen
Kopfbewegungen den zähen, an der Luft sofort erhärtenden Spinnstoff
aus den Röhren heraus, wobei der Faden natürlich doppelt wird. Erst
wird ein lockeres Gespinst von sogenannter Flockseide angelegt,
später der feste Kokon in regelmäßigen Achtertouren gesponnen. Die
braune Puppe ruht in der seidenen Hülle, die sie zum Schutze gegen
Feinde und schädigende äußere Einflüsse in etwa 31⁄2 Tagen um sich
herum gesponnen hat, 14–18 Tage lang, um sich während dieser Zeit
zum geflügelten Geschlechtstier, der Imago, zu entwickeln. Sobald
der Schmetterling fertig ausgebildet ist, reißt er an einem Pol die
vorher durch ein verdauendes Ferment aufgeweichte Puppenhülle durch,
schlüpft aus und läßt die Flügel erstarren, ohne aber Flugversuche zu
unternehmen. Doch so weit läßt es der Mensch in der Regel gar nicht
kommen, außer wenn er die Gewinnung von Eiern, sogenannten Grains,
zur Fortpflanzung des Seidenspinners beabsichtigt. Da die Kokons
abgehaspelt werden müssen, um die Seidenfäden, auf die es der Mensch
abgesehen hat und deretwegen er das Tier überhaupt in Pflege genommen
hat, zu gewinnen, so wird das Ausschlüpfen des Falters verhindert,
indem man die Puppe durch Anwendung von Hitze oder dem giftigen
Schwefelwasserstoff tötet.
Bevor der Mensch die Seidenspinnerraupe zur Gewinnung von Seide
selbst züchtete, sammelte er deren Kokons auf den Bäumen, von deren
Blättern sie sich ernährte. Später trieb er eine wilde Zucht, indem
er die Raupen auf bestimmten, in der Nähe seiner Wohnung zu diesem
Zwecke gepflanzten Bäumen ansiedelte und hegte, um dann nach deren
Einpuppung Ernte zu halten. Diese wilde Zucht wird noch im Norden
Chinas, besonders aber in Indien betrieben, in welch letzterem Lande
sie noch wichtiger als die häusliche Zucht ist, bei welcher die
Raupen in geschlossenen Räumen gehalten und mit vom[S. 524] Maulbeerbaume
gepflückten Blättern gefüttert werden. Diese engere Zucht ist in China
zuerst eingeführt worden und hat sich von da über zahlreiche Länder
der Erde verbreitet. Sie ist jedenfalls in jenem Lande eine uralte,
da dort schon im hohen Altertum vom Kaiser und seinem Hofe wie auch
von den Vornehmen seidene Gewänder neben den älteren wollenen und
leinenen getragen wurden. Nach der Sage soll die Gattin des Kaisers
Huang-li im 26. Jahrhundert v. Chr. als erste die Seidenraupe genährt
und nach deren Einpuppung mit ihren Fingern, d. h. ohne Zuhilfenahme
einer Maschine, die Seidenfäden von den Kokons abgehaspelt haben. In
Peking ist ihr ein innerhalb des verbotenen, vom Kaiser und seinem
Hofe bewohnten Stadtteils gelegener Tempel geweiht und dort werden
ihr alljährlich einmal von der Kaiserin und ihrem ganzen Hofstaat
Opfergaben dargebracht. In feierlichem Aufzuge begiebt sie sich
dahin. Im Tempelgarten schneidet sie eigenhändig mit einer goldenen
Schere Blätter des weißfrüchtigen Maulbeerbaums ab, während die sie
begleitenden Hofdamen dies mit silbernen Scheren besorgen. Damit werden
dann die Seidenraupen im Innern des Tempels gefüttert. Dann werden der
Kaiserin und deren Hofdamen von den Priestern Kokons dargereicht, von
denen sie mit den Fingern die Seide abzuwickeln versuchen. Und wie in
der Hauptstadt durch die Kaiserin, so wird in den Provinzialstädten
durch die Frauen der betreffenden Mandarine, die der Stadt vorstehen,
ein solches Fest zu Ehren der vergöttlichten Gattin des Kaisers
Huang-li, der Schutzgöttin der Seidenraupenzucht, gefeiert. Bis
vor kurzem zog auch die Kaiserin mit ihren Hofdamen, wie auch die
Prinzessinen, Seidenraupen. Heute geschieht dies allerdings nicht mehr.
Gleichwohl ist bis auf den heutigen Tag die Aufzucht der Seidenraupe
überall in China eine Beschäftigung der Frauen, während der Ackerbau
Sache der Männer ist.
Die beste chinesische Seide wird in der Provinz Tsche-kiang
hergestellt. Die Hauptstadt derselben, Hang-tschou, ist gleichzeitig
das Handelszentrum für Seidenbau und Fabrikation von Seidenstoffen, wie
heute Lyon für Europa. Die Seidenraupenzucht wird dort von den Bauern
im kleinen betrieben. Wie unsere Bauern ihre eigenen Kartoffeln und
Rüben auf ihren Äckern pflanzen, so pflanzt auch jeder Bauer in der
Provinz Tsche-kiang seinen Reis und Tee und zieht seine Seidenraupen,
die ihm nicht nur zur Lieferung von Seide, sondern auch zur Nahrung
dienen. Sind nämlich die Kokons abgebrüht und die Seidenfäden
abgewickelt, so werden die durch das Brühen getöteten[S. 525] Puppen als
leckere Speise verzehrt. Für die Zucht der Seidenraupe werden natürlich
immer nur die größten und vollkommensten Kokons verwendet. Schon am
ersten Tage, nachdem sich der Falter durch die seidene Hülle des Kokons
gebohrt hat und ans Tageslicht getreten ist, legt er nach erfolgter
Paarung — oft aber auch ohne diese — auf einen großen Bogen groben
Papiers, auf den man ihn gesetzt hat, seine gegen 500 winzige Eier ab.
Diese Papierbogen werden nun sorgfältig in reines Wasser getaucht und
auf horizontalen Bambusstangen zum Trocknen aufgehängt. Dort bleiben
sie den Sommer und Herbst über bis zum Dezember und werden dann in
einem reinen, staubfreien, sonnigen Zimmer auf den Boden gelegt. Im
Februar werden die Eierbogen nochmals dadurch gewaschen, daß man sie
eine Zeitlang mit warmem Wasser übergießt. Dies geschieht wohl auch
deshalb, um ein möglichst gleichzeitiges Auskriechen der Raupen zu
erzielen. Sobald die jungen Räupchen ausgekrochen sind, bekommen sie
Maulbeerblätter, die alle 2–3 Stunden neu gestreut werden. Sie dürfen
aber weder vom Regen noch vom Tau naß sein. In den Raupenzimmern legt
man die Blätter auf Papierbogen oder Matten auf Hürden, wobei man nach
der ersten Häutung das Lager mit den Exkrementen und unverbrauchten
Blattresten täglich entfernt. Zu dem Zwecke legt man Netze oder
durchlöchertes Papier auf die Raupen. Sehr bald kriechen sie hervor und
können auf neue, saubere Hürden übertragen werden. Das alte Lager wird
aufgerollt und hinausgeschafft. Mit dem Größerwerden der Raupen müssen
ihnen natürlich immer größere Räume zur Verfügung gestellt werden. Am
32. Tage nach dem Ausschlüpfen aus dem Ei, wenn die Raupen aufhören zu
fressen und man sieht, daß sie sich zum Verpuppen vorbereiten, hängt
man in den Raupenhäusern lose Strohbündel auf und setzt auf jedes
derselben 70–80 Raupen. Die Strohhalme geben ihnen den nötigen Halt,
um sich einzuspinnen. Nach spätestens fünf Tagen haben sie sich aus
den zarten Seidenfäden ihre Kokons gesponnen. Alsbald werden diese von
den Strohhalmen abgelöst, auf Bambusmatten gelegt und der Hitze von
Kohlenfeuern ausgesetzt, welche die Puppen tötet. In großen Betrieben
benutzt man dazu backofenartige Kammern, in denen die erhitzte Luft das
Töten der Puppen besorgt. Nun werden die Kokons sorgfältig sortiert
und in flachen Körben in heißes Wasser gelegt, um das Seidengespinst
zu lockern und die Fäden abhaspeln zu können. Nach dem Erweichen in
Wasser von 90–100° C. bringt man sie in solches von 60–70° und
schlägt sie mit einer von Hand oder in[S. 526] größeren Betrieben in Europa
durch einen Exzenter auf und ab bewegten Bürste, um die oberflächliche
Flockseide zu lösen und die Anfänge des Seidenfadens zu gewinnen.
Hierauf gelangen sie in einen Trog mit Wasser von 50–60° und werden
nach Vereinigung mehrerer Fäden zu einem Rohseidenfaden abgehaspelt.
Während in China die Seidenfäden mit den primitivsten Mitteln gewonnen
werden, benutzt man dazu in den Kulturländern Europas, die sich mit
Seidenzucht abgeben, großartige maschinelle Einrichtungen. Die Rohseide
wird dann auf besonderen Maschinen gezwirnt, indem man mehrere, meist
5–7 Fäden durch Zusammendrehen vereinigt. Von den 3000 m
Seidenfaden, aus denen ein ganzer Kokon besteht, gewinnt man nur etwa
300–600, ausnahmsweise auch 900 m brauchbare Seide. Dabei wiegen
500–600 Kokons 1 kg und etwa 10 kg derselben liefern
1 kg gesponnene Seide, die an Haltbarkeit jede Pflanzenfaser
übertrifft. Da nun aber diese Rohseide hart, steif und ohne Glanz
ist, wird sie durch Kochen mit Seifenlauge zur Entfernung des Bastes
„entschält“; dadurch wird sie nicht nur glänzend und weiß, sondern auch
leichter und besser färbbar.
Von allen Städten Chinas ist das in einer tief sich ins Land hinein
erstreckenden Bucht an der Küste südlich von Schang-hai gelegene
Hang-tschose durch seine Seidenindustrie am berühmtesten. Ganze
Quartiere werden hier von Seidenwindern und -spinnern eingenommen, die
Tag für Tag ohne Unterbrechung ihrem Gewerbe obliegen und sich nur an
3 oder 4 Tagen im Jahr, am Neujahrsfest, Ruhe gönnen. Der größte Teil
der Erzeugnisse dieser Stadt wird im Inlande abgesetzt, da die reichen
und vornehmen Chinesen sich von jeher mit Vorliebe in Seidengewänder
kleiden, die sehr kunstvoll mit prächtigen Stickereien hergestellt
werden. Die gesamte Ausfuhr der Provinz Tsche-kiang beläuft sich nur
auf 400 Pikuls (= 25000 kg) jährlich im Werte von 1⁄4 Million
Taels (= 11⁄2 Millionen Mark). Am meisten Seide wird aus Han-kau, im
Herzen Chinas am Yang-tse-kiang oder blauen Flusse gelegen, ausgeführt.
Hier erreicht ihr Wert etwa 24 Millionen Mark im Jahr. Ebenso viel
exportiert Kau-tau, dann folgen der Reihe nach Tschi-fu und I-schang.
Der Gesamtexport Chinas beträgt im Jahre etwa für 150–160 Millionen
Mark.
In den nördlichen Provinzen Chinas sowie in der Mandschurei werden die
Seidenraupen nicht mit Maulbeerblättern, sondern mit Eichenlaub, bei
uns in Europa auch mit den Blättern der Schwarzwurzel (Scorzonera
hispanica), großgezogen. Man läßt dort die[S. 527] Raupen auf den
Bäumen, wo sie sich selbst ernähren. Hier bleiben sie ohne Pflege und
besonderen Schutz, bis sie sich eingesponnen haben. Die Frühjahrkokons
werden nicht eingeheimst; man läßt aus ihnen die Falter auskriechen und
sich vermehren. Erst die Herbstkokons werden geerntet und auf Seide
verarbeitet. In diesen nördlichen Provinzen, wie auch im Stromgebiet
des Yang-tse-kiang, sind die Krankheiten der Seidenraupe, welche in
Frankreich und Italien so große Verheerungen anrichten, unbekannt;
dagegen sind sie in Tsche-kiang schon aufgetreten. Trotzdem liefert
China unzweifelhaft auch heute noch die meiste Rohseide; und wollten
die Chinesen endlich die bewährten europäischen Erzeugungsmethoden
annehmen, so würde es ihnen leicht werden, den sich in letzter Zeit
äußerst stark geltend machenden japanischen Wettbewerb aus dem Felde zu
schlagen und ihre schon jetzt so großen Einnahmen zu verdoppeln. Daß
dies in verhältnismäßig naher Zukunft der Fall sein wird, daran ist
nicht im geringsten zu zweifeln.
Wie die Chinesen den Seidenspinner zum eigentlichen Haustier
erhoben, haben sie auch die Seidenraupenzucht im Altertum als ihr
ausschließliches Monopol eifersüchtig gehütet. Dieses Monopol wurde
zum erstenmal, soweit wir wissen, im Jahre 140 v. Chr., durch eine
chinesische Prinzessin durchbrochen. Solche wurden schon damals als
Opfer der Politik zur Einleitung freundschaftlicher Beziehungen oder
zur Befestigung bestehender Bündnisse gewissermaßen als Ehrengeschenke
Fürsten der angrenzenden Länder gegeben. Eine solche brachte die Zucht
der Seidenraupe aus dem Herzen Chinas nach der uralten Kulturoase
Chotan am nördlichen Abhange des Kuen-lün oder Himmelsgebirges. Von
Kind auf mit der Aufzucht dieses Tieres vertraut, wollte sie es als
teure Erinnerung an die ferne Heimat mitnehmen. Das durfte sie aber nur
ganz im Verborgenen tun, und so schmuggelte sie Eier des Seidenspinners
in ihrem Kopfputz verborgen über die Grenze.
Schon lange vorher waren Kleidungsstücke und Stoffe von in China
bereiteter Seide als wertvolle Tauschmittel nach dem Auslande gebracht
worden, zumal nach dem reichen Indien, wo solche früher schon an den
Höfen und bei den Vornehmen einen beliebten Schmuck bildeten. Über den
Umweg Indien oder auch direkt kam solcher Seidenstoff schon im Altertum
auch in die Kulturländer am Mittelmeer, wo man sich allerdings von
dessen Gewinnung teilweise sehr abenteuerliche Vorstellungen machte. So
spricht der römische Dichter[S. 528] Vergil (70–19 v. Chr.) in seiner Georgica
„von den Wäldern des Negerlandes, die weißgraue Wolle tragen — er
versteht darunter offenbar die Baumwolle — und von der feinen Wolle,
welche die Serer von Blättern kämmen“. Unter der Bezeichnung Serer
verstand das klassische Altertum die Chinesen im fernsten Asien, und
deshalb kann unter dieser von Blättern gekämmten Wolle nur die Seide,
die bereits damals bei den Vornehmen Roms gebräuchlich war, verstanden
worden sein. Auch der ältere Plinius (23–79 n. Chr.) sagt in seiner
Naturgeschichte: „Die Serer sind berühmt durch die Wolle ihrer Wälder
(also die Seide); sie begießen die weißgrauen Haare der Blätter und
kämmen sie ab. Unsere Weiber müssen die Fäden wieder abwickeln und von
neuem weben. So mühsam ist die Arbeit, durch die unsere Damenkleider
hergestellt werden, so weit her holt man ihren Stoff“.
Tafel 59.

Seidenraupenzucht in Japan. 1. Die aus den Kokons
ausgeschlüpften Schmetterlinge werden auf Papierbogen ausgebreitet, auf denen
sie ihre Eier legen.

2. Fütterung der Seidenraupen mit Blättern des
weißfrüchtigen Maulbeerbaums.
Tafel 60.

3. Eingesponnene Seidenraupen (Kokons).

4. Die Seide wird von den Kokons abgehaspelt.
Die Behauptung, daß die Seide in Form von Haaren auf Blättern wachse,
ist zweifellos daher entstanden, daß man eine dunkle Ahnung davon
hatte, daß gewisse Blätter zu deren Gewinnung nötig seien. Daß aber
eine Raupe von diesen Blättern lebt und aus der Blattsubstanz Seide
erzeugt, das wußte man noch nicht allgemein. Doch hatten schon
einige besser unterrichtete Griechen Kunde davon. So spricht schon
der gelehrte Erzieher Alexanders des Großen, Aristoteles (384–322 v.
Chr.), von der Gewinnung einer Art Seide durch einen in Griechenland
einheimischen Spinner. Er schreibt nämlich in seiner Naturgeschichte:
„Aus einem großen Wurme, der eine Art Hörner hat und sich von
andern unterscheidet, wird zunächst durch Verwandlung eine Raupe,
dann ein bombylios (Kokon) und später eine Puppe; alle diese
Verwandlungen macht er in sechs Monaten durch. Von diesem Tiere haspeln
manche Weiber das Gespinst (ta bombýkia) ab und weben es dann.
Pamphila, die Tochter des Plates, soll zuerst auf der Insel Kos (in der
Nähe der Karischen Küste) diese Webekunst ausgeübt haben.“ Diese Stelle
des Aristoteles bringt der ältere Plinius mit geringen Veränderungen
und sagt dann, daß aus den Kokons eines Spinners (bombyx) als
bombycine bezeichnete Gewebe verfertigt würden, aus denen
man Kleider für prachtliebende Damen mache. Die Kunst, diese Fäden
abzuhaspeln und dann zu weben, habe eine Frau von Koos, Pamphila,
erfunden. Späterhin fährt er fort: „Auch auf der Insel Koos soll
eine Art Spinner (bombyx) entstehen, indem sich die vom Regen
abgeschlagenen Blüten der Cypressen, Terebinthen, Eschen und Eichen
durch den Hauch der Erde beleben. Zunächst sollen daraus kleine, nackte
Schmetterlinge (papilio) entstehen, welche bald[S. 529] gegen die
Kälte einen schützenden Haarüberzug erhalten und sich dann gegen die
Rauhigkeit des Winters eigene Kleider verfertigen, indem sie mit den
Füßen den feinen Haarüberzug (lanugo) der Blätter abkratzen.
Diesen krämpeln sie dann mit den Nägeln, breiten ihn zwischen den Ästen
aus und ordnen ihn wie mit einem Kamme, worauf sie sich in das Ganze
wie in ein bewegliches Nest einhüllen. Hierauf nimmt man sie ab, legt
sie in lauwarme irdene Geschirre und füttert sie mit Kleie. Daraufhin
bekommen sie Federn (pluma). Nun läßt man sie wieder frei,
damit sie ihre Arbeit aufs neue beginnen können. Die schon begonnenen
Gewebe werden in der Feuchtigkeit zähe und werden dann mit einer aus
Binsen gemachten Spindel in dünne Fäden gezogen. Selbst Männer tragen
solche leichte Kleider während der Sommerhitze, denn vom Panzer wollen
unsere Weichlinge, die kaum noch ein leichtes Kleid zu tragen vermögen,
nicht mehr viel wissen. Doch den assyrischen Bombyx überlassen wir
noch den Damen“. Unter letzterem scheint die echte Seide verstanden
worden zu sein, die vorzugsweise von den vornehmen Damen Roms zur
Kaiserzeit getragen wurde; denn der römische Geschichtschreiber Tacitus
(54–117 n. Chr.) schreibt in seinen Annalen, der Senat habe unter
der Regierung des Kaisers Tiberius (14–37 n. Chr.) beschloßen den
Aufwand einzuschränken und verbot Speisen in Gefäßen von massivem Gold
aufzutragen, wie auch den Männern das Tragen seidener Kleider. Unter
dem Gespinst von Kos muß aber das Erzeugnis eines anderen Spinners,
der dort vielleicht in wilder Zucht kultiviert wurde, verstanden
worden sein, wenn man nicht annehmen will, daß die aus gekrämpelten
Fäden hergestellte Floretseide irrtümlicherweise von einer auf Kos
lebend angenommenen Bombyxart abgeleitet wurde. Letzteres scheint sehr
wahrscheinlich zu sein, denn man sollte doch denken, daß, wenn auf
der Insel Kos tatsächlich eine Art Seidenspinner gezogen worden wäre,
man über diese Zucht noch weitere Angaben bei antiken Schriftstellern
finden sollte, was aber durchaus nicht der Fall ist.
Weit besser als die bisher genannten Autoren war der griechische
Geschichtschreiber und Geograph Pausanias, der zwischen 160 und 180 n.
Chr. einen Reiseführer durch die Kulturländer am Mittelmeer schrieb,
über die Herkunft der chinesischen Seide orientiert. Allerdings war
auch sein Wissen mit zahlreichen Irrtümern gespickt. Er schreibt
nämlich in seiner Periegesis: „Im Lande der Serer lebt ein Tierchen,
welches die Griechen sér nennen, während es bei den Serern selbst
anders heißt. Es ist doppelt so groß wie der größte Käfer, übrigens[S. 530]
den Spinnen gleich, hat auch acht Beine. Diese Tiere halten die Serer
in eigenen Gebäuden, die für den Sommer und Winter eingerichtet sind.
Das Gespinst dieser Tiere ist zart und sie wickeln es mit ihren Füßen
um sich herum. Vier Jahre lang werden sie mit Hirse gefüttert; im
fünften aber, und man weiß, daß sie nicht länger leben, bekommen
sie grünes Rohr (kálamos) zur Nahrung. Dieses schmeckt ihnen
unvergleichlich gut; sie fressen sich davon so dick und voll, daß sie
platzen und sterben. Man findet alsdann in ihrem Innern noch viele
Fäden.“
Wenn nun auch die alten Römer nicht recht wußten, was für ein Erzeugnis
die Seide sei, so wußten sie doch, daß die von ihnen Serer genannten
Chinesen im fernen Osten Asiens diesen kostbaren Stoff gewannen und
in den Handel brachten. Der römische Geschichtschreiber Ammianus
Marcellinus (geboren 330 zu Antiochia in Syrien, diente zuerst im Heer,
lebte später in Rom, wo er in lateinischer Sprache eine „Römische
Geschichte von 96–378“ in 31 Büchern schrieb und nach 390 starb) weiß
uns zu erzählen: „Die Serer sind ruhige, sich nie mit Waffen und
Krieg befassende Leute. Sie leben in einer gesunden Gegend, die reich
an ziemlich lichten Wäldern ist, holen von den Bäumen, nachdem sie
dieselben tüchtig mit Wasser bespritzt haben, eine Art Wolle, die, mit
der Flüssigkeit gemischt und dann gekämmt, einen äußerst feinen Stoff
liefert, der gesponnen die Seide gibt. Früher trugen nur vornehme
Leute solche Kleider, jetzt tragen sie selbst die gemeinsten ohne
Unterschied. — Kommen Fremde zu den Serern, um Fäden (d. h. Seide) zu
kaufen, so legen sie ihre Ware aus und der Handel wird geschlossen,
ohne daß ein Wort dabei gewechselt wird.“
Wenn auch nach diesem Autor im 4. Jahrhundert n. Chr. selbst die
gemeinen Leute seidene Kleider trugen, so war dies zu Ende der Republik
und zu Anfang der Kaiserzeit durchaus noch nicht der Fall. Damals waren
Seidenstoffe etwas überaus Kostbares, deren Anschaffung sich nur sehr
Reiche leisten konnten. So schreibt der römische Geschichtschreiber Dio
Cassius: „Um einen Begriff von der verschwenderischen Pracht zu geben,
welche der Diktator Julius Cäsar (es war in den Jahren 46–44 v. Chr.)
entfaltete, so bemerke ich, daß er, wie einige Schriftsteller erzählen,
im Theater seidene Stoffe zum Schutze gegen die Sonne über den
Zuschauern ausbreiten ließ. Die Seide ist ein für Üppigkeit bestimmtes
Gewebe, das eigentlich zum Gebrauche vornehmer Damen eingeführt wird.
Die Zuschauer im Theater, welche bis dahin bei jeder neuen Szene laut
über unvernünftige Verschwendung Cäsars geschrieen hatten, ließen sich
die seidenen Tücher (Velarien)[S. 531] zur Abhaltung der Sonne ruhig gefallen;
die Soldaten aber, welche sich ärgerten, daß das Geld nicht lieber für
sie selbst verwendet worden war, machten einen entsetzlichen Lärm und
konnten nicht eher zur Ruhe gebracht werden, als bis Cäsar einen von
ihnen mit eigener Hand packte und hinrichten ließ.“
Außer zu Kleidern für vornehme Damen und Velarien für Theater und
später auch Zirkus, wurde für alle möglichen Zwecke ein ausgedehnter
Gebrauch von Seidenstoffen gemacht. So spricht Properz (45 v. bis 22
n. Chr.) in seinen Elegien von mit Seide geschmückten Wagen, von in
arabischer Seide glänzenden Mädchen, von bunten Seidengeweben, die
gegen Kummer nicht helfen. Horaz (65–8 v. Chr.) schreibt in einer
seiner Epoden von „Büchern, die auf seidenen Kissen liegen.“ Ovid
(43 v. bis 7 n. Chr.) sagt in seinem Amores, die über den Rücken
herabwallenden Haare der Geliebten seien so zart wie Seide und so fein
wie Spinnengewebe. Quintilian berichtet von einer aus Seide gewebten
Toga, also dem Männerüberwurf. Martial spottet: „Galla ist alt und
häßlich, schmückt sich aber mit seidenen Kleidern.“ Und der ältere
Plinius schreibt in seiner Naturgeschichte: „Kränze sind schon seit
langer Zeit bei den Römern im Gebrauch; jetzt aber hat es die Üppigkeit
der Weiber so weit gebracht, daß man diejenigen Kränze für die besten
hält, die mit bunten Seidenbändern durchflochten sind und von Salben
triefen.“
In der späteren Kaiserzeit wurde der Luxus mit den kostbarsten Dingen,
darunter auch mit Seidengeweben, immer weiter getrieben. Stark darin
war der halbverrückte Kaiser Commodus. Nach dessen Ermordung im
Jahre 192 fand der zum Imperator ausgerufene Stadtpräfekt in Rom,
Pertinax, nach dem Berichte des Julius Capitolinus die Finanzen in
einem verzweifelten Zustande, der durch die unsinnige Verschwendung
seines Vorgängers Commodus verursacht worden war. Er sah sich daher,
um hierin Ordnung zu schaffen, genötigt, alles zu verkaufen und zu
Geld zu machen, was derselbe an verkäuflichen Dingen hinterlassen
hatte, so z. B. Hofnarren, liederliche Dirnen, zahlreiche kostbare
Kleider, deren Aufzug aus Seide, der Einschuß aber aus Goldfäden
bestand, dann Waffen und Schmuck aller Art aus Gold und Edelsteinen,
zahlreiche Gefäße, die aus Gold, Silber, Elfenbein oder kostbarem Holz
der Sandarakzypresse aus dem Atlasgebirge (citrus) gearbeitet
waren, Prunkkarossen usw. Bis dahin waren die Gewebe meist noch nicht
ganz aus Seide hergestellt, sondern nur der Aufzug war von Seide, der
Einschuß aber aus Wolle, Leinen,[S. 532] Baumwolle oder Gold, wie sie Commodus
trug. Erst nach seiner Zeit ist von ganzseidenen Gewändern (stola
holoserica — Stola war das bei den Römern über der Tunika
getragene lange Frauengewand, das unter der Brust zu einem weiten
Faltenbausch aufgegürtet wurde) die Rede, die als besonders üppig, weil
sehr teuer, galten. Und Älius Lampridius schreibt in seiner Biographie
des Kaisers Heliogabalus: „Kaiser Heliogabalus (regierte von 218–222
n. Chr.) soll der erste Römer gewesen sein, der ein ganzseidenes Kleid
(holoserica vestis) trug; bis dahin hatten römische Männer nur
halbseidene (subserica) getragen. — Er ließ sich Stricke aus
purpur- und scharlachroter Seide flechten, um sich damit erhängen zu
können, wenn sein letztes Stündlein geschlagen hätte. Um die Wahl zu
haben, hielt er auch in hohlgeschliffenen Edelsteinen Gifte vorrätig,
baute auch einen sehr hohen Turm und ließ an dessen Fuß den Boden mit
Gold und Edelsteinen pflastern, um sich gegebenenfalls recht großartig
auf dieses Prachtpflaster zu stürzen und so ganz glorreich den Hals
brechen zu können. Aber alle diese schönen Plänchen wurden vereitelt;
denn Hofnarren und Soldaten jagten ihn in einen Abtritt, schlugen ihn
da tot, schleiften ihn durch allen möglichen Dreck und warfen ihn
zuletzt mit einem Stein am Halse, damit er nicht begraben werden könne,
in den Tiberstrom.“
Im Gegensatz zu diesem an den größten orientalischen Luxus gewöhnten
Kaiser sagt der Geschichtschreiber Flavius Vopiscus von Kaiser Aurelian
(ward 270 nach Claudius II. Tod von den Truppen in Mösien zum
Kaiser ausgerufen, machte 272 der Herrschaft der Zenobia in Palmyra
ein Ende, besiegte den gallischen Gegenkaiser Tetricus, fiel aber 275
auf dem Zuge gegen die Perser durch Meuchelmord): „Kaiser Aurelian
hatte weder selbst ein ganzseidenes Kleid, noch schenkte er jemandem
eins. Als ihn seine Gemahlin um die Erlaubnis bat, wenigstens ein
pupurfarbiges seidenes Kleid tragen zu dürfen, antwortete er: „Nein,
bewahre! Die Seide darf nicht mit Gold aufgewogen werden.“ Damals
aber stand ein Pfund Gold einem Pfund Seidenstoffes an Wert gleich.“
Und vom Kaiser Tacitus, der 275, im Alter von 75 Jahren vom Senat zum
Imperator gewählt, treffliche Absichten hatte, aber schon 276 auf
einem Zug gegen die Goten in Kleinasien von seinen eigenen Soldaten
ermordet wurde, hebt sein Biograph Flavius Vopiscus rühmend hervor,
er habe allen Männern das Tragen ganzseidener Kleider verboten, da
er solche Sitte als allzu verweichlichend für unpassend fand. Sein
Verbot hatte aber nur vorübergehend Geltung und wurde unter seinen
Nachfolgern bald auf[S. 533]gehoben. Ungescheut trugen auch die Männer jene
üppigen Seidenstoffe aus dem fernen Asien. Erst später, als das Tragen
solcher Gewandung in breitere Volksschichten überging, kamen die
einsichtsvolleren Männer Roms wieder davon ab. Und der ums Jahr 400 n.
Chr. lebende Schriftsteller Claudius Claudianus berichtet, daß es zu
seiner Zeit Stutzer gab, denen selbst das seidene Kleid zu schwer war.
Derselbe Autor spricht in seiner Lobschrift über den Vandalen Stilicho,
der 395 Vormund des Kaisers Honorius und Regent des weströmischen
Reiches ward, von seidenen Zügeln. Als dieser Stilicho 408 von einem
Römer ermordet worden war, drang der Westgotenkönig Alarich mit seinem
Heere, das jener 403 bei Pollentia und Verona geschlagen hatte,
abermals plündernd in Italien ein und eroberte die Stadt Rom am 24.
August 410. Bei der Übergabe dieser Stadt stellte dieser Germanenfürst,
der bereits auf seinem Raubzuge durch Griechenland 395 die
Annehmlichkeit des Tragens seidener Kleidung kennen gelernt hatte, nach
dem Berichte des Geschichtschreibers Zosimus die Bedingung auf, daß ihm
die Römer außer andern Kostbarkeiten 4000 seidene Gewänder abliefern
sollten, was denn auch geschah. Daß dies möglich war, beweist, daß die
Seide damals in jener üppigen Hauptstadt des weströmischen Reiches
etwas ziemlich Gewöhnliches war.
In jener Zeit hatte die Zucht der Seidenraupe vom Gebiet von Chotan aus
durch ganz Turkestan so weite Verbreitung gefunden, daß um die Mitte
des 6. Jahrhunderts n. Chr. Dizabul, ein Herrscher der Turkvölker,
mit Umgehung des dazwischenliegenden Reiches der Sassaniden mit
dem oströmischen Kaiser Justinian I., der 527 seinem Onkel
Justinus I. in der Herrschaft folgte und bis 565 regierte,
Unterhandlungen über die Einfuhr von Seidenstoffen anknüpfte. Dieses
Anerbieten Dizabuls lehnte aber Justinian ab, da inzwischen die
Oströmer selbst die Seidenraupenzucht erhalten hatten. Im Jahre 551
hatten nämlich nach dem Geschichtschreiber Procopius zwei syrische
Mönche die ersten Eier des Seidenspinners und eine gründliche Kenntnis
der ganzen Zucht desselben von Turkestan nach Konstantinopel gebracht.
Da die Todesstrafe auf der Ausfuhr von Eiern der Seidenraupe stand,
schmuggelten sie diese in hohlen Stöcken auf oströmisches Gebiet
hinüber, wo man mit diesem kostbaren Geschenk sehr wohl zufrieden war.
Dort lernte man bald die Seide selbst gewinnen und daraus Seidengewebe
herstellen. So konnte Justinian mit Umgehung der in Syrien ansässigen
Seidenhändler aus der Seide in seinem eigenen Lande ein Monopol
machen. Und dieses wurde in der Folge bis ins 12. Jahr[S. 534]hundert streng
aufrecht erhalten. Späterhin wurde besonders die Insel Kos durch ihre
Seidenkultur berühmt.
Erst als man die Seidenraupenzucht im eigenen Lande hatte, korrigierte
man die falschen Anschauungen, die bis dahin über die Herkunft dieser
Art Gewebe im Abendlande geherrscht hatten. Doch gab es gleichwohl
noch genug Leute, die darin nicht recht Bescheid wußten und bei
den althergebrachten falschen Ansichten blieben. So schreibt noch
der 636 als Bischof von Hispalis (Sevilla) verstorbene Isidorus in
seiner Biographie des Origines: „Die Seide heißt sericum,
weil sie zuerst aus dem Lande der Serer kam. Dort sollen Würmchen
(vermiculi) leben, welche die Fäden auf Bäumen ziehen; solche
Würmer (vermes) werden von den Griechen bómbykes genannt.“
In Persien, Syrien und Kleinasien war die Seidenzucht schon zu
Muhammeds Zeiten (571–632) stark verbreitet, und obschon dieser
einflußreiche Prophet seinen Anhängern drohend zurief: „Wer hier Seide
trägt, wird dort keine tragen,“ konnte der seit dem Altertum hier
getriebene orientalische Luxus an kostbaren Webereien und Stickereien
unmöglich auf dieses neue hervorragende Material verzichten. So
erdachten sich die schlauen Anhänger des Propheten einen Kompromiß
zwischen den allzustrengen Geboten Muhammeds und den Bedürfnissen
des täglichen Lebens, und erklärten nur reinseidene Gewänder und
Gewebe für verboten, während Seide, die in anderes Gewebe eingewebt,
eingestickt oder eingenäht wurde, erlaubt sein sollte. Jedenfalls ist
die Seidenzucht in allen muhammedanischen Ländern bald zu großer Blüte
gelangt und hat besonders auch unter den gewerbetüchtigen Mauren in
Spanien eine große Bedeutung erlangt, indem der Export von kostbaren
Seidenstoffen von dort nach Europa ein nicht unwichtiger war. Aber
nicht von Spanien, wo die Mauren nur Seidenstoffe, nicht aber die
Seidenraupe selbst außer Land gaben, sondern von Sizilien aus wurde
die Seidenzucht zunächst nach Italien und dann nach Südfrankreich
verbreitet. In Siziliens Hauptstadt Palermo hatten die Araber seit
dem 10. Jahrhundert eine auch von ihren Nachfolgern, den Normannen,
nach der Eroberung der Insel im Jahre 1072 beibehaltene staatliche
Fabrik für Seidengewebe, die unter anderm auch die normannischen
Krönungsgewänder lieferte. Diese kamen durch Konstantia, die Erbin des
sizilischen Königs Wilhelm II., mit der sich Kaiser Friedrichs
I. Barbarossas Sohn Heinrich IV. 1186 vermählte, in
den Besitz der Hohenstaufen und wurden durch sie zu den deutschen
Reichskleinodien gemacht. Daher kommt es, daß der[S. 535] Mantel und die
Strumpfbänder, mit denen der Kaiser des heiligen römischen Reichs
deutscher Nation bei der feierlichen Krönung bekleidet wurde, arabische
Inschriften von Goldstickerei auf purpurfarbiger Seide tragen.
Ersterer, der im Jahre 1133 für Roger II. hergestellt wurde,
welcher sich drei Jahre zuvor in Palermo zum Könige von Sizilien und
Apulien, das er 1127 erbte, hatte krönen lassen, trägt außerdem das
echt arabische Motiv der Darstellung eines Löwen, der unter einer
Dattelpalme ein Kamel würgt.
In Italien breitete sich dann in begünstigten Gebieten die Seidenzucht
ziemlich rasch aus. So empfingen die Fabriken Norditaliens ein
wichtiges Produkt für ihre Weberei. Besonders zeichnete sich Lucca,
Bologna und Florenz aus; aber auch sie suchten daraus ein Monopol zu
ihren Gunsten zu machen, indem sie die Ausfuhr des Seidenspinners
und seiner Nährpflanze, des weißfrüchtigen Maulbeerbaumes, aus
ihrem Gebiete aufs strengste untersagten. Solches Verbot mußte
aber nur umsomehr die Begehrlichkeit der Nachbarn reizen. So ließ
Ludwig XI., der von 1461 an Frankreich regierte, in seinem
Lieblingssitze Plessis-les-Tours durch einen Kalabresen eine
Seidenzucht einrichten, die aber erfolglos blieb. Erst einem seiner
Räte gelang diese Einführung, indem er zuerst die Nährpflanze der
Seidenraupe, den weißfrüchtigen Maulbeerbaum, in Südfrankreich
anpflanzte und dann erst Eier des Seidenspinners zur Aufzucht der
Raupe einführte. In der Folge wurde die südfranzösische Seidenzucht
von den Königen Frankreichs in hohem Maße begünstigt, so daß
schon unter Heinrich IV. der Altmeister der französischen
Landwirtschaft, Olivier de Serres, sie als blühend hervorhob. Seit der
Zeit des prachtliebenden Ludwigs XIV. nahm dann Lyon in der
Fabrikation aller Seidenstoffe eine führende Stellung ein, gegen die
die oberitalienischen Städte, selbst Mailand, wohin sie 1550 eingeführt
wurde, zurücktreten mußten.
Während in Süditalien und Sizilien die vormals blühende Seidenweberei
im 14. Jahrhundert verschwand, behielten diese Länder in der Folge nur
die Erzeugung des Rohmaterials, während sich die dem damals überaus
mächtigen und reichen Herzogtum Burgund angegliederten Niederlande
einen großen Teil der Herstellung der allerkostbarsten Seidenzeuge,
speziell Brokate, aneigneten. In Deutschland bildete sich im Jahre
1670, und zwar in Bayern, die erste Seidenbaugesellschaft. Von 1764 an
bis zu seinem 1786 erfolgten Tode führte König Friedrich II.,
der Große, den Seidenbau in Preußen ein und begünstigte ihn in so hohem
Maße, daß Krefeld versuchen konnte, es mit Lyon[S. 536] aufzunehmen. Doch
verfiel in der Folge die ganze Unternehmung, weil es der Seidenraupe
hier zu kalt war, so daß Krefeld, um weiter bestehen zu können, das
Rohmaterial aus überseeischen Ländern, wie auch später Lyon infolge der
Muscardine, beziehen mußte. Dadurch erhielt die Zucht der Seidenraupe
im subtropischen Gebiet einen neuen Anstoß, zugleich aber wurde
die Seidenindustrie des Orients, die sich bis dahin, wenn auch in
geringerem Maße, in alter Weise erhalten hatte, durch die Entziehung
des Rohmaterials aufs empfindlichste betroffen. Jetzt ziehen Persien,
Kleinasien und Mazedonien die Seide für die französischen Fabriken, und
China und Japan exportieren zunehmend rohe Seide. Auch die indische
Seide geht jetzt fast ganz in die europäische Fabrikation über.
Rußland hat die alte Seidenkultur Zentralasiens an sich gerissen, wie
Frankreich diejenige Algeriens.
Am Kap der Guten Hoffnung wurden im Jahre 1730 ohne Erfolg Seidenraupen
gezogen; auch in Mexiko, Argentinien und Chile blieben die
diesbezüglichen Versuche bedeutungslos. Asien dagegen ist heute noch
die Hochburg der Seidenzucht. Während in Indien bis nach Indo-china
hinein die wilde Zucht die zahme weit überwiegt, wurde letztere von
China aus schon frühe weiter ostwärts verbreitet. So kam sie zu Beginn
des 2. Jahrhunderts in Korea auf und im Jahre 195 wurde sie durch
den Prinzen Koman, einen Sproß des chinesischen Kaiserhauses, nach
Japan, wo er sich niederließ, eingeführt. Sein Sohn ließ dann eine
große Schar aus China herübergebrachter Seidenweber über das ganze
Land verteilen, um das japanische Volk in dieser Kunst zu unterweisen.
Man erzählt sich, das 50 Jahre später der damalige japanische Kaiser
seine Gemahlin veranlaßt habe, die Häuser der Seidenraupenzüchter und
Seidenweber zu besuchen, um sie in ihrer Tätigkeit zu ermutigen. Ja, im
Jahre 462 ließ Kaiser Yurgake als ermunterndes Beispiel für das ganze
Volk seine Gemahlin höchst eigenhändig Seidenraupen züchten und sie
mit den Blättern des Maulbeerbaums füttern. Von dieser Zeit an wurde
die Seidenkultur nach dem Berichte der japanischen Annalen, wie in
China, ein Gegenstand von größter nationaler Bedeutung, so daß wie dort
Seidenstoffe von allen besser Situierten getragen und an Stelle anderer
Bezahlung als Steuer auch von den Staatsbeamten angenommen werden.
Heute werden alljährlich 24 Milliarden Kokons des Seidenspinners zur
Gewinnung von Seide verbraucht, obschon neuerdings auch Kunstseide
aus nitrierter Cellulose oder Schießbaumwolle hergestellt wird.
Durch die vielhundertjährige Zucht in geschlossenen Räumen zeigen
die[S. 537] Seidenraupen eine verminderte Widerstandsfähigkeit gegen
Infektionen und sind den verschiedensten Krankheiten ausgesetzt, die
große Verheerungen unter ihnen anrichten. Von den durch Spaltpilze
angerichteten Krankheiten, den sogenannten Mykosen, ist zunächst die
Schlaffsucht hervorzuheben, von den Franzosen flacherie und
den Italienern flaccidezza genannt. Sie trat in der zweiten
Hälfte des vorigen Jahrhunderts mit ungewöhnlicher Heftigkeit auf
und vernichtete einen starken Prozentsatz der Zuchten. Die Krankheit
macht sich meist kurz vor der Verpuppung bemerkbar und nimmt einen
sehr raschen Verlauf. Die Raupen zeigen dann verminderte Freßlust,
werden schlaff und verenden schließlich. Das Innere derselben verfließt
schon nach 1–2 Tagen zu einer schwarzbraunen Jauche, in welcher
sich viele Spaltpilze befinden. Eine andere Mykose verursacht die
Kalksucht, von den Franzosen muscardine, von den Italienern
dagegen calcino genannt. Sie wird durch den Pilz Botrytis
bassiana hervorgerufen, dessen Mycel das Innere des Raupenkörpers
durchsetzt, wobei die absterbende Raupe zuerst wachsartig, später aber
wie mit Kalk begossen erscheint, indem sie sich über und über mit den
Sporenträgern bedeckt, die durch Verstreuen der rasch in die gesunden
Raupen eindringenden Sporen andere Individuen anstecken. Die Seuche
ist seit 1763 bekannt und gewann zu Beginn des vorigen Jahrhunderts
besonders in Frankreich eine große Ausdehnung, ist aber seit 50 Jahren
fast ganz verschwunden. Die Fleckenkrankheit oder Pebrine zeigt sich
zuerst in verminderter Freßlust, dann erscheinen auf der Haut dunkle
Flecken und das Schwanzhorn der Raupe verschrumpft meist. Doch können
schwach infizierte Raupen noch einen Kokon spinnen und sich zu einem
Schmetterling entwickeln. Der Erreger dieser Fleckenkrankheit ist
ein Nosema bombycis genannter Spaltpilz, der ebenfalls leicht
übertragen wird und großen Schaden anrichtet. Ebenfalls verderblich
sind die Fett- oder Gelbsucht und die Schwind- und Schlafsucht.
Wie der Mensch Schläge der Seidenraupe mit strohgelbem, goldgelbem,
grünlichem oder weißem Kokon gezüchtet hat, hat er auch größere und
kleinere Rassen, wie auch solche mit ein und zwei Generationen im Jahr
gezogen. Ganz verwildert ist dieses Haustier nirgends, immerhin gab es
nach Aldrovandi im Jahre 1623 eine halbverwilderte Zucht in Kalabrien,
indem man dort die Raupe auf dem Maulbeerbaume selbst ansiedelte und
von diesen die Kokons sammelte. Der Haupthinderungsgrund des Gedeihens
einer solchen Zucht im Freien sind vor allem die insektenfressenden
Vögel, gegen die auch die Süd[S. 538]asiaten ihre halbwilde Zucht durch Netze
schützen müssen. Wahrscheinlich sind auch diese Feinde der wehrlosen
Raupe die Ursache gewesen, daß man die Zucht dieses Tieres mehr und
mehr ins Haus zog. Da in allen zur Seidengewinnung verwendeten Kokons
die Tiere getötet werden müssen, wird die Seidenzucht nur durch die
große Fruchtbarkeit des Schmetterlings ermöglicht. Durch Ausziehen des
klebrigen, dickflüssigen Inhalts der Spinndrüsen kurz vor dem Verpuppen
erzielt man in China und Japan ein sehr festes Material zum Anbringen
der Angel an der seidenen Schnur.
Als wilde Stammform des Seidenspinners hat man den in dem östlichen
Himalajagebiet vorkommenden Bombyx huttoni ansehen wollen,
den der Engländer Hutton wildlebend auf dem wilden weißfrüchtigen
Maulbeerbaum antraf. Jedenfalls muß er dem echten Seidenspinner
sehr nahe verwandt sein, da er sich mit ihm kreuzen läßt, wobei die
Nachkommen einer solchen Kreuzung fruchtbar sind. Ist dieser wilde
Seidenspinner tatsächlich die Stammform des zahmen, so muß früher sein
Vorkommen, das jetzt auf das östliche Himalajagebiet beschränkt ist,
weiter östlich über Yünnan nach Südchina gereicht haben, wo eben der
Wildling durch Zähmung zum Verschwinden gebracht wurde.
Doch ist dieser Spinner durchaus nicht der einzige, der verspinnbare
Seide liefert. So beherbergt Ostasien noch einige andere Spinner, deren
Kokons ebenfalls eine für den Menschen brauchbare Seide erzeugen.
Als zu Beginn der 1850er Jahre unter den Seidenraupenzüchtern
Südfrankreichs die als Pebrine erwähnte verheerende Epidemie ausbrach,
deren parasitäre Natur Louis Pasteur feststellte, sah man sich, als
sie den Züchtern schwere Verluste beibrachte und ihre ganze Existenz
in Frage stellte, nach andern Spinnern um, die sich in Europa züchten
ließen. Schon 1740 hatte der Missionar Pater d’Incarville über einen
südasiatischen Spinner berichtet, der 20 Jahre später von Daubanton als
„Halbmond“ in seinem Atlas abgebildet wurde und 1773 von Drury seinen
wissenschaftlichen Namen erhielt. Es war der Ailanthusspinner
(Saturnia cynthia), in Assam Erya genannt, der als Ersatz des
Maulbeerspinners 1856 von Pater Fantoni aus China nach Frankreich
eingeführt wurde. Seine Raupe, die auf dem Götterbaum (Ailanthus
glandulosa) und der Rizinusstaude (Ricinus communis) lebt,
entwickelt sich so rasch, daß in einem Jahre bequem dreimal frische
Kokons erzielt werden können, die eine vorzügliche Seide liefern. Ja,
Sir W. Neid, der Gouverneur von Malta, züchtete in der Zeit vom 2.
Dezember bis zum folgenden November sogar viermal voll[S. 539]kommen gesunde
Falter. Durch die künstlichen Zuchtversuche ist der schöne gelbbraune
Schmetterling in Italien, Südfrankreich, bei Straßburg im Elsaß, wo er
1878 ausgesetzt wurde, bei Frankfurt am Main, im Tessin, bei Trient, in
Istrien, bei Laibach, bei Wien und im östlichen Nordamerika heimisch
geworden. Leider treiben die beiden genannten Futterpflanzen, die sonst
in Deutschland ganz gut gedeihen, zu spät Blätter, um eine Zucht im
großen ohne Treibhaus lohnend erscheinen zu lassen. Daher sahen die
Akklimatisationsvereine sich nach anderen Seidenspinnern um, die mit
einheimischen Pflanzen gefüttert werden können.
Bald wurden aus China und Japan zwei große Falter eingeführt, die in
ihrer Heimat schon längst ihrer vortrefflichen Seide wegen gezüchtet
wurden und allen Wünschen zu entsprechen schienen. Beide lassen sich
bei uns leicht mit Eichenblättern ernähren. Es sind dies erstens der
chinesische Eichenseidenspinner (Saturnia pernyi).
Dieser in seiner Grundfarbe ledergelbe Schmetterling liefert in China
zweimal jährlich Kokons, nämlich im Juni und Oktober. Drei Tage nach
der Paarung, die 40–50 Stunden dauert, werden 150 bis 230 große, braune
Eier gelegt, die nach etwa acht Tagen die anfangs schwarzen, nach der
ersten Häutung aber grünen Raupen liefern. Setzt man ihnen saftiges
Eichenlaub vor und bespritzt man dieses samt den Raupen einige Male
mit Wasser, so gedeihen sie sehr gut und spinnen sich nach 50 Tagen
zwischen den Blättern ihrer Futterpflanze ein. Die im Herbst erzielten
Kokons überwintert man im Keller, damit die Raupen im April nicht
früher auskommen, als frisches Eichenlaub zu ihrer Fütterung vorhanden
ist. In China zieht man diese Raupen im Freien auf Eichengebüsch
unter Aufsicht von Wärtern, die die Vögel zu verscheuchen und die
Raupen von einem kahl gefressenen auf einen belaubten Busch zu setzen
haben. Die großen, braunen Kokons werden zuerst auf Bambushürden über
dem Feuer geröstet, um die darin befindlichen Puppen zu töten, dann
zehn Minuten lang in kochendes Wasser gelegt, dem man einige Hände
voll Buchweizenasche hinzufügt. Dadurch löst sich der das Gespinst
verbindende Klebestoff auf, so daß sich die Seide bequem abhaspeln
läßt. Diese ist fester und billiger als diejenige des Maulbeerspinners
und bringt den Chinesen reichen Ertrag.
Zweitens der japanische Eichenseidenspinner (Saturnia yama
mayu, d. h. Bergkokon). Dieser ist dem chinesischen sehr ähnlich,
jedoch hat der Falter mehr goldgelbe Flügel mit rötlichen Rändern.
Auch[S. 540] die Raupen sind fast gleich, doch haben diejenigen dieser Art
einen grünen, die der andern dagegen einen braunen Kopf. Bis 1856 war
die Ausfuhr seiner Eier in Japan mit der Todesstrafe bedroht; doch
gelang es Duchesne de Bellecourt, dem französischen Generalkonsul
und Bevollmächtigten in Tokio, Eier desselben an die Société
d’acclimatisation in Paris zu schicken. Trotz sorgfältigster Pflege
lieferten aber die mit Eichenlaub gefütterten Raupen nur einen einzigen
Kokon. Nun wurde Eugène Simon, der landwirtschaftliche Kommissar der
französischen Republik für China und Japan, beauftragt, Eier dieses
Eichenseidenspinners zu beschaffen, und mit Hilfe seines Freundes, des
holländischen Marinearztes Pompe van Meerdervoort, wurden heimlich
wieder einige Eier nach Europa gebracht. Mit diesen erzielten die
französischen Raupenzüchter guten Nachwuchs und konnten 1863 die
Fachausstellung in Paris mit Kokons und gehaspelter Seide beschicken.
Marquis de Riscal züchtete diesen Falter mit Erfolg im Freien, doch
ist er in Europa nirgends heimisch geworden. Die Aufzucht dieser
empfindlichen Raupe ist übrigens auch nicht so lohnend, da aus den
überwinternden Eiern nur eine Brut im Jahre zu erzielen ist. Sie spinnt
je einen großen, hellgrünen Kokon.
Auch der in China und Ostindien heimische Atlasspinner
(Saturnia atlas), der größte Schmetterling der Erde, der
25 cm breit und 18 cm hoch wird und rotbraun, mit
wie Atlas glänzenden weißen, schwarz umsäumten Flecken verziert
ist, liefert einen großen Kokon reich an Seide. Seine Raupe ähnelt
derjenigen des Ailanthusspinners, häutet sich aber einmal mehr als die
meisten Spinnerraupen, nämlich fünfmal. Sie wird bei uns am besten
mit Berberitzenlaub gefüttert, doch ist ihre Aufzucht in Europa zu
schwierig, um für die Seidengewinnung irgendwie in Betracht zu kommen.
Wie der Leib dieses riesigen Falters nur etwa 4 cm lang ist,
sind auch Raupe, Gespinst und Puppe verhältnismäßig klein. Die Zucht
der schwerfälligen Raupe, die sich nur bewegt, wenn sie frißt, ist sehr
langweilig. Diese Trägheit hat aber das Gute für sich, daß sie niemals,
wie andere Raupen, von der Futterpflanze herabfällt. Ihre ganze
Entwicklung nimmt bei uns etwa 40 Tage in Anspruch.
Endlich ist in Südchina der Spinner Saturnia pyretorum heimisch,
dessen Raupe sich von den Blättern des Kampfer- und Amberbaums ernährt
und dessen Gespinst zur Herstellung von Angelschnüren gebraucht wird.
Letztere kommen auch nach Japan in den Handel und werden dort unter
dem Namen tegusu seit langer Zeit von den Fischern als[S. 541] sehr dauerhaft
benutzt. Neuerdings ist dieser Spinner durch die Japaner auf Formosa
eingeführt worden, wo die große Häufigkeit der Kampferbäume Gelegenheit
zur Zucht ihrer Raupe gibt. Die Seide wird dadurch künstlich von ihr
gewonnen, daß sie nach der Reife in Essig getaucht wird, worauf man aus
ihrem Körper goldgelbe Fäden von 2 bis 2,5 m Länge zieht.
Auch Nordamerika hat drei Seidenspinner, die für die Seidengewinnung
benutzt werden könnten. Der wichtigste derselben ist die schön
braunrote Saturnia polyphemus mit auffallendem, schwarzgelbem
Augenfleck. Deren prächtig grüne Raupen sind fleischfarbig gestreift
und nach ihrer letzten Häutung mit 48 silber- und 8 goldglänzenden
Flecken geschmückt. Von der Sonne beschienen erscheinen sie wie mit
Diamanten übersät. Ihre schöne starke Seide ist schneeweiß, so daß sie
zu der lichtgrünen von S. yama mayu und der hellbraunen von
S. pernyi einen prächtigen Gegensatz bildet. Etwa gleich groß
ist Saturnia promethea, deren beide Geschlechter auffallend
verschieden gefärbt sind. Das Männchen ist schwärzlich und das Weibchen
rotbraun. Die Raupe ist aber nicht leicht zu züchten, da sie in bezug
auf Futter sehr wählerisch ist. Sie frißt in ihrer Heimat die Blätter
des Benzoe-, Sassafras- und Tulpenbaums, also von Bäumen, die bei
uns nicht überall angepflanzt werden. Bedeutend größer und schöner
ist Saturnia cecropia, die an Schönheit noch den Atlasspinner
übertrifft. Die ebenfalls wunderschöne Raupe ist leicht zu ziehen,
da sie fast jedes Laub annimmt. Sie braucht 7 bis 9 Wochen zu ihrer
Entwicklung und liefert einen recht großen Kokon, dessen Seide
technisch gut verwendbar ist. Ebenfalls hervorragend schön ist die
bedeutend kleinere Saturnia ío aus Nordamerika, die zwar keine
Seide liefert, aber wegen ihrer Schönheit mit Vorliebe gezüchtet wird.
Die auf Eichenzweigen leicht zu ziehenden Raupen sind dicht mit grünen
Härchen überzogen, die beim Anfassen ärger brennen als Nesseln. Sie
häuten sich fünfmal und brauchen 10–15 Wochen zu ihrer Entwicklung.
Außer in Ostasien wird nur noch auf Madagaskar seit alter Zeit eine
Seide gewonnen und zu Geweben verarbeitet. Hier ist der Lieferant der
starken Seide der Spinner Bombyx rhadama, der in manchen Dörfern
in größerer Menge gezogen wird und dessen Gespinst zu den durch ihre
Schönheit ausgezeichneten und sehr dauerhaften Seidenlambas verarbeitet
wird, die nicht nur von den wohlhabenden Eingeborenen als Überwürfe
getragen werden, sondern auch einen Exportartikel von allerdings
beschränkter Bedeutung bilden. Dann stellt[S. 542] auch in einzelnen Teilen
von Nigeria die Bevölkerung aus den Kokons von Anaphe infracta
einen somyan genannten Seidenstoff her. Die davon gewonnene
Rohseide ist braun oder gelblichbraun. Daneben gibt es dort auch eine
rein weiße Seide, die aus den Distrikten Bauchi und Bornu im Innern
nach dem Handelsplatz Ibadan gebracht wird. Man nennt sie Gambari-
oder Haussaseide. Offenbar ist sie ein Fabrikat gleichen Ursprungs mit
der gelblichen Rohseide, nur daß sie von anders behandelten Kokons
hergestellt wird. Die Eingeborenen sammeln die betreffenden Raupen von
den Bäumen, wenn sie gerade im Begriffe sind, sich einzuspinnen. Ein
Londoner Züchter hat Versuche mit der Züchtung dieser Raupe gemacht
und gefunden, daß, wenn man sie im Dunkeln aufzieht, sie stets rein
weiße Kokons statt der braunen hervorbringt. Da nun die Eingeborenen
beim Einsammeln der Raupen zum Zwecke der Gewinnung von Gambariseide
die Gewohnheit haben, die Tiere in ihren dunkeln Hütten aufzubewahren,
erklärt es sich leicht, daß dieses Produkt von rein weißer Farbe ist.
[S. 543]
XXIV. Die Geschichte der
Jagd.
So lange es Menschen gibt, die ihren Hunger nicht völlig an den von
der Natur gebotenen Früchten und anderer Pflanzennahrung stillten,
sondern auch noch zu tierischer Beute, zunächst noch roh, wenn auch
lebendwarm, später gekocht, ihre Zuflucht nahmen, so lange schon hat
es eine Jagd gegeben. Ihre Geschichte schreiben hieße die Geschichte
der menschlichen Kulturentwicklung darstellen. So wissen wir, daß schon
der vorgeschichtliche Eiszeitjäger, dessen ganze Kultur auf die Jagd
abgestellt war, ganz raffinierte Jagdmethoden anwandte und sich nicht
nur mit Wurfspeer und Keule, sondern auch mit Fallgruben, Fallen und
Schlingen sich der tierischen Beute, auf die er zu seinem Unterhalte
angewiesen war, zu bemächtigen suchte. Zudem nahm er wie alle
Primitiven zu Zauberprozeduren der verschiedensten Art seine Zuflucht,
als deren Niederschlag wir die mancherlei Darstellungen von Jagdwild an
den einst von den Mammut- und Renntierjägern der letzten Eiszeit und
frühen Nacheiszeit bewohnten Höhlen anzusehen haben.
In der Folge entwickelte sich die Jagd bei den verschiedenen
Volksstämmen in verschiedener Weise, je nach den vorhandenen Anlagen
und gegebenen Verhältnissen. Über die Jagd der alten Assyrer,
Babylonier und Ägypter geben uns manche bildliche Darstellungen
Kunde, doch sind wir daneben nur auf Vermutungen angewiesen, so daß
wir außerstande sind, auf so spärlichem Beweismaterial fußend, eine
Geschichte ihrer Jagd zu schreiben. Schon reichlicher fließen die
diesbezüglichen Urkunden von den alten Griechen, deren Jagdarten uns um
400 v. Chr. Xenophon, ein Schüler und Freund des Sokrates, in seinem
Buche über die Jagd und wiederum etwa im Jahre 130 v. Chr. Flavius
Arrianus aus Nikomedien in seiner Kynegetika beschrieben. Über das
römische Jagdwesen gibt es so gut wie keine Literatur. Anders verhält
es sich mit der Jagd unserer germanischen Vorfahren[S. 544] seit der Zeit
der Völkerwanderung. Da haben wir zunächst aus Gesetzesbestimmungen,
dann aus eigentlichen Jagdanweisungen ein so überreiches Material von
Tatsachen, daß wir uns hier mit einer kurzen Übersicht begnügen müssen.
Und zwar soll im folgenden als am nächsten liegend vorzugsweise die
Geschichte der Jagd unserer Vorfahren, so weit sie urkundlich bezeugt
ist, behandelt werden.

Bild 55. Ägyptischer Jäger mit zwei zusammengekoppelten
Jagdhunden. Auf den Schultern trägt er eine erlegte Oryxantilope. (Nach
Wilkinson.)
Tafel 61.

Der Assyrerkönig Assurbanipal (668–626 v. Chr.) auf reich
angeschirrtem Streitpferd auf der Löwenjagd.
(Nach einer Photographie von Mansell & Cie. in London.)
⇒
GRÖSSERES BILD
Tafel 62.

Berittene Jäger des Khans von Chiwa in Begleitung von
Jagdhunden.
⇒
GRÖSSERES BILD
Die ältesten Bewohner Deutschlands waren Kelten, die auf Einzelhöfen
lebten, Landwirtschaft und Viehzucht trieben und sich einer
verhältnismäßig hohen Kultur erfreuten. Das Andenken an ihr einstiges
Vorhandensein ist besonders in Deutschland westlich von der Weser
und südlich vom Main in zahlreichen Ortsnamen erhalten geblieben.
Sie wurden nach und nach von den von Osten und Norden heranrückenden
Germanen zurückgedrängt und unterjocht. Diese nahmen die alten
Keltenhöfe in Besitz, machten die früheren Bewohner zu Knechten
und führten nun als Herren die Wirtschaft auf den Einzelhöfen
weiter. Dazu wurden neue gebaut, das umgebende Land aber wurde zu
gemeinschaftlichem Eigentum an die verschiedenen Sippen verteilt und
bildete die Allmende, d. h. das Gemeindeland. Die Gesamtheit der freien
Hofbesitzer eines Gaues tat sich zu einer Hundertschaft — so genannt,
weil wenigstens hundert Familien umfassend —[S. 545] zusammen und bildeten
eine Markgenossenschaft, welche die gemeinschaftlichen Angelegenheiten
beriet. An ihre Stelle stellte sich als der tüchtigste der Markgenossen
ein Graf, dessen Amt nicht erblich war, zum Unterschied vom Königtum,
das der Gesamtheit der das Volk bildenden Markgenossenschaften vorstand
und dessen Amt sich in derselben Familie forterbte.
Da der Viehstand vorerst noch bescheiden war und nur ausnahmsweise zum
Schlachten diente, so war damals die Jagd in den wildreichen großen
Waldgebieten, wie in der Vorzeit, eine wichtige Nahrungsquelle zur
Beschaffung von Fleisch als Zukost zu der von den Frauen und Hörigen
gewonnenen Pflanzenspeise in Form von hauptsächlich Brot oder Brei. Ihr
wie dem Kriege lag der Freie ob, dem jede andere Arbeit als schimpflich
galt. Die Jagd galt als beste Vorschule für den Krieg, wurde aber nicht
weidmännisch in unserem Sinne betrieben. Man jagte ohne irgend welche
Schonzeit das ganze Jahr hindurch und berücksichtigte weder Alter
noch Geschlecht. Man folgte dem weidwund geschossenen Wild nicht wie
heute, um seine Qualen zu verkürzen, sondern weil man den Braten nicht
verlieren wollte. Zur Jagd benutzte man nach den Bestimmungen der vom
5. bis 8. Jahrhundert n. Chr. schriftlich fixierten Volksrechte der
deutschen Stämme verschiedene Jagdhunde, deren freventliche
Tötung mit 3–15 Solidi gebüßt wurde. Nun war damals ein Solidus ein
Goldschilling im Metallwert von 12 Mark, der aber tatsächlich einen
viel höheren Wert repräsentierte, da dafür eine erwachsene Kuh zu
kaufen war. Demnach waren die Bußen, die die Volksrechte verfügten,
ganz anständige Strafen. Das alamannische Recht bestrafte die Tötung
oder den Diebstahl eines Leithundes doppelt so hoch als diejenige eines
Pferdes, nämlich mit 12 Solidi, während letztere nur 6 Solidi galt.
Eine besondere Art der Strafe hatten die Burgunder, die dem Diebe
freistellten, sich mit 6 Solidi auszulösen oder dem gestohlenen Hunde
in Gegenwart des ganzen Volkes einen Kuß auf den Hintern zu geben.
Vom Jagdhund der germanischen Stämme, dem canis sagax oder
segutius auch sëusis oder sëusis, unterschieden
die Gesetze der Bajuvaren drei verschiedene Arten, nämlich außer
dem freilaufenden Triebhund die beiden an der Leine die Spur des
Wildes verfolgenden Hunde, den Spürhund und den Leithund. Letztere
standen bei Totschlag oder Diebstahl mit je 6 Solidi Buße doppelt so
hoch im Wert als ersterer, für dessen Verlust nur 3 Solidi Buße zu
entrichten waren.[S. 546] Mit dem Leithund, der vornehmlich als canis
segutius bezeichnet ist, wurde die Beute aufgespürt und verfolgt.
Worin sich der Spürhund der alten Bayern von diesem Leithund der
Alamannen, salischen Franken und Burgunder unterschied, ist nicht
klar; vielleicht war er eine als Schweißhund dressierte Unterart des
segutius. Wenigstens hatte man im späteren Mittelalter eigene
Hunde zur Verfolgung des mit der Armbrust angeschossenen Wildes, die
man als Bracken bezeichnete. Außerdem besaß man einen starken Schlag
von Hunden, die man auf Wildstiere, Bären und Wildsauen hetzte, für
welche in den Volksrechten weder eine lateinische noch eine deutsche
Bezeichnung vorkommt, sondern nur eine Beschreibung ihres Gebrauches.
Später nannte man sie lateinisch molossus, deutsch rudo,
woraus Rüde wurde. Daneben wurde eine als canis veltris oder
veltrus (im Deutschen später wint, d. h. Windspiel genannt)
bezeichnete leichte Hundeart gehalten, die den Hasen nicht nur
verfolgte, sondern ihn auch vermöge ihrer Schnelligkeit ergriff. Das
ganze Mittelalter hindurch spielten diese als Jagdhunde eine wichtige
Rolle und werden in vielen Weistümern erwähnt.
Sehr interessant ist die Erwähnung eines Hapuch-, d. h. Habichtshundes
im Volksrecht der Bayern, der uns als canis acceptoritius
im Gesetze der Friesen begegnet. Über dessen Gebrauch wird nichts
mitgeteilt; doch dürfen wir zweifellos annehmen, daß er zur Aufsuchung
des Federwildes diente, das damals nicht geschossen, sondern gebeizt,
d. h. durch gezähmte Falken und Habichte gefangen wurde. Noch in den
Weistümern des Mittelalters wird öfter der „Vogelhund“ genannt, und
zwar stets in Gesellschaft des „Habk“ (d. h. Habichts). Zur Verfolgung
kleineren Wildes diente bei den Burgundern der schon von den Römern
gebrauchte petrunculus, der „Steinbracke“, der seinen Namen
von den harten Fußsohlen ableiten soll, vermöge welcher er anhaltend
auf felsigem Terrain zu jagen imstande war. Bei den Friesen wird
er braco parvus oder Barmbracke genannt. Im Volksrecht der
Bajuvaren ist noch vom „unter der Erde jagenden“ Biberhund die Rede,
dessen freventliches Töten mit 16 Solidi gebüßt wurde, während die
ebendort erwähnten Hirtenhunde, die es mit dem damals noch sehr
häufigen Wolf aufnahmen und ihm das geraubte Vieh entrissen, auch, wenn
ein Geschrei wegen eines Wolfes erhoben wurde, weithin zu Hilfe eilten,
und die sehr geschätzten Hofhunde (Hofwart der alten Bayern) nur mit 3
Solidi bezahlt werden mußten. Diese Biberhunde dienten zur Erbeutung
des damals noch überall in Mitteldeutschland[S. 547] häufigen Bibers, waren
größer als unsere Dachshunde und gingen gern ins Wasser. Dachshunde,
die ihren Namen vom früher von ihnen mit Vorliebe gejagten Dachse
haben, während sie heute bei Abnahme jenes häufiger gegen den Fuchs
gebraucht werden, kamen erst im späteren Mittelalter auf.
Diejenigen Hunde des Frankenkönigs, die nicht am Hofe verblieben,
wurden zum Unterhalt in die Provinzen verteilt, wie es schon an den
Höfen der morgenländischen Fürsten des Altertums gehalten wurde. Den
darübergesetzten Beamten befahl Karl der Große genaue Aufsicht, daß sie
von den betreffenden Untertanen richtig gehalten und das nötige Futter
erhielten. Wahrscheinlich waren die königlichen Hunde auf der rechten
Seite gezeichnet; wenigstens scheint ein Befehl Karls des Großen vom
Jahre 803, daß diejenigen Leute, die auf der rechten Seite geschorene
Hunde haben, mit denselben vor dem Könige erscheinen sollten, nur
so erklärt werden zu können, daß dies zu tun niemandem außer dem
Könige gestattet war. Die Hunde hatten schon damals eigene Namen, mit
denen man sie rief. So spricht Hrabanus Maurus von einem Hunde Fax,
und anderswo ist von einer Hündin Zoba die Rede. Übrigens waren die
Jäger und Förster der Frankenkönige Leibeigene, von denen es außer
dem obersten Falkner (falconarius principalis) in Neustrien,
Austrien, Burgund und Aquitanien je einen Oberjägermeister (venator
principalis) gab. Diese hatten die nötige Zahl von Ministerialen,
venatores und falconarios, unter sich, welche
abwechselnd, teils bei Hofe, teils in den villis beschäftigt
wurden. Der in der karolingischen Zeit lebende Bischof Hinkmar nennt
in seinen Briefen über die Ordnung des karolingischen Hofes dreierlei
Arten von Jägern: bersarii (vom spätlateinischen bersare,
d. h. mit Pfeil und Bogen schießen = birsen der mittelalterlichen
Urkunden, woraus schließlich pürschen wurde. Erst seit etwa hundert
Jahren hat sich diese ursprüngliche Bedeutung des Wortes birschen dahin
verändert, daß man darunter ein Anschleichen an das Wild verstand),
Waldjäger mit Gebrauchshunden, veltrarii Feldjäger mit
Windspielen und beverarii, d. h. Biberjäger mit den Biberhunden
für die Wasserjagd auf Biber.
Außer Hunden waren von alters her auch gezähmte Falken,
Habichte und Sperber sehr geschätzte Jagdgenossen der
Deutschen, deren Verlust mit 1–45 Solidi gebüßt wurde. Auch hier hat
das Recht der salischen Franken, die ihren Namen vom Flusse Isala
oder Yssel haben und sich über das nördliche und mittlere Gallien
aus[S. 548]breiteten, das damals in höherer Kultur stand als die deutschen
Gaue, die höchsten Strafsätze. Vielleicht hatte das Geld dort
geringeren Wert. Die Burgunder leisteten sich auch bei diesen Strafen
ein besonderes Vergnügen, indem der Dieb eines Jagdhabichts 2 Solidi
Strafe und 6 Solidi Entschädigung an den Besitzer bezahlen oder den
Habicht 6 Unzen Fleisch von seinen eigenen Hoden fressen lassen mußte.
In den Strafbestimmungen der Volksrechte der Deutschen führen die
größeren Beizvögel den Namen accipiter oder acceptor
(meist wohl Habicht), die kleineren dagegen sparawarii (also
Sperber). Deutsche Benennungen finden sich nur in den Gesetzen der
Bayern, die sogar viererlei Jagdraubvögel unterscheiden, nämlich 1.
als vornehmsten, den Kranichar (chranohari), einen auf Kraniche
abgerichteten großen Raubvogel, wenn auch keinen Adler, da diese
Vogelgattung nicht den für die Beize dieser Vögel erforderlichen
raschen Flug besitzt. Damals müssen die bayerischen Moore und Sümpfe
reich an Kranichen gewesen sein, die nach der lex salica de furtis
avium damals auch in den Höfen vornehmer Leute zahm gehalten
wurden. Es waren dies vermutlich Wanderfalken. Solche aus Island kamen
erst im späteren Mittelalter nach Deutschland. Wandte sich doch im
8. Jahrhundert König Ethelberth von England an den heiligen Winfrid
(Bonifazius) um zwei Falken, welche geschickt und kühn genug wären, um
Kraniche zu ergreifen und zu Boden zu werfen, wobei er ausdrücklich
seine Anerkennung der trefflichen Naturanlagen der in Deutschland
vorkommenden Raubvögel aussprach.
Die im Mittelalter so gern geübte Reiherbeize fand wahrscheinlich
erst dann recht Eingang bei den Deutschen, als der edlere Kranich
durch die leidenschaftliche Verfolgung mit Beizvögeln schon seltener
geworden war. 2. den Gänsehabicht, einen hapuch, der Wildgänse,
3. einen solchen, der Wildenten fing, also einen Entenhabicht, und 4.
einen Sperber für Rebhühner und kleinere Vögel. Die Entwendung eines
dieser Vögel wurde mit dem neunfachen Wertbetrage wie andere Diebstähle
gesühnt. Dabei konnte eine sehr schwere Strafe herauskommen. Nimmt
man den Wertsatz des Volksrechtes der ripuarischen Franken für den
commorsus gruarius in Anwendung auf den chranohari, so
ergibt sich eine Geldbuße von 54 Solidi, was an Geldwert 54 Kühen
entsprach. Im Falle der Tötung war ein gleicher Vogel als Ersatz zu
geben und außerdem noch zur Sühne für einen Kranichar 6 Solidi, für
einen Gänsehabicht 3 Solidi, für einen Entenhabicht und einen Sperber
je 1 Solidus. Dabei verstand man unter hapuch außer[S. 549] dem
Hühnerhabicht auch die größeren Arten der einheimischen Edelfalken,
welche in späterer Zeit als Beizvögel erwähnt werden, nämlich den Würg-
und Wanderfalken, und unter sparawarius nicht nur den Sperber
oder Finkenhabicht, sondern auch den Baum- oder Lerchenfalken.
Im Volksrecht der Alamannen werden nur zweierlei Beizvögel genannt,
einer auf Kraniche und einer auf Gänse. Das Eigentum an ersterem war
durch eine Strafe von 6, an letzterem von 3 Solidi geschützt. Bei den
Langobarden wurde im Falle der Tötung eines Beizvogels eine Sühne von
6 Solidi bezahlt, im Falle des Diebstahls aber der achtfache Betrag
an den Beschädigten erlegt. Wer nun bei diesem Volke aus dem Gehege
des Königs solche Vögel vom Neste nahm, mußte 12 Solidi Buße bezahlen.
Geschah dies im Privatwalde eines andern von einem gezeichneten
Baume, so betrug die Sühne 6 Solidi. Hatte der Baum kein Zeichen, so
konnte man die Vögel ungestraft aus dem Neste nehmen. Wenn aber der
Waldeigentümer dazu kam, durfte er sich dieselben aneignen.
Falls Beizvögel an Zahlungs Statt anzunehmen waren, so betrug die Taxe
bei den ripuarischen Franken für einen ungezähmten 3 Solidi, für einen
auf Kraniche abgerichteten 6 Solidi, für einen acceptor mutatus
12 Solidi. Wo solche Taxen nicht bestanden, konnte der Zahlende den
Wert beschwören. Weil aber der Wert solcher Vögel zu hoch beschworen
wurde, verbot Kaiser Ludwig der Fromme deren Hingabe an Zahlungs Statt.
Die sehr hohe Bewertung dieser Vögel läßt die große Vorliebe für die
Beize bei den alten Deutschen ahnen. Übrigens stellte das Gesetz der
Bayern auch andere gezähmte Waldvögel, die auf den Höfen der Freien
gehalten wurden, unter seinen Schutz. Die Entwendung solcher Vögel,
„die durch Kunst und menschlichen Fleiß aus wilden zahm und zutraulich
gemacht werden, so daß sie auf den Höfen der Adeligen herumfliegen
und singen“, wurde mit 1 Solidus gebüßt, außerdem mußte der Übeltäter
beschwören, in Zukunft keinen Vogel mehr zu stehlen.
Außerdem sprechen die Volksrechte der alten Deutschen von gezähmtem
Rotwild — vornehmlich Hirschen — und gezähmtem Schwarzwild
— speziell Wisent und Ur — die zur Jagd gebraucht wurden. In welcher
Weise dies geschah, darüber wird nichts gesagt, doch scheint es sich um
Schießhirsche oder Schießbüffel gehandelt zu haben, d. h. solchen, die
sich vom Jäger leiten ließen, der hinter ihnen gedeckt sich unter dem
Winde dem gesuchten Wild so weit näherte,[S. 550] daß er mit Erfolg den Pfeil
auf dasselbe entsenden konnte (sagittare). Man scheint damals
mit Rotwild nicht nur an anderes Rotwild, sondern auch an Schwarzwild
herangeschlichen zu sein. Dann mußte das gezähmte männliche Wild in
der Brunst auch schreien, und zwar sowohl die Hirsche als auch die
Büffel. Vermutlich begab sich der Jäger mit seinem gezähmten Tier
vor Tagesanbruch auf einen der ihm bekannten Brunstplätze, um sein
Tier schreien zu lassen oder abzuwarten, bis die freien Tiere schrien
und sein Tier ihnen antwortete. Vielleicht waren die zahmen Tiere in
kleinen Gehegen gehalten und dienten dem Jäger dazu, wilde Verwandte
herbeizulocken, damit er sie dann, wenn sie nahe genug herangekommen
waren, abschießen konnte. Der Römer Columella erwähnt in seinem zweiten
Buche über Landwirtschaft, daß in Gallien zahmes Wild dazu diene,
das frischgefangene Wild, das in einen der Riesenparks jenes Landes
gesetzt war, an die Futterstellen zu gewöhnen. Möglicherweise dienten
solche zahme Tiere auch als solche Schlepper, um ihre Verwandten an
Futterstellen zu locken, wo sie abgeschossen zu werden vermochten.
Diese gezähmten Tiere wurden mit einem treudis oder
triutis genannten Zeichen versehen, wodurch sie Frieden
erlangten, so daß sie nicht erlegt werden durften. Dabei stieg ihr Wert
in dem Maße, als sie sich bei der Jagd bewährt hatten. Dementsprechend
richtete sich auch der Betrag der Sühne im Falle der Entwendung oder
Tötung. Wer bei den salischen und ripuarischen Franken einen auf der
Jagd erprobten zahmen Hirsch entwendete oder tötete, der mußte zur
Sühne 45 Solidi bezahlen. War der Hirsch noch nicht auf der Jagd
gebraucht worden, so betrug die Sühne bei den salischen Franken
35, bei den ripuarischen dagegen nur 30 Solidi. Im alamannischen
und langobardischem Volksrecht wurde bei Entwendung eines zahmen
Hirsches der neun- bezw. achtfache Betrag, d. h. die gebräuchliche
Diebstahlsstrafe gefordert. Dabei galt eine zahme Hirschkuh nur als
halb so wertvoll wie ein gezähmter Hirsch. Doppelt war die Strafe, wenn
der getötete Hirsch zu seiner Zeit brunstete gegenüber einem solchen,
der dies nicht tat.
Für den Jäger damaliger Zeit war ein gutes Reitpferd ein
notwendiges Erfordernis, um den Hunden bei der Hetzjagd auf Rot- und
Schwarzwild und auf Hasen zu folgen und zur Erlegung oder Abnahme des
betreffenden Wildes rechtzeitig an Ort und Stelle zu sein, oder die
das Federwild verfolgenden Beizvögel im Auge zu behalten. Zum Reiten
dienten, wie es scheint, vorwiegend Hengste, ca[S. 551]balli genannt,
daher caballicare reiten. Außerdem hatte man aber auch eigene
Zuchthengste und solche Hengste, die zum Ziehen von Wagen benutzt
wurden. Auch ist in den Volksrechten von Wallachen die Rede (caballi
spadati), welche geringeren Wert hatten. Die Stuten hießen
jumenta, weil sie außer zur Nachzucht vorzugsweise als Zugtiere
benutzt wurden. Bei den Alamannen konnte in Fällen von Diebstahl
der Wert eines Zuchthengstes bis zu 12 Solidi beschworen werden,
und die Strafe betrug das Neunfache des Wertes; ebensohoch war der
Wert eines Pferdes, das man marach hieß. Der Wert eines gewöhnlichen
caballus und einer säugenden Stute dagegen betrug nur 6 Solidi,
einer gewöhnlichen Stute, die noch nicht trächtig war, 3 Solidi, wie
für einen Zuchtstier, während eine Kuh bloß bis zu 1 Solidus gewertet
wurde.
Man war in jener Zeit sehr heikel in bezug auf seine Reitpferde. So
mußte bei den Franken einer, der ein fremdes Roß eigenmächtig ritt, zur
Sühne an den Eigentümer 30 Solidi Strafe bezahlen, während die Strafe
für die Entwendung des wertvollsten Pferdes eines Privatmannes nur die
Hälfte mehr, nämlich 45 Solidi, betrug.
Abgesehen von den für die Jagd reservierten Forsten hielt der König
besonders in Niederungen, Brüchen und Sümpfen von einem Hag von Bohlen
eingefriedete Tierreservationen, deutsch Brühl, lateinisch bersa
genannt. Ihnen standen Leibeigene vor, die bersarii genannt
wurden und bei der Jagd Hilfe leisten mußten. Solche Brühle konnten
einen großen Umfang haben. In einem solchen bei Frankfurt am Main
stürzte Ludwig der Deutsche 864 bei einer Hirschhatz mit dem Pferde und
beschädigte sich eine Hüfte erheblich.
Der Franke Angilbert, Abt von St. Riquier, der mit Zustimmung Karls
des Großen, der ja selbst ein uneheliches Kind gewesen war, mit dessen
Tochter Berta in freier Liebe lebte und zwei Knaben von ihr hatte,
beschreibt uns in einem höfischen Gesang nach der Art Vergils eine
Parkjagd Karls in dem großen von Mauern umgrenzten Brühl bei Aachen.
Dieser Tierpark war vom Flüßchen Wurm durchflossen, an dessen Ufer
sich grüne Wiesen ausbreiteten, auf denen sich Sumpf- und Wasservögel
tummelten. An andern Stellen waren die Ufer steil. Auch zwischen den
Gehölzen, in denen „Wild von jeglicher Art“ stand, erstreckten sich
Wiesenflächen, auf denen König Karl zu lagern liebte. Mit ihm brachen
morgens in aller Frühe auch die Königin und die Töchter, goldene
Reifen im Haar und in schöner Gewandung, auf prächtigen Pferden auf.
Im Tale des Parkes wurde[S. 552] von den Jägern ein Keiler hochgemacht und
von kräftigen Hunden gehetzt. Die Reiter folgten, bis der Keiler
gedeckt und von Karl abgefangen war; währenddem schauten die Damen vom
Berge aus zu. In der Zwischenzeit hatte ein Teil der Jägerei die Jagd
auf zusammengetriebene Rudel von Sauen vorbereitet. Zu diesem Zwecke
war ein großes Netz ausgespannt worden, gegen welches die Wildsauen
getrieben wurden, um dort von Karl und seinen Begleitern mit dem
Wurfspeer abgestochen zu werden. Nach diesem Massenmord wendete sich
Karl langsam den Zelten zu, die von der Dienerschaft am frischen Quell,
dicht am Gehölz im Schatten hoher Buchen aufgeschlagen worden waren.
Hier erwarteten ihn die Damen, die dann mit den Jägern an vor den
Zelten aufgestellten Tischen das schmackhafte Mahl einnahmen. Mit dem
Eintritt der Nacht begab sich die Gesellschaft in den Zelten zur Ruhe,
um am folgenden Tage zu neuem Weidwerk gestärkt aufzuwachen.
Wie in der Urzeit bedingte die Unvollkommenheit der Schußwaffen noch
im frühen Mittelalter die weitgehende Verwendung von mechanischen
Fangvorrichtungen zur Erbeutung des Wildes. So wurden an den
Wechseln desselben Fallgruben, foveae oder fossae,
errichtet, in Form großer viereckiger Gruben, die unten weiter waren
als oben und mit Zweigen, Laub und Erde bedeckt und unsichtbar
gemacht waren, so daß jedes Tier, das die trügerische Decke betrat,
hinunterstürzen mußte und leicht erbeutet werden konnte.
Schon Cäsar erzählt in seinem Buche über den gallischen Krieg, daß
die Germanen häufig den Ur in solchen Fallgruben fingen. Auch Wisent,
Hirsch, Damhirsch, Reh und Bär, wie der Elch, der nach einer Urkunde
König Ottos I. vom Jahre 943 noch in den Niederlanden häufig
war, wurden mit Vorliebe auf solche Weise gefangen, oder dadurch,
daß man ihnen Netze stellte, in denen sie sich verfingen. Eine
andere Art der Fangjagd war das Legen von Fallen (taliolae)
und Fußschlingen (pedicae) zum Festhalten des Wildes, dann
das Aufhängen von Halsschlingen (laquei) an den Wechseln.
Außerdem werden in den Volksrechten noch Selbstgeschosse in Gestalt
von gespannten Bögen (arcus), die bei Berührung einer Schnur
selbsttätig einen starken Pfeil (sagitta) entsandten, der das
Wild — besonders das Raubwild, wie Wölfe und Bären — erschoß. Die
Gesetze damaliger Zeit bestimmen, daß das Anlegen solcher gefährlicher
Fangapparate den Nachbarn mitgeteilt werden müsse, um möglichst
etwaiges Unglück zu verhüten. Dabei mußten Schutzvorrichtungen für
Menschen angebracht[S. 553] werden. Unterblieb dies und ereignete sich
eine Tötung oder Beschädigung, so mußte je nach Beschaffenheit der
betreffenden Person das volle Wehrgeld derselben wie bei einer
absichtlichen Verletzung beziehungsweisen Tötung bezahlt werden. Wenn
aber ein Fremder Schaden erlitt oder getötet wurde, war der Jäger nur
ein Drittel der gesetzlichen Sühne schuldig.
Außer Wurfspieß dienten als Fernwaffen vor allem Pfeil und Bogen. Erst
im späteren Mittelalter, vom 11. Jahrhundert an, kam die Armbrust auf
und verdrängte mehr und mehr letztere. Als unerwünschter Räuber und
Wildschädling wurde besonders der Wolf verfolgt, ihm Fußangeln und
vergiftete Köder gelegt. Unter Karl dem Großen war die systematische
Wolfsjagd eine Aufgabe der Landespolizei. Jeder Unterbeamte des Grafen
sollte in seinem Amtsbezirke zwei Wolfsjäger haben, die vom Heerbann
befreit waren und die öffentliche Gerichtsversammlung des Grafen nur
dann zu besuchen brauchten, wenn Anklagen gegen sie erhoben wurden.
Jeder Gerichtseingesessene war ihnen eine Abgabe an Getreide schuldig.
Auch das kleine Weidwerk des Vogelfangs wurde mit allerlei Schlingen
und Fallen geübt.
Für alle Freien bildete die Jagd eine Lieblingsbeschäftigung, so daß
sie oft andere wichtige Geschäfte hintan setzten. So erließ Karl der
Große 789 eine Verordnung, wonach die Grafen an den Gerichtstagen nicht
auf die Jagd gehen sollten. Von den Fürsten erfahren wir, daß sie fast
ausnahmslos mit Leidenschaft die Jagd liebten. König Guntram, der
Enkel des Gründers des Frankenreichs, Chlodwigs, ließ nach dem Bericht
Gregors von Tours einen seiner vornehmsten Hofbeamten, den Kämmerer
Chundo, wegen unberechtigter Erlegung eines Urs im Vogesenwald, welche
Handlung nicht einmal unzweifelhaft erwiesen war, erbarmungslos
steinigen. Ein anderer Enkel Chlodwigs, Theodebert, fand seinen Tod
im Kampfe mit einem gewaltigen Wildstier durch einen von diesem
abgeschlagenen Baumast, der an des Königs Kopf heftig anschlug. Von
König Dagobert I. wird gesagt, daß er durch beständige Übungen
mit den Waffen und in der Jagd eine unvergleichliche Gewandtheit und
Rüstigkeit erlangt hatte. Ebenso gewandt war Karl der Große, der sich
noch im hohen Alter gern mit der Jagd befaßte. Er erließ mehrmals
scharfe Verordnungen über den Jagdschutz in den königlichen Forsten;
denn kraft des Eigentumsrechts hatte er wie jeder andere Eigentümer
eines geschlossenen Grundbesitzes das ausschließliche Jagdrecht auf
seinen Landgütern.
[S. 554]
Das Wort forestum oder forestis, woraus das deutsche
Forst und das französische forêt wurde, bedeutet in den
lateinischen Urkunden stets den Sonderwald, im Gegensatz zum
Markgenossenschafts- und Allmendewald. Es wird im Deutschen mit
Bannwald bezeichnet. Der forestarius (woraus Förster entstand)
der karolingischen Zeit war ein höriger Jagdbediensteter, denn eine
Forstwirtschaft in unserem Sinne gab es damals noch nicht. Dürres und
gefallenes Holz konnte jedermann auch im Bannwald holen, aber ohne
Erlaubnis keine Bäume darin fällen und seine Schweine nicht ungefragt
darin auf die Eichelmast treiben. Wer die Erlaubnis zu letzterem
erhielt, mußte den Zehnten als Entschädigung für die Mastnutzung
bezahlen.
Der oberste Verwaltungsbeamte eines königlichen Landgutes (judex
villae, d. h. Hofrichter) hatte auch den Wald und das darin
befindliche Wild zu überwachen, für Jagdhunde und Beizvögel für den
königlichen Dienst zu sorgen, die Umzäunungen der eingeparkten Orte in
gutem Stande zu halten, die Wölfe vertilgen zu lassen und sollte eigene
Ministerialen zur Anfertigung von Netzen für Jagd- und Vogelfang, wie
auch für den stets dabei verstandenen Fischfang halten. Hatte jemand
aus dem Volke einen Wilddiebstahl in den königlichen Forsten begangen,
so mußte er unnachsichtlich die gesetzliche Strafe von 60 Solidi —
eine sehr harte Strafe — bezahlen. Niemand sollte beim Huldigungseide,
den damals das ganze Volk zu leisten hatte, einen Wilddiebstahl
verhehlen.
Zur Zeit des Frankenreichs erhielten auch die Kirchen von den Königen
und Fürsten, ebenso reichen Privaten, die sich mit dem Himmel
gutstellen wollten und ein böses Gewissen wegen Verbrechen und
Gewalttat der verschiedensten Art hatten, mit den geschenkten Gütern
und Waldungen auch das Recht darin zu jagen zu alleinigem Eigentum.
Die Geistlichen sollten aber wegen ihres kirchlichen Amtes nicht
selbst jagen, sondern ihr Jagdrecht durch ihre Ministerialen ausüben
lassen. Doch hielten sie sich vielfach nicht an diese Vorschrift und
gingen selbst zu Pferd zur Jagd. So haben die Könige je und je dagegen
einschreiten müssen. Im Jahre 759 erließ Karl der Große das Gebot,
wonach sich die Diener Gottes alles Herumschweifens mit Hunden, auch
Sperbern und Falken, enthalten sollten. 789 ward das Gebot erneuert:
Bischöfe, Äbte und Äbtissinnen sollten weder Kuppeln Hunde noch
Jagdfalken oder Habichte halten. Karl überließ zwar 774 Geistlichen
eines Klosters einen Wald mit der Vergünstigung, darin Hirsche und
Rehe zu jagen, aber nur deshalb, damit sie vom Leder dieser Tiere
die zum[S. 555] Gottesdienst gehörenden Bücher und mit dem Fleische die
Körper der kranken Brüder stärken und herstellen könnten. Auf die
nämliche Art erlaubte er 789 einem andern Kloster, die Mönche dürften
in ihren eigenen Waldungen jagen, um Leder zu Büchereinbänden und
Handschuhen zu gewinnen. Man sieht daraus, daß Karl den Geistlichen
teilweise nachgeben mußte, die ihrem kirchlichen Amte die Jagd als
nationalen Sport nicht opfern wollten. Er überließ auch wirklich dem
Stifte Osnabrück einen Wald ohne alle Einschränkung der Jagd auf
wilde Schweine, Hirsche, Vögel, Fische und was sonst zum Bannforste
gehörte. Übrigens benutzten die Beamten oder Meier der Klöster, z. B.
des Klosters St. Gallen, wie uns der jüngere Ekkehard berichtet, den
Umstand, daß die Mönche selbst nicht jagen durften, und versicherten
ihren Herren, daß die Jagd ihnen als Männern gehöre. Später wurde den
Geistlichen die Jagd wenigstens zu gewissen Zeiten erlaubt. So überließ
König Arnulf 890 dem Erzbischof Dietmar von Salzburg die Jagd auf Bären
und Schweine drei Wochen vor Herbstnachtgleiche bis zum Feste des
heiligen Martin (11. Nov.).
Nach dem römischen Schriftsteller Arrian, der in der Mitte des 2.
Jahrhunderts starb, hatten schon die keltischen Jäger, die mit
Vorliebe Hetzjagden auf Hirsche und Hasen abhielten, in Nachahmung
der römischen, ihre geselligen Vereine, die unter dem Schutze einer
weiblichen Gottheit standen, welche er, da er griechisch schrieb, mit
dem Namen Artemis bezeichnet, und es bestand der löbliche Gebrauch,
dieser Artemis zu Ehren alljährlich ein Liebesmahl zu feiern. Die
Gelder dazu wurden im Laufe des Jahres gesammelt, und zwar in Form
einer Spende, welche die Jäger in die Klubkasse zu geben hatten. Die
Spende belief sich für einen erlegten Hasen auf zwei Obolen, für einen
Fuchs auf eine Drachme, für ein Reh aber auf vier Drachmen. Je nach
dem Kassenstand wurde dann am Jahresfest eine Ziege, ein Schaf oder
ein Rind gekauft und der Göttin der Jagd geopfert, d. h. zu Ehren
derselben von den Mitgliedern verschmaust, wobei auch die Hunde ihr
Teil erhielten.
Etwa 400 Jahre nach Arrian treffen wir anscheinend ähnliche Zustände.
So läßt der Bischof Gregor von Tours einen Diakonus Vulfelaich von
einer Klostergründung erzählen, die sich im Jahre 585 zugetragen
hatte. Vulfelaich hatte bei Trier ein Bild der römischen Jagdgöttin
Diana gefunden, „das das abergläubische Volk abgöttisch verehrte“. Nun
kam dieser sonderbare Heilige auf die verrückte Idee, sich bei jenem
Heiligenbilde als Säulenheiliger zu produzieren und auch[S. 556] im Winter
auszuhalten, obschon ihm die Zehen erfroren. Wenn er nun von Ferne
einen Menschen zu Gesicht bekam, fing er an zu predigen: „Es sei nichts
mit der Diana, nichts mit den Bildern, nichts mit dem Götzendienst,
unwürdig seien jene Lieder, die sie beim Weine und den schwelgerischen
Gelagen sängen. Würdig sei es allein, dem allmächtigen Gotte, der
Himmel und Erde erschaffen habe, Opfer des Dankes zu bringen.“ Als
Vulfelaich sich einen Anhang erworben hatte, stieg er von seiner
Säule und veranlaßte die Menge, die Bildsäule der Diana mit Stricken
umzuwerfen und mit Hämmern in kleine Stücke zu zerschlagen.
Über die jagdlichen Verhältnisse des Mittelalters geben uns wiederum
die verschiedenen Rechtsbücher jener Zeit Kunde, von denen die
berühmtesten das um das Jahr 1230 aufgezeichnete Sachsenrecht,
der „Sachsenspiegel“, und der bald nachher, um 1276, verfaßte
„Schwabenspiegel“ sind. Vom 10. bis zum 13. Jahrhundert dehnten
sich die Bannforste immer mehr aus und die Jagd in ihnen war ein
Reservatrecht dessen, dem der Wildbann gehörte. Nicht nur der Kaiser,
sondern auch die Grafen hatten den Königsbann, der sich auf die hohe
Jagd bezog, während nur die Jagd auf Raubwild, zu dem auch der Bär
gehörte, freigegeben war. So wurde durch den Wildbann das alte Recht
gebrochen, wonach die Jagd ein Zubehör auf Grund und Boden war. Schon
im 9. Jahrhundert schenkten die Könige an Klöster Liegenschaften,
ohne das Recht der Jagd. Die Gemeinfreiheit schwand immer mehr dahin.
Diesen Vorgang beschleunigte ein grausames Schuldrecht durch die immer
mächtiger werdenden Grafen. Der wirtschaftliche Kampf wurde noch
erschwert durch die gewaltsame Art, wie der Heerbann zusammengebracht
wurde. Um nun der Willkür der Grafen zu entgehen, stellten sich die
meisten der freien Markgenossen unter den Schutz des Königs oder der
Kirche. Nun konnten sie, da der Heeresdienst nur den freien Männern
oblag, nicht mehr willkürlich ausgehoben werden. Als Vasallen des
Königs und der erstarkten Geistlichkeit mußten sie als Gegenleistung
für den gewährten Schutz fronen und zinsen.
Die ersten nachweisbaren Spuren von Frondienst, welche die unfreie
Bauernschaft im Interesse der Jagd zu leisten hatte, betraf die
Instandhaltung der Brühle oder Tierparke, deren Instandhaltung
ausschließlich der unfreien Bevölkerung oblag. Schon Ludwig der Fromme
verordnete im Capitulare vom Jahre 820, daß kein freier Mann
gezwungen werden sollte, an den herrschaftlichen Brühlen (brolii
domi[S. 557]nici) zu arbeiten. Die Ausübung der Jagd war im ganzen noch
dieselbe wie zur Zeit der Stammesherrschaft, nur wandte der neue große
Grundbesitz natürlich einen größeren Apparat an, er hatte eigene
Jagdbediente, eine vermehrte Anzahl Hunde und einen großen Vorrat von
Netzen und andern Fangvorrichtungen. Die zur Jagd gebrauchten Hunde
waren dieselben wie früher. Es wurden besonders starke und scharfe
Fanghunde (molossus oder Rüde) gehalten, die den Kampf mit Bären
und Wildstieren ehrenvoll bestanden. Ausgedehnte Jagdbezirke wurden
mit lose auf Stellstangen liegenden Fallnetzen umstellt und durch die
Hörigen das Wild hineingetrieben. Hier fing es sich in den Maschen der
herabfallenden Netze und wurde von den in der Nähe versteckten Jägern
abgestochen.
Die Jagd wurde immer mehr eine beliebte Zerstreuung der Grundherrn,
und ein weites, wildreiches Jagdrevier, in welchem zu Ehren der Gäste
Jagden abgehalten wurden, gehörte zu jedem großen Grundbesitz. So gab
es an den Fürstenhöfen keine große Festlichkeit ohne Jagdvergnügen,
wobei auch die Damen mit dem Falken auf der Faust der Reiherbeize oder
der Hetzjagd mit den flinken Federspielen oblagen. Dem jungen Brun
de Montagne wurden, als er noch Säugling war, junge Hunde und Falken
verehrt. Das war damals das vornehmste Spielzeug des Adeligen.
Da man sich oft ganze Wochen hindurch dem Jagdvergnügen hingab, führte
man Zelte mit sich, mit denen das ganze Mittelalter hindurch ein
großer Aufwand getrieben wurde. Mit ihnen und dem nötigen Proviant
beladene Pferde wurden an bestimmte Plätze, an denen man zusammenkommen
wollte, vorausgesandt. Die Landesherren aber bauten sich schon frühe
Jagdschlösser, die mehr Bequemlichkeit als solche Zelte boten,
inmitten ihrer größeren Jagdforste. Schon Karl der Kahle ließ sich das
vermutlich an der Isar gelegene Jagdschloß Bacivum bauen, das er oft
besuchte. Und sein Enkel Karlmann starb daselbst 884 an einer auf der
Jagd durch unglücklichen Zufall erhaltenen Verwundung. Heristallum war
ein Jagdschloß der Frankenkönige, an der Mosel gelegen und schon zu
Karls des Großen Zeiten als solches berühmt; es ging noch auf Heinrich
I. den Vogler (876 bis 936), den 919 von den Franken und Sachsen
in Fritzlar zum König gewählten Sohn Ottos des Erlauchten, Herzogs
von Sachsen, den eigentlichen Gründer des deutschen Reiches, über,
wurde aber dann von den plündernd die Flüsse herauffahrenden Normannen
zerstört. Ein solches Jagdschloß wird im mittelhochdeutschen Gedicht
aus dem Ende des[S. 558] 12. Jahrhunderts Biterolf und Dietlieb jeithove oder
gejeithof genannt, im Erek des Hartmann von Aue (1170–1215), der an
den Kreuzzügen von 1189 und 1197 teilnahm, wird es jagehûs genannt, im
Epos Parzival Wolframs von Eschenbach (gest. um 1225) dagegen weidehûs.
Das Jagdhaus im Erek liegt an einem See, zwei Meilen rundherum ist der
Wald von einer Mauer umgeben und innerhalb der Mauer sind drei Gehege
angelegt, von denen das eine Rotwild, das andere Schwarzwild und das
dritte „kleinen Klunder“, d. h. Füchse, Hasen u. dgl. enthält. Es sind
Hunde da zur Hirschhatz und Windhunde für die Hasen, gegen Schweine und
Bären „breite, starke Spieße“; und im Jagdhaus sind allerlei Fangnetze
und „gutes Geschütz“ vorhanden.
Im späteren Mittelalter waren solche Jagdschlösser etwas ganz
Gewöhnliches. So besaß Kaiser Maximilian I. (geb. 1459, reg.
von 1486–1519) ein Jagdschloß bei Augsburg, Wellenburg genannt,
westlich davon dasjenige von Wellersberg, noch weiter entfernt das von
Dillingen; ferner nennt er selbst Jagdhäuser in Günzburg, Weißenhofen,
Pfaffenhofen, Angelberg und Oberndorf. Wo solche Jagdhäuser fehlten,
wird wohl die Gastfreundschaft der Untertanen in Anspruch genommen
worden sein, namentlich die der Klöster. In Verbindung damit
entwickelte sich dann die Pflicht der Atzung und Hundelege.
Die Häute des erlegten Wildes wurden unter anderem auch zu Anzügen
und Handschuhen verarbeitet. So kleidete sich Karl der Große mit
Vorliebe in Wildleder und noch im 16. Jahrhundert war die Jägertracht
aus Tierfell keine Seltenheit. Auf der Jagd Verunglückte und andere
Tote wurden zur Beförderung in frisch abgezogene Hirschhäute genäht,
und es scheint sogar allgemein Sitte gewesen zu sein, die Könige von
Frankreich nach ihrem Tode in eine solche einzuwickeln. Für gewöhnlich
bestand die Kleidung des Jägers aus einem Hemd mit halblangem Wams,
das im Winter grau, im Sommer grün sein sollte. Bei den Vornehmen war
das Winterwams mit Pelz gefüttert. Gegürtet wurde das Wams mit einem
Ledergurt, der das Jagdschwert und das Weidmesser trug. Die Beine
steckten in strumpfartigen Hosen, die Füße waren mit Schuhen oder
Stiefeln bekleidet und auf dem Kopf saß ein Filzhut oder eine Kappe.
Als Waffen benützte man außer dem Schwert den Ger als Wurfspeer und
Stoßwaffe zugleich. War er besonders für letzteren Zweck bestimmt,
so trug er vielfach einen Querriegel. Mit ihm, dem espieu der
Franzosen, im Gegensatz zur geworfenen lance, ließ der Jäger
die Wildsau auflaufen und ging er dem Bären zu Leibe. Der Riegel
war[S. 559] fest oder beweglich und in letzterem Falle mit ledernen Riemen
angebunden, die um den Schaft gewickelt und daselbst festgenagelt
waren. Man benützte aber auch den espieu, die Saufeder, zum Werfen.
Als Fernwaffe diente der mit dem Bogen entsandte Pfeil. Dieser sollte
acht Handbreiten lang, seine eiserne Spitze aber fünf Finger lang und
vier Finger breit sein. Abgeschnellt wurde er mit dem vorzugsweise
aus Eibenholz hergestellten Langbogen, dessen Sehne besser aus Seide
denn aus Hanf angefertigt sein sollte. Der Bogen sollte, an der Sehne
gemessen, 20 Handbreiten lang und so biegsam sein, daß ihn der Jäger
längere Zeit gespannt halten konnte, wenn er sich dem Wild langsam
und sichernd näherte. Zum Langbogen kam jetzt noch der Kreuzbogen,
die Armbrust, hinzu. Schon im Jahre 1048 wird die Armbrust in einer
Urkunde Tirols erwähnt, es dauerte aber Jahrhunderte bis sie in
Deutschland den Langbogen verdrängte. In Frankreich war dies noch
später der Fall. In den französischen Artus- und Abenteuerromanen
wird die Armbrust als Waffe noch nicht erwähnt; dagegen geht in dem
nach französischem Vorbilde um 1210 vom mittelhochdeutschen Dichter
Gottfried von Straßburg gedichteten Epos „Tristan und Isolde“, Tristan
mit ihr bürschen. Als Kriegswaffe wurde die Armbrust früher heimisch
denn als Jagdwaffe. So wurde in Paris im Jahre 1359 die Gesellschaft
der Armbrustschützen gegründet, aber als Jagdwaffe soll die Armbrust
in Frankreich erst seit 1554 nach einer Verbesserung durch Andelot
allgemein benützt worden sein. Kaiser Maximilian I. führte mit
Vorliebe die Armbrust, mit einem Bogen aus Stahl, bei Frostwetter
dagegen benutzte er eine solche mit Bogen aus Horn. Das Weidmesser
wurde im 12. und 13. Jahrhundert in Frankreich quenivet
bezeichnet, ein Ausdruck, der sich im französischen canif, im
englischen knife und im norddeutschen Knif bis auf den heutigen
Tag erhielt. Als die Schwerter für den Krieg, die bis dahin eine runde
Endigung gehabt hatten, seit dem 12. Jahrhundert spitz ausliefen, wurde
auch das Jagdschwert nach vorne zu gleichmäßig spitz hergestellt,
um zum Stechen zu dienen. Das Jagdpersonal trug kein Schwert, dafür
aber das Weidmesser, franz. escorcheor, deutsch Weidener. An
einem Band trug der Jäger um die Schultern das Horn, zuerst aus dem
Horn von Wildbüffeln, später von Hausrindern angefertigt; war es
ausnahmsweise aus dem kostbaren Elfenbein hergestellt, so hieß es
oliphant. Damit gab man die Signale, durch welche nicht nur die
Jäger benachrichtigt, sondern auch die Hunde gelenkt und die ganze
Jagd geleitet wurde. Huer et corner, d. h. Schreien und Hornen[S. 560]
waren das unerläßliche Mittel der Hetzjagd im freien Revier, welche die
beliebteste Jagdart des Mittelalters war. Man nannte sie in Deutschland
das Überlandjagen, in Frankreich die chasse à courre. Die
Entwicklung dieser Jagdart zu einer eigenen Kunst vollzog sich mit dem
Aufkommen der großen Vasallen in Frankreich, wo diese Jagdart durch die
fränkischen Eroberer von den unterworfenen Kelten übernommen wurde.
Letztere haben nach der Überlieferung Arrians schon die Hetzjagd auf
Hirsche und Hasen geübt.
Der Grundbesitz hatte in Frankreich schneller als in Deutschland und
England zu einem mächtigen und selbständigen Vasallentum geführt, das
Ludwig II. und Suger, Philipp der Schöne, Ludwig XI. und
Richelieu erst brechen mußten, bevor eine staatliche Einheit möglich
war. Dieses reiche, vornehme Vasallentum hat die Hetzjagd geschaffen,
begünstigt durch die Überlieferung solcher Jagdweise aus keltischer
Vorzeit und die verhältnismäßig hohe Kultur, die schon Julius Cäsar
an den Galliern rühmte und die in der Folge Frankreich jenen großen
Vorsprung vor Deutschland und England in materieller und geistiger
Hinsicht verschaffte. Die Vasallen besaßen ein ausgedehntes Jagdrevier
und bezogen aus dem ausgedehnten Grundbesitz die Mittel, ein geschultes
Jagdpersonal und zahlreiche Meuten zu unterhalten. In der Mitte des
14. Jahrhunderts schätzt Gace de la Bigne die Meuten in Frankreich auf
20000 Stück. Nach Frankreich bildete das vom Normannen Wilhelm eroberte
und an seine Vasallen aufgeteilte England diese vornehme französische
Jagdart bei sich aus, während in Deutschland der Mangel an materiellem
Reichtum und das Fehlen des keltischen Blutes im Jäger wie im Hund
solche noble Passion erst spät und zögernd aufkommen ließ.
Wie in Frankreich war auch in Deutschland das ganze Mittelalter
hindurch der Gebrauch des an einem Riemen geführten Leithundes
(franz. liëmier) allgemein üblich. Mit ihm wurde der Hirsch
oder sonstiges Wild „bestätigt“ und dann von den Jägern zu Pferd mit
den Laufhunden gehetzt, bis es gestellt und abgestochen zu werden
vermochte. Dabei suchte man ihm die Flucht über Land, wo man ihm
weniger leicht zu folgen vermochte, zu verwehren und ihn im Walde
festzuhalten, indem man den zu bejagenden Waldbezirk durch Knechte und
Bauern umstellte, die den Auftrag hatten, das Ausbrechen des Wildes
aus dem Walde zu verhindern. Dabei wurde der einzelne Posten als Warte
bezeichnet. Dieser sollte durch Schreien und Lärmen das auszubrechen
versuchende Wild zurückjagen; geschah dies nicht und brach[S. 561] das Wild
aus, so wurde der betreffende Bauer nach dem Weistum von Rode mit
der Wegnahme des besten Ochsen bestraft. In Tristan und Isolde des
Meisters Gottfried von Straßburg und in den Nibelungen des unbekannten
ritterlichen Dichters aus dem Beginne des 12. Jahrhunderts ist mehrfach
von solchen Warten bei der Jagd die Rede. Auch bei der Jagd im Meleranz
sind drei Warten mit Hunden aufgestellt. Man ließ nämlich nicht von
Anfang an die ganze Meute, sondern immer nur einen Teil derselben auf
den Hirsch (oder anderes Wild) los, da die Hunde nicht ausdauernd genug
waren, um ihn mattzuhetzen und nach einiger Zeit der Ablösung durch
frischgebliebenes Material bedurften. So wurde ein Teil der Meute
auf die Warten gegeben und später angehetzt, wenn der Hirsch gerade
vorüberflüchtete.
Wenn ein hoher Herr „über Land“ jagte, dann legte die vorsichtige
Jägerei Windhundwarten weit hinaus auf Feld, die auf den halb
mattgehetzten Hirsch (oder anderes Wild) losgelassen wurden und ihn
in der Regel bald stellten. War das Revier von einem Fluß begrenzt,
so wurden auch Schiffswarten aufgestellt. Die Meute bestand aus
wenigstens 12 Laufhunden und einem Leithund. Im Nibelungenlied hat
Gunther zwei Meuten, also zweimal 12 gleich 24 ruore (= Bracken)
zur Verfügung. Als Siegfried gleichfalls auf die Jagd reiten will,
schlägt ihm Hagen vor, das Jagdpersonal und die Hunde zu teilen. Da
nimmt Siegfried wohl das Personal an, verzichtet aber auf die Meute
und bittet sich nur den Leithund aus. Im Meleranz besteht die Meute
aus 13 ruorhunden und diese ziehen „in die ruore“,
d. h. auf die Jagd, und im Weistum des bei Trier gelegenen Spurkenburger
Waldes heißt es, der Förster soll zweimal im Jahre den Vogt und einen
Ritter nebst Knechten und einen Jäger mit 12 Hunden und einem Leithund
bei sich aufnehmen. In der Meute wurden junge Hunde mit den alten
gemischt, damit sie von diesen angelernt würden. Namentlich auf gute
Leithunde wurde großer Wert gelegt, da die Vorsuche sehr wichtig war.
Ja, in Frankreich verlangte jeder Seigneur vor der Jagd einen Bericht
über Beschaffenheit, Alter und Geweihstärke des zu jagenden Hirsches.
Die deutschen Fürsten waren in ihren Ansprüchen bescheidener, und
sie mußten es sein, weil sie selbst nicht die Voraussetzungen einer
guten Vorsuche erfüllen konnten und nicht immer im Besitz eines guten
Leithundes waren. So treffen wir in zahlreichen Briefen von deutschen
Fürstlichkeiten des 15. Jahrhunderts Bitten um gute Leithunde.
Aus diesem Überlandjagen hat sich zuerst in Frankreich die klas[S. 562]sische
Parforcejagd — à force de chiens — entwickelt, welche uns
fertig zum erstenmal in dem vermutlich in der zweiten Hälfte des 13.
Jahrhunderts verfaßten Gedicht la chasse du cerf entgegentritt.
Darin wird ein wissensdurstiger Laie über diese Jagdart von einem Jäger
unterrichtet. Sie erscheint dort ums Jahr 1200 fertig ausgebildet, war
bei der im 14. Jahrhundert zuerst auftretenden jagdlichen Literatur in
Prosa auf der Höhe, auf welcher sie sich bis ins 16. Jahrhundert hinein
hielt. Nach der Angabe des Roy Modus jagte man zehn Arten Wild à
force. Von diesen waren fünf rot: Edelhirsch, Hinde, Damwild, Reh,
Hase, und fünf schwarz: Wildsau, Bache, Wolf, Fuchs und Fischotter.
Es galt aber für ebenso weidgerecht, das schwarze Wild im Netz zu
fangen. Jagdbar hieß der Hirsch, wenn er ein Geweih von wenigstens 10
Enden trug. Die Fußspur eines solchen, die einen längeren Tritt und
breitere Ballen als die einer Hinde hat, wird, wenn möglich, von dem
am Riemen vom Jäger geführten Leithund in der Morgenfrühe des zur Jagd
bestimmten Tages ausgemacht. Findet der Jäger auch noch die Losung
(Kot) eines solchen, so tut er dieselbe in sein Horn, um sie als
Wahrzeichen zur Versammlung mitzunehmen und dort vorzulegen. In der
Hand darf er sie nicht tragen, weil sie dabei die charakteristische
Form verlieren würde. Ist der Hirsch durch Verfolgung der Fährten bis
zu feinem vermutlichen Lager ausgemacht, so erhält der inzwischen
mit der Jagdgesellschaft am Versammlungsorte eingetroffene Grundherr
davon Bericht durch die Besuchknechte. Die an gedeckten Tischen sich
an kalter Küche und Wein zum bevorstehenden Jagdritt erfrischende
Gesellschaft läßt auch die Besuchknechte sich sättigen und durch einen
Trunk laben; dann bricht sie auf, nachdem inzwischen die Warten dort
aufgestellt sind, wohin der ausgemachte Hirsch nicht flüchten sollte.
Besonders gefährdete Stellen, wie die Ufer breiter Ströme, in die
sich der geängstigte Hirsch gern flüchtet, wurden mit Vorliebe durch
Windhunde gesichert. Auch waren zuvor die Relaishunde verteilt, die dem
flüchtig vorbeieilenden Wild nachjagen sollten.
Der Seigneur erhebt sich zum Zeichen des Aufbruchs, die Jäger steigen
zu Pferd und die Jagdgesellschaft folgt dem Besuchknecht, der den
Hirsch bestätigt hat, zu der Stelle, da dieser am Morgen die Fährte
verließ. Die Gesellschaft bleibt im Hochwald vor der Dichtung, in
der sich der Hirsch befinden muß, halten, während der Besuchknecht
seinem Leithund auf der Fährte folgt, bis er ihn zum Lager des
Hirsches geführt hat. Ist dieses noch warm, als Zeichen dafür, daß
der Hirsch[S. 563] es eben verlassen hat, so gebärdet sich der Leithund wie
toll an der Leine und gibt freudig laut. Durch Hornsignal wird nun
die Meute mit den Jägern avisiert und unter lautem Gebell beginnt das
Jagen. Besonders nach dem Lautgeben oder Schweigen der alten Hunde
wird beurteilt, ob man bei der Verfolgung des flüchtig gewordenen
Hirsches auf richtiger Fährte ist oder nicht. Signale und Rufe leiten
die Teilnehmer nach der jeweiligen Richtung der Flucht des Hirsches,
bis dieser, der vergeblich alle Schliche und Finten anwandte, endlich
vom weiten Laufe erschöpft und um sein Leben bangend von den Hunden
gestellt und dann vom herbeigeeilten Jagdherrn durch einen Stich ins
Herz abgetan wird. Sein Tod wird von allen Jägern durch das Signal
„Hirsch tot“ verkündigt. Hierauf wird ihm das Fell abgezogen und sein
Körper zerlegt und verteilt, wobei auch die Hunde ihren Anteil an den
Eingeweiden erhalten.
In ähnlicher Weise wurde mit den nötigen Abänderungen das übrige Wild
par force gejagt, wobei sich ein ganz bestimmtes Zeremoniell,
auf das wir nicht eintreten können, herausbildete. Besonders an
Wildsauen wurde eine Massenschlächterei ohnegleichen vollzogen, da
solche damals noch sehr zahlreich vorhanden waren und wegen ihrer
Schädlichkeit für den Landbau rücksichtslos verfolgt wurden. So schrieb
z. B. Kurfürst Albrecht von Brandenburg 1480 an seinen Sohn: „Wir
haben beiläufftig 30 und 100 swein ‚gefangen‘. Und ist noch Swein und
ander Wildpert, gott seis gelobt, genug hie außen und gutter frid:
gott geb’ lang!“ Vierzehn Tage darauf meldete er ihm abermals, er habe
„32 und 100 swein“ gefangen; es seien aber 200 da. Der französische
Verfasser des Roy Modus hält das Treiben des Wildes zu den Netzen für
die beste Jagdart und das schönste Vergnügen mit Hunden, dem sich die
großen Grundbesitzer auch häufig hingaben. Der Graf von Foix dagegen
erklärt diese Netzjagd nicht für ritterlich, ebenso verurteilen sie
verschiedene deutsche und englische Autoren, die sich darüber äußerten.
Nicht auf die Beute komme es an, sondern auf die Art, sie kunstgerecht
zu erjagen. Auch Treibjagden wurden von den großen Herren veranstaltet,
indem die hörigen Bauern Treiberdienste leisten mußten und das Wild
mit großem Lärm gegen die mit grünem Laub verkleideten Stände mit den
vornehmen Jägern trieben, die es mit der Armbrust und später mit der
Büchse erlegten. Zuerst wurde das kleine Wild durch Harriers genannte
kleine Hunde rege gemacht und dann erst das Rotwild durch Hirschhunde
gehetzt. Um das Wild zwangläufig zu führen, waren außer den den Wald[S. 564]
umstellenden Warten mit Windhunden auch solche im Treiben aufgestellt.
Je näher zu den Ständen, um so dichter standen sie. Eine der ältesten
Mitteilungen über die Treibjagd finden wir in der am Ausgang des 12.
Jahrhunderts gedichteten Eneide des Heinrich von Veldecke. Darin wird
von Askanius eine Treibjagd in der Weise ausgeübt, daß Schützen mit
Pfeil und Bogen sich vor die Bäume stellen und sich Wild zutreiben
lassen. Auf die Fährte des verwundeten Hirsches wurden dann die Hunde
gehetzt.

Bild 56. Die Abrichtung des Jagdfalken durch den Falkner.
An der Wand befindet sich ein Federspiel. (Holzschnitt von Jost Ammann
in „Das Neuw Jag und Weydwerck Buch“, Frankfurt 1582.)
Gern birschte sich der Einzeljäger in die grüne Farbe des Waldes
gekleidet gegen den Wind, den Bogen in der Hand, Schritt für Schritt
an das Wild heran. Dazu benutzte er entweder natürliche Deckungen oder
künstliche, indem er einen Schirm aus grünen Zweigen oder ein Schild
mit aufgemalten Ochsen vor sich hielt. Nach dem Schuß ließ man das
getroffene Tier durch Bluthunde verfolgen. Für solche Jagd empfiehlt
Roy Modus einen leichten und biegsamen Bogen zu ver[S. 565]wenden, den der
Schütze längere Zeit gespannt halten konnte, während er sich dem Wilde
näherte.

Bild 57. Reiherbeize mit dem Falken und dem Windspiel.
Im Hintergrunde Hasenjagd mit Laufhunden. (Holzschnitt von Jost Ammann
in „Das Neuw Jag und Weydwerck Buch“, Frankfurt 1582.)
Neben diesen Jagdarten spielte die von alters her geübte Beize mit
dem Jagdfalken das ganze Mittelalter hindurch eine sehr große Rolle.
Man schrieb damals die Einführung dieser Jagdart fälschlicherweise
dem sagenhaften König Dankus von Armenien zu. Tatsache ist, daß sie
allerdings durch die Kreuzzüge mancherlei Beeinflussung aus dem
Orient, wo sie ebenfalls mit großer Leidenschaft ausgeübt wurde,
erfuhr, besonders von seiten des im 10. Jahrhundert lebenden Arabers
Mohammed Tarkani, der ein verbreitetes Buch über die Jagd mit dem
Falken schrieb. Unabhängig von ihm schrieb der gelehrte Albertus Magnus
(als Graf von Bollstädt 1193 zu Lauingen in Schwaben geboren, wurde
Dominikaner und starb, nachdem er Bischof von Regensburg gewesen, 1280
in Köln) und fast gleichzeitig Kaiser Friedrich II., der Enkel
Friedrichs I. Barbarossas (1194–1250), eine[S. 566] allerdings erst im
Jahre 1596 in Augsburg gedruckte Abhandlung über das Federspiel. Das
Buch des von einer sizilianischen Mutter geborenen und mit Vorliebe
in Palermo residierenden Fürsten, der zahlreiche Beziehungen zu den
Arabern unterhielt und selbst einen Harem besaß, handelt eigentlich
nur von der Zähmung des Falken und nicht von der Jagd mit ihm, obschon
es den Titel trägt: de arte venandi cum avibus (über die Kunst
mit Vögeln zu jagen). Dieser Fürst war selbst ausübender Falkenjäger
und ließ zu seiner Belehrung vor der Abfassung des Buches über die
Falknerei Falkner aus dem Oriente kommen, wo die Kunst mit dem Falken
zu jagen in hoher Blüte stand. Auch in Byzanz war die Falkenbeize
ein beliebtes Vergnügen der großen Herren. Dort schrieb Demetrios,
wahrscheinlich Arzt des griechischen Kaisers Michael Palaeologus, in
griechischer Sprache ein Buch über Falknerei, das im Jahre 1612 ins
Französische übersetzt in Paris gedruckt wurde.
Zur Kreuzfahrerzeit und später kamen die gesuchtesten Jagdfalken aus
Island und Norwegen und wurden neben den von unsern Altvordern von
jeher gezähmten Habichtarten, dem Hühnerhabicht und Sperber, als sehr
geschätzte Jagdgehilfen gehalten. Diese hellfarbigen nordischen Falken
waren auch bei den vorderasiatischen Völkern die gesuchtesten. So
schlug Sultan Bajazet I., nachdem er am 28. September 1396 bei
Nikopolis das abendländische Kreuzheer unter König Siegmund besiegt
hatte, alles Lösegeld aus, das ihm für die dabei gefangen genommenen
Herzog von Nemours und zahlreiche andere französische Edelleute
angeboten wurde, gab sie aber sofort frei, als ihm statt des Geldes
zwölf weiße isländische, zur Beize abgerichtete Falken vom Herzog von
Burgund geschickt wurden. Und Philipp August, König von Frankreich, dem
bei der Belagerung von Akkon ein prächtiger weißer Falke wegflog, bot
den Türken für dessen Rückgabe vergeblich 1000 Goldstücke.
Wie gute Jagdhunde waren abgerichtete Falken das ganze Mittelalter
hindurch die beliebtesten Geschenke zwischen hohen Herren. Namentlich
war Preußen eine dankbare Quelle für Falken. So sandte der Hochmeister
Heinrich von Richtenberg im Dezember 1471 acht Falken an den Kurfürsten
Albrecht von Sachsen, und Albrecht von Brandenburg machte Maria, der
Katholischen, ein ähnliches Geschenk. Lange Zeit übte die dänische
Regierung den Brauch, alljährlich eine Anzahl Falken durch ein
besonderes Schiff aus dem Norden holen zu lassen und sie geschenkweise
an die europäischen Fürsten zu verteilen. Brabanter[S. 567] Kaufleute brachten
Falken aus dem Norden nach Frankreich und Spanien. Im Weißkunig
wird von Kaiser Maximilian gesagt, er habe Falken gehabt aus der
Tartarei, aus der Heidenschaft, aus Rußland, Preußen und von der Insel
Rhodus. Lopez von Ayala, kastilischer Gesandter bei Karl V.
und Karl VI., erzählt, daß der Preis eines Falken mit hohem
Flug 40 Franken in Gold und derjenige eines speziell auf den Reiher
abgerichteten Falken 60 Goldfranken betrug. Das sind nach unserem
Gelde 472 und 708 Mark, also in Berücksichtigung des damaligen hohen
Geldwertes ganz anständige Preise.
Eingehend wird die Abrichtung des meist aus dem Horst genommenen und
in einem künstlichen Horst mit rohem Fleisch, Käse, Eiern und Milch
aufgezogenen jungen Falken geschildert. Der Akt der Zähmung ging in
der Weise vor sich, daß ihm die Klauen geschnitten und die Fangschuhe
aus leichten Riemen mit einer kleinen Schelle, bei deren Klang man
später den Falken leichter wieder zu finden vermochte, angelegt
wurden, damit er auf der Faust gehalten werden konnte. Durch Blenden
mit losem Zusammennähen der Augenlider und Hungernlassen, wobei sie
24 Stunden in einen dunkeln, stillen Raum auf der durch einen dicken
Handschuh aus Hirschleder geschützten Faust umhergetragen wurden —
dabei löste ein Falkner den andern ab — wurden die Tiere abgemattet
und zunichte gemacht. Gern sah man, wenn die übermüdeten Vögel während
des Umhertragens einschliefen, denn gerade das Schlafen auf der Faust
machte nach Roy Modus den Falken vertraut. Nach dieser Frist bekam
der Vogel zu „ätzen“, d. h. zu fressen, und zwar stets auf der Faust.
Einige Tage später trug man ihn an hellere, belebtere Orte und lockerte
allmählich den Faden, mit dem die Augenlider zusammengenäht waren,
daß er etwas zu sehen vermochte; schließlich zog man ihn ganz heraus.
War der Vogel im Hause zahm geworden, so trug man ihn ins Freie und
gewöhnte ihn an Hund und Pferd. Wenn der Falkner das erstemal mit dem
Vogel das Pferd bestieg, um auszureiten, hatte er gern einen leichten
Regen, weil der Vogel dann weniger unruhig war. Dann bekam der Falke in
stiller Gegend auf einem Federspiel genannten, mit Leder überzogenen
Stiel, an dem flatternde Bänder und Vogelschwingen befestigt waren, zu
fressen. Er wurde nun daran gewöhnt, auf diesem gefüttert zu werden;
dadurch gelang es, ihn herbeizulocken, wenn er verflogen war, indem
man ihm den Federspiel zeigte und die Bänder im Winde flattern ließ.
Das erweckte in dem hungrigen Tiere das Bewußtsein, er werde dort zu
fressen bekommen, und kam herbei,[S. 568] um sich daraufzusetzen. Deshalb
mußte der Falke stets hungrig sein, wenn es zur Jagd ging, sonst
riskierte der Falkner, daß er nicht wiederkam.
War der Falke so weit zahm, daß er auf den Ruf herbeigeflogen kam,
ruhig auf der Hand stand und darauf fraß, so begann man damit, ihm
lebenden Raub zu zeigen. Meist benutzte man dazu Tauben, denen man die
meisten Schwungfedern ausgerissen hatte, so daß sie mehr flatterten als
flogen, so daß sie vom Falken leicht zu schlagen waren. Dann durfte der
Falke von der Taube fressen. Später nahm man sie ihm ab und bot ihm
dafür das Ziget oder den kalten Flügel. Die ersten Stoßübungen machte
der Falke an einer langen Schnur, und erst wenn der Falkner des Vogels
sicher zu sein glaubte, wurde ihm die Fessel abgenommen. Nach und nach
brachte man den Vogel an größeres Wild und allmählich lernte er Enten,
Gänse, Fasanen, Hasen, Trappen, Weiher, Kraniche und Reiher schlagen.
In zahlreichen mittelalterlichen Gedichten ist vom Falken die Rede;
denn damals war die Reiherbeize das Hauptvergnügen der großen Herren
weltlichen und geistlichen Standes. Überallhin, selbst zur Messe nahmen
sie wie ihren Hund, so auch den Falken mit sich. Die Beize konnte nur
bei gutem Wetter und am besten im Herbst geübt werden, da die Falken
im Frühjahr mauserten und dann äußerst empfindlich waren, im Winter
aber durch den Schnee geblendet wurden. In der Zeit der Hohenstaufen
war der Gebrauch der Lederhaube durch die Araber aufgekommen und wurde
an Stelle der Blendung durch Zusammennähen der Augenlider nicht nur
bei der Dressur, sondern auch später zu Hause und unterwegs öfter
aufgesetzt, um das Tier ruhig zu halten. Der Falke wurde vom Jäger oder
der Jägerin in der Weise auf der behandschuhten rechten Hand gehalten,
daß er mit den Fängen zwischen das Handgelenk und die gebogenen Finger
griff. Nie durfte die Schelle erklingen, wenn der Vogel richtig
getragen wurde. Die Fessel war um den kleinen Finger geschlungen; an
ihr wurde der Falke gehalten. Beim Ausritt mußte der Falke stets gegen
den Wind gerichtet sein und erst wenn er jagen sollte, nahm man ihm
die Haube ab. Eine solche Falkenbeize erforderte sichere Pferde, die
kein Hindernis scheuten, da man beim Dahinsausen in Verfolgung des
von den Stöberhunden aufgescheuchten Reihers die Augen mehr gegen den
Himmel zur Beobachtung der interessanten Flugkünste von Raubvogel und
Wild, als auf die Erde richtete und deshalb leicht stürzte. Besonders
war dies bei den in Seitensitz reitenden Damen der Fall, die im
Mittel[S. 569]alter das rechte Bein nicht um das Sattelhorn gelegt hatten,
sondern seitwärts im Sattel saßen, die Füße auf ein Brett gestellt. Da
konnte denn freilich der Halt kein sicherer sein. Auf einer Reiherbeize
verunglückte denn auch durch einen Sturz vom Pferd am 27. März 1482,
erst 25jährig, die immens reiche Tochter und Erbin Herzogs Karl des
Kühnen von Burgund, seit 1471 die Gemahlin des Erzherzogs Maximilian
von Österreich, des späteren Kaisers Maximilian I., dem sie
zwei Kinder, Philipp den Schönen und Margarete, geboren hatte. Auch
Maximilians zweite Gemahlin verunglückte auf einer solchen Jagd durch
Sturz vom Pferde.
In Frankreich wurde die Beize auch vom Mittelstand geübt. Ritter,
Domherren, Bürger und Junker taten sich zusammen und ließen ihre Falken
und Sperber auf Rebhühner und Lerchen fliegen. Der Anblick des zu
Tode gehetzten Wildes bot diesen noch wenig feinfühligen Menschen die
schönste Augenweide und war ihre höchste Lust. In Tirol war schon seit
dem Jahre 1414 dem Adel verboten, Fasanen und Rebhühner auf eine andere
Art zu fangen als mit dem Federspiel. Kaiser Maximilian I. hat
dann die Reiherbeize in den österreichischen Erblanden neu belebt und
an vielen Orten auch Enten, zum Teil unter Aufwendung von erheblichen
Kosten, als Jagdwild hegen lassen. Auch auf seinen Reisen und Feldzügen
übte er die Jagd und das Beizen aus, ersteres am Vormittag und
letzteres am Abend. Allgemein wurde die abendliche Beize bevorzugt,
weil dann der Falke den größten Hunger hatte und die geringste Neigung
zeigte, sich zu verfliegen.

Bild 58. Jäger mit Hund und Jagdfalk.
(Nach einem Holzschnitt von Jost Ammann.)
Noch im späteren Mittelalter wurde gezähmtes Edelwild gelegentlich zur
Jagd gebraucht, ebenso war der Fang vermittelst Antrieb gegen mitten
im Wald errichtete künstliche grüne Hecken beliebt, die im Zickzack[S. 570]
verliefen und an den offenen Winkelspitzen Netze in Beutelform
aufwiesen, in denen sich das hier auszubrechen versuchende Wild fangen
mußte, während die einspringenden Winkel durch Reisig geschlossen
wurden. War das Tier wie eine Fliege im Netz gefangen, so eilten die
in der Nähe versteckten Wachen herbei, um es zu töten. Dieses Jagen
mit hag war ebenso bequem als ergebnisreich, wenn es gelang ein
Rudel Wild dagegen zu treiben. Nach und nach wurden die feststehenden
Hecken durch die beweglichen Netze und hohen Tücher verdrängt, denen
schon Roy Modus und Foix im 13. Jahrhundert den Vorzug gaben. Ein
Hauptgrund für die Aufgabe der Hecken war auch die Wilderei, der
dadurch Vorschub geleistet wurde.
Außer in solchen Hecken wurde das Wild wie früher auch in Fallgruben
gefangen. Diese waren unten weiter als oben und mit Zweigen verdeckt.
Von der Fallgrube gingen zwei oder vier Hecken in schräger Richtung
ab, welche das nahende Wild zwangläufig nach der Grube führten, in die
es hineinstürzen mußte. Die Gruben für Schwarzwild und Raubzeug wurden
im Walde, die für Rotwild dagegen im Freien angelegt. Auch Fallen und
Schlingen wurden noch gelegt, besonders für die kleineren Tiere und
Vögel. Letztere wurden außerdem auch mit Netzen und Leimruten gefangen,
wobei allerlei Lockvögel zu Hilfe genommen wurden. Habichte und Falken
köderte man mit einem Huhn und fing sie in Schlingen. Sperber dagegen
lockte man durch einen andern Sperber, der in einem Bauer saß. Auch
solche ältere Vögel wurden zur Jagd abgerichtet. Wenn sie dabei dem
Falkner auch mehr zu schaffen gaben als die jungen, aus dem Nest
genommenen Vögel, so lohnten sie andererseits die vermehrte Mühe durch
größere Kühnheit und waren daher sehr beliebt.
Bären und Wölfe wurden mit Selbstschüssen zu erlegen versucht; man
fing sie auch in der Schlinge und in Schlagfallen und jagte sie mit
Spürhunden vielfach in mit Netzen eingehegten Revieren. Die noch immer
zahlreichen Wölfe suchte man in Fallgruben und an Luderplätzen mit
vergiftetem Fleisch unschädlich zu machen. In ähnlicher Weise wurde den
Füchsen nachgestellt, die im Altfranzösischen gupil und erst
später renard — wohl eine Nachbildung von Reinecke — genannt
wurden. Die Fischotter wurden wegen des Schadens, den sie in den
Fischteichen anrichteten und wegen des gesuchten Pelzwerks, das nach
Albertus Magnus zur Verbrämung anderer Pelzarten gebraucht wurde, in
Schlingen, Netzen und Fallen gefangen oder mit Spürhunden ge[S. 571]jagt. Ihr
Fleisch galt wie das des Bibers als Fastenspeise und wurde als solche
in den Klöstern gern gegessen.

Bild 59. Hetzjagd auf Wölfe mit Netzen. (Holzschnitt von
Jost Ammann 1582.)
Wie das Rotwild wurden auch die Gemsen von Kaiser Maximilian I.,
den man gern als letzten Ritter bezeichnet, durch Treiber mit Hunden zu
Tal gehetzt und an Engpässen in Netzen gefangen oder durch Hecken und
Netze zwangläufig vor die Armbrust oder den Wurfspieß des hohen Jägers
und seiner Gäste geführt. Der Kaiser erzählt selbst im Weißkunig durch
die Feder seines Hofschreibers, M. Treizsaurwein, daß er im Tal Smyeren
in Tirol eine Jagd hatte, bei der 600 bis 1000 Gemsen ins Jagen kamen,
und daß einmal 183 Stück gefangen worden seien. Als erster hat er
seinen Untertanen gegenüber behauptet, ohne es allerdings beweisen zu
können, daß die Jagden „Kaiserliche Regalia“ seien. Nur er wollte die
Jagd in seinen Erblanden, die durch Fälschung von Freiheitsbriefen von
den Habsburgern zu einem selbständigen Herzogtum gemacht worden waren,
ausüben und bestrafte jeden Jagd[S. 572]frevel der Bauern, die gerade in Tirol
auf ihr altangestammtes Recht der Jagd pochten, aufs strengste, ja
nicht selten mit den Tode. So ließ er auch den Bauern Mathäus Sailler
von Zirl, der unbefugt auf der Pirsch angetroffen wurde, kurzerhand
an den Galgen hängen. Schon im Jahre 1414 war in Tirol verordnet
worden, daß niemand ohne landesfürstliche Erlaubnis Hirsche, Rehe,
Bären, Gemsen oder graue Hasen jagen oder fangen dürfe; ausgenommen
war der Adel, der auf seinen Besitzungen die Jagd behielt. Schon auf
dem Landtage zu Bozen im Herbst des Jahres 1478 klagten die beim
Jagdvergnügen der Herren zur Fron gezwungenen Bauern über Wildschaden.
Aber es wurde ihnen versagt, sich dagegen selbst zu helfen. Erst
bei Maximilians Tode am 12. Januar 1519 in Wels ließ sich der lange
verhaltene Grimm der Bauern nicht mehr dämpfen und sie begannen alsbald
einen rücksichtslosen Vernichtungskrieg gegen alles Wild, das der
Kaiser für seine Jagden in den Tiroler Bergen gehegt hatte.
Das ganze Mittelalter hindurch wurde keinerlei Schonzeit für das Wild
gehalten und mit Vorliebe wurden auch trächtige Tiere gejagt. So findet
es der Verfasser des Roy Modus sehr unterhaltend, die säugende Hinde
zu hetzen. Am besten jagt man nach seiner Auffassung das Tier, wenn
es hochträchtig ist, wegen der schönen Jahreszeit im Mai und Juni.
Ist aber das Hirschkalb schon gesetzt, dann kehrt die Mutter auf der
Flucht oft zu ihm zurück, wenn es nicht rasch genug folgen kann,
und wagt nicht, es zu verlassen. Solches zu beobachten gewähre ein
besonderes Vergnügen. Zuweilen sei das Tier mit Kalb feister als ein
geltes Tier. „Findest du also ein Tier mit Kalb, gib dir Mühe, es mit
dem Leithund zu bestätigen und laß die Hunde danach jagen.“ Führwahr,
Mitleid kannten die Menschen jener Zeit nicht! Sie ergötzten sich an
dem Anblick, wenn die vom Jagdsperber verfolgte Lerche, die bei den
Menschen Schutz suchend sich unter sie warf, vom Raubvogel erwürgt
wurde. Roy Modus sagt von einer solchen Schilderung: „Wenn der Sperber
sie dann fängt, das ist ein köstliches Vergnügen!“ Der feingebildete
Albertus Magnus, Bischof von Regensburg, sagt, daß der Gerfalke mit
frischem, noch warmem Fleisch gefüttert werden müsse. Deshalb ließ man
ihn vom noch lebenden Tiere fressen. Darum rissen etliche Falkner einer
lebenden Henne einen Schenkel aus und am nächsten Tag den andern, um
dem Falken ein schmackhaftes Gericht zu bieten. Der große Albert tadelt
zwar solches, aber nur deswegen, weil am zweiten Tage das Fleisch nicht
mehr gut sein könne „von wegen der hitz, so der schmertz erwegt“.
Die[S. 573] unmenschliche Grausamkeit, der solche Handlung zugrunde liegt,
empfindet der fromme Graf von Bollstädt nicht als solche. Der große
Weidmann Maximilian I., der sich schon als Herzog von Österreich
den Rang eines Kurfürsten anmaßte und sich „des heiligen Römischen
Reichs Erzjägermeister“ nannte, ließ sich mit Vorliebe das gehetzte
Wild in einen See treiben, um es dort gemächlich vom Schiff aus zu
töten. Einmal schoß er eine hochträchtige Hirschkuh, die alsbald nach
der schweren Verwundung ein Kalb gebar, „bevor Er noch die Pluetthundt
daran hat gehetzt“, wie er uns selbst in seinem geheimen Jagdbuch
erzählt. Das Wort Edelmann, das damals von solch großer Bedeutung
war, kommt vom angelsächsischen ead oder ed, dem
altdeutschen ôd Besitz und heißt nur der (an Grundbesitz) reiche
Mann; mit edler Gesinnung und Edelmut hatte es durchaus noch nichts
zu tun. Solcher Erwerb ward erst einer späteren, feiner fühlenden
Zeit vorbehalten, die nicht mehr unter Umständen ein Menschenleben
geringer achtete als dasjenige eines aus purem Egoismus gehegten
Wildes. Derselbe fürstliche Kerl, den sein Leibeigener, der rechtlose
Bauer, mit seinen zahlreichen Dienern und der oft hunderte von Hunden
umfassenden Meute ohne Entgelt füttern mußte, hing ihn kurzerhand an
den Galgen, wenn er sich dessen weigerte, und niemandem hatte er ob
solcher Schurkerei Rechenschaft abzulegen.
Was diese Edelleute im Mittelalter an dem ihnen untergebenen rechtlosen
gemeinen Volke gesündigt haben, ist zu bekannt, als daß hier weiter
darauf eingegangen werden mußte. Der fromme Cyriacus Spangenberg
sagt in seinem 1561 erschienenen Jagdteuffel: das Sprichwort sage,
ein Edelmann solle vor dem 60. Jahr nicht wissen, daß er eine Seele
und ein Gewissen habe, sonst könne er nicht zu Geld kommen. Die
Jagd wurde immer mehr zu einem Hoheitsrechte, die der Landesfürst
allein sollte ausüben dürfen. Der Grundbesitz des Landesherrn umfaßte
außer dem allodium, dem ererbten Familienbesitz, und dem
beneficium, den Bodenflächen, mit denen ihn einst der Kaiser
belehnt hatte, noch allerlei eingezogene Güter. Auf diesen übte er
allein die Jagd aus, wie auch in den Bannwäldern, die sein Haus
sich mit der Zeit zu verschaffen gewußt hatte. Beständig suchte die
fürstliche Jägerei ihre Rechte zu erweitern und auf alle Reviere
auszudehnen, in denen noch ein Rudel Wild stehen konnte. Schon im Jahre
1499 beschwerte sich beispielsweise die Ritterschaft in Landshut, daß
die fürstliche Jägerei auf den Lehen die hohe Jagd ausübe und auch mit
der kleinen Jagd sich viel zu schaffen mache. Im Jahre 1516 wurde zwar
Prälaten,[S. 574] Edelleuten und den Geschlechtern in den Städten, „da sy
es von alter hergebracht haben“, die Jagd auf Rehe, Wildschweine und
Bären eingeräumt sowie die Niederjagd ausdrücklich zugewiesen, aber
das Hochwild behielt sich der Herzog selber vor. Er setzte damit den
tatsächlich schon vorher bestehenden Unterschied zwischen hoher und
niederer Jagd gesetzlich fest. Und die von ihm angestellten Pfarrer
mußten von der Kanzel herab dem Volke verkünden, daß die Jagd allein
der hohen Obrigkeit gebühre, die Luther als von Gott eingesetzt und
deshalb schon an sich göttlich, d. h. gottähnlich, bezeichnet hatte.
Je mehr die großen Grundbesitzer in ihrer Eigenschaft als Landesherren
erstarkten, um so despotischer traten sie auf, um so weniger nahmen
sie Rücksicht auf das Wohl ihrer Untertanen. Sie dehnten den Wildstand
möglichst aus, um so ausgiebig wie möglich dem Jagdvergnügen zu frönen
und die Jagdküche stets reichlich mit Wildbret zu versehen. Mochte
dabei auch das Wild die Äcker der Untertanen verwüsten und oft in
einer einzigen Nacht die Früchte von des Bauern vielmonatlichem Fleiß
vernichten. Es war ihm nicht einmal erlaubt, auf eigene Kosten seine
Felder gegen die Verwüstungen von seiten des herrschaftlichen Wildes zu
schützen, indem ihm die Errichtung von Zäunen untersagt war. Erst wenn
er nachweisen konnte, daß seine Hufe von Urväter Zeiten her eingezäunt
waren, wurden ihm solche erlaubt. Aber diese mußten so niedrig sein,
daß das Hochwild darübersetzen konnte, so daß also auch sie keinen
Schutz der Flur gewährten.
Wenn irgendwo von einem Herrn ein Wildstand herangezüchtet werden
sollte, so nannte man das „ins Gehege legen“, weil man einst im
Mittelalter die Bannforste durch eine Hecke einzuschließen pflegte,
damit das Wild nicht auswechsle. Mit dem Erstarken der fürstlichen
Macht, die niemand außer sich selbst zu jagen gestattete, hielt man
die Einhegung nicht mehr für erforderlich, da die Untertanen ja doch
kein Wild erlegen durften und es dem Landesherrn willkommen war, wenn
es auf den dem Wald benachbarten Feldern Äsung suchte; dann brauchte
er es nicht zu füttern und sparte sein Geld. Die Besitzer der vom
Fürsten ins Gehege gelegten Felder durften diese nicht bebauen, wie
sie wollten, die Wiesen nicht abmähen und kein Vieh auf sie treiben,
ja in der Satzzeit sie nicht einmal betreten. Half sich etwa ein Bauer
selbst gegen den ihm zugemuteten Wildschaden oder ließ er es sich
gar in den Sinn kommen zu wildern, so wurde er aufs grausamste an
Leib und Gut bestraft. Wie der bereits erwähnte Cyriakus Spangenberg
1561 schreibt, wurden „etlichen unterthanen umb eines Hasen willen
die Augen[S. 575] ausgestochen, hende oder füsse abgehauen, nasen und ohren
abgeschnitten und dergleichen unmenschlichkeiten an inen begangen.
Aber es wolt lang werden, solch’s alles zu erzehlen.“ Und der
Konsistorialrat M. Rebhan in Eisenach meint: „Wie mancher Fürst oder
Edelmann straffet denjenigen härter, der ein Wild umbbracht, als der
einen Menschen ermordet hat.“ Im Jahre 1537 entkam dem Erzbischof
Michael von Salzburg ein angeschossener Hirsch und flüchtete sich in
das Kornfeld eines Bauern, wo er verendete. Statt ihn an seinen Herrn
abzuliefern, behielt ihn der Bauer, der arm war und viele Kinder zu
ernähren hatte. Als der Erzbischof davon erfuhr, ließ er den Mann
sofort fesseln und ins Gefängnis abführen und befahl seinem Richter,
Gericht über ihn zu halten und ihn zum Tode zu verurteilen. Da aber der
Richter, der menschlich mit dem armen Manne fühlte, das Todesurteil
nicht fällen wollte, ließ der Erzbischof den Bauern stracks in das Fell
des vorgefundenen und verzehrten Hirsches nähen und ihn dann vor allem
Volk auf dem Marktplatz von seinen englischen Doggen zerfleischen und
zerreißen, wobei er selbst ins Jägerhorn stieß und sich am Anblick
der Qualen des armen Mannes ergötzte. Gehängt und gevierteilt werden
war sonst die gewöhnliche Strafe für Jagdfrevel. Nur adelige Wilderer
kamen mit sehr hohen Geldstrafen davon. Natürlich hatten die Bauern
dem Herrn schwer zu fronen und ohne Entschädigung nicht nur die
Jagdangestellten, sondern auch deren Pferde und die große Hundemeute
zu füttern und Treiberdienste bei der Jagd zu tun, wobei ihnen in der
grimmigen Winterkälte oft genug die Zehen erfroren. Nach Wagner war im
Herzogtum Württemberg die Jägerei die Hälfte des Jahres unterwegs in
einer Zahl von 30–40 Mann mit ebensoviel Pferden und einem Heer von
Hunden, das sich auf 600 bis 800 Stück belief. Dieser Schwarm legte
sich mit Vorliebe in die Klöster, wo solche noch vorhanden waren,
oder auf die großen Gutshöfe, aus dem einzigen Grunde, weil er sich
da besser aufgehoben wußte als bei den Bauern, die selber nichts zu
beißen hatten und eben für gut genug geachtet wurden, die Hunde für den
Herrn aufzuziehen. Dabei waren diese herrschaftlichen Jagdangestellten
durchaus nicht bescheiden in ihren Ansprüchen und erzwangen sich oft
unter Anwendung von Gewalt eine bessere Bewirtung. So hatte zwar die
Württembergische Jagdordnung bestimmt, daß die Jäger des Morgens eine
Suppe und Brot und des Mittags wie des Abends vier Gerichte, dazu an
Wein 11⁄4 bis 2 Maß pro Mann, der Herr Windmeister aber 5 Maß erhalten
sollten; als aber diese Jagdbediensteten im Kloster Bebenhausen 1607
nur ein Vorgericht,[S. 576] dann Suppe und Fleisch mit süßen Kirschen und
Äpfelschnitzen, nachher gesalzenes Fleisch und Bratwurst und zum
Nachtisch Käse aus Münster, Lebkuchen aus Nürnberg und frisches Obst in
Form von Äpfeln und Birnen zu essen bekamen, beklagten sie sich schwer
bei ihrem Herrn und bekamen in der Folge auch Recht. Künftighin mußten
sie besser bewirtet werden.
Ursprünglich hatte der Königsdienst die Pflicht der Herberge und
Speisung des Gebieters mit seinem ganzen Anhang und Troß mit umfaßt,
weil noch keine Gasthäuser vorhanden waren. Diese Königsrechte gingen
dann auf die Stellvertreter, die Grafen, und in der Folge auf die
Landesherren über, die sich das Recht anmaßten, die Leistungen der
Untertanen selbst zu regeln. Auch alle Steuern gingen einst aus dem
alten Königsdienst hervor und hafteten ursprünglich auf dem Boden und
nicht auf der Person. Erst im 15. Jahrhundert fingen die Landesherren
an, die Steuer auf die fahrende Habe umzulegen. Mit dem Recht der
Steuer übernahmen sie zugleich auch das am Boden haftende Recht der
Atzung und Herberge, das sie dann auf ihr Jagdbedientenpersonal
übertrugen. In Hessen-Kassel ward 1681 noch bestimmt, daß die Städte
und Dörfer, welche durch die Jagden berührt wurden, für das gesamte
Jagddienstpersonal und deren Pferde sorgen sollten. Erst als diese
Gastlichkeit infolge der Begehrlichkeit des Jagdbedienstetenpersonals
zur wahren Landplage wurde, entschloß man sich im 17. Jahrhundert zur
Ablösung derselben durch eine jährliche Zahlung, die beispielsweise für
das Stift Kaufungen seit 1629 500 Taler betrug.
Tafel 63.

Reste einer Reihe alternierender, im anstehenden Kreidekalk
ausgehauener Wildfanggruben der Solutréenzeit bei Laugerie haute in der Dordogne
(Südfrankreich). (Eigene Aufnahme des Verfassers, der in der vordersten steht, um
die noch jetzt vorhandene Tiefe derselben zu zeigen.)

Fürstliche Wasserjagd im 18. Jahrhundert. Nach einem
Stich von J. E. Ridinger (1695–1767).
Tafel 64.
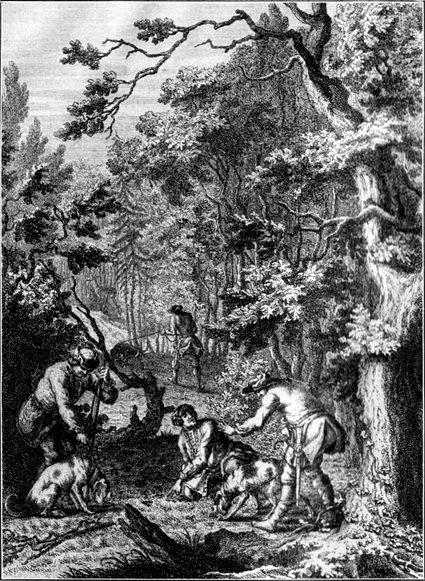
Hirschjagd mit Leithunden. Nach einem Stich von J. E.
Ridinger (1695–1767).

Vogeljagd mit Leimruten und Lockvogel. Nach einem Stich von
J. E. Ridinger (1695–1767).
Aus reinem Egoismus und nicht aus moralischen Bedenken kam es im
16. Jahrhundert an den aufgeklärteren Höfen zur Aufstellung einer
Schonzeit, wenigstens so lange das Wild minderwertig war. So kamen 1521
Hessen und Henneberg mit unter den ersten überein, die Jagd auf Rotwild
„in der Kalbung“ ruhen zu lassen, und diese Einschränkung wurde zehn
Jahre später auf die Zeit von Anfang März bis Anfang Juli erweitert.
Für Mecklenburg ward 1562 eine geschlossene Jagdzeit festgesetzt
und bald folgten ihm darin auch andere Staaten. Aber erst im 17.
Jahrhundert gelangte man allgemein zur gesetzlichen Aufstellung einer
Schonzeit und zur moralischen Verurteilung vor allzu groben Verstößen
gegen weidgerechtes Jagen, wie solches heute als selbstverständlich
geübt wird. Sonst stand die Jagd auch damals noch in sittlicher
Beziehung auf einer recht tiefen Stufe, wie die Herren, die sie übten,
denen das täglich geübte Sichbesaufen die wichtigste Beschäftigung war.
Mit den geistlichen Herren stand es[S. 577] auf katholischer Seite selbst
nach der Reformation nicht besser als mit den weltlichen. Wie der Adel,
so nahm auch die hohe Geistlichkeit noch immer Jagdfalken und Hunde
mit in die Messe, so daß der Gang der gedankenlos heruntergeleierten
heiligen Handlung und der eintönige Gesang der Priester vom Bellen
der Hunde unterbrochen wurde. Auch die Geistlichkeit brachte die
Feiertage mit Jagen zu und hatte oft mehr Jagdhunde als die weltlichen
Landesherrn. Der Übermut der Herren und des von ihnen geschützten
Jagdpersonals kannte keine Grenzen und erlaubte sich gegen die Bauern
und deren Weiber und Kinder Eingriffe, die sich hier nicht wiedergeben
lassen.
Die allgemein geübte Jagdart in Deutschland war das „Jagen am
Zeug“, wobei der betreffende Bezirk so gut wie möglich umgrenzt und
abgeschlossen war, um ein Entweichen des Wildes zu verhindern. Während
aber im Mittelalter außer den Warten vorzugsweise lebende grüne Hecken
mit Schlingen und beutelförmigen Netzen in den Durchgangsöffnungen
Verwendung fanden, wurden im 16. und 17. Jahrhundert neben solchen
vorzugsweise Fallnetze benutzt, die den großen Vorzug hatten, beweglich
zu sein und nach Bedarf an verschiedenen Orten aufgestellt werden zu
können. Nachdem der betreffende Bezirk morgens mit Berücksichtigung
des Windes in aller Stille mit Fallnetzen und Wachen umstellt
war, wurde die Hundemeute auf die vorher bestimmte Fährte gesetzt
und die Treibjagd ging los, indem die Treiber das eingeschlossene
Wild mit den hinter ihm herstürmenden Hunden den Hecken und Netzen
zutrieben. Letztere schlugen als Fallnetze über dem angstvoll einen
Ausweg suchenden Wilde zusammen und hielten es fest, bis die in der
Nähe versteckten Warten es abstechen konnten. Die früher geübte
kunstgerechte Spurjagd war jetzt ausgeschlossen. Die Hunde jagten
nicht mehr nach der Nase, sondern nach den Augen und verfolgten jedes
Wild, das ihnen begegnete, in gleicher Weise, so daß es innerhalb des
sich gegen die scheinbar offene, tatsächlich aber mit Netzen umstellte
offene Seite verengernden Treibergürtels ein wüstes Durcheinander von
einzelnen bellenden, jagenden Hunden und angstvoll flüchtendem Wild
gab. Die Warten waren hinter grünen Schirmen aus Laub innerhalb des
Triebes vor den Fallnetzen versteckt und hetzten, sobald das flüchtende
Wild auf die Netze zukam, ihre Windhunde hinter ihm her, so daß es aus
Schrecken vor diesen und dem Geschrei der Warten in die Netze lief
und hier alsbald abgestochen werden konnte. Um dem Grundherrn, seinen
Damen und Gästen Gelegenheit zu geben, diesen kritischen Moment der
Jagd zu beobachten[S. 578] und sich am Abstechen des wehrlosen Wildes höchst
eigenhändig zu beteiligen, waren neben den Schirmen der Warten mit den
Windhunden auch solche für die hohen Herrschaften errichtet. Stellte
sich ein Hirsch den Hunden, so suchte man ihn zu schießen, wenn er sich
nicht von der Seite her, während ihn die Hunde beschäftigten, erstechen
ließ. Das getötete Wild wurde auf der Stelle zerlegt, das Fleisch
verteilt oder auf bereitstehende Wagen für die Hofküche verladen und
den Hunden die nicht vom Menschen beanspruchten Eingeweide überlassen.
Ein Überlandjagen in Form von Verfolgung des Hirsches zu Pferd
im freien Revier ohne Hecken und Netze war damals in Deutschland
eine große Ausnahme und kam erst im darauffolgenden Zeitalter auf,
während solches in Frankreich noch immer üblich war. Das klassische
französische Werk des 16. Jahrhunderts über die Hetzjagd mit Spürhunden
ist die venerie von Fouilloux. Dieser Autor rechnet zur
venerie nur die Hetzjagd von Hirsch, Reh und Hase, nicht aber die
des Wildschweins, weil letzteres mit Rüden gehetzt werde. Fuchs und
Dachs dagegen wurden statt mit chiens courants mit chiens de
terre gejagt.
Bevor die Jagdgesellschaft zur Hirschhetze aufbrach, hatte sie
gut gespeist und so reichlich getrunken, daß die ganze Jagd in
angeheitertem Zustande vor sich ging. Sie verlief ähnlich der bereits
geschilderten des 14. Jahrhunderts, ebenso die Sauhatz, zu welcher
zahlreiche Hunde bereit gehalten wurden. So erschien 1592 Herzog Julius
von Braunschweig zur Sauhatz an der Oberweser mit nicht weniger als 600
Jagdhunden, Saurüden oder Hatzhunde genannt. Man schätzt die Zahl der
alljährlich den Saujagden zum Opfer fallenden Rüden für Deutschland
allein auf 20000 Stück. Die Schäfer waren in den meisten Gegenden
dazu verpflichtet — natürlich ohne irgend welche Entschädigung —
jährlich je einen Hund zu stellen. Taten sie es nicht, so wurden sie
mit der Wegnahme von fünf Hammeln gestraft. Da man so billig zu den
Hunden kam, wurden sie auch nicht geschont und mit Vergnügen wütenden
Ebern geopfert. Landgraf Philipp von Hessen, der von jedem Untertan
„so Schafe und einen Pferch hat“ alljährlich einen Rüden verlangte und
ihm im Falle des Nichtleistens das Recht zur Schäferei nahm, erlegte
im Jahre 1561 auf den Sauhetzen, an denen er persönlich teilnahm, 1714
Sauen. Der Reinhardtswald allein lieferte ihm 1563 1072 Wildsauen, und
sein Nachfolger, Landgraf Wilhelm, fing 1584 in einem einzigen Jagen
daselbst 133 Sauen. Welch eine Metzelei setzte es ab, eine solche Menge
von Tieren in den Netzen abzustechen, und[S. 579] wie mögen die armen Bauern
geseufzt haben, wenn ihnen diese so zahlreich auftretenden Borstentiere
ihre Äcker verwüsteten. In der Jagd auf die Wildsau war insofern eine
Verfeinerung vom Mittelalter bis zum 16. Jahrhundert eingetreten, als
die Bracke, die damals auch zur Sauhatz verwendet wurde, als zu edel
dafür galt und man sich dabei meist mit minderwertigen Hunden behalf.
Eine wichtige Rolle spielte auch die Jagd auf den Wolf, für dessen
Vertilgung die Bauern ihrem Herrn eine besondere Steuer bezahlen mußten.

Bild 60. Sauhatz. Der Mann zu Fuß bedient sich der
Saufeder zum Abstechen des Ebers. (Nach einem Holzschnitt von Jost
Ammann in „Das neuw Jag und Weydwerck Buch“, Frankfurt 1582.)
Die Hatzjagd auf Hasen wurde von dem deutschen Adel mit Windhunden
geübt, während in Frankreich die allerdings feinere Jagd mit Spürhunden
bevorzugt wurde. Sie machte im allgemeinen auch mehr Freude als
die Hirschhetze, da man die Hunde besser sah und diese auch mehr
zusammenhielten. Die Hasenmeute betrug 12 bis 16 Hunde und war
gewöhnlich zahlreicher als die Hirschmeute. Sie arbeiten zu sehen
war wie im Mittelalter das Entzücken derer, die sich den echten[S. 580]
jägerischen Geist bewahrt hatten, wie er im 12. bis 14. Jahrhundert in
Frankreich wie in Deutschland herrschte. Die Technik dieser Jagd war
ebenfalls ähnlich derjenigen des Mittelalters.
Um die Mitte des 16. Jahrhunderts verdrängte die Büchse die Armbrust,
besonders seitdem 1517 in Nürnberg das Radschloß erfunden worden war,
das die Lunte überflüssig machte. Sie hieß auch Pirschrohr und danach
nannte man die Jagd, bei welcher man sich ihrer bediente, im Gegensatz
zum Hetzen Pirschjagd. Doch war sie im allgemeinen wenig beliebt und
galt nicht für weidmännisch. Nichtsdestoweniger brach sie sich mehr und
mehr Bahn, weil sie billiger war als die mit jagenden Hunden. So fand
sie besonders an kleineren Höfen zuerst Eingang. Landgraf Wilhelm von
Hessen erlegte 1582 durch Pirschen 345 Stück Wild und nur 307 durch
Jagen. Auch der Schrotschuß taucht bereits im 16. Jahrhundert auf; 1556
wird er zuerst erwähnt.
Beim Pirschen auf Rotwild trat alsbald nach dem Schusse der Bluthund in
Aktion, indem er, von der Leine gelöst, das Wild verfolgte und, wenn
er es eingeholt hatte, zu packen und niederzureißen versuchte. Da in
dem vom deutschen Geistlichen Johannes Colerus um 1600 in Wittenberg
herausgegebenen lateinischen immerwährenden Kalender Leit- und Bluthund
stets zusammen genannt werden, muß man annehmen, daß der Leithund
damals auch zur Blutarbeit verwendet wurde. Wegen dieser Bestimmung
sollte er groß und stark sein, damit er das Wild niederreißen konnte.
So wurde er wie die Jagdhunde im allgemeinen mit Windhund- und
Doggenblut gekreuzt, und so entstand eine starke Spürhundrasse wie
sie mit zuerst das Neue Jagd- und Waidwerkbuch von Feyerabend 1582
auf Seite 11 zeigt. Auch die Bilder von Jost Ammann zeigen uns solche
durch Kreuzung erzielte auffallend große Jagdhunde. Aus diesen schweren
Spürhunden entstand dann der schwere Typ der deutschen Vorstehhunde,
wie er sich an manchen Orten bis in die zweite Hälfte des 18.
Jahrhunderts erhielt.
In dem Maße wie der Adel durch das Regal des Landesfürsten das Recht
der Jagd verlor, schwand auch die Falkenbeize, die sich im Mittelalter
durch die Begeisterung des Ritterstandes so hoch erhoben hatte. Solange
das Kornfeld, das der Reiterzug bei der Falkenbeize durchjagte, dem
Bauern gehörte, hatte der Adel keinen Anstoß an dieser Art Jagd
genommen; nun aber das Korn sein eigen war und durch die Leibeigenen
gepflanzt wurde, wurde er andern Sinnes und wollte seine Felder
geschont wissen. Er hatte auch keine Lust mehr dazu, den[S. 581] Tag am Hofe
zu verbringen und mit seinen Falken zu vertändeln, mußte vielmehr auf
seinem Gute nach dem Rechten sehen und seine Hörigen beaufsichtigen,
damit sie gehörig für ihn arbeiteten. Auch hatte die Küche wenig Nutzen
von der Falkenbeize, die viel Geld kostete, nicht nur für die Zähmung
und den Unterhalt der Falken, sondern auch für die selten gewordenen
Reiher, die künstlich im Reiherhaus aufgezogen werden mußten, wenn bei
Bedarf kein Mangel daran vorhanden sein sollte.
An Stelle der deutschen Ordensherrn von Marienburg hatten die Könige
von Dänemark die Lieferung von Falken übernommen, mit denen sie die
meisten Höfe, die sich diesen Luxussport noch leisteten, zu versorgen
pflegten. Alljährlich sandten sie ein Schiff nach Island und ließen
von dort die geschätzten weißen Wanderfalken holen, die sie durch ihre
Falkner an die Höfe verteilen ließen, wobei diesen für jeden Falken
eine Gabe von 12–16 Talern ausgehändigt wurde. Die hessischen Fürsten
erhielten jedes Jahr durchschnittlich sechs Falken zu ihrem ziemlich
großen Bestand, für dessen Unterhalt die Falkner ungefragt auf den
Dörfern die erforderlichen Hühner und Tauben selbst nehmen durften.
In andern Herrschaftsgebieten war der Taubenzehnte eingeführt, der in
Hessen im Jahre 1703 in eine feste Abgabe von 400 Tauben umgewandelt
wurde. Landgraf Moritz von Hessen-Darmstadt untersagte 1593 seinen
Untertanen ganz die Jagd mit den Falken, „dass wir selbsten unsere
Lusten damit gern haben wollten.“ Auch am Hofe zu Kassel wurde die
Falkenjagd nach dem Dreißigjährigen Kriege wieder eingeführt; sie
hielt sich dort bis ins 18. Jahrhundert. In Württemberg dagegen
ging die Beize schon mit dem 17. Jahrhundert zu Ende und ward 1714
gänzlich abgeschafft. Der Reiher wurde nicht mehr gehegt, sondern zum
Raubvogel erklärt, und 1726 wurde ein Preis auf seinen Kopf gesetzt. So
kehrte die Jägerei zur alten Jagdweise der Markgenossen, zum Habicht
und Sperber der Volksrechte zurück. Sie kaufte die Beizvögel von
umherziehenden Falknern, fing sie wohl auch selber mit Schlaggarnen
am Finkenherd ein, wenn sie auf die Lockvögel stießen, selten zog
sie selbst Nestlinge auf, weil dies sehr beschwerlich war. Allgemein
im Brauch war noch die Hasenbeize. Dabei suchten 2–3 Stöberhunde das
Feld nach Hasen ab, während der Jäger mit dem Vogel auf der Hand zu
Pferde folgte. Am Riemen wurden einige Windspiele mitgeführt, die dann
dem ergriffenen Hasen, dem vom Raubvogel zuerst die Augen ausgehackt
wurden, den Garaus machten. Auch auf das Feldhuhn wurde der Habicht
gern geworfen. Wie ein Pfeil[S. 582] schoß er hinter der Hühnerkette her und
griff ein Huhn heraus. Die andern ließen sich vor Schreck zu Boden
fallen und lagen nun so fest, daß der Hund sie greifen oder der Jäger
mit der Hand sie aufheben konnte.
Im 18. Jahrhundert besaß der große Grundbesitz unbeschränkte Macht.
Mit Verachtung sah er auf alle Bürgerlichen und noch vielmehr auf
die leibeigenen Bauern herab, mit denen er in der gewissenlosesten
Weise verfuhr und sie auf das schamloseste ausbeutete. Zäune zur
Abhaltung des sich stark vermehrenden Wildes von den Äckern waren
verboten oder, wo sie, wie beispielsweise in Sachsen von 1775 an „aus
Landesmütterlicher Vorsorge“ den Untertanen gestattet waren, durften
sie nur um Kohl- und Obstgärten gezogen werden und mußten so nieder und
die einzelnen Pfähle oben stumpf sein, daß das Rotwild darübersetzen
und sich dabei nicht verletzen konnte. Einzig das Schwarzwild wurde
dadurch abgehalten. Im Jahre 1718 erließ der Herzog von Württemberg
das Reskript, daß alle Zäune seines Landes mit Ausnahme der Zäune
an der Landesgrenze niedergelegt werden sollten. Den Bauern wurde
untersagt, auf ihren eigenen Gütern das Laub zusammenzurechen und die
Eicheln aufzulesen, damit sie dem Wilde als Lagerstatt und Futter
dienen konnten. Auch Hunde durfte der Bauer nicht fortlaufen lassen
oder gar zum Verscheuchen des Wildes von seinen Äckern verwenden. In
ganz Württemberg war während des 18. Jahrhunderts das Halten von Hunden
überhaupt verboten. So blieb dem Bauern, der etwas ernten wollte,
nichts anderes übrig, als selbst oder durch seine Familienangehörigen
den ganzen Tag und die Nacht hindurch die Felder zu bewachen, damit
das Wild, besonders die Sauen, dieselben nicht verwüsteten. So mußten
allein in Sachsen Nacht für Nacht 4000 Menschen wachen, damit der
despotische Landesvater gelegentlich auf die Jagd gehen konnte. Auf das
heutige Deutschland übertragen, mußten für die Bewachung der Felder in
der Nacht wenigstens 68000 Menschen allnächtlich ihren Schlaf opfern,
und diesen schweren Dienst mußten die größtenteils von der Fronarbeit
am Tage ermüdeten Leute vielfach bei Regen und Kälte verrichten. Das
Rotwild, dessen Bestand von Seckendorf 1656 für Sachsen auf 3000
Stück geschätzt wurde, durchstreifte truppweise die Felder, wenn
das Getreide reifte, und machte sich daselbst bequeme Lagerstätten.
Von den Sauen aber, deren Sachsen nach derselben Schätzung damals
etwa 6000 aufwies, lag etwa ein Drittel beständig auf den Feldern,
unbeachtet der niederen Zäune, die sie mit Leichtigkeit zu überspringen
vermochten.[S. 583] So schreibt ein anonymer Sachse 1799 in einer Schrift
über die Schädlichkeit der Jagd: „Wer die Gegenden an der Elbe,
z. B. von Dresden bis Wittenberg, von Torgau bis Wurzen, wie auch die
Gegend von Colditz, Annaberg usw. durchreitet, der wird in den dortigen
Feldern, wenn er die von diesen Tieren vernichtete Hoffnung des armen
Landmannes sieht, sich selbst zum Jammer und Mitleid gerührt fühlen
und die Stimme der fröhlichen Jäger vor den Klagetönen der über ihren
Verlust Jammernden nicht hören können. — Im Jahre 1777 reisete ich in
das Erzgebirge nach Elterlein, einem Städtchen, welches unweit Annaberg
liegt. Hier sprach ich unter andern Einwohnern auch den Stadtrichter.
Dieser Mann zeigte mir eine schriftliche Taxe, welche einen Verlust
von 5000 Talern betrug, den die wilden Schweine nur diesem kleinen
Städtchen zugefügt hatten.“ Und Franz Philipp Florinus schreibt in
seinem 1751 in Nürnberg erschienenen Oeconomus prudens vom
Rotwild: „Im Sommer liegt es bei nächtlicher Weile im Getreide und
läßt sich von den Wachfeuern und dem Geheul der Bauern fast wenig
abschröcken, maßen, sobald es aus einem Samen herausgetrieben wird,
gleich in den nächsten und besten hineingehet.“
In Württemberg war es nicht anders. Schon im 17. Jahrhundert wollten
die Klagen über den Wildschaden nicht aufhören. Wenn diese zu laut
wurden, ließ der Herzog etwa eine Hetze abhalten und zwang die Bauern,
ihm das Wildbret, für das er keine Verwendung hatte, zu teurem Preise
abzukaufen und selbst zu essen. Der Wildstand im damaligen Württemberg
betrug rund 9000 Stück Edelwild und 2000 Sauen. In der Zeit von
1770–1790 wurden durchschnittlich 3300 Stück Rotwild und 1100 Sauen
jährlich bei den Hofjagden erlegt. Die Hofküche aber brauchte (nach
einer Berechnung vom Jahre 1679) nur etwa 300 Stück Rotwild und 350
Sauen. Setzen wir auch den Bedarf für den oben erwähnten Zeitabschnitt
auf 1000 Stück, so blieben immer noch 3400 Stück für den Zwangsverkauf
an die Untertanen übrig, der für eine flüssige Rente galt. Die Zustände
in Württemberg zur Zeit des Herzogs Karl Eugen, der 1744 die Regierung
übernahm, schildert der Prälat Johann Gottfried Pahl. Vom Gelde der
von den Höflingen mißhandelten und ausgesaugten Bauern ließ der
Herzog kostspielige Bauten herstellen, Opern aufführen, zu denen die
Vorbereitungen einen Aufwand von 100000 Gulden erforderten, glänzende
Geburtstagsfeste in Form von „Festinjagden“ veranstalten, die bald
in dieser, bald in jener Gegend des Landes veranstaltet wurden und
300–400000 Gulden verschlangen. „Da erschien[S. 584] alles im höchsten Glanze,
es wurden die prächtigsten Schauspiele und Ballette gegeben; Veronese
brannte Feuerwerke ab, die in wenigen Minuten eine halb Tonne Goldes
verzehrten. Der ganze Olymp war versammelt, um den hohen Herrscher
zu verherrlichen, und die Elemente und die Jahreszeiten brachten ihm
ihre Huldigungen in zierlichen Versen dar. Der Herzog liebte diese
Art von Vergnügen ebenso leidenschaftlich, als er andererseits der
kostspieligen Baukunst frönte. Ein zahlreiches Korps von höheren und
niederen Jagdbedienten stand ihm zu Gebote. Seiner Nachsicht gewiß,
durften sie sich die rohesten Mißhandlungen und die schreiendsten
Ungerechtigkeiten gegen den seufzenden Landmann erlauben. Man zählte
in den herrschaftlichen Zwingern und auf den mit dieser Art von
Dienstbarkeit belasteten Bauernhöfen über tausend Jagdhunde. Das Wild
ward im verderblichsten Übermaße gehegt. Herdenweise fiel es in die
Äcker und Weinberge, die zu verwahren den Eigentümern streng verboten
war, und zerstörten oft in einer Nacht die Arbeit eines ganzen Jahres;
jede Art von Selbsthilfe ward mit Festungs- und Zuchthausstrafe gebüßt,
nicht selten gingen die Züge der Jäger und ihres Gefolges durch
blühende und reifende Saaten. Wochenlang wurde oft die zum Treiben
gepreßte Bauernschaft, mitten in dem dringendsten Feldgeschäfte ihren
Arbeiten entrissen, in weite, entfernte Gegenden fortgeschleppt. Ward,
was nicht selten geschah, eine Wasserjagd auf dem Gebirge angestellt,
so mußten die Bauern hierzu eine Vertiefung graben, sie mit Ton
ausschlagen, Wasser aus den Tälern herbeischleppen und so einen See
zustande bringen. — Um den Glanz zu vermehren, hatte man eine große
Menge fremden Adels ins Land gezogen. Es wimmelte von Marschällen,
Kammerherren, Edelknaben und Hofdamen; mehrere von ihnen genossen
große Gehalte. In ihrem Gefolge erschien ein Heer von Kammerdienern,
Heiduken, Mohren, Läufern, Köchen, Lakaien und Stallbedienten in den
prächtigsten Livreen. Zugleich bestanden die Korps der Leibtrabanten,
der Leibjäger und der Leibhusaren, deren Uniformen mit Gold, Silber und
kostbarem Pelzwerke bedeckt waren...“ Diese Gesellschaft benahm sich
den für halbe Tiere gehaltenen Bauern gegenüber skandalös und verführte
mit Vorliebe deren Töchter, ohne an das Bezahlen von Alimenten für die
nicht ausbleibenden Kinder zu denken. Allein für die von ihm selbst
gestifteten Kinder bezahlte der Herzog Karl Eugen großmütig „ein für
allemal“ 50 Gulden, und seine Geliebten hatten das viel beneidete
Vorrecht, blaue Strümpfe tragen zu dürfen.
[S. 585]
Auch der fromme Herzog Ernst Ludwig von Hessen hatte, wie alle Fürsten
Mitteleuropas, sein Land in einen Wildpark verwandelt, um der Jagdlust
zu frönen, mochten auch die fronenden Bauern in Armut und Elend
verkommen. Von den vielen Nachtwachen, die die Leute jahraus, jahrein
leisten mußten, um das Wild von ihren Feldern abzuhalten, schliefen
sie beim Gottesdienst ein, worüber sich die Pfarrer beklagten. Das war
die Zeit, da die Fürsten, auch geistliche Herren, wie der Bischof von
Münster, ein Bernhard von Galen, ihre Untertanen für durchschnittlich
155 Mark an auswärtige Regierungen als Soldaten verkauften, damit diese
mit ihnen ihre Kriege führen konnten. Viele Tausende mußten so zwecklos
in fremdem Lande verbluten. Bei Culloden entschieden die Hessen den
Untergang der Stuarts, und Marlborough wie sein Gegner Villeroi fochten
meist mit deutschen Truppen gegeneinander. Der Erzbischof Karl hatte
dem Herzog Philipp mit Deutschen den spanischen Thron bestritten, und
bevor die Angelegenheit geregelt war, verbluteten 400000 Menschen auf
dem Schlachtfelde.
Bei der unmenschlichen Behandlung und der Nutzlosigkeit aller Arbeit
infolge der Übergriffe des Landesfürsten kamen viele der Bauern aus Not
dazu, zu wildern, um sich überhaupt am Leben zu erhalten. Sie taten
dies aus Verzweiflung und Auflehnung gegen die grausame Herrschaft,
die ihnen beständig das größte Leid zufügte, obschon sie im Falle
des Erwischtwerdens mit den härtesten Strafen bedroht waren, so im
gelindesten Falle mit etlichen Jahren Zwangsarbeit in Ketten, bei
Wiederholung mit Abhauen der rechten Hand, beim dritten Male aber mit
dem Galgen zu büßen hatten. Oft wurden Bauern, wenn sie nur mit einer
Büchse in einem Gehege angetroffen wurden, ohne große Untersuchung
mit kurzem Prozeß binnen 24 Stunden gehängt. Wer dem Wilde verlarvt
nachging, wurde kurzerhand in der Verlarvung aufgehängt. Hessen hatte
1613, Preußen 1728 angeordnet, daß die überführten Wilderer ohne
Gnade aufzuknüpfen seien. Der Herzog von Württemberg bestimmte 1737
als Strafe derer, „welche diebischer Weise Wild geschossen haben“,
das Abhauen der rechten Hand, mindestens aber öffentliche Arbeit „mit
aufgesetzter Wildererkappe auf Lebenszeit“, bei Rückfall Aufhängen am
Galgen. Diese Wildererkappe, die dem zur Schanzarbeit Verurteilten
an den Kopf geschlossen wurde, war ein grauenvolles Marterwerkzeug,
das aus einem eisernen Reifen mit einem schweren Hirschgeweih daran
bestand. Der Landesvater von Weimar verfügte 1751, „daß alle Wilderer
als offenbare Straßen[S. 586]räuber und Mörder angesehen und auf Betreten
sofort aufgehängt, deren Weiber gebrandmarkt und ins Zuchthaus
gesetzt werden sollen, daß ein Förster oder Jäger, der einen Wilddieb
totschießt, 50 Taler verdient, während seine Witwe, falls er selbst
totgeschossen wird, lebenslänglich 200 Taler Pension erhält, daß aber
ein Jäger, der den Wilddieben durch die Finger sieht, selbst aufgehängt
wird“. 1761 wurde in Württemberg eine Belohnung von 20 Gulden für einen
toten und 30 Gulden für einen lebenden Wilddieb, der alsbald aufgehängt
wurde, ausgeschrieben. Am findigsten waren die Fürsten, die das
einträgliche Geschäft des Menschenhandels trieben. So schloß der Herzog
von Württemberg 1716 einen Vertrag mit der Republik Venedig ab, wonach
alle Sträflinge, auch die Wilderer, die mit dem Leben davonkamen, auf
die Galeeren verkauft wurden. So brachten die Kerls noch Geld ein und
man war sie los! Das Reskript wurde in feierlicher Stunde nach dem
Gottesdienst mit salbungsvoller Stimme von den Kanzeln verkündet.
Während die Bauern so unmenschlich strenge bestraft wurden, kam der
Adel beim Wildern mit Geldstrafen davon. Diese waren beispielsweise
in Preußen gepfeffert und betrugen 1720 500 Taler für einen Hirsch
oder für eine Wildsau; davon erhielt der Angeber den vierten Teil. In
dem Vertrage zwischen Hanau und Frankfurt a. M. vom Jahre 1787 wurde
die Denunziantengebühr auf den dritten Teil der Geldstrafe bemessen
und damit der Verrat zu einem einträglichen Gewerbe ausgebildet. In
der Jagdordnung Josefs II. von 1786 wurde dem „Entdecker eines
Wildschützen“ 12 Gulden und dem „Einbringer“ eines solchen 25 Gulden
Belohnung zugesichert. Diese Jagdordnung war übrigens als ein großer
Fortschritt zu begrüßen, indem darin die Vorrechte der Krone aufgehoben
wurden. Wenigstens das Schwarzwild wurde auf Tiergärten beschränkt und
das Recht zum Abschuß freier Sauen jedem Menschen zugesprochen. Für
den Fall, daß sich der Jagdinhaber diesem Abschuß widersetzen sollte,
verfiel er in eine Strafe von 25 Dukaten. Das Betreten angebauter
Grundstücke wurde verboten, die Einzäunung derselben dem Bauern
freigestellt, und zwar in jeder Höhe. Dem Jagdinhaber aber wurde das
Wild unter Abschaffung einer Schonzeit als sein unbeschränktes Eigentum
freigegeben, er aber zugleich für Wildschaden ersatzpflichtig gemacht.
Damit begann die Morgenröte einer neuen Zeit, die gerechter als die
vorhergehende die allgemeinen Menschenrechte, die die französische
Revolution proklamierte, vertrat.
[S. 587]
Am Ende des 18. Jahrhunderts waren aber sonst in keinem andern Staate
so vorsorgliche Bestimmungen getroffen, wie von dem edeldenkenden Josef
II. Dieses ganze Jahrhundert hindurch waren die Jagdfronen noch
im Steigen begriffen, denn statt 500–700 Mann wie im 17. Jahrhundert
wurden jetzt ebensoviel Tausende zum Zusammentreiben des Wildes aus
ihrer Häuslichkeit herausgerissen, um ganze Wochen hindurch ohne irgend
welche Entschädigung, ja unter Vorschrift der Selbstbeköstigung, im
Walde zuzubringen und das Vergnügen eines Tages für die Hofgesellschaft
vorzubereiten. Zur Massenschlächterei von Hochwild gesellte sich
diejenige von Hasen, wie denn zu Stammheim in Württemberg am 20.
November 1756 ein Kesseltreiben abgehalten wurde, das eine Ausdehnung
von 91⁄2 Meilen hatte, drei Tage dauerte und gegen 4600 Mann in
Anspruch nahm. Zu den Treiberdiensten kamen die Jagdfuhren, der
Wegebau, die Zaunarbeit, das Futtersammeln und der Wildfang. Zu
letzterem gehörten auch die Wolfsjagden, die am schwersten auf dem
Volke lasteten und wofür auch die Städter zu bezahlen hatten. Es kam
oft vor, daß die Bedienten des Landesherrn einerseits die Geldabgabe
bezahlen ließen und andererseits die Leute trotzdem zwangen, bei der
Wolfsjagd zu erscheinen, ansonsten sie gebüßt wurden. Und wer von
ihnen frühmorgens beim Apell nicht anwesend war, der wurde als fehlend
angesehen, auch wenn er den ganzen Tag anwesend war und mithalf. Dabei
mißhandelten die übermütigen Dienstleute die Bauern in einer Weise, daß
es einem heute noch beim Lesen solcher Gemeinheiten die Schamröte ins
Gesicht treibt.
Die Pflicht der Untertanen, die fürstliche Jägerei zu beherbergen und
zu verpflegen, kam im 18. Jahrhundert mehr und mehr außer Übung, weil
der gesteigerte Verkehr Gasthäuser geschaffen hatte, in denen die
Jäger nächtigen und sich an Speise und Trank stärken konnten. Auch
hier hatte wie bei der Wolfsjagd eine Geldablösung stattgefunden.
So kam in Württemberg zwischen dem Fürsten und dem Kirchenrat 1777
ein Vertrag zustande, wonach gegen eine jährliche Zahlung von 12002
Gulden die Klöster von den Besoldungsbeiträgen für die Jägerei, von
Kostgeld und Pferdefutter, von der Pflicht, das Jagdzeug, die Seilwagen
und Jagdschirme zu unterhalten, die Hunde zu ernähren usw. befreit
wurden. Den Gemeinden ward 1714 die Verpflichtung auferlegt, beim
Dachsgraben die Hunde zu füttern, und, wo sie nicht abgelöst war, blieb
auch die Hundelege in Kraft, wie denn z. B. im Uracher Forst jeder
steuerpflichtige Untertan, der keinen[S. 588] Hund in Pflege hatte, zu einer
jährlichen Abgabe von 3 Gulden 20 Kreuzern gezwungen wurde. Vielfach
ließen die Jäger des Landesherrn aus eigener Machtvollkommenheit
ihre eigenen Hunde an Stelle der herrschaftlichen von den Untertanen
aufziehen; andere ließen sich heimlich die Pflicht der Hundelege gegen
bares Geld abhandeln und stellten den Hund bei einem Bürger ein, der
nicht bezahlen wollte. Wieder andere trieben einen heimlichen Handel
mit den Hunden ihres Landesherrn. Vielfach suchten die Forstbeamten die
Pflichten der Untertanen noch auszudehnen und die Strafen zu erhöhen.
Dabei nahmen sie den dritten Teil der Strafgelder als sogenannte
„Ruggebühr“ ein. Man kann sich denken, welchen Gebrauch sie von solcher
Vollmacht machten, um sich möglichst zu bereichern. Auch den Müllern
wurde am Ausgang des 17. Jahrhunderts an Stelle der Pflicht zur
Schweinemast die noch lästigere Pflicht des Fütterns der Jagdhunde des
Landesherrn aufgebürdet. Die Leineweber dagegen mußten die Leinewand
für das Jagdzeug zu einem billigen Preise anfertigen. Es handelte sich
dabei meist um große Beträge; allein das kleine Hessen-Kassel hatte
einen jährlichen Bedarf von 1600 Ellen. Außerdem mußte jeder Jude
alljährlich 1000 Federn für die Federlappen liefern.
In dieser Zeit der unbeschränkten Macht des großen Grundbesitzes
ward der weidgerechten Ausübung der Jagd eine erhöhte Aufmerksamkeit
geschenkt. Vor allem wurde teilweise schon in der zweiten Hälfte des
17. Jahrhunderts, ziemlich allgemein aber im 18. Jahrhundert eine
Schonzeit des Wildes eingeführt. Dabei war der Gedanke maßgebend, daß
während einer solchen das Wild sich fortpflanzen, heranwachsen und
feist werden sollte, damit der jagdliche Ertrag ein möglichst großer
sei. Viele Landesherren aber, so vor allem derjenige von Württemberg,
hielten sich nicht an die von ihnen hierüber aufgestellten Bestimmungen
und arrangierten zu jeder Jahreszeit, wenn es ihnen gerade einfiel,
ihre mit Massenschlächtereien verbundenen Jagdfeste. In manchen
Territorien aber hielt man strenge auf die Einhaltung der Fristen.
So setzte Hessen-Darmstadt 1776 eine Strafe von 50 Dukaten für das
Erlegen eines Hirsches in der Schonzeit fest; beim zweitenmal ward
die Strafe verdoppelt und beim drittenmal das Recht zur Ausübung der
Jagd aberkannt. Weimar schloß die hohe Jagd am 1. Dezember, Magdeburg
Mitte, Hessen-Darmstadt Ende Februar, in Mainz dagegen hörte die
Hirschjagd schon Ende Oktober auf. Auch in der kleinen Jagd begann man
vielfach dem Wild eine kurze Ruhepause zu lassen, so in der Rheingauer
Forstordnung dem[S. 589] Hasen die Zeit vom 16. März bis 24. August, den
Rebhühnern vom 2. Februar bis 10. August.
Trotzdem die von Frankreich übernommene Parforcejagd gerade im 18.
Jahrhundert an manchen deutschen Höfen zur Einführung gelangte,
tauchte andererseits als große Neuerung im Jagdbetrieb das mehrfach
wiederkehrende Verbot der Hetzjagd auf, hervorgerufen durch die
schärfere Ausbildung des Regals und die Ruhe des herrschaftlichen
Wildes. Um die jagenden Hunde den fürstlichen Revieren fernzuhalten,
wurden alle andern als die fürstlichen Jagdhunde „ein für allemahl
abgeschafft“ — so im Rheingau 1737 —, bloß Schweißhunde gestattet,
und diese sollten nur am Riemen für verwundetes Wild Verwendung finden.
Nach wie vor war aber das Hetzen des Wildes quer über die Felder
der Bauern, auch im Frühjahr, dem Adel gestattet. Nur dieser durfte
überhaupt neben dem Landesherrn noch Hunde zur Jagd halten.
Zu Anfang des 18. Jahrhunderts kamen die zünftigen Weidesprüche
außer Gebrauch und dafür wurden für die Jagdbediensteten Uniformen
eingeführt, für die Bürgerlichen mit Silber, für die Adeligen dagegen
mit Gold durchwirkt.
Die Pirsch- und Parforcejäger, wie auch die Falkner, hatten ihre
besonderen Abzeichen. Neben dem Weidmesser kam der Hirschfänger auf.
Die alte Form des Hift- oder Jägerhornes hatte sich, seitdem es üblich
geworden war, es aus Metall zu verfertigen, in verschiedene Unterformen
gespalten.
Der Großtuerei der Zeit entsprechend wurden die Jagden im größten
Maßstabe abgehalten. Am beliebtesten war das sogenannte Hauptjagen,
bei welchem eine Vorbereitung von einigen Wochen, ja Monaten nötig
war. Tausende von Bauern wurden für diese Zeit zum Zusammentreiben des
Wildes aus großem Umkreis ohne irgend welche Entschädigung, vielmehr
mit der Verpflichtung der Selbstbeköstigung, angestellt. Das Anlegen
der Treiberlinien leiteten die Besuchknechte, die frühmorgens mit
dem Leithunde den besten Wildstand, worunter namentlich jagdbare
Hirsche, d. h. solche von zehn und mehr Enden, ermittelten und nach
dem Ergebnisse ihrer Suche die nötigen Anordnungen zur Jagd trafen.
Das Wild wurde von allen Seiten her zusammengetrieben, bis das Revier
so klein geworden war, daß Lappen, Netze und Zeuge hinreichten, um es
einzustellen. Die Treiber hatten Tag und Nacht zu wachen, daß das Wild
nicht ausbrach, bis die nötige Arena zu seiner Abschlachtung durch den
Landesherrn von andern fronenden Bauern errichtet war. Diese bestand
aus[S. 590] drei Teilen, dem Zwangtreiben, der Kammer und dem Lauf. Es waren
breite, rings von hohen Tüchern eingefaßte Gänge. Mitten in der Arena
war den hohen Herrschaften ein mit grünem Laub und Girlanden verziertes
Bretterhaus gebaut, von dem aus sie dann das Wild ohne die geringste
Gefahr für sich selbst abschießen konnten. War dies alles errichtet,
so wurde der Landesherr davon benachrichtigt und kam mit großem Troß
zum Abstechen des Wildes, das immer wieder durch die Treiberlinien
durchzubrechen versuchte und deshalb seinen Hütern viel zu schaffen
machte. Aus dem ganzen Lande wurden die herrschaftlichen Hunde durch
die Rüdenknechte und Hundejungen aus ihren Pensionaten in den Dörfern
und Städten abgeholt und durch fronende Bauern nach der Stätte des
Hauptjagens gefahren oder in bequemen Tagemärschen zu Fuß dahin
geführt, um an der Jagd teilzunehmen.
Der Hof fuhr an dem für das Hauptjagen bestimmten Tage mit großem
Gefolge auf den Laufplatz und verabschiedete hier die Wagen, um mit
ihren Gewehren die sichere Bretterhütte in der Arena zu besteigen.
Hinter derselben waren die Kammer- und Leibhunde aufgestellt, während
die andern Fanghunde vor dem die Kammer vom Lauf trennenden Quertuche
ihren Posten fanden. Vom Oberjägermeister und dessen Stellvertreter
wurde durch Öffnen des Quertuches nach Belieben Wild vor die
Herrschaften hereingelassen, damit sie es in aller Bequemlichkeit mit
Musikbegleitung abschießen konnten. Dabei wurden unterschiedslos junge
wie alte, weibliche wie männliche Tiere auf meist qualvolle Weise zu
Tode gebracht. Auf die krank Geschossenen und zu Tode Geängstigten
wurden zur Abwechslung Hunde gehetzt und Schwärmer unter sie geworfen.
Da sie sich nicht flüchten konnten, drängten sie sich zitternd in die
Winkel. Schließlich wurde zum Augenschmaus der Fürstlichkeiten durch
hineingelassene Jäger ein allgemeines Gemetzel unter ihnen angerichtet.
Einem ersten folgte ein zweites, drittes, ja oft viertes Gemetzel,
wobei viele hunderte von Tieren vorgetrieben und langsam abgetan
wurden. Zum Schluß fand ein prunkvolles Essen statt, das bis in die
Nacht dauerte und schließlich in Völlerei ausartete, wobei sehr grobe
Späße getrieben wurden. Am folgenden Tage wurde das zuvor aufgebahrte
Wild von den Jägern zerwirkt und in Fässern eingesalzen, um dann an die
Untertanen verkauft zu werden. Die fronenden Bauern aber brachen die
Tücher, Netze, Federlappen und Zelte ab und hatten die Hunde wieder
ihren Kostgebern zuzuführen.
[S. 591]
Weniger kostspielig als solche Hauptjagen waren ähnliche, aber nur
ebensoviel Tage als jene Wochen heischende, die man Bestätigungsjagen
nannte. Zu diesen wurden nur die Bauern der nächstliegenden Dörfer zum
Treiben aufgeboten. Die Hunde jagten das zusammengetriebene spärlichere
Wild in der Kammer und auf dem Lauf umher, bis die Herrschaften es
zusammengeschossen hatten. Noch einfacher und billiger waren die
eingestellten oder Kesseljagen, die in einem Tage bewerkstelligt
werden konnten, indem man einen Waldteil, in welchem Wild steckte, mit
Netzen umstellte. In den umstellten Bezirk begaben sich dann die hohen
Herrschaften mit den losgelassenen Hunden, um hier mit Schießen und
Stechen zu wüten und ein allgemeines Blutbad anzurichten. Wurden die
Netze fängisch gestellt, damit das Wild in die Netze fallen sollte, um
darin mit Flinten und Messern getötet zu werden, so nannte man solch
„ergötzliche Jagd“ Netzjagen.
Zur Augenweide der hohen Herrschaften wurden auch, wie im alten Rom,
mit Vorliebe Tierkämpfe arrangiert, bei welchen man die Kampflust der
betreffenden Tiere durch Schrecken mit dazwischen geworfenen Schwärmern
zu wecken versuchte. Nutzte das nicht, so ließ man große Hunde unter
sie, um sie durcheinander zu jagen und zu neuem Kampfe zu reizen.
Von berittenen Jägern mit 4–5 Meuten von je 8–10 Hetzhunden wurden die
Streifjagen auf Schwarzwild abgehalten, wobei die Herrschaften zu Wagen
gefahrlos zusehen konnten. Weniger beliebt war die alte Treibjagd,
wie auch Birsch und Anstand. Auch die an manchen deutschen Höfen
eingeführte Parforcejagd erfreute sich im allgemeinen nur geringer
Sympathie, da das angestrengte Reiten den bequemen Herrn nicht recht
paßte. Zudem erforderte sie einen großen Aufwand, den sich nur größere
Höfe leisten konnten. So kostete sie den Höfen von Hessen-Darmstadt
und Württemberg jährlich etwa 35–40000 Gulden, Summen, die neben der
kostspieligen Maitressenwirtschaft nicht überall leichterhand aus dem
ausgesogenen Lande aufgebracht werden konnten. Die Technik derselben
war seit dem Mittelalter ziemlich unverändert geblieben. Dabei wurde
auch in Deutschland der Leithund wie die Meute während des Jagens
mit französischen Worten geleitet. Hatte man im 16. Jahrhundert dem
gefangenen Hirsch die Schalen gespalten und den Lauf verletzt, um
die jungen Hunde an ihm arbeiten zu lernen, so war man im 18. nicht
mitleidiger gesinnt. Nur fing man es anders an, um denselben Zweck zu
erreichen. Der zu hetzende Hirsch wurde durch einen guten Schützen
leicht verletzt und die ganze[S. 592] Hundemeute zur Verfolgung der blutigen
Spur veranlaßt. Man nannte das Bilbaudieren. Es geschah nur zur Lust
der nachreitenden Herren und Damen; denn das Fleisch eines so gejagten
und zu Tode gequälten Hirsches war gar nicht zu genießen.
Noch immer wurde der Hase zu Pferd mit schnellfüßigen Windhunden
gehetzt oder mit dem Habicht gebeizt. Mit letzterem jagte man mit
Vorliebe allerlei Federwild, besonders Rebhühner. Doch war die
Falkenjagd damals nicht mehr in Blüte; ihr war mit dem Untergange des
Rittertums der Lebensnerv abgeschnitten worden. Einer der letzten Höfe,
der solche noch aufrecht erhielt, war derjenige von Hessen-Kassel, an
welchem Landgraf Friedrich 1772 noch einen Oberfalkenmeister mit vier
Falkenknechten und einen Reiherwärter hielt. Doch wurde diese überlebte
Herrlichkeit nach seinem Tode von dessen Nachfolger aufgegeben. Auch
am Württembergischen Hofe wurde die Falkenjagd noch bis zur Mitte des
18. Jahrhunderts geübt. Damals pflegte man die Falkner aus Brabant
kommen zu lassen. Die Habichte dagegen fing man im Lande selbst und
ließ sie durch jene auf die Beize dressieren. Doch wurde ihre Hilfe mit
zunehmender Ausbildung des Schießens auf fliegendes Wild immer seltener
in Anspruch genommen und fiel schließlich ganz weg. In der Mitte des
18. Jahrhunderts überwog in Deutschland das Fangen der Rebhühner mit
Netzen weit das Schießen. Für diesen Netzfang benutzte man, wie einst
für die Habichtbeize, besondere „vorliegende“ Hunde, die mit dem
Aufkommen der Schießjagd zunehmende Bedeutung erlangten. So wurde aus
der Bracke der eigentliche Vorstehhund gezüchtet, der als Hühnerhund
schon am Ausgange des 16. Jahrhunderts erwähnt wird. Er diente damals,
wie auch im 17. und weit ins 18. Jahrhundert hinein, nur zum Aufspüren
und Vorstehen des Wildes, bis dann von Italien her die Aufgabe, das
geschossene Wild zu suchen und zu apportieren hinzutrat und als
unerläßlich für einen vollkommenen Vorstehhund betrachtet wurde.
Während die alte Bracke ihre Raubtiernatur auch beim Jagen beibehalten
und das aufgespürte Wild fangen durfte, nur auf Horn und Ruf Folge
zu leisten hatte, durfte der Vorstehhund dem gefundenen Wild nicht
folgen und es nicht greifen, sondern mußte davor stehen bleiben. Erst
wenn es geschossen war, durfte er es apportieren und bekam nicht wie
jener davon zu fressen oder das Blut zu trinken. Diese Überwindung der
angeborenen Instinkte und Unterordnung unter den menschlichen Willen
wurde dem Hunde vom Menschen in eiserner Zucht durch die Peitsche und
das Halsband mit eisernen[S. 593] Spitzen innen, an dem er vermittelst der
Leine auf die Jagd geführt wurde, beigebracht. Welch schweren Stand
die Dresseure dabei hatten, kann jeder sich vorstellen, der versucht,
eine Bracke oder einen Laufhund zum Vorstehhund heranzubilden, was
nach den zeitgenössigen Jagdschriftstellern im 17. und 18. Jahrhundert
noch oft vorkam. Diese Grausamkeit wurde geübt, um das Vergnügen des
Menschen zu erhöhen, weil der Jäger mehr Lust beim Schießen als beim
Fang der Hühner durch den Hund empfand. Mitgefühl mit der leidenden
Kreatur hatte auch der Mensch des 18. Jahrhunderts noch nicht; deshalb
wurde auch keine Nachsuche des angeschossenen Wildes gehalten; Lerchen,
Finken und andere Singvögel wurden in Massen gefangen und verzehrt,
die gefangen gehaltenen Singvögel zur Steigerung der Häufigkeit ihres
Gesanges in grausamer Weise wie früher geblendet.
Wie im frühen Mittelalter legte man damals noch meist mit Palissaden
umgebene Tiergärten zur Lust des Landesherrn und seiner Hofgesellschaft
an. Darin standen außer dem Lusthaus, von dem die Wege strahlenförmig
sich weithin erstreckten, so daß das Wild gesehen werden konnte, sobald
es darüberging, noch allerlei andere Hütten und Gebäulichkeiten, nebst
dem Schießhaus, das am Äsungsplatze lag. Wurde dort auch das Wild
gefüttert und damit zutraulich gegen den Menschen gemacht, so hinderte
das dennoch die hohen Herren und Damen nicht, gemächlich vom im Winter
geheizten Schießhaus aus es zu erlegen.
Dieser ganze feudale Plunder, wie überhaupt die regalistische
Auffassung des Jagdrechts erhielt ihren Todesstoß im Jahre 1789 durch
den Ausbruch der großen französischen Revolution, welche mit allen
Vorrechten und grundherrlichen Lasten, auch mit dem Jagdrecht auf
fremdem Grund und Boden gründlich aufräumte. In den linksrheinischen,
damals zu Frankreich gehörenden deutschen Gebieten wurden das
Jagdregal und die übrigen Feudallasten um 1800 aufgehoben und auch
nicht mehr hergestellt, als diese Gebiete wieder mit Deutschland
vereinigt worden waren. Dagegen erhielt sich das Jagdregal im
rechtsrheinischen Deutschland bis zum Revolutionsjahr 1848, das
seine völlige Beseitigung, sowie diejenige der übrigen Reallasten
herbeiführte. Mit dem Jagdrecht auf fremdem Grund und Boden wurden
auch die Jagddienste und die Jagdfolge aufgehoben. Allgemein wurde dem
altdeutschen Grundsatze Geltung verschafft, wonach auf seinem Grund
und Boden ein Jeder jagdberechtigt ist. Allerdings verlieh erst ein
zusammenhängender Flächenraum von 300 Morgen dem Besitzer fort[S. 594]an
das Recht, die Jagd selbst auszuüben. Diese Bestimmung hat bis auf
den heutigen Tag ihre Giltigkeit behalten. Da nun aber im Deutschen
Reiche etwa 96 von 100 landwirtschaftlichen Betrieben eine Größe unter
300 Morgen aufweisen, sind ebensoviele der ländlichen Eigentümer und
Pächter vom Jagdrecht ausgeschlossen. Die ihnen gehörende Bodenfläche
beträgt mehr als die Hälfte der landwirtschaftlichen Betriebsfläche in
Deutschland. Auf diese Fläche ergießt sich nun im Herbst eine Schar
weidlustiger Kapitalisten, die reich genug sind, um sich diesen Sport
leisten zu können. Sie mieten das Jagdrecht von den Landgemeinden, die
dasselbe dem Meistbietenden zusprechen. So gibt es in Deutschland etwa
300000 Jäger auf rund 60 Millionen Einwohner. Diese sind aber auch
als Jagdberechtigte zum Ersatz des Wildschadens verpflichtet. Diese
Verpflichtung wurde zum erstenmal in der österreichischen Jagdordnung
von 1786 ausgesprochen und hat seither überall Anwendung gefunden.
Hatten im 17. und 18. Jahrhundert die Fürsten und reichen Adeligen eine
rücksichtslose Wildhege und Jagdausübung auf Kosten der Allgemeinheit
ausgeübt, so befriedigten während den Revolutionen die Bauern in nicht
minder rücksichtsloser Weise ihren lange im Stillen genährten Haß gegen
das von jenen gehegte Wild, das jahrhundertelang ungestraft ihre Äcker
verwüsten durfte. Vor allem der Rotwildstand wurde damals bedeutend
dezimiert. Zugleich verdrängte mit Beginn des 19. Jahrhunderts die
Schieß- und Niederjagd die älteren Jagdarten, die immer weniger
weidgerecht gehandhabt worden waren. Das Perkussionsgewehr hatte
die Radschloßflinte verdrängt, aber erst 1820 wurde das Zündhütchen
erfunden, womit die Zündung unabhängig von den Regengüssen gemacht
wurde. Dieser Fortschritt war ein so außerordentlicher, daß die
Erfindung des Hinterladergewehrs durch den Franzosen Lefaucheux, die
schon 1835 erfolgte, lange bei uns unbeachtet blieb und erst in den
1850er Jahren anfing, die alten Vorderlader zu verdrängen. Neben der
durch die Vervollkommnung der Gewehre immer leichteren Schießjagd
verlor auch die früher so überaus wichtige Netzjagd auf kleineres Wild,
besonders Rebhühner, immer mehr an Bedeutung. Dabei wurde der Dressur
eines möglichst vollkommenen Vorstehhundes die größte Wichtigkeit
beigelegt.
Bis zur Mitte des vergangenen Jahrhunderts bestand der Frondienst
der Bauern bei der Jagd noch in Deutschland; erst durch die
Nationalversammlung im Jahre 1848 wurde er in Preußen abgeschafft
und müssen seither die nur noch bei den großen Kesseltreiben gegen
die[S. 595] Hasen in Dienst tretenden Treiber wie andere Arbeiter für ihre
Arbeit bezahlt werden. Das Jagdvergnügen der Herren bringt vielen
Leuten Verdienst und die Jagdpacht den betreffenden Gemeinden eine
schöne Einnahme. Man hat ausgerechnet, daß der Ertrag der letzteren
etwa 40 Millionen Mark jährlich beträgt. Außerdem betragen die Kosten
von Jagdverwaltung und Betrieb, Jagdschutz und Wildpflege weitere 15
Millionen Mark jährlich, die ebenfalls zuguterletzt dem Volke zugute
kommen.
Mit dem Aufschwung der weidgerecht gehandhabten modernen Jagd wurde der
Zucht und Dressur der Jagdhunde, besonders in den letzten 30 Jahren,
die größte Aufmerksamkeit geschenkt. Heute besitzen die deutschen
Jäger mindestens 200000 meist vortrefflich arbeitende Jagdhunde,
deren Fütterung, Dressur und Pflege jährlich etwa 17 Millionen Mark
erfordern, wozu noch der Betrag der Hundesteuer für dieselben in
der Höhe von 1 Million Mark zu rechnen ist. Rechnen wir hinzu den
gewaltigen Umfang der Fabrikation von Gewehren, Munition, Jagdgeräten,
Jagdkleidung, die Reisekosten der Jäger und die Transportkosten des
Wildes, so ergibt sich, daß die Jagd allein in Deutschland einen
Geldumsatz von 130 Millionen Mark jährlich erzeugt. Hiervon fallen
etwa 30 Millionen Mark auf die Verwertung des erbeuteten Wildes,
nämlich 25 Millionen Mark für die rund 25 Millionen kg
Wildbret, 4 Millionen Mark für die Felle und 1 Million Mark für die
Geweihe von Rot- und Damhirschen und Rehböcken. Daraus läßt sich die
große volkswirtschaftliche Bedeutung der Jagd erkennen. Der Wert
des gesamten deutschen Wildstandes wird auf etwa 100 Millionen Mark
geschätzt und bildet einen nicht zu unterschätzenden Bestandteil des
Nationalvermögens, der bedeutende Zinsen abwirft.
[S. 596]
XXV. Die wichtigsten
Jagdtiere.
Nachdem wir nun mit den verschiedenen im Laufe der Jahrhunderte in
Europa geübten Jagdmethoden bekannt geworden sind, wollen wir einen
kurzen Überblick über die wichtigsten bei uns gejagten Tiere geben.
Dabei unterscheidet man eine hohe Jagd auf Rotwild, nämlich Hirsch,
Reh, Damhirsch, Elch und Gemse, dann Schwarzwild, d. h. Wildschwein,
ausnahmsweise auch auf den Bär, und eine niedere Jagd auf Hase, Biber,
Eichhörnchen, Murmeltier, Wolf, Fuchs, Dachs, Fischotter, Wildkatze,
Luchs, Marder, Iltis, Wiesel und das verschiedene Federwild, welch
letzteres im folgenden Abschnitt für sich besprochen werden soll.
Seitdem Ur und Wisent bei uns ausgerottet sind, gilt der Rot-
oder Edelhirsch (Cervus elaphus) als das edelste
jagdbare Tier unserer Wälder. Deshalb wurde auch die Jagd auf ihn mit
größtem Gepränge ins Werk gesetzt und besondere Methoden zu dessen
weidgerechter Erlegung ausgebildet. Diese haben wir der Hauptsache
nach kennen gelernt, so daß wir uns hier damit begnügen können,
seine Besonderheiten kurz aufzuzählen. Ein in der Weidmannssprache
als jagdbar und gut bezeichneter Hirsch muß bei der deutschen
Jagd wenigstens 12 Enden an den Stangen seines Geweihes haben und
etwa 150 kg wiegen. Er ist dann sechsjährig, während ein
sogenannter Kapitalhirsch in der Feistzeit bei guter Äsung gegen
300 kg wiegt und 20, ausnahmsweise auch bis zu 24 Enden an
seinem Geweih aufweist. Dieses Geweih sitzt aufrecht auf einem kurzen
Rosenstock, ist vielsprossig einfach verästelt und wird als sekundäres
Geschlechtsmerkmal nur vom Männchen aufgesetzt, um die grimmigen
Kämpfe um den Besitz des Weibchens auszufechten. Im Februar wird
es abgeworfen und jeweilen in den folgenden Monaten mit wachsender
Endenzahl neu gebildet. Während dieser Geweihbildung leben die Männchen
zurückgezogen, bis sie im Juli oder August ihre stolze Kopfzier wieder
voll[S. 597]endet und „gefegt“, d. h. den lästigen Bastüberzug durch Reiben an
Bäumen entfernt haben. Dabei wird vielfach die ursprünglich weiße Farbe
des Gehörns beeinflußt, so z. B. sind Bruchhirsche, die an Erlen gefegt
haben, an der dunkelbraunen Farbe des Geweihs kenntlich.
Erst im Miozän begann bei den ungehörnten Vorfahren der Hirsche
das erste bescheidene Geweih sich zu entwickeln, und zwar als
einfache, zunächst mit Haut bedeckte, später von der Haut entblößte
Stirnzapfen ohne jede Spur einer Rose. Darauf folgten chronologisch,
wie es das einzelne Hirschindividuum als kurze Rekapitulation der
Stammesgeschichte bei seiner Entwicklung durchmacht, zunächst das
Spießer-, dann das Gablergeweih mit meist unvollkommen entwickelter
Rose, die als Beweis dafür gelten kann, daß die Geweihe damals
begannen periodisch abgeworfen zu werden. Erst im Pliozän trat als
Weiterbildung des Hirschgeweihs der Sechsender auf, dem sich nach
und nach, durch die unbehinderte Verbreitungsmöglichkeit begünstigt,
Individuen mit noch weiter gegabelten Geweihen anschlossen. Damals
sind die Hirsche über die ganze Nordhemisphäre der Erde gewandert und
haben sich in zahlreiche Arten gespalten, von denen der Edelhirsch in
bezug auf die Geweihbildung die weitaus schönste Form entwickelte. Nach
neunmonatlichem Bestande lockert sich der Stirnzapfen durch Entstehung
gewisser vielkerniger Zellen, der sogenannten Knochenbrecher, bis sich
das Geweih in einer konkaven Fläche vom Stirnzapfen löst.
Gutgenährte Hirsche im mittleren Lebensalter tragen die stärksten
Geweihe. Reiche Nahrung, unterstützt durch Salzlecken und Genuß von
Kalkphosphaten in assimilierbarer Form, ebenso Trennung von den
Hirschkühen kann die Geweihbildung so ungewöhnlich beschleunigen,
daß schon im dritten Lebensalter statt eines Sechsenders Zehn- und
Zwölfender entstehen, oder ein sonst sechsjähriger Zwölfender im
nächsten Jahre als Sechzehnender erscheint. Umgekehrt verringert
sich im hohen Alter bei Abnahme der Körperkräfte die Zahl der Enden
wieder. Mehr als 20 Enden sind schon sehr selten. Gemäßigtes und
Höhenklima, Sumpf- und Moorboden begünstigen, anhaltend heißes,
tropisches Klima und Ebenen hemmen die Geweihbildung. Auch die
Geweihe gefangener, auf Inseln oder in abgegrenzten Wäldern
lebender Hirsche zeigen, wie diese selbst, einen Rückgang in der
Entwicklung. Außer Erkrankungen der Stirnzapfen können Verletzungen
der Weichteile, insbesondere der Geschlechtsorgane und des Skeletts
die Geweihbildung teilweise oder ganz unterdrücken oder Mißbildungen
der Geweihe hervorrufen. Je[S. 598] schwerer die Verletzung oder je näher
die Zeit der Verletzung dem Beginn der Geweihbildung war, um so
größer ist die Abnormität in der Geweihbildung. Sonderbarerweise
deformiert die Verletzung einer Vorderextremität beide Geweihteile,
während die Verletzung einer Hinterextremität nur die Mißbildung
einer, und zwar der entgegengesetzten Geweihhälfte zur Folge hat.
Wahrscheinlich ist die letzte Ursache aller Abnormitäten in der
Geweihbildung die Ernährungsstörung, die die Hirsche infolge von
Verletzungen und Krankheiten erleiden. Auch mangelhafte Entwicklung der
Geschlechtsdrüsen spielt dabei mit. So bedingt eine Entwicklungshemmung
der Hoden Geweihlosigkeit. Bei kastrierten Hirschen steht, einerlei ob
sie bei der Kastration ein Geweih trugen oder nicht, die Geweihbildung
still, und einseitig kastrierte werfen das Geweih nur auf einer, und
zwar der Schädigung entgegengesetzten Seite ab und setzen es nur dort
wieder auf.
Der Edelhirsch bewohnte ursprünglich ganz Europa bis zum 65. Grad
nördlicher Breite und Südsibirien bis zum 55. Grad nördlicher Breite.
Nach Süden hin bilden der Kaukasus und die Gebirge der Mandschurei
die Grenzen seines Verbreitungsgebiets. In allen stärker bevölkerten
Ländern hat er begreiflicherweise stark abgenommen oder ist, soweit
er nicht künstlich gehegt wird, verschwunden. Am häufigsten ist er
noch in Osteuropa und Asien, besonders im Kaukasus und im bewaldeten
südlichen Sibirien zu finden. Er liebt ausgedehnte ruhige Waldgebiete
oder dicht bewachsene Bruchgegenden, bewohnt aber auch, beispielsweise
in Schottland, unbewaldete Berge und findet dort nur in deren Tälern
und Schluchten Verstecke. Seinen Stand oder Wohnort ändert er in
ungestörten Gegenden nur in der Brunstzeit und beim Aufsetzen des
neuen Geweihs, ebenso bei Mangel an Äsung. Er lebt rudelweise nach
Alter und Geschlecht gesondert — nur die Kapitalhirsche leben bis
zur Brunstzeit meist einzeln — tagsüber versteckt, um sich erst
bei Sonnenuntergang auf regelmäßigen, nur infolge von Störungen
aufgegebenen Wechseln aus dem Dickicht nach seinen Äsungsplätzen auf
Feldern, Wiesen und andern lichten Plätzen zu begeben. Dort hält er
sich fressend die Nacht über auf, um sich mit der Morgendämmerung
wieder in sein Versteck zu begeben. Während die Hirsche in den aus
lauter männlichen Stücken bestehenden Rudeln selbst auf ihre Sicherheit
bedacht sein müssen, fällt in den aus männlichen Exemplaren gemischten
Rudeln die Pflicht der Wachsamkeit hauptsächlich den weiblichen
Stücken, den Tieren, zu. So steht an der Spitze solcher Rudel stets
ein Leittier, eine Hirschkuh, von der das[S. 599] Vordringen des ganzen
Rudels auch in der Brunstzeit so lange abhängt, als das Rudel nicht,
wie man sagt, vom Hirsche gepeitscht, d. h. getrieben wird. Zu Beginn
der in den September und Oktober fallenden Brunstzeit trennen sich die
Männchen, und zwar die älteren vor den jüngeren, von ihren Rudeln, um
die Weibchen aufzusuchen und, beim Rudel angekommen, die schwächeren
Hirsche von ihm zu entfernen. Mit im Nacken angeschwollenem Hals und
windhundartig eingezogenen Weichen geht der Hirsch den Tieren nach und
Nebenbuhlern entgegen, um sie von seinem Harem in grimmigem Kampfe zu
verdrängen. Unterliegt er dabei, so muß er denselben dem glücklicheren
Sieger überlassen; doch entfernt er sich erst, wenn alle Versuche zu
siegen erfolglos waren, unwillig das ihm abgejagte Rudel umkreisend.
Treffen aber gleichstarke Hirsche zusammen, so bekämpfen sie einander
so lange, bis der eine getötet ist oder beide Kämpfer mit den Geweihen
ineinander verschlungen sind und nicht mehr loskommen, wodurch sie
beide dem Hungertode verfallen. Oft bleibt der Streit stundenlang
unentschieden. Nur bei völliger Ermattung zieht sich der Besiegte
zurück. Abends und morgens ertönt der Wald vom Röhren der Hirsche, die
ihre Nebenbuhler zum Kampfe auffordern.
Nach der Brunstzeit, die jeweilen nach vollkommener Entwicklung des
Geweihes und des Sommerhaares eintritt und mit dem Beschlagen der Tiere
endet, rudelt sich das Rotwild wieder friedlich zusammen. Es bildet
sich das dichtere, warme Winterhaar, und im Februar werfen die starken
Hirsche schon ihr Geweih ab, während die jüngern dieses oft erst im
Mai verlieren. Bei jenen ist es schon im Juni, bei diesen erst wieder
im August vollkommen ausgebildet. Nach dem Abstoßen des Geweihs bildet
sich auch das Sommerhaar aus; ist dieses entwickelt, so wirft die
Hirschkuh im Mai oder Anfang Juni nach einer Tragzeit von 40–41 Wochen
ein, selten zwei Kälber, die der Mutter schon nach wenigen Tagen folgen
und nur während der Brunst auf kurze Zeit von ihr abgeschlagen werden.
Das neugeborene Kalb liegt in einem Versteck zwischen hohem Heidekraut
oder anderem Gestrüpp, bleibt tagsüber sich selbst überlassen und wird
abends von der Mutter aufgesucht und genährt. Verläßt sie es wieder,
so drückt sie das Kleine mit der Schnauze in sein Lager nieder, wo es
zusammengekugelt, den Kopf nach Hundeart dicht beim Schwanze haltend,
den ganzen Tag über ruhig liegen bleibt, ohne auch nur den Kopf zu
erheben. Doch entfernt sich die Mutter nicht weit von ihm; an einer
Stelle unter dem aus der Richtung des Kalbes kommenden Winde ist sie
stets auf seine[S. 600] Sicherheit bedacht und vertreibt sofort alle sich
ihm nähernden Raubtiere. Bald folgt das Junge der Alten, wächst rasch
heran und trennt sich vor Jahresfrist von der Mutter. Bis zum ersten
Haarwechsel im Oktober trägt es ein weißgeflecktes Jugendkleid.
Im ersten Herbst wird das weibliche Kalb Schmaltier, im folgenden
Übergehendtier, später, wenn es zu tragen beginnt, Alttier genannt,
während das Hirschkalb im ersten Winter Spießer, im zweiten Gabler,
meist aber gleich Sechsender wird. Auch die Stufe des Achters wird
häufig übersprungen, sehr selten aber die des Sechsers und die des
Zehners. Im dritten Jahr ist das Hirschkalb erwachsen.
Mit der Äsung wechselt der Edelhirsch nach der Jahreszeit ab; im
Herbst hält er sich gern an die Buchen- und Eichelmast, im Winter lebt
er von Baumrinde, Moos und Heidekraut. Dabei zwingt ihn hoher Schnee
aus den höheren Gebirgen auf Vorberge und in Ebenen hinabzusteigen,
wo er sichere, gegen den Wind geschützte Stellen aufsucht, um im
Frühjahr nach dem alten Standort zurückzukehren. In der Brunstzeit
nehmen die starken Hirsche nur wenig Futter zu sich, trinken aber um
so mehr und baden und suhlen mit Leidenschaft, wenn sie das Rudel in
die schützende Deckung gebracht haben. Regelmäßig werden vom Rotwild
in der Nähe seines Standortes angelegte Salzlecken aufgesucht.
Außer Wolf und Luchs ist sein größter Feind der Mensch, der es auf
dem Anstand oder Birschgang schießt, es zu Pferde, zu Wagen und zu
Schlitten beschleicht, es auf Treibjagden, nur noch ausnahmsweise
auf Parforcejagden erlegt und den Hirsch in der Brunstzeit durch das
Nachahmen seiner Stimme auf einer Schneckenschale oder einem besonderen
Instrument, dem Hirschruf, herbeilockt. Getriebenes Rotwild geht
ohne Umstände ins Wasser. Angeschossene, von Hunden heftig verfolgte
Hirsche suchen namentlich in bergigen Gegenden gerne die Bäche auf,
in denen die Hunde den wegen ihrer langen Beine begünstigteren Tieren
nur schwer folgen können. In die Enge getrieben, wehren sie sich, den
Rücken deckend, mit ihrem Geweih tapfer gegen eine ganze Hundemeute,
indem sie damit wuchtige Stöße austeilen. Selbst dem Menschen können
sie gefährlich werden. So wurde unter anderen auch der griechische
Kaiser Basilius im Jahre 886 von einem Hirsche, der ihm das Geweih in
den Leib stieß, getötet, nachdem er vorher schon einmal durch einen
solchen beinahe das Leben verloren hätte. Sonst wird das Edelwild auch
von Fliegen, Mücken und Bremsen in hohem Maße gepeinigt. Es läßt sich
leicht zähmen und zum Fahren und Reiten, wie auch zu verschiedenen
Kunst[S. 601]stücken abrichten. So fuhr nach Pausanias die Priesterin der
Diana an deren Tempel zu Paträ in Achaia beim jährlich einmal prunkvoll
durch eine Prozession gefeierten Feste der Göttin auf einem von zahmen
Hirschen gezogenen Wagen. Nach Älius Lampridius fuhr auch Kaiser
Heliogabalus in Rom mit vier Hirschen, und nach Flavius Vopiscus führte
Kaiser Aurelian bei dem Triumphe, den er 273 nach Besiegung der Königin
Zenobia von Palmyra und des gallischen Gegenkaisers Tetricus in Rom
abhielt, einen einst dem Gotenkönige gehörenden Wagen mit, an den
vier Hirsche gespannt waren. Außerdem ließ er im Zuge 20 Elefanten, 4
Königstiger, verschiedene zahme Löwen, 200 verschiedene Bestien aus
Syrien, Giraffen, Elche und andere Seltenheiten vorführen. Sehr beliebt
waren die Hirsche bei den Jagdspielen in der Arena. So ließ Kaiser
Probus bei solchen einmal tausend Hirsche auf einmal in die Arena
los. Wie reich müssen die Wälder damals noch an solchem Wild gewesen
sein, daß eine so große Zahl derselben auf einmal zur Augenlust des
Pöbels zu Tode gehetzt werden konnte. Daneben hielt man schon damals
in den Parks der Vornehmen zahmes Rotwild, worunter gelegentlich auch
als Rarität Albinos. So sah Pausanias um 160 n. Chr. in einem Park
in Rom weiße Hirsche, konnte aber nicht angeben, woher sie stammten.
Noch im Mittelalter waren sie an manchen Orten sehr zahlreich; so
wurden im Jahre 1619 auf einer Treibjagd in Preußen 672 Hirsche, 614
Tiere und 179 Kälber erlegt, darunter ein Zwanzigender von über 360
kg Gewicht. Das Rotwildbret ist geschätzt, nur zur Brunstzeit
ist es wegen des ihm anhaftenden strengen Geschmacks unbeliebt; aus
seiner Haut verfertigt man ein starkes, weiches Leder und aus seinem
Geweih die verschiedensten Gegenstände. Leider ist der Schaden, den das
Rotwild anrichtet, viel größer als der Nutzen, den es bringt. Nur aus
diesem Grunde ist es in den intensiver bevölkerten Gegenden Europas
ausgerottet worden.
Weit kleiner, deshalb auch viel weniger schädlich und infolgedessen
auch seine Haltung mit den modernen forstwirtschaftlichen Grundsätzen
besser vereinbar ist das Reh (Capreolus caprea),
das schon nach anderthalb Jahren ausgewachsen ist. Im Vergleich
zum Edelhirsch ist es gedrungener gebaut und sein Kopf kurz und
abgestumpft. Das Gehörn zeichnet sich durch breite Rosenstöcke und
verhältnismäßig starke, mit weit hervortretenden Perlen besetzte
Stangen aus. Gewöhnlich setzt die Hauptstange nur zwei Sprossen an,
so daß das ganze Gehörn nicht mehr als sechs Enden hat. Und diese
Sechserstufe erreicht[S. 602] das Reh so schnell, daß seine Altersbestimmung
dadurch unmöglich ist. Sein Alter, das auf 15–16 Jahre, in seltenen
Fällen aber auch bis 20 Jahre geht, ist nicht leicht, am sichersten
noch am Gebiß zu bestimmen. Das Gehörn steht wie beim Hirsch in
innigstem Zusammenhang mit der geschlechtlichen Reife des Rehes. So
bekommen Rehböcke, die in frühester Jugend ihrer Hoden beraubt wurden,
kein eigentliches Gehörn, sondern eine als Perückengehörn bezeichnete
unförmliche Wucherung, die auch entsteht, wenn die Hoden, etwa durch
einen Schuß, verkümmern. Falls aber die Böcke nach der Ausbildung des
Gehörns ihrer Hoden beraubt werden, werfen sie das Gehörn überhaupt
nicht ab. Auch hier macht sich die Entfernung oder Verletzung nur eines
Hodens am Gehörn der anderen Körperseite geltend. Die ersten Spieße
werden im Februar oder März gefegt, und in der Regel im darauffolgenden
Dezember abgeworfen. Auf diese sogenannte Kopfspießerstufe folgt
die Schmalspießerstufe, wobei die Spieße noch kein scharfes Ende
und auch keine eigentliche Rose, sondern an deren Stelle einen aus
Perlen besetzten Kranz haben. Sie werden im darauffolgenden Dezember,
wenn der Bock 21⁄2 Jahre alt ist, abgeworfen. Erst auf der auf
die Schmalspießerstufe folgenden Gablerstufe zeigt das Gehörn zum
erstenmal wirklich scharf ausgebildete Enden, wodurch es erst zu einer
Waffe wird. Gleichzeitig damit tritt die Geschlechtsreife ein. Mit
dem ersten wahren Sechsergehörn ist der Rehbock vier Jahre alt. Die
hell- bis dunkelbraune Färbung des Gehörns hängt wesentlich von den
Holzarten ab, an denen es gefegt wurde. So färbt die gerbstoffreiche
Rinde der Eiche die Stangen dunkel, während sie an Kiefern ziemlich
hell bleiben. Fortpflanzungsfähige Rehgeißen erhalten nie ein Gehörn;
diese Abnormität in Form kleiner, zwar auf Rosenstöcken stehender,
aber keiner Fegung unterliegender Knöpfe, die nur ausnahmsweise zu
wohlgefegten Gehörnen auswachsen, entsteht nur bei unfruchtbaren Tieren
mit mehr oder weniger zwitterigen, bei alten auch mit entarteten
Geschlechtsorganen. Gelegentlich mag auch eine äußere Verletzung an der
Stirne Gehörnbildung bei Ricken veranlassen; denn bei einer Rehgeiß,
der ein Glassplitter an einer der Stellen, wo der Bock das Gehörn
trägt, eingedrungen war, bildete sich dort ein 11,6 cm langer,
ein wenig gegabelter Auswuchs. Dieses pathologische Geißengehörn
wird wohl niemals abgeworfen, was bei den Böcken etwa Mitte Dezember
geschieht. Nach vier Monaten, etwa Ende April, ist das neue Gehörn
gewöhnlich fertig und gefegt, und zwar bei den stärkeren Böcken früher
als bei den schwächeren.
[S. 603]
In Farbe und Behaarung macht das Rehwild mit der Jahreszeit einen
ähnlichen Wechsel durch wie das Rotwild. Auf die dunkel rostrote,
dünne Sommerdecke, die wesentlich aus sprödem, brüchigem Grannenhaar
besteht, folgt eine braungraue, dichte Winterdecke, die reichlich
mit der weichen, warmen Unterwolle versehen ist. Davon hebt sich der
blendendweiße Spiegel ab, der dem gesellig lebenden Tier bei der Flucht
im Waldesdunkel die Richtung, in der seine Genossen flohen, verrät.
Merkwürdig sind die Haare des Spiegels durch ihre Beweglichkeit.
Der Spiegel kann nämlich zusammengezogen und ausgedehnt werden und
scheint beim sichernden, d. h. bei dem sich über seine Sicherheit
unterrichtenden Tiere viel größer als sonst; beim Äsen dagegen wird der
Spiegel zusammengezogen. Außer den gewöhnlich gefärbten Rehen kommen
auch albinotisch weiße, schwarze und gescheckte vor. Die schwarzen Rehe
werden bei der Umfärbung im Frühling so fahl, daß sie dann nur noch
durch den Kopf als solche gekennzeichnet sind. Zu ihnen rechnet man
auch die sogenannten Schwarzbuckel, Rehe, die im Sommer zwar rotbraun,
im Winter aber an Hals und Rücken, oft sogar bis mitten an den Leib
tiefschwarz gefärbt sind, im übrigen aber die gewöhnliche Färbung der
Rehe zeigen. Gleich der Weißfärbung tritt auch die Schwarzfärbung
plötzlich auf, doch scheint sie mehr oder weniger auf sumpfigem und
moorigem Boden, wie er sich in der norddeutschen Tiefebene vielfach
findet, vorzukommen. Bei Paarungen mit andersgefärbten Rehen vererbt
sie sich viel leichter als Weißfärbung. Wo sich ein schwarzes Reh
zeigt, gibt es in wenigen Jahren mehrere, so daß sich schwarzes Rehwild
leicht vermehren lassen würde.
Das Verbreitungsgebiet des Rehs erstreckt sich mit Ausnahme der
nördlichsten Länder über ganz Europa und den größten Teil von Asien. In
der Schweiz und in Südeuropa ist es fast ausgerottet. Seinen liebsten
Stand bilden nicht die großen, zusammenhängenden Waldungen, wie sie der
Hirsch bevorzugt, sondern die gleich Inseln in den Feldern zerstreut
liegenden Wälder. Es zieht nicht die reinen Nadelholzgegenden, sondern
diejenigen vor, in denen Laubholz mit abfallenden Früchten, wie Eichen,
Buchen, Ebereschen, Elsbeeren usw. an blumenreiche Wiesen mit kräftigem
Graswuchs stößt. Das Strauchwerk des Untergrundes bietet ihm in den
jungen Trieben vorzügliche Äsung und zugleich ein geschütztes Lager.
Niemals bildet das Reh so starke Trupps wie das Edelwild. Während des
größten Teils des Jahres lebt es familienweise zusammen[S. 604] ein Bock
mit einer, seltener zwei bis drei Ricken und deren Jungen; nur da,
wo es infolge starken Abschusses an Böcken fehlt, gewahrt man Rudel
von 12–15 Stück. Im Winter vereinigen sich bisweilen mehrere Familien
und leben längere Zeit miteinander. Die Kälber halten sich bis zur
nächsten Brunstzeit zu den Ricken, werden dann von diesen abgeschlagen
und bilden oft eigene Trupps für sich. Während des Tages hält sich das
Reh in einer ruhigen, geschützten Stelle des Walddickichts verborgen
und tritt gegen Abend, in Gegenden, wo es ungestört bleibt, bereits in
den späteren Nachmittagsstunden, auf junge Schläge, Wiesen oder Felder
mit saftigem Klee oder kräftig sprossender Saat, besonders Roggen,
heraus, um zu äsen. Dabei ist es wählerisch und nascht von allem nur
das Beste, bleibt auch beim Äsen nie lange an demselben Platz, sondern
sucht sich Abwechslung zu verschaffen. Es leckt gern Salz und scheint
in der Zeit des vollen Pflanzenwachstums nur dann zu trinken, wenn es
krank ist. Sein geringes Wasserbedürfnis deckt es von der Feuchtigkeit
der aufgenommenen Pflanzenteile und von dem in den Blattwinkeln
abgelagerten Tau oder Regen.
Zuerst tritt die alte Geiß mit anbrechender Nacht vorsichtig aus
dem schützenden Walde heraus, um in der Nähe ihrer Kitze, die im
Dickicht ruhen, zu äsen. Auf den geringsten Klageton derselben kommt
sie angstvoll herbeigerannt, um jene zu beschützen und einen etwa
sich an sie heranschleichenden Fuchs mit den Vorderläufen in die
Flucht zu schlagen. Auf den ersten Warnungsruf der Mutter drücken
sich diese Tierchen, solange sie erst unbeholfen zu gehen vermögen,
mit vorgestrecktem Kopf fest in ihr Lager im dichten Unterwuchs oder
hohen Gras. Erst wenn sie 4–6 Wochen alt sind, folgen sie der Mutter
zu den Äsungsplätzen. Sie knuppern auch hier und da ein wenig am Gras
oder Klee, aber es schmeckt ihnen noch nicht, da ihre Verdauungsorgane
nur Milch zu bewältigen vermögen. Während der Nacht bleiben die Rehe
auf den Wiesen und Feldern, um mit der Morgendämmerung wieder ihre
Verstecke im angrenzenden Wald aufzusuchen. An gewitterigen Tagen sind
sie sehr unruhig, benutzen kaum die üblichen Wechsel und ist auch ein
Birschgang auf sie an den gewöhnlichen Äsungsplätzen erfolglos.
Ende Juni schwellen den Rehböcken die Hoden an und beginnt die
Brunstzeit, die im Juli auf der Höhe ist und bis in den August hinein
andauert. Von Geilheit getrieben umwirbt der Rehbock ungestüm die
Geiß, die sich nicht gleich willfährig zeigt und sich lange im[S. 605] Kreise
herumdreht und sich dem Bocke, dessen sie sich kaum erwehren kann, zu
entziehen sucht. Der in voller Begierde hinter der brunstigen Geiß
herziehende Bock vergißt alle Vorsicht, stößt röchelnde Laute aus und
folgt in immer kleiner werdenden Bogen der Geiß, die sich schließlich
beschlagen läßt. Da der Bock in dieser ruhelosen, angestrengten Zeit
wenig frißt und häufig beschlägt, wird er immer matter. Trotzdem
springt er noch Wochen nach der Brunst auf den Ruf der Geiß und ist
seine Kampfbegier gegen Nebenbuhler noch größer als zuvor. Grimmig
kämpfen die Böcke um die Weibchen und können dabei mit ihrem Gehörn
so aneinander geraten, daß sie sich nicht wieder trennen können und
verfolkelt, wie der Jäger sagt, elend verhungern müssen.
Das im Eileiter befruchtete Ei des Rehs verweilt ohne sich weiter
zu entwickeln bis nach Mitte Dezember, also volle 41⁄2 Monate im
Fruchthalter, der auch keine Veränderung zeigt. Erst dann beginnt
es sich rasch zu entwickeln und die Gebärmutter auszudehnen, so daß
der Keimling nach etwa 25 Tagen sich nur noch zu vergrößern braucht.
Vierzig Wochen nach erfolgreichem Beschlage, also im Mai, setzt die
Rehgeiß an dem stillen Orte, an den sie sich zu ihrer Entbindung
zurückgezogen hat, ein bis zwei, selten drei Kitze, die der Mutter
schon nach wenigen Stunden, allerdings zunächst recht unbeholfen,
in spinnenhaften Bewegungen zu folgen vermögen. Nach der Brunstzeit
gehen die vorübergehend von der Mutter abgeschlagenen Kitze wieder
mit ihr und oft gesellen sich noch die zweijährigen hinzu. Bis zum
September ist der Sprung gesammelt und Ende September tun sich mehrere
derselben, aber selten mehr als 8–10 Rehe, zu Rudeln zusammen, die der
inzwischen wieder von den Strapazen der Brunst erholte Bock führt. Das
Verfärben beginnt jetzt wieder und schreitet je nach der Witterung
rascher oder langsamer vor. Mitte Oktober ist kaum mehr ein braunrotes
Reh anzutreffen. Um diese Zeit werfen schon einzelne starke Böcke ihr
Gehörn ab; die meisten aber verlieren ihr Gehörn erst im November,
manche sogar erst im Dezember oder gar im Januar.
Einst waren außer dem Menschen, der mit Schlingenstellen und Schießen
ihm nachstellte, Bär, Wolf und Luchs die schlimmsten Feinde des Rehs.
In Mitteleuropa kommt nur noch der Fuchs in Betracht, der unabläßlich
den Rehkitzen und kranken älteren Rehen nachstellt. Angeschossenem
Rehwild folgt der Fuchs auf der schweißigen Fährte wie der beste Hund;
findet er es noch lebend auf dem Wundbett, so beschleunigt er den Tod
durch Zerreißen der Halsadern, ist es aber schon verendet, so beginnt
er es von der Wunde aus anzuschneiden. Auch[S. 606] Wildkatze, Baummarder
und Iltis stellen den Kitzen eifrig nach und kennen deren Fiepton und
Angstschrei genau. Von den mitteleuropäischen Vögeln wird nur der Uhu
den jungen Rehen gefährlich, im Hochgebirge und in Asien auch der
Adler. Eine besondere Klasse von Feinden, gegen die die Rehe vollkommen
machtlos sind, bilden die den Hirsch greulich peinigenden Dassel- oder
Bießfliegen und Bremsen, deren Larven entweder in den Schleimhäuten
der Nasenhöhle oder im Unterhautzellengewebe besonders des Rückens
schmarotzen und ihrem Träger arg zusetzen, ja ihn gelegentlich zugrunde
richten können. Lästig werden auch Zecken, Läuse und verschiedene
Eingeweidewürmer; ebenso sind ansteckende Krankheiten, worunter
besonders die Tuberkulose und Wild- oder Rehseuche, zu erwähnen.
Wegen ihrer Anmut und ihres zutraulichen Wesens werden Rehe schon
seit alter Zeit als Hausgenossen gehalten. Der um die Mitte
des 1. Jahrhunderts n. Chr. in Rom lebende Spanier Columella
schreibt in seinem Buche über den Landbau: „Wilde Tiere, wie Rehe
(capreolus), Antilopen, Hirsche und Wildschweine, hält man
entweder zu eigenem Vergnügen, oder zum Verkauf und Gewinn. Im ersteren
Falle genügt jeder nahe am Wohnhaus gelegene umzäunte Platz und man
füttert und tränkt sie aus der Hand; im zweiten muß ein Stück Wald, der
auch Wasser enthält, für das Wild bestimmt und ummauert oder mit Latten
umzäunt werden.“ Plinius meint, die Rehe und Wachteln ernähren sich von
Gift, werden dabei dick und fett, sind aber gleichwohl die gutmütigsten
Tiere der Welt. Tatsächlich fressen Hirsche und Rehe in der Brunstzeit
mit Vorliebe Pilze, worunter auch giftige, die ihnen nicht schaden.
Merkwürdigerweise behauptet derselbe Plinius in seiner Naturgeschichte,
daß das „kleine, ästige Gehörn des Rehwilds“ nicht abfällt. Dies und
daß es von den antiken Schriftstellern kaum erwähnt wird, beweist, daß
es schon damals in den Mittelmeerländern fast ausgerottet war.
Das eingefangene Rehkitzchen gewöhnt sich sehr rasch an seine Umgebung,
sowohl an Mensch als auch an Tier. Es spielt mit dem Hunde wie mit
seinesgleichen, legt bald alle Scheu ab, ist für Leckerbissen sehr
empfänglich, klettert auf Bänke und Tische und wird der verhätschelte
Liebling aller. Bei der Ricke kann diese Liebenswürdigkeit länger
anhalten und bleibt sie mit zunehmendem Alter ein angenehmer
Hausgenosse, aber es empfiehlt sich, zur Zeit der Brunst ein wachsames
Auge auf sie zu haben, falls Wald in der Nähe ist und Rehe dort stehen.
Ist ihr der Weg zum Walde abgeschnitten, dann[S. 607] bleibt sie dem Hause
treu. Der gefangen gehaltene Rehbock jedoch wird schon nachdem er
seine Spitzen gefegt hat, unangenehm, er gefährdet Kinder und Frauen
durch seine Stöße, tyrannisiert alle Haustiere, besonders die braven
Jagdhunde, die genau wissen, daß sie ihm nichts tun dürfen, und muß
regelmäßig früher oder später eingesperrt oder einem zoologischen
Garten geschenkt werden. Hier ist ihm in der Regel trotz sorgsamer
Pflege und vielfältiger Fütterung kein sehr langes Leben beschieden,
da der Aufenthalt in einem eingehegten, wenn auch noch so großer
Wildpark sein Gedeihen ungünstig beeinflußt. Er gehört in den Wald,
dessen Zierde er ist, und bildet die bevorzugte Beute des Weidmanns,
der ihn auf Anstand oder Ansitz, auf dem Birschgange, durch Blatten
oder Treiben mit Hunden erlegt. In Deutschland werden alljährlich etwa
200000 Rehe geschossen, die drei Millionen Kilogramm Wildbret geben und
einem Verbrauchswert von 3–4 Millionen Mark gleichkommen. Das Wildbret
vom Reh ist sehr kurzfaserig und liefert deshalb einen sehr zarten
Braten. Das Mark der Röhrenknochen gibt ausgelassen ein vorzügliches
Fett zum Schmieren von Gewehrschloß und anderen Stahlwerkzeugen. Die
Gehörne bilden Material zu allerlei Zierat, das Fell liefert Decken und
Leder, mit Haaren vom Winterfell werden feinere Reitsättel gefüttert.
Jedenfalls ist aber der Schaden, den das Reh in jungen Schlägen
anrichtet, größer als sein Nutzen.
Im Gegensatz zu dem in der Gefangenschaft hinfälligen Reh, das sich
auch keineswegs regelmäßig im Zwinger fortpflanzt, ist der zwischen
Rotwild und Renntier stehende Damhirsch (Dama vulgaris)
für das Leben in Parks wie geschaffen. Man kann sich auch kaum eine
größere Zierde solcher großer Anlagen beschaffen als eben das Damwild,
das seinen Namen davon tragen soll, daß es das Wild der Damen ist.
Es ist weit weniger scheu als Hirsch und Reh, treibt sich an lichten
Waldstellen oft ungescheut am hellen Tage umher und wechselt weder so
regelmäßig noch so weit wie der Rothirsch. Im engeren Wildpark wird es
so neugierig-zutraulich, daß es den Namen Wild kaum mehr verdient und
es schon ein ganz schlimmer „Schießer“ sein muß, der am Niederknallen
eines so wenig scheuen liebenswürdigen Geschöpfes noch ein Vergnügen
findet. Mit seinen bunten Farben und seiner unruhigen Lebhaftigkeit
ist es zur Belebung einer Parklandschaft wie geschaffen, und
tatsächlich bevölkert es auch, besonders in England, die Umgebung aller
Sommerschlösser, für deren nicht selten gelangweilte vornehme Bewohner
es gewiß viel unterhaltender ist als[S. 608] das scheu sich zurückziehende
Rotwild. Nur muß man junge Bäume und Anpflanzungen gegen das Damwild
noch sorgfältiger schützen als gegen das Rotwild, da es noch mehr
wie dieses das Schälen, d. h. Abnagen der Rinde und Verbeißen,
d. h. Abfressen der sprossenden Zweige und Blätter, jene beiden großen
Verbrechen des Wildes in den Augen des Forstmanns und Gärtners, sich
zuschulden kommen läßt. Doch kann man diese Neigung, der zweifellos
bestimmte physiologische Bedürfnisse zugrunde liegen, dadurch ablenken,
daß man den verschiedenen, in der modernen Forstwirtschaft allerdings
streng verpönten Unterholzsträuchern im Park ihre Stelle läßt, außerdem
auch durch rationelle Fütterungs- und Leckeinrichtungen von Salz mit
Lehm und aromatisch bitteren Stoffen abschwächt.
Was die geographische Verbreitung des Damhirsches betrifft, so hat
es, wie verschiedene Knochenfunde beweisen, vor der Eiszeit ganz
Mitteleuropa bis Norddeutschland bewohnt, wurde aber durch die
Klimaverschlechterung während derselben in die Länder am Mittelmeer bis
zur Sahara verdrängt. Von dort wurde er erst in der Neuzeit durch den
Menschen künstlich wieder in Mitteleuropa eingeführt, wo er im Altertum
und Mittelalter vollkommen fehlte. Heute ist er bis Südschweden und
Norwegen verpflanzt worden. Am frühesten kam er nach England, wo es
schon 1465 dunkelfarbiges Damwild im königlichen Park von Windsor gab.
Unter dem Großen Kurfürsten wurde er um 1680 nach der Mark Brandenburg
und unter Friedrich Wilhelm I. um 1730 nach Pommern gebracht.
Hier überall gedeiht der Damhirsch bei einiger Winterpflege recht gut,
aber er ist fast zu einem Haustier geworden, dessen Färbung manchem
Wechsel unterworfen ist. Gewöhnlich ist er loh- oder gelbbraun, auf dem
Kopf und obern Hals dunkler gefärbt und auf dem Rücken vom Nacken bis
zum Schwanzende mit einer dunklen Linie gezeichnet. An Rumpf und Hüften
ist er mehr oder weniger deutlich weißgefleckt und an der Unterseite
des Körpers weiß. Daneben gibt es aber auch fleckenlose braune,
gelbe, fast schwarze und ganz weiße Damhirsche mit allen Übergängen
ineinander. Im allgemeinen ist das Damwild im Sommer mehr rötlich
gefärbt und deutlicher gefleckt, im Winter dagegen mehr grau und fast
fleckenlos. Charakteristisch ist sein bei völliger Ausbildung unten
drehrundes, oben handförmig ausgebreitetes Geweih, das je einen Mittel-
und Augensproß nach vorn entsendet.
Das Damwild liebt hügeliges Land, in welchem sanfte Täler mit niederen
Anhöhen abwechseln, ebenso lichte Laubwaldungen und Haine,[S. 609] deren Boden
mit kurzem Gras bewachsen ist. Es gleicht in seiner Lebensweise dem
Rotwild, ist nur unsteter und unruhiger, hält an seinem Standort und
seinem Wechsel im allgemeinen fester als jenes und pflegt auch stärkere
Rudel zu bilden. Seine Feistzeit fällt in den September, die Brunst
tritt im November ein und etwa einen Monat später als beim Edelhirsch
wirft das etwa acht Monate lang tragende Tier ein oder zwei bis zur
folgenden Brunstzeit von ihm gesäugte Kälber, die, falls es Männchen
sind, im zweiten Jahr runde, sich in jedem Frühling erneuernde und
sich allmählich zerteilende Geweihstangen erhalten, an denen zuerst
Augen-, dann Mittelsproß und zuletzt die schaufelförmig erweiterte,
nach hinten zerteilte Spitze auftritt. Die alten Damhirsche werfen im
Mai, die jungen Spießer im Juni ihr Geweih ab, das sich bis zum August
oder September erneuert. Das Damwild liefert zarteres Wildbret und eine
weichere und elastischere, aber auch schwächere Haut als das Rotwild
und wird ebenso gejagt und benutzt wie dieses. Seine Munterkeit bewahrt
es auch in engerer Gefangenschaft, an welche es sich leicht gewöhnt.
Einst über ganz Mitteleuropa verbreitet, aber heute hier überall
ausgerottet ist der Elch (Alces machlis). Diese
hochbeinige, stattliche Hirschart mit plumpem Körper, großem Kopf,
dicker Schnauze und im männlichen Geschlecht mit Kehlbart und
mächtigem, fast wagrecht verlaufendem schaufelförmigem Geweih liebt
moorreiche Waldungen. Wenigstens tummelt sich der Elch vom April bis
September fast ausschließlich im Sumpf, über dessen Schlammboden ihn
die großen, breiten, tief gespaltenen Hufe leicht tragen. Früher war
er westlich bis Großbritannien und Frankreich, südlich bis in die
Lombardei verbreitet. In Norditalien scheint er bereits zur römischen
Kaiserzeit ausgestorben gewesen zu sein. Der Grieche Pausanias
schreibt um 170 n. Chr.: „Der Elch (alkḗ) sieht dem Hirsch
und dem Kamel ähnlich, bewohnt das Land der Kelten. Menschen können
es nicht aufspüren und es kann daher nur erlegt werden, wenn man
große Strecken einkreist und dann immer näher zusammenrückt.“ Um 208
schaffte Gordian als Konsul nach Julius Capitolinus 10 Elche für die
Jagdspiele nach Rom und 273 ließ Kaiser Aurelian auch dieses Tier
als Schaustück aus Gallien in seinem Triumphzuge aufmarschieren. In
Gallien verschwand der Elch schon im 5. Jahrhundert n. Chr. Länger
blieb er in Deutschland erhalten. Im Walde Viergrund bei Nördlingen
in Bayern erlegten zwei Hofleute des Königs Pipin einen Elch, dessen
riesenhaftes Geweih sich im Original und in einer Abbildung bis heute
erhielt. Im[S. 610] 10. Jahrhundert lebte der Elch noch in Flandern, im 14.
in Böhmen; im 16. war er schon in Mecklenburg und dem größten Teile
Deutschlands ausgerottet. In Sachsen wurde das letzte Exemplar dieser
Tierart 1746, in Schlesien 1746, in Galizien 1760 erlegt. In Ungarn,
wo es noch im 17. Jahrhundert Elche gab, waren zu Ende des 18. keine
mehr vorhanden. Aus Westpreußen ist der Elch erst zu Anfang des 19.
Jahrhunderts verschwunden, in Ostpreußen wird er im kaiserlichen Forst
von Ibenhorst gehegt. In Skandinavien, Nordrußland und Sibirien kommt
er noch in inselartiger Verbreitung vor, verträgt sich aber nirgends
mit geordneter Forstwirtschaft, da er ein schlimmer Waldfrevler ist,
fast ausschließlich von Sträuchern und jungen Bäumen äst, und zwar
nicht bloß deren Blätter und junge Schößlinge, sondern namentlich
auch die Rinde und holzigen Zweige bis zu Fingerdicke. Im Februar und
März schält er die Rinde der Nadelholzgewächse, später diejenigen der
Laubbäume, und zwar ist für ihn als Sumpfhirsch das Lieblingsgesträuch
die Werftweide. Im Winter bilden Baumknospen seine Hauptnahrung. Wo
er sich sicher fühlt, zieht er Tag und Nacht, beunruhigt dagegen vor
Sonnenunter- und Aufgang seiner Nahrung nach, um die übrige Zeit im
Dickicht oder Moore zuzubringen. Nach der Sättigung legt er sich nach
Rinderart zum Wiederkauen nieder.
Im allgemeinen friedfertig und gesellig lebt der Elch familienweise;
nur die starken Hirsche bleiben bis gegen die Brunstzeit allein. In
der Brunstzeit im August bis September verhalten sich die Männchen
ähnlich den Rothirschen, fordern auch durch Schreien ihre Nebenbuhler
heraus und kämpfen wütend mit ihnen um den Besitz der Weibchen.
Besiegte Elchhirsche, die keine Tiere zur Begattung finden, geraten
in eine Art Koller, der sie unaufhörlich herumschweifen, wohl gar in
bewohnte Gegenden laufen und ebenso abmagern läßt wie die glücklicheren
Geschlechtsgenossen. Das beschlagene Tier zieht sich gegen das Ende
der 40 Wochen betragenden Tragzeit in einsame Sumpfgegenden zurück, wo
es meistens zwei Kälber setzt, die es sorgsam beschützt und ernährt.
Nach drei Jahren sind die Weibchen erwachsen, die Männchen dagegen
erst im fünften Jahre, wobei sich bei ihnen das Geweih schaufelartig
auszubreiten beginnt. Ein ausgewachsener Elchhirsch wiegt 330
kg, ein ausgewachsenes Elchtier dagegen nur 280 kg,
während ein eben gesetztes Elchkalb 10–12 kg wiegt. Der Elch
erreicht nur ein Alter von 20 Jahren und hat besonders unter den
Angriffen der rudelweise jagenden Wölfe zu leiden, die ihn im Winter
auf dem Eise leicht zu Falle bringen. Gefährlich ist ihm auch der Bär,
der gern einzelne[S. 611] Elche beschleicht, ebenso der Luchs, der Elchkälbern
auflauert und sie bei Entfernung der Mutter überfällt und abwürgt. Bei
mehrmaliger Beunruhigung ändert der Elch seinen Stand, haßt überhaupt
mehr als die übrigen Hirsche alle Störungen aufs tiefste und verläßt
eine Gegend, in der er wiederholt behelligt wurde. Jung eingefangene
Elche werden leicht zahm und wurden früher in Schweden zum Ziehen
von Schlitten abgerichtet; doch bleiben sie in der Gefangenschaft
nur verhältnismäßig kurze Zeit am Leben und sterben an zunehmender
Abmagerung vorzeitig dahin. Das Zusammensein mit Vertretern lebhafter
Hirscharten ist dem Elch zuwider; nur mit den ruhigen, gelassenen
Renntieren verträgt er sich gut, eignet sich aber wegen seiner
Hinfälligkeit in der Gefangenschaft nicht zur Domestikation.
Ein trefflich kletternder Bewohner des Hochgebirges ist die kluge
Gemse (Capella rupicapra), die ein ausgesprochenes
Tagtier ist und durch ihr bei aller blitzartigen Entschlossenheit doch
ruhig überlegendes Wesen sich vorteilhaft von der kopflosen Scheu
und nervösen Schreckhaftigkeit der mehr nächtlichen hirschartigen
Waldtiere unterscheidet. Sie bewohnte früher das Vorland der Gebirge,
bis sie sich in harter Bedrängnis durch den Menschen auf das für
ihn schwer zugängliche Hochgebirge zurückzog. Aber auch da ist sie
nicht wie der Steinbock ein reines Felsentier, sondern eigentlich
ein Bewohner des obersten Waldgürtels, wo sie am liebsten weilt.
Früh zieht sie zur Äsung auf bekannte Weideplätze, um bis um 10
Uhr saftige Kräuter allerlei Art und junge Triebe von Sträuchern,
besonders Alpenrosen, zu fressen, dann wandert sie einem Waldbestand
oder einem Legföhrendickicht zu, um hier wiederzukauen. Um 4 oder
5 Uhr wird sie wieder rege, zieht auf den Äsungsplatz, wo sie bis
zur Nacht, bei Mondschein bis 10 oder 11 Uhr, frißt, um dann die
Nacht über in gedeckter Stellung teilweise wiederkauend zu ruhen.
Auf der Flucht entwickelt sie eine überraschende Sprungfertigkeit
und Kletterkunst. Mit ihren sehnigen langen Läufen mit starken,
scharfrandigen Hufen springt sie dann bis 7 m weit und schnellt
sich an senkrechten Wänden bis 4 m in die Höhe. Im Notfall
rutscht sie mit zurückgestemmtem Körper und scharf gegen das Gestein
eingesetzten Hinterhufen schnurrend die steilsten Wände hinunter und
auch ein Absturz bis zu 100 m soll ihr nicht schaden, wenn sie
nur unten auf weichen Schnee fällt. Droht oben Gefahr, so eilt sie
mit wilden Sätzen abwärts, wobei sie 10–15 m hohe Bergwände
herunterspringt, um hart an der Wand zu entkommen. Im Winter rutscht
sie oft zum Vergnügen auf dem Bauch[S. 612] mit vorgestemmten Füßen steile
Schneehalden hinunter, wobei sie in hockender Stellung so lange mit
den Hinterbeinen sich abschnellt, bis sie ins Gleiten gekommen ist.
Ihre Sinne, besonders der Geruch, sind vortrefflich ausgebildet; dabei
ist sie in hohem Grade wachsam und unterscheidet sehr wohl harmlose
Menschen vom sich an sie heranschleichenden Jäger.
Als höchst geselliges Tier vereinigt sich die Gemse zu ziemlich großen
Rudeln von 30–40 Stück, die die Geißen, deren Kitzchen und die jüngeren
Böcke bis zum zweiten, höchstens dritten Jahre umfaßt. Alte Böcke leben
außer der Paarungszeit für sich oder vereinigen sich nur vorübergehend
mit einigen wenigen ihresgleichen. Im Rudel übernimmt eine alte,
erfahrene Geiß die Leitung, doch wachen alle älteren Mitglieder
desselben abwechselnd für die Sicherheit des Trupps. Jede Gemse, die
etwas Verdächtiges gewahrt, drückt dies durch ein weithin vernehmbares,
mit Aufstampfen des einen Vorderfußes verbundenes Pfeifen aus, worauf
das Rudel, sobald es sich von der Tatsächlichkeit der Gefahr überzeugt
hat, sofort die Flucht ergreift. Gegen die Paarungszeit hin, welche
um Mitte November beginnt und bis Anfang Dezember währt, finden sich
die starken Böcke bei den Rudeln ein, indem sie sich dumpfgrunzend um
die Geißen bewerben. Bei ihrem Erscheinen stieben die jungen Böcke
erschreckt auseinander. Da die starken Böcke keinen Nebenbuhler bei dem
von ihnen mit Beschlag belegten Rudel dulden, setzt es unter den geilen
Gesellen grimmige Kämpfe ab, wobei der unterliegende Bock gelegentlich
einen Abgrund hinuntergestoßen oder ihm mit dem spitzen nach rückwärts
gebogenen Gehörn auch der Bauch oder eine andere Körperstelle
aufgerissen wird. Zuerst werden die jüngeren, dann die älteren Geißen
beschlagen. Dabei läßt der Bock von einer bei ihm viel stärker als
bei der Geiß anschwellenden Drüse hinter den Krickeln einen für uns
widrig duftenden, den Geißen aber angenehmen und sie sexuell erregenden
Duft ausströmen. Bei der Brunst, während welcher er beständig erregt
ist und kaum etwas frißt, magert der Gemsbock stark ab, um sich nach
Ablauf derselben allerdings rasch wieder zu erholen. Die Satzzeit fällt
auf Ende Mai oder Anfang Juni. Während jüngere Geißen stets nur ein
Kitzchen setzen, gebären alte deren zwei, ausnahmsweise auch drei, die
ungemein rasch heranwachsen, schon im dritten Monat Hörner erhalten und
bereits im dritten Jahr die volle Größe der Alten erreicht haben.
Ungeachtet mancherlei Gefahren und der harten Bedrängnis schnee[S. 613]reicher
Winter vermehren sich die Gemsen da, wo sie gehegt und nur in
vernünftiger Weise abgeschossen werden, ungemein rasch und sind eine
unvergleichliche Zier unseres Hochgebirges. Die Jagd auf sie ist
ein beschwerdereiches Vergnügen, das einen ganzen Mann verlangt.
Ihr Wildbret ist vorzüglich und übertrifft an Wohlgeschmack noch
dasjenige des Rehs, das als das beste der einheimischen Wildarten
gilt, bei weitem durch seinen würzigen Beigeschmack. Das Fell wird
zu einem vorzüglichen Wildleder verarbeitet, die Hörner zu allerlei
Zierat verwendet, während die 20–23 cm langen, schwarzen
Haare mit gelb-weißer Spitze, die als eine Art Mähne dem Rücken
entlanglaufen, als „Gamsbart“ in Nachahmung einer Tiroler Sitte einen
beliebten Hutschmuck auch für die Städter im Reisekostüm bilden. Nur
jung eingefangene Gemsen lassen sich zähmen. Sie werden zunächst mit
Ziegenmilch, dann mit saftigen Kräutern, Kohl, Rüben und Brot ernährt
und einer gutartigen Ziege mit deren Zicklein zugesellt, in deren
Gesellschaft sie zu allerlei keckem Spiel aufgelegt sind. Zutraulich
drängen sie sich an ihren Pfleger heran, um sich Futter zu erbitten.
Erst in erwachsenem Zustande kommt bei ihnen meist eine gewisse
Wildheit zum Durchbruch, die sich durch nachdrücklichen Gebrauch ihrer
Hörner bekundet. In einem Stalle behagt es ihnen nicht. Auch im Winter
wollen sie Tag und Nacht im Freien zubringen und begnügen sich auch im
Schnee mit ein wenig Streu als Lager. Alt eingefangene Gemsen bleiben
immer furchtsam und scheu und pflanzen sich in der Gefangenschaft
kaum je fort. Von jung eingefangenen Gemsen hat man in verschiedenen
Tiergärten Junge gezüchtet.
Häufiger als auf Gemsen findet sich für den deutschen Weidmann
Gelegenheit, auf Sauen zu jagen. Das Wildschwein (Sus
scrofa) ist der einzige Vertreter der Schweinefamilie in ganz
Europa. Mit Vorliebe wählt es sich feuchte, sumpfige Gegenden zu
seinem Aufenthaltsort, gleichgültig, ob diese bewaldet oder mit
Sumpfwuchs bestanden seien. Nur wo es verfolgt wird, zieht es sich
in das Waldesdickicht zurück, um darin unter tiefbeasteten Fichten
oder im Gestrüpp tagsüber zu ruhen, wobei es sich eine mit Moos und
Farnen gepolsterte Vertiefung im Boden zum bequemen Lager herrichtet.
Mit einbrechender Dämmerung erhebt es sich, um zunächst einer
Suhle zuzustreben, in welcher es sich ein halbes Stündchen wälzt.
Wenn alles ruhig geworden ist, sucht es mit Vorliebe die reifenden
Getreidefelder und Kartoffeläcker auf, um sich darin gütlich zu tun.
Dabei frißt es weit weniger als es verwüstet, weshalb es dem Landmanne
begreif[S. 614]licherweise so verhaßt ist. Sonst sucht das Wildschwein in
Wald und auf Wiesen Erdmast in Form von Trüffeln, fleischigen Wurzeln,
Kerbtierlarven, Würmern, Schnecken, aber auch Mäusen und anderen
kleinen Säugetieren nebst Leichen aller Art; im Herbst und Winter
ernährt es sich vorzugsweise von abgefallenen Eicheln, Bucheln,
Haselnüssen und Kastanien, verfolgt angeschossenes und kränkelndes
Wild, um ihm den Garaus zu machen, und frißt in der Not die eigenen
Jungen. Beim Fressen sichert es häufig mit emporgehaltenem Rüssel,
zumal wenn es aus einem Dickicht ins Freie und über einen Weg wechselt.
Fällt ihm etwas Verdächtiges auf, so entfernt es sich nach Ausstoßen
eines schnaubend-fauchenden Tons so geräuschlos, daß man glauben
könnte, es sei in die Erde verschwunden. Das unbedeutendste verdächtige
Zeichen genügt, das scheue Tier zu vertreiben. Geruch und Gehör sind
bei ihm seiner nächtlichen Lebensweise entsprechend ausgezeichnet,
während das Gesicht mangelhaft ist. Den Jäger erkennt es an der
Witterung, nicht an seiner Gestalt. Verfolgt stürzt es sich ohne
Bedenken in reißende Ströme, um sie zu überschwimmen, wobei es sehr
geschickt und ausdauernd schwimmt.
Als sehr geselliges Tier pflegt sich das Wildschwein zu Rudeln
zusammenzutun, und zwar die stärkeren Keiler für sich, während die
Bachen genannten Weibchen mit den Frischlingen und geringen Keilern
gehen. Vom dritten Lebensjahre an leben die dann Hauptschweine
genannten Männchen als Einsiedler und schlagen sich erst zur
Paarungszeit, zur sogenannten Rauschzeit, zu den Rudeln der Weibchen,
um deren Besitz sie mit gleichstarken Keilern erbitterte Kämpfe
führen. Die geringeren Keiler werden vertrieben, wenn sie sich zur
Rotte, wie man eine Herde Wildschweine nennt, gesellen. Abgeschlagene
Wildschweine suchen ihren Geschlechtstrieb vielfach bei Herden von
zur Eichel- oder Buchelmast in den Wald getriebenen Hausschweinen zu
befriedigen, wodurch dann Blendlinge entstehen, die wegen ihres wilden
und scheuen, mit schlechter Mastfähigkeit gepaarten Temperaments dem
Zuchtsauenbesitzer wenig willkommen sind. Den Hauptschutz der Keiler
bei ihren grimmigen Kämpfen mit den Nebenbuhlern bildet ein an den
Schulterblättern zwischen Haut und Fleisch, oft bis zwei Finger dicker
„Schild“ aus hornartiger weißer Masse. Harnisch dagegen nennt man die
feste Kruste, die sich an Brust und Vorderschulter der Keiler durch
Reiben an den Stämmen Harz ausschwitzender Fichten bildet, deren Harz
die Borsten und die Unterwolle zu einer harten, schützenden Decke
zusammenklebt.
[S. 615]
Schon ehe das Wildschwein vollkommen ausgewachsen ist, wird es
fortpflanzungsfähig. Von Ende November bis in den Januar dauert die
Rauschzeit. Nach einer Tragzeit von 20 Wochen wirft die Bache, für sich
abgesondert, so lange sie noch jung ist 4–6, später 10–12 Frischlinge,
die auf gelbgrauem Grunde braune Längsstreifen aufweisen. Es ist
dies ein altmodisches Gewand, das die Vorfahren einst auch erwachsen
trugen. Die Frischlinge werden von der Bache aufmerksam bewacht
und im Falle eines Angriffs mutig verteidigt. Schon der geringste
Klagelaut eines Jungen ruft die Alte herbei, die sich wutschnaubend
auf den Friedensstörer wirft. Die Wildschweine werden 20–25 Jahre alt,
erreichen nur ausnahmsweise ein Gewicht von 225 kg bei einer
Länge von 1,6 m und einer Höhe von 0,5 m. Die einzige
Seuche, die bei ihnen auftritt und sie rasch dahinrafft, ist die
Halsbräune. Sie werden auf dem Anstand, namentlich auf der Saukanzel,
dann auf der Birsch und auf der Jagd mit Treibern und Hunden erlegt.
Jedenfalls ist der Schaden, den sie verschulden, nicht so bedeutend,
daß er ihre vollkommene Ausrottung rechtfertigen würde. Dadurch, daß
sie durch Aufwühlen weiter Bodenstrecken nach Engerlingen (Larven des
Maikäfers) diese Schädlinge ausrotten und gleichzeitig die natürliche
Besamung der Waldbäume erleichtern, sind sie dem Forstmanne geradezu
nützlich. Während sie heute auf freier Wildbahn bei uns selten geworden
sind, werden sie noch vielfach in eingehegten Waldbezirken als
geschätzte Jagdtiere gehalten. Die Jagd auf sie hat seit alten Zeiten
als ein ritterliches Vergnügen gegolten, war es aber nur solange der
Jäger mit der Saufeder ihnen direkt entgegentrat, um sie zu fällen.
Heute aber, wo man sie ohne alle Lebensgefahr auf weite Distanz mit
den weitreichenden Präzisionsgewehren schießt, ist alle Ritterlichkeit
dahin. Ihr Fleisch ist sehr geschätzt, weil es neben dem Geschmack
des Schweinefleisches den des echten Wildbrets hat. Das Gehirn der
Wildsau ist hoch entwickelt, weshalb sie sich leicht abrichten läßt.
Auf den britischen Inseln ist sie wie der Wolf schon seit längerer Zeit
ausgerottet.
Nur ganz ausnahmsweise kommt ein mitteleuropäischer Jäger auf den
braunen Bären (Ursus arctos) zu Schuß. Wer diesen in
freier Wildbahn kennen lernen will, der muß schon nach Siebenbürgen
oder Rußland gehen, wo er auch jetzt noch in gewissen Gegenden nicht
selten vorkommt. In Siebenbürgen bewohnt er die Legföhrenregion
des Gebirges, während er in den Rokitnosümpfen Rußlands ein echter
Sumpfbewohner ist, der sich nur zur Winterszeit in trockeneres Gelände[S. 616]
zurückzieht. Im allgemeinen liebt der Bär schwer zugänglichen oder doch
wenig besuchten, dichten Wald, in welchem ihm Höhlen unter Baumwurzeln
oder in Baumstämmen, im Felsengeklüfte, mit reichem Unterholz
bewachsene Inseln in Brüchen Obdach und Ruhe vor seinem Erzfeinde, dem
Menschen, gewähren. Er kann 2 m Länge, 1 m Höhe und ein
Gewicht von 300 kg erreichen und trägt im Winter ein dichtes,
zottiges, langhaariges Fell, im Sommer dagegen ein viel kürzeres,
dünneres und dunkleres von brauner bis schwarzer Farbe. Trotz seines
schwerfälligen Körperbaues ist er ein gewandtes Tier, das im tiefen
Schnee Sprünge von 3,5–5,5 m machen kann und auch beim Klettern
eine große Gelenkigkeit zeigt. Mit seiner urwüchsigen Kraft, die ihn
einen 350 kg schweren Hirsch aus einer Grube zu ziehen und
weit wegzuschleppen erlaubt, verbindet er eine ungeheure Ausdauer und
Zähigkeit im Ertragen von Strapazen und im Aushalten von Verwundungen.
Während sein Geruch und Gehör ausgezeichnet sind, ist das Gesicht bei
ihm nur schlecht entwickelt. Seine geistigen Fähigkeiten sind sehr
gute, doch ist er bei aller Gutmütigkeit höchst falsch und mißtrauisch,
liebt Behaglichkeit ungemein, greift aber, sobald er gereizt wird,
sofort an. Er ist seinem Gebiß und der Beschaffenheit seiner Eingeweide
nach Allesfresser, hält sich im allgemeinen aber mehr an Pflanzen-
als Fleischkost. Monatelang kann er sich mit Früchten, besonders
Eicheln, Bucheln und Haselnüssen, dann Beeren aller Art, reifendem
Mais, saftigem Hafer und anderem Getreide neben Schnecken, Käfern und
Insektenlarven ernähren. Wo ihm aber Gelegenheit dazu geboten wird,
ergreift er gern Wild oder größere Haustiere des Menschen, besonders
Rinder und Schafe, um sie zu fressen. Kann er keine lebenden Tiere
haben, so begnügt er sich auch mit Aas. Meist schlägt er sein Opfer mit
einer seiner kräftigen Vorderpranken am Rücken, wobei die scharfen,
langen Krallen tief ins Fleisch eindringen, und beißt es dann am Halse
tot. Beim Verzehren des gestreckten Tieres reißt er ihm zuerst die
Brust auf, um die Eingeweide zu verzehren. Was er nicht fressen kann,
wird notdürftig von ihm verscharrt oder mit Reisig bedeckt und später
wieder aufgewühlt. In Siebenbürgen sind außer Haustieren, besonders
Rindern, Wildschweine und Rehe seine gewöhnlichen Opfer, während er in
Rußland außerdem auch Elche erbeutet. Begieriger als nach jeder anderen
Nahrung ist er aber nach Honig. In den Bäumen, in deren Höhlungen
wilde Bienen wohnen und ihre Vorräte angelegt haben, kratzt und beißt
er Löcher, um zu der von ihm so geliebten süßen Speise zu gelangen.[S. 617]
Wasser kann er nicht längere Zeit entbehren. Solange sein Standquartier
wasserreich genug ist, um seinen Durst zu stillen, verläßt er es nie.
Erst wenn ein sehr heißer Sommer Wassermangel herbeiführt, besucht er
benachbarte, mit Wasser versehene Gegenden, um sofort in sein Revier
zurückzukehren, sobald dessen Wassermangel vorüber ist.
Bei der Eichel- und Buchelmast im Herbst hat er sich genug Fett
angemästet, um im geschützten Lager gekrümmt, mehr auf der Seite als
auf dem Bauche liegend über die für ihn schlimme Jahreszeit zu ruhen.
Ein Winterschlaf ist es kaum zu nennen; denn es ist mehr ein duselndes
Wachen, bei dem er niemals die angeborene Vorsicht außer acht läßt.
Kurze Zeit nach dem Lagern sind die Bären noch unruhig; besonders die
schlechtgenährten verlassen das Lager häufig, um sich, weil ihnen die
gegen Kälte schützende Fettschicht der feisten fehlt, durch Bewegung
zu erwärmen. Sobald sie beunruhigt werden, erheben sie sich, um ein
anderes Lager zu beziehen. Eingeschneite oder in Höhlen lagernde
Bären liegen am festesten. Bärinnen mit Jungen und alte, früher schon
einmal angeschossene Bären sind am ängstlichsten und erheben bei jedem
verdächtigen Geräusch den Kopf, um sich bei nahender Gefahr beizeiten
zu flüchten.
Solange der Winter anhält, bleibt der Bär im Lager, wobei sich seine
Sohlen häuten. Sobald Tauwetter eintritt, erhebt er sich, reckt und
streckt und schüttelt sich und geht zunächst auf die Beerensuche,
wobei er mit seinen Pranken die die Moosbeerensträucher bedeckende
Schneeschicht beseitigt, um zu den roten Beeren zu gelangen. Im Mai
oder Anfang Juni suchen sich meist zur Nachtzeit, mitunter schon
in der Dämmerung, laut brummend Bär und Bärin, um sich zu paaren.
Indessen hält sich die Bärin nicht nur an einen Bären, so daß es unter
den Männchen nicht selten harte Kämpfe absetzt, die mit dem Tode des
schwächeren endigen können. Um die Mitte des Winters, im Dezember oder
Januar, wirft die Bärin in ihrem weich mit Moos, Gras und Blättern
ausgestopften Lager das erste Mal höchstens zwei, später drei, auch
wohl vier, im Alter aber schließlich nur ein Junges, um vom 16.-18.
Jahre an gelte, d. h. unfruchtbar, zu bleiben. Im Gegensatz zum Bären
wechselt sie häufig ihr Lager und spielt mit den Jungen auf dem Schnee,
den sie nicht selten vollständig festtritt. Sie bleibt aber länger im
Winterlager als das Männchen. Erst wenn die Jungen ihr folgen können,
verläßt sie es, um zunächst nur in der Nähe umherzustreifen und die
Jungen im Aufsuchen von Fraß, im Klettern und in andern Dingen zu
unterrichten. Können die Jungen[S. 618] einige Strapazen aushalten, so zieht
die Familie weiter, wobei die Bärin als Beherrscherin ihres Distrikts
jedes Vorkommnis mißtrauisch überwacht und sich dem Eindringen des
Menschen standhaft und mutig widersetzt, auch die Jungen tapfer
verteidigt, während sie nicht selten die unbeholfenen Säuglinge bei
Gefahr verläßt. Sind die Jungen so weit selbständig, daß sie sich
ernähren und erhalten können, so verteidigt sie dieselben fast gar
nicht mehr. Die Jungen beziehen auch, falls die Mutter nicht wieder
trächtig ist, immer denselben Distrikt zum Überwintern, aber besondere,
niemals weit von dem jener entfernte Lagerplätze. Ist die Bärin aber
trächtig, so duldet sie die Jungen unter keinen Umständen in ihrem
Distrikt, sondern vertreibt sie mit Beißen und Ohrfeigen. Von den
Jungen, die von diesem Zeitpunkte an selbständig sind, geht jedes im
nächsten Frühjahr seinen eigenen Weg. Erst im fünften oder sechsten
Jahre werden sie fortpflanzungsfähig. Vom Menschen aufgezogene Bären,
die selbständig fressen und ihren Fraß selbst aufsuchen können, sind
ungemein schwer auszusetzen und arten förmlich zu Haustieren aus, die
sich nicht mehr vertreiben lassen.
Zur Jagd auf den Bären gehört persönlicher Mut, kaltes Blut und
vollständige Sicherheit in der Handhabung der Waffe; dann ist sie
ebenso ungefährlich wie die auf irgend ein anderes Raubtier. Sie wird
in verschiedenen Gegenden auf verschiedene Weise betrieben. Entweder
wird der Bär mit einer Treiberkette und einer Hundemeute aus dem zuvor
festgestellten Lager getrieben oder in diesem selbst geschossen. Im
Frühjahr und Herbst, wo er Aas am begierigsten annimmt, jagt man ihn
auf dem Anstand bei geschlagenem Vieh. Gewöhnlich besucht der Bär das
Aas erst nach eingetretener Dämmerung oder in der Nacht und ist in der
Dunkelheit schwer zu treffen. Auch durch Selbstschüsse auf den von ihm
begangenen Wechseln und in Tellereisen wird er gefangen. Sein Fleisch
ist wohlschmeckend, besitzt zwar durch Reichtum an Glycogen wie das
Pferdefleisch einen nicht jedermann zusagenden süßlichen Geschmack;
doch sind die Schinken gesalzen und geräuchert ausgezeichnet. Sein
weiches, kaum je ranzig werdendes Fett, das einen guten Ruf als ein den
Haarwuchs beförderndes Mittel besitzt, wird gut bezahlt und sein Fell
gilt 60–250 Mark.
Das gemeinste Beutetier der mitteleuropäischen Jäger ist der
Feldhase (Lepus vulgaris), der ganz Mitteleuropa und
einen Teil des westlichen Asien bewohnt. Im Süden vertritt ihn der
kleinere und rötlich gefärbte Hase der Mittelmeerländer, im hohen
Norden der Schnee[S. 619]hase und im Hochgebirge der Alpenhase, welch
letztere im Sommer bräunlichgrau, im Winter aber bis auf die schwarzen
Ohrspitzen weiß gefärbt sind. Die Nordgrenze der Verbreitung des
Feldhasen geht von Schottland über Südschweden zu den Gegenden am
Weißen Meer; in Sibirien fehlt er. Er hält sich am liebsten auf
ausgedehnten, fruchtbaren Ebenen, auch an lichten Waldrändern auf,
kommt jedoch im Innern von großen, dichten Wäldern selten vor, wird
aber in Gebirgsgegenden noch regelmäßig in der Laubholz-, seltener
in der Nadelwaldregion angetroffen. In den Alpen steigt er bis zu
1600 m und im Kaukasus fast bis zu 2000 m. Er ist
im allgemeinen mehr ein Nacht- als ein Tagtier, obwohl man ihn an
heiteren Sommertagen schon vor dem Untergang der Sonne und noch am
Morgen im Felde, wo er seine Nahrung sucht, umherstreifen sieht. Für
gewöhnlich verläßt er sein Lager oder das ihn bergende Gehölz erst
bei Sonnenuntergang, vor Eintritt der Dämmerung, um sich zum Äsen und
Spielen ins Freie zu begeben. Bei Sonnenaufgang sucht er wieder sein
Lager auf, um tagsüber zu ruhen. Höchst ungern verläßt er den Ort,
an welchem er aufgewachsen und groß geworden ist. Er ernährt sich
von Gras, jungem Getreide und allerhand saftigen Kräutern, in harten
Wintern auch von saftiger junger Baumrinde, besucht aber zu allen
Jahreszeiten gern die Kohl- und Gemüsegärten. Er äst nachts und bringt
den ganzen Tag, das Auge auch im Schlaf weit geöffnet, schlummernd
in einem zwischen Erdschollen oder Gebüsch wohlversteckten, immer
gegen den Wind geschützten Lager zu, worin er sich bei stürmischem
Schneewetter gern vergräbt oder einschneien läßt. Nie geht er gerade
auf den Ort los, wo er ein altes Lager weiß oder ein neues machen will,
sondern läuft erst ein Stück über den Ort, wo er zu ruhen gedenkt,
hinaus, kehrt um, macht wieder einige Sätze vorwärts, dann wieder
einen Sprung seitwärts und verfährt so noch einige Male, bis er mit
dem weitesten Satz an den Platz gelangt, auf dem er bleiben will. Bei
der Zubereitung des Lagers scharrt er im freien Felde eine etwa 5–8
cm tiefe, am hintern Ende etwas gewölbte Höhlung in die Erde,
welche so lang und breit ist, daß der obere Teil des Rückens nur sehr
wenig sichtbar bleibt, wenn er die Vorderläufe ausstreckt, auf diesen
den Kopf mit anliegenden Löffeln ruhen läßt und die Hinterbeine unter
den Leib zusammendrückt.
Der Feldhase verläßt sich mehr auf sein scharfes Gehör als auf
sein schlechtes Gesicht, erlaubt dem Menschen, den er weniger als
Hunde fürchtet, auf seine Schutzfärbung vertrauend, oft ganz nah
an ihn heran[S. 620]zukommen. Plötzlich aufgeschreckt, verläßt er sich
lediglich auf die Schnelligkeit seiner Beine, läuft jedoch selten
lange geradeaus und nähert sich, Winkel und Hacken schlagend, bald
wieder seinem Lager. Weit davon vertrieben, kehrt er, am folgenden
Tage anderswo aufgeschreckt, gern dahin zurück. Bei der eiligen
Flucht läuft er am liebsten ebenaus oder bergan, da er sich wegen
seiner kurzen Vorderbeine beim Laufen bergab leicht überschlägt.
Ist dem fliehenden Hasen ein Hund dicht auf den Fersen, so schlägt
er, um ihn an sich vorbeischießen zu lassen und einen Vorsprung in
umgekehrter Richtung zu gewinnen, einen plötzlichen Hacken; drängt
ihn die Not, so durchschwimmt er auch Teiche und Flüsse. Viermal
im Jahre setzt die Häsin nach einer Tragzeit von je 30 Tagen 2–4
Junge, die sehr ausgebildet, mit offenen Augen zur Welt kommen. Nur
während der ersten 5–6 Tage verweilt sie bei ihren Kindern, dann aber
überläßt sie dieselben ihrem Schicksal, kehrt nur während 14 Tagen
von Zeit zu Zeit zum Ort zurück, wo sie die Brut verließ, lockt sie
mit einem eigentümlichen Geklapper mit den Löffeln herbei und läßt
sie saugen. Bei Annäherung eines Feindes verläßt sie freilich ihre
Kinder, obwohl auch Fälle bekannt sind, daß alte Häsinnen die Brut
gegen Raubvögel und Raben verteidigten. Die Geschwister entfernen
sich zunächst nur wenig voneinander, wenn auch jedes sich ein anderes
Lager gräbt. Abends rücken sie zusammen auf Äsung aus und morgens
gehen sie gemeinschaftlich nach dem Lager zurück. Erst wenn sie
halbwüchsig sind, trennen sie sich voneinander. Nach 15 Monaten sind
sie erwachsen, können sich aber schon im ersten Jahre fortpflanzen.
Ihre Lebensdauer schätzt man auf 8–10 Jahre; doch stirbt der Hase wohl
nie an Altersschwäche, sondern wird vor der Zeit von einem seiner
zahlreichen Feinde erbeutet und gefressen. Außer dem Menschen stellen
ihm alle kleineren Raubtiere und größeren Raubvögel, selbst der
Storch, nach. Vom Menschen wird er am häufigsten auf Treibjagden und
in Kesseltreiben erlegt, doch auch auf dem Anstand geschossen und mit
Hunden aufgesucht. Durch wiederholte Jagden gewitzigt, erhebt er sich
schon beim Vernehmen des Jagdlärms vom Lager, um sich an ihm bekannte
geschützte Orte zu flüchten. Gefangene Hasen werden leicht zahm,
gewöhnen sich ohne Weigerung an alle Nahrung, die man den Kaninchen
füttert, sind jedoch empfindlich und sterben leicht dahin. Bringt man
junge Hasen zu alten, so werden sie regelmäßig von diesen totgebissen.
Außer ihrem wohlschmeckenden Fleisch wird auch das Fell verwendet. Aus
der von Haaren entblößten und gegerbten Haut ver[S. 621]fertigt man Schuhe und
eine Art Pergament oder benutzt sie zur Leimbereitung.
Ein überaus seltenes Wild Mitteleuropas ist der Biber (Castor
fiber), der früher hier häufig war, aber dem Menschen und seiner
Kultur weichen mußte. Unablässig verfolgt, ist er in den meisten
Gegenden, am frühesten in den Mittelmeerländern, ausgerottet worden.
Die Griechen nannten ihn kastor und die Römer fiber
und machten Jagd auf ihn nicht sowohl seines geschätzten, weichen
Felles wegen, als besonders zur Erlangung des Bibergeils. Dieses
befindet sich in Form einer gelblichen, schmierigen, eigentümlich nach
Karbolsäure riechenden Masse in zwei birnförmigen, zu beiden Seiten
der Geschlechtsöffnung gelegenen Beuteln und spielt vor allem zur
Brunstzeit zur gegenseitigen Anlockung der Tiere eine große Rolle.
Besonders beim Männchen sind die Kastorbeutel stark entwickelt und wird
ihr Inhalt an bestimmten Stellen entleert. Die Anziehungskraft dieses
Geils ist so groß, daß sich Biber, die, dadurch angelockt, in eine
Falle gerieten, aber entkamen, schon nach wenigen Tagen in einer andern
Falle fangen, darunter sogar Tiere, die in Eisen Fußteile eingebüßt
hatten. Dem Menschen diente es von alters her als geschätzte Arznei.
So sagt schon der ältere Plinius in seiner Naturgeschichte: „Der Biber
trägt einen Arzneistoff an sich, den man castoreum nennt. Bei
drohender Gefahr beißt er sich den Teil, worin jener Stoff enthalten
ist, selbst ab, weil er wohl weiß, weshalb man ihn jagt. Übrigens hat
der Biber ein entsetzliches Gebiß, fällt, wie mit Stahl, Bäume an den
Flüssen; und hat er einen Menschen gepackt, so läßt er nicht eher los
als bis die Knochen zersplittert sind. Er sieht aus wie ein Fischotter,
hat aber einen Fischschwanz (d. h. einen fischartig mit Schuppen
bedeckten Schwanz). Sein Haar ist weicher als Vogelflaum.“
Noch im Mittelalter war der Biber in allen Ländern nördlich von den
Alpen zu finden. In England kam er noch ums Jahr 1188 als seltener
Bewohner des Flusses Teify in Wales vor, wurde aber dann auch hier
ausgerottet. An einzelnen Flußgebieten Mitteleuropas hielt er sich in
kleinen Kolonien bis gegen die Mitte des 19. Jahrhunderts. In Böhmen,
wo die Biber schon im 18. Jahrhundert ausgestorben waren, führte
man 1773 aus Polen wieder welche ein, die sich, aus ihrem Zwinger
gebrochen, so stark vermehrten, daß sich einmal über hundert Familien
um Wittingau vorgefunden haben sollen. Als sie jedoch begannen die
Dämme zu untergraben, begann man einen Vernichtungskrieg gegen sie,
der 1865 nur noch zehn übriggelassen hatte.[S. 622] Zur Gewinnung des noch
immer gesuchten Bibergeils fielen die letzten Tiere bald Wilddieben zur
Beute. Das allerletzte hatte man in einem Zwinger im Rosenberger Teiche
untergebracht, wo es im Januar 1883 starb. Auch in Österreich-Ungarn
kommen heute keine Biber mehr vor. Einzelne fanden sich indessen noch
im Jahre 1857 in Siebenbürgen, 1860 in Galizien und 1865 bei Semlin auf
den Inseln zwischen Donau und Sau. Bei Fischamend, an der Mündung der
Fischa in die Donau, wo noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts größere
Biberansiedelungen bestanden, wurden die beiden letzten Biber 1863
erlegt. In Bosnien und der Herzegowina, wo, wie anderswo, verschiedene
Ortsnamen für das frühere Vorkommen des Bibers zeugen und Skelettfunde
es bestätigen, sind keine Biber mehr zu finden.
Früher noch als aus Österreich-Ungarn verschwanden die Biber in
Livland. Noch im 18. Jahrhundert lebten sie dort in Ansiedelungen,
und 1724 begünstigten sie in hohem Maße durch ihre Dammbauten die
Überschwemmungen. Aber auch dort führte die große Wertschätzung des
Bibergeils noch mehr als ihr schönes Fell zu ihrer Ausrottung. Im
Jahre 1841 wurde im Quellgebiet der Aa der letzte Biber geschossen.
In Skandinavien, wo der Biber einst sehr häufig war, ist er heute
vielleicht nicht mehr vorhanden. In Mittelrußland scheint er schon
vor Ende des 18. Jahrhunderts ausgestorben zu sein. Nur an einem
Nebenfluß des Pripet im Westen und an der Petschora und Dwina im
Norden leben noch Biber, obschon ihnen wegen des Pelzes und des
vorzüglichen sogenannten moskovitischen Bibergeils stark nachgestellt
wurde. In der Schweiz lebten noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts Biber
an der Steinach bei St. Gallen, sind aber auch dort schon längst
ausgerottet worden. Unter den deutschen Bibern lebten die letzten des
Alpenvorlandes auf bayerischem Gebiet, und zwar an der Sur, einem in
die Salzach fließenden Bach. Auch in den auf österreichischem Gebiet
liegenden Antheringer Auen nordwestlich von Salzburg kam der Biber
noch 1867 vor. Am Rhein sollen die Biber schon vor über 300 Jahren
ausgestorben sein; im Gebiete der Möhne in Westfalen hielten sie sich
länger; dort wurde der letzte talabwärts durch die Ruhr nach dem Rhein
vertrieben und am 2. Oktober 1870 an der Werthausener Fähre erschlagen.
Heute lebt der Biber auf deutschem Gebiet nur noch in einem
beschränkten Gebiet an der Saale und an der Elbe zwischen Wittenberg
und Magdeburg, wo er als große Seltenheit vom Menschen geschützt
wird, dennoch aber zusehends abnimmt. Nicht selten fängt er sich in[S. 623]
den Stellnetzen der Fischer oder in den für die Fischotter gelegten
Eisen. Hier lebt er meist paarweise, nur in den stillsten Gegenden zu
größeren Familien vereinigt und meist wie der Fischotter in einfachen
unterirdischen Uferhöhlen hausend. Nur wo er ungestört leben kann
errichtet er seine Burgen mit im Innern backofenförmigen Hütten, wobei,
wie bei den meisten Tieren, das Weibchen der eigentliche Baumeister
ist und das Männchen mehr Zuträger- und Handlangerdienst leistet.
Außerdem baut er nötigenfalls Dämme von bis 150 und 200 m Länge
und 2–3 m Höhe bei einem Durchmesser von 4–6 m unten
und 1–2 m oben, um das Wasser aufzustauen und in gleicher
Höhe zu erhalten. Die so aufgestauten Flüsse überschwemmen dann die
Täler oft auf weite Strecken, bringen dadurch die teilweise unter
Wasser gesetzten Bäume zum Absterben und nachträglichen Umstürzen
und schaffen so künstliche Teiche und Seen. Zum Bau seiner Dämme und
Hütten benutzt der Biber verschieden lange und dicke, der Rinde, von
der er außer dem Blattwerk vorzugsweise lebt, beraubte Knüttel, die
er übereinander schichtet und mit Steinen beschwert und mit Sand,
Schlamm und Lehm verdichtet. Er ist ein durchaus nächtliches Tier,
das sich erst nach Sonnenuntergang von seinem Lager erhebt, um mit
anbrechendem Tag in seinen Bau zurückzukehren. Bei Tage schläft er
auf dem Bauch oder Rücken, nicht aber auf den Seiten liegend, in
seiner sehr rein gehaltenen Wohnung. Er entleert sich seines Kotes
wahrscheinlich nur im Wasser. Nur in kalten Wintern hält er sich, ohne
Winterschläfer zu sein, Tag und Nacht in der Wohnung auf und verläßt
sie nur bei Tauwetter auf kurze Zeit, um neue Nahrung zu holen oder
die Wohnung auszubessern. Schon Ende Februar beginnt die Brunstzeit
des in Einzelehe lebenden Tieres, die bis in den März hinein dauert.
Gegen das Ende der wahrscheinlich sechs Wochen langen Tragzeit bleibt
das Weibchen ungestört in der Wohnung, um 2–3, höchstens 4 blinde, doch
schon behaarte Junge zur Welt zu bringen, die an den vier Brustwarzen
der Mutter saugen, dem Schreien kleiner Kinder ähnlich klingende Töne
hören lassen, acht Tage nach der Geburt die Augen öffnen und bei
günstigem Wetter bald mit ins Wasser genommen werden, wo sie sich
gleich schwimmend und tauchend umhertummeln, auch wohl an den Rücken
der schwimmenden Mutter anklammern. Nach etwa vier Wochen erhalten sie
schon zur Milch Rinde von Espen, Pappeln, Weiden, Erlen und Birken, die
die Mutter ihnen zuträgt; nach weiteren 6–8 Wochen gehen sie selbst
in den Wald, um Rinden abzunagen und den Eltern bei ihren Arbeiten zu
helfen. In[S. 624] diesem Alter eingefangen, sind sie sehr leicht zähmbar und
können so zahm werden, daß sie ihrem Herrn wie ein Hund überallhin
folgen. Im dritten Lebensjahre werden sie fortpflanzungsfähig und
verlassen die Wohnung ihrer Eltern, um sich selbständig zu machen und
einen eigenen Hausstand zu gründen. Bäume mit Hartholz benagt der Biber
nur, um seine Zähne zu schärfen; sonst hält er sich ausschließlich an
solche mit weichem Holz, und zwar Laubholz. Nadelholzbäume fällt er
nur, wenn sie ihm im Wege stehen, verarbeitet sie aber nicht weiter,
jedenfalls des Harzgeschmackes wegen, der ihrem Holze anhaftet.
Leckerbissen sind ihm die saftigen Wurzelstöcke mancher Sumpf- und
Wasserpflanzen, wie Seerosen, Schilf, Kalmus und Schachtelhalme.
Vor Beginn des Winters sammelt er sich einen Vorrat, wozu er meist
berindete Knüttel seiner Lieblingsnahrung wählt, von denen er, wenn er
Hunger hat, gewöhnlich nur die Rinde und im äußersten Notfall einen
Teil des Holzes verzehrt. Solche Vorratshaufen werden als falsche
Hütten oder unechte Burgen bezeichnet. Besonders große Vorräte trägt
er dann zusammen, wenn ein strenger Winter bevorsteht. Er erreicht ein
hohes Alter, wurde selbst in der Gefangenschaft 50 Jahre alt, und wird
heute kaum je gegessen, da sein Fleisch tranig schmeckt. Außer dem
Menschen hat der freilebende Biber wenig Feinde.
Ein anderes Nagetier von geringer Bedeutung ist das allbekannte
Eichhörnchen (Sciurus vulgaris), das die bewaldeten
Gegenden ganz Europas und Nordasiens bewohnt. Meist ist es braunrot,
nur in manchen Gebirgen schwarz gefärbt, klettert vorzüglich von einem
Baum zum andern, ohne auf den Boden zu kommen, lebt von Haselnüssen,
Bucheckern, Eicheln, Nadelholzsämereien, jungen Vögeln und Eiern, im
Notfall auch von Knospen und Baumrinde, gelegentlich auch von Pilzen.
Von seiner Nahrung, die es, auf den Hinterbeinen sitzend, mit den
beweglichen Vorderfüßen zum Munde führt, legt es im Herbst in hohlen
Bäumen Wintervorräte an. Es hält keinen eigentlichen Winterschlaf, wenn
es auch bei unfreundlichem Winterwetter sein freistehendes, rundes, im
Innern weich gepolstertes, mit einem einzigen Eingangsloch versehenes
Nest, das es in Mehrzahl für sich erbaut, oft tagelang nicht verläßt.
Darin und auch in Baumlöchern wirft das Weibchen vier Wochen nach der
die Männchen zu erbitterten Kämpfen mit Nebenbuhlern veranlassenden,
von Ende Februar bis in den April dauernden Paarungszeit seine 3–7,
etwa neun Tage blind bleibenden Jungen, die es sorgsam nährt und nach
Störungen in ein anderes Nest trägt. Nachdem sie entwöhnt wurden,
schleppt ihnen die Mutter, vielleicht[S. 625] auch der Vater, noch einige Tage
lang Nahrung zu; dann werden sie ihrem eigenen Schicksal überlassen.
Doch bleiben sie, häufig spielend und gemeinsam Nahrung suchend, noch
längere Zeit beisammen, bevor sie sich zerstreuen. Im Juni wirft
die Alte das zweite Geheck, dessen Mitglieder sich später oft mit
denjenigen des ersten vereinigen, um in demselben Waldesteil ihr Wesen
zu treiben. Im Edelmarder hat das Eichhörnchen seinen furchtbarsten
Feind. Das muntere Tierchen ist eine der Hauptzierden unserer Wälder
und läßt sich, jung gefangen, leicht zähmen. Es gewöhnt sich bald an
seinen Herrn und wird wegen seiner Lebhaftigkeit in Verbindung mit
großer Reinlichkeit gerne gehalten.
Wichtiger ist für die Alpenländer, die Pyrenäen und Karpaten das
Murmeltier (Arctomys marmotta), das auf den höchsten
Steinhalden des Hochgebirges, wo kein Baum und Strauch mehr wächst,
auf ringsum von steilen Felswänden eingerahmten, der Sonne möglichst
Zutritt gewährenden Grasplätzen lebt und sich am liebsten von saftigen
Bergkräutern und deren Blüten ernährt. Es erreicht eine Leibeslänge
von 51 cm, außer der Schwanzlänge von 11 cm, bei einer
Höhe von 15 cm, ist dicht schwarzbraun behaart, lebt während
des Sommers paar- oder familienweise in nur 1, höchstens 2–4 m
langen Sommerwohnungen, deren oft kaum das Durchzwängen einer Faust
zulassender Gang in einen erweiterten Kessel führt. Dieser ist bald
einfach, bald in zwei Arme geteilt, von denen der eine zum Wohn- und
Schlafkessel, der andere zum Abort führt. In letzterem Fall wird er
auch im Winter benutzt und hat dann einen geräumigeren Wohnkessel. Im
ersteren Falle wird eine besondere Winterwohnung bezogen, die 300–600
m tiefer liegt und durch eine 2–6, ja 8 m lange, am Ende
meist aufwärts gerichtete Röhre in eine 1–2 m im Durchmesser
haltende, längliche oder runde Kammer führt, die die Tiere schon im
August mit abgebissenem und getrocknetem Grase und Kraut beschicken.
Die losgegrabene Erde der selten tiefer als 1,5 m unter dem
Rasen liegenden Höhle wird nur zum kleinsten Teile hinausgeschafft;
das meiste wird festgetreten, wodurch die Gänge fest und hart werden.
Noch ehe sich die 5–15 Glieder starke Familie zum Winterschlaf in
den Bau begibt, wird dessen Winterbenutzung durch davorliegende
Heureste verraten. Nach den ersten rauhen Tagen gegen Ende Oktober
wird die Winterwohnung bezogen und ihr Eingang mit Heu, Erde, Steinen
verstopft, damit kein Raubtier eindringe. Hier ruht die zuvor gemästete
Gesellschaft zusammengerollt im Winterschlafe unter stark ver[S. 626]minderter
Lebensintensität, wobei sie die geringe Wärmeabgabe durch Verbrennen
des zuvor angesammelten Fettes bestreitet. Im April erscheinen sie
dann stark abgemagert vor der Öffnung ihrer Winterwohnung, um an
schneefreien Stellen etwas verdorrtes Gras zur Stillung ihres Hungers
zu fressen. Dann verzehren sie wohl auch von dem bis dahin nur als
Lager dienenden, im Herbste eingetragenen Heu. Sobald die Vegetation
wieder zu sprossen beginnt, finden sie reichlich Futter und erholen
sich bald von ihrer Abmagerung, paaren sich, und schon im Juni findet
man die 4–6 zuerst aschgrauen, später gelbbraun werdenden Jungen, die
sich, ehe sie etwas herangewachsen sind, selten vor dem Baue zeigen.
Sie werden von der auf den Hinterbeinen sitzenden und die Vorderbeine
weit ausgespreizt haltenden Mutter lange gesäugt und bleiben bis in
den nächsten Sommer hinein bei den Eltern. Auch die Familien, die
keine höher gelegene Sommerwohnung beziehen, machen oft weite Gänge
auf blumenreiche Weideplätze, von denen sie den unwillkommenen, unter
erbärmlichem Geschrei fliehenden Artgenossen durch tüchtige, mit
den Vorderpfoten auf Kopf und Rücken ausgeteilte Hiebe vertreiben.
Dabei fressen, spielen und ruhen sie abwechselnd. Alle Augenblicke
sehen sie sich um und überwachen mit der größten Aufmerksamkeit die
Umgebung. Das erste, das etwas Verdächtiges bemerkt, einen Raubvogel,
Fuchs oder Menschen, pfeift tief und laut durch die Nase, die übrigen
wiederholen das Warnungssignal teilweise und im Nu sind sie in die
benachbarten Löcher verschwunden. Bei dieser ihrer Wachsamkeit ist
es für den Jäger sehr schwer, sie zu beschleichen. Deshalb erbeutet
man gerne die Murmeltiere durch das vielerorts allerdings verbotene
Ausgraben der Baue, auch wohl in Fallen, die man oft nur für die alten
Tiere einrichtet. Man sucht sie auch mit eigens darauf abgerichteten
Hunden auf, die ihnen den Rückweg zum Bau abschneiden und sie in den
nächsten Schlupfwinkel treiben, wo sie mit einem Stock totgestoßen
werden. Da ihr Gewicht im Herbst auf 6–8 kg steigt, liefern sie
einen nicht zu verachtenden Braten. Ihr Fleisch hat zwar einen erdigen
Wildgeschmack, wird aber gewöhnlich durch Einreiben und Abbrühen mit
Salz und Salpeter und Räuchern während einiger Tage vor dem Kochen
wohlschmeckender. Das Fett dient den Gebirgsbewohnern als Arznei für
allerhand Übel, der frisch abgezogene Balg wird bei Rheumatismus
angezogen, und die Tiere selbst dienen dem Älpler als Wetterpropheten.
Im halbwüchsigen Alter gefangene Junge lassen sich leicht auffüttern
und werden im Umgang mit dem Menschen sehr zahm[S. 627] und zutraulich. Sie
achten auf den Ruf ihres Pflegers, sind gehorsam und gelehrig, so daß
man ihnen allerlei Kunststücke beibringen kann. Früher durchzogen arme
Savoyardenknaben mit solch einem gezähmten Murmeltier Almosen heischend
die Städte und Dörfer. Neuerdings ist jedoch der intelligentere Affe
an dessen Stelle getreten, und wandern nun an Stelle der Savoyarden
Italiener damit durchs Land.
Von andern Nagetieren werden noch die baumbewohnenden, in Wäldern,
Hainen und Baumgärten lebenden Bilche oder Schlafmäuse
(Myoxus) gelegentlich gefangen gehalten. Sie sind zwar
außerordentlich reinlich wie die Murmeltiere, aber im Gegensatz
zur Zutraulichkeit jener scheu und wenig liebenswürdig. Besonders
unfreundlich benimmt sich der gefangen gehaltene Siebenschläfer
(Myoxus glis), der sich durchaus nicht an seinen Pfleger gewöhnt
und ihn, wie jeden andern, der sich ihm nähert, wütend anknurrt.
Dieses besonders die Eichen- und Buchenwaldungen Süd- und Osteuropas
bewohnende, 16 cm Leibes- und 13 cm Schwanzlänge
erreichende aschgraue Tier, das sich tagsüber verborgen hält und nur
nachts nahrungsuchend in seinem Revier herumstreift und von einer
Gefräßigkeit ohnegleichen ist, außer Eicheln, Bucheln, Kastanien,
Hasel- und Walnüssen auch saftiges Obst liebt und alle kleinen Tiere,
denen es begegnet und die es zu überwältigen vermag, mordet und
frißt, sammelt gegen den Herbst Nahrungsvorräte ein und speichert
sie in seinen Höhlen auf. Diese macht es in trockenen Erdlöchern, in
altem Gemäuer oder in tiefen Baumhöhlungen zurecht, bereitet sich ein
Nest von zartem Moos und fällt darin, gewöhnlich mit mehreren seiner
Artgenossen gemeinsam, zusammengekugelt gegen den Oktober hin in
tiefen Schlaf, der gewöhnlich sieben Monate lang andauert. Es erwacht
daraus Ende April, paart sich und wirft in seiner Höhle 3–6 nackte und
blinde Junge, die sich sehr rasch entwickeln und schon vor dem Herbste
selbständig sind.
Im Herbste wird der Siebenschläfer durch Ansammlung von
Brennmaterialien für seinen sieben Monate dauernden Winterschlaf recht
fett und galt in diesem Zustande den alten Römern als Leckerbissen.
Sie wurden von ihnen in besondern Zuchtanstalten (glirarium
von glis = Siebenschläfer) gezogen und zum Verbrauch gemästet.
Eine solche umfaßte nach Varro einen kleinen Hain von Eichen, der von
einer glattwandigen Mauer umgeben war, damit sie nicht hinausklettern
konnten. Darin machte man ihnen zum Schlafen und Nisten geräumige
Höhlungen zurecht. „Das Mästen geschieht in großen, faßartigen Töpfen,
an deren[S. 628] Wänden inwendig Treppen sind; auch muß eine Höhle darin
sein, worin die Tiere ihr Futter verstecken können. Die Mast wird
durch Eicheln, Walnüsse und Kastanien, die im Überflusse gereicht
werden, bewirkt; dabei wird das Faß dunkel gehalten.“ Der drei
Generationen später lebende Plinius bemerkt in seiner Naturgeschichte:
„Der Siebenschläfer (glis) ist ein Tier, dessen Genuß,
gleich dem der Austern und ausländischen Vögel, durch Gesetze der
Zensoren und des Konsuls Marcus Scaurus verboten wurde. Der Erfinder
der Tiergärten (Fulvius Lupinus) hat auch die Kunst erfunden,
Siebenschläfer in Töpfen zu mästen. Es ist dabei wohl zu beachten,
daß man nur Landsleute aus demselben Walde zusammenstecken darf; denn
wenn fremde dazukommen, und wenn sie nur durch einen Berg oder Fluß
getrennt gelebt hatten, so beißen sie sich tot. Ihre abgelebten Eltern
versorgen sie mit kindlicher Liebe. Mit jedem Frühjahr erwachen sie
verjüngt. Ihre Winterruhe ist von der der Haselmäuse (nitela)
nicht verschieden.“ Heute noch stellt ihm der Mensch überall da, wo er
häufig ist, teils des Fleisches, teils des Felles wegen eifrig nach,
lockt ihn in Fallen aller Art und künstliche Winterwohnungen, um ihn
darin zu erbeuten. In Unterkrain erbeuten ihn die Bauern in mit einer
saftigen Birne oder Pflaume beköderten Schnellfallen. Außerdem gräbt
man teilweise mit Obst gefüllte Fässer in die Erde, in die ein Rohr
führt, in welchem Eisendrähte so befestigt werden, daß sie wohl das
Hineinschlüpfen, aber nicht das Herauskommen des Bilches gestatten.
Hier fangen sich die Tiere oft in so großer Menge, daß mancher Bauer
während eines Herbstes 200–400 Bilche erbeuten kann.
Im Gegensatz zum knurrigen Bilch und dem ebenso verdrossenen
Gartenschläfer (Eliomys nitela) wird die anmutige,
niedliche, gelblichrote Haselmaus (Muscardinus
avellanarius), deren Heimat Mitteleuropa ist und die nicht selten
in Dohnenstiegen gefangen wird, weil sie auch den Beeren der Eberesche
nachgeht, ein höchst beliebter Stubengenosse des Menschen. In England
wird sie wie Stubenvögel zu Markt gebracht und wie diese sehr viel
in Käfigen gehalten. Sie verliert in der Gefangenschaft bald ihre
Scheu, wenn auch nicht ihre Furchtsamkeit, und gewöhnt sich rasch an
den Menschen. Durch ihre große Reinlichkeit, Liebenswürdigkeit und
Verträglichkeit mit ihresgleichen, die zierlichen Bewegungen und ihr
munteres Wesen wird sie bald zum Lieblinge des Menschen. Sie frißt
anfänglich nur nachts, sparsam und bescheiden und fällt auch in der
Gefangenschaft in Winterschlaf, wenn die Örtlichkeit nicht stets
gleichmäßig warm gehalten wird. Sie ver[S. 629]sucht sich dann ein Nestchen zu
bauen und hüllt sich in dieses oder schläft in einer Ecke ihres Käfigs.
Bringt man sie wieder an die Wärme, z. B. zwischen die warme Hand, so
erwacht sie, schläft aber bald wieder ein.
Ein für uns Mitteleuropäer nur ausnahmsweise in Betracht kommender
Wildhund ist der Wolf (Canis lupus), der in Paaren oder
einzeln sowohl offenes Land als auch Wälder bewohnt, am Tage wie in
der Nacht beutelüstern umherschweift und sich manchmal, besonders im
Winter, zu Rudeln zusammentut, um gemeinsam unter Ausstoßen eines
fürchterlichen Geheuls größeres Wild zu jagen und auch den Menschen
anzufallen. So fielen im Jahre 1875 nicht weniger als 161 Menschen
russischen Wölfen zum Opfer. Die Wölfe, die beim scharenweisen
Durchstreifen einer Gegend in einer Reihe hintereinander herlaufen,
verfolgen ihre Beute in einem außerordentlich ausdauernden Galopp,
reißen ein eingeholtes Tier nicht sofort nieder, sondern verwunden
es, folgen ihm, beißen es abermals und hetzen es so zu Tode. Pferde-
und Rinderherden schließen, sobald sie Wölfe wittern, einen Kreis und
stellen sich, die Pferde mit den Hinterbeinen, die Rinder mit den
Hörnern, zur Wehr, greifen einzelne Wölfe auch ohne weiteres an. Nicht
bloß große Rudel, sondern auch einzelne Wölfe können ein entsetzliches
Geheul ausstoßen, das selbst den Menschen vor diesem sonst feigen Tiere
erzittern läßt. Die Paarungszeit des Wolfes dauert vom Dezember bis in
den April. Die 14 Tage dauernde Ranzzeit der Wölfin tritt nämlich bei
alten Weibchen früher ein als bei jüngeren. Während der Paarungszeit
kämpfen die Männchen oft auf Leben und Tod. Etwa 13 Wochen nach der
Paarung wirft das Weibchen in Felshöhlen oder Erdlöchern 6–10 neun bis
vierzehn Tage lang blindbleibende Junge, die bis zur nächsten Ranzzeit
bei der Mutter bleiben, bis zum dritten Jahre wachsen, dann auch
fortpflanzungsfähig werden und ein Alter von 12–15 Jahren erreichen.
Junge Wölfe lassen sich leicht zähmen und gewöhnen sich gleich
Hunden an ihren Herrn, weshalb es leicht zu verstehen ist, daß der
Wolf in verschiedenen Abarten zum Stammvater eines großen Teiles der
Haushunde wurde. Den alten Wölfen, denen großer Verstand und ungemeine
Schlauheit innewohnt, sucht man in Schießhütten und auf Treibjagden
beizukommen. Sie werden auch in tiefen, steilwandigen Gruben,
sogenannten Wolfsgruben, gefangen, die man mit Reisig und darüber mit
Moos und Schnee bedeckt, auf einer in der Mitte der Grube stehenden
Stange mit einem Huhn oder dergleichen beködert und mit einem etliche
Fuß hohen Zaun[S. 630] umgibt, der vom Wolfe übersprungen werden muß und ihn
daran hindert, unzeitigen Verdacht zu schöpfen. Denn der Wolf ist
außerordentlich vorsichtig und weiß unbekannten Öffnungen, Schlingen
oder Fallen aus dem Wege zu gehen, wird jedoch auch in Tellereisen
gefangen, soll sich aber, wenn er gefangen ist, häufig tot stellen
und in einem geeigneten Augenblick entlaufen. Da er auch Aas angeht,
wird ihm auch mit vergiftetem Fleische nachgestellt. Früher, als es
in Europa noch viel Wölfe gab, waren sie eine wesentliche Gefahr der
Herden. Noch heute ist bezeichnenderweise bei den Renntiere züchtenden
Lappen das Wort Friede gleichbedeutend mit Ruhe vor Wölfen. In Rußland,
das noch reich daran ist, fallen ihnen jährlich etwa 180000 Stück
Großvieh und über 600000 Stück Kleinvieh, besonders Schafe, zur Beute.
Laserewski bemißt den durch sie angerichteten Schaden an Haustieren auf
15 Millionen, an nutzbarem Wilde aber auf 50 Millionen Rubel (= 165
Millionen Mark). Dazu kommt noch, daß sie auch von der Tollwut befallen
und dann Menschen wie Tieren gleich gefährlich werden. Selbst die
Hunde hassen den Wolf und scheinen kein größeres Vergnügen zu kennen,
als auf ihn Jagd zu machen. Auf der südrussischen Steppe, wo der Wolf
in selbstgegrabenen Höhlen wohnt, wird er zu Pferd so lange gehetzt,
bis er nicht mehr laufen kann, und dann totgeschlagen. Den größten
Nutzen bietet er in seinem Winterfell, das als gutes Pelzwerk vielfach
verwendet wird. Die besten und größten Felle kommen aus Skandinavien,
Nordrußland, Sibirien und Nordchina und werden mit 10–25 Mark bezahlt.
Außerdem gewähren viele Regierungen noch ein besonderes Schußgeld für
die Erlegung eines Wolfes.
Ein kleinerer, aber noch viel listigerer Wildhund ist der Fuchs
(Canis vulpes), der in den eigentlichen Wolfsgegenden
verhältnismäßig selten ist, da der Wolf ihm feindlich wie dem Hund
gegenübertritt und ihn tötet und frißt, wo er nur kann. In dem Maße
aber als der Wolf ausgerottet wird, vermehrt er sich und weiß sich
dank seiner Schlauheit und Gewandtheit auch da noch zu behaupten, wo
dies andern Raubtieren nicht möglich wäre. Um zu rauben, zieht der
Fuchs die Nacht dem Tage vor; doch jagt er an stillen Orten auch bei
Tage. Den Tag über hält er sich mit Vorliebe in dichten Schonungen
und mit Gestrüpp bewachsenem Gelände auf, um dort zu schlafen, bis er
mit Eintritt der Dämmerung oder schon in den Nachmittagstunden auf
Raub ausgeht. Dabei gilt seine Jagd allem Getier, vom jungen Reh an
bis zum Käfer, vorzüglich aber den Mäusen, die den Haupt[S. 631]bestandteil
seiner Mahlzeiten ausmachen. Auch Beerenfrüchte, Stein- und Kernobst,
besonders Trauben, verschmäht er so wenig als Honig, wenn er solches
haben kann. Am Bache lungert er umher, um eine Forelle oder einen
Krebs zu erbeuten. Am Meeresstrand frißt er den Fischern die Netze
aus; im Walde nimmt er die gefangenen Vögel aus den Dohnen- und
Schnepfenstiegen. Als ungeselliges Tier geht jeder Fuchs seinen
eigenen Weg und bekümmert sich um andere seiner Art nur insoweit, als
es ihm Vorteil gewährt. Sobald die Füchsin Ende Januar oder Anfang
Februar hitzig zu werden beginnt, was sich durch Schwellung der
äußeren Geschlechtsteile und Austritt von etwas Blut aus der Scheide
bekundet, beginnt sie unruhig umherzutraben. Zu mehreren folgen ihr
dabei die männlichen Füchse, einer seine Füße in die Fußtapfen seiner
Vorgänger im Schnee setzend. So geht es fast ohne Halt und Rast die
ganze Nacht durch den Wald und über das Feld, bis schließlich einer
das Ziel seiner Begierden erreicht hat und der Füchsin in ihr Lager
folgt. Nach einer Tragzeit von 60–63 Tagen, gegen deren Schluß die
Füchsin den selbstgegrabenen oder von einem daraus verjagten Dachse
bezogenen Bau nur bei Nacht und für kurze Zeit verläßt und vom Gatten
mit Raub versorgt wird, wirft sie 4–7 unbeholfene, 14 Tage lang blind
bleibende, aber alle Milchzähne besitzende Junge, die sie mit großer
Zärtlichkeit säugt. Sie verläßt sie in den ersten Tagen ihres Lebens
gar nicht, später nur für kurze Zeit in der Nacht und scheint ängstlich
bestrebt zu sein, ihren Aufenthalt zu verheimlichen. Etwa fünf Wochen
nach der Geburt erscheinen die mit rötlichgrauem Grannenhaar über
ihrem ursprünglichen Wollkleid bedeckten Jungen, um sich zu sonnen und
untereinander oder mit der gefälligen Alten zu spielen. Diese beginnt
ihnen lebende Käfer, Frösche, Mäuse und Vögel zuzutragen und lehrt sie
dieselben fangen und verzehren. Scharf nach allen Richtungen hinsehend
und riechend, überwacht sie die sorglosen, äußerst possierlichen
Spiele der Jungen und veranlaßt sie, beim geringsten Verdacht einer
Gefahr sofort in den Bau zu kriechen. Wird dieser stärker beunruhigt,
so verläßt sie ihn mit den Jungen noch in der nächsten Nacht, wobei
sie die zu weiten Wanderungen etwa noch zu schwachen Kleinen einzeln
oder zu zweien im Maule wegträgt. Nur in höchster Not raubt sie
gleich dem männlichen Fuchs in nächster Umgebung des Baus und nähert
sich ihm höchst vorsichtig gegen den Wind, um ihre Jungen nicht zu
verraten. Hat sie nichts Verdächtiges wahrgenommen, so naht sie sich
dem Baue trabend, um ihre Beute vor ihm abzulegen und die hungrigen
Jungen[S. 632] durch einen leisen Ruf zur Mahlzeit einzuladen, die sehr
rasch beendet ist. Schon im Juli begleiten die Jungen die Alte in der
Abenddämmerung in die Umgebung des Baus auf die Jagd und werden von
ihr sorgfältig zum Rauben angeleitet, wobei ungeschickte Junge durch
scharfe Bisse bestraft werden. Wenn das Getreide hoch genug ist, zieht
die Fuchsfamilie nachts aufs Feld, wo manches junge Rebhuhn und mancher
halbwüchsige Hase den jungen Füchsen zur Beute fällt, bis die Ernte die
zu dieser Zeit nur selten zu Baue gehenden Tiere zur Rückkehr in den
Wald zwingt, wo sie sich tagsüber im dichten Buschwerk verbergen. Wenn
aber die Blätter im Herbste fallen, trennen sich die mit Vollendung
des ersten Lebensjahres fortpflanzungsfähigen, aber erst nach Ablauf
des zweiten ausgewachsenen jungen Füchse allmählich von der Mutter, um
unter glücklichen Umständen, nach gefangenen zu urteilen, ein 16 Jahre
übersteigendes Alter zu erreichen. Jung eingefangene Füchschen kann man
leicht aufziehen. Sie werden, falls man sich viel mit ihnen abgibt,
bald zahm, wenn auch nie eigentlich zutraulich, und erfreuen durch ihre
Munterkeit und Beweglichkeit. Außer dem Menschen hat der Fuchs bei
uns wenige Feinde. Dieser vertilgt ihn als Jagdschädling wo er kann
mit Schießen, Fangen, Vergiften und Ausgraben und verwertet höchstens
seinen Pelz. Durch Vertilgung sehr zahlreicher Mäuse, die, wie gesagt,
seine Hauptspeise bilden, und deren er 20 bis 30 Stück pro Mahlzeit
verbraucht, macht er sich einigermaßen nützlich. Auch er leidet wie
Wolf und Hund gelegentlich an Tollwut und kommt dann am hellen Tage ins
Innere von Dörfern, um dort alles zu beißen, was ihm in den Weg kommt.
Ebenfalls nicht selten in Mitteleuropa ist der Dachs (Meles
taxus), der gelegentlich in Weinbergen und auf Rübenfeldern Schaden
anrichtet, aber diesen reichlich durch Wegfangen und Verzehren von
allerlei Ungeziefer, besonders Engerlingen und Mäusen, in Wald und Flur
nützt. Unter allen Mardern ist er der nützlichste und ein Erhalter,
nicht aber ein Schädiger des Waldes, weshalb er den weitgehendsten
Schutz verdient. Auf der Sonnenseite dicht mit Gestrüpp bedeckter Hügel
gräbt er sich mit seinen Krallen eine geräumige Höhle mit mehreren
Ausgängen, von denen die wenigsten von ihm benützt werden, sondern
als Notausgänge zur Flucht oder als Luftgänge dienen. Überall in
ihr herrscht die größte Reinlichkeit, wodurch sich der Dachsbau vor
allen übrigen ähnlichen unterirdischen Behausungen von Säugetieren
vorteilhaft auszeichnet. Der Hauptraum im Bau, der Kessel, ist sehr
geräumig und weich mit Moos ausgepolstert. In diesem traulichen
Gemach ruht[S. 633] der Dachs während des Tages, um ihn erst, wenn die Nacht
vollkommen hereingebrochen ist, zur Nahrungssuche zu verlassen.
Nur ganz ausnahmsweise treibt er sich in stillen Waldungen während
des Hochsommers schon in den späteren Nachmittagsstunden herum, um
außer kleinen Tieren aller Art auch saftige Wurzeln, Buchnüsse und
Obst zu verzehren. Nur zur Zeit der Paarung gesellt sich der Dachs
vorübergehend zu einem Weibchen, bewohnt aber den ganzen übrigen Teil
des Jahres allein einen Bau. In dem ihrigen wirft die Dächsin Ende
Februar oder Anfang März 3–4, selten 5 bis zum zehnten Tage blinde
Junge, die sie treu behütet und denen sie nach der Säugezeit so lange
Würmer, Schnecken, Engerlinge, Wurzeln und kleine Säugetiere in den
Bau schleppt, bis sie sich selbst zu ernähren vermögen. Schon nach 3–4
Wochen begeben sich die kleinen Dachse in Gesellschaft ihrer Mutter vor
den Eingang der Höhle, um sich zu sonnen und zu spielen. Bis zum Herbst
bleiben sie bei der Mutter, trennen sich dann und leben für sich, indem
sie sich eine eigene Höhle graben. Im zweiten Jahre sind sie völlig
ausgewachsen und beginnen sich fortzupflanzen. Der Dachs erreicht ein
Alter von 10 oder 12 Jahren. In Gegenden mit kalten Wintern hält er
einen Winterschlaf ab, wobei er die Mündungen seiner Wohnung verstopft.
Schon in England, das ein verhältnismäßig mildes Klima besitzt,
unterbricht er denselben. Jung eingefangene und sorgfältig aufgezogene
Dachse werden sehr zahm und anhänglich, alte aber nie. Man fängt den
Dachs in Fallen, jagt ihn mit Dachshunden oder Foxterriers aus seinem
Bau und gräbt oder bohrt ihn aus. Nur ganz früh am Morgen kann man
dem heimkehrenden Dachse wohl auch auf dem Anstande auflauern und ihn
erlegen. Sein Fell wird für allerlei Pelzwerk verwendet, seine ziemlich
steifen Haare geben ein gutes Material für Bürsten und sein Fleisch
wird von Jägern gern verzehrt.
Ein Wassermarder von reichlich 1,2 m Länge, wovon 42 cm
auf den Schwanz zu rechnen sind, ist der Fischotter (Lutra
vulgaris), der ganz Europa und Asien nördlich vom Himalaja
bewohnt. Er findet sich an allen fischreichen Gewässern, wo er sich
mehrere unterirdische Wohnungen gräbt, deren Eingang sich stets etwa
1⁄2 m tief im Wasser befindet, um mit einem etwa 2 m
langen, schief aufwärts steigenden Gang in einen regelmäßig mit
Gras und Laub ausgepolsterten geräumigen Kessel zu führen, von dem
ein zweiter schmaler Gang zur Vermittlung des Luftwechsels nach der
Bodenoberfläche geht. Im Wasser ist er zu Hause und führt darin weite
Streifzüge aus, um[S. 634] außer Fischen, die die Hauptmenge seiner Nahrung
bilden, allerlei Wassertiere, Vögel und deren Eier und saftige Wurzeln
nebst Obst zu erbeuten. Alte Fischotter leben gewöhnlich einzeln,
alte Weibchen aber streifen lange Zeit mit ihren Jungen umher oder
vereinigen sich mit andern Weibchen oder um die Paarungszeit mit
solchen und Männchen und fischen dann in Gesellschaft. Neun Wochen nach
der Paarung, bei uns gewöhnlich im Mai, wirft das Weibchen in seinem
sichern Uferbau 2–4 fast schwarze Junge, die nach 9–10 Tagen die Augen
öffnen und von der Mutter sorgfältig verpflegt werden. Im Alter von
ungefähr zwei Monaten nimmt sie die Mutter auf den Fischfang mit, um
sie in allen Otterkünsten zu unterrichten. Im zweiten Jahre sind sie
schon erwachsen und fortpflanzungsfähig. Jung aus dem Nest genommen
und richtig behandelt wird der Fischotter sehr zahm und anhänglich
an seinen Herrn, dem er treu wie ein Hund auf Ruf und Pfiff folgt.
Wie den Kormoran benützen die Chinesen auch ihn beim Fischfang. Daß
ein so intelligentes, gewandtes Raubtier wie er im Fischstand eines
Gewässers großen Schaden anrichtet, ist begreiflich. Nach dem Urteil
Sachverständiger verzehrt er täglich wenigstens 1 kg Fische.
Deshalb haben schon zu Beginn des Mittelalters Otterjäger von Beruf
ihn gleich dem Biber mit eigens dazu abgerichteten Hunden gejagt.
Sie standen unter den Fischmeistern und waren weniger angesehen
als andere Jäger. Noch bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts gab
es an allen Fürstenhöfen und auf größeren Besitzungen Otterjäger,
die sich zur Otterjagd besonderer Otterhunde bedienten. Diese schon
längst ausgestorbene Rasse war niedrig, langgestreckt, stichelhaarig,
dunkelbraun, mit seitwärts abstehenden Ohren, starkem Gebiß und von
bissigem, zänkischem Charakter. Mit dem Schwinden der Ottern und Biber
gerieten diese Otterjäger in Deutschland in Vergessenheit, während sich
in England der Ottersport in früherer Blüte erhielt. Die Otterjagd
wird auf verschiedene Weise betrieben, nämlich durch Ansitz auf den
Otter, durch die Suche nach ihm mit Dachs- und Vorstehhunden, durch
die Treibjagd, die Jagd mit Sperrnetzen, das Stechen des Otters mit
dem Ger und durch die Parforcejagd. Der Ansitz auf den Otter ist wenig
erfolgreich, die übrigen Jagdweisen, die nur mit Hunden betrieben
werden können, sind nur in seichten Flüssen oder Bächen aussichtsvoll,
während die Hunde in großen, tiefen Gewässern nichts auszurichten
vermögen. Deshalb stellt man dem Otter, wo man ihm sonst nicht
beikommen kann, mit Fallen nach und sucht ihn auch in Schlingen und
durch Selbstschüsse zu erbeuten.
[S. 635]
Ganz Europa, mit Ausnahme des höheren Nordens, namentlich Skandinaviens
und Rußlands, bewohnt die Wildkatze (Felis catus), ein
echtes Waldtier, das ausgedehnte, dichte Wälder der Mittelgebirge,
namentlich Nadelwälder, bevorzugt, von denen sie in die Wälder
des Flachlandes hinausschweift. In Mitteleuropa wird sie noch im
Harz und in den Ostalpen, besonders aber in den ganz unbewohnten
Gebirgswaldungen der Karpaten gefunden. Sie ist bedeutend stärker als
die Hauskatze, hat einen dickeren Kopf, einen gedrungeneren Leib, einen
kürzeren, buschigeren, schwarzgeringelten Schwanz, der von der Wurzel
bis zum schwarzen Ende gleichmäßig dick, ja an der Spitze aufgetrieben
erscheint. Ihre Farbe ist bräunlichgrau mit schwarzen Querstreifen, auf
dem Scheitel mit schwarzen Längsstreifen und gelblich weißem Fleck an
der Kehle. Sie erreicht eine Körperlänge von 70–90 cm und ein
Gewicht von 9 kg. Sie ist äußerst scheu und lebt nur während
der Ranzzeit oder solange die Jungen noch nicht selbständig sind in
Gesellschaft, sonst stets allein. Den Tag über verbirgt sie sich gern
in hohlen Bäumen, Felsspalten, verlassenen Fuchs- oder Dachsbauten, oft
auch in dichtbewachsenen Sümpfen und tritt mit Beginn der Dämmerung
ihre Jagdzüge an. Vorsichtig und listig, unhörbar sich anschleichend
und geduldig lauernd, überfällt sie den Hasen in seinem Lager, den
Vogel in seinem Nest, das Eichhörnchen auf dem Baume, springt dem Reh
und dem Hirschkalb auf den Rücken und zerbeißt ihm die Halsschlagader,
lauert an Seen und Wildbächen auf Fische und Wasservögel und weiß sie
mit großer Geschicklichkeit zu erbeuten. Weitaus die Hauptnahrung aber
bilden Mäuse und daneben kleine Vögel. Das in der Art der Fortpflanzung
der Hauskatze nahestehende Tier wirft im April oder Mai sechs anfangs
noch blinde Junge, bringt sie in Baumhöhlen, Felsspalten oder ähnlichen
Verstecken unter, schleppt sie bei Befürchtung von Gefahr in ein
anderes Versteck, gleicht im Benehmen sehr der Hauskatze, spinnt in
guter Laune wie sie und drückt ihre Gefühle durch Bewegungen der
Schwanzspitze aus. Vielfach vermischt sie sich mit der Hauskatze und
erzeugt dann ungebärdige Junge, die leicht verwildern und sich wie der
Vater raubend in den Wäldern herumtreiben.
Der früher überall in den Ländern nördlich der Alpen verbreitete
Luchs (Felis lynx) wird gegenwärtig nur noch im Norden
von Skandinavien und Rußland gefunden. Ostwärts verbreitet er sich
durch den größten Teil des nördlich vom Himalaja gelegenen Teiles
von Asien. In den entlegenen Gebieten der Alpen wird er gelegentlich
noch erbeutet,[S. 636] ist in den Karpaten häufiger, wurde aber auf den
Mittelgebirgen Deutschlands und Frankreichs längst ausgerottet. Die
letzten fünf Luchse des Thüringer Waldes wurden zwischen 1773 und
1796, der letzte oberschlesische Luchs 1809, die letzten beiden
Harzer Luchse 1817 und 1818, der letzte Luchs der schwäbischen Alb
1846, der letzte französische in dem Departement Haute-Loire 1822
geschossen. Er ist ein ausgesprochenes Waldtier, das mit Leichtigkeit
Bäume erklettert, um von deren untersten Ästen aus dem Wild auf dessen
Wechseln aufzulauern, ihm beim Vorübergehen ins Genick zu springen und
die Halsschlagader aufzubeißen. Wie die Wildkatze ist der Luchs ein
durchaus nächtliches Tier, das sich tagsüber in allerlei Schlupfwinkeln
der dichten von ihm bewohnten Wälder versteckt hält, um nachts auf
Raub auszugehen. Im Gegensatz zum Wolf hält sich der Luchs oft längere
Zeit in ein und demselben Gebiete auf, um es nachts nach allen
Richtungen zu durchstreifen. Größeres Wild zieht er kleinerem vor und
scheint sich durchaus nicht mit Mäusefang zu befassen. Er schleicht
den Rehen in den Waldungen, den Gemsen auf den Alpen nach, berückt
Auer-, Birk-, Hasel- und Schneehühner und fällt räuberisch unter die
Schaf-, Ziegen- und Kälberherden, unter denen er gelegentlich großen
Schaden anrichtet, indem er mehr erwürgt als er zur Nahrung braucht,
auch von einem von ihm geschlagenen Tier oft nur das Blut aufleckt und
kleine Partien frißt, das übrige aber, Wölfen und Füchsen zur Beute,
liegen läßt. Dadurch macht er sich dem Jäger wie dem Hirten gleich
verhaßt, die ihn überall mit Eifer verfolgen. Jung eingefangen und
an den Pfleger gewöhnt, wird er sehr zahm und zutraulich. Außer dem
Kalbfleisch ähnlichen, sehr schmackhaften Fleisch, das noch zu Anfang
des vorigen Jahrhunderts auf fürstlichen Tafeln als vorzügliches
Mittel gegen Schwindel gegessen wurde, ist sein Pelz sehr gesucht.
Die skandinavischen gelten als die schönsten und werden mit 30 Mark
und darüber bezahlt. Sibirien liefert alljährlich etwa 15000, Rußland
und Skandinavien etwa 9000 Felle. Die Pelze der Luchse des östlichen
Sibirien kommen ausschließlich in den chinesischen Handel und werden
von den an die Mongolei grenzenden Völkern, besonders den Chinesen,
sehr begehrt.
Mit diesen letzteren Wildarten haben wir uns schon mit den eigentlichen
Pelztieren befaßt, die wesentlich ihres schönen, dichten Felles
wegen gejagt werden. Zu ihnen gehören auch Marder, Iltis, Wiesel,
Hermelin, Zobel und die übrigen Marderarten, die wir im nächstfolgenden
Abschnitte für sich betrachten wollen. Es sei hier nur noch be[S. 637]merkt,
daß zum Ersatz des vielfach ausgerotteten einheimischen Wildes
vielfach fremdes eingeführt wurde, so beispielsweise Hasen und
Rotwild aus Ungarn; doch sind die großen Hoffnungen, die man an diese
Blutauffrischung knüpfte, nur zum geringen Teile erfüllt worden. Mit
gutem Erfolge hat man jedoch das südeuropäische Wildschaf, den Muflon,
aus Korsika und Sardinien, im Harz, im Thüringerwald und in anderen
Gebirgsgegenden eingeführt. Seine Lebensgewohnheiten wurden auf
Seite 135 besprochen, so daß wir an dieser Stelle nicht näher darauf
einzutreten brauchen.
[S. 638]
XXVI. Nützliche wilde Vögel.
Alle größeren einheimischen Vögel sind beliebte Jagdobjekte, von der
scheuen Trappe und dem Urhahn bis zu den Rebhühnern. Die stattliche
Trappe (Otis tarda) ist ein Bewohner der baumlosen
Ebene, die außer der Brutzeit als Standvogel in geselligen Vereinen
von 6–10, im Winter oft in Scharen von 50–100 Stück lebt. Von den
entlegensten Brachfeldern, auf denen sie stets Nachtruhe hält,
zieht sie morgens früh auf ihre Futterplätze, wo sie außer größeren
Insekten und Sämereien aller Art hauptsächlich Teile grüner Pflanzen
frißt. Dabei reckt der scheue Vogel oft den Kopf in die Höhe, um sich
umzusehen. Geht er ruhig seiner Nahrung nach, so schreitet er langsam
und gemächlich einher, läuft er davon, so holt ihn ein flüchtiger Hund
nur schwer ein. Im Fluge bewegt er sich mit langsamen Flügelschlägen
ohne sonderliche Anstrengung. Im März kämpfen die Männchen um die
Weibchen, bis die Paare sich gefunden haben und zu brüten beginnen. In
der zweiten Hälfte des Mai, wenn sich das Weibchen im jungen Getreide
verbergen kann, bereitet es das Nest in Form einer Mulde im Boden
und brütet darin in 30 Tagen seine 3 Eier aus. Die zunächst sehr
unbeholfenen, erst nach einigen Tagen ordentlich laufen lernenden
Jungen verbergen sich mit der Mutter meist im Getreide und leben
zuerst nur von Insekten und deren Larven, später von zartem Grün.
Sie werden von den Eltern sorgsam bewacht und kräftig selbst gegen
ebenbürtige Feinde verteidigt. Da die Trappen besonders im Alter kein
wohlschmeckendes Fleisch haben, werden sie hauptsächlich wegen der
Schwierigkeit, mit der ihnen beizukommen ist, gejagt. Um sie leichter
beschleichen zu können, bedient man sich des Schießpferdes oder des
Bauernwagens, verkleidet sich gelegentlich auch einmal als Bauernfrau
mit dem obligaten Tragkorb.
In höherem Ansehen als sie stehen beim Weidmann die Ur- und
Birkhühner, von denen fast nur die Männchen im Vorfrühling —[S. 639]
von Ende März an — auf der Balz, während welcher die sonst äußerst
vorsichtigen Vögel weder sehen noch hören, geschossen werden. Das
Urhuhn, d. h. großes Huhn (Tetrao urogallus), ist ein
echter Waldvogel und lebte ursprünglich im Tiefland, wurde aber mit
der Ausrodung des Waldes aus der Ebene ins Gebirge hinauf vertrieben.
In Europa ist es heute von den Gebirgen der südeuropäischen Halbinseln
bis Rußland und zum Eismeer und durch Sibirien bis nach Kamtschatka
verbreitet. Das meiste Urwild kommt in Asien, aber auch noch in Rußland
vor. Allen andern Waldarten zieht es den Kiefernwald vor, lebt aber nur
in ausgedehnten Waldbeständen mit reichem Unterwuchs und ernährt sich
vorwiegend von Kiefernadeln, Wacholderbeeren und anderer Pflanzenkost.
Das Birkhuhn (Tetrao tetrix) dagegen liebt gemischte,
lockere Waldbestände mit zerstreutem Buschwerk und erhielt seinen Namen
nach seiner Vorliebe für Birken. Es äst gern Laubknospen und hat einen
bestimmten Standort, den es nur wechselt, wenn es beunruhigt wird.
Sein Verbreitungsgebiet stimmt mit dem des vorigen überein, doch lebt
es sowohl im Tiefland, als im Mittel- und Hochgebirge, und geht in
letzterem über die Baumgrenze hinaus. Seine Balzzeit währt von Mitte
März bis Mitte oder Ende Mai; dabei balzt der Birkhahn im Gegensatz
zum Urhahn, der dies stets auf Bäumen tut, fast ausschließlich auf
dem Boden, auch fleißiger und zu verschiedener Tageszeit, nicht bloß
wie jener in der Morgen- und Abenddämmerung. Auf den Balzplätzen
des Tieflandes und des Mittelgebirges, auf Waldblößen, Weiden oder
Torfstichen balzen manchmal gleichzeitig 20 und mehr Hähne, im
Hochgebirge treten sie dagegen mehr vereinzelt auf. Je schlechter ein
Forst bewirtschaftet wird, desto eher ist Birkwild darin anzutreffen.
In Rußland und Sibirien verbreitet es sich mehr und mehr nach Norden,
indem es vielfach die Stände des durch die großen Holzrodungen
vertriebenen Urwilds einnimmt. In Neufundland ist es mit Erfolg
eingeführt worden. In Mitteleuropa ist es weniger zahlreich als das
Urwild vertreten, dagegen ist es im Norden zahlreicher als jenes.
Infolge der stärkeren und besseren Bodenbewirtschaftung nimmt es bei
uns mehr und mehr ab, wie auch das Haselwild.
Das Haselhuhn (Tetrao bonasia) ist das kleinste der
mitteleuropäischen Waldhühner und liebt im allgemeinen ähnliche
Standorte wie das Urwild, meidet aber die dem Birkwild besonders
zusagenden wilden oder verwilderten Holzbestände und Kahlschläge. Gern
lebt es an Waldstellen, wo es leicht zwischen Laub- und Nadelholz
wechseln kann. Es[S. 640] ernährt sich vorzugsweise von Laubholzknospen und
Waldbeeren, wie auch von kleinen Tieren aller Art. Es lebt vorzugsweise
in den gemischten Wäldern von Mittelgebirgen und in den Vorbergen und
dem Waldgürtel der Alpen, obwohl es ursprünglich mehr ein Vogel des
Tieflandes als des Gebirges ist. Am reichsten an Hasel-, wie überhaupt
an Waldhühnern, ist heute noch die russische Tiefebene. Je mehr in
andern Ländern der Wald aus dem Tieflande verschwand, um so mehr
hat sich das Haselhuhn in deren Gebirge zurückgezogen. Je mehr die
unterwuchslosen, geschlossenen Hochwälder aus Reinbeständen namentlich
von Nadelholz verschwinden, um so seltener wird das Haselwild, weil
ihm dadurch besonders die zu seiner Äsung notwendigen Beerenfrüchte
entzogen werden. Es hält sich vorzugsweise am Boden auf, wo es durch
Scharren allerlei Insektenlarven und Gewürm verschiedenster Art zu
erlangen sucht. Es läuft sehr gewandt und bildet familienweise ganze
Ketten im Wald, kommt jedoch manchmal auch einzeln vor. Da es sich
bei Beunruhigungen im Gestrüpp oder im dichten Astwerk versteckt oder
sich an den Boden drückt, wird es von Unkundigen auch in gutbesetzten
Revieren kaum je wahrgenommen. Es ist ein treuer Standvogel und liefert
ein hochgeschätztes Wildbret. Es erzeugt mit dem Schnee- und Birkhuhn
Bastarde.
Unter den beiden Arten der europäischen Schneehühner liebt
das Moorhuhn (Lagopus albus) feuchte, mit Krüppelwald,
besonders mit Birken- und Weidenbeständen, abwechselnde Niederungen
und Moorgründe. Es lebt meist im Gestrüpp der Tundren und Moore,
nicht aber im Waldinnern. Dieser mehr nordische Vogel ist in den
Mittelgebirgen Schottlands und Skandinaviens sehr häufig und findet
sich überall zirkumboreal außer in Grönland und auf Island, wo nur
das Alpenschneehuhn gefunden wird. In Deutschland findet es sich
nur im nordöstlichsten Preußen, wo es im Sommer in unzugänglichen
Mooren brütet. Einzelne Moorhühner des Nordens überwintern in ihrem
Brutgebiet, die Mehrzahl aber begibt sich nach Süden bis dahin, wo der
Nadelwald aufhört und die Birkenbestände beginnen, um im April oder
Mai auf ihre nordischen Brutplätze zurückzukehren. In Schottland und
Skandinavien wird es wegen seines wohlschmeckenden Fleisches eifrig
gejagt und in sehr großen Mengen auf den Markt gebracht.
Tafel 65.

Im Heidegestrüpp brütendes schottisches Moorhuhn
(Lagopus scoticus). Vom gemeinen nordischen Moorhuhn
unterscheidet es sich durch braune Schwingen, graue Beine und vor allem dadurch,
daß es im Winter nicht wie jenes weiß wird.
(Unretuschierte Naturaufnahme von Cherry und Kearton.)
⇒
GRÖSSERES BILD
Tafel 66.

Durch ihre Färbung geschützte brütende Waldschnepfe
auf dem Nest.
(Nach Meerwarth, Naturstudien.)
⇒
GRÖSSERES BILD
Das Alpenschneehuhn (Lagopus mutus) lebt im Hochgebirge
über 1800 m Höhe zwischen wilden Steinmassen, Zwergweiden,
Alpenrosen, Legföhren und anderem Gesträuch. Im hohen Norden ist es
der Be[S. 641]gleiter des Schneehasen und Moschusochsen und durch sein
dichtes Federkleid gut gegen die Kälte geschützt, weiß sich auch mit
seinen gleich denen des Moorhuhns dicht befiederten Füßen tiefe Gänge
in den Schnee zu graben, die es an seine Nahrung, die Knospen der
verschiedensten Sträucher, bringen und es auch vor seinen Feinden
schützen. Es ist kleiner und geselliger als das Moorhuhn und wird
wegen seiner an Einfalt grenzenden Arglosigkeit leicht die Beute von
Jägern und Raubvögeln. In Skandinavien bildet es, wie der Fisch an der
Küste, so im Innern die gewöhnliche Fleischspeise, während das Moorhuhn
mehr auf den Markt der südlichen Städte gebracht wird. Das Fleisch
des Alpenschneehuhns ist indessen dunkler und weniger schmackhaft als
dasjenige des Moorhuhns; es ähnelt dem Hasenwildbret.
Ein ausschließlicher Feldvogel, aber auch ein Freund von Gebüsch und
niederem Gehölz, ist das Rebhuhn (Perdix cinerea). Es ist
Standvogel und nur zum Teil Strichvogel, lebt im Winter familienweise,
die übrige Zeit in einzelnen Paaren, die treu zusammenhalten. Im auf
Saatfeldern, im hohen Wiesengras und Gestrüpp oder an Buschrändern
gut versteckten Neste werden 10–12 Junge ausgebrütet, die von den
beiden Eltern sorgsam behütet und zum Auffinden der aus Insekten,
Getreidekörnern und anderen Sämereien, wie auch grünen Pflanzenteilen
bestehenden Nahrung angeleitet werden. Erwachsen bilden sie mit den
Eltern eine sogenannte Kette, die im Herbst mit Hilfe des Vorstehhundes
gejagt wird. Hat derselbe mit seinem vorzüglichen Geruchssinn eine
solche an den Boden geduckte Rebhuhnfamilie ausgekundschaftet, so
bleibt er mit lang vorgestrecktem Hals und einer erhobenen Pfote
wie angewurzelt stehen, bis der Herr sie sieht und auf sie schießen
kann. Das im Grunde nicht sehr scheue Rebhuhn wird in Gegenden, wo es
gejagt wird, sehr vorsichtig und weiß sich seinem Feinde durch rasches
Verstecken zu entziehen. In Südeuropa tritt es seltener auf, desto
häufiger aber in Mitteleuropa, wo es eines der gemeinsten Feldvögel
und das gewöhnlichste Federwild ist. Auf Neuseeland wurde es vor einem
Menschenalter mit Erfolg eingeführt.
Die alten Griechen und Römer fingen die Rebhühner mit Netzen, um
sie teilweise zahm zu halten und die Männchen gegeneinander kämpfen
zu lassen, wie dies heute noch auf den Kykladen mit Steinhühnern
geschieht. Nach Oppian wurden sie in der Weise mit Netzen gefangen,
daß man sie durch andere Rebhühner hineinlocken ließ, oder der mit
einer Hirschhaut verkleidete Jäger schlich sich an sie heran, um sie
in Schlingen oder auch Netzen zu fangen. Der etwas später, zu[S. 642] Beginn
des 3. Jahrhunderts n. Chr. lebende Grieche Älian schreibt in seinem
Buch über die Tiere: „Diejenigen Rebhühner (perdix), die eine
helle Stimme oder große Kampfeslust haben, sträuben sich sehr, wenn
sie von Menschen gefangen werden, weil sie wissen, daß sie nicht zum
Schlachten, sondern deswegen gefangen werden, weil sie durch ihre
Stimme und den Kampfesmut ergötzen sollen. Diejenigen aber, die sich
bewußt sind, daß sie weder als Sänger, noch als Kämpfer geachtet sind
und zum Braten gefangen werden, sind schlau genug, dem Menschen seinen
Spaß zu verderben; denn sie fressen nichts, wovon sie fett werden
könnten, dagegen Knoblauch in großer Menge. Wer das weiß, gibt sich
demnach mit dem Fang dieser Tiere keine Mühe; wer solches aber nicht
weiß und auf den Fang geht, der erlebt an seinem Braten wenig Freude.“
Ein weiterer Bewohner der Grassteppe und Getreidefelder ist die
Wachtel (Coturnix communis), die die milderen Gegenden
Europas von Süditalien nördlich bis Mittelschweden, aber auch weit
ausgedehnte Gebiete von Afrika, namentlich aber die Steppenländer
Asiens bis nach Nordchina bewohnt. In Europa beherbergen Ungarn und
die südrussischen Steppen die meisten Wachteln; in Deutschland hat
ihre Zahl besonders im Süden stark abgenommen. Sie ernährt sich wie
das Rebhuhn von Insekten, Sämereien und grünen Pflanzenteilen, ist in
der Morgen- und Abenddämmerung am tätigsten und verläßt nur in der
Mittagshitze ihr Versteck, um sich zu sonnen und im Sande zu baden.
Sie fliegt nur ungern und verkriecht sich viel lieber, als daß sie
sich einer Gefahr durch Fliegen entzöge. Auf freiem Felde überrascht,
drückt sie sich ganz flach auf den Boden, was sie auch tut, wenn sie
aufgescheucht wurde und sich wieder niederwarf. Im Frühjahr ist das
Männchen sehr kampflustig und schlägt sich auf Leben und Tod mit
Nebenbuhlern um ein Weibchen. Dann läßt es fleißig seinen bekannten
Schlag hören, den die Römer mit „dic cur hic (sage, weshalb
bist du da),“ die Deutschen mit „Bück den Rück“ oder „Flick de Büx“
wiederzugeben versuchten. Wegen dieses seines Balzgesangs wird die
Wachtel gern als Stubenvogel gehalten. Sie wird im umgitterten Raume
bald ganz zahm und schreitet in ihm auch leicht zur Fortpflanzung.
Sogar in den Bauernstuben läßt man sie gern brüten und schätzt den
Vogel wegen seines stets munteren Wesens und der Vertilgung manchen
Ungeziefers. Noch mehr als bei uns ist die Wachtel in Persien und der
Bucharei ein beliebter Stubenvogel, der nicht nur zahlreich in Käfigen
gehalten, sondern auch als lebendiges[S. 643] Spielzeug viel in den Händen
getragen und gehätschelt wird. Den wilden Vogel schießt man im Herbst
wie das Rebhuhn vor dem Hühner- oder Vorstehhund oder fängt ihn in
Netzen, und zwar oft mit der Wachtelpfeife, einem kleinen Instrument,
das den die Nebenbuhler in die Schranken fordernden Schlag der Hähne
oder den Lockton des Weibchens „Krüb krüb“ genau nachahmen muß.
Erst im Juli paart sich die Wachtel. Schon während des Brütens
trennt sich das Männchen vom Weibchen; denn die Wachteln führen kein
Familienleben wie die Rebhühner. Das Nest der Wachtel findet sich, gut
versteckt, meist zwischen Äckergewächsen, seltener im Wiesengras und
Sommergetreide, bildet eine kleine, kunstlos mit Hälmchen ausgekleidete
Vertiefung, in der 8–14 Eier ausgebrütet werden. Gleich nach dem
Auskriechen laufen die Jungen mit der Mutter davon und werden bald
selbständig.
Die Wachtel gehört bei uns zu den Zugvögeln. Viele Wachteln überwintern
zwar schon in Südeuropa, die meisten gehen aber weit nach Afrika
hinein, teilweise bis nach Südafrika. Ende September ziehen sie ab;
Mitte September ist der Zug am stärksten, bis anfangs Oktober die
letzten Nachzügler abreisen. Die Wachteln fliegen zwar gut, reisen aber
gern in der Richtung eines leichten Windes, werden durch Gegenwind
veranlaßt, Land oder auch nur Klippen oder Sandbänke, selbst das
Verdeck von Schiffen, wo sie ermattet und verwirrt liegen bleiben,
aufzusuchen und sollen sich sogar auf den Meereswellen eine Zeitlang
ausruhen, kommen aber häufig darin um. In zahlloser Menge erscheinen
sie auf ihrem Zuge in Südeuropa und Nordafrika und werden dort in Menge
gefangen, so daß sie für die betreffenden Bewohner eine ergiebige
Nahrungs- und Erwerbsquelle bilden. Außer der spanischen Küste,
Sizilien und manchen Gegenden Nordafrikas ist besonders auch Capri
wegen der Ergiebigkeit des Wachtelfangs berühmt. Frühere Bischöfe,
zu deren Sprengel das Eiland gehörte, hatten einen bedeutenden Teil
ihres Einkommens dem Wachtelfang zu verdanken, der mit Fuß- und
Halsschlingen, mit Klebe- und Steckgarnen, vornehmlich aber mit
italienisch roccoli genannten Schlagnetzen ausgeübt wird. Die
gefangenen, fetten Tiere werden gerupft, ihnen die Köpfe und Füße
abgeschnitten, der Bauch geöffnet und die Eingeweide herausgenommen,
sie dann wie Heringe verpackt und versendet. Schon die alten Griechen
und Römer lagen diesem Fange ob, wie auch die Kinder Israels auf ihrem
Zuge durch die Wüste. Der griechische Schriftsteller Oppianos sagt,
daß man die Wachteln, wenn sie mit geschlossenen[S. 644] Augen aus Furcht vor
dem Meere aufs Land fallen, in Garnen fängt, indem man sie entweder
durch in Käfigen gehaltene Wachteln lockt oder in die man sie treibt,
indem man ein Kleid auf zwei Stäbe steckt, hochhält und so vorwärts
schreitet. In einem kürzlich in Ägypten aufgefundenen Fragment des im
3. Jahrhundert v. Chr. lebenden alexandrinischen Dichters Kallimachos
soll ein Priester auf einer der Kykladen ungünstigen Wind für den
Wachtelfang bitten... „wenn sich der Wachteln (órtix) Volk
stürzt in das Netz aus Garn“. In seiner Naturgeschichte berichtet
Plinius von ihnen: „Die Wachteln (coturnix) sind kleine, bei
uns mehr an der Erde als in der Luft lebende Vögel. Sie fliegen
scharenweise über das Meer und bringen, wenn sie sich dem Lande nähern,
selbst Schiffe in Gefahr; denn sie fallen oft in solcher Menge, und
zwar bei Nacht in die Segel, daß die Schiffe versinken. Bei ihren
Reisen haben sie bestimmte Gegenden, in denen sie sich niederlassen,
um zu ruhen. Bei Südwind fliegen sie nicht, weil dieser Wind ihnen zu
feucht und schwer ist, und doch wollen sie mit dem Winde fliegen, weil
ihr Körper schwer und ihre Kraft gering ist. Die Anstrengung, welche
ihnen der Flug verursacht, geben sie durch klagende Töne zu erkennen.
Sie fliegen daher vornehmlich mit dem Nordwind und unter Anführung des
Wachtelkönigs (eines größeren Vogels, der mit ihnen zugleich nach Süden
zieht, aber natürlich sie nicht anführt). Die erste Wachtel, die sich
dem Lande naht, holt sich der Falke. Ziehen sie nun weiter, so tun
sie sich nach Begleitern um und überreden die Glottis, die Horneule
(otus) und den Cychramus, mitzufliegen. Erhebt sich ein dem Zuge
widriger Wind, so nehmen die Wachteln kleine Steinchen als Ballast in
die Füße, oder den Schnabel voll Sand und fliegen dann weiter. Sie
fressen vorzüglich gern giftige Sämereien und werden deshalb nicht
verspeist. Sie sind das einzige Tier, das gleich den Menschen am bösen
Wesen leidet, und deshalb pflegt man, so oft man eine Wachtel sieht,
auszuspucken.“
Daß die Römer nicht wie ihre Nachkommen, die heutigen Italiener, die
Wachteln gern gegessen hätten, ist kaum anzunehmen. Sagt doch Varro
zu Ende der Republik ausdrücklich: „Manche Leute mästen in ihren
Vogelhäusern auch Ortolane und Wachteln und verkaufen dann beide
teuer.“ Auch die Griechen verzehrten diesen Vogel gern, aber noch
lieber benützten sie die, wie uns bezeugt wird, mit Netzen gefangenen
und mit Hirse gefütterten Wachteln, wie heute noch die Chinesen und
Süditaliener, zu Kampfspielen. Der 125 n. Chr. geborene griechische
Schriftsteller Lukianos sagt, in Athen seien die Wachtel[S. 645]kämpfe sehr
beliebt und häufig gewesen. Die Leute hätten sich dabei in großer Menge
versammelt; ja, es habe ein Gesetz bestanden, das den Jünglingen gebot,
den Wachtel- und Hahnenkämpfen zuzusehen, um von diesen Vögeln, die mit
Hartnäckigkeit auf Tod und Leben kämpfen, Tapferkeit zu lernen. Nach
dem Berichte des Plutarch war der junge Alkibiades (450–404 v. Chr.)
in seiner Vaterstadt Athen auf den Markt gekommen, wo das versammelte
Volk gefragt wurde, wer freiwillige Steuern bezahlen wolle. Da meldete
sich Alkibiades. „Über diese Freigebigkeit war das Volk entzückt,
klatschte und schrie, da vergaß Alkibiades selbst vor lauter Freude die
(Kampf-)Wachtel, die er zufällig unter dem Mantel trug, lies sie los
und sie flog davon. Nun schrien die Leute noch ärger, jagten hinter
der Wachtel her und es gelang dem Steuermann Antiochus, sie wieder
einzufangen.“ Der Philosoph Platon sagt, indem er auf die übertriebene
Wachtelliebhaberei seiner Zeitgenossen anspielt, im Lysis: „Mir ist
denn doch ein braver Freund lieber als die beste Wachtel oder der beste
Hahn“, und der Komödiendichter Aristophanes nennt die Söhne seines
Kollegen Karkinos „Hauswachteln“, weil sie sich zu Hause immerfort
zankten. Er sagt von der Wachtel, sie lasse ihre Stimme während des
Kampfes ertönen, das Rebhuhn dagegen vorher und der Haushahn nach dem
Siege. An einer andern Stelle schreibt er, die Athener hätten denen,
die sie liebten, gern Purpurhühner, Wachteln oder Gänse geschenkt.
Noch um 200 n. Chr. waren die Wachteln als Kampfvögel bei den Griechen
beliebt, denn der damals in Alexandrien lebende Athenaios nennt
Leute, die gar zu erpicht auf Kampfwachteln sind, Wachtelnarren.
Von ihnen übernahmen die Römer diese Liebhaberei, so daß wir die
Behauptung des Plinius, daß man in Rom keine Wachteln esse, dahin
deuten können, daß sie von den reicheren Römern lieber zu Kampfspielen
denn als Braten verwendet wurden. Noch heute ist in vielen Städten
Italiens, insbesondere in Neapel, der Wachtelkampf eine beliebte
Volksbelustigung. Die Wachtelhähne werden mit Hirse gefüttert und dann
auf jedes Ende eines länglichen Tisches einer gesetzt. Alsbald nähern
sich die Tiere und hauen so wütend mit Schnabelhieben aufeinander ein,
daß die Federn fliegen und das Blut aus offenen Wunden fließt, bis
eines besiegt ist und die Flucht ergreift. Der Besitzer der siegreichen
Wachtel bekommt den ausgesetzten Preis und kann das Tierchen, wenn
es mehrmals gesiegt hat, oft für 10–12 Goldstücke verkaufen, da der
Käufer durch weitere Siege diese Summe reichlich wieder einbringen
kann. Allerdings haben schon im Altertum die besseren Ele[S. 646]mente von
dieser Volksbelustigung gelassen. So schreibt Marcus Antonius, er habe
vom Philosophen Diognetos gelernt, keine Wachteln zum Vergnügen zu
halten und überhaupt sich nicht mit Albernheiten abzugeben. Übrigens
wurde damals die Wachtel außer zum Kampf auch zu Spielen aller Art
verwendet. So schreibt Julius Pollux von einem griechischen Spiele,
das Wachtelhieb genannt wurde. Dabei setzte einer seine Wachtel in die
Mitte eines gezogenen Kreises; ein anderer aber versetzte ihr einen
schwachen Hieb mit dem Finger. Wich nun die Wachtel nach diesem Hiebe
aus dem Kreise, so hatte der Besitzer der Wachtel die Wette verloren.
Denselben Griechen verdankten die Römer und in der Folge das
ganze Abendland die Einführung des Fasans (Phasianus
colchicus), von dem wir erfahren, daß ihn einst die unter Anführung
des Jason zur Erlangung des von einem grimmigen Drachen gehüteten
goldenen Vließes ausgezogenen Argonauten, d. h. Schiffer auf dem
Schiffe Argo, am Flusse Phasis, im Lande Colchis südlich vom Kaukasus
kennen lernten und danach phasianós, d. h. den phasischen Vogel
nannten. Dieser ursprünglich Westasien bewohnende Vogel ist heute
durch den Menschen nicht nur in den Mittelmeerländern, sondern in
Europa bis England und Norddeutschland, d. h. soweit die klimatischen
Verhältnisse es zuließen, verbreitet worden. Schon die Römer, die
ihn von den Griechen mit demselben Namen übernommen hatten, brachten
ihn wie den Pfau in ihre Kolonien nach Südfrankreich und Helvetien,
von wo aus er allerdings erst zu Ende des Mittelalters als Wildling
weiter nordwärts vordrang. Während er heute in ganz Süddeutschland,
Böhmen und Österreich im Zustande vollkommener Wildheit lebt, wird
er in Norddeutschland noch unter Obhut des Menschen in sogenannten
Fasanerien gehalten, und, wenn freilebend, wenigstens in strengen
Wintern gefüttert. Als nunmehr vollkommen eingebürgertes Wild wird der
Fasan mit dem Hühner- oder Vorstehhund in seinem Lager aufgesucht und
zum Schuß gebracht, oder nach Zerstreuung eines Volkes in Steckgarnen
gefangen. Man beschleicht auch die Hähne beim Balzen und stellt, wenn
viele auf einmal geschossen werden sollen, förmliche Treibjagden auf
sie an, wie dies bei großen Herren Mode ist.
Eine Lieblingsjagdart vieler Jäger ist die auf dem sogenannten
Schnepfenstrich, wenn im ersten Frühjahr die Schnepfen aus ihren
in Südeuropa gelegenen Winterquartieren zu uns in ihre Brutgebiete
zurückkehren. Was dieser Jagd ihren besonderen Reiz verleiht, ist
das dabei zu beobachtende Wiedererwachen der Natur, wenn schon
die Wild[S. 647]tauben, das Rotkehlchen, die Amsel, die Heidelerche, die
Bachstelze aus dem Süden eingetroffen sind und mit ihren Werbelauten
den Wald beleben. Man unterscheidet drei Arten von Schnepfen.
1. Die Waldschnepfe (Scolopax rusticula), die mit
Ausnahme einiger nordischer Inseln alle Länder Europas, wie auch ganz
Mittel- und Nordasien bewohnt. Im Norden trifft man sie während des
Sommers in allen größeren Waldungen an, wo sie, ohne einen Unterschied
zwischen Laub- und Nadelholz zu machen, feuchte, sumpfige Stellen,
niemals aber eigentliche Sümpfe und freie Moräste bewohnt. Nur in
der Dämmerung begibt sie sich auf Waldwiesen und Viehtriften in der
Nähe des Waldes, wo sie sich von allerlei Getier ernährt, die sie
mit ihrem feinfühligen, langen Schnabel aus der Erde zieht. Fleißig
wendet sie zur Erbeutung von Würmern, Schnecken und Insektenlarven das
vermodernde Waldlaub um und bohrt in Rinderdünger, wie auch in von
jenen belebten weichen Bodenschichten ihren Schnabel ein, den sie zum
Erfassen und Verschlingen ihrer Beute nur vorne öffnet, ohne ihn aus
dem Boden herauszuziehen. Laufend weicht sie zwar häufig einer Gefahr,
z. B. einem Hühnerhund, aus und duckt sich, ihrer Schutzfärbung wohl
bewußt, zu Boden, aber, um etwas zu suchen, fliegt sie am liebsten.
Dabei bewegt sie sich in geringer Höhe langsamer als die übrigen
Schnepfenarten.
Die ungeheure Anzahl von Waldschnepfen, die auf ihrem Herbstzuge fast
alljährlich gefangen und vertilgt wird und trotzdem immer wiederkehrt,
legt die Vermutung nahe, daß das Hauptbrutgebiet der Waldschnepfe die
dünn bevölkerten, einsamen Wälder Nordrußlands und Sibiriens sind.
Jedenfalls ist die Waldschnepfe im Osten und Norden viel reichlicher
als Brutvogel vertreten als im Westen und Süden. Während sie schon
auf den Karpaten in ziemlicher Zahl brütet, gehört sie im waldarmen
Frankreich und England zu den seltenen Brutvögeln und wird auch bei uns
fast nur auf dem Durchzuge geschossen, wenn sie je nach der Witterung
von Mitte März an in ihre nordische Heimat zurückkehrt. Ihre Straße
ist nicht stets dieselbe, so daß man sie in einem bestimmten Revier
nicht alle Jahre gleich häufig zu sehen bekommt. Der Balzflug, der
gewöhnlich nur in einer Höhe von 12–15 m ausgeführt wird und in
der Abend- und Morgendämmerung nicht viel länger als 1⁄4 Stunde dauert,
niemals bei Kälte und Ostwind, besonders aber bei warmer, regnerischer
Witterung und bei Südwestwind, der die stets mit dem Winde wandernden
Schnepfen herbeiführt, stattfindet, ist eine Art Unterbrechung des
Frühlingszuges,[S. 648] um dem Männchen ein Weibchen zu verschaffen oder
einem schon gewonnenen seine Aufmerksamkeit zu erweisen. Wenn es dann
liebetrunken mit dick aufgeblähtem Gefieder mit kurzen Flügelschlägen
langsam unter Ausstoßen leiser, pfeifender und quaksender Töne über dem
Gehölze streicht, fällt es dem Blei des Jägers zum Opfer.
2. Die Sumpfschnepfe oder Bekassine (Gallinago
coelestis), deren Heimat ebenfalls der Norden Europas und Asiens
ist. Auch sie überwintert in Südeuropa, Nordafrika und Indien und
zieht Ende März und im April zu ihren Brutplätzen im Norden, um schon
Ende August bis Oktober wieder ihre Rückreise in die Winterquartiere
im Süden zu vollführen. In Norddeutschland, Dänemark, Skandinavien,
Rußland und Sibirien ist sie sehr gemein und lebt dort auf sumpfigen
Wiesen und Mooren zwischen Weiden- und Erlengebüsch. Ihr Nest findet
sich auf kleinen Hügelchen und auf Grasbüscheln im Sumpf und enthält in
der zweiten Hälfte des April vier Eier, die vom Weibchen ausgebrütet
werden, während das Männchen morgens und abends über dem Nestplatz
seinen eigentümlichen Balzflug vollführt. Mit dem Ausschlüpfen der
Jungen hat der regelmäßige Balzflug ein Ende. Dank ihres geschützten
Aufenthaltsortes und ihrer größeren Flugfertigkeit ist sie weniger
Gefahren als die Waldschnepfe ausgesetzt. Wegen ihres schmackhaften
Wildbrets, das jenes der Waldschnepfe entschieden übertrifft, wird
sie allenthalben verfolgt, wenn auch nicht überall mit besonderem
Eifer, da das Umherwaten im Sumpfe nicht jedermanns Sache ist. Wie die
Waldschnepfen lassen sie sich auch in der Gefangenschaft halten, doch
ist ihre Eingewöhnung keine sehr leichte.
3. Die Moorschnepfe (Gallinago gallinula), die kleinste
aller Schnepfen. Sie ist ebenfalls ein Sumpfbewohner und hat ihre
Heimat im Norden, besonders in Rußland und Westsibirien. Wie die andern
Schnepfen wird sie an denselben feuchten Stellen bei ihrem Durchzuge
geschossen, um als Leckerbissen verzehrt zu werden.
Von weiteren jagdbaren Vögeln sind die Enten und Gänse
zu nennen, die besonders für die nordischen Völker eine wichtige Rolle
spielen. Der bei uns häufigste Brutvogel unter den Wildenten ist die
Stockente (Anas boscas), deren Nest man an buschreichen
Ufern unter Weiden und Erlen, zwischen Schilfrohr und Sumpfpflanzen,
im Grase oder auf mäßig hohen Bäumen in verlassenen Krähen- und
Raubvogelnestern findet. Es enthält anfangs April 8–14 schmutzigweiße,
von denen der, wie wir sahen, von ihr abstammenden Hausente nicht
unterscheidbare Eier. Die nach 26tägiger Bebrütung aus ihnen
aus[S. 649]schlüpfenden Jungen werden von ihrer Mutter auf versteckreiche
Gewässer geführt, unter ihren Flügeln erwärmt und fast bis zur
Erlangung vollständiger Flugfähigkeit sorgsam beschützt und geleitet.
Sie ernähren sich mit der verschiedensten tierischen und pflanzlichen
Speise. Während die Weibchen brüten und ihre Jungen aufziehen,
vereinigen sich die Männchen zu kleineren oder größeren Gesellschaften.
Die im Oktober ihr Jugendkleid verlierenden Jungen gehen dann mit den
alten Artgenossen aus den stillen Gewässern auf die Flüsse, um hier
Scharen zu bilden und, wenn das Wasser gänzlich zufriert, nach milderen
Gegenden im Süden zu ziehen. In schräger Linie oder ein hinten offenes
Dreieck bildend fliegen sie meist zur Nachtzeit nach Südeuropa, um
schon im Februar oder März in ihr Brutgebiet zurückzukehren. Dieses
erstreckt sich von der unteren und mittleren Donau, Süddeutschland
und der Schweiz bis zur Waldgrenze im Norden und verbreitet sich auch
über Nordasien und Nordamerika. Der äußerst scheue und vorsichtige, in
der Gefangenschaft leicht zur Fortpflanzung zu bringende Vogel wird
namentlich in Brüchen, wo er dem Samen des Schwadengrases nachfliegt,
auf dem Morgen- und besonders auf dem Abendanstand erlegt. Auch fängt
man ihn in Laufschlingen und mit Angeln, in großen Massen aber in den
sogenannten Entenfängern oder Vogelkojen, die es freilich früher in
größerer Menge als jetzt in Deutschland gab. Es sind dies fünfeckige
Teiche, die an jeder der fünf Ecken spitz zulaufende, von Erdwällen
umgebene und mit mannshohen Blendschirmen aus Schilfrohr eingefaßte
Ausbuchtungen haben, die mit einem Netze bedeckt sind und in eine
gewöhnliche Fischreuse endigen. Die Wälle und die Umgebung der Koje
sind mit dichtem Buschwerk bepflanzt. Auf den Teichen und deren
Ausläufen befinden sich zahlreiche zahme Enten, Spieß-, Pfeif- und
Stockenten mit gestutzten Flügeln. Der Kojenwärter, der sich durch ein
stets bei sich getragenes Torfräuchergefäß verwittert, streut dann
seinen zahmen Enten Futter, meist Gerste, und lockt sie damit unter
die Netze, wohin ihnen die Wildlinge ohne Bedenken folgen. Durch das
Erscheinen des Kojenwärters aufgescheucht, wollen sie ihm entfliehen,
wobei sie immer mehr in den Blindsack und schließlich in die Reuse
geraten, wo sie getötet werden. Dann wird den Lockenten abermals
Futter gestreut, und das Spiel beginnt von vorne. Ist eine Ausbuchtung
zweimal abgetrieben, so kommt die nächste an die Reihe. So werden
viele Tausende von Enten jährlich gefangen, z. B. auf der Insel Föhr
in einem Herbst über 30000 Stück. Weniger aber als durch die Jäger und
Entenfänger[S. 650] nimmt die Stockente infolge der zunehmenden Bodenkultur,
besonders infolge der Trockenlegung von Wiesen und Sümpfen, bei uns ab.
Etwas kleiner als die Stockente ist die zu derselben Zeit nach Süden
ziehende Schnatterente (Anas strepera), die ihren
Namen dem schnatternden Rufe des Weibchens verdankt, an dem man sie,
namentlich wenn das helle Pfeifen der Männchen dazwischen klingt, von
allen andern in Deutschland vorkommenden Entenarten unterscheiden kann.
Der auch durch einen eigentümlichen wippenden Flug ausgezeichnete Vogel
bewohnt den Norden von Europa, Asien und Nordamerika und nistet mehr
im Osten unseres Kontinents bis zum Schwarzen Meer. In Deutschland
nistet er namentlich in Schlesien und in einigen Seen Ostpreußens. In
das von ihr kunstlos hergestellte Nest legt das Weibchen 6–12 trüb
olivengrünliche Eier, die sie selbst ausbrütet.
Häufiger als sie ist die Spießente (Anas acuta)
mit langem, dünnem Hals und stark verlängertem Schwanz. Zu ihrem
Aufenthalte wählt sie ausgedehnte Sümpfe mit vielen Wassergräben und
freien Wasserflächen, dann große, schilfreiche Seen und verwilderte
Teiche mit Wasserpflanzen aller Art, nicht aber buschreiche, im Walde
versteckte Örtlichkeiten, wie sie die Stockente liebt. Hier findet man,
bei uns in der zweiten Hälfte des April, 8–10 sehr bleiche, graugrüne
Eier, die etwas kleiner als die der Stockente sind. Ihr Brutgebiet
erstreckt sich über den Norden Europas, Asiens und Nordamerikas, wo
sie ungefähr dieselben Gegenden wie die Stockente bewohnt, aber weiter
nach Norden geht. Sie wandert vom Oktober an nach Süden und kehrt im
März und April in ihr Brutgebiet zurück. Auf dem Zuge ist sie neben der
Krick- und Pfeifente die häufigste Ente an der Nordseeküste.
Dasselbe Verbreitungsgebiet hat die Löffelente (Anas
clypeata), die ihren Namen von dem vorn stark verbreiterten
Schnabel hat. Sie zieht Ende August nach Südeuropa und Nordafrika, nach
Indien und Südchina, um im März und April paarweise auf ihre Brutplätze
zurückzukehren, wo man im Mai das zwischen Schilf und Binsen stehender
Gewässer versteckte und mit 7–14 trüb gelblichweißen Eiern belegte Nest
findet.
Die häufigste deutsche Sommerente nach der Stockente ist die
Knäckente (Anas querquedula), obwohl sie später als jene
bei uns ankommt und früher wieder abzieht. Sie hat ihren Namen von
ihrer gewöhnlichen Stimme, ist klein und äußerst gewandt im Fliegen,
so[S. 651] daß sie sich durch geschickte Schwenkungen selbst einem auf sie
stoßenden Falken in der Regel zu entziehen vermag. Sie nistet vom Rhein
bis nach Südschweden im Schilf oder Gebüsch an sumpfigen Gewässern.
Ende April findet man 9–12 gelblichweiße Eier in ihrem Nest.
Ebenso zierlich von Gestalt, aber schöner wie sie ist die
Krickente (Anas crecca), die ihr Brutgebiet weiter
nördlich hat und auf dem Durchzuge fast überall an der deutschen Küste
erscheint. Sie ist wenig scheu, fliegt schnell und geräuschlos und
ist eine fertige Taucherin, die eine weite Strecke unter dem Wasser
zurücklegen kann.
Ebenso mehr dem Norden eigentümlich ist die Pfeifente (Anas
penelope), so genannt, weil sie beim Fluge einen lauten, pfeifenden
Ton von sich gibt. Auch sie kommt auf dem Zuge regelmäßig an unsere
Küsten und wird dann erbeutet. Ebenso im Norden, besonders in Rußland
häufig ist die kleine Tafelente (Fuligula ferina), die
mit einem vernehmbaren Rauschen fliegt und sich mit einem kleinen
Anlauf von der Wasserfläche erhebt. Eigentliche Moore dagegen bevorzugt
die verwandte Moorente (Fuligula nyroca). Sie gehört
vorwiegend dem Osten von Europa an und reicht bis Turkestan.
Von den zahlreichen übrigen Enten ist besonders die Eiderente
(Somateria mollissima) für den Menschen von Bedeutung, weil
sie ihm die durch ihre Feinheit und Elastizität hochgeschätzten Dunen
liefert. Sie ist ein echter Meeresvogel, der sich auf dem Lande nur
schwerfällig fortbewegt und auch beim Fluge rasch ermüdet. Sie taucht
vortrefflich und bleibt dabei gewöhnlich zwei Minuten unter Wasser.
Sie taucht selbst in der stärksten Brandung unter und bringt von 20
bis 24 m tiefem Grunde ihre teils aus kleinen Tieren, besonders
Miesmuscheln, teils aus Tang bestehende Nahrung in ihrem Kropfe herauf.
Sie bewohnt den Norden der ganzen Erde und kommt in Europa von Jütland
bis Spitzbergen vor. Je weiter nach Norden, um so häufiger wird sie.
Schon in Mittelnorwegen lebt sie zu Tausenden, von den Küstenbewohnern
durch besondere, leider nicht überall geachtete Gesetze geschützt und
gehegt. Sie brütet mit Vorliebe auf kleinen Inseln, wohin der Eisfuchs,
ihr gefährlichster Feind, nicht hingelangen kann, erst im Juni und
Juli, und zwar nicht in einzelnen Paaren wie die echten Tauchenten,
sondern in großen Gesellschaften zusammen. Das aus allerlei Stoffen
der Umgebung, besonders Tang, höchst liederlich zusammengeschichtete
Nest wird innen mit den feinen Dunenfedern ausgepolstert, die sich
das Weibchen vom Bauche rupft. Diese sind bräunlichgrau und an der
Wurzel weiß gefleckt, haften zwar so fest[S. 652] aneinander, daß auch bei
starkem Wind nicht eine wegfliegt, trotzdem aber ballen sie sich nicht
zusammen. Da, wo sich der Mensch um deren Brutgeschäft kümmert, indem
er den Vögeln außer den Dunen auch die sehr wohlschmeckenden Eier
nimmt, legt er alte Kisten und mit Brettern und Reisig überdeckte
Steine zum Empfange der für ihn so überaus nützlichen Gäste bereit. So
scheu der Eidervogel früher war, so zutraulich zeigt er sich jetzt, da
er sich des Schutzes des Menschen sicher fühlt. Dreist kommen diese
Vögel bis unmittelbar an das Gehöft des einsamen Küstenbewohners
gewatschelt, ja begeben sich sogar in das Innere der Hütte, um sich
einen passenden Platz zum Nest auszusuchen. So geschieht es nicht
selten, daß manche Eidervögelweibchen in Kammern, Backöfen oder
Ställen brüten und dadurch der Hausfrau fast lästig werden. Anfänglich
begleitet das Männchen sein Weibchen regelmäßig bei allen diesen
Fußwanderungen; wenn aber das Gelege vollständig geworden ist, verläßt
es Nest und Weibchen und fliegt aufs Meer hinaus, wo es sich mit andern
Männchen vereinigt und jenem das Brutgeschäft überläßt.
In bewohnten Gegenden kommt nun das Eiderentenweibchen nur selten dazu,
seine erste Brut aufzuziehen, da die Nester regelmäßig der wertvollen
Dunen und Eier beraubt werden. Einsichtige Eigentümer der Brutplätze
von Eiderenten begnügen sich damit und lassen die Vögel dann gewähren;
habsüchtige und unverständige Leute aber rauben ihnen nicht bloß die
erste Brut von 4–6 Eiern, sondern auch die zweite, die aus 3, oder
gar die dritte, die nur aus 2 Eiern, manchmal nur aus einem einzigen
besteht und gleich der zweiten oft merklich kleinere Eier aufweist. Für
das Wegnehmen der dritten Brut werden aber die Leute gewöhnlich durch
den dauernden Abzug der Vögel bestraft. Da das Eiderentenweibchen, das
sich, wenn ihm die Dunen wiederholt weggenommen wurden, trotzdem es
sich den Bauch beinahe kahl rupft, für die späteren Gelege nicht mehr
genug Dunen hat, so muß dann das Männchen herhalten, das sich auch vom
Weibchen geduldig ausrupfen läßt, um es dann allerdings zu verlassen.
Das Weibchen besorgt das Brüten und Aufziehen der Jungen allein. Die
Norweger tragen die eben ausgeschlüpften Jungen gern in einem Korbe zum
Meere, um sie dort auszuschütten. Ihnen folgen die besorgten Mütter, um
wieder zu ihren Jungen zu gelangen, die sie dann an sich locken, um sie
zum Leben im Wasser zu erziehen.
Für die armen Bewohner der Küsten des hohen Nordens ist der Handel mit
Eiderdunen sehr wichtig; deshalb suchen sie die Eiderenten[S. 653] in die
Nähe ihrer Wohnungen zum Brüten anzusiedeln, wo sie dann ganz zahm
werden. Am wertvollsten sind die Dunen dann, wenn sie vor dem Brüten
aus dem Nest genommen werden, da sie nachher meist verunreinigt sind.
Ein Kilogramm gut gereinigter Dunen, zu dessen Gewinnung 10–15 Nester
geplündert werden müssen, wird mit 30 Mark und darüber bezahlt. Zur
Füllung eines Bettes sind etwa 2,5 kg Dunen nötig, die sich,
auf einen kleinen Raum zusammengedrückt, bei nachlassendem Druck
so schnell wieder ausdehnen, daß ein mit ihnen gefülltes Bett an
Weichheit und Warmhalten seinesgleichen sucht. Die Eier werden wie die
Hühnereier verwendet. Auch das Fleisch der Eiderente wird gegessen und
ihr abgezogener Balg zur Anfertigung warmer Unterkleider verwendet.
Geschossen wird die Eiderente auch auf dem hohen Meere selten. Der dort
sehr scheue Vogel verlangt seines dichten Pelzes wegen einen tüchtigen
Schuß mit grobem Schrot und ist so ungemein zählebig, daß er sich,
wenn ihn der Schuß nicht augenblicklich tötet, durch Tauchen zu retten
sucht, wobei er sich an Pflanzen auf dem Meeresgrund festbeißt, dort
verendet und deshalb für den Schützen meist verloren geht.
Von den zahlreichen nordischen Vögeln dienen noch manche andere dem
Menschen regelmäßig als Speise, so außer verschiedenen nordischen
Enten und Gänsen auch die im hohen Norden brütenden Schwäne
(Höcker-, Sing- und Zwergschwan), deren Fleisch, wenn die Tiere noch
jung sind, äußerst zart und wohlschmeckend ist. Deren mit den Federn
gargemachten Häute liefern ein kostbares Pelzwerk und die Dunen einen
bedeutenden Handelsartikel. Auch Möven, Segeltaucher
und Pelikane liefern gutes Fleisch, geschätzte Eier und ein
zu Muffen und Verbrämungen beliebtes Pelzwerk. Noch wichtiger als
sie sind für den Menschen die Gänse, von denen einzig die
Graugans (Anser cinereus), die Stammutter unserer
Hausgans, in Mitteleuropa brütet, während die übrigen Gänsearten
mehr nördlich brüten und nur bei ihrem Durchzuge nach dem Süden bei
uns geschossen werden. Nach der Überwinterung in Afrika erscheint
dieses Tier bei uns in großen Gesellschaften mit viel Lärm, um in
wasserreichen Einöden zu brüten. Hier kämpfen die jüngeren Männchen
ums Weibchen, während die älteren schon gepaart sind. Das Weibchen
legt, wenn es jung ist, 5, wenn es älter wird bis 10 trüb gelblichweiße
Eier, die es mit von Brust und Bauch abgerupften Dunen umgibt. Es
bebrütet sie mit der infolgedessen fast bloßgewordenen Haut und bedeckt
sie beim jedesmaligen Verlassen des Nestes sorgsam mit Dunen, damit
sie nicht etwa erkalten.[S. 654] Die den Eiern nach einer vierwöchentlichen
Brutzeit entschlüpfenden Jungen werden von der Mutter noch einen Tag
lang erwärmt, dann zum Aufsuchen zarter Pflanzennahrung aufs Wasser und
später wieder aufs Land geführt, während der Vater ängstlich auf die
Sicherheit der Seinen bedacht ist und sie beim geringsten Anzeichen
von Gefahr warnt. Als junges Tier zu Ausgang der Ernte geschossen,
liefert die Graugans einen vorzüglichen Braten, ist aber als scheuer,
vorsichtiger Vogel schwer zu beschleichen. Sie wird meist morgens und
abends auf dem Anstand erlegt. Meist verläßt sie uns im August, um nach
Süden zu ziehen, wobei die flugfähigen Jungen schon im Juli den Eltern
vorausgezogen sind. Die Graugans ist zierlicher und schlanker als die
Hausgans, von der sie sich sonst nur durch ihr stets bräunlichgraues
Gefieder unterscheidet.
Im September und Oktober trifft bei uns die den hohen Norden Asiens
bewohnende Saatgans (Anser segetum) auf ihrem Zuge
nach Süden ein, um entweder bei uns oder in südlicheren Gegenden zu
überwintern und im April wieder auf ihre Brutplätze zurückzukehren.
Etwas später als sie trifft die etwas kleinere, ebenfalls hochnordische
Ackergans (Anser arvensis) teils als Durchzugsvogel,
teils als Wintergast bei uns ein, während die dieselben Breiten
bewohnende kurzschnäbelige Gans (Anser brachyrhynchus)
mehr Westeuropa streift. Dagegen trifft man nicht selten bei uns
im Winter die Nordasien bewohnende Bläßgans (Anser
albifrons). Alle sind sehr vorsichtige, scheue Tiere, die sehr wohl
den gefährlichen Jäger vom harmlosen Bauern zu unterscheiden vermögen.
In China, wo sie in großer Zahl überwintern und gesetzlich geschützt
sind, erweisen sie sich infolge des Schutzes, den sie genießen, viel
zutraulicher gegen den Menschen als bei uns. Besonders zahlreich sind
auch dort die Saatgänse, die sich sogar im Innern von Peking in Scharen
niederlassen, während sie bei uns überall geschossen werden, wo sie
sich zeigen.
In Waldrevieren gewinnt gelegentlich die Jagd auf Drosseln
Wichtigkeit, da sie mitunter mehr abwirft als diejenige des übrigen
Federwildes. Diese geschieht fast nur mit Dohnen in Form von an
die unteren Baumäste aufgehängten Bügeln, die Vogelbeeren oder
Holundertrauben als Lockspeise erhalten, bei deren Verzehrenwollen sich
die armen Tiere an den heimtückischerweise angebrachten Schleifen aus
Pferdehaar fangen und dabei erwürgt werden. Für solche Drosselarten,
die, wie die Wacholder- und Ringdrossel, sich mehr an der Erde
aufhalten, werden zwischen den von ihnen mit Vorliebe besuchten[S. 655]
Wacholderbüschen Pferdehaarschleifen als sogenannte Laufdohnen am Boden
befestigt.
Auch der Krammetsvogel, so genannt, weil er auf seinem
Durchzuge im Herbst gern Krammets- oder Wacholderbeeren nascht,
oder die Wacholderdrossel (Turdus pilaris) ist ein
vorzugsweise im Norden brütender Vogel, dessen Heimat fast die Grenze
des Baumwuchses erreicht. Hier nistet er als ein echter Waldvogel in
großen Kolonien gesellig in den lichten, niederen Wäldern des Nordens,
um im November zu uns zu kommen, in gelinden Wintern auch wohl ganz
bei uns zu bleiben, meistens aber nach Südeuropa und selbst Nordafrika
zu ziehen. Er wird wegen seines Fleisches geschätzt; doch kommen als
Krammetsvögel auch seine Verwandten auf den Markt, vor allem auch die
ebenfalls hochnordische Weindrossel (Turdus iliacus) und
die außer im Norden auch auf den Alpen und anderen südlichen Gebirgen
lebende Ringdrossel (Turdus torquatus). Schon von Mitte
September an führt der Herbstzug diese Drosseln in beerenreiche Wälder
Südeuropas, Kleinasiens, Persiens und Nordafrikas, von wo sie Ende
März oder im April in ihre kalten Brutgebiete zurückkehren. Mit ihnen
wird dann auch die am liebsten in hohen Wäldern lebende, Nadelholz dem
Laubholz vorziehende Misteldrossel (Turdus viscivorus)
erbeutet, die ein nicht minder wohlschmeckendes Fleisch besitzt. Sie
bewohnt Nord- und Mitteleuropa und Nordasien bis zum Himalaja hinauf.
Im Norden ist sie Zug-, weiter südlich dagegen Strich- und Standvogel,
der im Vorfrühling und Spätherbst familienweise umherstreicht, um
Futter zu suchen und sich dabei vielfach in den schnöden Dohnen fängt.
Wie heute noch in den romanischen Ländern Südeuropas, vor allem in
Italien, so wurde früher auch bei uns Jagd auf die Gesamtheit der
kleinen Vögel gemacht, die auf ihrem Durchzuge, besonders im Herbst,
gut gemästet nach Süden ziehen. Man benutzte und benutzt heute noch
dazu den Vogelherd, den schon der Sachsenherzog Heinrich der Sage nach
bestellt haben soll, als er im Jahre 919 von den Franken und Sachsen
in Fritzlar zum deutschen Könige gewählt wurde. Davon erhielt dieser
eigentliche Gründer des Deutschen Reiches, der die Einheit des von ihm
innerlich gefestigten Reiches herstellte, seinen Beinamen der „Finkler“
oder der „Vogelsteller“. Zur Anlage eines solchen Vogelherdes wählt der
Vogelsteller zur Zugzeit im Herbst eine hochgelegene, von den Zugvögeln
regelmäßig besuchte Stelle, etwa einen bebuschten Hügel auf der
Zugstraße. Hier stellt er ein großes Schlagnetz auf, stellt im Bereiche
desselben Futter zum Speisen der hungrigen[S. 656] und Wasser zum Tränken
der durstigen Wanderer auf und ladet diese durch besondere Lockvögel
ein, bei ihrem Durchzuge sich hier niederzulassen und zu stärken. Dazu
tut auch der in einer Rasen- oder Laubhütte versteckte Papageno mit
der Lockpfeife sein Möglichstes, bis die armen Wichte, wenn sie sich
müde und hungrig oder durstig niederlassen, durch Niederfallen des
Netzes infolge eines Ruckes an der Schnur, gefangen werden, wonach
ihnen meuchlings der Hals umgedreht wird. Heute schämen wir feinfühlig
gewordenen Kulturmenschen uns solcher Roheit und lassen die durch
Insektenvertilgung äußerst nützlichen und durch ihren ansprechenden
Gesang uns lieben Vögel, die doch keinen nennenswerten Nährwert haben,
lieber am Leben und an ihrer nützlichen Arbeit in Wald und Feld. Anders
die gefühlsrohen, noch von der römischen Kaiserzeit an Blutvergießen
und Tierquälerei nicht nur keinen Anstoß nehmenden, sondern sich
vielmehr noch daran erfreuenden Romanen, die diese kleinen Leichname
gerupft, an dünnen Weidenruten aufgezogen, auf den Markt bringen und
ihren Volksgenossen gegen geringes Entgelt zum Braten und Verspeisen
mit einer Reis- oder Maisspeise verkaufen. Wie in den Städten Italiens
kann man auch in Marseille solche Vögel für billiges Geld kaufen. Es
ist eigentlich eine Schande, daß solche Leckerei in einem sonst so
hochstehenden Kulturstaate heute noch geduldet wird.
Unter allen diesen Vögeln sind besonders die Lerchen von den
Feinschmeckern geschätzt. Unter ihnen versteht man in erster Linie
unsere mitteleuropäische Feldlerche (Alauda arvensis),
die auf allen Ebenen mit Getreidebau, auf öden Heiden und auf feuchten
Marschländern, nicht aber im Wald, auf kahlen Bergrücken und in
Ortschaften angetroffen wird. Auf einem ihm zusagenden Gebiet wählt
sich jedes Pärchen einen kleinen Bezirk aus, worin es keinen Nachbarn
duldet. In jubilierenden Trillern läßt das Männchen, während das
Weibchen brütet, immer höher gen Himmel steigend, seinen Balzgesang
erschallen, um sein Brutrevier gegen allfällige Eindringlinge zu
behaupten. 2–3mal im Jahre brüten sie und von Ende September an ziehen
sie in großen Gesellschaften in die Winterherberge nach Süden, um
schon Ende Februar scharenweise in ihre Heimat zurückzukehren. In
gelinden Wintern können manche auch in unseren Gegenden zurückbleiben.
Doch sind es nicht sie, sondern Haubenlerchen, welche wir dann auf
unseren Straßen, selbst in Städten, nach Futter suchend, umhertrippeln
sehen. Die Haubenlerche (Galerita cristata) ist ein
Gattungsgenosse der Heidelerche, deren flötender, abwechselungsreicher[S. 657]
Gesang dem der Feldlerche wenig nachsteht. Sie ist ein echter
Steppenbewohner, der in den Ebenen Mittelasiens von China und der
Mongolei an bis Südrußland Standvogel ist und erst seit der Mitte
des vorigen Jahrhunderts sich bei uns in Mitteleuropa einbürgerte.
Bei ihrem Vordringen nach Westen folgte sie hauptsächlich den großen
Heerstraßen, auf denen sie ihre Nahrung sucht, besonders auch, indem
sie den unverdauten Haferkörnern im Roßmist nachgeht, und in deren
Nähe sie auch gern brütet. Man sollte meinen, jeder feinfühlige Mensch
ziehe die so nützliche lebende Lerche mit ihrem unsere Ackerfluren
belebenden und die Laut gewordene Poesie des Feldes darstellenden
herrlichen Gesang der gebratenen vor. Dies ist aber leider durchaus
nicht der Fall. Sie wird heute auch bei uns in Menge gegessen, wenn
auch ihr Konsum seit 1850 auf etwa den vierten Teil zurückging.
Immerhin verbraucht Berlin deren noch 30000, Wien 36000 und Paris gar
1500000 jährlich. In Frankreich kamen um 1750 zuerst in Pithiviers,
dem Safranzentrum, die Lerchenpasteten auf, denen sich in unserer Zeit
die „Lerchen in Aspik“ als eine Glanznummer des Frühstücksprogramms
der Schlemmer neben der Gänseleber mit Trüffeln hinzugesellten. Der
deutsche Kaiser Wilhelm II. ist ein besonderer Verehrer dieser
feinen Bissen und die dazu nötigen Lerchen fangen und liefern ihm als
besonderes Privileg die Halloren in die kaiserliche Küche. Wenn solches
noch bei uns an tonangebender Stelle geschieht, so haben wir keine
Ursache, den Romanen ihre Grausamkeit und Herzlosigkeit vorzuwerfen,
daß sie solch edle Sänger einem so schändlichen Lose opfern! Auch
die Tatsache, daß die Lerchen gut schmecken, entschuldigt nicht die
Brutalität, die in ihrem Verspeisen liegt. Wir können nur die rohe
Gesinnung des Schriftstellers Rosner bedauern, der 1894 schrieb: „Eine
ausgebeinte, feiste schmucke Lerche ist allerdings nur ein Bissen,
aber ein Bissen von wunderbarer Saftfülle und geradezu köstlichem
Wohlgeschmack, der den ganzen Schmeckapparat bis in die feinsten Fibern
hinein in namenloses Entzücken versetzt.“
Von den Feinschmeckern Chinas werden gleicherweise die eßbaren
Vogelnester als eine der feinsten Delikatessen geschätzt
und in großen Mengen nach China eingeführt, wo sie als die
Geschlechtstätigkeit anregendes Mittel gelten und schon aus diesem
Grunde sehr gesucht sind. Deren Erzeuger sind eine Art Segler Südasiens
und Indonesiens, die Salanganen (Collocalia nidifica),
die unsere Uferschwalbe etwas an Größe übertreffen und an den Wänden
dunkler Höhlen aus dem zähen Schleim ihrer Speicheldrüsen ihre sehr
bald erhärtenden, getrock[S. 658]netem arabischen Gummi gleichenden zierlichen
Nester erbauen. Die Höhlen, in denen sie auf Java und sonst nisten,
sind Eigentum bestimmter Personen, die sie besonders zur Nistzeit
streng bewachen lassen, damit kein Unberufener sich unerlaubterweise
solche Nester aneigne. Dreimal im Jahre brüten diese Tiere, wobei
sich Männchen und Weibchen alle 6 Stunden ablösen sollen. Dabei wird
von ihnen niemals von einem Neste zweimal Gebrauch gemacht, sondern
sie bauen für jede Brut ein neues Nest, an dem sie etwa einen Monat
lang zu arbeiten haben, während das alte Nest mit der Zeit stinkend
wird und abfällt. Der Zahl der Bruten entsprechend wird dreimal im
Jahre geerntet, sobald die Jungen halbwegs flügge geworden sind. Dabei
geht gleichwohl etwa die Hälfte der Jungen zugrunde. Doch vermindert
sich die Zahl der Salanganen nicht wesentlich, da man an den Orten,
wo man an die Zukunft dieser Vögel denkt, jährlich wenigstens eine
Brut ganz ausfliegen läßt. Eine einzige, vom Meer ausgewaschene große
Höhle an der Südküste von Java liefert 500000 Nester; verteilt man nun
diese auf drei Ernten, so ergibt es sich, daß über 33000 Salanganen
darin ihrem Brutgeschäfte obliegen. Alljährlich werden etwas über 5
Millionen Salanganennester nach China ausgeführt, die einen Gesamtwert
von 6 Millionen Mark repräsentieren. Man benützt sie hauptsächlich zu
Suppen; sie quellen im heißen Wasser auf und schmecken an sich fade,
sollen aber in der sorgfältigen Zubereitung, die ihnen die Chinesen
angedeihen lassen, köstlich zu essen sein, wie mir solche berichteten,
die mehrfach Gelegenheit fanden, sie bei vornehmen Chinesen zu essen.
Wie einst bei unseren Vorfahren, so steht heute noch bei den
Hirtenvölkern der asiatischen Steppen, den Kirgisen, Baschkiren und
wie sie sonst heißen mögen, die Jagd mit Falken und Adlern hoch
in Ehren. Man beizt mit ihnen Antilopen und Hasen, wie auch Wölfe
und Füchse; dabei erscheinen die Jäger noch in Prunkaufzügen auf
prächtigen Pferden, die ganz an die Jagdaufzüge der Deutschen im
Mittelalter erinnern. Die Abrichtung der Jagdfalken und übrigen zur
Jagd gebrauchten Raubvögel war ein eigener Zweig der Jägerei in Europa.
Im Abschnitte über die Geschichte der Jagd wurde Näheres darüber
berichtet. Von Europäern, die sich noch heute diesem Sport widmen, sind
außer Russen und dem Herzog von Bedford in England nur die englischen
Offiziere in Indien zu nennen. Diese reiten gern mit einem Jagdfalken
auf der mit starkem Lederhandschuh bekleideten Rechten auf die
Antilopenjagd.
[S. 659]
Am großartigsten wurde von jeher die Falkenjagd in Mittelasien
betrieben. So schreibt der weitgereiste Venezianer Marco Polo von
seinem vieljährigen Aufenthalt in Zentralasien vom Tatarenchan Kublai
ums Jahr 1290: „Im März pflegt Kublai Chan Kambalu zu verlassen; er
nimmt dann etwa 10000 Falkner und Vogelsteller mit sich. Diese werden
in Abteilungen von 200–300 Mann im Lande verteilt, und was von ihnen
erlegt wird, muß dem Chan abgeliefert werden.“ Der Franzose Tavernier,
der sich viele Jahre in Persien aufhielt, erzählt im Jahre 1681: „Der
König von Persien hält sich über 800 Falken, wovon die einen auf wilde
Schweine, wilde Esel, Antilopen und Füchse, die andern auf Kraniche,
Reiher, Gänse und Feldhühner abgerichtet — der fachmännische Ausdruck
heißt abgetragen — sind.“ 1827 schreibt der Engländer John Malcolm
über die Falkenjagd in Persien: „Man jagt zu Pferde, mit Falken und
Windhunden. Ist eine Antilope aufgetrieben, so flieht sie mit der
Schnelligkeit des Windes. Alsbald läßt man Hunde und Falken auf sie
los; die letzteren fliegen nahe am Boden hin, erreichen das Wild bald,
stoßen gegen dessen Augen und halten es auf; inzwischen kommen die
Hunde heran und packen es.“

Bild 61. Der Angelnherzog Harald und seine Mannen reiten
auf die Jagd.
Anfang des 1066 gestickten 70 m langen, 0,2
m breiten Teppichs von Bayeux.
Bei den Kirgisen und Baschkiren ist die Falknerei noch ein
hochgeschätzter Betrieb, in welchem man Adler für großes und
Falken, Habichte und Sperber für kleines Wild verwendet. Bei ihnen
wird ein bewährter Jagdfalke so hoch bewertet, daß der glückliche
Besitzer sich eher entschließen würde, sein Weib als seinen Vogel
zu verkaufen. Die geschätztesten Jagdgehilfen des Menschen sind die
Edelfalken, unter denen, wie wir bereits besprachen, der den
hohen Norden bewohnende, fast rein weiße Jagdfalke (Falco
candicans) im Mittel[S. 660]alter der geschätzteste war. Man bezog ihn
damals vorzugsweise aus Island, wo er auch noch brütet. Sonst begnügte
man sich meist mit dem über ganz Europa verbreiteten, alle Erdteile
vom hohen Norden bis in die heiße Zone bewohnenden Wanderfalken
(Falco peregrinus). Während er im Norden auch häufig auf der
flachen Tundra vorkommt, wählt er in den heißeren Ländern die kühleren
Gebirgszüge zu seinem Aufenthalt. Dort baut er sein Nest auf dem
nackten Boden, hier wählt er zur Errichtung seines Horstes am liebsten
Höhlungen in unzugänglichen, nackten Felswänden oder nistet, wo er
solches nicht haben kann, auf hohen Waldbäumen. Dabei wählt er gern,
um sich Mühe zu ersparen, das Nest eines andern Raubvogels, eines
Reihers oder Raben. Ist ein solches, das ihm passen würde, besetzt,
so vertreibt er den betreffenden Eigentümer mit Gewalt. Er ist ein
äußerst mutiger Vogel, der mit raschen Flügelschlägen meist niedrig
über die Erde dahinfliegt. Auf einen aufgescheuchten Vogel, den er
rasch überstiegen hat, stößt er mit reißender Schnelligkeit schief von
oben herab. Er vermag nur fliegende Vögel zu erbeuten, da er mit so
großer Heftigkeit auf sie stößt, daß er sich beim Stoßen auf den Boden
verletzen würde. Seine Beute bilden Vögel von der Größe einer Lerche
bis zu der einer Ente, ja einer Wildgans. Im Walde sind es Ur-, Birk-
und Haselhühner, auf dem Felde vorzugsweise Rebhühner, die er wegfängt,
um sie stets auf freiem Felde zu verzehren, niemals aber im Gebüsch,
weshalb Bussarde und Milane oft über ihn herfallen, um ihm seine Beute
abzujagen. Indessen vertreibt ihn nur die freche Schmarotzermöve aus
seinem Gebiet. In Deutschland ist jetzt der Wanderfalke als Brutvogel
selten. Als solcher zieht er im Herbste nach Süden, um indessen
durch Besucher aus dem Norden ersetzt zu werden. Oft schlägt der
Wanderfalke sein Winterquartier auf Türmen in belebten Städten auf,
von wo aus er den Tauben nachstellt. So nistete im Jahre 1880 sogar
ein Paar auf dem Turm der Petrikirche mitten in Berlin. Als großer
Schädling kann er nicht geduldet werden und wird deshalb von Jägern
und Taubenzüchtern aufs eifrigste verfolgt. Gefangen hält er sich bei
sorgsamer Pflege jahrelang im Käfig und nimmt hier mit allerlei Fleisch
vorlieb, verlangt aber viel Nahrung. Er ist der gewöhnliche Jagdfalke
der Vergangenheit und Gegenwart, der auch dem Dorf Falkenwerd bei
Herzogenbusch in Flandern den Namen gab. Dort bestand Jahrhunderte
hindurch die beste und zuletzt einzige Falknerschule Europas. Da
früher die an Ort und Stelle gefangenen Vögel für den großen Bedarf
nicht hin[S. 661]reichten, reisten die Angestellten der Falkner oder diese
selbst weit herum, selbst nach Norwegen und Island, um solche zu
fangen. Dies geschah vorzugsweise im Herbst. Man behielt in der Regel
nur die Weibchen, und zwar am liebsten die von demselben Jahre, weil
diese sich zur Dressur am besten eignen. Die zweijährigen galten auch
noch als brauchbar, ältere dagegen ließ man wieder fliegen. Der Fang
geschieht in folgender Weise: Der Falkner sitzt gut verborgen auf
freiem Felde und hält eine auf dem Boden sitzende Taube an einer etwa
100 m langen Schnur fest. 40 m vom Falkner entfernt geht
diese Schnur durch einen Ring, neben welchem ein Schlagnetz liegt,
von dem eine Schnur ebenfalls zum Falkner verläuft. Ist ein Falke im
Anzug, was durch einen unweit der Taube gefesselten, äußerst eifrigen
und scharfsichtigen Wächter, nämlich einen Würger, schon zu einer
Zeit angezeigt wird, da das menschliche Auge durchaus noch nichts zu
erkennen vermag, so wird der Taube mit der Schnur ein Ruck gegeben,
wodurch sie emporflattert, den Falken anlockt und von ihm in der Luft
ergriffen wird. Sobald dies geschehen ist, zieht der Falkner die Taube
und mit ihr den sie krampfhaft festhaltenden Falken allmählich bis zum
Ringe, wo plötzlich das Schlagnetz beide zudeckt. Der frisch gefangene
Falke muß zunächst drei Tage hungern und wird dann in der früher
angegebenen Weise abgerichtet. Ein gut abgerichteter Vogel wird nicht
selten mit 800 holländischen Gulden (= 856 Mark) bezahlt.
Jedenfalls ist die Kunst, Falken zur Jagd abzurichten, eine uralte,
schon von den asiatischen Kulturvölkern des hohen Altertums geübte.
Der Grieche Ktesias aus Knidos, der von 416–399 v. Chr. als Arzt am
persischen Hofe in Susa lebte und eine wertvolle persische Geschichte
schrieb, die uns leider nur in Auszügen und Bruchstücken erhalten
blieb, berichtet von den Indern, daß sie gern mit dem abgerichteten
Falken jagen. Ums Jahr 75 hören wir von der Falkenjagd bei den
Thrakern. Damals war sie auch schon bei den germanischen Stämmen
eingeführt, doch haben weder die Griechen, noch die Römer sie ausgeübt.
Erst ums Jahr 480 n. Chr. hören wir vom römischen Geschichtschreiber
Sidonius Apollinaris, daß des römischen Kaisers Avitus’ Sohn,
Hecdicius, der erste war, der in seiner Gegend die von den Deutschen
Falkenbeize genannte und jedenfalls auch ihnen entlehnte Jagd mit dem
abgerichteten Falken einführte. Dieser Sport fand bei den Vornehmen
alsbald großen Beifall und selbst die Geistlichen taten mit, so daß man
schon im Jahre 506 auf einer[S. 662] Kirchenversammlung zu Agda das Führen
von Jagdfalken und Jagdhunden verbot. Wie die deutschen Stämme die
auf die Jagd abgerichteten verschiedenen Raubvögel seit dem frühen
Mittelalter überaus hochschätzten, haben wir bereits gesehen. Auch ihre
Fürsten jagten mit Vorliebe hoch zu Pferd hinter dem Jagdfalken her.
So wird von Friedrich I. Barbarossa, dem zweiten Kaiser aus dem
Haus der Hohenstaufen (1123–1190), berichtet, daß er selbst Falken,
Pferde und Hunde zur Jagd abrichtete. Sein Sohn, der mit der Erbin
von Sizilien, Konstantia, vermählte und in Messina verstorbene Kaiser
Heinrich IV. (1165–1197) war gleicherweise ein großer Liebhaber
der Falknerkunst. Und dessen Sohn, Friedrich II., der sich ganz
als Sizilianer fühlte (1194–1250), war ein leidenschaftlicher Falkner,
der sogar ein namhaftes Buch über die Kunst, mit Raubvögeln zu jagen,
schrieb. Noch der prachtliebende, aber ausschweifende König Franz
I. von Frankreich (1494–1547) hatte einen Oberfalkenmeister,
unter welchem 15 Edelleute und 50 Falkner standen. Die Zahl seiner
Jagdfalken betrug 300. Sein Rivale, Kaiser Karl V., belehnte die
Johanniter, den ältesten der drei geistlichen Ritterorden, im Jahre
1530 mit den Inseln Malta, Gozzo, Comino und dem Lande Tripolis unter
der Bedingung, daß sie ihm jährlich einen nordischen weißen Jagdfalken
liefern sollten. Selbst die geistlichen Herrn schwärmten für Jagdfalken
und nahmen sie selbst in die Kirche mit, bis sie die ihnen lästige
Formalität des täglichen Messelesens gedankenlos genug absolviert
hatten. Als ihnen solches von ihrem Oberhaupte verboten wurde, blieben
doch die Barone, über die jener keine Macht hatte, auf ihrem Recht, die
Jagdfalken während des Gottesdienstes auf den Altar setzen zu dürfen.
Die ganze mittelalterliche Poesie strahlt die Freude aus an diesem
ritterlichen Sport und spricht an unzähligen Stellen vom Falken als dem
Lieblingsgenossen des höfischen Menschen jener Zeit.
Außer dem nordischen weißen Jagd- und dem stattlichen Wanderfalken
wurde aber auch das verkleinerte Abbild des letzteren, der
Baumfalke (Falco subbuteo), gelegentlich zur Jagd
abgerichtet. Als der schnellste unter allen europäischen Raubvögeln
fliegt er leicht und pfeilgeschwind und überholt alle andern Vögel,
selbst Schwalben und Mauersegler. Mit bewundernswürdiger Gewandtheit
verbindet er große Kühnheit und Entschlossenheit; auch er fängt niemals
sitzende, sondern nur fliegende Vögel, auf die er schief von oben herab
so reißend schnell stößt, daß man seine Gestalt nicht zu erkennen
vermag. Allerhand kleine Vögel, vor allem Lerchen und Schwalben, bilden
außer fliegen[S. 663]den größeren Insekten, wie Heuschrecken und Käfer, die
Nahrung des niemals Aas berührenden Vogels. Die Lerchen fürchten ihn
so sehr, daß sie entsetzt zur Erde stürzen und sich mit den Händen
greifen lassen, wenn er plötzlich erscheint. Erblicken sie ihn aber
rechtzeitig, so retten sie sich in die Höhe, in die er ihnen nicht
folgt. Ist das Getreide hoch genug, so daß sich die Lerchen darin vor
dem Baumfalken verbergen können, beginnt er, sich mehr den Schwalben
zuzuwenden, die die meisten anderen Raubvögel necken und verfolgen,
vor ihm jedoch, gewöhnlich in einem lärmenden Schwarm, eiligst in die
Luft, ins Röhricht oder in ein anderes Versteck fliehen. Wo er sich
auch zeigt, ist die ganze Gegend in einem Augenblick schwalbenleer.
Sieht der Baumfalke eine vom Haupttrupp abgelöste Schwalbe, so verfolgt
er sie sogleich. Falls sie noch jung und weniger gewandt als eine
Alte ist, ist sie schon nach wenigen Stößen verloren. Alte Schwalben
entwischen einem noch ungeübten jungen Baumfalken leichter, und auch
alte Baumfalken ziehen mißmutig ab, wenn sie 4–10 Fehlstöße getan
haben. Zuweilen leitet der Baumfalke, als ob er die Vögel verwirren
wolle, seine Jagd mit eigentümlichen Schwenkungen ein, und manchmal
jagen Männchen und Weibchen gemeinsam, ohne sich indessen beim
Verzehren der Beute vertragen zu können. Mit seiner Beute kehrt der
Falke nach seinem vorher innegehabten Standorte auf einem hohen Baume
zurück, um sie dort gemütlich zu verzehren. Diesen Standort verläßt
der kleine Räuber erst ziemlich spät am Morgen, überkreist dann
seinen liebsten Aufenthaltsort, den Wald, und begibt sich erst nach
Sonnenaufgang auf die Feldjagd, bei der er nicht selten dem Hunde eines
Jägers folgt, um die von ihm aufgescheuchten Lerchen und andere kleine
Vögel dicht vor dem Jäger wegzufangen. Zum Nestbau hat er ebensowenig
Lust als seine Verwandten und die meisten anderen Raubvögel. Zum Nisten
benutzt er am liebsten ein fremdes, besonders ein Krähennest, das
meistens erst im Juni 3–4 Junge, wie beim Wanderfalken, enthält. Sobald
sie flugfähig sind, werden sie von den Eltern im Fluge gefüttert. Im
September und Oktober verläßt uns der Baumfalk, um im April wieder
zu erscheinen. Er bewohnt sonst die gemäßigten Länder Europas von
Schweden bis zum Mittelmeer und die entsprechenden Breiten Asiens und
überwintert im Süden.
Sehr häufig wurde auch der bedeutend größere, statt 30 wie jener
50 cm wie der Wanderfalk langwerdende Habicht
(Astur palumbarius) besonders von den alten Deutschen zur
Jagd abgerichtet. Sein liebster Aufenthalt sind mit Feldern und
obstbaumbepflanzten Wiesen ab[S. 664]wechselnde Wälder in der Nähe von
Dörfern. Dort baut er sich auf einem hohen Baum, sei es Laub- oder
Nadelholz, sein Horst, in welchem man in der zweiten Hälfte des April
2–4 Eier findet. Die oben mit grau-, unten mit reinweißen Dunen
bekleideten Jungen sitzen zuerst mit geschlossenen Zehen auf den
Fersen, lernen erst nach Wochen stehen und sind erst nach zwei Monaten
befiedert genug, um auszufliegen. Die Mutter ist so überaus anhänglich
an ihre Jungen, daß sie ihretwegen alle Vorsicht außer acht läßt
und nicht nur auf Kinder, sondern auch erwachsene Menschen, die die
Jungen bedrohen, mit Wut stößt. Allerlei Vögel und kleine Wirbeltiere,
selbst Hasen, bilden die Nahrung des Habichts. Ein lähmender Schrecken
ergreift alle kleineren Vögel bei seinem Erscheinen, so daß sie oft
starr sitzen bleiben und sich vom Räuber greifen lassen. Flüchtende
Vögel sind nicht einmal im Gebüsch vor ihm sicher; er springt ihnen zu
Fuß nach und zerrt sie aus den dichtesten Dornen hervor. Gleich dem
ihm an Gewandtheit ebenbürtigen Sperber stürmt er Waldrändern oder
Zäunen entlang, auch wohl über ein niedriges Dach hinweg oder zwischen
zwei Gebäuden hindurch und ergreift seine Beute so schnell, daß der
erschrockene Vogel erst zu lärmen beginnt, wenn der Habicht schon mit
ihm davonfliegt. Von allen Seiten, selbst von unten her ergreift er
fliehende Vögel und versteht es auch, im Gegensatz zu den Edelfalken,
auf sitzende zu stoßen. Mit seinen scharfen Krallen tötet er sehr rasch
die meisten Tiere, selbst Raben; mit den Fängen und nie im Schnabel
trägt er seine Beute davon. Am besten kann man sich an ihn schleichen,
wenn er vollgefressen auf einem Aste ruht. Dagegen ist er wegen seiner
Raubgier in Fallen und auf Vogelherden leicht zu fangen. Den Verlust
der Freiheit ertragen alte Vögel nicht leicht; selbst mit Hilfe ihrer
geraubten Jungen gefangene und mit ihnen zusammengesperrte Habichte
gebärden sich so wütend, daß sie zuerst die Jungen auffressen und sich
dann gegenseitig überfallen, wobei meistens das größere und stärkere
Weibchen übrig bleibt. Junge Habichte indessen werden leicht zahm.
Aber auch Wildfänge verstand man früher durch ein drei Tage und drei
Nächte andauerndes, den Schlaf verunmöglichendes Wiegen zu zähmen, um
sie für die Jagd abzurichten. Denn wie heute noch in der Tartarei und
in Indien, war er früher bei uns als Jagdgenosse des Menschen teilweise
noch höher geschätzt als die Edelfalken, zu denen er übrigens damals
gerechnet wurde. In der Jagdkunst übertrifft tatsächlich der Habicht
mit dem ebenso gewandten und mutigen Sperber, der gleich jenem sowohl
auf schnellfliegende als auch auf sitzende Vögel stößt,[S. 665] selbst die
Edelfalken. Das Ausnehmen eines Habichtnestes im Bannwalde wurde
schon bei den alten Deutschen streng bestraft, ebenso, wie wir sahen,
der Diebstahl eines für die Jagd dressierten Habichts. König Eduard
III. von England (1312–1377), der grimmige Gegner Frankreichs,
dem er einen Teil seiner westlichen Besitzungen entriß, der Stifter
des berühmten Hosenbandordens, setzte sogar den Tod auf den Diebstahl
eines Habichts, und ließ jeden, der ein Habichtnest ausnahm, auf ein
Jahr und einen Tag ins Gefängnis setzen. Der Habicht bewohnt als
Brutvogel die gemäßigten und nördlichen Gegenden von Europa und Asien
bis zum fernsten Osten in Japan; doch fehlt er in manchen Gegenden aus
unbekannter Ursache.
Außer dem Habicht ist auch der bedeutend kleinere, im männlichen
Geschlecht 31, im weiblichen 36–40 cm lang werdende
Sperber (Accipiter nisus), wie bei den alten Deutschen,
so noch heute bei asiatischen Steppenvölkern ein hochgeschätzter
Beizvogel, der im südlichen Ural von allen Falken am meisten zur Jagd
gebraucht wird, wenn auch hauptsächlich nur zu solcher auf Wachteln.
Er kann am besten gezähmt werden, wenn man ihn im Dunenkleid aus dem
Neste nimmt und schon ganz jung dressiert. Er gehört bei uns nebst dem
Turmfalken zu den bekanntesten Raubvögeln; denn er dehnt namentlich im
Winter seine Raubzüge ohne Scheu bis in belebte Ortschaften aus. Doch
bleiben nicht alle Sperber den Winter über bei uns. Die meisten ziehen
im September und Oktober weg, um im März und April auf ihre Brutplätze
zurückzukehren. Das Brutgebiet des Sperbers erstreckt sich über ganz
Europa, Nordwestafrika und die entsprechenden Gebiete Asiens. Hier hält
er sich am liebsten in Feldgehölzen oder in kleineren, an Wiesen und
Felder grenzenden Waldungen in der Nähe von Ortschaften auf, kehrt auch
von seinen Jagdzügen und zur Nachtruhe dahin zurück. Im Stangenholz
häufiger eines Nadel- als Laubholzes errichtet er sein Nest dicht am
Stamm, oft aus einem gutgelegenen Krähennest hergerichtet und so groß,
daß der lange Schwanz des brütenden Weibchens es nicht überragt. Dieses
brütet von Mitte Mai bis Mitte Juni sein Gelege von 3–5 Eier aus,
verteidigt seine Brut aufs energischste und greift selbst Knaben, die
den Horstbaum ersteigen, mit Krallenhieben an. Beide Eltern tragen den
Jungen Nahrung in solcher Fülle zu, daß nicht selten 8–10 kleine Vögel
gleichzeitig auf dem Horste liegen, doch ist nur das Weibchen imstande,
diese in entsprechender Weise für die Jungen zu zerlegen. So hat man
beobachtet, daß junge Sperber, deren Mutter getötet worden war, bei
vollbesetzter[S. 666] Tafel verhungerten, weil der Vater zu ungeschickt war,
ihnen die Speise mundgerecht zu machen. Noch lange nach dem Ausfliegen
werden die jungen Sperber von den Eltern geführt und unterrichtet, bis
sie dieselbe Meisterschaft im Erhaschen der Beute wie jene erlangt
haben; dann müssen sie sich ein anderes Jagdgebiet suchen. Mit
reißender Geschwindigkeit streicht der Sperber auf seinen Jagdzügen
dicht über die Erde dahin und schießt oft weite Strecken hindurch ohne
Flügelschlag durch die Luft und mit angelegten Flügeln pfeilartig
durch dichte Baumkronen. Er fliegt meistens niedrig, weiß alle sich
ihm entgegenstellenden Hindernisse, wie Hecken und Zäune, leicht zu
überwinden, biegt mit unglaublicher Schnelligkeit um scharfe Ecken und
überrascht so wie ein Blitz aus heiterem Himmel die kleinen Vögel,
deren Futter- und Sammelplätze er genau auszukundschaften versteht.
Diese fürchten ihren unheimlichen Feind auch über alles und werfen sich
sofort zu Boden oder verkriechen sich in ein nahes Mauseloch.
Der Sperber jagt alle Vögel von der Größe eines Zeisigs bis zu der
einer Taube, mit Vorliebe Sperlinge, denen er sogar in vom Menschen
besetzte Zimmer folgt. Dabei stößt er in schräger Richtung und von
oben herab auf seine Beute, und immer unter einer raschen Schwenkung
im Augenblick des Greifens, so daß er seine Beute von unten oder von
der Seite zu packen kriegt. Hat der Sperber keinen besonders großen
Hunger, so beschreibt er mit seiner Beute zuweilen zierliche Kreise
in der Luft, bevor er sie nach Ausrupfen der großen Federn gemächlich
auf einem Baumast verzehrt. Knochen, Federn und Haare gibt er wie
alle Raubvögel in sogenannten Gewöllen von sich. Junge Nestvögel,
namentlich solche, die am Boden ausgebrütet wurden, gehören zu seinem
Lieblingsfutter; aber auch die Eier verschont er nicht. Die weit
größeren Edelfalken und der Habicht fressen den Sperber als verhaßten
Konkurrenten ohne Umstände, wenn sie seiner habhaft werden können.
Auch der Mensch verfolgt ihn als überaus schädlichen Räuber gleich
dem Habicht, wo er nur kann. Um ihrer habhaft zu werden, stellt er
Käfige aus Drahtgitter auf, die unten einen Doppelboden haben, zwischen
welchen eine Locktaube gesteckt wird. Oben ist dieser sogenannte
Habichtskorb offen, in der Mitte hat er ein Trittholz, das mit einem
Schlagnetz in Verbindung steht. Stößt nun der Räuber auf die Taube
herab und berührt er das Trittholz, so löst sich alsbald das Schlagnetz
aus und bedeckt die obere Abteilung des Korbes.
Eine beliebte Methode, um diese, wie auch die dem Menschen[S. 667] verhaßten
kleinen Raubvögel, wie Raben und Elstern zu schießen, besteht in
der Anwendung einer Krähen- oder Schuhuhütte. Diese ist auf einem
freiliegenden, weithin sichtbaren Hügel angebracht und außen mit Rasen
bedeckt. Ein Pfahl mit Querholz trägt den Uhu, den man durch Zerren an
einer Schnur zum Flattern bringt, wenn ihn seine Feinde nicht bemerken
sollten. Ringsum stehen eingegrabene Bäume mit dürren Ästen, auf denen
sich die Vögel niederlassen können und von denen sie herabgeschossen
werden können, wenn sie nicht schon beim Losfahren auf den Uhu erlegt
werden.
Zum Schlusse geziemt es sich, unter den Vögeln, die mit dem Menschen in
engerem Zusammenhange stehen, auch den weißen Storch (Ciconia
alba) anzuführen, der im Gegensatz zu seinem einzigen, ebenso
weit verbreiteten europäischen Gattungsgenossen, dem schwarzen
Storch (C. nigra), seit dem hohen Altertum in Sage und
Geschichte unzertrennlich mit ihm verbunden ist. Als das Einschlagen
des Blitzes verhindernd und überhaupt glückbringend, siedelte er ihn
auf den Giebeln seiner Wohnungen und Kirchen an, indem er ihm in einem
flachen Korb oder in einem alten Wagenrad Nistgelegenheit bot, die er
sonst auf hohen Bäumen mit ausgebreiteten Ästen oder abgebrochenem
Wipfel suchte, um hier sein kunstloses Nest aus Stecken, Reisern,
Schilfrohr und Erdklumpen zu bauen. Sein würdevolles Betragen, sein
gravitätischer Gang und die Eigenschaft, sich von im Boden hausenden
und darin die Seelen der darin Bestatteten in sich aufnehmenden Tieren
zu ernähren und damit selbst ein Seelenträger zu sein, brachte ihn beim
gemeinen Volke von jeher in den Geruch der Heiligkeit und garantierte
ihm, als in vermeintlichem Besitze überirdischer Kenntnisse und Gaben
seiend, Unverletzlichkeit. Bei den alten Germanen war er der Adebar
oder Seelenträger, der die kleinen Kinder den Eltern bringen sollte.
Bei den Orientalen zeigt er sich uns in den Märchen von Tausend und
einer Nacht als ein verwunschener Prinz, dem die höchste Einsicht in
künftiges Geschehen verliehen sein soll. Vom Menschen unterscheide er
sich nur durch das Fehlen des Sprachvermögens. Was dem Storche aber
an Stimmitteln fehlt, das ersetzt er reichlich durch sein Klappern,
das schon von den Jungen im Neste geübt wird, beim Männchen stärker
als beim Weibchen ist und bald Freude und Verlangen, bald Hunger, Zorn
und Ärger ausdrückt. Mit Klappern erheben sich die Störche, wenn sie
gegen Ende August in größeren Trupps nach dem warmen Süden verreisen,
mit Klappern begrüßen sie im Frühjahr ihr Nest, wenn Ende Februar oder
Anfang März zuerst das[S. 668] Männchen und einige Tage später das Weibchen
nachts in ihre alte Heimat und Niststätte einrücken. Alljährlich kehrt
dasselbe Paar dahin zurück, um ihre 3–5 Jungen großzuziehen, die nach
dem Ausschlüpfen aus den Eiern noch mehr als zwei Monate hindurch
unter der rührenden Pflege und Aufsicht der Eltern im Neste bleiben.
In den ersten Tagen würgen ihnen die Alten halbverdauten Futterbrei in
den Schnabel, indem sie dessen Spitze in den Mund nehmen, so daß die
Jungen nur zu schlucken brauchen. Später würgen sie ihnen das Futter
aus dem Kehlsack, zuerst ins Nest hinein, später an dessen Rand, und
schließlich lassen sie dieselben ihre tierische Nahrung sich selbst
suchen.
Schon die alten Griechen glaubten, wie uns Aristophanes und
gleicherweise Aristoteles erzählen, die Störche hätten von alters her
ein Gesetz, wonach die Jungen, sobald sie flügge sind, ihre Eltern
ernähren müssen. Aristoteles sagt, daß die Störche und andere Vögel,
wenn sie verwundet würden, Dosten (origanon) auflegen. Noch
der gelehrte Plinius schreibt in seiner Naturgeschichte: „Man weiß
noch nicht, woher die Störche (ciconia) kommen und wohin
sie ziehen. Wollen sie fortziehen, so versammeln sie sich an einem
bestimmten Orte, wobei keiner fehlt, er schmachte denn in menschlicher
Gefangenschaft. Und sie beginnen nun den Zug, als wenn der Tag dazu
durch ein Gesetz bestimmt sei. Niemand hat sie wegziehen sehen,
obgleich jeder die Anstalten zu ihrem Abzuge bemerkt; ebensowenig sieht
man sie zurückkehren, sondern nur, daß sie zurückgekehrt sind; denn
beides geschieht zur Nachtzeit. In Asien liegt auf einer weiten Ebene
ein Ort, welcher Pythonos Kome heißt; dort versammeln sich die Störche,
murmeln, zerreißen den zuletzt kommenden und dann erst ziehen sie weg.
Manche behaupten, der Storch habe keine Zunge (tatsächlich hat er eine,
aber eine sehr kleine). Wegen Vertilgung der Schlangen wird er so hoch
geehrt, daß Leute, die einen töteten, sonst in Thessalien mit dem Tode
bestraft wurden. Die Störche kehren jedes Jahr zu ihrem Neste zurück.
Die jungen ernähren ihre Eltern, wenn diese schwach werden.“ Und der
Grieche Älianos schreibt: „Alexander der Myndier (der ein auch von
Athenaios um 200 n. Chr. erwähntes naturgeschichtliches Buch schrieb)
sagt, daß die Störche, wenn sie alt geworden sind, nach den im Okeanos
gelegenen Inseln ziehen, dort menschliche Gestalt annehmen und für
die fromme Liebe, die sie ihren Eltern erwiesen, den Lohn empfangen.
Auch wollen die Götter dort, wie ich glaube, ein frommes und heiliges
Geschlecht absondern, da ein solches sonst nirgends unter der Sonne
ein Plätzchen findet. Mir scheint das keine Fabel. Und[S. 669] was hätte denn
Alexander davon gehabt, wenn er sich solche Fabeln erdacht hätte. Ein
verständiger Mann wie er lügt selbst dann nicht, wenn er den größten
Vorteil davon haben könnte.“
Ähnliche Verehrung, wie bei den Abend- und Morgendländern der
Storch, genoß bei den alten Ägyptern der heilige weiße Ibis
(Ibis religiosa), der durch das Verschlingen und Wegschaffen
von tierischen Leichen ebenfalls als ein Seelenträger galt und als
solcher mit besonderen Eigenschaften ausgestattet gewähnt wurde.
Der griechische Geschichtschreiber Diodorus Siculus schreibt: „Die
Ägypter behaupten, der Ibis nütze durch Vertilgung der Schlangen,
Heuschrecken und Raupen“, und Strabon sagt, daß sie in Ägypten, dank
ihrer Unverletzlichkeit, sehr zutraulich seien. „In Alexandreia wimmeln
alle Straßen von ihnen; sie sind nützlich, weil sie alles Tierische
auflesen, namentlich die Abfälle der Fleisch- und Fischmärkte,
andererseits aber lästig, da sie alles beschmutzen.“ Sein Kollege
Älianos weiß die merkwürdigsten Dinge von diesem, nach ihm der
Mondgöttin heiligen Tiere zu berichten, das nie aus Ägypten weggehe,
weil dieses Land unter allen das feuchteste sei. Zum Ausbrüten seiner
Eier brauche er so viel Tage als der Mond ab- und zunimmt. „Freiwillig
wandert der Ibis nicht aus; fängt ihn aber jemand und bringt ihn mit
Gewalt fort, so ist alle Mühe vergeblich; denn der Vogel hungert sich
zu Tode. Er schreitet ruhig und wie ein Mädchen einher und geht immer
nur Schritt vor Schritt. Die schwarzen Ibisse beschützen Ägypten gegen
die aus Arabien kommenden geflügelten Schlangen, die weißen Ibisse
aber vernichten die Schlangen, welche zur Zeit der Überschwemmung aus
Äthiopien kommen. Ägypten wäre verloren, wenn es nicht von Ibissen
beschützt würde. Er ist sehr hitziger Natur, frißt Schlangen und
Skorpione. Nur sehr selten sieht man einen kranken Ibis. Den ganzen
Tag geht er im Schmutze herum, sucht darin nach allerlei Dingen,
steckt den Schnabel in alles, badet sich aber erst gehörig ab, bevor
er schlafen geht. Um den Katzen zu entgehen, nistet er auf Palmbäumen;
denn auf diese klettern die Katzen wegen der daran befindlichen
Hervorragungen nicht gern.“ Tatsächlich bevorzugt der Ibis zum Nisten
eine Mimosenart, die die Araber der dichten, ungemein dornigen, ja fast
undurchdringlichen Äste halber harasi, d. h. die sich Schützende
nennen. Aus den Zweigen des harasi besteht auch das innen mit
Grashalmen ausgepolsterte flache Nest des Vogels, in welchem die 3–4
Eier ausgebrütet werden.
Zur Zeit der alten Ägypter haben die heiligen Vögel sich
höchst[S. 670]wahrscheinlich im Zustande einer Halbgefangenschaft in
Tempelhöfen fortgepflanzt. Heute tun sie dies bei guter Pflege nicht
allzuselten in unseren Tiergärten. Noch heute stellt man dem Ibis im
Sudan nicht nach, obgleich sein schmackhaftes Fleisch die Jagd wohl
lohnen würde. So aßen auch die alten Griechen und Römer den Storch
nicht. Erst der gottlose einstige Prätor Asinius Sempronius Rufus soll
die Sitte, junge Störche zu essen, in Rom eingeführt haben, worauf
Horaz in einer seiner Satiren auf seine genußsüchtige Zeitgenossen
anspielt.
Wie die Ägypter den heiligen Ibis, so hielten die alten Griechen
und Römer das prächtig gefärbte Purpurhuhn (Porphyrio
hyacinthinus) in halber Gefangenschaft in den Höfen ihrer Villen
und Heiligtümer. So schreibt der Grieche Älian von ihm: „Das Purpurhuhn
(porphyríon) ist ein ausgezeichnet schönes Tier. Es badet sich
im Staube wie im Wasser, frißt aber nicht gern vor Zeugen, daher am
liebsten in einem Versteck. Die Menschen haben es sehr gern und füttern
es mit großer Sorgfalt. Es paßt gut in prachtliebende, reiche Häuser,
auch in Tempel, und geht in diesen als heiliger Vogel frei umher.
Schwelger schlachten den Pfau, der ebenfalls schön ist, aber ich weiß
von keinem Menschen, der das Purpurhuhn für die Tafel geschlachtet
hätte.“ Mit dem Untergang der alten Kultur verschwand auch dieses Tier
wieder aus der Nähe des Menschen.
[S. 671]
XXVII.
Pelz-, Schmuckfedern- und Schildpattlieferanten.
Zu allen Zeiten hat bei den mehr im Norden wohnenden Völkern, bei
denen es im Winter empfindlich kalt wurde und denen es an der nötigen
Erwärmung der nur mangelhaft verschließbaren Räume fehlte, die
Pelzkleidung hohe Wertschätzung gefunden. Dies war um so eher möglich,
als gerade die für sie zunächst in Betracht kommenden nordischen Tiere
zum Schutze gegen die winterliche Kälte ein sehr schönes, dichtes
Fell besitzen, das sich der Mensch zu seiner Erwärmung, daneben auch
als Zierde gern aneignete. Noch im Mittelalter spielte der Pelzbesatz
als Schmuck in der Männerkleidung eine große Rolle, während ihn heute
fast ausschließlich die Frauen tragen. Bei diesen ist allerdings der
Pelz nicht nur zum Wärmen, sondern in erster Linie als Schmuck, heute
mehr Mode als je; die elegante, reiche Frau schwelgt geradezu im
Pelzwerk. Und wie immer, ist die für sie geschaffene Mode auch für die
minderbegüterten Kreise maßgebend. Sie paßt sich den kleinen Geldbörsen
an, und die dienstwillige Industrie zaubert für diese Nachahmungen aus
billigem Pelzwerk hervor, die, technisch von überraschender Vollendung,
schließlich auch der Arbeiterfrau und dem Dienstmädchen eine Pelzstola
und einen Pelzmuff zu tragen gestatten.
Bis über das Mittelalter hinaus war das gewaltige russische Reich
der Hauptlieferant des Pelzwerkes für die Kulturvölker Europas und
die Häfen der Ostsee bildeten die Hauptstapelplätze dieses Handels.
Die Entdeckung Amerikas lenkte den Pelzhandel in neue Bahnen und
verschaffte den Europäern zahlreiche neue Produkte, die teilweise
große Wertschätzung fanden. Um den großen Bedarf zu decken, sind heute
zahllose Menschen mit der Beschaffung und Verarbeitung von Pelzen aller
Art beschäftigt; und zwar kommt das Material Kanadas in London und
dasjenige Sibiriens in Nischni Nowgorod und Irbit im Gouvernement Perm
auf den Markt. In diesen Städten kaufen dann[S. 672] die Leipziger Großhändler
und andere die Ware, um sie zugerichtet und teilweise auch gefärbt in
den Handel zu bringen. Nur für den echten Sealskin besitzt London noch
das Monopol, sonst hat es Leipzig für alle übrigen „Rauchwaren“ — wie
der technische Ausdruck lautet —, so daß dort die Pelzhändler aller
kaukasischen Kulturländer ihren Bedarf einkaufen. Da nicht weniger als
75 Prozent des ganzen Bestandes des großen russischen Pelzstapelplatzes
Nischni Nowgorod nach Leipzig gelangen, ist es begreiflich, daß ein
jährlicher Umsatz von etwa 50 Millionen Mark in Pelzen erzielt wird.
Die erste Zubereitung der Felle ist fast in allen Ländern dieselbe.
Nachdem das Fell vorsichtig abgezogen ist, wird es mit einem scharfen
Messer von anhaftenden Fett- und Fleischteilen so gut wie möglich
gereinigt und dann an einem luftigen, kühlen Ort im Freien getrocknet.
Hierauf werden sie auf der Innenseite reichlich mit Salz bestreut und
eines auf das andere gelegt. In dieser Lage bleiben sie 2–3 Wochen.
Nach diesem Pökelprozeß sind sie zum Versand fertig. Zu diesem Zwecke
werden sie mit der Pelzseite nach außen je zu zweien zusammengerollt
und stark verschnürt. So gelangen sie auf die Auktionsplätze, wo sie
von geübten Händen geglättet und dann versteigert werden. Die auf der
Auktion erworbenen Felle wandern, bevor sie der Kürschner in die Hände
bekommt, in eine Pelzbearbeitungsfabrik, in der sie zugerichtet werden.
Dabei wird das rohe, getrocknete Fell zuerst in Wasser oder feuchten
Sägespänen aufgeweicht, damit es geschmeidig werde; dann wird es,
nachdem es in Zentrifugen getrocknet wurde, an der Rückseite mit großen
Messern von etwaigen noch anhaftenden Fleischteilchen gesäubert und
unter Zusatz von etwas Fett in besonderen Maschinen gewalkt. Hierauf
wird es in rotierenden Trommeln unter Zusatz von Sägespänen entfettet,
ausgezogen und gespannt, damit es Form gewinnt, nochmals gereinigt
und zum Schluß vielfach geschoren oder gerupft, um die längeren
Grannenhaare zu entfernen. Umgekehrt werden manche Pelze „frisiert“,
indem man mit unendlicher Geduld bestimmte Haarsorten, z. B. weiße
(Silberhaare) in dunkeln Pelz einklebt.
Ein großer Teil der Pelzwaren wird auch gefärbt, nicht nur die
Nachahmungen, wie man wohl anzunehmen geneigt ist. So zeigt z. B.
das Fell der zwischen Kamtschatka und Alaska lebenden Bärenrobbe,
von den Engländern fur seal genannt, im Naturzustande ein dichtes
gelbes Wollhaar, und darüber ein grobes aschgraues bis braunschwarzes
Grannenhaar. Erst wenn letzteres entfernt und das ganze Fell
dunkel[S. 673]kastanienbraun gefärbt ist, entsteht der herrliche samtartige
Sealskin, für den unsere Damen eine so erklärliche Vorliebe haben. Um
nun diesen beliebten Pelz auf den Markt bringen zu können, werden die
grausamsten Massenschlächtereien abgehalten, in denen die wehrlos auf
dem Lande zur Fortpflanzung und Paarung versammelten Tiere zu Tausenden
erschlagen werden. Ebenso sind sämtliche Persianer, die gekräuselten
Felle junger Schafe, gefärbt, wodurch sie erst den eigentümlichen
prachtvollen Glanz erhalten. Dabei ist die Kunst der Färberei heute
so weit fortgeschritten, daß sie absolut wetterbeständige Ware
liefert. Wo es Imitationen herzustellen gilt, wirken Zurichterei
und Färberei auch zusammen. Und diese sind sehr wichtig, da sie
auch Minderbemittelten beinahe an Schönheit, jedenfalls aber an
Haltbarkeit den Originalien ebenbürtige Nachahmungen bieten. So wird
der teure Sealskin mit Vorteil durch den Sealbisam, den geschorenen
und gefärbten Pelz der nordamerikanischen hell- bis dunkelbraunen
Bisamratte, ersetzt, neuerdings aber durch den noch viel billigeren
Sealkanin von langhaarigen Kaninchen meist belgischer Herkunft. Welche
Preisunterschiede dabei in Betracht kommen, illustriert am besten
die Angabe, daß ein einfacher Muff in echtem Sealskin 100 Mark, in
Sealbisam 15 Mark und in Sealkanin nur 4 bis 6 Mark kostet.

Bild 62. Altdeutsche Kürschnerwerkstatt.
(Nach einem Holzschnitt von Jost Ammann.)
Aus den Zurichtereien und Färbereien gelangen die Pelze zu
Hunderttausenden in die Speicher der Großhäuser zurück, um von hier
aus in den Handel gebracht zu werden. So treffen zur Ostermesse, die
immer noch einen zeitlichen Mittelpunkt des Rauchwarenhandels bildet,
die Aufkäufer nicht nur der engeren Heimat, sondern aus aller Herren
Ländern in den Großhäusern Leipzigs ein, um ihren Bedarf[S. 674] einzuhandeln.
Dieser wird dann im Laufe des Sommers fertiggestellt, um im nächsten
Herbst und Winter verkauft zu werden. Die Ostermesse ist auch die
Haupterntezeit der zahlreichen Kommissionäre und Makler, die der
Rauchwarenhandel ernähren hilft. Diese geben mit ihrem geschäftigen
Wesen dem Brühl den Charakter der Messe, in der unaufhörlich gehandelt,
gefeilscht, gelärmt und gestritten wird. Doch hat heute die Ostermesse
lange nicht mehr die Bedeutung für den Rauchwarenhandel, die sie
einst besaß. Konzentrierte sich in ihr ehemals das Hauptgeschäft, so
bildet sie in diesem nur eine, allerdings wichtige und unruhvolle
Etappe. Heute geht nämlich der Verkauf von Pelzwaren mehr oder weniger
während des ganzen Jahres vor sich. Die erleichterten Reisebedingungen
ermöglichen den Käufern den häufigeren Besuch Leipzigs. Viele ziehen
überhaupt den Kauf zu einer ruhigeren Periode, als die Messezeit
es ist, vor. Dazu kommt, daß die von den Grossisten auf den großen
Londoner Auktionen erstandenen Waren zur Osterzeit noch nicht
zugerichtet sein können, und daß von der Messe zu Nischni Nowgorod,
die vom Juli bis September stattfindet, die russischen Waren erst im
Frühherbst in Leipzig eintreffen können. Dazu kommt noch, daß die neuen
Moden, die immer noch hauptsächlich in Paris gemacht werden, erst zu
Ende des Sommers oder zu Herbstbeginn in die Erscheinung treten, und
daß die Pelzkonfektion dann durch sie oft noch zu großen Einkäufen
veranlaßt wird.

Bild 63. Fellgerber.
(Nach einem Holzschnitt von Jost Ammann.)
Die vornehme russische Gesellschaft versteht viel von edlen Pelzen;
denn in jenem Lande spielte das Pelzwerk von jeher eine wichtige
Rolle in der Kleidung der reicheren Leute. Besonders der Zobel
stand dort mit an der Spitze der Wertschätzung. Ist doch die[S. 675] alte
Zarenkrone eine mit Goldschmuck und Juwelen besetzte Zobelmütze. Noch
höher als Zobel werden aber Schwarz- und Silberfüchse eingeschätzt,
d. h. solche, die ein glänzend schwarzes oder ein mit silbrigen
Haaren durchschossenes schwarzes Fell haben. Die schönsten Exemplare
derselben kommen nicht aus Sibirien, sondern aus dem nordamerikanischen
Labradorgebiet, und ein ausgesuchtes Stück kostete schon vor Jahren
11600 Mark. Ein ebenfalls sehr hoch bewerteter Pelz ist derjenige des
ursprünglich ausschließlich aus Kamtschatka, neuerdings aber mehr aus
Alaska ausgeführten Seeotters, der in ausgesuchtester Qualität auf
5–6000 Mark zu stehen kommt. Die sibirischen Zobelfelle stehen den
nordamerikanischen bedeutend voran, und sie sind um so geschätzter,
je dunkler sie sind, auch je regelmäßiger die silbergespitzten
Grannenhaare im Fell verteilt sind. Daher schwankt der Wert eines
solchen sehr. Während ein geringes, erst durch „Blenden“, d. h.
Auffärben ansehnlich gemachtes Zobelfell schon zu 60 Mark zu haben ist,
kosten die besten 1000 bis 1500 Mark und mehr. Wenn auch der Zobel
in den letzten Jahren viel seltener geworden ist, kommen außer den
nordamerikanischen immer noch jährlich 40000 bis 50000 nordasiatische
Zobelfelle in den Handel, von denen aber nur ein kleiner Prozentsatz
die hochgeschätzte dunkle Farbe aufweist.
Außer dem Zobel liefert Rußland auch den Edelmarder, der im Wert dem
hellen Zobel nahe kommt. Die besten Stücke derselben liefert aber
Norwegen und Finnland. Ferner liefert Rußland den Nörz, ebenfalls eine
Marderart, deren beste Felle allerdings Nordamerika liefert, dann den
kostbaren Hermelin, dessen Preis sich in den letzten Jahren, nachdem
er eine Zeitlang wenig begehrt war, durch die gewaltige Nachfrage
verzehnfachte. Es ist dies bekanntlich eine Wieselart, deren im Sommer
gelblichbrauner Pelz in kälteren Gegenden mit viel Schnee rein weiß
wird bis auf die schwarze Schwanzspitze. Weiterhin beziehen wir aus
Rußland die Felle von Iltis, Wolf und Bär, außerdem in ungeheuren
Massen von sibirischen Eichhörnchen, die man als „Feh“ oder „Grauwerk“
bezeichnet. Endlich stammen von dorther auch die in Südrußland,
noch mehr aber in der Bucharei gewonnenen Persianer, die von jungen
Fettschwanzschafen, die noch nicht Gras gefressen haben, gewonnen
werden.
Beginnen wir die Aufzählung der verschiedenen Pelzlieferanten mit
dem sibirischen grauen Eichhörnchen. Je weiter östlich, um so
dunkler und wertvoller wird dessen Fell; diesseits des Urals ist es
heller und billig im Preise. An der Lena leben die Bauern von Anfang[S. 676]
März bis Mitte April ganz dem Eichhörnchenfang vermittelst Fallen,
von denen mancher dort über 1000 stellt. Die Tungusen erlegen es
mit stumpfen Pfeilen oder gebrauchen engläufige Büchsen mit Kugeln
von der Größe einer Erbse, und schießen es in den Kopf, um das Fell
nicht zu verderben. Rußland und Sibirien liefern deren jährlich 6
bis 7 Millionen im Werte von 3 Millionen Mark. Davon kommen bloß 2–3
Millionen Felle auf den westeuropäischen Markt; die übrigen werden im
Lande selbst verbraucht oder gehen nach China. Außer dem Felle, von dem
die grauen Rücken Mäntel und anderes Pelzwerk, die weißen Bauchseiten
dagegen, zu großen Tafeln zusammengenäht, ein beliebtes Pelzfutter
geben, verwendet man die Schwänze zu „Boas“ und die Schwanzhaare zu
guten Malerpinseln.
Auch das kleinere und plumper gebaute sibirische Backenhörnchen,
der Burunduk (Tamias striatus), der am häufigsten in
Zirbelkieferbeständen lebt und unter den Wurzeln dieser Bäume eine
gabelförmig geteilte Höhle anlegt, deren einer Teil als Wohnraum, der
andere als Vorratskammer für Getreidekörner und Nüsse dient, von denen
sie für manchen Winter 5 kg in den Backentaschen nach Hause
schleppen, liefert hübsche Bälge. Diese gelangen meist nach China, wo
man sie hauptsächlich zur Verbrämung wärmerer Pelze benützt.
Von allen Nagetieren hat der Biber das geschätzteste Fell.
Von Amerika her kamen früher jährlich etwa 150000 derselben im
Gesamtwerte von 3 Millionen Mark in den Handel. Heute aber sind es
deren höchstens noch 50000 im Jahr, und zwar sind auch von ihnen die
dunkeln die wertvollsten. Je nach seiner Güte wird das Stück mit 20–60
Mark bezahlt. Er wird dort von den Trappern meist in Fallen gefangen,
nur ausnahmsweise geschossen. Da er aber auch in Amerika mehr und
mehr abnimmt, muß vielfach der Sumpfbiber oder Coypu
(Myopotamus coypu), die Nutria der spanischen Amerikaner,
mit ihrem Felle für ihn eintreten. Auch der Sumpfbiber ist ein
ausgesprochenes Wassertier von nahezu der Größe des Fischotters, das
vorzugsweise die reich mit Pflanzen bewachsenen Ufer der stillen Wasser
Südamerikas zu beiden Seiten der Anden bewohnt. Jedes Paar gräbt sich
am Ufer eine metertiefe, 60 cm weite Höhle, in der es die Nacht
und einen Teil des Tages zubringt. In dieser Wohnung wirft das Weibchen
8–9 Junge, die behaart und mit offenen Augen zur Welt kommen, schon in
den ersten Tagen fressen und bald ihrer Mutter auf ihren Streifzügen
folgen. Die Tiere werden in ihrer Heimat mit Schlagfallen gefangen oder
mit eigens abgerichteten Hunden[S. 677] gejagt. Ihr weißes, wohlschmeckendes
Fleisch wird gegessen, das braune Fell jedoch in großen Mengen in den
Handel gebracht. Davon kommen jährlich eine halbe Million nach Europa,
um hier nach Ausrupfen der langen, groben Grannenhaare zu Pelzbesätzen
zu dienen. Das dichte, weiche Wollhaar gibt einen sehr schönen und
dabei billigen Pelz, ist daher sehr beliebt.
Viel teurer und begehrter ist das seidenweiche, aschfarbene Fell
der die hohen Anden zwischen Südchile und dem Norden von Bolivia
bewohnenden Chinchilla oder Wollmaus (Chinchilla
lanigera), an dem schon die vorgeschichtlichen Peruaner, die
Inkas, ihre Freude hatten. Wie sie aus den Haaren der Vicuña die
feinsten Stoffe herstellen, bereiteten sie aus den Haaren dieser
Wollmaus wunderbare Gewebe für ihre Herrscher. Sie erbeuteten das
Tierchen in Schlingen und Schlagfallen, die sie vor deren Löcher
aufstellten, daneben auch mit gezähmten Wieseln, die speziell auf
die Chinchillajagd abgerichtet waren, wie in Südeuropa die Frettchen
auf die Kaninchenjagd. Nach Europa kamen die ersten Chinchillafelle
gegen Ende des 18. Jahrhunderts, und zwar vermittelte Spanien den
Handel damit. Für das Dutzend der kleinen Fellchen dieser in großen
Gesellschaften in selbstgegrabenen Erdlöchern lebenden Tierchen wurde
früher an die Jäger 6–8 Mark bezahlt. Seither sind die Preise infolge
der übermäßigen Jagd danach gewaltig in die Höhe gegangen. Schon 1899
bot ein französisches Haus 150–300 Franken für das Dutzend und jetzt
ist der Preis dafür auf über 1060 Franken gestiegen. Noch ums Jahr 1900
schätzte man die jährliche Ausfuhr allein aus den beiden argentinischen
Provinzen Coquimbo und Vallenar auf 40400 Dutzend. 1905 betrug die
Gesamtausfuhr der Felle aus Chile 18153 Dutzend, 1906 nur 9776, 1907
4000 und 1909 3000 Dutzend.
Die Chinchilla bevorzugt steinige, dürre Hänge und Hochebenen, die mit
dem zierlichen Leguminosenstrauch Balsamocarpum brevifolium,
der algarobilla der spanischen Chilenen, bewachsen sind, von
dessen wie Nuß schmeckenden Samen sie sich ernährt und die sie auch
in ihren Höhlen aufspeichert. Zur Zeit der Paarung sind die Männchen
sehr eifersüchtig und kämpfen ingrimmig wegen der Weibchen miteinander.
Letztere werfen zweimal im Jahr 2–4 Junge, für die sie aus sich selbst
ausgerauften Haaren ein weiches Lager bereiten. Sie sind auch später
sehr besorgt um sie und führen sie zum Futter. Morgens und nachmittags
sind diese hübschen Nager am lebhaftesten und verlassen alsdann ihre
Höhlen, um auf die Nahrungssuche auszugehen, ohne sich jedoch[S. 678] weit
zu entfernen. Sie lassen sich leicht in der Gefangenschaft halten
und werden darin bald recht zahm; nur die Männchen vertragen sich
gegenseitig nicht gut. Solange es genug dieser Tierchen gab, war
die Chinchillajagd sehr lohnend und brachte noch vor wenigen Jahren
mit geringer Mühe reichen Gewinn. Seitdem diese Tiere aber beinahe
ausgerottet sind, ist ihre Jagd kaum mehr lohnend. Meist werden sie,
wenn das Gestrüpp auf größere Strecken niedergebrannt ist, mit Knüppeln
aus ihren Höhlen aufgescheucht und, in weitem Kreise beginnend,
allmählich der Mitte zugetrieben, wo sie, unterschiedlos alte und
junge von abgerichteten Hunden totgebissen werden. Außerdem werden sie
vielfach vermittelst Rattenfallen gefangen. Neuerdings beginnt man sie
zur Pelzgewinnung zu züchten. Auch das Fleisch wird sehr geschätzt.
Von nordamerikanischen Pelzlieferanten ist der Waschbär oder
Schupp, der Raccoon der Amerikaner (Procyon lotor), zu
nennen, dessen gelblichgraues, schwarzgemischtes Fell die beliebten
Schuppelze liefert. Dieser Kleinbär von 80–90 cm Gesamtlänge ist
gleichzeitig Boden-, Wasser- und Baumtier. Am Tage schläft er in einem
hohlen Baume oder auf der Astgabel einer dichten Baumkrone, um dann
nachts auf Beute auszugehen. Gern hält er sich in der Nähe seichten
Wassers auf, um Fische und Krebse zu fangen oder Süßwassermuscheln zu
erbeuten. Außerdem ernährt er sich von Fröschen, Süßwasserschildkröten,
Vögeln und deren Eiern, Mäusen, Insekten aller Art, aber auch Nüssen,
Früchten und Korn. Im Norden hält er einen Winterschlaf ab. Das
Weibchen wirft im April 4–6 Junge, die es ein Jahr lang um sich behält.
Wegen seines sehr geschätzten Pelzes, der früher in den Staaten des
Mississippitales als eine Art Münze im Werte von 1⁄4 Dollar galt,
wird er eifrig verfolgt und entweder in am Rande von Sümpfen oder
Flüssen unter Wasser angebrachten Fallen aus Stahl gefangen oder
während der Nacht mit eigens dazu abgerichteten, gewöhnlich zur
Rasse der Fuchshunde gehörenden Hunden gejagt. Diese wissen seiner
Spur zu folgen und treiben ihn nach kurzer Zeit auf einen Baum, wo
er, falls er sich nicht in einem Loche verkriecht, vom Jäger erlegt
wird. Neuerdings wird er, da er sich leicht in der Gefangenschaft
fortpflanzt, zur Pelzgewinnung in eingehegten Waldteilen gezüchtet.
Jung eingefangen wird er gewöhnlich sehr bald und in hohem Grade zahm.
Seine Beweglichkeit und Zutraulichkeit machen ihn dem Menschen als
Gesellschafter angenehm.
Der Winterpelz der amerikanischen grauen Eichhörnchen geht unter
dem Namen Petitgris, ist aber weniger geschätzt als der russische[S. 679]
Feh; ebenso verhält es sich mit demjenigen des Luchses. Dagegen wird
der Pelz der nordamerikanischen Iltisse ebensosehr wie derjenige der
altweltlichen geschätzt. Der Iltis oder Ratz (Mustela
putoria) ist ein Nachttier, das am Tage zwischen Gestein,
aufgestapeltem Holz, in verlassenen Fuchs- oder Kaninchenlöchern ruht,
abends jedoch seinen Schlupfwinkel verläßt, um auf Raub auszugehen.
Dabei verzehrt es alle Tiere, die es zu überwältigen vermag. Außer
Fröschen sind Mäuse, Wachteln, Rebhühner, Hühner, Enten und Fische
seine bevorzugte Nahrung. Er ist sehr gewandt, versteht meisterhaft
zu schleichen und unfehlbare Sprünge auszuführen, klettert gut,
besteigt aber selten Bäume. Nach Art der Stinktiere verteidigt er
sich im Notfalle durch Ausspritzen einer sehr stinkenden Flüssigkeit
und schreckt dadurch oft die ihn verfolgenden Hunde zurück. Seine
Lebenszähigkeit ist unglaublich groß. Nach zweimonatlicher Tragzeit
wirft das Weibchen im April oder Mai in einer Höhle oder noch lieber
in einem Holzhaufen 4–5, zuweilen auch 6 Junge, die es sorgfältig
großzieht, so daß es dieselben schon nach sechs Wochen auf seine
Raubzüge mitnehmen kann. Junge Iltisse lassen sich leicht durch
Katzenmütter großziehen und zähmen; doch erlebt man an ihnen wenig
Freude, da der angeborene Blutdurst mit der Zeit durchbricht. Sie
lassen sich ohne Mühe zum Kaninchenfang abrichten. Wir sahen ja am
Schlusse des 13. Abschnittes, daß durch jahrhundertelange Domestikation
in Verbindung mit Albinismus aus dem Iltis das Frett hervorging, das
als Mäusefänger bei den Griechen und Römern eine nicht unwichtige Rolle
spielte, bevor die Katze von Ägypten her zu ihnen gelangte. Der Iltis
wird besonders seines dichten Felles wegen gejagt, das aber wegen des
ihm anhaftenden unangenehmen Geruches weniger geschätzt ist als es
ohnedies der Fall wäre.
Dem Iltis ungemein nahestehend ist der Nörz (Mustela
lutreola), ein halber Wassermarder, der vortrefflich schwimmt und
taucht und die Fische bis in ihre Verstecke verfolgt, selbst flinke
Forellen und Lachse erbeutet. Im Moore verfolgt er Wasserratten und
allerlei Wasser- und Sumpfvögel mit Einschluß von Enten. Er hält sich
gewöhnlich an den Ufern von Flüssen und Seen auf und kommt fast nur
noch in Rußland vor. In Nordamerika vertritt ihn der ganz ähnlich
lebende, fast ebenso gefärbte Mink (Mustela vison),
dessen Pelz noch weicher und wolliger ist. Beide graben sich unter
überhängenden Flußufern ein Loch oder beziehen in einem hohlen Baum ein
Lager, das sie mit Federn auspolstern und in das das Weibchen[S. 680] im April
4–6 Junge wirft, die bis zum nächsten Herbste bei der Mutter bleiben.
Jung eingefangen lassen sie sich leicht zähmen und in ähnlicher Weise
wie das Frettchen verwenden. Wegen des Gestankes war sein Pelz früher
so wenig geschätzt, daß es Fang und Förderung kaum lohnte. Neuerdings
legt man ihm einen größeren Wert bei, weshalb die Tiere viel gefangen
werden und dadurch stellenweise stark vermindert worden sind. Ums Jahr
1865, in welchem ein gutes Minkfell in Amerika 5 Dollar kostete, wurden
von Neuschottland allein über 6000 Minkfelle jährlich ausgeführt. In
den letzten Jahrzehnten wurden in Europa durchschnittlich 55000 Nörze
erbeutet, während die Anzahl der in dieser Zeit jährlich gefangenen
Minke 160000 erreichte und im Jahre 1888 sogar 370000 betrug. In jenem
Jahre kostete ein russisches Nörzfell etwa 4 Mark, ein Minkfell dagegen
bis 10 Mark. Die besten Minkfelle kommen von Alaska und Neuengland.
Vortreffliche Pelze liefern auch die anderen Marderarten, unter denen
der berühmte Zobel (Mustela zibellina), den weitaus
kostbarsten liefert. Er ist dem Baummarder sehr nahe verwandt, hat nur
einen viel ausgesprochener kegelförmigen Kopf, große Ohren, längere und
stämmigere Beine und ein langhaarigeres, seidenweiches, gelbbraunes
bis schwarzes Fell. Letzteres gilt für um so schöner, je größer seine
Dichtigkeit, Weichheit und Gleichfarbigkeit ist. Die dunkleren Felle
stehen im Preise weit höher als die helleren und können fast schwarze
von reiner Farbe bis 2500 Mark das Stück erzielen, während helle von
geringster Qualität schon für 50 Mark das Stück zu haben sind. Diese
ganz dunkeln stammen von Tieren, die in den dichtesten Urwäldern
leben, in die kein Sonnenstrahl einzudringen vermag. Das Wohngebiet
des Zobels erstreckte sich einst vom Uralgebirge im Westen bis zum
Beringsmeer im Osten und vom 68. Grad nördlicher Breite bis zu den
südlichen Grenzgebirgen Sibiriens. Aber infolge der langjährigen
unablässigen Verfolgung ist er aus vielen Gegenden verschwunden
und ist nur noch in den abgelegensten Gebirgswäldern Ostsibiriens
und Kamtschatkas einigermaßen häufig. Dieser menschenscheue Marder
liebt die einsamen Wälder, in denen er, seinem Lieblingswilde, dem
Eichhörnchen, nachziehend, größere Wanderungen unternimmt und bei
deren Verfolgung ungescheut auch breite Ströme, selbst während des
Eisgangs, durchschwimmt. Sehr beliebte Aufenthaltsorte sind für ihn
die ausgedehnten Arvenwaldungen, deren riesige Stämme ihm ebensowohl
passende Schlupfwinkel wie in den ölreichen Samen ihrer[S. 681] Zapfen eine
erwünschte Speise darbieten. Auch er ist ein Nachttier, das bei Tage
in Baumlöchern oder unter Baumwurzeln schläft und erst nachts auf
Raub ausgeht. In Baumlöchern wirft er einmal im Jahr, und zwar meist
im April, seine 4–5 Jungen, die er wohl behütet und später zur Jagd
erzieht.
Die Zobeljagd beschränkt sich auf die drei Monate Oktober, November
und Dezember. Da die Jagdgründe in der Regel sehr weit abgelegen
sind, brechen die Zobeljäger mit eigens abgerichteten Hunden schon im
September auf, um beim ersten Schneefall an Ort und Stelle zu sein.
Die Hunde müssen während der Reise zugleich die Schlitten ziehen,
welche mit Lebensmitteln für mehrere Monate beladen sind. Auf den
Jagdplätzen vereinigen sie sich zu kleinen Gesellschaften, die sich
Hütten bauen und nach allen Richtungen ihre Streifzüge unternehmen.
Man stellt Fallen und Schlingen der verschiedensten Art und verfolgt
mit den Hunden die Spur eines Zobels auf Schneeschuhen. Sobald ein
solcher aufgespürt ist, sucht man ihn auf einen Baum zu treiben, den
man alsbald mit Netzen umgibt, auf die er durch Schütteln der Zweige
oder mit Stangen hinuntergeschlagen wird. Fällt der Zobel vorbei, so
wird er entweder von den Hunden eingeholt und zu Tod gebissen, oder
auf einen andern Baum getrieben, wo man ihn wiederum, wenn möglich
ohne Schuß, der sein kostbares Fell verderben könnte, zu erlangen
sucht. Ist ein Zobel erbeutet, so wird er in ein Tuch gewickelt
und mit einem Stück Holz so lange geklopft, bis das Innere zu Brei
zerschlagen ist und durch kleine Löcher um den After und die Augen
herausgenommen werden kann. Dann wird das Fell umgedreht und weiter
präpariert. Auf diese Weise wird es ermöglicht, das ganze Fell völlig
unverletzt in den Handel zu bringen. Jedenfalls ist der Zobelfang
eine ununterbrochene Reihe von Mühseligkeiten aller Art, und wenn ein
Jäger zwanzig Zobelfälle auf einer Expedition erbeutet, so schätzt er
sich glücklich. Für ein einzelnes Zobelfell erhält der Jäger Waren
im Werte von 16 Rubeln (= 52 Mark). In St. Petersburg gilt es dann
ein Mehrfaches davon. Völlig wertlos sind die Bälge der im Frühjahr
erbeuteten Zobel, auch wenn sie noch ihre Winterhaare haben, denn
dieses fällt selbst dann noch aus, wenn die Haut schon hergerichtet
ist. Natürlich wird von dem kostbaren Pelz jedes Fleckchen verwertet;
so werden beispielsweise die helleren und dunkleren Partien der Kehle
zu farbenprächtigen Pelzstücken zusammengefügt, die als Mantelfutter
sehr beliebt sind. Infolge des Immerseltenerwerdens des Zobels machen
sich die Zobel[S. 682]jagden je länger um so schlechter bezahlt, so daß die
russischen Pelzhändler in diesem Jahre beschlossen, den Präsidenten
des Ministerrats telegraphisch um ein Verbot des Zobelfangs während
zweier Jahre zu bitten. Nur hierdurch könne der Ausrottung des Zobels
vorgebeugt werden.
Unter unseren einheimischen Säugetieren liefert der Baum- oder
Edelmarder (Mustela martes) das weitaus kostbarste
Pelzwerk, das in seiner Beschaffenheit am meisten demjenigen des Zobels
ähnelt. Die schönsten und größten liefert Skandinavien. Diese sind noch
einmal so dicht und so lang als diejenigen unserer deutschen Edelmarder
und in der Farbe grauer. Unter den deutschen finden sich mehr
gelbbraune als dunkelbraune, welch letztere mehr in Tirol vorkommen
und dem amerikanischen Zobel oft täuschend ähneln. Die südlicher
vorkommenden Edelmarderarten sind heller, blaßgraubraun oder gelbbraun.
Der Edelmarder lebt von menschlichen Wohnungen weit entfernt in Wäldern
und findet sich um so häufiger, je einsamer, dichter und finsterer sie
sind. Er ist ein echtes Baumtier und ein unübertroffener Kletterer,
bereitet sich in hohlen Bäumen, Felsspalten, verlassenen Nestern von
Wildtauben, Raubvögeln und Eichhörnchen ein weiches Lager aus Moos, das
er — denn er besitzt gleichzeitig mehrere Wohnungen — nach Störungen
mit einem andern vertauscht. Wo er sich sicher fühlt, geht er schon in
den frühen Abendstunden, sonst erst mit Beginn der Nacht auf Raub aus.
Vom Rehkälbchen und Hasen bis hinab zur Maus ist kein Säugetier vor
ihm sicher, ebenso Wald- und Feldhühner. Geräuschlos schleicht er zu
ihrem Lager, mag dieses auf einem Baume oder am Boden sein, überfällt
sie plötzlich und würgt sie ab, gierig sich am Blute der zerbissenen
Halsschlagader labend. Außerdem plündert er alle Vogelnester aus,
raubt den Bienen den Honig und sucht sich an Früchten und Beeren der
verschiedensten Art zu laben. Wenn ihm Nahrung im Walde zu mangeln
beginnt, wird er dreister und schleicht sich an die menschlichen
Wohnungen heran, um den Hühnerställen und den Taubenschlägen einen
Besuch abzustatten und darin große Verwüstung unter den Insassen
anzurichten. Er würgt nämlich, von Blutgier berauscht, auch dann
noch, wenn sein Hunger gestillt ist. Im Januar oder Februar findet
die Paarung statt und im April oder Mai wirft das Weibchen in sein
Mooslager 3–5 Junge, die 14 Tage lang blind sind, im Alter von 6–8
Wochen jedoch schon selbständig auf den Bäumen herumspringen und von
den Alten sorgsam zur Jagd angeleitet werden. Solche Junge lassen sich
wie junge Zobel leicht[S. 683] zähmen, während alt eingefangene Individuen
ihre Wildheit niemals verlieren. Überall wird der Edelmarder auf das
eifrigste verfolgt, weniger um seinem Würgen zu steuern, als vielmehr
um sich seines wertvollen Felles zu bemächtigen. Man fängt ihn in
Tellereisen und Kastenfallen mit einem Stückchen in ungesalzener Butter
mit etwas Zwiebel und Honig gebratenem Brot, das man mit Kampfer
bestreut. Am leichtesten erwischt man ihn, wenn man ihn mit einem
scharfen Hunde bei Neuschnee bis zu seinem Lager verfolgt und ihn dort
schießt oder vom Hunde, gegen den er wütend springt, abwürgen läßt.
Etwas kleiner als der Edelmarder und mit einem weit weniger
wertvollen helleren, kürzeren Pelze versehen ist der Stein-
oder Hausmarder (Mustela foina), so genannt von seiner
Vorliebe für Felsen, Steinhaufen und menschliche Wohnungen, in denen
er Mäuse, Ratten, Hühner, Tauben und anderes Geflügel zu erbeuten
hofft. Sein Verbreitungsgebiet erstreckt sich weiter südlich und
weniger nach Norden als dasjenige des vorigen. In Deutschland ist er
häufiger als der Edelmarder, den er an Kühnheit übertrifft und dessen
Lebensweise sich fast ganz mit der seinigen deckt. Er ist schon aus
dem Grunde weit schädlicher als jener, weil er weit öfter Gelegenheit
findet, dem Menschen Verluste an seinem Hausgeflügel beizubringen und
sein Spalierobst zu brandschatzen. Wie seine Verwandten ist auch er im
Vergleich zu seiner Größe ein außerordentlich blutdürstiges Tier, das
oft mehr Beute tötet als es fressen kann. Während der Paarungszeit,
die Ende Februar, ungefähr drei Wochen später als diejenige des
Edelmarders, stattfindet, läßt dieser sonst schweigsame Marder
katzenähnliche, schon auf weite Strecken hörbare Rufe vernehmen. In
seinem in einer Baumhöhle, einer Felsenspalte oder an einem anderen
geschützten Ort aus Heu oder Stroh errichteten Nest wirft das Weibchen
4–5 vierzehn Tage lang blinde Junge, die sich leicht zähmen lassen.
Während das Fell des Edelmarders auf 30–100 Mark zu stehen kommt,
kostet das des Steinmarders 20–40 Mark. Auch sein Pelz ist um so
wertvoller, aus um so nördlicherer Gegend er stammt. So werden die
Edel- und Steinmarderfelle Nordeuropas meistens als Zobel verkauft,
obschon sie jenen an Wert weit nachstehen, nicht bloß wegen ihrer Farbe
und der geringen Haarlänge, sondern auch wegen der verhältnismäßig
bedeutenden Länge des von den Grannen kaum verdeckten Wollhaars.
Der nächste mitteleuropäische Verwandte des Iltis ist das
Hermelin oder große Wiesel (Mustela erminea),
das nördlich von den Pyrenäen und dem Balkan in ganz Europa, ebenso
in Mittel- und Nordasien[S. 684] bis zur Ostküste Sibiriens vorkommt. In
Deutschland ist es eines der häufigsten Raubtiere, das tagsüber in
einem Erdloch oder anderen Schlupfwinkel schläft, um gegen Anbruch
der Dämmerung rege zu werden und außer Mäusen, Ratten, Schlangen und
Eidechsen, Kaninchen, Tauben, Hühner, Sperlinge, Schwalben, Lerchen
und dergleichen aus ihren Nestern zu holen. Meist jagt es paarweise,
nicht selten auch zu dreien, zeigt große Behendigkeit, tollkühnen Mut
und eine unbändige Mordlust. Im April oder Mai legt das Weibchen in
ein verstecktes, weich ausgepolstertes Nest 5–6 und mehr Junge, die
es sorgfältig beschützt und großzieht. In allen nördlicheren Gegenden
seines Verbreitungsgebietes wird es im Winter bis auf die auch dann
schwarzbleibende Schwanzspitze weiß, so bei uns in Deutschland,
wie in Skandinavien und dem schottischen Hochland, während es in
Nordengland häufig, aber nicht immer, und in Südengland nur selten
weiß wird. In die Enge getrieben, strömt es einen höchst unangenehmen,
durchdringenden Duft aus, wenn auch weniger stark als der Iltis. Es
wird in Fallen aller Art, auch Rattenfallen, in die es zufällig gerät,
gefangen. Jung aus dem Nest genommene Hermeline werden sehr zahm,
folgen ihrem Herrn wie ein Hund und bereiten ihm viel Vergnügen. Früher
war der Hermelinpelz sehr geschätzt und durfte nur von Fürsten getragen
werden. Heute tragen ihn oder dessen Imitation auch Bürgersleute; doch
ist er gleichwohl im allgemeinen weniger begehrt als einst, da die
Krönungsmäntel der Fürsten aus ihm mit den schwarzen Schwanzspitzen
wie Flämmchen zwischen dem reinen Weiß bestanden. Die aus nördlicheren
Gegenden stammenden Pelze sind gleichfalls besser und deshalb begehrter
als die aus südlicheren, die kürzeres, dünneres und weniger reinweißes
Haar besitzen. Während noch im Jahre 1833 über 100000 Hermelinfelle
nach England kamen, fand man später die Mühe des Sammelns nicht mehr
lohnend genug; doch hob sich in letzter Zeit ihr Import infolge der
gesteigerten Nachfrage in bedeutendem Maße und ist ihr Preis sehr stark
gestiegen.
Weit weniger wertvoll ist der Pelz des kleinsten europäischen Marders,
des Wiesels (Mustela vulgaris). Es ist im Norden der
ganzen Welt verbreitet und findet sich in geeigneten Gegenden fast
überall, indem es in Baumhöhlen, Steinhaufen, altem Gemäuer, unter
hohlen Ufern, in Maulwurfsgängen, Hamster- und Rattenlöchern, im Winter
in Scheunen, Kellern und Ställen, unter Dachböden usw. Schlupfwinkel
vor seinen größeren Feinden sucht. Von dort aus unter[S. 685]nimmt dieses
kühne und neugierige Tier, wo es ungestört ist selbst bei Tage, wo es
aber verfolgt wird bloß bei Nacht oder wenigstens tagsüber nur mit
größter Vorsicht, seine Raubzüge, bei denen es alle kleinen Tiere, die
es zu überwältigen vermag, abwürgt und frißt. Als geselliglebendes Tier
jagt es oft auch gemeinschaftlich, wobei es von den größeren Tieren,
die es mordet, nur das Blut leckt. Meist in einer Erdhöhle oder in
einem hohlen Baum wirft das Weibchen nach fünfwöchiger Tragzeit 2–3mal
im Jahr 5–8 Junge, die es lange säugt und dann noch mehrere Monate mit
Mäusen ernährt, die es ihnen lebendig zuträgt. Bei Gefahr verteidigt
es dieselben mit größtem Mute und trägt sie bei Beunruhigung im Maul
an einen andern Ort. Von Kindheit auf an den Menschen gewöhnt, werden
die Wiesel ungemein zahm und können 4–6 Jahre in der Gefangenschaft
aushalten. In der Freiheit dürften sie ein Alter von 8–10 Jahren
erreichen und machen sich durch die Mäusejagd, zu der sie sich
vortrefflich eignen, ungemein nützlich, so daß sie so viel als möglich
geschont werden sollten, um so mehr ihr winziges Pelzchen nur geringen
Wert hat.
Sehr wertvoll ist der Pelz des früher besprochenen Fischotters
(Lutra vulgaris), der 30–50 Mark wert ist und zu Mützen,
Kragen und Verbrämungen verwendet wird. Noch beliebter ist er bei den
Mongolen, die viel höhere Preise als die Europäer für ihn bezahlen. Am
wertvollsten ist aber derjenige des nordamerikanischen Fischotters,
der einen Wert bis zu 200 Mark erreicht. Ein Riese von über 1 m
Körperlänge und einem Schwanz von 60 cm ist der brasilische
Fischotter (Lutra brasiliensis), der ungleich andern
Ottern ein ausgesprochenes Tagtier ist. Auch sein Fell steht hoch
im Preise. Unvergleichlich kostbarer als dieses ist aber das des
Seeotters (Enhydris lutra), der eine Gesamtlänge von
1,5 m bei einer Schwanzlänge von 30 cm und ein Gewicht
von 40–50 kg erreicht. Der lange, walzenförmige Körper trägt
vorn kurze und hinten längere Füße mit Schwimmhäuten. Das auffallend
lose Fell besteht der Hauptsache nach aus dem weichen Wollhaar von
dunkelbrauner Farbe, zwischen dem sich die langen, steifen, an der
Spitze weißen Grannenhaare nur in geringer Anzahl finden. Sie verleihen
aber dem Pelz das prachtvolle, silberschimmernde Aussehen und den
herrlichen Glanz. Je gleichmäßiger und dichter die Silberspitzen in
dem Pelz verteilt sind, um so kostbarer ist er; davon gibt es einzelne
Stücke, die bis 8000 Mark wert sind. Ein gutes Fell bringt schon dem
kamtschadalischen Jäger[S. 686] 100 Rubel ein und kostet durchschnittlich
1200–1600 Mark, in tadellosen Stücken in Europa sogar 4000–6000 Mark.
Im Frühjahr, vom März bis Mai, ist der Pelz am besten. Daher wird die
Jagd auf den Seeotter zu dieser Jahreszeit am eifrigsten betrieben. Und
zwar wird dieses Tier entweder in seinem Lager beschlichen und getötet
oder vom Boot aus, nachdem man sich leise an dasselbe herangerudert
hat, erschlagen, auch durch Schüsse in den Kopf erbeutet. Zu Ende des
Winters wird es auf dem Eise auf Schneeschuhen eingeholt und mit einem
Stocke totgeschlagen.
Der Seeotter ist ein äußerst scharfsichtiges, kluges und behendes Tier,
das sich mit vollendeter Meisterschaft im Wasser bewegt und auch am
Lande sehr flink ist. Seine Heimat sind die Gestade des nördlichen
Stillen Ozeans. Längs der amerikanischen Küste geht er aber weiter nach
Süden als längs der asiatischen, wird aber auch hier dank der eifrig
auf ihn betriebenen Jagd immer seltener. Er ernährt sich der Hauptsache
nach von Schaltieren und Seeigeln, daneben von Krabben, weniger von
Fischen. Das, wie es scheint, zu verschiedenen Jahreszeiten geborene
einzige Junge ist erst im vierten oder fünften Jahre ausgewachsen;
es läßt sich in der Gefangenschaft nicht aufziehen, da es darin
ausnahmslos eines freiwilligen Hungertodes stirbt. Vielleicht weil es
da in größerer Menge sein Lieblingsfutter findet, zieht es gewisse
Örtlichkeiten anderen vor. So werden mehr als zwei Drittel der an den
Küsten von Alaska erbeuteten Seeotter in der Umgebung der Insel Saanach
und Chernobours erbeutet. Früher waren sie bei den ostwärts von den
Alëuten im Beeringmeer gelegenen Prybiloffinseln so häufig, daß in der
ersten Jagdperiode nach der Entdeckung dieser Inseln dort über 5000
Stück erbeutet wurden. Sechs Jahre später war der Seeotter bei den
Prybiloffinseln vollständig verschwunden, und auch an fast allen andern
Stellen seines Verbreitungsgebietes ist er so selten geworden, daß
er, wenn er nicht aussterben soll, schleunigen Schutzes bedarf. Heute
werden jährlich höchstens 500 Seeotterfelle auf den Markt gebracht und
meist Kragen daraus geschnitten. In China sind solche Seeotterpelze
besonders beliebt und reiche Würdenträger lassen sich ganze Mäntel
daraus verfertigen, die selbst dort mit 15000–20000 Mark bezahlt werden
müssen.
Ungefähr dieselben Breiten wie der Seeotter bewohnt die nordische
Bärenrobbe (Otaria ursina), eine in den männlichen
Exemplaren bis 2,4 m lange und 400 kg schwere Pelzrobbe
mit einem Gürtelumfang von 1,8–2,1 m. Während diese ihre
volle Größe etwa[S. 687] im sechsten Jahre erreichen, tun dies die viel
kleineren Weibchen schon im fünften Jahre. Sie werden nur 1,2 m
lang, 40–50 kg schwer und erhalten einen Gürtelumfang von 76
cm. In der Jugend sind sie glänzend schwarz, später die Männchen
an den oberen Teilen mit Ausnahme der Schultern beinahe schwarz mit
einer mehr oder weniger starken, bald mehr grauen, bald mehr rötlichen
Bereifung, auf den Schultern grau, am Gesicht bräunlich, an der Brust
bräunlich orangefarben und an Bauch und Beinen rötlichbraun. Die
Weibchen dagegen tragen ein viel helleres Gewand, das oben ziemlich
einförmig grau, unten dagegen bräunlich oder roströtlich ist. Die
Bärenrobbe kam früher an der amerikanischen Seite des Stillen Ozeans
südwärts bis nach Kalifornien vor, an der asiatischen bis zum Südende
der Insel Sachalin. Heute besucht sie zur Fortpflanzung vor allem die
beiden Inseln St. Paul und St. Georg der Prybiloffgruppe. Das Klima
dieser hochnordischen Inseln ist sehr unwirtlich; selbst im kurzen
Sommer bedeckt fast immer Nebel das Land, der Regen setzt fast keinen
Tag aus und im Winter liegt alles unter Eis und Schnee begraben.
Auf diesen vollständig öden und vom Menschen nicht bewohnten Inseln
erscheinen im Mai nach der Schneeschmelze zuerst die erwachsenen
Männchen der sonst im offenen Meer von Fischen lebenden Bärenrobbe.
Sie sind sehr scheu und halten sich zunächst immer dicht am Ufer auf,
später suchen sie sich mehr landeinwärts Standplätze auf, an denen im
Juni noch weitere Männchen zu ihnen stoßen, mit denen sie oft grimmige
Kämpfe ausfechten, um ihren jeweiligen Standort zu behaupten. Von den
fortwährenden Kämpfen mit den Nebenbuhlern erschöpft und verdrängt
müssen viele der ersten Ankömmlinge sich weiter landeinwärts einen
neuen Standplatz suchen; manche derselben gehen an den mit den scharfen
Eckzähnen erzeugten schweren Wunden zugrunde. Ein laut dröhnendes
Gebrüll, das selbst das Donnern der Brandung übertönt, wird von den
im ununterbrochenen Kampfe befindlichen Männchen ausgestoßen. Zu den
Kämpfen um den Platz treten nach Ankunft der Weibchen Mitte Juni die
um deren Besitz, die mit voller Wut während der ganzen Paarungszeit
fortgesetzt werden. Kein Wunder, daß die Männchen Mitte Juli, wenn die
letzten Weibchen ankommen, schon völlig erschöpft sind. Schließlich
haben aber die meisten Weibchen bekommen, deren Zahl je nach der
Stärke der Männchen und der Lage der von ihnen eingenommenen Plätze
verschieden ist. Bei einem durch die günstige Lage seines nur mit
einem Zugangsloch versehenen Platzes begünstigten alten Männchen[S. 688] hat
man über 45 Weibchen beobachtet; die in der Nachbarschaft des Ufers
festgesetzten Männchen haben durchschnittlich 12–15, die weiter ins
Land zurückgedrängten nur 5–9 Weibchen und manche der am weitesten
landeinwärts verdrängten Männchen erlangen überhaupt keine. Indessen
können etliche von den bis fast an den Schluß der Paarungszeit
unbeweibten Männchen die Stelle der inzwischen infolge Erschöpfung
abgezogenen Nebenbuhler einnehmen. Während der ganzen Paarungszeit, die
bis in den August hinein andauert, können die ihren Platz zu behaupten
wünschenden Männchen denselben auch nicht einen Augenblick verlassen
und fasten wenigstens drei, manchmal auch vier Monate hindurch. Dabei
leben sie von dem vorher reichlich angesammelten Speck.
Die Weibchen der Bärenrobbe sind sehr sanftmütige Geschöpfe, die
niemals einen Streit miteinander haben und selten einen Schrei
ausstoßen, auch wenn sie von den Männchen roh behandelt oder gar mit
den Hauern schwer verwundet werden. Nur wenn sie ihr Junges geworfen
haben, blöken sie, um es an sich zu locken. Gleich bei ihrer Ankunft
werden sie von den dem Ufer nächsten Männchen mit aller Aufmerksamkeit
empfangen, wechseln aber in der Folge oft ihren Besitzer, indem sie
immer weiter nach dem Innern drängen, wo sie unter sorgfältiger
Vermeidung von Plätzen mit Wassertümpeln Herden bilden. Hier werfen
sie bald nach ihrer Ankunft je ein Junges, das sie immer wieder nach
ihren Exkursionen zum Fressen ins Meer aufsuchen, um es zu stillen. Mit
dem Größerwerden desselben bleibt die inzwischen aufs neue befruchtete
Mutter immer länger aus. Anfangs August versuchen sich die dem Ufer
nächsten Jungen im Schwimmen. Wenn auch die ersten Schwimmübungen sehr
unbeholfen ausfallen und bald eingestellt werden, so bilden sie sich
bald zu geschickten Schwimmern aus, die von Ende September in größeren
Gesellschaften das Meer nach Beute durchsuchen. Ende Oktober verlassen
sie mit den Müttern und älteren Geschwistern die Inseln, um sich mit
Eintritt des Winters nach dem wärmeren Süden zu begeben.
Tafel 67.

(Copyright M.
Koch, Berlin.)
Biber.

(Copyright M.
Koch, Berlin.)
Von Bibern errichteter Damm.
Tafel 68.

(Copyright Underwood
& Underwood.)
Junge Ohrenrobben am Strand der Insel Santa Catalina in Kalifornien.
⇒
GRÖSSERES BILD
Auf den Prybiloffinseln dürfen nur die unbeweibten ein- bis
sechsjährigen Männchen getötet werden, und auch diese nur in bestimmter
Zahl, um der Ausrottung der Tiere vorzubeugen. Die Regierung der
Vereinigten Staaten hat das alleinige Recht zum Robbenschlag auf den
Prybiloffinseln im Jahre 1869 an eine Handelsgesellschaft verpachtet
und ihr erlaubt, auf St. Georg jährlich 25000 und auf St. Paul 75000,
also zusammen 100000 junge Männchen zu töten.[S. 689] Durch die Ausbeutung
dieses Rechtes hat die Gesellschaft von 1869 bis 1889 über 33 Millionen
Dollar eingenommen, und zwar unter Aufwendung einer geringen Arbeit,
indem sich die ein- bis sechsjährigen männlichen Bärenrobben für sich
halten und von den Angestellten der Gesellschaft leicht vom Meere
abgedrängt werden können. Die auf dem Lande unbeholfenen, vor Angst
brüllenden Tiere werden nun langsam dem Innern zugetrieben, wobei sie
in einer halben Stunde beinahe einen Kilometer zurücklegen. Dann müssen
sie eine Zeitlang ruhen und sich erholen, bis sie weitergetrieben
werden können. Unterwegs werden alle wegen Beschädigung des Felles
unbrauchbaren Tiere und die etwa mitgefangenen Weibchen ausgesondert
und ihnen die Rückkehr zum Meere gestattet. Der anderen harrt, an den
Schlachtplätzen in der Nähe der Salzhäuser angelangt, ein schreckliches
Schicksal. Nachdem sie eingehürdet, sich gekühlt und ausgeruht haben,
werden sie in Scharen von 50–100 Stück durch Hiebe auf den Kopf mit
schweren eichenen Knütteln niedergehauen und von den noch warmen,
zuckenden Leibern die Felle abgestreift und in die Salzhäuser gebracht.
Hier werden sie immer zwei und zwei mit den Haarseiten aufeinander
gelegt und so schichtenweise verpackt, wobei jede Schicht mit einer
Lage Salz bedeckt wird. Nachdem die Felle so 2–3 Wochen gelagert
haben, werden sie paarweise, aber jetzt mit der Haarseite nach außen,
zusammengerollt und, in Fässer verpackt, in die Schiffe verstaut, die
sie nach London, dem Hauptmarkt dieser rohen Felle, führen. Von dort
kommen sie nach Entfernung des groben aschgrauen bis braunschwarzen
Grannenhaars als kostbarer Sealskin in den Handel, um als
Jackett eine Dame oder als Kragen den Mantel eines reichen Herrn zu
zieren. 40–50 Robbenjäger töten und enthäuten an einem Tage bis zu 3000
Stück der wehrlosen Pelzrobben. Während des Sommers 1872 haben 45 Leute
über 72000 Bärenrobben in weniger als vier Wochen zum Schlachtplatz
getrieben, getötet und abgehäutet.
Trotz der Bestimmung, daß in jedem Jahre nur 100000 männliche
Bärenrobben getötet werden dürfen, soll diese Anzahl vielfach
überschritten werden. Die Folge davon ist, daß die Zahl der die
Prybiloffinseln zur Fortpflanzung aufsuchenden Bärenrobben immerfort
abnimmt. Die jungen Männchen und unfruchtbaren Weibchen bleiben auch
den Sommer über auf hoher See, wo ihnen britische Schiffe nachstellen.
Hat eins der wohlausgerüsteten etwa 50 britischen Segelschiffe eine
Bärenrobbe in der Beringsee gesichtet, so werden mit je zwei Matrosen
und einem mit zwei Schrotflinten und einer Kugel[S. 690]büchse ausgerüsteten
Jäger bemannte kleine Boote auf die Pelzrobbenjagd ausgesandt. Ruhig
fährt das Boot an die wahrgenommene Bärenrobbe heran und der Jäger
sucht sie durch einen Schuß in den Kopf zu töten, was allerdings durch
die große Wachsamkeit der Tiere in den allermeisten Fällen vereitelt
wird, indem sie beizeiten die Gefahr merken und untertauchend in
die Tiefe verschwinden. Der Jäger soll nur dann schießen, wenn er
seiner Beute ganz sicher zu sein glaubt. Ist diese getroffen, so
beginnt sie sofort zu sinken, weshalb das Boot sich beeilen muß, an
den Kadaver heranzukommen, ihn zu gaffeln und an Bord zu nehmen. Die
auf die Robbenjagd geschickten kleinen Boote bleiben auf dem Wasser,
solange sie eine Bärenrobbe sehen können, und wenn sie manchmal auch
nur eine oder zwei während eines ganzen Tages erbeuten, so fallen
ihnen gelegentlich auch mehr, bis zwanzig, zum Opfer. Das Fleisch
dieser Tiere wird von den Eingeborenen, aber auch den Europäern, gern
gegessen, da es recht schmackhaft ist.
In derselben Weise wie der Bärenrobbe wird auf den Prybiloffinseln
der im männlichen Geschlecht bis 4 m langen, einen Umfang von
2,5–3 m und ein Gewicht von 500–650 kg erreichenden
Stellerschen Ohrenrobbe (Otaria stelleri), von den
Matrosen wegen ihres grimmigen Gesichtsausdrucks Seelöwe
genannt, nachgestellt. Diese größte aller Pelzrobben, die in der Jugend
lebhaft kastanienbraun, erwachsen dagegen in beiden Geschlechtern
hellrötlichbraun ist, wurde im Jahre 1741 während Berings erster
Forschungsfahrt in diesem Weltteil entdeckt und von dem Bering
begleitenden Naturforscher Steller, nach welchem das Tier später
benannt wurde, beschrieben. Da diese Robbe ihren schweren Körper
über Land nur sehr mühsam fortbewegt, begibt sie sich während der
Fortpflanzungszeit nicht so weit ins Land hinein wie die Bärenrobbe,
nämlich nicht sehr weit über den Bereich der höchsten Flut hinaus.
Während der Paarungszeit im Frühsommer besucht sie dieselben
Küstenstrecken wie die Bärenrobbe, die sie durch ihre bedeutendere
Stärke verdrängt, ohne daß sie sich ihrem gewaltigen Gattungsgenossen
gegenüber zur Wehr setzte. Doch scheint es die männliche Ohrenrobbe bei
der Bildung und Beschützung ihres Harems weniger genau zu nehmen als
die männliche Bärenrobbe. Die Ohrenrobbe ist äußerst scheu und wachsam
und läßt keinen Menschen nahe herankommen, ohne daß sie sich plötzlich
Hals über Kopf ins Meer stürzte. Hierbei werden die Weibchen von den
Männchen begleitet, die die Jungen bewachen, sie im Wasser schwimmend
umkreisen und sie[S. 691] so lange zusammenhalten, bis eine neue Landung
gefahrlos erscheint. Bei den Jungen bleiben auch die mit ihnen und den
Männchen ins Wasser geflohenen Weibchen, tauchen und schwimmen hierhin
und dorthin, beim jedesmaligen Auftauchen den Störenfried mit einem
heisern Grollen bedrohend.
Auf ihren Paarungsplätzen erscheinen die männlichen Ohrenrobben im
Mai. Ihnen folgen 3–4 Wochen später die Weibchen, die ihre Jungen
einen Monat früher als die Bärenrobben werfen. Auch bei ihnen nehmen
die stärksten Männchen die meisten Weibchen in Beschlag, um bis Ende
September mit ihnen zusammenzubleiben. Gewöhnlich versammelt jedes
genügend starke Männchen 10–15 Weibchen um sich, um sie bald nach dem
Werfen der Jungen zu befruchten. Auch nach der Paarungszeit halten
sich die Ohrenrobben den ganzen Winter hindurch nahe der Küste. Doch
sind sie nicht mehr zahlreich auf den Prybiloffinseln. Man schätzt
die Anzahl der die Insel St. Paul besuchenden Ohrenrobben auf etwa
25000, während 7000–8000 auf die zweite Hauptinsel der Prybiloffgruppe,
St. Georg, kommen sollen. Ein Beobachter meint, daß übrigens nur
15000–20000 Ohrenrobben im Jahre die Prybiloffinseln besuchen. Auf
der Insel St. Paul werden die zum Abschlachten bestimmten Ohrenrobben
langsam der Küste entlang getrieben, wobei sie fortwährend tiefe
Klagetöne ausstoßen. Um die Tiere aufzuscheuchen, genügt es, in ihrer
Nähe plötzlich einen Regenschirm auszuspannen. Dies wird alle paar
Minuten wiederholt, bis die ganze Herde munter geworden ist und sich
unter viel Gebrüll und Gekläff in Bewegung setzt. Durch Rufe und
Flaggenschwenken am Ende und an den Rändern der Herde werden die Tiere,
die jetzt so gut wie möglich vorwärtshumpeln, so lange in Bewegung
gehalten, bis sie neuer Ruhe bedürfen. Endlich am Schlachtplatz
angelangt, werden die zum Erschlagen durch Keulen viel zu gewaltigen
ausgewachsenen Männchen mit Büchsen totgeschossen und ihr Fell
abgezogen. Die Weibchen und jungen Männchen dagegen, die die besten
Pelze liefern, werden erstochen. Mit einem scharfen Messer wird das
Unterhautzellgewebe der abgezogenen Häute und zugleich damit die tiefer
als die Wollhaare wurzelnden Grannenhaare durch Entwurzelung aus dem
Pelze entfernt. Im übrigen ist die Behandlung der Felle dieselbe wie
bei den Bärenrobben.
Von ihnen wie von den weiter südlich lebenden Ohrenrobben wird auch
das Fett gesammelt und eingekocht, das schwach behaarte Fell der
letzteren zur Herstellung eines starken Leders erbeutet. Vor etwa[S. 692]
100 Jahren war die Zahl der Ohrenrobben vieler Gegenden ungeheuer
groß. An der chilenischen Küste, die seitdem nahezu eine Million
Felle lieferte, sollen damals 500000–700000 dieser Tiere gelebt
haben. In Südgeorgien wurden im Jahre 1800 nicht weniger als 112000
Bärenrobben erbeutet, wovon auf ein einziges amerikanisches Schiff
rund 50000 kamen. Damals wurde auch die Entdeckung von Bärenrobben an
der australischen Küste bekannt, von wo im Jahre 1804 ein einziges
Schiff 74000 Häute ausführte. Auch an den südostwärts vom Kap der
Guten Hoffnung gelegenen Prinz Edward-Inseln wurden große Scharen von
Ohrenrobben erbeutet, und zwischen 1820 und 1821 wurden über 300000
Häute von den Südshettlandinseln ausgeführt, wo 1821 über 100000 junge
Ohrenrobben, ihrer Mütter beraubt, zugrunde gingen. Von der in der
Nähe der Küste von Neusüdwales gelegenen Antipodeninsel wurden 1814
und 1815 über 400000 Felle großer Pelzrobben ausgeführt, wovon der
vierte Teil bei der Ankunft in Europa wegen ungenügender Zubereitung
als Dünger verkauft oder fortgeworfen werden mußte. Kein Wunder, daß
die Anzahl der Pelzrobben der südlichen Meere schon im Jahre 1813 so
gering geworden war, daß die auf ihren Fang ausgehenden Schiffe statt
Gewinn meistens Verlust hatten, und daß eine den Pelzrobben geltende
Schiffsreise ein großes Risiko in sich faßte, ob sie sich überhaupt
bezahlt macht. So unvernünftig hat das grimmigste Raubtier, der Mensch,
mit den ihm unerschöpflich scheinenden Naturschätzen gewütet, die ihm
bei einigermaßen vernünftiger Ausbeutung viele Jahrhunderte hindurch
Reichtümer ohne Zahl gewährt hätten. Die einst immensen Herden von
Pelz- und Haarrobben sind heute so sehr zusammengeschmolzen, daß
jährlich insgesamt nur noch etwa 185000 Pelz- und 875000 Haarrobben
erbeutet werden. Wenn nicht ganz energische Schonungsmaßregeln von
seiten der betroffenen Nationen ergriffen werden, wird das völlige
Aussterben der großen Ohrenrobben wie so mancher anderer Wunder der
Schöpfung — es sei hier nur an die gewaltige Stellersche Seekuh
erinnert — nur eine Frage der Zeit sein.
Ein anderes Wassertier, dessen Pelz sehr geschätzt wird, ist der
ebenfalls auf den Aussterbeetat gesetzte Biber, von dem in
einem früheren Abschnitte eingehend die Rede war. Für den Handel ist
nur noch mit dem Biber in Nordamerika, speziell Kanada, zu rechnen.
Von dort kommen ungefähr noch 50000 Felle jährlich in den Handel. Die
Farbe des Bibers, die gewöhnlich auf der Oberseite dunkelbraungrau, auf
der Unterseite dagegen heller ist, variiert ganz bedeutend. Es gibt[S. 693]
von ihm ganz helle und ganz dunkle Exemplare; die Pelze der letzteren
sind die wertvollsten. Bei deren Zubereitung wird das grobe, braune
Grannenhaar entweder stehen gelassen oder entfernt, so daß nur das
weiche, dichte, graublaue Wollhaar zurückbleibt, das ein sehr feines,
überaus geschätztes Pelzwerk liefert.
Eines der wichtigsten Pelztiere ist der Fuchs, dessen
Lebensweise ebenfalls bereits besprochen wurde. Der bei uns heimische
Rotfuchs mit rötlichgelbem, auf dem Rücken braunrotem Pelze hat an
seiner dichten, buschigen Lunte meistens eine weiße Spitze. Je nach
ihrer Farbe und Dichtigkeit steigen die Felle des Fuchses bedeutend
an Wert. Die schönsten für Pelzwerk in Betracht kommenden Rotfüchse
stammen aus Alaska und Kamtschatka; aber auch Sibirien hat sehr
gesuchte Fuchspelze. Im Gouvernement Tobolsk wurden in den letzten
Jahren 50000–75000 junge und nur 5000–10000 ausgewachsene Füchse
jährlich gefangen. In den Gouvernements Jakutsk und Jenissei, wo die
Jungen nicht gefangen werden dürfen, kommen jährlich 15000 bis 25000
Füchse zur Strecke. Zu diesem Rotfuchs tritt in den Polarländern noch
der Weißfuchs. Eine besondere Art desselben mit blaugrauer Farbe ist
der Blaufuchs, der schon sehr hoch im Preise steht. Bei weitem am
kostbarsten sind aber die Silber- oder Schwarzfüchse, die in Sibirien,
auf den Alëuten und im nördlichsten Teile Kanadas leben, aber heute
infolge der unaufhörlichen Verfolgung überall selten geworden sind, so
daß man sie manchenorts in regelrechte Zucht in eingehegten Revieren
genommen hat, um einigermaßen mühelos ihren kostbaren Pelz zu erhalten.
Derselbe hat ganz schwarzes, sehr feines, langes Haar, das stets
nach unten fällt. Trägt dieses Haar weiße Spitzen, so wird der Pelz
Silberfuchs genannt, überwiegt aber das reine Schwarz in der Färbung
und sind nur wenige Stellen mit Silberhaaren bedeckt, dann heißt der
Pelz Schwarzfuchs. Ganz reine Schwarzfüchse ohne jedes Silber sind ganz
außerordentlich selten. Von ihnen werden jährlich noch nicht ein halbes
Dutzend erbeutet, und der Wert eines solchen Felles steigt bis auf
12000 Mark.
In den Provinzen Schensi und Schansi wird das an Gestalt der
Angoraziege ähnliche Tibetschaf in großen Massen nur des Pelzes wegen
gezüchtet. Der deutsche Pelzhandel kennt diese Felle, die sich durch
eine feine, langhaarige, glänzendweiße Wolle auszeichnen, seit kaum
20 Jahren. Heute aber werden jährlich wenigstens 600000 Stück davon
importiert, und zwar meist schon in zugerichtetem Zustande, was die
Chinesen, die überhaupt Meister in der Kürschnerkunst sind, ganz
vortrefflich besorgen.[S. 694] In den weiten Ebenen und Steppen der Bucharei
dagegen lebt in großen Herden bis zu 5000 Stück das auf Seite 127
besprochene Fettschwanzschaf von Arkalabstammung, das die schwarzen,
seidenglänzenden, vielfach gekräuselten und gerollten Pelze gibt,
die unter dem Namen Astrachan, Krimmer oder Persianer in den Handel
gelangen und prächtige Wintermäntel und Jacken liefern. Ihn erzeugen
die ganz jungen Schafe, während die Felle der neugeborenen Lämmer, die
ein eigenartiges, moiréähnliches Muster zeigen, Breitschwanz genannt
werden. Letztere werden an Ort und Stelle schon mit 8 Mark das Stück
bezahlt, während die Felle der älteren Lämmer als Astrachan nur 4 bis 5
Mark kosten. Um die Bildung der feinen Löckchen des Felles zu fördern,
näht man zuweilen die jungen Lämmer während ihres kurzen Lebens in ein
Fell oder ein Stück grobe Leinwand ein. Die Bucharen sind sehr stolz
auf diese ihre Schafe, die so herrliche Felle besitzen und die es noch
nicht gelang anderswo anzusiedeln. Die Felle werden alljährlich von den
Vertretern großer Pelzfirmen an Ort und Stelle eingekauft oder gelangen
auch auf die großen Märkte nach Astrachan. Sie werden darauf in rohem
Zustande in besonderen Fabriken einer ersten Präparierung unterworfen,
die sie für die Reise nach Europa geeignet macht. Hier werden sie
vollends gereinigt und, da das natürliche Schwarz zu stumpf wirkt, noch
künstlich gefärbt, bis sie den sie so beliebt machenden schwarzen Glanz
erlangt haben.
Zu Nachahmungen wertvollerer Pelze dient hauptsächlich der dichte
Winterpelz des Kaninchens. Zu diesem Zwecke wird er gewöhnlich
geschoren, gefärbt und kommt dann als Sealkanin, Nutriakanin,
Chinchillakanin und Zobelkanin in den Handel. Am beliebtesten ist das
Fell des Silberkaninchens, das im Rohzustande herrliche Imitationen
des echten Hermelins liefert. Deshalb wird dieses Tier in sehr großen
Mengen gezüchtet und seine Felle in gewaltiger Zahl namentlich in die
romanischen Länder eingeführt, wo sie meist sehr gut bezahlt werden.
Außer durch Kaninchenfell wird der so beliebte Chinchillapelz vielfach
auch durch das Fell einer australischen Beuteltierart imitiert. Das
Fell des nordischen Eisfuchses wird sehr häufig durch dasjenige des
nordischen Schneehasen nachgeahmt oder aus dem Felle des vorhin
genannten weißen Tibetschafes imitiert, nachdem es durch Aufbügeln
und Auskämmen einem Regenerationsverfahren unterworfen wurde. Auf
eine bestimmte nordische Wolfsart führt meist der vielgerühmte
Kamtschatkafuchs seinen Stammbaum zurück und hinter dem Luchspelz aus
Rußland steckt in der Regel das Fell eines australischen Beutel[S. 695]tieres.
Der russische Edelmarder entpuppt sich dem Kundigen nicht selten
als Fell des nordamerikanischen Opossums, also ebenfalls eines
Beuteltieres. Gleicherweise werden auch die als Kolinski bezeichneten
Felle des tatarischen Marders durch diejenigen von Hauskatzen geschickt
nachgeahmt.
Wie die Säugetiere der nördlichen Breiten mit ihrem dichten Pelz,
müssen die Vögel der sonnenreichen Tropenländer mit ihrem herrlichen
Gefieder dem Menschen dienen. Wie jene hat er deshalb auch diese
mit erbarmungsloser Gier in ungezählten Scharen gemordet, so daß
das Herz jedes Naturfreundes sich in Bitterkeit zusammenkrampft,
wenn man bedenkt, wie scheußlich gegen jene frohe, bunte Schaar im
Laufe der letzten Jahrzehnte dank der infamen, launischen, von den
herz- und gedankenlosen Halbweltdamen in Paris zum größten Teil
diktierten Mode gewütet wurde. Und dank ihrer angeborenen Eitelkeit
macht auch die bessere, anständige Frau jenen frivolen Hetären all
diesen Blödsinn nach. Der beklagenswerten Mode des Tragens von bunten
Vogelfedern oder ganzen Vogelbälgen auf den Damenhüten sind schon viele
Milliarden Vögel in der herrlichsten Zeit ihres Lebens, in der Zeit
der Fortpflanzung, wenn sie ihr schönstes Kleid, das Hochzeitskleid,
anhaben, herzlos in den Tod geschickt und mit ihnen ihre Brut dem
Hungertode und der Vernichtung preisgegeben worden. Wir haben bei
Besprechung der kulturgeschichtlichen Rolle der Straußenfeder gesehen,
daß ihr im 15. Jahrhundert am üppigen, reichen burgundischen Hofe die
zierliche Aigrette als Hutschmuck vorausging. Diese Aigrette wurde
ursprünglich vom Silberreiher (Ardea alba) gewonnen,
der am liebsten in schwer zugänglichen Rohrdickichten an den Ufern
stehender oder langsam fließender Gewässer nistet und einst wie in
ganz Südeuropa, so in den Donautiefländern, von Ungarn an bis in die
Dobrudscha hinein, ein häufiger Brutvogel war. Durch die ihm seiner
prächtigen Schmuckfedern wegen bereiteten Nachstellungen ist er nicht
nur dort, sondern überall auf der Welt, wo er nistet, selbst in den
entlegensten Gegenden, überaus selten geworden. Auch der dieselben
Gegenden bewohnende überaus anmutige Seidenreiher (Ardea
garzetta), der in den Brutkolonien seine Nester fast ausnahmslos
auf den obersten, ziemlich dünnen Seiten- und Gipfelzweigen der
Bäume errichtet, in denen er von Ende Mai an seine 3–4, selten 5
hellbläulichgrünen Eier bebrütet, ist dank den eifrigen Nachstellungen
beinahe ausgerottet, obschon seine Schmuckfedern viel weniger begehrt
sind und dementsprechend niedriger im Preise stehen als diejenigen
des Silber[S. 696]reihers. Die mit sparrigen, kurzen Strahlen versehenen
Schmuckfedern dieser Edelreiher stehen bei dem Männchen den Rücken
entlang und nicht am Hinterkopfe, wie man gewöhnlich glaubt. Ihretwegen
werden sie geschossen. So hat man im Jahre 1898 in Venezuela allein
1538738 dieser Edelreiher zur Gewinnung der Aigretten getötet; zehn
Jahre später konnte man nur noch 259916 derselben erbeuten. Dort und
in Mittelamerika, Afrika und Ostasien, wo er einst in ungezählten
Scharen lebte, ist er so überaus selten geworden, daß man trotz der
hohen Preise die größte Mühe hat, die Nachfrage nach den Aigretten zu
befriedigen.
Eine einzige Sendung eines großen Londoner Hauses umfaßte außer 19000
Aigretten 80000 Seevögel und 800000 Paare von Flügeln verschiedener
Art. Eine andere einer Berliner Firma enthielt 32000 Kolibris. Die
Kolibrifedern dienen nicht nur zur Verzierung von Damenhüten, sondern
auch zum Garnieren von Schuhen, von denen allerdings ein Paar 6000
Mark kostet. So ist es kein Wunder, daß z. B. auf der Insel Trinidad,
wo der Gang der Ausrottung überschaut werden kann, von ursprünglich 18
Kolibriarten nur noch 5 existieren. Von den wundervollen Paradiesvögeln
Neuguineas kamen 1907 19742 Bälge in London auf den Markt. Eine einzige
Sendung einer Londoner Firma zählte 28300 Bälge dieser Art auf und
täglich laufen neue große Sendungen derselben in London ein. Kürzlich
schossen japanische Raubjäger auf einsamen Inseln der Hawai-Gruppe
250000 brütende Albatros, jene herrlichen Flieger des offenen Meeres,
die mitten auf den gewaltigen Wasserwüsten der Ozeane als fast einzige
Vertreter der Vogelwelt anzutreffen sind, um sie über Japan auf den
Londoner Mark zu bringen. In einer einzigen Saison wurden von einer
Pariser Modistin 40000 Seeschwalben verbraucht. Hunderttausende von
nützlichen einheimischen Schwalben und Stieglitzen, wie der schönsten
und seltensten exotischen Vogelarten werden jährlich der Eitelkeit der
europäischen Frau geopfert. Wie die Paradiesvögel stehen vor allem
die herrlichen Glanzstaare, Quesals, Trogone, Sittiche, Kolibris und
zahlreiche andere Schmuckvögel der Tropen auf der Liste der bald der
Ausrottung Verfallenen. So hat man berechnet, daß für die europäische
Damenwelt allein über 300 Millionen Ziervögel jährlich ihr Leben lassen
müssen. Es ist dies, wie Dr. Paul Sarasin in Basel in seinem
Aufruf zur Gründung eines Weltnaturschutzbundes mit Recht sagt: „ein
die Natur beleidigendes Riesenopfer an die Eitelkeit und Herzlosigkeit
der europäischen Frau.“
[S. 697]
Es wäre höchste Zeit, daß die betreffenden Nationen sich in zwölfter
Stunde aufrafften, um diesem sinnlosen Treiben der Ausrottung der
schönsten Geschöpfe unserer Erde ein jähes Ende zu setzen. Haben
wir nicht in den bunten Seidenbändern und den mit großer Naturtreue
erzeugten künstlichen Blumen hübsche Garnituren genug, um auch die
größten Ansprüche der verwöhntesten Dame zu befriedigen?
Außer Pelz und Feder ist auch das Schildpatt und die Haut
mancher Schlangen und Alligatoren ein gesuchter Handelsartikel.
Das Schildpatt oder Schildkrot wird von der eine Gesamtlänge von
nahezu 1 m erlangenden, als gieriger Räuber ausschließlich
von tierischen Stoffen lebenden Karettschildkröte (Chelone
imbricata) gewonnen. Diese lebt nicht nur im Indischen und
Stillen, sondern auch im Atlantischen Ozean, hat zwar ungenießbares
Fleisch, liefert aber durch ihre 3–7 mm dicken, auf braunem
Grunde eine gelbe Zeichnung tragenden, dachziegelartig angeordneten
Rückenplatten, von denen ein ausgewachsenes Tier 2–6 kg besitzt,
ein wichtiges Rohmaterial für allerlei Schmucksachen, wie Kämme,
Dosen und Einlegearbeiten. Dieses Schildpatt wird indessen auch von
mehreren anderen verwandten Schildkröten gewonnen und kommt in bester
Beschaffenheit von Indonesien, in großer Menge aber auch vom Roten
Meer, von Westindien und den Küsten Südamerikas in den Handel. Nur
wenn es stark erwärmt wird, löst es sich leicht vom Rückenpanzer der
betreffenden Schildkröte. So wird dieses bedauernswerte Tier über einem
Feuer aufgehängt und so lange geröstet, bis jene Wirkung erzielt worden
ist. Die Chinesen, die einsahen, daß das Schildkrot durch trockene
Wärme leicht verdorben werden kann, bedienen sich gegenwärtig zu
diesem Zwecke des kochenden Wassers. Nach überstandener Ablösung des
Schildkrots gibt man die Karettschildkröte wieder frei und läßt sie dem
Meere zulaufen, da man glaubt, daß sich das Patt wieder erzeugt.
Das Schildpatt übertrifft nicht nur an Schönheit und Güte jede andere
Hornmasse, sondern läßt sich auch leicht zusammenschweißen. Es
genügt, die einzelnen Tafeln, die ungleich dick und spröde sind, in
siedendheißes Wasser zu tauchen und sie dann zwischen Metallwalzen zu
pressen. Bei hinreichendem Druck haften sie so fest aneinander, daß man
die einzelnen Teile nicht mehr unterscheiden kann, behalten dabei auch,
nachdem sie langsam erhärtet sind, jede ihnen im erweichten Zustande
beigebrachte Form vollkommen bei und eignen sich somit vortrefflich
zur Herstellung von Dosen und Kämmen. Selbst die Abfälle können noch
gut benutzt werden, da man mit ihnen die Vertiefungen zwischen[S. 698] den
einzelnen Tafeln ausfüllt und sie wieder in der Wärme so lange preßt,
bis sie sich mit jenen innig verbunden haben.
Dieses Schildpatt wurde schon im hohen Altertum zur Herstellung von
allerlei kostbaren Schmuckgegenständen verwendet. So sagt Seneca, der
Erzieher Kaiser Neros: „Die Schale der Schildkröte, dieses scheußlichen
und über alle Maßen faulen Tieres, wird mit großer Kunst und Sorgfalt
bearbeitet, durch allerlei Mittelchen bunt gefärbt und zu ungeheueren
Preisen gekauft.“ Und Plinius schreibt in seiner Naturgeschichte:
„Carvilius Pollio, ein verschwenderischer und in Gegenständen des
Luxus erfinderischer Mann, hat zuerst die Schalen der Schildkröten
zerschneiden und mit den Platten Betten und Präsentierteller überziehen
lassen.“ Auch Ovid, Vergil, Martial, Juvenal und Lucanus erwähnen das
Schildpatt, von dem Julius Capitolinus speziell berichtet, daß in Rom
kaiserliche Prinzen in damit ausgelegten Badewannen gebadet wurden.
In der Renaissancezeit wurden damit besonders kunstvolle Einlagen in
wertvolle Möbel erzeugt. Erst in der Neuzeit sind Dosen und Kämme
daraus verfertigt worden. Jetzt wird es sehr viel, wie das teure
Elfenbein, in billigem Celloidin nachgeahmt.
Verwandt mit der Karettschildkröte ist die viel größere
Suppenschildkröte (Chelone viridis), die bei den
Feinschmeckern in hohen Ehren steht. Dieses im Stillen, im Indischen
und im Atlantischen Ozean, selten als Irrgast auch im Mittelmeer
auftretende, 2 m lang und 500 kg schwer werdende Tier
lebt vorwiegend von Pflanzen, namentlich von Seetang, und wird von
Westindien aus lebend auf den europäischen Markt gebracht. Im Meere
schwimmt es mit solcher Kraft, daß es sich ungefährdet in die stärkste
Brandung wagen darf. Nur zum Eierlegen verlassen die weiblichen
Suppenschildkröten das hohe Meer und steuern bestimmten, altgewohnten,
von Menschen nicht bewohnten Plätzen mit sandigem Ufer zu, um dort
nachts ihre Eier lose in den Sand zu vergraben. Dabei lassen sie sich
von den Menschen leicht erbeuten. Doch muß er sich ganz leise an
sie heranschleichen, da das ungemein argwöhnische und trotz seines
stumpfsinnigen Benehmens mit sehr scharfen Sinnen ausgestattete Tier
beim geringsten Verdacht schleunigst dem Meere zustrebt und, wenn
es das Wasser auch nur mit den Vorderflossen erreicht hat, selbst
durch die vereinte Kraft mehrerer Männer nicht mehr zurückgehalten
zu werden vermag. Ist es weit genug vom rettenden Wasser entfernt,
so muß man versuchen, den mit seinen riesigen Ruderfüßen wütend um
sich schlagenden Koloß auf den Rücken zu werfen, wozu ein einzelner
Mensch manchmal nicht stark genug ist.[S. 699] Auf dem Rücken liegend ist die
Schildkröte völlig wehrlos und endgültig in die Gewalt des Menschen
gegeben. Am folgenden Morgen werden die Gefangenen in eigens für sie
bereitete Behälter mit Seewasser oder auf die Schiffe gebracht. In der
Gefangenschaft fressen sie kaum, magern deshalb rasch ab und verlieren
ihren Wert. Auf dem Verdeck der Schiffe werden sie auf dem Rücken
liegend mit Stricken befestigt, ein Tuch über sie gebreitet und dieses
so oft mit Seewasser begossen, daß es beständig naß oder wenigstens
feucht bleibt. In den europäischen Seestädten hält man sie in großen
Kübeln, die alle 2 bis 3 Tage einmal mit Wasser gefüllt werden,
schlachtet sie dann, indem man ihnen den Kopf abhackt, und hängt sie
1–2 Tage so auf, daß alles Blut ablaufen kann. Erst dann hält man das
Fleisch geeignet zur Bereitung von köstlichen Suppen.
Die Indianer Südamerikas töten diese und andere Meerschildkröten
des Öles wegen, das in ihrem Fleische enthalten ist, kochen es
aus und sammeln die zahlreichen Eier, die im Sande oder noch im
Leibe des Tieres enthalten sind, in großen Körben, um sie zu Hause
zu verzehren. Die Eier mehrerer, die südamerikanischen Flüsse
bewohnender Halswenderschildkröten (Pleurodira) sind
für manche Indianerstämme von größtem Nutzen. Am berühmtesten wurde
aber durch die farbenreiche Schilderung Alexanders von Humboldt
die im ganzen tropischen Südamerika östlich der Anden lebenden
Arrauschildkröte (Podocnemis expansa), ein Tier von
77 cm Panzerlänge und einem Gewicht von 20–25 kg. Zur
Zeit des niedrigsten Wasserstandes der von ihr bewohnten Flüsse,
zu Anfang März, kommt diese Schildkröte alljährlich an die von ihr
zur Eiablage bevorzugten sandigen Ufer und Inseln und genügt ihrem
Fortpflanzungstrieb. Hier wird sie teilweise von den in großer Menge
zur Ernte herbeieilenden Indianern erlegt; zum weitaus größten Teile
läßt man sie unbehelligt ihre taubeneigroßen, mit ziemlich dicker
Pergamentschale versehenen Eier ablegen, um diese zu erbeuten. Die
betreffenden sandigen Ufer sind dann durchschnittlich 1 m
tief damit gefüllt. Sie werden von den Indianern mit den Händen
ausgegraben, in Körben ins benachbarte Lager getragen und in große,
mit Wasser gefüllte hölzerne Tröge geworfen. In diesen werden sie mit
Holzschaufeln zerdrückt, umgerührt und der Sonne ausgesetzt, bis der
obenauf schwimmende ölige Teil, das Eigelb, dick geworden ist. Das Öl
wird dann abgeschöpft und über starkem Feuer gekocht. Gut zubereitet
ist es farblos mit einem Stich ins Gelbliche, geruchlos, um so besser
haltbar, je stärker es gekocht wurde und dient als sehr ge[S. 700]schätztes
Speisefett. Da es meist recht unreinlich gewonnen wird und teilweise
ausgebildete und dann in der Weiterentwicklung gehemmte Keime enthält,
die verfaulen, besitzt es in der Regel einen fauligen Geschmack, der
aber der Wertschätzung von seiten der Indianer keinen Eintrag tut.
Begreiflicherweise ist keine Schildkröte in engere Beziehungen zum
Menschen getreten. Dagegen ist dies mit einigen anderen Reptilien
der Fall, vor allem mit einigen Schlangen, die der Mensch teils
aus heiliger Scheu wegen ihres überaus giftigen Bisses, teils aus
praktischen Gründen, weil sie ihm bei der Bekämpfung der seinen
Vorräten schädlichen Mäuse und Ratten gute Dienste leisten, in
Kultpflege nahm. Bei manchen Volksstämmen Indiens und Afrikas sind
verschiedene gefürchtete Giftschlangen geradezu heilige Tiere, denen
regelmäßig Opfer von Milch dargebracht werden. Dies war schon im
Altertum der Fall, wo beispielsweise in Ägypten die überaus giftige
Hornviper (Cerastes cornutus), ein typischer sandfarbener
Wüstenbewohner, als heiliges Tier in einigen Tempeln gehalten und vom
Menschen gefüttert wurde. Gleicherweise geschah es im alten Athen
mit der ungiftigen Natter, von welcher der Geschichtschreiber
Herodot erzählt: „Die Athener sagen, als Schutzgeist wohne in ihrer
Burg im Tempel der Athene eine große Schlange, und diese füttern sie
alljährlich mit einem Honigkuchen. Als nun die Perser die Stadt mit
Heeresmacht bedrohten, verkündete die Priesterin der Pallas, diesmal
sei der sonst immer verzehrte Honigkuchen unberührt geblieben. Hieraus
schlossen nun die Athener, die Göttin habe die Stadt verlassen; sie
faßten demnach alsbald den Entschluß, ein Gleiches zu tun, schafften
ihre Habe fort und begaben sich auf die Schiffe.“ Die Rolle, welche die
harmlose Äskulapnatter (Coluber aesculapi) als heiliges
Tier des Heilgottes Asklepios an dessen Heiligtümern in Griechenland
und später, als sein Dienst bei Gelegenheit einer schweren, drei Jahre
die Stadt heimsuchenden Seuche nach Rom überpflanzt wurde, im ganzen
römischen Reiche spielte, ist zu bekannt, als daß hier näher darauf
eingetreten zu werden brauchte. Diese zutrauliche Schlange wurde auch
sonst in römischen Haushaltungen als guter Geist und Mäusefängerin
gehalten und mit Milch gefüttert, so wie heute überall in Brasilien
halbzahme ungiftige Hausschlangen an Stelle der Katzen zur Befreiung
der Häuser von der lästigen Mäuseplage gehalten werden. Unter diesen
ist die beliebteste eine Giboea genannte kleine Art Boa von etwa 4
m Länge und der Dicke eines Arms. Diese wird z. B. auf[S. 701] den
Märkten von Rio de Janeiro, Pernambuco und Bahia für 4 bis 5 Mark
verkauft und findet stets Abnehmer. Die Schlange liegt den ganzen Tag
schläfrig im Hausflur; erst bei Eintritt der Nacht beginnt sie ihre
Jagd, gleitet geräuschlos den Mauern entlang und schnellt geschwind wie
der Blitz auf eine Maus oder Ratte zu, die sie mit tödlicher Sicherheit
ergreift. Sie begnügt sich aber nicht mit einem Fraß, sondern tötet die
schädlichen Nager massenhaft aus bloßer Mordlust. Ihrem Herrn gegenüber
wird sie vollständig zahm und bekundet große Anhänglichkeit an das
Haus, das sie fast niemals verläßt, so daß eine gute Hausschlange für
den Besitzer ein wahrer Schatz ist.
Von den Reptilien sind sonst einzig noch die Alligatoren zu
halben Haustieren erhoben worden, und zwar weil ihre Haut ein zur Mode
gewordenes geschätztes Luxusleder, ihre Zähne einen beliebten Schmuck
liefern und winzige Alligatorbabies nebst mit Edelsteinen gezierten
kleinen Schildkröten, die gleicherweise als lebende Broschen getragen
werden, die „Lieblingstiere“ der extravaganten reichen Amerikanerinnen
geworden sind. Um nun diese durch die zunehmende Besiedelung immer
seltener werdenden Tiere leichter erlangen zu können, haben findige
Yankees begonnen, sie zu züchten. So gibt es in den Vereinigten
Staaten, besonders in Kalifornien, eigentliche Alligatorenfarmen, in
denen diese gefürchteten Saurier in besonderen Gehegen gehalten werden.
Um sich vor Schaden zu schützen, legt der Farmer den bösartigsten
dieser in Pflege genommenen Echsen einen regelrechten Maulkorb an.
Im Monat Juli scharren sich die Weibchen aus Riedgras und Reisig ein
primitives Nest zusammen und legen 30–40 längliche Eier hinein. Ist
dies geschehen, so bedecken sie dieselben sorgfältig mit demselben
Material und überlassen der Sonne das Ausbrüten ihrer Nachkommenschaft.
Der Farmer aber entnimmt den Nestern alsbald die meisten Eier, um
sie einem Brutapparat anzuvertrauen. Darin werden die Eier bei einer
Temperatur von 70° C. unter täglicher Anfeuchtung in etwa 60
Tagen ausgebrütet. Haben die Jungen die Eischale verlassen, so sind
sie schon eine gesuchte marktfähige Ware. Sie gedeihen ohne besondere
Pflege und werden mit Fleischabfällen gefüttert. Ihr Wachstum geht
außerordentlich langsam vor sich. So hat ein zwei Fuß langes Tier ein
Alter von annähernd zehn Jahren, während ein zwölf Fuß langes oft
das stattliche Alter von hundert Jahren aufzuweisen hat. Die großen
Exemplare sind für Menagerien und zoologische Gärten sehr begehrt.
[S. 702]
XXVIII. Die Transpender.
Das Tier war dem Menschen der älteste Fettlieferant, den später
mit dem Aufkommen des Hackbaues und dem Anpflanzen gewisser Öl in
ihren fettreichen Samen liefernder Pflanzen das vegetabilische Fett
wenigstens bei den Kulturvölkern mehr und mehr verdrängte. Gleichwohl
nimmt auch der gesittete Kulturmensch gern die Fettquellen des
Tierreichs in Anspruch, um seinem gesteigerten Bedarf nach solchen
Genüge zu tun. Unter diesen sind die Transpender die wichtigsten. Es
sind dies alles dem Leben im Wasser angepaßte Raubtiere, teilweise
geistig sehr hochstehende warmblütige Säugetiere, deren Körper zur
Aufrechterhaltung der bedeutenden Eigenwärme in dem sehr viel besser
als die Luft die Wärme leitenden nassen Element eine dicke Schicht
eines schlechten Wärmeleiters umgibt. Diese warmhaltende Fettumhüllung
in Form einer massenhaften Ansammlung von im Lebendzustande flüssigem
Fett im Zellgewebe vermindert zugleich das bedeutende Gewicht der meist
eine gewaltige Größe erreichenden Tiere, läßt sie dementsprechend
leichter in der salzigen Flut schwimmen und hilft zugleich den riesigen
Wasserdruck bzw. die Schwankungen desselben beim raschen Hinabtauchen
in große Tiefen und Wiederauftauchen ohne Schaden ertragen. Und je
nördlicher das Wohngebiet der betreffenden Tierart sich erstreckt, je
größer also die Wärmeabgabe im eisigen Meerwasser ist, um so mächtigere
Fettschichten sammelt das betreffende Tier um sich an.
Die gesuchtesten, weil ausgiebigsten Fettspender sind die heute nur
noch im hohen Norden in einiger Zahl vorkommenden Wale, die man
nach ihrem Gebiß in Zahn- und Bartenwale einteilt. Beide
Arten von Tieren sind Räuber, die ausschließlich von tierischer Beute
sich ernähren. Während aber die Zahnwale auch größere Tiere, besonders
Tintenfische und Fische in teilweise größerer Meerestiefe erbeuten
und fressen, ernähren sich die nur in ihrer Jugend rudimentäre[S. 703]
Zähne aufweisenden und später kammartig von den Rändern des Gaumens
herabhängende Barten aus Fischbein ausbildenden Bartenwale von
winzigen pelagischen Weichtieren, meist Flügelschnecken, die sie zu
Tausenden mit jedem Schluck Meerwasser in die Mundhöhle aufnehmen.
Beim Schließen und Zusammendrücken der Mundhöhle fließt das Wasser
durch das Nachobenpressen der gewaltigen Zunge seitwärts durch die
feinen Lücken des Fischbeinsiebes in Gestalt der Barten ab, während die
kleinen Weichtiere zurückbleiben und durch den engen Schlund in den
Magen und Darmkanal zur Verdauung und Assimilation aufgenommen werden.
Diese Fischbeinsiebe sind bei manchen Walen nur wenige Dezimeter, bei
vielen aber auch 4–5 m lang und ebensoviele Dezimeter breit. Das
Fischbein von Walen der besten Art wiegt zuweilen 1500 kg, ist
für die Industrie außerordentlich wertvoll und kann für manche Zwecke
kaum durch einen andern Stoff ersetzt werden; von anderen Arten aber
ist es so kurz, schlecht und brüchig, daß es nur einen niedrigen Preis
erzielt. Diese letzteren, die schon für 1 Mark das Kilogramm zu haben
sind, bilden nicht den Gegenstand des eigentlichen Fischbeinhandels,
der ausschließlich mit den Barten der rückenfinnenlosen Glattwale
sich beschäftigt. Diese nennt man deshalb auch die Rechtwale (engl.
right whales), und zwar unterscheidet man als die besten die
„Polarbarten“ des Grönlandwals, dann die an Güte nächstfolgenden
„Nordwestbarten“ des Japanwals und endlich die „Südseebarten“ des
Südpolarwals, deren Verwendung im eigenen Lande der Weltmarkt den
Japanern und Australiern um so weniger streitig macht, als sie kleiner
und weniger elastisch sind als jene. Für die Damenkonfektion und die
Peitschenindustrie, wofür das Fischbein heute noch unersetzlich ist,
werden die Fischbeinlamellen in großen Dampfkesseln erhitzt und dann
nach Entfernung der minderwertigen Außenteile von Reißern genannten
Arbeiten dem Fasernwuchs entsprechend der Länge nach gespalten. Diese
Stangen werden von Arbeiterinnen weitergespalten, auf rotierenden
Filzscheiben poliert und grosweise zum Versand fertiggemacht. Mit der
zunehmenden Abnahme der Wale ist das Fischbein außerordentlich teuer
geworden, so daß es schon heute einen kostbaren Artikel darstellt.
Die Wale sind ins Wasser gegangene und dementsprechend umgestaltete
Huftiere, wie die Seekühe ins Wasser gegangene Elefantenverwandte
und die Robben ins Wasser gegangene Raubtiere sind. Im Gegensatz zu
den durch Kiemen atmenden Fischen haben die durch Lungen atmenden
Wale als mächtiges Auftriebswerkzeug zum regel[S. 704]mäßigen Emporsteigen
an die Oberfläche des Wassers zum Luftatmen eine wagrechtstehende
Schwanzflosse ausgebildet und fehlt bei ihnen, weil als Wärmeschutz
des Körpers überflüssig, das bis auf wenige Borsten an Kinn und
Oberlippe aufgegebene Haarkleid der Säugetiere. Zur raschen Bewegung
im Wasser wurde der Hals unterdrückt und wurden die sieben Halswirbel
zu schmalen, platten Scheiben zusammengepreßt, die vielfach noch
untereinander verwachsen sind. Vom Schultergürtel ist nur noch das
Schulterblatt vorhanden, während die vorderen Gliedmaßen mit einer
Überzahl von Fingern zu Steuerflossen verändert wurden. Von den
hinteren Gliedmaßen sind nur noch im Fleisch verborgene Rudimente
vorhanden. Die markhöhlenlosen Knochen sind mit Fett erfüllt. Am
Schädel ist der Hirnteil ausnehmend klein, doch ist die Intelligenz
der Wale nicht so gering, wie man vermuten könnte. Die Sinnesorgane
sind nicht besonders entwickelt, das Gesicht ist schlecht, das Gehör
ziemlich gut, der Geruch vollkommen fehlend. Die auf dem höchsten
Teile des Kopfes ausmündende Nase ist nur ein Luftkanal, der
unten in den fest verschließbaren Kehlkopf mündet und die während
des langen Schwimmens unter Wasser in den Lungen zurückgehaltene
körperwarme Atmungsluft mit großer Gewalt nach außen schleudert. Diese
ist mit Feuchtigkeit gesättigt und verdichtet sich in der kalten
Atmosphäre der nordischen Meere zu einer Art Dampfstrahl. Das ist
das sogenannte „Spritzen“ der Wale. Der mehrfache Magen deutet auf
Huftierverwandtschaft. Das Blutgefäßsystem zeichnet sich durch häufige
Auflösung der größeren Blutgefäße in sogenannte Wundernetze aus, die
offenbar den chemischen Atmungsprozeß, d. h. die Abgabe von Sauerstoff
und Aufnahme von Kohlensäure seitens des Blutes, verlangsamen und
so den Tieren langes Anhalten des Atems und damit langes Tauchen
ermöglichen. Besonders an Herz- und Lungenschlagader finden sich
sackförmige Blutbehälter, in welchen sich sowohl arterielles als
venöses Blut ansammeln kann. So können große Wale 10–20 Minuten, bei
Verfolgung sogar bis eine Stunde unter Wasser bleiben. Die Brutpflege
ist dem Wasserleben angepaßt. Die Milchdrüsen liegen in Vertiefungen
zu beiden Seiten der Geschlechtsöffnung und die Milch wird dem Jungen,
das meist in einer wenig tiefen Bucht sehr hoch entwickelt geboren
wird und sogleich der Mutter folgt, durch den Druck eines besonderen
Muskels ins Maul gespritzt, sobald es dieses in die erwähnte Vertiefung
hineinstreckt. Wie die Tragzeit bei den größeren Arten bis auf zwei
Jahre geht, ist die Säugezeit auf mindestens ein Jahr anzunehmen. Dabei
wird das Junge von[S. 705] der um es sehr besorgten Mutter unter Nichtachtung
ihres eigenen Lebens verteidigt.
Die Wale kommen in allen Meeren vor, leben gesellig in sogenannten
„Schulen“ und machen, ihrer Lieblingsbeute nachziehend, weite
Wanderungen. Während sie früher nicht selten waren, sind sie heute
nur noch in geringen Resten vorhanden, was jeder Naturfreund in hohem
Maße bedauern muß. Allerdings werden nicht alle Walarten gewerbsmäßig
verfolgt, sondern nur alle diejenigen, bei denen der Wert der Ausbeute
die Gefahr und Mühe des Fangens und die Kosten der Ausrüstung aufwiegt.
Nur beim Küstenfang, der bloß gelegentlich betrieben wird, und zwar
wenn eben Wale an den Küsten erscheinen, ist man nicht besonders
wählerisch; dann muß die Masse es bringen, wie man zu sagen pflegt.
Dabei werden auch kleinere Walarten oft zu Hunderten vermittelst Booten
in seichte Buchten getrieben und dort jämmerlich abgeschlachtet. Den
Menschen kommt hierbei zustatten, daß die Wale sich leicht durch den
Lärm anrückender Boote aufscheuchen und sich in ihrer Verwirrung auf
den Strand treiben lassen. Brechen aber erst einige durch die Linie der
Boote hindurch, so folgt ihnen unaufhaltsam in geschlossener Masse die
ganze Schule und die Menschen haben das Nachsehen. Große Wale dagegen
kommen selten der Küste so nahe, daß sie sich auf den Strand treiben
lassen; sie müssen kunstgerecht verfolgt und erlegt werden, was früher
mit Harpunen geschah, jetzt aber mit aus kleinen Kanonen gefeuerten
Granaten mit Widerhaken an etwa 700 m langem, glatt geöltem,
ungemein leicht ablaufendem Tau geschieht. Sobald das aus der kleinen,
beweglichen Harpunenkanone gefeuerte Stahlgeschoß tief in den Körper
des Wales gedrungen ist, explodiert es daselbst, wobei ein zweiter
dumpfklingender Schuß ertönt. Dies tötet den Wal meist augenblicklich.
Sollte dies nicht der Fall sein und der Wal zu entfliehen versuchen,
so spreizen sich beim Anziehen des Harpunentaues die beweglichen
Widerhaken der Granate und halten ihn am leicht ablaufenden Taue fest.
Vom Blutverlust und vom Ziehen des schweren Schiffes ermattet der Wal
bald, stirbt und wird an Bord gezogen, um schon hier oder später am
Lande zerlegt zu werden. Im ersteren Falle wird der Körper durch eine
starke, vom Vordersteven aus um die Schwanzwurzel geschlungene Kette
längsseit mit dem Kopf nach hinten festgelegt und die Speckhülle in
Längsstreifen abgelöst, wobei ein Teil der Mannschaft von einem vom
Bord herabgelassenen Hängegerüst aus mit scharfen, langgestielten
Spaten arbeitet. Ein anderer Teil schneidet[S. 706] die an Bord gehißten
Speckstreifen klein und bedient die großen Trankessel, die nur anfangs
mit Holz, später mit den Grieben des ausgelassenen Specks geheizt
werden. Der so gewonnene Tran wird in Fässer gefüllt und diese werden
dann in mehreren Lagen im Schiffsraum verstaut. Ebenso wird das
wertvolle Fischbein losgelöst und im Schiff aufgestapelt, um später zu
sehr guten Preisen verkauft zu werden.
Die ersten Nachrichten über den Walfang stammen aus dem 9. Jahrhundert
von Angelsachsen und Isländern; doch beschränkte man sich damals
wesentlich auf den gelegentlichen Küstenfang. Erst seit dem 13.
Jahrhundert begannen die Basken als kühne Seefahrer besonders die
großen Bartenwale mit eigens zu diesem Zweck ausgerüsteten Schiffen bis
nach Grönland hin zu verfolgen. Als mit ihrem politischen Niedergang
auch ihre Seeschiffahrt aufhörte, traten besonders holländische, später
auch britische Walfänger an ihre Stelle und machten ungeheure Beute.
In der letzten Hälfte des 17. Jahrhunderts sandten die Holländer in
manchen Jahren etwa 260 Schiffe mit 14000 Seeleuten auf den Walfang
aus. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts gesellten sich zu ihnen die
Engländer in namhaften Kontingenten, so daß die Zahl der Fangschiffe
in die Tausende, die der getöteten Wale in die Zehntausende und der
Gesamterlös aus diesen in die Hunderte von Millionen ging. Um auch sein
Volk an diesem großen Gewinn zu beteiligen, ließ Friedrich der Große
gegen das Ende seiner Regierungszeit ebenfalls Walfänger ausrüsten.
Doch war damals die goldene Zeit des Walfanges schon vorbei. Im 19.
Jahrhundert verringerte sich die Zahl der erbeuteten Wale dermaßen,
daß man schon in die entlegensten Gebiete des hohen Nordens und Südens
fahren mußte, um überhaupt noch Beute zu machen. Gegenwärtig sind die
Nordamerikaner die wichtigsten Waljäger, die auch die Südpolarwelt nach
den so geschätzten Tranlieferanten absuchen und noch einigermaßen gute
Geschäfte machen, bis auch ihnen einmal durch gänzliche Ausrottung
dieser Meeresriesen das Geschäft unmöglich gemacht wird.
Unter allen Walen ist der 18–20 m lang werdende, schwarz
gefärbte Grönlandwal (Balaena mysticetus) einer der
gesuchtesten, da er 130–200, manchmal sogar 280 Faß Tran und 500–1500
kg dunkles Fischbein in mehr als 380 in der Mitte 3–4 m
lang werdenden Platten liefert. Letztere sind sehr geschätzt und
kosteten schon 1881 22000 Mark die 1000 kg, heute aber über
56000 Mark. Je nach der Größe repräsentiert dieser Wal einen Wert von
20000 bis 40000 Mark, so daß man begreift, daß er ein sehr gesuchtes[S. 707]
Beutetier ist. Er schwimmt in kleinen Gesellschaften den seine Nahrung
bildenden Ruderschnecken des Nordens nach, sammelt sich im Herbst
in größeren Schulen, um nach Süden zu ziehen, wo er den Winter über
verbleibt. Nach der Schätzung Sachkundiger legt er beim gewöhnlichen
Schwimmen durchschnittlich 8 km in der Stunde zurück, kann sich
aber bei Verwundung mit mehr als doppelter Geschwindigkeit fortbewegen.
Verwundet bleibt er bis zu 50 Minuten lang unter Wasser, während er
sonst alle 12–15 Minuten zum Atemholen an die Oberfläche kommt. So
plump auch sein Leib erscheint, so rasch und geschickt sind seine
Bewegungen. Von Natur ist er sehr friedfertig, ja äußerst furchtsam, so
daß er die Boote seiner Verfolger nie angreift. Im Frühjahr bringt das
Weibchen nach einer Tragzeit von 14 Monaten ein einziges, selten zwei
Junge zur Welt, die ein Jahr lang gesäugt werden, wobei sich die Alte
etwas zur Seite neigt, um ihnen die Zitze darzubieten. Das Wachstum
geht sehr rasch vor sich, so daß das Junge bereits während der Saugzeit
eine Länge von 6 m bei einem Umfange von 4 m und ein
Gewicht von 6000 kg erreicht.
Im nördlichen Stillen Ozean ist der wichtigste Bartenwal der
Grauwal (Rhachianectes glaucus), der im männlichen
Geschlecht 11–13, im weiblichen 12–14 m lang wird, oben
bläulichgrau, unten fast weiß ist und nur 45 cm lange, spröde
gelbe Barten besitzt. Auch er ist infolge der eifrigen Verfolgung sehr
selten geworden, so daß er in Gefahr schwebt, ausgerottet zu werden.
Der einst auch im Norden sowohl des Stillen als des Atlantischen
Ozeans verbreitete Südwal (Balaena australis) kommt im
eigentlichen südlichen Eismeer nicht mehr vor. Er war der wichtigste
Transpender der baskischen Walfänger, bis er zu Ende des 16.
Jahrhunderts bei uns so selten geworden war, daß diese sich dem Fange
des wertvolleren Grönlandwales zuwandten.
Weit öfter als diese und besonders der Grönlandwal wird der plumpe
Buckelwal (Megaptera longimana) in Schulen angetroffen.
Dieser oben schwarze, unten aber dunkelaschfarbene Wal von bis 15
m Länge, mit kurzen, breiten Barten, die grob sind und wenig
federn, kommt zu beiden Seiten des Äquators bis zum nördlichen und
südlichen Eismeer vor und hat seinen Namen von einer buckelartigen
Erhebung auf dem hinteren Teil des Rückens, die eine kleine
Rückenflosse trägt. Die bis 4,3 m langen Brustflossen haben
ihm den Namen Langflossenwal eingetragen. Er bewegt sich meist sehr
lebhaft, wird aber nicht selten an ruhigen, sonnigen Tagen schlafend an
der spiegelnden Meeresoberfläche angetroffen. Das Buckelwalweibchen[S. 708]
wirft oft zwei Junge und hat, auch wenn es nur eines besitzt, nach der
langen Säugezeit kaum mehr Speck. Überhaupt liefert mancher Buckelwal
nur 8–10 Faß Tran, während fette deren bis 75 Faß liefern.
Weit größere Kehlhautfurchen als die Buckelwale besitzen die
Finnwale, Tiere, die ihren Namen von einer kleinen,
sichelförmigen, weit hinten auf dem Rücken stehenden Rückenfinne oder
Rückenflosse haben. Diese schlanken Tiere mit flachem, zugespitztem,
1⁄5–1⁄4 der Gesamtlänge einnehmendem Kopf haben nur kleine, schmale,
bloß vier Finger in sich bergende Brustflossen und kurze Barten mit
grobem Fischbein. Die Mitglieder der in allen Meeren vertretenen
Gattung waren früher, solange die echten Wale noch häufiger waren,
weniger zahlreichen Verfolgungen durch Walfänger ausgesetzt, da sie
sich schneller bewegen und schwerer zu töten sind, zudem weniger
Speck und nur ein schlechtes Fischbein liefern. Auf der Nordhalbkugel
leben vier Arten, nämlich der selten über 20 m, meist nur
18–19,5 m lange gemeine Finnwal oder Rorqual
(Balaenoptera musculus), der oben schiefergrau und unten weiß
gefärbt ist und wie der vorige hauptsächlich Fische frißt. Er wird
nicht selten in Scharen von 10–20 Stück angetroffen, spielt gern um
fahrende Schiffe herum und wird im Schwimmen an Geschwindigkeit und
Kraft nur vom Riesenfinnwal (B. sibbaldi) übertroffen,
der bis zu 26 m lang wird und bei dieser Länge etwa 90 Fässer
Tran liefert. Er besitzt lange Kiefer und große Brustflossen,
entwickelt mit seiner mächtigen Schwanzflosse eine unvergleichliche
Kraft und treibt beim Ausatmen seinen wasserdampfgesättigten Hauch
höher als die anderen Walarten. Schiffen folgt er manchmal auf weite
Entfernungen, ist aber weniger kühn als der gemeine Finnwal. Im
Frühling zieht er nordwärts und im Herbst südwärts.
Nicht wie diese von Fischen, sondern ausschließlich von kleinen
Krebsen lebt Rudolphi’s Finnwal (B. borealis), der bis
16 m lang wird und auf bläulichschwarzem Grunde längliche
weiße Flecken aufweist. Er atmet geräuschloser als seine Artgenossen
und macht beim Auftauchen statt 5–6 Atemzügen deren nur 1–2. Auch er
wird eifrig verfolgt, obschon er nur halb so viel wert ist als der
gemeine Finnwal, nämlich nur etwa 700 Mark, und bloß 15–30 Fässer
Tran liefert. Der kleinste Finnwal ist der durch seine zugespitzte
Schnauze ausgezeichnete Schnabelwal (B. rostrata), der
selten über 10 m lang wird. Er ist oben grauschwarz, unten weiß
und hat nahezu weißes Fischbein. Er wird in den nördlichen Meeren
beider Erdhälften noch ziemlich häufig gefunden,[S. 709] fühlt sich ganz
wohl zwischen Eisschollen und wird meist allein, selten paarweise
angetroffen. Er besucht gern die Fjorde und Buchten Norwegens, in denen
er mit Netzen gefangen und daraufhin mit Speeren getötet wird.
Zu den Zahnwalen gehört als deren von den Walfängern gesuchtester
Vertreter der über alle wärmeren Meere verbreitete, im nördlichen
oder südlichen Eismeer fehlende Potwal (Physeter
macrocephalus). An Größe steht er nur einigen der längsten
Bartenwale nach. Die Männchen erreichen 17–18 m Länge, während
die schlankeren Weibchen bedeutend kleiner bleiben. Früher sollen
gelegentlich Männchen von 24 m Länge gefangen worden sein, die bis
100–120 Fässer Tran lieferten. Außer diesem gewinnt man von ihm
noch das sogenannte Walrat oder Spermaceti, ein wasserhelles Öl,
das sich vornehmlich im Kopfe des Tieres, dann in einer bis zum
Schwanze verlaufenden Röhre und in vielen kleinen, in Fleisch und Fett
zerstreuten Säckchen gefunden wird, in der Kälte gerinnt und dann eine
weiße Färbung annimmt. Das grobfaserige Fleisch wird von vielen dicken
Sehnen durchflochten. Der große Rachen geht fast bis zum Auge und trägt
eine Reihe wurzelloser, kegelförmiger Zähne von wechselnder Zahl,
weil manche ausfallen und im höheren Alter nicht mehr ersetzt werden.
Die Zunge ist mit ihrer ganzen Unterseite am Grunde des Unterkiefers
festgewachsen; der Magen ist vierteilig. Gewöhnlich trifft man den
Potwal in Gesellschaften an, die 20–30 Stück verschiedenen Alters
und Geschlechts unter Anführung von alten Männchen vereinigen. Gern
treibt er sich in der Nähe von Steilküsten umher, meidet aber ängstlich
die ihm so gefährlichen Untiefen, obwohl er auch dort gelegentlich
angetroffen wird. Beim ruhigen Schwimmen gleitet er leicht unter der
Oberfläche dahin, bei schnellerem dagegen schlägt er so heftig mit dem
Schwanz auf und nieder, daß sein Kopf bald tief untersinkt, bald hoch
emportaucht. Gar nicht selten stellt er sich senkrecht ins Wasser,
was andere Wale kaum je tun. Er soll in einer Stunde 20–24 km
weit schwimmen können. Seine Hauptnahrung bilden große, in ziemlicher
Tiefe lebende Kopffüßler, die wir teilweise nur aus Potfischmägen
kennen. Von diesen Tintenfischen bildet sich in seinen Gedärmen eine
immer eine Anzahl von Krakenschnäbeln aufweisende wachsartige, leichte
Masse von verschiedener Färbung, die einen höchst angenehmen Geruch
besitzt, durch Kochen sich in ein Öl umwandeln und bei großer Hitze
verflüchtigen läßt. Es ist dies der einst als Arznei sehr gesuchte
Amber, der heute nur noch in der Par[S. 710]fümerie eine große Rolle spielt.
Viel häufiger als aus dem Leibe des Potwals gewinnt man ihn durch
Auffischen im Meere, wo man ihn in oft sehr großen Klumpen von bis
90 kg Gewicht antrifft. Außer Tran, Walrat und Amber finden
auch die Zähne des Potwals Verwendung. Sie sind zwar im Innern etwas
gelblich, doch sehr fest und dienen zur Herstellung von Knöpfen und
Spielmarken. 1 kg derselben wird mit 5–8 Mark bezahlt.
Bei der Vielseitigkeit seiner Nutzstoffe ist es kein Wunder, daß
diesem Ungeheuer schon lange eifrig nachgestellt wird, obschon er
der wehrhafteste aller Wale ist und verwundet ohne Scheu die größten
Schiffe angreift, auch nicht selten kleinere Segler und Kutter zum
Kentern bringt und die Menschen durch seinen ungestümen Angriff
gefährdet. Im vergangenen Jahrhundert haben ihn besonders Engländer und
dann Amerikaner im Stillen Ozean verfolgt und große Reichtümer durch
ihn gewonnen, da ein ausgewachsenes Männchen Stoffe im Werte von bis
zu 20000 Mark liefert. Seit zwei Menschenaltern aber ist der Ertrag
des Potwalfanges bedeutend zurückgegangen, weil er bei der jetzigen
Seltenheit des Tieres kaum mehr lohnt. Sein Tran wird teuerer bezahlt
als anderer Walfischtran. Von ihm gibt es mehrere Abarten. Alle sind so
sehr dem Leben auf hoher See angepaßt, daß sie in der Nähe der Küste
häufig hilflos werden und stranden.
Hierin stimmen mit den Potwalen die verschiedenen Entenwale
(Hyperoodon) überein, die der Hauptsache nach durch gestrandete
Exemplare bekannt wurden. Auch sie leben im offenen Meere und ernähren
sich von pelagischen Tintenfischen. Sie haben ihren Namen von der
schnabelartigen Form ihrer längeren oder kürzeren Schnauze, besitzen
aber im Gegensatz zu den Potwalen im Unterkiefer nur ein bis zwei Paar
Zähne, die besonders bei den Männchen sehr groß werden. Der gemeinste
von ihnen ist der im männlichen Geschlecht 9 m, im weiblichen
7,3 m lang werdende Dögling oder Entenwal im
engeren Sinne (H. rostratus), bei dem die beiden an der Spitze
des Unterkiefers stehenden Zähne während des Lebens vollständig im
Zahnfleisch versteckt bleiben. Dieser in der Jugend oben schwarze, mit
zunehmendem Alter aber hellbraun und zuletzt fast gelb werdende Zahnwal
ist auf den Norden des Atlantischen Ozeans beschränkt und gehört zu
den wandernden Walen, der aber nicht weit über Großbritannien hinaus
nach Süden vorzugehen scheint, da man an der Westküste von Frankreich
und Spanien noch niemals Exemplare von ihm gestrandet[S. 711] fand, wie dies
im Herbste gewöhnlich an den Küsten des Kanals und der Nordsee der
Fall ist. Schon früh im Jahre wandert dieser Entenwal nach Norden,
um in größerer Tiefe seine größtenteils aus Tintenfischen bestehende
Nahrung zu erbeuten. Dem weiten Weg in die Nährgründe entsprechend
bleibt er sehr lange unter Wasser und atmet sehr schwer, wenn er wieder
auftaucht. Mit großer Lebendigkeit schwingt er sich gelegentlich
hoch in die Luft, um nach Artgenossen Umschau zu halten; denn, wenn
er auch meist in einzelnen, übrigens gewöhnlich noch jungen Stücken,
ausnahmsweise auch als altes Weibchen mit seinen beiden Jungen auf den
Strand gerät, trifft man ihn als geselliges Tier meist in Herden von
4–10 Stück. Sie werden manchmal von einem der allerdings häufig einzeln
lebenden erwachsenen Männchen geführt und vom Geselligkeitstrieb so
beherrscht, daß die Mitglieder einer Herde bei einem verwundeten
Genossen bleiben, bis er tot ist, so daß man bisweilen sämtliche
Mitglieder einer Herde nach und nach töten kann. Die Erbeutung des
wenig furchtsamen, dagegen, wie es scheint, sehr neugierigen Döglings
wird auch durch dessen Gewohnheit, um die Schiffe herum und darunter
hinweg zu schwimmen, sehr erleichtert; doch ist er sehr zählebig. Alte
Männchen haspeln rasch die ganze Harpunenleine ab und bleiben zuweilen
zwei Stunden unter Wasser, um anscheinend völlig munter wieder zu
erscheinen. Dennoch ist sein Fang lohnend genug, da erwachsene Männchen
in ihren Köpfen wenigstens 100 kg Walrat haben und außerdem
mehrere Faß Tran liefern.
Auf der südlichen Erdhalbkugel, wie es scheint, in größerer Anzahl
vertreten als auf der nördlichen, sind die in verschiedenen Arten
bekannt gewordenen Riemenzahnwale (Mesoplodon), so
genannt, weil die beiden, gewöhnlich nicht am Ende, sondern mehr in
der Kiefermitte stehenden Zähne des Unterkiefers zwar zugespitzt,
aber seitlich stark zusammengedrückt sind, wodurch sie namentlich bei
einer Art der Gattung, bei der sie stark verlängert und gebogen sind,
eine riemenartige Gestalt annahmen. An den europäischen Küsten ist
der etwa 4,5 m lang werdende Sowerby’s Riemenzahnwal
(M. bidens) der häufigste. Er ist durch einen fast geraden
Schnabel, von welchem an sich der Kopf allmählich wölbt, um vor dem
Atemloche eine ziemlich starke Hervorragung zu bilden, und durch seine
verhältnismäßig kleinen Zähne gekennzeichnet.
Den Entenwalen näher steht der sehr weit verbreitete, aber seltene und
nur von gestrandeten Stücken bekannte Cuvierswal (Ziphius
cavi[S. 712]rostris). Bei ihm sind die an der Spitze des Unterkiefers
stehenden beiden Zähne gut entwickelt. Von allen Walen aber strandet
am allerhäufigsten der zu den Rundkopfwalen gehörende Grindwal
(Globiocephalus melas), dessen große Geselligkeit ihm bei Gefahr
regelmäßig verderblich wird. Kaum ein Jahr vergeht, in welchem nicht
hier oder da eine größere oder geringere Zahl dieser Tiere, die zu den
wichtigsten Nutztieren der Nordländer gehören, auf den Strand läuft. Im
Jahre 1779 verunglückte eine Herde von 200, 1805 eine solche von 300
Stück auf den Shetlandinseln; in den Jahren 1809 und 1810 wurden gar
1110 Stück in einer nach den Grindwalen Walfjord genannten Bucht auf
Island durch die eifrigen Bemühungen der Menschen ans Ufer geworfen,
und 1845 sollen in einem Zeitraum von sechs Wochen 2080 Stück auf den
Faröerinseln in ähnlicher Weise erbeutet worden sein. Überall, wo sich
Herden dieses Tieres zeigen, erfolgt eine allgemeine Jagd auf sie. Die
ganze Fischerflotte der Nachbarschaft eilt unverzüglich aufs Meer, um
den Tieren durch Bildung eines aus Booten bestehenden Halbkreises den
Rückzug abzuschneiden und die ganze Grindwalgesellschaft in eine Bucht
oder dergleichen hineinzutreiben, wobei man die Tiere durch Werfen von
zu diesem Zwecke reichlich mitgenommenen Steinen zu erschrecken sucht,
wenn sie durchzubrechen versuchen. Gelingt der auf den Faröerinseln
noch durch Seile, mit Strohpuppen von Boot zu Boot gezogen, erschwerte
Durchbruch auch nur einem einzigen Wal, so ist die ganze Gesellschaft
für die Fischer verloren, weil dann die übrigen Tiere trotz aller
Bemühungen der Fischer dem ersten folgen. Gelingt es aber, die
Grindwale in seichtes Wasser zu treiben, so drängen sie in ihrer Angst
so ungestüm vor, daß sie stranden. Dann eilt die ganze Bevölkerung
mit allerlei Waffen, wie Harpunen, Speeren, Beilen, Pickeln, Spaten
u. dgl. herbei, um unter heillosem Geschrei den hilflosen Tieren
den Todesstreich zu geben. Weithin färbt sich das Meer vom Blut der
Gemordeten rot. Solcher Tag bedeutet einen Festtag für die Insulaner;
denn bei der meist gewaltigen Beute gibt es Fleisch und Speck die
Fülle. Zuerst werden Leber, Herz und Nieren als besondere Leckerbissen
gegessen; dann labt man sich an Fleisch und Speck, und was man von
diesen nicht essen kann wird eingesalzen oder getrocknet. Auf jeden
Grindwal rechnet man eine Tonne Tran. Unter allen Angehörigen der
artenreichen Delphinfamilie ist der Grindwal einer der größten. Er wird
nämlich etwa 6 m lang und bildet unter allen Walen die größten
Scharen, nämlich Gesellschaften, die nicht selten 200–300 Stück[S. 713] zählen
und gelegentlich aus 1000, ja selbst aus 2000 Tieren bestehen. Wenn das
Leittier dieser sonst das hohe Meer bewohnenden Wale in seichtes Wasser
gerät und dort festgerannt ist, folgen ihm die übrigen Mitglieder der
Herde blindlings, wodurch eben ganze Scharen stranden und verderben.
Er geht ziemlich weit nach Norden, nämlich bis Grönland, und kommt
in verschiedenen Abarten in fast allen Meeren vor, scheint aber im
Mittelmeer selten zu sein. Er besitzt in jeder Kieferhälfte nur 8–12
auf das vordere Ende der Kiefer beschränkte kleine Zähne, ist einförmig
schwarz gefärbt — deshalb wird er auch Schwarzwal genannt — von
Natur sehr sanftmütig und ernährt sich vorzugsweise von Tintenfischen,
daneben aber auch von Fischen und Weichtieren. Er ist durch seinen
schnabellosen, fast kugelförmigen Kopf, durch eine lange, niedrige,
dicke Rückenflosse und durch lange, schmale Brustflossen ausgezeichnet.
Von den Mundwinkeln bis zu den Brustflossen erstreckt sich ein weißer
Fleck.
In allen Meeren rings um den Nordpol lebt ebenfalls meist in großen
Gesellschaften der auch Beluga genannte Weißwal
(Delphinapterus leucas). Dieses 5–6 m lang werdende Tier
ist in der Jugend hell graubraun, erwachsen dagegen gelblichweiß und
entbehrt der Rückenflosse. Große Herden der Weißwals treten namentlich
an den Küsten von Spitzbergen und Nowaja Semlja auf. Gern besucht der
Weißwal die Mündungen von Flüssen, in die er beträchtliche Strecken
weit hinaufsteigt. Er ernährt sich von Kopffüßlern, Fischen und Krebsen
und gerät gelegentlich bei der Verfolgung von Heilbutten oder Flundern
in seichtes, ihm kaum das Schwimmen erlaubendes Wasser. Oft ziehen
die Mitglieder einer Herde in einzelnen Reihen, selten mehr als zwei
oder drei der Tiere nebeneinander, unregelmäßig auftauchend dahin,
wobei sie oft ein schwaches Gebrüll ausstoßen. Wo er nur kann, macht
der Nordländer Jagd auf ihn. Wie den Grindwal sucht man ihm durch vor
die Eingänge der Fjorde und Buchten aufgestellte Netze den Rückweg
zum Meer zu versperren und ihn mit Harpunen und Lanzen zu töten. Im
offenen Meere ist ihm dank seiner Geschwindigkeit und Gewandtheit kaum
beizukommen, so daß die Walfänger meist auf seine Jagd verzichten,
obschon er einen Handelswert von durchschnittlich 60 Mark besitzt. Die
Zirkumpolarvölker schätzen ihn außerordentlich hoch und benützen alle
Teile von ihm. Auch die Europäer verwenden außer dem Tran, von dem ein
ausgewachsenes Tier über 450 Liter gibt, das Fleisch und die Haut, die
in England als Tümmlerhaut verkauft und in Rußland zu Pferdegeschirr
u. dgl.[S. 714] verarbeitet wird. Wenn auch gefangene Weißwale in der
Gefangenschaft bald sterben, so erweisen sie sich als leicht zähmbar
und gelehrig. Wiederholt wurden diese Tiere im Westminsteraquarium in
London vorübergehend gehalten.
Ebenfalls eine hochnordische Delphinart ist der Narwal oder
das See-Einhorn (Monodon monoceros), ein gewöhnlich
in kleinen, 15 bis 20 Stück starken Scharen auftretendes Tier
von 4–5 m Länge, unten weiß, oben dunkelgrau gefärbt, mit
unregelmäßigen, verwaschenen, helleren und dunkleren kleinen Flecken
dazwischen. Abgesehen von einigen kleinen, verkümmerten, unregelmäßig
auftretenden Zähnen ist der weibliche Narwal zahnlos, was auch für das
Männchen gelten würde, wenn dieses nicht durch einen im Oberkiefer
stehenden 2–2,5 m langen und an der Wurzel einen Umfang von 20
cm besitzenden Stoßzahn ausgezeichnet wäre. Dieser Zahn gehört
in der Regel der linken Oberkieferhälfte an, ist schraubenförmig,
und zwar immer von links nach rechts gewunden, auf dem größeren Teil
seiner Länge hohl und besteht aus einer sehr dichten, sahnenfarbigen,
elfenbeinartigen Masse. Äußerst selten entwickeln sich bei einem
Männchen zwei Stoßzähne, wie sie sich z. B. an einem Narwalschädel
des Museums von Cambridge finden, an dem auch der rechte Zahn
merkwürdigerweise von links nach rechts gedreht ist. Dieser Stoßzahn
dient den Männchen bei ihren Kämpfen um die Weibchen. Die Tiere sind
sehr lebhaft und spiellustig, ernähren sich ebenfalls vorwiegend von
Tintenfischen, daneben von verschiedenen Krebsen und kleinen Fischen.
Wie bei allen Walen werfen die Weibchen meist nur ein einziges, nur
ausnahmsweise zwei Junge, die von ihnen lange gesäugt und sorgsam
behütet werden.
Wegen der sehr geschätzten Stoßzähne, seines trefflichen Fleisches
und seines gewöhnlichen Waltran an Güte übertreffenden Tranes hat der
Narwal heute in allen den Walfängern zugänglichen Meeren bedeutend an
Zahl abgenommen. Südlich des Polarkreises kommt er nur ausnahmsweise
in verirrten Exemplaren vor. So weiß man nur von drei Narwalen, die
zwischen den Jahren 1648 und 1808 an der Küste Englands auftauchten
und erlegt wurden. An der deutschen Nordseeküste wurden nur im
Jahre 1736, aber zweimal, solche beobachtet und erlegt. Bei der
ungeheuren Seltenheit des Tieres an den nördlichen Küsten Europas
kann es nicht wundern, daß man seine Stoßzähne, denen man allerlei
Wunderkräfte zuschrieb, mit ungeheuren Summen bezahlte. Galten sie
doch als vom Einhorn der Bibel abstammend, weshalb dieses fabelhafte
Tier im englischen Wappen[S. 715] auch solche Zier trägt. Kaiser und Könige
ließen sich oft mit dem zierlichsten Schnitzwerke versehene Stäbe
daraus verfertigen und sich nachtragen, auch wurden die kostbarsten
Bischofsstäbe daraus geschnitzt. Noch im 16. Jahrhundert bewahrte
man im Bayreuther Archiv auf der Plassenburg vier Narwalzähne als
außerordentliche Seltenheit auf. Einen derselben hatten zwei Markgrafen
von Bayreuth von Kaiser Karl V. für einen großen Schuldenposten
angenommen, und für den größten wurde von den Venezianern noch im Jahre
1559 die ungeheure Summe von 30000 Zechinen (= 198000 Mark) angeboten,
ohne daß es ihnen gelungen wäre, in den Besitz desselben zu gelangen.
Ein Zahn, der in der kurfürstlichen Sammlung zu Dresden an einer
goldenen Kette hing, wurde auf 100000 Reichstaler geschätzt.
In den gemäßigten Meeren, auch im Nordatlantischen Ozean, in
der Nordsee und im Mittelmeer lebt der fast 4 m lange,
hauptsächlich Tintenfische fressende Risso’s Delphin (Grampus
griseus). Viel verbreiteter und auch weiter nach Norden gehend
ist der 9 m, meist aber 5–6 m lange Schwertwal
(Orca gladiator), der nirgends häufig ist und sich nur in
kleinen Gesellschaften teils in offenem Meere, teils nahe den Küsten
umhertreibt, um Beute zu machen. Er ist nicht nur der größte, sondern
auch der raublustigste und gefräßigste aller Delphine, der nicht bloß
von Fischen, sondern auch von Seehunden und kleinen Delphinen lebt.
Er ist so unersättlich, daß er gelegentlich vier oder mehr Tümmler
nacheinander verschlingt. Im Magen eines gegen 5 m langen
Schwertwales befanden sich einmal nicht weniger als 14 Seehunde. Ja, er
greift gelegentlich sogar die größten Wale, darunter den Grönlandwal,
an, um ihnen ganze Stücke Fleisch aus den Seiten und von den Lippen zu
reißen. Schon Plinius weiß in seiner Naturgeschichte zu erzählen, daß
der orca junge und alte Wale angreift und sie mit seinen großen
Zähnen zerfleischt. „Die Wale können weder ausweichen, noch Widerstand
leisten und suchen nur zu entfliehen und das hohe Meer zu erreichen;
ihre Feinde aber versperren ihnen den Weg, treiben sie in die Enge und
jagen sie auf die Sandbänke oder Klippen. Solche Kämpfe bieten ein
erhabenes Schauspiel dar und die Wogen brausen und schäumen infolge des
Schlachtgetümmels, als ob der ärgste Wirbelwind wütete.“ Obgleich der
Schwertwal sehr viel Tran besitzt, wird doch nirgends regelmäßig Jagd
auf ihn gemacht.
Der gemeinste Delphin unserer Meere ist der Tümmler oder
Braunfisch, auch Meerschwein genannt (Phocaena
communis), der 1,5–2, in seltenen Fällen auch wohl 3 m
lang wird. Er lebt im[S. 716] ganzen Norden des Atlantischen Weltmeers,
wandert gegen den Winter nach Süden, im Frühling wieder nach Norden
und verfolgt dann die Heringe mit solchem Eifer, daß er den Fischern
die Netze zerreißt. Seine Gefräßigkeit ist sprichwörtlich, er verdaut
außerordentlich schnell und bedarf einer ansehnlichen Menge von
Nahrung. Gesellig wie alle Delphine, findet man ihn nur in kleinen
Scharen mit überraschender Schnelligkeit durch die Wellen dahineilen.
Er zieht im Gegensatz zu den anderen Walen die Küstengewässer dem hohen
Meere entschieden vor und tummelt sich, wie schon die Alten wußten,
besonders lebhaft vor und während eines Sturmes im Wasser umher. Selbst
in der schwersten Brandung weiß er der Gefahr des Strandens zu entgehen
und schwimmt spielend um die Schiffe, denen er begegnet. Früher wurde
er auch seines Fleisches wegen, jetzt wird er hauptsächlich zur
Gewinnung seines Tranes und seiner Haut, die gewöhnlich als Haut des
Weißwals auf den Markt gelangt, verfolgt.
Viel berühmter als er und mit den merkwürdigsten Fabeln bedacht
ist unter den verschiedenen eigentlichen Delphinen der gemeine
Delphin (Delphinus delphis). Dieser etwa 2,3 m lange,
gewöhnlich oben dunkelbraune und unten weiße Zahnwal besitzt eine
schnabelförmig ausgezogene Schnauze und ist durch seine ungewöhnliche
Lebendigkeit und Spiellust allen Seefahrern bekannt. Früher wurde er
an den meisten Küsten Europas seines Fleisches wegen gejagt; nur die
alten Griechen und Römer hielten das Töten dieses dem Meeresgotte
heiligen Tieres für eine Sünde und Schande. Plinius sagt von ihm, daß
er gegen den Menschen freundlich gesinnt sei, die Musik, besonders
den Ton der Wasserorgel sehr liebe und leicht so zahm werde, daß er
sich mit Brot füttern lasse. Unter der Regierung des Kaisers Augustus
habe ein Delphin im Golf von Puteoli (dem heutigen Pozzuoli) bei
Neapel eine solche Zuneigung zu einem Knaben, der ihn mit dem Namen
Simon anrief und mit Brot fütterte, gefaßt, daß er jedesmal erschien,
wenn er gerufen wurde, dem Knaben aus der Hand fraß, ihn durch seine
Stellung zum Aufsitzen einlud und ihn mitten durch das Meer nach
Puteoli in die Schule trug und ihn von dort wieder nach Hause brachte.
Dies sei mehrere Jahre so gegangen, bis der Knabe an einer Krankheit
starb. „Jetzt kam der Delphin noch oft traurig ans Ufer geschwommen
und überlebte, ohne Zweifel von Sehnsucht gequält, seinen Geliebten
nicht lange.“ Mehrfach weiß Plinius nicht nur von Knaben, sondern
sogar von Männern zu berichten, die von Delphinen weithin übers Meer
getragen worden seien. „Alles[S. 717] dies,“ fährt er fort, „macht auch die
Geschichte des Arion glaublich. Er war zu Schiffe und die Matrosen
wollten ihn wegen seiner Schätze ermorden. Da bat er um die Erlaubnis,
nochmals seine Kithara erklingen lassen zu dürfen. Beim Klang der Töne
versammelten sich die Delphine, und als er sich ins Meer stürzte, ward
er von ihnen aufgenommen und ans Ufer von Tänarum (am Peloponnes)
getragen.“ Nach ihm sollten in einem See an der Rhonemündung die
Delphine, zu Hilfe gerufen, den Menschen die Fische ins Netz treiben
und dafür mit einem Teil der Beute und mit in Wein getauchtem Brot
gefüttert werden.
Im Mittelalter war man auch in den Mittelmeerländern weniger
skrupulös gegen diesen „Liebling Poseidons“ und harpunierte ihn
gern, um ihn als geschätzte Fastenspeise wie die eigentlichen Fische
zu verzehren. In der Neuzeit wird der Delphinfang besonders an der
atlantischen Küste Nordamerikas mit starken Netzen eifrig betrieben
und scheint sich reichlich zu lohnen, da 3,5 m lange Stücke
des in allen gemäßigten und warmen Meeren verbreiteten großen
Delphins (Thursiops tursio) etwa 110 Liter Tran liefern.
Auch die in den großen Strömen Indiens und Südamerikas vorkommenden
Flußdelphine, die kaum über 2 m Größe hinausgehen, werden
vielfach ihres Fleisches und Tranes wegen gejagt.
Als Transpender viel wichtiger als diese Zwergwale sind die mancherlei
großen Robben, die heute eine Hauptbeute der Walfänger bilden.
Auch diese ins Wasser gegangenen Raubtiere haben sich weitgehend,
wenn auch lange nicht so wie die Wale, dem Wasserleben angepaßt. So
haben sie die beiden Hinterbeine zu einem kräftigen Ruderschwanze
zusammengelegt, der die vorwärtstreibende Kraft beim Schwimmen ist.
Beim Geradeausschwimmen werden die Vorderflossen an den Körper
angezogen gehalten und nur bei Richtungsänderung werden sie zu
Hilfe genommen. Am weitesten in der Umbildung der Hinterfüße zu
reinen Flossen ist der Seehund gegangen, der sich am Lande wie eine
Spannerraupe bewegt und sich durch rasch aufeinanderfolgende hüpfende
Bewegungen des ganzen Körpers vorwärts schnellt. Das geringste Maß
der Umbildung der Extremitäten zu Flossen zeigt das Walroß, das sich
durch die starke Verkürzung der Schenkelknochen auf dem Lande zwar
auch noch unbeholfen, aber doch ganz nach Art der großen Landtiere
vorwärtsbewegt, indem es je ein Vorder- und ein Hinterbein gleichzeitig
vorsetzt. Zwischen diesen beiden Extremen finden wir bei den Robben
alle möglichen Übergänge.
[S. 718]
Die Haut der Robben ist äußerst elastisch und liegt dem Körper
nur lose auf, damit sie sich bei der Anhäufung des Fettes im
Unterhautzellgewebe nach Belieben dehnen kann. Bei ihnen ist das
Haarkleid nur spärlich geworden und nicht ganz ausgemerzt wie bei den
Walen; es ist so reichlich mit Talg eingefettet, daß es durchaus kein
Wasser annimmt. Äußere Ohren, wenn auch sehr kleine, haben noch die
danach auch Ohrenrobben genannten Seelöwen. Die Ohröffnungen können
durch willkürliche Muskeln verschlossen werden. In der Ruhe sind die
schlitzförmigen Nasenlöcher durch elastische Knorpel verschlossen,
können aber willkürlich durch strahlig angeordnete Muskelbündel
geöffnet werden. Der Geruch ist außerordentlich scharf, wie überhaupt
das Gehirn ein verhältnismäßig hochentwickeltes Raubtiergehirn
darstellt, das von guter Intelligenz zeugt. Die Hornhaut der großen,
klug dreinblickenden Augen ist dem Brechungswinkel der Lichtstrahlen
im Wasser entsprechend flach gewölbt, während dafür die Linse als
Anpassung an das Wasserleben fast kugelig ist. Entsprechend der weichen
Fischnahrung sind die Zähne verhältnismäßig schwach, besonders die
Schneidezähne sehr klein und hinfällig. Das Milchgebiß verschwindet
schon vor oder unmittelbar nach der Geburt. Das Nahrungsbedürfnis ist
groß und der Stoffwechsel ein rascher. So frißt der gemeine Seehund
täglich etwa 7,5 kg Fische, der viel größere kalifornische
Seelöwe dagegen 20 kg. Am Herzen und an den großen Gefäßen sind
durch Erweiterungen und Auflösungen in sog. Wundernetze Vorrichtungen
getroffen, die es den Flossenfüßlern ermöglichen, verhältnismäßig
lange unter Wasser zu bleiben, ohne atmen zu müssen. Die Tiere leben
gesellig; die meisten derselben haben sog. „Brutplätze“, an denen
sie sich stets wieder zur Fortpflanzung einfinden. Zuerst erscheinen
auf denselben die Männchen, und zwar vorzugsweise alte, die höchst
eifersüchtig aufeinander sind und als Polygamisten möglichst viel
Weibchen für sich in Anspruch zu nehmen suchen. Bei ihren Kämpfen um
die Weibchen brüllen die größeren Robben, besonders die Walrosse,
furchtbar, während bei den kleineren die Lautäußerungen mehr dem Bellen
eines heisern Hundes gleichen, woher auch der Name „Seehund“ herrührt.
Bald nach der Ankunft der kleineren und schlankeren Weibchen an den
„Brutplätzen“ werfen sie ihr meist einziges Junges. Sehr selten werden
deren zwei geboren, die für junge Raubsäugetiere merkwürdig entwickelt
sind, so daß die gefährliche Zeit der Säugung je nach der Größe der
Art nur 4–8 Wochen dauert. Wie die eifersüchtigen Männchen während
des Bewachens der von[S. 719] ihnen erkämpften Weibchen ausschließlich vom
angesammelten Speck zehren, fressen auch die Weibchen auf dem Lande
nichts während der Säugungszeit, da sie von den Männchen gewaltsam vom
Besuche des Meeres abgehalten werden. Diese Robbenansammlungen bei
Gelegenheit der Fortpflanzung werden vom Menschen zum Robbenschlag
benutzt. Erst nach Verlust des sehr weichen Jugendkleides begeben sich
die jungen Flossenfüßler ins Meer, wo die Mütter sie schwimmen, tauchen
und Fische fangen lehren. Dabei werden sie von jenen aufs sorgsamste
beschützt. Die Weibchen haben 2–4 Paar weit nach hinten liegender
Zitzen und behalten die Jungen bis zur Geburt des folgenden Sprößlings
bei sich. Die Seehunde sind sehr liebenswürdige und gelehrige
Geschöpfe, die, abgerichtet, ihrem Herrn die Fische ins Netz treiben
und unschwer allerlei Kunststücke lernen.
Überall auf ihren „Brutplätzen“ werden die verschiedenen Robbenarten
mühelos erbeutet. So sind sie an vielen Orten beinahe ausgerottet
worden. Früher pflegte man in Grönland etwa 33000, bei Neufundland über
500000 und bei Jan Mayen mindestens 30000 Stück des bis 2 m lang
werdenden grönländischen Seehundes oder der Sattelrobbe
— so genannt von einem eigentümlichen an einen Sattel erinnernden
schwarzen Fleck auf dem Rücken (Phoca groenlandica) — jährlich
zu erbeuten, da dieses Tier in großen Scharen auftritt und deshalb
einen Hauptgegenstand der Robbenjagd im nördlichen Atlantischen
Ozean bildet. Die Sattelrobben waren einst so massenhaft auf ihren
„Brutplätzen“ vorhanden, daß eine Schiffsbesatzung an einem einzigen
Tage 500–800 erwachsene und 2000 junge Tiere tötete. Im Jahre 1866
erbeutete ein einziger Dampfer in neun Tagen deren 22000 Stück. So
wurde denn, um der Ausrottung des Tieres zu wehren, im Jahre 1876 den
britischen Untertanen eine Schonzeit für Sattelrobben auferlegt, ein
Beispiel, das bald darauf auch in anderen Ländern nachgeahmt wurde.
Von den andern hochnordischen Robbenarten, die mehr einzeln auftreten,
sich von der Küste stets fernhalten und im März auf Treibeis ihre
Jungen gebären, werden jährlich nur etwa je 1000–3000 Stück erbeutet.
Einer der mutigsten dieser Seehunde ist die von den Robbenschlägern
Klappmütze genannte Blasenrobbe (Cystophora
cristata), deren bis 3 m lang werdende Männchen einen mit
der Nase in Verbindung stehenden blasenartigen Sack willkürlich mit
Luft aufblähen können. Das nicht bloß von Fischen, sondern zum größten
Teil auch von Tintenfischen lebende Tier gehört zu den wandernden[S. 720]
Robbenarten und verteidigt sich nicht selten auch gegen den Menschen
so mutig, daß deren Jagd für die Eskimos in ihren leichten, aus
Robbenhaut verfertigten Booten nicht ungefährlich ist. Der größte
nordische Seehund ist die im männlichen Geschlecht eine Länge von 3
m erreichende Bartrobbe (Phoca barbata), die mehr
einsiedlerisch lebt, aber von den Eskimos gern gejagt wird, da ihre
dicke Haut zur Anfertigung von Harpunenleinen sehr geschätzt ist und
ihr Fleisch und Tran schmackhafter als die anderer Robben sein sollen.
Die größte Robbe ist die in den Männchen bis 6 m Länge und ein
Gewicht von über 3000 kg erreichende Elefantenrobbe
(Macrorhinus leoninus), die ihren Namen davon hat, daß die
Männchen nicht den gewöhnlichen Robbenkopf der Weibchen und Jungen
haben, sondern einen kurzen, gewöhnlich schlaff herunterhängenden,
aber willkürlich aufblähbaren, an der Spitze schief abgeschnittenen
Rüssel haben, der den Tieren ein höchst sonderbares Aussehen verleiht.
Die Elefantenrobbe bewohnt das Südpolarmeer bis in die gemäßigteren
Regionen und geht in einer Abart an der Westküste Amerikas bis über
Kalifornien hinauf. Vor 20–30 Jahren war sie noch ziemlich häufig, ist
aber überall infolge der unsinnigen Verfolgung recht selten geworden.
Dies läßt sich sehr wohl begreifen, da die Tranausbeute bei alten,
gut genährten Männchen gegen 1000 Liter beträgt. Vor 60 und 70 Jahren
wurden allein an der patagonischen Küste jährlich durchschnittlich
40000 Elefantenrobben erschlagen. Auf den Kerguelen, die bei ihrer
Entdeckung von ihnen wimmelten, hatten einmal nordamerikanische
Robbenschläger, die rohesten und rücksichtslosesten dieser
Mordgesellen, so ungeheure Mengen Tran von diesen Tieren eingeheimst,
daß der Markt damit überfüllt war und sie keinen Absatz dafür fanden.
Kurz entschlossen verbrannten sie die zahllosen mitgebrachten mit Tran
gefüllten Fässer, um nicht die Preise zu drücken. Welche Niedertracht
liegt nicht in solch unsinniger Handlung!
Weniger der Gefahr der Ausrottung ausgesetzt als die Elefantenrobbe ist
das das nördliche Eismeer und die nördlichen Teile des Atlantischen und
Stillen Ozeans in zwei Unterarten bewohnende wehrhafte Walroß
(Trichechus rosmarus), die ungeheuerlichste aller Robben, von
der im Mittelalter die wunderlichsten Sagen in Europa kursierten.
Einen eingezalzenen Kopf desselben sandte ein Bischof von Drontheim
1520 an den Papst Leo X. nach Rom; dieser wurde in Straßburg
abgezeichnet und der Züricher Naturforscher Konrad Geßner gab eine
ziemlich richtige Beschreibung von ihm. Einen guten, aus[S. 721]führlichen
Bericht von ihm gab erst Martens von Hamburg, der zu Ende des 17.
Jahrhunderts das Walroß im Eismeere selbst zu sehen bekam. Das Tier
erreicht bei einem Umfang von 2,5–3 m und einem Gewicht bis
1500 kg eine Länge von 4,5 m. Das Gebiß des jungen
Walrosses ist demjenigen der Ohrenrobben ähnlich zusammengesetzt. Von
den ursprünglich 30 Zähnen behalten ausgewachsene Walrosse nur 18, von
denen die zwei oberen wurzellosen Eckzähne zu gewaltigen Hauern werden,
die nahezu 80 cm lang und gut 4 kg schwer werden können.
Infolge der rücksichtslosen Verfolgung sind aber Hauer von solcher
Größe selbst bei ausgewachsenen Männchen jetzt schon sehr selten.
Eckzähne von 60 cm Gesamtlänge und 2 kg Gewicht können
schon als stark entwickelt gelten und ragen etwa 45 cm weit aus
dem Kiefer hervor. Die Eckzähne der weiblichen Walrosse werden selten
mehr als 50 cm lang. Beim pazifischen Walrosse mit breiterer und
höherer Schnauze sind sie länger und stärker, dazu mehr gegeneinander
geneigt. Sie dienen dem Tiere dazu, seinen unförmlichen Körper aus dem
Wasser aufs Eis hinaufzuziehen und unterstützen es auch bei seinem
unbeholfenen Forthumpeln über Land. Der Hauptdienst aber, den sie
seinem Träger leisten, besteht darin, daß das Walroß mit ihnen Schlamm
und Sand gewissermaßen durchpflügt, um darin nach Schaltieren zu
suchen. Außer Tintenfischen, Fischen und Krebsen sind nämlich Muscheln
die Hauptnahrung dieser Tiere, die deren Schalen mit ihren Mahlzähnen
zertrümmern und dann wieder ausspucken. Mit der Beschaffenheit ihrer
Nahrung hängt es zusammen, daß die Walrosse sich selten auf hohem
Meere, sondern meist in der Nachbarschaft des Ufers aufhalten, und zwar
in mehr oder weniger großen Herden, deren Gebrüll man schon aus weiter
Entfernung vernimmt. Ihrer Herdentiernatur entsprechend tun sie sich
zur Verteidigung eines verwundeten Genossen zusammen und greifen dann
ungescheut feindliche Boote an, die sie mit ihren mächtigen Hauern
leicht zum Kentern bringen. Außer auf dem Lande werden sie auch vom
Wasser aus in besonders dafür gebauten starken Booten verfolgt, wobei
man ihnen den Rückzug ins Wasser zu verlegen sucht; denn die das Meer
erreichenden Stücke entkommen dem Jäger gewöhnlich. Man sucht sie
mit Harpunen zu spießen, um sie dann ans Land zu ziehen und dort mit
langen Lanzen oder durch Büchsenschüsse zu töten. Fett liefern die
Walrosse zwar verhältnismäßig weniger als die eigentlichen Robben,
denn die größten Stücke geben selten mehr als 250 kg. Auch ist
das Walroßfett weniger fein als[S. 722] das Robbenfett. Die 2,5–4 cm
dicke Haut wird zu Sattelzeug, besonders zu starken Schuhsohlen und
Ruderriemen verarbeitet. Wertvoller als sie sind die allerdings den
Elefantenstoßzähnen weit an Güte nachstehenden Hauer, die in Amerika
1879 nur 40 Cents, 1883 aber schon 41⁄2 Dollar das Pfund kosteten.
Während die Walrosse früher an den Küsten Nordeuropas in größerer
Zahl vorkamen und südwärts bis Schottland wanderten, sind sie heute
selbst auf Grönland und Spitzbergen so selten geworden, daß sich ihre
Erbeutung nur noch als Nebenbetrieb des Walfanges lohnt. Auf der
Bäreninsel beim Nordkap wurden bei einer Gelegenheit deren innerhalb
sechs Stunden nicht weniger als 600–700 getötet und ein anderes Mal in
kaum sieben Stunden 900–1000 abgeschlachtet. In weniger als acht Jahren
waren sie dort ganz ausgerottet. Auf einer Insel bei Spitzbergen stach
man an einem einzigen Tage über 900 Walrosse tot, die man unbenutzt
liegen ließ, da man auf das Wegschaffen einer solchen Beute nicht
eingerichtet war. Ähnlich sinnlos wurde auch anderwärts gegen diese
auf dem Lande wehrlosen Tiere vorgegangen. Bei Labrador tötete die
Besatzung des französischen Schiffs Bonaventura im Jahre 1589 1500
große und kleine Walrosse auf einer kleinen Insel, und 1593 tötete die
Besatzung eines französischen Schiffes so viele derselben, daß deren
Knochen noch jahrelang künstliche Strandstrecken bildeten. Zu jener
Zeit scheinen Walroßhauer sehr geschätzt gewesen zu sein und wurden
fast ausschließlich an den Tieren benutzt; sie kosteten doppelt so
viel als das beste Elfenbein und wurden zu Kämmen und Messerschalen
verarbeitet. Das pazifische Walroß war niemals so verbreitet als das
atlantische. Sein Vorhandensein im nördlichen Stillen Ozean wurde um
die Zeit von 1640–1645 bekannt; aber eine regelrechte Jagd auf es
begann erst 1680, da der Walfang bis dahin viel vorteilhafter war.
Mit der zunehmenden Verminderung der Wale wandten sich die Walfänger
mehr und mehr dem Walroß zu, und zwischen 1870 und 1880 wurden rund
2 Millionen Gallonen Walroßtran und 400000 Pfund Walroßzähne auf den
Markt gebracht, was einer Beute von etwa 100000 Walrossen entsprach.
Ebenso mitleidlos schlachtete der Mensch einen andern Riesen der
Schöpfung ab, so daß dieses Wunder der Natur bald nach seinem
Bekanntwerden überhaupt ausgerottet war. Es ist dies das gewaltige
Borkentier, eine 7,5–9 m Länge mit einem Bauchumfang von
5,5 bis 6 m und einem Gewicht von 4000 kg aufweisende
Seekuh, mit der am 12. Juni 1742 die schiffbrüchigen Leute des im
Jahre zuvor[S. 723] auf der nach ihm benannten Insel verstorbenen jütischen
Schiffskapitän in russischen Diensten Vitus Bering bekannt geworden
waren. Nach dem Arzte der Expedition, G. W. Steller, einem eifrigen
Naturforscher, der die erste Beschreibung dieses merkwürdigen Tieres
gab, wird es auch Stellersche Seekuh (Manatus gigas)
genannt. Die 4 cm dicke, dunkelgefärbte Lederhaut war so rauh
und runzelig, daß sie von Steller der Rinde oder Borke eines Baumes
verglichen wurde. Dieses stumpfsinnige Tier lebte gesellig in Herden
in der Nachbarschaft von Flußmündungen und fraß Tang, namentlich die
dort in reichlicher Menge vorkommenden Laminarien. Ihr Unvermögen
zu Tauchen zwang diese unbeholfenen Geschöpfe ihre Nahrung in
seichtem Wasser zu suchen, und da Stürme und Eis die Küsten ihres
nordpazifischen Wohngebiets oft schwer zugänglich machten, waren die
Tiere im Frühling gewöhnlich stark abgemagert. Auf diesen leicht zu
erbeutenden Fleischlieferanten aufmerksam geworden, lebten in der Folge
alle Pelzjägerexpeditionen von ihm und nahmen große Vorräte von dessen
Fleisch eingesalzen mit sich fort. Die Pelzjäger pflegten sich dem
unbeholfenen Tier, während es in seichtem Wasser lag, vorsichtig zu
nähern und zu versuchen, ihm einen tödlichen Lanzenstich beizubringen.
Natürlich wurden so nur wenig Seekühe auf der Stelle getötet; die
Mehrzahl entfloh ins tiefere Wasser, unterlag dort der Verwundung, um
dann später ans Ufer gespült zu werden und nutzlos zu verfaulen, zumal
das Borkentier so schnell in Verwesung überging, daß sein Fleisch schon
24 Stunden nach dem Tode wertlos war. Von den 1500–2000 Borkentieren
auf den 15 für sie geeigneten Weideplätzen der Beringinsel wurde das
letzte 1767 oder 1768 getötet. Im Jahre 1754, nur neun Jahre nach
der Entdeckung der Insel, war das Borkentier auch auf der kleinen
Kupferinsel ausgerottet. Bis zum Jahre 1883 waren zwei Skelette in
den Museen von St. Petersburg und Helsingfors und zwei im Britischen
Museum in London aufbewahrte Rippen alles, was der Wissenschaft von
Überbleibseln dieses Wunders der Schöpfung übrig geblieben war. Da
brachte der im Auftrag des Nationalmuseums der Vereinigten Staaten zur
Forschung nach Borkentierskeletten ausgesandte Stejneger im Laufe von
zwei Jahren noch ansehnliche Reste von Schädeln und Knochen zusammen,
die sich in verschiedenen Tiefen des Sandes fanden und dadurch
aufgefunden wurden, daß man eiserne Stäbe in den Sand hineinstieß.
Viele Knochen fanden sich so weit vom Ufer entfernt, daß die Annahme
naheliegt, die Insel habe sich seither gehoben.
[S. 724]
Dieselbe geistige Beschränktheit haben die anderen noch existierenden,
gesellig als Pflanzenfresser an seichten, tangbewachsenen Küsten oder
im Süßwasser lebenden Seekühe. Wie den Walen fehlen ihnen die
hinteren Gliedmaßen und ist infolgedessen das Becken verkümmert, so daß
dessen Reste teilweise gar nicht mehr mit dem übrigen Skelett verbunden
sind. Die Knochen, besonders des Kopfes und der Rippen, entbehren
einer Markhöhle, sind massig und schwer, um das Sinken dieser Tiere
an ihren Weideplätzen zum Abgrasen des Seetangs zu erleichtern. Sie
haben einen deutlich abgesetzten Hals mit nicht verwachsenen Wirbeln,
im Gegensatz zu den äußerlich ganz zu Fischen gewordenen Walen. Die
äußere Gehöröffnung erinnert durch ihre auffallende Kleinheit noch an
die Wale, aber Augen und Nase liegen oben am Kopf an ihrer gewöhnlichen
Stelle, die äußeren Nasenlöcher sind mit einer Klappe versehen. Das
Zwerchfell steigt von vorn unten auffallend schräg nach hinten oben, so
daß sich die Brusthöhle nach rückwärts fast über die ganze Bauchhöhle
hinweg erstreckt. Mit den sehr geräumigen Lungen können die Tiere ohne
einzuatmen bis 8 Minuten aushalten. Die Mundhöhle ist mit hornigen
Kauplatten versehen und die Backenzähne wachsen zeitlebens nach, indem
sie entsprechend der Ausnutzung nach und nach erscheinen. Die Hände
haben bloß vier Finger, jeder aus drei schlanken Gliedern bestehend und
durch eine gemeinsame Haut vereinigt. Zu Beginn des Frühjahrs kämpfen
die Männchen um den Besitz der Weibchen, die nach längerer Tragzeit
stets nur ein Junges werfen, das sie mit größter Mutterliebe umgeben
und beim Säugen mit einer der Flossen an eine der beiden brustständigen
Zitzen halten. Ihre Stimme besteht in einem schwachen, dumpfen Stöhnen,
während des Atmens vernimmt man auch ein heftiges Schnauben. Von ihnen
finden Fleisch und Speck, Haut und Zähne Verwendung.
An den Küsten des Indischen Ozeans lebt der nach der malaiischen
Bezeichnung für Meerkuh genannte Dujong (Halicore
dujong). Halicore heißt Seemaid, so auch deutsch geheißen
nach der schon von Plinius und Älian erzählten Fabel, daß an den Küsten
Indiens Seetiere in Gestalt von Satyrn mit Weibergesichtern leben,
deren Körper nach hinten in lange, gewundene Schwänze auslaufen und
die statt der Füße Flügel haben. Nachts kämen sie aus dem Wasser ans
Land, um Gras und Palmenfrüchte zu fressen, und in der Morgendämmerung
kehrten sie ins Meer zurück. Dieser 3–5 m lange Dujong bevorzugt
die Nähe der Küste, die reich mit ihnen Nahrung bietenden Meeresalgen
bewachsen ist, und lebt dort paarweise oder in kleinen Familien,[S. 725] alle
paar Minuten zum Atmen an die Wasseroberfläche kommend und dann langsam
wieder in die Tiefe versinkend. So lange es noch Nahrung an einer
Stelle gibt, verändert das faule Tier kaum seinen Aufenthaltsort. Erst
wenn eine Meerwiese abgeweidet ist, siedelt es langsam nach anderen
tangbewachsenen Stellen über, welche ihm wieder eine Zeitlang Nahrung
liefern. Besonders die Jungen haben äußerst zartes, weniger fettes,
süßliches Fleisch, das vom Menschen sehr begehrt ist, weshalb die Tiere
von den Anwohnern gern gejagt werden. Das an der Luft getrocknete harte
Leder gibt vortreffliche Sandalen.
Während der Dujong höchstens Flußmündungen aufsucht, geht der die
Ostküste Mittel- und Südamerikas und die Westküste Afrikas bewohnende
ebenso große und bis 400 kg schwere Lamantin — eine
französische Verballhornung des spanischen Manati, d. h. mit Händen
versehen — (Manatus latirostris und andere Arten) von den
Küsten weit die Flüsse aufwärts und bei Überschwemmungen auch in
Seen und Sümpfe, wo er die an ruhigen Stellen reichlich wachsenden
Wasserpflanzen abweidet. Da auch sein Fleisch vorzüglich, wenn
auch ziemlich fett ist, wird ihm überall mit Eifer nachgestellt.
Eingesalzen und getrocknet bleibt es sehr lange gut und soll nach einem
Schriftsteller des 16. Jahrhunderts sogar Gnade vor den Feinschmeckern
am spanischen Hof gefunden haben. Unter den fortwährenden Verfolgungen
ist er an den meisten Stellen, wo er einst sehr häufig war,
verschwunden und allgemein sehr selten geworden. Die weit ins Innere
hineingehende westafrikanische Art ist schwarzgrau und wird nur etwas
über 2 m lang. Die bleigraue gewöhnliche südamerikanische Art
wird selten über 3 m lang und bildete einst ein beliebtes
Jagdobjekt für die Eingeborenen, denen sein schmackhaftes Fleisch als
besonders lecker gilt.
Endlich wäre noch als einst für die Seefahrer wichtiger Fett- und
Fleischlieferant die Dronte oder der Dodo (Didus
ineptus) zu nennen. Dodo kommt vom portugiesischen doudo,
d. h. Tölpel. Dieser Name wurde dem reichlich truthahngroßen Girrvogel
der Insel Mauritius gegeben, weil er äußerst wenig scheu, wozu seine
geringe geistige Begabung beigetragen haben mag, mit ungemein plumpem,
schwerfälligem Körper auf kurzen, watschelnden Beinen dem Menschen
entgegentrat. Der große Kopf trug einen starken, hakenförmigen
Schnabel; der Körper war spärlich mit lockerem, grauem, auf der Brust
braunem Gefieder bedeckt und trug an Flügel und Schwanz gelbliche oder
schmutzigweiße steife Federn. Infolge Fehlens von Feinden hatten diese
Vögel ihre Flugfähigkeit eingebüßt und sich durch reichliche Ernährung
zu[S. 726] den reinsten Fettkugeln entwickelt, die den ersten Schiffen, die
dort landeten, willkommenen lebenden Proviant lieferten. Als erster
schreibt der holländische Admiral Jakob Cornelius van Neck von ihm als
Walckvogel, rühmt aber sein Fleisch nicht besonders. Besser mundete
es der Mannschaft des 1601 auf Mauritius landenden holländischen
Schiffes eines gewissen Wilhelm van West-Zannen, den die reiche Beute
sogar zu einem Gedicht begeisterte. An einem Tage erbeutete seine
Mannschaft 24, am folgenden 20 der großen, überaus schweren Vögel,
von denen sie insgesamt nicht einmal zwei bei einer Mittagsmahlzeit
verzehren konnten. Bei der Abfahrt nahm sie einen großen Vorrat an
eingesalzenen Dronten mit. Andere holländische Schiffe folgten dem
Beispiele Zannens, schwelgten in Dodo- und Landschildkrötenfleisch,
nahmen Mengen von eingesalzenen Vögeln mit und ließen die Reihen der
Dronten stark gelichtet zurück. Deshalb ist es nicht zu verwundern, daß
sich der letzte Bericht über lebende Dronten im Schiffstagebuche des
englischen Steuermanns Benjamin Harry findet, der Mauritius im Jahre
1681 besuchte. Schon 1693, also noch nicht ein Jahrhundert nach seiner
Entdeckung, war die Dronte ausgerottet; denn Leguat, der sorgfältige
Beschreiber eines damit verwandten, etwas weniger schwerfällig
gebauten, ebenfalls längst ausgerotteten Vogels, des Einsiedlers
(Pezophaps solitaria) der Insel Rodriguez, erwähnte sie nicht
mehr und bemerkt überdies, daß Wasserhühner und Schildkröten dort
selten geworden seien. Kurz nach der Ausrottung der Dronte verließen
die Holländer, die bis dahin Mauritius besetzt hielten, die Insel, von
der die Franzosen 1715 Besitz ergriffen, um sie 1811 an die Engländer
abzutreten. Dieser wiederholte Besitzwechsel hatte zur Folge, daß
alles Wissen über den sonderbaren Vogel verloren ging und nicht einmal
in der mündlichen Überlieferung weiterlebte. Auch waren die wenigen,
übrigens längst verloren gegangenen, in Museen aufbewahrten Stücke des
Dodo so wenig bekannt, daß selbst einige Naturforscher am früheren
Vorkommen eines solchen Vogels zu zweifeln begannen. Diese Zweifel
wurden jedoch durch verschiedene Veröffentlichungen wieder zerstreut,
und im Jahre 1866 gelang es, beträchtliche Mengen von Dronteknochen
zu sammeln. Sie fanden sich ausschließlich im Bodenschlamm des unter
dem Namen mare aux songes, d. h. Traumpfütze, bekannten großen
Moores, das mit dem Land herum noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts
dicht mit großen Bäumen bedeckt war, deren Früchte einst den Dronten
zweifellos als Nahrung dienten. Die hier gefundenen Überreste scheinen
von einst friedlich hier verstorbenen[S. 727] Dronten zu stammen; denn keiner
unter den im Moore aufgefundenen Knochen zeigt Spuren einer Benagung.
Als einzige Darstellung der Dronte sind solche auf zwei Gemälden von
Roland Savary und seinem Neffen Johann, holländischen Malern aus der
ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, auf uns gekommen. Diese malten den
Vogel nach lebend nach Holland gebrachten Exemplaren. So räumt der
Mensch unbarmherzig und gedankenlos mit allem auf, was sich ihm in
der Schöpfung an wehrlosen, aber ihm irgendwie nützlichen Geschöpfen
entgegenstellt.
[S. 728]
XXIX. Tiere als Spielzeug.
Von jeher hat der Mensch, wie wir schon in der Einleitung dieses
Buches bemerkten, jung eingefangene und sich dann leichter an seine
Gesellschaft gewöhnende Tiere zu keinem andern Zweck als zu seiner
und der Seinen Unterhaltung in seinen Niederlassungen gehalten.
Alteingefangene Männchen von solchen Tierarten, die als eifersüchtige
Nebenbuhler gern miteinander kämpfen, ließ er zu seiner Belustigung
gegeneinander los und freute sich, wenn sie sich recht zerzausten.
Nach Überwindung des kommunistischen Urzustandes und der Erwerbung
von Besitz ging er mit seinen Genossen Wetten ein, setzte für den
Gewinnenden Preise aus und erhob das Spiel zum Sport. Die Wetten
bildeten später einen Hauptzweck solcher Tierkämpfe, seien die
Ausübenden Grillen, Wachteln, Hähne, Gänse oder Widder. Mit der
Verrohung der Massen bei durch zahlreiche Kriege an Blutvergießen
gewöhnten Stämmen hatten solche Kämpfe nur Reiz, wenn sie blutig
endeten und wenn möglich, auf Leben und Tod gingen. So hefteten die
Malaien ihren Kampfhähnen haarscharf geschliffene Stahlklingen an ihre
Sporne, mit denen sich die Duellanten sehr oft gegenseitig erstachen.
Im alten Rom wurden diese blutigen Tierkämpfe zu Massenabschlachtungen
gesteigert, in denen selbst Menschen auftraten, um miteinander zu
kämpfen und sich nach dem Willen des Pöbels abzustechen. Es sind
dies die bekannten Gladiatorenkämpfe, die aus Fechterspielen
bei Gelegenheit des Begräbnisses hervorragender Männer hervorgingen,
wie sie zuerst die Etrusker und dann auch die Römer in jenen Zeiten
ausübten, als auf dem Forum bei der Bestattung eines Feldherrn die
Kriegsgefangenen, die er erbeutet, zu Ehren des Totengeistes des
Verstorbenen auf Tod und Leben miteinander kämpfen mußten. Vielfach
ließ man auch an solchen Leichenspielen schwere Verbrecher gegenseitig
an sich das Todesurteil vollziehen. Das taten diese nicht ungern;
denn Seneca sagt in einer seiner Episteln, daß ein solcher lieber[S. 729]
öffentlich kämpfend in der Arena sterbe, als daß er sich in einem
geschlossenen Raum hinrichten lasse. Und zu diesem Schauspiel wurde das
Volk eingeladen, wie noch im 18. und 19. Jahrhundert das Henken und
Köpfen vor großem Publikum geschah. Wer von diesen Verurteilten brav
focht und durch seine Tapferkeit Bewunderung erregte, dem wurde vom
Volke durch Akklamation das Leben geschenkt. Auch viele Kriegsgefangene
und mißliebige Sklaven wurden als Gladiatoren verhandelt. Gewöhnlich
standen sie bei jedem Gefecht etwa hundert gegen hundert, die einen
mit großen, die andern mit kleinen Schilden, die einen mit Netz und
Harpune, die anderen mit Schwert oder Dolch, alle aber mit kostbaren
Helmen, vielfach aus purem Silber mit Edelsteinen eingelegt, mit
Pfauenfedern als Helmbusch versehen. Zum Kampf erscholl grelle Musik,
um das Stöhnen und Todesröcheln der Sterbenden zu übertönen. Die
Leichen wurden fortgeschafft, frischer Sand in die Blutlachen gestreut
und das Volk ging befriedigt nach Hause. Die gewandten Fechter aber,
denen es gelang, solche Schlachten zu überleben, wurden die Helden des
Tages und Lieblinge des Publikums, wie es heute den Stierkämpfern in
Spanien ergeht, und der Festgeber beschenkte sie in der Arena selbst
mit Schüsseln voll blinkenden Goldes. In der Kaiserzeit waren solche
Gladiatorenkämpfe bei allen festlichen Anlässen zu sehen, und bei den
viermonatlichen Siegesfesten des Trajan im Jahre 107 sollen im ganzen
10000 Mann gefochten und zum größten Teil ihren Tod gefunden haben.
Für diese Massenkämpfe und die alsbald zu besprechenden Tierhetzen
wurden mit ungeheuerem Aufwand luxuriöse Arenen gebaut, die möglichst
die ganze freie Stadtbevölkerung aufnehmen sollten. Denn auch die
Frauen erschienen zu solchen Schauspielen und brachten selbst die
Kinder mit. Während sie im Zirkus mitten unter den Männern saßen, waren
sie im Amphitheater von ihnen getrennt. Rom gelangte zuerst im Jahre
29 v. Chr. durch den reichen Statilius Taurus zu einem Amphitheater.
Dieser Bau wurde aber durch das meist als Colosseum bezeichnete
berühmte flavische Amphitheater übertroffen, das vom Kaiser Vespasian
erbaut und im Jahre 80 von dessen Sohn Titus eingeweiht wurde. Es war
185 m lang, 156 m breit und 50 m hoch, besaß 80
Portale und faßte 85000 Zuschauer. Die Arena selbst war 86 m
lang und konnte nebst dem Zuschauerraum mit einem etwa 180 m
langen Zelttuche gegen die Sonne überspannt werden. Unter ihr waren
weite Hohlräume, aus denen wie durch Zauber ganze Kämpfergruppen
und Scharen von wilden Tieren emporgehoben werden konnten. Auch[S. 730]
vermochte man sie unter Wasser zu setzen, um ganze Seeschlachten darin
vorzuführen. Wurde des Kaisers Anwesenheit erwartet, so erschien das
ganze Publikum weiß gekleidet und bekränzt. Solche Festtage waren in
Rom durchaus keine Seltenheit. Hören wir doch gelegentlich, daß es
dort jährlich 175 regelmäßige Spieltage gab, die außerordentlichen bei
Triumphen usw. gar nicht gerechnet. Davon entfielen 10 Tage auf die
Gladiatorenkämpfe, 64 auf Wagenrennen, 101 dagegen auf das Theater, in
welchem vorzugsweise operettenhafte Possen, deren Coupletmelodien man
auf allen Gassen pfiff, mit allerlei Anzüglichkeiten auf stadtbekannte
Personen, und zweideutige Pantomimen aufgeführt wurden. Am meisten
zogen beim rohen Pöbel die Fechterspiele und Tierhetzen, bei denen
Blut in Strömen floß und die Arena voller Leichen lag. Das gab eine
Aufregung, wenn man seltene wilde Tiere miteinander kämpfen und sterben
sah! Da füllten sich schon vor Sonnenaufgang die Zuschauerränge,
um ja einen guten Platz bei solchen interessanten Tierhetzen zu
erhalten. Das fesselndste dieser Schauspiele waren die eigentlichen
Jagden, venationes genannt, bei denen ungeheuere Mengen von wilden
Tieren von besonders dazu angestellten Leuten verfolgt und erlegt
wurden. So wurden in der Kaiserzeit alle größeren Tiere der damals den
Römern zugänglichen Welt nicht nur in einzelnen Exemplaren, sondern
gelegentlich in ganzen Scharen dem nach Unterhaltung verlangenden Volke
in der Arena vorgeführt und von gut geschulten, gut bewaffneten und
von starken Hunden unterstützten Jägern, die ihr Handwerk trefflich
verstanden, zum Gaudium des Pöbels kunstgerecht gejagt und schließlich
abgeschlachtet. Nur seltene Tierarten wurden verschont, um späterhin
abermals bei solchen Jagden auftreten zu können. Hauptsächlich waren
es dem Menschen gefährliche Raubtiere, die bei diesen Jagdspielen
auftraten und zur Belustigung des festfeiernden Volkes getötet wurden,
so vor allem Bären, Panther, Tiger, Löwen und Hyänen, seltsamerweise
aber nicht der Wolf. Der mochte für jenes Vergnügen zu gemein und wegen
seiner Feigheit reizlos zum Abschlachten sein. Selten kamen harmlose
große Bestien wie Flußpferde und Giraffen aus dem fernen Afrika in
die Arena, um dem Volke, das damals noch keine zoologischen Gärten
kannte, vorgeführt zu werden. Nach Plinius zeigte Marcus Scaurus in Rom
bei den Spielen, die er als Ädil gab, das erste Flußpferd nebst fünf
Krokodilen, und hatte dazu einen besonderen Teich graben lassen. Nach
Dio Cassius wurde bei den feierlichen Spielen, die Kaiser Augustus gab,
wiederum ein Flußpferd gezeigt und erlegt. Zur Zeit Heliogabals und der
Gordiane waren in Rom im Amphi[S. 731]theater Flußpferde zu sehen, die damals
wegen der vielen Verfolgungen schon nicht mehr in Ägypten vorkamen,
sondern aus dem Lande der Blemmyer im Sudan geholt werden mußten, also
zweifellos sehr teuer zu stehen kamen. Nach Plinius sah man in Rom die
erste Giraffe bei den Spielen, die der Diktator Cäsar gab, und seitdem
öfter. Nach Flavius Vopiscus gab es zur Zeit des Aurelian mehrere
Giraffen in Rom, und zwar nach Julius Capitolinus zur Zeit der Gordiane
nicht weniger als zehn. Was mögen diese Tiere, die weither vom oberen
Nilgebiet bezogen wurden, bei den mangelhaften Verkehrsverhältnissen
jener Zeit für eine umständliche Reise hinter sich gehabt haben, bis
sie dem verwöhnten Pöbel in Rom gezeigt werden konnten!
Nach dem Geschichtschreiber Dio Cassius ließ der römische Kaiser
Caligula in Rom 400 Bären auf dem Kampfplatz erscheinen und mit
großen Hunden und schwerbewaffneten Gladiatoren kämpfen. Und Julius
Capitolinus berichtet, daß Gordian I., als er unter Caracalla
und Alexander Severus Konsul war, an einem Tage in Rom 100 libysche
Bestien, an einem andern 1000 Bären im Amphitheater auftreten und
töten ließ. Als er zum sechsten Male Spiele gab, wurden im ganzen 200
Damhirsche, 30 wilde Pferde, 100 wilde Schafe, 10 Elche, 100 kyprische
Stiere, 300 Strauße, 30 wilde Esel, 150 Wildschweine, 200 Steinböcke
und ebensoviel Antilopen dem Volke preisgegeben. Und unter seinem
Enkel Gordian III. (238–244) wurden einmal in Rom 32 Elefanten,
10 Elche, 10 Tiger, 60 zahme Löwen, 30 zahme Leoparden, 10 Hyänen, 1
Flußpferd, 1 Nashorn, 10 große Löwen, 10 Giraffen, 20 wilde Esel, 40
wilde Pferde und noch zahllose derartige Tiere auf die Arena geführt
und bei den Jagdspielen getötet.
In seiner Biographie des Kaisers Probus (276–282) schreibt Flavius
Vopiscus: „Probus gab im Zirkus ein ungeheures Jagen und überließ
dem Volke die Tiere. Dabei verfuhr er so: Erst ließ er von Soldaten
entwurzelte Bäume im Zirkus pflanzen und wartete ab, bis sie mit grünem
Laube prangten. Als nun der Wald fertig war, wurden alle Zugänge
geöffnet: Es kamen 1000 Strauße in die Arena hinein, dann 1000 Hirsche,
1000 Wildschweine, 1000 Antilopen, Steinböcke, wilde Schafe und andere
graßfressende Haartiere, soviel man hatte auftreiben und füttern
können. Jetzt wurde auch das Volk hereingelassen und jeder packte und
behielt, was ihm beliebte. Am folgenden Tage ließ er im Amphitheater
auf einmal 100 mit Mähnen prangende Löwen los, deren Gebrüll wie Donner
rollte. Sie wurden sämtlich mit sarmatischen Speeren erlegt. Nach
ihnen traten 100 li[S. 732]bysche Leoparden auf, dann 100 syrische, ferner
100 Löwinnen und 300 Bären. Übrigens war das ganze Schauspiel mehr
großartig als hübsch.“
Nach Plinius hat zuerst Quintus Scaevola als Ädil mehrere Löwen in
Rom kämpfen lassen. Dann ließ Lucius Sulla, der spätere Diktator, als
Prätor zuerst 100 alte bemähnte Löwen kämpfen, später Pompejus in der
Rennbahn 600 Löwen, worunter 315 mit Mähnen, und Cäsar als Diktator 400
Löwen. Gezähmte Löwen hat nach demselben Autor zuerst Marcus Antonius,
der Triumvir, vor den Wagen gespannt, und zwar nach der Schlacht bei
Pharsalos, wo er von Augustus besiegt worden war. Nach Dio Cassius
gab Pompejus bei der Einweihung des von ihm erbauten Theaters außer
Wettrennen, Schauspielen, Konzerten und gymnastischen Spielen auch
Tierhetzen im Amphitheater, wobei in der Zeit von fünf Tagen 500 Löwen
erlegt wurden und 18 Elefanten mit bewaffneten Männern kämpften. Und
Julius Capitolinus berichtet, daß bei Jagdspielen, die Kaiser Antoninus
Pius (der Adoptivsohn Kaiser Hadrians, regierte von 138–161) gab,
Elefanten, gefleckte Hyänen, Krokodile, Flußpferde, Tiger und andere
Tiere aus allen Weltgegenden auftraten. Damals wurden auf einmal 100
Löwen auf den Kampfplatz gelassen.
Wie an den morgenländischen Fürstenhöfen gab es gelegentlich auch
im Kaiserpalast in Rom gezähmte große Raubtiere als Begleiter der
Cäsaren, wie am Schlusse des XII. Abschnittes über die Katzen
berichtet wurde. Die sich als Götter fühlenden halbverrückten Kaiser,
wie Caracalla (212–217) und Heliogabalus (218–223) ließen sich wie
die ihnen vorschwebenden Vorbilder aus dem Olymp gelegentlich von
bestimmten wilden Tieren auf ihrem Zweigespann ziehen, so ersterer von
Löwen mit der Behauptung, er sei die Göttin Cybele, die man sich von
Löwen gezogen vorstellte, und letzterer nach Lampridius von Tigern als
angeblicher Bacchus; der Tiger war ja mit seinem buntgefleckten Fell
das Leibtier jenes angeblich aus Indien nach den Mittelmeerländern
gekommenen Gottes der Fruchtbarkeit und des Lebensgenusses. Älian sagt,
daß unter den Geschenken, welche die Inder ihrem Könige darbringen,
auch zahme Tiger seien. Aus Indien gelangten solche auch nach Westasien
und in den Machtbereich des römischen Reichs. Nach Plinius hat
Pompejus den ersten zahmen Tiger, den er aus Kleinasien im Jahre 63
v. Chr. mitbrachte, zu Rom in einem Käfig gezeigt. Nach ihm zeigte
Claudius, der Stiefsohn des Augustus, der nach Caligulas Ermordung
im Jahre 41 von den Prä[S. 733]torianern zum Kaiser ausgerufen wurde, deren
vier zu gleicher Zeit. Afrikanische Panther durften nach einem alten
Senatsbeschluß nicht nach Italien gebracht werden. Doch setzte nach
Plinius der Volkstribun Cnäus Aufidius beim Volke ein Gesetz durch,
wonach sie wenigstens zur Verwendung bei Jagdspielen im Amphitheater
nach Rom gebracht werden durften. Scaurus habe als Ädil zuerst 150 nach
Rom kommen lassen, dann Pompejus 410 und der vergötterte Augustus 420.
Alle wurden bei Jagdspielen im Zirkus Maximus zur Unterhaltung des
römischen Plebs getötet.
Derselbe Autor sagt, daß Pompejus zum erstenmal den nordischen Luchs
bei den zirzensischen Spielen in Rom vorführte. Sein Beispiel ist
späterhin kaum je nachgeahmt worden, da dieses Tier zu klein ist, um
Aufsehen zu erregen, was doch der Hauptzweck dieser Tierkämpfe war.
Dagegen war, wie oben geschildert, der grimmige Bär ein dankbares
Objekt, das besonders in der Arena der nördlich der Alpen gelegenen
Theater, die dieses Tier aus den ausgedehnten Wäldern der Umgebung
sich leicht verschaffen konnten, häufig aufzutreten hatte und von
Hunden gehetzt wurde und mit Menschen kämpfte. Auch dieses Tier hat
sich wenigstens ein Kaiser zu seinem Liebling erwählt. Es war dies der
aus Pannonien gebürtige Valentinian I. (364–375), ein sonst
tüchtiger Regent und Krieger. Von ihm erzählt der Geschichtschreiber
Ammianus Marcellinus: „Kaiser Valentinianus hielt sich zwei Bären,
die er mit Menschenfleisch fütterte. Den einen derselben nannte er
Goldkrümchen, den andern Unschuld. Diese Bestien wurden aufs allerbeste
verpflegt; ihre Käfige standen neben dem Wohnzimmer des Kaisers (er
residierte in Mailand) und treue Wärter mußten für ihre Wohlfahrt
sorgen. Endlich ließ er die Unschuld, nachdem sie vor seinen Augen
eine große Anzahl Menschen gefressen hatte, zur Belohnung dieses guten
Dienstes im Walde frei.“
Zur Kurzweil der mächtigen Herren der Welt wurden in den Palästen Roms
neben gezähmten Raubtieren auch zahme Affen und Papageien gehalten.
Nach dem Griechen Älian war der Affe beliebt, „weil er herrlich
nachahmt und allerlei Verrichtungen leicht lernt, so z. B. tanzen und
die Flöte spielen. Ja, ich habe einen gesehen, der die Zügel hielt, die
Peitsche schwang und kutschierte. An schlimmen Streichen läßt’s der
Affe auch nicht fehlen, namentlich wenn er den Menschen nachahmen will.
Beobachtet er z. B. von fern eine Amme, wie sie ein Kind badet, so paßt
er auf, wo sie es dann hinlegt, schlüpft, wenn die Stube leer ist,
zum Fenster hinein, holt das Kindchen aus[S. 734] dem Bett, legt es in die
Wanne, holt siedendes Wasser vom Feuer, begießt damit das unglückliche
Geschöpf und tötet es so auf eine jämmerliche Weise.
In Indien gehen die Paviane in Tierfelle gekleidet, sind gerecht,
tun niemandem was zuleide, sprechen nicht, heulen aber und verstehen
die Sprache der Inder. Sie fressen das Fleisch wilder Tiere, halten
sich auch Ziegen und Schafe und trinken deren Milch. Zur Zeit der
Ptolemäer lehrten die Ägypter den Pavian buchstabieren, auf der Flöte
oder auf einem Saiteninstrument spielen. Das Tier ließ sich auch
seine Mühe bezahlen und steckte, wie ein geübter Bettler, den Lohn
in ein angehängtes Ränzchen. Bekommt so ein Pavian Mandeln, Eicheln,
Nüsse und dergleichen, so knackt er sie auf, wirft die Schale weg und
frißt den Kern. Er trinkt auch Wein und labt sich ganz gehörig an
gesottenem und gebratenem Fleisch, wenn er’s bekommt. Zieht man ihm
ein Kleid an, so schont er es. Hat man ein ganz junges Paviänchen, so
kann es gesäugt werden wie ein Kindchen. — Klitarchos (ein Begleiter
Alexanders des Großen) erzählt, es gebe in den indischen Gebirgen so
große Affen, daß Alexander samt seinem Heere nicht wenig erschrak, als
er plötzlich eine Menge solcher Affen sah und sie für eine feindliche
Armee hielt. Um sie zu fangen, ziehen die Jäger vor ihren Augen Schuhe
an, lassen dann aber die Schuhe stehen, die aus Blei gefertigt und
also schwer sind, zugleich auch Schlingen enthalten. Man erzählt auch
noch allerlei andere Dinge von Affen, die für gescheite Leute recht
interessant sind.“ Auch Plinius weiß allerlei Merkwürdiges von den
Affen zu erzählen. Er sagt von ihnen unter anderem: „Die Affen kommen
der menschlichen Gestalt am nächsten. Ihre Klugheit setzt in Erstaunen.
Nach Mutianus sollen sie sogar Schach spielen und die Figuren
unterscheiden lernen. Die geschwänzten Affen sollen bei abnehmendem
Monde traurig sein, den Neumond aber mit Jubel begrüßen. Mond- und
Sonnenfinsternisse fürchten sie gleich andern Tieren. Haben sie in der
Gefangenschaft Junge bekommen, so tragen sie diese herum, zeigen sie
allen und freuen sich, wenn sie liebkost werden. Meist ersticken sie
die Jungen durch allzu zärtliche Umarmungen.“ Daher die noch bei uns
gebräuchliche Redensart von der Affenliebe. Einst soll ein Affe auch
künftiges Geschehen vorausverkündet haben, wie uns der beredte Cicero
in seinem Buche über Prophezeiungen erzählt: „Als die Spartaner vor der
Schlacht bei Leuktra (in Böotien südwestlich von Theben, wo 371 v. Chr.
die Thebaner unter Epameinondas über die Spartaner unter Kleombrotos
siegten) Ge[S. 735]sandte nach Dodona schickten, dort den Jupiter zu fragen,
ob Sieg zu hoffen sei, da prophezeite ihnen ein Affe schweres Unglück.
Die Sache verhielt sich so: Als die Gesandten die Urne zurechtgestellt
hatten, worin sich die Lose befanden, kam der Lieblingsaffe des Königs
der Molosser und warf die Lose und alles, was zum Losen gehörte, nach
allen Seiten hin auseinander. Darauf sprach die Priesterin des Jupiter
die Worte: ‚Denkt nicht an Sieg, ihr Lakedaimonier, denkt nur an eure
Rettung!‘“
Nach den vorhin aus den Angaben der alten Autoren mitgeteilten
Tatsachen läßt sich ersehen, welch ungeheurer Verbrauch von wilden,
aber auch gezähmten Tieren aus allen damals den Römern erreichbaren
Weltgegenden besonders in der Hauptstadt, aber auch in den
Provinzialstädten, die hinter jener nicht zurückbleiben wollten,
jährlich stattfand, alles nur zur Unterhaltung und zum Vergnügen des
Volkes, das in Rom ohne ernsthafte Beschäftigung, von den Machthabern
gefüttert und verwöhnt, nach Brot und Zirkusspielen (panem et
circenses!) schrie. Dort in der Hauptstadt war stets so viel los,
daß der Dichter Juvenal sagen konnte: „Deshalb trauert, wer aus Rom
auswandert!“
Trotz aller unbeschreiblichen Grausamkeiten, die dabei geübt wurden,
ist aber doch anzuerkennen, daß die Römer mit ihren Tierhetzen zugleich
auch ein unvergleichliches Kulturwerk leisteten. Wenn allein Kaiser
Augustus während seiner allerdings 45jährigen Regierungszeit nicht
weniger als 3500 afrikanische Tiere an den Spielen in Rom umbringen
ließ, wenn bei einer einzigen Hetze des Pompejus 500 Löwen umkamen
und der Betrieb so bis ins 5. Jahrhundert andauerte, so summiert sich
das schließlich zu Millionen. Darunter waren weit mehr schädliche als
nützliche Tiere, und zwar große Raubtiere. So geschah es, daß alle
Provinzen des ausgedehnten Reiches von den großen Raubtieren, die süd-
und westdeutschen Wälder von den Bären planvoll gesäubert und dadurch
erst der friedlichen Kultur erschlossen wurden. Dafür sind die auf
deutschem Boden ausgegrabenen Mosaikfußböden — so beispielsweise auch
das von uns wiedergegebene schöne Mosaik in Bad Kreuznach, etwa aus dem
Jahre 300 n. Chr. — denkwürdige Monumente, wenn sie uns wie dort den
Bären in der Arena von Schwerbewaffneten angegriffen zeigen.
In Pompeji hat man mehrere Anschläge (programmata) vorgefunden,
durch welche dergleichen Tierhetzen angekündigt wurden. Sie waren mit
roten Buchstaben auf die geweißten Mauern der Stadttore[S. 736] geschrieben.
Um nun immer wieder neue Anzeigen darauf schreiben zu können, wurden
letztere öfters neu geweißt. Ein solches in Pompeji aufgefundenes
Programm besagt: „Die Gladiatorentruppe des Ädilen Aulus Svettius
Cerius wird zu Pompeji am 31. Mai (79 n. Chr.) kämpfen; es wird eine
Tierhatz geben und das Amphitheater wird mit Tüchern beschattet sein
(familia gladiatoria pugnabit — venatio et vela erunt).“
Ein anderes zeigt folgendes an: „Die Gladiatorentruppe des Numerius
Popidius Rufus wird am 29. Oktober (79) zu Pompeji kämpfen; es wird
eine Tierhatz geben.“ Tücher zum Schattenspenden werden da keine
erwähnt, da die Sonne im Spätherbst nicht mehr zu heiß schien, und nur
für sie, nicht für etwaigen Regen, waren jene über die Arena und die
Zuschauerplätze ausgespannten Tücher bestimmt. Allerdings kam diese
hier angekündigte Schaustellung nicht mehr zustande, da bekanntlich
jene etwa 30000 Menschen beherbergende blühende Landstadt Kampaniens im
August durch einen fürchterlichen Aschenregen des Vesuvs verschüttet
wurde. Bei den 1748 begonnenen, oft unterbrochenen, erst seit 1860
mit Energie wieder aufgenommenen Ausgrabungen, wobei bisher erst ein
Drittel der Stadt aufgedeckt wurde, fand man am Amphitheater die sich
nach der arena, dem Kampfplatze hin öffnenden Zwinger für die
wilden Tiere nebst den für die Fechter bestimmten Räumen gut erhalten.
An der Brustwehr waren noch inzwischen von der Witterung zerstörte
Bilder, welche den Kampf zwischen Löwe und Pferd, Bär und Stier, Tiger
und Eber vorstellten. Man fand in jenem Amphitheater eine ziemliche
Menge Einlaßbilletts in Gestalt kleiner Knochenplatten, die die Nummer
des betreffenden Platzes rot aufgemalt trugen.
Mit dem Verfall des Römertums hörten diese Jagdspiele auf; doch
vergnügten sich die großen Herren noch im Mittelalter gelegentlich
damit, in eigenen Tiergärten großgezogene Bären mit großen Doggen
kämpfen zu lassen. Besonders war solches am sächsischen Hofe unter dem
Kurfürsten August dem Starken (1670–1733), dem späteren König von Polen
der Fall. Flemming erzählt, daß im Jahre 1630 im Schloßhofe in Dresden
binnen acht Tagen drei Bärenhetzen stattfanden. In den beiden ersten
mußten sieben Bären mit Hunden, im dritten aber mit großen Keilern
kämpfen, von denen fünf auf dem Platze blieben. Die Bären wurden
außerdem durch Schwärmer gereizt und vermittelst eines ausgestopften
roten Männchens genarrt. Gewöhnlich stachen die großen Herren selbst
die von den Hunden festgehaltenen Bären ab; August der Starke pflegte
ihnen aber den Kopf abzuhauen.[S. 737] Mit der Verfeinerung der Sitten kamen
aber diese rohen Schauspiele glücklicherweise allmählich ab.
Tafel 69.

Das etwa aus dem Jahre 300 n. Chr. stammende schöne Mosaik
in Bad Kreuznach (Hüffelsheimerstraße 26), das uns Gladiatoren- und Tier-,
besonders Bärenkämpfe in der Arena zeigt.
⇒
GRÖSSERES BILD
Tafel 70.
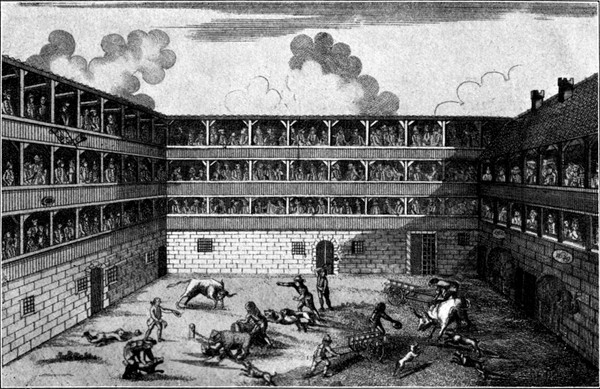
Eine Ochsen- und Bärenhatz, wie sie von der Zunft der Metzger
bis ins 18. Jahrhundert hinein im Fechthause zu Nürnberg abgehalten wurde.
(Nach einem zeitgenössischen Stich.)
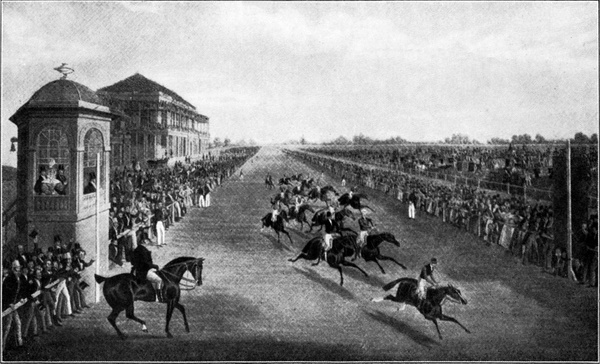
Englisches Derbyrennen in Epsom zu Anfang des 19.
Jahrhunderts.
(Nach einer zeitgenössischen Lithographie.)
Wie Gladiatoren- und Tierkämpfe, ebenso der unfeine Mimus und
Pantomimus Ausflüsse des ungebildeten Römertums waren, so bildeten
die Griechen die nationalen Ringkämpfe und Wettrennen, wie auch das
feinere Theater aus. Hier soll nur von den Pferderennen die Rede
sein. Schon bei Homer finden wir in der Ilias bei Gelegenheit der
Leichenfeier von Achilleus’ Freund Patroklos ein Wagenrennen für
Zweispänner veranstaltet, wobei Achilleus Starter und Richter und
Phoinix Kontrolleur am Wendeposten war. Fünf namhafte Griechen fuhren
bei diesem ausgesprochenen Herrenfahren, bei dem schon eifrig gewettet
wurde. Als erster Preis figurierte ein Weib „kundig untadeliger
Arbeiten“ und ein gehenkelter, 22 Maß fassender Dreifuß, als zweiter
Preis eine 6jährige, mit einem Maultier trächtige Stute, als dritter
ein neuer viermaßiger Silberkessel, als vierter zwei Talente Gold und
als fünfter eine neue Doppelschale.

Bild 64. Zweispänniger Rennwagen von einer griechischen
Vase des 7. Jahrhunderts v. Chr.
In der Folge treffen wir das Rennfahren an den vier nationalen Spielen,
den olympischen, pythischen, nemeischen und isthmischen, die alle
vier oder zwei Jahre abgehalten und von ganz Griechenland beschickt
werden. Dabei wurden nur Hengste verwendet, die in Kategorien von
über und unter fünf Jahren eingeteilt wurden. In Olympia wurden acht
verschiedene Rennen gefahren, und zwar in der Rennbahn, die so gebaut
war, daß die Zuschauer den ganzen Verlauf des[S. 738] Kampfes verfolgen
konnten. Dabei mußten die Konkurrierenden außer den beschworenen neun
Monaten heimatlichen Trainings einen Monat in Olympia selbst geübt
haben. Und bei diesen Übungen wurden alle minderwertigen Gespanne
ausgeschaltet, so daß nur bestes Material zum Wettrennen kam. Das
Hauptrennen bestand in einem Wagenrennen mit vier Hengsten über fünf
Jahre, wobei in gestrecktem Galopp zwölf Umläufe der Rennbahn, im
ganzen 18,5 km gefahren werden mußten. Dann kam ein Wagenrennen
mit zwei Hengsten über fünf und ein solches mit vier Hengsten unter
fünf Jahren, wobei acht Umläufe, d. h. 12,3 km gefahren werden
mußten. Nachher folgte ein Wagenrennen mit zwei Hengsten unter fünf
Jahren mit drei Umläufen, d. h. 4,6 km, ein Reitrennen auf
Hengsten von über fünf und ein solches auf Hengsten von unter fünf
Jahren mit sechs Umläufen, d. h. 9,3 km. Endlich kam ein
Reitrennen auf Stuten, wobei der Reiter beim letzten Umlauf abspringen
und zu Fuß nebenher laufen mußte, und zum Schlusse ein Wagenrennen
mit Maultieren. Dadurch, daß der Besitzer und nicht der Fahrer den
Hauptruhm erntete, legten mehr reiche Leute Geld in die Pferdezucht,
auch wenn sie selbst nicht rennen wollten. Um vier gute Rennen zu
erhalten, mußte der Sportsmann mindestens zehn Pferde züchten oder
kaufen, und aus dieser Zahl wurde nach sorgfältigem Trainieren das
beste Material ausgewählt. Dabei mußten auch für die Wagenrennen die
Pferde zuerst durch Bereiten ausgebildet werden, um ein gleichmäßiges,
andauerndes Reiten im Galopp, eine leichte Wendsamkeit und den
disziplinierten Gehorsam zu erreichen.
Von den Griechen Unteritaliens übernahmen dann die Römer die
Wagenrennen zumeist mit dem Viergespann. Zu Ende der Republik und
namentlich zur Kaiserzeit bildete das Schauspiel der Wettrennen im
Zirkus eine wichtige Art der Unterhaltung des Stadtrömers. Für diese
diente der in der Senkung zwischen Aventin und Palatin gelegene
Zirkus Maximus von 650 m Länge, in welchem im 4. Jahrhundert
etwa 270000 Zuschauer auf lauter Marmorsitzen Platz fanden. Die von
einem Wassergraben umgebene Rennbahn war durch eine spina genannte
Mauer in zwei Teile geteilt und besaß am Ende die gefürchteten metae,
je drei freie Kegelsäulen aus Goldbronze, an denen die Wagen bei zu
knappem Heranfahren nur zu leicht zerschellten. An den Spieltagen gab
es 20–24 Wettfahrten, wobei der leichte zweiräderige Wagen von vier
meist 3–5jährigen Hengsten gezogen wurde. Die besten Renner kamen
aus Spanien, Sizilien, Kappa[S. 739]dozien und Afrika, d. h. Algerien. Das
Hauptpferd des Quadriga war das an der Außenseite laufende; ihre
Namen sind uns zu hunderten erhalten, wie auch derjenigen berühmter
Berufskutscher, zu denen junge, leichte Leute genommen wurden.
Ja, schon zehnjährige Knaben produzierten sich als Rennfahrer und
führten das Viergespann mit Erfolg zum Ziel. Siebenmal mußte die Bahn
durchlaufen werden, wobei die Kutscher der verschiedenen Quadrigen in
Röcke von verschiedener Farbe gekleidet waren. Um die Brust trugen sie
den aus Leder und Schnüren verfertigten Wagenlenkerverband, der sie bei
einem Sturze vor Rippenbrüchen schützen sollte; in ihrem Gürtel stak
ein scharfes sichelförmiges Messer, um im Falle der Gefahr die Zügel,
die sie um den Leib geschlungen hatten, zu durchschneiden. Auf dem
Kopfe hatten sie eine schützende Lederkappe; in der Rechten hielten sie
die kurze Peitsche aus Leder und in der Linken die Zügel.

Bild 65. Wettfahren mit dem Viergespann bei der
Leichenfeier des Peltas. Links sitzen die Preisrichter und vor ihnen
stehen die als Preise ausgesetzten drei Dreifüße. Darstellung von einer
griechischen Vase des 6. Jahrhunderts v. Chr.
Bei der Eröffnung eines jeden Rennens wurden zuerst die Statuen der
Götter Roms und der vergöttlichten Kaiser in feierlicher Prozession
durch den Zirkus getragen, und das Volk huldigte jedem Bilde durch
Zuruf. Dann zog der festgebende Beamte oder Kaiser wie ein Triumphator
durch die Bahn, nahm den Ehrensitz ein und gab das Signal zum Beginn
des Rennens, indem er aus seiner Loge ein Tuch herabwarf. Auf die
besten Renner, deren Namen und Stammbaum jeder Habitué kannte,
wurde eifrig gewettet. Weit vorgebeugt standen die Rennfahrer auf
den leichten zweirädrigen Wagen und belauerten die Gegner, hielten
anfänglich zurück, um dann plötzlich vorzufahren und dem nächsten
Fahrer mit ihrem Wagen den Weg zu verlegen, nicht selten auch mit
Peitschenhieben aufeinander loszuhauen. Die zahlreichen Unfälle machten
eben den Reiz dieser Fahrten aus. Die Wagen zerschlugen sich und die
Fahrer wurden von den Nachfolgenden überfahren oder von ihren eigenen
Pferden geschleift, wenn sie nicht rechtzeitig mit ihren Sichelmessern
die Zügel[S. 740] durchzuschneiden vermochten. Den Gipfel der Bravour aber
erstiegen jene Rosselenker, die nach dem Verluste des eigenen Wagens
nach Herunterschlagen des Gegners mit dessen Gespann siegten.
Diese Rosselenker hatten etwas barbarisch Heldenhaftes. Wir haben
Grabinschriften von solchen, die über 2000 Siege davontrugen. Der
Kutscher Scorpus wird von Martial als das Entzücken Roms besungen; die
Todesgöttin, sagt er von ihm, habe seine Siege mit seinen Lebensjahren
verwechselt und so sei er schon als Jüngling gestorben. Ein anderer,
Eutychus, ist für uns denkwürdig, weil der römische Fabeldichter
Phädrus, ein Freigelassener des Augustus, ihm seine dem Griechen Äsop
nachgedichteten Fabeln widmete. Eine Fülle von Bildsäulen wurde diesen
Leuten errichtet, und Kaiser Heliogabalus machte den Kutscher Cordius
unmittelbar zum Kommandanten der Feuerwehr. Dieser Kaiser ließ auch
Quadrigen von Kamelen laufen und gar den großen Wassergraben des Zirkus
mit Wein füllen und darauf allerlei Schiffskämpfe ausführen.
In der Blütezeit der Wagenrennen waren nicht einzelne Private, sondern
Gesellschaften oder Klubs die Besitzer der Gespanne. Anfangs waren
es zwei, dann vier Parteien, die sich Ställe hielten und Kutscher
mieteten. Letztere waren meist Unfreie oder, wenn sie Freigelassene
waren, fuhren sie um Geld für diejenige Partei, die ihnen am meisten
bezahlte. Ihre enggeraffte ärmellose Tunika zeigte weithin die Farbe
der Partei, für die sie fuhren. Im Laufe der Zeit gingen die Erfolge
der Weißen und Roten mehr und mehr zurück, während die Blauen und
Grünen sich der größten Popularität erfreuten. Auch die Kaiser waren
vielfach leidenschaftlich an dieser Begeisterung für einzelne Parteien
beteiligt, so Vitellius und Caracalla für die Blauen, Nero und Domitian
für die Grünen. Und als nach der Teilung der beiden Reichshälften der
Sitz der Regierung von Rom nach Byzanz verlegt wurde, gingen die Kämpfe
zwischen den Blauen und Grünen hier weiter, so daß durch sie nicht nur
Straßenaufläufe, sondern eigentliche Palastrevolutionen hervorgerufen
wurden. Das ganze Volk verfolgte mit leidenschaftlichem Interesse die
Vorgänge auf der Rennbahn. Von ihrer bronzenen Tribüne pflegten die
Herrscher von Byzanz dem Kampfe zuzusehen. In den Pausen zog sich
dann der Hof zur Mahlzeit zurück. Aber derjenige Kaiser, der dabei
auf die Genüsse der Tafel zu viel Zeit verwendete, setzte damit seine
Popularität aufs Spiel; denn dann wurde das Volk ungeduldig, begann zu
murren und schließlich ertönte der Ruf: „Erhebe dich endlich, du unsere
Sonne, und[S. 741] gib das Zeichen.“ Denn das war das am meisten beneidete
Vorrecht des Kaisers, daß er mit einer Handbewegung das Zeichen zum
Start geben mußte.
Wie in Rom gab es auch selbst unter den vornehmen Geistlichen von
Byzanz eigentliche Pferdenarren. Ein solcher war auch der Patriarch
Tophanes, der für seinen Marstall eine Reihe prunkvoll ausgestatteter
Ställe besaß, in denen selbst die Krippen aus massivem Silber
gearbeitet waren. Ein Heer von Dienern sorgte für das Wohlbefinden
der Pferde, streute ihnen nicht nur Heu und Gerste, sondern Datteln,
Feigen, Rosinen und andere Leckerbissen in die Krippen. Die Ställe
wurden mit kostbaren Wohlgerüchen parfümiert und die Pferde auch in
Wein gebadet. Wie weit die Leidenschaft dieses Kirchenfürsten für
seine Pferde ging, zeigt ein charakteristischer Vorfall. Eines Tages
zelebrierte er in der Sophienkirche (Hagia Sophia) das Hochamt.
Plötzlich sah man den Prälaten den Altar verlassen, verschwinden
und Kaiser und Volk in der Kirche stehen lassen. Was war geschehen?
Ein Eilbote hatte dem hohen Herrn die Kunde gebracht, daß sein
Lieblingspferd einem Füllen das Leben gegeben habe. Da litt es ihn
nicht länger in der Kirche. Er unterbrach seine geistliche Handlung
und eilte sofort nach den Ställen, um sich von dem Vorfall selbst zu
überzeugen.
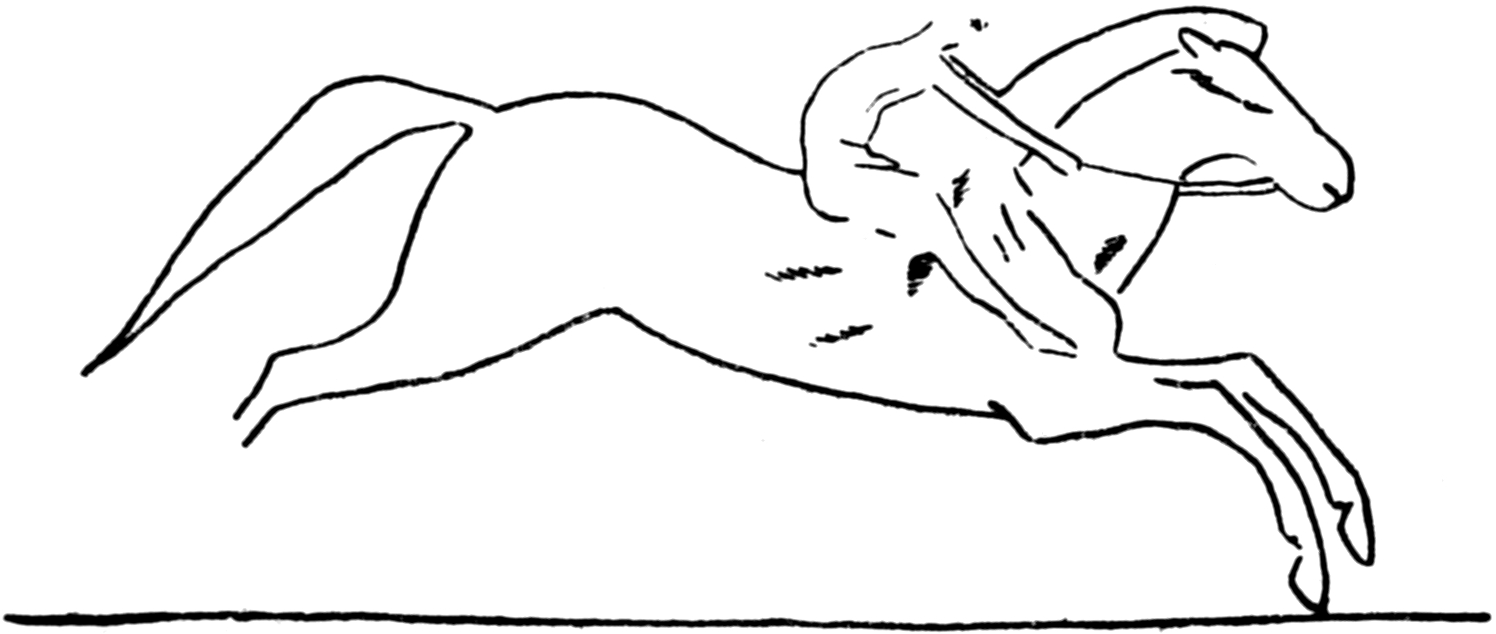
Bild 66. Griechischer Rennleiter von einer um 550 v.
Chr. gemalten Vase.
Hatten schon die Griechen das Wettreiten dem Wettfahren hintangestellt,
so taten es die Römer noch mehr. Jene Südländer waren eben kein
Reitervolk gewesen, wie etwa die Hunnen und Germanen; ihnen wäre auch
ein einfaches Wett- oder Hürdenrennen zu reizlos und undramatisch
gewesen. Um diese rohen Gemüter zu erfreuen, brauchte es schon
stärkerer Reizmittel als solche harmlose Reiterkünste. Den alten
Deutschen dagegen war das Pferd als Fortbewegungsmittel in Krieg und
Frieden gleich wichtig. Erst in der Zeit der Völkerwanderung kamen
bei ihnen Sättel in Gebrauch, auf die man zum[S. 742] weicheren Sitzen auch
noch Decken oder Kissen legte. Während man früher nur auf Trense ritt,
wurde in der Ritterzeit die Kandare, oft mit sehr langem Hebelarm,
üblich. Seit der Merowingerzeit wird der Steigbügel und der Sporn mit
einfacher Spitze wie bei den alten Römern gefunden. Öfter findet sich
in den Gräbern jener Zeit nur ein Sporn, und zwar am linken
Fuße, um das Pferd zu einer Schwenkung nach rechts zu veranlassen,
weil man so dem Feind seine durch den Schild geschützte linke Seite
zukehrte. Schon Tacitus sagt in seiner Germania von den germanischen
Pferden: „Sie werden nicht gelehrt, verschiedenartige Wendungen nach
unserer Art zu machen, sondern man läßt sie geradeaus oder mit einer
Schwenkung nach rechts laufen.“ Zu der Ritterzeit hatte man dann stets
zwei Sporen, und zwar vom 12. Jahrhundert an mit Rädchen. Solange
der Kettenpanzer nur den Mann bedeckte, kam man mit den feingebauten
warmblütigen Schlägen aus. Erst als die Ritter sich nicht nur selbst in
schwere Eisenrüstungen kleideten, sondern auch ihre Pferde in solche
steckten, war man wegen des zu tragenden schweren Gewichts darauf
angewiesen, kräftige kaltblütige Schläge zu bevorzugen. Auf diesen
zogen die Ritter in ihren Plattenpanzern wie in den Krieg so auch zum
friedlichen Scheinkampf, zum Turnier. Dieses, ursprünglich der
Turnei, vom Französischen le tournoi — von tourner,
mit dem Pferd einen Kreis beschreiben — genannt, kam mit dem ganzen
Apparat der Ritterschaft aus Frankreich, das, von der altrömischen
Kultur befruchtet, früher als Deutschland zur Kulturblüte gelangte. In
Deutschland ist das erste Turnier 1127 in Würzburg abgehalten worden.
Es wurde von Fürsten oder vornehmen Gesellschaften veranstaltet und
war nur dem Adel zugänglich. In prunkvollem Aufzuge, den feurigen
Hengst mit einer Decke (covertiure) in denselben Farben und
mit denselben Wappenbildern wie der Waffenrock des Ritters geziert,
fand man sich mit seinem Gefolge zum ritterlichen Kampfspiel an dem
Orte ein, wohin die Einladung rief. Dabei fanden sich auch allerlei
fahrende Sänger und Gaukler, wie zu jedem Feste im Mittelalter, ein,
und schöngeschmückte, edle Frauen sahen von Tribünen dem Spiele zu.
Im ausgebildeten Turnier unterschied man drei verschiedene
Waffenübungen. 1. Den mit französischem Namen bezeichneten Buhurt,
ein Reitergefecht in Gruppen, ohne Rüstung und mit ungefährlichen
Waffen. Im Nibelungenlied erscheint er noch als die Hauptsache.
2. Den Tjost, später das Stechen genannt, das dem Ritterideal am
meisten entsprach und in den Ritterepen immer mit besonderer Vorliebe
ge[S. 743]schildert wird, das vom Erneuerer des Rittertums, König Maximilian
I., mit Vorliebe gepflegt wurde. Der Tjost bestand in dem Kampf
zwischen zweien, die in schwerer Rüstung mit eingelegter Lanze mit
eigentümlicher stumpfdreizackiger Krone an der Spitze aufeinander
losrannten und sich gegenseitig aus dem Sattel zu werfen suchten. Trotz
dem Plattenpanzer und dem das ganze Gesicht bedeckenden Helm gab es da
gelegentlich nicht ungefährliche Verletzungen, wie Knochenbrüche und
Augenauslaufen, so daß ein gewisser Mut zu solchem Stechen gehörte. 3.
Das eigentliche Turnier, das den Schluß und die Hauptsache der ganzen
Veranstaltung bildete. Es war eine Art Kavalleriemanöver, wobei die
Gesamtmasse der Ritter in zwei gleichwertige Hälften geteilt wurde, die
unter den dazu bestimmten Kommandierenden gegeneinander kämpften. Dabei
wurde zuerst mit der Turnierlanze, dann mit dem stumpfen oder durch
einen Stock ersetzten Schwerte, erst zu Pferd, dann zu Fuß gefochten.
Nach dem Urteil des Schiedsgerichts wurden die Sieger ausgerufen und
empfingen von zarter Hand ihren Ehrenpreis. Später wurden verschiedene
Varianten des Tjostierens und Turnierens unterschieden, wie das
Buntrennen, das Offenrennen, das geschift Scheibenrennen, das geschift
Tartschenrennen, das wälsche Rennen in dem Armetin (einer bestimmten
Helmart), das loblich gemain deutsch Stechen (mit dem Krönlein,
der stumpfdreizackigen Lanze), das Stechen im hohen Zeug und im
geschlossenen Sattel und anderes mehr. Das letzte echte Turnier in
Deutschland fand 1487 in Worms statt.
Wenn auch noch im 17. Jahrhundert Schauturniere gelegentlich an einigen
Höfen Deutschlands stattfanden, so war doch mit dem Beginn des 16.
Jahrhunderts die Zeit dieser ritterlichen Kampfspiele des Mittelalters
endgültig vorbei. Man begnügte sich nach italienischem Vorbild der
Renaissancezeit mit allerlei Figurenreiten, malerischen Aufzügen und
Quadrillen. Dieses Figurenreiten war von den Arabern und Sarazenen
ausgegangen und kam mit der Bezeichnung caracolo, d. h. Wendung
im Kreise (aus dem Arabischen karak) nach Italien, gelangte
dann als caroussel zu den Franzosen und von da zu den übrigen
Kulturvölkern Europas. Man versteht darunter ein Evolutionsspiel zu
Pferde, bei dem das Kreise- und Achterfigurenbeschreiben eine große
Rolle spielte. Diese Reitübungen förderten in der Folge sehr die
Beweglichkeit und Feldtüchtigkeit der Reiterei, so daß sie teilweise
noch bis in unsere Zeit beibehalten wurden.
Dieses karak der Araber, das speziell die Mauren pflegten,
ist[S. 744] eines der Reiterspiele, wie sie bei allen Völkern, die Pferde
halten und zum Reiten benutzen, seit dem hohen Altertume beliebt
waren. Diese Reiterspiele stehen gewöhnlich in unmittelbarer
Beziehung zur Kampfmethode des betreffenden Volkes und sollten in
erster Linie dazu dienen, die Kriegstüchtigkeit der Jungmannschaft zu
erhöhen. So treffen wir schon bei den alten Griechen den beliebten
altdeutschen kriegerischen Tanz pyrrhiche, den die Knaben im
15. Jahre erlernten und in welchem unter Flötenklang alle Bewegungen
und Verrichtungen, die beim Kampfe vorkommen, rhythmisch nachgeahmt
wurden. Später wurden solche Übungen auch zu Pferde vorgenommen. Damit
übten sich besonders die Reiter, als Vorbereitung für die wirkliche
Schlacht. Als dann die Römer mit der griechischen Kultur bekannt
wurden, übernahmen sie dieses Kunstreiten mit Waffen und bildeten es
bei ihrer Reiterei weiter aus. Diese Gelegenheit, prächtige Pferde und
gelenkige Beweglichkeit vor bewundernden Zuschauern zu zeigen, ließen
sich die vornehmen römischen Stutzer nicht entgehen. Von Beginn der
Kaiserzeit bis zum Fall des römischen Reichs wurde dieses Kriegsspiel
zu Pferd gern als Schaustellung vorgeführt und hieß später ludus
trajanus, weil Kaiser Trajan dies besonders begünstigte und neue
Variationen dabei einführte. Eine lebendige Beschreibung desselben
findet sich in Claudians Lobgedicht auf das Konsulat des Honorius;
dann finden wir es gelegentlich auf Inschriften erwähnt und auf
Gemmen und Münzen abgebildet, als Beweis dafür, wie beliebt es war.
Nach Überschwemmung des weströmischen Reiches durch die germanischen
Barbarenhorden, pflegte Ostrom dieses Erbe weiter, und so treffen wir
dieses Reiterspiel in Byzanz mit allerlei persischen Ausschmückungen
im sogenannten Ringstechen, bei welchem man mit einer langen Lanze
gegen eine mit konzentrischen Kreisen in verschiedenwertige Flächen
eingeteilte runde Scheiben anritt, und in einer Art Karussel wieder.
Im Orient wurde von alters her das neuerdings bei den vornehmen
Europäern beliebte Polospiel zu Pferde geübt. So sandte einst
der Perserkönig Darius, Sohn des Hystaspes, dem König Alexander von
Makedonien (521–485), als er ihm den Tribut verweigerte, einen Ball
und einen Stock zum Polospiel und ließ ihm sagen, solche Beschäftigung
passe für ihn besser als Krieg anzufangen. Die Kreuzfahrer sahen das
Polo in Byzanz beim griechischen Kaiser Manuel Komnenos und brachten
es nach Europa, wo es allmählich zu einem Spiel zu Fuß degradiert und
in England zu Kricket, Fußball und Golf[S. 745] differenziert wurde. Bei den
Persern und den kriegerischen Stämmen Nordindiens erhielt sich das Polo
bis auf den heutigen Tag. Als der Iman Ibn Omar den Schah Nur-ed-Din
von Persien (ca. 1070 n. Chr.) selbst Polo spielen sah, meinte er,
solche Übung passe nicht für einen Herrscher. Da antwortete er ihm:
er spiele, bei Gott, das Spiel nicht zu seinem Vergnügen, sondern als
gutes Beispiel für seine Untertanen, damit ihre Pferde geübt und sie
selbst gelenkig würden, um im Kampfe ihren Mann zu stellen.
Wie einst bei den Persern das Polo, so ist heute bei den Arabern
der Dscherid — bei uns besser unter der algerischen Bezeichnung
fantasia bekannt — ein fast täglich zur Übung der Pferde
vorgenommenes Reiterspiel. Darin ist das Karussel mit den
militärischen, bei ihren Kämpfen gebräuchlichen Evolutionen verbunden.
Unter Geschrei und Schwingen des Dscherid, d. h. des aus dem Holz
der Dattelpalme hergestellten Wurfspeers, ritten zwei Reiterscharen
in wildem Galopp aufeinander los, um kurz voreinander anzuhalten,
umzukehren und unter allerlei Wendungen das Spiel aufs neue zu
beginnen. In vollem Laufe mußte der zu Boden geworfene Dscherid wieder
aufgenommen werden, dann stand oder legte man sich auf den Sattel,
benutzte die Vorhand des Pferdes als Schutz und Schild, hing während
des Galopps ganz auf der Seite und schoß dabei mit Pfeil und Bogen
auf ein bestimmtes Ziel, sprang vom Pferde ab und schwang sich wieder
hinauf. Mit der Einführung der Gewehre begnügte man sich, dann blind zu
schießen und einen großen Lärm zu verführen.
Außer den verschiedenen Reitübungen wurde das Pferd schon im hohen
Altertum auch zu allerlei Kunststücken verwendet, wie wir sie heute
besonders im Zirkus zu bewundern Gelegenheit haben. So weiß schon Homer
in der Ilias von Kunstreitern zu berichten, wenn er sagt: „Gleichwie
ein guter Kunstreiter, nachdem er aus einer großen Anzahl vier Rosse
zusammengefügt, abwechselnd sicher und beständig von einem Pferd auf
das andere springt, während sie dahinfliegen, so schwang sich Ajas
von einem Schiff auf das andere“. Schon bei den alten Mykenäern der
Mitte des zweiten vorchristlichen Jahrtausends finden wir auf den
Freskomalereien der Palastwände mit Vorliebe solche Jonglierkünste
abgebildet, und zwar sind es statt Pferde wilde Stiere, die beim
Anstürmen in der Arena von leicht geschürzten Männern oder Frauen
an den Hörnern gefaßt werden, wobei sich das betreffende Individuum
in kühnem Bogen über das Ungetüm schwingt, um teilweise mit einem
wahrhaftigen Salto mortale wieder den Boden[S. 746] zu gewinnen. Daß solche
Darstellungen an den Wänden der Fürstenpaläste so häufig vorkommen,
beweist, daß die betreffenden kunstvollen Spiele des schwachen, aber
intelligenten Menschen mit dem starken, einfältigen Tier in jenen
Kreisen höchst beliebt waren.

Bild 67. Altägyptischer Stierkämpfer mit einem einfachen
Stock gegen die Stiere vorgehend. (Nach Wilkinson.)
Schon im alten Reiche Ägyptens sehen wir mehrfach den Menschen, mit
einem einfachen Stock bewaffnet, wildgemachten Stieren entgegentreten
und sie dank seiner geistigen Überlegenheit bezwingen. Solche Spiele
mit Tieren, speziell Kämpfe des Menschen mit wildgemachten Stieren,
kamen schon frühe aus dem Niltal und Westasien auch nach Griechenland
und Rom, wo sie beim Volke besonders populär wurden. Während aber in
den Wirren der Völkerwanderung diese Stiergefechte zur Belustigung
des dabei zuschauenden Publikums aus allen Ländern im Machtbereiche
der römischen Kultur verschwanden, erhielten sie sich als nationales
Vergnügen einzig in Spanien, das dort und im spanischen Amerika trotz
wiederholter Aufhebung wegen der dabei ausgeübten Tierquälerei bis
auf den heutigen Tag sich größter Popularität erfreut, ja trotz aller
Anstrengungen der Tierschutzvereine sich sogar über Südfrankreich
verbreitete und bis nach Genf in die Schweiz hineingelangte. Daß
solches in unserer aufgeklärten, humandenkenden Zeit möglich ist,
beweist eben, daß ein Zug von Gefühlsroheit und Grausamkeit seit dem
Tierhetzen und Menschenschlächtereien im Altertum im romanischen Blute
steckt, der dem Germanen, der ja auch von manchen Tierquälereien,
besonders bei Ausübung der Jagd, nicht ganz freizusprechen ist,
völlig abgeht. Letzterer ist zu gefühlvoll und mitleidig, um die dem
Menschen trotz ihrer natürlichen Waffen wehrlose Kreatur absichtlich
zu peinigen und sich an ihrem Schmerz und den[S. 747] damit verbundenen
Ausbrüchen von Grimm zu erfreuen. Der Romane aber hat selbst in
der zärter fühlenden Frau noch nicht seine angeborene und durch
Jahrhunderte nicht gebändigte Rohheit überwunden und kennt nichts
höheres, als selbst die Mutter Gottes und die Heiligen an ihrem Feste
durch ein Stiergefecht zu ehren. Diese werden in besonderen
Amphitheatern — da, wo noch solche aus dem Altertum vorhanden
sind, mit Vorliebe in diesen — auf öffentliche Kosten oder von
Privatunternehmern abgehalten. Der ganze Verlauf des Volksfestes
ähnelt in hohem Maße demjenigen der Arena bei den alten Römern. Die
Stierfechter (toreros) teilen sich in picadores, die
zu Pferd — allerdings auf dem Tode verfallenen wertlosen Rosinanten
mit verbundenen Augen —, die Beine gegen allfällige Angriffe des
Stieres mit seinen spitzen Hörnern sorgsam einbandagiert, mit ihren
Lanzen gegen den Stier losreiten, ihn reizen und ermüden; dann die
banderilleros, die mit roten Bändern gezierte, mit Widerhaken
versehene Stäbe in die Schultern des Tieres stoßen und es dadurch und
durch den damit verbundenen Schmerz wütend machen. Ferner aus den
chulos oder capeadores, die mit Bändern und Schärpen
seine Wut, wenn sie nachzulassen droht, aufs neue erregen und möglichst
steigern, und endlich die meist als matadores bezeichneten
espadas oder Schwertträger, die mit ihren feinen Degen dem Tiere
den Todesstoß ins Rückenmark zu geben haben. Vermochten sie damit
den aufs äußerste gequälten Stier nicht zu töten, so gibt ihnen der
cachetero den Gnadenstoß.
Zahllos sind die verschiedenen Arten von Tierdressuren, die teils schon
im hohen Altertum, besonders aber heute in unserer genußsüchtigen,
stets nach neuen Sensationen begehrlichen Zeit, dem danach begierigen
Publikum im Zirkus und in Varietétheater vorgeführt werden. Da begnügt
man sich nicht mit dem Anblick friedlich den Wagen ziehender oder auf
Kugeln rollender, sorgsam den furchtsamen Hasen, ohne ihn zu verletzen,
apportierender Löwen, von Elefanten als Seiltänzer oder Musikanten,
die auch griechisch und lateinisch schrieben, wie dies zur römischen
Kaiserzeit Sensation erregte, sondern bringt brennende Lampen aus
Glas und andere heikle Gegenstände jonglierende Seehunde, mit der
Nasenspitze ihnen zugeworfene Erdbeeren und andere Früchte auffangende
und balancierende Seelöwen, usw., von wie Menschen gekleideten und
sich als Gentlemen beim Essen, Rauchen, Radfahren usw. benehmenden
Schimpansen ganz zu schweigen. Es würde uns zu weit führen, auch nur
die merkwürdigsten, durch unendliche Geduld erzielten Tierdressuren
hier zu erwähnen. Es ge[S. 748]nüge, nur solche Errungenschaften des
Menschengeistes über die Tierseele zu erwähnen.
Auch Menagerien und Tierschaustellungen sind keine Erwerbung der
Neuzeit; mit den Tiergärten kamen sie teilweise schon im Altertum vor.
Besonders letztere waren an fürstlichen Hofhaltungen beliebt. So ist
im Schi-king ein Tiergarten des Kaisers Wen-wang (um 1150 v. Chr.)
unter der Bezeichnung „Park der Intelligenz“ erwähnt, worin allerlei
Säugetiere, Vögel, Schildkröten und Fische gehalten wurden. Einen
ähnlichen Tiergarten unterhielten die aztekischen Herrscher in Mexiko.
Da gab es nach den zeitgenössischen spanischen Berichten zahlreiche
Gehege, Zwinger, Vogelhäuser und Wasserbecken, in denen die Fauna
Mittelamerikas vollständig vertreten und in systematischer Anordnung
untergebracht war. Die Verpflegung der Raubvögel allein soll täglich
500 Truthähne beansprucht haben.
Auch den Vornehmen des alten Rom waren Tiergärten bei ihren Villen
eine beliebte Anlage, die meist viele Morgen Landes umfaßte und zum
Schutz gegen das Eindringen von Raubtieren mit einer hohen, glatten
Mauer umgeben war. Im Innern waren Gruppen von hohen Bäumen mit
ausgebreiteten Ästen, die dem Adler und anderen Raubvögeln das Jagen
darin verunmöglichen sollten. In ihnen wurden Hasen, Rehe, Hirsche,
Antilopen und Wildschweine teils zum Vergnügen, teils des Gewinnes
wegen gehalten. Man gewöhnte sie daran, zur Fütterung zu kommen, wenn
ins Horn gestoßen wurde. Varro, dem wir diese Angaben verdanken, sagt
u. a.: „Im Tiergarten des Quintus Hortensius (eines berühmten Redners)
ist ein erhabener Platz mit Pavillon. Während dort gespeist wird,
erscheint ein Orpheus in langem Gewande mit einer Kithara. Er beginnt
die Saiten zu schlagen, es wird ins Horn gestoßen; da erscheinen
sogleich Wildschweine, Hirsche und andere vierfüßige Tiere in Menge und
gewähren ein lustiges Schauspiel.“
Im Mittelalter traten die tierfreundlichen Araber das Erbe der
Römer an und ein Tiergarten gehörte zum notwendigen Requisit jedes
muhammedanischen Fürstenhofes. Als der größte der Omajaden, Abdurrhaman
III., die Stadt Az-Zahra bei Cordova errichten ließ, ordnete
er auch die Anlage eines Gartens an, in welchem in umgitterten und
eingezäunten Räumen Vögel und seltene vierfüßige Tiere gehalten
wurden. Dies war der älteste Tiergarten Europas. Viel später, zur
Renaissancezeit, unterhielten die kleinen Fürstenhöfe Italiens je eine
kleine Sammlung fremder Tiere. Die berühmteste der[S. 749]selben war diejenige
des Herzogs Ferrante von Neapel, die unter anderem als bis dahin im
christlichen Abendlande noch nicht gesehene Tiere, eine Giraffe und
ein Zebra, aufwies, die der Herzog vom Kalifen von Bagdad zum Geschenk
erhalten hatte. 1513 schenkte ein Türkensultan dem Könige Emanuel
von Portugal ein ostindisches Nashorn, der dieses zusammen mit einem
Elefanten dem Papste Leo X. verehrte. Dieses Wundertier hat
Albrecht Dürer 1515 in einem bekannten Holzschnitt gezeichnet.
In Mitteleuropa finden sich Tiergärten zuerst bei den reicheren
Klöstern. So enthielt der „Twinger“ des Klosters St. Gallen im 10.
Jahrhundert Bären, Dachse, Steinböcke, Murmeltiere, Reiher und
Silberfasanen. Im späteren Mittelalter war der Tiergarten in der
Residenz des Hochmeisters des Deutschen Ordens zu Marienburg am
bedeutendsten. Er enthielt außer Hirschen, Rehen und kleinerem Wild
große Ure, Geschenke des Großfürsten Witold von Litauen und des Komturs
von Balga, ferner einen Zwinger mit Bären und Affen, dann Meerkühe und
Meerochsen und seit 1408 auch einen Löwen.
Namentlich im 16. Jahrhundert waren Ure, Elche und wilde Pferde
die begehrtesten Tiere für die fürstlichen und adeligen Liebhaber
Deutschlands, derentwegen ein lebhafter Briefwechsel und besondere
diplomatische Missionen stattfanden. Die Hauptlieferanten dieser Tiere
waren die Hochmeister des Deutschen Ordens und der Herzog von Preußen.
Schon 1518 sandte der Hochmeister dem Kurfürsten Joachim I. von
Brandenburg einen Ur, der als seltenes Schauspiel gebührend angestaunt
wurde. Die Elche waren damals schon nicht mehr häufig und gingen beim
Transport mitunter zugrunde. So teilte der Pfalzgraf Otto Heinrich vom
Rhein dem Herzog von Preußen 1533 mit, daß von den ihm übersandten
Elchen „das Männle, als es bis auf 64 Meilen Wegs von Königsberg
gekommen, und das Fräule bis auf 28 Meilen von hinnen gestorben“ sei.
In den 1550er Jahren war es besonders der Erzherzog Ferdinand von
Österreich, der sich zur Bereicherung seines Tiergartens in Prag von
Zeit zu Zeit an den Herzog von Preußen wandte. Im Jahre 1591 erhielt
Landgraf Wilhelm IV. von Hessen von Herzog Karl von Schweden
einen Elch, der im Tiergarten von Zapfenburg vortrefflich gedieh.
Im Mai schrieb der Landgraf entzückt an jenen: „Das Elend ist so
lustig, daß wir ein gutes Gefallen an ihm tragen, denn sobald wir nach
Zapfenburg in unsern Tiergarten kommen und es uns reden hört, läuft es
zu uns und läuft hinter unserm Birschwäglein.“ Zwischen den kleineren
und größeren[S. 750] fürstlichen Tiergärten entwickelte sich ein lebhafter
Austausch, so daß wenigstens die einheimischen Tiere gut vertreten
waren. In den Reichsstädten wurden in den trockenen Gräben vielfach
Hirsche gehalten, was für Frankfurt a. M. 1399, für Solothurn 1448, für
Friedberg 1489, später auch für Zürich, Basel und Luzern nachgewiesen
ist.
Während alle diese Tiergärten ausschließlich zur Unterhaltung
gegründet wurden, hatte schon Ptolemäos I., Sohn des Lagos,
einer der Feldherren Alexanders des Großen, der erst als Statthalter
der Nachkommen Alexanders, seit 321 selbständig bis zu seinem Tode
283 regierte, neben allerlei wissenschaftlichen Instituten mit einer
großen Bibliothek auch einen großen zoologischen Garten in Alexandrien
errichtet, auf dessen Vermehrung auch sein Sohn und Nachfolger
Ptolemäos II. Philadelphos eifrig bedacht war. So zeigte er den
erstaunten Alexandrinern zum erstenmal ein Nashorn und eine Giraffe.
Zur römischen Kaiserzeit bestand dieser Tiergarten noch, aber mit dem
Untergang der antiken Kultur verschwand auch er, und viele Tierarten,
die den Alten bekannt gewesen waren, gerieten in Vergessenheit oder
verwandelten sich im Volksbewußtsein in seltsame Fabelwesen. Erst mit
der Erweiterung des Horizontes durch die Kreuzzüge begann im Abendlande
im 12. Jahrhundert ein langsames Wiedererwachen des zoologischen
Interesses, das aber erst im Zeitalter der geographischen Entdeckungen
wesentlich gefördert wurde.
Als Geburtsjahr der modernen Zoologie darf man das Jahr 1635
ansehen, in welchem ein Edikt Ludwigs XIII. die beiden
Leibärzte Hérouard und Gui de la Brosse zu der Gründung des Jardin
des plantes ermächtigte, der zunächst nur als ein Versuchsgarten
für Medizinalgewächse gedacht war, bald aber mit einer Menagerie
verbunden wurde. Während der großen französischen Revolution wurde auf
Veranlassung von Bernardin de St. Pierre die Versailler Menagerie mit
dem Jardin des plantes vereinigt, und 1797 wurde sogar eine Expedition
nach Afrika gesandt, um neue Tierarten zu erwerben. Ein Gönner des
Gartens war später Mehemet Ali, Pascha von Ägypten, der außer einem
afrikanischen Elefanten, Antilopen usw. auch eine Giraffe sandte, die
1827 in Paris anlangte. Dort wurde sie in der Folge so populär, daß
sich die Mode ihrer bemächtigte und sich die Pariser Damen und Stutzer
länger als ein Jahr à la girafe trugen. Heute wäre allerdings
eine solche Moderichtung schon nach einem Vierteljahr veraltet und
verlassen.
Nicht minder berühmt als der Jardin des plantes in Paris war[S. 751] die
kaiserliche Menagerie zu Schönbrunn, die 1742 durch Kaiser Franz
I. und Maria Theresia gegründet worden war und die Bestände der
älteren kaiserlichen Menagerien in sich aufgenommen hatte. Es waren
dies die Menagerie von Ebersdorf (um 1552 gegründet), von Neugebäu
und die vom Prinzen Eugen angelegte Menagerie im Belvedere. Zur
Bereicherung der Schönbrunner Menagerie wurden auf Geheiß Kaiser Josefs
II. zwei große Expeditionen unternommen, die erste von 1783–1785
nach Nordamerika und Westindien, die zweite von 1787 bis 1788 nach
Südafrika, Isle de France (Mauritius) und Bourbon.
Der erste wissenschaftlich geleitete zoologische Garten in England war
ein Privatunternehmen des Earl of Derby in Knowsley bei Liverpool. Nach
dem Tode seines Eigentümers ging der sehr bedeutende Tierbestand in
den Besitz der 1828 gegründeten Zoological Society über, die 1829 in
Regent’s Park einen zoologischen Garten anlegte. Schon 1830 enthielt
der Garten über 1000 Tierarten. 1852 wurde mit dem Bau von geräumigen
Aquarien begonnen. Dieser Londoner zoologische Garten wurde das Vorbild
für die meisten Institute dieser Art, die auf dem Kontinent in rascher
Folge ins Leben gerufen wurden und deren bedeutendsten die Gärten von
Amsterdam (1838), Antwerpen (1843), Berlin (1844), Brüssel (1851),
Rotterdam (1857), Frankfurt a. M. (1858), Kopenhagen (1858), Köln
(1860), Dresden (1861), Haag (1863), Hamburg (1863), Moskau (1864),
Breslau und Hannover (beide 1865) sind.
Durch diese und zahlreiche andere seither eröffnete zoologische Gärten
wurden die wandernden Menagerien und Tierbuden unserer Jahrmärkte,
die bis dahin ausschließlich der Aufklärung des großen Publikums
gedient hatten, stark in den Hintergrund gedrängt. Früher dienten
dressierte Affen und Tanzbären auf den Jahrmärkten zur Befriedigung der
Sensationslust des Volkes. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts kamen von
größeren ausländischen Säugetieren nur der indische Elefant und das
indische Nashorn nach Mitteleuropa. Ersterer wurde zuerst 1443 auf der
Messe in Frankfurt a. M., dann 1562 auf der Breslauer Johannismesse und
1607 in Hamburg, letzteres 1741 zuerst in Holland gezeigt. Es war ein
bei seiner Ankunft drei Jahre altes Tier, das auf den Ankündigungen
ausdrücklich als der Behemoth der Bibel (Hiob 40, tatsächlich aber war
dies ein Flußpferd) und das Einhorn des Mittelalters bezeichnet und
erregte ungeheueres Aufsehen. Auf der Ostermesse 1747 erschien es in
Leipzig, wo ihm Gellert in dem Gedichte:
[S. 752]
„Um das Rhinozeros zu sehen,
Erzählte mir mein Freund,
Beschloß ich auszugehen“ usw.
ein literarisches Denkmal errichtete. Im Herbste desselben Jahres kam
es nach Nürnberg, im Frühling 1748 nach Augsburg, wo es Joh. Ridinger
sehr gut abzeichnete und radierte.
Auffallend spät erschienen Kamele in Deutschland. Die erste auf uns
gekommene Nachricht, die sich auf ein solches Tier bezieht, datiert aus
dem Jahre 1487. Erst als es der Großherzog Ferdinand II. von
Toskana 1622 auf seinem Landgute San Rossore bei Pisa zu Zuchtzwecken
einführte, wurden alle Tierbuden und Tiergärten damit versorgt.
Um dieses Tier, das beständig mit dem zweihöckerigen Trampeltier
verwechselt wurde, wand sich wie um die vorigen ein ganzer Kranz von
Fabeln. Am meisten wurde von unseren trinkfesten Vorfahren die Tatsache
angestaunt, „daß der Romdarius auch zu Sommerszeiten 3 Monate ohne
Sauffen leben kann“.
Von den übrigen, wohl in jeder größeren Menagerie vorhandenen Tieren
ist das Lama außer in Spanien, wo es bald nach der Eroberung Perus
durch Pizzaro gezeigt wurde, zuerst 1558 in Antwerpen zur Schau
gestellt worden, das Krokodil 1566 in Nürnberg, der Elch 1586 ebenfalls
in Nürnberg, das Stachelschwein, das seine totbringenden Stacheln auf
den Gegner schießen sollte, 1627, der indische „Riesenbüffel“ 1745, der
afrikanische Strauß schon 1450 auf der Frankfurter Messe, das Zebra um
1670, der Eisbär 1754 als „crulanischer (wahrscheinlich grönländischer)
Meer-Löwe oder weißer Walfisch-Bär“. Verhältnismäßig spät und selten
— wohl weil ihre Ernährung mit frischem Fleisch sehr kostspielig war
— waren große Raubtiere zu sehen, so 1584 in Nürnberg ein Löwe, 1611
ein Löwe und ein Tiger. Um so beliebter und verbreiteter waren seit dem
Ende des 18. Jahrhunderts auf allen deutschen Jahrmärkten verschiedene
Robben, besonders deren kleinster Vertreter, der Seehund als angeblich
„menschenfressendes Ungeheuer“ zu sehen. Auch größere Affen wurden
damals als Satyre oder wilde Männer bei uns gezeigt.
Um die Mitte des 18. Jahrhunderts, mit der Zeit der Aufklärung,
begann die Blütezeit der Wandermenagerien, als deren erste die
des „Herrn Dalmatine, eines geborenen Dalmatiners“ von 1750–1760
Deutschland durchzog. Deren uns erhaltene Anpreisungszettel wimmeln
von unrichtigen, abenteuerlichen Angaben und Übertreibungen von
der Gefährlichkeit der gezeigten Tiere. Besonders mit der Herkunft
derselben[S. 753] nahm man es damals nicht genau. Ums Jahr 1800 erschien
in Nürnberg die Menagerie Anton Alpi & Co. mit zwei Elefanten, zwei
Eisbären, einem „großen breitgestreiften König der Tiger aus Bengalen“,
einem „Pander oder gefleckten bengalischen Tiger“, einer Hyäne,
einem „Kasoar“, einem „Condor aus Afrika, man nennet ihn auch den
Lämmer-Geyer oder Geyer-König“, einem „Eremiten oder Einsiedleraffen“,
einem kanadischen Biber — „seine Nahrung besteht bloß in Holz“ —
und „zwey junge Cangoru, welche — wie der Königstiger — noch nie in
Deutschland lebendig gesehen worden sind“. Weniger phantastisch waren
die Ankündigungen der zwischen 1813 und 1815 Deutschland bereisenden
Menagerie Simonelli. Sie besaß einen von den damaligen Zoologen zu
den Faultieren gerechneten Lippenbären und als Glanzstück einen
jungen „großen Barbaro männlichen Geschlechts, welcher die Negerinnen
wegraubt; er ist vom Geschlecht der Waldmänner. Von dem Barbaro kommt
der wahre Orang-Outang oder Waldmann her. Dieser Barbaro, erst 4 Jahre
alt, ist bereits 41⁄2 Fuß hoch, seine vollkommene Größe ist 6 oder 7
Fuß; dieses Tier, das man sehr jung auf der Insel Madagaskar bey dem
Cap der guten Hoffnung gefangen hat, ist jetzt gezähmt, jedoch hält man
es aus Furcht des Zufalls in einem wohlbehaltenen Käfig an einer guten
Kette so, daß es den Zuschauern gar nicht schaden kann.“ Es mag dies
ein Schimpanse auf Westafrika gewesen sein.
Seit den 1820er Jahren wuchs die Zahl der Wandermenagerien ins
Ungemessene. Unter diesen übertraf alle an Reichhaltigkeit des Inhalts
und Eleganz der Ausstattung das berühmte Institut der holländischen
Familie van Aken, das zwei Jahrzehnte hindurch alle Tierfreunde
des Kontinents in Entzücken versetzte und 1840 an den Zoologischen
Garten von Amsterdam überging. Um 1830 kamen die Dressuren der großen
Raubtiere, besonders des Löwen auf; da war es ein Mitglied der Familie
van Aken, der von der Damenwelt vergötterte „kühne Anton“, dem sogar
die Bändigung eines bengalischen Tigers gelang. Nicht minder berühmt
war sein Zeitgenosse Henri Martin aus Marseille, dessen Lieblingslöwe
„Coburg“, der gewöhnlich das Zimmer mit ihm teilte, einen unrühmlichen
Tod fand, indem er an einem verschluckten Pantoffel starb. In unserer
Zeit hat erst der unternehmende Karl Hagenbeck in Stellingen sowohl den
Import als die Dressur fremdländischer Tiere auf den Gipfel getrieben.
Darin wird er auch von keinem amerikanischen Nebenbuhler übertroffen,
die ja sonst von allem „the biggest in the world“ zu haben
behaupten.
- Aal, 422.
- Ackergans, 654.
- Ägyptische Biene, 520.
- Älesbury-Ente, 354.
- Äsche, 428.
- Äskulapnatter, 700.
- Affen, 733, 751, 752.
- Afrikanische Biene, 520.
- Aigretten, 696.
- Ailanthusspinner, 538.
- Albatros, 696.
- Alligatoren, 701.
- Alpaca, 222, 224.
- Alpenschneehuhn, 640.
- Amber, 709.
- Amhurstfasan, 332.
- Anchovis, 417.
- Ancona-Hühner, 319.
- Andalusier Hühner, 319.
- Angolaschaf, 126.
- Angorameerschweinchen, 277.
- Angoraschaf, 129.
- Angoraseidenkaninchen, 275.
- Araberpferd, 206.
- Araras, 395.
- Argali, 137.
- Arkal, 126.
- Arrauschildkröte, 699.
- Aschenhund, 18.
- Astrachanpelz, 694.
- Atlasspinner, 540.
- Auerhahn, 639.
- Auster, 460.
- Backenhörnchen, 676.
- Bachforelle, 426.
- Badeschwamm, 482.
- Bär, brauner, 615, 731, 733.
- Bärenhetze, 736.
- Bärenrobbe, 686.
- Bankiva-Huhn, 300, 316.
- Bantam-Huhn, 320.
- Banteng, 54.
- Barsch, 441.
- Bartenwale, 703.
- Bartgrundel, 443.
- Barsoi, 26.
- Bartrobbe, 720.
- Battahund, 8.
- Baumfalke, 662.
- Baummarder, 682.
- Bekassine, 648.
- Beluga, 713.
- Berberpferd, 210.
- Bergamaskerschaf, 134.
- Bergschaf, englisches, 134.
- Bernhardinerhund, 32.
- Beuten, 512.
- Bezoarziege, 95.
- Biber, 621, 676, 692, 753.
- Bilch, 627.
- Bindenschwein, 145.
- Birkhuhn, 638.
- Blasenrobbe, 719.
- Blaufelchen, 427.
- Blaufuchs, 693.
- Bluthunde, 37.
- Boa, 701.
- Bodenrenke, 427.
- Bogenkrabbe, 449.
- Borkentier, 722.
- Brachse, 444.
- Brahmaputra-Huhn, 320.
- Brahmas, 320.
- Braunfisch, 715.
- Brautente, 355.
- Bressehund, 19.
- Brieftaube, 382.
- Bronzehund, 22.
- Buckelrind, 54.
- Buckelwal, 707
- Büffel, 79, 752.
- Bündnerschaf, 119.
- Bündnerschwein, 154.
- Bullenbeißer, 36.
- Burunduk, 676.
- Chinchilla, 677.
- Chinesische Gans, 351.
- Chittagong-Hühner, 317.
- Churraschaf, 130.
- Cochinchina-Huhn, 320.
- Collie, 23.
- Coypu, 676.
- Crève-Cœur-Hühner, 119.
- Cuvierswal, 711.
- Cyprische Biene, 520.
- Dachs, 632.
- Dachshunde, 27.
- Damhirsch, 607.
- Davidshirsch, 228.
- [S. 756] Delphin, gemeiner, 716.
- Delphin, großer, 717.
- Deutsche Biene, 519.
- Diamantfasan, 333.
- Dinkaschaf, 126.
- Dodo, 725.
- Dögling, 710.
- Doggen, 27, 35.
- Dogge, dänische, 35.
- — deutsche, 35.
- Dorking-Hühnerrasse, 319.
- Dromedar, 216.
- Dronte, 725.
- Drosseln, 387, 654.
- Dscherid, 745.
- Dschiggetai, 170.
- Dschungelrind, 53.
- Dujong, 724.
- Edelfalke, 659.
- Edelfasan, 331.
- Edelhirsch, 596.
- Edelkoralle, 479.
- Edelmarder, 682.
- Eichelhäher, 391.
- Eichenseidenspinner, 539.
- Eichhörnchen, 624.
- — graues, 675, 678.
- Eiderente, 651.
- Einhorn, 714, 751.
- Einsiedler, 726.
- Eisbär, 752, 753.
- Elch, 609, 749, 752.
- Elchhund, 14, 747.
- Elefant, indischer, 238.
- — afrikanischer, 243.
- Elefantenrobbe, 720.
- Elenantilope, 144.
- Elstern, 391.
- Emdener Gans, 350.
- Ente, 352.
- Entenwale, 710.
- Erde, eßbare, 487.
- Esel, 161.
- Eskimohund, 11.
- Fahhad, 294.
- Falbkatze, 280.
- Falken, 547, 658.
- Falkenjagd, 565, 658.
- Falkenzähmung, 567.
- Fangvorrichtungen, 552.
- Farbentauben, 377.
- Farörschaf, 137.
- Fasan, 331, 646.
- Feh, 675.
- Feldhase, 618.
- Feldlerche, 656.
- Feldtaube, 377.
- Felsentaube, 361.
- Fettschwanzschafe, 127, 694.
- Fettsteißschafe, 139.
- Fezzanschaf, 126.
- Finken, 384.
- Finnwale, 708.
- Fischbein, 703.
- Fischotter, 633, 685.
- — brasilischer, 685.
- Flachfische, 419.
- Flamingos, 339.
- Flibustier, 70.
- Flundern, 419.
- Flußdelphine, 717.
- Flußkrebs, 450.
- Flußperlmuschel, 475.
- Flußpferd, 730, 751.
- Forelle, 425.
- Foxterrier, 15.
- Freibeuter, 70.
- Freiburgerrind, 69.
- Frettchen, 298.
- Frutigerschaf, 134.
- Fuchs, 630, 693.
- Garneelen, 451.
- Gartenschläfer, 628.
- Gaur, 53.
- Gayal, 53, 78.
- Gazelle, 141.
- Gebirgspapagei, 398.
- Gebrauchshund, 21.
- Gemse, 611.
- Gepard, 294.
- Germanenpferd, 202.
- Giboea, 701.
- Giraffe, 731, 749, 750.
- Gladiatorenkämpfe, 728.
- Glanzstaare, 696.
- Goldfasan, 332.
- Goldlackhuhn, 319.
- Granaten, 451.
- Graugans, 343, 653.
- Graupapagei, 394.
- Grauwal, 706.
- Grauwerk, 675.
- Greyhound, 26.
- Grindwal, 712.
- Grönlandwal, 706.
- Großflosser, 445.
- Großstirnrind, 68.
- Grunzochse, 90.
- Guanaco, 222.
- Guineaschaf, 126.
- Habicht, 547, 663.
- Hahnenkämpfe, 308.
- Halswenderschildkröte, 699.
- Hamburger-Hühner, 319.
- Hase, 618.
- Haselhuhn, 639.
- Haselmaus, 628.
- Haubenhühner, 318, 319.
- Haubenlerche, 656.
- Hausen, 429.
- Hausgans, 343.
- Haushahn, 313.
- Haushund, 7.
- Hauskatze, chinesische, 290.
- — europäische, 288.
- — malaische, 290.
- Hausmarder, 683.
- Hausmaus, zahme, 278.
- Hausschwein, asiat., 155.
- — europäisches, 145, 154.
- Haustiere, 1.
- Hebridenschaf, 136.
- Hecht, 443.
- Heidebiene, 519.
- Heideschafe, 136.
- [S. 757] Heidschnucken, 136.
- Herdenhund, 7.
- Hering, 414.
- Hermelin, 683.
- Heuschreckenkrebs, 451.
- Hirtenhunde, 38.
- Hirsch, 596.
- Hirschhund, 21.
- Höckergans, 351.
- Höckerschwan, 356, 653.
- Hokkohuhn, 337.
- Holothurien, 477.
- Honig, 502.
- Honigbiene, 488.
- Hornviper, 700.
- Houdan-Hühner, 319.
- Huchen, 425.
- Hülsenwurm, 44.
- Hühner, italienische, 318.
- — spanische, 318.
- Hühnerweissagung, 302.
- Huhn, 300.
- Huhntauben, 380.
- Hund, 3.
- Hundebandwurm, 44.
- Hund, epirotischer, 31.
- Hundekünste, 43.
- Hummer, 449.
- Hyäne, 753.
- Hyänenhund, 45.
- Ibis, 669.
- Ibizahund, 27.
- Iltis, 679.
- Iltisfrettchen, 299.
- Infusorienerde, 486.
- Inkahund, 39.
- Inostranzews Hund, 17.
- Italienische Biene, 519.
- Jagd, 543.
- Jagdfalke, 565, 659.
- Jagdhunde, 545.
- Jagdspiele, 733.
- Japanische Ente, 355.
- Jardin des plantes, 750.
- Kabeljau, 413.
- Kaiserente, 354.
- Kakadus, 398.
- Kamele, 189, 213.
- Kamel, einhöckeriges, 216, 740, 752.
- — zweihöckeriges, 215.
- Kammuschel, 463.
- Kampfhühner, 318.
- Kanadagans, 351.
- Kanarienvogel, 384.
- Kaninchen, 270, 694.
- — japanische, 275.
- — russische, 275.
- Karausche, chinesische, 437.
- Karausche, europäische, 438.
- Karettschildkröte, 697.
- Kariben, 229.
- Karousselreiten, 743.
- Karpfen, 430.
- Karpfkarausche, 439.
- Karthäuserkatze, 289.
- Kaschmirziege, 107.
- Kasuar, 753.
- Katze, 280.
- Katze der Insel Man, 290.
- Kaulbarsch, 442.
- Kaurischnecke, 459.
- Kea, 398.
- Kieselgur, 486.
- Klappmütze, 719.
- Kluthuhn, 317.
- Knäckente, 650.
- Knotenschwanzkatze, 290.
- Kochinchinahuhn, 317, 320.
- Königsfasan, 332.
- Königstiger, 293, 732, 753.
- Kolibris, 696.
- Kongoschaf, 126.
- Kopffüßler, 451, 709.
- Koralle, schwarze, 480.
- Kormoran, 400.
- Krainer Biene, 519.
- Krammetsvogel, 387, 655.
- Kraniche, 338.
- Krickente, 650.
- Krimmerfelle, 694.
- Krokodil, 730, 752.
- Kropffelchen, 428.
- Kropftauben, 379.
- Krüperhühner, 317.
- Kuhantilope, 144.
- Kuhglocken, 76.
- Kulan, 170.
- Kunstreiten, 745.
- Kurzhornrind, 59.
- Kurzkopfrind, 61.
- Kurzschnabelgans, 654.
- Lachs, 423.
- Lachsforelle, 427.
- Lachtaube, 382.
- Lackenfelder Huhn, 321.
- La Flèche-Hühner, 319.
- Lama, 222, 752.
- Lamantin, 725.
- Landhühner, 318.
- Landschaf, 133.
- Langhornrind, 56.
- Langshan-Hühner, 320.
- Langstirnrind, 59.
- Languste, 449.
- Laubenfische, 445.
- Laufhund, schweizer., 18.
- Leiners Hund, 22.
- Leporiden, 276.
- Lerchen, 656.
- Libyerschaf, 127.
- Lippenbär, 753.
- Lockentauben, 278.
- Löffelente, 650.
- Löwe, 292, 732, 752.
- Luchs, 635, 733.
- Madagassische Biene, 520.
- Mähnenschaf, 121.
- Märzgans, 343.
- Maifisch, 428.
- Maikong, 40.
- Makrele, 418.
- Malaienhühner, 318.
- Malaienziege, 111.
- Maltesertaube, 390.
- Mamberziege, 106.
- [S. 758] Mammut, 269.
- Manati, 725.
- Mandarinenente, 355.
- Maräne, 427.
- Markhor, 106.
- Marschrind, 69.
- Marschschaf, 137.
- Maskatesel, 172.
- Maskenschwein, 159.
- Maulbeerseidenspinner, 521.
- Maulesel, 174.
- Maultier, 164, 174.
- Meerschnecken, 452.
- Meerspinne, 449.
- Meerschwein, 715.
- Meerschweinchen, 276.
- Menagerien, 748.
- Merinoschaf, 130.
- Merlan, 412.
- Miesmuschel, 463.
- Milu, 228.
- Mink, 679.
- Minorca-Hühner, 319.
- Misteldrossel, 655.
- Mövchen, 379.
- Möven, 653.
- Molosserhund, 32.
- Mondkult, 48.
- Mongolen-Ziege, 110.
- Moorente, 651.
- Moorhuhn, 640.
- Moorschnepfe, 648.
- Moschusente, 355.
- Mürgüsziege, 110.
- Muflon, 135.
- Muräne, 420.
- Murmeltier, 625.
- Muschelesser, 4.
- Nackthalshühner, 317, 319.
- Nalpserschaf, 119.
- Napfschnecken, 458.
- Natter, glatte, 700.
- Narwal, 714.
- Nase, 440.
- Nashorn, 731, 749, 751.
- Nedjeschaf, 123.
- Neufundländerhund, 34.
- Nigerschaf, 126.
- Nilgans, 240.
- Nörz, 679.
- Nordische Biene, 519.
- Norfolkschaf, 133.
- Nutria, 676.
- Nutzfische, 412.
- Nutztiere, 2.
- Ochse, 51.
- Ohrenrobbe, Stellersche, 690.
- Onager, 170.
- Orpington-Hühner, 320.
- Oryxantilope, 141.
- Paco, 225.
- Paduaner Hühner, 320.
- Pampasrind, 72.
- Panther, 733.
- Papageien, 393, 733.
- Paradiesfische, 445.
- Paradiesvögel, 696.
- Pariahunde, 5, 16.
- Parforcejagd, 563.
- Pavian, 734.
- Pekingente, 354.
- Pelikan, 653.
- Pelzhandel, 671.
- Pelzrobben, 692.
- Penelopehuhn, 337.
- Perlen, 465.
- Perlhuhn, 322.
- Perlmuscheln, echte, 465.
- Perückentauben, 378.
- Persianer, 675, 694.
- Pfahlbauspitz, 8.
- Pfau, 324.
- Pfauentauben, 379.
- Pfeifente, 651.
- Pferd, 180.
- — okzidentales, 203.
- — orientalisches, 203.
- Pferdeschwamm, 482.
- Pflanzenperlen, 477.
- Phönixhuhn, 317, 318.
- Phoinix, 334.
- Plymouth-Rocks, 320.
- Polospiel, 744.
- Porzellanschnecken, 459.
- Pommersche Gans, 350.
- Potwal, 709.
- Präriewolf, 39.
- Przewalskis Pferd, 187.
- Pudel, 24.
- Purpurhuhn, 670.
- Purpurschnecken, 454.
- Purzlertauben, 380.
- Puter, 335.
- Quesal, 696.
- Raben, 391, 752.
- Radiolarien, 486.
- Ramelsloher Huhn, 321.
- Ratz, 679.
- Rebhuhn, 641.
- Rechtwale, 703.
- Regenbogenforelle, 425.
- Reh, 601.
- Reiher, 339.
- Reitochsen, 74.
- Renken, 427.
- Rennfahren, 737.
- Renntier, 228.
- Rhönschaf, 134.
- Riemenzahnwale, 711.
- Riesenfinnwal, 708.
- Riesengienmuschel, 464.
- Rind, 47.
- — hornloses, 56.
- Ringdrossel, 655.
- Rissos Delphin, 715.
- Robben, 717.
- Roquefortschaf, 137.
- Rorqual, 708.
- Roßschweife, 91.
- Rotbarben, 418.
- Rotbart, 418.
- Rotforelle, 427.
- [S. 759] Rotfuchs, 693.
- Rothirsch, 596.
- Rotwild, gezähmtes, 549.
- Rudolphis Finnwal, 708.
- Saatgans, 654.
- Säbelantilope, 141.
- Sahnenziege, 103.
- Saibling, 427.
- Salanganen, 657.
- Salm, 423.
- Samojedenspitz, 11.
- Sandgarneele, 451.
- Sardelle, 417.
- Sardenschaf, 133.
- Sardine, 416.
- Sattelrobbe, 719.
- Schabrackenschakal, 17.
- Schäferhund, 23.
- Schaf, 116.
- — chinesisches, 139.
- — finnisches, 136.
- — nordrussisches, 136.
- — skandinavisches, 136.
- Schakal, 5.
- — kaukasischer, 8.
- Schakalwolf, 17.
- Scheckenkaninchen, 275.
- Schellfisch, 412.
- Schildkröten, 697.
- Schildkrot, 697.
- Schildpatt, 697.
- Schimpanse, 747, 753.
- Schlafmaus, 627.
- Schleie, 439.
- Schmerle, 443.
- Schmuckvögel, 696.
- Schnatterente, 650.
- Schnäpel, 428.
- Schnecken, 452.
- Schneehuhn, 640.
- Schnepfen, 646.
- Schollen, 419.
- Schraubenziege, 106.
- Schupp, 677.
- Schwalben, 696.
- Schwan, 356.
- Schwanengans, 351.
- Schwarzbockantilope, 295.
- Schwarzfuchs, 693.
- Schwarzhalsschwan, 359.
- Schwarzschwan, 359.
- Schwarzwild, gezähmtes, 549.
- Schwein, 145.
- — romanisches, 154.
- — kraushaariges, 154.
- Schweinezucht, deutsche, 151.
- Schweißhund, 21.
- Schwertwal, 715.
- Sealskin, 673, 689.
- Sebastopolgans, 350.
- Seeeinhorn, 714.
- Seeforelle, 426.
- Seegurke, eßbare, 478.
- Seegurken, 477.
- Seehund, grönländischer, 719, 747, 752.
- Seeigel, 478.
- Seekühe, 724.
- Seekuh, Stellersche, 723.
- Seelöwe, 690, 747.
- Seeotter, 685.
- Seeschwalben, 696.
- Seevögel, 696.
- Seezunge, 419.
- Segeltaucher, 653.
- Segusier Hund, 20.
- Shetlandschaf, 137.
- Senegalschaf, 126.
- Seidenhühner, 317, 320.
- Seidenraupenzucht, 527.
- Seidenreiher, 695.
- Seidenspinner, 521.
- Seitenschwimmer, 419.
- Sepia, 451.
- Siamkatze, 290.
- Siebenschläfer, 627.
- Silberfasan, 333.
- Silberfisch, 434.
- Silberfuchs, 693.
- Silberkaninchen, 275.
- Silberlack-Hühner, 319.
- Silberreiher, 695.
- Silbersprenkel-Hühner, 319.
- Simmentalerrind, 69.
- Singschwan, 357, 653.
- Sittiche, 696.
- Slughi, 26.
- Somaliziege, 106.
- Sowerbys Riemenzahnwal, 711.
- Sperber, 547, 665.
- Spermaceti, 709.
- Spiele, circensische, 733.
- Spieltauben, 377.
- Spießente, 650.
- Springbock, 143.
- Sprotte, 416.
- Steckmuschel, 464.
- Stachelschwein, 752.
- Steinbock, europäisch., 114.
- — nordafrikanischer, 141.
- — sibirischer, 115.
- Steinbutt, 419.
- Steinmarder, 683.
- Steinseeigel, 478.
- Steppenesel, westasiatischer, 170.
- — nordafrikanischer, 162.
- Steppenkuh, 141.
- Steppenrind, 68.
- Steppenschaf, 126.
- Steppenwolf, 26.
- Sterlet, 429.
- Stieglitz, 696.
- Stiergefecht, 747.
- Stirnrind, 78.
- Stockente, 353, 648.
- Stör, 429.
- Störche, 339.
- Storch, weißer, 667.
- — schwarzer, 667.
- Strauß, 403, 752.
- Struppgans, 350.
- Strupphühner, 317.
- Sumpfbiber, 676.
- Sumpfluchs, 289, 292.
- Sumpfschnepfe, 648.
- [S. 760] Sundarind, 54.
- Suppenschildkröte, 698.
- Syrische Biene, 520.
- Tafelente, 651.
- Tahr, 111.
- Tanzmäuse, japan., 279.
- Tanzbär, 751.
- Tanzratte, 279.
- Tarpan, 184.
- Taschenkrebs, 449.
- Tatarenschaf, 139.
- Taube, 361.
- Teichkarausche, 434.
- Teichkarpfen, 430.
- Thüringerschaf, 134.
- Thunfische, 418.
- Tibetdogge, 28.
- Tibetschaf, 693.
- Tiergärten, 748.
- Tierhetzen, 735.
- Tierschaustellungen, 748.
- Tiger, 293, 732, 752.
- Tintenfische, 451.
- Toggenburger Ziege, 103.
- Tollwut, 44.
- Tonnenschnecke, 457.
- Torfhund, 8.
- Torfrind, 52, 59.
- Torfschaf, 119.
- Torfschwein, 152.
- Trampeltier, 215.
- Transpender, 702.
- Trappe, 638.
- Trauerschwan, 359.
- Trepang, 477.
- Tritonshörner, 458.
- Trogon, 696.
- Trommeltauben, 378.
- Truthuhn, 335.
- Tschau, 11.
- Tschita, 294.
- Tümmler, 715.
- Tümmlertaube, 380.
- Tungusenhund, 11.
- Turteltaube, 383.
- Uklei, 477.
- Ur, 58, 62, 749.
- Urhuhn, 639.
- Vicuña, 222.
- Vogelnester, eßbare, 657.
- Vorstehhunde, 20.
- Wacholderdrossel, 387, 655.
- Wachtel, 642.
- Wachtelkämpfe, 644.
- Wagen, heiliger, 51.
- Wagenrennen, 737.
- Waldbienenzucht, 510.
- Waldschnepfe, 647.
- Wale, 703.
- Walfang, 705.
- Walliser Schaf, 134.
- Walliser Ziege, 102.
- Walrat, 708, 711.
- Walroß, 720.
- Wanderfalke, 660.
- Wandermenagerien, 753.
- Wanderschafe, 131.
- Warzentauben, 381.
- Waschbär, 678.
- Wasserbock, 141.
- Wegschnecke, rote, 454.
- Weinbergschnecke, 452.
- Wellensittiche, 396.
- Weindrossel, 655.
- Weißfische, 445.
- Weißfuchs, 693.
- Weißwal, 713.
- Wettfahren, 741.
- Wiesel, 298, 684.
- — großes, 683.
- Wildgänse, 653.
- Wildhund, 3.
- Wildkatze, 635.
- Wildpferd, 180.
- Wildschwäne, 653.
- Wildschwein, 613.
- Windhunde, 24.
- Wisent, 85.
- Wolf, abessinischer, 26.
- — europäischer, 629.
- — indischer, 22.
- — nordamerikanisch., 39.
- Wolfsabkömmlinge, 17.
- Wollschaf, westasiat., 129.
- Wyandotte-Hühner, 320.
- Yak, 90.
- Yorkshire-Terrier, 16.
- Zackelschafe, 133.
- Zahnwale, 702.
- Zander, 441.
- Zaupelschaf, 133.
- Zebra, 178, 749, 752.
- Zebroide, 178.
- Zeburind, 54.
- Zeideln, 510.
- Zeidelweide, 510.
- Ziege, 94.
- — gemsfarbige, 102.
- — hornlose, 102.
- — kreuzhörnige, 111.
- Ziermäuse, chinesische, 278.
- — japanische, 278.
- Ziervögel, 696.
- Zobel, 675, 680.
- Zoologischer Garten, 751.
- Zwerghühner, 320.
- Zwergschwan, 357, 653.
- Zunu, 126.
- Zypernkatze, 289.
Verlag von Ernst Reinhardt in München.
Als Band IV der Sammlung „Die Erde und die Kultur“
erschien:
Die Kulturgeschichte der Nutzpflanzen
von
Dr. Ludwig Reinhardt.
2 starke Bände in Lexikonformat von ca. 1500 Seiten. In
Leinwand geb.
Preis M. 20.—
Mit vielen Illustrationen im Text und 150 Kunstdrucktafeln.
Urteile der Presse:
Prof. Möbius in „Frankfurter-Zeitung“. Es war eine dankenswerte,
aber auch schwierige Aufgabe, die sich der Verfasser gestellt hatte,
denn gründliche historische und wirtschaftliche Studien mußten mit
botanischen Kenntnissen verbunden und das Ganze dann als angenehm zu
lesende Erzählung vorgetragen werden, wenn das Buch wirklich populär
und wissenschaftlich zugleich sein sollte. Diese Aufgabe ist aber
unseres Erachtens glänzend gelöst worden, so daß wir das Erscheinen
des Werkes freudig begrüßen können. Man liest jedes Kapitel mit
Vergnügen und lernt, wenn es sich um eine wichtige Pflanze handelt,
die Geschichte ihrer Entdeckung und Einführung, ihre Kulturmethoden
und Sorten, ihre Verarbeitung und Verwendung kennen. Dabei wird unsere
Vorstellung unterstützt durch zahlreiche Abbildungen, deren meiste als
photographische Reproduktionen auf besonderen Tafeln beigefügt sind.
Botanisches Zentralblatt vom 18./IV. 1911. Das Werk füllt
eine wesentliche Lücke aus. Der Bilderschmuck ist ausgezeichnet, viele
Bilder sind bisher noch nirgends veröffentlicht worden.
Kosmos. Leicht verständliche Schreibweise verbindet sich hier
mit gewissenhaftester Arbeit in der kritischen Verwendung des Materials
und beides zusammen wird dem Werke hoffentlich viele Leser sichern.
Österreichische Gartenzeitung April 1911. Der Versuch ist dem
Verfasser über Erwarten gut gelungen. Das vortreffliche Werk vermittelt
nicht nur Kenntnisse, sondern es ist ein Genuß es zu lesen.
Pädagogische Rundschau vom 1./IV. 1911. Das Werk stellt
ein Musterbeispiel deutschen Fleißes und deutscher Gründlichkeit vor,
dessen Lektüre eine wahre Fundgrube des Interessanten und Wissenswerten
bietet und im Hinblick auf die anschauliche und fesselnde Darstellung
jeden Lehrer, mag er nun Botaniker von Fach sein oder sich bloß über
die Geschichte der Einführung und die wirtschaftliche Bedeutung
unserer Kulturpflanzen eingehend unterrichten wollen, in hohem Grade
befriedigen wird.
Mannheimer Tagblatt vom 9./I. 1911. In allen Dingen weiß
Reinhardt zu fesseln und anzuregen. Der Fleiß des Verfassers ist mit so
viel Frische, Laune und Sinn für Humor gemischt, daß er, und das ist
wohl das beste Zeugnis, das einem deutschen Gelehrten zuteil werden
kann, den Genuß einer Dattel, Ananas und Banane nicht im mindesten
beeinträchtigt.
Deutsche Kolonialzeitung vom 4./III. 1911. Der
Verfasser hat sich mit seiner Darstellung unstreitig ein großes
Verdienst erworben. Wir besitzen kein anderes neuzeitliches Buch,
welches diesen Stoff in ähnlich umfassender Weise behandelt; dazu
ist dem Reinhardtschen Buche eine anschauliche, frische, allgemein
verständliche Darstellungsweise eigen, so daß ein jeder, dessen Auge
sich noch an dem Blühen und Wachsen in der Natur zu erfreuen vermag
und der sich für die Entwicklung unseres Wirtschaftslebens und für
die Lebens- und Produktionsbedingungen der Völker in Vergangenheit
und Gegenwart interessiert, das Buch immer wieder gern zur Hand
nehmen wird, um daraus Unterhaltung und Belehrung zu schöpfen. Der
Wert des Buches wird noch wesentlich erhöht durch die Beigabe von 81
Abbildungen im Text und nicht weniger als 168 Bildertafeln mit durchweg
vorzüglichen und zum Teil schwer zugänglichen Photographien. Im
Verhältnis zu Inhalt, Umfang und Ausstattung des Buches muß der Preis
als sehr niedrig bezeichnet werden.
Hamburger Fremdenblatt vom 22./I. 1911. Eine Schöpfung,
die unser Erstaunen wach ruft. Man muß schon seine Feder etwas zügeln,
um nicht im Lobe zu hoch zu greifen. Mit sicherem Gefühl hat er das
Wesentliche vom minder wesentlichen gesondert. Worauf es aber vor allem
ankommt: Seine Angaben sind durchaus zuverlässig, wie ich mich an
verschiedenen Stichproben überzeugen konnte.
Unter dem Sammeltitel „Die Erde und die Kultur“ werden folgende
Bände erscheinen:
Band I.
Die Erde und ihr Wirtschaftsleben. (Erscheint Sommer 1912.)
„ II.
Kulturgeschichte des Menschen. (Erscheint Herbst 1912).
„ III.
III. Kulturgeschichte der Nutztiere. Preis M. 10.— (liegt vor).
„ IV.
Kulturgeschichte der Nutzpflanzen. 2 Teile zu je M. 10.— (liegt vor).
Jeder Band ist in sich abgeschlossen und einzeln käuflich.
Verlag von Ernst Reinhardt in München.
Vom Nebelfleck zum Menschen
Eine gemeinverständliche Entwicklungsgeschichte des Naturganzen nach
den neuesten Forschungsergebnissen von
Dr. Ludwig Reinhardt
4 starke Bände in eleg. Lwd. von zusammen 3000 Seiten mit über 1600
Illustrationen im Text und gegen 80 Tafeln und Karten
Preis M. 37.50
Jeder Band ist in sich abgeschlossen und einzeln käuflich
Bd. I: Die Geschichte der Erde. Mit 112 Abbildungen im
Text, 42 Volltafeln und 4 geologischen Profiltafeln, nebst farbigem
Titelbild von A. Marcks. 600 Seiten Gr.-8o. In elegantem
Leinwandband Preis M. 8.50.
Inhaltsverzeichnis:
I. Wie das Weltbild entstand. II. Die Sternenwelt.
III. Unser Sonnensystem. IV. Die Erde und der Mond.
V. Die Kometen und Meteore. VI. Die Erstarrungsgesteine
der Erde. VII. Der Vulkanismus. VIII. Die
Schichtgesteine. IX. Die Gebirgsbildung. X. Wasser
und Land. XI. Der Kreislauf des Wassers. XII. Die
Verwitterung der Erdoberfläche. XIII. Die Abtragung des
Festlandes.
Bd. II: Das Leben der Erde. Mit 380 Abbildungen, 21
Tafeln, 2 Stammbäumen und farbigem Titelbild nach Aquarell von Prof.
Ernst Haeckel. 650 Seiten Gr.-8o. In elegantem Leinwandband
Preis M. 8.50.
Inhaltsverzeichnis:
I. Das Leben und seine Entstehung. II. Die Entfaltung
des Lebens. III. Die Erscheinungen des Lebens. IV.
Die Funktionen des Lebens. V. Die Entwicklung des Lebens.
VI. Die Ausbildung der Tiere. VII. Die Ausbildung der
Pflanzen. VIII. Das Ende des Lebens. IX. Der Schutz des
Lebens. X. Die Abstammungslehre. XI. Über Symbiose.
XII. Vergesellschaftungen von Tieren und Pflanzen. XIII.
Pflanzengenossenschaften. XIV. Schmarotzertum.
Bd. III: Die Geschichte des Lebens der Erde. Mit 424
Abbildungen, 18 Tafeln, 7 Stammbäumen und farbigem Titelbild von L.
Müller-Mainz. 560 Seiten Gr.-8o. In elegantem Leinwandband.
Preis M. 8.50.
Inhaltsverzeichnis:
I. Einführung in die Palaeontologie. II. Die ältesten
fossilführenden Ablagerungen. III. Die frühpalaeozoischen
Organismen. IV. Die Tierentwicklung während der Silurzeit.
V. Die Entfaltung der höchsten Weichtiere. VI. Die
ersten Besiedler des Festlandes. VII. Das Aufkommen der
Wirbeltiere. VIII. Die Devon- und Kohlenformation. IX.
Das Zeitalter der Amphibien. X. Die Triasformation. XI.
Die Juraformation. XII. Die Kreideformation. XIII. Die
Tertiärformation. XIV. Das Pleistocän.
Bd. IV: Der Mensch zur Eiszeit in Europa und seine
Kulturentwicklung bis zum Ende der Steinzeit. 2. stark
verbesserte und vermehrte Auflage (3.-7. Tausend). Mit
535 Abbildungen, 20 Volltafeln und farbigem Umschlag von A.
Thomann. 950 Seiten Gr.-8o. In elegantem Leinwandband Preis M.
12.—
Inhaltsverzeichnis:
I. Der Mensch zur Tertiärzeit. II. Die Eiszeit und ihre
geologischen Wirkungen. III. Der Mensch während der ersten
Zwischeneiszeit. IV. Der Mensch der letzten Zwischeneiszeit.
V. Der Mensch der frühen Nacheiszeit. VI. Die
Übergangsperiode von der älteren zur jüngeren Steinzeit. VII.
Die jüngere Steinzeit und ihre materiellen Kulturerwerbungen.
VIII. Die Germanen als Träger der megalithischen Kultur.
IX. Die Entwicklung der geistigen Kultur am Ende der Steinzeit.
X. Steinzeitmenschen der Gegenwart. XI. Niederschläge aus
alter Zeit in Sitten und Anschauungen der geschichtlichen Europäer.
Urteile der Presse:
Geologisches Zentralblatt: „Unstreitig das Beste, was über
diesen Gegenstand vorhanden ist.“
Frankfurter Zeitung: „Das Buch ist das beste
allgemeinverständliche Werk, welches unsere Erde und ihre Geschichte
behandelt. Seit Neumayrs Zeiten ist keine so sympathische Behandlung
des spröden Stoffes mehr erschienen. Besonders Volksbibliotheken werden
einen großen Leserkreis mit den Reinhardtschen Büchern anlocken können,
und wenn erst das dritte Buch des Verfassers erschienen sein wird,
auf welches ich mich schon jetzt freue, dann werden wir eine populäre
Entwicklungsgeschichte der Erde und des Lebens besitzen, die für jeden
nachdenkenden Menschen eine Quelle des Genusses und der Freude sein
wird.“
Die Zeit: „Ein angenehm geschriebenes Werk... eine
empfehlenwerte, anschauliche Darstellung, die auch die Lücken unseres
Wissens nicht allzusehr verschließt — bekanntlich eine Hauptgefahr für
populäre Werke.“
Gaea: „Die vorzügliche wissenschaftliche und doch interessante
Form der Darstellung werden demselben zahlreiche Freunde erwerben.“
Allgemeine Zeitung: „Ein die weitesten Kreise interessierender
Stoff, fesselnde, leicht verständliche Schreibweise, gepaart mit
hohem wissenschaftlichen Ernst und umfassendem Wissen sind die
charakteristischen Merkmale des Werkes, mit dem uns Dr. L.
Reinhardt beschert hat. Er hat es verstanden, die in zahlreichen
Zeitschriften und Monographien zerstreuten Ergebnisse der Forschung zu
einem überzeugenden einheitlichen Bilde streng kritisch zu vereinigen.“