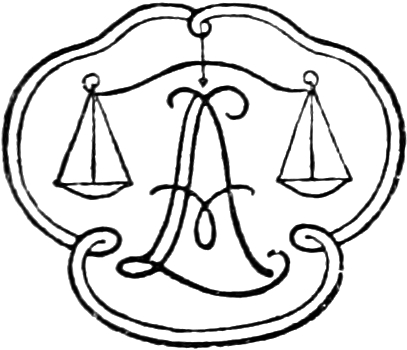Anmerkungen zur Transkription
Der vorliegende Text wurde anhand der 1910 erschienenen
Buchausgabe so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben.
Typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche
und heute nicht mehr gebräuchliche Schreibweisen sowie Schreibvarianten
bleiben gegenüber dem Original unverändert, sofern der Sinn des Texts
dadurch nicht beeinträchtigt wird.
Abhängig von der im jeweiligen Lesegerät installierten
Schriftart können die im Original gesperrt
gedruckten Passagen gesperrt, in serifenloser Schrift, oder aber sowohl
serifenlos als auch gesperrt erscheinen.
Kultur-Kuriosa
Erster Band
Von Dr.
Max Kemmerich erschienen bei Albert
Langen:
Dinge, die man nicht sagt 9. Tausend
Kultur-Kuriosa Zweiter Band 6.
Tausend
Prophezeiungen, Alter Aberglaube oder neue
Wahrheit? 4. Tausend
Aus der Geschichte der menschlichen
Dummheit 6. Tausend
Das Kausalgesetz der Weltgeschichte
2 Bde. Subskriptionspreis bis 15. Juli 1913 25 M., dann 32 M. geb. auf
Büttenpapier.
Kultur-Kuriosa
Erster Band
von
Dr. Max Kemmerich
Dreizehntes und vierzehntes Tausend
Albert Langen, München
Copyright by 1910 Albert Langen, Munich
Druck von Hesse & Becker in Leipzig
Einbände von E. A. Enders, Großbuchbinderei, Leipzig
[S. v]
Inhaltsverzeichnis
|
|
|
Seite
|
|
Vorwort
|
|
|
1.
|
Abschnitt: Modernes und Merkwürdiges in der
Vergangenheit
|
|
|
2.
|
Abschnitt: Rechtspflege
|
|
|
3.
|
Abschnitt: Die Ketzer und die römisch-katholische
Kirche
|
|
|
4.
|
Abschnitt: Toleranz und Ähnliches
|
|
|
5.
|
Abschnitt: Kriegswesen
|
|
|
6.
|
Abschnitt: Ehe
|
|
|
7.
|
Abschnitt: Sittlichkeit
|
|
|
8.
|
Abschnitt: Schicklichkeit und anderes
|
|
|
9.
|
Abschnitt: Medizinisches
|
|
|
10.
|
Abschnitt: Hygiene
|
|
|
11.
|
Abschnitt: Ehre
|
|
|
12.
|
Abschnitt: Religion und Glauben
|
|
|
13.
|
Abschnitt: Die „Hexen“ oder Ecclesia non sitit sanguinem!
|
|
|
14.
|
Abschnitt: Reliquien
|
|
|
15.
|
Abschnitt: Missionen und Kolonien
|
|
|
16.
|
Abschnitt: Autoritäten und Fortschritt
|
|
|
Anmerkungen
|
|
|
Nachwort
|
|
Die „Kultur-Kuriosa“ sind keine Anekdotensammlung, denn sie erheben
den Anspruch, nur solche beglaubigte Tatsachen anzuführen, die nicht
nur merkwürdig, sondern auch für ihre Zeit, gewisse Institutionen
und Anschauungen charakteristisch sind; sie sind auch keine
Kulturgeschichte, denn sie erstreben nach keiner Richtung hin
Vollständigkeit oder systematische Ordnung. Was sie sind, wird der
Leser wohl selbst herausfinden.
Daß die Schattenseiten stärker betont sind als die Lichtseiten, bringt
der Zweck des Buches mit sich. Sollte aber jemand aus dem Verschweigen
dieser oder jener Tatsache auf irgendeine Tendenz schließen, so möge er
sich den Titel ins Gedächtnis rufen. Unterließ ich den Hinweis
darauf, daß etwa Gregor VII. die Folterung der „Hexen“ verbietet, daß
der Benediktinerorden sich die größten Verdienste um die Überlieferung
der antiken Literatur erwarb, daß ein Franz von Assisi zu den Heiligen
der Kirche zählt, daß unsere Verfassung die Gleichheit aller vor dem
Gesetz verbürgt u. a. m., so hat das seine guten Gründe: Ich finde
das alles garnicht kurios. Würde ich diese und andere Erscheinungen
aufgenommen haben, so wäre das boshaft.
[S. viii]
Das Buch ist nun mal durchaus subjektiv, und jedem Leser sei
freigestellt, Dinge, die ich für höchst sonderbar halte, für die
natürlichsten von der Welt zu erklären und umgekehrt.
Objektiv wahr aber sind die mitgeteilten Tatsachen. Sollte ich
versehentlich in irgend einem Punkte geirrt haben, dann bitte ich um
Belehrung; sollte ich aber mit mancher liebgewordenen Vorstellung
aufräumen oder gar Gefühle verletzen, um Entschuldigung.
Wer mit mir die Achtung vor Leben, Ehre, Freiheit und Überzeugung
des Nächsten für das wichtigste Kulturkriterium hält, wichtiger
als alle technischen und wissenschaftlichen Fortschritte, als alle
künstlerischen Großtaten, der wird zugeben müssen, daß unsere Kultur
sehr jung ist und noch außerordentlich große Aufgaben gerade
auf diesem Gebiete zu erfüllen hat. Diese Jugend aber ist eine
Entschuldigung für manches.
Wenn ein Gelehrter, der auf eine Reihe wohlwollend aufgenommener
Publikationen blicken kann, sich hier nicht an Fachkreise, sondern an
jeden Gebildeten wendet, dann muß er dafür seine guten Gründe haben.
München, im März 1909
Der Verfasser
[S. 1]
Erster Abschnitt
Modernes und Merkwürdiges in der Vergangenheit
Wer kann was Dummes, wer was Kluges denken,
Das nicht die Vorwelt schon gedacht?
Goethe, Faust, I. Teil, 2. Akt
Die Richtigkeit dieser Worte des Mephistopheles wird wohl kaum
jemand ernstlich bestreiten wollen, und es hieße Eulen nach Athen
tragen, durch Sammlung moderner Ideen aus der Vorzeit eine gar
nicht bestrittene These zu beweisen. Etwas anderes ist es auch, was
wir hier versuchen, etwas viel Einfacheres, aber auch etwas viel
weniger Bekanntes: wir wollen zeigen, daß eine nicht geringe Zahl
von Erfindungen, Entdeckungen, technischen Errungenschaften und
Einrichtungen, die wir für gewöhnlich als Neuerwerbungen der Gegenwart
betrachten, auf deren Besitz wir uns vielleicht sogar viel einbilden,
schon ein respektables Alter aufzuweisen haben. Andrerseits werden wir
einiges finden, was wir nicht erwartet hätten. In zwangloser Anordnung
sei eine Reihe solcher Fakten aufgezählt:
Einer der ältesten bekannten Tunnel scheint der des Königs
Hiskia von Jerusalem aus dem siebenten vorchristlichen Jahrhundert
zu sein. Dieser heute noch erhaltene Siloah-Tunnel ist von beiden
Seiten her[S. 2] in den Stein gegraben. Zwar hielt der Kanal die gerade
Linie nicht ein, erreichte vielmehr statt einer Länge der Luftlinie
von 335 m eine solche von 535 m, aber die Wagerechte wurde erstaunlich
gut gewahrt, denn der gesamte Höhenunterschied beträgt nur 30 cm.
Annähernd in der Mitte trafen sich die von beiden Seiten vordringenden
Steinhauer[1]. Gar aus der ersten Hälfte des 2. Jahrtausends ist der
große Tunnel in Gezer in Palästina mit einer Wölbung wie die Londoner
Untergrundbahn. Er stieg 94 Fuß unter den gewachsenen Felsen.
So neu der Gedanke der Schienen uns erscheinen mag, er ist es
keineswegs. Man hatte sie bereits im Altertum, und zwar – der jetzigen
ausschließlich auf Eisen- und Straßenbahnen sich beschränkenden
Anwendung gegenüber fast ein Vorzug – vielfach auf stark befahrenen
öffentlichen Straßen. Man stellte diese Geleise durch Einschnitte in
den Boden her. Solche gab es z. B. an den Toren von Athen, auf dem
Wege, der direkt vom Piräus nach der Agora führte, sogar die römische
Alpenstraße in den Dauphiné-Alpen zeigt deutliche Spuren! Desgleichen
Straßen im Hauran̄, wie mir ein Reisender mitteilte. Die Ähnlichkeit
dieser in den steinigen Boden eingegrabenen Geleise mit unseren
Schienen wird noch vervollständigt durch die Anlage von richtigen
Ausweichkurven, die, im gehörigen Abstand angelegt, das Kreuzen
zweier Wagen auf dem einzigen Geleise gestatteten. Die Spurweite war
in Griechenland, bzw. in allen unter griechischem Einfluß stehenden
Ländern wohl überall ganz gleich, auf der in Frankreich ent[S. 3]deckten
römischen Straße betrug die Entfernung der Einschnitte voneinander
genau 1,44 m, also etwa soviel, wie bei unseren Vollbahnen[2]!
Quellensucher, ob mit oder ohne Wünschelrute, gab es ebenfalls
bereits im Altertum, und zwar in zunftmäßigen Verbänden. Einzelne
dieser Leute begleiteten sogar die Heere, um im Notfalle durch
sofortige Bohrungen Trinkwasser zu beschaffen. Im heutigen Algier
haben sich die Spuren zahlreicher Brunnen gefunden, die nunmehr von
den Franzosen wieder instand gesetzt wurden. Ihnen war es zu danken,
daß in der Wüste Oasen sich bildeten, die mit dem Verfall der Brunnen
im Jahrtausend der Barbarei wieder dem glühenden Sande weichen mußten.
Nachweislich haben die Römer im ungünstigen Terrain der afrikanischen
Wüste gegen 200 m tiefe Bohrungen mit größtem Erfolge angestellt.
Dabei ist es uns völlig rätselhaft, sowohl wie sie die Stelle der
unterirdischen Wasseradern erkannten, als auch wie sie die technischen
Mittel besaßen, die Bohrungen durchzuführen.
In neuerer Zeit war als Quellenfinder der französische Abbé Paramelle
am erfolgreichsten. Er hat seine Erfahrungen in einem Werke, betitelt:
„L’art de découvrir les sources“, niedergelegt. In den 64 Jahren
seines Lebens hat er 10275 Quellenangaben gemacht, von denen 9000 zur
Ausführung gekommen sind[3].
Der Blitzableiter wurde von den alten Ägyptern um 1300 v.
Chr., wenn auch noch in primitiver Form, vorausgeahnt. Zur Ableitung
des Blitzes wur[S. 4]den nämlich von Ramses III. in Medinet Abu – und
zweifellos auch anderwärts und wohl auch schon vor ihm – die Spitzen
der an den Stadttoren errichteten hohen Masten vergoldet.
Die griechischen und römischen Priester scheinen die Kunst besessen
zu haben, Blitze vom Himmel herabzulocken – wobei sie allerdings
bisweilen wie Tullus Hostilius (Livius I, 31, 8) erschlagen wurden. Sie
richteten zu diesem Zwecke metallbeschlagene Stangen auf, wohl weil sie
beobachtet hatten, daß Metalle vom Blitz bevorzugt wurden. Allerdings
fehlte noch die metallene Ableitung in das wasserhaltige Erdreich[4].
*
Daß die Reisegeschwindigkeit im Altertum gar nicht so gering
war, mag aus folgenden Notizen hervorgehen: Mit der Staatspost legte
man die 150 geographischen Meilen von Antiochia bis Konstantinopel
in sechs Tagen zurück, also pro Tag etwa 190 km. Cäsar reiste von
Rom bis an die Rhone in nicht vollen acht Tagen, machte also 150 km
pro Tag, was mit Recht, in Berücksichtigung der großen Entfernung,
für sehr schnell galt. Geradezu verblüffend schnell ritt der Kurier,
der die Nachricht von der Ermordung des Maximin – natürlich auf
gewechselten Pferden – in knapp vier Tagen von Aquileja nach Rom
brachte. Er legte also mindestens 200 km pro Tag zurück, eine Leistung,
die jeder Kavallerist erstaunlich hoch finden wird, da sie weit die
Durchschnittsleistungen unserer allerdings mit einem Pferde
bestrittenen Ritte um den Kaiserpreis übertrifft. Aber selbst wenn er
im Wagen gefahren sein sollte, was nach der Notiz möglich ist, könnte[S. 5]
er mit den hervorragendsten sportlichen Leistungen der Gegenwart
erfolgreich konkurrieren. Brauchte doch die Distanzfahrt im Sommer 1908
von Berlin nach München – etwa 700 km – vier Tage, also bedeutend
mehr Zeit auf die Einheit des Weges.
Die Kuriere, die die Nachricht vom Aufstand in Belgien, im tiefen
Winter des Jahres 69 n. Chr., nach Rom brachten, legten neun Tage lang
je etwa 240 km zurück! Hierbei ist aber zweifellos an Relais zu denken.
Die schnellste bekannte Reise ist die des Tiberius zum erkrankten
Drusus von Pavia nach Germanien. Durch das Land der eben besiegten
Chatten ritt er mit nur einem Begleiter – natürlich mit Pferdewechsel
– in 24 Stunden etwa 290 km!!! Das ist natürlich nur möglich, wenn
er weite Strecken galoppierte und rücksichtslos die Pferde tot ritt.
Trotzdem bietet die Sportgeschichte des letzten Jahrhunderts dazu kein
Analogon. Im Durchschnitt legte der im Wagen fahrende Reisende täglich
zur Römerzeit auf weite Entfernungen etwa 60–73 km zurück[4], während
der frühmittelalterliche Tagesmarsch nur 20–30 km betrug[5].
Im Jahre 1188 brauchte ein am 17. März mit einer päpstlichen Bulle
von Rom abgehender Bote 25 Tage, bis er am 15. April in Canterbury
eintraf[6].
In römischer Zeit galt eine Seereise von fünf Tagen von Ostia
bis Taraco in Spanien für schnell. Eine in umgekehrter Richtung in
weniger als vier Tagen gemachte bezeichnet der ältere Plinius als eine[S. 6]
der schnellsten je vorgekommenen. Cervantes nannte schon eine 12tägige
Fahrt von Neapel nach Barcelona eine glückliche[7].
Richard Löwenherz brauchte von Marseille bis Messina vom 16. August
1190 bis zum 23. September, also sehr lange. Er schiffte sich am 9.
Oktober 1192 in Akka ein und gelangte am 11. November nach Korfu; das
war die normale Geschwindigkeit im Mittelalter, – also bedeutend
geringer als zur Römerzeit[8].
Viel schneller ging natürlich die Nachrichtenübermittlung durch
Brieftauben. Die Griechen und Römer, ebenso wie die Araber
bedienten sich bereits dieser Post, und zwar in besonders ausgedehntem
Maße die letzteren, die von Bagdad bis Aleppo sowie längs der
kleinasiatischen Küste bis Alexandrien Brieftauben benutzten.
Gelegentlich wurden auch Schwalben zum gleichen Zwecke verwandt
(Plinius nat. hist. X, 71)[9]. Polybios erzählt (CX, 42 ff.) sogar von
der Feuertelegraphie der Griechen, die lange vor ihm Aeschylos
(Agamemnon 268 ff.) schon kannte. Doch handelt es sich um vorher
verabredete Mitteilungen.
Vom Verkehr zur Römerzeit gibt die Tatsache eine Vorstellung,
daß fast in jeder größeren Villa oder Ortschaft der Schweiz
Austernschalen gefunden wurden. Zu Avenches fand man auch Reste von
Datteln und Oliven. Die Tongefäße von Lugdunum (Lyon) finden sich in
ganz Gallien, England, Oberitalien, dem Alpengebiet bis Tirol und
Ungarn, und zwar überall mit demselben Fabrikstempel bezeichnet[10].
[S. 7]
Die alten Römer bauten bereits Seeschiffe mit einem Raumgehalt von 2670
Tonnen[11].
*
Im Altertum gab es auch eine Tageszeitung in den durch Cäsar
59 v. Chr. in Rom begründeten Acta diurna oder Acta urbis. In diesen
wurden amtlich Nachrichten öffentlichen und privaten Charakters
zusammengestellt und veröffentlicht, allerdings nicht vervielfältigt.
Ja, sogar Korrespondenten gab es, die gegen Bezahlung von Rom
Tagesneuigkeiten in die Provinz schickten.
*
Vegetarianer gab es ebenfalls schon im alten Rom. Seneca und
Plutarch gehörten nachweisbarlich zu ihnen, und letzterer hat sogar mit
allen Künsten der Dialektik seine Lebensweise verteidigt bzw. die der
Fleischesser angegriffen (Moralia „de carnium esu“).
Ebenso sind Antialkoholiker- und Temperenzlervereine
bereits im Altertume bekannt. Schon ein Ramses II. (ca. 1350 v.
Chr.) hat eine Antialkoholliga gegen die Trunkenboldigkeit der alten
Ägypter gegründet, wie im Jahre 1902 aus Malereien und Inschriften in
der France Médicale nachgewiesen wurde. Allerdings trieb man es auch
toll, und die Ägypterinnen des neuen Reiches – von den Männern ganz
zu schweigen – fanden so wenig Anstößiges an der Trunkenheit, daß
sich sogar Damen in dem Augenblick des Übelwerdens an der Wand ihres
Grabes verewigen ließen. Dazu sei bemerkt, daß bereits das alte Reich
vier verschiedene Biersorten und mindestens sechs Weinsorten, darunter
weißen, roten, schwarzen und nördlichen unterschied und wohl auch ein
Palmbranntwein bekannt war[12].
[S. 8]
Radikalen Erfolg mit seiner Antialkoholpropaganda hatte ein gewisser
Decaeneus kurze Zeit vor Strabon. Während die Geten bisher dem
Bacchus im Übermaße geopfert hatten, gewannen seine Brandreden auf
sie so großen Einfluß, daß sie nach und nach alle Weinstöcke im Lande
freiwillig ausrotteten und fortan ohne Wein lebten (Strabo VII, 3, 11
und Jordanis 11).
Bekanntlich werden heute noch in einigen Staaten des freien Amerika
alkoholische Getränke nur in Apotheken auf Grund von ärztlichen
Rezepten, die zu bekommen allerdings nicht allzu schwer ist,
verabreicht. Als ob erzwungene Abstinenz eine geringere Barbarei als
Völlerei wäre!
Die Elektrizität wurde, wie Scribonius Largus (11) und
Dioscorides beweisen, schon im Altertum zu Heilzwecken angewandt, wenn
auch noch in recht primitiver Weise. Bei langwierigen Kopfschmerzen
legte man nämlich den Zitterrochen auf, bis an der behandelten Stelle
Taubheit entstand. Genügte ein Fisch nicht, dann wurde die Prozedur
wiederholt.
Behandlung durch Massage kannte bereits Hippokrates um 400
v. Chr., und zwar noch nicht einmal als Erster. Bekanntlich ist sie
nach verschiedenen Ansätzen 1575, 1650 und 1853 erst wieder durch
den holländischen Arzt Mezger in die offizielle Medizin eingeführt
worden[13].
Ebenso wurde eine Art Kneippkur angewandt, und zwar von
Asclepiades von Prusa, einem Arzt, der im 1. vorchristlichen
Jahrhundert in Rom großen Zulauf hatte. Er war ein Feind vielen
Medikamentierens, ließ seine Patienten fasten, verordnete Bewegung
und Massage und verschrieb Kaltwassergüsse,[S. 9] wie sein Kollege in
Wörishofen. Ferner verordnete er Regenbäder und Waten im Sande mit
nassen Füßen. Antonius Musa hat 23 v. Chr. den Augustus mit dieser
Therapie geheilt.
Auch Vivisektionen zu wissenschaftlichen Zwecken kommen im
Altertum vor, und zwar außer an Tieren auch an Verbrechern, zuerst –
nach Celsus (Prooemium ed. Daremberg p. 4, Zeile 37 ff.) und Tertullian
(de anima 10) durch Herophilus, den der Kirchenvater Arzt, oder besser
„Fleischhacker“ nennt. Leichensektionen kommen (nach Plinius hist.
nat. XIX, 86) erst unter den alexandrinischen Ärzten auf, während
Aristoteles wohl aus religiösen Gründen noch davor zurückschreckte.
Das ganze frühe Mittelalter hindurch war die Leichenöffnung – auch
bei den sonst so aufgeklärten Arabern – verpönt. Mondino de Liucei
(ca. 1275–1326) hat seit anderthalb Jahrtausenden als Erster wieder
menschliche Kadaver seziert. Seit dem 15. Jahrhundert aber war erst
der Bann gebrochen und Anatomie ein ordnungsmäßiges Lehrfach auf den
Universitäten[14].
Während der Star noch bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts durch
Versenkung der aus der Pupille geschobenen Linse in den Glaskörperraum
geheilt wurde, ist die Operation, d. h. die Entfernung nach außen
durch Eingriff bereits dem 4000 Jahre alten Papyrus Ebers bekannt und
wurde, wie Antyllus bezeugt, in der Antike geübt, um wie so vieles im
Mittelalter in Vergessenheit zu geraten.
Ein Vorläufer Harveys, der im Jahre 1619 den Blutkreislauf
entdeckte, war schon Erasistratos von Keos, um 300 v. Chr. Leibarzt
des Königs Seleucos I. Ebenso ist Galen, bis auf die Venenklappen,
der Entdeckung des berühmten Engländers sehr nahe ge[S. 10]kommen. Aber
auch er hatte Vorläufer in den alten Ägyptern, die bereits eine
rudimentäre Kenntnis des Blutkreislaufes besaßen. Beginnende
Herzklappenerkrankungen suchten sie, wie die heutigen Ärzte, durch Ruhe
zu beseitigen[15].
Sogar eine mit Mandragora(Alraun)wurzel vorgenommene Narkose
war den Alten wohl bekannt. Dioskurides behauptet, daß die mit
diesem Mittel beim Patienten hervorgerufene Gefühllosigkeit drei
bis vier Stunden angehalten habe. Bilsenkraut läßt sich bereits bei
Homer als Narkotikum nachweisen. Im 12. und 13. Jahrhundert unserer
Zeitrechnung wurde es allgemein zur Schmerzlinderung verwandt und von
Guy de Chauliac um 1300 sogar bei Amputationen benützt. Bereits 1460
beschreibt Heinrich von Pflospeundt in seiner „Bündt-Ertzney“ die
Inhalationsnarkose vor Operationen mit Mohn (Opium), Bilsenkraut und
Alraun[16].
Im Altertum verstand man bereits künstliche Glieder
anzufertigen. Schon bei den alten Indern waren Nasen, Ohren und Lippen
aus Gips etwas ganz Gewöhnliches, was sich aus der Häufigkeit des
strafweisen Abschneidens dieser Körperteile erklärt. Griechische und
römische Soldaten, denen im Kriege ein Arm oder Bein abhanden kam,
wußten sich Ersatz zu beschaffen. Das Royal College of Surgeons in
England besitzt in seinem Museum ein solches in einem Grabe in Capua
gefundenes Bein von etwa 300 v. Chr. Es wird im Katalog folgendermaßen
beschrieben: „Das künstliche Glied stellt genau die[S. 11] Form des Beines
dar; es ist aus Stücken dünner Bronze hergestellt, die mit Bronzenägeln
an einem hölzernen Kern befestigt sind. Zwei Eisenstangen, die an ihren
freien Enden Löcher haben, sind an dem obersten äußersten Ende der
Bronze befestigt...[17]“
Auch künstliche Augen und künstliche Zähne kommen damals
schon vor. Der erste, der im christlichen Mittelalter die Einsetzung
eines künstlichen Auges in die Augenhöhle eines lebenden Menschen
beschrieb, war der berühmte französische Chirurg Ambroise Paré. Im
Jahre 1561 stellte er ein solches aus emailliertem Gold her, und zwar
in den natürlichen Farben. Paré gibt sich aber nicht als Erfinder
dieses Verfahrens aus und erklärt noch nicht einmal, daß die Sache neu
wäre[18].
Götz von Berlichingens berühmte eiserne Hand, die ihm der
Schmied von Olnhausen anfertigte, nachdem er seine Rechte 1504 bei
der Belagerung von Landshut eingebüßt hatte, besaß nicht nur eine
Vorläuferin in der eines Ritters, der etwa 100 Jahre vor Götz im Rhin
ertrank, und dessen Hand man 1834 in Alt-Ruppin nebst Schwert, Sporen
usw. im Rhinbett fand, sondern ein wackerer Römer war bereits auf
dasselbe Auskunftsmittel verfallen. M. Sergius Silus (d. h. Stülpnase)
hieß der verwegene Held, der z. Z. des Zweiten Punischen Krieges seine
verlorene Hand durch eine eiserne ersetzte, mit der er Meisterstücke
der Tapferkeit vollführte. Plinius, der die Heldentaten dieses kühnen
Urgroßvaters des berüchtigten Katilina überliefert (nat. hist. VII, 105
f. und Livius XXXII, 27 ff.), meint, andere seien Sieger über Menschen
gewesen, aber Sergius habe selbst das Schicksal überwunden[19].
[S. 12]
Von Bazillen als Urhebern der Malaria hatte bereits Varro eine
Vorstellung, wenn er (R. r. I, 12) schreibt, daß an sumpfigen Orten
kleinwinzige Lebewesen entstehen, die man mit dem Auge nicht wahrnehmen
kann und die vermittelst der Luft durch Mund und Nase eindringen und
geschwächte Personen infizieren. Erst 1726 kommt der niederländische
Arzt Dr. Knott auf den gleichen Gedanken, und zwar spricht er von
Kleinwesen als Erregern der Lungenschwindsucht und nimmt ebenfalls
an, daß sie eingeatmet werden. Vermutlich seien sie auch die Ursachen
anderer Krankheiten und daher als ansteckend zu betrachten. Der Erste,
der Bakterien sah, und zwar im menschlichen Speichel, war Leewenhoek
1683[20].
*
Die Taxameterdroschke wird bereits im 9. Kapitel des 10. Buches
von Vitruvius „de architectura“ beschrieben. Es waren das Wagen, die an
ihren Achsen Stunden- und Meilenzeiger hatten, indem nämlich jedesmal,
wenn eine Meile zurückgelegt war, ein Steinchen mit hörbarem Tone in
ein im Innern des Wagenbodens untergestelltes Bronzegefäß fiel. Zählte
man die Steine, dann wußte man auch, wie viele Meilen man zurückgelegt
hatte. Daß solche natürlich sehr teuren Wagen auch im Gebrauch waren,
steht fest. Im Nachlaß des verschwenderischen Commodus befanden sich
einige, die Pertinax mit anderen Kostbarkeiten versteigern ließ. Aber
sogar Automobile besaß Commodus. Anders wenigstens ist die von
Julius Capitolinus im 8. Kapitel der Biographie des Pertinax gegebene
Beschreibung nicht zu verstehen. Er spricht von vorspannlosen Wagen von
neuartiger Konstruktion, deren Räder sich mit[S. 13] Hilfe eines sinnreichen
Mechanismus und eines verwickelten Räderwerkes von selbst um ihre Achse
drehten. Die Sitze waren so angebracht, daß sie dem Wagenführer Schutz
vor den Sonnenstrahlen boten. Auch ließen sie sich so drehen, daß der
Reisende auf der Fahrt stets Rückenwind hatte.
Auch ein Araber kam auf diesen Gedanken. Im arabischen genealogischen
Werke Lubâb (zitiert von Wüstenfeld, Genealogische Tabellen der
arabischen Stämme und Familien, Register p. 377) ist ein Araber er =
Rabî ibn Zijâd erwähnt, der vor 656 starb. Er trug den Beinamen „Fâris
el-Arrâde“, d. h. der Maschinenreiter, weil er eine Maschine erfunden
hatte, auf der er fahren konnte, als ob er auf einem Kamel säße. (Nach
einer Notiz des Herrn Hauptmann E. v. Zambaur in Wiener-Neustadt.) Im
Mittelalter spricht zuerst der geniale Roger Bacon (1214–1294) im 13.
Jahrhundert einen ähnlichen Gedanken aus, doch dürfte es sich nur um
einen Schlitten mit Segeln gehandelt haben. Interessant aber ist die
weitere Notiz: „Man kann ferner Instrumente zum Fliegen machen,
so daß ein in der Mitte sitzender Mann eine Kurbel dreht, durch die
besondere Flügel nach Art der Vögel die Luft treffen“[21]. Also ein
Vorläufer der Gebrüder Wright! Allerdings erging es ihm schlechter wie
diesen, denn die Kirche ließ ihn als „Zauberer“ lange Jahre im Kerker
schmachten!
Von Automaten, in deren Konstruktion das Altertum so
außerordentlich erfindungsreich war, interessiert uns im Zeitalter der
Luftschiffahrt besonders eine hölzerne Taube des Archytas von Tarent,
die tatsächlich imstande war, auf kürzere Strecken in der Luft umher
zu fliegen. Wenn die Taube nach beendetem Fluge[S. 14] sich auf die Erde
niedergelassen hatte, konnte sie sich allerdings nicht wieder erheben.
(Vgl. Gellius X, 12.) Demetrius von Phaleron hatte eine kriechende
Schnecke, in Olympia aber war ein flügelschlagender eherner Adler
(Pausanias VI, 20, 12).
Sogar Warenautomaten kannte das Altertum. Heron von Alexandrien
im 2. Jahrhundert v. Chr. (vgl. die Ausgabe von W. Schmidt, Leipzig
1899–1901 mit Illustrationen) erzählt außer von vielen anderen auch von
Weihwasserautomaten, die in den Tempeln aufgestellt waren und aus denen
Wasser floß, wenn man eine Drachme oder einen Obolus hineinwarf.
Besonders merkwürdig ist der Automat, den nach Erzählung der
byzantinischen Chronographen der oströmische Kaiser Theophilus
(829–842), durch die Schriften des genialen Heron angeregt, sich
anfertigen ließ. Er ließ nämlich zu beiden Seiten seines Thrones zwei
Löwen aus reinem Golde anbringen. So oft der Kaiser nun auf dem Throne
Platz nahm, erhoben sie sich mittels einer mechanischen Vorrichtung,
brüllten und legten sich dann wieder nieder.
Der Gedanke des Taucherbootes begegnet uns bereits zur Zeit der
Kreuzzüge. Es war allerdings sehr primitiv. Im Gedichte Salomon und
Morolf (Vers 174 und 342, Voigt) heißt es nämlich: „Môrolf im bereiten
hiez Ein schiffelîn von ledere Er ûf daz mere stiez. Daz was mit beche
wol berant; Zwei venster (glase fenster) gâben im daz liecht: Alsô
meistert ez sîn hant.“ „An ir aller angesicht Senkt er sich nider ûf
den grunt. Ein rôre in daz schiffelîn ging, Dâ mit Môrolf den âtem
ving. Daz het er gewirket dar an Mit eime starken ledere Môrolf der
listige man. Ein snuore die lag oben dar an, Daz[S. 15] der dugenthafte man
Daz rôre nit liez brechen abe. Er barg sich zuo dem grunde Volleclîchen
vierzehen tage[22].“ Ob ein ähnliches Fahrzeug in der Wirklichkeit
existierte, sei dahingestellt. Keinesfalls war es ein behaglicher
Aufenthalt. Die Abbildung eines Unterseebootes bzw. einer Taucherglocke
aus dem 14. Jahrhundert befindet sich im cod. germ. 5 der Münchner Hof-
und Staatsbibliothek.
*
Die berühmte Schnurrbartbinde „Es ist erreicht“ hat ihre
Vorläufer schon um 1600 gehabt. Im 15. Kapitel des 4. Buches schreibt
Cervantes in seinem Don Quichote: „Er stellte sich im Bett auf, eine
spitze Mütze auf dem Kopfe, den Knebelbart in Banden, damit er nicht
schlaff würde und nieder fiele“.
Daß die geschnürte Taille mit Decolleté bereits im 2.
vorchristlichen Jahrtausend in Kreta getragen wurde, dürfte manche Dame
interessieren. Das reizende 34 cm hohe dort gefundene Figürchen der
Schlangengöttin zeigt ein solches Kostüm, das mit unserer Frauenmode
verblüffende Ähnlichkeit besitzt. Der über und über gefältelte Rock
einer andern Figur ist ebenfalls ganz mit eleganten Volants besetzt,
dazu trägt sie ein enges Mieder, eine im Bogen ausgeschnittene Korsage
und stark ausgebogene, wohl wattierte Hüften. Der Rock ist deutlich
glockenförmig. Besonders von rückwärts könnte man diese Figuren leicht
für Modedamen unserer Zeit ansehen[23].
*
Die Kugelgestalt der Erde lehrten bereits im 6. vorchristlichen
Jahrhundert Anaximander und Pythagoras, und mit besonderem Nachdruck
wies etwa 350 v. Chr. Eudoxos auf dieselbe hin, Archimedes[S. 16] aber suchte
einen aprioristischen Beweis dafür zu erbringen. Der Kalif Al Manûm
ließ den Umfang der Kugel auf 24000 engl. Meilen, die Länge eines
Grades bis auf 500 m genau berechnen[24].
Um 270 v. Chr. hat der alexandrinische Mathematiker und Astronom
Aristarchos von Samos den Stillstand der Sonne und die
Bewegung der Erde um die Sonne gelehrt. Seleucus aus Seleucia
hat bereits um 150 v. Chr. eine unendliche Ausdehnung der Welt
angenommen und das sonnenzentrische System geradezu als Lehre
aufgestellt.
*
Die athenische Landwirtschaft der griechischen Blütezeit kannte
weder die Sense, noch den Flegel: man schnitt das Getreide in halber
Höhe mit der Sichel und drosch, indem man die Körner durch Pferde und
Maultiere aus den Ähren treten ließ. Auch die Egge war unbekannt; man
mußte den Samen mit der Schaufel unter die Erde bringen. Auch die
Dreifelderwirtschaft kannten die Griechen zu keiner Zeit. Ebenso fehlte
ein brauchbares Feuerzeug, so daß das Herdfeuer nie ausgehen durfte.
Geschah es aber doch, dann mußte die Hausfrau es mit der Lampe von der
Nachbarin wieder ins Haus tragen[25].
*
Zur römischen Kaiserzeit kamen in Gallien bereits Glasfenster
vor[26].
Damals konnte in Rom jedermann einen Auslaß aus der allgemeinen
Wasserleitung in seinem Hause haben, ebenso in Antiochia und
Alexandrien. Sogar nächtliche Straßenbeleuchtung war vorhanden[27].
Während im alten Rom die Prügelstrafe selbst bei Stabsoffizieren
noch zulässig war, wird in der[S. 17] humanen Gegenwart der größte Rohling,
der Baumpflanzungen und Blumenbeete aus Übermut zerstört, den Frauen
die Zöpfe abschneidet und die Kleider mit Kot beschmiert, lediglich
einige Zeit auf Staatskosten verpflegt[28].
*
Das Scheck- und Girowesen bestand bereits im Altertum (Cicero
epist. ad Att. XI, 24, XII, 24, 27, XV, 15), ja, Wechsel wurden bereits
bei den Babyloniern verwandt. Ebenso ist die Hypothek eine
bereits im 6. vorchristlichen Jahrhundert bestehende Einrichtung[29].
*
Anarchisten gab es auch schon im Altertum, und zwar in
Palästina, das in dieser Hinsicht durch fast anderthalb Jahrtausende
die Welt in Atem hielt. Flavius Josephus erzählt von den Sicariern oder
Dolchbrüdern, die in der 2. Hälfte des 1. nachchristlichen Jahrhunderts
die Propaganda der Tat in größtem Stile betrieben, und zwar nicht
etwa als Räuber, sondern – wie in der Gegenwart – als politische
Mordgesellschaft.
Ihre höchste Blüte erlebte die anarchistische Gesellschaft der
Assasinen zur Zeit der Kreuzzüge im gelobten Lande. Sie gingen
hervor aus der mohammedanischen ketzerischen Sekte der Ismaeliten
und lehrten den reinen Nihilismus, d. h., daß alles gleichgültig
und daher auch alles erlaubt sei. Ums Jahr 1100 war ihr gewaltiger
Führer Hasan-i-Sabbah, der Alte vom Berge, der vom Schlosse Alamut aus
durch Meuchelmord und Gewalttaten seine Gegner im Zaume hielt. Trotz
ihrer sittlichen Grundsätze waren diese[S. 18] Assasinen – wie noch heute
die Anarchisten – ihren Führern blind ergeben, und zwar in solchem
Grade, daß sich auf einen Wink des Führers hin die Wachen vom Turm
herabstürzten, nur um ihren Gehorsam zu zeigen, oder daß eine Mutter in
Verzweiflung geriet, wenn ihr Sohn von einer gelungenen Mordexkursion
zurückkehrte, statt für seinen Glauben zu sterben. Ihr Wirken lebt noch
heute im Abendlande fort: assassino und assassin, von Haschischin, dem
Rauchen des berauschenden Hanfes abgeleitet, heißt Mörder[30].
*
Reliquien von Heiligen wurden bereits im Altertum gesammelt.
Man ging im Blödsinn vielleicht nicht so weit, wie das Mittelalter,
das ein Stück von der ägyptischen Finsternis und ähnliches vorwies,
immerhin wurde nach Pausanias das Ei der Leda in einem Tempel in
Sparta, und die falschen(!) Zähne des erymanthischen Ebers im Tempel
des Apollo im Lande Opike denen, die nicht alle werden, gezeigt. Eine
antike Reliquienliste gibt Fr. Pfister „Der Reliquien-Kult im Altertum“
(Gießen 1909) I. Bd., S. 323 ff.
*
Auch eine besoldete Claque besaßen bereits die alten Römer.
Nero soll gar 5000 in seinen Diensten gehabt haben. Die Chefs der
verschiedenen Claquedivisionen erhielten je 40000 Sestertien Gehalt!
(Sueton, Nero XX, Tacitus Ann. XIV, 15, Dio. Cassius LXI, 20)[31].
*
Das Monocle oder Lorgnon darf sich gleichfalls eines ehrwürdigen
Alters rühmen. Kaiser Nero sah den Gladiatorenkämpfen im Zirkus durch
einen Smaragd zu[S. 19] (Plinius nat. hist. XXXVII, 64)[32]. Erst 1730 wird
wieder ein Monocle erwähnt, das Keyßler beim englischen Gesandten in
Rom, Herrn von Storsch, sieht und wie folgt beschreibt: „Wegen seiner
blöden Augen bedient er sich eines Fernglases, so mit einem dünnen
Kettchen am Rocke befestiget ist. Die Haut um sein Auge ist also
gewöhnet, daß sie sich fest um dieses Glas schließt, und er nicht
nöthig hat, solches mit den Händen daran zu halten“.
*
Ein jährliches Honorar von etwa 90000 Mark bezog Q. Roscius,
ein Zeitgenosse Ciceros, als Schauspieler (Plinius nat. hist.
VII, 128, X, 141, XXXV, 163 Sueton. Vesp. 19). Damit dürfte er von
den höchstbesoldeten Mimen der Gegenwart kaum übertroffen werden. Im
dritten vorchristlichen Jahrhundert bezog der Kitharode Amoibeus in
Athen für jedes Auftreten 1 Talent, also 4715 Mark! Die in Korinth
gekaufte Flöte des großen Virtuosen Ismenios kostete 7 Talente! (Vgl.
Aristeas bei Athenaeus XIV, 623d)[33].
*
Im Museum zu Odessa steht ein Stein, der in der alten Griechenstadt
Olbia aufgefunden wurde. Er trägt die Inschrift: „Ich künde, daß
282 Klafter weit mit dem Bogen geschossen hat der berühmte
Anaxagoras, des Demagoras Sohn –...“ Das war allerdings eine
fabelhafte Leistung, denn 500 m sind selbst für einen Gewehrschuß nicht
wenig, geschweige für einen Bogenschuß! Allerdings dürfte es sich nur
um einen Weitschuß ohne Rücksicht auf ein bestimmtes Ziel gehandelt
haben. Daß aber der Stein von einer[S. 20] Schützengilde gesetzt
wurde, und zwar auf einer scheibenartigen Tafel, erinnert stark an die
modernen Gebräuche.
*
Die einzige Steuer, die der in Italien wohnende römische Bürger
zu zahlen hatte, war eine Erbschaftssteuer von 5% von allen
Erbschaften und Legaten über 20000 Mark mit Ausnahme der von den
nächsten Blutsverwandten herrührenden[34].
*
Außer in Rom standen in keiner Stadt Italiens im Altertum
Soldaten.
*
Die Errichtung von Statuen war in der Antike eine so häufige
Ehrung, daß in Brescia einmal sogar dem 6jährigen Sohne eines
Decurionen eine Reiterstatue aus vergoldeter Bronze errichtet wurde.
Allerdings waren Statuen billig, der Ausgezeichnete zahlte sie meist
selbst und gab zudem Festivitäten.
Bereits im Jahre 73 n. Chr. wurde ein offizieller Katalog der
dem römischen Staate gehörigen Kunstwerke, vielleicht unter
Mitwirkung des Plinius, angelegt. Das Bruchstück eines zweisprachigen
aus dem 3. Jahrhundert stammenden Museumskatalogs hat sich noch
erhalten[35].
Anschlagsäulen für Vergnügungsanzeigen und Reklamezwecke gab
es schon in Herculanum. Und zwar waren die Plakate mit Gummiarabicum
angeklebt[36].
*
[S. 21]
Das Zweikindersystem wird bereits von Hesiod empfohlen, und
zwar in der Form, daß das Haus höchstens zwei Söhne besitzen soll. Man
erreichte dies durch Kinderaussetzung, was aber bei dem humanen Sinn
der Griechen mehr rechtliche als praktische Bedeutung hatte, und durch
Förderung des außerehelichen Verkehrs der Geschlechter[37].
Die Römer trugen vielfach einen Phallus als Brosche bzw.
Amulett, wie auch die öffentlichen Häuser in Pompeji durch einen großen
steinernen Phallus kenntlich gemacht waren. Im Geheimkabinett des
Museo Nationale in Neapel befindet sich eine große Sammlung solcher
Phalli. Die ägyptischen Prinzessinnen erhielten denselben Gegenstand in
Naturgröße aus Stein gefertigt ins Grab mitgegeben, um auch im Jenseits
nichts entbehren zu müssen[38].
*
Ein Zahlungsmoratorium kennt bereits das Gesetz Hammurabis,
das älteste Gesetzbuch der Welt, das etwa anderthalb Jahrtausende
in Kraft blieb. Der 48. Paragraph lautet nämlich: „Wenn jemand eine
verzinsbare Schuld hat und ein Unwetter sein Feld verwüstet, oder die
Ernte vernichtet, oder wegen Wassermangel Getreide auf dem Felde nicht
wächst: so soll er in diesem Jahre dem Gläubiger kein Getreide geben,
seine Schuldtafel (im Wasser) aufweichen und Zinsen für dieses Jahr
nicht zahlen“[39].
*
Die Könige der Spartaner, Alexander der Große, Justinian und viele
andere wurden in Honig zur[S. 22] letzten Ruhe gebettet. Die
konservierende Eigenschaft von Wachs und Honig war bereits den Scythen
und Persern bekannt[40].
Dagegen war es im Mittelalter Sitte, die Leiche der verstorbenen
Fürstlichkeiten und hohen Personen auszuweiden. Dabei verfuhr man
oft unglaublich roh. Matthäus Parisiensis (1135) erzählt von den
Prozeduren, denen der Leichnam König Heinrichs I. von England († 1135)
durch einen Fleischer unterworfen wurde, folgendes: „Sein Leichnam
wurde nach Rouen gebracht und da begrub man seine Eingeweide, sein
Gehirn und seine Augen. Der übrige Körper wurde überall mit kleinen
Messern geschnitten, mit vielem Salze bestreut, in Rindshäute gehüllt
und so, um den üblen Geruch zu vermeiden, eingenäht. Aber letzterer
war doch so stark und überwältigend, daß er die Umstehenden krank
machte. Darum starb auch der Mann, welcher, durch eine große Belohnung
gewonnen, des Toten Haupt, um das stinkende Gehirn herauszunehmen, mit
einem Beile gespaltet hatte, obwohl er sich den Kopf mit Leintüchern
umwickelt, und hatte schlechte Freude an dem Lohne. Das ist auch der
letzte von vielen, die König Heinrich umgebracht hat. Darauf wurde
die königliche Leiche nach Caën von den Dienstleuten getragen, und
als man sie daselbst in der Kirche, in der sein Vater beerdigt war,
aufgestellt hatte, so floß doch, obschon der Körper mit vielem Salze
gefüllt, und in viele Häute gepackt war, beständig eine schwarze und
gräßliche Flüssigkeit durch die Häute hindurch und wurde in unter die
Bahre gestellten Gefäßen von den Dienern, die vor Ekel fast vergingen,
aufgefangen und fortgeschüttet“[41].
[S. 23]
Die getrennte Bestattung von Weichteilen und Fleisch war durchaus
Sitte. So wurden z. B. die Eingeweide Kaiser Heinrichs IV. in Lüttich
beigesetzt, seine Leiche aber in Speier[42]. Hier fand auch sein Sohn
Heinrich V. die letzte Ruhe, nachdem seine Eingeweide in Utrecht
beigesetzt worden waren[43]. Richard Löwenherz verordnete gar, daß sein
Leichnam in Fontevrauld, sein Herz in Rouen, seine Eingeweide, Blut und
Hirn aber bei Chaluz bestattet werden sollten (Rog. de Hovedene)[44].
Ganz sonderbar war der Brauch, die Leichen der in weiter Ferne
Verstorbenen zu zerstückeln und die Stücke so lange in Wasser und Wein
zu sieden, bis sich die Knochen vom Fleisch lösten. Während die Gebeine
in die Heimat gebracht wurden, fand die Bestattung des Fleisches an Ort
und Stelle statt. So wurde z. B. auch Friedrich Barbarossa († 1190)
gesotten! (Itin. reg. Ric. I, 24). Landgraf Ludwig IV. von Thüringen
(† 1227), der Gemahl der heiligen Elisabeth, wurde ebenso behandelt
(h. Elis. 3580 ff.), desgleichen, um noch ein Beispiel zu nennen,
Ludwig der Heilige von Frankreich († 1270) (Guilelmi de Nangiaco Gesta
Philippi regis. Bouquet, Rec. XX, 466)[45].
Übrigens verbot Papst Bonifazius VIII. im Jahre 1299 bei der Strafe der
Exkommunikation die Leichen auszuweiden, zu kochen und zu zerstückeln
(Nach Heinrich Rebdorf)[46].
[S. 24]
Zweiter Abschnitt
Rechtspflege
Eine Schadenersatzpflicht des Tierhalters, wie sie gegenwärtig die
öffentliche Meinung beschäftigt und wie sie im Bürgerlichen Gesetzbuch
ausgesprochen ist, kennt bereits Hammurabi. Die §§ 250 und 251 lauten:
„Wenn ein Ochse beim Gehen auf der Straße (Markt) jemand stößt und
tötet, so soll diese Rechtsfrage keinen Anspruch bieten. Wenn der
stößige Ochse jemandes ihm seinen Fehler, daß er stößig ist, gezeigt
hat, er seine Hörner nicht umwunden, den Ochsen nicht gehemmt hat, und
dieser Ochse stößt einen Freigeborenen und tötet ihn, so soll er ½
Mine Silber zahlen.“ Also nur bei grober Fahrlässigkeit des Tierhalters
ist er verpflichtet, für den entstandenen Schaden aufzukommen.[47]
Das gilt auch dem Arzt gegenüber, wie aus § 218 hervorgeht: „Wenn
ein Arzt jemand eine schwere Wunde mit dem Operationsmesser aus
Bronze macht und ihn tötet, oder jemand eine Geschwulst mit dem
Operationsmesser aus Bronze öffnet und[S. 25] sein Auge zerstört, so soll man
ihm die Hände abhauen.“ Dagegen ist aber auch das ärztliche Honorar
festgesetzt: „Wenn ein Arzt jemandem eine schwere Wunde mit dem
Operationsmesser aus Bronze macht und ihn heilt, oder wenn er jemand
eine Geschwulst mit dem Operationsmesser aus Bronze öffnet und das Auge
des Mannes erhält, so soll er 10 Sekel Silber erhalten“, heißt es im
§ 215. Immerhin war es unter diesen Umständen nicht immer angenehm,
Operateur zu sein.[48]
*
Nach altdeutschem Rechte mußte der Richter mit einem Stabe in der Hand
auf seinem Sitze so bis zum Sonnenuntergang oder Abbruch des Dinges
– unter Umständen in Wind und Wetter, Sonnenbrand oder Schneesturm
– sitzen bleiben, wie er sich bei Beginn des Dings niedergelassen
hatte, „Bein mit Bein“ deckend. Die Soester Rechtsordnung schreibt
darüber: „Es soll der Richter auf seinem Richterstuhl sitzen als ein
grisgrimmender Löwe, den rechten Fuß über den linken schlagen, und
wann er aus der Sache nicht recht könne urteilen, soll er dieselbe
ein-, zwei-, dreimal überlegen“[A]. Sein Aufstehen oder Niederlegen des
Stabes hob die Rechtskraft der Sitzung auf[49].
Das vom Richter gefällte Todesurteil mußte noch bei scheinender Sonne
vollstreckt werden. Während[S. 26] der Verurteilte hingerichtet wurde, saßen
Richter und Schöffen in nächster Nähe, um sich bei Speise und Trank von
den Anstrengungen der Sitzung zu erholen[50].
*
Der Übermut der „heiligen Feme“ ging so weit, daß auf die Klage des
Freischöffen Meister Steinmetz im Jahre 1495 durch Femspruch alle
über 18 Jahre alten Mannspersonen des Hochgerichtes Waltersburg in
Graubünden geächtet und der Rache des Gegners preisgegeben wurden. Im
Jahre 1471 hatte es dieses westfälische Sondergericht sogar gewagt, den
Kaiser zur Verantwortung zu ziehen[51].
*
Die Folter drang in die deutsche Rechtspflege ein als Folge der
kirchlichen Inquisition. Nach altgermanischem Rechte hatte der Beklagte
sich durch Eid und Eideshelfer befreien können, in seltenen Fällen
durch Gottesurteil oder Zweikampf. Hier wird man also kaum behaupten
können, die Kirche habe eine Milderung der Sitten herbeigeführt[52].
Wie es noch im 17. Jahrhundert bei der Folterung zuging, lehrt
ein Bericht über das Verfahren unter Bischof Julius Heinrich von
Halberstadt-Braunschweig: „Sie (die in der Folterkammer anwesenden
Glieder des peinlichen Gerichts) trunken einander fleißig zu, daß sie
auch so toll und voll wurden, daß sie einesteils eingeschlafen...
Etwan in die dritte Woche kamen sie wieder, und als sie nun in solcher
Trunkenheit ihr gefaßtes Mütlein ziemlichermaßen[S. 27] ausgeschüttet, seyn
sie für diesmal davongegangen... Zum dritten Male bin ich abermal in
die peinliche Kammer gebracht usw. und Hans Saub war so trunken und
voll, daß er beim Tisch einschlief, und wenn er hörte, daß ich etwas
härter sprach, so wachte er auf und weisete mit den Fingern, sagend:
Meister Peter, hinan, hinan mit dem Schelm und Stadtverräter, und wenn
er solches gesagt, schlief er wieder ein vor Trunkenheit. Ingleichen
soffen die andern tapfer auch herum Wein und Bier, und wurden aus
Trunkenheit und sonsten so verbittert, daß nicht zu sagen“[53].
*
Im Mittelalter gehörte jeder zehnte der zum Tode Verurteilten dem
Henker, der ihn – natürlich gegen entsprechende Entschädigung – frei
lassen konnte. Der Kaiser bzw. römische König hatte nicht nur das
Recht, jeden zu begnadigen, es genügte bereits, wenn der Missetäter vor
Zeugen den fürstlichen Gewandsaum berührte und küßte. Die aus der Stadt
Verbannten konnten, wenn es ihnen gelang, den Zügel des Königspferdes
zu erfassen, mit dem Herrscher sicher und freien Fußes in die Stadt
zurückkehren. Trotzdem hatte der Henker bisweilen alle Hände voll zu
tun. So erzählt Felix Platter in seiner Selbstbiographie (S. 327) der
von Basel habe im Bauernkriege über 500 köpfen müssen.
*
Als eine vom Richter zu erbittende Gnade galt auch sein Verbot an
den Scharfrichter, vor oder nach der Hinrichtung den Körper des
Delinquenten zu berühren und damit die Schande der Familie nicht zu
vergrößern.
[S. 28]
*
Analog dem Seidenfaden, der nach altdeutschem Recht die Gerichtsstätte
umzog, eine festere Schranke bildend als stehende Barrieren, wurden
auch einzelne Gefangene auf diese Weise gebannt. So wurde vom Baseler
Schultheiß ein bischöflicher Dienstmann im 13. Jahrhundert im roten St.
Ulrichturm eingesperrt, indem er den Eingang des Gefängnisses mit einem
Seidenfaden umspannte, dessen beide Enden mit Wachs versiegelt waren.
*
Vor der Hinrichtung trat der Scharfrichter vor den armen Sünder, ihn um
Verzeihung bittend für das Leid, das er ihm im Namen der Gerechtigkeit
zufügen müsse. Die Carolina Karls V. bestimmt im 98. Artikel, daß der
Scharfrichter nach vollzogenem Hauptschlage mit dem blutrauchenden
Schwerte vom Schafott herab die Vertreter der Justiz zu begrüßen
und zu fragen habe: „Habe ich recht gerichtet?“, worauf der Richter
urteilte: „Du hast gerichtet, wie Urteil und Recht gegeben, und wie
der arme Sünder es verschuldet hat.“ Darauf schloß der Scharfrichter
mit dem Lobspruch: „Dafür danke ich Gott und meinem Meister, der mir
diese Kunst gelehrt.“ Machte er einen „Kunstfehler“, dann konnte es
ihn allerdings den Kragen kosten, denn das Volk verstand darin keinen
Spaß[54].
*
Der Gehenkte mußte, eine nicht gerade hygienische Verordnung, über
der Erde verwesen. Als zwei Brüder zu Freiburg in der Schweiz im 16.
Jahrhundert es wagten, die Leiche des dritten Bruders in[S. 29] der Nacht vom
Galgen zu nehmen, um sie zu bestatten, wurden sie vom Richterkollegium
mit Ausstechen der Augen bestraft[55].
*
Bei Tierplagen, hervorgerufen durch Maikäfer, Heuschrecken, Engerlinge
usw. wurde mit Erlaubnis der Bischöfe ein Prozeß nach kanonischem Recht
eingeleitet. Von der Kirchenkanzel herunter verkündete der Priester
unter dem Läuten der Glocken den Klageakt, das sündige Ungeziefer vor
das geistliche Gericht ladend. Ein Advocatus diaboli wurde für die
Tiere bestellt, hier ein Maikäferanwalt, dort ein Rattenfürsprecher.
Klage und Gegenklage wurde vernommen und damit lange Seiten der noch
erhaltenen Prozeßakten gefüllt. Ein Verteidigungstermin wurde gestellt,
ja nach dem Zeugnis des Züricher Chorherren Felix Hämmerlin ließ man
in einem Maikäferprozeß der Diözese Chur „in Anbetracht ihres
jugendlichen Alters und ihrer Kleinheit“ die Vorladung dreimal
ergehen. Endlich erfolgte das Kontumazialverfahren mit schwerem
Bannfluch, den sich die Stadtbehörden jeweils aus den bischöflichen
Kanzleien verschrieben.
Noch 1796 wurde in Schwaben ein Stier zur Abwehr gegen die Tierseuche
lebendig begraben[56].
*
Im Weistum von Wilzhut, zwischen Braunau und Salzburg, wird (um 1400)
bestimmt, daß im Falle ein Bauer um Geld gestraft wurde, ohne
daß er es zahlen konnte, seine Frau geschändet werden sollte.[S. 30]
Die Weisheit des Gesetzgebers hat aber sogar den Fall vorausgesehen,
daß dem Gerichtspfleger die Frau nicht gefällt. Da aber ja nicht
dieser, sondern der Bauer bestraft werden soll, so hat eintretenden
Falles der Gerichtspfleger das Recht, dem Gerichtsschreiber die
Exekution zu übertragen. Kann aber auch er den Reizen der Bäuerin
keinen Geschmack abgewinnen, dann kann er dem Amtsdiener den Vollzug
„auferladen“. Auf dessen Neigungen erstreckt sich die Fürsorge des
Gesetzgebers nicht mehr[57].
*
Felix Platter erzählt in seiner Selbstbiographie (S. 269), er habe im
Jahre 1556 selbst gesehen, wie die Leichenteile einer anatomierten
Kindsmörderin in Südfrankreich am Galgen gehenkt wurden.
Das preußische Justizkollegium erließ im Jahre 1709 eine Verordnung,
laut welcher Galgen erbaut werden mußten, um diejenigen im Sarge
daran zu hängen, die während der Pest gestorben seien, ohne
Arznei eingenommen zu haben. Augenscheinlich gönnte man dem Volke
nicht, zu beweisen, daß es auch ohne die Ärzte ginge. Il est mort dans
les règles sagt Molière so schön.
Noch im Jahre 1711 wurde in Preußen für Deserteure als Strafe bestimmt,
daß ihnen die Nase und ein Ohr abgeschnitten werden sollte,
ferner wurden sie an die Karre geschmiedet und mußten lebenslänglich
auf Festung arbeiten. Friedrich Wilhelm I. bestätigte diese Strafen, ja
er bestimmte, daß überführte Helfer von Deserteuren sogleich, ohne des
Königs Genehmigung einzuholen, aufgeknüpft werden sollten[58].
[S. 31]
Die Jesuiten waren, was außerordentlich viel sagen will, die
Verworfensten der ganzen Geistlichkeit in moralischer Hinsicht. Was
sie sich herausnehmen durften, lehrt die berühmte Skandalgeschichte
des Jesuiten Girard. Dieser hatte als Rektor des Seminars und
Schiffprediger in Toulon auch eine heimliche Bußanstalt für Frauen
eingerichtet, in welche die schöne und fromme Katharina Cadière,
Tochter eines reichen Kaufmanns, 1728 eintrat. Es gelang Girard, durch
Anwendung der raffiniertesten sexuellen Mystik das unschuldige Mädchen
zu verführen, und durch alle möglichen unzüchtigen Mittel brachte er es
so weit, daß die Arme in schwere Hysterie verfiel. In diesem Zustande
schwängerte er sie, wußte aber sofort nach jesuitischer Moral durch
ein wirksames Abtreibungsmittel die Folgen zu verhindern. Im gegen ihn
angestrengten Prozeß wurde er freigesprochen!![59]
*
Im bayerischen Gesetzbuch, das Kreittmayr 1751 herausgab, ist die
Tortur noch aufrecht erhalten. Sie soll zwar nicht mehr als dreimal
wiederholt werden, aber bei Widerruf greift sie stets und so oft wieder
Platz, als der Widerruf geschieht. Auch wird die gleich anfänglich zu
zwei oder drei Malen eingeteilte oder wegen bezeigter Unempfindlichkeit
repetierte Tortur nur für einmal gerechnet! Ergeben sich bei
der Wiederholung neue Indizien, dann können die folgenden Grade noch
verschärft werden. Auch Zeugen dürfen gefoltert werden. Und zwar waren
Daumschrauben, Aufziehen, Spitzruten, Bock- und Leibgürtel, die 48
Stunden umgelegt blieben, gesetzliche Foltermittel! Daß man nicht
allzu sanft – nach dem Vorbilde des Hexenhammers und den in der
alleinseligmachenden Kirche geübten Praktiken – ver[S. 32]fuhr, geht aus
Kreittmayrs Bemerkung hervor, daß die Tortur dem Tode oder wenigstens
dem Handabhauen gleich geschätzt werde![60]
*
Als erster deutscher Fürst schaffte der Freidenker Friedrich der Große
von Preußen kurz nach seiner Thronbesteigung unterm 3. Juni 1740 die
Tortur ab, allerdings 112 Jahre später, als dies in England geschehen
war. Die Juristen leisteten dagegen – wie nicht anders zu erwarten –
den heftigsten Widerstand und erhoben die lärmendsten Vorstellungen.
Sie meinten, alle Diebesbanden von ganz Deutschland würden sich nun
nach Preußen wenden. Da Friedrich aber kein Jurist, sondern ein
genialer Mann mit gesundem Menschenverstand war, zudem frei von jeder
kirchlichen Beeinflussung, so blieb es dabei[61].
Die völlige Aufhebung der Tortur in Bayern erfolgte erst 1806[62], in
Hannover erst 1840[63]. Der letzte vom preußischen Staat angezündete
Scheiterhaufen brannte am 15. August 1786[64]. In Eisenach wurde vor
den Augen der zwangsweise herbeigeführten Schuljugend am 20. Juli
1804 ein vierfacher Brandleger aus Hötzelsroda bei lebendigem Leibe
eingeäschert. Ja, noch Ende des Jahres 1813 soll, wie ich, allerdings
ohne Quellenangabe, erfahre, in Berlin ein Verbrecherpaar, Mann und
Frau, wegen zahlreicher Brandstiftungen in gleicher Weise justifiziert
worden sein.
*
Könige und Hofrichter waren in gleicher Weise Schenkungen zugänglich.
Ein Abgesandter der Stadt Frankfurt berichtet 1418 dem Rate, „er möge
doch erwägen, wie wichtig es sei, dem König reiche Gaben zu senden;
die Nürnberger schenkten immer mehr als andere und seien deshalb
allmächtig“[65].
[S. 33]
Als der Rat der Stadt Frankfurt 1722 den späteren Schultheißen Ochs
(von Ochsenstein) nach Wien schickte, um den Reichshofrat Grafen Stein
für seine Sache zu gewinnen, erhielt er u. a. folgende Instruktion: er
solle dem Grafen erklären, „daß wir, wenn derselbe alles dies erwirken
und den Magistrat wieder in den Stand setzen werden, unsere reale
Erkenntlichkeit erweisen zu können, gegen Se. Exzellenz für die viele
gehabte Mühe uns nach und nach, längstens in Jahresfrist, mit einer
Remuneration von 10000 Talern i. e. 15000 Gulden einstellen würde“.
*
Auch der Kaiser war gegen Geld keineswegs unempfänglich. Ochs
erhielt 1729 den Auftrag, dem Kaiser 100000 fl. zu seinem Schloßbau
– für ein Trinkgeld war die Summe doch zu hoch – anzubieten.
Aber er erlebte eine Überraschung, über die er am 14. Januar 1730
folgendes schrieb: Er hätte vorsichtig dem Reichs-Vizekanzler das
Angebot gemacht. „Er hörte mich genau an und sagte: es seye zwar gut,
aber noch nicht de tempore; bürgerliche Deputirte hätten 200000
fl. offeriert, und zwar quartaliter 25000..“ ein köstliches
Wettschießen!
*
Der Vizepräsident des Reichshofrates hatte Ochs klar gemacht, daß
verschiedene Reichsstädte ihm etwas verehrt hatten. „Ich wolle also
Magistratum ersuchet haben umb ein Stück extraordinari Hochheimer Wein
vom 19er Jahr, und zwar vorher drei bis vier Proben, so in Krügen
immediate an Vice-Präsidenten in einem Kästlein geschicket werden
könnten. Ich habe es wie billig vor eine Gnade erkennen müssen, und
sehe[S. 34] auch nicht, wie es zu dekliniren“. Also wohin Ochs auch kommt,
überall am Kaiserhofe Bestechlichkeit! In derselben Tonart geht es
weiter. Fast alle Personen, mit denen Ochs in Wien zu tun hat, müssen
aus der Frankfurter Stadtkasse bestochen werden.
Kriegk stellt eine große Reihe von Bestechungsposten, die in den
geheimen Ausgaben Frankfurts gebucht sind, zusammen, und dabei ist nur
ein einziges Mal im Jahre 1771 angegeben, daß ein Herr eine ihm
angebotene Summe von 200 Dukaten nicht angenommen habe. Ob es zu wenig
war?
Bezeichnend für die Denkweise ist die Antwort des Baron von
Vockel in Wien, dem man 1754 100 Dukaten als Referenten in einer
Rechtsangelegenheit eingehändigt hatte: er habe das Geschenk
„danknehmigst angenommen und sothaner Generosität bei einer anderweiten
Gelegenheit justizmäßig (!) eingedenk zu sein angesichert“.
*
Noch ein Beispiel für unzählige! Die Reformierten wollten den Bau einer
Kirche durchsetzen und machten diesbezüglich auch beim kursächsischen
Hof Anstrengungen. Im Jahre 1750 erhielt nun der Frankfurter Rat
aus Dresden ein Schreiben, in dem es u. a. heißt: „Ihro Hoheit die
Churprincessin (eine Tochter Kaiser Karls VII.) haben auf den Ihnen
geschehenen Vortrag sich dahin geäußert, wie Ihro die ganze Sache
schon bekannt sei, und Sie Sich erinnerten, wie man in dieser Sache
nicht nur Ihren Hrn. Vater, den höchstseligen Kaiser Karl VII. mit
einer[S. 35] Summe Geldes gewinnen wollen, sondern auch Ihr einen schönen
Beutel mit Dukaten, wenn Sie zu dem reformirten Anliegen behülflich
sein würde, zu offeriren Gelegenheit genommen“. Die Bestechungsversuche
wurden also ganz öffentlich unternommen[66]!
Heute verstößt es gegen den Ehrenkodex der Rechtsanwälte, also von
Privatpersonen, ein höheres Honorar sich auszubedingen für den Fall,
daß sie in einem Prozeß gewinnen!
*
Bezeichnend für die Roheit des Mittelalters und die außerordentliche
Mannigfaltigkeit der vollstreckten Todesstrafen ist, daß man zum
Verbrennen verurteilte Personen begnadigte zum Sieden in einem
Kessel, der gewöhnlich mit Öl oder Wein, manchmal mit Wasser gefüllt
war[67]!
Im Jahre 1466 wurde in Frankfurt eine nicht genannte Todesstrafe in die
des Ertränkens umgewandelt weil – der Delinquent krank war[68]!
*
Während des ganzen Mittelalters, besonders aber in dessen zweiter
Hälfte, sind die Strafen im christlichen Abendlande gewiß nicht
humaner, eher grausamer als vier Jahrtausende früher im Gesetzbuch
Hammurabis, als in Indien, China, Persien oder sonstwo. Legale Strafen
sind: Vierteilen, Rädern, Pfählen, Verbrennen, Ersäufen, Einmauern,
Lebendigbegraben, Ausdärmen, Abschneiden der Zunge, Ausstechen der
Augen, Sieden in Wasser oder Öl, Abziehen der[S. 36] Haut usw. usw.[69],
und zwar zum großen Teil noch im 18. Jahrhundert. Daß die Kirche
weit entfernt das Strafwesen zu mildern, durch das scheußliche
Inquisitionsverfahren es noch grausiger machte, mindestens nicht auf
Beseitigung der Tortur hinwirkte, ist bemerkenswert. Was ihr während
der anderthalb Jahrtausende der Herrschaft nicht gelang, erreichten die
Freigeister und Philosophen der Aufklärung in kürzester Zeit. Nicht die
Kirche hat die Menschenrechte proklamiert und damit das Mittelalter mit
seiner barbarischen Geringschätzung des Lebens beschlossen, sondern die
große französische Revolution, deren Segnungen Deutschland dem ersten
Napoleon verdankt. Zur Geburtstagsfeier des großen Korsen im Jahre 1806
mußte die Stadt Frankfurt ihr Hochgericht abbrechen. Der Marschall
Augereau brauchte den Platz für ein Feuerwerk, das aber nicht, wie
bisher, der Verbrennung Unschuldiger, sondern der Befreiung von uralter
Knechtschaft galt. Mit dem Code Napoleon ist die feudal-klerikale
Periode des Mittelalters und der Barbarei begraben.
Die Humanität ist also erst seit wenig mehr als einem Jahrhundert
Gemeingut des zivilisierten Europa und beginnt es zu werden mit dem
Augenblick, wo das Christentum, dessen Existenzberechtigung nach dem
Geiste seines erhabenen Stifters eben auf dieser Humanität basiert,
wenigstens als Kirche, zu herrschen aufgehört hat!
*
Genügt unser Recht allen Anforderungen der Vernunft und Menschlichkeit?
[S. 37]
Nach unserm BGB. wird die Alimentationspflicht von väterlicher Seite
verwirkt, wenn die Mutter in der kritischen Zeit mit mehreren Männern
Umgang hatte. Das heißt, das sowieso rechtlich und sozial schwer
geschädigte uneheliche Kind wird noch weiter gestraft, indem ihm jede
väterliche Unterstützung entzogen wird.
*
Die kontrollierte Prostituierte bleibt nach dem heute geltenden Recht
nicht nur straflos, sondern der Staat sichert sich sogar durch Steuern
einen Anteil an ihrem Verdienst. Dagegen kann aber jeder, der ihr
Wohnung gibt, wegen Kuppelei belangt werden. Ihr Gewerbe ausüben und
Steuer zahlen dürfen also die Prostituierten, wohnen aber nicht!
*
Auch § 175, der die widernatürliche Unzucht zwischen Personen
männlichen Geschlechtes mit Gefängnis, ev. noch mit Verlust der
bürgerlichen Ehrenrechte bedroht, ist als mittelalterliches Rudiment in
Geltung. Der Gesetzgeber nahm weder Anstand an der Inkonsequenz, beim
einen Geschlecht zu verbieten, was dem andern erlaubt ist, noch hielt
ihn Scheu vor den intimsten Intimitäten des Privatlebens zurück, noch
die Erwägung, damit einen Erpresserstand zu züchten. Ja, die Frage,
ob es sich um Laster oder krankhafte Veranlagung handelt, wurde noch
nicht einmal hinlänglich geprüft. Der Hauptgrund für Aufrechterhaltung
des Paragraphen ist der Widerstand orthodoxer Kreise, die deutsche
Verhältnisse des 20. Jahrhunderts unter dem Gesichtswinkel der vor
2½ Jahrtausenden im Judenvolke bestehenden beurteilen und das
gottgefällig[S. 38] nennen. Vielleicht sind diese auch der Ansicht, daß
Prozesse wie Harden-Moltke und Harden-Eulenburg der öffentlichen
Sittlichkeit förderlicher sind als Schmutzereien einzelner im stillen
Kämmerlein.
*
Auf der internationalen kriminalistischen Vereinigung des Jahres
1909 wurde festgestellt, daß in Deutschland jährlich 10 Millionen
Polizeistrafen verhängt werden! Also jeder vierte straffähige
Deutsche wird jährlich in wirksamer Weise an die segensreiche Tätigkeit
der hl. Hermandad erinnert.
*
Nach österreichischem Gesetz muß das „Allerheiligste“ der katholischen
Kirche von jedermann, Jude, Freidenker, Protestant, gegrüßt werden.
Ein Schwede, unkundig dieses Gesetzes, wurde vor einigen Jahren
wegen Unterlassung des Grußes in Ischl zu Gefängnis verurteilt!
*
Der Redakteur des „Bütower Anzeigers“ Hugo Röhl war auf Veranlassung
des Konsistoriums der Provinz Pommern angeklagt worden, durch eine
Artikelserie den Pastor und Lokalschulinspektor Pötter fortgesetzt
öffentlich beleidigt und unwahre Tatsachen über ihn verbreitet zu
haben. Der Tatbestand war folgender:
Pötter hatte den 42jährigen Lehrer Wockenfuß so lange gequält, bis er
Selbstmord begehen wollte. Am zweiten Osterfeiertag sang Wockenfuß
mit seinen Schülern zu einer Feier auf dem Gute. Bei einem deshalb
ausbrechenden Wortwechsel wurde Wocken[S. 39]fuß von Pastor Pötter zu Boden
gestoßen. Als die Wirtin des Pastors im Dezember 1902 einem Knaben
das Leben schenkte, brachte der Mann Gottes den Lehrer in Verbindung
mit den kursierenden Gerüchten, während in Wahrheit der Bruder
Pötters Vater des Kindes war. Kurz nach Weihnachten erschien Pötter
im Schulhause, ließ den Lehrer aus dem Bette unter den Weihnachtsbaum
im Schulzimmer rufen, las ihm aus der Bibel ein langes Kapitel vor
und sagte, als der verwunderte Lehrer ihn nach seinem Begehren frug:
„Schweigen Sie, es kommt! Sie sind einer von denen wie der Abschaum der
Menschheit, der Krupp ums Leben gebracht hat. Sie haben mich beleidigt!
Mit diesem Stock schlage ich den auf das Lästermaul, der noch einmal
so etwas sagt.“ Dabei erhob der Seelenhirte den Stock gegen Wockenfuß,
der am Verlassen des Zimmers durch zwei Männer verhindert wird, die der
Pastor mitgebracht und neben die Tür postiert hatte! Wockenfuß brach
ohnmächtig zusammen.
Die Folge war eine Klage des Pastors gegen den Lehrer auf Überschreiten
des Züchtigungsrechtes. Ohne Verhör wurde Wockenfuß mit Verweis,
Ordnungsstrafe und schließlich mit Entziehung des Züchtigungsrechtes
bestraft, endlich wurde er wegen vier einem Knaben erteilter leichter
Hiebe seines Amtes entsetzt. Pötter hatte ihm nämlich pflichtwidrig
nichts über den Entzug des Züchtigungsrechtes mitgeteilt!
So ähnlich hat der wackere Pastor alle seine Lehrer behandelt! Einer
konnte sich nur mit der Dunggabel seiner erwehren! Einen anderen sucht[S. 40]
Pötter zu einem für ihn günstigen Zeugnis in einer Strafsache gegen ihn
zu bewegen. Soundso oft steht Pötters Eid gegen den der Lehrer.
Der Staatsanwalt erkannte an, daß in allen Fällen, in denen der
„Bütower Anzeiger“ das Verhalten des Pastors zu Lehrer Wockenfuß scharf
gegeiselt hatte, der Wahrheitsbeweis völlig geglückt sei!
Und das Urteil? Der Gerichtshof zu Stolp in Hinterpommern hielt den
Wahrheitsbeweis in folgenden Punkten für erbracht: Pötter hat den
Lehrer Halpap aus dem Lehramt vertrieben, er hat eine „Fertigkeit“ in
Lehrerkränkungen, er hat die Unwahrheit gesprochen, er hat leichtfertig
und aus Rachsucht Anzeigen gegen den Administrator des Grafen Schwerin,
des Patronatsherrn, erstattet, er hat sich durch seine Handlungen
in Gegensatz zu seinem Eide gestellt. Ferner wurden die edlen und
selbstlosen Motive des Angeklagten Röhl vom Gerichtshof ausdrücklich
anerkannt und – es will gar nicht aus der Feder – dieser selbe Röhl
zu 500 Mark Geldstrafe oder 50 Tagen Gefängnis verurteilt!
Nach in ganz Deutschland geltendem Recht mußte das Gericht so
urteilen!
Und Pötter? Es wurde festgestellt, daß sämtliche Lehrer vor ihm die
größte Angst hatten, aber eine Beschwerde hätte gar keinen Sinn
gehabt, denn nach dem famosen, heute noch in Preußen gültigen
Disziplinargesetz vom 21. Juli 1852 ist, wenn ein Lehrer sich über
einen Vorgesetzten beschwert, die Behörde nicht verpflichtet,
auch den Lehrer nach Vernehmung des Vorgesetzten nochmals zu
hören, sondern die Aussagen des Vorgesetzten[S. 41] gelten für
erwiesene Tatsachen. Ferner: Wenn ein Vorgesetzter über einen
Lehrer Klage führt, so entscheidet die Behörde, ohne vorher den Lehrer
oder seine Zeugen gehört zu haben. Diese Gesetze gelten heute noch,
im 20. Jahrhundert, auch gegen Gymnasialprofessoren, und es gibt noch
in Deutschland „Männer“, die solche Behandlung sich gefallen lassen[70]!
*
Am 28. Juli 1905 nachts gegen 1 Uhr führte ein Ehepaar mit der
Schwägerin ihren Hund auf die Straße. Ein angetrunkener Passant
ärgerte sich über das Tier und äußerte zu einem in der Nähe stehenden
Schutzmann – Beuche hieß das Auge des Gesetzes – daß der Hund ohne
Maulkorb sei. Das war nun zwar nicht der Fall, aber pp. Beuche, der
wohl die Gelegenheit für günstig hielt, seine „Schneid“ zu beweisen,
brüllte den Eigentümer barsch an. Als dieser sich den Ton verbat,
packte ihn der Hüter der öffentlichen Ordnung am Genick und
stieß ihn vor sich her. Sein Protest dagegen wurde vom Beamten mit
Faustschlägen auf den Kopf beantwortet. Sein Hinweis auf einen
vom Polizeipräsidenten ausgestellten Jagdschein wurde vom Schutzmann
zurückgewiesen mit der Bemerkung, der „Wisch“ genüge ihm nicht,
zugleich bekam der Ehemann etliche Fußtritte. Seine Frau,
die ihre Entrüstung in Worte kleidete, bekam Faustschläge auf die
Brust, die, wie auch beim Ehemann, laut ärztlichen Attestes Spuren
hinterließen. Darauf erstattete der Gatte gegen den Schutzmann Beuche
Anzeige wegen Körperverletzung.
[S. 42]
Soweit ist alles in Ordnung, und wir hätten keinen Grund von den
Brutalitäten eines subalternen Rohlings an dieser Stelle Notiz zu
nehmen, wenn das Verhalten der Behörde sie nicht in andere Beleuchtung
rücken würde.
Die Staatsanwaltschaft lehnte nämlich ein Einschreiten gegen ihr
Organ ab und erklärte, daß der Beamte so, wie er gehandelt habe,
hätte handeln müssen! Nicht genug damit, drehte sie den Spieß
um. Da im Falle des Stattgebens der Anklage die drei Mißhandelten als
Zeugen gegen Beuche vereidigt worden wären, war die einfachste und
nördlich der Mainlinie auch beliebteste Art dies zu verhüten die, aus
Klägern bzw. Zeugen Angeklagte, die bekanntlich nicht schwören
können, zu machen. Damit war ihnen die Möglichkeit des Beweises
abgeschnitten. Der Gerichtshof glaubte – was er nach der Prozeßlage
ja auch bona fide tun konnte – dem als Zeugen vernommenen
Schutzmann und verurteilte den Ehemann zu 50 Mark Geldstrafe, die
eine Frau wegen versuchter Gefangenenbefreiung zu drei Tagen
Gefängnis, die andere wegen des gleichen Reates zu einem Tage.
Dabei handelte es sich um angesehene Personen aus dem Kaufmannsstande,
die noch niemals mit der Polizei in Konflikt gekommen waren. Das Urteil
wurde vom Schöffengericht I Berlin gefällt[71].
Da jedes Volk die Polizei hat, die es verdient, ist dem Vorkommnis
Allgemeingültigkeit nicht abzusprechen. Immerhin erscheint es
rätlich, noch einige ähnlich gelagerte Fälle, die zeigen, was der
Reichs[S. 43]angehörige zu Beginn des 20. Jahrhunderts von Subalternbeamten
aushalten muß – das ist das wesentliche – anzuführen.
Gleichzeitig sei aber konstatiert, daß wir nicht aus verbohrtem, uns
völlig fernliegendem Partikularismus lediglich solche Vorkommnisse
aus Norddeutschland registrieren, sondern nur deshalb weil uns aus
Süddeutschland kaum ähnliche Fälle bekannt sind. Gewiß gibt es auch
dort Rohlinge, aber Gerichte und Öffentlichkeit wissen mit ihnen fertig
zu werden.
*
Am 21. November 1906 wurde der Töpfer Marin in Zoppot wegen einer
Schulstrafe von einer Mark von zwei Schutzleuten, denen er
Zahlung anbot, am Bahnhof verhaftet und ins Gefängnis gebracht,
aus dem er am nächsten Tage mehr tot als lebendig entlassen wurde. Der
Arzt, der Marin zwei Tage später untersuchte, stellte ihm ein Attest
aus, wonach er den Mann in einem „geradezu desolaten Zustande“ befunden
hatte. Fast der ganze Körper war zerschunden, auch ließ die
Untersuchung den Bruch einer oder mehrerer Rippen vermuten.
Marin war daraufhin sieben Wochen erwerbsunfähig. Vor Gericht
wurde festgestellt, daß die Hüter der öffentlichen Ordnung zusammen mit
dem Gefängniswärter Marin, der Zahlung auch im Gefängnis anbot,
mit den Füßen und einem derben Stock mißhandelt und in die
Rippen getreten hatten. Außerdem nahm man ihm seinen Wochenlohn
von 22,70 M. ab. Als Marin sich in der Zelle auf die Pelerine des
einen Schutzmannes – Kamin hieß der Kavalier – setzte, schrie dieser
ihn an: „Du[S. 44] roter Hund sitzt auf meiner Pelerine“ und schlug
ihn mit dem Helm, den er an der Spitze hielt, ins Gesicht.
Marin erstattete Strafanzeige, und die Verhandlung fand vor dem
Landgericht in Danzig statt. Der Staatsanwalt stellte zunächst mit
großer Energie fest, daß Marin gewerkschaftlich organisiert, also
Sozialdemokrat sei. Daraufhin wurden der Gefängniswärter und
der Schutzmann zusammen zu einer Geldstrafe von 100 M. wegen
Körperverletzung und Beleidigung verurteilt!
Dasselbe Gericht hat einige Tage später einen nicht
vorbestraften 19jährigen Lehrling, der in angetrunkenem Zustande einen
Arzt und seine Gattin mehrmals anrempelte und beleidigte, dann aber
brieflich und vor Gericht seine Tat bereute, zu einem Jahr und einem
Monat Gefängnis verurteilt[72].
*
An einem Abend wartete Frau B. vor dem Stadtbahnhof Alexanderplatz
in Berlin, als ein betrunkener Schutzmann mit den Worten auf sie
zutrat: „Du Sau, was stehst du hier herum?“ Sie verbat sich das Duzen
und sagte, daß sie auf ihren Mann warte. Auf weitere Flegeleien hin
suchte sie ihm zu entrinnen, der Schutzmann lief ihr aber nach, zog,
als die Menge gegen ihn Stellung nahm, den Säbel, hieb um sich und
versetzte mit den Worten: „Du Sau, warte nur, wenn ich dich erst
auf der Wache habe“, ihr zwei Hiebe mit dem Säbel über das
Kreuz. Ein Arzt,[S. 45] der den Vorgang mit angesehen und beobachtet hatte,
wie der Schutzmann die Frau sogar in schamloser Weise angriff,
wollte als Zeuge mit auf die Wache kommen. Das war aber entschieden
nicht im Sinne der Hüter des Gesetzes, denn man wollte ihn erst nicht
hinein lassen. Ein Beamter nahm den Arzt beim Wickel und stieß ihn
einfach in die Arrestzelle, aus der er erst durch die Intervention des
Polizeihauptmannes befreit wurde. Dann erstattete man gegen ihn Anzeige
wegen Hausfriedensbruches, der aber nicht stattgegeben wurde.
Da das Gericht annahm, daß der Angeklagte sich subjektiv nicht
bewußt gewesen sei, in widerrechtlicher Weise gegen die Frau
einzuschreiten, sie auch nicht vorsätzlich geschlagen, sondern
sie nur beim Herumfuchteln mit dem Säbel getroffen habe,
verurteilte es ihn lediglich wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe
von 100 M.
*
Ein Arbeiter, der einem Schutzmann gesagt hatte: „Sie haben uns
gar keine Vorschriften zu machen, denn dazu sind Sie uns zu dumm; ich
habe so viel Grütze in den Beinen, wie Sie im Kopf“, wurde dagegen in
Halle vom Gericht zu einer Gefängnisstrafe von 2 Monaten verurteilt!
Ein Student, der ebenfalls in Halle einen Polizeisergeanten mit
dem Stocke derart über den Helm geschlagen hatte, daß der Stock in
Stücke ging, die Helmspitze abbrach und der Helm sich verbog, dann im
Wachtlokal spöttisch geäußert hatte: „Ach, bei der Halleschen Polizei
braucht man nur zu fragen, was die Sache kostet, dann ist schon[S. 46]
alles erledigt,“ wurde zu einer Geldstrafe von 40 M. verurteilt.
*
Der Referendar Morell war zusammen mit dem Kammergerichtsreferendar
Tschepke am 20. November 1906 auf einem Berliner Polizeirevier
erschienen, um einen Automobilführer, der sie falsch gefahren,
feststellen zu lassen. Die nächtliche Störung gefiel den wackern
Männern der Ordnung augenscheinlich gar nicht; deshalb stellten sie
zwar nicht den Autoführer fest, behielten aber die beiden Kläger
auf der Wache! Als Morell dagegen protestierte, schrie der
Wachthabende Korrhun dem Schutzmann Keppler zu: „Machen Sie den Mann
ruhig.“ Keppler kam dieser Aufforderung gründlich nach, faßte Morell an
beiden Schultern und schüttelte ihn gewaltsam so hin und her, daß er
mit dem Kopf gegen die Wand flog. Sein Hinweis auf seine Eigenschaft
als Referendar nützte gar nichts. Als Morell seinem sich entfernenden
Freunde nachfolgen wollte, stürzten sich beide Schutzmänner auf ihn,
hielten ihn mit Gewalt zurück, und während Keppler den Referendar
Tschepke hinausbeförderte, würgte Korrhun, ein Hüne, den
ersteren, schlug ihn auf den Kopf und ließ ihn schließlich in
eine Zelle sperren, wo er ihn hinter einem eisernen Gitter halb
bewußtlos bis 5½ Uhr festhielt.
Auf die Anzeige Morells hin, lehnte die Staatsanwaltschaft ein
Verfahren gegen die Schutzleute ab, leitete dagegen das typische gegen
Morell(!!) wegen „Beleidigung“ der Schutzleute,[S. 47] „Widerstandes
gegen die Staatsgewalt“ und „Hausfriedensbruch“ ein! Erst auf Anweisung
des Oberstaatsanwalts wurde die Anklage auch gegen die Schutzleute
wegen Beleidigung, Mißhandlung und Freiheitsberaubung erhoben, so daß
nunmehr neben Morell auch diese die Anklagebank zierten. Morell wurde
freigesprochen, da seine Angaben sich als wahr, die beider
Schutzleute als unwahr herausstellten. Korruhn erhielt 5 Monate
Gefängnis, Keppler eine Geldstrafe von 100 M.
*
Eine Frau wollte, wie ein konservativer Abgeordneter im preußischen
Abgeordnetenhause 1908 ausführte, von Grunau nach Hirschberg fahren.
Das Geld, das sie zur Bezahlung der Fahrkarte hinlegte, war schmutzig
und wurde für falsch gehalten. Daraufhin sperrte man die Frau
mit ihrem Kinde, einem dreieinhalbjährigen Knaben, ein. Eine
Hausuntersuchung beim Ehemann, einem Arbeiter, verlief resultatlos.
Die Frau blieb vier Tage eingesperrt, endlich kam das Geld
zur Reichsbanknebenstelle, von da an die Filiale des Schlesischen
Bankvereins und schließlich zu einem Goldarbeiter, aber es war und
blieb absolut echt. Der Staatsanwalt schickte es darauf zur kgl.
Münze, die den ganzen Betrag in funkelnagelneuen Stücken zurückzahlte.
Daraufhin wurde die Frau entlassen und meldete sich beim Redner. Die
Auslagen betrugen 17,90 M. Die Staatsanwaltschaft aber weigerte sich,
diese zurückzuerstatten. Redner setzte daraufhin einen Brief an die
Staatsanwaltschaft[S. 48] auf mit dem Hinweis, daß die Geschädigte sich im
Falle einer Ablehnung an den Justizminister wenden und der Vermittlung
eines Abgeordneten bedienen würde. Die Frau ließ diesen Brief von
einem Nachbarn abschreiben. Die Staatsanwaltschaft ordnete nun eine
Feststellung an – ob der Nachbar solche Briefe berufsmäßig
abschreibe, und ob etwa eine Steuerkontravention vorliege!
Auch wurde die Frau noch einmal darüber vernommen, ob sie etwa
Quecksilber in der Wohnung hatte!! Nach etwa 14 Tagen wies der
Justizminister 15 M. an, blieb also der armen Frau noch drei Mark
schuldig!
Risum teneatis amici!
*
Frau Marie Feuth, die Gattin eines jungen Architekten, der in
unglücklichen Geschäften sein Vermögen verloren hatte und von den
Gläubigern hart bedrängt ward, wurde im November 1906 in Berlin mit
ihrem Mann auf offener Straße verhaftet und in ein Polizeirevier
eingeliefert. Hier wurden beide in eine „Detentionszelle“ eingesperrt,
wo sie von 1½ Uhr mittags bis 8 Uhr abends sitzen mußten. Um diese
Stunde wurde das Ehepaar in den „grünen Wagen“ verladen und nach dem
Polizeipräsidium übergeführt.
Hatten sie den Wagen mit einigen Zuhältern geteilt, so trafen sie
dort noch Verbrecher, Dirnen und betrunkene Rowdys. Andern Tags gegen
11 Uhr wurde Frau Feuth in einem überfüllten Wagen voller Zuhälter
und Dirnen, die durch Zoten und Handgreiflichkeiten sich die Zeit
verkürzten, nach Moabit[S. 49] transportiert, dort zwei Weibern überwiesen,
die sie – zum zweiten Male – bis auf die Haut entkleideten.
Nach 10 Minuten kam die Oberin. Im Evakostüm mußte die Dame
den Raum durchschreiten und mit dem Gesicht gegen die Wand eine ganze
Weile stehen, bis alle ihre Sachen ausreichend beschnüffelt und gebucht
waren. Dann wurde sie vermessen, bis sie glücklich die Erlaubnis
erhielt, sich wieder anzukleiden. Hierauf wurde sie in eine Zelle
gesperrt, nach einer halben Stunde wieder herausgelassen, um sich mit
schwarzer Schmierseife zu waschen und in einer keineswegs reinen Wanne
zu baden. Ihre Leibwäsche wurde ihr genommen und sie erhielt die grobe
Anstaltswäsche, ein grobes sackleinenes Hemd und ein Paar für ihre
Schuhe viel zu dicke Strümpfe, so daß sie nur mit großen Schmerzen
gehen konnte. Beinkleider wurden nicht verabfolgt. Endlich mußte sie
sich durch eine Strafgefangene auf Ungeziefer untersuchen lassen!
In die Zelle zurückgeführt, wurde sie in schroffer Weise auf die
Obliegenheiten der Zellenreinigung usw. hingewiesen. Abends gab es
eine Art von Wassersuppe und ein Stück Brot. Der Raum wimmelte von
Ungeziefer, so daß die Dame angekleidet die Nacht über frierend
und weinend auf dem Bettrand sitzen blieb, weil sie sich nicht von der
Stelle zu rühren wagte. Sie wußte immer noch nicht, aus welchem
Grunde sie verhaftet worden war! Auch die Oberin wußte keinen Grund
anzugeben!
Frau Feuth blieb im Untersuchungsgefängnis 10 Tage, dann wurde
sie entlassen und das Verfahren gegen sie eingestellt. Erst jetzt
erfuhr sie den[S. 50] Grund ihrer Verhaftung: wegen des Verdachtes der
Beihilfe zum Arrestbruch.
Ihr Mann wurde nach 2½ Monaten von der Anklage der Urkundenfälschung
und der Verschleppung von Pfandgegenständen freigesprochen und
wegen Arrestbruches zu einem Monat Gefängnis verurteilt, der durch die
Untersuchungshaft verbüßt war.
Mit diesem „Arrestbruch“ hatte es aber auch seine besondere
Bewandtnis. Der Verteidiger hatte Herrn Feuth gesagt, er würde auch
von dieser Anklage freigesprochen werden, müsse aber noch lange in
Untersuchungshaft sitzen, denn bevor das Aktenmaterial geprüft sei,
vergingen Monate. Daraufhin entschloß sich Herr Feuth, sich ohne
Widerspruch wegen dieses Anklagepunktes verurteilen zu lassen,
um nur die Freiheit wiederzugewinnen! Seine Frau saß nämlich mit 85
Pfennigen an diesem Tage auf dem Berliner Pflaster!
*
Solche und ähnliche Fälle sind so zahlreich und wir könnten deren eine
solche Reihe anführen, daß wir sie als typischen Mißstand unseres
Rechtswesens bezeichnen können.
Der Amtsrichter Emil Theisen war im Jahre 1894 am Amtsgericht in
Frankfurt a. M. beschäftigt. Hier machte er alltäglich die Erfahrung,
daß bei der Festnahme von Personen und deren Vorführung vor den Richter
die zum Schutze der persönlichen Freiheit erlassenen gesetzlichen
Bestimmungen von der Polizei[S. 51]behörde nicht beachtet wurden. Als solche
Gesetzwidrigkeiten sich mehrten und ein Bericht an die Justizverwaltung
erfolglos blieb, machte er in der Überzeugung, daß der Tatbestand des §
341 St.G.B. vorliege, Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. Wiewohl nun
der Disziplinarsenat des Kammergerichtes als erwiesen ansah, daß die
Vorführung der vorläufig festgenommenen Personen vor dem Amtsrichter in
einer großen Anzahl von Fällen nicht dergestalt „ohne Verzug“
stattgefunden habe, als dies der Vorschrift der Strafprozeßordnung
entsprochen haben würde, erkannte er doch auf Zwangsversetzung
in ein anderes richterliches Amt von gleichem Range wegen der
beleidigenden Form der Anzeigen und Bruch des Amtsgeheimnisses.
Letzteres Delikt wurde darin gesehen, daß Theisen der „Frankfurter
Zeitung“, die den Fall gebracht hatte, zur Beseitigung einiger Schärfen
und um falsche Lesarten zu verhindern, einige berichtigende
Mitteilungen gemacht hatte. Der Oberstaatsanwalt hatte Theisen
gedroht, er werde sein ganzes Leben lang darunter zu leiden haben, wenn
er seine Strafanträge nicht zurückzöge! Darin sollte er auch recht
behalten, denn Theisens Karriere war beendet, weil er nach Ansicht
seiner Vorgesetzten „die Justiz zu sehr kompromittiert“ hätte. So geht
es also einem preußischen Richter, der Ungesetzlichkeiten rügt[73]!
*
Der Turmwächter König in Wasungen bei Jena hatte mehrere Jahre
hintereinander die unheimliche Beobachtung gemacht, daß in der
Silvesternacht um[S. 52] 12 Uhr ein Licht über den dortigen Friedhof
wandle. Auf Grund einer Wette ging er nun am 31. Dezember 1906 mit
seinem Freunde Bach, einem befreundeten Kellner und seinen beiden
Schwestern zur geheimnisvollen Stunde dort hin. Tatsächlich tauchte das
unheimliche Licht Punkt 12 Uhr auf. Während die Schwestern ausrissen,
feuerte Bach seinen mitgebrachten Revolver auf das Gespenst und
traktierte es dann mit Säbelhieben übel. Daraufhin lüftete das Gespenst
sein Inkognito und entpuppte sich als Bernhard Günkel in Wasungen, der
seit Jahren in der Neujahrsnacht vom Friedhof einen Kreuzdornzweig
zu holen pflegte. Dieser, stillschweigend gebrochen, ist nämlich
ein sicheres Mittel gegen Krankheiten bei Mensch und Vieh. Auf den
Strafantrag des Gespenstes wurde Bach vom Wasunger Schöffengericht
wegen Körperverletzung zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt. Die Meininger
Strafkammer bestätigte diese Strafe, wiewohl Bach, dessen Mut
jedenfalls größer war als seine Intelligenz, bekundete, er habe die
feste Überzeugung gehabt, nicht auf einen Menschen, sondern auf ein
Gespenst losgeschlagen zu haben.
Ob in diesem Falle der Staat nicht vielleicht besser getan hätte für
entsprechenden Schulunterricht zu sorgen, statt einem armen unwissenden
Menschen, der das glaubte, was die unfehlbare Kirche Jahrhunderte
gelehrt und mit Gewalt eingebläut hatte, streng zu strafen? Immerhin
ist die Tatsache ein wertvolles Kulturdokument, sowohl bezüglich der
Volksbildung als der Strafrechtspflege.
[S. 53]
Dritter Abschnitt
Die „Ketzer“ und die römisch-katholische Kirche
Wilhelm Pelisso, ein zwischen 1220 und 1240 im Bezirke von Toulouse
tätiger Dominikaner hat ein Tagebuch „Chronikon“ hinterlassen, dessen
Handschrift die Bibliothek von Carcassonne (n. 6449) bewahrt. Er
schreibt: „Zum Ruhme und Lobe Gottes und der seligen Jungfrau Maria
und des hl. Dominicus, unseres Vaters, und der ganzen himmlischen
Heerschar will ich einiges aufzeichnen, das der Herr in der Gegend
von Toulouse gewirkt hat durch die Brüder des Predigerordens
(Dominikaner) und auf die Bitten hin des hl. Dominicus...: Damals
starb ein ketzerischer Kleriker, der im Kreuzgang der Kirche beerdigt
wurde. Als dies Magister Rollandus hörte, ging er mit den Brüdern
(Dominikaner) dorthin, sie gruben ihn aus, schleiften ihn durch die
Straßen und verbrannten ihn. Zu gleicher Zeit starb ein Ketzer
namens Galvanus. Das entging dem Magister Rollandus nicht; er rief die
Brüder (Dominikaner), den Klerus und das Volk zusammen; sie gingen in
das Haus, wo der Ketzer gestorben war, sie zerstörten es von Grund
aus und machten es zu einer Dungstätte; den Galvanus gruben sie
aus. Seinen Leichnam[S. 54] schleppten sie in ungeheurem Zuge durch
die Stadt (Toulouse) und verbrannten ihn außerhalb der
Stadt. Das ist geschehen im Jahre 1231 zur Ehre unseres Herrn Jesu
Christi und des hl. Dominikus, und zur Ehre der römischen
und katholischen Kirche, unserer Mutter.“ Arnoldus Catalanus,
damals Inquisitor, vom päpstlichen Legaten ernannt, verurteilte zum
lebendig verbrannt werden zwei Ketzer, Peter von Puechperdut und Peter
Bomassipio; beide wurden zu verschiedenen Zeiten verbrannt.
Auch einige Verstorbene verurteilte er, ließ sie ausgraben und
verbrennen. Der Inquisitor Bruder Ferrarius (Dominikaner) ließ
viele Ketzer ergreifen, ließ sie einmauern; einige ließ er auch
verbrennen, unter Beistand des gerechten Gerichtes Gottes.. Der
Ketzer Johannes Textor wurde mit anderen verbrannt. Zur selben
Zeit ließen die Inquisitoren Bruder Peter Cellani und Bruder Wilhelm
Arnaldi (Dominikaner) einige Verstorbene ausgraben, durch
die Straßen schleifen und verbrennen. In Montemsegurum
(Montsegur) ließen sie den Johannes da Garda mit 210 anderen Ketzern
verbrennen. Und ein großer Schrecken entstand unter den Ketzern der
ganzen Gegend. (Dieser Wilhelm Arnaud wurde zur Belohnung für dieses
christliche Wirken am 1. September 1866 von Papst Pius IX. „selig“
gesprochen!!!) Inzwischen ließ der Bruder Pontius de S. Egidio,
Prior (des Dominikanerkonvents) zu Toulouse, den Handwerker Arnold
Sancerius vorfordern und nahm gegen ihn viele eidliche Zeugnisse
entgegen. Er selbst aber leugnete alles. Der Prior und die
Brüder aber verurteilten ihn. Er wurde zum[S. 55] Scheiterhaufen geführt,
rief aber fortwährend: „man tut mir unrecht, ich bin ein guter Christ
und glaube an die römische Kirche“. Dennoch wurde er verbrannt.
Im Jahre 1234 wurde die Heiligsprechung unseres hl. Vaters Dominikus
in Toulouse verkündet. Der Bischof Raimundus von Miromonte feierte die
Messe im Dominikanerkloster, und nachdem der Gottesdienst fromm und
feierlich beendet war, wuschen sie sich die Hände, um im Speisesaal
zu speisen. Da kam, durch göttliche Fügung und wegen der Verdienste
des hl. Dominikus, dessen Fest man feierte, einer aus der Stadt und
meldete, daß einige Ketzer zu einer kranken Ketzerin gegangen seien.
Sogleich gingen sie (der Bischof und die Dominikaner) dorthin. Der
Bischof setzte sich an das Bett der Kranken und sprach ihr viel von der
Verachtung der Welt. Und weil die Kranke im Glauben war, es sei der
Vorsteher der Ketzer, so antwortete sie frei auf alle Fragen. Der
Bischof entlockte ihr mit vieler Vorsicht ein Bekenntnis dessen, was
sie glaubte. Dann fügte er hinzu: Du darfst nicht lügen und nicht an
diesem elenden Leben hängen. Deshalb sage ich dir, du sollst standhaft
sein in deinem Glauben und nicht aus Todesfurcht anders aussagen,
als du in deinem Herzen denkst. Sie antwortete: Herr, wie ich sage, so
glaube ich, und wegen dieses elenden Lebens ändere ich meinen Vorsatz
nicht. Da sagte der Bischof: Du bist eine Ketzerin, was du bekannt
hast ist ketzerisch. Ich bin der Bischof von Toulouse und verkünde den
römisch-katholischen Glauben, den ich dich ermahne anzunehmen. Aber er
richtete nichts aus. Da verurteilte[S. 56] sie der Bischof in Kraft Jesu
Christi(!) als Ketzerin. Er ließ sie mit dem Bett, in dem sie
lag, zum Scheiterhaufen tragen und sofort verbrennen. Nachdem dies
geschehen, gingen der Bischof und die Brüder (Dominikaner) zurück
in den Speisesaal, und was dort bereitet war, aßen sie mit großer
Fröhlichkeit, Dank sagend Gott und dem hl. Dominikus. Dies hatte
der Herr gewirkt am ersten Festtage des hl. Dominikus, zur Ehre und
zum Ruhme seines Namens und seines Dieners, des hl. Dominikus,
zur Erhöhung des Glaubens und zur Niederwerfung der Ketzer[74].
In dieser Tonart geht es fort, doch dürfte die Probe genügen, um eine
Vorstellung von dem kirchlichen Wirken in christlicher Liebe zu geben,
das für Südfrankreich noch so segensvoll werden sollte.
*
Als die ersten Katharer – darunter 10 Domherren – 1022 zu Orleans
verbrannt wurden, sträubten sich noch vereinzelt die zwar rohen aber
nicht raffinierten Gemüter gegen diese Art der Verbreitung der Religion
der Liebe. Bischof Wazon von Lüttich (1042–1048) antwortete auf die
Frage des Bischofs Roger von Chalons, ob er die Ketzer verbrennen
lassen dürfe, daß Blutvergießen gegen den Geist und die Aussprüche
Christi sei, der das Unkraut mit dem Weizen stehen lassen will, bis
zum Tage seines Gerichtes. Gab es damals, wenn auch nur sehr
sporadisch, noch unter den Christen Menschen, so hörte das bald genug
auf, wenigstens soweit die tonangebenden Diener der Mutter Kirche in
Frage kommen.
*
[S. 57]
Dem Kardinal Heinrich, Bischof von Albano, der 1180 von Innocenz
III. (1198–1216) gegen die Albigenser in Südfrankreich geschickt
wurde, gebührt der Ruhm, den ersten Kreuzzug von Christen gegen
Christen gepredigt zu haben. Er hatte glänzenden Erfolg. Ein auf
päpstlicher Seite stehender Augenzeuge schreibt, daß er „ein weit
und breit verwüstetes Land, zerstörte Dörfer und Städte, ein Bild des
Todes“ hinterließ.
Papst Innocenz III. forderte mit glühenden Worten zur Vertilgung der
„Gottlosen“ auf. Unter Berufung auf des Apostels Paulus (!) Worte
„Dieweil ich tückisch war, habe ich euch mit Hinterlist gefangen“,
mahnt der Statthalter Christi in einem Schreiben an seine Legaten,
den Grafen von Toulouse, die Hauptstütze der „Ketzer“, schlau zu
täuschen, als ob man es nicht so sehr auf ihn abgesehen habe.
Dadurch werde verhindert, daß der Graf sich mit den Streitkräften
der übrigen Ketzer vereinige. Es sei dann leichter, ihn später, nach
Niederwerfung der übrigen, allein zu besiegen.
Dieser Kreuzzug führte 1209 im Juli und August zur Eroberung von
Beziers und Carcassonne. Da man nicht wußte, welche von den Bewohnern
Beziers ketzerisch, welche rechtgläubig waren, ließ der päpstliche
Legat mit den von echt christlicher Milde zeugenden Worten „Tötet
sie alle, Gott wird die Seinen zu erkennen wissen“, alle
hinschlachten. Es waren ihrer zwanzigtausend, Männer, Frauen
und Kinder! In der einen Kirche Maria Magdalena mordete man 7000
Menschen, die sich dorthin geflüchtet hatten. In Carcassonne wurden
zu gleicher Zeit 400 Ketzer[S. 58] verbrannt und 50 gehängt.
Triumphierend berichtete der Legat dies dem Papst: die göttliche Rache
habe die Ketzer wunderbar vernichtet.
Im weiteren Verlaufe dieses Kreuzzuges, der so glänzend die
zivilisatorische Macht der Kirche dokumentiert, wurden 1211 in Lavour
über 100 Ketzer mit Feuer und Schwert gemordet. Und zwar vollzogen die
päpstlichen Scharen dieses Blutbad, laut Berichten „mit ungeheuerer
Freude“. Am 20. Februar 1213 richteten zahlreiche zu Lavour
versammelte Bischöfe an Innocenz folgendes Schreiben: „Wir bitten
Euere Gütigkeit mit gebührender Ehrfurcht, kniend und unter Tränen
(die bekanntlich im frühen Mittelalter nie fehlen durften), daß Ihr,
gemäß dem Eifer des Phineas, den Ihr besitzt, diese schlechteste Stadt
(Toulouse) mit all ihren Verbrechern, mit all ihrer Unreinheit und
ihrem Schmutz, der sich angesammelt hat in dem aufgeschwollenen Leibe
dieser giftigen Schlange, die in ihrer Bosheit nicht geringer ist als
Sodoma und Gomorrha, von Grund aus der gebührenden Vernichtung
anheimfallen zu lassen“. Papst Innocenz entsprach diesen frommen
Bitten. Man unterzog sich dem Liebeswerk mit solchem Eifer, „daß
nicht nur offenbare Ketzer, sondern wer immer verdächtig erschien, dem
Scheiterhaufen überliefert wurde“.
*
Als unter Papst Honorius III. die Stadt Marmande gestürmt wurde, fielen
dem Rat der Bischöfe, alle Einwohner zu töten, 5000 Männer, Frauen
und[S. 59] Kinder, zum Opfer. Der Kardinal Bertrand wiederholte in seinen
Predigten beständig, daß „Tod und Schwert die ständigen Begleiter
des Kreuzheeres sein müßten; alles Leben müßte vertilgt werden.“
*
Der päpstliche Vernichtungskrieg gegen die Albigenser dauerte noch bis
zum Ende des 13. Jahrhunderts mit glänzendem Erfolge: Südfrankreich,
die Heimat der Troubadours und feinen ritterlichen Sitten, war
zur Wüstenei geworden, der heimische Adel verdrängt, die geistige
Führung endgültig an den Norden abgetreten. Es herrschte Ruhe,
Grabesfrieden[75].
Den Waldensern ging es nicht viel besser. Innocenz IV. forderte durch
eine Bulle vom Jahre 1248 in der Bourgogne auf. „Die Inquisitoren
verfolgten die Waldenser und verbrannten, wen sie auffinden konnten.“
Der von Papst Gregor IX. entsandte Franziskanerinquisitor Lorelli
schlachtete in den Alpentälern Savoyens und der Dauphiné die Waldenser
zu Hunderten.
Der 22. Mai 1393 wurde in Embrun festlich begangen. Die Stadt und
die Altäre der Kirchen waren geschmückt, die Priester in kostbaren
Gewändern umstanden sie. Die Christenheit hatte auch Grund sich zu
freuen, denn 80 Waldenser aus den Tälern von Freyssinières
und Argentière und 150 Waldenser von Vallouise wurden zum
Feuertode verurteilt. Die Hälfte der Gesamtbevölkerung dieser Täler
verschwand, ganze Familien: Vater, Mutter, Kinder.
*
[S. 60]
Ein Jahrhundert später drang der Kardinallegat des Papstes Innocenz
VIII., Albert von Cremona, in das Tal Vallouise ein. Da die Waldenser
sich in eine große Höhle des Berges Pelvoux geflüchtet hatten, ließ der
fromme Vertreter des Statthalters Christi am Eingang der Höhle Feuer
anzünden. Fünfzehnhundert Menschen, darunter Frauen und Kinder,
kamen teils durch Feuer und Rauch, teils durch das Schwert um. Den
päpstlichen Vizelegat Mormoiron ließen Alberts Lorbeeren nicht ruhen.
Daher machte er es später fünfundzwanzig Waldensern gegenüber ebenso.
Er ließ vor einer Höhle Feuer anmachen und alle kamen um.
Bis zum Jahr 1550 schätzt man die in der Provence geschlachteten
und verbrannten Waldenser, Männer, Frauen und Kinder, auf über
dreitausend!
*
Wenigstens wußten die Legaten immer, was sie der Mutter Kirche schuldig
waren: Der päpstliche Franziskanerinquisitor verbindet sich im Jahre
1382 mit einer Räuberbande von 22 Mann, um Ketzer zu ergreifen
und zu töten! Dem Räuberhauptmann Girardo Burgarone wurde dafür ein
Preis gezahlt!
*
Im Jahre 1373 starb ein Ketzer fünf Tage vor dem Urteil. Deshalb wurde
seine Leiche in ungelöschtem Kalk aufbewahrt, um möglichst unversehrt
verbrannt zu werden.
*
[S. 61]
Leo X. verdammte den Satz Luthers „Häretiker zu verbrennen ist gegen
den Willen des Hl. Geistes“ als häretisch[76].
Unter diesen Umständen ist es befremdend, daß die Kirche noch heute
gegen die Feuerbestattung ist. Etwa weil es sich ausschließlich um
Leichen handelt?
Um welcher Sünden willen wurden die Waldenser so verfolgt? –
Hoensbroech stellt noch eine Fülle von Daten zusammen – waren
sie keine Christen? verfluchten sie die Bibel? führten sie einen
unmoralischen Lebenswandel? Das Gegenteil war der Fall: sie lasen die
Bibel, führten ein von den Vorschriften der Bergpredigt geleitetes
Leben und verwarfen den Ablaß.
*
Eine Bischofsversammlung in Goslar verurteilte im Jahre 1051 mehrere
Ketzer zum Tode, weil sie sich geweigert hatten Hühner zu töten und
ausschließlich von Pflanzennahrung lebten. Sogar die Vegetarianer
können auf Märtyrer zurückblicken!
*
Als im Jahre 1184 Disputationen mit den Ketzern in Straßburg zu keinem
Ergebnis führten, weil sie alles aus der Bibel belegen konnten, wurden
die Lehren der Kirche als allein maßgebend hingestellt und – ohne
Rücksicht auf Übereinstimmung mit dem Evangelium – wer gegen sie
verstieß ohne Urteil verbrannt. Achtzig fanden gemeinsam auf dem
Scheiterhaufen den Feuertod.
*
[S. 62]
Erzbischof Gerhard II. von Bremen hatte sich mit den Stedingern,
einem Bauernvolk in den Weserflußmarschen im heutigen Oldenburg,
überworfen, wohl weil sie gegen kirchliche Bedrückung sich aufgelehnt
hatten. Deshalb erklärte Papst Gregor IX., erfüllt von Milde und
Nächstenliebe, ihnen am 29. Oktober 1232 und am 19. Januar 1233
den Kreuzzug. Aus ganz Norddeutschland strömten die Scharen
zu diesem gottgefälligen Werk, ein freies deutsches Bauernvolk auf
Pfaffengeheiß hin zu vernichten, herbei. „Raub und Plünderung wüteten
weit und breit; auch Weiber und Kinder wurden erschlagen; wie die
Erde blutig sich färbte, so auch der Himmel; aber nicht bloß der
Brand der Ortschaften zeigte die Wut der Sieger. Auch die Lohe der
Scheiterhaufen, auf denen die Gefangenen verbrannt wurden, verkündete
die Grausamkeit, die im Namen der christlichen Kirche verübt ward.“
In der dritten Stedingerbulle verlieh Gregor IX. allen gegen dieses
arme Volk Ziehenden die gleichen Ablässe, die den Kreuzfahrern im
Heiligen Lande zuteil wurden. Es war dem Statthalter Christi ernst
mit der Ausrottung des Bauernvolks. Als das „Kreuzfahrerheer“ am
Hemmelskamper Walde seine zweite schwere Niederlage erlitten harte, da
kam Erzbischof Gerhard auf einen Gedanken, würdig eines Kirchenfürsten:
er wollte die Deiche zerstören und die Stedinger ersäufen! Aber
wieder waren sie stärker als ihr Seelenhirte. Im Frühjahr 1234, nachdem
Predigermönche in Westfalen, Holland, Flandern und Brabant Fürsten
und Volk neuerdings nachdrücklich auf die billige Gelegenheit, sich
den christlichen oder doch[S. 63] päpstlichen Himmel zu sichern hingewiesen
und dadurch gewaltige Erbitterung und wohl auch geistige Habsucht
heraufbeschworen hatten, versammelte sich die Blüte des deutschen Adels
zu diesem gottgefälligen Vernichtungswerk. Selbst der Papst fühlte
ein menschliches Rühren und wollte die Möglichkeit eines Vergleiches
einräumen. Aber es war zu spät. Am 27. Mai 1234 beim Orte Altenesch
fiel die Entscheidung. Das blut- und beutegierige Kreuzheer, numerisch
und wohl auch an Bewaffnung dem Bauervolk weit überlegen, erdrückte die
Stedinger. Nur wenige wandten sich zur Flucht; über sechstausend
wurden getötet. Unterdessen stand auf einer Anhöhe die zahlreiche
Geistlichkeit mit Kreuz und Fahne und sang das schöne, hier wirklich
passende Lied: Media vita in morte sumus.
Für Bremen wurde die Schlacht bei Altenesch, eine der grausamsten
und blutigsten der deutschen mittelalterlichen Geschichte, ein
kirchlicher Feiertag! Man wußte Kulturtaten zu ehren.
*
Konrad von Marburg eröffnete seine glorreiche Laufbahn
als Inquisitor im Jahre 1212 mit der Verbrennung von achtzig
Waldensern in Straßburg! „Im Jahre 1214 fing Bruder Konrad von
Marburg an zu predigen, und welche Ketzer er immer wollte, ließ er
in ganz Deutschland, ohne Widerspruch zu finden, verbrennen. Und so
predigte er zehn Jahre lang.“
[S. 64]
Dieser Streiter Gottes und seine Helfer hatten dabei ein sehr
praktisches Verfahren. „Sie ließen in Städten und Dörfern verhaften,
wen sie nur wollten, und übergaben diese Leute den Richtern ohne
alle weiteren Beweise mit den Worten: das sind Ketzer, wir ziehen
unsere Hand von ihnen zurück. So waren die Richter genötigt,
dieselben zu verbrennen. Indessen sahen diese Richter ohne Erbarmen
ein, daß sie ohne die Beihilfe der Herren nicht die Oberhand gewinnen
konnten. Daher wandten sie sich an den König Heinrich und andere Herren
und gewannen sie, indem sie sagten: wir verbrennen viele reiche
Ketzer, und ihre Güter sollt ihr haben. In den bischöflichen
Städten soll die eine Hälfte der Bischof, die andere aber der König
oder ein anderer Richter bekommen. Darüber freuten sich
nun diese Herren, leisteten den Inquisitoren Vorschub, beriefen sie
in ihre Städte und Dörfer. Auf diese Weise gingen viele Unschuldige
zugrunde, blos um der Güter willen, welche jetzt die Herren erhielten“.
Das Geschäft blühte also, zumal sie auf die Frage, weshalb sie so
barbarisch vorgingen, antworteten: „Hundert Unschuldige verbrennen
wir, wenn nur ein Schuldiger darunter ist“.
Die Ketzerverfolgung, die von 1231 bis 1233 in Deutschland unter
diesem im Namen und mit Wissen des Statthalters Christi „arbeitenden“
Konrad wütete, wurde mit bewunderungswürdigem Eifer durchgeführt. Ein
Zeitgenosse schreibt: „Niemand wurde Gelegenheit gegeben, sich zu
verteidigen, oder auch nur die Zeit sich die Sache zu überlegen,
sondern sofort mußte man sich entweder als schuldig bekennen[S. 65] und wurde
dann als Büßer geschoren, oder man leugnete das Verbrechen, und
dann wurde man verbrannt. War man aber geschoren, so mußte man
die Mitschuldigen angeben, widrigenfalls man verbrannt
wurde. Daher glaubt man, daß auch (!) Unschuldige verbrannt
wurden. Denn viele bekannten aus Liebe zum eigenen Leben und um ihrer
Erben willen, sie seien gewesen, was sie nie waren. Darauf wurden sie
gezwungen, Mitschuldige anzugeben. Sie verklagten Leute, ohne sie
verklagen zu wollen, Dinge aussagend, von denen sie nichts wußten. Auch
wagte es niemand, für jemand, der verklagt war, Fürsprache einzulegen
oder auch nur Milderungsgründe vorzubringen, denn dann wurde er als
Verteidiger der Ketzer betrachtet, und für diese und die Hehler
der Ketzer war vom Papst die gleiche Strafe wie für die Ketzer
selbst bestimmt. Hatte jemand der Sekte abgeschworen und wurde er
rückfällig, so wurde er, ohne noch einmal widerrufen zu können,
verbrannt“.
Und wie verhielt sich der Papst zu diesen Greueltaten? Gregor IX.
erließ 1231 eine Verfügung: „Berufungen derlei Personen (der
Ketzer) sind nicht zuzulassen; kein Anwalt, kein Notar darf ihnen
seine Dienste leihen, sonst verlieren sie für immer ihr Amt“.
Der Erzbischof Siegfried von Mainz schrieb, als Hekatomben der
Verfolgungswut dieses Konrad geopfert wurden, nach Rom: „Magister
Konrad erlaubte keinem sich zu verteidigen und seinem eigenen
Pfarrer zu beichten. Jeder mußte bekennen, er[S. 66] sei ein Ketzer,
habe eine Kröte berührt und geküßt. Manche wollten lieber sterben,
als so Schreckliches von sich auszusagen; andere erkauften das Leben
durch Lüge und sollten nun angeben, wo sie solche Dinge gelernt hätten.
Da sie niemand zu nennen wußten, baten sie um Bezeichnung der
Verdächtigen, und als man ihnen die Grafen von Sayn und Arnsberg
und die Gräfin von Looz nannte, sagten sie: Ja, diese sind schuldig.
So wurde der Bruder vom Bruder angeklagt. Ich (der Erzbischof
von Mainz) habe den Meister Konrad zuerst unter vier Augen, dann in
Gemeinschaft mit den Erzbischöfen von Köln und Trier ersucht, er möge
mit mehr Mäßigung verfahren, aber er gab nicht Ruhe“.
Am 10. Juni 1233 schrieb der Statthalter Christi, Gregor IX.,
überfließend von Menschenliebe, dem frommen Konrad, „wenn lindernde
Arznei nicht hilft, müsse das faulende Fleisch mit Feuer und
Schwert entfernt werden“. Gleichzeitig schrieb er an König
Heinrich: „Wo ist der Eifer eines Moses, der an einem Tage 23000
Götzendiener vernichtete? Wo ist der Eifer eines Phineas, der
den Juden und die Madianiterin mit einem Stoße durchbohrte? Wo
ist der Eifer eines Elias, der die 450 Baalspropheten mit dem Schwerte
tötete? Wo ist der Eifer eines Mathatias, der entflammt für das
Gesetz Gottes am Altare den Juden tötete?“
Als Konrad von Marburg endlich erschlagen worden war, schrieb
Gregor, ein Verbrechen, wie die[S. 67] Ermordung Konrads, „eines Mannes
von vollendeter Tugend und eines Heroldes des christlichen
Glaubens“ könne überhaupt nicht nach Gebühr gezüchtigt werden!!!
*
Im alten Rom wurden bekanntlich die Christen auch verfolgt, es genügte
aber die Teilnahme der Angeschuldigten am Götterdienst und dem Kaiser
dargebrachte Opfer als Beweise der Unschuld! Und zwar selbst bei einer
im Verdacht des Christentums stehenden Priesterin. Die Ausstellung
einer Urkunde über Opfer, Libation und verzehrtes Opferfleisch genügte
als Schutz gegen Verfolgungen. Origines sagt ausdrücklich, daß
„wenige und nur sehr leicht zu zählende“ bis zur Verfolgung des
Decius den Märtyrertod erlitten haben[77]. Aber selbst in dieser
haben in der großen Gemeinde in Alexandria nur 10 Männer und 7 Frauen
für den Glauben geblutet! Ein Vergleich mit den der Inquisition zum
Opfer Gefallenen ist weder numerisch noch hinsichtlich der Grausamkeit
in der Verfolgung auch nur im allerentferntesten zulässig. Allerdings
waren die Römer auch nur Heiden.
*
Die maurischen Herrscher Spaniens gewährten den unterworfenen Christen
und Juden volle Glaubensfreiheit, sie durften Kirchen und
Klöster haben und ihren Gottesdienst frei üben. Weit entfernt, zum
Abfall vom Christenglauben zu zwingen, sahen die[S. 68] mohammedanischen
Herrscher der Pyrenäenhalbinsel ihn nicht einmal gern. Trotzdem
gingen viele zum Glauben des höheren Kulturvolkes über. Juden standen
sogar hohe Staatsämter offen, während sie unter christlichem Regiment
furchtbar bedrückt worden waren. Damals war Spanien geistig und
materiell das blühendste Land Europas[78].
*
Unter Isabella von Kastilien und Ferdinand dem Katholischen wurden die
letzten Mauren aus Spanien vertrieben, und die Segnungen der Kirche
ergossen sich über das Land. 1480 begann die vom Papst Sixtus IV.
geförderte Tätigkeit der Inquisition besonders gegen die Reichsten und
Vornehmsten. Thomas von Torquemada wurde 1483 Oberinquisitor. 1492
erging ein Edikt, das alle Juden ohne Ausnahme aus Spanien vertrieb.
Sie durften ihre Habe veräußern oder vertauschen, aber die
mindestens 160000 (nach andern 800000) Vertriebenen durften den
Erlös dafür, Gold, Silber und andre verbotene Ware nicht
mit sich nehmen! Beim Fall von Granada, 1492, wurde den Mauren
Glauben, Moscheen und Recht vertraglich zugebilligt, und ganze
10 Jahre lang hielten die katholischen Fürsten ihre Zusagen. 1502
wurden alle freien Mauren ausgewiesen[79].
*
Nach der geringsten Schätzung wurden unter Karls V. Regierung in den
Niederlanden 50000,[S. 69] nach andern 100000 Ketzer hingerichtet.
Herzog Alba rühmte sich, in den 5 bis 6 Jahren seiner Regierung mehr
als 18000 mit kaltem Blute hingerichtet zu haben. Auf dem Schlachtfelde
habe er noch viel mehr getötet. Demnach war er der Henker von
mindestens 40000 Menschen.
Philipp II. von Spanien führte gegen die Ketzer einen 30 Jahre
dauernden Krieg. Er ließ jeden Ketzer, der nicht widerrufen wollte,
verbrennen. Widerrief er, wurde ihm Gnade erwiesen; da er sich
aber einmal befleckt hatte, mußte er natürlich auch sterben, nur
genügte statt des Feuertodes in diesem Falle der durch das Schwert[80].
Man hat die allein in Spanien während des 16. Jahrhunderts wegen
protestantischer, jüdischer oder mohammedanischer „Ketzerei“
Verbrannten auf etwa 18000 berechnet. Mag diese Zahl auch um etliche
Tausende übertrieben sein, so muß doch berücksichtigt werden, daß außer
in Spanien und den Niederlanden noch in Mexiko, Cartagena, Lima, sowie
dem damals noch spanischen Sizilien und Sardinien gleichzeitig in
derselben Weise die Religion der Liebe verbreitet wurde[81].
*
Die letzte Verbrennung in Rom dürfte am 22. August 1761 stattgefunden
haben; in Spanien fand in Sevilla am 7. November 1781 das letzte[S. 70]
Autodafé statt. Im römischen Falle war der Delinquent vorher gehängt
worden[82].
Voltaire hat in seiner Schrift „Dieu et les hommes“ berechnet, daß
während der Glanzperiode des Papsttumes 10 Millionen von Menschen der
„Mutter Kirche“ zum Opfer fielen. Von ihr befreiten die Menschheit die
Philosophen der verhaßten Aufklärung, die französische Revolution und
die Naturwissenschaften. Als die Religion der Liebe in ihrer bisherigen
Form abgewirtschaftet hatte, fing die Menschenliebe an; gewiß nicht aus
Verschulden ihres erhabenen Stifters.
[S. 71]
Vierter Abschnitt
Toleranz und Ähnliches
Melanchthon, wegen seiner Milde bekannt, rühmte Kalvin ausdrücklich
wegen der Verbrennung des Servet und verlangt „die Verhängung
bürgerlicher Strafen bis zur Todesstrafe gegen die Katholiken“[83].
Das war noch ganz der Geist der Bamberger Halsgerichtsordnung von 1507,
die bestimmte: „Wer durch die ordentlichen geistlichen Richter für
einen Ketzer erkannt und dafür dem weltlichen Richter überantwortet
wurde, der soll auf dem Feuer vom Leben zum Tode bestraft werden“.
Die Exkommunikationsformel gegen den Rat der Stadt Magdeburg lautete:
„Er scheide sie (die Katholiken) als faule, stinkende Glieder
ab von der Gemeinde Christi, er schließe ihnen den Himmel zu und die
Hölle weit auf, er übergebe sie dem leidigen Teufel, sie am Leibe
zu martern, zu quälen und zu plagen,... er gebiete auch von Amts
wegen, daß andere Christen sich solcher verbannten Menschen gänzlich
enthalten, mit ihnen nicht essen oder trinken, sie zur Hochzeit oder
ehrlicher Gesellschaft nicht laden,... sie auf der Straße nicht grüßen
und in Summa für Heiden oder Unchristen halten sollen mit
allen ihren Sünden teilhaftigen Anhängern, bis sie ihre Sünden bekennen
und Kirchenbuße tun“[84].
*
[S. 72]
Über die von den Protestanten unter Karl II. in England unternommene
große Katholikenverfolgung schreibt Macaulay: „Inzwischen waren
die Gerichtshöfe, welche inmitten politischer Bewegungen sichere
Zufluchtsstätten für die Unschuldigen jeder Partei sein sollen, durch
wildere Leidenschaften und schmutzigere Bestechungen beschimpft, als
selbst bei den Wahlbühnen zu finden waren... Bald strömten aus allen
Bordellen, Spielhäusern und Bierkneipen Londons falsche Zungen hervor,
um Römisch-Katholische um ihr Leben zu schwören.“ Damals fielen
Tausende und Abertausende den Protestanten zum Opfer[85].
Wie Felix Platter berichtet, wurden im Jahre 1554 Protestanten
in Frankreich mit dem Tode bestraft, ein Vornehmer aber an die
Galeere geschmiedet. Im gleichen Jahre sah er in Avignon oben am Palast
Reformierte im eisernen Käfig zu Tode eingesperrt.
*
Das lutherische Sachsen war ängstlich darauf bedacht, jeglichen
kalvinistischen „Irrglauben“ fern zu halten. Da der Kanzler Christians
I., Dr. Krell, einer weitherzigeren Ansicht huldigte, wurde er am Tage
der Beerdigung seines Herrn (1591) verhaftet und ihm der Prozeß als
Kryptokalvinisten gemacht. Zehn Jahre lang mußte er Sommer und Winter
in einem fast überall offenen Kerker sitzen, wo er „in dem Stank
und Unflat ganz verderben“ mußte. Als älterer, von der Gicht schwer
heimgesuchter Mann, mußte er im Krankenstuhl aufs Schafott getragen
werden[86]. Hinsichtlich der Toleranz haben sich die verschiedenen
christlichen Konfessionen gegenseitig[S. 73] nichts vorzuwerfen; sie alle
befolgen gewissenhaft das Bibelwort: „So jemand zu euch kommt
und bringet diese Lehre nicht, den nehmet nicht (auf) zu Hause und
grüßet ihn auch nicht. Denn wer ihn grüßet, der machet sich teilhaftig
seiner bösen Werke!“ (II. Joh. 10) und „Wer glaubet und sich taufen
läßt, wird selig werden; wer aber nicht glaubet, wird verdammet
werden.“ (Mark. 16, 16).
*
Erst im Laufe des 17. Jahrhunderts läßt man in der Praxis den Grundsatz
cuius regio, eius religio ganzen Völkern gegenüber fallen und versucht
nicht mehr, ihnen die Konfession des Landesherren aufzuzwingen, wenn
etwa der Landesherr konvertiert, oder durch Erbschaft in den Besitz
von Landesteilen mit anderer Konfession kommt[87]. Früher wurde in
rücksichtsloser Weise auch in solchen Fällen zum Glaubenswechsel
gezwungen. Man denke etwa an die Pfalz! Natürlich erwartete man, daß
die Untertanen nun auch aus Überzeugung der neuen Konfession
anhingen.
Im Jahre 1634 tat der Hofprediger des Herzogs Johann Georg I. von
Sachsen den Ausspruch: „Den Kalvinisten zu ihrer Religionsübung helfen
ist wider Gott und Gewissen und nichts anderes, als dem Urheber der
kalvinistischen Greuel, dem Teufel, einen Ritterdienst leisten.“
In Kassel, einer reformierten Stadt, durften die Lutheraner noch in
der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts in ihrer Kirche keine Orgel haben,
auch war ihnen[S. 74] das Taufen und Kopulieren verboten, das beides von
reformierten Geistlichen vollzogen werden mußte.
*
Als im Jahre 1747 ein im Brückenturm zu Frankfurt a. M. befindliches
Spottgemälde auf die Juden nächtlicherweile zerstört worden war, ließ
der Magistrat es wieder erneuern.
Noch 1756 war den Juden verboten, die sogenannte Allee, den jetzigen
Goetheplatz, in Frankfurt zu betreten. Erst im Jahre 1806 wurde allen
Einwohnern ohne Ausnahme der Gebrauch der öffentlichen Spaziergänge
gestattet.
Bekanntlich trugen die Juden im Mittelalter zum Unterschied von den
Christen gewisse Abzeichen, spitze Hüte, gelbe Ringe usw. Noch im
Jahre 1786 wurde den Juden in Frankfurt eingeschärft, sie müßten
schwarze Mäntel als Abzeichen tragen, zugleich wurde ihnen untersagt,
Spazierstöcke zu führen. Bis zum Schluß des 18. Jahrhunderts durften
sie ihre Gasse an Sonn- und Feiertagen erst nach Beendigung des
Nachmittagsgottesdienstes verlassen.
Im Jahre 1800 hielt ein Doktor der Medizin, der in Frankfurt ein
öffentliches Badhaus besaß, es für nötig, folgende Bekanntmachung zu
erlassen: Es laufe das Gerücht um, die Juden könnten sich eines jeden
seiner Bäder bedienen; er zeige daher an, daß nur zwei der letzteren
zur Benutzung durch Juden[S. 75] bestimmt seien, also kein Christ in ein
Juden- und kein Jude in ein Christenbad eingelassen werde, sowie daß
auch das Weißzeug für beide Teile besonders gezeichnet sei.
Noch im Jahre 1807 ließ man die Juden in den Kaffeehäusern Frankfurts
nicht zu, und doch war damals bereits ein toleranter und aufgeklärter
Fürst Gebieter der Stadt.
Im Jahre 1817 brach in Frankfurt, wie in vielen anderen deutschen
Städten, eine Judenverfolgung aus. Erst 1832 wurde ihnen das Recht
gewährt, mehr als ein Haus und einen Garten besitzen zu
dürfen. Bis 1834 bestand eine Vorschrift, nach der jedes Jahr nur eine
bestimmte Anzahl jüdischer Ehen geschlossen werden durfte. Vollständige
Gleichberechtigung mit den Christen wurde den Juden erst 1864 in
Frankfurt eingeräumt!
*
In Italien ging es den Juden nicht besser. Keyßler erzählt in
seinen „Reisen“ (Hannover 1776, S. 177) im Jahre 1730 von strengen
Judengesetzen. Z. B. wurde jede auch noch so geringe Lästerung gegen
Maria, Heilige oder deren Bilder mit dem Tode bestraft. „Manns- und
Frauenpersonen der jüdischen Nation müssen, sobald sie über 14 Jahre
alt sind, auf der rechten Brust ein gelbes Zeichen von Wolle oder
Seide, ein Drittel Ellen lang, tragen, damit man sie von[S. 76] Christen
unterscheiden könne. Die jüdischen Eltern müssen ihren Kindern, welche
sich zum Christentum wenden, alles das hinterlassen, was diese bekommen
hätten, wenn ihre Aeltern ohne Testament gestorben wären. Zu solchem
Ende wird gleich bei der Bekehrung des Sohnes ein Inventarium über
das Vermögen des Vaters errichtet. Die Kinder bekommen auch den Genuß
der Güter, welchen sonst ihre Väter würden gezogen haben, so lange
sie unter der väterlichen Gewalt geblieben wären. In der Charwoche
dürfen die Juden von Mittwochen an bis daß Sonnabends die Glocken
geläutet werden, nicht aus ihren Häusern gehen, und müssen ihre Thüren
und Fenster, bey Strafe eines dreytägigen Gefängnisses mit Wasser
und Brodten, zu halten. Sie dürfen auch diese Zeit über auf keinem
musikalischen Instrument in ihrem Hause spielen oder singen, wo sie
nicht den öffentlichen Staupenschlag zur Vergeltung haben wollen.“
*
Frankfurt war eine protestantische Stadt, und deshalb nahm man in echt
christlicher Milde und Nächstenliebe seit 1591 keinen katholischen
Mitbürger mehr in den Rat auf.
Noch am 2. Juli 1781 sprach ein Schöffendekret in betreff des
Sporerhandwerks aus: einen Katholiken oder Reformierten als Lehrling
anzunehmen sei allerdings erlaubt, nicht aber ihm das Meisterrecht zu
gewähren.
[S. 77]
Der im Jahre 1796 zugelassene Dr. med. Lejeune aus Verviers war der
erste als Arzt rezipierte katholische Bürger von Frankfurt. Seit 1624
hatte in Frankfurt kein Katholik den ärztlichen Beruf ausüben dürfen.
*
Im 18. Jahrhundert gestattete man den jüdischen und katholischen
Verbrechern in Frankfurt weder den Besuch ihrer Geistlichen im
Gefängnis noch deren Begleitung bei der Hinrichtung, was beides im 17.
Jahrhundert mehrmals zugelassen worden war. Statt dessen drang man
den Delinquenten lutherische Geistliche auf. Als im Jahre 1750 ein
Katholik hingerichtet wurde und ein Dechant ihn im Vorbeigehen aus dem
Fenster heraus absolvierte, wurde das Volk aufs höchste erbittert und
hätte ihn fast gesteinigt. Der Rat aber faßte ein Memorandum ab, das
eine Protestation und den Ausspruch des Vertrauens enthielt, daß der
Dechant und die übrige katholische Geistlichkeit künftig in ähnlichen
Fällen nicht wieder derartige Neuerungen sich anmaßen würde, da
andernfalls die rechtliche Ahndung folgen würde.
In Frankfurt, einer gleich Hamburg streng lutherischen Stadt, durften
die Reformierten ihre Ehen und Taufen nur von lutherischen Geistlichen
vollziehen lassen. Diese Vorschrift blieb auch dann noch bestehen,
als 1781 den Reformierten erlaubt worden war, für ihre beiden Teile,
die Wallonen und die Deutschen, zwei Bethäuser in der Stadt selbst
zu errichten, und als 1792 und 1793 der Gottesdienst in diesen
neuen Räumen eröffnet worden war. Bisher[S. 78] hatten die Frankfurter
Reformierten selbst in ihren Privathäusern keinen Gottesdienst halten
dürfen. Erst im Jahre 1806 wurde die Gleichberechtigung aller
christlichen Konfessionen dort proklamiert.
Fast alle Handwerksinnungen nahmen Reformierte nicht als Meister
auf. Noch 1774 versagte man in Frankfurt einem Schneider, 1779 einem
Kürschner das Meisterrecht für ihre reformierten Ehefrauen. Der erste
mit einem bezahlten städtischen Amt bedachte Reformierte war – vom
Physikus Peter de Spina, der 1640 angestellt wurde, abgesehen – ein
1780 angenommener Lazarettchirurg und der 1783 zum Fähnrich ernannte
Hassel. Also auch in Goethes Zeit noch war es eine große Ausnahme,
wenn die lutherische Stadt einen Reformierten anstellte, was einem
Katholiken gegenüber überhaupt ausgeschlossen war[88].
*
Im Jahre 1855 fällte das Konsistorium zu Speier wegen einer Mischehe
zwischen einem Christen und einer Jüdin folgende Entscheidung:
„Daraufhin (auf die Mischehe) hat das kgl. Konsistorium unterm 29.
September 1855 im Namen des dreieinigen Gottes und kraft des Befehles
Jesu Christi die definitive Exkommunikation über den besagten
M. ausgesprochen und ihn hierdurch aus der christlichen Gemeinde
ausgeschlossen“[89].
*
[S. 79]
In dem Buche von Gottfried Thomasius „Grundlinien zum
Religionsunterricht an den oberen Klassen gelehrter Schulen“, 8.
Aufl., bearbeitet von Karl Christ. Burger, Oberkonsistorialrat,
Erlangen 1893, einem an bayerischen Gymnasien eingeführten Lehrbuch,
findet sich auf S. 97 folgende Stelle: „Daß.. die Einheit des
Glaubens vielfach gebrochen ist, daß verschiedene und in wesentlichen
Glaubensartikeln einander widersprechende Konfessionen bestehen, das
ist ein schweres Übel und ein bitterer Schmerz für alle Christen.“ –
Da entsteht die Frage, welche Kirche die wahre sei? Und darauf ist
die Antwort A(ugsburgische) K(onfession) VII: Diejenige, die sich in
ihrem Bekenntnis und in der Verwaltung der Gnadenmittel der Heiligen
Schrift gemäß hält. „Die evangelisch-lutherische Kirche hat dieses
Zeugnis und will daher mit der menschlich-gemachten Union unverworren
bleiben.“ Der glaubensstarke Autor möchte augenscheinlich am
liebsten heute noch Zustände, wie sie oben geschildert sind. Gottlob
kümmern sich gegenwärtig die wenigsten Menschen um solche Finessen. Für
sie dürfte kaum noch jemand Zeit haben, es sei denn ein versöhnlicher
Prediger des Evangeliums. Ist es unter diesen Umständen ein Wunder,
wenn oft gerade die Besten, vom konfessionellen Gezänk angewidert, der
Kirche den Rücken kehren?
Im gleichen Werkchen S. 51 ist der eben nicht leichte Versuch gemacht
zu beweisen, daß die bei Horaz (Ep. I, 16, 52) im Satze Oderunt peccare
boni virtutis amore aufgestellte Moral weniger erhaben ist[S. 80] als die
christliche. Dort guttun um der Sache willen, hier für Lohn, wenn auch
erst im Jenseits. Die Entscheidung dürfte nicht schwer sein.
*
Der erste Fürst, der seinen Untertanen völlige Religionsfreiheit, zwar
nicht de jure, aber de facto gewährte, war Friedrich der Große von
Preußen. Im Allgemeinen Preußischen Landrecht von 1794 wurde diese
Freiheit erst kodifiziert, aber nicht etwa als Geschenk des Fürsten,
sondern als angeborenes Recht des Bürgers[90]. Wie sich doch die
Zeiten ändern!
*
Früher schon hatte der edle Kaiser Joseph II. seine Völker von
Glaubens- und Gewissenszwang befreien wollen, aber das Resultat war
recht dürftig. Das Zirkular Josephs II. vom 30. April 1783 bestimmt
z. B.:
Personen, die aus der katholischen Kirche austreten wollen, „sollen
sechs Wochen lang in Klöstern oder von ihrem Pfarrer unterrichtet
werden, wobei die Pfarrer angewiesen sind, alles mögliche zu versuchen,
sie von ihrem Irrtum zurückzuführen.“ Zu den tolerierten
Kirchen wurden, trotz Josephs persönlicher Weitherzigkeit, nur die
„augsburgischen und helvetischen Religionsverwandten“, „Lutheraner
und Reformierte“ und die „nichtuniierten Griechen“ gezählt, denen
„Privatexerzition“ ihrer Religionen eingeräumt wurde. „Sollten aber
einige Untertanen zu einem anderen, in dem Toleranzgesetz nicht
begriffenen Religion oder Sekte sich erklären wollen, so seien[S. 81] diese
mit ihrer Erklärung auf der Stelle abzuweisen und ihnen zu bedeuten,
daß eine derlei Religion nicht bestehe und je werde geduldet
werden.“ Trotzdem empfand man das Gesetz als Erlösung!
Den drei Konfessionen wurden „Bethäuser“ ohne Glocken, ohne Türme,
ohne Eingang von der Straße, beileibe keine „Kirchen“ eingeräumt.
Erst jetzt brauchten sie bei der Verheiratung keinen Rekurs mehr zu
unterschreiben, daß die Kinder katholisch würden. Das Kleiderverbot
bzw. die Vorschrift, sich bestimmter Abzeichen zu bedienen, war bei den
Juden durch Edikt vom 13. Oktober 1781 aufgehoben worden. Wie jung ist
doch unsere Kultur, daß man dieses so beschränkte Entgegenkommen noch
heute als Großtat feiert!
*
In Frankreich gestattete erst kurz vor der großen Revolution Ludwig
XVI. im Jahre 1787 den Protestanten, rechtmäßig Mann und Frau und
legitime Eltern zu sein!
In England hob erst 1828 der Staat die letzten Reste der intoleranten
Gesetzgebung mit der Annullierung der Testakte und mit der
Katholikenemanzipation von 1829 auf.
Zuerst war es die französische Revolution und das freie amerikanische
Bürgertum, die vollste Gewissensfreiheit gewährten und durchführten.
Im ersten Amendement zur Verfassung der Vereinigten Staaten vom 13.
Dezember 1791 heißt es: „Der[S. 82] Kongreß soll nie ein Gesetz geben,
wodurch eine Religion zur herrschenden erklärt oder die freie Ausübung
einer andren verboten würde.“
*
Damit waren zum ersten Male ganz moderne Anschauungen verwirklicht.
Doch wohl jedenfalls eine Folge der durch anderthalb Jahrtausende der
christlichen Herrschaft erzielten Milde? Oder sollte schon früher
jemand diese Toleranz gehandhabt haben?
Dem Mohammedanismus genügte die politische Herrschaft. Bekehrung
lag ihm völlig fern. Er ließ den Christen auch in der Erobererzeit
volle Glaubensfreiheit. Selbst ihre Kirchen und Klöster durften
sie in der Regel behalten, und die kirchliche Verfassung wurde nicht
angetastet. Sie durften glauben oder sich zanken, wie sie wollten[91].
Die Mongolen, die größten Menschenschlächter, die die
Weltgeschichte kennt, gewährten völlige Glaubensfreiheit, wie
sie seit je die Chinesen gestattet hatten. Der franziskanische
Missionar Andreas aus Perugia schreibt aus dem Reiche des Kubilai im
Jahre 1326: „In diesem Reiche gibt es Menschen von allen Nationen,
die unter dem Himmel sind und von allen Religionen, und man gestattet
allen und jedem, nach seiner zu leben. Denn sie hegen die Meinung oder
vielmehr den Irrtum, daß jeder in seiner Religion selig werde. Wir
können frei und sicher predigen[92].“
Kaiser Akbar von Indien (1556–1605) war von solchem religiösem
Wahrheitsstreben erfüllt, daß er, während Europa von Religionskriegen
und Verfolgungen um des Glaubens willen heimgesucht wurde,[S. 83] jedermann
freie Übung der Religion gestattete. Dieser Mohammedaner brach die
Übermacht der mohammedanischen Geistlichkeit und versammelte an seinem
Hofe Brahmanen, Buddhisten, Parsen, Jesuiten und Juden zu ständigen
Disputierabenden. Nie vorher oder später hat Hindostan eine gleiche
wirtschaftliche und kulturelle Blüte erlebt[93].
Der verständige Wedel hält in seinem „Hausbuch“ (S. 341) Einigkeit
in der Religion für „unabwendlich nöthig, denn nichts ist, das die
Gemüter mehr von ander bindet oder verhaßt machet, als disparitas
religionis“, erkennt aber die Toleranz der Türken an: „Denn
obwol die Türcken steiff und fest über ihrer Religion halten und nicht
viel Krummes oder Disputirens davon gemacht wissen wollen, zwingen sie
doch inmittelst durch öffentliche Gewalt niemand dazu, weniger stellen
sie gegen Feinde oder Freunde desfals Verfolgungen, Plagen oder Marter
an, sondern lassen einem jeden, auch den Überwundenen, ihre Religion
und Gewissen frei. Eben das giebt vielen Ursach, sich unter das
türckische Reich zu geben, daher es auch mercklich erweitert wird. Denn
mit keinem Dinge die Gewissen mögen bezwungen oder begütiget werden, ja
es verlassen die Leute darumb Leib, Gut, Vaterland und Freunde, lassen
sich palen und braten.“
Während das altgriechische „Heidentum“ sehr, wenn auch nicht absolut
tolerant war, in Glaubenssachen nicht folterte, sich durch Widerruf
in der Regel zufriedenstellen ließ und ein äußerst selten gefälltes
Todesurteil – wie durch den Fall Sokrates hinlänglich bekannt –
durch den milden Schirlingsbecher voll[S. 84]streckte, loderten noch fast
anderthalb Jahrtausende, nachdem das Christentum Staatsreligion
geworden war, überall Scheiterhaufen!
Nicht ungern wird auf den Tod Christi als Zeugnis für die
römische Intoleranz hingewiesen. Aber die Tatsächlichkeit dieses
welthistorischen Ereignisses vorausgesetzt, wären die Hauptschuldigen
nicht die Römer, sondern die Juden gewesen, die als Erzväter der
Intoleranz zu gelten haben[94]. Nun hat aber Giovanni Rosardi
nachgewiesen, daß auf alle Fälle nach dem damals geltenden römischen
Recht die Kreuzigung Christi einer der größten Justizmorde aller
Zeiten war! Also nicht der römische Geist der Intoleranz ist schuld an
dieser unerhörten Tat, sondern lediglich die Unvollkommenheit einzelner
Menschen, die auch durch die besten Gesetze nicht beseitigt werden
kann[95].
*
Gottlob sind diese barbarischen Zeiten der Intoleranz, in denen jemand
wegen seines Glaubens, seiner Überzeugung verfolgt wurde, wo man Gefahr
lief, getötet oder ein Heuchler zu werden, endgültig vorbei. Es läßt
sich ja wohl nicht leugnen, daß die Rücksichtslosigkeit, mit der die
Kirchen gegen Andersgläubige oder auch nur Verdächtige verfuhren, bei
einer Religion der Liebe befremdend wirkt, um so mehr, als sie selbst
gegen jeden Angriff, mag er sich auch in die mildesten Formen gehüllt
haben, sehr empfindlich waren. Doch auch das ist vorbei, wenigstens in
einem Kulturstaate wie Deutschland. Die Verfassung verbürgt jedermann
Glaubensfreiheit, niemand leidet darunter, wenn er fortgeschrittener
ist als die Kon[S. 85]fessionen, niemand, wenn er der Rückständigsten einer
ist, sofern er nur seine Pflichten als Mensch und Staatsbürger erfüllt.
Mit einem Wort: Seit einem Jahrhundert leben wir als freie Bürger in
einem freien Kulturstaat.
Oder etwa nicht? Gibt es wirklich im zivilisierten 20. Jahrhundert
noch Leute und Parteien, die über ganz unbeweisbare religiöse und
metaphysische Fragen sich in die Haare geraten, womöglich die Gesetze
anrufen? Die den andern geringer schätzen, weil er Jude, Heide,
Protestant, Katholik oder Mohammedaner ist? Die ihm irgendein Recht
verkürzen? Wird Deutschland noch von Parteien zerrissen, von denen jede
behauptet, allein den Schlüssel zum Himmelreich zu besitzen, dabei aber
nicht in einen Wettkampf der Liebe, sondern in einen solchen des Hasses
eintritt? Wird irgend jemand an der freien Äußerung seiner Ansichten
und seines Glaubens gehindert? Gibt es noch Gewissenszwang?
*
Im Jahre 1907 kandidierte der Pfarrer Korell im Wahlkreise
Darmstadt-Großgerau als Kandidat der vereinigten Liberalen. Er
fiel durch, und in die Stichwahl kamen ein Sozialdemokrat und ein
Konservativer. Obwohl Pfarrer Korell an der Stichwahlparole seines
Wahlausschusses, der die Wahl des Sozialdemokraten empfahl, ganz
unbeteiligt war, auch bei der Stichwahl nicht mitstimmte,
wurde er vom hessischen Oberkonsistorium mit einem Verweis
bestraft, weil er die Interessen der evangelischen Kirche dadurch
verletzt habe, daß durch sein Schweigen die Meinung entstehen
konnte, ein Geistlicher halte die Sozialdemokratie für das kleinere
Übel!
[S. 86]
Im Jahre 1907 wurde der Pfarrer Cesar von der Reinoldigemeinde
zu Dortmund einstimmig gewählt. Das Konsistorium hielt es aber für
erforderlich, ihn einem Kolloquium zu unterwerfen, und versagte ihm
dann die Bestätigung der Wahl wegen „Mangels an Übereinstimmung mit
dem Bekenntnis der Kirche“. Der Protest der ganzen Gemeinde
mit Ausschluß einer einzigen Stimme beim Oberkonsistorium führte zu
keinem Resultat. Man erlaubt also trotz der vielgerühmten evangelischen
Freiheit – canis a non canendo? – noch in der Gegenwart einer
Gemeinde nicht die Wahl ihres Seelenhirten, bzw. zwingt sie, sich
Gedanken vortragen zu lassen, mit denen die ganze Gemeinde nicht
einverstanden ist. Und dann klagt man über die Gleichgültigkeit der
Gebildeten der Kirche gegenüber und den geringen Besuch der Predigt!
*
Einem Schulamtskandidaten wurde, weil er konfessionslos ist,
vom sächsischen Kultusminister nicht gestattet, an einem Leipziger
Gymnasium sein Probejahr abzudienen. Da er sich darüber beim Landtag
beschwerte, wurde in der Verhandlung vom 12. Januar 1909 von der
Deputation beantragt, die Beschwerde der Regierung zur Erwägung zu
überweisen, da es eine Rechtsbeugung sei, wollte der Landtag den Mann
hindern, das Probejahr abzuleisten, um fertiger Lehrer zu werden. Der
sächsische Kultusminister Dr. Beck bezeichnete dagegen das Vorgehen
des Kandidaten als einen Vorstoß der religionslosen Kandidaten und
Studenten, die Bresche in die bisherige Ordnung der[S. 87] Dinge legen
wollten. Durch das Eintreten der konservativen Mehrheit für den
Minister wurde die Beschwerde verworfen. Man scheint also in Sachsen
zum Jugenderzieher lieber einen Heuchler zu wählen, der Mitläufer einer
Konfession ist, als einen Mann mit dem Mute seiner Überzeugung. Ein
analoger Fall kam im Frühjahr 1910 im bayerischen Landtag zur Sprache.
Ein hoher Staatsbeamter hat dem Professor Sickenberger die allerdings
bestrittene Äußerung gegenüber getan, Personen, die mit ihrer Kirche
zerfallen seien, wären der Regierung „suspekt“. Sickenberger, früher
Lyzeal-, also nach der offiziellen Version Hochschulprofessor, erhielt
tatsächlich die nachgesuchte Anstellung als Gymnasialprofessor
nicht. Da gegenwärtig überall in Deutschland das Bekenntnis
zum christlichen, eventuell auch zum jüdischen Glauben, Voraussetzung
zum Eintritt in den Staatsdienst ist, können allerdings die laut
Konfessionsstatistik auf die einzelnen Kirchen entfallenden hohen
Zahlen von „Gläubigen“ nicht Wunder nehmen.
*
Am 26. März 1907 wurde von dem Prediger einer freien evangelischen
Gemeinde in Hohensolms bei Wetzlar auf dem Friedhofe ein Mitglied
der freien Gemeinde beerdigt. Die Ortspolizei belegte den Prediger
Heck und den Schwiegersohn des Verstorbenen mit 15 Mark Strafe, die
vom Schöffengericht in Wetzlar bestätigt wurde. Und zwar erfolgte
die Verurteilung, weil die Beerdigung eine „außergewöhnliche“
gewesen sei, da noch kein Dissident bisher auf dem protestantischen
Friedhof bestattet worden war[96]!
*
Während in Preußen jeder Kegelklub anstandslos die Eintragung ins
Vereinsregister und dadurch die[S. 88] Rechte einer juristischen Person
erlangt, erhalten freireligiöse Gemeinden ausnahmslos diese
Erlaubnis zur Eintragung nicht. Die Polizei macht in ihrer
notorischen abgrundtiefen Weisheit stets Einwendungen. So kommt es, daß
die Magdeburger freireligiöse Gemeinde ihren juristischen Sitz in –
Offenbach in Hessen hat! Als sie nun auch ihre Grundstücke auf ihren
Namen in das Grundbuch eintragen lassen wollte, verweigerte dies der
Grundbuchrichter mit der Begründung, daß zur Übertragung und Annahme
eines Vermögens von über 5000 Mark die landesherrliche Genehmigung
nötig sei. Das entsprechende Gesuch an den König wurde rundweg ohne
Angabe von Gründen abgelehnt. Somit ist die freireligiöse Gemeinde in
Magdeburg nicht imstande, in den Besitz ihres Eigentumes zu gelangen!
Es ist eine Wonne, in einem aufgeklärten, paritätischen Rechtsstaate zu
leben[97]!
*
Zwischen dem Lehrer und Küster Rehm und dem Pastor Hübener in Pampow
bestanden seit dem Jahre 1898 Differenzen. Als ersterer beim Pastor
das Abendmahl nehmen wollte, dieser aber die Bedingung daran knüpfte,
ihm Abbitte zu leisten, ging er zum Abendmahl nach Schwerin. Darauf
Anzeige des Pastors beim Konsistorium, das – in echt christlicher
Milde und treu den Grundsätzen der evangelischen „Freiheit“ – Rehm zur
Strafversetzung verurteilte, weil er die Parochialrechte
seines Geistlichen verletzt hätte. Dazu hatte das Konsistorium nun
gerade so wenig das Recht, wie der Pastor zur Abendmahlsverweigerung,
weshalb das Obere Kirchengericht auf die eingelegte Berufung hin
Rehm wegen Verletzung seiner Amtspflicht zu 30 Mark[S. 89] Strafe
verurteilte! Er hatte nämlich gegen seine Amtspflicht dadurch
verstoßen, daß er sich und die Seinen vom Gange nach Schwerin nicht
zurückgehalten hätte! Als Rehms Rechtsbeistand dieses Urteil
mit Rehms Einwilligung der „Mecklenburger Schulzeitung“ zum Abdruck
übergab, verurteilte das Konsistorium den Lehrer zur Suspension
von seiner Lehrerstelle auf die Dauer eines Jahres. Es mag ja
zugegeben werden, daß es für das Konsistorium sehr peinlich war,
urbi et orbi diesen nicht eben salomonischen Spruch zu unterbreiten,
immerhin hatte es offenbar seine Befugnisse wieder überschritten, als
es als geistliches Gericht einen Lehrer verurteilte. Das
erkannte auch das Obere Kirchengericht an, indem es die Strafe dahin
umänderte, daß Rehm nur auf ein Jahr vom Küsteramt suspendiert
wurde. Aber die weltliche Behörde war päpstlicher als der Papst:
die Unterrichtsabteilung des Ministeriums erklärte sich mit dem
konsistorialen System solidarisch, indem sie – allerdings unter
Belassung von Einkommen und Wohnung – auf die dienstliche Tätigkeit
Rehms für die Dauer eines Jahres verzichtete.
Aber es wurde noch besser: Im Kulturstaate Mecklenburg existiert
nach § 486 L. G. G. E. V. der Beichtzwang!! Da Rehm – mit
einigem Grunde – in Pastor Hübener seinen Feind erblickte, beantragte
sein Rechtsbeistand für ihn Befreiung vom Beichtzwang, wurde aber
abgewiesen. Denn: „eine Dispensation eines Küsters vom Parochialzwang
kann nicht erfolgen, sie würde ein dauerndes Ärgernis für
die Gemeinde sein“. Der Lehrer muß also nach[S. 90] wie vor bei seinem
persönlichen Feinde beichten! Ein Kulturidyll aus dem Deutschland des
20. Jahrhunderts!
Doch in Mecklenburg beruhigte man sich damit keineswegs. Am 23. Oktober
1905 erschien der Entwurf einer Verordnung betr. die Dienstverhältnisse
der seminaristischen Lehrer usw. Der § 61 dieses Kulturdokumentes
lautet:
„Ist mit einem Schulamt ein Kirchenamt verbunden, so hat die
Dienstentlassung aus dem Schulamte von Rechts wegen die Folge,
daß der Lehrer auch aus dem Kirchenamt ausscheidet. Ist mit
einem Kirchenamt ein Schulamt verbunden, so hat die Dienstentlassung
aus dem Kirchenamt von Rechts wegen die Folge, daß der Lehrer
auch aus dem Schulamte ausscheidet!“ Das nennt man evangelische
Freiheit! Denn daß ein Gewissenszwang in Deutschland vom Staate
ausgeübt wird, und zwar im 20. Jahrhundert, wird doch nicht wohl jemand
zu behaupten wagen[98]!
*
Der sozialdemokratische Redakteur Friedrich Westmeyer in
Hannover hat in Anspielung auf den Königsberger Geheimbundprozeß,
der die kgl. preußische Justiz in bengalischer Beleuchtung gezeigt
hatte, in einer fingierten Gerichtsverhandlung darzulegen versucht,
wie es Christus vor einem preußischen Gerichtshofe ergehen würde.
Natürlich war die einzig mögliche Tendenz seiner Abhandlung, zu zeigen,
daß[S. 91] selbst die Vollkommenheit Christi vor solchen Richtern
und auf Grund solcher Gesetze nicht standhalten könnte. Das
erkannten ohne weiteres zwei als Zeugen vernommene Pastoren vor
Gericht an. Aber die zarte Seele eines kgl. Staatsanwaltes war bis
in ihre Tiefen durch den Delinquenten, der noch dazu Redakteur,
ja sogar sozialdemokratischer Redakteur war, verwundet und sein
edler Glaubenseifer, sein glühendes Verlangen, wenn nicht nach der
Märtyrerkrone, so doch nach dem Ruhme, Christi Ehre zu verteidigen,
ruhte nicht, bis er zwei andere Pastoren glücklich aufgetrieben hatte,
die eine gütige Vorsehung mit einer nicht minder zartfühligen Seele
ausgerüstet hatte. Auf die Konstatierung dieser Männer Gottes hin,
daß sie sich in ihrem christlichen Gewissen verletzt fühlten, wurde
Westmeyer nach § 166 des Reichsstrafgesetzbuches (einen solchen
gibt es noch heute!!!) auf drei Monate ins Gefängnis gesperrt.
Gottlob war damit der am Seelenfrieden des Herren Staatsanwalts und
seiner Eideshelfer angerichtete Schaden glücklich repariert, Christi
Ehre gerettet.
Westmeyer wurde, nachdem sein Gesuch um Selbstbeschäftigung
abgelehnt war, mit einem Sittlichkeitsverbrecher und einem
Falschmünzer zusammen in ein bis zur halben Mauerhöhe
feuchtes Kellerloch gesperrt, wo er mit Sägen und Spalten von
Holz für seine Versündigung büßen mußte. Hier einige Notizen aus seinem
Tagebuch: Sonntag, 1. Oktober 1906 (das Jahrhundert ist besonders zu
beachten!). „Der Hunger ließ mich die Nacht nicht schlafen. Ich
bin aufgestanden von meinem Stroh[S. 92]sack und habe die Schublade
nach Krümchen Brot durchsucht. Umsonst! Es wird mir nichts anderes
übrig bleiben, als meine Eingabe vom 13. September um Bewilligung von
Zusatznahrungsmitteln zu wiederholen. Nach der Hausordnung kann ich
nämlich bei einwandfreier Führung die Hälfte meines Arbeitsverdienstes,
5 Pfennig pro Tag, für Zusatznahrungsmittel verwenden..“
Am 7. Oktober schreibt er: „Gestern abend spät brachte mir der Wärter
noch einen Brief meiner Frau auf die Zelle. Mein vierjähriger Knabe,
mein einziger, ist an Diphteritis erkrankt, mein fünfjähriges Mädchen,
ebenfalls an Diphteritis erkrankt, soll sich auf dem Wege der Besserung
befinden. Und meine Frau allein bei den todkranken Kindern! Der Vater
eingesperrt, weil er den allerbarmherzigsten Christengott beleidigt
haben soll. Derweil windet sich daheim mein Herzensjunge in Todesqual.
Seine Augen suchen den Vater, an dem er mit abgöttischer Liebe hängt...
Du, Nazarener, wenn ich dich wirklich beleidigt haben sollte, nun
kannst du doch zufrieden sein! Du bist gerächt[99]!“
So pflanzt der kgl. preußische Staat, das Deutsche Reich, im 20.
Jahrhundert Liebe zur Religion und zu Christus in die Herzen des
Volkes! Sollte eine innere Stimme ihm nicht sagen, daß eine Religion
„der Liebe“, falls sie wirklich nach 1½ Jahrtausenden der Herrschaft
noch des Polizeiknüttels bedürfte, keine Existenzberechtigung hätte?
*
[S. 93]
Nach einer Statistik des Berliner Strafrechtslehrers Professor Kahl
wurden in den Jahren 1881 bis 1903 wegen „Religionsvergehen“ nach §
166 des Reichsstrafgesetzbuches 6921 Personen verurteilt!!
Alle natürlich zu Gefängnisstrafen. Und zwar in 22 Fällen von
2 Jahren und darüber, in 158 zwischen 1 und 2 Jahren, in 1551 Fällen
zwischen drei Monaten und einem Jahr und in 5190 Fällen von einigen
Tagen bis zu drei Monaten.
Was folgert der Gelehrte daraus? Daß der Paragraph beibehalten
werden müsse, aber in einer Fassung, die auch die Parität der
protestantischen Kirche wahrt. Denn da die katholische viel mehr
Dogmen, Zeremonien und Gebräuche habe als die protestantische, daher
auch viel mehr Angriffspunkte biete, sei sie bevorzugt[100]!
So argumentiert ein Professor des 20. Jahrhunderts und zwar in
den Vorarbeiten zur deutschen Strafrechtsreform. Die kann gut werden!
Rußland, das einzige Land Europas, das einen entsprechenden Paragraphen
kennt, wird uns beneiden.
*
In Hagen in Westfalen hatte der Verein für Feuerbestattung ein
Krematorium erbaut, was im Jahre 1904 auch von der Polizei genehmigt
worden war. Gleichzeitig war dem Verein aber mitgeteilt worden, daß die
Benutzung des Krematoriums zur Einäscherung von Leichen nicht
gestattet würde. Da aber der Verein zu der Verbrennung lebender
Ketzer nicht fromm genug war, kam er um die Erlaubnis, Leichen durch
Feuer zu bestatten,[S. 94] beim Ministerium ein. Dieses entschied 1907 auf
Grund des preußischen Landrechtes vom Jahre 1794 (!) § 10, II, 17, daß
die Benutzung des Krematoriums bis auf weiteres untersagt sei. Der
Paragraph lautet: „Die nötigen Anstalten zur Erhaltung der öffentlichen
Ruhe, Sicherheit und Ordnung und zur Abwendung der dem Publico oder
einzelnen Mitgliedern desselben bevorstehenden Gefahren zu treffen, ist
das Amt der Polizei[101].“
*
Am 19. August 1907 verfügte der Regierungspräsident Dr. Stockmann
in Gumbinnen gegen den Lehrer Leipacher die „Einleitung des
Disziplinarverfahrens .. mit dem Ziel auf Entfernung aus dem Amt,“
gleichzeitig ordnete er sofortige Suspension an. Er bezog seitdem ein
monatliches Gehalt von 39,50 Mark, von dem er mit seiner Frau
leben mußte. Was war geschehen? Der Pfarrer Vierhuff in Grabowen,
im Nebenamt Oberschulaufseher, hatte Leipacher bei der Regierung
denunziert, wegen Mißbrauch der Lehrfreiheit. Er hatte den Geographie-
und naturkundlichen Unterricht nicht im Einklang mit der evangelischen
Kirchenlehre erteilt und dadurch das Glaubensleben (!) der Kinder
gefährdet. Der Pfarrer hatte aus überfließender Nächstenliebe die
Aufsätze, die Leipacher in Zeitschritten veröffentlicht hatte,
gesammelt, um den Lehrer bei der Regierung zu verklagen. Daß die
Regierung das zuließ, war ein eklatanter Verfassungsbruch, denn selbst
in Preußen hat auf dem Papier jeder das Recht,[S. 95] seine Überzeugung
auszusprechen. Leipacher wurde am 6. November 1907 in Gumbinnen seines
Lehramtes verlustig erklärt. Allerdings hatte Leipacher den Kindern
u. a. den biblischen Sündenfall als Sage bezeichnet. Hätte er doch nur
die Schlange weiter reden, auf dem Bauch gehen und ihr Leben lang Erde
essen lassen (Genesis 3, 14), dann wäre ja alles in schönster Ordnung
gewesen. Ja, Ostelbien und Mecklenburg in der Welt voran[102]!
[S. 96]
Fünfter Abschnitt
Kriegswesen
Wie Bernold von St. Blasien zum Jahre 1078 erzählt, ließen die Anhänger
Rudolfs von Rheinfelden, des Gegenkönigs Heinrichs IV., nach einer
Schlacht am Neckar Tausende von schwäbischen Bauern „zur milderen
Züchtigung“ entmannen.
*
Vor Tortona läßt Friedrich Barbarossa Galgen errichten, um jeden
Gefangenen sofort angesichts der Stadt aufzuhängen. Wie Otto Morena
weiter berichtet, ließ er zweihundert Veronesen Nasen und Lippen
abschneiden und andere zweihundert aufhängen.
Kulturhistorisch merkwürdig ist den Grausamkeiten gegenüber das
Urteil der Biographen und Historiker. Als Friedrich Barbarossa einen
Dienstmann, der sich früher ihm gegenüber vergangen hat, nicht
begnadigt, wiewohl er sich dem Kaiser am Krönungstage zu Füßen wirft,
schreibt Otto von Freising rühmend, er habe sich „von der Tugend der
Strenge nicht zum Fehler der Nachgiebigkeit verleiten lassen“.
[S. 97]
Als die in Tortona eingeschlossene Geistlichkeit ihn kniefällig um die
Gnade bittet, die Stadt, in der die Pest wütete, verlassen zu dürfen,
„fühlte er zwar wie innerlich sein Herz zum Mitleid sich wandte,
um aber den Verdacht der Schwäche zu vermeiden, beharrte er
äußerlich auf der Standhaftigkeit seiner früheren Strenge“ und schickt
sie unverrichteter Dinge heim.
Im Kriege gegen Mailand verwüstet Friedrich 1159 das Land – dem im
ganzen Mittelalter herrschenden Brauche gemäß – in scheußlicher Weise,
indem er sogar die Weinpflanzungen zerstören und Fruchtbäume abhacken
oder schälen läßt. Als die Gegner dasselbe tun, meint Rahewin, daß
dieses Wüten nicht einmal Barbaren gegenüber erlaubt sei, tadelt den
Kaiser aber wegen desselben Reates nicht.
Vor Crema läßt Barbarossa die Gefangenen hängen und die Geiseln
hinrichten, ja er bindet sogar Knaben, die er als Geiseln in Händen
hatte, an die Belagerungsmaschinen, so daß die Cremenser ihre eigenen
Kinder töten müssen. O Greueltat! ruft Rahewin aus, meint aber
natürlich nicht den Kaiser damit, sondern die Belagerten, die
Mut und Patriotismus genug besitzen, trotzdem die Angreifer weiter zu
beschießen. Als Resultat dieser und vieler anderer Grausamkeiten ergibt
sich für die Zeitgenossen das Urteil, daß Barbarossa human und
milde war[103]!!
[S. 98]
Nach der Chroniques des ducs de Normandie (27527) läßt König Eldred
von England die gefangenen dänischen Frauen nackt bis zur Brust in
die Erde eingraben und so wehrlos den Hunden und den Raubvögeln
preisgeben.
Die Schotten schnitten 1138 in England sogar schwangeren Frauen den
Leib auf und metzelten Priester vor dem Altar nieder.
Im Jahre 1198 waren in einem Gefecht fünfzehn französische Ritter
gefangen worden. Richard Löwenherz ließ vierzehn beide Augen
ausstechen, dem fünfzehnten nur eines. Der Einäugige mußte seine
Unglücksgefährten ins französische Lager geleiten. Philipp August aber
rächte sich, indem er fünfzehn gefangene englische Ritter blenden
ließ[104].
Es war Kriegsgebrauch, die eroberten Städte und Burgen zu
zerstören, die Einwohner nieder zu machen oder
in die Gefangenschaft zu führen, Frauen und Jungfrauen aber zu
vergewaltigen. Mit Vorliebe wurden vornehme Frauen
Troßknechten und Soldaten preisgegeben. Und zwar selbstverständlich
auch in Kriegen und Fehden im eigenen Lande und von
Christen unter sich, keineswegs nur in solchen gegen Ungläubige,
die sich stets humaner benahmen, als die Verbreiter des Evangeliums der
Nächstenliebe.
Als Kaiser Sigismund 1412 im Kriege gegen die Venezianer das feste
Schloß Motta erobert hatte, ließ er einhundertundachtzig Männern die
rechte Hand abhauen[105].
[S. 99]
Wie Benedikt von Weitmil (IV) erzählt, betrugen sich die Soldaten Karls
IV. in Böhmen, dem Lande ihres Herrn, wie folgt: „sie raubten den Armen
seine Habe, sein Vieh, marterten sie zuweilen, um Geld zu erpressen,
rissen den Weibern unbarmherzig die Kleider vom Leibe, taten den
Jungfrauen Gewalt an und verübten unendlich viel Böses[106].“
Im Jahre 1375 machten entlassene englische Söldner ihren zweiten
Einfall ins Elsaß. Wie sie sich benahmen, erzählt die Konstanzer
Chronik. „Item sy gewunnent vil stattly und burg und dorffer und
closter, und erstachent wip und man und kind, und furten die schonen
frowen mit in emoy, was sy dero fundent. stan sy zugent gen Brysach und
nach zu Basel und gen Burgonden und in Uchtland, und wustent, was vor
in was, lut und gut[107].“
Die Speierische Chronik berichtet über die Eroberung von Dinant im
Jahre 1466: „und als balde er die stat ingenam, do dottet er frauͤen,
man und kinder und warff sie über die muͤer uß in daz wasser, heißet
die Maß, und ertranckt ir auch gar vil dar in. er liß auch die stat
plundern und alz daz nemen, das dar inne waz. und dar nach liß er die
stat an stoßen und verbornen und die kirchen und huser und thorn und
muͤern gar zersleiffen, und macht ein eben felt dar uß und liß acker
und wisen dar uß machen.“ Es handelt sich um den Herzog von Charolais,
der auf die Bürgerschaft von Dinant sehr erbost war, weil sie ihn
für einen Bastard des Herzogs von Burgund erklärt hatte. Die Form,
in der diese Beschimpfung in die Erscheinung trat, ist auch überaus[S. 100]
charakteristisch für die mittelalterliche Roheit: Man hatte von ihm ein
Bild malen lassen, dieses an den Füßen aufgehängt und mit Kot beworfen!
Wie in Feindesland gehaust wurde, geht auch aus dem Schreiben der
Eidgenossen an den in Speier versammelten Städtetag hervor. Die
Speierische Chronik schildert die Greueltaten, die sich burgundische
Söldner 1474 im Sundgau zuschulden kommen ließen. Nachdem erzählt
wurde, wie sie Kirchen zerstört, Priester geschmäht und viele Menschen
getötet hatten, heißt es: „und besunder vil junger frawen und dochter
wider iren willen geschendt und gewaltiglich genotzugt, vil sugender
kind iren muttern ab der brust gezerret und die auch vil andern junger
knaben und dochtern, by trien, viern, funff ader mer jaren alt, usser
lant gefurt, den armen luten und mannen umb zytlichs guts willen an
iren heymlichen gemachten onmenschlich pin und groß martir angetan,
erlich frawen gewondet, dochter erstochen, by iren harn und zopffen uff
gehenckt, etlich frauwen in der kirchen ir beyn von einander
gesperret und mit scharffen holczern in irn heymlichen gliddern gelt
gesucht, die deshalb auch gestorben sind, auch mit knaben und frauwen
erschroglich anmenschlich und annaturlich lesterlich sunden, nemlich
in der kirchen, uff dem kerner gewaltiglich begangen, derhalb
am gancz land under gen mocht, als auch umb dergleichen sunden ließ
versinken der allmechtig got Sodoma und Gomorra[108].“
Karl der Kühne ließ in Lothringen alles gefangene Kriegsvolk
aufhängen. Maximilian tat[S. 101] dasselbe, als er das Blockhaus von Galoo
bei Antwerpen erobert hatte: „und welche nit erschossen und erstochen
waren, dieselben ließ er alle henken[109].“
*
Plündern eroberter Städte war durchaus herkömmlich, ebenso war es
mit der ritterlichen Ehre zu vereinbaren, Gefangenen hohes Lösegeld
abzunehmen, dagegen war merkwürdigerweise die Ausplünderung einer
adeligen Dame dem Edelmann vom Ehrenkodex untersagt. Als Wilwolt
von Schaumburg nach dem Fall von Arras das Schloß erobert und den
Hauptmann gefangen hatte, brachte seine Frau freiwillig den Siegern
alle ihre Kostbarkeiten im Werte von 4000 Gulden. Da sagte Wilwolt:
„Wir Teutschen und vor aus von den Oberlanden, ob wir wol stet und
schlos gewinnen, pflegen keiner frauen oder junkfrauen, vom adl
geboren, nichts von irem geschmuck, zu irem leib gehörig, zu nemen, und
wo solichs ein edelman tet, würde er von seinen genossen sein leben
lang dester untreuer und unwerter gehalten. Darumb das jenig, so mir
zu teil wirdet, wil ich mein beut der tugenthaften frauen wider geben
und ir nichts verkern.“ Seinem Beispiel folgten dann auch, allerdings
widerstrebend, die welschen Hauptleute.
*
Nach dem Kriege war es oft schwer, die Soldtruppen wieder los zu
werden, zumal wenn sie den rückständigen Sold nicht bekamen. Aus dieser
Verlegenheit halfen sich die Ungarn 1492 auf sehr einfache Weise: Von
den 8000 ungelohnten Truppen erschlugen sie 6000 und zwangen den
Rest, in Österreich Zuflucht zu nehmen. Da sie dort selbst[S. 102]verständlich
zur Gewinnung ihres Lebensunterhaltes rauben mußten, überfiel sie
Kaiser Friedrich III. 1493 und ließ 1100 Gefangene aufhängen[110].
Unter diesen Umständen kann man es den Söldnern nicht verübeln, wenn
sie höchst ungern ihren Kriegsherren den Lohn stundeten.
*
Die offiziellen Gewalten haben noch in neuerer Zeit an Grausamkeit
nichts zu wünschen übrig gelassen und zwar in Kulturländern, denn in
Rußland war und ist ja alles möglich, wenigstens alles Barbarische und
Viehische.
Oliver Cromwell erstürmte 1649 die irische Hauptfeste Drogheda und
ließ die ganze Besatzung, über zweitausend Mann, niedermetzeln.
Später folgte ein gleiches Blutbad in Wexford nach. Nach
Beendigung des Krieges im Jahre 1652 war Irland verödet, fast die
Hälfte der Bevölkerung dem Schwert, Hunger und den Seuchen erlegen.
Andere Tausende waren ausgewandert, verbannt oder, nicht besser als
Sklaven, in die westindischen Plantagen verschickt[111].
*
Beim Rückzug der Jourdanschen Armee 1796 trug sich folgendes zu:
„Die Bauern mit Weibern und Kindern fielen über die zerstreuten
Haufen her, und schlugen alles, was ihnen unter die Hände kam,
ohne Barmherzigkeit tot. Jeder hatte ein erlittenes Unrecht zu
rächen. Die Ehemänner und Väter, welche durch die Schändung ihrer
Weiber und Töchter, die man oft vor ihren Augen begangen hatte,
aufgebracht waren, schnitten den armen Franzmännern das Glied, womit
sie gesündigt[S. 103] hatten, lebendig vom Leibe, und schlachteten
sie dann, wie man Schweine schlachtet. Die Wut der Bauern ging
anfänglich über alle Gränzen bis zur unerhörtesten Grausamkeit..“
*
Die alten Griechen hatten bereits im 8. vorchristlichen
Jahrhundert Tempelvereine, Amphyktionien. Die berühmteste Amphyktionie
war die pylische, die im Anfang des 6. Jahrhunderts mit der delphischen
verschmolz. Diese aus mehreren Staaten bestehenden Vereine schworen:
„Ich will keine amphiktionische Stadt zerstören, noch vom fließenden
Wasser abschneiden, weder im Kriege noch im Frieden; verletzt
eine Gemeinde diese Bestimmung, so will ich gegen dieselbe zu Felde
ziehen und ihre Städte zerstören[112].“ Daß diese alten „Heiden“ danach
handelten, beweist das Verfahren gegen Athen nach dem furchtbaren
Peloponnesischen Kriege. Erst die Genfer Konvention ist nach fast zwei
Jahrtausenden des Christentums zu den amphyktionischen Grundsätzen
zurückgekehrt.
*
Der große König Açoka von Magadha in Vorderindien (259–226
v. Chr.) erließ an seine Beamten als Richtschnur ihres Verhaltens
gegenüber den „unbesiegten Nachbarn“, also seinen wirklichen oder
möglichen Feinden folgendes Edikt: „Der König wünscht, daß sie
sich nicht vor mir fürchten sollen, daß sie mir vertrauen sollen, daß
sie durch mich nur Glück, nicht Unglück erlangen mögen.“
Ferner sollen sie folgendes verstehen: Der König wird von uns sich
gefallen lassen, was man sich gefallen lassen kann..... jene
(die Nachbarn)[S. 104] müssen bewogen werden, Vertrauen zu fassen, damit sie
verstehen: „Wie ein Vater ist der König zu uns – wie er sich selbst
liebt, liebt er uns – wir sind dem Könige wie seine Kinder.“...
„Zu diesem Zwecke habe ich dies Edikt erlassen, damit die Beamten stets
sich bemühen, bei meinen Nachbarn Vertrauen zu erwecken und sie zur
Befolgung des Gesetzes (Buddhas) zu bewegen[112].“
Dieser selbe Açoka, der erst zum Buddhismus übertrat und ihm von ganzem
Herzen zugetan war, blieb so völlig frei von jedem Fanatismus, der
einst u. a. Karl den Großen zur Ehre des Christengottes 4500 Sachsen
bei Verden enthaupten ließ, daß er vor allem Duldsamkeit gegen
Andersdenkende lehrt. Sogar dem Brahmanentum gegenüber wurde Toleranz
befolgt, und feindliche Handlungen unterblieben[113].
Damals konnte der Bauer zwischen kämpfenden Heeren sein Feld bestellen.
*
Als Mohammeds Nachfolger Abu Bekr seine Truppen zur Eroberung
Syriens im 7. Jahrhundert aussandte, d. h. im Begriff war, einen der
in seinen Folgen gewaltigsten Kriege der Weltgeschichte zu führen, gab
er ihnen folgende Instruktionen: „Leute, ich habe zehn Dinge euch zu
empfehlen, die ihr genau beachten müßt. Täuschet niemand und stehlet
nicht; handelt nicht treulos und verstümmelt niemanden, tötet weder
Kinder noch Greise noch Weiber, beraubt die Palmen nicht ihrer Rinde,
noch verbrennt sie, schlaget nicht die Frucht[S. 105]bäume ab und zerstöret
nicht die Saatfelder, tötet nicht Schafe, noch Ochsen, noch Kamele
außer für euren Lebensunterhalt. Ihr werdet Geschorene finden –
schlagt sie mit dem Säbel auf die Tonsur; ihr werdet auch Leute in
Zellen (d. h. Einsiedler) finden – laßt sie in Ruhe, damit sie in
der Erfüllung ihrer Gelübde fortfahren[114].“
Es ist ausdrücklich überliefert, daß diese Instruktionen von den
„fanatischen“ Mohammedanern auch befolgt wurden.
Jedenfalls hätten die christlichen europäischen Truppen im Chinafeldzug
von 1900 sich daran ein Beispiel nehmen können.
*
Daß die weitesten Wanderungen auch bei den schlechten
Verkehrsverhältnissen des Mittelalters dem kühnen Abenteurer möglich
waren, lehrt das Beispiel Harald Hardraades, eines Kriegshelden
des 11. Jahrhunderts.
In der Schlacht bei Stiklestad in Skandinavien, in der sein Bruder
Olaf Thron und Leben verlor, verwundet, flüchtet Harald zu den
Stammesbrüdern nach Rußland, dann nach Apulien, ward hierauf
unerkannt in Byzanz Führer der Waräger und vollbrachte ein Jahrzehnt
lang an ihrer Spitze Heldentaten, die ihn bis Sizilien, Nordafrika
und Ägypten führten. Danach ward er in Rußland der Schwiegersohn
des Fürsten Jaroslaw und bestieg schließlich, nach dem Tode seines
Neffen Magnus, den Thron Norwegens. Sein Ende fand er beim Versuche,
das Angelsachsenreich an sich zu bringen, in der Schlacht bei
Stamford[S. 106]bridge, nur 18 Tage vor dem Siege Wilhelms des Eroberers bei
Hastings (1066).
Er hatte also ganz Europa vom äußersten Norden und Nordwesten
bis in den tiefsten Süden und Südosten, die Küsten Asiens und Afrikas
in seinen Gesichts- und Wirkungskreis gezogen und kann als Verkörperung
der normännischen Ausbreitung gelten, die den Horizont der Kreuzzüge
schuf[115].
*
Es war im frühen Mittelalter durchaus Sitte, daß dem Heere sich
Kaufleute, leichtfertige Dirnen usw. anschlossen. Selbst an den
Kreuzzügen beteiligten sich Scharen dieser leichtfertigen
Weiber, die militärisch organisiert, mit Keulen bewaffnet und sogar
mit eigenen Fahnen versehen gewesen sein sollen. Vom 2. Kreuzzuge,
auf den König Ludwig VII. von Frankreich aus guten Gründen seine
etwas flotte Gattin mitgenommen hatte, heißt es: „Dies Beispiel
befolgten viele andere Edelleute und nahmen ihre Gemahlinnen mit,
und weil da Dienerinnen nicht fehlen konnten, so befand sich in dem
christlichen Heere, das keusch sein sollte, eine Menge von Frauen.“
Auch im Heere Konrads III. fehlte es nicht an fahrenden Weibern, was
dem erbaulichen Lebenswandel der christlichen Glaubensstreiter nicht
eben Vorschub leistete. Deshalb wurde, als Heinrich II. und sein Sohn
Richard Löwenherz 1188 den 3. Kreuzzug antreten wollten, bestimmt, daß
„keiner auf die Wallfahrt irgendein Weib mitführen solle, außer einer
Waschfrau zu Fuße, die unverdächtig sei.“ Wie[S. 107] „unverdächtig“
zu verstehen ist, wird nicht gesagt. Das kanonische Alter wird kaum
Bedingung gewesen sein. Genützt hat diese Bestimmung nicht viel, wie
auch der Erfolg der drakonischen Lagergesetze Friedrich Barbarossas
ziemlich problematisch blieb[116].
Noch zur Zeit der Landsknechte nahmen viele Weib und Kind mit ins
Feld und ins Lager. Die Ledigen litten auch nicht Mangel, denn ein
beträchtlicher Troß liederlicher Weiber folgte dem Heere und unterstand
der Disziplinargewalt des Troßweibels. Im Dreißigjährigen Kriege
schleppte z. B. ein Regiment von dreitausend Mann zweitausend
Weiber mit, gegen die die Autorität der Obersten nichts ausrichten
konnte. Im Verlaufe des Krieges übertraf der Troß die Zahl der
Kombattanten um das Drei- bis Vierfache. Diese Weiber mußten für
die Soldaten alle Arbeiten verrichten und alle Strapazen teilen, dazu
eine harte und mitleidlose Behandlung erdulden. Die „Lagerkinder“
wurden oft mit den Müttern ins Elend gestoßen. Dann konnten sie
nichts anderes werden als Bettler, Diebe oder Räuber, im besten Falle
Soldaten, was aber damals auf dasselbe herauskam[117].
*
Sehr gemütlich war die Kriegsführung der Italiener im 15.
Jahrhundert. Die Condottieri hatten „aus der Kriegsführung eine
Kunst gemacht, indem sie in solchem Maße temporisierten, daß meist
beide Teile verloren“. In der Schlacht bei Zagonara, „dieser in
ganz Italien berühmt gewordenen Niederlage“ wurde nur ein einziger
Mann getötet, aber nicht etwa durch[S. 108] Waffengewalt, sondern durch
Sturz vom Pferde und Ersticken im Schlamm. In der einen halben Tag
dauernden Schlacht bei Molinella fiel kein einziger. In der Schlacht
bei Anghiari, die von Lionardo in einem berühmten, leider verloren
gegangenem Karton verherrlicht wurde – Rubens entwarf in Anlehnung
daran seine Reiterschlacht in der Münchner Alten Pinakothek – soll
ein einziger Mann vom Pferde zertreten worden sein. Diese Machiavellis
„Florentinischer Geschichte“ entnommenen Daten sind zweifellos
übertrieben. Immerhin kennzeichnen sie die damalige Anschauung vom
Kriegswesen, die auf den Grundton gestimmt ist „Wie gewöhnlich
geschieht, siegte die Furcht“. Machiavelli faßt sein Urteil in die
Worte zusammen: „Nie gab es Zeiten, in denen der im fremden Lande
geführte Krieg minder gefährlich gewesen wäre, als in diesen.. Denn da
alle beritten, mit Rüstung bedeckt und vor dem Tode sicher waren, wenn
sie sich ergaben, so war überhaupt kein Grund vorhanden, weshalb sie
sterben sollten. Beim Kämpfen schütze sie die Rüstung; konnten sie
nicht mehr kämpfen, so ergaben sie sich“. „So wurde jene kriegerische
Tugend, die anderwärts durch langen Frieden unterzugehen pflegt, in
Italien durch die Lauheit der Kriegsführung unterdrückt.“
Die bei Caldana liegenden florentinischen Truppen hatten den Verlust
von 200 Troßknechten zu beklagen, die ins feindliche, neapolitanische
Lager desertierten, weil der Wein ausgegangen war! Aus diesem
triftigen Grunde wurde die Belagerung auch aufgehoben[118].
[S. 109]
König Friedrich Wilhelm I. von Preußen war bekanntlich ein
leidenschaftlicher Freund und Sammler schöner großer Soldaten. Für
die Art, wie er sie sich zu verschaffen wußte, ist folgende Notiz
vom Jahre 1713 bezeichnend: „Die Werbungen sind sehr scharf vor sich
gegangen, jedoch aber haben S. Kön. Maj. verboten, die Passagiere
auf den Posten nicht mehr anzuhalten, als wie etlichemal in der ersten
Hitze geschehen.“ Im übrigen machte man im ganzen Lande förmliche
Jagd auf Bürger und Bauern; auf den Straßen, in den Feldern,
sogar während des Gottesdienstes erfolgten die Aushebungen.
Als der Prediger Gottfried Arnold im Jahre 1714 in Perleberg eben
das Abendmahl austeilte, drangen Werber in die Kirche ein und
nahmen junge Leute mitten aus der Kirche fort. Der Prediger alterierte
sich darüber derart, daß er zehn Tage später starb. Noch im Jahre 1720
wurden in der Mark Gemeinden während des Gottesdienstes von den Werbern
des Soldatenkönigs – der im übrigen viel besser als sein Ruf war –
überfallen. Diese Vergewaltigungen führten endlich zu einem offenen
Aufstand: gerade die Tüchtigsten flohen in Scharen vor den preußischen
Werbewüterichen. Von solchen Flüchtlingen wurden die Industrien von
Elberfeld und Barmen begründet[119].
Mit List, Gewalt und Geld wurde auch außer Landes der
Menschenfang betrieben. Karl Julius Weber, der berühmte Verfasser des
Demokrit, erzählt, daß sein Großonkel, der Theologie studiert hatte und
in Nürnberg als Hauslehrer lebte, bei einem Spaziergang von preußischen
Werbern plötz[S. 110]lich überfallen, geknebelt, in einen Wagen geworfen
und so nach Potsdam entführt worden sei, weil er 6 Fuß und 3 Zoll
maß. Dieser Gewaltstreich kostete ihn sein ganzes Lebensglück.
Solche Fälle waren an der Tagesordnung. Man fing sogar einen langen
katholischen Geistlichen, den nachher unter Friedrich dem Großen in
hoher Gunst stehenden gescheiten Abbé Bastiani, aus Welschtirol,
als er gerade die Messe las, ein, und selbst ein Mönch aus Rom
blieb nicht verschont und wurde in die blaue Garde gesteckt. Solche
Übergriffe ließen sich die Nachbarn auf die Dauer nicht gefallen. In
Hessen-Cassel wurden z. B. mehrere preußische Werbeoffiziere gehenkt.
*
Kinder in der Wiege, die lang zu werden versprachen, erhielten
eine rote Halsbinde und die Eltern das Handgeld. Der Versuch
Friedrich Wilhelms, recht lange Gardisten mit recht großen Frauen
zusammen zu geben, um so recht lange Kinder zu erhalten, mißglückte zu
seinem großen Bedauern.
Die „lieben blauen Kinder“ durften nebenbei ein Gewerbe betreiben,
Bier- und Weinhäuser, Materialläden usw. halten, nur keine öffentlichen
Handarbeiten verrichten. Der König schenkte ihnen Geld und Grundstücke,
sogar Kanonikate und stand bei ihren Kindern Gevatter.
Da die Kompagniechefs der preußischen Truppen verpflichtet waren,
ihre Mannschaften vollzählig zu erhalten, waren alle zu Werbungen
geradezu ge[S. 111]zwungen. Die Chefs hoben ganze Kolonien in den
zugewiesenen Werbedistrikten aus, versetzten sie auf ihre Güter
als „Ergänzungsmannschaften“, machten die kleinen zu Bedienten, Köchen,
Reitknechten usw., kurz führten in die preußischen Staaten eine Art
von Faustrecht zurück. Erst das Kantonreglement von 1733 räumte
einigermaßen mit diesen unerhörten Zuständen auf[119].
Welcher Brutalitäten die Offiziere noch im 18. Jahrhundert fähig waren,
erhellt aus der Sitte der Garnison von Gaeta aus der Hirnschale
des dort als Mumie aufbewahrten Herzogs Karl von Bourbon zu
trinken. „nachdem aber etlichemal Verdrüßlichkeiten und Unglücke
darüber und bey solcher Gelegenheit unter ihnen entstanden, so ist
solche Unordnung gänzlich untersaget worden.“ Erzählt Keyßler im Jahre
1730[120].
*
Landgraf Friedrich II. von Hessen-Kassel, ein Fürst, der seine Residenz
zu einer der schönsten in Deutschland machte, gebildet, kunstliebend
und der Aufklärung zugetan – also keineswegs ein mittelalterlicher
Tyrann – verkaufte im Jahre 1775 12800 Hessen den Engländern
zum Gebrauche in ihren Kolonien. Bis zum Jahre 1782 wurden noch weitere
4200 Rekruten nachgeschickt. Dazu gab Hanau noch besonders 2400 Mann.
Da Hessen-Kassel damals 400000 Einwohner hatte, verschacherte
der Fürst fast den zwanzigsten Teil seiner Untertanen!
Die englischen Kommissarien kamen nach Kassel und besichtigten die
verkauften Menschen auf dem[S. 112] Markte, wie sie die Neger in Amerika zu
besichtigen gewohnt waren. Für jedes Stück dieser armen Kerle
zahlten sie 100 Taler. Sie wurden auf der Weser eingeschifft und
Friedrich der Große erhob bei Minden von ihnen beim Passieren seines
Landes den üblichen Viehzoll! Die beste Verurteilung dieses
Systems.
Klagten die Eltern der verschacherten Leute, dann kamen die Väter in
die Eisenarbeit, die Mütter ins Zuchthaus. Wer desertierte, mußte zwei
Tage lang Spießruten laufen – übrigens ein Kulturgeschenk Rußlands –
zwölfmal täglich, zuweilen bis zum Tode. Karl Justus Weber, der
das miterlebte, wurde von den Offizieren belehrt, daß das Gassenlaufen
der Gesundheit weniger nachteilig sei, als die alte Stockprügel!
Von diesen 19400 Mann kehrten im Herbst 1783 und im folgenden
Frühjahr 11900 zurück. 7500 Mann hatte der Krieg
weggerafft!
Merkwürdig ist, daß gleichzeitig – eine Einwirkung der Aufklärung –
in Hessen die Tortur abgeschafft wurde und die einfache Todesstrafe nur
mehr höchst selten Anwendung fand.
Übrigens hatte sich der Menschenschacher bezahlt gemacht: Als Landgraf
Friedrich II. 1785 starb, soll er trotz seiner vielen Bauten und
Reisen und des großen von ihm betriebenen Luxus 56 Millionen Taler
hinterlassen haben[121].
Die englischen Subsidien, die Georg III. für die hannöversche Armee
gegen Frankreich zahlte, berechneten die Prämie für einen toten oder
drei verwundete[S. 113] Soldaten bei der Infanterie auf 28 Taler, bei der
Kavallerie auf 11 Taler. Dagegen wurden für ein totes Pferd oder drei
verwundete Pferde 90 Taler vergütet. Ein deutscher Soldat wurde also
am Ende des 18. Jahrhunderts auf 11–28 Taler bewertet, also ein
Achtel bis ein Drittel so hoch wie ein Pferd. Gleichzeitig schätzte
der englische Nationalökonom William Petty den Wert eines Menschen auf
2888 Taler. Das waren allerdings auch Engländer![122]
*
Eines schönen Tages im Herbste des Jahres 1906 begegnete ein Hauptmann
auf der Landstraße in der Nähe Berlins einer vom Schießen heimkehrenden
Soldatentruppe. Er hielt sie an, hieß sie umkehren und mit ihm nach
Köpenick marschieren, wo er mit Unterstützung der requirierten
Polizei das Rathaus umstellen ließ. Dann begab er sich mit zwei Mann
zum Bürgermeister, nahm auf Grund einer gefälschten allerhöchsten
Kabinettsorder eine Visitation der Stadtkasse vor, ließ sich den Betrag
von 4000 Mark auszahlen, quittierte, verhaftete den Bürgermeister mit
dem Kassenrendanten und ließ sie per Wagen nach Berlin transportieren.
Der Bürgermeister ist veritabler Reserveoffizier, der „Hauptmann“
seines Zeichens Schuster, der lange Jahre seines Lebens hinter
Gefängnismauern zugebracht hatte. Daß eine Militärbehörde gegen
einen Bürgermeister als Zivilbeamten keine Maßregeln ergreifen kann,
bedenkt er nicht. Es hätte auch wenig genützt, denn wie die Soldaten
bei der Gerichtsverhandlung[S. 114] bekunden, hätten sie auf einen Wink des
„Hauptmanns“ hin den Vater der Stadt mit ihren Bajonetten durchbohrt.
Niemandem war es aufgefallen, daß der „Hauptmann“ alt und schäbig
aussah, niemandem, daß er unvorschriftsmäßig gekleidet war und in
Mütze statt im Helm seine Visitation vornahm. Keinem der Soldaten war
es eingefallen, den wildfremden Offizier nach seiner Legitimation zu
befragen. Ganz Europa lachte.
Welches Ansehen muß der Militärstand in einem Lande besitzen,
daß so etwas möglich ist! Daß eine Uniform allein genügt, eine ganze
Stadt mitten im tiefsten Frieden zu alarmieren, die höchsten Behörden
widerstandslos zu verhaften! Daß alle diese Maßnahmen ungesetzlich
waren, wußte man natürlich auch in Köpenick, aber der Zauber der
Uniform brachte jede Regung der Vernunft zum Schweigen.
*
Wie mag die Zukunft darüber urteilen, daß die großen Militärmächte
Europas durch ihre Offiziere die Armeen anderer Staaten reformieren
lassen? Im Chinafeldzuge 1900 hatte der Feind unser verbessertes
Gewehr System 88, das deutsche Seitengewehr vom gleichen Jahre,
Prismen-Entfernungsmesser, Ferngläser usw., manöverierte nach deutschen
Signalen und bewies fast deutsche Disziplin[123].
[S. 115]
Sechster Abschnitt
Ehe
Erst seit dem 8. Jahrhundert verlangte die Kirche Vollziehung der
Trauungszeremonie durch einen Geistlichen, aber noch bis etwa 1300
wurden Bauernhochzeiten ohne priesterliche Assistenz in Deutschland
gefeiert. Zur Zeit der Minnesinger war es noch nicht feststehende
Sitte, die Trauung in der Kirche vorzunehmen[124]. Es genügte, wenn die
Brautleute sich vor glaubwürdigen Zeugen die Ehe versprachen. Diese
Zivilehe, die bald vollzogen wurde, wurde für rechtsgültig angesehen.
Eine wichtige Zeremonie war die des Beilagers, von der auch bei
Kindern nicht Abstand genommen wurde. Als die Tochter König
Rudolfs von Habsburg, Guote, den König Wenzel von Böhmen heiratet,
legte man beide Kinder die Nacht über zueinander, wiewohl – so
berichtet der Chronist Ottokar von Steier CLXXIV – sie von ihren
Puppen, er von seinen Falken erzählte[125].
Als Kaiser Friedrich III. mit der reizenden 16jährigen Eleonore von
Portugal am 22. März des Jahres 1452 zu Neapel die Ehe vollzog – die
Trauung[S. 116] durch den Papst war bereits am 16. des Monats erfolgt – gab
es nicht geringe Schwierigkeiten. Friedrich hatte sich nämlich diesen
feierlichen Akt für Deutschland aufsparen wollen. Nach langem Sträuben
gab er endlich nach. Gerührt durch die Trauer Leonorens, die fürchtete,
ihm nicht zu gefallen, und bewogen durch König Alfonso, der ihm klar
machte, daß es viel einfacher sei, seine Nichte gleich hier zu lassen,
wenn er nicht befriedigt sei, als sie aus Deutschland zurückzuschicken.
Er ließ das Lager herrichten, legte sich darauf und ließ sich Leonore
in die Arme legen, dann wurde in Anwesenheit des Hofstaates über sie
eine Decke gezogen. Es blieb aber bei einem Kusse. Auch waren beide
in den Kleidern und standen unverzüglich auf. Die portugiesischen
Hofdamen fürchteten (oder hofften?), als sie das Überziehen der Decke
und die ernste Wendung, die die Sache anzunehmen schien, sahen, daß
es doch etwas shoking würde und kreischten. König Alfonso aber sah
mit sichtlichem Ergötzen lächelnd der Zeremonie zu. In der folgenden
Nacht wurde das Versäumte nachgeholt, und das junge Paar begab sich
zu Bett – jedenfalls unbekleidet, da das damals üblich war – aber
nicht in das priesterlich geweihte, das die Portugiesinnen hatten
herrichten lassen, sondern da Friedrich Gift oder Zauber fürchtete, in
ein anderes. Aber das ging nicht so glatt, denn die Kaiserin, die sich
schon zu Bette begeben hatte, wollte trotz dreimaliger Aufforderung
Friedrichs nicht ins andere Bett, in dem der Kaiser lag. Sie werde es
halten, wie es Brauch sei. Die Männer müßten zu den Frauen kommen und
nicht umgekehrt. Der Kaiser[S. 117] verfügte sich dann zu ihr und zog sie an
der Hand ins unverdächtige Bett.[126]
*
Wie die Ehe durch Prokuration geschlossen wurde, beschreibt der
Chronist Jakob Unrest wie folgt: „Kunig Maximilian schickte seiner
diener ainenn genannt Herbolo von Polhaim gen Brittania zu empfahn die
kunigliche prawt, der war in der stadt Remis (Reims) erlichn empfanngn,
und deselbst beslieff der von Polhaim die kunigliche prawt, als der
fursten gewohnhait ist, das ihre sendpotten die furstlichn prawt mit
ainem gewaptn man mit dem rechtn arm, und mit dem rechtn fues plos,
und ain plos swert darzwischn gelegt, beschlaffen. Also habn dy alltn
furstn gethan, und ist noch die gewohnhait“.[127]
Es handelt sich hier um die 1491 geschlossene Ehe Maximilians I.
mit der Anna von Bretagne. Übrigens wurde sie niemals vollzogen, da
der König Karl VIII. von Frankreich die Braut seines Rivalen trotz
des gewährten freien Geleites gefangen setzte und selber
heiratete. Die reiche Erbschaft schien ihm diesen Ehe- und
Wortbruch zu rechtfertigen. Bekanntlich ließ Maximilian sich diesen
Schimpf nicht gefallen und erklärte den Krieg.
Noch zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurde vom deutschen Fürstenrecht
ähnliches gefordert. Man legte das junge Paar nach der Trauung im
Beisein des Hofes in das Paradebett, das im Speisesaal hergerichtet
war. Dabei wurden Konfitüren und süßer[S. 118] Wein gereicht. Dann nahm man
das Paradebett auseinander und führte die Neuvermählten unter Pauken-
und Trompetenschall an die fürstliche Tafel.[128]
*
Erbaulich ging es bei der Verlobung der hl. Elisabeth her. Der
Patriarch von Aquileja, Berthold, ein Bruder der ungarischen Königin
Gertrud, schändete eine Gräfin. Da er sich durch Abreise der Rache
ihres Gemahles entzieht, dringt dieser in das Schlafgemach der Königin
ein und hängt sie, im Glauben sie sei mitschuldig, auf.[129]
Trotz der Sittenlosigkeit des deutschen Mittelalters, das sich aber
stets der Verwerflichkeit des Ehebruches bewußt blieb, war der gereizte
Ehemann sehr unbequem. Der Verführer hatte auf alle Fälle sein Leben
verwirkt, in der Regel wurde er verbrannt, oft ging es ihm noch
schlimmer. Die beiden Schwiegertöchter Philipps III. von Frankreich,
Margarethe, Gemahlin des Kronprinzen, und Blanche, die des Grafen de
la Marche, wurden geschoren und zu ewigem Gefängnis verurteilt. Ihre
Liebhaber Philipp und Gautier d’Aulnai öffentlich geschunden, kastriert
und gehängt.
Nicht geringe Unbequemlichkeiten hatte nach Thietmar von Merseburg ein
Ehebruch bei den Slawen in der heutigen Lausitz im Gefolge.
„Wenn unter ihnen einer sich erfrecht fremde Ehefrauen zu mißbrauchen
oder Hurerei zu treiben, so muß er sofort folgende Strafe erdulden: Er
wird[S. 119] auf die Marktbrücke geführt und ihm durch den Hodensack ein Nagel
geschlagen; dann legt man ein Schermesser neben ihn hin und läßt ihm
die harte Wahl, dort auf dem Platz sich zu verbluten, oder sich durch
Ablösung jener Teile zu befreien“. Der ertappten Frau ging es nicht
viel besser. „Wenn eine Buhlerin ertappt wurde, dann wurde sie mit der
entehrenden und erbärmlichen Strafe belegt, an ihren Genitalien ringsum
beschnitten zu werden. Dieses Präputium – wenn man den Ausdruck dafür
gebrauchen kann – wurde an ihrer Haustüre aufgehängt, damit
der Blick des Eintretenden darauf falle und er in Zukunft um so mehr
bedacht und vorsichtig wäre.“ Zur Zeit der Väter, sagt Thietmar, wurde
die Frau enthauptet.[130]
Eine ähnliche Geschichte erzählt der Chronist Matthäus Parisiensis,
Mönch von St. Alban in England: Johannes Brito ertappte 1248 einen
vornehmen Ritter namens Godefridus de Millers bei seiner Tochter,
schlug ihn, hing ihn mit gespreizten Beinen an die Balken, machte
ihn zum Kapaun und warf ihn halbtot hinaus. Dafür wurde er – zumal
er es einem sehr galanten Geistlichen gerade so machte – auf ewig
verbannt. Der König aber bestimmt, und das gibt diesem Falle seine
kulturhistorische Bedeutung: hinfort sei diese Verstümmelung verboten,
es sei denn als Vergeltung für den Ehebruch der eigenen Frau!
Das Mainzer Stadtrecht befiehlt als Strafe für Juden, die sich mit
Christenfrauen fleischlich ver[S. 120]gingen: „da sol man dem Juden sein Ding
abesniden und ein Aug ausstechen“. Übrigens ließ noch im Jahre 1545 ein
Edelmann in der Wetterau seinen Schalksknecht kastrieren[131].
*
Zahlreich sind die Fälle, in denen der Mann die im Ehebruch ertappte
Frau tötet. Aus Brantôme geht hervor, daß das im Frankreich des 16.
Jahrhunderts gar keine Seltenheit war.[132] Auch in Deutschland
war es in dieser Zeit noch gesetzlich zulässig. Z. B. heißt es im
Frankenhauser Stat. von 1558: „Ob einer einen Andern bei seinem
elichen Weibe nackend und bloß in einem Bette hete befunden und
in zorniger weise zufiele und den selbigen tod schlüge, der ist
unstreflich“.[133] In der Zimmerischen Chronik (II, S. 523 f.)
wird von einem Kaufmann erzählt, der seinen Schreiber mit seiner Frau
im Bade findet – merkwürdigerweise scheint die Badewanne damals bei
galanten Tete-a-tetes sich besonderer Bevorzugung erfreut zu haben –
und ihn tot schlägt: „Die obrigkait nam sich der sachen weiter nit an,
dieweil der schreiber an der thatt ergriffen“. Das war in Konstanz.
„Solch strigeln im badt biß auf den todt ist bei wenig jaren davor ain
pfaffen zu Zürich auch begegnet, der ist auch dermaßen von aim burger
daselb im badt beim weib ergriffen worden“. Sehr ergötzlich ist die
Geschichte, die sich 1532 in Oberndorf zutrug (ebenda III, S. 65 ff.),
wo ein ertappter Pfaffe mit zusammengebundenen Vieren zum Fenster
hinausgehängt wird. Merkwürdigerweise wird in der Regel die Frau wieder
in Gnaden aufgenommen.
*
[S. 121]
Besonders Fürstlichkeiten mußten oft Damen heiraten, die sie nie
gesehen hatten. Um nun nicht mit einem Scheusal hereinzufallen,
schickten sie Gesandte oder ihren Hofmaler auf die Brautwerbung. Als
1161 der griechische Kaiser Manuel um Milisendis, Schwester des Grafen
von Tripolis, werben läßt, müssen die Gesandten sich genau nach ihrer
Körperbeschaffenheit erkundigen oder, wie es in der altfranzösischen
Übersetzung dieser Stelle heißt: sie wollten sie oft reden hören und
ließen sie ganz entkleidet vor sich hin und her gehen.
Noch im 18. Jahrhundert wurde in Frankreich jede Verlobte eines
Prinzen vor der Verheiratung durch seine weiblichen Anverwandten einer
körperlichen Untersuchung unterzogen.[134]
*
Daß die Frauen von ihrem Manne geschlagen wurden, selbst mit einem
Knüttel, war im frühen Mittelalter so gang und gäbe und galt für so
wenig unpassend, daß es selbst in den Ritterromanen häufig erwähnt
wird.[135] Sogar Siegfried hat Krimhilde tüchtig verprügelt, als sie
die Brunhilde durch ihre Rede verletzt hatte (Nib. XV, 894). In Bayern
hat erst die Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuches, 1900, das
leichte Züchtigungsrecht des Ehegatten beseitigt.
*
Wer der Treue seiner Frau nicht sicher war, legte ihr schon im 13.
Jahrhundert einen Keuschheitsgürtel an, von dem sich Modelle
im Museum[S. 122] schlesischer Altertümer in Breslau, im Schloß Erbach im
Odenwald – hier gleich zwei Exemplare – im Museum des Arsenals in
Venedig, im Museum zu Poitiers, im Toussaud-Museum in London, in der
Sammlung Pachinger in Linz, im Clunymuseum zu Paris und wohl auch noch
anderwärts erhalten haben. Allerdings war der mißtrauische Ehemann
nicht sicher, daß der Händler nicht einen Nachschlüssel der Gattin oder
ihrem Liebhaber einhändigte.
*
Wie Graf Zimmern erzählt,[136] gab es in Sachsen und den Niederlanden
eine eigentümliche Sitte, „Beischlafen auf Glauben“, „was
doch wider alle vernunft ist, auch vil huren und dorechter weiber
gemacht hat. Man sagt ain guten Schwank von aim edelman in Niderlanden
oder Westphalen, ain Horst, dem ist auch ain solliche ehr mit ainer
jungfrawen angethon und uf glauben zugelegt worden. Als ihm nun nachs
die Keuz anfahen steigen, do hat er die jungfrawen anfahen zu begreifen
und mit ihr zu sprachen. sie hats alles von ime gelitten und vergut
gehaht, one das er ir nit underhalb der gurtel oder weiche greif. nun
parlamentirt er lang mit ir, vermaint, sie zu bereden, aber sie war
ganz standthaft und sagt im mit kurzen worten, er sollt darvon sten,
dann sie wurde im underthalb der Gurtel nichts verwilligen.“
Merkwürdige Anschauungen von Jungfräulichkeit herrschten in der
Grafschaft Sponheim unter dem gewöhnlichen Volke seit den ältesten
Zeiten. Zimmern[S. 123] erzählt darüber (III, S. 279 f.): „Wann ain junger
gesell sich verheiraten will und umb eine wurbdt, so mueß zuvor er irer
freundschaft burgen (Bürgen) setzen, das er ain hertbarer gesell seie
(das sein die verba formalia) das ist sovil, das er wol hasplen kundt
uf der betziehen. dargegen aber so muß im der hochzeiterna freuntschaft
verburgen, das iren dochter oder verwantin ein raine jungfraw
seie; iedoch dingen sie darbei uß drei stuck, nemlich
Kinderspill, als wann die halbgewachsne kinder mit ainander sich paren
und gaupen; item hurtenscheden, was hunder den zeunen oder dergleichen
Orten sich ongeferdt begibt, und dann hew- oder kornbaren, das wurt
insonderhait ußgedingt; dann wie baldt het am strohalm an sollichem ort
ain schaden gethon? fur diese drei scheden verspricht man keinem, und
da sie gleich ain guet zeit im beßenreis umbgeloffen, so mueß doch der
guet narr schweigen und zufrieden sein.“ Unter diesen Umständen war es
allerdings in Sponheim nicht schwer, als Jungfrau zu gelten. Ja, ja,
keusch waren unsere Vorfahren!
*
Noch gegen Ende des 16. Jahrhunderts herrscht, noch dazu in höfischen
Kreisen, eine ähnlich laxe Sitte. Der schlesische Ritter Hans von
Schweinichen weiß darüber in seinen „Denkwürdigkeiten“ (S. 38 f.) zu
erzählen:
Im Jahre 1573 reist er nach Lüneburg zu Herzog Heinrich. Nach dem
Abendessen wird getanzt und die Hofgesellschaft zieht sich
von der Reise er[S. 124]müdet zurück. „Die einheimischen junker verloren
sich auch, sowohl die jungfrauen, daß also auf die letzte nicht mehr
als zwo Jungfern und ein Junker bei mir blieben, welcher einen tanz
anfing. Dem folget ich nach. Es währet nicht lange, mein guter Freund
wischt mit der Jungfer in die Kammer, so an der Stuben war, ich hinter
ihm hernach. Wie wir in die Kammer kommen, liegen zwei Junkern mit
Jungfrauen im Bette; dieser, der mit mir vortanzet, fiel sammt der
Jungfer auch in ein Bette. Ich fraget die Jungfrau, mit der ich tanzet,
was wir machen wollten. Auf Mecklenburgisch so saget sie, ich
sollt mich zu ihr in ihr Bette auch legen; dazu ich mich nicht
lange bitten ließ, leget mich mit Mantel und Kleidern, ingleichen die
Jungfrau auch, und reden also bis vollend zu Tag, jedoch in allen
Ehren. Auf den Morgen hat ich das Beste, daß ich der Längest wär
auf dem Platz gewesen, gethan, und ich hatte es am besten verricht. Kam
derwegen beim Frauenzimmer in groß Gunst. Das heißen sie auf Treu
und Glauben beischlafen; aber ich acht mich solches Beiliegen nicht
mehr, denn Treu und Glauben möchte zu ein Schelmen werden.“
*
Das Jus primae noctis ist dokumentarisch nachweisbar bis zur Mitte des
16. Jahrhunderts. Ein Gesetz vom Jahre 1538 im Kanton Zürich lautet:
„Ouch hand die burger die rechtung, wer der ist, der uf den gütern,
die in den Kelnhof gehörend, die erste nacht bi sinem wibe ligen wil,
die er nüwlich zu der[S. 125] ee genommen hat, der sol den obgenanten
burger vogt dieselben ersten nacht bi demselben sinen wibe lassen
ligen.“ Der Bräutigam hatte allerdings das Recht, mit Geld seine
Braut freizukaufen. Auch die hohe grundbesitzende Geistlichkeit
beanspruchte das jus primae noctis, wohl allerdings mehr als weiteres
Mittel, die Untergebenen zu schröpfen, als um das Recht auszuüben.
Nach dem Lagerbuche des schwäbischen Klosters Adelberg vom Jahre 1496
mußten die zu Bortlingen sitzenden Leibeigenen das Recht dadurch
ablösen, daß der Bräutigam eine Scheibe Holz, die Braut ein Pfund
sieben Schillinge Heller oder eine Pfanne, „daß sie mit dem Hinteren
darein sitzen kann oder mag“, darbrachten. Der Maßstab, den die
geistlichen Herren anzulegen beliebten, spricht Bände! Anderwärts
konnten die Bräute sich loskaufen, indem sie dem Grundherrn so viel
Käse oder Butter entrichteten „als dick und schwer ihr Hinterteil
war“[137].
*
Sehr verständig, wenn auch für uns befremdend genug, ist Luthers
Ansicht, die er im Traktat „Vom ehelichen Leben“ niederlegt: „Wenn
ein tüchtig Weib zur Ehe einen untüchtigen Mann überkäme und könnte
doch keinen anderen öffentlich nehmen und wollte auch nicht gern wider
Ehre tun, soll sie zu ihrem Mann also sagen: Siehe lieber Mann, du
kannst mein nicht schuldig werden und hast mich und meinen jungen
Leib betrogen, dazu in Gefahr der Ehre und Seligkeit bracht, und ist
für Gott keine Ehe zwischen uns beiden, vergönne mir, daß ich mit
deinem[S. 126] Bruder oder nächsten Freund eine heimliche Ehe habe und
du den Namen habst, auf daß dein Gut nicht an fremde Erben komme, und
laß dich wiederum williglich betrügen durch mich, wie du mich ohne
deinen Willen betrogen hast.“ Der Mann hat nach Luther die Pflicht,
diese Bitte zu erfüllen; will er nicht, so darf er nicht böse sein,
wenn die Frau von ihm läuft[138].
Das Recht der Frau auf die ehelichen Freuden war gesetzlich garantiert.
Besonders in Westfalen war man augenscheinlich sehr besorgt, daß die
bessere Hälfte nicht zu kurz käme. In erster Linie muß der Nachbar
des untauglichen Ehemannes aushelfen. In der Landfeste von Hattingen
heißt es: „Da ein Mann wäre, der seinem rechten Weibe ihr frauliches
Recht nicht tun könne, so soll er sie sachte auf den Rücken nehmen
und tragen über neun Zäune und setze sie dort vorsichtig nieder, ohne
Stoßen, Schlagen, Werfen und ohne bösen Worte, rufe alsdann seine
Nachbarn an, daß sie ihm seines Weibes Not wehren helfen.
Und wenn dann seine Nachbarn das nicht tun wollen oder können, so soll
er sie senden auf die nächste Kirchweih in der Nähe, und daß sie dort
‚sich seiwerlich zumache und zehrung habe‘, hänge er ihr einen mit
Geld gespickten Beutel auf die Seite. Kommt sie von dorther wieder
ungeholfen, dann helfe ihr der Teufel.“
War der Frau glücklich „geholfen“ worden, dann – so bestimmt das
Benker Heidenrecht (III, 42) „soll er sie wieder nehmen, sie wieder
tragen nach[S. 127] Haus und setzen sie sacht nieder und ihr ein gebratenes
Huhn und eine Kanne Wein vorstellen[139].“
Nach dem Bochumer Landrecht (III, 70) mußte der Mann die Frau über die
Zäune tragen, dort fünf Stunden lang um Hilfe rufen, nützte das
nicht, dann sollte er sie im neuen Kleid mit Geld versehen auf einen
Jahrmarkt schicken. Blieb auch das erfolglos, dann mögen ihr „thausend
düffel“ helfen.
So fremdartig uns diese Bestimmungen anmuten, so sind sie es doch mehr
wegen ihres Symbolismus als wegen des Grundgedankens, der unendlich
viel verständiger ist, als der in unserer Gesetzgebung, der Impotenz
zwar als Scheidungsgrund gelten läßt, aber dem geschädigten Ehegatten
kein Vorrecht einräumt. In Österreich gar mit seiner hochwohlweisen
Ehegesetzgebung kann sich zwar die Ehefrau scheiden lassen, aber
heiraten darf sie nicht mehr, so lange der Mann lebt. Allerdings
hat sich das Leben seit je über diese papierne Feigenblattmoral
hinweggesetzt.
*
Nach dem heute in Österreich gültigen Eherecht sind aber nicht nur
die katholischen Ehegatten bis zum Tode aneinander gebunden, sondern
es wird auch das Band der Ehe für ganz ebenso unauflösbar erklärt,
„wenn auch nur ein Teil schon zur Zeit der geschlossenen
Ehe der katholischen Religion zugetan war“. Also auch der
akatholische Teil muß die Folgen einer Ehe mit einem Katholiken
sein[S. 128] ganzes Leben lang tragen! Dieser im § 111 des Bürgerlichen
Gesetzbuches festgehaltene Grundsatz wurde durch Einwirkung des
österreichischen Episkopates in den Jahren 1814 und 1835 noch weiter
verschärft, indem auch nicht nur getrennten Akatholiken die Ehe mit
Katholiken untersagt wurde, sondern auch für sie selbst, falls sie etwa
vor oder nach der Trennung ihrer akatholischen Ehe zum Katholizismus
übertraten, sogar das Band ihrer bereits getrennten Ehe
dergestalt wieder wirksam wurde, daß ihnen bei Lebzeiten des
früheren Ehegatten jede Wiederverheiratung untersagt wird.
Mehr als das: der oberste österreichische Gerichtshof nimmt den
nach Wahrmund ungesetzlichen Standpunkt ein, daß selbst die im
Auslande geschlossenen Ehen akatholischer Ausländer wegen angeblichen
Ehehindernisses des Katholizismus ex officio für ungültig erklärt
werden müssen, wenn ein oder der andere Eheteil vordem einmal
Katholik gewesen war!
Das Merkwürdigste dabei ist, daß Christus, wie Wahrmund nachweist,
sowenig wie die ganze Antike, von einer unbedingten Unauflöslichkeit
der Ehe etwas wußte[140].
*
Um die furchtbaren Menschenverluste des Dreißigjährigen Krieges besser
ausgleichen zu können, wurde u. a. am 14. Februar 1650 vom fränkischen
Kreistag in Nürnberg folgender Beschluß gefaßt: „.. (es) seinds auff
Deliberation und Berathschlagung folgende 3 Mittel vor die bequemste
und beyträglichste erachtet und allerseits beliebt worden. 1. Sollen
hinfüro innerhalb[S. 129] den nechsten 10 Jahren von Junger mannschaft oder
Mannßpersonen, so noch unter 60 Jahren sein, in die Klöster ufzunemmen
verbotten, vor das 2te denen Letzigen Priestern, Pfarrherrn, so
nicht ordersleuth, oder auff den Stifftern Canonicaten sich Ehelich
zu verheyrathen; 3. Jedem Mannßpersonen 2 Weiber zu heyrathen
erlaubt sein: dabey doch alle und jede Mannßperson ernstlich
erinnert, auch auf den Kanzeln öffters ermahnth werden sollen, sich
dergestalten hierinnen zu verhalten und vorzusehen, daß er sich völlig
und gebürender Discretion und versorg befleiße, damit Er als ein
Ehrlicher Mann, der ihn 2 Weiber zu nemmen getraut, beede Ehefrauen
nicht allein nothwendig versorge, sondern auch under ihm allen Unwillen
verhüette“[141].
Im 138. Band der Preußischen Jahrbücher macht unter dem Pseudonym
eines Professor Dr. Robert Hoeniger ein allzu bescheidener Forscher
eine großartige Entdeckung! Der Geist treibt ihn zu „beweisen“, daß
die bekannten Plünderungsszenen Callots aus dem 30jährigen Kriege
ebenso, wie die Beschreibung einer Plünderung in Grimmelshausens
Simplicissimus nicht etwa so zu verstehen seien, daß bei jeder
Plünderung gleichzeitig im selben Zimmer geraubt,
gestohlen, genotzüchtigt, gemordet, brandgelegt usw. worden sei –
wie wir ahnungslosen Gemüter bisher glaubten – sondern daß hier
zusammengezogen sei, was sich an verschiedenen Orten begeben habe.
Daraus folgert er, daß der Dreißigjährige Krieg gar nicht so schlimm
war. Obige Notiz erklärt er, allerdings ohne Beweis für – einen Witz!
Dieser[S. 130] tiefbohrende Forscher hat auch endlich die „Kultur-Kuriosa“
richtig erkannt (S. 418 Anm.) als „kritiklose Sammlung alles Unrats
und Unflats“. Dafür sei ihm hiermit die Unsterblichkeit der Fliege
im Bernstein verliehen. Leider kann ich für den modernen Kopernikus
augenblicklich nicht mehr tun.
*
Es war im hohen Mittelalter Sitte, daß nach der Hochzeit das Brautpaar
mit den Gästen ins Badehaus ging, um ein gemeinsames Brautbad
zu nehmen, wobei die Geschlechter nicht getrennt waren. Wie es
dabei noch nach der so sittlich wirkenden Gegenreformation zuging,
lehrt das Zittauer Ratsedikt von 1616: „Als denn vormals dy jungen
Gesellen nach dem bade widir (wider) gute sitten in badekappin und
barschenckicht (mit bloßen Schenkeln) getanzt haben, wil der Rath das
fortureh (hinfort) kein mans bild in badekappin oder barschinckicht
tanzen solle“[142].
*
Daß die Kirche, trotz des sakramentalen Charakters der Ehe und ihrer
prätendierten Unauflöslichkeit bei Personen, die mächtig genug
waren, vom Prinzip abstand, daß andrerseits zu allen Zeiten, auch
im frühen Mittelalter gegenüber seiner unbeschreiblichen Angst vor
den Höllenstrafen die gewissen Freuden des Diesseits nicht selten
siegten, mag nach der einen oder andren Seite hin, aus folgenden Fällen
hervorgehen:
Lothar II. verstieß 860 seine Gemahlin Theutberga, um seine Geliebte
Waldrada zu ehelichen.
[S. 131]
Kaiser Friedrich I., Barbarossa, ließ sich von Anna von Vohburg unter
dem Vorwande scheiden, sie sei unfruchtbar. In zweiter Ehe mit einem
einfachen Adeligen hatte sie aber Kinder.
König Ottokar von Böhmen ließ sich 1261 von Margarete, Tochter Leopolds
VI. von Österreich, scheiden.
Ludwig von Brandenburg, Sohn Ludwigs des Bayern, heiratete Margareta
Maultasch, die Erbin von Tirol, nachdem sie von ihrem Mann, Johann
Heinrich, Sohn des Königs von Böhmen, 1341 geschieden war.
König Ladislaus von Sizilien verstieß seine Gemahlin Konstanze
Chiaramonte 1392 und heiratete 1402 Maria von Lusignan. Seine erste
Gemahlin aber gab er dem Andrea di Capua, Conte d’Altaville gegen
seinen Willen zur Frau[143].
Clemens VI. bestätigte die unkanonische Ehe Johannas von Neapel mit
dem Prinzen von Tarent im Jahre 1348. Und das wiewohl die Königin im
begründeten Verdacht stand, ihren ersten Gemahl ermordet zu haben.
Allerdings machte sich diese Milde bezahlt, denn Johanna verkaufte
Avignon am 8. Juni des gleichen Jahres an den Papst um die kleine Summe
von 80000 Goldgulden[144].
Die Äußerung König Alfonsos des Großen von Neapel Kaiser Friedrich
III. gegenüber, er solle lieber in Neapel das Beilager mit Leonore
von Portugal halten, als in Deutschland, um sie, falls er von ihren
körperlichen Reizen nicht befriedigt sei, gleich bei ihm lassen
zu können, beweist hinlänglich, daß zu allen Zeiten der Mächtige
nach Belieben verfahren konnte. Allgemein bekannt ist auch Luthers
Einwilligung zur Doppelehe des Landgrafen von Hessen[145].
[S. 132]
Siebenter Abschnitt
Sittlichkeit
Der hl. Hieronymus († 420) erzählt uns, daß zu seiner Zeit in Gallien
noch Menschenfresserei existierte. In seiner Schrift gegen
Jovinian (II, 7) schreibt er nach Harnack: „Was soll ich von anderen
Völkerschaften sagen, da ich doch selbst als Jüngling in Gallien
die Attikoten, einen britannischen Stamm, Menschenfleisch habe
essen sehen. Wenn sie in den Wäldern auf Schweine-, Rindvieh-
und Schafherden stoßen, schneiden sie den Kindern und den Weibern
die Hinterbacken und Brüste ab und halten diese für einen köstlichen
Schmauß.“
*
König Chlodwig verleitete den Chloderich, seinen Vater, König Siegbert,
zu ermorden. Nach Ausführung dieser Bluttat sollten die Schätze des
Ermordeten geteilt werden. Als der Sohn den Kopf in die Schatztruhe
steckte, erschlug ihn einer von Chlodwigs Leuten mit der Axt. Zwar
beteuerte Chlodwig[S. 133] seine Unschuld am Ende Siegberts, setzte sich aber
in den Besitz seiner ganzen Hinterlassenschaft. Als er den Fürsten
von Cambrai, Ragnachar, und dessen Bruder Richar gefangen genommen
hatte, schlug er den ersteren mit seiner Streitaxt nieder, unter der
Motivierung, er habe durch seine Feigheit das königliche Geschlecht
entehrt. Dann tötete er auch den Richar, weil er seinem Bruder nicht
genügend Beistand geleistet habe. Von diesem König Chlodwig, der
bekanntlich das Christentum annahm, schreibt der fromme Bischof Gregor
von Tour: „Gott aber warf Tag für Tag seine Feinde vor ihm zu Boden und
vermehrte sein Reich, darum daß er rechten Herzens vor ihm wandelte
und tat, was seinen Augen wohlgefällig war.“[146]
*
Im 9. Jahrhundert wurden drei deutsche Kaiserinnen, Judith,
Gemahlin Ludwigs des Frommen, Richenta, Gemahlin Karls des Dicken, und
Ota, Gemahlin Arnulfs des Ehebruchs angeklagt. Bekanntlich ging
es Kunigunde, Gemahlin Heinrichs II., nicht besser. Bekannt ist auch
das lockere Leben der Töchter Karls des Großen; sogar sein Freund und
Biograph Einhard berührt im 19. Kapitel diesen Punkt. Karls Tochter
Hruotrud hatte vom Grafen Rorich einen illegitimen Sohn Ludwig, seine
zweite Tochter Bertha gebar dem Abt Angilbert zwei Söhne außer der Ehe.
*
Thietmar von Merseburg, ein Bischof, der zu Beginn des 11. Jahrhunderts
sein berühmtes Geschichts[S. 134]werk verfaßte, lobt eine Matrone
ausdrücklich, weil sie nicht sei wie die anderen Frauen. „Denn diese
zeigen größtenteils, indem sie einzelne Teile ihres Körpers auf eine
unanständige Weise entblößen, allen Liebhabern ganz offen, was an ihnen
feil ist, und wandeln, obwohl das ein Greuel vor Gott und eine Schande
vor der Welt ist, ohne alle Scham allem Volke zur Schau einher. Es
ist schlimm und höchst beklagenswert, daß kein Sünder im Verborgenen
bleiben will, sondern daß alle, den Guten zum Ärgernis, den Bösen zum
Beispiel, stets öffentlich hervorzutreten trachten[147].“
Gleich im nächsten Kapitel wird von einer Nonne Mathilde,
Tochter des Markgrafen Thiederich erzählt, die einen Slaven
heiratet, gebiert dann einem andern einen Sohn, wird aber
trotzdem Äbtissin in Magdeburg!
„In unseren Tagen, in denen die Freiheit zu sündigen mehr als je
ganz schrankenlos herrscht, treiben außer der Menge der verführten
Mädchen selbst noch gar manche verheiratete Frauen, denen geile Lust
den verderblichen Kitzel anreizt, Ehebruch und zwar noch zu Lebzeiten
ihres Mannes. Und damit nicht zufrieden überliefert manche noch,
indem sie ihren Buhlen heimlich dazu antreibt, ihren Ehemann der Hand
des Mörders, den sie darauf – ein böses Beispiel für die übrigen –
öffentlich zu sich nimmt und mit ihm, wie schändlich! nach vollem
Belieben buhlt. Ihr rechtmäßiger Ehegemahl wird[S. 135] verschmäht und
zurückgestoßen und sein Vasall ihm vorgezogen. Weil dergleichen nicht
mit schweren Strafen verfolgt wird, so wird es, befürchte ich, von Tag
zu Tag von vielen als eine neue Mode mehr gepflegt werden[148].“
So sah es also ums Jahr 1000 bei unsern keuschen Ahnfrauen aus!
*
Die in der 2. Hälfte des 10. Jahrhunderts dichtende fromme Nonne
Roswitha von Gandersheim hatte die Absicht, die unsittlichen
heidnischen Schriften zu verdrängen. Das hindert sie aber nicht, uns in
Bordelle zu führen, den Versuch eines Liebhabers, seine tote Geliebte
zu mißbrauchen, anzudeuten und in Marterszenen zu schwelgen.
*
Im Fragment „de rebus Alsaticis“ heißt es: „Um das Jahr 1200 hatten
auch die Priester ziemlich allgemein Beischläferinnen, weil
gewöhnlich die Bauern sie selbst dazu antrieben. Dieselben sagten
nämlich: Enthaltsam wird der Priester nicht sein können; es ist darum
besser, daß er ein Weib für sich hat, als daß er mit den Weibern aller
sich zu schaffen macht.“ Ob die Bauern unrecht hatten?
Daß das Konkubinat nichts Anstößiges war, geht aus den Worten des
Caesarius von Heisterbach hervor, der von einem Mönch erzählt, der
Pfarrer wurde:[S. 136] „Er nahm, wie das bei vielen Sitte ist, eine
Beischläferin ins Haus, mit der er auch Kinder hatte.“ Schon
um 1200 hielt man im Bistum Salzburg denjenigen Geistlichen für einen
Heiligen, der sich mit einer Konkubine behalf[149]!
Der Bischof Heinrich von Basel (1213–1238) „hinterließ bei seinem Tode
zwanzig vaterlose Kinder ihren Müttern“.
Bischof Heinrich von Lüttich, der vom Konzil von Lüttich abgesetzt
wurde und am 6. September 1281 seinen Nachfolger ermordete, hatte 61
Kinder.
Schon die Synode von Mainz hatte unter dem Vorsitz des Rhabanus Maurus
im Jahre 852 zur Steuerung des sittlichen Verfalls bestimmt, daß jeder
Mann vor der Ehe eine Konkubine haben dürfe[150].
Noch nach der Gegenreformation mit ihrer zweifellos die Sitten hebenden
Wirkung war das nichts ungewöhnliches, wie u. a. aus Johann von Wedels
ganz beiläufigen Bemerkung hervorgeht: „In den Ehestand hat er sich
nicht begeben, weil er den bischöflichen Stand geführet und im
Konkubinat unehlich sein Leben führen müssen“[151].
*
Vom Kloster Wolverhampton schreibt Petrus Blesensis: „Sie lebten
öffentlich und offenkundig in Unzucht und rühmten sich ihrer Sünde
wie Sodom, und im Angesichte der öffentlichen Schande nahmen sie
einer des andern Tochter oder Nichte zur Frau.[S. 137] Und so groß war die
verwandtschaftliche Verschwägerung unter ihnen, daß keiner imstande
war, ihre abscheulichen Verbindungen zu lösen.“
„Canonici und Ritter machten sich mit den edel geborenen Nonnen zu
schaffen.“ Das war schon im 11. Jahrhundert nichts Seltenes. In einem
Brief beschuldigt sogar die Geistlichkeit der Domkirche zu Bamberg
eine Äbtissin, sie habe ihre Nonnen so Mangel leiden lassen,
daß sie durch Liebesverhältnisse sich ihren Unterhalt verschaffen
mußten[152]!
*
In den Dekretalien des Bischofs Burchard von Worms (1000–1025) finden
wir u. a. (ed. Paris 1549 p. 277) folgende Stelle:
„Hast du dir, wie es manche Frauen zu tun pflegen, so eine Vorrichtung
oder einen Apparat in Form des männlichen Gliedes angefertigt nach
Maßgabe deiner Wünsche, und ihn an der Stelle deiner Schamteile oder
abwechselnd (alternis) mit einigen Bändern hingebunden und mit anderen
Weibern Unzucht getrieben oder taten es andere mit dem gleichen
Instrument oder mit einem andern mit dir? Wenn du es getan hast, sollst
du fünf Jahre lang an den gesetzlichen Feiertagen Buße tun.
Hast du, wie es manche Frauen zu tun pflegen, mit der vorgenannten
Vorrichtung oder irgendeinem anderen Apparat selbst mit dir allein
Unzucht getrieben? Tatest du es, dann sollst du ein Jahr lang an den
gesetzlichen Feiertagen Buße tun.
[S. 138]
Tatest du, was manche Frauen zu tun pflegen, wenn sie die sie quälende
Geilheit löschen wollen, die sich vereinen und gleichsam den Beischlaf
ausüben müssen und es können, indem sie miteinander ihre Genitalien
vereinen und indem sie sich so an einander reiben ihr Jucken zu stillen
trachten? Tatest du es, dann sollst du drei vierzigtägige Fasten lang
während der gesetzlichen Feiertage Buße tun.“
Das spricht nicht für die Sittenreinheit unserer vielgepriesenen Ahnen.
*
Tribadinnen wurden schon im 13. Jahrhundert erwähnt, besonders in den
Nonnenklöstern. Bereits im 11. Jahrhundert spielten die Lustknaben
in England geradezu eine Rolle, und besonders in Klöstern wurde der
widernatürlichen Unzucht gefrönt. Dieses uns aus den Vorgängen der
Jahre 1907 und 1908 ja genügend bekannte Laster war zur Ritterzeit
so verbreitet, daß ein Mann, der nicht sofort bereit war, weiblichem
Entgegenkommen Folge zu leisten, Gefahr lief, sich in den Verdacht der
„Ketzerei“ zu setzen. Daran änderte auch die Todesstrafe durch Feuer
nichts, die z. B. König Rudolf 1277 über einen Ritter Haspinperch nach
den Baseler Annalen verhängte.
Einen Gedanken, der anläßlich des Harden-Moltkeprozesses oft genug
ausgesprochen wurde, äußert bereits Jacques de Vitry († etwa 1240)
gelegentlich seiner Schilderung des Treibens in Paris: „Eine
einfache Unzucht hielten sie für keine Sünde; öffentliche Dirnen
schleppten überall auf den Gassen und Straßen[S. 139] die vorübergehenden
Geistlichen in ihre Bordelle. Und wenn diese etwa
einzutreten sich weigerten, so riefen sie gleich den Schimpfnamen
‚Sodomit‘ hinter ihnen her. Denn dies ekelhafte und abscheuliche Laster
hatte wie ein unheilbarer Aussatz oder ein verderbliches Gift in dem
Grade die Stadt ergriffen, daß es für anständig galt, sich eine oder
mehrere Mätressen zu halten. Ja, in ein und demselben Hause waren
oben die Schulzimmer, unten die Behausungen der Dirnen; im
oberen Geschoß lasen die Magister, im unteren trieben die Dirnen ihr
schmähliches Gewerbe“[153].
*
Wer zur Ritterzeit ein Weib mit Gewalt sich zu Willen machte, wurde
mit dem Tode bestraft, in England gar geblendet und entmannt. König
Adolf von Nassau wurde unter anderem abgesetzt, weil er sich
derartige Gewalttaten, die recht häufig waren, hatte zuschulden kommen
lassen. In diesem Punkte waren eben die Untertanen immer kitzlich, und
Machiavelli, sonst gewiß nicht schüchtern, ermahnt deshalb im Principe
ausdrücklich den Landesherren, sich etwas zu menagieren.
Mag die Höhe der Strafe bei Gewalttaten auch befremden, die Tatsache
der schweren Sühne ist gewiß kein Kuriosum, wohl aber sind es die
Ausnahmen; im Kriege gefangene Weiber, ja, reisende
Damen, deren Ritter man im ehrlichen Kampfe besiegt hatte, durfte
man mit Gewalt sich gefügig machen, wenn es auch nicht für sehr
chevaleresque galt[154].
[S. 140]
Die Geliebte des Ritters (Amie) ist geradezu gesetzlich anerkannt;
sie genoß alle möglichen Ehren, begleitete ihren Freund auf Turniere
und wurde von anderen Frauen keineswegs geringschätzig behandelt. Ihr
gegenüber durfte der Liebhaber nicht Gewalt anwenden[155].
*
Während das ganze Mittelalter hindurch ein außerehelicher Verkehr
für ganz und gar nicht unsittlich galt, ging zur Ritterzeit das
Edelfräulein, das vor der Ehe Kinder hat oder sich gegen die
Keuschheitstugend vergeht, jedes Anspruchs auf ihr Erbteil verlustig.
Wenigstens nach den Establissements de Saint Louis, livre I, chap. XII,
wo es heißt: „Gentisfame, quand elle a eu enfans, ains que’elle soit
mariagée, ou quand elle se faitdepuceler, elle perd son heritage par
droit, quand elle en est prouvée“[156].
Was die Folgen betrifft, so scheint man allerdings bereits im 11.
Jahrhundert dagegen Vorkehrungen getroffen zu haben. Wenigstens wird
von der Gräfin Clementia von Flandern berichtet, sie habe, als sie
binnen drei Jahren ihrem Manne drei Söhne geboren hatte, aus Furcht,
sie würden um das Land in Streit geraten, „durch Frauenkünste“ bewirkt,
daß sie nicht mehr Mutter wurde. Natürlich wurde sie dafür von Gott
dadurch bestraft, daß ihr alle Söhne lange vor ihrem Tode entrissen
wurden[157].
*
Zu dem 1394 in Frankfurt gehaltenen Reichstage waren den Fürsten und
Herren mehr als achthundert[S. 141] Freudenmädchen nachgefolgt. Als in den
Jahren 1414 bis 1418 in Konstanz die große Kirchenversammlung
tagte, waren dort etwa 1500 Dirnen anwesend. Sie kamen auch
auf ihre Kosten, wenigstens wird von einer berichtet, sie habe sich
achthundert Goldgulden erworben[158].
Auf dem Reichstage von 1521 in Worms ging es „ganz auf Römisch
(das läßt tief blicken!) zu mit Morden und Stehlen, und schöne Frauen
(d. h. feile Dirnen) saßen alle Gassen voll, es war ein solch Wesen wie
in Frau Venus Berg.“
*
Als König Sigismund im Jahre 1414 mit achthundert Pferden nach Bern
kam, um daselbst einige Tage zu verweilen, hatte der Stadtrat eine
zarte Aufmerksamkeit ausgedacht: Er befahl nämlich den Insassinnen der
Frauenhäuser, alle Herren vom Hofe freundlich und unentgeltlich
zu empfangen, und er selbst bezahlte nachher die Dämchen statt des
Königs und seines Gefolges. Sigismund aber rühmte laut diese
Zuvorkommenheit des Magistrates! Zwanzig Jahre später besuchte
Sigismund als Kaiser mit seinem Gefolge das Frauenhaus in Ulm, und der
Magistrat bezahlte die Kosten der Festbeleuchtung. Im Jahre 1435
ließ der Wiener Stadtrat gelegentlich Sigismunds Besuch die Dirnen der
beiden Frauenhäuser mit Samtkleidern versehen.
*
[S. 142]
Als 1450 eine von Friedrich III. nach Neapel geschickte österreichische
Gesandtschaft dort erschien, wurde sie in ähnlicher Weise geehrt: „In
allen Städten und Kastellen waren die Türen der Häuser offen, Streu
und Heu zugerichtet; was jeder haben wollte, das gab man ihm; die
Frauen im Frauenhause waren alle bestellt, durften keinen Pfennig
annehmen, weil alles nur auf einen Rabisch geschnitten wurde (d. h.
auf dasselbe Kerbholz); da fand man Mohrinnen und sonst schöne Frauen,
so daß es eine Lust war.“
Nicht Ehrenjungfrauen, sondern das Gegenteil empfingen mit
Blumen im Mittelalter am Stadttor den einziehenden Monarchen. Es war
für anständige Frauen zu bedenklich, mit dem Herrscher und seinem
Gefolge in Berührung zu kommen. Da Ferdinand I. ein sittenstrenger Mann
war, war bei seinem Einzug in Wien 1522 diese Vorsicht nicht nötig, und
die Dirnen blieben zu Hause.
Als Kaiser Maximilian 1512 in Regensburg einzog, kam eine ganze Anzahl
ausgewiesener liederlicher Frauenzimmer, sich am Saum seines Kleides
und am Schweif des Rosses haltend und vom alten Schutzrecht des Königs
Gebrauch machend, wieder in die Stadt.
Als 1557 in Frankfurt ein Fürstentag abgehalten wurde, zog der Rat
in Erwägung, ob nicht „zu Verhütung allerlei Unrats“ das Frauenhaus
geschlossen bleiben solle! Hierzu ist zu berücksichtigen, daß mit der
Reformation und Gegenreformation, vor allem[S. 143] aber seit dem Auftreten
der Syphilis im Beginn des 16. Jahrhunderts die Sittlichkeit sich
unbedingt gehoben hatte.
In Ulm gingen um 1527 selbst verheiratete Frauen mitunter ins
Frauenhaus.
*
Ein Abgeordneter, den im Jahre 1446 der Rat von Frankfurt nach
Köln schickte, führte in seiner Kostenberechnung auch die
Ausgabe für den Besuch des Frauenhauses auf[159].
Der Beamte, der in Straßburg die von einem Frauenhause zu zahlenden
Gelder zu erheben hatte, schrieb in sein Rechenbuch auch die Worte
ein: „Hab a gebickt, thut 30 Pfennig“. Bicken ist der im Elsaß
gebräuchliche Ausdruck für die Tätigkeit, um derentwillen man das
Frauenhaus aufsuchte[160].
*
Das non olet war den Frauenhäusern gegenüber stark ausgeprägt.
Bischöfe bezogen Einkünfte aus ihnen, und der Papst soll
gar im 16. Jahrhundert mitunter 20000 Dukaten eingenommen haben! In
Frankfurt zahlte der Rat bis 1561 aus dem Ertrag der Frauenhäuser an
der Mainzer Pforte einen Grundzins an das Leonhardstift.
Sogar als Lehen wurden Frauenhäuser vergeben, von
Fürsten, Bischöfen, ja selbst vom Reich![S. 144] Der Bischof von Würzburg
belehnte am Ende des Mittelalters die Grafen von Henneberg als
Marschälle des Bistums mit dem Würzburger Frauenhause. In Ober-Ehenheim
wurde noch 1577 Michael Kuhle vom Kaiser mit dem Frauenhause belehnt,
und die Grafen von Pappenheim bezogen bis 1614 ein Schutzgeld von
den fremden Krämern, Fechtern, Spielleuten und den „unzüchtigen
Weibern“.[161]
Der Domdechant von Würzburg besaß noch 1544 das Recht, daß
das Dorf Martinsheim ihm auf Verlangen eine „schöne Frau“ liefern
mußte[162]!
*
Als der Rat von Schaffhausen den benachbarten Edelleuten im Jahre 1527
ein Fastnachtsfest gab, wurden auch feile Dirnen zugezogen[163].
*
Wie sehr die Geistlichkeit neben dem Seelenheil auf körperliche
Wohlfahrt von jeher bedacht war, folgt aus der niedlichen Tatsache, daß
bereits im Jahre 1347 in Avignon, bekanntlich der damaligen päpstlichen
Residenzstadt, eine wöchentliche Untersuchung der Dirnen durch
einen Wundarzt vorgeschrieben war. Erst ein ganzes Jahrhundert später
läßt sich eine ähnliche Maßnahme in Ulm nachweisen[164].
*
Eine sehr humane Bestimmung findet sich überall: Daß unter keinen
Umständen, auch nicht wegen Schulden, die Dirne am Austritt aus dem
Bordell[S. 145] und an der Aufgabe des bisherigen Lebenswandels verhindert
werden durfte. Auch der Kirchenbesuch mußte ihnen jederzeit gestattet
werden[165].
Entgegen den sonst herrschenden Gesetzen, die den Dirnen das Tragen
von kostbaren Kleidern und Schmuck verboten, erließ der Züricher
Bürgermeister Waldmann 1485 die entgegengesetzte Bestimmung: nur
sie durften uneingeschränkt Putz tragen. Damit hoffte er auf den
Kleiderluxus der ehrbaren Frauen einzuwirken[166]. Übrigens gab es in
Venedig ein ähnliches Gesetz.
Die Kirche erklärte es als ein Verdienst, Dirnen zu
heiraten[167]!
*
Als der junge Heinrich von England 1431 in Paris einzog, machte der Zug
in der St. Denysstraße vor einem Brunnen halt, in dessen Bassin drei
nackte junge Mädchen umherschwammen. Aus der Mitte dieses Brunnens
wuchs ein Lilienstengel empor, dessen Knospen und Blumen Ströme von
Milch und Wein entsandten. Den bigotten Ludwig XI. empfing man 30 Jahre
später mit dem gleichen Schauspiel in den Mauern seiner Residenz. In
Lille wurde Karl dem Kühnen von Burgund die Ehre zuteil, vor einer
ungeheuren Zuschauermenge das Urteil des Paris an drei lediglich
mit dem Mantel der christlichen Nächstenliebe bekleideten Grazien
wiederholen zu dürfen[168].
[S. 146]
Als sich Kaiser Friedrich III. 1471 in Nürnberg aufhielt, schlugen
eines Tages, als er vom Kornhaus kam, „zwo hurn“ eine lange silberne
Kette um ihn, aus der er sich mit einem Gulden lösen mußte. Ehe er
seine Herberge erreichte, wiederholte sich dies Spiel nochmals[169].
Im Jahre 1492 sprach eine getaufte Jüdin in Basel öffentlich aus, es
gäbe keine fromme Jungfrau und Ehefrau in der Stadt, und wenn man
eine solche finden wolle, so müsse man sie in der Wiege suchen. Sie
ließ sich lieber ewig aus der Stadt verbannen, als diese Anklage
zurückzunehmen[170].
In Regensburg beklagte sich 1512 die Besitzerin des Frauenhauses
schriftlich beim Rat über den Eintrag, den sie in ihrem Gewerbe
erleide. Zur Fastenzeit würden in Klöstern und bei
Weltgeistlichen Dirnen beherbergt, um die gesetzliche Abgabe von
ihrem Gewerbe zu ersparen. Sie hatte die Dreistigkeit mit den Worten zu
schließen: „Ich will geschweigen der Frauen, die fromm Ehemann haben
und leider auch viel Abenteuer treiben.“
Selbst 12jährige Knaben besuchten am Ende des Mittelalters, d. h. zur
Reformationszeit – wirklich beendet wurde das Mittelalter erst durch
die französische Revolution – das Frauenhaus, und zwar anscheinend
gar nicht selten. In Ulm beschloß der Rat 1527, Knaben von 12–14
Jahren in die Frauenhäuser nicht mehr einzulassen, sondern mit Ruten
hinauszujagen.
*
[S. 147]
Die Sittenlosigkeit des mittelalterlichen Klerus spottet jeder
Beschreibung. In Nördlingen wagte im Jahre 1472 z. B. der
Magistrat nicht in seiner Frauenhausordnung die Zulassung von
Geistlichen zu verbieten, sondern beschränkte sich darauf, zu
untersagen, daß sie eine ganze Nacht darin blieben!
Als man 1526 in Nürnberg das Klarissinnenkloster aufhob, lief
ein Teil der Laienschwestern unmittelbar in die Frauenhäuser!
Die Klarissinnenklöster waren eigentlich zur Minderung der Unzucht
und zur Rettung gefallener Mädchen gestiftet worden! Verordnungen
der Städte, die die Insassen und Insassinnen der Klöster zur Zucht
ermahnten, waren an der Tagesordnung.
Im 16. Jahrhundert hatte nach Sleidanus und Fra Paolo in der
Schweiz jeder Priester seine Konkubine, und zwar soll ein
eidgenössisches Gesetz allen Priestern zur Sicherstellung
der ehrbaren Frauen vorgeschrieben haben, eine solche zu
halten.
Im Jahre 1433 motivierte der Züricher Rat eine sittenpolizeiliche
Maßnahme damit, daß Frauen und Männer, Pfaffen und Laien nachts
vermummt auf den Straßen erschienen, „unter ihnen auch die Frau
Äbtissin zum Frauenmünster und ihre Jungfrau Ursula“.
Daß Beginen die Konkubinen von Priestern waren, geschah so häufig,
daß in einer Verordnung des Mainzer Erzbischofs Gerhard II. der Name[S. 148]
Begine für gleichbedeutend mit Pfaffenmagd gebraucht wird.
Für die sittliche Schätzung der Geistlichkeit spricht ein Eintrag im
Bürgermeisterbuch Frankfurts von 1463, in dem „Pfaffen, pfaffenmede,
horen, bubenknechte, bekynen“ zusammen genannt werden!!
Die Moralität des Züricher Klerus war derart, daß der Rat im Jahre 1487
gebot, Verführer von Mädchen dürften nicht mehr vor das geistliche
Gericht geladen werden, sondern er selbst werde sie richten.
*
Der Freiherr von Zimmern erzählt in seiner Chronik (III, S. 69) vom
Leben im Nonnenkloster Oberndorf im Tal folgendes: „Was für guet leben,
sover anders das ür guet leben zu achten, in disem closter gewesen,
ist sonderlich bei dem abzunemen, das vil adels ab dem Schwarzwaldt
und am Necker in disem closter den ufritt gehapt, und het damals mit
gueten ehren und der warhait vilmehr des adels hurhaus dann des
adels spittal mögen genempt werden. vor andern haben die von Ow,
Rosenfeldt, Brandegk, Stain, Newneck vil gelts darin verthon, und hat
dise hohe schuel bös ehemenner und unnutze kindsvätter geben. beschaint
sich an dem, es sein uf am zeit vil vom adel und guet gesellen im
closter gewesen, die haben ain abentdanz zimlich spat gehalten.
hat sich mit fleis ohngefferdt begeben, das in allem danz die
liechter sein verlescht worden. do ist ain wunderbarliches Blaterspill
entstanden und sich menigclich anfahen zu paren. under anderm[S. 149] ist
versehen worden, daß die thurn (Türen) verhept und kain prinendt liecht
in sal kommen, noch gelassen. und gleichwol alldo niemands verschonet
worden, so hat sich doch niemands ob dem andern beclagt, allain ain
edelman under dem haufen, dem ist in seim sinn ein widerwertiger casus
begegnet, dann er in ainer ungeduld, wie er vermaint die zeit sei im
zu kurz und man werd villeucht bald ain liecht einhertragen, überlaut
geschreien: ‚lieben freundt, eilendt nit, lassendts noch einmal
umbher geen! ich hab mein schwester erwuschet‘. Nit mag ich wissen,
was er hernach für ain gestin überkommen. es ist kain eilen bei inen
gewesen, sondern haben inen gleichwol der weil gelassen.“ Damals ging
dort alles hin, was man kaum für Unrecht hielt, und die Güter des
Klosters mehrten sich infolgedessen.
Zimmern sagt ausdrücklich, daß Nonnenklöster sehr häufig die
Rolle von Bordellen spielten, und zwar gilt dies noch vom 16.
Jahrhundert. Natürlich kam das – außer bei den Eingeweihten –
nur durch Zufall auf. So als in Straßburg nachts ein Blitz ins
Frauenkloster einschlägt und die Bürger es gewaltsam öffnen, um das
Feuer zu löschen. Da kam das nächtliche Treiben, das wohl fast überall
herrschte, ans Licht. Zimmern schreibt darüber (III, S. 70):
„Also hat man ain mansperson, gleichwol der jaren noch jung, auf
einer closterfrawen im bet nackend gefunden, die das wetter und
der dunst baide erstecket. wie nun gleich hernach strenge inquisition
gehalten, hat sich wahrhaftigclichen erfunden, das etlich mehr
manspersonen im closter sich enthalten, die doch bei[S. 150] zeiten darvon
kammen. diese sein in der jugendt kindsweis in der umbtreibenden
scheuben (gemeint ist die Drehscheibe, die zur Verhütung des
Kindsmordes und um die abliefernden Eltern nicht erkennen zu können,
an den Nonnenklöstern zur Deponierung der Findelkinder angebracht
waren) ins closter gezogen worden, darin sie biß in ire manbare jar
behalten und nach der haut sein gebraucht worden. ohne zweifel haben
sie ir köstle wol verdienen und an den alten, garstigen, stinkenden
böcken ir junges leben, den leib und alle chreften verschinden muessen;
dann under anderm herfurkomen, das die eltesten under inen in disem
tahl die prerogativ oder preminenz gehapt, die jungern aber, die der
arbait villeucht baß werd gewesen, haben die weil fasten muesen und
sich ander closterarbait behelfen.“ Bei solchen Klöstern befanden
sich Weiher, die nicht abgelassen werden durften, damit man die dort
versenkten Kinderleichen nicht fand.
Aus dem Kloster Heistal bei Bregenz besuchte einst eine Nonne die
Gräfin von Kirchberg. Nicht ohne Schalkhaftigkeit erzählt Zimmern von
ihr (Chronik I, S. 330): „Dise guet closterfraw het wol kunden mit
gueten ehren Eptissin oder mutter im closter sein, und wer an
ir der nam nit verloren gewesen. aber der sachen beschehen vil bei
nechtlicher weil, darzu man nit gesicht, vil weniger soll hernach vil
darvon gesagt werden.“
Mag es auch Ausnahmen gegeben haben, die hier geschilderten Zustände
werden von dem Katho[S. 151]liken Zimmern als Zeitgenossen ausdrücklich als
die Regel bezeichnet und über die Lässigkeit der Obrigkeit, die
gerne die Augen zudrückt, Klage geführt.
Der Adel suchte die Klöster zu Abenteuern auf und kam auch auf seine
Rechnung, denn nicht genug damit, sich selbst zu prostituieren,
verkuppelten die Nonnen auch vielfach andere Frauen, die dorthin zu
Besuch kamen. (Zimmern III. S. 70ff.)
*
Geiler von Keisersberg, Prediger am Straßburger Münster, sagt in seinem
1517 erschienenen „Brösamlin“ (fol. 10a) über die Nonnenklöster: „Ich
weiß nicht, welches schier das best wer, ein tochter in ein semlich
closter thuon oder in ein frawenhauß. Wann warumb? ym closter ist
sie ein huor, so ist sie dennocht ein gnadfrauw dartzuo; aber wer sie
in dem frawenhuß, so schlüg man sie umb don grind und müst übel essen
unnd trincken; man würff sie ein steg auff die ander ab; denn so sie
gedechte, wer sie wer, unnd schlüg in sich selber, das sie in dem
closter nit thuon. Gebst du deiner tochter ein man, du hertest, du
fragtest, was ein man er were, was er hette, etc. Also wilt du dein
tochter in ein closter thuon, so frag auch, was man für ein wesen füre.
Du sihest wol, wa die thuren mit einem hanfstengel beschlossen seind,
und wa da ist ein uß und yngon als in einer batstuben.“
Wenn auch die Sittenprediger zu allen Zeiten über die unvergleichliche
Verworfenheit ihrer Zeitgenossen gezetert haben[171], so sind doch des
Franzis[S. 152]kaners Thomas Murner Ansichten, die er in der Narrenbeschwörung
XXXIX, 49 ausspricht, recht charakteristisch, weil sie zeigen, wie aus
dem Schoße der Kirche selbst über das Treiben in den Nonnenklöstern
geurteilt wurde.
„Der sin kind nit vermähelen kan Und hat kein gelt ir nit zu geben, so
muoß sie klösterlichen leben. (57) Wann sie dann zuo den jaren gat Und
sich empfindt in irem stat Und sie der narr facht an zuo jucken, So
laßt sie sich herumher bucken (deponere) Und fluocht dem vater underm
grund, Das er sie nit versehen kunt, Und hette vil lieber ein armen
man, Dann das sie wolt zuo metten gan. (67) Spricht man dann: Das ist
nit recht; Du schendest do mit din frums geschlecht“, So antwurt sie
gar bald und geschwind: „Ich wolt, das ich vierhundert kind Uf erden
brecht, nun in zuo leid. Was stießens mich in dieses kleid! (86) Sie
ist doch jung, recht oder alt, Wer die meisten kinder macht, Die würt
aptissin hie geacht. (97) Die frowenkloster sind jetzt all Gemeiner
edellüt spital.“
*
Bezeichnend ist, daß die Inwohnerinnen des Frauenhauses sich
über die Konkurrenz der Klosterfrauen beklagten! Hans Rosenplüt
sagt darüber in der „XV. clagen“: „Die gemeynen weib clagen auch ir
orden, Ir weyde sey vil zu mager worden. Die winkel weyber und die
haußmeyde, die fretzen teglich ab ir weide... Auch clagen sie[S. 153] über die
closterfrawen, Die können so hübschlich über die snur hauen, Wenn sie
zu ader lassen oder paden, So haben sie junkhar Conraden geladen[172].“
Auch nach der Gegenreformation war in den Klöstern keine übermäßige
Askese zu hause. Im St. Marienkloster zu Köln war es wenigstens
noch 1576 recht fidel. Schweinichen erzählt davon in seinen
„Denkwürdigkeiten“ (S. 108): „Darin hat es lauter Gräfin, Herren-
und Adelstandes, und wenn sie aus der Kirchen kamen, legeten
sie den Habit ab und trugen sich weltlichen, mochten auch daraus
heiraten... waren also lustig und guter Dinge mit den Nonnen,
tanzten und trunken sehr... wurden danach so bekannt im Kloster, daß
die eine Nonne, ein schön Mensch vom Adel, des Geschlechtes eine
Reckin, ein klein Kindlein davon bracht, weil wir noch zu Köln
und im Lande herum waren.“
*
König Ludwig XV. von Frankreich besaß einen eigenen Beamten für
das Arrangement seiner Orgien in der Person des „Intendant des
Menus-Plaisirs“ La Ferté[173]!
Der berühmte Hirschgarten, jenes riesige Bordell, das die Marquise von
Pompadour König Ludwig XV. einrichtete, und zwecks dessen Füllung im
ganzen Lande Unterhändler tätig waren, um neue Schönheiten anzuwerben,
hat wohl die riesigsten Summen verschlungen, die je ähnlichen
Vergnügungen geopfert[S. 154] wurden. Man hat ausgerechnet, daß jede
einzelne dieser Dämchen den öffentlichen Schatz eine Million
Livres gekostet habe. In Summa dürfte der Hirschpark während der
Zeit seines Bestehens eine Milliarde Livres verschlungen haben,
die selbstverständlich nicht der König aus seiner Privatschatulle,
sondern das Volk zahlte. Bezeichnend ist die Erzählung Casanovas,
daß den Hirschpark, in dem die tollsten Orgien gefeiert wurden, die
sich vorstellen lassen, niemand besuchen durfte außer die bei Hofe
vorgestellten Damen[174]!
*
Nach Polizeiberichten ist festgestellt, daß im Oktober 1793 alltäglich
der Pariser Revolutionsgarten und namentlich die Galerien bei dem
Theater Montansier mit ganz jungen Burschen und Mädchen im Alter von
7–14 und 15 Jahren angefüllt waren, die sich fast öffentlich den
Ausschweifungen der infamsten Unzucht hingaben. Dabei waren sie „fast
nackt wie die Hand und boten den Vorübergehenden das entwürdigendste
Schauspiel.“
In derselben Zeit traten die berüchtigten pornologischen Klubs an
die Öffentlichkeit und veranstalteten im Opernhaus nackte Bälle,
bei denen nur das Gesicht maskiert war. Die Zahl der täglichen
Dirnenbälle stieg damals auf mehrere Hundert, auf denen die „Naktheiten
der Griechen und Römer“ zur Schau getragen wurden, wo in 23 Theatern
der Unzucht gefrönt wurde.
*
[S. 155]
Paris hatte 1770 etwa 600000 Einwohner. Von diesen waren 20000 Dirnen.
Während der Revolution stieg die Zahl der letzteren auf 30000.
*
Wenn auch die Damen vom Ballett im allgemeinen nicht gegen den Vorwurf
der Askese in Schutz genommen werden müssen, so ist doch folgende
von Casanova erzählte Geschichte kennzeichnend für den Tiefstand der
Moral im damaligen Paris. Casanova sah eines Tages beim Ballettmeister
der Oper 5–6 junge Mädchen von 13–14 Jahren, sämtlich von ihren
Müttern begleitet und von bescheidenem, feinem Wesen. Er sagte ihnen
Schmeicheleien, die sie mit niedergeschlagenen Augen anhörten. Eine
von ihnen beklagte sich über Kopfschmerzen. Während Casanova ihr sein
Riechfläschchen bot, sagte eine ihrer Gefährtinnen: „Ohne Zweifel
hast du schlecht geschlafen.“ „Nein, das ist es nicht,“ erwiderte die
unschuldige Agnes, „ich glaube, ich bin in anderen Umständen.“
Casanova war erstaunt, da er das junge Mädchen natürlich für eine
Jungfrau gehalten hatte, und sagte: „Ich glaubte nicht, daß Madame
verheiratet wären.“ Sie sah ihn einen Augenblick überrascht an.
Dann wandte sie sich gegen ihre Gefährtin und beide lachten um die
Wette[175].
*
Die damalige französische Dame betrachtete die respektvolle
Zurückhaltung ihr gegenüber als eine ihren Reizen zugefügte
Beleidigung[176]!
*
[S. 156]
Der Klerus unterschied sich moralisch durchaus nicht von der übrigen
Bevölkerung. Die bei der Erstürmung der Bastille 1789 gefundenen Akten
über die Sittlichkeitsvergehen der Priester füllen zwei Bände! Ludwig
XV. wurde jeden Morgen über die Auffindung von Priestern in
Pariser Bordellen berichtet[177]!
*
Dafür verdanken wir heute den Klerikalen den famosen Entwurf, der unter
dem Namen „Lex Heinze“ fortleben wird, und in den Nonnenklöstern müssen
die jungen Mädchen im Hemd ins Bad gehen. So tugendhaft sind wir
jetzt!
[S. 157]
Achter Abschnitt
Schicklichkeit und anderes
Brantôme erzählt von einem französischen Prinzen, der häufig die
Damen des Hofes zu Festlichkeiten einlud. Dabei wurde ihnen der
Wein in einem sehr schönen Becher von vergoldetem Silber gereicht,
der über und über mit lasziven und erotischen Darstellungen bedeckt
war. Die Damen hatten nun die Wahl, Durst zu leiden oder den Becher zu
benutzen. Die Mehrzahl, auch junge Mädchen, amüsierten sich köstlich
und führten an die Darstellungen anknüpfend die pikantesten Gespräche.
Brantôme, der selbst als Augenzeuge wiederholt zugegen war und aus dem
Becher trank, erzählt: „Bref, cent mille brocards et sornettes sur
ce sujet s’entredonnoient les gentilshommes et dames ainsi à table,
comme j’ay veu, que c’estoit une très-plaisante gausserie, et chose à
voir et ouir; mais surtout, à mon gré, le plus et le meilleur estoit à
contempler ces filles innocentes, ou qui feignoyent l’estre, et autres
dames nouvellement venues, à tenir leur mine froide, riante du bout
du nez et des lèvres, ou à se contraindre et faire des hypocrites,
comme plusieurs dames en faisoyent le mesme. Et notez que, quand elles
eussent deu mourir de soif, les sommelliers n’eussent osé leur donner
à boire en[S. 158] une autre coupe ny verre. Et, qui plus est, juroyent
aucunes, pour faire bon minois, qu’elles ne tourneroyent jamais à ces
festins; mais elles ne lassoient pour cela à y tourner souvent,
car ce prince estoit très-splendide et friand. D’autres disoyent,
quand on les convioit: „J’irai, mais en protestation qu’on ne nous
baillera point à boire dans la coupe;“ et quand elles y estoient,
elles y beuvoient plus que jamais. Enfin elles s’y avezarent si bien
qu’elles ne firent plus de scrupule d’y boire; et si firent bien mieux
aucunes, quelles se servirent de telles visions en temps et lieu; et,
qui plus est, aucunes s’en desbauchèrent pour en faire l’essay; car
toute personne d’esprit veut essayer tout. Voilà les effets
de cette belle coupe si bien histoirée. A quoy se faut imaginer les
autres discourts, les songes, les mines et les paroles que celles dames
disoyent et faisoyent entre elles, à part ou en compagnie[178].“
In der französischen Hofgesellschaft des 16. Jahrhunderts waren solche
kleinen Scherze an der Tagesordnung. Brantôme erzählt in unmittelbarem
Anschluß an diese Geschichte von einem schönen Bilde im Besitze des
Grafen Chasteau-Vilain, auf dem unbekleidete Frauen in allen möglichen
Stellungen und Beschäftigungen dargestellt waren derart, daß ein
Asket in Wallung geraten wäre. Eine Anzahl Damen mit ihren Kavalieren
besichtigten die Galerie und besonders dieses Gemälde sehr eingehend,
und eine von hohem Rang wandte sich „comme enragée de cette rage
d’amour“ zu ihrem Galan und sagte: „C’est trop demeuré icy: montons
en carosse promptement,[S. 159] et allons en mon logis, car je ne puis plus
contenir cette ardeur; il la faut aller esteindre: c’est trop bruslé.“
„Et ainsi partit, et alla avec son serviteur prendre de cette bonne
eau qui est si douce sans sucre, et que son serviteur luy donna de sa
petite burette.“
*
Wie es im 16. Jahrhundert bisweilen in Deutschland bei Hofe zuging,
lehrt die saftige Geschichte, die Zimmern in seiner Chronik (I, S.
439) von der Herzoginwitwe von Rochlitz geb. Landgräfin von Hessen in
Rochlitz erzählt. „Wie die Fraw gewesen, also auch das Frawenzimmer und
ire Jungfrawen; daher sagt man als Marggraf Albrecht von Brandenburg in
der schmalkaldischen Vechte von ir geen Rochlitz geladen, alda er auch
gefangen, da haben seine Edelleut allerlei Kurzweil mit den Jungfrawen
triben, under denen eine gewesen, die hat ein Edelman für sich uf den
Schoß gesetzt und mit andern seinen Gesellen gespillt. Nit wais ich,
wie es gangen, oder was sie für ain warme ader befonden, sie ist dem
Edelman in der Schoß über sich gesprungen und gehotzet, sprechend: ‚Ei,
er kutzelt mich.‘“
*
Als Herzog Wilhelm von Gülch im Jahre 1540 die erst 12jährige Königin
von Navarra in Chatellerault heiratete, sie aber zur Vollziehung der
Ehe noch zu jung war, ließ, wie Zimmern erzählt (III, S. 343), König
Franz ihm für die Brautnacht eine andere adelige Jungfrau
zuführen. „Man sagt,[S. 160] der Herzog von Gülch hab des Kunigs Gnad mit
Willen angenommen, auch sich die Nacht erwisen, darob die Kunigin
von Navarra, sein Schwiger, und ir Dochter abnemen kunden, das er
gentil compaignon seie, und soll der Jungfrawen des Morgens
ein Tausendt Guldin geschenkt haben. Die hets noch ein Monat also
angenommen. Dieser Hurenhandel (anders kan ich in nit haißen) ward
dozumal am Hof und menigclichem in Frankreich fur ein sondere
gentilese gehalten.“
Auch hinter den Kulissen ging es nach demselben Gewährsmann fidel zu:
„Hiebei kan ich nit underlassen zu vermelden, als der Herzog und die
jung Kunigin mit der Deckin beschlagen warden und die Ceremonia mit dem
Gesegnen und andern Solenniteten lang wereten, dowarden hiezwischen
etliche große Frawen und Jungfrawen hünder den Tapissereien und
courtines nach allem vorteil gepletzt; dann des Königs Söne und etliche
Cardinal und Fursten halfen einander und sahe ie einer dem andern durch
die Finger. Do must mancher gueter Gesell, der sein Weib, Schwester
oder Döchter deren emden het, schweigen und verdrucken, war dennost
fro, das er so wol daran war.“
*
Daß man in Deutschland nicht gerade sehr zimperlich war, lehrt folgende
Geschichte, die derselbe Zimmern erzählt: „In gleichem Fahl haben
wir ein erbare und namhafte Matron zu Augspurg kent, die hat
offentlich in einem Panket zu Augspurk[S. 161] alle Schleckbißle und Wollust
der Music und anders erzelt, ordentlich und mit sonderm Ufmerken der
Zuhörer, und letstlich den Beschluß irer Rede ohne ainiche Schew deren
gegenwurtigen angehankt: ‚Aber ein spanischer... ubertref solche
Delicias alle mit ainandern.‘“ Zimmern (III, S. 385) setzt natürlich
das richtige Wort.
Mag man gegen diese Geschichte einwenden, sie sei ein einzelner Fall,
also kein charakteristisches Kulturdokument, so ist dem entgegen zu
halten – selbst wenn man den sonstigen Ton vieler Chroniken gar
nicht in Rechnung setzen wollte – daß Zimmern ausdrücklich von einer
„ehrbaren und namhaften Matron“ spricht.
*
Ein Seitenstück ist folgende Erzählung Zimmerns: „Bei wenig jaren
haben wir ain Closterfraw zu Hapstal gehapt, ist ein Erkmenin
gewesen, sie hat gehaisen..., die hat kains sollichen Instruments
(wie Königin Marie, Schwester Kaiser Karls V., von der eine
ähnliche Geschichte berichtet wird) bedorft, dann sie uf ain Zeit mit
dem Hanns Wolfen von Zulnhart und Jacob Gremlichen von Meningen umb
ain Gulden Wert Fisch verwettet, sie welle in ain klainen silbernin
Becher... (von mir ausgelassen!), das kain Dröplin neben ab
gehen soll; ist auch darauf in ir aller Beisein und Insehen
uf ain Disch gestanden und das, wie oblaut und sie sich ußgethan
verricht, auch das Gewet damit gewonnen. Die andern Nunnen haben gleich
die Fisch holen lassen und kochen, haben sich nider[S. 162]gesetzt zu Tisch
und den Zulnhart und Gremlich dermaßen getrunken, das sie baid den
selbig Tag mit Muhe ire Heuser wider erraicht.“ (III, S. 284.)
*
Was im 16. Jahrhundert an deutschen Höfen alles passierte, erhellt
unter anderem aus des schlesischen Ritters Hans von Schweinichen
„Denkwürdigkeiten“ (S. 26). Im Jahre 1568 wurde die Hochzeit der
Elena, Herzogin zur Liegnitz, mit Siegmund Kurzbach auf dem Schlosse
Liegnitz gefeiert. „Den ersten Abend, wie sich Braut und Bräutigam
zusammengeleget haben, und sich nun die Fürstlichen Personen auch zur
Ruhe geben wollen, indessen führet die Braut im hohen Zimmer, gen
Schloß Raunstein, ein groß Geschrei an: ‚O herzer Herr Siegmund!‘ und
das gar oft wiederholet. Wenn ich denn als Kammerjunge in JFG. Zimmer
aufwarte und die Herzogin das Geschrei höret, heißt sie mich Lichter
anstecken, läuft in dem engen Gang hin nunter, schlägt in der hintern
Thür an, schreiet: ‚Herr Siegmund, seid Ihr thöricht, schonet doch,
meinet Ihr, Ihr habet eine Viehmagd bei Euch?‘ Herr Siegmund kehret
sich nicht daran, bis letztlichen alles stille ward (wie wohl zu
gedenken ist, was die Ursache des Stillschweigens gewest sei); also zog
die Herzogin nach dem Stillschweigen wiederum ab. Auf dem Morgen hielt
die Herzogin den Herrn Kurzbach bald das vor und fraget, warum er nicht
aufgemacht hätte. Der Herr Kurzbach saget, er hätte es nicht gehöret,
weil er gebalzet hätte wie der Auerhahn, und[S. 163] gab ein Lachen daran
und ging davon. Es wollte sich hernach ferner kein Geschrei erheben,
sondern die Hochzeit ward in allen Freuden verbracht.“
*
Johann Wedel erzählt in seinem „Hausbuch“ (S. 511 f.) von einem
merkwürdigen Gesellschaftsspiele, das am Hof zu Stettin im Beginn des
17. Jahrhunderts gepflegt wurde und zwar nicht etwa nur im Fasching,
sondern das ganze Jahr hindurch:
„Es werden viel zettel, drinn der könig und hoffes-ampter benannt,
geschrieben, welche alle, gleich wie mans mit den glückstöpffen hält,
zusammen vermischet, blindlings herausgenommen und allen hofsgenossen,
auch wohl bürgern in der stadt und andern, die man gerne bei der
gelächter-spiele haben wil, derer nahmen aufgeschrieben, jederm
einer derselben zugeschaft. Was nun für eine dignität oder ampt auf
den zettel verzeichnet, auf des nahmen es fällt, daß muß der, dem
derselbe zukömmt, annehmen und geschieht oft, daß der geringste diener
könig und hinwiederumb der fürst feuerbüter wird, das wird dann mit
großem gelächter angefangen, müssen sich die personen nach gebühr
des ampts, so ihnen zufällt, verkleiden, werden drauf sämtlich in
einer procession und ordnung mit trompeten herumbgeführet, darnach
mit einem freuden-mahl, drinn der diener, so nun könig ist, zu tische
oben ansitzet und der fürst, der ihm dienen muß, vorm tische stehet,
essen zuträgt und aufwartet, gemittelt, endlich mit dantzen, springen,
gesöffen und guten räuschen geschlossen und dann[S. 164] nichts weiter, denn
dabei keine rittermäßige übungen vermerckt werden. Welches affenwerk
ich so groß nicht zu tadeln, weniger aber zu loben weiß, vornemlich
wenn mans in einem stetigen gebrauch halten (Alles ding hat seine zeit)
und ein beständig jahrfest daraus machen und ohn unterscheid, so wol in
zeit der trauer, wie kurtz nach hertzog Barnims christmilder gedächtniß
todesfall geschehn, als freude üben wollte.“
*
Ein Hauptvergnügen beim Tanzen der Bürgerschaft – auf Hofbällen
war man anständiger – im 15. und beginnenden 16. Jahrhundert war,
die Tänzerin hoch zu heben und zu schwenken „das man jhn hinden
und vorne hinauff siehet biß in die weich, also das man jhr die
hübsche weiße beinle siehet..“ Bei den Reigentänzen ging es
auch entsprechend zu, „da werden auch nit minder unzucht und schand
begangen, weder inn den andern, von wegen der schadtlichen und
schamparen hurenlieder, so darin gesungen werden, damit man das
weiblich geschlecht zu der geilheit und unkeuschheit anreizet“ sagt
Geiler.[179]
In Zürich mußte im späteren Mittelalter von der Behörde
verboten werden, nicht „bei nacktem Leibe“ auf dem Tanzboden zu
erscheinen.[180] Geiler sagt, „bis auf den halben Rücken ist
alles bloß und nackt und vorn bis zu den Büsten, daß sie auch die
enthaltsamsten Männer locken können“.
[S. 165]
Über die noch Ende des 16. Jahrhunderts herrschenden Gepflogenheiten
beim Tanz und zwar in guter Gesellschaft belehrt uns der
badische Rat und Obervogt zu Pforzheim Johann von Münster in seinem
1594 erschienenen „gott seligen Traktat vom ungottseligen Tanz“. Danach
kommt es gar nicht selten vor, daß der Kavalier „die Jungfrau oder
Frau, sobald sie ihm den Tanz geweigert hat, wider alle Billigkeit,
Rechtlichkeit und Recht aufs Maul zu schlagen sich unterfing!“
Wenn aber die Person bewilligt hat, den Tanz mit dem Tänzer zu halten,
treten sie beide herfür, geben einander die Hände, und umfangen und
küssen sich nach Gelegenheit des Landes. Wenn aber der Tanz zu Ende
gelaufen ist, bringt der Tänzer die Tänzerin wiederum an ihren Ort,
da er sie hergenommen hat, mit voriger Reverentz, nimmt Urlaub und
bleibet auch wol auf ihrem Schoß sitzen und redet mit ihr.
Übrigens war es in Südfrankreich, und wohl auch anderwärts, noch 1552
Sitte, daß Männer Frauen mit einem Kuß begrüßten. Auch in England wurde
noch im 16. Jahrhundert der Gast durch küssen begrüßt[181].
*
Im Jahre 1575 wollte die Herzogin von Liegnitz einem Bankett nicht
beiwohnen, weil die Hofmeisterin von Kittlitz, Freundin ihres Mannes
und ihre Feindin, anwesend war. Deshalb stellt der Herzog seine
Gemahlin zur Rede. Schweinichen, der als Kammerjunker zugegen war,
erzählt (S. 60 ff.): „JFG. redeten die Herzogin hart an, warum sie
nicht zum Tische kommen wollt, derwegen so wollten es JFG. haben,
daß sie zu Tische gehen sollte, weil JFG. viel ehrliche Leut und
Frauenzimmer eingeladen hätte. JFG. die Herzogin[S. 166] wollten zwar so gute
Worte nicht geben, sondern nach vielen Entschuldigungen fuhren JFG.
die Herzogin ’raus, sie möchte bei der Hure, der Kittlitzin, nicht
sitzen. Welches zwar den Herzog sehr verdroß, dutzet die Herzogin
und sprach: ‚Du sollst wissen, die Frau Kittlizin ist keine Hure;‘
schläget der Herzogin ein gut Maulschelle, davon die Fürstin auch
taumelt. Also fahre ich zu, und fasse JFG. in die Armen, halte
etwas auf, bis sich die Fürstin in die Kammer salvieren kann. Mein
Herr aber wollte der Herzogin nach und sie besser schlagen.“ Die
Ohrfeige, die der Herzogin ein blaues Auge eintrug, alteriert den guten
Schweinichen sonst weiter nicht, nicht mehr jedenfalls als das Dutzen.
Noch am gleichen Tage wird Frieden geschlossen, wobei die Herzogin die
von Schweinichen zu übermittelnde Bedingung stellt: „Daß
freilichen der JFG. auf die Nacht in ihrer Kammer liegen wollten
(denn mein Herr sonsten in einem Vierteljahr bei der Herzogin nicht
gelegen)“. Außerdem nimmt die Hofmeisterin am Bankett nicht teil. Daß
die Herzogin aus Rache später die Ohrfeige ihrem Bruder, dem Markgrafen
von Ansbach, klagt, gehört nicht mehr hierher und wurde von ihr selbst
später bereut.
*
Der im 16. Jahrhundert bei Hofe herrschende Ton wird gut beleuchtet
durch die Gespräche, die Schweinichen in seinen Denkwürdigkeiten
verzeichnet. Nach einer kaum wiederzugebenden Unterredung mit dem
Herzog über die Gründe, die ihn verhindern, den Wünschen der Herzogin
von Liegnitz nachzugeben, hat er mit deren Freundin und Schwägerin,
einer Fürstin, folgendes erbauliche Zwiegespräch:[S. 167] „Die Frau Kurzbachin
Wittwe saget wider mich: ‚Ihr und euer Herr könnet nichts, man soll
euch alle beide ausschneiden.‘ Darauf gab ich Antwort: ‚Gnädige Frau,
wie käme ich dazu? Ich weiß nicht, was mein Herr kann, aber das weiß
ich von mir, daß ich es wohl kann, und da EFG. nicht glauben, so
versuchen Sie’s. Wann Sie es probieren würden, wollt ich wohl
sicher des Ausschneidens sein.‘ Da fing die Frau Kurzbachin an zu
lachen: ‚Wann ihr und euer Herr so thätig seid, so hättet
ihr uns eines Theiles nächten drunten behalten, daß wir heute
Brautsuppen gessen hätten; wir mußten aber unbeschnaubert wieder ’rauf
ziehen.‘ Ich gab zur Antwort: ‚Gnädige Frau, ich habe im Tanzen nächten
das meinige gethan, ich wollte im andern auch als ein gut Mann gethan
haben, daß ich ein gut Lob davon gebracht, wann es mir so gut hätte
werden wollen.‘ Die Frau Kurzbachin aber hielt auf dem ihrigen, ich
konnte nichts. Da bot ich ihr Trotz an, es zu versuchen, gab sie mir
die Antwort, sie wollt mich tummeln, daß ich das Aufstehen vergessen
sollt; dabei blieb es, Satis.“ (S. 157.)
*
Liselotte von der Pfalz schreibt unterm 25. August 1719: „Ich kann
nicht leiden, daß man mich an den Hintern rührt, denn es macht mich so
toll, daß ich nicht mehr weiß, was ich tue; ich hätte Mr. le Dauphin
schier eine brave Maulschelle gegeben, denn er hatte die schlimme
Gewohnheit, aus Possen, wenn man sich setzte, einen die Faust mit
ausgestreckten[S. 168] Daumen unter den Hintern zu stellen. Ich bat ihn,
um Gottes willen die Possen bleiben zu lassen, das Spiel mißfiel mir zu
sehr, und machte mich so bös, daß ich nicht gut dafür sein konnte, ihm
eine brave Maulschelle zu geben, daß ehr gethan als gedacht sein würde;
da hat er mich mit Frieden gelassen.“[182]
Der Dauphin würde kaum diese Flegeleien sich angewöhnt haben, hätten
nicht andere Damen des Hofes daran Gefallen gefunden.
*
Zimperlichkeit kann man überhaupt den damaligen Damen nicht vorwerfen.
Liselotte schreibt u. a. am 21. November 1720: „Wenn Mr. Law wollte,
würden ihm die französischen Damen wohl, mit Verlaub, den Hintern
küssen; sie sehen, wie wenig scrupuleux sie seyn, ihn pissen zu sehen;
er wollte Damen keine Audienz geben, weil ihm gar Noth zu pissen
war, wie er es den Damen endlich sagte, antworteten sie: cela ne
fait rien, pissés et écoutés nous, also blieben sie so lange bei
ihm.“[183]
*
Für Zustände und Briefton gleich charakteristisch ist der Brief der
Liselotte an die Kurfürstin von Hannover vom 9. Oktober 1694: „Vous
etes bien heureuse d’aller chier quand vous voulés; chiez donc tout
votre chien de sou. Nous n’en sommes pas de même ici, oû je suis
obligée die garder mon etron pour le soir; il n’y a point de frotoir
aux maisons[S. 169] du coté de la forest. J’ai le malheur d’en habiter une, et
par consequent le chagrin d’aller chier dehors, ce qui me fache,
parceque j’aime à chier à mon aise, et je ne chie pas à mon aise, quand
mon cul ne porte sur rien. Item tout le monde nous voit chier;
il y passe des Hommes, des femmes, des filles, des garçon, des Abbés
et des Suisses; Vous voiez par là, que nul plaisir sans peine, et que
si on ne chioit point, je serois à Fontainebleau comme le poisson dans
l’eau. Il est trés chagrinant que mes plaisirs soient traversés par des
etrons... Soyez à table avec la meilleure compagnie du monde, qu’il
vous prenne envie de chier, il faut aller chier...“ und so fort[184].
Die Kurfürstin antwortet unter dem 31. Oktober in derselben Tonart:
„.. Enfin vous avez la liberté de chier partout quand l’envie vous en
prend, vous n’avez d’egard pour personne, le plaisir qu’on se procure
en chiant vous chatouille si fort que sans egard au lieu ou Vous vous
trouvez, Vous chiez dans les rues, Vous chiez dans les allées,
vous chiez dans les places publiques, vous chiez devant la porte
d’autruy sans vous mettre en peine, s’il se trouve bon ou non, et
marque que ce plaisir, est pour le chieur moins honteux que pour ceux
qui le voyent chier, c’est qu’en effet la commodité et le plaisir ne
sont que pour le chieur...“
*
Liselotte schrieb am 5. Mai 1716 über den Dauphin: „Er hatte gern,
daß man ihm auf dem Kackstuhle entretenierte, aber es ging gar
modest,[S. 170] denn man sprach mit ihm, und wandte ihm den Rücken zu;
ich habe ihn oft so entreteniert, in seiner Gemahlin Kabinett, die
lachte von Herzen darüber, schickte mich allzeit hin, ihren Herrn zu
entretenieren“[185].
*
Da Friedrich Wilhelm I. von Preußen mit schwermütigen Anwandlungen
zu kämpfen hatte, bewog ihn seine Umgebung 1728, einen Besuch bei
König August dem Starken zu machen, der wohl den glänzendsten Hof
damals in Europa hielt. Wie die Markgräfin von Bayreuth erzählt,
verabredete Grumkow mit König August, um den sehr sittenstrengen
preußischen König zu erheitern bzw. zu verführen, nach einem opulenten
Diner ein eigenartiges Attentat auf seine Tugend. Die beiden Könige
besuchten im Domino eine Redoute und gingen dort plaudernd von einem
Zimmer ins andere, bis sie in ein schönes und großes Gemach kamen,
„in welchem alles Gerät äußerst prächtig war, mein Vater bewunderte
alle diese Schönheit, als plötzlich eine Tapetenwand niedersank und
das befremdenste Schauspiel sich darstellte. Ein Mädchen,
schön wie Venus und die Grazien, lag nachlässig auf einem Ruhebette,
in dem Zustand unsrer ersten Eltern vor dem Sündenfall zeigte
sie einen Körper, wie Elfenbein so weiß und schöner, als der der
mediceischen Venus.“ Die berechnete Wirkung auf Friedrich Wilhelm
blieb aus. Immerhin zeigt dieser Vorfall, was man selbst in relativer
Öffentlichkeit im galanten Jahrhundert wagte. Die ganze Angelegenheit
wird auch nicht harmloser durch die Gegenwart des sechzehnjährigen
Kronprinzen, nachmaligen Friedrich des Großen[186]!
[S. 171]
Auch die öffentliche Sittlichkeit hat sich wesentlich erst seit der
französischen Revolution gehoben, wenigstens bei uns. In Halbasien ist
es so wie früher geblieben.
Nach Zeitungsmeldungen wurde vor einigen Jahren auf einem von König
Alexander von Serbien gegebenen Hofballe ein Korsett
gefunden!
In Deutschland aber gibt es Scharen von Männern, denen
Unsittlichkeitsschnüffelei und Prüderie schon längst Rang und Titel von
Eunuchen honoris causa eingetragen haben sollten. Aber wahres Verdienst
wird eben nicht mehr gebührend anerkannt.
[S. 172]
Neunter Abschnitt
Medizinisches
Im Anfang des 13. Jahrhunderts untersagte Papst Honorius III. aus
Mißachtung des ärztlichen Standes allen Geistlichen die Ausübung der
Heilkunde.
Auf der Würzburger Diözesan-Synode vom Jahre 1298 wurde den Geistlichen
nicht nur die Ausübung der Wundarzneikunst, sondern sogar die
Gegenwart bei chirurgischen Operationen ausdrücklich untersagt.
Dadurch wurde die Wundheilkunst mit einem Makel befleckt[187].
Noch im Jahre 1416 wies die Wiener Fakultät einen Chirurgen, der
sich zur Doktorwürde meldete, als unverschämten Menschen zurück.
Im Jahre 1456 graduierte sie jedoch einen Doktor der Chirurgie.
Immerhin mußte noch im Jahre 1577 Kaiser Rudolf II. ausdrücklich die
Ehrlichkeitserklärung der Wundärzte wiederholen[188].
Bis zum Jahre 1912 hatten in Bayern zwar die aus dem
Unteroffiziersstande hervorgegangenen Feuerwerksoffiziere
Hofzutritt, nicht aber die Militärärzte,[S. 173] mit Einschluß des
Generalstabsarztes der Armee, der im Range eines Divisionskommandeurs
steht!
*
Eine Lehre, die noch heute mancher Arzt befolgt, gibt Arnoldus
Villanovanus, der um das Jahr 1300 in Montpellier als medizinischer
Lehrer wirkte: „Weißt du bei Betrachtung des Urins nichts zu finden, so
sage, es sei eine ‚Obstruktion‘ der Leber zugegen. Sagt nun der Kranke,
er leide an Kopfschmerzen, so mußt du sagen, sie stammen aus der Leber.
Besonders aber gebrauche das Wort ‚Obstruktion‘, weil sie es nicht
verstehen, und es kommt viel darauf an, daß sie es nicht wissen, was
man spricht[189].“
*
Gegen Geisteskranke hatte man sehr nachdrückliche Mittel. Wurden sie
lästig, dann legte man sie ins Gefängnis, rasten und tobten sie, an
die Kette. Geisteskranke Fremdlinge aber schaffte man über die Stadt-
oder Landesgrenze, nicht ohne sie gehörig ausgepeitscht zu haben, damit
ihnen die Lust zur Rückkehr verging[190].
*
Der dicke Markgraf Dedo litt sehr unter der Fettsucht. Sein Arzt
bewog ihn dazu, sich den Leib aufschneiden zu lassen, um das
überflüssige Fett zu entfernen. Natürlich starb er (1190) an dieser
Prozedur[191].
*
[S. 174]
Herzog Leopold von Österreich war am 26. Dezember 1194 bei einer
ritterlichen Übung vom Pferde abgeworfen worden und hatte den
Unterschenkel so unglücklich gebrochen, daß die Knochensplitter
eine Spanne lang aus der Haut hervorragten. Die herbeigerufenen
Ärzte ordneten das Nötige an, amputierten aber den Fuß nicht. Als
er am andern Morgen schwarz geworden war, galt die Amputation als
unerläßlich, aber niemand wagte sie vorzunehmen. Da setzte der
Herzog selbst das Beil auf sein Schienbein, sein Kämmerer schlug
dreimal mit dem Hammer darauf, und so wurde das kranke Glied
entfernt. Er starb am 30. Dezember. Nerven hatten diese Herren!
*
Als Kaiser Otto II. an einer der in südlichen Klimaten so häufigen
Verdauungsstörungen litt, nahm er – natürlich auf ärztliche Anordnung
– eine Dosis von 17½ Gramm Aloe, an der er auch starb. Ein
Bruchteil dieser Menge hätte schon seinen Tod herbeiführen müssen.
Kaiser Otto IV. starb nicht minder unromantisch. Im Frühjahr 1218 nahm
er, wie alljährlich, ein Abführmittel. Er vergriff sich in der Dosis,
ob aus eigenem Verschulden oder aus Schuld des Arztes, entzieht sich
unserer Kenntnis, und ging nach fünf Tagen kläglich zugrunde.
*
Nicht ohne einigen Humor ist das Abenteuer, das Albrecht I. widerfuhr,
als er beim Genuß von[S. 175] Fisch und Wildprett plötzlich von heftigem
Unwohlsein befallen wurde. Der Verdacht, vergiftet zu sein, war
groß und bei den damaligen politischen Methoden a priori auch nicht
unbegründet. Er ließ deshalb sofort Ärzte kommen, die mit Latwergen,
Theriak und Aromaten ihm vergebens zu helfen suchten. Da hing man den
Fürsten bei den Füßen auf, damit das Gift aus Augen, Ohren, Nase und
Mund herausrinnen könne! Begreiflicherweise verlor Albrecht bei dieser
Kur die Besinnung und – ein Auge, dessen Stern durch die Wirkung des
Giftes oder der Heilmethode dauernd zerstört blieb. Auch behielt er
zeitlebens eine fahle Gesichtsfarbe.
Unterdessen hatten sich die zwei Edelknaben, die den König bei Tisch
bedient hatten, als sie sein Unwohlsein bemerkten, um den Verdacht
der Vergiftung von sich abzuwälzen, auf die inkriminierten Speisen
gestürzt, würgten sie hinunter und – blieben gesund oder doch
jedenfalls am Leben. Danach gewinnt es den Anschein, als hätten die
Ärzte – unter denen wir uns hier, wie in den obigen Fällen, nicht etwa
Stümper, sondern die ersten Koryphäen ihrer Zeit zu denken haben
– ihre Gewaltmittel nicht gegen Gift, sondern gegen ganz harmlose
Leibschmerzen angewandt.
*
Ein Jahrhundert später verfuhr man nicht wesentlich anders. Kaiser
Sigismund erkrankte bei der Belagerung von Znaim im Jahre 1404 heftig
an Gift zugleich mit dem 27jährigen Herzog Albrecht von Österreich,
der dem Anschlag auch erlag. Sigismund wurde von seinem Leibarzt
an den Füßen aufgehängt.[S. 176] so daß die Brust auf einem Kissen auf
dem Boden ruhte, um das Gift aus dem Munde abfließen zu lassen. In
dieser peinlichen Situation mußte der Fürst 24 Stunden aushalten.
Merkwürdigerweise überwand die starke Natur des nachmaligen Kaisers
sowohl Gift wie Heilmethode und er genaß völlig, wie der Arzt mit Stolz
behauptete, lediglich dank seiner genialen Kur.
*
Im ganzen Mittelalter ist die Ehe mit Wahnsinnigen aus
politischen Gründen an der Tagesordnung.
*
Die Gemahlin Kaiser Maximilians I., die schöne Maria von Burgund,
ritt, obwohl bereits mehrere Monate guter Hoffnung, eine Jagd, stürzte
und starb an den Folgen. Ebenso ging Maria, Kaiser Sigmunds Gemahlin,
zugrunde. Die Rücksicht auf die Gesundheit wurde im Mittelalter
so völlig außer acht gelassen, daß man gar kein Bedenken trug,
schwangere Frauen Jagden reiten zu lassen.
*
Wie gering bis in die neuere Zeit die Achtung vor dem medizinischen
Wissen war, ergibt sich u. a. aus den Komödien Molières. Als Gil Blas
schwer erkrankt in einem Orte liegen bleibt, dünkt er sich gerettet,
weil dort kein Arzt sei.
*
Die Leichenöffnung wurde vom Papst noch anfangs des 14.
Jahrhunderts untersagt, was allerdings den Senat von Venedig nicht
abhielt 1308 zu bestimmen, daß zum Zweck anatomischer Studien jährlich
eine Leiche geöffnet werde. In Prag wurde auch[S. 177] bereits unter Karl
IV. ein Verbrecher im Gefängnis „abgestochen“ und die Leiche zu
wissenschaftlichen Zwecken zergliedert. In Holland hob erst Philipp II.
im Jahre 1555 das Verbot, Leichen zu sezieren, auf, aber nur die von
Hingerichteten durften zu solchen Zwecken verwandt werden. Noch kurz
vorher war es für den Mediziner mit nicht geringen Gefahren verbunden,
sich in den Besitz von Leichen zu setzen. So erzählt Felix Platter
in seiner Selbstbiographie (S. 232 ff.), daß er 1554 frische Kadaver
heimlich ausgraben mußte. Die Sektionen nahmen nicht nur Ärzte, sondern
auch Maler vor. Die erste Frau wurde erst 1720 in den Niederlanden
seziert[192]. Dagegen hat Kaiser Ferdinand schon 1559 dem Arzt
Thurneyßer in Tirol eine Frau überwiesen, der die Adern geöffnet worden
waren[193].
*
Oswald Croll gab in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts folgende
Beschreibung zur Bereitung der Mumienlatwerge: „Man soll den
todten Cörper eines rohen, gantzen, frischen und unmangelhaften
24jährigen Menschen so entweder am Galgen erstickt oder mit dem Rade
justiciert oder durch den Spieß gejagd worden, bei hellem Wetter,
es sei Tag oder Nacht, erwehlen... in Stücke zerschneiden, mit
pulverisierter Mumia und ein wenig Aloë bestreuen, nachmals einige Tage
in einem gebrannten Wein einweichen, auffhenken, wiederumb ein wenig
einbeitzen, endlich die Stück, in der Lufft aufgehänkt, lassen trucken
werden, biß es die Gestalt eines geräucherten Fleisches bekommt und
allen Gestank verliert, und zeugt letzlichen die ganze rothe Tinktur
durch einen gebrannten Wein oder Wacholdergeist nach Art der[S. 178] Kunst
heraus.“ Aus dieser Tinktur wurde dann mit andern Arzneistoffen eine
höllische Latwerge bereitet, die vor der Pestilenz schützen und sie
heilen sollte[194].
*
Noch zu Ende des 18. Jahrhunderts las ein bekannter Arzt ein
Publikum(!) an einer deutschen Universität, das im
Lektionskatalog angekündigt war: „De variis concubitus modis“.
Also sogar in die intimsten Winkel von Amors Reich drang die
Wissenschaft ein, sicherlich nicht, ohne zahlreiche und begeisterte
Jünger zu finden. Über dieselbe Materie gab es bei den Griechen
verschiedene Schriften unter den Namen der Astyanassa, der Cyrene,
Elephantis und Philänis, lauter Damen! Bekannt sind Ovids
Anweisungen in seiner Ars amatoria III, 771 ff.[195] und ein indisches
Seitenstück, das an Wissenschaftlichkeit und gründlicher Erschöpfung
des Themas seinesgleichen sucht, ist das Kamasutram des Vatsyayana, das
Richard Schmidt aus dem Sanskrit übersetzte.
*
In den Jahren von 1727–1762 herrschte in Frankreich eine merkwürdige
Massenepidemie, „Konvulsionen“ genannt, die den St. Medarduskirchhof
zu Paris zum Mittelpunkt hatte. Frauen, Mädchen, Kranke jeder Art
füllten den Kirchhof mit den angrenzenden Straßen und konvulsionierten
dort um die Wette. Frauen luden, lang hingestreckt, die Zuschauer ein,
auf ihren Bauch zu schlagen, und beruhigten sich nicht eher,
als bis 10–12 Männer sich mit voller Gewalt über ihnen aufgetürmt
hatten. Natürlich hatte diese fromme Seuche eine erotische Färbung
und trug nicht wenig bei, die sexuelle Zügellosigkeit zu[S. 179] verbreiten.
Bezeichnend dafür ist, daß die Frauen bei ihren Anfällen niemals andere
Frauen, sondern stets Männer zur Hilfe riefen, und zwar junge
und kräftige Männer. Dazu kleideten sie sich höchst indezent, zeigten
stets Neigung zu adamitischer Entblößung, nahmen laszive Stellungen an,
warfen verlangende Blicke auf die zu Hilfe eilenden Männer, und es kam
vor, daß sie – natürlich in ihrer Muttersprache – mit lauter Stimme
riefen: Da liberos, alioquin moriar!
Die Frauen luden die Männer ein, „Bauch, Busen und ihre Schenkel zu
Promenaden zu benutzen“ und mit ihnen zu „kämpfen“. Die Folge waren
zahlreiche Entbindungen dieser sonderbaren Heiligen[196].
*
Daß die Flagellanten ähnlich sich gebärdeten, ist hinlänglich bekannt.
Bei den Geißelungen unterschied man zwei „Disziplinen“, die
„obere“ und die „untere“, letztere fand besonders bei den
Frauen den meisten Beifall.
Eine wesentlich anmutigere Manie herrschte in den deutschen
Nonnenklöstern im 15. Jahrhundert. Damals kam eine Nonne auf den netten
Einfall, eine andere zu beißen. Dieser gefiel der Spaß, und sie
biß wieder eine andere, bis schließlich das Beißen zu einer Epidemie
wurde, die sich mit rasender Schnelligkeit von einem Nonnenkloster zum
andern verbreitete; bald bissen sich alle Klosterkätzchen vom Belt bis
nach Rom[197]!
Viele von uns werden sich auch noch der Kußepidemie erinnern, deren
Opfer der Leutnant Hobsen war, der im spanisch-amerikanischen Kriege
sein eigenes[S. 180] Schiff „Merrimac“ in die Luft gesprengt hatte. Nach jedem
Vortrag, den der Arme hielt, stürzten sich die sonst so zurückhaltenden
amerikanischen Damen auf ihn, um ihn zu küssen.
In einem flandrischen Kloster fing plötzlich eine Nonne an in ihrem
Bett höchst befremdliche Bewegungen zu machen. Auch das steckte an,
und bald arbeiteten die Nonnen sämtlich des Nachts so heftig, daß
die Bettstellen knackten. Da sich das sonderbare Übel von Kloster
zu Kloster fortpflanzte, sah sich die Geistlichkeit gezwungen, von
Amts wegen einzuschreiten. Mit Weihwasser und Wedel gelang es auch –
wie ja nicht anders zu erwarten – den Teufel aus den Nonnen
auszutreiben[198].
*
Vielleicht können wir hier einiger anderer Manien gedenken, die zwar
ganz anderen Motiven entsprangen, auch keinerlei erotischen Einschlag
aufweisen, aber durch die weite Verbreitung und große Heftigkeit ihres
Auftretens den Charakter von Massenwahnsinn annehmen.
Im Byzanz des 5. Jahrhunderts wütete eine das ganze Volk beherrschende
Leidenschaft: die der dogmatischen Spitzfindigkeiten. Es ist die
Zeit der Dogmenbildung, eines Nestorius, und dieses Bestreben, eine
möglichst reine Lehre festzusetzen, ließ auch die unteren Volkskreise
nicht zur Ruhe kommen. Die Frage nach der Gottähnlichkeit oder
Gottgleichheit war ein allgemein mit größtem Eifer und Spitzfindigkeit
diskutiertes Thema, das jedes andere Interesse verdrängte[199].
*
[S. 181]
Eine ähnliche, allerdings minder trockene Manie hatte die Araber
Spaniens für die Poesie ergriffen. Das ganze Volk war von der
Leidenschaft des Reimens und Versemachens ergriffen, Lied und Spruch
ertönten überall. Dichter waren einflußreiche Ratgeber der Fürsten, mit
Ehren und Reichtum überschüttet; ein glücklich gefundener Reim, ein
feines Bild, eine kunstvolle metrische Wendung vermochten dem Urheber
eine glänzende Laufbahn zu erschließen.
*
Die Kreuzzüge als Massenpsychose zu bezeichnen, ließe sich
sicherlich rechtfertigen. Aber selbst wer davor zurückschreckte,
eine zwei Jahrhunderte anhaltende, mindestens eine Million der
tüchtigsten Krieger vernichtende Periode unserer Geschichte als
pathologische Erscheinung zu bezeichnen, wird nicht anstehen, dies dem
Kinderkreuzzuge des Jahres 1212 in Südfrankreich gegenüber zu
tun. Damals zogen 30000 Kinder unter Führung des Hirtenknaben Etiennes
dem sicheren Untergang entgegen. Von den sieben Schiffen, die die
Kinder in Marseille bestiegen, gingen zwei unter. Die fünf anderen
gelangten nach Ägypten, wo die Kinder als Sklaven verkauft wurden.
*
Daß auch in unserer, anscheinend religiös so aufgeklärten Zeit noch
Massenpsychosen ähnlicher Art, wie Flagellantentum und Veitstanz
im Mittelalter möglich sind, möge aus folgendem hervorgehen: In
Morzine-Savoyen herrschte eine „Besessenheitsepidemie“ von 1857–1862;
im südlichen Baden die „Predigerkrankheiten“ von 1852 auf 53 und
im Jahre 1888 in Nilsiac[S. 182] in Finnland. Tanzseuchen grassierten im
Anfang des 19. Jahrhunderts in Abessinien, 1863/64 in Madagaskar
und 1868–73 bei den Lappen. Noch heute existiert die sich selbst
verstümmelnde Sekte der Skopzen in Rußland, der Duchoborzen in Kanada,
die splitternackt im eisigen Winter ausziehen auf die Suche nach dem
Heiland. Im Jahre 1896 beobachtete man eine Epidemie im Gouvernement
Kiew, die durch die Predigten einer verrückten alten Frau gegen
Vornahme einer Volkszählung hervorgerufen war. Dreißig Personen ließen
sich lebendig begraben und fanden so einen schaudervollen Tod.
Daß aber sogar in der Gegenwart in Deutschland religiöse Epidemien
vorkommen, lehrte uns das Jahr 1907. Damals wurden im „Blauen Kreuz“
in Kassel den ganzen Juli hindurch täglich religiöse Versammlungen
veranstaltet, wobei Verzückungszustände, Erleuchtungen und das
sogenannte Zungenreden eine Rolle spielten. Ein Rausch, eine religiöse
Extase bemächtigte sich der Versammlung. Mit Gesängen, lauten
Sündenbekenntnissen und Bußreden mischten sich unartikulierte Töne,
wildes Stammeln, Stöhnen, Schreien. Man erblickt verzerrte Gesichter,
rasende Gebärden, Menschen, die wie ohnmächtig zu Boden sinken und halb
bewußtlos um sich schlagen. Irgend jemand springt plötzlich auf und
stößt unverständliche Rufe aus, die der Versammlungsleiter dann als
Ausfluß überirdischer Erleuchtung deutet. Ein lauter Jubel erhebt sich,
man wirft sich auf die Knie, umarmt sich, Geständnisse entringen sich
den bebenden Lippen, Frauen behaupten Visionen zu haben, die Erregung
erreicht ihren Höhepunkt.
[S. 183]
Schon nach wenigen Wochen hatte sich die Bewegung auf die Nachbarorte
Kassels verbreitet und zwar lieferte die Landbevölkerung das stärkste
Kontingent. Widerspruch oder Versuche der Aufklärung wurden in der
Versammlung dadurch beantwortet, daß man den Teufel hinauswarf. Da es
in den ersten Augusttagen zu schweren Schlägereien kam, wurden diese
religiösen Versammlungen hinfort von der Polizei verboten[200].
*
Der Engländer John Evelyn besuchte im Jahre 1641 die Kirmes von
Rotterdam und erzählt darüber in seinem Tagebuch: „Der jährliche Markt
oder die Kirchweih von Rotterdam war derart mit Bildern ausgestattet,..
daß ich überrascht war... Der Grund für diese Menge von Bildern und
ihre Billigkeit ist darin zu suchen, daß die Leute Mangel an Land
haben, um ihr Geld darin anzulegen, so daß es eine gewöhnliche
Erscheinung ist, einen simplen Bauern 2000–3000 L. St. auf diese
Weise anlegen zu sehen. Ihre Häuser sind damit angefüllt, und sie
verkaufen sie auf ihren Jahrmärkten mit großem Gewinn[201].“ Es dürfte
in der Kulturgeschichte ein einzig dastehender Fall sein, daß Bauern
ihr Vermögen in Kunstwerken anlegen.
*
Den Türken verdankt Europa die Bekanntschaft mit der Tulpe, deren
erstes blühendes Exemplar der berühmte Conrad Geßner im Jahre 1559
im Garten eines Augsburger Patriziers sah. Wenige Dezennien später
war die schöne Blume in Europa verbreitet, und besonders in Holland
entstand eine solche Leidenschaft, seltene und wunderliche Abarten
und Farben[S. 184]mischungen zu erzeugen, daß sie in der ersten Hälfte des
17. Jahrhunderts geradezu zu einer nationalen Katastrophe führte.
Man kaufte und verkaufte Tulpen auf Zeit und Entrichtung der
Differenz zwischen dem vereinbarten und am Verfalltage notierten
Preise. Man zahlte für einzelne Zwiebeln bis zu 2000 hol. Gulden und
mehr; das ganze Volk war von diesem Spekulationsfieber ergriffen,
wohl dem ältesten seiner Art im christlichen Abendlande. Als 1637
plötzlich die Ernüchterung eintrat, waren große Verschiebungen in den
Besitzverhältnissen und nachhaltige Verkehrsstockung die Folge[202].
Eine ähnliche Manie knüpfte sich an die von Law im August 1717
gegründete „Mississippigesellschaft“. Die Leidenschaft für
deren Aktien war so maßlos, daß binnen eines Jahres statt 500 Livres
pro Stück 18000 angelegt wurden. Die Folge war Staatsbankerott und die
größte Börsenkrisis, die die Welt bisher gesehen hatte[203].
*
Ärztinnen – nicht etwa nur mit Hausmitteln im Bedarfsfalle
aushelfende Frauen, die es zu allen Zeiten gab – existierten bereits
an der medizinischen Schule in Salerno. Besonders berühmt ist Trottula,
die im 11. Jahrhundert alle an Ruf überstrahlte. Im 12. Jahrhundert
gab es dort eine ganze Reihe, die viele medizinische Rezepte erfanden
und anwandten. Eine von ihnen, Mercuriade, soll sogar in der Chirurgie
Hervorragendes geleistet haben. Vom 10. September 1321 hat sich ein
Dokument erhalten,[S. 185] in der Francisca, Gemahlin des Matthäus de Romana,
die Erlaubnis erhält, in Salerno chirurgische Praxis auszuüben,
da sie „nach wohlbestandenem Examen“ ein Zeugnis der Universität
Salerno besitze. Der Herzog Karl von Kalabrien sagt ausdrücklich,
daß das Gesetz den Frauen die Ausübung der Medizin gestatte. Daß man
im Mittelalter männliche Ärzte möglichst vom weiblichen Geschlechte
fernzuhalten suchte, war dem Aufkommen der Ärztinnen günstig. Den
Ärzten war es nach einem westgotischen Gesetz des 6. Jahrhunderts
ausdrücklich verboten, Frauen in Abwesenheit ihrer Verwandten die Ader
zu schlagen.
Bereits 1351 gab es in München eine Augenärztin. Während nach langer
Pause 1807 eine Dame, Regina Josepha von Siebold, in Würzburg studieren
durfte, hat man noch bis 1910, ja in einigen Staaten bis heute, trotz
gleicher Vorbildung und gleicher Examina wie sie die männliche Jugend
absolviert, den Frauen, mit Ausnahme von Bayern und Baden, die
Immatrikulation auf den deutschen Universitäten versagt[204].
*
Im ancien régime herrschte der Glaube, die Hand des Königs könne von
Skrofeln befreien. Deshalb wurde 6–7 mal im Jahre in den Kirchen
bekannt gegeben, daß der König „berühren“ würde. Dann fanden sich
in Versailles 700–800, auch noch mehr, Kranke ein, die mit den
nötigen Abständen in Reihen aufgestellt und ausgerichtet wurden.
Die königlichen Ärzte untersuchten sie, ob sie auch wirklich krank
waren, was nötig war, da viele Simulanten sich ein[S. 186]schmuggelten.
Da nämlich der König jedem Skrofulösen zwei Sous, den von auswärts
zugereisten sogar fünf Sous einhändigen ließ, versuchte mancher ein
Geschäft aus dieser heiligen Handlung zu machen. Nach der Untersuchung
erschien der König, dem ein Hauptmann der Garden voranschritt, mit dem
Großalmosenier und einigen Herren vom Dienst. Die Ärzte hielten dem
sich auf die Knie niederlassenden Kranken, von beiden Seiten hinter ihm
stehend, den Kopf, während der Gardehauptmann die Hände des Knienden
zwischen die seinigen nahm, um ein Attentat zu verhüten. Dann trat
der König an den Kranken heran und machte ihm mit der bloßen Hand vom
Kopf zum Kinn und vom einen Ohr zum andern streichend das Zeichen des
Kreuzes mit den Worten: „Der König berührt, Gott heilt dich.“ Dann
wurde der Patient mit seinen Sous abgeführt, um nicht nochmals die
Zeremonie und vor allem die königliche Freigebigkeit in Anspruch nehmen
zu können[205].
Ob der König mit seiner appetitlichen Tätigkeit viele Heilerfolge
erzielte, wird nicht berichtet.
*
Der berühmte Arzt, Dr. Thomas Dover, der Erfinder der nach ihm
benannten, heute noch gebräuchlichen Pulver, war ein erfolgreicher
Seeräuber! Um 1660 geboren ließ er sich nach Beendigung seiner
Studien in Bristol nieder, erwarb sich einiges Geld und unternahm
hierauf mit einigen Kaufleuten eine privilegierte Kaperexpedition. Auf
der Insel Juan Fernandez entdeckte Dover 1709 als einzigen[S. 187] Bewohner
den schottischen Matrosen Alexander Selkirk, der hier vier Jahre und
vier Monate zugebracht hatte. Bekanntlich ist dieser Selkirk der Urtyp
der Robinson Crusoe-Geschichte geworden. Hierauf erstürmte Dover die
beiden Städte von Guayaquil und kehrte mit seiner Expedition der
peruanischen Küste entlang über Kalifornien und den Stillen Ozean im
Jahre 1711 mit einer Beute von etwa 3½ Millionen Mark, von denen
Dover einen beträchtlichen Anteil erhielt, nach England zurück. Nach
einigen weiteren Reisen ließ sich Dover in London nieder, wo er
u. a. „Des alten Arztes Erbe“ (The Ancient Physicans Legacy), das 1733
erschien, schrieb. Es war eine populär-medizinische Abhandlung,
verfaßt, um dem Autor Praxis zu verschaffen[206].
*
Georges Mareschal, ursprünglich Barbier, dann Leibchirurg Ludwigs XIV.
wurde ein so gewandter Operateur von Blasensteinen, daß er einmal
acht Patienten in wenig mehr als einer halben Stunde von ihrem Leiden
befreite. Er brachte es auf ein Jahreseinkommen von 300000 Frank!
Allerdings erhielt er für einen Aderlaß jedesmal 2500 Frank[207]!
*
Bezeichnend für den Unfug, der damals mit der Klistierspritze, einer
Erfindung des holländischen Arztes Reynier de Graaff, getrieben wurde,
ist die aus einem Prozeß bekannte Tatsache, daß dem französischen
Prälaten, François Bourgois 2190 Klistiere verabreicht wurden, für die
er den geforderten Preis[S. 188] nicht bezahlen wollte. Die Pariser Spitäler
brauchten damals in einem einzigen Jahre für mehr als 700000 Frank
Blutegel[208]!
*
Der Wein gehörte bei unsern Altvordern so zur unentbehrlichen
Nahrung, daß in allen Sitzungen der Ratsausschüsse sowie bei allen
außergewöhnlichen Geschäften des Rates im späteren Mittelalter Wein
getrunken wurde. Man rechnete täglich eine Maß Wein pro Mann als
normales Deputat, nicht nur im städtischen Dienst als Stärkung für die
Ratsglieder und Zunftgenossen, die bei außerordentlichen Gelegenheiten
die Torwachen verstärkten, oder mit den Bürgermeistern in den Straßen
umherritten, auch beim Militär. Der kaiserliche Kommandant verlangte
z. B. 1552 während der Belagerung Frankfurts eine Maß täglich für jeden
Soldat.
Als 1411 ein Teil der deutschen Fürsten wegen der Königswahl auf kurze
Zeit in Frankfurt anwesend war, wurden 14½ Fuder Wein konsumiert!
Fast genau so viel ließ der Rat angesichts des Reichstages, der 1485
in Frankfurt gehalten werden sollte, für die Fürsten und Herren
anschaffen[209].
Der schlesische Ritter Hans von Schweinichen, wie seine fürstlichen
Herren ein berühmter Trinker, der gewissenhaft seine Räusche
bucht – fast auf jeder Seite so und so oft – schreibt in seinen
„Denkwürdigkeiten“ (S. 77) von der „feinen Kurzweil“, die in den
Augsburger Trinkstuben war. „Wann man[S. 189] Gäste einlädt und giebt von der
Person 18 Wssgr., so wird man mit zwanzig Essen gespeiset und dabei
den besten Rheinfall und Rheinwein, so zu bekommen ist, getrunken, und
dessen so lang, bis man alle voll ist. Wie ich denn etliches Mal
dergestalt Gäste auf der Trinkstuben zu mir einlud. Wann man aber einen
Thaler von der Person giebt, so wird man Fürstlich tractiret. Ich hätte
mir wollen wünschen, daß solches Leben lange und viel Jahr gewähret
hätte.“
*
Bei Hof war es nicht besser; sogar auf Reichstagen war die
Betrunkenheit der Fürsten eine ständige Erscheinung. Graf Lynar,
ein Ausländer, nahm 1590 an der Berliner Hoftafel ungern teil, „wegen
des Trinkens“. An den sächsischen Höfen war „das stetig Vollsein
ein alt eingewurzelt Uebung und Gewohnheit“. Besonders berüchtigt waren
die „pommerischen Trünke“. Die geistlichen Fürsten konnten auch den
Humpen schwingen, nicht minder die Damen. Manchem modernen Studenten
hätten diese Leistungen die Schamröte ins Gesicht getrieben![210]
Das Merkwürdigste ist nun, daß die Ärzte solche Trinkexzesse für
gesund erklärten![211]
[S. 190]
Zehnter Abschnitt
Hygiene
Leute, die sich eines gottgefälligen Lebenswandels befleißigten,
badeten im frühen Mittelalter nicht. Die hl. Elisabeth verbreitete
durch völligen Verzicht auf diesen Genuß in Bälde einen solchen Geruch
der Heiligkeit um sich, daß ihre Umgebung es nicht mehr aushielt
und sie veranlaßte, ein Bad zu nehmen. Der Erfolg war allerdings
gering, denn sie hatte kaum das Wasser berührt, als sie auch schon
hinaussprang, um dafür Buße zu tun.[212]
Desto reinlicher waren die weltlicher Gesinnten. Sie, auch die Bauern,
badeten sehr häufig. Die Ritter, die natürlich nackt waren, wurden
dabei von zarten Damenhänden bedient, wie z. B. auf einer Miniatur der
Manesseschen Handschrift in der Heidelberger Universitätsbibliothek
zu sehen ist. Übrigens wird heute noch in Skandinavien dieser Dienst
der Weiblichkeit reserviert. Sonst scheint sich aber das Waschen auf
Gesicht und Hände beschränkt zu haben. Keinesfalls waren Waschtische
bekannt. Noch das Frauenzimmerlexikon von 1729 kennt zwar das
Gießbecken und die Gießkanne, mit der man etwas Wasser auf die Hände
goß und dann das Gesicht notdürftig benetzte, aber weder Waschtisch,
noch Waschbecken.[213][S. 191] Daher steht es fest, daß die Reinlichkeit,
seitdem im beginnenden 16. Jahrhundert die auftretende Syphilis das
Schließen der öffentlichen Badestuben veranlaßt hatte, sehr gering war.
Die Italiener der Renaissance, damals den Völkern Nordeuropas an
Reinlichkeit überlegen, befolgten keineswegs allgemein die Sitte, sich
täglich gründlich zu waschen. Trotzdem galt ihnen der Deutsche als
Inbegriff alles Schmutzes[214].
*
Wie selten die Tugend der Reinlichkeit selbst beim deutschen Adel war,
lehrt der Nachruf, den Johann von Wedel seiner 1606 verstorbenen Frau
schrieb: „Nichts desto weniger (d. h. wiewohl sie dem Kleiderluxus
abhold war) hat sie sich der Reinlichkeit und Wartung ihres Leibes mit
ehrlicher Kleidung und gebührlichem Schmuck beflissen, welches eine
feine äußerliche Tugend ist, die Jungfrauen und Frauen wohl zieret, daß
sie nicht wie Schlammüttere herein ziehen, dafür dem Teufel oftmals
grauen möchte, sondern sich waschen, zieren, schmücken, reinlich
halten, dessen die Schrift ehrlich gedenket (Ecclesiastes IX)“[215].
*
Wie es zur Zeit des Konstanzer Konzils in einem deutschen Badeorte
zuging, beschreibt der berühmte Humanist Poggio Bracciolini in einem
bekannten Brief an seinen Freund Niccoli vom Jahre 1417. Es handelt
sich um Baden in der Schweiz. Nachstehend einige[S. 192] Stellen nach der
Übersetzung von Alwin Schultz in seinem Deutschen Leben im 14. und 15.
Jahrhundert:
„Es ist dort so ausgelassen, daß ich zuweilen meine, Venus sei mit
allen Vergnüglichkeiten von Cypern nach diesem Bade übersiedelt,
so werden ihre Gesetze beobachtet, so aufs Haar ihre Sitte und
Leichtfertigkeit wiedergegeben, so daß sie, wenn sie auch die Rede des
Heliogabal nicht gelesen, doch von Natur gelehrt und unterrichtet genug
erschienen...
Öffentliche Bäder sind nur zwei vorhanden, offen (palam) zu beiden
Seiten, Badestätten des Volkes und des gemeinen Haufens, zu denen
Weiber, Männer, Knaben, unverheiratete Mädchen, die Hefe der ganzen
Umgebung zusammenströmt. In ihnen scheidet eine Mauer die Männer von
den Frauen. Es ist lächerlich zu sehen, wie abgelebte alte Weiber
und jüngere Frauen nackt vor den Augen der Männer ins Wasser
steigen. Ich habe oft über dies prächtige Schauspiel gelacht, dabei
an die Spiele der Flora gedacht und bei mir die Einfalt dieser Leute
bewundert, die weder auf so etwas hinsehen, noch irgend etwas Böses
davon denken oder reden. Die Bäder in den Privathäusern (etwa dreißig)
sind aber sehr fein (perpolita); Männer und Frauen gemeinsam, aber
durch eine Holzwand geschieden. In ihr sind mehrere Fenster angebracht,
so daß man zusammen trinken und sich unterhalten kann, nach beiden
Seiten hin zu sehen und sich zu berühren vermag, wie dies ihrer
Gewohnheit nach oft geschieht. Über dem Bassin sind Korridore, auf
denen Männer stehen, zuzusehen, um sich zu unterhalten, denn ein jeder
darf in andere Bäder gehen und sich dort aufhalten, zuzuschauen, zu
plaudern,[S. 193] zu scherzen und sich zu erheitern, so daß man die Frauen,
wenn sie ins Wasser steigen oder aus demselben herauskommen, sieht.
Keiner wehrt die Tür, keiner argwöhnt etwas Unsittliches. Männer tragen
nur eine Schambinde (campestribus utuntur), die Frauen ziehen leinene
Hemden an, von oben bis zum Schenkel, oder an der Seite offen, so daß
sie weder den Hals, noch die Brust oder die Arme bedecken. Im Wasser
selbst speisen sie auf gemeinsame Kosten, ein geschmückter Tisch
schwimmt auf dem Wasser, und auch Männer pflegen teil zu nehmen...
Es ist merkwürdig, zu sehen, in welcher Unschuld sie leben, mit welchem
Vertrauen Männer es ansahen, daß ihre Frauen von Fremden berührt
wurden. Sie wurden nicht gereizt, achteten nicht darauf, nahmen alles
von der besten Seite. Nichts ist so schwer, das bei ihren Sitten nicht
leicht wurde. Sie hätten ganz in den Staat Platos gepaßt, wo alles
gemeinsam ist, da sie schon ohne seine Lehre so eifrig in seiner Schule
erfunden werden. In einigen Bädern sind Männer unter den Frauen, denen
sie entweder verwandt sind, oder es wird ihnen aus Wohlwollen
gestattet...
Ich glaube nicht, daß es auf der Welt ein wirksameres Bad für die
Fruchtbarkeit der Frauen gibt; da recht viele der Unfruchtbarkeit wegen
hierher kommen, so erfahren sie seine merkwürdige Kraft. Sie beobachten
genau die Vorschriften, und es brauchen Mittel die, welche nicht
empfangen können. Unter diesen ist besonders folgendes bemerkenswert:
eine[S. 194] unzählige Menge von Adeligen und Nichtadeligen kommt hier
zusammen; zweihundert Meilen weit her, nicht eben der Gesundheit,
sondern der Lust wegen, alles Liebhaber, alles Freier, alle, denen an
einem genußreichen Leben gelegen ist. So siehst du unzählige schöne
Frauen, ohne Männer, ohne Verwandte, mit zwei Dienerinnen und einem
Knechte oder einer alten Angehörigen, die leichter zu täuschen als
zu ernähren ist... Da leben Äbte, Mönche, Brüder und Priester in
größerer Freiheit, als die andern, baden zuweilen mit den Frauen
und schmücken die Haare mit Kränzen, alle Religion beiseite lassend...“
Es kann sein, daß Poggio übertrieben hat. Immerhin gibt es auch heute
noch Bäder, etwa Franzensbad, die nicht ohne guten Grund im Rufe
stehen, die Unfruchtbarkeit zu beseitigen, keinesfalls stets allein
durch ihr Wasser.
Bezeichnend für die Volkstümlichkeit des Badens bei unsern Altvordern
ist, daß man statt Trinkgeld „Badgeld“ sagte. Die Folgerung aber, daß
man sich mit der äußeren Feuchtigkeit begnügte, wäre übereilt[216].
*
Die Badestuben vertraten etwa die Stelle der heutigen Kaffeehäuser, wo
man sich traf, plauderte und einen großen Teil des Tages zubrachte. Im
Bade selbst verweilte man mitunter vier Stunden, und in Ems erforderte
die Kur, jeden Tag eine Stunde länger, bis zu zehn Stunden im Wasser zu
sitzen.[S. 195] Man trank und sang gemeinsam, wie es auf zahlreichen Bildern
dargestellt ist.
*
Daß Gatte und Gattin in derselben Wanne saßen, war ganz gewöhnlich,
aber es war auch an vielen Orten Sitte, daß in größerer Gesellschaft
Männlein und Weiblein zusammen badeten. Zu Baden in der Schweiz
waren dabei die unteren Volksklassen ganz nackt, die Männer der
höheren Stände aber waren mit einem Schurz, die Frauen mit einem
weitausgeschnittenen Badelaken bekleidet. Viele Badestuben hatten
auch nur ein einziges Auskleidezimmer, das von beiden Geschlechtern
gleichzeitig benutzt wurde. In der Badeordnung für das Glottertal
wurde – allerdings erst 1550 – vorgeschrieben, daß jeder Mann sein
Beinkleid und Hemd, jede Frau oder Jungfrau ihr Hemd nicht eher
als in der Badewanne selbst ablegen solle. Man scheint also diese
Anstandsregel wohl nicht immer beobachtet zu haben.
Ein Blitzlicht auf die Sittlichkeit des 16. Jahrhunderts wirft auch
folgende Verfügung aus der Badeordnung des Glottertals: „Item soll
ain jedt wederer Bader, es seyen Manns- oder Weybspersonen, ire
Heimlichkeiten zuedecken.“
*
Fromme Leute errichteten häufig eine Stiftung, um sich meldenden Armen
davon gratis Bäder verabreichen zu lassen, sogenannte „Seelenbäder“.
Schmeller versicherte, daß noch im Jahre 1827 einige Zünfte[S. 196] zu
Quatember und zu anderen Zeiten solche Bäder für das Seelenheil
ihrer verstorbenen Mitglieder spendeten. Hoffen wir zum Besten der
im Fegefeuer schmorenden, daß es dabei sittsamer zuging, als im
Deutschland des 15. und 16. Jahrhunderts.
*
Hans von Schweinichen erzählt zum Jahre 1551 in seinen
„Denkwürdigkeiten“: „Allhier erinner ich mich, daß ich wenig Tage zu
Hofe war, badete die alte Herzogin, allda mußte ich aufwarten als ein
Junge. Es währt nicht lange, kommt ein Jungfrau, Unte Riemen
genannt, stabenackend raus, heißt mich ihr kalt Wasser geben,
welches mir seltsam vorkam, weil ich zuvor kein nacket Weibesperson
gesehen, weiß nicht, wie ich es versehe, begieße sie mit kaltem Wasser.
Schreit sie laut und rufet ihren Namen an und saget der Herzogin,
was ich ihr mitgespielt; die Herzogin aber lachet und saget: ‚Mein
Schweinichen wird gut werden.‘ Inmittels habe ich gewußt, was nacket
Leut sind, warum sie sich aber mir also erzeiget, wußte ich nicht für
was vor ein Ende.“
Wie Guarinonius erzählt, ging es noch zu Beginn des 17. Jahrhunderts
in kleineren Städten, wie Hall in Tirol, recht paradiesisch zu. Es war
Brauch, halb oder ganz nackte Mädchen von 10–18 Jahren über die Straße
ins Bad zu schicken und sie von ganz nackten Burschen von 10–16 Jahren
begleiten zu lassen. Daß auch erwachsene Männer und Frauen sich ebenso
benahmen, ändert nichts an der Sache[217].
*
[S. 197]
Eines Tages im Jahre 1185 stand König Philipp August von Frankreich
am Fenster seines Palais, als einige vorüberfahrende Wagen den
Straßenschmutz aufwühlten. Der sich dabei entwickelnde Gestank war so
furchtbar, daß der König, wiewohl doch an die Ausdünstungen seiner
Residenz Paris gewöhnt, ohnmächtig wurde. Er befahl darauf
Pflasterung einiger Straßen. Infolge vieler Verordnungen legte man
sich zwar im Verlauf der Jahrhunderte einigen Zwang auf im ferneren
Verunreinigen der Straßen, fuhr auch den Unrat fort, aber nur bis zur
Place Maubert, dem Marktplatz, der völlig verpestet wurde. Erst 1531
mußten die Bewohner von Paris zwangsweise Aborte und Senkgruben in
ihren Häusern anlegen. Bisher hatte man sich zumeist mit der Straße
beholfen, wie das im 17. Jahrhundert noch vielerorts in Deutschland,
z. B. in Hall in Tirol, Sitte war.
*
Als Kaiser Friedrich III. Tuttlingen besuchen wollte, ging es
nicht, weil die Stadt zu schmutzig war. Am 28. August 1485 ist er
in Reutlingen um ein Haar mitsamt seinem Pferde im Straßenschmutz
versunken. Schweine wurden überall in den deutschen Städten gehalten,
nicht nur daß man sie frei in den Straßen herumlaufen ließ, man brachte
ihre Kober auch nach der Straßenfront hin an. In Berlin wurde das erst
1641 verboten, erst 1681 aber wurde das Mästen der Borstentiere dort
überhaupt untersagt. Seit 1671 mußte jeder Bauer, der nach Berlin kam,
eine Fuhre Unrat mit aus der Stadt nehmen.
[S. 198]
Die Verordnung des Nürnberger Magistrates von 1490, daß täglich ein
Knecht die toten Schweine, Hunde, Katzen, Hühner und Ratten auf der
Straße zu sammeln und vor das Tor zu bringen habe, begeisterte ein
poetisches Gemüt zu einem Jubelhymnus[218].
*
Im Jahre 1666 wurde eine Reinigung der Straßen von Paris vorgenommen.
Das war ein solches Ereignis, daß es nicht nur angedichtet wurde,
sondern man sogar zwei Medaillen zu dauerndem Gedächtnis
schlug[219].
Noch im Jahre 1697 wurde polizeilich festgestellt, daß die Bewohner Tag
und Nacht aus ihren Fenstern alles schmutzige Wasser, Urin und Unrat
jeglicher Art auf die Straßen warfen. Wer das nicht tat, sondern sich
im glücklichen Besitze eines Abortes befand, bediente sich zu diesem
Zwecke einer allen gemeinsamen Grube, deren Inhalt von Zeit zu Zeit
in den Hausgarten entleert wurde! Das war im glänzenden Paris eines
Ludwigs XIV.[220]!
In Sicherheit vor Güssen war man nur in den breiten Straßen, wenn man
sich in ihrer Mitte hielt, wo ein schlammiger Rinnsal floß. Jeden
Augenblick öffnete sich ein Fenster, und wer das Unglück hatte, den
geheiligten Warnungsruf „gare l’eau“ zu überhören, über den ergoß sich
erbarmungslos der Inhalt eines Nachttopfes oder eines Schmutzeimers.
Es gab in der ganzen Stadt kein Fleckchen, wo man sicher vor solchen
Überraschungen war, noch wo man dem entsetzlichen Gestank hätte
entfliehen können. In[S. 199] Ermangelung von Aborten benutzte man alle
Straßenecken, die Umgebung der Kirchen, ja die Paläste, wie man heute
noch in Neapel ähnliches sehen kann. Im Palais de Justice stieß man
z. B. überall auf Exkremente, sogar der Louvre wurde nicht verschont:
in den Höfen, auf Treppen und Balkonen, hinter den Türen, überall wo
jemand gerade ein Bedürfnis fühlte, entledigte er sich am hellichten
Tage seiner Bürde, ohne daß die Palastbewohner sich darum kümmerten.
Heinrich III. war darin allerdings kitzlig: durch Verordnung vom
August 1578 befahl er, daß jeden Morgen, bevor er sich erhoben hatte,
die Fäkalien aus den Höfen und seinen Sälen gekehrt werden mußten! Er
hielt eben auf Reinlichkeit. Im übrigen roch es aber in den spanischen
und französischen Palästen noch zu Ludwigs XIV. Zeit zwar stärker wie
Rosen, aber nicht besser[221]. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts schlug
deshalb ein Bürger die Einführung von Nachtstühlen in den königlichen
Palästen vor.
*
Der Zustand der öffentlichen Hygiene hob sich auch im 18. Jahrhundert
in Paris nur sehr allmählich. Es kam vor, daß die schlecht angelegten
Abtrittgruben sich in die benachbarten Brunnen leerten! Da
kleine Bedürfnisse noch das ganze Jahrhundert, ja bis tief ins 19.
hinein überall auf den Straßen verrichtet wurden, auch nach wie vor
Nachttöpfe ahnungslose Passanten mit ihrem Inhalt bekannt machten, gab
deren Aroma dem der Vergangenheit nicht viel nach. Noch 1780 mußte
unter Protest der Bewohnerschaft[S. 200] von der Polizei die Ausleerung von
Nachttöpfen usw. aus den Fenstern verboten werden!
*
Im Jahre 1701 fand man beim Leeren einer Abortgrube die Leiche der
Gattin eines Chirurgen, was aber kein Aufsehen erregte[222].
*
Noch im Jahre 1780 wurden die Straßen von Paris nicht selten durch
die stark angeschwollenen furchtbar stinkenden Gossen in zwei Hälften
geteilt, so daß man nur durch schwankende Laufbrücken die Kommunikation
von der einen Straßenseite zur andern bewerkstelligen konnte. Der
Inhalt dieser Gossen aber bestand aus einer schwarzen, übelriechenden
und scharfen Brühe, die Stoffe, mit denen sie in Berührung kam,
verbrannte. Daher das schöne Sprichwort: „Il tient comme boue de
Paris[223]“.
Bei Regen spien die Dachrinnen von jedem Hause herab ihr Wasser auf
Passanten und Straße, so daß man erst nach seinem Aufhören durch
über die Gossen gelegte Bretter den Übergang von einer Seite zur
andern ermöglichen mußte. Erst 1764 wurden diese freien Dachrinnen
verboten[224].
*
Zur Ritterzeit waren Nachttöpfe unbekannt. Wie man sich behalf,
geht aus einem Gedicht hervor: „Do quam der vrouwen eine Gegangen
alters eine Vür der kemenâten tür Und wolte gerne da vür Sich
des wazzers erlâzen.“ Zu Aborten verwendete man offene Erker, die
zweifellos herrliche Aussicht gewährten, im übrigen aber recht luftig
waren. Um die in den Burggraben fallenden Fäkalien kümmerte sich kein
Mensch.[S. 201] Im Erfurter Schloß befand sich aber sogar eine Kloake, und
zwar gerade unter einem Saale. Das war entschieden nicht angenehm,
besonders nicht für Kaiser Friedrich Barbarossa und seine Paladine.
Denn als er dort im Jahre 1183 einen Reichstag hielt, brachen die
Balken des Saales, und eine Menge Leute stürzten hinein. Acht Fürsten,
viele Edele und über hundert Ritter fanden dabei ihren Tod, während der
Kaiser sich durch einen Sprung aus dem Fenster rettete.
Überhaupt stürzten Häuser oder Balkone außerordentlich häufig ein.
Nicht weniger als drei deutsche Kaiser, Ludwig der Fromme, Ludwig
der Deutsche und Arnulf, sind allein im 9. Jahrhundert bei dieser
Gelegenheit verletzt worden. Ebenso Heinrich III. im 11. und Heinrich
VI. im 12. Jahrhundert[225].
*
J. J. Rousseau brachte Stunden auf dem Nachtstuhle zu. Der Herzog von
Orléans erteilte hier, umgeben von seiner Dienerschaft, dem Herzog von
Noailles Audienz!
*
Als gelegentlich der Krönung Ludwigs XVI. in der Kathedrale von Reims
der Königin ein Appartement eingerichtet wurde, das man mit Closet
„à l’angloise“ ausstattete, also mit einer Art Wasserspülung, die
noch 1807 äußerst selten war, hielt man das für eine nicht mehr zu
überbietende Kriecherei[226]! Übrigens wurde das Wasserklosett bereits
im 17. Jahrhundert in England erfunden[227]!
Vor wenigen Jahren, vielleicht heute noch, besaß das Königsschloß in
Stockholm keine Aborte. Alles,[S. 202] auch fürstliche Gäste, mußte sich
auf den Korridor hinter eine spanische Wand begeben. Aber da diese
keineswegs alles verhüllte, so konnten die Vorübergehenden die Beine
oder wenigstens die Füße des dort Sitzenden sehen.
Noch im Jahre 1900 hatten große Trakte der Münchener Residenz keine
Aborte. Wie Verfasser aus zuverlässiger Quelle weiß, bedienten sich
höchste Herrschaften bis in die Gegenwart nicht des Wasserklosetts,
sondern ausschließlich des Nachtstuhles. Noch heute dient in Bayern
vielfach auf dem Lande – nach Manövererfahrungen – der Misthaufen den
gleichen Zwecken, und eine den oberen Teil des Sitzes – aber nicht
etwa die Beine – verhüllende Holzverschalung ist ein nicht überall
anzutreffender Luxus.
*
In einem Bericht, den der Chirurg Tenon im Jahre 1788 über den Befund
im Hospital Hôtel-Dieu auf königlichen Befehl abfaßte, findet sich
folgende Darstellung der dort herrschenden Zustände:
Ein einziges der Gebäude des Spitales barg 2627 Kranke, darunter
Fieberkranke, Wöchnerinnen, Blatternkranke usw. Die Betten, etwa
1,10 m breit, waren für je zwei bestimmt, wurden aber mit sechs
belegt, drei am Kopf-, drei am Fußende. Dadurch lagen die Füße
auf den Schultern oder im Gesicht der anderen. Daher war es für die
Patienten, die hochkant liegen mußten, da ihnen nur je etwa 35 ctm.
Platz zur Verfügung stand, unmöglich zu schlafen.
[S. 203]
Der Inhalt der Nachtstühle wurde täglich im Krankenzimmer
selbst in größere Gefäße übergeschüttet. Dadurch und durch das
Herabfallen der Fäkalien auf den Fußboden war die Luft in den Räumen
verpestet.
In den Kleiderkammern hingen die Kleider der mit Krätze und Blattern
behafteten zwischen denen der anderen Patienten. Natürlich auch die
verlausten zwischen den reinen. Wer das Hospital verließ, bekam also
seine Kleidungsstücke infiziert mit Pocken- und Blatterkeimen,
Krätze und Läusen zurück. Auch die Gewandstücke der Verstorbenen
wurden hier aufbewahrt, bis sie – sieben bis acht Tausend pro Jahr –
verkauft wurden, überall hin Krankheiten verbreitend.
Die Strohsäcke der Kranken, die Urin und Exkremente nicht halten
können, werden um vier Uhr morgens geöffnet und auf den Fußboden
ausgebreitet. Gleichzeitig werden die Strohfüllungen der anderen Betten
geleert. Statt den beschmutzten Inhalt an Ort und Stelle zu verbrennen,
wird das Stroh auf Karren ins Hospital Saint-Louis gefahren.
Die Mauern sind bedeckt mit Auswurf, der Fußboden mit Fäkalien, die aus
den Strohsäcken rinnen, oder beim Leeren der Nachtstühle verschüttet
werden. Danach ist auch die Luft in den Sälen.
Im Saale Saint-Jérôme in diesem famosen Hospital, damals dem größten
chirurgischen Operationssaale Europas, ist die Luft durch die
benachbarte Leichenhalle verpestet; die übrige Umgebung strömt
ebenfalls üble Gerüche aus. Sonne fällt nicht hinein.
[S. 204]
In Gegenwart der zu operierenden werden die Instrumente hergerichtet,
ja man operiert in Gegenwart der übrigen Patienten.
Während in Versailles fast niemand an Trepanation stirbt, kommen in
diesem Hospital alle durch Infektion um.
Die kranken Wöchnerinnen liegen mit den gesunden zusammen, drei bis
vier im selben Bett, solche mit Krätze zusammen mit gesunden.
Der Auszug aus dem offiziellen Bericht dürfte genügen[228].
*
Der Friedhof des „Innocents“, der in Paris ein Jahrtausend zur
Bestattung gedient hatte, war so verpestet, daß der Generalleutnant
Berrier im Jahre 1746 mit eigenen Augen einen Schwaden aufsteigen sah
von dem Massengrab, das dort in der Regel etwa 1500 Personen aufnahm.
Im Jahre 1765 beklagten sich – nach zahlreichen Vorläufern – die
Anwohner darüber, daß die Verpestung durch die Ausdünstungen des
Friedhofes derartig stark sei, daß innerhalb weniger Stunden die
Nahrungsmittel in den benachbarten Häusern verdürben.
Erst 1776 wurde die Beerdigung innerhalb der Kirchen behördlicherseits
eingeschränkt, aber noch keineswegs ganz untersagt. Über die damaligen
hygienischen Zustände klärt ein Brief Voltaires an den Dr. Paulet auf:
[S. 205]
„Sie haben in Paris ein Hôtel-Dieu, wo ewige Ansteckung herrscht, wo
sich die Kranken, der eine auf den andern gehäuft, gegenseitig Pest und
Tod aufhängen. Sie haben in den kleinen Sackgassen Schlächtereien, die
im Sommer einen Kadavergeruch verbreiten, der imstande ist, ein ganzes
Stadtviertel zu vergiften. Die Ausdünstungen der Toten töten in euren
Kirchen die Lebenden, und die Beinhäuser des ‚Innocents‘ sind noch ein
Zeugnis von Barbarei, das uns weit unter Hottentotten und Neger stellt.“
Die Ausdünstungen des Friedhofes steigerten sich so, daß am Ende des
Jahres 1779 in einem benachbarten Hause das Licht im Keller erlosch.
Die Beschreibung der weiteren Details ist zu ekelhaft, um hier
wiedergegeben zu werden[229].
[S. 206]
Elfter Abschnitt
Ehre
Wie das Kind den Stuhl schlägt, an dem es sich stieß, statt seiner
eigenen Ungeschicklichkeit gram zu sein, so suchte das Mittelalter
seinen ganzen Haß gegen die doch selbst gewollte Blutgerichtsbarkeit
und Grausamkeit am Henker auszulassen. Damit jeder ihm schon von
weitem ausweichen konnte, wurde im Jahre 1543 dem Scharfrichter
vorgeschrieben, in der Öffentlichkeit mit rot-weiß-grünen Lappen am
Rockärmel und Mantelarmloch zu erscheinen. Der Henker mußte außerhalb
der Stadtmauern wohnen, die Erwerbung des Bürgerrechtes war ihm
versagt, betrat er selbst eine Herberge, so bekam er Speise und Trank
abseits von den anderen Gästen am „Henkertischchen“ gereicht, wobei er
auf einem nur dreibeinigen Stuhle sitzen mußte. Zum Unterschied von den
anderen war sein Krug henkellos, eingegossen wurde ihm rückwärts über
die Hand. Wohl in Erinnerung an diesen Brauch gilt es heute noch am
Rhein als Unhöflichkeit, wenn der Gastgeber einem Gast über die Hand
eingießen wollte. Zahlte der Henker, so mußte er die Münze ablegen,
worauf der Empfänger darüber wegstrich oder darüber hinblies,[S. 207] bevor er
sie einsteckte. Auch in der Kirche hatte er einen von den „ehrlichen
Leuten“ strenge geschiedenen Platz. Wie es dem Henker erging, so auch
dem Schinder oder Abdecker. Bemerkenswert ist die große Ähnlichkeit der
die Verachtung ausdrückenden Gebräuche im Abendlande mit den in Indien
den Parias gegenüber üblichen.
*
Die Frauen der Stadt Husum hatten noch am Ende des 17. Jahrhunderts der
vom Rate besoldeten Wehe- und Bademutter verboten, der Ehefrau des
Henkers oder Schinderknechtes in Kindsnöten beizustehen! Da drohte
der Rat, „wofern sich nicht binnen 24 Stunden eine Frau fände, die
der Bewußten beispränge, so werde E. E. Rat überall keine Bademütter
weiter dulden, sondern dafür sorgen, daß künftighin Mannspersonen des
Barbieramtes den Frauen die benötigte Hülfe leisten sollten“. Aber auch
diese Drohung nützte den frommen Christinnen gegenüber nicht viel. Als
sich endlich ein armes altes Weib zu diesem Liebeswerk fand, mußte sie
selbst im Tode dafür büßen! Die rachsüchtigen Frauen entzogen ihr jede
Pflege und Guttat und ließen selbst ihre Leiche tagelang unbesorgt, bis
der Rat endlich den Nachtwächter zu ihrer Bestattung bewegen konnte.
*
Da das Angebot an Scharfrichtern sehr gering war, half sich der Rat
bisweilen, indem er einen zum Tode Verurteilten das Leben schenkte
unter der Be[S. 208]dingung, Henker zu werden. Ein aus einer anderen Stadt
erbetener Scharfrichter schnitt dann dem Gewählten in offener Zeremonie
zum Zeichen des Standeswechsels beide Ohren ab!
Nur mit Geld war der Henker gut dotiert. Er stand im Gehalte dem
Stadtprediger oder Stadtphysikus gleich, außerdem war er fast
überall Bordellwirt und verdiente durch Ausübung von ärztlicher
Praxis[230].
Erst die französische Revolution erlöste den Henker von der
jahrhundertelangen Unehre. Auch hier waren die Menschenrechte wirksamer
als die christliche Nächstenliebe.
*
Im Mittelalter wurden alle, die sich das Leben genommen hatten,
entweder ausgeschleift und verbrannt, oder in ein Faß getan und (in
Frankfurt) in den Main geworfen. Dabei war es gleichgültig, ob der
Selbstmörder eines Verbrechens bezichtigt war, ob er bei Vernunft
gewesen oder nicht. Nur wenn einer erwiesenermaßen nicht im Besitze
seiner Geisteskräfte war, wurde er nicht verbrannt, sondern ins Wasser
geworfen, bzw. am Ende des Mittelalters auf den Schindanger gebracht
und dort mit etwas Erde überdeckt.
Wer sich selbst erhenkt hatte, durfte durch niemand als den Henker
abgeschnitten werden. Um die Heiligkeit der Haustürschwelle nicht zu
entweihen, mußte dann die Leiche durch ein unter derselben ge[S. 209]machtes
Loch hinausgezogen werden. An einigen Orten warf man die Leiche zum
Fenster hinaus. Es wird als besondere Vergünstigung bezeichnet, daß man
1486 einer Frau gestattete, den Leichnam ihres Mannes, der sich aus
Wahnwitz selbst entleibt hatte, in den Main zu werfen, statt das durch
den Henker tun zu lassen.
*
Im Jahre 1522 wurden sogar die Güter eines Juden, der sich selbst
entleibt hatte, in Frankfurt konfisziert, was sonst nicht Brauch war.
*
Erst im Jahre 1723 kommt es in Frankfurt vor, daß man die Bestattung
eines wahrscheinlich geisteskranken Selbstmörders auf dem gewöhnlichen
Friedhofe erlaubte. Aber sie mußte ganz im stillen und auf dem
hintersten Teile geschehen.
*
Gegen aufgefundene Leichen, selbst wenn es sich um Ermordete handelte,
verfuhr man ganz ähnlich wie gegen Selbstmörder, und zwar aus
religiösen Bedenken. Wußte man doch nicht bestimmt, ob der Tote ein
Christ, und wenn schon, ob er auch ein frommer Christ gewesen
sei, auch war die Möglichkeit, es handle sich doch um Selbstmord, nicht
ausgeschlossen! Deshalb mußte die Erlaubnis des Pfarrers zu einem
ehrlichen Begräbnis eingeholt werden[231].
Erst 1497 kam man in Frankfurt auf den Gedanken, dem zum Tode
Verurteilten den Selbstmord[S. 210] durch eine Art von Zwangsjacke unmöglich
zu machen. Man band den Delinquenten nämlich in einem besonders
konstruierten Stuhl fest[232]. Daß man bis dahin dem armen Sünder, der
unter Umständen zu einem höchst qualvollen Tode verurteilt war, nicht
jede Möglichkeit der Selbstentleibung nahm, dürfte wohl darin seinen
Grund haben, daß nur wenige es versuchten, sich dem Nachrichter durch
eine so schimpfliche Todesart zu entziehen.
*
„Die Zünfte müssen so rein sein, als wären sie von den Tauben gelesen.“
Dieser schöne Grundgedanke wurde gehandhabt wie folgt:
Die bloße Tatsache, daß ein Zunftgenosse einen Hund auf irgendwelche
Weise tötete, hatte zur Folge, daß ihm das Handwerk gelegt
wurde, d. h. daß er und eventuell seine Familie brotlos
gemacht wurden. Man betrachtete den Totschlag eines Hundes als Eingriff
in das verachtete Gewerbe des Scharfrichters.
Im Mittelalter wurden Adelige zur Strafe des Hundetragens verurteilt,
und Widukind erzählt, daß die Übersendung eines räudigen oder
verstümmelten Hundes als Absage an den Feind galt.
Erst durch den § 23 des Reichsschlusses vom 16. August 1731 wurde die
Bestimmung, den Totschläger eines Hundes aus der Zunft auszuschließen,
beseitigt[233].
[S. 211]
Im Jahre 1690 wurde dem jüngsten Sohne eines ehelich geborenen Bauern,
der das Schneiderhandwerk erlernen wollte, die Aufnahme in die
Bunzlauer Schneiderzunft versagt, weil – seine Großmutter vor
50 Jahren, als sie noch unverheiratet war, mit ihrem Dienstherrn ein
Kind hatte!
Im Jahre 1656 legte die Tuchmacherzunft in Grünberg einem Lehrling das
Handwerk, weil seine Mutter im Dreißigjährigen Kriege von einem Reiter
genotzüchtigt worden war, wiewohl der Rat feststellte, daß gegen die
Frau nichts Ehrenrühriges vorlag.
Der Sohn eines Bauern und Gerichtsmannes, der die Weißgerberei erlernen
soll, wird 1691 abgewiesen, weil sein Großvater, ein begüterter
Bauer, vor 30–40 Jahren als gräflicher Diener bei der Kastration von
Pferden geholfen hatte.
*
Damals wurde in die Zünfte nur aufgenommen, wer außer ehelicher Geburt
auch eheliche Erzeugung seiner Eltern und Voreltern nachweisen
konnte! Dasselbe wurde von den Frauen der Zunftgenossen gefordert.
Die Verzeihung eines Ehebruches genügte zum Ausschluß aus der Zunft.
Hammurabi dachte darin milder. § 129 seines Gesetzes lautet: Wenn
jemandes Ehefrau mit einem Zweiten ruhend ertappt wird, soll man sie
(beide) binden und ins Wasser werfen. Wenn der Eheherr der Frau[S. 212]
verzeiht, so soll auch der König seinen Untertan begnadigen[234].
*
Im Jahre 1696 war eine Frau in Hernstadt an der Bartsch im
Fieberdelirium ins Wasser gesprungen und ertrunken. Der Witwer mietete
einen Taglöhner und fuhr mit ihm im Kahn zur Leiche, um sie aus dem
Wasser ziehen zu lassen. Dieser seiner Frau erwiesene Liebesdienst
wurde ihm und seiner Tochter aus zweiter Ehe noch ein Menschenalter
nachgetragen, denn als diese sich mit einem Schneider verheiraten
wollte, wurde ihr wegen der einstigen Schiffsführung ihres Vaters
ein Zeugnis ihrer ehelichen Geburt und ihrem Bräutigam die
Aufnahme in die Zunft verweigert[235].
*
Als im Jahre 1757 der Winterthurer Rittmeister Hegner zur „Sonne“
vier Pferde, die in der Eulach ertrunken waren, herausziehen half,
machte er sich die Tragweite wohl nicht klar: „In raschem Eifer hatte
er an einem Seil gezogen, ohne zu fragen, wer es befestigt, und ohne
sich umzusehen, wer neben ihm ziehe. Bald war er nach Zürich zitiert,
um sich zu legitimieren, daß er nie an einem Seil gezogen oder
eins angerührt, das der Henker angemacht. Auf seine ehrliche
Verantwortung ward ihm auferlegt, ein Attest vorzulegen, daß dies
nicht geschehen. Man ging nämlich damit um, den Rittmeister Hegner
für einen anrüchigen Mann, und somit des ehrenvollsten Dienstes, des
Kommandos einer Dragonerschwadron, für unwürdig zu erklären. In dieser
ehrenhaften Not[S. 213] trat er vor Schultheiß und Rat mit der Bitte, daß
Kundschaft angehört und ihm ein Attest gegeben werde. Allein ‚die
Bedenklichkeit und anscheinende Weitläufigkeit dieses Handels‘ setzte
den Rat in Furcht. Er willfahrte dem Begehren des Bürgers nicht und
ließ um des Scharfrichters willen den Rittmeister im Stich“[236].
*
Als Gegenstück zum subtilen Ehrbegriff der Zünfte seien hier einige
Daten aus der Familiengeschichte der mächtigen Grafen von Cilli
angeführt. Aus diesem Geschlecht hatte Kaiser Sigismund sich seine
berüchtigte Gemahlin Barbara erwählt. Wir werden sie später näher
kennen lernen.
Ulrich II., der Schwager Sigismunds, war ein wilder Knabe. Als er mit
einer Frau ein Verhältnis hatte und deren Mann, den er deshalb in
seine Dienste genommen hatte, ihn um Entlassung bat, gab er sie ihm,
schickte aber Diener nach, die ihn ermordeten. Das ereignete sich etwa
1455, und kein Hahn krähte danach. Sein Vater Friedrich II. war nicht
besser (c. 1370–1454). Zuerst war er vermählt mit Elisabeth, Tochter
des Grafen Stephan Frangipani. Er verließ sie, um sich heimlich mit
der Veronica von Teschewitz zu verbinden. Als der Wüterich dann zur
ersten Frau zurückkehrte, um Versöhnung zu feiern, erstach er sie
mit seinem Jagdmesser. Diesmal war es eine Gräfin, und da konnte die
Sache denn doch nicht vertuscht werden. Friedrich wurde sogar zum
Tode verurteilt, dann begnadigt und seinem Vater übergeben, der ihn
längere Zeit[S. 214] gefangen hielt. Als er frei gelassen wurde, war keine
Frau oder Jungfrau vor ihm sicher. Hatte er eine geschändet, dann
schickte er sie einfach ohne jede Entschädigung wieder zum Mann oder
Vater zurück. Einem Ehemann, der seine Frau nicht ohne weiteres wieder
zurücknehmen wollte, legte er, empört über diese Anmaßung, eine
Geldstrafe auf! Wie könne er es wagen, ihm Schwierigkeiten zu
machen, wo doch er selbst, ein edler Graf, die Umarmungen einer Frau
nicht verachtet habe, die vorher von diesem Plebejer entweiht
worden sei! Einen Adeligen ließ er aus Eifersucht grausam töten, weil
er ihn im Verdacht hatte, mit einer seiner zahlreichen Geliebten sich
eingelassen zu haben. Seine heimliche Gemahlin Veronica ließ sein Vater
Herrmann (1385–1435) im Bade ertränken (c. 1428). Als dieser edle Graf
das Zeitliche segnete, schrieb die Chronik von Cilli – und das ist
bezeichnend – „Nach dem was groß Clag, denn er war ein frommer
Mann und ein rechter Sühner und Friedmacher, wo er mocht
zwischen Armen und Reichen“[237].
*
David Teniers d. J., der sich um den Adel bewarb, sollte ihn 1657 unter
der Bedingung erhalten, daß er keine Malereien mehr ausstelle oder für
Geld male[238].
Die Künstler gehörten ja das ganze Mittelalter hindurch zum
Handwerkerstande und waren genau so zunftmäßig
inkorporiert wie etwa die Metzger oder Tuchmacher. Noch im 17.
Jahrhundert galten die Erzeugnisse der Malerei im allgemeinen gar
nicht[S. 215] höher als ein Stück Tischler- oder Schmiedearbeit, und die
größten Künstler sehen wir mit industriellen Arbeiten, Ladenschildern,
Ofenschirmen usw. beschäftigt. Ein Dürer, Holbein, Burgkmair,
die ersten Größen ihrer Zeit, unterstanden dem Zunftzwang
und wurden, wenn auch als sehr tüchtige, so doch immerhin als
Handwerker eingeschätzt. Jean von Goyen, Aart van der Neer,
Hobbema, Jan Steen, Jakob van Ruisdael II, J. Collaert, also
hervorragende Meister des 17. Jahrhunderts, verdienten noch neben
der Malerei ihr Brot als Garköche, Gastwirte, Strumpfhändler, Bäcker
usw.[239]
*
Erst im Jahre 1773 wurde durch einen vom 20. März datierten Erlaß
der Kaiserin Maria Theresia auf eine Anregung von Antwerpen hin
bestimmt, daß die Maler, Bildhauer, Stecher und Architekten von jedem
Gildenzwang befreit sein sollten und die Ausübung ihrer Künste mit dem
Adelsstande für vereinbar erklärt[240]. Allerdings waren schon lange
vorher einzelnen großen Meistern fürstliche Ehren erwiesen worden. Z.
B. machten weder Rubens noch Guido Reni Besuche, sondern empfingen nur
solche im Atelier. Als letzterer aus Bologna nach Rom zurückkehrte, das
er im Zorn über Honorarschwierigkeiten verlassen hatte, fuhren ihm die
Wagen der Kardinäle bis Ponte Molle entgegen. Als Bernini die erste
französische Stadt betrat, wurden ihm deren Schlüssel überreicht, und
drei Tage vor Paris holte ihn die königliche Sänfte ein[241]. Dagegen
suchten noch bis ins 18. Jahrhundert Mitglieder der Gilden[S. 216] ihre
Arbeiten durch Hausieren an den Mann zu bringen, und es verstieß nicht
gegen den Ehrenkodex, wenn ein Maler oder ein Maler-Kunsthändler sich
an einer Brücke oder sonst einem öffentlichen Platz mit seinen Bildern
aufstellte[242].
*
Auch in Griechenland zur Zeit der höchsten Kunstblüte wurde der
bildende Künstler unter die Handwerker gezählt. Bezeichnend sind
dafür Plutarchs Worte: „Wir schätzen ein Werk, aber wir verachten
seinen Schöpfer“ oder: „Kein anständiger junger Mensch, der den Zeus
in Pisa oder die Hera in Argos sieht, wird sich deshalb wünschen, ein
Phidias oder Apelles zu sein; denn, wenn uns ein Werk angenehm und
gefällig ist, braucht darum doch noch keineswegs sein Schöpfer unsere
Nacheiferung zu verdienen“[243].
*
Wenn uns auch selbst aus dem frühen Mittelalter eine Reihe von
Künstlernamen überliefert sind[244], so war im allgemeinen doch die
Person des Schöpfers eines Kunstwerkes von ganz geringer Bedeutung
gegenüber der, die es bezahlte. Wichtiger als die Meister sind
die Stifter, deren Porträts und Namen sich auf zahllosen Gemälden und
Skulpturen erhalten haben.
[S. 217]
Zwölfter Abschnitt
Religion und Glaube
Die sogenannten Sieben Todsünden sind, wie Zielinski
nachgewiesen hat, aus der heidnischen Astrologie entnommen und haben
wahrscheinlich durch Vermittlung der stoischen Philosophie ihre
Ausbildung erhalten. Auch Horaz kennt sie[245].
*
Der Vers 7 in der 1. Epistel Johannis, Kapitel 5, den die Dogmatiker
als Hauptbeweis für die Lehre von der Dreifaltigkeit brauchen,
ist nach der Untersuchung des katholischen Theologieprofessors
Karl Künstle (Das Comma Joanneum, auf seine Herkunft untersucht.
Freiburg 1905) von dem Häretiker Priscillian im 4. Jahrhundert
eingeschoben worden!! Von demselben Vers erklärte die Indexkongregation
1897, daß es nicht gestattet sei, an seinem authentischen Charakter zu
zweifeln. Künstles Schrift erschien mit bischöflicher Approbation!
*
Demeter, die Mutter des Dionysios, heißt „heilige Jungfrau“,
Isis, die Mutter des Horus, spielt eine besondere Rolle, Sargon, Gudea,
Asernasipal,[S. 218] Asurbanipal usw. behaupten von sich die Jungfrauengeburt
von der Göttin Istar, und diese wunderbare Herkunft wird von ihnen
beansprucht, wiewohl wir ihre wirkliche Herkunft kennen. Das hängt mit
dem Tierkreisbild der Jungfrau zusammen und der Konstellation
der Wintersonnenwende. Um Mitternacht am 25. Dezember geht am
östlichen Punkte des Himmels das Sternbild der Jungfrau auf. Daher die
Festsetzung der Geburt Christi auf diesen Tag und die Legende seiner
jungfräulichen Geburt[246].
Heute noch lehrt die römisch-katholische Kirche die Jungfräulichkeit
Mariä und die Gottheit Christi in dem Sinne, daß Gott
durch den hl. Geist sein Vater wurde. Letzteres wird auch von der
protestantischen Kirche noch aufrecht erhalten. Dazu seien zwei Stellen
des Neuen Testamentes zitiert: Matthäus Kapitel 1 Vers 25: „Und
erkannte sie nicht, bis sie ihren ersten Sohn gebar; und hieß
seinen Namen Jesus.“
Matthäus Kapitel 13 Vers 55 und 56 lauten: „Ist er nicht eines
Zimmermanns Sohn? Heißt seine Mutter nicht Maria? Und seine Brüder
Jakob und Joses und Simon und Judas? Und seine Schwestern,
sind sie nicht alle bei uns?“
Die Evangelien sind eben nur unfehlbar, wenn es gewissen Kreisen und
Institutionen paßt.
Zur Gotteskindschaft Christi finden sich zahlreiche Analogien
in der Antike. Vom Philosophen Plato war schon zu seinen Lebzeiten die
Sage auf[S. 219]gekommen, seine Mutter Periktione habe ihn vom Gott Apollo
empfangen, ebenso war Augustus Apollos Sohn, während Alexanders und
Scipios Vater Zeus war, der auch den Wundermann Apollonius von Tyana
gezeugt haben soll. Origines sagt diesbezüglich: „Der einfache Antrieb,
so etwas von Platon zu erdichten, war, daß man glaubte, ein Mann,
der mit größerer Weisheit und Kraft als die Durchschnittsmenschen
ausgestattet war, müsse auch aus höherem und göttlichem Samen seinen
leiblichen Ursprung gehabt haben.“ Die Nutzanwendung daraus auf
Christus zu ziehen, überließ Origines seinen Lesern[247].
Seit 1870 ist nicht nur Christus von Maria, sondern auch diese von
ihrer Mutter Anna „unbefleckt“ empfangen worden. Wenigstens hat das
Vatikanische Konzil diese Feststellung gemacht.
*
Auch von Buddha wird erzählt, daß er von der jungfräulichen
Königin Maja geboren wurde, in deren Leib das himmlische Geistwesen
Buddha unbefleckt und unbefleckend einging. Auch bei seiner Geburt
erstrahlte überirdisches Licht und erschienen Scharen himmlischer
Geister, die einen Lobgesang anstimmten zum Preise des Kindes, das der
Welt Heil, aller Kreatur Freude und Frieden bringen, die Feindschaft
zwischen Gottheit und Menschheit versöhnen werde. Auch hier erkennt ein
frommer Seher im Kinde den künftigen Erlöser[248].
*
[S. 220]
Die Auferstehung Christi nach drei Tagen erinnert an das große
Auferstehungsfest der Babylonier in Nisan, also etwa gleichzeitig
mit dem Tode und der Auferstehung Jesu. In feierlichen Prozessionen
und Riten wurde in Babel in der Frühlingszeit die Auferstehung
des Marduk gefeiert. Die drei Tage, die Auferstehung Jesu
gleichzeitig mit Sonnenaufgang, die Feier des „Herrentages“, die
Sonnenfinsternis bei Jesu Tode, die Engelerscheinungen
zeigen in die Richtung jener babylonischen Gedanken. Auch der
Satan, die bösen Dämonen, besonders die sieben bösen
Geister, sowie Jesu Selbstbezeichnung „der Menschensohn“ = „der
Mensch“ weisen nach Babylonien[249].
*
Auch der Hexenwahn ist, wie Friedrich Delitzsch in „Mehr Licht“
(Leipzig 1907) feststellt, chaldäischen Ursprungs, und zwar genau in
der Form der römisch-katholischen Kirche. Auch die Verbrennung durch
Feuer – durch solche in Effigie ersetzt – geht auf dieses uralte Volk
zurück.
*
In Tarsus war schon zur Zeit des Pompejus ein Sitz der von Persien
ausgegangenen Mithrareligion. In die Mithrareligion wurde man
durch Weihen aufgenommen, die als ein mystisches Sterben und
Wiedergeborenwerden sich darstellen, wodurch die Schuld des alten
Lebens getilgt und ein neues, unsterbliches Leben durch den Geist
erzeugt werde. Die Geweihten nannten sich deshalb „wiedergeboren
für ewig“. Die Verwandtschaft dieser Lehre mit der des Apostels
Paulus – der bekanntlich in Tarsus lebte – von der christlichen
Taufe (Römer 6) ist schlagend. Auch das hl. Mahl,[S. 221] bei
welchem das geweihte Brot und der Kelch mit Wasser
oder Wein als mystische Symbole zur Mitteilung des göttlichen Lebens
an die Mithragläubigen diente, gehörte zu den Sakramenten
dieser Religion. Auch hier ist die Parallele mit Pauli Lehre vom hl.
Abendmahl schlagend[250].
*
Der Sühnetod Christi hat seine Vorläufer in dem des Adonis,
Attis und Osiris. Bei der Adonisfeier im Frühling wurde zuerst
sein („des Herren“) Tod und die Bestattung seiner durch ein Bild
dargestellten Leiche begangen. Am folgenden – bei der Osirisfeier
am dritten, bei der Attisfeier am vierten – Tage erscholl die
Kunde, daß der Gott lebe, und man ließ ihn, d. h. sein Bild, in die
Luft aufsteigen. Letztere Zeremonie hat sich in der Osterfeier der
griechischen Kirche bis heute erhalten. Paulus, der in Antiochia länger
wirkte, hatte dort diesen Kult zweifellos kennen gelernt. Die Rettung
des Gottes (Adonis, Attis, Osiris) aus dem Tode, galt als Rettung
seiner Kultgenossen. In den Mysterien des Attis, der Isis und des
Mithras wurde durch symbolisches Sterben und in den Hades
hinabsteigen angedeutet, daß die Gläubigen zur Teilnahme am Leben
des Gottes gelangen. In einer Mithrasliturgie betet der Geweihte:
„Herr, wiedergeboren verscheide ich, indem ich erhöhet werde, und da
ich erhöhet bin, sterbe ich; durch die Geburt, die das Leben zeugt,
geboren, werde ich in den Tod erlöst und gehe den Weg, wie du gestiftet
hast, wie du zum Gesetz gemacht und geschaffen hast das Sakrament“.
Die Ähnlichkeit dieser Vorstellung mit der mystischen des Paulus vom
Tod und der Auferstehung[S. 222] Christi und vom Mitsterben und
Mitauferstehen der auf Christum Getauften ist schlagend[251].
*
Bereits im Altertum gab es festbesoldete geistliche Orgelspieler, wie
aus einer in Rhodus gefundenen, aus dem 3. nachchristlichen Jahrhundert
stammenden Inschrift hervorgeht. Der Orgelspieler hat zu Ehren des
Dyonisios Bacchios zu spielen und erhielt dafür jährlich 360 Denare.
Die besonderen Festlichkeiten „zur Erweckung des Gottes“, die nach
dem Osirisvorbilde alle zwei Jahre gefeiert wurden, hatten größte
Ähnlichkeit mit der Karsamstagzeremonie vieler katholischer Kirchen.
Bei diesen Festlichkeiten dürfte der Orgelspieler seine Kunst geübt
haben[252].
*
Die römische Kirche nennt sich heute noch die „Katholische“, also
allgemeine, wiewohl nur etwa ein Drittel der Erdbewohner
Christen sind, von diesen aber etwa 120 Millionen „orthodox“ und
etwa 170 Millionen protestantisch, während der römisch-katholischen
Kirche nur etwa 260 Millionen, also nicht einmal die Hälfte
der Christenheit angehören und nur ein Sechstel der ganzen
Menschheit[253]!
*
Die Kirche lehrt heute noch u. a. folgendes:
„Maria hatte schon den freien Gebrauch des Verstandes, bevor sie das
Licht der Welt erblickte, im Schoß ihrer Mutter Anna. Wir dürfen
annehmen, daß sie schon ungeboren weit mehr von Gott wußte und vom
Jenseits, von des Menschen[S. 223] Ziel und Ende, von den Mitteln, das Ziel zu
erreichen, als die größten Geister nach jahrelangem Denken, Studieren
und Beten wissen[254].“
*
Der Kardinal und Fürsterzbischof von Salzburg erließ am 2. Februar
1905 einen Hirtenbrief, in dem folgende Stellen über die Macht des
Priesters vorkommen: „Wo auf der ganzen Erde ist eine Gewalt, welche
dieser Gewalt gleichkommt?“ Die Gewalt der Fürsten und Könige wird
durch sie übertroffen. Aber wo ist selbst im Himmel eine solche
Gewalt?: „Wenn du dort dich umschaust, so siehst du die Schar der
Patriarchen und Propheten, der Märtyrer und Blutzeugen und die Scharen
der hl. Jungfrauen und dann die Engel und Erzengel und die Throne und
Herrschaften – können sie dich lossprechen von deinen Sünden? Nein...
selbst Maria, die Gottesmutter, die Königin des Himmels, sie kann es
nicht... O unbegreiflich hohe Gewalt! Der Himmel läßt sich von
der Erde die Art und Weise zu richten vorschreiben, der Knecht
ist Richter auf der Welt, und der Herr bestätigt im Himmel das
Urteil, das jener auf der Erde fällt.“
Der Priester besitzt die Gewalt, Brot und Wein in den wahren
Leib und das wahre Blut Christi zu verwandeln: „Christus,
der eingeborene Sohn Gottes des Vaters, durch den Himmel und Erde
geschaffen sind, der das ganze Weltall trägt, ist dem katholischen
Priester hierin zu Willen.“ Christus hat „dem katholischen
Priester über Sich, über[S. 224] Seinen Leib, Sein Fleisch und Blut,
Seine Gottheit und Menschheit Gewalt gegeben und leistet dem
Priester Gehorsam[255],“ d. h., er läßt sich von ihm verspeisen.
*
Noch heute steht für die römisch-katholische Kirche die Existenz
eines wahrhaftigen Teufels fest. Am 13. und 14. Juli 1891 hat
der Pater Aurelian vom Wemdinger Kapuzinerkloster nach eingeholter
Erlaubnis der Bischöfe von Augsburg und Eichstätt mit eigener Hand
den Teufel aus einem besessenen Knaben ausgetrieben und einen
„authentischen Bericht“ über den ganzen Vorgang am 15. August 1891
im Klosterarchiv niedergelegt. Darin erklärt Pater Aurelian u. a.
wörtlich: „Wer die Besessenheit in unsern Tagen leugnen wollte, der
bekennt hiermit, daß er abgeirrt ist von der Lehre der katholischen
Kirche[256].“
*
In den katholischen und protestantischen Schulen wird heute noch
gelehrt, daß Gott in sechs Tagen die Erde aus nichts schuf, daß
Adam aus Lehm, Eva aus einer Rippe gemacht wurde, kurz die ganze
biblische Schöpfungsgeschichte, und zwar nicht etwa als Mythus oder zur
Veranschaulichung für die kindlich naive Art, in der man sich vor 2½
Jahrtausenden diese gewaltigen und restlos wohl nie löslichen Probleme
klarzumachen suchte, sondern alles als buchstäbliche, geoffenbarte
Wahrheit. Wer schon etwas geweckter ist und daran zweifelt,
riskiert eine ungenügende Religionsnote, die Versetzung in[S. 225] höhere
Klassen ausschließt. So erziehen Staat und Kirche zu Überzeugungstreue
und Wahrhaftigkeit!
*
Eine erbauliche Geschichte, die heute noch – neben mancher
gleichwertigen – in den Volksschulen gelesen wird, ist die von der
Volkszählung Davids (2. Buch Samuelis, 24. Kap.): Gott hat den
König David angereizt, Israel und Juda zu zählen, worauf der König dies
Geschäft seinem Feldherrn Joab übertrug. Trotz der Gegenvorstellungen,
die jener erhob, blieb David – wie ja mit Rücksicht auf den hohen
Auftraggeber selbstverständlich – bei seinem Befehl, und so ging die
Volkszählung im ganzen Lande vonstatten. Als sie aber vorüber war,
bekam der König Gewissensbisse und betete zu Gott: „Ich habe schwer
gesündigt, daß ich das getan habe, und nun, o Gott, nimm hinweg die
Missetat deines Knechtes, denn ich habe sehr töricht gehandelt.“ Gott
aber ließ David die Wahl zwischen dreierlei Heimsuchungen: „Willst
du, daß sieben Jahre Hungersnot in dein Land kommen? Oder daß du drei
Monate lang verfolgt von deinen Feinden fliehen müssest? Oder daß drei
Tage Pestilenz in deinem Lande sei?“ Der König, landesväterlich wie er
nun einmal war, wählte die Pestilenz, der 70000 aus dem Volke erlagen.
Dann erlosch die Seuche. Nun dämmerte es David – der, man bedenke,
die Volkszählung auf Gottes Befehl ausführen läßt und dann sein
Volk, zur Strafe für seinen Gehorsam, aufopfert, weil er selbst die
Konsequenzen nicht tragen will – daß er doch jedenfalls eher etwas
verschuldet[S. 226] habe als sein Volk, und er sprach zu Gott: „Siehe, ich
habe die Missetat begangen, aber diese Schafe (nämlich das Volk, das
nicht ohne Grund in der Bibel immer so genannt wird), was haben sie
getan? Laß doch deine Hand wider mich und meines Vaters Haus sein.“ Er
wurde aber nicht weiter bestraft, und die Sache war erledigt.
Auf diese Weise wird in den Volksschulen ad oculos die Gerechtigkeit
Gottes demonstriert, desgleichen die Herrschertugenden Davids und die
kulturelle Höhe des „auserwählten“ Volkes, dessen Gesetze uns heute
noch vorgehalten werden. Das Beispiel taugte besser zum Beweise für
die Rückständigkeit und Barbarei des jüdischen Aberglaubens und – die
Verbohrtheit der modernen religiösen Erziehung[257].
*
Herr Commer, unrühmlich bekannt durch sein Verhalten in der
Schellaffäre, hat die Erdbeben als „Grollen des Satans“ erklärt, steht
auf dem Standpunkt der Bautzschen Höllentheorie, leugnet die Umdrehung
der Erde um die Sonne, spricht dem Foucaultschen Pendelversuch die
Beweiskraft ab, lehrt die Erschaffung der Welt in 6 Tagen à 24 Stunden
und verteidigt die Hexenverbrennung. Trotzdem oder wohl deshalb ist
er päpstlicher Prälat, Doktor der Theologie und Jurisprudenz und
ordentlicher Universitätsprofessor in Wien, und zwar das alles im 20.
Jahrhundert[258].
*
Gegen die Eherechtsreformer in Österreich, die Aufhebung des bisherigen
mittelalterlichen Gesetzes[S. 227] erwirken wollen – dort ist heute noch die
Ehescheidung (nach deutscher Terminologie) unzulässig, die getrennten
Gatten aber müssen bis zum Tode des anderen ledig bleiben; ein
kostbares Vermächtnis aus der klerikal-feudalen Vergangenheit – wird
heute noch als gewichtigstes Argument angeführt, daß – Gott
selbst im Paradiese die Ehe zwischen Adam und Eva als unlösliche
Institution eingesetzt habe!!![259]
*
Heute noch wird gelehrt, daß die Menschheit durch den Sündenfall
sich die Strafen der Hölle und des Fegefeuers zugezogen hätte.
„Der allmächtige Gott hat nämlich den Menschen zuerst schwach und
unvollkommen geschaffen und ihn sodann verantwortlich gemacht. Der
allwissende Gott hat Adam und Eva einer Probe unterworfen, von der er
natürlich voraus wußte, daß sie sie nicht bestehen würden. Und als dann
dieser Fall wirklich eingetreten war, hat der allgütige und gerechte
Gott dafür nicht bloß sie selbst, sondern auch alle ihre Nachkommen
mit ewiger Verdammnis bestraft. So entstand die Erbsünde. Und auf eine
gleich klare und überzeugende Weise wurde die Menschheit auch wieder
von ihr erlöst.“[260]
*
Durch den Syllabus Papst Pius IX., der natürlich heute noch zu Recht
besteht, wurden unter anderem folgende „Irrtümer“ verdammt:
§ 12. „Die Dekrete des apostolischen Stuhles und der römischen
Kongregationen hindern den freien Fortschritt der Wissenschaft.“
[S. 228]
§ 18. „Der Protestantismus ist nichts anderes, als eine verschiedene
Form derselben christlichen Religion, in welcher es ebensogut möglich
ist, Gott zu gefallen, wie in der katholischen Kirche.“ Damit wird also
dem Protestantismus die Qualität einer christlichen Kirche abgesprochen!
§ 45. „Die ganze Leitung der öffentlichen Schulen, in denen die
Jugend eines christlichen Staates erzogen wird, nur die bischöflichen
Seminarien in einiger Beziehung ausgenommen, kann und muß der
Staatsgewalt zugewiesen werden, und zwar so, daß keiner anderen
Autorität irgendein Recht, sich in die Schulzucht, in die Ordnung der
Studien, in die Verleihung der Grade und die Wahl oder Approbation
der Lehrer zu mischen, zuerkannt werden kann.“ Also geistliche
Schulaufsicht und Aufsicht über die Universitäten wird heute noch
gefordert!
§ 53. „... die staatliche Regierung kann sogar allen Hilfe leisten,
welche den gewählten Ordensstand verlassen und die feierlichen Gelübde
brechen wollen.“
§ 74. „Ehesachen und Verlobungen gehören ihrer Natur nach vor das
weltliche Gericht.“
§ 77. „In unserer Zeit ist es nicht mehr nützlich, daß die katholische
Religion unter Ausschluß aller anderen Kulte als einzige Staatsreligion
gelte.“
§ 78. „Es ist daher zu loben, daß in gewissen katholischen Ländern
gesetzlich verordnet ist, daß den Einwanderern die öffentliche Ausübung
ihres Kultus, welcher er auch sei, gestattet sein solle.“ Also heute
noch fordert das Papsttum vom Staate, daß er zwar[S. 229] die Erziehung der
eigenen Jugend nicht leiten darf, aber allen Andersgläubigen
Religionsfreiheit versagt[261].
Die Sätze 19, 23, 24 und 27 dieses Syllabus beweisen das Verlangen
auch heute noch, die Ketzer zu vernichten. Im kanonischen Recht
besteht noch Todesstrafe für Häresie, wie auch jeder Bischof dem
Papst schwören muß, die Ketzer zu verfolgen.[262]
*
Ein Kulturkuriosum ersten Ranges ist der Syllabus Pius X. vom 4. Juli
1907, ein noch größeres, daß es sogar gebildete Menschen gibt, die
sich darum kümmern! Durch diese zwar nicht „unfehlbare“, aber doch
durch die gewaltige Autorität des Papsttums gestützte Entscheidung wird
die Kirche als höchste Instanz bei Entscheidung wissenschaftlicher
Fragen, selbst solcher rein profaner Art, proklamiert. Nach § 7
kann die Kirche, wenn sie „Irrtümer“ verwirft, sogar die innere
Zustimmung von den Gläubigen verlangen, also nicht nur äußeren
Gehorsam. Die ganze moderne Bibelwissenschaft wird verdammt, besonders
aber im § 11 ausdrücklich konstatiert, daß die göttliche Inspiration
sich in der Weise über die gesamte heilige Schrift erstreckt, daß sie
alle ihre einzelnen Teile vor jedem Irrtum bewahrt! Der folgende
§ verbietet ausdrücklich, die Bibel so auszulegen wie andere Bücher
menschlichen Ursprungs.
Die §§ 20–26 verurteilen die wissenschaftlich festgestellte Diskrepanz
zwischen den historischen Tatsachen und den kirchlichen Dogmen, die
folgenden die Ergebnisse der historisch-kritischen Forschung über die
Person Christi. Endlich wird die genetische Ent[S. 230]wicklung des
Sakramentenwesens verworfen, z. B. im § 44 behauptet, daß schon
die Apostel das Sakrament der Firmung anwandten, desgleichen
die der kirchlichen Verfassung und Verwaltung, sowie die der Lehre.
Den Schluß aber bildet die Konstatierung, daß die bisherigen
theologischen Lehren und Anschauungen nicht revisionsbedürftig
seien.
Wer unbefangen den Syllabus liest, wird mit fast allem einverstanden
sein, bis er erfährt, daß vor jedem ein „verdammt wird die Behauptung“
zu denken ist.
*
Zur Zeit der Kreuzzüge war bei der Taufe völlige Nacktheit
erforderlich. Und zwar erstreckte sich diese auch auf die Damen der
„Heiden“ bzw. Mohammedaner, denen beizuwohnen den christlichen Rittern
sicherlich Vergnügen bereitete[263].
*
Der Beichtvater hatte das Recht, sein Beichtkind zu schlagen. Auch die
heilige Elisabeth mußte sich von ihrem Beichtvater Konrad von Marburg
solche Züchtigung gefallen lassen.
*
Die fromme Nonne Juliane, die in dem Kloster auf dem Berge Coreillon
bei Lüttich lebte, hatte einst eine seltsame Erscheinung: beim Beten
sah sie regelmäßig den vollen Mond mit einer kleinen Lücke. Von
autoritativer Seite wurde diese Vision auf die natürlichste Weise
erklärt: der Mond stelle die Kirche, die Lücke aber den Mangel
eines Festes zur Feier der Einsetzung des heiligen Abendmahles
vor. Diese Interpretation war so evident, daß sich der Bischof Robert
von Lüttich, von den Archidiakonen[S. 231] Johannes und Jacobus Pantaleon
und anderen Theologen aufgeklärt, ihrer Logik nicht entziehen konnte.
So ordnete er denn 1246 die Feier des so dringend gebotenen Festes in
seinem Bistum an. Als jener Pantaleon 1261 als Urban IV. den Stuhl
Petri bestiegen hatte, verordnete er – 1264 – durch eine Bulle die
Feier in der ganzen katholischen Kirche. Noch heute wird bekanntlich
Fronleichnam alljährlich mit größtem Pompe begangen[264].
*
Kaiserin Barbara, Gemahlin Sigismunds, starb am 11. Juli
1451 an der Pest. Sie war häufig im Ehebruch von Sigismund ertappt
worden, da dieser selbst aber nichts weniger als treu war, verzieh
er ihr jedesmal. Als Witwe lebte sie in Melnik bei Königgrätz „unter
einem Schwarm von Buhlknaben und Beischläfern“. Messalinen hat es
immer gegeben, deshalb ist dieser Lebenswandel nicht sonderlich
verwunderlich, wenn es auch nichts Alltägliches ist, wenn eine deutsche
Kaiserin verzehrt von unersättlicher Sinnlichkeit – wie Enneas Sylvius
bezeugt – den Männern nachläuft. Desto bemerkenswerter ist Barbaras
krasser Materialismus. „So weit sank sie in ihrer wahnsinnigen
Verblendung, daß sie heilige Jungfrauen, die für den Glauben an Jesu
den Tod erlitten, öffentlich Törinnen schalt, welche die Freuden der
sinnlichen Lust nicht zu genießen verständen ... Sie leugnete auch, daß
es nach diesem Leben ein anderes gäbe, und behauptete im Ernst, daß die
Seelen mit den Körpern zugrunde gingen“[265].
*
[S. 232]
In „Aucussin und Nicolette“ läßt schon einige Jahrhunderte früher die
reizende „Chantefable“ den Helden auf die Mahnung, sein Seelenheil
nicht aufs Spiel zu setzen, antworten: „Was habe ich denn im Paradies
zu tun? Ich will gar nicht ins Paradies, aber meine liebste Nicolette
will ich. Ins Paradies gehören alte Priester und Bettler, die stets vor
dem Altar herumgelegen haben, in häßlich schmutziger Kleidung, halb tot
vor Hunger und Kälte; die gehören ins Paradies! Was hab ich mit
ihnen zu schaffen? – Aber in die Hölle will ich, wo die Dichter sind
und die Ritter, die im Turnier oder im Kriege starben, wo die schönen
Frauen sind, die zwei Freunde hatten oder drei mit ihrem Eheherrn,
dort glänzt Gold und Silber, dort prangen edle Pelze und Hermeline,
dort sind Harfner und Spielleute und die Könige dieser Welt. Mit
ihnen will ich sein und Nicolette, meine süße Freundin, bei mir
haben[266].“
Heine kleidete bekanntlich denselben Gedanken in die Worte: Den Himmel
überlassen wir den Engeln und den Spatzen.
*
Im Jahre 1905 erschien in zweiter Auflage mit kirchlicher Approbation
in Mainz ein Werk von Dr. Joseph Bautz, a. o. Professor der Theologie
an der kgl. Universität zu Münster, „Die Hölle“ betitelt. In diesem
grundgelehrten von profunder Weisheit strotzenden Buche wird eingehend
Dasein, Ort und Dauer der Hölle ergründet. Er kommt dabei besonders S.
36 ff. zu dem Resultate, daß sie[S. 233] im Innern unserer Erde liege, aber
das genügt dem kühnen Entdecker nicht, er geizt nach höheren Lorbeern.
Und das ist gut so, denn nur durch diese laudum immensa cupido ist
es zu erklären, daß Bautz sich das unsterbliche Verdienst erwirbt,
sogar eine Topographie der Hölle festzustellen. Es gibt vier
unterirdische receptacula, von denen die eigentliche Hölle am untersten
liegt, während der sinus Abrahae „in höherer und würdigerer Lage sich
befindet. Dafür spricht auch der Umstand, daß der reiche Prasser,
um den Lazarus zu schauen, seine Augen aufhob. Der limbus
puerorum liegt in der Nähe des sinus Abrahae in einiger Entfernung
von der eigentlichen Hölle und wird wie letzterer von ihren Flammen
nicht berührt. Das Fegefeuer aber befindet sich wohl in unmittelbarer
Nähe der Gehenna, weil viele Theologen mit dem h. Thomas behaupten,
das Feuer des Purgatoriums sei mit dem der Hölle ganz identisch. Dazu
kommt, daß die unmittelbare Nähe der Hölle um so mehr zur Betrübnis,
zur Verdemütigung und Läuterung der armen Seelen gereichen muß. Und
mögen diese Seelen auch durch die Gnade den erbsündigen Kindern an
Würde überlegen sein, für die Zeit ihrer Läuterung gebührt ihnen doch
schärfere Züchtigung und deswegen auch ein niederer Ort.“
Der sinus Abrahae ist zur Zeit unbewohnt, nach der Auferstehung wird es
auch das Fegefeuer sein. Die im limbus puerorum wohnenden Kinder werden
dann eine andere Behausung zugewiesen erhalten.
Daß die Hölle etwa zu klein für unsere sündigen Seelen sein sollte,
braucht uns nicht zu besorgen,[S. 234] denn wenn sie auch zur Zeit – trotz
Freimaurerei, Liberalismus und Freigeisterei – wie der gelehrte
Verfasser ermittelte, nur wenig umfangreich ist, so hat doch Lessius
berechnet, „daß ein ganz geringer, verschwindender Teil des Erdinnern
hinreicht, um eine geradezu fabelhafte Anzahl von Menschen aufzunehmen“.
Nicht hoch genug kann das Verdienst des Höllentopographen veranschlagt
werden dafür, daß er für die Vulkane eine überzeugende und
einfache Erklärung gefunden hat. Sie sind – Schlote der Hölle!
So ist auch die Lösung dieses Rätsels dem 20. Jahrhundert gelungen.
Zeppelin und Bautz können sich in berechtigtem Stolze die Hände reichen.
Dieses Buch kann sich, wie der Verfasser im Vorwort zur zweiten Auflage
mit Genugtuung konstatiert, der Zustimmung zahlreicher Theologen, auch
protestantischer, erfreuen. Ja, sogar seinen Plagiator hat Bautz
gefunden!!!
Da es haarsträubenderweise „aufgeklärte Geister gibt, für welche Hölle
und Teufel Märchen sind“, die sogar an Bautz’ Höllentheorie, an den
„grausigen Flammen, die hart unter unseren Füßen drohend lodern“, zu
kritteln wagen, muß er ihnen gegenüber Stellung nehmen. Er tut es
in der vornehmen Sachlichkeit und bescheidenen Würde, die sein als
Kulturkuriosum unschätzbares Werk auch sonst auszeichnen.
„Glücklicherweise gehören derartige Intelligenzen nicht zu den Quellen,
aus denen der katholische[S. 235] Theologe zu schöpfen, auch nicht zu den
Auktoritäten, deren Urteil für ihn irgend einen Wert hat.“ Ja, Bautz
kann auch scharf sein, aber nur um der guten Sache willen.
*
Im Jahre 1902 erließ der preußische evangelische Oberkirchenrat
eine Verordnung, die eine einheitliche Regelung des Lernstoffes
für den evangelischen Schul- und Konfirmandenunterricht
durch die Provinzialkonsistorien unter Vereinbarung mit den
Provinzialschulkollegien und den Regierungen anordnete. Sie ist jetzt
in allen Provinzen durchgeführt worden. Danach müssen die Kinder
folgendes auswendig lernen: 20–40 Sprüche aus dem Alten, 100–110
Sprüche aus dem Neuen Testament, 6 Psalmen, 20 Kirchenlieder und den
Wortlaut der 5 Hauptstücke des lutherischen Kleinen Katechismus.
Das sind in Summa mindestens 180 Bibelverse und 180
Kirchenliederstrophen, die die Kinder sich wörtlich
einprägen müssen. Auf dem Lande sind es meistens noch viel mehr, da
damit ja nur das Mindestmaß an geistiger Atzung fixiert ist.
Der religiöse Memorierstoff der Berliner Gemeindeschule fordert laut
Lehrplan 121 Kirchenliederverse, 110 Bibelsprüche, den Wortlaut
der ersten drei Hauptstücke des lutherischen Katechismus, ferner
fünf Psalmen mit zusammen 45 Versen, das alles von 10–11jährigen
Kindern! Diese Weisheit wird in sechs Wochenstunden, denen nur zwei
Stunden für Rechnen gegen[S. 236]über stehen, eingetrichtert. Wer da nicht
fromm wird, dem ist einfach nicht zu helfen[267].
*
Im Jahre 1885 „bekehrte“ sich der in Frankreich sehr bekannte
Schriftsteller und Freidenker Leo Taxil. Der päpstliche Nuntius
in Paris nahm ihn sofort unter seine besondere Obhut und forderte ihn
auf, mit seiner Feder hinfort für die Kirche Gottes zu kämpfen.
Das tat er auch und seiner emsigen Feder entströmten eine Reihe von
Werken, die zwar an Wahnwitz und Teufelsspuk das Tollste enthielten,
was die Phantasie aushecken konnte, nichts desto weniger oder
vielleicht auch deshalb den Beifall der katholischen Presse, den
der Geistlichkeit, ja sogar die Zustimmung des Papstes Leo XIII.,
der alle las, und enorme Verbreitung fanden. Doch das genügte dem
Pfiffikus nicht, und so vereinigte er sich denn mit einem Dr. Karl
Hacks, um durch etwas noch Großartigeres zu beweisen, was hundert
Jahre nach Kant, im Zeitalter der Naturwissenschaften und der Technik
gläubigen Gemütern alles aufgetischt werden konnte. Unter dem Namen
Dr. Bataille schrieb dieser das Buch „Le Diable au 19. siècle“,
dessen erste Lieferung am 29. September 1892 erschien. Es ist ein in
Romanform geschriebenes Reisewerk, worin Dr. Hacks die verschiedenen
Länder, die er bereist hat, beschreibt unter dem Gesichtspunkt des
Teufelskultus, der in ihnen getrieben wird.
So sieht der Verfasser z. B. beim Satanspapst Pike ein teuflisches
Telephon, durch welches er den[S. 237] sieben großen Direktorien, Charleston,
Rom, Berlin, Washington, Montevideo, Neapel und Kalkutta seine
Weisungen übermittelt.
Mit Hilfe eines magischen Armbandes kann Pike den Luzifer jeden
Augenblick herbeirufen. Eines Tages nahm Satan Pike sanft auf seine
Arme und machte mit ihm eine Reise auf den Sirius(!). In wenigen
Minuten waren über 50 Millionen Meilen zurückgelegt. Nach Besichtigung
des Sternes langte Pike in den Armen Luzifers wohlbehalten wieder in
seinem Arbeitszimmer in Washington an.
In London wird durch diabolische Künste ein Tisch zum Plafond gebracht
und in ein Krokodil verwandelt, das sich ans Klavier
setzt, fremdartige Melodien spielt und die Hausfrau durch
ausdrucksvolle Blicke in Verlegenheit bringt! In diesem Stile geht
es weiter.
Ein zweiter Mitarbeiter Taxils war der Italiener Margiotta, der im
Jahre 1894 das Buch „Adriano Lemmi, chef supréme des Franc-Maçons“
schrieb. Er verdiente damit in wenigen Monaten 50000 Frs. und der
ultramontane Verlag von Schöningh in Paderborn beeilte sich, mit
diesem Erzeugnis die deutschen Katholiken zu beglücken. Er erzählt,
daß der Teufelspapst Memmi im Palazzo Borghese zu Rom einen förmlichen
Satansdienst eingerichtet habe. Er ließ ein Kruzifix mit nach unten
hängendem Christuskopf unter dem Rufe „Ehre dem Satan“ bespeien,
durchbohrte bei jedem Briefe, den er an seinem Schreibtisch schrieb,
Hostien, die aus katholischen Kirchen entwendet waren, mit einer
Bohrfeder, ließ bei allen Banketten der Freimaurer Satanshymnen singen[S. 238]
und besondere Räume für Mopsschwestern (Frauenloge, deren Ritual
Taxil in seinen „Dreipunktbrüdern“, Verlag der Bonifatius-Druckerei
zu Paderborn, eingehend beschreibt) einrichten, mit denen die Brüder
Orgien feierten. Dabei tritt Bataille die obscönsten Dinge mit Behagen
breit, in dem er sich auf höhere Weisung beruft: „Wir gehorchen ohne
Hintergedanken den Befehlen des Heiligen Vaters, der will, daß wir der
Freimaurerei die Maske abreißen, mit der sie sich verhüllt, und sie so
zeigen, wie sie ist.“
Damit nicht genug, ließ Taxil mit Hacks vom Juli 1895 bis Juni 1897
in Paris das Lieferungswerk „Miß Diana Vaughan. Mémoires d’une
Expalladiste. Publication mensuelle“ erscheinen. Es waren die Memoiren
eines früher dem Teufel verschriebenen, jetzt bekehrten jungen Mädchens
mit ihren eigenen Worten geschildert und – wie die Dame selbst –
natürlich von den beiden Witzbolden erfunden.
Wie nicht anders zu erwarten, fanden die Memoiren in der katholischen
Welt reißenden Absatz und begeisterte Lobredner. Sie verdienten es aber
auch. Miß Vaughan war nämlich am 29. Februar 1874 geboren als Frucht
einer Verbindung ihrer Mutter mit dem Teufel Bitru, dem sie
schon als kleines Kind geweiht wurde. Als sie mit 10 Jahren „Meister“
der Palladistenschule zu Louisville in Amerika wurde, brachte der
Oberteufel Asmodeus außer 14 Legionen Unterteufeln auch den Schwanz
des Löwen des Evangelisten Markus mit, den er selbst ihm abgeschnitten
hatte. Dieser Löwenschwanz legte sich Diana um den Hals und gab ihr
einen Kuß![S. 239] usf., folgt eine Geschichte immer haarsträubender als die
andere. So von der Sophie Walder, die am 23. September 1863 als Tochter
Bitrus geboren, von ihm gesäugt und dann verführt wurde, so daß
Bitru ihr gegenüber als Vater, Amme und Gatte sich vorstellt!
Noch im Dezember 1895 konnte die „Germania“ in mehreren
Sonntagsbeilagen diese erbaulichen Geschichten ihren Lesern als
Wahrheit erzählen! Die Stimmen aus Maria Laach, die
Historisch-Politischen Blätter und andere angesehene katholische
Organe blieben dahinter nicht zurück. Die Spekulation des Kleeblattes
auf die, welche nicht alle werden, hatte durchschlagenden Erfolg.
Auf einen Brief Taxils, den er als „Miß Vaughan“, Tochter Bitrus, an
den Kardinalvikar von Rom, den Kardinal Parochi schrieb, in dem er ihm
seine „Eucharistische Novene“ und 500 Francs übersandte, antwortete
dieser:
„Rom, den 16. Dezember 1895.
Mein Fräulein und liebe Tochter in unserm Herrn!
Mit lebhafter und süßer Rührung habe ich Ihr Schreiben vom 29. November
zugleich mit dem Exemplar der „Eucharistischen Novene“, erhalten.
Zunächst bescheinige ich den Empfang der mir gesandten Summe von 500
Frs., von denen 250 nach Ihrer Bestimmung für das Organisationswerk des
nächsten Antifreimaurerkongresses verwandt werden. Die andere Hälfte
in die Hände Seiner Heiligkeit[S. 240] für den Peterspfennig zu legen, ist
mir eine Freude gewesen. Sie (Seine Heiligkeit) hat mich beauftragt,
Ihnen zu danken und Ihnen seinerseits einen ganz besonderen Segen
zu schicken... Ihre Bekehrung ist einer der herrlichsten Triumphe der
Gnade, die ich kenne. Ich lese in diesem Augenblick Ihre Memoiren,
die von einem brennenden Interesse sind...“
Am 27. Mai 1896 schrieb der päpstliche Geheimsekretär Rod. Verzichi an
die famose „Miß Vaughan“ auf ausdrücklichen Befehl Seiner Heiligkeit,
daß der Papst „mit großem Vergnügen“ die Eucharistische Novene gelesen
habe.
Vom 26. September bis 1. Oktober 1896 tagte der Antifreimaurerkongreß
in Trient, unterstützt durch 22 Kardinäle, 23 Erzbischöfe und 116
Bischöfe und durch einen besonderen Segen Leos XIII. gestärkt.
Schon im August war Leo Taxil als einer der Vorstände des
Zentralexekutivkomitees des Antifreimaurerbundes vom Papste in
besonderer Audienz empfangen worden.
Am 29. September hielt im Angesicht des versammelten Kongresses der
Abbé de Bessonies eine Rede, in der er mit Nachdruck aussprach, daß das
antifreimaurerische Frankreich alles das für wahr halte und fest
glaube, was er über die Echtheit der Vaughanenthüllungen vortrage.
Leo Taxil ergriff selbst das Wort und wurde begeistert wegen seiner
Verdienste um die Kirche gefeiert!
Am 19. April 1897 erklärte Taxil im Sitzungssaale der Gesellschaft für
Erdkunde zu Paris sein ganzes bisheriges Tun und Treiben, seine Bücher
und[S. 241] Schriften, sei ein einziger, großer, mit vollem Bewußtsein
von ihm begonnener und fortgesetzter Schwindel! Er schloß seine
Rede mit den an die zahlreich versammelten katholischen Geistlichen
und Journalisten gerichteten Worten: „Meine hochwürdigen Väter, ich
danke aufrichtig den Kollegen der katholischen Presse und unsern
Herrn Bischöfen dafür, daß sie mir so trefflich geholfen haben, meine
schönste und größte Mystifikation zu organisieren[268].“
[S. 242]
Dreizehnter Abschnitt
Die „Hexen“ oder Ecclesia non sitit sanguinem!
Bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts etwa bekämpfte die katholische
Kirche den Hexenglauben oder war ihm gegenüber wenigstens sehr
skeptisch. Der „engelgleiche Doktor“ Thomas von Aquino, heute noch
größte Autorität der Kirche, bildete dann die unflätige Theorie von
den incubus und succubus aus, die nur als Wirkung des Zölibates zu
verstehen ist, und dieser Wahnwitz imponierte so gewaltig, daß nicht
zum wenigsten auf diese Autorität hin die Kirche die systematische
Hexenverfolgung betrieb. Heute behaupten Apologeten, daß die Kirche für
die Hexenprozesse keine Verantwortung habe, denn sie ist ja bekanntlich
unfehlbar. In der Abschwörungsformel aber, die der berüchtigte Malleus
maleficarum, der Hexenhammer, für die nicht an Hexerei Glaubenden
aufstellt, heißt es: „Der Unglaube an Hexerei verstößt ausdrücklich
gegen die Entscheidung der heiligen Mutter, der Kirche, aller
katholischen Lehren und der kaiserlichen Gesetze. Die Entscheidung
zweifelhafter Dinge im Glauben steht vor allem bei der Kirche und
vornehmlich beim Papste;[S. 243] von der Kirche aber ist gewiß, daß sie nie
im Glauben geirrt hat.“
Als der Professor der Theologie Cornelius Loos, ein eifriger
Katholik, 1591 den Hexenwahn bekämpfte, ließ ihn der päpstliche
Nuntius Frangipani in Trier einsperren und zwang ihn zum
Widerruf. Unter anderem mußte er anerkennen, daß seine Behauptung,
die Hexenausfahrten seien eine Täuschung, stark nach Ketzerei
rieche. Der Jesuit Delrio fügt hinzu: „Mögen die Anhänger des Loos
erfahren, wie vermessen und schädlich es sei, die Delirien eines Weier
(der ebenfalls den Hexenwahn bekämpfte) dem Urteil der Kirche
vorzuziehen[269].“
*
Daß die Intelligenz unter kirchlicher Ägide wenigstens in diesem Punkte
zunahm, wird sich schwerlich behaupten lassen! Wundervoll aber ist eine
Unfehlbarkeit, die offensichtlich sogar fortbesteht, wenn das konträre
Gegenteil zu verschiedenen Zeiten gelehrt wird!
*
Der Kirche war es vorbehalten, den im 15. Jahrhundert nur mehr
schwach im Volke vertretenen Hexenglauben durch den Hexenhammer
frisch zu beleben. Schon damals gab es Leute, die – zur
Entrüstung der beiden wackeren Dominikaner und Theologieprofessoren
Institoris und Sprenger, den Verfassern des „Hexenhammers“ – zu
behaupten wagten, es gebe keine andere Hexerei auf der Welt,[S. 244] als im
Glauben der Menschen. Gegen diese auf Humanismus und fluchwürdige
Emanzipation von der unfehlbaren kirchlichen Lehre zurückzuführende
Ketzerei, hinter der das Schrecklichste zu vermuten war, das jemals
der mittelalterlichen Kirche drohte: der gesunde Menschenverstand,
mußte natürlich energisch vorgegangen werden. Papst Innozenz VIII. –
welche Ironie liegt allein in diesem Namen! – erließ am 5. Dezember
1484 die Bulle „Summis desiderantes affectibus“, ein erhabenes Dokument
wahrhaft väterlicher Liebe, gedacht im Geiste Christi. Die Unzucht mit
dem Teufel, Teufelsbeschwörung, Verhinderung der Zeugungskraft bei
Männern und der Empfängnis bei Weibern, Impotenz etc. sind darin als
Hexenwerk gebrandmarkt. Die Gegner der Verfolgungen, seien sie
noch so hohen Standes, sind mit Bann und Interdikt zu belegen
und nötigenfalls der weltliche Arm gegen sie anzurufen[270].
Hergenröther, ein Autor des 19. Jahrhunderts, meint, der Papst habe
dadurch „mildernd und belehrend“ gewirkt!!!
*
Der Hexenhammer, erschienen mit dreifacher Approbation, nämlich einer
päpstlichen Bulle, einer königlichen Urkunde vom 6. November 1486 und
einem empfehlenden Gutachten der theologischen Fakultät der Universität
Köln vom Mai 1487, in unzähligen Auflagen verbreitet als Richtschnur
in der Behandlung von Hexen und Zauberei, noch vom Leipziger Professor
Carpzow († 1666), einem orthodoxen Lutheraner, als Autorität
anerkannt, entwickelt folgende „christliche“ Grundsätze[271]:
[S. 245]
Verteidiger der wegen Hexerei angeklagten Personen sind gestattet,
aber – auf den Wunsch des Angeklagten darf bei seiner Wahl keine
Rücksicht genommen werden. Der Richter hat ihn zu ermahnen,
daß er sich nicht der Begünstigung der Ketzerei schuldig
mache; dieser aber macht er sich in hohem Grade schuldig, wenn
er „indebite“ einen schon der Ketzerei Verdächtigen verteidigt!
Die Namen der Belastungszeugen dürfen ihm nur mitgeteilt werden,
wenn er untadelhaft, eifrig (zelosus!!) und ein Freund der
„Gerechtigkeit“ ist, aber auch dann nur unter eidlichem Geheimnis!
*
Der Richter wird angewiesen, die Angeklagten zu befragen, ob sie
glauben, daß es Hexen gäbe, die Wetter machen, Menschen und Tiere
infizieren usw. „Bemerke wohl, daß die Hexen dies meist das erstemal
verneinen (d. h. nur durch Zwangsmaßregeln der Kirche wird ihnen
ein blöder Wahn eingebläut, den der Laienintellekt damals bereits
überwunden hatte!) Hiermit machen sie sich verdächtiger, als wenn
sie antworten würden: die Entscheidung über diese Frage überlasse
ich den Oberen. Daher, wenn sie es verneinen, sind sie weiter zu
befragen: Wie kommt es denn dann, daß man sie verbrennt? Werden sie
denn unschuldig verbrannt?“ Verneinten sie die letztere Frage, dann
wurden ihre Aussagen widerspruchsvoll und darum verdächtig, während mit
der Bejahung sie sich selbstverständlich einer toteswürdigen Ketzerei
schuldig machten.
*
[S. 246]
Der Richter darf Todfeinde der Angeklagten nicht als Zeugen zulassen.
Unter Todfeindschaft ist aber nur eine solche zu verstehen,
die durch Mord, Totschlag oder tödliche Verwundung herbeigeführt
wurde!
*
Die Inquisitoren übergaben ihr Opfer dem weltlichen Gericht mit
der stehenden Mahnung, ihres Leibes und Lebens zu schonen, einer
nichtssagenden heuchlerischen Formel. Denn hätte die Staatsbehörde den
Verurteilten das Leben schenken wollen, so wäre sie sofort in die
auf Begünstigung der Häresie gesetzten Zensuren verfallen.
*
Dem Richter steht es frei, den Weg der Milde (via pietatis)
einzuschlagen. Dieser besteht zunächst darin, daß die Folter nicht
wiederholt werden darf, wenn nicht neue Indizien hervortreten. Will
die Gefolterte – deren Blut nicht vergossen werden durfte, weshalb
es lediglich gestattet war, ihre Gelenke auszukugeln, die
Knochen zu zermalmen, sie mit Fackeln zu sengen und
endlich lebendig zu verbrennen, was ja auch in völliger Harmonie
mit der kirchlichen Barmherzigkeit ohne Blutvergießen abging – will
sie nicht gestehen, dann soll man ihr noch andere Folterwerkzeuge
vorzeigen und sie damit bedrohen. Wird sie auch dadurch nicht
eingeschüchtert, dann ist die Folter am zweiten oder dritten Tage
fortzusetzen, nicht zu wiederholen!
[S. 247]
Läßt sich die Angeklagte trotz langer Gefangenschaft zu einem
Geständnis nicht bewegen, dann soll der Richter sie im Gefängnis
besuchen, ihr versprechen, Gnade walten zu lassen, „indem
er aber darunter nicht Gnade für sie, sondern für sich oder den Staat
versteht“. In diesem Punkte folgte der Staat der erhabenen Moral
der Seelenhirten nicht. Die bayerische Instruktion von 1622 hat die
Anwendung dieses Mittels ausdrücklich verboten.
*
War es nicht gelungen, den Angeklagten durch Zeugenaussagen oder
mittels des Gefängnisses, gestellter Fallen und der Folter zu einem
Geständnis zu bewegen, und bestanden überhaupt gegen ihn keine anderen
Indizien, als sein schlechter Ruf in bezug auf Ketzerei – in diesen zu
kommen war aber schon deshalb sehr leicht, weil ausdrücklich auf die
Familie der „Hexe“ als meistens auch der Hexerei ergeben das Augenmerk
des Richters gelenkt wurde, so daß schon allein die Verwandtschaft
der Hexerei hochverdächtig (vehementer suspectus) machte –
dann wurde der „Weg der Milde“ beschritten.
Dieser bestand darin, daß der verstockte Sünder nicht etwa
freigesprochen, sondern mit der kanonischen Purgation belegt wurde.
Katholische und bewährte Männer, die seinen Wandel schon längere Zeit
kennen, müssen 7, 10, 20 oder 30 an der Zahl, und zwar seines
Standes, also Geistliche, Weltliche oder Adelige, als Eideshelfer
ihm beistehen. Will der Angeklagte auf dieses Reinigungsverfahren nicht
ein[S. 248]gehen, dann verfällt er der Exkommunikation und wenn er in dieser
ohne Purgation ein Jahr verblieb, wird er als Ketzer verurteilt d.
h. verbrannt! Ebenso geht es ihm, wenn er die ihm auferlegte Anzahl
von Eideshelfern nicht herbeischaffen kann. Da das außerordentlich
schwer war, da jeder darum angegangene fürchten mußte, selbst in den
Ruf der Hexerei zu kommen, wird wohl die Nächstenliebe der Inquisitoren
sich zumeist – wenn auch erst nach Jahresfrist – in gewohnter Weise
haben betätigen können.
*
Diesem Hexenhammer ist in erster Linie zuzuschreiben, daß alle
drei christlichen Religionen in hingebender Weise um die Palme
wetteiferten, am meisten den Glauben an Hexerei auszubreiten und am
rücksichtslosesten gegen Hexen vorzugehen. Das amtliche Suchen nach
ihnen begann erst zu einem Zeitpunkt, wo ohne Kirche in Deutschland
Vernunft und Humanität gesiegt hätten.
*
Görres, der Abgott ultramontaner Geschichtsschreibung und Bannerträger
einer „modernen“ historischen Schule, nennt diesen Hexenhammer ein
„in den Intentionen reines und untadelhaftes Werk, aber in einem
unzureichenden Grunde tatsächlicher Erfahrungen aufgesetzt, nicht immer
mit geschärfter Urteilskraft durchgeführt und darum oft unvorsichtig
auf die scharfe Seite hinüberneigend.[S. 249]“ Welche Milde! welche
Gerechtigkeit! nur schade, daß sie auf keine bessere Sache verwendet
wird.
*
Es ist merkwürdig, daß dieselbe Kirche, die nicht müde wurde, durch
Jahrhunderte mit Feuer und Folter ihre wirklichen und vermeintlichen
Widersacher zu verfolgen, die mit den gewaltsamsten Mitteln den größten
Blödsinn propagierte, heute noch von mimosenhafter Empfindlichkeit
und mädchenhaftem Zartgefühl ist, wenn man ihr im geringsten
zu nahe tritt, und zwar nicht etwa wie sie es tat, durch grausame
Verfolgung und qualvollen Tod im Namen des Gottes der Liebe, sondern
lediglich durch Wort und Schrift und Suchen nach Wahrheit. Sollte das
im Unterbewußtsein schlummernde Gefühl, der historischen, logischen und
naturwissenschaftlichen Wahrheit nicht standhalten zu können, Ursache
sein dafür, daß Polizei und Gefängnis bis zum heutigen Tage dem Kämpfer
für Licht und Freiheit drohen? Ist es das Gefühl der Überlegenheit,
daß jeden Wohlerzogenen zwingt, im Verkehr mit Strenggläubigen und der
Geistlichkeit eine Rücksicht walten zu lassen, die im allgemeinen nur
Damen zu beanspruchen pflegen?
Dabei ist kaum zu bezweifeln, daß die kirchliche Weltanschauung,
sofern sie in den Grenzen der Religion und Metaphysik bleibt und
sich weder in die Sphäre der Politik noch Erfahrungswissenschaft
einschmuggelt, was gar nicht nötig ist – so berechtigt ist wie
irgend eine andere, daß der an Gott, Offenbarung und Unsterblichkeit
Glaubende nicht um ein[S. 250] Quentchen weniger intelligent zu sein braucht,
als der Leugner. Bestünde Trennung von Kirche und Staat und damit
auch tatsächliche, nicht nur papierne Glaubensfreiheit, würde die
Kirche ihre Irrtumsmöglichkeit zugeben, wobei sie immerhin an den
geoffenbarten Grundwahrheiten ihrer Lehre festhalten könnte, dann
würde auch der fortschrittlich Gesinnte keinen Grund haben, sie mit
Erbitterung zu bekämpfen, sondern selbst der Gegner würde dieser
gewaltigen Organisation, der erhebenden Schönheit ihres Kultus und
der Unwiderlegbarkeit – allerdings auch Unbeweisbarkeit ihrer
metaphysischen Basis Ehrfurcht zollen müssen.
*
Ein Kulturkuriosum ersten Ranges ist der Feuereifer, mit dem
Katholiken und Protestanten sich gegenseitig die Schuld an den
Hexenverbrennungen oder – da die Priorität der katholischen Kirche
sich nicht wohl leugnen läßt – die größte Heftigkeit der Verfolgungen
vorwerfen. Denn daß auch die Protestanten verbrannten, und zwar eifrig,
steht fest[272].
Die unfehlbare Kirche – der Papst war es damals bekanntlich noch nicht
– dekretiert etwas, was überall, wenn auch nicht ohne Widerspruch,
Eingang findet; durch Naturwissenschaft und Aufklärung wird der
Wahnwitz selbst der Geistlichkeit allmählich klar gemacht, nun ist es
Aufgabe jedes Frommen, zu beweisen, daß die Kirche gar nichts dafür
kann! Also Unfehlbarkeit auf alle Fälle!
[S. 251]
Übrigens ist die Hexenverbrennung eine direkte Konsequenz der
Evangelien[273]!
*
Der Würzburger Bischof Philipp Adolf von Ehrenberg (1623–1631) ließ in
den acht Jahren seiner Regierung 900 Personen verbrennen. Im Herzogtum
Lothringen wurden in 16 Jahren 800 Hexen verbrannt. Was im ersten Falle
die alleinseligmachende Kirche tat, ist im zweiten der hingebenden
Frömmigkeit eines katholischen Fürsten zu danken[274].
*
Das Buch des Kalvinisten Weier „de praestigiis daemonorum,“ mit dem
er 1563 als erster Deutscher den Hexenwahn bekämpft; – wiewohl es
stets Leute, selbstredend Laien gab, die den Wahn nicht mitmachten
– wurde in Rom und anderwärts auf den Index der verbotenen
Bücher gesetzt. Der Verfasser selbst wurde von katholischer und von
protestantischer Seite als Mitschuldiger und Genosse der Hexen
verdächtigt. Er war nicht Theologe, sondern Arzt. Fast auf allen
Gebieten sind ja gute Gedanken und Neuerungen nicht Zünftlern, sondern
Außenstehenden zu danken. Die von Diefenbach in seinem „Hexenwahn“
angeführten katholischen Vorläufer Weiers sind, wie Riezler nachweist,
sämtlich bona oder mala fide zu Unrecht genannt[275].
*
Als Balthasar Bekker sein Buch „Verzauberte Welt“ 1691 herausgab,
kostete ihn sein Auftreten[S. 252] gegen Hexenwahn und Teufel, den er nach
der Bibel höchstens als einen machtlosen gefallenen Geist anerkennen
wollte, seine Stelle. Christian Thomasius, der 1701 sein Werk „Theses
de crimine magiae“ publizierte, wurde von Juristen und Theologen aufs
heftigste angegriffen. Der gesunde Menschenverstand und die Liebe
zum Fortschritt waren eben seit je nicht gerade die hervorragendsten
Eigenschaften der Gelehrten- so gut wie der Handwerkerzünfte.
Die Leipziger theologische Fakultät (Neuer Pitaval, Band 32) hat
gelegentlich des Teufelsbeschwörungsprozesses in Jena im Jahre 1715
folgendes Urteil abgegeben: „.... Wir halten dafür, daß bei diesem
casu tragico singulari nicht nur auf die Exhalationes der angezündeten
Kohlen, welche Menschen zuweilen naturali modo ersticken, sondern auch
auf die causam primam, nämlich den gerechten und allgewaltigen Gott zu
sehen, der je zuweilen dem Satan zuläßt, daß er bei den causis secundis
sein Werk praeter ordinem naturae a creatore constitutam mithabe; denn
was solche Philosophi vorgeben, als wenn die Spiritus keine Operationes
in materiam et corpora hätten, ist wider die notorische Erfahrung,
sonderlich auch wider die Heilige Schrift, die von Operationibus
Daemonum in corpora et animam genug Exempel anführt, daher des
fascinierten Bekkers in Holland vorgebliche Meinung sowohl von
christlichen Philosophiis als Theologiis billigst widerlegt, verworfen
und verdammt ist, weil sie der christlichen Religion einen Grundstoß
gibt und die Leute vollends vor dem Teufel sicher macht...[S. 253]“
Das war also die offizielle protestantische Meinung im Todesjahre des
Sonnenkönigs, in den Tagen von Newton und Leibniz[276]!
*
Das von Kreittmayer 1751 ausgearbeitete bayerische Strafgesetzbuch
bestimmte über Hexerei und Zauberei: Bündnis oder
fleischliche Vermischung mit dem Teufel oder dessen Anbetung
und Verunehrung der Hostien werden mit lebendiger Verbrennung
bestraft. Die Strafe des Schwertes steht auf Gemeinschaft mit dem
Teufel und Beschwörungen oder zauberische Mittel, wodurch jemand an
seinem Leben, Leibes- oder Gemütsgesundheit, Vieh, Früchten, Hab und
Gut Schaden geschieht[275].
Noch im Jahre 1713 wurde eine Hexe nach dem Spruch der protestantischen
Tübinger Juristenfakultät verbrannt, während beim Hexenprozeß in Berlin
im Jahre 1728 das Urteil auf lebenslängliches Arbeitshaus lautete.
In Deutschland gebührt der Fürstabtei Kempten der Ruhm der letzten
Hinrichtung einer Hexe. Es war das im Jahre 1775. Lessing zählte
damals 46 Jahre, Goethe 26! Das protestantische Glarus hat gar noch
im Jahre 1782 ein Opfer zu verzeichnen, wiewohl die Hexenverfolgungen
im allgemeinen in den protestantischen Ländern um eine bis zwei
Generationen früher eingestellt wurden, als in den katholischen. Noch
im Jahre 1836 wurde eine „Hexe“ von den Fischern der Halbinsel Hela
der Wasserprobe unterzogen. Sie ertrank bei dieser Prozedur. Die
griechisch-katholische Kirche hat bekanntlich diesen Wahn überhaupt
nie mitgemacht.[S. 254] Sie hatte auch keinen Papst, auf dessen unheilvolles
Eingreifen allein nicht nur das Wiederaufleben eines im Absterben
begriffenen Wahnes, sondern auch dessen lange Dauer zurückgeführt
werden muß.
Die Begriffe Hexerei, Ketzerei und Zauberei fehlen erst im bayerischen
Strafgesetzbuch vom Jahre 1813[277]! Die Aufklärung und die infolge
der französischen Revolution beginnende Befreiung der Geister und
Schätzung der Menschenrechte haben auch hier endlich getilgt, was die
„unfehlbare“ und die andern Kirchen an der Menschheit verschuldet
hatten.
*
Daß noch bis in die Gegenwart der Katholizismus im Unterschied vom
Protestantismus, bei dem die mittelalterliche Borniertheit auf diesem
Gebiete etwas früher wich – wie stolz kann das Christentum sein, daß
es rund vier Jahrhunderte dem Gott der Liebe Unschuldige verbrannte! –
wo er die Möglichkeit dazu besitzt im gottgefälligen Wirken fortfährt,
erhellt aus folgendem: Im Jahre 1860 wurde eine Frau zu Camargo in
Mexiko lebendig verbrannt. Eine Frau mit ihrem Sohne bestieg 1874 zu
St. Juan de Jacobo im Mexikanischen Staate Sinalva den Scheiterhaufen,
und noch im Jahre 1888 soll eine Frau nach mehrmaliger Geißelung auf
dem Marktplatz einer Stadt in Peru als Hexe ihr Leben haben lassen
müssen. Ja, ja, die Religion der Liebe[278]!
*
Heute ist die Aufklärung so unheimlich groß, daß die offizielle
Wissenschaft die sogenannten okkulten Phänomene nicht nur ablehnt,
sondern noch nicht[S. 255] einmal prüft! Geister wie Schiaparelli,
Forel, Flammarion, Lombroso, Crookes, Wallace, Richet u. a. m. werden
zwar nicht verbrannt, im übrigen sogar als Ehrenmänner behandelt, aber
man hält ihre Beobachtungen keiner Widerlegung für wert. Dogma
und ungeprüfte offizielle Weisheit haben eben immer geherrscht und
herrschen heute noch. Freie Geister, die nicht Tatsachen an Theorien,
sondern Theorien an Tatsachen prüfen, waren immer Outsider. Die
ungeheure Masse der Nachbeter kann wirklich nichts dafür, ob das Dogma,
das sie verficht, klug oder dumm, richtig oder falsch ist. Immer sind
es einige Leithämmel, denen alle anderen nachlaufen. Wie dankenswert
wäre eine Kulturgeschichte, die einmal nicht das herausstreicht, was
die Menschheit den „Autoritäten“ verdankt, sondern nachweist, wie
sie – nach kurzer Förderung – auf lange hinaus den Fortschritt
hemmten!
[S. 256]
Vierzehnter Abschnitt
Reliquien
Seit den ersten Jahrhunderten des Christentums erfreuten sich die
Reliquien der Heiligen überall der größten Beliebtheit. Das ging
so weit, daß Leute auf eigene Faust oder im Auftrage eines fremden
Bischofs die Kirchhöfe durchwühlten, um sich dann mit den Gebeinen der
Märtyrer davon zu machen. Eines Tages entdeckten die bestürzten Römer
griechische Männer, die neben der Basilika St. Pauls Knochen gruben.
Da diese Reliquien neben der ihnen beigelegten schützenden Wirkung
auch das Gute hatten, Pilger aus allen Teilen der Erde anzuziehen, so
wurden sie von den Römern wie ihre Augäpfel gehütet. Gregor der Große
(590–604) schrieb der Kaiserin Constantia auf ihre Bitte um ein Stück
vom Leibe des hl. Paulus einen Brief voll verhaltener Entrüstung. Die
heiligen Leiber zu berühren sei ein todeswürdiges Verbrechen, aber es
genüge bereits ein Stück Tuch, das das Apostelgrab bedeckt hatte, in
eine Büchse gelegt, um Wunderwirkung zu erzielen, ebenso Feilspäne
von den Ketten Petri, die bereits im 6. Jahrhundert vom Papste als
höchstes, der späteren goldenen Rose gleich geachtetes Geschenk
verliehen wurden[279].
*
Astolf, König der Langobarden, belagerte 755 Rom. Zwar plünderten
seine Truppen alle Kirchen und Klöster außerhalb der Stadt, die in
ihrem Machtbereich lagen,[S. 257] mißhandelten auch die Mönche und Nonnen,
verspotteten Heiliges und verbrannten Heiligenbilder, das hinderte
sie aber nicht, zu gleicher Zeit die Kirchhöfe der Märtyrer zu
durchwühlen, um sich mit ihren Gebeinen zu beladen. Damals wurden
die bisher unversehrten Katakomben zerstört und die Knochen der
Blutzeugen in Wagenladungen nach der Lombardei geschafft[280].
Im Jahre 1672 wurden aus 3 Katakomben nicht weniger als 428 Leiber
entfernt, um als Geschenk oder um Geld in die katholische Welt zu gehen.
Ein Jahrhundert später blühte der Reliquienhandel Roms üppig. Der
Pilger kaufte dort Reliquien, Knochen aus den Katakomben, wie
der moderne Reisende Kunstgegenstände und Photographien erwirbt.
Infolgedessen überstieg die Nachfrage das Angebot und Tote
wurden gefälscht[281].
*
Im Jahre 1635 edierte Bonfante seinen Triumpho de los Sanctos des Reyno
de Cerdeña, eine Sammlung der ältesten Inschriften Sardiniens. Da er
aus Irrtum die Siglen B. M., Bene Merens, für Beatus Martyr erklärte,
schuf er mit einem Schlage mehr als 300 Heilige. Der Ruf dieses
Schatzes wurde laut, die Stadt Piacenza bewarb sich um einen Teil davon
und die großmütigen Sarden schenkten ihr 20 „Märtyrer“, die jubelnd
entgegen genommen wurden.
*
Als der hl. Romwald einst Italien zu verlassen drohte, beabsichtigte
man, ihm Mörder nachzuschicken, um ihn wenigstens als kostbare
Reliquie im Lande zu behalten[282]!
[S. 258]
Der hl. Dionysius existiert in zwei vollständigen Exemplaren zu St.
Denis und in St. Emmeran in Regensburg, ferner rühmen sich Prag und
Bamberg des Besitzes seines Kopfes. Er besaß also zwei vollständige
Körper und vier Köpfe[283].
Im Reliquienschatz der gesamten katholischen Welt befinden sich:
1. Vom hl. Andreas: 5 Körper, 6 Köpfe, 17 Arme, Beine und Hände.
2. Von der hl. Anna: 2 Körper, 8 Köpfe, 6 Arme.
3. Vom hl. Antonius: 4 Körper und 1 Kopf.
4. Vom hl. Blasius: 1 Körper und 5 Köpfe.
5. Vom hl. Lukas: 8 Körper und 9 Köpfe.
6. Vom hl. Sebastian: 4 Körper, 5 Köpfe und 13 Arme. Diesen allen
weit über sind die hl. Georg und Pankraz mit je 30 Körpern.
Nach so langer Zeit! Wie viele müssen sie erst bei Lebzeiten
gehabt haben[284]!
*
In Aachen wird heute noch alle sieben Jahre das Hemd der
allerseligsten Jungfrau und Gottesgebärerin Maria ausgestellt,
desgleichen die Windeln Christi!
*
Das Kloster Macon rühmte sich des Besitzes der Haut des hl. Dorotheus.
Die frommen Nonnen stopften die Haut mit Baumwolle aus und stellten
den Heiligen her, als ob er lebte. Da sie aber damit Unfug trieben,
schenkte die Äbtissin die Reliquie, in Unkenntnis ihres Wertes,
den Jesuiten. Diese stifteten ihr zu Ehren die Brüderschaft vom
hl. Leder: wodurch sie viel Geld verdienten. Die Nonnen
erfuhren das und klagten beim Papst auf Rückgabe des Heiligtums,
das ihnen auch zugesprochen wurde.[S. 259] Aber die Jesuiten hatten die
Reliquie in unverantwortlicher Weise verstümmelt. Darob große
Entrüstung und abermalige Reklamation beim Papst auf Rückgabe des
fehlenden Teiles. Da dieser aber den Mangel, wenigstens für ein
Nonnenkloster, nicht für erheblich hielt, mußten sich die Nonnen als
Ersatz mit zwei geweihten Muskatnüssen begnügen[285].
*
Der umbilicus (die Nabelschnur) und 13 praeputia Christi gehörten und
gehören zum Teil noch zum Reliquienschatz der Kirche. Eine dieser
hochheiligen Vorhäute wird noch heute in Charroux verehrt und gilt dem
Landvolk als „der heilige Präziputius“. Im 17. und 18. Jahrhundert
pilgerten besonders schwangere Frauen dorthin, um sich mit ihr segnen
zu lassen[286]. Eine andere erquickt noch heute die frommen Pilger in
Calcata, unfern Rom[287].
Dieses hochheilige Präputium hat eine große und glorreiche Geschichte.
Zunächst galt es, das der Verehrung entgegenstehende Dogma von der
unversehrten Auferstehung zu beseitigen. Das war aber gar nicht so
einfach.[288]
Da Christus „in voller Integrität“ auferstanden war, wurde von einigen
Theologen konstatiert, daß das Präputium zur Integrität des Juden
nicht erforderlich sei. Ferner ist Christus nur insofern „ganz“
auferstanden, als dieses „ganz“ zum „Sein“ und „Schönsein“ gehört,
aber „ohne“ findet es der Jude entschieden schöner. Eine andere Schule
– diese für das Seelenheil so hochwichtige Frage hat natürlich eine
Menge von Schulmeinungen hervorgerufen –[S. 260] unter Führung des Jesuiten
Raynaldus lehrt, daß Christus doch „mit“ auferstanden sei, trotzdem
sei aber die Reliquie echt, denn er schuf sie aus einer beliebigen
Materie. Mit kaum zu überbietender Poesie spricht der Jesuit Salmeron
in seinem Evangelienkommentar (Köln 1602) von diesem Körperteil als dem
„fleischenen Verlobungsring“ für seine Braut, die Kirche. Und
der Bischof Rocca hat für die Vielheit dieser hochheiligen Reliquie die
höchst plausible Erklärung, daß Gott in seiner Allmacht bewirkt habe,
daß dasselbe Präputium zu gleicher Zeit an verschiedenen
Orten gezeigt werden könne!!
Diese Schwierigkeit war also zu aller Zufriedenheit aus der Welt
geschafft. Aber nur ein seichter Fant wäre über die andere,
weit wichtigere Frage, die gebieterisch Beantwortung heischt,
hinweggeglitten: Hat Christus in der Eucharistie ein Präputium
oder nicht[289]? Da Christus zu Lebzeiten das hl. Abendmahl
einsetzte, damals aber als Jude „ohne“ war, so muß logischerweise auch
in der Hostie dieser zwar nicht umfangreiche, aber desto wichtigere
Körperteil fehlen. Da aber nach der Auferstehung der verklärte Leib
wieder komplett war, hätte er auch in der Hostie es sein können.
Eine unendlich verwickelte Frage, über deren Beantwortung sich die
verschiedenen Schulen nicht einigen konnten.
Noch ein Gewissenszweifel ist zu beseitigen: Ist die Gottheit mit dem
hier auf Erden zurückgebliebenen Präputium noch vereinigt? Muß es
infolgedessen „angebetet“ oder braucht es nur „ver[S. 261]ehrt“
zu werden? Auch hierüber konnte man keine rechte Harmonie erzielen,
doch Bischof Rocca, Sakristan Sr. Heiligkeit, entschied sich dahin,
daß das Präputium nach der vierten Modus der Latreia angebetet
würde, der es den Haaren und Kleidern Christi gleich setzt,
insofern es ein Körperteil ist, der ihm einst angehörte.
Endlich war noch das Problem zu lösen, was nach dem Weltuntergang
aus der kostbaren Reliquie würde. Die verbreitetste Lehrmeinung
entschied dahin, daß es den Weltuntergang überdauern und an
irgend einem Ort des Himmels in saecula saeculorum aufbewahrt würde.
Das in der Sancta Sanctorum Kapelle aufbewahrte Präputium verschwand
zwischen April 1903 und Sommer 1905.
*
Der hl. Camillus de Lellis wurde am 25. Mai 1550 in den Abruzzen
geboren. Seine Mutter war damals bereits 59 Jahre alt. Mit 19 Jahren
wurde Camillus Soldat in venezianischen Diensten, war aber dank seiner
Streit- und Spielsucht und seines Ungehorsams kein Muster eines
solchen. Mit 25 Jahren trat er in den Kapuzinerorden ein und erwarb
sich durch charitative Werke große Verdienste.
Das ist alles in der Ordnung, und wir hätten keinen Grund, vom Heiligen
Notiz zu nehmen, hätte er nicht auch Wunder gewirkt, „die
hinreichend verbürgt scheinen.“ So bewirkte er, daß das Weinfäßchen
einer Frau, die täglich eine Flasche Wein[S. 262] in das Kloster des Camillus
sandte, nie leer wurde. Sein Leichnam blieb auch nach seinem Tode
„frisch und biegsam“ und zwar 10 Jahre lang, denn als „der Arzt bei
Erhebung des Leibes einen Schnitt in die Brust machte, floß aus der
Wunde eine Flüssigkeit von außerordentlichem Wohlgeruch. Während
der 6 Tage, an denen der Leib des Heiligen ausgesetzt war, ergoß sich
eine Art Öl.“ Auch jetzt wirkte er noch Wunder, ja, jetzt hatte er
damit besonders schöne Erfolge.
Als eine Römerin, die an einem besonders großem, eiterigen Kropf
litt, sich Mörtel aus des Heiligen Zimmer zugleich mit einem Bilde
des Camillus auf den Kropf legte und darüber das Zeichen des Kreuzes
machte, trat die Wirkung gleich ein. „Kaum war dies geschehen, so
verschwand der Schmerz. Die Frau war vollkommen geheilt.“ Dieser Mörtel
hat überhaupt eine erstaunliche Kraft. Er heilte auch eine Frau, die
dem Tode nahe war, als ihr ein Priester etwas davon in einem Löffel
Suppe einflößte. Ein Mädchen, das an einem Nasenpolypen nebst Fieber,
Krämpfen und kaltem Brand litt, wurde durch zwei Fäden aus dem Hemd des
Heiligen kuriert.
An der Authentizität dieser Angaben ist jeder Zweifel unmöglich, da
Athanasius Zimmermann S. J. in einer 1897 bei Herder in Freiburg
erschienenen Schrift über Camillus de Lellis gehandelt hat. Und was
gedruckt ist, ist doch bekanntlich wahr!
*
[S. 263]
Das „Agnus Dei“ ist ein kleines Medaillon aus weißem Wachs,
noch heute von den Zisterziensermönchen des hl. Kreuzes zu
Jerusalem aus dem Wachs der Osterkerzen der Sixtinischen Kapelle und
der anderen römischen Kirchen angefertigt. Dieses ovale Gebilde trägt
auf einer Seite das Sinnbild des Osterlammes mit der Aufschrift: „Ecce
Agnus Dei qui tollit peccata mundi“, das Wappen und den Namen des
Papstes, der sie mit dem hl. Chrisam geweiht und gesegnet hat, auf der
andern Seite das Bildnis der hl. Jungfrau oder eines Heiligen. Die
Weihe der Agnus, die die Kirche zu den Sakramentalien zählt,
findet im ersten Jahre jedes Pontifikats statt, ferner regelmäßig
alle sieben Jahre, außerdem wenn der Papst es mit Rücksicht auf die
Bedürfnisse der Gläubigen für angebracht hält. Die Päpste Urban V.,
Paul II., Julius III., Sixtus V. und Benedikt XIV. erkennen den Agnus
für alle jene, welche sie mit Andacht und Vertrauen gebrauchen,
folgende Eigenschaften zu: „Sie löschen die läßlichen Sünden aus und
tilgen den Fleck, den die im Bußsakrament bereits vergebene Sünde
zurückläßt. Sie schlagen die bösen Geister in die Flucht, befreien
von ihren Versuchungen und bewahren vor der ewigen Verdammnis. Sie
behüten vor plötzlichem und unvorhergesehenem Tod. Sie verhindern
die schreckhaften Einflüsse der Phantome und beschwichtigen das von
bösen Geistern hervorgerufene Entsetzen. Sie verleihen göttlichen
Schutz gegen Feindschaft, sichern vor Unglück und Verderben, verleihen
Wohlstand. Sie beschützen im Kampf und verhelfen zum Sieg. Sie machen
Gifte unschädlich und bewahren vor den Schlingen des[S. 264] Feindes. Sie
sind ausgezeichnete Schutzmittel gegen Krankheiten und auch ein
wirksames Heilmittel. Sie bekämpfen die Epilepsie. Sie verhindern
die Verheerungen der Pest, der Epidemien und der verseuchten Luft.
Sie beruhigen die Winde, brechen die Wucht der Orkane
und der Wirbelwinde und verjagen die Ungewitter.
Sie retten vor Schiffbruch. Sie vertreiben die Gewitter
und bewahren vor Blitzgefahr. Sie verjagen die Hagelwolken. Sie
löschen die Feuersbrünste und halten deren Verheerung auf. Sie sind
wirksam gegen die Wolkenbrüche, das Übertreten der Flüsse und die
Überschwemmungen. Die Agnus behüten endlich Mutter und Kind
während der ganzen Zeit der Schwangerschaft und beseitigen die Gefahren
bei der Niederkunft, deren Schmerzen sie mildern und abkürzen. H.
Barbier de Montaut, Kämmerer Seiner Heiligkeit“[290].
Welcher Segen, daß es im 20. Jahrhundert noch so etwas gibt! Welche
Torheit, daß nicht jedermann ein Agnus, von dem bereits das geringste
Teilchen die gleiche Kraft besitzt wie das Ganze, ständig bei sich
trägt, oder doch in seinem Hause hat! Die Leute wollen eben immer noch
nicht einsehen, wie nahe das Gute liegt!
*
Wie Herr Ingenieur Feldhaus mir mitteilt, sah er noch im
Frühjahr 1909 in der Kirche zu Doberan in Mecklenburg eine
Flasche mit ägyptischer Finsternis!!!
*
Die Inquisitions-Kongregation in Rom stellte am 29. Juni 1903 fest,
daß es kein Aberglaube sei, wenn Papierbilder, die die Madonna
darstellen, in Wasser aufgelöst, getrunken oder zu Pillen gedreht
verschluckt werden, um Genesung von Krankheiten zu erlangen[291].
[S. 265]
Fünfzehnter Abschnitt
Mission und Kolonien
Der Ausbruch der Chinawirren 1900 war teilweise verursacht durch die
Erbitterung gegen die Missionen. Den frommen Christen daheim schaudert
es beim Gedanken, daß es, wenn auch im fernen China, überhaupt Menschen
von solcher Verworfenheit geben könne, daß sie dem Missionswesen, dem
hingebenden, aufopfernden Liebeswerk abhold sind. Es ist nicht ohne
Interesse zu sehen, in welcher Gestalt die Religion der Liebe dem
hochstehenden uralten Kulturvolke entgegentritt. Daß auch im fernsten
Osten die konfessionelle Zersplitterung und Konkurrenz fortbesteht, daß
jede Sekte behauptet, allein das wahre Christentum zu verkörpern, und
die andere verwirft, ist selbstverständlich.
Es existiert eine Anstalt „Oeuvre de la Sainte-Enfance“, die jährlich
Millionen zur Taufe und Rettung kleiner Chinesenkinder aufwendet. Im
Juniheft ihrer Annalen vom Jahre 1897 heißt es: „Seit 1884 hatten
wir das Glück, 20552 kleine sterbende Kinder zu taufen, davon 3558
in diesem Jahre. Alle diese kleinen Engel, werden sie oben nicht
wirken, für die Bekehrung des ungläubigen China?“
[S. 266]
Im selben Hefte wird von der Hungersnot erzählt, die 1893
Yünnan heimsuchte. Die frommen Mönche des „Oeuvre“ berichten:
„Die Vorsehung hat, es ist wahr, unsere Arbeit sehr
vereinfacht, indem sie eine große Anzahl unserer kleinen Kinder
in den Himmel rief. Diese vorzeitigen Todesfälle, so betrübend in
einem christlichen Lande, sind ein Gegenstand der Freude und des
Trostes in diesen heidnischen Gegenden.“
Im 21. Heft p. 258 heißt es: „Machen Sie doch einen kleinen Besuch
im Hause der unbefleckten Empfängnis in Peking. Sehen sie diese
bescheidene Eingangstür? Sie ist dieses Jahr für eine große Anzahl
kleiner Brüder und Schwestern die Pforte des Himmels geworden. 873
kleine Kinder wurden uns jedes für 45 Cts. an dieser Pforte gegeben,
und davon sind 843 gestorben, nachdem sie durch das heilige
Wasser der Taufe wiedergeboren waren.“
Ein anderer Mönch meldet: „Ein Säugling kostet etwa 5 Frs. im Monat.
Gewiß, ich flehe zu Gott, daß diese lieben kleinen Seelen uns
sobald wie möglich verlassen und zum Himmel fliegen mögen. Aber
schließlich, wenn sie schon nicht sterben wollen, muß man sie doch
ernähren und aufziehen.“ Ja, die Engelmacherei ist also gar nicht
so leicht, wie der Laie in seinem Unverstand glauben mag! Immerhin
kann eine dieser Anstalten mit berechtigtem Stolz konstatieren, daß
von 12000 ihr anvertrauten Täuflingen nur 124 oder 125 das erste
Lebensjahr erreicht hätten!
[S. 267]
Der Bischof Quierry beglückwünschte die Missionare dieses „Oeuvre“,
wie die gleichen Annalen erzählen, daß sie jedes Jahr mehr als 40000
Kinder in den Himmel schicken!! Und trotzdem konnten sie die Chinesen
von der Unübertrefflichkeit des Christentums und seiner Liebeswerke
nicht überzeugen. An einem solchen Volke ist allerdings Hopfen und Malz
verloren[292].
*
Ein alter Farmer „Gottlieb Bleibtreu“ schreibt in den Windhuker
Nachrichten einen Aufsatz, in dem er sich über Stolz, Überhebung und
Anmaßung der Herero beklagt: „Gibt es nicht soviel zu essen, daß es für
Mann und Weib ausreicht, dann ist das erste, worüber geklagt
wird, die Kost, und da dies ein Grund der Beschwerde ist, kann sich der
Arbeitgeber beim Bezirksamtmann noch einen Nasenstüber holen, falls
er Veranlassung nimmt, Gegenbeschwerde zu führen. – Wenn sich nun
jetzt schon, wo die Hereros noch Kriegsgefangene sind, diese in
alten Sitten und Gebräuchen wurzelnden Anmaßungen in solch brutaler
Weise fühlbar machen, wie soll das werden, wenn sie wieder frei und
ihr eigener Herr sind? Hier gibt es nur ein Mittel zur Abhilfe, und das
heißt in bestimmten Grenzen gehaltener Arbeitszwang.“
Wenn Herr Bleibtreu Gefühlsmensch ist, der die Herero dafür, daß sie
für Ausbeutung, die soweit geht, daß sogar die notwendige Nahrung ihnen
nicht verabfolgt wird, kein Verständnis haben, auch noch strafen[S. 268] will,
so ist das seine Privatsache. Wenn aber die Hamburger Nachrichten am
23. September 1906 ihm völlig beipflichten, so stimmt das doch etwas
nachdenklich.
*
Im Jahre 1904 erschien eine von einem Herrn Schlettwein verfaßte
Broschüre mit folgendem Passus: „Wir stehen mit der Kolonialpolitik
am Scheidewege. Nach der einen Seite das Ziel: gesunder Egoismus
und praktisches Kolonisieren, nach der andern Seite übertriebene
Menschlichkeit, vager Idealismus, unvernünftige Gefühlsduselei.
Die Hereros müssen besitzlos gemacht werden. Das Volk muß nicht
nur als solches unmöglich gemacht werden, es müssen auch
alle das Nationalgefühl erweckenden Faktoren beseitigt werden.
Man muß die Hereros zur Arbeit zwingen, und zwar zur Arbeit
ohne Entschädigung, nur gegen Beköstigung. Eine jahrelange
Zwangsarbeit ist nur eine gerechte Strafe für sie und dabei die
einzig richtige Erziehungsmethode. Die Gefühle des Christentums und der
Nächstenliebe, mit welchen die Missionen arbeiten, müssen zunächst mit
aller Energie zurückgewiesen werden.“
Den Autor dieses Kulturdokumentes berief das Kolonialamt als
Vertrauensmann in die Budgetkommission, und man ließ gerade ihn im
Lande herumziehen, um für diese Kolonialpolitik Propaganda zu
machen.
Herr Schlettwein führte seine Theorie praktisch durch. Wie am 6. März
1907 im deutschen Reichstage festgestellt wurde, zahlte er den in
seiner Viehzucht beschäftigten Männern 15 Mark im Monat, den[S. 269] Frauen
gar nichts. Die Männer werden verköstigt – ob nach Bleibtreus Beispiel
bleibe unentschieden – die Frauen erhalten „Feldkost“ bestehend in
Raupen, Fröschen, Heuschrecken, Mäusen und Gras[293]!
*
Aus dem Tagebuch des Dr. Vallentin, das im Aprilheft 1894 der „Neuen
deutschen Rundschau, Freie Bühne“ veröffentlicht wurde, sei folgendes
entnommen: Am 13. 3. 93. Ich erfahre interessante Einzelheiten
über den Bakokoaufstand. In den Berichten befinden sich zahlreiche
Ungenauigkeiten. Herr Assessor Wehlau, welcher die Expedition führte,
soll beim Niederbrennen der Dörfer faktisch befohlen haben, einigen
alten Weibern die Hälse abzuschneiden; Männer konnte er nicht
gefangen nehmen. Statt der im betreffenden Bericht erwähnten 150
Gefangenen sollen es deren nur 12–15 gewesen sein. Matt, verwundet,
halb verschmachtet, zerschlagen und geschunden wurden diese – meist
alte Frauen, Greise und Kinder – an Land geschafft und unter Schlägen
und Stößen in Ketten zum Gefängnis geführt. Drei sollen am Fuß des
Flaggenmastes, unter der wehenden, deutschen Reichsfahne, vor Hunger
gestorben sein.
Am 17. 3. 93. Aus dem unter Führung des Assessors Wehlau unternommenen
sogenannten „Bakokofeldzuge“ erfahre ich heute wieder verschiedene
Einzelheiten. Es soll wirklich grauenhaft gewesen sein. Die Gefangenen
sind tagelang in der glühenden Hitze auf dem Schiffe („Soden“) an die
Reelings derart[S. 270] festgeschnürt worden, daß in die blutrünstigen und
aufgeschwollenen Glieder Würmer sich eingenistet hatten. Und diese
Qual tagelang in der Tropenhitze und ohne jede Labung! Als dann die
armen Gefangenen dem Verschmachten nahe waren, wurden sie einfach wie
wilde Tiere niedergeschossen.
Am 31. 3. 93.... Wahrend meiner Krankheit ist Assessor Wehlau von
seinem neuen Feldzuge heimgekehrt. Gefangene hat er nicht mitgebracht.
Da sie – so äußerte er beim Essen – hier doch alle stürben, hätte
er sie auf dem Schiffe totschlagen lassen (wörtlich: „habe
ihnen ’n Paar auf den Kopp geben lassen“). Dann erzählte er weiter:
Die Soldaten, namentlich einer, hätten es famos ’raus, den Feinden
die Haut über den Schädel zu ziehen. Am Unterkiefer wurde mit dem
Messer ein Schnitt gemacht, dann mit den Zähnen angepackt, und der
ganze Skalp über Gesicht und Kopf herübergezogen.
Am 4. 5. 93 Gerichtstag, abgehalten von Assessor Wehlau!...
Ein Schwarzer, Aug. Bell, ist beschuldigt, eine Uhr gestohlen zu haben.
Er wird vorgeführt. Das erste, was ihm vorgehalten wird, ist: es gibt
nur zweierlei Wege, entweder er gesteht, er habe den in Frage stehenden
Diebstahl begangen, oder er bekommt 50 Hiebe. Bell sagt aus: „Nein, ich
habe die Uhr nicht gestohlen.“ Sofort wurde er abgeführt und erhält
50 Hiebe mit der Rinozerospeitsche. Wieder vorgeführt gesteht er auf
weiteres Befragen, daß er[S. 271] die Uhr gestohlen habe. Er wird darauf zu
6 Jahren (schreibe und sage sechs Jahren) Gefängnis,
100 Mk. Geldstrafe und 15 Hieben am ersten Sonnabend jedes Monats
verurteilt.
Aug. Bell soll während jener vorerwähnten Verhandlungen ca. 80 Hiebe
bekommen haben, sowohl dafür, daß er nicht gleich eingestand, daß
er die Uhr gestohlen hätte, als auch wenn er, bei der Niederschrift
des Protokolls, die verlangten Antworten nachsprechend, stotterte.
Was aber 80 Hiebe an einem Nachmittag zu bedeuten haben, das kann
nur der in vollem Umfange ermessen, der jemals einer derartigen
Prozedur beigewohnt hat. Ein rohes, gehacktes Beefsteak ist nichts
dagegen.
20. 6. 93... Es sind nach dem Berichte drei Gefangene gehängt worden.
In Wirklichkeit hat Assessor Wehlau dieselben der Wollust der
Soldaten preisgegeben, und diese haben die drei Leute regelrecht
abgeschlachtet. Maschinist Gebhardt von der „Nachtigall“ schildert
diesen Vorgang folgendermaßen: „Die Schwarzen wurden mit Messern
zerschnitten, zerhackt und verstümmelt, da Assessor Wehlau den Befehl
gegeben hatte, die Gewehre beim Töten nicht zu gebrauchen.
Am 18. 8. 93 abends hat der stellvertretende Gouverneur Kanzler Leist
sich aus dem Gefängnis drei Weiber holen lassen (Kassenverwalter
Hering sagte es mir am selben Abend) und dieselben über Nacht bei sich
behalten – darunter die schöne Ngombe, Tochter des Ekwe Bell. Am
nächsten[S. 272] Morgen sind die Weiber ins Gefängnis zurückgeschickt worden;
Ngombe wurde mit einem Geschenk von 5 Mk. bedacht...
Am 2. 10. 93. Vergangene Nacht wurde ich durch lauten Lärm im Gefängnis
aus dem Schlafe geweckt (ca. ½-12 Uhr nachts). Als die Stimmen immer
lauter wurden ging ich hinaus und sah einen Polizeigehilfen im heftigen
Wortwechsel mit drei andern Schwarzen, von denen einer so angezogen
war, wie die Boys des Kanzlers Leist, die an ihren roten Hüfttüchern
erkenntlich sind. Auf mein Befragen wurde mir mitgeteilt, daß der
„Governor“ (Leist) ein Weib aus dem Gefängnis holen
ließe. Ich legte mich ärgerlich zu Bette, konnte aber wegen des
immer mehr anwachsenden Lärmes innerhalb des Gefängnisses, aus dem
es wie Weibergeheul und scheltende männliche Stimmen ertönte, nicht
einschlafen; ich begab mich daher auf die Veranda, wo ich schon den
Kassenverwalter Hering traf. Beide sahen wir jetzt, wie ein Weib
unter Sträuben und Schreien von drei Schwarzen in der Richtung zum
Kanzlerhause hinweggeschleppt wurde. Um ca. 4 Uhr nochmals Lärm im
Gefängnis! Am nächsten Morgen stellte ich mich, als ob ich von nichts
wüßte, fragte einige Schwarze über die Ursache des Getöses in der Nacht
aus und erhielt zur Antwort: The Governor want a woman for usw. Der
Schluß läßt sich denken.“
Soweit das Tagebuch Dr. Vallentins in Auszügen.
Wie wurden nun die Kulturträger bestraft? In der Gerichtssitzung vom 7.
Januar 1896 vor der[S. 273] kaiserlichen Disziplinarkammer wurde festgestellt,
daß die Tötung der drei Gefangenen keine Amtsverletzung sei,
da sie im Kriegszustande erfolgte, dagegen sei die grausame Art der
Ausführung als Amtsverletzung anzusehen. Korvettenkapitän Becker hatte
vor Gericht bekundet, daß in Kamerum allgemein üblich sei, den
Gefangenen die Köpfe abzuschneiden. Wenn das nicht geschehe, werde
es von den Eingeborenen als Feigheit bezeichnet.
Die Strafe gegen Wehlau lautete auf Versetzung in ein anderes Amt
von gleichem Range, auf eine Geldstrafe von 500 Mk. und
Tragung der Gerichtskosten[293]!
*
Paul Rohrbach, von 1903–1906 Ansiedlungskommissar in Südwestafrika,
stellt in seinem Buche „Deutsche Kolonialwirtschaft“ fest, daß man
Herero, die sich auf die Zusicherung der Straffreiheit stellten,
niederschoß. Im Kongostaate herrschte nach dieser Quelle noch
im Jahre 1907 die alte Praxis des Händeabhackens, des
Zusammenschießens und Niederbrennens der Dörfer wegen
ungenügender Kautschuklieferung. Und zwar unter direkter Teilnahme
der weißen Beamten!
Da solche Fälle in den Kolonien aller Nationen, besonders der
Franzosen, Engländer und Niederländer an der Tagesordnung sind und,
wie die Greuel im Kongostaate, wo ein ausdrückliches Reglement
verordnet, daß die aus der Verbindung eines Weißen mit einer Negerin
entspringenden Kinder „Eigentum[S. 274]“ des Staates sind[294], lehren, noch
heute stattfinden, sind sie von symptomatischer Bedeutung für die
Art, in der die christlichen Völker Europas ihr Amt, den Eingeborenen
Kultur zu vermitteln, handhaben. Da hier nur Kulturvölker
Berücksichtigung finden, müssen wir über die Greueltaten der Russen
sogar gegen eigene Landsleute hinweggehen.
Die Grausamkeiten und Plünderungen der verbündeten Nationen im
Chinakriege 1900 sind noch in aller Erinnerung[295].
[S. 275]
Sechzehnter Abschnitt
Autoritäten und Fortschritt
Als Kolumbus auf seine die Kugelgestalt der Erde
voraussetzende Entdeckungsfahrt auszog, wurde er für einen Ketzer
erklärt, und die Kirchenversammlung von Salamanka gab ihm
in frommer Gesinnung den Bannstrahl mit auf den Weg. Man
konstatierte, daß die Bücher Mosis, die Psalmen, die Propheten,
die Evangelien, die Epistel und die Schriften der Kirchenväter
Chrysostomus, Augustinus, Hieronymus, Gregorius, Basilius und Ambrosius
dagegen zeugten. Als er zurückkam, ja als Magelhaens 1522 von einer
Reise rund um den Erdball zurückkehrte, ließ man sich aber trotzdem
nicht belehren, daß eben alle diese Schriften von Irrtümern strotzen.
*
Bekanntlich verdanken wir die Neuentdeckung des heliozentrischen
Sonnensystems erst Kopernikus (1473–1543). Im Jahre 1616 wurde
aus Anlaß der Aktion gegen Galilei sein Buch auf den Index librorum
prohibitorum gesetzt, von dem man es erst 1754 entfernte. Erst 1822
gestattete die Indexkongregation den Druck von Büchern,[S. 276] welche die
Bewegung der Erde lehren. Bis dahin drehte sich also für den gläubigen
Katholiken die Sonne noch um die Erde, d. h. erst nach 2100 Jahren
durfte er die Lehre Aristarchs annehmen!
Luther verwarf die gewaltige Tat des Kopernikus als Narrheit, und
zwar aus einem zwingenden Grunde: weil in der Bibel Josua die Sonne
stillestehen läßt und nicht die Erde!
Das 1. und 2. Keplersche Gesetz wurde (1609 und 1618) von
der Kongregation des Index expurgatorius verboten, weil beide dem
Kopernikanischen System als Stütze dienten, und weil man es nicht für
passend fand, irgendein Gesetz anzuerkennen, das mit Gottes freiem
Willen im Widerspruch stand. Die Macht der Geistlichkeit, die auf
diesen freien Willen Einfluß ausübte, gutes Wetter oder Regen machte
etc., wurde dadurch eingeschränkt. Das Geschäft durfte aber unter
keinen Umständen verdorben werden[296].
*
Da Giordano Bruno unter anderem behauptet hatte, es gebe
mehrere Welten, wurde er am 16. Februar 1600 in Rom
verbrannt. Natürlich war die Kirche daran, wie an allen
Hexenverbrennungen, völlig unschuldig, hatte sie ihn doch mit der
stehenden Formel der weltlichen Behörde überliefert „so barmherzig als
möglich zu sein und ohne Blutvergießen zu bestrafen“[297].
[S. 277]
Für die Dreistigkeit Galileis, eine Wahrheit entdeckt zu haben,
wurde er trotz seines Widerrufes vom römischen Inquisitionsgericht
durch 3 Jahre Kerker bestraft. Ferner mußte er an einem ihm
angewiesenen Orte leben, und die Beisetzung in geweihter Erde wurde ihm
versagt. Mag er dadurch die kirchliche Unsterblichkeit verloren haben,
so kann er doch mit der andern ganz zufrieden sein[298].
*
Die Kirche war eine heftige Feindin der Experimentalphysik
und das nicht ohne Grund. Die Physiker konnten durch ihre teilweise
verblüffenden Experimente den bisher allein von der Geistlichkeit
geübten „Wundern“ erfolgreich Konkurrenz machen oder doch ihnen das
Geschäft verderben, und das mußte natürlich verhütet werden. Sogar bis
auf die Tiere erstreckte sich dieser Brotneid. Als jemand seinem Pferde
einige Kunststücke beigebracht hatte, wurde es 1601 in Lissabon vor
Gericht gestellt und, weil vom Teufel besessen, verbrannt[299].
*
Als 1752 die kgl. Gesellschaft in England den Gregorianischen
Kalender einführte, natürlich gegen eine heftige Opposition von
kirchlicher Seite, wurden einige Mitglieder der Gesellschaft vom
aufgehetzten Pöbel in den Straßen Londons verfolgt, weil sie ihnen
11 Tage ihres Lebens geraubt haben sollten[300]!
*
[S. 278]
Auch im 19. Jahrhundert ließ sich die Geistlichkeit nicht lumpen, so
wenig wie in der Gegenwart. Als in Amerika Anästhetika bei
Geburten angewandt wurden, um den Frauen die Schmerzen zu erleichtern,
trat die Geistlichkeit mit Heftigkeit dagegen auf. Der Grund war, daß
– Moses im 1. Buche 3, 16 erzählt, Gott habe zum Weibe gesprochen:
„Ich will dir viele Schmerzen schaffen, wenn du schwanger wirst; du
sollst mit Schmerzen Kinder gebären..[301]“.
*
Die Schutzpockenimpfung wurde keineswegs durch einen Arzt in die
europäische Medizin eingeführt, sondern durch Lady Wortley Montague,
die als Gattin des britischen Gesandten in Konstantinopel in den
Jahren 1716–1719 die von Indern und Orientalen schon längst geübte
Schutzimpfung von Menschenblattern gegen die Pocken kennen lernte.
Sie verschaffte dieser wichtigen, wenn damals auch noch keineswegs
ungefährlichen und von ärztlicher Seite natürlich hart angegriffenen
Neuerung – wo hätte je eine Zunft von außen kommende Anregungen
freudig aufgenommen? – in England Verbreitung. Die Geistlichkeit
aber sträubte sich dagegen, da sie in Krankheiten wie auch in
Erdbeben eine unabwendbare Heimsuchung Gottes gegen die Menschheit
um ihrer Sünden willen sah. Die Geistlichkeit ist eben in gewissen
Eigenschaften auf der ganzen Erde sich gleich. Vor dieser Gemeinsamkeit
tritt die Differenz der Religion und Konfession zurück. Auch die
Impfung mit Kuhpockenlymphe ist nicht von einem Arzte ent[S. 279]deckt
worden. Jenner lernte sie vielmehr von Laien. Seit dem Jahre
1761 hatte der Pächter Jensen und Schullehrer Plett sie bereits in
Holstein angewandt. Diesmal bemächtigte sich aber die Wissenschaft der
Errungenschaft relativ schnell. Denn schon 38 Jahre(!) später, im Jahre
1799, wurden die ersten Impfungen von deutschen Ärzten in Hannover
vorgenommen, und zwar unter englischem Einfluß[302].
*
In der Gegenwart wüten Katholizismus und orthodoxer Protestantismus aus
gleich triftigen Gründen gegen die Entwicklungslehre, Darwinismus
und Lamarckismus. Es gab eben noch nirgend einen Fortschritt oder
eine neuentdeckte Wahrheit, die nicht von Kirche und Geistlichkeit
bekämpft worden wäre. Die Angst dieser Faktoren vor Wahrheit und Wissen
wird köstlich illustriert durch die von der theologischen Fakultät
zu Paris aufgeworfene Frage, was aus der Religion werden solle,
wenn das Studium der griechischen und hebräischen Sprache erlaubt
sei[303]. Also nicht nur im Buche der Natur zu blättern ist für
die Gottesstreiter gefährlich, sogar die Nachprüfung der Quellen, aus
denen sie ihre Existenzberechtigung herleiten wird – nicht ohne Grund
– von ihnen gefürchtet! Chamberlain nennt die Bibel sogar das
einzige für Rom wirklich gefährliche Buch!
*
Als Professor Friedrich Delitzsch 1901 und 1902 seine so
außerordentliches Aufsehen erregenden Vor[S. 280]träge über Babel und Bibel
hielt, konnte man sich um etliche Jahrhunderte zurückversetzt glauben.
Delitzsch hatte darauf hingewiesen, daß dem Bibelstudium durch die
Ausgrabungen von Keilinschriften reiche Förderung in historischer und
realer Hinsicht zuteil würde: die Namen von Örtlichkeiten, historische
Personen treten in helleres Licht. Es zeige sich, daß Kanaan eine
Kulturprovinz Babyloniens sei, das dorthin Handel und Recht und Sitte
und Wissenschaft verpflanzt habe. Der Sabbat sei babylonisch,
desgleichen eine ganze Reihe biblischer Erzählungen, wie die von der
Sintflut, Schöpfung, Sündenfall, Paradies, Leben nach dem Tode,
Engeln und Dämonen, letzten Endes sogar der Monotheismus.
Dieser bestand bekanntlich bei den Israeliten ursprünglich durchaus
nicht in der Form, wie sie offiziell heute gelehrt wird, und trotz
„Dreieinigkeit“ und Teufel angeblich bei uns besteht, sondern in der
des Henotheismus, daß eben der Judengott stärker und mächtiger war, als
die der benachbarten Völkerschaften[304].
Diese Vorträge riefen bei sehr vielen einen Sturm der Entrüstung
hervor, und es wurde im Ernste von „orthodoxer“ Seite der
leidenschaftliche Versuch gemacht, um der Heiligkeit des Glaubens
willen die Sonderstellung Israels und seine besondere göttliche Mission
zu verteidigen, d. h. sich mit Entschiedenheit gegen die Assyriologie,
als eine exakte und historische Wissenschaft zu wehren, bzw. ihre
Resultate ungeprüft oder mit Scheingründen abzulehnen. Das mußten
sie tun zur Beruhigung der Gemeinde[305]! Es gibt also noch
in Deutschland zu Beginn des 20. Jahr[S. 281]hunderts weite Volksschichten,
die sich beunruhigt fühlen, wenn man den Nachweis erbringt, daß die
Juden, dieses Parasitenvolk, das während seiner ganzen selbständigen
Geschichte weder auf politischem noch auf kulturellem Gebiete
Nennenswertes geleistet hat, Schüler der weit bedeutenderen Babylonier
sind[306]! Die im Ernst glauben, Zustände, die im halbbarbarischen
Vorderasien vor 2½ Jahrtausenden herrschten, auf die Gegenwart
übertragen zu können, ja letztere an ersteren zu messen! Und das
alles, weil sie glauben oder zu glauben vorgeben, der liebe Gott habe
seinen auserwählten Juden die Bibel wörtlich in die Feder diktiert!
Tatsächlich steht es bei Kollisionen zwischen historischen oder
naturwissenschaftlichen Ergebnissen mit der Bibel für viele fest, daß
erstere irren, wie es ja auch noch heute Leute geben soll, die an den
Stillstand der Sonne auf Josuas Befehl glauben. Also heute noch
lassen sich Deutsche in ihrem Denken und Handeln von Anschauungen eines
kleinen, einst in fremdem Erdteil wohnenden Volkes beeinflussen, das
kulturell etwa auf der Stufe stand, die unsere Vorfahren unter den
fränkischen Kaisern einnahmen!
*
Um das Jahr 1600 wurde ein Webstuhl erfunden, der sogenannte
„Mühlstuhl“, der auf einem Räderwerk und mechanischem Antrieb beruhte,
eine wesentliche Erleichterung der bisherigen Fabrikationsweise. Da
die Arbeiterschaft über Konkurrenz schrie, verfaßte die kaiserliche
Kanzlei in den Jahren 1681, 1685 und 1719 immer neue Verordnungen,
die die An[S. 282]wendung des Mühlstuhls in der deutschen Industrie
verboten. Zuerst wurde er in Sachsen zugelassen und sogar durch
Prämien unterstützt, als es galt, die schweren Wunden zu heilen, die
der Siebenjährige Krieg geschlagen hatte. Also über anderthalb
Jahrhunderte hatten die Behörden sich dem Gebrauche einer wichtigen
Erfindung widersetzt[307]!
*
Im Jahre 1306 war in England das Verbrennen der Steinkohle von König
Eduard I. verboten worden wegen des Rauches und des üblen Geruches[308].
*
Als J. von Baader, der Veteran des Eisenbahnbaues, sich im Jahre 1831
an die Ständekammer wandte mit der Bitte um Unterstützung, beschloß
sie zwar in einer noblen Anwandlung „das Anerbieten J. v. Baaders
zur Einführung einer neuerfundenen Bauart von Eisenbahnen und zum
Nachweis des Reellen seiner Erfindung durch Versuche im großen in
der Art anzunehmen, daß ihm aus Staatsmitteln 3000 Gulden gegeben
würden, die er sofort wieder zurückersetzen müsse, wenn seine
Versuche den gemachten Zusicherungen nicht entsprächen“, die Kammer
der Reichsräte verweigerte aber ihre Zustimmung! Zwei Jahre später, am
10. Juli 1833, wurde endlich der Beweis erbracht, daß die Regierung
– wenn schon nicht die Kammern – die außerordentliche Tragweite des
Projektes mit weitem Blick erkannt hatte und demnach in großherziger
Weise unterstützte. Die[S. 283] Ministerialentschließung lautet: „Die k.
Regierung in Ansbach wird ermächtigt, für den Fall der Realisierung
der Anlage einer Eisenbahn zwischen Nürnberg und Fürth durch Bildung
einer Aktiengesellschaft 2 – zwei – Aktien au porteur
auf Rechnung des Zentralindustriefonds zu erwerben, um hierdurch
die lebhafte Teilnahme der Staatsregierung an dem wichtigen
Unternehmen zu bewähren.“ Der Preis der Aktie betrug 100 Gulden, von
denen 10% angezahlt wurden. Es war nötig, den König um Unterstützung
anzugehen, sonst wären die restierenden 180 Gulden noch nicht
am 25. November 1835 bezahlt worden! Das war die von der Regierung
der ersten deutschen Eisenbahn gewährte Unterstützung! Bedenkt man
allerdings, daß es damals Leute gab, die die Eisenbahn als eine
Teufelserfindung verabscheuten und es als eine Versuchung Gottes
erklärten, mit Dampf statt mit Pferden und anderen Tieren zu
fahren, die dazu vom Schöpfer dem Menschen gegeben seien, dann kann man
der Regierungsspende von 200 Gulden eine gewisse Großartigkeit nicht
absprechen[309].
*
1806 behauptete das Mitglied des Instituts, Mercier, in einem Werke,
daß die Erde sich nicht bewege. Er werde nie zugeben, daß
sie sich „wie ein Kapaun am Bratspieß“ drehe. Bereits die Schule
des Pythagoras hatte die tägliche Bewegung der Erde gelehrt. Weder
Platon noch Aristoteles gaben das zu, und der große Geograph Ptolemäus
bezeichnet die Hypothese als Narretei und „völlig lächerlich[310]“. Das
hl.[S. 284] Offizium hatte s. Z. Galilei gegenüber diese Lehre für „töricht
und absurd vom philosophischen Standpunkt und für teilweise formell
ketzerisch“ erklärt.
*
Als am 11. März 1878 in der Académie des Sciences der Physiker Du
Moucel den versammelten Gelehrten den Phonographen Edisons
vorführte, sprang der Akademiker Monsieur Bouillaud, durchdrungen von
klassischer Bildung voll edler Empörung über die Frechheit des Neuerers
dem Vertreter Edisons an die Kehle und schrie: „Sie Schuft! Glauben
Sie, wir lassen uns von einem Bauchredner zum Besten halten?!“
Am 30. September des gleichen Jahres gab Bouillaud nach eingehender
Prüfung des Apparates die Erklärung ab, er sei überzeugt, daß es sich
nur um eine geschickte Bauchrednerei handle. „Man könne doch
unmöglich annehmen, daß ein schäbiges Metall den edlen Klang der
menschlichen Stimme wiedergeben könne.“
*
Als Lavoisier die Luft in ihre Bestandteile zerlegte und
entdeckte, daß sie vornehmlich aus den zwei Gasen Sauerstoff und
Stickstoff bestehe, also kein Element sei, rief diese Entdeckung
einen Sturm der Entrüstung hervor. Der Chemiker Baumé, Erfinder
des Aräometers und Mitglied der Académie des Sciences, wetterte
dagegen: „Die Elemente oder Grundbestandteile der Körper sind von
den Physikern aller Jahrhunderte und aller Nationen anerkannt und[S. 285]
festgestellt worden. Es ist nicht zulässig, daß die seit 2000 Jahren
anerkannten Elemente jetzt heute in die Kategorie der zusammengesetzten
Substanzen eingereiht würden. Man darf das Verfahren, Luft und Wasser
in seine Bestandteile zu zerlegen, ruhig als unsicher hinstellen; ganz
absurdes Geschwätz, um nicht noch mehr zu sagen, ist es aber, die
Existenz von Feuer und Erde als Elemente zu leugnen. Die den Elementen
zugeschriebenen Eigenschaften stimmen mit den bis heute erreichten
chemischen und physischen Kenntnissen überein; sie haben als Basis für
eine Unmenge Entdeckungen und Theorien gedient, eine glänzender als die
andere, und man würde diesen Lehren alle Glaubwürdigkeit nehmen, wenn
Feuer, Wasser, Luft und Erde nicht mehr als Elemente gelten sollten.“
*
Auf einen genau beobachteten Meteorfall, bei dem man das
Aufleuchten gesehen, den Knall gehört, den fallenden Meteor bemerkt
und ihn noch ganz glühend aufgefunden und der Akademie zur Prüfung
übersandt hatte, schrieb der berühmte Lavoisier einen sehr
gelehrten Bericht an diese, indem er die Unmöglichkeit nachwies, daß
Steine vom Himmel fallen.
Gassendi, einer der selbständigsten und unterrichtetsten
Geister des 17. Jahrhunderts, sieht 1627 mit eigenen Augen am hellen Tage einen
Meteor aus der Luft fallen, untersucht den 30 kg schweren Stein[S. 286] und
führt das Phänomen auf ein unbekanntes Erdbeben zurück.
*
Vor wenigen Jahren sprach Verfasser, der selbst diesen und anderen
Fragen völlig neutral gegenüber steht, mit einem berühmten Professor
der Physik über okkulte Phänomene. Von der Ansicht ausgehend, daß man
nicht Beobachtungen und Tatsachen an Theorien, sondern diese an jenen
prüfen müsse und daß jede Theorie täglich neuen Prüfungen standzuhalten
habe, legte er ihm nahe, der Sache nachzugehen. Er erhielt die
Antwort, daß ihm das zu gefährlich sei, denn wenn er sich von
ihrer Richtigkeit überzeuge, würde er seinen Ruf bei den Fachgenossen
einbüßen!
Die Beobachtung des großen Physikers Galvani, die er 1791
an Froschschenkeln machte und in deren Verfolgung er den nach ihm
benannten Strom entdeckte, wurde – von einigen wenigen abgesehen –
allgemein mit ungeheurem Gelächter aufgenommen. Er schrieb 1792
darüber: „Ich werde von zwei verschiedenen Parteien angegriffen, von
den Weisen und von den Dummen. Den einen wie den andern bin ich ein
Spott, und man nennt mich den Tanzmeister der Frösche. Trotzdem weiß
ich, daß ich eine neue Naturkraft entdeckt habe.“
*
Harvey, der Entdecker des Blutkreislaufes, wurde von Guy-Patin
und der gesamten Fakultät mit beißendem Sarkasmus gequält.
*
[S. 287]
Ignaz Semmelweis (1818–1865), der Entdecker des
infektiösen Charakters des Kindbettfiebers, auf dessen
Anordnungen hin die Sterblichkeit an dieser Krankheit in der Wiener
geburtshilflichen Klinik auf ein Viertel sank, wurde von den
Fachgenossen solcher Widerstand entgegengesetzt, daß er sich
völlig aufrieb und im Irrenhause endete.
*
Als Fulton 1804 dem großen Napoleon den Vorschlag machte, zum
Kriege gegen England eine Dampfschiffflotte zu bauen, ließ Napoleon das
Projekt durch das Nationalinstitut zu Paris prüfen. Er schrieb unterm
21. Juli des Jahres an den Minister de Champagny: „Sie haben mich viel
zu spät darauf aufmerksam gemacht, da dieses Projekt imstande ist,
das Aussehen der Welt zu verändern... Eine großartige Wahrheit,
eine tatsächliche, handgreifliche Wahrheit steht vor meinen Augen.
Sache der betreffenden Herren (der Kommission) wird es sein, dieselbe
zu sehen und sich zu bemühen, sie zu erfassen. Sobald Bericht darüber
erstattet ist und Ihnen zugegangen sein wird, ist er mir zu übersenden.
Sorgen Sie dafür, daß diese Sache in höchstens acht Tagen erledigt ist,
denn ich bin ungeduldig“.
Noch 1816 wurde das Gesuch des Marquis de Joffroy, der bereits 1776
einschlägige Versuche ver[S. 288]anstaltet hatte, vom Pariser Patentamt
und dessen Leiter Colonne mit Rücksicht auf den geringen Wert der
Erfindung abgelehnt[311]!
*
Philippe Lebon, der Erfinder der Gasbeleuchtung (1797) konnte
die Welt nicht davon überzeugen, daß eine Lampe ohne Docht brennen
könne. Erst 14 Jahre nach seinem 1804 erfolgten Tode wurde seine
Erfindung in Paris eingeführt, während Birmingham schon 1805 mit der
Gasbeleuchtung vorangegangen war.
*
Als die ersten Proben mit der Eisenbahn gemacht wurden, wiesen die
Ingenieure nach, daß die Lokomotiven unmöglich von der Stelle kommen
könnten und daß ihre Räder sich immer nur um sich selbst drehen
würden. Arago erklärte in der französischen Deputiertenkammer 1838,
daß die Transportkosten in Frankreich, die sich z. Z. auf 2803000
Frs. beliefen, nach Ausbau des Bahnnetzes auf 1052000 Frs. vermindern
würden, so daß das Land jährlich zwei Drittel der Einnahmen aus den
Transportkosten verlieren würde.
Thiers meinte: „Ich gebe ja zu, daß die Eisenbahnen die Beförderung
von Reisenden etwas er[S. 289]leichtern werden, wenn der Gebrauch auf
einige ganz kurze Linien in der Nähe großer Städte, wie Paris,
beschränkt bleibt. Man braucht keine weiten Strecken.“
Das kgl. bayerische Medizinalkollegium erklärte, daß der Bau der
Eisenbahnen ein großes Verbrechen gegen die öffentliche Gesundheit
wäre, denn eine so schnelle Bewegung würde bei den Reisenden
Gehirnerschütterung, bei den Zuschauern aber Schwindelanfälle erzeugen.
Das Kollegium empfahl daher dringend, an beiden Seiten der Schienen
Scheidewände in der Höhe der Wagen aufzurichten[312].
Die bayerische oberste Baubehörde aber konstatierte die Unmöglichkeit
für Züge, auf einem Damme zu fahren. Es müßten unbedingt Mauern
zur Unterlage für die Schienen errichtet werden[313].
*
Als 1853 der Vorschlag gemacht wurde, ein Unterseekabel von
Europa nach Amerika zu legen, schrieb Babinet, einer der größten
Autoritäten in der Physik und Examinator an der Polytechnischen
Schule zu Paris, in der Revue des Deux Mondes: „Ich kann diese
Pläne nicht ernsthaft nehmen; die Theorie des elektrischen Stromes
zeigt unwiderlegbar deutlich die Unmöglichkeit einer solchen
Übertragung, selbst wenn man nicht mit dem Strom rechnet, der sich
von selbst auf einer so langen elektrischen Strecke bildet und sich
schon auf der kurzen Reise von Dover nach Calais fühlbar macht. Das
einzige Mittel,[S. 290] die Alte und die Neue Welt zu verbinden, ist, die
Beringstraße zu passieren, vorbei an den Faröerinseln, Island, Grönland
und Labrador.“
*
Unterm 13. Juli 1873 wurde die Aufnahme Darwins in die Akadémie des
Sciences abgeschlagen und dafür ein Herr Loven gewählt.
*
Robert Mayers Entdeckung von der Erhaltung der Energie wurde
von der Gelehrtenwelt derart verspottet, daß er in eine schwere
Nervenkrankheit verfiel, in deren Folge er sich aus dem Fenster stürzte.
*
Der Elektriker Ohm wurde von seinen Zeitgenossen als Narr
verspottet.
*
In England verweigerte die kgl. Gesellschaft 1841 eine
Erinnerungstafel für den berühmten Joule. Einige Dezennien
später wurde die Errichtung eines Denkmales für Darwin verweigert und
dafür ein Affenhaus gegründet.
Als Franklin der kgl. Gesellschaft in London seine Erfahrungen über
die Fähigkeit einer Eisenstange, die Elektrizität der Atmosphäre
abzuleiten, mitteilte, war ein Heiterkeitsausbruch die einzige Antwort,
und die gelehrte Gesellschaft weigerte sich rundweg, den Vortrag
drucken zu lassen.
*
[S. 291]
Im Jahre 1781 veröffentlichte François Blanchard († 1809) im
Journal de Paris einen Brief, in dem er einen Flugapparat
beschrieb, an dessen Konstruktion er 10 Jahre lang gearbeitet hatte.
„Auf einem kreuzförmigen Gestell ruht eine Art Boot von 4 Fuß Länge
und 2 Fuß Breite, welches sehr widerstandsfähig ist, obwohl es nur
aus dünnen Stäben besteht. Zu beiden Seiten des Schiffchen erheben
sich 6–7 Fuß hohe Stützen, die 4 Flügel von je 10 Fuß Länge tragen.
Diese bilden zusammen einen Schirm, der einen Durchmesser von 20 Fuß
und mithin einen Umfang von mehr als 60 Fuß hat. Die 4 Flügel bewegen
sich mit überraschender Leichtigkeit. Die ganze Maschine, obwohl von
beträchtlicher Größe, kann bequem von 2 Männern in die Höhe gehoben
werden. Sie hat in der Tat die größte Vollkommenheit erreicht. Man wird
mich, schneller als einen Raben, die Luft durchschneiden sehen, ohne
daß der rapide Flug mir den Atem benimmt, da ich durch eine sinnreiche
Schutzvorrichtung davor gesichert bin.“
Viel war bei dieser Ankündigung Aufschneiderei. Immerhin machte er
im Garten seines Hauses Flugversuche und es gelang ihm in der Tat
mit Hilfe eines Gegengewichtes von 20 Pfund, das an einer Stange
herabglitt, eine Höhe von 80 Fuß zu erreichen. Der Apparat bedurfte
also nur mehr eines Auftriebes von 20 Pfund, um das Problem zu lösen.
Später soll diese Differenz gar auf 6 Pfund ermäßigt worden sein.
Das war ein zweifelloser Erfolg. Anders dachte darüber der berühmte
Astronom J. J. L. de Lallande (1732–1807), der in einem
Schreiben vom 18. Mai 1782 im Journal de Paris seinem Unwillen über
das von[S. 292] Blanchard erregte Aufsehen Luft machte. „... Gestatten Sie,
daß ich das Wort ergreife, um Ihren Lesern die Versicherung zu geben,
daß das Schweigen der Gelehrten ein Schweigen der Nichtachtung
ist. Es ist in jeder Hinsicht als unmöglich erwiesen, daß sich
ein Mensch in die Luft erheben und darin halten könne. Coulomb,
Mitglied der Akademie der Wissenschaften, hat vor etwa einem Jahre in
einer unserer Sitzungen einen Vortrag gehalten, in welchem er, auf
Erfahrungstatsachen gestützt, durch eine Berechnung der menschlichen
Kräfte nachweist, daß man dazu Flügel von 12000 bis 15000 Fuß Größe
haben müsse, die mit einer Geschwindigkeit von 3 Fuß in der Sekunde
bewegt werden müßten. Nur ein Tor kann auf Realisierung solch
phantastischer Ideen noch hoffen.“ Er fügte noch hinzu, daß es
ebenso unmöglich sei, sich durch das geringere spezifische Gewicht
luftleerer Körper zu erheben.
Noch in dem gleichen Jahre, im November 1782, hat Stephan Mongolfier
den Warmluftballon zu Avignon erfunden[314].
*
Ein Herr an einer katholisch-theologischen Fakultät erklärt
heute noch die Entstehung der Kohle dadurch, daß Gott die Finsternis
in die Erde hinein gebannt habe, und wo diese wieder zum Vorschein
komme, geschähe es zur Erzeugung und Befriedigung teuflischer Gelüste,
wie Völlerei und Schlemmerei[315]!
Als 1908 Graf Zeppelin, dem mit nicht geringerer Skepsis von
„autoritativer“ Seite begegnet sein soll[S. 293] – bekanntlich behandelte man
ihn auf dem Kieler Ingenieurtag 1901 als Narr –, seine großartigen und
erfolgreichen Experimente mit dem lenkbaren Luftschiff anstellte, war
der erste Gedanke der Kulturvölker der an die hierdurch hervorgerufenen
Umwälzungen im Gebiete der Kriegführung!
[S. 294]
Literaturnachweis
Erster Abschnitt
Abkürzung: Beil. = wissenschaftliche Beilage der M.
Allgemeinen Zeitung.
Eine Reihe der in diesem Abschnitt angeführten Daten ist der
Zusammenstellung von P. Wagler „Modernes im Altertum“ Beil. 1902, Nr.
212, 213, 219 und 220 und 1904, Nr. 162 f., 171 f. und 174 entnommen.
Hier auch stets die Quellenangaben.
Zweiter Abschnitt
Dritter Abschnitt
Vierter Abschnitt
Fünfter Abschnitt
Sechster Abschnitt
Siebenter Abschnitt
Achter Abschnitt
Neunter Abschnitt
Zehnter Abschnitt
Elfter Abschnitt
Zwölfter Abschnitt
Dreizehnter Abschnitt
Vierzehnter Abschnitt
Fünfzehnter Abschnitt
Sechzehnter Abschnitt
Die wohlwollende Aufnahme der Kultur-Kuriosa von seiten der Kritik
und des Publikums enthebt mich der Notwendigkeit, das Buch zu
rechtfertigen. Daß orthodoxe und reaktionäre Stimmen dagegen polterten,
hatte ich erwartet, ja erhofft. Auffällig war nur, daß auch manchmal
von wohlmeinender Seite der Geist des Buches nicht verstanden wurde.
Las ich, daß die Tendenz des Verfassers „im Grunde genommen gut“ sei,
konnte ich mich nur schwer eines Lächelns enthalten. Die Versicherung,
daß ich auf die niederen Instinkte spekuliere, bewies mir aufs
neue, daß mancher, ohne es zu wissen, sichere Anwartschaft auf das
Himmelreich hat (Matth. 5, 3). Ja, es gibt Leute, denen ein gerechter
Richter oder eine moralische Handlung kurios erscheint, und diese
dünken sich Erbpächter des Patriotismus!! Wer nicht immer hurraaaaah!
schreit, gilt in den Augen manches Biedermanns schon für verdächtig.
Darüber zu streiten liegt mir fern.
Einem andern Einwand möchte ich begegnen: der Bemängelung des
Quellennachweises. Richtiger als die Frage, wo etwas steht, ist die,
ob es auch wahr ist. Nur gesicherte Tatsachen mitzuteilen war
und ist aber mein erstes Bestreben. Wie sehr es mir gelang, beweist,
daß auch die leidenschaftlichsten[S. 306] Gegner mir keine nennenswerten
Irrtümer nachweisen konnten. Doch auch wer an der Art des Zitierens
etwas auszusetzen hat, würde vielleicht eines Besseren belehrt worden
sein, hätte er sich die Mühe genommen, die angegebenen Stellen
nachzuschlagen. Er würde dann dort fast ausnahmslos die Angabe der
primären Quellen gefunden haben. Nichts wäre für mich einfacher gewesen
als sie abzuschreiben, aber mit einer Belesenheit zu prunken, die ich
nicht besitze, ist nicht meine Art. Immerhin habe ich in dieser neuen
Auflage einige Konzessionen gemacht.
Für Ergänzungen und Berichtigungen bin ich nach wie vor dankbar. Vor
allem ist es mir ein Bedürfnis allen jenen, die die Freundlichkeit
hatten, durch Notizen zur Vervollkommnung des Buches beizutragen,
herzlichst zu danken. Es sind dies die Herren: Ingenieur M. Feldhaus in
Berlin-Friedenau, Oberst z. D. Schäfer in Berlin, Rechtsanwalt Eichhold
in München, Schriftsteller Julius Berger in Wien, Dr. Hans F. Helmolt
in München, Dr. G. Merzbach in Berlin und Ingenieur Fritz Hoffmann in
Berndorf bei Wien. Desgleichen danke ich allen jenen, die mir brieflich
ihre Sympathie aussprachen, in erster Linie Herrn Professor Dr. Ernst
Mach, Mitglied des Herrenshauses in Wien.
München, im Februar 1910
Der Verfasser
Das 12. Tausend ist bis auf einige Zusätze und Korrekturen ein
unveränderter Abdruck der vorigen Auflagen.
München, im Mai 1913
Der Verfasser
Dr. Max Kemmerich
Prophezeiungen
Alter Aberglaube oder neue Wahrheit?
Mit einem Kapitel über den Weltkrieg
6. Auflage. Geheftet 6 Mark, gebunden 8 Mark
Die Zeit, Wien: Um streng wissenschaftlich zu verfahren,
begnügt sich der Verfasser nicht mit einer Anekdotensammlung und der
Aufstellung von Grundsätzen für die Beurteilung der einzelnen Fälle,
sondern unterwirft eine berühmte Prophetie und die Gesamttätigkeit von
sechs mehr oder weniger berühmten Sehern und Seherinnen einer strengen
Prüfung darauf hin, ob das Eintreffen ihrer Vorhersagungen ein Werk
des Zufalls oder Ergebnis einer Berechnung sein könne.... Wenn man
den Namen Nostradamus so oft im „Faust“ gelesen hat, aber rein nichts
von dem Mann weiß, freut man sich, endlich einmal Genaues über ihn zu
erfahren.... Daß die „Prophezeiungen“ reißend abgehen werden, kann man
ohne Prophetengabe und Träume voraussagen, denn so etwas lesen alle
Leute gern, auch die Aufgeklärten, die über den „Unsinn“ spotten oder
drauf schimpfen.
Kultur-Kuriosa II
8. Auflage. Geheftet 4 Mark 50 Pf., gebunden 6 Mark 50 Pf.
Berliner Börsenzeitung: Es ist ihm nicht um den Ruhm eines
findigen belesenen Kopfes und geschickten Kompilators zu tun, der
amüsante Historien angenehm zu erzählen weiß, sondern er will weit
mehr: ihm liegt daran, den wahren Stand unserer heutigen Kultur durch
Aufzeigen deren historischer Basis klar darzustellen.... Auch in diesem
zweiten Bande seiner Kultur-Kuriosa übt er seine so rühmenswerte und
– natürlich – so angefeindete Offenheit, die ihm nach wie vor das
Muckertum... auf den Hals hetzen, den geistig Mündigen jedoch zu seinem
Freunde machen wird.
Aus der Geschichte der menschlichen Dummheit
6. Auflage. Geheftet 4 Mark 50 Pf., gebunden 6 Mark 50 Pf.
Zeitschrift für Bücherfreunde, Leipzig: Ein jeder wird
gestehen: das Buch wird fröhliche Menschen ergötzen und unterhalten,
nachdenkliche Menschen nachdenklicher machen und sie ins Psychologische
führen. Pessimisten aber werden in diesen Dokumenten einen Trost
finden: daß nämlich die Schlechtigkeit der Menschen noch durch ihre
Dummheit übertroffen wird; – und das ist ein großer Trost.
Neues Wiener Tagblatt: Das neue Buch Kemmerichs gehört
jedenfalls zu den lichtvollsten Erklärungen für die düstere Psyche
vergangener Jahrhunderte und wird sicherlich viel dazu beitragen, die
Reste, die aus jenen Tagen zurückgeblieben sind, zerstören zu helfen.
Verlag von Albert Langen in München
Von Dr. Max Kemmerich erschien ferner
Das Kausalgesetz der Weltgeschichte
Zwei Bände
In Halbfranz gebunden 32 Mark
Kritische Rundschau, München: Was will nun das Buch? Es soll
darin der Beweis geliefert werden, daß man mit Hilfe des Gesetzes von
der Erhaltung der Energie, angewandt auf die Geschichtswissenschaft,
imstande ist, das Kausalgesetz der Weltgeschichte intuitiv zu
durchschauen und kommende Ereignisse voraus zu berechnen....
Selbstbekenntnisse eines Wahrheits-Suchers, so könnte man dieses
Buch taufen. Eine Individualpsychologie, wie sie kaum jemals mit
solcher Offenheit geschrieben worden sein dürfte. Möge sie recht
viele Leser finden, diese Individualpsychologie, Leser, die trotz
aller Unebenheiten und Schroffheiten nicht ermüden, dem Verfasser
verständnisvoll zu folgen, wenn er sie in tieferliegende Wahrheiten
einweihen will, die sich ihm intuitiv erschlossen haben.
Dr. Hans F. Helmolt:... Die umfassende Weite seines
Gesichtskreises, die Kühnheit seines Gedankenfluges, der Scharfsinn
seiner Schlußfolgerungen, seine trotz wiederholter Ableugnung
staunenswerte Belesenheit und der leichte Fluß seiner Ausführungen
bei der Lösung selbst der schwierigsten Fragen.... Epoche aber wird
Kemmerichs „Kausalgesetz“ sicherlich machen als psychologische
Zergliederung eines entscheidenden Ausschnittes aus der eigenen
Entwicklung. Hierin erinnert es direkt an Augustin oder Rousseau.
Heinrich Lhotzky:... wir sahen uns in Deutschland vor einen
europäischen Krieg gestellt. Da las ich das Buch wieder. Die
Ereignisse gaben ihm eine erschütternde Auslegung.... Wie gesagt,
ist es möglich, daß den Kemmerichschen Voraussagen weder Beachtung
noch Glaube geschenkt wird, und nichts liegt dem Verfasser ferner,
als dafür zu agitieren. Er sieht voraus, daß sein Mahnruf ungehört
verhalle, obgleich es sich nur um sinngemäße Anwendung unentrinnbarer
Naturgesetze auf unsere Geschichte handelt, wie man etwa im Sommer und
Herbst sich vorsieht, den Winter zu überstehen....
Verlag von Albert Langen in München