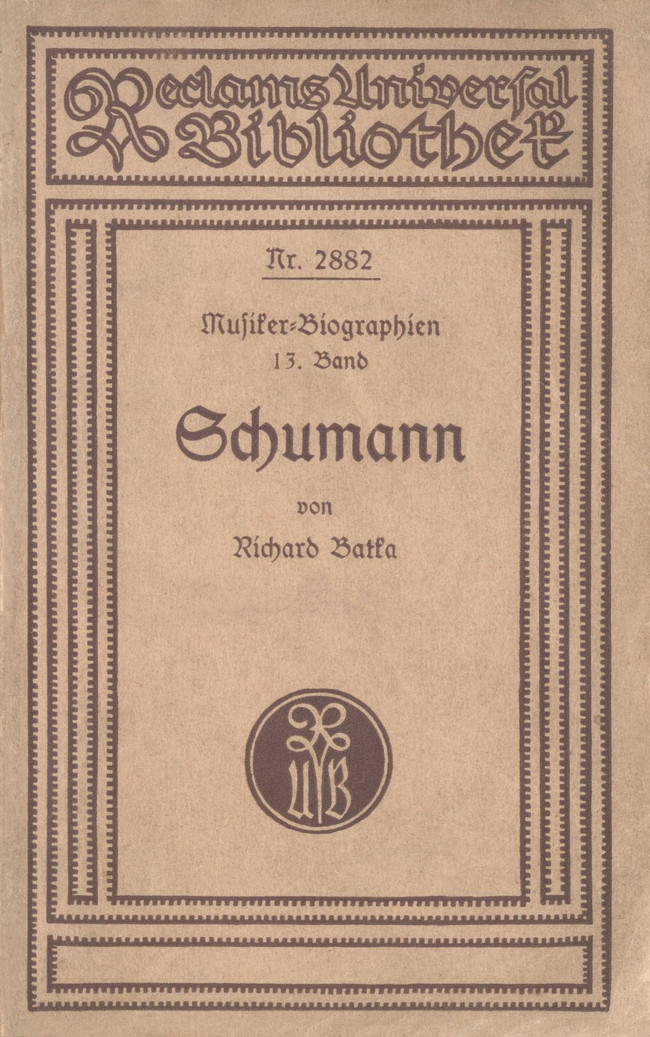
Title: Schumann
Author: Richard Batka
Release date: December 28, 2020 [eBook #64151]
Most recently updated: October 18, 2024
Language: German
Credits: the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net
Anmerkungen zur Transkription
Der vorliegende Text wurde anhand der 1891 erschienenen Buchausgabe so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute nicht mehr gebräuchliche Schreibweisen sowie Schreibvarianten bleiben gegenüber dem Original unverändert, sofern der Sinn des Texts dadurch nicht beeinträchtigt wird.
Die Fußnoten wurden an das Ende des jeweiligen Kapitels gestellt.
Die Angabe von Tonarten erfolgt uneinheitlich bezüglich der Groß- und Kleinschreibung, sowie der Verwendung von Schriftarten. Die vorliegende Bearbeitung folgt in dieser Hinsicht der Originalvorlage.
Abhängig von der im jeweiligen Lesegerät installierten Schriftart können die im Original gesperrt gedruckten Passagen gesperrt, in serifenloser Schrift, oder aber sowohl serifenlos als auch gesperrt erscheinen.
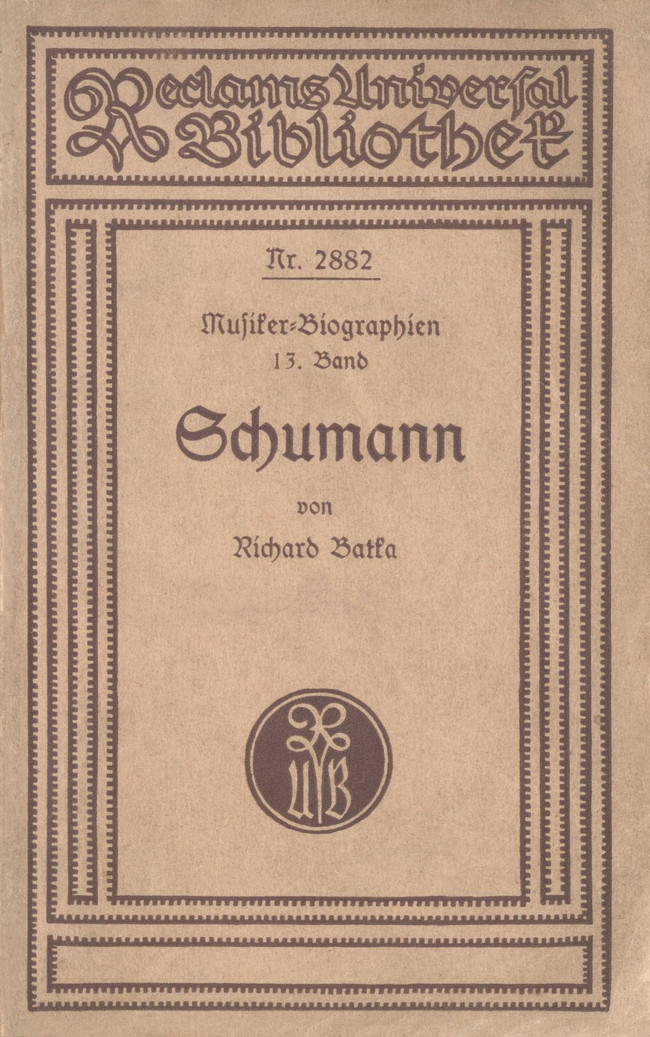
Musiker-Biographien
13. Band
von
Richard Batka
Zweite Auflage
Verlag von Philipp Reclam jun. Leipzig
Copyright 1891 by Philipp Reclam jun. Leipzig
Uebersetzungsrecht vorbehalten
Druck von Philipp Reclam jun. in Leipzig
|
Seite
|
|
|
Vorwort
|
|
|
1. Die Jugendzeit (1810–1828)
|
|
|
2. Die Studienjahre (1828–1830)
|
|
|
3. Erste Künstlerzeit (1830–1835)
|
|
|
4. Klara (1835–1840)
|
|
|
5. Die Lieder (1840)
|
|
|
6. Wollen und Wagen (1840–1849)
|
|
|
7. Letzte Lebensjahre (1849–1856)
|
|
|
8. Rückblick
|
Die deutsche Kulturgeschichte lehrt, daß die Ideale der Musik in vier aufeinander folgenden Zeiträumen sich nach und nach erweitert haben, so zwar, daß zu den bereits erkannten Zielen stets neue und schönere gewonnen werden. Zur Zeit Händels und Bachs gipfelt die Musik noch vorzugsweise in kunstreichem architektonischen Bau; in der Mozartschen Periode kommt dazu die Forderung des sinnlichen Wohlklangs; Beethoven, der Riese, entdeckt sodann die unermeßliche Fähigkeit der Tonkunst, ganz individuelle Gefühle und Stimmungen auszusprechen, und Wagner endlich verschwistert sie auf das Innigste mit der Poesie. Zwischen den beiden letztgenannten Meistern nimmt Robert Schumann zeitlich und ideell eine Mittelstellung ein. Noch ist er in erster Reihe Musiker, aber in oder an seine Tonwerke drängen sich schon vielfach poetische Elemente; der Gebrauch, Instrumentalsätze mit sinnigen Überschriften zu versehen, der bereits gelegentlich bei Beethoven vorkommt, findet sich bei Schumann so allgemein, daß man ihn fast den Programmusikern zuzählen möchte, wäre es nicht anderseits bekannt, daß er jene poetischen Titel meist nach der musikalischen Ausführung der Tonstücke zu verfassen pflegte. Was Schumann vor der älteren Komponistengeneration, deren Studium einzig im Kontrapunkt und Harmonielehre aufging, voraus hat, ist die klassische und litterarische Bildung, wie wir sie auch bei anderen Künstlern seiner Zeit, z. B. Berlioz, Mendelssohn, Meyerbeer, Liszt, Cornelius, Wagner und anderen antreffen. Diese verleiht ihm nicht nur den feineren Sprachsinn, vermöge dessen er in Vokalkompositionen Wort und Ton weit genauer in Übereinstimmung bringen kann, sondern auch die Fähigkeit, sein Urteil und seine Erfahrung in Sachen der Musik schriftstellerisch zu verwerten. Durch sein Beispiel[S. 6] wird allmählich – seit der Mitte der dreißiger Jahre – eine gänzliche Umgestaltung der musikalischen Kritik in Deutschland herbeigeführt und das ästhetische Richtamt gerät aus den Händen schnellfertiger Dilettanten in die Sachverständiger und Künstler. Wird schließlich noch erwähnt, daß Schumann die Mehrzahl seiner gleichstrebenden Zeitgenossen an Tiefe des Gefühls und wirklicher Begabung weit hinter sich läßt, so ist damit seine historische Bedeutung, wenn auch nicht erschöpft, so wenigstens in den wesentlichsten Punkten gekennzeichnet.[1]
[1] Aus der schon breit angeschwollenen Schumannlitteratur seien namentlich folgende Schriften, die auch dem vorliegenden Lebensabriß zu Grunde liegen, genannt: Fr. Liszt, R. Schumann. (Gesammelte Werke IV., 1855.) Wasiliewski, R. Schumann. (Bonn 1857, 3. Aufl. 1880.) Reißmann, R. Schumann, sein Leben und seine Werke. (Berlin 1865.) R. Pohl, Erinnerungen an R. Schumann. (Deutsche Revue, 1878.) Ph. Spitta, R. Schumann, ein Lebensbild. (Leipzig 1882.) G. Jansen, Die Davidsbündler. (Leipzig 1883.) M. Kalbeck, Aus R. Schumanns Jugendzeit. (Endlingers österreichische Rundschau, 1883.) Clara Schumann, R. Schumanns Jugendbriefe (Leipzig 1886.) Jansen, R. Schumanns Briefe. (Neue Folge, Leipzig 1886.) Reimann, R. Schumanns Leben und Werke. (Leipzig 1887.) B. Vogel, R. Schumanns Klaviertonpoesie. (Leipzig 1887.) Erler, R. Schumanns Leben aus seinen Briefen. (2 Bde., Berlin 1887.) Jansen, R. Schumanns schriftstellerische Thätigkeit. (Grenzbote, 1891.)
Ergänzend sei noch auf folgende Werke hingewiesen: Gesammelte Schriften, herausgegeben von Dr. Heinrich Simon (Univ.-Bibl.) 1888; von M. Kreisig (1914). Biographien von A. Niggli (1879), H. Abert (1903), Ernst Wolff (1906), A. Steiner (1911), Walter Dahms (1916). Wasiliewskis Schumanniana (1884); seine Schumann-Biographie erschien 1906 in 4. Auflage. Briefwechsel mit Henriette Voigt (J. Gensel, 1892); Briefe in Auswahl (K. Storck, 1896); Der junge Schumann (Alfred Schumann, 1910); Schumann-Brevier (Friedr. Kerst); Aus Schumanns Kreisen (La Mara, 1911); Sonderheft der „Musik“. Schumanns Faustszenen (S. Bagge, 1879; Manfred Waldersee, 1880); Lieder in ersten und späteren Fassungen (W. E. Wolff, 1914); Formale Eigentümlichkeiten in Schumanns Klavierwerken (R. Hohenemser); Schumann als Schriftsteller (H. Deiters); Clara Schumann (Berthold Litzmann). In französischer Sprache erschienen: A. Marguerite („son œuvre de piano“); R. Pugno („Leçons écrits sur Schumann“); die Biographien von L. Schneider und M. Maréchal (1905) und Camille Mauclair (1906); in holländischer Sprache eine solche von J. Hartog.
Romantik, erwachendes Nationalgefühl und frisches, wissenschaftliches Streben – das sind die bedeutsamen Zeichen, unter denen Robert Alexander Schumann am 8. Juni 1810 das Licht der Welt erblickte. In demselben Jahre nämlich erschien Kleists „Käthchen von Heilbronn“, Webers „Sylvana“, Jahns „Deutsches Volkstum“ und die neugegründete Berliner Universität begann ihre umfassende Wirksamkeit. Freilich, der Wellenschlag der herrschenden Zeitideen sollte ihn vorderhand nur wenig berühren; lag doch sein Geburtsort, das kleine sächsische Zwickau abseits von den Mittelpunkten deutschen Geisteslebens. Hier, im anmutigen Muldethale, dem verbildenden und zerstreuenden Getriebe einer großen Stadt entzogen, behielt er die Wahrheit und Ursprünglichkeit des Empfindens und gedieh, bei Mangel äußerer Anregung zu jener Sammlung Einfalt und Innerlichkeit, welche von jeher die Quelle künstlerischen Schaffens gewesen ist.
Die musikalischen Anlagen hat Schumann nicht wie andere Meister der Tonkunst von seinen Eltern überkommen. Mutter Johanna, geborene Schnabel aus Zeitz, eine vortreffliche, aber in kleinstädtischen Vorurteilen aufgewachsene Frau, besaß im ganzen nur wenig Sinn für Musik. Vater August Schumann, ein ernster, tüchtiger, überaus strebsamer Mann, der nach allerlei Drangsalen eine angesehene Ver[S. 8]lagsbuchhandlung gegründet und sich durch rastlosen Fleiß zu beträchtlicher Wohlhabenheit emporgearbeitet hatte, war eher litterarischer Beschäftigung zugethan. Er führte die Taschenausgaben ausländischer Klassiker ein, gab die zu ihrer Zeit vielgelesenen „Erinnerungsblätter“ heraus, schrieb selbst mehrere wichtige kaufmännische Werke und hat sich noch kurz vor seinem Tode durch eine Übersetzung von Byrons „Beppo“ und „Childe Harold“ bekannt gemacht. Seine schriftstellerische Ader vererbte sich nebst manchen Charaktereigenschaften auch auf Robert, der als jüngstes von fünf Geschwistern natürlicherweise der Liebling des Hauses war, „der lichte Punkt“, wie ihn die Mutter nannte. Er genoß die sorgfältigste, liebevollste Erziehung, besuchte mit dem Beginne des sechsten Lebensjahres die Döhnersche Sammelschule, ja sogar Klavierunterricht wurde ihm erteilt, so gut, oder vielmehr so mangelhaft es in dem unbedeutenden Städtchen damals anging. Zwar fehlte es seinem Musiklehrer, dem biederen, etwas pedantischen Organisten Kuntsch, gewißlich nicht am besten Willen; allein als Autodidakt, ohne sichere Methode, war er nicht imstande, das ihm anvertraute Talent in die rechten Bahnen zu weisen und ihm die Handwerksregeln der Kunst als treue Geleiter beizeiten zu eigen zu geben.
Früh schon erwachte in dem lebhaften, ehrgeizigen Knaben der Schaffensdrang. Er verfaßte Räuberkomödien und führte sie mit Hilfe der Brüder auf einer dazu hergerichteten Bühne zu Hause auf. Auch wird erzählt, er habe seine Kameraden überaus drastisch am Klaviere zu charakterisieren gewußt. So liefen poetische und musikalische Liebhabereien eine Zeitlang nebeneinander her, bis ein zufälliges Erlebnis zu Gunsten der Musik den Ausschlag gab. Auf einem Ausfluge nach Karlsbad bekam er nämlich (1819) den Virtuosen Moscheles zu hören und empfing von dessen Spiele den ersten nachhaltigen Eindruck seines Lebens. Einen Konzertzettel, den Moscheles berührt hatte, behielt Schumann noch lange Jahre als kostbare Reliquie in Verwahrung und sein ganzes Sinnen[S. 9] und Trachten war fortan auf das Klavierspiel gerichtet. Auch der Beginn der Gymnasialstudien änderte daran nichts weiter. Vielmehr gab sich Robert im Vereine mit einem gleichgesinnten Freunde, Piltzing, beinahe ausschließlich den Musikfreuden hin.
Eines Tages geriet dem Zwölfjährigen die Partitur einer Righinischen Ouverture in die Hand und brachte ihn auf den verwegenen Einfall, die stummen Zeichen, welche geheimnisvoll und vielverheißend aus dem Hefte starrten, klingen und ertönen zu lassen. Gedacht, gethan. Ein Orchester von Mitschülern wird gebildet, Schumann dirigiert und ergänzt die fehlenden Baßstimmen am Klaviere. Nach und nach erweiterte sich das Repertoir und wies endlich, zu nicht geringer Befriedigung der kleinen Künstlergesellschaft, sogar ein Werk ihres Kapellmeisters, den 105. Psalm für Chor und Orchesterbegleitung auf.
Durch solche Erfolge kühn gemacht, wagte es Robert sich auch außerhalb des väterlichen Hauses zu produzieren, namentlich bei der Familie Carus, „wo alles Freude, Heiterkeit, Musik war“, wo er zuerst die Quartette unserer klassischen Meister kennen lernte. In den Vortragsabenden des Gymnasiums wirkte er gleichfalls eifrig mit, bald als Deklamator, bald als Klavierspieler, und entwickelte eine solche Fertigkeit auf dem Instrumente, daß der alte Kuntsch den Unterricht mit dem Bemerken einstellte: Robert könne sich nun schon allein weiter forthelfen.
Mittlerweile hatte Vater Schumann, der Treffliche, ohne selbst musikalisch zu sein, die Begabung des Sohnes mit richtigem Blicke erkannt und trug sich alles Ernstes mit dem Gedanken, ihn Musiker werden zu lassen. Praktisch wie er war, wandte er sich sogleich an die rechte Thüre, indem er den damals in vollem Ruhmesglanze erstrahlenden Karl Maria von Weber anging, die Ausbildung des Kindes zu übernehmen. Obschon sich nun Weber bereit erklärt hatte, zerschlugen sich dennoch in der Folgezeit die Unterhandlungen,[S. 10] man weiß nicht aus welchem Grunde. Sicherlich mag ein Teil der Schuld auf die Mutter fallen, welche sich dem Plane ihres Gatten von Anfang an entschieden widersetzte, da in ihren Augen der Künstlerberuf mit „schwankender Zukunft und unsicherem Brote“ gleichbedeutend schien. Robert blieb also am Gymnasium und das Zwickauer Stillleben nahm seinen Fortgang.
Bald nach dem Scheitern dieses Planes wandte sich die Neigung des Knaben wiederum der Poesie zu. Die Werke unserer Dichter, wie sie das väterliche Geschäft in reicher Fülle ihm darbieten konnte, wurden gierig verschlungen; zu einer im Schumannschen Verlage erscheinenden „Bildergalerie der berühmtesten Männer mit beigefügtem Texte“ lieferte Robert im Alter von vierzehn Jahren litterarische Beiträge. Nicht lange darnach finden wir ihn an der Spitze eines Vereins von Studiengenossen, welcher nach dem Muster des Göttinger Hainbundes sich die Kenntnis und Pflege der deutschen Litteratur zum Zweck gesetzt hatte. Schillers Dramen wurden mit verteilten Rollen gelesen; an Goethe wagte man sich noch nicht heran; doch scheint wenigstens der Faust schon damals ein Lieblingsbuch Schumanns gewesen zu sein. Auch Schulze, Houwald, Müllner, Byron haben nebst den griechischen Schriftstellern größeren oder geringeren Einfluß auf ihn ausgeübt.
Das Jahr 1826 brachte zwiefache Trauer und Sorgen. Zwei geliebte Wesen wurden Robert entrissen, das eine ihm über alles teure durch den Tod, das andere in gewisser Hinsicht gleichfalls auf immer. Schwester Emilie verfiel in eine unheilbare Gemütskrankheit und am 10. August erlag der Vater, sein liebreicher, verständnisvoller Führer, einem zehrenden Siechtum. Da vollzog sich, unter dem Eindrucke dieser schmerzlichen Ereignisse eine bedeutende Wandlung in Schumanns ganzem Charakter: der einst so muntere, lebhafte Knabe ward zum stillen, in sich gekehrten, nachdenklichen Jüngling. „Ich habe Ansichten und Ideen über das[S. 11] Leben gewonnen, mit einem Worte ich bin mir heller geworden,“ verzeichnet sein Tagebuch.
Um diese Zeit begann auch die Liebe in Schumanns Brust zu erwachen. Er schwärmte für Nanni, eine reizende Mädchengestalt, und wenige Wochen später hatte eine stolze Schönheit, Liddy, sein Herz gewonnen. Nicht auf lange freilich; denn sie vermochte dem Gedankenfluge Jean Pauls, in dessen Schriften unser Robert eben damals schwelgte, nicht recht zu folgen und seine Entrüstung über solche Einfalt machte der zarten Liebe ein frühzeitiges Ende. Noch einmal traf er darnach mit dem Mädchen auf einem Ausfluge wieder zusammen und begleitete es auf einen Hügel, wo sie den Sonnenuntergang genießen wollten. Da – doch hören wir Schumann selbst, wie er über diese Begebenheit in einem Briefe berichtet: „Der ganze Tempel der Natur lag weit und breit vor den trunkenen Augen: wie eine Thetis hätte ich in diese Blumenströme fliegen und versinken mögen; denke dir, daß ein verblühtes Ideal in der Brust still wieder aufzukeimen begann, daß dieses verlorene Ideal an meiner Seite stand! Und endlich, da die Sonne erst untergetaucht war und Frühlinge von blühenden Rosen aus dem sterbenden Strahle aufdämmerten, als die Höhen der Berge glühten, die Wälder brannten und die unermeßliche Schöpfung in sanfte Rosenmassen zerfloß, da ich so hineinschaute in diesen Purpurocean und alles, alles sich zu einem Gedanken formte und ich den großen Gedanken der Gottheit dachte und Natur, Geliebte und Gottheit entzückt vor mir standen – siehe – da zog im Osten eine schwarze Wolke herauf und ich ergriff Liddys Hand und sagte zu ihr: ‚Liddy, so ist das Leben,‘ und ich wies auf den schwärzlichen Purpur am Horizonte – und sie sah mich wehmütig an – und eine Thräne glitt von ihrer Wange. Da glaubte ich’s wieder gefunden zu haben das Ideal und schweigend pflückte ich eine Rose. Aber ein Donnerschlag und ein Blitzstrahl fuhr im Osten herauf, als ich sie ihr geben wollte – und ich nahm[S. 12] die Rose und zerzupfte sie – jener Donnerschlag hatte mich aus einem schönen Traume aufgeweckt. Ich war wieder auf der Erde und das hohe Bild des Ideals verschwunden, wenn ich an die Reden denke, die sie über Jean Paul führte.“
Bedarf es darnach etwa weiterer Zeugnisse für seine Verehrung des großen Humoristen? Schumann stellte ihn damals über alle anderen Dichter und konnte auch später, als er bereits im vollen Mannesalter stand, noch bitterböse werden, wenn jemand den Wert seines Lieblings herabzusetzen wagte. (Vgl. Hanslick, Aus dem Konzertsaal, S. 392.) „Wenn die ganze Welt Jean Paul läse,“ heißt es in einem anderen Briefe, „so würde sie bestimmt besser, aber unglücklicher; er hat mich oft dem Wahnsinn nahe gebracht. Aber der Regenbogen des Friedens schwebt immer sanft über allen Thränen und das Herz wird wunderbar erhoben und milde verklärt.“ Daß die Gedichte, welche er in jener Zeit verfaßte und die ein hübsches Verstalent verraten, von Jean Paulschen Wendungen strotzen, kann man sich nach der obigen Stilprobe leicht vorstellen. In derselben überschwenglichen Sprache sind auch seine beiden Romane (Juniusabende und Selene), von denen aber nur der erste fertig geworden ist, geschrieben. Doch wäre es irrig, den jungen Schumann für einen fortwährenden Träumer und Sentimentalen zu halten, denn wir vernehmen auch von lustigen Spritzfahrten mit seinen Genossen Rascher und Walther, wobei tüchtig gekneipt, geküßt und schließlich „wankend und schwankend“ nach Heim gezogen wird.
Inzwischen glomm unter der Asche seiner verloschenen Musikerhoffnungen die Liebe zur Tonkunst still, aber unvertilgbar weiter, so daß es nur eines Windhauches bedurfte, um sie aufs neue zur hellen Flamme zu entfachen. Da traf im Sommer 1827 eine Verwandte des Carusschen Hauses, die junge Gattin des Colditzer Arztes Dr. Ernst Carus, in Zwickau zu Besuch ein und „Fridolin“ – so wurde Schu[S. 13]mann von der befreundeten Familie scherzweise genannt – wandte sich, von ihrem seelenvollen Gesange begeistert, mit Leidenschaft wieder der Musik zu. Durch sie machte er die Bekanntschaft mit Schuberts und Mendelssohns Tonwerken, durch sie wurde er zu neuerlichen Kompositionsversuchen angeregt. Allein da sein Vormund, der Kaufmann Rudel, mit der Mutter in der Verurteilung des Künstlerberufes eines Sinnes war, schien jede Aussicht, der Musik leben zu können, versperrt, und Robert wagte auch nicht, teils aus Mangel an Thatkraft, teils aus Rücksicht für die zärtlich geliebte Mutter, dem Wunsche der letzteren zu widerstreben.
Zu Ostern 1828 verließ er das Gymnasium. Wohlbewandert in den klassischen Sprachen – sogar an dem von seinem Bruder Karl verlegten Thesaurus totius latinitatis hat er mitgearbeitet – bestand er die Abgangsprüfung mit glänzendem Erfolge. Bevor er sich aber nach Leipzig begab um Jus zu studieren, geleitete er noch einen jüngst gewonnenen Freund, den Studenten Gisbert Rosen auf seiner Fahrt nach Heidelberg. Schwärmerische Verehrung für den Dichter des „Titan“ verband die beiden, gleichgestimmten Jünglinge, die natürlicherweise Bayreuth als nächstes Reiseziel erkoren und in der alten Markgrafenstadt ein paar selige Stunden dem Andenken ihres Abgottes weihten. Am nächsten Tage gings über Nürnberg und Augsburg nach München, wo sie Heinrich Heine und den Maler Zimmermann kennen lernten. Hier in München trennten sich ihre Wege. Rosen eilte über Augsburg dem Neckar zu, indessen Schumann nach Sachsen zurückkehrte, dem Schicksal grollend, das die Menschen zusammenführt, vereint und wieder voneinander reißt.
„Leipzig ist ein infames Nest, wo man seines Lebens nicht froh werden kann. Du sitzest vielleicht jetzt auf den Ruinen des alten Bergschlosses und lächelst vergnügt und heiter die Blüten des Juni an, während ich auf den Ruinen meiner eingesunkenen Luftschlösser und meiner Träume stehe, und weinend in den düsteren Himmel meiner Gegenwart und Zukunft blicke; überhaupt fliehe ich die erbärmlichen Menschen und bin manchmal so recht zerknirscht über die Winzigkeit und Erbärmlichkeit dieser egoistischen Welt. Ach, eine Welt ohne Menschen, was wäre sie? Ein unendlicher Friedhof, ein Totenschlaf ohne Träume, eine Natur ohne Blumen und Frühling, ein toter Guckkasten ohne Figuren – und doch! Diese Welt mit Menschen, was ist sie? Ein ungeheurer Gottesacker eingesunkener Träume, ein Garten mit Cypressen und Thränenweiden, ein stummer Guckkasten mit weinenden Figuren.“ Solche Ergüsse, an Freund Rosen gerichtet, kennzeichnen die Gemütsstimmung, in welcher der nunmehrige stud. jur. Schumann die ersten Tage in Leipzig verlebte, deutlich genug. „Die Natur – wo finde ich sie hier?“ klagt er bald darauf der Mutter, „kein Thal, kein Berg, kein Wald, wo ich so recht meinen Gedanken nachhängen könnte, kein Ort, wo ich allein sein kann, als in der verriegelten Stube, wo es unten ewig lärmt und spektakelt.“ Die Leipziger Burschenschaft, in welcher damals eine recht neblige Deutschtümelei herrschte, entsprach seinen idealen Vorstellungen ganz und gar nicht und er trat bald mit anderen Gleichgesinnten zur Verbindung „Markomannia“ über, ohne darum im studentischen Leben vollständig aufzu[S. 15]gehen. Musik und Poesie trugen über Kneipe und Fechtboden fast immer den Sieg davon.
Allmählich begannen die Wogen seines Schmerzes gelinder zu schlagen. Im benachbarten Zweinaundorf fand er einen Ort, der seinen Natursinn einigermaßen zufrieden stellte; auch fügte sich’s günstig, daß jene Verwandte der Carusschen Familie, von der oben als trefflicher Sängerin die Rede war, mit ihrem Gatten nach Leipzig übersiedelte. Schumanns musikalische Natur empfing in dem musikfreundlichen Hause mannigfaltige Anregung und Pflege, zumal da die hervorragendsten Künstler der Stadt daselbst zu verkehren pflegten. Von hoher Bedeutung wurde für ihn namentlich die Bekanntschaft mit Friedrich Wieck, dem berühmten Klavierlehrer und dessen neunjähriger Tochter Klara. An dem Spiele der kleinen Virtuosin konnte er recht deutlich absehen, welche Erfolge durch einen planvollen, methodischen Unterricht zu erzielen sind und war eifrig bemüht, die Mängel der eigenen Technik, wie sie sich bei einem Autodidakten mit Notwendigkeit herausstellen müssen, unter Wiecks kundiger Leitung wieder auszugleichen. Seinem Lehrer erwuchs hier die heikle Aufgabe, die halberblühte Knospe noch einmal zusammenzufalten, was bis zu einem gewissen Grade in der That auch gelang; nur von der Unentbehrlichkeit theoretischer Musikkenntnisse war Schumann einstweilen nicht zu überzeugen. Statt Harmonielehre zu treiben, versenkte er sich in Gemeinschaft mit einigen musikalischen Kommilitonen in die Schätze deutscher Kammermusik, studierte Bachs „Wohltemperiertes Klavier“ und entzückte sich an den Tonwerken des jüngst verstorbenen Meisters Schubert, welchen er gern mit Jean Paul zu vergleichen pflegte. „Wenn ich Schubert spiele, so ist mir’s, als läs’ ich einen komponierten Roman Jean Pauls.“ Unter Schubertschem Einflusse entstanden auch mehrere eigene Kompositionen, Polonaisen, Variationen und ein Dutzend Lieder, welch letztere er an G. Wiedebein, einen damals geschätzten Liederkomponisten, zur Beurteilung[S. 16] einschickte. Die Antwort fiel günstig aus: „Sie haben viel, sehr viel von der Natur empfangen; nützen Sie es und die Achtung der Welt wird Ihnen nicht entgehen.“
An dem öffentlichen Musiktreiben Leipzigs, welches seit dem Ende der zwanziger Jahre immer reicher und reicher erblühte, nahm Schumann lebhaften Anteil. Der Thomanerchor, die Gewandhauskonzerte, erfreuten sich schon damals eines ausgezeichneten Rufes, ja selbst die untergeordneteren Institute, z. B. der Orchesterverein „Euterpe“ oder die Matthäischen Quartettakademien boten achtbare Leistungen. Minder Gutes läßt sich von dem etwas verwahrlosten Theater sagen; doch besaß es wenigstens an seinem Kapellmeister Marschner eine bedeutende Kraft, so daß man im allgemeinen der Behauptung Schumanns beipflichten kann, es gebe in Deutschland keinen besseren Ort für einen jungen Musiker als Leipzig.
Jawohl, für einen Musiker! Aber war er denn ein solcher? Gehörte er nicht ins Kollegium, vor das Corpus juris, statt in den Konzertsaal und vors Klavier? Das ist die bedenkliche Seite seines Leipziger Universitätslebens. Zwar wird in den nach Zwickau gerichteten Briefen von fleißigem Kollegienbesuche gesprochen und über die Eiskälte der Rechtswissenschaften gejammert; allein aus den Briefen an vertraute Freunde geht mit Sicherheit hervor, daß Schumann fast nie ein juristisches Kollegium besucht, geschweige denn ein juristisches Buch zur Hand genommen hat. Wohl aber hörte er die Vorlesungen des Philosophen Krug und las Fichtes, Kants und Schellings Schriften.
Im folgenden Jahre vertauschte Robert die Leipziger Hochschule mit der in Heidelberg. Wenn er indessen der Mutter, um ihre Einwilligung zu erhalten, als Grund dieses Wechsels angiebt, daß dort die berühmtesten Professoren lehrten, so ist das bei einem Studenten, der die Überzeugung hegt, „daß alle Kollegien überhaupt nur Eseln nützen können,“ bloß eitel Vorwand. In Wahrheit wollte er aus dem von[S. 17] der Natur recht stiefmütterlich bedachten Leipzig heraus – zumal da Wieck den Klavierunterricht kurz zuvor wegen Zeitmangels eingestellt hatte – wollte andere Menschen kennen lernen und vor allem wieder einmal Freund Rosen in die Arme schließen. Die gute Mutter war bald überredet und Schumann wandte seelenvergnügt dem „erbärmlichen Leipzig“ den Rücken.
Das war eine Fahrt, unter blauem Himmel über lachende Frühlingsau’n! Dazu hatte ihm der Zufall in Willibald Alexis einen geistvollen Gefährten beigesellt, dem er sogar noch eine Strecke rheinabwärts bis Koblenz das Geleite gab. In einem reizenden Briefe an die Mutter schildert er ausführlich all seine Reiseerlebnisse, beschreibt die lieblichen Mainlande, das interessante Frankfurt, die herrlichen Abende am Rhein und vergißt auch nicht einige Bemerkungen über die Kost und – die Mädchen einzuflechten. Nur eine Stelle aus dem merkwürdigen Berichte sei herausgehoben: „Um neun Uhr fuhren wir von Wiesbaden ab. Ich drückte die Augen zu, um den ersten Anblick des alten, majestätischen Vater Rhein mit ganzer Seele genießen zu können; und wie ich sie aufschlug, lag er vor mir, ruhig, still, ernst und stolz wie ein alter, deutscher Gott und mit ihm der ganze blühende, grüne Gau mit seinen Bergen, Thälern und Rebenparadiesen.“ Es liegt ein Stück Kulturgeschichte in diesen Worten; noch wenige Jahrzehnte zuvor konnte der Deutsche mit dem Namen „Rhein“ nur die Vorstellung seiner Reben verbinden; jetzt haftet an ihm eine Reihe mythischer Anschauungen, jetzt ist er eine Art Heiligtum unseres Volkes geworden, und das Weinlaub, das sein ehrwürdiges Haupt umkränzt, wird vom Epheu der Sage beinahe überwuchert. Die Poesie dieses Stromes musikalisch zu erfassen, wie es später Liszt in der „Lorelei“ oder Wagner in den „Nibelungen“ gethan hat, mußte Schumann allerdings versagt bleiben: sie war damals beinahe noch ein ausschließliches Eigentum der Dichtkunst.
In Heidelberg, „der Vaterlandsstädte schönster“, führte Schumann mit Rosen ein wahres Götterleben. Freilich, wenn er nach Hause schreibt, daß ihm bei Thibaut selbst das Jus besser schmecke, daß er jetzt die Würde der Jurisprudenz begreifen lerne, so ist das gar nicht buchstäblich zu nehmen. Der große Gelehrte betrieb, wie er offen zur Schau trug, seine Wissenschaft nur mit Unlust und es war ein Ausspruch von ihm bekannt, er würde, wenn er nochmals zu leben hätte, lieber Musiker werden, als Pandektist. Solche Denkungsweise eroberte ihm Schumanns Herz im Sturme, so wenig sich der Verehrer Schuberts sonst mit dem musikalischen Glaubensbekenntnisse des greisen Professors auch befreunden konnte. Thibaut hatte nämlich in seinem 1825 erschienenen Buche „Über die Reinheit in der Tonkunst“ eine archaische Richtung eingeschlagen und pflegte die Werke der alten Meister in seinem Hause aufführen zu lassen. Auch Schumann wurde diesen Abendunterhaltungen beigezogen. „Sie glauben kaum,“ schreibt er an Wieck, „was ich bei ihm für herrliche, reine, edle Stunden verlebt habe und wie sehr seine Einseitigkeit und pedantische Ansicht über Musik bei dieser unendlichen Vielseitigkeit und bei diesem belebenden, entzündenden und zermalmenden Geiste schmerzt.“
Der trefflichen Lehrer ungeachtet wurden die Kollegien aber nach wie vor arg vernachlässigt. In dieser Hinsicht war Schumann einmal unverbesserlich. Viel lieber durchstreifte er die reizende Umgebung Heidelbergs oder stürzte sich, als der Winter seinen Ausflügen ein Ziel setzte, in den Strudel des lustigen Studentenlebens. „Fast alle Abende,“ heißt es in einem Briefe an die Mutter, „bin ich in Gesellschaften oder auf Bällen.“ Bald treffen wir ihn bei den Schlittenfahrten, welche die Studentenvereine – er gehörte der Saxoborussia an – in großem Stile veranstalteten, bald und zwar am häufigsten huldigt er dem Tanzvergnügen. Zugleich bereitet er sich zu einer „italienischen Reise“ vor, welche in den zwischen Winter- und Sommersemester ein[S. 19]geschalteten Ferien angetreten werden sollte und treibt zu diesem Behufe das Studium der italienischen Sprache. Einen Teil der Sonette Petrarkas hat er zu dieser Zeit mit wunderbarer Treue und Gewandtheit, wie erzählt wird, metrisch ins Deutsche übertragen. Mutter und Vormund wollten anfangs von dem kostspieligen Plane begreiflicherweise nichts wissen, aber Robert legte ihnen so eindringlich dar, daß die Ferien ja nicht zum Studium der Bücher, als vielmehr der Welt, d. h. zum Reisen angeordnet seien, drohte schließlich gar das erforderliche Geld wo anders auszuleihen, bis er zuletzt doch die Bewilligung erhielt und im August, das Ränzel am Rücken, den Stab in der Hand, gleich Eichendorffs lustigem Taugenichts sein liebes Heidelberg verlassen konnte.
Nachdem er die majestätische Alpenwelt durchzogen, stieg er nieder ins wälsche Gefilde. Sechs Tage wurden unter allerhand kleinen Abenteuern in Mailand zugebracht, wo er auch zum erstenmale (im Scalatheater) italienische Musik und Gesangeskunst zu hören Gelegenheit hatte. Eine bedenkliche Abnahme des Reisegeldes zwang ihn endlich in Venedig zur Umkehr. Mit geringer Barschaft, aber reich an Erfahrungen traf er im Oktober 1829 wieder in der Neckarstadt ein.
Während des folgenden Winterhalbjahres bildete wieder die Musik Schumanns eigentliches Studium. Als Klavierspieler war er in ganz Heidelberg berühmt, namentlich seit er in einem Konzerte des Musikvereins die Alexandervariationen von Moscheles glänzend vorgetragen hatte. Am liebsten jedoch musizierte er in engem Freundeskreise und riß namentlich durch seine freien Phantasien auf dem Piano alle Hörer unwiderstehlich hin. Sein Studiengenosse Töpken erzählt, daß ihm diese unmittelbaren Ergüsse Schumanns immer einen Genuß gewährt hätten, wie er ihn später, so große Künstler er auch gehört, in der Art nie wieder gehabt habe.
Wie im verflossenen Winter gab sich Schumann auch diesmal den Karnevalsfreuden rückhaltlos hin. Auf den öffentlichen und privaten Bällen Heidelbergs und Mannheims – die beiden Städte standen in Bezug auf gesellige Unterhaltungen in regem Wechselverkehr – durfte der wohlgebildete, stattliche Jüngling als vorzüglicher Tänzer nicht fehlen. Daß dabei viel, sehr viel Geld aufging, kann man sich denken, und es brauchte langer Bitten, ehe der Vormund überredet war, sein flottes Mündel in dem teuren Heidelberg zu belassen.
Da sein väterliches Erbteil nicht hinreichte, um von den Zinsen zu leben, gar für einen Menschen, der an solche Ansprüche gewöhnt war wie Robert, hätte er sich nunmehr ernstlich auf das Studium werfen sollen. Allein im Grunde seines Herzens stand bereits der Entschluß fest, die Künstlerlaufbahn trotz aller Hindernisse zu betreten, und das wunderbare Spiel Paganinis, den zu hören er zu Ostern 1830 nach Frankfurt geeilt war, scheint diesen Entschluß zu völliger Reife gebracht zu haben. Am 30. Juli endlich eröffnete er der Mutter sein Vorhaben in einem langen Briefe: „Mein ganzes Leben war ein zwanzigjähriger Kampf zwischen Musik und Jus. Jetzt stehe ich am Kreuzwege und erschrecke bei der Frage: Wohin? Folg’ ich meinem Genius, so weist er mich zur Kunst und ich glaube den rechten Weg. Schreibe du selbst an Wieck in Leipzig und frage ihn, was er von mir und meinem Lebensplane hält. Fällt er ein günstiges Urteil, nun, so fehlt es an Fortkommen und Ruhm sicherlich nicht.“ Die Bestürzung der Mutter, als sie vernahm, daß ihr Robert, den sie bald am Ziele seines Studiums wähnte, einen ganz neuen Beruf ergreifen wolle, war ungeheuer. Zitternd und ängstlich schrieb sie an Wieck: „Auf Ihrem Ausspruche beruht alles, die Ruhe einer liebenden Mutter, das ganze Lebensglück eines jungen unerfahrenen Menschen, der bloß in höheren Sphären lebt und nicht ins praktische Leben eingehen will. Ich bitte und be[S. 21]schwöre Sie als Gatte und Vater, als Freund meines Sohnes, handeln Sie als redlicher Mann und sagen Sie unumwunden Ihre Ansichten, was er zu fürchten oder zu hoffen hat.“
Wieck antwortete mit einem glänzenden Zeugnisse, das die sorgende Frau einigermaßen beruhigen konnte. Sie versagte darnach ihre Einwilligung nicht, und Schumann, überglücklich über den günstigen Ausgang dieser folgenschweren Angelegenheit, reiste zum zweitenmale, aber froheren Mutes als Schüler nach Leipzig. „Ich vertraue Ihnen ganz, ich gebe mich Ihnen ganz, nehmen Sie mich wie ich bin und haben Sie vor allen Dingen Geduld mit mir. Kein Tadel soll mich niederdrücken und kein Lob wird mich faul machen. Ich wollte, Sie könnten jetzt in mich sehen; es ist still darinnen, nur um das ganze Welthaupt geht ein leiser, leichter Morgenduft.“ Mit diesen Worten führte er sich bei dem verehrten Lehrer ein.
Überblicken wir Schumanns bisherigen Entwickelungsgang, so fällt sogleich auf, daß er sich erst unverhältnismäßig spät dem Künstlerberufe widmete, daß seine Erziehung auf ganz andere Ziele gerichtet gewesen war, als auf die, welche ihm fernerhin einzig und allein vorschweben sollten und daß ihm theoretische Kenntnisse in der Musik beinahe noch gänzlich fehlten. Dagegen besaß er eine nicht gewöhnliche Fertigkeit am Klaviere, feinen musikalischen Sinn und ein hervorragendes Interpretationsvermögen. Unvergeßlich ist es seinen Heidelberger Freunden geblieben, wie er z. B. Webers[S. 22] „Aufforderung zum Tanze“ vorzutragen und während des Spieles zu erläutern wußte. „Jetzt spricht sie,“ sagte er, „das ist der Liebe Kosen; jetzt spricht er, das ist des Mannes ernste Stimme. Jetzt sprechen sie beide zugleich und deutlich höre ich auch, was beide Liebende einander sagen.“
Solche Eigenschaften, der mächtige Zug der Zeit und die Hoffnung auf baldigen Erwerb wiesen Schumann gebieterisch in die Virtuosenlaufbahn, zu welcher er sich denn auch mit wahrem Feuereifer vorbereitete. In drei bis vier Jahren hoffte er den hochverehrten Moscheles erreichen zu können. Allein während der beseligende Gedanke, nun völlig der Kunst anzugehören, und die Voraussicht künftiger Meisterschaft ihm die Brust mit stiller Heiterkeit erfüllte, stand es nicht eben günstig um seine äußeren Verhältnisse. Die Brüder, über den plötzlichen Wechsel des Berufes ein wenig verstimmt, unterstützten ihn nur sehr spärlich mit Geld, so daß er in allerlei lästige Verlegenheiten geraten mußte. Erst nach einem Besuche Schumanns in Zwickau zu Ostern 1831 erscheint, wahrscheinlich durch Vermittelung der Mutter, welche jetzt immer tapfer auf seiner Seite stand, das frühere herzliche Einvernehmen mit der Familie wieder hergestellt.
„Nun ist der Himmel so schön blau,“ schreibt er bald darauf nach Hause, „daß ich jemand haben möchte, dem ich’s so recht sagen könnte, wie glücklich und sommerlich es in mir aussieht, wie mein inneres ruhiges Kunstleben alle Leidenschaften zurückdrängt, wie ich manchmal recht den Augenblick der Gegenwart fühle. Es ist nämlich eine schöne Sache um einen jungen Dichter und vollends um einen jungen Komponisten. Du kannst gar nicht glauben, was das für ein Gefühl ist, wenn er sich sagen kann: dies Werk ist ganz dein, kein Mensch nimmt dir dies Eigentum und kann dir’s nicht nehmen, denn es ist ganz dein; o fühltest du dieses Ganz! Da der Grund zu diesem Gefühle nur selten kommt, da der Genius nur ein Augenblick ist, so[S. 23] bricht es dann auch in seiner ganzen Schönheit hervor und erzeugt eine Art von beruhigendem Selbstvertrauen, das keinen Tadler zu fürchten braucht.“
Was diese Briefstelle erst andeuten, aber noch nicht offen verraten wollte, kommt schon in den nächsten Monaten zu Tage. Schumann hatte nämlich den Sommer benützt, um einige noch in Heidelberg entworfene Kompositionen auszuführen und konnte schon am 21. September der Mutter das Erscheinen seines ersten Werkes: Thème sur le nom Abegg, varié pour le pianoforte ankündigen. „Wüßtest du, was das für Freuden sind, die ersten Schriftstellerfreuden! Stolz wie der Doge von Venedig mit dem Meere, vermähle ich mich zum erstenmale mit der großen Welt.“
Gewidmet ist die im Walzerrhythmus gehaltene Gelegenheitsarbeit einer fingierten Comtesse Pauline d’Abegg, hinter welcher eigentlich eine Mannheimer Ballbekanntschaft, Meta Abegg, die Verehrte eines Freundes, steckt. Auch in Opus 2, den Papillons, zwölf kleinen, flatternden und schäkernden Stücken, das letzte Kapitel der „Flegeljahre“ Jean Pauls in Töne umgesetzt, bedient er sich noch der Tanzform. Außerdem sollte damals eine Toccata (op. 7) vollendet werden, doch hielt ihn von der Ausarbeitung die während der Komposition der obengenannten Werke gewonnene Einsicht von der Notwendigkeit theoretischer Musikkenntnisse zurück. Er nahm gegen Ende des Jahres, als Wieck mit seiner Tochter auf einer Kunstreise nach Paris begriffen war, bei Heinrich Dorn, Kapellmeister am Leipziger Theater, Unterricht. Freilich wollte das trockene Studium einem Phantasiemenschen seines Schlages gar nicht behagen. „Mit Dorn werde ich mich nie amalgamieren können,“ klagt er an Wieck; „er will mich dahin bringen unter der Musik eine Fuge zu verstehen.“ Allein später, nachdem die Vergangenheit bereits ihr verklärendes Licht über jene Lehrzeit gebreitet hatte, gab er dem Lehrer seine Dankbarkeit mit bewegenden Worten kund. Ihre Berechtigung soll hier nicht[S. 24] näher untersucht werden; genug, daß der Schüler, als Dorn im Frühling 1832 nach Hamburg abberufen wurde, schon so weit vorgeschritten war, um sich mit Nutzen weiter bilden zu können und hinreichende Sicherheit zu besitzen glaubte, um eine so „herkulische“ Arbeit, wie es die Übertragung der Violinkaprizen Paganinis für das Pianoforte war, zu unternehmen. Der kühne Versuch gelang und fand auch gebührende Anerkennung. Namentlich freute sich Schumann über eine sehr wohlwollende Recension seines Werkes in Haslingers „Musikalischem Anzeiger“, die dem Dichter Grillparzer zugeschrieben wird, wahrscheinlich aber von dessen Bruder Camillo herrühren dürfte. In geistreicher Weise sind die leicht schwebenden, auf die raffinierteste Violintechnik berechneten Etüden harmonisch ausgebaut, ohne dadurch beschwert oder herabgezogen zu werden.[2] Aus derselben Zeit stammt auch Opus 4, die Intermezzi, liedförmig entwickelte Tonsätze verschiedenen Charakters. Ihr Titel erklärt sich aus dem ähnlichen Gebrauche dieses Wortes in Eichendorffs, Heines und anderen Gedichtsammlungen.
Trotz dieser schöpferischen Thätigkeit und der emsig fortgesetzten theoretischen Studien brauchten die Vorbereitungen zur Virtuosenlaufbahn keineswegs lässiger betrieben zu werden. Schumann widmete sich eben vom frühen Morgen bis tief in die Nacht der Musik und verkehrte im allgemeinen nur wenig mit der Außenwelt. Aber gerade das Streben nach raschester Vervollkommnung sollte ihm verhängnisvoll werden, denn er zog sich durch ein unglückliches Experiment, welches die Unabhängigkeit der Finger voneinander beschleunigen sollte, eine Lähmung des rechten Mittelfingers zu, die später, infolge verkehrter Behandlung, eine Zeit lang[S. 25] sogar die Hand ergriff und alle seine Virtuosenträume für immer zu nichte machte. Soviel aus Schumanns gelegentlichen Äußerungen zu entnehmen war, hatte er den bezeichneten Finger vermittelst einer selbst erfundenen Vorrichtung, während die übrigen Finger übten, emporgezogen und durch die übergroße Anspannung ein Erschlaffen der Sehne verursacht. Glücklicherweise schien anfangs Aussicht auf Genesung vorhanden zu sein, so daß der Arme nicht gleich verzweifeln mußte, sondern nach dem ersten nicht geringen Schrecken den guten Mut bald wiedergewann. Einstweilen, bis der Finger geheilt wäre, beschloß er, sich mit doppelter Kraft auf die Komposition zu werfen und schrieb, um das Brett zu bohren, wo es am dicksten war, „ganz nach eigenem Sinne und ohne Anleitung“ einen symphonischen Satz, der später auch wirklich in einem Konzerte der Klara Wieck (18. November 1832) zur Aufführung gelangte, obendrein in seiner Vaterstadt. Schumann war zu diesem für ihn hochwichtigen Ereignisse natürlicherweise nach Zwickau geeilt und blieb daselbst den Winter über, mit der Umarbeitung seines Werkes, auf welches er große Hoffnungen setzte, eifrig beschäftigt. In der neuen Gestalt wurde es dann am 12. Februar 1833 im benachbarten Schneeberg gespielt. Schon einige Wochen später kehrte der junge Autor nicht ohne Stolz und Selbstbewußtsein nach Leipzig zurück.
Er bezog eine reizende Wohnung in Riedels Gärten, wie sie ein stilles Dichtergemüt nur wünschen konnte, voll Sonnenschein, Blütenduft und Vogelgesang. Das zweite Heft der Kaprizen und die phantasiereichen „Impromptus sur une Romance de Clara Wieck, dedié à Monsieur Fr. Wieck“ (op. 5), eine Huldigung an das befreundete Künstlerpaar, sind hier im Laufe des Frühlings entstanden. Schumann wandte sich also, offenbar mißtrauisch gegen seine symphonische Begabung wieder der Klaviermusik zu. Zwar trat seine Symphonie noch ein drittes Mal in einem Wieckschen Konzerte im Gewandhause an die Öffentlichkeit, ist[S. 26] aber nie im Druck erschienen. Immerhin diente sie dazu, ihm die Freundschaft namhafter Musiker, Hauser, Pohlenz und Stegmeyer, mit denen er fortan häufig verkehrte, zu erwerben. Schumann war gerade damals viel geselliger als je in späteren Jahren. Er pflegte des Abends, nach beendigter Tagesarbeit das Restaurant zum „Kaffeebaum“ aufzusuchen, wo er im Kreise von Bekannten einige Stunden zubrachte. Es waren fast ausschließlich Künstler und Altersgenossen, die dort zusammenkamen: Wenzel, Knorr, Stegmayer, Ortlepp, Dr. Reuter, Lühe und Lyser. Auf Schumanns Vermittlung hin stellte sich auch Wieck ein, der gelegentlich sogar Klara mitbrachte und – als Ältester – den geistigen Mittelpunkt der Gesellschaft abgab. Robert aber saß seitwärts in einer versteckten Ecke, den Kopf auf den Arm gestützt, die unentbehrliche Cigarre im Munde, mit halbgeschlossenen Augen, wie in Traum verloren. Dann wieder auflebend bis zur Gesprächigkeit und Lebhaftigkeit, wenn ein interessanter Ideenaustausch angeregt wurde, so daß man das Erwachen aus seiner Versunkenheit, das Heraustreten an die Außenwelt beobachten konnte. (Brendel.) Das Gespräch bewegte sich gewöhnlich um die musikalischen Zustände Deutschlands, welche eben in jener Zeit nichts weniger als erfreulich zu nennen waren; insbesondere in Bezug auf die Klaviermusik. Hier dominierten Herz, Hünten, Czerny mit ihrem brillanten Floskelwesen und leeren Klingklang, während die kürzlich verstorbenen Meister Beethoven, Weber, Schubert schier vergessen schienen und jungen, bedeutenderen Talenten, wie Chopin, Mendelssohn und andern keine Beachtung zu teil wurde. Sie begegneten einer Kritik, die, allen neuen und außergewöhnlichen Erscheinungen abhold, dieselben entweder schonungslos herunterriß oder vollständig totschwieg, jedes oberflächliche Machwerk dagegen, sofern es nur in althergebrachter Manier verfertigt war, ungebührlich lobte. So geschah es z. B. in der Leipziger „Allgemeinen musikalischen Zeitung“, seitdem die Redaktion[S. 27] aus den Händen des alten, trefflichen Rochlitz in jene G. W. Finks übergegangen. In Berlin führte Rellstab, der Herausgeber der „Iris“ sein gefürchtetes Richtschwert gegen Schumann, Chopin, Mendelssohn und Schubert. Neben diesen zwei kritischen Zeitschriften kommt der Wiener „Musikalische Anzeiger“ (redigiert von Castelli) gar nicht in Betracht; er pries das Beste und Schlechteste, all einerlei.
Da fuhr eines Junitages der Gedanke durch die jungen Brauseköpfe: laßt uns nicht müßig zusehen, greift an, daß es besser werde, daß die Poesie in der Kunst wieder zu Ehren komme, daß der musikalische Zopf und die kritische Honigpinselei ein Ende habe! So entstand der Plan einer neuen Zeitschrift für Musik, in deren Leitung sich Wieck, Knorr, Ortlepp, Schumann und Stegmayer teilen sollten. Freilich bis zur Verwirklichung hatte es noch gute Wege. Hoffmeister, der zur Übernahme des Verlages ausersehen war, zauderte trotz endloser Unterhandlungen. Auch fehlte es nicht an Differenzen zwischen den Herausgebern selbst. Wieck zum Beispiel, der eigentlich bloß seinen Namen hergab, fühlte sich zurückgesetzt, wenn einer der jungen Leute die Betreibung der Sache energisch in die Hand nahm. Ohne Schumanns hingebungsvolle Thätigkeit wäre das Unternehmen sicherlich noch gescheitert. Wie wohl er sich in dem neuen Wirkungskreise befand, läßt sich aus den tollen Streichen ermessen, die er den Sommer über mit seinen Genossen inscenierte. Es kam vor, daß er sie auf der Heimkehr aus dem „Kaffeebaum“ noch um Mitternacht in den Riedelschen Garten lud; das Gitter ward mit Lebensgefahr überklettert, der Kellner des Weinschanks, der sich im Hause befand, herausgetrommelt und unter den rauschenden Bäumen begann ein übermütiges Gelage.
War nun die Überanstrengung durch die Vorarbeiten zur Zeitschrift oder eine Verkühlung schuld oder beides zugleich – er verfiel nach solch einer nächtlichen Schwärmerei in eine schwere Nervenkrankheit. Unglücklicherweise mußte den[S. 28] Genesenden noch die erschütternde Nachricht von dem Tode seiner Schwägerin Rosalie und seines Bruders Julius treffen, wodurch die Erholung neuerdings hinausgeschoben wurde. Erst im Dezember durfte er die Arbeit an der Zeitschrift wieder aufnehmen.
Um dieselbe Zeit, zu Ende des Jahres 1833, hatte ein junger schwäbischer Musikus Leipzig zum dauernden Aufenthalt erkoren und wurde bald nach seiner Ankunft mit dem Schumannschen Freundeskreise bekannt. „In Krauses Keller trat ein junger Mensch an uns heran, alle Augen waren auf ihn gerichtet. Einige wollten eine Johannesgestalt an ihm finden, andere meinten, grübe man in Pompeji einen ähnlichen Statuenkopf aus, man würde ihn für den eines römischen Imperators erklären. Alle jedoch stimmten darin überein, daß es ein Künstler sein müsse, so sicher war sein Stand von der Natur schon in der äußerlichen Gestalt gezeichnet – nun, ihr habt ihn ja alle gekannt; die schwärmerischen Augen, die Adlernase, den feinironischen Mund, das reiche, herabfallende Lockenhaar und darunter einen leichten, schmächtigen Torso, der mehr getragen schien als zu tragen. Bevor er an jenem Tage des ersten Sehens uns leise seinen Namen „Ludwig Schunke aus Stuttgart“ genannt hatte, hörte ich innen eine Stimme: ‚das ist der, den wir suchen‘ – und in seinen Augen stand etwas Ähnliches.“ Schumann gewann an dem edlen, liebenswürdigen Künstler einen teuren Herzensfreund, die Zeitschrift einen ihrer wärmsten Verfechter. Dank seines werkthätigen Beistandes konnte die erste Nummer schon im April erscheinen.
Ihr von Schumann entworfenes Programm war im wesentlichen eine Paraphrase des Goetheschen Lehrspruches:
Es lautet: „An die alte Zeit und ihre Werke mit allem Nachdruck erinnern, darauf aufmerksam zu machen, wie nur an so reinem Quelle neue Kunstschönheiten gekräftigt werden[S. 29] können – sodann die letzte Vergangenheit, die nur auf Steigerung äußerlicher Virtuosität ausging, als eine unkünstlerische zu bekämpfen – endlich eine neue poetische Zeit vorzubereiten, beschleunigen zu helfen. – Unerschütterlich steht in uns die Ansicht, daß wir noch keineswegs am Ende unserer Kunst sind, daß noch viel zu thun übrig bleibt, daß Talente unter uns leben, die uns in unseren Hoffnungen auf eine neue reiche Blütenzeit der Musik bestärken und daß noch größere erscheinen werden. – Die Erhebung deutschen Sinnes durch deutsche Kunst, geschieht sie nun durch Hinweisung auf ältere Muster oder durch Bevorzugung jüngerer Talente; mag als das letzte Ziel unserer Bestrebungen angesehen werden. – Wir wüßten nicht, was wir vor anderen Künsten und Wissenschaften voraus haben sollen, wo sich die Parteien offen gegenüberstehen und befehden, noch überhaupt, wie es sich mit der Ehre der Kunst und der Wahrheit der Kritik vereinbaren ließe, den drei Erzfeinden unserer und aller Kunst, den Talentlosen, dann den Dutzendtalenten, endlich den talentvollen Vielschreibern ruhig zuzusehen. Wir schreiben ja nicht, um die Kaufleute reich zu machen, wir schreiben den Künstler zu ehren.“
In kurzer Zeit gebot die Zeitschrift über eine stattliche Anzahl tüchtiger Mitarbeiter; wir nennen unter anderen: Bank, Berger, Dorn, Griepenkerl, Stephen Heller, Kahlert, Keferstein, Kistner, Koßmaly, Krägen, Lorenz, Löwe, Lyser, Mangold, Marx, Nauenburg, Riefstahl, Schüler, Töpken, Truhn, Weißmann, Wenzel, Zuccalmaglio. Für die Redaktion zeichneten Schunke, Schumann, Wieck und Knorr. Man blättere in den ersten Bänden der Zeitschrift nach: das fröhliche, kräftige Leben darin wird noch jetzt Anteil erwecken; auch Versehen kamen vor, wie sie ja im Gefolge aller jugendlichen Unternehmungen sind. Jeder steuerte eben bei, was er hatte. Der Stoff schien damals endlos; man war sich eines edlen Strebens bewußt; neue Götterbilder sollten aufgestellt, ausländische Götzen niedergerissen werden;[S. 30] man arbeitete Tag und Nacht. Es war das Ideal einer großen Künstlerbrüderschaft zur Verherrlichung deutscher, tiefsinniger Kunst, das wohl jedem als das herrlichste Ziel seines Strebens vorleuchten mochte. Und wie denn die Zeitschrift zu günstiger Stunde, unter günstigen Umständen unternommen wurde, einmal weil man des Schneckenganges der alten musikalischen Kritik überdrüssig war und weil wirklich neue Erscheinungen am Kunsthimmel aufstiegen, dann weil die Zeitschrift im Schoß von Deutschland, in einer von jeher berühmten Musikstadt entsprang und der Zufall gerade mehrere junge, gleichgesinnte Künstler vereinigt hatte, so griff das Blatt auch rasch um sich und verbreitete sich nach allen Gegenden hin. Fast alle bedeutenden Tonsetzer dieser Periode: Mendelssohn, Chopin, Hiller, Taubert, Stephen-Heller, Gade, Berlioz, Franz, Verhulst und Sterndale Benett wurden teils durch dieselbe zuerst verständnisvoll gewürdigt, teils geradezu in die musikalische Welt eingeführt – nur gegen Meyerbeer nahm die Zeitschrift eine ablehnende Haltung ein; mit Recht darf man heute behaupten. Im übrigen liegen ihre Verdienste vornehmlich auf dem Felde der Klaviermusik. Hier erzielte sie einen vollständigen Umschwung des Geschmackes; indem fortan gedankenvollere, polyphone Gebilde an Stelle der alten virtuosen Passagenwerke traten. Für die gleichfalls in Aussicht genommene Opernreform in ähnlicher, gedeihlicher Weise zu wirken, blieb ihr dagegen versagt, schon darum, weil es in „Klein-Paris“ kein rechtes Theaterleben gab und den Herausgebern, abgesehen von der unerläßlichen Begabung, auch die Erfahrung im dramatischen Genre abging.
Die Herausgeber! Ist’s denn erlaubt, von ihnen in der Mehrzahl zu sprechen? Wieck war immerfort auf Reisen, Knorr erkrankte, so daß eigentlich nur Schumann und Schunke als Häupter der Leipziger romantischen Schule in Betracht kamen. Schunke wiederum, dem die Feder nicht[S. 31] parieren wollte, war bloß eine moralische Macht, so daß die Redaktionsgeschäfte fast einzig und allein auf Schumanns Schultern lasteten. Jetzt mußten dem Musiker, der bereits 1831 in der Finkschen Zeitung einen schönen Aufsatz über Chopin und 1833 einen über Klara Wieck im „Kometen“ veröffentlicht hatte, seine schriftstellerischen Gaben frommen. Er lieferte nicht allein zahlreiche Beiträge, bearbeitete die eingelaufenen, manchmal recht elend stilisierten Artikel, sondern besorgte auch Korrespondenzen, Verrechnungen, Korrekturen, Anweisung der Honorare u. s. w. – alles ohne irgend einen pekuniären Vorteil. Zum Komponieren blieb ihm unter solchen Umständen allerdings nur spärliche Muße.
Es war ungefähr zur Zeit des ersten Erscheinens der Zeitschrift, als Schumann, nicht ohne längeres Sträuben seinerseits, bei dem kunstsinnigen Kaufmanne Carl Voigt und dessen Gattin Henriette eingeführt wurde. Aber „nur einen Schritt in ihr Haus gethan, und der Künstler fühlte sich heimisch darin. Aufgehängt waren über dem Flügel die Bildnisse der besten Meister; eine ausgewählte musikalische Bibliothek stand zur Verfügung; der Musiker, schien es, war Herr im Hause, die Musik die oberste Göttin.“ Ein beredter Zeuge des regen Künstlerverkehres ist das Album der Frau Voigt, durch die Autographe berühmter Musiker – Mendelssohn, Löwe, Chopin und anderer – mit denen sie teilweise auch Briefwechsel unterhielt, sehr kostbar. (Jansen.) Poetisch und musikalisch begabt – sie war L. Bergers Schülerin im Klavierspiel – hat Henriette (die „Beethovenerin“) auf den ihr freundschaftlich zugethanen Schumann bildend und belebend eingewirkt. Sie wurde auch seine Vertraute in dem etwa gleichzeitig sich entspinnenden Liebesverhältnisse zu Ernestine von Fricken.
Dieselbe, die Tochter eines reichen böhmischen Barons aus Asch, kam im Frühjahr 1834 nach Leipzig, um sich bei Wieck im Pianofortespiel zu vervollkommnen, „ein herrliches, reines, kindliches Gemüt,“ wie Robert sie schildert, „zart[S. 32] und sinnig, mit der innigsten Liebe an mir und allem Künstlerischen hängend, außerordentlich musikalisch – kurz ganz so, wie ich mir meine Frau wünsche.“ Am 5. September verlobte sich Schumann mit ihr, erhielt auch die Einwilligung des Vaters – allein der Brautstand war nicht von langer Dauer. Schon im August des nächsten Jahres wurde das Verlöbnis, aus Gründen, die sich unserer Kenntnis noch entziehen, in aller Freundschaft wieder gelöst.
Inzwischen hatte sich ein tief schmerzliches, aber nicht unerwartetes Ereignis zugetragen. Ludwig Schunke war (7. Dezember 1834) an einer zehrenden Brustkrankeit, Novalis vergleichbar, sanft aus dem Leben geschwunden. Schumann war trostlos. Zu seiner Trauer um den Geliebten gesellten sich noch allerlei, durch die Liederlichkeit des Verlegers der Zeitschrift, E. Hartmann, hervorgerufene Zerwürfnisse, welche endlich dadurch beigelegt wurden, daß Schumann, der nach Schunkes Tode und Knorrs und Wiecks Rücktritt von den Leitern des Unternehmens allein übrig geblieben, die Zeitschrift ankaufte und dem Buchhändler Johann Ambrosius Barth zum Verlag übergab. Herausgeber und Besitzer in einer Person (vom 1. Januar 1835 ab), benützte er das erworbene Eigentumsrecht, um wichtige Verbesserungen im kritischen Teile des Blattes eintreten zu lassen. Musikalische Schöpfungen sind, wie schon bemerkt, in diesem Zeitraume nur wenige zu verzeichnen. Ehe wir uns aber mit ihnen befassen, ist es notwendig, bei dem „Davidsbunde“ zu verweilen, der in den Spalten der „Neuen Zeitschrift“ eine große Rolle spielt. Schumann dachte sich dabei einen idealen, natürlicherweise bloß im Kopfe seines Stifters existierenden Geheimbund fortschrittlicher Künstler, welcher König David, den mannhaften Besieger der Philister, als Schutzpatron verehrte. Unter den Mitgliedern ragen namentlich dreie hervor: Florestan, Eusebius und Meister Raro. Florestan ist der Wortführer der neuen Richtung in der Musik. Rücksichtslos und un[S. 33]gestüm zieht er gegen jedes pedantische Festhalten am alten Zopf zu Felde. „Warum denn rückwärts komponieren? Wem die Perücke gut steht, der mag sich eine aufsetzen; aber streicht mir die fliegende Jugendlocke nicht weg, wenn sie auch etwas wild über die Stirn hereinfällt. Also Locken, Sonatenschreiber und keine falschen...! Wie kommen wir dazu, uns von vorigen Jahrhunderten Vorschriften geben zu lassen?“ Im Gegensatze zu ihm ist Eusebius weich und schwärmerisch, ein mädchenhaft schüchterner Jüngling. Meister Raro endlich vermittelt zwischen beiden; er vertritt die Besonnenheit und Einsicht des gereiften Mannes. Wie diese merkwürdigen Gestalten im Verhältnis zu Schumann aufzufassen sind, erklärt er selbst in einem Briefe an Dorn: „Florestan und Euseb ist meine Doppelnatur, die ich wie Raro gern zum Mann verschmelzen möchte.“ Auch hinter den übrigen Bündlern hat man wirkliche Personen zu suchen; es sind Walt (Rakemann), Julius (Knorr), Jonathan (Schunke?), Serpentinus (Bank), Fritz Friederich (Lyser) und Giara oder Zilia (Klara Wieck). Zur Gestalt Meister Raros soll Friedrich Wieck einige Züge geliehen haben.
Aber nicht allein in der Zeitschrift liebt es Schumann, sich hinter den Namen Florestan und Eusebius zu verbergen. Sie prangen auch als Verfasser auf dem Titelblatt der ersten Ausgabe seiner leidenschaftlichen Fis-Moll-Sonate (op. 11), deren Wert zum erstenmale Franz Liszt erkannt und in seiner geistreichen Weise dargelegt hat. (Gazette musicale, 1837, Nr. 46.) Freilich will die Bezeichnung „Sonate“ nicht durchwegs passen: die Triebkraft der Phantasie sprengt eben da und dort die überlieferten klassischen Formen. Einen ähnlich stürmischen Charakter trägt das sonst minder bedeutende op. 8 Allegro (seiner Braut gewidmet), welches Schumann an Frau Voigt mit dem Bedeuten sandte, „daß der Verfasser mehr tauge als das Werk und weniger als die, der es zugeeignet ist.“ Bei weitem[S. 34] höher steht dagegen op. 9 der Karneval, ein anmutig belebtes, an pikanten Rhythmen und bunten Modulationen reiches Faschingsbild. Das beständig wiederkehrende Motiv ASCH weist uns auf die persönlichen Beziehungen dieser Schöpfung; es drückt den Namen der Vaterstadt Ernestines in Noten aus. Schumann fand es „sehr schmerzlich“, wie denn das ganze Werk in ernster Stimmung komponiert worden ist. Der Musik wird das aber niemand anmerken; sie charakterisiert das fröhliche Gewimmel im hellerleuchteten Ballsaal ganz meisterlich. Der bedächtige Pierrot schreitet vorüber, Pantalon und Colombine kommen leichten Fußes einhergetrippelt, der Harlekin schlägt seine Capriolen und eine Kokette läßt verführerisch ihre Augen spielen. Die Davidbündlerschaft fehlt auch nicht beim Feste. Wir sehen den wild dreinfahrenden Florestan, den träumerischen Eusebius, Chiara, Estrella (Ernestine), ferner Paganini und Chopin. Die Krone des Ganzen aber bildet der kecke „Marsch der Davidsbündler gegen die Philister“, welch letztere sehr ergötzlich durch die Melodie des Großvatertanzes („Und als der Großvater die Großmutter nahm“) charakterisiert sind. Natürlich werden die Armen zu guterletzt jämmerlich geschlagen und Davids siegreiche Jünger erheben frohlockend ihr übermütiges Jubellied.
[2] Noch freier verfährt Schumann in einem zweiten Hefte, das der Verleger des besseren Absatzes wegen als op. 10 erscheinen ließ; er streift diesmal der Komposition alles Geigenmäßige ab und ersetzt die Klangeffekte des Streichinstrumentes sehr geschickt durch solche, die dem Klaviere eigentümlich sind.
Nicht lange nach der Lösung des Verhältnisses zu Ernestine von Fricken hielt eine neue Liebe Einzug in Schumanns Herzen, eine Liebe, deren Keime wohl schon manches Jahr in seiner Brust geruht haben mochten, ehe sie trieben, sproßten[S. 35] und breit sich entfalteten, eine Liebe, die ihn harte Kämpfe und bittere Schmerzen gekostet, eine Liebe, der die deutsche Kunst einige ihrer schönsten und edelsten Blüten zu verdanken hat. Es war Klara Wieck, die langjährige Freundin, welche Ernestines Stelle dauernd einnehmen sollte. Geboren am 13. September 1819, fand sie schon als Kind ihres Klavierspieles halber allgemeine Bewunderung. Neun Jahre alt ließ sie sich zum erstenmale öffentlich hören, zwei Jahre später begann sie mit dem Vater, dessen vorzügliche Lehrmethode in ihrem Spiele die größten Triumphe feierte, weite Konzertreisen, die über Dresden, Weimar, Kassel, Frankfurt bis Paris führten. Die Aufnahme war überall enthusiastisch. In Weimar trug der greise Goethe das Stuhlkissen eigenhändig für sie herbei und schenkte ihr beim Abschied sein Brustbildmedaillon mit der Widmung: „Der geistreichen Klara Wieck.“ Auch andere berühmte Männer: Spohr, Mendelssohn, Alexander von Humboldt, Chopin, Herz und andere nahmen an ihr lebhaftes Interesse; Schumann verehrte sie „wie der Pilgrim das ferne Altarbild“ und stellte sie in eine Reihe mit Paganini. Über ihre äußere Erscheinung giebt Heinrich Dorn folgende Nachricht: „Meine Klara (denn sowohl von ihrem Vater, als von allen, die sie kannten, wurde sie nicht anders genannt), war 1831 ein reizender Backfisch; zierliche Gestalt, blühende Gesichtsfarbe, zarte, weiße Händchen, üppiges, schwarzes Haar, kluge, glutvolle Augen; alles war an ihr appetitlich.“ Mit Robert, „dem herrlichen, prächtigen Menschen,“ stand sie in geschwisterlichem Verhältnis. „Klara,“ schreibt er seiner Mutter 1833, „die wie immer innig an mir hängt, ist die alte – wild und schwärmerisch – rennt und springt und spielt wie ein Kind und spricht wieder einmal die tiefinnigsten Dinge. Es macht Freude, wie sich ihre Herzens- und Geistesanlagen jetzt immer schneller, aber gleichsam Blatt für Blatt entwickeln. Als wir neulich zusammen von Connewitz heimgingen (wir machen fast täglich zwei- bis dreistündige Märsche),[S. 36] hörte ich, wie sie für sich sagte: „O, wie glücklich bin ich, wie glücklich!“ Wer hört das nicht gern! Auf demselben Wege stehen sehr unnütze Steine mitten im Fußsteg. Wie es nun trifft, daß ich oft im Gespräche mit anderen mehr auf- als niedersehe, geht sie immer hinter mir und zupft an jedem Stein leise am Rock, daß ich ja nicht falle. Einstweilen fällt sie selbst darüber.“ Bald darauf spricht Schumann dem Mädchen mit der Dedikation der Impromptus die Hoffnung aus, „daß die Vereinigung unserer Namen auf dem Titel eine unserer Ansichten und Ideen für spätere Zeiten sein möchte. Mehr bieten kann ich Armer nichts.“ Während des Brautstandes mit Ernestine verblaßte begreiflicherweise das Bild Klaras, die sich obendrein meist auswärts auf Kunstreisen befand. Doch schon im Sommer 1835 schwebt ihm überall ihr „Engelskopf“ mitten unter Festen und Freudenhimmeln vor. Täglich, ja stündlich fühlte er sich mehr zu ihr hingezogen und während des folgenden Winters vollzog sich die Umwandlung des bisher bloß freundschaftlichen Bundes in ein offenes Liebesverhältnis. Klaras rege Beteiligung am Leipziger Musikleben, welches damals durch die Ankunft Mendelssohns einen neuen, mächtigen Aufschwung nahm, brachte sie fortwährend mit Robert in Berührung. Im Februar 1836 endlich, kurz nach dem Tode seiner Mutter (gestorben 4. Februar) erscheint das förmliche „Sie“ im Briefwechsel durch das vertraute „Du“ ersetzt, denn Schumann schreibt: „Vielleicht daß der Vater die Hand nicht zurückzieht, wenn ich ihn um seinen Segen bitte. Freilich giebt es da noch viel zu denken, auszugleichen. Indes vertraue ich auf unseren guten Geist. Wir sind vom Schicksal schon füreinander bestimmt: schon lange wußte ich das, aber mein Hoffen war nicht so kühn, dir es früher zu sagen und von dir verstanden zu werden.“
Nun war Vater Wieck unserem Künstler zwar aufrichtig gewogen und hatte gern zur Verbreitung seiner Werke beigetragen, allein in puncto seiner Tochter verstand der alte,[S. 37] etwas fahrige Herr keinen Spaß. Klara, sein Stolz, die sichtbare Verkörperung seiner illustren Klaviermethode, schien ihm wahrlich zu Höherem bestimmt als die Frau eines noch ziemlich unbekannten und unbemittelten Komponisten abzugeben! Er wies die kühne Werbung rundweg ab und reiste, um eine weitere Annäherung zu vereiteln, mit Klara auf der Stelle nach Breslau. Doch gelang es Schumann, der als Redakteur der Musikzeitung überall Verbindungen hatte, wenigstens geheimen Briefwechsel mit der Geliebten zu pflegen.
Sein nächstes Streben war jetzt auf die Gründung einer sicheren Existenz gerichtet, denn die fünfhundert Thaler Rente, die er von seinem väterlichen Erbteil bezog, reichten wohl hin ihn vor Not und Sorge ums tägliche Brot, den treuen Gefährtinnen des deutschen Musikers, zu schützen, aber nicht zum Unterhalt einer Familie. Durch Verpflanzung der Zeitschrift nach Wien hoffte er ihre Einträglichkeit um ein Bedeutendes zu steigern und betrieb deshalb in aller Stille aber eifrig diese Angelegenheit. So schwand das Jahr unter viel Bekümmernis, für die ihn nur der häufige Umgang mit Felix Mendelssohn einigermaßen entschädigen konnte. Mendelssohn besaß, was Schumann am meisten fehlte: musikalische Durchbildung, Weltgewandtheit, außerordentlichen Formensinn und imponierte damit dem jüngeren Meister bis zu heller Begeisterung. „Er ist der beste Musiker der Zeit, zu dem ich aufschaue wie zu einem hohen Gebirge,“ ruft er aus, während der Schöpfer des „Paulus“, dem Schumanns kostbares Gut, der Gehalt im Busen eigentlich abging, mit der schönen Form im Geiste die künstlerische Bedeutung des Freundes, so sehr er ihn als Menschen hochschätzte, nie begriffen hat. Wehe aber, wenn sich jemand in Schumanns Gegenwart ein abfälliges Urteil über Mendelssohns Musik erlaubte! Das konnte den sonst so stillen, fast apathisch Scheinenden in die größte Erregung versetzen. Übrigens bemerkt er selbst einmal ganz richtig: „In[S. 38] ähnlichen Verhältnissen wie er (Mendelssohn) aufgewachsen, von Kindheit an zur Musik bestimmt, würde ich euch samt und sonders überflügeln.“
Fast täglich trafen die beiden Meister am Mittagstische des Hotels de Baviere zusammen. Außerdem gehörten noch Walther von Goethe, Frank, David und Sterndale Benett zur Tafelrunde. Dem letzteren, der sich damals längere Zeit in Leipzig aufhielt, sind die Etudes symphoniques (op. 13) gewidmet, höchst originelle Variationen, deren prächtiges Finale mit dem beabsichtigten Anklang an ein englisches Volkslied („Wer ist der Ritter hochgeehrt?“) direkt an das Nationalgefühl Benetts appelliert. Daneben vollendete Schumann noch ein Concert sans orchestre (op. 14, später Sonate III genannt) und die herrliche C-Durphantasie (op. 17) „eine tiefe Klage um Klara.“ Anfangs wollte er sie, da ihr eventueller Ertrag für das in Bonn zu errichtende Beethovendenkmal bestimmt war, „Obolus“ oder „Ruinen, Siegesbogen und Sternenkranz“ betiteln, bis er sich später für „Große Sonate“ und schließlich für das weit angemessenere „Phantasie“ entschied. Als Motto trug das Werk den Schlegelschen Vers: „Durch alle Töne tönet im bunten Erdenraum ein leiser Ton gezogen für den, der heimlich lauschet.“
Mit dem leisen Tone ist, wie aus einem Schumannschen Briefe hervorgeht, Klara gemeint. Auf sie weisen uns denn auch die Kompositionen des folgenden Jahres, die Phantasiestücke (op. 12) und die Davidsbündlertänze (op. 6) hin, von welchen namentlich die erste in der Kunstwelt Anerkennung und Liebe gefunden hat. In diesen wunderbaren Stimmungsbildern entfaltet sich Schumanns Talent in seiner ganzen Fülle und Eigentümlichkeit, mag er nun „des Abends“ schwärmen oder seltsame „Traumeswirren“ schildern oder „Grillen“ nachjagen oder die bedeutungsvolle Frage „Warum?“ an das Schicksal richten. Für das gelungenste Stück hielt er selbst das fünfte „In[S. 39] der Nacht“, worin er, als es bereits fertig war, die Geschichte von Hero und Leander zu finden glaubte: „wie er sich ins Meer stürzt, sie ruft, er antwortet, er durch die Wellen glücklich ans Land – dann die Kantilene, wo sie sich in den Armen haben – dann, wie er wieder fort muß, sich nicht trennen kann, bis die Nacht wieder alles in Dunkel hüllt.“ Mit Bezug auf das Schlußstück: „Das Ende vom Lied“, schreibt Schumann an Klara: „Ich dachte dabei, nun am Ende löst sich alles in eine lustige Hochzeit auf, aber am Schluß kam wieder der Schmerz um dich dazu und da klingt es wie Hochzeit- und Sterbegeläute untereinander.“ Ganz ähnlich lautet eine Briefstelle über die Davidsbündlertänze, welchen als Motto der alte Spruch: „In all und jeder Zeit verknüpft sich Lust und Leid; bleibt fromm in Lust und seid dem Leid mit Mut bereit“ vorangesetzt ist. „In den Tänzen,“ heißt es dort, „sind viele Hochzeitsgedanken – sie sind in der schönsten Erregung entstanden, wie ich mich nur je besinnen kann; ein ganzer Polterabend nämlich ist die Geschichte und du kannst dir Anfang und Schluß ausmalen. War ich je glücklich am Klavier, so war es, als ich sie komponierte.“
Vergleicht man die angeführten Stellen miteinander, so ergeben sich aus ihnen wertvolle Aufschlüsse über den Verlauf seines Liebesromanes. Während zur Zeit der Komposition der Phantasiestücke ihn noch bange Zweifel an dem guten Ausgang heimsuchen, sehen wir ihn jetzt in ungetrübter Heiterkeit der Zukunft entgegenschauen. Klaras unerschütterliche Treue war’s, die ihn vor gänzlicher Resignation bewahrte, ja schließlich sogar mit solcher Zuversicht erfüllte, daß er am 13. September 1837, ermutigt durch das freundliche Benehmen des Vaters, um ihre Hand nochmals anzuhalten wagte. Wieck hatte schon vermeint, daß die Leidenschaft der beiden Liebenden, die sich auf stillschweigendes Übereinkommen hin über ein Jahr nicht gesehen, durch die Trennung erkalten werde und mußte nun zu seinem Ärger[S. 40] gewahren, daß die Flamme heller brenne wie zuvor. Überrascht und außer Stande begründeten Einwand zu erheben, gab er bloß unklare, ausweichende Antwort. Er spielte auf Schumanns ungeregelte Verhältnisse an: dieser schränkte sich auf das Äußerste ein. Er ließ verlauten, daß Schumann noch mehr verdienen müsse. Dieser nahm, obgleich die Zeitschrift auch so prosperierte, seinen alten Plan, die Übersiedelung nach Wien, energisch wieder auf, besonders als Klara dortselbst im Dezember große Triumphe gefeiert hatte. Die Unterhandlungen mit Wiener Freunden des Blattes (Vesque von Püttlingen und Joseph Fischhof) zogen sich hin bis zum Herbst des folgenden Jahres, und Schumann schrieb in dieser Zeit drei seiner vorzüglichsten Werke: Die Novelletten (op. 21), die man als Nachklang der Phantasiestücke betrachten kann, ferner die Kreisleriana (op. 16) und Kinderscenen (op. 15).
Jene geben sich, wie ja die Überschrift sagt, als Schöpfungen des berühmten romantischen Musikus Kreisler, mit welchem sich Schumann hier identifiziert. Man kennt diese originelle Gestalt T. A. Hoffmanns, deren excentrisches Wesen und Gebaren durch atemversetzende Synkopenketten sehr zutreffend charakterisiert wird, aus „Kater Murr“ (Universal-Bibliothek Nr. 153–156). Von einer neuen, überaus liebenswürdigen Seite zeigt sich Schumanns Genius in den „Kinderscenen“. Mit welcher Feinheit, bemerkt Liszt, läßt er die verschiedensten Jugendeindrücke aufeinander folgen! Wie harmonisch verteilt er Licht und Schatten im Fortschreiten von Begebenheiten im äußeren Leben des Kindes zur Schilderung seiner Innerlichkeit! Und – um nur bei einem allgemein bekannten Werk einen Augenblick zu verweilen – wie glücklich ist die Aufeinanderfolge der Stücke! Glaubt man doch bei der Erzählung „von fremden Ländern und Menschen“ die aufhorchenden blonden Kinderköpfchen starr nach dem Munde des Erzählers gerichtet zu sehen, bis die „kuriose Geschichte“ ihre erregte Phantasie wieder in das[S. 41] umgebende Leben zurückführt, wo dann mit dem „Haschemann“ der Übergang zum Tummeln und Spielen gemacht wird. Da ist aber ein Kind, dessen Gedanken schon in die Ferne, nach dem Unmöglichen schweifen, das Freude auf Freude, Spiel auf Spiel häufen möchte. Dem bittenden Kinde antwortet man mit weisem, sanftem Vorwurf: „Glückes genug.“ So müssen die kaum sich entfaltenden Seelen schon das schwere Wort von der irdischen Unzulänglichkeit begreifen lernen. Doch dem innigen Sittenspruch folgt eine „wichtige Begebenheit“. Da wenden sich die jungen Gemüter von dem Betrübtsein, das selbst der leiseste Vorwurf ihnen bringt, zu den wechselnden Vorfällen der Wirklichkeit, in denen wieder für einige der Hauptreiz darin liegt, daß sie zu schwärmerischem Nachsinnen, zu „Träumereien“ führen, denen man nirgends besser als „am Kamin“ nachhängen kann. Dort beginnen wieder wunderbare Geschichten voll merkwürdiger Ereignisse, wie der „Ritter vom Steckenpferd“ oder voll Grausens, wenn sie „fast zu ernst“ werden oder „fürchten machen“. Nun aber senkt sich das friedlichste und liebenswürdigste der Gespenster, der Sandmann, über die von wirren Bildern des Tages ermüdeten Augen des „einschlummernden Kindes“ und „der Dichter spricht.“ Er spricht zu den Ruhenden und giebt seinen Segen all den kleinen Ereignissen des Tages, deren Bedeutung sein denkender Geist erhöht; denn im symbolischen Spiegel zeigen sie die großen Begebenheiten des reiferen Lebens, wie sie oft in derselben Folge von denselben Eindrücken angeregt erscheinen.
Anfang Oktober 1838 reiste Schumann, nachdem an seiner Statt Oswald Lorenz die Leitung der Redaktionsgeschäfte übernommen hatte, selbst nach der Donaustadt, um sowohl mit den Behörden und Verlegern die nötigen Unterhandlungen zu pflegen, als auch um das Publikum ein wenig kennen zu lernen. Allein schon nach den ersten Tagen sah er sich in seinen Hoffnungen gründlich getäuscht; der heilige Boden, auf welchem die größten deutschen Tondichter[S. 42] einstens gewandelt, war jetzt der Tummelplatz italienischen Opernklingklangs und ausgelassener Tanzmusik. Man wird den künstlerischen Niedergang Wiens wohl am treffendsten seit dem Falle der Euryanthe (Oktober 1823) datieren, da von diesem Zeitpunkte an die Freunde deutscher Kunst, eingeschüchtert und uneins den fanatischen Parteigängern Rossinis das Feld ganz und gar überließen. Bald nach seiner Ankunft schon bekennt Schumann, „ich passe nicht unter diesen Schlag Menschen; hinge es von mir ab, morgen ging ich nach Leipzig zurück; die Zeitung verliert offenbar, wenn sie hier erscheinen muß;“ ja, nicht einmal das Erscheinen des Blattes sollte er durchsetzen können, da man ihm als Ausländer die Bedingung stellte, daß ein österreichischer Verleger an die Spitze des Unternehmens trete, die Wiener Buchhändlerfirmen aber davon nichts wissen wollten, weil sie für ihren Strauß, Proch u. s. w. von der „revolutionären“ Zeitschrift fürchteten. In den landesüblichen, lobhudelnden Recensententon mit einzustimmen und dadurch in den Augen Norddeutschlands feige, matt und verändert zu gelten, dazu war Schumann natürlicherweise nicht zu bewegen. Von der Aussichtslosigkeit seines Vorhabens völlig überzeugt, kehrte er im Frühjahr 1839 schweren Herzens nach Sachsen zurück. So ganz fruchtlos sollte übrigens der Wiener Aufenthalt für die Kunst nicht gewesen sein, denn eine Anzahl reizender Klavierwerke ist damals teils neu entstanden, teils vollends ausgeführt worden und zwar folgende: Scherzo, Gigue und Romanze (op. 32), Arabeske (op. 18), Blumenstück (op. 19), Humoreske (op. 20), Nachtstücke (op. 23), Faschingsschwank (op. 26). Von diesen erfordern nur die beiden letztgenannten einige Bemerkungen. Im Faschingsschwank, der in Wien erschienen ist, macht sich nämlich Schumann den Spaß, der hohen Censur ein Schnippchen zu schlagen, indem er recht unschuldig mitten unter allerlei Tanzmotiven plötzlich die in Wien streng verbotene Marseillaise anklingen läßt. Die Nachtstücke hingegen sind darum[S. 43] merkwürdig, weil sich in ihnen die ersten Spuren einer beginnenden Gemütsverdüsterung zeigen. „Es kommt darin,“ schreibt er, „eine Stelle vor, auf die ich immer zurückkomme; da ist, als seufzte jemand recht aus schwerem Herzen: „Ach Gott.“ Ich sah bei der Komposition immer Leichenzüge, Särge, unglückliche, verzweifelte Menschen und als ich lange nach einem Titel suchte, kam ich immer auf den: Leichenphantasie. Beim Komponieren war ich auch oft so angegriffen, daß mir die Thränen herankamen und wußte doch nicht warum. Da kam Theresens (seiner Schwägerin) Brief und nun stand es klar vor mir. Bruder Eduard lag im Sterben.“
Solche melancholische Stimmungen verflogen indessen rasch in dem buntfarbigen, regsamen Wiener Leben. Auch an erhebenden Momenten fehlte es nicht, wozu man den freundschaftlichen Verkehr mit Mozarts Sohne und den Besuch der Grabstätten der großen Tonmeister zählen muß. Auf dem Heimwege vom Währinger Kirchhof war’s, da fiel ihm ein, daß Schuberts Bruder Ferdinand ja noch lebe. Er suchte denselben auf, durchwühlte den Nachlaß des früh Verblichenen und entdeckte darin zu seiner Freude die große C-Dursymphonie, welche sogleich an Mendelssohn zur Aufführung übersendet wurde. Auch gelang es ihm, Breitkopf und Härtel zur Drucklegung des bedeutenden Werkes zu bewegen. Ausführliches über die denkwürdige Episode findet man im dritten Band seiner „Gesammelten Werke“ (Universal-Bibliothek, Nr. 2621 u. 2622).
Nach Leipzig zurückgekehrt, widmete sich Schumann mit allen Kräften der Zeitung, die ihn nach der langen Abwesenheit „wieder so jugendlich anlachte“ wie in den Tagen ihrer Gründung. In richtiger Erkenntnis, daß ihm nur die Vereinigung mit der Geliebten den zu freiem Schaffen unentbehrlichen Seelenfrieden verleihen könne, hielt er sodann im Sommer 1839 zum drittenmale bei Wieck um Klara an. Der alte Starrkopf aber weigerte sich so hartnäckig, daß dem[S. 44] liebenden Paare kein anderer Ausweg übrig blieb, als den Heiratskonsens gerichtlich zu erzwingen. Wie peinlich mußte diese Notwendigkeit unseres Künstlers stille, empfindsame Natur berühren, zumal da Wieck in seiner Wut alle Haltung verlor und sich nicht scheute, eine Schmähschrift gegen den Bräutigam seiner Tochter zu veröffentlichen! Komponiert wurde in dieser aufgeregten Zeit nur wenig: drei Romanzen für Klavier (op. 23). Klara, die in bitterem Kampf zwischen Liebe und Kindespflicht für Robert entschieden hatte, verließ jetzt den Vater und begab sich zu ihrer Mutter, Wiecks erster geschiedener Gattin nach Berlin.
Der gerichtliche Entscheid, dessen Ausfall übrigens nicht zweifelhaft sein konnte, ließ lange auf sich warten. Inzwischen kam das Jahr 1840, zu dessen Beginne sich Schumann durch seinen Freund Keferstein an der Universität Jena um den Doktortitel bewarb. Derselbe wurde ihm auch wirklich in Anbetracht seiner künstlerischen, kritischen und ästhetischen Thätigkeit honoris causa verliehen. Bald darauf hatte der neugebackene Doktor die Freude, seinen verständnisvollen Beurteiler in der Gazette musicale (vergl. S. 33), Liszt, der eben in Leipzig konzertierte, von Angesicht kennen zu lernen. Der geniale König des Klaviers machte auf Schumann einen tiefen Eindruck. „Liszt erscheint mir alle Tage gewaltiger,“ schreibt er, „ich bin mit ihm fast den ganzen Tag beisammen. Er sagte mir gestern, mir ist’s, als kennte ich Sie schon zwanzig Jahre – mir geht’s auch so. Wir sind schon recht grob gegeneinander... Wie er doch außerordentlich spielt und kühn und toll und wieder zart und duftig, daß wir alle zitterten und jubelten!“ Das waren ein paar schön verlebte Tage in dieser schmerzlichen Zeit des Harrens und der Ungeduld.
Endlich, im Sommer, traf der ersehnte Heiratskonsens ein und nun stand der ehelichen Verbindung der Vielgeprüften kein Hindernis mehr im Wege. Am 12. September traute sie Pfarrer Wildenhahn, ein Schulkamerad[S. 45] Roberts, in aller Stille in Schönefeld, einem Dorfe bei Leipzig.
Keine glücklichere, keine harmonischere Vereinigung – sagt Liszt schön und treffend – war in der Kunstwelt denkbar als die des erfindenden Mannes mit der ausführenden Gattin, des die Idee repräsentierenden Komponisten mit der ihre Verwirklichung vertretenden Virtuosin. Robert und Klara Schumann reihen sich in den Sagen der Kunst den glänzenden Beispielen von dem schönen Walten der Natur ein, welche diese beiden Künstler und Liebenden, die auf Erden nur in und durch sich glücklich werden konnten, nicht durch Zeit und Raum trennte, sondern ihnen zu günstiger Stunde in gemeinsamem Vaterlande das Leben gab, damit sie sich begegnen, ihre Geschicke in einem Strome vereinigen, ihre Herzen in ein Meer gemeinsamer, tiefer Anschauungen versenken konnten. Die Annalen der Kunst werden beider Gedächtnis in keiner Beziehung trennen und ihre Namen nicht vereinzelt nennen können, die Zukunft wird mit einem goldenen Schein beide Häupter umweben, über beiden Stirnen nur einen Stern erglänzen lassen, wie auch ein berühmter Bildner (Rietschel) die Profile des unsterblichen Paares schon in einem Medaillon vereinigt hat.
„Ich schreibe jetzt nur Gesangssachen, großes und kleines, auch Männerquartette. Kaum kann ich Ihnen sagen, welcher Genuß es ist, für die Stimmen zu schreiben, im Verhältnis zur Instrumentalkomposition und wie das in mir wogt und[S. 46] tobt, wenn ich in der Arbeit sitze. Da sind mir ganz neue Dinge aufgegangen,“ berichtet ein Brief vom 19. Februar 1840 an Keferstein. Wirklich hat Schumann in diesem Jahre, das man darum auch das „Liederjahr“ zu nennen pflegt, ausschließlich Vokalwerke geschaffen, und zwar so schöne, so vollendete, daß sie noch gegenwärtig als unübertroffene Muster dastehen und den Gipfelpunkt der ganzen Kunstform in Deutschland bedeuten. Gleichwie einst Beethoven im Schlußsatze der neunten Symphonie das Wort zu Hilfe nehmen mußte, um jene Deutlichkeit des Ausdruckes zu erzielen, welche der Instrumentalmusik allein versagt ist, so drängte, si licet parva componere magnis, unseren Meister, nachdem er in seinen scharf charakterisierenden Klavierstücken die äußerste Grenze rein musikalischen Ausdrucksvermögens berührt hatte, die Kraft des Empfindens, welche durch das reiche Liebesglück dieses Jahres zu höchster Gewalt gesteigert worden war, am Ende auch zur menschlichen Sprache hin. Der äußere Anlaß, der Schumann bewog, von dem bisher kultivierten Felde der Klavierkomposition auf das vokale Gebiet überzutreten, ist nicht recht bekannt. Noch im Sommer 1839 schrieb er an Hirschbach: „Komponieren Sie doch mehr für Gesang, oder sind Sie vielleicht wie ich, der ich Gesangskompositionen, so lange ich lebe, unter die Instrumentalmusik gesetzt habe und nie für eine große Kunst gehalten? Doch sagen Sie niemandem davon.“ Vielleicht hat der rege Briefwechsel mit dem Liederkomponisten Koßmaly die erste Anregung gegeben.
Damit wir Schumanns hohe Verdienste um das deutsche Lied nicht unrichtig bemessen, dürfen wir bei ihrer Würdigung sein künstlerisches Verhältnis zu Schubert nie aus dem Auge verlieren. Daß der Fortschritt des Schöpfers der „Winterreise“ seinen Vorgängern gegenüber größer sei, als der Fortschritt von ihm zu Schumann, wird kein Einsichtiger bestreiten wollen. Auch entspringen manche Vorzüge des Schumannschen Liedes nicht etwa einer – in diesen Punkten wenigstens überlegenen Begabung, als[S. 47] vielmehr äußeren, zufälligen Umständen. Nirgends erwachte z. B. der Sinn für Sprachreinheit und Sprachrichtigkeit so spät wie in Österreich. Nicht lange vor Mozarts Tode gestand der österreichische Dichter Alxinger, daß er mit eiserner Geduld fast jedes Wort in einem Lexikon nachschlagen müsse, ehe er es niederzuschreiben wage und bewunderungswürdig erscheinen unter solchen Verhältnissen die so häufigen Offenbarungen feineren Sprachgefühls bei ungebildeten Musikern wie Mozart oder Schubert. Man darf nicht zweifeln, daß diese Meister, durch irgend einen Zufall in frühester Kindheit aus der Heimat etwa nach Sachsen verschlagen und daselbst an einem Gymnasium erzogen, den Neueren an sorgfältiger Beachtung des Sprachaccentes und an packender Wahrheit des Ausdrucks keineswegs nachstehen würden und ähnlich verhält es sich mit der Wahl der Gedichte. Schubert mußte noch komponieren, was ihm gerade zu Händen kam; Schumann hingegen vermochte, dank seinen ausgebreiteten litterarischen Kenntnissen frei aus dem unerschöpflichen Born deutscher Lyrik zu wählen, was ihm der Komposition würdig und fähig schien. „Weshalb nach mittelmäßigen Gedichten greifen, was sich dann immer an der Musik rächen muß? Einen Kranz von Musik um ein wahres Dichterhaupt schlingen – nichts Schöneres. Aber ihn an ein Alltagsgesicht verschwenden, wozu die Mühe?“ Am häufigsten hat Schumann Rückert und Heine komponiert, welche durch mehr als vierzig Stücke vertreten sind; dann folgen Goethe (24), Eichendorff (22), Burns (19), Justinus Kerner (17), A. v. Chamisso (14), E. Geibel, Elisabeth Kulmann, Hoffmann von Fallersleben (11), Uhland, Robert Reinick (10), Nikolaus Lenau, Möricke (9), Lord Byron (6), Friedrich Hebbel, Andersen (5). Vereinzelt erscheinen Moore, Mosen, Platen, Zedtlitz, Schiller, Halm, Anastasius Grün, Klopstock, Shakespeare, Immermann u. a. Das ergiebt, wenn noch einige Texte altdeutscher oder spanischer Herkunft mit eingerechnet werden, an dreihundert Gesangsstücke, von welchen die Hälfte[S. 48] allein auf das Jahr 1840 fällt; vier Hefte mehrstimmiger Gesänge (op. 29, 33, 34, 43) und die doppelte Anzahl mit Sololiedern, nämlich: Liederkreis von Heine (op. 24), Myrthen (op. 25).[3] Zwölf Gedichte von Justinus Kerner (op. 35). Sechs Gedichte von Robert Reinick (op. 36). Liederkreis von Eichendorff (op. 39). Frauenliebe und Leben von Chamisso (op. 42). Zwölf Gedichte aus Rückerts Liebesfrühling (op. 37). Fünf Lieder (Andersen zugeeignet, op. 40) und Dichterliebe von Heine (op. 48). Das ist viel, sehr viel und reicht doch nicht heran an Schuberts erstaunliche Fruchtbarkeit, zumal, wenn man die kurze Lebenszeit dieses Meisters mit in Betracht zieht.
Schon die obigen Daten lassen erkennen, daß Schumanns Lied auf der romantischen Lyrik beruht, während Schubert sich, wie man weiß, von Goethes Muse angezogen fühlte. Zwar hat Schumann auch und öfter Goethesche Gedichte in Musik gesetzt, doch bezeichnenderweise meist solche aus dem Divan (Myrthen) und Wilhelm Meister (op. 98), die eine Neigung zur Romantik zeigen. Übrigens gehören sie nicht zu seinen vorzüglichsten Leistungen, vielmehr wird uns die ganze Innigkeit seines Herzens gerade bei der Komposition jüngerer Liederblüten enthüllt. Ein Übel freilich haftet diesen modernen „Vertonungen“ immer an. Gedichte, die fast kaum für den laut gesprochenen Vortrag, sondern bloß für die stumme Lektüre bestimmt sind, werden in einer Weise in Musik gesetzt, daß sie, gesungen, dem eigenen Dichter als etwas ihm Wildfremdes vorkommen müssen. Bei einem Gedichte, welches als Litteraturgedicht bereits vollkommen der Absicht des Poeten genügte und somit eine musikalische Ausführung gar nicht aus sich bedang, kann die musikalische Komposition natürlich auch bloß wiederum ein besonderes[S. 49] Gedicht des Musikers sein, das mit dem Wortgedichte einen oft ganz willkürlichen oder nur allgemeinen Gefühlszusammenhang hat. (Wagner.) Die Fälle, in denen es thatsächlich zur vollen Übereinstimmung zwischen Text und Komposition kommt, sind ziemlich selten, sogar bei den Meistern dieser Kunstform. Auch Schumann gelang sie nur einigemale, am schönsten wohl in dem herrlichen Cyklus „Frauenliebe und Leben“; sonst, z. B. bei den – im übrigen entzückend gesetzten – Eichendorffschen Liedern, kann er bloß einzelnen hervorstechenden Eigentümlichkeiten, dem Verschwimmenden, in Duft sich Auflösenden gerecht werden, indessen manch feiner Zug dieser Poesien verloren geht. Wieder anders verhält es sich mit Fr. Rückert. Seine Verse gewinnen im Schlepptau einer schönen Melodie („Du meine Seele, du mein Herz“), welche über die häufigen trivialen Wendungen hinwegtäuscht; bei sorgfältiger Deklamation aber treten die Mängel seiner bunt schillernden, stimmungsarmen Lieder deutlich zu Tage. Bei Kerner, Burns, Reinick trifft Schumann sehr glücklich den Volkston (Wohlauf noch getrunken, Erstes Grün; – Das Hochlandsmädchen, Mich zieht es nach dem Dörfchen hin; – O Sonnenschein, Ständchen), oft aber sucht er, wie insbesondere bei Reinick, diese anspruchslosen Gedichte tiefer aufzufassen, wodurch ein fühlbares Mißverhältnis zwischen dem naiven Text und der reflektierenden musikalischen Wiedergabe entstanden ist.
Mit Heinrich Heine hat’s eine eigene Bewandtnis. Sangen einst die Romantiker gern von wandernden Musikanten, die mit lustigem Spiel alles Volk zu Tanz und Freude bewegen, während schneidendes Weh in ihrem Herzen haust, so macht sich der ungezogene Liebling der Grazien den Spaß, das ganze Verhältnis einfach umzukehren. Er thut, als sei er unsagbar traurig, an Leib und Seele elend aus Liebesgram, bis dem vertrauensseligen Leser die Thränen der Rührung über die Backen laufen, indessen der Schalk sein heimlich Gaudium hat. Unter der ungeheueren Schar[S. 50] der Angeführten sieht man neben sehr vielen Ästhetikprofessoren und Litteraturhistorikern auch unsere harmlosen Liederkomponisten der Reihe nach figurieren. Sie merkten den Ulk nur stellenweise, da wo Heine selbst den täuschenden Schleier mit einem plötzlichen Witze zerschleißt: daß ja die ganze Dichtung ein genial durchgeführter Witz sei, ist keinem aufgegangen. Damit soll der Wert z. B. der Schumannschen Heinelieder nicht geschmälert sein, sondern bloß dem verbreiteten Irrtum begegnet werden, als habe Schumann den Geist der Heineschen Lyrik mit großer Treue bewahrt. Das ist ganz unmöglich, denn die Musik, die wahrste von allen Künsten, wäre gar nicht imstande, ironische Stimmungen auszudrücken. Unser Meister nahm also diese Lügenpoesie gläubig hin als das, was sie schien, strebte ihren (absichtlich) übertriebenen Klagen durch Erschöpfung des musikalischen Ausdrucksvermögens zu entsprechen, so daß sie schließlich gar, gleichsam wiedergeboren aus dem Schoße der Tonkunst, als echte und edle Gebilde jedes Herz bezaubern und entzücken.
Mit der Verschiedenheit der Texte hängt es auch zusammen, daß dem Klavierpart bei Schumann eine viel bedeutendere Rolle zugeteilt ist, als bei Schubert. Die pointenreiche, komplizierte, moderne Lyrik läßt sich in all ihren feinen Details durch die Singstimme gar nicht erschöpfen; hier tritt unterstützend und ergänzend der Klavierpart hinzu und verschmilzt mit der Gesangsmelodie, welche ohne ihn oft gar nicht als Melodie verstanden werden könnte, zu einem unauflöslichen Ganzen. Bald weckt er vor dem Eintritt des Gesanges im Hörer die erwünschte Stimmung, bald spinnt er die, in den letzten Worten des Gedichtes angeregten Gedanken weiter fort, nicht selten führt er sogar die Gesangsmelodie, die manchmal gar nicht über dem Dreiklang der Tonart endigt und gleichsam abgebrochen scheint, erst zum befriedigenden Abschluß. In diesen Nachspielen liegt nicht zum mindesten die Schönheit Schumannscher Lieder. Wie sinnig schlägt er, um nur ein berühmt gewordenes[S. 51] Beispiel anzuführen, am Ende des Cyklus „Frauenliebe und Leben“, die Töne des ersten Liedes „Seit ich ihn gesehen“, wieder an, als verliere sich die Witwe in Erinnerung an ihr zerronnenes Liebesglück!
Daß die reich ausgestattete Klavierbegleitung die Singstimme beeinträchtigt, ist ein nur teilweise berechtigter Vorwurf. Es ist wahr, scharfgezeichnete melodische Linien finden sich bei ihm nicht so häufig wie z. B. bei Schubert. Soll eine traumhaft schwankende Empfindung dargestellt werden, so kommt der Gesang über einzelne Melodienknospen, deren volles Erblühen man vergebens erwartet, nicht hinaus, er bleibt zuweilen bloß musikalische Deklamation, und die Begleitung wird die eigentliche Trägerin des poetischen Gedankens. Anderseits aber weiß Schumann, wo die Singstimme den einfachen Gehalt eines Liedes erschöpfen kann, mit der Begleitung auch zu sparen und sich mit wenigen charakteristischen Accorden zu begnügen. Wenn er den Sänger oft in unbequeme Lagen, zu weiten Sprüngen und dergleichen zwingt, so muß man das seinem Streben nach möglichst prägnantem Ausdruck schon zu gute halten. Ein Kunstwerk ist eben keine Schuletüde, es fordert vom Ausführenden gesteigerte, nicht bloß gewohnhafte Bethätigung des erworbenen Könnens. Sehr richtig bemerkt da Ehlert,[4] daß es sich nicht darum handle, „für die Stimme möglichst bequem zu schreiben, sondern darum, eine poetische Empfindung musikalisch auszudrücken, natürlich nur so weit, als dies ohne offene Verletzung der gesanglichen Rücksichten möglich ist...“ Wer beim Komponieren eines Liedes ans Atemholen denkt, der kann alles sein, nur kein Poet. Das Schumannsche Lied nimmt eine ganz besondere Stellung ein. Die Vertiefung in den poetischen Lokalton des Gedichtes durch Schubert schon in hohem Maße ausgebildet, wird von[S. 52] ihm bis zur erstaunlichen Gewißheit des Selbsterlebten geführt. Wie wenig Mittel oft dazu gehören, ersehe man aus „In der Fremde“ (op. 39, Nr. 1), wo die scheinbar einfachste, accordliche Bewegung die „schöne Waldeinsamkeit,“ in der den Sänger „keiner mehr kennt,“ mit bebender Handgreiflichkeit zeichnet, oder aus der „Mondnacht“ (ebenda Nr. 5), wo wenige Stimmen der Begleitung das „es war als hätte der Himmel die Erde still geküßt“, so – ich kann nur wiederholen – erlebt malen, daß jeder es fühlt, hier spannt ein Dichter im Mondlicht und Blütenschimmer „weit seine Flügel aus.“ Namentlich alles Träumerische, Weiche, Verschämte hat niemals durch einen anderen Musiker einen treffenderen Ausdruck erfahren. Nie vielleicht wohnte in einem Manne so viel dichterisches Erröten über die Rätsel seiner Bestimmung wie in ihm. Sein eigentlicher Ausdruck in dieser Liederzeit war das Jünglingshafte mit seinem dunkelscheuen Kraftgefühl, seinem morgenrötlichen Schimmer und seiner Frühlingsschwermut.
Es erübrigt nur noch zu erwähnen, daß sich Schumann 1840 auch in der Ballade versuchte und darin mit ihrem unübertrefflichen Meister, Carl Löwe,[5] nicht unrühmlich um den Preis rang. Belsazar von Heine (op. 57), je drei balladenmäßige Gesänge von Geibel und Chamisso (op. 30 der Hidalgo, op. 31 die Löwenbraut, op. 32 die Kartenlegerin) und drei Hefte Balladen und Romanzen (op. 45, 49 die beiden Grenadiere), die feindlichen Brüder; (op. 53 der arme Peter), denen später noch ein viertes (op. 64 Tragödie) folgte, stammen noch aus dem Liederjahr; op. 87, der Handschuh von Schiller, aus 1849. Doch[S. 53] liegt die Bedeutung Schumanns als Vokalkomponist nicht gerade in diesen, wenn auch wertvollen Werken, sondern vor allem in seinen Liedern, welche bei ihrem Erscheinen freilich mißachtet und verkannt worden sind. Um so mehr freute Schumann das Dankgedicht Friedrich Rückerts für die Komposition des „Liebesfrühlings“, an welcher auch Klara mit drei Liedern (2, 4, 11) beteiligt war. Es lautet:
An Robert und Klara Schumann.
Heutzutage ist ganz Deutschland über den Wert der Schumannschen Lieder, dieser echten Kinder des Frühlings und des Glückes einig geworden und schätzt sie als Perlen musikalischer Lyrik, von welchen ihr Schöpfer mit Recht behaupten durfte: „Ich getraue mir nicht mehr leisten zu können und bin auch zufrieden damit.“ Jawohl, zufrieden!
[3] Enthält Gedichte verschiedener Poeten: Byron, Moore, Burns, Rückert, Heine, Mosen und Goethe.
[4] Aus der Tonwelt. (Essays, Berlin 1882, 2. Aufl.) R. Schumann und seine Schule, S. 221 ff.
[5] Von Schumanns Wertschätzung Löwes giebt die folgende Stelle aus einem Aufsatz im Leipziger Tageblatt (1835) ein schönes Zeugnis: „Sollten wir irgend einen lebenden Komponisten anführen, der vom Beginne seiner künstlerischen Laufbahn bis zum jetzigen Augenblicke deutschen Geist und deutsches Gemüt beurkundet und es im Zartesten wie im Wildesten, in der Sprache der ersten Liebe, wie im Ausbruche des tiefsten Zornes ausgesprochen hätte, so müßten wir Löwe nennen.“
Wir sahen, wie der bittere Kampf um Klara die herrlichen Kräfte des Schumannschen Genius zur Entfaltung brachte; jetzt betrachten wir auch die Wunden, die er davontrug, Wunden, die nie wieder verharschten, aus denen langsam sein edelstes Herzblut verrann, bis die Nacht des Todes den völlig Erschöpften in ihre Arme schloß und von qualvollem Siechtum erlöste. Zu diesem Behufe muß aber noch einmal auf jene Zeit des Ringens zurückgegangen werden.
Seit der zweiten Werbung um seine Tochter hatte Vater Wieck einen tiefen Ingrimm gegen den aufdringlichen Schwiegersohn gefaßt und keine Gelegenheit versäumt, Robert, insbesondere aber dessen künstlerisches Schaffen, herabzusetzen und diese Äußerungen kamen dem Betroffenen alle zu Ohren. Er schalt ihn phlegmatisch („Fismollsonate und phlegmatisch! Liebe zu einem solchen Mädchen und phlegmatisch!“ bemerkt Schumann dazu), spottete, daß seine Kompositionen niemand kaufe und fragte höhnisch, wo denn sein Freischütz und sein Don Juan wären? Solche Reden stachelten in Robert den vom Vater überkommenen Ehrgeiz auf. „Mir ist immer,“ schreibt er (1840), „als hätte ich doch, z. B. gegen Mendelssohn noch nicht genug auf der Welt geleistet und das drängt und peinigt mich manchmal.“ (Vgl. damit S. 37.)[S. 55] Auch der Einfluß seines Zeitalters, des jungen Europa, dessen Geistesprodukte insgesamt mehr dem Streben nach öffentlicher Auszeichnung als wahrem Schaffensdrang ihr Entstehen verdanken, darf nicht unterschätzt werden. Dazu kam jetzt gar seine Stellung als Gatte, später auch als Vater, so daß eine Reihe von Umständen zusammentraf, die Schumann veranlaßten, das Feld seiner künstlerischen Thätigkeit zu erweitern. „Sonst“, lautet charakteristisch genug sein Bekenntnis, „galt mir gleich, ob man sich um mich bekümmere oder nicht. Hat man Frau und Kinder, so wird das ganz anders. Man muß ja an die Zukunft denken, man will auch die Früchte seiner Arbeit sehen, nicht die künstlerischen, sondern die prosaischen, die zum Leben gehören und diese bringt und vermehrt nur der größere Ruf.“ „Wenden Sie sich,“ rät er Koßmaly, „ganz zur größeren Orchestermusik, das macht Namen und flößt den Verlegern Respekt ein. Schreiben Sie größere Stücke: Symphonien, Opern. Mit Kleinem ist schwer durchdringen.“
Gerade in diesem „Kleinen“ aber war Schumann groß. Er war Genremaler in der Musik, wie sein geliebter Jean Paul es in der Poesie gewesen. In knappen Formen, auf engem Raume Vieles und Bedeutendes zu sagen, darin bestand seine eigentümliche Meisterschaft. Doch das schien ihm jetzt allzu gering: der Gatte der ruhmbedeckten Klara mußte „Größeres“ zu Werke bringen! Hatte er einst mit einem Citat aus Wilhelm Meister die deutschen Künstler gewarnt, das Bette ihres Talentes nicht zu überschreiten, so verkündete er jetzt mit lauter Stimme: das unterscheide eben die deutschen Musiker von Italienern und Franzosen, das habe sie groß gemacht, daß sie in allen Gattungen sich versuchten. „Wenn wir daher,“ fährt er fort, „einige Pariser Opernkomponisten große Künstler genannt finden, so möchten wir erst fragen: wo sind denn eure Symphonien, eure Quartette, eure Psalmen u. s. w.?“ In dieser Meinung begann er denn auch alle möglichen Gattungen zu kultivieren,[S. 56] Symphonien, Quartette, Oratorien, Opern u. s. w. – all einerlei.
Daß ihm der erste Versuch das Feld seiner Künstlerschaft zu verlassen, die Liederkomposition, so überraschend gelungen war, trug wohl dazu bei, Schumann über den Umfang seiner Begabung zu täuschen. Allein in Wirklichkeit hatte er mit diesem ersten Versuche die ihm gesteckten Grenzen noch gar nicht überschritten. Schumann war eine eminent lyrische Natur, das wird gerade an seinen Liedern klar, in denen er vor allem die entsprechende Stimmung wiedergiebt, während Schubert mehr auf dramatischen Aufbau bedacht ist. In früherer Zeit hatte er das selbst wohl eingesehen; jetzt lenkte er, vom Ehrenwahn geblendet, ab von dem lauschigen Waldpfad, auf den die Natur ihn gewiesen, zur sonnigen, breiten, symphonischen Heerstraße.
Nun wär’s von vornherein nicht anzunehmen, daß ein bedeutender Geist, auch wenn er sich auf einem seiner natürlichen Anlage fern liegenden Gebiete hervorthun will, bloß Unbedeutendes producieren werde. Allein bald mehr, bald minder bemerkt man doch die Forcierung des Talentes, welche da und dort zu schwülstigen Übertreibungen führen muß, während wieder viele Stellen hinter den Anforderungen der betreffenden Kunstform zurückbleiben. Die nächste Folge davon ist Ungleichheit des Werkes; neben Partien von großem Kunstwert stehen dann unmittelbar solche, die sich aus tändelnden, unebenbürtigen Themen zusammensetzen, was die richtige Beurteilung des Ganzen überaus erschwert. Wo aber können wir das deutlicher wahrnehmen als an Schumanns Symphonien, mit denen er 1841 die zweite Periode seines Schaffens eröffnet hat?
Die große „Frühlingssymphonie“ (B-Dur, op. 38) entstand unter dem Eindrucke eines Böttgerschen Gedichtes[6][S. 57] in wenigen Tagen. Schumann war damals im Vollbesitze seiner schöpferischen Kraft und, wie im ersten Anlauf vieles gelingt, so ist gleich der erste Satz gar herrlich ausgefallen: ein blühendes Tonstück, welches den Gedanken „Im Thale geht der Frühling auf“ illustriert. „Gleich den ersten Trompeteneinsatz“, schreibt Schumann darüber, „möcht’ ich, daß er wie aus der Höhe klänge, wie ein Ruf zum Erwachen – in das Folgende könnte ich dann hineinlegen, wie es überall zu grüneln anfängt, wohl gar ein Schmetterling aufsteigt, wie nach und nach alles zusammenkommt, was zum Frühling etwa gehört.“ Geringeres Interesse erregt die bald darauf verfaßte Orchestersuite: Ouvertüre, Scherzo, Finale (op. 52) und auch die zweite Symphonie D-moll (erschienen 1853 als op. Nr. IV, op. 120) steht trotz mancher Schönheiten im einzelnen nicht so hoch, ist aber bei weitem einheitlicher gestaltet. Im Vergleich zu den früheren Kompositionen fällt namentlich die formale Rundung, die besonnene Zügelung der Phantasie auf, welche wir sicherlich seiner Rivalität mit Mendelssohn zuzuschreiben haben; denn Mendelssohn übte auf seinen Freund eine seltsame, magische Anziehung aus, der die grundverschiedene Individualität desselben nur mühsam widerstand; wie denn Schumann in Momenten, wo ihn die eigene schöpferische Kraft verläßt, fast immer in Mendelssohnsche Phrasen zu verfallen pflegt. Die Schnelligkeit, mit welcher er den ihm fremden Orchestersatz bewältigen lernte, verdient übrigens rückhaltlose Bewunderung; volle Meisterschaft darin zu er[S. 58]werben, blieb ihm freilich versagt, ja, man merkt diesen Symphonien an, daß sie am Klaviere ersonnen und erst nachträglich instrumentiert worden sind.
Im folgenden Jahre (1842) warf sich Schumann ganz ausschließlich auf die Kammermusik, offenbar durch die in seinem Hause häufig stattfindenden Quartettmatineen veranlaßt. Die Chancen waren für ihn hier zum Teile minder günstig, insofern als dieses Genre noch innigere Vertrautheit mit dem Charakter der einzelnen Instrumente erfordert. Zum Teile freilich wieder besser: denn während die für den öffentlichen Konzertsaal berechnete, in großen Zügen zu entwerfende Symphonie seiner nach innen gekehrten Natur nicht entsprach, war ihm der Kammermusikstil, welcher feinere Ausführung in den Details und kontemplatives Einspinnen in gewisse Figuren verträgt, weitaus homogener. Man sehe nur seine Streichquartette (op. 41) an, besonders das dritte in A-Dur. Kann er gar auch das Klavier zur Mitwirkung herbeiziehen, so entstehen so prachtvolle Werke wie das Klavierquintett (op. 44), das wohl das hervorragendste seiner Gattung seit Beethoven genannt werden darf. Welche kontrapunktistische Kunst steckt in dem Schlußsatz! Von einer Klavierbegleitung kann eigentlich keine Rede sein, denn das Klavier wird ebenso wie die Viola von Schumann stets konzertierend behandelt. An Kunstwert kommt dieser Schöpfung das Klavierquartett (op. 47) sehr nahe: ein Trio, betitelt Phantasiestücke für Pianoforte, Violine und Violoncell (op. 88) ist minder bedeutend; seine schönsten Trios (D-moll und F-dur) schrieb Schumann erst vier Jahre später.
Schon im nächsten Winter sehen wir den unermüdlichen Meister auf wieder anderem Gebiete thätig. Nachdem er mit einem melodiösen Andante und Variationen für zwei Klaviere (op. 46) längst verlassene Bahnen für ein Weilchen neuerdings betreten, unternimmt er die Komposition eines groß angelegten Chorwerkes (op. 50), welchem[S. 59] Moores Poem „Das Paradies und die Peri“ zu Grunde liegt. Die deutsche Bearbeitung rührt von Schumanns Jugendfreund Flechsig her, einzelne Stücke, und zwar den Chor der Nilgenien, der Houris, das Quartett „Peri, ist’s wahr“, das Solo „Verstoßen“, „Gesunken war der goldne Ball“ sowie den Schlußchor dichtete er selbst hinzu. Dann ging es mit heller Begeisterung an die Komposition des hochpoetischen Werkes, dessen Inhalt im Folgenden kurz skizziert sei: Eine Peri – mit diesem Namen belegt der orientalische Mythus feenartige, eines Vergehens halber aus der Oberwelt verstoßene Luftgeister – eine solche Peri sehnt sich heiß nach ihrer seligen Heimat zurück; und, da sie trauernd am Eingang des Paradieses steht, wird ihr durch Engelsmund in rätselhaften Worten Rückkehr verheißen, wenn sie „des Himmels liebste Gabe“ zu den heiligen Pforten bringe. Jene zu suchen, durchwandert sie Indiens Blumenhügel und die Wüsten des Nillandes, aber weder die letzten Blutstropfen eines im heldenmütigen Kampfe gegen den Unterdrücker gefallenen Jünglings, noch der letzte Seufzer einer Braut, die zu ihrem von der Pest ergriffenen Geliebten herbeigeeilt, treu an seiner Seite stirbt, vermögen der Peri Entsühnung zu erwirken. Zum drittenmale schwebt sie auf neue Suche hernieder, diesmal über Syriens Fluren. Es ist Abend. Ein Kind spielt harmlos unter Blumen, während unweit davon ein alter Räuber sein Pferd am Brunnen tränkt. Vom Minaret ertönt der Vesperruf der Muezzin und andächtig faltet das Kind die Händchen zum Gebete. Das sieht der wilde Reitersmann. Die Erinnerung an die eigene unschuldsvolle Kinderzeit übermannt ihn – er weint. Seine Reuethränen aber trägt die Peri empor und – die Pforte des Paradieses springt auf. Nicht was Menschen für das höchste Opfer halten, die Hingabe des Lebens, dem Vaterlande oder der Liebe dargebracht, gilt also auch dem Himmel als die wertvollste Gabe: die Thräne des reuigen Sünders, die Erneuerung des eigenen Ich ist das[S. 60] Höchste und Größte in den Augen des Ewigen. Und das Finden dieser Thräne, d. h. die Erkenntnis jener Wahrheit öffnet der Peri den Himmel. Dies ist die durchaus christliche Idee der allegorischen Dichtung, die sich, zumal ihr das farbenprächtige, morgenländische Gewand einen bestrickenden Zauber giebt, für die musikalische Darstellung, wie kaum eine andere, dankbar erweist. (Reimann.) Schumanns Kunst feiert denn auch an diesem Stoffe wahre Triumphe und selbst wer das fatale Genre („Weltliches Oratorium“) zu verdammen geneigt ist, muß die außerordentlichen lyrischen Schönheiten, die einander in langer Kette folgen, anerkennen. Schade nur, daß die einzelnen Stücke, namentlich im letzten Drittel, zu wenig kontrastieren, wodurch der Hörer bei der Ausführung schließlich ermüdet wird. Schumann selber schreibt, eine innere Stimme habe ihm während der Komposition zugerufen: dies ist nicht vergeblich, was du thust.
Sein äußeres Leben verlief inzwischen ziemlich einförmig; nur in die Zeit der „Peri“ fallen zwei erwähnenswerte Ereignisse. Im April 1843 wurde er nämlich durch Mendelssohn an das neugegründete Leipziger Konservatorium als Lehrer der Komposition berufen und bald darauf fand auch eine Versöhnung mit dem Schwiegervater Wieck statt, welche ihm um Klaras willen lieb sein mußte. Seine Lehrthätigkeit ist ohne sonderliche Erfolge geblieben, dazu fehlte ihm vor allem die nötige Beredsamkeit. Gewöhnlich setzte er sich mit der Arbeit eines Schülers an den Flügel, las sie, und wenn ihm etwas mißfiel, so griff er es auf dem Klaviere, wobei er jenen nur mit einem mißbilligenden Blicke ansah. Der positive Gewinn, den man aus seinen spärlichen Bemerkungen davontrug, war gering. In jenen Kämpfen um Klara hatte nicht nur sein künstlerisches Streben eine andere Richtung genommen, auch mit seinem äußeren Wesen war eine große Veränderung vor sich gegangen. Er mied je länger, je mehr größere Gesellschaft und zeigte sich selbst im Verkehr mit seinen besten Freunden wortkarg. Henriette Voigt er[S. 61]zählt, daß sie manchmal mit ihm an schönen Sommerabenden eine Wasserfahrt gemacht habe. Da wären sie denn eine Stunde schweigend nebeneinander im Kahn gesessen. Bei der Trennung aber habe ihr Schumann die Hand gedrückt und nur gesagt: „Heute haben wir uns recht verstanden.“ Etwas Ähnliches weiß Brendel zu berichten: „Schumann hatte einen vorzüglichen Markobrunner in Gohlis entdeckt und forderte mich auf, ihn dorthin zu begleiten. In glühender Hitze pilgerten wir selbander, ohne ein Wort zu sprechen, durch das Rosenthal, und draußen angekommen, war diesmal in der That der Markobrunner die Hauptsache. Es war kein Wort aus ihm herauszubringen und so ging es auch auf dem Rückwege. Nur eine Bemerkung machte er, die mir zugleich einen Blick in das gestattete, was ihn erfüllte. Er sprach über die eigentümliche Schönheit eines solchen Sommermittags, wo alle Stimmen schweigen, vollkommene Ruhe in der Natur herrscht. Er war versunken in diesen Eindruck und bemerkte bloß, daß die Alten ihn mit dem Ausdruck „Pan schläft“ treffend bezeichnet hätten. In solchen Momenten nahm Schumann nur insoweit Notiz von der Außenwelt, als sie zufällig in seine Träume hineinspielte. Gesellschaft war für ihn dann nur da, um ihn des Gefühls des Alleinseins zu entheben.“
Zu Anfang des Jahres 1844 begleitete Robert seine Frau auf einer Konzertreise nach Rußland, welche er ihr schon vor der Hochzeit hatte versprechen müssen. Überall, in Mitau, Riga, Petersburg, Moskau, ward die Künstlerin enthusiastisch aufgenommen und auch ihr Gatte erwarb seiner Musik zahlreiche Freunde, z. B. die Grafen Wielhorsky, in deren Palais seine B-Dursymphonie und seine Quartette zur Aufführung kamen. Nach den Anstrengungen der letzten Zeit mußte die Arbeitspause und der Wechsel der Umgebung höchst wohlthätig auf ihn einwirken; allein kaum zurückgekehrt, machte er sich schon wieder an einen grandiosen Plan, die Komposition des Goetheschen Faust und schrieb[S. 62] mit Aufgebot aller Kraft den größeren Teil der gewaltigen Schlußscene: dann erfolgte – im Herbste – naturgemäß der Rückschlag. Ein nervöses Leiden stellte sich ein, finstere Dämonen beherrschten ihn, so daß der Arzt auf das dringendste Enthaltung von jeder geistigen Arbeit und Verlassen des musikalisch allzu bewegten Leipzig anriet. Schumann übersiedelte nach Dresden, anfangs mit der Absicht, daselbst nur für kurze Zeit zu verweilen; doch entschloß er sich später, diese Stadt zum dauernden Aufenthaltsorte zu erwählen. Die Redaktion der Zeitschrift, welche er seit seiner Verheiratung als drückende Last empfunden, hatte er schon vom 1. Juli des Jahres an seinen Freund und langjährigen Mitarbeiter Oswald Lorenz abgegeben; später, im Januar 1845, verkaufte er sie an Franz Brendel. „Ich habe was in meinen Kräften stand gethan, die besten Talente meiner Zeit zu fördern,“ sagte er zu ihm bei der Übergabe. „Fahren Sie darin fort!“ Wirklich ist die „Neue Zeitschrift“ stets eine eifrige Verfechterin des Kunstfortschrittes geblieben und hat namentlich zur richtigen Würdigung der „neudeutschen Schule“ sehr viel beigetragen.
Allmählich besserte sich der leidende Zustand des Meisters. Im nächsten Frühling war er glücklicherweise so weit hergestellt, daß er wieder an musikalische Thätigkeit denken durfte, wobei er sich zur Vorsicht einstweilen auf kontrapunktistische Studien beschränkte, weil dieselben mehr den Verstand als seine überreizte Phantasie in Anspruch nahmen. So entstanden damals die Studien und Skizzen für den Pedalflügel (op. 56, 58). Vier Fugen für das Pianoforte (op. 72) und sechs Orgelfugen über den Namen Bach (op. 60), wahre Prunkstücke kontrapunktistischer Kunst, schöne Früchte seiner täglichen Beschäftigung mit den Werken des großen Thomaskantors, welcher er seit jenem, so bald abgebrochenen Unterrichtskursus bei Dorn immer eifriger obgelegen. „Bachen ist nach meiner Überzeugung überhaupt nicht beizukommen; er ist inkommensurabel,[S. 63]“ schreibt er einmal einem Freunde und gesteht, daß ihn die armseligen, musikalischen Erzeugnisse um ihn her förmlich misanthropisch machen. „Da rette ich mich immer in Bach und das giebt wieder Lust und Kraft zum Wirken und Leben.“
Darnach wandte sich sein neubelebter Mut wieder den freieren Kunstformen zu. Das hochbedeutende Klavierkonzert A-moll (op. 54) wurde vollendet und eine dritte Symphonie C-Dur (op. 61) in Angriff genommen. Die Gesellschaft einiger Freunde (Ferdinand Hiller, Auerbach, Bendemann, Reinick, Rietschel, Hübner), welche sich zweimal wöchentlich im „alten Postgebäude“ beim Biertisch zu versammeln pflegte, suchte er jetzt häufiger auf. Daß sich zu dem Komponisten des Tannhäuser, der dort ebenfalls verkehrte und dessen Ruf ganz Dresden erfüllte, kein näheres Verhältnis herausgebildet hat, wird man bei der Verschiedenheit der Charaktere begreiflich finden. „Schumann ist ein hochbegabter Musiker,“ erzählt Wagner, „aber ein unmöglicher Mensch. Als ich von Paris kam, besuchte ich ihn, sprach von den französischen Musikzuständen, dann von den deutschen, sprach von Litteratur und Politik – er aber blieb so gut wie stumm, fast eine Stunde lang. Ja, man kann doch nicht immer allein reden! Ein unmöglicher Mensch!“ Schumanns Urteil hingegen lautete, Wagner sei zwar sehr unterrichtet und geistreich (– „ein geistreicher Kerl voll toller Einfälle“ –), rede aber unaufhörlich und das könne man doch auf die Länge nicht aushalten.
Über den „Tannhäuser“ selbst äußerte sich Schumann nach der Durchsicht der ihm von Wagner geschenkten Partitur gegen Mendelssohn ziemlich wegwerfend: um kein Haar breit besser als Rienzi, eher matter, forcierter. Allein schon ein paar Wochen später erklärt er, manches zurücknehmen zu müssen, denn „von der Bühne herab sieht sich alles ganz anders an. Ich bin von vielem ganz ergriffen gewesen... Tannhäuser enthält Tiefes, Originelles, überhaupt hundert[S. 64]mal Besseres als seine früheren Opern. In Summa, er kann der Bühne von großer Bedeutung werden. Das Technische, die Instrumentierung finde ich ausgezeichnet, ohne Vergleich meisterhafter gegen früher.“ Solch anerkennende Beurteilung ist Wagner damals noch selten zu teil geworden.
Im Jahre 1846 weist das Schumannsche Kompositionsverzeichnis bloß mehrere Chorlieder: op. 55 Fünf Lieder von Burns, op. 59 Vier Gesänge von Lappe, Platen, Möricke, Rückert und die Vollendung der C-Dursymphonie auf. Die Kritik pflegt diesem Werke, in welchem er seine musikalische Kraft zum Grandiosen, Beethoven-Gleichen zu steigern rang, den Preis vor den übrigen Symphonien zuzusprechen, in theoretischer Hinsicht, was die kunstvolle Durchführung und Kombination der Themen anbelangt, gewiß mit Recht. Es bedeutet ohne Zweifel den Höhepunkt seiner Künstlerlaufbahn, aber keineswegs seine vorzüglichste Leistung. Man fühlt, daß es nicht dem „innersten Lebensdrange“ entspringt und erst im Adagio kommt der echte Schumann, der Lyriker voll zur Geltung und erhebt seinen wunderbarsten Gesang. Allein, ob auch der Meister seine Kraft auf das Äußerste anspannte und aufrieb – der ersehnte Ruhm blieb immer noch aus. In Dresden freilich hatte er sich über Mangel an Anerkennung nicht zu beklagen und wenn er nach Leipzig zu Besuch kam, was ab und zu geschah, war ihm die enthusiastischste Aufnahme gewiß. Auch die Verleger machten keine Schwierigkeiten. Überall sonst aber kannte ihn die große Menge bloß als den Mann der Klara Wieck, so wenig Schumann das zugeben wollte. Als einmal ein alter Freund bemerkte, daß Klara sehr viel dazu beigetragen habe, ihm den Weg als Tonsetzer zu erleichtern, sprang er höchst beleidigt auf und lief davon. Wie schmerzlich mußte ihn da der offenbare Mißerfolg mehrerer seiner schönsten Kompositionen auf der 1847 unternommenen Konzerttour nach Wien berühren. Sie wurden am 1. Jänner im Musikvereinssaal mit achtungsvollem Still[S. 65]schweigen aufgenommen; die Achtung galt seiner – Frau. Die wenigen Anhänger zitterten vor einer möglichen Wiederholung des Vorfalls bei einem auswärtigen Hofkonzert, wo Serenissimus nach vielen Artigkeiten für Klara unseren Meister huldreichst fragte: „Sind Sie auch musikalisch?“ Im Künstlerverein „Konkordia“ traf Schumann den zufälligerweise gleichfalls anwesenden Meyerbeer an; aber beide Männer wichen einander vorsichtig aus. (Hanslick.) Zum Abschied gab das Schumannsche Ehepaar eine glänzende Soiree, bei welcher alle Wiener Celebritäten: Bauernfeld, Eichendorff, Stifter, Deinhardstein und last not least – Grillparzer erschienen waren. Der Letztere, ein warmer Bewunderer der Künstlerin Klara, hatte diese schon 1838 in einem schönen Gedichte besungen; von ihrem Gatten als Komponisten Notiz zu nehmen, fiel ihm damals eingestandenermaßen nicht ein. So stand es um Schumanns Ruhm am Donaustrande. Besser fielen die beiden Konzerte in Prag aus,[7] wo Ambros, ein begeisterter Verehrer des Meisters in der „Bohemia“ unter dem Davidsbündlernamen Flamin wirksame Propaganda gemacht hatte und auch in Berlin, wo „Paradies und Peri“ unter des Autors Direktion – recht elend, nebenbei bemerkt – zur Aufführung kam. Im Juli endlich besuchte Schumann auch seine Vaterstadt, die ihren größten Sohn auf jede mögliche Weise, durch Fackelzug, Ständchen u. s. w. ehrte. Die Reisen und Zerstreuungen dieses Jahres scheinen heilsamen Einfluß auf seinen Geist ausgeübt zu haben, denn seine Produktion ist gegen 1846 unstreitig reicher. Nebst mehreren Chören, und zwar Abschiedslied (op. 84), Ritornelle von Rückert in kanonischen Weisen (op. 65), drei Gesänge für Männerchor[S. 66] (op. 62), schrieb er zwei sehr schöne Trios (op. 63 u. 80); die Ouvertüre sowie den ersten Akt einer romantischen Oper Genoveva (op. 81).
Schon längst hatte sich Schumann mit dem Gedanken an ein musikalisches Drama getragen, ja sogar 1838 ein von Becker (nach T. A. Hoffmanns Novelle: Doge und Dogaressa, Univ.-Bibliothek Nr. 464) verfertigtes Libretto zu komponieren begonnen. Es wurde indessen bald wieder beiseite gelegt, weil er darin ein „tiefes, deutsches Element“ vermißte. In den folgenden Jahren steigerte sich, angesichts der Successe der großen Pariser Opern, sein Wunsch zu verzehrender Sehnsucht. „Wissen Sie mein morgen- und abendliches Künstlergebet?“ schreibt er 1842, „deutsche Oper heißt es. Da ist zu wirken. – Die deutschen Komponisten scheitern meistens an der Absicht, dem Publikum gefallen zu wollen. Gebe aber nur einmal einer etwas Eigenes, Einfaches, Tiefes, Deutsches, und er soll sehen, ob er nicht mehr erlangt.“ Eine ganze Reihe nationaler Opernstoffe fand sich in seinem Projektenbuche aufgezeichnet, unter andern Nibelungen, Wartburgkrieg, Lohengrin, Till-Eulenspiegel, Meister Martin und seine Gesellen. Allein vergebens fahndete er nach einem Dichter für sie, vergebens fragte er bei Zuccamaglio, Griepenkerl, Marbach um geeignete Texte an. Endlich glaubte er in Robert Reinick, welcher bereits für Freund Hiller ein Libretto geliefert hatte, den rechten Mann gefunden zu haben und veranlaßte ihn, die dramatischen Bearbeitungen der Genovevasage von Tieck und Hebbel zu einem Opernbuche zusammenzuschweißen. Doch war dessen Arbeit nicht nach Schumanns Sinne, und da Hebbel selbst eine Umgestaltung seines Stückes freundlich, aber entschieden ablehnte, sah sich der Meister der Töne dazu gedrängt, den Pegasus nach Wagners Vorgang selbst zu besteigen. Unter seinen Händen entspann sich die Handlung der Oper nun also: Pfalzgraf Siegfried zieht in den Maurenkrieg und läßt seine junge Frau, Genoveva, in der Hut[S. 67] seines Günstlings Golo zurück. Dieser, in sündiger Liebe für die Gebieterin entbrannt, aber mit Entrüstung zurückgewiesen, verbündet sich mit ihrer zauberkundigen Amme Margaretha, um sie zu verderben. Es wird das Gerücht von einem vertrauten Verhältnis zwischen Golo und Genoveva ausgestreut, die empörte Dienerschaft dringt in der Herrin Schlafgemach und findet darin – den alten Kastellan Drago, welcher sich, um Genovevas Unschuld erweisen zu können, daselbst heimlich verborgen hatte. Der Greis wird von den Knechten, ohne Gehör zu finden, erwürgt, Genoveva als des Ehebruches Schuldige ins Gefängnis geschleppt. Dann eilen Margaretha und Golo zu Siegfried, das Geschehene zu melden. Der ergrimmte Gatte will die Ungetreue töten lassen, befragt aber, um ganz sicher zu gehen, Margarethas Zauberspiegel. Das trügerische Gerät zeigt ihm Dragos und Genovevas sträflichen Umgang, so daß er vor Wut den Spiegel zerschlägt und davonstürzt. Aus den Trümmern aber steigt Dragos Geist auf und befiehlt der Hexe, ohne Verzug dem Grafen die Wahrheit zu gestehen. Im vierten Akte soll Genoveva, welche eine zweite Werbung Golos wiederum abgefertigt hat, in der Wildnis hingerichtet werden. Aber zur rechten Zeit erscheint der über den Sachverhalt aufgeklärte Gatte und führt sein schuldloses Weib im Triumphe auf das Schloß zurück. – Die vielfachen Willkürlichkeiten und Unklarheiten in der Motivierung treten an diesem knappen Aufriß noch nicht so grell zu Tage wie an dem Stücke selbst. Zwar machte der wohlmeinende Wagner Vorstellungen und Einwände, aber Schumann in dem Wahne, jener wolle ihm seine besten Effekte verderben, wurde ordentlich böse und unter seinen näheren Bekannten fand sich keiner, der ihn bewogen hätte abzustehen, nicht nur von der Komposition dieses Textes, sondern einer Oper überhaupt; vielmehr hetzten sie den Irrenden, der schon jeden Kompaß verloren, eher noch in die falschen Bahnen hinein. Die Wahrheit zwingt uns anzuerkennen, daß Schu[S. 68]mann auch auf diesem, seiner lyrischen Natur geradewegs widerstrebenden Gebiete viel richtiges Wollen bekundet hat. Von italienischen Mustern wollte er durchaus nichts wissen und „Lassen Sie mich in Ruhe mit der Kanarienvogelmusik und den Haarbeutelmelodien“ rief er, als man ihm von Cimarosas Matrimonio segreto sprach. Sein Vorbild war Webers Euryanthe. An Stelle des alten Recitativs, das er für eine überlebte Kunstform hielt, strebte er eine musikalische Deklamation zu gewinnen – freilich ohne Glück. Der Mangel an scharfen Kontrasten, an diesen Kennzeichen eines echten Dramas, ist’s, der die Genovevamusik auf der Bühne so wirkungslos macht; das konnten sogar eifrige Parteigänger Schumanns gleich bei der ersten Aufführung in Leipzig, welche sich zu seinem Leidwesen bis zum 25. Juni 1850 hinauszog, sich nicht verhehlen. Die Spannung auf dieses Werk war nach Lobes Mitteilungen groß und viele Umstände vereinigten sich zu Gunsten des Komponisten. In Leipzig hatte er viele Freunde und Verehrer. Mehrere berühmte Künstler waren zugegen: Liszt, Spohr, Meyerbeer, Hiller u. s. w. Schumann dirigierte die Oper selbst. Das Leipziger Publikum ist für Musik leicht entzündbar und mit Beifallsbezeugungen nicht karg. So konnte man einen jener glänzenden Kunstabende erwarten, welche Leipzig beliebten Künstlern für gelungene Leistungen gern bereitet. Die Erwartung wurde jedoch teilweise getäuscht. Außer der Ouvertüre applaudierte man nur noch die Aktschlüsse und in den Journalen entwickelte sich eine unerquickliche Polemik für und wider. Schumann aber, fest überzeugt, daß jeder Takt seiner Oper völlig dramatisch sei, nahm ungünstige Kritiken, entgegen seiner einstigen Gepflogenheit, gewaltig krumm, ja, zögerte nicht, ein langjähriges, freundliches Verhältnis zu Krüger, welcher das Werk etwas scharf recensiert hatte, sogleich zu lösen. So verlief die ganze Opernaffaire in jeder Hinsicht übel und bis auf den heutigen Tag ist es den deutschen Theatern trotz mannigfacher Ver[S. 69]suche nicht gelungen, Schumanns Schmerzenskind dem Repertoire zu erhalten.
Nebst der Genoveva fällt in das Revolutionsjahr 1848 noch das kantatenartige Adventlied von Rückert (op. 71) und zwei Klavierwerke: die phantasievollen, farbenprächtigen, durch Rückerts Makamen des Hariri angeregten Bilder aus dem Osten (op. 66) und das Album für die Jugend (op. 68), das uns auf seine eigene, reichbesetzte Kinderstube zurückweist. „Ich wüßte nicht, wann ich mich je in so guter musikalischer Laune befunden hätte, als da ich die Stücke (op. 68) schrieb,“ berichtet er an Reinecke. „Es strömte mir ordentlich zu. Sie sind mir besonders ans Herz gewachsen – und recht eigentlich aus dem Familienleben heraus. Die ersten Stücke im Album schrieb ich nämlich für unser ältestes Kind zu ihrem Geburtstag und so kam eines nach dem andern hinzu. Es war mir, als finge ich noch einmal von vorn an zu komponieren; und auch vom alten Humor werden Sie hier und da spüren. (Vergl. Nr. 12.) Von den Kinderscenen unterscheiden sie sich durchaus. Diese sind Rückspiegelungen eines Älteren und für Ältere, während das Album mehr Vorspiegelungen, zukünftige Zustände für Jüngere enthält.“ Ein Pendant zu diesen reizenden Genrestücken, von welchen Nr. 16 Erster Verlust, Nr. 13 Mai, lieber Mai, Nr. 28 Erinnerung (an den 1847 gestorbenen Mendelssohn) und Nr. 30 Adagio namentlich hervorgehoben seien, bildet das im folgenden Jahr komponierte Liederalbum für die Jugend (op. 79), mit welchem Schumann die später von Taubert, Reinecke und anderen weitergeführte Gattung der Kinderlieder aufnahm. In der Anordnung bemühte er sich die Stufenfolge vom Leichten zum Schwierigeren einzuhalten, Mignon (Nr. 29) schließt endlich ab „ahnungsvoll den Blick in ein bewegteres Seelenleben richtend.“
Von diesen lieblichen, wenn auch manchmal leidvollen, lyrischen Perlen sticht die ungefähr gleichzeitige „Musik zu[S. 70] Lord Byrons Manfred“ (op. 115) überaus grell ab. Das Gedicht, welches nur uneigentlich der dramatischen Gattung angehört, war für den Lyriker wie geschaffen und bot freien Spielraum zu grüblerischem Versenken. Für die innere Zerrissenheit, die düstere Schwermut des Byronschen Helden, wie sie der Meister in den wiederkehrenden Anfällen seines Nervenleidens selbst empfunden haben mag, fand er denn auch tiefergreifende Töne und besonders die Ansprache an Astarte: „Gerufen hab’ ich dich aus dunkler Nacht“ ist den bedeutendsten Schöpfungen seines Genius beizuzählen. Freilich wirkt diese Musik nicht so sehr auf der Bühne, für welche ja auch das Gedicht nicht berechnet ist; auch nicht im Konzertsaal, trotz des verbindenden Textes, welchen Richard Pohl dafür geschrieben hat; sondern beim einsamen Genusse am Flügel daheim.
Das Jahr 1849 ist an Kompositionen in Schumanns Leben unstreitig das fruchtbarste. „Man muß ja schaffen,“ schreibt er, „so lange es Tag ist.“ Namentlich fällt die große Zahl der Chorkompositionen (op. 67, 69, 75, 91, 93, 98 b, 108, 137, 141, 145, 146) auf, was sich aber aus seiner Stellung als Dirigent eines Gesangvereins leicht erklärt. Schon 1847 hatte er nach Ferdinand Hiller die Leitung der Dresdener Liedertafel übernommen, jedoch bald wieder aufgegeben; teils weil er darin zu wenig musikalisches Streben vorfand, teils weil ihm „die ewigen Quartsextaccorde des Männergesang-Stiles“ bald langweilig wurden. Größeres Vergnügen bereitete dem Meister ein von ihm selbst am 5. Januar 1848 gegründeter Chorverein, welcher in kurzer Zeit an hundert Mitglieder zählte. „Wir kommen,“ heißt es in einem Briefe, „oft außerhalb der Stadt zusammen, wandeln dann bei Sternenschein zurück und dann erklingen Mendelssohnsche und sonstige (das heißt seine eigenen) Lieder durch die Nacht und alle sind so fröhlich, daß man es mit werden muß.“ Aus der Zahl dieser, zum Teil ungemein schwierigen Chöre seien die Jagdlieder[S. 71] (op. 137), die Motette: „Verzweifle nicht im Schmerzensthal“ (op. 93), das zarte Requiem für Mignon aus Wilhelm Meister (op. 98) und das von Schumann besonders geliebte Nachtlied von Hebbel (op. 108) namhaft gemacht. Außerdem komponierte er nebst drei Liederheften (op. 79, 95, 98 a) und vier Duetten für Sopran und Tenor (op. 78), noch einige Liederkreise für eine und mehrere Stimmen: Minnespiel von Rückert (op. 101), Spanische Liebeslieder (op. 138) und das köstliche, gleichsam aus Jasminduft gewobene Spanische Liederspiel (op. 74). Eine melodramatische Begleitung zu Hebbels Ballade „Schön Hedwig“ (op. 106) leitet uns zu den reinen Instrumentalwerken hinüber. „Es ist eine Art der Komposition, die wohl noch nicht existiert und so sind wir immer vor allem dem Dichter zu Dank verbunden, die, neue Wege der Kunst zu versuchen, uns so oft anregen.“ Dem heutigen Geschmacke sagt diese anorganische Verbindung zwischen Wort und Tönen nicht mehr zu; Schumann dagegen that sich auf seine Errungenschaft viel zu Gute und schrieb noch 1853 eine ähnliche Musik zu Hebbels „Haideknaben“ und Schelleys „Flüchtlingen“ (op. 122). Auch die absolute Musik ist durch eine erkleckliche Anzahl von Kompositionen vertreten; zunächst durch mehrere Klavierwerke: die interessanten Waldscenen (op. 82). Vier Märsche (op. 76). Zwölf vierhändige Stücke (op. 85) sowie Introduktion und Allegro für Pianoforte und Orchester (op. 92); dann durch Phantasien, Konzertstücke und dergleichen für Violoncello, Horn, Klarinette und Oboe. (op. 70, 73, 86, 94, 102).
Die Folgen solch übermäßiger Anstrengung, zu welcher sich noch die mannigfachen Aufregungen durch die politischen Wirren dieses Jahres gesellten, blieben nicht aus. Ein unerträglicher Kopfschmerz peinigte den Meister, so daß die in Angriff genommene Vollendung des „Faust“ nur langsam fortschreiten konnte. Seit den ersten Arbeiten daran[S. 72] (1844) hatte er nach zweijähriger Pause nur ab und zu ein Stück hinzukomponiert, den „Schlußchor“, „Gerettet ist das edle Glied“, die „Gretchenscenen“ und „Fausts Erwachen“. Im Sommer 1848 wurde sogar eine Privataufführung im Schumannschen Hause veranstaltet und zur Goethefeier (29. August 1849) gab man das Werk an mehreren Orten, in Weimar, Dresden und Leipzig. Freilich, wenn die Behauptung laut wurde, daß der zweite Teil des Faust erst durch Schumanns Musik verständlicht worden sei, so ist das nur insofern richtig, als dieser von der Gedankenlosigkeit stets arg verlästerte Teil der Mitwirkung der Tonkunst bedarf, um den gehörigen Eindruck hervorzubringen und insofern, als viele Musiker, durch diese Komposition aufmerksam gemacht, sich den „zweiten Teil“ besser angesehen und darum vielleicht besser verstanden haben. Übrigens lag es gar nicht in Schumanns Vermögen, den ungeheuren Vorgang des Weltgedichtes mit ebenbürtiger Musik auszustatten, sondern er komponierte ihn auf seine Weise, das heißt in den lyrischen Partien, z. B. dem wahrhaft himmlischen Hymnus an die Gottesmutter wunderschön. Anderes, z. B. der Schlußchor, muß als unpassend bezeichnet werden, denn wir hören zwar ein Chorstück von erlesener Pracht, dessen Melodik aber dem durchaus mythischen Sinn der Verse, in welchen die letzten Dinge aller menschlichen Weisheit ausgesprochen sind, nicht entspricht. Der Autor selber fühlte das wohl und geriet darüber einigemale in Desperation. Er komponierte die Nummer um – ohne auch mit dieser zweiten Fassung den rechten Ton getroffen zu haben. Der Palestrinastil, in dessen Herrlichkeiten sich Schumann ebendamals versenkte, wäre hier vielleicht am Platze gewesen. 1850 schrieb er dann noch die Scene mit den grauen Weibern, sowie Fausts Tod hinzu; die Ouvertüre, wohl der schwächste Teil des Werkes, ist erst 1853 entstanden, aus dem Bedürfnis, das Ganze abzurunden und auf die verschiedenen Stimmungen wenigstens einigermaßen vorzubereiten.[S. 73] Mittlerweile hatte Ferdinand Hiller seine Konzertdirektorstelle in Düsseldorf aufgegeben und sollte die Leitung des Kölnischen Konservatoriums übernehmen. Bei seinem Abgange schlug er zu seinem Nachfolger Schumann vor, von dem er wußte, daß er sich, erfolglos freilich, in Wien, Berlin und Leipzig um ein ähnliches Amt beworben habe. Der Meister zögerte lange, sich von der lieben Heimat zu trennen; denn erstens standen daselbst mehrere, für ihn sehr wichtige Aufführungen seiner Peri und Genoveva bevor, dann gab Klara mit Konzertmeister Schubert in Dresden stark besuchte Soireen und schließlich schien Aussicht vorhanden, durch Vermittlung einflußreicher Freunde zum Kapellmeister an des flüchtigen Wagner statt ernannt zu werden. Während nun die ganze Angelegenheit in der Schwebe hing, begab sich Schumann mit seiner Frau auf Kunstreisen über Leipzig nach Hamburg, wo er mit Jenny Lind bekannt wurde und an ihr eine begeisterte Interpretin seiner Lieder fand. Der berühmten Sängerin ist – zum Dank für ihre Mitwirkung bei zwei Konzerten Klaras – das Liederheft op. 89 gewidmet.
Nach Dresden zurückgekehrt, vernahm er, daß die Stelle am Hoftheater schon durch einen anderen, C. Krebs, besetzt sei; man mochte in maßgebenden Kreisen an der „revolutionären“ Gesinnung des großen Künstlers Anstoß genommen haben. Denn in politischer Hinsicht stimmte er mit Wagner so ziemlich überein und machte kein Hehl aus dieser seiner Denkungsweise. Bei einem Spaziergange mit dem bekannten Litteraten Graf Baudissin suchte ihm der letztere zu beweisen, daß die konstitutionelle Monarchie allen übrigen Regierungssystemen vorzuziehen sei. Schumann hörte scheinbar aufmerksam zu, die Auseinandersetzungen zeitweise mit einem billigenden Kopfnicken begleitend. Doch mußte er wohl in die Fortspinnung irgend eines musikalischen Gedankens verloren gewesen sein, denn als ihn Baudissin frug, ob er ihn nun zu seiner Ansicht bekehrt habe, antwortete Schumann: „Die[S. 74] Republik bleibt doch die beste Staatsform!“ Seine Märsche (op. 76) wurden von Vertrauten sogar „Barrikadenmärsche“ genannt, obwohl ihm, bei seinem zurückgezogenen Wesen, nichts ferner lag, als etwa persönlich auf den Barrikaden eine Rolle zu spielen. Genug, er sah sich in seinen Hoffnungen getäuscht und entschloß sich nunmehr rasch zur Übersiedelung ins niederrheinische Land. Komponiert hat er im Laufe des Jahres 1850 bis zu diesem Zeitpunkte (Anfang Oktober) bloß ein Chorwerk (op. 144) und mehrere Lieder (op. 83, 89, 90 sowie einige aus op. 77, 96, 127). Ein seltsamer Zufall fügte es, daß Schumann den Lenauschen Gedichten in op. 90 ein altes Requiemslied angehängt, als die Nachricht vom Ende des unglücklichen Dichters eintraf. Er hatte ihm, ohne es zu wissen, das Totenlied gesungen; und wenige Jahre später sollte er selbst der furchtbaren Krankheit erliegen, welche jenen, ihm nahverwandten Geist so früh zerrüttete und zerstörte.
[7] Das Programm enthielt u. a.: 29. Jänner. Klavierstücke von Bach, Skarlatti, Mendelssohn, Chopin; sechs Lieder und das Klavierquintett von Schumann. 2. Februar. Leonorenouvertüre (Nr. 3, C-Dur); Lieder von Speyer, Klavierstücke von Klara, von Henselt und Liszt. – Kanon und Klavierkonzert von Schumann.
„Ich suchte in einer alten Geographie nach Notizen über Düsseldorf und fand da unter den Merkwürdigkeiten angeführt: drei Nonnenklöster und eine Irrenanstalt. Die ersteren lasse ich mir gefallen allenfalls, aber das letztere war mir unangenehm zu lesen. Ich will dir sagen, wie das zusammenhängt. Vor einigen Jahren wohnten wir in Maxen, da entdeckte ich denn, daß die Hauptansicht aus meinem[S. 75] Fenster nach dem Sonnenstein[8] zuging. Dieser Anblick wurde mir zuletzt ganz fatal; ja, er verleidete mir den Aufenthalt. So, dachte ich denn, könne es auch in Düsseldorf sein. Ich muß mich sehr vor allen melancholischen Eindrücken der Art in acht nehmen.“
Ahnte der arme Meister, als er diese Zeilen an Hiller schrieb, das ihm drohende Verhängnis? Stieg das düstere Bild der Zukunft schreckhaft vor seiner Seele auf? Fast scheint es so. Denn er mußte doch zuweilen die allmähliche Ermattung seines Geistes fühlen, fühlen, wie die Phantasie, ja zuletzt die klare Denkkraft ihn verließ; o furchtbare Erkenntnis! Aber immer wieder, als sei er einem Fluche verfallen, trieb ihn der unselige Ehrgeiz und alte Gewohnheit zu neuem Schaffen an, zermarterte er sein müdes, brennendes Hirn und beschleunigte so seinen Untergang. Als er im besten Mannesalter, im sechsundvierzigsten Lebensjahre starb, da hatte die deutsche Kunst keinen wertvollen Entgang mehr zu beklagen, es war ein völlig Erschöpfter, den sie zur ewigen, wohlverdienten Ruhe in die Grube senkten.
Zu Anfang der Düsseldorfer Periode hätte das allerdings niemand vermuten können. Der neue Wirkungskreis, die Ortsveränderung, die reizvolle Gegend und der ehrenvolle Empfang – alles das übte zunächst einen belebenden Einfluß auf Schumann aus. Man merkt es an den sogleich nach der Ankunft begonnenen Kompositionen, dem Cellokonzert (op. 129) und besonders an der fünften, der „rheinischen“ Symphonie Es-Dur (op. 97), welche den symphonischen Stil in mancher Hinsicht besser trifft als ihre älteren Schwestern, wohl darum, weil sich Schumann diesmal sein Ziel nicht so hoch gesteckt hatte. Frische musikalische „Bilder des Lebens am Rheine“ ziehen an uns vorüber und der vierte Satz, der „im Charakter einer feierlichen Ceremonie“ gehalten werden soll, weist sogar auf eine bestimmte Be[S. 76]gebenheit, die Erhebung des Erzbischofs von Köln (Geissel) zum Kardinal, welcher Schumann beigewohnt hatte.
Mit der neuen Stellung war er sehr zufrieden, obwohl ihm zum Dirigenten viele wichtige Eigenschaften fehlten: die körperliche Geübtheit, die Geistesgegenwart und vor allem die so notwendige Mitteilungsgabe. Belehrungen über die Vortragsweise erwartete man von ihm vergebens, sondern er ließ das Stück durchspielen und wenn es noch nicht ging, wiederholen. Oft sagte er seinen Musikern, er habe sich dies oder jenes ganz anders gedacht, ohne sie über die eigentümliche Art seiner Auffassung weiter aufklären zu können. Zum Glück war das Düsseldorfer Orchester durch Hiller, Rietz und Mendelssohn so weit geschult, daß die Unzulänglichkeit Schumanns, den man auf den Händen trug, dem Publikum nicht weiter bekannt wurde. Nebst den Abonnementskonzerten hatte er nur noch die wöchentlichen Übungen des Singvereines und die an gewissen Festtagen stattfindenden Musikaufführungen in der katholischen Kirche zu leiten, so daß ihm genug freie Zeit übrig blieb, um seinen eigenen Studien nachzugehen. Im Sommer war er gar nicht beschäftigt. Er benützte die Konzertferien zu kleineren oder größeren Ausflügen, reiste zum Beispiel im Juli 1851 in die Schweiz und im August dieses Jahres zum Musikfeste nach Antwerpen, wo er zum Schiedsrichter beim Wettsingen gewählt worden war. Sonst verfloß sein Leben in Düsseldorf zumeist recht einförmig. Um zwölf Uhr mittags ging er mit Klara und irgend einem Bekannten spazieren, von sechs bis acht besuchte er ein Gasthaus, um Zeitungen zu lesen und ein Glas Bier zu trinken – die übrigen Stunden des Tages waren der Arbeit gewidmet. Da saß er in seinem traulichen, langgestreckten, mit Bücher- und Musikalienschränken verstellten Zimmer am Flügel und komponierte.
Über die Werke dieser Periode sei zusammenfassend bemerkt, daß sie dem Hörer im allgemeinen nur wenig Genuß[S. 77] gewähren. Nicht als ob, wie in den letzten Gaben der Beethovenschen Muse der allzu hohe Ideenflug das unmittelbare Verständnis erschwerte – im Gegenteil, die Unkraft der schaffenden Phantasie ist es, die es zu keiner künstlerischen Wirkung kommen läßt und bloß Mitgefühl für den armen Meister hervorrufen kann. Er hat, wie Dräsecke sagt, als Genie begonnen und als Talent aufgehört; schon seit jener Erkrankung um die Mitte der vierziger Jahre ist das allmähliche Herabsinken seines Geistesfluges, die Atrophie seines Genius zu beobachten. Mit fiebrischer Hast, zu welcher die äußere, fast apathische Ruhe unheimlich kontrastiert, springt er von einem musikalischen Gebiet auf das andere, schreibt bald Lieder (op. 107, 117, 119, 125, 135) und begeistert sich für die Gedichte der Elisabeth Kulmann (op. 103, 104), „einer wahren, seligen Insel, die im Chaos der Gegenwart emporgetaucht;“ bald Violinsonaten (op. 105, op. 121 D-moll); bald wieder kleinere Klavierstücke (op. 109, 111), bald ein Trio (G-moll, op. 110), bald Märchenbilder für Viola (op. 113), bald eine Messe (op. 147) oder ein Requiem (op. 148). Richard Pohl, der nachmals berühmte Kritiker, und Moritz Horn müssen ihm Opern- und Oratorientexte herstellen; Projekte, wie die Braut von Messina und Hermann und Dorothea giebt er gleich wieder auf, komponiert aber wenigstens Ouvertüren dazu (op. 100 und 136). Auch Shakespeares Julius Cäsar erhält eine Ouvertüre (op. 128). Sehr lange beschäftigt ihn dann der Gedanke an ein Oratorium „Luther“, über das sich ein reger Briefwechsel mit Pohl entspinnt. Einige Stellen daraus seien hier angeführt, als Beispiel, bis zu welchem Grade Schumann seine „Dichter“ beeinflußte und wie er sich das Ideal eines Oratoriums ersonnen hatte: „Das Oratorium müßte ein durchaus volkstümliches werden, das Bürger und Bauer verstände – dem Helden gleich, der ein so großer Volksmann war. Und in diesem Sinne würde ich mich auch be[S. 78]streben, meine Musik zu halten, also am allerwenigsten künstlich, kompliziert, kontrapunktisch, sondern einfach, eindringlich, durch Rhythmus und Melodie vorzugsweise wirkend. Im übrigen stimme ich mit allem, was Sie wegen Behandlung des Textes in metrischer Hinsicht sagen, wie über die volkstümlich altdeutsche Haltung, die dem Gedichte zu geben wäre, durchaus überein. – Das Oratorium müßte für Kirche und Konzertsaal passen. Es dürfte mit Einschluß der Pausen zwischen den verschiedenen Abteilungen nicht über zweieinhalb Stunden dauern. – Alles bloß Erzählende und Reflektierende wäre möglichst zu vermeiden, überall die dramatische Form vorzuziehen. – Möglichst historische Treue, namentlich die Wiedergabe der bekannten Kraftsprüche Luthers. Sein Verhältnis zur Musik überhaupt, seine Liebe für sie, in hundert schönen Sprüchen von ihm ausgesprochen, dürfte gleichfalls nicht unerwähnt bleiben. – Hutten, Sickingen, Hans Sachs, Lucas Kranach, die Kurfürsten Friedrich und Johann von Hessen müssen wir wohl aufgeben – leider! Erzählungsweise mögen sie aber alle vorkommen. Ich glaube, wir müssen den Stoff auf die einfachsten Züge zurückführen, oder nur wenige der großen Begebenheiten aus Luthers Leben herausnehmen. Auch glaube ich, dürfen wir dem Eingreifen übersinnlicher Wesen nicht zu großen Platz einräumen, es will mir nicht zu des Reformators ganzem Charakter passen, wie wir ihn nun einmal recht als einen geraden, männlichen und auf sich selbst gegründeten kennen. – Gelegenheit zu Chören geben Sie mir, wo Sie können. Händels ‚Israel in Egypten‘ gilt mir als das Ideal eines Chorwerks und eine so bedeutende Rolle wünschte ich dem Chor auch im ‚Luther‘ zugeteilt. Der Choral ‚Ein’ feste Burg‘ dürfte als höchste Steigerung nicht eher als zum Schluß erscheinen, als Schlußchor. – Lassen Sie uns das große Werk mit aller Kraft ergreifen und daran festhalten.“ Doch kam es trotz der in den letzten Worten gegebenen Versicherung zur Ausführung des so wohl bedachten Planes[S. 79] nicht. Andere, wichtiger dünkende Projekte drängten sich in den Vordergrund. Denn im verzweifelten Streben ja nur Originelles, Bahnbrechendes zu produzieren, sann Schumann endlich gar auf die Einführung neuer Kunstgattungen, nahm das „weltliche Oratorium“ wieder auf und erfand das unerfreuliche, zwitterhafte Genre der „Chorballade“.
Der Rose Pilgerfahrt (op. 112) heißt das bis zur Abgeschmacktheit sentimentale Carmen Horns, welches jetzt ein – sehr untergeordnetes – Seitenstück zu der sinnigen „Peri“ abgeben sollte, ein Carmen, dessen Heldin eine menschgewordene Blume ist, welche liebt, heiratet und endlich, man weiß nicht recht warum, von der Elfenkönigin unter die Engel aufgenommen wird. Kaum begreifen wir, wie Schumann dies fade Produkt gezierter Goldschnittlitteratur anziehen konnte, ihn, der einige Jahre vorher sich geäußert: „Schwache Worte zu komponieren ist mir ein Greuel; ich verlange keinen großen Dichter, aber eine gesunde Sprache und Gesinnung.“ Horn war thöricht und eingebildet zu glauben, an dem geringen Erfolg, den das Werk bei den ersten Aufführungen davontrug, sei die „in der Auffassung verfehlte“ Musik des Meisters schuld. Diese gehört nun freilich nicht zu seinen besten Leistungen, enthält aber immerhin gar manche reizvolle Nummer. Derselbe Dichter richtete ihm auch die Uhlandsche Ballade: Der Königssohn (op. 116) für seine Experimente her, Pohl im folgenden Jahre Des Sängers Fluch (op. 139). Darnach kommt der Geibelsche Romanzenkranz Vom Pagen und der Königstochter (op. 140) an die Reihe und schließlich 1853 das Glück von Edenhall (op. 143) von seinem Hausarzte Dr. Hasenclever bearbeitet. Das Prinzip dieser zwischen Epos und Drama schwankenden Gattung, wie es in op. 139 am deutlichsten ausgeprägt erscheint, besteht darin, daß der erzählende Teil des Gedichtes einer gewissen Stimme übertragen, alles Übrige jedoch, nötigenfalls mit Hilfe von beträchtlichen Texterweiterungen, zu[S. 80] Sologesang, Duett, Terzett oder Chor umgestaltet wird, je nachdem es die Situation erfordert. So entwarf Schumann zu „des Sängers Fluch“ folgendes Schema:
Nr. 1. Chor mit Solis.
Es stand in alten Zeiten – blühender Genoß.
Nr. 2. Duettform (etwa zehn Zeilen).
Alter und Jüngling.
Nun sei bereit – steinern Herz.
Nr. 3. Recitativ (Sopran).
Schon stehen – zum Ohre schwoll.
Ensemble.
Alter, Jüngling, König, Königin, Chor.
(Breit auszuführen).
Nr. 4. Recitativ.
Und wie vom Sturm zerstoben – Gärten gellt.
Nr. 5. Harfner.
Weh euch!
Nr. 6. Chor.
Der Alte hat’s gerufen – Das ist des Sängers Fluch.
Pohl legt nun den beiden Sängern ganze Uhlandsche Lieder in den Mund und der Chor drückt seine Ergriffenheit mit dem, zu diesem Zwecke veränderten Verse: „Wie schlägt der Greis die Saiten, so wundervoll und mild“ aus. Ferner wird der Königin ein früheres, zärtliches Verhältnis zum Jünglinge insinuiert. Die beiden sind so unvorsichtig, im Angesichte des ganzen Hofes ein langes Liebesduett anzustimmen, worauf der König in begreiflicher Entrüstung den kecken Troubadour mit den Worten: „Stirb feiger Sklavensohn!“ niedersticht. Daß Schumann die poetischen Sünden eines unerfahrenen Kunstnovizen für gut befinden, ja sogar[S. 81] veranlassen konnte, zeugt gewiß von einer bedeutenden Trübung seines einst so klaren, richtigen Blickes.
Im März 1852 gab das Schumannsche Ehepaar unter großem Zulauf auswärtiger Musiker (Liszt, Robert Franz, Joachim, Meinardus u. a.) eine Anzahl von Konzerten in Leipzig, doch vermochten selbst vor diesem wohlgesinnten Publikum gerade die letzten Werke keinen rechten Erfolg zu erringen. Denn selten nur erhellt in ihnen ein Blitz, manchmal wohl ein fernes Wetterleuchten des Genies das lastende Dunkel. Müde und abgespannt kehrte der Meister nach Düsseldorf zurück, an dem Männergesangsfest (im August) beteiligte er sich nur wenig und eine Kur in Scheveningen, wo er mit seinem alten Freunde Verhulst das Wiedersehen feierte, brachte nur vorübergehende Besserung. Von seinem sonderbaren Zustand giebt eine Erinnerung des Malers Bendemann an eine Abendgesellschaft, bei welcher auch Schumann zugegen war, interessanten Bericht: „Nach dem Essen trug Klara einige Klavierstücke vor. Schumann hatte sich unterdes seiner Gewohnheit nach in ein Nebenzimmer zurückgezogen. Seine Frau, die immer sehr besorgt um ihn war, ging nach Beendigung ihrer Vorträge zu ihm hin. Ich begleitete sie. Als wir eintraten, schrak er aus seinem träumerischen Versunkensein empor und fragte: Wer hat da gespielt? Ich merkte, wie die Frage Frau Schumann ins Herz schnitt. Aber Robert, ich habe ja gespielt, erwiderte sie mit bebender Stimme. So warst du das!? gab Schumann gleichgültig zurück und versank wieder in seine Meditationen. Die sonderbaren Worte hatten die liebe Frau so angegriffen, daß sie förmlich unwohl wurde und den Wunsch aussprach, nach Hause zu gehen. Schumann hatte darnach nur ein kurzes: Warum denn? Es ist ja ganz nett hier! – Aber bester Schumann, wenn Ihre Frau unwohl ist, müssen Sie sie doch nicht zurückhalten, sagte ich, mich ins Mittel legend. Da brach er denn auf. Am andern Morgen aber empfing ich einen Brief von ihm,[S. 82] worin er sich ziemlich beleidigt über meine Einmischung aussprach.“ (Schrattenholz, E. Bendemann). Über seinen damaligen Geisterglauben erzählt ein anderer Freund, Wasiliewski, Folgendes: „Als ich im Mai 1853 eines Tages in Schumanns Zimmer eintrat, lag er auf dem Sofa und las in einem Buche. Auf mein Befragen, was der Inhalt des letzteren sei, erwiderte er mit gehobener Stimme: ‚O! Wissen Sie noch nichts vom Tischrücken?‘ ‚Wohl!‘ sagte ich in scherzendem Tone. Hierauf öffneten sich weit seine für gewöhnlich halbgeschlossenen Augen. Die Pupille dehnte sich krampfhaft auseinander und mit eigentümlich geisterhaftem Ausdrucke sagte er langsam: ‚die Tische wissen alles.‘ Als ich diesen drohenden Ernst sah, ging ich, um ihn nicht zu reizen, auf seine Meinung ein, infolge dessen er sich beruhigte. Dann rief er seine zweite Tochter herbei und fing an mit ihr und einem kleinen Tische zu experimentieren, wobei er ihn auch den Anfang der C-mollsymphonie von Beethoven markieren ließ.“ Doch konnte Schumann zu gewissen Zeiten auch recht umgänglich, ja wohl aufgeräumt sein. Beim großen niederrheinischen Musikfest (Pfingsten 1853) that er sich als Dirigent sogar wieder hervor und brachte nebst der umgearbeiteten D-mollsymphonie auch eine neu komponierte Festouvertüre über das Rheinweinlied mit Gesang (Soli und Chor) unter vielem Beifall zur Aufführung. Denkwürdig ist sodann sein Verhältnis zu Johannes Brahms, der an ihn durch Joachim empfohlen war. Schumann, die außergewöhnliche Begabung des zwanzigjährigen Künstlers erkennend, griff anerkennungsfreudig wie immer, noch einmal zur Feder und proklamierte ihn in der Brendelschen Zeitschrift – nicht als vielverheißenden Jünger, sondern als „starken Streiter“ und Meister, der berufen sei, „den höchsten Ausdruck unserer Zeit in idealer Weise auszusprechen.“ Brieflich bezeichnet er ihn als den, „der kommen mußte“, als „einen jungen Aar“, welcher „die größte Bewegung in der musikalischen Welt hervorrufen[S. 83] werde“. Selbst wer diesem enthusiastischen Preise nicht in ganzem Umfange beipflichten kann, muß zugeben, daß Brahms unter den absoluten Musikern der letzten Zeit entschieden und verdientermaßen den ersten Platz sich erobert hat. Kurz, der „blonde Johannes“ war Schumanns erklärter Liebling von Stund an. Oft gedachten die beiden Künstler bei ihrem Beisammensein auch des fern weilenden, aber zum Konzerte erwarteten Freundes Joachim, ja, der stille, schweigsame Robert schwang sich gar einmal zu folgendem Toast in Charadenform auf: „Drei Silben; die erste liebte ein Gott, die zwei anderen lieben viele Leser, das Ganze lieben wir alle; das Ganze und der Ganze sollen leben!“ (Jo-achim). Auch existiert eine Violinsonate, welche er, Brahms und der junge Musiker Albert Dietrich dem berühmten Geigenvirtuosen zu Ehren geschrieben haben. Sie wurde ihm nach seiner Ankunft in Düsseldorf vorgespielt und richtig erkannte er den Verfasser jedes einzelnen Satzes. Später ersetzte Schumann die zwei fremden Sätze durch eigene Musik und gab die Komposition als (op. 131) heraus.
Leider zählten solche Perioden geistiger Frische nur nach Tagen. In demselben Monate (Oktober), in welchen der Verkehr mit Brahms fällt, nahmen auch die Abonnementskonzerte ihren Anfang und schon beim ersten zeigte es sich deutlich, daß Schumann seiner Aufgabe als Dirigent nicht mehr gewachsen sei. Man bat ihn, das Dirigieren zur Schonung seiner Gesundheit wenigstens vorläufig dem zweiten Kapellmeister zu überlassen, beleidigte aber durch dieses vielleicht nicht genug schonend vorgebrachte Ansinnen den reizbaren Meister derart, daß er seine Stelle ohne Verzug niederlegte.
Er wandte Düsseldorf den Rücken und begab sich mit Klara auf eine Konzerttour nach Holland. Da durfte er denn, mit Ehren überhäuft, die ihm vermeintlich zugefügten Kränkungen vergessen. „Das holländische Publikum,“ schreibt er frohbewegt, „ist das enthusiastischste, die Bildung im[S. 84] ganzen dem Besten zugewendet. Überall hört man neben den alten Meistern auch die neuen. So fand ich in Hauptstädten Aufführungen meiner Kompositionen vorbereitet (der dritten Symphonie in Rotterdam und Utrecht, der zweiten in Haag und Amsterdam, auch der Rose in Haag), daß ich mich nur hinzustellen brauchte, um sie zu dirigieren. Ich habe zu meiner Verwunderung gesehen, daß meine Musik hier beinahe heimischer ist als im Vaterlande.“
Am 22. Dezember traf das Künstlerpaar wieder zu Hause ein, mit dem Vorsatz, die leidige Stadt im Laufe des kommenden Frühlings für immer zu verlassen. Zwei litterarische Pläne beschäftigten den Meister fortan: Zuerst die Herausgabe seiner gesammelten Aufsätze in Buchform,[9] wobei es ihm eine Freude war zu bemerken, daß er in der langen Zeit, seit über zwanzig Jahren, von den damals ausgesprochenen Ansichten fast gar nicht abgewichen sei; dann eine Zusammenstellung aller Dichtersprüche über Musik von den ältesten Zeiten an, unter dem Titel „Dichtergarten“. An der Vollendung dieser Arbeit verhinderte ihn jedoch sein neuerdings ausbrechendes Leiden.
Becker erzählt, daß Schumann einmal im Gasthause plötzlich die Zeitung weggelegt habe mit den Worten: „Ich kann nicht mehr lesen; ich höre fortwährend A.“ Solche Sinnestäuschungen kehrten jetzt mit doppelter Stärke wieder. Des Nachts erscheinen ihm Schubert und sein lieber Mendelssohn und singen ihm eine rührende Melodie vor, bis er vom Lager springt und sie aufzeichnet.[10] Geisterstimmen tönen ihm entgegen, bald mild und freundlich, bald drohend und vorwurfsvoll. Eine furchtbare Angst ergreift den Be[S. 85]unruhigten, während Klara durch vierzehn bange Nächte und Tage alles aufbietet, um die quälenden Gedanken des Gatten zu zerstreuen. Umsonst! Am Fastnachtsmontag, am 17. Februar 1854, entfernt er sich heimlich aus dem Hause, eilt auf die Rheinbrücke und springt, seinen peinlichen Zustand zu enden, in den eisigen Strom. Aber anwesende Schifferknechte fischen ihn noch lebendig wieder heraus: einen Wahnsinnigen. Man brachte ihn am 4. März in die Privatheilanstalt des Dr. Richarz zu Endenich bei Bonn.
Ererbte Disposition und übermäßige Anstrengung des Geistes – das gaben die Ärzte als Ursache der Krankheit an. Allein sie erklären damit nicht alles. Schumann war ein großer, kräftiger, gesund aussehender Mann, dessen Leben im ganzen glücklich genannt werden darf. Alles, was er wünschte, hatte er errungen, Freundschaft, Liebe, Künstlerschaft; nie hatte ihm die Sorge ums tägliche Brot ihr bleiches Antlitz gewiesen. Bedenkt man, wie andere Künstler schwach an Körper, bettelarm, mit wundem Herzen durch die Welt gewandelt sind, ebenso produktiv, vielleicht noch produktiver als unser Meister, ohne dabei dem Wahnsinn verfallen zu sein, so muß man einräumen, daß es hier eine besondere Bewandtnis gehabt habe. Fragen wir darum nicht weiter die Medizin, sondern lieber einen mitfühlend verstehenden Genius – Grillparzer. Und dieser sagt uns mit ausdrücklichem Bezug auf Schumann: „Ich meine immer, ein Künstler, der wahnsinnig wird, sei im Kampfe gegen seine Natur gelegen.“ Herrlicher Tiefblick des Dichters! Wie beschämt er die Instrumente des secierenden Gelehrten, welche nur über Gehirnentartung, Gefäßerweiterung und dergleichen Aufschluß zu geben wußten. Grillparzer, der Schumann bloß einmal flüchtig gesehen, löst uns durch einen scharfen Hieb seines Intellekts den gordischen Knoten der Schumannfrage und führt uns zur Erkenntnis, daß nicht das Übermaß des Schaffens, sondern das Schaffen gegen seine Natur und Eigenart diesen Geist erschöpft und zer[S. 86]rüttet habe. Im Verlaufe unserer Darstellung wurde dieses Moment schon mehrmals hervorgehoben.
Zu Endenich lebte Schumann meist in einem Zustande tiefster melancholischer Depression. Manchmal trat wieder eine so bedeutende Besserung ein, daß man sogar auf völlige Genesung hoffen zu können glaubte: dann verschwand der irre Blick aus seinen Augen, er musizierte und schrieb an Familie und Verleger. Doch am Beginn des Sommers 1856 ging es mit ihm merklich zu Ende. Seine Freunde, die in treuer Anhänglichkeit oft zum Krankenhaus wanderten, um Nachrichten einzuholen, kamen mit immer traurigerer Botschaft heim. Die einzige Beschäftigung dieses einst so bedeutenden Geistes bestände darin, sich in einem, von Brahms geschenkten Atlas eingebildete Reisen zusammenzusuchen. Am 29. Juli um vier Uhr nachmittags verschied er sanft in den Armen seiner Gattin. Sie und alle, die Schumann liebten, fühlten sich erleichtert: er war ja befreit von schwerem Leiden.
Die Nachricht von Schumanns Tode durcheilte Bonn und die anderen rheinischen Städte in wenigen Stunden. Auf Straßen und Plätzen wurde man darauf angeredet, ob man die Trauerkunde schon vernommen. Von fern und nah eilten die Verehrer des Meisters zu seinem Begräbnis, Brahms, Joachim, Dietrich gingen barhaupt hinter dem Sarge, Hiller sprach die Grabrede und die Bevölkerung Bonns war in Scharen herbeigeströmt, um den Leichenzug zu sehen, als würde ein König beerdigt. Auf dem Bonner Kirchhof vor dem Sternenthor, nicht weit von Vater Arndt, ruht jetzt der müde Sänger. Dort hat ihm im Mai 1880 die Liebe seiner Freunde ein würdiges Denkmal errichtet.
[8] Bekannte Irrenanstalt.
[9] Erschienen bei Wigand, 1854. Später ging das Verlagsrecht an Breitkopf und Härtel über. Neue Ausgabe: Universal-Bibliothek Nr. 2472/73. 2561/62. 2621/22.
[10] Johannes Brahms hat über dieses im Nachlasse des Meisters vorgefundene Thema sehr schöne Variationen geschrieben (op. 23).
Wenn unser Auge bei der Betrachtung des Schumannschen Lebensganges an manchen Schwächen und Irrtümern haften mußte, so darf der folgende Abschnitt nun ganz dem Preise seiner bedeutenden Leistungen gewidmet sein. Mag der eine dieser, der andere jener den Vorzug zuerkennen – über ihren hohen Wert ist heutzutage alle Welt einig und zählt ihn, wenn auch nicht zu jenen Gewaltigen, welche die gesamten idealen Bestrebungen des verfließenden Zeitalters kraftvoll zusammenfassend, einem künftigen den Stempel ihres Geistes aufdrücken, so doch zu den Musikern ersten Ranges. Er war ein musikalischer Kernmensch und vermag darum sogar in Kunstgattungen, für welche ihm die spezielle Befähigung abging, in Ehren zu bestehen und die volle Teilnahme des Hörers zu erwecken. Sollen wir aber diese seine spezielle Befähigung genauer umschreiben, was könnten wir Treffenderes vorbringen, als das Urteil, welches er selbst, über einen anderen Künstler (L. Berger) freilich, gefällt hat: „Überhaupt war er in kleinen Formen glücklicher als in größeren, wie dies oft bei Naturen der Fall, die stets ihr Bestes, Tiefstes, Innigstes geben möchten. Schlage man solche Stücke nicht zu gering an. Eine gewisse breite Unterlage, ein bequemes Aufbauen und Abschließen mag mancher Leistung zum Lobe gereichen. Es giebt aber Tondichter, die, wozu andere Stunden brauchen, in Minuten auszusprechen wissen: zur Darstellung, wie zum Genießen solcher geistig konzentrierter Kompositionen gehört aber freilich auch eine gesteigerte Kraft des Darstellenden wie des Aufnehmenden und dann auch die rechte Stunde und Zeit; denn schöne, bequeme Form läßt sich immer genießen und auslegen;[S. 88] tiefer Gehalt wird aber nicht zu jeder Zeit verstanden. Daß Berger auch größerer Formen Meister war, hat er in seinen Sonaten und Konzerten bewiesen. Keineswegs aber geben wir für diese eben jene kleineren, genialeren Arbeiten hin, wie jene Charakterstücke, einige seiner Variationen und vor allem seine Lieder.“
So Schumann. Um die Schönheiten seiner Musik zu empfinden, bedarf es natürlich, wie bei allen tiefer gedachten Kunstwerken einer eingehenden Bekanntschaft. „Als ich Schumann zu spielen anfing,“ erzählt Robert Hamerling,[11] „glaubte ich in seiner Tonsprache dem hellen Klangreize anderer Meister gegenüber etwas Herbes, Dumpfes zu finden, welches jedoch, sobald es nur vom rechten Geschick und Verständnis bewältigt war, in den süßesten Wohllaut sich auflöste. Vor allem will das Individuelle, Charakteristische des Tonstückes bei ihm erfaßt und festgehalten sein und aus diesem Grunde ist die Kenntnisnahme der Überschriften, die er über seine Werke setzt, für den vollen Genuß des Hörers so unentbehrlich, wie für den Vortrag. Was soll der Hörer von den Sprüngen des Harlekins denken, wenn er nicht weiß, daß es eben Harlekinssprünge sind.“ Als Gegensatz zu Mendelssohns ohrenfälligem Formenspiel wurde diese Musik vom Publikum anfangs mit der – gleichfalls unverständlich dünkenden – „Zukunftsmusik“ zusammengeworfen, wozu noch der Umstand beitrug, daß Brendel in seiner Zeitschrift die beiden Richtungen mit demselben Enthusiasmus verfocht. Schumanns Parteigänger protestierten entschieden, aber nicht ganz mit Recht gegen solche Beiordnung, denn thatsächlich finden sich zwischen ihm und der „Weimarer Schule“ gar viele und wichtige Berührungspunkte.
Beiden ist vor allem die geschichtliche Basis: Bach und (der letzte) Beethoven gemeinsam. „Das Tiefkombinatorische,[S. 89] Poetische und Humoristische der neueren Musik,“ bemerkt Schumann, „hat seinen Ursprung zumeist in Bach. Die sogenannten Romantiker stehen Bach weit näher als Mozart, wie ich selbst tagtäglich vor diesem Hohen beichte, mich durch ihn zu reinigen und zu stärken suche,“ und ein andermal gesteht er, daß ihn nur mehr „das Äußerste“ reize; „Bach fast durchweg, Beethoven zumeist in seinen späteren Werken.“ „Es ist wahr, zum Verständnis der Beethovenschen letzten Quartette gehört mehr als bloße Lust zum Hören. Der empfänglichste, offenste Musikmensch wird ungerührt von ihnen gehen, wenn er nicht tiefe Kenntnis des Charakters Beethovens und dessen späterer Aussprache mitbringt. Dann aber, ist er auf dem Wege dahin, so kann auch dem menschlichen Geiste kaum etwas Wunderwürdigeres geboten werden, als jene Schöpfungen, denen in ihrer tiefsinnigen Gestaltung, ihrem alle menschlichen Satzungen überschwebenden Ideenfluge von anderer neuerer Musik gar nichts und im übrigen nur einiges etwa von Lord Byron oder von Jean Pauls und Goethes späteren Werken verglichen werden kann.“ Die Tonkunst ist ihm „die veredelte Sprache der Seele; andere finden in ihr einen Ohrenrausch, andere ein Rechenexempel und üben sie in dieser Weise aus. Aber das wäre eine kleine Kunst, die nur klänge und keine Sprache noch Zeichen für Seelenzustände hätte!“ Auch die Lehre von der Einheit des Kunstgefühls, von der Urverwandtschaft der Künste läßt sich in Schumanns Schriften und Briefen nachweisen. „Die Ästhetik der einen Kunst ist die der anderen; nur das Material ist verschieden. Der gebildete Musiker wird an einer Rafaelschen Madonna mit gleichem Nutzen studieren können, wie der Maler an einer Mozartschen Symphonie. Noch mehr: dem Bildhauer wird jeder Schauspieler zur ruhigen Statue, diesem die Werke jenes zu lebendigen Gestalten; dem Maler wird das Gedicht zum Bild, der Musiker setzt die Gemälde in Töne um.“ Gleich den „Neudeutschen“ möchte sich Schumann vom partikularistischen[S. 90] Standpunkt des Musikers zum höheren, allgemeineren des „Künstlers“ schlechthin erheben. „Sieh dich tüchtig im Leben um, wie auch in anderen Künsten und Wissenschaften,“ ruft er dem Musiker zu und bekennt: „Es affiziert mich alles, was in der Welt vorgeht, Politik, Litteratur, Menschen; über alles denke ich nach meiner Weise nach, was sich dann durch die Musik Luft machen, einen Ausweg suchen will. Deshalb sind viele meiner Kompositionen so schwer zu verstehen, weil sie an entfernte Interessen anknüpfen, oft auch bedeutend, weil mich alles Merkwürdige der Zeit ergreift und ich es dann musikalisch aussprechen muß.“ Sogar was die Programmmusik anbelangt, stimmt er mit den Neudeutschen in der Kardinalfrage: nach ihrer Berechtigung überein. Er meint zwar einmal, es sei kein gutes Zeichen für ein Tonstück, wenn es der Überschrift bedarf; es wäre dann gewiß nicht der inneren Tiefe entquollen, sondern erst durch irgend eine äußere Vermittlung angeregt; und vom Programm einer Berliozschen Symphonie: „Ganz Deutschland schenkt es ihm; solche Wegweiser haben immer etwas Unwürdiges, Charlatanmäßiges.“ Doch stehen damit zahlreiche andere Aussprüche Schumanns in offenbarem Widerspruch, so daß es den Anschein hat, als sei er in dieser Frage nicht ganz schlüssig geworden. Man höre: Warum könnte nicht einen Beethoven inmitten seiner Phantasien der Gedanke an Unsterblichkeit überfallen? Warum nicht das Andenken eines großen gefallenen Helden ihn zu einem großen Werke begeistern? Warum nicht einen anderen die Erinnerung an eine selig verlebte Zeit? Italien, die Alpen, das Bild des Meeres, eine Frühlingsdämmerung – hätte uns die Musik noch nichts von diesem allen erzählt? Ja, selbst kleinere, speziellere Bilder können der Musik einen so reizend festen Charakter verleihen, daß man überrascht wird, wie sie solche Züge auszudrücken vermag. So erzählte mir ein Komponist, daß sich ihm während des Niederschreibens das Bild eines Schmetterlings, der auf einem Blatte im[S. 91] Bache mitfortschwimmt, aufgedrungen: dies hätte dem kleinen Stücke die Zartheit und Naivetät gegeben, wie es nur irgend das Bild in der Wirklichkeit besitzen mag.... Man irrt sich gewiß, wenn man glaubt, die Komponisten legen sich Feder und Papier in der elenden Absicht zurecht, dies oder jenes auszudrücken. Doch schlage man zufällige Einflüsse und Eindrücke von außen nicht zu gering an. Unbewußt neben der musikalischen Phantasie wirkt oft eine Idee fort, neben dem Ohr das Auge, und dieses, das immer thätige Organ, hält dann mitten unter den Klängen und Tönen gewisse Umrisse fest, die sich mit der vorrückenden Musik zu deutlichen Gestalten verdichten und ausbilden können. Je mehr nun mit der Musik verwandte Elemente die mit den Tönen erzeugten Gedanken oder Gebilde in sich tragen, von je poetischerem oder plastischerem Ausdrucke wird die Komposition sein und, je phantastischer oder schärfer der Musiker aufpaßt, um so mehr wird sein Werk erheben oder ergreifen. Daß sich Schumann zu seinen Symphonien durch äußere Momente anregen ließ, wurde bereits erwähnt, aber selbst in seine Kammermusikwerke spielen, wie es scheint, allerlei poetische Ideen hinein. Umgekehrt, und das ist das Entscheidende, genießt Schumann absolute Musik nicht rein musikalisch, sondern als Poet, als Künstler: „Ich kann nicht unterlassen anzuführen, wie mir einstens während eines Schubertschen Marsches der Freund, mit dem ich spielte, auf meine Frage, ob er nicht ganz eigene Gestalten vor sich sehe, zur Antwort gab: Wahrhaftig, ich befand mich in Sevilla, aber vor mehr als hundert Jahren, mitten unter auf- und abspazierenden Dons und Donnas mit Schleppkleid, Schnabelschuhen u. s. w. Merkwürdigerweise waren wir in unseren Visionen bis auf die Stadt einig.“ Verwahrte sich Schumann nicht ausdrücklich dagegen, so dürfte man ihn (mit Liszt) nach den Überschriften, die er seinen Tonstücken giebt, als Programmatiker betrachten; doch erklärt er zu wiederholten Malen, sie seien erst später ent[S. 92]standen und nur „feinere Fingerzeige für Vortrag und Auffassung.“ Mag dies nun für all seine Werke zutreffen oder nicht – jedenfalls ist Schumann, zwar kein Partner, wohl aber ein Vorläufer der „neudeutschen Schule“, das notwendige Mittelglied zwischen ihr und Beethoven.
Der Glaube, in welchem er komponierte, war der an die unversiegbare Kraft des deutschen Kunstgeistes: „Mir ist oft, als ständen wir an den Anfängen, als könnten wir noch Saiten anschlagen, von denen man früher noch nicht gehört.“ Auch der Hinweis auf die Zukunft kehrt bei Schumann häufig wieder, ja einmal sagt er gar: „Eine Zeitschrift für zukünftige Musik fehlt noch, als Redakteure wären freilich nur Männer, wie der ehemalige, blind gewordene Kantor an der Thomasschule (Bach) und der taube, in Wien ruhende Kapellmeister (Beethoven) passend.“ Aber gleich den Neudeutschen verwirft er bloße Nachahmung dieser verehrten Meister. Persönlichkeit scheint ihm nicht nur das „höchste Glück der Erdenkinder“, sondern auch die vornehmste Eigenschaft jedes wirklichen Künstlers. „Nenne mich beileibe nicht mehr Jean Paul den Zweiten oder Beethoven den Zweiten,“ schreibt er Klara; „da könnte ich dich eine Minute lang hassen. Ich will zehnmal weniger sein als andere, aber nur für mich etwas.“ Noch muß die nationale Tendenz Schumanns hervorgehoben werden, denn er ist eigentlich der erste Komponist, der sein Deutschtum stärker betont, der die Anlehnung an ausländische Muster geflissentlich vermeidet – ganz wie die Neudeutschen. „Die höchsten Spitzen italienischer Kunst reichen noch nicht an die Anfänge wahrhaft Deutscher,“ sagt er, ebenso überzeugungsvoll, als ungerecht, und die Fremdwörter, welche sich zu seiner Zeit auf Titeln und in den Vortragsbezeichnungen breit machten, auszumerzen, war sein eifrigstes Bestreben. Als Brendel bei der Übernahme der Zeitschrift die Absicht aussprach, sie in Zukunft mit lateinischen Lettern drucken zu lassen, protestierte Schumann sehr heftig dagegen und erklärte, daß[S. 93] er dann imstande sei, sie nicht wieder anzusehen. – Endlich hat Schumann mit den Neudeutschen die Doppelthätigkeit als Künstler und Schriftsteller gemeinsam. Bei ihm ist diese Vereinigung zweier Talente, wie Liszt vortrefflich ausführt, „noch durch das Verdienst erhöht, daß er nicht unbewußt dem Drange der Verhältnisse nachgab und, nachdem er diese erkannt, nicht erst die äußerste Notwendigkeit zum Handeln abwartete. Nicht zufrieden, für seine Idee, die damals ebenso wenig allgemein begriffen wurde, als sie es kaum in den nächsten Dezennien sein dürfte, zu eifern, zu predigen, zu arbeiten, zu kämpfen, setzte er für die erkannte Wahrheit Gut und Leben ein. Ein richtiger Blick ist zu allen Zeiten sein Vorzug, seine Kritik liefert ein schönes Beispiel eines prinzipiell strengen, faktisch wohlwollenden Geistes, der anspruchsvoll für die Kunst, nachsichtig gegen die Künstler ist, der gern aus seiner Heimat in den Wolkenschichten als freundlicher Gast in bescheidenen Niederungen einkehrt, dem Vielwollenden vieles verzeiht, redliche Gesinnung und beharrliches Streben ermuntert, sich mutig und voll Zorn gegen reiche Geister erhebt, die ihren Reichtum nicht zum alleinigen Nutzen der Kunst erheben wollen, der selbst im Tadel sanft gegen Schwache ist und im Lobe selbst gebieterisch gegen Erfolgreiche – ehrlich aber gegen alle.“ Schumanns unmittelbaren Schülern kann freilich der Vorwurf nicht erspart werden, die von ihm erlernte stilistische Gewandtheit mehr dazu benützt zu haben, ihren eigenen Witz auf Kosten des Kunstwerkes glänzen zu lassen, als es verständnisvoll und wohlwollend zu beleuchten; allein wer wird den Meister für die Verirrungen seiner Jünger zur Verantwortung ziehen? Er hatte fürwahr eine höhere Meinung von dem ehrwürdigen Amte der Kritik: „Thörichten, Eingebildeten schlägt sie die Waffen aus der Hand,“ sagt er, „Willige schont, bildet sie; Mutigen tritt sie rüstig freundlich entgegen: vor Starken senkt sie die Degenspitze und salutiert.“ Ferner: „Wir gestehen, daß wir für die höchste[S. 94] Kritik halten, welche durch sich selbst einen Eindruck hinterläßt, dem gleich, den das anregende Original hervorbringt. In diesem Sinne könnte Jean Paul zum Verständnis einer Beethovenschen Symphonie durch ein poetisches Gegenstück mehr beitragen, als die Dutzend-Kunstrichter, die Leitern an den Koloß legen, um ihn nach Ellen zu messen.“
Unter den zahlreichen, zum größeren Teile in die „Gesammelten Schriften“ aufgenommenen, kritischen Artikeln Schumanns haben namentlich zwei bedeutenden Einfluß auf den musikalischen Geschmack in Deutschland gehabt; der eine über Berlioz, worin er den Wert dieses zumeist als Halbverrückten behandelten Künstlers unbefangen aufdeckte, ist besonders in methodologischer Hinsicht von außerordentlicher Bedeutung und man hört es noch heute von Musikern, daß sie daraus mehr wirkliches und nützliches Wissen schöpfen, als aus den umfangreichsten Lehrbüchern musikalischer Gelehrsamkeit. In späterer Zeit wurde Schumann allerdings empfindlicher gegen das Bizarre, Extravagante in Berlioz’ Musik, doch blieb es immer sein Stolz, „mit der kritischen Weisheit nicht zehn Jahre hinterdrein gefahren zu sein, sondern im voraus gesagt zu haben, daß Genie in dem Franzosen gesteckt.“ Griepenkerls, von wahrem Fanatismus für Berlioz erfüllte Broschüre: „Ritter Berlioz in Braunschweig“, besprach er, trotzdem gegen ihn selbst polemisiert wurde, überaus freundlich und schloß mit den Worten: „Möge die kleine Schrift gelesen werden; sie enthält manch blitzenden Gedanken und konnte auf so vieles Unwürdige, Ignorantenhafte, was neuerdings über Berlioz geschrieben worden ist, gar nicht ausbleiben.“ Dem merkwürdigen Künstler aber schlage, was um ihn vorgeht, alles zum Besten aus, wie Goethe sagt im Tasso:
Ganz anders gestaltete sich hingegen das Verhältnis Schumanns zu einem anderen, nicht minder berühmten Pariser Musiker: Meyerbeer. Nicht als hätte er bei diesem das große Talent verkannt, aber sein unkünstlerisches Streben nach Effekt, die innere Hohlheit seiner Werke stieß den idealistischen, ehrlichen Deutschen ab. Bedenkt man das ungeheuere, durch die bezahlte Tagespresse erzeugte Ansehen, welches Meyerbeer genoß und seinen verderblichen Einfluß auf den öffentlichen Kunstgeschmack (es gab Leute, die ihn Mozart an die Seite stellten!), so muß Schumanns Artikel gegen „Die Hugenotten“ als eine nationale und künstlerische That bezeichnet werden. „Nie unterschrieb ich etwas mit so fester Überzeugung als heute,“ sagte er am Schlusse des Aufsatzes und auch späterhin ist er von seiner Meinung nicht abgekommen. Die erste, nicht günstige Kritik über „Tannhäuser“ scheint, wenigstens indirekt, Meyerbeer verschuldet zu haben, insofern, als Wagners offenkundige Beziehungen zu ihm, Schumanns Argwohn erweckten. Mit welchem Freimut er sein Urteil zurücknahm, sobald er sich von der Unbilligkeit des Tadels überzeugt hatte, hörten wir schon.
Sowohl durch seinen gewählten, reinen und graziösen Stil, als durch die treffende, harmonische Anwendung seiner Bilder gehört Schumann unbedingt zu den hervorragendsten Schriftstellern der dreißiger Jahre. Bis dahin hatte man in Deutschland selten Wissenschaftliches, Vernünftiges und Richtiges über Musik in einem blühenderen Stil als dem bei Lehrbüchern der Arithmetik gebräuchlichen vortragen gehört. Schumann vermied diese Trockenheit der Fachmenschen, die in so wenig anziehender Weise und immer nur vom technischen Standpunkt aus über Musik derartig gesprochen hatten, daß man leicht von ihr selbst hätte abgeschreckt werden können. Er wußte die Laien zu interessieren, denen bisher die musikalischen Zeitschriften meistens für zu viel Langeweile zu wenig Belehrung geboten hatten.
Wie Jean Paul die zwei kontrastierenden Seiten seines Wesens in „Walt und Wult“ verkörpert hat, so Schumann bekanntlich das Seinige in „Florestan und Eusebius“. In wie feiner Weise macht er sich nun diese Fiktion für seine Kritik zu nutze! Er stellt Florestan als Repräsentanten der abstrakten Kunst hin und Eusebius als das liebevoll auffassende Künstlergemüt und vermochte, indem er bald diesem, bald jenem das Wort erteilte, Doppelkritiken nach den bei der Beurteilung notwendigen zwei Gesichtspunkten zu geben. Noch mehr. Er gewinnt durch diesen Davidsbund auch eine prächtig sinnige Einkleidung für seine kritischen Aufsätze. Als er neu erschienene Tanzlitteratur zu besprechen hat, bedient er sich beispielsweise der Fiktion eines Maskenballes, welchen die Bündler veranstalten und wobei die zu besprechenden Stücke aufgespielt werden. Oder er berichtet über die Gewandhauskonzerte des Oktober 1835 in Form von Briefen, die Eusebius an Chiara (Klara) nach Italien schreibt. Auch recht lustige Episoden weiß er gelegentlich zu erfinden, so wenn bei einer von Franzilla Pixis gesungenen Donizettischen Arie „etwas sehr Nasses“ auf der Backe selbst des gestrengen Kunstrichters Florestan sichtbar wird. Daheim läuft er dann wütend auf und ab, vor sich hinsprechend: „O ewige Schande! O Florestan, bist du bei Sinnen, hast du deshalb den Marpurg studiert, deshalb das wohltemperierte Klavier seciert, kannst du deshalb den Bach und Beethoven auswendig, um bei einer miserablen Arie von Donizetti nach vielen Jahren so etwas wie weinen? Hätte ich die Thränen, zu nichts wollt’ ich sie zerkratzen mit der Faust!“ Darauf setzt er sich unter schrecklichem Lamentieren ans Klavier und spielt jene Arie so wirtshausmäßig, lächerlich und fratzenhaft, daß er endlich beruhigt zu sich sagen kann: „Wahrhaftig, nur der Ton ihrer Stimme war’s, der mir so ins Herz ging!“
Die Idee des Davidsbundes wurde von den Freunden Schumanns ehedem viel bewundert, ja, man dichtete aller[S. 97]hand Tiefsinnigkeiten in sie hinein. „Vor allem mahne uns dieser Name,“ kommentiert Wedel (Zuccamaglio), „an den ewigen, heiligen Bund der Dicht- und Tonkunst. Der Name des gekrönten Sängers, der nur in gottbegeisterten Liedern sich verewigte, deute uns immer das Verhältnis zwischen Kunst und Religion, erinnere uns, daß die Sprache einer Geisterwelt nicht herabgewürdigt werden darf, dem Niedrigen im Menschen zu schmeicheln und das Verwerfliche zu übergolden und zu verbrämen.“ Solche Gedanken lagen wohl Schumann ursprünglich fern. Er war, obgleich gut christlich gesinnt, doch eigentlich keine tief religiöse Natur. Das erklärt sich aus der Geistesrichtung der Periode, in welcher er lebte. Auch auf Unterschiede zwischen den christlichen Konfessionen zu halten, fiel ihm nicht ein, was schon durch den Umstand bewiesen wird, daß er, der doch Protestant war, 1852 für die katholische Kirche in Düsseldorf eine Messe und ein Requiem geschrieben hat.
Schließlich soll noch angeführt sein, daß Schumann in den Jahren 1837–39 darauf sann, dem nur in seiner Phantasie existierenden Bunde wirkliches Leben zu erteilen, einen großen, deutschen Künstlerbund zu begründen. Auch einen anderen derartigen Plan hegte er damals: die Errichtung einer Agentur zur Herausgabe von Musikwerken, „welche den Zweck hätten, alle Vorteile, die bis jetzt den Verlegern in so reichlichem Maße zufließen, den Komponisten zuzuwenden.“ Man sieht, auch an praktischen Vorschlägen ließ es dieser merkwürdige Geist nicht fehlen, so wenig er selbst darnach geschaffen war, sie in Wirklichkeit durchführen zu können. Immerhin muß man seinem richtigen, idealen Wollen die gebührende Anerkennung entrichten.
Robert Schumanns Leben und Schaffen, stellt es nicht treu die Eigenart seiner Zeit, des zweiten Drittels unseres Jahrhunderts dar? Es ist das Zeitalter erneuter Regsamkeit auf dem Gebiete der Kunst, der Wissenschaft und des öffentlichen Lebens. Überall zeigen sich Keime und Ansätze,[S. 98] viel Enthusiasmus und Fleiß, aber geringe Thatkraft. Es ist das Zeitalter politischer und geistiger Zersplitterung; aber auch der Vorbereitung auf die später gewonnene Einheit; und Schumann strebte weiter: nach Erfüllung wenigstens in der Kunst und setzte sein edles Leben vergebens daran. Erst das künftige Geschlecht sollte ernten, wo jenes gesäet hatte. Dank darum den emsigen Säeleuten und nicht zum mindesten fürwahr unserem Meister. Seine Werke aber mögen im deutschen Volke immer unvergeßlich bleiben!
[11] R. Hamerling, Prosa. Bd. 1: Meine Lieblinge (Hamb. 1891).
1. Numerierte Werke.
2. Unnumerierte Werke.
[12] op. 1–23, ausschließlich zweihändige Klavierwerke.
[13] Wo nichts weiteres angegeben ist, sind die Lieder einstimmig mit Begleitung des Pianoforte.
[14] Das Zeichen † bedeutet, daß die Entstehungszeit dieser, im Texte nicht weiter berührten Komposition nicht bekannt ist, zwei ††, daß das Werk aus mehreren zu verschiedenen Zeiten entstandenen Stücken besteht.
[15] Die Werke von op. 136 an sind erst nach Schumanns Tode erschienen.
Ende.
Musiker-Biographien
aus Reclams Universal-Bibliothek
Auber. Von Ad. Kohut. Bd. 17. Nr. 3389
J. S. Bach. Von Rich. Batka. Bd. 15. Nr. 3070
Beethoven. Von L. Nohl. Bd. 2. Nr. 1181/81 a
Bellini. Von Paul Voß. Bd. 23. Nr. 4238
Berlioz. Von Br. Schrader. Bd. 28. Nr. 5043
Bizet. Von Paul Voß. Bd. 22. Nr. 3925
Brahms. Von Richard von Perger. Bd. 27. Nr. 5006
Cherubini. Von M. E. Wittmann. Bd. 18. Nr. 3434
Chopin. Von E. Redenbacher. Bd. 30. Nr. 5327
Cornelius. Von Edgar Istel. Bd. 25. Nr. 4766
Franz, R. Von R. Freiherrn Procházka. Bd. 16. Nr. 3273/74
Gluck. Von Heinrich Welti. Bd. 9. Nr. 2421
Götz, Herm. Von G. R. Kruse. Bd. 36. Nr. 6090
Händel. Von Br. Schrader. Bd. 19. Nr. 3497
Haydn. Von Ludwig Nohl. Bd. 3. Nr. 1270
Liszt. 1. Teil. Von Lud. Nohl. Bd. 4. Nr. 1661
— 2. Teil. Von August Göllerich. Bd. 8. Nr. 2392/92 a
Loewe. Von M. Runze. Bd. 24. Nr. 4668
Lortzing. Von H. Wittmann. Bd. 11. Nr. 2634
Mahler. Von Arthur Neißer. Bd. 35. Nr. 5985/86
Marschner. Von M. E. Wittmann. Bd. 20. Nr. 3677
Mendelssohn. Von Bruno Schrader. Bd. 21. Nr. 3794
Meyerbeer. Von Ad. Kohut. Bd. 12. Nr. 2734
Mozart. Von Ludwig Nohl. Bd. 1. Nr. 1121
Rossini. Von Adolf Kohut. Bd. 14. Nr. 2927
Anton Rubinstein. Von Nic. D. Bernstein. Bd. 29. Nr. 5302
Schubert. Von A. Niggli. Bd. 10. Nr. 2521
Schumann. Von Rich. Batka. Bd. 13. Nr. 2882
Spohr. Von Ludwig Nohl. Bd. 7. Nr. 1780
Strauß. Von F. Lange. Bd. 31. Nr. 5462
Verdi. Von Max Chop. Bd. 32. Nr. 5595
Volkmann. Von Hans Volkmann. Bd. 33. Nr. 5753
Wagner. Von Ludwig Nohl. 2. Aufl. Bd. 5. Nr. 1700/1700 a
Weber. Von Ludwig Nohl. Bd. 6. Nr. 1746
Hugo Wolf. Von E. Schmitz. Bd. 26. Nr. 4853
Zelter. Von G. Rich. Kruse. Bd. 34. Nr. 5815
Näheres über Einbände und Preise enthält der neueste Katalog von Reclams Universal-Bibliothek
