
Title: Mein kleiner Chinese: Ein China-Roman
Author: Alma M. Karlin
Illustrator: August Friedrich Seebacher
Release date: January 13, 2021 [eBook #64283]
Most recently updated: October 18, 2024
Language: German
Credits: the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net
Ein China-Roman
von
A. M. Karlin
Mit 6 Federzeichnungen

1921
Verlag Deutsche Buchwerkstätten
Dresden
Alle Rechte, insbesondere das der Uebersetzung, vorbehalten
Copyright 1921 by Verlag Deutsche Buchwerkstätten Dresden
Gedruckt bei H. B. Schulze, Dresden
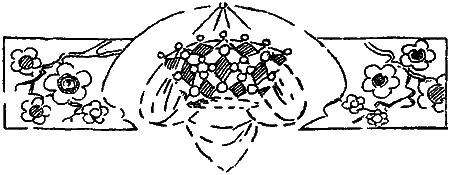
| East is East, and West is West, |
| but the two can never meet. |
| Rudyard Kipling. |
I.
Lieber Leser! Da die ganze Geschichte mit der ich dich hier zu langweilen beginne, von meinem kleinen Chinesen und – von mir selbst handelt, wirst du wissen wollen, wo ich zu Hause bin, wie ich heiße, vielleicht sogar wie ich aussehe. Ich komme daher deinen Fragen zuvor und gebe die gewünschten Aufklärungen. Meine Heimat liegt irgendwo zwischen der malerischen Küste der ewig blauen Adria und dem Pommerland. Dort nenne ich ein Stück Land von der Größe eines Schnupftuchs, einen Hund, der nach Aussage böswilliger Zungen eine Kreuzung aller kleineren Hunderassen sein soll und dessen Rute dieselben heimtückischen Verleumder der überraschenden Aehnlichkeit halber mit dem geringelten Schweiferl eines Schweines vergleichen, eine blauäugige Angorakatze, eine Schildkröte, drei Kanarienvögel, die ich sämtlich als Männchen kaufte und die sich unbegreiflicherweise bei mir in Weibchen verwandelten, einen Igel, eine alte Henne und eine Anzahl Küchenschabeneinwanderer mein eigen. Mein Name – lieber Leser erschrecke nicht! – ist Katherina Schulze. Mama nennt mich Ina, weil dies ein wenig aristokratisch klingt, meine Schwester Jenny ruft mich Käthe, doch in vertraulichen Momenten immer nur Kater, wogegen ich mich schon oft energisch aufgehalten habe. Umsonst! Jenny behauptet, daß wir zusammenpassen wie der Schuh zum Stiefelknecht. Meine Verwandten bezeichnen mich als den »verlorenen Sohn«, obschon ich taufscheinlich nachgewiesen eine Tochter bin, und dies einzig und allein, weil ich die oben angeführten Reichtümer schnöde verlassen habe, um in der Fremde an Alter und Weisheit zuzunehmen.
Man sagt: »Jung war der Teufel sauber« und jung war ich natürlich auch einmal, und das ist wohl der einzige Anspruch, den ich auf Schönheit machen konnte. Leser, nun weißt du alles! Wie ich bin und wie es mir erging, wirst du erfahren, wenn du dich bemühen willst, mich auf meiner Reise durch das Reich der Vergangenheit zu begleiten.
Dem Kühnen gehört die Welt, das habe ich mir immer vorgehalten. Wer nicht über die engen Grenzen des ihm ursprünglich eingeräumten Horizonts hinauszudringen versucht, wer nie in die Tiefen des Lebens hinabsteigt, und wer nie die Erde verläßt, um im Geiste höhere und reinere Regionen zu durchschweben, der hat zwar auch gelebt, aber doch nur wie eine Seidenraupe in ihrem Kokon. Leben ist die Erforschung des noch Unbekannten. Das kleine Kind, das zum erstenmal auf allen Vieren um den Tisch kriecht, erforscht die Welt ebenso sorgfältig und bereichert sein Wissen verhältnismäßig ebensosehr, wie der große Gelehrte, der seine Forschungsreise um den größeren Tisch, die Erde, macht. Das Erforschen bringt aber auch oft Gefahren mit sich – so ein auf allen Vieren gemütlich hinkriechender Forscher kann auf eine im Teppich verborgene Schere stoßen, kann seine Händchen und Beinchen in allerlei unliebsame Berührung mit Ecken und Kanten bringen, kann seine Weichteile mit Näh- und Stecknadeln spicken, sich die Stirn gegen manch ein unvorhergesehenes Hindernis schlagen, kann plötzlich durch einen herabfallenden Gegenstand unsanft getroffen, kann sonst noch von unzähligen Abenteuern und Leiden heimgesucht werden, und dem Forscher, der gelernt hat sich seiner zwei Beine statt der ursprünglichen vier Körpervorsprünge oder Auswüchse zu bedienen, ergeht es oft auch nicht um ein Haar besser, mit dem einzigen Unterschied, daß bei ihm nicht nur der Körper, sondern auch noch Geist und Charakter in Mitleidenschaft gezogen werden. Das muß nun freilich in den Kauf genommen werden, denn wie gesagt: Wer nichts wagt, gewinnt nichts.
Ich selber bin das menschgewordene Fragezeichen, wenn es sich um neue Dinge handelt, vorausgesetzt, daß diese nicht die Mode betreffen, denn gegen Erörterungen dieser Art habe ich eine unüberwindliche Abneigung. Diesem Triebe meines Wesens, immer neue Sachen kennenlernen zu wollen, verdanke ich die schönsten und auch die bittersten Stunden meines Lebens, denn wurde ich für meine Bemühungen oft reich belohnt, so blieb mir andrerseits Leid häufig nicht erspart.
In den drei Jahren, während denen ich ähnlich unserem Freund Ahasverus von Ort zu Ort gezogen bin, habe ich vieles Schöne in mich aufgenommen, viele Nationen und Rassen kennengelernt und die Verschiedenheiten ihrer Charaktere und Anschauungen mit großem Interesse studiert. Durch das Geschick begünstigt, dem ich durch meine Beharrlichkeit nachhalf, lernte ich Japaner und Indier kennen, von denen ich viele aufrichtig bewunderte, obschon sie oft sehr – aber sehr – verschieden von uns waren.
Da ich auch Neger mit Lippen wie die einladendsten Frankfurter Würstel kannte, dachte ich mir mit Recht, daß ich alles aufbieten müsse, um auch noch Chinesen in den Kreis meiner Bekannten einzureihen, auf daß diese mit ihrer uralten Kultur mir neue Horizonte eröffnen würden.
Für mich ist ein gefaßter Entschluß auch schon Tat. Nicht zehn Minuten später warf ich einen Brief an den Sekretär eines chinesischen Studentenvereins in den roten Schlund eines einladenden Londoner Briefkastens.
Ich hatte den Sekretär ersucht, die Mitglieder des Vereins zu fragen, ob jemand geneigt wäre, eine moderne Sprache in Austausch für Unterricht im Chinesischen zu lernen. Glücklicherweise hatte ich eine gute Auswahl Sprachen auf dem Lager.
Als ich am folgenden Tage, einem Sonnabend, um zwei Uhr vom Amt heimkehrte, lag ein Brief für mich auf dem Hutständer in der Halle. Ich riß ungestüm den Umschlag auf und hatte die Genugtuung, zu lesen, daß ein gewisser, hochbegabter Chinese namens Hoang-Zo sich zum Tausch bereiterklärte, da er italienisch lernen wollte. »Du bist doch ein ganzer Kerl, Katherina Schulze!« sagte ich mir. »Jetzt hast du sogar einen Chinesen – leider wahrscheinlich nur einen unbezopften, was natürlich den Wert verringert, aber immerhin einen waschechten Chinesen erangelt.« Die Adresse des unvergleichlichen Studiosus lag bei.
Allerdings war ein Wermutstropfen in dem Nektar – der Sekretär redete mich mit »Herr« an, und ich fürchtete nun, daß der angehende Gelehrte mir den Laufpaß geben würde, sobald er sich über mein Geschlecht im klaren war. Hoffend, daß der Einfluß des Westens die angeborene und anerzogene Verachtung der Weiber einigermaßen gemildert hatte, teilte ich ihm nebst meinen Freistunden auch die bedauerliche Tatsache mit, daß mich die Sünden in meiner vorigen Inkarnation dazu verdammt hatten, in der gegenwärtigen als Mädel herumzulaufen, und bat ihn gleichzeitig, von dieser traurigen Verwandlung keine weitere Notiz nehmen, sondern mich ganz als Mann betrachten zu wollen.
Die Antwort ließ nicht auf sich warten – er vergab mir großmütig mein Geschlecht und versprach, mich um drei Uhr nachmittags zum Tee abzuholen. In England ist es Brauch und Sitte, daß ein Herr eine Dame zum Tee einlädt, den er mit ihr in irgendeinem der zahlreichen, oft sehr hübschen Teehäuser, wo möglicherweise sogar die Musik spielt, einnimmt. Aber ich hatte damals noch einige verzopfte Ideen aus der Heimat mit, denen zufolge man nie etwas von einem Mann annehmen darf, wenn er nicht weißes Haar oder eine Frau mit mindestens sechs Kindern, womöglich gar beides hat, und ich wußte mit Bestimmtheit, daß Mr. Hoang-Zo kein weißes Haar hatte. – Die Frau mit den sechs Kindern konnte er nun freilich haben, da man in China oft schon mit 15 Jahren heiratet, aber andrerseits konnte ich nicht gut unsre Bekanntschaft mit der heiklen Frage eröffnen:
»Bitte, wie viele Kinder haben Sie schon?«
Zur festgesetzten Stunde klingelte es. Ich öffnete selbst und nicht ohne gehöriges Zähneklappern die Tür, da meine Hausfrau, eine mit Speck und Kindern reich gesegnete Italienerin, immer eine Viertelstunde brauchte, bevor sie aus den unteren Küchenregionen angepustet kam. Vor mir stand ein bartloser junger Mann, etwa einen halben Kopf größer als ich selbst (mich hat der liebe Herrgott sehr kurz zugeschnitten), von blaßgelber Gesichtsfarbe, etwa wie eine im Eintrocknen begriffene Zitrone, die in der Farbennuance zwischen gelb und braun schwankt, mit merkwürdig zwinkernden Augen – eine Folge sehr großer Kurzsichtigkeit –, die mich durch festsitzende Augengläser musternd betrachteten, und über die sich kaum sichtbar schwach gezeichnete Augenbrauen wölbten. Nase hatte er keine, besser gesagt keine vollständige Nase nach europäischen Begriffen, da die beiden geschlitzten Augen nicht durch ein kleines Vorgebirge getrennt, sondern durch eine Tiefebene verbunden waren. Ihm einen Zwicker anzutragen, wäre die bitterste Ironie gewesen. Sein Lächeln dagegen, das zwei Reihen kleiner, schneeweißer Zähne sehen ließ, war äußerst gewinnend, wenn es auch, wie ich später lernte, nur selten aufrichtig gemeint war.
»Mister Hoang-Zo?« sagte ich, indem ich die Tür hinter mir ins Schloß fallen ließ.
Er verbeugte sich leicht und nannte meinen Namen. Seite an Seite schritten wir dahin, und ich kam zu der Ueberzeugung, daß Chinesen nicht so sehr verschieden von anderen Sterblichen waren, besonders wenn sie in europäischer Kleidung waren und keinen Zopf trugen.
In Russell Square fanden wir eine Teestube und saßen bald gemütlich, von Kuchen umgeben, in einer Ecke, während vor uns der Tee aus der braunen Kanne dampfte. Eigentlich war es meine Aufgabe als Dame, den Tee einzuschenken, aber ich war froh, daß er mir diese Arbeit abnahm, und fand es auch ganz in der Ordnung, daß er sich an die chinesische Sitte hielt und sich immer zuerst bediente.
Alle Scheu war unglaublich rasch von mir gewichen. Ich hatte das Empfinden, als wären wir alte Bekannte, und als ich dessen erwähnte, entgegnete er lächelnd, daß wir uns wahrscheinlich in der vorigen Inkarnation schon gekannt hätten, was mich innerlich wundern machte, ob ich vielleicht einst ein Chinese gewesen.
Wir sprachen über die Philosophie des Weisen Konfuzius, über die Lehren des Taoismus, über den großen Denker Chuang-Tse, über die Verschiedenheit in den philosophischen Anschauungen des Ostens und des Westens, über das Für und Wider der Unsterblichkeit der Seele und ähnliche Fragen, die mich außerordentlich interessierten und über die er glänzend sprechen konnte. Sein Englisch war beinahe akzentfrei und seine Konversation verriet umfassendes Wissen nebst scharfer Urteilskraft.
Endlich wurde beschlossen, daß ich jeden Sonntag nachmittag zu ihm kommen würde, wo er von mir italienisch, ich von ihm chinesisch lernen wollte. Darauf reichten wir uns wie uralte Freunde die Hände, ich dankte noch einmal für den Tee und den in Aussicht gestellten Unterricht, und so schieden wir.
| »Wenn du nehmen willst, |
| mußt erst du geben.« |
| Lao Tse. |
II.
Ausgerüstet mit einem gelben Heft – die passendste Farbe für Notizen auf Chinesisch – stand ich am folgenden Sonntag pünktlich wie der Tod beim dritten Glockenschlag außerhalb der kleinen Cottage in Highbury, wo Mr. Hoang-Zo zurzeit wohnte. Auf meinen Druck auf die elektrische Klingel kam niemand, als ich aber den Türklopfer mehreremal unsanft auf die Bronzeplatte fallen ließ, erschien eine weißbeschürzte Fee, die mich eine teppichbelegte, sehr schmale Treppe hinaufgeleitete und mich in ein Zimmer schob, an dessen Tür sie zweimal vergeblich gepocht hatte.
»Mister Hoang-Zo wird gleich kommen,« versicherte sie mir, und damit verschwand sie, wahrscheinlich, um ihn zu suchen. Ich benützte die Gelegenheit und ließ meine Blicke durch den kleinen und oberflächlich möblierten Raum schweifen, der jedenfalls einen Salon vorstellen wollte – beim Wollen blieb es indessen. Was aber auf mich einen so überaus anheimelnden Eindruck machte, das war keineswegs die Aussicht auf einen kleinen Garten mit einigen Obstbäumen ohne Obst, sondern die geradezu beispiellose, künstlerische Unordnung, die mir sofort kundtat, daß Mr. Hoang-Zo eine mir verwandte Seele war, denn was Unordnung anbelangt, so kann ich darin Erstaunliches leisten. Bücher lagen auf und unter dem Tische, auf dem Kaminsims, auf dem Fensterbrett, auf den Gestellen, auf den halbgeöffneten Koffern und Kisten, hinter den Stühlen und auf denselben. Bücher und Papiere sahen neugierig aus den halbgeschlossenen Laden, grüßten freundlich hinter der verstaubten Kohlentrommel hervor und fielen bei der geringsten Erschütterung des Terrains dem Eintretenden einladend zu Füßen. Tonangebend waren vor allem und überall Bücher, aber hie und da wurde die übergroße Weisheit wohltuend durch ein Paar Hosen oder ein Paar Schuhe abgeschwächt.
Als sich meine Augen genugsam an diesem seltenen Bilde geweidet hatten, kam Hoang-Zo, dem es augenscheinlich nicht behagte, daß meine Augen soeben mit Interesse ein Taschentuch betrachteten, das aus unbekannten Gründen zum Tintenwischer erniedrigt worden war.
»Ich weiß nicht, wie lange ich hierbleiben werde,« sagte er schnell, »und daher habe ich auch nicht auspacken wollen.«
Ich konnte ihm nachfühlen – ich selbst packte auch nie aus, sondern fischte im Koffer so lange herum, bis das Unterste nach oben kam und ich das augenblicklich Gewünschte erschnappt hatte.
Sowohl als Lehrer als auch als Schüler war er musterhaft. Er faßte sehr schnell auf, erriet die Bedeutung unbekannter Worte aus dem Zusammenhang, las mit Aufmerksamkeit und lehrte mich mit Geduld und viel Geschick.
Zwischen den beiden Stunden brachte die Dienerin jedesmal den Tee, und Hoang-Zo forderte mich auf, daran teilzunehmen. – Er schien die Lage der chinesischen Frauen für gar nicht so schrecklich zu finden als sie uns hier dünkt. Heutzutage gab es viele Schulen für Mädchen, die Füße wurden ihnen nicht länger verkrüppelt, sie lernten oft sogar fremde Sprachen und wurden, seiner Ansicht nach, von den Gatten gut behandelt.
»Wirklich?« fragte ich etwas ungläubig.
»Gewiß,« entgegnete er. »Auch der chinesische Gatte liebt seine Frau, aber allerdings ist uns Ritterlichkeit gegen die Anhängerinnen des zarten Geschlechts unbekannt,« fügte er hinzu.
Als dieses Gespräch stattfand, mochte ich etwa drei oder vier Wochen seine Schülerin gewesen sein. Ich dachte einige Augenblicke über seine Bemerkung nach und sagte dann aus der Tiefe meiner Ueberzeugung heraus:
»Ja, es muß schrecklich für eine Europäerin sein, sich in diese Verhältnisse einzuleben,« und mit einem entschuldigenden Lächeln für unsere Schwäche fügte ich hinzu: »Wir sind so gewöhnt, daß ein Mann uns mit dem Anlegen eines Mantels hilft, uns die Tür öffnet und so weiter, obschon wir es ja ebensogut selbst tun könnten.«
»Das ist selbstredend Ansichtssache,« meinte er.
Als es Zeit zum Aufbruch wurde, war ich überrascht, zu bemerken, daß er mir in den Regenmantel half und mir die Tür angelweit aufriß. Erst als ich wieder auf der Gasse stand, erinnerte ich mich meiner unbedachten Worte und ärgerte mich, daß ich, ohne zu wollen, etwas gesagt hatte, was er möglicherweise als eine Zurechtsetzung empfunden. Ich nahm mir vor, in Zukunft besser aufzupassen.
Da ich den Vorzug hatte, sehr viele nette Asiaten – zumeist Indier und Japaner – zu kennen, fragte ich ihn eines Tages in der Teepause, wo sich unsere Konversation um alles erdenkliche drehte, ob er eine Ehe zwischen Asiaten und Europäern für angezeigt hielt.
»Zwischen den südlicheren Nationen Europas und Chinesen dürfte es ratsam sein, da sowohl der Charakter als auch das Aeußere – die dunklen Augen, das dunkle Haar und der dunklere Teint – mehr zusammenpassen. Mit Germanen, Skandinaviern oder Engländern wäre dies indessen weniger angezeigt, da Kinder solcher Ehen oft ein unangenehmes Aussehen haben – sehr oft grellrotes Haar und wasserblaue Augen zu einem dunklen Gesicht,« entgegnete er mit seinem unergründlichen Lächeln, von dem ich nie wußte, ob es Spott, Wohlwollen oder herablassende Nachsicht ausdrücken sollte.
»Und sind solche Ehen glücklich?« fragte ich und sperrte meine Augen erwartungsvoll auf.
Wieder spielte das geheimnisvolle Lächeln um seinen bartlosen Mund.
»Das kann ich leider nicht sagen – ich war noch mit keiner Europäerin verheiratet und glaube überhaupt, daß es schwer ist, glücklich zu werden – für manche Charaktere wenigstens,« fügte er nachdenklich hinzu.
»Der Mensch betrachtet wohl alle Mädchen als eine unnütze Last der Erde,« dachte ich mir, als ich mich wieder über das gelbe Heft neigte und langsam buchstabierte:
»Ni s' Tsungo jen,« was »Sie sind ein Chinese« bedeuten soll.
Wenn ich damals gewußt, wenn ich nur entfernt geahnt hätte – aber die Binde der Unwissenheit verhüllte meinen Geist, und noch jetzt glaube ich, daß es ein Segen war.
| ›Verlassen, verlassen, verlassen bin i!‹ |
| (Oesterreichisches Volkslied.) |
III.
Hoang-Zo war nach Paris gereist, wo er einige Wochen studieren wollte, und wo er sich um die Braut eines nach China zurückgekehrten Freundes zu kümmern hatte. Er schrieb mir einige sehr humoristische Karten, aus welchen keineswegs allzu großes Entzücken hervorklang, stellte seine Ankunft in London um Mitte November fest und empfahl mir mehrere gute Werke über die Philosophie des Ostens.
Auch für mich hatten die Winterfreuden meines Exils begonnen. Ein ganz besonders nebelreicher Herbst war angebrochen, und in den Zimmern war es so ungemütlich wie nur möglich.
Ich war in den verschiedensten Boarding-Houses gewesen, aber nachdem ich allerlei schlechte Erfahrungen bezüglich Gesellschaft und Kost gemacht, entschloß ich mich, nur ein Zimmer zu mieten und mich selbst zu beköstigen. Im Anfang verlegte ich mich, da ich im glücklichen Besitze eines Spiritusherdes war, auf so hochgehende kulinarische Leckerbissen wie Makkaroni, aber da diese die leidige Angewohnheit hatten, gerade wenn ich mit etwas anderem beschäftigt war, über den Rand der Pfanne zu gucken und Ausflüge auf den Boden zu machen, und weil sie andrerseits sich oft darauf steiften, daß ein Teil von ihnen hart blieb, der andere aber höchst zuvorkommend schon zerfiel, bevor er den Teller erreichte, gab ich es auf. Ich versuchte es mit Eiern, und auch da war alles »gut Glück« und nicht Wissen. Am sichersten waren hartgesottene Eier, denn wenn sie einmal hart waren, konnten sie natürlich nicht weicher werden, aber die weichgekochten und von mir vorgezogenen Eier, die waren eine Quelle der Enttäuschung für mich. In die große Pfanne, ich hatte nur eine, da ich als »ewiger Jude« nicht eine Kücheneinrichtung mit mir schleppen wollte, gingen sie sehr gut, aber heraus wollten sie nicht. Ich fischte und fischte mit dem Teelöffel nach dem Ei, meist so lange, bis das Ei hartgesotten war, einmal mit dem Erfolg, daß ich es wirklich herausbrachte und sogar mit Schwung an mir vorbei und auf den Boden, wo es sich als Eierspeise servierte, und beim letzten Male meiner Eierkochversuche sprang das Ei davon, das siedende Wasser über meine Hände und Kleider und die treulose Pfanne auf meine Füße, während der Spiritus in voller Flamme diese Gelegenheit benützte, sich an meinem Rockzipfel schadlos zu halten. Ich schrie wie am Spieß und habe seit jener Zeit nur mehr Tee gekocht. Dabei wagt man wenigstens nicht sein Leben.
Um auf die Wärmevorrichtung meines Gemachs (Loch scheint mir indessen zutreffender) zurückzukommen. Ich hatte einen offenen Kamin in meinem Zimmer, wie sie in England gang und gäbe sind, an welchem man sich auf der einen Seite rösten kann und auf der anderen erfriert, ausgenommen man dreht sich wie ein Kreisel die ganze Zeit um die eigene Achse. Als ich jedoch die ersten Heizversuche unternahm, bemerkte ich zu meiner Freude, daß eine dichte Rauchwolke die Luft verpestete, und als meine Rufe die dicke Hausfrau alle Stockwerke heraufgebracht hatte, erklärte sie mir mit dem Gleichmut, der diese Klasse weiblicher Wesen auszeichnet, daß sich der Kamin nur heizen ließe, wenn der Wind aus einer bestimmten Richtung bliese. Die für ihn passende Richtung habe ich nie herausgefunden – wahrscheinlich ist sie in der Windrose nicht zu entdecken. Sie tröstete mich damit, daß der Rauchfang des Hauses an meiner Wand vorübergehe und ich es daher immer hübsch warm haben werde. Hübsch hatte ich es dort nie, und warm noch weniger, aber im weitesten Sinne hatte sie recht. Dank dem Schornsteine und dem milden englischen Klima überstand ich den Winter lebendig, aber man darf sich nicht wundern, wenn ich unter solchen Umständen alles aufbot, so wenig wie möglich daheim zu sein. Scherzend sagte ich oft zu meinen Kollegen:
»Wenn ich nicht eine so große Abneigung gegen das Heiraten hätte, würde ich mir wirklich einen Mann nehmen, um eine Häuslichkeit zu haben.«
»Und wer würde kochen?« fragten sie mich.
Ich dachte an meine mißglückten Kochversuche und meine Abneigung gegen derlei Beschäftigungen.
»Und Strümpfe stopfen und so weiter?«
»Auch er,« entgegnete ich lachend.
»Und Geld verdienen, wer soll das?«
»Ich!« Dazu allein war ich gern bereit. Ich verdiente sehr viel mit meinen Sprachkenntnissen – ihnen verdankte ich auch meine Anstellung beim Amt –, aber für andere Sachen war ich so untauglich wie möglich. In meinen Interessen, meinen Fähigkeiten, meinen Tugenden und meinen Untugenden war ich Mann – meine Kleidung und mein Körperbau verdammten mich zur Mädchenexistenz mit allen ihren Schattenseiten. Das war auch der Hauptgrund meines freiwilligen Exils. Mama und Jenny konnten mich nicht verstehen, und erstere sagte immer:
»Du bist so ganz anders wie alle anderen Mädchen!«
Jenny konnte sich vor dem Spiegel drehen, konnte an einer Schleife fünf Minuten lang zupfen, um sie in die vorteilhafteste Lage zu bringen, konnte das schönste Buch aus der Hand werfen, sobald das neue Modeblatt gebracht wurde, und fand nichts ergötzlicher, als im Stadtpark zu den Klängen der heimischen Kapelle im besten Kleide auf und ab zu gehen und allen Leuten zuzunicken, – dem ein wenig tiefer und diesem etwas oberflächlicher, dieser Dame mit einem Lächeln und jenem Herrn mit Grabesmiene, ganz wie Mama es vorgeschrieben hatte. Mir kam nichts geisttötender vor.
Oder wir gingen ins Theater. Um drei Uhr nachmittags verschwanden Mama und Jenny vollständig von der Erdoberfläche, und um sieben Uhr kamen sie, zwei schöne, sehr geschmackvoll frisierte und tadellos gekleidete Damen, jede mit einem Triumphlächeln auf den Lippen, zu mir ins Zimmer, aber ein Blick auf mich ließ sie beinahe bewußtlos werden, und ich bin überzeugt, daß nur der Gedanke an die große Arbeit bei ihrer vierstündigen Vorbereitung sie davor rettete.
»Käthe!!! Du bist ja noch nicht angezogen!« rief Mama, als ob die Welt aus den Angeln gegangen wäre.
»Ich gehe, wie ich bin,« erwiderte ich ruhig.
»Ein junges Mädchen in dunkler Seidenbluse – unmöglich!« warf Mama ein.
»Warum nicht?« fuhr ich gelassen fort. »Mir steht dunkelblau besser als alle die allzu lichten Farben, und ich fühle mich wohler darin.«
»Käthe,« mischte Jenny, damals kaum fünfzehn Jahre alt, in das Gespräch, »ich will nicht mit dir gehen, wenn du nicht anders gekleidet bist.«
Oft blieb ich nach solchen Auftritten zu Hause, da mir alle Lust an der Aufführung vergangen war. Manchmal kleidete ich mich verdrießlich in irgendeine dreifarbige, meiner Ansicht nach geschmacklose Bluse, zuzeiten ging ich wie ich war und ließ die beiden schimpfen, aber da ich mir wohl bewußt war, wie wenig ich in den heimischen Rahmen paßte, und da ich mich daheim ebenso einsam fühlte, wie später in der kalten, weiten Welt, so habe ich nie bedauert, den Flug in die Welt begonnen zu haben.
Ich habe einzig verstehen gelernt, daß Männer, die ihr Leben lang als Junggesellen herumgewandert sind, eine Häuslichkeit als Krone des Glücks betrachten, und nicht umsonst, wahrlich nicht umsonst! Aber um ein vollkommenes Bild, eine seelisch schön abgetonte Wiedergabe eines Menschen zu geben, bedarf es nicht nur eines Rahmens, meinetwegen eines reichen Rahmens – nein, es ist nötig, daß der Rahmen paßt, daß er das Bild hervortreten läßt und es nicht zur Fratze herabstimmt. Durchschnittsmenschen schaffen sich leicht einen passenden Rahmen oder passen auch schnell in irgendeinen Rahmen hinein, die anderen, doch – ich will nicht philosophieren.
Der Monat November sowie der zurückgekehrte Chinese Hoang-Zo fanden mich tief in allen Winterwiderwärtigkeiten steckend, die durch die Tatsache, daß der junge Gelehrte jetzt keine Zeit hatte, die Stunden fortzusetzen, wahrlich nicht vermindert wurden. Eines Abends, als wir uns im Nebelmeer begegneten, fragte er mich, ob ich nicht so freundlich sein wollte, einen jungen Chinesen – kaum ein- oder zweiundzwanzig Jahre alt – als Schüler für Deutsch und Französisch zu übernehmen. Ich willigte sofort ein – war nicht alles besser als das fürchterliche Daheimsitzen in einem kalten, ungemütlichen Zimmer?
»Er ist aber sündhaft dumm!« sagte Hoang-Zo, »und ich muß Sie bitten, eine Bezahlung für die Stunden anzunehmen, denn an einen Austausch ist bei dem Menschen nicht zu denken. Eigentlich schäme ich mich,« fuhr er fort, »Ihnen so ein trauriges Exemplar meiner Landsleute zu überlassen, aber Sie scheinen mir besonders geeignet, ihm etwas beizubringen – wenn sich ihm etwas beibringen läßt,« setzte er bekümmert hinzu.
»Wir können es ja versuchen,« erwiderte ich lächelnd. Wir bestimmten daher die Preise, und nur wenige Tage später erhielt ich einen mit Fehlern gespickten Brief meines neuen Schülers, der mir seinen Besuch für den darauffolgenden Sonntag in Aussicht stellte.
Der Sonntag kam und ging, ohne Mr. Ming Tse zu bringen, wohl aber fand ich Montag früh eine Karte vor, auf der er sich entschuldigte und mir versicherte, die Gasse nicht gefunden zu haben.
»Findet das Hascherl nicht einmal eine Gasse wie Guildford Street!« Ich seufzte unwillkürlich auf. Und so einem Menschen sollte ich mit dem Nürnberger Trichter die Weisheit einpumpen – gewiß ein recht zweifelhaftes Vergnügen.
Der zweite Brief oder besser die zweite Karte war von Hoang-Zo. Er bat mich, seinem Schützling Montag abend die erste Stunde zu geben und fügte hinzu, daß Ming Tse kaum fünf Minuten von der Endstation der Hampstead Elektrischen wohne. Name der Gasse und Hausnummer ersah ich aus Mr. Ming Tses Karte.
| »Our deeds our angels are, or good or ill, |
| Our fatal shadows that walk by us still.« |
| Beaumont & Fletcher. |
IV.
Es war ein feuchtkalter Wintertag. Seit einer Woche hatte Sankt Peter die Schleusen des Himmels geöffnet, und heute hatten wir nebst feinem, durchdringendem Regen auch noch einen jener berüchtigten Londoner Nebel, der schon lange, bevor es Nacht wurde, alle die triefenden Häuser und die schmutzbedeckten Gassen den Blicken der Menschheit entzog. Selbst die Elektrische, in der ich saß, schien mir trotz der vielen Beleuchtungskörper düster, da der Nebel sich in großen Wellen durch den langen Wagen dahinrollte, voll unerlaubter Neugierde bei Mund, Nase und Ohren in das Innere der Reisenden hinabkletterte, sich zärtlich an den weißen Halskragen und die tadellosen Manschetten der Zylinder tragenden Herren schmiegte und das ursprüngliche Weiß meiner Bluse in ein bescheidenes Grau verwandelte.
»Hampstead!« rief der Schaffner vom anderen Ende. Mit einem Ruck riß ich meine Habseligkeiten – zwei Bücher und die Handtasche – an mich und stürzte mich kühn in die auf und nieder wogenden Nebelfluten, die mich schon nach wenigen Augenblicken vollständig verschlangen.
Die Gasse – das Endziel meiner Wanderung – war die zweite zu meiner Rechten und führte steil abwärts. Der gedämpfte Schein einer Straßenlaterne ließ mich wohl die Vorgärten der Villen unterscheiden, doch wäre es eine Unmöglichkeit gewesen, die Hausnummer abzulesen. Ich öffnete daher eine der kleinen Gartenpforten und ging dicht an das Haus heran, um die Nummer auf der erleuchteten Scheibe der Haustür entziffern zu können.
»Nummer 22,« sagte ich halblaut, ging zurück und schloß die Pforte wieder, dann tastete ich mich vorsichtig an den Vorgärten entlang und zählte die Nummern, bis ich Haus 18 erreichte.
Während ich unter der Loggia stand und wartete, daß mein Klingelzeichen irgend jemand zur Tür brachte und ich das Muster auf der Glasscheibe – Pfirsichblüten und Früchte – studierte, war mir doch etwas ängstlich zumute. Den ersten Chinesen hatte ich um drei Uhr nachmittags an einem klaren Sommertage kennengelernt, jetzt war es Abend, Winter und – ich schüttelte das unangenehme Gefühl ärgerlich ab. Der neue Schüler sollte ja noch ein wahres Kind sein, und ein Kirchenlicht war er entschieden nicht, wenn also jemand zittern sollte, so war es gewiß er und nicht ich.
Die Tür wurde von einem Stubenmädchen geöffnet, und ich drückte die Bücher unwillkürlich fester an mich, als ich fragte:
»Mister Ming Tse zu sprechen?«
»Mister Ming Tse speist soeben, wird aber sofort kommen,« sagte das Mädchen und stieg vor mir die Treppe empor. Im ersten Stock machte sie halt, und indem sie eine Tür öffnete und mich eintreten ließ, trat sie zurück und verschwand.
Ich stand in einem kleinen, geschmackvoll möblierten Salon, in dem alles von peinlichster Sauberkeit sprach – jedenfalls waren nicht alle Chinesen Feinde der Ordnung wie Hoang-Zo. Aus dem Kaminsims waren eine Anzahl ausgezeichneter, schön gebundener Bücher in strammster Ordnung aufgestellt, ganz wie eine Abteilung Soldaten, von denen keiner einen Millimeter von der Linie abweichen darf. Im Kamin selbst brannte ein Feuer, zum Schrecken einer geizigen Hausfrau und zum Entzücken einer erfrorenen Seele, wie ich selbst; ich fühlte auch gleich, daß mein Wohlbefinden zunahm. Auf den kleinen Nipptischchen standen Vasen mit frischen Blumen zierlich geordnet, auf den Stühlen lagen reich gestickte Polster, nette Zierdeckchen waren, wo tunlich, vorteilhaft angebracht. Die Wände wiesen viele Photographien, meist von Chinesen in europäischer Kleidung, auf, aber ein Bild an der Wand zeigte vier Personen in chinesischen Trachten und schien Frauen vorzustellen. War mein neuer Schüler am Ende der glückliche Besitzer eines Harems oder doch einer Frau?
Ein leichtes Geräusch hinter mir machte mich umsehen. Vor mir stand eine menschliche Miniaturausgabe, ein zartgebauter kleiner Chinese, der gewiß nicht um ein Haar größer war als ich – innerlich schmeichelte ich mir sogar, daß ich vielleicht um einige Haarbreiten mehr maß –, in tadellosem europäischem Anzuge und verbeugte sich vor mir mit einer Grazie, die ich vorher noch bei keinem Asiaten und nur bei wenigen Europäern gesehen hatte. Für diese Art Aeußerlichkeiten bin ich ungemein empfänglich.
»Herr Ming Tse?«
»Fräulein Schulze?«
Wir reichten uns gegenseitig die Hände, lächelten beide, und die Verbeugung wiederholte sich.
»Ich freue mich, Sie als Schüler begrüßen zu können,« sagte ich in Ermangelung von etwas Besserem, »und hoffe, daß Sie stets fleißig studieren werden.«
Ming Tse legte ein überaus feierliches Versprechen ab, immer fleißig arbeiten zu wollen, schob den allerschönsten Polster auf den allerbequemsten Stuhl des Zimmers, rückte ihn an den Tisch und lud mich ein, Platz zu nehmen. Diese Aufmerksamkeit entging mir nicht.
Auf dem Tische lagen Bleistifte, Federn, Federstiele, Lineale, Papiere und Bücher auch wie die Soldaten geordnet da. Er nahm nicht wie alle meine sonstigen Schüler an meiner Seite Platz, sondern setzte sich mir gegenüber an das entgegengesetzte Ende des Tisches, und da merkte ich auch, daß sowohl Bücher, Bleistifte, Federn und selbst die Tintenfässer doppelt vorhanden waren, so daß kein Austausch dieser Artikel zwischen Lehrer und Schüler stattfand.
Während ich seinen Sprachkenntnissen auf den Zahn fühlte, wobei ich sogleich bemerkte, daß viele Plomben nötig waren, hatte ich Gelegenheit, ihn näher zu betrachten. Seine Gesichtsfarbe war dunkler als die Hoang-Zos, man hätte ihn eher braun als gelb nennen können, die scharf geschlitzten Augen waren halbgeschlossen und nicht wie bei dem Philosophen zusammengekniffen, aber Gläser trug auch er, die Augenbrauen waren schwach gezeichnet und hörten schon früh auf. Wimpern fehlten ganz. Das vollkommene Oval des Antlitzes wurde durch die starken Backenknochen ein wenig beeinträchtigt, und die etwas dicke Unterlippe sowie die unregelmäßig stehenden Zähne verunschönten, doch nur unbedeutend, den Mund, aber dafür erfreute er sich einer ganzen Nase mit gutgebildetem Nasenrücken, hübsch geformten Nasenflügeln und einer tadellosen Nasenwurzel, auf der im Notfalle ein Kneifer hätte sitzen können. Das einzig wirklich Schöne an dem Kopfe war das rabenschwarze, glänzende, lange Haar, das denselben in reichster Fülle umgab und wie alles, was ihm gehörte, den untrüglichen Stempel der Ordnungsliebe trug. Nicht ein Haar – und viele reichten von der etwas niederen Stirn bis in das Genick – erlaubte sich Wanderungen auf eigene Faust zu unternehmen, und selbst eine ungestüme Kopfbewegung veränderte nichts daran.
Sooft er mir ein Papier oder sonst einen Gegenstand reichen mußte, drehte er ihn immer zuerst so um, wie er mir am bequemsten sein würde, und fragte mich auch im Verlauf der Stunde, ob mir Wasser erwünscht wäre, was ich dankend ablehnte. Ich war über diese bei Orientalen so ungewöhnliche Höflichkeit – besser Ritterlichkeit, denn höflich habe ich sie mir gegenüber meist gefunden – so erstaunt, daß ich mich nicht enthalten konnte, zu sagen:
»Was für reizende Umgangsformen Sie haben! Wo haben Sie sich dieselben angeeignet?«
Er lächelte zufrieden – sein Lächeln war sehr einnehmend, da sowohl dieses und noch mehr sein Lachen unwiderstehlich zur Nachahmung reizte – und entgegnete munter:
»Das Benehmen hat mein Vater mit dem Stock in mich hineingeprügelt.«
Die Aufrichtigkeit der Antwort, der komische Gesichtsausdruck meines Schülers und die neue Situation unterhielten mich dermaßen, daß ich herzlich lachte, und Ming Tse lachte laut und herzhaft mit. Ich fühlte, wir waren uns nähergekommen, und fand plötzlich, daß er ja eigentlich ganz gute Kenntnisse besaß. Mein Gott, man kann von einem Chinesen – und noch dazu von einem so kleinen Chinesen – doch nicht Unmögliches verlangen.
In einem Punkte war er von Europäern sehr verschieden – er vermied, wie die meisten Asiaten, jedwede Berührung. Wenn er mir ein Buch reichte, wenn er mir etwas näherschob, immer sah er streng darauf, daß sich unsere Hände nicht berührten. Rief ich ihn einer Korrektur halber an meine Seite, so blieb er in der Entfernung eines halben Meters stehen und strengte sich übermenschlich an, von dort aus das von mir Gezeigte zu lesen. Er machte immer einen großen Bogen, sooft er um den Stuhl, auf dem ich saß, herumgehen mußte, nichts berührte mich als der Blick seiner schwarzen Augen, aber er sah mich nie geradezu an. Die Lider fielen beinahe vollkommen herab, und nur aus den Augenwinkeln heraus sah man etwas Schwarzes blinzeln. Er öffnete die Augen nur, wenn er böse war – öffnete sie zu ihrer vollen Größe, und da wünschte man nur eins, daß er sie möglichst schnell wieder schließen würde. Die Gesichtszüge aber verrieten nie, was im Innern vorging. Alle Asiaten verstehen es, ihrem Gesicht den Stempel der Unergründlichkeit aufzudrücken, und die unerschütterliche Ruhe der Maske verändert sich nicht, nicht einmal in Affekten, nur um die Augen und um den festgeschlossenen Mund legt sich ein unheilverkündender Zug – wohl dem, der ihn nie gesehen! Merkwürdig – Hoang-Zos gemütliches kurzsichtiges Blinzeln hatte mir nie Furcht oder Grauen eingeflößt, aber die fast geschlossenen Augen meines neuen Schülers berührten mich unheimlich, wie sehr ich auch gegen dieses Empfinden ankämpfte. Sie schienen zu erforschen, unausgesetzt zu prüfen, und ließen ihrerseits keine Prüfung zu. Eine Ahnung flüsterte mir zu, daß dieses scheinbare Kind ein Buch mit sieben Siegeln war, die zu brechen nicht leicht – einem Europäer vielleicht überhaupt nicht – gelingen würde.
Der eigentliche Unterricht war vorüber, die Tage und Stunden waren bestimmt.
Er schob meinen Stuhl zum Feuer, machte eine gebietende Handbewegung, die mich innerlich furchtbar zum Lachen reizte, und sagte ganz in dem Tone, als ob ich der Schüler und er der Lehrer gewesen:
»Jetzt werden wir ein wenig miteinander plaudern.«
Das Feuer war viel zu warm, und meine Sehnsucht, auch einmal die Zunge bewegen zu dürfen, viel zu groß, als daß ich »nein« gesagt hätte. Ich setzte mich gehorsamst nieder, ließ meine Füße auf dem Feuerschutzgitter ruhen und fragte:
»Wie gefällt Ihnen Europa?«
»Gut!« erwiderte er in einem Tonfall, der das Gegenteil verriet.
»Wohl sehr verschieden von China, nicht wahr?« fuhr ich fort.
Er taute langsam auf. »Ich kann die europäische Kleidung nicht leiden,« erklärte er mit Nachdruck.
Das interessierte mich, da meine vorigen Bekannten dessen nicht erwähnt hatten. »Warum?« fragte ich daher schnell.
»Oh,« kam es langsam von seinen Lippen, während er sich nachdenklich zurücklehnte und eine Zigarette rauchte, »weil sie so eintönig ist – immer dieselben Farben für Herren: grau, blau oder schwarz.«
»Und warum noch?« erkundigte ich mich weiter.
»Weil man immer nur Wolle oder Baumwolle verwendet, nie Seide. In China,« fügte er rasch hinzu, »habe ich immer nur Seide getragen, da hat man auch seidene Unterwäsche, nicht Fetzen wie hier,« bemerkte er wegwerfend.
»China ist reich an Seide, wir sind es nicht,« warf ich ein.
»Und diese Kragen!« räsonierte er von neuem. »So hart, so unbequem! Nie kann man sie fest genug machen, und immer sind sie eine Qual, gerade wie die Manschetten, die steif und unbehaglich die Hand umschließen und in diesem schrecklichen Lande gleich schwarz sind.«
Ich stimmte zu. Kragen und Manschetten mußten unerträgliche Dinge sein.
»Und die Hosen,« fuhr er fort.
»Ja, aber ohne Hosen können Sie doch nicht leicht umherwandern, nicht einmal in China,« sagte ich, und wir lachten beide.
»Gewiß nicht,« gab er zu, »aber wir tragen einen Kaftan oder ein so zugeschnittenes Kleidungsstück darüber und brauchen daher nicht so enge und strammsitzende Beinkleider zu tragen, die wehe tun. Auch formen unsere Hosen mit der Weste ein Stück, so daß sie nie hinunterfallen können.« Er sah mich so bitterböse an, als ob ich der Erfinder europäischer Hosen gewesen wäre.
»Aber hier fallen die Hosen gewiß nicht leicht herunter,« beeilte ich mich zu bemerken.
»O ja,« sagte er, ohne freundlicher auszusehen, »das kann geschehen. In China schneidet man dem Mann den Kopf ab, wenn ihm das passiert,« versicherte er mir mit Ueberzeugung.
Wenn mich Mama oder Jenny gehört hätten! Sie, die dieses Kleidungsstück nur mit heiligen Umschreibungen gebrauchten und holdselig erröteten, falls jemand unbedachtsam das Gespräch auf ein so unanständiges Bekleidungsding hinlenkte.
»Was kommt Ihnen noch merkwürdig in Europa vor?« fragte ich unverdrossen weiter, um ihn von den Hosen, die augenscheinlich keinen Beifall in seinen Augen fanden, abzubringen.
»Der dumme Aberglaube hier!« Dabei blies er eine dichte Rauchwolke gegen die Zimmerdecke.
»Was dünkt Ihnen Aberglaube bei uns?«
»Alles!« erwiderte er lakonisch.
»Alles?« wiederholte ich ungläubig.
»Alles! Sagen Sie zum Beispiel nicht, daß jemanden der Teufel holen soll?«
Freilich hatte ich im Herzen oft manch einen unter das Regiment Beelzebubs gewünscht, noch öfter gern im Pfefferland gesehen, aber gerade als Glaubens- oder Aberglaubensausbruch – –
»Das soll man aber eben weder sagen noch wünschen,« warf ich ein, konnte aber ein Lächeln nicht unterdrücken.
»Das macht nichts,« wehrte er ab. »Sie glauben aber doch« – und da er mein Lächeln sah, verbesserte er sich, »Leute glauben aber dennoch, daß der Teufel existiert.« Nach einer kurzen Pause fragte er beinahe leidenschaftlich:
»Haben Sie vielleicht schon einmal den Teufel gesehen?«
»Bis jetzt habe ich noch nicht das Vergnügen gehabt, seine Bekanntschaft zu machen – es sei denn in der Gestalt einiger meiner Mitmenschen.«
Er lachte. »Viele glauben daran,« fügte er hinzu.
»Und Gott!« sagte er nach einer Weile. »Auch ihn hat niemand gesehen, er erhört trotz aller Gebete nicht unsere Bitten, nicht unsere Wünsche, das hat mir schon manch ein Christ gesagt – das ganze ist Humbug, Bibel und alles,« beteuerte er.
Ich wußte, daß die meisten Chinesen nach unseren Begriffen sehr irreligiös waren. Waren auch sie der abstrakten Idee der Gottheit abhold, so schätzten sie doch unsere moralischen Gesetze, die in Europa durch die Religion ebensogut wie in China durch die Lehren des Weisen Konfuzius gelehrt wurden. Meiner Natur lag es fern, bei jemand Bekehrungsversuche anzustellen. Jeder hatte das Recht, zu denken, was er wollte oder besser, das, wozu ihn das Beobachten des Lebens gebracht hatte. Ich hatte nie Sympathie für die Missionäre gefühlt, die ihre Ueberzeugung anderen Rassen aufzwangen. Für jeden Menschen ist die eigene Anschauung die entscheidende und die maßgebende, daher beschränkte ich mich auch zu sagen, daß der Begriff »Gott« ein abstrakter sei, den sich jeder Mensch nach seiner Individualität auslegen müsse.
Der kleine Chinese schüttelte mißbilligend sein schwarzes Haupt. Wie ich aus Erfahrung wußte, waren sowohl seine Landsleute wie auch Japaner abstrakten Begriffen fast gar nicht zugänglich. Der sonst reichen japanischen Sprache fehlt es sogar vollständig an Ausdrücken für die meisten abstrakten Begriffe. Auch Konfuzius verliert sich nicht in metaphysischen Betrachtungen, – er gibt praktische Ratschläge über den Umgang mit dem Nächsten, über die Pflichten der Könige, weist auf die hauptsächlichsten Gesetze der Moral hin, stellt Höflichkeit und Elternliebe als erste derselben auf und berührt fast nie und da nur höchst flüchtig Fragen, die Unsterblichkeit der Seele oder die Gegenwart eines Gottes betreffend.
Lao Tse stellt »Gott« als Naturkraft hin – das große, ewig in Bewegung und in Veränderung begriffene Weltall, aus welchem wir auftauchen und in das zurück wir wieder verschwinden. Die Bewohner des fernen Ostens sind keine Träumer, lieben es aber oft, auf philosophischem Gebiete solche Fragen aufzuwerfen und zu erforschen. Ming Tse dagegen war nicht Träumer – bewahre! – und gar nicht philosophisch veranlagt. Er war Materialist und daher legte er sich den Begriff »Gott« seiner Veranlagung gemäß kurz und bündig als »Humbug« aus. Ein europäischer Unsinn, das war alles.
Es war spät geworden, und ich erhob mich, um meine Jacke anzuziehen. Nach augenblicklichem Zögern kam mir Ming Tse zu Hilfe, stand aber so weit als möglich von mir entfernt, und faßte meinen Ueberwurf nur beim äußersten Ende an, ihn, sobald ich nur halbwegs hineingeschlüpft war, sogleich loslassend und zurücktretend.
Er öffnete alle Türen für mich, begleitete mich die Treppe hinab, fragte mich ganz väterlich, ob ich wohl imstande sein würde, meinen Weg zur Elektrischen zu finden, und machte mich noch besonders auf die drei Stufen aufmerksam, die von der Villa zum Vorgarten führten. Hierauf reichten wir uns die Hände, und er wiederholte:
»Donnerstag um halb acht, ganz wie heute!«
»Und viel studiert bis dahin!« rief ich lachend zurück.
Wieder umgaben mich die Nebelwolken, doch schienen sie mir nicht so schrecklich wie vorher. Ich hatte in einem behaglichen Zimmerchen sitzen und recht munter plaudern können. Er war ja reizend, dieser kleine Chinese.
| Lyksalig, lyksalig, hver Sjæl som har Fred, |
| Dog ingen kender Dagen för Solen gaar ned. |
| Dänischer Neujahrspsalm. |
V.
Weihnachten war gekommen und wieder vergangen, der Plumpudding war verspeist, die Mistelzweige entfernt, die Pantomimen zu Ende gespielt und die Knallbonbons verknallt worden. Ich hatte die beiden Feiertage wie immer bei Freunden in Brighton verbracht, bei denen ich immer warme Aufnahme gefunden.
Am Neujahrsabend war ich in das Ostende Londons, das sogenannte Verbrecherviertel gegangen, wo nahe der indischen Docks die dänische Seemannskirche liegt, und dort wohnte ich der Neujahrsfeier bei.
Um Mitternacht schritt ich durch die gefährlichen Gassen des Chinesenviertels, wo einem vor Lärm fast die Sinne vergingen. Aus allen Fenstern wurden Knallerbsen geworfen, kleine Pistolen krachten, Feuerräder wurden geschwungen, Raketen stiegen in die Luft, dazwischen schrien alle chinesischen Seeleute aus Leibeskräften, die fünffarbige Flagge wehte mir überall entgegen und rote Papierstreifen mit allerlei chinesischen Aufschriften waren gleichfalls sichtbar. Der dem Viertel sonst eigene Schmutz war heute verschwunden, und man konnte sogar Blumen vereinzelt auf Fenstern bemerken.
Ruhiger war es im nächsten, dem indischen Viertel, wo die Seeleute der ostindischen Schiffe ihre Seemannsheime hatten und wo man oft Inder in ihren weiten Trachten und den vielfarbigen Turbans sehen konnte, manchmal liefen sie auch nur in ein großes Leinentuch gehüllt über die Straße. Auf den breiten Stufen vor dem Tore saßen oft eine große Anzahl von ihnen, und schön waren sie, trotz ihrer elenden Fetzen, das mußte man zugeben. Männliche Erscheinungen, kräftig und finster, mit nachtschwarzen Augen und langem Barte. So spät waren sie bei dem kalten Wetter nicht draußen. Heute schliefen gewiß alle, aber als ich am deutschen Seemannsheim, einem sehr reinlich aussehenden Hause, vorbeiging, hörte ich Neujahrslieder singen und einige junge Leute standen auf der Steintreppe und riefen sich »Prosit Neujahr!« zu.
Hier kletterte ich auf eine Elektrische, die überfüllt war und auf der ich nur rückwärts hängend mitfahren konnte. Wir passierten Commercial Road mit allen seinen Judengeschäften, Whitechapel mit dem Russenviertel (lauter arme Unglückliche, die hier Zuflucht gefunden haben) und kamen endlich nach Aldgate, wo der große Judenmarkt liegt, der jeden Sonntag ein Bild riesiger Tätigkeit ist. Da hört man fast ausschließlich Israelitisch und kann vieles um einen wahren Spottpreis kaufen, nur muß man schäbig gekleidet und sehr vorsichtig sein. Bald waren wir in besseren Stadtteilen und endlich hielt die Elektrische in Theobalds Road, von wo ich nur zehn Minuten zu gehen hatte, um nach Hause zu kommen.
Als ich Guildford Street betrat, hörte ich das Läuten der Glocken und fragte mich, wie wohl das neue Jahr sein würde. Vor jedem Hause standen Leute mit gefüllten Gläsern in den Händen und grüßten das kommende Jahr. Ich kam mir wieder so verlassen vor, so ganz verlassen, wie schon so oft, seit ich nach London mit seiner unwiderstehlichen Melancholie gekommen war.
Es ist gut, daß wir nicht in die Zukunft blicken können, wie hätten wir sonst die Kraft, das Leben zu ertragen?
Seit sechs Wochen unterrichtete ich nun schon Ming Tse. Er war immer sehr aufmerksam gegen mich, sehr höflich und – sehr faul. Wenn ich ihn fragte, ob er seine Aufgabe gelernt hatte, war die Antwort stets bejahend und der Erfolg ebenso sicher verneinend.
»Warum haben Sie nicht gelernt?«
»Weil Herr Hoang-Zo hier war und mich daran hinderte.«
»Herr Hoang-Zo hat mir eben heute von Cambridge geschrieben, wo er eine Woche zu bleiben gedenkt,« entgegnete ich ruhig.
»Weil ich nicht recht wußte, was ich lernen soll,« sagte er, ohne irgendwie die Fassung zu verlieren.
»Kleiner Schwindler, es steht ja in Ihrem Buche, – Sie haben es selbst niedergeschrieben in Ihr Studienheft.«
»Ich konnte nicht entziffern, was dort geschrieben war, habe alles unrichtig eingetragen,« erklärte er mit halbgeschlossenen Augen und den unergründlichen Gesichtszügen, mir gegenübersitzend.
Ich nahm das Heft auf, bevor seine kleine Hand es erreichen konnte. Die Schrift war klar und deutlich, und ich hielt ihm das Blatt lächelnd entgegen.
»Mister Ming Tse, jetzt würde ich wirklich gespannt sein, die Wahrheit zu hören, aber bemühen Sie sich nicht, wenn das vielleicht ein zu großes Opfer ist,« sagte ich ohne irgendwelchen Unwillen zu verraten. Chinesen lieben es, der Wahrheit so viel als möglich aus dem Wege zu gehen, sie haben gegen diese Dame eine unüberwindliche Abneigung, und einem Nationalcharakterzug muß man Rechnung tragen.
Meist gestand Ming Tse sodann auch lachend ein, daß er einfach mit den Indiern, die im Hause wohnten, die kostbare Zeit verschwätzt hatte, was ihn aber trotz aller meiner Vorstellungen nicht veranlassen konnte, größeren Eifer an den Tag zu legen.
»Ich mag nicht studieren,« erklärte er offenherzig.
Seine französische Aussprache hätte jeden Franzosen kopfstehen vor Entsetzen gemacht und sein Deutsch war gleichfalls unter jeder Kritik, dafür besaß er in letzterer Sprache einen Wortreichtum, den ich unter sehr merkwürdigen Umständen entdeckte.
Eines Tages kam ein kleiner Chinese – ein 15jähriges Bürschlein – ihn besuchen, gerade als ich dort war, und da legte Ming Tse einen Eifer an den Tag, der mich besonders amüsierte. Er stellte selbst Fragen an seinen Freund und gab allerlei, meist falsche Aufklärungen, aber ich wollte ihm die Genugtuung, ein wenig protzen zu dürfen, nicht verleiden, da ich hoffte, daß dies ihn mit einem gewissen Ehrgeiz erfüllen werde in Zukunft mehr zu leisten. Auf einmal lehnte er sich gravitätisch zurück, sah herablassend auf seinen Landsmann und teilte ihm mit, daß er nun deutsch mit ihm reden werde, – wovon der andere selbstredend keine blasse Ahnung hatte.
»Wo bist du, mein lieber Esel?« eröffnete er die merkwürdige Unterhaltung und fuhr unbeirrt fort: »Du Schafskopf, Rindvieh,« und so weiter, während der kleine Freund ihn voll Bewunderung anschaute und ihm ein Kompliment nach dem anderen machte. Zusammen wirkte dies so unwiderstehlich, daß ich aus dem Lachen nicht herauskam, aber als der Besucher verschwunden war, fragte ich doch etwas streng:
»Um Gottes willen, Herr Ming Tse, wo haben Sie diese Kenntnisse gesammelt?«
»In der Schule hier in England, von meinem deutschen Professor, er hat das jeden Tag wiederholt.«
Und das war auch alles, was er trotz aller meiner Anstrengungen jemals gut in meiner Muttersprache sagen konnte.
Schon nach den allerersten Stunden hatte er es eingeführt, mir mit Früchten oder sonst irgend etwas, einem Glas Limonade oder Fruchtsaft aufzuwarten. Sobald die Stunde vorüber war – und wann sie zu Ende sein sollte, bestimmte immer er, indem er einfach das Buch schloß und eine Zigarette entzündete; nichts hätte ihn da vermocht, auch nur fünf Minuten weiterzuarbeiten, so daß ich mich notgedrungen fügen mußte –, zog er einen Stuhl ans Feuer, setzte einige Bananen auf einen Teller und befahl kurz und bündig:
»Jetzt müssen Sie essen.«
Die Aufmerksamkeit rührte mich jedesmal. Wie wenige Schüler denken daran, wie anstrengend es für den Lehrer ist, zwei Stunden hintereinander zu sprechen und die ganze Spannkraft des Geistes auf einen einzigen Punkt zu lenken, damit der Schüler so viel Nutzen als möglich vom Unterricht hat? Ich nahm also eine Banane und aß.
»Sie müssen auch die zweite essen,« erklärte er in einem Tone, der mich riesig unterhielt, da er so gebieterisch war und jeden Widerspruch meinerseits von vornherein abschnitt – jetzt war er der Herr, und dieser Austausch der Rollen verursachte mir stets Heiterkeit.
In solchen Momenten teilte er mir seine Beobachtungen mit, und ich mußte mir eingestehen, daß er ein scharfer Kritiker und ein feiner Beobachter war, wenn er auch als Schüler nur als Null vor der Ziffer glänzte. Zudem hatte er eine unwiderstehlich komische Art, seine Ansichten in trockener Weise und mit großer Entschiedenheit kundzutun. Dazu setzte er ein Gesicht auf, das einen zum Tode Verurteilten zum Lachen gereizt hätte. Auch in den Stunden selbst konnte er durch seine Gewohnheit, den Federstiel in den linken Mundwinkel zu stecken und die Feder gegen die Decke zeigen zu lassen, wobei er die Augen zusammenkniff und den Kopf zurückwarf, so lächerlich phantastisch aussehen, daß ich vor Lachen kaum zu sprechen vermochte.
»Wie lange rauchen Sie schon?« fragte ich meinen kleinen Chinesen in so einer Plauderstunde.
»Seit meinem siebenten Jahre,« versetzte er und fügte mit sichtlicher Zufriedenheit hinzu, indem er mit der Hand über seine Brust fuhr: »Es ist alles ganz schwarz da drinnen, und daher bin ich auch so klein geblieben. Wenn mein Vater das wüßte, würde er mich zu Tode prügeln – aber nur die Mutter weiß es.«
»Ja, ja, die Mütter,« dachte ich, »die sind überall dieselben.«
»Deshalb sind Sie auch wenig zum Studium aufgelegt,« sagte ich zu ihm; »könnten Sie nicht etwas weniger rauchen?«
»Ich werde versuchen,« entgegnete er mit jener Betonung, die beweist, daß der Versuch mißglücken wird, aber geradeaus »nein« zu sagen, davon hielt ihn seine chinesische Höflichkeit ab.
Ein anderes Mal fand ich einen silbernen Bleistift auf meinem Platze, und Ming Tse sagte in gebieterischem Tone: »Für Sie!«
»Aber Herr Ming Tse –« begann ich, als er mir in die Rede fiel.
»Wenn Sie ihn nicht annehmen, so studiere ich nicht,« und seine zarten Kinderhände hatten das Aufgabenheft erfaßt, bereit, es zu zerreißen. Seine schwarzen Augen blitzten hinter den Augengläsern hervor, und die ganze Gestalt verriet die Sehnsucht, mich zwingen zu wollen. Ein Blick auf den schlanken, mir unentwickelt scheinenden Körper ließ mich das Komische in der gegenwärtigen Lage sehen, und lächelnd sagte ich zu ihm:
»Ich danke Ihnen, Herr Ming Tse, Sie hätten dies aber nicht tun sollen.«
»Gegen seine Professoren muß man immer höflich sein,« erwiderte der Chinese; »in China darf man einen Lehrer nie wegschicken, falls er, alt und schwach, um Hilfe zu bitten kommt, und ein Lehrer hat auch das Recht, uns zu schlagen, und er darf uns bei unserem Taufnamen nennen, was nur die Eltern außer ihm tun dürfen.«
Ich wußte, daß die Frau nicht das Recht hatte, diesen Namen auszusprechen, und daher überkam mich eine unbezwingliche Lust, zu hören, wie der heilige Name lautete. Ich fragte ihn also mutig.
»Li Bai,« war die Antwort, »und Sie können mich so nennen,« fügte er großmütig hinzu.
»Das wäre eine allzu große Freiheit meinerseits,« erwiderte ich, »aber der Name ist sehr hübsch, und ich danke Ihnen, ihn mir genannt zu haben.«
Meine Antwort schien nicht seine volle Zufriedenheit zu erwecken, er murmelte etwas vor sich hin, ließ indessen nichts laut werden und begleitete mich gerade so höflich zur Türe wie immer.
Obschon es Mitte Februar war, litten wir noch immer unter einem wahren Hundewetter. Es hatte wochenlang geregnet, und heute lag wieder ein unbehaglicher Nebel über der Stadt, wenn auch nicht so dicht, als es oft der Fall war.
Ganz vertieft in das eben Erlebte, ging ich so schnell als möglich die Gasse hinauf und bog bei dem großen Briefkasten wie ein Pfeil um die Ecke, während von der entgegengesetzten Seite jemand genau wie ich mit den Augen auf den Boden und den Sinn auf andere Welten geheftet, daherkam, was zur Folge hatte, daß wir mit voller Dampfkraft ineinanderfuhren – meine Tasche und Bücher flogen in einige Pfützen, und auch mein Angreifer schien übel hergenommen zu sein, wenigstens lag seine Brille zerbrochen auf der Erde. Ich rieb meine Nase, die mit einem ungalanten Westenknopf unsanft in Berührung gekommen war, und mein Partner im Unglück fischte im Kotmeer herum und führte merkwürdige Schwimmbewegungen aus, die mich verstehen ließen, daß er – oh, vergebliche Hoffnung – seine verlorene Brille wiederzugewinnen trachtete. Als ich näher auf ihn sah, erkannte ich ihn.
»Mister Hoang-Zo!« rief ich überrascht und versicherte ihm gleichzeitig, daß seine Brille das Zeitliche gesegnet hätte, worauf ich mich erbot, ihn bis zur Türe seines Hauses zu begleiten. Er wohnte nur wenige Häuser von Ming Tse entfernt.
»Was für Fortschritte macht Ming Tse?« fragte mich unterwegs mein ehemaliger Lehrer.
Ich gab meinem kleinen Chinesen ein besseres Zeugnis als er es verdiente, da ich wußte, daß ihm Hoang-Zo immer Vorwürfe machte, seine Prüfungen nicht schneller zu vollenden, und sagte auch, daß ich Ming Tses große Höflichkeit reizend fände.
Er lächelte, und ohne daß ich recht wußte warum, war mir das Lächeln unangenehm. Es schien etwas auszudrücken, was ich nicht fassen konnte. Er enthielt sich jeder Bemerkung mit Bezug auf meinen Schüler, dankte mir für die Begleitung, entschuldigte sich wegen des Zusammenstoßes und tastete seinen Weg in das Haus. Armer Mensch, ohne Gläser war er vollkommen hilflos – dieser Gedanke vertrieb sofort jede Neigung, auf ihn wegen des unerklärlichen Lächelns böse zu sein.
Und Wochen kamen und gingen.

A. F. Seebacher |
| Non ti lagnar de' mali, |
| Non creder soli i tuoi; |
| Ognuno dei mortali |
| Ha da soffrire i suoi. |
| Bertola. |
VI.
Als ich eines Abends wieder zur Stunde eintraf, lief mir Ming Tse erregt entgegen, faßte mich an der Hand und zog mich, so schnell er konnte, in das Zimmer.
»Fräulein Schulze,« rief er, »springen Sie auf diesen Stuhl, und sehen Sie sich das Bild meines Vaters an. Ich habe es heute erhalten.«
Als ob das Haus in Flammen stünde und ich bei dem Feuerlöschen helfen sollte, so hurtig warf ich meinen Mantel ab und zog die Handschuhe aus, dann näherte ich mich dem Stuhle, den Ming Tse schon erwartungsvoll an der Lehne hielt. Es war eines jener zarten Sesselchen, auf die sich keine gute deutsche Hausfrau und noch weniger eine Oesterreicherin hätte setzen dürfen, ohne daß eine Katastrophe zu befürchten gewesen wäre, und selbst ich vertraute meine Seele (und meinen Körper) den höheren Mächten an und hoffte nur, daß der Möbelfabrikant so vorsorglich gewesen wäre, das zierliche Dingelchen mit einer unsichtbaren Haltbarkeit auszustatten. Hierauf schwang ich mich darauf, während Ming Tse seine kleinen Pfötchen auf die Lehne legte und zu mir aufsah. Während ich mir im stillen ausmalte, wie es wohl wäre, wenn der Stuhl unter mir schnöde zusammenbrechen und wer wohl zuerst auf der Bildfläche erscheinen und meine Knochen zusammenlesen würde, hielt ich meine Augen gehorsamst auf das große Bild des Vaters gerichtet. Es stellte einen großen Mann in der Tracht eines Mandarins dar, mit einem langen Seidenkaftan und einer großen Schärpe um die Hüften. Das Gesicht war bartlos und rundlich und hätte bei flüchtiger Beobachtung als wohlwollend und gütig bezeichnet werden können, aber wer sich die Mühe gab, näher hinzusehen, dem entging nicht ein gewisser grausamer Zug um den Mund und eine unangenehme Falte nahe den Augen. Die Haltung verriet Selbstbewußtsein und festen Willen. Als Freund mochte er gerecht sein – als Feind aber –?
»Wie gefällt er Ihnen?« erkundigte sich Ming Tse, indem er der schwanken Basis, auf der ich stand, einen nicht mißzuverstehenden Puff gab, was ich mir so auslegte, als »höre nun gefälligst mit den inneren Betrachtungen auf!« Daher beeilte ich mich, meinen unsicheren Standpunkt so schnell als tunlich zu verlassen.
»Sehr gut,« sagte ich, sobald ich wieder festen Boden unter mir hatte. Was hätte ich sonst auch sagen dürfen?
»Sie freuen sich gewiß sehr, sein Bild erhalten zu haben?« fragte ich.
»Ja, sehr, und hier habe ich schon Seidenschleifen zur Fahne gekauft, die ich herumwickeln will.«
Er entfaltete eine ganze Menge Seidenschleifen, die, einst irgendwie miteinander verbunden, die chinesische Flagge darstellen würden. Er reichte mir die Enden aller Bänder und hielt sie in der richtigen Ordnung, indem er mich bat, eine Schleife daraus zu machen.
Er hätte mich ebensogut bitten können, auf dem Kopfe zu stehen und ein Champagnerglas mit meiner großen Zehe zu präsentieren. Was anderen Mädchen ein Kinderspiel war, das war für mich ein Ding der Unmöglichkeit. Ming Tse bemerkte dies auch bald und nahm mir die Bänder stumm aus der Hand.
»Sie passen besser zum Studium,« tröstete er mich lächelnd nach einer kleinen Pause, in der ich mir gewaltig dumm vorkam. – –
In den nächsten Wochen lernte ich Ming Tse, erleichtert durch folgenden Umstand, immer besser kennen.
Kaum eine Woche nach dem Eintreffen des Bildes fand ich ihn eines Tages sehr erregt vor, und seine ersten Worte überzeugten mich, daß etwas Außergewöhnliches vorgefallen sein müsse.
»Setzen Sie sich zum Feuer, Fräulein,« kommandierte er, »wir müssen etwas besprechen, bevor wir zu studieren anfangen.«
Ich gehorchte mit der gewünschten Eile und versicherte ihm, daß ich ganz Aug' und Ohr wäre.
»Ich habe meinen Geschichts- und Mathematikprofessor davongejagt,« teilte er mir kurz und bündig mit.
»Herrn L.?« fragte ich. »Warum doch nur?«
»Er wollte immer, daß ich zu ihm kommen sollte, und neulich war ich wirklich zum Tee bei ihm und seiner Mutter. Beide versuchten mich zu überreden, daß ich zu ihnen übersiedeln sollte, und seine Schwester war – sehr zuvorkommend gegen mich. Ich glaube, er wollte mich mit seiner Schwester verheiraten,« fügte er nach einer kleinen Pause hinzu.
Mir erschien plötzlich der Mathematikprofessor ein Ausbund irdischer Verderbtheit, und ich lobte Ming Tse sehr, sich von ihm losgesagt zu haben.
»Außerdem,« fuhr der Chinese fort, »habe ich fast nichts von ihm gelernt – Geschichtsdaten wußte er selber nicht, und er trug immer so undeutlich vor. Anstatt Mathematik erzählte er mir allerlei Geschichten von Mädchen und –«
»Sie haben sehr, sehr recht getan, diesen unverschämten Menschen vor die Tür zu setzen,« rief ich eifrig, und mir schien es, als sei es einfach unverantwortlich, daß ein Europäer einen so unschuldigen Jüngling so verderben wollte. Ob es aber wirklich nur aufrichtige sittliche Entrüstung war, was mich so sprechen ließ und was mir den unbekannten Mathematikprofessor als ein Ungeheuer vorschweben machte?
»Mathematik kann ich selbst weiterstudieren,« erklärte Ming Tse, »und den Geschichts- und Geographieunterricht, den müssen Sie übernehmen,« setzte er hinzu.
»Aber Herr Ming Tse, ich habe keine Zeit, ich –«
»Sie müssen, und wenn Sie nicht wollen, dann reise ich nach China zurück, dann mache ich keine Prüfungen, dann ist alles umsonst – Sie müssen!« wiederholte er gebieterisch, und in seinem Gesichtchen las ich zum erstenmal etwas wie weiche Bitte.
Mein kleiner Chinese! Er war ja trotz seiner maßlosen Faulheit mein Lieblingsschüler, und ich hätte lieber auf den Schlaf verzichtet, als ihm die Bitte abgeschlagen. Daher erklärte ich mich bereit. Glücklicherweise hatte ich zu eigener Unterhaltung und Belehrung bei meiner Ankunft in London viele Bücher über englische Geschichte gelesen und konnte daher sehr zufrieden sein über die Grundlage. Natürlich würde ich mich für jede Stunde besonders vorbereiten und auch einen Plan bezüglich des Geographieunterrichts entwerfen müssen. Aber warum nicht? Es würde eine ausgezeichnete Wiederholung für mich sein, eine Notwendigkeit sogar, kurz, ich fand mich sehr leicht – auffallend leicht – in mein Geschick.
Ming Tse bestimmte zwei Tage zu je zwei Stunden, so daß wir uns nun viermal die Woche sahen. Ich war froh, daß ich der Einsamkeit so leicht entgehen konnte und segnete meine Beharrlichkeit in allerlei Forschungsaufgaben. Mein Schüler machte gleichfalls den Eindruck, zufrieden zu sein – und, was konnte ich mehr wünschen?
Nachdem der junge Mann schon in Paris und London studiert und in China zwölf Jahre lang Weisheit eingepaukt erhalten hatte, mußte er wohl schöne Vorkenntnisse besitzen. Indessen war es doch immerhin der Mühe wert, einige Sprungfragen, allgemeines Wissen betreffend, zu unternehmen.
Gleich bei meinem Kommen bat er mich, ihn nicht über englische Geschichte zu fragen, sondern noch einmal von Jakob I. an den ganzen vorgeschriebenen Lehrstoff vorzutragen. Dies tat ich also, ließ alles Ueberflüssige weg, machte den Vortrag so einfach und so leicht faßlich als möglich und diktierte ihm einige Stellen – ich bestand nämlich darauf, daß er Notizen nahm, damit meine Rede nicht ganz umsonst bleibe.
Nach dem eigentlichen Studium stellte ich einige Fragen an ihn, die mir als zum unerläßlichen Wissen eines Menschen beider Hemisphären notwendig schienen.
»Wer war Napoleon?«
Pause.
»Was wissen Sie von ihm? Etwas haben Sie gewiß von ihm gelesen oder gehört?«
»Er war ein großer Kämpfer oder so etwas!« war die gleichmütig gegebene Antwort. Mehr von dem Eroberer wußte er nicht.
»Wer war Christoph Columbus?«
»Nie von ihm gehört!«
»Herr Ming Tse!!! Christoph Columbus?« wiederholte ich, wie um ein Licht im dunklen Gehirnkasten meines Schülers zu entzünden.
»War das nicht so ein Kerl, der einmal Bücher über Amerika schrieb?« erkundigte sich mein kleiner Chinese, als ob ihn die Sache nichts weiter angehen würde.
»Bücher hat er wahrscheinlich nicht so übermäßig viele geschrieben,« konnte ich mich nicht enthalten etwas sarkastisch zu bemerken, »aber entdeckt hat er das Land – eine ganz unbedeutende Sache.«
Ming Tse lachte, er hatte den Spott herausgefühlt, der jedoch wirkungslos an seiner asiatischen Ruhe abprallte.
»Was für ein nutzloses Geschrei die Europäer wegen einer solchen Kleinigkeit machen,« sagte er verächtlich. »Wir haben Amerika schon viel länger gekannt – und ohne Columbus,« versetzte er und sah dabei aus, als ob dieser Umstand einzig und allein ihm selber zu danken wäre. Aber da die Chinesen Amerika wirklich ohne Columbus gefunden, wagte ich keine weiteren Bemerkungen. Ich ging zur Geographie über, und da wurde alles verlangt – die physische, politische und besonders die europäische Geographie.
Mit der physischen nahm ich den Anfang und hatte zum erstenmal die Genugtuung zu sehen, daß der Schatten eines Interesses bei ihm erwachte, als ich die verschiedenen Naturereignisse, so gut es ging, erklärte und überall noch Zeichnungen hinzufügte. Dies lernte er in der Tat gut.
Hierauf wollte ich ihm ein wenig auf den Zahn fühlen bezüglich der allgemeinen Geographie und bat ihn daher, mir die hauptsächlichsten Länder Europas aufzuzählen und die Hauptstädte zu nennen.
Er fand nur drei Länder – England, Deutschland und Frankreich. Ich half ihm aus.
»Die Hauptstadt von Belgien?«
»Budapest.«
»Bedaure, was soll denn Ungarn ohne Hauptstadt anfangen?«
»Kopenhagen!«
»Aber Herr Ming Tse, Kopenhagen ist die Hauptstadt von Dänemark,« sagte ich etwas geärgert.
»Mir auch recht,« erwiderte er gelassen.
Ich sagte ihm nun mindestens zehnmal alle Länder und Städte vor und zeigte sie alle auf der Landkarte. Er sah sie alle an, als ob sie Kieselsteine gewesen wären, und wiederholte, was ich sagte, wie ein Kind, das schlaftrunken sein Vaterunser herableiert. Sofort bat ich ihn aufzuhören – welchen Nutzen hätte er von der Fortsetzung einer solchen Stunde gehabt?
Im Herzen aber begann ich mich zu fragen, ob dieser Schüler trotz aller meiner Mühe je eine Prüfung erfolgreich ablegen würde.
Nach den Geographiestunden plauderten wir wie nach all den übrigen Stunden, und dabei fielen einige Streiflichter auf seinen Charakter.
Ob ich vielleicht, mir unbewußt, Hoang-Zo als Muster der Tugend hingestellt, oder besser sein Talent und seinen Fleiß allzu häufig rühmend erwähnt hatte, ich weiß es nicht – jedenfalls kam Ming Tse zu der Ueberzeugung, daß ich eine ungewöhnlich gute Meinung vom Philosophen hatte, möglicherweise sogar eine bessere als von ihm selbst, und in seinem Kopf erwachte sofort der Gedanke, diesen Nimbus zu zerstören, langsam und vorsichtig, ganz langsam, aber sicher.
Als daher der Name Hoang-Zos wieder genannt wurde, schüttelte der kleine Chinese sein rabenschwarzes Haupt, seufzte und sagte:
»Herr Hoang-Zo hat kein gutes Herz.« Pause. Er sah mich mit den Ecken seiner Augen – denn diese schwarzen Punkte im Nasenwinkel konnte man kaum als etwas anderes bezeichnen – forschend an und fügte hinzu:
»Aber sehr, sehr begabt.«
»Und sehr fleißig,« warf ich ein. »Er studiert den ganzen Tag im Britischen Museum.«
»Oh, ja, Britisches Museum!« lachte er höhnisch. – »Mädchen!«
»Herr Hoang-Zo??? Unmöglich!« rief ich voll Entrüstung. »Er kann die Mädchen nicht leiden – er denkt nicht an sie,« erklärte ich mit Eifer.
»Er hat schöne Mädchen sehr gern – sehr gern – und er ist ein schlechter Mensch, aber dafür so begabt, so begabt, nicht wahr?« fragte er mich.
Der Sarkasmus war unverkennbar. »Ich kenne Herrn Hoang-Zo nicht näher,« erwiderte ich. »Gegen mich war er immer sehr lieb, ich bin aber auch nicht schön und das erklärt ja vieles,« sagte ich und warf unwillkürlich den Kopf in den Nacken. »Ich dachte indessen, Sie wären sein Freund.« Diese Anspielungen mißfielen mir.
»Sein Freund?? – Ja, wenn er Geld borgen will,« sagte Ming Tse.
Das war eine neue Entdeckung. »Braucht er so viel Geld? Er studiert auf Kosten seiner Regierung, nicht wahr, und erhält 15 Pfund monatlich?« Das hatte der kleine Chinese mir früher einmal mitgeteilt.
»Gewiß, aber 15 Pfund sind nicht genug, wenn man schöne Mädchen gern hat,« fügte er schelmisch lächelnd hinzu.
»Ein Mädchen gern zu haben ist ja kein Verbrechen,« entschuldigte ich meinen früheren Professor.
»Nein,« ohne mich anzusehen. Plötzlich funkelten die halbgeschlossenen Augen zu mir herüber. »Aber er gibt ihnen Pulver.«
»Er gibt ihnen Pulver?« fragte ich verständnislos.
Der Kleine grinste wie der leibhaftige Gottseibeiuns.
»Pulver, daß sie einschlafen – zwei Stunden einschlafen – verstehen Sie?« fragte er mich.
Und ob ich verstand! War eine so maßlose Schlechtigkeit in einem so hochentwickelten Menschen möglich!! Konnte die grinsende kleine Figur vor mir die Wahrheit sprechen?
»Man gibt jemand das Pulver doch nicht auf der Gasse und gegen den Willen ein?« sagte ich, diese Anklage gegen meinen bewunderten Philosophen und Professor abwehrend.
»Auch nicht nötig,« lachte Ming Tse. »Man lädt sie einfach zum Tee ein.«
Ich fühlte, daß der Stuhl unter mir nicht Stütze genug war. Wie der Reiter auf dem Bodensee, der starb, als er hörte, welchen Gefahren er entgangen war, so schien es mir, daß ich zum mindesten ohnmächtig werden könnte, wenn ich mir vorstellte, wie ich gedankenlos am Rande des Verderbens herumgetänzelt war. Zum erstenmal in meinem Leben freute ich mich, daß ich nicht so schön wie Jenny, daß ich das Gegenteil von hübsch war.
Ming Tse mochte mein Entsetzen meinen weitaufgesperrten Augen ablesen, denn er beruhigte mich, indem er sagte:
»Herr Hoang-Zo denkt auch sehr gut von Ihnen, er hat mir schon damals von Ihnen erzählt und gesagt, daß er mit Ihnen eine Ausnahme macht, Sie denken nur ans Studium.«
Ob mein Wissen oder meine Häßlichkeit ausschlaggebend war – wahrscheinlich die beiden Dinge vereint –, war ich Mr. Hoang-Zo doch über die Maßen dankbar, besagte »Ausnahme« gemacht zu haben, was immer auch seine Gründe gewesen. Und ich, die ich den Tee mit so viel Vergnügen getrunken hatte! Dieser Gedanke kam peinigend oft zurück und jagte mir jedesmal die Gänsehaut über den Rücken.
»Himmel, wenn ich geahnt hätte, daß man so schlecht sein könnte!« rief ich aus.
Ming Tse krümmte sich vor Vergnügen, ich mußte aber auch das verkörperte Entsetzen ausdrücken.
»Nicht so sehr, sehr gut, nicht wahr, Fräulein, aber sehr begabt?« fragte er mich.
»Zu begabt!« rief ich ärgerlich.
»Mir liegt nichts an Mädchen,« versicherte mein kleiner Chinese mit überlegener Miene. »Nur Mädchen, die älter sind als ich und die viel wissen, die gefallen mir.« Pause, – während welcher ich mich einigermaßen zu fassen versuchte. »Und ich schaue nicht auf Schönheit wie Hoang-Zo,« erklärte er.
Er stellte Früchte auf den Tisch. »Kein Pulver,« versicherte er lächelnd.
»Gott sei Dank, daß dieser nette kleine Chinese kaum 22 und noch ein ganzes Kind ist,« dachte ich. Wie wenig ich doch Chinesen verstand!
Mein ehrwürdiges Alter war damals 23, also hätte ich mir auf meine Greisenhaftigkeit noch nicht allzuviel einzubilden brauchen.
Das war ein Streiflicht gewesen, das mir deutlich zeigte, wie sehr ihm daran lag, sich selbst als ersten gelten zu machen, wie wenig er es wünschte, andere Menschen bewundert zu sehen.
Er wußte, daß ich Indier sehr intelligent und sehr interessant fand. In der Villa, in der er wohnte, lebten auch Indier und es verging keine Plauderstunde, in der er mir nicht etwas Nachteiliges von ihnen erzählte.
»Herr Kashdartha ist ein schlechter Mensch,« sagte er eines Tages. »Er wird bald ein Kind haben.«
»Er wird bald ein Kind haben?« fragte ich ungläubig.
»Ja. Erinnern Sie sich, ein hübsches, kaum sechzehnjähriges Mädchen manchmal im Hause gegenüber gesehen zu haben?«
»Eine kleine Blondine mit blauen Augen und immer lachendem Munde?« fragte ich.
»Stimmt. Die wird ein Kind jetzt haben.«
»Wie schrecklich!« rief ich aus. »Und wird er sie heiraten?«
»Hat schon eine Frau in Indien,« erklärte er lakonisch. Nach einigen Minuten fügte er hinzu:
»Die Indier geben auch Pulver, Fräulein, sehr schlechte Menschen, Sie dürfen nichts mit ihnen zu tun haben. Schlechte Menschen!« wiederholte er.
Ich war sprachlos. Meine Indier, die jungen Hindus, die ich gekannt hatte, waren lauter hochintelligente Männer gewesen, die sich viel reiner und besser als wir armen Frauenzimmer vorkamen, so daß manche uns gar nicht die Hand zum Gruße reichen wollten. Eins war sicher: Dieser kleine Chinese schien das Schlechte in Mitmenschen und Rassen geradeso zu entdecken, wie manche alte Zauberer Schätze mittels eines Zauberstäbchens fanden. Ich dachte nicht schlechter darum von den Indiern, die ich kannte, aber eine gewisse Enttäuschung, ein unabschüttelbares Mißtrauen blieb zurück.
Es geschah nun öfter, daß er mich nach der Stunde zur Elektrischen hinabbegleitete. Bald gingen wir den kleinen Umweg über die Heide – es war in England im Winter an regen- und nebelfreien Tagen nicht viel kälter als im Sommer – bald den Berg hinab auf der breiten Alleestraße bis zu Hampstead Hill. Ich zog den Weg durch die Straßen schon deshalb vor, weil wir auf der Heide nicht nur durch das nasse Gras gehen mußten, sondern hauptsächlich wohl aus dem Grunde, weil wir dort immer Liebespaare auf dem Grase oder den Bänken fanden, ohne Unterschied der Jahreszeit oder der Tagesstunde.
Da wandte sich Ming Tse immer mit einem überlegenen Lächeln an mich und sagte:
»So sind die Mädchen in Europa.« Das ärgerte mich immer grenzenlos.
»Es sind nur die Schlechten von ihnen,« verteidigte ich.
»Die allermeisten,« erwiderte er lakonisch. »Viele aus guten Häusern, viele verlobt mit anderen Männern,« fügte er hinzu.
Ich wußte, daß er recht hatte und es tat mir leid, daß wir den fernen Asiaten ein so entsetzliches Vorbild gaben, wir, die wir auf unsere höhere Moral so stolz und von ihr so überzeugt sind.
Sobald ich auf die Elektrische gesprungen war, blieb Ming Tse regungslos stehen und winkte mit seiner kleinen, zierlichen, braunen Hand noch einmal zu mir herauf, während ich ein gleiches tat, bevor ich hineinging und der Wagen sich in Bewegung setzte.
Noch jetzt steht klar das Bild des kleinen Chinesen vor mir, wie er unbeweglich stand und mit der Hand herübergrüßte zur Elektrischen, zu mir.
Schade, daß uns das Schicksal damals nicht getrennt hat.
| Oh la povera barchetta |
| sola sola in alto mare! |
| Alto mare anche la sponda, |
| se nessuno e ad aspettare. |
| C. R. Vani. |
VII.
Nirgends auf der weiten, weiten Welt ist es schön, wenn man allein ist. Umgeben von schneegekrönten Bergen mit oft sichtbarem Alpenglühen, von Nadelwäldern, wo man hundert eigenartige Baumformen vor sich sieht, oder am Meeresstrand, wo sich die Wellen an den scharfen Klippen donnernd brechen, in lieblichem Tale, wo Blumen aller Arten das Auge erfreuen, wo Getreidefelder wie Meeresfluten vom Winde bewegt auf und nieder wogen, da kann man die Einsamkeit fühlen. Aber dennoch mag das aufrührerische Herz dann nach jemand rufen, der es ganz versteht. Gleichgültige Menschen oder die Menschen, die uns nicht begreifen, für die wir ein Rätsel sind und die uns »verändern« wollen, weil ihre Eigenart der unsrigen wie ein Positiv und Negativ gegenübersteht, die mildern nicht die Einsamkeit – sie vergrößern sie unter Umständen.
Aber um wieviel schrecklicher ist die Einsamkeit, wenn die Natur geschwunden, wenn hohe, düstere Häuser, ernste Menschen, lärmende Fuhrwerke und häßliche Ankündeschilder uns umgeben? Persönlich bin ich der Ansicht, daß man nirgends auf Erden besser studiert als in London, weil alle Zerstreuungen fehlen und man nur an sein Wissen denkt, und auch, daß niemand die Einsamkeit vollkommen kennengelernt hat, wer nicht einen Winter ganz allein in der Siebenmillionenstadt geweilt hat. Wer diesen Ernst, die ewige Ruhe inmitten des ohrenbetäubenden Lärms, den Nebel und immer bedeckten Himmel ein Jahr lang ausgehalten hat, der kann mit Recht von sich sagen, daß er »den lieben Herrgott kennengelernt« hat, und das in keineswegs erfreulicher Weise.
Die Bauten sind meist aus rotem Ziegelstein, vom Nebel und Regen mit einer schwarzbraunen Kruste überzogen. Auch in Häusern, wo man verhältnismäßig viel für ein möbliertes Zimmer bezahlt, ist die Treppe nach zehn Uhr abends, in anderen auch früher ein schwarzer Schlund, in dem man sich auf gut Glück und oft auf allen Vieren begeben muß, wenn man nicht ein vorzeitiges Ende nehmen will oder es wünscht, einen Teil seiner Knochen gebrochen zu haben. Aber was sind alle diese Uebelstände gegen die Einsamkeit, die einen nicht bigotten Ausländer an einem englischen Sonntage überkommt, wo jeder Engländer wenigstens zweimal des Tages in die Kirche geht und zwei Stunden jedesmal drinnen sitzt.
Wenn man die ganze Woche angestrengt gearbeitet hat, geht man nur ungern am einzigen Ruhetag in ein Museum, wo der Geist wieder angestrengt wird, schlafen kann man doch auch nicht von Samstag abend bis Montag früh, und mit seinen trüben Gedanken als einziger Gesellschaft die alten Kleider verbessern oder Handschuhe waschen, ist, wie nützlich und sogar notwendig dies auch sei, keine Erholung für die Werkeltagsmühe. Im Winter regnet es, und im Sommer, wo man die Parke besuchen kann, sind diese kein Eldorado. Fliegt einem nicht der Ball eines Kindes an den Kopf und saust nicht der Reif eines anderen gegen die Füße, so stolpert man gewiß über ein paar Liebende, die im Grase liegen und über so eine Rücksichtslosigkeit natürlich entrüstet sind. Bleibt das Daheimbleiben in einem zweifelhaft reinen Zimmer, das, selbst wenn es gassenseitig ist, keinerlei Abwechslung bietet, da in den Hauptstraßen nur Aemter in den oberen und Geschäfte in den unteren Stockwerken sind und in den Seitengassen, wo Leute wohnen, nichts zu sehen ist, da nur diejenigen oder doch fast nur diejenigen die Gasse betreten, die eben in ihr wohnen. Dafür hat man andere Besucher von etwas zweifelhaft angenehmer Art. Allerlei Leierkastenmänner kommen angezogen, die um der Feier des Tages willen ausschließlich Hymnen spielen und mit gebrochener Stimme manchmal den Text dazu singen; ferner kommt im Winter der Butterkrapfenmann mit seiner melancholisch klingenden Glocke, der mir fast immer Tränen entlockte. Klingt doch sein »Bim-bim« genau wie das Schellengeläute und mahnte mich der Ton deutlich an die Heimat mit ihrem hohen Schnee, dem warmen Ofen, den zischenden Bratäpfeln und dem blauen Himmel, der auch im Winter so klar sein konnte, sobald es zu schneien aufgehört. Ihm folgen die Bettler, die je nach ihrem Temperament eine schreckliche Mordgeschichte, ihren eigenen Lebensbericht in Versen verfaßt, oder eine Hymne singen, glücklicherweise aber mit solchem Gekrächze, daß man der Worte verlustig geht und sich der Kunstgenuß auf die lieblichen Töne beschränkt. Der Apfel- und Orangenmann bleibt auch nicht aus. Auf seinem zweirädrigen Wagen, besser seiner Schubkarre, fährt er durch alle Gassen, sein »two pence a pound« ausrufend und seine schmutzigen Finger dabei über die Früchte gleiten lassend – wahrscheinlich um den Genuß zu erhöhen. Endlich erscheinen die Zeitungsausträger, die ihr gellendes »Evening News« oder »Sunday Times« mit den betreffenden in den Blättern befindlichen Neuigkeiten ausschreien, als ob sie die Toten zum Leben erwecken wollten oder einen Wettbewerb mit den Posaunen von Jericho eingegangen wären. Gewiß ist wenigstens einer – meist jedoch zwei oder drei Leute – in der Gasse der glückliche Besitzer eines Grammophons, und da es bekanntlich sehr sündhaft wäre, sich am Tage des Herrn weltlichen Vergnügungen hinzugeben, so ein ehrsamer Ladenbesitzer aber andererseits nur am Sonntag Zeit genug hat, sich den musikalischen Genüssen zu widmen, so besänftigt er sein Gewissen und befriedigt gleichzeitig seine Sehnsucht, indem er ausschließlich Hymnen spielen läßt.
Langsam aber sicher wirken diese äußeren Umstände auf den inneren Menschen – den Charakter, das Gemüt – zurück. Das Leben ist nicht länger Leben, sondern ein trauriges Dahinschleichen in erdrückender Atmosphäre. Rom ist die Stätte der Kunst, Paris die der Unterhaltung, des wilden Genießens, London aber die des Studiums, des Handelns und – des Vergessens, denn ein Schleier senkt sich dort wohltuend auf Geist und Körper, man vergißt, vergißt alles, mit der Zeit selbst, daß man noch am Leben ist. Daher sagt man mit vollem Recht, daß alle die Leute, die getäuschte Hoffnungen zu begraben haben, nach England kommen, nicht nur, weil es das Land der Freiheit ist, sondern hauptsächlich weil sein Klima, die Lebensverhältnisse, der große Unterschied in allem zwischen dem Inselreiche und dem Kontinent das Vergessen so sehr erleichtern. Die goldene leuchtende Sonne Roms scheint eine Ironie zu sein, wenn im Innern eine so grauenvolle Finsternis herrscht; die Heiterkeit in Paris erweckt Aerger, Neid, Unwillen in den Herzen derer, die mit den Freuden des Daseins abgeschlossen zu haben meinen, aber der graue Himmel Großbritanniens, die abweisende Haltung der Engländer, die nicht in die Geheimnisse einzudringen trachten, die uns neben sich leben lassen, ohne sich um uns zu kümmern – alles dies erleichtert uns das Vergessen. Alle entthronten Herrscher gehen dorthin ins Exil. Staatsmänner, deren Staatsstreich mißlang, Nihilisten, die dort von Freiheit träumen, Verbannte, die nie zurückkehren dürfen, Politiker, die von ihrer Höhe gestürzt, Liebende, die ihr Glück auf immer begraben haben, sie alle ziehen nach London. Wer mit dem Leben – dem erträumten, dem erhofften Leben – abgeschlossen hat, begibt sich auf die Insel, und dort verwandelt sich der Schmerz, auch der heißeste, der wildeste, in Melancholie. Wer zuviel von ihr abbekommt, versinkt entweder im Schlamm des Lasters oder begeht Selbstmord.
Ich saß in meinen vier Pfählen und hatte eben in der oben aufgezählten Ordnung den Butterkrapfenmann, die Bettler, den Orangenverkäufer, die Zeitungsausschreier und einige Leierkastenspieler vorüberziehen gehört, hatte meine Handschuhe und andere Kleinigkeiten gewaschen, denn der warme Dunst des siedenden Wassers erwärmte gleichzeitig das Zimmer, in dem es Ende März noch immer sehr kalt und unfreundlich war, hatte einige Minuten lang die fallenden Regentropfen beobachtet und vernahm eben, daß zwei Grammophone »losgelassen« worden waren. Ich hatte die größte Lust, mich, wie schon oft, auf das Bett zu werfen und bitterlich zu weinen, aber da ich wußte, daß es nicht dabei blieb und ich mich im Uebermaß der Verzweiflung wieder gegen die kahlen Wände werfen und mir tagelang das Lächeln physisch wehtun würde, bezwang ich mich. Ich zog meine Jacke an, um wenigstens nicht zu frieren, und mich auf das Bett, den einzigen bequemen Platz, setzend, zog ich einen Brief Jennys aus der wurmstichigen Tischlade, den ich am vorhergegangenen Abend bekommen hatte. Wenn doch meine Schwester mir ähnlicher gewesen wäre! Nein, sie war Mamas Ebenbild, ich konnte nicht hoffen, bei ihr Verständnis zu finden. Sie war – dem Himmel sei Dank – wie andere Mädchen!
»Käthelchen!« begann der Brief.
»Ich kann Dir gar nicht sagen, wie sehr mich Dein Brief und besonders das schöne Armband gefreut hat. Weißt Du, eigentlich fürchtete ich schon, daß Du so gelehrt geworden seist, daß Dir nur ein Buch eine passende Gabe für mich erschienen wäre, – mir, die ich es dem Gutenberg nie verzeihen kann, die dumme Buchdruckerkunst erfunden zu haben. Wenn Mönche noch heutzutage Bücher kopieren müßten, brauchte ich weder so viel zu studieren, noch so viel langweilige Klassiker durchzulesen, gerade damit ich »gebildet« bin. Ich gehe viel lieber auf das Eis und fahre Schlittschuhe oder tanze – ach Käthe, wieviel ich heuer im Winter getanzt habe! – oder gehe ins Theater, aber Mama hat mir diesmal nicht so viel hübsche Blusen gekauft, was mich oft ganz unglücklich gemacht hat.
Käthe, denkst Du nie an das Heimkehren? Jetzt läufst Du schon drei Jahre in der Welt herum und Mama sagt immer, daß es kein gutes Licht auf uns werfe. Ich mache mir nichts aus dem ›guten Licht‹, aber ich möchte Dich so gern hier haben, damit ich öfter ausgehen könnte. Du weißt, Mama findet, es schickt sich nicht, daß ein junges Mädchen allein ausgeht, und wenn ich sage, ja, aber die Käthe, so sagen alle: ›Ja die Käthe!!!‹ und Tante Elly fügte hinzu: ›Die hat doch alles nach ihrem Kopfe getan‹.
Glaube nicht, daß ich nie ohne Sehnsucht an Dich denke. Mir sagte die alte Köchin, daß Du jemanden einst sehr, sehr lieb gehabt hast und deshalb fortgezogen bist, und daß Du ihn nie, nie vergessen wirst, obschon er schon lange tot ist. Seit der Zeit lege ich jedesmal Blumen auch auf sein Grab, wenn ich Papas letzte Ruhestätte besuche und flüstere leise: ›Von der Käthe!‹ Bist Du mir böse, weil ich dessen erwähne? –
Wie ich meinen achtzehnten Geburtstag feierte, fragst Du, lieber Kather? Wir hatten das reinste Familienkonklave. Zuerst kam Tante Emma mit der spitzen Nase und dem langen Strickstrumpf.
»Ist mein kleines Mädelchen noch nicht bei der Arbeit?« fragte sie mich, denn sie will, ich soll jeden Tag wenigstens einen halben Strumpf für die Armen stricken.
»Aber Tante, an Festtagen arbeitet man nicht, das steht im Katechismus,« erwiderte ich.
»Müßiggang ist aller Laster Anfang,« entgegnete Tante Emma streng, »aber für heute muß man dich wohl entschuldigen.«
Als Geschenk gab mir das Scheusal ein Nähkörbchen.
Ihr folgte Tante Paula, die mich ermahnte, nicht wieder die heilige Messe zu versäumen. »In den Park gehen, das kann die kleine Madame Eitelkeit,« sagte sie streng, »aber in das Gotteshaus gehen, dazu sind die Beine zu schwach. Hier hast du ein neues Gebetbüchlein, mein Täubchen!«
»Alte, geizige Krähe,« dachte ich mir, »du siehst mich schon nicht so bald in der Kirche. Ich kann daheim auch beten, und Mama tut es auch nicht anders.« (Jenny war nicht ungläubig – nicht an allem zweifelnd und verzweifelnd wie ich selber, aber oberflächlich, vollkommen gleichgültig. Ich beneidete und ich beklagte sie. Wer nicht tief empfindet, leidet, aber genießt auch weniger.)
Ach, Käthe, Du wirst nie erraten, was mir meine Mama gab. Denke Dir, eine Bettgarnitur! Ich bin so ein dummes Mädel, aber kaum war Mama bei der Türe draußen, so hielt ich es nicht länger aus. Ich warf mich auf die neuen Schätze und weinte, weinte Fluten von Tränen, und doch hätte ich keinen richtigen Grund anzuführen gewußt. Ich hatte nur so ein unbestimmtes Gefühl – bitte, Käthe, lach' mich nicht aus! –, daß mir eine Bettgarnitur nur Freude bereitet hätte, wenn sie für zwei gewesen wäre, so ein dummes, dummes Ding ist Deine Schwester. Und ich kenne ja nicht einmal einen passenden »Zweiten«.
Um 11 Uhr kam Tante Hermine, Onkel Paul und meine Basen, die mir Blumen und Tante Stoff zu Hemden gaben. Zu Hemden! Hemden muß mir Mama in jedem Falle kaufen, wenn ich nicht hemdenlos durch die Welt gehen soll, aber eine Tante, die sich 364 Tage jede abfällige Bemerkung und jede verletzende Kritik erlauben kann, hat die moralische Verpflichtung, am dreihundertfünfundsechzigsten Tage ihrer Nichte als Ersatz dafür ein wunderschönes Geschenk zu machen, so eine Art Schmerzensgeld zu zahlen, aber Hemden, das ist die Pein noch erhöhen. Ich hatte so fest auf eine mattblaue Seidenbluse mit zwei Falten auf jeder Seite und – aber ich weiß, daß Dich Kleiderfragen nicht interessieren – gerechnet, und nun diese Enttäuschung.
Berta puffte mich, als ich an ihr vorbeiging.
»Wie ich achtzehn Jahre alt war, hatte ich schon einen Bräutigam,« sagte mir die Natter. Ich hätte ihr gerne geantwortet, daß sie ihn nicht selber und ehrlich erworben habe, sondern daß große Fleischköder in Gestalt unzähliger Bewirtungen ausgeworfen worden waren, und daß ein Mann immer anbeißt, wo es etwas zum Essen gibt; aber Mama warf mir einen warnenden Blick zu, und ich strafte sie einfach mit geringschätzigem Lächeln.
Tante Hermine bemerkte plötzlich, daß ich mein Sonntagskleid an- und keine Schürze umhatte.
»Natalie,« sagte sie zu Mama, »deine Tochter wird nie einen Mann finden. Wenn ein junges Mädchen nicht häuslich erzogen ist und auf den Mann nicht gleich den Eindruck eines fleißigen Hausmütterchens macht, da ist alle Hoffnung, sie zu versorgen, vergebens.«
»Aber Hermine, das Kind –« entschuldigte sich Mama.
»Jenny ist kein Kind mehr, Jenny ist heute eine ganz erwachsene junge Dame,« widersprach die Tante. In meiner Achtung stieg sie dadurch ungemein, und ich begann ihr sogar das Hemdengeschenk zu verzeihen.
Kaum waren diese Besucher gegangen, als Tante Elly mit Kusine Lotta anmarschiert kam. Beide wünschten mir viel Glück und mischten, wie immer, gehörig Pfeffer der Bissigkeit bei.
Tante Elly betrachtete mich eine Weile mit demselben Gesichtsausdruck, den ich bei ihr wahrgenommen habe, sooft sie in einer Fleischwarenhandlung die Schinken und Hammelkeulen einer Prüfung unterwirft oder am Markte die Melonen und Gurken auf ihre Reife prüft, dann wandte sie sich an Mama und sagte:
»Jenny kleidet sich, als ob sie schon erwachsen wäre, und wie immer gibst du, Natalie, bei deinen Kindern nach. So ein Backfischlein soll noch kurze Kleider tragen und in jedem Fall sich nicht die Locken drehen.«
»Jenny sollte lieber noch die Naturwissenschaften studieren, sie ist noch ein furchtbarer Ignorasmus und müßte wenigstens drei Jahre täglich Unterricht von guten Professoren erhalten, um sich in gebildeter Gesellschaft sehen lassen zu können,« fügte Lotta bei, und ihre Nasenspitze fuhr in die Luft.
»Meine Liebe,« dachte ich mir, »so viel von der Naturgeschichte weiß ich wahrlich, um bestimmen zu können, daß du eine auf zwei Beinen gehende Klapperschlange bist,« aber laut wagte ich nichts zu sagen. Du, Käthe, hättest ihnen gleich eins über den Schnabel gegeben. (Und mit Vergnügen, dachte ich. Arme Schwester!)
Lotta gab mir eine kleine Bronzefigur, einen Tänzer vorstellend, und fügte der Gabe noch einige gute Lehren bei. Tante Elly gab mir eine Tüte Backwerk – zur Versüßung der Pille wahrscheinlich. Sodann versicherte sie Mama, daß sie bei uns beiden den Erziehungswagen total verfahren habe, daraufhin gingen sie. – –
Als ich nach dem Abmarsch sämtlicher Verwandten durch den Garten lief, um mich moralisch auszulüften und gerade über ein paar Rasenflächen gesprungen war, hörte ich über den Zaun herüber den jungen Doktor mit verstellter Demut fragen:
»Wohin sehen meine Augen die achtzehnjährige Majestät in voller Würde schreiten?«
Ich ärgerte mich wahnsinnig, nicht würdevoller den Garten herabgeschritten zu sein, denn weißt Du, Kather, dieser junge Mann ist der Sohn des Oberstabsarztes, der soeben sein Doktorexamen überstanden hat und nun darauf ausgeht, die Mitmenschen so schnell als möglich in die nächste Welt zu schicken, wie Großmama sagt, was aber nur Verleumdung ist, verstehst Du? Er ist so hübsch und hat einen so zierlichen schwarzen Schnurrbart und so schöne schwarze Augen und ein interessantes blasses Gesicht, daß ich mich ihm gleich anvertrauen würde – wie dumm ich mich ausdrücke –, jetzt wirst Du glauben, seiner Schönheit willen geschieht es. Nein, nein.
Eigentlich behandelt er mich gar nicht als »erwachsen«, er hat mich vor ganz kurzer Zeit noch am Zopfe gezogen und fragt mich auch, sooft er mich sieht, wie viele Speise ich kürzlich bei meinen Kochversuchen verdorben habe, aber ich antworte immer höflich – man muß gegen Nachbarn höflich sein, sagt Mama, und so entgegnete ich auch diesmal ohne scheinbaren Aerger:
»Ich hole einige Blumen für den Mittagstisch.« Ein wenig warf ich trotzdem die Lippen auf. Einer erwachsenen Dame gegenüber – – –
Aber im nächsten Augenblick war jeder Mißmut verschwunden. Er reichte mir einen Strauß der herrlichsten La France über den Zaun und rief fröhlich:
»Gratuliere, Geburtstagskind!«
O Käthe, Männer können doch entzückend sein, wenn sie wollen – aber leider wollen sie nur so selten, so äußerst selten!
Ich habe mir die Rosen aufgehoben, als sie trocken geworden. Man hat nur einmal im Leben einen achtzehnten Geburtstag, gelt, Käthe? Ich wünschte, ich wäre so mutig wie Du und könnte in die weite Welt ziehen. Der Doktor – ich habe Dir gar nicht seinen Namen gesagt, er heißt Emil Wurmbrandt – hat mir neulich gesagt:
»Fräulein, um Ihret und um Ihrer Freunde willen wünschte ich, daß Sie Ihrem Fräulein Schwester ähnlicher wären!« Käthe, wie soll ich das nur anfangen? Willst Du mir helfen?
Jetzt muß ich schließen – wir gehen auf ein Tanzkränzchen, und ich habe ein hinreißend schönes Kleid mit rosa Schleifen auf der rechten – aber das interessiert Dich nicht.
Schicke nur recht oft ein Modeheft!
Deine Schwester Jenny.«
Ich legte den Brief neben mich auf das Bett, dessen Matratze in mir das Empfinden wachrief, als läge ich auf einem Kartoffelsack, denn sie bestand aus Hebungen und Senkungen, mit gelegentlichen Vorgebirgen und Tiefebenen, lehnte mich müde zurück und dachte über die Zeit meines freiwilligen Exils nach. Drei Jahre, seit ich von der Heimat fort war! Der Mann, den ich einst geliebt hatte, war tot – und mehr. – Oft später hatte ich Heiratsanträge von Männern der verschiedensten Nationen gehabt, ohne daß ich mich zu einer Ehe hätte entschließen können. Sie sprachen dieselben Worte, gebrauchten dieselben Beteuerungen, würden dieselben Kosenamen anwenden, die er einst gebraucht, und dies verletzte mich jedesmal im Herzen. Ich hätte es nicht ertragen können, nein, nie! Jennys biegsamer Charakter, ihr flatterhafter Sinn paßten sich den heimischen Verhältnissen viel besser an als der meinige. Sie würde heiraten, weil man ihrer und Mamas Ansicht nach heiraten mußte, weil es »hübsch« war, »gnädige Frau« zu sein, und weil man sich doch nicht um eine Hochzeitsreise beschwindeln lassen durfte, nicht weil sie den Mann, den sie erwählte, besser als alles auf Erden liebte. Sentimental war Jenny nicht, sie genoß das Leben, ohne sich über das Warum und Woher den Kopf zu zerbrechen.
Drei Jahre! Mir schienen es zwanzig Jahre, so reich an Erfahrungen war die Zeit gewesen. Dem Glücklichen schlägt keine Stunde, sagt man, um so besser vernimmt der Unglückliche nicht nur den Stunden- sondern den Sekundenschlag. Dem Frohen dünkt das Jahr eine angenehme Folge von Frühling, Sommer, Herbst und Winter, der Traurige teilt das Jahr in 365 Tage ein, von denen jeder Tag 24 Stunden hat, von denen er gewiß 16 Stunden sich seiner Lage voll bewußt ist und die 60 Minuten jeder einzelnen Stunde auf bleiernen Schwingen vorüberziehen fühlt.
Ich setzte meinen Hut auf und zog den Mantel fester um mich. Ich wollte durch die triefenden Gassen wandern, um meine Glieder in eine andere Stellung zu bringen. Der frühe Abend war angebrochen, die Gaslaternen warfen ihren Schein über das nasse Pflaster, und ich dachte, als ich langsam in dieser Einsamkeit dahinstolperte, darüber nach, wie man die gegenwärtige Lage verbessern könnte. Heimkehren wollte ich nicht, ich brauchte bloß an alle Vorwürfe bezüglich meiner »Verschiedenheit« von den anderen Mädchen zu denken, um diese Idee zu verwerfen, weiterleben so konnte und wollte ich noch weniger. Da reifte langsam der Entschluß, den ich bis jetzt verworfen hatte: Ich wollte sterben. Aber wie? Ich ging der Reihe nach alle Gifte und ihre Wirkungen durch und wünschte, ich wäre Chemiker. Aus den Bars drang Musik, aus einigen Häusern ertönte Lachen. An den Mauern entlang huschten Schatten – Unglückliche, die kein Heim, kein Obdach hatten. – Ich betrat Tottenham Court Road mit seinen glänzenden Ankündeschildern, hellerleuchteten Cafés und vielen Straßenlaternen. Gleichgültig gegen alles schritt ich dahin und blieb unwillkürlich, eher geistig als körperlich müde, vor einem Bilderladen stehen, als ich mir plötzlich bewußt wurde, daß jemand an meiner Seite stand und ein Gespräch anknüpfen wollte. So etwas war mir früher hundertmal passiert und hatte mir immer schnell über die belebteste Straße geholfen, heute jedoch war ich so müde, daß ich mich nur langsam weiterschleppte. Der Schatten an meiner Seite blieb, und ich hütete mich, in seine Richtung zu schauen. Ich glitt vom Bürgersteig herab und ging auf die andere Seite der Straße, worauf ich in eine Seitengasse einbog, die mich nach Guildford Street zurückführen sollte.
Auf einmal sagte jemand dicht neben mir:
»Gu Habend!«
An meiner Seite stand der »Schatten« von früher. Ein koketter Schnurrbart und große dunkle Augen waren das Auffallendste an ihm. In den Augen vieler Mädchen hätte er gewiß als schön oder wenigstens hübsch gegolten, mich stieß der siegesgewisse Ausdruck in seinem Gesicht ab. Nachdem ich ihn von oben bis unten schweigend betrachtet hatte, ging ich weiter. Er folgte unverdrossen, was man sonst in London nie tut, wenn keine Ermutigung erfolgt. Was sollte ich tun? Der Kerl sah wie ein Italiener aus, ich bat ihn daher in dieser Sprache, mich in Ruhe zu lassen.
»Ick bin Kritsch,« sagte er.
O du Himmel, von der Sprache habe ich noch nie etwas gehört. Konnte er ein Orientale sein oder irgendein Südamerikaner? Er sah doch wie ein Europäer aus. Ich versuchte es mit Französisch, mit Spanisch und Deutsch. Umsonst! Alles, was ich erreichte, war:
»Ick sein Kritsch, Sie nette Mäk–ken!«
»Ick Tabak zuzuzuzuzuzu!« erklärte er nach einer Pause. Dieses Wort war der gewünschte Blitz im Dunkel. Fast alle Tabakverkäufer in London sind Türken oder Griechen. Der »Kritsch« war ein Grieche.
Vor einem schmutzigen Hause blieb er stehen.
»Hier bin ick!« erklärte er mir.
»Freut mich!« entgegnete ich und ging weiter.
»Nick gehn – nick gehn –« rief er gereizt, lief mir nach und faßte mich am Arm. Nirgends war eine Menschenseele zu sehen, die mir zu Hilfe hätte kommen können, aber dessen bedurfte es auch nicht. Ich wußte, daß ich eine Stimme produzieren konnte, die sich über mehrere Gassen erstrecken würde – wenn notwendig. Vorläufig versuchte ich im einfachsten Englisch, jedes Wort so klar und deutlich wie möglich aussprechend, dem »Kritsch« begreiflich zu machen, daß er an die gefehlte Adresse gekommen sei.
»Gute Kaffee – sehr gute Kaffee oben,« wiederholte er. »Süße Frückt, viel süß auck,« zählte er seine Lockmittel auf.
Ich schüttelte den Kopf, daß mir das Genick weh davon tat. Dieses Zeichen mußte denn doch international sein, aber die Hand des Griechen hielt mich so fest wie im Anfange.
Endlich zog er ein Goldstück aus der Tasche und reichte es mir. Nun begann der Spaß mir zu viel zu werden, und zum Glück erschien am Ende der Gasse in diesem Augenblick die Säule der Gerechtigkeit. Das Geldstück gewaltsam in die Hand des Griechen zurückdrückend und mit der freien Hand auf die kommende Gestalt zeigend, stieß ich ihn von mir. Ein Blick auf die uniformierte Persönlichkeit, das Sinnbild von Ordnung und Sittlichkeit, war auch genug gewesen. Der »Kritsch« verschwand in dem Hause, als ob der Böse hinter ihm wäre, und ich konnte ruhig meinen Weg fortsetzen. Die Episode hatte mich aus der Melancholie aufgerüttelt und meinen Gedanken eine andere Wendung gegeben.
Wenn nun so ein armes Mädchen, das vielleicht nicht genug Geld hat, um für sein elendes Zimmer zu zahlen, an meiner Stelle gewesen wäre? Wenn man so jemand das Goldstück angeboten hätte in einer kalten, trostlosen Nacht? – Wie leicht wird es den reichen Mädchen, die immer begleitet, immer beschützt herumgehen, die nie etwas entbehren, gut zu bleiben, und mit welcher herzlosen Verachtung und mit welchem Dünkel sehen sie auf ihre unglücklichen Schwestern herab, die eine ganze Kette ungünstiger Zufälle nach schwerem Kampfe aus reiner Ermüdung zu Fall gebracht. Diese reichen Mädchen sollten bedenken, daß sie nur gut sind, weil sie keine Möglichkeit haben, etwas anderes zu sein. Urteilen können sie erst, wenn sie selbst im Kampfe gestanden und gesiegt haben, – verurteilen nie. –
Ich schritt nachdenklich heimwärts. In den belebteren Gassen strömten die Gläubigen aus allen Kirchen und sonstigen Gebäuden, wo religiöse Uebungen abgehalten wurden, heraus, übermäßig elegant gekleidete Frauen schritten mit gemalten Gesichtern und frechem Ausdruck um den Mund auf und ab, im Rinnsal spielten einstige Künstler, die in der Welt herabgekommen waren, Violine, und Sängerinnen, deren Stimme versagt hatte, sangen Opernarien, vom Lärm der auf und nieder flutenden Fuhrwerke übertönt. Vergrämt aussehende Italienerinnen mit schwarzem Tuche malerisch um das noch immer anziehende Gesicht geschlungen, standen in den Pfützen und drehten die Drehorgel, auf der mit großen Buchstaben ihre Leidensgeschichte geschrieben war, Blumenmädchen boten schüchtern die Parmaveilchensträuße an, und zwischen ihnen hindurch, an ihnen vorüber schritt ich ernst und dachte darüber nach, wie ich wohl am besten sterben könnte. Tränen des Himmels – die kühlenden Regentropfen – benetzten mein blasses Gesicht, und der Wind fuhr wie leise liebkosend darüber hin. Und so erreichte ich mein Heim – besser das Loch, wo ich das erkaufte Recht hatte, mich niederzuwerfen – wieder.
Kein Licht – trotz allen Gebets kein Licht – zeigte sich am fernen Horizont. Und die Tage kamen und schwanden.
| Voghiam, voghiamo, o disperate scorte, |
| Al nubiloso porto de l'obblio, |
| A la scogliera bianca de la morte – |
| Carducci. |
VIII.
Der Frühling mit seinen scharfen Ostwinden war vorüber, der Sommer war jäh ins Land gezogen. Nicht länger legte sich der Nebel über die Siebenmillionenstadt, aber der bekannte Großstadtdunst hatte zur Folge, daß man den Himmel trotzdem nie klar zu sehen bekam, so daß ich mich oft fragte, ob bei uns daheim der Himmel wirklich so blau gewesen, wie meine Phantasie ihn mir nun vorspiegelte.
Ich hatte heimgeschrieben und Mama gebeten, mir Jenny auf einige Wochen zu überlassen. Ich verdiente genug, um mir diesen Luxus leisten zu dürfen, und ich verging vor Sehnsucht nach irgendeinem Wesen, mit dem ich hätte sprechen können. Jenny verstand mich nicht, aber es war doch meine Schwester, zu der ich sprach, um die ich sorgen durfte. Wie gefürchtet, gab Mama nicht ihre Zustimmung. Die Tanten hatten ihr so lange abgeredet, da es Jenny so selbständig machen würde, und ein Mädchen müsse vorsichtig sein, wenn es eine gute Partie machen wolle usw. – So war meine letzte Hoffnung geschwunden. Mein alter Freund und Kollege war erkrankt, viele Bekannten hatten London verlassen, die Verhältnisse im Amt waren bedeutend unangenehmer geworden, eine kleine Französin, der ich lange geholfen hatte, und für die ich monatelang allerlei Opfer brachte, zeigte sich als Feindin und als vollständig undankbar – ich war des ewigen Einerleis satt, ich glaubte an nichts mehr, da Rettung von keiner Seite kam, ich konnte das innere Gleichgewicht nicht finden, und was ich vor wenigen Wochen noch als Möglichkeit betrachtet hatte, war nun zum Entschluß geworden. Gifte waren schwer erhältlich, ich wollte daher ein langsames Mittel anwenden, von dessen Unfehlbarkeit ich oft gehört hatte. Ich kaufte Weinessig und trank ein Glas davon jeden Morgen. Oh, die Qualen, die ich ausstand! Der Ekel, der mich jedesmal überkam, wenn ich das Glas an meine Lippen führen sollte, die entsetzlichen Schmerzen, die dem Genusse des Getränks folgten! Manchmal taumelte ich vor Schmerzen und Unwohlsein gegen eine Straßenecke, oft saß ich Stunden nachher fast regungslos auf meinem Stuhl im Amte, die Arbeit nur mechanisch ausführend, während große Schweißperlen auf meiner Stirn standen. An manchem Tag erbrach ich, was ich getrunken, und der Brechreiz und Ekel waren oft so heftig, daß ich nahe daran war, das Glas auf den Boden zu schleudern und aufzuhören, aber da sah ich mich in meiner Bude um, dachte, daß ich eine lieb- und freudenlose Existenz möglicherweise noch sechzig Jahre würde ertragen müssen, und wie sauer der Essig, wie furchtbar der Widerwille auch war, ich setzte an und trank aus. Es war schwer, oh, so schwer zu sterben, aber es war noch grauenvoller zu leben, vielleicht gar lange leben zu müssen. Nur das nicht! Und ich trank – ich trank – und wieder kamen die Tage und schwanden. –
In dem Dunkel, das mich umgab, war der einzige Lichtpunkt der kleine Chinese. Seit über sechs Monaten war er nun mein Schüler, und jede Stunde brachte uns näher zueinander. Er hatte Tee aus China erhalten und machte nun jedesmal Tee, sooft ich ihm eine Stunde gab. Er hatte einen kleinen Schnellsieder, einen Teetopf und zwei hübsche Tassen und war so geschickt bei der Teefabrikation wie das allerhausmütterlichst erzogene deutsche Mädchen. Er hielt mir immer das Wasser und die Kanne hin, damit ich mich überzeugen konnte, daß kein »Pulver« verwendet wurde, obschon ich ihm oft sagte, daß ich keinerlei Zweifel hegte.
Er hatte der großen Hitze wegen – die ich zwar, sei es Schwäche oder Unempfindlichkeit, nicht fühlte – einen kleinen Fächer und fächelte sich unaufhörlich; auch klagte er wieder, daß man hier so »dumm« gekleidet gehe. Sein Heimweh war größer denn je.
Sooft er neue Kleider erhielt, zog er immer die Schachtel sorgsam auf das Sofa und zeigte mir alles – rühmte den Schnitt der Beinkleider, die Weichheit des Stoffes, die Farbe der Weste usw. und führte auch seine schönen chinesischen Seidenhemden vor, die mir wirklich gefielen. Sie waren so dicht, so weiß und so weich. Sonst mußte ich über seine Eitelkeit lachen. Er kaufte wenigstens vier Krawatten wöchentlich und war auch in anderen Luxusartikeln geradezu verschwenderisch. Er war sehr eitel und fand an Kleidern denselben Gefallen, hatte für die Mode dasselbe Interesse wie Jenny daheim, stäubte seinen Salon täglich noch einmal selbst ab, ordnete und kaufte Blumen und hatte sehr viel Sinn, ein Zimmer behaglich zu machen. Er drückte allem, mit dem er in Berührung kam, seinen Stempel auf, während ich immer, selbst daheim in meinem eigenen Zimmer, ein Gast, stets ein Fremdling blieb. Mein einziger Stempel, wenn ich überhaupt einen aufdrückte, war – ich muß es mit Schande gestehen – die Unordnung.
Es geschah oft, daß Ming Tse nach der Stunde ein kleines Sträußchen aus der Vase zog und es mir mit der Bemerkung gab, ich müsse etwas im Knopfloch tragen. Als Schüler war er faul – maßlos faul –, aber er brachte mich mit seinen Grimassen, seinen treffenden Kritiken, seinen komischen Stellungen und der Eigenartigkeit seines Wesens trotz meines Trübsinns noch immer zum Lachen – kurz, von allen Freunden und Bekannten war er der einzige, der mir geblieben, daher sagte ich mir oft – oft sogar mit innerem Zittern – »noch eine schwache Säule zeugt von entschwund'ner Pracht –«
Der Kleine tyrannisierte mich indessen, als ob er Professor und ich der Schüler wäre. Ich mußte tun, was er nun einmal wünschte – und ich tat es. Eines Tages sagte er mir:
»Herr Hian-Sho-Dschin, dem ich von Ihnen erzählt habe, möchte gern von Ihnen Stunden nehmen. Sie werden gehen, nicht wahr?« fragte er mich in dem Tone und mit dem Gesichtsausdrucke, der sagen wollte: »Du mußt!« und daher erklärte ich mich bereit. Ob ich mich zu Tode arbeitete oder sonstwie ins Grab sank, war ja einerlei, wenn ich nur diese Erde los wurde.
Am folgenden Tage erwartete er mich bei der Haltestelle der Elektrischen, um mich zu seinem Freunde zu führen. Wir wanderten Seite an Seite den kleinen Hügel hinauf, der zu der Wohnung Hian-Sho-Dschins führte, und anstatt wie sonst weit von mir entfernt dahinzugehen, kam er diesmal näher und legte sogar einige Sekunden lang seine kleine Hand auf meine Schulter. Ich war so verwundert, daß es mir nie eingefallen wäre, die Hand abzuschütteln. Im Gegenteil, ich ging vorsichtig weiter und tat nichts dergleichen. Er mußte jedenfalls von seinem Lehrer eine gute Meinung haben, so erklärte ich mir diese neue Vertraulichkeit.
Als wir ankamen, war der junge Seekadett Hian-Sho-Dschin noch nicht daheim. Ming Tse führte mich daher in seinen Salon und tat, als ob das ganze Haus sein eigen wäre. Ich setzte mich in einen Lehnstuhl ans Fenster, Ming Tse dagegen ging überall herum, untersuchte alle Bücher, alle herumliegenden oder -stehenden Gegenstände und zog, als er damit fertig war, zu meiner überaus großen Verwunderung einen Schlüsselbund aus der Tasche, mit welchem er sofort daran ging, zu versuchen, alle Schlösser aufzubrechen. Einige gaben nach, und Ming Tse untersuchte sorgfältig den Inhalt der verschiedenen Laden und Kasten.
»Aber Herr Ming Tse!« rief ich entsetzt, »was wird Ihr Freund sagen?«
»Gar nichts; ich bin ja sein Freund,« meinte er lakonisch.
»Das ist bei – Chinesen – so Sitte,« dachte ich mir und wußte nicht, ob ich lachen oder mich ärgern sollte.
Inzwischen hatte Ming Tse mit Hilfe seiner Schlüssel alles geöffnet und durchgesehen, was noch geöffnet werden konnte, mit Ausnahme einer Lade, die allen Anstrengungen widerstand. Mein kleiner Chinese ließ sich nicht einschüchtern. Ruhig zog er sein Taschenmesser heraus und begann das Schloß zu erbrechen.
»Das geht wirklich nicht,« protestierte ich. »Was wird Ihr Freund von mir denken?«
»Oh,« entgegnete er lachend. »Sie brauchen es ja nicht mir nachzumachen.«
Inzwischen war das Schloß erbrochen, und Ming Tse las die Briefe, die in der Lade waren, alle mit der größten Seelenruhe durch, kein Protest meinerseits konnte ihn davon abhalten.
»Ich muß wissen, wieviel Mädchen er hat,« gab er als Entschuldigung für seine Handlungsweise an.
»Lieber Herr Ming Tse,« warf ich lachend ein, »kümmern Sie sich, bitte, mehr um den armen Jakob I., von dem Sie nach fünf Monaten noch ebensowenig wissen wie vor diesem Zeitraum, und lassen Sie Herrn Hian-Sho-Dschins Briefe in Ruhe. Sie sind noch zu klein, um an Mädchen zu denken,« neckte ich ihn.
»Meinen Sie?« Ein eigenartiger Ausdruck kam in sein Gesicht, die Augenlider senkten sich fast ganz über die schwarzen Punkte, und nur zwei Schlitze leuchteten mir aus dem gelben Gesichtchen entgegen.
»Größer werde ich nie werden,« sagte er mit Nachdruck, »und Hian-Sho-Dschin ist nicht einen Tag älter als ich,« fügte er hinzu.
In diesem Augenblick kam mein Schüler, und das Gespräch wurde abgebrochen. Der neue Chinese war bedeutend größer als Ming Tse, hatte aber ein kugelrundes Gesicht, wirres schwarzes Haar, das wie Borsten abstand, runde, ausdruckslose Augen und dicke Lippen, die unregelmäßige Zähne verdeckten, von denen der eine ganz ausgebrochen war. In seinem ganzen Auftreten lag etwas Unsicheres, Verschlafenes, was mich fürchten ließ, kein besonderes Kirchenlicht erfangen zu haben. Ming Tse wohnte der ersten Stunde als Kritiker bei. Er machte Grimassen, sobald Hian-Sho-Dschin einen Fehler machte und unterhielt sich und mich, indem er nachäffte, wie zögernd und unbeholfen der Seekadett ein Diktat schrieb. Er ließ die Feder immer ein paarmal in der Luft herumfahren, bevor er ansetzte, und auch da sah es aus, als ob er ein Greis wäre, dessen Hand die Feder nicht mehr ruhig führen könne.
Sein Ideal war das Lesen politischer Artikel, von denen er gewiß nichts verstand, aber da seine Begeisterung für diese Art Literatur so groß war, tat ich nichts dagegen.
Mit wahrer Gönnermiene führte er mich nach der Stunde von Hian-Sho-Dschin weg und sagte mir in dem Tone eines weisen Vormundes, indem er mich von der Seite ansah:
»Sie dürfen aber nie – nie etwas annehmen von Hian-Sho-Dschin, er ist noch viel schlimmer als Hoang-Zo.«
Ich gelobte feierlich, seiner Warnung zu gehorchen, konnte mich jedoch nicht enthalten, innerlich zwischen Europa und Asien einen Vergleich zu ziehen. Auf seine Art und Weise hatte der kleine Chinese mich gewiß gern – er war sogar um mich besorgt –, aber dies hinderte ihn nicht, mich mit gefährlichen Personen bekannt zu machen, nein, mich geradezu zu bitten, hinzugehen. Warum?
Während wir über die Heide gingen, fragte ich ihn:
»Herr Ming Tse, würde es Ihnen leid tun, wenn ich sterben würde?« Ich fühlte, daß ein Wort des Bedauerns mir wohltun könnte.
Er sah mich verwundert an. »Ja, gewiß.« Nach einer kleinen Pause fuhr er fort: »Ich würde einen Brief schreiben, einen sehr langen und lieben Brief und ihn auf Ihrem Grabe verbrennen.«
Nach chinesischen Anschauungen kann nämlich der Tote auf diese Weise erfahren, was der Lebende ihm sagen wollte. Unwillkürlich erwachte die Neugierde in mir, zu erfahren, was in dem langen und lieben Briefe stehen würde, aber ich sagte nur:
»Das wäre in der Tat sehr lieb von Ihnen, Herr Ming Tse.«
»Sie sind mein liebster Professor,« entgegnete Ming Tse, und ich fühlte, daß mir vor Rührung die Tränen in die Augen stiegen, kam ich mir doch so verlassen und unverstanden vor, und tat mir dieser einfache Ausspruch, der am Ende ja nur »chinesische Höflichkeit« war, doch so wohl! Ich wandte indessen mein Gesicht ab, um meinen kleinen Chinesen nichts von dem, was in mir vorging, merken zu lassen. –
Es mochte mehr als eine Woche verstrichen sein. Seit etwa vier Wochen hatte ich mit Aufbietung aller meiner Willenskraft jeden Morgen ein Glas Essig getrunken, aber zu meiner Verzweiflung merkte ich noch gar keine Wirkung. Wohl war ich blasser geworden und hatte dunkle Ringe unter den Augen, wohl aß ich wenig und ging mit Anstrengung, trotzdem flüsterte mir eine innere Stimme zu, daß ich nicht, wie ich ausgerechnet hatte, in sechs Monaten tot sein würde. Ich fühlte mit Mutlosigkeit, daß ich diese Marter nicht sechs Monate aushalten könnte – ich mußte ein anderes, ein schnelleres Mittel finden, aber welches?
Da erinnerte ich mich an »Der Blumen Rache« von Freiligrath. Ich wollte Lilien, Tuberrosen und andere stark duftende Blumen kaufen, Tür und Fenster sorgfältig verhängen, einen langen, langen Spaziergang machen, von dem ich todmüde nach Hause kommen würde, wollte mich auf das Bett werfen, wo ich so oft bitterlich weinend gelegen hatte, und wollte die Blumen in allerlei Gefäßen um dasselbe gruppieren, die am stärksten dufteten aber auf mich legen und dann – Hoffentlich gab es kein Erwachen!
Ich hatte die Nacht vom Sonnabend zum Sonntag gewählt. Dieser Tag war immer so viel entsetzlicher als die sechs anderen zusammengenommen, daß ich mir eine wahre Freude daraus machte, einen Sonntag zum Abfahrtstag zu ernennen. Ob Hölle, ob nichts auf der anderen Seite – es war mir gleichgültig. Ich hatte die Hölle hier, und das Nichts hat mich nie erschreckt. Wie schön, wie überwältigend schön es sein mußte, zu vergessen, daß man je gelebt hat! Dann waren alle Leidenschaften tot, alle Wünsche begraben. Ich verbrannte meine Briefe, verschenkte meine alten Kleider, gab meinen Kolleginnen kleine Geschenke und rechnete meine Hinterlassenschaft zusammen. Sie würde klein sein, da mich die Blumen so viel Geld kosten würden. Sooft ich an einem Blumengeschäft vorbeiging und mein Auge auf die großen, glänzenden, stark duftenden Lilien fiel, fuhr ein leiser Schmerz durch mein Inneres. Sterben war ja schön – es war das einzige, was mir Trost bringen konnte, was erfolgreich die Sehnsucht nach Glück in mir vernichten würde, aber es war traurig, zu sterben, bevor man gelebt hatte. Ich hatte treu geliebt und lange – so lange, daß ich nie vergessen konnte, und doch hatte ich das oft damit verbundene Glück nie gekannt, kaum geahnt. Ich schüttelte heftig diese unnützen Betrachtungen ab und sagte mir leise: »Uebermorgen!«
Und mir schien es, als hörte ich die Schwingen des Todes mich umrauschen.

A. F. Seebacher |
| Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt, |
| Und bist du nicht willig, so brauch' ich Gewalt. |
| Goethe. |
IX.
Es war Freitag abends – noch vierundzwanzig Stunden, und die Frist war abgelaufen. Heute sah ich Ming Tse – den letzten Lichtpunkt in meiner traurigen Existenz – zum letztenmal. Noch einmal würde das fremdländische Parfüm des chinesischen Tees den kleinen Raum durchstreifen und mich schmeichelnd umkosen, noch einmal würde die komische, kleine Gestalt den Federstiel in den Mundwinkel versetzen und nachdenklich aufwärts blicken, noch einmal würde ich sein ansteckendes Lachen hören, noch einmal von ihm zur Elektrischen begleitet werden, und dann – dann war alles vorüber. Montag früh würde man hoffentlich in den Blättern lesen, daß – aber wozu daran denken? Nicht mehr sechzig trostlose Jahre vor mir, Friede, Ruhe! Wie schön mir die bestaubten Blüten am Wegrand schienen, wie weich ins Rosa der Farbenton der fernen Wolken ging! Wie die einfachen Sperlinge mir zart geformt vorkamen und die Klänge einer Mundharmonika Erinnerungen an längstvergangene Kindertage wachriefen. In diesem Augenblicke fühlte ich, daß ich die Welt liebte, nicht weil ich zu bleiben wünschte, sondern weil ich wußte, daß ich von ihr schied, gerade deshalb liebkoste ich alles, was ich sah, in Gedanken und nahm Abschied von all dem Schönen, das sich mir zeigte.
Ming Tse kam mir wie immer freundlich entgegen und gab mir eine rote Rose, indem er sagte, daß diese auf der weißen Bluse sich gut ausnehmen würde, hierauf schritten wir an die Arbeit. Ich machte nur wenige Ausstellungen, und nur, als das Ende der Stunde nahte und er den Tee in der kleinen rosa Tasse vor mich hinstellte, fragte ich ihn, ob er nicht einige deutsche Gedichte lesen wollte. Ich hatte ihm vor einigen Tagen ein Buch deutscher Gedichte der hervorragendsten Dichter gegeben – es sollte ihm eine Art Erinnerung sein, wenn – Er erklärte sich zu meiner inneren Verwunderung gleich bereit, meinen Wunsch zu erfüllen. Was sollte dieser mir so unbekannte Eifer bedeuten? Wollte er mir in das Grab die Ueberzeugung mitgeben, die ich bisher nicht von ihm gehabt, daß er sich für etwas nicht rein Materielles interessieren könne?
»Was soll ich lesen?« erkundigte er sich, indem er das Buch vom Regal nahm und es aufschlug.
Ich weiß nicht mehr, was wir zuerst gelesen, das zweite Gedicht aber, das ich wählte, war der »Erlkönig«, weil es mir leicht verständlich erschien.
Ming Tse las und übersetzte weit besser als gewöhnlich, doch als wir zur vorletzten Strophe kamen, ging mein Erstaunen geradezu in Bewunderung über, denn er las diesen Vers zweimal, und zum erstenmal, seit ich ihn lesen hörte (und das geschah nun fünfmal wöchentlich seit nahezu acht Monaten), lag ein gewisses Gefühl, etwas wie Pathos in Stimme und Ausdruck.
»Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt,« sagte er und sah absolut überzeugt aus von dem, was er las. »Was war nur in ihn gefahren?« überlegte ich.
»– und bist du nicht willig, so brauch' ich Gewalt!« Eigentlich schien mir dieser Teil noch besser zu gefallen, wenigstens legte er den größten Nachdruck auf »so brauch ich Gewalt«. Ich muß ihm unrecht getan haben, sagte ich mir. Er hat Gefühl und Verständnis für Kunstgenüsse, er hat möglicherweise sogar eine Seele (was ich bis dahin sehr angezweifelt hatte) und ist besseren, erhabeneren Regungen zugänglich, nur hat niemand es verstanden, sie in ihm zu entwickeln.
Während ich mich diesen Betrachtungen hingab, hatte Ming Tse das Gedicht fertig gelesen und niedergelegt. Der eine Arm lag auf der grünen Tischdecke, der andere lag regungslos auf seinen zaundürren Beinchen. Die Sonne war im Sinken begriffen, und die ersten Schatten der Dämmerung erfüllten den Raum, ohne jedoch das Anzünden der Lampe nötig zu machen. Seine ruhigen, immer gleichen Gesichtszüge verrieten nichts von dem, was in ihm vorgehen mochte, nur die wimperlosen Lider waren tief gesenkt – die Augen schienen geschlossen. Durch das offene Fenster drang fernes Klavierspiel undeutlich herein, und in der kurzen Pause konnte man das Summen einer ins Zimmer verirrten Biene hören.
Die Augen öffneten sich nicht, aber das Gesicht wurde mir zugewendet, als er die Frage an mich richtete:
»Wollen Sie meine Frau werden?«
Wenn der Mond vom Himmel herab und zum offenen Fenster hereingestiegen wäre, hätte ich nicht erstaunter sein können. Ich habe doch schon öfter selbst Heiratsanträge gehabt, habe den Verlobungen anderer beigewohnt (gewiß ein seltener Fall), hatte manch ein Paar Liebende zusammengebracht, aber so etwas wie diese unvermittelte Frage über den Tisch herüber von dem kleinen Chinesen – das überstieg selbst meinen doch gewiß ungewöhnlich ausgedehnten Horizont.
»Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt, und bist du nicht willig, so brauch' ich Gewalt,« sagte Ming Tse mit jener unerschütterlichen Ruhe, die nur ein Asiate haben kann. Die Worte an und für sich waren freundlich gemeint, der Ton hätte in seiner Leidenschaftslosigkeit ebensogut »ich hasse dich« ausdrücken können.
»Würden Sie mit einer Europäerin glücklich werden können, und würde Ihr Vater einen solchen Schritt Ihrerseits je billigen?« fragte ich, als ich den Gebrauch meiner Sprachwerkzeuge zurückerlangt hatte.
»Mein Vater hat Europäer gern, und er weiß, daß ich mit Ihnen stets weiterstudieren könnte. Was mich anbetrifft, so sind Sie die einzige Person, die ich in Europa gern habe, und in China habe ich nur noch eine Person lieb – meine Mutter!« sagte er ruhig.
Ich hätte um alles in der Welt gern seine Augen gesehen. Wenn man über seine ganze Zukunft entscheidet, wenn man sein Leben, sein Glück, seine Freiheit in die Hand eines Mannes legt, so möchte man gern irgendwelche moralische Ueberzeugung haben, daß er diese Schätze, unser Um und Auf, zu hüten wissen wird; aber die schwarzen Augen des Chinesen waren verdeckt von den Lidern, die wie aus Elfenbein geschnittenen Züge verrieten nichts von seinen Gefühlen oder Absichten, und er kam mir nicht näher. Er saß mir gegenüber und – wartete.
Sollte ich »nein« sagen? Allerdings entging ich damit neuen moralischen Konflikten, möglicherweise wies ich damit kommendes Unheil ab, aber andrerseits, warum sollte ich nicht »ja« sagen? Meine Lage war nicht wie die anderer Mädchen. Einen Europäer hätte ich nicht heiraten mögen, weil er mich zu sehr an – an ihn, den Verlorenen, erinnert hätte, aber warum nicht einen Orientalen? Verschieden genug waren sie, um ein Erinnern auszuschließen.
Und was begann ich, wenn ich »nein« sagte? Ich wollte ja morgen sterben. War es nicht wie eine Fügung des Himmels, daß mich der kleine Chinese gerade heute fragte, ob ich seine Frau werden wollte? Der Tod lief mir nicht davon. Entweder war meine Zukunft heller, und da konnte ich weiterleben, oder sie war ebenso dunkel oder noch dunkler (ich schauerte unwillkürlich zusammen), und da konnte ich sterben. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, und unterdessen konnte ich versuchen, die schlummernde Seele in diesem kleinen Chinesen zu wecken. Er war ein Jahr jünger, wir waren gleich groß und im Wissen war er mir weit unterlegen. Ich würde ein gewisses Uebergewicht haben. Da ich nichts zu verlieren hatte, konnte ich nur gewinnen.
Ming Tses Augen oder die Ecken seiner Augen blieben die ganze Zeit auf mich geheftet. »Ja oder nein?« fragte er endlich.
»Ja!«
»Ich bin sehr froh,« sagte er einfach. »Ich freue mich auf die Zeit, wo wir immer beisammen sein werden.«
Er hatte gleich mir oft und bitter unter der Einsamkeit gelitten, es würde dies ein Band mehr zwischen uns sein.
Wir lächelten uns zu – das war alles. Zum erstenmal schien es mir, als ob die europäische Sitte sich bei einer Verlobung zu küssen, unleugbar seine Vorteile habe. Gerade in jenen Augenblicken fühlte ich, daß es angenehm sein müßte, sich, und wäre es auch nur einige Sekunden lang, an eine anteilnehmende Brust zu lehnen, war ich doch wie ein vom Sturm mitgenommenes und beinahe gestrandetes Schiff eben in einen Hafen eingelaufen – aber der Hafen, das fühlte ich leider gleichzeitig, war eben ein chinesischer.
Wir sprachen nur über alltägliche Dinge, nur als ich mich erhob, um wegzugehen, sagte er:
»Jetzt mußt du mich »Du« und »Li Bai« nennen, Käthe!«
»Sehr gerne!« erwiderte ich. Er begleitete mich zur Elektrischen, reichte mir gerade so einfach die Hand zum Abschied wie immer und fügte nur hinzu:
»Jetzt sind wir Freunde, nicht wahr?«, was ich bejahte. Ein letzter Gruß von der kleinen braunen Hand, in die ich alles gelegt hatte, was einem Mädchen teuer sein kann, und die Elektrische trug mich um die Ecke, während ich das Gefühl hatte, als halte mich irgendein böser Geist bei den Füßen und ließe mich gewaltsam kopfstehen, wodurch ich alles, was früher gerade war, verkehrt sehen mußte. Mich deuchte, als hätte sich mein Gesichtspunkt vollständig verändert, als hätte ich den Splitter eines Zauberspiegels ins Auge bekommen, der mich alles verzerrt und ganz anders als vorher erblicken ließ. Er hatte nicht einmal die Hand auf meinen Arm gelegt – er war in der Entfernung von einem Meter den ganzen Abend, auch auf dem Heimwege, geblieben. Wenn ich Verschiedenheit von Europäern wünschte, hier hatte ich eine genügende Menge davon.
Und auf diese Weise war ich die Braut von Li Bai Ming Tse geworden.
| Toujours Mars ne met pas au jour |
| Des sujets de sang et de larmes, |
| Mais toujours l'empire d'amour |
| Est plain de troubles et d'alarmes. |
X.
Sechs Wochen waren seit jenem ereignisvollen Abende ins Land gegangen, und dennoch glaube ich nicht, daß Li Bai und ich uns geistig genähert hatten in dieser Zeit. Er hörte aufmerksam zu, wenn ich ihm von allerlei Kunstwerken erzählte, er sammelte mit sichtlichem Vergnügen die Karten, Bilder aus der Mythologie vorstellend, und war nicht abgeneigt, die Sagen zu erfahren, aber weiteres Interesse erweckten sie nicht bei ihm. Wir lasen Werke zusammen, – er ohne Anteilnahme. Wir nahmen die englische Literaturgeschichte durch, und manche Perlen wurden ausgegraben, aber an ihn waren sie verschwendet. Er liebte nur ganz einfache Sachen der Wirklichkeit, am allermeisten als Hausfrau herumzuschalten, alles aufzustellen, zu putzen, zu schmücken. Er konnte stundenlang bei dem einen Indier sitzen und ihm zusehen, wie er ein Skelett zusammensetzte, räumte für ihn die Bücher auf und flickte jeden Sonntag nachmittag seine Sachen, bevor er zur Gesandtschaft ging, wo er den Abend verbrachte. Hatte ich gehofft, weniger einsam zu sein, wenn ich mit ihm verlobt war, so mußte ich mir eher das Gegenteil eingestehen. Ich kam mir eben durch den Kontrast noch verlassener, noch einsamer vor, tröstete mich indessen mit dem Gedanken, daß ich noch genug von seiner Gesellschaft haben würde, sobald wir verheiratet waren.
An Ueberraschungen fehlte es nie, denn wenn ich schon nicht über meine Verwunderung, daß irgendein Mann ein Recht haben sollte, ein Mädel zu küssen und es nicht tun würde, hinwegkam, so hatte ich Grund, mich über andere Sachen noch mehr zu wundern.
Es war etwa eine Woche nach unserer Verlobung, als er mich bat, meine Hand flach auf den Tisch zu legen, da er Messungen vornehmen wollte. Ich tat wie er mir geheißen, und er maß und maß eine halbe Ewigkeit an meinem Daumen herum, machte dann Zeichnungen auf ein Papier und schnitt endlich einen Kreis aus, über dessen Anblick er sehr vergnügt schien.
»Himmel, Li Bai,« rief ich lachend, »wollen Sie mir Daumenschrauben machen lassen?«
»Willst du,« korrigierte er.
»Verzeih' mir! Also sollen es Daumenschrauben werden?«
»Herr Hoang-Zo hat mir ein Pfund für dieses mein Wissen bezahlt,« versicherte mir mein kleiner Chinese.
Aufrichtig gesagt, hätte ich für sein Gesamtwissen nicht den übertriebenen Preis von 20 Mark bezahlt – das erschien mir für den Vorrat der reinste Wucherpreis –, aber vielleicht kannte ich wirklich nicht das mager assortierte Warenlager seines Wissens in seinem ganzen Umfang.
»Willst du mir nicht sagen, warum du herumgemessen hast?« fragte ich, mehr aus Wissensdurst als aus profaner Neugierde.
Er lachte, daß er sich schüttelte, und schien mit sich über alle Maßen zufrieden.
»Ich werde es dir sagen, wenn wir verheiratet sind,« tröstete er mich und begann an meiner Nase herumzumessen. Mein Gesichtsvorsprung war immer mein wunder Punkt, da feindliche Zungen ihn mit einer Kartoffel in einem Mißjahr verglichen hatten und ich mit bestem Willen von meiner Nase nicht behaupten konnte – ohne mich der haarsträubendsten Lüge schuldig zu machen –, daß sie hübsch sei. Ich wehrte mich daher sehr energisch, an ihr geometrische Studien anstellen zu lassen, was Li Bai aber keineswegs abhielt, in seinen Messungen fortzufahren. Nachdem sie scheinbar beendet waren, durfte ich den vorgesetzten Tee in Ruhe trinken.
Nicht vierzehn Tage nachher verreiste er auf zwei Wochen in ein Bad in Wales, wohin entfernte Bekannte ihn geladen hatten. Die Trennung schien ihm nicht nahezugehen und der Gedanke ihm nie zu kommen, daß ich mich einsam fühlen könnte.
Er hatte oft zu schreiben versprochen und hatte – zwei Karten geschickt. Ich war grenzenlos entmutigt, doch noch so schwach von den vorhergegangenen seelischen und körperlichen Leiden, daß mir die Kraft und der Mut fehlte, energisch vorzugehen, ihm den Laufpaß zu geben und auf eigenen Füßen zu stehen. Ich wußte, daß ich nicht fähig war, jetzt eine Veränderung zu ertragen. Ich tat daher das einzige, was ich unter diesen Umständen tun konnte: ich litt schweigend.
Ganz an komischen Episoden fehlte es indessen nicht. Kurz nach seiner Rückkehr von Wales flog er eines Abends auf mich zu (dieses geradezu kindliche Entgegenfliegen ließ mich manches übersehen und vergessen) und rief:
»Denke dir! Man schneidet Hian-Sho-Dschin den Kopf ab!« Seine Stimme klang entschieden triumphierend, denn da Hian-Sho-Dschin aus dem Süden, Ming Tse aus dem Norden Chinas kam, war sowohl ihre Sprache (oder doch der Dialekt) als auch ihre Anschauungen und Charaktere sehr verschieden, und Ming Tse sah immer mit Verachtung auf seinen mondscheibenbesichteten Landsmann, obschon letzterer ihn um Kopfeslänge überragte.
Mir fehlten die Worte. »Den Kopf abschneiden?« Es tat mir plötzlich ungeheuer leid um das Mondscheibengesicht und den stotternden jungen Seekadetten.
»Doch nicht hier, du lieber Himmel?« rief ich entsetzt.
»Ja, – nein,« erwiderte Li Bai. »Der Vater war Revolutionär, und ihm schneidet man dieser Tage in China den Kopf ab, und sobald Hian-Sho-Dschin nach China kommt, schneidet man ihm auch den Kopf ab,« erzählte mir Li Bai mit Frohlocken.
»Der arme junge Mensch!« sagte ich mitleidig. Er war mir allerdings alle Stunden, die ich ihm gegeben hatte, schuldig geblieben, aber deshalb wollte ich doch um keinen Preis daran denken, daß es angenehm sei, ihm den Kopf abzuschneiden.
»Er darf nie in sein Land zurückkehren,« meinte ich.
»Macht nichts, wir haben genug Schafe dort,« entgegnete Ming Tse. Nicht ein Funken Mitgefühl zeigte sich für den unglücklichen Landsmann.
»Wie hartherzig du bist, Li Bai!« sagte ich vorwurfsvoll.
»Warum sollte ich heucheln?« fragte er ganz verwundert. »Es tut mir nicht leid um ihn, warum soll ich es daher sagen? Hier in Europa tritt man jemand auf den Fuß, sagt ›es tut mir so leid‹ und lacht dabei trotzdem ganz vergnügt. Wir sagen nicht ›so leid‹, wenn wir nichts fühlen.«
Das war gewiß sehr wahr, ich war schon oft jemand auf die Zehen getreten, ganz besonders im Omnibus, und hatte vielleicht sogar manch ein Hühnerauge fest gequetscht, ohne daß mein Herz besonders »sorry« gewesen war, obschon meine Lippen mechanisch sofort »sorry« geflüstert hatten, aber dennoch – trotz alledem –? Chinesen sind Chinesen, dachte ich mir, und damit war alles gesagt.
Als Traum eines jungen Mädchens hätte ein solches Verhältnis nur Enttäuschungen mit sich geführt, denn obschon er mir oft Blumen, Obst und selbst Schmuckstücke gab, so zeigte er doch nie Zärtlichkeit. Auch auf die Liebe kam er nicht mehr zurück. Wozu denn? Er hatte es mir ja einmal gesagt und es war zu hoffen, daß ich nicht an Gedächtnisschwund litt, warum daher zweimal ein und dieselbe Sache erwähnen?
Andrerseits hatte es den Vorteil, daß mir alle unangenehmen und oft lächerlichen Fragen, die ein Europäer an mich gestellt hätte, erspart blieben, wie z. B. ob ich schon früher geliebt habe. Es gehört wirklich der grenzenlose Dünkel und die Verblendung eines eitlen Mannes dazu, sich vorzustellen, daß man dreiundzwanzig Jahre gerade auf ihn gewartet habe, um mit dem Verlieben anzufangen. Selbst wenn man bis zu diesem Alter »den einzigen und richtigen Mann« nicht gefunden hätte, würde man ihm doch nicht jene vertrauensselige Zuneigung entgegenbringen können, wie fünf Jahre vorher. Man kennt da schon das Leben, hat Männer in ihrem Umgange mit anderen Frauen beobachtet und hat bemerkt, daß die Götter, zu denen man einst mit so viel Bewunderung und mit vollster Ueberzeugung ihrer Unfehlbarkeit aufgesehen hat, nur Gipsfüße, wenn nicht gar – Hufe haben! Man liebt noch, aber eher vergebend, als bewundernd, blind vertrauend jedenfalls nicht mehr.
Ein Europäer versucht bei seiner künftigen Frau nicht nur das Herz mikroskopisch zu untersuchen – er trachtet auch so viel als möglich von dem Seelenleben seiner kommenden Lebensgefährtin kennenzulernen. Ming Tse war sich, das glaube ich heute noch, nicht bewußt, daß ich so ein Ding wie ein tieferes Seelenleben hatte. Er wußte, daß ich viel gelernt hatte, was gewiß irgendwo im Kopfe herumschwamm, – das war alles. Die Schönheit der Natur machte keinen Eindruck auf ihn, ebensowenig Musik oder Poesie, daher verstand er nicht, daß sie andere Leute entzücken konnten. Alles Abstrakte war in seinen Augen »Unsinn«, deshalb konnte ich in die Welt meiner Träume flüchten, ohne je zu fürchten, daß er mir dorthin folgen würde, um neugierig zu forschen. Ich ließ über mein Inneres, mein tiefstes ›Ich‹, einfach einen Vorhang niederrauschen und was vor dem lag, das gehörte dem Chinesen. Die nie geahnten Schätze würde er nicht entbehren.
Auch die dritte Untugend der Europäer – die ärgste meiner Ansicht nach – hatte er nicht. Er versuchte nie an mir herumzumodeln. Während ich seine Lehrerin war, hatte er nach jeder Stunde seine Beobachtungen über meine Persönlichkeit eingetragen, und das endlich sich ergebende Resultat war entschieden zufriedenstellend, nachdem er mich heiraten wollte. Jetzt kannte er mich – wenigstens seiner Meinung nach – und ein weiteres Forschen wäre Kraft- und Zeitvergeudung gewesen. Wozu verändern, was jedenfalls nur schwer zu ändern wäre? Er ließ mich so verbleiben, nahm mich so, wie ich war, und versuchte nie mich umzugestalten. Meinem europäischen Temperament getreu, hätte ich zwar gern auf ihn verändernd eingewirkt, sah indessen einerseits die Hoffnungslosigkeit eines solchen Unternehmens, andrerseits die Ungerechtigkeit einer solchen Handlung angesichts seiner Nachsicht gegen meine Schwächen ein und ließ es bleiben. Ich wollte lieber alles aufbieten, mich ihm anzupassen, als zu verlangen, daß er sich so vollständig europäisieren sollte.
Endlich kam die Antwort seines Vaters. Er hatte eingesehen, daß sein Sohn zu keiner Prüfung kam und war nicht abgeneigt, ihn heimkommen zu lassen. Er widersetzte sich auch nicht einer Heirat mit einer Europäerin, die ihn früher unterrichtet hatte und die imstande sein würde, diesen Unterricht auch in China fortzusetzen. Ferner würde es ihm auf diese Weise leichter sein, den Sohn später noch einmal nach Europa zu schicken, da er gewiß die europäische Gattin auf seiner Seite haben würde, – kurz, der Mandarin gab seine Zustimmung mit der einzigen Bitte, daß die Heirat, die ohnehin nach den Gesetzen in China stattfinden mußte, nicht nur auf europäische, sondern auch auf chinesische Art und Weise gefeiert werden solle. Mama sollte mich begleiten und die Trauung ehemöglichst geschlossen werden.
Seine Mutter schien dagegen sehr gegen eine solche Heirat zu sein, da jedoch der Wunsch des Mandarins auch sie zwang, leistete sie keinen offenen Widerstand. Ich hatte dies allerdings genau so erwartet, fürchtete nun aber nichtsdestoweniger die kommenden Feindseligkeiten zwischen mir und der künftigen gelben Schwiegermutter.
Ming Tse war selig, nach China zurückkehren zu dürfen. Er ging den ganzen Tag umher, um die nötigen Einkäufe zu machen, packte seine Riesenschachteln, Kisten und Koffer mit unheimlicher Genauigkeit und so schön, daß nicht ein Kleidungsstück gedrückt, nicht eine unnötige Falte gemacht wurde. Die Bücher, deren Bekanntschaft er nur äußerlich gemacht hatte, wurden gleichfalls wie die Soldaten eingepackt und standen in den Kisten ebenso schön »Habt Acht!« wie sie es früher am Kaminsims und auf dem Tische getan hatten.
Oft besuchten ihn seine Landsleute, und da entstand ein so heilloser Lärm (sie sprachen alle in ihrer Muttersprache und gestikulierten mit Händen und Füßen), daß man sein eigenes Wort nicht hören konnte, dazu verdrehten sie die Augen, als ob sie vom Veitstanz besessen wären. Neben mir saß oft ein junger Seekadett – ein Freund Hian-Sho-Dschins – und ihn fragte ich eines Tages, warum sich die Chinesen eigentlich immer zankten, wenn sie zusammenkamen.
»Sie zanken nicht, Fräulein,« antwortete er mir mit seiner weichen, wohltuenden Stimme, »sie tauschen nur in ganz freundlicher Weise ihre Meinungen aus.«
»Ich küß' die Hand,« konnte ich mich nicht enthalten innerlich zu bemerken, »wie gebärden sie sich wohl dann, wenn sie sich tatsächlich in den Haaren liegen!«
Die meisten dieser jungen Leute, die alle zwischen zwanzig und achtundzwanzig Jahre alt waren, hatten Frauen daheim, die sie fünf Jahre und länger nicht gesehen hatten und die ihr freudenloses Dasein unter der Herrschaft einer Schwiegermutter fristen mußten.
Inzwischen veränderten die Männer ihre Ideen vollständig, und die Frau, die ihnen früher genügt hatte, schien ihnen jetzt ungebildet, möglicherweise sogar unschön. Hatten sie die Gattin vorher schon nicht gut behandelt, so würde sie jetzt eine noch schwerere Stellung haben. Wie schrecklich sind doch die Einrichtungen in einem Lande, wo man zwei sich unbekannte Wesen aneinanderknüpft, bevor sie ein Alter erreicht haben, wo sie sich dagegen wehren könnten. Allerdings ist die Macht der Eltern so groß, daß auch ein Wehren von seiten der Kinder ganz nutzlos wäre; der Sohn hat in Japan zum mindesten das Recht, seine Meinung über die Zukünftige auszusprechen, die er einmal von Ferne zu sehen bekommt, in China nicht einmal dies, und dem Mädchen hilft nichts, nichts als sich zu fügen. Trotzdem kommt es heutzutage vor, daß Mädchen freiwillig auf die Ehe verzichten. Die Schwester Hoang-Zos, dessen Vater tot war, wollte nicht heiraten, und der Bruder, der selbst sehr viele europäische Ansichten teilte, zwang sie nicht dazu. Er selber soll seine erste Frau – so sagte Ming Tse – an gebrochenem Herzen haben sterben lassen. Zwei Jahre lang war er fern von der Heimat in Japan und kehrte auch trotz der Bitten seiner Gattin nicht an ihr Sterbebett zurück. Im großen und ganzen fühlte ich mich durch diese Betrachtungen keineswegs zu einer Ehe mit einem Chinesen ermutigt, doch war mir Ming Tses heiteres Gemüt – er war wie ausgetauscht, seit er heimkehren durfte – ein Hoffnungsstrahl. Gewiß würden wir als zwei gute Kameraden miteinander leben können.
Endlich hatte ich auch heimgeschrieben, Mama von meiner Verlobung erzählt, Li Bais finanzielle Stellung erklärt und sie gebeten, sich so schnell als möglich auf die Reise nach China vorzubereiten, da sie nach dem Gesetz die Dokumente – Ehevertrag usw. – mit dem Vater Ming Tses austauschen müsse. Ferner bat ich sie, Jenny mitzunehmen. Li Bai drang darauf, die Fahrten für uns alle drei zu bezahlen, und um alle Streitigkeiten darüber abzuschneiden, hatte er schon jetzt die Sitze bestellt und die Karten zugesichert erhalten, so daß ich Mama erklärte, daß jede Weigerung ihrerseits unmöglich gemacht wäre. Ich wußte, daß sie überall hin gern reiste, wo man nicht über das Wasser zu fahren brauchte, und daher zweifelte ich nicht, daß sie nach einigen »Ach« und »Oh!« sich auf die Socken machen würde.
Nach fünf Tagen kam die Antwort. Mama protestierte zwar vier Seiten lang, sagte aber auf der fünften, daß sie selig war, mich so gut versorgt zu wissen und auf der sechsten, daß sie schon alle Vorbereitungen getroffen, um mich nach China zu begleiten. Das Hochzeitskleid für sie selbst und die Toilette für Jenny würde in zwei Tagen fertig sein, und in etwa vierzehn Tagen würden beide Damen in London eintreffen, von wo aus wir am 29. September nach Berlin, Moskau und weiter mit der sibirischen Eisenbahn nach Tientsin, Ming Tses Vaterstadt, fahren würden.
Meine Schwester schrieb:
»Liebster, dummer Kather! Ich weiß in der Tat nicht, ob ich Dir gratulieren oder kondolieren soll, doch tröste ich mich mit dem Gedanken, daß Du, die Du so ein vernünftiges Mädel bist, gewiß nicht »ja« gesagt hättest, wenn Du nicht überzeugt wärest, glücklich zu werden. Mir standen vor Entsetzen die Haare zu Berg, als ich Deinen Brief gelesen habe. Einen Chinesen!? Einen echten, gelben Chinesen!! Hat er einen langen Zopf? Oh, Käthe, nimm ihn nicht, wenn er einen Zopf hat!! Ich habe einst in einem Roman gelesen, daß die Chinesen ihre Zöpfe dazu verwenden, ihre Feinde zu erdrosseln. Und ist er gelb, so gelb wie eine Zitrone? Wie ich mich freue, ihn kennenzulernen, – aber heiraten würde ich keinen Chinesen, o nein, Käthe, o nein. Ich habe gleich nach Erhalt Deines Briefes alle alten Geographiebücher, deren Inhalt ich längst vergessen, hervorgesucht und auch im großen Konversationslexikon alles über Chinesen durchgelesen und finde, daß sie gute Handelsleute, genügsam und fleißig, aber sehr grausam sind. Wirst Du Dir müssen die Füße verkrüppeln lassen, bevor Du seine Frau wirst? Es soll furchtbar wehtun, Käthe, laß' es lieber bleiben, du hast ja ohnehin kleine Füße, wenn sie auch nicht wie die »goldenen Lilien« der Chinesinnen sind, die kaum hin und her wackeln können und immer in einer Sänfte getragen werden müssen.
Jetzt will ich Dir berichten, welche Wirkung Deine Verlobung auf die »Familie« gemacht hat – und dann – – noch etwas. O Käthe, ich sehne mich nach Dir! Ich habe so viel erlebt.
Wir saßen am Frühstückstisch – Mama und ich –, als wir unsere Briefe erhielten. Mama las den ihrigen zum zweitenmal, als ich den meinigen erbrach, da ich um eine Pröbstlinge in den Garten gesprungen war. Bevor ich über die ersten Worte gekommen, sprang Mama auf, umarmte mich, weinte und schluchzte, daß ich mich ganz kalt werden fühlte und sagte dann: »Jenny, Deine Schwester hat sich verlobt.« Sie ging sofort in die Küche und schickte die alte Resi zu den Tanten, um sie zu bitten, in wichtiger, freudiger Angelegenheit sogleich zu uns zu kommen. Ich hatte unterdessen Deinen Brief gelesen.
»Mama!« rief ich entsetzt, als sie zurückkehrte, denn mir war vor lauter Schrecken der Appetit vergangen, »es ist ein gelber Mann, ein Chinese mit Zopf und Fächer, mit dem sie sich verlobt hat!«
»Sei keine Gans,« fiel mir Mama in die Rede, »Zöpfe haben sie heutzutage nicht mehr und wenn auch, um so besser, da kann ihn Käthe daran ziehen, sooft er ihr etwas nicht richtig macht.« Nach einer Pause fuhr sie fort: »Und die Farbe hat nichts zu bedeuten, Jenny, du dummes Ding, weiße Männer haben auch ihre Faxen.«
Daraufhin zog Mama ihr allerbestes Seidenkleid an, legte Deinen Brief auf das kleine Nähtischchen am Fenster, setzte sich in den großen Lehnstuhl und führte von Zeit zu Zeit das Taschentuch an die Augen, aber trotzdem schien es mir, als ob sie sehr glücklich wäre.
Ich selbst lief in den Garten und warf mich auf den Rasen, wo ich bitterlich weinte, denn immer sah ich einen gelben Mann vor mir, der seinen dünnen schwarzen Zopf um Deinen zarten Hals wickelte und würgte und würgte; und je mehr er Dich würgte, um so gelber wurde er im Gesicht. Da siehst Du, wie kindisch ich bin, Schwesterchen!
Eine schwache Stunde später war unsere Türglocke in unausgesetzter Bewegung. Tante Hermine mit ihren Töchtern, Onkel Sebastian mit seiner langen Pfeife, Tante Elly mit Lotta und ihrem Mann, der selbst an einen Chinesen erinnert, da er so gelb im Gesicht ist – nur zum Zopf wäre nicht Vorrat genug da –, Onkel Paul, der zum Trost für sein auferlegtes Schweigen eine echte Havanna zwischen den Lippen drehen durfte, Onkel Mossi, lieb und lustig wie immer, mit seinen beiden Dackeln, Tante Emma mit einem Strumpf und Tante Paula mit dem anderen, beide frisch vom Morgengottesdienst, kamen angelaufen. Als alle feierlich Platz genommen hatten, wischte Mama erst sorgfältig ein paar Tränen ab und teilte ihnen hierauf mit, daß Du Dich mit dem Sohne eines Mandarins, Herrn Li Bai Ming Tse, verlobt hast und daß – weiter kam die arme Mama nicht, denn alle hatten die Hände in die Luft gestreckt und stießen unartikulierte Laute aus. Die Onkel klammerten sich an die Sessellehnen fest und die Tanten und Kusinen fielen alle in Ohnmacht. Ich hatte dies vorausgesehen, und daher standen schon mehrere Riechfläschchen bereit, die ich nun den Tanten als gehorsame Nichte unter die Nasen hielt, aber Onkel Mossi, der bemerkte, daß Lotta die Augen geschlossen hatte, um besser über eine kommende Bissigkeit nachdenken zu können, stellte sich, als ob er auch sie bewußtlos glaubte, und hielt ihr eine Flasche Salmiak unter die Nase. Du hättest die Wirkung sehen sollen! Onkel Mossi stand vorsichtig seitlich von ihrem Stuhle, und als sie die Flasche entrüstet von sich stieß, flog ein Teil des Inhalts nicht auf den Lieblingsonkel, sondern geradeswegs in den offenen Mund Tante Emmas, die vor Erstaunen über Deine Verlobung denselben weit aufgerissen hatte. Du hättest sie alle schreien hören sollen! Die arme Tante schrie wie am Spieß und führte einen wahren Indianerkriegstanz aus, weil die Zunge so sehr brannte. Wie ich wünschte, daß Lotta den Inhalt geschickt auf die Zunge verteilt erhalten hätte! Onkel Mossi sah so unschuldig aus, wie irgendein angemalter Heiliger an der Wand in der Domkirche.
Als sich die Gemüter so weit beruhigt hatten, daß die Zungen sich wieder im alten Geleise bewegten, ertönte es von allen Seiten:
»Ein Chinese!!!«
Und da die Onkel wußten, daß ein Refrain immer willkommen war, wiederholten sie in ihrer Baßstimme:
»Ein Chinese!«
»Ein Heide!« rief Tante Emma und schüttelte mißbilligend ihr jungfräuliches Haupt.
»Sie verdirbt uns die Rasse!« erklärte Tante Hermine erbittert.
»Mit ihrer Unkenntnis der Hauswirtschaft hätte sie für einen Deutschen nicht gepaßt,« versicherte Base Rita.
»Sie hat wohl keinen Europäer finden können, nachdem sie mit einem Chinesen vorlieb genommen hat,« warf Base Gusti bitter ein.
»Ein armes, irregeleitetes Menschenkind! Was für andere Folgen konnten Natalies mißglückte Erziehungsversuche erzielen,« kam es von Tante Ellys Lippen.
»Ein Trotzkopf und ein Unverstand war die Käthe immer, und ich habe immer gesagt, daß sie ihrem Verderben entgegengeht. Wer die Ratschläge seiner Angehörigen verwirft, dem ist der Untergang sicher,« zischte Lotta.
Ich schlängelte mich an Onkel Mossi heran.
»Onkelchen, warum sind sie alle so bösartig?«
»Weil sie neidisch sind, Jenny, weil sie selber noch ungekaufte Ware auf dem Lager haben. Mach dir nichts daraus, mein Kind!« tröstete er mich und strich mir mit seiner kühlen Hand über das Haar.
»Und du, Natalie,« fragten jetzt die Tanten im Chor, »du wirst einen so wahnsinnigen, einen so haarsträubenden Schritt billigen?«
»Was kann ich tun?« fragte Mama, die sich so leicht beeinflussen läßt. »Käthe ist großjährig.«
»Ueberlasse sie ihrem Schicksal,« rief Lotta mit Grabesstimme.
»Laß sie durch die Polizei gewaltsam nach der Heimat zurückbringen,« schlug eine der Tanten vor.
»Drohe ihr mit Enterbung!« bat Tante Elly und ihre Augen sprühten vor Vergnügen.
»Zum Kuckuck auch,« donnerte Onkel Mossi, »die Käthe entscheidet und nicht Ihr.«
Die anderen Onkel dienten als Wandschmuck, wie immer im Familienrat.
Ich glaube, daß nur die Angst vor der Salmiakflasche, die Onkel Mossi so unternehmungslustig schwang, die Tanten abhielt, noch einmal in Ohnmacht zu fallen, als Mama ihnen erklärte, daß wir schon morgen nach D. abreisen würden, um alle nötigen Einkäufe für die Reise nach China zu machen, und daß wir in einem Monat schon durch Sibirien sausen würden. Ich merkte, wie sich alle an den Hals griffen, als ob der Kragen nicht weit genug gewesen wäre.
»Natalie,« kreischte Tante Paula auf, »man wird dir dort den Kopf abschneiden. Man haßt Europäer, und dein Kopf ist in Gefahr.«
»Kusine,« flüsterte Tante Emma, »du erreichst China gar nicht. Man wird dich auf der Bahn ausrauben und deinen nackten Leib aus dem Waggonfenster werfen.«
»Du wirst doch nicht auch noch deine zweite Tochter dem Untergange weihen?« erkundigte sich Tante Hermine mit scheinbarer Besorgnis um mich.
»Bist du in der Tat imstande, so gewissenlos zu sein, Natalie,« predigte Tante Hermine, »dieses unschuldige Wesen (ich wußte nicht, daß ich ein so unschuldiges Wesen war) in diesen orientalischen Sündenpfuhl mitzuschleppen?«
»Willst du Jenny wirklich in diese Pestatmosphäre geleiten, wo die Blattern sie lebenslänglich entstellen können?« fragte Lotta spitz. Ich bin überzeugt, daß es ihr gleichgültig war, wie ich aussah.
»Natalie,« erklärte Tante Elly feierlich, »ich kann dich von dieser verrückten Idee nicht abhalten. Ich habe für Käthe mit ihrer entschiedenen Natur und ihrem eigentümlichen Wesen nie Sympathie gehabt und wünsche ihrem vermeintlichen Glücke kein Hindernis in den Weg zu legen, aber Jenny soll daheim bleiben. Ich selbst werde dein Kind zu mir nehmen.«
»Lieber die Pest und die Blattern,« flüsterte ich Onkel Mossi zu, indem ich mich an ihn klammerte.
»Kann mein Nichtchen nicht unter meinem Schutze zurückbleiben?« fragte der herzensgute Onkel.
Wenn Blicke vernichten könnten, so wäre der arme Onkel nicht mehr unter den Lebenden.
»Da wäre ein junges, unschuldiges Ding in die rechten Hände,« sprach Lotta für sie alle die Meinung aus. Ich konnte Onkel Mossi gut nachfühlen, als er zwischen den Zähnen etwas murmelte, was sehr nach »so eine verdammte Schlange und Giftmorchel« klang.
Trotz verzweifelten Widerstandes aller Tanten und Basen – die männlichen Vertreter unseres Stammes glänzten wie immer durch ehrfurchtsvolles Schweigen und dichte Rauchwolken – wurde beschlossen, daß Mama reisen und ich sie begleiten würde, und daher küßten mich alle Tanten beim Abschied und ließen dicke Krokodilstränen auf mich niederfallen. Sie versicherten mir, daß ich wahrscheinlich meine Gesundheit und jedenfalls meine Unschuld und Tugend auf dieser Reise einbüßen würde, und ich war so gerührt zu hören, daß ich so viel Unschuld und Tugend besaß, daß ich jeder Tante eine extratiefe Verbeugung machte, als Lotta an mich herantrat und hörte, daß ich Tante Hermine versprach, so viel als möglich von den mitgenommenen Tugenden wieder zurückzubringen.
»Du?« herrschte sie mich mit ihrer kreischenden Stimme an, »du wirst irgendwelche Tugenden bewahren? In dir schlummern die Samenkörner der Verderbtheit wie in deiner entarteten Schwester!« sprach's, stieß mich rauh von sich und verschwand mit erhobenem Haupte durch die Tür.
Kaum waren sie draußen, so flog ich Mama um den Hals.
»Gestorben sind sie beinahe vor Neid und Galle,« rief ich entzückt und Mama sah überglücklich aus. Ich glaube, sie hätte Dich auch an den Stamm eines Kaffernstammes abgetreten, wenn es die Tanten hätte ärgern können. Den Rest des Tages ging ich zu allen meinen Bekannten und sagte:
»Meine Schwester heiratet sehr reich – einen Chinesen – und wir, Mama und ich, fahren zur Hochzeit nach China.« So etwas kann nicht jeder. Ich war selig, die erstaunten Gesichter zu sehen und bin Dir so dankbar, Käthe, einen so interessanten Mann gewählt zu haben. Ein wenig, ein ganz klein wenig ängstlich bin ich doch auch.
Mama weinte zwar den ganzen Tag ein wenig – das schickt sich so, aber ich wußte, daß sie sehr froh ist, denn der Aerger der Verwandten ist ihr eine unsägliche Beruhigung. Ich fragte, ob es sich für mich auch schickte, den ganzen Tag zu weinen, doch beruhigte sie mich und sagte, daß nur eine Mutter dies zu tun brauche.
Am Abend ging ich in den Garten. Mir war indessen jetzt doch etwas ungemütlich zumute. China ist weit weg und ich bin hübsch, nicht wahr, Käthe, und Blattern sind nicht angenehm, aber ich freue mich so auf die Reise, die Abwechslung, die schöne chinesische Seide, den fremdartigen Schmuck – und auf Dich auch, natürlich.
Wie ich gehofft hatte, sah ich Doktor Wurmbrandt am Zaune stehen. Ich ging schnell auf ihn zu, reichte ihm meine Hand und sagte:
»Meine Schwester heiratet einen leibhaftigen Chinesen und ich fahre morgen nach China.«
Im nächsten Augenblick war er über den Zaun gesprungen.
»Fräulein Jenny, ich habe in der Stadt schon davon gehört – es kann nicht sein, daß Ihr Fräulein Schwester eine solche Partie eingeht?« rief er leidenschaftlich.
»Er ist sehr reich!« entschuldigte ich Dich.
Er ließ meine Hand fallen. »Also ist Geld alles im Leben, Fräulein Jenny?« fragte er ernst.
Mir wurde so heiß. »O nein, Herr Doktor,« sagte ich, indem ich auf den Rasen niedersah, »aber ich weiß keinen anderen Grund zu nennen, warum Jenny einen Chinesen heiratet.«
»Gefühle scheinen bei Ihnen keinen Rolle zu spielen!« sagte er hart.
»Oh, Herr Doktor, die Käthe hat schon einmal geliebt und – und – ich glaube nicht, sie tut es ein zweites Mal. Sie hat ihn zu lieb gehabt,« sagte ich und fühlte, wie meine Stimme zitterte.
»Da haben Sie recht!« entgegnete er viel freundlicher. »Armes Fräulein Käthe!« Wir waren eine Weile ganz still.
»Leben Sie wohl, Herr Doktor,« flüsterte ich endlich, »und wenn ich an der Pest oder den schwarzen Blattern sterbe, so vergessen Sie mich nicht ganz!« bat ich schüchtern.
»Fräulein Jenny,« sagte er so ernst, wie er noch nie zu mir gesprochen, »versprechen Sie mir eins: Heiraten Sie keinen Chinesen, wie anziehend er auch sein möge!«
Ich gelobte dies feierlich. Ich hätte ihm weder diese noch irgendeine andere Bitte abschlagen können. Wenn Männer diesen Ton anschlagen, sind wir Frauen das reinste Wachs in ihren Händen.
Er zog eine kleine Schere aus der Tasche. Indem er wieder in den alten neckenden Ton verfiel, bat er mich, eine Locke meines Haares abschneiden zu dürfen, »der Blatterngefahr halber!« wie er sich ausdrückte. Er schnitt die Locken im Genick ab und brauchte meiner Ansicht nach eine schrecklich lange Zeit dazu. Ich fühlte, wie sein Atem dicht über meinen Hals dahinstrich – er mußte wohl so nahe schauen, weil es schon beinahe finster war –, und mir wurde ganz eigentümlich dabei. Warum wohl? Als er mit der Operation fertig war, küßte er meine Hände – Käthe, alle beide – und wünschte mir eine glückliche Reise.
Mir wurde so schwer ums Herz, so unsäglich schwer, und ehe ich es verhindern konnte, fiel eine Träne auf die Hand des Doktors. Da schämte ich mich unsinnig, riß mich los und flog auf das Haus zu.
Ich warf mich angezogen auf das Bett und weinte. So schlief ich ein und träumte plötzlich, daß ein Chinese mit furchtbar geschlitzten Augen einen Zopf – so einen weichen, weichen Zopf! – um meinen Hals schlang, und ich schrie wie besessen. Mama und die Köchin schüttelten mich wach. Auf dem Bette saß Murr, der Kater! Seinen Schwanz hatte ich für den Zopf eines Chinesen angesehen.
Mama sagte mir, daß eine so dumme Gans wie ich nicht wieder zu finden sei, und daß ich mich schnell anziehen möge, um Punkt acht auf der Bahn zu sein. Du kennst ja Mamas Bahnfieber, die immer eine geschlagene Stunde auf den Zug warten muß. Ich wusch meine entzündeten Augen mit Rosenwasser, um auf der Fahrt hübsch und frisch auszusehen, und kleidete mich in mein neues Reisekleid, das mir ausgezeichnet sitzt, Du wirst schon sehen.
Als wir schon in den Zug eingestiegen waren, kam noch jemand hurtig über den Bahnsteig gelaufen. Es war Dr. Wurmbrandt, der mir einen wunderschönen Strauß roter Rosen brachte und mich so merkwürdig ansah, daß ich fast ebenso rot wurde wie die Blumen. Ich konnte gerade noch danken und ihm die Hand reichen, bevor sich der Zug in Bewegung setzte.
Die Tanten waren alle da und hatten noch viele warnende Worte gesprochen.
Als der Doktor mir den Rosenstrauß übergab, merkte ich, daß die Gesichter der Tanten und Kusinen gelbgrün wurden, und Mama fragte im Tone eines Untersuchungsrichters:
»Interessiert sich der Doktor für dich?«
»Ich – ich weiß es nicht,« antwortete ich und wurde wieder rot wie eine Klatschrose.
»Keine schlechte Partie,« sagte Mama mehr zu sich selbst als zu mir.
»Jenny, schicke ihm von Zeit zu Zeit eine Ansichtskarte,« befahl sie. »Man muß sich den Männern immer wieder ins Gedächtnis bringen.«
Und jetzt, Käthe, sind wir in D., wo wir allerlei Einkäufe machen.
An unserem Tische speist ein alter Rittmeister und macht mir sehr den Hof – ein Baron X. oder U., ich kann mir seinen Namen nicht merken.
Mama ist sehr liebenswürdig und sagte mir vor dem Schlafengehen:
»Sei zuvorkommend gegen den Rittmeister, Jenny, ein Soldat ist besser als ein Doktor.«
Da wurde ich aber böse. »Der Doktor ist jünger und hübscher,« protestierte ich, aber Mama schickte mich zu Bett und versicherte mir, daß ein Mädchen in meinem Alter nicht weiß, was gut für sie ist. So ein Unsinn! Ich bin achtzehn Jahre!
In zwei Wochen sind wir in London. Leb' wohl, Käthe!
Deine Jenny.«
So haben meine nächsten Angehörigen meine Verlobung mit einem Chinesen aufgenommen.
| Tud tukaj solnce gre okrog, |
| Doline vidim, hrib in log; |
| Pa solnce naše bolj blišči, |
| In hrib naš lepše zeleni. |
| J. Strel. |
XI.
Es war der Vorabend unserer Abreise von London. Seit zwei Wochen waren Mama und Jenny bei mir, beide entzückt von meinem künftigen Gatten. Er war geradezu rührend aufmerksam gegen sie. Den ganzen Tag führte er sie herum, zeigte ihnen alle Sehenswürdigkeiten Londons, kaufte Jenny allerlei Schmucksachen, die sie in den siebenten Himmel versetzten, und versprach ihr eine Masse chinesischer Seide, sobald wir nach China kamen. Gegen Mama war er ausgesucht höflich und in jeder Weise zuvorkommend und war ihr, da er gern plauderte und Mama eher mit ihrem Schatten sprechen würde, als nicht den Mund zu öffnen, ein sehr angenehmer Begleiter. Ich selbst genoß nur wenig von ihrer Gesellschaft, da ich die letzte Woche im Amt weilte, wo man nicht sofort eine Stellvertreterin für mich finden konnte. Den Rest meiner Zeit mußte ich den Schneiderinnen und sonstigen praktischen Vorbereitungen widmen. Ich legte eine gewisse fieberische Hast an den Tag und tat alles überstürzt – mir halb unbewußt, wollte ich vor mir selbst, meinen eigenen Gedanken davonlaufen. Mit Mama hatten wir kein längeres Gespräch gehabt – am ersten Tage sagte sie mir, daß mein kleiner Chinese an einen Affen erinnere, am zweiten, daß er ausgesucht gute Umgangsformen habe, und am dritten, daß ich einen besseren Mann weder im Osten noch im Westen hätte finden können, wenn ich mit der Laterne am hellichten Tage nach ihm gesucht hätte – selbst nahm ich alle drei Erklärungen ruhig und mit etwas Unglauben auf – besonders die dritte, aber wozu widersprechen? Es war entschieden, ich ging nach China, und Europa mit seinen Licht- und Schattenseiten lag bald, ach, allzu bald hinter mir. Die Reue ist ein hinkender Bote – und ich wollte nicht bereuen. Sterben, sagte ich mir bitter, kann ich immer noch.
Jenny, die den ganzen Tag vor den großen Auslagen in Regent Street stand, auf der Themse bis Richmond und Hampton Court fuhr, die Albert Hall zu den großartigen Nachmittagskonzerten besuchte und nur die gleißende Seite Londons sah, konnte nicht begreifen, daß ich dieses vermeintliche Eldorado, ohne größeres Bedauern an den Tag zu legen, verließ. Mama und meine Schwester fanden wieder einmal, daß die Käthe kein normales Mädchen sei, und schüttelten mit sichtlicher Teilnahme die Köpfe.
Ich stand lange am offenen Fenster und ließ die kühle Herbstluft um meine brennende Stirn wehen. War ich vom Regen unter die Traufe gekommen, war ich feig gewesen, nicht ein Ende zu machen, als ich schon an der Pforte des Todes stand? Bedeutete mein Entschluß eine Biegung zum Besseren auf dem dornenvollen Lebenspfade, war es jener Schwung im Glücksrade, der mich nach aufwärts tragen würde, und würde ich im Osten finden, was der Westen mir verneint? Oder war es eine jener unglückseligen Stufen, auf die man unsicher tritt, und von welchen man jäh in unerwartete schreckliche Tiefen gleitet? Wer konnte es sagen? Meine Augen klammerten sich an mein Lieblingsgestirn, den großen Bären oder, wie ich vorzog es zu nennen, den Himmelswagen, und schienen um Antwort zu bitten, doch vergeblich. Die Sterne, sie funkelten am nachtschwarzen Himmel in ihrer einsamen Majestät, und was sie mir zu sagen schienen, war dies: »Auch wir sind allein, obschon wir einander so nahe zu sein scheinen. Millionen Meilen trennen oft ein Gestirn vom andern, das, von der Erde gesehen, so nahe am andern liegt, und einsam sind auch die Menschen, denn ihre Körper sind einander nahe, aber die Seelen sind weit, weit entfernt! Wenn du Frieden, wenn du Glück, wenn du vor allem Kraft finden willst, so lerne auf dich selbst vertrauen und dir selbst genügen.« Damals dachte ich, daß die Sterne unrecht hätten – heute weiß ich, daß nur der Mensch leben kann, ohne an innerem Leid zugrunde zu gehen, der gelernt hat, sich selbst zu genügen. Weder um Hilfe, noch um Liebe, noch um Gesellschaft, noch um Anteilnahme zum Nächsten zu schauen. Wer in sich alles findet, – und bis der Mensch in sich alles findet, so daß er in der Welt und doch getrennt und unabhängig – innerlich unabhängig, denn äußerlich bleibt er natürlich stets etwas abhängig von seinen Mitmenschen – lebt, hat Schutz vor dem Leid gefunden. Kein strahlendes Glück kann je wieder die Seele des so von der Menschheit Getrennten durchbeben, weil sein Interesse in dem Nächsten aufgehört hat, aber die Höllenpein zwischen Hoffen und Verzagen erfaßt ihn nie wieder. Er steigt nie mehr in himmelanjauchzender Glückseligkeit zu den Wolken empor, aber er erspart es sich gleichzeitig, aus dem siebenten Himmel auf die Erde zu fallen, und ist süß das Emporfliegen, so ist vernichtend bitter der Sturz, der in uns alles zerbricht, was das Leben wertvoll macht – Hoffnung, Glaube, Liebe, Vertrauen auf andere, den Trieb zur Besserung, zur Vervollkommnung, das Mitleid mit den Unglücklichen und die warme Mitfreude mit den Glücklichen – alles schwindet, und zurück bleibt jene Ruhe, die kein Glücksfall und kein neues Unglück bedeutend erschüttern kann. Wohl dem, den ein gnädiges Geschick davor bewahrt hat, den Gipfelpunkt irdischer Zufriedenheit in dieser Unempfindsamkeit zu suchen – und zu finden! An jenem Abende habe ich die Lektion noch nicht erlernt gehabt, die Sehnsucht nach der Liebe meiner Mitmenschen, nach Glück, war noch nicht erloschen, daher führte das unerbittliche Geschick mich nach China, um dort den Unterricht fortzusetzen, und was vom Schicksal selbst gelehrt wird, o Leser! – das erlernt man. – –
Es klopfte. Ich wandte mich verwundert um, denn Mitternacht hatte es längst geschlagen, und alle Leute im Hause waren zur Ruhe gegangen. In einem langen wallenden Nachtgewande, mit einer brennenden Kerze in der Hand, die schönen braunen Augen weit geöffnet, stand Jenny vor mir.
»Schwesterchen,« fragte ich, indem ich ihr die Kerze aus der Hand nahm und sie neben mich auf mein Sofa, das Bett, zog, »warum wanderst du noch durch Gänge und über Treppen nach der grausigen Mitternacht, wie einst der Geist von Hamlets Vater?«
»Käthe,« flüsterte sie, indem sie ihre weichen Arme um meinen Hals schlang, »ich bin vielleicht nicht immer eine gute Schwester gewesen und habe dich schrecklich vernachlässigt. Verzeih mir!«
»Du bist eine ebenso gute Schwester gewesen wie ich es verdient habe,« entgegnete ich und liebkoste Jenny.
»Ich fürchte mich um dich, Käthe,« sagte sie weich.
»Das brauchst du nicht, Jenny,« beruhigte ich sie, »mir droht nicht Gefahr, und – ich habe meine Zukunft selbst gewählt.«
»Schwester,« begann Jenny nach einer kurzen Pause von neuem, »ihr küßt euch nie.«
»Küssen ist im Orient nicht Sitte, man findet, daß es sehr unhygienisch sei, und daher gibt man sich im fernen Osten nicht einmal die Hand, wenn man sich begegnet, sondern schüttelt seine eigene Hand an Stelle derjenigen des Bekannten – eine weise Vorsichtsmaßregel in einem Lande, wo so viele ansteckende Krankheiten epidemisch und die sanitären Einrichtungen keineswegs auf der Höhe sind,« gab ich zur Antwort.
»Bist du auch schon so hygienisch geworden, Käthe?« fragte sie und sah mich groß an.
»Ich füge mich den Sitten des Orients,« entgegnete ich ausweichend. Ich wollte meiner Schwester nicht eingestehen, daß ich noch nicht so sehr »hygienisch« in meinem Empfinden geworden war.
»Hat er dich nie – nie geküßt?« fragte Jenny, die so etwas ganz und gar nicht fassen konnte.
»Nein, nie,« versetzte ich lachend. Denn Jennys Augen waren so rund vor Verwunderung wie die eines Kindes. »Einmal hat er allerdings gesagt, daß er es versuchen würde, wenn ich eines Tages nicht einen Hut aufhaben würde, aber bisher,« ich blickte sie schelmisch an, »habe ich immer einen Hut aufgehabt.«
»Himmel!« rief Jenny entsetzt, »und es ist ihm nie eingefallen, den Hut abzunehmen?«
»Wenn wir verheiratet sind, werde ich keinen Hut auf dem Kopfe haben, und darauf wartet er wahrscheinlich,« versuchte ich als Erklärung anzuführen.
»Glaubst du,« fragte sie mit einer urkomischen Ueberlegenheit, »daß Doktor Wurmbrandt sich hätte – natürlich wenn er mich liebhaben würde – abhalten lassen durch einen Hut und selbst, wenn dieser so groß wie ein Wagenrad gewesen wäre?«
»Liebste Jenny,« erwiderte ich lachend, »nicht, wenn dein Hut den Umfang einer Moschee gehabt haben würde, aber du vergißt, daß der Doktor eben – Europäer ist.«
»Ein Mann, der nicht küssen kann, der – der ist nicht heiratsfähig.« Jennys Entrüstung war so groß, daß sie meine ernsten Gedanken verscheuchte und ich über die unschuldigen Ansichten des Kindes herzlich lachen konnte.
»Jenny,« neckte ich meine Schwester, »wie oftmal denkst du an den Doktor?«
»Oh – nicht – nicht so sehr, sehr oft, Kather,« sagte Jenny nachdenklich.
»So etwa sechzigmal die Minute?« fragte ich gelassen.
»Aber Kather, wie kannst du –?« wehrte Jenny, erglühte aber wie eine Pfingstrose.
»Jenny,« bat ich sie, »hab' ihn recht lieb, und spiele nicht mit allen Männern, die du triffst. Glaube mir, Kind, Huldigungen sind angenehm, aber ein treues Herz, auf das man wirklich bauen kann, ist tausendmal schöner und kostbarer.«
Jenny küßte mich und gelobte mir, so wenig kokett wie möglich zu sein. »Ueber sein Können ist niemand verpflichtet,« sagt ja selbst Goethe, und ich verlange auch nur, daß Jenny ihr Bestes in dieser Hinsicht leisten würde. Blicke mit Vorübergehenden und Mitreisenden würden trotzdem noch zur Genüge – und darüber hinaus – gewechselt werden.
Ein ernstes Gespräch ließ ich nicht aufkommen. Meine Schwester war zu jung, zu unerfahren, um mich zu verstehen, und um nichts in der Welt hätte ich mich verleiten lassen, ihre schönen Jugendillusionen zu zerstören, ihr die Erde – das Leben auf derselben eigentlich – so zu zeigen, wie es wirklich war oder wie ich wenigstens es gefunden hatte. Mein bitterer Pessimismus sollte nicht einen Augenblick die frohe Zuversicht meiner Schwester trüben. Als es zwei Uhr schlug, hüllte ich Jenny in ein langes Tuch ein, zündete ihr Kerzenstümpfchen wieder an und schob sie gebieterisch zur Tür hinaus.
»Du mußt schlafen, Jenny,« ermahnte ich sie, »du weißt, daß Mama mit ihrem Bahnfieber dich um sechs Uhr wecken wird, damit wir um zehn Uhr pünktlich auf der Station sind, und auch du, Fräulein Eitelkeit, wirst diese Zeit gut verwenden können, um dich so hübsch wie möglich zu machen. Jenny, Schwesterchen, ich kenne dich! Gute Nacht!«
»Noch eine Frage, Käthe,« bat sie schmeichelnd, »eigentlich kam ich nur deshalb zu dir. Wie werden deine Kinder sein? Weiß oder gelb?«
Ich schob sie sanft zur Tür hinaus und sagte lachend und geheimnisvoll:
Ich hörte, wie Jenny vor der Tür vor lauter Entsetzen und Ueberraschung nach Atem rang, öffnete daher die Tür noch einmal eine Spanne weit und flüsterte ernst:
»Sei doch kein Gänschen, Jenny – hoffentlich werde ich keine Kinder haben – gesprenkelt sicher nicht,« damit schloß ich die Tür endgültig.
Um halb zehn Uhr vormittags waren wir alle pünktlich auf dem Bahnhof – Victoria Station – versammelt. Meine europäischen Freunde hatten schon gestern von mir Abschied genommen, und da die allermeisten gegen diese Heirat waren (Engländer sind noch mehr gegen Mischung der Rassen als andere Europäer), so stand ich unbegleitet auf der grauen Plattform der düsteren Halle. Um so zahlreicher vertreten war die chinesische Kolonie. Einige konnten kein Wort außer Chinesisch, und wir nickten uns gegenseitig nur zu, andere sprachen etwas Englisch. Sie alle umringten Ming Tse, der seiner Schenkungsseligkeit wegen sehr beliebt war, wenn er ihnen auch oft unangenehme Wahrheiten mit verblüffender Aufrichtigkeit sagte. Mehrere von ihnen brachten Körbchen voll herrlichen Obstes – Trauben die einen, Pfirsiche die andern, und ein Chinese brachte eine Tüte rotbackiger Aepfel, mit denen Jenny schon jetzt liebäugelte.
Um zehn Uhr wurde das Abfahrtssignal gegeben, und der lange Zug setzte sich in Bewegung. Am Korridorfenster stand Li Bai und winkte seinen Freunden zu, solange man noch ein Viertel eines einzigen Chinesen in der Ferne erkennen konnte, und war noch einige Zeit nachher etwas einsilbig. Lange jedoch, bevor wir nach Queenborough kamen, plauderten wir alle höchst vergnügt miteinander.
Ming Tse, der ein reizender Reisekamerad war, breitete sein lichtblaues Seidentaschentuch über meinen und Jennys Schoß aus und verteilte Früchte. Mama wollte an der Fütterung vorläufig nicht teilnehmen, aber Jennys weiße Zähne bissen mit sichtlichem Behagen in die appetitlichen Aepfel. Ihr war die Reise ein großer Spaß, Mama ein wichtiges Ereignis, das feierlich behandelt und durchgeführt werden mußte, Ming Tse eine Genugtuung sondergleichen, da er endlich in die geliebte Heimat zurück durfte, und mir – eine Frage an das Schicksal, die Entscheidung über meine ganze Zukunft. – Und dennoch hatte nicht einer der drei Mitreisenden, die mir doch am allernächsten auf der Welt standen oder bald stehen würden, die blasseste Ahnung von dem, was in mir vorging, und infolgedessen das allergeringste Mitleid. Nicht einer von ihnen hätte mich verstanden, wenn ich gesprochen hätte, und so betrug ich mich als guter Gefährte, lachte und scherzte mit ihnen und fühlte mehr denn je, was für eine elende Komödie das Leben war, wo man immer und vor allen Leuten eine Maske tragen mußte und doch noch froh war, daß man das Recht hatte, eine Maske zu tragen, die einen vor dem Hohn der Mitmenschen, die anders dachten, schützen konnte.
In Queenborough verließen wir den Zug, um uns auf das Schiff zu begeben. Erst Mama mit einem Träger an ihrer Seite, dem sie ununterbrochen wiederholte, so schnell wie möglich zu gehen. Das erbitterte ihn so, daß er ihr mitteilte, die Sturmflagge wehe schon vom Mast – während in Wirklichkeit nicht ein Lüftchen sich regte, und ein so glänzend blauer Himmel, wie er nur selten über Großbritannien lacht, sich über unsern Häuptern wölbte –, hinter ihr Jenny mit den Fruchtkörbchen und einer Hutschachtel, dann ich, ebenfalls mit mehreren Schachteln beladen, und endlich Ming Tse, der zwei Träger beaufsichtigte. Die großen Koffer waren alle vorausgeschickt worden, was wir mitführten, war lediglich Handgepäck, und trotzdem wälzten wir uns wie eine Karawane heran. Sobald wir das Schiff betreten hatten, ging Mama zum Kapitän und erkundigte sich, ob wir in der Tat untergehen würden, was er verneinte und Mama gelobte, sein Möglichstes zu tun, eine so furchtbare Katastrophe abzuwenden. Er sprach mit großer Ernsthaftigkeit, aber um die Mundwinkel zuckte es verräterisch, und seine grauen Augen blinzelten mir, sooft ich näherkam, vielsagend zu. Die arme Mama, die das Fahren auf dem Meere nicht verträgt, verschwand in eine Kajüte und blieb trotz des herrlichen Wetters und der spiegelklaren See verschwunden, so lange wir nicht festen Boden unter uns hatten, Ming Tse schob uns Mädchen in eine Ecke und setzte sich als Haremswächter davor. Seine Augen schossen Blitze, sooft sich ein männliches Wesen uns näherte, und Jenny sah sich daher gezwungen, jeden Flirt zu unterlassen. Dagegen fütterte er uns die ganze Zeit mit den herrlichen, riesengroßen Pfirsichen, an die ich noch jetzt mit Genuß zurückdenke – gewiß die schönsten, die ich gesehen oder gegessen hatte.
Nach einer Weile begann die alte Baracke – denn diese holländischen Schiffe sind klein und armselig ausgestattet – trotz des klaren Himmels und der ruhigen See ein wenig zu wackeln, was Ming Tse veranlaßte, sich tiefer in den Reiseplaid zu wickeln und steinunglücklich dreinzuschauen. Jenny benützte die Schwäche des Wächters dazu, auf das Hinterdeck zu entfliehen, wo sie ihre Blicke über die Fluten, über den Himmel und – über die Mitreisenden, über letztere nicht am wenigsten, gleiten ließ.
»Gott sei Dank, daß du nicht wie deine Schwester bist,« brummte mein Verlobter. »So ein Mädchen ist die reine Pest.«
Wir unterhielten uns besonders über einen alten Juden, der uns nahe saß und aus einem schmutzigen Papier heraus ein Stück Fleisch wickelte, was ich als Ueberreste eines Huhns, er als die eines Kaninchens betrachtete.
Der Vorfall erinnerte mich an eine merkwürdige Episode in Ming Tses Londoner Existenz. Er erhielt einst, ohne es zu wissen, ein Kaninchen vorgesetzt und war so böse, als er erfuhr, was er gegessen hatte, daß er sofort ausziehen wollte. Kein Wunder! Da sein Vater nie Kaninchen verspeisen durfte, war es dem Sohne auch nicht erlaubt, und ich erinnerte mich, daß der arme Chinese eine ganze Menge Brechpulver einnehmen mußte, damit das widerspenstige Kaninchen wieder herauswanderte, denn drinnen bleiben durfte es nicht – das wäre ein himmelschreiendes Verbrechen gegen alle seine Vorfahren gewesen. Folglich quälte ihn der Anblick des Juden und des Kaninchens in einem solchen Grade, daß er überall herumging, nur um diesen zwei Schreckgestalten auszuweichen. Mich wickelte er vorsichtig in einen großen, warmen Plaid und schob den Deckstuhl so nahe an das Schiffsende heran, daß ich nichts als die Fluten übersehen konnte. Er selbst suchte und fand Jenny.
»Ihre Schwester braucht Sie,« sagte er kurz. Dann fügte er hinzu: »Sie haben genug herumgeschaut, die armen Männer müssen endlich Ruhe haben,« – sprach's und schob sie, die ihn um Kopfeslänge überragte, gebieterisch in meine Richtung.
»Jenny,« fragte ich sie, sobald Li Bai außer Hörweite war, »hast du nur diese Blusen mit kurzen Aermeln und ausgeschnittenem Halse?«
»Gewiß,« lautete die Antwort. »Mama sagt, ich habe so schöne Arme und einen hübsch geformten Hals – warum soll ich ihn da zudecken, wie du den deinen?«
»Schwester, sei nicht so maßlos eitel und sprich nicht immer von deinen Vorzügen, du wirst dich Fremden gegenüber lächerlich machen. Dies ist jedoch nur nebenbei bemerkt,« sagte ich, als ich sah, daß Jenny beleidigt die Lippen aufwarf, »ich wollte dich nur bitten, immer lange Aermel zu tragen und auch einen hohen Kragen zu wählen, so lange du im Orient bist. Die Orientalen finden es im höchsten Grade abstoßend und unmoralisch, so gekleidet zu gehen. Tust du es, wirst du dir viele Unannehmlichkeiten zuziehen.«
»Oh, Unsinn,« erklärte meine Schwester, legte aber in Zukunft doch Blusen, wie ich sie vorgeschlagen hatte, an.
Ming Tse kam zu uns zurück. »Wollt ihr nicht Kaffee trinken, Kinder?« fragte er.
Ich, die ich ahnte, wie der Kaffee auf dem Schiff sein würde, lehnte sofort ab und riet den andern, mir nachzutun. Jenny tat es, Li Bai aber ging mutig in die Tiefen. Als eine Viertelstunde nach der andern verging und er nicht zurückkehrte, ging ich auf die Suche nach ihm aus. Er taumelte mir bei der Treppe entgegen, wankte auf die Brüstung zu und sah wie ein Geist aus.
»Was ist dir geschehen, Li Bai?« fragte ich besorgt.
»Kaffee!« war die einzige Antwort. Gleich darauf verlangte der Meergott seinen Tribut und – erhielt ihn.
Erst als ich nach einer Weile den armen Chinesen in einen Deckstuhl verpackt und mit einem Reiseplaid umwickelt hatte, erzählte er, daß er nach langem Warten einen teuren Kaffee bekommen hatte, der keinen Geschmack und wenig Farbe besaß, ganz lauwarm war und ihn sofort seekrank machte. Er schimpfte auf die Holländer, als ob die ganze Nation nur schlechten Kaffee kochen würde, und hat noch heute eine sehr unschmeichelhafte Meinung von Holland und seinen Bewohnern.
In Vlissingen kehrte Mama zur Oberfläche als handelndes Menschenkind zurück, und auch Ming Tse stand wieder sicher auf seinen zarten Beinen. Der Kapitän nickte Mama wie einer alten Bekannten zu und war stolz darauf – wie er ihr versicherte –, sie so gut an allen Gefahren vorüber in den Hafen geführt zu haben, doch Mama sah gar nicht so dankbar aus als man Ursache hatte zu vermuten, und Li Bai sah den Kapitän, das Schiff und die Besatzung so wütend an, als wollte er ihnen allen einen Paß zum Reiche der Seejungfrauen ausstellen.
Kaum war die Zollrevision vorüber, wollte Ming Tse etwas essen und weigerte sich, den Berliner Expreß zu betreten, bevor er wußte, und aus guter Quelle wußte, daß der Speisewagen mitfolgte. Erst als wir uns im Wagen gegenübersaßen und uns die überstandene Fahrt nur ein Traum schien, tauten Mama und der kleine Chinese, die beide bei den Göttern und Heiligen ihres Landes schworen, nie wieder die Planken eines Schiffes zu betreten, ein wenig auf.
An der deutschen Grenze war wieder Zollrevision, und hierauf durften wir schlafen. In Berlin blieben wir nur einen halben Tag, und mir tat es wohl, nach langer Zeit wieder in einem Lande zu weilen, wo man meine Sprache sprach. Jenny war selig, »Unter den Linden« einige Einkäufe machen zu können, und Ming Tse war ebenso unermüdlich wie sie im Wählen allerlei Kleinigkeiten, die man nach China mitführen sollte. Am Abend verließen wir Berlin, und Jenny drückte ihr Näschen an die Scheiben, um acht Uhr abends das Nachtleben Berlins vom Zuge aus beobachtend. Natürlich neckten wir sie hinterher und fragten, was ihr vom »Nachtleben« am besten gefallen habe. Ich freute mich innig, daß meine Schwester noch so beglückend naiv war, und bedauerte, Mama zugeredet zu haben, sie nach China mitzunehmen. Jetzt war eine Aenderung nicht mehr zulässig.
An der russischen Grenze leerte man unsere Koffer einfach auf den schmutzigen Bahnsteig aus, und die Zollbeamten – oder wie mein Vetter sie zu betiteln pflegte, – die Kofferspione – fuhren mit ihren zweifelhaft reinen Händen schauerlich unter den Sachen herum. Li Bai, der seinen Koffer mit der ihm eigenen Pedanterie gepackt hatte, sprach chinesisch – kaum Kosenamen, denke ich mir –, und ich hatte große Mühe, den übervollen Koffer wieder zu schließen. Ich bat daher Jenny, sich darauf zu setzen, damit ihr Gewicht den störrigen Gesellen eines Besseren belehren möge, aber da kam ich schön an. Li Bai entließ uns mit einem Blicke und einer Handbewegung, die keine Feder hinreichend wiedergeben könnte und packte meinen Koffer selbst. Jenny fiel beinahe in Ohnmacht, als sie bemerkte, was für Kleidungsstücke dabei notwendigerweise durch seine kleinen Hände wandern mußten, aber ich habe in der Hinsicht stärkere Nerven. Der fertige Koffer war ein Meisterwerk, und wohl oder übel mußte sich Jenny demselben Schicksal unterwerfen, denn Ming Tse sagte mit mehr Wahrheit als Höflichkeit:
»Ihr könnt beide nicht einen Koffer packen.«
Bei der Paßrevision und auch im Speisewagen half mir meine Kenntnis des Russischen, was meinen Reisegefährten sehr imponierte, weil sie mit der Sprache des Zarenreiches gar nicht vertraut waren. Sie half mir auch sehr in Moskau, wohin wir am folgenden Tag spät abends gelangten und im Hotel l'Europe abstiegen, wo man die Sprachen der ganzen gebildeten Welt hören konnte. Herrlich schönes Moskau! Früh am nächsten Morgen stand ich auf dem kleinen Balkon und sah hinweg über die unzähligen Kuppeln und Türme, die malerischen Gebäude dieser echt russischen Stadt, mit dem Kreml im Hintergrund und dem flutenden Verkehr zu meinen Füßen. Wir waren im Oktober und die Blätter der Bäume wiesen alle Farbennuancen vom hellsten Gelb bis zum tiefsten Braun auf, rote Blätter funkelten dazwischen hervor und der tiefblaue Herbsthimmel, auf dem die aufgehende Sonne eben einige Wölkchen rosig färbte, bevor sie die Kuppeln und Baumspitzen küßte, rief in meinem Herzen allerlei Gefühle wach, von denen das stärkste jedoch der Wunsch war, das, was ich jetzt in mir widerklingen hörte, durch den Pinsel oder die Feder verewigen zu können. Die Größe und reine, erhabene Schönheit der Natur verglichen mit unserem armseligen Haschen und Jagen – wonach? Die ewig wiederkehrende Frage des »Seins oder Nichtseins«, das beseligende Bewußtsein, daß alles Kleinliche in solchen Augenblicken von uns abfällt wie ein altes Kleid, dessen wir länger nicht bedürfen, ein Verlassen des eigenen Ichs, um sich über die Erde hinaus in unbekannte Welten zu schwingen – alles dies bewegt die Seele bei dem Anblick reiner Schönheit, und muß man auch bald in die graue Wirklichkeit zurückkehren, bleibt doch der Eindruck des Gesehenen zurück und zittert als schöne Erinnerung noch lange in uns nach.
»Käthe,« rief in diesem Augenblick Mama, »ich wünschte, du würdest nicht eine halbe Stunde lang mit der Nase auf die Wolken gerichtet stehen, sondern lieber auf deine Toilette schauen. Deine Krawatte sitzt schief.«
»So richte sie bitte,« erwiderte ich müde. Was war eine Krawatte gegen das Universum?
»Aber Käthe,« entfuhr es Jenny, »hast du wirklich Lust auf dem Balkon zu stehen, wenn alle Gäste noch schlafen? Jetzt ist ja niemand zu sehen.«
»Jenny,« erwiderte ich ernst, »ich schaue nicht die Leute an – die interessieren mich nicht. Ich blickte,« setzte ich träumerisch hinzu, »auf die Schattierungen der Blätter und die Farbenabstufung am Himmel.«
In diesem Augenblick trat Ming Tse ein.
»Käthe studiert Farbenabtönungen am Himmelsbogen und darunter,« rief meine Schwester ihm entgegen.
Ich zog Li Bai auf den Balkon. »Ist es nicht wunder-, wunderschön?« fragte ich ihn und legte unwillkürlich meine Hand auf seinen Arm, als wollte ich etwas von dem, was mich so stark bewegte, durch Magnetismus auf ihn übergehen lassen.
»Nichts zu sehen,« bemerkte er gelassen. »Komm zum Frühstück!« Damit schüttelte er meine Hand ab und folgte den anderen hinab in den Speisesaal. Ich kam mir wieder einmal vor wie ein Schiffbrüchiger auf einer einsamen Insel, der in der Ferne ein Schiff sieht, dessen Aufmerksamkeit er aber nicht erregen kann. So ging auch ich hinunter und – frühstückte.
Ueber die Sehenswürdigkeiten Moskaus will ich hier nicht sprechen – eine Reisebeschreibung soll dieses Werk nicht werden – genug, wir besahen alles, was dort von Interesse war und verweilten zwei Tage in dieser Stadt. Ming Tse war zuvorkommend wie immer, unser Verkehr rein freundschaftlich und wohl niemand, der uns Seite an Seite durch die Straßen der alten Stadt wandern sah, hätte glauben können, daß hier zwei Verlobte dahinmarschierten, so weit entfernt voneinander gingen wir, und so ruhig und leidenschaftslos waren unsere Züge. Mama fand unsere Haltung äußerst comme il faut, Jenny lächerlich und ich? Ich dachte an jene längstentschwundene Zeit zurück, wo selbst ich davon geträumt hatte, daß man als Braut im irdischen Paradiese schwebe, daß eine unbekannte, früher ungeahnte Seligkeit das Herz schneller schlagen, das Blut schneller kreisen lasse. Die Glückseligkeit war entschieden nicht europäisch – aber die Ruhe, die gleichmäßige Heiterkeit, die ich im Verkehr mit Li Bai fand, war nicht zu verachten – es war der orientalische Abglanz, voilà tout!
Sonnabend! Jennys Wangen glühen vor Aufregung, Mama empfiehlt ihre Seele und besonders den Körper dem großen Geist, betend, daß sie mit dem Kopf auf dem Rumpfe wohlerhalten wieder nach Moskau zurückkommen möge, Ming Tse freut sich wahnsinnig auf das endliche Wiedersehen mit seiner Mutter, und ich wünsche aus ganzer Seele, daß die Zukunft lichter als die Vergangenheit werden würde; so stehen wir alle gegen Mitternacht auf dem großen und belebten Kursk-Nishninowgoroder Bahnhof und warten auf den sibirischen Zug, der uns in das Reich des fernen Ostens tragen soll. Endlich wird das Abfahrtszeichen gegeben, wir betreten unsere Abteile, die wie kleine Zimmer sind, die man nach Belieben sperren kann, sooft man sie verläßt und wo alles sehr bequem und elegant ist. Noch ein Blick über Moskau mit seinen Hunderten von Lichtern, den dunklen, kaum sichtbaren Kuppeln und Türmen, und wir sausen durch die mondhelle Nacht über die große Ebene rund um die Wolga, auf der die unzähligen Schiffe auf- und niederfahren, von denen in den warmen Sommermonaten ununterbrochen Gesang ertönen soll – die melancholischen Lieder erklingen da aus den Kehlen der Schiffer, die damit die Unbehaglichkeiten der Reise zu mildern suchen. Nun war alles still, nur das fahle Mondlicht beleuchtete das nächtliche Rundbild. Die drei Mitreisenden verfügten sich in ihre Zellen, ich aber lag, überkommen von dem Gedanken, Europa vielleicht auf Jahre, vielleicht auf immer, Lebewohl gesagt zu haben, die Nacht hindurch wach und blickte, als sich endlich die schweren Morgennebel hoben, auf das in der Ferne auftauchende Hügelland.
Li Bai klopfte schon früh an meine Türe, und da die beiden Damen noch schliefen, gingen wir allein in den Speisesaal, wo ein dicker Mann uns gegenüber Platz nahm. Ich mochte kaum einen Schluck getan haben, als er trotz meiner abwehrenden Haltung ein Gespräch anfing, und da ich russisch konnte und Li Bai nicht, fiel die Bürde der Unterhaltung auf mich. Es stellte sich heraus, daß mein Gegenüber ein wohlhabender Pferdehändler war, der bis Samara mitfuhren wollte, und da ich mich interessierte, wann wir dahin kommen würden, ging er gleich daran, im Fahrplan die Ankunftszeit zu finden.
Mein kleiner Chinese sah wie eine dräuende Gewitterwolke aus, obschon ich immer wieder das Gespräch mit dem Fremden unterbrach, um ihm alles zu übersetzen, und als er nun merkte, daß der Händler mir galant allerlei Ankunftszeiten auf ein Stück Papier schrieb, war er so böse, daß er mich fragte:
»Wozu braucht der Mensch da höflich gegen dich zu sein? Und wozu braucht er dir Ankunfts- und Abfahrtszeiten herauszuschreiben, dieser dicke Idiot!? Haben wir nicht selbst einen Mund unter der Nase und zwei Augen oberhalb derselben, so daß wir selbst fragen und herausfinden können, was wir wollen?«
Damit faßte er mich am Arm und zog mich hinter sich durch den ganzen Zug, bis wir vor Mamas Zelle standen, an die er klopfte.
»Mama,« rief er, sobald er sie begrüßt hatte, »hier bringe ich dir die Käthe. Wenn ich nicht auf sie achtgegeben hätte, wäre sie mit einem Pferdehändler, der nach Samara fährt, durchgebrannt!«
Seine geschlitzten Augen sahen in diesem Augenblicke keineswegs übermäßig hübsch oder angenehm aus.
Mama dankte ihm aus voller Seele, wenn auch mit einem Lächeln um die Lippen, Jenny aber warf sich auf das Bett, strampelte vor Vergnügen mit den Beinen und lachte, daß ihr die Tränen über die Wangen liefen. Für den Rest des Tages wich Li Bai nicht von meiner Seite, und ich fragte mich, wie es werden würde, wenn ich einmal in China sei. Seinem Versprechen gemäß sollte ich das Recht behalten, auszugehen, sooft ich dies wünschte, wenn er auch gänzlich abgeschlagen hatte, mich meinen Beruf dort weiter ausüben zu lassen. Wie nur alles enden würde? Vorläufig unterhielt mich sein Betragen nur.
Am zweiten Tage gegen Mittag kamen wir nach Samara, und von da an begann eigentlich erst so recht die Reise. Russen aller Arten standen in ihren etwas schmutzigen Kleidern auf dem Bahnhof und warteten auf den gewöhnlichen sibirischen Zug, der mit russischer Gleichgültigkeit gegen das Sprichwort »Zeit ist Geld« innerhalb der nächsten zwei bis drei Stunden eintreffen sollte. Auf allen Stationen hält der einfache sibirische Zug; die armen Auswanderer, denen es beinahe ebenso schlecht wie den Gefangenen geht, können aussteigen und sich heißes Wasser holen, womit sie ihre Teevorräte erneuern, und die Eisenbahnbeamten behandeln sie nicht viel besser als Tiere. Man erzählt sich, daß ein Zugführer einst einigen armen Russen, die auch auf einer solchen Station ausgestiegen waren, höflich sagte: »Meine Herren, es ist Zeit zum Einsteigen!« aber niemand nahm irgendwelche Notiz davon. Nach dem zweiten Glockenzeichen sagte er: »Einsteigen, bitte!« doch ganz ohne Erfolg. Diese Unglücklichen glaubten nicht, daß die Aufforderung an sie gerichtet war, und erst als er hinzutrat und sie anschrie: »Verdammtes Pack, seht zu, daß ihr augenblicklich in den Zug kommt,« verstanden sie, wer gemeint war, und eilten auf ihre Plätze.
Der Zug flog über die weite Ebene von Batraki, die mit ihrer Abwechslungslosigkeit ununterbrochen bis Kinel fortdauert und erst bei ihrer Kreuzung mit der Hügelkette unweit des Padowaflusses ein Ende nimmt, während wir in dem bequemen Zuge saßen, wo wir einen Lesesaal mit guter Bibliothek und vielen Zeitungen hatten, in dem man Schach spielen konnte und wo man so viele Briefe an kleinen Tischchen schreiben konnte, als man nur wollte. Da waren Badezimmer und Küche, der schöne Speisewagen und der elegant möblierte, mit vielen weichen Sitzgelegenheiten ausgestattete Salon, die netten Schlafzimmerchen und die langen Korridore, durch die man von einem Ende des Zuges zum andern gehen konnte. Da es schon ziemlich kühl war, wurde der Zug geheizt, was den Aufenthalt überall sehr angenehm gestaltete. Ming Tse und Jenny wanderten wie Kinder durch alle Räume, untersuchten alles, freuten sich über jede Entdeckung und waren ganz gleichgültig gegen die Gegenden und die Orte, die wir passierten. Der Zug fing in voller Fahrt das nötige Wasser aus der der Strecke angrenzenden Wasserleitung auf und brauste mit unverminderter Fahrt durch die Stationen, auf denen wir nur wie im Fluge Soldaten und Gefangene stehen sahen. Lange lagen am Morgen die Nebel über der Landschaft, und früh schon sank am Abend die Dunkelheit herab.
Am folgenden Tage erspähten meine Augen endlich den erwarteten schlichten Grenzobelisk, auf dem mit russischen Buchstaben »Europa – Asia« stand und an dem wohl manch' ein armer Verbannter mit Schaudern vorbeigegangen. Hier mußte man Abschied nehmen von der Zivilisation, nun waren wir in Asien, dem gefürchteten Sibirien. Ach, auch ich hatte Europa jetzt hinter mir gelassen – wie, wie würde ich Asien finden?
Li Bai kam gelaufen. »Mutter, Käthe, kommt, jetzt kommen die hängenden Brücken, die großen Schluchten!«
»Der Ural?« fragte ich lebhaft und war augenblicklich am Fenster, Mama gleichfalls.
»Es ist ja gleichgültig, wie der Berg heißt,« meinte Li Bai, »hübsch ist die Gegend.«
Ich vergab ihm gern seine Unwissenheit und Gleichgültigkeit, verriet er doch zum ersten Male, daß die Schönheit eines Gegenstandes (außer Kleidern) auf ihn wirkte. Es war auch großartig, was wir sahen. Vorüber ging die Fahrt an herrlichen Bergseen, in denen sich der Schnee der Berggipfel klar spiegelte, an Abhängen, über die Schwebebrücken führten, an Aushöhlungen vorbei, die majestätisch in ihrer Großartigkeit wirkten; Abgründe erblickten wir, die uns den Atem benahmen und in denen wir Gießbäche wild rauschen hörten; bald führte die Bahn durch einen künstlich gebildeten Unterbau dahin, bald bahnte sie sich den Weg durch einen endlosen Tunnel, immer wechselnd, immer Bewunderung erregend. Zwischen Zlatoust, »dem goldenen Mund«, und Urshumka erreicht sie endlich ihren Höhepunkt. Mächtige Kurven, wilde Wasserfälle und schroffe Felswände verleihen auch weiterhin der Strecke großen Reiz.
Jenny hatte einen großen Bewunderer gefunden, der ihr auf Tod und Leben den Hof machte und uns alle interessanten Punkte erklärte, nicht nur während wir sprachlos vor Staunen und Entzücken den Ural kreuzten, sondern auch später, als er uns auf die Aushöhlung des Dergatsch, ein wahres Meisterwerk, aufmerksam machte. Er belehrte uns, daß nur einundzwanzig Werst vom malerischen Orte Ssuleja, an dem wir wie der Wind vorbeisausten, das berühmte Bakalsche Grubenwerk liegt, welches überreich an Eisenerz – vielleicht das reichste Sibiriens – ist, und erzählte, daß in dem Museum von Zlatoust ein Nagel aufbewahrt werde, den Kaiser Alexander I. eigenhändig geschmiedet haben soll. Kurz, der Russe war ein sehr angenehmer Gesellschafter für Jenny und Mama. Ich durfte freilich nicht viel mit ihm sprechen, sonst sah Li Bai drein wie ein vierzehntägiges Regenwetter mit gelegentlichem Schauer und Donnerwetter.
Trotzdem der Russe gewiß nicht zehn Worte mit mir gewechselt und sein ganzes Herz – so schien es wenigstens – Jenny zu Füßen gelegt hatte, sah Li Bai ihn doch mit Vergnügen bei Tschelabinsk den Zug verlassen, um mit der Zweigbahn nach Jekaterinenburg zu fahren, wo er Geschäfte hatte. Es war der Vorabend meines Geburtstages, und als mir Ming Tse zum Abschied die Hand reichte, zog er mich plötzlich etwas von Mama und Jenny weg und flüsterte mir geheimnisvoll zu:
»Ich habe etwas sehr Hübsches für dich, Käthe, für morgen,« und er hielt einen Augenblick inne, »und morgen werde ich dich – küssen!« Sprach's, drückte meine Hand noch einmal und verschwand in sein Schlafabteil.
Ein Europäer hätte wahrscheinlich gefunden, daß er der gewinnende Teil bei diesem Vorgang wäre, aber Li Bai sagte es mit dem Tone und der Miene eines Menschen, der sich vollauf bewußt ist, welche unendliche Großmut er dem Gegner zeigt und welch unschätzbare Gnade damit verliehen wird. Ich war unglaublich gespannt, wie er sich dabei ausnehmen werde und wie mich diese seine Zärtlichkeit berühren würde. Ich war sogar ängstlich, da ich gegen jedwede Berührung außergewöhnlich empfindlich bin und ich mich fürchtete, mir könnte ekeln. Allerdings war er so rein und nett, jung und bartlos, daß ich mich einigermaßen beruhigt fühlte, aber mit großer Spannung sah ich nichtsdestoweniger dem kommenden Tage entgegen.
Als daher Jenny früh an mein Abteil klopfte und mir eine hübsche Handarbeit als Geschenk überreichte, bat ich sie, mit Mama voraus in den Speisesaal zu gehen, da ich natürlich Ming Tse allein treffen wollte. Mama gab mir eine lange Goldkette, an die ich mein Firmungsgeschenk, eine Golduhr, hängte, und nachdem wir beide geweint hatten – ganz wie's sich schickt, wenn man vierundzwanzig Lenze hinter sich hat –, blieb ich allein in meinem Abteil.
Etwa fünf Minuten später klopfte es verstohlen an die Pforte, und auf mein »Herein!« erschien zögernder als gewöhnlich mein kleiner Chinese auf der Schwelle.
»Möge sich dieser Tag noch oft wiederholen!« sagte er, indem er ein sehr schönes Kettchen mit einem Anhänger um meinen Hals legte, und dabei berührten seine Lippen fast unmerklich meine Wange, gerade als fürchtete der Besitzer dieser Lippen sie an mir zu verbrennen. Er war auch gewiß dreimal so verlegen wie ich, blickte mich gar nicht mehr an, und obschon ich ihm warm dankte, wandte er sich mir nicht wieder zu, sondern faßte mich energisch bei den Schultern und schob mich vor sich dem Speisewagen zu.
Als wir vor der Türe des Wagens standen, hielt der kleine Chinese einen Augenblick inne und fragte mich:
»Bist du zufrieden, Käthe, daß ich dich geküßt habe?«
Und ich, die ich mich der Hoffnung hingab, daß hier wie in allen Dingen Uebung den Meister machen würde, entgegnete lächelnd:
»Sehr zufrieden und sehr froh, Li Bai!«
Damit betraten wir den Speisewagen, der eben mit voller Fahrt durch das wichtige Gouvernement von Orenburg dahinbrauste und in dem am appetitlich gedeckten Frühstückstisch Mama und Jenny saßen und ein Butterbrot nach dem anderen in den inneren Kräftebehälter hinabspazieren ließen.
Am Nebentische saßen zwei hagere Engländer, aber Jennys Augen und Mamas Beredsamkeit (Mama spricht auch mit Leuten, deren Sprache sie nicht mächtig ist, und macht aus drei Worten ausländischer Wortkenntnis mehr, als ich aus einem reichen Wortschatz von vielen tausend Wörtern) hatten das ihrige getan – man sprach herüber und hinüber, und die beiden Herren machten uns aufmerksam, daß wir eben an Mischkino vorbeifuhren, das die Waren von ganz Sibirien für die berühmte Irbitsche Messe erhält. Als wir später im Salonwagen saßen und an Kurgan vorbeisausten, wußten die Engländer zu erzählen, daß dieser Ort seinen Namen dem Umstande verdankt, daß in unmittelbarer Nähe der Stadt künstliche Erdaufschüttungen in Gestalt von Kurganen oder Hünengräbern liegen, die mit Wald und Gräben umgeben sind und um die sich viele Sagen spinnen, besonders um den einen, in welchem einst eine wunderschöne Königstochter gelegen haben soll und die, als die Tataren immer wieder ihren Grabhügel der unermeßlichen, darin vergrabenen Schätze willen plünderten, eines Nachts auf silbergeschmücktem Wagen, der von zwei milchweißen, feurigen Rossen gezogen wurde, aus dem Hügel herausfuhr und sich in den unergründlichen Tschuklomsee stürzte. Natürlich blickten wir alle interessiert auf die eigentümliche Stadt mit ihrer breiten, öden Hauptstraße, ihren kleinen, fast durchschnittlich ebenerdigen Häusern und den im Hintergrunde auftauchenden Hünengräbern. Ueberall lag schon Schnee, obschon wir kaum Mitte Oktober hatten, und die Aussicht auf all die öden Strecken vor uns bot wenig Fesselndes, bis wir auf der breiten Eisenbrücke den mächtigen Tobol überschritten, an dem so viele Nomadenstämme sich niederließen und der eine so wichtige Rolle für diese Leute spielte.
Ich fühlte eine Hand auf meinem Arm. Li Bai stand neben mir und sagte gelangweilt:
»Komm mit mir, Käthe, wir gehen durch den Zug.«
Kaum waren wir in Bewegung, als er mir sagte:
»Diese Fremden sind ganz überflüssig, sie sollen mit Mama und Jenny sprechen. Für dich haben sie kein Interesse, nicht wahr?« fragte er mich und kniff die Augen gewaltig zusammen.
»Gar kein Interesse, aber sie kennen die Gegend gut. Hörst du nicht gern alles über ein Land, das man durchfährt?«
»Ja – a!« entgegnete er gedehnt. »Ist doch immer die alte Geschichte,« fügte er wegwerfend hinzu. Hierauf lehnte er sich ruhig zurück und erzählte mir allerlei Geschichten von China – von Vampiren, die ihren Feinden in der Nacht das Blut aussaugen, während sie am Tage meist die Gestalt eines schönen Mädchens haben; von Räubern, die sich in ein reiches Haus einschlichen und die Tochter des Hauses überfielen, worauf sie verschwanden, aber ihren Namen – oft einen sehr gefürchteten – zurückließen; von Dämonen, die sich in die Häuser einschlichen und allerlei Unheil stifteten und Aehnliches. Er schien, obschon er unseren Aberglauben, unsere Märchen, ja selbst unseren Glauben verspottete und verlachte, von dem, was er erzählte, ganz durchdrungen zu sein. Daß er auch nicht ohne Aberglauben mit Bezug auf die alltäglichen Vorkommnisse war, zeigte sich am folgenden Tage.
Wir hatten Irkutsk passiert, wo wir den Zug endlich einmal verlassen und auf dem mit Buräten, Jakuten, Tungusen, Japanern, Chinesen und den gefürchteten Kosaken mit ihren feurigen Augen und ihren hohen Pelzmützen übervoll besetzten Bahnsteig auf und ab gehen konnten, und saßen gerade vor einigen russischen Nationalspeisen, als eine tote Fliege in der Suppe Li Bais sichtbar wurde. So etwas ist immer unangenehm und abscheuerregend – wer zweifelt daran? – aber mein Verlobter nahm es doch noch viel tragischer, als man dies erwarten konnte.
»Eine Fliege! Eine Fliege in der Suppe!« sagte er mit Grabesstimme. »Das bedeutet einen Todesfall in der Familie!«
All unsere Versicherungen, all unsere Bemühungen, ihm begreiflich zu machen, daß dies nur ein Aberglaube sei, war vergeblich, und für den Rest des Tages war Li Bai äußerst schlechter Laune und sehr niedergedrückt.
Der nächste Tag war etwas freundlicher. Es schneite nicht mehr, und Li Bai sah auch fröhlicher aus, obschon er ganz in Trauer gekleidet erschien – selbst mit schwarzer Krawatte und matten Manschettenknöpfen.
»Was ist geschehen?« fragte Mama, die sogleich an die Fliegenprophezeiung dachte.
»Vor sieben Jahren starb mein Großvater an diesem Tage, und daher ist es notwendig, daß ich für heute Trauer anlege.«
Der chinesischen Sitte gemäß legt man an den Sterbetagen der Mutter und der männlichen Verwandten stets Trauer an (für die übrigen Frauen wird jedoch nicht Trauer getragen), selbst wenn schon über zwanzig Jahre seit dem Tode des Betreffenden verstrichen sind. Mama fand dies rührend, aber ich konnte nicht umhin zu denken, daß es doch unangenehm sein dürfte, falls man sehr viele Verwandte zu betrauern hat, da man in diesem Falle aus dem Trauertragen kaum herauskommen kann.
Endlich gelangten wir zum See Baikal, von den einheimischen Russen das »Heilige Meer« genannt, der einer der größten Süßwasserseen der Welt und entschieden der gewaltigste der Alten Welt ist. Die Chinesen nennen diesen See »Pei-ho« oder »Nordmeer«, die Mongolen geben ihm den Namen »Dalai-Nor«, was »Heiliges Meer« bedeutet, oder auch »Baikul« oder »gesegnetes Meer«. Die den See umgebenden Höhenzüge verleihen ihm einen besonders malerischen und großartigen Charakter. Die Randgebirge bilden verschiedene Gestalten, um die die lebhafte Phantasie der Eingeborenen viele Sagen gesponnen hat. Jede der zahlreichen Landzungen hat einen eigenen Namen und die Inseln werden von den lamaïtischen Priestern und auch von den burjatischen Schamanen als die Aufenthaltsorte des Gottes der Unterwelt Begdosi angesehen. Rund um den riesigen See gibt es eine Anzahl geweihter Stätten, an denen bald dem Gotte der Weisheit, bald dem Seegotte Dianda, bald anderen Göttern geopfert wird, damit diese Götter keine Menschenopfer verlangen sollen, wohl aber geneigt werden, den Fischern viele Fische an den Strand und in die Netze zu treiben. Die Farbe des Sees ist hell und die Fluten leuchten dem Beschauer auffallend durchsichtig entgegen. Als wir ihn passierten, war er schon teilweise zugefroren, im Juni und Juli aber soll an den sonst so stürmischen Gestaden eine so wunderbare Windstille herrschen, daß das Wachsen einer Anzahl merkwürdiger Wasserpflanzen sehr begünstigt wird und die die Fluten bald grünlich, bald rötlich erscheinen lassen, weshalb man diese Zeit »die Blütezeit des Baikals« nennt.
Li Bai war schon in höchster Aufregung, denn wir näherten uns der chinesischen Grenze. Nur noch wenige Tage und ich hatte meine neue Heimat erreicht. Jenny war sehr gespannt auf die neuen Eindrücke und Mama sah dem himmlischen Reiche mit einigem Mißtrauen entgegen. Ich glaube, sie wäre am liebsten gleich wieder zurückgefahren.
Seit jenem Kusse an meinem Geburtstage, der mich mehr an die Liebkosung einer Freundin als an den ersten Kuß eines Verlobten erinnerte, waren wir in unser früheres freundschaftliches Verhältnis zurückgefallen, und ich fragte mich, ob er auch als Gatte so fremd und kalt bleiben würde.
Kosenamen gebrauchte er nie, und nur das englische »dear«, was seiner Kürze wegen sehr gut einen Namen ersetzen konnte, schlich sich in unsere Rede ein. Er war sehr höflich, erriet unsere Wünsche bezüglich allgemeiner Bequemlichkeiten, machte Jenny einen zuvorkommenden Schwager und Mama einen höflichen aber unverständlichen Schwiegersohn, der zu allem »ja« sagte und alles »nein« tat, was ein gewisses diplomatisches Talent verriet. Die Abwechslung der Reise hatte wohltuend auf mein aus dem Gleichgewicht gebrachtes Gemüt und auf meine erschütterten Nerven gewirkt, und ich war infolgedessen heiterer geworden, wozu die komischen, oft treffenden Bemerkungen meines kleinen Chinesen sehr beitrugen. Eigentlich sagte mir Jenny oft, daß ich kein Recht hätte, ihn »den kleinen Chinesen« zu nennen, da ich nicht um ein Haar größer und schwerlich mehr wie zwei Zentimeter breiter als er war. Aber er erschien mir nicht nur körperlich, sondern auch seelisch – weniger klein, als vielmehr jung – und doch war er es nicht, wie ich mich später überzeugte. Ich konnte deshalb nicht umhin, ihn immer als »meinen kleinen Chinesen« zu betrachten, wie wenig Recht mir meine eigene Größe oder der Mangel einer solchen auch dazu gaben. Daß er so klein war, so zart aussah, war mir ein Trost!
Früh am folgenden Morgen kamen wir zum Dorfe Nagodan – der chinesischen Grenze. Die Kosaken verschwanden und eine Anzahl Chinesen mit kaftanähnlichen Kleidern und großen, in der Mitte spitz zulaufenden Hüten nahmen ihre Plätze ein. Hier war Zollinspektion, und ein verzweiflungsvolles Anklammern an sein Hab und Gut. Li Bai hatte uns gewarnt, die Träger auch nur einen einzigen Augenblick aus den Augen zu verlieren, da sie gleich mit den Koffern auf Nimmerwiederkehr verschwinden würden. Li Bai sprach, erklärte, schimpfte und bewachte, und es gelang uns mit vereinten Kräften einen Diebstahl zu verhindern, obschon es keine Kleinigkeit war, allen den zudringlichen, schmutzigen Chinesen zu wehren, die um jeden Preis ihre gelben Pfoten in die Tiefen unserer Koffer stecken wollten, und die mit affenartiger Geschwindigkeit bald einen Gegenstand, bald den andern ergriffen, um ihn in die weichen Falten ihres wallenden Gewandes verschwinden zu machen. Dazu schrien sie ununterbrochen und gestikulierten mit Händen und Füßen, daß mir ganz schwindlig im Kopf wurde und ich froh war, als die schreckliche Inspektion vorüber und wir wieder im Zuge waren.
Hier begann die chinesische Küche. Wir speisten zum erstenmal auf chinesische Art und Weise in Mukden, wo man uns zuerst grünen Tee ohne Zucker oder Milch in den kleinen, mit allerlei Zeichen und chinesischen Figuren überstreuten, henkellosen Tassen servierte. Ihm folgte eine Riesenschüssel Reis, der blendend weiß und ganz trocken war – er ersetzt in China unser Brot –, und kleingeschnittenes Fleisch mit einer Art Seegras, das mir gut schmeckte und mich unterhielt, da es beim Essen ein Heidengeräusch machte. Man hätte glauben können, daß ich zum mindesten die allerstärksten Hühnerknochen mit einem wahren Löwengebiß zerdrückte, so riesig war der Lärm, den die Zerkleinerung dieses Gemüses hervorrief. Wir mußten uns zum erstenmal der chinesischen Eßstäbchen bedienen. Das war eine schwere Aufgabe. Li Bai hielt die feinen Stäbchen geschickt zwischen Zeige- und Mittelfinger und fischte aus dem Schälchen (denn wir aßen nicht von Tellern) sehr gewandt die Fleischstückchen, die er in die kleine Saucenschüssel, die bei jedem Besteck lag, tauchte und zum Munde führte. Mama, Jenny und ich aber, wir waren verloren. Li Bai warf in jede unserer Schalen mit dem entgegengesetzten Ende seiner Stäbchen alle erhaschbaren Leckerbissen, aber umsonst. Wenn wir sie endlich aufgefaßt hatten, ließ gewiß eine unvorsichtige Handbewegung die mühsam aufgeladene Beute ins Wanken kommen und manchmal flog sie mit der Sicherheit eines wohlgezielten Pfeils in das Gesicht oder auf die Bluse eines Mitspeisenden, und als endlich ein reichlich in die pikante schwarze Sauce getauchtes Stück Huhn auf diese ungewollte Weise Li Bai »platsch« gegen die tadellose Krawatte geflogen war, warf er einen Blick gegen den Himmel, als ob er die unsichtbaren Mächte einladen wollte, solche Ungeschicklichkeit näher in Augenschein zu nehmen, schüttelte das Haupt, als ob so etwas noch nie vorgekommen wäre, und öffnete dann seinen Koffer, dem er schweigend drei Löffel entnahm, die er uns mit unbeschreiblichen Gesichtsausdruck überreichte. Dann knüpfte er sich eine frische Krawatte um und setzte seine Mahlzeit fort, durchdrungen von dem erhebenden Bewußtsein, daß er unserer Schießlust Einhalt geboten hatte, indem er uns die gefährlichen Stäbchen gegen Löffel ausgetauscht. Den Schluß der merkwürdigen Mahlzeit bildete ein Litschikompott, das ausgezeichnet schmeckte. Die Früchte erinnern an unsere Pfirsiche, nur sind sie glatthäutig und viel kleiner. Der Geschmack ist sehr fein und die Frucht erquickt ganz unbeschreiblich. Tschau-tschau dagegen war mir zu süß, – er war noch süßer als unsere kandierten Früchte, übermäßig verzuckert und klebrig.
Wir stiegen spät am Abend in Peking aus. Li Bai führte uns in das europäische Hotel unweit der deutschen Gesandtschaft und nahm dann Abschied von uns. Wir sollten noch zwei Tage in der Hauptstadt Chinas bleiben, er aber fuhr voraus nach Tientsin, um seine Eltern zu begrüßen und den chinesischen Zauberer noch einmal zu befragen, wann der günstigste Trauungstag für uns sein würde. Daher nahm er auch alle meine Geburtsdaten mit, denn nach chinesischem Glauben spielt das Horoskop eines Menschen eine sehr wichtige Rolle. Viele Chinesen, die lange in Europa gewesen sind, haben mit diesem Humbug lange gebrochen, aber Li Bai war in seinem ganzen Wesen Chinese – unveränderlich Chinese – und ich viel zu nachsichtig in meinem Denken, als daß ich mich diesen seinen Wünschen irgendwie widersetzt hätte. Er konnte soviel es ihm beliebte an chinesischen Sitten und Gebräuchen festhalten, wenn er mich nur recht liebhaben wollte und mich stets höflich und gut behandelte.
Als wir uns zum Abschied die Hand reichten, flüsterte ich ihm zu:
»Li Bai, ich fürchte mich ein wenig vor deinem Vater!«
»Unsinn!« entgegnete er. »Mein Vater wird dir nicht den Kopf abreißen, er hat Europäerinnen gern und ist froh, daß du so viele Sprachen sprichst.«
Diese Versicherung beruhigte mich ein wenig, doch nicht ganz. Wie würde ich mich je in diese Verhältnisse finden? Ein heißes, drückendes Angstgefühl stieg bei diesem Gedanken in mir auf, aber mit Aufgebot meiner ganzen Willenskraft drängte ich es zurück. Warum jetzt zittern, wo alles entschieden ist? Alle Menschen sind gleich, und gewiß kann es viele gute Menschen unter gelbem Aeußern geben, ebenso viele vielleicht als unter weißem oder braunem.
Ich hatte einem alten Herrn geschrieben, den ich einmal in Paris kennengelernt hatte und der nun, wie ich wußte, schon seit vielen Jahren zwischen Europa und Asien hin und her reiste, seinen eigentlichen Stammsitz geschäftshalber jedoch in Peking hatte. Früh am folgenden Morgen kam Herr Frise, um uns die Stadt mit allen ihren Sehenswürdigkeiten zu zeigen.
Er geleitete uns zuerst in die echt chinesische Stadt, wo wir in alte Porzellanfabriken und Geschäfte gingen, wo wir die herrlichen Schüsseln, Kannen, Vasen und Tassen bewundern konnten, die alle als Merkzeichen ihrer chinesischen Erzeugung den Drachen aufwiesen. Die Chinesen lieben es, solche echte Vasen oder Schüsseln zu sammeln und als Familiengut aufzubewahren, denn dieses Porzellan bedeutet ein ganzes Vermögen, etwa wie unsere Bücher vor der Erfindung der Buchdruckerkunst.
Die Straßen von »Shung-tien-fu«, oder wie die Chinesen die Stadt noch öfter nennen, nämlich »Peh-Djing«, d. h. nördliche Hauptstadt, sind entsetzlich. Sie sind weder geschottert noch gepflastert und der durch viele Hunderte von Jahren unablässig über sie hinwegrollende Verkehr hat den schrecklichen Sandboden in einen Hohlweg verwandelt, in dem man im Sommer vor Staub fast ersticken soll und in welchem man jetzt zur Winterszeit im Kot fast stecken blieb. Die kleinen echt chinesischen Wagen, die nach Aussage unseres Begleiters heute noch ebenso wie vor vielen hundert Jahren aussahen und die dem alten Weisen Konfuzius gewiß nicht um ein Haar verändert erscheinen würden, falls er plötzlich auferstehen und in den Gassen auf und ab gehen würde, halten sich noch heutzutage streng an die Achsenlänge, die wahrscheinlich unter Lao Tse in Kraft getreten war. Die Beförderung in einem solchen Vehikel läßt Herz, Lunge und Leber dergestalt gegeneinander fliegen, daß nur ein Orientale mit seiner Unempfindlichkeit gegen physische und moralische Schmerzen so eine Fahrt auf die Dauer aushalten kann. Daher tritt die japanische Jinriksha immer mehr in Kraft, aber auch da gehört eine gewisse Geschicklichkeit dazu, in diesen zweirädrigen Wägelchen nicht das Gleichgewicht zu verlieren und unsanft in den Straßenschlamm geschleudert zu werden. Trotzdem wird dieses fremdartige Verkehrsmittel besonders in Shanghai und Hongkong sehr viel verwendet.
Die reichen Chinesinnen wanken nicht auf ihren verkrüppelten Füßen (was Gott sei Lob ein Ende nimmt) durch die elenden Gassen, sondern werden in Sänften getragen, und nur die armen Chinesinnen müssen versuchen, ihr Gleichgewicht zu erhalten. Wie man uns sagte, soll der liebende Gatte seine Frau nie auf den Mund, sondern immer nur auf diese »goldenen Lilien« küssen, die aber nie ganz bloßgelassen werden, da der Fuß nur eine formlose, abstoßende Masse ist.
Von allen Häusern und besonders den Auslagefenstern hingen allerlei bunte Papierstreifen mit chinesischen Zeichen versehen herab, überall sah man heftig sprechende Chinesen in eifrigem Handel begriffen. Trafen sich zwei Bekannte, so reichten sie sich nie die Hand. Es schüttelte nur jeder seine eigene Hand und legte, wenn er besonders liebenswürdig sein wollte, beide Hände gekreuzt über die Brust, in dem er den Körper leicht nach vorn beugte.
Wir gingen auch zum Gesandten, um alle Einzelheiten der Eheschließung zu bestimmen, und ich muß sagen, daß der alte Herr sehr liebenswürdig war und nichts unversucht ließ, um eine Verbindung zu vereiteln. Wäre meine Existenz nicht so traurig gewesen, so hätte ich möglicherweise seinen Vorstellungen nachgegeben. So aber war ich bereit, mich in die unbekannten Gefahren zu stürzen, in der Hoffnung, dort der Einsamkeit zu entgehen, in der trügerischen Voraussetzung wohl auch, daß es mir gelingen werde, die Liebe meines Gatten zu erringen oder seine chinesischen Gefühle für mich in irgendeine europäische Münze gleich hohen Wertes zu verwandeln. Noch zweifelte ich nicht ernstlich daran, daß mein unausgesetzter Einfluß günstige Folgen haben und mir den endlichen Sieg sichern würde. Er mußte doch wie andere Leute eine Seele haben – die Frage war nur, wie konnte ich die Perlen, die am Grunde seines Seins schlummerten, auf die Oberfläche fördern. Mama, die über die Warnungen des Gesandten nicht entzückt war, fürchtete sich ihrerseits viel zu sehr vor dem Gerede der Leute, als daß sie gewünscht hätte, mich vor der Ehe zu retten, und nur Jenny schlang weinend ihre Arme um meinen Hals und sagte, daß sie selber nie einen Chinesen heiraten könnte, auch nicht, wenn er so höflich wie Li Bai wäre, und damit war die Angelegenheit erledigt.
Wir wanderten auf der Stadtmauer umher, besuchten einige Tempel, die berühmten Tore der Stadt usw., und nach Ablauf von zwei Tagen saßen wir wieder im Zug, der uns nach Tientsin, der bedeutendsten Stadt des Nordens, bringen sollte.
Mama war von all den neuen Eindrücken in einen unruhigen Schlummer verfallen. Jenny und ich blickten auf die uninteressante Ebene hinaus, durch die sich der Pe-ho-Fluß träge schlängelt, und die er oft, wenn seine Wasser durch jähe Regengüsse anschwellen, furchtbar überschwemmt.
Plötzlich sah ich über Jennys blasses Gesichtchen zwei Tränen rollen. Ich zog mein Schwesterchen an mich und fragte sie, was ihr diese Tränen entlockt habe.
»Ni–chts!« entgegnete sie langsam und schmiegte sich eng an mich. »Ich – ich möchte nur so gern wissen, ob – ob – du glücklich sein wirst?« schluchzte sie sodann.
»Jennychen,« sagte ich weich, »das Glück ist ein individueller Begriff, und vielleicht habe ich es nicht in mir, so himmelanstürmend glücklich zu sein. Ich prüfe immer, ich ahne immer mehr hinter den Worten, als sie wirklich ausdrücken, möglicherweise auszudrücken bestimmt sind, aber ich habe ja selbst diese Ehe gewollt und –«, ich zwang mich, meiner Stimme einen heiteren Klang zu geben, »du weißt, daß des Menschen Wille sein Himmelreich ist.«
Eine Weile saßen wir schweigend da und hielten uns fest umschlungen. Ach, wenn ich meine Schwester immer, immer so nahe gehabt hätte!
»Möchtest du nicht einige Monate bei mir bleiben?« fragte ich. »Im Februar geht der Gesandte nach Europa zurück, und er versprach mir, dich mitzunehmen, falls Mama nun allein reisen würde. Nein, nicht allein,« fügte ich hinzu, als ich Jennys Zögern sah, »sondern mit Herrn Frise, der in fünf Wochen wieder nach Europa in geschäftlicher Angelegenheit reist.«
»Würde mein Bleiben dir ein Trost sein, Käthe? Du bist ja jung verheiratet dann und in den Flitterwochen.«
»Ja,« erwiderte ich gepreßt. »Weißt du, Jenny, chinesische Flitterwochen dürften nicht so – süß sein, daß – – daß deine Gegenwart störend wirken würde – – aber Jenny, zieht dich vielleicht der Doktor? Wenn, so will ich dich nicht halten, dein Glück geht allem voran.«
»Jenny wird bei dir bleiben,« sagte sie und sprach von sich wie ein kleines Kind in der dritten Person, indem sie ihr blondes Köpfchen an meine Schulter legte. »Der Doktor,« fuhr sie zögernd fort, »hat meine Haarlocke.«
Wir lachten beide, da wir beide uns augenblicklich bewußt waren, daß der arme Doktor nur wenig Trost aus einer Locke, und sei sie noch so schön, ziehen würde. Ich aber sehnte mich so sehr, wenigstens während der ersten Zeit jemanden aus meiner Heimat bei mir zu haben, daß ich Jenny nicht gern hätte reisen lassen. Auch dachte ich mir, daß es dem Kinde nicht schaden würde, etwas mehr von der Welt zu sehen, bevor sie sich für immer an den Doktor band, zu dem sie wie eine niedrige Sklavin zu ihrem Herrn und Gebieter aufschaute, was mir, die ich die Männer kannte, nicht gefiel. Die besten von ihnen sind herzlose Egoisten, die schlechtesten – least said, soonest mended!
Endlich hielt der Zug in Tientsin, dem Hafen Pekings, der berühmten Manufakturstadt, die wie ein Marmeladefleck auf einem riesigen Pfannkuchen dalag. Li Bai war da, um uns zu begrüßen und uns in das Haus eines Chinesen zu bringen, wo wir wohnen sollten, bis wir in das Haus des Mandarins übersiedelten, der stets über eine Anzahl Fremdenzimmer verfügte. Bis zur Trauung sollten wir indessen in dem genannten Hause bleiben.
Kaum hatten wir uns gewaschen und uns von der zweistündigen Fahrt etwas erholt, so kleideten wir uns in unsere besten europäischen Toiletten und bereiteten uns vor, dem gefürchteten Mandarin in seinem Bankkontor unsere Aufwartung zu machen. Li Bai, ebenfalls in tadelloser europäischer Kleidung, begleitete uns durch die Straßen Tientsins, das so gar nicht den Eindruck einer chinesischen Stadt machte. Da fuhren elektrische Wagen auf und ab, Telegraphendrähte spannten sich von einen Stange zur andern, die Häuser, in diesem Teile wenigstens, waren nach europäischem Muster gebaut und wiesen alle mehrere Stockwerke auf. Wir passierten den großen deutschen Klub, den wir am folgenden Tage besuchten, und wo man ausgezeichnetes Bier und unsere Würstel, die geliebten Würstel erhalten kann. Große Gärten, die jetzt allerdings öde dalagen, erstreckten sich vor vielen Bauten und alles machte einen freundlichen Eindruck, ganz anders als das schmutzige Peking, wenn auch hier die Reinlichkeit noch nicht ihren Höhepunkt erreicht hatte.
Wir durchkreuzten einige kleine Gassen, die sogleich das chinesische Gepräge trugen, sowohl was Reinlichkeit als auch Bauart und Geruch anbelangt. Aus manchen ebenerdigen Fenstern hingen Kinder. Man hatte ihnen eine Art Gängelband unter die Arme befestigt, so daß sie nun frei heraushingen, vieles sehen und sich nicht wehtun konnten. Nach unseren Ideen muß so ein aus dem Fensterhängen nicht sehr angenehm sein, aber Li Bai versicherte mir, daß alle ärmeren Chinesinnen ihre Kinder so vor dem Ueberfahrenwerden bewahrten, da sie nicht Zeit hatten, auf die Kleinen unausgesetzt achtzugeben. Das erinnerte mich an Japan, wo man den Kindern, wie bei uns den Hunden, ein Halsband mit Namen und Adresse umgibt, so daß das verlorene Kind früher oder später, tot oder lebendig, an den Besitzer zurückgelangt.
Wieder in eine breitere Gasse einbiegend und uns, so gut es ging, vor dem schaurigen Nordostwind schützend, indem wir uns immer fester in unsere Mäntel und Pelze hüllten, standen wir endlich vor einem Gebäude, auf dem auf englisch: »United Oriental and Tientsin Bank« mit großen Buchstaben geschrieben stand. Li Bai öffnete die Tür und ließ uns eintreten. Die Schwelle zum gefürchteten Mandarin, dem Bankdirektor und zukünftigen Schwiegervater, war überschritten.

A. F. Seebacher |
| Jeg har drevet omkring uden Maal, uden Med, |
| Livets Guldkorn jeg spredte som Sand, |
| Jeg har tilsat min Tro, jeg har mistet min Fred, |
| Og nu staar jeg ved Afgrundens Rand. |
| Vilhelm Bergsöe. |
XII.
Ein chinesischer Schreiber machte eine tiefe Verbeugung vor Mama und eine weniger tiefe vor Jenny und mir, öffnete eine kleine Tür im Hintergrund, meldete uns auf chinesisch und trat dann zurück, um uns in das Allerheiligste eintreten zu lassen. Ich merkte, daß Jenny ganz blaß wurde und ich muß einräumen, daß mein Herz mir gleichfalls in die Schuhe sank – auch aus meinem Gesicht schien alle Farbe gewichen zu sein und am liebsten wäre ich auf den Boden gesunken.
Uns entgegen trat ein hoher, breitschulteriger Chinese in kaftanähnlicher Kleidung und mit allen äußeren Abzeichen eines hochstehenden Mandarins – die gestickte Seidenkleidung, die breite Schärpe, die funkelnden blauen Knöpfe – und bot Mama auf europäische Weise die Hand, indem er sie gleichzeitig aufforderte, Platz zu nehmen. Jenny verbeugte sich tief und trat augenblicklich zurück, um mich vorzulassen.
Li Bai legte seine zarte Hand auf meinen Arm und sagte seinem Vater in seiner Sprache, wer und was die kleine Mädchengestalt vor ihm war, während ich wie ein altes Taschenmesser zusammenknickte und bei meiner Verbeugung, teils aus Ehrfurcht, teils aus Furcht, mit meinem Gesichtsvorsprung beinahe die Erde abwischte.
Als ich wieder auftauchte, das heißt, nach der tiefen Verbeugung meine verwunderten Augen zum erstenmal zum großen Mandarin aufschlug, von dem ich die unbestimmte Meinung hatte, daß er mir sofort den Kopf abschneiden lassen könnte, wenn er es nur wollte, bemerkte ich, daß der Schatten eines Lächelns über sein Gesicht huschte.
Er reichte mir ebenfalls die Hand zum Gruße, was ich eigentlich gar nicht erwartet hatte, und während ich zum zweitenmal eine mißglückte Art von Kotau oder chinesischer Festverbeugung machte, sagte der Mandarin in einer über Erwarten angenehmen Stimme, wenn er auch nur sehr langsam und vorsichtig englisch sprach (denn deutsch sprach er gar nicht):
»Das also ist die Braut meines Sohnes Li Bai, seine vorherige Lehrerin?«
Ich bejahte und verbeugte mich heldenmütig zum drittenmal, worauf der Mandarin mich selbst zu einem Stuhl geleitete und mich mit einer Handbewegung einlud, mich zu setzen, was ich mit meinen zitternden Beinen nur allzu gern tat.
»Wollen Sie meinem Sohn auch weiter helfen, damit er nach, sagen wir Jahresfrist, nach Europa zurückkehren und die höheren Prüfungen machen kann?«
»Ich werde stets mein Bestes tun,« versicherte ich, und dann nahm ich meinen gesamten Mut in beide Hände, denn ich sagte mir mit Recht, daß ich mir meine Stellung jetzt sichern mußte, wenn dies überhaupt je geschehen sollte, und sagte mit der weichsten Stimme und im bescheidensten Tone, den ich hervorbringen konnte, aber nichtsdestoweniger mit einer gewissen Festigkeit in beiden:
»Ich spreche und schreibe viele europäische Sprachen, Herr Ming Tse, und ich würde sehr glücklich sein, wenn ich während einiger Tagesstunden in der Bank als Korrespondent arbeiten dürfte. In London schon hatte ich viel Uebung in dieser Art Arbeit und ich hoffe mit der Zeit auch Sie, Herr Bankdirektor, zufriedenzustellen.«
Die strengen Augen in dem regungs- und ausdruckslosen Gesichte waren scharf und unbewegt auf mich gerichtet, wenn sie auch, ganz wie beim Sohne, von den Lidern halb verborgen waren.
»Schon der Unterricht Li Bais wird viel Zeit in Anspruch nehmen,« erwiderte der Mandarin, aber da ich ihn unverwandt bittend ansah, fügte er hinzu:
»Ich freue mich, zu sehen, daß Sie über ein so reiches Wissen verfügen und werde mich dessen erinnern, sooft ich Ihrer freundlichen Hilfe bedürfen werde.«
Es war nicht viel, was ich erreicht hatte, aber etwas war doch geschehen. Li Bai war sehr unzufrieden, und schon als sein Vater von einer möglichen Rückkehr nach Europa, mehr noch, als er von den Studien sprach (er wollte um jeden Preis, daß Li Bai das Doktorat in moderner Philologie abgelegt hätte), war meines Verlobten Gesicht so lang wie eine Essiggurke und so sauer, wie eine solche geworden, und als ich nun geendigt hatte, begann er dem Vater auf chinesisch etwas vorzureden, jedenfalls eine Weigerung, mich ausgehen zu lassen. Aber der Mandarin war nicht umsonst Mandarin und Vater mit unumschränkter Macht – er befahl ihm, so schloß ich nämlich aus den strengen Mienen des einen und den unzufriedenen des anderen – energisch still zu sein und setzte sich sodann Mama gegenüber, mit der er die Uebergabe der Dokumente und andere Formalitäten besprach, was lange Zeit dauerte.
Bei chinesischen Heiraten werden alle Einzelheiten immer durch einen Zwischenträger ausgemacht, die nötigen Geschenke werden bestimmt und eine bessere Art Kaufvertrag wird aufgesetzt, während der Zauberer den passenden Tag bestimmt. Ist dieser Vertrag einmal abgeschlossen, so ist eine Lösung der Verlobung nicht mehr möglich – es muß erst geheiratet werden, bevor eine Scheidung in Kraft treten kann, daher bricht man einen solchen Kontrakt nie. Hier lagen die Verhältnisse allerdings anders, aber nach den neuen Gesetzen mußte ein genauer Vertrag aufgesetzt werden, den beide Elternpaare unterschreiben mußten und in dem nicht nur das Vermögen beider Teile festgesetzt wurde, sondern auch bestimmt, was für Strafen für dieses oder jenes Vergehen des einen oder des anderen Teils bestimmt werden sollen – auch Bestimmungen mit Bezug auf das Vermögen im Falle einer Scheidung, Teilung der Kinder usw. und auch, wie oft mein künftiger Gatte mir gestatten mußte, heim nach Europa zu reisen und die Fahrt zu zahlen und auch, auf wie lange Zeit ich ihn verlassen durfte, ob und wie viele Kinder ich mitnehmen sollte und vieles andere. Alle drei Jahre sollte ich drei Monate lang bei meiner Mutter oder Schwester in Europa weilen dürfen, das wurde bestimmt. Die anderen Punkte überließ ich ganz Mama zu bestimmen, da wir alles schon vorher gründlich erörtert hatten.
Als der Tag zur Ueberreichung und Unterschreibung des Dokuments vor dem chinesischen Magistrat (auch eigentlich eines Mandarins) und der Eheschließung am gleichen Tage vor dem deutschen Konsulat bestimmt worden war, trat der Mandarin noch einmal vor mich hin und sagte langsam und feierlich:
»Mein Sohn ist Chinese und seine Mutter wie auch er selbst würde gerne, daß die Trauung, wenngleich mit einer Europäerin, doch nach chinesischer Sitte gefeiert werden möge. Wollen Sie sich darin den Sitten unseres Landes fügen?« Die Frage war leidenschaftslos gestellt, aber schien mehr einen Befehl als eine Bitte zu enthalten.
Ich stimmte sofort zu. Warum sollte ich mich weigern, Li Bai und meiner zukünftigen Schwiegermutter diesen Gefallen zu tun? Mein Herz klopfte nicht wonnig beglückt, wie das einer europäischen Braut, die im weißen Gewande und mit Myrthenkranz und Schleier in eine frohe Zukunft blickt – ich hoffte nur Friede, nur ein wenig Freude und Rettung vor der schreckvollen, graueneinflößenden Einsamkeit. Ich würde mein Bestes tun, mich ganz wie eine Chinesin an diesem Tage zu benehmen, ob ich mich wohl dabei fühlte oder nicht. Dies würde Li Bai gewiß mild stimmen und ihn vielleicht zärtlich gegen mich machen, und danach fühlte ich plötzlich einen brennenden Wunsch. Wenn mich in allen diesen Zweifeln und Bangen doch jemand, der mich selbstlos oder meinetwegen selbst selbstsüchtig liebte, in die Arme genommen hätte! Ich kam mir so furchtbar verlassen und schutzbedürftig vor.
Es war zuerst – als ich noch in Europa war – festgesetzt worden, daß Li Bai und ich einen Haushalt nach europäischem Muster haben und nicht mit der ganzen Familie zusammen wohnen würden, aber nun sagte mir der Mandarin, daß es so furchtbar schwer gewesen sei, eine passende Wohnung zu finden, daß er es für ratsam halte, mich zu bitten, auch eines der für die verheirateten Söhne bestimmten Häuschen zu beziehen, da ich mich weder um die Küche noch um sonst etwas zu kümmern haben würde – alles würde für mich gemacht werden.
Ich war betroffen, da ich mich immer geweigert hatte, unter demselben Dache – und sei es noch so groß – wie meine gelbe Schwiegermutter zu wohnen, aber nachdem mich Li Bai mit Bitten bestürmte und mir versicherte, daß wir ganz abgesondert leben würden, ganz genau wie draußen, und daß er so gern bei seiner Mutter bliebe, daß es sich ja nur um die Wintermonate handle und wir im Sommer gewiß eine eigene Wohnung haben würden und bald wieder nach Europa gingen usw., wie eben ein Mann, der etwas erreichen will, reden und überreden kann, so sagte ich endlich, wenn auch gegen meinen Willen und gegen meine innere Ueberzeugung »ja und Amen«, das Einzige, was mir zu sagen übrig blieb.
Daraufhin bat ich den gestrengen Schwiegervater noch einmal höflich, meine Sprachkenntnisse nicht zu vergessen und über mich zu verfügen, tauchte noch einmal ehrfurchtsvoll unter, um nicht europäisch unhöflich zu erscheinen, und als dies geschehen, gingen wir. Ohne es zu wissen, hatte ich mir den schwer einzunehmenden Mandarin zum Freunde gemacht. Es sollte eine Zeit kommen, wo ich dies sehr, sehr angenehm empfinden würde.
Meine Schwiegermutter sollte ich erst am Tage der Eheschließung kennenlernen, nur mein Bild und die Beschreibung des Mandarins gaben ihr einen schwachen Begriff von dem Geschöpf, das nun ihren Sohn beeinflussen würde, denn fürchtete ich den Einfluß der Schwiegermama – des gefürchtetsten aller Tiger – so war auch sie nicht ohne Furcht vor der verhaßten Europäerin.
Wie die nächsten zwei Wochen vergingen, kann ich kaum sagen. Mir schien es, als sei alles nur ein böser Traum, aus dem ich erwachen mußte, sei es, um mich in liebenden Armen weich beschützt zu finden, sei es, um mich von schlitzäugigen Furien verfolgt zu sehen – eins nur fühlte ich, daß ich vor der Pforte stand, die in ein neues Reich führte, und daß die Pforte merkwürdig verschnörkelt und sehr fremdartig war.
Wir wanderten die ganze Zeit in den Gassen von Tientsin umher. Mama und Jenny machten allerlei Einkäufe, wobei uns erfahrene Europäer sehr liebenswürdig an die Hand gingen. Wir besuchten den großen Park, der nun öde im Winterkleid vor uns lag, besuchten die großen Warenhäuser, zu denen riesige Fahrzeuge während acht Monaten des Jahres Waren von ganz China und von vielen anderen Erdteilen brachten, studierten die orientalische Kunst in Tempeln mit schrecklichen Götzenbildern (es ist eigentümlich, welche Vorliebe die Asiaten für graueneinflößende Gebilde haben, denen man überall begegnet), in Kunstgeschäften und in den Häusern solcher Europäer, die wir kannten und die große Sammlungen solcher Bilder hatten. Eigentümlich ist bei allen Bildern der Mangel jedweden Schattens und jedweder Perspektive. Ein Mann ist größer als das unmittelbar danebenstehende Haus, ein Baum ist kleiner als ein Pferd, und alle Personen, Tiere und Sachen haben, wie einst Peter Schlehmil, ihren Schatten verkauft – oder so scheint es. Einzig in ihrer Art sind die Porzellanmalereien, bei denen man diesen Mangel nicht fühlt. Die Farben sind großartig gewählt und die Feinheit der Arbeit unnachahmlich, besonders schön aber sind alle Elfenbeinschnitzereien und Papierrollen mit chinesischen Zeichen.
Wir gingen auch in eine Seidenspinnerei. Die chinesischen Seidenraupen sind viel größer als die europäischen und werden auch in vielen Privathäusern gehalten und gezüchtet. Man spannt ein großes Stück Papier von der Form eines Tischtuches auf ein Brett und setzt sodann die Seidenraupen an beide Enden, die nun über das Papier hinkriechen und ihre dicken leuchtenden Fäden ziehen. Die chinesische Seide ist viel dicker, widerstandsfähiger und schöner als die europäische und wird dort, so wie bei uns Wollstoffe, für alle Kleider verwendet. Mama und Jenny waren entzückt davon und kauften eine ganze Menge Seidenstoffe ein, obschon ich ihnen sagte, daß sie furchtbar hohen Zoll dafür bezahlen würden.
Auch auf mich machte all das Neue und Schöne einen angenehmen Eindruck, aber ich war zu geschwächt, um mich wirklich dem Genuß alles dessen hingeben zu können. Auch hatte ich meine vorige Genußfähigkeit in hohem Grade eingebüßt – ich konnte nicht mehr so froh sein, als mir dies früher möglich gewesen. Wer einmal die Tore des Todes sich hat öffnen sehen – noch dazu aus eigenem Antriebe – wer sich ihnen bewußt Schritt auf Schritt genähert hat, wem sie dunkel und schaurig wochenlang entgegensahen, dem scheint der Rest des Lebens ein Geschenk, er lebt nicht mehr als Schauspieler auf der Bühne des Lebens, wo alles entweder Tragödie oder Komödie, doch in den meisten Fällen Tragikomödie ist, sondern nur mehr als Zuschauer, für den das Leben noch Interesse, aber nicht mehr das tätige Interesse hat. Er bleibt – weil er nicht gehen kann, aber im Innern ist eine Saite jäh zerrissen.
Ich hatte einsehen gelernt, daß der Begriff »Zeit« eine Illusion ist, daß eine Qual nur deshalb so unerträglich scheint, weil wir in unserer Beschränktheit nicht ihr Ende sehen können, weil sie uns »ewig« dünkt und wir glauben, daß wir »nie« über sie hinwegkommen werden. Aber wenn wir gelernt haben, daß es nur gilt, dem »Heute« aus dem Wege zu gehen, gut oder schlecht durch die Gegenwart zu gleiten, so sind Zukunft und Vergangenheit besiegt. Wenn es uns nur gelingt, die augenblickliche Pein zu dämpfen oder ihr aus dem Wege zu gehen, so ist alles gewonnen. Morgen ist nicht mehr heute und was heute unabwendbar und unveränderlich erscheint, hat morgen schon eine Wendung der Umstände uns aus dem Wege geräumt. Die Schwierigkeit des Lebens liegt im Erträglichmachen und Umgehen des Heute. In diesen zwei Wochen lebte ich nicht – ich ließ das Leben an mir vorübergleiten und daher brachte es keine neuen Aufregungen mit sich.
Mama war sehr zufrieden – Chinese oder nicht Chinese – so war Li Bai doch ein reicher Mann, eine »Partie« wie man bei uns sagt, sein Vater Mandarin, Bankdirektor und einflußreich in Tientsin und über diese große Stadt hinaus. Was wäre da noch weiter zu bedenken? Ob ich glücklich sein werde? I, du Himmel, das hängt von mir ab, nicht von den Müttern. Daß ich so weit entfernt sein werde? Was tut's? Die Verwandten werden sich dennoch über meine Verheiratung ärgern und das genügt Mama. Jenny war zu jung, zu leichtsinnig, zu unerfahren, um sich über mein künftiges Schicksal den Kopf zu zerbrechen. Ich war mit dreizehn Jahren fühlendes, urteilendes Weib gewesen, meine Schwester würde mit vierundzwanzig möglicherweise auch noch »Kind« sein. Daher lachte Jenny den ganzen Tag und Mama sah überaus glücklich aus. Ich war ruhig – weder froh noch traurig – ich schwieg und ich – lebte.
Es ist beklagenswert, daß Mütter auch in Europa geradeso unempfindlich gegen das Geschick ihrer Kinder in einer Ehe sind, wie die phlegmatischen Asiaten, die auf ein Mädchen als unnütze Last herabsehen. Europäerinnen, die in den eleganten Salons und beim five o'clock-Tee die Hartherzigkeit der gelben »Barbaren« so streng verurteilen, gehen oft heim und tun desgleichen. Sie verhandeln ihr Kind an reiche Männer oder solche, die Titel und Würden aufweisen können und die sonst den Eindruck machen, als habe sie der Tod vergessen – alt, häßlich, lasterhaft, brummig und krank – und reden dem ahnungslosen jungen Dinge vor, daß es sich »die Hände oder wenigstens die Finger ablecken muß« eine so gute Partie gemacht zu haben. Sie zwingen mit Drohungen und Versprechen das junge Mädchen in eine solche Ehe und tun dann hocherstaunt, wenn dasselbe sich tief unglücklich fühlt. Sie sprechen unter Umständen noch von »schreiendem Undank«, wenn die junge Frau, die zu spät die volle Bedeutung des Begriffs »Ehe« kennengelernt hat, fühlt, daß die ihr auferzwungene Pflicht über ihre Kräfte geht, und das einzige Mittel ergreift, das ihr in der Regel offensteht, mit einem jüngeren Manne zu fliehen oder sich mindestens mit ihm neben dem reichen Gatten zu trösten, was die Mütter viel milder beurteilen als die Flucht. Bleibt das Geld auf diese Weise doch erhalten! Und das nennt man »europäische Kultur«. –
Die Vorbereitungen hatten etwas über zwei Wochen Zeit in Anspruch genommen – das allermeiste war schon vorher schriftlich erledigt worden, und nun hatten Mama und der Mandarin täglich Konferenzen über die Ausstattung des künftigen Heims, das halb chinesisch, halb europäisch eingerichtet werden sollte, über die Mitgift und ihre Verwaltung, über die Hochzeitsfeierlichkeiten usw.
Der Zauberer hatte den dritten November als den passendsten Tag für unsere Verbindung festgesetzt, und alle hatten sich damit einverstanden erklärt. Morgen sollte ich von chinesischen Mädchen in chinesische Roben gesteckt und in den Brautsessel gehoben werden, der mich in feierlichem Umzug zum Hause meiner Schwiegereltern zu bringen bestimmt war. Die europäische Eheschließung sollte jedoch schon in den Vormittagsstunden in europäischer Tracht auf dem Konsulate vollzogen werden.
Ich sah Li Bai nur auf Augenblicke in allen diesen Tagen, da er bis über den Kopf in Hochzeitsvorbereitungen steckte. Trafen wir uns endlich, war er so höflich und so – zurückhaltend wie immer.
Und die Stunden verflossen und das gefürchtete »morgen« wurde »heute«.

A. F. Seebacher |
| Drum prüfe, wer sich ewig bindet, |
| Ob sich das Herz zum Herzen findet. |
| Schiller. |
XIII.
Seit Mitternacht schon pfiff der Nordwind um das Haus und fuhr heulend und klagend um die Ecken, der anbrechende Tag brachte Regen und endlich Schneegestöber mit sich, und wie warm wir uns auch in unsere Mäntel auf der Fahrt zum Konsulat hüllten, zitterte ich doch, teils vor Aufregung, teils vor Kälte so sehr, daß ich nicht ein Wort der Begrüßung an Li Bai richten konnte, der bitterböse aussah und scheinbar auch nur bei einem Ofen zu sitzen wünschte.
Die kalte Begrüßung, der dunkle Himmel, der heulende Sturm und unsere triefenden Gewänder wirkten vereint dergestalt auf mich ein, daß ich ohnmächtig wurde, was den einen Vorteil mit sich führte, daß alle, auch Li Bai, sehr lieb gegen mich waren, als ich endlich die Besinnung wieder gewann.
»Du wirst sehen, wie schön es ist, verheiratet zu sein,« flüsterte Li Bai mir zu, als Jenny und auch Mama mit dem Konsul sprachen.
Ich hatte zwar gerade in dem Augenblick die allergrößten Zweifel bezüglich der Schönheiten oder Annehmlichkeiten einer Ehe, aber ich war froh, daß er froh war – eine Fröhlichkeit deckte die andere – und so lächelte ich ihm beruhigend zu und versicherte, mich wohl genug zu fühlen, um den Kontrakt zu unterschreiben.
»Nachmittags darfst du nicht ohnmächtig werden,« sagte er noch, als er mir aufhalf, »das ist gegen die chinesische Sitte.«
Ich versprach ihm, alles aufzubieten, um nicht gegen die chinesische Sitte zu verstoßen und dadurch beruhigt, geleitete er mich an den Tisch, und die Trauung oder wenigstens die Eheschließung, da jeglicher kirchliche Segen fehlte, wurde vollzogen.
Li Bai half uns freundlich in den Wagen, bat mich, nicht aufgeregt zu sein und kehrte hierauf in sein Heim zurück, um mich daselbst zu erwarten und feierlich zu empfangen. Nach unseren Gesetzen war ich nun Käthe Ming Tse. Mir deuchte fast, als wäre ich selbst eine andere geworden.
Mama und Jenny zogen sich auf meine Bitten zurück, und ich blieb allein mit den Chinesinnen, die mich in eine ihrer Landsmänninnen verwandeln sollten. Sie kämmten mein langes blondes Haar flach zurück, so daß meine Stirn doppelt hoch erschien, und gossen eine Menge wohlriechenden Oels darauf. Nachdem dies geschehen war, wollten sie mein Gesicht in die Arbeit nehmen, die Lippen mit Rot vergrößern und die Augenbrauen in eine schmale hochgeschwungene Linie verwandeln, während sie den Rest des Gesichts weiß zu färben wünschten. Aber gegen diesen Punkt des Programms wehrte ich mich entschieden. Wie ein Zirkusklown zweiter Güte wollte ich denn doch nicht aussehen. Mein Gesicht verblieb wie es war – und endlich mußten meine gelben Schwestern sich in das Unabänderliche fügen. Sie setzten mir den Brautschmuck auf das geölte Haar, das ich, fetttriefend wie es war, nicht berühren wollte, befestigten die aus Gold- und Silbermünzen und Ketten zusammengestellte kostbare Haube so gut es ging auf meinem vor Furcht und Angst ganz verwirrten Kopf und fanden, daß mir das unförmige Scheusal gut stünde. Hierauf steckten sie mich in seidene Unterwäsche, die wie die Oberkleider aus roter Seide war, warfen das rote Brautkleid über mich, das hoch am Halse geschlossen wird und zu den Schultern jäh abfällt, denn je greller diese Linie ist, desto schöner dünkt sie den Chinesen. Die Schultern dürfen um keinen Preis gerade sein, sondern müssen gegen den Arm zu abfallen. Das Kleid, das jede Biegung der Gestalt verdeckt und wie ein Kaftan bis zu den Knöcheln fällt, wird auf der linken Seite geknöpft, unter dieser Robe aber hatte ich weite Hosen, ähnlich denen der türkischen Damen, die lose über das Knie hinabfielen. Ueber mein Brautkleid gab man mir noch ein rotes Seidenkleidungsstück, einer Jacke ähnelnd, das mir bis etwas tiefer als die Mitte reichte und reich mit Gold gestickt war. Es hatte sehr weite Aermel, ebenfalls reich mit Goldstickereien verziert, aus denen meine Hände weiß hervorleuchteten. Trotz aller Bitten ließ ich mir nicht die Nägel färben und wollte auch nie sie mir wachsen lassen wie viele der reichen Chinesinnen es tun, bis sie nichts mehr in die Hand nehmen konnten, aus Furcht, die Nägel zu zerbrechen. Meine Füße, die von Natur schon klein ausgefallen waren (ich bin ja selbst so klein), wurden noch in zu enge Seidenpantöffelchen mit Goldstickerei gequetscht, was mich, vereint mit den ungewöhnlich hohen Absätzen, vom sichern Stehen abhielt. Ich wankte wie eine echte Chinesin unsicher im schwankenden Gleichgewicht hin und her.
Die Chinesinnen fanden mich sehr »gelungen« und betrachteten ihr Werk mit sichtlicher Genugtuung, als aber Mama und Jenny hereinkamen, fielen sie bei meinem Anblick beinahe um. Ich stand, besser, ich wackelte in der Mitte des Zimmers, fühlte mich nicht nur ängstlich bezüglich des Bevorstehenden, sondern auch rein physisch unbehaglich in den ungewöhnlichen Kleidern, dem geölten Haar, dem schweren Kopfputz und den schrecklichen Pantoffeln. Das konnte man mir auf den ersten Blick ansehen, und ich glaube, ich machte dazu das denkbar dümmste Gesicht.
Mama setzte sich auf einen Stuhl und starrte mich entgeistert an. Ihr europäischer Schönheitssinn empörte sich gegen eine solche Verwandlung meines äußeren Ichs, Jenny aber lachte zum erstenmal an diesem Tage und rief:
»Käthe, du siehst wie ein wunderschön geputzter Kartoffelsack aus!« Sie warf sich auf eines der niedrigen Sofas und krümmte sich vor Lachen.
»Wirst du als rote Vogelscheuche wirklich zu deinem Gatten gehen?« fragte mich Mama. »Wäre es nicht viel besser gewesen, dich ganz in Weiß mit Schleier und Kranz zu kleiden? Aber du willst einmal immer nach deinem Kopfe handeln,« setzte sie geärgert hinzu.
»Du vergißt,« warf ich ein, »daß es nicht mein Wunsch gewesen, so gekleidet zu gehen, sondern Li Bais. Soll ich ihm eine Bitte am Hochzeitstage abschlagen?«
»Gewiß hätten dich alle sehr schön als weiße Braut gefunden und nun siehst du so schrecklich aus,« ereiferte sie sich.
»Ach, Mama,« bat ich, »laß die Einwendungen. Die Chinesen finden ein weißes Kleid (ihre Trauerfarbe) nicht passend für einen Freudenakt wie eine Hochzeit und ich bin nicht länger Europäerin,« fügte ich langsam hinzu, während ich fühlte, wie mich etwas im Halse gewaltig würgte, »sondern Chinesin seit – seit – heute früh.«
»Leider!« entfuhr es der Mama. Es war ihr zum erstenmal wirklich leid, daß ich einen Chinesen geheiratet hatte, weil – weil ich dadurch verlustig ging, ein schönes europäisches Brautkleid zu tragen. Bei der zivilen Eheschließung hatte ich nur ein lichtbraunes Kostüm angehabt.
Jenny verstand trotz ihrer Jugend die Tragik des Augenblicks besser. Vielleicht dachte sie, wie anders ihre Trauung in Europa mit dem Doktor sein würde, wie ganz anders sie fühlen würde und wie froh ihre Altersgenossinnen sie umkreisen würden. Sie begriff, zum erstenmal vielleicht, was ich in dieser Stunde litt, wo weder eine Klage noch eine Träne mir entschlüpfte.
»Laß die Käthe,« rief sie fast gereizt und wollte mir um den Hals fliegen, aber dagegen wehrten sich die Chinesinnen. Das hätte ihre sorgsame Arbeit zerstören können. Ich lächelte meiner Schwester daher nur dankbar zu.
Mama fügte sich in das Unabänderliche. Wenn ihre Tochter schon Vogelscheuche sein mußte, so wollte sie daraus Vorteil ziehen. Sie betrachtete mich sorgfältig von allen Seiten, damit sie daheim in Europa allen Bekannten und den Verwandten davon erzählen konnte, sah sich den sonderbaren Brautschmuck genauer an und fand endlich, daß mein Ensemble noch ärger hätte sein können. Daß ihr Kind heute über Leben und Tod (denn bei einer chinesischen Heirat setzt man noch viel leichter als bei einer europäischen das Leben aufs Spiel) entscheidet, das hatte sie für den Augenblick vergessen.
Plötzlich verkündete ohrenbetäubendes Geschrei und nervenerschütternder Lärm, daß meine Stunde geschlagen hatte, und der Bote kam, um mich in das Haus meines Gatten zu überbringen. Ich fühlte eine innere Leere und ein Gefühl physischen Uebelbefindens, als ich mir vorstellte, daß ich nun mit allem abbrechen sollte, was ich bisher gekannt hatte, um an der Hand meines kleinen Chinesen einen neuen Lebenspfad einzuschlagen. War die kleine Hand hinreichend, mich zu stützen? War seine Liebe stark genug, mir Trost zu geben, wenn physische und moralische Leiden an mich herantreten würden? Eine grenzenlose Mutlosigkeit überkam mich, und ich nannte mich einen elenden Feigling, gezögert zu haben, als ich schon so nahe am Styx gestanden. Oh, wenn doch schon alle Qualen, alle Zweifel ein Ende hätten! Wie ich mich nach der Zärtlichkeit Li Bais sehnte! Würde er auch als Gatte mir so fremd bleiben? Wie schrecklich, wie schrecklich! Warum, warum hatte ich »ja« gesagt? Aber da stieg wieder jene schreckliche Leidenszeit in London vor mir auf und die Frage starb dahin im Herzen, bevor sie sich noch recht geformt hatte.
Der prachtvoll gekleidete Bote überreichte unterdessen im Nebengemache meiner Mama eine chinesische Rolle, auf der mit kunstvollen Zeichen geschrieben war, was ich Mama schon früher erzählte, das darauf stehen würde, nämlich, daß der dumme Vater seines noch dümmeren Sohnes nicht selbst um die Braut kommen, um sie von meiner Mama hohen und ehrenvollen Palast in seine niedrige Hütte zu führen, sondern lieber einen Boten schicken wolle, der melden soll, daß alles zum Empfange der Braut bereit sei. Der Brief, der auf rotem Papier geschrieben war, endete mit dem Wunsche, daß Mama ein Alter von hundert Jahren erreichen und ihr Geschlecht bis ins fünfte Glied gesegnet werden möge. Damit empfahl sich von der großen Mama der dumme jüngere Bruder. Chinesische Höflichkeit!
Jetzt begannen sowohl Mama als Jenny, trotz aller meiner Bitten, sich zu beherrschen, fürchterlich zu weinen und wollten mich immer und immer wieder in die Arme schließen, wogegen sich die fünf Chinesinnen, meine Ehrenjungfrauen, entschieden wehrten, so daß ich beständig hin und her gerissen wurde. Zum Schlusse schob mich eine ehrwürdige chinesische Matrone, die selbst schon viele Söhne ins Leben gesetzt hatte (denn nur eine solche darf es tun), zur Tür hinaus und warf mir, bevor ich die Schwelle überschritt, ein seidenes Tuch – natürlich auch rot – vor das Gesicht und über den halben Kopf, auf daß niemand meine Züge sehen sollte. Hierauf hob man mich in den engen Brautsessel, der auch ganz rot verkleidet und reichlich mit Seide austapeziert war, schob die rotseidenen Vorhänge zurück, versiegelte die Oeffnung mit einem kleinen roten beschriebenen Papierstreifen, und erst als nirgends mehr ein neugieriger Blick oder auch nur ein Lufthauch eindringen konnten, setzte sich der Zug wieder in Bewegung. Ich im engen Stuhle, wo ich nur zusammengekauert sitzen konnte, sah nichts und atmete schwer, ich vernahm nur das wilde Pochen meines eigenen Herzens und fühlte nur eins: Das immer wiederkehrende Flehen, daß Li Bai lieb gegen mich sein würde. Wie ich mich vor all dem neuen fürchtete! Nicht nur vor der fernen Zukunft, sondern auch vor der nahen, der ganz nahen! Ob Männer ahnen, wie unser Herz vor Angst klopft, wenn wir unser Geschick auf ewig in ihre Hand legen? Ob sie wissen, wie schrecklich die Furcht vor jedweder Brutalität uns die Kehle zusammenschnürt? Ob sie rücksichtsvoller wären, wenn sie es wüßten? Es gibt wohl einige, die es sind, doch ach, ihre Zahl ist so verschwindend klein!
Jenny erzählte mir später, daß der Zug mit Musikanten begann, die auf einer Art Trompeten die ohrenzerreißendsten Laute hervorbliesen, während andere allerlei merkwürdige Instrumente bearbeiteten, die ganz gut imstande waren, auch das widerstandsfähigste europäische Trommelfell zu zersprengen; ihnen folgte eine lange Reihe von Fahnenträgern, die auf Stöckchen rote Bänder mit allerlei glückverheißenden Aufschriften trugen, welche sie erregt hin und her schwenkten und nicht wenig Lärm mit ihren Zungen dazu machten. Hinter diesen kamen andere Chinesen, die farbige Lampions trugen, was nach Jennys Angabe sehr hübsch aussah, fast wie unser Fackelzug daheim. Die Lampions waren vorwiegend rot, doch fand man auch andere Farben vor und alle hatten Sprüche darauf geschrieben, was die Wirkung vom chinesischen Standpunkt aus sehr erhöhte. Eine Anzahl Chinesen trugen große rotgemalte Schilder, auf denen in goldenen Buchstaben allerlei Zitate von Konfuzius und anderen großen Denkern standen, oft auch nur von Gelegenheitsdichtern geschrieben, die mit ihren Lobsprüchen den Ehestand verherrlichten. Hie und da sah man auch einen Chinesen mit einer Gans unter dem Arm – das Symbol ehelicher Treue – das sehr hochgehalten wird. Es gibt also, wie man sieht, Länder, wo selbst eine Gans zu Ehren kommt. –
Im Hause eines Mandarinen sind Gefängnisse, Gerichtssäle, Gästeräumlichkeiten und schließlich die Privatwohnung beisammen untergebracht und geschickt verteilt. Als wir endlich dieses Haus erreicht hatten – das sich schon von außen durch die Stufen, die zum Tore hinaufführten, von den Häusern eines gewöhnlichen Sterblichen unterscheidet und das auch drinnen, wenn man einmal die verschiedenen Höfe und Pforten durchschritten hat und innerhalb der Mauer, die um so ein Haus oder besser einen Häuserkomplex führt, sich großer Ausdehnung erfreut – trug man mich samt meines Marterstuhles, in dem ich mehr tot als lebendig hockte, durch eine Doppelreihe von Musikanten. Sie brachten nicht nur mich zum Leben zurück, sondern sie hätten mit ihrem Lärm selbst die Toten aus den Gräbern hervorzaubern können – die Posaunen von Jericho mußten die reinsten Aeolsharfen gegen die chinesischen Musikleistungen gewesen sein. In der Vorhalle nahm Li Bai in Gegenwart aller Gäste feierlich die Siegel ab, klopfte an den Brautstuhl und schlug die Seidenvorhänge zurück. Eine chinesische Dienerin hob mich, noch immer mit dem »roten Fetzen«, wie ich das Seidentuch, das mir jede Aussicht benahm, innerlich betitelte, vor dem Gesicht, aus der Sänfte, lud mich geschickt, wie einen Lumpensack, auf den breiten Rücken und humpelte mit mir so durch mehrere Räume, sprang sogar über ein eigens zu diesem Zwecke entflammtes Holzkohlenfeuer, während eine zweite Dienerin einen Napf Reis, einige Speisestäbchen und Betelnüsse über mein sündiges Haupt hielt, was alles zusammen Dauerhaftigkeit und Ueberfluß bedeuten soll.
Im nächsten Raume angekommen, durfte ich mein Tuch bis über die Lippen heben um die »Vereinigungsbecher« roten Weines, die mit roten Bändern verbunden und bis zu unserer Ankunft mit einem roten Tuch geheimnisvoll umwunden waren, zu leeren. Kaum war dies geschehen, als man mich wieder auflud – Jennys Vergleich mit einem Kartoffelsack paßte auch in dieser Hinsicht vortrefflich – und mich in der großen Halle oder dem Haustempel vor der Ahnentafel wieder ablud, damit Li Bai und ich einen tadellosen Kotau vor den Vorfahren der berühmten Ming-Tse-Familie machen konnten. Li Bai opferte ihnen Wein. Sobald dies geschehen war, war der eigentliche Trauungsakt vorüber. Ich wurde wieder hochgenommen und durch eine Anzahl Zimmer und über den breiten Garten – so viel konnte ich trotz des Tuches bemerken – in unser künftiges Heim getragen. Hier setzte mich die Chinesin auf das Bett, die Hochzeitsgäste und andere Besucher – denn an solchen Tagen ist ein chinesisches Haus von allen Leuten überlaufen, ja selbst Bettler dringen ein, wenn man sich nicht früher mit einer großen Summe abkauft – stellten sich um mich, und Li Bai, der sich auf das zweite Bett geschwungen hatte, nahm mir langsam das eklige Tuch vom Gesicht. Schon nach einigen Augenblicken wünschte ich mir das Tuch lebhaft zurück, denn nichts zu sehen war noch immer besser, als in alle diese neugierigen Augen zu blicken, die mich feindselig betrachteten. Meine zukünftige – nein, jetzt schon meine wahre und unabschüttelbare Schwiegermutter – besah mich mit kritischen Blicken, denn in der Regel kennt sie die Schwiegertochter schon vor der Ehe, prüft sie mit Rücksicht auf ihre Kenntnisse in feinen Handarbeiten und im Gitarrespiel, wenn es sich um reiche Familien handelt. Bei armen Familien kommt meist ihre Körperkraft in Betracht, da sie als Lasttier dem künftigen Gatten und seiner ganzen Familie dienen soll, daher wählt man oft eine Frau, die um einige Jahre älter als der Mann ist, damit sie in jeder Weise den gestellten Ansprüchen entsprechen kann.
Hier war es nun ganz anders. Der Mandarin hatte alles erledigt und auch erzählt, daß ich keine der chinesischen Tugenden, wohl aber nützliche europäische Eigenschaften besäße, die ihrem Sohne zugute kommen dürften, über die seine Gattin aber weder ein Urteil formen, noch irgendwie Aufsicht halten konnte. Sie war eine kleine magere Frau mit straff zurückgestrichenem Haar, das nur im Genick einen Knoten bildete, und ich konnte nun leicht begreifen, warum Li Bai so klein und so zart war, trotzdem sein Vater sich einer für einen Chinesen ungewöhnlichen Größe erfreute. Li Bai war eben das Ebenbild seiner Mutter.
Alle Hochzeitsgäste besahen mich vom Scheitel bis zur Zehe, bis mir ganz unwohl wurde und nur eins mir zur Beruhigung war – nämlich, daß meine geringen Kenntnisse des Chinesischen mich nicht in den Stand setzten, alles zu verstehen, was um mich herum gesagt wurde, denn an diesem Tage hat jeder Gast das Recht und selbst die Pflicht, seine Meinung so unumwunden als möglich über die Braut auszusprechen und so viele anstößige Witze über sie zu machen, als es überhaupt denkbar ist. Die Braut aber muß unbeweglich sitzen, darf weder lachen noch weinen, noch sich vom Bette wegrühren oder eine Miene verziehen. Sie sitzt unbeweglich auf dem Lager, während alle sie betrachten wie etwa ein ausgestelltes Pferd, ein zu verkaufender Hund, oder ähnliches. Vom Kopfende des Bettes flattern rote Papierstreifen in Masse nieder. Auf einigen steht, so übersetzte mir Li Bai später, »Von diesem Bette aus möge sich euer Stammbaum gründen«, oder »Möget ihr mit Kindern reich gesegnet sein«, oder »Mögen Söhne in reicher Zahl euch erfreuen« und andere, mit ähnlichen Worten und gleicher Bedeutung, Sprüche, die mir gar keine Freude machten und deren Nichterfüllung ich innig erhoffte und sehr wünschte.
Ein spanisches Sprichwort sagt: »Sei der Tag lang oder sei er kurz – endlich erklingt dennoch das Aveläuten.« War der Tag mir auch länger als alle erschienen, die ich bis jetzt durchleben mußte, so brach doch auch der Abend an und damit nahm das Festessen seinen Anfang. Mama und Jenny nahmen nicht teil – das wäre wieder gegen die Sitten des Landes gewesen –, und ich war wirklich froh darüber. Es war mir stets leichter, eine unangenehme Lage, die sich nicht ändern ließ, allein zu überleben, als andere zu Zuschauern zu haben, die es mir wahrscheinlich nur erschweren würden die mühsam erkämpfte Fassung zu bewahren. Die Männer saßen in einem Zimmer an einem Tische, die Frauen alle in einem anderen Raume auch an einem Tische, und alle bedienten sich der gebenedeiten Stäbchen, mit denen ich noch immer nicht ordentlich umgehen konnte. Die niederen Sitze, die merkwürdigen Gefäße und merkwürdigeren Speisen, die meiner Ansicht nach aus zusammengeschnittenen Katzen, Hunden und Ratten bestanden (natürlich nur Einbildung, denn wir hatten Hühner und ähnliches Geflügel klein zerschnitten), die komischen Eßwerkzeuge und das ununterbrochene Geschnatter in einer mir fast ganz fremden Sprache – alles machte mich glauben, daß ich mich unter wilden Menschen befand. Appetit hatte ich keinen – und aus guten Gründen – und daher störte mich der Gebrauch der Stäbchen nicht. Ich mischte und mischte in der Schale herum und schien von allem zu essen, in Wirklichkeit kamen nur ein paar Bissen über meine Lippen und nur dem Tee huldigte ich, da er mich erfrischte. Sprechen konnte ich mit keinem Menschen und das erwartete scheinbar auch niemand von mir. So saß ich an der Tafel, eine traurige, kleine rote Seidenfigur, auf die alle Augen unablässig neugierig gerichtet waren, und hoffte, daß die Mahlzeit doch endlich aufhören würde. Ich dachte an Mama, an Jenny, an mein Vaterland, an meine Vergangenheit und wohl meist an Li Bai, aber Tröstliches leuchtete mir nicht aus allen diesen Gedanken entgegen. Jede Minute machte mich nervöser, je mehr der Abend vorrückte, um so weniger wünschte ich Li Bai zu sehen. Schließlich bedeutete sein Kommen meinen Fall vom Regen unter die Traufe oder von der Pfanne in das Feuer. Ich fühlte nur ein brennendes Verlangen, mich flach auf den Boden zu werfen und zu weinen – zu weinen – wie ich es seit London nicht mehr getan hatte.
Als die Suppe eingenommen worden war – damit hört eine chinesische Mahlzeit ebenso sicher auf, als eine europäische damit beginnt, und nachdem große Bowlen Reis und unzählige Schüsseln voll Herrlichkeiten in die Mägen der Anwesenden hinabgewandert waren –, wurde ich wieder zurück in das Brautgemach geführt, wo Li Bai mich begrüßte. Ich hätte ohnmächtig werden können, wenn ich überhaupt imstande gewesen wäre noch etwas zu tun, aber ich fühlte mich nicht mehr – ich war wie eine Wachspuppe, die sich bewegt, in der aber kein Leben ist.
Li Bai schickte alle Gäste fort – eigentlich sollen die jungen Gatten erst in der dritten Nacht allein gelassen werden, aber dagegen hielt sich Li Bai auf –, kam auf mich, die ich wie ein Häufchen Unglück am äußersten Bettrand zusammengekauert und stumm saß, zu und küßte mich zum erstenmal auf die Lippen.
»War es sehr schlimm, Käthe, so zu sitzen?« fragte er freundlich. »Du bist sehr brav und tapfer gewesen!«
»Nein, nicht so sehr,« erwiderte ich und fühlte, daß etwas in mir zu tauen begann, denn seine Zärtlichkeit tat mir in diesem Augenblicke wohler als meine Feder es je beschreiben könnte.
Er nahm mir langsam den schweren Brautschmuck ab, strich liebkosend mit der Hand über meine Wange und küßte mich mehrmals, was mich bald die Leiden der vergangenen Stunden und all die bitteren Zweifel vergessen ließ. Vielleicht würde ich dennoch glücklich werden. Ich faßte den festen Entschluß, meinem Gatten in jeder Weise entgegenzukommen und obschon ich auch in diesem Augenblick keineswegs seine Wünsche teilte, ließ ich es doch ruhig geschehen, daß er mir half, aus den unbequemen chinesischen Kleidern zu schlüpfen, wenngleich sie mir plötzlich gar nicht mehr unbequem schienen. So ändern sich je nach den Umständen unsere Anschauungen.
Von der Decke hingen unzählige Lampions nieder, die über das ganze Gemach ein rötliches Licht ergossen. Eines nach dem anderen wurde von Li Bai vorsichtig ausgelöscht, bis nur ein kleines Lämpchen in der östlichen Zimmerecke brannte.
Li Bai legte seine Arme zärtlich um mich, küßte mich (er hatte wirklich diese Kunst, wenn man die kurze Uebungszeit in Betracht zieht, ganz unglaublich gut erlernt) und sagte lächelnd:
»Ein Licht muß im Schlafgemach zweier Gatten immer brennen, das ist chinesische Sitte. Es stört dich doch nicht?« fragte er.
»O nein,« erwiderte ich, mich an ihn schmiegend, »aber warum verlangt die Sitte es so?«
»Damit die Kinder alle sehend auf die Welt kommen – wenn kein Licht brennt, werden sie blind geboren.«
Obschon wir in Europa dies nicht glauben, fügte ich mich willig. Von jetzt an war ich wirklich eine – Chinesin.

A. F. Seebacher |
| Wie heilt sich ein verlassen Herz, |
| Der dunkeln Schwermut Beute? |
| Mit Becher-Rundgeläute? |
| Mit bittrem Spott? Mit frevlem Scherz? |
| Nein, mit ein bißchen Freude. |
| C. F. Meyer. |
XIV.
Am nächsten Morgen mußte ich mich wieder in chinesische Kleider kleiden, diesmal in dunkelblau, wenn ich mich recht erinnere, die wieder reich mit Gold gestickt waren, und deren Farbe, glaube ich, ein Sinnbild ehelicher Tugend sein sollte.
Jenny hatte rotgeweinte Augen und nicht nur ihre Guckerchen und ihr Gesicht, nein, ihre ganze graziöse Gestalt war ein verkörpertes Fragezeichen an mich. Ich lächelte ihr beruhigend zu – es mag wohl auch nicht sonderlich angenehm sein, einen Europäer zu heiraten und Li Bai war recht nett gegen mich gewesen, eine Klage wäre daher unbegründet erschienen.
Die Festlichkeiten nahmen ihren Fortgang. Masken betraten das Haus, um die Braut mit ihrem schrecklichen Aussehen erfolgreich durch das ganze große Haus zu jagen, hier, wo man fünfundsechzig Zimmer hatte, die alle zur Feier des Tages offen standen, wahrlich keine Kleinigkeit, um so mehr, als ich mich wahrlich nicht zum Laufen aufgelegt fühlte. Aber irgendwie entging ich ihnen doch und da ich unter Diwanen verschwand und mich gegen Kasten aller Arten drückte, fanden sie es amüsanter, die europäisch gekleidete Jenny zu verfolgen, die wie ein Wiesel vor ihnen herflog und schrie – schrie –, daß selbst chinesische Ohren davon befriedigt werden mußten, wie sehr sie sich auch nach Lärm sehnen. Der Mandarin erschien zufällig auf der Schwelle und lachte wirklich herzlich, als er Jenny so wild schreiend durch den Garten galoppieren sah. Endlich kam ihr Chung-Fu, mein Schwager, zu Hilfe, in dessen Arme sie plötzlich lief – was, wie sie mir nachher anvertraute, noch viel schlimmer war, als vor den schrecklichen Masken laufen zu müssen.
»Glaubst du, Käthe,« fragte sie, indem sie sich an mich schmiegte, »daß – der Doktor – dies – dies – als unpassend betrachten würde?«
»Meine liebe Jenny,« erwiderte ich und setzte eine unergründliche Miene auf, »kommt es dir nicht selbst treulos vor gegen den armen Doktor, der deine blonde Locke immer in der Brieftasche nahe an seinem nur für dich schlagenden Herzen trägt, daß du dich so mir nichts dir nichts einem Chinesen an den Hals wirfst?«
In Jennys Gesichtchen wetterleuchtete es bedenklich.
»Aber Käthe – ich – ich – bin ihm ja nicht – gar nicht – absichtlich in die Arme gelaufen – und – und es war so – so schrecklich!« sagte sie ganz verzagt und stotternd.
»Mach' dir nichts daraus, Jenny,« entgegnete ich munter und sah sie schelmisch von der Seite an. »Der Doktor wird es mit der Treue wohl auch nicht so genau nehmen und trotz der blonden Locke noch andere Mädchen an sein Herz drücken.«
»Oh, Käthe!« rief meine Schwester voll Entsetzen und machte so runde Augen, die sich überdies noch mit Tränen zu füllen begannen, daß ich sie augenblicklich in die Arme schließen und ihr sagen mußte, daß der Doktor ein Muster der Treue und Tugend war, der nur an sie dachte und nur für sie lebte, und daß auch sie ihm, trotz der unfreiwilligen Umarmung Chung-Fus (wie angenehm so eine Umarmung auch an und für sich sein mochte) seiner ganz würdig geblieben – vollkommen würdig, diesen Halbgott nach ihrer Heimkehr auf ewig glücklich zu machen.
»Oh, süßeste Käthe, glaubst du das wirklich?« fragte sie und sprang jubelnd auf. »Von allen Schwestern auf Gottes Erdboden bist du die weiseste und netteste und beste!«
Und daraus kann der Leser ersehen, wie leicht es ist, Beifall zu gewinnen, wenn man nur das sagt, was der andere hören will.
Bei der Festmahlzeit war die Tischordnung in gewissen Punkten europäisiert worden. Wohl saßen die Herren alle am unteren Ende der großen Tafel und die Frauen, wenn auch nicht in einem anderen Gemache, so doch abgesondert am oberen Tafelende, aber in der Mitte war es doch so eingeteilt worden, daß Mama den Mandarin, Jenny Chung-Fu und ich Li Bai an meiner Seite hatte. Mama und der Mandarin sprachen von europäischen Sitten und Gebräuchen, und Mama sprach lebhaft und unbefangen, als ob sie ihr ganzes Leben nur mit Chinesen zusammen gesessen, Jenny dagegen hatte ihr liebes Kreuz mit ihrem Tischnachbar, der nur sehr wenig Englisch, gar kein Deutsch und daher nur mit Gebärden sprach, die, vereint mit chinesischen Brocken, einigen englischen Wörtern und der Augensprache, zu der Chung-Fu als letztes verzweifeltes Mittel griff, eine Art primitiver Konversation zur Not zuließen. Verstand Jenny auch nur schlecht Englisch und gar kein Chinesisch und war die Gebärdensprache oft nicht ausdrucksvoll genug – auf die Augensprache verstand Jenny sich wie selten jemand und damit ging es endlich auch geläufig, nur hatte meine Schwester augenscheinlich keine Lust, mit einem Chinesen zu flirten.
Wir hatten Vogelnestersuppe, die Mama ungemein interessierte, deren Name aber nur eine falsche Uebersetzung eines Seegewächses ist, ferner frische Bambusblätter als Gemüse, die wirklich schmackhaft waren, Schinkenscheiben, die ganz an unseren Westfäler Schinken erinnerten, saftiges und schön serviertes Zuckerrohr, chinesische Kuchen, die wie umgestülpte Pfannen aussahen und die mit allerlei Schriftzeichen und Arabesken reich verziert waren, parfümierten Tee und andere Seltenheiten. Li Bai war, wie immer, sehr aufmerksam und warf mir mit seinen Stäbchen allerlei Leckerbissen in den Napf – Jenny dagegen, die immer auf und nieder sah und nie acht gab, was sie tat, war den unausgesetzten und ihren europäischen Begriffen sehr ungewohnten Angriffen ihres jüngsten Anbeters und Tischnachbars ausgesetzt und mir eine unerschöpfliche Quelle der Belustigung.
Schon als Kind hatte Jenny die Gewohnheit, den Mund offen zu halten, sooft sie über etwas erstaunt war. Hier, an einer chinesischen Tafel, wo alles auf merkwürdigen Schüsseln serviert wurde, wo die Gerichte selber so interessant und neu waren, wo man eigentümliche Laute vernahm, die in Europa – wenigstens in der guten Gesellschaft – nicht gang und gäbe waren, wo die Frauen mit ihren gemalten Augenbrauen, die Männer mit ihren glattrasierten Vorderköpfen und ihren Zöpfen (glücklicherweise hatten noch einige die Zöpfe nicht abgeschnitten), so fremdartig wirkten und ununterbrochenes Staunen erregten, kam es selbstredend oft vor, daß Jenny ihren hübschen Mund weit offen hielt und das Essen ganz vergaß.
Nach chinesischer Sitte darf der Gastgeber so etwas nicht zulassen. Daher formte Chung-Fu jedesmal in seiner eigenen Schüssel einen Knödel aus den besten Leckerbissen und war nicht so genau damit, ob er die Finger auch noch dazu zu Hilfe nahm oder nicht, und schob ihn, sobald das Meisterwerk transportfähig war, in Jennys einladend offengehaltenen Mund, die sofort anfing, Erstickungsversuche zu machen oder den Knödel herauszuwerfen. Vergebliche Mühe! Chung-Fu hatte so etwas vorausgesehen und hielt daher vorsorglich seine Hand dicht vor ihre Lippen. Der Knödel mußte hinunter – heraus konnte er nicht.
Sooft meine Schwester mit dem Stäbchen umsonst Fischversuche in ihrem Trögchen unternahm und ihre Augen vor Verwunderung weit aufriß, wenn die Ladung im letzten Moment zurückrollte, benützte der aufmerksame Chung-Fu, dem eine solche Danaidenarbeit jedenfalls Mitleid abpreßte, auch die Gelegenheit und schob ihr etwas in den Mund – mit seinen Stäbchen, seinen Fingern oder auf andere Weise, das war ganz Nebensache –, Jenny wurde gefüttert, wie sehr sie sich auch wehrte.
Diese Fütterungsprozesse unterhielten nicht nur mich, sondern die ganze Tischgesellschaft – besonders die weibliche. –
Am dritten Tage hatte ich ein lichtes, gold- und silbergesticktes Seidenkleid an, das auch irgendeine symbolische Bedeutung hatte, die ich indessen vergessen. Heute erst wurden wir endgültig verbunden, denn man führte uns zu den Stammtafeln der Vorfahren, in anderen Worten an den Hausaltar, wo wir drei tiefe Kotaus machen mußten. Zu beiden Seiten des Altars standen schön geschmückte Tische, auf welchen Eß- und Trinksachen aller Art aufgestellt waren, die den Ahnen geopfert wurden. In der Mitte der Halle befand sich eine Art Podium und dieses bestieg nun der Mandarin, gleichfalls in seiner Festtoilette, und teilte unter zahllosen Kotaus den Vorfahren mit, daß Li Bai und ich nach allen Regeln der chinesischen Sitte und nach Befragung des Zauberers Mann und Frau geworden waren und daß er, der Mandarin, nun um den Segen der Vorfahren für uns bitte. Er verließ nach weiteren Kotaus den erhöhten Sitz und wir traten näher, um den von diesem wichtigen Akte verständigten Ahnen unsere Aufwartung zu machen, die in der dreimaligen Wiederholung eines tadellosen Kotaus bestand. Damit waren die eigentlichen Hochzeitszeremonien zu Ende und wir in den Augen der ganzen Familie erst wirklich Mann und Frau, deren erste Aufgabe es nun sein mußte, so schnell wie möglich einen Sohn und Erben zu bringen.
Würde ich eine echte Chinesin gewesen sein, so hätte ich an diesem Tage meinen Eltern eine Gans oder doch den Teil einer gebratenen Gans nach Hause getragen haben, als Zeichen, daß mein Gatte mit mir zufrieden und an meiner Unschuld nichts auszusetzen war.
Mama und Jenny sollten noch etwa drei Wochen bleiben, Jenny vielleicht sogar drei Monate, und vorläufig wohnten beide in den Gastzimmern, über die jeder Mandarin reich verfügt. Jeden Abend wurden alle Tore sorgfältig geschlossen und von da ab machte der Nachtwächter seine Runde – niemand konnte heraus, niemand mehr hinein, ohne von ihm gesehen zu werden.
Die chinesische Zeitrechnung weicht von der unsrigen bedeutend ab. Die Jahre rechnet man entweder nach einem Zeitabschnitt von 60 Jahren oder nach der Regierung eines Herrschers, der bei seiner Thronbesteigung immer auch eine Art Regierungstitel annimmt. Letztere Art ist die verwickeltere. Die Monate selbst richten sich genau nach dem Monde und zählen bald 29, bald 30 Tage, aber um den dadurch entstandenen Unterschied auszugleichen, hat man alle drei Jahre einen Extramonat und rechnet in Zeitabschnitten von 19 Jahren, während welcher Zeit sieben Extramonde eingeschoben werden. Für die ersten zehn Tage jedes Monats hat man einen besonderen Namen. Der Tag wird in zwölf Stunden eingeteilt und jede chinesische Stunde entspricht zwei europäischen Stunden.
Die Tage flossen ruhig dahin. Mama und Jenny wanderten in Tientsin herum, besahen alles, was sehenswert war und ließen sich selbst durch angebrochene Kälte nicht abhalten. Ich brauchte mich um den Haushalt nicht zu kümmern – die chinesischen Diener und Dienerinnen besorgten alles und man hat ihrer viele, da ein Monatslohn sich auf ein bis zwei Mark beläuft. Kost und Wohnung muß man allerdings dazurechnen, aber wie wenig ist das, wenn man unsere Löhne in Europa betrachtet! Die Kost erhielten wir, wie alle Hausgenossen, aus der gemeinsamen Küche des Mandarins. Wenn irgendwo noch ein Staubwölkchen blieb, so war Li Bai schon hier, um es mit wahrem Genuß abzuwischen. Er fand kein größeres Vergnügen, als so recht eifrig überall Ordnung zu machen, alles nett aufzustellen, und alle seine Sachen durchzusehen. Meine Hauptaufgabe bestand daher darin, Li Bai zu überreden, mit mir auf deutsch, englisch oder französisch zu lesen und sich die englische Literatur und Geschichte etwas öfter und näher anzuschauen als bisher. Umsonst! Wohl lasen wir häufig zusammen und ich konnte auch kleine Fortschritte bemerken, die besonders den Mandarin beglückten, wenn er gegen Abend auf eine Stunde zu uns kam, aber dauerndes Interesse oder wirklichen Fleiß konnte ich bei ihm nie zutage fördern. War er nicht in Stimmung, so sagte er, daß er sich »miserable« fühlte und da war mit ihm nichts anzufangen. Schon in London hatte ich bemerkt, daß eigenartige Stimmungen ihn überkamen, jetzt aber gestand er mir offenherzig ein, daß er in solchen Augenblicken und an solchen Tagen (mir fiel es später auf, daß sie sich etwa alle vierzehn Tage wiederholten und immer am ärgsten zu Beginn jedes Monats waren) die Lust in sich fühle, jemand zu töten oder doch recht weh zu tun. Körperlich tat er mir nicht weh, aber moralisch folterte er mich an solchen Tagen bis zur Unerträglichkeit. Er konnte die grausamsten Sachen äußern, die ihm durch den Kopf fuhren, und konnte ein geradezu teuflisches Vergnügen daran finden, mich weinen zu machen. Sah er erst Tränen in meinen Augen, so quälte er mich auf die entsetzlichste Art stundenlang weiter und nur als ich gelernt hatte, gleichgültig auszusehen, ließ er schneller von dieser Quälerei ab. Wenn er diese Anfälle hatte, so leuchteten seine Augen finster und bösartig unter den geschlossenen Lidern hervor, und sein Gesicht verzerrte sich von Zeit zu Zeit zu einem höhnischen Lächeln. Es war umsonst, in solchen Augenblicken ein besseres Empfinden in ihm wachzurufen – er war gegen alles Gute und Edle taub. War der Anfall vorüber – er war oft von Kopfschmerzen begleitet und dauerte von sechs Stunden bis über zwei Tage –, so war er wieder der nette kleine Chinese von ehedem. Wenn ich ihm dann leise vorhielt, daß er so wenig nett gegen mich gewesen, versuchte er alles gut zu machen, indem er mich küßte, was er als Universalmittel gegen alle meine Leiden ansah, da ich, in deren Herzen die Hoffnung auf bessere Zeiten immer wieder bei dieser Zärtlichkeit zu erwachen begann, stets lächelte, wenn er mich küßte.
Ausgehen durfte ich nicht – war er übellaunig, d. h. »miserable«, wie er es nannte, so quälte er mich halb zu Tode dafür, und war er gut gelaunt, so neckte er mich und warf mich scherzweise herum und brummte wohl stundenlang, indem er kühn behauptete, daß ich das Wiederkommen ganz vergessen hätte. Daher schloß ich mich Mama und Jenny beim Ausgehen kaum an. Fragten die beiden Li Bai, ob ich denn nicht mitgehen dürfte, so entgegnete er: »Gewiß, gewiß,« aber nachher war es ebenso gewiß, daß er mich dafür ordentlich quälte.
Blieb ich indessen bei ihm zu Hause und waren seine Anfälle vorbei, so hatten wir eine unerhört schöne Zeit. Da spielte Li Bai mit mir Fangen, Verstecken und andere Spiele, küßte mich oft und zärtlich und verwandelte sich ganz in eine kleine nette Spielkatze. Ich hatte eine ungewöhnlich ernste Kindheit gehabt – Jenny, die ein Muster des Gehorsams war, blieb gern bei den vielen Mädchen in der Pension. Aber für mich, den Aufwiegler, den Freigeist und Ausbund des Ungehorsams und der Widersetzlichkeit, bedankte man sich sofort und schickte mich zurück, dahin von wo ich gekommen. Ich hatte deshalb nur wenig Spielgenossen gehabt, lieber gelesen, gelernt und gegrübelt, wie frühreife Kinder es tun, und fühlte mich nun wirklich glücklich darüber, daß ich einen so heiteren Spielkameraden in meinem Gatten gefunden hatte. Zum Ideenaustausch und moralischen Halt konnte er mir nicht dienen, als Gatte entsprach er zu wenig unseren europäischen Anschauungen, aber als Spielgenosse war er unübertrefflich und noch heute denke ich mit ungetrübter Freude an unser Spiel zurück – wie wir aufeinander warteten, wie eines das andere aussperrte, wie ich mit seinem Tagebuch davonlief und er meine Briefe zu erhaschen und zu untersuchen versuchte und wie das einzige Mittel, das ich erfolgreich gegen seine kräftigen Hände (denn er war sehr stark) verwenden konnte, der große Badeschwamm war, den ich ihm vollgetränkt entgegenhielt und vor dem er große Hochachtung hatte, so daß ich den Schwamm als meinen sichersten Schild betrachtete und bei unseren Neckereien immer zuerst auf den Waschtisch zuflog.
Li Bai hatte seit dem Hochzeitstage, wo er ganz wie ich in rotseidene und goldgestickte Roben gehüllt gewesen war, seinen europäischen Anzug abgelegt und trug nun ausschließlich sein kaftanartiges chinesisches Gewand aus weicher Seide, das zur Winterszeit warm wattiert war. Er fragte mich oft, ob ich nicht auch lieber die Trachten der chinesischen Frauen tragen würde, doch dagegen wehrte ich mich, nicht etwa aus lächerlicher Eitelkeit, sondern nur weil ich damit allzusehr jede Spur der Europäerin verwischt hätte, und dies wünschte ich um meiner Schwiegermutter willen nicht. Sie haßte mich, das fühlte ich ganz genau, wenn sie auch nie irgend etwas offen Feindliches gegen mich unternahm. Sie wußte Li Bais Stimmung auszunützen, wenn er »miserable« war, um mich durch ihn quälen zu können, und ich verdankte es auch ihr, daß Li Bai sich so sehr sträubte, mich mit meinen Verwandten ausgehen zu lassen.
Der Mandarin hatte noch außer Li Bais Mutter, seiner rechtmäßigen Frau, drei Konkubinen, die der armen Frau das Leben oft schwer machten und Li Bai, der seine Mutter innig liebte – sie war gewiß die einzige, der dieses seltsame Herz ganz gehörte –, war oft streng und unfreundlich gegen diese drei Sklavinnen, wie er sie nannte. Ich sprach nur wenig mit meiner Schwiegermutter, da meine Kenntnis des Chinesischen eine allzu geringe war, und wenn ich auch manchmal mit Li Bai in die seltsame alte Küche gehen durfte, um sie dort ihre Befehle erteilen zu sehen, wichen wir uns gefühlsgemäß doch so oft als möglich aus; ich hütete mich aber ebensosehr, die drei Sklavinnen irgendwie zu beleidigen und grüßte sie immer, sooft wir uns trafen, was, wenngleich Li Bai unangenehm, dem Mandarin sehr angenehm war.
So war es mir gelungen, ohne Feindlichkeiten im Hause meines Schwiegervaters zu leben, bis ein Ereignis eintrat, das sehr nachhaltige Folgen nach sich zog. Seit mehreren Wochen – Mama hatte ihren Aufenthalt ausgedehnt und war nun schon fünf Wochen länger als ursprünglich festgesetzt, in Tientsin – war ich täglich, mit Li Bais »ungnädiger« Erlaubnis (er fügte sich nur den Befehlen seines Vaters), zur Bank gezogen, wo ich zuerst nur vereinzelte Briefe, später aber eine ganz beträchtliche Zahl, schrieb, besonders als der Mandarin sich überreden ließ, eine Schreibmaschine zu kaufen, mit der ich allein umgehen konnte.
Wir sprachen fast nie mehr als das Allernotwendigste miteinander, und ich unterließ es nie, so höflich als möglich gegen meinen Schwiegervater zu sein, dessen immer gleiches ruhiges und unergründliches Wesen mir Achtung und Interesse einflößten, zu denen sich auch etwas heilsame Furcht mischte. Er legte meist die Arbeiten vor mich auf den kleinen Tisch und sagte in kurzen Worten, was er auszudrücken wünschte. Er rechnete nie seine Zahlen im Kopfe oder selbst auf dem Papier aus, sondern bediente sich wie alle Chinesen und Japaner der Rechentafel, die sieben Kolonnen umfaßte und auf der man sicherer und schneller als nach unserem europäischen System bis in die Millionen rechnen konnte. Hatte er die Summe bestimmt, so schrieb er sie in chinesischen Ziffern nieder, die ich sehr gut lesen konnte, da ich mich schon in Europa daraufhin geübt hatte, und zur Vorsicht übersetzte ich sie stets in unsere Ziffern, auf die er zur Prüfung immer noch einen Blick warf. War alles erledigt, so setzte ich mich an die Maschine und schrieb voller Seligkeit einen Brief nach dem anderen. In London, wo ich oft die fesselndsten Uebersetzungen zu machen hatte, wäre mir diese Bankarbeit entsetzlich einförmig erschienen, aber hier war es mir, als ob ich wieder einmal freigelassen worden wäre, um mich in meinem gewohnten Element zu tummeln. Da fiel das Fremdartige und Gedrückte meines Wesens ab, da wurde ich wieder fest und bestimmt in allen meinen Ansprüchen und fühlte neuerdings, daß ich ein vollberechtigter Mensch war.
Mein Schwiegervater lobte mich nie – weder wenn ein Funken von erhöhtem Wissen sich bei Li Bai zeigte, der gern ein wenig vor seinem Vater seine Kenntnisse lüftete, noch wenn in der Bank ein Brief nach dem anderen in verschiedenen europäischen Sprachen verfaßt rein und nett kopiert vor ihm lag –, aber ich merkte eins: er wies alle Bitten Li Bais, mich nicht zur Bank kommen zu lassen, energisch ab, und auch bei den Studien wußte er Li Bai unter mein Regiment zu stellen. Und dann kam der erste ernste Auftritt.
Chung-Fu, der zwar schon verheiratet war und auch ein Söhnchen besaß, mit dem Jenny sich lebhaft angefreundet und das von ihr sogar etwas Deutsch zu sprechen erlernt hatte, fand an meiner Schwester größeren Gefallen als es mir ratsam schien. Er folgte ihr überallhin, war immer sehr aufmerksam gegen sie und machte ihr allerlei kleine Geschenke, wenn gerade niemand in der Nähe war – Streifen mit chinesischer Schrift, Fächer, kleine Vasen usw. Jenny war leichtsinnig und wohl auch arglos, sie nahm alles an und lachte Chung-Fu aus, aber ich wurde immer besorgter und endlich bat ich Mama, wie schwer mir der Abschied auch wurde, um Jennys willen heimzureisen. Ich gab Mama keinen näheren Grund an und sagte nur, daß Jenny heiratsfähig sei und es ungerecht wäre, sie länger als nötig in China zurückzuhalten. Mama, die von den Herrlichkeiten des Himmlischen Reiches genug hatte, entschloß sich leicht zur Abreise, obschon sie mich ein »gefühlloses« Wesen nannte, da ich sie selbst darum bat. Ich quittierte den Vorwurf, so ungerecht er war, schweigend und atmete erleichtert auf – doch ich frohlockte zu früh.
Am Morgen des folgenden Tages sprach Mama zum Mandarin darüber und sagte, daß ihre Geschäfte es nötig machten, nach Europa zurückzureisen, wenn sie auch nur mit blutendem Herzen von ihrer lieben Tochter Käthe schied; doch sie wisse sie ja in guten Händen usw. usw., was Mütter eben unter solchen Umständen zu sagen pflegen, ob es nun wahr oder nicht.
Der Mandarin äußerte eine Reihe höflicher Klagen und stimmte ihrem Entschluß hierauf vollkommen bei, nur sagte er, daß sie sehr gut ihre Geschäfte allein besorgen könne, und daß Jenny noch einige Monate bei mir bleiben müsse.
»Aber Mandarin,« rief meine Mama, »Jenny ist ein heiratsfähiges Mädchen und nun ist die Zeit, sie daheim auf Bälle zu führen und ihr einen passenden Mann zu suchen.«
»Und wenn,« fragte der Mandarin langsam, »und wenn Jenny nun hier einen Mann finden würde, der reich ist und ihr eine glänzende Versorgung bieten könnte?«
Mein Herzschlag stockte. Sollte der Mandarin ernstlich daran denken, Jenny seinem zweiten Sohne Chung-Fu als Konkubine zu geben, oder wollte dieser unter irgendeinem oberflächlichen Vorwand sich von seiner chinesischen Gattin scheiden lassen, um Jenny an sich zu knüpfen? »Ach, das ist wohl ausgeschlossen,« dachte ich.
»Chinesen heiraten gewiß nicht gern Europäerinnen und –«
»Und wenn sich nun so eine Partie doch fände?« unterbrach der Mandarin meine Mutter.
»So wäre dies auch ganz umsonst, selbst wenn er der reichste und beste Mann wäre!« sagte ich, indem ich mich erhob und auf die beiden Sprechenden zutrat.
Die Augen des Mandarins öffneten sich nicht, nur die Lider zuckten, und ich hatte das Empfinden, als ziehe sich eine tiefe Linie von jedem Augenwinkel gegen die Schläfen zu. Er war ganz, ganz ruhig, und seine Stimme klang sehr gelassen, aber mit eisiger Kälte durchzittert, als er sein Haupt leicht mir zuwandte und fragte:
»Und warum?«
»Ja, warum, Käthe? Wäre es nicht ein Glück für Jenny –?«
Ich bebte innerlich vor Entrüstung. Wäre Mama wirklich imstande, Jenny um schnöden Geldes willen an einen Chinesen zu verkaufen und allein nach Europa zurückzureisen? Ich betrachtete sie. Sie war noch heute eine hübsche und vor allem eine elegante Frau – sie würde sich wahrscheinlich wieder verheiraten, sobald ihre Töchter erfolgreich verschachert worden waren. Aber nein, Jenny sollte ihr Glück nicht verscherzen, sollte es nicht verlieren um selbstsüchtiger Pläne anderer willen, daher sagte ich ruhig und entschlossen, wie ich es wohl sonst nie gewagt haben würde, dem Mandarin zu antworten:
»Weil meine Schwester schon heimlich verlobt ist!« sagte ich und blickte Mama unverwandt an.
»Seit wann bestimmen Kinder selbst über ihr Geschick und seit wann ist der Wille der Tochter maßgebender als der der Mutter?« fragte der Mandarin und seine Augen ruhten vernichtend kalt und streng auf mir. Wenn er böse gewesen wäre, wenn er mit blitzenden Augen auf mich zugetreten sein würde, da hätte ich mich lange nicht so unheimlich berührt gefühlt, als von der kalten, vollkommen ruhig gestellten Frage und dem ausdruckslosen Gesicht, auf dem sich nicht eine Miene verzogen hatte.
»In Europa bestimmen wir selbst über unsere Zukunft!« erwiderte ich mit äußerster Gelassenheit.
»Mit wem ist Jenny verlobt?« fragte Mama.
Jetzt hieß es va banque spielen.
»Mit Doktor Emil Wurmbrandt!« sagte ich.
Jenny war glücklicherweise abwesend – ihre Verlegenheit, ihr Zögern hätte alles verderben können. Ich blickte Mama fest an und sagte mit Nachdruck:
»Der Doktor wird in wenig Jahren eine schöne gesellschaftliche Stellung haben – seine Eltern sind wohlhabend und einflußreich – Jenny paßt nur zu einem Europäer!« sprach's und wandte mich ab.
»Sind die Wünsche Ihrer Töchter für Sie maßgebend?« fragte mit unverkennbarem Spott der gefürchtete Mandarin.
»Ich will meine Kinder glücklich sehen!« entgegnete Mama, die nur an den Doktor, an die Verbindungen seiner Eltern, an den Glanz einer Trauung, den Neid der Tanten und so weiter dachte, und an der jeder Pfeil des Spotts wirkungslos abprallte.
»Ich kenne den Doktor sehr gut und wünsche lebhaft eine solche Verbindung!« sagte Mama rasch. »Das süße Dingelchen hat wohl aus lauter Scheu über den Antrag nicht gesprochen, bis wir wieder auf der Heimreise wären!« fügte sie mit sichtlicher Befriedigung hinzu. Sie dankte meinem Schwiegervater warm für die Gastfreundschaft, die er ihr und Jenny gezeigt hatte, und drückte ihr Bedauern aus, daß sie seine Bitte, Jenny noch einige Monate in China zu lassen, nicht erfüllen könne, damit neigte sie grüßend das Haupt und eilte auf ihre Zimmer zu.
Ich fühlte, wie etwas mir kalt und unbehaglich den Rücken hinablief, als ich die verschleierten Blicke des Mandarins auf mich gerichtet sah. Wir standen uns wohl eine geschlagene Minute regungslos gegenüber, dann sagte er kalt:
»Sie sind sehr bemüht, Ihrer Schwester Glück zu gründen – ist es so schlimm, mit einem Chinesen verheiratet zu sein?«
»Nein,« antwortete ich tonlos, »aber man muß auf vieles verzichten, was man in Europa in einer Ehe finden kann. Wenn ich mit Li Bai glücklich bin, folgt daraus noch nicht, daß meine anspruchsvolle Schwester es auch sein würde.«
»Und was muß man in einer chinesischen Ehe entbehren?« fragte er finster.
Ich dachte an Li Bais wechselndes Verhalten, seine oft ausbrechende Grausamkeit, seine Gleichgültigkeit gegen mein Unwohlbefinden, seinen Mangel an Nachsicht und seine immer seltener werdenden Liebkosungen.
»Zärtlichkeit und Freiheit!« erklärte ich daher unerschrocken.
Er schien meine Entgegnung absichtlich zu überhören. Er verweilte einige Sekunden lang in derselben Stellung wie früher, dann sagte er:
»Mein Plan mißlang – durch Ihre Schuld.« Er fügte kein einziges Wort hinzu, er sprach den Satz nicht lauter als alle anderen Sätze aus, aus seinen ruhigen Gesichtszügen sprach keine Drohung – nicht einmal die geringste Unzufriedenheit – und doch wußte ich, daß kein Verbrecher so bitter bestraft werden würde für sein Vergehen, als die kleine Schwiegertochter, die seine Pläne so jäh über den Haufen gestoßen.
»Um Jennys willen,« sagte ich mir, als ich mit tiefer Verbeugung von Ming Tse senior Abschied nahm.
Kaum war ich glücklich seiner angsteinflößenden Persönlichkeit entgangen, als ich Jenny suchte und sie endlich mit Chung-Fus Söhnchen auf dem Schoße fand, mit dem sie eifrigst spielte und den sie küßte. Dieser Anblick erschreckte mich so, daß ich alles andere darüber vergaß.
»Um Himmels willen, Jenny,« rief ich, »küsse den Kleinen nicht. Du weißt, wie furchtbar unsittlich man das Küssen hier findet, und daß meine Schwiegermutter es mir nie verzeihen würde, so etwas geduldet zu haben?«
Jenny ließ den kleinen siebenjährigen Chinesen von ihrem Schoße auf den Boden gleiten. Da flog auch schon meine Schwägerin herbei und riß das Kind zeternd mit sich fort. Ein haßerfüllter Blick traf meine Schwester und dann auch mich.
Kaum waren wir allein, als ich Jenny von meinem Gespräch mit dem Mandarin erzählte.
»Aber Käthe, der Doktor will mich am Ende gar nicht, er hat nie –« warf sie ein.
»Du mußt Mama sagen, daß er um dich in aller Form gefreit hat!« erklärte ich mit Bestimmtheit. »Ich werde dir einen Brief mitgeben, den du sofort aufgibst, wie du frei hier herauskommst. Wahrscheinlich wird der Doktor dich heiraten, denn er scheint dich zu lieben, dafür spricht die Locke – und anderes, aber wenn auch nicht –, so lange dich der Arm chinesischer Gerechtigkeit erreichen kann, mußt du Mama und alle anderen Leute in dem Glauben lassen, daß du mit deinem Doktor verlobt bist. Jenny,« fuhr ich tiefernst fort, »wenn du einen Fehler machst, kommst du nie mehr nach Europa zurück.«
Meine Schwester sah den Ernst der Lage ein und spielte ihre Rolle vortrefflich. Ich selbst schrieb einen langen Brief an den Doktor, den Jenny in ihrer Bluse versteckt herumtrug, bis es ihr gelang, ihn unbemerkt in einen Briefkasten zu werfen. In dem Briefe aber hatte ich dem Doktor die ganze Sachlage erklärt und ihm gesagt, daß er sich nicht für gebunden zu halten brauche, da ich Mama sofort von dem wahren Sachverhalt verständigen würde, sobald China mit seinen Schrecken hinter den mir teuren Reisenden liegen werde.
Zwei Tage später reisten Jenny und Mama ab. So sehr zitterte ich um das Glück meiner Schwester, daß ich fast gar nicht weinte, als sie schieden, und erst als ein Telegramm von Nagodan mir sagte, daß sie das Himmlische Reich wieder verlassen hatten, überkam mich das Bewußtsein meiner grenzenlosen Einsamkeit. Seit dem Gespräch mit meinem Schwiegervater wurde ich nicht mehr in die Bank gerufen, und mit der Abreise Mamas und Jennys war das letzte Band zerrissen, das mich an die Außenwelt knüpfte.
Ich war wieder allein – wieder der Einsamkeit preisgegeben – und besaß noch weniger als früher. Ich hatte eines Trugbildes wegen das letzte Gut geopfert, das ich besessen hatte – die Freiheit!
Erst jetzt war ich wirklich allein!
Und wieder vergingen Tage und Wochen.
| Von keinem Leid, so schwer es sei, |
| Laß stimmen deine Seele trüber. |
| Geht auch dein Leiden nicht vorbei, |
| So gehst du doch vorüber. |
| Hartmann. |
XV.
Es mochten drei Wochen nach Mamas Abreise verstrichen sein, als Li Bai eines Abends mit ganz entstellten Zügen zu mir gestürmt kam. Der arme Kerl konnte nicht sitzen, so furchtbar hatte sein Vater auf ihn losgeprügelt. Li Bai hatte sich gegen eine der Konkubinen vermessen und sich erlaubt, sie zu schlagen, als sie sich ihm widersetzte, wofür der Mandarin von seinen väterlichen Rechten ausgiebigen Gebrauch gemacht und seinen jüngsten Sohn mit dem Stocke bearbeitet hatte. So etwas klingt uns Europäern ganz unglaublich, ist es jedoch in Wirklichkeit nicht. Auch wenn der Sohn schon vierzig Jahre alt ist, darf der Vater ihn durchprügeln, und das so kräftig und so oft er nur will – ausgenommen, wenn der Sohn selbst Vater ist. Im Augenblick, wo er diese Würde erreicht hat, darf der Vater ihn nicht mehr körperlich züchtigen, denn da ist er endlich, ob er nun fünfzehn oder fünfzig Jahre zählt, »Respektsperson« geworden. Ein Mann, der keine Kinder hat, ist in China eine wertlose Person – wahrscheinlich strafen ihn die Götter, indem sie ihm für seine Vergehen keinen Erben schenken wollen.
Erbittert über seinen Vater, war Li Bai lange Zeit in einer solchen Wut, daß man mit ihm gar nicht sprechen konnte, und als er endlich wieder gefasster war, beschwor er mich, schnell ein Kind zu haben, damit er seine Freiheit wiedererlangen könne. In solchen Augenblicken sehnte er sich, glaube ich, nach dem freien Europa zurück.
Ich kann kaum sagen, daß in unserem Verhältnis eine große Veränderung eintrat, nur wurde Li Bai immer kälter, blieb immer länger abwesend von daheim und wurde immer reizbarer. Seine Anfälle wurden immer heftiger und wiederholten sich häufiger als zuvor, was mich aber am meisten verwunderte und mit Angst erfüllte, das war zweifellos der Umstand, daß die leichte Tünche europäischer Kultur langsam aber sicher von ihm abglitt, etwa wie eine Schlange langsam aber ununterbrochen ihre alte Haut abstreift. Er war reinlich – das war ihm angeboren –, aber dies war auch die einzige Tugend, die nicht ins Wanken geriet. Alle die kleinen Aufmerksamkeiten, die er mir in Europa so oft gezeigt und im Beginn unserer Ehe noch geübt hatte, verschwanden nach und nach. Er ging nun nie mehr hinter, sondern nach chinesischer Sitte vor mir, er öffnete nicht länger die Tür für mich, um mich durchzulassen, sondern nahm von meiner Gegenwart keine Notiz. Beim Essen bediente er mich nicht wie einst, sondern warf einige Speisen auf meinen Teller oder in meine Schüssel, oft auch erst, nachdem er sich selbst bedient hatte. Er tadelte – und dies mit Recht – meine Abneigung gegen häusliche Beschäftigungen und meine Unordnung, und wenn er mit mir studieren sollte, war er so bissig in seinen Bemerkungen, so unhöflich und oft so grausam, daß ich nur mit Zittern daran zurückdenke. Dazwischen konnte er Anfälle seiner Wildheit haben und mich jäh am Halse zu würgen beginnen, was ihm stets leid tat, sobald er wieder sein eigenes Ich war. Wenn er manchmal wieder lieb wurde, war es nur in höchst gleichgültiger Weise, und seine stereotype Entschuldigung für alle seine Eigenarten war, daß alle Weiber gleich seien. – So lange sie den niedrigsten Zwecken dienten, war es einerlei, wie sie aussahen oder wer sie waren. Jede Europäerin wird mir nachfühlen können, wie ich darunter litt, selbst wenn ich um des lieben Friedens willen schwieg.
»Wenn dies deine Anschauungen sind, Li Bai,« sagte ich eines Tages, »warum hast du dann gerade mich gewählt?«
»Weil du eben am nächsten warst!« erwiderte er mit mehr Aufrichtigkeit als Zartgefühl.
Auch an anderen entmutigenden Einflüssen fehlte es nicht. Nach langer Zeit hatte der Mandarin mich wieder einmal in die Bank rufen lassen, wo zu meiner Freude ein großer Haufen Korrespondenz zur schleunigen Erledigung auf mich wartete. Ich arbeitete mit fieberhaftem Eifer und vergaß für die Zeit alles Bittere in meiner Existenz, als sich die Tür öffnete und zwei Europäerinnen und ein Europäer eintraten. Ich mußte eine Weile lang allerlei Bankangelegenheiten besprechen, da mein Schwiegervater ausgegangen war und die anderen Beamten der europäischen Sprachen nicht mächtig waren, und bald entspann sich das lebhafteste Gespräch.
Der Herr war schon zwei Jahre ansässig in Tientsin, die Damen waren ihn soeben besuchen gekommen, und nun erzählte er uns allen seine humorvollen Erfahrungen mit den chinesischen Dienstboten.
»Da ist zuerst mein »Boy« mit seinem Pidgin Englisch, der mir vielen Verdruß macht!« erzählte er lachend. »Man möchte meinen, daß er einen Harem voll Frauen und ein Dutzend Mütter hat, denn alle Augenblicke wird entweder die Frau oder die Mutter krank und stirbt, und da muß er heimreisen – natürlich reisen immer einige meiner Sachen mit ihm, aber es wäre ganz nutzlos, sich dagegen irgendwie aufzulehnen. Jeder Boy stiehlt, und zwar so viel er kann, aber er sieht glücklicherweise darauf, daß ihm dabei niemand ins Handwerk pfuscht. Auch nimmt er selten Geld, da könnte der Herr vielleicht doch grausam genug sein, ihn den Obrigkeiten zu übergeben, und ein Dieb wird in China furchtbar streng bestraft.«
Daran erinnerte ich mich, denn oft mußte der Mandarin sein Urteil sprechen. Manchmal wirft man ihn ins Gefängnis, wo er langsam zugrunde geht, oft macht man ihn um einen Kopf kürzer, oder man gibt ihm fünfundzwanzig oder mehr Stockstreiche auf die Fußsohlen, was auch nicht angenehm sein soll.
»Aber was ist der Boy gegen den Koch!« jammerte der lustige Herr. »Wohl kann er im letzten Augenblick und ohne vorherige Benachrichtigung ein vorzügliches Mahl auf den Tisch stellen, indem er die Fleischspeise bei Koch im Hause links und die Mehlspeise bei Koch im Hause rechts, und die Suppe bei Koch im Hause gegenüber und vielleicht das Gemüse bei Koch im Hause an der Ecke ausborgt, aber in die Küche durfte man nicht gehen, wenn man nicht vor Ekel vergehen wollte. Nicht genug, daß der Boden an und für sich an einen Stall weit eher als an einen Küchenboden erinnert,« sagte unser Erzähler, »und die Bänke und Tische vor Schmutz geradezu kleben, sind auch die Töpfe, Schüsseln, Teller und Pfannen oft mit einer dicken Rinde von angebranntem Fett, Gemüseüberresten oder dergleichen bedeckt, ohne daß es den Koch im geringsten stören würde. Wenn man ihm aber die Schüssel hinhält und sagt, daß dieselbe nicht rein sei, so dreht er sie erst ein paarmal gründlich in den eigenen schmutzigen Fingern hin und her und stellt sie dann ruhig mit dem Bemerken nieder, daß sie noch lange nicht schmutzig genug sei, um gewaschen werden zu müssen.«
Wie ich dabei an meine Mama dachte, sie, die über unsere alte und oft nicht allzu saubere Köchin die Hände über dem Kopf zusammenschlug – was würde sie wohl sagen, wenn sie einen chinesischen Koch im Hause hätte?
»Sie können sich denken, meine Damen,« fuhr Herr Leghorn fort, »daß so ein Koch auch mit der gleichen Reinlichkeit gekleidet ist, und daß er seine Hände nur dann wäscht, wenn er sie vor Schmutz nicht mehr frei bewegen kann. Gegen Messer, Gabeln und Löffel hat der Koch eine unüberwindliche Abneigung, denn wozu hat ihn eine weise Vorsehung mit zehn Fingern ausgestattet, wenn er sie nicht gebrauchen soll? Seine Pfote ist das einzig geltende Thermometer, seine Zunge der Löffel, mit dem er die Suppe herausschöpft und kostet. Er verdient sein Marktgeld ebensogut wie die drallen Köchinnen in Europas Großstädten, indem er das billigste einkauft und die höchsten Preise anrechnet, oder indem er vom Gewicht zurückbehält oder es sammelt, bis wieder ein Päckchen zusammengekommen ist, das er dem Herrn dann als neueingekauft überreichen und anrechnen kann.«
Die Damen und ich beklagten den armen Herrn Leghorn sehr, aber er lachte nur und meinte, daß er ja bald aus dem ver....... Loch fortkommen werde und ihm dieser Gedanke ein Trost sei.
»Und mein Wäschermann oder Waschmann, wie ich den Menschen wohl nennen muß,« ergänzte Herr Leghorn seinen Bericht, »das ist der fürchterlichste von ihnen allen. Er leiht meine Hemden und meine übrige Unterwäsche minderbemittelten Menschenkindern und bringt sie mir dann sehr schön zusammengefaltet wieder, so daß man die Löcher auf den ersten Blick gar nicht wahrnimmt. Wirft man ihm aber so einen gemachten Schaden auch vor, so sagt er nur: »Nichti ichi, seini Waschi dem haben so gemachi.«
Wir lachten alle – der gute Chinese redete sich auf das Präparat aus, das er verwendete, um die Wäsche rein zu bekommen.
Noch eine geraume Weile dauerte das Gespräch fort, und erst beim Abschied fragten mich die drei, wie ich selbst nach China gekommen wäre. Einige Sekunden lang zögerte ich – ich wußte, was mein Geständnis bedeuten würde –, aber dann sagte ich mit Entschlossenheit:
»Ich bin die Frau Ming Tses, des Sohnes des hiesigen Bankdirektors!«
Jedes Lächeln, jedes Wohlwollen verschwand aus den Gesichtern der drei Besucher, die über eine Stunde lang so vertraulich mit mir geplaudert hatten. Man muß im Orient gelebt haben, um zu verstehen, was es bedeutet, sich mit einem Eingeborenen vermählt zu haben. Man ist Paria, »one has lost caste«, wie die Engländer sagen, und kann nicht mehr in seine eigene Gesellschaft zurückkehren. Der Mann wird von seinen Angehörigen angefeindet, die Europäerin aber, die es gewagt hat, einen Bund fürs Leben mit einem Asiaten zu schließen, ist für immer aus dem Kreise ihresgleichen ausgestoßen. Sie hat das Heiligste – ihre eigene Rasse – verraten, und unversöhnlich stellt sich ihr Geschlecht ihr gegenüber. Mit einem leichten Kopfnicken verschwanden die drei Gäste und ich blieb zurück, vermieden und geächtet wie ein Aussatzkranker.
Neujahr, welches in China einen Monat später als in Europa anbricht, war nun vor der Tür. Die Amtssiegel und alles Amtspapier war versiegelt worden und durfte erst nach den Neujahrsfeierlichkeiten wieder gebraucht werden, alle Wohnungen wurden gründlich gereinigt, und selbst in der elendesten Kulihütte, wo nur ein schmutziges Loch mit einigen Decken und Kisten das ganze Hausgerät bildete, wurde mit Wasser gewüstet wie nie sonst. Haus und Menschen mußten rein sein, wenn die Jahreswende mit ihrem Segen sich näherte. Von allen Haustüren hingen rote Papierstreifen mit »Fu« in großen Zeichen, was »Glück« bedeutet. Um diese Zeit müssen alle Schulden bezahlt werden, und wehe dem Unglücklichen, der nicht imstande ist, es zu tun. Da kommen die Gläubiger und legen Beschlag auf sein Haus und lassen, was dem Chinesen schrecklicher dünkt, in der Neujahrsnacht die Haustür offen stehen, durch die alle bösen Geister und Dämone in das Haus eindringen und sich dort niederlassen, den Bewohnern allerlei Unglück mitbringend. Am Neujahrsmorgen erhält jedes Kind zwei neue Winter- und zwei neue Sommerkleider, und jeder ältere Bruder muß dem jüngeren ebenfalls ein Geschenk machen, während dieser wieder an die noch jüngeren Familienmitglieder, wie z. B. an seine Neffen, ein Geschenk weitergehen lassen muß. Alle Bekannten gehen in ihren besten Kleidern zu allen Verwandten und allen Bekannten, so daß alle Menschen vom ärmsten bis zum reichsten auf der Gasse anzutreffen sind.
Dies ist auch die beste Zeit zum Drachenfliegen, und Li Bai war ganz selig, weil wir zwei wunderschöne Seidendrachen hatten – der eine davon stellte ein Haus, der andere eine riesige Schlange vor –, die am Abend und an den folgenden Tagen steigen sollten.
Es ist mir oft aufgefallen, wie sehr die Chinesen und auch die Japaner an den allereinfachsten, ja an geradezu kindlichen Vergnügungen und Spielen ihre allergrößte Freude finden. Selbst der ehrwürdige Mandarin, der täglich viele hunderttausend Mark durch seine Hände gleiten ließ und dessen Lippen oft ein strenges Urteil über einen Verbrecher aussprachen, selbst er freute sich über den Anblick des Drachen, als dieser stolz in die Lüfte flog, und Li Bai war so eifrig, daß er sich kaum Zeit zum Essen gab. Wirklich alte Chinesen, die ihre Urgroßenkel bei sich hatten, sahen zu den Drachen auf und freuten sich über den Fall des einen und den Flug des anderen wie muntere Schuljungen und erinnerten mich auch an die erregten Zuschauer bei einem europäischen Pferderennen oder einer Regatta.
Selbst die chinesische Bühne, die wirklich für unsere Begriffe sehr langweilig und unschön ist, und bei der die Phantasie des Zuschauers fast alles Fehlende ersetzen muß, erfreut mit ihren fast kindlichen Darstellungen die Chinesen. Frauen als Schauspielerinnen gibt es nicht, und die jungen bartlosen Chinesen ersetzen ganz gut das fehlende Geschlecht, aber die lärmenden Musikanten und die übereinfache Bühnenausstattung macht jeden Theatergang uns Europäern eher zu einer Folter als zu einem Vergnügen.
Unserer Musik und unserer Bühne sind dagegen die Orientalen ebenso feindlich gestimmt. Ihnen erscheint unsere Musik ebenso tonlos und unschön wie uns die ihrige, und unser Theater interessiert sie nicht. In Berlin hat mich ein junger Japaner in die Oper begleitet, mich aber schon vor Beginn der Vorstellung gebeten, freundlichst zu entschuldigen, wenn er gleich einschlafen würde, und das tat er auch, bevor die göttlichsten Arien zwei Minuten lang das Haus erfüllt hatten. Er schlief still und diskret – nicht etwa mit tiefem Schnarchen, wie es eine charakteristische Eigenschaft der meisten Europäer ist –, aber er schlief fest und ruhig, bis der Vorhang fiel und das erste Stück ausgespielt war. Im zweiten Stücke wechselte die Szene ununterbrochen, da ein frecher Räuber verfolgt wurde, und das gefiel meinem orientalischen Freunde so gut, daß er gar nicht mehr an das Einschlafen dachte, sondern lebhaft mitlachte, sobald die Polizei dem Flüchtling nahekam oder er ihnen entwich. Das Mittelmäßigere vom künstlerischen Standpunkt, aber das dem kindlichen Gemüte Näherliegende erfreut sich des vollen Beifalls des fernen Asiaten. Indier dagegen lieben das Mystische, das Erhabene.
Trotz der starken Kälte standen wir den größten Teil des Tages auf der Straße, um die unzähligen Drachen steigen zu sehen, von denen einige wie ein Haus, andere wie Tiere, andere wie große Blumen aussahen, und die ebenso, wie in Nizza die blumenbekränzten Wagen beim Blumenkorso, Anlaß zu Prahlerei gaben; denn so ein Seidendrachen kann oft sehr kostspielig sein.
Am lebhaftesten ging es gegen Abend zu. Da erschütterten Knallerbsen das Trommelfell, Stimmen schwirrten durcheinander, Raketen flogen in die Luft, rote Bänder und Papierstreifen wurden geschwenkt, Musikanten schlugen mit bewundernswerter Ausdauer und Unerschrockenheit auf die Trommeln, andere Berufsgenossen stießen in die schrillen Trompeten, Kinder rannten einem zwischen die Beine und schrien aus vollen Lungen, Feuerwerke wurden abgebrannt und überall wohlriechende Holzarten in Brand gesetzt. Das einzig Hübsche an dem Ganzen schienen mir die unzähligen Lampions, die um alle Häuser befestigt waren und dem Beschauer auch aus jedem Hause entgegenleuchteten. Sie hatten verschiedene Farben, doch wurde hellrot bevorzugt, und die meisten hatten »Glück« darauf geschrieben.
Auch für den Magen war gut gesorgt worden. Berge von Kuchen aller Art standen bereit, und meine kleinen gelben Nichtchen und Neffen leisteten in der Unterbringung dieser Ware Unglaubliches, indessen bemerkte ich mit Bedauern, daß sich die Nichten erst dem »Kuchentroge« nähern durften, nachdem die gnädigen großen Brüder abgespeist hatten. –
Es mochte etwa Mitte Februar sein. Li Bai war vierzehn Tage abwesend gewesen, und wenn ich auch in der furchtbaren Kälte nicht zur Bank gehen durfte, fühlte ich mich doch nicht so verlassen, als ich gefürchtet hatte, denn der Mandarin schickte mir die Maschine in meine Wohnung, und so konnte ich den ganzen Tag lang auf ihr herumklappern – zuerst um Geschäftsbriefe zu verfassen und sodann um Briefe an Jenny zu schreiben und dem Doktor für seinen Brief zu danken.
Er hatte von einer Auflösung der Verlobung nichts hören wollen und dankte mir in warmen Worten, mich seiner und Jennys so freundlich angenommen zu haben, bat mich, sein Heim immer als das meine anzusehen und teilte mir mit, daß Jenny schon Ende Januar seine Gattin werden würde.
Den Brief erhielt ich verspätet, da man mir in der Abwesenheit meines Gatten nie Briefe aushändigte und mir auch nicht gestattete, irgendwelche abzusenden, so lange Li Bai nicht in Tientsin war. Trotzdem gelang es mir hie und da ihre Wachsamkeit zu täuschen und es schien mir fast, als ob der Mandarin mir selbst dazu verhelfen wollte, wenigstens war er es, der mich immer gegen die Ränke seiner rechtmäßigen Frau zu schützen verstand.
Sie ließ mich wenigstens einmal die Woche durch ihre Schwiegertochter fragen – oder fragte wohl manchmal auch selbst –, ob ich von den Göttern verlassen wäre oder ob ich auf etwas Herrliches Aussicht zu hoffen hätte.
Nun hatte ich gegen meine Ueberzeugung schon mehrmals gesagt, daß mich die Götter nicht mochten und ich nichts zu hoffen hatte, nun aber war ein solches Schweigen nicht länger möglich. Wie weit ich meine Kleider auch sein ließ, sie verschwiegen meinen Zustand nicht länger, und als daher Li Bai heimkehrte, teilte ich ihm mit, daß er in wenigen Monaten Vater sein würde.
Wie groß die Liebe der Chinesen für Kinder ist! Wir waren uns schon ganz fremd geworden, Li Bai und ich, und ich wußte, daß er es mit der ehelichen Treue gar nicht so genau nahm, wie streng die Strafen für so ein Vergehen auch seien. Der Ehebruch wird eigentlich immer nur bei der Frau gestraft, der ihr Gatte, falls er sie bei der Tat ertappt, den Kopf abschneiden darf, um ihn zusammen mit dem Kopfe des Liebhabers zum Magistrat zu bringen, wo er für diese tugendhafte Tat nicht nur freigesprochen, sondern noch belobt wird. Jetzt flammte in ihm plötzlich etwas von alter Zuneigung auf, und er wurde wieder genau so aufmerksam wie vorher – in mancher Hinsicht zärtlicher, als er es je gewesen.
Auch meine gelbe Schwiegermama setzte ein bedeutend freundlicheres Gesicht auf, schickte besondere Speisen zu mir, sorgte doppelt für meine Bequemlichkeit und erteilte Li Bai allerlei gute Ratschläge. Der Zauberer wurde geholt um auszurechnen, an welchem Tage der neue Weltbürger seinen Einzug halten würde, und aller denkbarer Hokuspokus wurde getrieben, was ich ruhig geschehen ließ, nur eins verlangte ich: Ich wollte rechtzeitig in das englische Spital gebracht werden, um dort nach unserer Art gepflegt zu werden, da mir der Gedanke, dann von Chinesinnen umgeben zu sein, ganz unerträglich war. Da ich Li Bais Versprechen kaum traute, wandte ich mich direkt an den Mandarin, der gegen eine Uebersiedlung in das Krankenhaus war, mir aber gelobte, eine »Nurse« oder Pflegerin von dort aufzunehmen und den europäischen Arzt zu verständigen, und mehr konnte ich nicht erwarten.
So weit weg von der Heimat, unter so ganz veränderten Verhältnissen sollte ich einem Wesen das Leben geben? Ich würde nun auf immer an Li Bai gebunden sein – auf immer, denn ist in China die Scheidung leicht, wenn man keine Kinder hat, so wird sie geradezu unmöglich, wenn Nachkommen da sind. Wohl könnte ich in einem anderen Hause wohnen, mich aber nie von China entfernen, da die Regierung nur höchst ungern gestattet, daß irgendein Untertan das Reich verläßt. Nun war ich auf immer verdammt, in diesem lieblosen Lande zu verweilen, aber Li Bais neuerwachte Zärtlichkeit und jenes Glücksgefühl, das jede Mutter auch unter den traurigsten Umständen durchströmt, brachte Freude auch in meine freudlose Existenz im Reiche der himmlischen Mitte.
Die Silberkette wurde schon gekauft, die man dem kleinen Weltbürger (wenn es ein Sohn sein sollte) umgeben würde, die er sein Leben lang in Erinnerung an seine Mutter trägt und die am Hochzeitstage mit einer goldenen vertauscht wird. Für Mädchen trifft man keine Vorbereitungen – Mädchen zählen nicht –, und während ein Sohn mit einem Edelsteine verglichen wird, beschreibt man ein Mädchen als wertlosen Ziegelstein. Die guten Chinesen vergessen, daß ohne Ziegelsteine keine Edelsteine in China wären.
Jeden Abend zauberte Li Bai zu meiner Unterhaltung herum und setzte geheimnisvolle Mienen auf, sooft er sich mir näherte oder um mich herumging.
»Was tust du, Li Bai?« fragte ich lachend.
»Ich zaubere, damit du einen Knaben bekommst und nicht etwa ein Mädchen,« erwiderte er ganz überzeugt.
»Wie er wohl aussehen wird?« meinte ich nachdenklich. »Am Ende ist es ein Ausbund der Häßlichkeit.«
»Mein Sohn?« fragte Li Bai hocherstaunt. »Ich habe ihn gemacht,« setzte er stolz hinzu, und damit hatte er jede Zumutung über sekundären Erfolg zurückgewiesen. Sein Sohn konnte nur ein Prachtwerk sein. Wie ich lachte. –
Die angenehmen, heiteren Stunden waren zurückgekehrt. Mußte ich jetzt auch stillsitzen, so tat doch Li Bai viel, um mich zu unterhalten und fügte sich sehr oft meinen Wünschen da, wo er es vorher nie getan hätte. Leider dauerte dies nur etwa einen Monat, dann trat ein alter chinesischer Brauch trennend zwischen uns.
Eines Tages merkte ich, daß Li Bais Bett entfernt wurde. Ich war unbeschreiblich erstaunt und öffnete meine Augen so weit es ging, indem ich vergeblich versuchte, den Grund dieses Gebarens zu erfahren.
Meine Schwiegermutter legte ihren Arm um mich – wohl um mich zu beruhigen, aber nervös, wie ich war, begann ich laut zu weinen, und endlich kam Li Bai und versicherte mir, daß wir nach chinesischem Brauche nicht länger zusammen wohnen dürften, da es dem Sprößling schaden könnte.
Wie ich mich wehrte, so mutterseelenallein gelassen zu werden, wie oftmal ich unter Tränen Li Bai bat, meine europäische Abstammung in Betracht zu ziehen, wie zärtlich forderte ich ihn auf, meinen Bitten nachzugeben und einen eigenen Haushalt zu gründen, wo ich nicht unausgesetzt von seiner Familie verfolgt werden würde. – Umsonst! Li Bai küßte mich, versprach alles mögliche und – verließ noch am selben Tage Tientsin, um in Geschäftsreisen oder angeblichen Geschäftsreisen einige Wochen fern zu bleiben.
Gerade um diese Zeit verträgt eine Frau am wenigsten das Alleinsein. Was Wunder, daß ich Tag und Nacht weinte, da ich immer stärker unter dem Heimweh litt, und als der Mandarin mich eine Woche nach Li Bais Abreise sah, war ich so mager geworden und sah so schlecht aus, daß er den Sohn sofort zurückkehren ließ – vielleicht weniger um meine Pein zu vermindern, als aus Furcht, es könnte dem künftigen Träger des Namens Ming Tse schaden oder seine Ankunft gar vereiteln. Genug! Eine Woche später wohnte Li Bai trotz aller chinesischen Sitten wieder mit mir unter einem Dache.
Der Frühling war ins Land gezogen und alle die Zwergbäumchen in dem großen Garten waren in Blüte, die Brücken leuchteten in ihrem zarten Weiß und die Sonne spiegelte sich funkelnd in den zahllosen kleinen Bassins, die sehr geschmackvoll angelegt waren. Schlanke orientalische Bäume standen im Hintergrund der Parkanlagen und warfen ihren Schatten über einen Weiher, über den auch eine zartgeschwungene Holzbogenbrücke führte, und der, wie gering auch sein Durchmesser war, doch eine beträchtliche Tiefe besaß und den Kindern im Sommer als Schwimmplatz diente.
Unter diesen hohen Bäumen verträumte ich manche Stunde mit einem Buche oder mit einer der kleinen Nichtchen an meiner Seite, die in eintönigen Reimen, halb singend, halb sprechend, ihre Schulaufgaben aufsagte. In der Familie des Mandarins studierten auch die Mädchen, wenngleich die Knaben nicht damit einverstanden waren.
Alles was die Kinder können und wissen mußten, wurde auswendig gelernt und gesungen. Nichts Geisttötenderes als so ein chinesischer Unterricht, wo die Kinder von acht Uhr früh bis zum Sonnenuntergang in der Schule weilen mußten, wo man sie zuerst das Zeichen ordentlich zu schreiben lehrte, dann dessen Aussprache, hierauf die Bedeutung des Wortes und endlich seinen Wert im Satze. So wurde langsam der ganze Konfuzius auswendig gelernt, der allerdings die wichtigsten sittlichen Gesetze enthält, über Rechtswissenschaft und die Pflicht von Königen spricht, die genauen Zeremonien für jeden wichtigen Moment im Leben vorschreibt, über chinesische Geschichte teilweise Aufklärung gibt, aber über die augenblicklich notwendig gewordenen Kenntnisse, wie allgemeine Geographie, Physik, Geometrie usw. gar keine Aufschlüsse erteilt, den Schüler nie zum Denken anregt. So stellt dieser Unterricht eigentlich nur ein mechanisches Auswendiglernen dar. Dennoch wird an diesem Plane auch für die großen literarischen Wettprüfungen festgehalten.
Der arme Chung-Fu, der Jenny immer noch nicht vergessen und mir ebensowenig verziehen hatte, kam im April zur Prüfung und erzählte bei seiner Heimkehr von den mitgemachten Leiden.
Die Prüfungsgebäude in Peking umfassen eine ganze eigene Stadt und jedem Kandidaten wird eine eigene Zelle angewiesen, in der ein Brett an der linken Wand das Bett und den Stuhl vorstellt und ein Brett, etwas höher an der rechten Wand befestigt, den Tisch ersetzen muß. Jeder Kandidat muß Kerzen und Lebensmittel mitbringen, aber weder Bücher noch Papier dürfen mitgenommen werden. Jeder Kandidat wird bei seinen Namen aufgerufen, erhält eine Nummer, muß sich von Kopf bis zu den Füßen genau untersuchen lassen, damit auch nicht ein Stück Papier unerlaubterweise eingeschwärzt wird, bekommt hierauf Papier, Tusche und einen Pinsel und darf an dem Kanzler und dem Vizekanzler vorbei in das Reich der Prüfungsräumlichkeiten wandern.
Sind erst alle Kandidaten aufgerufen worden und in ihre Zellen verschwunden, so wird die Pforte feierlich versiegelt, einige Räucherstäbchen verbrannt, damit die bösen Geister draußen bleiben müssen, und sobald dies geschehen, kann niemand mehr hinein und niemand mehr heraus. Drei Fragen werden gestellt und drei Tage und drei Nächte arbeiten die Kandidaten ununterbrochen, dann muß die Arbeit abgegeben werden; ein Ruhetag entsteht und dann kommen wieder drei Fragen und drei Tage Beantwortungszeit und wieder ein Ruhetag und sodann wiederholt sich dieser Vorgang zum dritten und letztem Male.
Da sollen Männer bis über achtzig Jahre und schwache Jünglinge von zwanzig Jahren zu sehen sein, und bei dieser furchtbaren Anstrengung ist es kein Wunder, daß viele junge Leute irrsinnig werden oder sterben. Aber auch dann wird die Tür nicht geöffnet, sondern man wirft die Leichen einfach über die Mauer zu der vor ihr harrenden Menge.
Chung-Fu, der über seinen Erfolg sehr stolz war, erklärte den Tod der unglücklichen Kandidaten indessen auf ganz andere und abergläubische Weise. Die Geister, d. h. die uns stetig umgebenden bösen Geister dürfen nicht zulassen, daß eine böse Handlung ungestraft dahingeht und ein Bösewicht ein Mandarin wird. Hat ein Kandidat daher einen Mord auf dem Gewissen, so schleicht der Geist des ruhelosen Ermordeten im letzten Augenblick vor der Torschließung in die Prüfungsstadt hinein und sucht in den Zellen nach seinem Mörder. Trifft er ihn endlich, so verwandelt sich das gelbe Licht der Kerze langsam in ein grünes Licht und der Kandidat weiß, daß der Geist gekommen ist, um ihn zu erwürgen. Kein Schreien, keine Flucht kann ihn retten. Der Geist erwürgt ihn auf der Stelle und der Tote wird über die Mauer geworfen.
An einem herrlichen Maiabende sah ich meine älteste Nichte, ein Mädchen von etwa vierzehn Jahren, unter den Bäumen liegen und schlafen und wunderte mich, als ich sah, daß Li Bais Mutter auf sie zueilte und sie mit sich fort in das Haus zog, scheinbar böse, die arme Kleine dort gefunden zu haben.
»Warum wollte deine Mutter nicht, daß Pe-Niu unter den Bäumen schlafen soll? Es ist ja so schön dort draußen und hier ist es schwül und drückend!« fragte ich.
»Pe-Niu ist ein Mädchen und ein junges Mädchen darf nicht im Freien unter Bäumen einschlafen,« belehrte mich Li Bai. »Tut sie es, so kommt ein Vampir, und dann hat sie ein Kind, das weder ein Mensch noch ein Tier ist,« fügte er ganz ernsthaft hinzu.
»Li Bai, das glaubst du doch nicht?« rief ich verwundert, aber mein kleiner Chinese schüttelte nur den Kopf und meinte, daß ich nicht lachen sollte über Sachen, die ich nicht verstünde.
An Dämone und Vampire glauben Chinesen, wie die Katholiken an die Heiligen.
| Barnets smil og glaede söd |
| er som livet uten død. |
| Barnesmil og barnetro |
| bygger over døden bro. |
| Norwegisches Lied. |
XVI.
Langsam verstrichen die Wochen, sie glitten fast unbemerkt an mir vorbei, die ich leidend auf den Kissen meines Lagers lag und die Zeit herbeisehnte, wo ein kleines süßes Wesen die gefürchtete Einsamkeit auf immer von mir nehmen würde. Li Bai war aufmerksam gegen mich, aber wie verschieden von den Männern des fernen Okzidents! Wie unempfindlich gegen die körperlichen Leiden seiner Mitmenschen, wie verständnislos gegen jedes tiefere seelische Weh. Er konnte kindlich heiter oder männlich brutal sein – Mann in des Wortes schönster Bedeutung war er nie.
Jenny schrieb mir oft. Sie war mit dem Doktor verheiratet und im zehnten Himmel oder so klang es wenigstens aus ihren Zeilen heraus. Ich gönnte dem Kinde sein reines Glück, aber ich vermochte nicht ganz die Frage zu unterdrücken, warum Jennys Geschick so viel, viel lichter als das meinige sein durfte, warum ich immer nur Pech, sie immer nur Glück hatte? Hunderterlei philosophische Betrachtungen ließen sich daran knüpfen und doch wollte mich keine Antwort befriedigen. Wieviel glücklicher als wir Menschen waren die elenden Raupen, auf die wir doch nur mit Verachtung herabsahen! Jede hatte dieselben Lebensberechtigungen und genoß dieselben Freuden wie ihre Nachbarin, kein weniger vorteilhaftes Aeußere schnitt ihre Glückschancen jäh ab, keine Gewissensbisse konnten eine Raupenexistenz trüben, keine leidenschaftlichen Wünsche ein Raupeninneres erzittern machen, es sei denn der Wunsch, ein saftiges Blatt zu verspeisen. Hatte eine Raupe einen Baum voll solcher Blätter gefunden, konnten die anderen gewiß sein, auch auf denselben Baum klettern zu dürfen. Mein ewig forschender Geist versuchte und versuchte immer vergeblich das Rätsel unseres Seins zu lösen. Li Bai litt nie unter dieserlei Gedanken, ihm war alles gleich, wenn er nur hübsche Kleider, Geld, genug Speise und Trank und – Mädchen hatte, alles andere hatte keine Bedeutung für ihn.
Nur ein Ereignis aus dieser Zeit steht klar vor meinen Blicken. Unser Nachbar, Herr Liang Tse, wurde plötzlich zu seinen Vorfahren einberufen, und da er nicht nur ein alter Nachbar, sondern auch ein guter Freund des Mandarins war, nahm unsere ganze Familie regen Anteil an dem Unglücksfall. Unter reger Teilnahme darf man nun freilich nicht unser europäisches Mitleid verstehen – so etwas kennt ein Chinese nicht –, wohl aber ein Sichwichtigmachen und ununterbrochenes Hin- und Herlaufen zwischen unserem Hause und dem Sterbehause der Liang Tses.
Sieben Tage lang darf nämlich daheim nichts gekocht werden, und daher bringen alle Nachbarn die nötigen Lebensmittel in das Sterbehaus, die aber nicht mit den Speisestäbchen, sondern nur mit den Fingern in den Mund befördert werden. Wenn man bedenkt, daß die Vorschrift ebenfalls befiehlt, daß man sich in der Zeit weder waschen noch die Haare schneiden, noch die Nägel verkürzen soll, so wird man leicht begreifen, wie unendlich appetitlich so eine Hand am siebenten Tag aussieht – für europäische Begriffe natürlich, denn ein Chinese sieht nicht den Schmutz, sondern lediglich die große Trauer der Hinterbliebenen in einer solchen Handlung.
Die weiblichen Familienmitglieder müssen Tag und Nacht bei der Leiche bleiben, und alle müssen so laut als möglich ihre Klagen gegen den Himmel (oder die Zimmerdecke) schreien. Wer das Sterbezimmer betritt, muß auf Händen und Füßen herankriechen, um den Toten die gebührende Ehre zu zeigen. Parte werden auf braunem Papier geschrieben und durch die Neffen oder Enkel des Dahingeschiedenen in die Häuser aller Bekannten geschickt, aber man erwartet auch eine gewisse Belohnung für solche Aufmerksamkeit. Die so mit Parte bedachten Personen geben meist den Kindern einige Geldstücke, die beitragen, die hohen Begräbniskosten zu decken, denn so eine Beerdigung eines Hausvaters ist eine sehr kostspielige Sache in einem Lande, wo man den Toten viel mehr Ehren zollt als den Lebendigen.
Der Sarg allein, der mindestens so groß wie ein kleines Zimmer ist und aus dem dicksten Mahagoniholz sein muß, kostet sehr viel Geld und wird oft schon viele Jahre vor seinem Ableben von dem Manne selbst gekauft und nach und nach abgezahlt. In der Mitte dieser großen Kiste ist eine Oeffnung, groß genug, den Toten bequem ruhen zu lassen, rund um diese Vertiefung aber befinden sich allerlei Fächer, in die alle Kleider, Schmuckgegenstände usw. des Verstorbenen gelegt werden und die ihn in das Grab hinabbegleiten. Damit ist aber lange nicht genügt. Täglich müssen eine große Anzahl Räucherkerzen und wohlriechendes Holz verbrannt werden und der Tote darf nicht früher der Erde übergeben werden, bevor der Zauberer nicht den richtigen Platz gefunden hat, was oft recht viele Tage in Anspruch nimmt; ferner muß die Familie weiße Trauerkleider haben, die sie jedoch schon nach der Beerdigung gegen dunkelblaue (Halbtrauer) umtauschen können. Alle roten Papierstreifen im Hause müssen entfernt und diese durch weiße ersetzt werden, was alles viel Geld kostet; aber am meisten kostet wohl der lange Trauerzug.
Die Leiche wird mit einer Schicht Baumwolle umgeben und sodann der Sarg sorgfältig verklebt, damit auch nicht die allergeringste Spalte bleibt. Ist dies geschehen, so trägt man den Sarg, den zwanzig Männer kaum heben können, über die Schwelle und der Trauerzug setzt sich in Bewegung. Voran tragen Chinesen allerlei Nachahmungen von Dienern und Dienerinnen auf Papier, wie auch von Tieren, Hausgeräten aller Art, von Kleidungsstücken und ähnlichen Sachen, die alle auf dem Grabe feierlich verbrannt werden und mit denen sich der Geist in der nächsten Welt seinen neuen Haushalt gründet. Papierene Gold- und Silbermünzen werden auf den Weg gestreut, damit die Dämone über sie herfallen und den Toten unbeachtet lassen. Viele Räucherkerzen und Papiere werden unterwegs und auf dem Grabe verbrannt, und die Leidtragenden stimmen die ohrenzerreißendsten Klagegesänge an. Die Söhne des Dahingeschiedenen müssen immer von zwei Chinesen unter den Armen gehalten werden, weil man annimmt, daß sie vor lauter Gram und Kummer nicht gehen können, aber in Wirklichkeit ist ihr Schmerz keineswegs allzu groß. Wirft sich gar ein Sohn in den Staub, um darin herumzurollen und Jammerlaute auszustoßen, so muß der Zug stehenbleiben, bis der Mustersohn sich wieder gefaßt hat, und so eine öffentliche Kummerbezeugung wird ihm sehr hoch angerechnet. Bei den Chinesen mehr als bei allen anderen Völkern gilt überall und vor allem der Schein.
Am Grabe angekommen, das fast durchwegs die Form eines Hufeisens hat und das immer bewacht ist, da die großen mitversenkten Schätze die Banditen sehr anlocken, werden alle nachgeahmten Tiere, Diener, Hausgeräte usw. verbrannt, Räucherkerzen ebenfalls, das Jammergeschrei der Leidtragenden muß meilenweit hörbar sein und dann erst darf man an den Rückmarsch denken. Fahren darf niemand und da oft ein Beerdigungsplatz viele Stunden weit entfernt liegt, kommen die Leidtragenden mehr tot als lebendig heim. Aber was tut's? Sie haben ihre Pflicht erfüllt und ein schönes Beispiel kindlicher Liebe und Hingebung gegeben.
Hundert Tage nach dem Sterbetag des Vaters wird seine Namenstafel dem Hausaltare eingefügt, vor dem der jetzige Hausherr täglich seinen Kotau machen muß, und damit ist die Geschichte erledigt. Nein, nicht ganz! Denn drei Jahre lang sollen die Kinder Trauer tragen und in der Zeit dürfen sie keine Ehen schließen. Man beschränkt die Trauerzeit jedoch heutzutage meist auf zweieinviertel Jahr, was noch immerhin sehr lange für unsere Begriffe ist.
Li Bai, der sich vor dem Tode sehr fürchtete und mir oft sagte, daß er lieber ein blinder lahmer Krüppel sein würde als sterben zu wollen, war durch dieses Ereignis sehr niedergedrückt und bekam einen bösen Anfall nach dem anderen, was natürlich in Grausamkeiten, wenn nicht in Werken, so doch in Worten, mir gegenüber sein Ende nahm. Auch war er von beispiellosem Aberglauben.
»Wenn eine Katze auf dem Dache oberhalb des Sterbezimmers ist und ein Hund unter das Bett des Toten kriecht, so kann der Tote aufstehen und dann tötet er alle, die er erreichen kann,« sagte er ganz überzeugt. »Und daher muß immer ein Wächter das Dach bewachen und die Leute unten das Eindringen eines Hundes verhüten,« er rückte mir ganz ängstlich näher, »wenn es aber doch geschehen sollte, daß der Tote aufstehen kann, so muß man ihm einen Stock in die Hand geben, da faßt er ihn gleich mit beiden Armen und fällt um und dann kann man sich ihm ruhig nähern und ihn zurück auf das Bett legen.«
Auch wußte er von Toten zu erzählen, die im Sarge laut geschrien hätten, von Dämonen, die allerlei Unfug getrieben, weil man nicht Räucherkerzen genug abgebrannt hatte, von Vampiren, die sich auf den Körper ihres vorigen Feindes stürzten und sein Blut langsam aussaugten und vieles dieser Art.
Grausame Geschichten gefallen dem chinesischen Temperament, grausame Strafen zu ersinnen ist ihnen ein seelischer Hochgenuß. Li Bai konnte ein wahres Vergnügen daran finden, mir trotz meines Zustandes von Enthauptungen chinesischer Verbrecher zu erzählen und die furchtbare Methode des langsamen Verbrennens einer Gattenmörderin zu beschreiben, der man ein chemisches Präparat in Gestalt einer Stange in den Magen stößt, das sie langsam innerlich verbrennt. Drei Tage und drei Nächte leidet das Opfer die furchtbarsten Schmerzen, bevor endlich die Erlösung eintritt. Die Folter wird noch allgemein angewendet und die verschiedenen Todesarten sind allzu grausam, als daß ich sie hier beschreiben wollte. Sie scheinen den Chinesen keineswegs zu hart und eins ist gewiß: Sie empfinden körperlichen Schmerz nicht wie wir. Sie ertragen Foltern, die kein weißer Mann aushalten könnte und sie verstümmeln absichtlich ihre Glieder, brennen ohne Klagen ihre eigenen Augen aus oder schlagen sich mit einem Stein Beulen auf den Kopf, um sich zum Bettlerfache auszubilden. Sie gehen an menschlichem Elend mitleidslos vorüber, vielleicht weil oftmalige Hungersnot, Seuchen und Ueberschwemmungen sie unempfindlicher gemacht haben, sie sind heldenmütig im Ertragen ihrer Leiden und Krankheiten, welche sie meist dem Einflusse böser Geister zuschreiben, und sie sind kaltblütiger als wir. Ihre Moral ist nicht unsere Moral, ihre Neigungen stimmen nicht mit den unsrigen überein. Sie sind fesselnde Bekanntschaften und schlechte Verwandte; als Diener sind sie schweigsam, fleißig, genügsam und ausdauernd, sehr schmutzig, unredlich und verlogen. In ihrer Heimat sind sie ebenso gut, wie wir in der unsrigen, aber wie wir nicht zu ihnen passen, passen auch sie nicht zu uns. Der Mond hat gewisse Vorzüge, seine Schönheit und seinen Wert, aber er muß am Nachthimmel sich zeigen. Vereint am Himmel können Sonne und Mond nicht stehen, ohne sich gegenseitig allzusehr zu benachteiligen. Westen ist Westen und Osten ist Osten, sagt Kipling, aber die beiden können sich nie treffen. – Nein, nie treffen in gleichen Anschauungen, gleichen Grundsätzen, gleichem Ziele zusteuernd. –
Täglich trat bei Li Bai mehr und mehr der materialistische Zug seines Wesens hervor, die Kopfschmerzen, die, wie wir endlich entdeckten, von dem unsinnigen Brauch herrührten, sich eine schlanke Mitte zu schaffen und zu erhalten, indem er einen breiten Ledergürtel straff über den Magen spannte, nahmen immer zu und seine Wutausbrüche wurden nicht geringer. Er sollte immer studieren, um im Herbst nach Europa zurückzukehren – der einzige Hoffnungsstrahl, der das grausige Dunkel meines Lebens erhellte – und dies wollte er nicht. Er liebte das tatenlose Dahinleben, das Zeitvergeuden und die oberflächlichen Gespräche, die er mit seinen Freunden pflegen konnte, und wollte auch, zu seiner Ehre sei es gesagt, seiner Mutter gern als Schutz gegen die Konkubinen seines Vaters zurückbleiben, aber der Mandarin übte seine ganze Strenge aus und ich tat, was ich vermochte, um ihm den Uebergang vom Nichtstun zur Arbeit so leicht als möglich zu gestalten.
Ein heißer, wolkenloser Junitag. Li Bai stand vor dem großen Spiegel in der Ecke unseres Schlafgemachs und rasierte sich – etwas, das er nie zu tun versäumte, da er sich glühend einen Bart wünschte, der aber bei den Chinesen selten vor dem Alter von vierzig Jahren sichtbar wird und daher, weil ein Zeichen weiseren Alters, immer Ehrfurcht einflößt; aber obschon er mir oft beteuerte, daß sich schon eine Unzahl Haare zeigten, muß ich gestehen, daß ich nie den Schatten auch nur eines einzigen kleinen Härleins entdecken konnte und sein Gesicht so glatt wie die reinste Haut eines jungen Mädchens war.
Ich fühlte mich elend – elend – und doch hatte der Zauberer mir den Storchbesuch erst für Anfang August angekündigt, aber jedenfalls hatten die ununterbrochenen kleineren und größeren Aufregungen das ihre beigetragen. Ich schrie auf und sank bewußtlos zurück.
Als ich die Augen wieder aufschlug, stand Li Bai über mich gebeugt da und fragte, ob ich mich nicht ganz wohl fühlte.
»Li Bai,« sagte ich bittend, indem ich meine letzten Kräfte aufraffte, »sende jemand in das englische Hospital.«
Einen Augenblick schien es, als wollte er Einwendungen machen, dann aber mußte mein Aussehen wohl jeden Zweifel getilgt haben, denn er machte sich daran auszugehen. Bevor er das Zimmer verließ, trat er noch einmal an mein Lager, wo ich schweißbedeckt und stöhnend lag.
»Mutter wird bald kommen und die ›Nurse‹ auch,« sagte er, »und mach' dir nichts daraus, wenn du ein paar Stunden große Schmerzen hast. Das ist immer so.« Damit nahm er seinen Fächer und verschwand. –
Alles, was später geschah, schwebt mir eher als schrecklicher Traum vor, nicht als Wirklichkeit. Ich litt furchtbar und, wie es mir deuchte, eine Ewigkeit, aber es wird, wie Li Bai so anteilnehmend sagte, nur einige Stunden gewesen sein. Man gab mir Chloroform und so oft ich meine Augen öffnete, neigte eine freundliche blonde Krankenpflegerin sich über mich, die mir zulächelte und mir meine Lage nach Kräften erleichterte und ein dicker Doktor sprach ermutigende Worte – dann – dann – sank ich in langes, langes Vergessen zurück, aus dem ich nach Fieber und Leiden erst drei Wochen später erwachte.
Die Sonne warf durch eine Spalte einen einzelnen Sonnenstrahl über den dunklen Teppich, als ich wieder zu vollem Bewußtsein erwachte. Mir gegenüber saß die Nurse und arbeitete an einer Stickerei. Sie stand sofort auf und trat an das Lager.
»Wieder wohl und frisch?« lächelte sie.
»Nein,« entgegnete ich matt, »nur noch nicht tot.« Das Wort »frisch« erschien mir der schrecklichste Hohn, war ich doch so schwach, daß es mich Ueberwindung kostete, den Arm zu heben.
»Jetzt wird es schnell gehen und Sie werden zu Kräften gelangen,« sagte sie liebenswürdig.
»Was ist mit mir geschehen?« fragte ich und erst dann kam volles Verständnis für alles Vorgefallene zurück.
Die Nurse lächelte geheimnisvoll und eine Flut von neuem Empfinden erwachte mit diesem Lächeln in mir.
»Mein Baby?« sagte ich und fühlte, wie jeder Blutstropfen mir zum Herzen strömte.
»Ein Knabe!« sagte die Krankenpflegerin. »Er ist bei seiner Großmama.«
Gerade da kam Li Bai. Er neigte sich über mich mit derselben gleichmütigen Höflichkeit, die ich so gut an ihm kannte – ohne ein Wort des Bedauerns, daß ich so sehr gelitten – um seinetwillen gelitten – hatte, ohne Zärtlichkeit dafür, daß er nun den erwünschten Erben hatte. Ich hatte meine Schuldigkeit als Weibchen getan – damit war alles erledigt. –
»Siehst du,« sagte er stolz und triumphierend, »daß ich recht hatte! Ich habe dir einen reizenden Sohn gegeben mit meinen Zaubereien, und du kannst mir dankbar sein.«
Also die Dankesschuld war meinerseits??! – Das beweist, daß jedes Ding auf Erden von zwei Gesichtspunkten aus gesehen werden kann und man nur zu wählen braucht, bis man den passenden findet.
Frau Ming Tse kam nun auch und in viele Seidentücher gehüllt, brachte sie meinen kleinen Sohn, der ohne mein Wissen »Sing« genannt worden war, dessen Horoskop aufgestellt wurde und der schon die Silberkette um den Körper gewickelt trug, die ich allein ihm hätte geben sollen. In der Tat, ich war Mutter nur in zweiter Linie in den Augen aller dieser Menschen.
Mit zitternden Händen griff ich begierig nach dem Bündel, das meinen Schatz enthielt, und nun fielen meine Augen zum erstenmal auf das Wesen, um dessentwillen ich so viel leiden mußte, das mir im fernen Land ein Trost und eine Stütze werden sollte, ein Band vielleicht, das mir helfen würde, wo alles andere mißlang, die Seele und das Herz meines chinesischen Gatten zu finden oder zu erwecken.
Vor mir lag ein kleines Geschöpfchen mit weißer Gesichtsfarbe aber ganz chinesischen Zügen. Die scharf geschlitzten Augen, die starken Backenknochen und die flache Nase ohne richtige Nasenwurzel, Li Bais etwas breite Lippen und sein straffes schwarzes Haar – ja, Klein-Sing war ganz und gar Chinese, trotz der Hautfarbe – das einzige, was er von seiner Mutter hatte. Würde seine Seele mir ähneln oder kalt und gefühllos wie die Herzen der Chinesen sein? Jetzt hoben sich langsam die wimpernlosen Lider und ein Paar nachtschwarze Aeuglein sahen mich verwundert an, dann verzog sich das kleine Schnäuzchen meines Sohnes und Erben, und ein lautes »Ä-ä« wurde hörbar. Ich hatte meine Mitmenschen, mein Vaterland, Li Bai und alles vergessen. Ich dachte nur an das kleine Wesen, das hier in meinen Armen lag und das so wunderschön – oder so schien es mir – »A-ä« sagte.
Die Schwiegermutter streckte ihre knochigen Hände nach der süßen Last aus, aber ich preßte Sing fester an mich. Er war mein, ganz mein eigen und niemand sollte ihn berühren.
Li Bai neigte sich über mich.
»Du wirst müde sein, Käthe, laß' Sing meiner Mutter. Sie hat ihn so lieb.«
»Ich habe ihn auch lieb,« erwiderte ich und meine Augen funkelten, »und Sing ist mein Kind!«
»Gewiß,« sagte er finster, »aber auch das meine.« Damit ergriff er das Bündel, das mir so viel Freude bereitete, wenn es mir auch nicht wie mein Kind vorkam, dieser kleine, komische Chinese, den ich doch so innig liebhaben wollte und so gern zu behalten wünschte, ergriff es und reichte es seiner Mutter, die damit verschwand.
Ich legte mein Haupt müde auf die Kissen und fühlte, wie eine Träne nach der anderen über meine eingefallenen Wangen rann. Die Nurse neigte sich tröstend über mich. Li Bai war verschwunden.
»Ich hole es später wieder,« sagte sie leise, trocknete meine Tränen ab und gab mir etwas zu trinken, woraufhin ich einschlief und die Gegenwart vergaß.
Mama hatte sehr beglückt geschrieben – Li Bai hatte ihr die Geburt meines Sohnes telegraphisch mitgeteilt – und Jenny bat mich, ihr den gelben Neffen recht bald nach Europa zur Beschauung zu bringen. Sie war sehr glücklich in ihrer Ehe und lebte mit dem Doktor von allen Tanten fern in Mainz am schönen Rhein. Auch sie erwartete einen Erben und freute sich auf das kommende Glück. Ach ja, sie würde ihr Kind auch für sich behalten dürfen!
In der Nacht durfte ich Sing bei mir haben, und das Kind weinte nie. Früh am Morgen kam die gefürchtete Schwiegermutter und trug es davon, und den Rest des Tages verbrachten wir damit, das Kind uns gegenseitig wegzustehlen. War Li Bai daheim, so war seine gleichförmige Bemerkung:
»Sie ist die Mutter – wir sind nicht aus der Erde gekrochen, sondern eine Mutter hat uns geboren; wir schulden ihr Achtung und Gehorsam, wenn sie also Sing haben will, mußt du ihr das Kind lassen.«
Manchmal lehnte ich mich dagegen auf, manchmal ließ ich meinen Schatz klaglos davontragen und die Mutter, die gewiß sah, daß ich unter der Trennung mit Sing litt, tat was sie konnte, um ihn mir oft wegzunehmen.
Es mochten seit des Kleinen Geburt zehn Wochen vergangen sein, als der Mandarin, der seinen Enkel auch manchmal auf die Arme nahm (denn Kinder liebt man überall in China), zu mir kam, um mir einige wichtige Briefe zur Beantwortung zu überreichen. Er fand mich nicht wie sonst lesend oder studierend – mein einziger Trost in meiner Verlassenheit –, sondern auf dem Lager ausgestreckt, bitterlich weinend vor. Obschon er nicht danach aussah, als ob er zu den Personen gehören würde, die Herzensergüsse mit Verständnis entgegennehmen, vertraute ich ihm auf seine Frage nach meinem Kummer doch an, daß wir in Europa gewöhnt sind, unsere Kinder selbst zu haben, und daß ich mich so unendlich verlassen fühlte, da Li Bai immer bei seiner Mutter, bei seinen Brüdern oder bei Freunden in Tientsin weilte, ich meinerseits durch meine Ehe abgeschnitten von den Gefährten meiner Rasse sei und so nicht mehr wisse, wie ich dieses Leben in tiefster Einsamkeit aushalten solle.
Ich hatte erwartet, den Mandarin böse zu sehen, hatte selbst gedacht, daß er mir geradeswegs sagen würde, ich könnte ja zu dem Mittel greifen, zu dem so viele unglückliche Chinesinnen greifen mußten – nämlich dem Wasser, durch das der Rauch der langen chinesischen Pfeifen gezogen ist und das, wie bitter es auch schmecken soll, doch unfehlbar zu einer Reisekarte in die Ewigkeit verhilft.
Nichts Derartiges geschah. Ernst und nachdenklich ruhten seine Augen auf mir, und nach einer kleinen Weile sagte er, wenn auch scheinbar ohne Mitgefühl in seiner Stimme:
»Li Bai ist zu sehr Chinese, als daß er einer Europäerin einen guten Gatten machen könnte!« meinte er kopfschüttelnd.
»Glauben Sie,« fragte er nach einer Pause, »daß Li Bai je das Doktorat machen wird?«
»Nein!« sagte ich aufrichtig. »Er hat keinen Ehrgeiz, keinen Fleiß, kein Interesse. Alle meine Bemühungen waren erfolglos!« gestand ich geknickt.
»Dies war nicht Ihre Schuld!« entgegnete er. »Sie sollen nicht mehr so lange allein sein!« sagte er sodann und ging.
Von da an durfte ich Sing den ganzen Vormittag behalten und am Abend brachte man ihn mir schon früh, aber ich beobachtete, daß der Blick meiner Schwiegermutter unendlich feindselig auf mir ruhte, wenn sie auch nicht mehr wagte, Sing so lange wie früher von mir fernzuhalten. Ein leises Grauen beschlich mich oft, wenn ich sie so lautlos herbeischleichen sah und ihre ölige Stimme vernahm, die immer einige höfliche Erwiderungen auf meinen tiefen Kotau hatte. Aeußerlich sprach nichts – es sei denn das unmerkliche Zucken um die Augen und Mundwinkel – von ihrer Abneigung gegen mich, aber eine Art sechster Sinn ließen mich diese ihre Gefühle wissen, als ob sie es mir offen gesagt hätte.
Mit Hilfe Li Bais gelang es ihr noch an manchen Tagen, den Kleinen fortzutragen, aber sie wagte nicht mehr sich zu weigern, ihn auszuliefern, wenn ich nach einiger Zeit mit Kotau und höflicher Bitte meinen Sprößling abholte. Sie reichte ihn mir mit den öligsten Worten und dem verbindlichsten Lächeln, aber die wimperlosen Lider senkten sich über die Augen, und die kleinen knochigen Hände ballten sich, als wollten sie einen unsichtbaren Feind erwürgen.
Und Wochen kamen und gingen. Sie brachten mich immer näher dem Ereignis, das für meine Zukunft entscheidend werden sollte.

A. F. Seebacher |
| E vo' senza ba taglia e senza gloria |
| E più non mi sorride il Dio d'un giorno. |
| Dentro è gelo e infinita ombra intorno |
| E sopita dei cieli è la memoria. |
| Ada Negri. |
XVII.
Es war in den ersten Septembertagen. Die große Hitze war vorüber, aber noch immer waren die Tage schwül, und es war angenehm, im Schatten der Bäume am fernen Weiher zu liegen. Sing war seit ein paar Stunden bei seiner Großmutter, da ich seit mehreren Tagen nicht wohl war. Ich konnte keine Krankheitsanzeichen angeben, nur Müdigkeit, Unlust zu jeder Arbeit und selbst zum Essen und Trinken. Li Bai war auf ein paar Tage verreist, die Geschäftsbriefe hatte ich trotz meiner Ermattung schon am Morgen vollendet, daher entschloß ich mich, in den Park zu gehen.
Als ich schon auf der Schwelle stand, kam die Dienerin meiner Schwiegermutter und fragte mit ihrem ergebensten Lächeln und mit vielen Demutsbezeugungen, ob ich nicht unter den schlanken Bambusrohren und den Teakbäumen ein wenig ruhen wollte, und ich nickte zustimmend. Wohl war es nicht mehr zu heiß in den Häusern selbst, aber etwas drückend war die Atmosphäre noch immer, deshalb schritt ich trotz meiner unerklärlichen Müdigkeit, die sich sogar auf mein Denkvermögen zu erstrecken begann, rüstig auf den Weiher zu, wo mir der Schatten der fremdartigen Sträucher in Herbstpracht entgegenschimmerte. Plötzlich fühlte ich eine unüberwindliche Sehnsucht nach meinem Kinde in mir erwachen. Wenn ich den kleinen weißen Chinesen – dieses seltsame Gemisch des Ostens und Westens – in meinen Armen hielt, schien es mir oft, als ob dies nicht ein Teil meines Selbst sein konnte. Da kam mir dieses fremdartige Wesen als etwas nicht zu mir Gehöriges vor, aber wenn ich die Augen schloß und nur sein weiches Gesichtchen an das meine preßte, da fühlte ich, wie ein unbeschreiblicher Strom von ihm auf mich überging und eine tiefe Liebe zu diesem Geschöpfchen in mir entbrannte. Vielleicht hatte er mein Wesen geerbt – oh, wie wunderschön wollte ich da seine Seele gestalten, voll Poesie, voll Verständnis für alles Schöne, alles Edle, alles Hohe! Wie wollte ich alles aufbieten, mir die Liebe meines Kindes zu sichern und ihm alle meine Gedanken zu weihen. Bis jetzt hatte ich es nicht verstanden, daß ein Weib Trost für alle Leiden in einem Kinde finden konnte, nun dämmerte das Begreifen dieser Tatsache langsam in mir. Müde wie ich war, schleppte ich mich, wie von einer inneren Macht gezogen, bis zu den Gemächern meiner Schwiegermutter. Das Zimmer war wider Erwarten ganz leer und nur auf der weichen Seidendecke lag etwas, was »ä-ä« sagte und seine winzigen Fingerchen zu zählen schien.
»Sing!« rief ich und umschlang leidenschaftlich den gefundenen Schatz. Niemand war anwesend, um ihn mir streitig zu machen, und ihn auf und ab schaukelnd und Zukunftspläne entwerfend, gingen wir, besser ging ich auf den Weiher zu. Die Sonne stand schon tief im Westen und ihre letzten Strahlen vergoldeten mit magischen Farbenspiegelungen das bunte Laub der Bäume. War es der Sonnenschein, war es meine Stimme, die immer wieder mit steigender Zärtlichkeit seinen Namen rief, war es die Ahnung von etwas, was außerhalb unseres alltäglichen Bewußtseins liegt – Sing lächelte mir zum erstenmal zu und streckte seine kleinen Aermchen mir entgegen. Ich blieb stehen, hob ihn hoch zu mir empor und preßte sein Gesichtchen gegen meine Lippen.
»Sing, Sing, mein Liebling!« flüsterte ich.
Die großen schwarzen Augen waren weit geöffnet und leuchteten seltsam, die kleinen Händchen griffen nach meinen Haaren, meiner Nase und glitten wie liebkosend über meine Wangen herab. Das kleine Mündchen lächelte, und Laute, die unzweifelhaft etwas Liebes bedeuten sollten, kamen von den dicken Lippen. Noch einmal küßte ich allen gelben Schwiegermüttern zum Trotz das zarte Antlitz meines Sohnes, und dann schritt ich auf die kleine gewölbte Brücke zu, die über den Weiher zu dem lauschigen Plätzchen führte. Hinter mir hörte ich die Dienerin schreien, die immer wiederholte:
»Sie hat das Kind! Sie hat das Kind!« was mich mit geheimer Genugtuung erfüllte.
Nun hörte ich auch die Stimme meiner Schwiegermutter, die mir lebhaft etwas zurief, aber ich nahm keine Notiz davon. Sie hatte mir selbst sagen lassen, ich möge mich unter die Teakbäume legen und ausruhen, und es konnte sie doch wahrlich nicht wundernehmen, wenn ich meinen Sohn mitnahm. Warum schrie sie plötzlich so wild, ich solle umkehren?
»Ka, Ka,« hörte ich sie rufen (das war ihr Name für mich, der in der Tat sehr chinesisch klang, wenn man ihn so veränderte), »bringe Sing zurück. Bleib' stehen!« rief sie wieder auf Chinesisch.
»Sie denkt, sie kann mir mein Kind wegnehmen, weil der Mandarin abwesend ist und Li Bai auch, aber darin soll sie sich irren. Ich behalte mein Kind – jetzt und in Zukunft!«
Hinter mir klang das eilige Laufen zweier Paare Füße, die mir mein höchstes Gut entreißen wollten, oder so dachte ich, da mein Herz voll Bitterkeit und Mißtrauen gegen meine Schwiegermutter war. Ohne mich umzusehen und nur Sing liebend gegen mich drückend, betrat ich den kleinen Steg. Mir deuchte, als hätte jemand hinter mir einen Schreckensruf ausgestoßen, aber ich war meiner Sache nicht sicher und dachte, daß es sich um einen Wutausbruch der Chinesin handelte. Doch als ich mich der Mitte des Weihers näherte, fühlte ich, wie die Brücke langsam nachgab und unter mir zusammensank.
Ein leichter Krach, ein gellender Aufschrei von meinen Lippen, der aus zwei anderen Lippen ein Echo fand, und ich glitt hinunter in die Tiefe. Verzweifelnde Anstrengungen machend, um die Oberfläche zu erreichen oder doch das Kind über den Wasserspiegel zu heben, klammerte ich mich mit der einen freien Hand fest an die Reste der eingebrochenen Brücke und versuchte mich emporzuschwingen, doch vergeblich. Ein wahnsinniger Schmerz im Fuß verhinderte mich daran. Ich hatte ihn zwischen ein Brett hineingeklemmt und verstand plötzlich, daß ich nicht an die Oberfläche gelangen konnte, daß man den Steg eigens hatte durchsägen lassen, um mich durch einen »Unfall«, wie man am Konsulat melden würde, aus dem Leben zu schaffen. Li Bai hatte einen Träger seines Namens – die Mutter des Kindes, die verhaßte Europäerin, sollte sterben.
Oh, die grausigen Sekunden, bevor ich ganz das Bewußtsein verlor, das entsetzliche Verstehen, daß das zarte Kind in meinen Armen steif wurde, daß dies Seelchen dahin zurückkehrte, woher es gekommen, eins wurde mit Tao. Wenn Tao alles war, dieses langsame Hingleiten von heftigem Todeskampfe in ruhigeres Hinsterben, das Rauschen in den Ohren, das dem Sterbenden das Brausen der Todesschwingen zu sein scheint, und dann die Nacht, die endlich Vergessen bringt. – – –
Als ich wieder zum Bewußtsein erwachte, lag ich auf dem Rasen am Rande des Weihers, über mich neigte sich scheinbar gelassen und ruhig wie immer der gestrenge Mandarin, und in den Armen hielt ich, noch immer leidenschaftlich fest an mich gepreßt, Sing, mein totes Kind! Langsam fielen meine Arme nieder, langsam schlossen sich die Lider aufs neue, die zu viel Elend gesehen hatten, um mehr schauen zu wollen, und nur wie im Traume hörte ich, wie der Mandarin zum englischen Arzte sagte:
»Sie hat das Bein gebrochen und soll in das Hospital gebracht werden!«
»Wäre sie nicht besser daheim aufgehoben als unter Fremden?« fragte der Doktor sichtlich verwundert.
»Sie ist am besten bei Ihnen untergebracht!« entgegnete im selben gelassenen Tone der Mandarin, aber ich hörte heraus, daß er den teuflischen Plan durchschaut hatte und mich in Sicherheit zu bringen wünschte.
Ich fühlte, wie man mich auf eine Tragbahre legte, dann schwanden mir die Sinne. – – –
Sechs Wochen waren ins Land gezogen, die kalten Oktobertage senkten ihre Nebelschleier auf Tientsin herab und ein feiner Regen schlug gegen die Fenster des Saales, in welchem ich auf einem großen Bette lag und auf meinen Fuß sah, der heute zum erstenmal aus dem Gipsverband genommen worden war.
Ueber fünf Wochen hatte ich in heftigen Fieberphantasien gelegen und nichts von dem gewußt, was draußen in der Welt vorgefallen war. Li Bai war gestern zu mir gekommen, kalt und höflich wie immer vor allen Fremden, und hatte sein Bedauern über mein »Mißgeschick«, wie er es nannte, ausgedrückt. Ich hatte die Nurse gebeten, uns allein zu lassen, und ihm dann alles so erzählt, wie es sich zugetragen hatte.
»Wir müssen eine eigene Wohnung haben, Li Bai!« sagte ich energisch. »Der Arzt hat Vergiftungserscheinungen in mir entdeckt und ich weigere mich, in das Haus deiner Mutter zurückzukehren!«
»Sie wird dir vergeben, wenn du sie um Verzeihung bittest!« sagte er. »Sie ist gut.«
»Soll ich sie um Vergebung bitten, weil sie mich umbringen wollte?« fragte ich und meine Augen blickten finster forschend in die meines Gatten.
Er schwieg und wandte sich ab.
»Soll ich mich entschuldigen, weil sie mein Kind getötet?« fragte ich noch einmal, und selbst diese elende kleine Gestalt fuhr bei dem Tone zusammen.
»Warum hast du ihr das Kind nicht gegeben, als sie es verlangt hat?« fragte er mich, und einen böseren Blick habe ich nie in menschlichen Augen gesehen.
Eine Pause entstand.
»Ich werde nie nach Europa zurückkehren,« warf er bitter hin, »und wenn mein Vater mich noch so sehr zwingen wollte. Lieber –« er vollendete nicht.
Der Arzt erschien mit der Wärterin, und da die Unterredung wieder Fieberanzeichen hervorgerufen hatte, verbot der Doktor Li Bai weitere Besuche während der nächsten Tage.
Ich starrte eben auf meinen ausgewickelten Fuß, auf dem wieder Strumpf und Schuh saßen, als sich die Saaltür öffnete und der Mandarin erschien.
»Besser, Ka?« fragte er.
»Ja, danke, leider!« erwiderte ich bitter.
Seine Augen sahen mich forschend an. »War Li Bai hier?«
»Gestern.« Ich schwieg einige Sekunden lang, nicht wissend, was oder vielmehr wie ich sagen sollte, was gesagt werden mußte.
»Er will nicht nach Europa zurück – er will auch seine Mutter nicht verlassen – und –« ich sank müde auf das Krankenlager zurück.
»Ka,« sagte er, »Sie sind ein tapferes Mädchen, das heißt, eine tapfere Frau!« verbesserte er sich. »Sie haben Jenny gegen meinen Willen vor – vielem – gerettet.«
Er berührte zum Abschied flüchtig meine Hand, eine seltene Gunstbezeugung, und sagte dann mit etwas wie Mitleid in der Stimme:
»Wenn Sie das Hospital verlassen können, so kommen Sie zu mir zur Bank und da – da werden wir sprechen.« Damit ging er.
Ein paar Tage humpelte ich mühselig zwischen den Betten auf und ab, um meinen Fuß wieder in Ordnung zu bringen, dann ging es besser, und eine Woche nach meiner Unterredung mit dem Mandarin durfte ich das Hospital verlassen.
Um zehn Uhr stand ich, schwach und vor Kälte trotz meiner Pelze heftig zitternd, vor der Bank meines Schwiegervaters. Vielleicht war es auch Aufregung, was meine Zähne so unheimlich gegeneinander klappern ließ. Derselbe Diener, der uns vor einem Jahre die Tür geöffnet hatte, schlug nun dieselbe für mich allein zurück, und ich stand vor dem Mandarin, der mich mit einer höflichen Handbewegung aufforderte, Platz zu nehmen.
Eine Weile saßen wir uns stumm und regungslos gegenüber, dann sagte der Bankdirektor mit einer Festigkeit und Unumwundenheit, die gegen alle chinesischen Grundsätze und alle Ueberlieferungen des Himmlischen Reiches verstieß:
»Li Bai, mein jüngster Sohn, ist ein Esel.«
Ich widersprach nicht, denn, wenn eine Tatsache so einleuchtend ist, wie diese, ist selbst chinesische Höflichkeit nicht mehr vonnöten.
»Ka,« fuhr er fort, »Sie sind eine sehr nette, kluge und immer gefällige Schwiegertochter gewesen. Ich möchte nur ungern Unannehmlichkeiten mit dem deutschen Konsul haben. Wollen Sie nach Europa zurückkehren? Wollen Sie, daß wir eine Scheidung einleiten und als Grund – als Grund –«
»Böse Zunge der Gattin angeben!« sagte ich. »Das ist ein Scheidungsgrund in China und das genügt.«
»Aber dies gilt nicht vor Ihrem Konsul!« sagte er.
»Mangel an Uebereinstimmungsvermögen, Untreue, was Sie wollen, nur lassen Sie mich nach Europa zurück!« versetzte ich müde.
»Wir werden Li Bai die Schuld geben,« sagte der Mandarin entschieden, »und ich werde nicht nur das von Ihrer Mama in meiner Bank niedergelegte Vermögen sofort auf eine europäische Bank überschreiben lassen, sondern Ihnen, wie vereinbart gewesen, einen jährlichen Betrag von –«
Ich lehnte ab. Ich wollte von den Chinesen nichts haben, aber was immer die Bewohner der Mitte auch sein mögen, redliche Geschäftsleute sind sie. Die Heirat war eine mißglückte Unternehmung, und er bezahlte ohne Murren das Defizit.
Eine Viertelstunde später war alles besprochen und ich kehrte in das Hospital zurück, um im Rekonvaleszentenheim noch so lange zu bleiben, bis die Scheidung vor dem chinesischen Magistrat und dem deutschen Konsulat vollzogen war, was in der nächsten Woche schon vorüber sein sollte. Heimkehren unter sein Dach wollte ich nicht, und darin gab mir der Mandarin vollkommen recht.
Die Scheidung sollte am 1. November vollzogen werden. Meine Koffer waren alle von Li Bai gepackt und nach Hongkong geschickt worden, da ich die Seereise zurück machen wollte; Mama hatte ich schriftlich von meiner veränderten Lage mit Bedauern (ich wußte, wie sehr sie auf die öffentliche Meinung hielt) Nachricht gegeben und zugleich mitgeteilt, daß ich erst einige Monate später reisen würde und auch bei meiner Heimkehr Jenny besuchen, aber nicht in meine Vaterstadt kommen wollte, um ihr alle Unannehmlichkeiten zu ersparen. Folglich war alles angeordnet und ich wieder frei – ach frei! Nur ein Gang blieb noch, ein schwerer. Ich hatte meinen Schwiegervater gebeten, Sings Grab besuchen zu dürfen, und heute kam er, mich am Vorabend meiner Scheidung noch einmal durch den Garten zu begleiten, wo so unendlich viel Bitteres mir begegnet war.
Oede und feucht lag er vor mir, als ich an der Seite des Mandarins auf den Weiher zuschritt, die wieder hergestellte Brücke überschritt und unter den Teakbäumen vor dem Grabe meines Söhnchens stand. Keine geweihte Erde umhüllte seinen kleinen Sarg, kein Grabstein zeigte die Stelle, wo er begraben lag, nur einige kleine Steinchen zeigten den Ort, wo man die Kinderleiche der Erde anvertraut hatte.
»Schlaf' in Frieden, du mein lieber, kleiner Chinese!« flüsterte ich zärtlich. »Du hast nun abgestreift den Körper, den dein Vater dir gegeben hat, doch das Stücklein Seele, das du von mir erhalten, von deiner europäischen Mutter, die fühlen und leiden und entsagen konnte, das hast du hinübergerettet, wo es kein Leid mehr gibt. Mit deinem Scheiden, süßer kleiner Engel, hast du das Band zerschnitten, das deine unglückliche Mutter an Chinesen knüpfte, das sie in fremden Landen bei grausamen Menschen zurückhielt. Hab' Dank und schlaf' in Frieden hier in fremder Erde! Deinen zarten Körper muß ich zurücklassen, dein Seelchen aber bleibt mit mir verbunden, bis der Engel Gottes einst die Toten weckt!«
Ich brach einen kleinen Zweig von einem Teakbaum, dann ging ich wieder, begleitet von dem immer gelassenen Mandarin, durch den Hof und die vielen Pforten zurück. Weder Li Bai noch sonst irgend jemand kam mir nahe, aber als ich an dem Hause meiner gelben Schwiegermutter vorbeiging, schien es mir, als ob ein Vorhang bewegt worden wäre – vielleicht täuschte ich mich auch.
»Auf morgen!« sagte der Mandarin.
»Auf morgen – und Dank!« entgegnete ich leise.
Und fried- und heimlos wie einst, wanderte ich zum englischen Hospital zurück.
| Y prosigo mi senda, hacia, adelante, |
| Viendo lo que más ansio más distante |
| Y mi ventura yá desvanecida. |
| Cúanto me vuelvo más á lo pasado, |
| Hallo la vida un sueño mal sonado, |
| De quien ni sueña que es soñar la vida. |
| Mucio Teixeira. |
XVIII.
Die Scheidung war ohne Schwierigkeiten durchgeführt worden. Beim Konsul hatten die Berichte des Doktors sehr den Weg geebnet, und bei den chinesischen Behörden tat sowohl das Ansehen als auch die weislich verteilten Bestechungen (im Orient noch mehr als im Okzident gilt das Sprichwort: »Wer schmiert, der fährt«) des Mandarins das ihrige. Die Vermögensbestimmungen waren schon vorher besprochen worden, so daß ein kurzgefaßter Bericht alles erklärte, und da keine Kinder da waren, fiel auch diese stets so schwer zu entscheidende Frage gänzlich weg. Noch ehe am 1. November die Mittagsmahlzeit die Angestellten den Berufspflichten entzog, war ich wieder frei, konnte gehen und tun, wie es mir gefiel.
Schweigend fuhren wir zur Bahn, und als das Zeichen zur Abfahrt gegeben worden war, reichte mir der Mandarin noch einmal die Hand, mit der gleichen unerschütterlichen Ruhe und den unbeweglichen Zügen, die ich so oft an ihm gefürchtet und bewundert hatte, wünschte mir eine angenehme Heimreise und wies meinen Dank für seine freundliche Hilfe und den Schutz, den er mir hatte angedeihen lassen, ruhig zurück.
Ich reichte Li Bai die Hand, aber er wies sie zurück und sprang auf den sich eben in Bewegung setzenden Zug, während der Mandarin noch einmal eine grüßende Handbewegung machte und dann unseren Blicken entschwand.
»Ich begleite dich bis Hongkong!« sagte er entschieden.
Wie einst, als er noch mein Schüler im nun so fernen Westen gewesen war, half er mir so oft es nur möglich, bediente mich, als wir in Peking speisten, und war der vollendete europäische Kavalier, den ich in Europa so nett gefunden. Selbst das kindliche Wesen war unverändert. Er konnte über die Mitreisenden ebenso treffende Bemerkungen machen wie einst in London, und keine Spur von »miserable« war sichtbar.
Wir mußten die ganzen Abend- und Nachtstunden in den unbehaglichen chinesischen Zügen verbringen, und nur Li Bais fortwährende Bestechungen des Zugpersonals hatten zur Folge, daß wir wenigstens eine Art Wärmeflaschen einfachster Gattung erhielten, die unsere Füße und Hände vor dem Erstarren bewahrten.
Als einige der Mitreisenden ausgestiegen waren, neigte sich Li Bai über mich und sagte mit etwas von jener Weichheit und Zärtlichkeit in der Stimme, die in den allerersten Wochen unserer unglücklichen Ehe zuweilen durchgeklungen war, wenn er mir »No nai ni«, das chinesische »Ich liebe dich!« zuflüsterte:
»Ich möchte dich noch einmal küssen, Käthe, es ist ja das allerletzte Mal im Leben, daß wir zusammen sind.«
Zum letztenmal! Es liegt immer etwas Trauriges und zugleich etwas weich Versöhnendes in so einem »zum letztenmal«. Ich hob mein Gesicht schweigend zu dem seinen. Armer, lieber, kleiner Chinese! Es war wohl nicht seine Schuld, daß er so wenig »europäisch« war, und er konnte wohl ebensowenig dafür, daß er weder ein Herz noch eine Seele besaß, oder daß die beiden, falls er sie dennoch hatte, nie zum Vorschein kamen. –
Am folgenden Tage kamen wir in Hongkong an, dessen wunderschöne Lage und vollständig europäisches Gepräge mich angenehm überraschten, und bald brachten zwei Jinrikshas uns hinaus zum Hafen, wo der »Albatros« verankert lag. Meine Koffer waren schon an Bord gekommen und die Kajüte sah einladend, wenngleich so klein als nur denkbar, aus. Wir sollten zuerst in Singapore eine Woche verbleiben, dann zum Kap der Guten Hoffnung weitersegeln, und endlich, nachdem wir auch die Kanarischen Inseln besucht hatten, nach Norwegen fahren. In etwa zwei Monaten dürfte das Schiff in den Hafen von Christiania einlaufen.
Vier Stunden später verkündigte die schrille Dampfpfeife, daß der »Albatros« seine Reise anzutreten beabsichtigte. Li Bai legte die eben von ihm gekauften Früchte und Kuchen auf meinen Deckstuhl, breitete fürsorglich den Reiseplaid für mich aus und reichte mir dann die Hand zum Abschied.
Man scheidet nie leicht von dem Manne, dem man alles gegeben, was man zu geben hat, an den uns Bande knüpfen, die nur äußerlich getrennt werden können, die aber innerlich nie zerreißen. Der Name unseres Gatten steht auf der Platte unserer Erinnerung mit ehernem Griffel eingeritzt, gleich unverlöschlich, ob das, was darunter steht, zu seiner Ehre oder Schande lautet.
»Laß uns unsere Schwächen vergessen und nur des Guten gedenken, Li Bai!« bat ich, als ich zum letztenmal die zarte Hand in der meinen fühlte.
Unverständlich wie immer, wenn es sich um seelische Empfindungen handelte, klangen ihm meine Worte, die Lider deckten wie damals, als er mich bat, seine Frau zu werden, die schwarzen rätselhaften Augen, die Züge waren kalt und unbeweglich, wie immer, wenn nicht Zorn oder Lachen sie verzerrten.
»Leb' wohl, Käthe – und glückliche Reise!«
Das letzte Glockenzeichen ertönte. Er berührte mit seinen Lippen ebenso scheu und flüchtig wie an meinem Geburtstage meine Wange zum Abschied, drückte noch einmal leicht meine Hand und lief dann hurtig den Landungssteg hinab, der eingezogen wurde.
Die Schiffsschraube setzte sich langsam in Bewegung, mehr und mehr drehte sich das große Fahrzeug, bis es in die richtige Lage kam, und dann setzte die Maschine mit voller Kraft ein und dampfte der fernen Heimat zu.
Unten aber, auf der Mole der chinesischen Hafenstadt, stand eine kleine Gestalt, die ein blauseidenes Taschentuch aus einem europäischen Anzuge (Li Bai hatte sich zur Reise europäisch gekleidet) gezogen und winkte – winkte – gerade so wie in London, wenn die große Elektrische sich in Bewegung setzte und er noch einmal zu mir zurück grüßte.
Ich drängte die Tränen gewaltsam zurück, um so lange als möglich diese zierliche Gestalt sehen zu können, die unbeweglich auf der Mole stand und winkte, bis das Schiff weit, weit vom Strande die Wogen teilte und mein kleiner Chinese nur mehr ein Punkt am Horizont war.
»Was für eine hübsche Gestalt und welch nette Umgangsformen dieser kleine Chinese hatte, der von jener Dame Abschied nahm!« hörte ich einen älteren Herrn unweit von mir zu seinem Mitreisenden sagen.
»Ach, lieber Unbekannter, du hast recht, aber die zarte Gestalt und die netten Umgangsformen sind auch alles, was dieser kleine Chinese sein eigen nennt, und noch von diesen beiden Gaben ist seine Gestalt das einzige, was sich nie verändert,« dachte ich.
Die anderen Reisenden sahen vorwärts, weit hinweg über die schäumenden Wogen, ich aber blickte zurück auf die Küste, wo nicht nur mein Gatte einer, wie ich hoffte und wünschte, besseren Zukunft entgegenging, sondern wo unter Teakbäumen und gewaltigen Bambusstämmen die Reste eines Körperchens lagen, das ein Teil meines Ichs – vielleicht mein bester Teil – gewesen. Li Bai würde schnell verwinden und vergessen, aber ein Mutterherz vergißt nie – auch nicht ein gelbes Kind, das nur drei kurze Monate lang an der Mutterbrust gelegen!
»Schlaf' in Frieden, mein toter Sohn!«
| Laissons gronder en bas cet orage irrité, |
| Qui toujours nous assiège; |
| Et gardons au-dessus notre tranquillité |
| Comme le mont sa neige. |
| Va, nul mortel ne brise avec passion |
| Vainement obstinée, |
| Cette âpre loi que l'un nomme Expiation |
| Et l'autre Destinée. |
| Victor Hugo. |
XIX.
Sechs Monate waren vergangen. Wochenlang hatte ich nur die glitzernden Wogen geschaut, die mächtig heranrollten, sich mit donnerndem Geräusche an den starken Planken des Schiffes brachen und in Schaum zerplatzten.
Wie sie, eilen wir alle auf das endlose Ziel zu, und wie sie vergehen wir, um vielleicht wiederzukommen, gerade wie die zerstäubten Wassermassen sich zu neuen Wogen, oft zu mächtigeren, formen.
Ueber mir hatte der blaue Himmel sich wolkenlos gewölbt, und diese Einförmigkeit der Umgebung, dieses matte Dahinträumen hatte nach und nach die Stürme meiner Seele eingeschläfert.
Ich hatte gelernt, was ich früher nie begreifen wollte, daß wir nur auf uns rechnen dürfen, nicht auf unsere Umgebung, daß wir den Frieden nur in der Ruhe finden, die oberhalb von Wünschen und Fürchten liegt. Ich kämpfe nicht mehr gegen den Strom des Lebens, ich lasse seine Wogen mich hinwegheben über alle Hindernisse, die guten wie die bösen, und gleite so ohne tiefe Schmerzen und aber auch ohne große Freuden dem Ziele zu. Einmal erklingt wohl selbst für mich das Aveläuten!
Eine Zeitlang war ich in Südafrika verblieben, mehrere Wochen verbrachte ich in Las Palmas auf den herrlichen Kanarischen Inseln, und einen Monat verweilte ich im hohen Norden, wo die stolzen, unbeugsamen Tannen sich allerlei wundersame alte Märchen zuflüstern. Den Rest der Zeit sah ich nur über die unendliche Wasserfläche und lernte die schwere, ach so schwere Kunst des Vergessens.
War ich auch scheinbar von den Reichen des reinen Glückes verbannt, so blieb mir mein Wissen, eine Quelle unversiegbarer Schätze. Mir standen die Literaturen vieler Nationen offen, eine reiche Geisteswelt lag vor mir und Freunde warteten meiner, die weder Falschheit noch Untreue kannten. Zu ihnen konnte ich flüchten, sooft und auf wie lange ich es wünschte. Sie wollten mir die Einsamkeit ertragen helfen, nicht so vollkommen vielleicht, als Menschen es zu tun imstande sind, wenn wir die rechten daheim oder in der Fremde gefunden haben. Aber sie verursachten mir dafür auch niemals Seelenpein, wie sie die besten Menschen zuweilen uns zuzufügen nicht vermeiden können – oder wollen.
Es gibt verschiedene Musikinstrumente auf der weiten, weiten Welt und verschiedene Arten, ihnen Töne zu entlocken, denn Töne geben sie alle von sich – und so sind auch wir Menschen Instrumente, die je nach der Berührung, die schrecklichsten und schrillsten Mißtöne oder die herrlichste Melodie von sich geben. Einige Menschen ähneln Trommeln, andere Trompeten, wieder andere Harfen oder Geigen. Auf einer Trommel kann bald jemand spielen, aber es gehört ein Meister dazu, der Harfe oder der Violine harmonische Töne zu entlocken. Es ist schwer, den Meister zu finden, sehr schwer. Aber man kann – wenn man weise ist – verhindern, daß unkundige Hände die Saiten zum Springen bringen, indem wir niemand gestatten, das Instrument zu berühren.
Besser keine Töne, als Mißtöne.
Seit zwei Wochen weile ich bei Jenny, die mich sehr lieb aufgenommen hat und mich behalten will, bis ich wieder Kräfte gesammelt habe, um in die Ferne zu ziehen, denn ruhelos wie der ewige Jude treibt es mich von Ort zu Ort.
Auf den Wunsch meines Schwagers hin habe ich die Geschichte von meinem kleinen Chinesen geschrieben, die ein Warnungsruf an die Mädchen meiner Rasse sein soll. Chinesen haben wie wir ihre Licht- und Schattenseiten – nicht weniger Lichtseiten als wir –, aber sowohl Licht als auch Schatten ist verschieden im Osten wie im Westen, das möge immer bedacht sein.
Nur einem entsetzlichen Unfall verdankte ich meine Freiheit, sonst wären es wohl die Tore des Todes gewesen, die meiner Seele den Ausflug zur ewigen Freiheit eröffnet hätten.
Soeben kommt meine Schwester mit meinem entzückenden Nichtchen auf den Armen durch den Garten und der Doktor geht an ihrer Seite und hält sie umschlungen, als könnte jemand plötzlich seinen Schatz entführen, falls er nicht seinen Arm so fest – so innig fest um sie legen würde.
Wie glücklich die beiden Menschen doch geworden sind!
»Weißt du, Kather,« ruft sie mir, die ich in der Hängematte liege (für mich der bescheidene Begriff erreichbarer irdischer Glückseligkeit) und diese Blätter noch einmal durchsehe, fröhlich zu, »daß ich selig bin zu wissen, daß die gelbe Gefahr auf immer beseitigt ist?«
»Ja,« lächle ich müde, denn mein Nichtchen erinnert mich an mein totes Kind, »das ist ein Traum, der ausgeträumt ist.«
Jenny versteht mich, ihr Glück hat sie vertieft, veredelt. Sie streicht liebkosend über meinen Arm und preßt unwillkürlich ihren blonden Liebling fester an sich, der Doktor aber, der rührend lieb gegen mich ist und eine ernste Stimmung nicht aufkommen lassen will, zieht sein schönes, junges Weib und das süße Kindchen zärtlich an sich und sagt mit der Eitelkeit und dem Selbstbewußtsein, die jedem Manne des Westens wie des Ostens eigen:
»Es gibt ja auch noch ganz nette Europäer.«
Und Jennys glückstrahlende braune Augen sagen »Amen«.

Im Verlag
Deutsche Buchwerkstätten Dresden
ist ferner erschienen:
Der Hof
des Schweigens
Roman von Anny Wothe
Es ist ein heiliges Land, das wir hier in diesem so glänzend geschriebenen Roman der gefeierten Erzählerin betreten. Es ist das Eis- und Feuerland, das Land der alten Göttersagen, das Land der Sagas und der holden Frauen, das Land der nach Freiheit dürstenden Söhne des starren Eislandes mit seinen tausend Wundern. Island, das noch so wenige kennen, tut uns in diesem Roman weit seine herrlichen, unbekannten Zauberwelten auf, daß wir erschauern vor der seltsamen Schönheit dieser Wunderwelt. Anny Wothe gibt uns in dem Roman »Der Hof des Schweigens« ein glänzendes Gemälde von Land und Leuten der herrlichen Insel im starren Nordlandsmeer. Die Verfasserin hat mit dem feinen Fühlfaden der Seele und offenem künstlerischen Blick, gepaart mit gründlicher Kenntnis der Bewohner des Landes, in diesem Roman ein Seelengemälde von so künstlerischer Eigenart und erschütternder Tragik geschaffen, daß wir nicht müde werden, dieses herrliche Buch immer und immer wieder zu lesen.
Verlag Deutsche Buchwerkstätten / Dresden
Im Verlag
Deutsche Buchwerkstätten Dresden
ist ferner erschienen:
Kains Entsühnung
Roman von Luise Westkirch
Der Roman führt in ein Stück Oedland, Neuland, eine Wildnis mitten im Herzen Deutschlands. Uralter Menschenschlag haust dort wie auf einer einsamen Insel, abgeschnitten von der modernen Kultur und den Hütern ihrer Gesetze. Hart ist das Leben der Leute, rauh und gewaltsam ihr Sinn. Ihre Leidenschaften toben ungebrochen sich aus in ursprünglicher Kraft und Wildheit. Ein rechtschaffener Mann hat in verspäteter Liebesraserei für ein Weib, das ihn lächelnd betrügt, seinen liebsten Freund getötet. Wie er in strenger Selbstüberwindung und hartem Kampf mit dem eigenen Herzen diese Tat sühnt vor seinem Gott und dem eigenen Gewissen, das bildet die Grundidee des Werkes, das durch die sympathischen Gestalten eines glücklicheren Liebespaares erhellt und belebt wird.
Verlag Deutsche Buchwerkstätten / Dresden
Im Verlag
Deutsche Buchwerkstätten Dresden
ist ferner erschienen:
Der Marquis
von Weyermoor
Roman von Luise Westkirch
Die Geschichte einer Ehe im »Teufelsmoor« erzählt dieser Roman, die Geschichte eines leichtsinnigen, nach mühelosem Genießen haschenden jüngeren Sohnes, der seine Liebe und seine Freiheit der reichen Bäuerin verkauft für die Wonne, Geld ausstreuen zu können mit vollen Händen, und der dann im errafften Reichtum darbt und gern aufhören würde, der »Marquis« von Weyermoor zu sein, wie seine Landsleute ihn im Spott getauft haben, – wenn er frei und arm als einfacher Arbeiter leben dürfte an der Seite des Mädchens, das er nicht aufgehört hat zu lieben. In diese Läuterung und Wandlung im Charakter des Helden spielt, begangen am Sankt Niklastag in der Vermummung des Sankt Niklas, ein dunkler Mord, der die Schicksalsfäden zuerst verwirrt und endlich zerreißt.
Verlag Deutsche Buchwerkstätten / Dresden
Im Verlag
Deutsche Buchwerkstätten Dresden
ist ferner erschienen:
Der
Kampf um den Dollar
Ein Auswanderer-Roman
von Arthur Zapp
Durch den Versailler Vertrag ist das Auswanderungsproblem erneut aufgerollt worden. Der Zappsche Roman gibt ein getreues Spiegelbild von den Aussichten, Zufällen und Ueberraschungen, die des Einwanderers in Amerika harren. Wir erleben, wie sich der deutsche Unternehmungsgeist in großzügiger Weise betätigt, wie ihm ruinöse Rückschläge nicht erspart bleiben, wie aber starkes Zielbewußtsein sich schließlich durchsetzt. Allerdings gelingt es nur einem von drei jungen Auswanderern, die Verhältnisse zu meistern. Der zweite, ein schwacher Charakter, ist zu zart besaitet, um in diesem Lande des rücksichtslosen Erwerbssinnes Wurzel zu fassen. Eine romantische, reizende Liebesgeschichte, die sich durch das ganze Buch hindurchzieht, verklärt die Laufbahn dieses Mannes, dem auf verschlungenen Wegen zum wahren Glück die unangenehmsten Erfahrungen mit den amerikanischen Gesetzen über das Eheversprechen nicht erspart geblieben sind. Vollends im Banne der Räuberromantik geht der dritte ehemalige Freund unter. Die Handlung ist spannend bis zum Schluß und gibt einen vollendeten Abriß über die augenfälligsten Erscheinungen im Lande des rollenden Dollars.
Verlag Deutsche Buchwerkstätten / Dresden
Das Originalbuch ist in Frakturschrift gedruckt.
Darstellung abweichender Schriftarten (ausgenommen römische Zahlen):
gesperrt : Antiqua .
Der Schmutztitel wurde entfernt.
Die sechs ganzseitigen Illustrationen wurden verschoben, um den Lesefluss nicht zu hemmen, nämlich
1. von der Position vor der Titelseite vor das Kapitel XIII,
2. von der Position hinter Seite 48 vor das Kapitel VI,
3. von der Position hinter Seite 96 vor das Kapitel IX,
4. von der Position hinter Seite 176 vor das Kapitel XII,
5. von der Position hinter Seite 200 an das Ende von Kapitel XIII,
6. von der Position hinter Seite 264 vor das Kapitel XVII.
Die aus verschiedenen Sprachen stammenden Verse an den Kapitelanfängen wurden einschließlich der Rechtschreibfehler unverändert übernommen.
Der Text des Originalbuches wurde grundsätzlich beibehalten, mit folgenden Ausnahmen,
Seite 20:
"dieser" geändert in "diese"
(dem Gleichmut, der diese Klasse weiblicher Wesen auszeichnet)
Seite 44:
"daß" geändert in "das"
(setzte er ein Gesicht auf, das einen zum Tode Verurteilten)
Seite 150:
"den" geändert in "dem", "»" und "«" eingefügt
(auf dem mit russischen Buchstaben »Europa – Asia« stand)
Seite 158:
"laïmatischen" geändert in "lamaïtischen"
(werden von den lamaïtischen Priestern)
Seite 166:
"»diese goldenen" geändert in "diese »goldenen"
(immer nur auf diese »goldenen Lilien« küssen)
Seite 180:
"dort so," geändert in "dort, so"
(und wird dort, so wie bei uns Wollstoffe)
Seite 189:
"deinen" geändert in "deinem"
(als rote Vogelscheuche wirklich zu deinem Gatten gehen)
Seite 214:
"." eingefügt"
(dem Mandarin sehr angenehm war.)
Seite 221:
"ihre" geändert in "Ihre"
(Mein Plan mißlang – durch Ihre Schuld.)
Seite 230:
"," eingefügt
(Man ist Paria, »one has lost caste)
Seite 255:
"Wort" geändert in "Worte"
(ein dicker Doktor sprach ermutigende Worte)
Seite 255:
"sie" geändert in "Sie"
(Sie werden zu Kräften gelangen)
Seite 256:
"beweißt" geändert in "beweist"
(Das beweist, daß jedes Ding auf Erden)
Seite 276:
"das" geändert in "daß"
(das allerletzte Mal im Leben, daß wir zusammen sind)