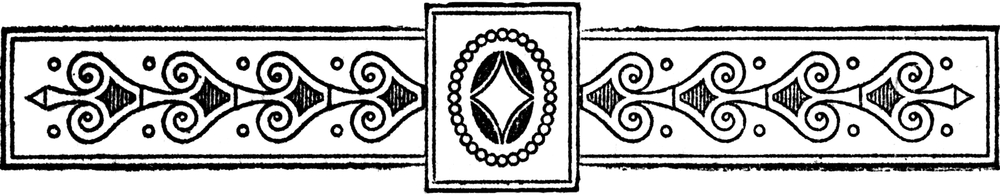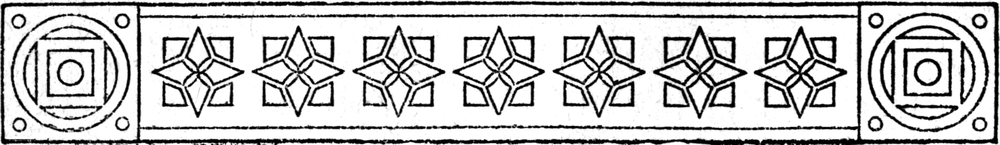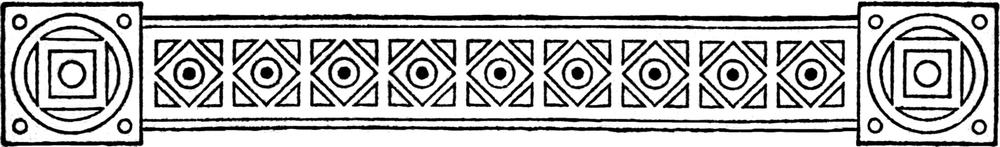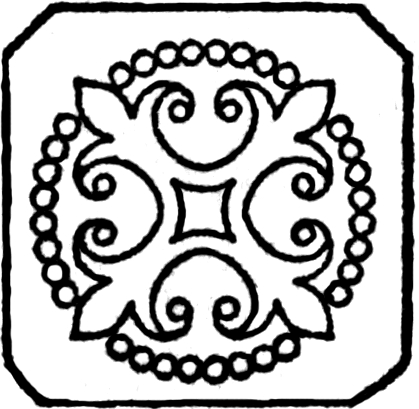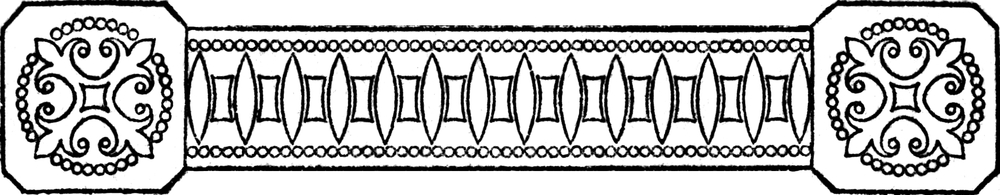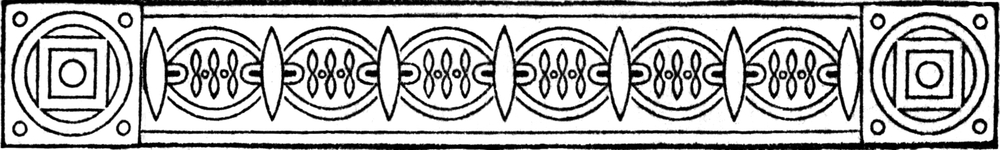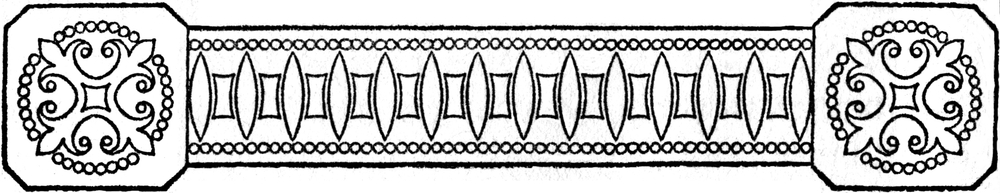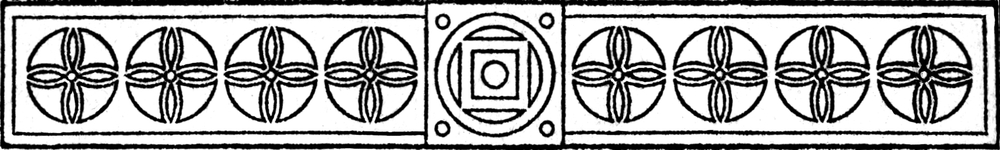Anmerkungen zur Transkription
Der vorliegende Text wurde anhand der 1919 erschienenen
Buchausgabe so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben.
Typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche
und heute nicht mehr gebräuchliche Schreibweisen sowie Schreibvarianten
bleiben gegenüber dem Original unverändert, sofern der Sinn des Texts
dadurch nicht beeinträchtigt wird.
Umlaute in Großbuchstaben (Ä, Ö, Ü) werden im
vorliegenden Text in deren Umschreibungen (Ae, Oe, Ue) dargestellt.
Das Original wurde in Frakturschrift gesetzt; Passagen
in Antiquaschrift erscheinen im vorliegenden
Text kursiv. Abhängig von der im
jeweiligen Lesegerät installierten Schriftart können die im Original
gesperrt gedruckten Passagen gesperrt, in
serifenloser Schrift, oder aber sowohl serifenlos als auch gesperrt
erscheinen.
Der Uebel größtes...
Meisters
Buch-Roman
Eine Sammlung hervorragend
schöner Romane aus der Feder
angesehener, bekannter Autoren
Einundvierzigster Band: Der Uebel größtes ..
Verlag von Oskar Meister, Werdau i. Sa.
Der
Uebel größtes ..
Roman von
Käte Lubowski.
Einundvierzigster Band des Buch-Romans
Verlag von Oskar Meister, Werdau i. Sa.
Copyright 1919
by Oskar Meister, Werdau.
Alle Rechte vorbehalten.
Um die elfte Vormittagsstunde war derjenige Teil des Oeynhausener
Kurparkes, dem die Gäste den Namen „Schweiz“ gegeben hatten, von
Rollstühlen und Spaziergängern nahezu frei. Die Meisten ruhten nach
den Bädern vorschriftsmäßig aus. Jene aber, die es mit der Kur nicht
so streng nahmen, lustwandelten in möglichster Nähe der Musik. Nur
eines der bequemen Wägelchen glitt, fast zu eilig für den wundervollen
Frieden dieser Einsamkeit an der romantischen Schlucht vorüber, welche
der silberhelle Hambkebach in jahrzehntelanger Kleinarbeit mit Frische
segnete. Es war keine der gewöhnlichen Lenkerinnen, die ihn vorwärts
stieß. Die Hände erschienen gepflegt und schmal. Die feingliedrige
Gestalt zeigte eine stolze Haltung. Der schlanke, sehr weiße Hals
trug einen Kopf mit auffallend schönen Gesichtszügen. Zuweilen
schob sich die Fülle des braunschwarzen lockigen Haares, von einem
Sommerlüftchen gehoben, zu den langbewimperten Lidern hinunter, die
zwei ausdrucksvolle, sammetdunkle Augen bargen.
Als die Fahrt noch an Schnelligkeit zunahm, wandte sich der Kopf der
grauhaarigen Frau im Rollstuhl zu der Führerin herum.
[S. 6]
„Fräulein Eva von Ostried, der Gaul, den Ihre Phantasie seit geraumer
Zeit zu reiten belieben, gefällt mir nicht,“ klang es dazu in frischem,
scherzhaften Ton. „Er ist zu hitzig. Steigen Sie sofort ab.“
Die junge Lenkerin ging bereitwillig auf die gütige Zurechtweisung
ein: „Hochverehrte Frau Landgerichtspräsident Hanna Melchers aus
Berlin-Grunewald, Wangenheimstraße 10, ich kann Ihrem Wunsch nicht
nachkommen, denn... er geht, leider, mit mir durch!“
Ein leichtes Seufzen ertönte.
„Schon wieder? – Was haben Sie, Kind? Ich merke seit einigen Tagen,
daß Sie verändert sind. Zum Verlieben bietet sich hier kein Anlaß. Der
männlichen Jugend ist ja kaum in unversehrtem Zustande zu begegnen und
ich weiß doch zur Genüge von Ihrer durchaus verständlichen Freude an
der Gesundheit..“
„Nein.. verliebt.. bin ich nicht!“
„Was aber ist’s dann? Wir leben nun drei Jahre mit einander und ich
kenne Sie allmählich genau. Spukt in dem Köpfchen wieder der alte
Traum?“
„Ja,“ sagte Eva von Ostried und ihre Lippen preßten sich zusammen, als
müsse sie den Schrei der Sehnsucht ersticken, „ich möchte singen..
singen..“
„Als ob Ihnen das verwehrt würde, Eva. In dem kleinen
Unterhaltungszimmer unserer Pension Messing steht ein ausgezeichneter
Flügel und eine andächtige und dankbare Zuhörerschaft ist Ihnen
ebenfalls sicher. Trotzdem haben Sie mir das feierliche Versprechen
abgenommen, daß ich töricht genug war, Ihnen zu geben. Warum
verheimlichen Sie hier ängstlich Ihr Talent?“
[S. 7]
„Soll ich wirklich vor der herzensguten, aber doch bereits unstreitig
etwas kindisch gewordenen Frau la chaise, die mit ihrem seligen
Fritzchen zwölfmal in Brasilien war und daneben lediglich Tabak und
höchstens noch ihre „beste“ Olga von daheim gelten läßt – oder vor
diesem fürchterlichen, alten Baron, der beständig die Hände bewegt, als
beabsichtige er seine Zuhörerschaft zu kitzeln, damit sie über seine
Witzchen auch lachen kann, singen? – Verlangen Sie das von mir?“
„Verlangen würde ich es wohl nur von meiner leiblichen Tochter.“
Der Rollstuhl stand plötzlich still. Zwei weiche, heiße Lippen preßten
sich auf die Hände der Präsidentin.
„Ich bin egoistisch und schlecht. Verdanke ich Ihnen doch alles. Was
wäre damals aus mir geworden, wenn Sie mich, die ohne langjährige
Zeugnisse auf Ihr Gesuch kam, nicht den vielen Andern, vorzüglich
Empfohlenen vorgezogen hätten?“
„Lassen wir diese Fragen, mein Kind. Ich bilde mir ein, eine gute
Menschenkennerin zu sein..“
„Und nun habe ich Sie im Laufe der Zeit oft genug enttäuschen müssen.“
„Auch diese Wahrscheinlichkeit blieb damals nicht unberücksichtigt. Sie
hatten mich deutlich in Ihrer Seele lesen lassen.“
„Obwohl ich zuerst von meinen Kämpfen und Enttäuschungen schwieg?“
„Die kargen Tatsachen verrieten mir genug. – Sie waren auf den Wunsch
eines Jugendfreundes Ihres verstorbenen Vaters von dem nach seinem
Tode in andere[S. 8] Hände übergegangenen Majorat nach Berlin gekommen und
ließen Ihre wundervolle Stimme unentgeltlich von ihm ausbilden. Daß er,
ein Jahr später, bei dem grausamen Eisenbahnunglück ums Leben kam und
Sie, die völlig Mittellose, danach vergeblich den Vormund und früheren
Gutsnachbar um ein Darlehn zum Weiterstudium anflehten, verhehlten
Sie mir nicht. Das Andere – die harten Enttäuschungen, die Sie in
dem ungewohnten Kampf ums tägliche Brot in den verschiedenen aus Not
angenommenen Stellungen zu bestehen hatten, las ich deutlich aus ihrem
schmalen Gesicht und dem ängstlichen Ausdruck der Augen. Ihre spätere
Beichte vervollständigte nur diese Geschichte..“
„Aber Sie haben nicht angenommen, daß ich rückfällig werden könnte.“
„Ich habe es gewußt! – Sehnsucht stirbt schwer. Und Sie sollen Ihr
Sehnen ja auch behalten und pflegen. Nur Geduld müssen Sie üben. Erst
fester werden, mein Kind. Erst noch diese heiße Eitelkeit abstreifen,
die fiebernd nach Ruhm und Huldigung verlangt.“
Der dunkle Kopf senkte sich schuldbewußt.
„Sie sind unaussprechlich gut zu mir.“
„Keine Uebertreibungen! Hundertmal haben Sie, in zorniger Aufwallung,
anders gedacht, wenn ich Ihrem Verlangen entgegenstand. Ich begreife
auch das voll.“
„Wenn ich doch wüßte, womit ich Ihnen dies Alles jemals vergelten
könnte.“
Frau Melchers lächelte leise.
„Das Wort „Vergeltung“ ist niemals von einem häßlichen Beigeschmack
frei, Eva. Sie sollen nur stets ganz[S. 9] offen zu mir sein.. und mich
weiter lieb haben. Anderes verlange und erwarte ich nicht.“
„Das glaube ich. Es ist ja so leicht.“
Ein prüfender Blick streifte das schöne Gesicht. Die kluge Frau kannte
die größeste Schwäche ihrer Hausgenossin, die sie wie eine Tochter
lieben gelernt, sehr genau. Wenn die reiche Phantasie spielte und die
ungestüme Eitelkeit den Kritiker abgab, konnte es leicht geschehen,
daß Eva von Ostried sich über die von der Präsidentin geforderte
Wahrhaftigkeit hinwegsetzte, ohne sich eines Unrechts bewußt zu werden.
„Und nun hören Sie mir einmal aufmerksam zu, Eva,“ forderte die gütige
Stimme. „Es kommen nicht sehr viel Stunden, die sich dafür eignen. Sie
sollen etwas wissen, was Sie – vielleicht längst geahnt haben. –
Sie werden demnächst das einundzwanzigste Jahr vollendet haben. Der
Vormund, der nach dem jähen Tode Ihres Gönners seine Erlaubnis zur
Wiederaufnahme Ihrer Studien, auch mir gegenüber, brieflich versagte,
verliert dann seine Gewalt über Ihr Handeln. Im Herbst dürfen Sie also
über sich verfügen. Aber.. wir wollen erst noch Weihnachten und Ostern
in aller Stille zusammen feiern. So traut und gänzlich der Häuslichkeit
gehörend, wie die andern Jahre. Nichtwahr, mein Kind?“
„Ich begreife nicht, wie Sie das meinen. Soll ich dann fort von Ihnen?“
„Ja, Eva, dann verliere ich Sie. In meinem Heim werden Sie allerdings
weiter leben, aber für mich selbst kaum noch Zeit finden. Denn Sie
werden wieder als einzige Beschäftigung Musik studieren. Ihre Sehnsucht
darf neue[S. 10] Befriedigung suchen. Ihr Fleiß muß eisern werden. – Die
nötigen Mittel gewähre ich Ihnen. Gegenleistungen verlange ich freilich
auch. Ich muß, so lange ich lebe, über Ihnen wachen dürfen, Eva. Fühlen
Sie, wie ich das meine?“
Eva von Ostried warf sich mit ausgebreiteten Armen über die kluge Frau.
Sie konnte nicht sprechen. Ihr Körper bebte von einem Schluchzen des
Glückes.
Endlich aber schob sie die Präsidentin sanft zurück.
„So und jetzt zum Theater! Denn, nicht wahr, darum nahmen wir doch
jenes Eiltempo? – Heute Abend wird also Mignon gegeben? Obschon ich
es mir von dieser Stelle aus nicht als reinen Genuß denken kann..
sollen Sie Ihren Willen haben. Ob daraus nicht für Sie, die jeden Ton
dieser Oper genau kennen und die Partie des Mädchens aus der Fremde
ausgezeichnet wiederzugeben wissen, eine arge Enttäuschung wird?“
Das schöne Mädchengesicht strahlte wieder.
„Wie herrlich ist es, daß Sie, die schwer zu Befriedigende, mir dieses
Lob schenken. Ja... ich freue mich unsagbar auf den heutigen Abend.
Zu denken, daß.. ich selbst.. es besser machen könnte.. Ist das nicht
vielleicht der höchste Genuß?“
Ein leichter Schatten glitt über das feine, alte Gesicht.
„Darin werden wir uns niemals verstehen! Mir ist immer weh zumute, wenn
Jemand eine übernommene Aufgabe mangelhaft erfüllt. – Aber jetzt muß
ich zur Eile mahnen. Der letzte Ton der Kurmusik ist verhallt.“
Und der Rollstuhl glitt wieder durch den Dom satten, frischen Grüns dem
kleinen neuerbauten Theater entgegen.
[S. 11]
„Kommen Sie doch auch mit,“ bat Eva, ehe sie zur Kasse ging.
Die Präsidentin schüttelte den Kopf.
„Haben Sie ganz vergessen, daß der Geheimrat meinem rebellischen Herzen
die allergrößeste Schonung und vor allen Dingen frühzeitige Bettruhe
anbefohlen hat? Nein.. das ist ausgeschlossen.“
Eva von Ostried wurde rot. Dann aber fand sie eine Entschuldigung für
ihre Vergeßlichkeit. Wie konnte ein junges, gesundes Wesen beständig
daran denken, daß eine Leidende unausgesetzt der Rücksicht bedürfe?
„Nur etwas aus der Sonne können Sie mich zuvor noch schieben,“ forderte
die Präsidentin ohne Empfindlichkeit, „denn aus den für Sie heiligen
Räumen finden Sie nicht so schnell zurück.“

Es währte aber diesmal sogar für die Langmut der Präsidentin
zu lange. Die dünnen Glöckchen der Kirche und des Salzwerkes
verkündeten die zwölfte Stunde. Vom Königshof herüber erscholl das
melodisch abgestimmte Tamtam, das eine Viertelstunde vor Beginn der
Hauptmahlzeit, die überall zur gleichen Zeit festgesetzt war, die
Gäste zusammenrief und immer noch ließ sich Eva von Ostrieds helles
Gewand nicht erblicken. Schon wollte die an Pünktlichkeit streng
Gewöhnte eine ihr vom Ansehen bekannte, gerade des Weges daherkommende
Rollstuhllenkerin bitten, ihren Wagen in die Pension zu bringen,
als endlich, atemlos vor Erregung, die Säumige kam. Die Präsidentin
vergaß die beabsichtigte scharfe Zurechtweisung. Der Anblick des
jun[S. 12]gen, schönen Geschöpfes, dessen ausdrucksvolle Augen begeistert
strahlten, entzückte sie, wie er es stets tat. Das reuige Betteln um
Vergebung dieser neuen, kleinen Nachlässigkeit würde genügt haben,
um ihre Empörung in mildes Begreifen umzuwandeln. – Sie wartete
umsonst darauf. Eva von Ostried saß im tiefsten, goldensten Land ihrer
Zukunftsträume und klagte Mignons Steyrisches Lied heraus:
Kam ein armes Kind von fern
Zigeuner brachten es eben
Traurig bleich... seine Glieder beben....
Das riß die Geduld der Gütigen.
„Beeilen Sie sich, Eva,“ sagte sie streng und kurz, „oder ich werde,
so matt ich mich gerade heute auch fühle, der ärztlichen Vorschrift
entgegen, aussteigen und versuchen, im Laufschritt noch pünktlich
zu Tisch zu erscheinen.“ In dem nämlichen Augenblick erwachte Eva
von Ostried zur Wirklichkeit. Sie erblaßte und in ihre Augen kam der
Ausdruck einer großen Hilflosigkeit.
„Das werden Sie mir nicht antun,“ schmeichelte sie. „Schelten Sie
tüchtig.. aber sprechen Sie nicht in diesem unerträglich kühlen Ton
zu mir, wenn ich ihn auch verdient habe.. Gewiß – ich vergaß meine
Pflicht. Sobald Sie die Ursache erfahren, werden Sie mich begreifen..“
„Sie können mir später berichten. Jetzt.. vorwärts, Eva.“
Der geräumige Speisesaal, in welchen die Beiden, heute als letzte
Mittagsgäste, eintraten, war fast zu sehr besetzt.[S. 13] Alle Plätze ohne
Rücksicht auf die Wohlbeleibten, erschienen gleich schmal, sodaß
der Hüne unter den Anwesenden, ein alter früherer Oberst der Garde,
vor seinem gefüllten Teller in zorniger Ungeduld des Augenblickes
wartete, in dem sich seine rechte Nachbarin, einstweilen befriedigt,
zurücklehnte. Zu seiner Linken nahm Eva von Ostried Platz. Das
milderte seinen Zorn. Obwohl er unvermählt geblieben, schätzte er
Frauenschönheit über allem Andern.
Als Eva nicht wie sonst auf seine neckenden Fragen in dem gleichen Ton
antwortete, neigte er den mächtigen Kopf ein wenig zur Seite und sah
sie mit schlauem, verständnisvollen Blinzeln an:
„Strafpauke intus, mein gnädiges Fräulein?“
„Ja,“ nickte sie und setzte leise hinzu „aber verdient.“
„Zu toll geflirtet?“
„Ist das hier überhaupt möglich?“
„Na.. erlauben Sie mal. Wenn Sie von uns elenden Bürgern schon absehen,
der Paul Karlsen, der erste Liebhaber und Opernsänger ist doch noch
da.. Und Sie gehören zu den eifrigsten Besuchern des Theaters..“
Den Namen des jungen Menschen, der ein großer Künstler zu werden
verhieß, hatte er im Gegensatz zu dem andern nur Geflüsterten stark
betont.
Das scharfe Ohr seiner schon wieder auf den nächsten Gang lüsternen
rechten Nachbarin fing ihn auf, sie nickte lebhaft und begann, froh,
endlich einen Gesprächsstoff gefunden zu haben:
„Ja, dieser Karlsen. Denken Sie doch, er soll auch heute im Mignon den
Wilhelm singen!“
[S. 14]
Ein Backfisch, der seiner hochgradigen Bleichsucht und des daraus
entstandenen nervösen Herzens wegen hier war, mischte sich mit
allerliebster Wichtigkeit ein:
„Leider wird er ihn nicht singen können. Die schöne Mignon, auf die wir
uns einen halben Monat lang gefreut haben – der Gast – hat vor einer
Stunde einen bösen Unfall gehabt.“
Die Neuigkeit pflanzte sich fort, denn sie hatten fast alle hingehen
wollen.
„Wie jammerschade,“ wehklagten die jungen Mädchen.
„Wir werden das Geld natürlich zurückerhalten,“ freuten sich die
praktischen Mütter.
„Keine trügerischen Hoffnungen, meine Damen,“ spöttelte ein alter
Gichtiker, „soviel ich vor kaum zehn Minuten gehört habe, soll bereits
ein vollwertiger Ersatz gefunden sein.“
Lebhafte Fragen bestürmten ihn von allen Seiten.
„Woher wissen Sie es? Das wird nicht ohne weiteres geglaubt.“
„Mir hat es der Theaterdirektor in eigenster Person anvertraut. Eine
berühmte, große Sängerin, die zufällig hier zur Kur weilt, wird
einspringen. Er tat sehr geheimnisvoll und verriet nichts weiter, so
sehr ich auch in ihm drang.“
Frau Melchers wandte sich leise an Eva von Ostried.
„War es das, was Sie mir erzählen wollten, Eva?“
Die langen dunklen Wimpern lagen fast auf der rosigen, weichen Haut der
Wangen.
„Ja,“ sagte sie, „das und.. noch etwas. Die Aufregung über das
plötzliche Mißgeschick war so groß – daß... ich[S. 15] oben... nicht..
früher fortkonnte..“ Frau Melchers nickte ihr freundlich zu.
„Schon gut, Eva. – Nun freuen Sie sich natürlich doppelt auf den
heutigen Abend, nicht wahr?“
„Ich.. fürchte.. mich.. aber daneben auch..“
„So hat sich der kleine Teufel des Neides schon wieder von seiner Kette
befreit?“
„Noch nicht...“
„Ich werde das Weitere von Ihnen hören. – Später. – Erst muß
ich ruhen. Ich weiß nicht, in meinen Gliedern ist eine sonderbare
Mattigkeit. Sie schmerzt fast. Am liebsten verschliefe ich die ganze
zweite Hälfte des Tages..“
„Soll ich nachher den Geheimrat rufen,“ fragte Eva angstvoll.
„Was soll er mir, Kind? – Ich habe es mir allein ausgeprobt. Wenn
das Herz matt und doch unruhig hüpft, brauche ich viel Ruhe. Niemand
soll sprechen. Am besten auch jedes Geräusch vermieden werden. – Sie
dürfen darum heute einen ganz freien Nachmittag haben. Genießen Sie ihn
nach Herzenslust. – Soll ich die jungen Mädchen am Tisch fragen, ob
vielleicht ein gemeinsamer Ausflug nach der Porta zustande käme. Zum
Beginn des Theaters können Sie, trotzdem, pünktlich zurück sein.“
Eva von Ostrieds Hände legten sich bittend auf die Rechte der
Präsidentin.
Aus ihrer Stimme klang ängstliche Abwehr.
„Bitte, bitte, tun Sie das nicht. Ich bin viel lieber allein. Diese
jungen Mädchen bleiben mir fremd und unverständlich in all ihren Reden
und Empfindungen. Und schließlich würde ich doch nur die Geduldete
unter ihnen sein.“
[S. 16]
„Weil Sie mir.. dienen, Eva?“
„Nicht.. weil ich Ihnen diene.. Was gäbe es wohl Schöneres für eine
Waise. Nur, daß ich es überhaupt tun muß, begreifen diese vom Glück
verwöhnten nicht. Das richtet eine Scheidewand zwischen ihnen und mir
auf. – Wirklich..“
„Sie sind ein großes Kind..“
„Ich wollte, ich wäre es! Als Kind habe ich niemals einschlafen können,
wenn irgend etwas Geheimnisvolles auf mir lastete.“
„Soll das heißen, daß es damit anders geworden ist?“
„Ich verstehe mich selbst manchmal nicht mehr. – Was mir einen
Augenblick als ein unfaßbares Glück erscheinen will, jagt mir im
nächsten bereits Furcht und Schrecken ein..“
„Eva, Kind, das sind Nerven! Jawohl, so melden sie sich an.“
„Nein – nein, es ist etwas anderes..“
„Dann könnte es nur ein böses Gewissen sein. Und davon halte ich Sie
frei.“
Der dunkle Kopf senkte sich tief. Eva von Ostried wurde der Antwort
überhoben – das Gespräch noch allgemeiner und lebhafter, sodaß an eine
weiter unbeachtet geführte Zwiesprache nicht zu denken war. – –
„Womit also werden Sie diesen sonnigen Nachmittag ausfüllen, Eva,“
fragte die Präsidentin, als sie, sorglich gebettet, sich mit einem
Seufzer des Behagens in dem kühlen Zimmer ausstreckte.
„Wenn Sie mich wirklich nicht brauchen können, lege ich mich in einen
einsamen dunklen Winkel und träume..“
[S. 17]
„Und kommen vor dem Theater noch einmal kurz zu mir, damit ich Sie in
dem neuen, weißen Kleide sehe, ja? – Das Abendessen werde ich heute
auf dem Zimmer nehmen, bitte, sagen Sie es an. Und morgen bin ich
wieder ganz frisch.“
Fühlte sie das Zögern des jungen Wesens? Eva von Ostried blieb noch
einige Minuten neben ihrem Lager stehen, als laste etwas schweres auf
ihrer Seele. Las sie das Geheimnis in den sprechenden Augen, das sich
zuerst offenbaren wollte und nun doch plötzlich dies Vorhaben als so
ungeheuerlich empfand, daß die Ausführung nicht gewagt wurde?
Sie deutete die offenbare Unsicherheit anders.
„Machen Sie nicht länger ein so reueerfülltes Gesicht, Evalein. Ich
hab’s längst vergessen, daß Sie mich ungebührlich lange warten ließen.
Im übrigen, Kind, nicht wahr, Sie wissen doch, daß ich Sie mit dem
Gefühl einer Mutter lieb habe?“
Eva von Ostried schluchzte an der Brust der Gütigen.
„Ja.. das weiß ich und darum..“ Frau Melchers unterbrach sie schnell.
„Darum jetzt heraus in die Sonne. Vergolden und durchwärmen lassen, was
dunkel und geheimnisvoll erscheinen will. Gehen Sie, Eva, ich bin sehr
müde..“
Eva von Ostrieds Pulse klopften in fieberhafter Erregung, als sie,
zu der Stunde der allgemeinen Mittagsrast, den Weg zum Kurtheater
einschlug. Ihr Vorwärtshasten wirkte wie ein beständiger Kampf. Nach
wenigen Laufschritten blieb sie stehen, sah rückwärts, zögerte, als
riefe sie[S. 18] eine mahnende Stimme zur Umkehr und jagte dann doch weiter,
als müsse sie um jeden Preis die versäumte Zeit einholen. Einmal sprach
sie ganz laut zu sich, weil ihre zitternde Seele dies dumpfe Schweigen
nicht länger zu ertragen vermochte.
„Und.. ich werde es ihr doch sagen! Sie ist so gut..“ Gleich darauf
huschte ein ängstlicher Schein über ihr Gesicht. – „Wenn sie es mir
aber nicht gestattet? O, sie kann auch hart und fest bleiben, sofern
sie etwas nicht billigt.“
Die Mittagssonne goß auf jedes Blatt einen großen, goldenen Tropfen.
Unzählige, bis zum Rande gefüllte Becher schwebten auf allen Zweigen.
Einer strömte seinen kostbaren Inhalt über Eva von Ostrieds schlanke,
schöne Gestalt aus und überfunkelte sie mit verschwenderischen Glänzen.
Ihre Augen waren geblendet. Unsanft stieß sie mit dem Eiligen zusammen,
der ihr entgegenlief.
„Hoppla.. Fräulein von Ostried.. wohin des Weges? Sie wollen mir doch
nicht etwas ins Handwerk pfuschen.“
Der Geheime Sanitätsrat Schwemann war es, der die Präsidentin
behandelte.
„Nein, das wage ich nur in äußerster Not.. etwa, wenn Frau Präsident
absolut nichts von Ihnen oder Ihresgleichen wissen will, Herr
Geheimrat,“ sagte sie frisch.
„S’ wär schon besser gewesen, sie hätte sich früher an einen von
unserer Zunft gewandt,“ brummte er halblaut.
„Steht es schlecht mit ihr, Herr Geheimrat?“
„Habe ich das etwa behauptet? – Fällt mir gar nicht ein. Ist übrigens
irgend etwas nahes Verwandtes vorhanden?“
[S. 19]
„Sie ist ganz einsam in der Welt.“
„Na, dann hören Sie mal einen Augenblick zu. Sie gefällt mir nämlich
immer weniger. Ist körperlich viel zu sehr für dies ernsthafte
Herzleiden herunter. Und schont sich dabei nicht gehörig, was die
Geschichte natürlich verschlimmert.“
„O Gott, was soll ich tun. Sagen Sie mir alles, Herr Geheimrat?“
„Sie? – Sehr viel ist dagegen nicht zu machen. Sie können ihr
höchstens jede Aufregung fernhalten und sie gehörig päppeln. – Also...
es ist nicht so einfach, meine Liebe. Kann sehr wohl mal kommen, daß
eines Tages, scheinbar ohne neue Ursache, etwas Menschliches eintritt.
– Das wollte ich Ihnen doch unter vier Augen sagen, ehe Sie abreisen.
In zwei Tagen soll die Reise ja wohl heimwärts gehen.“
Eva von Ostrieds Lippen bebten.
„Ich habe Niemand mehr als sie“ klagte sie erschüttert.
„Weil ich mir etwas Aehnliches gedacht habe, sage ich Ihnen das auch
hauptsächlich. Nun aber keine vorzeitige Leichenbittermiene. Das würde
sie selbst am meisten betrüben. – Sie kann sich natürlich auch noch
längere Zeit halten. Wie gesagt.... auch dem Gesundesten geschieht
zuweilen ein rasches Unglück. Sehen Sie die Sängerin an. Fällt vor ein
paar Stunden einfach auf dem ebenen Fußboden hin und bricht sich ein
Bein. Dabei nicht etwa glatt und anständig. Es wird eine langweilige
Geschichte werden. Grade komme ich von ihr. Na ja... sollten sich
übrigens auch besser nach dem Essen aufs Ohr legen. Die Sonne sticht
gewaltig....“ –
[S. 20]
Gegenüber der Seitenpforte des Theaters, durch welche die Schauspieler
mehr oder minder pünktlich, zu schlüpfen pflegten, stand eine
kühngeschweifte Bank. Darauf ruhten sie nach den Proben aus und
belustigten sich damit, über die vorüberkommenden Kurgäste, sofern sie
nicht zu den eifrigen Verehrern ihrer Kunst zählten, zu spötteln. Denn
sie kannten fast jeden Einzelnen ihrer treuen Gemeinde, die höchstens
alle Monat einmal ihr Aussehen änderten. Zur Zeit war diese Bank leer.
Eva von Ostried nahm darauf Platz. In ihrem Gesicht lag der Ausdruck
tiefen Kummers. Die Unterredung mit dem Geheimrat hatte vorübergehend
die eigenen Interessen erstickt. Bittere Selbstvorwürfe stürmten auf
sie ein.
Während ihre Wohltäterin nach den vorangegangenen Anzeichen einer
großen Mattigkeit, sicherlich wieder von einem jener tapfer ertragenen
Anfälle gequält wurde, stand sie im Begriff sie zu hintergehen.
Die mütterliche Güte und Nachsicht der Präsidentin, die ihr der
Unbekannten, als sie zerbrochen und matt in ihr Haus kam, wieder die
Kraft zur Lebensfreude schenkte, rührte sie von neuem.
Durfte sie diesen Schritt tun, obgleich sie genau wußte, daß die
Präsidentin ihn mißbilligen, wenn nicht gar auf das Strengste
untersagen würde?
In ihrem Gesicht zuckte ein harter Kampf. Eitelkeit und Dankbarkeit
rangen mit einander. Das berauschende Vorempfinden uneingeschränkter
Bewunderung maß sich mit der überwältigenden Freude, daß sie sich
in absehbarer Zeit ihren geliebten Studien wieder gern voll widmen
und sie ohne drückende Sorgen zu Ende bringen sollte. In[S. 21] diesem
Augenblick lief ein barfüßiger Junge an der Bank vorüber. Sie empfand
sein Erscheinen als die Bekräftigung der guten Vorsätze und winkte ihm
stehen zu bleiben.
„Ich will schnell einen Zettel schreiben,“ sagte sie freundlich „und Du
trägst ihn mir hinein, ja?“ Er nickte bereitwillig und setzte sich zu
ihr. Ein aus dem Taschenbuch herausgerissenes Blatt bedeckte sich mit
ihren feinen, klaren Schriftzeichen.
„Mein Versprechen war übereilt“ schrieb sie, „ich kann es leider nicht
halten. Teilen sie dies bitte, Herrn Direktor mit.“
Schon hatte sie ihn zusammengefaltet und den Wartenden beauftragt,
ihn an Herrn Paul Karlsen abzugeben, als drinnen eine umfangreiche,
wenn auch etwas scharfe Stimme, Philines halb spöttisches halb
mitleidsvolles Lied zum Gehör brachte:
Hollah, mein werter Herr
Mögt Ihr uns nicht erst sagen
Wer ist das arme Kind
Des Antlitz scheint zu klagen.
Wie mit einem Zauberschlage änderte sich der Ausdruck in Eva von
Ostrieds Zügen. Alle weiche, kindliche Dankbarkeit schwand daraus. Ihre
Lippen öffneten sich, als tränken sie jeden einzelnen Ton durstig auf.
Ihre Augen flammten. Mechanisch zerpflückte sie das Geschriebene und
reichte dem erstaunt und neugierig blickenden Jungen ein Geldstück hin.
„Ich werde selbst gehen. Es ist gut!“
Und doch fühlte sie dumpf und schwer, daß der Schritt, den sie im
Begriff stand zu tun, besser unterbleibe. Aber es war für alle
Erwägungen zu spät geworden. Aus der[S. 22] kleinen Seitentür trat in
diesem Augenblick, eine schlanke Männergestalt und lief in freudiger
Erregtheit auf sie zu.
„Wo in aller Welt bleiben Sie? Schnell hinein. Niemand im Städtchen
ahnt, daß Sie der vom Himmel gefallene, göttliche Ersatz sein wollen.
Es wird erhaben werden.“
Und sie folgte in willenloser Mattigkeit dem voranschreitenden Karlsen,
von dem das Publikum auch hier behauptete, daß er ein großer Künstler
zu werden verspreche.
Die dünngewordenen Stimmchen der Glocken hatten schon die vierte
Morgenstunde verkündet, als Eva von Ostried endlich einschlafen konnte.
Ihr Zimmer lag neben demjenigen der Präsidentin. Nachdem sie gegen
elf Uhr heimgekehrt war, hatte sie durch die Verbindungstür schlüpfen
wollen, um alles, was ihr widerfahren war, getreulich zu beichten. Ihr
scharfes Ohr erlauschte aber zuvor die tiefen, regelmäßigen Atemzüge,
die einen friedvollen Schlummer verrieten. Wie wertvoll dieser für die
Präsidentin war, wußte sie genau. Darum verschob sie alles bis zum
nächsten Morgen.
Der zog strahlend und schöner, wie die der gesamten letzten Wochen
herauf. Eva von Ostried wurde nicht wie sonst, durch den ersten Strahl
des großen Lichts zu ihren Pflichten geweckt. Die ungeheure Erregung
des verflossenen Tages hatte eine bleischwere Müdigkeit auf sie
gesenkt. Nun schläft sie, die sonst, pünktlich um sieben Uhr, das erste
Frühstück der Präsidentin ans Bett brachte, mit dem unbewußten Behagen
gesunder, kraftvoller Jugend.[S. 23] Fräulein Messing, die Inhaberin der
Pension, freute sich darüber. Die große Neuigkeit machte sie doppelt
unruhig und geschäftig. Darum trug sie auch eigenhändig das Brettchen
mit der ersten Tagesmahlzeit zu der Präsidentin herein. Mit einem
verständnisvollen Lächeln wies sie dabei zu der fest geschlossenen
Verbindungstür hinüber.
„Wir wollen ihr heute ausnahmsweise den langen Schlaf gönnen, nicht
wahr Frau Präsident?“
Frau Melchers hatte mit Rücksicht auf den gestrigen Theaterbesuch,
bisher die Klingel nicht gerührt. Trotzdem billigte sie diese
Versäumnis durchaus nicht. Mit leicht gerunzelten Brauen gab sie zur
Antwort:
„Sie wollen doch nicht behaupten, daß ein Aufbleiben bis zur zehnten
oder elften Abendstunde für ein junges, kräftiges Mädchen eine
Anstrengung bedeutet?“
Fräulein Messing wiegte den Kopf hin und her und lächelte, als wollte
sie sagen „Halte mich doch nicht für ganz ahnungslos“... Weil ihr die
laute Aeußerung aber zu wenig respektvoll vorgekommen wäre, milderte
sie dieselbe und sagte triumphierend:
„Wir wissen es natürlich jetzt Alle und beglückwünschen auch Sie in
herzlicher Mitfreude.“
Frau Melchers begriff vorläufig nichts, als daß sich am verflossenen
Abend ein Vorgang abgespielt haben mußte, der ihr ein Geheimnis war und
der doch auf das Innigste mit ihrer Begleiterin verknüpft blieb.
„Sie sprechen für mich in Rätseln, Fräulein Messing. Darf ich um eine
klarere Fassung ihrer sicherlich gut gemeinten Wünsche bitten?“
[S. 24]
Wäre Fräulein Messing weniger erfüllt von dem überraschenden Ereignis
gewesen, hätte sie den Ausdruck großen Erschreckens auf dem Gesicht
der alten Dame wahrgenommen. So aber merkte sie lediglich, daß hier
ein Geheimnis vorliege und freute sich, die Erste zu sein, die es der
Nichtsahnenden enthüllte. In ehrlicher Verwunderung schlug sie die
Hände zusammen.
„Frau Präsident sind also wirklich ahnungslos? Nein, so etwas! Da will
ich gern berichten. – Als wir uns gestern Abend an Mignon erfreuen
wollten, wurde uns die große Ueberraschung zuteil, Fräulein von
Ostried als solche zu erleben. Gnädige Frau, es war einfach himmlisch.
Solche Stimme habe ich noch niemals gehört. Das Publikum raste vor
Begeisterung. Und unsere gesamte Pension hat in aller Eile – das „wie“
ist mir freilich bis jetzt verborgen geblieben – einen herrlichen
Aufbau aus lauter roten Rosen gestiftet, den Herr Oberst selbst im
Namen Aller überreicht hat.“
Die Präsidentin hatte sich aufgerichtet und rang mühsam nach Atem. Sie
war lange unfähig zu einer Entgegnung. Endlich stieß sie hervor:
„Gehen Sie, bitte.. und senden Sie.. mir sofort.. Fräulein von Ostried.“
Das soeben Gehörte war ein harter Schlag für sie. Zwar hatte sie
gewußt, daß Eva ehrgeizig und eitel zugleich sein konnte – war auch
wiederholt gegen deren Anwandlungen von kräftiger Selbstsucht zu Felde
gezogen.. daß sie aber jemals imstande sein könnte, hinter ihrem
Rücken, den ersten Schritt in die Oeffentlichkeit zu wagen, empfand
sie, besonders nach den heute gemachten Zusicherungen,[S. 25] nicht nur als
Undankbarkeit, sondern als eine Unaufrichtigkeit, die sie schmerzhaft
quälte.
Gewiß – sie verhehlte sich nicht, daß ihre wiederholt geäußerte
Mattigkeit Eva von Ostried das Befragen und Beichten erschwert hatte.
Immerhin – würde sie bei ernstlichem Willen die Möglichkeit dazu
gefunden haben. Sie suchte sie aber nicht, weil sie im Voraus wußte,
daß ihr unter gar keinen Umständen die Erlaubnis zu diesem verfrühten
Auftreten erteilt worden wäre. Denn die Präsidentin war Eine von Denen,
die es viel zu ernst und heilig mit der Ausübung der Kunst nehmen,
um sie zu einer Entweihung durch fiebernde Eitelkeit mißbrauchen zu
lassen. Mochte für all diese Ohren Eva von Ostrieds Stimme noch so
wunderschön geklungen haben, ihr fehlte doch noch unendlich viel,
um sich öffentlich hören zu lassen. Um sie auch vorher innerlich
reifen zu machen, hatte sie die Beschränkung der Musikstudien bisher
durchgesetzt. Was sie ihr gestattete, war lediglich ein wöchentlich
einmaliger Unterricht durch einen der ersten Stimmbildner. Solange Eva
ihrem Einfluß zugänglich blieb, hatte sie die berechtigte Hoffnung,
sie für alle Gefahren, die ihr um der Schönheit halber viel mehr als
den späteren Genossinnen drohen würden, zu festigen. Sobald sie sich
erst völlig in jenen Kreis der anders Denkenden einfügte, wurde ihr
erziehlicher Einfluß geringer, um fraglos sehr bald aufzuhören.
Daß Eva sich bei der ersten Versuchung als schwach erzeigt hatte,
erfüllte sie mit einer dumpfen Zukunftsangst. Denn sie liebte das junge
Geschöpf!
Eva von Ostried kam bleich und verweint herein. Sie zeigte nichts von
dem Glanz einer überwältigenden Freude.[S. 26] Fräulein Messings überstürzte
Mitteilung, aus der sie entnehmen mußte, daß Frau Melchers alles wisse,
hatte sie tief gedemütigt. Zudem blieb die andere Erfahrung, von
welcher außer ihr bisher – Gottlob – nur der Andere etwas wußte, mit
grausamer Härte auf sie ein. Sie warf sich vor dem Lager auf die Knie
und barg schluchzend den Kopf in die Kissen. Die Stimme der Präsidentin
klang ungewohnt hart an ihr Ohr:
„Stehen Sie auf! Nur jetzt kein Theater!“
Diese Worte schmerzten mehr, wie ein Schlag. Sie zuckte zusammen und
stammelte etwas.
„Es ist mir schwer genug geworden – aber ich konnte.. nicht anders,“
sollte es heißen.
„Warum nicht? Was hielt Sie zurück, der Stimme Ihres Gewissens zu
folgen. Denn ich hoffe, daß es sich geregt hat.“
„Ja – das tat es. Ich hatte mich bereits zur schriftlichen Absage
durchgerungen. Da hörte ich den Gesang der Philine. Das reizte mich,
der zu Unrecht auf ihr Können Eingebildeten ihre Mängel zu beweisen. –
Sie hatte mich am Vormittag wie ein Kind behandelt, das nicht ernst zu
nehmen ist.“
Die Präsidentin zwang sich zur Ruhe.
„Es bleibt mir unerklärlich, wie man dort überhaupt von Ihrem Talent
erfahren hat oder sollten Sie anläßlich der häufigen Theaterbesuche,
längst innige Freundschaft mit den Verschiedenen gepflegt haben, von
welcher ich natürlich ebenfalls nichts wissen durfte?“
Eva von Ostried richtete sich empor. An dem offenen Blick merkte die
Präsidentin, daß diese Annahme falsch sei.
[S. 27]
„Ich kannte bis gestern persönlich nur Herrn Karlsen, der mir auch
jedesmal die Karte für die Vorstellungen ausgehändigt hat.“
„Dann berichten Sie, wie man auf Sie als Ersatz der eigentlichen Mignon
kommen konnte.“
„Herr Karlsen teilte mir heute Mittag in höchster Aufregung den Unfall
des Gastes mit, als ich mir die Karte zur Abendvorstellung besorgen
wollte. Gleichzeitig schilderte er mir den großen Ausfall für die
Schauspieler, weil die gezahlten Preise zurückerstattet werden mußten.
Erfahrungsgemäß werde an einem der alten und ältesten Lustspiele
wenig verdient, sondern lediglich mit einer guteingeübten Oper. Der
Direktor aber müsse nun noch außerdem der anspruchsvollen Philine das
vereinbarte Spielhonorar zahlen. Dies traurige Ereignis vernichte
wiederum die stille Hoffnung aller auf eine endliche Aufbesserung ihrer
Verhältnisse.“
„Nun wurde Ihr Mitleid wach und Sie boten sich an.“
„Nein, das tat ich wirklich nicht. – Ich sagte nur, daß ich bei
ernstlichen Bemühungen sehr wohl an einen guten Ersatz der Mignon
glaube.“
„Damit reizten Sie natürlich Karlsens Widerspruch?“
„Er wußte mich schnell von der Unrichtigkeit zu überzeugen, indem er
behauptete, die kleinen erreichbaren Vertretungen benachbarter Städte
seien ohne wiederholte Proben überhaupt nicht imstande, die Partie zu
übernehmen.“
„Da konnte Ihre Eitelkeit nicht länger stumm bleiben?“
„War ich eitel? Ich fühlte nur ein eigentümlich wundervolles Behagen,
daß ich ihn widerlegen konnte, stellte mich[S. 28] einfach hin und sang ihm
die wenigen Strophen aus dem ersten Akt vor.“
„Und da war er sogleich starr vor Bewunderung!“
„Ich weiß es nicht! – Plötzlich umringten sie mich alle. Der Direktor
– der alte Jarne – die neidische Philine... Mein Widerspruch
verhallte.. Sie zwangen mich einfach zu einem festen Versprechen.“
„Haben Sie wenigstens gewußt, was Sie mir damit antaten, Eva, indem Sie
mich hintergingen?“
„Ich habe es schwer gefühlt. Die ganze stolze Freude meines ersten
Erfolges hat es mir verbittert..“
„Sie übertreiben. Daran zu glauben vermag ich beim besten Willen nicht.“
„Und doch ist es so. Bei jedem Hervorruf lastete die Reue auf mir. Ich
mußte an irgend eine Strafe denken.“
„Die ich über Sie verhängen würde?“
„Nein – an eine andere. Und sie ist gekommen. Ich möchte Ihnen so gern
davon sprechen.“
„Um mich zu versöhnen, Eva?“
„Um mich zu erleichtern. Mein Herz ist sehr schwer.“
Da wallte das Muttergefühl an diesem fremden Kinde von neuem warm in
der Präsidentin auf. Ihre Hand legte sich auf den geneigten Scheitel.
„Glücklich sehen Sie freilich nicht. Also, was ist geschehen?“
Eva von Ostried schlug beide Hände vor das erglühende Gesicht, weil sie
sich vor dem klaren, tiefen Blick schämte.
„Der Karlsen hat mich nach der Vorstellung geküßt,“ stammelte sie.
Die Präsidentin erschrak.
[S. 29]
„Und Sie lieben ihn?“ Eva schüttelte den Kopf.
„Bisher war er mir gleichgültig. Seitdem er das gewagt hat, verachte
ich ihn. Daß er es tun durfte – hat mir das Glücksgefühl nach dem
gestrigen Abend vollends ausgelöscht. Sagen Sie mir, daß so etwas nie
– nie wieder möglich sein wird. – Ich ertrüge es kein zweites Mal.“
„Damit würde ich etwas behaupten, an das ich selbst nicht einen
Augenblick glaube.“
„Sie sind also überzeugt, daß die Kunst, wenn sie auch als etwas Reines
und Hohes empfunden und ausgeübt wird, vor solchen Uebergriffen nicht
schützt?“
„Ich hätte Sie für reifer gehalten, Eva! – Das sind die Fragen eines
Kindes.“
„Wissen Sie, was ich bei diesem entsetzlichen Kuß gefühlt habe? Daß ich
imstande wäre, meine geliebte Kunst zu opfern – wenn mir später das
gleiche geschehen würde.“
Und sie legte, wie ein furchtsames Kind erschauernd ihr heißes Gesicht
in die weichen Hände der Präsidentin.
„Niemals erschien mir die Welt ähnlich reich gesegnet wie in diesem
Jahr,“ sagte Frau Präsident Melchers und wies zu den Obstbäumen ihres
Gärtchens hinüber, die unter den silbernen Tauschleiern eines frühen
Septembermorgens tiefgeneigt ihre Lasten trugen.
Eva von Ostried stand, für einen Ausgang bereit, ebenfalls auf
der offenen Veranda. Sie empfand keine staunende Dankbarkeit beim
Anblick dieser Wunder. Aus ihren Blicken sprach etwas Unruhvolles.
Nur für kurze Zeit hatte ihr der Segen dieser Stille, die – obschon
nahe dem großen Getriebe Berlins – dennoch aller Unrast fern und
fremd zu bleiben schien, wohlgetan. Jetzt fühlte sie sich wieder
von dieser Abgeschlossenheit gepeinigt. Jede Stunde bedeutete ihr
etwas Verlorenes. Jeder Tag einen unersetzlichen Verlust. Heimlich
durchkostete sie die rieselnden Wonnen ihres ersten Erfolges und wußte
nichts mehr von Reue oder Empörung.
Sagten es ihr nicht immer aufs Neue die bewundernden Blicke fremder
Menschen, daß sie ungewöhnlich schön ist?
War es darum nicht auch verzeihlich, wenn die Leidenschaft eines Mannes
und Künstlers sich an ihrem Anblick entflammte und vergaß?
[S. 31]
Die Präsidentin beobachtete heimlich den wechselnden Ausdruck auf Eva
von Ostrieds Zügen. Sie wußte richtig in diesem jungen Gesicht zu
lesen. Die Sorge um Evas Zukunft verringerte sich nicht. Der Wunsch,
neben ihr bleiben zu dürfen, bis die Selbstzucht oder eine harte
Enttäuschung alle Schlacken fortgefegt haben würde, war auch heute in
ihr. Sie fühlte, wie sich die junge Seele ihr seit der Rückkunft aus
Oeynhausen mehr und mehr verschloß. Aber sie unterdrückte tapfer alle
Bitterkeit.
War es nicht auch das Los der leiblichen Mutter allmählich das Kind
der Schmerzen an irgend eine fremde Freude zu verlieren? Und hatte der
kommende Tag wirklich die große Bedeutung, die sie ihm zumaß?
„Nun gehen Sie, Eva und besorgen die Kleinigkeiten zu unserm Mahle,“
sagte sie und zwang damit ihre Gedanken zu fröhlicheren Dingen. „Mein
alter Freund, Justizrat Doktor Weißgerber, hat mir versprochen, das
Fest Ihrer Volljährigkeit mit uns zu feiern.“
„Ach,“ meinte Eva lachend, „was soll er mir? Er ist alt, bedenklich und
weise.“
Ein rascher Blick streifte sie.
War sie wirklich so harmlos, nicht die tiefe Bedeutung seines Besuches
gerade an ihrem Ehrentage zu ahnen? – Der junge Mund plauderte sorglos
weiter.
„Am liebsten würde ich morgen Abend in das große Wohltätigkeitskonzert
gehen, zu dem mir ein liebenswürdiger, leider unbekannter Spender eine
Karte zugesandt hat..“
„Und ich?“ Nun klang doch eine leichte Bitterkeit aus der gütigen
Stimme.
[S. 32]
Eva wurde rot.
„Sie erfreuen sich doch auch gern an guter Musik..“
„Freilich tue ich das! Aber ich ermüde jetzt zu sehr dabei.“
„Wenn Herr Justizrat bei Ihnen bleiben würde?“ Der Eigenwunsch besiegte
alle anderen Bedenken.
„Seine Zeit ist kostbar, das wissen Sie. Opfert er mir schon die
Mittagszeit, wage ich nicht noch weiteres von ihm zu fordern.“
Eva schwieg. Aber ihr war es, als laste eine Kette auf ihr, welche die
Schönheit des Lebens für sie fesselte. – Unfreudig wandte sie sich
nach kurzem Zaudern, um die aufgetragenen Besorgungen zu erledigen.
Die Präsidentin blickte ihr nach, solange etwas von ihr sichtbar blieb.
Dann sah sie die durch die alte Pauline hereingebrachte Frühpost
durch, vermißte dabei die Zusage des aufmerksamen Freundes und ging
zum Telephon, um ihn zu befragen, wann er morgen frühestens kommen
könnte. Der Vorsteher seines Büros antwortete an seiner Statt, daß der
Justizrat seit gestern leider mit einer heftigen Erkältung zu Bette
liege und hohes Fieber habe. – Das beunruhigte sie auch wegen des
Andern. Gar zu gern hätte sie nun endlich ihrem längst ordnungsmäßig
aufgesetzten Testament jene Nachschrift angefügt, die Eva von Ostrieds
Zukunft sicher stellte. Einem ausdrücklichen Wunsch ihres verstorbenen
Gatten entsprach es, daß sie vor Ausführung jeden größeren Entschlusses
den Rat seines als treu und klug erprobten Jugendfreundes hörte.
Bisher war sie seinem Wunsch stets gefolgt. Für die beabsichtigten
Stiftungen, denen, mangels Erbberechtigter,[S. 33] ihr großes Vermögen neben
reichen Legaten bestimmt war, hatte sie auch eines klugen, juristischen
Beistandes bedurft. Nun hieß es ein Teilchen von dem bereits Verfügten
abzustreichen und diesem neuen Zweck zuzuführen. Der Gedanke an ein
Hinausschieben wollte sie unruhig machen. Die Gewöhnung an klares,
ruhiges Ueberlegen siegte jedoch.
Schließlich kam es auf ein paar Tage des Wartens dabei nicht an.
Sie war damit beschäftigt, den Gaben, die Eva von Ostried morgen
erfreuen sollten, ein möglichst festliches Aussehen zu verleihen, als
die alte Pauline, die bereits der jungen Frau Assessor Melchers treu
gedient hatte, hereinkam und den Besuch eines fremden Herrn meldete.
Es war kaum zehn Uhr vormittags. Die Stunde dafür also ungewöhnlich.
Deshalb ließ ihn die Präsidentin nicht eher hereinbitten, bis er sein
Anliegen genannt hatte.
Das war in kurzen Worten geschehen.
„Er käme wegen unserm Fräulein,“ berichtete Pauline und die anfängliche
Mißbilligung war aus ihrem Gesicht verschwunden.
Der bald darauf Eintretende war ein Mann von ungefähr fünfzig Jahren.
Seine breitschultrige Gestalt zeigte die Kraft und Frische eines
Menschen, der einem gesunden Beruf nachgeht. Sein Gesicht war tief
gebräunt. Unter den buschigen Brauen blickten die Augen treu und
klar. Er gefiel der Präsidentin, noch ehe sie ihn angehört hatte. Das
anfängliche Unbehagen, es könne sich um einen der vielen heimlichen
Verehrer ihres schönen Schützlings handeln, wandelte sich in eine
Art behaglicher Neugier. Von diesem ehrenhaft Wirkenden konnte ihrem
Liebling unmög[S. 34]lich eine Gefahr drohen. Als er seinen Namen nannte,
streckte sie ihm herzlich die Rechte entgegen.
„Amtsrat Wullenweber aus Hohen-Klitzig, Regierungsbezirk Köslin,
Hinterpommern,“ wiederholte sie mit einem warmen Lächeln. „Also –
Eva von Ostrieds Vormund! Wie es mich freut, Sie persönlich kennen
zu lernen. Unser Briefwechsel war damals kurz und gestaltete sich
unerfreulich, nicht wahr?“
„Ja,“ sagte er, „ich bildete mir fest ein, daß Sie, Frau Präsident, den
unglücklichen Gedanken meines Mündels kräftig unterstützten.“
„Warum bezeichnen Sie ihn als unglücklich, Herr Amtsrat?“
„Das läßt sich nicht in ein paar Worten sagen.“
„Soll dies heißen, daß die Zeit zu einer richtiggehenden, sogar für
eine Frau begreiflichen Erklärung, Ihnen auch heute fehlt?“
„Zeit hätte ich schon, Frau Präsident. Mein Zug geht erst in vier
Stunden. Mein Hauptgeschäft, der Ankauf einer landwirtschaftlichen
Maschine, ist bestens besorgt.“
„Ach,“ machte sie enttäuscht, „und ich dachte, daß Sie zu mir kämen,
weil doch morgen Eva von Ostried selbständig wird.“
Er lächelte. Das gab seinem ernsten, stillen Gesicht etwas unendlich
Gutes und Liebenswertes.
„Ich glaube, Sie unterschätzen die Sorgen und Lasten des Landmannes
in dieser jetzigen, bösen Zeit, Frau Präsident. Sobald er den
Rücken wendet, geschieht bestimmt eine Dummheit. Ich will mich also
nicht als Einer hinstellen, der allein von der Verantwortung seiner
Vormund[S. 35]schaft getrieben wird. Wenn schon ich nicht verhehlen kann, daß
mir Eva von Ostried viel Sorge gemacht hat.“
„Lieber Herr Amtsrat, das Schicksal teile ich mit Ihnen! Wer sie lieb
hat, wird ewig mit einer gewissen Unruhe im Herzen ihrer Entwicklung
zusehen.“
„Eigentlich lieb ist sie mir nie gewesen,“ gestand der Amtsrat
freimütig ein, „dazu hatte sie zu viel von ihrem Vater.“
Ein verstehendes Lächeln erschien auf dem Frauenantlitz.
„Dann haben Sie ihrer Mutter sicher sehr nahe gestanden.“
„Woher wissen Sie das, Frau Präsident?“ Er sah sie erstaunt und
unsicher an.
„Ich ahne es mit dem Gefühl der reifen Frau. – Der Vater war
augenscheinlich niemals Ihr wahrer Freund. Die Tochter steht Ihrem
Herzen nicht sonderlich nahe und dennoch wehrten Sie sich mit einem
fast leidenschaftlichen Grimm gegen die Fortsetzung ihrer einst vom
Vater gebilligten musikalischen Ausbildung, nachdem der berühmte Gönner
tot war. Da muß also entweder das höchste Gefühl von Verantwortung
und dieses haben Sie mir ja soeben abgestritten – oder das, einer
geliebten Verstorbenen gegebene Versprechen zugrunde liegen.“
„So ist es wirklich. Evas Mutter war die beste und edelste Frau!“
„Sie sind unvermählt geblieben, Herr Amtsrat?“ Er nickte wehmütig.
„Ein paar mal habe ich später aus dieser Einsamkeit herauswollen und
es doch nie über kläglich gescheiterte Versuche gebracht. Das heißt:
verstehen Sie mich nicht[S. 36] falsch. Der andere Teil merkte nichts davon.
Nur mit mir allein brachte ich die Geschichte in Ordnung. Das genügte.
– Ich konnte Evas Mutter nicht vergessen.“
„Verzeihen Sie, wenn ich forsche. Unzartheit ist es nicht. Wie konnte
es kommen, daß Sie sich nicht – war selbst anfangs keine Gegenliebe
vorhanden – von so viel Tiefe und Treue rühren ließen?“
Sein grauer Kopf neigte sich auf die Brust.
„Als ich sie kennen lernte, gehörte sie schon dem Andern. Und ich
war sein Freund und nächster Nachbar. Wissen Sie.. kein Freund, wie
Sie und auch ich jetzt, ihn verlangen. Dazu waren wir Beide viel zu
verschieden. Ich eines schlichten Vaters vierter und jüngster Junge,
zur strengsten Arbeit und Pflichterfüllung seit den ersten Hosen an,
erzogen – er, der Einzige des schönen, flotten und leichtsinnigen
Majoratsherrn auf Waldesruh. Springt man aber jahrelang zusammen barfuß
über die Stoppeln, lauert im Erlenbusch auf die nistende Rohrdommel
oder Nachtigall, weil irgend ein Landbezopftes dem dummen Jungen den
Kopf verdreht hat – na, dann macht sich so was von selbst. Mein
Vater hat zudem dem flotten alten Herrn auf Waldesruh des öfteren
ausgeholfen, ohne sonderlich streng auf die Zinsen zu sehen. So kams,
daß er, der sonst reichlich hochmütig sein konnte, auch mich als
Spielgefährten seines Sohnes gnädig duldete. Meine Brüder sind in
andern Provinzen untergekrochen. Bis auf einen, der sich glücklich
bis zum Major durchgehungert hat und, nachdem ihm ein Jagdunglück,
das kriegerische Handwerk gelegt, hier in Berlin mit seinen beiden
Kindern kein beneidenswertes Dasein hatte. Die Landwirte saßen[S. 37] auf
guten, kleinen Höfen, die Mann, Weib und Kind ernähren. Sie sind schon
verstorben. – Ich kam durch das Erbteil einer Muhme in die Lage, die
väterliche Domäne zu übernehmen, nachdem mein alter Herr sich zum
Sterben hingelegt hatte. – Ein Jahr später schoß sich der schöne,
tolle, leichtsinnige Vater Ostried eine Kugel durch den Kopf. Sein
Sohn, der bei den Pasewalker Kürassieren stand, mußte die Uniform
ausziehen. Das verlangte eine Familienbestimmung. Er tat es ungern,
wenngleich er sich trotzdem so viel Vergnügen, wie nur irgend möglich,
bereitete. Kaum war das Trauerjahr zu Ende, jagte ein Fest das andere.
Der Acker kam dabei natürlich nicht zu seinem Recht. Aber, ich merke
schon, ich erzähle zu langatmig, Frau Präsident.“ Sie wehrte ab.
„Mich interessiert auch das Kleinste in Ihrer Geschichte, Herr Amtsrat.
Und Zeit haben wir reichlich. Der Blick, den Sie soeben nach der Tür
warfen, soll wohl die Frage nach Eva von Ostried ausdrücken, nicht
wahr?“
„Stimmt wieder. Sie ist doch noch bei Ihnen?“
„Sonst wüßten Sie es längst anders. Sie besorgt jetzt nur allerhand für
ihren Geburtstag. Ich bin leider für körperliche Anstrengungen nicht
mehr tauglich. – Nachher hoffe ich, werden Sie sie noch bestimmt sehen
können.“
Er wiegte bedächtig den Kopf hin und her.
„Darauf lege ich keinen Wert, Frau Präsident. Ich würde ihr gegenüber
entweder gerührt – oder hilflos sein. Beides könnte den mangelnden
Respekt nicht bringen. – Nein, lassen Sie nur! Will es der Zufall, daß
sie kommt, so lange ich da bin, drücke ich mich natürlich nicht.“
Sie verstand ihn wieder.
[S. 38]
„Und nun weiter,“ drängte sie.
„Ja und zu einem dieser stolzen Feste kam denn auch eine vergrämt
aussehende Baronin mit ihrer Tochter. Mich hatte er auch geladen, und
– weiß Gott – wie es kam, ich erschien, obwohl ich zuvor dutzende
von Malen abgesagt hatte. – Bis dahin wußte ich nicht viel davon,
wie lieblich eine Frau sein kann. Denn die Langbezopften in unserm
Dorf hatten fast durchgängig Regennasen und derbe, rote Gesichter. Ich
war auch sonst keiner von den Redseligen. Aber an dem Tage konnte ich
überhaupt keinen Ton rausbringen. Nicht mal einen Glückwunsch fand
ich zusammen, als mir mein Freund – Hasso von Ostried – die mir
unirdisch schön erscheinende Tochter der alten Baronin als seine Braut
vorstellte. – Ich habe sie dann auch noch singen hören. Mein Gott –
zu Musik hat bei uns nie die Zeit gereicht. Darum wußte ich vorher
nichts von ihrem Zauber. Er hat alles in mir wach und groß gerüttelt.
Aber es durfte doch nicht leben. Als ich lange nach Mitternacht
heimgestolpert bin, wußte ich, daß ich Hasso von Ostrieds Braut liebte
– und wollte nie, nie wieder in sein Haus. Ihr nie – nie wieder
begegnen. Und bin nachher doch, ganz freiwillig, hingegangen, weil ich
wußte, daß sie bald Einen nötig hatte, der es treu und gut mit ihr
meinte. Auf den sie unbedingt zählen konnte, wenn das unbarmherzige
Kreuz für ihre schwachen Schultern zu schwer würde. – Denn er, der
von Gottes- und Rechtswegen dazu bestimmt gewesen, kümmerte sich bloß
die ersten Jahre um sie. Nachher war anderes genug da. – Die Jagd
– schöne Gäule – auch ein paar Frauen, die seiner nicht das Wasser
reichen konnten. Auch wollte er es nicht verwinden, daß[S. 39] das endlich
geborene Kind ein Mädchen war und keinen Bruder bekam. – Sie – Evas
Mutter – wurde blasser und elender von Jahr zu Jahr. Er hat gelacht,
wenn ihn einer warnend darauf hinwies. Ihre Tröster waren die Musik
und – ich! Das hat sie mir gestanden – drei Tage vor ihrem Tode, der
ganz leise und sanft gewesen sein muß, denn Niemand im Schloß hat etwas
früher davon gemerkt, als bis alles vorüber gewesen ist.“
„Und sie hat nicht gewollt, daß Eva, wenn sich die schöne Begabung auf
sie übertrüge, sie jemals öffentlich ausübe,“ fragte die Präsidentin,
als er einen Augenblick schwieg.
„Sie hat mein Versprechen mit ins Grab genommen, Frau Präsident.“
„Darf ich wissen, worin dies bestand, Herr Amtsrat?“
„Das ist ja die Hauptsache, damit Sie mich und meine damalige
Schroffheit endlich verstehen. Sie müssen wissen, daß sie sich niemals
zu mir über ihren Mann beklagt hat. Darum hat mich dies Letzte auch so
erschüttert. Für sich und ihre Schönheit wollte sie nichts. Jahraus
– jahrein ging sie in einem weißen Kleide und ich glaube nicht, daß
sie etwas anderes anzuziehen hatte. Manch einer riß seine Witze drüber
und hat gemeint, sie spare heimlich, um dem teuren Gatten alle Jahr
ein paar Flaschen echten Sekt zu schenken, von dem die Buddel damals
schon 30 Mark gekostet hat. Ich als Einziger habe die Wahrheit erfahren
dürfen. Ganz zuletzt – wie schon gesagt. Ich will Ihnen ihre Worte
wiederholen. „Sie sollen über meiner Tochter wachen,“ hat sie gebeten
und als ich leise auf Evas Vater hinweisen mußte, nur geflüstert: „Sie
wird ihm bald genug eine Last sein, denn er ist noch jung und will viel
vom[S. 40] Leben. Die Ostriedschen Familiengesetze verlangen aber, daß den
unmündigen Töchtern bei einer zweiten Eheschließung ein Vormund gesetzt
werde. In gewisser Weise hängt er an ihr,“ hat sie dann weiter gesagt,
„denn sie wird einst sehr, sehr schön sein. Das macht ihn stolz. Sonst
aber – innerlich – empfindet er dauernd ein Unbehagen, Eva und er
gleichen einander zu sehr. Sie ist eitel und egoistisch wie er – schon
jetzt – und..“ Hier hat sie ihr Gesicht in den Händen verborgen, als
schäme sie sich ihrer Geständnisse, „ich glaube beinahe, käme sie nicht
in sehr feste, treue Hände, daß auch sie es mit den Begriffen der Ehre
nicht so ganz genau nähme. Darum – solange Sie Gewalt über sie haben,
erlauben Sie nicht, daß sie das Talent, das ich ihr vererben mußte,
– die Stimme, deren Schönheit sich meinem Ohr längst angekündet hat,
zum Beruf ausbildet. Er würde ihr zum Unsegen werden. – Ich selbst
dachte niemals an etwas derartiges. Schon der Gedanke, mich öffentlich
zeigen zu sollen, mich von jedem bewundern und anstarren zu lassen –
machte mir Schmerzen. – Entwickelt sie sich aber weiter zur Tochter
ihres Vaters, wird sie gerade dies glühend ersehnen..“ Ja, so hat sie
gesprochen, Frau Präsident. Zuletzt händigte sie mir noch ein Päckchen
ein, das ich ihrer Tochter bei deren Volljährigkeit übergeben müsse.
Es waren fünfhundert Mark. Wieviel Entbehrungen mochten daran hängen?
Bedenken Sie, aus der Hauswirtschaft nahm sie keinen Pfennig ein. Was
der Garten abwarf, bekam der Schloßherr gleich auf den Schreibtisch
– wenn die Kaufleute die Erzeugnisse nicht schon zuvor für längst
gelieferte Waren mit Beschlag belegt hatten. Einzig hundert Mark
im Jahr[S. 41] erhielt sie aus einer Stiftung vonseiten der verstorbenen
Mutter her. Davon also hat sie dies zusammengerafft. – Ich hab’s gut
angelegt und hier ist es. Es sind tausend Mark draus geworden. Nicht
viel.. Ich habe mir erzählen lassen, daß nach ihrem Tode der Witwer
einer schönen Schauspielerin einen einzigen Mantel für das Dreifache
gekauft habe. – Aber, es ist doch viel mehr wert wie Millionen. Das
Herz dieser seltenen, tapferen Frau hängt daran. Wollen Sie das alles
ihrer Tochter erzählen? – Ich kann’s nicht so. Ich würde wieder und
wieder denken müssen.. das ist Hasso Ostrieds Tochter.. und würde das
Bild vor mir sehen, das ich oft in Wirklichkeit hatte. Obschon der
zwei Jahre nach ihrem Tod von dem Ostriedschen Kuratorium zwangsweise
eingesetzte Verwalter des Majorats ihnen später jeden Kohlkopf und
Groschen zugezählt hat und die Eva mit ihren siebzehn Jahren auch
nicht mehr gänzlich blind und taub durch die Tage ging – hat sie die
Feste, die er – wer weiß – aus welchen Mitteln, schließlich wieder
veranstaltete, mitgemacht – sich allerlei bunte Fähnchen gekauft und
mitgelacht..“
„Vergessen Sie ihre Jugend nicht, Herr Amtsrat.“
„Ihre Mutter ist auch jung gewesen und schön wie ein Engel und rein und
hochbegabt,“ murrte er.
„Vielleicht auch glücklich. – Wissen Sie denn, Herr Amtsrat, ob es ihr
nicht ein tiefes großes Glücksempfinden brachte, daß Sie ihr ergeben
waren?“
„Daran habe ich niemals gedacht.“
„Und es liegt doch so nahe! Ich denke mir, daß sie Ihre feine, starke
Liebe immer fühlte und das unbegrenzte Vertrauen zu Ihnen faßte, weil
Sie sich im Zaum hielten. Eine[S. 42] Frau geht nicht dauernd an tiefstem
Mannesempfinden vorbei. Vielleicht wäre sie sonst unter ihrer Last
zusammengebrochen.“
Er saß ganz still. Seine breiten, sonnverbrannten Hände lagen schwer
auf den Knien.
„Wenn es wahr wäre,“ sagte er ein paarmal vor sich hin, „das wäre
schön.“
„Es ist wahr,“ bekräftigte die Präsidentin. „Wie stellte sich übrigens
Evas Vater später zu Ihnen?“
„Er war auffallend kurz und unfreundlich, wenn wir uns zufällig an den
Grenzen trafen. Sein Haus betrat ich nicht wieder.“
„Merken Sie jetzt, daß ich im Recht bin? Obgleich er die Tote nicht mit
wirklicher Treue liebte, war seiner Eitelkeit der Gedanke, daß Sie ihr
mehr, als er, bedeutet hatten, unerträglich.“
„Er bestimmte sogar in einem hinterlassenen Brief ausdrücklich einen
andern Vormund, wie mich, im Falle ich ihn überleben sollte, und seine
Tochter zu diesem Zeitpunkt noch unmündig wäre. Dabei war er von dem
Wunsch der Toten genau unterrichtet.“
„Wie kam es also, daß Sie es dennoch geworden sind?“
„Nun, er war im Laufe der Jahre den Herren vom Gericht bekannt
geworden. Seine zahlreichen Gläubiger wurden durch seine
Gleichgültigkeit stets gezwungen, sich letzten Endes an die große
Stelle für das öffentliche Recht zu wenden. Auch war sein Leumund
schlechter geworden, seitdem er allein mit der Tochter lebte. Derjenige
aber, den er als Vormund für seine Eva vorgeschlagen hatte, war genau
so ein leichtsinniger, loser Vogel wie er selbst.“
[S. 43]
„An seinen verhältnismäßig frühen Tod muß er doch gedacht haben. Wie
wäre sonst jener Brief zustande gekommen?“
„Ein toller Ritt nach durchzechter Nacht brachte ihm die schwere
Lungenentzündung, an deren Folgen er nach ein paar Wochen auch
gestorben ist. Seine Natur hat sich erstaunlich lange gegen den
Sensenmann gewehrt. In dieser Zeit der Langenweile und vielleicht auch
der Nachdenklichkeit ist das erwähnte Schriftstück, das sonst keinerlei
Wichtiges enthält, entstanden.“
„War er eigentlich mit dem Entschluß seiner Tochter und dem
hochherzigen Anerbieten seines Freundes, des bekannten Königlichen
Kammersängers, sofort einverstanden? Evas Ansicht, die dies lebhaft
bejaht, ist mir in dieser Beziehung nicht maßgebend?“
„Doch, ich glaube es auch! Das Messer saß ihm an der Kehle. Allmählich
sahen auch die Gläubigsten unter seinen Kreditgebern, daß das
Kuratorium ihn unerbittlich beschränkte. Sie zogen sich mehr und mehr
von ihm zurück, um zu den alten Dummheiten keine neuen anzufügen. Denn
er hatte etwas bestrickend Liebenswürdiges, das auch die Vernünftigsten
oft genug blendete. – An mich hat er sich niemals gewandt. Und das ist
das Einzige, was ich ihm hoch anrechne. – Er kannte die ungeheuren
Einnahmen des Kammersängers, der, gleich ihm aus einer altadligen
Familie stammte, und mag wohl – bestimmt durch die glanzvolle Aussicht
für die Tochter, durch welche sich auch seine Lage endlich wieder
heben mußte, die erbetene Erlaubnis zu ihrer Uebersiedlung nach Berlin
bereitwilligst gegeben haben. Eva soll dort übrigens ganz zur Familie[S. 44]
gehört haben. Die Gattin des Künstlers wurde mir seiner Zeit als gute
Hausfrau gerühmt. – Davon werden Sie natürlich mehr wissen, wie ich?“
„Eva ist damals ganz in ihrer Kunst aufgegangen und hat sich scheinbar
um die ihr reichlich prosaisch dünkende Frau des Gönners wenig
gekümmert. Jedenfalls hat der Umstand, daß die nach dem Tode ihres
Mannes sofort den Haushalt auflöste und – ohne Rücksicht auf Eva –
nach München übersiedelte und sich niemals seitdem durch eine Zeile
nach ihr erkundigt hat, zur Genüge bewiesen, wie lose das Band eines
Zusammenhaltes zwischen ihnen gewesen ist..“
„Alles in allem wird Eva von Ostried aber inzwischen eingesehen haben,
daß ich es gut mit ihr gemeint habe?“
„Leider kann ich das nicht bejahen!“
„Ich nahm die Tatsache, daß sie keinen weiteren Versuch zu meiner
Umstimmung machte, für weise Einsicht an.“
„Wie wenig kennen Sie die Tochter Ihrer geliebten Toten! Ihr Schweigen
hatte einen andern Grund. Ich machte ihr klar, daß ich Ihnen keine
schnelle Aenderung einmal gefaßter Ansichten zutraue und vertröstete
sie auf die Zukunft. Da war sie klug genug, sich einstweilen zu
bescheiden.“
„Danach scheinen Sie also ihre Wünsche zu unterstützen, Frau Präsident?
Das ist mir nach dem starken Eindruck, den ich von Ihnen empfing,
unbegreiflich.“
„Auch Sie wären andern Sinnes geworden, hätten Sie sich, gleich mir,
von dem Ernst ihrer Bestrebungen, überzeugen müssen. Und nun gar die
eigene Mutter. Ich habe kein Kind besessen. Und doch fühle ich, daß
eine Jede[S. 45] von uns zurücktreten kann und auch will, wird sie inne, daß
sie der wahren Befriedigung des Kindes hinderlich ist.“
„Darin sollen Sie Recht behalten. Frau von Ostried war wohl eine
scheue, stille Frau für sich selbst. Hätte sie aber einsehen müssen,
daß die Tochter schwer unter der Versagung ihrer Erlaubnis litt, wäre
sie fraglos nachgiebig geworden.“
„Nun begreife ich Sie immer weniger.“
„Das ist auch schwer für Sie. Wir leben in zu verschiedenen
Verhältnissen. Für Sie ist die Grenze, die ich als Horizont achte,
nur ein Scheinbegriff geblieben, hinter dem sich die Unendlichkeit
ausdehnt. Und Wachstum gibt es in Ihrem Leben auch wohl ohne Segen
und Regen. Ich sah nur mein ganzes Leben hindurch klare Luft, den
Horizont und die Entwicklung jeglichen Dinges durch Sonne und Regen...
Einmal bin ich im Theater gewesen und danach nie wieder. Es hat mich
abgestoßen. Lachen Sie ruhig darüber. Eine Frau stand auf der Bühne und
hat alles das vor fremden Ohren preisgegeben, was sie sonst schamhaft
mit sich allein abmacht. – Mir kam sie dadurch wie entkleidet vor. –
Dies Gefühl hat mir die Richtschnur gegeben. Schön und gut! Es mag viel
Kunst dabei sein können. Das verstehe ich nicht. Viel Unwahrhaftigkeit
und Uebertreibung aber auch. Dazu kommt, daß in der Familie meines
einzig noch lebenden Bruders eine Tochter, die viel Hang zur Musik und
zur Künstlerschaft hatte, verloren gegangen ist. Es ist mir sehr nahe
gegangen. Die Kinder meiner andern Brüder, von denen ich Ihnen auch
sagte, sind frühzeitig gestorben. Nun habe ich nur noch einen Neffen,
mit dem ich nie recht warm werden konnte.“
[S. 46]
Daß ein Mann, der das Leben mit all seinen Härten, Entsagungen und
Verlockungen kannte, ein öffentliches Auftreten von dieser Warte
beurteilte, rührte die Präsidentin. Freilich mochte es reichlich
unmodern sein – ja, in den Augen der Meisten wohl gar lächerlich
wirken. Ihr zeigte es den hohen, sittlichen Wert dieses Mannes, dessen
unbewußte, kinderreine Keuschheit sich gegen Schaustellungen der
Gefühle heftig sträubten.
„Was hätte ich dagegen tun wollen,“ sagte sie nach einer Weile des
Schweigens. „Es wurzelt zu tief bei ihr. Ich hätte sie ganz verloren.
Nun darf ich sie wenigstens noch eine Zeitlang behalten.“
„Sie besitzt aber nichts, als das Geld, das ich vorher in Ihre Hand
gelegt habe, Frau Präsident, und ich habe mir erzählen lassen, wie
hoch die Kosten einer gründlichen Ausbildung sind. Damit sollen aber
die Ausgaben noch nicht aufhören. Eine erhebliche Summe, sozusagen
als Daseinssicherheit, muß außerdem vorhanden sein. Mal gibt’s keine
Einnahmen. Mal kosten die Kleider mehr, wie das gesamte Spielhonorar
beträgt..“ Sie mußte unwillkürlich über seinen Eifer, hinter dem sich
ein Stückchen Triumph barg, lächeln.
„Ich bin reich,“ gestand sie endlich. „Sehr reich sogar und habe für
niemand leiblich Verwandtes zu sorgen. Das hat mir oft bitter weh
getan. Ich meinte, die gnädige Vorsehung schickte mir Eva von Ostried
als Ausgleich für mancherlei Entbehrtes. Nun, Enttäuschungen kamen
auch hinterher. In gewissem Sinne ähnelt sie bestimmt dem Vater, wie
Sie ihn mir schilderten. Wenn auch alles liebenswerter und weicher in
ihr gestaltet ist. Ich konnte gar[S. 47] nicht anders handeln, als ich es
schließlich getan habe. Mit dem Augenblick, in dem ich sie in mein Haus
aufnahm, gab ich mir das Versprechen, für sie zu sorgen. – Im April
nächsten Jahres etwa wird sie wieder ernsthaft ihre Studien aufnehmen.
Die Mittel bis zum Schluß und ein rundes Kapital für die von Ihnen
erwähnten Dinge, soll sie von mir erhalten. Ich bringe das in den
nächsten Tagen in Ordnung.“
„Dann habe ich das Meiste umsonst geredet, Frau Präsident.“
„Glauben Sie das nicht, Herr Amtsrat. Ich gebe alles in passender
Stunde an Eva weiter. Es wird Wurzel schlagen. Mit Strenge ist nicht
viel bei ihr zu wirken. Regt sich aber der gute Kern – spricht die
Dankbarkeit und besonders das Erbe ihrer Mutter – eine große Reinheit
in Empfindung und Anschauung – dann kann sie erstaunlich fügsam und
weich sein. Die durch die Wiedergabe Ihrer Worte von neuem geweckte
Erinnerung an ihre tote Mutter wird ihr zum Schutz werden.“
„Sie wird das bißchen Erlernte von der Musik gründlich vergessen
haben,“ wandte der Amtsrat ein. „Drei Jahre ist sie nun bei Ihnen.“
„Und Sie meinen wirklich, daß ich in dieser Zeit das Erreichte nicht
wenigstens erhalten hätte? So kurzsichtig und engherzig war ich nicht.
Ich habe ihr einen bedeutenden Lehrer gehalten und wenn ich auch keine
zeitraubenden Uebungsstunden gestattete – eben weil sie sich an
die Erfüllung bestimmter Pflichten gewöhnen sollte – dies Ende zur
Rückkehr sah ich stets voraus. Es waren also auch in dieser Beziehung
keine verlorenen Jahre.“
[S. 48]
„Die kommenden Zeiten werden unruhig für Sie werden, Frau Präsident.
Und eine Stütze dürften Sie im Alter kaum an ihr haben.“
„Ich glaube auch nicht, daß ich ihrer bedarf, lieber Herr Amtsrat. Ich
entstamme einer kurzlebigen Familie. Eigentlich halte ich mich schon
länger, als es mir vor ungefähr zehn Jahren ein besonders barscher
Arzt bemessen hat. Ich bin auch jederzeit bereit. Nur vorher will ich
noch, etwa im ersten Frühlingsgrün des nächsten Jahres, eine liebe
Jugendbekannte in ihrem Heimatsstädtchen aufsuchen. Immer wieder habe
ich das hinausgeschoben. Jetzt bin ich fest dazu entschlossen. Und
wissen Sie, wen ich bei dieser Gelegenheit noch besuchen möchte? Dieser
Gedanke ist ganz neu.. Einen guten, treuen Menschen, welcher der beste
und zuverlässigste Freund gewesen ist. Seine Scholle liegt meinem Wege
überaus günstig. Wenn ich richtig schätze, kaum eine Bahnstunde von der
pommerschen Seestadt entfernt, in welcher meine Bekannte lebt. Wollen
Sie seinen Namen wissen? Er heißt Amtsrat Wullenweber und wird hiermit
feierlich angefragt, ob er mich wohl auf einen Tag haben mag?“
Er strahlte, sie aus seinen treuen, blauen Augen ehrlich erfreut an.
„Ob ich mag, Frau Präsident! Ich will alles vom Boden bis zum Keller
putzen lassen und meine alte Klidderten soll mal zeigen, was eine
richtige, gute hinterpommersche Wirtschafterin leisten kann.“
„Um Gotteswillen,“ lachte sie fröhlich, „das wird bestimmt unmöglich
gemacht. Eines Tages trete ich, ohne vorherige Anmeldung, mit einem
kleinen Reisetäschlein, bei[S. 49] Ihnen an und werde dankbar sein, wenn
Sie mir einen Platz an Ihrem Tisch und höchstens noch ein Gericht
Dabersche Kartoffeln mit fetter Buttermilch gönnen. Denn Sie müssen
wissen, daß meines lieben Mannes erste Richterstelle in Köslin war, das
ebenfalls im Regierungsbezirk Köslin liegt. Darüber sind freilich schon
einige dreißig Jahre vergangen. Auch haben wir damals weder Zeit noch
Lust gehabt auf den benachbarten Gütern Bekanntschaften anzuknüpfen.
Meines Mannes Dezernat war sehr umfangreich. Ein Anwalt, der ihm die
zahlreichen Verträge und Testamente abgenommen hätte, wollte sich aus
Furcht, kein genügendes Auskommen zu finden, nicht niederlassen.“
„Und jetzt sitzen dort längst ihrer zwei, die in guter Freundschaft
miteinander leben.“ –
„Sie kennen das kleine, saubere Städtchen natürlich ganz genau?“
„Versteht sich, Frau Präsident. So dick gesät sind ja die Nester bei
uns da hinten bekanntlich nicht. Mit meinen jungen Schimmeln schaffe
ich die Geschichte in knappen drei Stunden.“
„Wie seltsam spielt die Vorsehung. Ich bin geneigt, dies alles als
etwas anzusehen, das Eva von Ostried zum Nutzen und Frommen werden muß.
Vielleicht lernen Sie sie bald näher kennen und gewinnen sie im Laufe
der Zeit ebenso lieb, wie ich es tue.“
„Daran würde ihr kaum etwas gelegen sein. Ich habe herausgefühlt,
daß ihr Vater über mich in einem Ton gesprochen haben muß, der weder
Vertrauen noch Hochachtung säen konnte.“
[S. 50]
„Und dennoch bitte ich Sie in dieser Stunde von ganzem Herzen, unser
Sorgenkind nicht aus den Augen zu lassen, wenn sich die Prophezeiung
jenes Arztes einmal überraschend schnell an mir vollziehen sollte.“
„Sie werden gemerkt haben, daß ich ein schwerfälliger Mensch bin, Frau
Präsident.“
„Einer, hinter dessen schlichtem Wort jedenfalls die Tat steht, Herr
Amtsrat.“
„Aber auch ein Weltfremder und Ungeschickter.“
„Sie zögern also?“
„Wenn Weg und Ziel im Dunst liegen, geht die Fahrt gewöhnlich schief.
Ich wüßte nicht, womit ich ihr helfen könnte.“
„Das ist mir vorläufig gleichfalls verborgen. Es kann aber sehr wohl
kommen, daß sie durch irgend welche Ereignisse hilflos wird. Ich will
morgen auch diesen Fall mit ihr besprechen. Sie soll sich an Sie
wenden, wenn sie allein nicht mehr weiter kann.“
„Tut sie das, Frau Präsident, will ich ihr nach bestem Wissen raten und
helfen. Darauf mein Wort.“
„Das genügt mir. Ich danke Ihnen innig, Herr Amtsrat, und jetzt lassen
Sie uns ein Glas jenes alten schweren Weines zusammen trinken, dessen
letzte Flasche seit einem viertel Jahrhundert auf einen würdigen
Augenblick im Keller wartet.“
Hell war auch der neue Tag und voll goldenen Lichtes. Eva von Ostried
stand unter einem besonders gesegneten Apfelbaum. Ein Stückchen blauen
Himmels und die be[S. 51]grenzte Ferne drängte sich durch das Gewirr der
Zweige und Früchte. Stolze Träume schoben ihr jedes Hindernis fort.
Sie fühlte sich frei wie nie zuvor, trotzdem ihr nichts geschehen war,
als daß sich heute ihr einundzwanzigstes Lebensjahr vollendete. Der
kommenden, ernsten Arbeit gedachte sie freilich auch. Mehr aber des
andern, nach dem sie sich unaussprechlich sehnte.
Reich – angebetet – beneidet zu werden, war ihr Streben. Von jeher
haßte sie dies Einschränken und Sorgenmüssen. Der Traum ungezählter
Tage, das bewußte und unbewußte Sehnen nächtlicher Träume, gilt dem
Glanz einer sorglos heiteren Zukunft. Erst, nach dem großherzigen
Versprechen der Präsidentin erkannte sie schaudernd, daß ihr Leben
verfehlt und zerbrochen gewesen wäre, hätte die gütige Frau ihre
Zukunftswege nicht zu ebnen versprochen.
Bei dem bloßen Gedanken an diese Möglichkeit schüttelte sie wiederum
ein Grauen. Vielleicht hätte sie dann, gezwungen von ihrer Sehnsucht,
den Versuch gemacht, um jeden Preis die fehlenden Mittel selbst zu
beschaffen. So aber war es schöner und bequemer!
Sie nickte der Sonne zu und jauchzte hell auf – streckte die Arme und
griff spielerisch nach den blendenden Kreisen.
„Der Ruhm soll mir beide Hände mit Gold füllen.“
Von der Veranda her ertönte ihr Name. Ungeduldig winkte ihr die
Präsidentin.
„Wo bleiben Sie, Eva?“
Da flogen die Träume von dannen. Was aber blieb, war noch köstlich
genug. Gaben – Freundlichkeit – und Ermahnungen. Auch diese! Eva
von Ostried hörte schein[S. 52]bar aufmerksam zu, als ihr Frau Melchers vom
alten Amtsrat Wullenweber und allem, was zwischen ihnen gesprochen war,
sagte. Im Stillen dachte sie:
„Ehe ich mich jemals an den engherzigen, mürrischen Nachbar wende,
würde ich lieber hungern.“
Daß dies Schreckliche in Wahrheit eintreten könnte, erschien ihr
freilich undenkbar.
Als sie das Erbe der Mutter empfing, mußte sie weinen.
Es war ja so unendlich wenig. Ihr Vater hatte oft mehr als das
Dreifache in einer Nacht im Spiele verloren. Aber es rührte sie! Die
verblaßten Erinnerungen füllten sich mit lebendigen Farben. –
Ihre feine, kleine, stille, zarte Mutter! – Wie sie Paul Karlsen in
der Dunkelheit des gemeinsamen Warteraums an sich gerissen, hatte sie
ihrer plötzlich gedenken müssen – sie um Hilfe anflehend. – Den
Vater hatte sie damals vergessen. Der war ja auch nur für die lustigen
Stunden dagewesen. – Sie hielt das Geld traumverloren fest und sah
unverwandt darauf nieder.
„Was gedenken Sie damit zu beginnen, Eva,“ forschte die Präsidentin
neugierig. „Am besten tragen Sie es noch heute auf die Bank.“
„Ich gebe es nicht fort,“ sagte Eva hastig. „In meinem Schmuckkasten,
der leider nichts birgt, als die kleine goldene Brosche von Ihnen, wird
es liegen und geduldig warten.“
„Worauf denn, Kind?“
„Daß ich es in etwas Wunderschönes umsetze. Ich weiß auch schon, worin.
Zum Beispiel einen Teil in den entzückenden Hut mit dem Reiher, von dem
uns neulich die[S. 53] Verkäuferin sagte, daß ihn getrost eine regierende
Fürstin tragen könne.“
„Dies mühsam abgedarbte Scherflein Ihrer guten Mutter wollten Sie so
hinwerfen, Eva?“
„Schelten Sie nur! – Schön und verführerisch bleibt der Gedanke doch.
Da geht eine Prinzessin oder zum mindesten eine Millionärin, würden sie
sagen und sich nach mir umdrehen. Und würden vor Neid fast platzen. Und
ich lache mich halb tot und freue mich.“
Da brach jene oft bekämpfte Verständnislosigkeit, die den eigentlichen
Wert des Geldes garnicht begriff, wieder durch. Scheinbar war sie
unbesiegbar. Die Präsidentin beschattete die Augen mit der Rechten.
Es war doch nicht möglich, daß sie ohne ihren alten Freund und
Rechtsbeistand die Bestimmung über Eva von Ostrieds zukünftiges Erbe
traf.
Eva von Ostried hatte keinen Augenblick die Empfindung, etwas
Unrechtes ausgesprochen zu haben. Sie lief fröhlich der Post entgegen,
die soeben, nach dem langhallenden Klingelton, in den am Gitter
angebrachten Kasten hineingeschoben wurde. Bald darauf hielt die
Präsidentin einen an sie gerichteten Brief in der Hand. Die Schrift
auf dem Umschlag war ihr fremd. Ohne sonderliche Eile öffnete sie ihn.
Ihre häufig auch nach außen hin betätigte Herzenswärme brachte ihr
fast täglich die bittenden Jammerrufe Notleidender ins Haus. Als sie
die wenigen Zeilen überflogen hatte, erblaßte sie und sagte weich und
zärtlich:
„Du sollst mich nicht vergeblich gerufen haben.“
Solange Eva von Ostried im Hause der Präsidentin weilte, hatte sich
jene noch niemals von einer Aufregung sichtbar beherrschen lassen.
Zu allen Zeiten wußte sie das wohltuende Gleichmaß einer abgeklärten
Ruhe zu bewahren. Jetzt aber sprang sie mit den Zeichen einer großen
Erregung auf und ging hastig in dem blumengeschmückten Zimmer auf und
nieder. Dabei ließ sie den soeben empfangenen Brief keinen Augenblick
aus der Hand. Immer wieder überlas sie ihn und fuhr zuweilen sanft
darüber hin, als ob sie etwas Liebes streicheln wolle. Endlich blieb
sie vor Eva stehen.
„Meine alte, liebe Jugendfreundin mußte mich erst rufen, ehe ich mich
zu ihr finde. Was hilft es, daß ich fest entschlossen war, diese Reise
anzutreten? Da steht, daß sie sich längst nach mir gesehnt hat und mich
nur nicht früher zu rufen wagte, weil sie Rücksicht auf mein Herzleiden
nehmen wollte. Wenn ich nun zu spät käme.“
Ehe Eva etwas darauf erwidern konnte, las sie das Schreiben vor:
„Wundere Dich nicht, meine liebe Hanna, daß ich mit Blei schreibe
und daß der Umschlag fremde Handzeichen – nämlich diejenigen einer
liebevollen Pflegerin – trägt. Es geht mir nicht gut. Ich hatte
vor einigen[S. 55] Wochen den Fuß gebrochen und war seitdem zu strenger
Ruhe verurteilt. Alles schien einen günstigen Verlauf zu nehmen,
bis eine Lungenentzündung hinzutrat, die mir viel Schmerzen macht.
Zwar bin ich stets, wie Du weißt, ein harter Mensch gewesen, aber
man kann doch nichts voraussagen.
Ich habe Sehnsucht nach Dir, Hanna, und würde mich innig freuen,
wenn Dir Deine Gesundheit endlich gestattete, zu mir zu kommen. In
diesem Fall telegraphiere ausführlich. Du wirst dann von meiner
Pflegerin, die nachmittags stets ein Stündchen spazieren gehen muß,
auf dem Bahnhof erwartet und in mein Haus geleitet werden.
Deine alte treue
Maria Wunsch.“
Dann sagte sie eilig und fest:
„Bringen Sie mir sogleich das Kursbuch, Eva, und beauftragen Sie
Pauline, daß sie den kleinen Handkoffer herunterschafft. Das
weitere besprechen wir, sobald ich das Telegramm mit der genauen
Ankunftsbestimmung fertig habe.“
Eva von Ostried legte die Hand bittend auf den Arm der Präsidentin.
„Sie dürfen unmöglich reisen! Denken Sie daran, wie eindringlich
Geheimrat Schwemann vor jeder Anstrengung und Aufregung gewarnt hat. –
Wenn ich auch gelobe, daß Sie sich über keine meiner Vergeßlichkeiten
ärgern sollen – wenn ich selbst auf der Reise und während unseres
Aufenthalts sehr tüchtig und umsichtig sein will – so würde es doch zu
viel für Sie werden.“
[S. 56]
„Ich glaube, Sie haben mich mißverstanden, Eva. Ich denke diesmal
allein zu reisen. Sie werden daheim bleiben.“
Das schöne, junge Gesicht wurde blaß vor Schreck.
„Sind Sie unzufrieden mit mir? War ich auf der letzten Reise nicht
liebevoll und aufmerksam genug? O, ich fühle es. Die unglückliche
Theatergeschichte trägt die Schuld daran.“
„Nein, mein Kind, die hat gar nichts mit meinem heutigen Entschluß zu
schaffen. Ich war voll zufrieden mit Ihnen. Die kleine Episode, mit der
mich allerdings betrübenden Heimlichkeit, kann nichts daran ändern.
Der Grund ist ein anderer. Das Heim meiner alten Freundin ist eng und
mehr als bescheiden. Nun bereits eine Pflegerin darin nächtigt und ich
mich demnächst auch noch dazu finde, würde für Sie kaum ein Plätzchen
bleiben. Und im Hotel? – Ja, dann hätte ich wiederum nicht viel von
Ihnen und meine gute, sorgsame Maria würde sich dauernd aufregen, weil
sie so beschränkt in der Ausübung ihrer Gastfreundschaft sein muß. Nein
– nein. Diese Unruhe müssen wir ihr ersparen. Erinnere ich mich recht,
habe ich unterwegs irgendwo einen längeren Aufenthalt. Das stelle ich
sogleich fest. – Jedenfalls Zeit genügend, Ihnen ein Kärtchen zu
schreiben, Aufzeichnungen, wie ich das auf jeder Reise zu tun liebe, zu
machen und beschaulich die verschiedenen Tageszeitungen zu lesen.“
„Tun Sie es nicht! Ich flehe Sie an,“ bettelte Eva von Ostried.
„Diesmal bleibe ich fest. Sparen Sie jedes Wort. Eine freudige
Sicherheit wie ich sie lange nicht mehr empfand,[S. 57] sagt mir, daß ich
recht handle. Geht es mir trotzdem schlecht – fühle ich mich ohne Ihre
kleinen Hilfeleistungen, an welche ich mich allerdings gewöhnt habe, zu
matt, werde ich Sie umgehend telegraphisch rufen. Das verspreche ich
Ihnen.“
Noch einmal machte Eva den Versuch zur Umstimmung.
„Wenn Sie mir nur erlauben, daß ich Sie bis zu Ihrem Ziel begleite. Ich
könnte sofort mit dem nächstmöglichen Zuge zurückreisen.“
„Wie hilflos und hinfällig muß ich Ihnen erscheinen. Nein und zum
letzten Mal, nein, Eva. Sie bleiben hier, helfen der guten Pauline beim
Einlegen der Früchte – schreiben mir fleißig und singen und studieren
in der übrigen Zeit nach Herzenslust.“
Da mußte Eva von Ostried sich fügen. Sie tat es langsam und
widerwillig. Als die Präsidentin sie noch einmal zurückrief,
hoffte sie auf eine Sinnesänderung. Es handelte sich aber um etwas
Nebensächliches, das nichts an dem Beschlossenen änderte.
„Noch schnell etwas über mein Reisekleid,“ sagte die Präsidentin
frisch, „meine gute Maria liebte einst besonders ein schwarzes,
schlichtes Seidenkleid an mir, das ich seit Monaten nicht mehr trug,
weil es mir zu feierlich war. Sie finden es sorglich verpackt in
der zweiten Bodenkammer in dem alten Schrank. Streng modern ist es
natürlich längst nicht mehr. Gleichviel – ich will ihr die Freude
machen nach der langen Zeit darin unser Wiedersehen zu feiern. Sie wird
daran auch merken, wie treu ich selbst das Kleinste und Unwichtigste
aus unserm Verkehr im Gedächtnis bewahre.“
[S. 58]
Eva von Ostried wagte keine weiteren Einwendungen.
Der ruhige, durchaus bestimmte Ton, in dem die Präsidentin gesprochen,
ließ sie erkennen, daß auf dem bisherigen Wege keine Sinnesänderung
zu erwarten stand. Ihr Herz klopfte in einer jäherwachten, ihr
selbst unbegreiflichen Angst. Vielleicht würde die alte Pauline mehr
ausrichten. – Die treue Dienerin schüttelte den Kopf, als Eva ihr in
hastigen Worten das Nötige mitteilte.
„Sie hat es sich vorgenommen. Dagegen können wir nichts machen,“ meinte
sie bedrückt.
„Versuchen Sie doch wenigstens ihr abzureden, Pauline,“ bat Eva von
Ostried eindringlich. „Wer so lange wie Sie mit ihr zusammen gewesen –
ihr gedient – sie umsorgt, und schließlich auch das Schwerste, den Tod
ihres Gatten mit durchgemacht hat, der muß verstehen, wirkungsvoller
als ich zu bitten.“
Das faltige Gesicht senkte sich kummervoll.
„Wie wenig kennen Sie unsere Frau Präsidentin noch, wenn Sie daran
glauben. Ja – käme es hierbei allein auf sie an. Wäre das eine Reise
zur bloßen Erholung. – Eigensinnig war sie nie und für ordentliche
Ratschläge hatte sie immer ein offenes Ohr, auch wenn sie so ein
einfacher Mensch gab, wie unsereins. Es geht aber um Jemand, dem sie
gut ist und gegen den sie etwas wie ein böses Gewissen hat. Da ist sie
nicht zu halten. Nein, Fräuleinchen, wir beide können bloß den lieben
Gott innig bitten, daß er sie uns gesund zurückschickt.“
Das sonderbar beklemmende Gefühl wollte Eva von Ostried nicht
freigeben. Stärker wurde ihre Unruhe. Sie war fieberhaft fleißig, weil
sie hoffte, ihre Gedanken da[S. 59]durch abzulenken. Allein auch dies Mittel
versagte. Schließlich, als sie mit den hauptsächlichsten Vorbereitungen
zur Reise fertig geworden, setzte sie sich auf Frau Melchers besonderen
Wunsch an den Flügel und begann deren Lieblingslied zu singen:
Am Abend, wenn die Sternlein all
Zum güldnen Tanz antreten,
Dann falt’ ich fromm die Hände mein
Um für Dein Glück zu beten..
Mitten in den weichen, wundervoll reinen Tönen versagte ihre Stimme.
Mit einem erstickten Schluchzen legte sie den Kopf auf die Tasten.
„Was haben Sie, Kind,“ fragte die Präsidentin erschrocken.
„Ich weiß es selbst nicht. Einmal vor langen Jahren war mir ähnlich
zumute. Damals brannte in Waldesruh die gefüllte Scheune herunter und
der Wind stand so ungünstig, daß alle ein Herüberspringen der Flammen
auf unser Schloß fürchteten.“
„Es ist aber letzten Endes glücklich bewahrt geblieben, nicht wahr?“
„Ja – wie durch ein Wunder!“
„Sehen Sie wohl! Auf dies Wunder wollen auch wir hoffen. Das heißt, ich
wüßte kaum, aus welcher Not es uns zur Zeit helfen sollte. Der heutige
Tag hat Sie ungewöhnlich erregt, Evalein. Das ist verständlich. Es tut
mir herzlich leid, daß wir ihn so wenig festlich und würdig zu Ende
führen konnten.“
Eva hob die tränennassen Augen zu der Gütigen empor.
„Haben Sie mir wirklich jene Eigenmächtigkeit in Oeynhausen voll
vergeben,“ fragte sie leise.
[S. 60]
„Ich will zugestehen, daß ich anfangs schwer darunter gelitten habe.
Nun ist längst alles wieder gut. Lassen Sie sich sagen, daß ich Sie wie
mein eigenes Fleisch und Blut liebe. Ja – Eva, daran denken Sie stets.
Nicht nur heute und morgen, sondern auch und besonders, wenn Sie einst
ohne mich wandern müssen. – Jetzt aber genug von diesen Dingen. Wir
wollen uns nicht unnötig weich machen.“
Da fühlte sich Eva endlich von dem unerklärlichen Alp befreit und
jauchzte ein zartes Frühlingslied heraus. Die Präsidentin nickte
lächelnd und dachte:
„Wie weich und gut sie ist, trotz ihrer Fehler und wie liebenswert. –
Warum habe ich mir so viel Sorgen um sie gemacht? Ein Blumengarten ohne
Unkraut ist doch eine Unmöglichkeit. Ich werde mit Gottes Hilfe schon
das Wuchernde mit Stumpf und Stiel ausrotten. – Schwere Aufgaben sind
allemal die lohnendsten.“
Und sie strich in mütterlicher Zärtlichkeit heimlich über Eva von
Ostrieds Aermel, ohne daß diese in ihrer begeisterten Versunkenheit
etwas von der stillen Liebkosung merkte. Seit langen Jahren war der
Präsidentin nicht so leicht und glücklich zu Sinn gewesen, wie in
dieser Stunde.
*
Um elf Uhr am nächsten Vormittag war die Abreise endgültig festgesetzt.
Die alte Pauline hatte es sich nicht nehmen lassen, trotz der Abwehr
der Präsidentin einen riesigen Strauß bunter Astern und letzter Rosen
zu binden. Sie war gerade damit beschäftigt, ihn an die Schirmhülle zu
befestigen, als die Glocke der Gartenpforte anschlug.
„Wir dürfen jetzt keinen Besuch annehmen,“ flüsterte Eva von Ostried
der Getreuen zu. „Die letzte Stunde muß[S. 61] Frau Präsidentin möglichst
ruhig verbringen. Hören Sie nur, wie stürmisch geklingelt wird.“
„Ich lasse keinen rein, Fräuleinchen; es sei denn der Geldbriefträger.“
Es war aber nur ein einfach aussehender älterer Mann in der Tracht
eines schlichten Bauern. Anfangs begriff er nicht, daß es Leute geben
sollte, die einem Unbescholtenen den Eintritt verwehrten. Als sich aber
die Pforte durchaus nicht vor ihm öffnen wollte, wurde er zornig.
„Denken Sie vielleicht, ich wäre eigens aus dem Oderbruch hergekommen,
um mich von Ihnen wieder wegschicken zu lassen, als wollte ich betteln.“
Die alte Pauline suchte ihn zu besänftigen.
„Nehmen Sie doch endlich Vernunft an. Ich sage Ihnen zum letzten
Mal, es geht eben heute nicht. Unsere Frau Präsidentin will gleich
verreisen. Eigentlich darf sie gar nicht, weil ihr Herz nicht in
Ordnung ist. Darum muß sie wenigstens, bis der Wagen kommt, ganz still
liegen.“
„Das kann sie meinetwegen ja auch,“ murrte der Bauer. „Wenn Sie denken,
daß ich sie aufregen tue, irren Sie. Was ich von ihr will, macht bloß
Freude.“
„Warten Sie einen Augenblick,“ meinte Pauline, durch sein zähes
Ausharren unschlüssig geworden, „ich rufe mal schnell das Fräulein
heraus. Die wird Ihnen das alles besser klar machen.“
Eva bemühte sich trotz ihrer ärgerlichen Ungeduld, die sich beim
Anblick des Hartnäckigen steigerte, möglichst sanft zu sein.
„Wirklich, lieber Mann, es geht nicht. Kommen Sie nach ein paar Wochen
wieder oder – schreiben Sie an Frau[S. 62] Präsident, wenn Sie mich durchaus
nicht in Ihre Angelegenheit einweihen wollen.“
„Schreiben – schreiben,“ echoete der Bauer. „Wenn ich hätt’ schreiben
wollen, wäre ich erst gar nicht hergekommen. Ich befaß mich aber
mit solchen neuen Moden nicht gern. Von Mund zu Mund – von Hand zu
Hand – ist alles sicherer. Als ich vor zehn Jahren Frau Präsidentin
unter meinem Dach hatte, haben wir auch nichts Schriftliches zusammen
aufgesetzt. Sie hat zu mir gesagt: Sie sind ein rechtschaffener Mann.
Ich hab’ Vertrauen zu Ihnen. Und hier ist das Geld –“
„Geld wollen Sie also auch heute wieder von ihr, wenn ich Sie recht
verstehe?“ forschte Eva von Ostried.
Da riß die Geduld des Bauern vollends.
„Ich bin der Tabakbauer Kleinschmidt aus dem Oderbruch, eine Meile von
Schwedt, und brauch’ kein Geld mehr. Gott sei Dank. Und wenn Sie’s
immer noch nicht wissen, merken Sie sich’s jetzt wenigstens. Ich bring’
ihr Geld. Das, was ich ohne Schuldschein oder Hypothek als bloßes
Darlehn auf mein Gesicht und meine beiden Hände hin mal gekriegt hab’.
Ich hab’ noch nie bis heut erlebt, daß man einen, der Geld bringt,
nicht rein läßt. Und nun bestellen Sie ihr das, wenn Sie nachher keinen
Aerger haben wollen.“
Das tat Eva nach kurzem Ueberlegen wirklich.
Die Präsidentin erhob sich sofort.
„Natürlich lassen Sie ihn nunmehr ungesäumt zu mir, Eva. Ich kann
mir den Zorn dieses braven, tüchtigen Mannes sehr wohl vorstellen.
Allerdings begreife ich vorläufig nicht, wie er mir jenes Darlehn
ohne vorherige Auf[S. 63]kündigung einfach ins Haus bringen kann. Indes war
die bisherige Art unseres Geschäftsabschlusses ja auch eigenartig und
ungewöhnlich. Jedenfalls rufen Sie ihn mir!“
Sie streckte dem Eintretenden freundlich die Hand entgegen.
„Nichts für ungut, lieber Kleinschmidt. Sie haben wohl gemerkt, daß
die, welche ich als die Meinen bezeichnen muß, weil sie treu für mich
sorgen, überängstlich sind. Sehen Sie’s ihnen nach. Ich muß das täglich
ertragen und noch dazu mein allerfreundlichstes Gesicht machen. Sie
werden doch nur sehr kurz davon betroffen.“
„Ich an Ihrer Stelle würde sie schön auf den Trab bringen, Frau
Präsident.“
„Möchte ich auch mehr als einmal besorgen, lieber Kleinschmidt.
Aber – ich fühle, daß ich sie notwendig habe und nehme deshalb die
gelegentlichen kleinen Uebertreibungen geduldig in den Kauf. – Ich
will verreisen, wie Sie natürlich schon gehört haben. Sie sind mir also
nicht böse, wenn ich Sie nicht zu längerem Verweilen nötigen kann.“
Er zog umständlich eine dicke Brieftasche hervor.
„Als es mir damals so schlecht ging, weil uns die beiden Staatskühe
fielen und der Nachbar mich mit dem Wechsel betrogen hatte, wollte ich
mich aus der Welt machen.“ Die Präsidentin legte die Finger an die
Lippen.
„Nicht mehr dran rühren, Kleinschmidt. Es ist ja alles wieder gut
geworden.“
„Ist es auch! Ich hab’ mich langsam rausgebuddelt, weil es eben doch
noch einen guten Menschen gegeben hat, woran ich nicht mehr glauben
wollte.“
[S. 64]
„Es gibt deren Viele,“ versuchte sie ihn abzulenken, aber er beharrte
eigensinnig bei seinem Thema.
„Nee – bloß einen. Dabei bleib’ ich. Jede andere feine Dame hätt’
sich wohl halb zu Tode geschrien, als sie sah, daß sich ein alter
Nichtsnutz, bei dem der blaue Vogel überall hinflog, das Leben nehmen
wollt’. Zum mindesten wäre sie bestimmt auf die Dorfstraße gelaufen und
hätt’s bekannt getan. – Sie haben bloß still meine Hände gestreichelt
und geweint. Und sind die ganze Nacht bei mir geblieben und haben immer
getröstet. – Und am nächsten Morgen nahmen Sie ein Buch aus der Tasche
und fragten, wieviel ich nötig hätt’.“
„Hören Sie auf, Kleinschmidt. Es peinigt mich wirklich.“
„Sie sagten ja, Sie wären Geduld gewöhnt, Frau Präsident. Ich muß Ihnen
das mal so richtig klar machen, – Sie haben mir viel Geld gegeben
und kannten mich doch bloß als einen, der ein luftiges Zimmer für –
weiß Gott, genug Geld an Sie abvermietet hatt’. – Das hat mir erst
richtig das Leben gerettet. Nun konnt’ ich mich nicht mehr wegstehlen.
– Sie mußten Ihr Geld zurückhaben. Und hier ist es! – Auf Heller und
Pfennig. Die letzten Zinsen sind auch beigepackt.“
Umständlich begann er die zerknitterten Scheine auf den Tisch zu
zählen. Sie machte eine entsetzte Bewegung.
„Wo soll ich jetzt mit dieser Summe bleiben? Sie sehen, ich stehe im
Begriff, eine Reise anzutreten. Mitnehmen mag ich sie nicht. Sie daheim
im Schreibtisch zu belassen, ist mir zu ängstlich, wennschon ich bisher
vor Dieben bewahrt geblieben bin.“
[S. 65]
Er wußte ihr keinen Rat. Es blieb ihm unverständlich, daß bares, gutes
Geld unwillkommen sein konnte.
„Nehmen Sie es wieder mit, Kleinschmidt, und bringen oder schicken Sie
es mir per Post ein paar Monate später. Selbstverständlich berechne ich
Ihnen für diese Zeit keine Zinsen.“
Er schüttelte energisch den Kopf.
„Nee, Frau Präsident, das mach ich nicht! Behalten Sie es man. Wer so
ein schönes großes Haus besitzt, hat auch Keller und Schlupfwinkel, wo
es vor dem lichtscheuen Gesindel sicher liegt.“
Er lächelte schlau. Sie erkannte, daß es zu viel Zeit nehmen würde, um
ihn zu überzeugen und begann mechanisch die Scheine nachzuzählen.
„Es stimmt natürlich,“ sagte sie. „Zwölftausend Mark und
zweihundertvierzig als halbjährige Zinsen. Wissen Sie, dies Geld
schwebt eigentlich gänzlich in der Luft. Ich habe es nicht mal
ordnungsmäßig gebucht. Wären Sie, trotz Ihres mir bekannt gewordenen
Fleißes nicht in die Lage gekommen, es zurückzuzahlen, hätte ich es
Ihnen einfach geschenkt.“
In sein verwittertes Gesicht stieg die Röte der Scham.
„Schenken mag wohl leicht sein, Frau Präsident. Das Nehmen ist ein
sauer Ding. Ich wär’ mein Leben nicht mehr froh geworden. – Die
Tochter hat auch gesagt: „Vater, wir wollen uns ran halten, daß der
Tisch klar wird.“ Sie wissen wohl, ihr geht es gut. Der Mann ist
nüchtern und flink und die vier Kinder tun schon manchen Handschlag in
der Wirtschaft. – Nun will ich aber nicht länger aufhalten.“
[S. 66]
Sobald er gegangen war, rief die Präsidentin Eva von Ostried herein,
deutete auf das noch ausgebreitete Geld und sagte eilig:
„Das hat er mir soeben zurückgezahlt. Es kann natürlich nicht im Haus
bleiben. – Die Einbrüche in der Nachbarschaft mehren sich. Bringen Sie
es sofort auf die Bank, liebe Eva. Wie günstig, daß wir sie gleich an
der nächsten Ecke haben. Sie wissen, ich bin durchaus keine ängstliche
Natur. Nach den jüngsten Erfahrungen unserer Bekannten, denen die
leichtsinnig im Schreibtisch aufbewahrte Summe gestohlen wurde, ohne
daß der Dieb bisher zu ermitteln gewesen, würde mir aber der Zwang
hierzu die ganze Reise verderben. Geschenke mache ich über alles gern.
Nur eine Unachtsamkeit, aus welcher ein verdienter Verlust käme, würde
ich mir schwer vergeben.“
Eva hatte bereits den Hut aufgesetzt.
„Und ich würde vor lauter Angst und Verantwortlichkeitsgefühl keine
Minute ruhig schlafen können,“ gestand sie. – Im Laufschritt eilte sie
durch den Vorgarten und stand nach wenigen Minuten vor dem stattlichen
Gebäude der Großbank. Ihre Hand lag schon auf der eisernen Klinke neben
der schweren zurückgeschobenen Schutzrollwand, als ihr Blick auf eine
Mitteilung fiel, die in der Mitte der Tür angebracht war:
Heute wegen Revision der Kassen geschlossen. Einen Augenblick stand
sie wie erstarrt. Dann, als die Uhr irgend einer öffentlichen Anstalt
schlug, ward sie mit Schrecken inne, daß in einer halben Stunde die
Fahrt zum Bahnhof beginnen müsse. Krampfhaft die kleine Ledertasche
umklammert haltend, eilte sie zurück.
[S. 67]
Was sollte nun mit dem Geld geschehen? – Durfte sie zugeben, daß sich
die Präsidentin beunruhigte? Ja mehr als das – daß sie bei ihrem stark
entwickelten Gefühl zur Ordnung und Vorsicht keinen Augenblick von
dem quälenden Gedanken an den aufgezwungenen Leichtsinn befreit sein
würde. Immerhin – es half nichts! Gemeinsam wollten sie ein möglichst
sicheres Versteck heraussuchen. Vielleicht wußte die alte Pauline gar
einen eisernen Kasten, den sie nach dem Muster mißtrauischer Altvordern
etwa im Keller vergraben könnten. Als sie sich dies ausmalte, mußte
sie lachen. Das befreite sie von allem Bangen. Ein neuer Gedanke kam
ihr, wurde kaum geprüft, sondern sogleich als der einzig mögliche
Rettungsweg empfunden. War es nicht geradezu ihre heilige Pflicht,
der herzensguten Präsidentin und zweiten Mutter diese ihr plötzlich
durchaus nicht übertrieben erscheinende Sorge abzunehmen? Als sie die
Villa erreicht hatte, wartete dort schon die zuvor bestellte Droschke.
„Es ist ja noch viel zu früh,“ rief sie dem Lenker zu. Der schwippte
als Antwort nur mit der Peitsche. Erst als sie, lauter und
ungeduldiger, ihre Worte wiederholte, ließ er sich zu einer knappen
Erwiderung herbei.
„Meinem Fuchs is et all zu spät und auf den Fuchs kommt et ganz alleen
an, Fräulein.“ Das allerdings mußte sie zugeben. Die Präsidentin
erwartete sie – fertig zum Einsteigen – bereits voller Ungeduld.
„Nun, ist alles erledigt, Eva?“ Ein leises Rot stieg bis unter die
lockigen, braunen Haare in die weiße Stirn.
Eine Sekunde blieb die Antwort aus. Ihre Augen hielten dem forschenden
Blick nicht stand. Ein jäher Wider[S. 68]wille gegen die beabsichtigte Lüge
stieg in ihr auf. Aber die sichtliche Unruhe der Präsidentin beendete
ihr kurzes Schwanken. Sobald die Bank wieder geöffnet würde, kam ja
doch alles in Ordnung...
„Ja, es ist ordnungsmäßig eingezahlt.“ Dann zeigte sie, scheinbar
empört, nach draußen: „Hören Sie nur den alten, unfreundlichen
Kutscher. Jetzt beginnt er, so laut er nur kann, auf uns zu schelten,
weil wir seinen Fuchs warten lassen und jetzt – halt – halt – Mann
– wir kommen ja schon.“ War er wirklich im Begriff gewesen, ohne sie
davon zu fahren, wie sie es der erschrockenen Präsidentin zurief?
Leichtfüßig sprang sie als Erste in den Wagen, half der Präsidentin
fürsorglich hinein, während die alte Pauline, bedächtig und kräftig
mit beiden Armen nachschob, nickte noch einmal freundlich den
Rückbleibenden zu und sprach alsdann mit drolligem Eifer, allerhand
unwichtige Kleinigkeiten fragend, auf die Präsidentin ein.
– – Schön war’s doch, dies Alleinsein!
An dem Gefühl, das wider Willen über Eva von Ostried kam, als sie vom
Bahnhof zurückgekehrt, in die hohen Zimmer eintrat, merkte sie, wie
streng eingeteilt sonst ihr Tag sein mußte. Mit unbeschreiblicher Wonne
warf sie sich in den bequemsten Lehnstuhl und summte ein Lied vor sich
hin.
War die Präsidentin auch engelgut – empfand sie selbst eine nie
verlöschende Dankbarkeit für sie daran, daß diese beliebig über
ihre Zeit verfügen konnte und natürlich auch verfügte, änderten
diese Gefühle nichts das Geringste. Eva von Ostried wußte plötzlich,
wie heiß ihr Sehnen – nicht zuletzt nach dem verlorenen Recht der
Selbstbestimmung – die ganze Zeit gewesen war. Mit einem Schauer
des Ent[S. 69]setzens gedachte sie ihrer beiden erste Stellen, die sie,
nach dem Tod des Gönners, sofort anzunehmen gezwungen war. Zwar hatte
ihr der Amtsrat Wullenweber, dem sie von dieser Veränderung Kenntnis
geben mußte, vorübergehend seine Gastfreundschaft geboten, „wenn
sich durchaus nicht schnell ein anderer Ausweg finden lasse,“ aber
der Gedanke, aus dem warmen, mit feinstem künstlerischen Geschmack
eingerichteten Heim des verstorbenen Meisters in sein ihr kahl
und ungemütlich in Erinnerung lebendes Haus, als eine nur ungern
Geduldete, unterzuschlüpfen, dabei jeden Augenblick die tiefroten
Türme des alten Waldesruher Schlosses in der Nähe zu sehen – hatte
etwas Unerträgliches für sie gehabt. Lieber ließ sie sich von einer
anspruchsvollen, ungerechten Herrin bis an die Grenze ihrer Kraft
quälen – bis sie es eines Tages dann doch nicht länger ertragen konnte
und weiterzog, zur nächsten, bei der es ihr auch nicht viel besser
erging.
Nun waren die zahlreichen Wunden der kleinen, täglichen Nadelstiche
längst verheilt. Sie lebte, umgeben von Nachsicht und Güte, bei der
edelsten aller Herrinnen und dennoch – – War sie ehrlich mit sich,
mußte sie zugeben, daß einzig der Gedanke an die Zukunft sie tapfer
auf dem Wege kleinlicher Pflicht weiterlaufen ließ. Hätte sie keine
Aussicht gehabt, sehr bald ihre geliebten Studien wieder aufzunehmen,
wäre ihr vielleicht auch diese warme Stätte allmählich zur Hölle
geworden. – Mit geschlossenen Augen träumte sie sich in die Zeiten
hinein, die nach dem Frühjahr ihrer warteten. Gewiß – es würde viel
Arbeit – Kampf und Fleiß kosten. Unstreitig auch wiederum Tage geben,
an denen sie am eigenen Können verzweifelte.
[S. 70]
Danach aber mußte die köstliche Erfüllung aller Sehnsucht kommen! –
Sie hatte den Schatz in ihrer kleinen Handtasche völlig vergessen.
Achtlos lag er auf dem Tisch, während sie mit leichtgeöffneten Lippen
den köstlichen Duft der blühenden Huldigungen zu trinken schien, die
ihrer in der goldenen Ferne harrten!
– Um die dritte Nachmittagsstunde dieses Tages kam Ralf Kurtzig,
der alte Meister und frühere langjährige Parsifal des Bayreuther
Festtempels. Er beschäftigte sich am Feierabend seines Lebens damit,
fleißig nach gottbegnadeten Talenten Umschau zu halten. So fand er auch
im Hause des jüngeren Kollegen Eva von Ostried, die Vielversprechende.
Zu spät hatte er, von einer langen Reise heimkehrend, den Tod des
Kammersängers erfahren und die Pforten seines reichen, gastlichen Heims
verschlossen gefunden. Sofort dachte er an Eva von Ostrieds Zukunft,
denn ihre Mittellosigkeit war ihm bekannt geworden. Fieberhaft hatte
er nach ihr gesucht. Aus rein künstlerischem Interesse, wie er es vor
sich erklärte. In Wahrheit trieb ihn – tief versteckt und von ihm
selbst noch nicht erkannt – ein spätes, leidenschaftliches Feuer.
– Ihre Spur schien verweht. Er hockte im vierten Rang der Oper, um
ihr zu begegnen. Weil sie Schuberts reine Kunst über alles geliebt
hatte, versäumte er keinen dieser Liederabende. Es blieb vergeblich
– bis er sie an der Seite der ihm durch eine reiche Schenkung an die
Bühnengenossenschaft bekannten Präsidentin in einem philharmonischen
Konzert wieder sah.
So kams, daß er – eingeweiht in Frau Melchers ihm zuerst grausam
erscheinende Pläne – ihr Lehrer wurde.
[S. 71]
Es gab kaum Jemand, der sparsamer mit seinem Lob umging, wie er.
Darum blieb es auch das höchste Streben seiner wenigen Schüler ihn
wenigstens nicht zum Tadel zu reizen. – Heute lief ihm Eva wie ein
ausgelassenes Kind entgegen. Die verhaltene Ehrfurcht vor seiner weisen
Künstlerschaft war sprühender Daseinsfreude gewichen. Er empfand das
sofort und freute sich heimlich daran.
Der Mensch sprach in ihm vor dem Künstler. Das geschah selten.
„Wie schön sie ist,“ mußte er denken und weiter, „die wundervolle
Herbheit, von der sie selber nichts ahnt, wird ihr den Weg, den sie
gehen muß, nicht leicht machen.“ Er fühlte, verwundert, daß ihn
diese Gewißheit verjüngte, verlor eine Sekunde die kühle, sichere
Ueberlegenheit und beschattete die Augen, als blende ihn das rote
Licht, das ungehindert durch die Bogenfenster der Diele in das
Musikzimmer quoll. Dann hatte er sich wieder in der Gewalt und sagte in
dem spöttelnden Ton, mit dem er jede warme Regung bestrafte:
„Ihr alter Gralhüter meldete bereits, daß die hohe Herrin dieses
Zauberschlosses verreist sei. Sie murmelte daneben noch allerlei von
Früchten und Beeren, die Ihre tätige Mitwirkung verlangten.“
Sie sah mit bittenden Augen zu ihm auf.
„Sie sind mir noch ein Geburtstagsgeschenk schuldig,“ bettelte sie.
„So –“ machte er gedehnt, „seit wann denn?“
„Seit gestern.“
„Schade – sonst hätte man es als verjährt bezeichnen können.“ Und mit
einem Augenzwinkern, als blende ihn[S. 72] immer noch der rote Schein, setzte
er hinzu: „Wonach geht also Ihres Herzens Wunsch?“
„Ich bin volljährig geworden, Meister. Da darf ich heute unbescheiden
sein.“
„Verlangen Sie immerhin. Die Erfüllung steht ja bei mir.“
„Sie müssen mir etwas vorsingen.“
„So – das muß ich?“ – In kindlicher Zutraulichkeit griff sie nach
seiner schlanken, weißen Rechte.
„Ich habe mich den ganzen Vormittag darauf gefreut.“
„War es nicht anmaßend, die Bitte schon als erfüllt zu betrachten?“
„Vielleicht! Sie haben ja aber oft genug betont, daß der Bescheidene
zwar sehr angenehm, aber doch durchaus unbrauchbar für das praktische
Leben wäre.“
„Ja – was soll es denn sein?“
„Parsifals Lied aus dem zweiten Aufzug,“ bat sie mit dem Ausdruck der
Sehnsucht in Augen und Stimme:
Auf Ewigkeit
Wärst Du verdammt mit mir
Für eine Stunde
Vergessen meiner Sendung
In Deines Arms Umfangen.
Sein Gesicht hatte wieder den steinernen Ausdruck, um dessentwillen ihm
viele der früheren Kollegen die Seele abgesprochen hatten.
„Wir reden später noch darüber,“ meinte er kurz. „Vorerst heißt es
fleißig sein. Beginnen Sie also –“
Wie ein gehorsames Kind fügte sie sich. Die wundervolle Stimme klang
weich und voll, aus jedem Ton der[S. 73] Uebung. Trotzdem war er nicht
zufrieden. Kurz und scharf rügte er und verlangte Wiederholungen.
Für jemand, der seine Art nicht kannte, hätte es leicht den Anschein
erwecken können, als sitze er um des täglichen Brotes willen neben
einer Schülerin, die zu unterrichten ihm nicht den geringsten Spaß
bereitete. Und doch sonnte sich auch heute sein künstlerisches
Empfinden an dem strahlenden Glanz dieses gesegneten Talents. Er quälte
sie mit Vorsatz, um zu prüfen, ob auch danach noch ihr leidenschaftlich
geäußerter Wunsch um Erfüllung bäte oder ob sie in leisem Gekränktsein
sich von ihm abwende. –
Sie tat es nicht.
Kaum hatte er durch ein Nicken zu verstehen gegeben, daß die
eigentliche Stunde zu Ende sei, als sie ihn auch schon – mit gänzlich
verändertem Ausdruck – an die Erfüllung seines Versprechens mahnte.
„Das verheißene Reden über meine Bitte schenke ich Ihnen, Meister,“
sagte sie und lächelte schalkhaft.
Er sang ihr wirklich die nachträgliche Festgabe!
Sie hockte in einem Winkel und hatte den Kopf auf die verschränkten
Arme gelegt, damit er nicht die Tränen sehen sollte, welche ihr das
höchste Gefühl der Andacht erpreßte. Er sah sie aber dennoch und freute
sich auch dessen. – Sie wußte nicht, wie lange dies Weihespiel gewährt
hatte. Die strahlende Sonne war blaß geworden. Ein leichter Dunst von
Müdigkeit ließ die leuchtenden Farben des Herbstes matter erscheinen.
Wie ein reichgewesenes, nunmehr erfülltes Leben wartete dieser Tag
seinem Sterben entgegen. Es war still zwischen ihnen geworden. Sie kam
aus ihrem Winkel her[S. 74]aus, setzte sich stumm an den Platz, den er soeben
verlassen und sang ihm den Dank.
Ich will wiegen Dich, ich will wachen....
Knabe saß auf der Mutter Schoß
Spielten zusammen, bis er groß....
Lebenserfüllung auch hier! Das Lied der Solveig, das einen wandermüden
Sturmgesellen endlich erlöst!
Der Meister regte sich nicht. Sterbensfrieden segnete Raum und Zeit.
Das wundersame Erzittern, das die Kunst dem Reinen schenkt, feierte
sein Auferstehen.
Ich will wiegen Dich und wachen
Schlaf und träume, Du Knabe mein
– – Die Wirklichkeit regierte wieder! –
„Wenn der Drache und der gesegnete Obstgarten nicht wären, würde ich
Sie jetzt in das Deutsche Opernhaus mitnehmen,“ sagte Ralf Kurtzig, als
sie verstummt war. – Und das war sein Dank. – „Es wird heute Carmen
gegeben – mit der Olitava als Gast.“
Eva von Ostried jubelte hell auf.
„Die alte Pauline erlaubts von Herzen gern, denn – im Vertrauen –
eine große Hilfe bin ich ihr doch nicht und – gestern – war – ja –
mein Geburtstag.“
– – Sie saßen im Hintergrund einer Loge und lauschten mit verhaltenem
Atem. Das Lied blutroter Leidenschaft flammte und brannte sich in
das Herz des Einen – Und das war nicht das junge – Die heiße
Teufelin triumphierte über den sanften, blonden Engel. Das edle,
scharfgeschnittene Gesicht des Fünfzigers erschien um Jahrzehnte
verjüngt. Seine tiefen, machtvollen Augen bohrten sich in[S. 75] Evas Gesicht
– machten sie einen Herzschlag lang verwirrt – erinnerten aber im
nächsten Augenblick an zwei andere – – damals in Oeynhausen. Sie
mußte wieder an Paul Karlsens gestohlene Zärtlichkeit denken, für die
sie eine Zeitlang nicht mehr den früheren Zorn aufzubringen vermocht
hatte. – Jetzt begriff sie ihr zur Milde gewandeltes Urteil nicht.
Ein eigentümliches, fremdes Gefühl hatte sie gepackt. Sie wehrte sich
in schauderndem Auflehnen gegen das Empfangen und Erwidern aller
gespielten Leidenschaft – und verurteilte diese Regung doch, ohne sich
davon zu befreien, als die Wahnvorstellung einer engen Seele.
Ob sie auf der Bühne überhaupt jemals davon loskam?
Die scheue Reinheit ihrer Mutter lebte in ihr auf. – Angst und Zorn
verflogen indes wieder. Sie schloß die Augen, lauschte den Klängen und
fühlte sich bald wunschlos glücklich – –
Gegen elf Uhr war sie daheim. Die alte Pauline saß noch vor dem
aufgeschlagenen Bibelbuch auf der Diele. Eva begann zu schelten:
„Sie sollten längst zur Ruhe sein, Pauline! Die letzten beiden Tage
waren ohnehin viel zu anstrengend für Sie!“
„Ich hätte heute doch nicht schlafen können, Fräuleinchen. Meine
Gedanken springen zu wild.“
„Sie ängstigen sich natürlich um unsere liebe Herrin, nicht wahr?“
Die Alte nickte kummervoll.
„Seit ein paar Stunden sehe ich überall ihr Gesicht und das sieht aus,
als wenn sie unzufrieden mit uns wäre. – Wir hätten sie doch nicht
weglassen dürfen.“
[S. 76]
„Was wollten wir dagegen machen, Pauline? Sie hielten ja selbst jede
Gegenmaßregel für umsonst.“
„Man hätte hinter ihrem Rücken zu Herrn Justizrat schicken müssen.“
„Haben Sie vergessen, daß der mit hohem Fieber zu Bett liegt?“
„Schreiben hätte er ihr wohl können.“
„Quälen Sie sich nicht länger. Morgen früh werden wir eine Karte haben,
die uns erzählt, daß sie uns gar nicht nötig hat. Oder – vielleicht
telegraphiert sie uns sogar ihre glückliche Ankunft.“
„Wenn ihr unterwegs was passiert wäre, Fräuleinchen.“
„Sie sind schrecklich, Pauline. Ich werde nun auch keine Ruhe finden
können.“
Die Treue malte sich mit selbstquälerischer Gründlichkeit allerhand
furchtbare Möglichkeiten aus.
„Denken Sie doch, wenn sie ihren Herzkrampf bekäme und Niemand wüßte,
wer sie wäre und wohin sie gehörte.“
„Darüber beruhigen Sie sich. Ihr Handtäschchen enthält ihre genaue
Adresse. Darunter steht mein Name mit der Bemerkung, daß jede
Mitteilung an mich zu richten wäre.“
„Verlangte sie das ausdrücklich, Fräuleinchen?“
„Natürlich. – Sie wissen ja, wie gut sie alles bedenkt.“
„Wenn das nur kein trauriges Vorzeichen ist. – Sie hat gewiß schon
irgend eine schwere Ahnung gehabt.“
„Nein, Pauline. Auch die gesundesten Vorsichtigen unterlassen so etwas
nicht. Ich selbst reise niemals, ohne meine ausführliche Adresse vorher
aufzuschreiben.“
[S. 77]
„Mir wär sowas graulig. Gerade, als hätte man nur so auf das größeste
Unglück gewartet. – Hören Sie die Eule schreien, Fräuleinchen?“
„Das tut sie bereits seit einigen Wochen um diese Zeit, Pauline.“
„Ich höre sie heute wirklich zum ersten Mal. Wir nannten sie zu Hause
den Totenvogel und zogen uns die schweren Federbetten über die Nase,
weil wir uns fürchteten. – Wenns doch bloß erst morgen wär.“
Eva von Ostried wurde ungeduldig. In ihren Nerven schwang sich noch das
Gold der Töne. Alles andere versank in einen Abgrund, um vielleicht am
nächsten Tage, wenn die Sonne hell darüber schien, wieder bestimmte
Form zu gewinnen.
„Gute Nacht, Pauline,“ sagte sie. „Ich bin rechtschaffen müde.
Gehen Sie endlich auch zur Ruhe. Dann wird sich Ihr Wunsch auf dem
schnellsten und natürlichsten Wege erfüllen.“
Das alte Mädchen konnte sich nicht dazu entschließen. Sie saß und
betete immer die gleichen Worte aus dem frommen Lied ihrer Kindheit:
Alle Menschen groß und klein
Sollen Dir befohlen sein!
Endlich bewegten sich die welken Lippen nur noch mechanisch. Der Kopf
sank schwer auf die Brust herab. Sie träumte, daß ihre gute Frau
Präsident ungeduldig nach ihr klingele und fuhr mit einem lauten Schrei
aus dem unruhigen Schlaf empor.
– – Eva von Ostrieds tiefe, gleichmäßige Atemzüge bewiesen
sehr schnell, daß Sorge, Gedanken und Freude in[S. 78] dem Schlummer
beneidenswerter Jugend ausruhten. Sie vernahm nichts von dem
anhaltenden Schrillen der kleinen Glocke an der Gartenpforte. Erst das
Klopfen an die eigene Tür ließ sie auffahren.
Die alte Pauline stand, mit einem Telegramm in der Hand, vor ihr. Und
sie riß – nun auch von einem sonderbar kalten Gefühl gepackt – die
blaue Verschlußmarke in der Mitte durch – –
Es war – doch – nicht möglich! –
Jeder Blutstropfen wich aus Eva von Ostrieds Gesicht. Ein eiserner
Reif schien sich um Brust und Schläfe zu pressen. Sie stand plötzlich
in der Mitte des Zimmers, suchte nach ihren Kleidern und fand nichts,
als das Flimmern des Mondes, der überall seine Silbermünzen aufzählte.
Ihre Glieder begannen so stark zu zittern, daß sie kraftlos auf einen
Stuhle sank und den einzigen Wunsch hatte, die Hände der alten Pauline
zu fassen, damit dies entsetzliche Grauen vor ihr wiche.
Das alte Mädchen starrte auf das Telegramm, das zu Boden geglitten
war. Die helle Nacht durchleuchtete jeden Winkel mit jenen silbernen
Schlafenstunden, von denen die Präsidentin behauptete, daß sie auch den
unruhvollsten Seelen den Frieden schenkten. Eine Ahnung, zu grauenvoll,
um zu Ende gedacht zu werden, erschütterte die beiden Menschen.
Da löste sich der Krampf eisiger Kälte in Eva von Ostrieds Seele in
einem Schrei auf. Die Hände der alten Pauline tasteten das Blatt vom
Boden empor. Mühsam buchstabierte sie Wort um Wort:
Dame mit Ausweis Präsident Hanna Melchers, Grunewald und Ihrer
Adresse soeben in Wartesaal[S. 80] 2. Klasse Herzschlag erlegen. Leiche
zur hiesigen Halle überführt.
Belgard a. Persante.
Bahnhofsdirektion.
– – Es war immer noch Nacht. Das Warten auf das erste Morgengrauen
wurde unerträglich. Auf dem Tisch aus heller Birke lag das Kursbuch,
das Eva vergessen hatte, in die Handtasche der Präsidentin zu legen. Es
war noch aufgeschlagen. Trotzdem fand sie nicht, was sie suchte.
Und man mußte doch zu ihr!
Sie saßen dicht beieinander und schwiegen. Nur einmal flüsterte die
alte Pauline:
„Sie wird auch wohl dies längst bedacht haben. Der Justizrat weiß
sicher mit allem Bescheid.“
Nun warteten sie darauf, daß man endlich einen Kranken, dessen
Nachtruhe nicht gestört werden durfte, um Rat fragen konnte. – Sobald
im Osten der erste rosige Streifen den Morgen ankündigte, telephonierte
Eva von Ostried in seine Privatwohnung. Er antwortete ihr selbst. In
seiner Stimme war weder Entsetzen noch Staunen, als er es gehört hatte.
„Sie haben alles zur Reise nach Belgard vorbereitet, Fräulein von
Ostried? Das war überflüssig! Ich fahre selbst. Und zwar – warten Sie
mal – so – ich hab’s schon – mit dem Vormittagszuge um 9 Uhr. Alles
weitere später. Ich werde Ihnen von dort Nachricht geben.“
Eva wagte eine Einrede.
„Sie sind sicher noch krank, Herr Justizrat. Wird es Ihr Arzt
erlauben?“
[S. 81]
Kurz und klar tönte seine Erwiderung:
„Ich habe ihr dies versprochen, denn sie hat mit ihrem unerwarteten
Tode stets gerechnet. Sie beide halten sich natürlich zu Hause, damit
Sie jederzeit meine Nachricht sofort trifft.“ –
Nun galt es wiederum zu warten!
Eva saß zusammengekauert an dem Platz, von dem aus sie der Präsidentin
deren Lieblingslieder gesungen hatte. Auf dem Flügel stand noch das
Solveiglied von gestern.. Und durch das Entsetzen schlich sich die
Ahnung, daß sie jetzt ganz frei war.
Sie schämte sich, weil sie daran zu denken vermochte. Der Weg zur
Kunst lag lockend vor ihr. Ihre Seele war sehnsüchtig und weich wie
nie zuvor. Die scheue Ahnung wuchs schnell zur freudigen Gewißheit –
und bepflanzte ihren Weg mit köstlichen Blumen. – Sie dachte innig an
die Tote und konnte doch bereits wieder das fordernde – schöne Leben
fühlen.
Dagegen half keine heiß aufwallende Scham. – Die Zukunft war rosenrot.
– Das stille Gesicht der Toten mußte kalt und wachsbleich sein.
– Eine neue Empfindung überkam sie. Wie sie wähnte, ganz rein und
frei von allem Irdischen. – Sie wurde davon vor dem Bild, das die
Präsidentin als junge Frau darstellte, auf die Knie gezwungen. –
Das kluge, gütige Antlitz erschien ihr wie das eines Vergebung und
Verstehen auf sie herablächelnden Engels. Niemals glaubte sie die
mütterliche Frau mehr geliebt und verehrt zu haben, wie in diesen
Augenblicken!
Die Empfindung stärkster Dankbarkeit löste ihr auch die ersten Tränen
aus. Daß sie fortan frei und unabhängig sein[S. 82] durfte – fern ab von
der grausamen Not, die der Alltag bringen kann – das war das Werk
der Toten, von dem sie erst, als bestimmt beabsichtigt, in Oeynhausen
Kenntnis erhielt. – Während ihre Tränen unaufhaltsam rieselten, hörte
sie Melodien, von denen kein anderes Ohr einen Laut vernehmen konnte.
Und ahnte nicht, wie sehr sie – mit diesem Ausdruck der Reinheit und
Entrücktheit – ihrer verstorbenen Mutter glich. Nur, daß jene allzeit
ihre reiche Begabung vor fremden Augen wie ein köstliches Geheimnis
verborgen gehalten, während ihre Tochter nach Anerkennung und Ruhm
fieberte.
– – Die Schrecken des Todes waren überwunden. – Der goldene Traum
vom Leben war zu schön. – Der ausdrückliche Wunsch der Präsidentin,
neben dem Gatten, der in der Waldesruhe des Stahnsdorfer Friedhofes
schlief, beigesetzt zu werden, hatte sich erfüllt. Die kleine, würdige
Feier, von welcher – ebenfalls nach der Bestimmung der Verblichenen
ihren Bekannten erst am folgenden Tage Kenntnis gegeben werden durfte,
war vorüber. Justizrat Weißgerber, noch blaß und matt von der kaum
überstandenen Erkrankung, saß vor dem Schreibtisch der Präsidentin und
hatte beide Hände auf die Schriftstücke gelegt, die er – nach ihrer
Bitte – zur gründlichen Durchsicht mit in sein Heim nehmen wollte.
„Nun sollen Sie auch endlich näheres über ihre letzte Stunde hören,
Fräulein von Ostried,“ sagte er dabei zu Eva. „Ich mußte mich
gestern kurz fassen. Die Zeit war karg bemessen. – Sie wissen,
daß sie einen ungefähr einstündigen Aufenthalt in diesem kleinen
pommerschen Städtchen nehmen mußte. Kellner und Wirt berichteten[S. 83] mir
übereinstimmend davon. Zuerst hat sie eifrig geschrieben, wie sie das
auf Reisen gern tat. Wir sprachen einmal über diese ihre Angewohnheit.
Sie meinte, mancherlei Vergessenes und Versäumtes käme auf diese Weise
bei ihr zu seinem Recht. Briefe und Karten behaupteten freilich die
Beiden hinterher nicht aufgefunden zu haben. Aber, sie kann ja auch
das Geschriebene noch selbst in den Kasten gesteckt haben. Entfernt
soll sie sich jedenfalls auf wenige Minuten haben. Kurz darauf hat sie
einen leichten Herzkrampf gehabt. Die Frau des Bahnhofswirts hat ihr
beigestanden und ihr auch eins ihrer Eigenzimmer zum Ausruhn angeboten.
Das lehnte sie indessen ab. Nur ein Glas starken Weines soll sie sehr
hastig getrunken haben. Offensichtlich tat ihr das wohl, denn sie hat
bald darauf den Hilfreichen in ihrer uns zur Genüge bekannten gütigen
Art gedankt und dem Kellner ein sehr reiches Trinkgeld gegeben, obschon
sie noch eine kleine halbe Stunde bleiben mußte. Wenig später hat sich
der Anfall wiederholt. – Der Arzt wurde gerufen und hat nur noch ihren
Tod feststellen können. Das andere wissen Sie ja.“
Eva von Ostried tat mit zuckenden Lippen eine Frage:
„Ob sie wohl noch – sehr – gelitten hat.“ – Das Staunen über das,
was der Jugend unfaßbar grausam erscheint, durchfror sie von neuem.
Der Justizrat schüttelte den Kopf.
„Sie hätten den Ausdruck des Friedens sehen müssen, der auf ihrem
Gesicht lag.“ – Dann fragte er und in seiner Stimme war ein Klang von
Neugier:
„Warum mochten Sie übrigens nicht neben Pauline sein, als der Sarg hier
noch einmal geöffnet wurde, wie sie[S. 84] auch dies erlaubt hatte, wenn
einer von Ihnen den Wunsch danach äußerte?“
Eva von Ostried zögerte mit der Antwort.
„Ich habe meinen toten Vater gesehen –“ Es klang wie das Geständnis
von schwer überwundenem Grausen.
„Ich glaube wohl, daß es kaum noch Jemand mit einem so geringen
Schuldkonto, wie sie es hatte, geben kann,“ meinte er sinnend.
„Sie sind überzeugt, daß der Friede in ihren Zügen daher gekommen sei?“
„Ja – das bin ich voll und ganz!“
„Wie grausam ist auch dies. Das Leben lassen und alle Schuld –
zusammengedrängt – in letzter Stunde empfinden und bereuen zu müssen,“
sagte sie schaudernd und dachte dabei wiederum an ihren Vater, dessen
Qual nicht zu Ende hatte kommen können.
Er zuckte mitleidslos die Schultern.
„Einmal rächt sich eben alles! – Das ist der Trost von uns Juristen,
wenn wir lediglich mit dem Beweis unserer starken Ueberzeugung belasten
können. – Nun muß ich aber zu meiner Arbeit. Mein Bürovorsteher ist
verzweifelt. Stöße von Akten warten auf mich.“
Sie hielt ihn nicht zurück, obgleich ihr schwere Fragen auf den Lippen
brannten. An der Schwelle wandte er noch einmal den Kopf nach ihr.
„Sie hatte mich schon vor Jahresfrist gebeten, nach ihrem Tode
möglichst unverzüglich den Antrag auf Eröffnung ihres Testaments zu
stellen. Ich habe es also bereits veranlaßt. In ein paar Tagen hoffe
ich, wird auch Ihnen Nachricht zugehen.“
[S. 85]
„Fräulein von Ostried, ich weiß nichts näheres, als daß sie sich
mit der Absicht getragen hat, Ihnen in jeder Beziehung die Wege zu
ebnen. Vielleicht wollte sie es mit mir an Ihrem letzten Geburtstag
durchsprechen. Vielleicht erschien es so einfach, daß sie hierfür
meinen Rat nicht brauchte. – Jedenfalls – machen Sie sich keinerlei
Zukunftssorgen. Nicht wahr, Sie werden dann doch sofort mit aller Kraft
Ihre Studien fortsetzen?“
„Ja, Herr Justizrat, das beabsichtige ich zu tun – denn auch mir hat
sie in Oeynhausen von dieser Absicht gesagt.“
„Wohin Sie sich zunächst wenden – ob Sie, einer Bestimmung gemäß, noch
in diesem Haus bleiben oder ob sie andere Wünsche gehabt hat – nun,
wir werden ja bald alles hören. – Jedenfalls schon heute das eine,
jederzeit bin ich für Sie da. Ich weiß, wie nahe Sie ihr standen.“ Und
Eva von Ostried empfand es als ein unsagbares Glück, daß sie diese
edle, gütige Frau wie eine Tochter geliebt hatte. – –
Vier Tage später kam die alte Pauline mit einem geöffneten Schreiben
zu Eva von Ostried. Ihr Gesicht zeigte einen hilflosen und verlegenen
Ausdruck, als sie ihr den großen Bogen hinreichte.
„Bitte, lesen Sie sich das auch mal durch. Ich versteh’s nicht
ordentlich. Damit muß doch eine andere als ich gemeint sein.“
Eva tat ihr den Gefallen und nickte ihr am Schluß freundlich zu.
„Es stimmt alles, Pauline. Sie sind nun reich!“
Da begann das alte Mädchen bitterlich zu weinen. Und unter Tränen stieß
sie heraus:
[S. 86]
„Mir ist so angst. – Nein, nein, Fräuleinchen – ich glaube nicht –“
„Ich will es Ihnen langsam vorlesen, Pauline. Hören Sie zu. Dann klingt
es wahrscheinlicher.“
Sie stand mit andächtig gefaltenen Händen neben Eva von Ostried.
In dem vorschriftsmäßig eröffneten Testament der verstorbenen Frau
Hanna Melchers, verwitwete Landgerichtspräsident, fand sich die
folgende Bestimmung, von der wir Ihnen hiermit Kenntnis geben:
„Ich bestimme ferner, daß meine gute Pauline Müller, in dankbarer
Anerkennung ihrer nahezu dreißigjährigen mir treu geleisteten
Dienste bis zu ihrem Tode aus meinem Nachlaß monatlich die Summe
von einhundert und fünfzig Mark erhält. Außerdem soll sie sich nach
Ihrer Wahl die Möbelstücke für zwei Stuben aussuchen und alles
dasjenige an Wäsche und Kleidern, was ihr zu besitzen wünschenswert
erscheint.
Mein Testamentsvollstrecker und Freund, Justizrat Dr. Weißgerber,
möge freundlichst bei dieser Wahl an einem von ihm zu bestimmenden
Tage zugegen sein –“
Das alte Mädchen regte sich noch immer nicht. Sie war sehr rot und
ihre Hände zitterten, trotzdem sie sie fest zusammengelegt hatte. Sie
nahm langsam das Schreiben wieder an sich. Ihre Blicke suchten eine
bestimmte Zeile, die ihr die wichtigste erschien. – Schwerfällig
buchstabierte sie, während ihr die Tränen über die Wangen liefen:
– Meine gute Pauline Müller –
– Eva von Ostried harrte seither einer ähnlichen Mitteilung. Sie war
erstaunt, daß sie nicht mit der gleichen[S. 87] Post ebenfalls die amtliche
Benachrichtigung empfangen hatte. Als der zweite Tag ereignislos zu
Ende ging, wollte sie sich an den Justizrat wenden. Aber – schon zum
Ausgehen bereit – empfand sie etwas wie Scham über ihre Ungeduld. Die
Präsidentin hatte das Nichterfüllen von Versprechungen allzeit hart
verurteilt. – Wie durfte sie auch nur einen Augenblick Zweifel hegen?
Der nächste Tag – ja, vielleicht bereits die kommende Stunde – würden
auch sie beglücken.
Mit fieberhafter Ungeduld widmete sie sich dem Aufräumen der Zimmer.
Obgleich es ihr selbst sinnlos erschien, säuberte sie mit einer ihr
sonst fremden, peinlichen Gründlichkeit jeden Winkel und vermied dabei
dem Gedanken, der ihr wie ein Wahnsinn erschien, Raum zu geben.
In der Nacht fand sie keinen Schlaf. Die Eule schrie wieder. – Der
Totenvogel, wie ihn die alte Pauline genannt hatte.
Was aber konnte ihr noch Lebendiges geraubt werden?
Das eine, große, letzte Hoffen, auf welches sich ihr Leben aufbauen
sollte. Es duldete sie nicht länger im Bett. Sie erhob sich und riß die
Fenster auf. Noch immer war Vollmond und silbernes Leuchten.
Wenn ihr die Präsidentin jenes Hintergehen in Oeynhausen doch nicht
vergeben hätte – wenn sie erst noch abwarten wollte – und wartete –
bis – es – nun – zu spät geworden?
Sie sank am Fenster nieder und kühlte die heißen, zuckenden Finger am
Glas der Scheiben. Das brachte sie zur Besinnung.
[S. 88]
– Es waren Hirngespinste schlafloser Stunden – ohne Berechtigung. Ja
mehr. – Eine Beleidigung für die Beste und Fürsorglichste, die niemals
etwas Beschlossenes versäumt hatte. –
Sie begab sich wieder zur Ruhe und schlief nun traumlos und sanft, bis
Pauline sie weckte.
„Stehen Sie schnell auf, Fräuleinchen. Herr Justizrat ist da und will
mit Ihnen reden.“
Das kluge Gesicht des alten Juristen zeigte eine fremde Unsicherheit,
als Eva von Ostried ihm gegenüberstand.
„Wundern Sie sich nicht über mein frühes Erscheinen,“ versuchte er sich
zu entschuldigen. „Ich hätte ebenso gut bereits gestern um diese Zeit
bei Ihnen sein können. Aber, es war mir zu unfaßbar. Ich konnte und
wollte es nicht glauben.“
In ihr regte sich das Angstgefühl der verflossenen Nacht von neuem.
„Was ist geschehen, Herr Justizrat?“ Er zögerte mit der Antwort.
„Das Testament, wissen Sie –“ Er sah, wie sie erblaßte. Das gab ihm
die Sicherheit zurück. „Ich habe vorgestern noch einmal darin Einsicht
genommen. Es war mir freilich längst bekannt. Nach Besprechung mit Frau
Präsident hatte ich es aufgesetzt. Ich erwartete aber einen noch nicht
dem Wortlaut nach gesehenen Nachtrag – in Form eines Zettels oder
meinetwegen eines Briefes. – Denn, es ruht noch nicht sehr lange beim
zuständigen Amtsgericht. – Ich fand nichts. – Kurz – Sie sind darin
nicht bedacht, Fräulein von Ostried.“ Eine Weile wartete er geduldig
auf eine Entgegnung. Sie schwieg. Er hatte die[S. 89] starke Empfindung, daß
er ihr darüber forthelfen müsse, ohne indes das rechte Mittel zu kennen.
„Ich habe Ihnen bereits gestern angedeutet, was ich aus ihrem Munde
weiß. Eine harmlose Bemerkung allein ist das nicht gewesen. Sie bat
mich damals auch, daß ich Ihnen zur Seite stehen möchte, wenn sie nicht
mehr dazu imstande wäre. – Was anders kann sie gemeint haben, als
daß ich Sie auch bei Anlegung des von ihr Ererbten beraten möge? –
Meine Erkrankung – die Unmöglichkeit an dem Fest Ihrer Volljährigkeit
zugegen zu sein. – Vielleicht ihre Reise. – Ja, das alles kann
dazwischen gekommen sein. Und dennoch glaube ich auch jetzt an kein
Aufschieben. – Ich sage da vielleicht etwas Sinnloses. – Ich müßte
es eingesehen haben, daß irgend ein Zufall – sie an der Ausführung
gehindert hat. – Gestern zog ich das noch überhaupt nicht in Betracht.
Ich war sicher, daß sich unter den von mir aus ihrem Schreibtisch
entnommenen Schriften eine Bestimmung zu Ihren Gunsten vorfinden mußte
–“
Eva von Ostried hob den Blick. Ein entsetztes Fragen, das ihm ans Herz
griff, lag darin.
„Und Sie – fanden – es endlich?“ Die Kehle war ihm wie eingerostet.
All diese Tausende und Abertausende – Heime und Stiftungen bekamen
sie – gänzlich fremde, wenn auch bedürftige Menschen. Und diese hier
– die sie geliebt, an der sie sich erfreut hatte – die sollte leer
ausgehen?
Er riß sich zusammen. Es mußte doch geschehen.
„Nein, ich fand nichts, Fräulein von Ostried.“
[S. 90]
Sie stand mit schlaff herabhängenden Armen vor ihm. Allmählich
veränderte sich der Ausdruck ihres Gesichts und wurde schreckhaft
starr, als sähe sie ein Gespenst. – Es war die Zeit, der sie
entgegenging. – Schwer hing sich die Freudlosigkeit an ihre Glieder
und machte ihre blühende Jugend frühzeitig welk und alt. Alles Hoffen
versank mit diesem Schlag. –
Da war ein schnurgerader, sandiger Weg mit ungezählten spitzen Steinen.
Den mußte sie gehen, weil es nach diesem keinen andern für sie gab. –
Er tat sehr weh. – Aber nur ihr Blut floß. Das Leben blieb.
Sie wimmerte auf und wußte doch nichts davon. Dem alten Mann griff es
ans Herz. Das lichte Bild seiner Freundin wollte sich verdunkeln.
„Wenn ich ihr doch helfen könnte,“ dachte er grimmig.
„Ich habe trotz meiner großen Einnahmen auch nur gerade so viel, als
ich für mich und meine fünf Töchter brauche,“ sagte er in einem Ton,
als schäme er sich dieser Wahrheit. „Sie wissen es durch unsere Tote.
– Meinen beiden verwitweten Töchtern gebe ich die gesamten Mittel zur
Fortführung ihres kinderreichen Haushalts – sonst –“
Sie hörte nur dies letzte Wort, das bedauerte, keine Almosen spenden zu
können. Sie mußte also wie eine Bettlerin vor ihm stehen. Sonst hätte
er das nicht zu sagen gewagt. – Ihre Muskeln spannten sich langsam an.
Ihre Augen wurden stahlhart. Sie fühlte alle Peitschenhiebe, mit denen
der Alltag ihrer wartete, voraus und bäumte sich dagegen auf.
„Ich besitze eigenes Vermögen, das mir der frühere Vormund durch Frau
Präsident aushändigen ließ,“ sagte sie[S. 91] hochmütig. Eine Last glitt von
seiner Brust. Sie hörte ihn aufatmen und mußte lächeln, weil er ihren
Stolz so willig glaubte. –
„Gottlob – dann ist es ja doch nicht so hart, wie ich gefürchtet habe.“
„Durchaus nicht. Keine Sorge um meine Zukunft, Herr Justizrat!“
„Sie werden sich aber stets an mich wenden, wenn Sie irgend einen Rat
gebrauchen sollten.“
„Sehr gütig von Ihnen. Hoffen wir, daß ich in keinerlei böse Lagen
gerate –“ Ihre sonst melodische Stimme klang fast schrill. Ihr Lächeln
wirkte maskenhaft. Er fuhr mit dem Taschentuch über die hohe, kahle
Stirn. „Ich möchte noch gleich mit der alten Pauline wegen der von ihr
zu wählenden Sachen verhandeln –“
Pauline war eigensinnig. Sie mochte von all den schönen, vielfarbenen
Seidenkleidern der Präsidentin nur eins. – Und gerade das unmodernste
und älteste, worin sie gestorben war.
„Anziehen werd’ ich’s natürlich nie,“ meinte sie, von neuem aufweinend,
„denn sie hat’s noch mehr in Ehren gehalten, wie ihre andern –“
– – Eva von Ostried kniete vor der altertümlichen Kommode und raffte
ihre Habseligkeiten zusammen. Ohne Ueberlegung warf sie alles in
einen großen, sehr neu aussehenden Koffer. Die fieberhafte Ungeduld,
möglichst schnell aus diesem Hause fortzukommen, trieb sie zur Eile.
Sie wollte keinen Bissen Gnadenbrot weiter annehmen, keine Bettelgabe
begehren. Während sie sich das stolz und trotzig vornahm, fiel ihr
Blick auf das, was ihr gehörte.[S. 92] Eine glühende Röte überzog ihr
Gesicht. Wozu spielte sie Versteck mit sich? War nicht alles, was sie
besaß durch die Güte der Verstorbenen geschaffen? Hatten ihr nicht
deren zarte Geschenke und das liebevolle Erspähen ihrer geheimsten
Wünsche alles beschert? Was blieb ihr, wenn sie darauf freiwillig
Verzicht leistete? – Das Gefühl ihrer Ohnmacht gegenüber dieser
Tatsache war so stark, daß sie nicht weiter schaffen konnte. Entsagung
– Kampf und Armut lauerten überall auf sie als willkommene Beute. Denn
was bedeuteten die armseligen tausend Mark Muttererbe?
Sie mußte auflachen. Es klang grell und schaurig in diesem hellen,
freundlichen Mädchenstübchen. – Die Tränen schossen ihr in die
Augen. Das weitere Leben war wertlos geworden. – Und dennoch – es
fortwerfen, weil der goldene Traum der Künstlerhoffnung verwehrt war?
Unmöglich! In den Adern pochte die Jugend. Allein die Vorstellung,
sterben zu müssen, schuf schon ein wildes Wehren dagegen.
Der sandige Weg mit den spitzen Steinen würde beschritten und – zu
Ende gelaufen werden! – Ohne die geliebte Kunst!
War das überhaupt auszudenken? – Täglich fremden Launen zu dienen,
stündlich Nadelstiche zu erdulden, bis alles Empfinden tot war?
Amtsrat Wullenweber fiel ihr ein. Wenn sie ihn bitten würde? – Es
war Wahnsinn mit diesem Gedanken auch nur zu spielen. – Auch Ralf
Kurtzig, der alternde Meister, konnte ihr nicht helfen. Sie wußte durch
die Präsidentin, daß er wohl Reichtümer eingeheimst, aber niemals
aufzuspeichern verstanden hatte.[S. 93] Und ihr Studium war teuer. – Die
ersten Lehrkräfte waren notwendig. Die Weiterbildung auch des Gehörs
durch den Besuch der besten Konzerte blieb Erfordernis. – Gute und
nahrhafte Kost, anständige Kleidung mußten auch sein – – Sie hatte
erlebt, wie das Geld unter den Fingern zerrann. – –
Sie wollte alles begraben! – Als sie meinte, daß mit diesem Vorsatz
das Hauptsächlichste geschehen war, packten sie Verzweiflung und Jammer
so heftig, daß sie aufschrie und sich über ihre Noten warf...
Und doch – wenn nur der erste Schritt getan war!
Sie wurde nachdenklich – vergaß die begonnene Arbeit, riß den Hut
vom Haken und drückte ihn auf das Haar. – Wenn sie hier fort wollte,
mußte ein neuer Unterschlupf gefunden werden. – Und fort wollte sie.
Je früher, desto besser. – Im Laufschritt eilte sie die breite, stille
Straße hinunter. – Wollte zu der Zweigniederlassung der von der
Präsidentin bisher gelesenen Zeitung, um ein Gesuch nach einer Stellung
aufzugeben – vergaß dann aber sofort wieder diesen Vorsatz und eilte
gedankenlos weiter, den wundervollen, schattigen Plätzen entgegen, an
denen die prunkvollen Häuser der glücklichen Besitzer lagen.
Die Welt war klar, satt und durstlos. An stillen Seitenstraßen schienen
die jungen Buchen zu bluten, als verschenkten sie freudig ihren
Lebenssaft. Unbeschreibliche Sehnsucht nach einem Menschen, der sie in
dieser Stunde haltloser Verzweiflung voll verstehen könnte, überkam Eva
von Ostried. Sie wußte sich Niemand!
Ihre Schönheit hatte zu allen Zeiten glühende Bewunderer gefunden.
Aber sie kannte sich selbst noch zu wenig,[S. 94] um schon zu wissen, daß
sich lediglich ihre stark entwickelte Eitelkeit durch die unverhüllten
Blicke der Leidenschaft befriedigt gefühlt.
Wäre es anders gewesen, hätte sie damals unmöglich Paul Karlsens
gestohlene Zärtlichkeit als eine unerhörte Beleidigung empfinden
können. Ihr Herz war bisher völlig unberührt geblieben. Ihre
Frauensehnsucht suchte indessen unbewußt – an den lauten Huldigungen
vorbei – nach den stillen Gassen, die zu dem Tempel reiner Liebe
führen.
Und dennoch sträubte sie sich heftig gegen die Zumutung, die Krone des
Frauendaseins einzig in der Ehe mit einem Manne zu suchen.
Plötzlich verlangsamten sich ihre Schritte. Lauschend neigte sich der
Kopf. Rächten sich die Stunden der Aufregung und gaukelten ihr Töne vor
aus jener Welt, die ihr von heute an verschlossen war. Oder gehörte die
jauchzende Stimme hinter ihrem Rücken der Wirklichkeit an?
Ach, daß die Seele Dein meiner Seele sich eine,
Du teures Kind, laß mich Deine Augen sehn.
In diesem weißen Kleid, mit diesem Heiligenscheine
Bist Du ein Engel aus Himmelshöhen.
Sie wollte dem wohlbekannten Liebeswerben Wilhelms entfliehen, stürzte
weiter und stand doch im nächsten Augenblick durch den lockenden Ruf
bezwungen, wie gebannt still.
Zwei Hände rissen die ihren, die kalt und matt gewesen, an sich.
„Kleine, süße Mignon, endlich sehen wir uns wieder.“
[S. 95]
Paul Karlsen war an ihrer Seite und sie ließ ihn nicht ihre Verachtung
spüren. – Alles lag weit hinter ihr! Wie eines wirren Traumes, den ein
Kind gehabt und sich ganz falsch gedeutet hatte, gedachte sie flüchtig
seines Kusses.
Er hatte ihre Hände freigegeben und schritt ruhig neben ihr dahin.
„Wohin wollen Sie, Fräulein von Ostried?“ Das klang durchaus korrekt
und brachte ihr einen Strom zuversichtlicher Hoffnung.
„Wenn ich das selbst wüßte,“ entgegnete sie leise. Er betrachtete sie
aufmerksam und schob sich ein wenig an sie heran.
„Fronen Sie nicht mehr bei Ihrer alten Dame, hinter deren Stuhl ich Sie
oft genug – zähneknirschend – sehen mußte?“
Da sagte sie ihm von dem Tode der Präsidentin. Er hörte ihr aufmerksam
zu.
„Gottlob – also der Kunst endlich zurückgegeben! – Wird das schön
werden. Wir halten natürlich fortan fest zusammen.“
Sie mied seinen bittenden Blick.
„Ich gehe fort von Berlin.“
„Ah!“ machte er enttäuscht, „wohin denn? Berlin bietet doch die besten
Ausbildungsmöglichkeiten. Auch kann man hier gar nicht anders, als
sehr brav sein. Ich habe mirs vor allen andern Städten ausgesucht.
– Ob gerade darum? Nein, das zu behaupten wage ich doch nicht. –
Wissen Sie, nun ist’s entschieden. Don Karlos – Meister Heinrich und
die verehrten blutigen Könige des nämlichen Namens mit aufsteigender
Numerierung sind tot und[S. 96] feierlich begraben. – Vor Ihnen steht der
künftige erste Heldentenor der Welt.“ Sie empfand brennenden Neid,
schämte sich der Aufwallung und fragte hastig:
„Wie ist das möglich geworden?“
„Tja –“ machte er und schwippte leichtsinnig mit den Fingern durch die
Luft, „es hat sich halt endlich eine unversiegbare Goldader auffinden
lassen.“
Sie ahnte nicht, daß immer noch der Neid aus ihren wundervollen,
leidenschaftlichen Augen sprang. Ihm entging es nicht. Er spielte seine
Rolle ausgezeichnet – hielt sich fest im Zügel, wenn er sie auch noch
bezaubernder als damals in Oeynhausen fand.
„Und Sie – wie weit sind Sie gekommen? – Ihnen fehlte nicht mehr viel
zur künstlerischen Reife!“
Ihre Hand ballte sich in ohnmächtigem Zorn. Er am wenigsten durfte
etwas von ihren jähzerstörten Hoffnungen ahnen. Sie schämte sich ihrer
Armut.
„Ich? – Nun, es wird sich bald genug etwas für mich finden lassen. Ich
kann nur noch vorläufig zu keinem festen Entschluß kommen.“
Er betrachtete sie heimlich und bemerkte einen bittern fremden Zug, der
vor wenigen Monaten bestimmt noch nicht dagewesen war. Sie erschien ihm
plötzlich wie ein Becher aus edlem Kristall, der alles offenbart. Auch
sie spielte ihm eine Komödie vor. Aber, sie spielte sie nicht glaubhaft
genug. Ihr mußte entschieden etwas geschehen sein, das sie gedemütigt
hatte. Ihr Stolz, der ihn anfangs entflammte, ehe er ihn unbequem und
zuletzt lächerlich gefunden, war in diesem Augenblick unecht. Aber er
wollte sie ein wenig quälen.
[S. 97]
„Sie müssen mir versprechen, daß Sie an der ersten Stelle Ihrer
Tätigkeit meiner in warmer Fürsprache gedenken,“ bat er mit
knabenhafter Frische und hielt ihr die Rechte hin. „Schlagen Sie ein,
Fräulein von Ostried.“
Es klang respektvoll und freundschaftlich. Der Ton tat ihr wohl. Ihre
Ehrlichkeit litt indes kein weiteres Versteckspiel. Ihr Herz, das sich
gerade hatte beruhigen wollen, begann wieder wie rasend zu pochen. Ihre
Augen füllten sich mit Tränen, so sehr sie auch dagegen kämpfen mochte.
Das stellte er mit stürmischer Freude fest. Ganz zart bemächtigte er
sich von neuem ihrer Hände:
„Sie können mir vertrauen. Wirklich – Herrgott – wer machte mal keine
Dummheit – Ihre Schönheit hatte mich einfach kopflos gemacht – nein
– es war doch wohl mehr die grenzenlose Bewunderung Ihres herrlichen
Talents. Vergeben Sie mir, Eva. Sehen Sie in mir einen Freund und
Bruder –“
Da sagte sie ihm alles!
Er bedauerte sie nicht, als sie zu Ende gekommen war, trotzdem er
sie „armes Hascherl“ nannte. Es klang vielmehr aus den Worten ein
schelmisches Lachen, weil er dem traurigen Zufall die Rechnung
verderben wollte.
„Das ist wahrhaftig keine Kopfhängerei wert! Wozu wäre ich Ihnen
denn sonst heute in den Weg gelaufen? – Sie dachten auch nur einen
Augenblick ernstlich daran, der Musik zu entsagen? Ja, wissen Sie denn
nicht, daß Sie damit die größeste Sünde begingen. – Und – sündigen
dürfen Sie nicht! – Herrgott, Mädel, was haben Sie für Gold in der
Kehle. Darauf pumpt Ihnen jeder gerissene Geschäftsmann, so viel Sie
wollen.“
[S. 98]
Sie mußte, angesteckt durch seine hinreißende Zuversicht, lächeln.
„Meine alten Gönner und Lehrer leiden an dem nämlichen Uebel, wie ich
selbst,“ sagte sie bitter und dachte in erster Linie an Ralf Kurtzig.
„Und die jungen,“ fragte er und suchte ihren Blick. Sie wollte sich
nicht empfindlich zeigen und konnte doch nicht hindern, daß eine
glühende Röte ihr Gesicht überzog. Er betrachtete sie mit den Augen des
Künstlers, der sich an jeder gelungenen Schöpfung freut. – Als sie
jetzt mit der ihm nur zu wohlbekannten Bewegung der Unnahbarkeit den
Kopf zurückwarf, reizte sie – wie einst – sein Mannesempfinden. Der
Wunsch, ihre stolze, schlanke Gestalt an sich zu pressen – den roten,
lockenden Mund mit glühenden Küssen zu bedecken, verlangte genau so
ungestüm wie nach dem Zusammenspiel seine Erfüllung.
Nur, daß er sich heute überwand und nicht das Geringste tat, um den
zarten Keim ihres jungen Vertrauens zu zerstören. Er sprach weiter, als
habe er keine Antwort von ihr erwartet:
„Ich wollte Sie nur ein wenig quälen – Ihnen zeigen, daß Sie im
Augenblick aus eigener Kraft nichts vermögen.“ Sie wurde unsicher.
„Sie widersprechen sich ja.“
„Weil ich soeben noch von den klugen Geschäftsleuten redete? Das
halte ich aufrecht! – Sie warten sozusagen an allen Ecken auf Sie,
mein Fräulein. Es kommt lediglich darauf an, daß Sie den richtigen
festmachen. Die Wahl muß vorsichtig gehandhabt werden. Zugleich
mit diesem Ehrenwerten lauern hundert Fallen, in welche Ihre
Un[S. 99]erfahrenheit glatt hineintappt, wenn Ihnen der kühle Berater fehlt.“
Sie seufzte auf, weil sie ihm glauben mußte.
„Ich könnte mich an den juristischen Berater der verstorbenen
Präsidentin wenden. Er hat mir seine Hilfe angeboten.“
„Ein Jurist und sei er noch so tüchtig, versteht nichts von all diesen
Dingen. – Da gibt es Vorschläge und schließlich Abschlüsse, gegen die
kein Paragraph gewachsen ist.“
„Das bestärkt mich in der Notwendigkeit, zu entsagen.“
„Sehen Sie an! So sehr verachten Sie also mich und meine Freundschaft?“
„Sie wollten mir wirklich helfen?“
„Merken Sie das endlich? Ich habe bereits einen Plan. Wir besteigen die
nächste elektrische Bahn und fahren gemeinsam zu – nun – nennen wir
ihn meinetwegen Herrn Freundlich! Der Mann ist bis zu einem gewissen
Grade gefällig und auch beinahe ehrlich, wenn man seine Schliche so
lange und genau kennt, wie ich. – Mir hat er jedenfalls vor Jahren
rührend geholfen. Freilich,“ und sein Gesicht nahm einen zerknirschten
Ausdruck an, „ein bißchen hänge ich – aus purer Vergeßlichkeit –
immer noch bei ihm. Wirklich nur deshalb. Meine Goldader hätte ihn
längst befriedigen können. – Also – wollen Sie?“
Sie zögerte noch. Die Hoffnung durchleuchtete aber schon das kurze
Zaudern.
„Er kennt mich doch nicht?“
„Darum verbürge ich mich eben für Sie! Mich kennt er und weiß genau,
was ich kann und noch leisten werde. – Passen Sie auf, wir schaffen
es mit Leichtigkeit. Ein paar[S. 100] tausend Mark gewährt er unter durchaus
annehmbaren Bedingungen zweifellos.“
Sie folgte ihm willenlos, als er in eine Seitenstraße einbog und zu
einer Haltestelle herüberquerte.
Sie saßen Seite an Seite auf dem schadhaften Tuch der schmalen Sitzbank
und schwiegen. Das Hoffen, das Eva von Ostried für alle Zeit eingesargt
zu haben meinte, trieb grüne Keime. – –
Herr Freundlich bewohnte ein düsteres, etwas feuchtes Kellergelaß und
war sehr unfreundlich. Ueber seiner scharfgebogenen Nase spähten zwei
kleine stechende Augen in Karlsens schönes, leichtsinniges Gesicht.
„Wie werde ich Sie nicht wiederkennen, Herr Karlsen,“ unterbrach er ihn
mürrisch, „Sie stehen ja noch mit achtzig Mark und fünfzig Pfennig zu
Buch.“
„Sie irren, Bester, es können unmöglich mehr als dreißig Mark sein.“
„Fangen Sie nicht schon wieder an zu handeln. Ich sage Ihnen, daß es
sogar neunzig sind, wie mir eben einfällt.“
„Schön. Sie sollen Recht behalten. Sonst ist es demnächst zu hundert
angewachsen. Das weitere in dieser Sache später. – Heute will ich
nichts für mich. Ich bringe Ihnen hier Fräulein von Ostried, die
schon einmal mit noch nie dagewesenem Erfolg in Oeynhausen die Mignon
gesungen hat. – Ihre Stimme birgt ganze Goldfelder.“
Die schlauen Augen glitten, den Wert ihrer Schönheit abschätzend, jetzt
über Eva von Ostrieds Gestalt und Antlitz. Sie empfand diese Blicke mit
körperlichem Schmerz.
„Um wieviel handelt es sich denn?“ fragte er langsam und vorsichtig.
[S. 101]
„Fünftausend Mark würden vorläufig genügen.“
„Und die Sicherheit?“
„Gebe ich Ihnen! Zudem verpflichtet sich die Dame schriftlich zu
regelmäßiger Abzahlung in Raten nach Abschluß ihres ersten Vertrages.“
Herr Freundlich lachte kurz und trocken auf.
„Eine schöne Sicherheit! Wollen Sie mich vielleicht zum Narren halten?“
Eva begann zu zittern. Die Scham, daß sie Paul Karlsens Vorschlag
angenommen, wurde so stark, daß sie zur Tür strebte, um ohne Gruß zu
scheiden. – Da streckte sich die dürre Hand des Geldverleihers nach
ihr aus.
„Nicht so hitzig, Fräulein. Sie gefallen mir sonst. – Und ich könnte
Ihnen schon helfen!“
Eva von Ostried sah in diesem Augenblick hilfesuchend nach Paul Karlsen
hinüber. Sie wurde unsicher.
„Wir müssen uns aber vorher erst auf gut Deutsch mit einander
verständigen,“ fuhr er fort. „Es soll natürlich die Oper sein. Kennen
wir doch. – Was anderes wird’s auch tun. Kurz gesagt: Ich wüßte was
Passendes für Sie. Auf die Stimme kommt’s dabei nicht besonders an.
Aber Kleider und Firlefanz müssen sein. Was sonst verlangt wird, ist
bei Ihnen vorhanden. – Sie gehen zum Varieté, Fräulein!“
Eva von Ostried riß nun doch die niedere Tür auf und flüchtete die
ausgetretenen unsauberen Stufen empor auf die Straße.
Ohne sich nach Paul Karlsen umzusehen, lief sie weiter.
„Sie dürfen mir nicht zürnen, ich habe es gut gemeint,“ bettelte seine
Stimme demütig. Sie sah starr geradeaus,[S. 102] damit er die Tränen ihrer
Scham und Verzweiflung nicht merken sollte.
„Jetzt werden Sie kein Vertrauen mehr zu mir fassen können,“ klagte
er. „Und ich wollte dies doch lediglich versuchen, damit Ihnen – das
andere – nicht etwa schwer fallen sollte.“ Nun wandte sie ihm doch ihr
Gesicht zu.
„Welches andere? Glauben Sie hiernach wirklich noch, daß ich einem
zweiten Versuch zustimmte?“
„Ich glaube nichts. Aber ich weiß. Es ist kein Versuch mehr. – Sie
brauchen lediglich „Ja“ zu sagen. Dann ist alles in Ordnung.“
„Ich wollte, ich wäre Ihnen nicht begegnet,“ sagte sie hart.
„Morgen werden Sie anders denken.“
„Morgen werde ich vielleicht schon Berlin verlassen haben.“
„Nein,“ sagte er und seine Lippen wurden schmal vor Erregung, „morgen
werden wir beide – gleich ausgelassenen Kindern – der Zukunft
entgegenlachen. Wetten?“ Sie tat, als habe sie dies Letzte nicht gehört.
„Ich muß meine Sachen fertig packen. Leben Sie wohl.“
Er hielt Ihre Hand fest.
„Fräulein von Ostried – ich bin Ihre Zukunft! Fühlen Sie das nicht? –
Es ist nicht Großsprecherei. Es ist einfache, ungeschminkte Wahrheit.
– Sie werden pünktlich heute Abend um neun Uhr vor dem Gartentor der
Villa sein, die sich Karlsbaderstraße 14 befindet.“
„Ich werde nicht kommen. Verlassen Sie sich darauf.“
„Streiten wir nicht. Ich erwarte Sie. Also keine Angst. Dort wird sich
jemand finden, der Ihnen ohne Schuldschein[S. 103] und sonstige Versprechungen
alle Mittel gewährt, die Sie nötig haben. – Es ist kein Scherz dabei.
Sehen Sie mich an.“
Sie schüttelte den Kopf ohne den Blick zu heben.
„Lassen Sie mich. Ich will nicht mehr.“
„Ich mag leichtsinnig und verschwenderisch – faul und meinetwegen
sogar nicht immer zuverlässig sein. Ein der Kollegenschaft gegebenes
Versprechen habe ich noch nie gebrochen. – Hören Sie. Mein Ehrenwort,
daß Sie nicht umsonst kommen werden. Daß Sie das bezeichnete Haus als
Eine verlassen, die für alle Zeit zu ihrer Kunst zurückgekehrt ist.“
Sie antwortete ihm nicht. Sie riß nur ihre Hand gewaltsam aus der
seinen und setzte ihren Weg allein fort.
Er machte keinen Versuch ihr zu folgen.
Aber solange die klare Ferne ein Schatten ihres schwarzen Kleides
zeigte, sah er ihr mit einem Lächeln des Triumphes nach.
Paul Karlsen ging mit gemächlichen Schritten über den rostfarbenen
Kies. Zu beiden Seiten des schmalen Weges blühte der Vorgarten. Ueber
dem weinumzogenen Haus lag die Mittagssonne. Augenscheinlich hatte
er es nicht eilig. Auch die wenigen bequemen Marmorstufen der Treppe
nahm er fast zögernd. In dem Vorraum, der zur eigentlichen Diele
führte, erwartete ihn die steife Gestalt eines alten Dieners, der etwas
eigentümlich Lebloses hatte. Paul Karlsens Augen waren noch von der
Fülle der Sonne geblendet. Er erschrack, als sich eine Hand nach seinem
Hut ausstreckte, trotzdem er dies Bild nun doch nachgerade kennen mußte.
„Na – bin ich heute pünktlich, alter Hagen,“ fragte er lässig.
Das Gesicht veränderte sich nicht. Nur die leise Stimme klang
vorwurfsvoll.
„Die gnädige Frau wartet seit einer Stunde mit dem Essen!“
Er lachte kurz auf, warf den Kopf in den Nacken und murmelte etwas.
„Verdammter Zwang,“ hieß es. –
In dem großen, sehr kühlen Eßzimmer harrten auf köstlichem Leinen zwei
Gedecke. – Dieser Raum wirkte pomp[S. 105]haft und erdrückend. Die Bespannung
der Wände mit schwarzem Rupfen allzu feierlich. Die wuchtigen Möbel
spreizten sich in ihrer Kostbarkeit. Die Sonne, welche durch stilvoll
bemalte Scheiben ohnehin ihren Weg niemals finden konnte, war vollends
von schweren Vorhängen abgesperrt. Nur die Tafel mit dem blendend
weißen Leinen trug eine Fülle blutroter Rosen und dunkelblauem Kristall.
Plötzlich löste sich aus der halbdunklen Schwermut die überschlanke
Gestalt einer weißgekleideten Frau und schritt auf Paul Karlsen zu.
Das längliche Gesicht war auffallend bleich. Die Nase trat scharf
hervor, als habe ein kürzlich überstandenes Krankenlager den Wangen die
natürliche Rundung genommen.
Karlsen führte ihre Hand an die Lippen und ließ den Wortlaut seiner
Stimme in gut gespielter Ueberraschung klingen:
„Du hast ja diese Leichenkammer heute so herrlich geschmückt, kleine
Frau. Wer soll denn beigesetzt werden? Und ein neues Gewand hast du
ebenfalls angelegt.“
Ihr stiegen die Tränen auf. Nicht weil er sie warten ließ. O nein –
daran hatte sie sich längst gewöhnt. Aber – daß er nicht – daran
dachte.
„Das Kleid,“ sagte sie hastig, um nicht laut aufweinen zu müssen,
„kennst du es wirklich nicht, Paul?“
Er zog sie nach einem der hohen Fenster herüber und zerrte den Vorhang
zurück. In dieser Bewegung lag ein Aufbäumen auch gegen vieles andere.
„Nee, mein Kind. Keine Ahnung habe ich.“
„Ich trug es an dem Tage unserer heimlichen Verlobung in Oeynhausen.“
[S. 106]
Er lachte verlegen auf.
„Richtig! – Natürlich! – Jetzt sehe ich es. Das sind aber doch
höchstens vier Monate her und noch längst kein Jahr. Wo ist also der
geschätzte Anlaß zu einer besonderen Feier?“
„Heute sind wir einen Monat Mann und Frau,“ sagte sie leise und konnte
nun doch nicht hindern, daß ein runder Tropfen auf das kostbare Gewand
fiel. – Er zog ungeduldig die Stirn empor.
„Schön – also einen Monat! Was ist das im Vergleich zu all den Jahren,
die hoffentlich noch vor uns liegen. – Also, ich habe dieses hohe Fest
verschwitzt. Nimm’s nicht übel. Mir brummt der Kopf. Es gibt doch mehr
Arbeit und Schwierigkeiten zu überwinden, als ich anfänglich annahm.“
„Ich störe dich doch nicht etwa bei deinen Studien, Paulchen?“
Er hatte seinen Rufnamen überhaupt niemals gemocht. Dies „Paulchen“,
das er ihr nicht abgewöhnen konnte, reizte ihn zuweilen bis zur
Tollheit. Jetzt überhörte er es, weil er etwas erreichen wollte.
„Du im Besonderen bist das bescheidenste und leiseste Wesen, das es
geben kann. Im allgemeinen freilich wäre ich gerade jetzt für eine
kurze Zeit nicht eben ungern solo.“ Sie sah entsetzt zu ihm auf.
„Soll das heißen!“ Sie konnte nicht vollenden. Ihre Stimme erstickte in
Tränen. Er schüttelte sich, als fröre er.
„Tu mir den einzigen Gefallen und höre mit dem Weinen auf, Elfriede.
Ich komme mir ja andauernd wie ein Barbar vor. Nein, nicht du sollst
für wenige Tage deine[S. 107] zur Zeit kränkelnde Mutter, eine Straße weiter,
besuchen und sie dadurch halb unsinnig vor Freude machen – welchen
Wunsch sie mir schon vor einer Woche, allerdings mit der Bitte, ihn
dir vorläufig zu verheimlichen, verraten hat – sondern ich werde zu
meinem Lehrer unter den blendenden Dachgarten ziehen. Denn, weißt du,
kleine Frau, ich muß üben und immer nur üben – kann mich nicht mehr
an eine feste Tischzeit binden – vertrage überhaupt zu solchen Zeiten
vorübergehend keine andere Gesellschaft als eine männliche.“
Sie legte die Hand auf seinen Arm.
„Paulchen, schenk mirs zum heutigen Tag, daß ich in mein altes
Mädchenstübchen zur Mutter darf. Du mußt deine Bequemlichkeit gerade
jetzt haben.“
„Das würde eine schöne Geschichte geben, mein liebes Kind! Deine
Mutter würde plötzlich vergessen, wie sehr sie sich nach dir gesehnt
und felsenfest glauben, ich behandele dich schlecht und lieblos.
Denn sieh mal, immerhin bleibt es etwas wunderbar, wenn eine junge,
liebliche Frau nach einmonatlicher Ehe ihren Ehemann – wenn auch nur
vorübergehend – verläßt.“ Der letzte Satz gab ihr eine ungeheure Kraft.
„Glaubst du wirklich, Paulchen, daß ich der Mutter meinen Besuch in
diesem Lichte hinstellen würde?“
„Na, na, Kleines – wer kennt sich mit euch Frauen aus? In gewissem
Sinne ähnelt ihr euch alle verteufelt.“
Sie widersprach mit jähaufflackerndem Rot.
„Hast du schon vergessen, was ich dir in der grünen Einsamkeit des
Siels am Karpfenteich gelobt habe?“ Natür[S. 108]lich hatte er nicht die
geringste Ahnung. Aber er hütete sich es einzugestehen.
„Frauengelöbnisse sind unberechenbar, wie eure Eifersucht, Schatz.“
„Hältst du mich für eifersüchtig?“
„Es käme auf die Probe an. Glatt verneinen möchte ich das nicht!“
„Ich würde sie bestehen. Verlaß dich drauf.“
„Lieber nicht. Deine Mutter wohnt ein bißchen zu nahe, Kleines.“
„Wie tief mußt du mich einschätzen, Paul!“
„Bewahre. Riesig hoch sogar. Hätte ich dich denn sonst geehelicht?“
Sie legte mit einer rührenden Gebärde der Demut ihr Gesicht auf seine
schlanke Hand.
„Sage so etwas niemals wieder, Paulchen. Wir wollen uns doch fest,
ganz fest vertrauen.“ Ihm wollte ein Lachen aufsteigen. Es wurde aber
zuletzt ein Hüsteln daraus.
„Wollen wir auch. Natürlich. Aber jetzt komm gefälligst. Ich verspüre
einen Bärenhunger.“ Erschrocken drängte sie ihn zur Tafel hinüber.
„Verzeih – ich vergesse das so oft neben dir!“
Er musterte ihre magere, noch kindlich unentwickelte Gestalt und
seufzte leicht auf.
„Leider, mein guter Schatz! Eß und trink, lieb und sing. Ja – so stand
es an einem alten Bauernhaus in Sachsen. Und recht hat der Spruch! –
Wie ich sehe, hast du zur Feier des hohen Tages auch herrlich für Stoff
gesorgt. Hoffentlich ist er gut.“
[S. 109]
Sie ließ es sich nicht nehmen, ihm aus der schweren Kristallkaraffe die
funkelnde Schale zu füllen.
„Probiere ihn, Paulchen.“ Er hob das kostbare Glas und ließ es hell an
das ihre klingen.
„Herrlich! – Ueberhaupt – das muß ich immer wieder anerkennen, du
bist eine ganz prachtvolle, kleine Hausfrau.“
Strahlend sah sie zu ihm auf.
„Darum habe ich auch einen Wunsch frei, ja?“
Der Diener trug die Suppe auf. Die Unterhaltung verstummte. Sobald er
unhörbar entschwunden war, sagte Paul Karlsen spöttisch:
„Er liebt mich nicht, Elfchen. Weißt du das eigentlich?“
„Er liebt jeden, der mir gut ist,“ sagte sie ruhig, fast streng.
„So? Na, weißt du, das bezweifle ich stark. Oder willst du etwa
andeuten, daß ich –“
Sie ließ ihn nicht zu Ende kommen. Sanft legte sie ihre Hand auf seinen
Mund.
„Ich bin dir unaussprechlich dankbar dafür. Trotzdem wünsche ich mir
noch eine Kleinigkeit.“
„Was denn, Kleines?“
„Den Besuch bei meiner Mutter.“
„Ausgeschlossen! Die Gründe für meine Härte habe ich dir genannt.“
„Sie sind sämtlich hinfällig. Ich fange es eben so geschickt an, daß
Mama zum Schluß sich heimlich bei dir bedanken wird.“
„Wie wolltest du das anstellen?“
„Sehr einfach. Heute nachmittag zur üblichen Whistpartie, wäre ich
doch herübergegangen. Da werde ich also[S. 110] ausnehmend blaß aussehen
müssen. – Lache nicht – ein wenig Weiß genügt schon. Sie wird mich
wieder zur Schonung quälen, in ihrer Ueberängstlichkeit meinen längeren
Besuch verlangen, damit sie sich selbst von meinem Gesundheitszustand
überzeugen kann und zwar dies alles in deiner Gegenwart.“
„Um Gottes willen, ich soll dich doch nicht etwa begleiten. Das hast du
bisher doch klug zu vermeiden gewußt.“
„Bringe mir dies Opfer, Liebster.“
„Also gut! Ich will sogar gern mitkommen. Das heißt höchstens für ein
bis zwei Stunden.“
„Solange wird es gar nicht nötig sein,“ meinte sie froh. „Aber nun höre
weiter. Du sperrst dich gegen das von ihr Geforderte und verweigerst
schließlich in aller Form deine Erlaubnis. – Dann wird sie hitzig
werden und unter allen Umständen darauf bestehen. – Ich kenne sie
doch.“
„Du bist ja eine ganz gefährliche, kleine Heuchlerin, Schatz.“
Er zog sie leicht in die Arme. In tiefem Glücksgefühl schloß sie die
Augen, die das einzig Schöne in ihrem Gesicht waren.
„Ist das nicht ein feiner Plan, Paulchen?“
„Ausgezeichnet sogar, wenn mir inzwischen die Sache nicht wieder leid
geworden wäre. Du hast als Ernst aufgefaßt, was bei mir nur eine Art
Gefühlsausbruch war.“
„Daß du es, wenn auch nur einen Augenblick gewünscht hast, zeigt mir
die Notwendigkeit und nachher – wird es um so schöner sein.“
„Gelt, das hätten wir vor einem Vierteljahr auch noch nicht gedacht?“
[S. 111]
„Was denn,“ schnurrte er mit erwachender Behaglichkeit.
„Daß wir so schnell unser Glück erzwingen würden.“
Er nickte mit vollem Mund, denn inzwischen war der Braten gekommen,
der, zart und saftig, selbst den größten Feinschmecker befriedigt hätte.
„Wärst du nicht plötzlich nach der schroffen Ablehnung meines Werbens
durch die Frau Kommerzienrat, wollte natürlich sagen, deiner lieben
Mama, kränker geworden und dadurch jegliche Wirkung der Kur auf dein
rebellisches Herzlein in Frage gestellt – wer weiß, wer dann heute an
meiner Stelle neben dir säße –“
„Wie wenig du mich im Grunde doch kennst, Paulchen. Fühlst du nicht,
daß ich niemals einem andern als dir gehört hätte?“
Er nickte ihr zu.
„Kleines Treues – du!“ Dann begann er zu scherzen und von jener
Zeit zu plaudern, weil er genau wußte, daß ihr dies die liebste
Unterhaltung war. Seine feurigen Augen strahlten tief in die ihren. Das
schmeichlerische weiche Organ machte auch das unbedeutendste Wort zu
einer Zärtlichkeit. Seine Laune war plötzlich glänzend.
Ueber den blutroten Rosen und dem blauen Kristall schien die Krone des
Glückes, die allein die Liebe gibt, in warmen Glanz zu schweben! – –
„Ja,“ sagte einige Stunden später Frau Kommerzienrat Eßling zu ihrer
alten Freundin und Vertrauten, die – wie seit Jahren – als Erste
zur Whistpartie gekommen war, „in der Nähe hätte ich sie nun ja.
Aber, was will das sagen. So viel man auch aufpaßt – allwissend ist
doch Niemand. Wer sagt mir, ob Elfriede unter seiner An[S. 112]leitung nicht
ebenfalls Komödie zu spielen gelernt hat?“
Frau Generalkonsul Enck war keine mißtrauische Natur. Aber dieser
überstürzt geschlossenen Verbindung zwischen dem überzarten, beständig
kränkelnden Mädchen und diesem bildhübschen Leichtfuß, dem Karlsen,
brachte sie doch ihre schärfste Mißbilligung entgegen. Hätte man sie,
wie das sonst bei jeder wichtigen Entscheidung der Fall gewesen, nur
um Rat gefragt. Man hatte jedoch, einfach über ihren Kopf fort, in
aller Stille dem durchaus nicht von ihr ernstgenommenen Verlöbnis, die
eheliche Verbindung auf dem Fuße folgen lassen.
Nun kamen natürlich Reue und Gewissensbisse über die besorgte, selbst
leidende Mutter. Anderseits kannte sie die bewundernswerte Energie
der Kommerzienrätin zu genau, um dieses Bündnis von vornherein als
dauerndes anzusehen.
„Sie hätten es sich gründlicher überlegen sollen,“ konnte sie sich
nicht versagen, zu erwidern. Die andere sah starr auf das feine
Porzellan der kostbaren Teeschalen herab.
„Sie haben niemals Kinder besessen. Da können Sie so etwas wohl sagen.
Stehen Sie nur an zwei Krankenbetten, in denen scheinbar bisher
kerngesunde, bildhübsche, lebenslustige Mädchen – – Auch die andern
Aerzte haben zuerst keine Ahnung davon gehabt. Denn daß mein Mann an
den Folgen einer hartnäckigen Lungenentzündung in jungen Jahren starb,
gab noch allein keinen Grund zur Beängstigung für seine Kinder ab.
Erleben Sie mal erst, was ich ertragen habe. – Wie habe ich damals
gegen das furchtbare Gespenst gerungen. Hart bin ich gewesen – so
hart.“
[S. 113]
In ihrem energischen Gesicht, aus dem die scharfe Nase, wie sie auch
ihre jetzt noch einzige Tochter hatte, auffallend hervorsprang, zuckte
es.
„Regen Sie sich nicht mit den alten Geschichten auf, Frau Eßling.“
„Die Aussprache mit Ihnen tut mir wohl. Zu wem sollte ich wohl davon
reden, wenn nicht zu Ihnen, vor der ich kein Geheimnis habe. – Seitdem
ich meinen alten Franz, den Diener, meiner Elfriede gegeben habe, weiß
niemand im Haus um diese Sachen.“
„Malen Sie sich nicht zu schwarz, Beste,“ verteidigte die Konsulin.
„Sie mögen damals streng gewesen sein. Wer wäre es in der gleichen Lage
nicht gewesen. An eine Härte glaube ich nicht.“
„Sie sollen selbst urteilen. In St. Blasien war’s, wohin ich nach
den erfolglosen Kuren in Hohenhonnef und Davos aus eigenem Entschluß
noch mal mit den beiden ältesten Töchtern ging. Denn Sie wissen, ich
konnte und wollte nicht daran glauben, daß alles vergeblich sein
sollte. In der Liegehalle war ein vergnügliches Leben unter dem jungen
Volke, und keines war da, das an ein frühzeitiges Sterben gedacht
hätte. Als Gesunder läßt man die sonst im Verkehr der verschiedenen
Geschlechter streng beobachteten Richtlinien außer Acht, weil die
armen totgeweihten Geschöpfe doch keine Vollmenschen mehr sind. Nicht
wahr, wenn unsereins so ein schmalschultriges Kerlchen mit fieberroten
Flecken auf den herausstehenden Backenknochen sieht, dann fragt man
nicht erst lange danach, was er sonst ist, hat und will, selbst wenn
er augenscheinliches Wohlgefallen an dem eigenen Fleisch und Blut
zeigt. Im Gegenteil,[S. 114] man freut sich noch gar darüber, und kommt
sich wer weiß wie großmütig und gar edel vor, weil man die leibliche
Mutter von seinem Glückserreger ist. Darum bin ich auch nicht einen
Augenblick besorgt gewesen, als der junge Bildhauer meiner kranken
Aeltesten über alle Gebühr hinaus den Hof machte. Erst, als der ihn
behandelnde Arzt, dem ich mein Bedauern über diesen hoffnungslosen Fall
aussprach, mir rund heraus und lachend erklärte, er wäre froh, wenn
jeder seiner Kranken so gesund wäre, wie dieser Künstler, der sicher im
nächsten Jahr wieder völlig obenauf sein würde, wurde ich nachdenklich,
vorsichtig und streng. – Mein Mädel nahm ich ins Gebet. Den Bildhauer
behandelte ich so schlecht, wie es nur irgend ging. – Es war für
alles zu spät. – Eines Tages erklärte mir meine Tochter, daß sie sich
mit dem Jüngling von Habenichts verlobt habe. Sie hat vor mir auf den
Knien gelegen und mich um meine Einwilligung angefleht. Ich blieb hart.
Daß der offensichtlich seinem Aussehen nach Totgeweihte lediglich an
den Folgen einer schweren Rippenfellentzündung schonungsbedürftig
sei, hatte meine Hoffnung bezüglich der eigenen Kinder wunderbar
gekräftigt. – Einen Tag nach dem vergeblichen Flehen meiner Aeltesten
reisten wir, die noch nicht zur Hälfte vollendete Kur abbrechend, nach
Hause. Briefe kamen, wurden von mir abgefangen und prompt vernichtet.
Jede Nacht hörte ich das bitterliche Schluchzen meiner Aeltesten –
merkte, wie sie bleicher und hinfälliger wurde und glaubte plötzlich
doch nicht mehr an den Ernst des Verhängnisses. Es war so nahe. Meine
kleine Elfriede, die wenigst anmutigste der Drei, hatte ich indessen
aufs Land in Pension gegeben, weil der Arzt von der Möglich[S. 115]keit einer
Ansteckung, selbst bei größester Vorsicht, gesprochen. Nun konnte ich
ganz der Pflege und Sorge für die beiden andern leben. – Einmal hat
der Bildhauer gewagt, bis in mein Haus vorzudringen. Ich habe ihn auch
empfangen. – Seitdem hat er keine Zeile mehr geschrieben. Denn ich war
deutlich gewesen. – Vier Wochen nachher hat meine Tochter, unterstützt
von ihrer Schwester, noch einen letzten Sturm auf mein Mutterherz
gemacht. Weiß Gott, es hat sich in dieser Stunde nicht geregt. Ich habe
es als Laune und Eigensinn empfunden, was doch mehr gewesen ist.“
Die Andere legte begütigend die Hand auf die zuckende Schulter der
Kommerzienrätin.
„Wir wissen alle, was Sie die langen Jahre für eine aufopfernde,
prachtvolle Mutter gewesen sind.“
„So prachtvoll, daß ich mich hinterher noch meines gefestigten
Charakters gefreut und ein paar Tage ernsthaft mit dem armen Kind
geschmollt habe. Auch meine Zweite hat begonnen für sie und den
Bildhauer unentwegt zu betteln. – Als sie einsah, daß ich nicht
nachgab, verstummte sie zwar, aber es war seltsam, auch mit ihr wurde
es seitdem schlechter. Sie schienen sich beide in das Unabänderliche
meines Willens gefügt zu haben, bis zu jenem schrecklichen Augenblick,
an dem mich die Pflegerin in der Nacht rief. Da hat meine Aelteste, die
stets ein sanftes, scheues Ding war, mir gesagt, wie unerträglich ihr
Dasein ohne den Geliebten gewesen und wie wenig sie sich freue, daß
es nun endlich aufhören dürfe. – Als die Sonne aufging, war sie tot.
Und ich habe Tag und Nacht, von Reue zerrissen, um Vergebung gefleht
und mir gelobt, wenigstens an den an[S. 116]dern beiden gutzumachen, wenn es
mir vergönnt wäre. – Meine Zweite hat keine Kraft mehr zu einer Liebe
gehabt. Sie ist ein Jahr später, wie Sie wissen, auch eingeschlafen.
Da hatte ich nur das Elfchen, die Jüngste. Das Landleben hat ihr auch
nicht die richtige Lebenskraft vermitteln können. Sie blieb weiter zart
und schonungsbedürftig. Was es ist? Ich weiß es nicht! Ein bißchen
Müdigkeit, das die Aerzte als Bleichsucht ansprechen. Ein bißchen
Blässe. So fängt es ja gewöhnlich an. – Und ich wollte und will sie
behalten. – Ich war nicht mehr blind und taub. Als ich die Blicke sah,
mit denen der Schauspieler Karlsen, den ich übrigens schon vor einigen
Jahren im Hause einer Bekannten, die ihn sich zu Gesangsvorträgen
herüberkommen ließ, kennen gelernt, meine Elfriede anstarrte, wußte
ich sofort, daß ein Kampf von neuem beginnen müsse. Und wußte – auch
sein Ende! Denn ich war nicht mehr stark und gesund genug, um noch
einmal jene Zeiten von damals durchzumachen. Sein spielerisches Werben
ging mir wider alles Empfinden. Er war ein viel minderwertiger Mensch
als einst der Bildhauer. Sowas fühlt man als reife Frau sehr schnell.
Eins kam noch hinzu. Wer, wie ich, aus einem reichen Kaufmannshause
stammt, in dem alles ordentlich gebucht und verrechnet wird, kann sich
niemals mit den Gepflogenheiten der Künstlerschaft befreunden. Denn ein
Künstler ist der Karlsen. Das steht auch bei mir fest. Daneben ist er
aber noch etwas anderes –“
„Wie im Grunde genommen die meisten Männer, liebe Eßling.“
„Das weiß ich doch nicht. Sind sie es aber wirklich, so setzt man
es wenigstens nicht als selbstverständlich bei ihnen[S. 117] voraus. In
ähnlichen Fällen pflegen sie sich mit dem Mantel einer weisen Vorsicht
zu panzern, der den Schein wahrt. Das fällt bei meinem Schwiegersohn
gänzlich fort. Er steht einfach da und erwartet die Huldigungen der
Frauen als den natürlichsten Tribut. Bleiben sie aus – je nun –
so ist das eben bei ihm wie bei jedem andern Künstler, noch dazu
bedauernswert. Dann hat er eben nicht eingeschlagen. Findet – hat
er überhaupt schon vorher eins ergattert – kein neues oder doch nur
ein sehr zweifelhaftes Unterkommen, steigt weiter herunter, sinkt
schließlich bis zur Schmiere herab.“
„Nun, das ist bei Karlsen wohl niemals zu befürchten.“
„Nein. Er weiß sich in Szene zu setzen und auch zu halten, was noch
wichtiger ist. Schlau, durchtrieben, bildhübsch, liebenswürdig, flott.
– Sehen Sie, ich habe mir die Klarheit meines Urteils durchaus nicht
trüben lassen. Jawohl, das ist er! Daneben aber auch unzuverlässig und
treulos.“
„Haben Sie dafür schon Beweise?“
„Brauche ich nicht! Es ginge wider die Weltgeschichte, wäre es anders.
Meine Elfriede ist keine Frau, die solchen Mann dauernd fesseln kann.
Glauben Sie mir, der braucht einen Satan von Weib, das ihn in Atem hält
– ihn quält und peinigt und ihm höchstens Sonntags die Fingerspitzen
zum Kuß überläßt. Er hat sie auch nicht einen Augenblick wirklich
geliebt, während jener Bildhauer meiner Aeltesten rechtschaffen gut
gewesen ist. Das alles sehe ich erst jetzt ein. Das bewußte Messer
saß ihm hart an der Kehle und sein Ehrgeiz – denn den hat er in
hervorragendem Maße – sann auf Mittel und Wege, wie er seine Stimme
weiter ausbilden und sich die Welt erorbern konnte.“
[S. 118]
„Sie werden doch aber Ihrer Elfriede nichts von all diesen Sachen
andeuten, Frau Eßling.“
„Wozu? Die Mühe kann ich mir sparen. Sie ist dermaßen in ihn verliebt
und vertraut ihm so blindlings, daß sie zur Zeit ohne Ueberlegung die
eigene Mutter aufgäbe, um ihn zu behalten und ihm weiter zu dienen.“
„Jedenfalls fühlt sie sich wohl dabei. Sie war stets durchsichtig wie
Glas – unfähig der Lüge. Das wissen Sie am besten. Die Ehe bekommt
ihr auch gut. Wie ich sie das letzte Mal sah, hatte sie einen Schein
von Jugend und Frische, den ich bisher an ihr vermißte. Ja, sie lachte
sogar herzhaft.“
„Wenn ich das nur genau wüßte,“ machte die Kommerzienrätin gequält.
„Ich deutete es Ihnen bereits an. Auch das Komödienspiel läßt sich
bei so einem harmlosen, aufrichtigen Charakter wie dem ihren gar
wohl erlernen. Und sehen Sie – da bin ich endlich bei meinem Plan
angekommen. So nahe sie mir wohnt – so mühelos ich jederzeit herüber
kann, so treu und gewissenhaft der alte Franz auch aufpaßt und mir
unweigerlich sofort Verdächtiges zutragen würde, ebenso fremd ist sie
mir doch in dieser kurzen Zeit geworden. Der Mann mit seiner absoluten
Gewalt über sie steht zwischen uns. Jede ihrer Handlungen wird von
ihm beeinflußt. Ich weiß niemals, was aus ihrer eigenen Seele kommt.
Darum muß ich sie eine kurze Zeit bei mir – hier in diesem Hause –
in ihrem kleinen Mädchenstübchen, das immer ihr Entzücken gewesen ist,
haben, muß sie scharf beobachten und sie seinem Einfluß, wenn auch nur
vorübergehend, entreißen, damit ich völlig klarsehe.“
[S. 119]
„Wie wollen Sie das anfangen? Er wird sich bald dagegen auflehnen.“
„Meinen Sie? Die Klugheit würde es ihm freilich anraten. Aber – ja,
wenn er sie wirklich liebte. So aber wird er es als angenehm empfinden,
wieder mal allein und noch dazu in der ungewohnten Pracht zu leben.
Ich weiß, Sie waren nicht mit der prunkvollen Ausstattung des Heims für
die jungen Leute einverstanden. Sollte ich aber mein Kind entbehren
lassen? Da entschloß ich mich eher dazu, ihn unnötig zu verwöhnen.“
„Sie haben entschieden zu viel Zeit zum Grübeln, liebe Eßling. Ziehen
Sie sich nicht länger von allen Menschen zurück. Kommen Sie auch wieder
öfter zu mir. Sie wissen, in meinem Hause verkehrt viel Jugend. Da geht
es fröhlich zu. Und bringen Sie auch Elfriede öfter mit. Es wird ihr
gut tun.“
„Sie können es ihr ja heute gleich vorschlagen. Ich fürchte nur, es
bleibt wirkungslos, wie alles, was ich bereits zu ihrer Zerstreuung
versucht habe. Dabei ist sie, wie mir Franz zuverlässig berichtet,
sehr oft den ganzen Tag allein. Der Hausherr kommt lediglich zu den
Hauptmahlzeiten und dann nicht etwa pünktlich. Nun, der Zustand
anhaltender Einsamkeit wird bestimmt abgestellt werden. Um keinen
Preis darf sie mir versauern. Ich werde eine möglichst gleichaltrige
Gesellschafterin aus vornehmer Familie für sie nehmen. Die Aerzte haben
mir wiederholt von der Notwendigkeit, sie froh zu erhalten, gesprochen.“
„Sie sind zwar eine ebenso kluge wie tatkräftige Frau, meine Liebe.
Indes keine Zauberin. Ich muß Ihnen[S. 120] sagen, daß ich weder an Elfriedes
längeren Besuch noch an das Dulden der neuen Hausgenossin glaube.“
„Vorläufig bin ich in beiden Fällen zuversichtlich. Das Gesuch
nach einer Gesellschafterin ist heute bereits in den gelesensten
Tageszeitungen erschienen. Da der künftige Herr Kammersänger keine
Zeit hat, auch noch den Inseraten seiner Zeit einen Blick zu gönnen
und meine Tochter daheim niemals auf diesen Gedanken kam, bin ich
sicher, daß sie bisher nicht das Geringste von meinem Plan ahnen.
Verkehr in Elfriedes altem Kreis haben sie nicht. Diese Menschen gehen
nämlich meinem Herrn Schwiegersohn, wie ich aus Elfchens gelegentlichen
schüchternen Bemerkungen entnehme, auf die Nerven. Also, wer sollte
ihnen meine Fürsorglichkeit verraten haben?“
„Ist es nicht gefährlich bei der mir geschilderten Veranlagung Ihres
Schwiegersohnes ihm so ganz mühelos ein weibliches Wesen ins Haus und
an den Familientisch zu bringen?“
„Was wollen Sie? Sucht er, wird er stets finden. Was allzu bequem
gemacht wird, reizt gewöhnlich am wenigstens. Zudem – müssen sich alle
Bewerberinnen bei mir melden. Ich werde sie mir sehr genau betrachten
– ihre Verhältnisse und, wenn irgend möglich, auch ihre Veranlagung
untersuchen und dann hoffentlich eine gute Wahl treffen.“
„Wenn sie Ihnen nun aber, mit vereinten Kräften, nicht gestatten, die
gütige Vorsehung zu spielen?“
„Daß meine Elfriede sich zuerst dagegen auflehnt, weiß ich sogar
bestimmt. Sie ist rührend bescheiden und macht für ihre Person
keinerlei Ansprüche. Es wird ihr gräßlich[S. 121] sein, zu der ihr bereits
aufgedrungenen Jungfer noch eine zweite Umsorgerin zu benötigen. Was
will das aber sagen? Ihr schwacher Einspruch wird unstreitig an der
feurigen Zustimmung ihres Mannes sterben, wenn er es nicht bereits
unter der klugen Anwendung meiner Mittelchen getan hat. – Ihm wird
diese Lösung außerordentlich genehm sein. Dann braucht er nicht mal
mehr den guten Willen zum halbwegs pünktlichen Erscheinen bei Tisch
aufzubringen, denn daß er ihn auch nur einmal in die Tat umgesetzt hat,
glaube ich bei seinem Egoismus keinesfalls.“
„Ich bewundere Ihre Klugheit aufrichtig, Frau Eßling.“
„Es ist nur die folgerichtige Einsicht von notwendig gewordenen Uebeln,
deren schädliche Wirkungen ich mich bemühe, so gut es gehen will, von
meinem Kinde abzuwenden. – Hören Sie! Ist das nicht ihr Schritt? Nein
– ich irre mich nicht. Das Ohr der Mutter ist scharf. Aber – was ist
das? Sie kommt nicht allein? Da ist doch das unverschämte Lachen ihres
Mannes. Sollte er ausnahmsweise die Gnade haben?“ –
Es war, als lege sich plötzlich über die strengen, steifen Formen der
schweren Möbel ein warmer Glanz. Die alten Nippes in der Servante
begannen leise und vergnügt zu klirren. Im Nebenzimmer streckte
sich der rotbemützte Kopf des grüngefiederten Papageis blitzschnell
empor. Das ehrwürdige Zimmer war erfüllt von dem Schmelz der weichen
Männerstimme.
„Darf ich ebenfalls um eine Tasse Ihres unvergleichlich guten Tees
bitten, verehrte Schwiegermama?“
Gedankenlos duldete Frau Eßling seinen Handkuß. Ihre Augen blieben
dabei gespannt auf die Tochter gerichtet.
[S. 122]
„Du siehst erschreckend blaß aus, Kind. Wie hast du geschlafen?“
„Ausgezeichnet, Mama.“
„Das glaube ich dir nicht! Zeige deine Hände. Natürlich – sie sind
ganz kalt. Hast du gefroren? Warte einen Augenblick, ich werde sofort
an Franz telephonieren. Es ist bestimmt zu kühl bei Euch. Darum habe
ich ja am Vorraum der Diele die kleinen Oefen aufstellen lassen, damit
sie angemacht werden, wenn die Zentralheizung noch nicht geht.“
„Laß doch, Mama,“ wehrte Elfriede gequält und suchte ängstlich den
Blick ihres Mannes. „Die Sonne wärmt noch ganz wundervoll.“
Aber die Kommerzienrätin ließ sich nicht zurückhalten. Sie hatte schon
den Hörer in der Hand, um dem alten Diener die nötigen Befehle zu
erteilen.
Paul Karlsen saß mit einem rätselhaften Lächeln dabei. Er begehrte
nicht auf, schlug nicht etwa mit der Hand zwischen die zerbrechlichen
Kostbarkeiten, in denen der goldgelbe Tee deutlich schimmerte. Sondern
er nickte seiner Frau beruhigend zu.
„Mama hat ganz recht. Ich habe es mir heute auch schon gedacht.“
Trotz dieser ungewohnten Fügsamkeit fand seine Gegenwart durch die
Kommerzienrätin nicht viel Beachtung. Ueber ihn fort sprach sie
unaufhörlich zu ihrer Tochter herüber, als befinde sich zu ihrer Linken
ein leerer Platz.
„Du wirst übrigens ein oder mehrere Tage bei mir bleiben, Elfriedchen.
Ich muß endlich wissen, ob du abends erhöhte Temperatur hast.
Widersprich nicht. Ich erlaube[S. 123] auf keinen Fall, daß du heute Abend in
dein leider etwas feuchtes Heim zurückkehrst.“
Da ließ sich Karlsens unwiderstehlich frohes Lachen hören. Aber es riß
die andern durchaus nicht zu der gleichen Fröhlichkeit hin. Seine Frau
sah scheu zu ihrer Mutter herüber.
„Verehrte Schwiegermama, Sie scheinen vergessen zu haben, daß nur ein
einziger über das Gehen und Verweilen von Elfriede zu bestimmen hat.
Dieser Eine bin ich, mit Respekt zu melden.“
Diesmal ahnte sie nicht, daß er Komödie spielte. Sein Ton war sehr
ernst geworden. Sein junges, bartloses Gesicht wirkte fast streng. Den
lächelnden Blick des Einverständnisses, den er mit Elfriede tauschte,
bemerkte sie nicht. Ihre angeborene Heftigkeit – niemals ernsthaft von
ihr bekämpft – brach sich Bahn.
„Das bliebe abzuwarten, Herr Schwiegersohn,“ sagte sie in scharf
zurechtweisendem Ton. „Sind Sie etwa hierher gekommen, um mich
aufzuregen?“
„Ich wüßte nicht, daß ich diesem vielleicht erstrebenswerten und daher
löblichen Vorsatz schon jemals freie Entwicklung gegönnt hätte.“
„Lassen Sie doch die Phrasen, Karlsen. Bei mir wirken sie nicht.“
„Diese Bitte gebe ich gehorsamst zurück, Schwiegermama. Kurz: Elfchen
wird mich nach Hause begleiten. Nicht wahr, Schatz?“
Ein schelmischer Ausdruck huschte über das Gesicht der jungen Frau, und
ließ es sehr anziehend erscheinen. Sie war glücklich wie ein Kind, daß
sie im Einverständnis mit[S. 124] ihrem Mann dies unschuldige kleine Geheimnis
haben durfte. Ohne zu zögern, antwortete sie:
„Ja – das werde ich bestimmt tun, Mama. Du hast doch gehört, daß Paul
es ausdrücklich wünscht.“
Da richtete sich die Kommerzienrätin steif empor und fragte kurz und
empört zu der Konsulin gewandt:
„Was sagen Sie dazu? – Vor Ihnen, die Sie Elfriede über die Taufe
gehalten und allzeit wie ein eigenes Kind geliebt haben, brauche ich
mich nicht zu genieren.“
Frau Enck war wegen der richtigen Antwort in tödlicher Verlegenheit.
Einerseits schätzte sie gleichfalls diesen jungen Menschen nicht allzu
sehr, weil sie in seiner Gegenwart beständig das Gefühl hatte, als
langweile er sich sträflich. Daneben aber stand ihm in dieser Sache ihr
Hang zur Gerechtigkeit bei.
„Beschlafen Sie sich alles noch mal gründlich,“ versuchte sie zu
besänftigen. Aber es mißlang ihr gründlich.
Frau Eßling wurde erregter und daher auch in ihren Worten heftig. Sie
erhob sich, trat nahe an den Schwiegersohn heran und sagte drohend:
„Sie hören, ich wünsche und befehle es. Und nichts wird mich andern
Sinnes machen können.“
Nun war auch Paul Karlsen aufgestanden. Seine schlanke, elegante
Gestalt überragte die rundliche der Kommerzienrätin um Haupteslänge.
„Verehrte Schwiegermama, vorerst eine kleine bescheidene Berichtigung.
Ihre kühn aufgestellten Behauptungen sind wirklich falsch. Der
männliche Teil in der Ehe hat auch heute noch das Recht – genau wie zu
jener Zeit Ihrer Jugend – den Aufenthalt seiner Gattin zu bestimmen,
so[S. 125]fern er sich dies Recht nicht durch grobe Pflichtverletzungen
verwirkt hat. Davon weiß ich mich frei. – Ich würde Ihnen ja herzlich
gern einen Gefallen tun. Mir selbst aber Opfer auferlegen – nee –
wissen Sie, dazu fühle ich mich nicht stark genug.“
Es klang so überaus ehrlich, daß sogar seine Frau einen Augenblick
stutzte. An dem hilflosen Blick, den sie ihm zuwarf, merkte er, daß er
nicht weitergehen, nicht in dieser Rolle übertreiben dürfe. Er schwieg
also vorsichtig und wartete die nächste Erwiderung ab. Sie blieb lange
aus. Dann aber klang die vordem herrische Frauenstimme plötzlich um
vieles leiser. Fast bittend.
„Es soll sich nur um eine kurze Zeit handeln, Karlsen. Sagen wir – um
drei bis vier Tage! Wirklich nicht länger.“
Er machte den Eindruck eines Menschen, der aufmerksam eine unliebsame
Angelegenheit in Erwägung zieht. Daß er nicht sogleich antwortete,
sondern – wie um Beherrschung ringend – mit gesenktem Blick auf seine
wohlgepflegten, schöngeformten Hände herabsah, gefiel der Konsulin
ausnehmend gut. Dann meinte er bitter:
„Ich habe Ihre Neigung nicht, Schwiegermama. Das weiß ich natürlich und
hätte mich gehütet auch nur ein Wort darüber zu verlieren, wenn diese
Sache nicht gekommen wäre. Jetzt lassen Sie mich darüber sprechen.
Glauben Sie, es wirkt erziehlich und macht edler, was Sie doch
beabsichtigen, wenn Sie mich dauernd Ihre Abneigung fühlen lassen? O
nein – aber Verbitterung und Trotz können sehr wohl daraus entstehen.
Bedenken Sie die Folgen, die wiederum das haben kann. – Nicht so
schnell. Nein,[S. 126] meine Liebe zu Elfriede läßt mich eine ganze Menge
geduldig ertragen. Aber – letzten Endes ist man doch nur ein schwacher
Mensch. Und ich bin und bleibe noch dazu ein Komödiant. Einer, der gern
Theater spielt, blendet, täuscht, nicht wahr – so schätzen Sie mich
doch ein?“
Die Kommerzienrätin sah ihn unsicher an.
„Sie sind zu ehrlich, um mir zu widersprechen, Frau Schwiegermama
und ich, nun ja, ich war bis heute zu unehrlich, um gerade heraus zu
sagen, daß ich mich tausendmal wohler in einer kleinen, bescheidenen
Mietswohnung mit einem Mädchen für Alles fühlen würde. Der von Ihnen
errichtete Tempel, in dem nicht mal die Sonne gern weilt, ist mir viel
zu unbehaglich. Der alte Leisetreter von Diener stört mich. Nicht, wie
Sie triumphierend meinen mögen, weil ich seine Späheraugen fürchte,
sondern nur, weil mir dies Gesicht in seiner Maskenhaftigkeit zuwider
ist. Und wenn es nach mir ginge, machte ich Ihnen eine tiefe Verbeugung
und schlüpfte mit meinem lieben Schatz irgendwo – meinetwegen im
hohen Norden Berlins – unter. Aber sehen Sie, das durchzubiegen
bringe ich nicht übers Herz. Nicht Elfchens wegen. Denn schließlich
bin ich ihrer Gegenliebe sicher. Ich habe aber ebenfalls eine Mutter
gehabt, Frau Kommerzienrat, und wenn die auch nur eine schlichte,
bescheidene Frau gewesen ist – sie war ebenso stolz auf mich und hing
mit genau derselben Liebe an mir, wie Sie jetzt an Ihrer Tochter. Und
nur darum, das betone ich ausdrücklich – gebe ich meine Erlaubnis zu
dem vorübergehenden Verweilen meiner Frau unter Ihrem Dach. Erinnern
Sie sich gefälligst. Als wir beide uns neulich zufällig trafen, nahmen
Sie nicht Elfriedes[S. 127] bleiches Aussehen, an dem ich vielleicht schuldig
sein könnte, zum Vorwand für diesen Besuch, sondern Sie versuchten mich
durch ihre eigene Kränklichkeit zu rühren. – Der Komödiant – in mir
sagt leise: „Sieh an, sie kanns fast noch besser wie du.“ Der Mann,
je nun, dem war der krumme Weg just nicht angenehm. – Aber diesen
Mann haben Sie sich ja bisher niemals die Mühe genommen, kennen zu
lernen. Einen Augenblick – ich komme gleich zu Ende. – Elfriede mag
getrost bei Ihnen bleiben, solange sie will. Mich aber müssen Sie jetzt
entschuldigen. Wie Sie mich einschätzen, werde ich unverzüglich meine
vorübergehende Freiheit gehörig ausnutzen wollen. Also – nicht wahr,
Sie haben nichts gegen mein Verschwinden. Im übrigen hoffe ich, daß der
edle Stratege Franz während Elfriedes Abwesenheit brav und zuverlässig
seine Pflicht als Geheimpolizist erfüllt –“
Die Kommerzienrätin rang um ein gutes oder wenigstens versöhnliches
Wort, denn die Schlichtheit des Gesagten hatte mehr Eindruck auf sie
gemacht, als sie sich eingestehen mochte. Ihre starre Natur suchte
vergeblich danach. Und die Hand, die sie ihm entgegenhielt, übersah er.
Nur seine Frau nahm er in die Arme und küßte sie herzhaft auf den Mund.
„Wiedersehen, Kleines! Ich schicke dir am besten sogleich deine
Zofe rüber. Erbarme dich und nimm sie, ja? Was soll ich mit all den
Wachsfiguren.“
Sie schmiegte sich zärtlich an ihn und flüsterte:
„Paulchen – mir ist ganz wirr. – Lange halte ich die Trennung von dir
doch wohl nicht aus.“ Und er gab ebenso zurück:
[S. 128]
„Mein kleiner, tapferer Kamerad, das ist auch gar nicht beabsichtigt.“
Als er wenig später heimging, lachte er leichtsinnig auf. Er hatte
sich wieder mal auf der ganzen Linie nach ungeteiltem Beifall einen
glanzvollen Abgang verschafft. Wann wäre ihm auch jemals ein Kampf,
den er ernsthaft zu gewinnen trachtete, nicht zum Siege ausgeschlagen?
– Mit wachsender Ungeduld sehnte er die Stunde herbei, die ihm
ein ungestörtes Beisammensein mit der zur Zeit von ihm am meisten
bewunderten Frau schenken sollte.
Eva von Ostried lief wie einst als Kind, wenn der große Hofhund ihr
hart auf den Fersen war, und trotz der wärmenden Sonne fror sie. An der
großen Brücke, über welche die Wagen mit dem dumpfen Geräusch einer
riesenhaften Trommel dahinrollten, saß ein Bettler mit einer Drehorgel.
Die Töne ließen sie auflauschen.
Auf ihrem Wege stand eine alte Frau und rief ihre Zeitungen aus.
Mechanisch kaufte sie. Vielleicht fand sich schnell eine Unterkunft.
Irgendwo. Sie schüttelte sich. Aus der Tiefe ihrer Seele stieg ein
Vorwurf empor.
„Ich hätte diesen Karlsen gar nicht anhören dürfen, nach dem, was er
mir angetan hatte.“
Dann lächelte sie. Die Freude, ihm den sicher erwarteten Triumph zu
zerstören, tat ihr wohl.
Auf dem Flur daheim stand die alte Pauline und hielt eifrig Ausschau
nach ihr.
„Wo bleiben Sie bloß, Fräuleinchen? Waren Sie draußen bei unserer Frau
Präsident?“ Die Alte hatte rotgeweinte Augen.
„Bei unserer Frau Präsident? Nein, da war ich nicht.“ Es klang bitter.
„Kommen Sie schnell. Sie müssen ja halb verhungert sein.“
[S. 130]
„Daran muß ich mich jetzt gewöhnen, Pauline.“
„Daß Sie damit spaßen können. Wenn Sie mich so reich bedacht hat, wie
wird sie da erst für Sie gesorgt haben.“
„Glauben Sie das wirklich immer noch? Ich habe kaum zur Hälfte
verdient, was ich von ihr bezog. Müßte eigentlich noch brav
herauszahlen.“
Das treue Mädchen begriff nichts. Sie merkte nur, daß die junge Gestalt
vor Erschöpfung schwankte und führte sie sanft in das helle Stübchen,
das unordentlich und zerwühlt aussah.
„Jetzt legen Sie sich still nieder. Ich hole Ihnen einen Teller voll
kräftiger Suppe. Und nachher bereden wir alles. Ich habe mir was Feines
ausgedacht. Sie werden nun doch wohl ganz und gar Musikant werden
wollen. Denn unsere Frau Präsident hat immer gesagt, daß es jetzt bald
damit losginge. – Ich könnte mich ja aufs Altenteil setzen. Aber das
verstehe ich nicht recht. Ich zieh’ lieber zu Ihnen, Fräuleinchen. Das
Haus hier, hat Herr Justizrat gesagt, wird verkauft. Solange dürfen wir
beide noch darin bleiben.“
„Ich nicht,“ sagte Eva mit zuckenden Lippen, „ich habe hier nichts mehr
zu suchen.“
„Sie sind doch wie ihr eigenes Kind gewesen. Ich weiß gar nicht,
was Sie wollen. – Darum kann ich Sie auch nicht allein lassen. Sie
sind mir eine Art Vermächtnis. Ich putze Ihnen die kleine Wohnung
und koche und mache alles, wie Sie es nun längst gewöhnt sind. Genug
Möbel – darunter den schönen feinen Flügel für Sie habe ich mir schon
ausgesucht. Sie sollens genau wie bis jetzt kriegen.[S. 131] Dann ist es, als
wäre sie noch bei uns. Und ich schlafe weiter in meinem Eisernen.“
„Gute Pauline – ich werde kaum eine eigene Wohnung brauchen. Ich nehme
ebenfalls in Zukunft willig mit einem eisernen Bette fürlieb.“
„Ich bin ein einfältiger, alter Mensch und will nicht aufdringlich
sein. Aber wenn Sie mir das erklären möchten, Fräuleinchen.“
„Erklären? Was denn? Es ist ja alles in bester Ordnung! Sie ist tot und
ich muß sehen, wie ich möglichst schnell zu einer neuen Stelle komme.
Sie meinen, daß ich plötzlich reich geworden wäre durch sie? Wie käme
ich wohl dazu? Das wäre ja mehr als seltsam.“
Sie schluchzte auf und war doch der Ueberzeugung, daß sie lache.
„Versteh’ ich endlich recht? Sie wären nicht von unserer guten Frau
Präsident bedacht, Fräuleinchen?“
„Dazu war sie nicht verpflichtet, Pauline. Ich habe mehr von ihr
erhalten, als ich jemals verdient habe.“
„Fräuleinchen, sie hätte nicht sterben können, wenn Sie unversorgt
zurückgeblieben wären. Mag einer reden, was er will. Sagen, daß der
Tod sie überrumpelt hätte. Ich weiß es besser. Da muß sich noch was
vorfinden, sage ich.“
„Es ist nichts da, Pauline. Verlassen Sie sich drauf.“
„Lieber guter Gott! Nun sollen Sie hier raus? Ganz nackt und blos? und
ich und die andern haben so viel!“
„Das ist nur gerecht. Sie haben sich’s verdient! –“
„Das ist Unsinn! Wir beide ziehen zusammen, wie ich schon gesagt habe.
Denken Sie doch, ich soll einhundertfünfzig Mark im Monat verleben.
Wie mache ich das? Ich[S. 132] spars doch bloß wieder zusammen und das hätte
keinen Sinn und Verstand. Denn ich habe keinen auf der Welt und es
würde wieder eine neue Stiftung draus. Nein, ich sorge für Sie. Und
nachher, wenn Sie erst richtig ausgelernt haben und es drückt sie,
geben Sie mir alles wieder. Ja? Wollen wir es so machen?“
Wer hohnlachte da? Eva von Ostried fuhr erschrocken empor. Sie hatte
deutlich ein heiseres Lachen gehört.
„Ach – Pauline, ich habe nur gescherzt. Ich bin ja selbst reich. Mein
früherer Vormund hat am Tage meiner Volljährigkeit der Frau Präsident
in meiner Abwesenheit das Muttererbe gebracht. Gleich nachher will
ich’s auf die Bank tragen. Denn es ist immer noch hier im Haus.“
Das alte Mädchen schüttelte ungläubig den Kopf.
„Das ist wahrhaftig ein verkehrter Stolz, Fräuleinchen. Damit tun Sie
mir sehr weh. Sie haben nichts! Sie konnten ja früher mit mir drüber
spaßen. Ehe ich’s also nicht mit meinen eigenen Augen gesehen habe,
glaube ich Ihnen das nicht!“
Eva von Ostried stand plötzlich vor der alten Pauline. Sie war
verändert. Ihr noch soeben farbloses Gesicht glühte, als habe sie
Fieber. Krampfhaft suchte sie nach ihrer kleinen, schwarzen Handtasche.
„Um Gottes willen, wo ist sie geblieben? Ich habe sie doch noch soeben
gehabt?“
„Da liegt sie ja, Fräuleinchen. Ganz sicher!“
Die schlanken Hände rissen den festen Bügel ungestüm auf, tasteten
unter den Papieren herum und brachten einen dicken Umschlag ans Licht.
[S. 133]
„Schauen Sie nur – wie viel Geld.“ Das alte Mädchen staunte.
„Wirklich!“ machte sie unsicher.
„Und nun seien Sie mir nicht böse, wenn ich nichts essen mag, Pauline.
Nur schlafen muß ich. Nachher will ich gleich wieder fort. – Meine
Sachen sollen doch bald abgeholt werden. Und fertig packen muß ich auch
noch.“ –
Dann war sie allein! – Und das Geld, das der alte Tabaksbauer kurz
vor der Abreise der Präsidentin zurückgezahlt hatte, war immer noch in
ihrem Besitz. Die Wucht der schweren Ereignisse, die seither über sie
hereingebrochen, löschten die Erinnerung daran bis zu dieser Stunde
aus. Jetzt aber wollte sie sogleich den Justizrat Weißgerber anklingeln
und ihm davon Mitteilung machen. –
Sein Büro war bereits geschlossen. Er selbst befand sich zur Zeit, wie
ihr am Apparat mitgeteilt wurde, auf einer kleinen beruflichen Reise,
von welcher er erst spät Abends zurückerwartet wurde. Nun mußte sie es
bis zum nächsten Tage aufschieben.
Mit keinem Gedanken hatte sie in der Zeit der jagenden Aufregungen
des ihr anvertrauten Schatzes gedacht. Die Vorstellung, daß er in
dem Wirrwarr sehr leicht abhanden hätte kommen können, erfüllte sie
nachträglich mit eisigem Schrecken. Vielleicht hatte die Vorsehung
es beabsichtigt. Es war jedenfalls gut gewesen, daß sie das Geld der
alten Pauline vorzeigen konnte. Nun brauchte sie kein Bettelbrot zu
essen. Denn sie hatte dumpf gefühlt, daß sie sonst dem heftigen Drängen
nachgegeben haben würde.
Das Gefühl der Mattigkeit war geschwunden. Sie suchte wieder ihre
Habseligkeiten zusammen. Ihre Hände zitter[S. 134]ten nicht mehr. Sie war
ganz ruhig geworden. Einmal ging sie zum Nachttisch, auf dem die
frischgefüllte Wasserflasche stand. Wie durstig sie war und wie gut der
billige Trunk mundete.
Dann schaffte sie weiter. Die Sonne warf eine Hand voll Strahlen durch
das Fenster auf die kleine Handtasche und hob sie empor wie auf einem
goldenen Brett. Eva von Ostried nickte herüber, als grüße sie etwas.
Das viele – viele Geld! Wenn es ihr Eigen wäre, käme alle Not zu Ende.
Was könnte es alles schenken?
Ein Bett, in dem sie ausruhen konnte, solange es ihr gefiel. Einen
Tisch mit einer Lampe darauf, die leuchten durfte – auch zu dem Flügel
hin, den sie sich davon erstehen würde. Der Flügel, an dem sie sitzen
und sich ihres Lebens Glück ersingen konnte.
Sie schauerte zusammen. Wie war es möglich, daß sie überhaupt dieser
Vorstellung Raum gab. Fremdes Geld? Anvertrautes Gut! Was ging es sie
an? Mochten sich die verschiedenen überreich bedachten Stiftungen darin
teilen. Mechanisch häufte sie, was ihr gehörte, weiter zusammen. Wohin
nun aber mit all diesem Tand?
Ihr Blick fiel auf die an der Brücke gekauften Tageszeitungen. Sie
vertiefte sich in die Menge feingedruckter Anzeigen. An der einen
blieben ihre Blicke haften und kehrten dorthin zurück:
Suche sofort aus bester Familie für meine Tochter gebildete
Gesellschafterin. Ernste Lebensauffassung, fester Charakter neben
guten Zeugnissen Bedingung. Vorstellung jederzeit. Auch abends bis
10 Uhr bei Frau Eßling, Eisenacherstr. 10, Grunewald-Berlin.
[S. 135]
Also ganz nahe. Mit einer spitzen Schere schnitt sie sorgfältig die
Reihen aus. Sobald sie hier fertig war, wollte sie sich vorstellen.
Sie legte das schmucklos schwarze Kleid an, in dem sie ihren Vater
betrauert hatte. Den wertvollen Spitzenkragen, ein Geschenk der
Präsidentin, zerrte sie so heftig herunter, das die spinnwebenfeinen
Sternchen zerrissen. Zu diesem Gange durfte sie sich nicht schmücken.
Als Gesellschafterin einer sicherlich jungen Tochter mußte sie häßlich,
unscheinbar und wesenlos sein. Der Spiegel gab ihr Bild in seiner
vollen Schönheit wieder. Die Kämpfe, die rückwärts lagen, quälten
sie von neuem. Die unverdiente Eifersucht ihrer früheren Herrinnen
– der Neid der Dienstboten wegen ihrer Sonderstellung im Hause, der
eigene, lodernde Zorn, stumm die tiefe Einschätzung zu ertragen und
nicht zuletzt die Angst, daß sie eines Tages aus Groll, Einsamkeit und
Lebensdurst – verdient wäre.
Und nie – nie mehr die geliebte Kunst? Daran hatte sie überhaupt nicht
denken wollen. Das zerbrach ihre Kraft. Nun lag sie wieder matt und
frierend da und konnte nichts denken. Dumpf fühlte sie, daß dies mehr
als ein Grauen vor dem nahen Wege nach dem Golgatha zur Pflicht war.
Ein Lebensabschied; der Tod aller Wünsche und Freuden!
Diese zu erwartende Not jagte ihr eine fiebernde Gier durch das Blut.
Ein paar tausend Mark nur. Denn jene kleine eroberte Summe würde kaum
für die notdürftigsten Anschaffungen genügen. Freilich verwahrte
Amtsrat Wullenweber noch einige Möbelstücke aus mütterlichem[S. 136] Besitz
für sie. Wo aber war der Raum, der sie bergen konnte? Das Leben war
unerhört teuer. Wiederum nach wenigen Schritten stehen zu bleiben und
rückwärts zu müssen. Nur das nicht abermals!
Jenes vorübergehend von ihr vergessene Geld, dessen Vorhandensein
niemand ahnte – denn die Präsidentin hatte ihr das Nähere erzählt –
wäre übergenug, um sie glücklich zu machen.
Aber ein Gefühl des Ekels über sich selbst stieg ihr in die Kehle. Wie
tief sie gesunken war, daß solche Gedanken kommen konnten. Sie schloß
die Tasche in den Schreibtisch ein und suchte eine andere hervor. Dabei
sah sie einen Zettel, den die Präsidentin an eine der zahlreichen
Geburtstagsgaben geheftet hatte.
„Meinem Sorgen- und Glückskinde!“
Sie sah auch das gütige, feine Gesicht deutlich vor sich und hörte
die Worte, mit denen sie in Oeynhausen ihre Zukunft erleuchtet und
festgelegt hatte. Kam nicht das Versprechen solcher Frau bereits der
vollzogenen Handlung gleich. Hatte sich die unabänderliche Tat der
Schenkung nicht schon damals vollzogen? – Wen träfe das Verschwinden
dieses Geldes? – Es wäre ja gar kein Raub.
Aber was wäre es denn? – Aber eine Mahnung ward ihr im Innern: Eine
zerlumpte Zigeunerin hatte einst auf dem väterlichen Majorat der
Mamsell aus deren Schlafkammer den unechten Sonntagsring entwendet. Die
Knechte liefen ihr mit Wagenrungen und Heugabeln nach, weil es gleich
zu Tage kam, griffen sie und spien nach ihr, denn zum Schlagen war sie
ihnen zu schlecht gewesen.
[S. 137]
Die kleine Eva hatte das alles mitangesehen und ebenfalls versucht
das flinke, rote Zünglein zu recken, um nicht hinter den Erwachsenen
zurückzustehen.
Jener Ring! Ach – das war etwas ganz anderes. Er hatte eine Besitzerin
gehabt, die ein armes Mädchen gewesen und sich nur mühsam so etwas
leisten konnte.
Dies Geld aber – –
Sie lag plötzlich auf den Knien und rang die Hände. Ihr Hirn war leer.
Im Herzen – am Halse – in den Fingerspitzen jagte eine entsetzliche
Angst. Ein Name klang gellend – in Todesfurcht herausgeschrien –
durch das Zimmer.
„Mutter – Mutter – hilf mir doch!“
Auf dem stillen, süßen, scheuen Frauenantlitz, das aus vergoldetem
Rahmen auf die verlassene Tochter herabsah, lag der Schatten des
scheidenden Tages und ließ es noch leidvoller erscheinen!
Kein Rettungsanker hielt stand. Nirgends war eine Stätte der Zuflucht
für sie bereitet.
Die roten Türme des Waldesruher Heimatschlosses würden zwar noch
erhaben über alles andere hinwegsehen und die Gräber der Eltern
gehörten ihr nach wie vor. Ein verwitweter Vetter gleichen Namens saß
jetzt als Erbberechtigter auf dem alten Majorat und mochte den Zufall
segnen, der dem tollen Ostried einen Sohn versagte. Vielleicht bei ihm
untertauchen – wenn auch nur für kurze Zeit? – Aufnahme würde sie
finden. In der Familienchronik war der jeweilige Besitzer ausdrücklich
angewiesen, jeden bedürftigen und würdigen weiblichen Nachkommen[S. 138] eines
Vorgängers für mindestens sechs Monate unentgeltlich im Schlosse zu
beherbergen.
Der bloße Gedanke daran peinigte sie aber schon!
Stellte sie nicht in Wahrheit die Bettelprinzeß dar, wie ihr das einst
ein Trunkener höhnend nachgerufen hatte? Keine andere Macht, meinte
sie, käme der des Geldes gleich. Das Blut des Vaters kreiste in diesen
Augenblicken wild durch ihre Adern, sie wollte gefeiert und verwöhnt
werden. Es war undenkbar, daß sie untertauchte, um im Dunkel ewiger
Entbehrungen zu verkommen.
Ein harter Trotz kam über sie. Sie war sich der Macht, die sie auf Paul
Karlsen ausübte, voll bewußt. Und er war doch reich geworden, wie aus
jedem seiner Worte hervorging.
Sie riß das schlichte Kleid herunter und suchte eins aus weicher,
fließender Seide hervor. Wie eine Braut geschmückt wollte sie zu ihm
gehen und wie eine Königin Gnaden spenden.
Und dann lag sie doch wieder mit dem Gesicht auf der blanken Platte des
Mahagonitisches und grub in Scham und Not die Zähne tief in das Gewebe
der seidenen Zierdecke.
„Nie – nie – nie kann ich das tun!“
Wenn er sie aber zu seinem Weibe begehrte? Und was konnte er anders
mit dem heimlichen Werben in jedem Blicke gemeint haben? Paul Karlsens
Frau, die Genossin des Künstlers, die treue Kameradin eines gleich ihr
Emporstrebenden?
Warum schüttelte sie sich plötzlich? Das Blut der Mutter kam nun auch
zu seinem Recht. – Ohne Liebe sich ver[S. 139]kaufen – das war noch härter
wie die Fron des Alltags.
Auch nicht um der Kunst willen? Sie fühlte, daß es ihr ans Leben gehen
wollte.
Wenn sie vor jedem entscheidenden Schritt erst zu Ralf Kurtzig, dem
alten Meister, gehen würde? Vielleicht wußte er ihr einen Gönner, der
aus Freude an ihrem Talent freigebig war. Vielleicht riet er ihr aber
auch, daß sie lieber hungern und verzichten solle, als ihre Kunst
aufzugeben. Ja – es war sogar sicher, daß er diesen Rat erteilte. –
Befolgen hätte sie ihn nicht können. Nach dem Tode ihres ersten Gönners
hatte sie damit einen kurzen Versuch gemacht. –
Die alte Pauline klopfte leise und trug ein vollbesetztes Tablett
herein. „Jetzt müssen Sie etwas genießen, Fräuleinchen.“
Eva von Ostried wollte fest bleiben. Es gehörte ja alles der Frau, die
wohl doch im letzten Augenblick ihr feierliches Versprechen bereut
hatte. Aber das Hungergefühl schmerzte beim Anblick der guten Sachen.
Sie überlegte nicht länger.
Erst, als sie völlig gesättigt war, verachtete sie sich deswegen. Jäh
packte sie die Angst, daß sie sich letzten Endes auch zu dem andern
zwingen lassen könnte.
Stumpf legte sie das kostbare Kleid wieder ab und schlüpfte in das
schmucklose Trauerfähnchen. Dann ging sie langsam den Weg, der zur
Eisenacherstraße führte.
Irgendwo auf dem Wege dorthin zu ihrer Linken lag ein weinumwachsenes
Haus. Der goldgelbe Kies war stumpf und bleich geworden, weil ihn die
Sonne nicht mehr beschien. Es war eben acht Uhr. Sie wußte die Zeit
nicht.[S. 140] Mit schleppenden Schritten ging sie an dem Hause im Schatten
vorüber. Ein paar volle Akkorde schlugen von dem tönenden Reichtum
drinnen, an ihr Ohr. Sie wollte nichts hören. Eine Stimme erhob sich:
Geschmolzen ist der Winter Schnee
Ganz stumm und still verfalln dem Grabe..
Ein Krampf schüttelte sie. Nur nicht stehen bleiben. Weiter. –
Aber sie ging doch nicht. An das kunstvoll gehämmerte Gitter gelehnt,
lauschte sie gierig.
Herr Tristan hob vom heißen Pfühle
Sein mattes Haupt und sprach – – –
Nicht länger trage ich die Scham,
So bloß zu stehn mit meinem Gram....
Der Gesang schwieg. Ein Fenster schlug auf. Sie stand wie verzaubert.
Ueber den blassen Kies knirschten die Schritte eines Mannes.
„Kleine Mignon!“
Sie fühlte sich an die Hand genommen und in das Haus gezogen.
„Ich will nicht! Ich will nicht!“ stammelte sie. Leise lachte er auf.
„Sie hat’s nicht erwarten können,“ dachte er und fand sie schöner und
begehrenswerter als je in dem klösterlich strengen Gewande.
– Paul Karlsens schneller Entschluß, sie in das Musikzimmer und nicht,
wie er das ursprünglich beabsichtigt, in sein Herrenzimmer zu führen,
erwies sich als sehr klug. Die Bildnisse der Meister edler Tonkunst,
die von den Wän[S. 141]den herab grüßten, wirkten beruhigend und anheimelnd
auf Eva von Ostrieds Fassungslosigkeit. Sie empfand plötzlich ihre
Anwesenheit hier nicht mit quälendem Vorwurf. Es blieb ungewöhnlich.
Jedoch auch nichts weiter.
Paul Karlsen neigte sich mit ritterlicher Besorgnis zu ihr herab. „Ist
es Ihnen auch zu feierlich bei mir, Fräulein von Ostried?“ Sie hob den
Blick frei zu dem seinen.
„Hier weht Heimatsluft, Herr Karlsen. Uebrigens – war ich nicht auf
dem Wege zu Ihnen.“
„Ah,“ machte er.
Sie errötete, weil sie fühlte, daß er ihr nicht glaubte. Sollte sie
ihm von ihrem eigentlichen Vorhaben, dessen Ausführung sein Gesang nur
verzögert haben würde, erzählen? Sie brachte es nicht über die Lippen.
Einen Augenblick saßen sie sich schweigend gegenüber. Dann sagte sie,
in ehrlicher Bewunderung umherschauend:
„Wie wunderschön Sie es haben, Herr Karlsen! Die Goldader, von der Sie
sagten, muß wirklich ergiebig sein.“ Er nickte zufrieden.
„Unerschöpflich fließt sie sogar. Wir haben einen Diener, eine Köchin
und noch mehrere beigeordnete Untertanen im Hades der Küche, die ich
freilich noch nicht zu Gesicht bekommen habe.“
Er zählte es mit der Wichtigkeit und dem Stolz eines fröhlichen Jungen
her, der sich sehr wohl in den neuen, glanzvollen Verhältnissen fühlt.
Eva von Ostried war nicht neugierig. Sie hätte aber dennoch gar zu
gern gewußt, wie ein Schicksalsgenosse, von dessen Schulden man sich
in Oeynhausen Wunderdinge erzählte, plötzlich zu diesen Märchendingen
gekommen war.
[S. 142]
Er hatte das vorausgesehen und sich bereits auf dem Heimgang von seiner
Schwiegermutter eine durchaus glaubhafte Erklärung zurechtgelegt.
„Es war ein Onkel von Thule,“ summte er Desdemonas zitterndes Lied
vom König. „Und dieser alte Herr mit Druckknöpfen von Eisen und Feuer
an der gewichtigen Geldkatze besaß einen Neffen. Einen Nichtnutz
natürlich, der totsicher vor die Hunde gehen würde. Dieser Schlingel
bildete sich felsenfest ein, eine Stimme zu haben, die anders wäre,
wie die des Onkels von Thule. Frechheit, nicht wahr? – Er glaubte
weiter, daß die Dummen in absehbarer Zeit mal ihr Geld ausgeben würden,
um sie hören zu dürfen. Man bedenke – der Onkel aus Thule war in
seinem Leben niemals in eine Oper gegangen. Und besagter Neffe hätte
in seinem Tabak- und Kaffeeexportgeschäft wundervoll unterkommen
können. – In Hamburg. Er bot es ihm sogar schriftlich an. Der Bengel
antwortete überhaupt nicht darauf, trotzdem eine Freimarke beilag. Er
pumpte ihn aber auch nicht an. Lieber ganz Fremde, die sich wirklich
überraschend leicht finden ließen. – Und der Onkel von Thule kam –
zwar nicht zum Sterben, wohl aber nach Oeynhausen, denn er war immer
ein kleiner Schlemmer gewesen und nun lag sein Herz im Fett. Und er
gab auch nicht seiner geehrten Buhle den bekannten güldenen Becher,
sondern seinem Nichtsnutz von Neffen einen Wink, damit er sich mal zu
ihm ins Hotel begeben möchte. – Daß er ihn zuvor ein paar mal aus
sträflicher Langeweile, von einem leidenden, zufällig hochmusikalischen
Geschäftsfreund verführt, in allen damals gegebenen Opern gehört hatte,
nur nebenbei. Jeder, der einen stumpfsinnigen Badeaufenthalt[S. 143] von
mehreren Wochen durchgemacht hat, wird ihm diese Entgleisung vergeben.
– Also – der Bengel erschien und nun machte sich das weitere
ganz von selbst. – Wir sind nach Berlin übergesiedelt, denn die
Exportgeschichte in Hamburg hatte genug für uns abgeworfen und – na ja
– da wären wir nun.“
Keinen Augenblick zweifelte sie an der Richtigkeit seiner Erzählung.
„Wie schön ist es, daß sich Ihr Talent voll entfalten kann,“ sagte sie
und kämpfte gegen allen Neid.
„Das hätte es auch ohne den Onkel fertig gebracht. Wie können Sie
das von einem – nun nennen wir es getrost Zufall, abhängig machen!
Schwerer wäre es freilich gewesen und länger würde es mit dem Aufstieg
vielleicht gedauert haben. Auf die Spitze wäre ich doch gekommen.“
„Das ist Manneskraft.“ Es klang wie eine Klage.
„Nein, das ist die gesunde Erkenntnis des eigenen Könnens,“ widersprach
er, „die sollte Jedes haben, das sich seine Begabung nicht lediglich
einbildet. Sie also auch, Fräulein von Ostried.“
„Ich habe es mir anders überlegt. Ich will nicht weiter.“
„Was wollen Sie nicht, bitte? – Nicht mehr singen? Einfach
abschwenken? Gehen Sie doch! Jetzt wären wir endlich bei unserm
eigentlichen Thema angelangt. – Nachdem Sie sich umgesehen und meine
Geschichte vernommen haben, werden Sie auch glauben, daß mir die Gelder
nicht mehr knapp sind.“
„Was geht das mich an?“ fragte sie brüsk und machte Miene, sich zu
erheben. „Ich will jetzt gehen. Ihr Herr Onkel wird Sie nicht länger
entbehren mögen.“
[S. 144]
„Mein Herr Onkel ist bei seinen Whistbrüdern,“ lachte er leise. „Von
denen macht er sich bestimmt nicht vor Mitternacht los. Denn – eine
Frau haben wir nicht mehr. Die ist lange, lange tot. – Nur der alte
Franz paßt derweilen auf, damit ich keine Dummheiten mache. Denn der
Onkel von Thule macht sie lieber noch selber. Wundern Sie sich also
nachher etwa in ein paar Stunden nicht, wenn er plötzlich stocksteif –
stockdämlich irgendwo herumsteht. Sonst habe ich es aber wirklich in
jeder Beziehung ausgezeichnet. Kann sozusagen tun und lassen, was ich
will. Die Geldkatze steht unverschlossen zu meiner Verfügung. Dazu ist
mein fester Monatswechsel blendend.“
„Wozu sagt er mir das alles?“ dachte Eva von Ostried und ihr Herzschlag
drohte in einer erstickenden Angst auszusetzen. „Er will doch nicht
etwa selbst –?“ Das Gefühl des Widerwillens, stärker noch als
dasjenige der Empörung und des Zornes über die unerhörte Kühnheit, mit
der er sie damals beleidigt hatte, regte sich wieder.
Sie begriff nicht mehr, daß sie ihm willenlos hierher folgen konnte,
nach diesem Erlebnis. Ihr Gesicht war sehr bleich geworden. Ihre Augen
irrten mit einem flackernden Blick umher, als sie sich jetzt erhob.
„Wie mich das für Sie freut! Lassen Sie sich’s weiter wohl sein, Herr
Karlsen.“ Jedes Wort mußte sie erkämpfen. „Und schnellen, sicheren
Aufstieg.“ Es klang tonlos. Er war gleichfalls aufgestanden und sah auf
sie herab – immer noch, als sie längst zu Ende gesprochen hatte. Das
brachte ihr eine größere Unsicherheit. Sollte sie ihm jetzt die Hand
reichen oder – grußlos entfliehen.
[S. 145]
„Nur noch einen Augenblick,“ forderte er und seine Brauen schoben
sich eng zusammen. „Zwar weiß ich wirklich nicht, womit ich diesmal
Ihre Unzufriedenheit erregt haben könnte – irgendwie werde ich mich
ja aber doch wohl vergangen haben. Denn für solche Wirkungen besitze
ich auch ein musikalisches Feingefühl. Sicherlich habe ich zu viel um
den Brennpunkt herumgeredet. Verzeihen Sie mir. – Als ich Ihnen von
dem mir gutbekannten Gönner sprach, der Ihnen auf mein Wort helfen
würde – stand mein Plan bereits fest. Und das ist er geblieben. –
Entschuldigen Sie mich für einen Augenblick. Ich hole nur eine wichtige
Kleinigkeit nebenan aus meinem Studierzimmer.“
Ehe sie eine Entgegnung fand, war er bereits verschwunden. Durch
die zurückgeschobenen Vorhänge konnte sie den Raum übersehen. Ihre
Blicke lösten sich von seinen Händen, die hastig in den aufgezogenen
Schiebladen des Schreibtisches herumkramten und wanderten –
gedankenlos – umher. Es trieb sie zur Flucht und sie blieb dennoch.
Sie nahm nichts von alledem, was sie anstarrte, in sich auf. Die
Bilder verschwammen zu farblosen Massen. Die wuchtigen Vasen auf hohen
Sockeln, die sicher ein kleines Vermögen kosteten, wuchsen wie Steine
auf, die in unsichtbarer Faust nach ihrem Herzen zielten. Mit fast
übermenschlicher Gewalt zwang sie sich dazu, etwas zu denken – zu
sehen – zu empfinden.
Da lag, gerade über seinem Kopf, ein großer grüner Fleck mit
leuchtenden Blutstropfen. –
Nein, ein Bild war’s; als sie schärfer, sich dazu zwingend, hinsah,
erkannte sie die überschlanke Gestalt eines weiblichen[S. 146] Wesens darin,
die unter rotem Mohn auf grüner Wiese stand. Auf dem Gesicht lag der
volle Schein einer glutrot gemalten Sonne und hob es scharf heraus. In
seiner rührenden Anspruchslosigkeit wirkte es fast mit diesem Leuchten,
das von innen heraus zu strahlen schien, lieblich. Obwohl Nase und Mund
viel zu groß darin standen. Sie prägte es sich ein, um nur nicht denken
zu müssen, daß sie mit jeder Minute ihres längeren Verweilens von ihrem
Mädchenstolz verschwende.
Endlich kam er zurück. – Hochrot! Zornig!
„Niemals kann ich das finden, was ich gerade suche. Das ist gräßlich!
Jetzt endlich ist es gelungen. Sehen Sie, bitte! Nun – was ist das?“
„Ein Scheckbuch,“ sagte sie tonlos, „aber ich begreife nicht.“
„Ganz recht. Sie haben also viel mehr Geschäftssinn wie ich – etwa
vor sechs Monaten. Genauere Anweisungen brauche ich Ihnen also wohl
nicht mehr zu erteilen. – Sie nehmen dies an sich und füllen einfach
mit einer bestimmten, von Ihnen beliebig festzusetzenden Summe jeden
Monat die Geschichte aus. Das weitere macht dann schon die Bank!“ Sie
streckte beide Hände von sich, als wehre sie eine furchtbare Versuchung
ab.
„Um Gottes willen, nur das nicht!“
„So verhaßt bin ich Ihnen, Eva? Was Sie ohne Bedenken von dem alten
Blutsauger, der Sie zur Bretteldiva machen wollte, angenommen hätten,
ohne diese Bedingung, das wollen Sie mir nicht gestatten?“
„Ich weiß nicht, ob ich es Ihnen jemals zurückerstatten kann.“
[S. 147]
„Darüber sorgen Sie sich nicht. Zinsen allerdings – verlange ich.“
Daß er sachlich zu sprechen begann, machte sie ruhiger.
„Wovon sollte ich die zahlen.“ Er sah sie fest an.
„Wovon? Fühlen Sie das nicht, Eva?“
Ihre Hände hingen matt hernieder. Er betrachtete sie lange. Aber er
nahm sie nicht in die seinen. Nur nichts übereilen. Langsam begann er
ihr in Worten ein lebendiges Bild zu malen.
„Sie beziehen, am liebsten in meiner Gegend, eine kleine feine Wohnung.
Nur kein Kellerloch oder Dachstübchen. Das drückt von vornherein das
Können nieder. Auch die öffentliche Meinung. Dann schaffen Sie sich
jemand, der Ihnen den Kleinkram des täglichen Lebens fernhält und
nebenbei diskret ist. Dann erst sehen Sie sich nach geeigneten Lehrern
um. Natürlich müssen sie erstklassig sein. Auf die Honorare darf es
nicht ankommen. Und dann – ergibt sich das Schönste wie von selbst.
Das Lernen. Das Vertiefen. Die Seligkeit, daß es bestimmt geschafft
wird. Die Vorausempfindung all des brennenden Neides der liebwerten
Kollegenschaft – aber auch der Macht, die täglich wachsen und genau
wie die meine, zur Andacht niederreißen wird – mag die Menge willig
sein oder nicht.“
Mit weitvorgestrecktem Haupt hatte sie ihm gelauscht. Das war ein
Klang aus jener Welt, in der allein sie glücklich zu werden wähnte.
Ein echter Klang. Das fühlte sie. In diesem Augenblick empfand sie
auch keinen Widerwillen gegen Paul Karlsen. Seine Güte zurückzuweisen,
erschien ihr unnatürlich. Ja – unmöglich, je länger sie über seinen
Vorschlag nachdachte.
[S. 148]
„Die Zinsen – wie hoch?“ fragte sie nur noch.
Da lag er ihr zu Füßen und zwang sie in einen tiefen, niederen Sessel
hinein.
„Deine Liebe und sonst nichts! Fühlst du immer noch nicht, wie ich mich
nach dir verzehre. Siehst du nicht, daß ich dir alles zu Füßen legen
möchte und nur verlange, daß du dich von mir anbeten und lieben läßt?“
Sie stieß ihn nicht zurück, trotzdem sie unter seiner Berührung
zusammenschauerte. Nur ein Gedanke hämmerte in ihrer Stirn:
„Bin ich jetzt seine Braut? – Und muß ich nun auch sein Weib werden?“
Ein Finger pochte leise an die hohe Tür. Paul Karlsen fuhr auf und
setzte sich ihr gegenüber.
„Haben Herr Karlsen gerufen?“ Der alte Diener streckte sein
unbewegliches Gesicht bescheiden in das Zimmer hinein.
– Der Zauber dieses Augenblickes war ihm unwiderbringlich verloren.
Ihre Not für ein Weilchen überwunden.
Sie schickte sich an zu gehen, und er hielt sie nicht zurück.
„Ich werde Nachricht geben. Vielleicht morgen schon,“ flüsterte sie und
glaubte zu wissen, daß sie sich ihm aus Liebe zur Kunst verkaufen könne.
Kaum tausend Schritt von Karlsens Villa entfernt stand abseits von der
Verkehrsstraße eine Bank. Auf diese strebte Eva von Ostried zu. Im
Augenblicke war es ihr unmöglich, ihren Weg fortzusetzen. Alles Denken,
bis zur äußersten Grenze erschöpft, setzte aus und sie gab sich willig
dieser Müdigkeit hin.
Sie fühlte, daß sie sich dem Manne, der ihr seine Liebe geboten,
anverlobt habe. Daß sie überhaupt nach seinem Kuß zu ihm ging, ließ nur
diese Deutung zu. Er mußte annehmen, daß sie sein Gefühl erwiderte!
Und es war doch eine Lüge! Sie fühlte nichts für ihn.
Die Blicke, die er auf ihr hatte ruhen lassen, peinigten sie noch
nachträglich! Das Erinnern an seine heißen, zuckenden Hände, die sie
umklammert hatten, als er vor ihr kniete, brachte ihr erneut die starke
Empfindung des Widerwillens gegen seine Zärtlichkeiten.
Das Verhältnis zwischen ihren Eltern fiel ihr ein. Der Vater hatte
zuweilen, nach einer besonders guten Flasche Wein von der hingebenden
Zärtlichkeit ihrer Mutter in der Verlobungszeit gesprochen. Und
doch war später aus der Ehe das geworden, was Evas erste Jugend
unaussprechlich ängstigte und sie noch jetzt mit Grauen erfüllte! An
dem[S. 150] unverbesserlichen Leichtsinn des schönen Ostried zerbrach die
Kraft und das Leben ihrer Mutter, nachdem wohl schon längst ihre Liebe
dem starren Pflichtbewußtsein weichen mußte.
Und sie selbst wollte sich jetzt ohne einen Funken schlummernder
Zärtlichkeit binden?
Um den roten Mund grub sich eine Falte, die ihr Gesicht hart machte.
Der Preis, den sie sich dadurch erringen würde, war hoch genug, um
einem törichten, streng verschwiegenen Mädchentraume dies Opfer zu
bringen.
Sie war bereit! Aber nicht mehr völlig bedingungslos. Das Gesuch der
Frau Eßling wegen der Gesellschafterin für die Tochter fiel ihr ein.
Sie wollte versuchen, dort ein paar Wochen unterzuschlüpfen, um sich
eine Bedenkzeit zu sichern.
Frau Kommerzienrat Eßling befand sich in einer selten weichen
Stimmung, als ihr gemeldet wurde, daß eine Bewerberin draußen warte.
Der Sieg über den Willen des Schwiegersohns hatte sie vorübergehend
versöhnlicher gestimmt. Ihr Gerechtigkeitsgefühl konnte sich zudem
gegen die Wahrheit seiner Bitterkeiten nicht verschließen. In der
Hauptsache füllte sie die Freude, die Tochter wieder – wenn auch nur
für kurze Zeit – bei sich zu haben, gänzlich aus. Daneben verschwand
jede Trauer und Auflehnung.
Elfriede Karlsen lag, wie einst während langer Jahre, auf dem Ruhebette
und ließ sich mit dem Lächeln eines dankbaren Kindes von ihrer Mutter
verwöhnen. Noch ahnte sie die neueste Fürsorge der Kommerzienrätin
nicht. Mit wenigen hastigen Worten wurde sie ihr jetzt als eine
Notwendigkeit hingestellt.
[S. 151]
„Aber, Mama,“ sagte sie flehend, „das ist grausam von dir –“
„Du solltest froh sein, daß ich auf diesen erlösenden Gedanken gekommen
bin, Elfriedchen. Die vielen einsamen Stunden taugen nicht für dich. Du
grübelst zu viel.“
„Ich warte auf meinen Mann und das ist wunderschön,“ sagte sie. Es lag
alle Treue und Zärtlichkeit darin.
„Diese Stunde ist nicht geeignet, um darüber zu streiten, Kind. Schnell
nur eins: Ihr betont beide bei jeder Gelegenheit, daß ein Künstler frei
sein muß und du willst ihn doch nicht von der Kette lassen?“
Das blasse Gesicht rötete sich trotz der weißen Puderschicht, die Frau
Eßling ihrer Tochter niemals zugetraut.
„Soll das heißen, daß ich ihn ungebührlich in Anspruch nehme, ihn
in seiner Entwicklung hemme? – Das aber kann unmöglich deine wahre
Ansicht sein, Mama. Noch vor wenigen Tagen hast du mir den ernsthaften
Vorwurf einer viel zu großen Anspruchslosigkeit gegen Paul gemacht!“
„Darin liegt kein Widerspruch, mein Kind! Natürlich und verständlich,
wenn eine junge, verliebte Frau die Minuten zählt, bis ihr der Gatte
endlich wiedergeschenkt ist. Aber auch ebenso begreiflich, wenn bei
einer Veranlagung wie dein Mann sie nun doch einmal hat, ihn jeder
leiseste Zwang behindert und vielleicht sogar verstimmt und hemmt.“
„Hat er sich etwa dir gegenüber beklagt, Mama?“
Die Kommerzienrätin lachte bitter auf.
„Wo denkst du hin, Elfriedchen. Ein so großer Künstler nimmt sich nicht
die Mühe, eine gewöhnliche Sterbliche,[S. 152] wie mich, in seine Empfindungen
einzuweihen. Aber erinnere dich nur. Ist er nicht häufig genug
ungehalten gewesen, wenn du etwa eine Stunde oder noch länger wie ein
geduldiges Lämmchen mit dem Essen auf ihn gewartet hast?“
„Mama, nimm den alten Franz wieder zu dir,“ bat die junge Frau gequält.
Sie wußte sofort, aus welcher Quelle ihre Mutter die Kenntnis jedes
auch des kleinsten und unwichtigsten Geschehnisses aus ihrem Leben
schöpfte.
„Du hast mich schon mehrmals darum gebeten, Elfriede. Und heute, wie
früher sage ich dir, daß er bleiben wird und muß.“
Elfriede Karlsen seufzte tief auf.
„Was also soll diese Gesellschafterin mir helfen?“
Frau Eßling fühlte, daß der anfängliche Widerstand zu wanken begann.
Etwas wie Neugier klang aus der Frage.
„Unendlich viel, Elfchen! Natürlich muß sie klug und gebildet, frisch
und einwandfrei sein. Ihr werdet Euch schnell anfreunden. Du hast
niemals eine Freundin besessen. Dann sind die Stunden des Wartens
plötzlich ausgefüllt. Vielleicht erscheinen sie dir im Laufe der
Zeit sogar, wenn Ihr zusammen ein nettes Buch lest – Spaziergänge
macht, Einkäufe erledigt und Bilder anseht, zu kurz. Jedenfalls, ein
vorwurfsvolles Gesicht oder gar, was mir bei weitem gefährlicher
erscheint, ein abgespanntes, enttäuschtes und nicht gerade glänzend
aussehendes Frauchen wird Karlsen nicht vorfinden, auch wenn er sich
selbst erheblich verspäten sollte. Was meinst du, muß die Folge hiervon
sein? So viel habe ich gelernt, um zu wissen, daß Karlsen launenhaft
ist. Das Geringste kann ihn verstim[S. 153]men; eine Kleinigkeit kann ihn aber
zu einem hinreißenden Gesellschafter machen.“
„Ich habe keine Ahnung gehabt, daß du ihn so genau kennst,“ sagte
Elfriede.
„Höre nur weiter, Friedchen! – Indem du nicht länger mit dieser
deutlich zur Schau getragenen Sehnsucht nach ihm schmachtest – nicht
mehr die Hände ringst, wenn eine seiner Leibspeisen ungenießbar
geworden ist, dir die Augen auch nicht mehr rot und trübe weinst, wirst
du dir deinen Mann zu einer Dankbarkeit verpflichten, die dich ihm
wichtiger und damit unentbehrlicher machen muß, als dies leider bisher
der Fall gewesen ist.“
Die junge Frau hatte sich aufgerichtet und sah unsicher zu ihrer Mutter
hinüber.
„Wenn du wirklich Recht hättest, Mama! Aber ich kann nicht daran
glauben. Beständig eine Dritte am Tische zu haben denke ich
mir qualvoll. Vergißt du, daß sie mir von der kurzen Zeit des
Beisammenseins das Beste wegnimmt?“
„Kind, du bist die Frau eines Künstlers. Du mußt sorgen, daß du
sie auch bleibst!“
Elfriede Karlsen war sehr bleich geworden.
„Du glaubst doch nicht, daß mich Paul nicht mehr liebt?“
„Wenn ich das auch nur fürchtete, würde ich anders mit meinem Herrn
Schwiegersohne umspringen. Nein, davon ist bis jetzt keine Rede. Aber
ich will verhüten, daß es jemals zu einer merklichen Abkühlung käme.
Glaube mir, Friedchen, mein Rat ist klug und wohlerwogen. Dies Mittel,
das ich ihm ebenso wie dir verordne, wird dich voll glücklich machen.
Nicht wahr, das wäre doch schön, mein[S. 154] Kind? Jetzt geh einen Augenblick
ins Nebenzimmer. Zuerst will ich alles Unwesentliche mit der Bewerberin
besprechen. Scheint sie mir die Rechte für dich zu sein, so rufe ich
dich.“
Eva von Ostried ließ die prüfenden Blicke und die gründlichen Fragen
der Kommerzienrätin in vollendet guter Haltung über sich ergehen. Sie
zeigte keine Empfindlichkeit, weil sie draußen ungewöhnlich lange zu
warten gehabt hatte. Mit ruhiger Selbstverständlichkeit nahm sie in
einem ihr von Frau Eßling gebotenen Sessel Platz und beantwortete kurz
und klar deren Fragen.
„Die Zeugnisse, die Sie vorweisen können, sind nicht eben glänzend,
Fräulein von Ostried.“
„Eher das Gegenteil, gnädige Frau! Kaum siebzehnjährig nahm ich die
erste Stelle an und besaß doch keinerlei Vorkenntnisse, nur den guten
Willen, meine Pflicht zu erfüllen.“
„Wollen Sie mir nun etwas über Ihre Jugend – die Jahre vorher, meine
ich und vor allem von der Notwendigkeit, die Sie auf den Erwerbsweg
zwang, erzählen?“ fragte die Kommerzienrätin.
„Gern! – Mein Vater war Besitzer des Majorats Waldesruh im Kreise
Köslin, Provinz Hinterpommern. Meine Mutter, eine geborene Baroneß
Strachwitz, starb, als ich vierzehn Jahre zählte. Unsere Verhältnisse
waren stets die denkbar schlechtesten. Waldesruh war bereits unter
meinem Großvater arg heruntergewirtschaftet. Bei dem Tode meines Vaters
blieb mir nichts Nennenswertes. Mein Vormund, Amtsrat Wullenweber,
wünschte zudem, daß ich mir sogleich einen Erwerb schaffe. Besondere
Sachen hatte[S. 155] ich nicht erlernt. So stand mir lediglich der Weg des
Kinderfräuleins oder der Hausstütze offen.“
„In der zweiten Stelle, in der Sie kaum vier Monate weilten, müssen
doch ganz besonders wichtige Gründe die Veranlassung zu so schnellem
Wechsel gegeben haben? Ich sehe, daß dies Zeugnis die Bemerkung „auf
ausdrücklichen Wunsch entlassen“ enthält.“
„Diese Gründe waren allerdings vorhanden, gnädige Frau,“ gab Eva ruhig
zu. „Des Hausherrn Verhalten. Jedenfalls konnte ich nicht länger in
seinem Hause bleiben.“
„Ich verstehe! Es gefällt mir ausnehmend, daß Sie so empfinden. Sie
sind ein sehr schönes Mädchen. Das werden Sie nicht nur von andern
gehört haben, sondern selbst genau wissen.“
Eva von Ostried nahm diese Worte als das einfache Feststellen einer
Tatsache hin. Es wäre ihr kindisch erschienen, abzuwehren oder gar zu
widersprechen.
„Darum fühlte ich mich auch im Hause der verwitweten Frau
Landgerichtspräsident Hanna Melchers überaus glücklich. Drei Jahre war
ich bei ihr und kann wohl sagen, daß eine Mutter nicht gütiger und
liebevoller zu mir hätte sein können.“
„Und dieses letzte und wichtigste Zeugnis, Fräulein von Ostried?
Sollten Sie vergessen haben, es mir auszuhändigen?“
„Leider besteht es nicht, gnädige Frau. Frau Präsidentin ist während
einer allein unternommenen Reise unerwartet einem Herzschlage erlegen.
Sie könnten sich aber über mich bei Justizrat Dr. Weißgerber, dem
langjährigen Freund[S. 156] und Testamentsvollstrecker der Frau Präsidentin,
erkundigen.“
„Wann ist er daheim? – Wissen Sie das? In sein Büro möchte ich diese
Sache nicht gern tragen.“
„Er hatte heute außerhalb zu tun. Immerhin wäre es möglich, daß er
schon zurückgekehrt ist.“
Sie sagte das leise und zögernd, weil ihr plötzlich einfiel, daß
auch sie ja eigentlich noch wegen des Geldes den Versuch der späten
Rücksprache hätte machen sollen. – Der Kommerzienrätin war das
Schwanken in der jungen Stimme nicht entgangen. Auch wunderte sie sich
über den plötzlich veränderten Ausdruck des schönen Gesichtes. –
Erst in diesem Augenblick dachte Eva von Ostried daran, daß es leicht
möglich sei, der Justizrat sage am Apparat etwas von ihren vernichteten
musikalischen Aussichten. Darüber hatte sie aus guten Gründen
geschwiegen.
Frau Eßling aber glaubte bestimmt, daß Eva von Ostried jene Auskunft,
trotzdem sie auf dieselbe ausdrücklich hingewiesen, zu fürchten hatte
und war umso mehr entschlossen, den Justizrat zu befragen. – Der
Justizrat war soeben angekommen und bestätigte am Fernsprecher kurz und
klar, daß Eva von Ostried zur vollsten Zufriedenheit der Verstorbenen
drei volle Jahre in deren Hause gewesen sei, und daß sie auch von
ihm persönlich in jeder Beziehung als ausgezeichneter Charakter
geschätzt werde. Er ließ sogar mit einfließen, daß die Präsidentin
fest entschlossen gewesen, die junge geliebte Hausgenossin sicher zu
stellen. Zweifellos habe sie an der Ausführung dieses Entschlusses der
schnelle Tod gehindert.
Frau Eßling kam befriedigt vom Fernsprecher zurück.
[S. 157]
„Ich möchte es gern mit Ihnen versuchen, wenn Sie denselben Wunsch
haben,“ sagte sie freundlich. „Ich hoffe, wir werden sehr schnell mit
einander einig werden. Nur wenige Anweisungen und Bedingungen müßte
ich Ihnen zuvor nennen: Sie würden nicht in meinem Hause zu leben
haben, sondern bei meiner jungverheirateten Tochter, die Sie gleich
noch kennen lernen sollen. Denn sie weilt vorübergehend bei mir. Ihre
Pflichten werden sich leicht gestalten. – Sind Sie musikalisch?“
„Ja,“ sagte Eva. „Es dürfte sicher genügen. Ich singe.“
„Das ist mir sehr angenehm. Meine Tochter hat entschieden ein feines
Gehör, war aber stets zu leidend, um sich den Anstrengungen langen
Uebens auszusetzen. Würden Sie ihr etwa auch Unterricht erteilen
können?“
Evas Hände wurden eiskalt. Wie ein Hohn des Schicksals erschien ihr das
alles. Aber sie nickte bereitwillig.
„Gut. Für häusliche Arbeiten ist im übrigen eine Kraft vorhanden. Es
kommt mir, wie Sie gemerkt haben werden, lediglich darauf an, daß meine
Tochter zerstreut und froh erhalten wird. Sie muß zu viel allein sein.
Das taugt nicht für ein stilles, ja scheues Wesen, wie das ihre. Können
Sie lustig sein, Fräulein von Ostried?“
„Ich werde es vielleicht lernen, gnädige Frau.“
„Und treu, Fräulein von Ostried? Absolut? In jeder Lage? Bei jeder
Versuchung?“
„Wie habe ich das zu verstehen, gnädige Frau?“
„Wie ein Mädchen Ihrer Herkunft und Bildung dies verstehen muß. –
Treu der Herrin. Was das heißt – hm – eine Erklärung ist nach Ihren
Erfahrungen in Ihrer zweiten Stelle wohl kaum notwendig. – Mein
Schwiegersohn[S. 158] ist Künstler. Ich weiß nicht mal, ob ich das schon
erwähnte. Künstler entzünden sich zumeist sehr schnell und heftig. Und
Sie sind, wie ich das bereits feststellte, von der Natur besonders
reich bedacht.“
„Ich würde lieber sterben, als eine Ehe zu zerbrechen helfen.“
„Den Eindruck habe ich auch von Ihnen. – Meine Erfahrung mag Ihnen
wiederholen, was Sie längst selbst erfahren haben werden. Das
Köstlichste und Wertvollste bleibt das gute Gewissen. „Der Uebel
größestes aber ist die Schuld!“ schrieb mir mein seliger Vater unter
den Einsegnungsspruch. Seither habe ich es als Wahrheit immer wieder
bestätigt gefunden. – Treu der Herrin, sagte ich, die Sie sehr gütig
– sehr schwesterlich behandeln wird. – Treu aber auch mir. – So
selbstverständlich das Erfüllen der ersten Bedingung ist, so sonderbar
wird Sie die zweite anmuten. Ich,“ ihre Stimme klang plötzlich
gedämpft, „habe nicht dasjenige Vertrauen zu meinem Schwiegersohn,
das nötig sein sollte, um ruhig und sorglos das Glück des einzigen
Kindes in seinen Händen zu lassen. Diese Heirat ist nur ungern von mir
zugegeben. Ich mißtraue ihrer Beständigkeit. – Wollen Sie, im Fall
Sie die untrüglichen Beweise für die Berechtigung meines sehr regen
Mißtrauens haben, mir dies unverzüglich mitteilen?“
„Das muß ich entschieden ablehnen,“ erwiderte Eva von Ostried bestimmt.
„Ich erwähnte bereits, daß ich mich verachten würde, wenn ich Unfrieden
zwischen Eheleute streute.“
„Wenn ich auf diese Erklärung hin auf ihre Dienste bei meiner Tochter
verzichten müßte, Fräulein von Ostried?“
[S. 159]
Eva zögerte mit der Antwort. Das Verlangen nach einem Platze, der
sie vorläufig – vor der Not des Lebens schützte – an dem sie sich,
fern von der leiblichen Not, ungehindert prüfen konnte, ehe sie sich
fest an Paul Karlsen band, drängte sie zum Einlenken. – Die innere
Wahrhaftigkeit aber verbot ihr ein Nachgeben.
„Trotzdem könnte ich es nicht versprechen, gnädige Frau.“
Die Kommerzienrätin betrachtete das junge Gesicht lange. Dann reichte
sie Eva von Ostried die Rechte hin.
„Also gut. – Die Treue für meine Tochter soll mir genügen. –
Vergessen Sie das andere. – Noch ein Wort über Ihr Gehalt. Ich
beabsichtigte Ihnen hundert Mark monatlich anweisen zu lassen. Sind Sie
damit zufrieden?“
„Fünfzig Mark weniger, wie das Gnadengeld der alten Pauline beträgt,“
dachte Eva bitter, obschon ihr diese Summe genügte.
„Es wird reichen, gnädige Frau,“ sagte sie eintönig.
„So, damit wäre alles besprochen. Jetzt werde ich meine Tochter
benachrichtigen. Einen Augenblick, bitte.“ – –
„Ich fürchte nur, das Sie sich neben mir langweilen werden,“ sagte die
junge Frau.
Eva lächelte.
„Wir wollen versuchen, uns jeden Tag mit einer besonderen Freude zu
erheitern, gnädige Frau.“
Die Kommerzienrätin fand den Ton, in dem ihre Tochter zu der neuen
Gesellschafterin sprach, für den Anfang viel zu warm. Gewiß hatte auch
sie vorhin ein schwesterliches Verhältnis als sehr wahrscheinlich
erwähnt. Immerhin mußte dies doch erst verdient werden. Sie riß deshalb
das Gespräch wieder an sich.
[S. 160]
„Ist Ihnen der Montag nächster Woche als Tag des Eintritts recht,
Fräulein von Ostried? Sie sind doch durch nichts gebunden, nicht wahr?
– Oder wollten Sie noch etwas im Hause der Verstorbenen ordnen?“
„Ich könnte bereits morgen kommen, gnädige Frau! Das alte treue
Mädchen, das der Präsidentin lange Jahre diente, besorgt alles Nötige
allein. Aber Sie haben mir noch gar nicht Namen und Wohnung Ihrer Frau
Tochter genannt.“
Die junge Frau antwortete an Stelle ihrer Mutter. Es gewährte ihr immer
aufs Neue eine stolze Freude, sich als Frau des jungen Künstlers zu
bekennen.
„Unser Häuschen liegt sehr nahe hier; Karlsbaderstraße 10. Wir haben
es wundervoll. Nur ein wenig dunkel und kühl. Auf dem Schilde am
Gittertore steht Paul Karlsen. – Das ist mein Mann.“
Eva von Ostried blinzelte, als werde sie aus dem Dunkel in einen
grellerleuchteten Raum gestoßen.
Sie sollte also zu Paul Karlsens Frau? In sein Haus? Und achtgeben, daß
er die – eheliche Treue halte?
Das Frauenbild auf grüner Wiese im roten Mohn hatte bereits den Mann
zu ihren Füßen gesehen. Den Mann, als dessen Braut sie sich betrachtet
hatte.
„Was ist Ihnen,“ fragte die junge Frau ängstlich und sah hilflos zu
ihrer Mutter hin. Hatte Eva von Ostried wirklich aufgestöhnt, als werde
sie von heftigen Schmerzen gepeinigt?
Es mußte ein Irrtum gewesen sein! Jetzt stand sie mit dem Ausdruck
eines Lächelns da. Nur auffallend gerade und steif hielt sie sich.
[S. 161]
„Verzeihen Sie – ich bekam soeben wieder einen jener kleinen Anfälle,
mit denen ich, leider, häufiger zu kämpfen habe.“
Frau Eßlings Stimme klang erregt.
„Warum haben Sie bisher nicht davon gesprochen?“
„Gott – man will doch „unter“, gnädige Frau. Nicht wahr?“
„Du wirst sie darum nicht fortschicken,“ flüsterte die junge Frau
bittend.
Die Kommerzienrätin überhörte den Einwand ihrer Tochter völlig.
„Durchaus begreiflich, liebes Fräulein. Sie finden auch ganz sicher
ein Haus, in dem diese Kleinigkeit nicht stört. Nur für meine Tochter
passen Sie, leider, nicht als ebenfalls Schonungsbedürftige. Das sehen
Sie auch ein?“ Eva von Ostried nickte mechanisch.
„Vollkommen, gnädige Frau.“
Warum ging sie jetzt nicht. Ihr Lächeln wurde der Kommerzienrätin
unerträglich, bis ihr ein Gedanke kam.
„Kann ich Ihnen vielleicht in anderer Weise etwas helfen, Fräulein,“
fragte sie, im Grunde herzlich froh darüber, daß sich ihre Handlung auf
gütlichem Wege ungeschehen machen ließ. „Ich halte Sie doch für ein
vernünftiges Mädchen.“
Eva von Ostried neigte ein wenig den Kopf, als danke sie für eine
Huldigung. – Sie blieb aber weiter unbeweglich stehen und lächelte
maskenhaft. Der jungen Frau kamen die Tränen.
„Ich würde Sie trotzdem bitten, Fräulein von Ostried,“ sagte sie rasch
und herzlich, „aber wenn Mama nicht will,[S. 162] muß ich mich stets fügen.
Seien Sie, bitte, nicht so sehr traurig. Ich werde Sie all meinen
Bekannten warm empfehlen und bis Sie etwas gefunden haben, besuchen Sie
mich fleißig alle Tage. Auch zu den Mahlzeiten. Wir speisen gegen 2 und
7 Uhr. Ja, wollen Sie das tun?“
Frau Eßling war ins Nebenzimmer gegangen und kam jetzt eilig zurück.
Sie drückte einen verschlossenen Umschlag in Eva von Ostrieds Hand.
„Alles Gute für Ihren Weg und fallen Sie beim Hinausgehen nicht über
die dumme Stufe, die zur Diele hinabführt.“
„Sie sind sehr gütig, gnädige Frau! Verlassen Sie sich darauf. Ich
werde nicht fallen!“
Hatte sie sich verneigt oder – war sie grußlos geschieden? Die
ausgestreckte Rechte und den bittenden Blick der jungen Frau mußte sie
wohl übersehen haben.
„Sie hat etwas verloren,“ sagte Frau Elfriede verwirrt und zeigte auf
das Weiße, das dort lag, wo noch soeben die schöne stolze Gestalt
gestanden hatte.
Es war der Umschlag, in den Frau Eßling großmütig einen
Fünfzigmarkschein getan hatte.
Am nächsten Morgen gegen neun Uhr war Justizrat Weißgerber schon
wieder in der Wohnung seiner alten, toten Freundin. Er ging durch
die nur angelehnte Gartenpforte über die Diele sofort zur Küche.
Denn er wollte ungestört mit der alten Pauline sprechen. Diese hatte
eine mächtige Hornbrille auf der Nase und fertigte umständlich und
sorgsam das Verzeichnis der mit Obst und Gemüse ge[S. 163]füllten Gläser an.
Offensichtlich war ihr eine Störung bei dieser Arbeit sehr unangenehm.
„Es gibt soeben noch etwas Wichtigeres für Sie zu tun, Pauline,“ sagte
der Justizrat eilig. „Sehen Sie mal her. Auf diesem Zettelchen, den
ich in einem Notizbuch aus dem Jahre 1917 fand, spricht unsere Frau
Präsident von allerhand wichtigen Aufzeichnungen, die sich in einer
kleinen, schwarzen Kiste, um deren Verbleib die gute Pauline wisse,
finden lassen sollen. Haben Sie eine Ahnung, wo sich besagte Kiste zur
Zeit befindet?“
„Eine kleine schwarze Kiste? – Jawohl! Die habe ich selbst auf der
Bodenkammer in eine größere gestellt.“
„Wir müssen sie eiligst herunterschaffen.“
„Wozu denn, Herr Justizrat?“
„Denken Sie ein wenig nach. Sie wissen nun ja auch darin Bescheid. Uns
fehlt doch etwas, nicht wahr?“
In das alte Gesicht kam ein Zug von Spannung.
„Sie hoffen gerade so wie ich, daß sich was für das Fräulein finden
lassen muß. Ach – Herr Justizrat, sie ist wie außer sich. Zum Erbarmen
sieht sie aus. Die halbe Nacht habe ich gesucht. Da ist kein Eckchen,
das verschont wär’. Ich hatte bestimmt im Gefühl, daß ich es finden
müsse, glauben Sie mir. Sogar das Bett unserer Frau Präsident hab’
ich aufgetrennt. Meine selige Großmutter hatte auch was Schriftliches
in ihrem Kopfkissen versteckt. – Aber alles umsonst. Wie vor einem
Rätsel steh’ ich. Alles, was unsere Frau Präsident anfaßte und sagte,
war so klar wie Glas. Aus diesem Dunkel kann ich mich mein Lebtag nicht
rausfinden.“
[S. 164]
„Wenn ich Sie recht verstehe, ist Fräulein von Ostried nun doch
zusammengebrochen, so tapfer sie sich angestellt hat. Mir gegenüber
würde sie sich zweifellos weiter zusammennehmen. Sie werden darüber
mehr wissen. Oder doch nicht? – Ich glaube, daß sie wieder in Stellung
zu gehen beabsichtigt? Eine Dame verlangte telephonisch ausführliche
Auskunft über sie.“
„Sie ist sehr stolz, Herr Justizrat. Das habe ich früher nie gefühlt.
Ist’s ihre adlige Herkunft, oder was anderes. Sie will jedenfalls
nichts von unsereinem annehmen. Und wie gern tät ich’s doch!“
„Das kann ich ihr nicht verdenken, Pauline. Es tut ihr weh, daß sie
leer ausgegangen sein soll. Am meisten quält sich darüber ihr Stolz,
auf den Sie schlecht zu sprechen sind. Glauben Sie mir, es ist gut, daß
sie den besitzt. Hat Sie sich heute zu Ihnen ausgesprochen?“
„Sie hat nur gesagt, daß gegen Mittag jemand ihre Sachen abholen würde.“
„Und über das „Wohin“ kein Wort?“
„Nichts. Fragen habe ich nicht mögen. Es kam mir zu aufdringlich vor.
Sie hat ja eigenes Geld, Herr Justizrat. Ich hab’s mit meinen Augen
gesehen. Das wird sie nun wohl erst aufbrauchen.“
Selbst seinem juristischen Scharfsinn fehlte im Augenblick die
Verbindung zwischen Eva von Ostrieds ihm gegenüber getaner Aeußerung
und ihrem scheinbar ganz neuen Entschluß, nun doch wieder in Stellung
zu gehen.
„Gleichviel, Pauline, tun wir unsere Pflicht, indem wir die Kiste
durchstöbern. Wenn sie auch nichts von Wichtigkeit bringt, müssen wir
uns bescheiden!“
[S. 165]
Trotzdem er sich wiederholt sagte, daß eine erfahrene, klardenkende
Frau wie es die Präsidentin gewesen, Beschlüsse von größester
Wichtigkeit unmöglich zusammen mit wertlosen Zeilen, die lediglich
einen Erinnerungswert für sie selbst haben mochten, zusammenschichten
würde, durchsuchte er – eine Viertelstunde später – umständlich jedes
noch so kleine Blättchen.
Auch dies war vergeblich, genau, wie er es gefürchtet hatte, und
seufzend klappte er endlich den Deckel herunter und legte das viel zu
wuchtige Schloß eigenhändig in die Krampe.
„Am liebsten ginge ich zu ihr und bäte sie vorläufig in mein Haus,“
sagte er vor sich hin.
„Ich fürchte, Herr Justizrat, das wird nichts helfen. Sie ist wie von
Stein geworden. – Als ich ihr heute Morgen den Kaffee gebracht habe,
war sie kalkweiß. „Haben Sie schlecht geschlafen, Fräuleinchen,“ hab’
ich gefragt und wollte ihre Hand ein bißchen streicheln. Denn so ein
Elternloses mag sich jetzt doppelt und dreifach einsam fühlen. Aber,
was meinen Sie, Herr Justizrat; weggezogen hat sie ihre Hand und ganz
vergnügt getan. Daß sie prachtvoll geschlafen hätt’ und sich wer weiß
wie sehr auf die Arbeit freue. Ja, das hat sie gesagt. Angesehen hat
sie mich dabei aber nicht. – Seitdem war ich nicht wieder bei ihr
drin. Nur ein bißchen gehorcht hab’ ich mal, ob sie vielleicht geweint
hat. Ich glaub’ aber wohl nicht. Laut geredet hat sie. Ich hab’ sogar
verstanden, was es war. „Der Uebel größtes...“ Jawohl, immer nur diese
drei Worte sind’s gewesen.“
[S. 166]
„Wäre sie nicht bereits volljährig, hätte ich mich ihretwegen längst
mit dem Vormund in Verbindung gesetzt.“
„Ich glaube, damit wär’ sie auch nicht zufrieden gewesen. Sie hat kein
Vertrauen zu ihm fassen können und wird froh sein, daß er ihr nichts
mehr zu sagen hat.“
„Besitzt sie denn keine Freundin. – Niemand, der einigen Einfluß auf
sie ausüben könnte, Pauline?“
„Davon hab ich nie etwas gemerkt. Unsere Frau Präsident hat ihr in
meiner Gegenwart mehr als einmal zugeredet, sie sollte doch mit diesem
oder jenem jungen Mädchen, das in unser Haus kam, spazieren gehen. Das
hat sie immer abgelehnt. Den Grund kann ich mir auch denken.“
„Ich wüßte keinen. Ich habe vielmehr die Ueberzeugung von ihr, daß sie
ein guter und zuverlässiger Kamerad sein müßte.“
„Sie ist aber zehnmal hübscher wie die andern. Sie sollten nur mal die
Blicke sehen, wenn sie auf der Straße geht. Mit ihr zusammen Einkäufe
zu machen, war ein richtiger Spaß. War das ein Herumgedrehe und
Nachgegucke. – Hinterhergelaufen sind sie auch wohl. – Fremdes junges
Blut freut sich darüber aber nicht. Das wird leicht neidisch.“
„Möchte ihr die Schönheit nur nicht zum Unsegen werden.“
„Die Angst ist unnötig, Herr Justizrat. Sie konnte zu kalt und stolz
aussehen, wenn’s einer von den jungen Herren gar zu auffällig mit
seiner Bewunderung trieb.“
Der Justizrat mußte lächeln.
„Sie haben auch diesmal Recht, Pauline. Es will mir nur nicht in den
Kopf, daß man sich jetzt einfach nicht mehr um sie bekümmern soll.“
[S. 167]
„Das wär allerdings traurig. Aber ich werde, ob sie will oder nicht,
aufpassen auf sie. – Geht es ihr schlecht, komm ich zu Ihnen, Herr
Justizrat. Das andere besorgen Sie denn.“
Eben ging Eva von Ostried, wie in tiefen Gedanken versunken, unten
vorüber, ohne die beiden sorgenvollen Gesichter zu bemerken. Sie
hatte einen eiligen Gang vor. Noch einmal wollte sie versuchen,
unterzukommen. Die neueste Tageszeitung hatte ihr wiederum einen
Fingerzeig gegeben. Die hastige Unruhe des Verkehrs war ihr etwas
Ungewohntes. Ihr Kopf begann von neuem zu schmerzen. Trotzdem dachte
sie nicht daran, umzukehren. Ein verbissener Trotz lag auf ihrem
bleichen Gesicht, als sie endlich in die Friedensstraße einbog und die
bezeichnete Nummer zu suchen begann. Das neue Gesuch verlangte eine
gebildete Stütze im Osten Berlins.
Das Haus, in das sie eintrat, war so dunkel, als sei es ohne Fenster
erbaut worden. Im Flur roch es nach Mittagskohl, Kaninchen und Leim.
Jeder einzelne Geruch für sich wäre erträglich gewesen. Die Vereinigung
erregte ihr Uebelkeit. – Das im dritten Stock auf ihr Klingeln
öffnende Mädchen, lächelte ihr vertraulich zu:
„Na, denn man rin in die gute Stube. Drei sind all vor Ihnen.“
Sie wurde in die Küche gewiesen. Eine der Wartenden rückte gefällig auf
ihrem Schemel zur Seite.
„Wir werden uns schon vertragen.“
Eva kam der freundlichen Aufforderung nicht nach. Sie kämpfte mit dem
Gefühl des Schwindels. „Ein Glas Wasser,“ bat sie matt.
[S. 168]
Eins der Mädchen hielt einen Tassentopf ohne Henkel unter die
aufgedrehte Leitung. An den schneeweißen Lippen der Neusten merkten
sie, daß deren Einsilbigkeit nicht dem Hochmut entsprang. Eva von
Ostried wollte trinken, aber sie vermochte das unsaubere, abgestoßene
Gefäß nicht an den Mund zu führen. Stumm setzte sie es nieder und
wandte sich zum Gehen.
– – Am Spätnachmittag dieses Tages hielt eine Droschke vor dem
Haus der verstorbenen Präsidentin. Eva von Ostried hatte bereits auf
sie gewartet. Nun trat sie vom Fenster zurück. Koffer und Handtasche
waren fertig zum Fortschaffen. Sie selbst zum Einsteigen bereit.
Auf dem Mahagonitisch lag wieder die kleine schwarze Tasche mit den
zwölftausend Mark anvertrauten Geldes. Ihre Hand streckte sich danach
aus und zuckte doch wieder leer zurück. Dann aber preßte sie die Lippen
zusammen und riß sie an sich. –
Nun war es entschieden! –
Die alte Pauline kam angelaufen: „Sie wollen doch nicht etwa schon weg,
Fräuleinchen?“
„Ist es nicht höchste Zeit damit,“ fragte sie ruhig. „Leben Sie wohl,
Pauline.“
„Wohin soll es denn nun gehen? Das ist doch gar nicht möglich.“
„Wohin?“ Die schönen Augen schlossen sich leicht. Der Raub in ihrer
Hand hatte ihr Herz erkältet. „Vielleicht schreibe ich Ihnen einmal,
beste Pauline.“
Amtsrat Wullenweber auf Hohenklitzig erwartete Gäste. Sein einziger
Bruder, der als Major a. D. in Berlin lebte, sollte, geleitet von dem
Sohne, eintreffen.
Dieser Bruder war ein schwererträglicher Egoist geworden, nachdem ihn
ein hartes Geschick zweimal grausam strafte. Der erste Schlag raubte
dem verschwenderischen und von jeher leichtsinnigen, daneben aber im
Dienst tüchtigen und ehrgeizigen Offizier die bis dahin ausgezeichnete
Gesundheit. Ein ungeschickter Schütze schoß ihn auf einer Treibjagd so
unglücklich an, daß er sich seither nur an zwei Krücken fortbewegen
konnte. Der zweite Hieb traf ihn schwer an seiner Ehre und machte ihn
zum schroffen Verächter jeglichen Menschenwertes, weil er die helfenden
Krücken verzeihender Einsicht nicht zu finden vermochte.
Amtsrat Wullenweber hatte von einem persönlichen Empfange am Bahnhof
abgesehen. Er stand auf der Steintreppe vor seinem unscheinbaren
Gutshause und spähte nach der Staubwolke aus, die ihm das Nahen des
Wagens verraten sollte.
Und nun saßen sie zu Dreien an einem runden Tische und sprachen
über völlig gleichgültige Dinge. Das Zimmer blitzte in Frische und
Sauberkeit. Auf den kalt- und steif[S. 170]wirkenden Möbeln aus hellster
Birke zeigte sich kein Stäubchen. Es fehlte aber dennoch jede Spur
einer liebreich schmückenden Frauenhand. Das Mahl war einfach, aber
schmackhaft zubereitet, doch schien keiner den rechten Genuß daran zu
finden.
Amtsrat Wullenweber, der ein ebenso ausgezeichneter Ackerwirt wie
schlechter Diplomat war, setzte das Grübeln über die ungefährlichste
der persönlichen Fragen mit stummer Energie fort. Endlich meinte er sie
gefunden zu haben und wandte sich an den Neffen, der schlankgewachsen,
blond und merkwürdig ernsthaft für seine zweiunddreißig Jahre, zwischen
ihnen saß.
„Na, Walter, nächstens mußt du nun auch wohl schon drei Jahre Assessor
sein, nicht wahr?“
Doktor jur. Walter Wullenweber besaß die strahlend blauen Augen eines
reich Begnadeten, der sich trotz aller Lebenshärten, seine kleine Welt
voller innerer Schönheit unversehrt erhalten hat.
„Etwas länger bereits, Onkel,“ erwiderte er und seine Stimme klang
weniger klar, wie bisher.
„Nun – und –“
„Immer noch nicht Präsident,“ scherzte er. „Trotzdem fühle ich mich
den Umständen nach recht wohl. Die Arbeit befriedigt mich, nachdem ich
meinen auch dir ja zur Genüge bekanntgewordenen Jugendwunsch überwand.
Ja, ich freue mich sogar darauf, als Richter zu wirken. Am liebsten in
einer möglichst kleinen Stadt mit viel ländlicher Umgebung.“
„Dann melde dich hierher an das Amtsgericht Köslin,“ riet der Amtsrat.
„Da hast du alles. Alltäglich machst du[S. 171] in Straf-, Zivil- und
Grundbuchsachen. Sonntags flitzt du zu mir raus und speist von der
Glanzdecke.“
Der Major a. D., der mißmutig und schweigsam zugehört, mischte sich
jetzt ins Gespräch.
„Und ich schimmele indessen in unserer hochherrschaftlichen Hofwohnung
am grünen Strand der Spree und warte auf irgend einen geduldigen
Jemand, der mich die Hühnerstiege herunterschleift, damit ich nicht
gänzlich verkomme.“
In dem ernsten Gesicht des jungen Juristen zuckte es unwillig. Aber er
blieb ruhig.
„Wenn du dich nicht zum Mitkommen in besagtes Städtchen entschließen
könntest, müßten wir uns allerdings zuerst nach einer kräftigen Stütze
für dich umsehen,“ sagte er ohne Empfindlichkeit.
„Soll ich jetzt vielleicht auch noch in eines jener mir schon als
Fähnrich unausstehlichen Nester unterkriechen?“
„Von einem Zwang kann natürlich keine Rede sein, Vater. Auch ich ließe
mich nie mehr zu etwas zwingen.“
Der alte Herr sah scharf zu dem Sohn hin.
„Was soll das heißen, bitte?“
„Daß ich den Weg gehen werde, den ich mir, nach manchem inneren Kampf,
ausersehen habe.“
„Darf ich wenigstens erfahren, wohin er dich führen soll.“
„Ganz gewiß. Zur Anstellung als Richter, dem gewöhnlich Gegebenen, wenn
man die nötigen juristischen Vorstufen überwunden hat.“
„Mach dich gefälligst nicht lächerlich, Walter! Wenn man in unserer
Lage sitzt, kommt es lediglich aufs Geldverdienen an.“
[S. 172]
Assessor Wullenweber schüttelte den Kopf.
„Ueber dieselbe Ansicht wäre es – vor ungefähr zwölf Jahren – beinahe
zwischen uns zum Bruch gekommen. Damals ließ ich mich von dir zwingen.
Mein bescheidenes Muttererbe hätte vielleicht wirklich nicht zu dem als
sinnlos von dir bezeichneten von mir ersehnten Lebensberuf ausgereicht
und du hattest recht, mir ein persönliches opfern deiner Mittel als
ausgeschlossen hinzustellen. Heute jedoch,“ und seine Stimme wurde
hell und scharf, „wäre jeder Versuch zu meiner Umstimmung für dich
aussichtslos. Oder doch nur von Erfolg, wenn ein sehr trauriger Grund
dazu käme.“
Der Major hatte sich zurückgelehnt und spielte an den schwarzen Heften
der Bestecks. „Was verstehst du darunter?“ Für eine harmlose Frage war
der Ton zu scharf.
„Ehrenschulden, die unbedingt abgetragen werden müssen. Und ich habe
keine, Vater.“
Das Mahl war beendet.
„Wir setzen uns noch eine Pfeife lang auf die Veranda,“ schlug der
Amtsrat, der seinen heftigen, verbitterten Bruder nicht sogleich am
ersten Tage durch eine schroffe Einmischung reizen wollte, vor.
Sie saßen alle Drei auf den sauber gescheuerten Steinfließen und
stießen dicke Tabakswolken aus den kurzen Rohren. Zu einer gemütlichen
Unterhaltung wollte es auch jetzt nicht kommen. Die Luft schien wie mit
Zündstoff angefüllt.
„Sage mal selbst,“ wandte sich der Major plötzlich an seinen Bruder,
„hältst du es für möglich, daß einer mit seiner kleinen Pension
auskommen kann?“
[S. 173]
Der Assessor wechselte die Farbe.
„Was soll das heißen, Vater?“
„Bleib’ ruhig sitzen! Schlimm genug, daß dir das nicht längst allein
klar geworden ist.“
„Ich verstehe nicht, worauf du hinaus willst.“
„Scheinst ja merkwürdig schwer von Begriffen in diesem Punkt zu sein.
Kurz – ich mag nicht länger rumhocken und entbehren – stillhalten und
abstreichen.“
Der Amtsrat sah das bleichgewordene Gesicht seines Neffen und nickte
ihm fast väterlich zu, obwohl sie sich bisher merkwürdig fremd
gegenüber gestanden hatten. „Nimm’s nicht tragisch, Junge. Wir ändern
ihn doch nicht mehr,“ sollte es heißen. Dann zog er die Stirnhaut
empor, wodurch er sich schon als Sechsjähriger unter seinen Brüdern
eine besondere Achtung verschaffte und kniff ein wenig die Lippen ein,
als schlucke er eine bittere Arznei. Aber er wurde damit fertig!
„Du hast’s wirklich verteufelt eng und dunkel in Berlin, Bruder.
Davon habe ich mich ja vor ein paar Wochen selbst überzeugen müssen.
Aber dein Junge solls und kanns diesmal nicht ändern. Das siehst du
bei ruhiger Ueberlegung auch ein. Ich mache dir einen vernünftigen
Vorschlag. Packe deinen Kram und zieh’ zu mir. Zwei Stuben kannst du
ganz für dich haben und diese Veranda und den ganzen Garten, denn ich
sehe auf dem Felde genug Grünes. Jawohl – meinetwegen auch noch das
kleine Seezimmer dazu, obgleich ich mich daran gewöhnt habe. Nur den
Jungen laß endlich von der Leine!“
„Ich geh’ nicht raus aus Berlin,“ knurrte der Major eigensinnig.
[S. 174]
„In deiner Lage ist das ein Wahnsinn, Richard.“
„In meiner jetzigen – vielleicht! Darum soll sie eben auch geändert
werden. Walter kann leicht und angenehm das dreifache verdienen, wenn
er nur mal ruhig nachdenkt. Wir mieten uns nachher irgend eine kleine
Villa. Ich kann mir einen Diener halten. Und das Leben wird wieder
einigermaßen anständig.“
„Du hast mir bereits neulich etwas derartiges angedeutet, Vater. Ich
faßte es keinen Augenblick als Ernst auf.“
„Darum habe ich mir die Wiederholung bis heute aufgespart. Onkel soll
zuhören. Nicht wahr, Wilhelm,“ wandte er sich an den Amtsrat, „ein
guter Rechenmeister warst du immer.“
„Ich rechnete aber für mich und mit mir als Verdiener, mein Lieber.“
„Soll das ein versteckter Vorwurf sein?“
„Deute es dir, wie du willst! Daß Walter nicht Musik studieren durfte,
darin mischte ich mich nicht ein. Das verstehe ich schließlich nicht.
Wie er sich damals als grüner Bengel damit abgefunden hat, das gefiel
mir, wenn schon er sich auffallend ablehnend zu mir benommen hat. Darum
nehme ich heute und später seine Partei.“
„Ihr tut gerade, als wollte ich ihn zu etwas Unerhörtem verleiten und
ich will ihn doch lediglich in eine gute, ja famose Lage bringen.“
„Ueber dies Kunststück würde ich gern näheres erfahren,“ lachte der
Amtsrat gemütlich.
„Er soll als Teilhaber bei einem äußerst geschätzten, erstklassigen
Anwalt eintreten. Der Mann hat ohne Vermögen angefangen und eine aus
sieben Köpfen bestehende Familie[S. 175] durchgebracht. Neben der seinen,
erhält er noch die Familien seiner beiden ältesten verwitweten Töchter.
Das Geschäft muß also einträglich sein. Als anfänglichen Monatsgehalt
ist er willens, einem tüchtigen Assessor, der dauernd eintritt,
vorläufig neunhundert Mark zu gewähren. Nachher soll es steigen oder
gar zur Hälfte gehen, denn er hat einen Knax weggekriegt und kanns
allein nicht mehr schaffen. Später besteht natürlich die sichere
Aussicht zur gänzlichen Uebernahme seiner juristischen Praxis. Ich habe
die Empfindung, daß dieser Zeitpunkt nahe ist. Der Mann macht’s wohl
kaum noch sehr lange.“
Walter Wullenweber war anfangs mit einem ungläubigen Lächeln der
Schilderung seines Vaters gefolgt. Jetzt begann er damit zu rechnen,
daß tatsächlich etwas Wahres daran sein mußte.
„Woher weißt du das alles,“ fragte er sachlich und noch vollkommen
beherrscht.
„Gott – ich habe mal was bei dem Mann zu tun gehabt. Wir sind ins
Gespräch gekommen. Er hat mich sogar mal in deiner Abwesenheit
freundschaftlichst besucht. Verzeih’ nur gütigst, wenn ich mich
ein paar Straßen weiter ohne deine gnädige Mithilfe oder Erlaubnis
davonmache.“
Walter Wullenweber kannte seinen Vater genau. Darum wußte er auch
jetzt, daß der nicht etwa unter seiner Bevormundung litt, sondern, daß
sein Gewissen in irgend einer Beziehung nicht das reinste war. Diese
bestimmte Annahme schärfte ihm in plötzlich erwachsender Angst den
Blick.
Zeigte der Sechzigjährige nicht die deutlichen Spuren einer nervösen
Unsicherheit wie nach jeder begangenen Torheit? Und war sein
ohnehin sprunghaft wechselndes Be[S. 176]nehmen in letzter Zeit nicht noch
unbeständiger geworden? Jetzt mußte sich Wullenweber mit aller Kraft
zur Bewahrung seiner Ruhe zwingen.
„Konnte ich dir nicht ebenso gut raten und helfen, wie es der
Justizrat Weißgerber imstande war, Vater? Du siehst, so ganz blind
und taub bin ich doch nicht neben dir dahingegangen. Ich sah Euch vor
einiger Zeit aus einem Weinlokal herauskommen. Das nahm mich bei dem
Vielbeschäftigten eigentlich Wunder – ich wollte dich auch fragen –
vergaß es aber nachher über etwas wichtigerem. Nicht wahr, bei ihm
gedachtest du mich auch unterzubringen? Aber, lassen wir das jetzt.
Etwas anderes erscheint mir wichtiger. Wozu brauchtest du einen fremden
Juristen? Wozu trugst du das Geld aus dem Hause?“
Der schwache Versuch, die Angelegenheit ins Scherzhafte zu ziehen,
mißlang.
„So weit bin ich noch nicht heruntergekommen, mein Sohn, um mir dauernd
und in jeder Kleinigkeit von dir Vorschriften machen zu lassen. Noch
bestimme ich. Und wenn einer von uns beiden zu gehorchen hat, bist du
es. Das merke dir.“ Der Amtsrat versuchte zu beschwichtigen.
„Kinder, nur keinen Streit!“
„Verzeih, Onkel, daß dies gleich die erste Stunde ausfüllen muß. Du
hast ja aber selbst gehört, daß sich Vater die Auseinandersetzung
ausdrücklich für diesen Tag aufgespart hat.“
„Zänkereien vertrage ich nicht,“ begehrte der Major auf. „Meine Ruhe
wollte ich endlich mal haben, frei sein. Du sollst nicht wieder aus
einer Lappalie ein Erdbeben machen, Walter.“
[S. 177]
Ein langer strenger Blick streifte ihn.
„Du weißt, daß ich schon übermorgen abreisen muß, Vater. Dann ist also
dein Wunsch erfüllt. Ich möchte aber nicht mit dieser seltsamen Unruhe
an die Arbeit zurück. Wir wollen uns aussprechen. Ich erkläre dir
nochmals, daß alles, was du über mich bestimmen solltest oder bereits,
ohne mein Wissen, bestimmt hast, hinfällig ist. Niemals werde ich nur
um des Geldes willen einen Weg, den mir mein Innerstes vorzeichnet,
aufgeben.“
„Ich hätte wissen müssen, daß du keiner Kindesliebe fähig bist.“
„Sprich nicht weiter, Vater. Denke rückwärts.“
„Habe ich nicht nötig! Was ich getan habe, auch das, woran du jetzt
vielleicht auch noch rühren möchtest, ich täte es gleich wieder.“
„Richard,“ mahnte der Amtsrat still. „Laß die Schatten ruhen.“
„Ihr meint wohl, ich fürchte mich vor ihnen? Weit gefehlt, was sich an
meinem eigenen Stamm nicht biegen lassen will, muß weggebrochen werden.“
„Versündige dich nicht, Bruder.“
„Sprecht doch endlich ihren Namen aus. Macht mir Vorwürfe. Schiebt mir
alle Schuld in die Schuhe. Ich kann’s ertragen. Ich werde Euch Rede und
Antwort stehen.“
Er war der Ueberzeugung, daß seine Stimme im Zorn gellte, und sie
war doch nur ein zitterndes, angstvolles Flüstern. Der Schatten, dem
er anscheinend mutig begegnete, mußte ihn atemlos gehetzt haben.
Das Gespräch verstummte. Der Atem des alten Offiziers bekam keine[S. 178]
Kraft mehr. Sein Gesicht erschien in der ungewissen Beleuchtung
des schwefelgelben Abendsrots grau und verfallen. Ein junges,
leidenschaftliches Geschöpf, dem die Mutter zu früh sterben mußte, saß
plötzlich auf dem vierten Stuhl. Und doch lag in Wahrheit nichts als
der unruhige Schein wilden Weinlaubs darauf. Die einzige Tochter des
Majors und Walters Schwester!
Der Amtsrat wischte sich über die Augen. Seitdem das mit ihr geschehen
war, hatte der Bruder sein Haus gemieden. Erst jetzt war er, ohne
besondere Einladung, wieder gekommen.
„Die Reise hat mich etwas angestrengt,“ sagte der Major plötzlich. „Ich
will schlafen gehen.“ – –
Eine Weile verharrte der Amtsrat noch in nachdenklichem Schweigen. Dann
tippte er dem Neffen auf die Schulter.
„Du mußt mir alles von damals erzählen, Walter. Aus den Briefen, die
mir der Vater geschrieben hat, bin ich nicht klug geworden. Hast du
irgend etwas über sie erfahren können?“
„Nein, Onkel. Es ist alles vergeblich geblieben. – Du weißt, Vater war
stets ein leidenschaftlicher Schachspieler. Auch unser Leben hat er
berechnen wollen, weil es für sein eigenes nicht mehr anging. Mancher
Zug mag richtig gewesen sein! Nur der Grundgedanke blieb falsch. Nach
ihm waren wir, seine beiden Kinder, willenlose Figuren. Dir ist die
Lieselotte auch lieb gewesen. Ihre Tollheiten erfrischten, ihr Liebreiz
entzückte jeden. Der Vater war sehr stolz auf sie, solange sie sich ihm
bedingungslos fügte. Sie hatten stets miteinander Geheimnisse vor mir.
Ich durfte ihr[S. 179] daher meine brüderliche Liebe nicht so voll zeigen, wie
ich sie empfand. Mußte streng mit ihr sein, denn ich wollte doch nicht,
daß sie verloren gehen sollte. – Sie fügte sich dem Vater also willig,
bis die Liebe über sie kam. Den Anfang habe ich mit erlebt. Er sang auf
der Abendgesellschaft einer reichen Frau, die sich einbildete, seine
Stimme entdeckt zu haben. – In Berlin selbst lebte er nicht dauernd,
und das machte mich ruhig. Er nannte sich Schauspieler und zog überall
umher, wo man ihn bezahlte. Einen ersten Brief fing ich ab – las ihn
und nahm sie mir vor. Sie versprach, ihn zu vergessen. Das Versprechen
hat sie aber nicht gehalten. Die kleine Lieselotte war mit einem
Schlage Komödiantin geworden.“
„Und hat Euer Vater nichts davon gemerkt.“
„Du weißt, er besitzt die Fähigkeit, Unbequemes solange zu übersehen,
wie es nur irgend angeht. Eines Tages hatte er aber seinen größten
Schachzug fertig überlegt. – Ein Millionär hatte die Lieselotte auf
einem Winterball kennen gelernt und begehrte sie. Die Anbetung des
älteren reichen Mannes hat ihr bis zu einem gewissen Grade sogar Spaß
gemacht. Als sie merkte, daß er ernste Absichten hatte, wurde sie
zuerst ängstlich, dann scheu, und schließlich energisch. Sie wollte
ihn nicht. – Es war aber bereits alles zwischen dem Vater und jenem
abgehandelt. Er hatte ihm auch eine Menge Schulden bezahlt, von
denen wir Kinder nichts wußten. Es war also seiner Ansicht nach eine
Unmöglichkeit, die Sache rückgängig zu machen. – Lieselotte hat nicht
an den Ernst seiner Drohung, daß sie sich diesmal unweigerlich fügen
müsse, geglaubt. So hinreißend lieblich sie war, ebenso unbändig,
leidenschaftlich und le[S. 180]benshungrig ist sie gewesen. Von dieser Seite
kennst du sie nicht. Hier war sie lediglich das spielerische Kind.
Allmählich wuchs sich ihr Durst nach Freiheit zu einer fast krankhaften
Gier heraus. Vielleicht hätte sie doch schließlich eingewilligt, wäre
der andere, an dessen ehrliche Absichten ich niemals glaubte – nicht
immer wieder dazwischen getreten. – Ein Lump, Onkel, in der Maske
eines bildhübschen Schlingels. – Sie blieb taub und blind. Ich habe
in jenen Zeiten täglich versucht, auf sie einzuwirken, schließlich
in jener Nacht nach den letzten, wilden Auseinandersetzungen mit dem
Vater, auch fest geglaubt, daß sie zur Einsicht gekommen wäre. –
Nach ein paar Monaten, hoffte ich, würde sich der Grimm des Vaters
und ihre eigene blinde Leidenschaft verebbt haben. Ich hatte mich
gründlich verrechnet. Am nächsten Morgen war sie verschwunden. – Du
kannst überzeugt sein, Onkel, das Menschenmögliche, um ihren Aufenthalt
herauszubringen, habe ich versucht.“
„Und der Millionär, Walter?“
„Hat umgehend seine Forderungen eingeklagt.“
„Pfui Teufel.“
„Ich glaube, als ordentlicher Geschäftsmann mußte er das tun.“
„Wie habt Ihr’s möglich machen können, Junge?“
„Es ging schon!“
„Viel Vertrauen hast du nicht zu mir gezeigt.“
„Doch, Onkel! Ich wußte zum Beispiel ganz genau, daß du helfen würdest,
wenn ich dich darum gebeten hätte.“
„Ich versichere dir, daß mir niemals eine Bitte oder Anfrage von Euch
zugegangen ist.“
[S. 181]
„Das weiß ich! Weil ich unbedingtes Vertrauen in deine Bereitschaft
setzte, durfte der Brief des Vaters, der deine Hilfe forderte, nicht
abgehen.“
„Das verstehe ich nicht, Junge.“
„Du hättest dein Geld niemals von ihm zurückerhalten und wenn er es dir
hundertmal zugesichert hätte.“
„Darum also hast du es nicht erlaubt? Ich habe dich bisher nicht
richtig gekannt.“
„Das hat mir oft genug leid getan, Onkel. Sehr gern hätte ich vieles
mit dir besprochen, was ich nun allein mit mir ausfechten mußte. Wie
sollte ich es aber ändern? Ehe ich nicht die alte Rechnung des Vaters
beglichen hatte, mochte ich das nicht anstreben!“
„Das wäre dir wirklich gelungen?“
„Ja, seit einem Monat bin ich diese Last los.“
„Aus eigener Kraft?“
„Ich glaube, ein glattes Bejahen gäbe ein falsches Bild. Mein Studium
wurde billiger, als ich es mir ausgerechnet hatte. Ein paar tausend
Mark erübrigten sich davon. Und der Rest? Weißt du, es mag einer
so viel auf Berlin schelten, wie er Lust hat. Ein Gutes bringt es
zweifellos. Erwerbsmöglichkeiten, an welche man selbst in einer
größeren Mittelstadt gar nicht denken würde. Einige, die ich benützte,
mögen nicht gerade standesgemäß gewesen sein. Daß sie durchaus
anständig waren, bedarf nicht der Zusicherung. In der Hauptsache
verdiente ich durch Repetitorien. Mir saß alles noch frisch im
Gedächtnis. Da habe ich ein halbes Dutzend Referendare zum Examen
eingepaukt. Sie schafften es und das brachte mir weitere. So ist
eigentlich nicht mal ein Wunder dabei gewesen.“
[S. 182]
„Und du meinst, daß dein Vater jetzt endlich gelernt hat, mit dem
Seinen auszukommen?“
„Bisher habe ich den Gedanken an neue Schulden nicht haben können.
Er hat ja doch gesehen, wie ich schuften mußte. Vorhin wurde ich
allerdings stutzig. Hattest du nicht auch das Gefühl, als schleppe er
an einer Last, die er überängstlich zu verbergen versucht?“
„Ich schob das auf die Erinnerung an Lieselotte.“
„Die wirkt ganz anders! Danach kommen Stunden, in denen er sich
einschließt und nachher trinkt.“
„Und das ist nun deine Jugend!“
„Meine eigentliche Jugend ist der unerschütterliche Glaube an eine gute
Zukunft.“
„Du hast eine von Herzen lieb, nicht wahr, mein Junge?“
„Nein, Onkel, noch nicht! Mir blieb zu wenig Zeit dazu, glaube ich.
Aber ich fühle, daß es eines Tages kommen wird. Und darum lebe ich
trotz allem auch gern. Ein Ziel ist da und ein fester Wille zur
Erfüllung aller Pflichten.“
„Sonderbarer Heiliger.“
„Bis heute habe ich zu keinem davon gesprochen, Onkel.“
„Das glaube ich dir aufs Wort! Siehst du, da haben wir uns nun
jahrzehntelang gekannt und ich habe doch nichts weiter von dir gewußt,
als daß du einen Jugendwunsch, von dessen Ernsthaftigkeit ich mich
allerdings überzeugt hatte, überwunden hast. Ich fand das riesig
vernünftig und die Art, in der du es tatest, hat mir gefallen, wie ich
ja schon erwähnte. – Diese eine Stunde hat gründlichere Arbeit als
die ganzen Jahre getan. Nun kenne ich dich wirklich. Weiß Gott, viel
Freude ist nie in meinem Leben ge[S. 183]wesen. Nicht mal das Ziel, das du
dir gesetzt hast, war darin vorgesehen. Nur immer der graue Alltag.
Ich habe viel Staub schlucken müssen, denn zu den Sonn- und Feiertagen
ließ ich mir nie recht Zeit. Jetzt freue ich mich und bitte meinem
Leben manches ab. Sieh hinaus. Der Mond scheint gerade hell. Die Felder
mit Stoppeln haben ihre Ernte hinter sich. Das Brachland muß ausruhen,
damit es im nächsten Jahre wieder seine Schuldigkeit tut. Sogar die
Fichtenkusseln wachsen langsam aber sicher ins Geld. – Ich hab’ bloß
immer in meinem Dasein säend geschuftet. Ohne Sinn und Verstand. Denn
für wen? Ein ekliges Geschäft, wenn man darauf keine Antwort weiß.
Jetzt wird’s anders werden. Du mußt öfter zu mir kommen, Junge!“
Einen Augenblick ruhten ihre Hände fest in einander! Das war wie ein
Schwur, obgleich kein Wort dabei gesprochen wurde.
„Und jetzt wollen wir in die Klappe gehen,“ sagte der Amtsrat wieder in
seinem alten, fast befehlshaberischen Tone, den sich ein Herr leicht
angewöhnt, der auf seinem Stück Eigenland streng nach Ordnung
sieht. – –
Walter Wullenweber konnte nicht schlafen. Hinter der weißgetünchten
Wand ruhte sein Vater und war ihm, nur durch eine dünne Verschalung
getrennt, so nahe, daß er das unruhige Umherwerfen des schwerfälligen
Körpers vernehmen mußte. Im Karpfenteich und in den sich
daranschließenden Sumpfgräben quakten die Frösche. Aus den Viehställen
sang zuweilen eine klirrende Kette.
Hinter der weißen Wand ward ein Stöhnen hörbar. Er erhärtete sich
dagegen. Mußte er nicht auch, schweigsam,[S. 184] oft genug leiden? Tief
wühlte sich sein Kopf in den verschwenderischen Reichtum der weichen
Federkissen ein. Und doch lauschten die Sinne – wider Willen – und
erlauschten, daß sich der Mann, der um keinen Preis alt und schwach
sein wollte, in Schmerzen wand. Da sprang er auf und ging zu ihm.
„Was hast du, Vater? Soll ich dir von deinen Tropfen geben?“
Der Major winkte ab. „Laß nur. Dagegen helfen sie doch nicht! Ich halte
das nicht länger aus.“
„Luft und Stille hier werden dir gut tun. Nur Geduld.“
„Dazu habe ich keine Zeit mehr.“
„Was hast du, Vater?“
„Du mußt mir helfen, Walter!“
„Sobald es Tag geworden, wollen wir nach einem Arzt senden,“ sagte
Walter Wullenweber und glaubte doch nicht, daß der hiergegen etwas
vermöge.
„Was soll mir der? Ich brauche nur dich!“
„Ich bin ja bei dir!“
„Du willst mich nicht verstehen. Da in der Tasche steckt der Wisch.“
Und Walter Wullenweber las:
„Wenn Sie innerhalb von zwei Wochen nicht Ihr mir gegebenes
Ehrenwort einlösen und das Geliehene zurückzahlen mit 7 Prozent
Zinsen, mache ich die Sache anhängig. Halten Sie mich nicht für
ganz dumm. Ich kenne Mittel und Wege, die Sie klein bekommen. Erst
im vergangenen Jahre ist einem alten Offizier ein gebührender
Denkzettel vom Ehrenrat aus ähnlichem Anlaß[S. 185] erteilt. Denn wenn
einer sein Ehrenwort bricht, so ist er nichts weiter als ein
Schuft. – – –“
„Ist das wahr, was hier steht?“
Hart und fast mitleidslos klang die Frage.
„Ja, es ist wahr! Aber –“
Walter Wullenweber ließ sich schwer auf den Schemel sinken, der
irgendwo stand. Er empfand in diesem Augenblick nichts als Verachtung
für den Mann, der ihm alles zerschlug, was er sich mühsam errang.
„Es geht mich nichts an,“ sagte er sehr langsam.
„Du willst mich nicht – retten?“
„Nein.“
„Ich soll also –?“
„Ganz recht; du sollst endlich einmal selbst tragen, was du verschuldet
hast. Ich bin nicht länger willig, mich zu opfern!“
„Es ist auch dein Name.“
„Leider! Ich werde meiner vorgesetzten Behörde unverzüglich von
dem Beschluß der deinen, sowie ich davon Kenntnis erhalte, Bericht
erstatten und tragen, was daraus für mich kommt!“
„Und wenn ich dir schwöre, daß dies das letzte Mal sein soll.“
„Ich würde keinen Glauben mehr an dich aufbringen können. Damals,
ja, da bildete ich mir ein, daß ein Mensch so etwas nicht zum andern
Mal fertig brächte. Kein Fremder einem Fremden gegenüber. Und dich
betrachtete ich damals noch als meinen Vater.“
„Soll das heißen, daß du heute – nicht mehr?“
[S. 186]
„Ja! Das wollte ich damit sagen!“
„Walter sei barmherzig.“
„Bist du es jemals gewesen? Hast du uns nicht alles zerschlagen,
Wunsch, Jugend, Zukunft?“
„Aber die Ehre, die habe ich doch hochgehalten!“
„Das bildest du dir nur ein.“
„Du bist nicht Offizier!“
„Auf meine Auffassung kommt es aber zur Zeit mehr an.“
„Wenn ich dir mein Ehrenwort verpfände, daß ich nie wieder.“
„Spare es dir! Ich lege keinen Wert darauf!“
Ein Schrei gurgelte aus dem weitgeöffneten Munde. Das Gesicht nahm eine
bläuliche Färbung an. Die Züge spannten sich. Das Kinn schob sich weit
vor. Und dann kam jäh ein sichtbarer Verfall.
„Ob das der Tod ist,“ fragte sich Walter Wullenweber und zog, wie bei
dem juristischen Aufbau eines wohlgelungenen Gutachtens die einzig
mögliche Folge aus der Bejahung: „Dann trage ich die Schuld!“
Es war aber nur ein leichter Schlaganfall, wie der aus der nächsten
Stadt zugezogene Arzt am Spätvormittag des neuen Tages feststellte.
Lebensgefahr lag nicht vor. Alle merklichen Folgen würden sich
voraussichtlich nach einiger Zeit verlieren.
Walter Wullenweber wich dem fragenden Blicke seines Onkel aus. Am
nächsten Tage rüstete er sich zur Abreise, ohne Nachurlaub erbeten zu
haben. Er fühlte, daß seine Anwesenheit den Kranken nicht förderte.
[S. 187]
„Du machst dem Futternapf meiner alten Klidderten wenig Ehre,“ sagte
der Amtsrat in der letzten Stunde zu dem Neffen. „Was ist’s denn? Hast
du mir nichts zu sagen, Junge?“
„Herzlichst zu danken. Sonst wüßte ich nichts.“
„So, ich dachte! Na schön. Warst du schon bei deinem Vater?“
„Ich stehe eben im Begriff.“
„Warte einen Augenblick. Ich begleite dich.“
Walter Wullenweber wollte eigentlich die paar letzten Minuten mit dem
Kranken allein sein. Er schwieg aber. „Vielleicht ist es besser so,“
dachte er stumpf und trat scheinbar ruhig an das Bett des Majors.
„Ich muß nun fort.“ Der Kranke wollte sich auf die Ellbogen stützen, um
sich ein wenig emporzuringen. Es gelang aber nicht.
„Ich gebe dir mein Wort, daß alles anders werden soll. Willst du mir
nicht die Hand reichen, Walter.“
Ein kurzes Zaudern. Dann reichte sie ihm der Assessor hin. „Werde
gesund, Vater!“
Da weinte Major a. D. von Wullenweber die ersten Tränen, seitdem ihm
das von dem ungeschickten Schützen geschehen war.
Eine Woche später erhielt er Nachricht von seinem Sohne.
Lieber Vater! Heute nur kurz die Mitteilung, daß ich von meiner
Behörde den Abschied aus dem Staatsdienst erbeten habe, um, sobald
er mir erteilt sein wird, bei Justizrat Weißgerber, mit dem ich
bereits einig bin, einzutreten.
Teile es auch Onkel mit. In Eile
Dein Walter.
[S. 188]
Als auch der Amtsrat den Inhalt kannte, schlug er mit der Faust auf den
Tisch.
„Und das erfahre ich erst heute? Was hast du denn wieder angestellt?
Konntest du wenigstens deinen Mund nicht rechtzeitig aufmachen, damit
dies verhindert wurde?“
Da erzählte der Major das Hauptsächlichste. Das Fehlende dachte sich
der andere schon hinzu.
„Wieviel wars denn zum Kuckuck?“
„Viertausend Mark!“ gestand der Major zerknirscht.
„Und wofür? Für Lumpereien natürlich!“
Das Nationaltheater hatte seinen großen Tag. Die Aufführung des ersten
Aktes des „Parsifal“ war vorüber. Die Reihen lichteten sich. Es
strömte die Stufen hinab, die in den Garten des Theaters führten. Auf
den meisten Gesichtern lag noch die Andacht des Weihespiels. Einzig
eine Frauengestalt hatte ihren Stuhlplatz inne behalten und saß mit
zusammengelegten Händen. In ihr zitterten die heiligen Klänge nach:
„Selig im Glauben.“
Zwei Herren waren, abseits des flutenden Menschenstromes, stehen
geblieben und sahen zu ihr hinüber.
„Sie haben vor Beginn im Erfrischungsraum mit ihr gesprochen, Kurtzig,“
sagte der Jüngere, „kommen Sie, wir gehen jetzt zu ihr.“
„Das wage ich nicht, Baron Alvensleben. Sie wissen, wer einen
Gottesdienst stört, muß eines Strafbefehls gewärtig sein.“
Der alternde Meister schüttelte den Kopf.
„Sie steht doch aber in der Oeffentlichkeit, mein Lieber!“
„So – tut sie das? Ich dachte, wir wären uns gestern Nacht nach ihrem
Konzert gerade darüber einig geworden, weshalb sie an der Laufbahn
einer Bühnensängerin vorbei, in der musikalischen Welt Berlins in der
Hauptsache als[S. 190] erste Bildnerin verheißungsvoller Stimmen gilt und sich
nur selten zu einer Konzertreise versteht.“
„Gott ja, gestern Nacht! Inzwischen habe ich darüber nachgesonnen und
muß gestehen, daß mir die Aufgabe, sie umzustimmen, sehr verlockend
erscheint.“
„Sie sind nicht der Erste, der das erkannt und auch versucht hat,
Baron.“
„Vielleicht aber der erste Leiter einer hocheingeschätzten Oper, der
willig ist, sie sogleich in seinen Verband zu übernehmen.“
„Auch diese Freude muß ich Ihnen leider zerstören. Vor einem halben
Jahre, als sie noch lange nicht so weit wie heute gekommen war, machte
bereits Ihr Kollege Spartenberg denselben recht energischen Versuch.“
„Sie kennen sie länger, Kurtzig?“
„Ungefähr fünf Jahre.“
„Da werden Sie auch um die Gründe wissen? Sie kennen auch mich. Ich bin
verschwiegen. Was käme da in Betracht?“
„Da fragen Sie mich zu viel, Baron.“
„Vielleicht erblich belastet?“
„Möglich! Die Mutter, nach dem Bilde zu urteilen, war eine Schönheit!
Der Vater soll ein flotter Herr gewesen sein, der ihr nichts als
Schulden und den alten Namen hinterließ.“
„Verdreht,“ sagte Baron Alvensleben, „aber hören Sie, versucht wird es
dennoch. Wenn nicht jetzt, ganz bestimmt am Schlusse. Wenigstens ein
Plauderstündchen im Parkhotel mit ihr.“
[S. 191]
„Schön! Machen Sie sich das Vergnügen! Sie können sich meinetwegen als
Zeuge ihrer gestrigen Triumphe einführen. Nur, sagen Sie ihr nichts von
unserer Bekanntschaft.“
„Na nu!“
„Ja, Baron. Sie vertraut mir voll und ich möchte nicht, daß dies jemals
anders würde. Kein Mißverstehen, Ihr Lächeln ist unangebracht. Die
Kunst kann, wie wir soeben festgestellt haben, sehr rein sein. Der
Künstler in mir freut sich an ihr, ringt um die Erhaltung ihrer Gunst,
zollt ihr neidlos die verdiente Anerkennung.“
„Das haben Sie mir gut gegeben, Kurtzig. Ich nehme es Ihnen nicht übel.
Kommen Sie. Nein, nicht in den Prunksaal. Sehen Sie, da schreit der
Unterschied zwischen Bayreuth und München. Die Aufführung verspricht
auch diesmal ganz hervorragend zu bleiben. Nur das Drum und Dran
ist’s, was hier nie erreicht wird. Die Weihe fehlt. An Kosimas
Brandaugen vorbei schlich man sich dort während der Pausen, trunken
vor Begeisterung in das sanfte Grün eines wirklichen Götterhains und
entheiligte sich nicht, bis die feierlich rufenden Tubenklänge wiederum
erbrausten.“
Ganz einsam saß Eva von Ostried in dem weiten Raume. Sie war auf vier
Tage nach München gekommen, um im Anschluß an die beiden Konzerte,
in denen sie sang, den „Parsifal“ vor allem zu hören. Nun hatte die
Musik alles Schlafende in ihr wachgerüttelt. In Berlin konnte sie
es zurückschieben in das Dämmern eines dauernden Halbschlummers.
Während sie bereits seit Jahresfrist lehrte, vernachlässigte sie das
Selbstlernen nicht. Ihre Zeit war[S. 192] dadurch mit jeder Stunde, ja, mit
jeder Minute, im voraus berechnet. Hier ruhte sie aus.
Aber überwand sie jetzt auch die Schatten, bezwang sie alle Gedanken,
indem sie sich zu der Menge begab, zum Einschlafen brachte sie sie
nicht wieder. Sie würden sich zwischen ihre Empfindung und die
Gestaltung der nächsten Aufzüge drängen und ihr nichts hinterlassen
als das bittere Gefühl, plötzlich vor der verschlossenen Pforte zum
Allerheiligsten zu stehen. Darum ließ sie sich willig von ihren
Gedanken zwingen.
Wie war es doch damals gewesen, als sie die Villa der toten Präsidentin
verließ? – Sie hatte sich eine kleine Wohnung genommen. Wirklich in
guter Gegend. Und eine Bedienung, die in jeder Beziehung ausgezeichnet
für sie sorgte, war auch schnell gefunden, weil sie mit dem Entgelt
nicht kargte. Dann kamen die Lehrer an die Reihe. – Die allerersten.
Ralf Kurtzig blieb ihr treu, wie sie ihm. Seine Gegenwart war ihr
ständig mit einer Feier verbunden, die sie wunderbar für die nüchternen
Arbeitsstunden des Unterrichts stärkte. Ohne das gesteckte Ziel jemals
zu verlieren, schritt sie weiter. Das Ziel, auf Heller und Pfennig
einst zurückzuerstatten, was – –
Jede neubeginnende Woche bestimmte sie zum Beginn des Zurücklegens. Es
wollte aber immer noch nichts damit werden.
Sie wurde erschreckend mager, nervös und hilflos. Denn ihre Nächte
hielten tausend Rächer für die durchhetzten, gedankenlosen Tage
in Bereitschaft. Der Inhalt der kleinen schwarzen Handtasche nahm
merkwürdig schnell ab. Es kostete alles noch viel mehr, als sie
berechnet hatte. Von[S. 193] den zwölftausend Mark hatte das erste Jahr mit
seinen zahlreichen Anschaffungen die Hälfte verbraucht. Nach dieser
Feststellung änderte sie auch ihren Lebensplan. Bis dahin sah sie
Unterrichtsstunden lediglich als eine Hilfsquelle an. Jetzt stellte
sie nach Rücksprache mit ihren Lehrern fest, daß bis zum ersten
Geldverdienen als Opernsängerin noch eine geraume Zeit vergehen
mußte. Denn als abgeschlossen konnten sie die Ausbildung ihrer Stimme
vorläufig noch nicht bezeichnen.
Und danach?
Sie zweifelte nicht daran, daß ihr die breite Oeffentlichkeit mit
Huldigungen und Beifall danken würde. – Ob sich aber auch in gleichem
Maße die Gagen einstellen würden? – Toiletten würden nötig werden, die
erschreckend viel kosteten, wenn nicht ein anderer sie bezahlte.
Auch jener andere hatte sich zur Verfügung gestellt. Paul Karlsen,
der sich aus den Berichten seiner ahnungslosen Frau die Zusammenhänge
leicht aufbaute, fand sie schnell und flehte um ihre Vergebung. Als Eva
von Ostried ihm für immer die Tür gewiesen, wußte sie, daß das Blut
ihrer Mutter in ihr stärker geworden, als dasjenige ihres Vaters. Auf
der einen Seite lockte ein Erfolg, wie sie ihn niemals auf der andern
erwarten durfte.
Knie beugten sich vor ihr! Hände haschten nach dem Saum ihres Gewandes.
Geld und Schmuck leuchteten. Lorbeer duftete. Und sie hielt es für
unmöglich, zu entsagen! Aber aus dem wirren Hetzen der Gespenster rang
sich eine Aussicht zum Frieden durch: Gutmachen!
Es war schwer, wenn nicht unmöglich! Und der heimliche Fluch würde
weiter lasten. Vielleicht, daß ihn der[S. 194] Beifall einer dankbaren Menge
– die Leidenschaft eines Einzelnen für Stunden abnahm?
Und wiederum danach? – Was sind Stunden im Vergleich zu Jahren –
Jahrzehnten?
In jener Zeit der härtesten Kämpfe klopfte eine blutjunge, blasse
Verkäuferin an ihre Tür. Sie hatte Eva von Ostried singen hören und
wußte seit diesem Augenblick mit dem feinen Gefühl der Ringenden, daß
jene eine Gottbegnadete war. – Fast weinend vor Verlegenheit und
Erschrecken über ihre Kühnheit hatte sie ihre Bitte vorgetragen.
„Helfen zum Aufstieg!“ – Retten aus dem Schlamm, der schon ihre Füße
netzte.
Eva von Ostried war voller Mitleid gewesen, obwohl sie nicht an die
Berufung dieses blassen Kindes zur Kunst glaubte. Warum sollte sie sich
aber kein kleines Liedchen von ihr anhören? Summte ihre Köchin nicht
auch beständig.
Das kleine Lied aber war zur Offenbarung eines großen Talents
geworden! Die schmale Verkäuferin schied mit dem Strahlen eines sie
überwältigenden Glücksgefühls. So kam Eva von Ostried zu ihrer ersten
allerdings nicht zahlungsfähigen Schülerin, und erlebte, wie diese
wuchs und strebte, wie Schlacke um Schlacke abfiel und das Edelmetall
alle Tage herrlicher hervorleuchtete. Sie würde es wohl auch noch
erleben müssen, wie jene einst von sich reden machen, Bewunderer haben,
die Menge hinreißen würde, während sie selbst nichts weiter war als
deren Förderin und Schleiferin.
[S. 195]
„Der Uebel größtes aber ist die Schuld!“ Davor gab es keine Rettung!
Einzig, wenn sie der Schar ihrer beständig wachsenden Schüler dienend,
sich selbst und die zuckenden Wünsche immer aufs neue überwand,
fühlte sie Ruhe, die fast dem Frieden gleichkam. Und doch blieb es
nur ein Scheinfrieden! An der Empörung ihrer Lehrer, als sie ihnen
den Entschluß bekannt gab – an jedem Blicke offenkundiger Huldigung,
der ihr gezollt wurde, empfand sie die unerhörte Härte ihres Opfers.
Unzählige Mal war eine Umkehr von ihr beschlossen. Und dann mußte der
leidenschaftlich gefaßte Vorsatz doch unter dem Vernichtungsfeuer der
Gewissensangst verbrennen!
Sie hatte nicht gewagt, jenes Geld aus dem Hause zu geben. Konnte die
Bank nicht nach seiner Herkunft forschen und sie entlarven?
Noch bevor die Tubenklänge die andächtige Gemeinde zurückgerufen
hatten, begann sich der Zuschauerraum zu füllen. Eva von Ostrieds
Blicke wurden plötzlich von etwas Flammenden gefesselt. In dem
brandroten Haar einer üppigen Erscheinung glühte ein Halbmond
köstlicher Edelsteine auf. Sie empfand den Anblick des auffallenden
Schmuckes an dieser Stätte als etwas Ungewöhnliches. Ernst und
feierlich, wie zum Tisch des Herrn waren die meisten erschienen. Es
reizte sie, nun auch das Gesicht unter dem lohenden Haar zu sehen.
Die leuchtend weiße Haut, der stark sinnliche Mund, die unnatürlich
schwarzen dichten Brauen kamen ihr bekannt vor.
Das war doch eine im Palasttheater beschäftigte Soubrette, die für
kurze Zeit ihre Flurnachbarin gewesen! –[S. 196] Und ihr Begleiter? Denn
immer wieder neigte sie sich in eifrigem Tuscheln zu dem schlanken
Nachbar hinüber. – Paul Karlsen!
Ein Wort von ihm – nahe an ihrem Ohr geflüstert – ließ sie
zusammenfahren. „Dummerchen!“ War das zu der andern gesagt
oder belustigte er sich über ihre Zurückweisung, sie als etwas
unbeschreiblich Albernes und Törichtes verhöhnend? Dann lachten beide.
Lachten sie etwa gemeinsam über sie? Hatte er ihr von jener Stunde
erzählt, die sie neben ihm in seinem Musikzimmer verbrachte oder die
Komik jener andern geschildert, die sie zum Hüter seiner ehelichen
Treue machen wollte? –
Ihr schossen die Tränen der Empörung in die Augen. Zum ersten Male
spürte sie ein starkes Verlangen nach einer Hand, die sie an diesem
allen vorüber, in die Stille und Klarheit führen und dort festhalten
würde.
– – Karfreitagsehnen! Unbeschreibliches Verlangen nach Glück und
Frieden! Heiligste Verzückung! Lossprechung von aller Schuld! Sei
heilig!
Der Lichtschein aus der Höhe erfüllte den Gral mit hellstem Erglühen.
Die Andacht war vollendet!
Eva von Ostried ahnte nicht, daß sie tränenüberströmt, in zitternder
Ergriffenheit fassungslos auf den sich langsam senkenden Vorhang
starrte. Sie merkte erst, daß sie gehen müsse, als sich leise eine Hand
nach der ihren tastete.
„Kommen Sie, Kind. Sonst sperrt man die heiligen Tore zu.“
„Sie sind’s, Meister?“ Zutraulich schob sie ihren Arm unter den seinen.
„Jetzt gehen wir ein wenig an den Hildebrand-Brunnen, ja?“
[S. 197]
Er wäre gern dorthin und überall weiter in dem weichen, fließenden Grau
dieser Dämmerstunde mit ihr gewandert, aber ein Dritter war plötzlich
neben ihnen und ließ sich nicht wegschieben.
„Baron Alvensleben!“ bequemte sich Ralf Kurtzig endlich seinen Namen
zu nennen. – Nun waren sie zu Dreien! Es war kein Zauber mehr dabei.
Alles sah nüchtern und verwaschen aus, denn der Regen rieselte leise
aus der Luft herab. Das gewahrte Eva von Ostried erst jetzt.
„Wir wollen uns möglichst schnell ins Parkhotel begeben,“ schlug der
Baron vor, als sei es ganz selbstverständlich, daß sie für den Rest
dieses Tages zusammenblieben. „Ihnen ist es doch recht, gnädiges
Fräulein? Ich habe einen kleinen Tisch am offenen Fenster bestellt. Die
Anlagen des Maximilianplatzes sind in diesem Jahre besonders schön.“
Sie sah bittend zu Ralf Kurtzig hinüber.
„Nicht wahr, ich vertrage nach solcher Musik keine fremden Menschen?“
Baron Alvensleben lachte leise. „Empfinden Sie mich etwa als fremd?
Mir sind Sie eine liebe Bekannte – seit vorgestern und gestern her.
Ich hörte Sie zweimal. Ihre Schubertlieder am ersten Abend waren
eine wundervolle Leistung, hinter welcher die sonst recht saubere
Kunstfertigkeit des Violinisten leider abgrundtief versank. Am
künstlerisch wertvollsten freilich faßten Sie am zweiten Abend das
Lied der Carmen auf, wie Sie ja auch mit dem hinreißenden Glanz und
der einzigen Wärme Ihrer Stimme der Bühne und nicht dem Konzertsaal
gehören.“
[S. 198]
Er tat, als merke er ihr Zusammenzucken nicht. Heimlich aber freute er
sich daran und pries die gründliche Kenntnis von der Beeinflussung auf
die Künstlerseele.
„Aha, der Köder lockt schon. Alter, guter Kurtzig, wir kennen doch den
Rummel,“ dachte er dabei. Er glitt klug und geschickt, als sei dies
nichts anderes, als eine bedeutungslos gemeinte Feststellung gewesen,
zu ihren Liedern zurück. Sie war ein seltener Vogel. Scheu – trotzig
und unsäglich empfindlich. Das fühlte er deutlich. Bestimmt eine, die
einen Regisseur zur Verzweiflung bringen konnte, daneben aber auch das
liebe Publikum vor Wonne rasen machend.
„Von wem stammte übrigens das kleine Lied, das Sie als Zugabe sangen,“
fragte er weiter. „Die Liederfolge verriet den Komponisten nicht. Die
drei Sternchen an Stelle des Namens pflegen sonst zu einem gewissen
Mißtrauen zu berechtigen. Diesmal nahm bei aller Schlichtheit die
Originalität der führenden Melodie stark gefangen.“
„Den Komponisten vermag ich nicht zu nennen,“ gestand Eva von Ostried,
„das kleine Lied hat eine eigene Geschichte.“
„Die Sie am offenen Fenster erzählen werden, ja,“ bat er mit einem
knabenhaft fröhlichen Blick.
„So lang, daß sie nicht zuvor beendet sein dürfte, ist sie nicht, Herr
Baron. – Ich saß eines Tages in einem Berliner Café und fand auf dem
Platze neben mir ein mit Noten bedecktes Blatt, augenscheinlich erst
ein Entwurf, denn es war viel ausgestrichen und verbessert. Ich nahm’s
mit nach Hause. Und seither singe ich es jedesmal als Zu[S. 199]gabe. Die
Wirkung, die es zuerst auf mich ausübte, ist die gleiche geblieben.“
Sie waren sehr schnell vorwärts gegangen. Ohne, daß Eva von Ostried
früher etwas davon gemerkt, standen sie vor dem Parkhotel. Mit einer
abwehrenden Bewegung wandte sie sich zur Umkehr.
„Jetzt wäre es geradezu eine Beleidigung, wollten Sie uns verlassen,“
sagte Alvensleben entrüstet.
„Ich begreife nicht, was Ihnen an meiner Gesellschaft liegen kann, Herr
Baron? Mir wäre es jetzt eine Qual in einem besetzten Raume zu sitzen,“
sagte Eva. „Das können Sie sicher am besten begreifen, Herr Baron. Der
Regen hat aufgehört. Ich gehe zum Hildebrand-Brunnen. Wenn Sie beide
mich dort später noch aufsuchen wollen, sollen Sie mich schon finden.
Ein Stündlein bleibe ich bestimmt.“
*
„Warum sind Sie so schweigsam, Kurtzig,“ fragte der Baron, als sie
sich endlich unter dem geöffneten Fenster gegenüber saßen. „Sie sehen
doch, ich ärgere mich auch nicht, obgleich mir eine ähnliche Abfuhr
noch nicht vorgekommen ist. Wer mag wohl der Glückliche sein, der sie
irgendwohin an ein Tischlein-deck-dich führen darf?“
„Es fällt ihr nicht ein, sich an den ersten besten zu hängen.“ Ralf
Kurtzig erwiderte das in einer ihm sonst fremden Gereiztheit.
„Aber bester Meister, wer traut ihr denn eine Geschmacklosigkeit zu?
Sicher ist er ein Auserwählter. Ob Adonis oder Künstler – oder gar
beides vereint – das wage ich nicht zu entscheiden. Sie werden ihren
Geschmack besser kennen.“
[S. 200]
„Ihr Herz hat bestimmt noch nicht gesprochen.“ Das klang nicht mehr so
sicher, wie das erste Mal. In der Stimme lag ein gequälter Ton, der den
Baron aufhorchen ließ. Er kniff das linke Auge zu und hob spähend das
gefüllte Glas empor.
„Wenn Sie das genau wissen – und Sie waren ja stets ein sehr sicherer
Beobachter – ja, warum zögern Sie dann noch, alter Freund?“
Ralf Kurtzig fuhr jäh zurück.
„Ich verstehe Sie nicht, Baron. In dieser Sache vertrage ich keinen
Scherz.“
„So tief sitzt es schon! Dann beeilen Sie sich gefälligst, ehe Sie zu
spät kommen. Eine Stunde Bedenkzeit hat sie Ihnen gegeben und zu einer
Verlängerung dürfte sie sich kaum verstehen.“
„Ich verbitte mir alles weitere in dieser Sache.“ Der alternde Meister
war so hastig aufgestanden, daß er dabei sein Glas vom Tische stieß.
„Kurtzig, machen Sie keine Geschichten. Sie werden doch wohl von einem
guten Freund eine harmlose Neckerei vertragen? Wozu hätte ich meine
gesunden Augen? Sie hängt augenscheinlich sehr an Ihnen, kennt Sie
durch verschiedene Jahre, lächelt Ihnen zu, strahlt Sie an. Herrgott,
was ist denn dabei? Haben wir nicht schon ganz andere Sachen erlebt?
Denken Sie an den alten Dresdner Amfortas aus den achtziger Jahren und
seine jugendschöne kaum zwanzigjährige Gattin, die Heroine des W.’r
Stadttheaters.“
„Ich bin ihr Lehrer, vor dem sie – genau wie meine andern Leute –
zittert und bebt.“ Es klang schon milder.
[S. 201]
„Wenn Sie das sagen, wird es ja wohl stimmen. Mir scheint, das Zittern
und Beben liegt reichlich lange hinter Euch beiden, was?“
„Ich habe Anteil an ihrer Entwicklung – Freude an ihrer Kunst und
Schönheit. Es fällt mir nicht ein, das zu bestreiten.“
„Na, sehen Sie wohl.“
„Mehr aber nicht!“
„Wozu das betonen. Lassen Sie. Wenn es uns noch hascht, will die Scham
kommen und einen großen Zorn daraus brauen. Dabei, großer Gott! Was hat
das Altwerden mit der Abkühlung der Gefühle zu schaffen? Die bleiben
nicht nur. Nein, sie werden stärker und klarer, wie alter Wein, der
doch auch den begehrtesten Rausch bringt. Danach gibt’s keinen Jammer.
Fahren Sie nicht auf. Wer ihn kennt, wirklich kennt, der zieht ihn
dem Most und dem feurigsten Heurigen allemal vor. – Und nun die Hand
her, alter Sturmgeselle. Dafür darf keine Scham auf Lager sein. Das
Einzige, was Sie bewegen kann, wäre ein großer und gerechter Stolz. Ich
streite nicht mal ab, daß mir ein Neidgefühl hochsteigen wollte. Sehen
Sie, so ehrlich bin ich Ihnen gegenüber. Und nun Schluß damit. Wenn
wir mit dem Essen fertig sind, mache ich noch einen Spaziergang an der
Isar entlang. Vielleicht allein. Vielleicht auch nicht. Aber auf Ihre
Begleitung rechne ich nicht. Sie gehen ja wohl nachher noch ein bißchen
an den Hildebrand-Brunnen?“ – – –
Ralf Kurtzig spürte eine wohlige Wärme durch seine Adern glühen. Der
Wein war gut. Und schließlich – der[S. 202] Alvensleben ein anständiger Kerl,
von dem man sich auch mal eine kleine Entgleisung gefallen lassen
konnte.
War’s denn überhaupt eine?
Sie sprachen jetzt eifrig von dem Winterspielplan, den der Baron
schon bestimmt hatte. Ralf Kurtzig hörte ihm nur scheinbar aufmerksam
zu. Seine Blicke irrten durch das geöffnete Fenster und suchten den
Brunnen. Er saß träumerisch da und nahm kaum etwas von den Speisen.
„Dann trinken Sie wenigstens, Kurtzig.“ Und der Baron schänkte
ihm fleißig ein. Dabei lag das wissende Lächeln eines, dem die
Frauen keinerlei Ueberraschungen mehr bestreiten können, um seinen
glattrasierten Mund. Mit dem verwöhnten Auge des Feinschmeckers kostete
er die zunehmende Spannung in den geistvollen Zügen des ihm gegenüber
Sitzenden behaglich aus. Er hatte doch stets das richtige Gefühl. Schon
gestern kam ihm die Gewißheit, daß es nur eines Fünkchens bedürfe, um
den Brand dieser späten Leidenschaft zu entzünden. Und dieser Funke
war gefallen. Weiterer bedurfte es nach seiner Erfahrung nicht mehr.
Ralf Kurtzig fühlte sich heiß, jung und sehnsüchtig. Und daran trug der
schwere Oberungar den Löwenanteil.
„Ich denke, wir sind jetzt voll befriedigt,“ sagte er und ließ die
Augen schärfer in die Ferne spähen.
Bereitwillig erhob sich der Baron.
„Das ist auch meine Ansicht. Man soll dem kühlen, grauen Tone dieses
Abends etwas Rot auflegen. Besorgen wir das also.“
Vor dem Eingang des Hotels trennten sie sich. Ohne zu zaudern setzte
Ralf Kurtzig seinen Weg in der Richtung auf den Hildebrand-Brunnen
fort. Erst nach einigen Minuten[S. 203] blieb er stehen, riß den Hut herunter
und ließ sich die müde, schwere Spätsommerluft um die Stirn gehen.
Was hatte er vor?
Es zuckte in seinen Armen, als wolle er Lasten heben und in die Lüfte
emporwerfen. Seine hohe, edel geformte Stirn wurde flammend rot.
Er war ein Narr! Hundertmal war er zu diesem Mädchen gegangen – hatte
auch wohl seine Hand gehalten – Rat erteilt – gescholten – und jetzt
plötzlich? Der Wein war schuld!
Er hatte es im Untergefühl, daß sie schließlich nur ihn auf der Welt
besaß, wenn sie auch noch niemals mit einander darüber gesprochen
hatten. Zuerst war es das Verhältnis zwischen Lehrer und Schülerin,
später dasjenige eines Vaters zur Tochter, eines Freundes zur Freundin.
Noch einmal, Ralf Kurtzig, du bist ein Narr!
Aber wahr blieb’s trotzdem, daß der sechzigjährige Amfortas mit der
Zwanzigjährigen über alle Maßen glücklich geworden war. Noch ein
rosenrotes, dufterfülltes Spätglück.
Warum sollte es also ihm unmöglich sein? –
Was denn? Keinen Schritt weiter. Nicht zum Hildebrand-Brunnen. Nicht
den Wahnsinn einer Stunde in das Leben einer tragen, deren einziger
Freund und Schutz er werden durfte. Sich selbst nicht zum Bettler
machen.
Und doch ging er weiter.
Da saß sie. Zusammengekauert. Verträumt. Er sah ihre Hände. Weiß und
zart hoben sie sich von den Spitzen ihres Kleides ab. Und jetzt winkten
sie ihn heran. Da war er neben ihr und nahm an ihrer Seite Platz.
[S. 204]
Ihre Augen leuchteten voller Glanz. Der leichte Schleier war
verschwunden. An ihren dichten langen Wimpern hing eine Träne.
„Warum haben Sie geweint,“ fragte er und wußte nicht, daß in seiner
Stimme die Leidenschaft zitterte. Sie hörte den Klang und wunderte
sich. Er war ihr fremd.
„Ich fühlte mich sehr einsam, aber dann habe ich mich auf Sie freuen
müssen,“ sagte sie dankbar.
„Auf mich?“ Wie ein Rausch stieg es von seinem wildpochenden Herzen zum
Hirn empor. Der Wein trug die Schuld. Nein, die weiche, graue Luft.
„Auf mich?“ fragte er noch einmal.
Sie nickte ihm zu und legte ihre Hand auf die seine. – Da lag sie.
Nicht zu berühren wagte er sie, obgleich alles in ihm danach schrie,
sie mit glühenden Küssen zu bedecken.
„Was wäre ich ohne Sie,“ fragte sie leise und weich.
Ist er ein Narr? Starr und steif saß er neben ihr. Ihre Hand war bei
einer hastigen Bewegung von der seinen herabgeglitten und hing nun –
matt und verlassen – zwischen ihm und ihr.
Der Brunnen plätscherte. Irgendwo durchschnitt das sanfte Dämmergrau
ein kleines funkelndes Licht. War das schon das Rot, von dem
Alvensleben gesagt hat? Seine Stirn wurde feucht. Mühsam erhob er sich.
„Ich muß fort.“
„Meister, was ist Ihnen? Habe ich Sie verletzt?“ In ihrem Ton lag tiefe
Traurigkeit. Da blieb er neben ihr.
Und plötzlich. – Er war nicht länger Herr über sich. Er hatte ihre
beiden, weichen, weißen Hände an sich gerissen und an sein Herz
gepreßt.
[S. 205]
„Hörst du das schlagen? Für dich! – Für dich!“
Sie wurde unruhig, obwohl sie den Wechsel in seinen Stimmungen kannte.
„Was haben Sie, Meister? Sind Sie krank?“
„Was mir ist? Fühlst du das nicht?“
Er hat sie „Du“ genannt. Wie seltsam. Früher hatte sie sich das
brennend gewünscht. Heute ängstigte es sie.
„Fühlst du meine Liebe nicht? Ich kann sie nicht länger verbergen. Ein
Jahr ist lang. Seitdem weiß ich es schon und habe dagegen gerungen. –
Nun geht’s nicht mehr. – Werde mein Weib!“
Sie starrte ihn fassungslos an. War er irre geworden? Er sprach weiter,
ohne ihre Antwort abzuwarten.
„Du gehörst mir ja schon längst mit jedem deiner Gedanken. Weißt du das
nicht?“ Sie fühlte seinen heißen Atem – das Nähern seiner Lippen und
wurde von einer wilden Angst, von einem Entsetzen emporgerissen. – –
„Ich kann nicht! Ich kann nicht!“
Er wollte sie küssen. Wild wehrte sie sich und stieß nach ihm, nach
ihrem geliebten, verehrten Meister, dem einzigen Menschen, dem sie voll
vertraut hatte. Er fühlte den Stoß und sah das aufsteigende Grauen in
ihren Augen – taumelte zurück, sah sie irre an und stammelte etwas.
Was? Sie verstand es nicht. Sie sah nur, daß er von ihr ging.
Nun hatte sie Keinen mehr auf der Welt!
Ein ganzes langes, reiches Leben umsonst gelebt! Den angestrebten
Daseinszweck verfehlend – nichts anderes in ihren Augen als eine Beute
wahnwitziger Lächerlichkeit!
Er konnte ihr nach diesem nie wieder begegnen. Das stand in ihm fest.
Eva von Ostried war in ihr Hotel zurückgekehrt. Hastig wollte sie die
Treppe emporeilen, da winkte das Fräulein aus der Buchhalterei ihr
durch das herabgelassene Schalterfenster zu.
„Ein Herr hat schon zweimal nach Ihnen gefragt. Jetzt wollte er sich
nicht wieder fortschicken lassen. Er wartet auf dem Gang vor Ihrem
Zimmer. Es war nichts dagegen zu machen.“
Eva von Ostried war sehr müde. Jeder Schritt wurde ihr schwer. „Wer
kann das sein,“ dachte sie ohne sonderliches Interesse.
Es war ein ihr gänzlich Fremder, klein und beleibt, im Aeußeren
elegant, der Anzug von modernstem Schnitt, Wäsche und Schlipsnadel
leuchteten um die Wette. Nur seine Hände paßten nicht dazu, die sich,
dicht behaart und mit kurzen, dicken Fingern und ungepflegten Nägeln
ihr wie freundschaftlich entgegen streckten.
[S. 207]
„Sakra, das hat lang gedauert, meine Gnädigste.“
Sie wich einen Schritt zurück. Ihr fiel es nicht ein, ihre Hand zu
heben. „Ich wüßte nicht, daß ich eine Verabredung mit Ihnen getroffen
hätte,“ entgegnete sie kühl.
Der Wohlbeleibte schien indes ihre Zurechtweisung nicht zu empfinden.
Er sah sie in strahlender Zufriedenheit an.
„So unschlau würden’s doch auch net sein,“ sagte er mit gutgespielter
Treuherzigkeit. „Wer zuerst kommt, tut halt auch zuerst mahlen, net
wahr?“
„Der heutige Tag war sehr anstrengend für mich. Bitte fassen Sie sich
kurz.“
„Sie werden schnellstens wieder aufg’lebt sein, Gnädigste. Ich hab
nämlich grad kei Kartl zur Hand. Mei Name ist Alois Sendelhuber.
Gnädigste wird schon meinen Namen g’hört haben.“
„Nein,“ sagte Eva von Ostried und betrachtete die klauenartig gebogene
Hornkrücke seines kräftigen Stockes, die wenig zu dem eleganten andern
passen wollte.
„Sollt’ man’s glauben? Mei kloans G’schäfterl hat sonst a guten Ruf.“
Eva von Ostried meinte endlich zu begreifen. Vielleicht war er gestern
oder vorgestern in ihren Konzerten gewesen und sprach nun das, was der
Kollege von der Geige ihr zart anzudeuten wagte, in schöner Offenheit
aus.
„Ich brauche gar nichts, Herr Sendelhuber. Danke vielmals für Ihre
Bemühung. Berlin, wohin ich mich morgen zurückbegebe, versorgt mich
schon ausreichend.“
Sein Gesicht wurde plötzlich unendlich schlau und vergnügt.
[S. 208]
„Auch kein neues Konzört-Angaschemang, meine Gnädigste?“
„Wie sagten Sie,“ fragte Eva von Ostried auflauschend und blitzschnell
überlegend, daß sie jetzt Geld verdienen müsse und dies am ehesten
durch Konzerte vermöchte. Ja, das wäre schön. Da kämen neue Einnahmen
zusammen und der Zeitpunkt der ersten ruhevollen Nacht würde näher
gerückt. Die weiche Wölbung seines mächtigen Bauches begann sich mit zu
freuen.
„Gelt’s, da spitzens? Also, wollen wir nun ’n eingehen. Wenn’s g’fällig
ist.“
Sie saßen sich in dem geräumigen Zimmer mit der geschmacklosen
Ausstattung der Dutzendräume gegenüber.
„I hätt für den November Neigung,“ meinte er und blätterte in seinem
nicht ganz saubern Notizbuch. „Den Ersten, Fünften und Neunten –“
„Den Neunten bin ich bereits versagt, Herr Sendelhuber.“
„Schad’t nix. Sagen Sie wo und bei wem, das andere mach i halt scho.
Kleinigkeit.“ Sie sah kühl und sehr hochmütig aus.
„Das gibt es bei mir nicht. Was ich versprochen habe, wird auch
erfüllt.“
„S’ sind halt noch a Anfangerin. Ach i über dö damische Konkurrenz weg,
mach i scho das G’schäft für uns zwei beid’. Also den Ersten, Fünften
und Neunten hab i g’sagt. Am Erst und Fünften hier, wo man Sie bereits
kennen tut. Am Neunten in Nürnberg. Und die Einnahm’? Wir teilen’s
halt!“
„Nein, das genügt mir nicht.“
[S. 209]
„Schauens – schauens!“ sagte er nachdenklich und begann zu rechnen.
Sie saß ganz still und mußte denken, was ihr Ralf Kurtzig jetzt wohl
raten würde.
„Unter zwei Drittel für mich tu ich’s auf keinen Fall, Herr
Sendelhuber.“ Dann zogen sich ihre Brauen zornig zusammen. Warum griff
sie nicht sofort zu? – Ralf Kurtzig hätte seinen Vorschlag für den
Anfang durchaus annehmbar gefunden? Ihm beugte sie sich schließlich
und sagte unsicher, noch ehe Herr Sendelhuber mit dem Rechnen zu Ende
gekommen war.
„Schön, meinetwegen, für diesmal die Hälfte.“
Sofort stellte sein Stift die emsige Arbeit des Zahlenmalens ein.
„’s is auch klüger. Sie stehen sich, im Vertrauen, bei der Hälft’
besser!“
„Also ein kleiner Gauner,“ dachte sie und äußerte doch nichts
dergleichen. Sie wollte plötzlich vor allen Dingen möglichst schnell
einen guten Ruf als Konzertsängerin haben und dazu brauchte sie solche
Leute. Denn unter den verschiedenen Abschriften alter Verträge, die er
ihr als Beweis seiner Tüchtigkeit und Beliebtheit vorlegte, befanden
sich lauter gute, bekannte Künstlernamen.
Er schrieb bereits auf einem umfangreichen Bogen.
„Also am Ersten, Fünften und Neunten. So war’s doch? Die damische Feder
tut’s scho wieder net, is halt a Kreiz.“ Er stieß sie kräftig auf die
Decke des Tisches, wischte mit dem breiten Zeigefinger den entstandenen
Tintenfleck fort und schrieb weiter.
[S. 210]
„Den Neunten werde ich unter keinen Umständen singen, Herr Sendelhuber.
Sie haben das wohl schon wieder vergessen.“
„Wo werd i? Da is nix weiter drüber zu reden. Also den N–eu–n–ten –“
Sie setzte ihren Namen darunter, ohne den Entwurf durchzulesen. Er
faltete ihn umständlich zusammen und barg ihn bei den andern.
„An Umsatz werden wir schon hab’n! Mähnetscht Sie wer?“
„Wie meinen Sie das, Herr Sendelhuber?“
Er machte eine kleine, vertrauliche Bewegung, führte sie aber nicht
voll aus, sondern lachte tonlos.
„I sah Sie halt mit dem Herrn Baron Alvensleben z’sammen. Und der
Kurtzig war auch dabei. Schaun’s – München ist net Berlin. Koane
G’schäftsstadt. Sei Ruh und sei Maß. Das wär den meisten Leut g’nug.
Bequem sind s’ halt. Wollen gern wissen, ob eins scho G’schmack g’fund
hat.“
Sie begriff endlich.
„Bei so einem Wuchs und G’schau und denn die Stimm.“
„Nett, daß er auch die Stimme erwähnt,“ mußte sie denken und wollte
auffahren. Damit hätte sie sich indes nur lächerlich gemacht. Und, was
die Hauptsache blieb und wohl ewig bleiben würde, solange es Kunst und
Künstlerinnen auf der Welt gab, sie mußte jetzt Geld verdienen.
„I lass’ Ihnen den Vertrag fein ausfertigen und schick’n nach Berlin.“
Das letzte Wort sprach er mit einer leichten Senkung in der fetten
Stimme, die seine Verachtung für die von ihm gemiedene Stadt beweisen
sollte.
[S. 211]
„Ich danke Ihnen, Herr Sendelhuber.“
Sie wollte allein sein. Eine schwere Müdigkeit drückte ihr die Lider
zu. Weil er nicht Miene machte, aufzustehen, überwand sie sich und
reichte ihm, über den Tisch, die Hand hin. Er war zu sehr mit dem
Einschrauben seines Füllfederhalters beschäftigt, als daß er sie etwa
aus Nichtachtung übersehen haben könnte. Lächelnd ließ sie sie sinken.
„Nun er mich sicher hat, ist das ja auch überflüssig.“
Endlich war er fertig.
„S–o, jetzt will i noch meine geröhste Kartoffeln eß’n und dann für
heut genug. A Wort noch, Freilein! Pfi–it! I muß ja noch a Depesch’n
geb’n! An die Gret Melchenhuber oder Margarete Kolwinirgers, wie sie
sich zu nenne beliebt. A schlaues Luderchen. I bin aber scho allemal a
Minut vor ihr aufg’wacht. – Also, Freilein, nix übelnehmen. Aber Sie
sollten a bessere Zeugmach’rin nehmen. A Adress’n kann i gern geben.“
Und er suchte wieder in seinem Notizbuch. „Bestell’n Sie a schönen Gruß
von mir. Dann pumpt’s halt gern.“
Sie lachte nun auch. Es machte sie noch reizvoller. Blitzschnell fuhr
er mit der roten Zunge über die wulstigen Lippen.
„Na also! Wir verstehe uns scheint’s doch ganz gut mitsamm’n. I hab’
die Aehre, Freilein und mit dem Zuschicken bin i pünktlichst.“
– – Eva von Ostried hatte sich noch ein kleines Abendessen nach
oben bestellt. Es war inzwischen zehn Uhr geworden; viel Gutes
stand also kaum mehr zu erwarten. Früher hätte sie nach einer
ähnlichen Erschütterung gar nicht daran denken können. Jetzt wies
sie das Pflichtgefühl,[S. 212] sich leistungsfähig zu erhalten, darauf hin
und verlangte gebieterisch Gehorsam. Was sollte werden, wenn sie
zusammenbrach, ohne zuvor ihre Schuld getilgt zu haben? –
Das Essen widerte sie an. Die Kehle war ihr wie zugeschnürt. Aber die
Mattigkeit, die ihre Hände beim Zufassen erzittern ließ, zwang sie zur
Vernunft. Außer der ersten Frühmahlzeit hatte sie heute noch nichts
weiter genossen, als das hastig gelöffelte Fruchteis im Speiseraume
des Prinzregenttheaters. Und morgen mußte sie doch frisch sein für die
Reise und die anstrengende Tätigkeit in Berlin.
Mechanisch stocherte sie in dem „Karfiol“ herum und bemühte sich
von den goldbraunen „Pflanzerln“ etwas in den Mund zu schieben. Es
deuchte sie eine schwere Arbeit. Sie zwang alle Gedanken zu dem
geschäftskundigen Herrn Alois Sendelhuber und konnte doch damit das
Bild nicht verscheuchen, das überall auftauchte und ihr Empfinden
peinigte. Die Erinnerung an den alternden Meister, der ihr einziger
Freund gewesen war.
Warum schob sie ihn in die Vergangenheit? Er stand trotzig und stark im
Leben und würde es überwinden! War sie mit ihrer entsetzten Verneinung,
von welcher der Verstand nichts wußte, voreilig gewesen? Mußte es nicht
ein wundervolles Ausruhen neben seiner reifen Persönlichkeit sein? Ein
einziges dankerfülltes Streben, um ihm zu vergelten, daß er so eine wie
sie...
Da war es wieder, was nun Stunden fest geschlafen hatte. Die heiße
Gewissensnot, weil sie einmal gestrauchelt war.
Davon ahnte er nichts. Sie hatte auch niemals in Betracht gezogen, es
ihm zu beichten.
[S. 213]
Und doch mit dieser Lüge einen, der ihr seinen Namen geben wollte, zu
belasten, war das nicht die zweite Sünde? Darüber hätte sie in diesem
Fall hinwegkommen können, weil sie ihn nicht als den Erwählten ihres
Herzens empfand. Nur, wo strömende, tiefe, gewaltige Liebe sich hingab,
durfte kein Geheimnis walten.
Wie friedlich es wohl dauernd mit ihm sein mußte. Geborgen von seiner
Stärke, getragen von der Abgeklärtheit seiner Lebensauffassung,
gestützt von den Erfahrungen seiner ruhmreichen Vergangenheit. Konnte
es eine bessere Erfüllung aller Jugendträume geben? Sie empfand
plötzlich heftige Sehnsucht nach der Festigkeit seiner Stimme. Daneben
stieß die Furcht vor dem ersten Wiedersehen nach dieser Stunde ihr Herz.
Drei Türen weiter wohnte er. Ob er endlich daheim sein mochte? Was
würde sie tun, wenn er jetzt zu ihr treten und sagen würde, daß sie ihn
nach diesem Scheiden nicht mehr wiedersehen werde, es sei denn, daß sie
die drei Worte am Hildebrand-Brunnen zurücknähme.
Ohne ihn würde es kalt und leer sein. Der Tag keine Freuden mehr. Sie
selbst müßten ratlos und unsicher in allen Dingen stehen. Sie malte
sich aus, wie er bei ihr gesessen hatte in Zeiten strengster Arbeit.
Ein unerbittlicher Lehrer, der quälen konnte, bis die Tränen der
Erschöpfung und des Zornes flossen.
Ein Finger pochte an die Tür. Eine Bedienerin trat über die Schwelle.
„Verzeihung, gnädiges Fräulein, ich soll nachschauen, ob der Herr von
Nummer 41, Herr Kurtzig ist sein Name, bei Ihnen wäre?“
[S. 214]
„Wer fragt das?“ forschte Eva von Ostried erstaunt.
„Die Herrn Künstler, die von der Klause herübergekommen sind und ihn
schon überall gesucht haben.“
„Ich bin allein, wie Sie sehen. Er wird in seinem Zimmer sein.“
„Nein, der Schlüssel hängt unten in der Buchhalterei. Er hat befohlen,
daß ihm zu elf Uhr eine Flasche Sekt aufs Eis gelegt werden möchte. Und
zwei Gläser dazu bestellt. Und einen kleinen Tisch mit lauter roten
Rosen. Die Blumen sind gerade vorhin gebracht worden vom Michelsberger
Franzel, der beim englischen Garten die schönste Binderei hält.“
„Wann hat er den Sekt bestellt? Erinnern Sie sich der Stunde?“
„Gleich nach acht Uhr kann’s gewesen sein, per Telephon aus dem
Parkhotel.“
„Bei wem machte er die Bestellung?“
„Bei mir, gnädiges Fräulein. Ich bediene ihn seit Jahren, wenn er
herkommt. Er weiß, daß Verlaß auf mich ist.“
„War er fröhlich, ich meine, klang seine Stimme so, als er mit Ihnen
sprach.“
Die frische kräftige Kellnerin nickte zutraulich.
„So froh hat er’s geschmettert, wie nur einer sein kann, der nachher
Sekt trinken will mit zwei Gläsern, gnädiges Fräulein! Und dazu die
roten Rosen. Wir sind halt alle sündige Menschen. Und der Herr Ralf
Kurtzig ist einer von denen, die mit achtzig Jahren noch nicht alt
sind.“
„Die roten Rosen werden welken,“ sagte Eva von Ostried träumerisch.
[S. 215]
„Schon möglich. Die Hitze war heute groß. Man konnte ja kaum atmen.“
„Und der Sekt und die beiden Gläser? Das Eis wird schließlich auch
schmelzen –“
„Wär alles recht schade, gnädiges Fräulein. Der Tropfen, der
ungetrunken bleibt, kann nicht einheizen und die meisten Leut’ können
doch nicht leben beim toten Ofen.“
„Der tote Ofen – was meinen Sie damit?“
„Was man meinen muß, wenn man ein Herz im Leibe hat. Wein und Lieb sind
halt Zwillinge. Wenn einem das erste bitter schmeckt oder vor der Nase
weggetrunken wird, ist gewöhnlich das andere versalzen.“
„Und was, glauben Sie, wird dann aus ihm?“ Eva von Ostried hatte
vergessen, mit wem sie sprach. Der Klang einer menschlichen Stimme tat
ihr wohl.
„Danach? Es kommt drauf an. Einer wirft sich in die Brust und versuchts
mit einem feinen Pelz aus andern Sachen, Gott weiß, da gibt’s ja genug.
Die einen spielen oder arbeiten gar wie wild und manch’ einer soll
dabei auch schon den Verstand verloren haben. Die andern mögen nicht
weiter. Die machen Schluß.“
Schluß – Schluß schrie es in plötzlich erwachender Angst in Eva von
Ostried. Die Kellnerin lauschte aufmerksam auf und deutete dann mit
schalkhafter Miene und weit von sich gestreckten Armen geradeaus.
„Hören Sie das Poltern, gnädiges Fräulein? Ich wette, daß das die
ungeduldigen Herren Künstler aus der Klause sind. Sie werden sich
einfach vor seine Tür hinhocken. Ja, das machen die! Passen Sie mal
auf.“
[S. 216]
Und mit einem Lachen in den Augen lief sie aus dem Zimmer, nachdem sie
noch vielmals um Vergebung wegen der dummen Rederei gebeten hatte.
– Eva von Ostried wollte sich endlich zur Ruhe begeben. Denn morgen.
Da war sie schon wieder bei Ralf Kurtzig. Vor der Abreise nach Berlin
hatten sie mit einander noch in die Pinakothek gehen wollen. Während
sie das dachte, lauschte sie nach den Geräuschen vor ihrer Tür. Da
trappten wohl wirklich Ralf Kurtzigs frühere Schüler, um noch ein
Stündlein bei ihrem Meister zu sitzen. Sie fühlte, daß er sich darüber
freuen würde, wenngleich sie seine polternden Worte bei der Erkenntnis
ihrer Huldigung zu hören meinte. „Geht lieber schlafen – Ihr. Das ist
Euern Stimmen zuträglicher.“
Sie öffnete die Tür. Ihre Blicke irrten den matterleuchteten Flur
entlang. Vier erwartungsvolle Gesichter wandten sich ihr entgegen.
„Grüß Gott, werte Kollegin! Halt – dageblieben? Rede und Antwort
gestanden: Wo haben Sie ihn gelassen?“
„Ich warte auch auf ihn,“ sagte sie und erschrak nun selber, denn sie
hatte sich das bisher nicht zugestanden.
„Da ist es das Einfachste und Erfreulichste, wenn wir das fortan
gemeinsam besorgen.“ Sie schüttelte den Kopf.
„Das geht leider nicht.“
„Und warum nicht,“ staunte der Sprecher. „Ich denke, Sie sind sein
Liebling?“
„Wer sagt Ihnen das?“
„Einer, der es bestimmt wissen muß. Können Sie gut raten?“
„Sie scherzen.“
[S. 217]
„Fällt mir nicht ein. Er hat, als ich ihm vorgestern durch ein Dutzend
Straßen nachgejagt bin und zuletzt auch glücklich eingefangen habe,
immer nur von Ihnen gesprochen. Denn ich war sein Lieblingsschüler!
Sind wir also nicht zwei ganz alte, sehr gute Bekannte?“
Sie wollte wissen, was er gesprochen hatte von ihr.
„Gott, was einer, wie er, halt so sagt. Nicht besonders viel!
Zusammengefaßt wohl kaum zehn Druckzeilen. Es kommt ja auch lediglich
auf den Inhalt an. Ist’s Ihnen wirklich um den zu tun?“
„Ja,“ nickte sie.
„Auch wenn Sie rot werden müssen, vor Stolz?“
„Auch dann!“
„Vielleicht bringe ich alles zusammen. Also, daß er Sie gefunden
hätte, daß er Ihnen zum Aufstieg helfen dürfte, das wäre doch das
Allerschönste aus seinem Leben.“
Sie blickte versonnen vor sich hin. Das Allerschönste.
„Nun verlange ich auch die Belohnung. Kommen Sie, einen fünften Schemel
besorgen wir. Uns hat gerade noch die Frauenstimme gefehlt. Sowie wir
das erste Geräusch hören, soll’s losgehen.“
„Was haben Sie vor?“
„Einen Willkommensgruß natürlich zur Begrüßung. Alle vernünftigen Leute
wären längst zur Ruhe, sagt die Kellnerin aus Berlin. Einen falschen
werden wir also nicht ansingen.“
„Nein, ich kann nicht bleiben, aber ich werde innen warten,“ sagte sie,
nickte ihnen freundlich zu und ging. Aber sie blieb wirklich in den
Kleidern.
[S. 218]
Lange, lange! Da hub draußen ein Singen und Klingen an:
Geschmolzen ist der Winterschnee,
Der Hornung wandelt sich zum See.
Nun kam er also!
Aber mit einem schrillen Mißton brach der Gesang ab und ein Raunen und
Reden und Laufen hörte sie herein.
Da eilte sie mit bangem Herzen hinaus zur Treppe – –
Auf einer Bahre hatten sie ihn gebracht. Einer der Träger erzählte mit
umständlicher Wichtigkeit, ohne daß ihn jemand darum befragt hätte:
„Wir gingen gerade vorüber, als sein Körper unten aufgeklatscht ist. Es
war nicht leicht, ihn rauszufischen. Hier ist seine Brieftasche, in der
wir eine Karte von diesem Hotel mit seinem Namen darauf gefunden haben.“
– Sein langes, eisgraues Haar hing tief in die Stirn hinein. Mit
großem hellen Blicke starrten die offenen Augen. Seine Lippen waren
nicht ganz so fest wie sonst geschlossen. –
Da warf sich Eva von Ostried neben der Bahre auf die Knie und preßte
seine schlaffen Hände an ihr Herz, wie er es am Brunnen mit den ihren
getan hatte. Und er wehrte ihr nicht.
Sie legte ihren Kopf dorthin, wo seine Liebe für sie gepocht. Es war
still – für immer.
Nach vier Tagen sandte Herr Alois Sendelhuber die Abschrift des
Vertrages an Eva von Ostried. Sie war gerade im Begriff, zu einer
Unterrichtsstunde nach dem Grunewalde hinaus zu fahren. Ihre neueste
Lernbegierige war die Tochter eines mehrfachen Millionärs und hatte bei
gutem musikalischen Gehör ein recht bildungsfähiges Zwitscherstimmchen.
Vor ihr lag, soeben abgeschlossen, ein Heft, in dem sie alle Ausgaben
und Einnahmen zu buchen pflegte. Sie hatte festgestellt, daß sie die
letzten fünf Wochen mit ihrem Verdienst allein ausgekommen war, ohne
den Rest des andern Geldes anzugreifen.
Freilich, was war das für ein Leben gewesen.
Der Spiegel warf ihre Gestalt in dem reichlich abgetragenen Kleid
getreulich zurück. Herrn Sendelhubers Kleidermacherin wäre mindestens
vier Wochen zu beschäftigen gewesen.
Demnach fehlte ihr alles, was sie einst als begehrenswert erstrebte.
Sie litt unter diesem gewaltsam durchgeführten Mangel wie an einer
schleichenden Krankheit.
Und schön!
Das alte jäh aufwallende Verlangen nach äußerem Tand packte sie
ungestüm. Nach der Stunde im Grunewald würde[S. 220] sie endlich alles
notwendig Gewordene in einem der ersten Geschäfte bestellen.
War denn aber wirklich dazu das Geld vorhanden? Sie hatte sich gelobt,
fortan – selbst wenn sich die Einnahmen vorläufig nicht steigern
sollten – den kleinen Blechkasten mit des ehrbaren Tabaksbauern
Zurückgezahlten nicht zu öffnen.
Aber jetzt riß sie ihn aus dem Dunkel des Schreibtisches hervor,
ließ die Feder aufspringen und entnahm dem dünngewordenen Päckchen
einen Schein! Er würde genügen.
Nach kaum einer Minute legte sie ihn wieder zu den andern zurück. Ihr
Gesicht war sehr blaß geworden.
Was hatte sie vorgehabt? Einen Teil des Raubes dazu verwenden wollen,
um der alten Eitelkeit zu dienen. Die mühselige Arbeit restloser
Selbstbezwingung also einfach vernichtend, indem sie von neuem sündigte.
Das konnte allein kommen, weil ihr Ralf Kurtzigs Beistand fehlte. Sie
nahm die Kreidezeichnung, auf der ihn ein junger, talentvoller Maler
mit klarem Blick für seine innere Größe darstellte, zur Hand und
vertiefte sich darin.
Ob sie ihn nicht doch geliebt hatte? Unbewußt?
Der Alltag entriß sie endlich allem Grübeln. Herrn Alois Sendelhubers
Vertrag sah sie vorwurfsvoll ob der Vernachlässigung an und verwandte
sich in dessen kleine, schlau zwinkernde Augen. Sie nahm ihn an sich,
um ihn später auf der Fahrt zu lesen. Jetzt galt es keine weitere
Zeit zu verlieren. In diesem Augenblick steckte aber die unzufriedene
Bedienerin den Kopf zur Tür hinein.
„Sie brauchen nicht zu glauben, daß ich Ihr Frühstück vergessen hätte,
Fräulein. Es war nur nichts mehr im[S. 221] Hause. Und wieder um Geld bitten
und das Gefrage und Vorwürfemachen mit anhören, gerad’ als ob man ein
kleiner Betrüger wär’, nee, lieber nich! Unterwegs wird ja auch wohl
was zum präpeln zu kriegen sein, denke ich.“
Eva von Ostried war das Blut in die Wangen gestiegen.
„Ich habe mich genau erkundigt,“ sagte sie kurz, „die Summe, die ich
hingebe, genügt für uns beide völlig.“
„Könnte ich mich denn nich auch mal bei derselben Quelle ein bißchen
belehren,“ fragte das Mädchen höhnisch und stemmte lachend beide Hände
in die Seite. „Oder hat’s vielleicht der Spatz gesagt, der hier alle
Morgen rumpiept, weil ihm keine Krume mehr gegönnt wird?“
„Sie werden unverschämt,“ sagte Eva von Ostried und bezwang ihre
Empörung.
„Nicht im geringsten, Fräulein. Bloß tückisch, weil ich immer an einem
leeren Futternapf stehen muß. Und darum, sehen Sie, ich bin viel zu
abgewachsen für Ihr Portemonnaie. Eine, die ’nen Kopf kleiner ist wie
ich und noch ein bißchen was von der vorigen Stelle auf den Rippen hat,
die müssen Sie sich nehmen. Ich geh’ nämlich in vierzehn Tagen.“
„Es ist gut,“ sagte Eva von Ostried und mußte doch schaudernd an die
neuen Unbequemlichkeiten denken, die daraus entstehen würden.
„Ich hätt’ noch was zu sagen.“
„Dann beeilen Sie sich. Ich muß fort.“
„Es nimmt bloß ein paar Minuten weg. Bis vor kurzem, na, sagen wir
mal, bis Sie nach München gondelten, habe ich doch im Ganzen recht
ordentlich gewirtschaftet, nich?“
[S. 222]
Eva von Ostried dachte nach und mußte zugeben, daß die Mahlzeiten
zumeist reichlich und schmackhaft gewesen.
„Daraus erkennen Sie selbst, wie gut Sie mit dem Wochengeld auskommen
können,“ stellte sie fest.
„Nee,“ triumphierte das Mädchen, „die Rechnung stimmt nich. Der Zuschuß
hat aufgehört. So klappt’s.“
„Welcher Zuschuß? Was meinen Sie damit?“
„Meine Mutter hat uns Kindern gesagt, wenn einer tot ist, dem man was
geschworen hat, könnt’ man getrost seinen Mund auftun. Darum will ich
auch nicht länger schweigen. Herr Kurtzig hat mir doch regelmäßig Geld
gegeben, damit das Fräulein seine kleine Freuden hätt’.“
„Geld! Und das erfahre ich erst heute?“
„Ich hab’s schon gesagt. Schwören mußte ich ihm, daß ich meinen Mund
hielt.“
„Wieviel?“ fragte Eva von Ostried und fühlte eine schwere Mattigkeit in
allen Gliedern.
„Wie kann ich das noch wissen. Viel hat er ja auch wohl nicht gerade
gehabt. Das merkt unsereins schnell. Mal zwanzig Mark, mal auch ein
bißchen weniger. Unter zehn Emmchen gab er aber nie. Dazu hat er das
Fräulein viel zu sehr verehrt.“
Eva von Ostried hatte die Empfindung, als wolle ihr Herz verbrennen.
Und in den Blicken des Mädchens stand die helle Schadenfreude über die
Bestürzung der jungen Herrin.
„Es gibt noch viele, die mehr spendieren würden, wenn sie Sonntag
abends hier ab und zu ein bißchen singen und spielen könnten,
Fräulein.“
[S. 223]
„Gehen Sie auf der Stelle,“ befahl Eva von Ostried und wies mit der
Hand nach der Tür.
„Mach ich gern! Wollen Sie meine Sachen nachsehen, ob ich aus Versehen
was Fremdes eingepackt hab’? Es ist nämlich schon alles parat.“
„Nein! Nur beeilen Sie sich möglichst, damit Sie aus meiner Wohnung
kommen.“
– – In der Küche polterten dann die Schritte eines Mannes, der das
bereit gehaltene Gepäck abholte. Kräftig wurde eine Tür zugeschlagen.
Sie machte keine Miene nachzusehen, ob das Mädchen nun endlich fort
sei. Sie fühlte sich wie zerschlagen.
Aus einem matten Pflichtbewußtsein, das sich widerwillig regte, ging
sie zum Fernsprecher und teilte der Schülerin im Grunewald mit, daß sie
sich zu elend fühle, um heute herauszukommen. Dann saß sie stumpf und
regungslos auf ihrem Platze.
Ralf Kurtzig, du hast es gut gemeint! Auch darin! Und doch, wenn du das
jetzt wüßtest, du warst ein so kluger, reifer Mensch, hast du nicht
geahnt, daß du dem Klatsch mit dieser Herzensgüte reichlich Nahrung
gabst?
Nein, das hatte er nicht erwogen. Dazu stand sie ihm zu hoch.
Konnte es wohl einen untrüglicheren Beweis als diesen für seinen
unerschütterlichen Glauben an ihre unantastbare Reinheit geben? Ein
edler Mensch kann ja gar nicht mit der Niedrigkeit eines andern rechnen.
Seine Liebe erschien ihr in einem völlig neuen Lichte. Ein ungeheurer
Stolz, daß er sie erwählen wollte, erfüllte sie. Eine dankbare Freude,
daß sie ihn erlaben durfte, bis zu jener Stunde am Brunnen.
[S. 224]
Aber solche Liebe, mag sie auch unerwidert bleiben, verpflichtet
zu einem vollgültigen Beweis von Würdigkeit. Sie nahm Herrn Alois
Sendelhubers Vertrag aus der Tasche und überlas den kurzen Inhalt
zweimal. Er hatte sie für den neunten November verpflichtet. Der neunte
November war aber, wie sie Herrn Sendelhuber wiederholt mitgeteilt
hatte, längst vergeben.
Es paßte Herrn Alois Sendelhuber natürlich besser, wenn er ihren
Einwand einfach vergaß. Sofort schrieb sie ihm und bat um Abänderung.
Als eine Woche später immer noch keine Antwort eingetroffen war,
drahtete sie. Und wartete nun erregt und ungeduldig auf seine Erklärung.
Herrn Sendelhubers Geschäftstüchtigkeit hatte nicht unterlassen,
im Falle sie sich ohne ärztliche Beglaubigung auch nur einer der
drei eingegangenen Verpflichtungen entzöge, eine erhebliche Strafe
festzusetzen. Die Summe würde voraussichtlich diejenige der gesamten
Winterkonzerte übersteigen.
Kurz entschlossen ging sie zu einem Anwalt.
Er fragte nicht, wie sie erwartet, nach ihren Wünschen. Aber er hörte
sie wenigstens an.
„Kontrakte werden gemacht, daß sie vor der Unterschrift durchgelesen
werden,“ sagte er großartig.
Das gleiche hatte sich Eva von Ostried auch bereits gesagt. Trotzdem
mußte dieser eine Punkt mit Leichtigkeit unwirksam zu erklären sein.
Das lag ihr im Gefühl.
„Ich habe Herrn Sendelhuber ausdrücklich und wiederholt erklärt, daß
ich an diesem neunten November nicht mehr frei wäre,“ warf sie ein.
[S. 225]
Darauf schien er kein Gewicht zu legen.
„Sind Sie überhaupt geschäftsfähig?“
„Ich bin volljährig.“ Er zuckte die Achseln.
„Meiner Ansicht nach nichts zu machen. Aber Sie können meinetwegen
wiederkommen. Bei einer Stunde ist der Bürovorsteher vom Essen zurück.
Und dann findet sich auch der Herr Justizrat ein.“
Als Eva von Ostried endlich wieder in der frischen Luft stand, mußte
sie herzlich lachen. Sie erschrak vor diesen fröhlichen Lauten. Wie
lange hatte sie doch nicht mehr dies heimliche Behagen gespürt!
Die Erscheinung des würdigen Vertreters von Bürovorsteher und Justizrat
hatte etwas zu köstlich Erheiterndes gehabt. Ob auch wohl der Herr
Justizrat – –
Der Titel füllte sich plötzlich mit lebensvoller Erinnerung. Hatte
ihr der treue Freund und Berater der Präsidentin nicht beim Abschied
auf das Bereitwilligste seine Dienste angeboten? Ihre Gedanken waren
seither nicht wieder zu ihm gelaufen. Sie hatte die Zeit, in welcher
sie ihm beinahe täglich begegnen mußte, künstlich versenkt. Nun aber
beschloß sie, nachdem sie die Wartefrist auf Herrn Sendelhubers
Antwort noch einmal auf vierundzwanzig Stunden verlängert hatte, ihn
aufzusuchen.
Als Eva von Ostried in die Mohrenstraße einbog, um Justizrat Weißgerber
an seiner Arbeitsstätte aufzusuchen, klopfte ihr Herz zum Zerspringen.
Alles Vergangene wurde wieder lebendig!
Der Vorraum wirkte immer noch wie ein mächtiges Abteil erster Klasse
auf sie. Ueberall waren gradlinige, mit rotem Plüsch überzogene
Sitzbänke aufgestellt. Nur der alte, würdige Bürovorsteher, der ihr
einst die neuesten Tageszeitungen als Zeitvertreib freundlich gebracht,
war einem jungen Kavalier mit aufstrebendem Haarwuchs gewichen, der
zuweilen einem ältlichen, demütigen Fräulein eine Weisung zurief und
jeder Kommende erhielt neuerdings eine Blechmarke zugeteilt, welche das
Recht auf Gehör ausdrücklich verlieh.
Geduldig wartend saß sie, bis ihre Nummer aufgerufen ward.
Mit einer sorgsam zurechtgelegten Entschuldigung, daß ihre Zeit bisher
keinen Besuch in seiner Privatwohnung gestattet habe, trat sie über die
Schwelle, aber die Entschuldigung blieb ungesprochen. Der, welcher an
alter Stelle vor dem wuchtigen Schreibtische saß, war nicht Justizrat
Weißgerber.
Die Tatsache wirkte eigentlich erleichternd auf sie.
[S. 227]
Das fremde kluge, ernsthaft männliche Gesicht flößte ihr sofort
Vertrauen ein. Während sie auf eine einladende Handbewegung ihm
gegenüber Platz nahm, fiel ihr die Farbe seiner Augen auf. Sie war
tiefblau und so klar, wie der Himmel, wenn er vom Glanz der Sonne
durchleuchtet ist. Seine Stimme freilich klang, im Gegensatz zu der des
alten erfahrenen Juristen, unsicher.
Als sie mit der Darlegung ihres Falles zu Ende gekommen war, suchte er
wiederholt nach passenden Worten und machte kleine Pausen, als er sie
endlich gefunden, in denen er sie fast erstaunt ansah. Sie fühlte, daß
er – wider Willen – ihrer Schönheit huldigen mußte.
Das geschah ihr oft. Aber noch nie zuvor empfand sie eine ähnliche
warme Freude darüber.
Nun hatte er sich wieder voll in der Gewalt. Sein Blick ruhte nicht
mehr auf ihrem Gesicht. Er schien alles von der Spitze des Stiftes, den
er unruhig zwischen Daumen und Zeigefinger wirbelte, herunterzulesen.
„Sie können beweisen, gnädiges Fräulein, daß Sie tatsächlich über den
strittigen neunten November verfügt hatten, während Sie in München mit
diesem – so danke sehr, Herrn Alois Sendelhuber verhandelten?“
„Einen vollgültigen Beweis nennen Sie dies wohl nicht,“ fragte sie und
hielt ihm das Notizbuch mit ihren Aufzeichnungen entgegen. Er ließ die
Blicke länger auf den aufgeschlagenen Seiten ruhen, als es die eine ihm
bezeichnete Zeile erforderte.
„Doch – doch,“ meinte er zerstreut und gab es ihr noch nicht zurück.
„Wollen Sie mir aber besser noch eine Bestätigung der Schwestern
Moldenhauer mit der Namhaft[S. 228]machung des Datums, an welchem die
Abmachung geschah, besorgen.“
„Das würde sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. So viel ich weiß,
befinden sie sich auf einer großen Konzertreise und sind erst eine
Woche vor dem neunten in Berlin zu erwarten.“
„Sie könnten es aber eidlich erhärten, nicht wahr?“
„Ja, das kann ich. Außerdem habe ich Herrn Sendelhuber mehrmals darauf
aufmerksam gemacht, daß ich ihm diesen Tag nicht geben kann.“
In das ernste Gesicht kam ein Lächeln, das es sehr jung machte.
„Mit Herrn Sendelhubers weitem Gewissen müssen wir uns als leidige
Tatsache abfinden. Ein Zeuge war bei Ihrer Unterredung nicht zugegen?“
„Nein, wir waren allein. Ich kannte ihn bis dahin gar nicht. Er
erwartete mich, als ich spät Abends heimkam.“
Sie hatte die Farbe gewechselt. Das entging ihm nicht.
„Es liegt kein Grund zur Beunruhigung vor,“ tröstete er. „Wir würden im
gerichtlichen Verfahren zweifellos obsiegen. Aber, nicht wahr, es wäre
friedlicher und erledigte sich vor allen Dingen ungleich schneller,
wenn man den genannten Herrn durch einen einfachen Briefwechsel zur
Einsicht brächte.“
„Mir hat er auf solche Bestrebungen nicht geantwortet.“
„Das glaube ich gern. Der Briefbogen mit der Firma zweier Anwälte ist
bekanntlich wirksamer wie das schönste Schriftstück mit Röslein und
Jasmin.“
Sie sahen sich beide an und mußten lachen. Das kleine Buch lag noch
immer in seiner Hand.
[S. 229]
„So ein Kunstwerk soll heute noch an ihn abgehen, gnädiges Fräulein.“
„Und dann,“ fragte sie schnell.
„Dann schreibe ich Ihnen, sobald ich etwas von ihm höre.“
Sie nickte und schielte nach dem Notizbüchlein. Er wurde rot wie ein
Schuljunge.
„Bitte, hier ist es wieder.“ Und dann nach einer kleinen Pause:
„All diese Stunden, die darin verzeichnet sind, müssen Sie die etwa
erteilen?“
Da erzählte sie ihm ein wenig von ihrem Tag.
„Wie halten Sie das aus, gnädiges Fräulein?“
„Sie sehen ja, mir geht es recht gut dabei.“
„Das wird das Verdienst Ihrer Angehörigen sein. Man wird Sie sehr
verwöhnen?“ Das Gegenteil erschien ihm unmöglich.
Sie blickte auf das spiegelblanke Holz der Tischplatte.
„Ich stehe ganz allein.“
Sie glaubte eine heimliche Angst aus seinen Blicken herauszulesen. Eine
feine Spannung hing in der Luft. In seinem Gesicht zuckte es nervös.
Warum saß sie noch hier?
Aber sie blieb und fragte plötzlich nach Justizrat Weißgerber.
„Seit ein paar Monaten geht es ihm gesundheitlich durchaus nicht nach
Wunsch. Darum suchte er sich einen Helfer. Und der bin nun eben ich.“
„Bleiben Sie dauernd hier?“ mußte sie fragen, denn die Vorstellung,
daß sie ihn, wenn sie in derselben Sache etwa noch einmal kommen
müßte, nicht mehr treffen könnte, begann ihr ein unbehagliches Gefühl
auszulösen.
[S. 230]
Daß er mit seiner Antwort zögerte, fiel ihr nicht auf.
„Ja, ich werde bleiben,“ sagte er endlich.
Klang das nicht, als sei er erst jetzt zu einem festen Entschluß
gelangt?
„Sie haben mir noch nicht Ihre volle Adresse gegeben, gnädiges
Fräulein. Herrn Sendelhubers schwer zu entziffernde Handschrift ließ
mich Ihren Namen zuverlässig nicht erkennen.“
„Richtig, das hätte ich beinahe vergessen.“
Er sah von der dargereichten Karte schnell wieder zu ihr.
„Ihren Namen habe ich schon oft gehört. – Bestimmt! Es ist kein Irrtum
möglich.“
„Wer könnte ihn genannt haben?“
„Sie müssen es erraten,“ forderte er fröhlich.
„Wer weiß, ob ich ihn nach diesem jemals wiedersehe,“ sagte sie sich
heimlich. „Warum soll ich mich also mit dem Gehen übereilen?“
„Justizrat Weißgerber hat von mir gesprochen, nicht wahr? Oder
mein Namen ist Ihnen in alten Schriftstücken, in denen ich als
Bevollmächtigte der Frau Präsidentin Melchers, in deren Haus ich bis zu
ihrem Tod gewesen, verzeichnet stehe, zu Gesicht gekommen.“
„Fehlgeschossen. Bitte – weiter raten!“
„Dann gebe ich den Kampf auf.“
„Erinnern Sie sich noch der alten Pauline?“
Alles Blut drängte ihr zum Herzen.
Wie war das möglich? Wußte er?
Nein, sie allein kannte das Geheimnis ihrer Schuld. – Er merkte auch
nichts von ihrer Erregung. Er freute sich nur dieser Minuten.
[S. 231]
„Ja, die alte Pauline! Ist sie nicht etwas ganz besonderes? Justizrat
Weißgerber empfahl sie mir, als ich ihm hilflos und, wie ich ehrlich
gestehen muß, eines Tages halb verhungert den üblichen kurzen
Wochenbericht über den Stand unserer Arbeit gab. Sie fühlte sich in
ihrem Feriendasein totunglücklich und hatte den Justizrat als alten
Gönner gebeten, ihr wieder angemessene Beschäftigung zu besorgen. Als
er meine Not sah, schickte er sie zu mir und siehe, wir schieden nicht
mehr von einander. Seitdem verwöhnt sie mich auf eigentlich unerlaubte
Art.“
Eva von Ostried wollte etwas erwidern – ebenfalls eine Freundlichkeit
über sie anfügen – eine Frage nach ihrem Ergehen tun – Ihre Kehle
blieb wie zugeschnürt. Vor ihr stand das Gespenst des Abschiedtages aus
der Villa der Präsidentin und lähmte ihre Zunge. Sie hatte es schlafend
gewähnt. Nun erhob es sich und zerstörte ihr Leben.
„So mußte es wohl kommen, daß sie mir auch von Ihnen berichtete.“
„Was hat sie gesagt,“ stieß Eva von Ostried hervor.
„Ja, was wohl, gnädiges Fräulein? Wollen Sie das wirklich hören?“
Nun wußte sie, daß die Treue, gleich den andern, ahnungslos geblieben
war.
„Sie sah immer nur das Allerbeste,“ lenkte sie ab und stand auf.
„Soll ich sie nicht wenigstens grüßen?“ fragte er.
„Natürlich!“ nickte sie, „sie hat mir ja nur Liebes und Gutes
erwiesen.“ Und dann nach einer Pause: „Sie geben mir wohl Nachricht,
wenn Herr Sendelhuber geantwortet hat?“
[S. 232]
Irrte er, oder war sie plötzlich verändert?
Klang ihre Stimme kühl und fremd? Hatten ihre schönen sprechenden
Augen den Ausdruck der Abwehr angenommen? Erregte es vielleicht ihr
Mißfallen, daß er ihr seinen Namen noch nicht genannt hatte?
„Sie müssen doch wissen, wem unsere alte, gemeinsame Freundin jetzt
dient, gnädiges Fräulein. Es ist ein gewisser Walter Wullenweber, bis
vor zwei Jahren Königlich Preußischer Gerichtsassessor beim Landgericht
3.“
Sein Name erweckte ihr sofort die Erinnerung an den einstigen
Vormund. Aber sie unterließ es nach einem Zusammenhang zu forschen.
Daraus hätten sich Fragen ergeben können, deren Beantwortung einen
scharfsichtigen Juristen zu allerhand für sie gefährlichen Schlüssen
zwangen. Er würde es durch die alte Pauline ohnehin früh genug
erfahren, wenn sie es ihm nicht bereits erzählt haben sollte.
Wenn er sich dann an den ehemaligen Vormund wandte, Fragen stellte,
erfuhr, daß ihr gesamtes mütterliches Vermögen ein Nichts gewesen und
die alte Pauline zu ihr schickte, damit die herausbringe, wie ihr das
jetzige Dasein möglich geworden war?
Ihr schwindelte. Da war die Schuld wieder, die sich quälend an ihr
rächte! Sie konnte es nicht länger unter seinem klaren, warmen Blick
ertragen.
Hatte sie ihm die Hand hingereicht oder nahm er sie einfach? – Sie
wußte es hinterher nicht. Sie spürte nur den kraftvollen Druck, der
ihre Finger umschlossen gehalten, als wären sie ein frierendes Vöglein!
[S. 233]
An einem Spätnachmittag, als sie aus dem theoretischen Unterricht, den
ihr der bekannteste Musikpädagoge Berlins erteilte, zurückkehrte, lag
ein Schreiben mit der Firma des Justizrats Weißgerbers und Rechtsanwalt
Wullenwebers auf ihrem Arbeitstisch.
Eva von Ostried riß ihn auf. Mit einem Schlage zog wieder die köstliche
Ruhe, die sie zuletzt in dem Sprechzimmer empfunden, in ihr Herz.
„Wir teilen hierdurch umgehend mit, daß wir soeben in den Besitz
der Antwort auf unser Schreiben vom 6. d. M. gelangt sind. Herr
Sendelhuber erklärt sich darin bereit, ohne sich unserer Ansicht
von der Rechtsunwirksamkeit des mit Ihnen bezüglich des neunten
Novembers geschlossenen Vertrages anzuschließen, gegen eine von
Ihnen zu zahlende Entschädigung von 300 (dreihundert) Mark, seine
Ansprüche bezüglich des genannten Tages, fallen zu lassen.
Wir halten, wie wir Ihnen seiner Zeit bereits mündlich ausführten,
die eventuelle richterliche Entscheidung für Sie günstig. Setzen
daneben aber unser Bestreben fort, diese Angelegenheit auf
gütlichem Wege zu regeln. Zur Vereinbarung dieses Zweckes wäre uns
Ihr Besuch in unserm Büro sehr erwünscht. Die Sprechstunden ersehen
Sie oben...“
Sie ließ das Schreiben sinken und sah starr zu der herbstlich bunten
Pracht des Parkes hinüber. Eine schwere Enttäuschung lähmte ihre
Denkkraft für Augenblicke.
Es war nur gut, daß diese Zuschrift nicht den Schlußvermerk trug:
„Privatgespräche werden in Zukunft höflichst verbeten oder entsprechend
berechnet!“
[S. 234]
Sie riß einen Bogen aus ihrer Mappe und schrieb hastig, daß sie keine
Zeit zu diesem Besuch finden könne und es daher den Unterzeichneten
überlasse, einen für sie möglichst günstigen Abschluß mit Herrn Alois
Sendelhuber zu erzielen. Schlimmstenfalls sei sie zu der von ihm
geforderten Buße bereit, denn zu einem Prozesse fehle ihr die Zeit,
sowie das nötige Vertrauen zu ihrer Geduld.
Als sie ihren Namen darunter gesetzt und das Geschriebene überlesen
hatte, schämte sie sich ihrer damit offenbarten Bitterkeit.
Und plötzlich wußte sie den wahren Grund ihres unruhevollen Wartens.
Wie ein Schlag war dies, der sie betäubte. Wenn er mit lächelnder
Duldsamkeit schon, als sie das erste Mal bei ihm gewesen, die richtige
Deutung für ihr langes Verweilen gefunden und ihr nun keine Hoffnungen
erwecken wollte?
Ja, das würde es sein! Hätte er ihr sonst diesen Brief senden können?
Darum mußte sie nun doch zu der vorgeschlagenen mündlichen Besprechung
gehen.
Sie zerpflückte ihre Antwort. Ihr Gesicht wurde hochmütig. Ihre
schlanke Gestalt reckte sich auf. Er sollte seinen Irrtum sehr schnell
einsehen!
Als sie ihm gegenüberstand, fühlte sie ganz klar, daß alle Unruhe
durch ihn gekommen war. Sie hätte vor Scham aufschreien können und
lächelte doch wie eine leblose Puppe, die Hand, die er ihr zum Gruß
entgegenstreckte, übersehend.
„Darf ich bitten, daß wir uns möglichst kurz fassen. Ich bin heute sehr
eilig, Herr Rechtsanwalt!“
[S. 235]
Er sah sie erschrocken an.
„Gnädiges Fräulein, habe ich Sie neulich irgendwie verletzt?“
Jetzt lachte sie hell auf.
„Im Gegenteil, Herr Rechtsanwalt, Sie haben einer Klientin durch Ihre
private Freundlichkeit mehr Zeit geopfert, als es klug war.“
„Soll das ein nachträglicher Vorwurf sein, weil ich Sie zu lange in
Anspruch genommen habe.“
„Deuten Sie es ganz nach Belieben. Nur, bitte, jetzt zur Sache, wie
Herr Justizrat Weißgerber früher zu sagen pflegte.“
Er saß ihr mit zornig zusammengezogenen Brauen gegenüber. Was fiel ihr
ein? Neckte sie ihn einfach oder waren das Künstlerlaunen.
„Ich habe kurz entworfen, was am besten Herrn Sendelhuber zu antworten
wäre. Darf ich es vorlesen oder belieben Sie selbst.“
Sie nahm ihm das Blatt mit leichtem Neigen des Kopfes aus der Hand und
vertiefte sich scheinbar in seinen Inhalt. Er beobachtete sie dabei
scharf.
Es währte sehr lange.
Ein kleines Lächeln durchsonnte die Finsternis seiner Mienen.
„Wenn ich es Ihnen näher erklären darf,“ erbot er sich.
„Ich habe es begriffen,“ antwortete sie kurz.
„Also?“ fragte er leise und sah sie mit dem Blicke an, der ihr das
erste Mal die köstliche Ruhe in das Herz getragen.
„Es ist gut, wie Sie es vorgeschlagen haben.“
[S. 236]
„Ja, aber Verzeihung, daß ich darauf aufmerksam machen muß, wir
verzeichneten zwei Vorschläge. Und einer darf es doch entschieden nur
sein.“
Sie wurde flammend rot, weil sie sich auf einer Unwahrheit ertappt sah.
Sie hatte kein Wort begriffen.
„Ich möchte keinen Prozeß,“ sagte sie wie ein törichtes Kind. „Das
andere soll mir gleich sein.“
Sie stand hastig auf.
„Gnädiges Fräulein,“ sagte er weich und bittend, „was haben Sie? Gehen
Sie nicht so fort. Ich bitte Sie herzlich.“
Sie lächelte krampfhaft.
„Was ich habe? – Nichts. Wie kommen Sie darauf, Herr Rechtsanwalt?“
Mit einer Verneigung gab er ihr den Weg frei.
„Wünschen Sie vielleicht, daß ich zuvor diese Angelegenheit noch einmal
mit Herrn Justizrat, als Ihrem früheren Bekannten, durchspreche?“
„Nein, ich danke. Ich möchte alles so schnell wie nur irgend möglich
vergessen und bin darum auch zu der von ihm geforderten Buße bereit.“
Er sah sie fest und lange an.
„Sie haben es ja schon vergessen, wenn Sie es überhaupt gefühlt haben.“
„Ich verstehe Sie nicht.“
„Als Sie mich neulich verließen, hatte ich die dankbare Empfindung, daß
wir beide uns voll verstanden hätten.“
„Dann haben Sie sich eben geirrt. Das soll den besten Juristen
bisweilen geschehen können.“
Wieder war er an ihrer Seite.
[S. 237]
„Fräulein von Ostried, ich kann es nicht glauben. Es würde mich sehr
unglücklich machen.“
Sie zerrte an den feinen Handschuhen und zerriß sie, weil sie etwas
Entsetzliches fühlte. Tränen, die aufsteigen wollten und die er doch um
keinen Preis sehen durfte.
Er sah sie aber doch. Und nahm ihre beiden Hände in die seinen.
„Ich flehe um ein ehrliches Wort.“
„Der Brief,“ sagte sie wider Willen, „ich dachte, Sie bereuten das
Private.“
Er begriff nicht sogleich.
„Warum denn um Gottes willen.“ Und dann mit plötzlichem Verstehen:
„Den Zeilen, auf denen ein Dutzend fremder Augen ruhten, durfte ich
nicht anvertrauen, wie es in mir aussah, während ich sie aufgab.“
Seine Stimme war plötzlich voller Jubel!
„Ein Dutzend fremder Augen,“ machte sie ungläubig, noch rosenrot vor
Scham.
„Ja,“ nickte er eifrig. „Hören Sie einen Augenblick aufmerksam zu.
– Durchschnittlich an jedem Tage gehen zwanzig bis fünfundzwanzig
ähnlicher Mitteilungen heraus. Ich bediene mich dazu eines Apparats,
nehme den Schalltrichter zur Hand und spreche hinein, was ich nach
gründlichem Ueberlegen für richtig halte. Ein Referendar, der mir zur
Ausbildung überwiesen ist, steht in vielen Fällen daneben und hört zu,
nachdem ich die Sache zuvor mündlich mit ihm durchgesprochen habe.
Oder, wie es bei dem Brief an Sie der Fall sein mußte, er selbst gab
ihn auf, während ich als Obergutachter zuhörte. Danach kommt[S. 238] der
Laufjunge und holt die Walzen ab. Das Fräulein in der Nische schreibt
sie getreulich herunter. Mit Durchschlag natürlich, wie das in einem
richtiggehenden Betrieb selbstverständlich ist. Die Kopie wird wiederum
dem Laufjungen anvertraut, der in aller Heimlichkeit danach trachtet,
sie zu lesen, weil er ebenso neu- wie lernbegierig ist. Der Schreiber,
der sie in das betreffende Aktenstück einheftet – denn auch Sie haben
bereits ein solches erhalten –“
„Hören Sie auf,“ bat sie kläglich.
„O nein, immer gründliches Verfahren. Ich erspare Ihnen nichts. Den
Schreiber interessiert schon erstmal Ihr Name. Nicht wahr, er ist
ungewöhnlich und klingt wie Musik. Und dann, daß Sie Künstlerin sind.
Wir haben hier natürlich die verschiedensten Größen als getreue
Klienten. Dies aber ist ein seltener Fall. Wie wird er ihn nicht
lesen. Der Invalide, der das Amt hat, die abgehenden Schriftstücke in
den Umschlag zu befördern – nun – warum soll er nicht das gleiche
durchaus menschliche Verlangen haben? Durfte ich da auch nur ein Wort
hineintragen, das mein Herz verraten hätte?“
Sie stand, übergossen von neuer tiefer Röte vor ihm. Noch einmal wehrte
sie sich verzweifelt.
„Was hat Ihr Herz damit zu schaffen?“
„Mein Herz?“ sagte er. „Das hat keine Ruhe finden können – seitdem!“
Eva von Ostried hatte seit kurzem ein jüngeres Mädchen in ihrer
Behausung, das sie in einem Zustande der Erschöpfung und Krankheit
aufgefunden und zu sich genommen hatte, ein Mädchen, über dessen
Vergangenheit ein undurchsichtiger Schleier gebreitet schien.
Gretchen Müller nannte es sich und niemand hier wußte um seine
Vergangenheit. Die Einzige, die das Recht gehabt, sie zu befragen,
rührte nicht daran. So blieb die Spur verwehrt.
Gretchen hatte Stunden, in denen ihr Herz ganz leicht war. Dann
pflegte sie die Blumen, besorgte wie die guterzogene Haustochter einer
sparsamen Bürgerfamilie, Zimmer und Küche und setzte sich darnach
mit einer Handarbeit zu der wuchernden Kresse und den rotblühenden
Feuerbohnen auf den kleinen Balkon.
Eva von Ostried war zu solchen Stunden nicht daheim. Ueber den Flügel
lag eine Decke gebreitet. Es war alles verschwiegen und leise!
Und doch brauchte nur ein Klingelton zu rufen, dann war es anders!
Zumeist öffnete Gretchen Müller nicht. Eva von Ostried schloß sich die
Tür nach ihrer Heimkunft selbst auf.
Und jetzt klingelte es dennoch, stark und fordernd. Da entschloß sie
sich nachzusehen. Eva von Ostried hatte von[S. 240] einer wichtigen Nachricht
gesprochen, die ihr möglicherweise zugehen würde.
Als die Tür aufsprang, fuhr das Mädchen mit einem Schrei zurück. Ihre
Arme streckten sich weit vor. Ihre Augen wurden starr vor Entsetzen.
Ihr Peiniger, der Zerstörer ihres jungen Lebens stand vor ihr und trat
fast lautlos herein.
„Diesmal hast du mir das Finden nicht eben leicht gemacht,“ sagte er in
einem freundlichen Unterhaltungston.
„Geh’!“ stieß sie hervor, „oder –“
„Du stockst sehr richtig, mein Herz. Jedes weiteres Wort wäre zum
mindesten eine Unvorsichtigkeit von dir.“
„Im nächsten Zimmer befindet sich meine Herrin. Sie muß sogleich
herauskommen.“
„Warum nennst du sie nicht mit ihrem Namen? Eva von Ostried klingt doch
sehr schön. Auch ist es eine Ehre für dich bei dieser hochbegabten
Zukunftsleuchte Unterschlupf gefunden zu haben.“
„Woher weißt du auch dies?“
„Ich erfahre alles, was ich wissen will. Das sollte dir eigentlich zur
Genüge bekannt sein. Ich weiß selbstverständlich auch, daß du zur Zeit
allein in der Wohnung bist. Fräulein von Ostried erteilt außerhalb
Stunden und kommt bestimmt nicht vor Mittag zurück.“
„Trotzdem wirst du dich sofort entfernen, oder ich rufe die Polizei.“
„Du hast gute Gründe, sie nicht zu rufen, mein Kind.“
„Du bringst mich dahin, daß ich auch diese Enthüllung nicht mehr
fürchte.“
[S. 241]
„Denke darüber, wie es dir beliebt. Ich meine doch, du solltest
Rücksicht nehmen. Es ist außerordentlich gefällig, daß dich diese Dame
aufgenommen hat. Der Lohn, den du zahlst, wenn sich die Polizei mit dir
und also auch mit ihr beschäftigen müßte, wäre, meiner Ansicht nach,
ein schlechter.“
„Du bist ein Teufel!“
„Ich besitze Briefe von dir, die mir andere Kosenamen geben. Freilich,
hießest du damals noch nicht Gretchen Müller.“
Sie hob die Hand, wie um sie auf seinen leichtsinnigen Mund zu pressen.
Er wich geschickt aus und zischte leise:
„Und darum solltest du die hohe Polizei mir gegenüber aus dem Spiel
lassen. Ich habe in meinem bisherigen Leben noch nichts getan, was ihr
Anlaß gäbe, mich scharf zu beobachten. Du aber –“
„Was ich geworden bin, hast du aus mir gemacht.“
„Das ist eine sehr bequeme Darstellung, mein Kind. Vergiß nicht, daß
jedes einzig die Folgen seiner Veranlagung trägt. Gut! Zufällig bin ich
derjenige, der die deine zum Ausbruch brachte. Das ist mein Pech. Denn,
ob du es auch als das deine fühlst – je nun? Sei doch ehrlich. Denke
daran, wie du mir freudig, um mit dem Jäger zu reden, „auf den ersten
Pfiff“ gefolgt bist.“
„Du hast deine Rolle zu gut gespielt, weil sie dir allzu geläufig war.
Wie konnte ich das ahnen?“
„Mag sein! Du wirst dir damals nicht eingebildet haben, daß ein Mann
wie ich vor dir noch kein Mädel geküßt hätte.“
[S. 242]
„Ja, das habe ich mir eingebildet! Bei Gott! Aber was willst du jetzt
von mir?“
„Nicht viel. Dir klarmachen, daß du in meiner Gewalt bist und bleibst!
Es ist nur klug und weise, wenn du nicht weiter in diesem hochfahrenden
Ton mit mir verhandelst.“
„Es muß doch ein Zweck dabei sein,“ wimmerte sie, „ich kann ihn nur
nicht erkennen.“
„Nimm an, daß ich dich wirklich geliebt hätte.“
„Du lügst jetzt wie stets,“ sagte sie.
„Dann weißt du mehr wie ich. Wozu hätte ich nötig, mich überhaupt noch
um dich zu kümmern, nachdem du mir diese unglaublichen Ungelegenheiten
bereitet hast.“
„Was hast du mit mir vor?“
Er ließ sich auf die Truhe nieder. Nun war er ihr so nahe, daß er ihr
mit der weißen, gepflegten Hand über das lose silberne Haar hätte
streichen können. Ein Sonnenstrahl schwebte auf sie herab und verfing
sich darin. Die fieberhafte Röte wachsender Angst gab dem schmalen
Gesicht den trügerischen Schein der Gesundheit.
„Du siehst immer noch sehr reizend aus,“ flüsterte er ihr ins Ohr.
„Indessen, du hast das richtige Gefühl. Ja, ich habe etwas mit dir vor.
Eine Kleinigkeit nur. Einen Gegendienst.“
„Ich bin zu schwach geworden, um dich gleichfalls zu verderben. Das
wäre der einzige Dienst, auf den du Anspruch hättest.“
„Laß das jetzt. Erinnere dich gefälligst an die Zeiten, in denen du mir
täglich deine Not geklagt hast. Angeblich[S. 243] littest du doch unerträglich
unter der Tyrannei der lieben Deinen. Dein Vater wollte Kapital aus dir
schlagen. Dein tugendsamer Bruder hätte dich am liebsten an die Kette
gelegt. Und das Schätzchen, das sie dir ausgesucht hatten. Sei doch
endlich mal ein bißchen fidel, mein Kind und lache mit – war er nicht
fürchterlich mit seinem vogelähnlichem Kopf und den drohenden Wulsten
unter den kleinen Augen? Na, ich will dir das schöne Bild nicht weiter
ausmalen. Du besorgst das in deinen jetzigen sicher recht stillen
Stunden besser allein. Also – Vorwürfe muß ich energisch zurückweisen.
Du hast es mir nicht schwer gemacht damals.“
„Ich habe dir vertraut.“
„Habe ich dies Vertrauen vielleicht nicht gerechtfertigt? Hättest
du nicht den Himmel auf Erden behalten können, wärest du nicht so
wahnsinnig kleinlich und eigensinnig gewesen? Hatte ich nicht ein
behagliches Nest für dich bereit? Fehlte auch nur das Geringste für
deine Bequemlichkeit darin?“
„In dem Augenblick, der mich lehrte, daß du längst anderweitig gebunden
warst, habe ich nichts mehr von dir angenommen. Das wenigstens sollst
du mir jetzt bestätigen.“
„Wenn du so großes Gewicht darauf legst. Schön, mein Kind. Ich
bestätige es hiermit feierlich. Warum aber? Ein Künstler braucht viel
Geld, wenn er selbst keins besitzt. Mit dem Pumpen ist das stets eine
mißliche Geschichte. Das Sicherste und Bequemste bleibt eine reiche
Partie. Ja, mag er selbst Unsummen einnehmen, er wird als freier Mann
stets doch eine Kleinigkeit über seinen Etat hinaus verbrauchen.
Das verstehst du nicht. – Ich verdiente dazumal noch wenig. Die
Kommerzienrätin, auf deren einer Abend[S. 244]gesellschaft ich dich nach der
bestellten Singerei, kennen lernte, bezahlte anständig. Aber sonst –
Lieber Gott. Da mußte ich mich eben auf diese Weise sichern.“
„Daß du dich vor deiner Frau nicht schämst?“
„Frage sie, ob sie nicht überaus glücklich mit mir geworden ist.“
„Ich möchte ihr die Hände küssen, damit sie mir vergibt, was ich ihr
unwissend geraubt habe.“
„Wünsche dir das meinetwegen. Daß es sich dir niemals erfüllt,
laß meine Sorge sein. Im übrigen – ich muß endlich deine Frage
beantworten: Du wolltest wissen, was ich mit dir vorhabe? Ich will vor
allen Dingen deine Lage aufbessern. Dich auf eigene Füße stellen. Du
magst dir hinfort ein Leben nach deinem Geschmack einrichten. Nimmst
du Vernunft an, werden wir uns sehr schnell verstehen. Höre zu. Ich
verlange von dir, daß du niemals zu Eva von Ostried meinen Namen
nennst. Spitzte sich auch selbst, im für mich ungünstigsten Falle,
ihr Interesse für dich derartig zu, daß sie völlige Offenheit von dir
verlangte. Denn sie ist schrecklich moralisch und würde dich nicht bei
sich behalten, wüßte sie – – Sage ihr in diesem Fall, was du willst.
Nur nicht die Wahrheit. Du hast ja damals, als du das Doppelspiel
triebst, sehr nett lügen können. Also schweigen, ja?“
Sie stieß seine Hand fort. „Eines solchen Versprechens bedarf es nicht!
Ich würde mich eher unter hundert Qualen zu Tode martern lassen, ehe
ich mein ganzes Geheimnis preisgäbe.“
„Schön. Dann sind wir in der Hauptsache einig. Ich danke dir,
Lieselotte.“
[S. 245]
„Nicht diesen Namen nennen, nicht den Namen!“
„Du hast ganz Recht. Je gründlicher wir sind, desto wirksamer wird
alles. Also, Gretchen Müller, höre mich noch ein paar Minuten an. Ich
will mich nicht entschuldigen. Das lag mir niemals. Selbst, wenn ich in
deinem Fall ausnahmsweise Gewissensbisse gehabt haben sollte.“
„Du hast sie nie gekannt. Diese Rolle liegt dir schlecht.“
„Dann nenne es meinetwegen anders. Immerhin – besteht der Wunsch bei
deiner Empfindlichkeit, etwas übrigens zu tun. Als ich dich kennen
lernte, war ich noch nicht mal ganz fest verlobt. In aller Heimlichkeit
nur. Und ich wußte noch nicht mit Bestimmtheit, ob überhaupt eine Ehe
daraus würde.“
„Gibt es denn wirklich so viel reiche Mädchen, daß dir damals schon die
zweite noch reichere in Aussicht stand? Lüge wenigstens jetzt nicht.
Du warbst in aller Form um mich und gabst mir dein Wort. Oder habe ich
mir dies alles nur eingebildet? Waren zuvor deine heißen Blicke und
Huldigungen, dein Ehrenwort nur Lüge? Empfandest du nichts von jenen
leidenschaftlichen Gefühlen, die du mir so oft geschildert hast?“
„Das sind viel Fragen auf einmal. Deine Frische hatte mich bezaubert.
Diese entzückende Lebendigkeit – nicht nur in der Auffassung, sondern
auch und besonders in der Wiedergabe alles Erlebten, Gehörten und
Erschauten, war mir neu. Dazu kam, daß du aus sogenanntem guten Hause
kamst. Ein Reiz mehr. Auch hattest du, obschon du keine Note kanntest,
das feinste musikalische Gehör, was mir bisher begegnet ist. Meine
Macht über Dich wurde unbegrenzt.[S. 246] Ich hätte dich zur Verbrecherin
machen können, wenn ich gewollt.“
„Das hast du gefühlt?“
„Vom ersten Augenblick unseres Kennenlernens an. Weißt du noch? Wir
standen eng zusammengekeilt vor der Kasse des Opernhauses. Da sprach
ich dich an, weil du mir ausnehmend gefielst. Merkst du jetzt, wie
diskret ich bin? Das Märchen von der ersten Begegnung im Hause der
Kommerzienrätin hatte ich mir um deinetwegen so fest eingeprägt, das
ich dies reizende Stündlein dir gegenüber vorhin zu erwähnen unterließ.“
„Mache meine Scham nicht noch größer,“ sagte sie mit zuckenden Lippen.
„Es ist ja auch belanglos. Das weitere will ich trotzdem kurz
zusammenfassen. Auch um meinetwillen. – Sieh mal, als ich dich dann
einen Monat später bei der musikalischen Rätin wiedersah und dir
bei der Vorstellung zuflüsterte, daß wir niemand von unserer süßen
Bekanntschaft erzählen wollten, warst du dazu bereit. Deiner lieben
Familie war ich sogleich angenehm. Dein Bruder mochte mich absolut
nicht. Dein Vater war ein ganz scharmanter Herr. Wir hätten uns sogar
ausgezeichnet verstanden, wäre er nicht zufällig dein Vater gewesen.
So witterte er in mir den Feind. Daß wir beide uns fortan in dem Hause
der alten Musiknärrin auch gesellschaftlich begegneten, erleichterte
die Sache natürlich. Glaube mir, ich hatte nicht daran gedacht,
dich ins Unglück zu bringen. Erst, wie du mich um Hilfe gegen den
fürchterlichen Geldsack anflehtest, da erwachte, ich könnte kurz sagen:
die Ritterlichkeit! Es klänge großartig, stimmte aber nicht. Ich wollte
den schweren Kerl aus[S. 247]stechen. Daneben dich natürlich auch von einem
Los, das dir Grauen einflößte, bewahren.“
„Daneben – wirklich.“
„Ja, so war’s! Dann kam alles ein bißchen anders. Du machtest
Dummheiten. Liefst kopflos von Hause weg, kamst zu mir als zu deinem
einzigen Freund und so weiter. Und zurück – verzeihe mir, daß ich dies
ausdrücklich feststelle – wolltest du unter keinen Umständen.“
„Ich dachte an eine Beschleunigung unserer Heirat. Denn für deine Braut
hielt ich mich. Hatte ich etwa kein Recht dazu?“
„Nach gut bürgerlichen Begriffen zweifellos! Künstleransichten sind
aber gemeinhin andere. Sage selbst, was sollte ich tun, wo du nun mal
da warst und mir erklärtest, lieber gingest du in den Tod, als zu
deiner lieben Familie zurück.“
„Höre auf, wenn du noch einen Funken Barmherzigkeit in der Seele hast.“
„Ich bin sogleich zu Ende. Ich war also nicht brutal genug, um dich
fortzuweisen. Schön, das war vielleicht mein Unrecht. Mehr Schlechtes
kann ich im Augenblick nicht zusammen finden.“
„Daß du weiter die verächtliche Komödie spieltest – mir den festen
Glauben, ich sei deine verlobte Braut und sehr bald dein Weib, auch
vor dem Gesetz, nicht nahmst, indem du mir endlich von deinen älteren
Verpflichtungen sagtest.“
„Wäre das nicht mehr als grausam gewesen? Was hättest du darauf getan?
Bedenke, damals hießest du noch nicht Gretchen Müller. Du wärst ins
Wasser gegangen oder[S. 248] hättest sonst einen Gewaltstreich mit denselben
Folgen verübt.“
„Das wäre Barmherzigkeit für mich gewesen.“
„Ich empfinde es anders. Vielleicht wir Männer überhaupt.“
„Du hast tausend neuer Ausflüchte erfunden, um mir zu beweisen, daß
sich unserer ehelichen Verbindung immer neue Hindernisse in den Weg
stellten.“
„Die Gründe habe ich dir soeben klargelegt, mein Kind.“
„Höre damit auf. Warum hast du nicht wenigstens später die Wahrheit
gesagt?“
„Wann? Jedes weitere Zusammensein wäre damit zerschlagen gewesen. Du
wärst auch später wohl noch fortgelaufen und damals warst du körperlich
fast noch mehr erschüttert wie jetzt. Du mußtest erst wieder in die
Höhe kommen.“
„Nein, das ist nicht der Grund. Rücksichtnahme kennst du nicht. Du
hättest unumwunden ausgesprochen, wenn ich dich allmählich beschwert
hätte.“
„Man hat auch seine – Anständigkeit.“
„Lasse sie mich endlich kennen lernen, damit meine Scham nicht so heiß
brennt.“
„Woher kennst du Eva von Ostried?“
„Vielleicht aus der Oeffentlichkeit – vielleicht auch nicht. Laß dir
genügen, daß ich sie kenne.“
„Das Recht, sie beim Vornamen zu nennen, steht dir nicht zu. Sie ist zu
rein, als daß du –“
„Du bist ein Närrchen! Aber, rein ist sie wirklich. Darin hast du dich
diesmal nicht getäuscht.“
„Ich habe nur den Wunsch noch, daß du gehst.“
[S. 249]
„Gleich – gleich! Du hast mir also versprochen, daß du Eva von
Ostried niemals verrätst, was zwischen uns gewesen ist. Ich habe die
bestimmte Ahnung, als hätte andernfalls dein scheinbar recht angenehmer
Aufenthalt hier sein Ende erreicht. Und dann wieder bei Fretzburg u.
Sohn in die Putzabteilung zurück? Nee, weißt du – übrigens würden sie
dich da gar nicht wieder einstellen.“
„Bleibst du jetzt noch eine Minute, so rufe ich um Hilfe!“
„Wer würde dich hören? Du siehst nach dem Fenster? Es ist unmöglich.
Aber ehe jemand erscheinen würde, wäre ich bestimmt verschwunden.
Und dann? Man würde dich einfach für geisteskrank halten. Zudem habe
ich nicht mehr vor, sehr lange zu bleiben. Nur eine Kleinigkeit will
ich noch schnell ordnen. In deinem Interesse, wie du mir hinterher
zugestehen wirst. Ich bitte dich, daß du jetzt zur Vernunft kommst.
Nimm an, ich käme erst in diesem Augenblick zur Tür herein und wäre
dir dankbar, weil du Eva von Ostried gegenüber den Mund zu halten
versprochen hast. Dir geht es schlecht. In diesem Gewand machst du den
Eindruck einer Nonne, die ihre Haube noch nicht aufgesetzt hat. Auch
sonst siehst du – verzeih’ diesen Ausdruck – etwas abgewirtschaftet
aus. Gefallen gegen Gefallen. Nimm diese Kleinigkeit. Mir macht es
nichts aus.“
Und er drückte ihr ein bißchen unter dem feinen Taschentuch geschickt
verborgen gehaltenes Päckchen mit Scheinen in die Rechte.
Als sie das Knistern hörte, wurde sie leichenblaß.
Lässig setzte er den Hut auf und nickte ihr zu.
[S. 250]
„Denk noch mal über alles nach und sei verständig, Lieselotte.“
Der Name brachte sie zur Besinnung. Matt hob sie die Hand mit dem Geld.
Er legte die seine darüber und zwang ihren Arm in den Schoß. Unter
seiner Berührung flammte eine purpurne Glut über ihr Gesicht bis zu dem
altsilbernen Haare hinauf. Dann hob sich die Hand noch einmal.
Mit einer Kraft, die sie sich selbst nicht zugetraut hatte, schlug sie
in das leichtsinnige, schöne Männergesicht. Die Scheine umflatterten
ihn, lagen auf seinen Schultern, zu seinen Füßen. Mechanisch bückte er
sich und sammelte sie auf. Neben dem Spiegel, der zu beiden Seiten auf
rotgetönter Esche blanke, starke Kleiderhaken trug, hing die vergessene
Reitpeitsche eines Schülers, der einen eigenen Gaul besaß. Die riß die
bebende Mädchenhand herunter. –
– – Dann war sie allein.
Sie setzte sich wieder auf den Hocker neben die Truhe und rieb an ihrer
Hand herum, als müsse sie einen Schmutzfleck entfernen. Sie weinte
nicht. Sie nickte nur vor sich hin. Dann überkam sie jäh das Heimweh!
Nach der engen dunklen väterlichen Wohnung, die sie oft genug hatte
erdrücken wollen – nach dem Vater selbst – vor allem aber nach dem
Bruder.
Daneben fühlte sie, daß dies unmöglich geworden war und von allen
Schmerzen, die auf ihr lasteten, erschien ihr diese Gewißheit als die
unerträglichste. Sie vergegenwärtigte sich das letzte, zukünftige
Leiden mit seiner verstärkten dem Wahnsinn nahebringenden Sehnsucht.
Und wußte doch, daß über ihre Lippen kein Ruf zu denen, die ihr einst
zugehört hatten, dringen würde. Sie mußte für immer[S. 251] einschlafen,
ohne an dieser Scham zu ersticken. Eva von Ostried, die Gütige, würde
liebreich ihre Hände halten – wohl gar ihren Kopf auf das im letzten
Kampf wildschlagende Herz betten – sie vielleicht sogar in die Arme
nehmen. Dann war alles aus und überwunden.
Wenn sie Eva von Ostried alles vergelten könne, vorher!
Ihr kam ein Lächeln, als sie diesen Wunsch empfand. Wie wäre das jemals
möglich? – –
„Heute nachmittag werden wir beide ein richtiggehendes Fest feiern,“
sagte Eva von Ostried, als sie, die sich sonst einer großen
Pünktlichkeit befleißigte, viel später wie gewöhnlich heimkam.
„Darauf freue ich mich,“ erwiderte Gretchen Müller und ließ nichts von
den stechenden Schmerzen merken, mit denen sie zu kämpfen hatte. „Wir
lassen die Vorhänge herunter und dann singen Sie, ja?“
„Nein, meine Liebe, das werden wir nicht tun. Diesmal geht’s ins Grüne
hinaus. Jawohl! Wehren Sie nur ab, zucken Sie zusammen, als erwarteten
uns draußen eine Schar hungriger Wölfe. Ich bleibe steinhart. Wissen
Sie, was der Arzt sagte, als ich ihn Ihretwegen befragte: „In erster
Linie frische, gute Luft.““
„Ich habe heute lange Zeit auf dem Balkon zugebracht.“
„Ich will seine Vorzüge nicht verkleinern. Es ist angenehm, daß wir
ihn haben. Einen vollwertigen Ersatz bietet er nicht. Das habe ich
Ihnen übrigens schon mehrmals erklären wollen. Sie fanden aber stets
neue Schönheiten und Annehmlichkeiten heraus und ich war nach der Tage
Last zu müde, um Sie zu widerlegen. Aber heute! Wissen Sie, was wir
anstellen werden? Die elektrischen[S. 252] Bahnen sind überfüllt. Zum Wandern
ist es zu weit. Also nehmen wir stolz einen Wagen.“
Um keinen Preis wollte sie die feinfühlige Kranke merken lassen, daß
sie vor jeder Anstrengung ängstlich behütet werden mußte. Gretchen
Müller empfand es aber doch.
Es war diesmal nicht Bescheidenheit, die sich ängstlich weigerte,
mitzutun, sondern die durch das heutige Erlebnis noch verstärkte Furcht
von früheren Bekannten oder gar von ihren nächsten Angehörigen gesehen
und erkannt zu werden.
„Wenden Sie nicht ein, daß es eine arge Verschwendung wäre,“ begann Eva
von Ostried von neuem, „ich für meinen Teil bedarf dieser Abwechslung
wahrhaftig ebenso dringend. Natürlich wird die Fahrt zum Grunewald
hinausgehen. Irgend ein Tischlein am Wasser muß sich finden lassen.
Wir werden uns einbilden, daß wir im eigenen Park säßen und die
Dienerschaft ein wenig beurlaubt hätten, um recht ungestört zu sein.“
„Ich kann nicht mitkommen,“ sagte Gretchen Müller mit eintöniger, müder
Stimme.
Da begriff Eva von Ostried, daß sie die Angst, die sich aus dem
Zucken der feinen Lippen offenbarte, beschwichtigen müsse. Jedes Wort
hätte geschmerzt. Jede Aufmunterung zur Beherrschung nur noch eine
vergrößerte Scheuheit hervorgerufen. Und sie wollte doch heilen. So
begann sie leise ein uraltes Reiselied zu summen:
Wir ziehen vermummt durch Stadt und Land
Von Freund und Feinden unerkannt..
Juvivallera – Juvivallera – –
„Ich kann nicht,“ wiederholte der blasse Mund.
[S. 253]
Das waren die Worte, die bisher Eva von Ostried als genügende Erklärung
angesehen hatte. Heute kämpfte sie dagegen an.
„Ich meinte auch oft genug, daß sich etwas nicht zwingen ließe und es
geht dann doch.“
„Weil Sie nicht wissen, wie schwer eine Schuld lasten kann.“
Einen Augenblick sah Eva von Ostried zögernd zu Boden. Dann sagte sie
leise und schwermütig:
„Doch, das weiß ich wohl.“
„Aber die brennende Scham kennen Sie nicht.“
„Für so wertlos halten Sie mich, Kind?“
„Nein,“ wehrte die andere erschrocken ab, „nur für nicht so tief
gesunken, als ich es bin.“
Einen Augenblick fühlte Eva von Ostried das Verlangen, sich dieser
Leidensgefährtin gegenüber auszusprechen. Es mußte unsäglich schön
sein, mit einander zu weinen. Dann empfand sie es als Schwäche,
überwand sie und sagte frisch und froh:
„Die aufgezwungenen Liebesgaben, mit denen man, in bester Absicht zwar,
seinen lieben Nächsten quält, sind die gefährlichsten, glaube ich. Also
begrabe ich hiermit meinen Wunsch feierlich.“
„Ich bringe Ihnen nichts wie Enttäuschungen, Fräulein von Ostried.“
„Dies heute war wirklich eine. Aber jetzt ist sie überwunden. Sprechen
wir schnell von etwas anderem. Sehen Sie nur, Sie haben da Ihr
Taschentuch verloren, Kindchen.“ Und sie hob das feine Batistgewebe auf
und betrachtete es aufmerksam. „Es gehört Ihnen doch oder[S. 254] sollte es
einer aus der Schülerschar vergessen haben. Lassen Sie mich nach dem
Namen sehen.“
Gretchen Müller machte eine Bewegung, als wolle sie sich darauf
stürzen, um es Eva von Ostried zu entreißen, aber als trügen sie die
müden Füße nicht länger, ließ sie sich wieder auf den kleinen Hocker
sinken.
„„P. K.“ ist es gezeichnet, Fräulein Gretchen? Ich kenne jemand, der
es verloren haben könnte, Fräulein Gretchen,“ sagte Eva von Ostried
ahnungsvoll. „Soll ich seinen Namen nennen oder – wollen Sie es tun?“
Scham und Angst schüttelten den elenden Körper.
„Ich will sterben,“ flehte das Mädchen.
„Wird es Ihnen so schwer,“ fragte Eva jetzt. „Dann muß ich es wohl tun.
Nicht wahr, Paul Karlsen war hier – bei Ihnen?“
Mit einem Aufschrei warf sich Gretchen Müller ihr zu Füßen und
umklammerte ihre Knie.
„Muß ich jetzt fort?“
Hinter Evas Stirn fieberten die Gedanken, wie einst –
„Wer hat das Recht zu verdammen? Niemand auf der ganzen Welt! Auch
die, welche sich schuldlos wähnen, nicht.“ Sie neigte sich und zog die
Kniende sanft zu sich empor. „Du armes, armes Kind.“
In ihren Augen glühte keine Verachtung. Ihr Gesicht verzog sich nicht
zu unnahbarem Stolz.
Es war eine alles begreifende und verzeihende Liebe darin!
Das müde, gepeinigte Mädchen erkannte, daß Eva von Ostried jenen Mann
niemals geliebt hatte und dennoch voll die Macht begriff, die er besaß!
Vor das Hohen-Klitziger Herrenhaus rollte ein Landauer! Die rassigen
Köpfe zweier Blauschimmel verdunkelten plötzlich das Küchenfenster,
hinter dem die Mamsell das Futter für die jungen Puten zurechtknetete.
Sie wandte sich nach der einzigen ihr zur Verfügung stehenden Hilfe um,
die damit beschäftigt war, von einem Paar langschäftiger Stiefel die
Kotspritzer mit einem Holzspahn herunter zu kratzen.
„Nee,“ dachte sie dabei, „die sieht kein bißchen proper aus,“ und
machte sich selbst zum Gehen bereit.
Sie pochte an die zweite Tür neben der Küche, hinter welcher der
Klitziger Herr zur Sicherheit noch einmal die Seiten zusammenrechnete,
deren Ergebnis sein Bruder bereits festgestellt hatte.
„Herr Amtsrat, die Waldesruher Schimmel halten vor der Treppe.“
Er sah flüchtig auf, ohne die Feder von den Zahlenreihen zu nehmen.
„Ist wohl ein neuer Kutscher, der noch nicht weiß, wo der Dorfschmied
wohnt.“
„Ich glaube nicht, daß es neuer Hufbeschlag sein soll, Herr Amtsrat.
Der Schloßherr sitzt im Wagen.“
[S. 256]
„So,“ sagte der alte Wullenweber nicht sonderlich interessiert,
„dann fragen Sie ihn nur nach seinen Wünschen. Ich wäre hier und für
dringende Sachen auch zu sprechen.“
Er blieb ruhig sitzen; aber er verrechnete sich. Sein verwittertes
Gesicht nahm einen unwilligen Ausdruck an. Bisher hatte es der Nachbar
nicht der Mühe wert gehalten, sich ihm in seinem Hause vorzustellen. An
der Grenze freilich wollte er es verschiedentlich tun. Dazu zeigte der
Amtsrat keine Neigung.
Der Waldesruher Herr stand in dem Rufe, ein adelsstolzer, hochfahrender
Mann zu sein, der sich einsam hielt. Daneben war er aber auch
zweifelsfrei ein tüchtiger Landwirt und das nötigte dem Amtsrat einigen
Respekt ab. Es war keine Kleinigkeit gewesen, den zurückgekommenen
Acker und die verfallenen Katenhäuser in Ordnung zu bringen.
Horst Waldemar von Ostried maß sieben Fuß. Also nicht in allen Fällen
konnte er dafür, wenn er über die meisten Menschen und Dinge fortsah.
In erster Ehe war er mit einer Gräfin Aschaffenburg vermählt gewesen,
die ihm keinen Erben geschenkt hatte. Seit ihrem Tode, der ein Jahr vor
der Uebernahme des Majorats Waldesruh erfolgte, befürchteten die Eltern
des nächsten Anwärters die Mitteilung seiner zweiten Heirat.
Wie er sich jetzt vor dem Aelteren verneigte, bemühte er sich
augenscheinlich freundlich und herablassend zu sein.
„Ich hatte es mir schon lange vorgenommen, Herr Nachbar.“
[S. 257]
„Ja, so’n Weg von einem Kilometer will überwunden und vorher überlegt
sein, Herr Nachbar,“ nickte der Amtsrat mit belustigtem Lächeln.
Der andere räusperte sich.
„Ich komme mit einer Bitte, Herr Amtsrat.“
„Das habe ich mir denken können, Herr von Ostried.“
„Es handelt sich nämlich um die Adresse von der Tochter meines
Vorgängers.“
„So, Sie möchten wissen, wo sich Ihre Base Eva zur Zeit aufhält?“
„Ganz recht; daran wäre mir viel gelegen.“
Ein prüfender Blick strich über die mächtige Gestalt des Schloßherrn
hin. Sollte diese Frage etwa die Vorbereitung zu einer zweiten Ehe
sein? Es war, als ahne der Riese ähnliche Gedanken. Fast hastig gab er
eine Erklärung ab.
„Wir müssen einen Familientag einberufen, zu dem – unserm Hausgesetze
gemäß – sämtliche Ostrieds gerader Linie eingeladen werden müssen.“
„Ich glaube, auf diesen Anspruch wird Eva von Ostried keinen besonderen
Wert legen.“
„Darauf kommt es nicht an. Es ist eine reine Formsache. Ich kann Ihnen
übrigens gern den Grund nennen, wenn es Sie interessieren sollte.“
„Bemühen Sie sich nicht. Ich mache mir nicht viel aus solchen
Geschichten.“
„Erlauben Sie mir, daß ich es trotzdem tue, um nicht für meine Person
in irgend einen unbegründeten Verdacht zu kommen.“
[S. 258]
Der Amtsrat mußte wieder lächeln. Schlau war der Kerl entschieden.
„Daß Sie sich daraus etwas machen, Herr von Ostried.“
„Die Tochter meines Vorgängers steht bei unserer ganzen Familie in
nicht sonderlicher Hochachtung.“
„Solange ich ihr Vormund gewesen bin, war nichts, auch nicht das
Geringste an ihrer Aufführung zu mäkeln.“
„Sie wollte doch – äh – zur Bühne.“
„Das meinen Sie damit? Ach so! Na ja, das beabsichtigte sie freilich
stark. Im Prinzip war ich auch dagegen, wie das ja die Verweigerung
meiner Erlaubnis bis zu ihrer Volljährigkeit bewiesen hat.“
„Darf ich also kurz referieren, Herr Amtsrat.“
„Wenn Sie es durchaus nicht anders tun. Bitte schön.“
„Ein Ostried-Javelingen hat kürzlich eine Eingabe um Verleihung
des seit fünfzehn Jahren nicht mehr zur Verteilung gelangten
Stiftungsgeldes für bedürftige Familienmitglieder gestellt. Zum
rechtswirksamen Gewähren ist nicht nur die schriftliche Zustimmung
sämtlicher stimmfähiger Ostrieds – auch der weiblichen –
erforderlich, sondern ihr Zusammenkommen an gemeinsamer Stelle zwecks
vertraulicher mündlicher Aussprache.“
„Jetzt fange ich an, die Notwendigkeit zu begreifen, Herr von Ostried.
Das muß sein, weil zu erwarten ist, daß dieser oder jener ein bißchen
Dampf vor einer Beleidigung oder Ablehnung mit Tinte hat.“
„Es gibt doch Sachen, die zu empfindlich sind, um sie
niederzuschreiben.“
„Gerade das habe ich gemeint. Da fliegt ein Wort in der Luft rum, die
Frauen flüstern es vielleicht bloß. Aber[S. 259] gehört und bewertet wird’s
jedenfalls. Und das mag schon genügen.“
„War Ihre Frau Mutter vielleicht –“
Der Amtsrat unterbrach ihn kurz. „Nein, durchaus nicht! Sie war
eine geborene Hafermatz aus Kölpin, Tochter des derzeitigen
Wirtschaftsbeamten. Meine Weisheit hat einen andern Ursprung. Ich
weiß das von einer, die auch mal um dieses Geld eingekommen ist,
weil damit ihr schwacher Körper wohl noch auszuheilen gewesen wäre.
Eva von Ostrieds Mutter hatte sich nämlich nach vielen und harten
Gewissensnöten zu diesem Ersuchen entschlossen. Sie tat’s ihrem Kinde
zu Liebe. Die Antwort war eine Woche später eine bestimmt verneinende.“
„Dann haben also bereits bei der Vorberatung, die schriftlich erledigt
werden kann, die Mehrzahl der Familienmitglieder den Antrag abgelehnt.“
„Jedenfalls wird es so gewesen sein.“
„Wir brauchen nicht Verstecken mit einander zu spielen, Herr Amtsrat.
Mein Vorgänger war kein Mann, dem man solche Zuwendungen machen durfte.
Unser Hausgesetz verlangt ausdrücklich einen tadellosen Charakter
oder um mit seinen Worten aus dem Jahre 1800 zu sprechen: Es muß eine
feine und ritterliche Familie sein, der früher und auch jetzo nichts
anzuhängen gewesen ist.“
„Sie sprechen da plötzlich von dem Manne. Ich habe nie gehört, daß dem
damaligen schönen Ostried irgend ein Organ schwach geworden wäre. Hier
handelte es sich um die Frau, die über jedem Zweifel erhaben stand.“
[S. 260]
„Was der Mann tut, darstellt oder unterläßt, fällt in der Ehe allemal
auf die Frau zurück. Auch darüber gibt es natürlich Bestimmungen.“
„Ein schönes Familiengesetz, das so was vorschreibt.“
„Darüber wollen wir nicht streiten, Herr Amtsrat.“
„Sie haben Recht. Einem Gaul, der ein Kleber ist, bringt ja auch kein
Schenkeldruck von der Stelle, wenn er nicht schließlich selbst will.“
Das hochmütige Gesicht verlor nichts von seiner kühlen Freundlichkeit.
„Für so eigensinnig hätte ich Sie nicht gehalten, Herr Amtsrat.“
„Das soll wohl eine Beleidigung sein,“ dachte der alte Wullenweber und
lachte vergnügt in sich hinein. „Mein Jungeken, damit hast du bei mir
kein Glück.“
Laut sagte er:
„Ich bin sogar so eigensinnig, daß ich Eva von Ostrieds Vater nicht
mehr in mein Haus reingelassen habe, seitdem es mir keine Ehre mehr
sein konnte, mit ihm umzugehen.“
Der Hieb saß.
„Aber seiner Tochter scheinen Sie erfreulicherweise die alte Zuneigung
erhalten zu haben,“ meinte der Schloßherr mit glatter Höflichkeit.
„Zu der Tochter stand und stehe ich weiter in gar keinem Verhältnis.
Sie ist mir fremd geblieben. Was ich übernahm, tat ich lediglich für
ihre Mutter. Uebrigens weiß ich seit ihrer Volljährigkeit nur das eine,
daß sie seit dem Tode ihrer mütterlichen Freundin, irgendwo in Berlin
untergetaucht ist.“
[S. 261]
„Auch die Adresse ist Ihnen unbekannt geblieben, Herr Amtsrat?“
„Noch gestern hätte ich das glatt verneinen müssen. Heute allerdings.“
Es klang zögernd. Aber der Schloßherr hat bereits das Notizbuch
hervorgesucht und netzte den Stift behutsam an den Lippen.
„Ich war vorher noch nicht zu Ende gekommen, Herr Amtsrat. Ich lege
aus zweierlei Gründen großes Gewicht gerade auf diese Adresse. Erstens
ist anzunehmen, daß Fräulein von Ostried, wenn auch nur, um sich für
die Teilnahmslosigkeit unserer Familie zu rächen, widersprechen würde,
sobald sie etwas von dem ohne sie gefaßten Beschluß erführe.“
„Mein Gott, wie sollte sie davon hören.“
„Es könnte immerhin möglich sein. – Der zweite Grund betrifft
sie selbst. Ich halte mich noch nicht befugt darüber zu sprechen.
Jedenfalls – – Also, wenn ich Sie jetzt bemühen darf, Herr Amtsrat.“
„So schnell geht das nicht. Sie denken wohl, ich brauchte sie ihnen so
ganz einfach bloß zudiktieren.“
„Etwas anderes zog ich allerdings nicht in Betracht.“
„Bedaure! Sie müssen sich noch selbst darum bemühen. Ich besitze
seit gestern nämlich lediglich die Möglichkeit, näheres über sie zu
erfahren. Mein Neffe, Rechtsanwalt Wullenweber, berichtet mir, daß sie
in einer geschäftlichen Angelegenheit seinen juristischen Beistand in
Anspruch genommen hätte. Seine Adresse ist zu Ihrer Verfügung.“ – Der
Amtsrat nannte sie.
[S. 262]
„Haben Sie eine Ahnung, verehrter Herr Amtsrat, ob Ihr Herr Neffe ein
tüchtiger Anwalt ist?“
„Ich bin ebenso wenig Jurist, wie Sie, Herr von Ostried und unser
zuständiges Amtsgericht kenne ich, Gottlob, bisher nur von außen. So
viel weiß ich aber, daß der Justizrat, dessen Teilhaber er ist, einen
guten Namen und ungeheuren Zuspruch hat.“
„Das genügt mir völlig. Anläßlich des Familientages muß ich nämlich
einen Anwalt für bestimmte Zusätze und kleine Abänderungen in unseren
Statuten gewinnen.“
Er empfand es als angenehm, dies bei seiner Bitte um Eva von Ostrieds
Adresse nunmehr in den Vordergrund stellen zu können.
„Wenn ich recht unterrichtet bin, haben Sie, Herr Amtsrat, als
einstiger Vormund und Bevollmächtigter von Eva von Ostrieds Vermögen
auch sehr wertvolle alte Möbelstücke aus dem Waldesruher Schloß zur
Aufbewahrung übernommen?“
Der Amtsrat lächelte grimmig.
„Vermögen! Das klingt außerordentlich stolz. Wissen Sie zufällig, wie
hoch sich die Summe bezifferte?“
„Wie käme ich zu einer genauen Kenntnis. Wir mit dem gleichen Namen
hofften damals, daß sie jedenfalls zu einem standesgemäßen Unterhalt
ausreichen würde.“
„Nett von Ihnen! Sie hofften, leider, vorbei. Eintausend Mark waren’s!“
„Wie könnte sie sich damit durchgefunden haben?“
„Die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich hatte die Ehre, eine
vortreffliche Frau, die ihr eine zweite Mutter geworden war, kurz vor
ihrem unerwartet eingetrete[S. 263]nen Tode kennen zu lernen, und ging mit dem
berechtigten Gefühl von ihr, daß sie fraglos einen Teil ihres soliden
Reichtums meinem verflossenen Mündel überschriebe. Erst gestern teilte
mir mein Neffe mit, der übrigens diese Wissenschaft wiederum von dem
Notar und Freund der Toten, dem schon erwähnten tüchtigen Justizrat,
schöpfte, daß der plötzliche Tod sie daran gehindert haben müsse.
Jedenfalls ging Eva von Ostried leer aus. Aber Sie fragten auch nach
den alten Möbeln. Einen Augenblick! Bitte, hier ist das Verzeichnis.
Es sind Stücke von großer Schönheit darunter. Das Sterbezimmer ihrer
Mutter besitzt Eva bereits. Deren kleines Wohnzimmer – übrigens
eingebrachtes und daher nicht zur Masse gehöriges Gut, wie auch jene
Sachen, die sich schon in Eva von Ostrieds Besitz befinden – stellt
dies dar.“
„Ein offenes Wort, Herr Amtsrat! Sind diese kostbaren alten Stücke
verkäuflich? Ich weiß nicht, ob Sie ahnen, daß ich leidenschaftlicher
Sammler von altertümlichen Möbeln bin. Einen ebenso hohen Preis wie
jeder andere fremde Liebhaber würde ich natürlich auch anlegen.“
„Ich bin so ungebildet in diesen Sachen, daß ich nicht mal sagen kann,
ob das wirklich Altertümer in Ihrem Sinne sind. Nur das eine weiß
ich aus dem Mund von Evas Mutter, daß sie schon im Heim von deren
Großeltern gewesen sind.“
„Darf ich wissen, wie Sie über einen Verkauf denken, Herr Amtsrat?“
„Darüber habe ich nichts mehr zu bestimmen, Herr von Ostried. Als ihr
Vormund hätte ich einen besonders günstigen Verkauf, mit Rücksicht auf
die bestehende Vermögens[S. 264]losigkeit, zweifelsfrei verantworten können.
Jetzt stehe ich kaum anders wie jeder Fremde zu der Besitzerin.“
„Könnten Sie mir wenigstens die Möbel zeigen, Herr Amtsrat?“
„Dazu wäre meine alte Klidderten nötiger als ich. Ich habe mich nur
bis zu dem Augenblick ihrer sicheren Unterstellung darum gekümmert.
Das Zudecken und Abstauben ist der Klidderten ihre Sache. Die wird
aber gerade mit dem Kochen zu tun haben. Eine Sache könnten Sie indes
ansehen. Evas Mutter machte sie mir zum Geschenk. Stil und Holzart
sind hier wie dort gleich. Sehen Sie dort, der Schreibtisch aus
italienischem Nußbaum.“
Es war ein wundervolles Stück mit reicher künstlerischer
Tiefschnitzerei. In Form und Art an die alten Zylinderbüros erinnernd,
die in keiner Großvaterstube zu fehlen pflegten. Nur, daß die Einlagen
über den reich geschnitzten Holzrändern aus Mosaikstückchen bestanden,
die sich zu kleinen, wirkungsvollen Bildern einten. Das runde große
Medaillon des Aufsatzes, das ein halbes Jahrhundert später, als Ersatz
des zerschlagenen Mosaikbildes eingefügt war, zeigte ein Pastellbild.
Ein namhafter Maler aus jener verzweifelten Zeit, in der Eva von
Ostrieds Mutter auf den Gedanken gekommen war, einen Teil des Schlosses
und des wundervollen Parkes erholungsbedürftigen Künstlern gegen
Entgelt zur Verfügung zu stellen, hatte es geschaffen.
Der Schloßherr warf mit einer geschickten Bewegung das Monokle
in das kurzsichtige rechte Auge. Sein müder Blick belebte sich
auffallend. Der tiefe Durchzieher, mit der einst auf dem Heidelburger
Fechtboden erhaltenen blutroten Belehrung, daß auch nicht sonderlich
hochgewachsene Leute[S. 265] eine gute Klinge führen können, begann zu glühen.
Das Hochmütige in seinen Zügen verschwand.
Als er nach langem aufmerksamen Betrachten den Kopf hob und die Hände
von der Schnitzerei nahm, war er ein ganz anderer wie zuvor. Es
bedurfte also nur des Aufflammens einer leidenschaftlichen Neigung, um
die oft genug abstoßend wirkende Tünche herunter zu bröckeln.
„Ich würde Ihnen zehntausend Mark geben, wenn Sie mir dies Stück
überlassen könnten, Herr Amtsrat.“
„Es wäre mir auch nicht um das Doppelte feil, Herr von Ostried.“
„Soviel allerdings. – Immerhin fordern Sie getrost. Wir werden uns
bestimmt verständigen.“
„Es ist unverkäuflich,“ entschied der alte Wullenweber kurz und zornig.
„Sie sind doch aber gar nicht Sammler solcher Dinge! Was kann dies für
Sie für einen Wert haben?“
„Den da,“ sagte der Amtsrat einsilbig und legte den Zeigefinger
behutsam auf das Pastellbild.
„Sehen Sie,“ frohlockte der andere, „damit wären wir uns schon
bedeutend näher gekommen. Dieses Bildnis würde ich sofort für Sie
entfernen lassen. Für meine Zwecke entstellt es das Ganze und
verringert seinen Wert erheblich.“
„S–o, das wäre also Ihre Ansicht?“
Der Schloßherr neigte sich zu dem Bild herab und schenkte ihm zum
ersten mal einige Aufmerksamkeit.
„Wen stellt es dar, wenn ich fragen darf?“
„Frau von Ostried und ihre Tochter Eva.“
[S. 266]
Noch einmal glitt sein Blick prüfend darüber hin. „Ich kannte die Frau
meines Vorgängers nicht persönlich,“ meinte er endlich und es klang wie
eine Entschuldigung. „Sie muß sehr schön gewesen sein.“
„Vielleicht befragen Sie deswegen die paar alten Leute, die sich ihrer
gewiß noch erinnern.“
Das klang eiskalt und schnitt eigentlich jede weitere Frage ab. Der
Schloßherr wollte es nicht empfinden. Er blickte immer noch, von
dem unvergleichlichen Reiz der beiden aneinandergeschmiegten Köpfe
gefesselt, auf das Bild von Mutter und Tochter.
„Sie sind scheinbar ein Frauenverächter, Herr Amtsrat.“
„Wieso? Weil ich mich im ersten Augenblick von Ihrer Frage abgestoßen
fühlte? Sie sollen sich nichts falsches vorstellen. Für mich ist Frau
von Ostried die Schönste auf der ganzen Welt gewesen und geblieben.“
Er mußte dies sagen, weil er kein anderes Mittel kannte, um die ihm
zudringlich und lästig werdenden Fragen abzuwehren. Der Schloßherr
begriff. Es war alles durchaus verständlich. Der leichtsinnige
Schloßherr, der sich nicht um die Seinen bekümmert hatte, auf der einen
Seite. Dieser biedere, brave Mann, der gewiß nur seine Augen und Ohren
für die kränkelnde, vom eigenen Gatten vernachlässigte Frau bereit
gehalten, auf der andern! Dazu diese strenge Abgeschlossenheit von Welt
und Leben.
Unangenehm blieb einzig, daß die Schönheit auf dem Pastellbild
den alten Namen trug wie er und der Kummersbacher, das Mitglied
des Herrenhauses auf Lebenszeit, und die Vettern Exzellenz, der
Generalleutnant und der Wirkliche Geheime Rat, sowie die andern
der Familie. Schließ[S. 267]lich hätte man sich auch damit im Lauf der
Jahre abgefunden, wenn dies verblüffend reizende Gesicht neben der
großäugigen Frau, das irgendwo in Berlin herumlief, nicht immer noch
weiter zur Familie gehörte. Die Tatsache, daß Eva bei dem Einladen zum
Familientag unmöglich übergangen werden durfte, bewies es deutlich. Ein
Gesicht wie dieses, selbst wenn es den kindlichen Zauber eingebüßt,
machte es der Trägerin doppelt und dreifach schwer, ohne Aufsehen durch
die Welt zu kommen.
„Wann haben Sie Eva von Ostried zum letzten mal gesehen, Herr Amtsrat,“
forschte er aus diesen Gedanken heraus.
Der alte Wullenweber fuhr erschrocken zusammen. So tief hatte er sich
mit der heraufbeschworenen Vergangenheit beschäftigt.
„Bei ihres Vaters Begräbnis ist es gewesen. Hätte ich gefehlt, wäre sie
ganz allein neben dem Seelsorger hinter dem Sarg, hergeschritten. Denn
die Tagelöhner blieben aus Bescheidenheit eine halbe Meile zurück. Und
von den Nachbarn oder seiner Familie war niemand dabei.“
„Die Anzeigen von seinem Tod müssen sich verspätet haben. Vielleicht
sind überhaupt keine verschickt. Ich jedenfalls erhielt die Nachricht
erst durch meine Berufung zu seinem Nachfolger.“
„Also doch rechtzeitig,“ meinte der Amtsrat bitter und sah nach der
Uhr, die mit behaglichem Pendelschlag die kleine Pause belebte.
„Ich habe nur einer Leidenschaft im Leben bisher nachgegeben,“ begann
er von neuem und diesmal leiser und weicher wie zuvor. „Ich verriet sie
Ihnen bereits. Schon[S. 268] in frühster Jugend war die Vorliebe für alte,
wirklich schöne Sachen so groß, daß ich mir jedes Vergnügen versagte,
um mich endlich in den Besitz eines ersehnten Gegenstandes zu bringen.“
„Verrückt,“ mußte der alte Wullenweber denken, aber es söhnte ihn etwas
mit diesem scheinbar kalten, wesenlosen Menschen aus.
„Vielleicht sprechen Sie persönlich mit Ihrer Base, wenn Sie zu dem
hochwichtigen Familientage in Berlin sind,“ schlug er vor.
„Vorläufig geht es mir um dies Stück.“ Und er fuhr, wie liebkosend,
über das edle, alte Holz.
Ehe noch der Amtsrat die scharfe Erwiderung, die ihm dies taktlose
Festhalten auf die Lippen zwang, aussprechen konnte, fuhr er fort:
„Ich würde Ihnen sehr gern durch einen Berliner Sachverständigen das
Pastellbild entfernen und in einen durchaus würdigen Rahmen bringen
lassen. Derselbe könnte mir auch den Ersatz für das Mosaikrund
besorgen. Ihnen ginge nach Ihren eigenen Worten durch die Hingabe des
alten Stückes selbst nicht allzu viel verloren. Mir aber täten Sie
einen großen Gefallen. Wollen Sie nicht wenigstens die Güte haben, sich
meinen Vorschlag zu überlegen?“
„Eine Gegenfrage,“ sagte der Amtsrat und seine Stimme klang stahlhart.
„Was würden Sie sagen, läge die Geschichte umgekehrt? Sie wollten aus
einem für Sie wichtigen Grunde nicht und der andere – nun – der hörte
eben nicht auf zu drängen. Sie würden mich aufrichtig verbinden, wenn
ich das wissen dürfte, Herr von Ostried!“
[S. 269]
Mit einem Schlage verwandelte sich das Gesicht des Majoratsherrn
wiederum in das unbeweglich hochmütige. Das Monokle hüpfte mit feinem
Klingen gegen einen Kopf des tadellos sitzenden Besuchsrockes. Die
blassen, kühlen Augen schauten von neuem wie aus einer Maske. Er nahm
die Hacken zusammen und verneigte sich leicht.
„Verzeihung, wenn ich aufdringlich erschienen bin. Sie haben natürlich
recht. Ich würde mir das ebenfalls verbeten haben. Nun, mein Agent in
Berlin wird ja wohl ein ähnliches Stück auftreiben können.“
Er reichte dem Amtsrat die Hand hin.
„Ich habe Sie ungebührlich lange aufgehalten, Herr Amtsrat!“
Seine Bewegungen waren wieder gemessen und herablassend. Eine jede
schien das aufrichtige Bedauern auszudrücken, daß er sich mit dem
ungefälligen Nachbar überhaupt eingelassen hatte.
– Der Abschied war schließlich fast hastig.
Wenn es einmal und zwar schüchtern gegen die Küchentür stieß, dann war
es Filax, der alte Stubenhund, den ein beständiger Hunger plagte. Wenn
es zweimal und zwar mit einem donnerähnlichen Geräusch dagegen krachte,
war es der Major a. D. Wullenweber, der die alte Klidderten anschnauzen
wollte.
Auguste, die fahrige blutjunge Deern, duckte sich jedesmal bei
Beginn des Polterns ängstlich zusammen. Die Mamsell jedoch öffnete
unerschrocken, wenn auch voller Behutsamkeit, damit der Draußenstehende
nicht etwa von einem heftigen Anprall umgeworfen würde und sagte
freundlich:
[S. 270]
„Ja, Herr Major, heute wird’s zehn Minuten später mit den frischen
Kartoffeln. Der Waldesruher Herr war bei uns.“
„Wenn Sie „frische Kartoffeln“ sagen, klingt das noch großartiger als
wenn seiner Zeit der Oberkellner in Esplanade meinetwegen „frische
Austern“ lispelte,“ höhnte er poltrig und unzufrieden.
„Ich kenne bloß Dabersche und denn magnum bonum und die kleine blaue
frühe, denn von der weißen halt’ ich nichts. Austern bauen wir hier gar
nich.“
„Sie sind ein Kamel, Klidderten.“
„Denn müßt ich ja wohl in die Wüste, Herr Major. So ist mir das von
meiner Jugend her erinnerlich. Und denn kriegten Sie alle überhaupt
nichts warmes auf den Tisch.“
„Nun schweigen Sie endlich still. Wenn man schon nichts zu essen
bekommt, muß man wenigstens einen ordentlichen Tropfen trinken.
Nehmen Sie mal Vernunft an, Fräulein Kliddert. Eine einzige Flasche,
Mamsellchen. Na los.“ Sie kam ein wenig näher. Aber doch nicht
mehr, wie auf fünf Schritt Distanz. Dann ließ sie die angeborene
Bescheidenheit halt machen.
„Begucken Sie sich bloß mal im Spiegel, Herr Major. Ist das nicht eine
wahre Freude mit Ihnen? Sehen Sie vielleicht aus wie einer, der in
die Sechzig will? Wirklich nicht. Von der dummen Krankheit, als Sie
gerade angekommen waren, ist keine Spur mehr zu merken. „Klidderten,“
hat neulich der Waldesruher Gärtner zu mir gesagt, denn er kommt jeden
Donnerstag aus alter Gewohnheit auf einen Schwatz in die Küche. „Was
ist das für ein Kavalier mit dem feinen Spitzbart –“
[S. 271]
„Hören Sie schon damit auf,“ murrte der Major, aber in seiner Eitelkeit
freute er sich kindisch darüber.
Die alte Klidderten schielte nach der andern Seite des Hauses hin, von
welcher ihr der Amtsrat zu Hilfe kommen sollte, denn die Blauschimmel
waren schon angetrabt. Dann war für diesmal wieder alles ausgestanden.
Vor dem Bruder schwieg der Herr Major davon!
Aber der Hohenklitziger Herr stand versonnen und sah dem davonrollenden
Gefährt mit gefurchter Stirn nach.
Die Gedanken schossen ihm wild durch den Kopf.
„Wenn der das Mädel in Berlin kennen lernen sollte und sie gefällt
ihm und er kriegt doch vielleicht nicht von seinem Agenten den
ähnlichen alten Schreibtisch und er denkt dann so nebenbei dran, daß es
vielleicht hübscher und angenehmer wäre, der jetzige Anwärter erbte das
Majorat nicht, sondern sein eigenes Fleisch und Blut und sie sagt „ja“,
denn wie sollte ein armes Ding wohl den Mut zu einem „nein“ finden.“
Aergerlich wandte er sich herum. Was ging ihn dies alles an? Hatte er
sich die letzten Jahre überhaupt um das Mädel – die Eva – gekümmert?
Trotzdem sie die Tochter der geliebten Frau war. Dumme Ausrede, daß
er an die Erbschaft durch die Präsidentin und ihr gutes Auskommen
felsenfest geglaubt hatte.
Ein Mann in seinen Jahren glaubt nur das, wovon er sich auch überzeugt
halten darf. Erst der Junge, der Walter, mußte sie ausfindig machen,
ehe er an sie dachte.
Gedankenlos war er weiter gegangen und stand nun vor der alten
Klidderten, die ihm heftig zublinkte. Diese Sprache begriff er
ausgezeichnet. Seitdem sich sein Bruder damals[S. 272] nach dem glücklich
überstandenen Schlaganfall zum Hierbleiben entschlossen hatte, stand
sie ihm auch hierin getreulich zur Seite. Es kamen immer wieder Tage,
in denen der Major ein unbändiges Verlangen nach den Dingen trug,
durch die er sich bis jetzt seine Vergnügungen verschaffte. In dieser
Abgeschlossenheit wäre ihm höchstens ein guter, alter Tropfen aus dem
Keller mit der lebensgefährlichen Treppe erreichbar gewesen. Er selbst
war aber nicht imstande, die schwindelnde Stiege hinabzuklimmen und die
alte blödsinnige Gans, wie er sie soeben bei sich nannte, tat ihm nicht
den heimlichen Gefallen.
Da sprach ihn der Amtsrat an: „Du hattest heute früh einen Brief von
Walter, nicht wahr?“
Der Major brummte eine Erwiderung die unverständlich blieb.
„Sonderbar,“ wunderte sich der Amtsrat, „weil er doch gerade erst
gestern an mich geschrieben hatte.“
„Wieso sonderbar? Kann er nicht auch mal ausnahmsweise was mit seinem
Vater zu bereden haben?“
„Natürlich. Er betonte aber gerade zu mir, wie knapp seine Zeit
geworden sei.“
„Wenn dich die Neugier sticht, kannst du den Brief nachher lesen.“
„Du weißt genau, daß es etwas anderes ist!“
„Meinetwegen. Du hör’ mal,“ und er zog den Amtsrat bei Seite wie ein
Kind, das etwas Heimliches zu sagen hat, vor dem es sich im Grunde
genommen, ein wenig schämt, „befiehl doch mal deiner verehrten
Scharteke da, daß sie uns eine von dem herben Ungar raufholt. Frage
nichts. Gib[S. 273] auch keine Lehren. Tu mir mal ausnahmsweise den kleinen
Gefallen.“
Der Amtsrat hatte eine heftige Ablehnung bereit. Als er aber das alte,
bittende Gesicht sah, überkam ihn eine eigentümliche Weichheit.
Schließlich war es keine Kleinigkeit, daß der Bruder Leichtfuß seinen
tiefgewurzelten Widerwillen gegen die ländliche Stille überwunden und
– seinem Ehrenwort getreu – ohne neue Schulden zu machen, bei ihm
ausharrte. Er tuschelte mit der Klidderten.
„Schön, holen Sie eine rauf. Wir haben ja ohnehin noch fünfzig von der
Sorte.“
„Aber, ihn bloß nichts davon merken lassen, Herr Amtsrat.“
„Wenn Sie sich nicht verplappern, Klidderten.“
„Wo werd’ ich denn. Ich bleibe dabei, daß es im Ganzen überhaupt bloß
noch zwei waren. Eine wurde ausgetrunken, als Herr Walter das letzte
mal bei uns war. Nu is denn keine einzige mehr da. Bloß noch der
Säuerling, den ich für’s Wildragut gebrauche.“
Mit verständnisvollem Lächeln verschwand sie hinter der schweren
Küchentür. – Der Amtsrat trank kaum ein halbes Glas von dem
goldklaren, alten, schweren Sorgenbrecher. Daß er ihm Bescheid
tun sollte, verlangte der Major auch gar nicht. Er selbst sog mit
geschlossenen Augen in kleinen, schmatzenden Zügen.
In der Mitte des Tisches dampften die frischen Kartoffeln mit einer
reichlichen Beigabe grüner Petersilie. Neben jedem der beiden Gedecke
duftete eine kräftige Scheibe Bratspeck. Dazu stand – wie gewöhnlich
– ein Topf mit köst[S. 274]licher Buttermilch bereit. Der alte Offizier wurde
wieder jung, leichtsinnig und prahlerisch.
„Als ich bei den Kürassieren in Dernburg stand, kriegte ich von zarter
Hand ganze Körbe voll Champus. Bedankt habe ich mich nie. Bei wem denn?
Man ahnte natürlich. Das Nest war ja klein. Aber die Eifersucht unter
der edlen Weiblichkeit war zu groß geworden. So war’s schlauer, ich
stellte mich unwissend.“
Der junge Kürassierleutnant hatte sich dann in die Infanterie stecken
lassen müssen. Wegen Schulden natürlich.
„Zuerst dachte ich mir das gräßlich. Hatte Selbstmordgedanken.
Schließlich machte sich’s ganz nett. Mädelchen waren da noch viel
aufmerksamer und verliebter.“
Als Hauptmann der Infanterie kam er auf der Treibjagd zu dem, was er
sein Unglück nannte.
„Alles vorbei. Es war zum Rasendwerden. Man war niemand mehr.“ Seine
Ehe hatte er vergessen. Sie war ja auch nur kurz gewesen. – In der
Flasche schimmerte der Boden mit dem Rest des Goldenen. –
„Doch – die Kinder! Vater spielen will gelernt sein. Mir lag’s nicht.
Der Junge war mir zuweilen direkt peinlich mit seiner unbequemen Art zu
gucken und Fragen zu stellen. Aber – das Mädchen.“
Der letzte Tropfen hing schwer an seinem grauen Bart, den der
Haarkünstler nun nicht mehr ausbesserte. Ihn stieß das Elend.
„Daß du’s weißt, ich bleibe nicht länger hier. Morgen früh geht’s
weg. Kannst du mir das verdenken? Zwei reichliche Jahre immer bloß
Buttermilch und die Faltenschnute von deiner Klidderten. Daß man das
überhaupt[S. 275] geschafft hat. Nie raus aus der Bude. Immer hinter den
Rechenbüchern und dabei noch das Gefühl, als mache der erste beste
Quartaner die Geschichte besser. – Jetzt geht in Berlin nach dem
toten Sommer das Leben wieder los. Auf der Tauentzienstraße, weißt du!
Mädelchen gibt’s da. Einfach süß. Wenn ich im Wagen oder wo am Fenster
sitze, mache ich immer noch eine gute Figur. Und die kleine Weinstube
beim Anstermeier. Piekfein. Und anständig. Niemals mahnen die. Bloß
einmal im Jahre, wenn’s einem natürlich am wenigsten paßt, erinnern sie
bescheiden. – Uebermorgen kann ich schon drin sitzen. Gleich nachher
will ich dem Jungen telegraphieren. Du läßt’s zur Post besorgen. Das
werd’ ich ja wohl noch verlangen können.“
Der Amtsrat hatte zugehört, ohne einmal den Schwall der Worte zu hemmen.
„Du wolltest mir Walter’s Brief geben,“ sagte er nur, als der Major
endlich verstummt war.
„Den Brief? Richtig. Hier ist er!“
„Ich werde ihn dir noch einmal vorlesen.“
„Nicht nötig. Habe mich bereits selbst genügend von seinem Inhalt
unterrichtet.“
Der Amtsrat bedachte den Einwand nicht. Er wußte, daß die Erinnerung an
das gegebene Wort auftauchen und zurückreißen würde. Halblaut begann er:
„Lieber Vater! Soeben habe ich die letzte Rate deiner Schulden
getilgt. Es ließ sich also, wider Erwarten, schnell erledigen.
Justizrat Weißgerber zahlte mir, als auch in letzter Instanz der
Millionenprozeß, von dem ich das letzte mal erzählte, zu unsern
Gunsten entschieden[S. 276] wurde, zwei Drittel des in diesem Falle von
unserem Klienten versprochenen Extrahonorars aus, weil ich die
ganze Mühe damit gehabt.
Freilich bin ich zur Zeit selbst völlig blank. Ich habe mein halbes
Vierteljahrsgehalt noch dazu gelegt, um endlich frei zu sein. Nun
mache ich dir einen Vorschlag. Willst Du durchaus wieder nach
Berlin, sollst Du wissen, das Du mir willkommen bist. Es kann jetzt
in jeder Beziehung besser, wie früher, für Dich gesorgt werden. Nur
mußt Du mit Deiner Reise bis zum nächsten Quartal warten, damit ich
Dir genügend Geld schicken kann. Hast Du noch selbst von Deiner
Pension zur Verfügung, teile mir das mit. In diesem Falle stände
Deiner früheren Rückkehr, wenn sie Dir wünschenswert erscheinen
sollte, nichts mehr im Wege.
Dein Sohn Walter.“
Ohne eine Bemerkung reichte der alte Wullenweber das Schreiben zurück.
Seine Augen brannten wie nach einem Erntetag mit heftigem Ostwind bei
reichlicher Sonne. Schweigend steckte auch der Major den Brief in die
Tasche. Geflissentlich sahen sie aneinander vorbei.
„Ich will mich noch eine Viertelstunde auf’s Ohr legen,“ meinte endlich
der Amtsrat und erhob sich.
Da langte auch der Major nach seinen Stöcken.
– – Der alte, schwere Goldene hatte ausgewirkt. Aber der feste Wille
zur schleunigen Rückkehr nach Berlin lebte weiter. Das Kursbuch mußte
herhalten.
„Hier war man ja doch schon mit den gefräßigen Spatzen munter. Also –
los. Morgen früh um sieben Uhr! Und keine Stunde zugegeben!“
[S. 277]
So stand’s auch in dem Telegramm an Walter Wullenweber zu lesen. Der
Major kniffte es sorgfältig zusammen. Jetzt würde man endlich bald
wieder ein Mensch werden!
Er stelzte in die weißgetünchte Schlafkammer von damals, die er immer
noch inne hatte. An der dünnen Bretterwand hing jetzt das Bild seines
Kaisers zwischen den beiden toten Majestäten, denen er ebenfalls seinen
Treueid geschworen hatte.
Als sein Sohn mit ihm redete – jawohl, so stimmte es. Der mit ihm,
denn er spielte nur den stummen, gequälten Zuhörer – war die Wand noch
leer gewesen.
Damals wurde auch ein Treueid geschworen.
Dachte er denn daran, ihn zu brechen? War es diese Einsamkeit, die ihn
nach innen sehen ließ. Das Alter oder das andere?
Die verlorene Tochter – seines Lebens Lust und Stolz.
Er las plötzlich aus einem Buch mit erhabenen Lettern.
„Eines Tages werde ich meinen letzten Treueid brechen, wenn ich nach
Berlin zurückkehren sollte!“
Die Erkenntnis erfüllte ihn mit Abscheu gegen sich selbst.
– An diesem Nachmittag saß er nicht hinter den Rechenbüchern. Er
stolperte im Garten herum, entdeckte noch etliche Aepfel in verwegener
Höhe und schimpfte mit Karl Pergande, dem Fünfzigjährigen, der das
Jungvieh unter sich hatte. – –
Bei der Abendpfeife auf der Veranda tippte er dem Bruder auf die
Schulter.
„Berlin paßt mir doch nicht mehr. Es ist zu laut, zu eng und zu teuer
für unsereins. Wenn du nichts dagegen hast, bleibe ich hier.“
[S. 278]
Der alte Amtsrat paffte sich in eine undurchsichtige Wolke hinein.
„Ist mir auch viel angenehmer,“ sagte er kurz. „Am Sonntag kommt
ohnehin der Pferdehändler aus der Stadt mit zwei angeblich fünfjährigen
Braunen. Die mußt du dir eingehend ansehen. Ich allein trau mir das
Geschäft nicht zu, denn der Hallunke tattert sehr geschickt.“
– Sie waren an diesem Abend durchaus nicht herzlicher wie sonst
zusammen.
Und dennoch fühlten sie sich beide zufrieden und ruhig, daß es nun
entschieden war.

„Du
bittest mich um eine vertrauliche Auskunft über das Vermögen
meines einstigen Mündels Eva von Ostried?“ schrieb Amtsrat
Wullenweber an seinen Neffen. „Das verstehe ich nicht. Neugier sähe
Dir unähnlich. Beabsichtigt ihr etwa Dein Justizrat Zuwendungen
zu machen? Notwendig hätte sie das sicher. Denn ihr gesamtes
mütterliches Erbe, das ich am Tage ihrer Volljährigkeit Frau
Präsident Melchers für sie übergab, betrug nur eintausend Mark.
Hätte ich geahnt, daß die wackere Frau unerwartet schnell, und
zwar mit dem von Dir erwähnten, für Eva von Ostried sehr traurigen
Ergebnis sterben mußte, hätte ich doch die Tochter ihrer Mutter
in ihr gesehen und mich auch nach der erfüllten Pflicht um sie
gekümmert. Ihr jetzt noch, nachdem sie sicher das Schwerste hinter
sich hat, zu schreiben, widerstrebt mir. Wohl aber möchte ich sehr
gern wissen, ob ihr Hilfe erwünscht wäre. Ich weiß nichts über
ihr Leben und Wirken. Wäre es nicht das Einfachste, Du zögest
Erkundigungen über ihre Lage ein? Geben sie irgendwie zu meiner
Unterstützung Anlaß, werde ich mich mit ihr stets in Verbindung
setzen. Laß es Dir durch den Kopf gehen und gib mir Bescheid,
sobald Du etwa erfährst, daß es ihr kümmerlich ergeht. Im anderen
Falle ist die Sache ja ohnehin auf das Beste erledigt.
[S. 280]
Dein Vater wird Dir inzwischen selbst seine Absicht, Hohen-Klitzig
nicht mehr zu verlassen, mitgeteilt haben. Daher mußte sich
mein Verhältnis zu ihm, von innen heraus, bessern. Erlauben Dir
die Geschäfte und die Gesundheit Deines Justizrats eine kurze
Ausspannung, so weißt Du, daß Du mit Deinem Besuch stets erfreust
Deinen
getreuen alten
Wilhelm Wullenweber.“
Der junge Anwalt las diesen Brief mit einer Empfindung, die ihm im
Augenblick noch unklar war. Er spürte nur, daß ihn der Inhalt unruhig
machte.
Seitdem Justizrat Weißgerber ihm von Eva von Ostrieds schwerer
Enttäuschung bei dem Tode der Präsidentin gesagt, ihre Verzweiflung
und Kämpfe geschildert, brachte er die Frage nicht mehr zum Schweigen,
woher sie nun doch gleich darauf das Geld zu weiteren Studien genommen
haben könnte... Ihre Schönheit wirkte, auch in der Erinnerung, in alter
Stärke auf ihn. Er empfand sie als das Vollendetste, das er jemals
gesehen hatte. Wie er, würden auch andere fühlen. Und ihr Bild trat
ganz scharf vor ihn hin. Er sah wieder ihr Erröten – den Glanz ihrer
großen, sprechenden Augen und fühlte das leise Beben ihrer Hand in der
seinen, und seine Unruhe wurde zur heißen Sehnsucht nach ihr! Aber nach
üblichen Begriffen kannten sie einander ja kaum!
Gestern war ihr Herr Alois Sendelhubers erneuter Bescheid
zugestellt. Walter Wullenweber hatte schließlich doch kurzweg einen
Entschädigungsanspruch in jeder Höhe ab[S. 281]gelehnt und ihr, bei einem
Beharren seiner Forderung, auf den Weg der Klage verwiesen. Darauf
hatte sich der schlaue Agent, der sich Eva von Ostrieds ihm besonders
wertvoll dünkende Kundschaft auf keinen Fall verscherzen wollte, zur
postwendenden „ausnahmsweisen“ Lösung des Vertrages – bezüglich
des strittigen neunten Novembers – verstanden. Somit war diese
Angelegenheit erledigt und nichts stand mehr aus, als die Entrichtung
der entstandenen Unkosten von Seiten der Anwälte, die der Justizrat
Weißgerber, nach Kenntnis der Angelegenheit, jedoch unberechnet zu
lassen wünschte. Das schwache Fädchen, an dem er sie gehalten, war
damit zerrissen.
Sie aber nie wiederzusehen, erschien Walter unmöglich. Er setzte sich
an den Flügel und versuchte die kleinen Lieder zu spielen, die ihm sehr
einsame und verzagte Stunden einst als Tröster geschenkt hatten. Seine
Sinne blieben nicht bei den Tönen. Sie irrten ab und verlangten nach
dem Leben.
Die alte Pauline brachte einen Brief herein. Sie verweilte noch wenig
im Zimmer, wie sie das auch bei der Präsidentin getan hatte.
„Herr Rechtsanwalt, ich hab’ neulich nun doch unserm Fräulein
geschrieben.“ Für sie stand Eva von Ostried längst wieder in der
Gegenwart genau wie einst. Er hielt die Blicke beharrlich gesenkt, als
könne sie sonst seine Gedanken lesen.
„Was hatten Sie ihr denn Wichtiges mitzuteilen, Pauline?“
„Nun, wie es mir indessen gegangen is und wie gut ich es auch wieder
bei Ihnen habe.“
[S. 282]
„Das wird nicht alles gewesen sein, obschon es, was meine Person
anlangt, bereits zu viel ist,“ sagte er mechanisch und sah interesselos
auf den Brief.
„Sie haben Recht. Die Hauptsache hab’ ich verschwiegen. Ich möchte doch
so gern wissen, wie sie wohnt und wie sie alles angefangen hat. Ach,
Herr Rechtsanwalt, warum kommt’s meist ganz anders, wie man denkt?
Ich hänge ja so sehr an ihr und hab’ mir damals beim Abschied fest
eingebildet, wüßt’ ich mal erst, wo sie wohnte, liefe ich auch gleich
hin. Denken Sie an, ich war auch wirklich schon mal da. Gleich, nachdem
ich von Ihnen die Adresse gehört hab’.“
Sie stockte und sah von ihm weg.
„Wann war das ungefähr, Pauline?“
„Heute vor zwei Wochen, Herr Rechtsanwalt!“
„Warum verschwiegen Sie mir das?“
„Ich war so von Herzen betrübt, Herr Rechtsanwalt.“
„War sie unfreundlich zu Ihnen?“
„Ach, ich hab’ sie gar nicht gesehen!“
„Das verstehe ich nicht!“
„Mir war’s selbst, als könnte das nicht mit rechten Dingen zugehen.
Bloß bis an ihre Tür bin ich gekommen.“
„Sie können mir alles sagen, Pauline. Ja, ich bitte Sie sogar herzlich
darum.“
„Ich hab’s gleich gefühlt, daß Sie einen guten Begriff von ihr haben,
Herr Rechtsanwalt. Und so sehr hab’ ich mich darüber gefreut.“
„Nun, dann erzählen Sie einmal!“
„Es ist schnell erzählt. Ich wußte doch nicht Bescheid und befragte
mich erst unten beim Hauswart. Da war[S. 283] eine drin, die mir gleich
erzählte, daß sie mal bei unserm Fräulein in Stellung gewesen. Sie
gefiel mir auf den ersten Blick nicht. Ach, Herr Rechtsanwalt, wenn Sie
wüßten, was ich von der zu hören gekriegt hab’.“
„Es wird nicht schlimm sein,“ meinte er. Aber in seiner Stimme zitterte
die Angst vor den nächsten Minuten.
„Doch! Ein Freund von unserm Fräulein soll der Person regelmäßig Geld
gegeben haben, damit sie nicht zu hungern brauchte. Aber nun ist er
plötzlich gestorben, in München, wo sie gerade ein Konzert gegeben
hat. Und nun sollte überall geknapst werden und das Fräulein sei
ihr noch obendrein dumm gekommen, als ob sie was dafür könnte, daß
sich noch kein neuer Freund gefunden hätt’. Solche Gemeinheiten bloß
auszusprechen, nicht wahr? Ich kenn’ doch unser Fräulein! Freude hat
sie wohl dran gehabt, wenn ihr einer nachgesehen hat. Wozu hätt’ ihr
der liebe Gott denn auch sonst all die Schönheit gegeben? Aber stolz
und rein ist sie immer gewesen. Das kann sich bei ihr einfach nicht
ändern. Und man hört ja schön die Lügerei heraus. In München soll sie
gesungen haben, gerade als der Freund sterben mußte. Und unser Fräulein
hätt’ schrecklich nachher geweint. Erzählt hätte sie nichts näheres
davon; bloß, daß er nicht mehr Sonntags und auch so kommen könnt’,
weil er eben tot wäre. – Aber irgend eine andere Person aus ihrem
Hause hat eine Zeitung angebracht. Da hat alles drin gestanden. Sogar
sein Namen. Und unser Fräulein soll ausdrücklich auch erwähnt sein als
eine, die ganz untröstlich gewesen ist, als sie seine Leiche gebracht
hätten. Und jetzt wäre ein Mädchen bei ihr. – Bestimmtes wisse man ja
wohl nicht. Aber, wenn sich eine[S. 284] niemals an die Sonne traute, keinen
Menschen ohne Verabredung zur Tür reinließ und immer so scheu wie ein
Hund rumkröche – denn könnte man sich schon allerlei denken. Der
Doktor, der die Hausmeisterkinder bei der Grippe behandelt hat, soll
zu irgendwem geäußert haben, daß sie den nächsten Kuckuck wohl nicht
mehr hören würde. Und wenn so eine dennoch gehalten würde und verwöhnt
und verhätschelt dazu, wie die Hausmeistertochter, die oben aufwartet,
erzählt, denn wüßte man schon genug.“
„Und Sie haben das alles doch geglaubt, Pauline! Sonst hätten Sie nun
gerade zu ihr hinauf müssen und sie befragen. Ja, das durften Sie nach
der langen zusammenverlebten Zeit ganz gewiß.“
„Ich mußte weinen,“ sagte sie still. „Ich war zu unglücklich von dem
Getratsch, Herr Rechtsanwalt, wie ich schon gesagt hab’.“
„Sie werden noch einen anderen Grund gehabt haben,“ meinte er. „Auch
Ihre Ehrbarkeit hat sich gegen diesen Besuch gesträubt?“
Ihr Gesicht war ganz blaß geworden.
„Das versteh’ ich wohl nicht richtig!“
„Nun, Sie hielten sich, nach dem Gehörten, wohl für zu gut, um Fräulein
von Ostried noch zu besuchen.“
Sie stieß einen leisen Schrei aus.
„Bei Gott, das war’s nicht!“
„Was könnte es anders gewesen sein?“
Sie suchte nach den rechten Worten.
„In meiner Jugend war ich sehr hitzig und auch jetzt noch geht nicht
alles so still zu, wie sich das wohl eigentlich für mein Alter ziemen
tät’. Dafür kann einer nichts, glaube[S. 285] ich. Ich war so voller Gift und
Galle, daß ich meine Hände kaum stillhalten konnt’. Die wollten der
lügnerischen Person an den Hals. – Und so hätt’ ich zu ihr reinkommen
sollen? Das wurde mir klar, als ich vor ihrer Tür stand. Verstellen
kann ich mich nicht; sie überhaupt würde gleich gewußt haben, daß
etwas vorgekommen wär’. Und wenn sie mich angesehen und auf’s Gewissen
gefragt hätt’, ja, Herr Rechtsanwalt, dann wär’ bestimmt alles –
aber auch alles – rausgesprudelt. Hinterher hätt’ ich mich prügeln
können, soviel es mir paßte. Was gesagt war, blieb! Und wenn ich’s
hundertmal widerrufen und bedauert hätt’. Den Schmerz wollte ich unserm
Fräulein nicht antun. Darum bin ich eins – zwei – drei wieder die
Treppe hinunter und habe mich unten auf der Straße erst mal richtig
ausgeweint. Am nächsten Tage wußte ich, daß alles Lüge war von Anfang
bis zu Ende. Aber wie das alles zusammenhängt, kann ich nicht wissen.“
Er sah starr geradeaus. Den Zusammenhang, den Pauline nicht zu finden
vermochte, den fand er leicht. Er sah ein armes, schönes, schwer
enttäuschtes Mädchen ohne Schutz und Rat. Die Folgen waren unschwer zu
erraten und wer dürfte darum verurteilen?
„Hatten Sie sich denn in aller Form bei ihr angesagt, Pauline?“
„Ich habe sie gefragt, wann ich ihr passend käm’.“
„Und die Antwort?“
Das alte Mädchen zögerte einen Augenblick verlegen!
„Geschrieben hat sie mir noch nicht, Herr Rechtsanwalt.“
„Hm?!“
[S. 286]
„Der Brief kann ja verloren gegangen sein, Herr Rechtsanwalt.“
„Sie werden wohl gar noch einmal bei ihr anfragen?“ sagte er nach einer
langen Pause.
„Nein, Herr Rechtsanwalt. Ich werd’ heute nachmittag direkt zu ihr
gehen. Herr Rechtsanwalt erlaubt’s mir doch?“
„Daß Sie ausgehen? Aber gewiß, liebe Pauline. Sie sollen mich überhaupt
nicht wegen dieser selbstverständlichen Dinge befragen.“
Jetzt lachte sie ein wenig. Dann hörte er die Tür gehen und war mit dem
immer noch uneröffneten Briefe allein. Das lenkte ihn zunächst ab. Die
fremde steife Schrift auf dem Umschlag war ihm unbekannt.
Der geöffnete Brief zeigte eine siebenzackige Krone über einem Adler,
der ein Lamm in seinen Horst schleppte. Der Waldsruher Majoratsherr
brachte darunter seine Wünsche zum Ausdruck.
Die Zeilen waren liebenswürdig abgefaßt. Hinter dem Auftrage, der die
Abänderung und teilweise Erweiterung der Familienstatuten erbat, zeigte
sich die Verheißung zur Rechtvertretung bei einem Zivilprozeß über ein
erhebliches Objekt. Daß der darin Beklagte dem jungen Anwalt als ein
minderwertiger Aufkäufer alter Waldbestände bekannt war, hätte ihm
das in Aussicht Gestellte nur angenehm machen müssen. Trotzdem regte
sich ein Gefühl des Widerwillens gegen den ihm bis heute unbekannt
gebliebenen Auftraggeber.
In diesem Augenblick war er unfähig zu jeder klaren, nüchternen
Erwägung. Erst ein wenig später glaubte er[S. 287] zu wissen, daß ein Mädchen
mit der Vergangenheit Eva von Ostrieds unmöglich dem in jeder Beziehung
verwöhnten Geschmack dieses adelsstolzen, schwerreichen Witwers genügen
könne.
Vergangenheit! – Wie kam er dazu, dies zweideutige Wort mit ihr in
Verbindung zu bringen? Dem elenden Klatsch eines natürlich sehr gegen
seinen Willen entlassenen Mädchens auch nur den geringsten Glauben zu
schenken?
Ihn verlangte nach einer Aussprache mit ihr. Es konnte sie unmöglich
vorbereitungslos treffen! Seine Blicke würden ihr längst alles verraten
haben.
Er legte Feder und Papier zurecht und schrieb.
Zuerst malte er ihr das Bild seiner Eltern. Dann ging er zu dem über,
was ihm leicht von der Feder ging.
„Als ich Sie sah, wußte ich sofort, daß die Stunde meines Glückes
da war. Ich zweifelte nicht. Das kam erst später. Sie fühlten
alles. Ich merkte es und war sehr froh darüber. Schon als Sie mich
das erste Mal verließen, lag mir jeder Zweifel fern. Ich war ruhig
und dankbar, daß das Glück nicht an mir vorüberging. Unsere zweite
Zwiesprache sprengte fast mein Herz vor Seligkeit. Sie hatten
unter der Schar der harmlosen Worte jenes Briefes nach einem Laut
gesucht, der Ihnen mehr verriet.
Darum durfte ich Ihnen auch schon jetzt meine Liebe zeigen. Sie
widerstrebten nicht. Mein Herz lag in ihrer Hand.
Nun folgten wunderliche Tage. Zuerst Stunden, die ich um jeden
Preis auskosten wollte, so schön und unver[S. 288]gleichlich waren sie.
Bis eines Tages mein wildes Verlangen sie unerträglich schalt.
Damals habe ich Sie aus der Ferne mit einem Andern gesehen. Ich bin
auf ihn – sicherlich einen völlig harmlosen Bekannten – sinnlos
eifersüchtig gewesen. Nicht wahr, er ist doch nichts anderes für
Sie? Zuweilen sprach ich mit der alten Pauline über Sie. Oft nur
Ihren Namen, das war mir genug. Ich vertraute mir nicht mehr.
Und das ist sehr hart. Sie sollen alles wissen. Das habe ich mir
gelobt. Wir dürfen hinfort kein Geheimnis zwischen uns dulden.
Fühlen Sie das auch? Ich habe Sie vor mir verdächtigt und niedrig
gestellt. Es war alles nur die sinnlos tobende Eifersucht. Ich habe
Sie über alles lieb! Das Ganze bringe ich Ihnen! Nicht nur den Rest.
Vor Ihnen habe ich keine geliebt. Ich bin überzeugt, daß ich auf
Sie warten mußte. Darum fordere ich auch Ihre ganze Seele!
Sie sollen mich als Bruder, Freund und Vater empfinden, dem Sie
alles sagen dürfen und auch sagen müssen, ehe ich Ihr Lebenskamerad
und Geliebter werden darf.
Sie sind rein. Ich weiß es! Kein Fleck ist vorhanden. Keine Stelle,
die sich verbergen müsse vor meiner Liebe. Wäre es anders, könnte
ich nicht über alle Begriffe selig sein, wie ich es jetzt bin!
Ihr Walter Wullenweber.“
Ohne abzusetzen hatte er zu Ende geschrieben! Unter einem wundervollen
Zwange, und wie das Gefühl eines starken, lebensspendenden Rausches
blieb es ihm in der Seele zurück.
[S. 289]
– Er lief in den Abend hinaus und sah nichts als unruhig segelnde
Wolken.
Als er heimkam, war es schon dunkel. In der engen Wohnung erwarteten
ihn Helle und Wärme. Die alte Pauline war zurück und hatte die
Abendmahlzeit gerichtet.
Er nahm an, daß sie ihm, ohne seine Frage, berichten werde. Aber gegen
ihre Gewohnheit verließ sie sogleich das Zimmer, in dem er zu speisen
pflegte. Langsam schob er Bissen um Bissen in den Mund, und lauschte
dabei nach der Küche hinüber.
Von der behaglichen Hängelampe herab schwang sich die dicke Schnur
mit der elektrischen Klingel für die Bedienung. Bisher hatte Walter
Wullenweber sie noch nicht benutzt. Er betrachtete die alte Pauline
nicht als seine Untergebene, sondern als einen freundlichen Hausgeist,
der aus eitel Lust an der Arbeit das Händestillhalten nicht erlernen
konnte. Jetzt preßte er den kleinen weißen Knopf in die Birne aus
rotgetöntem Holz.
Sie erschien sofort ohne sich verwundert zu zeigen.
„Wollen Sie mir gar nichts von Ihrem Ausflug erzählen?“ fragte er
obenhin.
Sie versuchte ihre Verlegenheit unter einem Kichern zu verstecken, das
ihm weitab von aller echten Fröhlichkeit erschien. Denn ihr Gesicht,
in dem bei einer wirklichen Freude alle Falten mitlachen mußten, blieb
sorgenvoll.
„Ach,“ machte sie, „das ist doch kein Ausflug gewesen, Herr
Rechtsanwalt!“
„Wie haben Sie Fräulein von Ostried gefunden, Pauline?“
„Ich hab’ halt wieder Pech gehabt.“
[S. 290]
„S–o, nahm Ihnen die Person von neulich zum zweiten Mal den Mut?“
Sie wurde ärgerlich.
„Sie sollen das doch nicht sagen, Herr Rechtsanwalt! Natürlich war ich
oben. Und geklingelt hab’ ich auch. Mir hat aber Keiner aufgemacht.“
„Die Herrschaft wird ausgeflogen gewesen sein. Der Tag war ganz dazu
gemacht.“
„Nein, zu Haus waren sie ganz gewiß.“
„Ihr Fräulein würde doch die alte Pauline, deren Liebling sie immer
noch ist, nicht so schlecht behandeln! Sie werden sich geirrt haben,“
widersprach er.
„Ich konnte es auch lange nicht fassen. Aber es war doch wohl so. Ehe
ich ihr ins Haus ging, habe ich mir nebenan die kleinen, netten Gärten
auf dem Bauland besehen. Vor dem Fenster an der Ecke stand Eine und
guckte gerade auf mich runter. Ich kann beschwören, daß das unser
Fräulein gewesen ist.“
„Sie haben sich eben versehen, beste Pauline. Ihre Augen haben sechzig
Jahre gedient. Da müssen Sie nicht mehr zu viel von ihnen verlangen.“
„Sie war’s bestimmt, Herr Rechtsanwalt. Ich hab’ raufgewinkt und sie
hat in der ersten Ueberraschung auch die Hand gehoben. Aber bloß ganz
matt. Nachher war sie gleich weg. Dann bin ich nach oben. Wohl zehnmal
hab’ ich geklingelt. Gerade wollte ich wieder gehen, da schob eins so
recht heimlich von innen die Platte vom Guckloch weg. Das Fräulein
war’s aber nicht. Vielleicht die Andere.“
[S. 291]
„Deren Aufenthalt bei Fräulein von Ostried die Person damals
mißbilligte?“
„So denke ich’s mir!“
„Konnten Sie das Gesicht wahrnehmen?“
„Freilich! Ich hab’ doch scharf aufgepaßt. Ganz elend und durchsichtig
war’s. Aber schlecht und verworfen – – Nee, Herr Rechtsanwalt. Solche
sehen anders aus.“
„Und dann haben Sie sich also davon gemacht?“
„Was sollte ich sonst tun? Zufällig fand ich einen Bleistift in meiner
Tasche und den Fahrschein verwahre ich mir auch allemal, weil die
Kinder darauf wild sind. Auf den hab’ ich geschrieben „die alte Pauline
war hier!“ und das in den Briefkasten geschoben.“
„Warum setzen Sie sich nicht,“ fragte er plötzlich. „Ich muß noch
mancherlei mit Ihnen besprechen. Wenn ich mich recht erinnere,
erzählten Sie mir von Fräulein von Ostrieds reichem Muttererbe. Oder,
sollte ich mich verhört haben?“
Sie erzählte es noch einmal kurz.
„Sie zeigte Ihnen also, um Sie über ihre Zukunft zu beruhigen, ihren
ganzen Reichtum?“
„Ja, so war’s!“
„Und die alte sparsame Pauline ist seitdem der Ueberzeugung, daß es
sich um Fünfzigtausend oder gar noch mehr handelte?“
„Ganz so dumm bin ich doch nicht. Mit Geld weiß ich gut Bescheid. Ehe
das Fräulein zu uns gekommen ist, hab’ ich alles auf die Bank tragen
und wieder runterholen müssen, so oft unsere Frau Präsident nicht mit
ihrem Herzen in Ordnung war.“
[S. 292]
„Ich will Ihnen genau sagen, wie viel es gewesen ist. Eintausend Mark
und kein Pfennig mehr!“
„Nein, nein. Es ist ein ganzes Pack Tausender gewesen.“
„Wenn Sie das eidlich erhärten sollten, gute Pauline.“
„Schwören, meinen Sie doch damit, Herr Rechtsanwalt? Da würd’ ich mich
keinen Augenblick besinnen. Wieviel Stück es gewesen sind, das kann ich
auf’s Haar nicht wissen. Zehn oder noch ein paar mehr waren es aber auf
Ehre und Gewissen. Zehn zum mindesten!“
„Ich will noch etwas arbeiten, Pauline,“ sagte er da ohne weiteren
Widerspruch.
Mit ein paar eiligen Schritten war sie neben ihm: „Was Schlechtes
dürfen Sie aber nicht von ihr denken, Herr Rechtsanwalt. Sie ist rein
wie ein Engel.“
Schwerfällig nahm er in einem entlegenen Winkel seines Arbeitszimmers
Platz. Möglichst von der Lampe entfernt, deren greller Schein ihm weh
tat. Zum zweiten Male an diesem Tage bereitete er sich zum Schreiben an
sie vor. Ach ja, wo war denn der erste Brief geblieben? Genau an dieser
Stelle hatte er sich befunden, als er fortgegangen war. Er sprang zu
der alten Pauline hinaus.
„Wo haben Sie den Brief von meinem Schreibtische, Pauline?“
„Sie meinen doch den an unser Fräulein?“
„Ja, wo ist er?“
„Im Briefkasten, Herr Rechtsanwalt. Das war meine erste Arbeit, als ich
wieder zu Haus war!“
Hinter Eva von Ostried lag ein Tag und eine Nacht voller Kampf und
Entsagen! Die scharfen Augen der alten Pauline hatten sich nicht
getäuscht. Es war wirklich ihre Hand gewesen, die sich, wiederwinkend,
hinter dem Fenster erhob. In jenem Augenblick war ihr das Leben wie
ein mächtiger Strom, der sie reißend schnell zum Glück führen wollte,
erschienen. Sie empfand nicht länger in der Nahenden die unerträgliche
Mahnerin an einen begangenen Treubruch...
Ihre Hand, die nur matt den Gruß erwiderte, war auch nicht schwach
geworden, weil sie sich fürchtete. Das kam erst später. Sie war selbst
zur Tür geflogen, um der Kommenden zu öffnen. Sehnsüchtig wartete sie
ihres ersten, auf der Treppe hörbaren Schrittes. Als er dann endlich
vernehmbar wurde, vollzog sich mit einem Schlag der Wechsel von
höchster Seligkeit zum tiefsten Entsetzen.
Erst jetzt kam die eigentliche Strafe für ihre Schuld. Alles
bisher Durchlittene war nichts gegen dieses. Erinnern und Reue und
Bußbereitschaft.
Ihr Kampf währte so lange, bis die Schritte Rast machten. Da war er
wider sie entschieden. Sie schleppte sich ins Zimmer zurück. Nur so
viel Kraft hatte sie noch gefunden, um der Hausgenossin, die sich schon
beim ersten[S. 294] Klingelzeichen zur Tür begeben hatte, das Oeffnen zu
verwehren.
Stundenlang lag sie danach blaß und starr auf dem Ruhebett.
Dann kam Walter Wullenwebers Brief.
Sie preßte den Brief an die schmerzende Brust, als sei sie gewiß, damit
lasse sich das Stechen und Bohren lindern. Und plötzlich preßten sich
ihre Lippen auf die Buchstaben.
Das Heimweh war wieder da. Das brennende, wilde Heimweh! Was sollte
nun werden? Eva von Ostried wußte, als sie den Brief gelesen, daß
sie täglich und stündlich auf ihn gewartet hatte! Ungezählte Mal
wiederholte sie sich die Worte seiner Liebe. Und dennoch haftete keines
in ihr, außer den wenigen: „.. Sie sind rein. Ich weiß es!“
Was sie in München nach Ralf Kurtzigs unerwarteter Werbung zum ersten
Mal empfunden hatte, daß sie dem Mann ihrer Liebe jenes furchtbare
Geheimnis enthüllen müsse, ehe sie die Seine werden könne, wurzelte
bereits fest in ihr. Walter Wullenweber sollte wissen und richten! In
seine Hände wollte sie die Entscheidung über ihr Schicksal legen.
Und dann erschien es ihr doch unerhört grausam. Sie suchte unentwegt
nach einem barmherzigen Ausweg.
Er würde sie verachten! – Vielleicht war seine Liebe aber so heiß, daß
er sie dennoch zu seinem Weibe machte?
Ja, und deshalb sollte er dies wissen!
Aber als sie die Feder eintauchte, beschloß sie, es ihm zu
verschweigen. Denn nun war ihr unbändig heißer Stolz erwacht. Eine
glaubhafte Erklärung, woher die Mittel[S. 295] zu ihrem Studium stammten,
würde sich finden lassen. Was wußte ein lediger Mann von den Kosten
einer Haushaltungsführung aus dem Nichts – von der Notwendigkeit
aller sonstigen Anschaffungen. Schlimmstenfalls konnte sie ihm von
jetzigen großen Einnahmen durch Schüler und Konzerte sprechen und das
Ueberwinden des ersten Jahres nach dem Tode der Präsidentin durch die
vorhandene kleine Erbschaft und reiche Selbstersparnisse erklären. Sein
Vertrauen war groß genug, um ihr alles zu glauben. Es erschien ihr
unerschöpflich wie ein Brunnen über der springenden Erdquelle.
Das ging aus seinem Briefe hervor.
Es handelte es sich ja auch um sein Glück! Nicht lediglich um das ihre!
Wem schadete sie, wenn das Geheimnis ihrer Schuld gewahrt bliebe?
Wieder las sie seine Zeilen.
Dann verriegelte sie ihre Tür.
Gegen Abend tastete sie sich endlich empor und antwortete ihm. Sie
hätte nicht zu sagen vermocht, woher ihr die Kraft dazu gekommen war:
„Vom ersten Augenblick unseres Kennenlernens an habe ich Sie als
einen grundguten Menschen empfunden. Viele solcher waren mir bis
dahin nicht begegnet. Darum zeigte ich mich auch anders, wie sonst.
Ich danke Ihnen für alles, was Sie mir in Ihrem Brief gesagt haben.
Es soll mir ein Ansporn zum Reifer- und Besserwerden sein. Erwidern
kann ich Ihre Liebe nicht. Ich habe mir die Kunst erwählt. Ihr muß
ich treu bleiben. Das begreifen Sie wohl. In dieser Stunde nehme
ich Abschied für immer von Ihnen und fühle für[S. 296] Sie wie für einen
lieben, großen, treuen Bruder, den ich innig bitte, uns Beiden
jedes Wiedersehen zu ersparen.
Es brächte mir nur Qualen und keine Sinnesänderung.
Aber wissen sollen Sie, daß mein Herz keinem andern gehört noch
jemals gehören wird....“
In der Karlsenschen Villa waren die Rolläden herabgelassen.
Die junge Herrin des Hauses verließ seit Wochen das Zimmer nicht mehr.
Zuerst war es eine harmlose Erkältung gewesen, hervorgerufen durch eine
Fahrt im offenen Wagen bei empfindlichem Ostwind. Paul Karlsen hatte
damals im „Deutschen Opernhaus“ als Stolzing auf Engagement gesungen
und, fiebernd vor Stolz und Rausch, erklärt, daß er im geschlossenen
Gefährt ersticken müsse. Da waren sie selbstverständlich ohne das
schützende Verdeck mit dem feurigen Braunen der Kommerzienrätin durch
die Nacht gejagt, um irgendwo mit ein paar auserwählten Kollegen den
ungeheuren Erfolg des Abends bei eiskaltem Sekt zu feiern.
Frau Elfriede war selig gewesen, weil er sie dazu mitnahm. Unter dem
Vorwande, dadurch schneller nach der Vorstellung heimzukommen, hatte
sie das Gefährt von ihrer Mutter, die es sonst dem Schwiegersohn nicht
gewährte, erbeten, nachdem diese umsonst die zarte Tochter von einem
Theaterbesuche bei dem rauhen Wetter abzuhalten versucht hatte.
[S. 297]
In ihrem lichtblauen Seidenkleide mit den wundervollen echten Spitzen
– das Rot des Fiebers und der Erregung auf dem schmalen Gesicht –
hatte die junge Frau fast hübsch ausgesehen. Dankbar umfaßte sie ihres
Mannes Rechte, weil er sie nicht zuvor heimgeschickt, um dann allein
zur Nachfeier fortzustürmen.
Freilich glaubte sie genau zu wissen, daß er das bisher einzig aus
Sorge für ihre Gesundheit so getan. Aber eben deswegen jauchzte sie
inwendig, daß sie einmal von ihm als Gesunde betrachtet wurde.
Wie hätte sie darum auch nur das leiseste Wort einwenden dürfen, als
er den Kutscher zu immer größerer Eile anfeuerte? Der Wind schnitt wie
mit scharfen Messern in ihre empfindliche Haut. Ihre Brust begann zu
schmerzen, weil sie krampfhaft den Atem einhielt. Sie brauchte aber nur
ihres jungen, sieghaften Stolzings zu gedenken, dessen Stimme besonders
im Preislied von berückendem Glanz gewesen. So war sie zugleich Weib
und Kind! Wunschlos glücklich und daneben neugierig auf den Blick in
das bunte Leben.
Nun war es ihr nicht viel anders wie den kleinen Spätmalven ergangen!
Sie büßte schwer. Aus der Erkältung war ein Husten geworden, der sich
sehr böse und hartnäckig gestaltete, weil ihn die Leidende zu lange
verheimlichte. Die schmerzhafte Brust- und Rippenfellentzündung, die
sich hinzugesellte, war zwar auch wieder überwunden. Eine kleine
Schwäche blieb indes zurück. Das Herz war angegriffen! Nur das Herz. –
Frau Eßling besuchte die Tochter täglich. Aber sie vermied es, mit
dem Schwiegersohn zusammenzutreffen. Das[S. 298] ließ sich, ohne damit zu
verletzen, sehr gut einrichten. Seitdem Paul Karlsen den fünfjährigen
Vertrag, der ihn an das „Deutsche Opernhaus“ band, unterzeichnet hatte,
war er noch weniger wie früher in seinem Heim anzutreffen.
Heimlich vor der Tochter hatte sich die Kommerzienrätin erkundigt,
ob ihn die Proben zur Zeit so voll, wie er behauptete, in Anspruch
nahmen. Und die gewonnene Auskunft mußte es bestätigt haben, denn sie
widersprach Frau Elfriede nicht mehr, wenn die über die Grausamkeit der
Spielleitung zu klagen begann. mdash;
Im übrigen betrachtete sie diese Erkrankung, die ja, Gottlob, bald zur
Genesung werden sollte, als ihr Geschenk, das sie dankbar genoß. Ihre
Befürchtungen waren auch geringer geworden, seitdem sich die Tochter
endlich bereit gefunden, während einiger Wintermonate mit ihr nach St.
Blasien zu gehen. Der wöchentlich einmal zu dem Hausarzt hinzugezogene
Professor erklärte sich mit dem Verlauf durchaus zufrieden und die
junge Frau selbst fühlte, außer der Mattigkeit, keinerlei Beschwerden.
Heute hatte sie sogar heimlich das Bett verlassen, um mit dem Gatten
das Mittagsmahl in dem feierlichen Speisezimmer einzunehmen. Sie
brach aber unter den geschickten Händen der Jungfer, die sie für die
Ausführung ihres Planes gewonnen, zusammen.
Nun ruhte sie längst wieder in den kostbaren Kissen und lauschte auf
den Tritt ihres Mannes, der sogleich hörbar werden mußte. Denn Paul
Karlsen wollte ihr den Rest dieses Tages zum Geschenk darbringen. Die
Proben fielen aus, ein paar von der Kollegenschaft sehnlichst begehrte
Aussprachen hatte er, nach seinem Bericht, abgesagt. Des[S. 299]halb blieb
auch die Kommerzienrätin heute fern. Nur der übliche Morgengruß, ein
Strauß frischgeschnittener Herbstblumen aus dem Heimatsgarten standen
auf der Glaseinlage des Nachttisches.
Vor dem Ruhelager stand ein zierlicher, mit bunten Weinranken und
flammendem Mohn geschmückter Tisch mit zwei Gedecken. Die drei von
schweren weißen Perlen gehaltenen rosa Schalen brannten und erfüllten
alle Gegenstände mit warmem, erwartungsvollem Leuchten.
Sie wußte, wie sehr ihres Mannes Stimmung von äußeren Dingen
abhängig war. Hatte unzählige Mal erlebt, daß ihn ein trüber Tag –
ein klagendes Wort, – ja, selbst eine unfrisch gewordene Blume in
den Vasen reizen und niederdrücken konnte. Darum sollte ihm alles
entgegenstrahlen wie zu einem Feste.
Selbst der graue Tag hatte sich gegen Mittag aufgehellt. Ein frischer
Wind fegte die letzten Wolken zusammen und warf sie in das Nichts. Die
Rolläden wurden jetzt emporgezogen. Der buntfarbige Schein des wilden
Weins vermählte sich mit den rosa Schleiern zu einer verschwimmenden
Farbe von unbeschreiblichem Reiz.
Die junge Frau dachte daran, daß sie in diesem Herbst eigentlich mit
dem Gatten in das kleine Landhaus am Scharmützelsee hatte flüchten
wollen, um wie eine richtige Hausfrau selbst die Mahlzeiten zu
bereiten, während er auf der dazu gekauften ergiebigen Jagd das
Wildpret für den nächsten Tag erlegte! Dies kleine Märchen, mit dem
sie ihm, sehr gegen den Willen der Mutter, einen langgehegten Wunsch
erfüllte, war für sie zu einer Quelle beständiger Sehnsucht geworden.
[S. 300]
Denn Paul Karlsen verbrachte seither die wenigen Mondscheinnächte, die
ihm keine Berufspflichten auferlegten, im Anstand auf der Wildkanzel,
und sie durfte ihm lediglich mit jedem ihrer Gedanken auf diesen
Streifzügen begleiten.
Gerade wollte sich ein tiefer, schmerzlicher Seufzer gegen die Härte
des Geschicks auflehnen, als ein leichter, federnder Schritt vor ihrer
Tür erklang.
Im Augenblick veränderte sich ihr Gesicht. Von innen heraus kam das
Strahlen, übergoß nun auch sie mit dem Schimmer rosigen Lebens –
tuschte ein liebliches Rot auf ihre Wangen und setzte glänzende Lichter
in ihre Augen, die ihm entgegen lachten.
„Wie schön, daß du endlich da bist, Paulchen.“
Er küßte ritterlich ihre Hand und warf sich, ehe er ihr gegenüber Platz
nahm, mit einem kleinen fröhlichen Jauchzer, der sie unbeschreiblich
glücklich machte, auf das kostbare Fell des Eisbären, welches ein
zweites breites Ruhebett deckte.
„Du bist eine ganz raffinierte Person, Elfchen! Direkt gefährlich hast
du’s gemacht!“
„Gefällt es dir wirklich, Paulchen?“
„Es ist – nee – stimmungsvoll wäre nicht das richtige Wort! Warte
mal –“ und er dachte scheinbar darüber nach, während er in Wahrheit
überlegte, wie er ihr nachher glaubhaft machen könne, daß er nun doch
nicht den ganzen Nachmittag und Abend an ihrem Lager verbringen werde.
Die feine, gepflegte Hand sank herab.
„So – jetzt hab ich’s! Raffiniert drückt es auch nicht voll aus. Sagen
wir mal – verliebt –“
[S. 301]
„Das bin ich aber gar nicht in dich.“
„Erlaube mal! Mein gutes Recht habe ich mir noch nie kürzen lassen.“
„Ich habe dich lieb,“ sagte sie mit rührender Schlichtheit.
Er hatte genau gewußt, daß sie dies erwidern würde, wie sie ihm
überhaupt keinerlei Ueberraschungen zu bereiten vermochte. Auch diesen
wirklich netten Ausputz hatte er ganz bestimmt erwartet. Es rührte ihn
gewiß, aber langweilig blieb die ewig gleiche, dienende Unterwürfigkeit
und Anbetung dabei doch.
„Du bist ein gutes, liebes Tierchen,“ lobte er freundlich, „erwähle dir
eine Extrabelohnung.“
„Darf ich sehr unbescheiden sein, Paulchen?“
„Wollen mal sehen,“ machte er lässig.
„Dann lies mir, nachdem wir gegessen und du dich gründlich geruht
hast, etwas vor. Besondere Wünsche wage ich nicht. Deine Stimme
erfüllt ja alles, auch das, was mich früher nicht fesseln konnte, mit
unvergleichlichem Glanz.“
Es schmeichelte seiner Eitelkeit. Aber – ihr vorlesen – gräßlich
langweilig! Neue Hinweise fand die gute, kleine Frau doch nicht
heraus. Lernen konnte er also dabei nichts. Im voraus fühlte er ihre
grenzenlose Bewunderung – sah förmlich, wie sie, überwältigt von
seiner Begabung, in Tränen ausbrach und schließlich ihre Arme um seinen
Hals schmiegen wollte.
Da war die kleine Teufelin, das Evachen, eine andere Zuhörerin. Die
junge Dresdener Künstlerin hatte neben ihm in den Meistersingern
gewirkt. Nun weilte sie zwar längst wieder an ihrem Hoftheaterchen und
zeigte vorläufig nicht die geringste Lust, dies gegen ein anderes, und
sei[S. 302] es selbst dasjenige, an dem er glänzte, einzutauschen. Heute war
sie auf der Durchreise in Berlin und, wie ihm ihr Telegramm mitteilte,
gern bereit, ihm im Esplanade ein langbemessenes Plauderweilchen zu
gewähren.
„Schön,“ sagte er endlich gönnerhaft, als sei er nun mit dem Nachdenken
fertig, „was nehmen wir also? Goethe, ja? Ein bißchen sollst du noch
vor Tisch naschen!“
Sie nickte mit leuchtenden Augen – und wartete.
Er dachte einen Augenblick daran, ihr einfach von einer dringenden
beruflichen Zusammenkunft zu erzählen, die ihm morgen sehr viel Zeit
fortnehmen würde. Dann aber schob er diesen Gedanken vorläufig zurück.
Vorsichtig begann er das herbeigeholte Buch aufzuschlagen und fuhr mit
den Fingern über die einzelnen Gedichte, als liebkose er sie.
„Hören wir mal die Epigramme, die der Meister in Venedig schuf.“ Und er
begann träumerisch und weich das Dritte:
Immer hat mich die Liebste begierig im Arme geschlossen,
Immer drängt sich mein Herz fest an den Busen ihr an.
Immer lehnt ihr Haupt an meinen Knien. Ich blicke
nach dem lieblichen Mund, ihr nach den Augen hinauf.
Sie war wie berauscht. Die Freude, weil dieser Begnadete ihr gehörte,
beschleunigten ihren flatternden Herzschlag noch mehr. Dies zarte
Geständnis – auch seiner Liebe – entschädigte sie für vieles, um das
sie zuweilen andere junge Frauen glühend beneidete. War ihr Glück dafür
nicht auch tausendmal vielfältiger und reicher?
Als er jetzt verstummte, wollte sie so fröhlich lachen, wie er es gern
hatte, einen Scherz versuchen, damit die von ihm bespöttelte Weichheit
fernblieb.
[S. 303]
Und sie konnte doch nur haltlos und überglücklich weinen! Es half
nichts, daß sie sich sofort seine lebhafte Abneigung gegen alle Tränen,
die nicht auf der Bühne vergossen wurden, klarmachte. Unaufhaltsam
strömten die Tropfen über ihr Gesicht und löschten alle trügerische
Frische fort.
Wie durch einen Schleier gewahrte sie, daß er seinen Mund mißbilligend
verzog. Todesangst ergriff sie, der schöne sehnsüchtig erwartete Tag
möchte ihm zu einer großen Enttäuschung werden!
„Ich bin zu glücklich,“ entschuldigte sie sich leise.
Er war aufgestanden und zu ihr getreten.
„Matt bist du, mein Kleines und ich, alter Tölpel, gebe mich zu dieser
unprogrammäßigen Aufregung auch noch her.“
„Du willst doch nicht sagen –“ Ihre Stimme zitterte ängstlich.
„Daß ich unmöglich den langen geschlagenen Nachmittag oder gar noch
den Abend deine angegriffenen Nerven quälen darf, so schwer mir ein
freiwilliger Verzicht auf diese famosen Stunden auch wird.“
„Paulchen, ich flehe dich an! Glaube mir doch, es ist nichts, als die
große, große Freude, dich heute bei mir haben zu dürfen.“
„Der Meergreis von Hausarzt, der dich kennt, solange du überhaupt da
bist, hat mir strengste Ruhe und Schonung für dich zur heiligsten
Pflicht gemacht.“
„Aber ich ruhe mich ja gerade bei der Musik deiner Stimme aus! Höre
nur, wie wundervoll artig mein Herz geht.“
[S. 304]
Lachend schüttelte er den Kopf. „Davon verstehe ich nichts, Elfchen!
Ich weiß jetzt lediglich, daß es dein Wohl gilt. Höchstens zwei Stunden
insgesamt bleibe ich bei dir. Dann entschwinde ich. Du schläfst fein
ein und träumst von mir, wenn nicht besser von unserm Altmeister
Goethe.“
„Das besorge ich an sämtlichen andern Tagen schon, Paulchen,“ beharrte
sie in fieberhafter Unruhe. „Dies heute ist mein Festtag, den ich nicht
hergebe.“
„Sei nicht kindisch, dumme, kleine Frau.“
Sie richtete sich auf und blickte ihn fast streng an.
„Ich werde sofort aufstehen und mich ankleiden lassen. Jawohl, das
mache ich! Ganz bestimmt, wenn du grausam bleibst.“ Er lenkte ein.
„Gut, dann will ich auch noch den Nachmittagstee bei dir nehmen. Aber
– Hand her. Kein Wort hinterher zu deiner Mama oder zu dem Meergreise!
Auch der häusliche Detektiv muß ahnungslos bleiben. Für ihn verschwinde
ich gleich nach dem Mittag, das hoffentlich nicht mehr allzu lange
auf sich warten läßt. Denn, verzeih, Kleines, aber ich habe einen
Bärenhunger.“
Er sprach den Speisen mit dem Appetit eines beneidenswerten Gesunden
zu, der eine beträchtliche Menge braucht, um sich den Ueberschuß seiner
Kraft zu erhalten. Seiner Stimme zu liebe war er ein sehr mäßiger
Trinker. Und dies blieb das einzige Opfer, das er brachte. Denn er
liebte einen guten Tropfen bei lustiger Gesellschaft und brauchte ihn
eigentlich zur Anreizung noch mehr, wenn sie fehlte. Darum hatte er
bei jeder der Hauptmahlzeiten einen Kampf mit sich zu bestehen, der
schließlich eine erhöhte Reizbarkeit auslöste.
[S. 305]
Heute beschloß er eine Ausnahme zu machen.
Er hob den Sekt aus dem Kühler und war im Begriff den Kelch seiner
Frau zu füllen, als er, noch ehe er begonnen, die Flasche wieder steil
emporhielt.
„Die Zufuhr von jeglicher Flüssigkeit muß bei dir – nach den Herrn
Aerzten – möglichst beschränkt werden. Das Herzchen darf sich nicht
überarbeiten.“
Sie zog ein Schmollmäulchen.
„Nur ein einziges Glas, Paulchen. Wir haben uns ja ohnehin schon gegen
Mama, den Arzt und den Alten verschworen.“
„Nun, dann will ich ausnahmsweise großmütig sein. Schaden kann es
eigentlich kaum. Trinke einen tüchtigen Schluck und dann berichte
wahrheitsgemäß von seiner Wirkung.“
Weil sie fühlte, wie sehr sie einer Stärkung bedurfte, leerte sie den
Kelch hastig. Er drohte ihr scherzhaft.
„Leichtsinn du! So war’s nicht gemeint.“
Bittend schob sie ihm das schlanke Glas herüber. „Noch einmal, ja?“
„Auf gar keinen Fall, Frau Elfriede.“
„Ich sollte doch Bericht geben. Wie aber vermag ich das. Kaum ein
Fingerhut voll war es.“
Er tat ihr mit einem nachsichtigen Lächeln den Willen.
Sie stießen miteinander an. Ihre Lippen röteten sich.
„Jetzt mußt du auch tüchtig essen,“ forderte er und häufte ihr den
Teller. Das hatte er noch nie getan. Es erfüllte sie mit heißer
Dankbarkeit. Gehorsam begann sie. Aber es ging nicht.
[S. 306]
„Ich bin immer noch zu durstig,“ gestand sie mit einem verlegnen
Seufzen. „Gib mir noch etwas. Merkst du nicht, wie es mich erfrischt?“
„Habe ich mich denn verhört, daß dir die vereinigte Macht der Aerzte
alle Flüssigkeitsaufnahme streng beschränkte,“ fragte er gedankenlos
und vergaß, daß er es bereits vorher, als feststehend, erwähnt hatte.
„Gewiß, ich irre mich. Denn du bist doch sonst verständig und folgsam
wie eine kleine Musterschülerin.“
„Das hast du entschieden geträumt, Paulchen. Vor ein paar Wochen, ja,
da hat die ärztliche Obrigkeit etwas Aehnliches gesagt. Das Verbot
hat längst ausgewirkt. Heute ist es also mein gutes Recht.“ Warm
und wohlig durchrieselte sie das edle, berauschende Getränk. Auch
er begann sich behaglich zu fühlen. Im Allgemeinen war’s doch recht
hübsch, daß er es so weit gebracht hatte. Einige Unbequemlichkeiten
gab es freilich zu überwinden. Die scharf äugende Schwiegermama – der
Detektiv von Diener und zuweilen sogar die kleine, verliebte Frau. Denn
sie war rechtschaffen wie ein Backfisch in ihn verliebt, trotz ihres
großartigen Protestes. Zu einem richtig flammenden machtvollen Gefühl
reichte ihr bißchen Kraft nicht aus.
Sie merkte, daß er fröhlich wurde. Das spannte ihre Kräfte an und ließ
sie nichts denken, als daß er voll glücklich sein möge. Die leise,
geschickte Jungfer bediente heute bei Tisch. Daß der Alte bei den
sterbenden Malven stand und scharf ins Zimmer hereinspähte, konnten sie
nicht ahnen, denn sie waren beide mit sich und den prickelnden Tropfen
zu sehr beschäftigt.
[S. 307]
Paul Karlsen blieb auch bei ihr, als das kleine Mahl beendet war.
„Jetzt mußt du deine Havanna rauchen,“ drängte sie liebevoll.
„In deinem Krankenzimmer? Nee, mein Schatz so ungeniert betrage ich
mich denn doch nicht –“
Sie hatte aber schon ein verborgen gehaltenes Schächtelchen mit
Zigarren hervorgeholt.
„Heute kommandiere ich, mein Lieb.“ Lachend ließ er sich die schwere
Havanna von ihr entzünden.
„Wenn uns jetzt deine Vorgesetzten sehen, Kleines.“
„Ich erkenne nur dich an und sonst niemand.“
„Na, na,“ machte er mit erhobenem Finger.
„Soll ich dir eine Probe von meiner Unfolgsamkeit gegen sie alle
ablegen?“
„Das wirst du gefälligst unterlassen. Es wäre wahnsinnig, wenn du in
deiner Lage eine Unvorsichtigkeit begingest.“
Ein schmerzhafter Stich durchzuckte ihr Herz. In deiner Lage? O, wie
sie die beständigen Hinweise auf ihre Schonungsbedürftigkeit haßte.
Freilich hatten sie nicht immer den gleichen Klang! Die Mutter wählte
zarte Umschreibungen dafür. Der alte Hausarzt bezeichnete es einfach
mit den verschiedenen sanften, warnenden oder empörten O–o! Der alte
treue Diener wagte zuweilen ein leises, flehendes aber. Sie meinten in
allen Fällen das Gleiche.
„Nämlich, nimm dich in Acht. Sonst –“
Sie dachte plötzlich mit der Empfindung aufrichtigen Mitleids an alle,
die einen frühen Tod erleiden mußten. Auch[S. 308] an die Schwestern, die sie
noch lebhaft in der Erinnerung als stille, bleiche, ungeliebte Wesen
hatte.
Sie aber wurde geliebt wie kaum eine zweite Frau, war glücklich und
dachte noch lange nicht an das Sterben! Dies bißchen Unpäßlichkeit.
Nun, was hatte dies zu sagen? War nicht diese oder jene aus ihrer
Bekanntschaft ebenfalls eine Zeitlang bleichsüchtig und matt gewesen?
Sie wollte gesund und stark werden. Für sich und den Liebsten und all
das, was vielleicht die Zukunft noch für sie bereit halten würde. Und
beweisen wollte sie ihm ebenfalls, wie unnötig und übertrieben die
ewige Bevormundung sei!
Sie rang sich auf und lief zu ihm! Er lag auf dem kostbaren
Eisbärenfell und paffte runde, kunstgerechte Ringel in das Rosa der
Luft.
Es stieg ihr wie Lachen auf, aber sie mußte husten, als solle sie
ersticken.
„Leichtsinn,“ schalt er. Aber auch er lachte dabei.
Sie begann, durch den ungewohnten Genuß des Sektes angeregt, durch den
eigenen Willen hochgehalten, zu tollen und wieder zu lachen, zerrte
eins der seidenen Kissen unter seinem Kopf hervor, warf es gegen sein
Gesicht und stand einen Augenblick mit wogender Brust – atemlos von
der ungewohnten Anstrengung mit einem Gefühl heftigen Schwindels.
Als es überwunden war, ohne daß er etwas davon gemerkt hatte, erhöhte
sich ihre Ausgelassenheit noch. Ein Rausch glühte in ihr. Dann wurde
sie mit einem Schlage ganz matt. Er fühlte ihren leichten Körper schwer
und immer schwerer in seinen Armen und trug sie auf ihr Lager[S. 309] zurück.
Dort lag sie regungslos unter dem Geriesel der feinen Spitzen.
„Jetzt sagst du lange Zeit kein einziges Wort,“ befahl er. „Ich werde
nicht weiter ruhen, sondern wieder lesen. Also, weiter im Text mit
unserm Goethe.“
Sie strengte sich umsonst an, ihm zu folgen. In bleischwerer Müdigkeit
sanken ihre Lider zu. Es war sehr still. Denn auch Karlsens weiche,
schmeichelnde Stimme klang wie ein Streicheln, das alles noch sanfter
machte. Er sah nach einer Weile zu ihr hin und entdeckte, daß sie
eingeschlafen war.
Sobald er verstummte, öffnete sie die Augen und starrte ihn mit
seltsam leeren Blicken an. Es war ihm auch, als röchele sie leise. Er
ging nicht zu ihr, um sie zu befragen, ob sie Schmerzen habe, aber
er begann wieder zu lesen, bis er endlich, heftig und mißmutig, das
Buch zuklappte und sich erhob. Da öffneten sich ihre Lider von neuem.
Diesmal streckten sich in zitternder Bewegung die Arme nach ihm aus.
„Paulchen.“ In traumverlorener Bitte klang sein Name. Da ging er
großmütig an ihr Lager und küßte sie.
„Schlaf weiter, kleine, müde Frau!“
Ihre Lippen waren so kühl, daß er zusammenfuhr. Ihr Gesicht ähnelte,
nun die Röte der Erregung daraus geschwunden, einer geblichenen Maske.
Wie sein Mund den ihren berührte, lächelte sie dankbar.
Unter dem feinen Batist der losen Jacke sah er das stoßweiße Zucken des
matten Herzens – merkte, wie ihre blassen Lippen nach einem tiefen,
erlösenden Atemzug dursteten. Mit kaltem Schrecken durchrieselte ihn
der Ge[S. 310]danke, daß plötzlich eine Verschlechterung eingetreten sein
könne, die ihn ans Haus fesseln mußte. Ihn zog es unwiderstehlich fort
– ins Esplanade.
Er wollte der Jungfer von seiner Befürchtung Mitteilung machen, ehe
er verschwand. Sah dann aber ein, daß er ihr lediglich von seinem
Ausgange sagen könne, damit sie sich zu der Kranken begebe. Sein
mehrmaliges Läuten nach ihr blieb indessen wirkungslos. Nur der alte
Diener erschien. Ohne stehen zu bleiben, rief er ihm, nur den Kopf
zurückwendend, zu:
„Die gnädige Frau hat mit bestem Appetit gegessen und jetzt schläft sie
herrlich. Ich fahre nach dem Scharmützelsee hinaus, um auf den Rehbock
zu gehen. Melden Sie das der Frau Kommerzienrat.“
Eine Antwort erhielt er nicht. Ungeduldig stürmte er durch den
Vorgarten, ohne zu sehen, daß sich über das alte Gesicht im Vestibül
eine heimliche Träne stahl!
Auf dem gärtnerischen Hätschelkinde des neueren Charlottenburgs,
dem Savigniplatze, rief ein alter Invalide eine Neuigkeit aus dem
Morgenblatte aus. Eva von Ostried wartete hier seit geraumer Weile
auf ihre Bahn; als die heisere Stimme an ihr Ohr schlug, streckte sie
mechanisch die Hand aus und kaufte ein Blatt.
Zuerst überflog sie die fettgedruckte Ueberschrift ohne sonderliches
Interesse. Dann aber las sie mit scharfer Spannung und konnte nicht
gleich voll begreifen:
„Kurz vor Redaktionsschluß ging uns die folgende Nachricht zu, die
eine angesehene und sehr wohltätige Dame der Berliner Gesellschaft
in tiefe Trauer versetzt. Als sich gegen acht Uhr abends in einem
zuvor für diesen Zweck bestellten Zimmer im Hotel Esplanade die uns
von der letzten Aufführung der „Meistersinger“ her als vollendetes
„Evachen“ bekannte Dresdener Kammersängerin J. P. mit dem neuen
Heldentenor des Charlottenburger Deutschen Opernhauses, Herrn
P. K., zu einem Imbiß niedergelassen hatten, erzwang sich eine
auffallend gekleidete Person den Eingang in diesen Raum und schoß
den vielversprechenden Künstler nieder. An einem zweiten Schusse,
den sie im Begriff stand, auf seine Begleiterin abzugeben, konnte
sie glücklicherweise gehindert werden. Der sofort herbeigerufene
Arzt vermochte leider nur noch den Tod des hochbegabten Sän[S. 312]gers
festzustellen. Aus eigner Ueberzeugung wissen wir, daß dem
heimgegangenen Künstler eine glänzende Laufbahn sicher war, die
das grauenhafte Verbrechen jäh zerstörte. Die Personalien der
Mörderin waren bis zu dieser Stunde noch nicht festzustellen,
weil sie hartnäckig jede Auskunft über ihre Person verweigerte.
Der Direktor des Hotels glaubt in ihr eine frühere Chansonette zu
erkennen. Ob dies richtig ist, bleibt abzuwarten. Dagegen erfahren
wir zuverlässig, daß am Nachmittag desselben Tages, also noch
bevor das Schreckliche geschah, die junge, seit langer Zeit schwer
leidende Gattin des Künstlers in ihrem schönem Heim im Grunewald
einem Herzschlag erlag. Ihr plötzlicher Tod steht in keinerlei
Zusammenhang mit dem Vorfall. Sie war die einzige noch lebende
Tochter der eingangs erwähnten Frau Kommerzienrätin E., die mit ihr
nun auch das letzte Kind verliert, nachdem vor Jahren ihre beiden
älteren Töchter von einer heimtückischen Krankheit dahingerafft
wurden....“
Eva von Ostried setzte sich auf eine der Bänke, vor denen eine Schar
Kinder spielten. Sie war bestürzt, denn Karlchen war das Opfer seiner
Schuld, und wieder flammte es in riesenhafter Schrift vor ihr auf:
„Der Uebel größtes...“ Und diesmal vervollständigte sie ruhig und fest
„aber ist die Schuld“. Seitdem sie ihr Lebensglück opfern mußte, fand
sie keine Strafe dafür zu groß. Es verging kein Tag, an dem nicht der
heiße, zwingende Wunsch zur Sühne in ihrer Seele flammte.
Als Eva von Ostried nach Hause kam, fand sie die Hausgenossin scheinbar
unverändert am Herde walten. Das gewährte ihr eine vorübergehende
Erleichterung. So legte sie die Arme um die schmalen Schultern und
führte Gretchen Müller sanft in das kleine Zimmer, in das die liebe[S. 313]
Sonne und das bunte Herbstlaub der alten Parkbäume hineinschienen.
„Ich habe Ihnen das Versprechen gegeben, Sie niemals, wie die Andern,
durch eine Frage zu quälen, Fräulein Gretchen“, begann sie unsicher.
„Denn es muß alles seine Zeit haben, um heilen zu können, Gretchen. Und
wir haben es deshalb noch nie in Worte gefaßt – – ich weiß aber, wie
nahe Ihnen Paul Karlsen einst gestanden hat...“
„Ich habe ihn sehr lieb gehabt. – – Das ist lange, lange her...“
„Und jetzt...“
„Sie wollen mir sagen, daß er tot ist, nicht wahr?“
„Sie wissen bereits?“
„Ich habe alles gelesen,“ antwortete das Mädchen.
Sie schauerte zusammen. „Ich habe ihn verachtet – ihm geflucht –
und doch – im innersten Herzen liebte ich ihn weiter. Warum das sein
muß, weiß ich nicht. Ich schämte mich, daß ich mich heimlich von ihm
küssen ließ, daß ich den Meinen Kummer und Schande machen mußte. Ich
löste mich eines Tages von ihm, schlug und spie nach ihm, und habe doch
immer nach seinem Anblick Sehnsucht gehabt. Keinem könnte ich das sonst
sagen, wie Ihnen. Als ich ihm folgte, wollte ich nichts anderes, als
daß er mich bald zu seiner Frau machen würde. Daß er nicht mehr frei
war, erfuhr ich viel später. Seitdem hat er mich nicht mehr berühren
dürfen. Tagelang habe ich gehungert, weil ich sein Geld verachtete;
denken Sie doch, das Geld seiner Frau! Kannten Sie sie? Ja? Wie sah sie
aus? Ich denke sie mir wie ein Kind, das weder einen eigenen Willen
noch ein eigenes Leben hatte.“
[S. 314]
„So ist sie wohl gewesen?“
„Ihr Vertrauen zu ihm muß grenzenlos gewesen sein. Darüber wurde eines
Tages in dem Kreis, in den er mich einführte, hinter seinem Rücken viel
gespöttelt. Dadurch habe ich davon erfahren....“
„Nur darum ist sie schrankenlos glücklich gewesen und auch geblieben,
Gretchen.“
„Glauben Sie an ihr Glück?“
„Ich habe es gefühlt,“ sagte Eva von Ostried und erzählte ihr, wie sie
die junge zarte Frau kennen gelernt.
„So glauben Sie nicht, daß sie etwas von mir geahnt hat?“
„Auf keinen Fall. Er war zu gewandt und zu klug, um ihr nicht die
vollendete Komödie des treuen Ehemannes vorzuspielen.“
„Dann wird sie mir auch niemals geflucht haben.“
„Nein, mein Kleines, das konnte sie bestimmt nicht tun, weil sie
ahnungslos war. Wäre sie es aber selbst nicht geblieben – hätte sie
im Laufe der Zeit einsehen müssen, daß seine Treue weniger wie ein
fadenscheiniges Tuch darstellte, dazu hätte weder ihre Kraft noch ihre
Veranlagung ausgereicht. Was sie an Gefühlsstärken besaß, gehörte ihm.“
„Können Sie sich vorstellen, daß ich am meisten um diese arme, stille,
vertrauensselige Frau gelitten habe?“
„Ja, das kann ich! Es war aber unnötig.“
„Nun ist sie gestorben, ohne dies erleben zu müssen...“
„Das erscheint mir als ihr größtes Glück. – Ich muß heute noch meine
Rechnungsbücher abschließen, Kind,“ meinte Eva dann in verändertem,
ruhigen Tone. „Es ist sehr viel nachzutragen. Und Briefe muß ich
ebenfalls schrei[S. 315]ben. Denn bald geht es zu den beiden Konzerten nach
München. Ich möchte Sie gern mitnehmen. Könnten Sie sich jetzt nicht
leichter entschließen?“
„Meine Angst vor der lauten Welt ist trotzdem größer geworden,“ gestand
Gretchen Müller beschämt. „Aber auch, wenn ich meine Bangigkeit
bekämpfen könnte, wäre die Qual zu groß für mich.“
„So elend fühlen Sie sich wieder?“
„Das wäre übertrieben. Ich bin nur dauernd sehr müde. Sehen Sie, jetzt
könnte ich zum Beispiel auf der Stelle einschlafen. Und nachts in der
gegebenen Zeit vermag ich kein Auge zu schließen.“
„Ich mache mir bittere Vorwürfe, daß ich Ihnen nachgab und den Arzt
lange Zeit nicht befragte.“
„Glauben Sie wirklich, daß er mir noch helfen kann?!“ Sie lächelte.
Das gab ihrem durchsichtigen Gesicht den gleichen, unendlich rührenden
Ausdruck, wie ihn die Heiligen auf den alten, steifen Bildern in
Kirchen besitzen.
„Sie sind zu viel allein, Gretchen.“
Eva von Ostried rechnete wirklich. Es war dasjenige, was ihr zu
erlernen am schwersten geworden war. Wenn sie rückwärts dachte, hatte
sie von jener Summe keinen Pfennig zu irgend einem unnützlichen
Vergnügen verbraucht. Und doch schmolz das Geld erschreckend zusammen.
Der Sommer hatte ihr im Verhältnis wenig Einnahmen gebracht. Die
schwerreiche Schülerin im Grunewald verlobte sich und verlor die Lust
zu weiterem Lernen. Ihre Lehrer forderten mit dem Steigen aller Werte
bedeutend höhere Honorare....
[S. 316]
Es wäre aber dennoch nur ein Teilchen über die Hälfte entnommen
gewesen, hätte sie Gretchen Müller nicht Obdach und Pflege gewährt.
Zuerst entnahm sie für diesen Zweck der kleinen Tasche skrupellos
Schein um Schein. Bis sie plötzlich mit jähem Entsetzen merkte, daß sie
nur noch zwei enthielt. Die Leidende mußte nach der strengen Forderung
des Arztes, ohne daß sie einen klaren Begriff davon bekam, auf das
Sorgfältigste gepflegt werden. Der Leidenden einfach zu eröffnen, daß
es ihr – leider – nicht länger möglich sei, sie zu behalten, erschien
ihr mehr als grausam. Ja, ihr Herz wollte es auch nicht zugeben! Sie
hing an dem stillen scheuen Wesen.
München mit der Einnahme der beiden Konzerte stand zwar in naher
Aussicht. Wer aber vermochte den Ertrag im Voraus zu berechnen?! Es
brauchten nur ungewöhnlich zahlreiche Darbietungen der ähnlichen Art
zusammenzutreffen, dann war das Ergebnis bei weitem nicht das erhoffte.
Das Honorar für den neunten November, in dem sie im Blüthnersaal singen
würde, war zwar festgelegt, aber nicht sonderlich hoch bemessen. Ihr
war es mehr auf das Zusammenwirken mit dem bekannten Künstlertrio wie
auf die Einnahmen angekommen.
Wie sollte sie also jemals imstande sein, mit Zins und Zinseszins,
wie sie es sich zur Lebensaufgabe gemacht, alles zurückzugeben? Die
heimliche Not wuchs zuweilen so mächtig, daß sie sie in alle Welt hätte
hinausschreien mögen.
Und doch wachte sie mit ängstlicher Sorgsamkeit über jedem ihrer Worte,
meinte oft genug aus einer unschuldigen Frage oder einem bedeutsamen
Blick ein Ahnen ihres Frevels herauszulesen.. Sie arbeitete und lernte
nur noch wie[S. 317] ein Automat! Einmal mußte ja doch alles anders werden!
Sollte sie sich jetzt noch der Bühne zuwenden?
Das sonderbare Erschauern durchkältete sie von neuem. Ihre Keuschheit
kämpfte dagegen an. Aber war sie nicht schön? Liefen ihr die Männer
nicht in voller Bewunderung nach? Nur ihres ermunternden Lächelns hätte
es bedurft, um die Fäden zu knüpfen. Sie mußte ihr Leben von Grund auf
ändern. Die Gleichgültigkeit gegen die kleinen Geschehnisse des Daseins
fortan bekämpfen. Da lag zum Beispiel noch uneröffnet die schon vor
Stunden angekommene Post.
Weltbewegendes war nicht darunter. Ein Schüler sagte für diesen
Nachmittag seine Stunde ab und erbat sich eine andere Stunde dafür. Das
brachte wieder Mühen und Aenderungen in Menge. Ihr theoretischer Lehrer
fragte an, ob sie eine in der Berliner Gesellschaft durch Schönheit und
Geld wohlbekannte Gräfin regelmäßig zum Gesang begleiten wolle. Sie
zahle ausgezeichnet. Dazu verspürte Eva von Ostried nicht die geringste
Lust, so gern sie auch ihre Einnahmen vergrößert hätte. Ihr Stolz
bäumte sich auf. In dem Bewußtsein ihrer Künstlerschaft empfand sie das
Anerbieten als eine Beleidigung. Freilich war es gut gemeint, denn sie
hatte neulich in seiner Gegenwart einen vernehmlichen Seufzer über die
wachsenden Ausgaben getan.
Eine Handschrift auf dem graugetönten steifen Leinenumschlag war ihr
fremd und nicht angenehm. Sie zeigte so viel Schnörkel und Haken, als
wisse der Schreiber nicht voll mit sich Bescheid. Es war der Brief des
Waldesruher Majoratsherrn, der sie für Mittwoch nächster Woche zur
Teilnahme an der Familiensitzung der Ostrieds in das Haus Adlon einlud.
[S. 318]
Früher hätte sie ihn achtlos bei Seite geschoben. Ihre einzige
Empfindung wäre möglicherweise eine berechtigte Bitterkeit gewesen,
daß sich das gesamte edle Geschlecht niemals um ihr Wohl bekümmert
habe. Eine Erinnerung aus ihrer Kinderzeit an zwei Erscheinungen, die
ihr damals wie aus Holz geschnitzt erschienen, tauchte auf. Die beiden
steifen, stummen Gestalten thronten eines Tages an der Spitze der
elterlichen Mittagstafel. Zwischen ihm hatte ein rothaariges, kleines
Mädchen von ihrem Alter Platz genommen, das sie lebhaft an ihren toten
Goldfisch erinnerte. Dessen Augen hatten aus dem gläsernen See ebenso
blaß, rund und erstaunt geblickt, wie diejenigen der schweigsamen Puppe.
Sie hatte die beiden Steifen mit Großtanten anreden und ihnen die Hand
küssen sollen. Das war ihr aber nicht möglich gewesen, weil sie ein
heftiger Widerwille geschüttelt hatte.
Ihr zarte, scheue Mutter hörte mit ängstlichen Augen den späteren
Erklärungen der ungebetenen Gäste zu, die wiederholt betonten, daß
sie lediglich des gebrochenen Wagenrades halber hier Einkehr gehalten
hätten.
Der Vater hatte zuvor in den Ställen seine Wut über den unerwünschten
Besuch ausgetobt. Aber nachher küßte er selbst die häßlichen Hände aus
Holz. Und dann waren sie plötzlich wieder fort gewesen! Näheres erfuhr
die kleine Eva über den kurzbemessenen Besuch von keiner Seite. Nur
wenn sie ungehorsam war, schreckte sie die Kinderfrau mit der Drohung.
„Warte, die gnädigen Großtanten sollen schon wiederkommen....“
Es traf aber nicht ein. Es kam seitdem überhaupt Niemand mehr von der
Verwandtschaft! Noch einmal überlas[S. 319] sie das Schreiben. Ihm fehlte jede
persönliche Bemerkung. Auch wurde eine Antwort auf diese Einladung
nicht erwartet. Wer nicht erschien und auch keinen Einspruch gegen den
bekannt gegebenen Tag erhob, unterwarf sich dem von der Mehrheit der
Anwesenden gefaßten Beschluß.
Heute überlegte Eva von Ostried mit einem Gefühl der Genugtuung, daß es
ihr gutes Recht sei, unter diesen Andern zu sitzen und mitzustimmen.
Ihr Einspruch würde genügen, um einen neuen Tag in Vorschlag zu
bringen. Diese Feststellung befriedigte sie. Seitdem sie jene Schuld
auf sich geladen, verlangte sie heißhungrig nach äußerer Anerkennung
ihrer Standesrechte. Wenn es sich also mit ihren Pflichten vereinen
ließe, würde sie vielleicht dieser Einladung nachkommen.
Der Generalleutnant a. D. Jeschko von Ostried, Exzellenz, zog zum
dritten Male die Uhr aus der Tasche, warf einen scharfen Blick über die
mit ihm an der gleichen Tafel Sitzenden und stellte fest: „Vier Uhr
genau!“ Dann wartete er noch eine Minute und erhob sich.
„Als Aeltester der hier anwesenden männlichen Ostrieds eröffne ich
hiermit den Familientag unseres Geschlechts und begrüße Alle an
dieser Stelle.“.... Hier unterbrach er sich und sah aus strengen, eng
zusammengeschobenen Augen auf den plötzlich erscheinenden alten Diener
des Kummersbacher Vetters, der die verschiedenen Ostrieds im Vestibül
zu empfangen und hierher zu weisen hatte. „Der Kummersbacher kann seine
Untergebenen keine Subordination lehren“, dachte er grimmig, während er
nervös mit der Rechten auf der Tafel herumtrommelte.
„Es ist noch eine Dame angekommen, die sich Fräulein Eva von Ostried
nennt“, meldete der Alte gemütlich. „Soll ich sie hereinführen, Euer
Exzellenz?“
„Nein,“ schrie der Generalleutnant, „denn nach der vollzogenen
Eröffnung brauche ich das nicht mehr zu gestatten.“
„Mach’ dich nicht lächerlich, Vetter,“ warf der Besitzer der Herrschaft
Kummersbach, Mitglied des Herrenhauses, launig dazwischen und blinkte
seinem getreuen Hermann verständnisinnig zu.
[S. 321]
„Los... hopp!“
Die Falkenaugen des alten Soldaten blitzten und die Adlernase stach
gefährlich in die Luft. Das zurechtweisende Wort erstarb ihm aber auf
den Lippen. In diesem Augenblick öffnete sich nämlich zum zweiten Mal
die Tür und ließ eine junge, auffallend schöne Erscheinung sehen.
„Um vier Uhr genau ist der Beginn der Verhandlung in jeder Einladung
festgesetzt. Wer sind Sie überhaupt, wenn ich fragen darf,“ rief ihr
die Exzellenz entgegen.
„Es schlägt soeben vier Uhr,“ sagte die Nahende ruhig und trat dicht
an den Ehrenplatz und damit zur Seite des Generalleutnants. Ihr Kopf
wandte sich dabei ein wenig nach rückwärts, als lausche sie.
„Hören Sie, bitte.“
Sie hörten es natürlich Alle, aber die meisten glaubten es trotzdem
nicht.
„Ich kenne Sie nicht,“ sagte der Generalleutnant wieder, weil er mit
einer zwischen Aerger und Bewunderung geteilten Empfindung zu kämpfen
hatte.
„Ich bin Eva von Ostried, die Tochter des im Jahre 1913 auf Waldesruh
verstorbenen Majoratsherrn Weddo. Hier ist meine Einladung!“
Er warf einen flüchtigen Blick darauf.
„Danach steht Ihnen natürlich die Teilnahme an dieser Sitzung frei. Ich
darf Sie vorstellen.“
Und er nannte ihren Namen, ohne ihr die der Anwesenden bekannt zu
geben. Eva von Ostried fühlte, wie ihr das Blut heiß ins Gesicht schoß.
Sie hatte keinen freundlichen Empfang erwartet. Diese Strenge und
Formlosigkeit empfand sie aber als Be[S. 322]leidigung. Vielleicht hätte sie
stolz genug sein müssen, um jetzt zu gehen, aber sie lächelte nur –
und blieb!
„Wohin darf ich mich setzen?“ fragte sie ruhig und hell.
Da stand Jemand auf und näherte sich ihr. Er war breitschultrig und
sonnverbrannt und seine Augen blickten unter den eisgrauen Brauen noch
jünglingsklar.
„Zu mir,“ sagte er kurz und herzlich. „Ich bin der Kummersbacher. Ob
dir das irgend etwas besagt, ahne ich nicht. Ich nenne dich du. Du
erlaubst doch?“ Und er bot ihr ritterlich den Arm und führte sie an
seinen Platz. „So, hier setz’ dich einstweilen. Bitte, Vetter Horst
Waldemar, etwas nach links, damit mein Hermann noch einen Schemel
reinklemmen kann“.
So saß Eva von Ostried denn neben dem, der auf Lebenszeit im Herrenhaus
Nachfolger ihres Vaters war. Eine peinliche Pause entstand. Wieder
durchbrach die Stimme des Kummersbachers die Schwüle.
„Ich will dir besser alle Anwesenden nennen, liebe Base.“
Und ohne sich durch den abweisenden Ausdruck der meisten Gesichter
beirren zu lassen, stellte er sie einzeln vor.
Schlank und stolz stand Eva von Ostried neben der breitschultrigen
Gestalt und neigte ihr Haupt nicht tiefer, wie sie das in allen andern
Fällen getan hätte, denn es streckte sich ihr keine Hand entgegen. Die
weiblichen Mitglieder beachteten sie anscheinend überhaupt nicht. Nur
die Männer spähten verstohlen nach ihr hinüber. Ihre Schönheit wirkte
verblüffend auf sie. Die gesuchte Einfachheit ihrer Kleidung hob die
knospenden Formen auf das Vorteilhafteste. Die ausdrucksvollen Augen
leuchteten aus dem sanf[S. 323]ten Elfenbeinton der weichen Haut und in dem
Nußbraun ihrer Flechten spielten goldene Lichter.
Horst Waldemar, der Majoratsherr, sah von seiner Höhe herab prüfend
auf die neue Nachbarin. Er mußte zugeben, daß er sie sich anders
vorgestellt hatte. Zwar mußte er nach dem Bilde, das sie im Kindesalter
neben ihrer Mutter zeigte, auf ein hübsches Gesicht gefaßt sein....
diesen außerordentlichen Reiz mit einer sichern und nicht nur
gespielten feinen Vornehmheit gepaart, hatte er nicht erwartet. Seine
Ansicht über die Tochter seines Vorgängers wurde dadurch natürlich
keineswegs geändert. Nach wie vor empfand er ihre Zugehörigkeit zur
Familie, die, mochte sie auch jahrelang nicht hervorgetreten sein, eine
Stunde wie die jetzige, zweifelsfrei feststellte, als peinlich. Bisher
hatte er noch nicht mit dem Mitglied einer Bühne unter den Augen seiner
weiblichen Verwandten an dem nämlichen Tisch gesessen. Trotzdem sprach
er sie jetzt an.
„Ich werde mir nächstens gestatten, in einer geschäftlichen Sache an
Sie heranzutreten, gnädiges Fräulein.“
Sie betrachtete ihn erstaunt. Er hatte das kühle wesenlose Gesicht
eines Menschen, der sich im Widerspruch mit den Schnörkeln und Haken
seiner Handschrift befand. Sie war überzeugt, daß er sehr genau mit
sich und seinen Wünschen Bescheid wußte. Kühl und knapp antwortete sie
ihm, während doch ein eisiges Erschrecken sie anpackte. Es war sehr
möglich, er kam ihr noch mit unbeglichenen Forderungen aus ihres Vaters
Schuldkonto.
„Sie können es einfacher haben. Ich bin schon heute bereit, Sie
anzuhören.“
[S. 324]
Er verneigte sich verbindlich. „Hoffentlich finde ich nachher
Gelegenheit dazu. Jetzt ergreift aber Vetter Exzellenz endlich das
Wort!“
Der Generalleutnant holte tief Atem, sah jeden Anwesenden, außer
Eva von Ostried, fest an, um sich das Nennen der einzelnen Namen
zu ersparen und begann: „Uns Andern ist die Vorgeschichte unseres
Verwandten Edgar von Ostried-Javelingen zur Genüge bekannt. Denn wir
gewährten ihm die Mittel zum Studium. Ich spreche dies also für das
fremde Mitglied. Die Studien hat er mit Abschluß des nötigen Examens
ordnungsgemäß und rechtzeitig erledigt. Leider mußten wir danach noch
einmal eingreifen, und diesmal ungebeten. Er wollte nämlich eine
Stellung als Regisseur annehmen. Bei einem Theater.“ Hier räusperten
sich die gnädigen Großtanten vernehmlich und die Zwillinge kicherten
verschämt auf. „Das war natürlich, so lange er sich offiziell zu
uns bekannte, nicht tunlich. Wir wiesen ihn auf die Tätigkeit des
privaten Schriftstellers hin, die auch seiner angegriffenen Gesundheit
zuträglicher war.“
„Darum pfeift er nun wohl auch auf dem sogenannten letzten Loch,“ warf
der Kummersbacher trocken ein. Der Einwand blieb aber unbeachtet und
die Exzellenz fuhr fort:
„Er hat in unserm Auftrage die Familiengeschichte unseres Geschlechts
neu bearbeitet. Selbstverständlich unter Zugrundelegung alter,
zuverlässiger Quellen. Sie ist gedruckt und bei dem Verlage Müller
und Schulze in Berlin für 22 Mark jederzeit zu beziehen. Was er sonst
noch geschrieben hat, weiß ich nicht. Mir hat er einmal ein Drama
zugeschickt, das mir Anlaß zu einem sehr ernsten Brief gab.[S. 325] Jedenfalls
befindet er sich zur Zeit in schlechter Vermögenslage. Darum hat er den
Antrag gestellt, die für bedürftige und würdige Mitglieder auf 5234
Mark angewachsene Summe verliehen zu erhalten. Ich für meine Person
hege keine Bedenken, sie ihm zuzuwenden. Der Tatbestand wäre hiermit
erschöpft. Ich bitte zur Abstimmung zu schreiten. Etwaige Gegengründe
sind möglichst kurz vorzutragen.“
Hermine von Ostried, die älteste der Großtanten stand wuchtig und
herausfordernd auf.
„Er selbst bezeichnete sich mir gegenüber als einen freien Künstler.
Das schickt sich meiner Ansicht nach nicht für ein Mitglied unseres
Hauses. Was ist das überhaupt? Die Zigeuner, die einst von meinem
seligen Herrn Vater die Erlaubnis zum Aufschlagen ihrer Buden, in denen
sie dressierte Affen und Seiltänzer zeigten, nachsuchten, nannten sich
ebenso. Ich muß darauf bestehen, daß er zuvor ausdrücklich verspricht,
einem heute ebenfalls noch festzusetzenden Konsortium jede seiner
Arbeiten vor Drucklegung zu unterbreiten. Denn vor der Welt decken wir
ihn doch sozusagen.“
Eva von Ostried, für welche die Rede mehr wie für den siechen Dichter
bestimmt war, der irgendwo im Nebenzimmer auf die Entscheidung
wartete, um nachher sein gerührtes „Danke schön“ zu stammeln, lächelte
freundlich.
„Darf ich um das Wort bitten, Exzellenz,“ fragte sie plötzlich sehr
höflich, als eine kurze Pause entstand.
„Ich war noch nicht fertig,“ sagte die Stiftsdame hochmütig und empört
über die offensichtliche Belustigung auf dem schönen Gesicht.
[S. 326]
„Du bist also nicht für eine bedingungslose Hingabe, beste Hermine,“
warf der Generalleutnant ungeduldig hin.
„Das habe ich nicht ausdrücken wollen, Jeschko. Ich wollte lediglich
meinen Standpunkt darlegen.“ Und dann fuhr sie lang und breit in ihrer
Rede fort, ohne daß ihr jemand aufmerksam zuhörte.
„Diese Summe hätte zwar ebenso gut dem Familiengesetz nach einer
der ledigen Töchter unserer Familie zugeführt werden können, aber
meinetwegen mag er sie nehmen,“ äußerte sich ein „Vortragender Rat“
etwas mißgünstig. Seine Gattin stieß ihn kräftig unter dem Tisch an
dasjenige Knie, in dem sich zur Zeit grade der Ischiasnerv unerträglich
regte.
„Ich bitte dich, diese Taktlosigkeit in Gegenwart des Waldesruher.
Es ist furchtbar mit dir...“ Die hochblonde Ingeborg saß hilflos und
errötend da, denn sie hatte begriffen, daß diese Bemerkung auch sie
anging. Ihr Gesicht wirkte sehr weiß und rot. Die Augen hatten den
starren ausdruckslosen Blick hübscher Wachspuppen. Die kräftige,
ebenfalls sehr weiße Zahnreihe leuchtete hinter den rosa Lippen auf,
auch wenn sie, wie jetzt, schwieg.
Ein „Regierungsassessor“ murmelte etwas von „unsereinem hätte es auch
schon hundertmal bitter not getan,“ aber es wurde dann ohne weiteres
Einreden zur Abstimmung geschritten und der Diener des Kummersbachers
erhielt den Auftrag, Herrn Doktor von Ostried Javelingen herein zu
bitten.
Eva von Ostrieds Blicke richteten sich voll warmen Mitleids auf den
Eintretenden. Er sah hager und verfallen aus. Seine Kleider saßen
schlotternd. Seine Hände waren[S. 327] wie vertrocknet. Aber in seinen
dunkelblauen Augen brannte ein helles Feuer. Er stand neben dem
Generalleutnant, Exzellenz, doch sah er eigentlich nur die Fremde in
diesem ihm sonst wohlbekannten Kreise. Sein Dank war verworren und
längst nicht so überströmend, wie das zu erwarten gestanden hätte. Er
schämte sich vor dem fremden, ihm über alle Begriffe schön dünkenden
Mädchen.
Nun war die Hauptsache erledigt!
„Du wolltest vorher etwas sagen, Base Eva, wenn ich nicht irre“.....
Die jünglingsklaren Augen des Kummersbacher winkten ihr aufmunternd
zu, als verhießen sie: „Nimm kein Blatt vor den Mund. Ich halte deine
Kante!“
In Eva von Ostried war allerdings bei den Worten des Stiftsfräuleins
Hermine heller Zorn emporgelodert. Die versteckte Art, mit der hier
mehr über sie wie über den armen, krankaussehenden Dichter der Stab
gebrochen wurde, erschien ihr verächtlich. Nun aber das erste Feuer
niederglimmen mußte, ohne zu strafen, fühlte sie die alte matte
Gleichgültigkeit.
Der Regierungsassessor erwachte aus seiner Schläfrigkeit und späte
erwartungsvoll nach ihr hin. Irrte sie oder zuckte in seinen
Mundwinkeln ein feiner, überlegenener Spott, der ihrem Schweigen
galt? Raffte sie sich jetzt nicht zum Sprechen auf, durfte sie
keinen Augenblick länger verweilen. Denn sie konnte sonst eine nicht
mißzuverstehende Aufforderung zum Verlassen dieses Zimmers durch die
Stiftstanten oder durch die soldatische Exzellenz erwarten.
Deshalb erhob sie sich jetzt doch.
„Ich wollte mich, als einzig dazu Berechtigte, in Abwesenheit des
Angegriffenen gegen die Mißachtung des[S. 328] freien Künstlers wehren,“
sagte sie ohne Erregung. „Nun aber ist ja der davon Betroffene selbst
dazu imstande. Wenn mir erlaubt wird, ihm kurz zu sagen, was von der
Stiftsdame Hermine behauptet wurde...“
„Dagegen protestiere ich,“ schrie die Angegriffene in maßloser Erregung.
„Es ist nicht Sitte, daß aus der geheimen Familiensitzung nachträglich
dem dabei nicht zugezogenen Hauptbeteiligten Eröffnungen gemacht
werden,“ entschied der Generalleutnant.
„Ich weise darauf hin, daß ich dies während der Beratung abmachen
wollte.“ Eva von Ostrieds Zurückweisung des ihr gemachten Vorwurfs
klang durchaus sachlich. „Nachdem ich von dem Tadel des Herrn
Generalleutnants Kenntnis habe, verzichte ich auf jedes weitere Wort.“
„Ich verlange, daß du sprichst,“ sagte der Kummersbacher streng und
scharf. Die andern kannten diesen Ton. Wenn er sich dazu verstieg,
pflegte er nicht früher Ruhe zu geben, als bis er seinen Willen bekam.
Eine kleine Pause entstand.
„Vetter Javelingen könnte ja noch mal abtreten,“ schlug der
Regierungsassessor lässig vor.
„So sprechen Sie denn, wenn es durchaus sein muß,“ erlaubte der
Generalleutnant kurz. Und Eva von Ostried fuhr fort:
„Es wurde vorher also der umherziehende Zigeuner dem freien Künstler
gleich erachtet. Das empfand ich an sich als keinen Schimpf. Auch
der heimatlose Ungar kann sehr wohl etwas von dem Gottesgeschenk in
sich haben. Ich richte mich gegen den Ton, in welchem der Vergleich
vorgebracht wurde. Er strebte die Herabsetzung und Verächt[S. 329]lichmachung
des Künstlerstandes an. Empfindlichkeit liegt mir ebenso fern wie der
Wunsch, nach diesem Tage vielleicht einen engeren Zusammenschluß an die
Familie, welcher ich entstamme, zu erstreben. Wenn aber die Rednerin
auch den abwesenden Dichter vorschob, so richtete sie in Wahrheit
ihre Angriffe gegen mich. Dabei war sie klug genug, meinen Namen
nicht klar zu nennen. Besäße ich einen brüderlichen oder väterlichen
Freund, würde ich diesen zur Erwiderung auf schriftlichem Wege
veranlassen. Aber ich stehe ganz allein. Nun ist es mir darum zu tun,
an derselben Stelle, die mich beleidigen wollte, zu antworten. Kurz
meinen Lebenslauf, seitdem ich Waldesruh verließ: Der Freund meines
Vaters übernahm meine Ausbildung zur Bühnenkünstlerin. Sein bedeutender
Ruf verbürgte die Richtigkeit seines Urteils. Nachdem er unerwartet
starb und mein Vormund, Amtsrat Wullenweber auf Hohen-Klitzig, seine
Erlaubnis zum Weiterstudium versagte, nahm ich verschiedene Stellungen
als Kinderfräulein und Gesellschafterin an. Zeugnisse darüber sind
vorhanden. Zuletzt weilte ich drei Jahre bei Frau Präsident Melchers.
Ueber diese Zeit erteilt Justizrat Weißgerber Auskunft.“
Der Waldesruher Majoratsherr, der bis jetzt mit leicht gesenktem
Kopf vor sich niedergesehen hatte, streifte sie mit einem raschen
Seitenblick. Famos sah sie aus und ganz famos sprach sie auch. Trotzdem
würde sie von der Familie nach diesem wohl ebenso wenig beachtet werden
wie bis dahin. Und er schien das Interesse für ihre Ausführungen zu
verlieren.
„Frau Melchers starb auf einer Reise nach Pommern am Herzschlag und
ich, die inzwischen mündig Gewordene, be[S. 330]schloß, endlich meinen
sehnlichsten Wunsch, die Ausbildung zur Bühne, fortzusetzen.“
„Woher hat sie das Geld dazu genommen,“ tuschelte das jüngere
Stiftsfräulein ihrer Schwester neugierig zu.
Eva von Ostried fühlte, daß sie schwach werden wollte. Nun kam der
dunkle Punkt! Und es hieb alles wieder auf sie ein... Die Not des
Gewissens glühte – die Angst bis an’s Lebensende unter dieser
heimlichen Schmach zu leiden ... Einen Augenblick gab sie ihre Sache
verloren. Dann erwachte ihr Stolz. „Meinem Gott und mir... und ihm,
den ich liebe, bin ich Rechenschaft schuldig. Diesen nicht...“ Und sie
sprach weiter:
„Das Geld – ganz recht. – Das war eine böse Geschichte. Denn mein
mütterliches Erbteil betrug nur tausend Mark. Ich hätte aber sehr bald
vielleicht das Zwanzigfache verdienen können, wenn nicht das Blut
meiner Mutter in mir wach geworden wäre. Ich konnte mich nun doch
nicht für die Bühne zur Laufbahn entschließen. Die Gründe dafür nenne
ich hier nicht. Sie würden doch kein Verständnis oder keinen Glauben
finden. Der Tropfen Ostriedsches Blut – das Erbe meines Vaters also
– war nicht dagegen. Zur Zeit verdiene ich meinen Lebensunterhalt
durch Unterricht und Konzerte. So werde ich im nächsten Monat zweimal
in München, am neunten November einmal im Blüthnersaal, hier, singen.
In der Hauptsache ernähren mich die Stunden, die ich begabten Schülern
erteile. Meine Wohnung befindet sich in Charlottenburg, Königsweg 24.
Ich hatte nicht nötig, dies alles zu sagen. Wie schon erwähnt, stehe
ich aber ganz allein für mich ein und bin daher dem niederen Klatsch
schutzlos ausgesetzt. Das Andenken[S. 331] an meine Mutter verbietet mir, mich
verdächtigen zu lassen.“ Sie neigte sich leicht und machte Miene zu
gehen.
Da stand der Generalleutnant, Exzellenz, langsam auf, kam um den Tisch
herum auf sie zu und hielt die Hand hin.
„Wir Männer haben zu wenig Zeit und auch zu wenig Begabung, um
die Richtigkeit gehässiger Berichte nachzuprüfen,“ sagte er nicht
unfreundlich. „Darum tut es mir persönlich leid, wenn Sie sich durch
unsere bisherige Zurückhaltung verletzt gefühlt haben sollten.“
Einen Augenblick legte sie ihre Rechte in die seine.
„Glauben Sie jetzt aber ja nicht, Exzellenz, daß ich mich in Ihren
Kreis drängen möchte.“
Er sah erstaunt auf. Gradwegs in ihre wundervollen, klaren Augen. Einen
Augenblick drohte ihn die weltmännische Sicherheit zu verlassen.
„Und warum nicht,“ fragte er erstaunt.
„Weil ich keine Zeit dazu fände und auch nicht ehrgeizig bin,
Exzellenz. Sonst stände ich ja wohl heute als Mitglied einer Bühne vor
Ihnen.“
Die andern Herren hatten sich gleichfalls erhoben und sahen etwas
verlegen auf den Generalleutnant. Sie tat, als merke sie nichts von dem
Erwägen, das aus allen Gesichtern sprach.
„Ich muß nun fort, Exzellenz.“
Neben ihr lachte der Kummersbacher behaglich auf. „Nee, meine Tochter,
du bleibst noch gefälligst eine Weile! Wir machen nachher unten eine
gemütliche Ecke. Du, meine Wenigkeit, unser Dichter und wer sonst noch
Lust hat, kann sich anschließen. Sage nicht „nein“... Bitte...“
[S. 332]
„Ich wollte mit der gnädigen Base noch wegen geschäftlicher Dinge
verhandeln. Darf ich also mitkommen?“ fragte der Waldesruher höflich.
„Schön. Kannst du machen! Wann kommt denn übrigens der Anwalt?
Warum Ihr durchaus die Familienbestimmungen abändern wollt, ist mir
zwar nicht klar. Es sind ohnehin zu viel. Aber wenn es sonst ein
vernünftiger Mann ist, kann auch das ganz nett werden. So’n Jurist
steckt einem manchmal gehörige Lichter über das, was man Logik des
Denkens nennt, auf.“
Der Waldesruher klemmte das Monokel ins Auge und prüfte die Uhr. „In
zwei Stunden wird er da sein. Solange hätte ich also Zeit.“
Eva von Ostried stand unschlüssig zwischen den Beiden. „Es hat doch
keinen rechten Zweck,“ meinte sie leise zu dem Kummersbacher.
„Zweck,“ lachte der vergnügt. „Na wer weiß! Sieh mal rüber. Die
gnädigen Stiftstanten giften recht erheblich, weil ihr Liebling, die
brave Ingeborg, fortwährend sehnsüchtige Blicke zu uns rüber wirft.
Allein darum lohnt es sich schon.“
„Willst du mit von der Partie sein, Inge,“ fragte er laut. „Ich stehe
dafür ein, daß du ungestohlen wieder abgeliefert wirst.“
„Wir wollten den Waldesruher Vetter grade herzlich bitten, daß er mit
uns den Tee nimmt,“ lehnte das ältere Stiftsfräulein in süßlichem Ton
für sie ab.
Horst Waldemar von Ostried ging hinüber und küßte der Sprecherin
flüchtig die Hand, die immer noch wie dürres Holz erschien.
[S. 333]
„Leider kann ich heute der gütigen Einladung nicht folgen, verehrte
Großtante. Ich bemerkte schon soeben, etwas Geschäftliches hindert mich
an diesem Vergnügen.“
Dem Dichter war es endlich gelungen, sich an Eva von Ostrieds Seite zu
drängen. „Wie innig habe ich Ihnen zu danken,“ flüsterte er.
„In der Hauptsache sprach ich für mich,“ meinte sie lächelnd.
„Daß Sie es überhaupt sagten, war schön.“
„Traurig genug, dass es gesagt werden mußte, nicht wahr?“
Er nickte. „Sie ahnen ja gar nicht, wie unbeschreiblich glücklich Sie
sind.“
„Ich!“ machte sie erschrocken. „Warum denn nur? Sie haben gehört – ich
bin von meinem gesteckten Ziele abgeirrt ...“
„Aus freien Stücken, ja! Diesen Zwang kann man sich wohl gefallen
lassen.“
„Er zerbricht auch mancherlei. Glauben Sie nur!“
„Was wissen Sie davon? Ihre Augen sind licht und rein.“ In diesem
Augenblick trat der Kummersbacher wieder heran und verdrängte ihn durch
das Vorhandensein seiner mächtigen Gestalt.
– Zu Vieren saßen sie um einen Rundtisch.
„Ich bringe dich nachher nach Hause,“ sagte der Kummersbacher. „Das
erlaubst du mir wohl? Auf der Fahrt können wir uns beide noch ein
bißchen aussprechen.“
Sie richtete sich auf und lächelte krampfhaft.
„Ich glaube, du bist sehr gut, Onkel Friedrich Wilhelm. Aber, nun ist
es für alles zu spät.“
[S. 334]
Sie sprach es nur für ihn. Ihre Stimme war ein Flüstern. Der
Waldesruher unterhielt sich weiter mit dem Dichter, obgleich er ihn im
übrigen nicht als vollwertigen Menschen ansah.
„Mir kannst du vertrauen, Kind. Ich begreife dich schon!“
„So war’s nicht gemeint. Ich dachte lediglich an das mancherlei
Schwere, das ich als junges, unreifes Ding, damals ganz allein mit mir,
abmachen mußte. Das machte mich vorübergehend bitter. Jetzt bin ich
damit fertig. Wirklich. Eine gemeinsame Fahrt denke ich mir für dich
sehr unangenehm nach diesem Sekt. Ich benutze nämlich die elektrische
Bahn.“
„Und dir von mir einen Wagenplatz bezahlen zu lassen, das widerstrebt
dir, mit andern Worten.“
„Ja, das tut es!“
„Du bist eine seltsame Heilige, scheint mir.“
„Aber nicht darum.“
„Also außerdem auch noch. Das kann ich leider nicht beurteilen.“
Der leichtergraute Kopf des Waldesruher wandte sich in diesem
Augenblick zu ihr hin.
„Darf ich jetzt endlich meine Frage an Sie richten, gnädige Base?“
„Ich bitte darum, Herr von Ostried.“
Er zuckte unter ihrer förmlichen Anrede ein wenig zusammen und saß
danach noch steifer und hochmütiger auf seinem Platz. Sonst war er
derjenige, der unerwünschte Vertraulichkeiten zurückwies.
„Sie besitzen von Ihrer Frau Mutter einen Schatz wertvoller, alter
Möbel.“
[S. 335]
„Das ist Ihnen bekannt?“ wunderte sie sich. „Wie seltsam.“
„Nicht so sehr, wie es den Anschein hat. Waldesruh und Hohen-Klitzig
grenzen noch immer.“
„Das hatte ich beinahe vergessen.“
„Und einen Teil der alten Leute behielt ich in meinen Diensten.“
„Wirklich?“ fragte sie mit leisem Spott.
Er überlegte, ob er ihr eine scharfe Zurechtweisung erteilen solle,
unterließ es aber, um sie nicht, ohne jedes Nachdenken, zu einer
abweisenden Antwort zu veranlassen.
„Die haben mir also davon berichtet,“ fuhr er fort, „als gerade eine
Sendung aus Berlin ankam, die von Kluserichter, dem Gutstischler,
ausgepackt wurde. Ich bin dann bald zu dem Amtsrat herübergefahren, um
sie zu besichtigen. Er verwies mich indes an Sie.“
Sie hatte wiederholt daran gedacht, sich auch diese Sachen in ihr Heim
kommen zu lassen, unterließ es aber, weil die jetzige Wohnung keinen
genügenden Raum dafür bot. Ihr Herz hing zudem nicht an den Stücken.
Für einen guten Preis würde sie sich jetzt ohne weiteres davon getrennt
haben, weil sie diejenigen Möbel, die einen wirklichen Erinnerungswert
für sie besaßen, bereits umgaben. Sie diesem zu überlassen, verbot
ihr Stolz. Wieder spürte sie die unsägliche Nichtachtung, die darin
lag, daß er ihrem toten Vater nicht die letzte Ehre erwies, die
Kaltherzigkeit, mit welcher er ihr, der Heimatlosen damals schriftlich
begegnete.
„Diese Sachen sind unverkäuflich,“ gab sie kurz zur Antwort.
[S. 336]
„Sie wollen also gar nicht mein Gebot hören?“
„Es würde mich nicht umstimmen.“
Sein Hochmut fand die schroffe Ablehnung einfach lächerlich. Eine
kindische Ueberhebung von dieser gänzlich Mittellosen, die mit eisigem
Schweigen abgetan zu werden verdiente. Die Leidenschaft des Sammlers
versuchte dennoch ein Letztes:
„Vielleicht darf ich später noch einmal nachfragen, ob Sie Ihre Ansicht
geändert haben?“
Sie zuckte die Achseln. – In demselben Augenblick hatte er
blitzschnell die ihn eiskalt überrieselnde Empfindung, daß neben dieser
unpersönlichen Stimme, die nach einem Wiedersehen verlangt hatte, auch
noch der Mann in ihm danach strebte. Brüsk erhob er sich.
„Verzeihung, ich will Befehl geben, daß mir sofort die Ankunft des
Rechtsanwalts gemeldet wird.“
„Das brauchst du doch nur an meinen Hermann nach oben zu
telephonieren,“ riet der Kummersbacher und unter seinem eisgrauen Bart
zuckte die Schadenfreude über die schneidige Abfuhr auf.
Trotz des Rates nahm der andere nicht wieder Platz. Es trieb ihn fort.
Das Gefühl lebhaften Aergers über die schroffe Ablehnung, nach welcher
er beschlossen hatte, den schlauen Agenten auf Eva von Ostrieds Schätze
zu hetzen, war verflogen. Jetzt wehrte er sich lediglich gegen das
wachsende Wohlbehagen, das ihm ihr Anblick bringen wollte.
„Weshalb hast du eigentlich den Anwalt so heimlich bestellt,“ fragte
der Kummersbacher vergnügt.
[S. 337]
„Heimlich? Das dürfte nicht zutreffen. Es war vorher mit Jeschko
ausgemacht, daß wir abändern wollten. Ihr habt Euch ja in Pausch und
Bogen schon längst vorher damit einverstanden erklärt. Mir fiel neben
dem Abfassen von der Bekanntgabe des Familientages natürlich auch die
Wahl des Anwalts zu.“
Er merkte nicht, daß ihn der Frager nur noch ein wenig fesseln wollte,
um mit inniger Schadenfreude zu prüfen, ob seine längst gemachte
Feststellung von dem starken Eindruck der schönen Base auf den Egoisten
wirklich zutreffe.
„Ich kenne hier nämlich verschiedene sehr tüchtige Anwälte,“ beharrte
er eigensinnig, „und denen würde ich gern eine Kleinigkeit zu verdienen
gegeben haben.“
„Dieser ist mir ebenfalls warm empfohlen. Ein gewisser Doktor
Wullenweber, vereinigt mit dem als sehr tüchtig anerkannten Justizrat
Weißgerber. Zudem Neffe meines Klitziger Nachbarn.“ Dann verneigte
er sich stumm gegen Eva, ohne ihr die Hand zu reichen und nickte den
beiden andern zu.
Sie sah plötzlich starr und bleich aus. Oder veränderte nur der erste
fahle Schein der Dämmerung, der gespenstisch durch die steingrünen
Vorhänge kroch, ihr Aussehen?
„Die Luft ist hier nicht besonders gut, nicht wahr?“ erkundigte sich
der Kummersbacher teilnehmend, als sie jetzt zu Dreien waren.
„Ich muß nach Hause,“ sagte sie tonlos, ohne auf seine Frage zu
antworten.
Es erschien ihr alles nebensächlich und phrasenhaft neben dem einen,
was sie soeben gehört.
„Dieser Entschluß kommt ein bißchen plötzlich, Kind..“
[S. 338]
Schweigend knöpfte sie an ihren Handschuhen.
„Ich blieb schon viel zu lange.“
„Warum ärgerst du dich eigentlich,“ forschte er beinahe sanft. „Ich
sehe keinen Anlaß.“
Sie lachte. Aber es klang wie ein Schrei.
„Aergern, nein, wirklich nicht!“
„Schön, dann also nicht! Meine Begleitung war dir nicht angenehm und
anders hast du es dir inzwischen wohl nicht überlegt?“
„Es war unrecht, daß ich gekommen bin,“ klagte sie leise.
„Ich freue mich aufrichtig darüber. Das kannst du mir glauben.“
Sie reichte ihm beide Hände zum Abschied. „Vielen, vielen Dank, Onkel
Friedrich Wilhelm.“
„Möchte wohl wissen, wofür?“ brummte er. „Ich sage trotz deines
deutlichen Abwinkens, „auf baldiges Wiedersehen.“ Höre mal zu. Im
Oktober bin ich wieder auf vier bis fünf Wochen daheim. Dann kommst du
zu mir. Ich bitte dich herzlich darum.“
Sie stand mit schlaff herabhängenden Armen vor ihm.
„Versprich mir das,“ drängte er, „Unser Dichter wird auch kommen.“
Der blasse Mensch freute sich wie ein glückliches Kind.
„Ja – ich komme bestimmt. Das wird sehr schön werden.“
„So schnell kann ich nicht Vertrauen fassen,“ entschuldigte sie sich.
„Siehst du, das begreife ich. Daß du wenigstens versuchen willst, es zu
bekommen, das kannst du mir auch versprechen?“
[S. 339]
„Ich glaube nicht, daß ich diesen Versuch machen werde.“
Er hatte ihr die breiten wuchtigen Hände auf die Schultern gelegt und
zog sie sanft zu sich heran. „Man hat es nicht anders verdient. Stimmt!
– Trotzdem –“ Und er neigte sich zu ihr und küßte sie auf den Mund.
„Denn ich könnte bequem dein Großvater sein, Mädel,“ sagte er nachher
wie erklärend, „aber auch schon mit der Vaterwürde wäre ich sehr
zufrieden!“
– – Wie eine Träumende ging sie die breiten, schönen Straßen
herunter. Sein Name hatte alles wieder aufgewühlt. Sie kam nicht los
von ihm. Und es mußte doch geschehen.
„Verehrte Base, gestatten Sie, daß ich Sie begleite –“ Ihr Kopf fuhr
herum. Das gelangweilte Gesicht des Regierungsassessors sah in diesem
Augenblick äußerst angeregt und verschmitzt aus. Eine Blutwelle der
Empörung stieg ihr bis in die Stirn hinauf.
„Ich gestatte lediglich, daß Sie sofort von meiner Seite verschwinden,“
sagte sie kalt und würdigte den Verblüfften keines Blickes weiter.
„Sie, Herr Rechtsanwalt Wullenweber, haben sich, wie mir mein
Waldesruher Vetter mitteilt, bereits über den Inhalt der vorhandenen
Familiengesetze unterrichten können,“ sagte Generalleutnant von
Ostried, der zur Vorbesprechung über die neu aufzunehmenden Paragraphen
mit dem soeben Angekommenen und dem Majoratsherrn, fernab von der
langen, feierlichen Tafel, in seinem nicht übermäßig geräumigen
Logierzimmer Platz genommen hatte.
Walter Wullenweber verneigte sich bejahend.
„Diejenigen Bestimmungen, welche seit Einführung des Bürgerlichen
Gesetzbuches – selbst in dieser Form als Familiengesetz – anfechtbar
geworden sind, habe ich mir erlaubt durchzuarbeiten und anders zu
formulieren.“
„Sehr schön,“ lobte die Exzellenz zerstreut, „aber das hat Zeit bis
nachher. Das Neue ist entschieden wichtiger. – Willst du mir mal
gütigst das kleine Heft herüber geben, Vetter?“
Der Waldesruher reckte nur den Arm weit aus und reichte es ihm hin.
„Famos. Immer wieder unterschätze ich deine Körperlänge. – So bitte,
Herr Rechtsanwalt, wollen Sie gefälligst Einsicht nehmen, was gewünscht
und erstrebt wird. Vor[S. 341] allen Dingen muß das lächerliche Befragen des
gesamten Familienrats, wenn zum Beispiel in der Familiengruft eine
neue Trauerweide vom Obergärtner gesetzt oder ein Grabmal aufgefärbt
wird, eingestellt werden. Künftig soll ein aus zwei oder drei Leuten
bestehender Ausschuß darin maßgebend sein. Andere Punkte freilich
sind bedeutender. Unsere, das heißt, meines Vetters und meine Ansicht
erfahren Sie nebenstehend.“
Walter Wullenweber las aufmerksam.
„Die vorgeschlagenen Abänderungen sind bei weitem einfacher und
zweckdienlicher,“ unterbrach er einmal das Schweigen; „nur fehlt
die rechtswirksame Form, wie z. B. hier bei einer hypothekarischen
Sicherheit für einen der Ostrieds gerader Linie. Das ist aber eine
Kleinigkeit.“
Dann vertiefte er sich wiederum, bis ihm das Rot einer heimlichen
Erregung über das stubenblasse Gesicht lief. Er sah den Waldesruher
Majoratsherrn prüfend an und in diesem Blick lag entschieden etwas
Feindliches.
„Sind Sie damit einverstanden, Herr von Ostried, daß der eventuelle
älteste Enkel Ihres verstorbenen Herrn Vorgängers nach Ihnen –
also vor dem bisherigen Anwärter – als Waldesruher Majoratsherr
in Frage käme? Absatz 3 der mir zugänglich gemachten Bestimmungen
verlangt ausdrücklich bei einer Abänderung in erster Linie die
Bereitwilligkeitserklärung des derzeitigen Majoratsinhabers. Darum
meine Frage. Auch darf ich nicht verhehlen, daß die Vorlage dieser
neuen Erbfolge bei auch nur einer widerstrebenden Stimme glatt erledigt
ist.“
Horst Waldemar von Ostried blickte eine Kleinigkeit gelangweilt drein.
[S. 342]
„Ihre erste Frage ist schnell beantwortet, Herr Rechtsanwalt. Warum
sollte ich dagegen sein? Bis jetzt lebe ich als kinderloser Witwer.
Sollte ich eine neue Heirat schließen.“
Die Exzellenz sah überrascht auf und knurrte etwas. „Na nu – das ist
mir ganz neu.“
„Wie meinst du,“ fragte der andere ruhig.
„Bitte weiter. Es war nichts von Wichtigkeit.“
„Ich wollte sagen, daß in jedem Fall mein Sohn, würde mir noch ein
solcher beschert sein, als mein Nachfolger auf Waldesruh in Betracht
käme. Diese ganze Neuregelung liegt reichlich weit im Felde. Immerhin
besteht ein Zwang für sie.“
„Den zu erkennen ist mir bisher nicht möglich gewesen. Darf ich alles
Notwendige wissen, um nachher sämtliche Einwendungen widerlegen zu
können.“
„An denen wird es selbstverständlich nicht fehlen,“ meinte die
Exzellenz ahnungsvoll. „Wappnen Sie sich also mit sehr viel Geduld,
sonst werden Sie bestimmt nervös!“
„Ehe ich zu dem Hauptsächlichsten komme, will ich Ihnen kurz
wiederholen, was Sie ja, von der Vertretung ihrer Interessen her,
bereits vor mir wußten,“ begann Horst Waldemar wieder. „Vorläufig ist
die Tochter meines Vorgängers noch ledig. Ich ahne auch nicht, ob eine
Aussicht zur Abänderung dieses Zustandes bereits vorhanden ist. Und
wenn selbst die junge Dame, die übrigens vorher bei dem ersten Teil der
Familiensitzung zugegen war – ist Künstlerin und es wird ein unserer
Familie voll ebenbürtiger Gatte als Vater eines neuen Majoratsherrn zur
Bedingung gemacht –“
[S. 343]
„Schön genug wäre sie allerdings für einen Prinzen, wenn sonst das
andere stimmte,“ warf die Exzellenz nachdenklich ein.
Der Waldesruher sah ihn bedeutsam an und zog rasch, wie, um dies
zu verdecken, seine Uhr. „Die Zeit eilt. Wir dürfen uns nicht bei
Nebensachen aufhalten.“
„Ich war noch nicht zu Ende,“ sagte Horst Waldemar kurz und fuhr
fort: „Ein Widerstreben würde, auch menschlich beleuchtet, völlig
unerklärlich sein. Trotzdem werden Sie nachher einen heißen Kampf
entbrennen sehen. Die übrige Familie weiß nämlich bis zu dieser Stunde
lediglich, daß die alten Gesetze durchgesehen und verbessert werden
sollen. Damit haben sie sich ohne weiteres einverstanden erklärt. Ihnen
mehr zu sagen, schien meinen Vetter und mir verfrüht. Es hätte Anlaß
zu unerfreulichen schriftlichen Erklärungen gegeben. Denn wir wissen,
daß jeder Einwand gegen die neue Erbvorlage vergeblich bleiben muß.
Das durch einen Zufall aufgefundene Zusatzschriftstück verlangt die
erwähnte Erbfolge ausdrücklich.“
„Dies Schriftstück war mir bisher nicht zugänglich. Sehr gern würde ich
mich jetzt mit seinem Inhalt bekannt machen.“
„Darum bitten wir Sie natürlich. Hier ist es. Sie sehen, eine Abschrift
hätte unüberwindliche Schwierigkeiten gebracht. Das Pergament ist
brüchig geworden und muß sehr vorsichtig behandelt werden. Zudem
hätte ein halbgebildeter Abschreiber kaum die Menge lateinischer
Redewendungen richtig wiedergegeben. Ich zog daher die Aushändigung
an Ort und Stelle vor und bin gern bereit, Ihnen bei scheinbar
unleserlichen Stellen zu helfen.“
[S. 344]
Walter Wullenweber prüfte eingehend den Inhalt des Dargereichten.
Er hatte sich jetzt wieder voll in der Gewalt. Seine scharfen Augen
bemühten sich unter den zahlreichen dunklen Stockflecken die kleine
spitze Schrift zu enträtseln.
Die Exzellenz reichte ihm eine Lupe über den Tisch hin. „Wenn Sie an
gewisse Stellen kommen, wird sie Ihnen gute Dienste tun.“
Nach einiger Zeit legte Walter Wullenweber die Rechte auf das Pergament
und sah auf:
„Nun dies aufgefunden ist, könnte selbst die heftigste Ablehnung nicht
mehr an der veränderten Erbfolge rütteln. Ich unterstelle natürlich
die Echtheit. Wenn sie von einem Mitglied in Zweifel gezogen würde,
kämen langwierige und kaum erfolgreiche Erhebungen heraus. Vollgültige
Beweise von der einen oder andern Seite erscheinen mir unmöglich.“
„Ausgeschlossen,“ sagte der Waldesruher mit großer Bestimmtheit. „Daran
wagt Keiner zu tippen. Zudem habe ich bereits die Uebereinstimmung
dieser Handschrift mit den Aufzeichnungen eines Ahnen einwandfrei
feststellen und von einem gerichtlichen Sachverständigen beglaubigen
lassen. Hier ist das Dokument darüber. Vielleicht vermag es Ihnen in
dem Kampfe zu dienen.“
„Dann dürfte jeder Einspruch wirkungslos bleiben.“
Der Generalleutnant schlug sich in bester Laune, auf die Knie. „Wie
ich mich freue,“ sagte er aus tiefstem Herzen, „wenn es auch nur ein
Schreckschuß ist und voraussichtlich bleiben wird. Diesen ewig müden,
gelangweilten Bengel, deinen bisherigen Nachfolger, muß das mal endlich
wach machen.“
[S. 345]
„Hier ist auch noch der Umschlag, in dem das Gefundene steckte, Herr
Rechtsanwalt.“
„Wie, Sie selbst haben es gefunden, Herr von Ostried?“
„Ohne meinen Vorsatz allerdings! Ich ließ das Kellergewölbe im
Waldesruher Schloß aufreißen, damit das schadhafte Mauerwerk
ausgebessert werde. Die merkwürdig geformten Nischen und die
zahlreichen Verstecke mit den unsichtbar eingelegten Steintüren
interessierten mich umso mehr, als bereits mein Großvater, der wie
ich Sammler von Altertümern war, uns Kindern von kostbaren seit den
Kreuzzügen dort lagernden Schätzen erzählt hatte. In Wahrheit fand sich
nur ein verrosteter Eisenkasten vor, der dies Schriftstück barg. Ob mir
oder den andern der Fund angenehm sein konnte oder das Gegenteil, habe
ich wirklich nicht erwogen. Es war einfach meine Pflicht, daß ich ihn
nach Kenntnis des Inhalts ungesäumt dem Senior unserer Familie, meinem
Vetter, Generalleutnant von Ostried, unterbreitete. Dies ist geschehen.“
Das klang ohne jede Beimischung von Gefühlswärme, wie Walter
Wullenweber feststellte. Es beruhigte ihn. Mit einigem Eifer begann
er den Entwurf der neuen Bestimmung zu formen. Jetzt war er fertig,
überlas alles und übergab es dann der Exzellenz, die es laut zum Gehör
brachte.
„Ausgezeichnet,“ stellten sie beide fest. „Wir können die Herrschaften
wieder zusammentrommeln lassen.“
„Einen Augenblick,“ sagte Horst Waldemar plötzlich, als sich die
Exzellenz erhob, um seinen Hermann zu beauftragen. „Den letzten
Punkt haben Sie zu erwähnen vergessen. Sie erinnern sich doch, Herr
Rechtsanwalt?“
[S. 346]
– Eine halbe Stunde später einten sie sich wieder um die lange
feierliche Tafel. Nur die Reihenfolge war ein wenig verändert. Eva von
Ostrieds Platz hatte jetzt der Regierungsassessor eingenommen, während
Walter Wullenweber zwischen dem Generalleutnant und dem Waldesruher saß.
Das Stiftsfräulein Hermine fuhr, nachdem der Generalleutnant nach den
unwichtigen Abänderungen den Punkt der neuen Erbfolge zur Kenntnis
gebracht, von ihrem Stuhl empor. Auch die andern starrten mehr oder
minder überrascht, nach dem Sprecher hin, der das Auffinden des
alten Schriftstückes noch mit keinem Worte erwähnt hatte. Er hatte
absichtlich davon geschwiegen.
Der Kummersbacher freute sich aufrichtig für Eva von Ostried. Nicht,
daß er schon ihren ältesten Sohn unter den Waldesruher Buchen hätte
herumgaloppieren sehen, nein, daran glaubte er nicht! Er gönnte ihr nur
von Herzen jene Ehrenerklärung, die in der Annahme der neuen Bestimmung
lag. Scharf spähte sein Blick zu Horst Waldemar hin. Sollte es bei
diesem angegrauten Eiszapfen etwa denkbar sein, daß er sich in die
jene, lockende Schönheit vergafft habe?
Der Vortragende Rat, Exzellenz, und seine Zwillingstöchter waren
mehr verwundert wie empört. Was ging es sie schließlich an, wer die
Waldesruher Herrlichkeiten genoß? Ihnen blieben sie jedenfalls fern.
Fassungslos machte die Mitteilung lediglich die Eltern des
Regierungsassessors, die bleich und stumm nach Atem rangen.
Der Anwärter selbst hatte nur eine Sekunde die Farbe verloren. Dann
war sein Plan gefaßt. Noch ehe Eva von[S. 347] Ostried das Geringste von
all diesem erfuhr, also sogleich nach Schluß der Komödie, würde
er ihr schreiben. Das verstand er ausgezeichnet. Sie sollte seine
Rechtfertigung schon annehmen und ihm, wenn er sich mündlich ihre
Verzeihung holte, eine andere Behandlung gewähren, als vorher zwischen
den sommermüden alten Linden!
Lodernden Zorn, der ihr häßliches Gesicht noch abstoßender erscheinen
ließ, empfand einzig das ältere Stiftsfräulein, während ihre um zehn
Jahr jüngere, als unbegabt geltende Schwester Klausine leise zu
weinen begann. Sie hatte sich schon zu lange auf die Sommerfrische in
Waldesruh unter Ingeborgs Fürsorge gefreut. Dieser Traum von Stille,
endlichem Frieden und unbeschnitten reichlichen Gerichten würde durch
den Sohn jener Unausstehlichen natürlich zu Schanden werden!
Hermine von Ostried wartete auf das letzte Wort des Generalleutnants.
Kaum war es gesprochen, schrillte ihre hohe, jetzt von Verachtung und
Zorn gellende Stimme.
„Es ist ein Scherz und nichts weiter, den du dir soeben mit uns erlaubt
hast, lieber Jeschko. Ich für meine Person lasse mir solche Sachen
nicht gefallen, mögen auch die andern töricht genug sein, sich dadurch
verblüffen zu lassen. Ich frage dich, was du damit bezweckst?“
Aber sie ließ ihm nicht etwa Zeit die Frage zu beantworten. Sein
lächelndes Gesicht, das sich nunmehr zu verklären begann, reizte sie
unaussprechlich. „Schamlos genug, daß Euch Männern diese Bettelprinzeß
die Köpfe verdreht hat.“
Da fuhr mit gewaltigem Schlag eine Faust auf die Tafel nieder. Das war
die Sprache des Kummersbacher.
[S. 348]
Der schmale Dichter, der auf seiner andern Seite saß, während zu seiner
Linken die schweigsame Gemahlin des Vortragenden Rates thronte, fuhr
zwar zusammen, denn er hatte mit seligen Augen von einer lichten,
schönen Frau geträumt, die bei ihrem Sohn in Waldesruh dereinst die
alte Heimat wiedergefunden. Als ihn aber die wortlose, donnernde Rede
vollends aus allen Träumen gerissen, als er begriff, wem dies galt,
leuchteten seine Augen strahlender und seine Seele band sich fest an
den alten, aufrechten, knorrigen Mann, der seinem Zorn jetzt auch Worte
verlieh.
„Keinen Mucks weiter! Hörst du?! Ich verbiete es dir! Du hast es dein
Leben lang gut verstanden, aus dem Hinterhalt zu geifern. Die dir
gehörig Bescheid tun könnte, ist nicht mehr da. Warum sie sehr bald
schon gegangen ist? Klar genug für einen, der ein bißchen nachdenken
kann. Ihr Frauen habt sie gemieden, als ob sie eine Pestkranke wäre.
Was hat sie Euch getan? – Antwort! Sie hat nichts von Euch erbettelt
und Euch damit das Recht vor der Nase weggeschnappt, sich um sie zu
bekümmern... ihr das Leben zu vergällen, wie Ihr das über alles gern
besorgt hättet. Warum sage ich eigentlich „Ihr“? Ich meine ja nur dich,
Hermine. Denn deiner armen Schwester Seele hast du, falls eine in ihr
gesteckt haben sollte, allmählich schon bei Lebzeiten aus ihrem mageren
Körper vertrieben. Es ist auch entschieden bequemer für dich.“
„Es ist ein Fremder mit uns am Tisch,“ flüsterte der Vortragende Rat
ihm beschwörend zu, „nimm Rücksicht darauf, Kummersbacher.“
„Das hätten die gefälligst bedenken sollen, die ihn angeschleppt
brachten. Im übrigen ist er Jurist und hält Ver[S. 349]schwiegenheit. Herunter
muß auch noch das andere. Sie hat sich allein durchgerungen, sage
ich dir. Schwer genug mag das manchmal gewesen sein. Und wenn selbst
nicht... wenn das Geld aus einer uns unbekannten Quelle geflossen
wäre...“
„Das ist unstreitig,“ rief die Angegriffene... „und zwar aus einer
unsauberen.“
„Wage das nicht ein zweites Mal auszusprechen! Ich bringe dich sonst
wegen Verleumdung vor das Gericht. So wahr ich hier stehe...“
„Du hast es ja soeben selbst angedeutet...“
„Weil es dir besser paßte, hast du mich nicht zu Ende kommen lassen.
Ich verbürge mich dafür, daß die Quelle rein gewesen ist. Jawohl! Und
wenn du sie noch durch ein einziges Wort – gleichviel ob offen oder
versteckt – herunterreißt ... bei Gott... ich räche sie! Zudem braucht
sie wenigstens in Zukunft kein Geld mehr aus irgendwelchen Quellchen.
Meines ist da und jederzeit für sie bereit. Es hat mich schon längst
bedrückt. Wenn sie auch vorläufig noch nicht will, sie muß und sie wird
schon, sage ich dir. Und Euch Allen hiermit!“
Der Vortragende Rat, Exzellenz, der den Kummersbacher seiner Zeit aus
guten Gründen um die Uebernahme der Patenschaft bei seinen Töchtern
erfolgreich gebeten, lenkte ein: „Du bist immer noch wie ein ganz
Junger, Kummersbacher. Wer greift sie denn schon an? Meine Frau und
ich durchaus nicht. Ist nichts an diesem Gerede, werden wir die ersten
sein, die ihr unser Haus öffnen.“
Noch einmal lohte der Zorn hell auf. „Was ist geredet worden? Was habt
Ihr über sie gehört?“
[S. 350]
Der Vorsichtige schwieg betreten und schickte einen kurzen Blick zu
seiner Gattin, der heißen sollte: „Jetzt zeige, daß du wenigstens ein
echt weibliches Geschick im Glätten dieser Wogen hast.“
Aber die Frau Vortragende Rätin blieb sich nur bewußt, daß ihr das
Stiftsfräulein Hermine dreihundert Mark für die neuen Wintermäntel der
Zwillinge (mit 5 Prozent Zinsen) zugesagt hatte. Sie stammelte daher
Unverständliches.
„Es ist zu widerlich,“ sagte der Kummersbacher kurz und verstummte.
Sie sahen alle nach dem älteren Stiftsfräulein hinüber. Die lächelte
jetzt. Das war noch viel abstoßender wie zuvor die Wut, die ihre Züge
verzerrt hatte.
„Ein einziger Einspruch genügt, um den neuen Beschluß abzulehnen,“
sagte sie lauernd. „Nun wohl, ich verweigere meine Zustimmung.
Alles andere ist mir gleichgültig. Und ich sage noch einmal.... die
Bettelprinzeß ist nicht schlau genug.“
Diesmal blieb der Kummersbacher ruhig. „Dies Wort hast du vor rund
dreißig Jahren schon auf ihre Mutter angewandt. Damit verdarbst du
der armen, scheuen Frau, als die sie mir von zuverlässiger Seite
später geschildert wurde, die als vertrauendes, unschuldiges Kind nach
Waldesruh kam, von vornherein ihre Stellung in der Familie. Damals
hattest du, leider, noch einen gewissen Einfluß. Auch ich habe mich
dadurch zurückschrecken lassen. Nein, das stimmt doch nicht. Dich
kannte ich von jeher. Daß sie den tollen Weddo heiraten konnte, nahm
mich gegen sie ein. Ein zweites Mal gelingt dir Aehnliches nicht,
selbst wenn dein teuflischer Einspruch die neue Satzung untergraben
würde.“
[S. 351]
Sie hörte nur dies und lachte voller Hohn. „Ein Wahnsinn, daß man uns
überhaupt damit kommt.“
„Bitte, Herr Rechtsanwalt, lesen Sie gefälligst das aufgefundene
Schriftstück vor,“ rief der Generalleutnant plötzlich dazwischen. Sein
Ton war wie eine Fanfare.
Sie stutzten und lauschten aufmerksam, was Walter Wullenwebers tiefe,
ruhige Stimme ihnen enthüllte. Der Major a. D. und seine Gattin sanken
mehr und mehr in sich zusammen. Das ältere Stiftsfräulein wurde
aschgrau.
„Fälschung,“ keuchte sie..., „elendes Machwerk. Aber wartet! Ich
entlarve Euch schon...“
Dem Vortragenden Rat, Exzellenz und dem Kummersbacher wurde das die
Echtheit feststellende Gutachten eines namhaften, auch vom Gericht
in den verworrensten Fällen als letzte Instanz angerufenen Gelehrten
auf diesem Gebiete zur Prüfung vorgelegt. Sie gaben es an die andern
Herren weiter. Als sich die Hand des Stiftsfräuleins Hermine danach
ausstreckte, wehrte der Generalleutnant kurz ab.
„Nach dem Vorangegangenen kann ich meine Erlaubnis dazu nicht geben.
Du, Hermine, kannst es jederzeit nach Ausweis über deine Person, im
Bureau unseres Anwalts, des Herrn Wullenweber, einsehen. Seine Adresse
wird dir zugehen. Und nun genug davon! Weiteres wird in dieser Sache
von dir nicht angehört werden. Damit wärst du auf den gerichtlichen Weg
zu verweisen.“
Eine drückende Stille entstand. Sie lehnte mit leicht geschlossenen
Augen auf ihrem Stuhl. Niemand bemühte sich um sie. Jeder am Tisch tat,
als beschäftige ihn zur Zeit grade etwas anderes. Als sie sich wieder
aufgerafft hatte, sagte sie merkwürdig ruhig:
[S. 352]
„Ich danke für diesen Hinweis. Er wird aber, denke ich, überflüssig
werden. Oder sollte der Vetter Generalleutnant sowie die andern
wirklich nichts von jener hauptsächlichsten Bedingung ahnen, die auch
dies alte seltsamerweise zur rechten Zeit aufgefundene Schriftstück
nicht außer Kraft setzen kann? Mit der schaffe ich es leicht.“
Der Generalleutnant wechselte mit dem Anwalt einen raschen Blick. „Es
ist klüger, wir zeigen uns ebenfalls davon unterrichtet,“ flüsterte
Walter Wullenweber.
„Ich bitte, daß Sie uns gefälligst jene Bestimmung zu Gehör bringen,
Herr Rechtsanwalt.“
Walter Wullenweber sprach fast ein wenig zu kalt und sachlich für
den Geschmack des Kummersbacher. Sein Inneres forderte jetzt eine
hinreißende Rede für Eva von Ostried. Es war aber vielleicht richtiger,
wie der junge Jurist es anfaßte.
„Die Bedingung, welche die,“ hier stockte er und fuhr erst fort, als
der Generalleutnant keinen Namen einschob, „jene Dame soeben erwähnte,
ist natürlich Seiner Exzellenz und dem Majoratsherrn ebensogut, wie
auch mir, dem Wortlaut nach bekannt und im Gedächtnis. Ich werde
sie zur Vermeidung jeden Mißverständnisses wörtlich verlesen. Sie
findet sich am Schluß der in Kraft stehenden Familiensatzungen und
erstreckt sich – ihrem Wortlaut und Sinn nach – auf sämtliche im
Vorangegangenen ausgeführte Bestimmungen. Dieser ausdrückliche Hinweis
geschieht für diejenigen unter den Anwesenden, welche sie bisher nicht
genau kannten und sich vielleicht nach Beendigung der Besprechung noch
einmal selbst davon zu überzeugen wünschen. Ich lese also vor:
[S. 353]
„Alles, was an Rechten, Wünschen und Anträgen erfüllt werden
sollte, geschieht in der schweigenden Voraussetzung, daß sich
Anwärter oder Antragsteller des zu Verlangenden oder des Erbetenen
bis zu dem Tage der Gewährung als durchaus wert und würdig erzeigt
haben. Sollten sich nach stattgefundener Verleihung untrügliche
Beweise von dem Unwert des Empfängers beibringen lassen, so ist
nicht nur das in Besitz genommene unverzüglich herauszugeben,
sondern auch die bereits empfangene Bereicherung mit Heller und
Pfennig durch den Seniorenkonvent – das sind die drei ältesten
männlichen Ostrieds grader Linie – abzuschätzen und zu ihren
Händen zurück zu erstatten. Unter Wert und Würdigkeit eines
männlichen Empfängers ist Ehrenhaftigkeit, solider Lebenswandel,
der sich von Aergernis erregender Völlerei, Glücksspiel und
ehelicher Untreue freihält, in der Hauptsache zu verstehen. Wert
und Würdigkeit eines weiblichen Empfängers muß noch strenger
beurteilt werden. Sittliche Reinheit hat hier für Ehrenhaftigkeit
zu stehen. Die Erzählungen von Schandmäulern, die dies anzweifeln,
soll zwar gehört, indes niemals ohne ernsthafte Prüfung vonseiten
des Seniorenkonvents geglaubt werden. Als Beweis des Unwerts ist
anzusehen: Wer einen Ehegatten, einen verlobten Bräutigam, auch
schon einen heimlichen Versprochenen, einer andern abwendig macht.
Wer durch unentwegtes Scharmutzieren, Kokettieren, ja selbst durch
herausfordernde Kleidung, den Ehrbaren Anlaß zu öffentlichem
Aergernis gibt. Ausgeschlossen von Gunsterweisungen aller Art
sollen ferner sein, die durch öffentliche Schaustellungen in Buden
und[S. 354] Zirkussen, sowie andern nicht einwandfreien Schauplätzen
laufend Gelder verdienen.“
Dieser letzte Passus ist wegen einer Gewissen angefügt, die sich
im Jahre 1570 des alten ehrenwerten Namen von Ostried durch solche
Künste unwert zeigte, ihn abgesprochen bekam und später in Elend
und Not endete. Dies als abschreckendes Beispiel unseren lieben
Frauen. Ihr Rufname ist ebenfalls ausgelöscht. Ihr Bildnis findet
sich in keiner Ahnengalerie vor.“
Walter Wullenweber hatte in den Blicken des älteren Stiftsfräuleins
das Aufleuchten des Triumphs deutlich wahrgenommen. Obwohl es ihm
lächerlich erschien, empfand er plötzlich eine unerklärliche Angst um
eine, die seine Liebe zurückgewiesen hatte; er befürchtete, daß jetzt
jemand der hier Versammelten die Erbringung solchen Beweises laut
verlangen könne. Und wiederum wünschte er einen Herzschlag lang, daß
der Seniorenkonvent die ihm später zweifelsfrei von diesem gehässigen
Stiftsfräulein unterbreiteten Ermittlungen bösester Art als zutreffend
bestätigen möge. Dann war sie frei und schutzloser, wie je – – und er
hätte sie schützen dürfen....
Als diese zweite stürmische Beratung zu Ende war, trat der
Kummersbacher auf ihn zu:
„Haben Sie zehn Minuten Zeit für mich, Herr Rechtsanwalt? Nichts
Geschäftliches. Und doch etwas, das von dem soeben Erlebten nicht zu
trennen ist.“
So saßen sie denn ein wenig später beisammen, und der Kummersbacher
begann: „Was ich eigentlich will, ist so ’ne Sache. Kann verschieden
aufgefaßt werden. Ich will nämlich auch eine Kleinigkeit von Fräulein
Eva von Ostried. Da[S. 355] sind welche, die stehen ihr nicht grade feindlich
gegenüber. Der Generalleutnant zum Beispiel; auch den Waldesruher
rechne ich dazu. Die andern, mit Ausnahme des kränklichen Herrn, der
sich schweigsam verhielt und, wie Dichter das leicht tun, für sie
flammt, hassen sie. Einer mehr, einer weniger. Fast hinter jedem Mann
steht ein Weib und hetzt ein bißchen. Hinter dem Stiftsfräulein der
auf Lebensdauer eingemietete Teufel, der sie völlig regiert. Hinter
dem Major außerdem die glühende Angst um das Wohl seines einzigen
Sprößlings. Da hat also schon seine Richtigkeit! – Ich habe Eva von
Ostried ebenfalls bis zum heutigen Tage nicht persönlich gekannt.
Habe mich leider, wie schon zugestanden, auch nicht um sie gekümmert.
Ein anständiger Kerl soll die gemachten Fehler, sobald er sie merkt,
abzuändern wenigstens versuchen. Und darum habe ich Sie hergebeten.
Sie hat es nicht leicht, sich durchzuschlagen. Das fühle ich. Wenn man
offene Augen haben will, bringt man das schnell heraus. Direkt von mir
nimmt sie aber vorläufig nichts an. Bestimmt hat sie mit Entbehrungen
zu kämpfen. Das soll aufhören. Zuerst habe ich daran gedacht, ihr
eine regelmäßige Monatsrente durch Ihre freundliche Vermittlung, ohne
Nennung meines Namens natürlich, auszusetzen. Sie würde das schnell
herausbringen und mit einem dankenden Wort an Sie zurückschicken. Nun
ist mir endlich was Besseres eingefallen. Sie leben in Berlin und
irgend welche musikalisch befähigte Jugend mag Ihnen auch bekannt
sein?!“
„Zufällig bin ich täglich mit einem jungen Menschen zusammen, dessen
ganzes Sehnen danach geht, sein musikalisches Talent in den Freistunden
vervollkommnen zu lassen.“
[S. 356]
„Das paßt großartig. Wer ist’s denn?“
„Einer unserer Schreiber.“
„Das dämpft meine Freude allerdings. Dem Kerlchen wird sie kein
fürstliches Honorar zutrauen, nicht wahr?“
Endlich begriff Walter Wullenweber. „So war das gemeint?“
„Natürlich! Ich beabsichtige für jede Stunde – na, sagen wir mal –
zehn Mark zu zahlen und ihn ungefähr vier bis fünf pro Woche nehmen zu
lassen.“
Der junge Anwalt mußte lachen. „Da er zu jeder Unterrichtsstunde
tüchtig üben muß, dürfte ihm daneben für seine bisherige Tätigkeit kaum
noch Zeit übrig bleiben.“
„Vielleicht hat er eine Schwester, die auch ideale Bestrebungen in sich
fühlt.“
„Sogar ihrer mehrere. Bescheidene, wohlerzogene Mädchen. Näheres
weiß ich allerdings nicht. Ich werde mich jetzt für die Familie
interessieren.“
„Ja, tun Sie das! Und wenn es möglich ist, könnten ja besser gleich
alle bei ihr antreten. Ihre Adresse kann ich Ihnen sofort geben...“
Eine Sekunde überlegte Walter Wullenweber. „Lassen Sie, Herr von
Ostried,“ sagte er dann und sein Ton klang anders wie bisher, „es ist
unnötig. Ich kenne sie.“
„So darf ich wissen, woher?“
„Fräulein von Ostried hat mich als ihren Beistand gegen einen ihrer
Agenten benötigt. Es galt, einen kleinen Irrtum richtig zu stellen...“
„Da war sie wohl persönlich bei Ihnen?“
„Ganz recht! Zweimal. Dann hatte sich die Sache zu ihren Gunsten
erledigt.“
[S. 357]
Dem Kummersbacher war diese Neuigkeit offensichtlich angenehm. Er
rückte näher heran und fragte den jungen Anwalt in vertraulichem Ton:
„Und glauben Sie auch nur ein Wort von dem, was das enge Hirn einer,
die nicht anders als böse denken und sein kann, über sie ausstreut?“
Bisher hatte sich Walter Wullenweber fest im Zügel gehabt. Jetzt ließ
seine Kraft nach.
Der Kummersbacher bemerkte die Veränderung seines Mienenspiels.
„Was haben Sie, Herr Rechtsanwalt? Die verdammte Stickluft hier.“
„Das ist es nicht,“ sagte Walter Wullenweber tonlos.
Der Kummersbacher sah ihn fest an, begriff langsam und nickte ein paar
mal.
„So stehts also. Und sie? Verzeihen Sie die Frage. Neugier liegt nicht
drin. Ich habe das Mädel so lieb wie eine Tochter gewonnen.“
Das Bekenntnis des alten Herrn, daß er sich um sie sorge, ließ keine
Ausrede zu.
„Ich – wollte sie zum Weibe. Aber – sie kam nicht...!“
Es wirkte wie das erschütternde Geständnis eines, der für einen
Augenblick die Maske abwirft, und der Kummersbacher fragte kein Wort
mehr. Er hatte auch keinen Trost bei der Hand. Kurz und herzlich sagte
er:
„Wir beide haben heute nicht das letztemal zusammen geredet! Nicht
wahr, das Gefühl haben Sie auch?“
Zeit und Arbeit trabten weiter, obwohl Walter Wullenweber in den
kommenden Tagen unter der starken Empfindung litt, daß sein Leben still
stehe! Niemals war in dem Weißgerberschen Bureau so heftig zu tun
gewesen, wie in diesen vergangenen Oktoberwochen. Dazu kam, daß der
Justizrat weiter an einer zunehmenden Körperschwäche litt, bei welcher
der Arzt strengste Schonung forderte, und Walter Wullenweber nahm sich,
um die Arbeit zu schaffen, jetzt dicke Stöße von Akten mit nach Hause.
Wenn er endlich gegen Mitternacht zur Ruhe ging, den Kopf noch voll
schwirrender Berufsgedanken, war er todmüde, verfiel auch schnell in
einen tiefen Schlaf, um plötzlich mit dem Gedanken emporzuschrecken:
„... nun habe ich gründlich verschlafen.“ Und doch war es kaum später
als zwei Uhr morgens.
Aber sein Bedürfnis nach Ruhe war gänzlich geschwunden. Er brauchte
alle Kraft, um nicht aufzuspringen und von neuem zu arbeiten.
Der dauernde Kampf, sich von den schweren, persönlichen Gedanken
freizuhalten, drohte ihn aufzureiben...
Ihre klaren, sprechenden Augen – die ganze Schönheit der jungen
stolzen Gestalt – vor allem ihre weiche Stimme, deren Klang ihm
verheißungsvoll zärtlich erschienen war.
Kurz! Er kam nicht von ihr frei.
[S. 359]
Lange begriff er nicht, wie das möglich sein konnte. Er wollte der
immer stärker werdenden Ahnung nicht Gehör schenken. Aber sie wurde ihm
zur Gewißheit. „Der Grund ihrer Ablehnung ist ein anderer! Sie liebt
dich, wie du sie liebst...“
Schließlich war er sicher, daß sie sich ihm um eines Geheimnisses
halber versagte! Die Saat des eigenen Mißtrauens, gestreut durch
den Bericht der alten, ahnungslosen Pauline von dem stattlichen
Päckchen brauner Scheine in der Handtasche – die einwandfreie
Feststellung ihrer eigenen Vermögenslosigkeit – dazu das Lockmittel
ihrer bezaubernden Schönheit, das augenscheinlich sogar die alten
harten Vertreter ihrer Familie auf ihre Seite gebracht, wuchs, seit dem
das Stiftsfräulein Hermine den Stab über sie brach. Er wollte nicht
daran glauben. Seine Liebe zu ihr war stärker als alles. Und doch,
täglich zertrümmerte er seinen Glauben an ihre Reinheit.
Die alte Pauline hatte ihren Namen nicht mehr erwähnt, seitdem er es
ihr verboten. Das war damals nach Eva’s Brief gewesen, als er noch
geglaubt hatte, daß sie nun für ihn abgetan sei. Jetzt war er oft
auf dem Wege zur Küche, um ihr zu gestehen, daß er ihr Schweigen
nicht länger ertragen könne. Hinein ging er niemals. Er blieb vor der
geschlossenen Tür und schüttelte den Kopf über seine Schwachheit.
Als er eines Morgens gegen neun Uhr an dem Schreibtisch seiner
Arbeitsstätte schaffte, brannte noch die elektrische Lampe. Um
diese Stunde durfte, ohne Vereinbarung, kein Klient vorsprechen.
Heute meldete der kleine musikalische Schreiber, dem dies Amt bis
zur Tischzeit oblag, eine Dame,[S. 360] die ihn ungesäumt in dringendster
Angelegenheit zu sprechen wünsche. Mit einem Schlage durchfuhr ihn
die Hoffnung, daß es Eva von Ostried sein könne. Er überlegte nichts,
sondern starrte der sich öffnenden Tür entgegen. – Es war aber das
Stiftsfräulein Hermine, die grau wie der herbe Tag, vor ihm stand.
Er wollte ihr kurz und unfreundlich eröffnen, daß sie sich bis zur
angezeigten Sprechstunde zu gedulden habe... aber seine Kehle war wie
zugeschnürt. Ungehindert ließ er sie sprechen.
„Ich möchte Sie um meine Unterschriftsbeglaubigung bitten, Herr
Rechtsanwalt.“ Dabei hatte sie schon mehrere Schriftstücke vor ihn
ausgebreitet und wies mit der harten, knöchernen Hand darauf hin. „Es
ist nämlich eine außerordentlich dringende Sache. Ich habe mein Geld
mit sechs Prozent anlegen können, während ich bisher dumm genug war, es
für nur vier einem kleinen Gutsbesitzer zu überlassen.“
Aus ihren Augen leuchtete die Habgier. Er merkte es deutlich, aber
es stieß ihn, den sonst Feinfühligen, nicht ab. Sein persönliches
Empfinden regte sich nicht.
Die Beglaubigung war schnell getan. Trotzdem blieb das Stiftsfräulein
noch. Sie hatte denselben Stuhl inne, wie damals Eva von Ostried. Daran
mußte Walter Wullenweber plötzlich denken. Die zusammengefalteten
Schriftstücke lagen immer noch in seiner Hand, ohne daß die
Eigentümerin Miene machte, sie an sich zu nehmen.
„Ich bitte sehr, das gehört Ihnen.“
Sie nickte. Aber sie nahm sie ihm trotzdem nicht ab. Um seinem Blicke
einen Ruhepunkt zu geben, senkte er ihn darauf[S. 361] nieder und las
mechanisch den Namen eines waghalsigen Unternehmers, der seit Jahren
ungeheure Werte an Grund und Boden an sich brachte. Sein Name war ihm
vielfach begegnet. Ohne, daß ihm bisher die Gerichte sein Handwerk zu
legen vermochten, hatte doch jeder, der sich mit seinen Angelegenheiten
beschäftigen mußte, das deutlichste Gefühl, daß dies Werk vieler
Millionen eines Tages zusammenbrechen und unzählige Vertrauensselige
unter sich begraben und zermalmen werde.
Die Verantwortung des Beraters von Rechtswegen regte sich in ihm. Auch
dieser Unangenehmen gegenüber!
„Sie haben das Geld doch noch nicht hingegeben?“
„Doch,“ nickte sie stolz. „Die Leute drängen ihm ja ihre Mittel
förmlich auf und er suchte nur eine bestimmte Summe.“
Walter Wullenweber war auch diese Gepflogenheit bekannt. Um bei
kleinen Sparern kein Mißtrauen zu erwecken, bezifferte er in seinen
Gutachten das Geforderte in der letzten Zeit kaum jemals höher als mit
hunderttausend Mark.
„Es machte grade unser gesamtes Vermögen aus,“ fügte sie noch hinzu.
„Und Sie haben sich zuvor bei niemand einen Rat geholt? Keinerlei
Auskunft über ihn eingezogen?“
„Das war unnötig. Jede der zweiundzwanzig Damen unseres Stiftes
war bereit, ihm das ihre, bis auf den letzten Pfennig, ebenfalls
anzuvertrauen. Ich war nur schneller wie sie und darum glücklicher.“
So widerwärtig sie ihm auch heute war, eine letzte Frage mußte er
dennoch an sie richten.
[S. 362]
„Wäre es möglich, daß Sie Ihr Geld, vielleicht mit einem kleinen
Verlust – noch zurückziehen könnten? Mir ist bekannt, daß solche
Leute, wenn sie dabei etwas verdienen können, sich ausnahmsweise dazu
bereit erklären.“
„Glücklicherweise ist das ausgeschlossen,“ kicherte sie. „Das Terrain
ist bereits damit erworben. Ich werde außer den sechs Prozent Zinsen
noch zwei weitere Prozent nach der Bebauung vom Reingewinn abbekommen.
Denken Sie – also das Doppelte der bisherigen Einkünfte...“
Er sagte nichts weiter dagegen. Wozu auch? Zu ändern gab es nichts mehr
und sie würde es noch früh genug erfahren. Sie deutete sein Verstummen
nach ihrer eigenen Veranlagung.
„Die andern Stiftsdamen würden mich steinigen, wenn sie wüßten, daß mir
dies rechtzeitig gelungen ist.“ Sie sah ihn lauernd an. Der abweisende
Ausdruck in seinen Zügen bestärkte sie in der Annahme, daß auch er ihr
dies glänzende Geschäft mißgönne. Darüber freute sie sich, wollte grade
eine hämische Bemerkung machen, unterdrückte sie aber rechtzeitig, weil
sie an das andere dachte, um dessentwillen sie in der Hauptsache zu ihm
gekommen war.
„Ich habe noch eine Bitte an Sie, Herr Rechtsanwalt.“
„Dafür bin ich zur Sprechstunde von 12 bis 2 Uhr nachmittags zur
Verfügung,“ meinte er abweisend. „Dies hier geschah nur ganz
ausnahmsweise! Der ungeschulte Schreiber soll keine unangemeldeten
Besucher vorlassen.“
„Wenn Sie mich jetzt noch einen Augenblick anhören, wird es nicht Ihr
Schade sein,“ tuschelte sie vertraulich.
„Ich bitte höflichst, einstweilen zu gehen,“ entschied er kurz, von
ihrer Vertraulichkeit abgestoßen.
[S. 363]
„Es handelt sich nämlich um Eva von Ostried,“ fuhr sie fort, als habe
sie seine Worte nicht vernommen.
Das entwaffnete ihn!
„Sie waren ja Zeuge meiner Ansichten über sie, Herr Rechtsanwalt.
Natürlich habe ich sofort versucht, die nötigen Beweise, von deren
Vorhandensein ich mich nach wie vor überzeugt halte, zu erbringen. Es
ist mir nicht gelungen. Ich habe keine Berührungspunkte zu den Kreisen,
in denen sie lebt. Wie soll ich also das bestimmt vorhandene Material
zusammentragen? Sie sind ein Mann und haben als solcher überall
Zutritt. Sie sind außerdem noch Jurist und wissen genau, worauf es hier
ankommt. Tun Sie mir den Gefallen und bemühen Sie sich in dieser Sache
an meiner Statt. An dem Tage, an dem Sie mir Vollgültiges bringen,
erhalten Sie von mir dreihundert Mark. Das gesetzliche Honorar, das Sie
als Anwalt für Ihre Bemühungen fordern können, bleibt davon unberührt.“
„Wenn Sie nicht wollen, daß ich ungesäumt dem Generalleutnant von Ihrem
Verlangen Bericht erstatte, entfernen Sie sich auf der Stelle.“
Sie ging mit wutverzerrtem Gesicht. „Gestehen Sie es nur, Sie sind auch
einer von denen, der in ihren Netzen zappelt,“ zischelte sie, schon auf
der Schwelle stehend. –
Er war wieder allein und riß die Fenster weit auf, als schwebe in
diesem Raum ein Pestgeruch wahnwitziger Verdächtigung, der ihm
Uebelkeit erregte. Dann hieb es wie mit Hammerschlägen auf ihn ein. „Er
war auch einer...“
Stimmte das nicht? Kam er von ihr los? Er fühlte, daß er an dieser
Sehnsucht und Ungewißheit langsam zu Grunde gehen müsse!
[S. 364]
An diesem Abend kam er erst gegen neun Uhr nach Hause. Die alte Pauline
war seinetwegen in Sorge. Sie wußte sich sein schon seit Wochen
verändertes Wesen nicht anders zu deuten, als daß er sich krank fühle.
Während er sonst beim Auftragen der Speisen gern einen Scherz machte,
saß er jetzt gedankenlos am Tisch und genoß hastig und unfreudig, was
sie ihm vorsetzte. Heute wartete der sorgfältig zubereitete Imbiß
längst auf ihn.
„Es gibt ein Gläschen Glühwein, Herr Rechtsanwalt,“ sagte sie
verheißungsvoll, „haben Sie das nicht gerochen? Die Luft geht scharf
und Sie sehen immer aus, als ob Sie nie richtig warm werden könnten.“
Er nickte ihr zu, während er die Aktentasche abwarf.
„Sie hätten Mediziner werden sollen, gute Pauline. Ihre Diagnose stimmt
aufs Haar.“
„Sie haben also wirklich gefroren und sagen mir keine Silbe davon,“
meinte sie vorwurfsvoll. „Wie gern hätte ich ein paar Kohlen in den
Ofen gelegt.“
„Der Glühwein wird auch helfen. Bringen Sie ihn nur möglichst schnell.“
Sie blieb nachher noch wie in früheren guten Tagen ein wenig am Tisch
stehen und sah ihm zu, in der Hoffnung, daß er sich aussprechen werde.
Hastig goß er den dampfenden Trank herunter.
„Kann ich noch eins bekommen, Pauline?“
„Aber gewiß! Nur wär’s vielleicht besser, ich brächt’ es Ihnen kurz
vor dem Schlafengehen. Das nimmt man, soll’s helfen, in ganz kleinen
Schlückchen – macht die Augen zu und schläft geschwind ein, wenn’s
sonst auch noch so lange dauern muß.“
[S. 365]
„Ich werde ausnahmsweise gehorsam sein. Also – nachher noch eins!
Vorher aber und zwar jetzt gleich, bitte, das andere...“
Sie hantierte kopfschüttelnd in der Küche, um seinen Wunsch zu
erfüllen. Er würde sich doch nichts angewöhnen? Neulich war er einmal
seltsam wankend nach Hause gekommen.
Auch dies zweite leerte er sehr schnell.
„Ich muß übrigens nachher noch einmal fort, Pauline.“
„Bei diesem Wetter? Hören Sie doch, wie der Regen an die Scheiben
klatscht.“
„Es hilft nichts. Ich muß eben. Suchen Sie, bitte, den alten
Lodenmantel heraus. Die elektrischen Bahnen werden noch überfüllter wie
sonst schon sein.“ Sie schlug jammernd die Hände zusammen.
„Jetzt womöglich auch noch eine Stunde oder länger zu Fuß laufen.
Lieber Gott, und ich hab’s so gut und trocken und warm. Kann ich das
nicht für Sie abmachen, Herr Rechtsanwalt? Lachen Sie mich nicht
aus. Ich weiß wohl, daß ich viel zu dumm für Ihre Sachen bin. Aber
vielleicht ist’s nur ein Auftrag oder so was. Es war doch schon mal so.
Da durfte ich auch an Ihrer Stelle gehen.“
Er legte gerührt seine Hand auf die ihre.
„Vielleicht machten Sie es diesmal sogar besser, als ich, Pauline. Aber
– nein – es darf nicht sein. Ich werde nicht früher ruhig.“
Das war wieder geheimnisvoll und unverständlich, wie jetzt so vieles.
Seufzend brachte sie den Mantel, der von den Kletterpartien aus der
Studentenzeit herstammte und hing ihn sorglich um seine Schultern.
[S. 366]
„Wann werden Sie wohl ungefähr zurück sein, Herr Rechtsanwalt?“
„Sie beabsichtigen doch nicht etwa aufzubleiben...“
– – – – Das Vorwärtskämpfen durch den dunklen, nassen Abend tat
ihm wohl. Der Regen, der jetzt fein und emsig herunterrieselte, netzte
seine pochenden Schläfen und beruhigte die wirren Gedanken. Trotzdem
fiel es ihm nicht ein, umzukehren – oder das, was er vor hatte, als
etwas Sinnloses zu empfinden. Es gestaltete sich im Gegenteil immer
klarer in ihm, daß er diesen Weg machen müsse!
Einmal versuchte er einen Platz auf der Plattform des elektrischen
Wagens zu bekommen. Es gelang ihm wirklich. Aber nun stand er –
eingekeilt von der Masse mürrischer, hastiger Menschen und atmete den
Dunst durchnäßter Mäntel und Kleider ein. Das dünkte ihn unerträglich.
In den kleinen verlaufenen Pfützen der Straße spiegelten sich die
trüben brennenden Laternen, sodaß es wirkte, als winke eine Schar
abgestürzter Lichtlein, die sich vor dem Ertrinken wehrten, zu ihm
herauf. Eine halbe Stunde ertrug er es. Dann sprang er ab und ging
das letzte Stück durch Wind, Regen und Kühle. Ohne zu zögern setzte
er seinen Weg fort. Als er die neue Kantstraße hinunterschritt und
zu beiden Seiten des kunstvollen Brückengeländers den Spiegel des
Lietzensees mit der neuen Fülle ertrinkender Lichter sah, beschleunigte
er seine Schritte. Ungezählte mal war er denselben Weg in Gedanken
gewandert, hatte ihn sich nach der Karte so genau eingeprägt, daß ihm
die Gegend vertraut erschien. Nun bog er rechts ab und hielt sich
an dem Drahtzaun entlang, der die alten schönen Bäume des Parkes am
Königsweg begrenzte.
[S. 367]
Das Haus, in dem Eva von Ostried wohnte, war schnell gefunden. Die
alte Pauline hatte es ihm, als sie noch darüber berichten durfte,
ausführlich und häufig genug beschrieben.
Gänzlich in das Dunkel gedrückt, stand er und starrte nach den Fenstern
hinüber, die er als die ihren zu erkennen glaubte. Hinter der Glastür,
die auf einen kleinen Balkon hinausführte, sah er den Schein einer
rotumhangenen Lampe –, er unterschied die Köpfe zweier Menschen dicht
nebeneinander. Der mit dem langgehaltenen fast bis zu den Schultern
herunterfallenden Haar war derjenige eines Mannes.
Diese Entdeckung durchzuckte ihn wie ein Stich. Er wollte auch
sein Gesicht sehen. Dies gelang ihm nicht. Es mußte, in tiefer
Versunkenheit, über etwas geneigt sein, das es völlig verbarg.
Auch von der weiblichen Gestalt vermochte er lediglich ein Stückchen
des freigetragenen Halses und eine Hand, die sich zuweilen nach einem
Gegenstand ausstreckte, mit Sicherheit festzustellen.
Es genügte ihm. Das Blut brauste vor seinen Ohren. Sein ohnmächtiger
Zorn löste sich langsam in eifersüchtige Qualen auf.
Nun stand er hier und sah zu, wie sich dort oben unter dem Schein
des verführerischen Purpurs, der das junge Blut doppelt erhitzen
mochte, eines der vielen Schäferstündchen abspielte. Er versuchte sich
einzureden, daß diese Gewißheit das beste Heilmittel für seine Liebe
sei, sah nach dem Schienenstrange der Elektrischen hin, der durch
Nebel und Nässe in der Ferne aufblitzte, und beschloß, heimwärts zu[S. 368]
eilen und traumlos auszuschlafen. Denn er war sehr, sehr müde. Aber er
machte keinen Versuch, sich zu entfernen. Er starrte weiter auf das
verschwimmende Bild der beiden dicht zusammengeneigten Köpfe.
Die breite Promenade war menschenleer. Nur einmal klappte die niedere
Tür der gegenüberliegenden Polizeiwache und ließ zwei stämmige
Schutzleute heraus. Ein paarmal drehten sie sich nach ihm herum, dann
gingen sie beruhigt weiter. Er fühlte nichts mehr wie das Bild, dessen
Gestalten er klar erkennen mußte, ehe er von hier schied. Seine Augen
brannten. Seine Zunge lag hart und trocken im Munde. Vielleicht war es
wirklich schon Mitternacht, denn irgendwo schlug eine Uhr zwölfmal.
Seine Taschenuhr war plötzlich stehen geblieben. Er entsann sich dumpf
eines Märchens, nach dem dies stets geschah, wenn eines Menschen
Liebstes die Augen für immer schloß. Erst später fiel ihm ein, daß es
ganz natürlich zuging, weil er vergessen hatte, sie aufzuziehen.
Er mußte nun heim!
Da schob sich ächzend die schwere Haustür, von innen geöffnet, auf, und
eine Männergestalt trat auf den Bürgersteig hinaus. In dem gleichen
Augenblick erlosch oben der rote Lampenschein.
Mit ein paar Sätzen war Walter Wullenweber bei dem Andern – – ging
neben ihm dahin, starrte ihn an wie ein Irrer....
Das war doch – –. Das Gefühl der Atemlosigkeit wich der Befreiung,
die zu schön erschien, um bedingungslos an sie zu glauben.
[S. 369]
„Herr Rechtsanwalt Wullenweber, nicht wahr?“ fragte eine Stimme, die
selbst in dem Augenblick gerechtfertigten Erstaunens noch sanft blieb.
Der schweigsame Dichter von der Familientafel der Ostrieds sah erstaunt
zu dem Anwalt auf. Walter Wullenweber suchte nach einer glaubhaft
klingenden Erklärung.
„Ich hatte in der Gegend zu tun und hoffte nun auf eine zufällig des
Weges daherkommende Droschke.“
Die Notlüge war zögernd und ungeschickt hervorgebracht. Aber Edgar von
Ostried-Javelingen kannte kein Mißtrauen. Langsam tastete er sich, nach
den traumhaften Stunden, in die Wirklichkeit zurück und lachte leise
auf:
„Dann ist es gut, daß mich der Zufall Ihnen in den Weg geführt hat.
Das gibt es hier kaum. Wir erhaschen aber bestimmt noch die letzte
Elektrische, wenn wir eilen. Nicht wahr, wir bleiben jetzt zusammen, um
später, wenn die Bahn uns heraussetzt, ein Stückchen durch die Nacht zu
gehen. Ist Ihnen das recht?“
Walter Wullenweber bejahte fast ungestüm. Ein wenig später saßen sie
nebeneinander wie zwei alte Freunde.
Walter Wullenweber wartete, daß ihr Name fallen würde.
„Ich war in Fräulein von Ostrieds kleinem, entzückenden Heim,“ begann
der Dichter endlich. „Ich weiß nicht, ob Sie ihre Adresse kennen.“
„Doch,“ meinte Walter Wullenweber mit mühsamer Beherrschung, „als der
Anwalt der Ostrieds...“
„Richtig. Wir hatten es an jenem großen Familientage ausgemacht, daß
ich sie zuweilen an Sonn- oder Feiertagen besuchen dürfe.“
[S. 370]
„Aber heute ist doch kein Feiertag,“ warf Walter Wullenweber mechanisch
ein.
„Nicht im gewöhnlichen Sinne! Für mich bestand er, obwohl sie selbst
leider nicht zu Hause war.“
„Fräulein von Ostried ist... abwesend?“
„Seit vier Tagen weilt sie in München, um dort in zwei Konzerten zu
singen.“
Walter Wullenweber seufzte tief auf. Wie hatte er das nur vergessen
können?! Durch seine Verhandlungen mit Herrn Alois Sendelhuber kannte
er die Daten genau.
„Hier habe ich übrigens eine glänzende Rezension aus den Münchener
Neuesten Nachrichten über das erste Konzert,“ plauderte der Dichter
und suchte einen Ausschnitt aus der Brieftasche. „Leider ist es zum
Lesen zu dunkel. Der Inhalt bringt eine schrankenlose Anerkennung ihres
herrlichen Stimmaterials bei vornehmster und edelster Vortragsweise.
Sie wird sicher dies alles ebenso interessieren wie mich, denn, nicht
wahr, auch Sie glauben bedingungslos an ihre Reinheit?“
Ueber Walter Wullenwebers Gesicht lief ein heftiges Zucken. Anfangs
wollte er die Frage überhören. Dann vermochte er es doch nicht.
Vielleicht blieb dies die einzige Gelegenheit, um sich aus dem
offenherzigen Bericht eines großen, guten Kindes, ein klares Bild zu
formen.
„Tun Sie es denn?“ fragte er dagegen. Ein erstaunter Blick traf ihn.
„Ich? Allerdings! Ich verehre sie auch um ihrer selbstlosen Güte und
Entsagungsfreudigkeit willen, von allen Menschen am meisten. Und ihre
Künstlerschaft ist begnadet. Dazu bedurfte ich keine Kritik. Das habe
ich sofort in der[S. 371] ersten Viertelstunde gefühlt, die ich ihrem Gesang
lauschen durfte. Sie machen ja plötzlich so ein merkwürdiges Gesicht,
Herr Rechtsanwalt? Trauen Sie mir keine Urteilskraft zu?“
„Sicher halten Sie sich von Fräulein von Ostrieds Vortrefflichkeiten
voll überzeugt!“
„Soll das vielleicht heißen, daß Sie an ihnen zweifeln?“
„Zweifeln? Ich glaube nicht, daß der Ausdruck paßt.“
„Auch jetzt bleiben Sie noch Jurist. Wie leid mir das tut. Als ich Sie
neulich längere Zeit beobachtet hatte, war ich sicher, daß Sie ein
starkes Gefühl für die Angegriffene hatten, obwohl Sie dies nicht zum
Ausdruck bringen konnten.“
„Nehmen wir an, daß Sie sich nicht darin getäuscht haben.“
„Dann dürfen Sie nicht an ihr zweifeln!“
„Alles Zweifeln entspringt dem Verstand! Dagegen kann das Gefühl nicht
an.“
„Wie sonderbar und hart! – Sie waren wohl nie in ihrem Heim? Hatten
keine Gelegenheit sie zu studieren, wie es mir vergönnt war.“
„Nein. Wie wäre das auch möglich gewesen. Sie suchte mich als Anwalt
auf, wir lernten uns dabei kennen – verhandelten –“
„Dann sind Sie entschuldbar, obgleich ich sofort einen nachhaltigen
Eindruck von ihr empfing. Verstehen Sie mich nicht falsch. Sie ist sehr
schön. Vielleicht überhaupt die Allerschönste. Es liegt nahe, daß ich
mich blind in sie verliebt haben könnte. Mein schwacher Körper – meine
armselige Stellung als Mensch und leider vor der großen Volksmenge auch
noch als Dichter wären kein Hindernis. Ich[S. 372] bin aber gar nicht verliebt
in sie. Ich liebe sie! Auch das nicht im üblichen Sinne. Wie man das
Gute und Schöne lieben und anbeten muß, so fühle ich für sie. Es kommt
mir gar nicht in den Sinn, daß dies etwa in den Augen solcher, denen
nichts heilig ist, lächerlich erscheinen könnte.“
„Schwärmer,“ sagte Walter Wullenweber leise. „Was erscheint Ihnen denn
so göttlich an ihr?“
„Vor einer Stunde war ich noch fest überzeugt, daß niemals ein Wort
davon über meine Lippen gehen würde. Jetzt fühle ich, daß ich, um ihr
einen Dienst zu erweisen, daran rühren muß. Sie sollen ein klares,
unverzeichnetes Bild von ihr erhalten. – Sie hat ein junges, sicher
dem Tode verfallenes Mädchen bei sich. Bei der habe ich heute gesessen
und ihr aus meinen neusten Schöpfungen vorgelesen. Sie ist sehr einsam
und muß sehr unglücklich sein und Eva von Ostried hat mich gebeten,
während ihres Fernseins nach ihr zu sehen. Völlig hat sie sich nicht
zu mir ausgesprochen. Es gibt aber Minuten, in denen eine schreckliche
Vergangenheit aus ihren entsetzten Augen redet. –
Was ich über Eva von Ostried an Tatsächlichen weiß, hörte ich von ihr.
Eines Tages hat sie das ihr bis dahin fremde Mädchen aufgenommen, die
Schwerkranke mit allen Opfern gepflegt und wie eine Schwester gehalten.
Der Grund ist mir klar. Sie weiß bestimmt, daß deren Wochen oder
Monate gezählt sind – daß niemand das sieche, heimatlose Geschöpfchen
aufnehmen würde. Darum machte sie ihr mit dem Sonnenschein ihrer Güte
die letzte Stunde leicht...“
„Dies todkranke, verlassene Mädchen ist eine Gefallene, nicht wahr?“
[S. 373]
Der Dichter zuckte zusammen. Ueber sein Gesicht flammte das helle Rot
der Scham oder Empörung.
„Ich weiß nicht, ob sie jemals gestrauchelt oder gar gefallen ist. Und
will es auch nicht wissen. Haben Sie allzeit aufrecht dagestanden?
Ja? Ich nicht! Ich habe Zeiten hinter mir, in denen ich zu dem
Schlechtesten fähig gewesen wäre. Warum ich es nicht ausführte? Ich
hatte eine Mutter, die ein Engel war und einen Vater, der ein Held im
Ertragen und Entsagen, auch in den opfervollsten Zeiten, blieb. Beide
Eltern starben, als ich zwanzig Jahre zählte. Viel zu früh natürlich.
Und dennoch spät genug, um mich stark und reif gemacht zu haben. Bei
jeder Anfechtung waren sie mein Schutz und Schirm. Wissen Sie denn,
ob das kleine, arme Gretchen Müller jemals einen Schutzgeist besitzen
durfte? Nun ist auch sie rein und still und sehnsüchtig nach allem
Guten. Was ist denn die Hauptsache? Was jemand getan oder versehen hat
oder wie er es zuletzt gutmacht? Ich glaube, dies letztere. Ich sage
Ihnen, das kranke Mädchen hat sich entsühnt. Und weil Eva von Ostried
das genau fühlt, wird ihre Güte und Liebe immer größer!“
„So ist Fräulein von Ostried von ihrem jetzigen Leben also voll
befriedigt?“
„Das glaube ich nicht. Sie ist ein verschlossener, starker Mensch,
der alles allein trägt. Meinen Sie vielleicht, daß sie sich etwa zu
Fräulein Gretchen ausspräche, denn ich darf das für mich noch nicht in
Anspruch nehmen. Unsere Bekanntschaft ist zu neu. Sie hat mir gegenüber
den Ton einer besorgten älteren Schwester, der neben all meiner
Anbetung den unbedingten Respekt keinen Augenblick vergessen macht.[S. 374]
Aber die Hausgenossin ahnt ein schweres Geheimnis in diesem Leben und
leidet schwer darunter, weil sie nicht zu helfen vermag.“
„Sie ahnt auch nicht, was es sein könnte?“
„Nein! Eva von Ostried vermeidet über sich zu sprechen.“ Noch einmal
äußerte sich der alte Argwohn in Walter Wullenweber: „Sie wird ihre
guten Gründe dafür haben.“
„Wahrscheinlich. Gut sind sie sicher. Ob richtig? Das wäre die Frage.
Ich jedenfalls verstehe, daß sie die Todkranke, die von viel Schmerzen
gepeinigt wird, nicht noch mehr belasten will.“
„Wie Sie für alles, was sie angeht, irgend eine Entschuldigung oder
Erklärung bereit halten.“
„Könnte ich sie sonst wirklich anbeten? Sie lächeln und denken, ein
Dichter kann das sehr wohl. O nein, Herr Rechtsanwalt. Wenn ich auch
arm und abhängig bleiben muß, meine Begriffe von Frauenehre und
Menschenwürde stehen fest. Die lasse ich mir von niemand antasten,
geschweige denn rauben. Wenn sich heute ein Dutzend weiser und
berühmter Denker die Mühe machen wollten, mich mit anscheinend logisch
aufgebauten Beweisen andern Sinnes zu machen, es hilfe ihnen nichts.
Wenn meine Seele klingt, wie sie das in Eva von Ostrieds Gegenwart tut,
dann irrt mein Gefühl nicht.“
„Sie sind ein beneidenswert glücklicher Mensch.“
Der elektrische Wagen lief nicht mehr. Die wenigen Fahrgäste waren
ausgestiegen. Nun kletterten auch die beiden letzten in ihre Gedanken
Versunkenen heraus.
„Bleiben wir noch ein wenig zusammen?“ fragte der Dichter wieder sehr
schüchtern.
[S. 375]
„Es kommt darauf an, wo Sie wohnen.“
Er nannte eine Straße im hohen Osten.
„Dann haben wir noch eine Viertelstunde den gleichen Weg.“
Schweigsam gingen sie durch die Nacht. Der Regen hatte aufgehört.
Sterne waren da und ein schmaler, blasser Mond.
„Herr Rechtsanwalt,“ sagte der Dichter plötzlich leise.
Walter Wullenweber fuhr zusammen. Er hatte die Gegenwart des andern
vergessen.
„Verzeihen Sie mir meine Schweigsamkeit. Mir ging so manches durch den
Kopf.“
„Das fühlte ich und würde Sie auch nicht gestört haben, wenn die
Viertelstunde nicht bald herum wäre. Eine Bitte hätte ich: Werden Sie
Eva von Ostried ein wahrer Freund und Berater, wenn Sie es können.
Ja? Sie ist sehr einsam und ich bin doch nicht die Persönlichkeit zum
schützen. Wollen Sie?“
Walter Wullenweber hielt die feingliedrige Hand des Dichters und preßte
sie voller Kraft.
„Ich will es versuchen!“
Nun ging er allein weiter. Die Sterne waren schon wieder verschwunden
und der schmale Mond blinkte nur noch wie ein gelber Faden, der zwei
dicke, graue, unruhige Wolken zusammen zu nähen versuchte. Ihm war
heiß, jung und sehnsüchtig zu Mute!
Der geräumige, vornehm ausgestattete Blüthnersaal schien bereits eine
halbe Stunde vor Beginn des heutigen Konzerts gefüllt. Aber mit dem
Glockenschlage strömte nochmals ein neuer Menschenstrom herein, staute
sich einen Augenblick und verteilte sich dann nach allen Seiten hin.
Wie das Rauschen einer Unruhe lief’s durch den Saal, dann schlossen
sich die Türen und es wurde ganz still.
Das Künstlertrio begann mit dem tatrischen Tondrama von Tschaikowski.
Vielleicht beherrschte der wundervoll reine Klang des Cello ein
wenig zu sehr die Melodie, die von der Geige hätte geführt werden
müssen. Aber das war nur für die ersten Minuten der Fall. Dann bot
das Zusammenspiel einen künstlerischen Genuß von höchster Vollendung
und die gewaltige Dramatik des ersten Satzes löste eine beifallslose
Ergriffenheit aus.
Nach der ersten Pause kam von einer der Türen Horst Waldemar von
Ostried und ging suchend – die Platzkarte in der Hand – die
vollbesetzten Reihen auf und ab. Er wußte genau, daß er irgendwo unter
einem Pfeiler einen Eckplatz hatte.
Als er endlich die kleine Dame im Schwabinger Künstlerkleidchen und die
dazu gehörenden braunen Haarschnecken[S. 377] vertrieben hatte, war es gerade
der Augenblick, daß Evas stolze, schlanke Erscheinung in dem sehr
schlicht gehaltenen Gewand aus weißer, fließender Seide auf dem Podium
erschien.
„Hast du jemals etwas so Märchenhaftes gesehen?“ flüsterte hinter
seinem Rücken ein begeistertes junges Wesen ihrem älteren, würdigen
Nachbar, der offenbar ihr Vater war, zu.
Horst Waldemar lauschte mit gespannter Aufmerksamkeit ihrer Antwort.
„Ausnahmsweise spielst du dich als echter Kindskopf auf,“ tadelte die
tiefe Stimme. „Befreie dich gefälligst von ihren äußeren Reizen, sonst
kannst du unmöglich das genügende Verständnis für sie als Sängerin
aufbringen. Und du weißt, daß sie das verdient.“
„Ich empfinde dich als einen merkwürdig gnädigen Kritiker, so bald es
sich um sie handelt, Papa.“
„Merkst du nicht, daß sie uns alle durch ihr Talent dazu zwingt,
Kind? Dies alles ist nur der Anfang. Eines Tages wird man in der
musikalischen Welt nur von ihr sprechen. Dann wird sie ungeheure
Honorare bestimmen und erhalten. Man wird sich einfach zerreißen,
um sie festzumachen. Das habe ich bereits vor einem Jahre gewußt.
Und niemals begriffen, daß sie sich mit dem bescheidenen Lose einer
Konzertsängerin begnügt.“
„Sie wird sehr bald einen Prinzen oder einen Doppelmillionär heiraten,
Papa, und dann darf sie nur für den Einen singen.“
Er lachte leise.
„Beide mögen sich finden lassen! Ob sie aber mag?“
[S. 378]
„Ich glaube, ich könnte nicht widerstehen.“
„Diesen Glauben teile ich. Du bist leider im Alltag das nüchternste
Geschöpf unter der Sonne, wenn es irgendwie Stellung, Vorteil oder
Glanz zu erkaufen gibt.“
Es klang bitter.
„Ich muß doch, seitdem Mama tot ist, sparen. Für uns Beide,“ sagte
sie, als schäme sie sich ein wenig für ihren alten Vater, der das
wirtschaftliche Einmaleins so schlecht beherrschte.
Er seufzte verzweifelt auf. „Ach, diese ewigen Geldnöte, Trude.“
Da jauchzte der erste Ton durch die andächtige Stille und löschte die
Nöte des Lebens aus. Schuberts tiefergreifende ewig schöne Weihelieder
erbrausten. Das Lied vom „Abendrot“ umspann die Hörer mit seinem
weichen, sehnsüchtigen Ewigkeitszauber.
Den fünf Handschriftliedern war ihre Stimme und die Begleitung voll
angepaßt und jubelnde Stürme echter Begeisterung lösten sie aus. Eva
von Ostried stand, als ginge sie die Raserei der Menge nichts an,
und trat schließlich, mit einer Handbewegung auf den Komponisten
deutend, bescheiden zurück. Er mußte an ihre Seite kommen. Die beiden
hochgewachsenen Menschen reichten sich einen Augenblick fest die Hände.
In diesem Augenblick erhob sich Horst Waldemar von Ostried so leise,
wie es seine mächtige Figur zuließ und tastete sich nach der Tür. Ihre
Mitwirkung war nach der gedruckten musikalischen Beitragsfolge hiermit
zu Ende. Noch einmal sah er zu ihr hinüber. Sie hatte die Hände wieder
frei und leicht zusammengelegt. Sein Blick war[S. 379] gefesselt. Gewaltsam
riß er ihn los. Noch ehe ihm das voll gelungen, hatte sie ihn bemerkt.
Eine Sekunde begegneten sich ihre Blicke. In der nächsten wandte sie
den Kopf zur Seite.
Ihm flog etwas durch den Sinn. Zusammenhanglos, wie er meinte und
töricht genug. Die Worte, die vorher der alte Kritiker über den
Prinzen gesagt hatte – „Ob sie aber mag?“ Dann reckte er sich noch
höher auf und verließ in dem Augenblick den Saal, als die unaufhörlich
Klatschenden sich glücklich eine Zugabe erbettelt hatten. Es war das
kleine Lied des unbekannten Komponisten, daß sie damals in München
gesungen:
Ich hatt’ eine weiße Rose
Auf meinem Blumenbrett...
Eva hatte sich dem nicht endenden Beifall entzogen und war auf der
Hintertreppe ins Freie gelangt, denn der Anblick des Einen, der sich
plötzlich weit vorgebeugt und unverwandt zu ihr herab gestarrt, hatte
ihr die Fassung und alle Freude an dem schönen, großen Erfolg geraubt.
Nun sah sie nur ihn, fürchtete ihm irgendwo zu begegnen und stellte
doch in dem nächsten Augenblick mit bitterer Angst fest, daß er
zu stark und zu stolz sei, um nach dem Geschehenen auch nur einen
solchen Versuch zu machen. Die herzliche Einladung des Trios zu einem
gemütlichen Beisammensein nach dem Konzert hatte sie, unter irgend
einem törichten Vorwand, abgelehnt. Wie eine Diebin schlich sie sich
fort. Der Schwarm der Hörer hatte sich verlaufen. In der Beförderung
der elektrischen Bahnen mußte vorübergehend eine Stockung eingetreten
sein. Es war alles still und tot um sie her.
[S. 380]
Plötzlich stand er neben ihr und ging an ihrer Seite weiter. Walter
Wullenweber hätte dies noch vor Stunden für unmöglich gehalten. Er
wollte nichts, als sie wiedersehen, und danach alles überlegen! Nun
zwang ihn etwas zu ihr.
„Woher kennen Sie das kleine Lied?“
„Das Lied? Welches Lied?“ fragte sie.
„Mein Lied.“
„Das von der weißen Rose? – Es ist das Ihre?“
„Ja, ich habe es vertont. Der Text ist von meiner armen, kleinen
Schwester.“
„Ich fand es vergessen in einer kleinen Konditorei und nahm es mit mir.
Seitdem habe ich es oft gesungen.“
„Eva,“ sagte er dicht an ihrem Ohr und alles, was er an Liebe, Leid,
Sehnsucht und Angst um sie getragen hatte, lag in diesem einen Worte.
Es riß sie von ihm fort, denn die alte Schuld schlug mit harten Fäusten
auf sie ein, aber sie hörte nichts als das eine leise, zärtliche Wort.
Und seine Hand riß die ihre an sich: „Ich liebe dich – weiter über
alles.“
Da gab sie den Kampf auf.
„Wo warst du so lange?“ fragte sie voll seliger Scheu.
Nun nahm er auch ihre schlanke stolze Gestalt. Einen Augenblick ruhte
sie an seinem Herzen.
„Ich war immer bei dir, Eva.“
„Und ließest mich doch ganz allein.“
„Durfte ich denn kommen? Hast du deinen Brief vergessen, den
schrecklichen kalten Brief?“
„Es war alles nicht wahr,“ stammelte sie.
„Warum dann aber? Wozu diese unsägliche Qual für uns Beide?“
[S. 381]
„Frage nichts! Ich weiß es nicht. Ich weiß nur das Eine.“
„Was ist das? Sprich es aus!“
„Daß ich dich ebenso liebe, wie du mich!“
Seine Arme umfaßten sie – trugen sie beinahe, und mit geschlossenen
Augen ließ sie es geschehen. „Du, du,“ sagte er nur, „nun hat alle Not
eine Ende!“
Da schlug es wieder in ihr wundes Gewissen. „Ich muß noch mit dir
sprechen. Morgen, ja?“
Das unheimliche Gespenst des dunklen Geheimnisses, unter dem er bis zur
Grenze des Ertragenkönnens gelitten – da war es wieder. Und dennoch
nichts mehr von alledem.
„Es ist doch Keiner da, der jemals ein Recht an dir gehabt hätte, Eva?“
Stolz und frei blickten ihre Augen in die seinen.
„Niemand! Das schwöre ich dir!“
Nun war alles – alles gut! Keine Frage sollte jemals an seinen Qualen
rühren. Er würde ihr bedingungslos vertrauen. Er hob ihre Hände und
preßte seine Lippen darauf.
Der nächste Tag war ein Sonntag. Mit holdseliger Befangenheit, die
ihn rührte und beglückte zugleich, hatte sie seinen Besuch in ihrem
Heim abgewehrt. So war es festgelegt, daß sie sich um die Mittagszeit
draußen in Wannsee treffen und alles nötige miteinander vereinbaren
würden. Denn sie waren im Innern gleich entschlossen, daß sie schon
diesen Winter als Mann und Frau durchleben mußten!
Auf dem schmalen Sitzbrett eines Bootes saßen sie und sprachen von sich
und ihrer Zukunft.
[S. 382]
„Ein glänzendes Los erwartet dich nicht, Liebste,“ meinte er. „Siehst
du, mein festes Einkommen genügt eigentlich. Aber da ist noch mein
Vater. Ich schrieb dir damals alles von ihm. Und dann meine kleine
Schwester. Wenn ich sie doch eines Tages wiederfände.“
Fest schmiegte sie sich an ihn.
„Mit mir, die ich leider mit ganz leeren Händen zu dir kommen muß,
rechnest du also lediglich als Verbraucherin?“
Er sah sie erschrocken an.
„Anders darf es nicht sein, Eva!“
„O doch! Verstehe mich nicht falsch. Ich werde an dir und deiner Liebe
volles Genüge finden. Das weiß ich. Frei von allem Ehrgeiz will ich dir
schaffen helfen, indem ich weitere Stunden gebe.“
„Nicht früher, bis es dringend notwendig geworden ist. Versprich mir
das schon jetzt.“
„Gut,“ sagte sie nach einer Weile. – An ihrem Zaudern merkte er, wie
schwer ihr die Zusage wurde.
„Ich glaube, das war von mir allzu egoistisch, Liebling. Aendern wir
es darum ungesäumt ab. Wenn deine Sehnsucht dich früher dazu treiben
sollte, dann sagst du es mir!“
Sie nickte.
„Wie du mir überhaupt alles – alles anvertrauen mußt. Nicht wahr? Aber
das ist ja selbstverständlich!“
„Wenn ich dir nun doch eine Kleinigkeit verschweigen würde,“ fragte sie
mit schmerzhaft zusammengezogenen Brauen.
„Es käme darauf an, was es wäre. Halte mich nicht für kleinlich. Ich
will dir immer grenzenlos vertrauen. Aber ein Geheimnis, daß schon
bestanden hat, ehe du mein Weib[S. 383] wärst. Siehst du, das müßte ich
kennen. Oder?“ Er stockte.
„Warum sprichst du nicht zu Ende, Walter?“
„Es war nichts, Liebste,“ lenkte er ab.
„Du willst kein Geheimnis dulden und schaffst in demselben Atemzug
eins,“ klagte sie.
Ihre Augen standen voller Tränen. Der Jammer über ihr Schicksal
erpreßte sie. Er aber glaubte, sie verletzt zu haben, befreite sich von
dem sich selbst gegebenen Versprechen und sagte rasch und klar:
„Du hast einen Anspruch, den Satz zu Ende zu hören. Ich wollte sagen,
wenn es das Geheimnis eines Geschehnisses wäre, von dem du wüßtest, daß
es nichts in mir änderte – das ich voll begreifen, ja vielleicht sogar
nachmachen könnte, dann gestände ich dir ohne weiteres das Recht zum
Verschweigen ein.“
„Also in keinem andern Fall?“
„Nein! Vielleicht könnte ich etwas, das ich nie begreifen lernte,
dennoch verzeihen.“
„Du mußt mir noch mehr darüber sagen, Walter. Ich verstehe dich noch
nicht völlig.“
„Und es ist doch so klar, Liebste! Ein hartes Geheimnis, lediglich
durch einen Zufall enthüllt, würde für immer Glauben und Vertrauen in
mir vernichten.“
„Auch die Liebe?“ fragte sie mit Aufbietung aller Kraft.
„Meinst, daß die ohne Glauben und Vertrauen möglich ist?“
Einen Augenblick rang sie um Atem. Jetzt mußte sie es ihm sagen. Keine
Minute durfte es länger nach diesem verschwiegen werden.
[S. 384]
Da legte er den Arm um sie und zog ihren Kopf an seine Brust. So ruhte
sie aus, während der leichte Kahn fast stillstand, und dachte dumpf und
verzweifelt und dennoch über alle Maßen selig: Noch einen Herzschlag
lang, und dann – –
Er küßte sie auf Mund und Augen. Ein leiser Wind begann sie ein wenig
vorwärts zu treiben. Die Sonne sah ihr warm und strahlend ins Gesicht.
Plötzlich ward sie fest entschlossen, ihr Glück nicht aufs Spiel zu
setzen. Denn der Zufall? Er konnte ihr nichts anhaben. Niemand außer
ihr wußte darum!
„Wir törichten, dummen Menschen,“ flüsterte sie an seinem Herzen und
lachte dabei. Wie von einem Alp befreit atmete er auf.
Daß sie jetzt schweigen konnte und lachen war der beste Beweis, daß er
sich alle Schatten nur eingebildet hatte!
Sie wurde sprühend ausgelassen.
„Daß hätte ich niemals für möglich gehalten,“ wunderte er sich beglückt.
„Du wirst noch viel Seltsames an mir erleben.“
„Sicher aber lauter Schönes und Beseligendes.“
„Möglich! Als deine Frau findet auch das immer noch ausstehende Wunder,
das eine Ahne verheißen hat, eine Erfüllung.“
„Worin könnte das wohl noch bestehen?“
„Daß einer Ostried, die gleich einer Nachtigall flötet – verzeih’
mir diese Anmaßung, aber so steht es geschrieben – eines Tages ein
Märchenschloß vom Himmel herabfällt, worin wir Beide dann unsere
allerreinste, allertiefste Liebe vor den neidischen Menschen verstecken
können.“
[S. 385]
„Das Schloß mag nahe genug sein. Aber, ich bin das Hindernis. Paß nur
auf, du kennst meine Schattenseiten nicht.“
„Ich weiß nur, daß ich glücklich durch dich bin. Was wird nur die alte
Pauline sagen, wenn sie alles erfährt.“
„Ich bilde mir ein, sie hat es vorausgewußt, Liebste.“
„Hat sie etwas derartiges verraten oder gar dir zugeredet.“
Es klang schelmisch und übermütig.
„Gelobt hat sie dich nur immer, bis ich ihr das im vollen Ernst
verbieten mußte.“
„Und darin ist sie gehorsam gewesen?“
„Aufs Wort.“
„Dann wirst du auch mich völlig beherrschen, Liebster.“
„Und du wirst dich zu deiner Kunst zurücksehnen?“
„Soll ich es dir wirklich wiederholen, du Unersättlicher? Mein Sehnen
bist du! Ohne dich wäre mir jenes sagenhafte Märchenschloß nie und
nimmer beschert worden.“
„So süß es in meinen Ohren klingt, Liebling. Der Jurist weiß es
anders.“ Und er erzählte ihr von jener durch Horst Waldemar von Ostried
aufgefundenen grundlegenden Erbfolgebestimmung. Sie hörte aufmerksam
zu und brach schließlich in ein helles Lachen aus. Diesmal kam es aus
einem schattenlos fröhlichen Herzen.
„Nun verstehe ich endlich den Brief des Regierungsassessors und nunmehr
entthronten Anwärters. Das heißt,“ fügte sie verbessernd ein, „jetzt
kann er wieder seine alte langweilige Maske vorstecken. Zwei Tage
nach dem Familientag erhielt ich ein Schreiben von ihm. Ach so –
ich muß noch etwas voranschicken. Er wollte mich nach jener Sitzung[S. 386]
heimbegleiten – aber ich hatte kein Verständnis dafür und schickte ihn
fort. Darauf nahm er Bezug. Es war ein schöner Brief. Du mußt ihn auch
lesen. Inhalt: Ich hätte es ihm angetan und er flehte um meine Huld!“
„Richtig Huld hat er geschrieben?“
„Jawohl! Du, das war sehr diplomatisch. Darunter konnte ich mir
allerhand vorstellen. Warte, es geht noch weiter. Wann er kommen dürfe,
um sich von meiner Vergebung zu überzeugen und wann vor allen Dingen
er mich seinen lieben Eltern bringen könne, die sich herzlich auf mich
freuten. Dabei schenkten mir damals besagte liebe Eltern auch nicht die
geringste Beachtung.“
„Was hast du ihm geantwortet?“
„Geantwortet? Aber, Liebster?“
„Nun ja –“
„Kein Wort natürlich! Er ist doch auch Jurist und wenn ich ihm ganz
klar meine Ansicht über diesen Fall mitgeteilt hätte, würde er mich
sicher vor das hohe Gericht geschleppt haben. Denn, du mußt bedenken,
daß ich bei Abfassung seines Briefes die für ihn ausschlaggebenden
Beweggründe noch nicht ahnte. Ich habe ihn einfach für wahnsinnig
gehalten. Später änderte ich diese betrübliche Ansicht in eine nicht
minder unschöne ab. Er wurde mir langsam zu einem gewissenlosen
Betörer, dem jedes Mittel zur Erlangung eines unsaubern Wunsches recht
ist.“
„Du hättest also Frau Regierungsassessor und noch viel mehr werden
können. Bestimmt aber die Schloßherrin von Waldesruh, wenn auch im
reifsten Alter. Der jetzige Majoratsherr scheint keine Lust zur
Wiedervermählung zu haben.“
[S. 387]
Sie zuckte zusammen, als fröstele sie. „Niemals sah ich ein
seelenloseres Gesicht als das seine! Findest du das nicht auch?“
„Sonderlich zu erwärmen vermag auch ich mich nicht für ihn. Aber er ist
ein Mann von hochanständiger Gesinnung. Nicht wahr, wie leicht hätte
er es gehabt, diese unbequeme Bestimmung aus dem verrosteten Kasten
einfach verschwinden zu lassen. Wenn er auch nachträglich ausgeführt
hat, daß sie ihn und einen eventuellen Sohn aus einer zweiten Ehe nicht
anficht. Immerhin, es brachte ihm Arbeit und Reibereien ein.“
„Natürlich. Ich vergesse immer wieder, daß ich in den Augen der ganzen
Familie verfehmt bin. Nein,“ verbesserte sie sich, „das wäre undankbar.
Der Kummersbacher war herzlich gut mit mir und der kleine Dichter, der
mich übrigens treu besucht, hat mir längst zwei Flügel verliehen.“
„Mache dich jedenfalls in allernächster Zeit auf die wichtige Eröffnung
gefaßt, Evalein, daß deiner späteren Linie bei einer standesgemäßen
Heirat die Aussicht zur Wiedererlangung der alten Heimat beschert sein
soll!“ Sie errötete tief und nestelte sich von neuem an ihn.
„Ich gehöre dir. Nur dir! Alles andere ist wertlos geworden! Du wirst
mir auch diese Mitteilung, die hinfällig geworden ist, ersparen –
nicht wahr?“
„Das darf ich als pflichtgetreuer Anwalt, der gar nichts mit deinem
Liebsten zu schaffen hat, nicht!“
„Aber, wenn ich nun doch sehr, sehr bald auch vor der Oeffentlichkeit
deine Braut heiße.“
„Damit bist du leider noch nicht meine Frau!“
[S. 388]
„Auch das wird gar nicht mehr so lange auf sich warten lassen?“
„Wären dir endlos lange zwei Monate als Verlobungszeit zu kurz,
Liebste?“
„Nein, nein! Das sind ja mehr als sechzig Tage!“
Schweigsam aneinander gelehnt saßen sie, sahen träumerisch nach den
silbergrauen Perlen und beschlossen, Hand in Hand, daß in den nächsten
Tagen ein ausführlicher Brief über dies Ereignis nach Hohen-Klitzig
berichten solle.
Noch einmal jammerte Eva von Ostrieds Gewissen auf. Dann hatte sie auch
diese Regung überwunden.
Sie hatte ein Herz aus Glas und der Geliebte sah alles, was darin
vorging! Selbst bis dahin ahnungslos, daß es so war, offenbarte ihr
erst sein entsetztes Stammeln, daß sich ihm nun doch ihr Geheimnis
enthüllt habe. Sie gewann es über sich, um seine Vergebung zu betteln,
sie zu gewähren war ihm unmöglich!
Er schüttelte sie ab und floh mit einem Ruf des Abscheus für immer – –
Als Eva von Ostried mit einem wilden Schrei aus diesem Traume
emporfuhr, versuchte sie sich zu verhöhnen. Nachmittags, wenn sie sich
zum Aussuchen der Verlobungsringe treffen würden, wollte sie ihm davon
erzählen. Zugleich erschrak sie über diese Kühnheit, denn lediglich das
gläserne Herz war ein Gebilde ihrer aufgepeitschten Nerven. Das weitere
entsprach ja der Wahrheit!
Die Morgensonne leuchtete durch die herbstlichen Bäume des Parkes
und trug zu ihrem goldenen Strahlen den Widerschein der gelb und
rotgefärbten Blätter ins Zimmer hinein; dabei wurde Evas Herz wieder
ruhig.
Gegen zehn Uhr vormittags brachte Gretchen Müller einen Rohrpostbrief.
Eva von Ostried streckte mit glücklichem Lächeln die Hand danach aus.
Walter Wullenweber schrieb in großer Eile:
[S. 390]
Mein Liebling, werde soeben telegraphisch zur Entgegennahme eines
Testaments in die Nähe Berlins aufs Land gerufen. Komme wegen
ungünstiger Bahnverbindung jedenfalls erst spät abends zurück. Auf
morgen also...
Ein neuer Tag ohne ihn! Es erschien ihr schmerzlich und doch süß
zugleich! Die Tränen kamen ihr vor Glück.
Der Montag vormittag war ihr sonst wegen der fünf aufeinanderfolgenden
Stunden dahingeflogen. Heute dehnte er sich endlos.
Nachdem ihr Tagewerk vollendet, schloß sie sich in das kleine
einfenstrige Zimmer ein, wie damals, als sie ihm den Abschiedsbrief
geschickt hatte. Ein Berliner Konzertagent kam, verhandelte mit
Gretchen Müller und begehrte Eva von Ostried danach ungesäumt zu
sprechen. „Er mag wiederkommen,“ sagte sie drinnen, ohne zu öffnen.
Was ging sie noch die Kunst an? Ihr Glück lag einzig in ihm.
Mechanisch nahm sie das dünne Päckchen aus dem Schreibtisch und legte
es vor sich hin. Ihr graute vor der erneuten Berührung. Mit spitzen
Fingern zog sie endlich seinen Inhalt ans Licht. Es enthielt nur noch
zwei Scheine. Die letzten! Das andere des Raubes war aufgebraucht.
Wenn sie die laufenden hauswirtschaftlichen Ausgaben beglichen
haben würde, mußte sie von neuem einen dieser Scheine wechseln. Die
letzte unbezahlte Arztrechnung für Gretchen Müller fiel ihr ein. Es
waren wiederum dreihundert Mark, trotzdem sie selten genug nach dem
Sanitätsrat gesandt hatte.
Es schadete ja auch nichts. Gewechselt mußte doch werden. Sie brauchte
ein Hochzeitskleid – einen Schleier und[S. 391] den grünen Myrthenkranz.
Wovon sollte sie dies und noch viel mehr bezahlen, wenn nicht von
diesem Gelde?
Seine Braut, die ihre äußere Schönheit gestohlen haben würde – im
wahrsten Sinne des Wortes. Den Treuschwur verachtend und selbst –
Verbrecherin!
Aber heimliche Stimmen flüsterten Trost und Hoffnung: „Er läßt dich
niemals! Ohne dich ist seine Zukunft schal. Sei ganz ruhig –“
Sie nickte und glaubte es zuletzt! Und spann nun aus, wie es sein
würde, wenn Sie ihm alles gesagt hätte. Eine unbeschreibliche Seligkeit
mußte das werden! Von dieser Vorstellung kam sie nicht mehr los.
Gegen Abend schrieb sie ihm alles, wie es sie dünkte, zu nüchtern. Da
sie es überlas, erschien es ihr grausam. Aber es war ihr unmöglich
gewesen von ihren Gefühlen dabei zu sprechen; die würde er klar
empfinden, ohne daß sie ein Wort verlöre, meinte sie. Unmöglich schien
es ihr auch, der Opfer Erwähnung zu tun, die sie gebracht und noch eine
Zeitlang weiter bringen mußte, weil sie der heimatlosen Schwerkranken
eine Zufluchtsstätte bot. Das alles würde Sache der mündlichen
Aussprache sein.
Als der Brief fertig war, begriff sie nicht, wie sie jemals zaudern
konnte. Sie trug ihn selbst fort, wie damals. – Dann ging sie ihren
Tag weiter! – –
Jedesmal, wenn vierundzwanzig Stunden später die Klingel gellte,
glaubte sie zu fühlen, daß er jetzt da sei.
Glaubte es immer wieder, bis dieser Tag sank und ein neuer kam, der
ebenso ereignislos verlief wie sein Vorgänger. Erst am dritten Tage
packte sie eine fürchterliche Angst. Wenn er nicht darüber fortkäme?
– Das währte[S. 392] aber nicht lange. Seine tiefe große Liebe würde niemals
sterben können.
Am vierten Tage hatte sie keine Hoffnung mehr! Und am fünften Tage
ertrug sie die Qual nicht länger. Ohne ihren Namen zu nennen, fragte
sie im Büro an, ob er zu sprechen sei. Darauf erwartete sie ein „Nein“
und erhielt statt dessen den Bescheid, daß er, wie alle Tage, seine
juristischen Sprechstunden abhalte.
Da warf sie sich auf einen Stuhl und mußte lachen. Es klang schaurig.
Sonst hätte sie aber schreien müssen – immer nur schreien – das ganze
Haus zusammen und noch weiter zu der Straße hinaus, denn die Fenster
waren weit geöffnet.
Er lebte und gab ihr keine Antwort! Was war das?
Ein paar Stunden später wußte sie es. Sie riß seinen Brief gleich vor
der Tür auf, als sie ihn empfing. Da sank sie bewußtlos zusammen, und
Gretchen Müller fand sie, den Brief in der Hand.
Gretchen Müller hatte noch niemals einen Blick in fremde Post getan.
Jetzt las sie, nach kurzem Zaudern, bewußt Wort um Wort, begriff nicht
alles, aber wußte doch, daß der Strenge nun auch bereit war, sein
eigenes Herz zu Tode zu foltern.
„Du wirst viel gelitten haben, ehe Dir dieser Brief möglich
war,“ schrieb er. „Das fühle ich deutlich. Was Du tatest, mag
Dir damals einen Augenblick als der einzige Ausweg erschienen
sein. Leichtsinnig hast Du es nicht tun können. Es wird sich auch
hundertfach gerächt haben. Alles das wiederhole ich mir seit Tagen.
Dein erster Brief war eine Folge davon und wie vieles andere wohl[S. 393]
noch, das Du unerwähnt ließest. Ich glaube sogar, daß ich eine
andere verteidigen könnte. Eine, die ich nicht liebe als meines
Wesens Heiligstes. Um Deine Freisprechung habe ich vor meinem Gott
gerungen und sie doch nicht finden können. Es ist unaussprechlich
grausam, auch für Dich. Aber daran läßt sich vorläufig nichts
ändern.
Ich ringe weiter. Habe Geduld mit mir und mit dem dumpfen
Schrecken, der mich nicht loslassen will.“
Nach überraschend kurzer Zeit konnte Eva von Ostried sich allein auf
das Ruhebett begeben. Suchend irrte ihr Blick umher.
„Ich habe den Brief auf Ihren Schreibtisch gelegt,“ sagte Gretchen
Müller.
Am nächsten Tage raffte sich Eva von Ostried auf und stand plötzlich
vor der Hausgenossin. „Wenn Sie mir schnell etwas Warmes bereiten
könnten, Gretchen. Ich muß nämlich zu dem Agenten, den ich neulich
durch Sie abweisen ließ. Wie gut, daß Sie sich seine neue Adresse geben
ließen.“
Es klang ruhig. Auch das Gesicht war, obgleich immer noch sehr blaß,
wieder ebenmäßig schön, wie zuvor. Entsetzt wehrte Gretchen Müller ab:
„Sie dürfen auf keinen Fall heraus. Hören Sie nur, wie scharf der Wind
pfeift.“
„Es war leichtsinnig, daß ich den Agenten nicht anhörte,“ sagte Eva.
„Erinnern Sie sich noch, was er sagte?“
„Ganz genau. Er käme, um eine Reihe Winterkonzerte mit Ihnen zu
vereinbaren und wenn es möglich sein könnte, auch über das andere zu
reden.“
[S. 394]
„Welches andere? Mir ist nichts bekannt!“
„Ich wagte nicht danach zu fragen. Er war eilig und beleidigt, weil Sie
ihn nicht vorließen.“
„Nun also, wie stehts jetzt mit der Wegzehrung, Gretchen?“
„Sie ist längst bereit. Aus dem Hause lasse ich Sie aber nicht.“
„Seien Sie nicht kindisch.“
„Ich flehe Sie an. Hören Sie nur dies eine Mal auf mich.“
Eva von Ostried fühlte ein inneres Erschrecken.
Es mußte einen Grund haben, daß Gretchen Müller sie zurückhalten
wollte. Sollte sie etwas ahnen?
Aber was war denn überhaupt geschehen? Zwei Menschen, die sich auf
seltsame Art gefunden, hatten sich ebenso wieder getrennt. Ein Teil
war schuldig, der andere schneeweiß. Noch besser. Eins rang mit der
Nacht des Wahnsinns; das andere hielt unentwegt seine juristischen
Sprechstunden ab.
Bedurfte es eines klareren Beweises, wer mehr litt?
Sie biß die Zähne zusammen. Und wenn sie auf dem Wege niederfallen
sollte, sie würde jetzt doch den Agenten aufsuchen und sich von ihm
anwerben lassen, wohin er sie haben wollte.
Und Toiletten würde sie anschaffen. Nicht mehr weiße, unschuldsvolle
Nonnenkleider, sondern prunkvoll schimmernde, wie es sich für eine
große Sünderin ziemte.
Und kostbare Steine mußten Arme und Hals in Zukunft ebenfalls
schmücken. Man bekam sie schon, wenn man es nur erlaubte!
[S. 395]
Ihre Augen brannten dunkel aus dem wieder erblaßten Gesicht. Heiß und
rot lockten die Lippen.
Sie suchte nach ihrem Mantel und vermochte ihn doch nicht zu fassen,
trotzdem er vor ihr am Ständer hing. Es schwebte und wogte plötzlich
alles um sie herum.
„Ich gehe doch,“ stieß sie hervor, als stände der mächtige Feind neben
ihr, der ihren Willen band.
Sie fühlte ein Knäul aufsteigen, an dem sie zu ersticken drohte.
„Wasser – einen Schluck Wasser,“ keuchte sie atemlos.
Sie netzte die Lippen, aber das Würgen blieb. Eine erbarmungslose Faust
stieß sie auf den nächsten Stuhl. Ihre Hand fuhr an die Stirn. Wie leer
das da war. Wie tot. Der Fahrt auf dem Wannsee erinnerte sie sich, als
sein Mund sich auf den ihren preßte. „Ohne Glauben und Vertrauen keine
Liebe möglich,“ sagte er – –
Irgend etwas löste sich in ihr; ein Schrei, ein Schluchzen; Tränen
stürzten aus ihren Augen.
Gretchen Müller sah starr geradeaus, als merke sie von alledem nichts.
Jedes Trostwort war sinnlos. Nur eins konnte helfen. Und dies eine
blieb zu schwer für sie! Sie dachte an alle Güte, welche sie durch
die jetzt namenlos Leidende erfahren hatte. Noch einmal durchlitt
sie die Qualen der Armut und des erschütternden Erkennens eigenen
Unwerts. Nichts blieb ihr erspart. Die Demütigungen, die sie als
Stellungssuchende erfahren, die Ansinnen, die ihr noch jetzt das Blut
vor Scham in die Wangen trieben – die Liebe zu dem Unwürdigen, die
nicht sterben wollte, obwohl sie ihn verachten mußte. Und zuletzt der
nagende, jammervolle Hunger. Wie hatte das alles monatelang in[S. 396] ihrem
Körper gewühlt, bis sie endlich entschlossen gewesen, das elende Leben
von sich zu werfen.
Erst jetzt war sie imstande eine Kleinigkeit für ihre Retterin zu tun.
Sie hatte lediglich nötig ihm zu sagen: „So ist es und nicht anders.
Mag sie selbst in den Augen der Welt das Schlimmste getan haben. Ich
weiß nichts und will nichts davon wissen. Es ist alles aufgewogen durch
ihre Güte und Größe. Ich habe doch Augen zu sehen. Wie viel Männer
hätten ihren Reichtum willig hingegeben für ihr Lächeln, für das Dulden
reicher Gaben. Sie hat nie etwas angenommen. Ich weiß, daß sie alle
Schätze für Einen aufgespart hat. Und nun richtet er sie. Wer darf das
tun?“
Mehr brauchte sie kaum zu sagen.
Fast gierig prüfte Gretchen Müller das Gesicht, das ihr doch längst mit
jedem Zug vertraut geworden. Seine Schönheit erfüllte sie in diesem
Augenblick mit unsagbarer Freude. Es war unmöglich, daß einer, der sie
liebte, hier freiwillig entsagte.
„Vielleicht entschließe ich mich sehr bald zur Bühne. Vielleicht auch
nicht! Es hat ja noch Zeit,“ sagte Eva nach längerer Zeit des Besinnens.
– – Eine Woche später ging ihr, aus dem Büro in der Markgrafenstraße,
von einer fremden kritzlichen Handschrift, deren Name unleserlich
blieb, unterzeichnet, nachstehende Eröffnung zu:
Gemäß einer durch Herrn Horst Woldemar von Ostried, derzeitigen
Majoratsherrn auf Waldesruh, aufgefundenen grundlegenden
Familienbestimmung aus dem Jahre 1701 wäre auch das weibliche
eheliche Kind eines[S. 397] ohne männliche Nachkommenschaft verstorbenen
Majoratsherrn von Waldesruh insoweit am Majorat erbberechtigt,
als ein aus ihrer ebenbürtigen Ehe hervorgegangener Sohn mit
dem vollendeten achtzehnten Lebensjahr, besagtes Majorat mit
allen darauf ruhenden Rechten und Verbindlichkeiten übernehmen
soll. Bedingung wäre, daß diese Tochter in jeder Beziehung
einen einwandsfreien Lebenswandel geführt hat. Sie haben nach
Ansicht des Seniorenkonvents bisher dies Recht nicht verwirkt
und werden deshalb hiermit vorgemerkt. Aus der abschriftlich
beigefügten, später aufgenommenen Bestimmung, die sich auf Seite
56 des Familienstatuts aus dem Jahre 1830 vorfindet, ersehen
Sie die genausten Bedingungen für diese Vormerkung ebenso, wie
auch dasjenige, was unter einer ebenbürtigen Ehe im Sinne der
grundlegenden Bestimmung zu verstehen ist.
Die Mitteilung, daß Sie von dieser Nachricht Kenntnis genommen und
mit Ihrer Vormerkung resp. Eintragung vor dem Regierungsassessor
von Ostried sich einverstanden erklären, erbitten wir gefälligst
umgehend.
Ohne auch nur einen Augenblick zu überlegen, antwortete Eva von Ostried:
Ich verzichte ausdrücklich auf dieses Recht und bitte, mich mit
ähnlichen sich etwa in Zukunft noch neu ergebenden Mitteilungen zu
verschonen.
Dann mußte sie lachen. Es entsprang der Bitterkeit und Verachtung über
alle Satzungen, die Menschen gemacht hatten. Langsam begriff sie das
eine:
Walter Wullenweber hatte die vorliegende Mitteilung nicht mit seinem
Namen decken können, weil sie in seinen[S. 398] Augen nicht dasjenige
„untadlige Weibsbildn“ war, das sie zu sein hatte, um als Stammutter
eines zukünftigen Majoratsherrn in Betracht zu kommen. Es regte sie
nicht mehr auf!
Ihr Gesicht wurde hart wie ihre Seele. Ihre Hand zitterte nicht, als
sie jetzt zum zweiten mal die Feder eintauchte, um einen unwiderruflich
letzten Brief an Walter Wullenweber zu schreiben. Sie tat es wie eine
Fremde:
„Ich will dein Ringen, wenn es inzwischen nicht aufgegeben sein
sollte, kurz beenden. Quäle dich nicht mehr damit, für mein
Verbrechen Entschuldigung oder gar Vergebung zu finden. Dazu ist
es zu spät geworden. Ich wüßte mir nichts mehr damit anzufangen.
Der Rausch, dem ich mich hingab, wirkt nicht mehr. Daß ich Dir für
Deine spätere würdigere Ehe das Beste wünsche, sei Dir ein Beweis,
wie ruhig und empfindungslos mein Herz für Dich geworden ist.“
Sie überlas das Geschriebene nicht. Eilig verschloß sie den Umschlag
und fühlte nichts dabei, außer der staunenden Verwunderung, daß sie ihm
erst heute geschrieben hatte.
Erst als er mit dem andern zusammen besorgt war, erschrak sie plötzlich
so sehr, daß sie sich setzen mußte, weil ihre Knie zitterten. Wie war
es möglich geworden, daß sie ihm darin noch das „Du“ gegeben hatte?
Pah, sie wollte nicht mehr darüber nachdenken. Ihre Seele sollte
endlich frei werden. Und als müsse sie diesen Entschluß ungesäumt
bekräftigen, drückte sie auf den Knopf der elektrischen Klingel, die
zur Küche hinausführte. Ihre Stimme klang aber fest, beinahe kalt, als
sie zu der Eintretenden sagte:
[S. 399]
„Meine Verlobung, liebes Gretchen, war nicht von Bestand. Sie ist
wieder gelöst. Und zwar endgültig!“
Dann sprach sie hastig, ohne eine Antwort zu ermöglichen, von
gleichgültigen Dingen.
– – Die nächste Zeit brachte viel Hast und Abwechslung. Der emsige
Agent hatte von Eva von Ostrieds augenscheinlich eingetretenen
Bekehrung zur Vernunft einem ihm bekannten Direktor Mitteilung gemacht.
Das wiederum ergab vertrauliche Anfragen, die eine ausführliche Antwort
erheischten. In irgendwelcher Weise band sich Eva von Ostried vorläufig
nicht.
Mitten in diese Unruhe hinein kam eines Tages der Brief des Waldesruher
Majoratsherrn, der zwecks mündlicher Rücksprache in der bekannten
Neuregelung und ihrer Ablehnung im Auftrage des Seniorenkonvents um die
Gewährung einer mündlichen Aussprache an einem von ihr zwischen dem
Zwanzigsten und Fünfundzwanzigsten zu bestimmenden Tage höflichst bat.
Der Vorwand wäre für jede Andere, wie Eva von Ostried, durchsichtig
gewesen. Seine Anwesenheit neulich im Blüthnersaal – eine vor Tagen
stattgefundene zufällige Begegnung mit ihm, bei welcher er deutlich die
von ihr vereitelte Absicht einer Annäherung zu erkennen gab, hätten sie
zum Nachdenken bringen müssen.
Ihr lag dies alles viel zu weit ab. Sie mochte ihn nicht wiedersehen.
Die Vorstellung seines kalten, ausdruckslosen Gesichts brachte ihr
ein unbehagliches Gefühl. Kurz, wenn auch nicht unfreundlich, lehnte
sie sein Ersuchen mit dem Hinweis ab, daß eine Aussprache ihren
unabänderlich feststehenden Entschluß nicht umzustoßen vermöge.
[S. 400]
An einem der nächsten Tage kam, nach längerer Pause diesmal, der Vetter
Javelingen wieder.
Eva von Ostried sah ihm erstaunt entgegen. „So feierlich? Ja, was gibt
es denn? Hat der neue Operntext seinen Komponisten gefunden und bringen
Sie mir schon die weibliche Hauptrolle zum Studium?“
Er schüttelte den Kopf.
„Das ist es nicht! Ich komme als Abgesandter des Kummersbacher.“ Er
sah, daß sie die Lippen verzog, als schmecke sie einen unangenehm
bitteren Trank.
„Augenscheinlich mochten Sie ihn damals sehr gern,“ wunderte er sich.
„Und jetzt plötzlich? Wirklich, ich merkte längst die Umwandlung.“ Es
klang hilflos.
„Von solchen Kleinigkeiten sollten Sie sich nicht quälen lassen,“
mahnte sie sanft.
„Es schmerzt mich, daß Sie sich so fest verschließen, Eva.“
„Tue ich das? Dann ist es jedenfalls nichts neues. Sie kennen mich
nur noch nicht von dieser meiner eigentlichen Seite. Gewiß, der
Kummersbacher war sehr gut zu mir und ich habe auch nicht das Geringste
gegen ihn. Ich bin aber wider alles Gewaltsame. Warum soll ich jetzt
plötzlich einer Verwandtschaft wegen, die mir bisher nichts war, in
einen neuen Kreis hineinlaufen? Denn, nicht wahr, mit dem Kummersbacher
allein hätte es in Zukunft nicht sein Bewenden.“
„Ich belästige Sie ja ohnehin schon,“ meinte er.
„Halten Sie mich für so unehrlich, daß ich mir eine Belästigung
gefallen ließe? Wenn Sie kommen, bringen Sie mir Freude mit. Wenn auch
nicht in allen Fällen für mich, die Vielbeschäftigte, so doch für
das liebe, kranke Mädchen,[S. 401] das ihrer dringender bedarf als ich, die
körperlich Gesunde. Schon darum sind Sie mir stets willkommen. Sie
wissen, meine Zeit gehört der Arbeit. Wenn es mir aber möglich wird,
lausche ich Ihnen herzlich gern.“
Er zog ihre Hand ehrerbietig an die Lippen. Sie mußte denken, ob er das
wohl auch tun würde, wenn er wüßte.
„Ich komme also heute mit einem Auftrage,“ gestand er fast schüchtern.
Ihr Gesicht nahm einen hochmütigen Ausdruck an. „In Wahrheit schickt
Sie gar nicht der Kummersbacher, sondern der Waldesruher, nicht wahr?“
„Nein... wirklich nicht! Aber – wissen Sie schon davon?“
„Daß er mich im Auftrage des hohen Seniorenkonvents zur Einwilligung
jener mich lächerlich anmutenden Eintragung bewegen will? Nun, das hat
er mir geschrieben!“
„Ich dachte an das... andere.“ Ein unbewußter Neid ließ seine sanfte
Stimme schärfer als sonst werden.
„Davon weiß ich nichts. Mag auch nichts hören. Verzeihen Sie diese
Offenheit.“
„Ich fürchte aber, Sie werden ihm nicht mehr entgehen.“
„Dann ist es immer noch Zeit, daß ich mich darüber ärgere oder freue.“
„Sie dürfen sich nicht freuen,“ sagte er leidenschaftlich.
„Ich glaube selbst, daß dies mein Schicksal ist.“
„Nicht so! Freude sollen Sie haben, so viel es nur irgend gibt....
Aber... Warum sind Sie so bitter geworden?“
„Sie irren, mein lieber Dichter. Nur abgearbeitet bin ich. Und... werde
es in Zukunft noch viel mehr sein. Sehen Sie hier – mein Büchlein ist
voller Pflichten. In[S. 402] nächster Woche singe ich zweimal in Dresden.
Danach in Weimar. Verhandlungen mit Dessau schweben gleichfalls. Berlin
will mich auch. Die Vorbesprechungen, dies ängstliche Aufpassen, daß
der Agent nicht den Löwenanteil in die eigene Tasche senkt, ist sehr
anstrengend.“
„Ich könnte es nicht.“
„Wenn man ein bestimmtes Ziel vor Augen hat, geht auch dies!“
„Sehnen Sie sich denn nach Reichtum, Eva?“ fragte er.
„Ja, das tue ich!“
Er erblaßte und sah auf seine schmalen, nervösen Hände nieder. „Reich
ist er. Sehr reich sogar! Der Kummersbacher sprach von mehreren
Millionen...“
„Nun also... hübsch für ihn! Wer der Glückliche ist, will ich nicht
wissen. Ich gönne jedem sein Schäfchen. Nur Sie sollen jetzt endlich
zum Ziel kommen. Was ist es für ein geheimnisvoller Auftrag, den Sie da
übernommen haben.“
„Der Kummersbacher läßt Sie innig um Ihren Besuch bitten, so bald es
sich einrichten läßt.“
„Hat er vielleicht gehört, daß ich gerade für die nächsten Monate
täglich voll besetzt bin?“
„Wie mißtrauisch Sie geworden sind.“
„Das gehört zu meinem Geschäft! Denn, wenn ich nach dem Beschlusse des
hohen Familienrats auch keine Bänkelsängerin bin, aber eine, die sich
von zwei Mark an von Jedem anstarren lassen muß, die bin ich nun doch
mal.“
„Ihnen muß etwas Hartes geschehen sein,“ forschte er.
„Vielleicht! – Machen Sie ein Sonett darüber. Aber am Schluß muß man
lachen können. Hören Sie?“
[S. 403]
Sie wurde ihm unheimlich.
„Also, der gute Kummersbacher erinnert sich seiner freundlichen
Einladung von dazumal?“ fuhr sie fort. „Sagen Sie ihm mit einem schönen
Gruß meine Dankbarkeit und ich käme bestimmt in der Zeit von Januar bis
April...“
„Dann beanspruchen ihn die Sitzungen im Herrenhaus und die
Nachberatungen in Berlin.“
„Eben darum,“ meinte sie ruhig. „Und nun kein Wort mehr davon. Ich
bitte Sie herzlich darum. Kleiden Sie meinetwegen die Ablehnung auf
Ihre zarte Weise ein. Ich will nicht die Gastfreundschaft der Familie,
von keinem Einzigen ...“
„Ohne Ausnahme?“ fragte er mit eigenem Nachdruck.
„Ausnahmslos,“ bestätigte sie. „Und jetzt kommen Sie. Ich werde Sie
begleiten. Gretchen Müller wird sehnsüchtig warten... Eine Stunde kann
ich mich ebenfalls von Ihnen fortreißen lassen. Dann muß ich wieder
arbeiten und Briefe schreiben. Ach, diese ewigen Geschäftsbriefe..“
– – – Er las leise und bescheiden, wie auch sonst am Anfang!
Die Eröffnung des Kummersbacher klang ihm in den Ohren. „Paß auf,
es kommt. Für so was habe ich einen feinen Riecher... Darum beeile
dich gefälligst, daß wir sie möglichst bald in meine ländliche Stille
kriegen. Ihre Nerven, die deiner Ansicht nach reichlich runter sind,
müssen erst in die Höhe, ehe er seinen Mund zu der entscheidenden Frage
auftut...“
Es kam wirklich... und zwar erheblich schneller, wie es der
Kummersbacher nach der mit heimlicher Schadenfreude von ihm
festgestellten Umwandlung des bis dahin scheinbar temperamentlosen
Vetters erwartet hatte. Eva von Ostried stand noch im Schmuck eines
weinroten Sammetkleides, das die Schneiderin erst soeben abgeliefert
und zum letzten mal angeprobt hatte, als die Klingel tönte.
Es war der Waldesruher Majoratsherr, der um die Ehre bat, die gnädige
Base sprechen zu dürfen.
Sie dachte lange nach, während er zuerst ungeduldig, danach empört über
das rücksichtslose Wartenlassen auf dem schmalen Korridor hin- und
herging. Warum erweckte dieser Besuch ihren Unmut? Er brachte ihr doch
eine ehrenvolle Genugtuung. Denn, wenn es sich nicht um eine solche
handelte, würde sich ein eiskalter, untadliger Ehrenmann wie dieser
solcher Mühe nicht unterziehen. Eine feine Falte stand zwischen ihren
Brauen, als sie sich endlich entschlossen hatte.
„Führen Sie ihn in das Musikzimmer, Gretchen.“
„Aber das Kleid,“ gab die andere zu bedenken.
„Es wird bei der kurzen Unterredung nicht stören.“
Horst Waldemar von Ostried sah eine Sekunde verblüfft auf. Sie reichte
ihm nicht die Hand entgegen. Nur den[S. 405] feinen Kopf neigte sie und
deutete höflich auf einen Polsterstuhl.
„Warum kommen Sie, Herr von Ostried?“
„Sie werden sich erinnern... mein Brief...“
„Also darum,“ machte sie gedehnt, „ich dachte, das sei längst abgetan.
Sie haben gehört, daß ich nicht will...“
„Darauf kommt es nicht an, gnädigste Base.“
„Soll das ein Scherz sein? Aber der läge Ihnen nicht..“
„Sie haben etwas bei der ganzen Sache übersehen,“ meinte er belehrend,
„oder vielleicht unser Anwalt?! Die von mir aufgefundene Bestimmung
hat ausdrücklich das Wort „soll“ bei der jetzt neu durchzuführenden
Erbfolge vorgesehen.“
„Niemand kann über den Willen eines Menschen bestimmen, als er allein,“
wandte sie kühl ein.
„Das ist ein großer Irrtum. Es gibt Höheres und Stärkeres, dem wir alle
uns beugen müssen.“
„Was könnte das sein,“ fragte sie ungläubig.
„In der Hauptsache... das Gesetz...“
„Jetzt wird er mir bestimmt alle Paragraphen aufzählen, die wir
beachten müssen,“ fürchtete sie dumpf und ergeben.
„Zuerst dasjenige, was in uns selber ist,“ begann er wieder.
„Das meine will, daß ich mit gleicher Münze heimzahle. Verachtung gegen
Verachtung.“
„Sie dürfen nicht abschweifen. Sonst werden wir uns nie verstehen.“
„Ich lege auch keinen Wert darauf.“
„Aber ich tue es. Sehen Sie, das Gesetz, welches ich meine, ist etwas
Ehrfurchtgebietendes, denn es kommt aus[S. 406] der Schmiede der Ehre! Wie
es sichtbare Orden und Ehrenzeichen für Heldentaten gibt, so sind
unsichtbare da, deren Fehlen mehr wie Strafen reden. Daß Sie laut der
jetzt zu Kraft erklärten Bestimmung vorgemerkt sind, ist ein solches
unsichtbares Ehrenzeichen.“
„Wenn Sie es so auffassen und gekommen sind, um mich zu Ihrer Ansicht
zu bekehren, danke ich Ihnen,“ sagte sie um vieles wärmer.
„Wie stellen Sie sich also jetzt zu unserer Frage?“
„Nicht anders wie zuvor.“
„Das heißt, Sie sehen auch jetzt noch ab?“
„Natürlich. Es liegt mir nichts daran.. Ich will frei sein. Ich
will...“ Sie wollte hinzufügen, daß sie keinen persönlichen Verkehr
wünsche, empfand dies aber einen Augenblick später als taktlos und
verstummte.
Er schien die Streifen des Teppichs, der weich und dunkel am Boden
hinkroch, zu zählen.
„Ich bitte Sie um Ihre Einwilligung,“ sagte er plötzlich.
Sie mußte ein Lächeln unterdrücken. „Was hätten Sie davon, Herr von
Ostried?“
Er zuckte nervös zusammen. „Warum nennen Sie mich hartnäckig mit
diesem... steifen Namen?“
„Erlassen Sie mir die Antwort. Sie sind zur Zeit unter meinem Dach und,
wenn ich auch kein Edelfräulein in Ihrem Sinne sein mag, das ist mir
stets heilig gewesen.“
„Ich möchte den sehen, der sich niemals irrt...“
„Gut! Wir wollen es nicht in Worte kleiden... Ich fühle es und danke
Ihnen nochmals. Sagen Sie den andern auch davon, denn, nicht wahr, der
– wie nennen Sie ihn doch? – Seniorenkonvent weiß um Ihr Kommen.“
[S. 407]
„Nein,“ sagte er kurz und sehr laut.
Das begriff sie nicht. „Ich habe mich niemals mit all diesen
Bestimmungen beschäftigt,“ entschuldigte sie sich.
„Ich will haben, daß Sie in den Augen der gesamten Familie rein und
makellos dastehen. Daß wir Sie dafür befunden haben, bewirkt das
noch nicht. Die Hämischen könnten behaupten, es habe sich inzwischen
etwas ihnen Verborgenes herausfinden lassen, das Ihre Unwürdigkeit
dennoch dartäte. Der Vetter Regierungsassessor hat Sie neulich auf dem
Familientag bereits auffallend genug übersehen.“
Jetzt mußte sie lachen.
„Stimmt das etwa nicht,“ fragte er gereizt. „Hat er Sie begrüßt oder
Ihnen auch nur ein verbindliches Wort gesagt?“
„Aber... nachgelaufen ist er mir und hat mir seine Begleitung
angeboten.“
„Und Sie?“
„Ich habe ihn fortgeschickt, wie man das auch ohne Ihre Familiengesetze
zu kennen, eben tut...“
„Darum wird er Sie jetzt um so mehr mit seiner Abneigung verfolgen.“
„Daran liegt mir auch nicht das Geringste.“
„Aber mir liegt daran!“
Sie sah ihn erschrocken an und stellte fest, daß er sehr rot und erregt
geworden war.
„Ihnen? Sie hören ja, daß ich mich auch weiter allein zu schützen
gedenke. Ja... und hören Sie weiter. Ich muß Ihnen einen Vorschlag
machen. Vielleicht ist es Ihnen allen unangenehm, daß ich den alten
Namen Ostried führe.[S. 408] Bitte, seien Sie ganz ehrlich mit mir. Ich bin
Künstlerin und kann ihn, ohne, daß es besonders auffällt, jederzeit
ablegen. Einmal war ich bereits dazu entschlossen...“
„Sie sollen ihn behalten! Aber der Vetter Regierungsassessor darf Sie
nicht verächtlich machen.“
Sie legte den Kopf ein wenig auf die Seite und blinzelte in die
Schatten, die jetzt dunkelblau und lila getönt den Raum erfüllten.
„Leider verachtet er mich durchaus nicht. Fast wäre mir das lieber
gewesen, als das andere...“
„Was ist das?“ fragte er.
„Wenn ich ihn nicht... sehr tief einschätzte, würde ich darüber
schweigen. Ich mißachte ihn aber. Darum...“ und sie erhob sich, ging in
das Nebenzimmer und nahm aus dem Mittelfach ihres Schreibtisches seinen
Brief.
„Lesen Sie ihn. Dies Schreiben ging mir zu, nachdem die Anschlußsitzung
über meine oder besser meines künftigen Sohnes Erbfolge stattgefunden
hatte.“
Horst Waldemar von Ostried las erstaunlich lange an den kurzen Zeilen.
„Es ist eine Gemeinheit,“ sagte er dann kurz und scharf. Sie nickte.
„Man könnte es wohl als solche bezeichnen! Daß Sie so ehrlich sind,
freut mich doppelt...“
„Könnten Sie mir den ungefähren Wortlaut Ihrer Antwort an ihn
mitteilen?“
„Nein... das möchte ich nicht.“
„Hätte ich mich in Ihnen getäuscht?!“
„Möglich! Vielleicht mißverstehen wir uns aber. Weil ich nämlich keine
Antwort gab, kann ich auch keinen Wortlaut wiederholen.“
[S. 409]
Er atmete auf. „Das war gut!“ Dann saß er stumm und schweigsam da.
„Warum geht er jetzt nicht,“ dachte sie erstaunt und sagte laut:
„Verzeihen Sie diese Dunkelheit. Ich will jetzt Licht machen... Ich
liebe die weichen, unbestimmbaren Farben der Dämmerung sehr.“
„Lassen Sie es!“ bat er.
Gehorsam nahm sie wieder ihren Platz ein. Die drückende Stille begann
sie unruhig zu machen.
„Fühlen Sie den Zweck meines Besuches nicht endlich heraus?“ fragte er.
Sie dachte nach und schüttelte den Kopf.
„Und dennoch ist es gut, daß er ihn geschrieben hat,“ meinte er aus
tiefem Sinnen heraus. Ihre Anschauungen mußten erdenweit auseinander
gehen... sonst hätte sie ihn doch wenigstens einmal ohne Erklärung
verstehen müssen.
„Mir gilt er nicht mehr, als der Beweis, daß der Name allein noch lange
nicht adelt...“
Er ließ diesen Einwurf unbeachtet. „Können Sie mir dies Schreiben
anvertrauen,“ fragte er.
„Wozu? Ich will nicht haben, daß er etwa zur Rechenschaft gezogen wird.“
„Eine Beleidigung in diesem Sinne enthält er nicht! Daß er den Wunsch
ausspricht, Sie seinen Eltern zuzuführen, beweist ja gerade, daß er Sie
respektiert. Er hätte noch etwas damit warten müssen. Aber er mag wohl
gefürchtet haben, ein anderer käme ihm zuvor...“
„Sie baten um den Brief,“ lenkte Eva von Ostried hastig ab, „darf ich
wenigstens wissen, zu welchem Zweck das geschah?“
[S. 410]
„Um eine Handhabe zu besitzen.“
„Verstehe ich Sie recht? Glauben Sie, daß er unklug genug ist, um diese
Sache vielleicht falsch wieder zu geben?“
„Das nicht. Seines Schweigens hierüber sind wir sicher. Nur etwas
anderes steht zu befürchten. Vor jedem lauten Wort wird er sich hüten.
Er ist in jeder Beziehung ein leiser, vorsichtiger Herr. Es könnte sich
aber ereignen, daß er Sie aus dem Hinterhalt angriffe. Sagen wir mal,
der Kummersbacher, der seine Augen und Ohren überall hat, würde etwas
erfahren und mir wieder erzählen?“
„Warum grade Ihnen?“
„Untersuchen wir das jetzt nicht. Unterstellen wir es als sicher.
Dann könnte ich diesen Brief vorzeigen und ihn bloßstellen, wie er es
verdient hat....“
„Eigentlich sind wir beide uns doch sehr fremd,“ meinte sie zögernd.
„Soll das heißen, daß Sie kein Vertrauen zu mir haben?“
„Vertrauen...“ sie dehnte das Wort aus, überlegte ein wenig und sah
dann wieder und diesmal – bewußt – zu ihm hinüber. Seine kalten
farblosen Augen hatten sich auffallend belebt. „Wir wollen den Begriff
nicht zerlegen. Behalten Sie den Brief. Ich danke Ihnen für Ihre gute
Absicht. Nicht wahr, wenn er etwa ein Jahr geschwiegen haben sollte,
dann vernichten Sie ihn. Ein Zurückschicken ist unnötig.“
Als er ihn in die feine helle Ledertasche versenkt hatte, tat er die
Frage, die er seit Wochen immer wieder überlegt und nach allen Seiten
erwogen und nun endgültig beschlossen hatte:
[S. 411]
„Weil Sie es nicht fühlen, muß ich es klar aussprechen. Könnten Sie
sich entschließen, meine Frau zu werden, Eva?“ Er sah, daß es sie
gänzlich überraschend traf und fuhr fort: „Ich werde im nächsten Monat
vierundfünfzig Jahr und gelte als ziemlich gefühllos. Vielleicht bin
ich es auch. Meine erste Ehe war durchaus korrekt. Wie sich die zweite
gestalten wird, liegt in Ihrer Hand. Sie werden enttäuscht sein, daß
ich Ihnen kein Wort von Liebe spreche. Ich kann das nicht. Schon als
kleiner Junge wäre ich lieber gestorben, ehe ich ein Gefühl verraten
hätte. Es ist Vererbung. Meine Mutter war ebenso.“
Sie saß wie erstarrt und konnte nur denken... „Möchte er doch weiter
sprechen. Wenn er aufhört, muß ich ihm antworten.“ Daß er ihr noch vor
kurzem unangenehm, ja widerlich gewesen, begriff sie nicht mehr. Zur
Zeit war er ihr nicht unleidlicher wie jeder andere!
Und was sang und klang plötzlich vor ihren Ohren? Sanfte,
verführerische Stimmen tönten! Und jede verhieß das nämliche! Erlösung
– Sühne – Ruhe! Ihm würde sie kein Wort davon sagen. Kein inneres
Drängen erzwang dies. Ihr ferneres Leben würde auf das Eine, Große,
Letzte eingestellt sein. Untadlig zu werden und weiter Gutes zu tun, wo
irgend sich nur die Gelegenheit bieten wollte.
Und vor allem – den Raub könnte sie zurückzahlen.
Er war ja schwerreich. Der Dichter hatte von mehreren Millionen
gesprochen. Denn jetzt war es ihr klar, daß er diesen und keinen
anderen gemeint hatte. Sie wollte von ihrem Nadelgelde und seinen gewiß
sehr reichlich fließenden Geschenken Pfennig um Pfennig zusammenraffen,
bis[S. 412] sie endlich alles an den Justizrat Weißgerber, als eine sich an
die Stiftung der Präsidentin anschließende Schenkung, zurückzuzahlen
vermochte...
Jetzt schwieg er und sah sie erwartungsvoll an. Eine furchtbare Angst
begann sie zu foltern, daß er aufstehen und gehen könne... beleidigt,
weil sie ihn keiner schnellen Antwort würdigte.
„Haben Sie sich bereits gebunden – dann allerdings,“ sagte er
undeutlich, wie ihr schien.
„Nein, ich bin frei.“ Das war keine Lüge.
„Wie lange soll ich warten,“ fragte er. Es klang fast demütig.
„Zwei Wochen,“ bat sie. „Ich habe ein paar Verpflichtungen in Dresden
und Weimar übernommen. Dann werde ich auch mit mir fertig sein.“
In seinen Zügen arbeitete es. Aber er verriet nicht seine Gedanken.
Er sah sie noch einmal an, als müsse er die Erinnerung an ihre stolze
Schönheit mit fortnehmen für diese beiden Wochen. Später würde er sie
nicht mehr nötig haben. Er wünschte keine lange Verlobungszeit.
Langsam stand er auf, küßte ihre Hand und schied ohne ein weiteres Wort.
Eva von Ostried zeigte sich die nächsten Tage gelassen, fast heiter.
Sie erschien wohl und frisch, als habe sie nicht über schlaflose Nächte
zu klagen. Daß ein wenig künstliches Rot über die tiefe Blässe und
den scharfen Leidenszug hinwegtäuschte, ahnte Gretchen Müller nicht.
Sie trat nie mehr, ohne zuvor feierlich anzuklopfen, in das kleine
einfenstrige Zimmer ein. Die unbestimmte Angst, eine Zusammengebrochene
oder doch Verzweifelte zu sehen, hielt sie[S. 413] zu dieser Vorsicht an.
Einmal, als sie Eva von Ostried ausgegangen wähnte, sah sie sie mit
eingewühltem Kopf auf dem Ruhebett liegen und hörte ein ersticktes,
jammervolles Schluchzen.

Der Kummersbacher saß vor seinem alten Zylinderbureau, sah abwechselnd
in das Wirtschaftsbuch seines Beamten und auf die kotbespritzten, von
aufgeweichten Lehmwegen zeugenden Stiefeln herab, dachte aber weder an
das eine noch das andere, sondern ärgerte sich mit verbissenem Ingrimm,
weil der Doktor, der seines Rheumas wegen die Ritte im Regen streng
untersagt hatte, wieder mal Recht behielt. Denn es zwickte und quälte
ganz abscheulich.
Draußen lief seit Tagen durch das graue Himmelssieb ein gleichmäßiger
Regen nieder und verwandelte Straßen, Aecker und Gärten in einen
zähen Brei von unappetitlicher Farbe. In solchen Zeiten merkte der
Kummersbacher, daß er ein lediger Mann war.
Er schielte nach den derben Jungen seines Hofmeisters, die unter dem
Fenster des Arbeitszimmers mit krampfhaft hochgezogenen Hosenleder über
die Pfützen sprangen.
Dieser Anblick verbesserte seine schlechte Laune nicht. Als Hermann,
der Getreue, seinen grauen Kopf zur Tür hineinsteckte, polterte er los:
„Was störst du mich fortwährend. Ich habe zu tun. Verstanden?“
„Eine Dame ist draußen,“ meldete er unerschrocken und setzte
vertraulich hinzu: „Sie war neulich auch in Berlin beim Familientag.“
[S. 414]
Im Nu war der Kummersbacher auf den Beinen.
„Wenn es die Eva wäre...“ Natürlich war sie es! Des kleinen Javelingens
Antwort stand immer noch aus. Vielleicht hatte sie dies gewünscht und
kam nun selbst, um sie zu bringen und... bei ihm zu bleiben.
„Hol’ andere Stiefel,“ kommandierte er. „Aber ein bißchen pausenlos –
und... das gnädige Fräulein führe solange in das Eßzimmer.“
Dann dachte er gerührt und ärgerlich, daß dies Gerenne vom Bahnhof
durch Wind, Regen und Brei eigentlich ein unverantwortlicher Leichtsinn
von ihr gewesen sei... Hermann stand immer noch vor seinem Gebieter.
„Was fällt dir ein. So lauf’ doch...“
„Gnädiger Herr,“ sagte er plötzlich und ein Lachen flog um seinen
faltigen glattrasierten Mund, „die Stiebel vom gnädigen Fräulein sind
noch viel dreckiger...“
Der Kummersbacher brummte etwas. Dann schob er sich an seinem Diener
vorbei und lief humpelnd auf die Diele heraus.
Hier stand etwas unendlich Gebücktes, Demütiges.
Bei diesem Anblick erlosch seine Freude. Er stutzte und schüttelte
den Kopf... Wo hatte der Hermann seine Augen gehabt? Das war doch
gar keine Dame. Ein bis auf die Haut durchnäßtes armes, heimatloses
Geschöpf war’s, das sich vor Hunger und Uebermüdung wohl nicht weiter
zu schleppen vermocht hatte.
„Gehen Sie in die Küche und lassen Sie sich allerlei Gutes von dem Koch
verabreichen,“ sagte er mit der unbewußten Weichheit und Milde, die ihn
stets beherrschte, sobald jemand seine Hilfe brauchte.
[S. 415]
Aber die Demütige blieb, richtete sich nur ein wenig empor und sagte
leise:
„Ich bin doch Klausine von Ostried...“
Es fuhr ihm in die Knochen. Er begriff nicht, wie sie sich zu ihm
durchgefunden hatte.
„Tritt, bitte, hier ein,“ sagte er endlich. „Du kannst auch im Zimmer
ablegen... und nachher mußt du dir wohl trockene Sachen anziehen.“
Sie trug nichts in der Hand wie eine kleine, abgegriffene Tasche mit
einstmals kunstvoller Perlenstickerei. Der Kummersbacher überlegte
kurz, daß sich darin kaum alles, was eine Frau für ihren äußeren
Menschen gebraucht, vorfinden könnte, wurde einen Augenblick verlegen
und sagte zu dem Diener gewandt:
„Was machen wir jetzt? Weiß der Himmel, nun haben wir nicht mal was zum
Anziehen für sie bei der Hand. Sie muß also vorläufig sehr bald in die
Federn. Na, nun geh, du kannst einen Grog für sie bringen und für mich
zur Gesellschaft auch einen. Dann richte das wärmste Fremdenzimmer ...
Hoppla!“
Klausine von Ostried, das Stiftsfräulein, hatte indessen ihre
triefenden Hüllen über den Kaminofen ausgebreitet, in dem ein lustiges
Feuer prasselte.
„Setz’ dich einstweilen nahe an die Glut,“ kommandierte der
Kummersbacher mitleidig. „So, aber verbrenne dir nicht die Hüfe...“
„Es ist himmlisch warm,“ flüsterte sie dankbar und hielt nun auch die
mageren Hände an die durchhitzten Stäbe.
Eine Weile gönnte er ihr diese Behaglichkeit. Dann tippte er ihr auf
die Schulter und fragte langsam:
[S. 416]
„Jetzt möchte ich endlich wissen, weshalb du das gemacht hast,
Klausine?“
Der freudige Ausdruck ihres verkümmerten, spitzen Gesichts erlosch.
Sie begann zu weinen. Wie bei einem Kinde liefen auch ihr schließlich
die Tränen stromweise über die eingefallenen Wangen. Er erinnerte
sich, daß sie in beständiger Furcht vor der Schwester leben sollte und
meinte endlich selbst die Erklärung für ihren Besuch gefunden zu haben.
Hatte er ihr nicht, in einer Aufwallung von Mitleid, bei dem letzten
Beisammensein in Berlin gesagt, daß sie jederzeit ein ruhiges Fleckchen
bei ihm finden werde, wenn sie es im Stift etwa nicht mehr ertragen
könne?
„Du willst jetzt lieber hier bleiben?“ fragte er weich.
Sie nickte nur und saß dann weiter – hilflos und ängstlich – neben
der Glut.
„Sage frei heraus, was passiert ist,“ forderte er nach neuem,
geduldigen Warten. Sie begann stärker zu zittern.
„Hunger,“ stotterte sie, als schäme sie sich dieses Geständnisses.
Da ging der Kummersbacher selbst – an dem verdutzten alten Melchers
vorüber – in die Speisekammer, schnitt von der freihängenden Seite
eine Handbreit Speck herunter, riß das Schwarzbrot in den einen, die
angebrochene Kümmelflasche in den andern Arm und ging wieder in das
Speisezimmer zurück. Die Geschichte mit dem Tablett und den übrigen
Zubehörteilen für ein richtiges Mahl dauerte ihm hierfür zu lange.
„Iß tüchtig,“ nötigte er und schnitt ihr mit seinem derben Jagdmesser,
das er niemals aus der Tasche ließ, selbst die Bissen zurecht.
[S. 417]
Gierig schlang sie alles herunter, bekam feuerrote Fleckchen und
trank auch einen tüchtigen Schluck von dem alten, scharfen Kümmel,
obwohl ihre Augen danach noch mehr tränten. Dann saß sie mit andächtig
zusammengelegten Händen und blinzelte in die knackenden Holzscheite.
„Jetzt wirst du reden, Klausine,“ befahl er nach geraumer Weile. „Was
also ist geschehen?“ fragte er ungläubig und rüttelte sie ein wenig am
Arm.
„Sie hat unser ganzes Geld verloren und das konnte sie nicht
überwinden.“
„Ja, wie hat sie das denn, in drei Deibels Namen, angefangen? Weißt du
Genaueres darüber?“
„Gesagt hat sie mir kein Wort. Aber ich habe es aus den Briefen
zusammengelesen. Du kannst dich selbst überzeugen. Ich habe sie dir
mitgebracht.“
Er überflog die zerknitterten Schriftstücke, ballte sie zusammen und
schleuderte sie endlich zornig in die äußerste Ecke des Zimmers.
„Auf diesen plumpen Schwindel ist sie so einfach glatt reingefallen?“
„Das weiß ich nicht. Sieh, hier ist noch ein Brief. Er kam vor vier
Tagen. Danach hat sie es getan...“
Er las auch diesen.
„Richtig! Da teilt ihr ein anderer sauberer Vogel höflichst mit,
daß ihr auf Grundstück soundso – im Grundbuch Blatt soundso –
eingetragenes Geld in Summe 104000 Mark bei der Zwangsversteigerung
ausgefallen sei. Also mit andern Worten, alles hops.“
„So habe ich es auch aufgefaßt.“
[S. 418]
Das wunderte ihn, weil er sie für einfältiger gehalten hatte. „Was also
hat sie getan, nachdem sie diesen Wisch gelesen?“
„Mich mit zwei Telegrammen zur Post weggeschickt. Ganz heimlich mußte
ich mich fortschleichen. Die andern im Stift durften nichts davon
ahnen.“
„Nun, und die Antwort? Sagtest du nicht, daß du sie gleich auf dem Amt
erwarten mußtest?“ Sie nickte wieder.
„Die hat sie in der Küche verbrannt. Wir haben nämlich jede unsere
besondere,“ erzählte sie wichtig.
„Laß jetzt die Nebensachen,“ verwies er streng. Sie hörte nicht darauf.
„In der Küche ist es doch geschehen,“ fuhr sie eintöniger fort und
begann schon wieder zu zittern.
„Was ist geschehen? – Nimm dich zusammen, Klausine. So weit warst du
schon vorhin...“
„Genaues weiß ich nicht. Als ich dazu kam, waren schon alle Stiftsdamen
bei ihr und schrieen und jammerten. Sie lag mitten auf den Fließ.
Der Gasschlauch hing herunter und die Luft war schrecklich, trotzdem
überall die Fenster offen standen...“
Nun begriff er! – Sie hatte den Verlust des Geldes nicht verwinden
können und wollte sich einfach aus dem für sie wertlos gewordenen Leben
stehlen.
„Sie ist tot?“ fragte er mit gedämpfter Stimme.
„Sie haben gleich nach dem Arzt geschickt... Noch eine kleine
Viertelstunde, hat der zu mir gesagt, dann wäre er zu spät gekommen.“
„Sie lebt also...“
„Sie hat mich doch zu dir geschickt...“
[S. 419]
„Und der Auftrag?“
Da lag ihm plötzlich die schmale, verängstigte, durchnäßte Heimatlose
zu Füßen. „Du sollst uns einen Winkel geben, wo uns kein Mensch sehen
und finden kann,“ bettelte sie...
„Ihr habt doch Euern Platz im Stift nach wie vor.“
„Sie kann nicht mehr dableiben. Sie müsse vor Scham sterben, hat sie
gesagt. Und sie schickt dir auch was, damit du es tust... Es wäre ihr
Letztes, läßt sie sagen...“
Es waren, mehrfach in einen kleinen schmutzig gewordenen Leinenbeutel
eingenäht, zweiundachtzig Mark.
Ein Würgen stieg in die Kehle des Kummersbachers hoch. Unsicher langte
er nach der Kümmelflasche und füllte einen kleinen Becher, der irgendwo
umherstand.
Verdient hatte sie durch ihre Härte, Geldgier und Verleumdungssucht
mancherlei. Aber dies war eine zu harte Strafe.
„Du wirst vorläufig hier bleiben,“ entschied er nach kurzem Ueberlegen.
„Ihr werde ich ausführlich schreiben.“ Ihr kleines Gesicht leuchtete
in seliger Freude auf. „Und jetzt klingle ich nach Hermann. Er wird
dir dein Zimmer anweisen. Lege dich aufs Ohr und versuche zu schlafen.
Nötig hast du’s. Deine Sachen lege auf einen Stuhl draußen vor die
Tür, damit sie richtig getrocknet werden können. Deine übrigen sollen
nachkommen. Ich veranlasse das schon.“
Als er allein war und wieder an seinem Schreibtisch saß, stand er auf
und schritt lange ruhelos auf und ab.
Als er mit sich einig war, schrieb er an Hermine:
Deine Schwester wird solange bei mir bleiben, bis sie frisch und
gesund ist. Du aber wirst Dich innerhalb[S. 420] zweier Wochen bereit
halten, meinem zu Dir entsandten Diener Hermann dorthin zu folgen,
wohin er Dich bringen wird. Er ist treu wie Gold und zuverlässig –
auch im Schweigen. Verlaß Dich also ganz auf ihn. In mein Haus kann
ich Dich leider nicht bitten. Vielleicht setze ich Dir die Gründe
auseinander, wenn Du erst wieder Deine Nerven in der Hand hast.
Jetzt nur das eine: Des Daseins Not wird nicht, solange Ihr lebt,
an Euch herankommen, weil Ihr denselben Namen tragt wie auch ich.
Nur dieser Grund und das grenzenlose Mitleid mit Deiner Schwester
treibt mich hierzu. Zwanzig Kilometer von Schloß Kummersbach
kaufte ich vor Jahresfrist für zwei inzwischen auch alt und grau
gewordene, treue, brave Menschen, die in meinen Diensten durch
einen Unfall das Gehör verloren, einen kleinen schmucken Bauernhof.
Das geräumige Wohnhaus hat drei unbenutzte hübsche, helle Stuben,
die ich sogleich für Euch herrichten lasse. An barem Gelde sollen
Dir, außer allem, was Ihr dort kostenfrei bezieht, monatlich 50
Mark überwiesen werden. Kommst Du mit dieser Summe nicht aus, bin
ich, nach Prüfung zu weiterem bereit.
Es war ihm unmöglich, ein Trostwort oder auch nur einen warmen Gruß
anzufügen.
Nach alter Gewohnheit siegelte er den Brief und übergab ihn seinem
Diener. Dann holte er noch einen Kümmel, obwohl er sich sonst nur
einmal in der Woche etwas derartiges zu leisten pflegte.
Gretchen Müller saß allein im Zimmer und hielt Rückerinnerungen. Ihre
seltsam aufregende Kindheit baute sich leuchtend klar vor ihr auf: Der
Vater, der sie, wenn er bei guter Laune war, mit Schmeichelnamen und
Süßigkeiten überschüttete – dem sie zuweilen noch am späten Abend
einen Brief ganz heimlich forttragen oder aus dem feinen Geschäft
an der nächsten Ecke eine Flasche Wein besorgen mußte, streichelte
ihr anerkennend das weiche Gesichtchen. Der Bruder, der dauernd über
ihr und allen Ausgängen wachte, erschien ihr trotz des unaufhörlich
zwischen ihnen bestehenden Kampfes als der Stab, der sie stützte und
leitete. Wenn sie abends in ihrem Bettchen lag und die Hände zu dem von
ihm gelehrten Gebet faltete, dachte sie seiner als letzten Gedanken.
Er half bereits von der Tertia an für den Haushalt mit zu verdienen.
Eine Anzahl Jungen, kaum älter als sie selbst, waren ins Haus gekommen.
Ihnen allen hatte er mit nie versagendem Eifer in schwachen Fächern
nachgeholfen. Zuweilen fiel von diesen Einnahmen eine Kleinigkeit für
sie ab. Ein gutes Buch oder ein Blumenzwiebelchen, dessen Entwicklung
sie eifrig zu überwachen hatte. Immer wieder hatte sie seiner gedenken
müssen.
Ihres Vaters, der sie bis auf das letzte unerhörte Quälen, das sie
schließlich dem Verführer in die Arme getrieben,[S. 422] nur immer verwöhnte
und bewunderte, gedachte sie längst als eines armen Verirrten, der auch
seinen eigenen, richtigen Weg niemals erkannte.
Und jetzt sollte sie – vielleicht sehr bald – sterben, ohne dem
Bruder gedankt, seine Vergebung erfleht und ohne ihn vor allem auf
die Straße zu seinem Glücke geführt zu haben! Bisher war sie sicher
gewesen, daß der Tod, wenn er endlich käme, von ihr als heißersehnter
Erlöser empfunden werde.
Seit Tagen grübelte sie unaufhörlich! Sie suchte allein zu sein, denn
sie wollte ungestört bleiben, um nur zu einem vernünftigen Entschluß zu
kommen.
Da klopfte es. – Zuerst wollte sie nicht öffnen. Schließlich tat
sie es, vor der Tür stand nur die schwächliche Sechszehnjährige des
Hausmeisters.
„Ich brauche Sie heute nicht,“ sagte Gretchen Müller leise und
enttäuscht.
„Fräulein von Ostried hat mir heute eine feine Ansichtskarte von
Dresden geschrieben,“ erzählte Jene wichtig. „Ich soll alle Tage
raufgehen und mich ja nicht von Ihnen wegschicken lassen. Sie hätte so
viel Angst um Sie und darum gar keine rechte Ruhe.“
Gretchen Müller hatte sich nachdenklich an das Fenster neben Eva von
Ostrieds Schreibtisch gesetzt. Es gab wirklich jemand, der sich um
sie sorgte? Wie schön das war! Sie hätte es eigentlich nach aller
empfangenen Güte wissen und daher keinen Augenblick vergessen dürfen.
„Sie sollen auch ordentlich essen und trinken,“ tuschelte die
Sechszehnjährige geheimnisvoll, indem sie auf einen freien Winkel neben
dem Schreibtisch zeigte. „Da in der[S. 423] Ecke stände was ganz Feines für
Sie, wenn Sie es noch nicht gefunden haben sollten.“
Eine Flasche stärkenden Weines, ein gebratenes Hühnchen und ein paar
andere Leckerbissen. Am Halse der Flasche war ein Zettelchen befestigt,
das Eva von Ostrieds klare Handschrift trug: Meinem lieben Gretchen,
damit ich sie frisch und wohl wiederfinde.
Daran hatte Eva von Ostried in ihrem Schmerz und in dem Kampf um die
Antwort der schwersten Zukunftsfrage denken können!
In diesem Augenblicke kam Gretchen Müller zum ersten Male die Frage an,
wieviel sie ihrer Wohltäterin wohl gekostet haben mochte. Eine genaue
Vorstellung besaß sie nicht davon. Sie hatte aber die bestimmte Ahnung,
daß es eine große Summe sein müsse.
Da lag die Mappe, in welche Eva von Ostried gewissenhaft alle
Rechnungen einzuheften pflegte. Sie hatte die sonst, nach jedem
Gebrauch ängstlich verschlossen, sicherlich über dem Schweren der
letzten Zeit vergessen. Mechanisch klappte Gretchen Müller sie auf und
überflog die einzelnen Posten. Immer wieder begegnete sie ihrem Namen
als Veranlasserin der Ausgaben. Entsetzt zuckte sie zusammen, rieb die
Augen, als wollte sie um jeden Preis aus diesem Traum erwachen und
vertiefte sich von neuem.
Dies alles waren Dinge, die sie benötigt hatte. Hier die langen
Rechnungen des Apothekers und das erste beglichene Arzthonorar, die
Kosten für die Pflegerin und Stärkungsmittel. Dort die Neuanschaffungen
für Wäsche und Kleider. Mit bebenden Fingern tupfte sie auf die
einzelnen Reihen und zählte sie umständlich zusammen:
[S. 424]
Dreitausend und fünfhundert Mark für sie. Und wovon?
Um Gottes willen! Wenn Eva von Ostried darum jene Schuld, die der Mann
ihrer Liebe nicht vergeben konnte, auf sich geladen hätte? Täglich
hatte sie doch an dem ängstlichen Erwägen jeder Ausgabe gemerkt, daß
Eva von Ostried nicht mit irdischen Schätzen gesegnet sein konnte!
Ihre abgezehrten Hände hatten sich zusammengekrampft, als flehten sie
um die Kraft zu dem schwersten, entsühnenden, letzten Schritt!
Wenn sie aber noch einmal gesundete? Wozu dann die neue, jammervolle
Qual? Dann würde sie gewiß nicht früher ruhen, bis sie alles
zurückgezahlt hatte.
Müde dämmerte sie ein. Wundervoll ruhig, wie seit Monaten nicht mehr,
gestaltete sich ihr Schlummer. Als sie nach Stunden daraus erwachte,
war sie frei von Schmerzen. Die Nacht durchschlief sie gleichfalls
traumlos tief bis zum Morgen, an dem sie die gellende Pfeife des
Novembersturms wachheulen mußte.
Ihr war so wohl und leicht, wie seit langem nicht.
„Ich werde bestimmt noch einmal gesund,“ dachte sie und tastete sich
auf, um etwas zu genießen.
Aber plötzlich – sickerte es warm und purpurn, wie ein eiliges
Bächlein, über ihre Lippen. Das war der fliehende Strom des Lebens;
dagegen gab es nun nichts mehr. Morgen war sie vielleicht schon tot!
Sie versuchte sich emporzurichten. Es schlug fehl. So rief sie
mit lauter Stimme, wie sie fest überzeugt war, den Namen der
Hausmeisterstochter. Es war aber nur ein heiseres Stammeln, das
ungehört verklang.
[S. 425]
In höchster Angst begann sie zu beten.
Als sie eine Stunde später noch einmal versuchte, sich zu erheben,
schien ihre Kraft gewachsen zu sein. Sie brachte es fertig, zum
Schreibtisch zu taumeln. Mit kaum leserlicher Hand malte sie wenige
Zeilen:
Lieber, guter Bruder! Komme sogleich zu mir. Ich soll sterben und
muß Dich zuvor noch gesprochen haben. Frage die Botin nichts. Du
wirst alles aus meinem Munde erfahren, auch warum ich bei Eva von
Ostried bin. Fürchte keine Begegnung mit ihr. Sie weilt in Dresden.
Die Schlüssel zur Wohnung schicke ich Dir mit. Es könnte sein, daß
ich nicht mehr zu öffnen imstande wäre.
Dann versuchte sie die Treppe herunter zu schleichen. Als sie endlich
vor der gutmütigen Hauswartfrau stand, schrie diese laut auf.
„Mein Je... wat ist denn mit Ihnen? Sie sehen ja wie ein Geist aus.“
„Ich bin sehr krank,“ sagte Gretchen Müller kaum verständlich. „Dieser
Brief muß sofort an die Adresse hier. Bitte, rufen Sie Ihre Tochter...“
„Amanda? Die ist leider nicht da! Kann ich nicht meinen Max schicken?“
„Wie alt ist er?“
„Ostern wird er acht.“
„Nein. Bitte, gehen Sie selbst! Hier, nehmen Sie – für Ihre Tochter.“
Es war ein Halskettchen aus feinstem Silberfiligran.
– – – Mit einem Aechzen sank sie dann auf das Ruhebett ihres
einfenstrigen Zimmers, und ihre fieberglänzen[S. 426]den Augen verfolgten
gespannt den gleichmäßig vorwärtsrückenden Zeiger der Uhr. Schließlich
schlief sie vor Schwäche ein.
Die alte Pauline stand, noch schneeweiß bis in die Lippen, vor Walter
Wullenweber und berichtete von dem Unglück, das sie am Vormittag
betroffen hatte.
„Wie es gekommen ist? Ich hatte mir einen heißen Stein ins Bett
geschoben. Wenn man alt ist, kann man nicht mehr so recht warm werden.
Hundertmal hab’ ich das schon gemacht und nie ist was passiert. Nun
heute grade. Die Betten sind verkohlt und das schöne Kleiderspind ist
ganz hin. Alle Sachen drin sind zu Fetzen verbrannt. Nur ein Kleid ist
wie durch ein Wunder verschont, das gute Schwarzseidene, in dem unsere
Frau Präsident gestorben ist...“
„Grämen Sie sich nicht darüber, Pauline,“ tröstete Walter Wullenweber.
„Wäre die Flurnachbarin nicht so beherzt gewesen, hätt’ ich Ihnen die
ganze Wohnung ausgeräuchert...“
„Freuen wir uns also des günstigen Ausgangs –“
„Nun hab’ ich richtig nichts anzuziehen. Und ich muß doch an ihr Grab.
Ihr Geburtstag is...“
„Ich denke, das gute Schwarzseidene ist verschont geblieben? Sagten Sie
das nicht soeben?“
Erschrocken wehrte sie ab. „Wo denken Sie hin, Herr Rechtsanwalt?! Das
ist mir heilig. Nein, nein....“
„Ihre Frau Präsidentin würde Sie auslachen, wenn sie das gehört
hätte..“
[S. 427]
„Meinen Sie wirklich?“ Es klang, als leuchte eine scheue Hoffnung durch
alle Trostlosigkeit.
„Auch nach meinem Empfinden wäre es kindisch, wenn Sie aus diesem
Grunde fernblieben. Nach allem, was Sie mir von ihr erzählt haben, kann
ich mir unmöglich denken, daß sie dies billigen würde.“
„Ich glaube beinahe auch nicht recht dran...“
„Wie können Sie noch überlegen? Der Schaden ist gewiß schmerzlich für
Sie, aber viel schmerzlicher würde es sein, wenn auch dies letzte Kleid
– dies Heiligtum in Ihren Augen – mitverbrannt wäre.“
„Darüber könnt’ ich bestimmt nicht wegkommen...“
„Sehen Sie wohl? Also Kopf hoch! und Hand her. – Vielleicht hat Ihre
Frau Präsidentin aus der Höhe den ganzen Brand überhaupt bestellt,
damit ihre alte, überbescheidene Pauline wenigstens einmal im Leben in
Seide rauscht.“
„Zuzutrauen wär’ ihr das schon...“
„Na also. Nachher werden Sie mir jedes verbrannte Stück genau aufzählen
und möglichst beschreiben, damit ich ordnungsgemäß Anzeige von dem
Brand machen kann. Einstweilen sehen Sie, bitte, nach, wer draußen
Sturm läutet.“
Es war die Hausmeistersfrau, die Gretchen Müllers Brief brachte.
„Lieber, guter Bruder...“ Walter Wullenweber wischte mechanisch über
die schrägliegenden Buchstaben, die ihm in zitternden Wellenlinien
entgegensahen. Er rief nach der alten Pauline. Seine Füße waren
plötzlich zu schwer zum Aufstehen, seine Hand zu unsicher zum Klingeln.
[S. 428]
„Ich möchte die Botin sprechen, die dies soeben gebracht hat. Schicken
Sie sie herein,“ sagte er mit schwerer Zunge.
„Ach Gott, Herr Rechtsanwalt.“ Er wehrte ab.
„Die Frau ist sehr eilig gewesen; gleich ist sie wieder weg.“
„Hm –“. „Da liegt noch was Eingewickeltes, Herr Rechtsanwalt,“
erinnerte Pauline. „Es sind Schlüssel, hat die Frau gesagt. Sie möchten
sich selbst die Wohnung aufschließen. Das Fräulein wäre nämlich ein
bißchen kränklich ...“
Der Name auf dem Schild und der Schlüssel in seiner Hand... Nein, nein,
es war kein Traum! Schon stand er mit einem unsäglichen Gefühl von
Verwirrtheit auf dem schmalen Korridor.
„Lieselott!“ rief er laut und erschrak über den Klang der eigenen
Stimme.
Dann tappte er weiter. Das Musikzimmer kannte er aus Eva von Ostrieds
Schilderungen. Er sah auch im Geist die hohe, stolze Gestalt der
Besitzerin und fühlte, daß seine heiße Liebe zu ihr niemals sterben
konnte. Jeder weitere Schritt war eine Qual für ihn. Wie ein Einbrecher
kam er sich vor und ging doch weiter... bis er in dem kleinen,
einfenstrigen Raume stand, dessen Fenster einen Ausschnitt der
sommermüden Bäume zeigte...
Auf dem Ruhebette lag eine schmale, zusammengekrümmte Mädchengestalt.
Das Gesicht war wachsbleich. Die Lippen farblos. Der Goldton ihres
Haares das einzig Lebendige an diesem starren Bilde.
[S. 429]
Mit einem dumpfen Aufschluchzen warf er sich über sie. „Kleine
Lieselotte!“
Seine Arme hoben sie ein wenig empor. „Lieselott, ich bin bei dir.“
Da zuckten die Lider endlich und ihre Augen wachten auf: „Walter...
Bruder...“ Nichts weiter vermochte sie zu sagen.
Er fragte nichts. Er lag auf den Knieen und hatte seinen Kopf in ihre
Hände gebettet. Sanft lehnte sie ihre Wange an sein dichtes, blondes
Haar.
„Wie schön ist das, Walterle...“ Und dann wie ein Hauch: „Der Vater...
unser Vater... weiß er schon?“
Er machte eine verneinende Bewegung.
„Walterle,“ sagte sie dicht an seinem Ohr, „ich habe mich halbtot vor
dir geschämt. Jetzt ist alles, alles gut! Aber, es dauert nicht mehr
lange. Und ich muß dir doch so viel erzählen.“
Zuerst sprach sie von sich, während er einen Stuhl neben ihr Lager
geschoben hatte und ihre Hände festhielt. Sie mußte häufig Pausen
machen. Sonst reichte ihr Atem nicht aus. Und er mußte doch so
unendlich viel wissen.
„Du wirst geahnt haben, wohin ich ging, als ich Euch verließ?“ begann
sie in bebender Scham.
„Ja,“ nickte er und verhüllte seine Augen mit der Rechten, „zu dem
Mann, vor dem ich dich schützen wollte.“
„Laß mir deine Hände, Walter.“
Er fühlte die Eiseskälte ihrer Finger und schauerte zusammen, weil er
daraus die Nähe des Todes zu spüren meinte. Ihre Stimme war so leise,
daß er sich zu ihren Lippen herabneigen mußte, um sie überhaupt zu
verstehen.
[S. 430]
„Er hatte geschworen, mich zu seiner Frau zu machen.“
„Das hast du geglaubt?“
„Wäre ich sonst zu ihm gegangen? Konntest du das auch nur einen
Augenblick von mir glauben, Bruder?“
Er schwieg. Das war das Härteste gewesen, daß er davon überzeugt war.
„Ich schwöre es dir! Als ich die untrüglichen Beweise seiner
Treulosigkeit hatte, als ich wußte, daß bereits eine andere seinen
Namen trug, ohne daß mir eine Ahnung davon gekommen war, verließ ich
ihn.“
„Wie habe ich dich gesucht, Lieselott...“
„Finden lassen durfte ich mich nicht von dir. Nicht wahr, das verstehst
du auch. Gelernt hatte ich nichts wie das bißchen Harfenspiel. Und in
ein Nachtkaffee wollte ich nicht! – Dein Name, Walter, hat mich vor
vielem zurückgehalten. Mit diesem Namen durfte ich auch nicht in der
Oeffentlichkeit arbeiten. Du hättest mich gefunden. Ein Zufall half
mir. Als ich wieder einmal umsonst nach Beschäftigung gegangen war,
fand ich, neben mir, in einem Abteil der Stadtbahn eine Tasche mit
Ausweispapieren... Ich nahm sie an mich. Es ging doch nicht anders.
Seitdem bin ich „Gretchen Müller.“ Aber er fand mich auch als solches
und ließ mir keine Ruhe. In dem Geschäft, das mich angenommen, machte
er mich unmöglich. Ich wollte sterben... Da war aber eine, die es
verhindert hat. Eine Schülerin von Eva von Ostried. Sie hat mich zu ihr
gebracht ...“
„Wie lange schon,“ fragte er heiser.
„Länger als zwei Jahre. Ohne Eva von Ostried wäre ich verhungert. Ihr
verdanke ich alles. Nicht nur, daß ich[S. 431] wieder anständige Kleider und
eine Heimat erhielt, das sie mich pflegte und umsorgte. Ach, das war
wohl schön... Aber das andere war das Wunder, das meine Seele gereinigt
hat. Wie eine Schwester ist sie allzeit zu mir gewesen. Sieh her, diese
Sachen hat sie für mich gekauft, damit ich auch in ihrer Abwesenheit
nicht darbe. Und hier in dieser Mappe stehts, wieviel Geld sie für mich
geopfert hat. Woher sie das konnte? – Walterle, ich weiß es nicht,
wie so vieles. Aber ich las deinen harten, letzten Brief an sie. Er
bestätigte meine Ahnung, die mich nicht verlassen, seitdem ich das
erste Mal einen Umschlag mit deiner Handschrift bei ihr sah. Sie ahnt
nicht, daß ich deine Schwester bin, wie sie mir auch deinen Namen nicht
verraten hat. Nur, daß sie Braut geworden und nachher – – das andere
– – daß alles aus sei – – hat sie mir gesagt. Walterle, hör’ zu –
– sie hat mich in die Arme genommen, auch damals, als der Verführer
bei ihr eindrang und sie wissen mußte... Laß – frage nichts – –
fluche ihm auch nicht. Er ist tot – – Vielleicht tat sie es, weil sie
auch um sich litt – – Und um dich. Am allermeisten. Nun hast du ihre
heiße Liebe, die nur für dich fühlt und bangt, zurückgestoßen...“
Er stöhnte auf. „Was mich das gekostet hat – – –“
„Ich weiß es, denn ich kenne dich, Bruder! Du hättest mich nie
wiedergefunden, wäre sie nicht in mein Leben getreten. – Nicht um mich
– – nein um ihretwillen fand ich die Kraft, dich zu rufen...“
„Sie liebt mich nicht mehr,“ wendete er ein.
„Ach du! Ihre Liebe ist so stark, daß sie sich vor ihr fürchtet. Darum
wird sie es auch vielleicht tun.“
[S. 432]
„Wovon sprichst du?“
„Ich habe mit eigenen Ohren gehört, wie ein Verwandter von ihr – ein
Majoratsherr – der denselben Namen wie sie führt, um sie geworben hat.“
„Und sie...? Ist sie schon seine Braut?“
„Noch nicht. Aber die beiden Wochen Bedenkzeit, die sie sich erbeten
hat, sind bald verstrichen...“
„Wann sind sie vorüber?“
„Es war vor neun Tagen...“ Er stand auf.
„Glaubst du, Lieselotte, daß sie nach allem mir noch einmal vertrauen
kann?“
„Ich weiß nicht, was Euch getrennt hat und will es nicht wissen. Nur,
daß sie dich weiter über alles liebt, weiß ich als einzig Gewisses.“
„Und ich sie ebenfalls –!“
„Also wirst du sie aufsuchen?“
„Es wird mich zwingen...“
„Dabei sollst du ihr diesen Brief geben. Ja, Bruder? Ehe du kamst, habe
ich ihn geschrieben. Es steht nur eine Zeile darin.“
„Und warum willst du nicht selbst – –?“
Sie lächelte ihn an. „Ich werde sterben. Es ist nur der Wein, der mir
diese letzte Kraft gab, auszuhalten. Jetzt darfst du mich nicht allein
lassen. Hörst du? Erst, wenn es ganz dunkel geworden ist, sollst du
heimgehen...“
Ein langes Schweigen kam. Er hatte sie aufgerichtet.
„Wo wohnt dein Arzt, Lieselotte,“ forschte er.
„Laß ihn, Walter. Was soll er mir noch? Sieh mich an. Du bist mein Arzt
und Erlöser... Und nun erzähle vom Vater – –“
[S. 433]
Er tat es, und sie nickte zuweilen.
„Jetzt wird er sich über meinen Gruß freuen, Bruder...“
„Ich werde ihm telegraphieren, Lieselott!“
„Morgen, ja! Nicht heute! Es tut so bitterlich weh – hier – hier –
–“ und sie zeigte auf die Brust.
Fest bettete er sie in seinen Armen.
„Glaubst du, Walter, daß mich eine andere, wie sie, damals aufgenommen
hätte – mit dem Schimpf der Verlassenen und Geächteten. Todkrank. Kaum
ein anständiges Stück Zeug auf dem Leibe – –“
„Hör’ auf!“ flehte er gequält.
„Du mußt genau wissen, wie es damals um mich stand. Sonst begreifst du
ihr großes, warmes Opfer nicht voll.“
„Doch, ich fühle es in seiner ganzen Tragweite, Lieselott.“
„Du hast sie vorher eine Heilige genannt. Das ist sie wirklich... Sieh,
ich weiß am besten, wie rein sich ihre Seele hält. Darin ist lauter
Licht und Keuschheit. Alles nur für dich!“
„Und ich konnte sie richten,“ dachte er dumpf.
Ihr leichter Körper wurde schwer in seinen Armen. Das Gesicht
veränderte sich auffallend. Es nahm spitze, fremde Züge an. Der Atem
setzte aus. – Es ging aber wieder vorüber.
„Tag und Nacht hat sie um dich geweint, Walter!“
Dann sprach sie lange nichts mehr. Nur der Atem kämpfte verzweifelter,
bis wieder ein rosenrotes Bächlein über ihre Lippen quoll. Danach wurde
ihr leichter wie zuvor. Nur die Stimme gehorchte nicht mehr, und die
Gedanken waren weit – weit weg.
[S. 434]
„Meine Harfe,“ verlangte sie mit einem röchelnden Lachen, „laßt sie mir
doch!“
Er dachte daran, daß er sie ihr zuweilen verschlossen gehalten, weil
sie ihre Aufgaben für die Schule und später für die Häuslichkeit
darüber vernachlässigte. Ueberall empfand er seine Mißgriffe.
„Herr Tebecke konnte keine Musik vertragen,“ träumte sie erschauernd.
Das war der Name des Mannes, dessen Reichtum den Vater geblendet und
sie aus dem Hause dem Andern entgegen gehetzt hatte.
Auf ihren eingefallenen Wangen erblühte ein Röslein. Die Augen
glänzten. Sie wußte nichts mehr von der Gegenwart...
Sie lag, die Hände fromm gefaltet und lächelte.
Mit einem Wehlaut warf er sich über ihre Hülle...
Die kleine weiße Rose, aus dem Heimatsboden gerissen, durch den Strom
sündiger Leidenschaft blutrot gefärbt, im Staub der Straße zertreten,
– nun war sie wieder schneeweiß und würdig für den himmlischen Garten
des allmächtigen Vaters!
Eva von Ostried war einen halben Tag eher, wie sie zuerst gedacht, aus
Dresden zurückgekehrt, hatte von jeder telegraphischen Benachrichtigung
abgesehen, weil sie der kleinen, aufmerksamen Hausgenossin keine Mühe
machen wollte und sich durch den mitgenommenen Schlüssel mühelos
Zutritt verschafft. Die verworrene Erzählung der Hausmeistersfrau unten
im Hausgange war ihr unverständlich geblieben. Nun stand sie, Sorge und
Zärtlichkeit auf dem Gesicht, vor – – Walter Wullenweber – –
Als sie ihn erkannte, streckten sich ihre Arme in stummer entsetzter
Abwehr aus. – Nichts begriff sie, als daß er da war. Alles andere
wurde ihr unfaßbar. Erst nach geraumer Weile merkte sie, was geschehen,
und schrie in grauenhafter Furcht auf, daß die Todkranke, als sie ihrer
letzten Stunde gewiß wurde, ihn gerufen haben mußte.
Aber warum? Hatte sie alles gewußt und wollte für sie bitten? Ja – so
war es! Durch diese Erkenntnis kam sie zur Kraft!
„Sie hat es gut gemeint,“ sagte sie endlich leise und weich, „und
es war auch gütig, daß du gekommen bist. Aber, nicht wahr, nun
wollen wir uns nicht länger quälen. Ich werde mein nächstes Konzert
abtelegraphieren und sie zur Ruhe betten lassen. Lebe wohl...“
Er war dicht neben ihr.
[S. 436]
„Eva!“
Sie hob nur die Hand.
„Laß alles schlafen. Das ist meine letzte Bitte.“
Da stieß er heraus, was sie erst allmählich erfahren sollte. „Sie ist
meine Schwester, Eva! Die arme kleine Lieselotte, von der ich dir
schrieb... damals – –“
„Deine – Schwester – die du so lange vergeblich gesucht hast?“
„Ja. Hier ist der Brief, mit dem sie mich rief.“
Sie starrte darauf hin, als begriffe sie seinen Sinn nicht. „Deine
Schwester?“ wiederholte sie nur immer wieder.
„Nicht wahr, das ändert alles!“
Sie sah mit wirrem Blick umher, an ihm vorbei und endlich auf das
bleiche, lächelnde Gesicht der Toten.
„Was könnte es wohl ändern? Doch, die Bitterkeit! Ich will dir
wenigstens die Hand reichen.“ Wie einst riß er ihre Rechte an sein
Herz. „Nicht so! Es ist nur um ihretwillen. Sie hat mir ja auch dies
Opfer gebracht.“
„Fühlst du es als Opfer, Eva? Vergiß doch! Ich liebe dich noch immer
über alles.“
Sie schüttelte den Kopf. „Nichts mehr davon. Es ist alles längst vorbei
und überwunden.“
„Bei ihrem Andenken schwöre ich dir, daß ich nie aufgehört habe, dich
zu lieben. Nur das andere...“ Er stockte.
„Es war sehr hart, aber ich habe es begreifen gelernt.“
„Jetzt mußt du begreifen, daß ich nicht ohne dich leben kann, Eva.“
„Du bildest dir nur ein, daß es so sein müsse. Begreiflich. Glaubst,
mir um deiner Schwester willen Dankbarkeit zu schulden. Der Schmerz
um sie – – ein wenig wohl[S. 437] auch die Reue – haben dich, den sonst
unbestechlich Ehrlichen so weit getrieben. Ich verstehe auch das. Und
will – vergessen – –“
„Du sollst nicht, Eva!“
„Wenn ich schon – – vorher vergessen hätte – –?“
Er sah sie fassungslos an. „Lieselott hat mir auch von der Werbung des
Waldesruher gesprochen. Solltest du dich bereits vor Ablauf der beiden
Wochen für ihn entschieden haben?“
„Ich wollte es tun,“ erwiderte sie sanft. „Aber – – nun wird es wohl
doch nicht gehen.“
„Warum nicht?“ drängte er mit neu erwachender Hoffnung.
„Warum? Ach – – das läßt sich schwer ausdrücken. Vielleicht, weil ich
mich auch seiner nicht wert fühle.“
Er umklammerte ihre Handgelenke. „Du sprichst nicht die Wahrheit – –“
„Ich könnte nichts anderes sagen – – im Augenblicke.“
„Soll das heißen, daß ich später – – morgen, übermorgen – –“
„Nein,“ wehrte sie erschrocken ab. „Es soll heißen, daß ich niemals
wieder – –“
„Wen? Den Andern?“
„Nein, dich,“ sagte sie, immer noch wie im Traum.
„Eva, ich flehe dich an. Denke daran, daß es das letzte Mal sein kann.“
„Das wäre gut! Ich will ruhig werden und sühnen. Gönne mir diese Ruhe.“
„Du hast hundertmal gut gemacht. Ich danke dir – –“
Sie ließ ihn nicht zu Ende kommen.
[S. 438]
„Nur an mein Glück hat sie gedacht, deine kleine Schwester. Das sieht
ihr ähnlich. Ich habe sie sehr lieb gehabt. Vielleicht – –“
„Sei barmherzig. Vergib mir meine Härte und Ungerechtigkeit.“
„Steh auf – – ich allein bleibe die Schuldige. Es hilft nichts,
ich – – habe gestohlen. Siehst du, jetzt zum ersten Mal geht das
fürchterliche Wort aus meinem Munde. Das Gespenst läßt sich nicht
vertreiben. Die Präsidentin hatte mir nichts zugedacht und ich habe es
nicht glauben wollen. Ich habe dir nie von meinem Verhältnis zu ihr
gesprochen. Jede ihrer Handlungen bewies mir, daß sie mich lieb hatte.
Selbst, wenn sie unzufrieden mit mir war, wurde sie nicht hart. Ich
merkte vielmehr, daß sie darunter litt. Und sie – – hat es mir auch
versprochen. Klipp und klar. Da ist es mir unfaßbar gewesen, daß sie,
die nie ein gegebenes Versprechen brach, nicht an mich gedacht haben
sollte. Bei Gott! Mein Gefühl hat unablässig dagegen geeifert, immer
noch, bis vor ganz kurzem. Nicht wahr, wenn sich schließlich doch ein
Nachsatz, der mich bedacht hätte, vorfand, dann – ja dann – –. Das
wirst du gewiß auch nicht verstehen. Wirst meinen, an meiner Schuld
ändere das nichts. Mich hätte es losgesprochen. Ich hätte mir einbilden
können, ich wäre nun nicht länger schuldig! So aber, wenn ich vergessen
wollte – wie damals – in deinen Armen – nachher kam es doch wieder.
Ein Satz nur, aber ein fürchterlicher, strenger noch wie du – – „Der
Uebel größtes... aber ist die Schuld...““
„Wir werden gemeinsam arbeiten und sparen, damit wir alles
zurückerstatten,“ flehte er erschüttert. „Denn so grau[S. 439]sam, daß du mich
nun zu deinem Schuldner auf Lebenszeit machst, der nicht abtragen darf,
was du seiner Schwester gegeben, kannst du nicht sein.“
„Das Geld – – das schreckliche Geld – –“ klagte sie. „Wie es dich
schon drückt, daß du es schuldest – –“
„Nein, das andere ist mir die Hauptsache. Deine Liebe, die
selbstverständliche Güte, dein Verstehen und Vergeben, mit dem du meine
Schwester überschüttet hast – –“
„Sollte ich, die schuldig Gewordene, sie verurteilen?“
„Ich war auch schuldig an ihr und habe dich doch gepeinigt.“
„Das tust du erst jetzt und ich kann es nicht länger ertragen. Laß uns
das Nötige ruhig mit einander besprechen. Ich überlasse dir natürlich
die Bestimmung über alles, was sie angeht. Willst du es lieber allein
besorgen, weil doch auch wohl dein Vater kommen wird... so begebe
ich mich für diese kurze Zeit in eine Pension. Wirklich, es macht
mir nichts. Du denkst, daß dies hier die Heimstätte deiner kleinen
Schwester sei, aus der, hinweggetragen zu werden, ihr gutes Recht ist.
Wenn alles vorüber ist, kehre ich schon zurück. Wohl kaum mehr für
lange... Ich weiß das alles noch nicht.“
Er stand hoch und stark neben ihr, als habe er die Last, die ihn zu
ihren Füßen niederzwang, endlich abgeworfen.
„Noch einmal. Ich liebe dich! Sei barmherzig. Stoße mich nicht zurück.“
„Weil ich es sein muß, sage ich: mache ein Ende! Glaubst du, daß du mir
dankbar zu sein hast, dann habe ich ja auch die Erfüllung einer Bitte
gut.“
„Sprich sie aus. Was du willst, soll geschehen!“
[S. 440]
„Ich danke dir. Vergiß mich, Walter!“
„Kannst du dir das wirklich erbitten?“
„Ja, das kann ich!“
Er griff an die Stirn. Sein Gesicht wurde von einer schmerzhaften Angst
verzerrt.
„Eine Erklärung verlange ich wenigstens...“
Sie sann ein wenig. „Wie soll ich das erklären? Fühlst du es nicht?“
Er schüttelte wild den Kopf.
„Nein? Du hast doch empfunden, daß ich dein Leben verdorben hätte...
wenn...“
„Empfunden? Doch nicht! Nur einen Augenblick lang gefürchtet. Das, was
dir gehört, hatte gar nichts damit zu schaffen. Das andere in mir,
das für das Recht steht und fällt, schrieb dir den Brief. Mein Herz
hat dich auch in diesem Augenblick keinen Deut weniger geliebt als zu
Anfang und jetzt!“
Mit leicht geschlossenen Augen lauschte sie ihm. „Es klingt schön. –
Ich glaube es aber nicht!“
„Dann muß ich vollenden. Ich verstehe, daß du mich niemals geliebt hast
wie ich dich...“
In ihrem Gesicht begann es zu zucken. Sie war am Ende ihrer Kraft.
Noch ein Wort – eine Wiederholung der alten Bitte – ein
Entgegenrecken seiner Arme und... Sah er denn ihre große, heiße Liebe,
daß er nicht müde wurde, sie zu verlangen? Er durfte sie nicht gewahr
werden. Nie mehr... Sein Leben mußte hell und rein bleiben. Würde sie
sein Weib, machte sie ihn zum Mitschuldigen und vernichtete ihn langsam
damit. Was lag an ihr? Mochte sie nachher zu[S. 441]sammenbrechen. Bis sie es
ausgesprochen hatte, würde sie sich aufrecht erhalten.
„Ich gehe also. Du und die alte Pauline, Ihr werdet alles nach deinem
Willen einrichten. Den Schlüssel kannst du danach unten bei der
Hausmeistersfrau abgeben. Ich hole ihn mir später schon...“
„Soll das deine Antwort auf meine Anschuldigung sein?“
„Verlangst du wirklich eine?“
„Eva,“ stöhnte er, „laß es genug der Folter sein. Ich bitte dich nach
diesem nicht mehr!“
Sanft streichelte sie die gefalteten Hände der Toten. Und es war, als
bringe ihr die eisige Kühle die Besinnung zurück – – als sei sie nun
gegen alle Sehnsucht gefeit.
„Ich kann nicht,“ gestand sie leise, „und wenn ich mich halbtot quälen
würde.“
„Quälen sollst du dich nicht. Nein – das hast du nicht um uns
verdient.“ Es klang hart und fest. „Du hast uns genug geopfert. – Noch
heute Abend werde ich meine kleine Schwester zu mir holen. Verzeih dies
Letzte. Ich muß dich solange aus deiner eigenen Wohnung vertreiben.
Danach aber – ich hoffe gegen zehn Uhr – ist jede Spur von uns
verwischt.“
Sie fühlte mit kaltem Schrecken, wie sie zu taumeln begann. Wenn er sie
jetzt noch einmal ansehen würde – – Seine Augen mieden ihr Gesicht,
während er, nach kurzer Pause, wieder zu sprechen begann.
„Du hast mir am Schluß deines letzten Briefes etwas schreiben können,
was ich lange nicht begriffen habe. Vielleicht hast du es wirklich so
gemeint. Daß ich glücklich wer[S. 442]den soll ohne dich. Jetzt beginne ich
deinen Wunsch zu begreifen. Du wirst und willst ohne mich glücklich
werden. Das weiß ich nun – –“
Sie widersprach ihm nicht. Einen Herzschlag lang wartete er darauf. –
„Lebe wohl, Eva.“
Hatte sie den gleichen Abschiedsgruß für ihn gehabt? Mit vorgeneigtem
Oberkörper stand sie und lauschte, wie sein Schritt auf dem
teppichlosen Stückchen Parkett zwischen Sterbezimmer und Musikraum
hörbar wurde – – wie er über den langen Korridor tappte – die Hand
auf den Drücker schlug, der stets ein wenig schwer gehorchte und die
Tür hinter sich zuklappte.
Dann erst brach sie mit einem wilden verzweifelten Aufschrei, der
nichts als unsterbliche, ewige Liebe nach ihm war, in die Kniee.
Major a. D. Wullenweber hatte nicht zur Bestattung seiner Tochter
kommen können. Noch bevor der Eilbrief seines Sohnes in Hohen-Klitzig
angekommen war, packte ihn ein neuer Schlaganfall. Lebensgefahr bestand
auch diesmal nach dem Urteil des Arztes nicht. Immerhin war die größte
Schonung und Ruhe erforderlich. Der Amtsrat verschwieg ihm daher den
Inhalt des zur Vorbereitung des Vaters an seine Adresse gerichteten
Briefes. So lag der Kranke – ahnungslos – mit leise röchelndem Atem,
ohne zu ahnen, daß in derselben Stunde, in welcher er nach drei Tagen
wieder mit Genuß einer schmackhaften Suppe zusprach, seine kleine
Lieselott an der Seite ihrer Mutter zur letzten Ruhe gebettet wurde.
[S. 443]
Die alte Pauline war von Walter Wullenweber so weit ins Vertrauen
gezogen, wie es sich um das traurige Geheimnis seiner kleinen Schwester
handelte. Mehr hatte er ihr auch nicht sagen wollen! Und sprach ihr
dann, als alles vorüber war, doch davon, daß er Eva von Ostried liebte
und sie, nach kurzem unaussprechlichen Glück, verlieren mußte.
„Sie dürfen morgen nun doch nicht zum Geburtstag Ihrer Frau Präsidentin
heraus,“ sagte er am dritten Abend nach der Beisetzung.
„Warum denn nicht, Herr Rechtsanwalt?“
„Weil Sie von rechtswegen längst ins Bett gehören...“
„Da halte ich es gar nicht aus. Mir ist, als müßte ich laufen und immer
blos laufen, um einzuholen, was mir sonst wegflitzt.“
„Ich habe einen schönen großen Kranz bestellt, Pauline. Lauter tiefrote
Astern, von denen Sie mir mal sagten, daß sie Frau Präsidentin von
allen Blumen am liebsten hatte,“ versuchte er sie zu beruhigen.
„Wie gut Sie sind,“ dankte sie gerührt.
„Gut?!“ lachte er gerührt auf. „Sie dürften eigentlich sowas nicht
sagen. Versprechen Sie mir jetzt feierlich, daß Sie sich mit meinem
Vorschlag einverstanden erklären.“
„Was soll ich denn, Herr Rechtsanwalt?“
„Morgen brav daheimbleiben und hier den Tag im Gedächtnis an Ihre Frau
Präsidentin verbringen. Den schönen Kranz trage ich ihr selbst ans
Grab. Es macht mir nichts aus...“
Sie wurde rot wie ein junges Mädchen, das eine Not nicht länger
verbergen kann. „Und wenn Sie mich fest[S. 444]bänden, bliebe ich nicht zu
Hause. So gut Sie es wieder mal meinen. Das geht nicht. Wie eine
Meineidige käme ich mir vor. Ich hab’ ihr in die Hand versprochen,
daß ich jedes Jahr, solange ich am Leben bin, ihr Grab an dem Tage
schmücken wollt’, denn sie konnte keine Unordnung leiden. Und wenn ich
mir gleich den Tod holen müßt’ – jawohl... hin würde ich doch machen.“
Da sagte er kein weiteres Wort dagegen, sondern ließ sie gewähren,
als sie am nächsten Tage in dem feierlichen Schwarzseidenen, mit dem
Kranz auf dem Arm vor ihm stand und leise und beschämt wegen ihres
Ungehorsams um Entschuldigung bat. –
Walter Wullenweber hielt sich mit eisernem Willen aufrecht. Seine stark
entwickelte Pflichttreue, die unermüdlich die angehäufte Arbeit abtrug,
unterstützte ihn. Nur in den kurz bemessenen Freistunden gab er sich
seinen trostlosen Gedanken hin.
Ob sie ihn wirklich nicht mehr liebte? Tagelang hatte er es als
sicher angenommen. Wie durch ein aufregendes Ereignis Gesicht und
Gehör verloren gehen konnten, mochte auch wohl ihre Liebe dieser
Erschütterung nicht standgehalten haben. Jetzt begann er ihre Scham und
ihren Stolz richtig einzuschätzen. Begriff, so sehr es auch gegen das
starre Gesetz ging, daß eine nachträglich aufgefundene Bestimmung der
Präsidentin zu ihren Gunsten die Last der Tat von ihr abgewälzt hätte.
Damit ward ihm auch das Andere klar. Daß sie mit diesem Augenblick
wieder sein und diesmal auf ewig gewesen wäre. Nun dies unmöglich
geworden war, hatte er keinen Anteil mehr an ihr! Er hatte den Kopf auf
die Platte des[S. 445] Schreibtisches gelegt und litt weit über alle Kraft
unter der Unmöglichkeit, dies jemals zu ändern – mdash; –
Das ungestüme Aufreißen der Korridortür, ihr heftiges Zuschlagen,
das Hereinstürzen der feierlich angetanen, alten Pauline, ließ ihn
erschrocken emporfahren. Selbst nach dem Brande war sie nicht so
fassungslos erschienen. Sie stand vor ihm, wie er sie noch nie gesehen
hatte. Ihre welken Lippen zittern.
Augenscheinlich wollte sie etwas berichten und brachte doch nichts
heraus, als ein Aufschluchzen der Freude!
„Das habe ich in der Tasche von unserer Frau Präsidentin
Schwarzseidenem gefunden,“ konnte sie endlich herausbringen.
Er las den Inhalt des gelblich gewordenen Zettels. Ihn voll zu
begreifen, war ihm noch versagt. Es war zu neu, zu gewaltig und
zu schön. Als er sich endlich dazu zwingen konnte und sich auch
überzeugte, daß Unterschrift und Datum diesen Zeilen volle Gültigkeit
verliehen, steckte er ihn zu sich und sprang auf.
Bescheiden, auch jetzt noch, wartete die alte Pauline auf das erste
seiner Worte.
Er preßte nur stumm ihre Hände zwischen den seinen, sodaß sie Mühe
hatte, einen Aufschrei zu unterdrücken und stürzte fort – – –
Mit stillem Lächeln sah sie ihm nach. Ihr war nicht verborgen, wohin
ihn jetzt sein Weg führen mußte.
Seit zwei Tagen weilte Eva von Ostried wieder in ihrem Heim. Es kam
ihr grenzenlos öde vor. Der jubelnde Bei[S. 446]fall, der ihr ebenso in
Dresden wie in Weimar geworden, lag weit hinter ihr. Ihr Blick galt der
Zukunft. Morgen in der Frühe würde sie den Vertrag unterzeichnen, der
sie auf die Dauer von drei Monaten in die verschiedensten Großstädte
führen sollte. Und dann – –
Ja – dann kam endlich doch wohl noch alles, wie sie es einst so heiß
gewünscht und nun längst nicht mehr erstrebt hatte – – –.
Wahrscheinlich zum kommenden Herbst würde sie einer schon jetzt
ergangenen dringenden Einladung des Dresdner Intendanten folgend, dort
auf Engagement singen.
Sie kämpfte nicht mehr. Alles schien überwunden zu sein. Das einzige
Gefühl, dessen sie sich für fähig hielt, bestand in einem brennenden
Neid auf die Tote.
Das kleine einfenstrige Zimmer, aus dem sie hinausgetragen war, blieb
seither unbenutzt. Furchtsam wurde es von Eva von Ostried gemieden.
Nicht die Tote allein wehrte ihr den Eintritt, sondern vor allem der
Lebende, der erst langsam für sie sterben mußte.
Sie saß vor dem Flügel, aber sie dachte nicht an das, was einst ihr
höchstes Sehnen gewesen. Wie längst durchlesene Bücher, die kein
Interesse mehr erwecken konnten, betrachtete sie die Stöße von Noten.
Es gab nur noch ein Lied für sie, das sie niemals vergessen würde, das
kleine Lied von der weißen Rose....
Sein Lied! Vorläufig hatte sie sich am Fenster einen Tisch mit allem
Nötigen zum Schreiben zurechtgestellt. Sinnend ruhte ihr Blick auf dem
großen weißen Bogen, der gespenstisch zu ihr hinwinkte. Ehe es Abend
geworden war, wollte sie einen Brief schreiben...
[S. 447]
Sie ging hinüber und tauchte die Feder ein. Wenn er fort sein würde,
hatte sie keine Anwartschaft mehr auf das alte stille Schloß in
Waldesruh! Trotzdem schrieb sie ihn hastig! Er wurde kurz.
Ich kann nicht Ihre Gattin werden. Aber ich danke Ihnen warm für
die mir zugedachte Ehre...
Warum konnte sie es nun doch nicht? – Auf dem Tischchen lag ein Stoß
geöffneter Briefe, die sie in Dresden und Weimar erhalten hatte.
Schwärmerische Ergüsse – –
Nun brach sie wieder hervor, die alte heiße, wilde Sehnsucht nach dem
Geliebten. Das mühsame Versteckspiel mit den eigenen Gefühlen war
nutzlose Marter. Ihre Seele gehörte ihm auf ewig.
Wie erlöst atmete sie auf, als draußen die Klingel ging. „Wirklich
kommt er,“ dachte sie befriedigt, während sie hinausging.
Sie konnte den Eintretenden in dem Zwielicht nicht sogleich erkennen
und ahnte doch sofort, wer er sei! Ihr Herz begann wie rasend zu pochen.
– – – Gehorsam blickte sie auf ein beschriebenes Blatt nieder,
das er vor sie hingelegt hatte, als sie sich im Musikzimmer
gegenüberstanden.
„Ich kann nicht,“ flüsterte sie, als sie die Handschrift sah. Da las
ihr Walter Wullenweber vor:
Nach einem Anfall großer Herzschwäche, den ich zwar überwunden
habe, dessen Wiederkehr ich aber fühle, bestimme ich hiermit
als Nachtrag zu meinem bereits gemachten Testament, daß meine
geliebte Pflegetochter Eva von Ostried bei meinem Ableben
Einhundertundfünfzigtausend Mark durch Herrn Justizrat Weißgerber[S. 448]
ausgezahlt erhalten soll. Und zwar ist diese Summe von derjenigen
für die Stiftungen festgelegten abzuziehen. An den ausgesetzten
Legaten soll nichts geändert werden. Meine treuesten Grüße gehören
meiner lieben Eva.
Zur Zeit Belgard a. d. Persante, Hinterpommern, im Wartesaal der 2.
Klasse, den 24. August 1918.
Frau Präsident Hanna Melchers.
Als Walter Wullenweber zu Ende gelesen hatte, sah er sie an. Und sah,
daß sie ihre Hände, wie bittend, zu ihm erhoben hatte. Nun lag sie an
seinem Herzen.
„Eva – jetzt – bleibst du mein?“
„Ja,“ flüsterte sie, „dein, nur dein!“
Er ließ den Brief der kleinen toten Schwester in ihren Schoß gleiten,
während er sie küßte.
„Den mußt du selbst lesen.“
Wie kurz er war! Die Zeichen fast unleserlich. Und doch der einzige
Satz wundervoll freisprechend – an dem endlich errungenen Glück
vollendend, was ihm im Augenblick – vielleicht noch unbewußt – fehlte.
„Der Uebel größtes ist die ungesühnte Schuld!“
In dieser heiligen Stunde streifte Eva von Ostried alle Bitterkeit ab.
Die Zeit des Leidens erschien ihr als eine Gnade, durch welche sie
pilgern mußte, um des Geliebten würdig zu sein. Während sie ihre Wange
an die seine schmiegte, sagte sie dankbar und demütig:
„Unsere kleine Schwester hat recht! Aber ich will noch weiter in ihrem
Sinne sühnen, um meines großen Glückes auch würdig zu bleiben!“