
Title: Landesverein Sächsischer Heimatschutz — Mitteilungen Band XI, Heft 7-9
Monatsschrift für Heimatschutz und Denkmalpflege
Editor: Landesverein Sächsischer Heimatschutz
Release date: October 6, 2022 [eBook #69101]
Most recently updated: October 19, 2024
Language: German
Original publication: Germany: Landesverein Sächsischer Heimatschutz, 1922
Credits: The Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net
Anmerkungen zur Transkription
Das Original ist in Fraktur gesetzt. Im Original gesperrter Text ist so ausgezeichnet. Im Original in Antiqua gesetzter Text ist so markiert.
Weitere Anmerkungen zur Transkription befinden sich am Ende des Buches.

Landesverein Sächsischer Heimatschutz Dresden
Monatsschrift für Heimatschutz und Denkmalpflege
Band XI
Inhalt: Kriegerehrungen aus Porzellan – Schradenwanderung – Tierschutz – Hexenabend – Wolftitz – Werbekunst in Dorf und Stadt – Die Osterblume am Wachtelberg bei Wurzen – Ein altes Patrizierhaus – Gefährdete heimische Pflanzenwelt – Zur Geschichte des Bibers in Sachsen – Vom romantischen zum denkenden Wanderer – Das Abkochverbot – Antons – Die Pflege der Schönheit und Eigenart der Heimat als soziale Aufgabe gerade für unsere arme Zeit – Das Raubwild im Haushalte der Natur – Landheimbau – Heimatschutzbewegung und Hotel – Die Pfarrlinde in Markersbach bei Gottleuba – Die Bekämpfung der Nonne – Johann Pezel und die Turmsonate – Schußpreise für Raubvögel – Schattenbäume für den Hof – Förderung des Anbaues von Nußbäumen – Die Postsäule von Aue
Einzelpreis dieses Heftes M. 50.–, Bezugspreis für einen Band (aus 12 Nummern bestehend) M. 200.–, für Behörden und Büchereien M. 50.–. Mitglieder erhalten die Mitteilungen kostenlos, Mindestjahresbeitrag M. 50.–, freiwillige Einschätzung erbeten
Geschäftsstelle: Dresden-A., Schießgasse 24
Dresden 1922
Im letzten Hefte unserer Mitteilungen erbaten wir freiwillige Beiträge zur Erhaltung der Zeitschrift. Wenn dieses stattliche Heft im alten Umfange noch erscheinen kann, so ist dies ein Erfolg obiger Bitte, eine Tat unserer Mitglieder. Und dabei hat noch nicht einmal ein Zehntel unserer 21000 Freunde unserm Aufruf entsprochen. Wir haben so viele und so begeisterte Zuschriften über den Wert unserer Mitteilungen, unserer grünen Hefte, empfangen, daß unser Wille »durchzuhalten« noch stärker geworden ist, selbst von einer Einschränkung des Umfanges der Zeitschrift wollen unsere Mitglieder nichts wissen. Unser herzlichster, aufrichtiger Dank sei denen gesagt, die uns halfen. An die, die uns ihr Scherflein noch nicht brachten, die vielleicht glaubten, es hat doch keinen Zweck, ein Durchhalten sei unmöglich, richten wir die Bitte, dem letzten Hefte die Zahlkarte zu entnehmen und uns einen Betrag freiwillig für weiteres Durchhalten zu spenden. Die Zeiten haben sich sehr, sehr geändert, mehrere Millionen Mark sind notwendig, damit die Sächsischen Heimatschutz-Mitteilungen weiter erscheinen können. Wenn uns alle unsere 21000 Mitglieder helfen, wird es möglich sein, und darum bitten wir.
Dresden, im September 1922
Landesverein Sächsischer Heimatschutz
Dr. ing. e. h. Karl Schmidt, Geh. Baurat
O. Seyffert, Hofrat Professor
[133]

Die Mitteilungen des Vereins werden in Bänden zu 12 Nummern herausgegeben
Abgeschlossen am 1. September 1922
von der Staatlichen Porzellanmanufaktur, Meißen
Ein neuer Kunstwillen hat sich in alle Zweigströme der schaffenden Künste ergossen, ist über mannigfache Klippen dahingebraust und oft auf Untiefen geraten und hat doch immer und unaufhaltsam die Schaffenden zu neuem Ausdruck mit fortgerissen. Es ist wohl ratsam, von Zeit zu Zeit im bunten Wirbel der neuen Erscheinungen Ausblick zu halten und bei solchen Erzeugnissen der werdenden Kunst, die ernster Kritik standhalten, prüfend haltzumachen.
Noch vor Kriegsende und besonders nach der Niederlegung der Waffen empfand man es als sittliche Pflicht, dem Gedenken der Opfer des verlorenen Krieges würdige Erinnerungszeichen zu setzen und ging mit opferwilligen Händen und viel Liebe an diese Aufgabe heran. Wenn auch einer stattlichen Reihe dieser Denkmäler ein guter künstlerischer Erfolg beschieden war, so wurden doch andernorts diese gutgemeinten Ehrungen gar zu oft katalogmäßige Ware oder gar kunstwidrige Greuel schlimmster Art. Da ist es uns eine rechte Freude, an dieser Stelle von einer Reihe guter Leistungen auf einem Sondergebiet plastischen Schaffens berichten zu können, nämlich von den in der Staatlichen Porzellanmanufaktur Meißen entstandenen Kriegergedenktafeln. Man wird fragen, eignet sich Porzellan denn zu monumentalem Ausdruck, ist es denn nicht zu zart und zu flüssig für den[134] Ausdruck des Herben, den man doch bei solchen Toten geweihten Denkzeichen fordern muß? Man sehe sich aber darauf die hier abgebildeten Erzeugnisse unserer Meißner Manufaktur an, und man wird zugeben müssen, daß ihnen durchaus jene ernste Würde innewohnt, zu der uns der Anblick oder die Erinnerung an liebe Tote zwingt. Und doch ist das nicht die einzige Empfindung, die uns bei Versenkung in die Tafeln beherrscht, ich finde bei aller Getragenheit spiegeln diese mannigfachen Gebilde sämtlich auch eine Erhobenheit wider: sie sind frei von Mutlosigkeit und wirken in dieser für unser Volk so entsetzlich hoffnungslosen Zeit wie ein feiner Sonnenstrahl, der sich zwischen schwarzen Winterwolken durchstiehlt, als wolle er sagen, es muß doch endlich Frühling werden.

Gehen wir zunächst von den Kleinsten der hier vorgeführten, sämtlich vom Bildhauer Paul Börner stammenden Keramiken aus. Sie wurden für malerische Dorfkirchen geschaffen und in deren Innern an sorgfältig ausgewählter Stelle in die Architektur der Kirchenwände eingefügt. Während die für einen Gefallenen des Siebziger Krieges gewählte Tafel in der Großdobritzer Kirche (Abb. 1) wegen ihres strengen und trotz der geringen Größe monumentalen Ausdruckes hervorgehoben werden muß, erinnert das in der Liebschützer Kirche aufgehängte Ehrenzeichen (Abb. 2) mit seinen trauernden Engelköpfen an ältere Vorbilder[135] volkstümlicher Kunst. Es ist ein rührender Zug schlichter Liebe in dieser Weihetafel; das ist eben das Beste an diesen Schöpfungen, daß sie weit entfernt vom Reindekorativen und der Ausdruck eines inneren Erlebnisses sind.
Nicht ganz auf gleicher Höhe steht die in der Porzellanmanufaktur selbst aufgehängte Gedenktafel für die Gefallenen des Werkes. Inschrifttafel und ihre Umrahmung sind nicht in so innige Verbindung gebracht worden, als man hätte wünschen müssen, auch ist das Figürliche ohne genügenden inneren Zusammenhang. Aber im ganzen zeigt auch diese Arbeit, was aus dem Porzellan herausgeholt werden kann.

Nun aber zu der im ehrwürdigen Meißner Rathaus an bedeutungsvoller Stelle des Treppenhauses angebrachten Gedächtnistafel (Abb. 3) für die städtischen Beamten und Angestellten. Eine Schriftfläche von schöner Umrißlinie fügt sich formvollendet zwischen die Konturen der sie tragenden trauernden Frauengestalten. Ausdruck von Gesicht und Haltung, Faltenwurf und plastische Abtönung, alles klingt in prächtiger Harmonie zusammen. Trotz starker stilistischer Sonderart ist das Übertriebene, das wir oft an neueren Kunstwerken bedauern, vermieden. Komposition und Ausdruck, Ideeliches und Stoffliches halten sich die Wage.
Ich glaube nicht zuviel zu sagen, wenn ich behaupte, daß uns solche Leistungen ein gut Stück weiter vorwärts bringen und vielleicht tragen unsere Abbildungen dazu bei, festeingewurzelte Vorurteile gegen das neue Kunstwollen zu mildern und zu beheben.
[136]
Aber auch im braunen Böttcherporzellan, dessen Wiederbelebung die Porzellanmanufaktur tatkräftig und mit schönem Erfolg fördert, wurden verschiedene Versuche angestellt. So wurde den im Kriege gebliebenen Arbeitern und Angestellten der Meißner Jutespinnerei eine derartige Tafel geschaffen. Etwas nüchtern und vielleicht etwas fabrikmäßig wird manchem die hierfür gewählte, streng geometrische Zusammenreihung von Namenstafeln erscheinen, aber das erfordert eben gerade der Organismus eines großen Industriewerkes, wo das Gefühlsmäßige zurückgedrängt, intimere Bildungen ausgeschlossen werden.
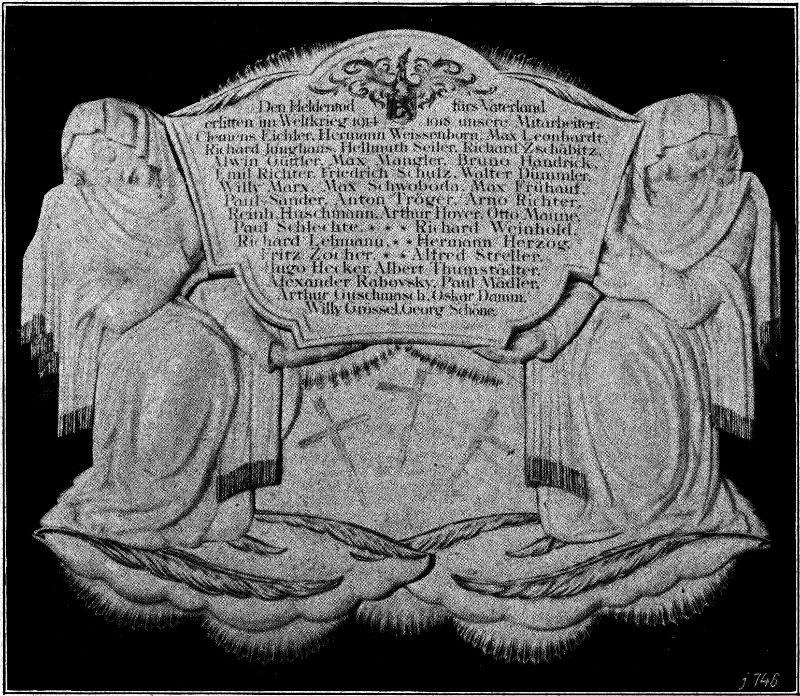
Welche reichen Entwickelungsmöglichkeiten sich darbieten, zeigen die beiden Schlußabbildungen (Abb. 4). Die obere, für die Kirche in Röhrsdorf bestimmte Platte beweist, verglichen mit der Großdobritzer Platte, auf wie einfachem Wege der kleinere Entwurf für eine größere Zahl von Gefallenen nutzbar gemacht werden kann, die untere Zeichnung, für eine studentische Verbindung berechnet, aber lehrt uns, wie durch Zusammenreihung kleiner Namenstafeln derartige[138] Gedächtnisplatten je nach der Eigenart der Wandflächen und je nach der Gefallenenzahl entstehen und reizvoll gestaltet werden können.
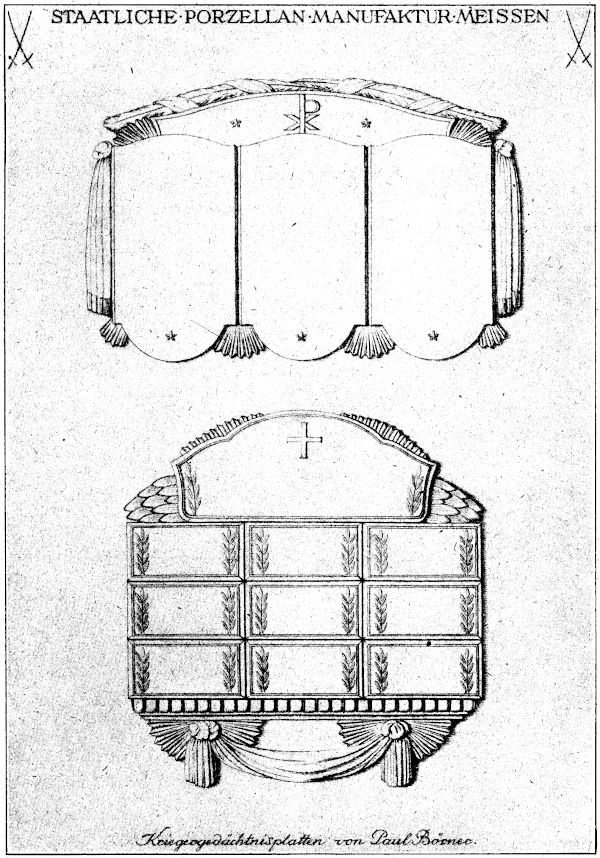
Es ist hier nicht möglich, auf die in Ausführung begriffene Umwandlung der mittelalterlichen Nikolaikirche in Meißen zu einer Kriegergedächtniskirche einzugehen. Auch dieses großzügige Unternehmen wurde der Staatlichen Porzellanmanufaktur anvertraut. Der Lösung dieser Aufgabe sehen wir mit Spannung entgegen, die nicht ganz frei von Sorge ist, daß der Eingriff in das mittelalterliche Gepräge des Kircheninneren zu stark werden könne, aber der Vorwurf, daß wir bei solchen Aufgaben die Gegenwart und ihre künstlerischen Tendenzen nicht zu Worte kommen lassen, soll nicht erhoben werden können, auch war die Erhaltung dieses vom Verfall bedrohten unbenützten Bauwerkes nur dadurch möglich, daß man ihm einen neuen Zweck gab.
Dr. Paul Goldhardt.
Von Edgar Hahnewald
Drei Großenhainer Kasernenjahre lang lag der bewaldete Hügelzug nördlich der flachen Ebene vor meinen Augen. Dahinter lockte das Unbekannte, die Ferne, die Freiheit, das Unerreichbare. Diese blaue Mauer verstärkte das Gefühl des Gebundenseins: darüber hinaus konnte der Blick nicht schweifen. Felddienstritte drangen nie bis dahin vor, denn dicht vor diesen Hügeln lief die Zickzacklinie der Grenze; der blaue Wall schied Sachsen und Preußen.
Die Karte zerlegte den Hügelzug in benannte Gruppen: das Pfeifholz, die Heidelberge, die Finkenberge, den Latschenberg. Aber das waren Namen, die vor der sinnlichen Wahrnehmung nichts besagten – da erhob sich die blaue Mauer, fern und unerreichbar. Dahinter lag eine andere Welt, von der Sehnsucht sich eine Vorstellung bildete, die sich nicht an die Karte band. Der kleine Hügelzug, an sich um nichts bedeutender als tausend andere Hügel in der weiten Welt, bekam eine Bedeutung: er begrenzte drei Jahre lang einen Lebensbereich.
Später, als man die Freiheit genoß, so weit zu wandern wie der Geldbeutel reichte, lockten andere Fernen. Die symbolische Hügelmauer nördlich von Großenhain geriet in Vergessenheit.
Aber eines Tages fand ich in den Kursächsischen Streifzügen von Otto Eduard Schmidt die Schilderung einer Fahrt um die Meißnisch-Lausitzische Nordostgrenze. Und während ich las, trat jener blaue Grenzwall wieder deutlich vor mich hin. Und aus der Begrenztheit dreier Großenhainer Jahre rückte ihn das Buch in den weitgespannten Rahmen der Kulturgeschichte.
Denn: dieser Hügelzug, der aus der Röderniederung südlich von Elsterwerda allmählich ansteigt und in einer ungefähr zwanzig Kilometer langen Schlangenlinie nach Osten streicht, um sich in der Gegend von Ortrand im Lausitzer Wald- und Hügelland fast unauffällig zu verlieren, war in der Zeit der germanischen[139] Eroberung tatsächlich ein Grenzwall, der zwei Welten trennte. Diesseits, südlich der Hügelmauer, lag das von fränkischen und thüringischen Kolonisten durchsetzte meißnische Land, jenseits dämmerten die slawischen Gaue der Niederlausitz.
Es war kein Zufall, daß die Deutschen nur bis zu jenen Hügeln und nicht weiter vordrangen, denn hinter diesem Wall bildete ein unzugänglicher Urwald ein natürliches Hindernis. Im Norden begrenzte ihn ein zweiter Hügelzug. Dazwischen fließen heute die Pulsnitz und die Schwarze Elster in einem sauberen, nahezu gradlinigen Spitzwinkel aufeinander zu, um sich bei Elsterwerda zu vereinigen. Damals aber versumpften sie im Urwald zwischen der nördlichen und südlichen Hügelkette. Berge, Urwald und Sumpf bildeten die natürliche, schützende Grenze, eine viele Stunden lange und mehrere Stunden breite Flächengrenze, wie sie damals die Deutschen liebten. Sie hatte schon die Semnonen und Hermunduren, die Lusizi und Dalaminzier voneinander geschieden. Sie schied nun die Mark Meißen von der slawischen Niederlausitz. Sie scheidet seit der Abtrennung der Provinz Sachsen sächsisches und preußisches Gebiet. Die fränkischen Kolonisten erstiegen gerade noch den Wall und schoben an seinem Nordhange entlang eine Reihe von Siedlungen gegen den Urwald vor, die alle heute noch daliegen: Wainsdorf, Merzdorf, Seiffertsmühl, Groeden, das schon die Dalaminzier als Deckung gegen die Liusitzen angelegt hatten, Hirschfeld, Großthiemig, Frauwalde, Großkmehlen (Kmehlen bedeutet Hopfendorf), Burkersdorf und Ortrand. Vermutlich waren diese Siedlungen durch Verhaue untereinander verbunden; sie bildeten eine Grenzwacht auf vorgeschobenem Posten.
Unter den Dörfern erstreckte sich der düstere, sumpfige Urwald. Und »wenn sich nun im Herbste die weißen Nebelschleier aus dem Sumpfwald hoben und das Brüllen des Elchs und des Auerochsen aus der Tiefe herauftönte, da fürchteten sich nicht nur die Ahnfrau und die Kinder, sondern auch den Männern war es wie eine tröstende Verheißung der Nähe des Christengottes, wenn der Sakristan in der Dämmerstunde das Glöcklein läutete. Sie nannten den unheimlichen Wald, den sie vor sich sahen, den Schraden, das heißt den Wald der bösen Geister (althochdeutsch: scrato = böser Geist, neuhochdeutsch: Schratt.)«
Diese Kunde gab mir Schmidts Buch.
Noch heute heißt jenes Gebiet zwischen den beiden Hügelketten der Schraden, und der Volksmund spricht von den Schradendörfern. Der Schradenwald ist längst verschwunden, das Oberbuschhäuser Forstrevier, das einen kleinen Teil der Ebene bedeckt, hat mit seinen schnurgeraden Gestellen gar keine Ähnlichkeit mit einem Urwald. Wo einst Elch und Auerochs durch unwirtliche Wildnis brachen, breiten sich heute künstlich entwässerte Wiesen und Felder. Aber immer noch hebt sich der Schraden schon auf der Karte als eine andere Welt von seiner Umgebung ab. Neben der dichter besiedelten Großenhainer Pflege und von ihr durch das dunkle Gestrichel der Hügel getrennt, liegt er als große leere Fläche ohne Dörfer, durchsetzt von dem feinen Raster, der auf der Karte sumpfige Wiesen kennzeichnet,[140] durchzogen von geradlinigen Straßen und Wassergräben und den beiden feingezackten Bändern der Pulsnitz und der Schwarzen Elster. Vor allem diese beiden Flußkanäle geben dem Schraden das besondere Gepräge.
Und man beschließt: da liegt eine andre Welt und da mußt du einmal hin.
Das stand als Vorhaben lange fest. Und nun, auf einer Osterwanderung von Radeburg nach Großenhain am Zickzacklauf der Röder entlang kam wieder dieser blaue Hügelwall in Sicht und lockte.
Am nächsten Morgen fuhr ich in den Schraden.
In der Nacht setzte starker Regen ein, und am Morgen regnete es noch. Es regnete während der Bahnfahrt nach Ortrand, es regnete auf die samtbraunen Äcker, auf die malachitgrünen Saaten, auf fröstelnde Dörfer in der Ebene. Es regnete in Ortrand. Ein herbstlich kühler Wind trieb graue Wolken über die kleine Stadt, deren gefällige Bescheidenheit selbst noch bei solchem Wetter anheimelt. Man geht nur einige Minuten und steht schon am jenseitigen Rande des Städtchens. Die hohen Bäume einer sauberen Allee rahmen hübsche Kleinstadtbilder ein: halb übersponnen von sprossendem Gezweig gucken braune Dächer über die Obstgärtchen weg, eine alte Kirche ragt, umringt von Dächern, Narzissen betupfen regengrüne Graspläne, über andere Dächer weg spitzt ein keckes Kapellentürmchen, ein Wasserstrahl gulkert in einen Steintrog, eine Frau in verwaschenem blauem Rock und blauer Hausjacke kommt und setzt ihren Eimer unter den Strahl und macht sich gar nichts aus dem Regen, draußen liegen grüne Wiesen mit Baumreihen an Wassergräben. Das alles, vom Regen bespritzelt, von grauem Gewölk überflogen, sah recht hübsch aus. Dabei gab es keine großen Geschichten mit Lichteffekten. Dach, Wiese, Acker, Garten gaben sich dem Regen so naiv grün, braun, rotbraun hin, wie sie eben von Haus aus sind.
Und als die Frist bis zum Abgange des Zuges nach Großenhain zurück bald verstrichen war, hörte der Regen auf. Fünf Minuten später lag Ortrand hinter uns und Kmehlen vor uns zu beiden Seiten der Allee mit den hohen Bäumen. Links stieg ein bewaldeter Hügelzug aus Feldern auf. Das war die blaue Mauer, und jetzt marschierten wir hinter ihr entlang.
Kmehlen, das alte Hopfendorf, hat zwei Sehenswürdigkeiten: einen reichgeschnitzten, reichvergoldeten niederländischen Flügelaltar des Brüsseler Bildschnitzers Jan Bormann, ein Werk, von dem die Kunsthistoriker heute noch nicht wissen, wie es in das weltferne Schradendorf geriet, und ein Wasserschloß. Schmucklos und dunkel steigen die Mauern aus dem tiefen Wassergraben auf, der das burgartige Schloß umzieht. Schwere, runde Ecktürme verstärken den Eindruck der Wehrhaftigkeit. Spätere Zeiten haben Blumen, gefällige Holzbrücken, verschnittene Hecken hinzugefügt, und wohl auch die Renaissancegiebel sind später hinzugekommen, die[141] die Schwere des dunklen Daches auflockern und gleichsam das Schloß leichter gegen den Himmel aufstreben lassen. Aber man kann sich das Schloß wohl gut in die graue Schradenvergangenheit zurückdenken, wenn in Novembernächten die Nordstürme in den alten Kastanien zausen, wenn der Regen auf das Dach rauscht und um das feuchte Dunkel der Gräben Schatten aus Nordlands-Balladen ziehn: »Der Sturmwind brauste im Kamin, die Hunde heulten laut am Tor …«
Freundlicher, gleichsam sommerlich auch unter Aprilwolken liegt das Wasserschloß Lindenau in der Pulsnitzaue. Von Kmehlen geht man auf lichten Wegen nur ein halbes Stündchen bis dahin, aber Schloß und Dorf Lindenau zählen schon zur Lausitz, weil sie jenseits des Flusses liegen. Diese Landschaft hat einen eigenartigen, frohstimmenden Reiz. Unter lichten Birken und breitästigen Eichen fließt die Pulsnitz heran. Zwischen hochbogigen Bäumen sieht man hinaus auf den weiten Schraden, auf die Vorpostenkette der Dörfer am Hügelhang. Linker Hand liegt ein lockerer Auwald. Muskulöse Eichen, riesenstarke Erlen, weißstämmige Birken mit dem feinsten Zweigregen um sich, tausend weiße Anemonen blühen zu ihren Füßen, Linden mit der feinen Kuppelarchitektur ihrer noch kahlen, eben erst sprossenden Äste, saftige Wiesen darunter, und Wasserläufe von allen Seiten – wie ein alter englischer Park liegt das da. Und dann wird es wirklich ein Park. Rhododendronbüsche breiten sich unter Bäumen aus, Edelkoniferen treten zu schönen Gruppierungen zusammen. Es ist kein Zaun da, der den Schloßpark abschließt – ein Graben mit samtbraunem Wasser ersetzt ihn. Und dann steht ein heiteres Schloß mitten drin, ein Schloß mit Renaissancegiebeln rechts und links und einem schlanken Turm in der Mitte. Gegenüber, in der Reihe der Wirtschaftsgebäude, steht ein Torhaus mit einem Türmchen. Und geht man durch das weitgewölbte Tor, so steht dahinter eine weiße, ländliche Kirche, und an einer geraden Straße mit hohen Bäumen reiht sich das Dorf auf. Parkweg und Wassergraben zwischen Schloß und Torhaus überspreiten uralte Linden mit ihrem Gezweig. Kastanien sprossen da und dort, Lärchen streben auf, von den grünen Funken der aufbrechenden Knospen umschwärmt, und hinter Gezweig und Gezweig steht das Schloß, der schlanke Turm vor der Baumfülle des Parks, von stillen Wässern umzogen, vom Bogen des Tores eingerahmt. Man ahnt, wie sonnig und schattig, wie licht und kühl an blühenden Junitagen das alles sein wird.
Das ist Lindenau, Linden-Au an der Pulsnitz.
Und dann die Pulsnitz selber.
Es regnete wieder. Während wir im Dorfgasthaus einen Kaffee tranken (die Wirtin plättete in der Gaststube und draußen bauschte der Wind eine Karussellplane) hatte es begonnen. Vor uns lagen einige Stunden Weg durch den Schraden, ohne Haus, ohne Dach – noch konnten wir umkehren, nach Ortrand zurückgehen.
[142]
Aber vor uns zog die Pulsnitz hinaus in die Weite, ein schmales Silberband zwischen glatten Grasdämmen, in der nebligen Ferne verschwindend. Das lockte uns hinaus.
Und nun lag der Schraden vor uns, um uns.
Man tritt in diese Landschaft, wie man einen Raum betritt – mit einem Schritt. Da liegt die Parkaue mit ihren Bäumen, mit dem Schloß, mit dem Reiz einer gewissen Verfeinerung – und da breitet sich der Schraden, die einsame Ebene im Regengrau, mit Wasserspiegeln und Sümpfen und Torfstichen, mit Birkenalleen und verstreuten Bäumen im Grenzenlosen.
Grenzenlos – so lag der Schraden vor uns. Der Horizont verschwand im Grau. Alle Formen lösten sich auf und wurden weich im Gesprühe, das uns der Wind entgegentrieb. Es regnete nicht entschieden, es war mehr ein nässendes Wehen, als ob fortwährend die Kohlensäurebläschen eines Selterwassers ins Gesicht spritzelten. Und nach einer halben Stunde war man naß. Dabei sickerte durch die übereinander hintreibenden Wolkenschleier ein milchiger Lichtschimmer, der das Grau ringsum durchscheinend machte und keine Trostlosigkeit aufkommen ließ. Die Landschaft überließ sich einer Melancholie, die ihr selber wohltat.
In den flachen Wässern spiegelte sich der geronnene Himmel. Durch das Wasser sproßte spitzes Gras. Regenperlen bedeckten das junge Grün mit einem ganz zarten Silberreif. Sumpfdotterblumen tupften die Wiesen mit ihrem selbstzufriedenen Gelb. Es war ein Vergnügen, die fetten, fleischig knapsenden Stengel zu brechen und den leuchtenden Strauß wie einen Klumpen Sonne durch den silbergrauen Tag zu tragen.
Geradefort, kilometerweit, wie mit dem Lineal gezogen, durchschneidet die Pulsnitz den Schraden. Der Moorgrund schimmert durch die Flut – klarflüssiges, samtbraunes Glas scheint zwischen grünen Uferrändern dahinzufließen. Im Dialekt der Gegend heißt das Flüßchen »die Pulse« – das Wort gibt das gleichmäßig ruhige Wallen dieses Wassers lautmalerisch wieder. Blickt man aber geradeaus, so liegt die Pulsnitz als gestrecktes Silberband in die grüne Ebene eingelassen. Hohe Dämme, ebenso geradlinig gezogen wie der Fluß selbst, fassen die Ufer ein. Manchmal steht ein Baum dicht dabei, ein Gebüsch wächst halb auf den Damm herauf, eine helle Birkenallee kommt von weither, steigt über die Dämme und zieht weiter, eine Brücke spiegelt sich im Fluß, vereinzelte Bäume stehen nah und fern in den Sumpfwiesen, und weit drüben, halb verloren im Grau, dämmert der Hügelzug mit den Schradendörfern.
Stundenlang schritten wir auf dem »Pulsdamm« dahin. Weit und breit war kein Mensch. Einmal ging ein Bauernwagen über eine ferne Brücke – Karren, Pferdchen, Brücke und ein Baum dabei trafen sich für ein Weilchen als feingeschnittenes[143] Schattenbild grau in grau über dem Silberfluß, dann verschwand das lautlose Gefährt hinter flockigem Gebüsch und wir waren wieder allein in der weiten Landschaft, unter dem verschleierten Himmel, der als graue Riesenwand von der flachen Erde aufstieg und unter dem Fluß und Damm, Baum und Wiese groß und einsam ihre stillen Reize ausbreiteten.
Über den naßgrünen Wiesen flatterten schwarzweiße Kiebitze im Taumelflug. Unaufhörlich erfüllten sie die Luft mit ihren besorgten Rufen. Manchmal klingt es schnalzend: knuiuiui knuii, manchmal erregt, durch die Luft fallend: kiwitt – kiwitt. Kiebitzrufe im Nebel – in der Erinnerung steigt die Einsamkeit russischer Landschaften auf. Sand und Sumpf und Nebel im Frühlingslicht und Kiebitzschreie im litauischen Moor: kiwitt – kie-witt …
Das Sprühen hatte aufgehört – man empfand es kaum noch, so gut stimmte es zu dieser Landschaft. Die grauen Wolken flogen höher. Von den Hügeln in der Ferne hoben sich die Schleier. Die Dörfer grüßten.
Und nun standen wir an einem Kreuzweg. Geradeaus blinkte die Pulse. Und quer zu ihrem Lauf zog eine Straße durch das weite Land, eine vom Regen reinlich gewaschene Straße, von weißstämmigen Birken gesäumt. Das zarte Gezweig flutete wie gelöstes Frauenhaar über der hohen Wölbung zusammen. Unter den Birken hin liefen Gräben mit klarem Wasser, in dem grüne Gewächse wie von Glas umschlossen sproßten.
Die Pulsnitz lockte und die Straße lockte. Wir schlugen die Straße ein und marschierten unter den Birken hin. Draußen hinter der Säulenreihe der weißen Stämme lag die weite Ebene. Fichtenwald mit schnurgeraden Schneisen. Verträumte Kanäle. Und wieder die Ebene.
Und wieder ein samtbrauner Fluß zwischen hohen Dämmen: die Schwarze Elster. Der Fluß ist breiter und die Dämme sind höher, aber reizvoller ist die Landschaft an der Pulsnitz.
Wir gingen von Plessa nach Elsterwerda immer auf dem Elsterdamme hin. Rechts begrenzten Hügel die kargere Landschaft: der nördliche Grenzwall des Schradens. Links, leicht verschleiert im kühlen Grau weitete sich die eigentliche Schradenlandschaft mit Gräben und Wässern und Dämmen und Sümpfen und dem lockeren Geflock der Bäume in der Wiesenaue und mit dem graublauen Hügelsaum in der Ferne. Als dunklerer Streifen und ganz allmählich an den Elsterlauf heranbiegend zog drüben der Pulsnitzdamm durch die Ebene, an den man an der Elster zurückdenkt und den man noch einmal gehen wird, im Hochsommer, wenn die Mittagsglut über dem duftenden Heu der Schradenwiesen zittert.
[144]
Als ich vor vielen Jahren mal in Ziegenrück übernachtete, lag im Zimmer meines Gasthofes ein altes Schwarzburg-Rudolstädter Gesangbuch von 1856, das ich aufschlug und folgendes schöne Lied darin fand:
Warum ich das alte Lied ganz hersetzte? Weil es eine berechtigte Klage der Tierschützer ist, daß die christliche Kirche sich wenig um die Tiere kümmert. Beweis: Die gähnende Leere der Gesangbücher, soweit der Tierschutz in Frage kommt. Es gab aber eine Zeit, wo es hierin besser war. So z. B. enthielt das alte Magdeburger Gesangbuch von 1837 eben dieses und auch ein anderes gutes Tierschutzlied.
Heimatschutz umfaßt unbedingt auch Tierschutz. Ich glaube, der Satz bedarf keiner besonderen Begründung. Pflanze und Tier beleben erst die an sich tote Rinde. Es ist daher nicht zu verteidigen, wenn selbst zu wissenschaftlichen Zwecken Vögel, die zu Zeiten[145] (nur zu gewissen Zeiten!) schädlich sind, in maßloser Weise in Unzahl abgeschossen werden, um ihren Mageninhalt zu untersuchen. Dadurch muß die Natur notwendig verarmen und kein Geringerer als ein Brehm hat schon auf die bedauerliche Tierarmut Westeuropas hingewiesen. Im allgemeinen vollzieht die Natur selber den notwendigen Ausgleich und tritt einer übermäßigen Vermehrung einer Art entgegen. Wir können also Herrn Prof. Dr. Hoffmann nur recht geben, wenn er Einspruch erhebt gegen den Abschuß zahlloser Elstern, und was noch weit schlimmer ist, von so seltenen Vögeln wie Wasseramseln, die man nur noch an Gebirgswässern trifft, ferner von insektenfressenden Singvögeln. Und beistimmen muß ihm jeder, wenn er sagt, daß der durch die Magenuntersuchung unter der Vogelwelt angerichtete Schaden viel größer ist als der Nutzen, den diese Untersuchungen uns und den überlebenden Artgenossen gebracht haben. Nisi utile est quod agimus, vana est gloria nostra (Hufeland).
Dr. Pause.
Von Dr. phil. Gerhard Stephan
In der Nacht des 30. April zum 1. Mai reiten die Hexen zum Brocken, um dort mit dem Teufel ihre alljährliche Versammlung abzuhalten. Auf ihrer Fahrt nach dem Harz verwünschen und verzaubern sie Haus und Hof, Felder und Gärten. Doch vor offenem Feuer scheuen sie zurück, deshalb werden im Kamin und auf Bergeshöhen mächtige Brände unterhalten. Die Grundstücke werden durch Kreuze, die mit Kreide an die Türpfosten gemalt werden, geschützt, auch die Anfangsbuchstaben der heiligen drei Könige, C(aspar), M(elchior) und B(althasar), werden gern dazugeschrieben.
So geschah es im Mittelalter. In unserer Zeit glaubt kein Mensch mehr an diesen tollen Unfug, aber die Sitte des Feuerbrennens und der Kreidebemalung hat sich vielerorts, besonders auch in katholischen Gegenden, erhalten. So auch bei uns im Kamenz-Bautzner Bezirke, und zwar besonders in den wendischen Gegenden, während die deutschen Gebiete nur in ihren Grenzstreifen sich am »Hexenabend« beteiligen.
Die Jugend ist es natürlich, die diese Sitte hochhält. Tagelang vorher sieht man die Jungens von Haus zu Haus laufen, um sich einen alten Besen zu erbetteln. Und auch gar mancher, der noch nicht ausgedient hat, muß dran glauben nach dem bekannten Motto: »Geh weg, oder ich find’ch«. Die Besen werden schön mit Holzwolle und ähnlichen brennbaren Stoffen ausgestattet, besonders Teer und Petroleum werden gern verwendet, und nun ruhen sie im Schuppen – den Abend erwartend.
Doch damit man nicht selbst den teuflischen Geistern verfällt, wird man von einer liebevollen Hand »bekreuzelt« oder, in schlichtes Deutsch übersetzt, einem der Rücken mit Kreide vollgeschmiert. Da kann man oft recht erboste und anderseits wirklich »teuflisch« sich freuende Menschenkinder beobachten. Aber merkwürdig: Es scheint, als ob nur der Choleriker eines solchen »Schutzes« vor dem Reich des Satans bedürfe!
Es beginnt kaum zu dunkeln, da brennen schon die Feuer auf den Höhen. Wir steigen den Kamenzer Hutberg hinan. Vor uns und hinter uns ein unendlicher Schwarm. Denn der »Hexenabend« ist ein Ereignis. Das weiß auch der geschäftstüchtige[146] Hutbergwirt – im alten Gasthaus hat er – zeitgemäß – eine »Ef-Zet-Likörstube« eingerichtet. Nun, wir nehmen sie nicht in Anspruch, sondern wenden uns lieber der »Mark« zu, wo auf der Höhe ein gewaltiges Feuer brennt. Und daherum die »Hexen«, das heißt eigentlich sollten es ja gerade deren Vertreiber sein, aber im Volke, wo sich die »historischen« Zusammenhänge etwas verwischt haben, sind es eben die »Hexen«. Sie schwingen ihre Besen im Kreise. Einem feurigen Rade gleicht es von fernen. »Auch die brave Polizei ist wie gewöhnlich schnell dabei«, – um den unvergleichlichen Busch in etwas abgeänderter Form zu zitieren – ihr Zweck wird ersichtlich aus dem immer wiederkehrenden Mahnwort: »Daßerr mirr ni de Felderr zerrtrretet«.
Wir blicken in die Ferne. Soweit das Auge nach Osten und Südosten schaut – Feuer und Feuerräder. Die wendische Gegend. Über fünfzig kann man zählen, die vorderen noch groß und mächtig, dazwischen öfters der Schatten vorbeihuschender Gestalten – es sieht ganz unheimlich aus. Nach dem Horizont zu wird es immer kleiner und die fernsten Feuer – in der Wittichenauer, Königswarthaer und Bautzner Gegend grüßen nur als kleine Punkte. Anders ist das Bild gegen Westen. Hier hemmen allerdings die letzten Ausläufer der Kamenzer Berge einen weiten Blick, aber soviel ist doch ersichtlich: außer in den nächsten Orten, wie Lückersdorf und Gelenau, gibt es nur vereinzelte Brände. Das Gelände liegt im Schatten der Nacht. Die Deutschen Kolonistendörfer. So zeigt sich auch hier der Unterschied zwischen zwei Volksstämmen, aber wie überall mit der »Übergangszone«.
Unsre hiesigen »Pfadfinder«, unter ihrem tätigen Feldmeister Mai, feierten ihren »Hexenabend« besonders schön. Sie waren schon am Nachmittag ausgerückt – zum Galgenberg, in einen alten Steinbruch, der sich schluchtartig nach hinten zog. Hier begann bald ein rühriges Treiben. Nachdem jede Gruppe um ihren Wimpel ihre mitgebrachten Sachen (was mochten die wohl alles enthalten?) verstaut hatte und die große Fahne auf der Höhe eingerammt war, um Gönnern und Freunden den Weg zu zeigen, gings an die Arbeit. Da mußte zunächst Holz herbeigeschafft werden – also zog ein Holzholerkommando mit einem Wagen los in den nahen Busch. Die andern aber scharten sich um Satanas, den Oberteufel, und probten für die »Wolfsschluchtszene« des »Freischütz«. Und als sie dann im Abenddunkel beim Schein des Holzfeuers gespielt wurde – »frei« nach Carl Maria von Weber oder besser Friedrich Kind, mit Hexen und Teufeln, mit Irrlichtern und Schrecken, da wirkte sie in ihrer Umgebung recht hübsch. Dann kam ein fröhlicherer Teil: Man sprang über das Feuer unter allerlei Heil- und Weherufen, die Besen wurden entzündet und der Schwarm der Hexen und »Hexriche« machte einen feierlichen Umzug um den Steinbruch. Einem vorbeifahrenden Zuge, aus dem die Klänge einer Gitarre ertönten, wurde eine besondere Ehrung durch das Schwenken der Besen zu teil – der Anblick für die Zuschauer war prächtig. Volkslieder am verglimmenden Feuer und ein fröhlicher Heimmarsch bildete den Abschluß für diesen Tag, während der folgende, der 1. Mai, der ja bekanntlich dieses Jahr schulfrei war, unsere Pfadfinder – carpe diem – draußen am Deutschbaselitzer Teiche in einem Waldlager bei selbstgekochtem Essen wiedersah.
[147]
Von Dr. Ing. Hubert Ermisch, Leipzig
Bilder von J. Mühler, Leipzig
Dort, wo sich im Süden der weiten Leipziger Ebene die ersten Höhenzüge zeigen, liegt freundlich eingebettet die alte Töpferstadt Frohburg.
An einem prächtigen Vorfrühlingstage wanderte ich durch die stillen Straßen des Städtchens. Wer ahnt, daß hier der Sitz einer Kunsttöpferei ist, die – besonders durch die Ausstellungen auf der Leipziger Messe – einen Weltruf hat?
Auf der Höhe hinter der Stadt, wo die alte Chemnitzer Straße die stattlichen Rittergutsbauten und das Schloß hinter sich läßt, bietet sich dem Auge ein überraschend schönes Landschaftsbild. Der Horizont wird gerahmt von den weitgedehnten Waldungen, hinter denen das berühmte Schloß Gnandstein liegt. Links ragen über die Hügel die zwei nadelspitzen Türme der Kirche von Greifenhain. Vor uns an den Wald geschmiegt, zum Teil von drei Seiten vom Wald umgeben, liegen die beiden fast zu einem verschmolzenen Dörfer Streitwald und Wolftitz, zwei als Sommerfrischen und Ausflugsorte allen Leipzigern wohlbekannte Stätten. Weiter nach rechts an der alten Chemnitzer Straße, umgeben von prächtigem alten Baumbestand, liegt das Rittergut Wolftitz. Der erste Anblick erweckt den Eindruck eines alten umwehrten Ritterschlosses. Ein spitzgedeckter Turm ragt zwischen den hohen Giebeln und breitgelagerten Dächern hervor. Die ganze Gruppe der Gebäude und Bäume bildet ein so einheitliches Ganzes, daß es in kunstliebenden Augen nur helle Freude wecken kann. Und noch eine weiter rechts vor dem Walde auf einem vorgelagerten Hügel sichtbare schöne, alte Baumgruppe zieht das Auge unwillkürlich an. Man denkt an alte heidnische Opferstätten oder an die Hünengräber der Lüneburger Heide. Diese Vermutung barg etwas Wahres in sich: Es ist die Totengruft, die Begräbnisstätte der Herren von Einsiedel, die seit 1455 Besitzer von Schloß und Rittergut Wolftitz sind. Ein selten schöner, weihevoller Platz, würdig des alten Herrengeschlechtes.
Ich wandere von der Höhe hinter dem Frohburger Schloß talwärts auf Wolftitz, meinem Ziele zu.
Kunstgeschichtliche Streifzüge soll man nicht unvorbereitet unternehmen. Das hat bei Schloß Wolftitz einige Schwierigkeiten. Die »Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler«, die sich zur Zeit der Bearbeitung dieses Gebietes im Wesentlichen mit kirchlichen Bauten beschäftigt, sagt über das Schloß nur wenig. Die geschichtlichen Nachrichten stammen aus dem bekannten Schumannschen Ortslexikon von Sachsen. Aus diesen beiden Quellen kann man entnehmen, daß der Bau des heutigen Schlosses Wolftitz aus dem fünfzehnten Jahrhundert stammt und 1625 bis 1626 restauriert wurde. Beides wird bestätigt durch die Architekturreste, die sich am Bau befinden. Die schlichten Fasenfenster, die spitzen Giebel sind noch gotischen Ursprunges, die Balkendecken und die meisten anderen künstlerischen Schmuckteile stammen aus dem zweiten Viertel des siebzehnten Jahrhunderts. Der Bau scheint im dreißigjährigen Kriege, der in dieser Gegend erst in den dreißiger Jahren des siebzehnten Jahrhunderts wütete, wenig gelitten zu haben.
[148]
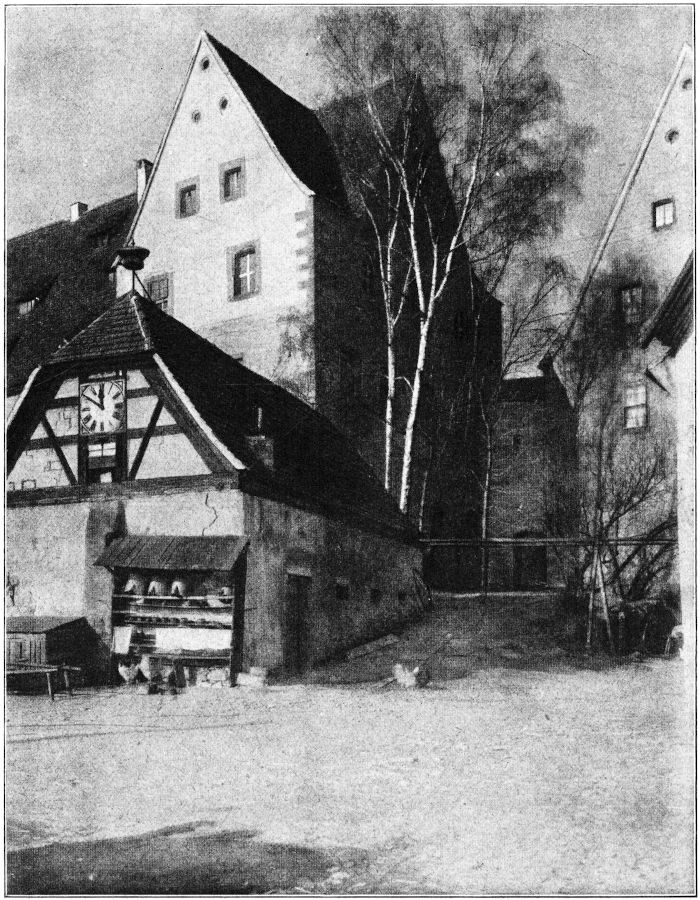
Die Landstraße führt zwischen dem Schloß und der ehemaligen Schmiede hindurch. Neben der Schmiede sieht man ein schönes barockes Tor und seitlich zwei gleichfalls barocke Figuren. Das Tor führt nach dem sogenannten Lustgarten, der jetzt der Obstgarten des Schlosses ist. Der Name in Verbindung mit den Architekturresten weist auf die Zeit, da man an die Herrensitze kleine nach französischer[149] Art zugestutzte Architekturgärten anfügte. Was der prachtliebende August der Starke in und um Dresden in großem Stile ausführte, das fand in etwas bescheidenerem Umfang wohl auch hier Aufnahme.
Gegenüber diesem Portal zum Lustgarten lag der jetzt leider verstümmelte Eingang zum Schloßhof. Wie er gestaltet war, das läßt sich nur mutmaßen aus dem im Torpfeiler vermauerten Schlußstein mit der immer wiederkehrenden Jahreszahl 1625. Der Blick in den Hof ist überaus erfreulich. Breitästig steht ein schöner alter Nußbaum in seiner Mitte. Links, das Wirtschaftsgebäude mit seinen großen Toren barg wohl dereinst Rosse und Wagen, darüber zieht sich eine reizvoll ausgebildete Holzgalerie. Der Hof wird beherrscht von dem Treppenturm, der sich an den einen Flügel des Schlosses – wohl ursprünglich dem eigentlichen Wohnflügel – anlehnt. Nach der äußeren und inneren Gestaltung des Treppenturmes möchte ich auch ihn dem Umbau der Jahre 1625 bis 1626 zuschreiben. Wo dereinst die alte Uhr die Stunden kündete, hat nun ein Wasserbehälter zu Nutz und Frommen der Schloßbewohner seinen Platz gefunden.
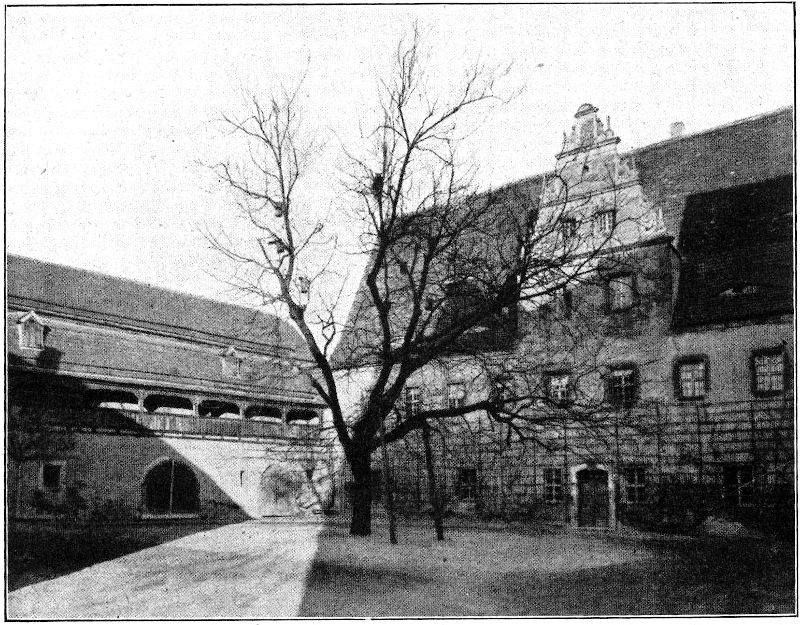
Leider stört in der schönen Harmonie des Schloßhofes das neben dem Hofeingang gelegene Försterhaus, dessen Architektur sich so gar nicht den anderen[150] Bauten – besonders durch das recht flache Dach – anschmiegt. Wie leicht hätte man mit nahezu gleichen Mitteln diesen Mißton vermeiden können.
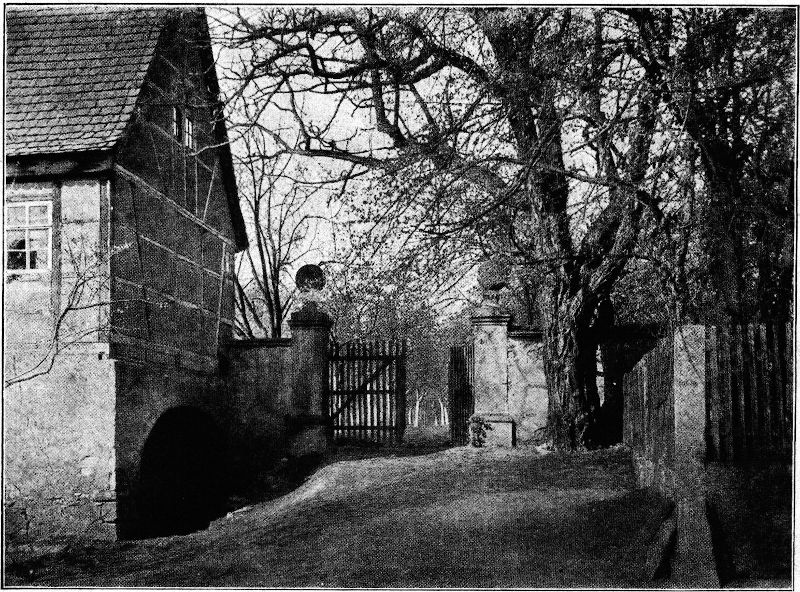
Das Schloß, das sich mir gastlich öffnete, betrat ich zunächst in dem dem Hoftor gegenüberliegenden Flügel, den ein Spätrenaissancedachaufbau über dem Portal ziert. Vermutlich war dies der Saalbau. Die neuerdings erfreulicher Weise freigelegten alten gekehlten Balkendecken gehen durch die ganze Geschoßtiefe hindurch, das Erdgeschoß ist überwölbt. Eine für die Zeit der Erbauung immerhin breite gradläufige Treppe führt zu diesem großräumigen Obergeschoß hinauf. Heute ist das ganze Geschoß durch eine Anzahl eingefügter Trennwände und durch eine liebevolle Behandlung der Wände, Decken und vor allem der Fensternischen zu einer sehr behaglichen und sonnigen Wohnung umgewandelt worden. Die freigelegten Balkendecken fügen sich trefflich ein. Jede Zeit hat dem Schlosse ihre Spuren hinterlassen und ich glaube, daß dieser Ausbau der ehemaligen Festsäle des Schlosses ein Musterbeispiel genannt werden kann für unsere Zeit. Wir sind arm geworden in der großen Welt. Unsere Heimat, unser deutsches Heim wird aber die Quelle werden für einen neuen Reichtum.
Im Gegensatz zu diesem ausgebauten Saalbau trägt der an den Turm sich anschließende Flügel noch ganz den Charakter des alten Herrenschlosses. Über dem[151] architektonisch ausgeschmückten Rundbogentor sind die Wappen derer von Einsiedel und von Haugwitz angebracht. Eine weite überwölbte Halle empfängt uns. Die Schlußsteine dieser Gewölbe zeigen übereinstimmend das Wappen der Einsiedel. Von der Halle aus ist die sogenannte Kapelle zugänglich, ein rechteckiges geräumiges Zimmer mit einer schönen gegliederten Holzdecke, die die Inventarisation auf die Jahre um 1530 datiert. Hier haben nach alten Verträgen die Pfarrer von Frohburg aller vierzehn Tagen zu predigen. Schumann erzählt, daß das Rittergut nach Eschefeld eingepfarrt sei, während eigentümlicher Weise das Dorf zu Greifenhain gehöre. Die Kapelle enthält ein schönes Taufbecken, Nürnberger Arbeit aus der ersten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts, auf dem der Sündenfall dargestellt ist. Außerdem sind eine Anzahl Bilder beachtlich, unter denen zwei echte Chranachsche Gemälde: Georg den Bärtigen und eine Judith darstellend, sowie die beiden von Luther und Melanchthon aus der Chranachschen Schule wohl die bedeutendsten sind. Die Farbstimmung des ganzen Raumes ist überaus wohltuend. Möchte doch die beabsichtigte Neubemalung – wenn sie wirklich nicht zu umgehen ist – nur einem Künstler ersten Ranges übertragen werden. Denn bei der nahezu gänzlichen Architekturlosigkeit des Raumes bedeutet die Farbstimmung alles.
Die eigentlichen Wohnräume des Schlosses liegen im Obergeschoß. Sie gruppieren sich um den schönen bildergeschmückten Vorsaal. Auch hier oben scheinen noch unter den Putzflächen der Decken, an denen vereinzelt Stuckverzierungen zu sehen sind, die alten Balken der Renaissance der Wiedererweckung zu harren. Schöne eingebaute Schränke, der Schmuck der noch alten Renaissancetüren und vor allem auch eine Anzahl Öfen aus der Zeit um 1800 lenken den Blick auf sich.
Sehenswert sind auch die Holzkonstruktionen der riesenhaften Dächer. Da ist noch nichts zu spüren von Holzmangel. Die Holzstärken wirken wie ein Spott auf unsere »Normen«.
An das Herrenhaus schließt sich der große Pachthof an. Besonders die Blicke von dort auf die hochgiebligen Flügel des Schlosses sind malerisch.
Prächtig schön ist der Wald, der zu dem Rittergut gehört. Der verstorbene Förster August Schmidt und der jetzige Förster Böttrich, der nunmehr dreißig Jahre diesen Wald und seinen guten Wildbestand behütet, haben sich damit ein lebendiges Denkmal gesetzt. Möchte jeder, der dort Stunden der Erholung genießt, wie vor allem allsommerlich die vielen Sommerfrischler von Wolftitz und Streitwald mithelfen die Schönheit dieses Waldes zu behüten.
Dort wo die Dorfstraße auf die Hauptstraße stößt, steht der von den Schloßherren gestiftete Kriegergedächtnisstein von Wolftitz. Schlicht und ernst, ein Zeichen der schweren Zeit, aber auch ein Zeichen dafür, daß man heute wie dereinst vor dreihundert Jahren Sinn für edle schöne Kunst in Wolftitz hat.
[152]
Der Kampf der Heimatfreunde gegen die Auswüchse des Reklamewesens hat in der Regel seinen tiefsten Anlaß in der geringen künstlerischen Qualität der Reklamemittel, die allein der Zweck, zu wirken, heiligte.
In der schönen Gottesnatur draußen zwar richtet sich die Kampfansage wohl an das Auftreten geschäftsmäßiger Anpreisungen überhaupt: denn in der Stille des Waldes, an grünen Hängen und zwischen blumigen Auen kränkt den Wanderfrohen schon der Versuch, ihn mehr oder minder gewaltsam in seiner reinen Freude an der ewigen Schöpfung durch Hinweise auf Erzeugnisse der Industrie oder auch besonders bemerkenswerte Ereignisse des Geschäftslebens stören zu wollen. In den Straßen der großen und kleinen Städte des Landes, im heimatlichen Dorfbilde aber ist es nicht das Vorhandensein der Reklame schlechthin, was das Auge auf Schritt und Tritt beleidigt, es ist viel mehr noch die mangelnde Fähigkeit, die Anforderungen der Werbekunst mit den Gesetzen der Baukunst, des Städtebaues, in Einklang zu bringen.
Sieh, wie ungeschickt sitzt dort das grasgrüne lackierte Schild am ehrwürdig grauen Giebel des schönen alten Hauses, an dem eine schlichte deutliche Schrift in zurückhaltender Farbgebung dem Fremden dasselbe künden könnte, wie das häßliche Schild, nur in viel edlerer Sprache! Oder wie schrecklich plump hängt das himmelblaue Blechbanner mit den gußeisernen Quasten an der freundlichen Schauseite der behäbig gelagerten Herberge, der ein Wirtshauszeichen, nach alter guter deutscher Art an langer Eisenstange befestigt, der schönste Schmuck sein würde. Und dann die vielen schwarzglänzenden Glasfirmenschilder mit den steifen gelben Buchstaben! Überhaupt – fort mit dem Glas in der Außenreklame, wo es fast stets alsbald in einen unüberbrückbaren Widerspruch zu Holz und Stein des Straßenbildes tritt. Eins der schönsten Städtebilder in sächsischen Landen können wir seit einiger Zeit nicht mehr betrachten, ohne zugleich den Ärger über eine riesige, buntfleckige Glastafel hinunterschlucken zu müssen, auf der eine Unmenge verschiedener Firmen in allen Farben des Regenbogens einander überschreien, um ihre Erzeugnisse anzupreisen. Das wäre nicht nötig gewesen, denn erst kürzlich ist es der umsichtigen Verwaltung einer kleinen Stadt unser engeren Heimat gelungen, sich mit Erfolg der Entstellung des wohlerhaltenen Stadtbildes durch solcherlei Reklame zu widersetzen: Fürwahr ein schöner Beweis praktischen Heimatschutzes, der Nachahmung verdient.
Alles in allem nochmals: Nicht die Tatsache, daß Reklame gemacht wird, ist es, was uns grämt, sondern wie sie gemacht wird, wie häßlich, wie wenig überlegt, wie kunstlos. Und doch ist gegenwärtig gerade die Werbekunst derjenige Zweig der angewandten Kunst, dem Not und ungeheuerliche Teuerung im Gegensatz zu anderen Gebieten noch am wenigsten schwere Fesseln anlegten. Wir sehen ja allenthalben auch recht erfreuliche Anzeichen dafür, daß sich hier eine zielbewußte Fortentwicklung fühlbar macht. »Daß wir die Reklame als Kunst ernst nehmen, ist ein Zeichen unserer Zeit.« Man sucht und findet neue Wege. Mit Wohlgefallen ruht das Auge da und dort auf einer schönen alten Schauseite, die in neuem, kräftig farbigem Gewand erstrahlt, mit einer klaren ruhigen Schrift das verkündend, was noch vor kurzem viele grelle Schilder und Tafeln durcheinanderbrüllten. Trefflich ausgeführte Plakate finden wir allerorten. In der eindrucksvollen Dresdner Werbeschau konnten wir viel finden von dem, was wir suchen und in weitester Verbreitung wünschten: wie, von den besten Künstlern geführt, eine neuartige Werbekunst neue Bahnen sucht und zu schönen Hoffnungen wohl berechtigt. Weite Gebiete stehen dieser Kunstart offen, große Entwicklungsmöglichkeiten liegen auf ihrem Wege: auch in der Gegenwart, denn die Reklame birgt, wenn sie gut ist, schon in sich die Deckung der für sie aufgewendeten Kosten. Umsomehr gilt es jetzt, diejenigen Kreise, die die praktische Ausübung des Reklamewesens betreiben, auf die hohe Bedeutung der ihnen anvertrauten Kulturaufgabe hinzuweisen.
Die Werbekunst im heutigen Sinne ist eine durchaus neuzeitliche Kunstart, die Überlieferung fehlt ihr. Darum ist sie bisher so fremd gewesen im Stadtbild, darum wird es ihr noch immer so schwer, sich mit ihrer Sprache hineinzuleben und hineinzufühlen in die Formensprache der Baukunst. Das wird ihr um so rascher gelingen, je gründlicher und sicherer der junge Nachwuchs der Ausübenden die Grundbegriffe von Formen- und Farbenschönheit, Schriftwirkung, Stil und[153] Materialgerechtheit beherrscht. Daran muß vor allem an Lehr- und Studienanstalten des Kunstgewerbes gearbeitet werden, wenn Handwerk und Industrie das Reklamewesen zu künstlerischer Höhe führen wollen. Trefflich hat kürzlich in Dresden der Reichskunstwart Dr. Redslob den Weg zur Erreichung dieses Zieles vorgezeichnet: »Unser Streben muß dahin gehen, die Kunst aus ihrer vereinzelten Stellung als Fach zu befreien, und wieder alles mit Kunst zu erfüllen, wie es einst selbstverständlich war. Der Wunsch nach Formengebung muß wieder etwas ganz Notwendiges sein. Höchst wichtig ist dabei, die enge Verbindung zwischen Kaufmann und Künstler zu schaffen, ohne die unser ganzes Wirtschaftsleben leiden muß.«
Aber auch du, der du deine Heimatstadt, dein Heimatdorf lieb hast, sollst an dem Ziel, die Reklame zu veredeln, mitarbeiten, kannst mitarbeiten. Denn dein Auge ist mehr, als du denkst, geübt, wohl zu entscheiden, was dem vertrauten Straßenbild, dem schönen alten Marktplatz mit dem Brunnen, den schlichten Bürgerhäusern oder dem guten Gasthof schadet mit zu Vielem und zu Häßlichem an Reklame, was ihnen frommt an schönem guten Beiwerk dieser Art. Betrachte aufmerksam, was da und dort an Trefflichem neu entstand und versuche, das auch in deinem Heimatort heimisch werden zu lassen. Ein gutes Wort, ein wohlmeinender Rat tun schon viel. Und sei gewiß: allmählich wird es gelingen, jene schlichtbescheidene Straßen-Werbekunst zurückzugewinnen, die vordem das Straßenbild schmückte, die nur vorübergehend von einer traditionslosen, überlauten Unkunst verdrängt worden war. Dann aber könnte etwas Unerwartetes geschehen: Reklame und Heimatschutz, bisher zwei leider so oft feindliche Brüder, würden sich verbünden zu gemeinsamem Werke, das dem schönen alten Heimatbilde wieder zu einer würdigen, bescheidenen und dabei doch wirkungsvollen Belebung durch gute Reklame verhilft.
Nicolaus
Von Professor Dr. Arno Naumann
Mit Aufnahmen von Dr. med. Hoffmann, Wurzen
Nach einem im Leipziger Zentral-Theater am Karfreitag gehaltenen Vortrag beschloß ich, in Wurzen zu übernachten, um am Ostersonnabend früh ein Naturdenkmal aufzusuchen, das mir als Mensch wie als Botaniker gleich beachtenswert erschien: »die Osterblume am Wachtelberg«.
Als Mensch reizte mich die Schönheit dieser heimischen Pflanze, die mich vordem ein einziges Mal als vereinzelter Herbstblüher am Staffelstein in Franken entzückt hatte, als Botaniker trieb es mich, diesen interessanten sächsischen Standort einer pflanzengeographisch bedeutsamen Pflanze zu besuchen.
Früh schon begab ich mich zu meinem pflanzenkundigen Vereinsbruder, Herrn Konrektor Oberstudienrat Dr. Hoffmann, Wurzen, und wanderte mit ihm bei herrlichstem Frühjahrssonnenschein zu dem eine halbe Stunde südlich von Wurzen gelegenen, Bismarckturm-gekrönten Porphyrhügel des Wachtelberges. Seine vereinzelten Birken zeigten schon den lichtgrünen Schleier sprossenden Laubes, und östlich des Gipfels breitete ein Kiefernwald seine dunklen Kronen (Abb. 1). Der Wachtelberg bietet einen erfreuenden Blick auf den Muldenlauf, dessen tote Arme der Landschaft einen besonderen Charakter verleihen. Unsere Blicke schweifen über den Wald des Rehberges, umfassen den Planitzwald und ruhen schließlich auf den fernen Auenwäldern, die sich längs eines diluvialen Flußbettes bis gegen Leipzig ziehen. Aus ihnen hebt sich die Ruine von Machern.
[154]
Wir waren zur rechten Zeit gekommen, denn überall am Südhang und an den trockenen Böschungen des Kiefernwaldes erblühte im herrlichsten Blauviolett dieses lenzholde Florenwunder, dem Linné den Namen Anemone Pulsatilla verlieh. Besser erscheint mir hierfür der selbständige Gattungsbegriff Pulsatilla mit vulgaris als Artnamen. Als deutsche Bezeichnung für diese Pflanze findet man in den Floren vielfach den Namen »Küchenschelle«, einen Namen, der in den meisten Pflanzenbüchern gedankenlos nachgedruckt worden ist. Er müßte, da er sich von der Ähnlichkeit der Blüte mit einer Kuhglocke abzuleiten scheint, besser in »Kühchenschelle« abgeändert werden. Deshalb ist der von Hallier in seiner Flora von Deutschland gewählte Name Kuhschelle annehmenswert. Wir aber wollen in unserer Arbeit den um Wurzen gebräuchlichen, so treffenden Namen »Osterblume« beibehalten und uns dieser volkstümlichen Bezeichnung freuen. Die fünf deutsche Arten zählende Gattung Pulsatilla ist besonders blütenschön und wird daher in mehreren Arten auch als lenzverkündender Gartenschmuck gepflegt, selten freilich mit glücklichem Erfolg.

Zwei weißblühende Arten besitzen wir in der hochgebirgischen Pulsatilla alpina, die auch im Harz und den Sudeten wächst und in der oft rosa überhauchten heidegewohnten Pulsatilla vernalis, die besonders häufig in Westpreußen trockene Hügel im ersten Frühling schmückt, aber auch im sächsischen Heidegebiet vorkommt (Lausa, Pulsnitz, Großenhain).
[155]
In der hellvioletten Blütenfarbe gleicht unserer süd- und westeuropäischen Osterblume die osteuropäische Schwester Pulsatilla patens, deren Grundblätter aber nicht eine doppelte Fiederung, sondern eine reizende Fingerung zeigen. Mit Entzücken denke ich noch der herrlichen Ostertage, an denen ich mit meinem lieben Vater in Nordböhmen am Kahleberg bei Kundratitz diese herrliche Pflanze zu Tausenden erblühen sah, die dunklen Basaltrücken in leuchtendes Blau hüllend. Einen ganz anderen Eindruck macht die nickende Pulsatilla pratensis, deren glockig zusammengeneigte Perigonblätter braunrot bis dunkelviolett schimmern. Im nordböhmischen Elbtal ist dieselbe, ebenfalls zur Osterzeit, auf allen trockenen Höhen und rasigen Wegrändern zu finden und führt dort den ansprechenden Namen: »Osterglocke«. In Deutschland besitzt sie besonders nördliche und östliche Verbreitung. In Sachsen besiedelt sie sonnige Stellen des Elbtalgebietes, fand in unseren Heimatschutzheften bereits in meinem Aufsatz über das Ketzerbachtal Erwähnung und ist dort auch nach Aufnahmen »unseres Ostermaier« bildlich dargestellt[1].
Die Osterblume findet sich am Wachtelberg auf trockner Grastrift mit vorherrschendem Feinrasen des Schafschwingels (Festuca ovina). Das nackte Gestein von Pyroxen-Quarzporphyr wird oft überzogen von den fingerblättrigen Polstern des Frühlingsfingerkrautes (Potentilla verna), welches zur Zeit unseres Besuches seine niedlichen goldgelben Blüten erschloß. Duftende Polster des Quendels (Thymus Serpyllum) schoben sich dazwischen, und der Besenginster hatte an seinen immergrünen Ruten bereits Blütenknospen angesetzt, während dunkle Heidekrautbüsche noch in winterlicher Zerzaustheit wie leblos dazwischenstarrten. Von anderen Pflanzen konnte ich teils aus winterlichen Resten, teils frisch sprießend erkennen: Pechnelke, Hornkraut (Cerastium arvense), Johanniskraut (Hypericum perforatum), Fetthenne (Sedum maximum), Mauerpfeffer (Sedum acre), Färbeginster (Genista tinctoria), Silberfingerkraut (Potentilla argentea), Feldbeifuß (Artemisia campestris), Habichtkraut (Hieracium Pilosella), Rispenflockenblume (Centaurea paniculata) und Golddistel (Carlina vulgaris); alles Pflanzen, welche sich mit dem Verwitterungsgrus von Silikatgesteinen begnügen.
In einem Briefe an den Landesverein Heimatschutz vom Mai 1920 sagt mein Freund, Herr Universitätsoberbibliothekar Dr. R. Schmidt, Leipzig: »Von der sonstigen Flora des Wachtelberges erfreuten mich besonders ein paar in schönster Blüte stehender Holzbirnensträucher (Pirus Achras) mit den charakteristischen Zweigdornen und große Trupps der Teesdalea nudicaulis. Pflanzen, die als Seltenheiten zu bezeichnen wären, habe ich außer Kuhschelle nicht bemerkt.«

Die Seltenheit dieser Blume bewog schon im Jahre 1910 den einsichtigen Stadtrat von Wurzen, sich an die Amtshauptmannschaft Grimma mit der Klage zu wenden, »daß die Gefahr besteht, daß sie, wenn weiterhin das Abpflücken der Osterblume durch Spaziergänger erfolgt, völlig verschwinde«. Die Amtshauptmannschaft riet dem Stadtrat, sich zunächst an den Landesverein »Sächsischer Heimatschutz« zu wenden. Dieser beauftragte den leider so früh heimgegangenen Kustos des Sächsischen Herbariums, Herrn Professor Dr.[156] B. Schorler, mit der Bearbeitung der Angelegenheit. Schorler erkundete, daß für die von der Osterblume besiedelten Triften als Besitzer der Gemeindevorstand Schmidt, Dehnitz, und der dortige Gutsbesitzer Robert Rasch in Frage kämen. Dabei betont Schorler in seinem Gutachten, »daß unsere Pflanze eine west- beziehungsweise südwesteuropäische Art ist, welche im Osten Deutschlands völlig fehlt.« In Mitteldeutschland sind die zwei sächsischen Standorte Bienitz und Wachtelberg die am weitesten nach Osten vorgeschobenen Posten und werden in fast allen Floren von Deutschland erwähnt. Die Osterblume wird am Wachtelberge sicherlich einen weit ausgedehnteren Standort besessen haben, ist aber durch Steinbruchsbetrieb und Feldwirtschaft schon recht eingeschränkt worden. Nimmt man nun hinzu, daß der Bismarckturm als Aussichtspunkt viele Besucher heranzieht, so ist die Gefahr des Verschwindens nahegerückt, zumal sie als erster Frühlingsblüher besonders lockt und in manchem Gartenbesitzer den Wunsch rege macht, dieselbe auszugraben und in seinen Garten zu verpflanzen, um sich im eigenen Heim alljährlich dieser Blütenschönheit zu freuen. Herrlich ist ja auch der in der Sonne weitgeöffnete, violette, sechszählige Blütenstern, aus dessen Mitte sich die zahlreichen goldgelben Staubgefäße wirkungsvoll abheben (Abb. 2). Die doppelt gefiederten Grundblätter der Pflanze erscheinen erst später, nur ein dicht unter der Blüte befindliches, gleich dem Stengel weißlich behaartes Hochblatt ist zur Blütezeit erkennbar. Das freiblättrige Perigon, die vielen Staubblätter und zahlreichen Pistille, welche beide auf dem Blütenboden stehen, erweisen die Zugehörigkeit der Pulsatilla zur Familie der Hahnenfußgewächse,[157] die so manches Giftgewächs umfaßt, darunter auch unsere Osterblume, welche früher infolge eines kampferartigen Stoffes als Arzneipflanze geschätzt wurde.
Nach dem Abblühen verlängert sich der Blütenstengel bis zu fast einem halben Meter Höhe und trägt die nunmehr herangereiften, mit Federschwanz versehenen Einzelfrüchte, ganz ähnlich wie die nahe verwandte Clematis. Der fedrige Fruchtschopf erinnert auch an den bekannten »Teufelsbart« ihrer Hochgebirgsschwester Pulsatilla alpina. Es ist ein köstlicher Anblick, wenn die Sonne durch die hochstengeligen Federköpfe scheint und sie wie Silberfiligran aufleuchten läßt. Schmidt, welcher an einem Osterblumenstock des Wachtelberges dreiundvierzig Blüten in verschiedenen Entwicklungsstadien zählte, bemerkt hierzu:
Nicht weniger angenehm wie der Anblick dieser Blütenpracht war mir die große Menge der Fruchtstände mit ihren heranwachsenden Federschweifen; ich schätze sie an die Tausend. Es steht somit fest, daß eine recht stattliche Zahl Blüten pflückenden Händen entronnen ist und Gelegenheit findet, ihre Samenanlagen zu reifen und sich zu verbreiten. Ich konnte beobachten, daß die Pulsatilla von ihrem ursprünglichen Gelände aus mit einigen Stöcken in die Sohle des ehemaligen Steinbruches vorgedrungen war. Dagegen fand ich an den anderen Seiten des Berges, zwischen Bismarckturm und Windmühle, nur ein einziges Exemplar.
Dies letzte beweist augenfällig, wie an den Orten regen Begängnisses dieser Pflanze von den Bergbesuchern nachgestellt wird. Es wäre aber nicht nur eine ästhetische Einbuße, wenn dieser herrliche Frühlingsbote vom Wachtelberg verschwände, sondern auch ein unersetzlicher floristischer Verlust, da uns dieses Vorkommen der Pflanze auf einen von Südwesteuropa zu uns herstrahlenden Wanderweg dieser Pflanzen hinweist, den sie mit so manchem andern Gewächs genommen. Es ist in Wahrheit eine Urkunde, welche eindringlich vom Entstehen unseres heimischen Florenbildes aus nach der Eiszeit zu uns hergewanderten Bürgern entlegener Pflanzengebiete zu uns spricht. Die mit Federanhang versehenen Früchte können, vom Winde entführt, sicherlich eine weite Luftreise unternehmen. Es ist daher sehr wahrscheinlich, daß der Wachtelberg dereinst seinen Osterblumenbestand von dem etwa zwanzig Kilometer westlich gelegenen Bienitz bei Leipzig empfangen hat. Der Bienitz selbst verdankt diesen Schmuck indirekt einem präglazialen Saalelauf, der diesen pflanzenberühmten Hügel mit herangeführtem Muschelkalk versorgt und die an den Saaleufern verbreitete Pflanze darauf angesiedelt hat.
Nach alledem kann es jedermann nur dankbarst begrüßen, daß auf Anregung der Amtshauptmannschaft Grimma schon im Frühjahr 1912 auf dem Wachtelberggelände Verbotstafeln angebracht worden sind mit folgendem Wortlaut:
Heimatschutz!
»Das unbefugte Betreten dieses Grundstücks, sowie das Abpflücken, Abzupfen und Abschneiden von Feld- und Wiesenblumen ist bei Strafe bis zu 30 Mark oder entsprechender Haft
verboten.
§§ 19 und 14 des Forst- und Feldstrafgesetzes.
[158]
»Der Wachtelberg trägt inmitten der fruchtbaren Getreidefelder noch heute seine ursprüngliche Pflanzenwelt und zeigt uns, wie die Flora der sonnigen Hügel östlich von den Leipziger Auenwäldern zusammengesetzt war, bevor der Mensch mit seinen Kulturflächen sie zerstörte. Er ist also als Naturdenkmal anzusehen, das uns wie eine wertvolle Urkunde von alten Zeiten berichtet. Dieses auch für unsere Nachkommen zu erhalten, ist unsere Pflicht. Leider sind die seltenen Pflanzen des Berges durch Abrupfen und Ausgraben schon so vermindert, daß die Gefahr ihrer völligen Vernichtung vorhanden ist. Um dies zu verhindern, hat die Amtshauptmannschaft auf die Bitte des Sächsischen Heimatschutzes das obige Verbot erlassen.«
Diese Art, Pflanzenschutz zu treiben, erscheint mir vorbildlich! Der Wortlaut eines Verbotes, das bei unerzogenen Menschen meist auf Widerstand stößt, muß eben in seiner polizeimäßigen Schärfe gemildert werden durch eine belehrende und fesselnde Angabe der Verbotsursache. Letzteres ist unbedingt angebracht, denn der Einsichtige wird sich dieser Betonung einer unabweisbaren heimatlichen Pflicht nicht verschließen. Ein in solcher Form begründetes Verbot wird selbst in unserer verbotsfeindlichen Zeit wirksam sein. Wo es noch versagt, werden auch alle anderen Mittel, welche zum Schutze von Naturdenkmälern vorgeschlagen und erdacht sind, hinfällig, denn ein gefühlsroher Mensch ist mit Nichts zu packen; er bleibt eben ein Schandfleck auf dem Kulturgewand seines Volkes!
[1] Vergleiche auch Dr. Naumann: »Praktische Wege des Heimatschutzes«, Heft 12, Bd. I, S. 417.
Aufnahme von Konrad Richter, Auerbach i. V.
Auch in Sachsen stößt der Wanderlustige gar nicht so selten auf wenig bekannte Bauten, die einer näheren Betrachtung wert sind. Alte Herrensitze und Baumgehöfte, Dorfkirchen, Rathäuser und Kleinhausbauten sind oft geschildert und dargestellt worden. Ein Patrizierhaus, wie das in der Abbildung gezeigte, findet man in Sachsen und vor allem auf dem Lande oder im Gebirge selten. Die reicheren Bürger, die in der Lage waren, sich vornehme Häuser zu bauen, suchten den Schutz der Stadt und das Zusammenleben in ihr; Patrizierhäuser auf dem Lande oder in kleinen Orten kannte man nicht.
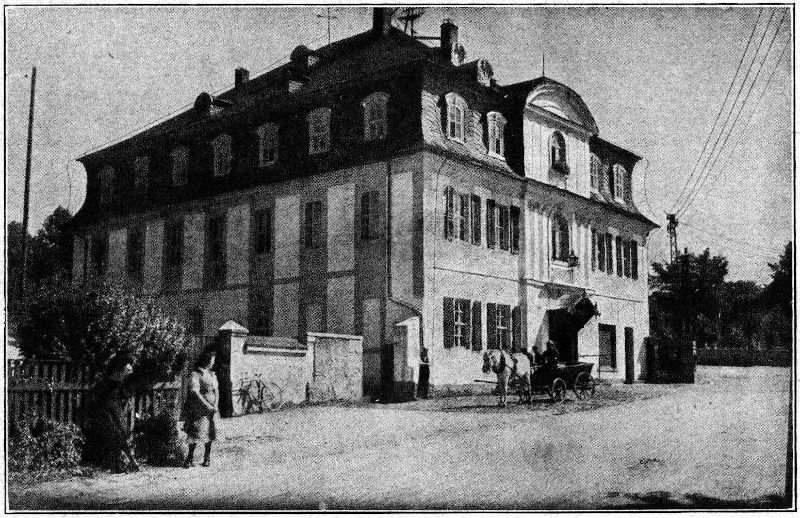
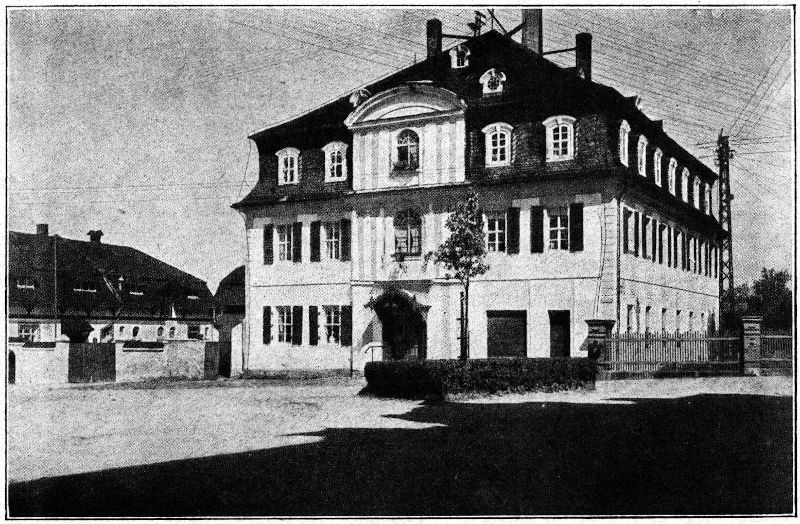
Um so überraschter ist man, in der kleinen Gemeinde Stützengrün i. V. ein so behäbiges, auf Wohlstand und Geschmack hinweisendes Haus zu finden. Der Bauherr hat zweifellos nicht irgendeine zufällige Planung durch einen Unternehmer zur Ausführung bringen lassen, er hat bewußt Form und Anlage seines Hauses geprüft und sich seinen Baumeister gesucht. Die sicherlich nicht in jeder Einzelheit fein durchgebildeten Formen des Hauses, die fast auf süddeutschen Einfluß hinweisen, lassen die Gesamtanlage doch außerordentlich wirkungsvoll erscheinen. Die horizontale Gliederung, die gleichmäßige Verteilung der Fenster und die Betonung ihrer Achsen durch gleich große Dachgeschoßfenster, die Durchführung der Achsenbeziehungen, die Hervorhebung des Einganges durch einen kleinen Giebelvorbau, die schmucken Fensterläden, die Putzgliederung und die starke Schattenwirkung des weit vorspringenden Gesimses sind die Bestandteile dieses ausgezeichneten Werkes.[160] Dazu betont die Besonderheit des Hauses noch das in dieser Gegend sonst nicht heimische Mansardendach, das aber zu diesem breitgelagerten Hause mit seiner süddeutschen barocken Form gehört.
Möge die Veröffentlichung die Freude am Finden heimischer Kunstwerke fördern.
Dr. Conert.
Von Paul Apitzsch, Ölsnitz i. Vogtl.
Ein sonnengoldner Sommertag blauet über den weiten Wäldern des südwestlichen Vogtlandes. Ich wandre in der Herrgottsfrühe mutterseelenallein von Bad Elster das Kesselbachtal aufwärts und erreiche bei der Theresienruh die sächsisch-tschechoslowakische Grenze. Zwischen Hochwald und mooriger Wiese zieht der mit granitnen Marksteinen besetzte Grenzweg dahin. Dort, wo vom Grenzpfad schmale Waldsteige nach den böhmischen Dörfern Krugsreuth und Thonbrunn abzweigen, liegen die Quellen des Kesselbaches. Lind fächeln im Frühwind auf geschwellten Moospolstern die weißen Fähnchen des Wollgrases (Eriophorum vaginatum). Dazwischen leuchten zwei Bergorchideen: die roten Blütenstände des gefleckten Knabenkrautes (Orchis maculata) und die gelblichweißen, stark duftenden Armleuchter der zweiblättrigen Platanthere (Platanthera bifolia). Zwischen Schachtelhalm und Farnkraut stehen vereinzelt, aus smaragdgrünen Blattrosetten emporragend, die veilchenblauen Blüten des Fettkrautes (Pinguicula vulgaris) und zu kleinen Genossenschaften vereinigt die mit roten Drüsenhärchen versehenen Blattsterne des rundblättrigen Sonntaues (Drosera rotundifolia), zwei immer seltner werdende insektenfressende Sumpfgewächse. An dem Höhenwege von der Theresienruh nach der Agnesruh und der Alberthöhe wächst im Preiselbeergestrüpp eine weitere botanische Seltenheit, die, außer im Vogtlande, nirgends in Sachsen vorkommt: die Buchsbaum-Ramsel (Polygala Chamaebuxus). Ihre starren, dunklen Blätter unterscheiden sich kaum vom Preiselbeerlaub, während die gelblichen Blüten denen des Waldwachtelweizens ähneln.
Wenn im Spätsommer die Waldblößen im purpurnen Glanze der Weidenröschen (Epilobium angustifolium) glühen, dann erscheinen überall an sonnigen Hängen die giftigen Blüten des blaßgelben Fingerhutes (Digitalis ambigua). Während dieser noch allerwärts im Vogtland und in andern Gebirgswäldern häufig vorkommt, ist sein gleichfalls giftiger Bruder, der rotblühende Digitalis purpurea, bereits dem Aussterben nahe. Vor zwanzig Jahren waren die purpurnen Fingerhüte im Steinicht zwischen Plauen und Elsterberg, im Triebtal und Kemnitzbachtale keine Seltenheit. Heute sucht man sie dort vergebens. Sie sind verdorben, gestorben. Ebenso gefährdet ist das Dasein der wenigen noch wildwachsenden Türkenbuntlilien (Lilium Martagon) im Burgsteingebiet und am Kandelhof bei Gutenfürst. Großstädtische Sommerfrischler und botanisierende Schüler werden dafür Sorge tragen, daß dieser Schmuck des Bergwaldes demnächst verschwindet. Im Frühherbst erscheinen dann die Heerscharen[161] der Heidekräuter oder Ericaceen. Die gewöhnliche Besenheide (Erica vulgaris L. oder Calluna vulgaris Salisb.) ist ja durchaus nicht gefährdet, wenn auch während der Kriegszeit hektargroße Flächen in Ackerland umgewandelt und ebenso große Gebiete des oberen Vogtlandes entheidet wurden und ihr Pflanzenwuchs als Stallstreu Verwendung fand. Aber sehr selten geworden ist die großblütige Sumpf- oder Moorheide (Erica Tetralix), die meines Wissens nur noch an einer einzigen Stelle des Vogtlandes vorkommt. Aus leicht begreiflichen Gründen werde ich diesen einzigen und letzten Standort nicht verraten. Ich würde sonst vielleicht das Gegenteil von dem erreichen, was ich beabsichtige.
Eine spezifisch vogtländische Ericacee, die in Otto Wünsches »Exkursionsflora für Sachsen« als »sehr selten« bezeichnet wird, ist die fleischfarbene Erica carnea oder Schneeheide. Im Gegensatz zu ihren Schwestern, die sämtlich an der Schwelle zwischen Spätsommer und Frühherbst in Blüte stehen, ist die Schneeheide ein Kind des Vorfrühlings, und ihre roten Polster sind ein hervorragender Schmuck der sächsisch-böhmischen Bergwälder bei Brambach, Schönberg, Wildstein. Ihr Vorkommen beschränkt sich im allgemeinen auf die südvogtländische Granitinsel rund um den Kapellenberg, wenn auch hier und da in den Kontaktgebieten, so im Muskowitschiefer bei Hennebach und Dürrngrün in Böhmen, Schneeheide vorkommt. Als im Jahre 1885 der Eisenbahndamm zwischen Ölsnitz und Adorf mit Brambacher Granitschutt beschottert wurde, gedieh auch dort Schneeheide; sie kränkelte aber bald und ging schließlich ein. Im Jahre 1906 versuchte ich, an der Südseite des Hasenpöhles bei Ölsnitz Schneeheide zu akklimatisieren. Kräftige Pflanzen aus den der Fürstenschule St. Afra in Meißen gehörigen Brambacher Rittergutswaldungen wurden eingesetzt. Jedem Steckling war ein großer Ballen heimatlicher Erde und reichlich Granitsand in die Fremde mitgegeben worden, um die Lebensbedingungen möglichst günstig zu gestalten. Vier Jahre später habe ich Schneeheidesamen aus Mieders und Fulpmes im unteren Stubaital in Tirol ebenfalls am Ölsnitzer Hasenpöhl unter Zuhilfenahme von vogtländischem Granitsand ausgesät. Und der Erfolg beider Versuche? Die gepflanzte Erica carnea gedieh zunächst ganz prächtig, ging aber dann stockweise ein, und die letzten spärlichen Exemplare starben 1919 am Heimweh. Der ausgesäte Same mag von vornherein die Aussichtslosigkeit der Entstehung fortpflanzungsfähiger Schneeheideexemplare geahnt haben und – ging gar nicht erst auf. Granitner Grund scheint eine Mitbedingung des Fortkommens der Schneeheide zu sein. Wesentlicher jedoch als die Kausalität zwischen Granit und Schneeheide scheint mir die hochinteressante Beziehung zwischen dem Vorkommen der Schneeheide und dem Vorhandensein radioaktiver Wässer zu sein. Es fällt unwillkürlich auf, daß die Schneeheide ausgerechnet im Bereich der sächsischen und böhmischen Bäder: Bad Elster, Brambach, Franzensbad, Karlsbad, Königswart und Marienbad vorkommt. Alle diese Bäder besitzen, wie schon Felix Heller in Band X, Heft 4–6, Jahrgang 1921 der »Mitteilungen des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz« ausführt, Quellen mit mehr oder weniger starkem Radiumgehalt. Brambach, mit der weitaus größten Zahl Macheeinheiten (2200), hat auch die stärkste Bodenbedeckung mit Schneeheide. »Es liegt da nahe, die Radioaktivität des Wassers als Ursache des Gedeihens der Pflanze anzusehen oder eine durch Radium-Emanation[162] bedingte höhere Bodenwärme.« Wissenschaftlich ausgeführte pflanzenbiologische Untersuchungen könnten hier Klarheit schaffen.
Die Schneeheide ist stark gefährdet, da sie in den blütenarmen Monaten März und April Verkaufsobjekt, Handelsware, Erwerbsgegenstand geworden ist. Trotz strenger Verbote der Amtshauptmannschaft Ölsnitz und der Bezirkshauptmannschaft Eger setzt bei beginnender Schneeschmelze alljährlich ein förmlicher Vernichtungskampf ein; und so ist das Fortbestehen der obervogtländischen Schneeheide genau so gefährdet wie das in den Alpenländern von einer rücksichtslosen Fremdenindustrie bedrohte Edelweiß.
Zu den aussterbenden Gewächsen der heimischen Wälder gehört noch ein anderes Vorfrühlingskind: der Kellerhals oder Seidelbast (Daphne Mezereum). In Wildrosenhecken und im Schlehdorngesträuch leuchten an kahlen, holzigen Stengeln scharlachrote Blüten und hellgrüne Blattspitzen. Ein starker Geruch, wie von bitteren Mandeln, entströmt den Giftblüten. Auch das prächtige Pfaffenhütchen (Evonymus europaea) unsrer Wälder wird seltener. Je charakteristischer und auffallender eine Pflanzenerscheinung ist, desto mehr fällt sie der Beachtung und – Vernichtung anheim.
Unsre Heimat hat in ihrem großen Lebeweseninventarium nicht nur aussterbende Tiere zu verzeichnen, sondern auch untergehende Pflanzen. Insoweit dieses völlige Verschwinden mit unbedingt notwendigen Kulturfortschritten ursächlich in Zusammenhang steht – ich denke an das Zurückgehen der Sumpf- und Moorflora infolge Urbarmachung bisher brachliegender Hochmoore –, ist dies wohl bedauerlich, kann aber im Interesse gesunder kultureller Weiterentwicklung des Menschengeschlechts nie und nimmer aufgehalten werden. Die Menschheit kann nicht hungern, um etwa eine seltene Torfmoosart der Nachwelt zu erhalten. Aber die gefährlichsten Feinde der seltnen Flora sind nicht die Pioniere der Kultur, sondern sogenannte »Naturfreunde«. Ihr deutschen Jungen, gefährdet nicht die letzten Reste einer sterbenden Pflanzenwelt, indem ihr die wehrlosen Leiber derselben zusammenpreßt und euerm furchtbaren Herbarium einverleibt! Diese Totenkammern, diese Leichenhäuser, diese Mumiensammlungen tragen die Schuld, wenn die eigenartigsten und charaktervollsten Vertreter unsrer heimischen Pflanzenwelt dem Tode geweiht sind. Andachtsvoll stehe ich vor der einzigen und letzten Erica Tetralix meiner Heimat. Ich rühre sie nicht an. So gehe hin und tue desgleichen!
Von Rud. Zimmermann, Dresden
Zu den Mitteilungen über das Vorkommen des Bibers in Sachsen von Dr. Koepert in Band X, Heft 1–3, Seite 56–58 der Heimatschutz-Mitteilungen seien mir einige ergänzende Angaben gestattet.
Der Biber, dessen einst viel weiter ausgedehntes Verbreitungsgebiet in Deutschland heute zu dem letzten, räumlich kleinen Vorkommen im Gebiet der Mulde und[163] der Elbe zwischen den Städten Dessau und Magdeburg zusammengeschrumpft ist, hat sich in unserem Vaterlande Sachsen ziemlich lange gehalten; sein letztes Vorkommen an der Mulde bei Wurzen ist erst in den vierziger Jahren des verflossenen Jahrhunderts erloschen. Allerdings hat er es bei uns nie zu einer besonders großen Verbreitung gebracht; die ganze Natur des Landes, das nur in seinen nördlichen Teilen dem Tiere zusagende Aufenthaltsorte bieten konnte, ist einer weiteren Ausdehnung seines Vorkommens von vornherein hinderlich gewesen. Bereits in vorgeschichtlicher Zeit stoßen wir auf seine ersten Spuren im heutigen Sachsenlande: Funde eines Unterkieferastes einmal in einer neolithischen Erdgrube bei Zauschwitz nahe bei Pegau (unweit der Elster) und zum anderen in der Heidenschanze bei Coschütz südwestlich von Dresden, sei er aus der slawischen oder der vorslawischen Zeit, denen sich spätere weitere sechs Kieferreste von Leckwitz unweit der Elbe aus slawischer Zeit angeschlossen haben, sind die ersten sicheren Belege vom Vorkommen des Tieres in nachdiluvialer Zeit und geben uns gleichzeitig Kunde von der Verwendung seines Fleisches in der »Küche« der vorgeschichtlichen Bewohner unseres Landes. In geschichtlicher Zeit nennt den Biber Lehmann in seinem »Historischen Schauplatz derer natürlichen Merckwürdigkeiten in dem Meißnischen Ober-Erzgebirge«, 1699. Er schreibt: »Biber sind nicht so gemein als die Fischotter, welche aber von den dazu bestellten Otternfängern aufgesucht und ausgegraben werden.« Jedoch dürfte er sich dabei, da der Biber seinem ganzen Wesen und seiner Lebensweise nach aber wohl kaum jemals im Erzgebirge, auf das sich ja die Lehmannsche Darstellung bezieht, vorgekommen sein dürfte, schwerlich auf eigene Erfahrungen und Kenntnisse gestützt, sondern lediglich unverbürgtes Gerede wiedergegeben haben. Wie Lehmann, so erwähnen auch andere spätere Schriftsteller den Biber nur dem Namen nach, geben aber niemals einen Fundort an oder sprechen sich über solche so allgemein aus, daß wir uns daraus kaum ein genaueres Bild von der ehemaligen Verbreitung des Tieres im heutigen Sachsen machen können. v. Fleming in seinem »Vollkommenen deutschen Jäger«, 1719, und ebenso Döbel in seiner »Jäger-Practica«, 1746, gedenken des Tieres nur kurz; v. Fleming sagt, daß »dieses Tier hier zu Lande sehr rar ist, und man nur wenige oder keinen antreffen wird,« während Döbel genauer ein Vorkommen nur aus dem Dessauischen, also überhaupt nicht aus Sachsen, anführt. Erst Dietrich aus dem Winckell erwähnt ihn 1805 in seinem »Handbuch für Jäger« »von der Mulde«, fügt dem aber leider auch wieder keine genauere Ortsbezeichnung bei, so daß sich nicht entscheiden läßt, ob er dabei auch die Mulde heute sächsischen Anteiles im Auge gehabt hat. Ebenso sagt Pölitz in seiner »Geschichte, Statistik und Erdbeschreibung des Königreichs Sachsen«, 1808–1810 (das damals aber ja noch die jetzt preußische Provinz Sachsen mit umfaßte), »daß man Biber allgemein in der Elbe und Neiße findet«, bis dann schließlich 1822 Schumann im achten Bande seines »Lexikons von Sachsen« sich als erster Schriftsteller genauer über das Vorkommen des Tieres ausläßt und uns mitteilt, daß »Biber nur an der Mulde bei Wurzen und an der Elbe bei Strehla vorkommen.« Ein uns erhalten gebliebenes Verzeichnis des während der Regierungszeit des Kurfürsten Johann Georg I. (1611–1656) auf Jagden entweder von diesem selbst oder in seinem Beisein erlegten Wildes führt[164] 37 erbeutete Biber auf, und ein weiteres aus der Regierungszeit seines Nachfolgers Johann Georg II. (1656–1680) gibt gar 597 Biber als erlegt an (die Angabe im neuen Brehm, Säugetiere, zweiter Band, Seite 443, von 347 Stück – nach Genthe – muß dementsprechend berichtigt werden) von denen neun vom Kurfürsten selbst erbeutet worden sind. Doch darf man dabei nicht vergessen, daß damals das Land eben auch noch die Provinz Sachsen mit umfaßte, die ja wohl ohne allen Zweifel den Löwenanteil an den erlegten Bibern geliefert haben wird.
Der Fang der Biber, die man lange Zeit hindurch fälschlicherweise als arge Fischräuber ansprach – erst Döbel in seiner »Jäger-Practica« läßt sie als solche nicht mehr gelten – lag im ehemaligen Kursachsen den Fischotter- und Biberfängern ob, die im Frühjahr und Herbst in ihren Bezirken von einem Amt zum anderen zu reisen und neben den Fischottern und dem übrigen kleinen Raubzeug auch dem Biber nachzustellen hatten. Sie erhielten, solange sie unterwegs waren, für sich, ihre Gehilfen und ihre Hunde eine tägliche Auslösung, und gegen Aushändigung der erlegten Tiere oder ihrer Felle noch einen besonderen Fanglohn. Der Biber scheint sich auch einer gewissen Schonzeit, allerdings weniger aus rein weidmännischen Gründen, sondern, wie es scheint, mehr einer bestimmten Verwendung seines Wildbretes wegen (als Fastenspeise), erfreut zu haben, wie aus einer Verordnung des Oberhofjägermeisters von Wolffersdorf vom 28. Februar 1750 an den Otter- und Biberfänger Kluge in Dittersbach bei Chemnitz hervorgeht. In dieser Verordnung wird dem Genannten vorgehalten, daß er »die Biber ohne Unterschied der Zeit gefangen und eingeliefert, da doch laut bereits erteilter Verordnung solches nicht eher als zur jetzigen Fastenzeit, da es hergegen daran mangelt, geschehen sollen,« und ihm von neuem anbefohlen wird, »künftig keinen Biber eher als zur Fastenzeit zu fangen und in der Haut ins Dresdener Provianthaus einzuschicken.« »Dafern ein Biber von ungefähr eingeht, so ist solcher jedoch jedesmal in der Haut zum Dresdener Provianthaus einzuschicken.« Von den Fischotter- und Biberfängern waren außer dem bereits von Dr. Koepert erwähnten, der in Hintergersdorf seinen Sitz hatte, noch drei weitere angestellt, je einer in Elbenau an der Elbe (Regierungsbezirk Magdeburg) und in Liebenwerda an der Schwarzen Elster, also in der heutigen Provinz Sachsen, der dritte in Dittersbach bei Chemnitz, dessen Bezirk gleich dem Hintergersdorfer nur auch heute noch sächsisches Gebiet umfaßte, nämlich die Ämter Augustusburg, Wolkenstein, Grünhain, Schwarzenberg, Stollberg, Chemnitz, Rochlitz, Colditz, Grimma, Wurzen, Leisnig und Sachsenburg. Im Jahre 1764 wurde durch eine Verordnung des damaligen Landesverwesers, des Prinzen Xaver, die Einrichtung der Fischotter- und Biberfänger, die mindestens bis ins siebzehnte Jahrhundert zurückreicht, aufgehoben. Es scheint, als ob neben diesen, von der Landesregierung bestellten Biber- und Otterfängern aber auch noch einzelne Ämter eigene Fänger verpflichteten. Pfau wenigstens berichtet uns, daß das Rochlitzer Amt 1651 einen solchen anstellte, der 1656 vier Biber an der Zschopau bei Waldheim fing.
Leider aber sind uns weder über die Mengen der von den Fängern erbeuteten Biber – und noch weniger über die Orte der Erbeutung sichere Angaben überliefert, es müßte dann sein, daß die fünfhundertsiebenundneunzig Biber aus der[165] Zeit Johann Georgs II. zum großen Teil den Fängern zum Opfer gefallen sind. Aus den Verordnungen an den Dittersbacher und den Hintergersdorfer Fänger aber wissen wir jedenfalls mit voller Sicherheit, daß auch im Gebiete des heutigen Sachsens Biber erbeutet worden sind, und wir werden dabei wohl kaum fehlgehen, wenn wir annehmen, daß sie ausschließlich im nordsächsischen Flachland teils an der Mulde, teils an der Elbe und wahrscheinlich auch in der Oberlausitzer Niederung, die wohl zum Bezirk des Liebenwerdaer Fängers gehört hat, gefangen worden sind.
Für die Oberlausitz erwähnt den Biber die Zittauer Forstordnung vom Jahre 1730. Jedoch ist nach Tobias hier der letzte bereits 1785 oder 1787 bei Leschwitz oder Deutsch-Ossig in der heutigen preußischen Oberlausitz gefangen worden, so daß die oben angeführte Angabe von Pölitz vom Vorkommen in der Neiße schon für ihre Zeit nicht mehr richtig gewesen ist. Immerhin wurden um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts in Bautzen noch Biberhüte angefertigt und weithin verschickt. Wann der Nager an der Elbe sächsischen Anteiles ausgerottet worden ist, ist leider nicht mehr festzustellen; außer der Mitteilung Schumanns vom Jahre 1822 besitzen wir von hier keinerlei Nachrichten mehr über ihn. Wohl aber liegen über sein Vorkommen und sein Verschwinden an der Mulde bei Wurzen einige verläßlichere Unterlagen vor. Das fürstliche Museum zu Waldenburg besitzt einen 1846 bei Wurzen erlegten Biber und außerdem befinden sich noch, wie 1909 Dr. Hesse mitteilt, im Leipziger Zoologischen Museum zwei Stücke gleichfalls von der Mulde. Das eine, ein altes Tier, trägt als Datum den 30. Januar 1809, das andere aber ist leider ohne Datum und nur mit der Fundortsangabe »Nischwitz bei Wurzen« ausgezeichnet. Hesse vermutet auf Grund der Abfassung und der Schrift des Zettels, daß es etwa gleichzeitig mit dem Waldenburger Stück, vielleicht aber auch noch bedeutend früher als dieses erbeutet sein könnte. Ein 1869 zuerst in der Gartenlaube erschienener Aufsatz Guido Hammers, der dann auch in dessen 1891 herausgekommene »Wild-, Wald- und Weidmannsbilder« übergegangen ist, berichtet von einem wildernden Schäfer in einem Dorfe bei Wurzen, der einen Biber an der Mulde in einem Eisen fing, das Wildbret mit seinen Vertrauten verzehrte, Fell und Geil aber nach Leipzig schaffte, wo es Hehler heimlich verwerteten. Nach einer Auskunft Hammers an Fickel ist der Zeit dieses Vorganges aber nicht mehr sicher nachzukommen, doch dürfte der letzte Biber auf Püchauer Flur, nördlich von Wurzen erbeutet worden sein. In dem Waldenburger Biber besitzen wir demnach das nachweisbar späteste Belegstück für das Vorkommen des Bibers in Sachsen. – Für ein Vorkommen des Tieres weiter flußaufwärts an der Mulde wie auch an der Elbe besitzen wir mit Ausnahme jener schon erwähnten Angabe von Waldheim aus historischer Zeit keinerlei Anhalt – für die Elbe allerdings läßt der schon eingangs erwähnte Coschützer Fund auf ein Vorkommen stromaufwärts bis in die Dresdener Gegend wenigstens in vorgeschichtlicher Zeit schließen – und auch des Tieres Wesen und Lebensweise sprechen, wie eingangs ebenfalls bereits angedeutet, gegen eine größere Verbreitung landeinwärts. Aus dem Gebiete der Vereinigten Mulde dürfte unser Tier in das der Zwickauer Mulde kaum weiter als über die Strecke Colditz–Rochlitz–Wechselburg vorgedrungen[166] sein – ein von Pfau als Stütze für ein häufigeres Vorkommen bei Rochlitz angeführter Flurnamen bezieht sich auf eine Stelle, deren ganzer Charakter gegen ein dauerndes Vorkommen des Nagers spricht – und für das Gebiet der Freiberger Mulde, deren Unterlauf für ein Vorkommen des Tieres viel geeigneter erscheint, als der der Zwickauer Mulde, wird sein Vorkommen aus dem Charakter des Tales bis über die Gegend Roßwein–Nossen hinaus wahrscheinlich. Einzeln mag er dann, wie der schon erwähnte Fund in der Zschopau bei Waldheim beweist, in den Unterlauf der Nebenflüsse aufgestiegen sein. Ein 1636 beim Fischen in der Mulde in Zwickau gefangener Biber, und ein anderer, 1748 auf einem Elbheger bei Niedermuschitz bei Meißen erbeuteter, dürften lediglich einzelne versprengte Tiere gewesen sein. Darauf deutet ja auch schon der Umstand hin, daß die zeitgenössischen Chronisten sie besonders erwähnen, demnach ihre Erbeutung als ein ungewöhnliches Ereignis aufgefaßt haben. – Aus der Einrichtung der Biber- und Otterfänger auf ein häufigeres Vorkommen und eine weitere Verbreitung zu schließen, ist meines Erachtens falsch; die Fänger waren zur Vertilgung von Raubzeug überhaupt angestellt und hatten dabei eben auch, soweit er in ihren Bezirken überhaupt vorkam, dem als Fischräuber angesprochenen Biber mit nachzustellen, und daß sie diesen dabei nie in großen Mengen fingen, geht deutlich auch aus der oben wiedergegebenen Vermahnung des Dittersbacher Fängers hervor, in der es heißt: »da es dann hergegen daran mangelt«, was aber bei einem häufigeren Vorkommen des Tieres nicht der Fall hätte sein können. Wenn daher Berge annimmt, daß man den Biber schon damals bei uns nicht mehr in größeren Kolonien, sondern immer nur einzeln oder familienweise antraf, so wird man ihm darin nur beistimmen können.
Ob schließlich das durch den Zauschwitzer Fund wenigstens für die vorgeschichtliche Zeit gesicherte Vorkommen des Nagers auch in der Weißen Elster noch in die geschichtliche Zeit hinein angedauert hat, läßt sich heute kaum entscheiden, doch spricht meines Erachtens nichts gegen die Annahme, daß der Biber dort wenigstens noch bis ins frühe Mittelalter hinein vorkam, und dort erst später seinem Schicksal erlegen ist.
Anmerkung: Eine Zusammenstellung des Schrifttums und der Quellen zu vorliegender Arbeit findet sich am Schlusse meiner Untersuchung »Zur Geschichte des Bibers im Gebiete des ehemaligen Königreichs Sachsen« im »Naturwissenschaftlichen Beobachter« 62, Frankfurt a. M. 1921, S. 97 bis 104.
Von Dr. Kurt Schumann
Es dürfte eine reizvolle Aufgabe sein, einmal eine Geschichte des Wanderns und des Wanderers zu schreiben, von den Tagen an, da Abraham auf Geheiß des in jenen Zeiten noch sehr menschlich mit seinen Geschöpfen verkehrenden lieben Gottes fortzog »aus seinem Vaterlande, aus seiner Freundschaft und aus seines Vaters Hause« ins Gelobte Land Kanaan bis ins Zeitalter des Wandervogels, der Feriensonderzüge und der Mount-Everest-Besteigung. Was würde da nicht alles an unseren Augen vorüberziehen, selbst wenn man von den großen Massenwanderungen[167] in den Zeiten des Krieges, der religiösen Begeisterung oder des Hungers absähe: der wandernde Prophet, der Minnesänger, der fahrende Schüler und der Handwerksbursche, der Bettelmönch und der Pilger, Goethe und Rousseau, Seume und Scheffel. Jede Zeit hat ihre Wanderer gehabt, Wanderer, die den Weg ebenso schätzten wie das Ziel, die um des Wanderns willen die warme Ofenecke mit der Landstraße vertauschten. Trotzdem kann man wohl behaupten, daß erst das vergangene Jahrhundert den Wanderer als Allgemeinerscheinung hervorgebracht hat. Mit Rousseau, dem ersten Wandervogel, fing es an, dann kamen die Romantiker, die uns die großen Volksliedersammlungen erwanderten, dann der »Spaziergänger nach Syrakus«, dann Eichendorff, dessen Wanderlieder heute noch in jedem Wald erklingen, Wilhelm Müller, der Sänger der durch Schuberts Vertonung überall bekannt gewordenen »Müllerlieder«, und Heinrich Heine, dessen Lieder aus der Harzreise die herrlichen Verse einleiten:
Im unberührtesten deutschen Waldgebiet aber steht das Denkmal Adalbert Stifters, des Dichters des »Hochwald«, am Blöckensteinsee. – Ein Hinweis auf die »Kulturstudien« Riehls, Rudolf Baumbachs »Lieder eines fahrenden Gesellen« und Fontanes »Wanderungen durch die Mark Brandenburg« möge diesen literarhistorischen Überblick schließen; denn es ist Zeit, auf eine ganz andere Kategorie von Wanderern aufmerksam zu machen, die Wandertrieb und Wanderstil ebenso stark beeinflußt haben, wie unsre wandernden Dichter.
Um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts nahm mit den glänzenden Erstersteigungen Whympers der Alpinismus einen verheißungsvollen Aufschwung. Die großen Alpenklubs bildeten sich und in ihrem Gefolge die verschiedenen Mittelgebirgsvereine, auf deren Tätigkeit und das gewaltige Wachsen der Großstädte der außerordentliche Aufschwung des Wanderns im letzten Viertel des neunzehnten Jahrhunderts zurückzuführen ist. Der Wandertyp dieser und bis zu einem gewissen Grade auch noch unsrer Zeit ist der »Tourist«. Er hat die Fehler und Vorzüge der Periode, die ihn wachsen sah, der Periode des wirtschaftlichen Aufschwungs. Er schafft sich eine praktische Kleidung, baut Wege und Hütten, sorgt für gute Karten, gründet allenthalben Sektionen, die Geld für seine Zwecke in reichem Maße zusammenbringen, macht stramme Touren, die Körper und Geist allerhand zumuten, nur eines tritt bei ihm in den Hintergrund, was die romantische Periode vor ihm in überreichem Maße besaß, die Poesie des Wanderns, das tiefe Erleben und Verstehen der Landschaft. Oder wäre es sonst möglich gewesen, daß dreißig Jahre lang vor den Augen von hunderttausend Touristen unsre Heimat in einer Weise verschandelt wurde, daß die nächsten zehn Generationen es nicht wieder gut machen können?
[168]
Da kam die notwendige Ergänzung von einer Seite, die mit dem Wandern zunächst gar nichts zu tun hatte, die nichts war als eine Protestbewegung gegen die »Alten«, gegen den Materialismus der Zeit, gegen die Unterdrückung einer Altersstufe: die Jugendbewegung, deren erste Verkörperung der Wandervogel war. Er stellte sich nicht etwa in Gegensatz zur Touristik, denn die kannte er kaum. Er entstand und gedieh am besten ja auch da, wo die Touristik nicht zu Hause war, im Flachland und in den aller Großartigkeit und aller Gebirgsvereine baren unbeachteten Mittelgebirgen Hessens und Frankens, an den Seen der Mark und in den Einöden der Heide. Er lief ohne Karte »ins Blaue«, verschmähte Wege und Unterkunftshäuser, kroch zu den Bauern ins Stroh, pfiff auf Bergschuhe, Spirituskocher und Thermosflasche, Lodenmantel und Wanderstock, »tippelte« eine Stunde und lag drei Stunden im Grase, versunken in die Schönheit eines Kiefernwaldes, eines Sonnenunterganges oder eines alten Bauerngehöftes, nährte sich von »Heuschrecken und wildem Honig« und sang dazu Lieder, die so alt waren, daß sie Arnim und Brentano hundert Jahre früher nicht entdeckt hatten. Eher vergaß er den Brotbeutel als die Laute. Das war soviel Romantik auf einmal, daß sie den älteren Zeitgenossen und ihren Vertretern auf dem Gebiete des Wanderns nur ein Lächeln entlockte. Glücklicherweise blieb es nicht dabei, und das ist das Verdienst der Alten, die innerlich jung genug geblieben waren und ähnlich fühlten wie diese Jungen, im Gegensatz zu ihnen aber deren unausgegorenes Gefühl in Willen und Tat umsetzten. Und diese Taten hießen: Dürerbund und Heimatschutz.
Die Rede von Ferdinand Avenarius vor der freideutschen Jugend auf dem Hohen Meißner im Oktober 1913 besiegelte den Bund zwischen dem Heimatgefühl der Jungen und dem Heimatwollen der Alten. Diese große Bewegung konnte nicht ohne Einfluß auf Art und Stil aller Wanderer bleiben, zumal auch die dem Wandervogel verwandten Jugendbünde diesen von ihm übernahmen. Eine der erfreulichsten Erscheinungen unsres sonst bisher so wenig erfreulichen Jahrhunderts ist die Tatsache, daß sich alle diese Bewegungen: Touristik, Jugendbünde und Heimatschutz gegenseitig befruchten und ergänzen. Und eines der angenehmsten Produkte dieser Wechselbeziehungen ist der Wanderer unsrer Tage. Das zeigt sich schon rein äußerlich. Er legt ebensowenig Wert auf die komfortable Korrektheit des Touristen wie auf die Formlosigkeit des Wandervogels. Er wandert barhäuptig und halsfrei, aber wenn die Sonne brennt oder wenn es stundenlang regnet, dann hindert ihn kein Prinzip, den Hut aus dem Rucksacke zu holen oder den Kragen zuzuknöpfen. Seine Unterkunftshäuser sind keine Hotels mit Speisekarte und Himmelbett, aber sie bestehen auch nicht nur aus einem Dach, einem Tisch und einem Heuhaufen. Dagegen legt er großen Wert darauf, daß sie sich in die Landschaft einfügen, in der sie stehen, und daß ihre Ausstattung so beschaffen ist, daß der eben geschilderte Wanderer hineinpaßt. Nichts dokumentiert besser die gekennzeichnete Entwicklung des Wanderers von 1900 bis 1920 als seine Unterkunftshütten. Welchen hervorragenden Anteil der Heimatschutz gerade auf diesem Gebiete hat, brauche ich hier nicht darzulegen.
Auch die Wahl der Wandergebiete zeigt den neuen Menschen. Er zieht nicht nur in Heide und Moor, aber er schätzt ihre feineren Reize neben den großartigen[169] der Alpen und des Schwarzwaldes, durchwandert Gebirge, die bisher die Touristik nicht gewürdigt hatte und findet in Vogelsberg und Rhön, Jura und Erzgebirge, Weserbergland und Eifel Schönheiten, von denen die Touristenweisheit sich nichts hatte träumen lassen. Er würdigt von Kulturstätten im Gegensatz zum Wandervogel nicht nur Burgruinen und mittelalterliche Nester; der Hafen von Emden und die Parks der Barockschlösser, der Leipziger Hauptbahnhof und die Münchner Galerien haben ihm nicht weniger zu sagen als die malerischen Gäßchen von Rothenburg und Kronach oder die zerfallenen Mauern von Hanstein und Hirsau. Wichtiger noch als der Gegenstand ist die Art seiner Betrachtung. Hier handelt es sich nicht nur um Mischung von Touristen- und Wandervogeleigenschaften, wenngleich ihm auch die mehr beobachtende Einstellung des einen ebenso vertraut ist, wie die mehr gefühlsmäßige des anderen. Hier setzt eine ganz neue Betrachtungs- und Erfassungsweise ein, die ich kurz bezeichnen möchte als das denkende Erleben der Landschaft. Man muß schon bis auf Goethe zurückgehen, um einen Wanderer zu finden, wie er sich jetzt als Gattung auszubilden beginnt. Es ist unmöglich, an dieser Stelle alle die Wurzeln, die zu dieser Entwicklung führen, aufzudecken (Ratzels Deutschland; die amerikanischen Einflüsse in der geographischen Wissenschaft; die Wanderfreude der jungen Geographengeneration; die Erweiterung des erdkundlichen Unterrichts auf der Mittelschule; die zentrale Stellung der Heimatkunde im Gesamtunterricht der Grundschule usw.). Nur auf eine Institution muß ich hinweisen, die diese Entwicklung unter den alten Wanderern mächtig gefördert hat, die Volkshochschule mit ihren verschiedenen Ausstrahlungen. Schließlich möchte ich noch versuchen, diesen neuesten Wanderertyp, den ich den denkenden nennen will, mit wenigen Worten zu charakterisieren. Der Hauptzug seines Wesens ist, daß er Zusammenhänge sucht und findet, wo seine Vorgänger nur Einzeltatsachen sahen. Für ihn ist ein Dorf nicht eben ein Dorf, ein Berg ein Berg, ein Tal ein Tal, ein Wald ein Wald. Die Rundlinge der Elbaue und des Niederlands haben für ihn ein anderes Gesicht als die Waldhufendörfer des mittleren Erzgebirges und die Streusiedelungen auf dem Kamme, denn er kennt ihre Geschichte und den Zusammenhang mit der Landschaft, in der sie liegen. Wenn er in den Tharandter Wald geht, genießt er vier Wälder, wo der Normaltourist nur einen sieht; denn einen ganz anderen Charakter hat der Buchenwald auf dem Basalt des Landberges als der Fichtenwald auf den weiten Porphyrdecken um Grillenburg, der Kiefernforst auf den Sandsteinhöhen des Markgrafensteins als der Mischwald an den Gneishängen des Weißeritztales. Jedes Tal, in dem junge und greisenhafte Formen wechseln, in dem auf die vom Sturzbach durcheilte Schlucht die weiche Mulde folgt, in der derselbe Bach in großen Windungen in selbstgeschaffener Aue müde dahinschleicht, läßt vor seinem Auge nicht nur die Geschichte des Tales, sondern diejenige der ganzen Landschaft aufsteigen, in die es eingebettet ist.
Für ihn bekommen die Namen der Berge, Straßen, Siedlungen, die unsre Vorfahren ihnen mit feinem Gefühl gaben, weil sie ihr Vaterland kannten und nicht nur im Munde führten, neues Leben. Die groteske Welt des Elbsandsteins klingt ihm entgegen aus den mit Stein, Horn, Hörnel, Turm, Tor, Wand, Schlucht, Schlüchtel, Klamm und Gründel zusammengesetzten Namen. Nur eine bedeutende[170] Erhebung in der Sächsischen Schweiz führt den Namen: Berg, und diese besteht nicht aus Sandstein, sondern aus Basalt: der Winterberg. Er trägt auch nicht wie alle andern den dürren Kiefernwald auf seinem Rücken, sondern Buchenwald. Ähnliche Gegensätze spiegeln sich in Namen wie: Sandschlucht – Steingrund, Verlorenes Wasser – Nasse Aue. Die Geologie des Vaterlandes wird lebendig, wenn sie uns entgegentritt in Namen wie: Grauberg (Gneis), Blauberg (Schiefer), Roter Berg, Rotes Vorwerk, Purpurberg (Porphyr, roter Quarz), Rotes Wasser (Zinnwäschen), Weißenstein, Weißenfels, Weißwasser (Kalk, Quarz, Granit), Eisenborn und Kupferberg. – Eschenhau, Eschdorf, Eichwald, Eichberg, Eichleite, Buchholz, Buchberg, Erlenschlucht, Lindhardt, Lindigt, Tanndorf, Tännigt, Kiefernhöhe, Fichtelberg und unzählige ähnliche Namen spiegeln den ursprünglichen Baumbestand wider, der leider bis auf die Flecke, wo der Untergrund es verbot, der nivellierenden Forstwirtschaft zum Opfer gefallen ist oder vom Kulturlande verdrängt wurde. Von den fränkischen und thüringischen Auswanderern, die in unsre Gebirge mit Axt und Pflug eindrangen, oder den Agenten (Locatores), die sie dahin führten und dann als Schulzen (Erbgerichte) betreuten, künden uns folgende Dorfnamen: Ullersdorf (Ullrich), Cunnersdorf (Konrad), Dittersdorf (Dietrich), Hartmannsdorf, Waltersdorf, Rathmannsdorf, Ottendorf, Leupoldishain, Nikolsdorf, Erkmannsdorf, Nenntmannsdorf, Hennersbach und Reinholdshain. Fürstennamen tragen einerseits die neben deren Schlössern gebildeten Ortschaften: Moritzburg, Augustusburg, Karlsruhe, Ludwigsburg, anderseits die Exulantensiedelungen, die unter ihrem Schutz entstanden: Georgenfeld (Gottgetreu), Johanngeorgenstadt, Carlshafen. Endlich noch ein paar Namen, die Leben und Wirtschaft unsrer Vorfahren widerspiegeln: Hammergut, Schäferei, Butterstraße, Salzstraße, Kirchweg, Mühlweg, Leichenweg, Rabenhügel und Galgenberg.
Ich glaube, diese Namenübersicht, die selbstverständlich zu einem dicken, höchst interessanten Buch ausgebaut werden könnte, zeigt schon, wie weit und wie tief das Gebiet des »denkenden« Wanderers ist. Sie zeigt aber auch, daß man nicht von heute auf morgen in diese Wandererkategorie übergehen kann. Schule, Volkshochschule, Heimatschutzvorträge und eine reiche Literatur bieten aber dem Wollenden und Ausdauernden die Mittel, um diese Ziele zu erreichen. Vielleicht ist ein andermal Gelegenheit, die sämtlichen Hilfswerke des denkenden Wanderers wohlgeordnet aufmarschieren zu lassen; an dieser Stelle will ich nur auf die Bücher hinweisen, die ausgearbeitete Touren bieten. Es sind dies in erster Linie die Dresdner, Chemnitzer, Lausitzer[2] und Leipziger[3] Wanderbücher, herausgegeben von Erdkundelehrern der betreffenden Orte. Dem vorwiegend historisch eingestellten Wanderer[171] werden Schmidts Kursächsische Streifzüge, dem geologisch interessierten die Führer von Beck, Nessig (Dresdens Umgebung), Krenkel (Nordwestsachsen), Beger (Lausitz) und Credner (Granulitgebirge) reiche Anregung geben[4].
Der unselige Krieg hat uns siebzigtausend Quadratkilometer deutschen Landes geraubt. Wie viele von uns haben sie gekannt? Wer kennt von den uns verbleibenden vierhundertsiebzigtausend Quadratkilometern nur den hundertsten Teil so, wie es eines Volkes der Denker und Dichter, Goethes und Humboldts, würdig ist? – Schöne Anfänge auf diesem Gebiete lassen schöneren Fortgang erhoffen. Die Volkshochschulkurse, die sich dieser Aufgabe widmen, sind überlaufen, und die geographischen Wanderbücher, die ebenfalls denkende Wanderer erziehen wollen, »gehen« beinahe wie Courts-Mahlersche Romane. Erfreulicherweise zeigt sich dabei auch wieder die Wahrheit des Karl Brögerschen Kriegsliederrefrains: »daß Deutschlands ärmster Sohn auch sein getreuester war.« Möchten diese Pioniere auf dem behandelten Gebiete recht bald viele Kameraden aus allen Schichten finden, die mit ihnen ein neues gemeinsames Glück sich erkämpfen in der schauenden, fühlenden und denkenden Eroberung der Heimat.
[2] Erschienen bei Wittig und Schobloch, Dresden-Wachwitz 1921/22.
[3] Verlag von Bressendorf, Leipzig 1920.
[4] Vergleiche auch die weniger geographisch als literarisch bedeutungsvollen Schilderungen in Johanna M. Lankaus Dresdner Spaziergängen und Edgar Hahnewalds Grünen Film. Weitere Wanderaufsätze von letzterem (Oschatz, Leisnig, Mühlberg, Strehla, Pulsnitz, die Röder, der Valtenberg, der Triebenberg, Stolpen, Bischofswerda, der Schraden usw.) erschienen in der Dresdner Volkszeitung. – An gleicher Stelle finden sich des Verfassers erdkundliche Wanderungen: 2. November 1921: Moritzburg, 23. November: Gottleuba-Nollendorf, 4. März 1922: die Heide, 1. April: Auf den Spuren der Eiszeit, 15. April: Durchs Meißner Land, 26. April, 13. Mai: Auf der Wetterwarte, 24. Juni: Auf der Zille.
Das vom Finanzministerium im Sommer 1921 erlassene Verbot des Mitführens von Geräten zum Abkochen in den fiskalischen Waldungen außerhalb der öffentlichen Wege hat manche Verstimmung in der Bevölkerung erregt und ist mehrfach als unbegründete Beschränkung der persönlichen Freiheit bezeichnet und deshalb auch in der Sitzung des Vorstandes Abteilung Naturschutz des Sächsischen Heimatschutzes zur Erörterung gestellt worden.
Über die Gründe, die zu dieser Maßnahme geführt haben, gab Oberforstmeister Feucht als Vorstand des Forstbezirks Schandau, der in erster Linie von zahlreichen und umfänglichen Brandschäden im Jahre 1921 betroffen worden war, folgende Aufklärung:
Bei dem anhaltend schönen, trocknen und heißen Wetter, das im Frühjahr 1921, Sommer und Herbst mit ganz kurzen Unterbrechungen geherrscht hatte, ergossen sich in die Sächsische Schweiz Ströme von Wanderern, von wilden und zahmen Wandervögeln, Pfadfindern und Bergsteigern, die zum großen Teile Geräte zum Abkochen mit sich führten.
Durch das Abkochen und vielfach grobe Fahrlässigkeit beim Rauchen sind in den Waldungen der Sächsischen Schweiz mit ihren dürren Sandböden und flachgründigen Felsbestockungen zahllose Brände von zum Teil erheblichem Umfange verursacht worden, deren Verhütung die Forstbeamten fast machtlos gegenüberstanden, da alle Warnungen und Verbote nichts fruchteten.
Das Abkochen ist, wie man hier vielfach beobachten konnte, in eine bloße Spielerei und einen groben Unfug ausgeartet, denn wenn jemand einen eintägigen Ausflug von Dresden in die Sächsische Schweiz macht, liegt wirklich keine Notwendigkeit vor, deshalb sich mit großen Kesseln zum Abkochen abzuschleppen, um so weniger, als gerade in der Sächsischen Schweiz an allen Ecken und Enden Wirtshäuser und sonstige Erfrischungsgelegenheiten in reichlichem Maße vorhanden sind.
Das kurze Vergnügen des Abkochens, das namentlich für jugendliche Gemüter mit einem gewissen romantischen Schimmer umgeben ist, kommt schließlich dem Lande und der Allgemeinheit der Steuerzahler sehr teuer zu stehen. Beträgt doch die Summe der Waldbrandschäden und Löschungskosten allein in den Staatsforsten im Jahre 1921 über dreiviertel Million Mark.
Besonders gefährlich ist dieses Abkochen neuerdings noch dadurch geworden, daß leider jetzt vielfach auch die Kletterer begonnen haben, auf für gewöhnliche Sterbliche unzugänglichen Felsen und Hörnern abzukochen, wo für die Forstbeamten das Löschen bei der schwierigen Zugänglichkeit[172] der Brandherde und bei der Unmöglichkeit, das Bodenfeuer auf solchen Felsen durch Überwerfen mit Erde und Sand zu löschen, eine ebenso undankbare wie lebensgefährliche Arbeit ist, weil genügend Erde auf diesen nur mit einer Rohhumusschicht bedeckten Felsen fehlt. Wenn sich bei solchen Löschungsarbeiten plötzlich der Wind dreht, wie dies bei Waldbränden häufig der Fall ist, so können die Arbeiter kaum schnell genug ausweichen und geraten selbst in Lebensgefahr. Wurden doch mehrfach an solchen Brandstellen die Kochgeräte aufgefunden, welche die Wanderer, die vielfach keine Ahnung von der Gefahr und dem raschen Umsichgreifen eines Waldbrandes, namentlich bei heftigem Winde, haben, bei ihrer raschen Flucht vor dem Feuer im Stiche lassen mußten.
Solche Brände auf kaum zugänglichen Felskegeln und Hörnern dauern oft wochenlang und verursachen durch die ständige Bewachung der bedrohten Bestände unterhalb dieser Felsen gewaltige Kosten, da Tag und Nacht Arbeiter zur Stelle sein müssen, um die immer wieder herabstürzenden glimmenden Humusmengen und die schließlich an den Wurzeln durchgebrannten abstürzenden alten Kiefern der Felsbestockung zu löschen, um neue Brände in den Beständen am Fuße der Felsen zu verhüten.
So währte z. B. der am Sonntag, den 26. Juni, ausgebrochene, mehrfach in den Tageszeitungen geschilderte Brand auf dem kleinen Lorenzstein wochenlang. Immer wieder flammte das Feuer, das nach dem leider zu kurzen Regen am 3. Juli bereits erloschen schien, bei stürmischem Winde wieder auf und eine der uralten Kiefern nach der anderen stürzte, nachdem sie an den Wurzeln durchgebrannt war, brennend ab, wie namentlich in der Nacht weithin beobachtet werden konnte. Auch zwei weitere Gewitterregen am 20. und 26. Juli löschten den glimmenden Humus nicht völlig, denn an den heißen schwülen Tagen des 30. und 31. Juli brach das Feuer infolge stürmischen Windes nochmals aus und erlosch erst, nachdem aller Humus an den ergriffenen Stellen verbrannt war.
Schweren Schaden hat auch der gewaltige Brand an dem Hangstein, Lamm und Lokomotive verursacht, woselbst am Sonntag, den 24. Juni, bei stürmischem Südostwind gegen 6 Hektar mit der ganzen schönen Felsbestockung dieser weit und breit bekannten malerischen Felsgruppe am Amselgrund vernichtet worden ist. Die Löschungskosten haben allein gegen vierzehntausend Mark betragen, der Schaden gegen vierzigtausend Mark.
Der ebenfalls an einem Sonntag, den 31. Juli, ausgebrochene Brand der Felsbestockung im Schrammsteingebiete brannte bis zum 11. August und erforderte eine ununterbrochene Bekämpfung und Bewachung der Bestände am Fuße der Wände, wofür ein Kostenaufwand von dreitausenddreihundertneunundsechzig Mark entstanden ist. Kleinere Brände auf unzugänglichen Felsen brachen noch mehrfach aus, z. B. auf dem Goldstein, den Thorwalder Wänden und noch am 2. Oktober, ebenfalls einen Sonntag, auf einem Felsenhorn zwischen Rauschen- und Falkeniergrund. Dieser Brand schwelte ebenfalls über eine Woche und verursachte gleichfalls umfängliche Löschungs- und Bewachungskosten von über dreitausend Mark.
In der Sächsischen Schweiz ist aber fast noch mehr als der materielle Verlust durch solche Brände vom Standpunkte des Heimatschutzes aus die unersetzliche Vernichtung der malerischen Felsbestockung der alten Kiefern mit ihren abenteuerlichen Formen zu beklagen, die vielfach jahrhundertelang den Stürmen und der Dürre in fast unbegreiflicher Weise getrotzt haben und nunmehr vielleicht niemals wieder auf diesen Höhen wachsen werden.
Ein künstlicher Anbau ist auf solchen Standorten ganz ausgeschlossen, nur die Natur selbst kann durch das eine oder andere Samenkorn, das von vielen Tausenden der Wind auf eine geeignete Stelle weht, allmählich wieder einen spärlichen Nachwuchs erzeugen. Aber auch diese Hoffnung ist nur schwach begründet, denn durch das von unverständigen Menschen an diese sonst unzugänglichen Orte gebrachte Feuer ist auch die gesamte Humusschicht, die im Laufe von Jahrhunderten sich auf diesen Höhen langsam angesammelt hatte und die einer kümmerlichen, aber zähen und ausdauernden Baumvegetation die spärlichen Nährstoffe lieferte, mit verbrannt. Die Aschenreste werden vom Regen abgespült oder vom Winde verweht und schließlich bleiben nur die nackten Felsen übrig, auf denen vielleicht nie wieder ein Samenkorn wird Fuß fassen können.
Die Versammlung hielt nach diesen Ausführungen weitere Schritte von seiten des Heimatschutzes nicht für angezeigt.
[173]
Von Denkmalpfleger Dr. Bachmann
(Aufnahmen von J. Ostermaier, Blasewitz)
Jedem Dresdner ist das kleine Landhaus wohl bekannt, das schräg gegenüber, flußabwärts der Waldschlößchenbrauerei auf dem Johannstädter Ufer gelegen ist. Fast das ganze Jahr hindurch lag bisher das Anwesen mit seinen schönen Baumgruppen trotz nächster Nähe der Großstadt in idyllischer Ruhe da, die nur von Spaziergängern oder Sporttreibenden belebt wurde. Einmal aber, im Sommer, zur Zeit der großen Vogelwiese, bildet »Antons«, wie die Dresdner es nennen, eine Insel in den hochgehenden Wogen der Volksfeststimmung.
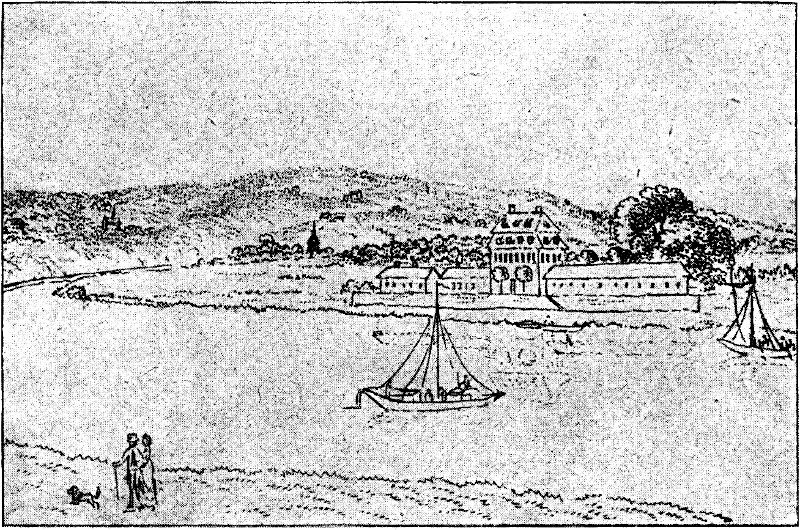
Antons ist nicht immer, wie bis zum Jahre 1921, Sommersitz einer Dresdner Familie gewesen. Carl Hollstein gibt uns darüber in Nr. 4 der Dresdner Geschichtsblätter von 1918 genauen Aufschluß. Danach wurde das Schlößchen mit dem Garten, ersteres aber noch ohne den Dachreiter und die Veranda (siehe Abb. 1), von dem Oberfloßinspektor der Elster- und Erzgebirgischen Flößerei, Christian Gottlob Anton, unter Kurfürst Friedrich August II. im Jahre 1754 angelegt und mit Gerechtigkeiten versehen: »sowohl der Gastier und Ausspannung, als auch des Branntweinbrennens, diesen und einheimische und fremde Biere und Weine einzulegen, zu verzapfen und verschänken usw.« Auch eine Kegelbahn wurde in einem der langen Wirtschaftsflügel untergebracht.
Antons war demnach auch Ausflugsort für die Dresdner und Kneipe zugleich und ist solches bis weit in das neunzehnte Jahrhundert geblieben. So wird es[174] also auch der exzentrische E. Th. A. Hoffmann gekannt haben, als er einige Jahre in Dresden verlebte, und so finden wir ja auch Antons in seinen Novellen genannt.
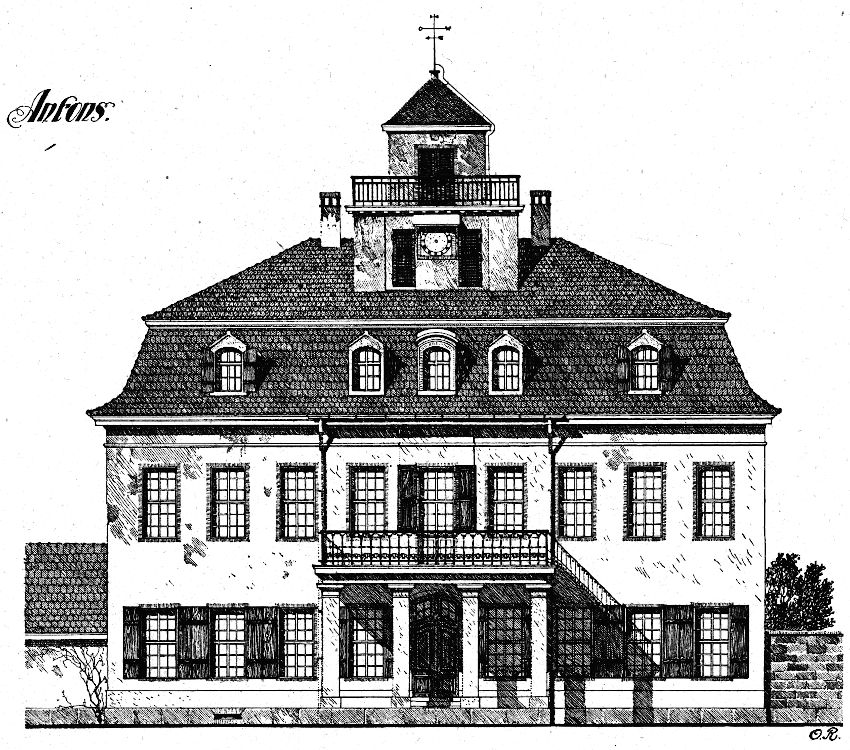
Auch Kriegsstürme sind oft darüber hinweggebraust, merkwürdigerweise ohne besondere Spuren hinterlassen zu haben. Truppen Friedrichs des Großen lagen hier während des Angriffs und der Beschießung auf Dresden und besonders heftig tobten im August 1813 um Antons, das benachbarte »Stückgießers« und das »Lämmchen« die Kämpfe zwischen Napoleons Garden und den angreifenden Russen, wie das der Freund Dresdner Geschichte in A. Brabants Buch »In und um Dresden 1813« nachlesen mag.
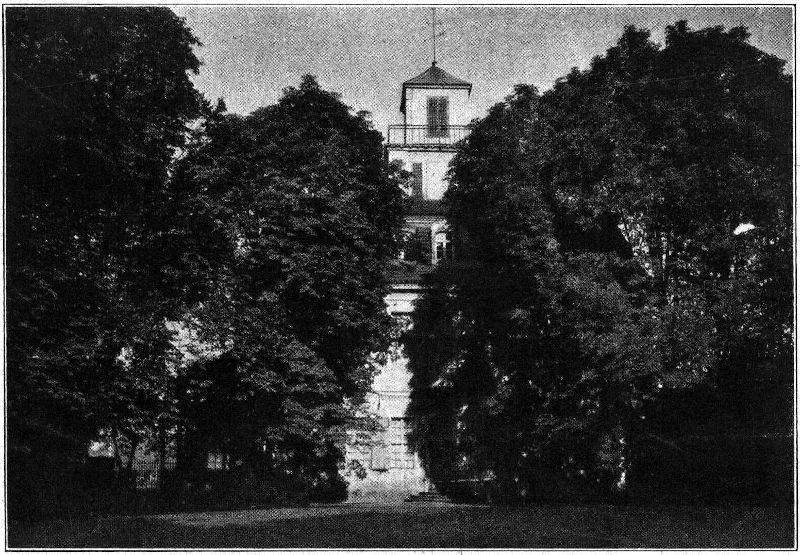
Antons hat verschiedentlich den Besitzer gewechselt. Nach dem Erbauer war lange Jahre das Anwesen Eigentum des Geh. Kriegsrates von Broizem, der eine[176] Baumallee von dem Fürstenwege (heute Blumenstraße) bis zum rückwärtigen Eingang anlegte, die aber vermutlich schon 1813 fortifikatorischen Maßnahmen zum Opfer fiel. Bis 1832 gehörte dann Antons einem Herrn von Limburger, der es an die bekannte alte Dresdner Bankiersfamilie von Kaskel verkaufte, in deren Händen es bis zur Übernahme durch die Stadt, 1921, verblieb.
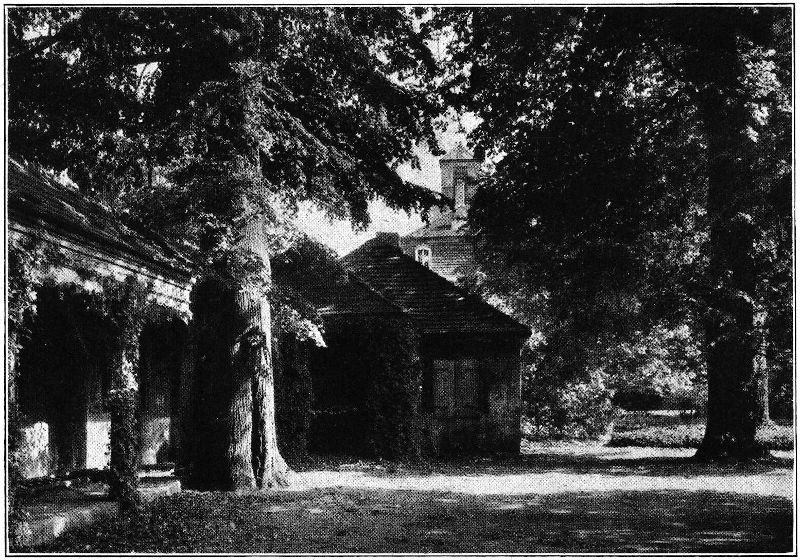
Wie die Zeichnung (Abb. 2) erkennen läßt, ist das Schlößchen selbst ein durchaus anspruchsloser, aber feingegliederter Bau, typisch für den Landhausstil seiner Entstehungszeit (1754). Was dem Ganzen aber die charakteristische Note gibt, ist die gutempfundene Eingliederung ins Landschaftsbild, geschaffen aus jenem untrüglich sicheren Geschmacks- und Stilempfinden heraus, das die Bauherren und Baumeister jener Tage auszeichnete und das wiederzugewinnen ja das Bemühen und die Sehnsucht unserer Tage ist.
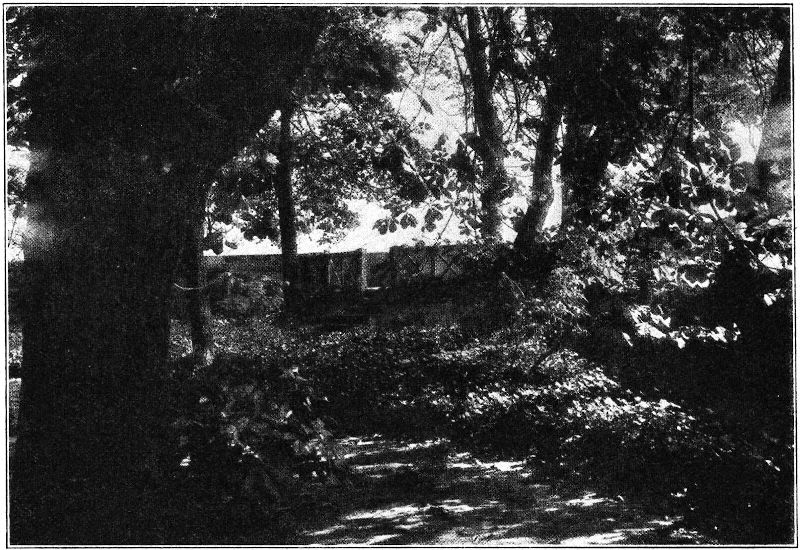
Im staatlichen Inventarisationswerk (Bd. Dresden 3, Seite 738) gibt Cornelius Gurlitt uns eine kurze Baubeschreibung, desgleichen Mackowsky in »Erhaltenswerte bürgerliche Baudenkmäler in Dresden«. Die in den Abmessungen durchweg bescheidenen Räume gliedern sich zu seiten einer Mitteltreppe. Im Erdgeschoß ist unter anderem ein Salon untergebracht, der sich mit einer breiten gedeckten Holzveranda nach dem Garteninnern öffnet, gleichzeitig aber auch durch das hier in der Gartenmauer angebrachte Lattengitter den Blick auf die Elbe gestattet. Im Obergeschoß ist nach der Loschwitzer Seite ein zweiter Salon gelegen, mit zierlicher[178] Blumentapete und Rokokostuckdecke in einfachen Mustern. Auch die fein profilierten Türen tragen bescheidenes Rokokoschnitzdekor. Freilich die schönen Stilmöbel und die Kristallüster sind mit dem Auszuge der letzten Bewohnerin verschwunden und das ehemals so feinsinnig zusammengestimmte Milieu von Antons ist damit leider für immer dahin. Das Aussichtstürmchen mit der Uhr, das »Belvedere«, und der von einfach profilierten Pfeilern getragene Balkonvorbau über dem Haupteingang an der Elbseite sind, wie schon erwähnt, spätere Zutat des neunzehnten Jahrhunderts, gliedern sich aber dem Gesamtbild in trefflicher Weise ein, wie ein Vergleich der Abbildungen 1 und 2 eindrucksvoll lehrt.

Antons schönster Schmuck jedoch ist der dicht an das Haus anschließende Garten, den man trotz seiner verhältnismäßig kleinen Abmessungen von etwa 150 zu 100 Meter Länge und Tiefe gern als Park bezeichnen möchte.
Riesige Kastanien und Linden umrahmen ein dicht am Hauptgebäude gelegenes Rasenrondell (siehe Abb. 3) und verdecken es nach dieser Seite fast gänzlich. Flußabwärts birgt sich die malerische alte Kegelbahn, von Efeu umsponnen, dicht unter alten Baumriesen, kaum daß die Sommersonne Platz hat, ein paar goldene Lichter auf Holzwerk und Weg zu legen (Abb. 4). Verschlungene Wege, nach englischem Geschmack angelegt und von Efeuhecken umrahmt, führen zu immer neuen, malerisch schönen Durchblicken. In der südlichen Gartenecke, im Mauerwinkel liegend, wird ein niedriger Aussichtsaltan sichtbar (siehe Abb. 5), von herrlichen Kastanien und Linden beschattet, und unweit davon strebt aus dunklen Efeubeeten eine mächtige Platane hell heraus (siehe Abb. 6). So klein die Anlage ist, so wirkungsvoll erscheint sie hier durch gärtnerische Kunst gestaltet.
Lange hat so Antons mit einer Parkanlage im tiefen Frieden geruht, ein Denkmal feinsinniger Kultur aus vergangenen Tagen. Heute nun herrscht lebhaftes Bade- und Sportsleben in und um das alte Landhaus herum und der stimmungsvolle Reiz des Ganzen ist damit wohl für immer dahin. Der Freund der Heimat und sächsischer Kultur muß sich aber fragen, ob zu dieser gewaltsamen Änderung wirklich ein zwingendes Bedürfnis vorlag, ob es wirklich nötig war, ein Stück bester Dresdner Tradition zu zerstören, um ein Luftbad mehr entstehen zu lassen in einer Zeit, in der die den Elbufern benachbarte Bevölkerung sich mehr und mehr gewöhnt, in der freien Elbe und an ihren Ufern ein möglichst uneingeschränktes Freibadeleben zu genießen. Uns will es scheinen, als hätten die für die »Modernisierung« von Antons von der Stadt ausgegebenen Millionen an anderem Platze besser und zweckdienlicher Verwendung finden können, denn auch die Erhaltung der Denkmäler alter Kultur ist eine Ehrenpflicht des freien Volkes, und der Ertüchtigung unserer Jugend dient in erster Linie auch der, der es unternimmt, sie vom Werte der Tradition und von den Grundlagen unserer heutigen Kultur zu überzeugen.
[179]
Von Fritz Koch, Weimar
Wenn man für eine Notwendigkeit eintritt, die Schönheit und Eigenart unsrer Heimat zu pflegen, so hört man nicht selten die Meinung, unsre Zeit sei zu hart und zu arm, als daß sie sich mit solchen idealen Dingen beschäftigen dürfte. Und doch hat unsre arme Zeit dazu erst recht die Verpflichtung.
Wer sich darüber klar werden will, muß freilich etwas weiter ausholen. Denn mit einer nur äußerlichen Betrachtung kann man den Zielen und den Notwendigkeiten des Heimatschutzes nicht beikommen. (Mit diesem Wort, das auch den Schutz der Bau- und Naturdenkmäler einschließen will, faßt man bekanntlich die Bestrebungen zur Pflege unsrer schönen Heimat zusammen.) Es handelt sich beileibe nicht um eine Liebhaberei. Der Heimatschutz ist vielmehr ein Teil einer großen Kulturbewegung. Der materiell so günstige Aufschwung unsres Vaterlandes seit dem Kriege von 1870 war unstreitig in mancher Beziehung nicht gleichbedeutend mit Kultur. Man vergaß vielfach, daß materielles Wohlergehen nicht Selbstzweck sein kann, sondern nur ein Mittel zu einer höheren Entwicklung, die möglichst weiten Volksschichten Vervollkommnung und Glück ermöglicht. Diese Überschätzung des Materialismus und Kapitalismus ließ unter anderm auch die Rücksichten außer acht, die man auf die Erhaltung der Schönheit und Eigenart des Bildes der Heimat nehmen muß; denn die Heimat mit allen ihren Schönheiten ist schließlich doch Gemeingut aller, ist etwas mehr als nur ein Objekt der Ausbeutung, als eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Die ärgsten Verunstaltungen unsrer früher überall so schönen Orts- und Landschaftsbilder waren die Folge. Andre wurden obendrein angerichtet bloß durch den Mangel an Verständnis und an Fähigkeit, ein Haus, eine Wegeanlage usw. vernünftig zu gestalten. Soweit man z. B. etwas Besonderes »für die Kunst« tun zu müssen glaubte, wie beim Hausbau oder bei der Errichtung von Denkmälern, machte sich ein übler Parvenügeschmack, ein hohles Protzentum breit.
Gegen diese Schädigungen der Heimat wandte sich die Heimatschutzbewegung, als ein Teil jener Gegenströmung gegen den Materialismus, die etwa seit der Wende des Jahrhunderts eine Erneuerung unsrer gesamten Kultur erstrebt. Der Heimatschutz begann den Kampf zum Schutze von idealen Gütern, die seines Erachtens das Leben in der Heimat erst lebenswert machen. Von Anfang an hat er jedoch dabei betont, daß er durchaus nicht überspannt und weltfremd vorgehen wolle, und hat darauf hingewiesen, daß, von einer höheren Warte aus betrachtet, seine Forderungen, die auf allgemeine kulturelle und speziell vielfach auf schönheitliche Gründe gestützt werden, schließlich doch auch das für die volkswirtschaftliche Entwicklung auf die Dauer allein Segensreiche und Notwendige sind. »Es ist das, was wir anstreben, keineswegs rückschrittlich, reaktionär oder romantisch, wie man es vielleicht schelten wird; wir denken nicht daran, dem Rade der Entwicklung, auch der wirtschaftlichen, in die Speichen zu fallen, um es aufzuhalten oder gar zurückzudrehen, was wir doch nicht vermöchten, – aber wir können und wollen es lenken, daß es nicht unnötig die Schönheiten unsrer Heimat zermalmt und uns nicht hinabführt in den Abgrund, sondern hinauf auf die Höhen wahrer Kultur. Daß diese Höhen, die früher nur von einer privilegierten Minderheit beschritten werden konnten, jetzt allen zugänglich gemacht werden, – das ist der einzige wahre Sinn des modernen technischen Fortschritts!« (Fuchs, Professor der Nationalökonomie an der Universität Tübingen, in »Heimatschutz und Volkswirtschaft«, 1905.) Der Heimatschutz will, indem er für den Schutz der Heimat wirkt, weitesten Kreisen den Blick öffnen für die Schönheit und Eigenart unsrer Heimat. Er will mit seiner Arbeit allen Menschen Möglichkeiten des Glücks und von Freuden erhalten, die doch gewiß zu den besten gehören.
Das ist die hohe soziale Aufgabe, die er übernommen hat, und das macht auch seine besondere Bedeutung für unsre arme Gegenwart aus! Gewiß, erst muß der Mensch – in dieser schweren Zeit doppelt – bemüht sein, sein Brot zu verdienen und überhaupt zu leben. Aber so heißt es auf jede Kultur verzichten, wenn man sagt, er könne in dieser Zeit überhaupt für nichts[180] andres mehr Sinn haben. Das ist aus äußeren Gründen falsch. Solange es zu Alkohol und Tabak reicht, muß es auch noch zu höheren, kulturellen Bedürfnissen reichen. Es ist aber auch aus inneren Gründen unrichtig. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, und der Reichtum ist eine Sache, die nicht nur auf äußere Dinge gegründet ist, sondern die ebenso in uns selbst liegt. Das bekannte Beispiel: Ein Reicher, der sich das teuerste Klavier gekauft hat, kann allein deshalb noch nicht darauf spielen. Aber auch ein Armer kann mit den vielen geistigen Genüssen und Werten, die ihm trotz seiner Armut zu Gebote stehen, nichts anfangen, solange er es nicht gelernt hat. Hier liegt das Geheimnis. Noch heute gilt das Dichterwort: In deiner Brust sind deines Schicksals Sterne. Je ärmer wir werden, je schlechter es uns geht, um so mehr müssen wir lernen, unser Leben mit idealen Werten auszustatten. Vor allem mit den Werten, die uns nichts kosten, die jedem, auch dem Ärmsten im Volke, zu Gebote stehen, wenn er nur seine Augen für die Schönheit dieser Welt offen hält. Man behaupte nun etwa nicht, der »Mann aus dem Volke« habe dafür doch keinen Sinn! Das ist einfach nicht wahr! Dutzende von Beispielen könnten zum Beweise beigebracht werden. Und für den, der uns trotzdem nicht glaubt, ergibt sich doch schließlich nur die Forderung an den Staat, besser als bisher für die Erziehung der »breiten Massen« zu sorgen, damit sie auch an den Genüssen der »sozial Höherstehenden« teilnehmen können. Zweifellos wird die Volksbildung gar nicht genug tun können, die Kenntnis der Heimat und die Freude an ihr zu vertiefen. Die Volkshochschule hat hier eines ihrer besten Tätigkeitsfelder. Vor allem aber wird es natürlich Sache der Schule sein, dieses Ziel weit mehr als früher in den Vordergrund zu stellen. Es ist bekannt, daß sie sich dieser Aufgabe bewußt ist. Sie kann dabei des Dankes und der Mitarbeit weitester Kreise sicher sein.
»Die Schönheit unsres Vaterlandes ist ein nationaler Reichtum.« Diesen Satz tragen die Veröffentlichungen des Heimatschutzvereins von Frankreich (das schon im Frieden Millionen für diese Bestrebungen aufwandte). Wir fügen hinzu: Sie ist ein Reichtum, den uns kein Feind rauben kann, nur wir selbst. Vor dem Kriege wollte man oft mit einem gewissen Schein des Rechtes geltend machen, es wäre nicht so schlimm, wenn auch viele Gegenden verunstaltet würden. Bei den billigen Verkehrsmöglichkeiten habe auch jeder Arbeiter, der in einer dumpfen freudlosen Vorstadt lebe, die Möglichkeit, am Sonntag in eine schöne Gegend zu fahren und sich dort zu erholen. Das ist bekanntlich jetzt anders. Jetzt müssen wir darauf dringen, daß jeder Wohnort und jede Landschaft nicht etwa nur gerade noch menschenwürdig, sondern so schön bleibt, daß man sich dort wohl fühlen kann.
Damit ist schon übergeleitet zu der Tatsache, daß der Heimatschutz sich nicht nur auf ideale Forderungen gründet, sondern sich auch mit vielen schwerwiegenden materiellen Interessen deckt; hier mit der Pflege der Volksgesundheit. So ist er z. B. längst, bevor diese Forderungen durch die neue Wendung der Politik vertreten wurden, für Bodenreform eingetreten, für innere Kolonisation, vor allem dafür, daß jedermann auch sein Gärtchen und sein Stück Land bekäme, weiter für Verstaatlichung der Naturkräfte usw. Und wenn der Heimatschutz sich gegen die Begradigung aller Wasserläufe wendet (deren Übertreibung Hochwasserschäden, Austrocknung des Landes, Verminderung des Fischreichtums mit sich gebracht hat) und gegen die Verunreinigung der Gewässer, und wenn er sich für den Schutz der nützlichen Vögel einsetzt, wenn er – um einige weitere Beispiele zu nennen –, vor den schematischen Bebauungsplänen mit viel zu breiten kostspieligen Straßen ebenso wie vor der Errichtung vieler überflüssiger Denkmäler gewarnt hat, so vertritt er damit auch schwerwiegende Interessen rein volkswirtschaftlicher Art.
Ganz besonders gilt dies für die Ziele des Heimatschutzes auf dem Gebiete des Bauwesens. Allenthalben ist von der Verbilligung des Bauens die Rede, und doch müssen die amtlichen Stellen fast in jedem Falle die Erfahrung machen, daß die Bauherren die Grundbedingung dazu außer acht lassen. Sie wollen nicht einsehen, daß man bei den jetzigen Verhältnissen (wenn man nicht zu den Reichen gehört) seinen Bau nur dann durchsetzen kann, wenn im Äußern wie im Innern so einfach und so sparsam wie möglich und auch wesentlich kleiner gebaut wird als früher. Fast alle Bauherren lassen sich Bauzeichnungen machen, wie man sie vor dem Kriege gewohnt war, möglichst im sogenannten »Villenstil«, sehr reichlich groß, mit Vor- und Anbauten, Verzierungen und sonstigem Aufwand. Und doch waren alle Einsichtigen schon vor dem Kriege längst darüber einig, daß nur ein irregeleiteter Geschmack und die Sucht nach dem Mehr-Scheinen-Wollen[181] solche Bauten sich wünschen, und daß die schlichten Wohnhäuser viel schöner sind. Was aber in der Zeit früheren Reichtums in erster Linie Geschmacksfrage war, das ist heute zwingende Notwendigkeit. Wir können uns solchen verfehlten Luxus einfach nicht mehr leisten. Wir müssen heute schlicht bauen, praktisch, solid und dauerhaft natürlich (denn das Unsolide ist auf die Dauer das Teuerste) und bei aller Einfachheit trotzdem oder richtiger gerade deshalb schön. »Die erste Bedingung für die Verbilligung eines Baues ist also eine gute, der Armut unserer Zeit entsprechende Bauzeichnung. Fehlt sie, dann nützt alle Sparsamkeit bei der Bauausführung nichts, es ist dann unmöglich, daß der Bau billig wird.« (Aus einer Bekanntmachung des Stadtrats Rennert in Meiningen, betreffend Baukostenzuschüsse.) So sind die Forderungen, die der Heimatschutz auf dem Gebiete der Architektur aus Gründen der Sachlichkeit und Wahrhaftigkeit seit Jahren erhoben hat, durch die wirtschaftlichen Zeitverhältnisse glänzend gerechtfertigt worden.
Aber nicht nur am Bauwesen, sondern überhaupt ist heute die Notwendigkeit der Bestrebungen des Heimatschutzes in allen einsichtigen Kreisen des Publikums anerkannt und ebenso auch durch den Staat. Der Heimatschutz findet jetzt seine feste Stütze in der Reichsverfassung. Artikel 150 stellt fest: »Die Denkmäler der Kunst, der Geschichte und der Natur, sowie die Landschaft genießen den Schutz und die Pflege des Staates.« Damit ist ausdrücklich betont, daß der Staat seine Verpflichtungen gegen die Heimatschutzsache mit der Schaffung von Gesetzesvorschriften allein nicht erfüllt, sondern daß er auch sonst Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege der Schönheit und Eigenart der Heimat treffen muß.
Es sind Maßnahmen und Aufwendungen, die sich hundertfach lohnen.
Von Hainz Alfred von Byern
»Wissen Sie,« sagte mir einmal ein Jagdherr, »das ist doch eigentlich sonderbar, auf meinem ganzen Revier gibt es kein einziges Stück Raubzeug, und trotzdem werden die Strecken von Jahr zu Jahr schlechter!«
»Jawohl,« entgegnete ich, »eben weil Sie alles Raubwild abschießen lassen!«
Der gute Mann sah mich ungläubig lächelnd an, er meinte wohl, ich wolle einen Scherz machen. Aber dann klärte ich ihn auf:
»Können Sie sich eine Großstadt, oder meinetwegen auch ein ganzes Reich, ohne Sanitätspolizei denken?«
»N–ein, – nein, eigentlich nicht –«
»So, na sehen Sie, und da wollen Sie klüger sein als die Natur, welche das Haarraubwild und die gefiederten Räuber einzig und allein aus dem Grunde erschaffen hat, um die Ausbreitung von Seuchen, die Fortpflanzung kranker und schwächlicher Stücke zu verhindern?! Denn jeder Fuchs, Marder und Iltis wittert es, ob ein Stück Wild krank oder gesund ist, jeder Wanderfalke, Hühnerhabicht, Rauhfußbussard und Milan schlägt das schwächste, zur Nachzucht ungeeignetste Stück, weil er es am leichtesten erbeuten kann!«
Mein Bekannter war recht nachdenklich geworden, und als ich ihn nach drei Jahren wieder besuchte – ei siehe da! – die Strecken hatten sich um fünfzig Prozent gehoben und Raubwild gab es gerade so viel, daß die gesunden und kräftigen Stücke von der »freiwilligen Sanitätspolizei« verschont blieben! –
Bitte, meine Herren, fragen Sie mal jeden alten, erfahrenen Praktiker! Er wird Ihnen – ich wette tausend zu eins! – sagen: »Ein Revier, namentlich ein Niederwildrevier ohne Raubwild muß herunterkommen, ist einfach ein Unding!« Eine Ausnahme gibt es: die Fasanerie! Da freilich soll es heißen: Krieg allen Räubern! Und mit allen weidgerechten Mitteln: Pulver und Blei, Knüppelfallen und Kastenfallen, Krähenhütte und Hasenquäke, aber nicht mit dem aasjägerischen, hundsgemeinen Gift und diesen furchtbaren, tierquälerischen Marterwerkzeugen, den Eisen, in denen sich so ein armes[182] Gottesgeschöpf eine lange, endlos lange Winternacht in stummen Schmerzen, in Todesangst quält und windet!
Zwei Arten Raubwild verdienen keine Schonung: wildernde Hunde und verwilderte Katzen. Die schieße ich ab wo und wann ich ihrer habhaft werde.
Aber es gibt mir einen Stich, wenn ich lese, daß Herr X. das »Weidmannsheil« hatte, einen Adler zu erbeuten. Ja, meine Herren, muß denn alles »verruiniert« werden?! Muß das wirklich sein?! Ich meine, wir, unser heutiges Geschlecht, unsere »moderne« Zeit, sind so bettelarm an ethischen Werten, an Dingen, die sich nicht mit schmutzigen Markscheinen kaufen lassen! Soll uns denn die Freude an der Natur, die Liebe zum Mitgeschöpf auch noch genommen werden?!
Wie meinten Sie, Verehrtester? Ein Marderbalg kostet jetzt fünfzehnhundert Mark? Sehr richtig, und ein Hirsch ist ein brauner Lappen! Aber, lieber Herr Neureich, Sie haben doch Kinder – Enkel sogar? Na also, sehen Sie mal, sollen die vielleicht statt Füchse Ratten, statt Falken Sperlinge schießen?! Dann sind sie nicht Jäger, sondern »Kammerjäger«.
»Jeder ist sich selbst der Nächste!«
»Ach nein, Herr Neureich, jeder – Sie und ich, – sind ein Glied in einer Kette, ein einziges Rädchen der gigantischen Maschine, und wir haben die Pflicht – verstehen Sie mich recht: die Pflicht! – das Erbe nicht zu verschleudern, sondern zu erhalten und zu mehren!
Sehen Sie nur einmal einem Wanderfalkenpaar bei seinen Flugspielen zu, beobachten Sie eine Marderfamilie und – wenn Sie dann den rechten Finger nicht auch mal vom Abzug lassen können, tun Sie mir leid – Sie Schießer!!«
Nun werden meine liebwerten Leser wohl bald aufsässig werden und sagen: »Nächstens verlangt der Kerl noch eine gesetzliche Schonzeit für das Raubzeug!« Ganz recht, meine Herren, das tue ich auch, wenigstens für einige seltene Arten: Fischreiher, Adler, Edelfalken, Baummarder, Uhu usw. Warum soll denn bei uns etwas nicht gehen, das z. B. in Mecklenburg schon seit einiger Zeit Landesgesetz ist?!
Freilich – wie viele unsrer jetzigen Jäger können wohl einen Rauhfußbussard von einem Mäusebussard, Wespenbussard oder Hühnerhabichtweibchen unterscheiden? (Daß es – hm – »Jagdkarteninhaber« gibt, die jeden Kuckuck als Sperbermännchen ansprechen, sei nebenbei erwähnt.)
Und – ich kenne Leute, die jedes Stück Raubwild grundsätzlich auf die unglaublichsten Entfernungen beschießen mit der drastischen Entschuldigung: »Ach was, das ist ja »nur« Raubzeug, hoffentlich kriegt es ein paar Schrote ab!«
Diesen Schindern und Aasjägern soll ein dreifaches Donnerwetter in die Knochen fahren! Wie sagt Riesenthal?
Laufen solche – solche – solche – (ich finde keinen Ausdruck aber – platzen soll’n se! Bajonett’ soll’n se schwitzen! Ä Ephei soll’n se wär’n un wuchern soll’n se um nix!) herum, haben sich als Jäger kostümiert und sind doch nichts als schlecht verkleidete Henkersknechte!
Diese Sorte ist schuld, wenn das Weidwerk bei den breitesten Volksschichten in Mißkredit gekommen ist, wenn uns von der grünen Gilde (wie dies kürzlich eine der verbreitetsten Tageszeitungen tat) »Sadismus« vorgeworfen wird!
Ihr Gesangbuchchristen und Pharisäer: ehrt den Schöpfer in seinem Geschöpf! Wer sagt euch denn, daß ihr mehr seid, ihr lieblichen Ebenbilder Gottes, als die stumme, leidende, wehrlose Kreatur?! Größenwahnsinnig seid ihr! – Vor Gott, dem Lenker aller Weltensysteme, dem Gestalter und Erhalter dieser Ungeheuerlichkeit, die wir mit unsern dumpfen, stumpfen Sinnen nicht begreifen können, seid ihr Mikroben, seid ihr Stäubchen im Weltenall!
Eines allein bleibt: die Liebe, die sich für uns ans Kreuz schlagen ließ, die Liebe, die auch im hilflosen Geschöpf ein gleichberechtigtes Wesen sieht!
[183]
Oder – wie wollt ihr Barmherzigkeit erlangen, wenn ihr selbst kein Erbarmen kennt?!
Und nicht nur ein Erbarmen aus Nützlichkeitsgründen, nein, auch dem verfehmten verfolgten Raubwild gegenüber!
Wohl bekomm’ euch meine Philippika, ihr Herren!
Unser altes Landheim, die Sorge am Habichtsberg bei Cranzahl, hatten wir verloren. Zu Pfingsten 1919 mußten wir sie verlassen, da das Haus zum Abbruch von der Gemeinde Cranzahl verkauft worden war. Aber die Amtshauptmannschaft Annaberg verbot den Abbruch, – und uns eröffnete sich die Aussicht, unser Heim, das uns in so vielen Jahren, seit 1913, lieb und traut geworden, wieder zu gewinnen, – als Ostern 1920 die Sorge abbrannte. »Durch Funkenflug der Lokomotive« stand’s in der Zeitung geschrieben. Aber wir wissen, daß das unmöglich ist.
Wir suchten uns ein anderes Heim. In jetziger Zeit eine recht schwere Aufgabe. Dieses Jahr, noch war Winter, untersuchten zwei von unserer Ortsgruppe das Häusel im Schmalzgruber Hammerwerk auf seine Bewohnlichkeit. Es war bereits stark verfallen, Türen und Fenster fehlten, innen sah es schwarz und finster aus. Dem Verfall geweiht.
»Das wird ein Heim für uns. Wir bauen es uns wohnlich aus!«
Der Besitzer, Herr Fabrikbesitzer Paul Pilz in Niederschmiedeberg, zeigte sich uns außerordentlich entgegenkommend, und bald war der Vertrag abgeschlossen. Wir hatten ein Heim, das wir wieder unser nennen konnten. Und für den Jungen bedeutet es eine große stolze Freude, wenn er sagen kann, dies Haus ist unser. Er ist mit seinem Heimatboden näher nun verbunden.
Aber eine gewaltige Arbeit stand uns nun bevor: das Häusel ausbauen. Kosten sollte, durfte und konnte es nicht viel. Arbeitslohn brauchten wir keinen, da wir selbst die Arbeiter stellten. Herr Pilz überließ uns viel Material für den Ausbau in der freundlichsten und freigebigsten Weise, so daß wir hier in ihm eine mächtige Stütze fanden. Sein Betriebsleiter, Herr Leichsenring, ging uns mit Rat und Tat zur Seite.
So war es eine Lust zu schaffen. Und mancher, der vorüberging, hat sich gewundert, wie eine Handvoll Annaberger Jungens und Studenten »mitten im kalten Winter« schwer gearbeitet haben und dabei so lustig waren.
Eins stand uns beim Ausbau von vornherein fest: das Häusel bleibt in seiner Eigenart voll gewahrt.
An einem frühen Sonntagmorgen vor den Osterferien rückte eine Schar Jungen mit Handwagen, Hacken, Schaufeln, Eimern, Besen, Kellen, Hammer, Beilen und einem Handofen von Annaberg weg nach dem neuen Heim in Schmalzgrube.
Kräftig ging der Angriff los. Das Wetter war prächtig, die Sonne lachte dazu, und bald stand das ganze Häusel im Nebel, so kehrten und fegten alle dienstbaren Geister darin herum und brachten den Dreck und Staub hinaus aus dem Haus. Nur die Hose auf dem Leib, so schranzte alles, daß es »nur so roochte«. Die zerfressenen Bretterdielen wurden auch gleich herausgenommen, es waren nur noch kleine Stücke, »Fragmente«. An diesem Tage war das Häusel sauber gekehrt, dahinter aber im Steinbruch hatte sich ein ganz beträchtlicher Schutt- und Kehrichthaufen gebildet. Schwarzgrau und verrußt sahen die aus, die aus dem Häusel herauskamen. Im nahen Bache wurde sich gründlich gewaschen, um am späten Nachmittage den Heimmarsch anzutreten. Nicht schlecht guckte unser lieber Leichsenring über die Arbeit, die in den paar Sonntagsstunden geschafft worden war. Ja, das war für die Buben ein ander Zugreifen und Schaffen, als auf der Schulbank zu sitzen.
Die Osterferien kamen. Mit ihnen neuer unerwarteter Schnee und neue Kälte, dann wieder Tauwetter, kalter Wind und wieder Schnee. Das alles in recht bunter Abwechslung.
Das hielt uns nun nicht ab, den Bau mit Wucht weiterzuführen. Ein Sachkundiger hatte uns einen Bauplan entworfen. Im übrigen half uns Vater Leichsenring, wo er nur konnte.[184] Und Mutter Leichsenring hatte nichts weniger zu tun, als zweimal am Tage für durchschnittlich fünfzehn Mann – alles starke Esser und keine Kostverächter – warmes Essen zu kochen. Wir kochten diesmal nicht selbst, damit wir hiermit keine Zeit verloren. Unser Nachtquartier hatten wir in einem leerstehenden Zimmer des Nachbarhauses bezogen.
Sofort begann die Arbeitsteilung. Die eine Hälfte der Mannschaft arbeitete im Heim, die andere ging »auf Transport«.
Uns war die Arbeit nicht leicht gemacht durch das böse Wetter. Verdrießen aber konnte uns das nicht.
In der unteren vorderen Stube arbeiteten immer drei bis vier Mann, hackten den schwarzen Boden, der steinfest gefroren war mühsam, oft nur splitterweise los. 25 Zentimeter tiefer wollten wir den Fußboden legen in einer Fläche von 27 Quadratmetern, weil wir ihn betonieren und darauf die Diele legen wollten. Acht Tage haben wir gebraucht, um den förmlich zu Stein gefrorenen Boden herauszuhacken. Die Hände wurden dabei steif und rissig. Die Hacke prellte ganz ekelhaft in den Händen. Dabei kam beim Tieferlegen des Bodens das Grundwasser hervor, so daß von Zeit zu Zeit ein Mann schöpfen mußte, was in der Kälte auch nicht gerade ein Vergnügen war. Außerdem pfiff der Wind durch die öden Fensterhöhlen.
In der Hausflur und in der hinteren unteren Stube wurden Stützbalken eingezogen. Im Obergeschoß rissen wir die Dielen heraus, um den noch versteckt liegenden Unrat herauszuschaffen. Manch altes Schloß und anderes verrostetes Eisenwerk fanden wir, so daß wir bald eine »Raritätensammlung« anlegen wollten. Zwei wohlerhaltene Kinderkutschen waren auch vorhanden. Wir benutzten den Oberteil davon zum Sand holen. Der Sand wurde aus dem nahen Teiche von zwei Mann herausgeschaufelt, in die Kinderkutschen geworfen und dann auf einem Schlitten von zwei Mann über die abschüssige Wiese ans Haus herangefahren und dort ausgeschüttet, wo ihn ein Mann durchs Sieb warf. Das Obergeschoß blieb im übrigen unberührt, nur die gröbsten Löcher im Schindeldach wurden mit Holzbrettern ausgebessert.
Die andere Abteilung, die ungefähr sieben Mann stark »auf Transport« rückte, hatte es nicht leichter. Da gab es Bretter, Balken, Schwarten, Lehm und anderes mehr heranzuschaffen. Früh um sechs Uhr wurde zu Herrn Pilz nach dem zweieinhalb Stunden entfernten Niederschmiedeberg mit einem Tafelwagen gefahren. Im oberen Preßnitztal lag Schnee, im unteren war er weggeschmolzen. Mit leeren Wagen abwärts zu Tale ließ sich gut fahren. Ganz anders aber wieder zurück: vierzig große schwere Bretter hatten wir aufgeladen. Wir mußten tüchtig schieben und zerren, um den Wagen durch den aufgeweichten Schmutz der Straße vorwärtszubringen. Toll aber wurde die Sache, als wir wieder in die Region des Schnees kamen. Da brach natürlich der schwer beladene Wagen erst recht ein. Wir griffen in die Speichen, um ihn vorwärtszubringen. Nur stückweise. Wir schwitzten. Die Zeit verging rasend schnell. Ich schickte einen Läufer nach dem eine Stunde entfernten Heim, daß die Leute aus dem Heim uns mit Schlitten entgegenkämen. Indessen versuchten wir mit unserer Last weiterzukommen. – Ein Geschirr auf der einsamen Straße! – Ob wir anhängen dürften? – Ja, wenn wir mitschöben! – Natürlich! – Mit drei Seilen banden wir fest. Gleich beim ersten Anzug des Pferdes rissen alle drei Seile mitten durch. Also das nächste Mal vorsichtiger anfahren! Es ging. Noch drei-viermal rissen uns die Seile. Der Kutscher hatte eine bewundernswerte Geduld mit uns. Aber wir kamen doch vorwärts. Bis das Gefährt nach Grumbach die neue Straße abbog. Nun wieder allein. Nach einer Stunde kommt die Ablösung mit zwei Schlitten. Umgeladen. Mit nur wenig Brettern auf dem Wagen fährt die alte Transportmannschaft ins Heim, während die Ablösung mit dem Schlitten nachkommt. Es ist bereits fünf Uhr nachmittag. Wir haben seit diesen Morgen noch nichts als eine Schnitte Brot gegessen. Wir sind im Heim, als ein Bote ankommt: der eine Schlitten sei zerbrochen. Also alles noch einmal raus! Teils auf dem anderen Schlitten, teils auf den Schultern bringen wir das letzte, immerhin noch große Stück die Bretter ins Heim. Wir waren froh, diese Tagesarbeit hinter uns zu haben.
Nicht besser war es anderntags mit der Lehmfuhre. Die war noch ein bissel schwieriger. In dem Moor, in dem Walde bei Grumbach gruben wir den Lehm, den wir zum Ofensetzen und Ausbessern der Holzverkleidung im Obergeschoß verwenden wollten. Den Waldweg bis zur Grumbacher Straße mußten wir erst ausschaufeln, so gut es ging. Und trotzdem wären wir[185] kaum noch durchgekommen, wenn uns nicht der Förster zu Hilfe kam, Eisenketten mitbrachte und sich selbst gleich mit ins Zeug legte. Sein Dackel lugte nicht schlecht. Unter lautem »Hühott« zerrten wir die schwere Lehmfuhre durch den schneeigen Waldweg auf die offene Landstraße. Dort konnten wir fahren bis durch Grumbach durch. Aber am Ausgang des Dorfes lag wieder eine gewaltige Schneewehe, die wir nicht überwinden konnten. Wir holten uns kurz entschlossen einen Ochsen vom Bauern, spannten ihn vor den Wagen. Und nun vorwärts. Der Bauer hieb auf den Ochsen ein und wir brüllten und schrien und schoben mit, bis die kleine Anhöhe und die Schneestelle unter beängstigendem Gestöhne des Wagens überwunden war. Seit jenem Tage sind wir mit dem Bauer gut Freund. – Dann konnten wir die Straße wieder allein fahren; Schnee lag da keiner mehr.
So galt es noch manchen Transport zu vollbringen. Und die Transportabteilung wurde darum nicht beneidet.
Die Arbeit ging rüstig vorwärts. Der Boden der Stube war fünfundzwanzig Zentimeter tief herausgeholt. In der Mitte hatten wir ein Wasserloch gegraben, quer durch den Fußboden eine Schleuse und die Fensterwand an einer Stelle durchstoßen, um Abfluß zu schaffen. Außen am Hause bauten wir einen unterirdischen Flußlauf.
Nun das Betonieren. Der Wassergraben im Fußboden wurde mit Steinen ausgesetzt und überdeckt, dann legten wir eine Packlagerschicht von Ziegelbrocken, die wir aus dem Herrenhaus herüber gehandlangert hatten, wobei es manchen Riß in der Haut gab. In diese Schicht bauten wir sieben Querbalken und zwei Längsbalken ein für die Dielung, nahmen sie sorgfältig in die Wage, was gar nicht so einfach war, als wir es uns vorgestellt hatten. Aus dem Herrenhaus schleppten wir nun die Säcke Zement herüber, mischten den Zement mit Sand. Ein alter Schachtmeister half uns dabei redlich mit. Es war das sein Palmsonntagsvergnügen, wie er uns sagte. Solche Leute gibt es doch heute selten. Bis abends neun Uhr betonierten wir. Da galt es tüchtig und sachkundig Zement mischen, die Mischung in die Stube zu schleppen und Wasser zum Gießen herbeitragen. Eine Zementschicht von fünf Zentimeter Dicke entstand. Die Balken ragten noch drei Zentimeter heraus, damit das Dielenholz nicht auf den Beton zu liegen kommt, sondern Luftzug möglich ist. In der rechten Stubenecke gossen wir einen zehn Zentimeter hohen, zwei Meter dreißig Zentimeter langen und ein Meter zehn Zentimeter tiefen Sockel für den Ofen mit Herd. Mit einem gelernten Ofensetzer zusammen setzten wir den Ziegelofen auf. Einen eisernen Ofen setzten wir nicht hinein, da die Größe des Zimmers und die geschwungenen Fensterbögen einen mächtigen Ofen mit Herd forderten. Für den Herd bestellten wir eine Platte von ganz gewichtiger Größe, die uns zweitausendzweihundert Mark kostete, eine ganz erkleckliche Summe für unsern Geldbeutel. Aber dafür haben wir ein stilgerechtes Zimmer, in dem wir, wenn es nun ganz fertig ist, uns wohlfühlen können.
Unterdessen zimmert ein Junge mit einem gelernten Zimmermann, den wir für einen Tag zur Verfügung gestellt bekommen haben, für die Fenster die Mauerrahmen. Am ersten Tage wurden zwei Stück fertig, der dritte angefangen, die nächsten zimmert der Junge kunstgerecht allein mit Winkelmaß und allem Werkzeug. Zwei Mann mauern die Rahmen ein. Auch hier muß mit der Wasserwage gearbeitet werden. Dann werden die Fensterläden gebaut mit drei Querleisten in der Z-Form und Angeln und Sturmhaken. Auch hier lernen wir, daß der untere Winkel der Querstreifen seinen Scheitelpunkt in der unteren Angel haben muß, damit sich der Fensterladen nicht senkt. Alles will bedacht sein. Und weißt du, wieviel Nägel man zu einem solchen Fensterladen von ungefähr einem Quadratmeter Größe braucht? oder zu einem Quadratmeter Diele?
Auf die Dielenbalken legten wir vorläufig Bohlen und Bretter und besserten die Wände aus, putzten und verkalkten sie. Diese Arbeit war gar nicht so einfach. Besonders schwierig waren die Fensterbogen, die arg in Verfall geraten waren, auszubessern. Aber zwei von uns, die im sonstigen Beruf sich stud. iur. und stud. med. vet. nennen, hatten den Schwung, den Mörtel anzusetzen und zu verreiben, besonders gut weg. Und nun ging es ans Weißen. Nachdem der Zement abgebunden hatte und trocken war, wurden die gespundeten und feingehobelten Dielenbretter genagelt. Sie zu schonen und vor allem vor dem Kalk zu bewahren, streuten wir Sägespäne.
[186]
Unsere Bauarbeit zog sich bis auf die Sonntage nach Ostern, bis in die Pfingstferien; zu den Großen Ferien hoffen wir leidlich fertig zu sein. Denn dann entfaltet der Wandervogel seine Schwingen und fliegt weit hinaus in die Welt, bis in fremde Länder. Und in seinem Heim wohnen geladene Gäste aus dem fernen Süden.
Nach des Tages Last und Müh’ zogen wir uns in unser warm geheiztes Quartier zurück. Zum Singen, das wir so sehr lieben, brachten wir es in den Osterferien kaum, dazu waren durch das schlechte Wetter unsere Kehlen zu rauh und heiser geworden. Aber der oder jener spielte auf der Laute, oder wir lasen vor. Aus Selma Lagerlöfs »Gösta Berling«. Und denen, die voriges Jahr mit oben in Schweden waren, tauchten frohe, freudige Erinnerungen auf, wir sahen wieder die herrlichen Seen, umschlossen von ernsten, rauschenden Wäldern, dachten an die schönen Stunden, die wir auf stolzen Schlössern verlebten, wie weiland die Kavaliere auf Eckeby im frohen Vermland.
Und so haltens wir Wandervögel. In der sonnigen Sommerszeit schweifen wir weit in die Ferne. Die Große Fahrt ist uns das Höchste, sie gibt uns das Meiste und Wertvollste. Aber gern kehren wir zurück in unsere Heimat, die unser ist.
Annaberg im Erzgebirge.
Fritz Wollmann, stud. rer. merc.
Aus dem Bewußtsein der Kürze des eigenen Lebens ergibt sich für den denkenden Mann, der seine Kraft an eine edle Aufgabe und ein hohes Ziel gesetzt hat, die Aufgabe, Motive und Ergebnisse seines Daseins an andere Männer weiterzugeben, daß, auch wenn sein Licht erlosch, sein Werk nicht stirbt. Aber damit in seinem Geist weiter gearbeitet werden kann, ist es nötig, Freunde und Schüler zu bilden. Es gibt keine große, geistige Gemeinschaft, die ihr Werk erhalten wissen will, die nicht ebenso verführe. Auch diejenigen, die ihre Heimat lieb haben, wirken in diesem Sinne. Es darf gefragt werden, ob durch unsere Bestrebungen schon alle erreichbaren Kreise berührt worden sind. An einen Stand zu erinnern mag erlaubt sein, an den Stand der Kellner. Niemand bezweifelt, daß seine Aufgabe nicht in der Sorge um gutes Essen und Trinken für die Gäste aufgeht; des tüchtigen Kellners Ziel ist es, dem Gast das Heim möglichst zu ersetzen. Er ist bemüht, dem Reisenden Unterhaltungsmöglichkeiten nachzuweisen; er wird oft zum Berater für Ausflüge, für Sehenswürdigkeiten. Um das tun zu können, wird er bemüht sein, aus den Reisehandbüchern sich selbst eine umfassende Kenntnis anzueignen. Aber sind diese Bücher ohne weiteres Hilfsmittel für den Heimatschutz? Niemand wird über die bekannten Reisehandbücher gering denken; sie bieten eine Fülle von Stoff. Aber es kann nicht von ihnen verlangt werden, daß sie die stillen Schönheiten, daß sie das Stimmungsvolle einer ganz schlichten Landschaft weitergeben, mitteilen können. Das ist nur persönlichem Erleben und, wenn ich so sagen darf, in der individuellen Mitteilung möglich. In dieser Art Mitteilung aber bewegt sich hauptsächlich die hierher gehörige Aufgabe der Kellner. Um sie zu erfüllen, bedürfen sie einer Einführung in das Wesen der Heimatschönheit, brauchen sie selber Mitteilung erlebter Schönheit und Stimmung. Für die Mitglieder des Heimatschutzes liegt hier eine Aufgabe. Wir werden – wenn es die Gelegenheit gibt – auch dem Kellner gegenüber es nicht an Mitteilung über die Schönheit seiner Stadt fehlen lassen dürfen, wir werden doch auch in den größeren Hotels nach den »Mitteilungen[187] des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz« fragen müssen. Jedermann weiß, daß man in Gasthöfen bisweilen Lektüre trifft, deren Wert man als fragwürdig bezeichnen darf. Warum sollen wir da nicht für wirklich Wertvolles freudig eintreten? So möchten diese Zeilen bitten, für die Heimatschutzbewegung in einem ganz besonderen Berufe Freunde und Förderer zu gewinnen.
Pfarrer Herzog, Aue i. E.
Eine wichtige Aufgabe des Heimatschutzes ist von jeher die Erhaltung alter Bäume. Die erheblichen Mittel, welche bisher für diese Art Altershilfe Verwendung fanden, haben manchen ehr- und denkwürdigen Baum vor völliger Zerstörung und Zusammenbruch bewahrt.

Auch der alten Pfarrlinde in Markersbach bei Gottleuba drohte dieses Schicksal. Es wäre ein besonders schwerer Verlust gewesen, stellt doch dieser Baum nicht nur ein durch Alter geweihtes Naturdenkmal dar, sondern er ist auch als getreuer Schicksalszeuge der Gemeinde kulturgeschichtlich von hohem Werte. Soll doch hier unter seinem grünen Blätterdache, der Überlieferung nach, der erste evangelisch-lutherische[188] Gottesdienst abgehalten worden sein, und da Markersbach 1576 seinen ersten evangelisch-lutherischen Pfarrer erhielt, kann das Alter dieser Linde auf etwa vierhundert Jahre angenommen werden. Daß bei diesem hohen Alter auch alle lebensfeindlichen Einflüsse sich besonders geltend machten, ist trotz des gesunden Aussehens des eineinhalb Meter im Durchmesser habenden Stammes und der vollen Laubkrone nicht verwunderlich. Durch die Öffnungen zweier vor langer Zeit abgebrochenen Hauptäste hatten Regen und Schnee ungehindert Zutritt in das unzugängige, völlig hohle Stamminnere und förderten die Fäulnis in besorgniserregender Weise. Diese Gefahr für den Weiterbestand des Baumes ist jetzt beseitigt. Die nicht ungefährliche, auf hohen Leitern auszuführende Arbeit des Verschließens der Astöffnungen wurde in zweckentsprechender Weise von Herrn Baumeister Reppchen in Gottleuba ausgeführt. Die Mittel hierzu stiftete ein seit Jahren mit Markersbach und seinen Bewohnern innigst verbundener Freund aller Heimatschutzbestrebungen, Herr Geheimer Kommerzienrat Meinel-Tannenberg.
Zum Danke dafür aber rauscht jetzt die alte ehrwürdige Pfarrlinde in Markersbach besonders freudig und aus ihrer mächtigen Krone klingt nicht nur in leisen Flüstern ein Lied aus längst vergangenen Tagen, sondern sie kündet auch laut und vernehmlich das hohe Lied ihrer Wohltäter. –
Georg Marschner.
Von Oberforstmeister Feucht, Bad Schandau
Während der letzten Kriegsjahre hat im südwestlichen Böhmen, zunächst in der Umgebung von Pilsen eine Massenentwicklung der Nonne stattgefunden, die wegen Mangel an Arbeitskräften wie an Leim, für den die Rohstoffe fehlten, überhaupt nicht bekämpft werden konnte und bereits zu gewaltigen Kahlfraßflächen geführt hatte, ehe im Jahre 1919 überhaupt die erste Kunde davon zu uns nach Sachsen gekommen ist. Aus diesen Kahlfraßgebieten sind nun bei schwüler Wärme und starkem südöstlichen Winde gewaltige Schwärme meist weiblicher Nonnenfalter abgeflogen, die in der Nacht vom 17. zum 18. Juli 1920 die Staatsforstreviere der Oberforstmeisterei Schandau von Sebnitz bis Gottleuba in einer Breite von fünfunddreißig Kilometer und etwa zehn Kilometer Tiefe überfluteten.
Von der Staatsforstverwaltung wurde sofort der Kampf gegen diese unwillkommenen, gefürchteten Feinde unserer Fichtenwaldungen mit allen verfügbaren Arbeitskräften an Männern, Frauen und Schulkindern durch Sammeln und Töten namentlich der weiblichen Falter aufgenommen. Das Ergebnis waren hundertdreitausend männliche und zweihundertdreiundsechzigtausend weibliche Falter. Auch die Gemeindevorstände und Privatwaldbesitzer sind auf Anregung der Forstverwaltung zum sofortigen Sammeln veranlaßt worden. Leider konnte diese Sammeltätigkeit bei der gewaltigen Größe der mit einem Schlage befallenen Fläche von gegen dreihundertfünfzig Quadratkilometer nicht so gründlich und vollständig mit den vorhandenen Arbeitskräften durchgeführt werden, daß ein voller Erfolg der Sammeltätigkeit[189] möglich gewesen wäre. Dies zeigte sich bei den im Herbst und Frühjahr vorgenommenen Eierzählungen, die in einzelnen Beständen schon Eiablagen von tausend bis dreitausend und mehr Eiern an manchen Stämmen ergaben. Es war also für das Jahr 1921 nichts Gutes zu erwarten.
Der Falterflug des Jahres 1921 hat dies, zumal das Frühjahr und der Sommer mit seiner anhaltenden warmen, trockenen Witterung, die für die Entwicklung der Nonne äußerst günstig war, durchaus bestätigt. Die Sammelergebnisse bei der Vertilgung von Raupen und Puppen waren folgende: zweimillionenzweihundertvierzigtausend Raupen, zweimillionenfünfhundertvierzehntausend Puppen und fünfzehnmillionensiebenhundertzweiundfünfzigtausend Falter, darunter dreizehnmillionensiebenhundertsiebenunddreißigtausend weibliche Falter. Diese ungeheure Zunahme und das Ergebnis der Probeeierzählungen an gefällten Stämmen gaben der Forstverwaltung Veranlassung für das Jahr 1922 umfassende Volleimungen in Aussicht zu nehmen. Diese Leimungen umfaßten eine Fläche von nicht weniger als zweitausendachthundertdreißig Hektar.
Leider war auch der Witterungsverlauf des Frühjahrs und des Sommers 1922 für die Entwicklung der Nonne wieder außerordentlich günstig. Das Frühjahr trat zwar spät ein, es herrschte aber dann fast ununterbrochen trockenes, windstilles Wetter, so daß die Entwicklung der Raupen bis zur Verpuppung völlig ungestört vor sich ging.
Die Folge war in vielen Beständen mehr oder weniger starker Lichtfraß, stellenweise in den besonders stark belegten Flächen auch Kahlfraß, jedenfalls war aber später festzustellen, daß viele Bestände, die sonst unfehlbar dem vollen Kahlfraß zum Opfer gefallen wären, durch den Leimring, der ungezählte Millionen von Spiegelräupchen vernichtete und später ebensoviel alte Raupen abfing, nur lichtgefressen und daher erhalten geblieben sind, so daß sich die Kosten für die Leimung reichlich bezahlt gemacht haben.
Gewaltig war in diesem Jahre der Falterflug, zeitweise machte er den Eindruck eines starken Schneegestöbers.
Ebenso wie 1920 uns aus Böhmen große Überflüge heimgesucht haben, sind nun in diesem Jahr aus den Hauptbefallsgebieten der Sächsischen Schweiz große Überflüge in nördlicher Richtung erfolgt und haben vermutlich die Gebiete des Fischbacher Waldes, der Dresdner und der Lausnitzer Heide, des Tharandter Waldes usw. heimgesucht und dort ihre Eier abgelegt, so daß nunmehr auch diese Gebiete und ebenso die dortigen Privatwaldungen für nächstes Jahr gefährdet erscheinen.
Die ungeheuren Schäden, die man von den Bergen der Sächsischen Schweiz gegenwärtig bei einem Blick nach Böhmen hinüber, aber auch schon in den sächsischen Waldungen selbst, stellenweise zu Gesicht bekommt und die großen Überflüge dieses Sommers, die auch die bewohnten Ortschaften und offenen Fluren und Gärten überfluteten, haben nun die öffentliche Meinung und weite bisher gleichgültigere Kreise aufgerüttelt und auf die Größe der unseren Waldungen drohenden Gefahren aufmerksam gemacht und die vorher vielfach fehlende Geneigtheit bei der Bekämpfung der Nonne werktätig Hilfe zu leisten, geweckt. Dies zeigen auch die zahlreichen in der Presse von mehr oder weniger berufenen Verfassern gemachten, gutgemeinten[190] Vorschläge, die Wahres und Falsches durcheinandermischen und längst versuchte und als unwirksam wieder aufgegebene Bekämpfungsmaßnahmen mit großer Begeisterung erneut empfehlen.
Es seien daher zur Aufklärung die bisher bekannten und in der Praxis bewährten Bekämpfungsmaßnahmen in aller Kürze etwas näher beschrieben.
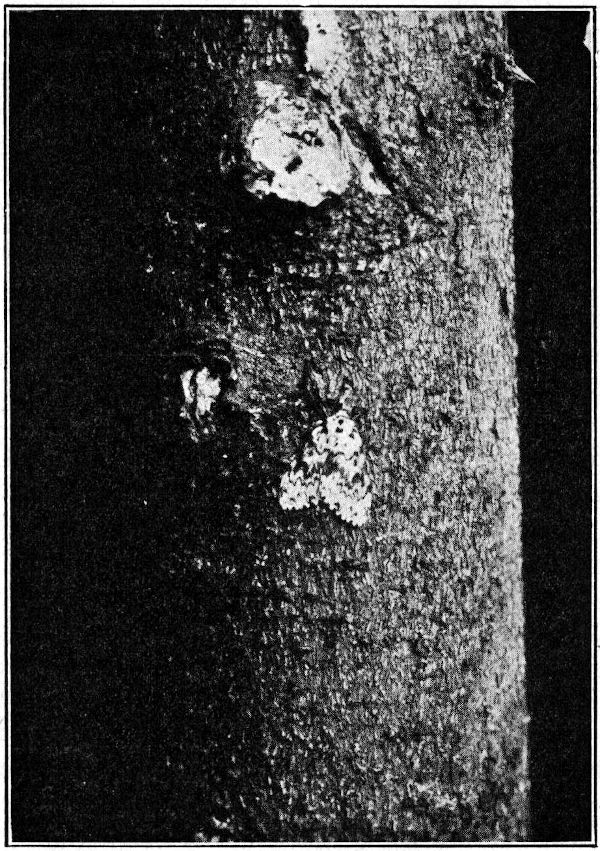
Die erste und sinnfälligste Maßnahme ist der Fang der Falter, namentlich der weiblichen, um die Eiablage zu verhüten. (Abbildung 1 zeigt einen weiblichen Falter an einen Fichtenstamm.) Diese Maßnahme ist bei einer beginnenden Nonnenkalamität oder bei eben erfolgten Überflügen in bisher nicht befallene Waldgebiete die wirksamste Vertilgungsmaßnahme, wenn sie sofort nach dem Auftreten der Falter mit möglichster Beschleunigung, also mit möglichst viel flinken und raschen Arbeitskräften, vorgenommen wird. Man kann also in diesem Falle, wenn man wirkliche Erfolge erzielen will, auf die Mitwirkung von Schulkindern nicht verzichten, um so weniger als das erfolgreiche Faltersammeln sich nur auf die kurze Zeit vor und während der Eiablage erstreckt. Falter zu sammeln, die ihre[191] Eier abgelegt haben, hat keinen Zweck, sie tun keinen Schaden mehr und sterben in Kürze ab.
Sehr lebhaft sind zur Faltervertilgung neuerdings wieder Leuchtfeuer, Fackeln, Scheinwerfer oder irgendwelche andere starke Lichtquellen empfohlen worden, alle diese Mittel sind bereits bei früheren Nonnenplagen, so z. B. in den Jahren 1908 bis 1910 in Sachsen und 1890/91 in Bayern in großem Maßstabe versucht worden, sämtlich ohne durchschlagenden Erfolg. Herrscht zufällig einmal bei einem Hochzeitsflug günstiges warmes Wetter, so fliegen wohl einige Zehntausende Falter in die Leuchtfeuer, meistens aber sind es Männchen, denn sowie die Weibchen mit der Eiablage beschäftigt sind, kümmern sie sich um Feuer und Fackeln nicht im geringsten mehr und bei rauhem kühlen Wetter tun dies auch die Männchen nicht.
Weiter kommt in Frage das Sammeln von Eiern. Diese Maßnahme ist mühsam und schwierig, denn die Eier sind gut unter Rindenschuppen verborgen, die erst mit dem Messer abgeblättert werden müssen, um die Eier zu finden. Will man die Eier abkratzen, fallen viele zu Boden und bleiben entwicklungsfähig. Besser ist daher die Eier mit Teer zu überstreichen. Im ganzen ist dieser Maßnahme nur geringe Bedeutung beizumessen, da man nur den geringen Teil der Eier im untersten Stammabschnitt vernichten kann.
Bei sehr starkem Befall kann auch das Eiersammeln lohnen, wie die Sammelergebnisse des Herbstes 1921 beweisen, die über einundzwanzigmillionen Eier im Forstbezirk ergeben haben.
Das Sammeln von Raupen kommt zumeist in Kulturen, in denen man die Raupen ablesen kann, in Frage. In Althölzern kommen zeitweilig, namentlich bei großer Hitze und kurz vor der Häutung große Massen von Raupen aus den Kronen bis in den untersten Stammteil herab, so daß sie hier ebenfalls mit gutem Erfolg in größeren Mengen vernichtet werden können, wenn diese Erscheinung rechtzeitig bemerkt wird.
Das Sammeln von Puppen ist nur neben dem gleichzeitigen Raupensammeln und bei starkem Befall von Wert; da die Puppen in borkigen Beständen ziemlich schwer zu finden sind, lohnt das Sammeln nicht sonderlich.
Mehrfach ist auch das Bespritzen mit giftigen Flüssigkeiten versucht worden. Dies empfiehlt sich namentlich zur Vertilgung von Spiegelräupchen unter Verwendung der bekannten auch gegen die Kiefernschütte gebräuchlichen Platzschen Pflanzenspritze mit fünfprozentiger Lösung von Obstbaumkarbolineum. Unter Verwendung des Verlängerungsrohres dieser Spritze kann man die Stämme bis hoch hinauf mit dem Verstäuber erreichen.
Auch mit giftigen Gasen, wie sie im Kriege Verwendung gefunden haben, sind in Böhmen umfassende Versuche gemacht worden. Leider zeitigte auch dieser Versuch keinen Erfolg. Es starben höchstens die Bäume ab, aber nicht die widerstandsfähigen Raupen.
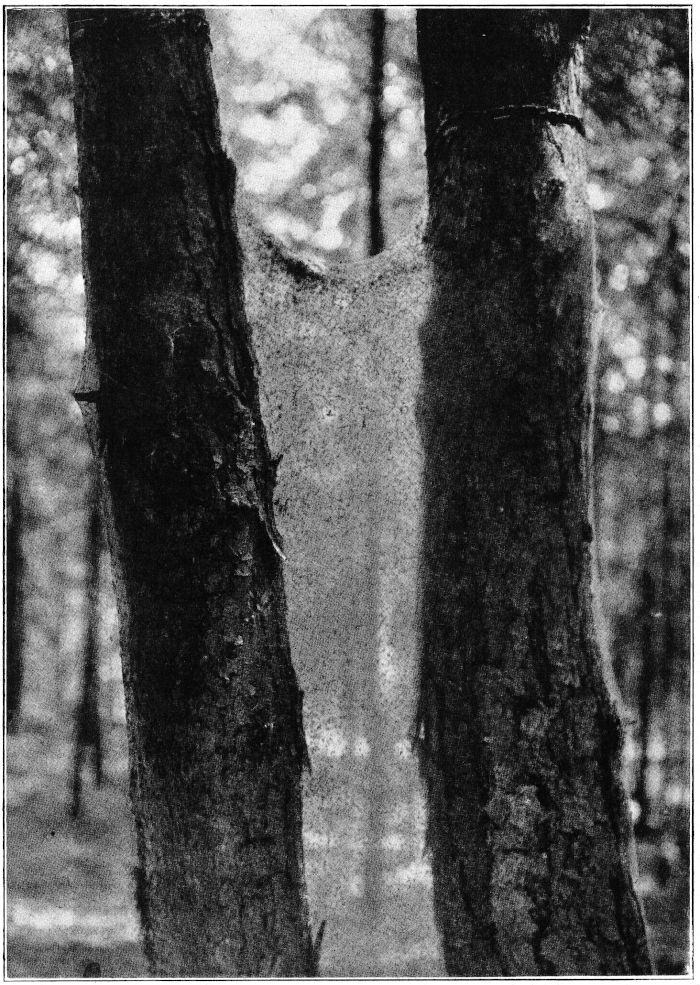
Als letztes uns zu Gebote stehendes Mittel bliebe nur noch der viel umstrittene Leimring zu besprechen. Seine Wirkung ist eine doppelte. Zunächst fängt er alle unterhalb des Leimringes aus den Eiern gekommenen Spiegelräupchen, die zum Fraße in die Baumkronen hinaufsteigen wollen, ab, und verurteilt sie zum[193] Hungertode. Wer in der Sächsischen Schweiz in diesem Frühjahre derartige geleimte Bestände besichtigt hat, wird bestätigen können, daß durch die Leimringe schon in einem einzigen geleimten Bestande Millionen und Milliarden von Räupchen vernichtet worden sind, bevor sie irgendwelchen Schaden anrichten konnten. Die Abbildungen 2 und 3 geben davon ein anschauliches Bild. Da man nun damit rechnen kann, daß etwa die Hälfte der Raupen sich zu weiblichen Faltern entwickelt haben würden, so sind für das nächste Jahr ebensoviel eierablegende Weibchen, die man beim Sammeln im Falterzustande in gleichem Maße niemals gefangen hätte, mit vernichtet worden.
Zum besseren Verständnis der Abbildungen 2 und 3 sei noch folgendes hinzugefügt: die im Frühjahr aus den Eiern ausgeschlüpften Räupchen sitzen zunächst einige Tage dicht gedrängt in sogenannten Spiegeln beisammen, ehe sie den Aufstieg in die Baumkronen beginnen. Bei ihren Wanderungen spinnen sie ununterbrochen ihre feinen Fäden, die sie auf den Unterlagen stellenweise festheften, so daß zuletzt feinste schleierartige Gespinste entstehen. Diese Gespinste werden um so dichter, je mehr Räupchen denselben Weg nehmen. Das ist namentlich unter den Leimringen der Fall, unter denen sich schließlich gewaltige Mengen von Spiegelräupchen ansammeln, die immer spinnend rastlos den Stamm umwandern, am Leimring, den sie nicht überschreiten können, sich an einen Gespinstfaden fallen lassen, um dann denselben Weg ruhelos zu wiederholen, bis sie schließlich an Nahrungsmangel zugrunde gehen.
Vielfach werden die leichten Räupchen, an ihrem feinen Spinnfaden hängend, vom Winde nach Nachbarbäumen verweht, dadurch bildet sich eine Querverbindung von einem Baum zum anderen, bei zahlreichen Raupen vermehren sich diese Fäden rasch, kreuzen sich und werden von den Räupchen nun gewissermaßen als Brücke von Baum zu Baum und von Ast zu Ast benutzt und immer dichter versponnen, so entstehen schließlich auch dichte Schleier zwischen nahe beieinanderstehenden Bäumen, in denen ebenfalls Massen von Räupchen zugrunde gehen.
Damit ist aber die Wirkung des Leimrings nicht erschöpft. Im Laufe ihres Lebens kommen zahllose Raupen, wie alle früheren und jetzigen Beobachtungen beweisen, sei es nun durch Sturm oder Regen oder aus eigenem Antriebe, z. B. während der viermaligen Häutungen oder wegen übergroßer Sonnenwärme in den Wipfeln, wenigstens einmal vom Baum herab und werden dann am Wiederaufklettern durch den Leimring gehindert. Es sammeln sich deshalb unter den Leimringen auch gewaltige Massen von fast ausgewachsenen Raupen an, wie Abbildung 4 zeigt. Diese Raupen können leicht vernichtet werden. Unterläßt man dies, so sind sie doch, nachdem sie den etwaigen Unterwuchs und das Heidelbeerkraut am Boden kahlgefressen haben, dem Nahrungsmangel ausgesetzt, so daß sie massenhaft zugrunde gehen oder für Krankheitskeime besonders empfänglich werden und bei dem dicht gedrängten Beisammensitzen, manchmal in doppelter Schicht übereinander, sich gegenseitig anstecken. Selbst der ungläubigste Thomas müßte beim Anblick derartiger Bilder in der Natur sich zu der Überzeugung durchringen, daß der Leimring gegenwärtig noch das relativ beste Mittel auch zur Einschränkung der Massenvermehrung der Nonne ist.
[195]
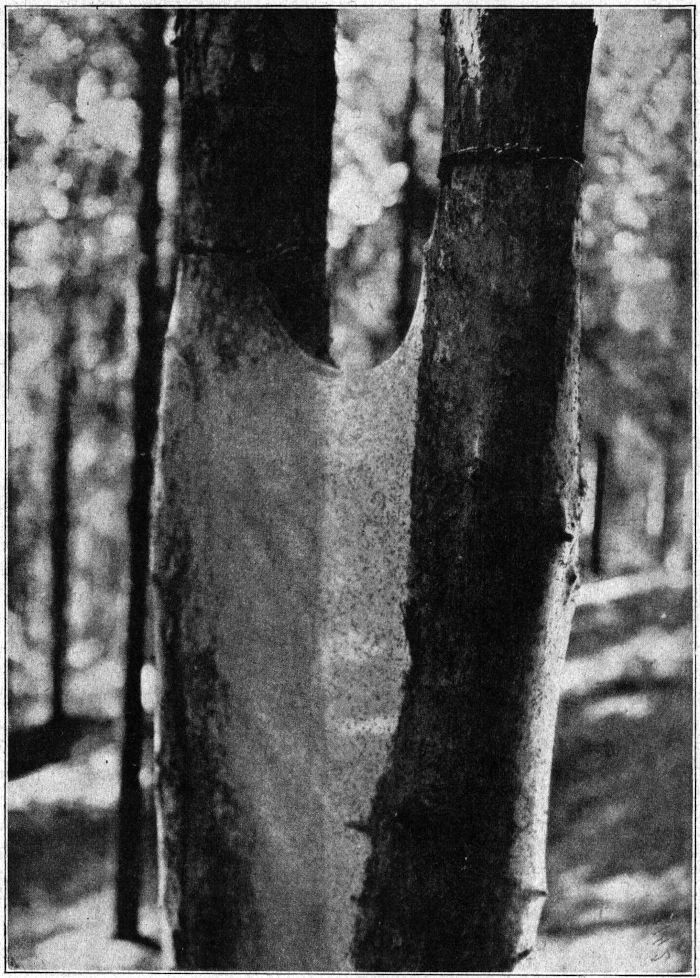
Das ist aber nicht seine einzige Wirkung. Fast größer noch ist seine wirtschaftliche Bedeutung, insofern als er viele Bestände, deren Eibelag für einen vollständigen Kahlfraß gerade hinreichen würde, durch Vernichtung eines großen Teiles der fressenden Raupen davor bewahrt. Dadurch werden große volkswirtschaftliche Schäden vermieden, die durch den Abtrieb hiebsunreifer und darum minderwertiger Bestände, sowie durch die übermäßige Vergrößerung der Wiederanbauflächen entstehen. Bei früheren Nonnenkalamitäten sind die ungeheueren Kahlschlagsflächen erst in zehn und mehr Jahren, nachdem der Boden durch das lange Bloßliegen stark gelitten hatte, mit sehr großen Schwierigkeiten und Kosten wieder angebaut worden. Außerdem wird durch den unregelmäßigen Kahlfraß der Nonne, mitten aus den geschlossenen Beständen heraus, vielfach die geordnete Bestandslagerung zerstört und Anlaß zu späterem ausgedehnten Windbruch gegeben.
Man kann daher jedem Waldbesitzer nur den Rat geben, seine Fichtenbestände, wenn durch die nötigen Probeeizählungen der starke Eibelag festgestellt ist, zu leimen, er erweist damit nicht nur sich selbst einen Dienst, sondern auch der Allgemeinheit, indem er dadurch zur Einschränkung der Weiterausbreitung der Nonnenplage beiträgt. Die Bereitstellung erheblicher Staatsmittel zur möglichst weitgehenden Durchführung der Leimung wäre deshalb vom allgemeinen volkswirtschaftlichen Standpunkt aus durchaus gerechtfertigt. Ein kleiner Waldbesitzer, der vielleicht nicht einmal schlagbaren Wald, sondern nur jüngere Bestände besitzt, die ihm keinen Ertrag liefern, könnte sonst die erheblichen Mittel, die das Leimen erfordert, vielfach gar nicht aufbringen. Will er sich das Geld zu den in diesem Jahre erheblichen Leimungskosten borgen, so wäre er mit Schulden belastet, die ihn zugrunde richten könnten.
Wie sich aus dem Gesagten ergibt, besitzen wir leider keine absolut sicher wirkenden Bekämpfungsmittel gegen die Nonne. Mißerfolge bei Anwendung eines oder des andern der geschilderten Mittel und selbst bei Anwendung aller dieser Mittel gleichzeitig sind bei dem stellenweise ungeheuren Massenauftreten der Raupen nicht ausgeschlossen. Das hat vielfach zu der fatalistischen Auffassung geführt, überhaupt nichts gegen die Nonne zu tun und alles der Natur zu überlassen. Diese Auffassung muß verhängnisvoll wirken. Für die Natur ist es vollkommen gleichgültig, ob eine gewisse Bodenfläche mit Wald bestockt ist oder ob sie zur Grassteppe, zu Moor oder Heide oder Flugsandboden wird, für den Menschen dagegen bedeutet dieses unter Umständen den Untergang.
Große Hoffnungen hat man auf die »biologische« Bekämpfung, jetzt ein sehr beliebtes Schlagwort, gesetzt, leider auch vergebens, denn alle Versuche, künstlich Krankheiten bei den Nonnenraupen, namentlich die sogenannte Wipfelkrankheit, zu erzeugen oder zu verbreiten, sind bis jetzt gescheitert. Alle Infektionsversuche im Großen in der freien Natur durch Ausbreiten von toten Raupen, Streu und Kot aus Orten, wo die Wipfelkrankheit unter den Raupen bereits herrschte, waren erfolglos.
Ebenso trügt die Hoffnung, die man auf die Wirkung von Schmarotzern, Schlupfwespen und Raupenfliegen (Tachinen) setzt. Diese Tachinen sind, wenn sich die Insektenwelt in der Natur im Gleichgewicht befindet, nur in verhältnismäßig geringer Zahl vorhanden, da sie von der Zahl der Wirtstiere abhängig sind,[196] in denen sie sich entwickeln. Ihre Massenentwicklung tritt deshalb erst ein, wenn die Wirtstiere sich schon außergewöhnlich vermehrt haben. Sie können also den Nonnenschaden ebenfalls nicht aufhalten, denn sie sind erst dann in Überzahl vorhanden, wenn der Schaden im Walde bereits geschehen ist.

Auch die Wipfelkrankheit, die in früheren Fällen jedesmal der Nonnenplage schließlich ein rasches Ende machte, tritt ebenfalls immer erst dann ein, wenn der Kahlfraß weite Flächen der Waldungen bereits vernichtet hat. So lange es uns nicht gelingt, die Erreger der immer noch ungeklärten Wipfelkrankheit zu finden und auch außerhalb der Raupen künstlich zu züchten, um sie schon beim Eintreten einer größeren Nonnenvermehrung sofort zur Infektion von Raupen verwenden zu können, um so die vernichtende Krankheit mit Erfolg künstlich zu verbreiten, wird unsere biologische Bekämpfung der Nonne, wie zeither, so gut wie erfolglos bleiben.
Das ist zunächst das bis zu einem gewissen Grade betrübende Ergebnis unserer heutigen biologischen Forschungen. Das darf uns aber nicht entmutigen, diese Forschungen fortzusetzen. Ebensogut wie das jahrzehntelange Suchen nach[197] den Erregern mancher menschlichen Krankheiten schließlich von Erfolg gewesen ist, wird dies hoffentlich auch bei der rätselhaften Wipfelkrankheit, die seit Jahrzehnten die Wissenschaft beschäftigt hat, gelingen.
Jedenfalls dürfen wir die Hände nicht in den Schoß legen, so lange uns die Wissenschaft keine besseren Bekämpfungsmittel in die Hand gibt, sondern müssen die bisher angewendeten, erfahrungsmäßig wirksamen Vorbeugungs- und Bekämpfungsmaßnahmen des Sammelns von Faltern, Eiern, Raupen und Puppen und namentlich des Leimens der besonders gefährdeten Bestände auch weiterhin im weitesten Umfang anwenden. Namentlich in den erst in diesem Jahre neu befallenen Landesteilen Mittelsachsens und des Niederlandes, wo die Plage noch in der Entwicklung begriffen ist, ist das eine zwingende Notwendigkeit. Je umfassender und gründlicher die Bekämpfung beim ersten Auftreten der Plage einsetzt, um so mehr ist auf einen Erfolg zu hoffen.
Von Herbert Biehle, Bautzen
Zu den vielen musikalischen Gebräuchen aus vergangenen Zeiten gehört auch das Turmblasen. Wie 1670 der damalige Leipziger Stadtpfeifer und spätere Bautzener Stadtmusikant Johann Pezel im Vorwort zu seiner »Musicalischen Arbeit zum Abblasen um zehn Uhr in Leipzig« schrieb, war es schon bei Persern und Türken üblich, beim Opfern die Gottheiten von Türmen anzurufen. Derselbe Gedanke, Gott möglichst nahe zu stehen, und eine gewisse Himmelssehnsucht, wie sie auch bei den gotischen Domen zum Ausdruck kommt, liegt dem Turmblasen zugrunde. Diese schöne Sitte ist hervorgegangen aus dem Hornrufe des Turmwächters, der das Herannahen von Feinden, Feuerausbruch und die Stunden verkündete. So entstand die besondere Hervorhebung der Haupttageszeiten mit ausgedehnteren Melodien. Später erfuhr das Turmblasen durch Luther eine kräftige Anregung; das von ihm begründete deutsche evangelische Kirchenlied wurde eine wertvolle Bereicherung der Turmmusik. Und wie stimmungsvoll und andachterweckend wirkt es, wenn im Sonnenglanze Trompeten und Posaunen in den lichten Morgen hinein rufen: Wachet auf, ruft uns die Stimme! Indessen entwickelte sich allmählich eine eigene Turmliteratur, die in der Turmsonate gipfelt. Sie ist aus der einfachen Liedform nach dem Vorbilde der italienischen Orchestersonate gestaltet.
Unter den wenigen, die Turmsonate vertretenden Komponisten steht Johann Pezel voran. Seine vierzig Turmsonaten sind für zwei Cornetti, zwei Tromboni und Basso trombone gesetzt. Heute würde die Ausführung technischen Schwierigkeiten begegnen; denn die edle Trompeterkunst wird nicht mehr gepflegt. Pezel bevorzugt das strahlende C-dur oder die ernste Stimmung des a-moll. Er hat die »Musicalische Arbeit« in Druck gegeben, weil er »verspüret, daß auch an anderen Orten dergleichen verlanget werde«; und in der Tat sind seine anmutigen Bläserstücke in sächsisch-thüringischen Landen oft erklungen und weit verbreitet gewesen. Hier war ja durch die protestantische Idee der Laienhilfe beim Gottesdienste der Musiksinn jedes einzelnen Bürgers geweckt und so der geeignete Boden bereitet worden, auf dem auch die Turmmusik gedeihen konnte.
Pezel hat 1664–1669 als Kunstgeiger, 1669–1681 als Stadtpfeifer in Leipzig gewirkt und war dann nach Bautzen berufen worden, wo er bis zu seinem Tode 1694 als Director musicae instrumentalis lebte. Aber nicht nur in seiner Eigenschaft als Stadtmusicus war er eine bemerkenswerte Persönlichkeit. Die große Anzahl seiner gedruckten Instrumentalwerke sicherte ihm besonders nach außen hin einen bedeutenden Ruf und einen festen Platz in der Geschichte der deutschen Instrumentalmusik. Um so verwunderlicher ist es, daß man sich über Pezels nähere[198] Lebensumstände noch ganz im Dunklen befand, bis es Verfasser gelang, in den Akten des Bautzener Ratsarchivs darüber Klarheit zu erlangen. Pezels Schaffenszeit gehörte jener Glanzperiode sächsischer Musikpflege an, als dieses Land, wie kein zweites, die bedeutendsten Musiker hervorbrachte. So wurde Sachsen auch die Hauptpflegestätte der Werke Meister Pezels, den wir als den Klassiker des gesamten deutschen Kunstpfeifertums seiner Zeit bezeichnen dürfen; er war für unser weiteres Vaterland ein Stück bodenständige Heimatkunst.
Außer Pezel hat 1696 der Leipziger Stadtpfeifer Gottfried Reiche Turmsonaten geschrieben, und ihr letzter Vertreter ist der durch sein Oratorium »Das Weltgericht« berühmte Friedrich Schneider aus Altwaltersdorf bei Zittau gewesen. Er fand schließlich in einem Oberlausitzer Bauern Schönfelder noch einen Nachfolger im vorigen Jahrhundert.
In vielen Städten, wie beispielsweise in Leipzig, Bautzen, Löbau, Görlitz, gehörte es zu den Amtspflichten des Stadtmusikanten, mit seinen Stadtpfeifergesellen in den Sommermonaten fast täglich vom Rathausturme zu blasen, wie auch an den ersten Feiertagen, zu Neujahr und bei sonstigen festlichen Anlässen. Vielleicht gibt diese Abhandlung auch den Architekten und Kunsthistorikern Anlaß, die Frage zu verfolgen, wieweit der Turmbau der damaligen und früheren Zeit diesen musikalischen Veranstaltungen durch bauliche Maßnahmen zur Aufstellung der Mitwirkenden in Gestalt von Galerien, Umgängen oder Balkonen Rechnung trug. Gegenwärtig ist dieser musikalische Brauch fast völlig in Vergessenheit geraten; wo er noch besteht, geschieht es auf Grund alter Stiftungen mit dem Abblasen von Chorälen.
Die Turmmusikpflege selbst darf als ein getreues Abbild jener alten Beschaulichkeit gelten, als man noch Muße und Sinn hatte, den schlichten Weisen der Stadtpfeifer vom Rathaus- oder Kirchturme zu lauschen. Und zu dem Begriff des deutschen Kleinstadtidylls um 1700 gehört auch die Turmsonate. Es wäre wohl lohnend, diese Perlen früherer Kunst auch der Gegenwart zugänglich zu machen; denn sie war ein Stück blühender Romantik. Und eine fromme Kunst.
Von Martin Braeß
Während die Jagdschutzvereine im Sinne des Natur- und Heimatschutzes die »Raubzeugprämien« teils wesentlich eingeschränkt, teils vollständig abgeschafft haben, glauben die Brieftaubenzüchter ohne solche Schußpreise nicht auskommen zu können, wie folgende, in verschiedenen Tageszeitungen erschienene Veröffentlichung beweist: »Der Verband deutscher Brieftaubenzüchter-Vereine setzt für das Jahr 1922 für den Abschuß der den Brieftauben schädlichen Raubvögel, als Wanderfalken, Hühnerhabichte und Sperberweibchen, eine Belohnung von zwanzig Mark für das Paar Fänge aus. Diese Belohnung wird Ende Dezember 1922 ausgezahlt. Zur Erhebung eines Anspruchs auf diesen Preis müssen die beiden Fänge eines Raubvogels (nicht der ganze Raubvogel) bis spätestens Ende November 1922 … frei zugesandt werden.«
Wenn man den Sperber kurz hält, so haben wir dagegen gewiß nichts einzuwenden. Er ist ein böser Geselle, der für unsre Kleinvögel zu einer schlimmen Geißel wird; dazu findet er sich fast in allen waldreichen Gegenden noch so häufig, daß eine Ausrottung dieses Vogels vorläufig nicht zu befürchten ist. Aber was der Sperber gerade den Brieftauben zuleide tun soll, ist nicht recht einzusehen. Auf Haustauben stößt er nur dann, wenn sich in dem Schwarm eine junge befindet, die noch nicht ganz flüchtig ist, wie er auch nur auf junge Wildtauben Jagd macht. Eine gesunde, flugfähige Brieftaube hat von dem kleinen Räuber wohl nichts zu befürchten. Anders Hühnerhabicht und Wanderfalke. Indessen, diese schönen Vögel sind in den meisten Gegenden unsres Vaterlandes bereits so selten geworden, daß man sie schonen sollte; keineswegs aber darf man durch Schußbelohnungen zu ihrer völligen Ausrottung auffordern. Die Brieftaubenzucht ist gewiß kein bloßer Sport, keine nutzlose Spielerei, sondern hat ihre Berechtigung, aber doch nur so lange und so weit, als sie sich nicht in bewußten Gegensatz[199] zu andern Bestrebungen setzt, die wie Heimat- und Naturschutz von einer ungleich höheren und allgemeineren Bedeutung sind. Der Brieftaubenzüchter muß eben beim Freiflug seiner Tauben mit Verlusten mancherlei Art rechnen und darf nicht verlangen, daß die Natur lediglich um seinetwillen ihrer schönsten Geschöpfe beraubt werde, an deren herrlichem Fluge so viele Naturfreunde ihre Freude haben. In Norddeutschland, namentlich auf der Seenplatte, die von Ostpreußen bis nach Schleswig-Holstein zieht, mag der Wanderfalke noch häufiger vorkommen; bei uns in Sachsen gehört er aber als Brutvogel bereits zu den seltensten Naturdenkmälern, und auch seine Wanderflüge im Herbst und Frühling führen ihn nicht allzuoft in unser Land. Ähnlich verhält es sich mit dem Hühnerhabicht, wenn auch dessen völlige Vernichtung für unsre Heimat noch nicht zu befürchten ist. Ich hoffe, es wird sich, wenigstens in Sachsen, kein Jagdberechtigter finden, der sich durch Abschuß so seltener Raubvögel die Prämie von zwanzig Mark verdienen will – was sind übrigens heute zwanzig Mark nach Abzug der Kosten für Patrone und Porto!
Aber die Aufforderung der Brieftaubenzüchter-Vereine hat noch eine schlimme Seite. Es ist bekannt, daß nicht jeder Jagdberechtigte die Raubvögel nach ihrem Flugbilde richtig anzusprechen versteht, und so wird gewiß mancher unschuldige Bussard, Turmfalke, manche Weihe u. a. unerfahrenen Schützen zum Opfer fallen.
Bei dieser Gelegenheit sei daran erinnert, daß das Sächsische Finanzministerium schon unter dem 30. Januar 1911, bzw. 20. Mai 1912 zwei Generalverordnungen erlassen hat, nach denen, »soweit irgend zulässig«, die Turmfalken, Wanderfalken, Schrei-, See- und Fischadler, die Uhus, Eulen, Weihe, Bussarde, ebenso der schwarze und rote Milan zu schonen sind, selbst die Reiher, obgleich diese für die Fischereiberechtigten gewiß ebenso und noch mehr als Schädlinge bezeichnet werden müssen, wie jene obengenannten Raubvögel für die Brieftaubenzüchter. Die einzelnen Berufs- und Interessentenkreise haben sich eben der allgemeinen großen Idee unterzuordnen, und diese kann in unserm Falle nur heißen: Schutz der Natur!
Von Gartenarchitekt Hans S. Kammeyer
Wenn die brennende Mittagssonne in den Sommermonaten ungehindert vom Himmel in den Hof strahlt, dann suchen Tier und Mensch ein schattiges Plätzchen. Der Hof, auf dem sonst reges Leben herrscht, liegt verlassen, selbst das Hühnervolk meidet die überreiche Wärme.
Es ist unbedingt notwendig, daß ein breitkroniger Baum in einem sonnigen Hof im Sommer Schatten bietet. Obstbäume sind so recht geeignet als Hofbäume, weil sie alljährlich auch einen Ertrag bringen. Während die Linde ein richtiger Hausbaum ist, wenn nicht mit dem Nutzen gerechnet wird, wähle man breitkronige Sorten für den Hof, die zu großen Bäumen heranwachsen. Ein rechtes Beispiel hierfür bietet der Birnbaum. Wie prächtig sieht er in weißem Blütenschmuck aus. In seinem Schatten stehen die Futterschüsseln und Trinkgefäße für das Federvieh. Hier werden die Hühner in der Mittagsstunde gefüttert, ohne daß sie unter der brennenden Sonne zu leiden haben. Zu allen diesen Vorteilen hat man dann noch im Herbst die reiche Ernte. Wir laben uns an den saftigen Birnen, die der Baum bietet.
Höfe und Hofplätze, die nach Süden offen sind und die volle Sonne hereinlassen, bepflanze man deshalb mit einem großwachsenden Hofbaum, an dem sich später noch die Kinder und Kindeskinder erfreuen.
An Obstbäumen kommen in Frage: Apfel: Reichsobstsorte Jacob Lebel, Weißer geflammter Cardinal, Landsberger Renette; Birne: Reichsobstsorte William Christbirne, Pastorenbirne und Prinzeß Marianne.
Von Zierbäumen, die sich ebenfalls zur Anpflanzung eignen, sind zu nennen: Aesculas hippocastanum, Roßkastanie; Ailanthus glandulosa, Götterbaum; Catalpa speciosa, Trompetenbaum;[200] Juglans regia, Walnußbaum; Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum; Platanus occidentalis und orientalis, Platane.
Von Hans Jacob
Die Anpflanzung des Walnußbaumes ist infolge der Verwüstungen durch die Kriegsjahre für die Zukunft besonders bedeutsam geworden. Viele Nußbäume sind der Holzgewinnung wegen abgeschlagen worden. Der Walnußanbau soll und muß deshalb mit allen Mitteln gefördert werden. Allerdings nicht wahllos, mit unsicherem Ergebnis, sondern in planmäßiger Weise. Zur Pflanzung müssen solche Pflanzstätten ausgesucht werden, an welchen erfahrungsgemäß der Nußbaum gut gedeiht und sichere Erträge bringt. Nußbäume sind in geschlossenen Pflanzungen nur da anzubauen, wo auf einen Ertrag der Unternutzung verzichtet werden kann. Für Einzelpflanzungen aber, und hierzu ist der Nußbaum mehr als alle andern Obstarten geeignet, gibt es fast allerorts noch eine ganze Menge brauchbarer Stellen. So auf Gutshöfen, Dorfplätzen, an Wegescheiden und an andern Orten, wo die Bäume nicht nur durch ihre Früchte Segen bringen, sondern auch zur Verschönerung der Heimat beitragen. Während man für solche Plätze die Anpflanzung fertig vorgebildeter Bäume bevorzugen soll, dürfte für den Großanbau die Aussaat an Ort und Stelle in Betracht zu ziehen sein. Da eine spätere Veredelung der Nüsse erhebliche Schwierigkeiten bietet, hat man auf jeden Fall dafür zu sorgen, daß als Saatgut nur Nüsse allerbester Abstammung verwendet werden. Nur reichtragende, spätblühende, widerstandsfähige Sorten mit großen, mäßig dünnschaligen Früchten sind geeignet.
Wenige Tage bevor das Heft 4/6 der »Mitteilungen« mit Dr. Kuhfahls Postsäulenaufsatz in meine Hände kam, war es mir gelungen, einen Rest der alten Auer Postsäule aufzufinden. Aufmerksam geworden darauf war ich bei Gelegenheit einer Ausstellung: »Die Gesamtentwicklung der Stadt Aue«, die ich eingerichtet hatte. Auf mehreren alten Bildern vom Marktplatz war dort eine Postsäule zu sehen, und zwar an der Ecke der jetzigen Markt- und Bahnhofsstraße (ehedem Lößnitzer Straße). Ältere Leute kannten sie noch. Der einstige Posthalter Walther hatte sie, als sie beseitigt werden sollte, in seinen Hof gestellt. Sein Sohn half mir, die Säule ausfindig machen. Sie dient jetzt als Steinbank an einem Hause Wiesenstraße 2, ist auf den sichtbaren zwei Seiten ziemlich abgenutzt, läßt aber noch ein Posthorn, den Namen Schneeberg, sowie Zahlenreste erkennen. Sockel und Spitze fehlen. Der Stein (Granit) weist unten ein Loch zur Befestigung auf und verjüngt sich obeliskenartig. Es besteht die Hoffnung, daß er wieder an geeigneter Stelle aufgerichtet wird.
Dr. Sieber, Aue.
Postmeilensäulen: Zum Aufsatz von Dr. Kuhfahl im Heft 4/6 XI sind uns und dem Verfasser erfreulicherweise eine Reihe von Mitteilungen zugegangen. Allen Einsendern sei bestens gedankt. Um weitere Ergänzungen wird gebeten. Dies neue Material wird später in einem Nachtrag veröffentlicht werden.
Die Schriftleitung.
Für die Schriftleitung des Textes verantwortlich: Werner Schmidt – Druck: Lehmannsche Buchdruckerei
Klischees von Römmler & Jonas, sämtlich in Dresden.
Soeben erschienen:
Die
Vegetationsverhältnisse
des östlichen Erzgebirges
von
Professor Dr. Arno Naumann
*
Mit einer Kartenskizze
(Sonderdruck aus der »Isis«, 46 Seiten Oktav)
*
Preis 20 Mark und Postgeld
Zu beziehen:
Landesverein Sächsischer Heimatschutz
Dresden-A.
Schießgasse Nr. 24
Friedhof und Denkmal
Halbmonatsschrift
herausgegeben von
Robert B. Witte
Für Künstler, Gartenfachleute, Industrie und Gewerbe das erste und einzige reichillustrierte Organ der gesamten Friedhofskultur
Das unentbehrliche Fachblatt für alle zuständigen Behörden
Probenummer
durch den Verlag der Zeitschrift
Friedhof und Denkmal
G. m. b. H., Dresden-N. 6
Lehmannsche Buchdruckerei, Dresden-A.
Weitere Anmerkungen zur Transkription
Offensichtliche Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Die Darstellung der Ellipsen wurde vereinheitlicht.
Korrekturen:
S. 139: Heist → Geist
scrato = böser Geist