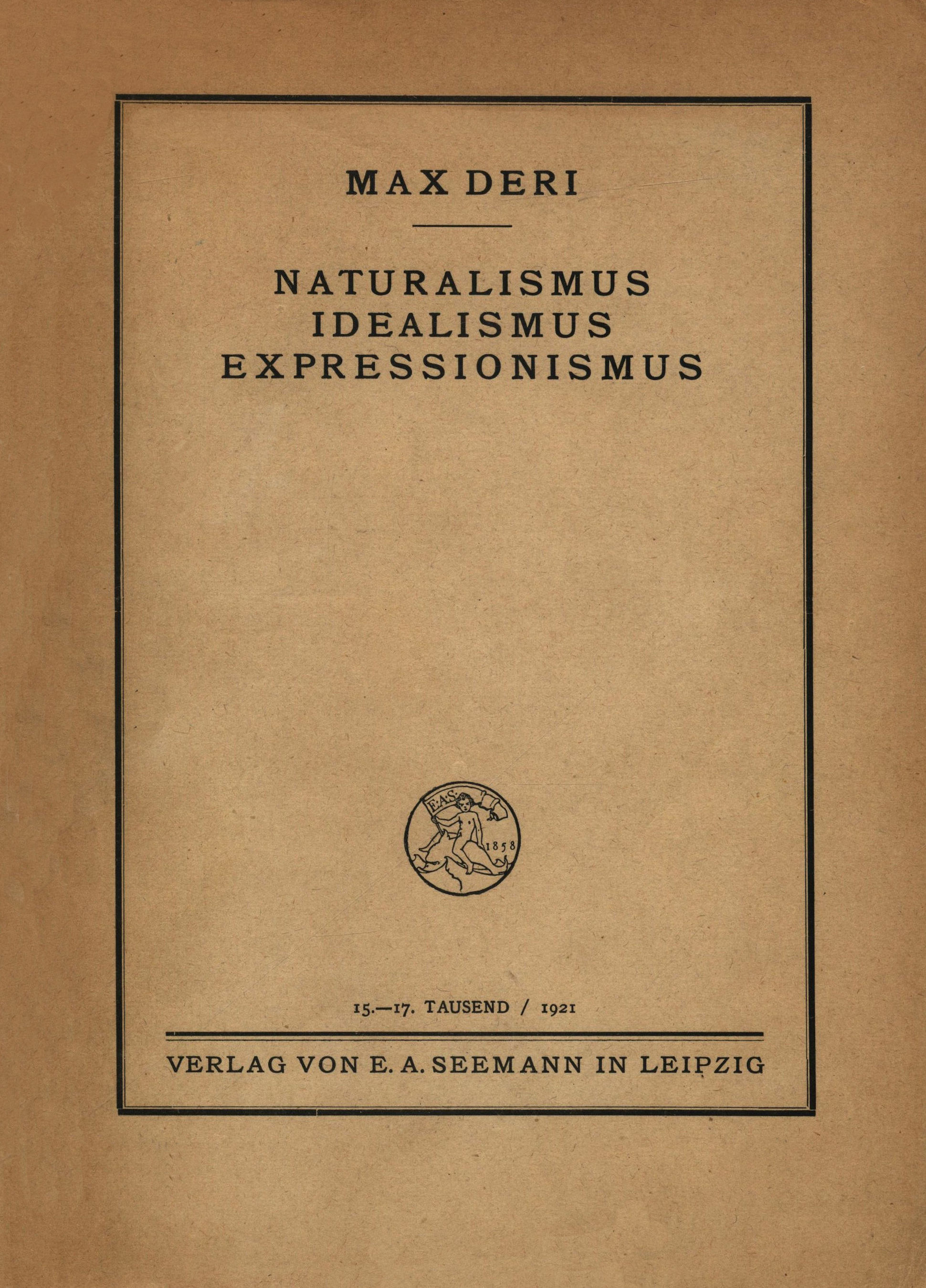
Title: Naturalismus, Idealismus, Expressionismus
Author: Max Deri
Release date: February 5, 2024 [eBook #72877]
Language: German
Original publication: Leipzig: Verlag von E. Seemann, 1921
Credits: The Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net
Anmerkungen zur Transkription
Der vorliegende Text wurde anhand der Buchausgabe von 1921 so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute nicht mehr verwendete Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original unverändert; fremdsprachliche Ausdrücke wurden nicht korrigiert.
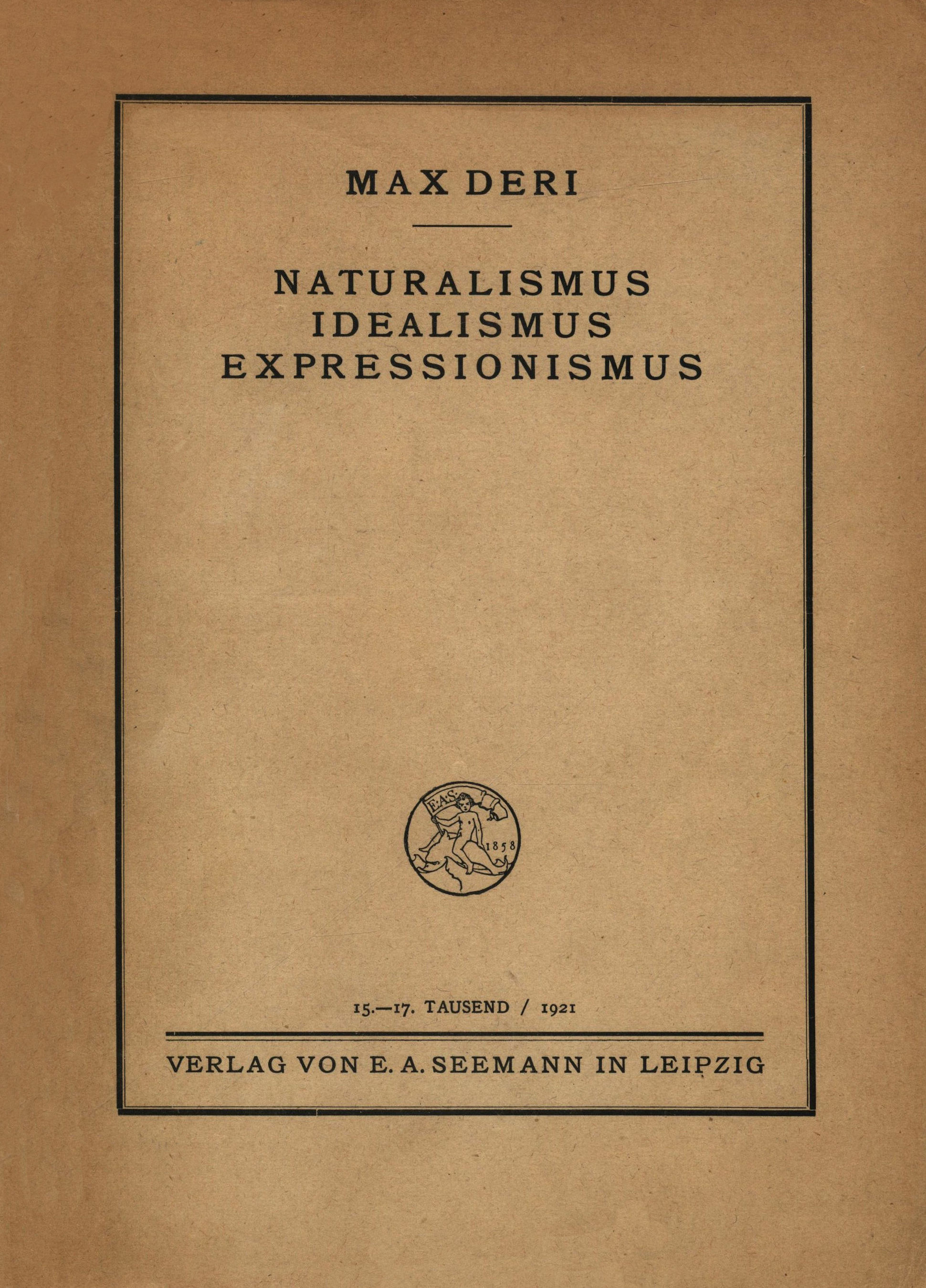
VON
MAX DERI

FÜNFZEHNTES BIS SIEBZEHNTES TAUSEND
VERLAG VON E. A. SEEMANN IN LEIPZIG 1921
[S. 1]
Anpassung der Gedanken an die Tatsachen nennt man Beobachtung, gegenseitige Anpassung der Gedanken aneinander Theorie.
Dieser Grundsatz, den Ernst Mach formuliert hat, leitet die folgenden Feststellungen. Er sagt von vornherein, daß alle metaphysischen Gesichtspunkte aus der Untersuchung ausgeschaltet bleiben sollen. Das Bewußtsein des Menschen wird als Ergebnis eines jahrtausendelangen Anpassungsprozesses der lebendigen Materie an das Milieu dieses Daseins aufgefaßt. Woher dieses Universum, dieser „Kosmos“ stammt, wird nicht gefragt. Ebensowenig, wieso die lebendige Substanz, aus der sich der Mensch aufbaut, die Fähigkeit der Reaktion auf die Eindrücke der Außenwelt besitzt. Diese beiden Voraussetzungen: das Dasein einer „Welt“ äußerer Vorhandenheiten, und das In-ihr-Sein lebendig-reaktionsfähiger Materie wird als Gegebenes hingenommen. Und nur danach wird getrachtet, die gegenseitigen Abhängigkeiten sowohl der äußeren Objekte, wie der inneren seelischen Reaktionen, wie auch der beiden Gruppen voneinander möglichst genau und unvoreingenommen festzustellen und zu beschreiben.
Beobachtung soll also der Vorgang heißen: die Tatsachen so lange möglichst genau in Begriffen nachzubilden, bis diese den Erfahrungen möglichst eindeutig und widerspruchslos zugeordnet sind. Und Theorie soll heißen: die auf Grund der anpassenden Nachbildung der Tatsachen erlangten Begriffe so lange immer wieder gegenseitig anzupassen, bis sie auch untereinander, im gesamten Begriffskomplex, keinerlei Widersprüche mehr enthalten.
Dabei ist es nach neuerer Anschauung — die man besonders eindringlich und überzeugend in den Schriften von Moritz Schlick vertreten findet — keineswegs möglich, Eine bestimmte Theorie, also Ein untereinander bis zur Widerspruchslosigkeit angepaßtes Begriffsystem als das einzig und allein „richtige“ zu erweisen. Sondern die moderne relativistische Anschauung, die jegliches „Absolute“ als eine Fiktion erkannt zu haben glaubt, steht auf dem Standpunkt, daß jede Theorie „richtig“ ist, die den Tatsachen der äußeren Erfahrung ein geschlossenes Begriffsystem eindeutig zuordnet. Die „Eindeutigkeit“ wird gefordert: als Resultat der Anpassung[S. 2] der Gedanken an die äußeren Tatsachen, in der Form, daß jeder Tatsache auch nur Ein Begriffsgebilde zugeordnet erscheint. Und die „Geschlossenheit“ in der Form, daß innerhalb des Begriffsystemes kein Widerspruch der einzelnen gedanklichen Gebilde untereinander bestehen bleibt. — So gelten heute etwa beide kosmischen Theorien, sowohl die ptolemäische, wie die kopernikanische, beide als „richtig“, beide als „möglich“. Die Theorie des Ptolemäus ordnet ihre Gedanken den Tatsachen der Bewegungen der Himmelskörper in Der Art zu, daß sie annimmt, die Erde „stehe fest“, und die Sonne sowie der ganze Sternenhimmel drehten sich um diese Erde als um ihren Mittelpunkt. Sie kommt dabei dann weiterhin, durch Anpassung der Begriffsbilder untereinander, zu einem eindeutigen System von Bewegungsbahnen: zu Kreisen, Ellipsen, Epizyklen und anderen komplizierten Kurven, in denen sich die einzelnen Himmelskörper um den Zentralpunkt der Erde bewegen. — Die Anschauung des Kopernikus dagegen nimmt die Anpassung der Vorstellungen an die Tatsachen in Der Weise vor, daß sie die Sonne als Zentralpunkt auffaßt, und die Erde und die Planeten sich um diesen Mittelpunkt bewegen läßt. Auch diese Anschauung kommt dann durch Anpassung der Tatsachen-Abbildungen untereinander zu einem in sich widerspruchslosen, geschlossenen Begriffsystem; hier aber ergeben sich als Bewegungsbahnen der Gestirne keine komplizierten Kurven mehr, sondern ausschließlich Kreise und Ellipsen. — Beide Anschauungen also sind, nach moderner Auffassung, möglich und „richtig“. Die Entscheidung aber, welcher von diesen zweien man schließlich den Vorzug gibt, wird aus dem Gesichtspunkte heraus getroffen, daß man — die restlose Tatsachen-Entsprechung und die restlose innere Eindeutigkeit beider Systeme vorausgesetzt — jedes vorzieht, das ein einfacheres, ein weniger kompliziertes System von Begriffen ergibt. In diesem Sinne gibt also letzthin das geistige „Ökonomie-Prinzip“, das einerseits von möglichst wenigen unbeweisbaren Grund-Voraussetzungen ausgeht, und andererseits zu der möglichst einfachen Anordnung der beobachteten Tatsachen führt, den Ausschlag bei der Wahl einer „Theorie“.
Geht man nun mit diesem Gesichtspunkte des Ökonomie-Prinzipes der Wissenschaft an die theoretische Grundlegung eines bestimmten Spezialgebietes, so muß man demgemäß vor allem danach trachten, bei der Aufstellung jener „unbeweisbaren“ — das heißt: nicht mehr auf bereits vorher Bekanntes zurückführbaren — Grund-Voraussetzungen, die jede Spezial-Theorie benötigt, mit einer möglichst geringen Anzahl auszukommen.
Es handelt sich bei den vorliegenden Untersuchungen um „ästhetische“ Probleme, das heißt um Fragen des Kunstschaffens und des Kunstgenießens.
[S. 3]
Zwei ganz allgemeine und für alle Teilgebiete geltende Voraussetzungen haben wir dabei bereits gemacht: erstens das tatsächliche Vorhandensein einer Außenwelt, und zweitens das tatsächliche Vorhandensein einer auf die Eindrücke dieser Außenwelt reagierenden lebendigen Substanz.
Nun wurden für das ästhetische Teilgebiet bisher meist von allem Anfang an noch zwei weitere Grund-Voraussetzungen aufgestellt.
Es wurde erstens behauptet, daß der Künstler sein Werk aus einer „spezifischen“ Eignung erstelle, die die „gewöhnlichen“ Menschen nicht besitzen. Eine wesentliche und qualitativ besondere „schöpferische“ Fähigkeit sollte dem „Künstler“ innewohnen, aus der allein ein Kunstwerk erstehen könne. Sie sei dem Künstler, und bloß diesem, „angeboren“, und Keiner, dem diese qualitative Besonderheit fehle, könne irgendwie für den Bezirk des Kunstschaffens in Anspruch genommen werden.
Zweitens aber sollte auch der Aufnehmende zum „wahren“ Kunstverständnis von einer spezifischen Eignung oder Veranlagung abhängig sein, die keineswegs bei allen Menschen zu finden wäre. Auch hier müsse eine qualitative Besonderheit als „angeboren“ vorliegen, wenn das Bemühen um das Erleben der Kunstwerke zum „wirklichen“ ästhetischen Erleben und zum „wahren Verständnis“ der Werke führen solle.
Wenn es nun gelingen würde, eine geschlossene ästhetische „Theorie“ zu gewinnen, die zwar von der willkürlichen Voraussetzung absieht, daß Künstler und Kunstverständige qualitativ besonders begabte Menschen seien, die aber dennoch zu einer „eindeutigen Zuordnung eines in sich widerspruchslosen Begriffsystemes an die ästhetischen Tatsachen“ gelangt, so wäre damit ein Resultat erreicht, das „einfacher“ wäre, weniger unbeweisbare Prämissen enthielte, und deshalb nach dem Ökonomie-Prinzipe der Wissenschaft den Vorzug vor dem anderen System verdienen würde. —
Ernst Mach war es, dem es im Laufe eines langen und an wissenschaftlichen Ergebnissen reichen Lebens gelungen ist, nachzuweisen, daß sich das alltägliche, jedem Menschen eignende „Denken“ von dem reinsten wissenschaftlichen Denken der größten intellektuellen Genies in keiner Weise qualitativ, sondern nur der Schärfe und der Intensität nach unterscheide. Und so soll im Folgenden versucht werden, die Tatsachen des ästhetischen Bereiches unter der Voraussetzung anzuordnen, daß jene oben erwähnte „spezifische“ Fähigkeit des Künstlers und des Kunstgenießenden als etwas von den Eigenschaften des „gewöhnlichen“ Menschen qualitativ Unterschiedenes nicht existiere; sondern daß sich das künstlerische Gestalten und Erleben in nichts als in seiner Intensität und in seiner Tiefe von einem bestimmten alltäglichen Verhalten aller Menschen unterscheidet.
[S. 4]
Der Mensch wird in diese Welt, an die er sich in jahrtausendelangem Prozeß angepaßt hat, hineingeboren und nimmt mit seinen Sinnesorganen die Gegebenheiten dieser Welt in einem weiten Erfahrungskreise auf. Der weiteste Umfang dieses Kreises alles Sichtbaren, Hörbaren, Riechbaren, Schmeckbaren und Tastbaren heiße, in der Ausdrucksweise von Ernst Mach, „groß U“. Was außerhalb dieses weitesten Bezirkes alles Erfahrbaren U noch liegen möge, wird wissenschaftlich nicht diskutiert. Jegliche Metaphysik bleibt damit also von vornherein ausgeschlossen.
Innerhalb dieses weitesten Erfahrungsbezirkes U lebt nun der erwachsene Mensch in dem kleineren Umfang seiner Leibeshülle, die, wiederum in Machscher Terminologie, „klein u“ genannt werden soll. Der Mensch stellt einen geschlossenen körperlichen Komplex vor, der an einzelnen Punkten „Reiz-Stellen“ für Eindrücke jener Außenwelt U besitzt. So sind die Augen für Licht-Reize, die Ohren für Schallwellen, die Nase für Geruchsempfindungen, die Zunge für Schmeck-Erfahrungen, die Haut für Tast- und Temperatur-Einwirkungen empfindlich. Diese Reize werden durch die Nervenbahnen zum Zentralsystem geleitet, das den Sitz des Bewußtseins, der „Seele“ bildet.
Sind wir so weit gelangt, so fragen wir nach der, wiederum unmittelbar gegebenen, nicht weiter „beweisbaren“ Zusammensetzung dieses Bewußtseins.
Beobachtung lehrt uns, daß wir drei seelische Grund-Gegebenheiten besitzen, die nicht weiter auf „früher Bekanntes“ zurückführbar sind: das Erkennen = Denken, intellektuelle Funktion; das Fühlen = emotionelle Funktion; und das Wollen = voluntaristische Funktion.
Prüfen wir die Zueinanderordnung, die diese drei Funktionen des menschlichen Bewußtseins untereinander einnehmen, so finden wir Folgendes.
Sehen wir etwa einen Baum, so ist mit der rein sachlichen Wahrnehmung des Gegenstandes, mit seinem „Erkennen“, unmittelbar ein spezifisches „Begleit-Gefühl“ mit-gegeben. Man kann sich, sollte man daran zweifeln, diese Tatsache unmittelbar vergegenwärtigen, wenn man entweder das Objekt der Betrachtung wechselt: also einmal eine „mächtige“ Eiche, dann eine „schlanke“ Birke, eine „Trauerweide“, eine „stolze“ Zypresse als Seh-Ding wählt. Die in Anführungszeichen gesetzten Attribute geben dabei Hinweise auf die unmittelbare Gefühls-Begleitung des intellektuell Wahrgenommenen und „Erkannten“. Oder man denke daran, wie außerordentlich stark die noch nicht abgestumpfte Gefühlsbegleitung bei völlig neuartigen Erlebnissen ist. Sei es etwa, daß man in zoologischen Gärten oder in Aquarien Tiere zum ersten Male sieht, die man bisher noch[S. 5] nicht kannte; sei es, daß man sich die unmittelbare Verknüpfung von erkennendem Wahrnehmen und begleitender Gefühlserschütterung vergegenwärtigt, die man erfuhr, als man zum erstenmal ein Luftschiff oder ein Flugzeug sah. — So erweist vielfaches Erleben den unmittelbaren Dualismus, die grundlegende Doppel-Gegebenheit des Erkennens und des Fühlens im menschlichen Bewußtsein. Diese beiden Funktionen sind offenbar nicht hintereinander geschaltet, sondern in unmittelbarem Parallelismus einander nebengeordnet.
Anders ist es beim Wollen. Sieht man hier von den automatisch gewordenen Reflex-Reaktionen ab, so kann man klar beobachten, wie jedes „bewußte“ Wollen an das Vorausgehen eines Erkennens oder eines Fühlens geknüpft ist. Erst entweder wenn ich durch das Thermometer „erkannt“ habe, daß es kalt geworden ist, kann ich die schützende Hülle „wollen“; oder erst wenn ich „gefühlt“ habe, daß es kalt zu werden beginnt, kann ich die Decke „wollen“. So ordnet sich also die Dreiheit der Funktionen des erwachsenen menschlichen Bewußtseins in der Form des folgenden Schemas teils nebeneinander, teils hintereinander an.
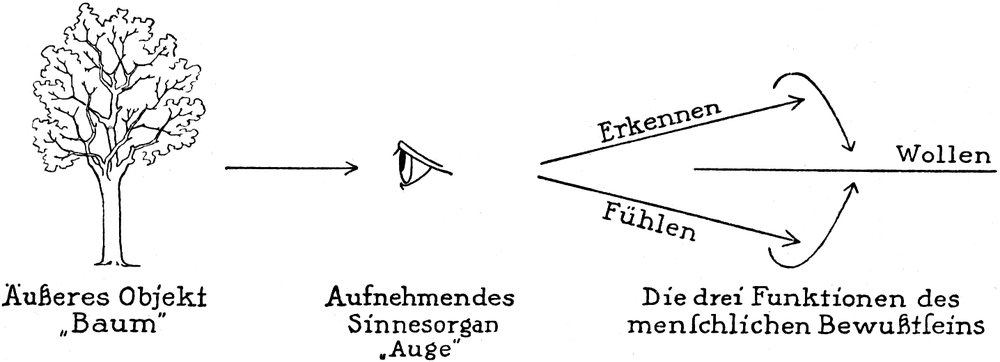
Ist der Wissenschaftler nun dahin gelangt, eine Mehrheit von Gegebenheiten als grundlegend bei einem äußeren oder bei einem innerseelischen Vorgang zu konstatieren, so pflegt er weiterhin zu versuchen, die einzelnen Teilstücke des Komplexes zu isolieren. Gelingt nämlich diese nach der „Methode der Variation“ durchzuführende Isolierung einzelner Elemente, so kann man für die Beobachtung Aufschlüsse sowohl über die spezielle Artung der Teilstücke, wie über die Rolle erwarten, die sie dem Gesamtkomplex gegenüber spielen.
Wendet man diesen Gesichtspunkt der möglichen Isolierung der Teilstücke eines Komplexes auf die obige schematische Zeichnung an, so ist vorerst sofort ersichtlich, daß es ein „isoliertes Wollen“ nicht geben kann,[S. 6] sofern kein Zwang auf das lebendige Bewußtsein ausgeübt wird. Zwar verlangt jedes „Du sollst“, daß man sein Wollen ohne vorherige Betätigung des Erkennens oder des Fühlens, also „isoliert“, in Funktion treten lasse. Doch derartige, seien es erzieherische, seien es gesetzliche „Befehle“, die nicht vor die gewollte Handlung der Einzelnen die Einsicht oder das Gefühl setzen, sind eben anormale Zwangs-Situationen, die für die Beobachtung des frei lebenden Bewußtseins ausscheiden. Denn für dieses ist jedes Wollen, das in seiner freien Auswirkung zu einer Handlung führt, von einem vorausgehenden erkennenden oder von einem vorausgehenden fühlenden Erlebnis bestimmt und determiniert.
Anders aber als für das Wollen liegen die Gegebenheiten des Bewußtseins für das Erkennen und für das Fühlen.
Wenn auch die innigen Verbundenheiten der drei Funktionen des menschlichen Bewußtseins aus ihrem schon organisch bedingten Zusammenhange letzten Endes niemals völlig isolierbar sind, so kann doch die „Einstellung“, die „Tendenz“ der Betätigung sich vornehmlich auf die Eine der Funktionen stützen oder richten. Und zwar hier im Besonderen also entweder auf das Erkennen oder auf das Fühlen.
Wir erleben vorerst vielfach, daß wir beim Aufnehmen der Naturgegebenheiten unser Augenmerk hauptsächlich auf das Wahrnehmen, das Erkennen der Tatsächlichkeiten richten können, indem wir uns bemühen, unser Fühlen und unser Wollen möglichst auszuschalten. Diese isolierende Einstellung der intellektuellen, der erkennenden Funktion führt zu dem, was wir das „wissenschaftliche“ Verhalten nennen. Wenn wir also unser Augenmerk darauf richten, unsere gefühlsmäßigen Reaktionen möglichst zurückzudrängen, unser willentliches Verhalten nicht lebendig werden zu lassen: sondern einzig und allein mit unserer intellektuellen Funktion die Tatsachen unserer äußeren und inneren Erfahrung zu beobachten und zu beschreiben, so befinden wir uns im Bezirke der reinen Wissenschaft. Oder, strenger formuliert: das möglichste Isolieren der intellektuellen Funktion des Bewußtseins führt zum wissenschaftlichen Verhalten. —
Bevor wir uns nun der Frage nach der Isolierbarkeit des Fühlens im menschlichen Bewußtsein zuwenden, wird eine kurze Einschaltung notwendig. Seit Jahrhunderten mühen sich die Menschen, jene vorhin erwähnte, angeblich qualitativ besondere Eignung des Künstlers und des „wahrhaft“ Kunst-Verständigen definitorisch zu fassen. Die Streitfrage geht dabei um das Wesen des „ästhetischen Schaffens“ und des „ästhetischen Genießens“. Da nun bereits seit langem so weit Übereinstimmung erzielt ist, daß es sich in beiden Fällen um spezifische Gefühls-Verhaltungsweisen[S. 7] handelt, wird andauernd danach gestrebt, das Wesen eben dieses „ästhetischen Gefühles“ als eine spezifisch besondere, von allen anderen Gefühlen streng unterschiedene Klasse festzustellen. Und das wichtigste Problem wird demgemäß, dieses „ästhetische“ Fühlen von allen anderen Gefühlen, also vom „gewöhnlichen“ oder „vulgären“ Fühlen, streng definitorisch zu unterscheiden.
Da es nun einerseits bisher noch niemals gelungen ist, die spezifische Definition dieses „ästhetischen Gefühls“ einwandfrei zu geben; und da andererseits die Theorie an Einfachheit, an „Ökonomie“ gewinnen würde, falls es gelingen sollte, ohne eine grundlegende Zweiteilung zwischen „ästhetischen“ und „gewöhnlichen“ Gefühlen auszukommen, sei die folgende Anschauung der Nachprüfung durch das Erleben empfohlen.
Diese Anschauung behauptet: es gibt überhaupt kein spezifisch ästhetisches Gefühl. Ein Wesensunterschied zwischen den Gefühlen des Kunstschaffens oder des Kunstgenießens und denen des „gewöhnlichen“ Lebens ist nicht aufzufinden, weil er nicht vorhanden ist. Sondern so, wie das „vulgäre“ Denken aller Menschen dem „wissenschaftlichen“ Denken selbst der größten intellektuellen Genies im Wesen völlig gleich ist; und so, wie zwischen diesen beiden nur ein Grad-Unterschied besteht, indem das wissenschaftliche Genie auf Grund einer mit größerer Vollkommenheit durchgeführten Isolierung des Denkens vom Fühlen und vom Wollen, sowie auf Grund stärkerer ursprünglicher quantitativer Veranlagung reichere oder umfassendere Resultate erzielt: so soll der hier vertretenen Anschauung nach auch das „vulgäre“ Fühlen dem „ästhetischen“ Fühlen im Wesen völlig gleich sein. Und auch zwischen diesen beiden Gefühlsarten soll nur ein Grad-Unterschied bestehen, indem das künstlerische Genie auf Grund einer mit größerer Vollkommenheit durchgeführten Isolierung des Gefühls vom Denken und vom Wollen, sowie auf Grund stärkerer ursprünglicher quantitativer Veranlagung zu reicherem oder tieferem ästhetischen Erleben gelangt.
In gleicher Weise also, wie man im obigen Bewußtseins-Schema durch das möglichste Isolieren der intellektuellen, der erkennenden Funktion des menschlichen Bewußtseins vom emotionellen und vom voluntaristischen Bezirk zum wissenschaftlichen Verhalten gelangte; in gleicher Weise führt, dieser Anschauung nach, die möglichste Ausschaltung des erkennenden und des willentlichen Bezirkes, und dabei die möglichst ausschließliche Einstellung auf das Gefühlserlebnis in den „ästhetischen“ Bezirk. In strenger Formulierung würde also der nicht weiter zurückführbare, sondern nur durch das unmittelbare Erleben beweisbare Grundsatz lauten: das[S. 8] möglichste Isolieren der emotionellen Funktion des Bewußtseins führt zum ästhetischen Verhalten.
Diese Anschauung behauptet also: es gibt kein „spezifisch ästhetisches“ Gefühl. Sondern jedes Gefühl, und sei es, welches immer — sei es ein ethisches oder ein religiöses, ein Freude- oder Trauergefühl, ein Zorn oder eine Hingebung, ein Schmerz oder eine Wollust — kann ästhetisch werden. Und es „wird“ ästhetisch eben dadurch, daß man es im Erleben seines funktionalen Ablaufes möglichst strenge und möglichst rein von allem Intellektuellen und von allem Willentlichen isoliert.
Während man also bisher entweder drei weiterhin unbeweisbare Voraussetzungen — über das ästhetisch-produktive, über das ästhetisch-rezeptive und über das „vulgäre“ Gefühl — machen mußte, oder doch zumindest zwei unterschiedene Arten von Gefühls-Erlebnissen: das „spezifisch-ästhetische“ Fühlen und das „vulgäre“ Fühlen als im Wesen völlig verschieden behauptete, wäre durch die obige Annahme der wissenschaftsökonomische Vorteil gewonnen, an Stelle dreier oder zweier unbeweisbarer Grund-Gegebenheiten bloß Eine zu setzen, die — je nach dem Grade ihrer Isolierung sowie nach dem Maße ihrer Auswirkung — das Gebiet der Kunst-Gefühle wie das der „gewöhnlichen“ Gefühle einheitlich zu umfassen imstande wäre.
Da nun derartige Grund-Behauptungen, die man früher „Axiome“ nannte, niemals im üblichen Sinne — wie bereits einige Male zugestanden — durch weitere „Zurückführung auf bereits Bekanntes“ unweigerlich feststellbar sind, sondern ihre „Wahrheit“, ihre inner-seelische „Wirklichkeit“ nur im unmittelbaren Erleben selbst erweisen oder eben nicht erweisen können, möge ein Beispiel diese Anschauungsweise zu klären versuchen.
Man denke sich auf eine weite Gebirgsaussicht. Vor dem Blick ein Kreis von Bergen mit Matten und Wiesen, Wäldern und Büschen, höher hinauf Gletscher und Felszacken, Schneefelder und Firnen, darüber der Himmel mit reichen Wolkenformen.
Nun isoliere man vor diesem Erlebnis vorerst die intellektuelle Funktion, das Wahrnehmen und Erkennen: man verhalte sich also „wissenschaftlich“. Man wird fragen, wie die Berge heißen, wie hoch sie sind, zu welchem Staatsgebiete, zu welcher Bergkette sie gehören, aus welchem geologischen Material sie bestehen, man kann sich für ihre Geschichte interessieren, dafür, ob sie bereits alle erstiegen, ob sie bewohnt sind, man kann ihre Vegetation, ihre Bewässerungsverhältnisse, ihr Klima erkunden ...: kurz, man kann, mit möglichster Ausschaltung alles gefühlsmäßigen und willentlichen Erlebens, die reine „Wissenschaft“ der „Geographie“ im weitesten Wortsinne treiben.
[S. 9]
Und man kann sich anders verhalten. Man kann sich mit möglichster Ausschaltung alles jenes oben aufgezählten Intellektuellen, und mit Ausschaltung auch alles Willentlichen — das etwa den besseren Aussichts-Punkt des Nebenstehenden „erstrebt“, oder einen der gesehenen Berge ersteigen „will“, oder eine erschaute vollfarbige Blüte pflücken und besitzen „will“ —: möglichst rein der Gefühls-Begleitung der gesehenen Objekte hingeben. Man „setzt sich auf das Gefühl zurück“, man läßt dieses Begleitgefühl der Objekt-Konstellation mit möglichster Isolierung rein und ungehemmt in sich schwingen. Tut man das, achtet man wirklich auf nichts anderes als auf dieses isolierte Erleben des Gefühles-an-sich, so kommt man in eine seelische Verhaltungsweise, die man von starken Kunsterlebnissen her bereits kennt. Man ist intellektuell völlig „abgeblendet“, und man ist willentlich völlig „passiv“, man gibt sich rein dem Gefühle hin: und da erfährt man sich als im spezifisch ästhetischen Verhalten lebend. —
Dieses ästhetische Verhalten steht also völlig parallel dem wissenschaftlichen Verhalten. Entsteht das wissenschaftliche Verhalten durch möglichst isolierendes Einstellen auf die erkennende Funktion den Erlebnissen dieser Welt gegenüber; so entsteht das ästhetische Verhalten durch möglichst isolierendes Einstellen auf die fühlende Funktion den Erlebnissen dieser Welt gegenüber. Und ist Wissenschaft keineswegs bloß die Lehre vom „absolut Wahren“, das es „an sich“ ja nicht gibt, sondern ist Wissenschaft die Lehre von der Erkenntnis und vom Irrtum im Laufe der Menschheitsentwicklung: so ist Ästhetik keineswegs bloß die Lehre vom „absolut Schönen“, das es ja gleichfalls nicht gibt, sondern Ästhetik ist die Lehre vom „Schönen“ und vom „Häßlichen“ im Laufe der Menschheitsentwicklung. Denn so wie die ärztliche Wissenschaft vom gesunden und vom kranken Körper handelt, so wie die Volkswirtschaft die Wissenschaft von dem Vermögen und von den Schulden, so wie die Elektrizitätslehre die Lehre von den „positiven“ und von den „negativen“ elektrischen Vorgängen, so wie die „Wärmelehre“ gleichzeitig auch „Kältelehre“, also die Lehre von den Temperaturen über und unter der zufälligen menschlichen Körpertemperatur ist: so müssen die „Gesetze der Ästhetik“, das heißt die immer wieder beobachteten Abläufe dieses ästhetischen Verhaltens ihre Gültigkeit bewahren, wie immer auch die Ergebnisse dieser Verhaltungsweise, sei es als positiv-schön, als gleichgültig-nullwertig, oder als negativ-häßlich „gewertet“ werden. Denn das Vorzeichen des Resultates kann niemals den funktionellen Ablauf bestimmen oder definieren, der zu gerade diesem Resultat zufälligerweise geführt hat. So darf also eine „Definition“, eine „Formel“, wenn sie allgemeine Gültigkeit besitzen[S. 10] soll, niemals davon abhängig gemacht werden, mit welchem Vorzeichen die einzelnen bestimmten Gegebenheiten an die Stelle der allgemein begrifflichen Bestimmungsstücke eintreten. —
Nehmen wir also die Grund-These vorerst probeweise an: ästhetisches Erleben ist isoliertes Gefühls-Erleben, so haben wir eine allgemeine, für alle Gefühle geltende Definition des Ästhetischen. Das Kunst-Ästhetische würde sich dann vom Natur-Ästhetischen nur dadurch unterscheiden, daß in der Natur die Anlässe für die Gefühle, die wir erleben, ohne unser Zutun und ganz unabhängig vom menschlichen Dasein vorhanden sind — auch wenn es überhaupt keine Menschen gäbe. Während die Kunstwerke von einzelnen Menschen erst gemachte Gebilde sind, die uns deren Gefühle vermitteln.
Es handelt sich demgemäß im Kunstbereiche ausschließlich um Gefühlserlebnisse. So vage und unfaßbar nun Gefühlserlebnisse sonst auch scheinen: innerhalb der Diskussion über Kunstwerke sind sie auf das sicherste faßbar. Denn sie hängen an dem zu erlebenden Objekt, am Kunstwerke, das als fertig Gestaltetes vorliegt. Mag bei der Konzeption und während des Schaffens selbst noch so viel Irrationales mitgehen: dies Irrationale bezieht sich bloß auf den Schaffenden selbst während des Werdeprozesses des Kunstwerkes. Sowie der Künstler, der nichts Anderes und nichts Mehreres ist, als ein Gestalter eines künstlichen Gefühls-Objektes, sein Tun zu Ende geführt hat, sowie also das Kunstwerk als fertiges Gebilde vorliegt, besteht nicht nur die Möglichkeit einer festen Umgrenzung des Gefühls-Erlebnisses, sondern für jeden Geschulten sogar die Sicherheit, nichts zu erfahren oder zu erleben, was nicht durch seinen Anlaß in dem vorliegenden Kunstwerk bündig zu erweisen wäre. Der Variationen, der Verflechtungen, der Harmonieverschiebungen oder Linienkrümmungen mögen noch so viele gebracht sein: in der festen Bindung des Erlebenden und des Erlebten an das Kunst-Objekt, in der Verklammerung, mit der das vermittelte Gefühl vom Gesamtbau bis zum Detail an der eben hier und eben so gebrachten Formung des Gebildes haftet, darin liegt die Sicherheit, nicht mit leeren Worten als Laut-Schällen zu jonglieren, sondern deren erlebte Bedeutungs-Inhalte als eindeutig bestimmte Tatsachen zu erläutern und zur Diskussion zu stellen.
Ohne nun hier auf eine noch ausführlichere Ableitung einzugehen, seien die Definitionen des „Künstlers“ und des „Kunstwerkes“ gegeben, die aus dem Vorausgegangenen zu erfolgern sind.
„Künstler“ vorerst ist jener, der imstande ist, auf Grund eines isolierten tiefen Gefühles ein Gebilde zu erstellen, das dieses Gefühl trägt. — Der Künstler unterscheidet sich also nach dieser Auffassung vom „gewöhnlichen“[S. 11] Menschen nicht durch sein Gefühl. Hunderte von Menschen mag es geben, und gibt es auch sicherlich, die ebenso tief empfinden, wie die großen und selbst die größten Künstler, und die auch imstande sind, in ihrem ästhetischen Verhalten dieses tiefe Fühlen vom Denken und vom Wollen möglichst rein zu isolieren. Was sie vom Künstler unterscheidet, ist bloß das Fehlen der zufälligen angeborenen Fähigkeit, sichtbare, hörbare oder sprachliche Gebilde zu erstellen, die dieses Gefühl tragen. Der Künstler ist demgemäß ein mehr oder minder „bedeutender“ Mensch, dem erstens die Gabe besonders tiefen und intensiven Fühlens eignet; und der zweitens die Fähigkeit besitzt, dieses Gefühl auch in einen objektiven Träger zu fassen.
Ein Kunstwerk weiterhin ist ein von diesem Menschen als Künstler aus isolierter Gefühls-Einstellung heraus gemachtes Gebilde, das imstande ist, dem Erlebenden das Gefühl, aus dem es entstand und das an ihm hängt, zu vermitteln. Und so wie jeder Mensch, nicht etwa nur ein „spezifisch Begabter“, bei den naturhaft vorhandenen Anlaß-Trägern für Gefühle zum ästhetischen Erleben gelangt, indem er die Gefühls-Begleitung des eben wahrgenommenen Objektes im Aufnehmen möglichst isoliert; so gelangt auch jeder Mensch, ohne Ausnahme, einem Kunstwerke gegenüber zum ästhetischen Erleben, indem er, gleicherweise in möglichster Isolierung, jenes Gefühl in sich lebendig macht und schwingen läßt, das durch die Gegebenheiten dieses künstlichen Gebildes getragen und vermittelt wird. —
Die theoretische Orientierung wird nun auch im Folgenden strenge dabei bleiben, nicht, wie meist bisher, den „Begriff“ oder — in platonischem Sinne — die „Idee“ eines Dinges in den Mittelpunkt der Betrachtung zu stellen, um von hier aus die naturhaften Objekte als einzelne „Individuationen“ jener „Idee“ aufzufassen; sondern sie wird auch in der „Theorie“, also im Versuch der „Anpassung der Gedanken aneinander“ immer wieder von der Natur-Erfahrung ausgehen, und alle Ergebnisse des theoretischen Denkens auch immer wieder an dieser Erfahrung kontrollieren. —
Ein Kunstwerk ist also ein von einem Menschen aus einem Gefühle heraus erstelltes Gebilde, das imstande ist, einem anderen Menschen das in ihm beschlossene Gefühl zu vermitteln.
Da demgemäß alle Kunstwerks-Gefühle an ihre Anlaß-Träger gebunden und durch sie bestimmt sind, werden wir den Versuch, diese künstlich vermittelten Gefühle weiterhin in unterschiedene Klassen zu sondern, in der Weise vorzunehmen haben, daß wir eben ihre künstlichen Anlaß-Träger in spezifisch verschiedene Gruppen einzuteilen streben.
Da ist nun leicht zu zeigen, daß in allen Kunst-Gebieten: im Sichtbaren[S. 12] der bildenden Künste, im Hörbaren der Musik, wie auch im Wort-Bereiche der Literatur, nur vier verschiedene Gestaltungsweisen jener künstlichen Gebilde, der Kunstwerke, möglich sind.
Die erste mögliche Gestaltung wird durch folgende Überlegung abgegrenzt.
Die Natur ist uns im Bereiche des Sichtbaren — den wir als Beispiel-Komplex herausheben — in den äußeren „Objekten“ gegeben. Hat nun ein derartiges sichtbares Natur-Objekt ein Gefühl vermittelt, das irgendwie bereichert oder erfreut hat, so kann man danach streben, sich dieses Gefühl auch unabhängig vom gerade vorhandenen, und vielleicht bald vergänglichen oder entschwindenden naturhaften Anlaß möglichst dauernd zu bewahren. Man denke etwa an jene oben erwähnte Berges-Aussicht, die ja an das Verweilen an dem Aussichtspunkte gebunden ist; oder man denke daran, daß die Gefühls-Vermittlung, die man erfährt, wenn man eine voll erblühte rote Rose in grünem Laub schauend erlebt, mit dem Hinwelken der Rose selbst auch verschwindet.
Hat man nun das Bestreben, sich gerade diese eben erfahrene, durch das Natur-Objekt vermittelte Gefühls-Erschütterung zu erhalten, so kann man dies ersichtlicherweise so zu bewerkstelligen versuchen, daß man das Objekt, an dem ja das vermittelte Gefühl hängt, in möglichster Dauer zu bewahren trachtet. Um also, sei es von dem wechselnden Standpunkte des Erlebenden, sei es von der raschen Vergänglichkeit des Natur-Objektes unabhängig zu werden, kann man versuchen, dieses Objekt zu „kopieren“, nachzugestalten: also eine „künstliche“ Nach-Bildung der Natur-Gegebenheit nach Form und Farbe in möglichst dauerndem Materiale als Träger der Gefühls-Vermittlung an die Stelle des ursprünglich Natur-vorhandenen Gefühls-Trägers zu setzen.
Dies zu behaupten, vielmehr als nicht nur durchaus möglich, sondern — im Laufe der Kunstgeschichte — auch als hundertfach wirklich, klar vor Augen zu stellen und zuzugeben, scheint heute Ketzerei. Und der Einwurf des „Panoptikums“ liegt nahe zur Hand. Doch einerseits ist noch niemals versucht worden, einem wirklich bedeutenden und überragenden Plastiker, etwa einem Donatello, die Aufgabe einer „Panoptikum-Gruppe“ zu stellen — die er sicherlich in hinreißend-naturalistischer Weise gelöst hätte —; und andererseits ist alles, was heute gegen diese künstlerische Gestaltungsweise gesagt wird, nur Tages-Wort zum — kunstpolitisch durchaus berechtigten — Kampfe gegen eine zufälligerweise gerade heute nicht lebendige und daher nicht erstrebte Erlebens- und Gestaltungsweise. Geht man aber hinter den Tageskampf zurück, sieht man die Stilweisen vergangener Kunstperioden durch, so findet man diese Übung der Kunstwerks-Gestaltung,[S. 13] die den naturhaften Gefühls-Träger nach-gestaltet, in weiten Bezirken, besonders gerade im jüngst vergangenen Naturalismus der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts, auf das reichste gepflegt.
Es gibt also, erfahrungsgemäß, eine Kunstgestaltung, die eine Nach- oder Ab-Gestaltung des naturhaften Gefühls-Anlasses erstrebt. Ihrer Tendenz nach. Es gibt beim Schaffenden eine Einstellung des Bewußtseins, die nichts anderes will, als eine Wiedergabe des sehend unmittelbar erlebten Natur-Inhaltes, ohne dessen Umgestaltung. Und man hat diese Einstellung des Bewußtseins seit jeher Naturnähe oder Naturalismus oder Realismus genannt.
Damit hätten wir die erste Art möglicher Kunstgestaltung erfahrungsgemäß festgelegt und definiert. Sie hält sich möglichst enge an die Natur, und sie kann diese abbildhafte Treue bis in das kleinste eben noch merkbare, zufällige Individualmerkmal zu treiben versuchen. Um also das Gefühlserlebnis, das irgendein Natur-Komplex dem Künstler vermittelt hat, sich und anderen zu erhalten und immer wieder vermitteln zu können, kann der Künstler den Anlaß-Träger des Gefühles möglichst genau in seinen Gegebenheiten so nachschaffen, daß er sich, innerhalb des Sichtbaren, bemüht, die Farben, Lichter und Schatten sowie die Formen des Natur-Gegebenen möglichst genau in jener Art wieder-zugeben, wie er sie bei immer wiederholter Betrachtung immer wieder vorfindet. Diese Art der Nach-Gestaltung wird sich dem Vor-Bilde der Natur „asymptotisch“, also in nie völlig erfülltem Streben, nähern. Doch die Einstellung, die Tendenz, das Ziel des Schaffens ist beim wahren objektiven Naturalisten eben in diesem Streben gegeben, sein künstlich geschaffenes Werk dem Natur-Vorbilde möglichst anzugleichen, um dann an diesem Kunst-Werke möglichst jene Gefühle wieder-zuerleben, die an dem vergänglichen Gefühls-Anlaß hingen. Und der Aufnehmende, der Genießende wird sich einem derartigen naturalistischen Kunstwerke gegenüber genau so verhalten, wie er sich der Natur gegenüber verhält: er gibt sich den lichtlichen, farblichen und inhaltlich-formalen Gegebenheiten des Werkes — in gleicher Weise, wie denen der Natur — passiv-aufnehmend hin.
So sicher aber, wie es eine intendierte Natur-Abschilderung und damit eine naturalistische Kunst gibt, so sicher auch ist diese Natur-Wiedergabe nicht die einzige Möglichkeit der Kunstgestaltung.
Der Mensch ist in seinem Schaffen nicht an die Natur gebunden: er kann die Lichter, Farben und Formen des Natur-Gegebenen in seinen künstlichen Gestaltungen verändern. Auch diese Tatsache ist wiederum eine nur durch das unmittelbare Erleben erweisbare Gegebenheit des menschlichen Bewußtseins. Jene seelische Fähigkeit, die man „Phantasie“ nennt,[S. 14] wurzelt nämlich mit dem Keime ihres Wesens darin, daß unsere Erinnerungsbilder, selbst die der festesten Natur-Objekte, keine starren Gebilde sind, sondern daß sie sich, sei es in Teilstücke zerlegen und willkürlich wieder zusammensetzen lassen, sei es in ihren Färbungen und Formungen ändern, strecken und zusammendrücken, dichten und dehnen, kurz im allgemeinsten Sinne variieren lassen.
Damit wird das uralte Problem von „Form“ und „Inhalt“ psychologisch klar. In der objektiven Natur existiert diese Zweiheit nicht. Natur hat wirklich weder Kern noch Schale. Die „Form“ des Eichenblattes „bestimmt“ seinen „Inhalt“, der Inhalt des Lindenblattes „ist“ seine Form. Form — in weitestem Wortsinne, also auch den farblichen Komplex einschließend — und Inhalt sind in der Natur, bis zu den zufälligsten Variationen der Einzelobjekte, durchaus identisch. Und damit kennt auch naturalistische Kunst dieses Problem und diese Zweiheit nicht. Auch hier — beim naturalistischen Drama wie beim naturalistischen Bild — sind Inhalt und Form dasselbe.
Sowie man sich aber dem Bewußtsein des Menschen zuwendet, treten Form und Inhalt auseinander. Sowohl im Phantasieleben des Erkennens, wie im Phantasieleben des Fühlens. Und die Möglichkeit dieser Zerfällung des Naturgebildes in Form und Inhalt ruht eben darauf, daß unsere Erinnerungsbilder keine starren Gebilde, sondern in weitestem Ausmaße in sich locker gefügt sind. So kommt es im erkenntnismäßigen Phantasiegebiete etwa zu dem Denk-Gebilde des „Begriffes“, der ja nichts anderes als das Resultat fast unübersehbarer naturhafter Einzelerfahrungen gibt; deren „Form“ dann der „Grenz-Umriß“ ist, in den sich die vielfachen individuellen „Inhalte“ gleicher Art-Erfahrungen fassen lassen. Er gibt, etwa als Begriff des „Baumblattes“, das allgemeinste formale Blattgebilde unter Ausschaltung aller individuellen und zufälligen inhaltlichen Variationen der beobachteten Einzel-Exemplare, und er vermag dies deshalb, weil er so locker beweglich und schmiegsam ist, daß er imstande bleibt, sich immer wieder jeder Variation zu fügen. — Und auch das gefühlsmäßige Phantasiegebiet lebt ausschließlich von der Möglichkeit der Zerfällung von Inhalt und Form bei den menschlichen Erinnerungs-Vorstellungen. Auch hier gibt selbst die produktivste Leistung keine völlige Neu-Schöpfung irgendeines Gebildes, auch hier bleibt selbst die anscheinend „freieste“ Gestaltung letzten Endes, von ihrem Ursprunge her, durchaus an die Gegebenheiten der Naturerfahrung, an die naturhaften Vor-Erlebnisse gebunden. Phantasiebegabte Künstler mögen dieser Anschauung noch so energisch widersprechen. Der Wissenschaftler muß feststellen, daß es kein einziges Phantasie-Produkt gibt, und schiene es noch so erfahrungsferne, dessen inhaltliche Elemente nicht aus Erlebtem geholt sind. Phantasiegestaltung kann, nach[S. 15] endgültiger Form und endgültigem Inhalt, so herzhafte Umgestaltung der Erfahrung sein, daß man am Ziel den Ursprung nicht mehr leicht erkennen mag. Geht man jedoch die Marken zurück, achtet man auf die Kerben, die, von frühester Kindheit an, die Erlebnisse schlugen, so führt der Weg aufs sicherste zurück zu unser aller Amme: zur Natur.
Hat man die Möglichkeit dieses Auseinandertretens von Form und Inhalt innerhalb des Phantasiebereiches einmal festgestellt, so wird man weiterhin danach fragen, ob sich vielleicht prinzipiell unterscheidbare Arten dieser natur-fernen Neu-Verbindungen beobachten lassen. Und da ergibt sich nun, daß sich bereits „theoretisch“, das heißt im Gedanken-Experiment, feststellen läßt, daß es hier wieder nur drei im Wesen verschiedene Arten geben kann, in denen man die natur-erfahrenen Dinge und Vorgänge zu natur-fernen Gebilden zu verändern vermag. Und wenn auch diese Gebilde, wie alle Tatsachen dieser Welt, mit tausendfachen Übergängen und Zwischenstufen ineinandergreifen, so lassen sich zur orientierenden Überschau dennoch relativ gesonderte Gruppen scheiden.
Die erste dieser Verhaltungsweisen löst die Erinnerungsbilder der Naturobjekte aus ihrer erfahrungsgemäßen Zusammensetzung oder aus ihrem erfahrungsgemäßen Zusammenhang mit anderen Objekten und stellt die derart gewonnenen Teilstücke — die aber durchaus in ihren naturgegebenen Formungen bewahrt werden — zu neuen, in der Wirklichkeit nicht vorhandenen Ganz-Gebilden zusammen. Das nächstliegende Beispiel sind die „Fabelwesen“, etwa die Figur eines Kentauren, der aus einem naturalistischen Menschen-Oberkörper und aus einem naturalistischen Pferde-Leib zusammengesetzt wird. Diese Art der Zerstückung von natur-erfahrbaren Objekten und der Neu-Zusammensetzung der so erhaltenen Teilstücke zu natur-unerfahrbaren Gebilden beherrscht einen weiten Bezirk, besonders der nordischen Phantasietätigkeit. Sie führt etwa Bosch zu seinen Fabeltieren, deren eines etwa aus folgenden Teilstücken besteht: aus einer naturalistischen leeren Eierschale, einem naturalistischen Vogelkopf, naturalistischen Entenbeinen, naturalistischen Fledermaus-Flügeln und einem gewöhnlichen offenen Taschenmesser als Schwanz; oder sie läßt Brueghel im „Kampf der Kassenschränke mit den Sparbüchsen“ phantasiemäßige Vorgänge und Zusammenhänge sich abspielen, die in ihren „inhaltlichen“ Teilstücken wohl naturalistisch sind, in dem „Formalen“ ihrer Beziehung aufeinander jedoch in der Wirklichkeit nicht vorkommen. Da diese Art künstlerischer Gestaltung also die einzelnen Partial-„Inhalte“ der Teilkomplexe wohl in naturhafter Verfassung wahrt, die weitere naturferne „Form“ aber dadurch erreicht, daß sie die aus verschiedenen Natur-Gegebenheiten hergeholten naturalistischen Teilstücke untereinander in phantasieartig-willkürlichem[S. 16] Wechsel verbindet, wollen wir sie naturalistische Permutation nennen.
Das Verständnis dieser naturalistischen Permutation pflegt beim Kunst-Aufnehmenden keinen Schwierigkeiten zu begegnen. Wir sind, hauptsächlich durch unsere Traum-Erfahrungen, derartigen Neubildungen von Kindheit an so sehr angepaßt, daß wir sie ohne weiteres zu „verstehen“ pflegen; das heißt, meist mühelos imstande sind, das an ihnen hängende Gefühl auch im Nach-Erleben lebendig zu machen.
Hat man sich durch die Tatsache des Vorhandenseins derartiger naturferner Gebilde einmal an den Gedanken gewöhnt, der phantasiemäßigen Um-Gestaltung der Natur-Objekte im Prinzip nicht mehr feindlich gegenüberzustehen, so werden auch die zwei weiteren prinzipiell noch möglichen Umformungen naturalistischer Objekte keinem unbesiegbaren inneren Widerstande mehr begegnen. Man bedenke vorher nur folgendes.
Die Einzelobjekte derselben Gattung, etwa die einzelnen „menschlichen Körper“, sind bei aller Ähnlichkeit doch auch so sehr voneinander verschieden, daß man in der phantasiemäßigen Umgestaltung eines solchen Körpers, auch wenn man ihn nicht zerstückt, sondern in seinem naturerfahrenen Zusammenhange und Aufbau beläßt, sehr stark von den durchschnittlichen Proportionen und von den formalen Einzel-Gegebenheiten abweichen kann, ohne seine Erkennungsmöglichkeit als „menschliche Figur“ zu vernichten. Diese Tatsache der „Weite des Erkennungsfeldes“ aller Einzelobjekte benutzen nun die zwei noch möglichen phantasiemäßig-künstlerischen „Umarbeitungen“ der Naturgegebenheiten. Sie benützen sie dazu, um Einzelgebilde oder Komplexe zu erstellen, die wohl in ihren „inhaltlichen“ Gegebenheiten durchaus der Wirklichkeit entnommen sind, die aber in ihrer formalen Ausgestaltung von jenen Gegebenheiten, in denen wir die erkannten Inhalte in der Natur zu finden gewohnt sind, durchaus abweichen.
Diese Abweichung kann nun wieder nach zwei durchaus verschiedenen Richtungen hin erfolgen.
Die erste der zwei möglichen Einstellungen geht so vor, daß sie sich bei der Darstellung des Wahrgenommenen bemüht, die individuellen Einzelzüge zu unterschlagen und die Gesamtform ins „Allgemeinere“ auszugleichen. Achtet also jener zuerst besprochene „Naturalist“ darauf, die Natur-Gegebenheiten von der Gesamtproportion bis zum kleinsten Detail wiederzugeben, achtet er etwa bei der Darstellung eines Baumes genauestens auf die Dicke und Konturführung des Stammes, auf die kleinste Formenbiegung der Äste, auf die leiseste Variation in Verdickung oder Verdünnung der Zweige, auf die Färbung, zufällige Beleuchtung[S. 17] und Beschattung, zufällige Haltung und Stellung der Blätter bis zur kleinsten Knospe: so sucht der Künstler dieser anderen Einstellungsart das „Allgemeine“ oder „Typische“ aus den vielen individuellen Baum-Erlebnissen herauszuziehen. Er erreicht dies nun dadurch, daß er sich bestrebt, die individuellen Einzelmerkmale zu vernachlässigen, dagegen all Das zu bringen, was sich gleicherweise bei allen Einzelindividuen findet: Stamm, Krone, Äste und Blätter in „allgemeiner“ Formung. Er gleicht die Farben und Lichter zu neutraler Haltung aus, gibt die Astführungen und Stammkonturen in stetig-kontinuierlichen Krümmungen: er erlebt mit besonderer Einstellung jene Zone, die sich bei allen Einzelerlebnissen derselben Gattung vorfindet, die also als Gemeinsames übrigbleibt, wenn man viele Individuen dieser Gattung „zur Deckung“ bringt. Dem „Begriffsbild“ in seiner völligen Un-Individualität wird das Objekt genähert, dem „Typus“, der „Idealfigur“, eben durch die Unterschlagung und Ausgleichung der individuellen Merkmale, möglichst nahe gebracht. — Diese Einstellung des künstlerischen Um-Gestaltens wird seit jeher Idealismus genannt.
Doch es gibt noch eine weitere Möglichkeit, die naturnahe Nach-Gestaltung zur naturfernen Um-Gestaltung zu führen. Dieser zweite Weg, das naturgegebene Objekt in seiner Ganzheit zu bewahren, gleichwohl aber zu phantasieartigem Ziele hin zu überschreiten, kehrt die Richtung der formalen Umgestaltung nach der Gegenseite.
Auch hier wird das Natur-Objekt als Gesamt-Gebilde in seinem Zusammenhange belassen. — Wo aber die idealistische Einstellung die naturhaften Einzelmerkmale des Objektes ausgleichend überbreitet, die Farben und Linien und Formen über die Variationen des Klein-Einmaligen glättend hinwegführt: da kann anders geartete Einstellung diese gleichen Individualmerkmale verstärken, erhitzen, intensivieren. Sie kann die Kerben vertiefen, die Hebungen verdichten, die Kurven aufhöhen, die Bewegung verstärken: sie kann alle Gegebenheiten des Sichtbaren als bloße „Anweisungen“ betrachten, die doppelt und dreifach zu intensivieren sind. — So wird auch hier, wie im Idealismus, das einmalige Erlebnis zum Über-Individuellen hin überschritten; doch hier nicht in jener Weise, die durch Ausgleichung der Individualmerkmale die naturalistische Form zum „ewigen Gleichmaß“ des Idealismus führt; sondern in der Art, daß durch die Verstärkung der Individualmerkmale eine Intensivierung der Erlebnisse nach der aktiven Seite hin erreicht wird.
Für diese Art der künstlerischen Gestaltung, die — ebenso wie der Naturalismus, die naturalistische Permutation und der Idealismus — seit jeher periodenweise gepflegt wurde, fehlte bis in die moderne Zeit eine eigene Wort-Bezeichnung; sie wurde bald Barock, bald Romantik, bald[S. 18] „Sturm und Drang“ genannt. Die neuere Zeit hat nun einen Namen angeboten, der das Wesen dieser seelischen Verhaltungsweise ausgezeichnet trifft: Expressionismus.
Nur das Wort ist neu. Sein Sinn ist so alt, wie die europäische Kunst. — Doch es ist ein gutes Wort. Denn wo man früher die zeitlich festgelegten Wörter „Barock“ oder „Romantik“ oder „Sturm und Drang“, jedem Historiker zu berechtigtem Gräuel, aus ihrer zeitlich festgelegten Bindung und Bedeutung reißen mußte, um Verwandtes zu bezeichnen, da bietet nun ein glücklicher Zufall einen Namen weiterer Geltung zu inter-zeitlichem Gebrauche an. Sicher waren Romantik oder Barock nicht „historische Vorstufen“ gegenwärtiger Kunstart. Sicher aber auch war die psychologische Verhaltungsweise, aus der heraus sie geschaffen haben, die gleiche wie heute. Man schafft heute wieder so, wie die hellenistische Spätantike, wie ein Teil der deutschen Renaissance um 1500, wie das Barock in Rubens oder Händel, in Bach oder Shakespeare, wie der Sturm und Drang im jungen Goethe und im jungen und alten Beethoven, wie die Romantik in Kleist oder Delacroix geschaffen hatte: man schafft der innerseelischen Einstellung nach ebenso. Denn dort wie hier steigert man die aus dem Naturerlebnis geholten Merkmale zu höherer Intensität. Man erhöht die Spannungen des Gesamtkomplexes, man staffelt die Szenen, man verstärkt die Ausbrüche, man kämpft in Hieb und Gegenhieb, man steigert die Melodieführung, man wuchtet in den Formen, wird ekstatisch in den Farben, hämmert den Rhythmus. Was nicht glühend von Gipfeln rinnt, gilt nicht. Nur was sich wie mit Zangen ins Blut schlägt, das faßt und hält. Intensivierung der Gestaltungen, Expression, Ausdruck gesteigerter Erlebnisse, bringt dieser Stil.
Mit dieser Art intensivierender Umformung der Natur ist die letzte der möglichen „Variationen“ der Natur-Objekte gegeben. Fassen wir also nochmals kurz zusammen, so kann es, wenn man von der Natur-Erfahrung ausgeht, nur folgende vier Arten künstlerischer Gestaltung geben.
Erstens den Naturalismus. Er bewahrt die So-Gegebenheiten der Natur in ihrer Färbung und Formung möglichst in Der Art, wie er sie bei immer wieder wiederholter Betrachtung „außen“ vorfindet. — Er erreicht durch dieses Nach-Schaffen, daß die an den künstlichen Gebilden hängenden Gefühle im Kerne, im Wesen ihrer Art jenen Gefühlen gleichen, die der Mensch vor den Original-Objekten der Natur erlebt hat.
Zweitens die naturalistische Permutation. Sie zerstückt die Ganz-Objekte der Naturerfahrung in einzelne Teile, bewahrt diese mehr oder minder strenge in den So-Gegebenheiten ihrer Färbung und Formung; setzt[S. 19] sie aber zu neuartigen, in der Natur nicht vorhandenen künstlichen Komplexen zusammen. — Sie erreicht dadurch, daß diese Phantasie-Gebilde auch spezifische Phantasie-Gefühle vermitteln, die man in der objektiven Außenwelt zu erleben nicht imstande wäre.
Drittens der Idealismus. Er gleicht die Einzelmerkmale des Individuellen aus, führt das einmalige Naturobjekt zum Typischen seiner Gattung hin; er bewahrt also dabei den Gesamtbau des Inhalts, verändert aber seine individuelle Form zum Allgemeinen weiterer Gültigkeit. — Er erreicht dadurch ein Gefühl weiterer Schwebung, allgemeiner Geltung; die Stimmung jener Dauer, jenes scheinbaren Immer-Lebens und Immer-Bleibens, das den „Ideen“ anhaftet.
Viertens der Expressionismus. Er intensiviert und übertreibt, ebenfalls unter Beibehaltung des Gesamtbaus, die Einzelmerkmale, die die individuellen Gegebenheiten des erlebten Natur-Objektes zeigen. — Mag der Idealismus den stärksten „Ewigkeits-Atem“ haben: er hat ihn auf Grund eben des Unterschlagens und Zurückdrängens aller starken Individual-Erlebnisse, auf Kosten alles Rausches, jeglichen Stürmens und Drängens. Was er, und damit alle „Klassik“, auf diese Art erreicht, ist ein ruhevolles Bleiben und Glänzen, ein Dauern über Jahrhunderte hin. Was ihn aber immer wieder beiseite drängt und beiseite drängen wird, ist der notwendige Fehler dieses Vorzuges: seine Eintönigkeit und Einförmigkeit, sein Zwang zur Ruhe und Un-Aktivität; sein seelischer Folie-Charakter, dem alles Sturmhafte ferne bleibt, an dem alle Verwirrungen und alles drängend zerrüttende Schicksal haftlos vorbeibrausen, wie die Wolken unter der eintönig blauenden Wölbung des fernhin ruhenden Äthers. Der Expressionismus dagegen erreicht jene Intensität und Spannung der Gefühle, jenes sturmhaft Ausbrechende und blutig Bewegte, das zur Ergänzung jener klassischen Ruhe von Zeitspanne zu Zeitspanne immer wieder notwendig, immer wieder so ersehnt wird. Er erhöht die Spannungen der Gefühle, sprengt alle Fesselungen an Naturmögliches, bricht alle Dämme klassizistischer Gebundenheit, führt die Gewalt des Gefühls in der Expression zu fast schrankenloser Steigerung der Ekstatik.
Als Selbstverständlichkeit — und ohne eine eigene „Klasse“ daraus bilden zu wollen — sei bloß noch angeführt, daß jene „Zerstückung“ in einzelne Teile, und deren Zusammensetzung zu Neubildungen, die von der „naturalistischen Permutation“ gepflegt wird, ohne weiteres auch bei idealistischen und expressionistischen Gestaltungen anwendbar ist. Hier werden eben aus den von verschiedenen Ausgangstypen hergeholten idealistischen oder expressionistischen Teilstücken die Neu-Gebilde zusammengesetzt. Die „Sphinx“ gebe ein idealistisches, der chinesische „Drache“ etwa ein[S. 20] expressionistisches Beispiel. Da wir es nun im idealistischen wie im expressionistischen Gebiete von vornherein mit natur-ferner Einstellung zu tun haben, ist diese Kombination verschiedener Teilstücke zu natur-unmöglichen Gestaltungen ja kein wesentlich neu hinzukommendes Schaffensmerkmal. —
Versucht man nun die vier Arten möglicher Kunstgestaltung in eine Tabelle zu fassen, so ordnen sie sich vorerst in die beiden Bezirke der Naturnähe und der Naturferne.
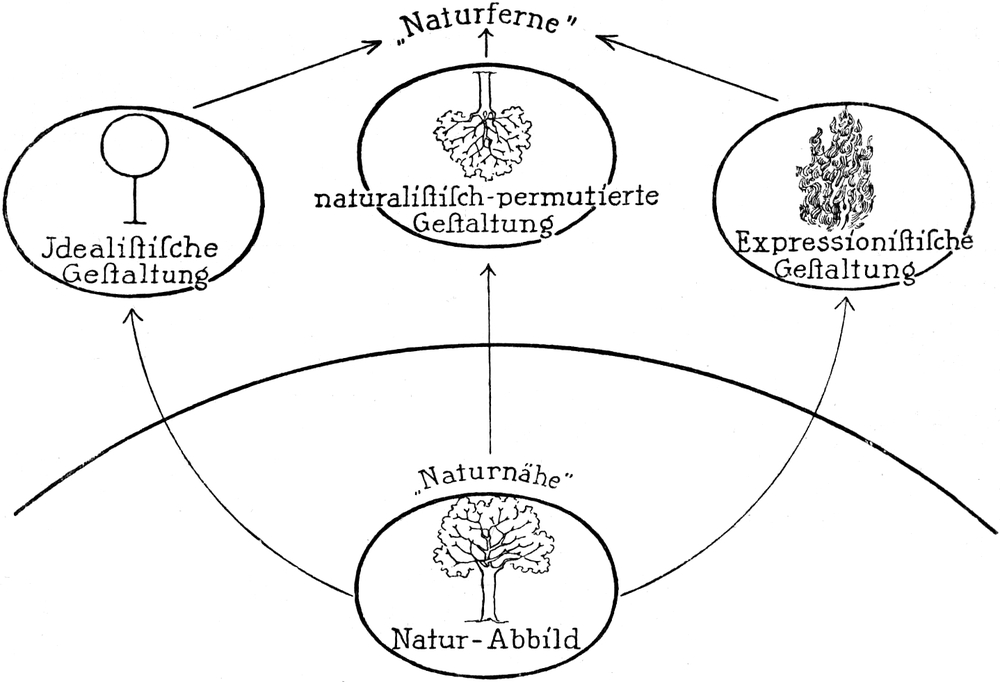
Der naturnahe Bezirk, der die naturalistischen Kunstwerke umfaßt, bleibt, als Basis und Ausgangspunkt alles anderen, in sich so einheitlich, daß er keiner weiteren Unterteilung mehr bedarf. Der naturferne Bezirk aber muß, wie wir sahen, eine gemäße Anordnung der drei im Wesen verschiedenen Gruppen: der naturalistischen Permutation, des Idealismus und des Expressionismus finden. — Dabei symbolisieren wir die naturalistische Permutation dadurch, daß wir das Beispiel-Objekt, den „Baum“, verkehrt ins Blickfeld stellen.
Diese Tabelle zeigt schematisch die vier Möglichkeiten künstlerischer Gestaltung. Zweierlei wäre dabei zum Schlusse noch zu bemerken.
Vorerst, daß es zwar so scheinen mag, als wäre alles Bisherige rein im theoretischen Gedanken-Experiment gefunden und festgestellt; daß dem[S. 21] aber keineswegs so ist. Denn diese „graue Theorie“ fingiert eine „Produktivität“, die sie niemals besitzt. Keineswegs aus „reiner Überlegung“ können derartige Ergebnisse gefunden werden. Es ist nur eine Verfahrungsweise moderner wissenschaftlicher Darstellungen, daß sie in ihrem Aufbau den Vorgang, der zu ihren Behauptungen geführt hat, umzukehren pflegen. Aller Erkenntnis Mutter ist die Erfahrung. Aus hunderten oder tausenden von Einzelerfahrungen löst man dann die Gemeinsamkeiten aus, und gelangt damit, immer mehr verallgemeinernd, schließlich zu „definitorischen“ Sätzen. Hat man derart auf induktivem Wege diese Allgemeinheiten einmal gefunden, so kehrt man in der wissenschaftlichen Darstellung gemeiniglich den Bau um: man stellt sich so, als hätte man die Begriffspyramide nicht von der Basis zur Spitze aufgebaut; sondern man setzt an die Spitze der Erörterungen die allgemeinsten Sätze als „Voraussetzungen“ oder „Definitionen“ oder „Axiome“, um dann — also nur scheinbar auf „deduktivem“ Wege — die Einzel-Ergebnisse aus ihnen „abzuleiten“. Und diese Ableitung kann sich um so „zwingender“ geben, als ja, bei vorher richtig vorgenommener Induktion aus den Einzelerfahrungen, selbstverständlich alle „abgeleiteten“ Einzelfälle in den allgemeinen Sätzen von vornherein implizite bereits enthalten sein müssen. Doch man verfährt bei der zusammengefaßten Darstellung deshalb in dieser Weise, weil damit ein System als reiner „Begriffs-Bau“ an Klarheit und Übersichtlichkeit gewinnt.
Gleichwohl aber gibt erst die ständig wiederholte „Probe“ an den Erfahrungen einem System seine wissenschaftliche Berechtigung. Sollte sich herausstellen, daß auch nur Eine der zugehörigen Erfahrungstatsachen den systematisierten Behauptungen nicht beizuordnen ist, oder ihnen gar widerspricht, so hat die ganze „Theorie“, und sei sie noch so klar und „schön“ aufgebaut, ihre Berechtigung durchaus verloren. Denn nur jene Theorie ist ja „richtig“ oder „wahr“, die sämtlichen Gegebenheiten eines Erfahrungsgebietes ihr Begriffsystem eindeutig und geschlossen zuordnet.
So muß und mag also erst die Nachprüfung an möglichst zahlreichen und aus möglichst verschiedenen Gebieten und Perioden geholten Kunstwerks-Erlebnissen erweisen, ob die dargelegten theoretischen Erörterungen sachlich-inneren wissenschaftlichen Wert besitzen.
Wir wollen nun im Folgenden versuchen, die in den vorstehenden kurzen Ausführungen nur summarisch gegebenen theoretischen Ableitungen durch die Analyse von Bild-Beispielen zu stützen. Diese Beispiele werden nicht historisch, sondern durchaus nur psychologisch erläutert. Das heißt,[S. 22] es soll nicht die „Geschichte“ der Werke erzählt werden, sondern die in den Bildwerken gegebenen Formungen werden auf jene seelische Verhaltungsweise des Künstlers zurückbezogen, aus der heraus sie seinerzeit entstanden sind. Die Erörterungen des Textes sind deshalb von hier ab durchaus an Hand, vielmehr „an Sicht“ der Beispiele zu lesen. Jedes Wort, das im Texte gebracht wird, muß im Bilde erlebt werden können. Denn die Worte sollen ausschließlich jene Gefühle nennen und bezeichnen, die in den Bildformungen gebracht sind. — Die Beispiele sind dabei gleichfalls völlig un-historisch, nur nach psychologischen Gesichtspunkten ausgewählt und geordnet. Und sie sind gerade deshalb aus möglichst vielen verschiedenen Stilperioden geholt, um die über-historische, die allgemein-seelische Geltung der vier möglichen Arten des Kunstschaffens: des Naturalismus, der naturalistischen Permutation, des Idealismus und des Expressionismus möglichst allgemein zu erweisen.
[S. 23]
Wir empfehlen dem Leser, sich für die vorerst folgende Gruppe von Bildbeispielen, für die „naturalistischen“ Kunstwerke, seinen „naiven Realismus“ nicht nehmen zu lassen. Wir wissen, daß es heute noch nicht wieder allgemein als angängig gilt, sei es das „wirkliche Vorhandensein“ der „Objekte“ dieser Welt zu behaupten, sei es schon gar, deren „naturalistische Kopie“ für ein „Kunstwerk“ zu erklären. Doch wir stehen gegenüber den zwei wesentlichen Einwürfen, die diesen beiden Behauptungen stets gemacht werden, auf dem Standpunkte, daß erstens jene Lehre, die alle Dinge und Vorgänge dieser Welt für bloße „Vorstellungen“ von uns erklärt, entweder tautologisch-überflüssig oder metaphysisch-unbeweisbar, in beiden Fällen aber jedenfalls durchaus und völlig entbehrlich ist; und wir sind zweitens der Meinung, daß der andere Einwurf, der das „rein naturalistische“ Kunstwerk negiert, indem er sein Wesentliches in jenen individuellen Klein-Veränderungen sehen will, die die „persönliche Handschrift“ des Künstlers ausmachen, am Kerne des Problems, nämlich an der Frage nach dem Wesen der seelischen Einstellung des Künstlers, völlig vorbeigeht.
Man erprobe also vorerst an Hand der Beispiele, ob die im ersten Teile gegebene „Theorie“ — die erst nach vielfachen Erlebnissen von Kunstwerken, also „a posteriori“ aufgestellt worden ist — nicht nur ein in sich widerspruchsloses System darstellt, sondern auch die einzelnen Begriffskomplexe den Tatsachen der Kunsterfahrung eindeutig zuordnet. Daß das System „geschlossen“ ist, also in sich keinen Widerspruch aufweist, zeigten die Ausführungen des theoretischen Teiles, sowie die an seinem Schlusse gebrachte „Tabelle“ der möglichen Kunstformen; ob es dann aber auch den Tatsachen des Kunstgebietes genügend und eindeutig angepaßt ist, kann nur die Nachprüfung an Hand einer größeren Anzahl von Beispielen erweisen. —
Die vier Handzeichnungen Albrecht Dürers geben in raschen Strichen die Gestalten von vier Tieren. Man wird vielleicht sagen wollen, daß das „Künstlerische“ dieser vier Skizzen darin beruhe, daß Dürer hier „das Wesentliche“ gebracht, und „das Unwesentliche“ weggelassen habe. Diese weltläufige Behauptung ist in mehrfacher Beziehung nicht aufrecht zu[S. 24] halten, das heißt: den Tatsachen der Erfahrung nicht genügend angepaßt. Denn einerseits werden wir gleich in der Folge naturalistische Beispiele kennen lernen, in denen derselbe Dürer bis auf das kleinste noch sichtbar-erfahrbare Element ins Detail geht: also auch alles „Unwesentliche“ bringt, und dennoch ein Kunstwerk schafft; und andererseits ist der Begriff des „Wesentlichen“ deshalb in diesem allgemeinen Sinne unbrauchbar, weil auch er nichts „Absolutes“ ist, sondern sich, in durchaus relativer Weise, in seinem Bedeutungs-Inhalt stets danach richtet, von welchem Standpunkte aus und mit welchen Zielen man eine Sache betrachtet. Für einen Tiger ist bei „der Ziege“ etwas ganz anderes „wesentlich“, als für das Ziegenlamm oder für eine Fliege; für den Viehzüchter etwas anderes als für den Wollhändler; für den Plastiker etwas anderes als für den Dichter oder den Philosophen; für den Maler etwas anderes, je nachdem er sich für die Farbe oder für die Form, für den Kontur oder für die Valeur interessiert, oder je nachdem, in welcher weiteren Stilphase und in welchem engeren Charakterkomplexe er eben zufällig steht.
Lassen wir also alle diese Pseudo-Probleme beiseite und fragen die Gestaltungen einfach danach: ob es uns möglich ist, sie auf eine seelische Verhaltungsweise zurückzubeziehen, aus der heraus sie mit Wahrscheinlichkeit entstanden sind.
Denn der wirkliche Vorgang ist doch offenbar folgender. Der Künstler sieht ein Objekt und kommt auf Grund dieses Erlebnisses in eine bestimmte seelische Verhaltungsweise. Aus dieser Bewußtseinslage heraus gestaltet er ein Kunstwerk. — Der Aufnehmende sieht dann dieses Kunstwerk. Er kann den Künstler, der nicht neben seinem Werke bleibt, nicht direkt fragen: aus welcher Bewußtseinslage hast du dies Bild erstellt? — Doch er kann etwas anderes tun: er kann das Werk selbst erleben, und sich durch das möglichst restlose Aufnehmen seiner Gegebenheiten in jene Bewußtseinslage tragen lassen, die der äußeren Bildformung innerseelisch entspricht. Da sich nun die Menschen des gleichen Kulturkreises und nicht zu weit auseinanderliegender Zeitperioden im Wesentlichen ihrer seelischen Reaktionen gleichen: wird sich im Bewußtsein des Erlebenden auf Grund der Kunstwerk-Gegebenheiten eine Gefühls-Verfassung herstellen, die jener in ziemlich weitem Ausmaße ähnlich ist, ja ihr bei einiger Übung bis zu einem sehr hohen Grade entspricht, aus der heraus der Künstler sein Werk gestaltet hat. Hat sich nun diese Gefühlslage im Bewußtsein des Erlebenden eingestellt, so hat er das Werk „verstanden“.
Es wird sich also in allen folgenden Analysen ausschließlich darum handeln: vorerst durch Erleben des Bildkomplexes dessen farblichen, lichtlichen und inhaltlich-formalen Gegebenheiten gefühls-vermittelnd in sich[S. 25] wirksam zu machen, also durch ihre Rückbeziehung auf die Seelenlage des Künstlers eben diese Bewußtseinsverfassung des Kunstwerk-Gestalters in sich herzustellen; um dann zu versuchen, diese Seelenlage mit entsprechenden Worten analysierend zu beschreiben.
Da zeigt es sich nun, daß Dürers Interesse bei diesen vier Tierfiguren auf ihren „wirklichen“ Stellungs- und Bewegungs-Habitus eingestellt war. Beim Löwen, den er nicht so gut „kannte“, bei dem ihm also reichere Beobachtungen des Wirklichen fehlten, gelang es ihm keineswegs, dieses ihm „Wesentliche“ einer Löwen-Haltung und des Löwen-Schrittes zu geben. Beim Hund trifft er die Haltung schon besser; am besten aber den spitzen Tritt der Ziege und das platte Liegen des Frosches. Kein naiver und noch „ästhetisch unverdorbener“ Beschauer wird in diesen Zeichnungen etwas anderes als Studien des „wirklich-Lebendigen“ erleben können.
Der Tendenz nach gleich, doch weitaus intensiver in der Annäherung an die Natur stellen der „Hirschkäfer“ und der „Feldhase“ das gleiche „Problem“. Wir würden die Behauptung wagen, daß kein Mensch, und wäre er der erfahrenste Kunst-Historiker, im Wesentlichen dieser beiden Natur-Studien die „individuelle Seele“ gerade Dürers erkennen könnte, wenn er nicht bereits wüßte, daß die Zeichnungen von Dürer sind. Nicht daß man nicht in Details, im graphologischen Duktus kleinster Linien und Kurven die „Handschrift“ Dürers nachzuweisen vermöchte. Doch eben nur in minder wesentlichen Details. Denn die Grund-Einstellung des Bewußtseins, die Tendenz des Schaffens ist so klar und eindeutig auf die Wieder-Gabe eines eben jetzt „objektiv“ Gesehenen gerichtet, daß eben mit dieser Einstellung fast alles in den Darstellungen Natur-Kopie wird, und fast kein Raum mehr für persönliche „Veränderung“ dieses objektiv-Gesehenen übrig bleibt. Man muß dabei auch noch bedenken, daß auch „die Natur“ nicht für alle Menschen die gleiche ist; sondern daß jeder Mensch in kleinen Abweichungen seine „besondere“ Natur sieht oder hört. Definieren wir aber die „Wirklichkeit“ als Das, was der Einzelne bei immer wiederholter Erfahrung, also im Sehbereich bei immer wiederholter Betrachtung auch immer wieder erfährt und vorfindet: so kann doch wirklich kein Zweifel sein, daß dieser Hirschkäfer und dieser Feldhase für Dürer im Wesentlichen des Schaffensprozesses reine „Wiederholungen“ des Objektes, reine Natur-Kopien waren.
Dürer hat dabei einen außerordentlich scharfen Blick für die Objekte und eine unerhörte Sicherheit, dieses Gesehene, zuweilen bis zur fast völligen Vor-Täuschung des Dreidimensionalen, in der Zeichnung auch wiederzugeben. Wie dieser Hirschkäfer seine Beine setzt, wie er das letzte Fußglied leise tappend und tastend an den Boden legt, wie die lichten Schatten[S. 26] zusammenlaufen; wie dann das Gefühl des leise Komischen lebendig wird, das diese Käferbildung dadurch hat, daß sie, mit ungeheuren Greifzangen bewehrt, dennoch so gänzlich wehrlos ist: all das ist aus unmittelbarem Wirklichkeits-Erleben unmittelbar in die Zeichnung übertragen.
Noch drastischer, noch unmittelbarer, noch „wirklicher“ ist diese packende physiologische Lebendigkeit beim Feldhasen erreicht. Was an drollig-purzeligem, körperlich-weichlebendigem Sein in einem solchen jungen Tiere drin ist, was das durch die breit aufliegenden Hinterbeine getragene, sprungbereite Hocken, das weichwollige Fell, die Schnuppernase mit den langen Haarborsten, die komisch langen Ohrlöffel an „Gefühlsvermittlung“ in der Wirklichkeit, beim lebendigen Urbild, brachten, das ist diesem Abbilde im Wesentlichen als Gefühlsbegleitung geblieben; und zwar dadurch, daß die „Gefühls-Träger“, die Farben, Lichter und Formen möglichst so wiedergegeben sind, wie sie sich bei der Beobachtung der Natur boten. Bei diesem Bilde sich an „Dürer“, und nicht am „Hasen“ freuen zu wollen, wäre wirklich völlige Verzerrung jedes gesunden, unmittelbar lebendigen Gefühls-Erlebens.
Was nun einem Hasen recht ist, muß auch einem Menschen billig bleiben.
Leibl hat die Identität von Form und Inhalt im naturalistischen Bereiche wie selten Einer erfühlt und in seine Bilder gebracht. Er hat die restlose Einstellung auf das Objekt mit innigster Hingabe gepflegt und damit Gestaltungen geschaffen, die allen Saft und alle Fülle, das berauschend Intensive, die Dichtigkeit der Struktur bis ins Molekulare hinein, das unmittelbar Pulsierende reinster Lebendigkeit bewahren. So wird er ein Meister und ein Muster für jene Einstellung, die so malen will, „wie Alle es sehen“; die das Auge in immer wiederholter Dauerbetrachtung zum Objekt wendet, um auch nicht im Kleinsten Anderes zu geben, als dieses vor-zeigt. Er wollte, wie er selbst sagte, „nicht schön sehen, sondern gut sehen“, er wollte „die Natur, nicht seine Natur“ geben.
So ist es etwa bei den „Drei Bäuerinnen in der Kirche“. Drei Jahre lang, von 1868 bis 1870, täglich mehrere Stunden, und immer vor den Modellen, und immer in der Kirche, hat Leibl an diesem Bilde gesessen. Alles ist von Einer Ecke des Bildes bis zur anderen „durchgemalt“, in Tausenden von Fixations-Akten sind die Gegebenheiten der Stellungen, der Gesten, der Köpfe — „zufällig“-einmalige Formung der Gesichter in charakteristischer Eigenart, ob „schön“, ob „häßlich“ — des kostümlichen Prunkes, des stofflichen Materiales ins Bild übertragen. Bis in das letzte, kleinste Schürzenfältchen, in jedes Karo oder jeden Streifen des Stoffes, bis in den letzten Stich der Stickerei des Brusttuches geht Leiblsche Verliebtheit der Augen.[S. 27] Von den Figuren bis in das Schnitzwerk der Bank fließt jener Blutstrom, jene naturalistische „Richtigkeit“ durch das Gemälde, daß die Hand das Auge ersetzen möchte, um materiell-schmiegsam und räumlich-umfassend Gesicht und Hände, Stoff und Holz ab-zustreichen, nach-zutasten, sinnlich-wirklich zu umgreifen.
Geht man dann vom Kleinsten wieder zurück ins Große, so findet und erlebt man drei Menschen in so unmittelbarer Lebendigkeit, daß es wirklich ist, als säße man ihnen leibhaftig gegenüber. Die Haltungen und Gesten sind individuell unterschieden, bis in die Nasenflügel und die Fingerfalten einmalig differenziert; und dabei im Ganzen so sehr Natur, daß sich die Begleitgefühle dieser Darstellung fast überhaupt nicht mehr von den Begleitgefühlen unterscheiden, die wir von den lebenden Modellen her aus unserem „wirklichen“ Erleben kennen.
Leibls „Dorfpolitiker“ bringen fünf Bauern, in die Ecke einer Stube zusammengehockt; über einem Blatt politisierend. Man merkt die Fünfzahl der Modelle, die sich Leibl zusammengeholt hat. Doch für Leibl, den ungeistigsten, aber naturnahesten aller Maler, ist ein „Modell“ nicht ein posierender „Ersatz“ für die „Natur“; sondern Natur und jedes Stück oder Stückchen von ihr sind ihm dasselbe. Er hatte die kräftigsten und gleichsam beschränktesten Augen der Nah-Sicht. Viel klüger als der Dümmste dieser Bauern war er selbst nicht. Aber die Zähigkeit seines bäuerischen Wesens hat er auf das Malen-an-sich geworfen, für das er begabt war, wie Holbein. Von der linken oberen bis zur rechten unteren Bildecke holt er Stück nach Stück, Millimeter neben Millimeter vom Draußen in die Bildtafel hinein, ob Gesicht oder Schmutzrand an der Stiefelsohle gilt ihm gleich. Das in naturalistischer Komik in die Verkürzung fliehende Profil des linken Flügelmannes, das verdrückte Gesicht des Mittleren, der verernstet-stupide Ausdruck des Nächsten, das naive Horcherprofil des Rechten, Hände, Fingerglieder, Zipfelmützen, Stoff und Leinen, Strumpfwolle und Knöpfe: in immer wiederholtem Dauerschauen und Dauergenießen erlebt er die Lebendigkeit jeglicher Materie nach Farbe und Form, mit dem Pinsel das Objekt so lange verfolgend und umschmeichelnd, bis er die „leibhaftige Natur“ gefangen hält.
Ein naturalistisches Kunstwerk ist dann gut, ist dann „schön“, wenn es die blutvoll-saftige Lebendigkeit der Natur möglichst nahe erreicht. Die Natur ist unser äußerster Maßstab der „Dichtigkeit“ und Fülle jeglicher Materie und jeglicher sachlichen Konstellation. Erreicht ein Werk diese Fülle bis zu solcher Nähe, daß es uns, wie die Natur, den Eindruck gibt, das „Gefühl vermittelt“, als ströme der Saft des Lebens so dicht durch seine Bahnen, daß eine Verletzung seiner materiellen Struktur es zum „Bluten“ bringt: dann erweckt es jenen Rausch des Wirklichen, jenes unmittelbare[S. 28] Lebendig-Sein, das höchstes Ziel aller Naturalisten war. Und das in der geradezu fanatischen Natur-Abschilderung Leibls ein prachtvolles Beispiel jener seelischen Einstellung des „Von Außen nach Innen“ gibt, die das Schaffen aller naturalistischen Zeiten ihrer Tendenz nach unleugbar beherrscht hat.
Dieses intensive, und dabei sozusagen völlig „kritiklose“ Versenken in alle Materie, ohne jede wertende Auswahl, was immer sie auch sei, schafft auch die seltene Möglichkeit, Leibls Bilder bis ins Einzelnste durchsehen zu können, ohne daß sich die Verbindungen zum Ganzen lösen. Eben wie in der Natur, wo auch ein Stück Materie an sich ebenso etwas „Fertiges“ bedeutet, wie der ganze Komplex. Wenn Leibl ein Bild einmal durch ständige extreme Nah-Sicht im Großbau, etwa in der Gesamt-Perspektive „verhauen“ hatte, so nahm er sein Messer und schnitt das Ganze in Teile. Die „Wildschützen“, an denen er vier Jahre lang, von 1882 bis 1886, gesessen hatte, und die bei intensivstem Klein-Bau im Gesamten räumlich mißlungen waren, zerschnitt er so zu einzelnen „Fragmenten“. Doch wie ein aus einem Stamm geschnittenes Scheit Holz in sich ein Ganzes bleibt, mag es auch blutende Wundflächen haben, so bleiben diese Stücke Leiblscher Bilder trotz ihrer brutalen Schnittränder lebende Teile eines Organismus. Denn die Dichtigkeit der Struktur, die Leibl dem Ganzen ohne Eine offene Stelle gab, müßte die Teilung — wie in der Natur — gleichsam bis zum Molekularen hin durchführen, um bloße Bruchstücke und Bausteine zu ergeben. So wird auch hier die „Miederstudie“ ein ganzes „Bild“, ein volles „Kunstwerk“, das der eigenhändigen Signierung wohl wert scheint. Man gehe auch hier diese wahre Augen-Weide bis in das Kleinste formaler und materialer Struktur nach. Man krieche wie ein Marienkäfer über eine Blüte oder wie eine Ameise durch dichtes Moos in alle Ecken und Furchen dieser Bildung, „schmecke“ den Material-Charakter der verschiedenen Stoffe, taste das Gebilde wie mit „Fühlhörnern“ gleichsam als „Wirklichkeit“ ab: und man wird abermals — zwar kein geistiges, aber das stärkste und widerstandsfähigste „materielle“ Band erleben, das diese Gestaltungen zusammenhält. —
Wer aber nun glauben wollte, daß „objektiver Naturalismus“ auf die Wieder-Gabe derart rein materieller, im Wesen ihres Charakters un-geistiger Objekte und Vorgänge beschränkt sei, der würde ein weites Fruchtfeld naturalistischer Kunstübung leichthin übersehen. Denn es gibt auch einen Naturalismus, der sich nicht nur die materielle Leiblichkeit zum Ziele wählt, sondern der die objektive Wirklichkeit auch eines seelischen Verhaltens kennt. Diese Tatsache dürfte durch folgende Überlegung klar werden.
Wir haben bereits einige Male feststellen können, daß der Bild-Inhalt[S. 29] im Bereiche des Naturalismus durch einen einmalig-bestimmten, objektiv-äußeren Anlaß gegeben ist, auf den sich das Bewußtsein des Künstlers richtet und an den es sich gebunden hält.
Dieser äußere Anlaß kann nun aber zweifacher Natur sein: er kann entweder auf Objekte der „toten Natur“ beschränkt bleiben; oder er kann Lebendiges, im besonderen den lebendigen Menschen mit als Objekt umfassen.
Handelt es sich ausschließlich um Objekte der „toten Natur“, so wird die Einstellung des Malers rein auf das Abschildern dieser Sachinhalte, auf die Wieder-Gabe der Farben, der Lichter, der Strukturtönungen des Materiales, sowie der formalen Gegebenheiten gerichtet sein. Das naturhaft Gegebene wird damit in diesem Falle, bei „unbelebtem“, also nicht mit willkürlicher Eigenbewegung begabtem Vorwurf, vollauf erschöpft. Es bleibt hier für den Naturalisten kein „Rest“, der in Wirklichkeit dem Sichtbaren noch „hinzukäme“. — Die Landschaft und das Stilleben sind hier die völlig entsprechenden Objekte.
Nun ist es allerdings weiterhin auch möglich — wie dies eben Leibl im Wesentlichen tat — auch alles „Lebendige“, also das mit willkürlicher Eigenbewegung Begabte, auf seine „tote äußere Hülle“ hin anzusehen: indem der Maler an den „Bewegungen als Ausdrucks-Trägern eines lebendigen Bewußtseins“ vorbeigeht und seine Aufmerksamkeit ausschließlich jenem Natur-Teil des Gegebenen zuwendet, der in seiner Form erhalten bliebe, auch wenn der betreffende Komplex nicht-lebendig wäre. Tut man dies, so vermag man den Kreis der Landschaft und des Stillebens unter Festhaltung der früheren Einstellung auch zu überschreiten und in stetigstem Übergange zu Porträt und Genre, ja zur seelisch mehr minder „toten“ Darstellung selbst „politisierender“ oder „religiöser“ oder „geschichtlicher“ Themen zu kommen. Wir wollen aber hier von allen diesen Zwischenstufen absehen und uns dem Gegen-Vorwurf der Landschaft und des Stillebens direkt zuwenden.
Dieser zweite Bezirk naturalistischer Darstellungs-Möglichkeiten ist nun damit gegeben, daß der „äußere Anlaß“, an den sich naturnahes Schaffen gebunden hält, nicht ausschließlich der „toten Natur“ entstammen muß; sondern daß er auch den lebendigen Menschen mit Betonung seiner seelischen Wirklichkeit mit umfassen kann. Und nun bedenke man, welche Weitung und Vertiefung die naturalistische Einstellung erfährt, wenn sie sich nicht bloß an die „äußere Hülle“ des Unlebendigen — und des Lebendigen — bindet, sondern auch das seelische Leben des Modelles mit in den Kreis der Einwirkungen zieht. Denn um diese seelischen Wahrwirklichkeiten des Modelles, nicht um die eigenpersönlichen des Künstlers,[S. 30] handelt es sich hier einzig und allein. Vom naturalistischen Künstler wird in diesem Bezirke erfordert, nicht nur den objektiv-äußeren, sondern auch den objektiv-inneren, den „seelischen Wirklichkeiten“ des lebendigen Menschen als Modelles reaktiv offen zu stehen; also selbst so tief und so reich zu werden, wie die innere Natur des Lebendigen ist: an dieser seelisch lebendigen Natur. Und er erreicht dies dadurch, daß er das Modell nicht nur als „totes“ Objekt, als Träger von Farben, Lichtern, Formen und einer äußeren Haut und Leibeshülle sieht, sondern auch als selbst lebendiges Subjekt erfaßt. Als einen körperlichen und seelischen Komplex, der an den Sachinhalten des Lebens seinerseits gefühlsmäßige Erschütterungen erfährt, die dann in ihm wirken; und die, wenn man ihn zum „Modell“ nimmt, innerhalb seines, des Modell-Bewußtseins, in gleicher Weise objektiv-vorhandene seelische „Wirklichkeiten“ sind, wie alle sein Äußeres bestimmenden Gegebenheiten der Farbe, des Lichtes, des Materials und der Formen auch.
Diese „seelischen Zustände“ des Modelles sind aber nun vorerst im Äußeren nicht sichtbar, solange dieses ein in sich unbewegtes Äußeres bleibt. Sowie man aber als „naturalistischer Maler“ nicht nur auf das „Unbewegliche“ des Modelles achtet, sondern auch auf die auf der Bewegbarkeit seiner einzelnen Körperteile beruhende Möglichkeit, auch sein direkt unsichtbares Innerseelisches zu zeigen: sowie man also die Bewegungen der einzelnen Körperteile, des Rumpfes, der Arme und Beine, des Kopfes, der Hände, die Verschiebungen der Augen, des Mundes, der Stirne als zeigende Faktoren erkennt, als „Gesten“, die das unmittelbar-Unsichtbare des seelischen Verhaltens mittelbar-sichtbar werden lassen; sowie man dann diese naturhaft gegebenen Gefühls-Zeiger wirklich innerlich reaktiv erlebt, also so tief und so reich empfindet, wie das wirkliche Leben diese Menschen selbst vertieft und erschüttert hat: dann bleibt man zwar „Naturalist“, aber man wird aus einem Schilderer der Oberflächen ein Schilderer innerer Schicksale. —
Geht man nun mit diesem Gesichtspunkt etwa zu Rembrandt, so zeigen die Bilder, die er nach der Mitte seiner dreißiger Jahre gemalt hat, die prachtvollsten Beispiele für diesen Naturalismus objektiver seelischer Wirklichkeiten.
Die Frau des Tobias hatte, hinter den erblindeten Augen ihres Mannes, eine kleine Ziege gestohlen und sie in einem Verschlage des Zimmers vor der Ehrlichkeit des Gatten versteckt. Nun, wo sie das Tier heimlich ins Freie führen wollte, verriet es sich und sie durch sein Sträuben und Meckern. Und als sie mit einer kleinen Lüge das Geschehene verdecken will, da bedeutet ihr ihr Mann, der sie ja kannte, Schweigen, und daß er wohl wisse, was geschehen sei.
[S. 31]
Eine kleine, dumme Geschichte aus dem alten Märchenbuche. So alltäglich, daß sie jederzeit und jede Stunde in dieser Welt, die ihre Gesetze jahrtausendelang dem Besitzenden zum Schutze, doch nicht zur Hilfe für den Armen gemacht hat, geschehen konnte und geschehen ist. Wenn hier nun jemand einwürfe, daß schon mit der Wahl des Themas, aus der Geschichte des alten Testamentes, Rembrandt den Umkreis des Naturalistischen verlassen hätte, so würde er einen Einwand erheben, der nicht stichhaltig ist. Denn wenn Rembrandt das Bild auch die „Frau des Tobias mit der Ziege“ nennt: er hat diesen Tobias und seine Frau „wirklich gesehen“. Denn er hat im Laufe seines naturalistischen Lebens und Schaffens Hunderte von wirklichen Menschen in Hunderten von Situationen erlebt und beobachtet; und er malt dann eine derartige alte Geschichte so, wie sie jederzeit neben ihm, im Holland des siebzehnten Jahrhunderts, um das Jahr 1645, an dem Tage, an dem er das Bild malte, sich hätte abspielen können.
Er setzt die beiden alten Leute in ein kleines holländisches Zimmer. Das Licht streicht durchs offene Fenster herein, in warmer Fülle und Dichtigkeit. Es fließt über alle größeren und kleinen naturalistischen Gegebenheiten der Einrichtung und der Geräte. Rembrandt setzt die kleine Ziege ins Licht, wie sie sich sperrt gegen die führende Hand; er zeigt die Frau in dem ärgerlich-Sorgenvollen ihrer Beugung; er läßt Licht und Farbe um den Tobias fließen, hellt ihn vorne etwas auf, wärmt ihm dunkler den Rücken. Und nun muß es sich weisen. Wie dieser Tobias auf das Erkennen des Diebstahls reagiert, wie seine reine Ehrlichkeit sich mit der Altersweisheit und der Güte seines Wesens paart: darin wird sich zeigen müssen, wie tief Rembrandt selbst in die Natur des Menschen hineingesehen hat. Und er hat tief gesehen. Nicht etwa zornig und nicht unbeherrscht, sondern im Innersten verstehend, hebt dieser alte Mann den halben rechten Arm, und neigt den Kopf ganz wenig nur zur Hand. Sonst nichts. Doch wie in dieser leisesten Bewegung, als naturalistischer Ausdrucks-Geste innerseelischer Wirklichkeit, das tiefste innere Verständnis deutlich wird und mit-gemalt ist, wie sich der Vorwurf über das Getane mit der Weigerung paart, noch Lügen-Worte zu dieser unguten Tat mit in den Kauf zu nehmen, wie dieser kleine Gesten-Komplex ganz deutlich sagt: ich weiß es doch, was du getan, rede nicht drüber weg: das ist der Kern. Nicht nur, was „tot“ am Menschen ist, auch was als lebendige Regung in ihm lebt; und dies wieder nicht als die Regung eines beliebigen Durchschnittsmenschen erlebt, sondern als die eines Besonderen, „Auserwählten“: das malt hier Rembrandt, der Naturalist der Seele. —
Dies war eine kleine, dumme Geschichte. Doch Rembrandt hat auch Größeres gesehen und gemalt. Das Größte, was die Geschichte naturalistischer[S. 32] Seelenmalerei kennt. Wenn Er nicht wäre, man hätte es wirklich schwer, zu erweisen, daß Naturalismus nicht geringere Tiefen des Menschlichen zu geben vermag, als Idealismus oder Expressionismus.
Jakob segnet seine Enkel Ephraim und Manasse. Wiederum ist es ein alt-testamentarisches Thema; doch wiederum ist es im allgemein-menschlichen Sinne so gemalt, wie es jederzeit und jeden Orts geschehen könnte.
Doch nicht jedes Maler-Auge könnte es so sehen; denn nicht jedes Menschen-Herz könnte es so empfinden. Ein rein menschlich Auserwählter hat hier zufällig auch malen können.
Drei Seelenarten gilt es hier zu bringen, zu erleben. Den alten Mann, halb schon erstorben, mühselig nur und kaum noch hier zuhause; das Elternpaar, geteilt in ihren Seelen, zwischen dem Vater dort, den Söhnen hier; die Kinder dann, im Kerne ohne inneres Verständnis dessen, was sie eigentlich an dieses Bett gerufen hat.
Der Alte lehnt, herum-gedreht, halb in den Polstern, halb an der angedrängt helfenden Schulter des Sohnes. Mit seinen Augen sieht er drüber fort ins Leere, verloren in der Stimmung des Gesichtes, recht ausgehöhlt vom langen Leben. Den Arm, der kaum mehr folgen kann, führt er zur Segengeste über den Kopf des älteren Knaben. Diese beiden Knaben dann, ohne jede fälschende Sentimentalität, in ihrer Seelen-Wirklichkeit gesehen, geben sich als die Kinder, die sie sind. Für sie ist es etwas Festlich-Besonderes, daß sie hereingerufen wurden, und wo der Jüngere noch verspielt sich in die weiche Decke drängt, da ist der Ältere gefaßt und fühlt sich als Den, mit dem jetzt Feierliches vorgenommen wird. Doch wo das bis zur Stumpfheit fast Verreifte des Alten und das noch nicht zu Reicherem Erblühte der Kinder kein seelisches Problem besonderer Tiefe stellen konnten, da weist sich Rembrandts Tiefe in der Seelenmalerei der beiden Eltern. Denn diese sind in innerlichem Zwiespalt da. Die Freude an den Kindern, an dem, was diese an Frohheit für die Gegenwart, an vollerem Versprechen für die Zukunft dem Elternpaar bedeuten müssen, mischt sich hier mit dem Leiden und der Trauer, die das Sterben des Vaters weckt. Die Mutter ist dabei weit näher ihren Kindern als dem Sterbenden. Ihr Auge folgt der Segengeste, den Mund umspielt trotz allem ein leise glücklich Lächeln, und ihre Neigung mit dem Kopfe gilt weit mehr dem Sinne, zum Werdenden ihr Ja zu sagen, als zum Vergehenden zu weinen. Den Höhegrad des Fühlens, die tiefste Stelle alles seelisch Wirklichen im Bilde bringt dann der Vater. Wie er, nun wirklich zwei-geteilt in seiner Seele, den Kopf mit leiser Neigung und das Gesicht mit leiser Drehung zum Sterbenden hin wendet; wie Wärme des lehnenden Stützens in der Schulter deutlich wird;[S. 33] wie innigstes Gefühl des Mit-Erlebens den Blick leicht seitlich auf die Hand des Vaters richtet, und zugleich, vom Innersten des Herzens her-geleitet, die Linke mit zärtlich-weich gespreizten Fingern unter das müde, fast schon todes-taube Handgelenk des Vaters führt, um es in Mildheit, helfend, stützend zu leisem, stumpfem Streichen über den Scheitel des Kindes weg-zu-leiten; und wie doch schließlich um den Mund ein traumhaft-halbgeteiltes, zwar leise auch traurig-wehmütiges, jedoch im Kerne dennoch glückhaft zu den Kindern Hingewendetes der Bewegung lebt: das ist so innigster Belebung, so wirklichster, natur-gegebenster Beseelung voll, daß in der tiefen, satten Pracht der Farben und in dem wärmend-leuchtenden des Lichtes, in dem lebendig-hüllenden der Schatten, in dem fließend-kosenden des Pinselstriches wohl alles Ambiente, alles was um den Kern herum in Rembrandts Augen strahlen mochte, gebracht sein mag; doch das Wesentliche seiner Seele, das Herz des Bildes lebt in jenen Gesten, die Rembrandt in der Natur als Zeiger tiefer Innerlichkeit gesehen hat, weil er selbst ein Tiefer, selbst ein Seltener in seinen eigenen inneren Antworten auf sein äußeres Schicksal war. —
Und noch ein Beispiel; und abermals eine Geschichte aus dem alten Testament. Doch abermals so gemalt, daß nichts „Historisches“, sondern bloß reine, tiefe, seltene Menschlichkeit das Bild gestaltet hat.
David vor Saul. Saul war in Wahnsinn gefallen, und jeder, der ihm nahte, war bedroht. Da sandte man den jungen David zu ihm, damit er mit seinem Harfenspiel das Wüten des Besessenen beschwichtige.
Als junger Judenknabe steht David in der rechten Ecke des Bildes, spielt seine Weise und sieht, verängstet halb, halb seine Augen auf das Spiel gerichtet, vom König fort. Dieser sitzt da, in großer Figur, die Lanze an der Hand, mit der er jeden warf, der sonst ihm nahte; auch hier bereit, aus seinem Wahn heraus zu rasen. Doch wie die Töne zu den Ohren klingen, da finden sie den Weg zur Seele, hellen die Umdüsterung der Wut und stillen alles Rasen. Der Griff des Arms wird locker, und stumpf geknickt lehnen Gelenk und Hand am Schaft der Lanze. Der Körper sinkt in sich zusammen und gibt sich der Entspannung hin. Und Ton auf Ton, heilsame Arzenei, singt seinen Weg zum Herzen. Da lösen sich verkrampfte Spannungen der Seele immer mehr, und aus den schauend weit gespannten Lidern rinnen die Tränen. Und horchend, hörend, träumend vor sich sehend, den vollen Blick der Augen in die Luft gerichtet, greift die Linke nach dem nächsten, was sie findet, und führt den Vorhang, der da hing, die Tränen wischend, über das Gesicht. So mit dem Wenigsten der Geste, so breit und schlicht, so ganz vom Innersten des Schmerzes aus.
Nur wem als reifem, innerlichem Menschen Schmerzlösendes jemalen[S. 34] nahe trat, nur wer in Wirklichkeit des Lebens die tiefe Quelle alt-geweinter Tränen je erfahren hat, die von den Tränen kleiner Kinder oder junger Menschen so Lebens-weit entfernt sind: nur Der kann hier dem Wege Rembrandts auch wirklich nahe sein. Denn so wie die Natur, in ihren seltensten und tiefsten Bezirken, das Maß des naturalistischen Künstlers ist: so ist sie gleicherzeit auch das Maß dessen, der derartige naturalistische Bilder nach-erleben, sich innerlich zu eigen machen will. —
Noch ein Rembrandt aus seinen reifen Jahren gebe das letzte Beispiel dieses ersten, des naturalistischen Bezirkes.
Rembrandt hat im Jahre 1650, also in der Mitte seiner vierziger Jahre, das Bild gemalt, in dem der alte Tobias und seine Frau auf die Rückkehr ihres Sohnes warten, der dem erblindeten Vater ein Heilmittel bringen soll, das diesem sein Augenlicht zurückgibt.
In durchaus objektiv-naturalistischer Einstellung ist das Bild gemalt.
Rembrandt malt den Tobias in seiner Stube, so wie er dort saß, so wie er heute noch dort sitzen könnte. Das Zimmer ist ein bürgerlich-holländischer Raum, das Licht fällt durch das hohe Fenster in die weich füllende Luft, die Frau sitzt am Rocken und spinnt. Sie spinnt mit den Zweckgesten ihrer Arbeit, und das wärmende Licht mag noch so weich und hüllend fluten, es wählt seinen Weg und sein Verweilen nicht anders, als es die Sonne an so manchem stillen Tage tut. So sehen die Bäume durch das Fenster, so liegt das Tuch darunter auf dem Tisch, so hängt das Vogelbauer oben, so bauscht sich das Gewand der Spinnerin im Sitzen; und so verschwimmen in den Ecken und an den Wänden im halben Dunkel allerlei Geräte, die auch das wirklich blickende Auge nicht ins fixierte Schauen zu nehmen brauchte. Der kleine Wasserkessel steht auf dem Dreifuß in der Flamme des Kamins, an den der alte Tobias seinen Polsterstuhl gerückt hat, um seines Sohnes Rückkehr zu erharren. Er tut’s. Er tut’s in jener Weise, in der auch jeder andere alte Mann, in der auch heute noch ein Greis, in der wir Alle, wenn wir älter wären, des Schicksals harren könnten. Des rein wahrwirklichen, nicht eines Märchenschicksals. Des rein Wahrwirklichen irgendeiner Nachricht oder Botschaft, auf deren Kommen oder deren Inhalt uns keinerlei Einwirkung möglich ist. In passiv ruhender Bereitschaft. Und hier nun setzt die Seelenmalerei des Naturalisten Rembrandt ein. Denn wie der Menschen gar so viele sind, und jeder eine andere Seele hat, wird jeder anders warten; da gibt es Mädchen, wie bei Courbet, die im animalisch-Satten ihres Leibes warten; da gibt es Könige, wie bei Menzel, die im ichsüchtig Betonten ihres Herrentumes warten; da gibt es Bauern, wie bei Leibl, die im breiten Starren ihrer Stumpfheit warten: und da gibt es wohl auch hin und wieder einen alten, weisen Mann — wie Rembrandt einer[S. 35] war —, der in der Stille innerer Resignation, mit leiser Hoffnung trüber Gegenwart, im Voraus schon verzeihend, wenn fehlgeschlagenes Mühen seinen Sohn mit bitter leeren Händen wiederbringen sollte, des Sohnes wartet. Er legt die Hände vorn im Schoß zusammen, und neigt den Kopf. Sonst nichts. Doch dieses Neigen, leicht vornhin gebeugt, dies stille, kaum bewegte Senken an die Brust und etwas, ganz ein wenig nur, zur linken Schulter, dies In-Sich-Nehmen allen harrenden Gefühles, es fast verbergen und kaum sichtbar machen; gerade dies so Wenige der Ausdrucksgeste führt sie zurück aufs innerste Gefühl. Auf die Wahrwirklichkeiten innersten Gefühles. —
Wer auch Rembrandt immer nur und immer wieder bloß als den Maler der „Haut der Welt“, des Lichtes und der Farben nimmt und wertet, der geht an seines Wesens Innerstem vorbei: an dem unerhört Ergreifenden der schlichten Ausdrucksgesten des „gewöhnlichen“ seelischen Lebens, die er malt. Jener bei ihm — seitdem er, reif und bewußt geworden, also etwa von seinem fünfunddreißigsten Lebensjahre an, sich nicht mehr selbst zu barocker Großbewegung aufzwang — bis zum Äußersten intimisierten Gesten leisester Beweglichkeit, die mit einer Reife sondersgleichen und mit einer Weisheit, die nur der mit-liebendste und mit-leidendste Bruder seiner Brüder erreichen kann, die stärksten seelischen Erschütterungen und Erhebungen, Verzweiflungen und Tröstungen in das Minimalste äußerer Bewegung fassen. Diese dann, zum Ursprungsort zurück-gelesen, auf das sie zeugende Gefühl zurück-gedeutet: führen eben auf jenes „naturalistisch gemalte wirkliche Bewußtsein“ eines zu tiefst ergriffenen Menschen.
Zum Schlusse dieses Kapitels mag angesichts der Wichtigkeit dieser Feststellungen nochmals kurz zusammengefaßt werden, was die Beispiele „naturalistischer Malerei“ bei richtiger Anpassung der Gedanken an die Tatsachen für die Theorie des Naturalismus ergeben haben.
Wir haben vorerst an den gebrachten Bildern Dürers und Leibls konstatieren können, daß es eine Einstellung des künstlerischen Bewußtseins gibt, die sich bemüht, die tatsächlichen So-Gegebenheiten der Natur möglichst genau so nach-zu-bilden, wie sie bei immer wieder wiederholter Betrachtung wahrgenommen werden.
So unweigerlich uns diese Tatsache auch aus den gebrachten Bildbeispielen hervorzugehen scheint, so sei dennoch der wesentliche und wohl einzige ernst zu nehmende Einwand, der gegen diese Behauptung erhoben zu werden pflegt, kurz erwähnt und besprochen.
Man pflegt zu behaupten, daß dasjenige, was auch die in üblichem[S. 36] Sinne „naturalistisch“ genannten Bildungen erst zu „wahren Kunstwerken“ mache, keineswegs ihre Übereinstimmung mit dem Natur-Vorbilde sei; sondern gerade im Gegenteile in jenen unvermeidbaren persönlichen „Abweichungen“ vom Naturvorbilde liege, in denen, und seien sie noch so gering, sich die „persönliche Natur-Auffassung“ des Bildners verrate.
Diese Behauptung nun, die das Wesentliche dieser Gestaltungen im klein-Persönlichen des „Pinselstriches“ sehen will — die also etwa das Wesen oder den Wert Leibls in die kleinviereckigen Partikelchen seiner individuellen Malweise verlegt, eben in die Art, wie er mit dem Pinsel die Farbe auf die Leinwand auftrug oder aufdrückte — diese Behauptung trifft zwar etwas ins Seelische, doch weit außerhalb des Kernes der künstlerischen Konzeption. Sie trifft bloß gerade noch den „Hof“, die „Fransen“ des schaffenden Bewußtseins, wie die Psychologie die Rand-Gegebenheiten dieser Art nennt. Es ist, wie wenn man zehn Menschen gleicherweise konstatieren ließe, daß von zwei vor ihnen liegenden Stäben der eine doppelt so lang ist, als der andere; sie hierauf diese Tatsache mit denselben Worten niederschreiben hieße: um dann aus diesen gleichen Worten nicht die Gleichheit der Beobachtungen zu entnehmen, sondern aus den „graphologischen“ Unterschieden der Buchstaben, aus der klein-individuell abweichenden Führung der die Buchstaben bildenden Linien und Züge eine Verschiedenheit der beobachtenden seelischen Grundstellung der Versuchspersonen zu konstruieren. Derartige verstiegene Gewaltsamkeiten müssen aus exakten Analysen ausgeschaltet bleiben. Und es muß also in gleicher Weise festgehalten werden, daß das Wesentliche der objektiv-naturalistischen Einstellung, der Tendenz des Schaffens, dadurch nicht berührt wird, daß nicht nur die Bilder verschiedener naturalistischer Perioden äußerlich verschieden aussehen, sondern daß auch die Bilder, die zehn gleichzeitig lebende naturalistisch orientierte Künstler vor demselben Modell gleichzeitig malten, alle untereinander persönliche Differenzen aufweisen würden. Die Diskussion über das Wesentliche muß an diesen Klein-Unterschieden vorbeigehen; so sehr es dann auch jedem künstlerisch Interessierten unbenommen bleibt, sich auch am „graphologischen Duktus“ des Striches oder der Pinselführung feinste Entzückungen und individuelle Tönungen des allgemeinen Erlebnisses zu holen. —
Beziehen sich diese Feststellungen vorerst auf die objektiv-naturalistische Wieder-Gabe des unmittelbar-äußerlich Sichtbaren, so gelten sie andererseits in gleicher Weise auch für die „naturalistische Seelenmalerei“. Auch hier lehrten uns unsere Beispiele, daß es sich im Wesentlichen der Konzeption um die Einstellung auf ein wirklich-Gegebenes, und der Tendenz nach um dessen Ab-Gestaltung handelt. Denn wenn eine so und tatsächlich[S. 37] vorhandene äußere Gegebenheit, wie etwa die Blindheit eines alten Mannes, mit der tatsächlich vorhandenen Begebenheit verknüpft erscheint, daß ihm ein Heilmittel für seine Augen gebracht werden soll: so ist die an diesen äußeren Komplex angeschlossene und auf sie hin erfolgende seelische Gesamthaltung dessen, der dieses Schicksal erfährt, in nicht geringerem Grade etwas „naturalistisch Wirkliches“, als die verursachenden äußeren Anlässe auch. Es ist eben die Wirklichkeit der inneren Natur des Menschen, die der Wirklichkeit der sie erzeugenden äußeren Natur der Dinge und Vorgänge als seelisches Korrelat durchaus entspricht. Von der seelischen Veranlagung dessen nun, der dieses Schicksal erleidet, von der seelischen Veranlagung des Modelles also, nicht des Malers, wird es abhängen, wie das Bewußtsein auf sein Schicksal reagiert: ob es in Stumpfheit und blödem Bleiben verweilt; ob es in tierhafter Raserei das Unzwingbare zwingen will; ob es in kindhaftem Spielen die Zeit vertrödelt; oder ob es schließlich in stiller Resignation und sordinierter Hoffnung eine Tiefe der Seele verrät, die unter den Menschen selten ist. Da nun wieder alle derartigen Verhaltungsweisen möglich und wirklich sind, da man in der „wirklichen Natur“ auch des seelischen Lebens jener Menschen, die dem naturalistischen Seelen-Maler als Modelle dienen, alle erdenkbaren Stufen von frivoler Oberflächlichkeit bis zu innigster Tiefe findet: wird sich, letzten Endes, die seelische Qualität des naturalistischen Künstlers darin offenbaren, welche Beispiele er wirklich auch sieht. So reich und so tief Welt und ihre seelischen Wirklichkeiten sind: so reich und so tief kann der naturalistische Künstler sein. Er muß nur die Reaktionsfähigkeit, die rein menschliche Bewußtseins-Weite für die Fülle auch aller innerseelischen Wirklichkeiten besitzen. Sein Ich ist nicht „das Maß der Welt“, wie beim naturfernen Künstler; sondern die Welt ist das Maß, an dem er gemessen wird.
So bleibt denn ebenso das gewöhnlichst-banale, wie das seltenste Bewußtsein eines Menschen, der Modell einer Darstellung wird, sofern es in seiner Art ein lebensfähiges, an einen bestimmten und einmaligen äußeren Anlaß geknüpftes und ohne jede Veränderung lebensmögliches Bewußtsein ist: objektive Wirklichkeit. Es gehört als „innere Natur“ in gleicher Weise zu diesem Wirklichen, wie die „äußere Natur“. Und ist es vorerst und an sich auch unerkennbar, so wird es eben nach seiner Art und Qualität in Gesten, in tausendfach verschiedenen, aber immer doch wirklichen und lebendigen Gesten aus unsichtbarer „innerer Natur“ zu sichtbarer „äußerer Natur“; als die es dann auch erkennbar und darstellbar ist. Da aber weiterhin innerhalb dieser Erkennbarkeit etwa zwischen dem innerlichst stupiden Glotzen der lebenslang-erstaunten Bauern bei Leibl, und dem innerlichst-liebevollen,[S. 38] hoffend resignierten Sinnen des alten Tobias bei Rembrandt wohl in der Art des Gefühles, nicht aber in seiner seelischen Zugehörigkeit, in seiner „psychischen Qualität“ ein Unterschied besteht: deshalb sind eben so Leibl wie Rembrandt beide „Naturalisten“. — Es sei denn, man würde tatsächlich und ernsthaft — meist jedoch nur, um den Naturalismus „schlecht zu machen“ — alles Seelische aus ihm ausgeschaltet wissen wollen, indem man das an einen spezifisch-einmaligen äußeren Anlaß geknüpfte menschliche Bewußtsein zu einem „Unwirklichen“ erklärte; womit die innerste „Natur an sich“ zur „Nicht-Natur“ geworden wäre — was wiederum nicht absurder klänge, als so manche andere Behauptung der weltläufigen Ästhetik auch.
Ist der Bezirk der Naturnähe durch die naturalistischen — oder realistischen — künstlerischen Gestaltungen durchaus erschöpft, so teilt sich, wie wir gesehen haben, der naturferne Bezirk in drei wesentlich unterscheidbare Teilgebiete: in das der naturalistischen Permutation, in das des Idealismus und in das des Expressionismus.
Naturalistisch permutiert nannten wir jene künstlerischen Gebilde, die zwar in ihren Einzelheiten die naturhafte Formung wahren; aber in der Zusammenstellung dieser Teilkomplexe zu Ganzgebilden, sei es der einzelnen Figuren, sei es des Zusammenhanges der Handlung, von den erfahrbaren Naturgegebenheiten abweichen.
Bereits das erste Bild mag uns dabei ein Beispiel dafür sein, daß die theoretisch in exakter Weise voneinander trennbaren künstlerischen Gestaltungsweisen in der Praxis der Kunstübung mit vielfachen Zwischenstufen ineinander übergehen. So zeigt das „Gefilde der Seligen“ von Arnold Böcklin, besonders in der weiblichen Hauptfigur und in den Hintergrunds-Darstellungen der lagernden und der reigenschlingenden Frauen, deutlich idealisierende Tendenzen. Doch abermals müssen wir darauf hinweisen, daß es sich bei der Aufstellung eines theoretischen Begriffs-Systemes immer nur um die Festlegung der Prinzipien handeln kann, zwischen deren ausgesprochensten Typen dann dem wirklichen Dasein das weiteste Feld freier Variation gewahrt bleibt.
Dabei darf man aber nicht etwa glauben, daß damit das Aufstellen von Systemen oder Theorien eine überflüssige Mühe wird. Sondern es ist hier, im bewußtseinswissenschaftlichen Bereiche, bloß ebenso, wie in jedem[S. 39] anderen, etwa auch im naturwissenschaftlichen Bezirk. Auch in diesem gelten ja die „Gesetze“ in exakter Weise nur für die rein begrifflichen Konstruktionen der wirklichen Abläufe, niemals für diese selbst; denn auch hier „stimmt“ kein Gesetz mehr, sowie man in die Fülle der naturgegebenen Verwicklungen eintritt. So aber, wie es etwa im Bereiche des Optischen zum Zwecke einer orientierenden Ordnung wohl Sinn und Wert hat, zu sagen, daß das Sonnenspektrum aus den Farben Rot, Gelb, Grün, Blau und Violett „bestehe“, trotzdem diesen Farben als „reinen“ Farben der geringste Bezirk des Spektrums gewahrt ist, während die Übergangs- und Zwischenfarben einen weitaus breiteren Raum bestreichen; ebenso hat es innerhalb des bewußtseinswissenschaftlichen Bezirkes Sinn und Wert, theoretische Grenzscheiden aufzurichten, über die hinweg dann die lebendige Wirklichkeit die Fülle ihrer Variationen und Kombinationen strömen läßt.
So wird man bei unvoreingenommener Beobachtung feststellen können, daß innerhalb des Böcklinschen Bildes die Mehrzahl aller gebrachten Gestaltungen im Einzelnen ihres Aufbaues durchaus naturnahe Formung zeigen; daß jedoch der Zusammenbau, sei es der einzelnen Figuren, sei es der gesamten Zustände und Vorgänge, durchaus natur-unmögliche, naturferne Konstellationen bringen.
Da ist vorerst die Hauptfigur des Kentauren. Sie bleibt in ihren beiden Haupt-Teilen durchaus naturnahe. Sowohl der pralle, stahlhaft-straffe Pferdeleib, wie auch der Menschen-Oberkörper sind in sich durchaus natur-entsprechende Teilstücke von wirklichen Erfahrungen. Erst ihre Zusammensetzung führt sie aus dem Bezirk des Natur-Möglichen hinaus. Gerade durch diese Zusammenstellung aber wird dann ein spezifisches Phantasie-Gefühl erregt, das man im wirklichen Dasein nicht zu erleben imstande wäre.
Diese Einstellung muß nun auf das Erleben des ganzen Bildes geweitet werden. Nicht nur der Kentaur, nicht nur die beiden Figuren der Nymphen rechts, die deutlich noch den Ansatz von Fisch-Leibern an Stelle menschlicher Beine zeigen: sondern die gesamte Bildvorstellung, das Aneinanderfügen und Zusammenbringen derartiger Fabel-Wesen mit natur-entsprechenden Menschen-Figuren, mit Schwänen, einem See, naturalistisch gemalten Felsen und Bäumen, Büschen und Wiesenhängen: all das bringt eine Stimmung zustande, die sich typisch sowohl von allem Naturalistischen, wie auch von allem Idealistischen oder Expressionistischen unterscheidet. Das durch derartige Gestaltungen vermittelte Gefühl trägt dabei einen deutlich „phantastischen“ Charakter.
Dabei sieht Böcklin die Natur gänzlich un-sentimental, zumeist in schärfster Strackheit und Geschliffenheit. So sind hier die Farben von[S. 40] stahlhafter Glätte, der Wasserspiegel wie poliertes Metall, die Formen — der Schwanenhälse etwa oder der Bäume des Hintergrundes oder des Uferrandes — von gestrafftester Spannung und Führung. Fast luftlos, bis in die Ferne klar bestimmt umrissen, vermitteln seine Bilder auf diese Art häufig das hallend-Harte, das arkadisch in dünne, reine Atmosphäre erhöhte Gefühl phantastisch-herber Träume.
Böcklins „Triton und Nereide“ gebe das zweite Beispiel. Wiederum ist es nicht nur die Zusammenfügung der Tritonen-Figur aus Menschen-Oberkörper und Seetier-Leib; sondern wiederum ist es die eigentümliche Einstellung Böcklins dem gesamten Werke gegenüber. Böcklin lehrte, daß der Maler niemals unmittelbar vor und nach der Natur malen solle, sondern „aus dem Kopfe“ malen müsse. Doch wenn man bedenkt, daß er sich stundenlang vor diese Natur, etwa an den Strand des Meeres, setzte, stundenlang das Spiel der Wellen, ihr Zerrinnen auf dem Strande, ihr Schäumen über Klippen schauend erfaßte, „auswendig lernte“, um erst dann im Atelier „aus dem Kopfe“ zu malen: so erkennt man, daß zwischen diesem Verhalten und dem des Naturalisten, der das Gesehene unmittelbar, andauernd prüfend und vergleichend, auf die Bildtafel überträgt, im Wesentlichen der seelischen Einstellung nicht der geringste Unterschied besteht. Das Verfahren Böcklins ist schwieriger und wird oft zu gründlicherem Erfassen der Naturgegebenheiten führen können; aber es bleibt im Wesen, den einzelnen Teilkomplexen gegenüber, ein objektiv-naturalistisches Verhalten.
Doch indem Böcklin so verfuhr, erleichterte er sich wieder die spezifische Art seines Gesamt-Gestaltens. Denn da er ja die Ganz-Form seiner Bilder nicht in naturalistischer Art schuf, hätte ihn ein Malen direkt vor der Natur immer wieder in der Konzeption des Gesamten aufs empfindlichste stören müssen. So aber konnte er die Permutation und Kombination der „erlernten“ Natur-Teile, das freie Um-Ordnen und Zusammen-Stellen der einzelnen Komplexe völlig frei schaffend im Atelier vornehmen und so trotz des naturalistischen Einzel-Materials seine völlig naturfern-phantasiemäßigen Gesamtgebilde um vieles leichter und ungehemmter konzipieren. Und es ist der gleiche seelische Grund, der nahezu alle jene Künstler, die die Schaffensart der naturalistischen Permutation pflegten, dazu geführt hat, im Atelier und „aus dem Kopfe“ zu malen.
Die Analyse der Böcklinschen Bilder wird also in erster Linie die Phantasie-Leistung betonen müssen. Und diese Phantasie-Leistung wieder liegt vor allem im rein Inhaltlichen der Konzeption. Mit einer seltenen Eindringlichkeit wird bei Böcklin die Wichtigkeit des Sachinhaltes klar. Hier an dem, in zeitlicher Beschränkung richtigen, aber im Allgemeinen seiner üblichen Verwendung falschen Wort von der ausschließlichen Wichtigkeit[S. 41] des „Wie“ eines Bildwerkes und von der völligen Gleichgültigkeit des „Was“, des Sachinhaltes der Darstellung, festhalten zu wollen, wäre beschränkter Fanatismus; und nicht jene auf das Erleben des historisch Daseienden gegründete Relativität aller Anschauungen, die weiß, daß die Sachen vor den Worten da sind und da waren, und daß nichts unfruchtbarer wird, als diese Worte und Schlagworte für unumstößlich Bindendes zu nehmen, nach dem sich Werdendes zu richten hätte.
Der Sachinhalt des Böcklinschen Bildes aber ist eine große Symbolgestaltung der mächtigen Stimmung des weithin gebreiteten Meeres. Menschliche und halbmenschliche Symbolfiguren werden Träger jenes un-meßbaren und, trotz aller Kleinbewegung, im Ganzen so unerhört dauernd wirkenden Erlebnisses. Inmitten der Meeresfläche lagern auf einer Felsenklippe Triton und Nereide. Die Nereide: breiteste vitale Lebensfülle, unmittelbare Freude am Dasein und Leben, weich angeschmiegt an den Stein; ein Wesen, dessen Körper nichts als die Verdichtung der vier Grund-Elemente von Sonne, Wasser, Luft und Erde scheint, die in ihm das satteste Dasein gewonnen haben. Sie gibt im äußerlich-Formalen ihrer horizontalen Bahn, wie im innerlich ruhend-Sonnenden ihrer seelischen Gelöstheit den Kontrast zur bewegteren Schiefe des in Haltung und Seelenstimmung fast schmerzvoll aufgedrängten Tritonen. In Gegenbewegung, sie von links nach rechts, er von rechts nach links gewendet, verklammert sich das Gefühl in der Mitte des Bildes zu breitem Schlusse. Und wie sie spielend ihm eine Handvoll Wasser ins Gesicht werfen will, um ihn aus seiner Hingegebenheit zu wecken, wird jede Spur von Sentimentalität, auch nur vom Fernsten her, vermieden. Als wahrhaft innerliche Personifikation, kein äußerliches, sondern innerseelisches Symbol für diese größte Weite aller Einsamkeiten drängt sich dies Halbwesen vom Felsen auf, biegt seinen Leib, dreht seinen Kopf der fernsten Dehnung des Horizontes zu und schwimmt mit Mund und Augen in die Ferne.
„Phantastik“ ist das Wort, das man für derlei Konzeptionen meist gebraucht. Und sein Bedeutungsinhalt scheidet sich eben von reinen Phantasiegebilden definitorisch dadurch ab, daß man mit diesem Wort die Gefühlsbegleitung jener Schöpfungen bezeichnet, die mit den Bausteinen des Naturalistischen Gebilde völlig naturferner Art erstellen.
So ist es auch bei der „Pest“. — Naturalistisch-permutierte Gestaltungen begegnen erfahrungsgemäß beim Publikum kaum irgendwelchen Widerständen oder Schwierigkeiten des „Verständnisses“, also des gefühlsmäßigen Nach-Erlebens; um so stärker pflegen sie von den zünftigen Ästhetikern angegriffen zu werden. So hat diese zünftige Ästhetik auch Böcklin schweres Unrecht angetan. Die Kraft seiner Visionen aber, die restlose und fast[S. 42] niemals „dienstbare“ Symbolisierung allgemeiner Themen und Vorgänge führt die meisten seiner Werke weit über jenes Niveau des „literarischen Geschichten-Malens“ hinaus, auf das man ihn im Zeitalter des Impressionismus erniedrigen wollte. So gibt auch hier wieder die Stärke der inhaltlichen Erfindung und der formalen Komposition dem Bilde unmittelbare Einschlagskraft. Durch die steil vertiefte, schmale Straße eines kleinen italienischen Städtchens rast die Fabelfigur des Pestdrachen. Was sie auf ihrem Fluge mit den breiten Fledermaus-Flügeln anweht, wen der Atem ihres schmalen Schädels, halb Schlangenkopf, halb Vogelschnabel, trifft, der sinkt zu Tode. Einmalig und un-abgebraucht in der Erfindung und in der Gestenführung, herbe und ohne jede Dienstbarkeit in der Wendung des Körpers, in der Haltung der Arme und der Beine sitzt die Figur auf dem Rücken des Tieres, beherrscht das Zentrum der Konzeption. Und überall wieder kann man erleben, wie Böcklin zum Innersten seiner Vision so gefunden hat, daß er naturalistische Teil-Erfahrungen zu phantastisch-willkürlichen Kombinationen zusammenfügte und erhöhte.
Der „Tod auf den Schienen“ von Max Klinger gebe ein Beispiel, wie derartige naturalistische Permutationen zu naturferner Phantastik des Gesamt-Gebildes und des Gesamt-Gefühles führen können, auch wenn sämtliche einzelnen Sachinhalte des Bildes naturnahe bleiben. Dies tritt dann ein, wenn die innere „Zusammenstellung“, die sachliche „Beziehung“, in die die Inhalte gebracht werden, der Natur-Wirklichkeit nicht entspricht. So ist hier in diesem Blatte nicht nur keine Stelle, sondern auch keine Figur oder Ganz-Form zu finden, die nicht durchaus naturalistisch empfunden und belassen wäre. Indem aber in dem alten Thema des Totentanzes die moderne Tatsache von Eisenbahn-Unglücken, der Keim der Konzeption, so durchgebildet wird, daß sich der Tod als naturalistisches, gleichwohl aber lebendiges Gerippe über die naturalistischen Geleise legt, gerade an einer Kurve der Bahn, die hart an einem Gebirgsabsturze hinläuft: wird erreicht, daß sich abermals — wie im kleineren Gebilde des Kentauren — naturalistische Teilstücke zu einem Ganz-Erlebnis verbinden, das durch seine Un-Wirklichkeit bei und trotz allen Detail-Wirklichkeiten den stärksten Grad der Phantastik erhält.
Auch hier also ist es wieder der sachliche Inhalt, das „Was“ des Bildes, das in erster Linie die Eindruckskraft begründet. Und auch hier wieder darf man an dieser „sachlichen Erfindung“ des Künstlers nicht etwa vorbeigehen. So wie Farben und so wie allgemeine Formen unmittelbar in einer rein gefühlsmäßigen künstlerischen Konzeption geboren werden können, so können auch sachliche Inhalte unmittelbare Träger einer rein künstlerischen Stimmung werden. Es ist dabei nur zu bedenken, daß genau so[S. 43] im bildkünstlerischen wie im literarischen Bereiche ein groß empfundener sachlicher Inhalt nur dann das Werk zu einem großen Kunstwerke werden läßt, wenn die Form nach allen ihren Elementen der Größe des Inhaltes gemäß ist; wenn also das „Wie“ der literarischen oder bildkünstlerischen Bezwingung an Intensität dem Sachinhalte entspricht.
Und das scheint uns bei diesem Blatte Klingers der Fall zu sein. Nicht nur ist die rein inhaltliche Phantasie in der Originalität des Zusammenführens von Teil-Inhalten, die bisher niemals noch verbunden worden waren, von seltener Fruchtbarkeit und Stärke; sondern auch die rein formale Ausgestaltung der naturalistischen Teilstücke ist dicht und stark. Das lässig Hingelagerte des Todes, sein so ruhendes Warten in fast höhnender Selbstverständlichkeit, im breiten Liegen des Oberkörpers und des hellen Mantels und im locker gelösten der gekreuzten Beine stehen in schlagendstem Kontraste zu dem blank Geglätteten des Bahndammes und dem hell Gestrafften, Eilenden der Schienenführung. Kraß treffen diese beiden Gefühle im Vordergrunde aufeinander; voll und gesammelt in überragender Ruhe und in der Teilnahmlosigkeit zeitlos unvergänglicher Natur bleiben die Bergformen im Mittel- und Hintergrunde. —
Und nun sei als letztes Bild dieser Gruppe, und als Beispiel, zu welcher Fülle und Dichtigkeit sich diese Schaffensart der naturalistischen Permutation im Phantasieleben des Nordländers zuweilen gesteigert hat, der „Fall der Engel“ gebracht, den Pieter Brueghel — in innerer Abhängigkeit von ähnlich starken phantastischen Erfindungen des Hieronymus Bosch — um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts gemalt hat. In einer im Einzelnen tatsächlich unübersehbaren und unbeschreibbaren Fülle sind hier die Kombinationen und Permutationen naturalistischer Teilerfahrungen zu einem Höllenkessel von Unholden vereinigt. Der Krumme und der Lahme, der Knopfgießer und der Dovrealte, Fisch und Kröte, Mensch und Sache, Schmetterling und Fledermaus, Blasbalg und Blütenblatt, Ritterhelm und Krüppelwesen, Rübenform und Menschenarme: in unbeschreiblichem, nur unmittelbar erlebbarem Chaos, in immer wieder neue Permutationen gebärendem Rausch der Phantasie werden Hunderte naturalistischer Teilbeobachtungen zu den unmöglich-phantastischsten Konglomeraten zusammengeschlossen, ineinandergeschweißt, verbunden, verflochten, verzahnt, verquetscht, durcheinandergetrieben. —
So führt die naturalistische Permutation zu Gesamtgebilden, die in den un-wirklichsten Gebieten menschlicher Phantasietätigkeit hausen; und die dennoch von ihren naturalistischen Klein-Bildungen aus eine phantastisch-unmittelbare Lebendigkeit bewahren.
[S. 44]
War das naturalistische Kunstwerk dadurch definiert, daß es vom Gesamten bis in das kleinste Detail die Gegebenheiten des Naturvorbildes auf das Genaueste nach-formte; hatte die naturalistische Permutation entweder die naturhaft bewahrten Klein-Gebilde von Teilstücken zu größeren natur-unmöglichen Ganz-Gebilden zusammengesetzt, oder auch naturalistische Groß-Gebilde in natur-unwirkliche Zusammenhänge sachlich-inhaltlicher Beziehungen eingestellt; so war idealistische Gestaltung dadurch bestimmt, daß sie die Individualmerkmale ausgleichend überbreitete und die Gesamtform dem Begriffsbilde annäherte.
Die Figur des „Idolino“ im Museum in Florenz gebe das erste Beispiel. Nach Stand- und Spielbein klar geschieden, ruht die Last des Körpers in freiem, sicherem Stehen auf den beiden Sohlen der Füße. Deutlich sind die beiden stützenden Säulen der Oberschenkel vom Rumpf getrennt, deutlich sind die Arme in den Achseln, den Ellenbogen und den Handgelenken geteilt und gelöst, deutlich hebt sich der Hals vom Rumpf, der Kopf vom Hals. Überall hat eine ausgleichende Hand die Wölbungen ins Geometrische gerundet, die Formen von allem Klein-Individuellen gereinigt, zum Typus hingeführt. Wo bei dem einen Modell deutlicher, bei dem anderen verwischter, einmal diese, einmal jene Teilung oder Kerbung zu finden war, da hat hier idealistisch aufs Allgemeine eingestellte Gesinnung die wesentlichsten und wichtigsten Teilungen unter dem Gesichtspunkte herausgehoben und betont, daß Klarheit, Deutlichkeit, Maß in allen Dingen, Ordnung und abgestimmte Harmonie das Werk erbaue und beherrsche. Darum sind Knöchel und Knie so ausdrücklich betont, darum ist die in der Natur meist nur angedeutete Linie von Hüfte zur Scham hinab und wiederum zur Hüfte hinauf in geschlossenem und geometrisch-beruhigtem Flusse durchgezogen, so daß man den Rumpf von seinen beiden Beinen heben kann, wie einen Architrav von seinen tragenden Säulen. In wundervoll ausgeglichener Rund-Modellierung sind Bauch und Brust geklärt, in die größeren, typisch immer wiederkehrenden Haupt-Teile geschieden. So führt auch weiterhin klärende Gesinnung, die das Allgemeinere, allen einzelnen Exemplaren wesentlich Eigentümliche sucht, des Künstlers Gefühl und Hand bei Hals und Kopf, bei Haaren, Stirn und Augen, Nase und Mund. In leichtem, allgemeinem Rhythmus hebt sich der rechte Arm, bricht sich leise in seinen hängenden Gelenken der linke. Und dieser linke Arm allein würde genügen, die Gesinnung des Ganzen zu zeigen. Wie er in runder Fülle, lässig und doch gehalten, in wundervollem Allgemeinschwung seiner leisen Bewegung sich klar in den Gelenken „hält“, wie er, bis in die letzte Biegung seiner[S. 45] Fingerspitzen, das Wirklichkeits-Entfernte, zum Größeren und Weiteren hin Beruhigte seines Gefühles weist: das ist wohl klassische Antike; doch im Wesen derartiger Konzeption, wie wir sehen werden, allen idealistischen Stilen von ihrer innerseelischen Einstellung her zu eigen.
An diesem Bildwerk mag man nun auch erkennen, worin die Gefahr alles Idealismus und eben der Fluch alles akademischen Klassizismus ruht. Je nachdrücklicher und konsequenter man nämlich die Individualmerkmale eines Dinges unterschlägt und zum Allgemeinen, Allen Gemeinsamen hin ausgleicht, desto stärker nähert man sich dem reinen Begriffsbilde, das im Grenzfalle am besten mit geometrisch konstruierten Kurven zu umschreiben ist. Diese geometrischen Gebilde aber haben dann, von ihrem durch eine gesetzmäßige Formel festgestellten Ursprung her, fast jede Gefühlsbegleitung verloren. Wenn alle gebogenen Formen des Gebildes Kreislinien, alle Wölbungen Kugelflächen, alle nicht-kurvigen Grenzen gerade Linien sind, so wird die Gefühlsbegleitung des Gebildes als eines auf Grund des „Erkennens“ „wissenschaftlich Konstruierten“ auf den geringsten Grad sinken müssen; und damit das Werk desto mehr dem Kunstbereiche verloren gehen, je allgemeiner, je typischer, je „idealistischer“ es ist.
Dies haben die Griechen wohl gefühlt. Sie stellten zwar jeweilig einen „Kanon“ auf, der das „gesetzlich“, also intellektuell Gebundene jeder Gestaltung von vornherein festlegen sollte. Doch einerseits wechselten sie ihre kanonischen Systeme je nach der Änderung, die ihr Gefühl im Laufe der Stilentwicklung erfuhr; und andererseits banden sie sich auch in der Zeit eines herrschenden Kanons, hier beim Idolino etwa des polykletischen, niemals strenge an die mathematisch errechneten Bestimmungsstücke. Und gerade Das ist ja das Ausschlaggebende. Während Dürer durch die streng durchgeführte geometrische „Konstruktion“ seiner Figuren nur erreichte, daß diese gänzlich gefühls-verödet und leer erscheinen; wichen die Griechen bei allen Bewegungen, bei allen Kurven- und Flächenführungen, wenn auch nur um ein Kleines, vom errechneten Kanon ab und erreichten dadurch eben das in sich so leise Bewegte des dauernd schwebenden Gefühles.
Und auch dieser idealistische Stil war nicht auf ein bestimmtes Gestalten beschränkt. Die Figur der Aurora, der „Morgenröte“ von Michelangelo zeigt bei allem Gedrängteren, massig Beschwerteren ihrer Bildung die gleiche idealistische Gesinnung. Auch diese Frauenfigur hier ist durch Ausgleichung aller individuellen Merkmale des Modelles zum Allgemeinen, Typischen erhöht. Auch hier reißt nicht ein einmalig-individuelles Erleben den Aufnehmenden in die persönlich bestimmte Sphäre des Dargestellten; sondern der weite Bezirk einer ganz allgemeinen Stimmung, ein Allgemeingefühl weitester Tönung geht von dem Werke aus. Viele Einzelerlebnisse[S. 46] besonderer Artung haben ihr Gemeinsames in einen Bezirk gesammelt, der den Morgen eines Tages aufgehen läßt, wie den Morgen vieler, vieler Tage, die Michelangelo durchlebt hat. Vom schwer Gedrückten seiner Seele, vom lastend Getrübten seines Bewußtseins her löst sich als Symbolfigur der breite Leib in schwerer, voller Schiebung seiner Glieder vom Fesselnden des Schlafes los, hebt sich in mächtiger Gedrängtheit dem neuen Tag entgegen. Klar zwar in allen Teilungen, klar im Ansatz und in den Biege-Gelenken seiner Glieder, klar auch in der Führung der Bewegungen; doch dunkel überschattet in der Seele und schwer umdüstert im Bewußtsein: zu jenem tragischen Idealismus, der Michelangelos eigentlichste Seelen-Heimat war. —
Und so wie die Einzelfigur, so wird auch das Handeln und Geschehen dieser Welt von idealistischer Gesinnung ins Allgemeine beruhigteren Tuns phantasiemäßig erhöht. Das Grabmal der Hegeso in Athen gibt eines der wundervollsten Beispiele des griechischen Idealismus der älteren Blütezeit. Vom Ganzen her bereits so angefaßt, daß jede Abweichung von der Natur gestattet scheint, die im Sinne des Gefühles getroffen worden ist. So sind, um die Fläche in ruhigem Gesamtbau zu erstellen, die natur-wirklichen Proportionen nicht gewahrt. Die Sitzende reicht mit dem Kopf so hoch fast im Relief, wie die vor ihr Stehende. Und dies deshalb, damit das Auge, das seine ab-gewogenen Wege sucht, nicht durch ein allzu Hartes, im Sinne idealistischen Gefühles allzu Herbes des Absturzes von Kopf zu Kopf aus seiner Gleite-Bahn gerissen werde. So wie das Bildwerk vor uns steht, geht stilles Schauen seinen Weg vom rückgestellten Fuß der Dienerin links unten, das Bein hinauf, zu Hüfte, Brust und Kopf; neigt mit dem Kopf nach vorne, wird aufgenommen von dem Kopf der Frau, der seine Biegung der Bahn des Blickes breit entgegenhält, sinkt mit den Falten über Brust und Leib zum Knie und schließt den Weg über den vorgestellten Fuß der Frau, der von dem hin-gebogenen der Dienerin rund-angelehnt umfaßt wird. Und geht der Blick noch einmal seine Bahn, so kann er in gleitendem Schweben die Guirlande nach-wiegen, die sich durch das Bildwerk vom Kopf der Dienerin über deren rechten Arm zum linken Arm der Frau und deren Kopf wie ein breit und voll Gehänge legt, dem die erhobene rechte Hand der Frau, die ein Schmuckstück zur prüfenden Betrachtung aus dem Kästchen nahm, den Schwerpunkt und die Mittel-Ruhe gibt.
Ganz wundervoll ist vom Ganzen bis ins Kleinste die Ausgleichung alles einmalig-Individuellen zum Allgemeinen weiter Schwebung des Gefühles durchgeführt. Und hier auch wieder jener Weisheit des Gefühles voll, die niemals in allzu feste Regeln schnüren wird, was nur in lockerer Bindung sein inneres Leben behält. So weicht etwa die ganze Komposition[S. 47] an der linken und an der rechten Seite leicht über den architektonischen Rahmen hinaus, überspült mit leisen Wellen das Feste der Gebundenheit. Und wie von hier aus bereits diese leise Lösung in aller strengen Bindung so herzbewegend spürbar wird, so geht diese eigentümlich lockere Strenge des Gefühles in Alles, bis in die kleinste Falte, ein. Wie alle Gelenke der beiden Körper scheinbar so strenge in ihrer Klarheit bloß-gestellt und in ihrer Funktion deutlich gemacht sind, und wie dennoch in allen diesen Gelenken eine leise Lockerung, ein Über-Führen der Bewegungen, ein mildes Modellieren deutlich wird; wie sich in jeder Falte Klarheit des Seins und Bestimmtheit des Verlaufes mit dem leise Spielenden relativer Freiheit einen: das ist so liebevoll „gesetzlich“ und dennoch leise „gegen“ das Gesetz, begriffsnahe, und dennoch lebendigen Gefühles voll: daß man die Fehl-Idee, die so viel Unheil für die Kunst gebracht hat, fast begreifen könnte: es gäbe nur Eine Schönheit: die des Idealismus der klassischen Antike.
In Wahrheit gibt es ja so viele „Schönheiten“, wie es wertvolle Gefühle gibt; also unendlich viele. Doch ist zuzugeben, daß dem Gefühl des Idealismus eine besondere Dauerhaftigkeit innezuwohnen scheint. Er besitzt sie ja von seinem Ursprung her. Denn indem er alle stark einmalig, also „vergänglich“ sprechenden Individualmerkmale tilgt, erreicht er, eben von diesem Kerne her, jenes Allgemeingefühl der Dauer, das allen begriffsnahen Bildungen so stark zu eigen ist.
So muß es ihm aber auch mißlingen, das „Dramatische“, das einmalig-Erschütternde eines Konfliktes auf seinem Höhepunkt zu geben. Wenn er, im Märchen von Orpheus und Eurydike, die Szene sich zum Vorwurf nimmt, da sich, am Wendepunkt des dramatischen Geschehens, Orpheus noch zu früh zu der Geliebten wendet, und sie damit für allezeit verliert: so wird unter seinen Händen auch hieraus ein gedämpft-geruhigtes Verweilen, ein Bleiben ohne Hast und Tat.
Wiederum ist die Komposition ins Wiegende ausgeglichenster Statik gebracht. Vom rückgestellten Fuß des Hermes links geht Weg und Blick den Körperstamm hinauf, mit dem Profil zum Kopf der Eurydike, dann hinüber zum Kopf des Orpheus, und durch dessen Arm und Körper zu dem entsprechend rückgestellten linken Bein. Die Falten ziehen leise singend, im steten Schreiten Gluck’scher Melodien ihre Wege. Der Mittelpunkt der Konzeption liegt dort, wo sich die Köpfe der beiden Liebenden zueinander neigen und Schmerz und Sehnsucht sich im Blick des Anderen die Antwort sucht. So tauchen sie im Schauen ineinander, und hier nun, wo das Herbste aufeinanderstößt, wo allzugroße Sehnsucht das schon fast erreichte Glück ins Unglück umreißt, tragisch verfrühtes Tun den Gipfelpunkt der Handlung[S. 48] in dramatischem Schlage auftreiben müßte — da sordiniert die Gesinnung des griechischen Idealismus wiederum das Geschehen zu still akkordhafter „Harmonie“. Eurydike hebt ihre linke Hand im still Gelösten ihrer Biegung auf und legt sie dem Geliebten tröstend an die Schulter; und Orpheus wendet seine Rechte in gleichfalls stillem Schwung des Armes zu ihrer Hand, zu sehnender Berührung. Und wie sich hier die Neigungen der beiden Köpfe, der Blick der Augen, die Kurven dieser Hände sanft verschlingen, wird stilles Schweben eines tiefen Allgemeingefühles, weit fortgehöht von jeder Leidenschaft, im Stillsten, Reinsten einer idealistischen Welt lebendig. Hermes tritt noch herzu, schlingt seine Linke um das Gelenk des hingegeben hängenden Armes der Eurydike, hält sich sonst still und wartend bei den Beiden: und so wird es, als ob ein reiner, großer Dreiklang, ins Moll gewendet, leise sordiniert, in ewig-gleichem Schweben in den Lüften stünde. —
Wie für die Einzelfigur, so mag auch für mehrfigurige Kompositionen noch gezeigt werden, daß innerhalb des Umkreises Einer Gestaltensweise, hier der idealistischen Schaffensart, sehr verschiedenartige Tönungen des Grundgefühles möglich sind. Zwei Kompositionen Michelangelos von der Decke der sixtinischen Kapelle in Rom mögen dies erweisen.
War im Idealismus der klassischen Antike die „ewige Dauer“ inhaltlicher und formaler Geklärtheit, leise überwebt durch das Schweben einer stillen Melancholie, das spezifische Differenzgefühl dieses Stiles, so zeigt der tragische Idealismus der italienischen Hochrenaissance, soweit er in Michelangelo verkörpert und durch ihn getragen wird, eine dunklere, gepreßtere, dramatischere Färbung.
Auch die „Erschaffung Evas“ idealisiert die Komposition und die Gestaltung. Vor nahezu neutraler Folie, vor einem Wenigen raumhafter Gegebenheiten, ist das Gebäude der drei Figuren errichtet. „Idealisiert“ bis zum letzten Detail, also mit Unterschlagung und Überbreitung sämtlicher individuellen Merkmale, sind auch hier Raum und Terrain, Hügel und Baum, Figuren und Gewand gegeben. Doch im Gedrängteren der Formen und der Gesten führt die Stimmung zu tragischerem Gehaben. Angepreßt, eingeschmiegt, wie in Gegen-Wendung gegen die Bewegung der Eva, fast schmerz-gequält bei dieser Geburt aus der dunkeln Knickung der Hüfte, drängt sich Adam in die stützende Höhlung des Hügels, preßt rechten Arm und rechte Seite an den gegenwirkenden Stamm. Der Kopf drängt nach rechts, der linke Arm drängt nach links und „öffnet“ damit die linke Seite. Und aus der fast rechtwinkligen Knickung des Körpers, die die ruhend-horizontale Basis der Beine mit dem weg-gedrängten Oberkörper gibt, hebt sich die Figur der Eva auf ihren Weg. Sie schließt mit ihrer ruhigen diagonalen[S. 49] Schiefe das idealisiert-rechtwinklige Dreieck der Komposition, dem Adam und Gottvater die beiden gebaut-statischen Seiten geben. Und dieser Gottvater steht wie ein massiger Pfeiler im Rechteckblock seines Gewandes in unerschütterlicher, majestätischer Ruhe da. Was ist seiner Macht die Erschaffung des Weibes — Das Werk eines halben Arms! Indem im Gegenzuge gegen das Neigen seines Kopfes die rechte Hand mit gewährend nach oben gewendeter Fläche sich hebt, indem sein halber Arm, nur bis zum Ellenbogen zur Aktivität sich mühend, die Bahn des Weges durch die Luft beschreibt — da hebt sich mit, erschaffen und zum Leben her-gezogen, der Körper Evas aus der Seite Adams. So mächtig ist Schöpferkraft im Bau Gottvaters hier gesammelt, daß glaubhaft wird, daß aus der Gegen-Führung dieser Hand und dieses Hauptes, die beide durch den Schöpfer-Blick genährt werden, ein ganzes, volles, freies Menschen-Weib ersteht. —
Gesteigert in der Kraft, doch durchaus noch im idealistischen Bereiche, lebt auch die Erschaffung Adams. Wiederum klärt idealistische Gesinnung im Unterschlagen alles Ambiente und alles kleiner Wirksamen den Raum und höht die beiden Hauptfiguren zum Typus auf. Zwei dunklere Komplexe, rechts und links im Raum verteilt und ausgewogen, stehen einander gegenüber. Schon in der Kurve der allgemeinen großen Führung, der ruhend-lagernden des Boden-Dreieckes links, der schwebend-bleibenden der Bogen-Rundung rechts, symbolhaft und Gefühls-vermittelnd wirkend. Denn so wie bereits von hier aus das Gefühl lebendig wird, daß eine aktivere Masse auf eine passivere zuschwebt, so ist diese Grundstimmung, daß das Belebende von rechts her sich dem noch Toten nähert, bis in die letzte Einzelheit festgehalten. Aus der Grund-Gesinnung, daß das aktiv-schöpfende Prinzip im Heranschweben durch den weiten Raum, weithin vor sich die Strahlkraft seiner Wirkung sendend, schon von Weitem her in der Annäherung die noch unbelebte Materie zum Leben weckte: verdichtet sich dann dieses Gefühl in der Schöpfergeste selbst. Schwebend-lagernd und noch immer fast mühelos breitet in der weiten Höhlung des Mantels Gottvater seine Glieder. Über der horizontalen Schichtung seines Unterkörpers und der darunter schwebenden Engelsfiguren dichtet sich das Nest der Putten. Doch als einzige aktive Form hebt sich der Arm — hier allerdings nicht mehr der halbe, wie bei der Erschaffung Evas, sondern der ganze Arm, dem Adam zu. Dieser aber, der tot und unbewegt des Atems harrte, der ihm das Blut durch seine Adern strömen ließe, ist schon durch die bloße Annäherung Gottvaters aus vor-geformter, doch noch unbelebter Materie zur Tätigkeit erwacht. Die rechte Seite schmiegt sich in prachtvoll durchgezogener Kurve vom Scheitel bis zum rechten Fuß noch lagernd-passiv dem Boden an; das linke Bein aber hat sich zu aktiver Regung angezogen[S. 50] und gibt mit seinem Knie den Sockel für den Arm, durch den der Lebensstrom voll in den Körper rinnt. So antwortet der weit-gelösten Kurve der rechten Körperseite die aktiv gepreßte und gespannte der linken, aus der dann in dreifach konvergierender Führung die Richtungswerte von Kopf und Knie und dem dies ideelle Dreieck über-fahrenden Arm zum Lebens-Quell hin streben. Und will man die unerhörte Kraft der rein inhaltlichen Konzeption ermessen, die Größe der rein sachlichen Phantasieleistung Michelangelos, so muß man bedenken, daß in jenen Zeiten das „Überspringen“ eines Funkens noch lange nicht jene banale naturwissenschaftliche Erfahrung jedes Kindes war, als die es heute aus Dutzenden von Schul-Experimenten elektrischer Natur in der Gesinnung Aller lebt. Sondern die „Idee“, in Einem Punkte der bis zu nahester Näherung geführten Spitzen zweier Finger dies Leben-Gebende nun letztlich in das noch Tote überzuleiten, ist damals so neu wie stark gewesen. Fast lechzend nach Empfangen senkt sich die halb-lebendige Hand Adams, der immer noch das eigene Knie vom Unterarm her die Stütze geben muß, der aktiv vor-gereckten Hand Gottvaters zu. Und von diesem Konzeptions-Kern aus, der abermals Dramatisches der Handlung zu idealistischer Ruhe klärt, ebbt dann der Weg in breiter werdender Bahn der beiden Körper wiederum zurück zu dem lebend-Schwebenden der rechten und dem empfangend-Lagernden der linken Bildhälfte. —
Dies also ist Idealismus. Er unterschlägt die individuellen Einzelzüge des einmalig Erlebten und gleicht sie ins Allgemeine aus. Der Rhythmus seiner Gestaltung hebt und senkt in gleichschrittigen Intervallen die Betonungen des ihm wichtigen allgemein Typischen und die Lockerungen des zu übergehenden Einzelnen. „Sie aber, sie bleiben / in ewigen Festen / an goldenen Tischen. / Sie schreiten vom Berge / zu Bergen hinüber: / aus Schlünden der Tiefe / dampft ihnen der Atem / erstickter Titanen, / gleich Opfergerüchen, / ein leichtes Gewölke.“ So schreitet im Wohl-Takt der getragene Rhythmus idealistischer Gesinnung; zum Land Orplid, das ferne leuchtet.
Haben wir bisher die spezifischen Gefühle nach-erlebt, die an den Formungen des Naturalismus, der naturalistischen Permutation und des Idealismus hingen, so bleibt noch die letzte Formungsmöglichkeit, die des Expressionismus, zur Verlebendigung übrig. Und auch hier wird es sich darum handeln, nachzuweisen, daß dieser Bezirk, der die Individualmerkmale der Erfahrung intensiviert, völlig gleichberechtigt neben jenen anderen[S. 51] drei Bezirken steht, die jeweils die Gefühls-Träger in ihrer naturhaften Formung beließen, oder sie zu phantastischen Gebilden permutierten, oder sie durch Ausgleichung der Gegebenheiten zu idealistischer Gestaltung hin veränderten. Und dieser Nachweis sei so versucht, daß der Ausgang jeweils von den naturalistischen Gegebenheiten her genommen und öfters idealistische Gebilde als Gegenbeispiele herangezogen werden. —
Das „Rasenstück“ Dürers gibt wiederum ein Beispiel für jene — der Tendenz nach — fast völlig „unpersönliche“ Einstellung, die sich mit aller Intensität bemüht, im Ab-Bilde die naturgegebenen Formungen des Daseins in der „Zufälligkeit“ ihrer Erscheinung möglichst zu bewahren. Auch hier kann behauptet werden, daß niemand, der es nicht schon vorher „weiß“, erkennen könnte, daß dieses Bild gerade von Dürer geschaffen worden ist. Denn die Mutter dieser Formen ist die „Natur“. In dieser Versponnenheit, in gerade diesem Nebeneinander und Durcheinander wachsen im heimischen Norden Stengel und Blätter, Gräser und Blumen zu verwirrtem Komplexe auf. Mit inniger Treue gegen die Natur gehen Auge und Hand Dürers allen Verflechtungen und Verwicklungen nach. Das Kompaktere und Verwachsene des Grundstockes, die Durcheinanderführungen, die durch die zufällige Verteilung der Samenkörner und Wurzeln entstanden sind, die Lockerungen, die dann durch den höheren Wuchs der Gräser entstehen: bis in die zartesten Biegungen, bis in die leisesten Verschiebungen, bis in das leichteste, freieste, Licht und Luft suchende strebende Aufzittern der Gras-Ähren geht verliebtestes Empfinden den zartesten Variationen nach, erlebt sie als Gegebenheiten draußen in der Natur und hält sie mit der naturalistischen Treue des nordischen Auges im Ab-Bilde fest. Wie wenn man sie im stillen, stetigen Streben, im inneren Kreisen ihres Saftes, im mikroskopischen Klein-Zellen-Bau innigsten Drängens zum Lichte erleben würde, so stehen diese bescheidenen Liliputaner des Pflanzenreiches in zitternder Lebendigkeit vor uns. Nordische Liebe für Unklarheit des Sichtbaren, für Dichtigkeit des Komplexes, für größtmögliche Fülle und Variation auf kleinstem Raume hat sie gesehen und dann nach-geschaffen.
Wo innigstes Einfühlen in das still-stetige Wachsen und Zellenbauen der Natur den Stift Dürers in treuester Haftung der vor-gegebenen Formung verliebt folgen läßt: da baut das Temperament Grünewalds die Gegebenheiten des Sichtbaren zum Ausdrucke seines eigenen inneren Gefühles um.
Ein Stück der Vegetation vom Isenheimer Altar, aus dem Antonius- und Paulus-Bilde, gebe das Gegenbeispiel. Die Wurzeln der Bäume kriechen in aktiver Streckung über den Boden, nehmen die Formen bewegungsfreier, willkürlicher Lebendigkeit an. Die Pflanzen des Vordergrundes schlagen mit ihren Blättern wie mit Flügeln, kriechen mit ihnen über den Boden,[S. 52] strecken ihre Leiber wie Hälse in die Höhe, drängen sich, in ganz anderer Art als bei Dürers Rasenstück, aktiv, verlangend, treibend ans Licht. Und das mittlere Blütenpaar peitscht seinen Gabelzweig in die Luft, packt im Zangengriff die Höhe, und wie die Köpfe zweier aufgeschossener Raketen sitzen die Blüten an den Enden. Licht und Schatten fluten als flüssig-leuchtende Materie über die Körper, reißen weite Helligkeitsbahnen und tiefe Dunkelschluchten durch das Gelände: überall, aus jeder Farbe, aus jeder Form, aus jeder Helle oder Dunkelheit spricht deutlich die Intensivierung der vorgegebenen Naturerfahrungen zu erhöhtem Ausdruck, zur Expression innerseelischen Empfindens. —
Ein Dreier-Paar: Hände in naturalistischer, in idealistischer, in expressionistischer Gestaltung.
Ein Händepaar Dürers, eine Studie zum Hellerschen Altar. Die Hände eines Modelles. Mag das unmittelbare Temperament, das auch Dürer von Hause aus eigen war, und das nur so lange Jahre seines Lebens durch die erkältende Glätte mißverstandener italienisch-idealistischer Orientierung verschüttet wurde, hier auch stärker mitsprechen, mag ein „Nachdruck“, den sein Griffel von diesem inneren Temperamente her erfuhr, auch an so manchen Stellen leise „expressionistisch übertrieben“ haben: im Kerne der Einstellung und im Wesentlichen der Formung zeigt das Blatt durchaus objektiv-naturalistische Gesinnung und Haltung. Man kann bis zum Eide durchaus davon überzeugt sein, daß die Hände des Modelles diese eigentümlich leicht gekrümmten Finger, diesen nach außen gebogenen Daumen, diese Schwierigkeit der Streckung des fünften Fingers infolge geringer Sehnen-Verkürzung, diese, gerade diese Führung der Adern auf dem Handrücken, die ja bei jedem Menschen anders läuft, wirklich auch „gezeigt“ hat. Bis in die Faltung jedes Fingergliedes, bis in Nagelform und in Beugungsreste verfolgt das Auge Dürers die So-Gegebenheiten der Natur und hält sie in der Abschrift fest.
Dagegen nun das Hände-Paar aus Michelangelos Erschaffung Adams. Wo Dürer die Einzelmerkmale des Gesehenen in ihrer Art und Form bewahrt; da geht die idealistische Gesinnung Michelangelos über alles individuell-Einmalige ausgleichend hinweg. Verfolgt man die obere Kurve, die vom linken Rand des Bildes über das Gelenk zur Fingerkuppe führt, so gleitet das Gefühl in die breite Bahn des Allgemeinen, hebt und senkt sich in gleichschrittigem Rhythmus, die angenähert-geometrische Rundung betonend, führt über locker gehaltene, rund erstellte Gelenke, breitet die Innenfläche zur gelösten Höhlung empfangender Passivität; strafft auch in der aktiven Hand Gottvaters kaum die Sehnen, bleibt in Haltung und Führung, wiederum vom Ganzen bis ins Klein-Einzelne einer Gliedkuppe oder eines[S. 53] Nagels, im Bezirke ausgleichender Gesinnung, die die individuellen Einmaligkeiten tausendfacher Modellverschiedenheiten tilgt und mit der allgemeinen, idealistischen Form deckt. War bei Dürers Händen der gefühlsmäßige Eindruck durchaus der eines einmaligen, individuell-bestimmten, niemals sich wiederholenden Erlebnisses; so lebt die Stimmung der Hände Michelangelos in der ewigen Wiederkehr des Gleichen, in dem, was Alle Individuen ausgleichend überbreitet und umfaßt.
Und nun wende man den Blick zuerst zurück zu Dürers Händen, und dann, im Vergleich des Erlebnisses, zur Hand des Gekreuzigten Grünewalds. Hat Dürer seine Bildung als Ab-Bildung geschaffen, und alle individuellen So-Gegebenheiten treu bewahrt; hat Michelangelo das Allgemeine des Typus idealisierend vor-geholt, indem er diese individuellen Merkmale ausgleichend über-sah; so bohrt sich Grünewald in diese Kerben des Einmaligen doppelt und dreifach ein, verstärkt sie, intensiviert sie, wo und wie er nur kann. Man nehme wiederum den Anlauf vom linken Bildrand aus. Im stärksten Wogen schwillt die Form des Armes aus schmal verengtem Ellenbogen nach beiden Seiten auf, stößt seine Wölbungen nach außen, höhlt sich dann im Abfall in die Rinnen der Sehnenzüge ein, verkrampft sich im Engpaß des Gelenks der Hand, breitet den Handteller zur Wurzelplatte aus, von der her dann die Finger vor dunklem Hintergrund ihr lautes Schreien in den Himmel schicken. Der Nagel schnürt und preßt die Hand verstärkt ans Holz, die Finger dehnen, strecken sich und krümmen ihren Ausdruck in die Luft. Weit ab von der Natur-Gegebenheit, so weit wie Michelangelo, doch nach der Gegen-Richtung, zeigt sich hier die Form. Weil Grünewald das Erschütternde dieses Schrecknisses, der Schändung und der Tötung Christi, aufs Intensivste und aufs Stärkste aus dem Herzen schreien wollte, weil jede Form ihr Anklagen und Rufen doppelt, dreimal, mehrfach in das Gewissen der Gemeinde und zum Himmel schicken sollte: deshalb intensiviert er, über-treibt er jede Form so weit, daß sie zwar noch erkennbar bleibt, doch ihre Eindruckskraft weit über die der vorgeformten Naturgegebenheit hinausgeht. So wird die Längung der Finger über-trieben, so wird etwa auch dort, wo im Absetzen des Daumens vom Daumenballen Naturform eine leise Kerbung zeigt, der Daumen ab-geschnürt, damit er in dem diskontinuierlich-plötzlichen seines Aufsprungs und seiner Reckung, der Biegung und der Richtung, im Überhöhten der Farben und des Lichterglanzes „Ausdruck“ gebe für das Gefühl, das mit seltenem Sturme in der Seele Grünewalds eingeschlossen war. —
Und was für Pflanzen und für Hände gilt, gilt gleicherweise für Gesicht, für Körper und für Komposition. Nun kann die Analyse wohl schon rascher vorwärtsgehen.
[S. 54]
Der „Baumeister Hieronymus“ von Dürer gibt wiederum das Beispiel, wie ein Gesicht des Menschen, in das zufälliges äußeres Schicksal und angeborenes inneres Temperament, in Spiel und Gegenspiel, in Ruf und Antwort an dieser Wand zusammenstoßend, ihre Runen eingeschrieben haben, möglichst treu in seiner So-Gegebenheit als „Porträt“ bewahrt werden kann. Ein „einmaliger Mensch“, an einem Tage, in einer Stunde hat so ihm sein Gesicht gewiesen. Hat so „ausgesehen“. Etwas bekümmert und zerplagt, von grübeliger Arbeit, die ihm anscheinend nicht allzuleicht fiel, mitgenommen und verherbt, bereits im Abbau seiner Lebensenergie, nicht allzu weitsichtig und überschaulich, kein „Philosoph“ des Lebens: ein einmaliger, wahrer Mensch.
Dagegen Adams Kopf aus Michelangelos „Erschaffung“. Wirklich auch von Michelangelo „erschaffen“. Der Kopf des Ersten Menschen, im Allgemeinen seines Typus. In klarem Bau hebt sich der Hals aus weiter, runder Grube, die zwischen Schultern und Schlüsselbeinen ausgehoben ist. In allgemeiner, weiter Wendung seiner klaren Muskelbahnen dreht er den Kopf ins neigende Profil, schickt seinen breiten Blick, die allgemein-gelöste Stimmung seines Mundes der lebengebenden Gottvater-Hand entgegen. In großen Flächen, in allgemeinen Linienzügen steht das Gebilde da, sind Haar und Ohr, sind alle Teile des Gesichtes, vom Größten bis ins Kleinste, bis zu den Nasenflügeln und den Augenbrauen „von der Natur entfernt“.
Und nun eine Studie von Grünewald zu einem „singenden“ Engel des Isenheimer Altares. All das, was an Verschiebungen des Gesichtes beim Öffnen des Mundes, Verziehen der Lippen, Verdrücken der Augen, Verfalten der Stirne bei einem singenden Knaben etwa zu „beobachten“ ist, ist hier über-betont, verstärkt, zu übermäßigem Ausdruck intensiviert. Die Formen quellen wieder wie über-lebendig vor, der Umriß läuft damit in stärksten Hebungen und Senkungen um das Gebilde, Verquetschungen und Pressungen, Verflochtensein von Falten auf der Stirne, als wären sie verwachsenes Wurzelwerk, das Vorstrecken der Nase, das Aufquellen der Backen, das pressend ineinander verknetete der Formen: weit ab von jeglicher Natur des Hieronymus-Kopfes Dürers; weiter noch ab von jener Ausgeglichenheit und Allgemeinheit, die Michelangelos Kopf des Adam zeigte. Expression, Ausdruck innerseelischen Temperamentes hat auch hier die Formen über-geformt, über-betont, zum fast schreienden Offenbaren Grünewaldschen Fühlens fortgeführt. —
Jede begriffliche Teilung eines Erfahrungsgebietes ist zwar notwendig, um die geistige Beherrschung über die sonst verwirrend unbeherrschbare Fülle des Tatsächlichen zu ermöglichen; doch sie wird eben dieser Fülle des Tatsächlichen nie gerecht. Sie scheidet in umzirkte Gruppen, was in[S. 55] Wirklichkeit durcheinandergeht — so führt sie etwa „theoretisch“ eine reinliche begriffliche Scheidung zwischen „Warmblütlern“ und „Kaltblütlern“, zwischen „Amphibien“ und „Fischen“ durch, die der Wirklichkeit nicht entspricht — und sie wird damit zu einer Gefahr für alles lebendige Erleben. Soll eine begrifflich-systematische Orientierung also nicht mehr Fehler besitzen, als eben nur die notwendigen Fehler ihrer Vorzüge — was, bei der Relativität aller Dinge, eben „Vollkommenheit“ bedeutet —, so muß jenes lebendige Erleben ihre Umgrenzungen und prinzipiellen Einteilungen immer wieder als unfeste und verschiebliche begreifen. Es muß bereit bleiben, der Gefahr der Sterilität eines starr behaupteten und intolerant durchgeführten Systemes dadurch zu begegnen, daß es jeder „Theorie“ in desto weiterem Umfange „Relativität“ zugesteht, je weniger es sich um eine reine Begriffswissenschaft, wie etwa die Geometrie, handelt, je mehr bloß der theoretische Überbau für reichste Erfahrungs-Wirklichkeit gegeben werden soll.
Um dies an einem Beispiele zu erweisen, soll noch gezeigt werden, wie auch im Bewußtseinsleben Eines Menschen die drei theoretisch gesonderten Einstellungen des Naturalismus, des Idealismus und des Expressionismus im kurzen Zeitraum weniger Jahre bei- und nacheinander wohnen können.
Den Kopf eines „jungen Mädchens“ zeichnet Dürer im Jahre 1515, in schlichter, naturnaher Einstellung. Kein „besonderes“ Gesicht, ein Durchschnittsmensch, mit allen jenen kleinen Verschiebungen um den „Typus“ des menschlichen Gesichtes herum, die infolge der unübersehbaren Versponnenheiten und Verwicklungen organischer Bildung immer auftreten. In der Kopfformung, im Verhältnis der leereren Gesichtsteile zwischen Ohren und Augen, Nase und Mund zu eben diesen Teilstücken, in der Bildung dann eben dieser Details sind alle individuellen Besonderheiten belassen und gepflegt. Und so ergibt sich als Resultat das bestimmte Gefühl, einem „einmaligen“ und einem „wirklichen“ Menschen gegenüberzustehen, der dieser Zeichnung sicherlich glich, dem diese Zeichnung sicherlich bis ins letzte „ähnlich“ war.
Im Jahre 1506 hatte dieser selbe Dürer den Kopf einer „Frau mit glatt gescheiteltem Haar“ gezeichnet. Er ist einer der wenigen seiner „konstruierten“ Köpfe, in denen Dürer, der geometrisch errechneten und abgezirkelten, also gefühlsleeren Form leise ausweichend, das völlig tote Gerüst geometrisch erdachter „Proportion“ innerlich verlebendigt hat. So kommt denn eine Einstellung zustande, die von idealistisch-erfühlter Formausgleichung her dem Kopf das Einmalige bestimmter und zeitlich beschränkter Existenz nimmt, um ihm dafür die ruhige Größe des Dauer-Lebens und Dauer-Bleibens begriffsnaher Formung zu verleihen. Es soll[S. 56] dabei nicht verschwiegen werden, daß man auch diesem Kopfe noch anmerkt, daß ausgleichender Idealismus Dürers Innerstem eigentlich nicht entsprach. Sondern daß im Gegenteil Dürer von Hause aus in seinen frühen Werken durchaus expressionistisch orientiert war. Er verschüttete bloß durch Selbst-Vergewaltigung zu italienisch-idealistischer Gesinnung alle diese ursprünglichen Quellen seiner Eigenart; ohne dabei — da es eben ein verstandesmäßig-gewollter, ein rechnerisch-geometrischer Begriffs-Schematismus war, den er sich aufzwang — jemals wirklich den innerlich erlebten, vom Allgemeingefühle her strömenden echten Idealismus südländischer Natur und Volksart zu erreichen. So ist denn auch in diesem Kopfe beides, sowohl das rechnerisch-Konstruierte, wie auch das expressionistisch-Zupackende in Resten noch deutlich zu erfühlen. Das kalt Geometrisierte in den Konturen und der Modellierung des Halses; das energischer die Formen über-Betonende in einem gewissen Über-spannten von Blick, Nase und Mund. Es ist fast, als hätte eine zupackende Hand mit sehnigem Griff in die idealistisch-ausgeglichene Form dieses Gesichtes gefaßt, und, im Zusammenpressen der Finger, die schmale Grat-Bahn aufgehöht, die Nase und Mund durch die breiten Flächen des Scheitels, der Stirne, der Wangen und des Kinnes ziehen. Hier in dieser schmalen Zone, zu deren Seiten auch der Blick der Augen, etwas abrupt in die Winkel verschoben, aus der allgemeinen Richtungs-Harmonie der großen Kopfbewegung ausbricht, hier biegen sich die Kuppe und die Flügel der Nase und die gespannt schwellenden Formen der Lippen in innerlich pulsierendem, innerlich stoßendem Gefühle, dem die allgemein-ruhende Form nicht gemäß war.
Dennoch aber bleibt die Allgemein-Stimmung, das Großgefühl dieses Kopfes ein Idealistisches. In weiter, freier Klarheit hebt sich der Hals von den Schultern, wendet sich der Kopf im Genick, hebt sich das Kinn, laden die Formen zu breitestem Schwunge aus. Das akkordhaft-ariose Tönen der italienisch-idealistischen Art ist hier Dürer in hohem Maße gelungen.
Will man nun den eigentlichen Dürer, will man ihn am Quell seines ursprünglichen Wesens, nämlich als Expressionisten kennen lernen, so muß man entweder zu seinen frühen Holzschnitten der Apokalypse, oder späterhin dann zu zeichnerisch-raschen, noch nicht „konstruktiv“ umgearbeiteten Entwürfen gehen; wie etwa dem „Memento mei“ vom Jahre 1505 oder der Beweinung vom Jahre 1522. Um hier jedoch den Vergleich mit den zwei anderen Kopf-Zeichnungen besser und nachdrücklicher durchführen zu können, sei die Zeichnung gezeigt, die Dürer im Jahre 1514 von seiner Mutter gemacht hat.
Wiederum ein „Gesicht“. Das Gesicht einer Frau, deren Leib durch[S. 57] den Mißbrauch von achtzehn Geburten zerstört, deren Geist durch Arbeit und sorgenvolle Mühen zeitlebens außerordentlich beschwert war. Und nun, da Dürer sie, die Dreiundsechzigjährige, der ihr Mann und fünfzehn ihrer Kinder bereits vor-gestorben waren, kurz vor ihrem eigenen Tode vor seine Augen und vor seinen Griffel nimmt, da denkt er weder an „Konstruktion“, noch ist er persönlich unbeteiligt genug, um die objektiv-naturalistische Einstellung bewahren zu können. Denn wo für den Maler, der das Bewußtsein des Porträtierten sonst nicht kennt, die Runen, die die ihrem Schicksal antwortende Seele in das Antlitz gräbt, die einzige Möglichkeit sind, auf Innerseelisches des Modells zu schließen: da kennt hier Dürer dieses Modell seit mehr als vierzig Jahren. Und damit weiß er mehr, als ihm die objektiven Formen sagen. Dies Mehr nun wird bei ihm gefühlserschütternd wirksam. So gräbt es auch die Runen stärker, schlägt die Kerben tiefer, intensiviert die So-Gegebenheiten der Natur zu stärkerem Ausdruck. Er überhöht so das vom Leben Leergespülte dieses Halses, verherbt den Mund, buckelt und höhlt die Backen, verstiert den Blick der Augen, über-spannt die Stirne im Kleingeriesel ihrer Sorgenwellen: und steigert so die Formen des Gegebenen, Gesehenen zum Ausdruck gefühlsmäßig erlebter Innerlichkeit, intensiviert sie zu expressionistischer Natur-Ferne.
So zeigt die Dreiheit dieser Köpfe, was wir ja auch aus eigenem Innenleben wissen: daß in Einem Bewußtsein, zeitlich voneinander geschieden, alle drei wesentlichen Grund-Verhaltungsmöglichkeiten gefühlsmäßiger Einstellung dasein können. —
Haben wir bisher nur Teilstücke betrachtet und untereinander verglichen, so mag nun vorerst die ganze Figur als Bild — diese noch im Dreier-Komplex — und dann zum Schlusse die kompliziertere Bild-Komposition Wesen und innerliche Berechtigung des Expressionismus erweisen.
Zuerst der „Christus an der Säule“ Rembrandts, gemalt etwa im Jahre 1646, in Rembrandts Vierzigstem. Ein kleines Bild. Doch voll und reif im Künstlerischen.
Ein schwächlich müder Jüngling ists, kein Christus. Das Überhöhende, naturhaftes Erfahren Überschreitende lag nicht in Rembrandts Seele. Nachdem er die gezwungenen Posen seiner Jugendart verlassen hatte, hat er den Christus immer wieder als reinen Menschen gemalt, dem „Hoheit“ niemals eignet. Dafür verinnerlicht er ihn im menschlichen Gefühl.
Rein naturalistisch ist das Bild empfunden. Ohne jede „Abweichung von der Natur“. Wahrwirklich so im Körper, wie im Seelischen. Der Jüngling stellt sich an die Wand, rückt das rechte Bein als eckig hingestelltes Spielbein vor, neigt sich im magern Körper und der schwachen Brust nach vorne, senkt still den Kopf und bleibt. Bleibt dem Auge und dem Malen[S. 58] Rembrandts, der mit sicherster Gewähr des Treffens, die Beine so, den Körper so, die Hände lax verschränkt, den Kopf gesunken und geneigt, das Ganze in das warme Licht des Zimmers eingehüllt, das „Objekt“ faßt. Sein Seelisches zu „deuten“, tut weder Rembrandt, noch der Analyse not. Der Jüngling war, schon als Modell, im Innersten so traurig-müde, so milde-gütig und hingebungsvoll geneigt, daß im rein körperlichen Neigen der Figur und ihres Kopfes das Hingegebene und Mit-Leid Weckende innerseelischer Wahrwirklichkeit zutage tritt, wie es im Leben selbst geschah.
Demgegenüber dann der „Stabträger“ der klassischen Antike.
In Stand- und Spielbein klar geschieden, mit dem wohltönenden Rhythmus, der alle Eckigkeiten und Besonderheiten einmalig zufälliger Haltung zum Wesentlichen abgestimmter Bewegung ausgleicht, tragen die beiden Beine, als Säulen-Stützen deutlich vom Rumpf getrennt, den Oberkörper, der leicht und klar in der Teilung der Hüftgelenke von den Stützen hebbar ist. Zu fast geometrisch allgemeinster Ausgleichung ist die Rundung der Schenkel, ist die zur Scham in reiner Bogenform und reiner Symmetrie sich senkende Grenzlinie des Körperstammes, sind alle senkrechten und wagerechten Teilmodellierungen der Oberfläche geführt. Klar sitzt der Hals, klar dreht sich im Scharnier der Kopf, klar ist sein Oval, klar seine Teilung des Gesichts; und klar ist auch die Teilung des ruhig hängenden Armes durchgeführt.
Das idealistische Gesamtgefühl ist uns vom „Idolino“ her bereits bekannt: eine sordinierte und leise melancholisch überbreitete Harmonie beruhigt klarer Größe.
Zum Gegenpole dieses beruhigt-idealistischen Gefühles muß nun jener Weg geleiten, der gegensätzliches Verfahren beim Gestalten wählt. Wo Individual-Merkmale einmal bleiben können; das andere Mal zum Allgemeinen hin zu überbreiten sind; da können sie zum dritten Male in sich verstärkt, erhöht, vergrößert werden. Der „Wilhelm Tell“ von Hodler sei hier das Beispiel. Er ist so wenig naturwahr, wie der Doryphoros. Doch so verschieden von ihm, wie rechts von links. Um hundertachtzig Grade, in gestrecktem Winkel, führen, von gemeinsamem Ursprung her, die beiden Wege auseinander, um, unversöhnbar weit, an einander feindlichsten Zielen zu enden.
Aus weit aufklaffendem Wolkenriß tritt Tell hervor. Nicht Tell nur soll er sein; sondern Symbolgestaltung des „Befreiers“. Das Allgemeingefühl, das wache Menschen dazu treibt, gegen Ungerechtigkeit und Vergewaltigung, gegen jene Beschränkung der persönlichen Freiheit also, die nicht von der Gemeinschaft, sondern von verbrecherisch herrschenden Einzelnen auferlegt wird, mit aller starken Macht inneren Willens aufzustehen,[S. 59] soll hier gestaltet werden. Da taugt kein einmaliges „Modell“ dazu; da taugt auch nicht verklärte Harmonie des Idealistischen. Sondern erhitzt vom Innersten her, symbolhaft aufgetrieben, aufgeworfen, von der stärksten Intensität des innerseelischen Gefühles genährt, müssen Formen erstehen, die dann eben an Ausdruckskraft und Freiheitswillen alles übertönen, was naturhafte Bildung zu erstellen pflegt.
Vom Sohlen-Sauge-Tritt der Füße aus, die wie verklammert an dem Boden haften, hebt sich durch die Doppelbahn der beiden überbreit-gespreizten Beine der Strom des Kraftgefühles zu den Hüften auf und baut hier mit dem dunklen Gurt den strack gestellten Sockel für den Oberkörper. In breitem Schwunge fließt der Kraftstrom weiter über Brust und Schultern hinauf zum Kopf, der wie ein Rammbär festgewuchtet steht; treibt weiter durch die beiden Arme, staut sich am rechten Rande an der Armbrust und wird hier rück-geschlossen zu dem Griff der Faust; hebt auf der linken Seite den rechten Arm des Tell in innerlich erpreßtem Schwunge auf, zur freien, breiten Hand: so stoßen dreimal offene Formen, die Hand, die Armbrust und das Face-Gesicht, unwiderstehlich durch den Raum nach vorne.
Allüberall bemerkt man dann die Intensivierung der Naturgegebenheiten. Vom vorhin schon erwähnten Sauge-Tritt der Sohlen an, der das Anschmiegsame flacher Menschenfüße in unerhörter Energie verstärkt; über die vorgetriebenen Muskeln beider Unterschenkel; über die treibend-zügige Verklammertheit des Körperstamms, der wie ein Felsblock raumgefestet steht; bis zu dem Schädel, der, um als Rammbär des Gewalt-Vorstoßes zu wirken, ins kubisch-Rechteckige seiner Form verdichtet wird; bis zu den beiden „Falten“ auf der Stirn, die, um die Energie maßlos zu erhöhen und um dem dunklen breiten Bart den Gegenpart zu halten, aus Stirnrunzeln zwischen den Augenbrauen zu kleinen, festen Kugelkuppen „intensiviert“ werden: überall merkt man die Tendenz am Werke, die individuellen So-Gegebenheiten der Natur zu über-höhen, sie auf-zustärken, sie zu „Gefühlssymbolen“ umzuzwingen, um inneren Allgemeingefühlen des Gestaltenden Ausdruck zu verleihen.
Nimmt man die ganze Figur nochmals in Blick und Fühlen, so gibt sie tatsächlich wohl Stärkstes überhöhter Kraft, geht mit unwiderstehlichem Stoß uns entgegen und reißt durch ihre Formenbildung zu jener seelischen Gewaltmacht hoch, die nur der Expressionismus bringen kann. —
Hat man sich einmal an die spezifische Art der „Abweichungen von der Natur“ angepaßt, die durch die expressionistische Gestaltungsgepflogenheit begründet sind, und nimmt man nicht mehr als „falsch“ oder „schlecht gezeichnet“, was eben dadurch verursacht ist, daß es „einem Gefühle Ausdruck geben soll“, so wird man auch reicheren expressionistischen[S. 60] Bildkompositionen gegenüber leicht die gerechte Einstellung finden können.
Mit dem Aufkommen expressionistischer Bild-Kompositionen tritt aber zugleich auch die Frage nach dem sachlichen Inhalte der Bilder, nach dem „Was“ der Darstellung, bedeutungsvoll hervor.
Die allgemeine Bedeutung jedes Menschen, auch des Nicht-Künstlers, tritt vor allem darin zutage, welchen Lebens-Inhalten er sein Interesse zuwendet. Auch wenn ein Mensch die zufällige Begabung des Festhaltens seiner erlebten oder erträumten Seeleninhalte in den Formen einer Kunstbetätigung nicht besitzt, kann ihm rein menschliche Seltenheit oder Bedeutung eignen. Sie wird dann eben in der Seltenheit seiner Bewußtseinsinhalte und in seinem daraus folgenden Tun und Lassen zutage treten. Vermag er andererseits diese Inhalte künstlerisch zu fassen, so wird er als bedeutender Mensch nebenbei noch zum bedeutenden Künstler.
Nun gibt es aber eine große Zahl allgemeiner Lebensinhalte, die den bedeutendsten wie den unbedeutendsten Menschen gemeinsam sind. So etwa alles, was als vaterländische oder religiöse Überlieferung, als Sage oder Märchen Allen gleichermaßen vermittelt wird; weiterhin dann die unentrinnbaren, jedem im Laufe seines Daseins bestimmten Erlebnisse der Familie und ihrer Verwirrungen, der Berufswahl und des Kampfes um materielle Sicherheit, die Freuden der Jugend, die Taten der Reife, die Lasten des Alters, das Kommen und Schwinden der Liebe und des Leides, das stetig sich Nähernde der Stunde des Sterbens. Besonders die Dreizahl von Jugend, Liebe und Tod gibt jedem Leben sein Gerüst.
Bei diesen allen Menschen gemeinsamen Sachinhalten sind es nun wieder die spezifischen künstlerischen Fassungen, die den bedeutenden Seltenen vom unbedeutenden Durchschnittskünstler unterscheiden. Wie dieser Zweite durch das Pflegen nächstgelegener, billigster Assoziationen sein menschliches Durchschnittsmaß verrät, dem dann das flach-dienstbare der formalen Ausgestaltung entspricht, so wird ein Größerer, Seltenerer — neben der phantasiemäßigen Erfindung völlig neuer Sachinhalte — dort, wo diese Inhalte durch Tradition oder durch das Allen gemeinsame Lebensschicksal vor-gegeben sind, durch neuartige Assoziationen sowie durch originale formale Formung des Werkes sein Überdurchschnittliches erweisen.
In dieser zweiten Lage ist Hodler, als er im Jahre 1895 die „Eurhythmie“ malt. Er hat diesem Werke keinen guten Namen gegeben, denn dieser führt — aus beschränkt-theoretischem Interesse — an dem Gefühlsinhalt des Bildes vorbei, indem er ein Äußeres betont, das durch ein weitaus größeres Inneres überrufen wird. Doch die Namengebung des Bildes ist auch nicht leicht, weil nun und in der Folge wieder einmal jene vorhin erwähnten[S. 61] alten, längst erlebten, längst dargestellten Themen gebracht werden, die als bleibende und immer wieder gegebene Erschütterungsinhalte menschlichen Lebens zu wirken beginnen, wie sie auch in der Zukunft immer wieder wirken werden. Leben und Liebe, Enttäuschung und Tod, Kampf und Verzweiflung, Verzicht und Ergeben. So kann man am besten zwei — leicht variierte — Verszeilen eines Gedichtes von Stefan George der Melodie des Bildes als Text unterlegen: So zieht ihr im Dämmer und euer Geleit Ist lächelnder Strahl, ihr, die sinkende Zeit.
Ihr, die sinkende Zeit: vom sachlichen Inhalte der Idee geht die Konzeption aus, wie dies immer noch bei gesunder naturferner Kunstübung der Fall war. Das Alter des Verzichtens, „da Alles gesagt ist im stummen Verein“, wenn die Sonne nicht mehr, wie der Jugend, vom Horizont sich hebend vor den Augen steht, wenn sie auch nicht mehr zur Lebensmittagsreife auf den Scheitel glüht, sondern wenn sie sich in den Rücken niedergesenkt hat, so daß der eigene Lebensschatten vor den Füßen den Rest des Weges ins Dunkel laufen läßt; wenn man die Zeit nicht mehr spürt als den Jäger, dem man im Jugendsturme weit vorauseilt, wenn man auch nicht mehr mit ihr in tätiger Reife im Gleichschritt geht, sondern wenn sie vorbei- und vorausströmt, und es ist, als wenn ihr Strom den Rest des Lebens aus dem Körper spülte: dann wandeln die Müden zu Grabe. Den Weg des Verzichtens.
Ein altes Lied. Und wieder einmal muß sich erweisen, ob die Kraft künstlerischer Schöpfung dies doch auch immer wieder für jeden Einzelnen als Erlebnis Neue in eine neue Fassung zwingen kann. Hodler kann es. Nie noch sind in früheren Gestaltungen diese fünf Männer so zu Grabe geschritten. In fünffacher Ordnung zur Mitte gebunden. Leise tönt im Bilderlebnis das Erlebnis eines Zeitablaufes mit, das so schwer und so selten in Bilddarstellungen zu zwingen ist. Es tritt hier herauf, weil wohl die Fünf in strenger Komposition zur Bildmitte hin gebunden sind, so daß sich das Gerüst der Formung für das Gefühl des Beschauers statisch gebaut und damit frontal-verweilend vor die Augen stellt, als Darstellung eines formal anscheinend Dauernden durch den Bildrahmen nochmals gebunden; weil aber dann innerhalb dieses statisch-bleibenden Gerüstes der inhaltliche Sinn der Darstellung, das Schreitende des Zuges, profilmäßig vorbei-gerichtet ist, im Bilde vorbeigeht, ohne daß die leiseste formale Hemmung ein Verweilen deuten würde. So gibt die Vereinigung dieser beiden Gegebenheiten dem Erlebnis das langsam-Vergehende, das wandelnde Vorüberziehen. Nicht etwa des Einzelnen, sondern der gesamten Bindung. So daß das Allgemeine, alles Einmalige übertönend, im breithin Geleitenden des Gefühles lebendig wird.
[S. 62]
Mit wundervoller und seltenster künstlerischer Weisheit ist dabei der Klang von beiden Seiten her zur Mitte aufgehöht, so daß er wie das Brausen eines Fünfakkordes klingt, bei dem der Mittelton die Führung hat. Nicht nur die Vereinzelung und leise Erhöhung der Mittelfigur, auch die inner-seelische Abstimmung schafft hier am Werk. Sind die Randfiguren noch lebenskräftiger, noch stärker im Bau der Körper und der Gesinnung der Gesichter, sind sie auch rein formal noch lebensfähiger und erdennäher, als der Mittelmann, so gibt der Kopf dann als der stärkste Träger alles inhaltlich-Seelischen das innerlichste Zeichen. Die Randgestalten neigen alle zwar den Nacken, gebeugt von Lebenslasten und Schicksalsfron, nach vorne, und im Sinken ihres Kopfes ist zwar der Blick zur Erde mitgesunken; doch einen Rest aktiven Erlebens bewahrt noch Jeder. Besonders wo, im vorderen Plan, der Eine noch sein Kinn in leichtem Lebenstrotz zur Brust hin drängt, der Zweite noch die Spuren seines Unwillens trägt, den ihm das Leben aufgezwungen hat. Auch dieser Trotz verklingt bei den Genossen. Doch während alle Vier das Haupt nur sinken lassen, fällt es beim Mittleren nicht nur vornüber, sondern auch zum Bild heraus. Damit aber wird er, der Haar-Entlaubte, zum Über-Reifsten, zunächst dem Hingehen Geweihten.
Und er ist auch der Einzige, bei dem jetzt unerbittlich die Forderung ersteht, naturfernem Gestalten recht willig gegenüberzutreten, um es richtig zu lesen. Sein Körper wird nach unten hin so breit, als saugte das Gewand sich an den Boden. Nach oben hin geht dann die Führung von Brust und Rücken schmal zum Hals zusammen, zu schmal für naturalistisches Erleben. Der Arm, der einzige im Bilde, schmiegt sich aus schmaler Schulter in die Form und längt sich, hingegeben hängend, zur Über-Länge, um zur Bewahrung des geschlossenen Umrisses den Knick des Knies zu decken. Sollen diese „Abweichungen von der Natur“ verstanden werden, so dürfen sie nicht am Äußeren der Erfahrungen des Lebens gemessen sein, sondern am Inneren des Gefühles. Hier aber werden sie unmittelbar lebendig. Denn dadurch, daß sich zwischen den ungebrochenen Kurven, vorne über Leib und Brust, hinten über den Rücken, der ganze Bau der Figur aus breitem Bett nach oben hin kontinuierlich und stetig so schmal zusammenzieht, wirkt dann der Kopf, als wäre er abgeschnürt. Und da sich diese Schmalheit seiner Ansatzfläche mit seinem Außen-Neigen eint, wird es, als ob er demnächst fiele: als Kopf vom Rumpf, als Frucht vom Lebensbaum. So lebensmüde und so sterbensreif neigt hier der Mittlere, als Einziger, den kahlen Schädel aus der schmalen Spur. So wird er auch zum Einzigen, der wirklich ganz bereits verzichtet hat. Und also schwillt bei ihm das Tönen dieses Sterbeklanges in dunkler Färbung auf, wird Er zum Grab-Geweihten, den näher noch am Leben Stehende den letzten Weg geleiten. —
[S. 63]
Als nächstes Beispiel diene Hodlers Bild „Jüngling vom Weibe bewundert“ aus dem Jahre 1903. Es bringt Reife der Komposition vereint mit sicherster Gestaltung. Denkt man die jetzt nur mehr im Beiwerk sich noch verkrümelnden Reste naturalistischer Anschauung: die Rasenfleckchen auf dem Boden, die Wolkenecken und etwa noch die Unsymmetrie der Blätter an den Zweigen in den Jünglingshänden aus dem Bilde fort, so bleibt ein reines Werk.
Die alte Wahrheit, daß der Zwang des Einen Geschlechtes zum Anderen Unwiderstehlichkeit einschließen kann, soll hier in der — auch im inhaltlichen Gegensinne geltenden — Fassung gestaltet werden, daß die Bewunderung des Weibes für den Mann zum sachlichen Thema wird. Um diese Unwiderstehlichkeit symbolmäßig glaubhaft zu machen und ihr den unwidersprechlich stärksten Inhalt zu geben, wird die Frau in der Mehrzahl, der Jüngling als Einzelner gebracht. Und um sich dreifach zu sichern, haben sich die Frauen zusammengetan, um stärker zu sein im Verein. Diese Bindung der drei Mittelfiguren in Einer Phalanx des Widerstandes soll die stärkste, die unlösbarste sein: also wird sie in architektonischer Formung vollzogen. Von der links an die Schulter gehefteten Hand der Ersten der Drei geht die Bahn der Bindung in strengen Brechungen rechter Winkel zur anderen Schulter, den Weg des Arms hinab, die Horizontalfläche der Handrücken als Brücke hinüber zur Mittleren, den Arm hinauf, zur Schulter herüber, den Arm hinunter, die Brücke hinum, den Arm hinauf, zur Schulter herum, den Arm hinab. Die linke Randfigur schließt sich noch zu weiterer Hilfe heran, auch sie, in klarer Dorsalansicht, im Stählernen ihres Rückgrates aufs Äußerste zum Widerstand bereit. So gehen die vier Repräsentantinnen, nachdem sie sich aufs Stärkste aneinandergefesselt und damit in gegenseitiger Stütze zu vierfacher Kraft vereint haben, stolz und gefaßt dem Jüngling entgegen. Und dieser kommt im Siegerschritt daher. Leichthin beschwingt fast setzt er seine Füße. Die Arme lässig, ohne Tun, hat er zu schmuckhaftem Gehaben frei. So sicher fühlt er sich. Und also ward das Schicksal auch erfüllet. Denn wie die Phalanx an dem Einzelnen vorbeigeht, verklammert und verzahnt, wie sie in fest vereintem Willen, sich nicht zu rühren und zu regen, geradeaus die Bahn zu gehen und Jenes nicht zu achten: an Ihm vorbeigeht — da dreht es mit Gewalt ihnen den Hals. Wie er vorbeigeht, sinnend und verspielt zugleich, da zwingt er sie. Mit nichts als seiner Gegenwart. Sie gehen weiter; doch im Gehen dreht es den Kopf ihnen herum, un-wider-stehlich, ihm nach-zu-sehen. Der Nächsten dreht es gar den Körper mit; sie weicht der Zwangsgewalt aus ihrer Form. Der rechte Arm geht mit und aus der Klammer zweier Hände weicht im ersten Paar die eine. Er löst den Halt. Und wie er,[S. 64] nicht achtend der Ver-führten, weitergeht, so klingt die Zwangsmacht seiner Gegenwart nach links hin ab. Das Kraftfeld zieht die Linien immer lockerer. Die Zweite, Dritte, Vierte wenden nur den Kopf. Doch alle Blicke gleiten seine Bahn, ihm nach. Sie wollten nicht; jedoch sie mußten. Es war ein Stärkeres in ihm; das sie bezwang.
Gibt es noch jemand, der sich der Gefühlsgewalt expressionistischer Gestaltung wehren kann? Er mag sich noch so fest an Altes binden; läßt er die ganze Szene nicht im Rücken, geht er an ihr auch nur vorbei, so zwingt sie ihn. Zu sich. Zu ihrer neuen-alten Art; in jenen wertvollsten Bezirk, den vielfaches Erleben spenden kann: die Allgemeingefühle menschlichen Bewußtseins in Formen jener Art zu fassen, die gegen das naturalistisch-Wirkliche zu Trägern großen seelischen Geschehens werden können.
So einsichtig und klar wird alle Theorie, wenn ein Erlebnis sie mit dem Bedeutungsinhalt füllt. Kein Mensch mehr, dem dies Bild lebendig geworden ist, wird daran zweifeln können, daß hier dem Satze recht gegeben wird, der alle Abweichungen von der Natur im Kunstbereiche dann berechtigt glaubt, wenn ein Gefühl als Formentreibendes dahinter stand. Und auch der Weg wird völlig klar, auf dem es zu diesem Verhalten kommen muß. Als Erstes erscheint eine Summe von Einzelerlebnissen gegeben, die, alle aus gleicher Gruppe einer Lebenserfahrung geholt, auf das Bewußtsein des Schaffenden in ihrer einmaligen Besonderheit gewirkt haben. Dann blieb von allen diesen Individual-Erlebnissen ein Rest, eine Erinnerungssumme als Allgemeingefühl im Bewußtsein des Künstlers. Dann aber sollte dieses Allgemeingefühl eben als Allgemeines gestaltet werden. Daß hierzu einmalig-individuelle, also naturalistische Formen nicht taugen, ist ersichtlich, weil ja deren Begleitgefühl immer die spezifisch-einmalige Tönung behalten würde. Also müssen Formen gestaltet werden, die erstlich von den naturalistisch-individuellen Gegebenheiten abweichen; und zweitens diese Abweichung so vollziehen, daß sie Träger des Allgemeingefühles, „Symbole“ für seine allgemeine Artung werden. Diese Formen, dann nicht mehr passiv-abwartend, sondern aktiv-nachbildend aufgenommen, durch „Einfühlung“ verlebendigt, werden aus Zeigern des Gefühles, das sie geboren hat, zu Zeugern, die dieses Gefühl wieder-schaffen: indem sie im Erlebenden durch „rückläufige Assoziation“ jenes Gefühl heraufzwingen, dem sie ihrer formalen Natur nach zugehören.
Und diese Einsichtigkeit und „Wahrheit“ der theoretischen Behauptungen ist ja nichts Verwunderliches, da diese ja aus dem Erleben der Kunstwerke geholt wurden. So müssen sie zu den Tatsachen, aus denen sie abgeleitet wurden, mit derselben Exaktheit und Sicherheit stimmen, wie dies für alle anderen „Gesetze“ gilt, die ja, selbst auch im physikalischen Bereiche,[S. 65] nichts sind, als „abgekürzte Beschreibungen“. Selbst die „Fallgesetze“ der Dynamik sind nichts Mehreres und nichts Höheres: sie beschreiben in konventionellen Zeichen die Tatsachen des freien Falles im Raume und stimmen immer nur ebenso annäherungsweise auf den speziellen Fall, wie die psychologischen „Gesetze“ der Ästhetik auch. Denn dort wie hier werden diese gesammelten Erfahrungsformeln für den „idealen Prozeß“ aufgestellt, dem dort wie hier dann die Wirklichkeit ihre nie fehlenden Störungen, etwa der äußeren oder inneren Reibungswiderstände, dort der Luft, hier seelischer Hemmungen, und meist noch ein ganzes Bündel weiterer Irrationalitäten zugesellt. Doch dies braucht nicht zu hindern, bei neuen Erlebnissen, deren spezifischer Ausgestaltung man noch nicht angepaßt ist, jene „Kurzbeschreibungen“, jene „Gesetze“ dem neuen Erscheinungskomplex gleicher Art auch zugrunde zu legen, um mit ihrer Erfahrungs-Hilfe das noch Unbekannte zu bezwingen, zu „verstehen“: es in seinem dort äußeren, hier inneren Wesen zu durchschauen und damit, dort erkennend, hier erfühlend, zu erfassen.
Diese Erwägungen mögen dazu bereiten, nun auch heftigeren Umformungen der Natur mit willigem Gefühle nachzugehen. Tut man dies bei den naturfernen Werken vergangener Stile ohne jeden inneren Widerstand, weil man sich ihrer spezifischen Ausgestaltung bereits von Jugend auf angepaßt hat; nimmt man hier etwa in der „Isokephalie“ der Griechen, in dem abstrakten Großbau der Mosaiken, in der Übertreibung aller Bewegungen bei Michelangelo, in den stärksten Verzerrungen Grünewalds, willig über all diese „Unmöglichkeiten“ der Form hinweg den Weg zu dem zugrunde liegenden Gefühl: so steht man den neuen Umformungen, den „noch ungewohnten Unmöglichkeiten“ unserer Tage allzurasch von vornherein abweisend gegenüber. Jedoch auch hier bedarf es nur einer willigen Anpassung an die spezifische „Sprache“, an die oft eigenwillig neue Ausdrucksform, um diese neue Sprache zu verstehen, und damit die den Formen zugrunde liegenden Gefühle, die ja im Wesen immer dieselben waren und auch dieselben bleiben werden, unmittelbar im eigenen Bewußtsein lebendig zu machen.
„Der Tag“, im Jahre 1900 gemalt, gibt eine derart eigenwillige Gestaltung.
Die kommende Sonne. Wen günstige Stunde das Emporsteigen des Gestirnes öfter hat schauen lassen, der kennt das Erlebnis dieser Allgewalt. In unwiderstehlichstem Heben steigt der Ball. Der Mensch steht da, festet seinen Blick an den Horizont. Er sieht den Rand der Glutkugel erscheinen, in stetigstem Vorrücken steigen und steigen. So fremd, so ferne und so übermächtig, daß zorniger Wille ihn fassen kann, den Ball zu zwingen, auf seiner Bahn zu halten. Doch er mag den ganzen Trotz seines Menschentumes[S. 66] zusammennehmen, er mag mit innerlichstem Krampf dem Gestirne die Bahn verbieten: in stetiger Gewalt steigt es und steigt, hebt es sich seinen Weg. Zur Ohnmacht wird der Trotz, zur Kleinheit wird der Wille vernichtet vor der Menschliches verachtenden Kraft des wirkenden Gestirnes. Natur in ihrer Allgewalt. Weit überragend irdisches Ermessen. Sie steigt und steigt, weil sie steigen will. Fast höhnend hebt sie sich empor, höher und höher. — Da sendet sie ihre Blendkraft ins trotzende Auge. Ein Flammenübermaß: und weggewendet kehrt sich der Mensch in seine Kleinheit.
Zwei Wesenheiten also begleiten den Weg der Sonne: die Gewalt ihres Hebens; die Blendkraft ihres Scheines. Stellt sich ein naturalistischer Maler, mit den so sehr ins Engste beschränkten Mitteln seiner Kunst, diese Erlebnisinhalte als Aufgabe, so greift er ins Unmögliche. Niemals könnte naturnahe Fassung dieses Erleben auch nur im Fernsten vermitteln. Nicht nur, daß die Farben hier völlig versagen; auch im Formalen bleibt der runde Ball die so viele Bildversuche zum fast Lächerlichen herniederziehende „rote Apfelsine“, die die Welt wie eine Laterne kleinen Menschenwerkes kümmerlich erleuchtet. Hier sind „Schranken des Materiales“ errichtet, die von dessen engem Vermögen gegenüber allem naturhaft-Kosmischen beschämendsten Bericht geben. Um wie viel reicher das unmittelbare Erleben der Natur ist, als dessen Darstellungsmöglichkeit in jeder Kunstart, und wie vermessen daher, in objektiv-naturalistischen Darstellungen den „ganzen Kosmos“ begriffen zu glauben, mag man an solchem Beispiele erkennen.
Doch wo selbst Goethe an der Schilderung vorbeigeht, „vom Flammenübermaß betroffen“, wo selbst seine Sprachkraft und Sprachschöpfung so sehr versagt: „Sie tritt hervor! — und, leider schon geblendet, kehr ich mich weg, vom Augenschmerz durchdrungen“, wo er, „vom Feuermeer umschlungen“, sich abwenden muß: „So bleibe denn die Sonne mir im Rücken“; da hat doch auch Goethe wieder gefühlt, daß nur naturferne Bildung, die etwa die Worte und Gegebenheiten der Sprache völlig vermeiden könnte, diesem Geschehen noch am ehesten gerecht zu werden vermöchte. „Ungeheures Getöse verkündet das Herannahen der Sonne.“ Und so könnte etwa das große Orchester der symphonischen Gestaltung aus ungeheurem Getöse aller Instrumente die Glutkraft reinsten Feuerscheines emporleuchten lassen in strahlenden Fanfaren. Geht aber Malerei an diese Aufgabe, so kann es niemals die einer naturnahen Orientierung sein. Niemals hätte selbst der „Lichtmaler“ Rembrandt an dergleichen nur gedacht. Und so oft auch der Sonnenfanatiker van Gogh daran gedacht und die Glut seiner Farben daran versucht hat: er mußte scheitern. Denn er wollte die Sonne als Sonne, als „Himmels-Körper“ malen; und so schmolz sie ihm Form und Farben fort, zerfraß ihm Auge und Gehirn. Denn schon[S. 67] die rein quantitative Übergröße ihrer Intensität mußte alles ins Nichts zerschlagen, was die Palette oder die graphische Form an Kleingebilden in Parallele stellen wollte.
Da demgemäß der Weg objekthaften Darstellens der äußeren Gegebenheiten unmöglich wird, bleibt nur der andere Weg der symbolhaften Darstellung des inneren Erlebnisses. Und hier wieder muß diesen Symbolträgern bei einem äußeren und inneren Formate, das in der Proportion möglichen Erlebens zu unserem Auge steht, die Kraft gegeben werden, mit den Mitteln des Sichtbaren so zu werken und zu wirken, daß zwanghaftes Steigen und blendendstes Sein sich vereinen.
Hodler erstellt das Symbol in nackten weiblichen Figuren. Sie sind ihm gut, sowohl die aktive Kraft, wie das passive Erleiden zu tragen.
Das zwanghafte Steigen zu vermitteln, verwendet er nun alle Elemente naturferner Gestaltung.
Er ist dabei nun kühner als in der „Eurhythmie“. Um das Zwanghafte der Bewegung zu geben, bindet er vorerst den ganzen Komplex in die stärksten Fesseln. Zu sicherem Verweilen führt die frontal gerichtete Fünfzahl der Figuren. In strengste Kompositionslinien ist sie gebunden. Die vertikale Mittelfigur baut die Achse des Bildes. Von der dunklen Horizontalen des unteren Bodenstreifens nahe am Bildrande ab fassen parallele Bogenformen die Komposition und binden sie zur Mitte. Vom Knie der Linken mit leichtem Heben in der Mitte zum Knie der Rechten — die Horizontlinie des Bodens — die Bahn der Ellenbogen — die Linie der Scheitel — die Begrenzung des Himmels: fünfmal wiederholt sich die Fesselung in einen flachen Bogen, um die Höhentendenz zu binden. Und viermal, je zweimal von jeder Seite binden die Richtungslinien der Arme und der Köpfe den Bau zur Mitte. So steht und bleibt ein Gebäude, schon von hier aus als Anordnung un-wirklich, über-wirklich, jedes schlechthin naturalistisch Gegebene des Zusammenseins von fünf Figuren weit negierend.
Nachdem so die formale Hülle gegeben ist, füllt die inhaltliche Konzeption den Kern. Aus dem Kreise der Genossinnen hebt sich strahlend die Mittlere empor. Sie ist das Symbol der aufgehenden Sonne. Unwiderstehlich soll ihr Aufgang dem Gefühle wirken. Denn wir haben gesehen, daß erstlich ihr Streben nach oben das zwanghaft Innerlichste, gegen alle Fesselung Steigende sein muß; und daß sich zweitens mit diesem Treibenden innersten Müssens die strahlendste Kraft, die leuchtendste Blendung vereinen soll. So haben wir es so oft in Wirklichkeit erlebt. Und im Symbol soll dieses Gefühl gestaltet werden, das, in diesen beiden Komponenten, als Erinnerungssumme in uns Allen lebt, die wir so oft schon die Sonne vom Horizont in den Himmel aufsteigen sahen.
[S. 68]
Zwanghafte Lösung also vorerst aus festester Bindung. Nun wird die fünffache Bogen-Fesselung gefühlsmäßig lebendig. Und jede „Unwirklichkeit“ und jede „Unmöglichkeit“ ist gestattet, wenn sie die Bindung verstärken, die Lösung unwiderstehlicher machen hilft. So wird erstlich die Führung der Beine in die unterste Bogenform eingezwungen. Gegen jede mögliche anatomische Gestalt und gegen jede natürliche Haltung werden die Unterschenkel gebogen, zum möglichst lückenlosen Schließen der Reihung der Kniee gebracht. Am deutlichsten und kühnsten im linken Unterschenkel der mittleren Figur, dem die „Vergewaltigung“ der Form aufgezwungen wird, damit er dem Allgemeingefühle diene. Denn da der linke Fuß, in natur-möglicher Haltung, durch sein Vorstoßen über die Bogenform diese „Bindung“ zerreißen würde, wird er eben im Gelenk „gebrochen“, in die Rund-Führung eingezwungen. Naturalistische Anpassung wird dadurch gestört. Man versuche jedoch, diese so in den Bogen gezwungene Form nicht naturhaft, sondern als Symbolform der Bindung zu sehen: und sie wird mit der Reihung der anderen zum Sockel, von dem aus die Lösung der Mittelfigur erfolgt. Denn ihr zwanghaftes sich Heben kann nur dann stark und unwiderstehlich wirken, wenn glaubhaft wird, daß sie trotz Allem, was sie fesseln will, und gegen Alles, was sich mit flachlastender Schwere an sie anhängt: emporsteigt. Empor sich hebt, als löste sie sich zur Freiheit aus einer Bindung, die, mag sie formal noch so gesichert erscheinen, von ihr nie als ernstlich gefühlte, als innerlich hindernde empfunden wurde; sondern die in treibend-innerlichster Selbstverständlichkeit verlassen wird. So hebt das rechte Bein in stetem Ziehen die Figur empor, so streckt der Körper sich in seine Vertikale, so heben sich die beiden Arme auf zum Himmel, so wendet Zielgefühl die offenen Flächen der Hände, die einzeln vorsteigenden Strahlenspitzen der Finger nach oben, so gibt ein überlegen-müheloses Antlitz die unbedingte Sicherheit: sie steigt empor.
Und um dann weiterhin das strahlend-Blendende zu geben, hebt sie die beiden Arme zu eckig-scharfem Rahmen um den Kopf. Denn gerundete Führung würde hier das herbe Blendende der Strahlung völlig schwächen. So muß auch hier Natur zur Ausdruckskraft anatomisch unmöglicher Formung gezwungen werden. Die rechtwinklig-eckigen Brechungen stechen im Gefühle, an ihnen prallt das Nahende zurück, so wie sich Auge und Gefühl des Menschen vor strahlend hellem Licht erschrocken wenden. Im Blendungsbogen biegen sich die Leiber der Gefährtinnen. Die nächsten ganz zurückgeschreckt, gekrampft gewendet vor der Flut des Lichtes. Die weiteren in milder Dämmerung; vielleicht, bejahend im Gefühl, der Morgen links, entsagend in der Wendung, rechts der Abend. So klingt im tiefer Zurückgesetzten und im Linderen der Bewegung der Randfiguren, im Runderen[S. 69] der Führung ihrer Gesten, im Dunkleren des Tones und Haar-Beschatteteren ihrer Körper der Donnerklang der Mittelzone zu leiseren Akkorden ab.
Und also ist die Aufgabe gelöst, ein Bild erstellt, das innerem Gefühl lebendig wird. Zwanghaftes Steigen und blendendstes Sein erreicht. Der werdende Tag, die kommende Sonne sind aufs Intensivste, und dennoch erlebnisfähig dem Auge gestaltet. —
Wer sich mit den „Vergewaltigungen“ des anatomisch-Richtigen im Bild des „Tages“ nicht gleich befreunden mag, dem sei als Gegenbeispiel ein Bild gezeigt, das Hodler drei Jahre nach dem „Tag“ gemalt hat. „Die Wahrheit“ soll symbolmäßig gestaltet werden. Wenn es nun wahr ist, daß expressionistisches Gestalten nicht an der Wirklichkeit des Seins, sondern an der Intensität des inneren Gefühles gemessen werden muß, das die Naturabweichungen erzwingt und mit dem Treibenden seines Gestaltungswillens erfüllt, so wird in diesem Bereiche all Das schlecht und ohne Wert, was eben diese Zwangs-Intensität vermissen läßt. Die „Wahrheit“ hier, die Laster, Lug und Trug vertreibt, ist aus ähnlichem Gesamtgefühle geboren, wie der „Tag“. Auch hier soll strahlendes Erleuchten die dunklen Triebe scheuchen. Hier ist die Siegfigur stehend gebildet. Aus dunklem Kreis hebt sie sich hell ins Licht. Doch lebt man sie nach, fühlt man ihr auf den Kern — so bleibt sie lahm. Trotz ihrer anatomisch größeren Richtigkeit, trotz des naturhaft Möglicheren ihres Baues, bleibt sie gestellt und taub. Nichts Treibendes, nichts unwiderstehlich Mitzwingendes hat ihr Stehen oder ihre Bewegung. Die Geste der Beine wie der Arme wie des Kopfes bleiben einfühlendem Bestreben stumm und tot. Und auch die Kurven der Dunkelgestalten haben mehr naturalistisch-Wegeilendes als zwanghaft-Weggeschrecktes. Sie sind von ihren abgewandten Vorderflächen her empfunden und gestaltet, statt daß die „Wahrheit“ sie im Rücken träfe, sie von sich stieße. Dies kann sie nicht, weil sie in sich zu schwach ist, zu wenig Ausdruck ihrer selbst. Die ganze Konzeption ist trocken, das ganze Werk erdacht mehr, als erfühlt; eine in der inneren Energie des Wirkens schwache Stunde hat eine schwache Expression geboren.
Sieht man von hier auf die Figur des „Tags“ zurück, so wirkt diese doppelt stark. Vergleicht man bis ins Einzelne die Ähnlichkeit der Geste beider Arme etwa, so wird das Intensive ihrer Brechung gegen die Lahmheit jener „möglicheren“ Armhaltung bei der „Wahrheit“ restlos klar. Und damit das Prinzip. Je stärker der Trieb des inneren Gefühles, desto stärkere Vergewaltigungen kann er tragen; wo bei schwächerem Gefühle schon kleine Wagnisse der Umformung zu Mißbildungen werden. —
Es gehört zum Wesen der Monumental-Kunst, daß ihr jenes Pathos eignet, das Distanz erzwingt. Wo das intime Kunstwerk dadurch definiert[S. 70] ist, daß es den Erlebenden unmittelbar an sich heranläßt, ihm als Lyrik unmittelbar ins Herz spricht, als Kammermusik nahe in die Ohren spielt, als Bild ihn mit in seinen Rahmen nimmt; da treibt ihn das Monumentalwerk, sei es als großes heroisches Drama oder als Symphonie oder als Wandgemälde, weit zurück, auf daß er aus weiterem Abstande her die Schwungkraft finde, sich zu einer Größe aufzurecken, die dem Eindruck standhält.
Um nun zu zeigen, zu welcher Größe natur-fernster Monumentalität, zu welch weitesten Allgemeingefühlen seltenster Stärke, wie wir sie an Hand naturalistischer Bildformungen niemals würden erleben können, gerade die expressionistische Gestaltungsgepflogenheit zu führen vermag, sei auch noch ein Monumentalgemälde Hodlers gebracht; und zwar in — fast grotesk wirkendem — Vergleiche zu einem Bilde ähnlichen Themas, das Hodler noch in seiner naturalistischen Frühzeit gemalt hat.
„Die Reformatoren“ aus dem Jahre 1884 zeigen Calvin im Gespräche mit vier Genossen im Hofe der Genfer Hochschule. In objektiv naturalistischer Einstellung ist versucht, die Situation so zu geben, wie sie sich zu ihrer Zeit abgespielt haben mochte. Die Szenerie und die Kostüme, wohl auch das Porträthafte, werden aus alten Urkunden oder von den noch heute bestehenden Gegebenheiten hergenommen, die Raumanordnung und die Zusammenstellung der Figuren, neben erst leise sich regenden kompositorischen Prinzipien, im Unmittelbaren des naturalistischen „Bühnenbildes“ zu verlebendigen gesucht. Die Gesten sind solche des naturalistischen Nachdenkens, Horchens, Redens, Diskutierens, und nur die lehrhaft abweisende rechte Hand Calvins versucht im schärfer Schneidenden der Fügung und im Steileren ihrer Haltung eine leise Überbetonung zu erreichen. Doch trotz dieser Details und trotz der geringen Sonderung Calvins von den Genossen und trotz der Variation in den Gegenbewegungen der beiden äußeren Männer, bleibt die Darstellung ein gestelltes Bild, das jeder Überzeugungskraft ermangelt. Wer nichts von der „Geschichte“ weiß, dem sagt die Darstellung nicht mehr, als daß fünf Männer miteinander diskutieren; was eine herzlich gleichgültige Angelegenheit bleibt. Da demgemäß erst die Benennung dieses Bildes den von ihm gemeinten Sinn erklären muß, da also, was es sagen will, nicht in ihm selber lebt und durch das rein Sichtbare bereits erfüllt wird, ist es ein „schlechtes“ Bild. Denn dann erst wird ein Bild in üblem Sinne zu dem, was meist „literarisch“ genannt wird, wenn mit den Mitteln der Sprache erst eine „Geschichte“ erzählt werden muß, bevor man den vom Bildinhalt gemeinten Sinn erkennen kann. Dann eben ist dieser sachliche Inhalt in seinem Formalen nicht erfüllt, dann ist es kein „Bild“ mehr, sondern wird „Illustration“ zu einem Text, der zum Verständnis des Gemalten vorher bekannt sein muß. Dies muß sich jedes Streiten[S. 71] darüber, ob „Sachinhalte“ betonter Art in Bildern überhaupt „erlaubt“ sind, stets vor Augen halten. Sie sind als „Literarisches“ nur dann „verboten“, wenn sie nicht in den Farben und den Lichtern, in den Figuren und deren Gesten, im Formalen ihrer Gestaltung und in der kompositionellen Fassung unmittelbar visuell zu erleben sind; sie sind aber nicht nur „erlaubt“, sondern sogar, je bedeutender, ergreifender, seltener sie sind, desto inniger zu wünschen, zu erstreben und zu pflegen, wenn sie im Sichtbaren des Bildes restlos ihre Erfüllung finden. —
Fragt man aber, wie etwa die außerordentlich starke Gemütsbewegung, die die Probleme der Reformation doch allen Menschen brachten, nun wirklich in ihrem Rauschmäßigen gefühlserschütternd bildhaft zu fassen wäre, so wird die Antwort wieder nur lauten können, daß diese Fassung nur irgendwie im Allgemeinsten, ohne jede naturalistisch-berichtende Erzählung erfolgen könne; in einer naturfernen Gestaltung, die symbolhaft erlebbar machen müßte, was als allgemeines, großes Grundgefühl den Erlebenskomplex der „Reformation“ begleitet hat.
Und so trägt auch die zweite Fassung dieses Themas, die Hodler eine volle Generation nach der ersten, im Jahre 1913, gemalt hat, nicht mehr den Titel „Die Reformatoren“, sondern: „Reformation“. Und auch diese Namengebung ist noch zu eng, und wohl nur eine Kirchturms-Benennung der Stadt Hannover, wo dieses Bild den allzu kleinen Rathaussaal zersprengt. Hodler selbst nannte es, in innerlicher Gemäßheit: „Einmütigkeit“. Denn daß diese Einigung auf Einen Schwur für Eine Sache gerade den Reformationsgedanken treffen muß, ist nirgends Bild-inhaltlich oder Bild-formal erlebbar. Es könnte auch was immer sein: es muß nur groß-bedeutend Alle hier ergreifen und ergriffen haben. Ja es könnte selbst die schlechteste Gesinnung, es brauchte keineswegs ein Schwur, es kann „Verschwörung“ sein: ob Freiheit, Gleichheit, Liebe aller Menschen; ob Raub und Mord, Krieg, Niedertracht, Verrat, blutigste Rachsucht rufen: es ist von rein visueller Bild-Erfüllung her nicht zu entscheiden. Nur Eines ist gewiß: Einmütigkeit!
Mehr als ein halbes Hundert weit überlebensgroßer männlicher Figuren. Und Alle in dem gleichen Tun des Arm-Erhebens.
Schon in der Konzeption von übergroßer Kraft. Wenn wir nicht staunend an uns selbst, an jedem Baum erlebten, wie stetig neu erzeugter Zellenwuchs im Treibenden des Werdens und organischen Gedeihens das Kind zum Großen wie das Reis zur Eiche werden läßt; wenn wir nicht wüßten, und, wenn auch in kleinerem Maße, von uns selbst her kennten, wie eine täglich neue Sammlung des Gefühles auf Einen Punkt, auf Einen Menschen, auf Eine Sache die Intensität und Fülle unserer Selbst zu ungeahnter Stärke[S. 72] führen kann; wenn wir nicht nacherlebend ahnten, wie Hodler hier, von der Idee entzündet, aus Kleinerem wachsend, und täglich neu zu Größerem sich rufend, an jedem neuen Mann sich neu gestärkt, an jedem Schwörenden emporgerissen hat: wir würden nicht ermessen können, was hier an Größe des Gefühles, an Wurf des Ganzen, an intensivster Form Gestalt gewann.
Das Rufende des Werkes ist so groß, die Wucht so einheitlich, so überrennend, daß eine Wort-Umschreibung kaum vonnöten wird. Wie wenn man sämtliche Pedale einer Orgel zum Brausen eines Einklangs träte, auf dem sich dann ein arioser Ruf kraftvoller Färbung höher noch erhöbe: so steht hier vor der Mauer der gedrängten Leiber gefühlsgestoßener Genossen dieser Eine, den Ruf des Mutes Aller in Einem Mut zu sammeln. Einmütigkeit soll aller Gesten einziges Leben sein. So recken Alle ihre Arme hoch zum Himmel, bei Allen gleich, bei Allen Einer Art. Das innere Gefühl treibt von den Sohlen aus die Form in ihre Richtung, streckt sie im Stoßen, längt so ihre Form. So weist der Arm nach oben, beteuert so den Schwur der Herzen, sichert die Gesinnung. Doch da den Vielen vorn ein Führender erstanden ist, dem sie sich anvertrauen, so weisen aller Hände Flächen auch nach vorn zu diesem, bauen ihm einen Zaun. Er aber steht als Einziger erhöht, schon farblich als der Stärkste wirkend in einem dunkeln rötlich Braun zwischen dem Rot und Gelb und dem Orange der Genossen. Die Zange seiner überhöhten Beine faßt in felsenstarkem Griff den Boden, die Geste seiner Arme greift, bei ihm als Einzigem, ins Breite; er hebt den linken Arm zur Horizontale, schlägt ihn zum rechten hin zurück, schwingt diesen rechten in breitem Bogen aus: vereinigt so der Anderen Rufen und leitet es in weitem Schwung nach oben zum klar erstellten Gipfel seines Fingers. Was kaum mehr möglich schien, wird so erreicht: er hält dem Wogen stand, er sammelt die Gesinnung Aller, nimmt ihr Gefühl in breitem Strome auf, verstärkt den Chor, reißt ihn nochmals empor: und überruft so die Gemeinschaft mit einem Klang von solcher Mächtigkeit, daß wie im Gipfelschlag das Gefühl der „Einmütigkeit“ in expressionistischem Schwunge in die Höhen steigt. —
Schon von der theoretischen Ableitung her muß es unwahrscheinlich scheinen, daß diese Gestaltungsgepflogenheit des Expressionismus eine in der modernen Zeit zum erstenmal „entdeckte“ und gepflegte sei. Denn die Menschen haben sich in den wenigen Jahrtausenden ihrer Geschichte, die wir überblicken, im Wesen ihrer Art und ihres Wirkens so außerordentlich wenig geändert, daß es schon von vornherein kaum denkbar scheint, sie sollten eine so wesentliche Kunstart erst in den heutigen Tagen „gefunden“ haben. Und in Wirklichkeit haben ja auch alle jene Zeiten, die[S. 73] wir Sturm und Drang, Barock oder Romantik oder Hellenismus nennen mögen, die spezifisch expressionistische Schaffensart gepflegt.
Der Stärkste, der innerlich Größte und Ergriffenste dieser Expressionisten in der europäischen Vergangenheit war Matthias Grünewald. Neben ihm wird zahm, was alle anderen Künstler dieser Richtung geschaffen haben. Er stellt die höchsten Anforderungen an die Bereitschaft des Nacherlebenden, sich durch stärkstes Ergreifen innerlichen Gefühles am weitesten von der Naturform weg, zu den natur-unmöglichsten Gebilden tragen zu lassen.
Sein Isenheimer Altar, gemalt um das Jahr 1510, mag uns als Beispiel dienen. Und von dessen Darstellungen wieder die Kreuzigung und die Auferstehung.
Die Kreuzigung des Isenheimer Altares bringt von vornherein in größten Dimensionen durchaus un-einheitliche und „willkürliche“ Proportionen. Fünfmal wechselt der Maßstab der Figuren in dem Einen Bilde. Vom Christus in der Mitte zum Täufer rechts, zu Johannes und Maria links, zur Magdalena zu Füßen des Kreuzesstammes, zum Lamme: in andauernd wechselndem, andauernd verringertem Maßstab ist die Größenproportion der Figuren gebracht. Denn Grünewald ist es um den Ausdruck einer innerseelischen Vision zu tun, und diese ist ihm eben so erschienen, daß in fünffach gestufter Folge die Figuren vor ihm erstanden.
Die mächtigste von allen, doppelt und dreimal größer als die anderen, ist die Gestalt Christi. Die naturhaft gegebenen Merkmale eines gekreuzigten Menschen sind zur stärksten Intensivierung hin erhöht. Grünewald bringt sie nicht so, wie sie sich dem beobachtenden Auge des Naturalisten zeigen; er gleicht sie nicht aus, wie idealistische Gesinnung es so oft tat; sondern er überhöht sie, erhitzt sie, kerbt sie doppelt, dreifach und vielfach. An die obere Fläche des Kreuzesbalkens, den die ziehende Last nach unten biegt, greifen die Arme, hochgezwungen, ins Überweite hingespannt; der Riesenleib hängt an ihnen, nicht gestützt durch das zu tiefe Fußbrett, sondern nur schmerzvoll sich anstemmend gegen den durch die beiden Füße gehämmerten Nagel. Diese Füße schwellen ins Ungemäße auf, wellen ihre Formen zum Ausdruck stärksten Schmerzes. Die Beine winden ihre Bahn nach oben, lebendig zügig streicht Gewaltgefühl durch ihre Form, drosselt und wirbelt den Kraftstrom im Gelenk, baucht sich in Oberschenkeln und Hüften zu weitem Bogen aus. Dann ist es, als schlürfte ungemessener Schmerz an schwächster Leibesstelle, zwischen Rippenrand und Hüften, die Seiten ein, daß das Gefühl herdroht, als risse gar der Unterkörper hier lastend ab. Auf die ihren Kontur weit ausstoßende Brust hängt dann der Kopf herab, als risse auch er wieder im Fallen aus den Schultern. Und über aufgehöhte[S. 74] Muskelberge und durch tiefe Sehnengruben drängt das Gefühl im Auftrieb durch die beiden Arme, steigt wellend, wogend auf zu den gespreizten Händen, die mit dem Intensivsten innerlich getriebener Form ihr Leid und Leiden, Grünewalds Verzweiflung über diese Tat, zum Himmel schreien.
Und neben der Figur dieses Überheilands, sein fahles Grünlichgrau vor dunklem, weitem Himmel mit gellend roten Farben links und rechts begleitend, stehen die Figuren des Restes seiner Gemeinde. Rechts der Täufer. Wie Pfähle stoßen seine Beine stumpf den Boden, wie einen unbewegten Klotz tragen sie Leib und Kopf: der ganze Körper des Johannes ist nur der Sprungblock für den rechten Arm. Wie explodierend aus der Hülle, so stößt der Ellenbogen vor, so bäumen Unterarm und Hand sich auf den Christus zu: denn er, der Täufer, ist es, der weiß, was hier geschah, daß hier das größte Unheil, das ein Gläubiger erdenken kann, zur Tat geworden ist. Und um dies Unheil aller Welt zu weisen, und um, trotz allem, aller Welt zu rufen, daß Dieser hier zum Weltenherrscher wachsen wird, zeigt diese Hand. Und wie vom innersten Gefühle aus, vom Herzen Grünewalds gestoßen und getrieben, die Form hier wird, die Form der Hand, da spannt es ihr im Zeigen den Daumen zum Zerreißen ab, da treibt es ihr im Weisen den Zeige-Finger zeugend zu über-großer Länge aus: da über-treibt es diese Form, gestoßen vom Gefühle her, zum Ausdrucks-Zeiger, da intensiviert es die naturalistische Gestaltung zum naturhaft ganz un-möglichen, expressionistisch Ausdrucks-tragenden und Ausdrucks-vermittelnden Gebilde.
Nicht anders ist es auf der linken Seite. Hier hat Johannes sich der weißgewandeten Maria zugesellt, der einzigen geruhigten Figur des Bildes. Doch ihre Ruhe ist nicht die des Lebens, ist Sterbens-Stille, Unlebendig-Sein. In jähem Winkel bricht sie in der Hüfte um, zurück-geschlagen von dem, was ihre Augen sahen. Hinter der stillen Totenmaske ihres Angesichts ist alles Leben starr geworden; und nur die Hände halten lose noch den Griff, zu dem Entsetzen sie zusammenschlug. Johannes packt sie an mit seiner Linken, als könnte dieser Zangengriff sie retten, stöhnt ihr sein doppelt Leid ins Angesicht; und längt dann seinen rechten Arm, längt ihn ins doppelt-Überlange, auf daß er von seiner fernen schmalen rechten Schulter aus zu ihrer rechten Hüfte fassen könne, um ihr Zusammenbrechen auf-zustützen. Denn da hier Form nicht ihren Maßstab an Dem finden kann, was „wirklich“ ist, da hier als Maß der Form auf ihre „Richtigkeit“ nur das Gefühl gilt, das sie treibt und zeugt, das sie verzerrt, verlängt, verkürzt, verdichtet oder löst, so muß sie auch an dem Gefühl allein gemessen werden, das sie geboren hat.
Und so auch Magdalena. Aus ihrer Verworfenheit ward sie geweckt,[S. 75] gehoben durch Ihn, den Einen, Einzigen, den sie wahrhaft je geliebt. Ihn haben sie ans Kreuz geschlagen, Ihn ihr genommen. In ihrem maßlos fassungslosen Schmerze um den Geliebten schleppt sie sich ihm nach. Wie eine Riesenschnecke kriecht ihr Leib am Boden, schiebt sich das flüssig in sich lebendige Gewand hinzu. Aus diesem breiten, saugend angesaugten Sockel hebt sich ihr Schmerz und ihre Liebe auf zu ihm. So wächst ihr in der Sehnsucht auch ihr Leib, die Glieder folgen in ihren Maßen diesem Sehnen, schwingen vom Knieen an den Bogen ihres Leibes in doppelter Erhöhung zu den Hüften auf. Der Ausdruck ihrer Liebe schafft ihr so den Sockel für den Schmerz, den nun Gesicht und Hände aufwärts rufen. Die Arme strecken sich und längen sich im Winden, Gefühl treibt sie so nah wie möglich dem Kreuzerhöhten zu. Und wo der Leib nun seine Grenze findet, dort ringt er aus verschränkt-verkrampften Händen sich nochmals hoch, dehnt seine Form ins Äußerste, läßt bis ins letzte Fingerglied die Klage stoßen, die Form von dem Gefühl bis zum Zerreißenden des Ausdrucks füllen. —
So steht ein Ganz-Gebilde da, das weltenfern von jeder Natur-Gemäßheit ist, und dennoch „schön“. Schön für denjenigen, den das Gefühl, das aus den Formen schreit, erschüttert und ergreift. Und damit dann bereichert. Was aber Allgemeines daraus gefolgert werden kann, ist doch, daß ein Kunstgebilde nicht daran gebunden ist, die Formen der Natur-Gegebenheit zu wiederholen. Sondern daß es sich vom Gefühle tragen lassen kann: so wie zu still beruhigtem Gestalten des Allgemeinen; so auch zu überhitzt-erhöhtem brennender Gefühle.
Als letztes Beispiel dieser über-steigerten Gestaltung sei noch die Auferstehung des Altares von Isenheim gebracht.
In mehrfach gebrochener Bahn führt über den nach links hingestürzten Krieger im Vordergrunde, die nach rechts hin strömende Breite des Leichentuches, die wiederum nach links gewendeten Beine des Auferstehenden der Weg zur Zentralzone der Konzeption, zum Oberkörper Christi. Wie ein Schuppentier in seinen Panzer eingewachsen stürzt der Krieger im Vordergrunde rücklings hin; zu seiner Linken stürzt ein zweiter ihm auf seinen Leib; im Hintergrunde zerschmettert sich ein dritter im Vornüberfallen seinen Schädel selbst am Boden. — Aus breiter Bahn des verlebendigt aufstreichenden Tuches lösen sich die Füße. Wie wenn das Knochenskelett des Menschen keinerlei Grenzen der Beweglichkeit kennte, wie wenn es biegsam wäre in seinen Röhren, wie zäher Stahl, so schwingt der Unterkörper Christi von den Spitzen der gelängten Füße im Doppelstrom nach links hin zu den Hüften auf, biegt sich wie in innerer Schnellkraft eines Bogens auf zum Kopf. Durch Knie und Hüfte streicht wiederum der Strom[S. 76] durchtreibenden Gefühls, als wäre die Form von kochender Materie erfüllt. Und wo das Auge dreimal hin und her gerissen wurde auf seiner Bahn das Bild empor: da richtet sich die Brust jetzt in die Vertikale, hält schwebend still und bleibt dem breiten Blick. Und von den Schultern aus treiben zwei Bogen nach rechts und links, biegen auch hier die Arme gegen ihr Skelett zu voller Rundung auf, breiten die flachen Hände außenwärts: und geben so mit Brust und Schultern den gefaßten Rahmen für beruhigt stilles Sein. Aus allem Sturm und Drang der Bildgestaltung steigt so zu ewiglich erlöster Stille des Gefühles der Erlöserkopf empor. Gefaßt ins Rund der weiten Aureole, vor still gestirntem Himmel. Ins Lichte löst die Form des Kopfs sich auf, verschwimmt im Schein, so daß das Höchste, Letzte dieses Bildes das stille, breite Schauen des Erlösers, des Erlösten bleibt. —
Es dürfte nicht notwendig sein, mit Grünewaldschen Fingern darauf hinzuweisen, wo hier allüberall die Formen der Naturgegebenheiten zum Ausdruck inneren Gefühles umgezwungen sind. Denn dieser Ausdruck ist bei Grünewald von solcher Stärke, von solch unwiderstehlicher Gewalt des Fassens, daß der Beschauer in seine Formenbahnen hineingerissen wird, bevor er noch die Zeit fand, sie an Naturgegebenheiten abzumessen. So mag denn gerade die unmittelbare Ausdruckskraft der Bildgestaltung Grünewalds erweisen, wie das Erleben allezeit und allerorten mehr und früher ist, als jede Lehre.
[S. 77]
So dürfte wohl von theoretischer wie von praktischer Seite her klar geworden sein, daß es nicht etwa nur eine einzige mögliche und „richtige“ Gestaltungsgepflogenheit in den Künsten gibt, sondern daß mehrere, völlig gleichgeordnete und völlig gleichberechtigte Gestaltungsweisen nebeneinander oder nacheinander zu konstatieren und anzuerkennen sind. Schält man aus den tausendfachen Mischformen der künstlerischen Wirklichkeit die möglichst begriffsreinen Typen heraus, so findet man eben die besprochenen vier Arten: im naturnahen Bezirk Eine, die naturalistische oder realistische Kunstform; im naturfernen Bezirke die drei Möglichkeiten permutativer, idealistischer und expressionistischer Veränderung der naturgegebenen Gebilde. —
Nun bleiben aber noch zwei überaus wichtige Fragen zu beantworten. Erstens die nach der „spezifischen Differenz“, auf Grund deren man die in diese drei letzten Gruppen gehörenden künstlerischen Umformungen der Naturgegebenheiten von anderen, nicht-künstlerischen Umformungen — etwa von primitiv-kindlichen, oder von zweckhaft-technischen, oder von abrupt-zufälligen, oder von nichtgekonnt-dilettantischen — definitorisch unterscheiden kann. Und zweitens die nach dem Werte, den man dem einzelnen Kunstwerke zuspricht.
Beide Fragen lassen sich eindeutig aus der Definition des Kunstwerkes beantworten, die wir allen unseren bisherigen Erörterungen zugrunde gelegt haben. Scheut man vor sprachlicher Schwerfälligkeit nicht zurück, um die zur Fixierung des Begriffes notwendigen Merkmale alle in Einem Satze aufgezählt zu haben, so lautet diese Definition endgültig folgendermaßen: Ein Kunstwerk ist ein von einem Menschen aus einem Gefühle heraus künstlich gemachtes Gebilde, das dieses Gefühl trägt und das gleichzeitig imstande ist, dieses Gefühl auch einem anderen Menschen zu vermitteln.
Aus dieser Definition folgt nun unmittelbar, welche Umformungen des naturgegebenen Vorbildes in allen jenen Fällen, in denen kein naturalistisches Kunstwerk erstellt werden soll, zu den spezifisch künstlerischen zu rechnen sind: denn nach dieser Definition führt eine Umformung der Natur nur dann, aber dann auch immer zu einem unnaturalistischen Kunstwerk, wenn sie auf Grund eines Gefühles erfolgt ist.
Die nähere Ableitung der diese naturfernen Gefühle tragenden Formen[S. 78] der „Gefühls-Symbole“, kann hier nicht erfolgen. Doch wird man, wenn man die naturfernen Kunstgebilde, sei es Michelangelos oder Grünewalds, in der Erinnerung heraufzwingt oder neu in den Blick nimmt, unmittelbar erleben — worauf wir auch mehrfach im Text der Analysen hingewiesen haben —, daß alle diese künstlerischen Umformungen bei hingebender Einfühlung Gefühle in uns hervorrufen, die spezifisch an ihnen hängen. Als derartige sachinhaltlose Träger für Allgemeingefühle wurden sie dann in die Formen der Sach-Gegebenheiten eingearbeitet und konnten diese — theoretisch gesprochen — so weit verändern, wie das „Erkennungsfeld“ reicht, also die sachliche Erkennbarkeit des Dargestellten noch gewahrt wird.
Damit ist auch gesagt, wie sich alle Form-Umbildungen künstlerischer Art von den Deformierungen infolge „Nicht-Könnens“ unterscheiden. Bei dieser zweiten Klasse erfährt das nachspürende Gefühl deutlich das Erlebnis eines Ungeschickten, eines Gehemmten, Dilettantischen, das nicht gewollt ist, das „hindernd“ mit dem Sachkomplex verbunden ist, das Gefühl „fesselnd“ oder „störend“ begleitet; im ersten Falle der rein gefühlsmäßig-künstlerischen Um-Formungen werden umgekehrt gerade vom Allgemeingefühle des sachinhaltlich Gebrachten her alle Abweichungen, eben als eingearbeitete echte Gefühlssymbole, aufs intensivste gefühlsverstärkend und erhöhend lebendig.
Damit ist nun bereits auch ein Teil der zweiten, der Wert-Frage beantwortet. Fassen wir die obige Definition des Kunstwerkes kurz zusammen, indem wir sagen: ein Kunstwerk ist ein künstlich gemachter Träger für ein Gefühl: so bietet diese Definition zwei Stellen, die wertend ergriffen werden können.
Erstens das „künstlich gemacht“. Voraussetzung zur Herstellung eines künstlichen Gebildes ist, daß man die „Technik“ beherrscht, die zum Resultate in gerade diesem Kunstgebiete führen soll: daß man auch, rein Hand-Werks-mäßig, erstellen kann, was man gefühlsmäßig erstellen will. Damit wird reichere Erfahrung oft schon auf den ersten Blick sehen oder hören, ob diesem rein Technischen das überdurchschnittlich-positive, das allgemein-nullwertige oder das unterdurchschnittlich-negative Prädikat zu verleihen sei: also ob das Bild, die Statue, das Bauwerk; das Lied, die Sonate, die Symphonie; das Gedicht, der Roman, das Drama; der Tanz oder die Schauspielergeste; bis zu Schlittschuhlauf oder rhythmischer Gymnastik hinunter: gut oder schlecht „gemacht“ sei. „Gut“ oder „schlecht“ sind also Prädikate, die der technischen Beherrschung, dem Können innerhalb der betreffenden Kunstart zugeschrieben werden.
Nun bietet aber die oben gegebene Definition des Kunstwerkes noch[S. 79] eine zweite wertend angreifbare Stelle: ein Kunstwerk ist ein künstlich gemachter Träger für ein Gefühl. Da wir nun durchaus von der Voraussetzung ausgegangen sind, daß der Künstler ein Mensch sei, wie wir alle, so muß für uns auch das durch sein Werk vermittelte Gefühl durchaus aus dem Bezirke jener Gefühle stammen, die wir aus unserem eigenen Leben zumindest ähnlich bereits kennen. Der Künstler mag diese Gefühle variieren, erhöhen, vertiefen, er mag von stärkster Phantasiebegabung her die Fähigkeit besitzen, ganz neue Kombinationen dieser Lebens-Gefühle einzuführen: so wie sich keine Form, und wäre sie die natur-fernste, denken läßt, die nicht in ihrem letzten Kerne auf die Naturerfahrung zurückführbar sein muß; so ist auch kein Gefühl möglich, dessen letzte Komponenten oder Keimzellen nicht aus den Erfahrungen des „gewöhnlichen Lebens“ stammen. Damit wird aber die Wertung der im Kunstwerke gebrachten Gefühle auf die Wert-Skala zurückgeführt, die wir auch im „gewöhnlichen Leben“ Gefühlen gegenüber immer anwenden, und neue spezifisch „ästhetische“ „Wert-Prinzipien“ werden überflüssig. Das im Kunstwerke gebrachte Gefühl ist damit aber wiederum durchaus von der seelisch-geistigen „Bedeutung“ abhängig, die der Künstler als Mensch besitzt. Fragen wir nun weiter nach den Gesichtspunkten, unter denen wir die Gefühle der „gewöhnlichen Menschen“ werten, so finden wir, daß wir dies nach ihrer „Seltenheit“, sei es an Art oder Intensität oder Tiefe, tun, in der sie über die allgemein-durchschnittlichen, allen Menschen mehr oder minder eignenden „banalen“ Lebensgefühle hinausgehen. Und so ist es denn auch bei den Kunstwerks-Gefühlen. Ein Künstler mag also die „Technik“ seiner Kunstart noch so gut beherrschen, er mag „artistisch“ noch so viel „können“, das Kunstwerk mag also rein technisch noch so „gut“ sein: wenn uns der Künstler rein als „Mensch“, — und damit das von ihm erstellte Kunstwerk — keine Gefühle „mitzuteilen“ hat, die über den Durchschnitts-Komplex, den wir selbst alle auch besitzen, sichtlich hinausgehen, so kann das Kunstwerk für uns keinen Erlebens-Wert des ihm zugrunde liegenden, von ihm vermittelten Gefühles besitzen. Es wird dann eben ein „gutes“, aber ein „banales“ Werk. So geht denn neben der rein technischen Wertung von „gut“ und „schlecht“ die rein ästhetische Wertung nebenher, die von „bedeutend“ oder „unbedeutend“, von „wertvoll“ oder „wertlos“ für das Erleben, oder, wie man meist sagt, von „schön“ oder „häßlich“ spricht. Diese Wertung aber gibt den Ausschlag. Und von dieser Einstellung aus schreiben wir dann den „künstlich vermittelten Gefühlen“, und damit deren Trägern, den „Kunstwerken“ die Vorzeichen des bereichernd-positiven: „Schönen“, unbewegt-lassend-nullwertigen: „Gleichgültigen“, oder störend-negativen: „Häßlichen“ zu.
[S. 80]
So muß man also bei der „Wertung“ eines Kunstwerkes scharf die beiden Wertungspaare unterscheiden: ein Kunstwerk ist dann „gut“ oder „schlecht“, wenn es eine Beherrschung oder Nichtbeherrschung des rein Technischen seiner Kunstart zeigt; und ein Kunstwerk ist dann „wertvoll“: gleich „schön“, oder „wertlos“: gleich „banal“, oder „abstoßend“: gleich „häßlich“, wenn es uns ein Gefühl vermittelt, das uns bereichert, gleichgültig läßt oder zur Abwehr stört. —
Gesagt sei nur noch — ohne hier den exakten Nachweis zu führen —, daß über die technische „Güte“ oder „Schlechtheit“ eines Kunstwerkes, sowie über die Art, die „Zugehörigkeit“ des in ihm gebrachten Gefühles unter Erfahrenen kein dauernder Streit sein kann, sondern daß hier unbedingte Einigkeit herstellbar sein muß und auch herstellbar ist; daß aber über den Wert des gebrachten Gefühles niemals Einigkeit Aller herstellbar sein kann. Denn dieser Wert ist ein Bereicherungs-Wert: er hängt also als „Verhältnis-Größe“ nicht nur von der neuen „Einnahme“ ab, sondern, wie jede Einnahme, in ihrem Zuwachs-Wert ebenso auch von dem bereits vorhandenen seelischen „Besitz“, von dem bereits früher erworbenen gefühlsmäßigen „Vermögen“. So wie die „Grenznutzentheorie“ in der Soziologie feststellt, daß „die subjektive Wertschätzung eines wirtschaftlichen Gutes um so geringer wird, je mehr von derselben Art sich bereits im Besitze desselben Wirtschaftssubjektes befindet“; so kann ein und dasselbe Gefühlserlebnis für den bereits seelisch reichen Menschen nichts, für den seelisch noch armen Alles bedeuten. Und umgekehrt kann oft ein erschütternd-großes Gefühlserlebnis von dem bedeutenden Menschen kraft seiner eigenen rein menschlichen Bedeutung auch erfaßt, aufgenommen und dann als äußerst wertvoll empfunden werden; während ein weniger bedeutender Mensch die Größe und Seltenheit jenes Gefühles zuweilen gar nicht zu erkennen, damit überhaupt nicht zu erleben, also auch nicht zu „werten“ vermag. So erweist sich der Gefühls-Gehalt des Kunstwerkes als ein „absoluter“; der ästhetische Wert aber, der ihm von den verschiedenen Erlebenden zugesprochen wird, als durchaus „relativ“.
Dennoch stellt sich bei weiterer Betrachtung diese Relativität des ästhetischen Werturteiles als nicht so völlig „anarchisch“ heraus, wie es nach dem eben Erläuterten den Anschein hat. Denn die Menschen des gleichen Kulturkreises oder nicht zu weit entfernter Kulturkreise sammeln sich doch wieder auf Grund ähnlicher Erziehung, ähnlicher Einflüsse, ähnlicher Vorerlebnisse, kurz ähnlichen geographischen und geistigen Milieus in Gruppen, denen gleichsam vergleichbar-ähnlicher seelischer Vor-Besitz eignet. So wird das ästhetische Werturteil zum Gruppen-Urteil, das[S. 81] von enger oder weiter umzirkten Gemeinschaften in ähnlicher Gleichheit den Kunstwerken gegenüber gefällt wird, wie jene auch den Lebens-inhalten gegenüber gruppenmäßig ähnlich reagieren. Gleichwohl würde sich, wollte man immer in die letzten Feinheiten des „Persönlichen“ eindringen, auch immer wieder die unbedingte Relativität des ästhetischen Werturteiles feststellen lassen.
So liegt denn alles daran, den Glauben an die „Eine“, an die „absolute“ Schönheit in der Kunstentwicklung aufzugeben; und zu erkennen, daß es im Bewußtseinsleben des Menschen wenige Dinge gibt, die in so hohem Grade relativ sind, wie gerade diese „Schönheit“. Denn da das Kunstwerk ein „künstlicher Vermittler für Gefühle“ ist, sind so viele „Schönheiten“ denkbar und erlebbar, wie es eben für den Einzelnen oder für die Gemeinschaft wertvolle Gefühle gibt. Und mag selbst für den Einzelnen in der kurzen Dauer Einer Lebenszeit wirklich auch Ein Gefühl das bevorzugte bleiben — obzwar selbst Das bei der weitaus größten Zahl der Menschen nicht der Fall ist —, so muß doch allgemeine Betrachtung feststellen, daß innerhalb der verschiedenen Gruppen im Wechsel der Zeiten und Jahrhunderte eben dieses bevorzugte Gefühl andauernd seinen Charakter ändert. Gerade die psychologische „Stilgeschichte“ — die Geschichte des „beliebtesten“ Allgemeingefühles in einer begrenzten Zeitspanne — gründet ja hierauf ihre innere Berechtigung.
Auf Grund der Kenntnis dieses Stilwandels als Gefühlswechsels und damit des Formenwandels der „künstlichen Träger“ dieser Gefühle, eben der Kunstwerke — also durchaus a posteriori — war es ja auch erst möglich, in begrifflicher Formulierung des „idealen Prozesses“ die vier wesentlich verschiedenen Formausbildungen „theoretisch“ nachzukonstruieren; und damit die vier „überhaupt möglichen“ Gefühls-Klassen, also Stil-Arten, innerhalb der Künste gruppenmäßig fest zu umgrenzen. Und wir sind damit verpflichtet, unsere Erlebensbereitschaft im Laufe der Jahrhunderte in durchaus gleicher Weise den naturalistischen, den permutativen, den idealistischen und den expressionistischen Kunstformungen offen zu halten. —
Nun gibt es aber unter den hundertfach verschiedenen Möglichkeiten, zu den Inhalten dieser Welt und dieses Lebens Stellung zu nehmen, auch jenes Gegensatz-Paar, das die Dinge und Vorgänge dieses Daseins einmal als Gewordene und dann wieder als Werdende auffaßt.
Fassen wir die Kunstwerke, die wir überhaupt kennen, als Gewordene, als Fertige, als Bleibende auf, so müssen wir uns so einstellen und so entscheiden, wie wir es bisher getan haben. Vor den Augen der „Geschichte“[S. 82] sind die verschiedenen Stil-Ausformungen gleichberechtigt, wie sie die Orientierung der jeweiligen Gemeinschaft im Wechsel der Zeiten entstehen läßt und als gerade bevorzugte pflegt. Sowie wir also Kunst-Geschichte treiben oder sobald wir als Kunsthungrige hinter die Erlebnisse des gegenwärtigen Tages in die Vergangenheit zurückgehen, müssen wir die größte Beweglichkeit der Einstellung walten lassen und mit jenen Maßstäben messen, die die jeweiligen Zeiten im Wechsel der Generationen bereit halten und verteilen. Wer historischen Kunstwerken wirklich innerlich gerecht werden will, der muß eben imstande sein, gleichsam mit den verschiedenen Zeiten auch seinen persönlich-eigenwilligen individuellen Charakter zu ändern und jeweils zu verleugnen, was er vorher noch erstrebt und angebetet hatte.
Anders wird es aber, wenn wir uns nicht mehr auf die Kunstwerke als Gewordene, historisch Fertige einstellen, sondern wenn wir die werdende Kunst unserer eigenen Tage miterleben. Hier kann es natürlich nur Ein gerade erstrebtes Gefühl der Gemeinschaft, also nur Eine gerade gesuchte „Schönheit“ geben. Denn im ewigen Fluß der Entwicklung hat, vom Tage aus betrachtet, nur das jeweils eben Lebendige recht. So sehr also für alle historische Betrachtung die Erfahrung die Mutter der Weisheit, und weiteste Toleranz dann deren Tochter ist; so sehr darf dagegen kämpferische Einseitigkeit die „Kunstpolitik“ des Tages lenken und begleiten. Hier wird die seelische Einstellung aller derer, die den Sinn des Lebens in der Entwicklung sehen, die zu hemmen ein Verbrechen an eben diesem Sinn des Lebens ist, keineswegs jene Toleranz betätigen dürfen, die der reife Stolz des Erfahrenen ist. Sondern gegen jeden Versuch jener klebend Konservativen, jener geistig Trägen, die immer wieder gerade mit ihrer Generation den Gipfel und höchsten Entwicklungspunkt erreicht zu haben glauben und behaupten — und deren Hemmungs-Gewalten ja doch niemals diese Weiterentwicklung aufzuhalten vermögen, sondern immer wieder nur zu lebenzerstörenden gewaltsamen Revolutionen führen — muß das gesunde Lebendige das Recht des Tages immer wieder fordern und erkämpfen. Kampf aber bedingt Einseitigkeit, fixierende Isolierung Eines Zieles, Beschränkung aus der Relativität auf Eine postulierte „Absolutheit“. Und so werden wir von dieser Einstellung auf Werdendes des Tages aus sagen müssen: mögen auch mehrere Kunstarten historisch und psychologisch möglich und wirklich und berechtigt sein: für die eben lebende Generation ist immer nur Eine die Einzige zu Erstrebende, die Einzige zu Erkämpfende, ist Eine die Absolute.
Fragt man nun, welche dies aber für uns heute lebende Menschen wäre, so kann die Antwort kaum zweifelhaft sein.
[S. 83]
Nach zwei Generationen naturalistischer Kunstübung seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts ist unser Erleben gegen naturalistische Gefühle völlig abgestumpft. Wir haben so viel dieses „Gutes“ aufgenommen und im Besitze, daß seine „Wertschätzung“ fast schon in Ablehnung umgeschlagen ist. Weitere Pflege der naturalistischen Kunstübung scheint also nach der seelischen „Grenznutzentheorie“ völlig ausgeschlossen. — Die idealistische Gestaltungsgepflogenheit dagegen scheint wieder von anderer Seite her völlig unmöglich. Die deutsche bildende Kunst ist von der Renaissancezeit an bis weit in die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts hinein, also seit mehr als dreihundert Jahren, durch die falsche, weil völlig milieu-ungemäße Einstellung auf idealistisch-klassizistische Gestaltungsgepflogenheit so völlig verödet worden, dem rückschauenden Blick bietet sich hier ein so gräßliches Trümmerfeld vergeblichen Bemühens, gescheiterter Existenzen, verwüsteter Gesinnung, daß es völlig unmöglich scheint, einen idealistischen Stil für die kommende Generation zu erwarten, auch nur zu wünschen. — So bleibt die expressionistische Gestaltungsgepflogenheit als die letzte, die einzige übrig. Mag sie heute noch im Sturm der Zeugung unreife Formen gebären, wankende Gebilde erstellen, die Wege nach vorerst noch schiefen oder falschen Richtungen roden, in Kubismus und Futurismus selbst in zukunftslosen Sackgassen sich festrennen: die Richtung ist gewiesen, das Ziel gestellt und gegeben: in aktiver Auswirkung des Gefühles zur Intensivierung der Naturformen zu schreiten, die Natur zu überrufen, Kraft zu bauen, Symphonien tönen zu lassen, Dramen zu errichten, Bildkomplexe zu erstellen, die die Naturgebilde nur als Sockel für den stärksten Schwung in höchste Phantasiebereiche nutzen.
Einige Formulierungen und Bildanalysen dieser Schrift hat der Verfasser seinem größeren Werke „Die Malerei im neunzehnten Jahrhundert“ entnommen, das im Herbst 1919 im Verlage von Paul Cassirer in Berlin erschienen ist.
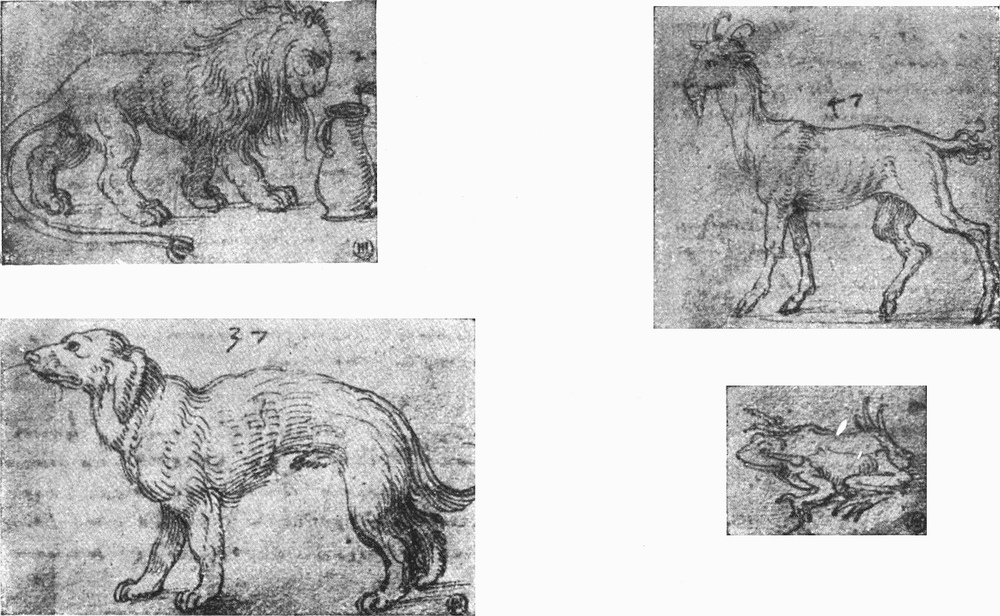
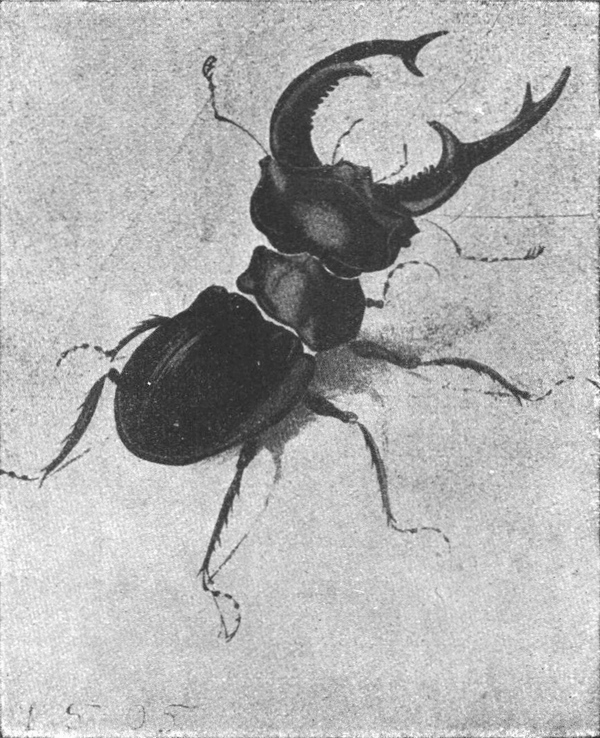
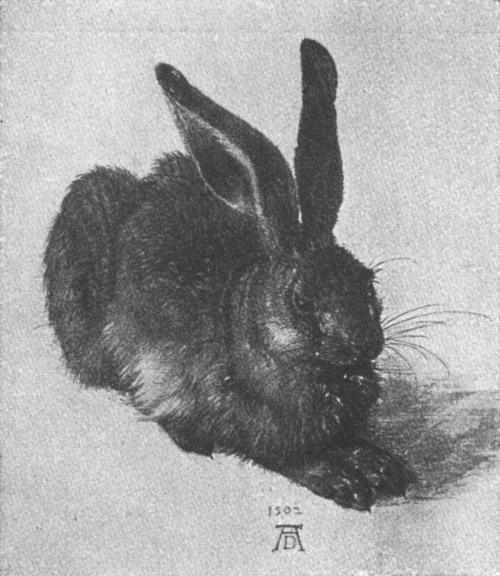


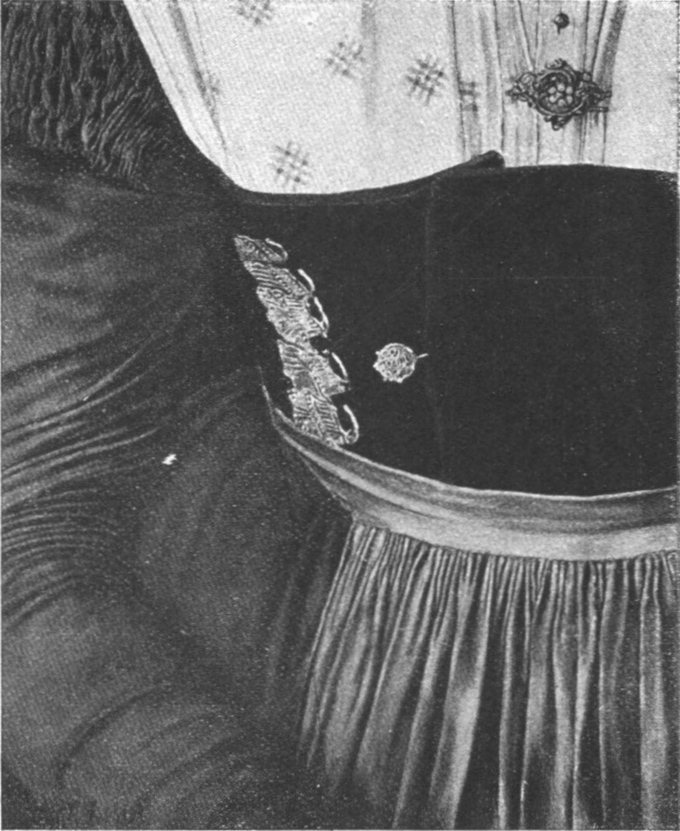








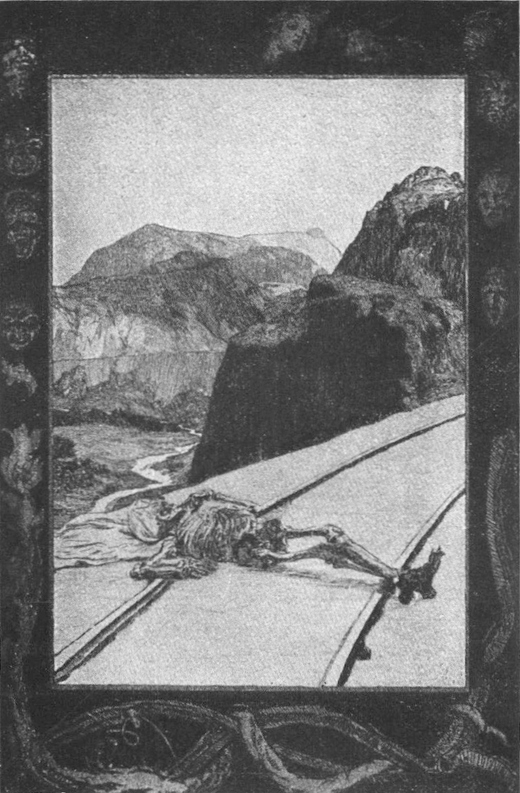


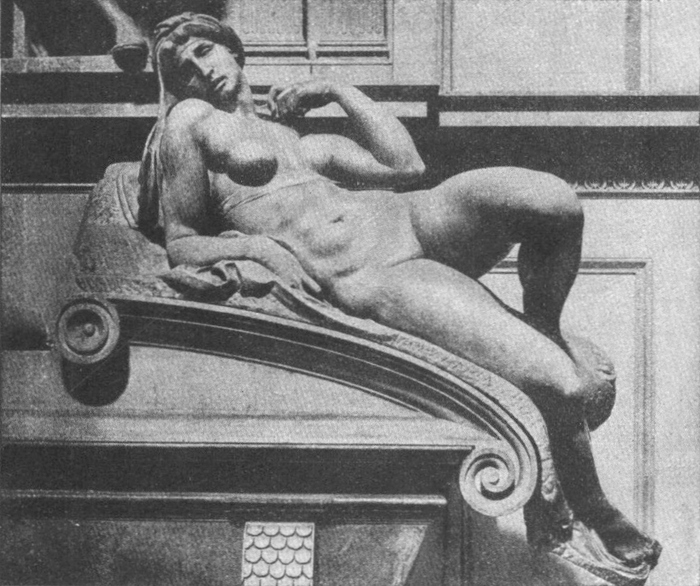







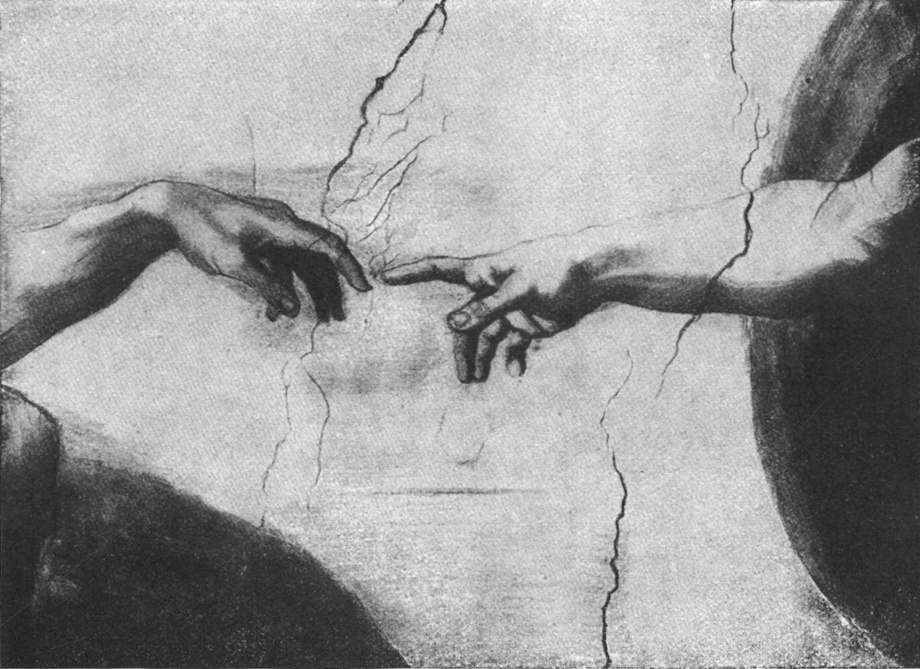
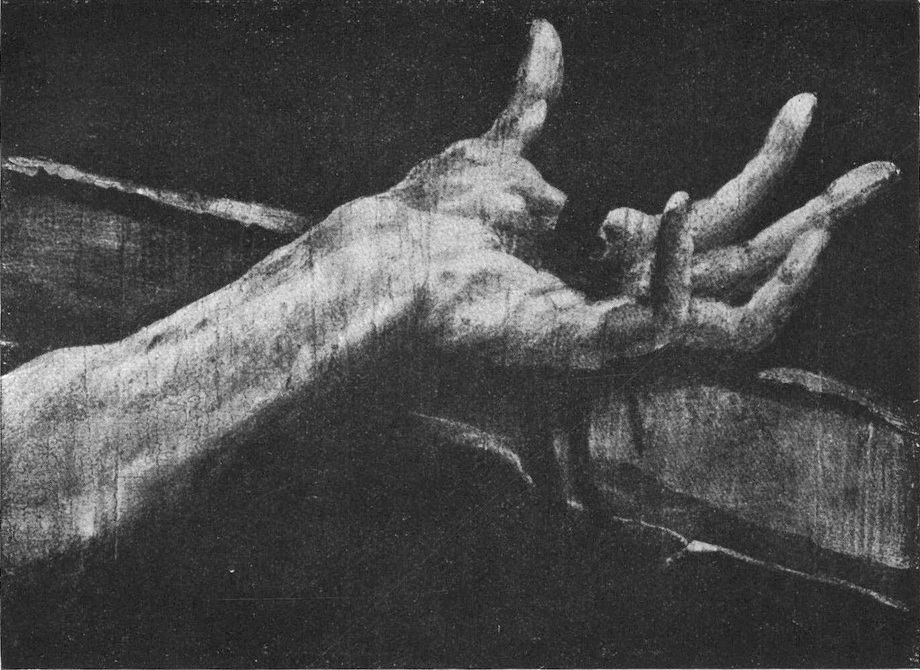






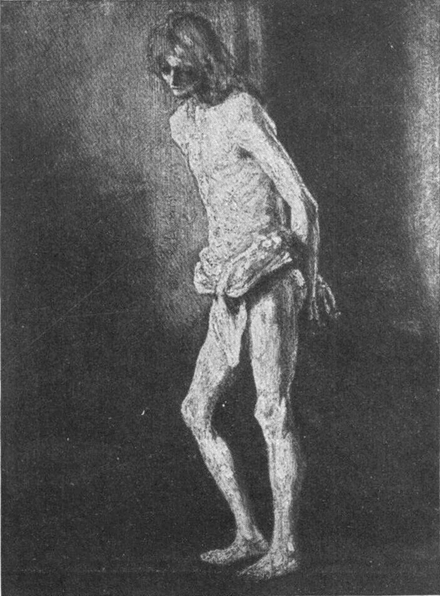
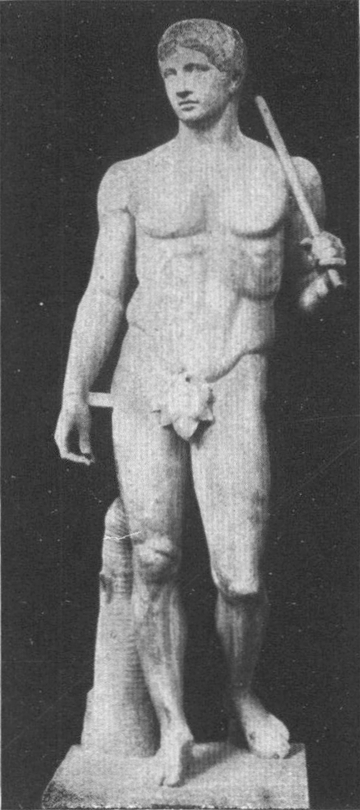

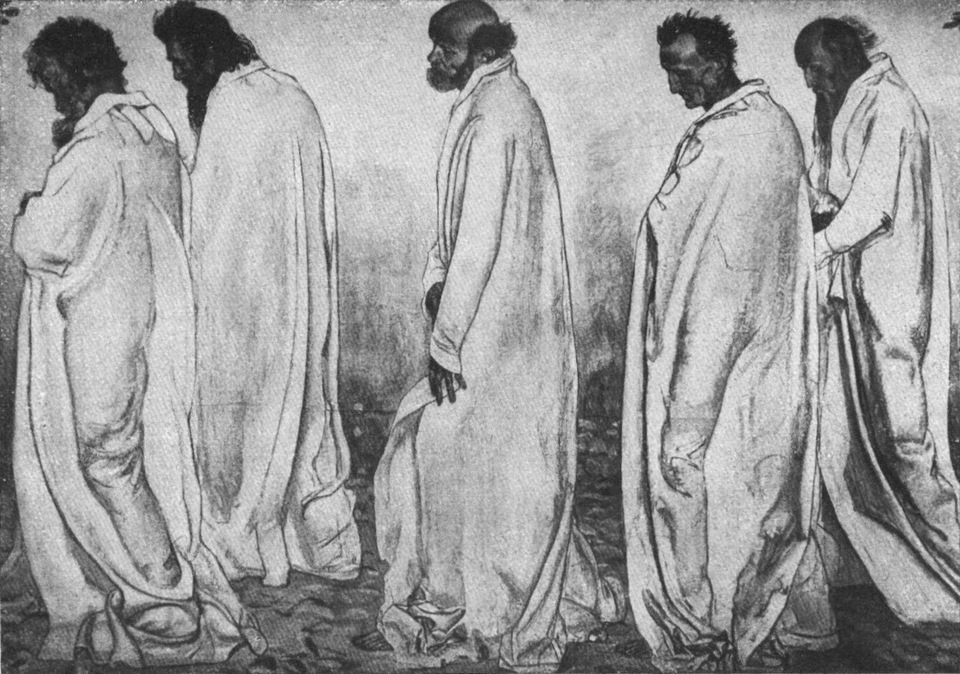


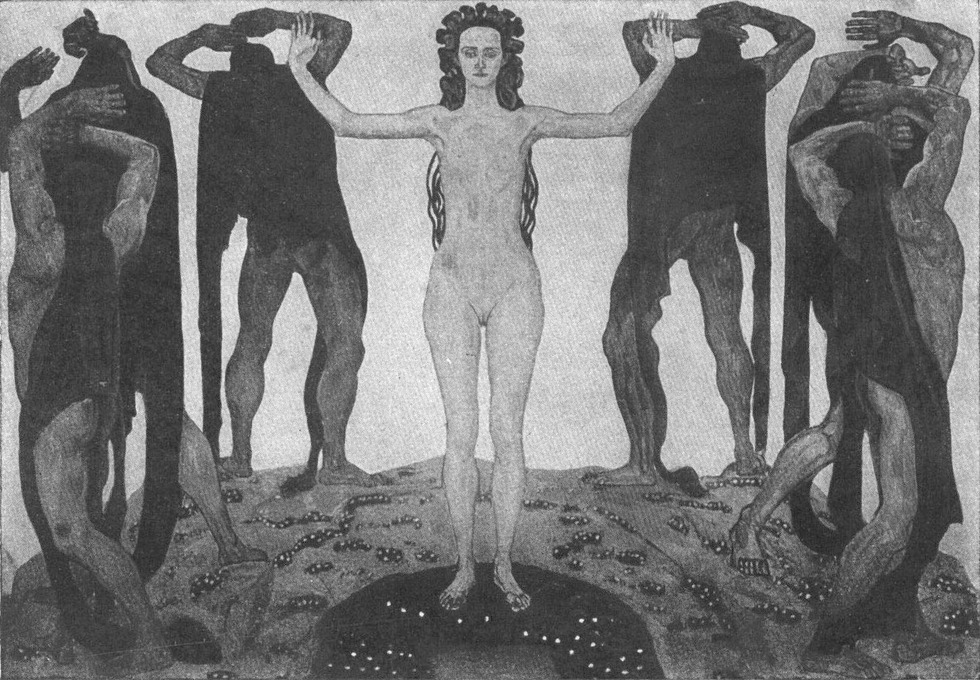


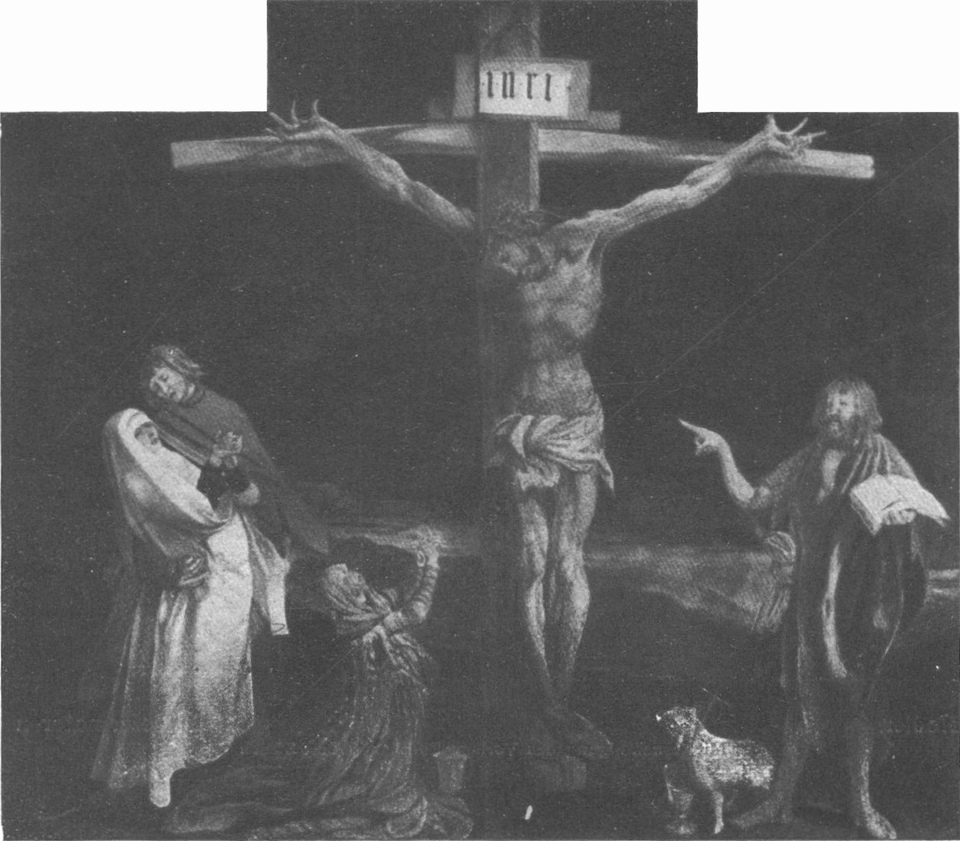





DRUCK VON ERNST HEDRICH
NACHF., G. M. B. H., LEIPZIG