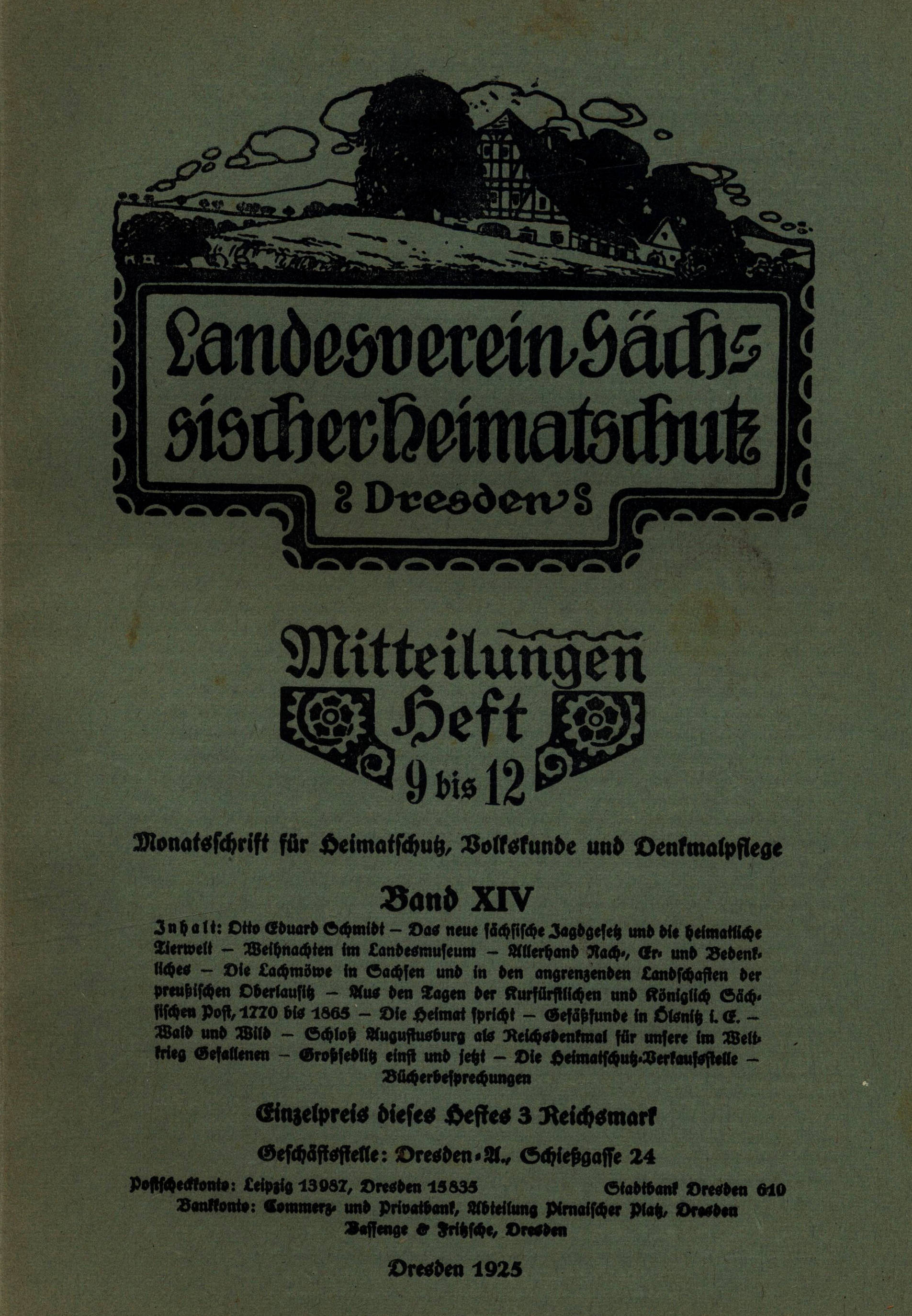
Title: Landesverein Sächsischer Heimatschutz — Mitteilungen Band XIV, Heft 9-12
Monatsschrift für Heimatschutz, Volkskunde und Denkmalpflege
Editor: Landesverein Sächsischer Heimatschutz
Release date: November 3, 2024 [eBook #74668]
Language: German
Original publication: Dresden: Landesverein Sächsischer Heimatschutz, 1925
Credits: The Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net
Anmerkungen zur Transkription
Das Original ist in Fraktur gesetzt. Im Original gesperrter Text ist so ausgezeichnet. Im Original in Antiqua gesetzter Text ist so markiert.
Weitere Anmerkungen zur Transkription befinden sich am Ende des Buches.
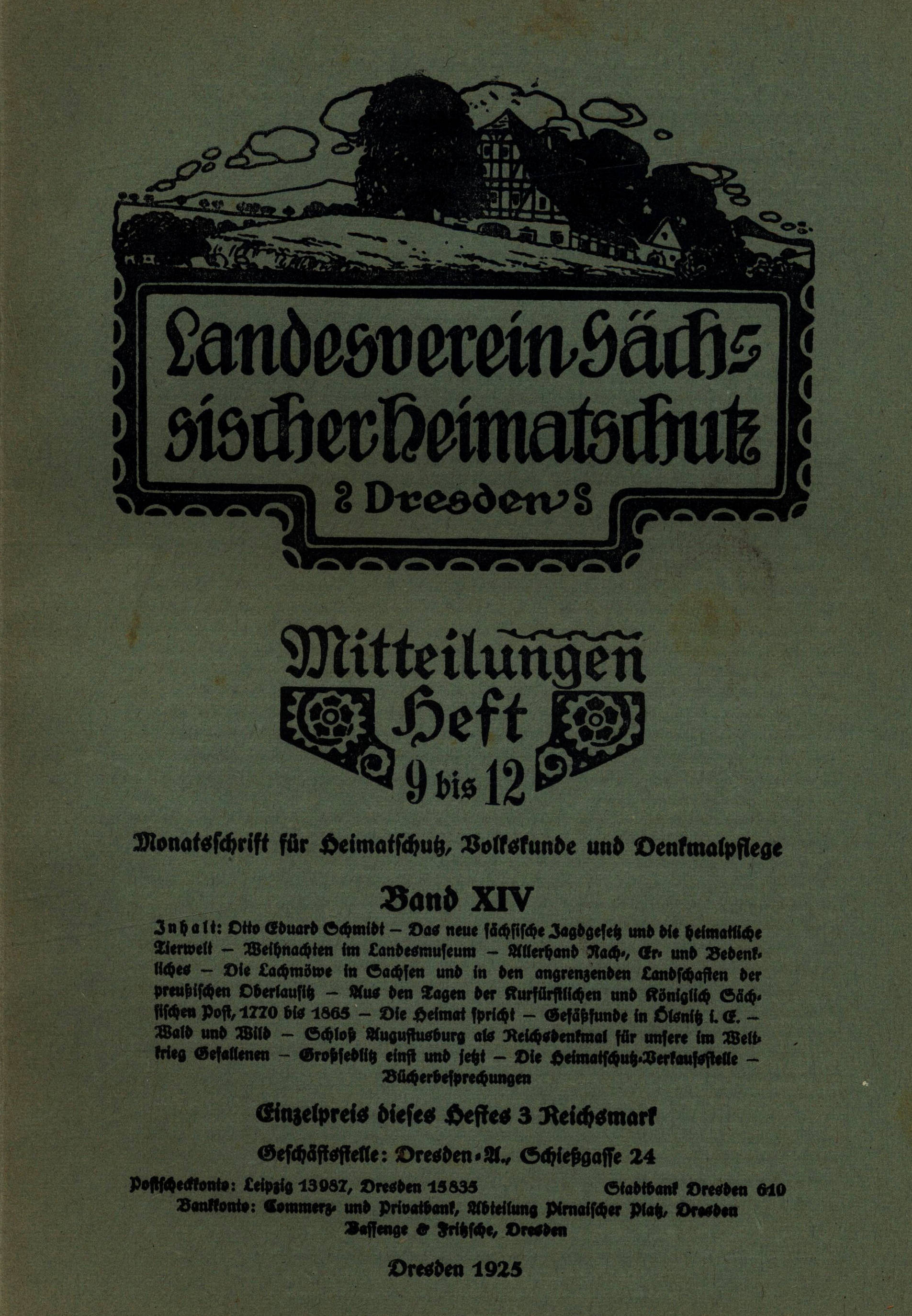
Landesverein Sächsischer
Heimatschutz
Dresden
Monatsschrift für Heimatschutz, Volkskunde und Denkmalpflege
Band XIV
Inhalt: Otto Eduard Schmidt – Das neue sächsische Jagdgesetz und die heimatliche Tierwelt – Weihnachten im Landesmuseum – Allerhand Nach-, Er- und Bedenkliches – Die Lachmöwe in Sachsen und in den angrenzenden Landschaften der preußischen Oberlausitz – Aus den Tagen der Kurfürstlichen und Königlich Sächsischen Post, 1770 bis 1865 – Die Heimat spricht – Gefäßfunde in Ölsnitz i. E. – Wald und Wild – Schloß Augustusburg als Reichsdenkmal für unsere im Weltkrieg Gefallenen – Großsedlitz einst und jetzt – Die Heimatschutz-Verkaufsstelle – Bücherbesprechungen
Einzelpreis dieses Heftes 3 Reichsmark
Geschäftsstelle: Dresden-A., Schießgasse 24
Bankkonto: Commerz- und Privatbank, Abteilung Pirnaischer Platz, Dresden
Bassenge & Fritzsche, Dresden
Dresden 1925
In den Jahren nach der bösen Zeit hat uns der Büchermarkt zahlreiche Neuerscheinungen gebracht und das Eine muß gesagt werden, wenn wir den Durchschnitt daraus ziehen: Es ist erstaunlich aufwärts gegangen! Die Zeit hat selbst Auslese gehalten. Die Besten unseres Volkes haben sich abgewandt vom seichten Lesestoff früherer Zeit, der gar oft nur süßlicher Tand war und den fühlenden Menschen nicht befriedigen konnte. Für sie ist ein neues besseres Buch zum Bedürfnis geworden, ein Buch, dessen Inhalt, ob ernst oder heiter, zum tiefen Erlebnis wird, und für die Menschen, die mit beiden Füßen fest auf der Heimaterde stehen, ein Buch, das die tief im Herzen wohnende Sehnsucht nach den Schönheiten und Wundern der Heimat stillt.
Wir Sachsen können uns glücklich schätzen, daß uns in den letzten Jahren eine kleine abgerundete Sammlung solcher trefflicher Bücher beschert wurde, die sechs Bände der Bücherei des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz. Liebe zur Heimatschönheit, Freude an der wundersamen Heimatnatur und Treue zur angestammten Scholle hat diese »Bücher des sächsischen Heimatfreundes« entstehen lassen. Heimatliebe und Heimatfreude wollen sie pflegen und bei denen wecken, die es verlernt oder nie gekannt haben, sehenden Auges durch die Heimat zu wandern, sich einzufühlen in ihre Schönheit, den tausendfältigen Stimmen zu lauschen, die die heimatliche Natur durchklingen, neue Hoffnung zu schöpfen aus den Denkmälern und Stätten der tausendjährigen Geschichte unseres Vaterlandes.
Die Bücher sind nicht dazu geeignet, in einem Zuge heruntergelesen zu werden wie Romane. Gar oft hebt sich unser Blick von den Zeilen und wir schauen traumverloren hinaus in die Ferne und sehen mit geistigem Auge die Heimatschönheiten vor uns erstehen, wie die Verfasser sie erschauten.
Dann wandern wir im Geiste mit Gerhard Platz durch die sonnenüberflutete Landschaft und im Morgennebel auf Weidmannspfaden durch den Erzgebirgswald oder weilen mit ihm im Kreise schlichter, glücklicher Menschen.
Wir sehen unser Land und Volk mit den Märchenaugen Max Zeibigs. Was uns Meister Ludwig Richter im Bilde an Erbaulichem und Beschaulichem beschert hat, das weiß Zeibig aus tief empfindendem Herzen in Worten zu schildern.
Bei Hahnewalds Sächsischen Landschaften packt uns die Wandersehnsucht und reißt uns mit zu froher, rascher Fahrt durchs Heimatland, heißt doch sein Leitwort »Sehne dich und wandere.«
Gustav Rieß läßt das alte silberschwere Freiberg und das von Bergmannsromantik durchklungene Freiberger Land vor uns erstehen und offenbart uns die Seele einer verklungenen Zeit mit ihren Freuden und Leiden.
Und Martin Braeß, dem Freunde der Tiere, wie trefflich gelingt es ihm, uns unsern Brüdern im stillen Busch, in Luft und Wasser nahe zu bringen, daß wir mit ihnen fühlen, in ihnen unsere Mitgeschöpfe sehen lernen.
Unerschöpflich ist der Reichtum an Schönheiten, der in den trefflichen Büchern ruht. Lies sie selbst und schaffe dir Stunden reinsten und edelsten Genusses, verschenke sie und mache anderen eine dauernde Freude; die Bücher lassen den fühlenden Menschen nicht los und wollen immer wieder gelesen sein. Auf jedem Weihnachtstische sollten sie darum liegen
die Bücher des sächsischen Heimatfreundes!
Preis je 4 M. Zu haben im Heimatschutz, Dresden-A., Schießgasse 24
Bestellkarte in diesem Hefte
[321]

Die Mitteilungen des Vereins werden in Bänden zu 12 Nummern herausgegeben
Abgeschlossen am 30. September 1925
Der deutsche Touristendampfer liegt im grünen Hafen Spitzbergens vor Anker. Seine Fahrgäste kommen eben in langer Bootsreihe von einem Ausfluge zurück. Da löst sich von der Funkenstation ein Motorboot und fährt den Heimkehrenden entgegen. Zwei junge Leute sind darin, die sich mit lautem Zuruf als Deutsche vorstellen. Sie bekunden ihre Freude über diese Begegnung mit Landsleuten so geräuschvoll und übermütig, daß es dem feiner Empfindenden beinahe etwas weh tut, daß er meint, einen tragischen Unterton heraushören zu müssen. Handelt es sich hier vielleicht um das Erlebnis, das in besonderem Sinne gerade für den Deutschen in Anspruch genommen werden muß; um das Erlebnis des verlorenen Sohnes, der erst in der Fremde merkt, was die Heimat für ihn bedeutet? Wir Deutsche sind im ganzen noch immer nicht so weit, daß wir Volk und Vaterland unmittelbar als ersten Wert unseres Weltbürgertums erfaßten. Wir haben die Männer bitter nötig, die uns auf dem strengen Wege des Beobachtens und Erkennens zur rechten Liebe und Begeisterung für unser Volkstum emporführen. Einem von ihnen aus warmem Herzen für solche Arbeit zu danken, die er auf den verschiedensten Gebieten[322] seines öffentlichen Wirkens, auch als treuer Mitarbeiter dieser Zeitschrift getan hat, gibt uns sein siebzigster Geburtstag die ersehnte Gelegenheit. Wir wollen versuchen, seine Art und seine Tat mit bescheidenem Worte zu erfassen.
Otto Eduard Schmidt ist ein Sohn des Vogtlands. Am 21. August 1855 wurde er in Reichenbach als Sohn des Kantors der Stadt geboren. Sich selbst zu verstehen aus dem Zusammenhang mit der Familie und mit der Landschaft, in die sie ihre Wurzeln geschlagen hatte, ist ihm immer ein wichtiges und fruchtbares Unternehmen gewesen. Er hat der Parole: Kümmere dich um die Geschichte deiner Familie, nachgehandelt, noch ehe sie ein so erfreuliches Echo gefunden hatte, wie das jetzt besonders auch in dem jüngeren Geschlecht geschehen ist. Wir hörten neulich einen berühmten Hygieniker sagen, der Mensch könne in seinem Leben das Schwerste ertragen, der eine glückliche Kindheit gehabt habe. O. E. Schmidt ist eine solche Kindheit beschieden gewesen, und er hat sie nicht nur als Erinnerungsstoff zu reizvoller Erzählung gestaltet, aus ihr hat er auch immer richtige Kräfte geschöpft, wie sie das Leben zu meistern vermögen. Dem Unterrichte des eigenen Vaters, der Realschule seiner Vaterstadt, die damals gerade im ersten Aufblühen war, dankt er die feste Grundlage seiner weiteren Ausbildung. Auf ihr konnte die Kreuzschule in Dresden den gymnasialen Abschluß in einer kürzeren Reihe von Jahren aufbauen, als ursprünglich möglich schien. Der »arme Kantorsgung«, dessen schmalen Geldbeutel die Fabrikantensöhne von Reichenbach bespöttelten, ist zu einem Manne geworden, der aus dem Schatz seines Geistes und Gemüts viele reich gemacht hat. Aber auch äußerlich hat sein Leben einen bedeutsamen Aufstieg zu Führung und Geltung gewonnen. Aus dem philologischen und historischen Studium an der Universität Leipzig erwuchs eine Doktordissertation, die der Professor Ludwig Lange angeregt, und mit der er dem jungen Gelehrten den Weg in eine zwanzigjährige wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Todeskampfe der römischen Republik gewiesen hatte. Aus diesem Studium erwuchs ein Staatsexamen, das O. E. Schmidt den Zugang zum höheren Schuldienst Sachsens öffnete. Es liegt uns daran, diese Seite seiner Lebensarbeit zu betonen, damit sie ja nicht hinter der schriftstellerischen zurücktritt. Er hat es eben fertiggebracht, als Lehrer und Schulleiter ganz seinen Mann zu stellen und zugleich in unbeirrbarem Fleiß und unbeugsamer Willenskraft den Weg des Forschers und Volkserziehers zu verfolgen. Vier Stätten teilen sich in seine amtliche Wirksamkeit. Das Staatsgymnasium in Dresden-Neustadt, das für ihn wie für manchen anderen immer mit dem Zauber der ersten Liebe zum Beruf umwoben blieb. Die Fürstenschule zu St. Afra in Meißen, in deren Lebensbereich zu gehören bei Lehrern wie Schülern gesunderweise immer ein gewisses Hochgefühl weckt. Das Wurzener Gymnasium und das Albertinum in Freiberg hat er dann als Rektor geleitet. Schon dieser Anstieg zeigt, daß ihm die Anerkennung der obersten Schulverwaltung nicht gefehlt hat. Aber auch die unüberbietbar köstliche Frucht schulmeisterlichen Strebens ist ihm gereift, die dankbare Treue der Mitarbeiter und der Schüler. In Grubes biographischen Miniaturbildern, deren achte Auflage O. E. Schmidt bearbeitet hat, erzählt er in einer der[323] fünfundzwanzig von ihm neu geschaffenen Lebensbeschreibungen von dem Renaissance-Pädagogen Vittorino da Feltre. Wenn da vom Lehrer die doppelte Kunst des Belehrens und Erziehens verlangt, wenn die körperliche Ausbildung als wichtig neben die geistige gestellt, wenn die Freude des Lehrers am fröhlichen Spiel der Jungen geschildert wird, wenn wir den Erzieher bemüht sehen, Schädlinge von ihnen fern zu halten, einfache Sitten und fromme Beugung unter den Willen Gottes zum tragenden Gerüst ihres Lebens zu machen, dann sind das wohl Erziehungsgrundsätze, die dem Erzähler bei seinem eigenen Lehrerwirken den Weg gewiesen haben.
Über die Grenzen dieser Dienste, die dem sächsischen Schulwesen geleistet sind, gehen die Wirkungen hinaus, die O. E. Schmidt mit seinen Büchern hervorgerufen hat. Als der kursächsische Streifzügler ist er wohl dem deutschen Lesepublikum am vertrautesten geworden. Wir bilden diesen Ausdruck, um einen doppelten Irrtum zurückzuweisen, der entstehen könnte. Er klingt an die Streifkorps und Nachzügler an, die in wilden Kriegszeiten das Land durchschwärmen; die fahren daher und nehmen, was sie erwischen können, und im nächsten Augenblick sind sie flüchtig davon. Nichts von solcher rauhen, oberflächlichen, effekthaschenden Art, wie sie durch den kriegerischen Vergleich etwa anschaulich wird, ist der Schriftstellerei O. E. Schmidts eigen. Und ihr Stoffgebiet ist weiter als das Gebiet von Kursachsen. Das hohe Lied der Heimat ist eine Blüte am Baum seines Schaffens, sie fällt vielen ins Auge und wird von vielen genossen. Aber wir dürfen Stamm und Wurzel nicht vergessen, die ihr erst die Möglichkeit zum Aufblühen gaben.
Äußerlich angesehen scheiden sich O. E. Schmidts Schriften in zwei Gruppen. Da ist einmal, was er über die römische Antike, besonders über Cicero und seine Zeit, und dann, was er zur Geschichte und Landeskunde Sachsens und früherer sächsischer Gebiete geschrieben hat. Etwa bis 1900 steht das Altertum im Brennpunkt seiner Studien. In eindringender Kleinarbeit sucht er den richtigen Wortlaut der Briefe Ciceros und die Zeit ihrer Abfassung festzustellen. So schafft er aus Hunderten von wissenschaftlich gesicherten Einzelbelegen den Grund, auf dem er dann ein lebendiges Bild von der Persönlichkeit Ciceros im Rahmen der Kulturentwicklung, in die es hineingehört, aufrichten kann. Das geschieht in dem Hauptwerk dieser ersten schöpferischen Periode »Der Briefwechsel des Marcus Tullius Cicero, von seinem Proconsulat in Cilicien bis zur Ermordung Caesars«. O. E. Schmidt hat sich darüber freuen dürfen, daß die Bewertung Ciceros, und überhaupt die Forschungen, die in diesem Buche niedergelegt sind, immer allgemeiner von der Wissenschaft angenommen und noch zuletzt von Eduard Meyer in seinem Werke über Caesar und die Begründung der Monarchie als grundlegend anerkannt worden sind. Wir sehen übrigens den Deuter der ciceronianischen Zeit zur ersten Liebe seiner wissenschaftlichen Arbeiten zurückkehren. Seit ihm 1919 die Pflichten seines Amtes abgebürdet worden sind – von einem Ruhestand kann bei O. E. Schmidt wirklich nicht die Rede sein – hat er eine durchgreifende Neubearbeitung von Wägners Rom vollendet. Schon mit der neunten Auflage von 1912 hatte er dieses Buch zu[324] seiner Gesamtdarstellung der römischen Geschichte umgestaltet; eine andere, noch ausführlichere, liegt in dem zweiten Bande von Spamers Weltgeschichte vor.
Zwischen diesem ersten Frühling aber und seinem Johannistrieb im siebenten Jahrzehnt keimt eine neue große Liebe auf. Seit der Jahrhundertwende verblaßt die heroische Linie der Landschaft Mittelitaliens und die kürzere, anmutigere Linie mitteldeutscher Gegend prägt sich schärfer aus. 1902 erscheint der erste Band der kursächsischen Streifzüge. Ihm sind vier andere gefolgt, die heute wohl fast alle in bereicherter Auflage vorliegen. Und auch die andere schriftstellerische Tätigkeit O. E. Schmidts, ob sie nun in großen Werken wissenschaftlicher Art oder in Büchern und Aufsätzen für den deutschen Leser Gestalt gewinnt, wendet sich der Heimat zu. Es ist uns nicht bekannt, was für ein äußerer Anstoß etwa diese neue Wendung ausgelöst haben mag. Nach ihrem inneren Gesetz erscheint sie uns aber als eine notwendige Folge aus der Anlage des Autors. Ein Mann, dem es gegeben ist, Leben zu erschauen und zu erfassen, der den Trieb spürt, die geschichtlichen Wurzeln dieses Lebens bloßzulegen, muß schließlich einmal auf das Leben stoßen, das ihm äußerlich und innerlich am nächsten ist, auf das Leben der Heimat. Dabei darf dies nicht vergessen werden: Heute ist die Heimatschriftstellerei die große Mode, auch Wanderberichte und Reiseeindrücke sehr bescheidener Art werden von ihrer Welle ins Publikum getragen; O. E. Schmidt hatte seinerzeit mit Staunen und Befremden zu kämpfen, er mußte die Leser erst erziehen für die gute Kost, die er ihnen brachte.
Es kann nicht unsere Aufgabe sein, das reiche Schrifttum dieser zweiten Schaffensperiode ebensowenig wie das der ersten in seinem ganzen Umfange zu würdigen. Für beides fehlt uns Sachkenntnis und Raum. Wir können nur versuchen, ein paar Züge hervorzuheben, die ihm gemeinsam und eigentümlich zu sein scheinen.
Hinter der Darstellung steht bei O. E. Schmidt immer ein gründliches Studium und eine sorgfältige Bewertung der Quellen. In der philologischen Arbeit an dem antiken Stoff hat er sich diese strenge Arbeitsweise angeeignet. Aber er bleibt nie im Kleinen und Einzelnen stecken. Er hat die Gabe entfaltet, in die vergangene Zeit sich so einzuleben, daß er sie auch anderen lebendig machen kann. Man lese etwa das Werk »Minister Graf Brühl und Karl Heinrich von Heinecken«, das als Band XXV unter den Schriften der Sächsischen Kommission für Geschichte 1921 herausgekommen ist. Da lernen wir sie alle kennen, die Helfershelfer des Verbrechers auf dem Ministersessel, vom Kammerherrn bis zum Kammerdiener, und seine Gegner, vom König bis zum Oberhofprediger. Gelegentlich muß der Herausgeber zu einem der Namen, die in den abgedruckten Briefen vorkommen, Anmerkungen machen wie diese: »Die Person des Professors Richter konnte ich nicht näher bestimmen.« Dann sehen wir zwischen diesen Worten ordentlich ein Schweißtröpfchen glänzen, das von der angewandten Mühe erzählt, und hören einen leisen Seufzer darüber, daß sie vergeblich gewesen ist. Bei all dieser Genauigkeit im einzelnen gibt doch das ganze Buch ein Bild von dem todkranken Rokoko, wie es nicht anschaulicher gedacht[325] werden kann. Auch auf die kursächsischen Streifzüge hat ihr Verfasser nicht ein beliebiges Reisehandbuch zu gelegentlichem Nachschlagen mitgenommen, sondern das ganze Rüstzeug der Urkundenkenntnis für die Geschichte, die der durchwanderten Landschaft ihre Spuren aufgeprägt hat. Wir erinnern uns an die Jahre, wo wir in Dresden freundnachbarlich mit O. E. Schmidt verkehrten, der bereits nach Meißen übergesiedelt war. An einem bestimmten Wochentage konnte man ihn stets in der Hauptstadt treffen, denn da kam er trotz aller Belastung mit den Schulpflichten herüber, um im Staatsarchiv zu arbeiten. Den Leser, dem nun die aus solchen Mühen entstandenen Schriften so leicht und angenehm eingehen, möchte man doch auch daran erinnern, daß O. E. Schmidt nicht eigentlich eine sogenannte flüssige Feder hat, daß er vielmehr auch an die Formgebung seiner Gedanken viel feilende Sorgfalt wenden muß. Das Ziel seiner forschenden Teilnahme sind Männer, deren Charakterbild in der Geschichte schwankt. Ihnen zu einer gerechteren Beurteilung bei der Nachwelt zu verhelfen, gewisse eingewurzelte Vorurteile der Geschichtsbetrachtung zu zerstreuen, ist ihm ein wichtiges Anliegen. Wir denken etwa an die Rettungen, die für Lessings Berliner Schriftstellerei kennzeichnend sind. Als O. E. Schmidt über Cicero zu schreiben begann, herrschte das Urteil Mommsens über den Arpinaten. Er durfte seinen Helden aus diesem Schatten heraus in ein günstigeres Licht rücken. In dem Buche »Fouqué, Apel, Miltitz, Beiträge zur Geschichte der deutschen Romantik«, wird einmal Fouqués Dichterruhm gegen mancherlei Verkennung sichergestellt und dann wird an dem Scharfenberger Kreis gezeigt, daß auch in dem weichen Klima der Romantik Männer ihren Wirklichkeitssinn und ihre Tatkraft sich bewahren konnten. Auch eine geschichtliche Gestalt, wie der Minister Brühl, ist nicht einfach mit einem Freispruch oder einer Verurteilung abgetan. O. E. Schmidt läßt seine falsche Politik und den Mißbrauch, den er mit seiner Amtsgewalt und mit dem Vertrauen seines Fürsten getrieben hat, scharf hervortreten, aber läßt uns doch auch in der ästhetischen Kraft seiner Prachtliebe und in seiner wirtschaftlichen Erfindungsgabe eine gewisse Genialität ahnen. Auf der anderen Seite sehen wir den großen Gegner Brühls, Friedrich II., im berechtigten Kampfe gegen das unbequeme Sachsen doch auch so kleine Mittel nicht verschmähen, wie es der Eingriff in den Privatbesitz des Ministers eines ist. In einer anderen Veröffentlichung der Sächsischen Kommission für Geschichte, sie heißt: »Aus der Zeit der Freiheitskriege und des Wiener Kongresses. Siebenundachtzig ungedruckte Briefe und Urkunden aus sächsischen Adelsarchiven«, verteidigt O. E. Schmidt Sachsen gegen den Vorwurf, daß es 1813 auf der falschen Seite gestanden habe. Er macht uns eine Reihe führender Männer bekannt, die mit Kraft und Wirkung den vaterländischen Gedanken des Befreiungskampfes in Sachsen vertreten haben. Daß sie damit nicht zur rechten Zeit durchdrangen, daß sie dann die drohende Zerstückelung Sachsens nicht verhindern konnten, war nicht ihre Schuld. Was er anderen anschaulich machen will, das sieht er sich nach Möglichkeit mit eigenen Augen an. Er weiß, daß die Vergangenheit nicht nur auf Urkunden von Pergament[326] und von Papier sich niedergeschlagen hat, daß vielmehr fernes Leben in Mauerwerk und Stein, in alten Sitten und Bräuchen, in Werken der Kunst und in der Sprache aufzuspüren ist. Vor allem hat es sich ihm als fruchtbar erwiesen, einen Menschen zu verstehen, zu erklären aus dem Gehäuse, das er seinem Dasein gab. Darum ging er nach Italien und suchte die Stätten auf, wo Ciceros Villen standen; so wurde ihm der Briefschreiber lebendig, der im Tablinum dieser Villen gesonnen und geschrieben hatte. Wir freuen uns mit dem rüstigen Siebziger, daß nun die Schranken böser Zeiten gefallen und der Weg zu neuen Südlandsfahrten offen steht. Die Wurzeln dieser schönen Rüstigkeit, der ungetrübten Wanderfreude auch im Alter, liegen doch darin, daß er den Wandertrieb, der schon im Knaben fröhlich aufwachte, so folgerichtig durch ein ganzes Leben gepflegt hat. Was hier ein Handwerksbrauch, dort ein Mittel der Entspannung, was gesellschaftliche Veranstaltung, was Mode, Parteisymbol sogar geworden ist, das Wandern, er hat es zur Kunst entfaltet. Er ist ein Mann, der suchen kann, der aber auch zu finden versteht; ein Mann, der sehen kann, aber auch anderen die Augen zu öffnen vermag. Gewiß reden die Steine; es ist aber doch reizvoller und förderlicher, wenn O. E. Schmidt neben das alte, schöne Tor, neben den zerfallenen Turm tritt und ihre Sprache deutet. Wir hätten den einzigartigen Blick auf Dom und Albrechtsburg nie genossen, wenn er uns nicht zu dem Bodenfenster seiner Meißner Amtswohnung hinaufgeführt hätte, von dem aus sich der Blick erschloß. Was haben seine Wandergefährten für Erquickung und Gewinn gehabt, was auch der gelegentliche Besucher, den er nach ernstem Gespräche durch eine der Mittelstädte seines amtlichen Wirkens führte – sie hat im Bädeker keinen Stern – ihm durch Anschauung alter Baudenkmäler neue Erkenntnisse aufschloß und das Gleichgewicht seines Gemüts zurückgab. Immer hat der kursächsische Wandersmann auch den Leuten aufs Maul gesehen. Aus ihrer Sprache hat er das Wesen der deutschen Stämme, denen seine besondere Aufmerksamkeit galt, und ihre Geschichte aufgeleuchtet. Seine Ausführungen über die sächsischen Dialekte sind ein wirksames Mittel gegen die Vergiftung, die gewisse Dialektdichtungen im Bliemchenstil bei den anderen deutschen Stämmen hervorgerufen haben; eine Vergiftung des Gemüts, die mit einem mitleidig-verächtlichen Lächeln auf alles Sächsische glaubt reagieren zu dürfen.
Die Stärke O. E. Schmidts liegt nicht in der beweisenden Gedankenführung, in der Zusammenfassung philosophischer Höhenschau. Ihm kommt es immer auf das Anschauen des Lebens und seine getreue Wiedergabe im schriftstellerischen Bild an. Wir begreifen, wie stark das deutsche Schicksal der Jahre 1914/18 auf ihn wirken mußte. Dazu kam der Auftrag des sächsischen Königs, die Taten der Sachsen im Weltkriege zu schildern. Dieses Unternehmen vorzubereiten, ist er dreimal zu längerem Aufenthalt an die Front geschickt worden. Ein weitschichtiger Briefwechsel mit Kriegsteilnehmern und persönlicher Gedankenaustausch mit den militärischen Führern hat sich angeschlossen. Als ersten Ertrag bekamen wir 1915 das Büchlein »Eine Fahrt zu den Sachsen an die Front«. Dem mit unendlicher Mühe fertiggestellten Hauptwerke versperrte[327] die Zensur den Weg in die Öffentlichkeit. Wir getrösten uns der kommenden Zeit, wo einmal die Staatsleitung und die Staatsbürger in gleicher Weise dieses Denkmal kriegerischer Leistung werden unbefangen werten können.
Am Anfang des vierten Bandes der Kursächsischen Streifzüge stellt O. E. Schmidt in einer Vision Jean Paul sich gegenüber und bezeugt dankbar den Einfluß, den er von ihm erfahren hat. Es besteht zwischen beiden nicht nur der äußere Anklang, daß weit über den engeren Kreis der Freunde hinaus auch der Doppelname Otto Eduard den allzuhäufigen Familiennamen entbehrlich gemacht hat. Vielmehr ist der Schilderer der kursächsischen Heimat seinem großen Vorbild auch in diesem Zuge ähnlich: er sieht die Welt mit den Augen eines Sonntagskindes an; darum erkennt er das Wundersame auch im kleinen und kleinsten. Er bringt es fertig, den bescheidenen Alltag sinnig zu beseelen und zu durchgeistigen. Einer der Freunde hat fein gesagt: »In jeder Pfütze sieht O. E. Schmidt das Stück Himmel, das sich darin spiegelt«. Mit einem freudigen Optimismus, der in der Güte und Reinheit seiner Gesinnung und letztlich in der frommen Haltung seines innersten Menschen ruht, bejaht er das Leben und freut sich der aufbauenden Kräfte, die in ihm wirken. Er ist davon durchdrungen, daß er eine Landschaft, ein Kunstwerk, einen Menschen nur dann verstehend erfassen kann, wenn er mit williger Liebe ihnen entgegenkommt.
Diese entgegenkommende Liebe und dieser Glaube an den Sieg des Guten haben in ihm die echte Gabe entfaltet, Freunden ein Freund zu sein; haben ihn befähigt, den Umfang persönlicher Beziehungen fast auf alle gesellschaftlichen Schichten seiner Heimat auszudehnen, in der bewußten Absicht, bei allen das Wertvolle zu finden und im Austausch mit ihnen seine Kenntnisse zu erweitern. Ob er mit der Wirtin im Dorfgasthaus plaudert, ob er sich von der Schwester eines toten Künstlers Werkstatt und Hinterlassenschaft zeigen läßt, ob er mit Pfarrer und Schullehrer in alten Kirchen und Ruinen umherkriecht, oder ob er in der Tafelrunde der Schloßherren sitzt, die ihn so gern als Sachverständigen in ihre Archive und als immer anregenden Erzähler in ihren geselligen Kreis rufen, immer bleibt er der Gleiche, fühlt sich am rechten Platz, ohne die Selbständigkeit seines Denkens und Fühlens irgend preiszugeben.
Zum Schluß kehren wir bei dem Siebziger ein, der mit seiner von ihm hoch gehaltenen Frau, mit Kindern und Enkeln den Familientag begeht; auf der Scholle, nach der er sich frühzeitig gesehnt, die er in heißem Mühen langsam sich erarbeitet, die er wieder, wie ein Häusler hackend und mähend, sich erhalten hat durch Zeiten der Not. Wir hoffen, daß auch wir, wenn das Fest schlafen gegangen ist, wieder einmal einkehren dürfen in Hirschsprung, nahe bei der Ladenmühle, daß er uns dann durch die schlichten aber heimeligen Räume des Bauernhäuschens führt und uns Hausrat zeigt, den er inzwischen vorm Untergang errettet und angekauft hat. Und wenn er uns dann die Geschichte dieses Stuhls und jenes Kruges erzählt, dann schauen wir verstohlen nach seinem Schreibtisch, ob sich da nicht wieder eine Handschrift zur Veröffentlichung rundet, und freuen uns auf das, was er uns wieder schenken will.
Rudolf Richter, Leipzig.
Fußnote:
[1] Dieser Aufsatz erschien in verkürzter Gestalt bereits zum siebzigsten Geburtstag des hervorragenden Gelehrten am 21. August 1925 in den Dresdner Nachrichten.
[328]
Von Martin Braeß
Ein Vergleich des am 1. September 1925 in Kraft getretenen sächsischen Jagdgesetzes vom 1. Juli dieses Jahres mit den bisher geltenden gesetzlichen Bestimmungen läßt erkennen, daß den Forderungen des Naturschutzes in weitgehendem Maße Genüge getan worden ist.
Zunächst fällt auf, daß § 2 eine vollständige, erschöpfende Aufzählung der jagdbaren Tiere enthält, während das bisher geltende Gesetz nur ganz allgemein »alle diejenigen herrenlosen und in ungezähmtem Zustande lebenden Säugetiere und Vögel, die bisher in hiesigen Landen als zur Jagd gehörig angesehen worden sind«, zum Gegenstand des Jagdrechts erklärte. (Gesetz, die Ausübung der Jagd betreffend vom 1. Dezember 1864, § 1, Absatz 2.) Zwar folgte auch hier eine Aufzählung der jagdbaren Säugetiere, die – obgleich sie lückenlos ist – doch nicht ausschließlich sein sollte, wie der Zusatz »namentlich« beweist; hinsichtlich der jagdbaren Vögel aber fehlte jede Einschränkung. Eine solche brachte erst das Gesetz, die Schonzeit der jagdbaren Tiere betreffend, vom 22. Juli 1876; dessen § 1 lautete: »Gegenstand des Jagdrechts sind fernerhin nicht mehr: die Lerchen, Drosseln und alle kleineren Feld-, Wald- und Singvögel, zu welchen jedoch Rebhühner, Wachteln, Bekassinen, Schnepfen und wilde Tauben, sowie die kleineren Raubvögel und alle Würgerarten nicht zu rechnen sind.« Es leuchtet ohne weiteres ein, daß der Begriff »kleinere Feld-, Wald- und Singvögel« viel zu allgemein ist, um Unklarheiten auszuschließen.
Nur eine erschöpfende Aufzählung aller jagdbaren Tiere konnte derartige Unklarheiten beseitigen. Daß dies geschehen, ist hinsichtlich der Vögel ein beachtenswerter Vorzug des neuen Gesetzes. § 2 zählt unter a folgende Säugetiere als »jagdbare Tiere (Wild)« auf:
»Rot-, Dam-, Muffel-, Reh- und Schwarzwild, Hasen, wilde Kaninchen, Biber, Dachse, Füchse, Fischottern, Marder, Iltisse, Wiesel (Hermeline), Wildkatzen, Eichhörnchen.«
Neu ist lediglich, daß das Muffelwild (Mufflon), das einzige Wildschaf Europas, das die hohen Gebirge der spanischen Provinz Murcia, Korsikas und des östlichen Siziliens bewohnt, unter die jagdbaren Tiere aufgenommen worden ist, nachdem man es in neuerer Zeit in Sachsen eingeführt hat, wo es vielleicht einmal, wie in den gebirgigen Teilen Thüringens und Schlesiens, eine gewisse Bedeutung erlangen mag. Sonst sind gegenüber dem alten Jagdgesetz nur in der Bezeichnung ein paar Änderungen getroffen worden: statt »Edelwild« ist der gebräuchlichere Ausdruck »Rotwild«, statt »Wiesel und Hermeline«, was unter Umständen dasselbe bedeutet, »Wiesel (Hermeline)« und, um jedem Mißverständnis vorzubeugen, statt »wilde Katzen« die Bezeichnung »Wildkatzen« eingesetzt worden. Daß dieses Raubtier, ebenso der Biber,[329] mit aufgezählt ist, dürfte für Sachsen wohl ziemlich gegenstandslos sein und bleiben.
Vielleicht befremdet es, daß in der Liste der jagdbaren Tiere nicht auch die Bisamratte angeführt ist, jener unwillkommene fremde Gast unserer Gewässer, der für Wasserdämme und Straßenbauten eine Gefahr bildet. Zur Bekämpfung dieses Schädlings ist aber ein besonderes Gesetz vom 30. Juli 1923 erlassen worden, das den Jagd-, ebenso den Fischereiberechtigten, den Eigentümern, Nutznießern, Mietern und Pächtern von Grundstücken und stehenden Gewässern die Verpflichtung auferlegt, das beobachtete Auftreten von Bisamratten der Amtshauptmannschaft, beziehungsweise dem Stadtrat anzuzeigen und die zur Abwehr nötigen Maßnahmen zu ergreifen.
Was die Fischottern, ebenso die Fischreiher betrifft, so bleibt wie bisher das ausschließliche Jagdrecht insofern eingeschränkt, als es nach § 12 des Fischereigesetzes vom 15. Oktober 1868 den Fischereiberechtigten gestattet ist, diese Tiere »zu fangen oder (ohne Benutzung von Schießgewehr) zu töten«. Allerdings müssen die so gefangenen oder getöteten Fischottern und Fischreiher »binnen vierundzwanzig Stunden an den Jagdberechtigten ausgeliefert« werden. Es ist zu wünschen, daß bei einer Neubearbeitung des Fischereigesetzes dieser § 12 wegen der Seltenheit der genannten Tiere wegfällt.
Die erfreulichsten Fortschritte im Sinne des Naturschutzes weist § 37 des neuen Gesetzes auf. Er handelt von den zeitlichen Beschränkungen der Jagdausübung, führt also die Schonzeiten der jagdbaren Tiere an. Unter den Säugetieren sind es lediglich das Schwarzwild, die wilden Kaninchen, Füchse, Fischottern, Iltisse, Wiesel (Hermeline) und Eichhörnchen, die einer Schonzeit entbehren, während selbst einigen Raubtieren, nämlich den Mardern, eine Schonzeit vom 1. März bis 31. Oktober und den Dachsen und Wildkatzen eine solche vom 1. Februar bis 31. August zugebilligt wird. Bisher erfreute sich unter allen Raubtieren, bepelzten wie befiederten, nur der Dachs einer Schonzeit (1. Februar bis 31. August). Aus Rücksicht auf ihre Seltenheit ist nun auch den Mardern (Edel- und Steinmardern) und den Wildkatzen eine solche zuerkannt worden.
Besonders erfreulich ist es, daß die Schonzeiten des Rot- und Rehwildes und der Hasen eine beträchtliche Ausdehnung erfahren haben. Die Gefahr, die dem Wildstande infolge des kalten Winters 1923/24 drohte, war so groß, daß die neuen Schonzeiten für das genannte Wild, wie sie das in Beratung stehende Gesetz vorgesehen hatte, schon vorher durch ein besonderes Gesetz vom 12. Dezember 1924 festgelegt wurden. Es sind die folgenden: für männliches Rotwild vom 1. Februar bis zum 31. Juli, für weibliches Rotwild vom 1. Februar bis zum 31. August, für männliches und weibliches Damwild vom 1. März bis zum 31. August, für Rehböcke vom 1. Dezember bis zum 30. Juni des folgenden Jahres, für weibliches Rehwild vom 1. Dezember bis zum 15. Oktober des folgenden Jahres, für Hasen vom 15. Januar bis zum 30. September.
[330]
Ein Vergleich mit dem Schonzeitgesetz vom 22. Juli 1876 zeigt, daß die Schonzeiten für männliches Rotwild um zwei Monate (Februar und Juli), für weibliches Rotwild um einen Monat (Februar), für männliches Damwild um zwei Monate (Juli und August), für Rehböcke gleichfalls um zwei Monate (Dezember und Januar), für weibliches Rehwild um einen halben Monat (erste Hälfte Dezember) verlängert worden sind.
Für die Sicherung eines gesunden Bestandes an Rot-, Dam- und Rehwild erscheint es ferner wichtig, daß die Schonzeiten für Kälber in dem Jahre, in dem sie gesetzt sind, die gleichen sind, wie für weibliche Stücke derselben Wildart.
Was das Muffelwild betrifft, so ist erstmalig seine Schonzeit gesetzlich festgelegt worden, und zwar für männliches Muffelwild vom 1. Februar bis zum 31. August, für weibliches vom 1. Dezember bis zum 30. September des folgenden Jahres.
Auch die Schonzeit der Hasen ist um einen halben Monat (zweite Hälfte Januar) verlängert worden.
Ungleich zahlreicher sind die Änderungen, die sich auf die jagdbaren Vögel beziehen. Hier galt es nicht nur Klarheit zu schaffen, die bisher fehlte, sondern auch der Vogelwelt einen weit größeren Schutz zu gewähren, dessen sie in einem so dicht bevölkerten Industrielande, wie es gerade unser Sachsen ist, dringend bedarf. Gewiß wird der Natur- und Vogelfreund immer noch einige Wünsche hegen, die auch das neue Gesetz nicht vollständig erfüllt, z. B. in betreff einzelner Tagraubvögel; aber im allgemeinen lehrt der Vergleich mit den bisher geltenden gesetzlichen Bestimmungen den großen Fortschritt auf dem Gebiete des Vogelschutzes, den das Gesetz klar zum Ausdruck bringt.
§ 2 zählt unter b folgendes Federwild auf: »Auer-, Birk- und Haselwild, Rebhühner, Fasanen, wilde Tauben, Ziemer, Bekassinen, Wildschnepfen, Trappen, Brachvögel, wilde Schwäne, Wildgänse, Wildenten, Rallen (Wasser-, Teich- und Sumpfhühner), Säger, Taucher, Möwen, Kiebitze, Fischreiher, Kormorane, Würger und rabenartige Vögel (Raben-, Nebel-, Saatkrähen, Elstern, Dohlen, Eichelhäher), Wachteln, Wachtelkönige, Uhus und alle Tagraubvögel.«
In dieser Liste begegnen wir einer ganzen Anzahl von Vogelarten, auf die das Reichsvogelschutzgesetz vom 30. Mai 1908 keine Anwendung findet; es sind dies: die wilden Tauben, die Wasserhühner, Säger, Taucher, Fischreiher, Kormorane, Würger, die rabenartigen Vögel, der Uhu und die meisten Tagraubvögel. Sie alle würden, falls man sie aus dieser Liste gestrichen hätte, nach dem Reichsgesetz »vogelfrei« sein, d. h. es dürfte sie jedermann fangen (allerdings nicht mit Schlingen) und töten, auch ihrer Eier und Jungen berauben. Weil sie aber jagdbar sind, steht solche Befugnis nur dem Jagdberechtigten zu. Auch hat die neue Fassung von § 1 des Schonzeitgesetzes: »Das Fangen und Erlegen nicht jagdbarer Vögel ... ist gänzlich verboten« dafür gesorgt, daß in vollem Umfang keine einzige Art mehr »vogelfrei« ist.
§ 37 setzt für das Federwild folgende Schonzeiten fest: für Auer-, Birk- und Haselhähne vom 1. Juni bis zum 31. März des folgenden Jahres, für[331] Rebhühner vom 1. Dezember bis 31. August des folgenden Jahres, für Fasanenhennen vom 1. Januar bis zum 30. September, für Fasanenhähne vom 1. Februar bis zum 30. September, für Bekassinen und Wildenten vom 1. Februar bis zum 15. Juli, für Waldschnepfen vom 1. Dezember bis zum 31. August des folgenden Jahres, für Brachvögel, Rallen, Taucher, Möwen, Fischreiher und Tagesraubvögel (mit Ausnahme der Turm- und Wanderfalken, sowie der Habichte und Sperber) vom 1. Februar bis zum 31. August. Auer-, Birk- und Haselhennen, Trappen, Kiebitze, Wachteln, Wachtelkönige, Ziemer, Uhus, Turm- und Wanderfalken dürfen bis auf weiteres nicht gejagt werden.
Vergleicht man diese Schonzeiten mit den bisher geltenden, so ergibt sich, daß Auer-, Birk- und Haselhähnen eine um fünfeinhalb Monat längere Schonzeit gewährt wird (früher nur Februar und vom 16. Mai bis 31. August), während sich die betreffenden Hennen das ganze Jahr ununterbrochener Schonung erfreuen dürfen (bisher nur vom 1. Februar bis 31. August). Die Schonzeiten der Rebhühner und Fasanenhähne ist die gleiche geblieben, die der Fasanenhennen um einen Monat (Januar) verlängert worden. Die Wildenten haben einen Zuwachs ihrer Schonzeit um zwei Monate erfahren (Februar, erste Hälfte März und erste Hälfte Juli), die Waldschnepfen um viereinhalb Monat (Dezember, Januar, März, April, erste Hälfte Mai); den Tagesraubvögeln, die bisher keine Schonzeit besaßen, wird mit Ausnahme von Habicht und Sperber eine solche von sieben Monaten (Februar bis August) gewährt. Turm- und Wanderfalke aber sind wie Trappen, Kiebitze, Wachteln, Wachtelkönige, Ziemer, Uhus und die oben genannten Hennen der Waldhühner das ganze Jahr zu schonen.
Nur einige Bemerkungen hierzu. Daß die Jagd auf die Waldschnepfen während des Frühjahrsstrichs (1. März bis 15. Mai) wegfällt, ist außerordentlich zu begrüßen. Es liegt ja auf der Hand, daß der Abschuß dieses Wildgeflügels zu der Zeit, wo es an seine Niststellen zurückkehrt, um das Brutgeschäft zu beginnen, dem Bestand starken Abbruch tun mußte. Für die Wildenten wird es von Vorteil sein, daß ihnen die Schonzeit um die erste Hälfte des Juli verlängert worden ist, obgleich auch dann noch die meisten mit der Führung der Jungen beschäftigt sind. Der Wunsch, ein oder die andere Entenart, z. B. die Schellente, völlig geschont zu sehen, ist begreiflich; aber hier Ausnahmen zu machen, dürfte unpraktisch und ziemlich zwecklos sein. Der Fischreiher besaß, weil er gegenwärtig im Inlande nicht mehr horstet, keine Schonzeit (Gesetz, die Schonzeit betreffend vom 22. Juli 1876, § 4, Absatz 4); es ist zu hoffen, daß er sich unter dem ihm gewährten Schutz – Schonzeit vom 1. Februar bis 31. August – an ein oder der anderen Stelle unseres Landes wieder als Brutvogel einfindet; allerdings müßte er den Nachstellungen seitens der Fischereiberechtigten möglichst bald entzogen werden.
Sehr erfreulich ist es, daß endlich alle Eulen aus der Liste der jagdbaren Tiere gestrichen sind; sie werden nun des Schutzes teilhaftig, den das Reichsvogelschutzgesetz ihnen gewährleistet. Daß man den Uhu mit Recht noch unter die jagdbaren Vögel zählt, ist schon oben dargelegt worden; als Naturdenkmal[332] darf er aber zu keiner Zeit gejagt werden, genau wie der seltene Wanderfalke. Es wäre ein Wunsch aller Naturfreunde erfüllt worden, wenn das Gesetz diesen unbedingten Schutz auch allen Adlerarten und Bussarden hätte zuteil werden lassen; sie müssen sich mit der Schonzeit vom 1. Februar bis 31. August begnügen. Der Nutzen der Turmfalken wird anerkannt, indem man ihnen das ganze Jahr über eine ununterbrochene Schonzeit gewährt. Daß im Gegensatz hierzu der Sperber, diese Geißel der Kleinvogelwelt, von jeder Schonzeit ausgeschlossen ist, wird allgemein gebilligt werden, während die gleiche Behandlung des Hühnerhabichts, der ebenfalls ein schlimmer Räuber ist, namentlich auch dem Hühner- und Fasanenbestand großen Schaden zufügt, wohl bei allen Jägern, seiner verhältnismäßigen Seltenheit wegen aber nicht bei allen Naturfreunden Zustimmung finden wird.
Um so größer ist die Genugtuung darüber, daß die Trappen das ganze Jahr über geschont werden sollen; es ist nun zu hoffen, daß diese seltenen Vögel unserem Niederland erhalten werden. Gleichen ungeteilten Beifall muß auch der unbedingte Schutz der Kiebitze finden, deren Zahl von Jahr zu Jahr geringer geworden ist, und der der Wachteln, die sich in letzter Zeit hier und da wieder vereinzelt eingestellt haben, nachdem sie bereits seit Jahrzehnten für viele Gegenden als Brutvögel völlig verschwunden waren. Das Einsammeln von Kiebitz- und Möweneiern war bisher zu jeder Zeit gestattet (Schonzeitgesetz § 4, Absatz 4); nunmehr darf dies nur vom 1. Januar bis zum 30. April geschehen, natürlich nur vom Jagdberechtigten. Dadurch erfahren die Nachgelege der genannten Vögel einen gewissen Schutz.
Der größte Gewinn aber scheint zu sein, daß nun auch die Jagd auf den Ziemer völlig ruhen wird. Manchem Jagdberechtigten mag es nicht ganz leicht werden, auf den Abschuß dieses kleinsten Wildbrets zu verzichten; aber wenn man bedenkt, daß es bei der Ziemerjagd gar nicht zu vermeiden ist, auch andere Drosseln mit abzuschießen, daß wir kein Recht haben, den Südfranzosen und Italienern wegen der Nachstellungen unserer Kleinvögel Vorwürfe zu machen, wenn wir selbst unsere nordischen Gäste ebenso empfangen, und daß es überhaupt unwürdig ist, solch kleines Wildbret in den Mund zu stecken, so wird man sich schließlich mit der neuen Bestimmung aussöhnen und dem Naturschutz gern dieses Opfer bringen.
Bisher begann die Ziemerjagd in Sachsen mit dem 16. November (Verordnung, die Jagdbarkeit der Ziemer [Zeumer] betreffend, vom 27. Juli 1878); aber in Preußen z. B. geht die Drosseljagd – sämtliche Drosselarten gehören nach der preußischen Jagdordnung vom 15. Juli 1907 § 39 Nr. 19 zu den jagdbaren Vögeln – schon am 21. September auf und währt bis zum Jahresschluß. So kam es, daß Jahr für Jahr in vielen unserer Feinkost- und Wildbrethandlungen »Krammetsvögel« feilgeboten und verkauft wurden, unter denen sich genug Amseln, Sing-, Wein- und Misteldrosseln befanden, weil man die Vögel zumeist aus dem Auslande bezog. Es war ein kläglicher Anblick, die zum Teil doch so herrlichen Sänger in langen Girlanden vor den Schaufenstern aufgereiht zu sehen. Das hat nun ein Ende. Denn die Ausführungsverordnung zu § 40[333] und 41 des neuen Gesetzes bestimmt: »Die Einfuhr und der Handel mit erlegten Trappen, Kiebitzen, Wachteln, Wachtelkönigen und Ziemern bleibt auch dann verboten, wenn die Stücke nachweisbar außerhalb Sachsens erlegt worden sind.« »Krammetsvögel« werden also vollständig als Verkaufsware verschwinden, und ebenso wird uns der traurige Anblick »echt französischer Weinbergswachteln« (!) in den Auslagen erspart bleiben. Dafür wollen wir dankbar sein.
Zugleich mit dem Jagdgesetz hatte die Regierung die Bearbeitung eines Landesvogelschutzgesetzes in Aussicht genommen. Dies ist aber unterblieben, namentlich aus dem Grunde, weil zunächst eine Neubearbeitung des Reichsvogelschutzgesetzes erwartet wird. Die sächsische Vogelschutzbestimmung steht mit im Schonzeitgesetz vom 22. Juli 1876 (§ 1, Absatz 2) und mußte vom neuen Gesetz aufrechterhalten werden. Sie lautet jetzt: »Das Fangen und Erlegen nicht jagdbarer Vögel und jede auf den Fang derselben berechnete Veranstaltung, das Zerstören ihrer Nester und das Ausnehmen der Eier und Jungen ist gänzlich verboten, auch dürfen dieselben zu keiner Zeit auf Märkten oder sonst in irgendeiner Weise feilgeboten und verkauft werden.«
Es ist zu erwarten, daß sich ein neues Landesvogelschutzgesetz dem Reichsvogelschutzgesetz enger anschließen wird. Vorläufig wollen wir uns freuen, daß Sachsen ein neues Jagdgesetz hat, das, wie wir wohl überzeugend dargelegt haben, in hohem Maße den Bestrebungen des Heimat- und Naturschutzes entgegenkommt.
Eine Erinnerung und eine Zuversicht
Von R. Bürckner, Dresden.
Als ob im Landesmuseum an der Asterstraße in Dresden nicht immer Weihnachten wäre! Wenn draußen das Maiglöckchen blüht, wenn die Sommersonne brennt, wenn Äpfel und Weintrauben reifen: im Museum wird immer beschert. Nicht bloß oben in der Erzgebirgischen Stube, wo der Weihnachtstisch das ganze Jahr aufgebaut steht, wo die Pyramide eben aufgehört hat, sich zu drehen, wo die Weisen aus dem Morgenlande zum Stalle ziehen. Nein, wenn du beim Eingang vor die erste, die Dresdner Stube trittst, wenn du unter den Bergspinnen, die vom Gewölbe blinken, hingehst: Es ist wie Weihnachten. Friede auf Erden. Weihnachtsfreude.
Aber du mußt dich wirklich freuen können, freuen wie ein Kind. Warum freut es sich? Bloß, weil alles so schön ist. O du Kindereinfalt mit deiner ungelehrten Freude! Wer dich doch immer hätte!
Hast du sie nicht, dann komme zu Weihnachten ins Landesmuseum. Komm und sieh, bleibe und höre und freue dich!
Wochenlang vorher wird beraten, wie diesmal Weihnachten gefeiert, wie diese Stube, jener Raum weihnachtlich geschmückt werden soll. Briefe gehen[334] hin und bitten um Mitarbeit, kommen her und bringen Zusagen viel, Absagen wenig. Alte Helfer bleiben treu. Neue schließen sich an. Hast du schon mitgetan? Warte nicht erst auf eine Einladung! Die von selber helfen, sind uns am liebsten.
Endlich ist alles fertig. Dieser Zulauf! Über viertausend Menschen sind letzte Weihnachten im Museum gewesen. Gerade, als ob z. B. ganz Dippoldiswalde mit allen Männern, Frauen und Kindern sich aufgemacht hätte. Gab das ein Gedränge! »Was fällt dir ein?« fragte der Vater unwirsch seinen kleinen Jungen, der zwischen den Leuten stak und hin- und herschob. Die Mutter beschwichtigte: »Er will den Hofrat sehen!« Da nahm ihn der Vater hoch – nun sah er den Hofrat, nun guckte und horchte er.
Ein Zweifaches zieht die Leute zu Weihnachten ins Museum: der Weihnachtsschmuck, die Weihnachtsfeier.
Der Schmuck beginnt mit einer Ranke draußen an der Tür. Schon im Vorraum stehen Bäume. Im Hintergrunde droht ein Riesen-Ruprecht. Aber er tut es ganz gutmütig.
Jetzt die Innenräume. Christbäume, Christbäume! Jeder anders angeputzt. Welcher ist der schönste? Der mit mattem Silberschmuck? Der mit bunten Sternen? Nein, dort der Pfefferkuchenbaum! Die Pfefferkuchen sind alle selbst entworfen, selbst aus Teig geformt. Der Herr Bäckermeister hat sie bloß gebacken, weil das im Ofen zu Hause nicht gut ging. Hier in der guten Bürgerstube: Wie das glitzert! Lauter Goldpapierketten und -büschel und -sterne. Sieh mal, dort auf dem kleinen Schreibpult, an dem früher der Naundorfer Gutsbesitzer seine Roggenrechnung machte: Zwei Wunderbäumchen! Vier goldene Nüsse als Füßchen, eine vergoldete Kartoffel als Mittelstück und fünf Gänsekiele darin als Träger von Rosinen und Mandeln. Ist das niedlich! Nicht bloß niedlich. Ganz echte rechte Volkskunst ist es, voller Liebe, voller Freude! Wer bringt uns mehr solche Sachen?
Unter dem großen grünen Baum ein ganzer Kranz erleuchteter Advents- und Weihnachtsbilder. Aber die müssen schwer auszuschneiden sein! Ja, dafür sind sie auch von Kunstgewerbe-Akademikern; gerade wie die Pfefferkuchen, die wir vorhin gesehen haben.
Bäume mit kräftigem, mit zartem Buntpapierschmuck, mit leuchtenden Glaskugeln, mit Sternen aller Art, mit bunten Bändern. Weihnachtsleuchter, durchscheinende Fensterbilder. Eine frei schwebende grün verdeckte Leiste als Laufbahn für ein Gewimmel ausgeschnittener bunter Figuren; alle rennen zum Christbaum, der sich in der Mitte erhebt. Oben in der Dresdner Bürgerstube mit dem herrlichen Blick auf die Frauenkirche ein in seinem altmodischen Papierschmuck fein abgestimmter Christbaum.
Kein Raum ist vergessen. Bei den kleinen Grabkreuzen steht ein grüner Baum im Schmucke seiner natürlichen Zapfen ernst und still in der Ecke. Dort und da die Treppe sollst du nicht hinaufgehen. Ein grüner Wächter sperrt den Weg.
[335]
Weihnachten überall!
»Gestatten, Herr ...! Mein Name ist Einert. Ich sehe hier so viele Christbäume, aber ich muß sagen, mir gefallen nur die im einheitlichen Schmuck, entweder lauter weiße Sterne, weiße Lichter oder lauter rote Körbchen, rote Ketten, rote Lichter, oder auch lauter Gold, lauter Silber. Wie denken Sie darüber?« »Kann wunderschön aussehen,« will ich antworten, da stellt sich Herr Frölich vor, der zugehört hat, und sagt: »Mein Christbaum muß sein wie eine Volksfestwiese, bunt und lustig, alles durcheinander: bunte Sterne, goldene Nüsse, Silberketten, Pfefferkuchen. Zwar hier, gestatten, daß ich vorstelle: Fräulein Fein, findet ausgerechnet die Pfefferkuchen geschmacklos, aber meine Kinder ...« Er kann nicht ausreden, denn Fräulein Fein bestätigt eilfertig seine Worte: »Außerdem hängen die Pfefferkuchenmänner aller menschlichen Bestimmung zuwider meist verkehrtherum im grünen Baum.« »Aber liebes Fräulein, der Pfefferkuchenmann hat nur die eine Bestimmung, lustig zu sein. Das Kopfnachunten macht ihm unendlichen Spaß und allen kleinen wie großen Kindern mit.«
Unsere Weihnachtsausstellung zeigt, daß es eine »Ästhetik des Christbaumes« glücklicherweise nicht gibt. Das fröhliche Herz findet den rechten Schmuck. Aber die Leute hat der Hofrat öffentlich bedauert, die sich um den Christbaum nur die eine Mühe machen, in den Laden zu laufen und – fünfundzwanzig Marzipanschweine einzukaufen.
Es ist am Spätnachmittag. Harter Ostwind durchfegt die Straßen, Glatteis macht das Gehen schwer. Aber das Museum steht voller Menschen. Worauf warten sie? – Wird denn heute gesungen? – Was wäre Weihnachten im Museum ohne Sang und Rede, ohne Feier! An jedem Tage mindestens eine, an manchen zwei, an einigen sogar drei. So kam es, daß wir letzte Weihnachten fünfundzwanzigmal Weihnachten gefeiert haben. Ja, hält denn das ein Mensch aus? Glänzend. Er muß bloß eine unauslöschliche Begeisterung und – treue Helfer haben. Die hatten wir wie beim Schmücken der Christbäume, so auch bei unseren Feiern. Schulkinder, Gesangvereine, höhere Schulen, Kirchenchöre, fröhliche Einzelsänger, liebenswürdige Einzelsängerinnen, alle, alle kamen, erfreuten die Besucher, erfreuten uns, erfreuten vor allem sich selber. Wie oft und doch nie genug haben wir »Stille Nacht, heilige Nacht« gehört! Wenn es so recht rein und fein durch die Bogenhallen klang, dann war’s, als ob man das alte liebe Lied in wunderschönem Druck auf kostbarem Papier vor sich sähe. Wir freuen uns dankbar jeder volkstümlichen Mitwirkung, und Abwechslung muß sein. Aber kein Weihnachtssingen kommt dem aus Kindermunde gleich. Wenn dann die Mädchen, die Knaben so mit aller Andacht zu ihrem Führer aufschauen: Luca della Robbia, deine Sängerbühnenkinder sind übertroffen. Geheimnisvoller Weihnachtszauber steigt empor, wenn die Engel, Maria und Joseph, die Hirten, die Weisen im langen Gange hergezogen kommen, Lichter in den Händen, Weihnachtslieder singend, begleitet von den Klängen der Lauten und Geigen. Sie kommen langsam heran zum großen Raume der Grabkreuze, sie treten vor die herrliche Madonna.[336] Recht wie eine liebe Mutter sieht sie ihnen zu, wenn sie ihr Weihnachtsspiel beginnen, ohne Puder, ohne Maskengarderobe, schlicht wie im häuslichen Kreise.
Nicht jedesmal wird gespielt. Dann erzählt der Hofrat von dem Bergmann, der ihn gebeten hat, sich die Maria anzusehen, die er für seine Weihnachtskrippe schnitzt, oder von dem kleinen Mädel im Erzgebirge, das seine Puppe kranksagte, als sie noch heil und ganz war, und gesund, obgleich sie inzwischen ein Loch in den Kopf bekommen hatte. Kinderphantasie, deine Gedanken sind nicht unsere, du mußt den nüchternen Erwachsenen belehren. Du hast auch dem kleinen Jungen jenen Tag zum glücklichsten seines Lebens gemacht, an dem er Karnickel sein und ins Erdloch kriechen durfte. Dagegen wir Großen: wie oft sind wir Karnickel und wie selten sind wir glücklich, schließt nachdenklich die Rede lachender Lebensweisheit. Noch vieles von Volksbrauch, von Volks- und Kinderkunst bekommen die Leute erzählt, gern und lange hören sie zu. Aber mit dem Zuhören ist’s nicht getan; sie müssen tätig mitfeiern. Der Tannenbaum, der Vogelbeerbaum vereinigen alle, die da sind, zu fröhlichem Schlußklang. Wir kommen wieder!
Ja, sie werden wiederkommen. Schon glimmen in der Ferne leise die Weihnachtskerzen auf. Wer wird diesmal die Bäume schmücken? Wer wird singen? Sollen wir Dresdner alles besorgen im Landesmuseum für Sächsische Volkskunst? Wer hat einen volkstümlichen Christbaumgedanken? Das heißt, der Gedanke allein tut’s nicht, wir warten auf die Ausführung. Oder kann jemand einen Weihnachtsberg aufbauen? Keinen neun Meter langen, sondern einen, der auch in die enge Stadtwohnung, der ins Museum paßt. Wir möchten wieder vielen, vielen Menschen Freude, Weihnachtsfreude, neue Freude bringen. Und gestehen wir’s nur: Wir selber haben dabei die größte.
Wir sind voller Zuversicht.
Ein Brief von Erdmut Sammetwühler
Sehr geehrter Herr Schriftleiter!
Ich bitte Sie, in den Spalten Ihrer Heimatschutzmitteilungen folgende Anzeige einzurücken. Obwohl ich weiß, daß Ihr Blatt sich mit bezahlten und unbezahlten Anzeigen dieser Art grundsätzlich nicht befaßt, hoffe ich doch auf Erfüllung meiner Bitte.
Ein erfahrener, alter Praktikus gibt kostenlos an jedermann Rat und Auskunft, wie Milchertrag, Kartoffelertrag usw. ohne Kostenaufwand mühelos gesteigert werden können. Zuschriften sind unter »Kostenlos« an den Landesverein Sächsischer Heimatschutz oder an K. Lucas, Meißen, einzureichen.
Erdmut Sammetwühler.
[337]
Mein lieber Herr Schriftleiter!
Sie werden sich jetzt meiner Bekanntschaft aus den Jahren 1920 (Bd. IX, Heft 1–3) und 1921 (Bd. X, Heft 7–9 der Mitteilungen) entsinnen. Jawohl, ich lebe noch. Die böse Zeit hat mich nicht unterbekommen. Wenn ich Ihnen so eine Anzeige bringe, dann denken Sie ja nicht, ich hätte auf meine alten Tage den Größenwahn geschnappt oder triebe mit Ihnen und den Heimatschutzbestrebungen Scherz. Nein, es ist mir ganz ernsthaft zumute bei der Eingabe meines Angebotes. Ich sehe im Geiste, wie Sie lächeln und mit dem Kopfe schütteln, ich glaube zu vernehmen ein deutliches: Quatschkopf, man merkt es, du wirst alt.
Also hören Sie an. Ihr sächsischer Landtag hatte in seiner Sitzung am 4. März 1921 ein von Ihnen eingebrachtes Schutzgesetz für uns und alle, die unter der unvernünftigen Pelzjägerei leiden mußten, mit seltener Einmütigkeit und selten fröhlicher Stimmung abgelehnt. Ich schrieb Ihnen noch den bekannten Brief »In eigener Sache ein letztes Wort« und hielt es dann für ratsam, auszuwandern. Sie sagen: Das stimmt. Aber wohin auswandern? Woher wußtest du von einem rettenden Lande?
Ja, mein Lieber, auch wir haben unsere Beziehungen, auch wir haben unsere Vertrauensleute überall sitzen. Außerdem sind unsere Nerven so fein, daß wir die terrestrischen Radiowellen ohne Hörer glatt aufnehmen und uns nach den auf diese Weise erhaltenen Mitteilungen richten können. Ich grub mich nach Schlesien durch, da ich erfahren hatte, daß der preußische Landwirtschaftsminister durch Erlaß vom 8. April 1920 den Regierungspräsidenten anheimgestellt hatte, zum Schutze unserer Sippschaft Polizeiverordnungen zu erlassen. Das ist auch für fünfzehn Regierungsbezirke und für einige Kreise geschehen. Damit war verboten, uns außer in geschlossenen Gärten, auf Deichen usw. zu fangen und zu töten. Nur in besonderen Fällen konnten von Ortsbehörden Ausnahmebestimmungen erlassen werden. Die Regierungsbezirke Düsseldorf und Trier, die Kreise Köln-Stadt und Bergheim im Bezirk Köln schränkten das Verbot des Fangens und Tötens ein auf fremde Grundstücke. Damit noch nicht genug. In dreizehn von den fünfzehn Regierungsbezirken (Schneidemühl, Köslin, Breslau, Liegnitz, Oppeln, Magdeburg, Merseburg, Minden, Hildesheim, Wiesbaden, Coblenz, Aachen, Sigmaringen) wurde sogar die öffentliche Ankündigung zur Abnahme unserer Felle verboten. Wenn auch nicht im Wege der Reichsverordnung, so doch im Wege der Landesgesetzgebung wurden wir geschützt. Die Minister für Handel und Gewerbe und für Landwirtschaft, Domänen und Forsten regten aber von sich aus den Erlaß einer Reichsverordnung an. Hatte der Regierungspräsident von Oppeln unter dem 22. Juli 1920 (nicht erst am 4. März 1921 sächsischer Landtagsrechnung) eine Polizeiverordnung zu unserem Schutze für das Abstimmungsgebiet des Regierungsbezirkes erlassen, so dehnte er durch Bekanntmachung vom 1. Dezember 1924 (Regierungs-Amtsblatt – nicht in der Sächsischen Staatszeitung – Stück 16 vom 18. April 1925) diese Verordnung auch auf den nicht zum ehemaligen Abstimmungsgebiete gehörenden Teil seines Regierungsbezirkes aus. So sind wir nunmehr in ganz Schlesien geschützt.
Sie sehen, wir sind ganz genau unterrichtet. Ich kann Ihnen sogar noch mehr erzählen. Seit dem 31. März 1920 gibt es in Württemberg ein Schutzgesetz für uns. Uns darf nur in geschlossenen Gärten nachgestellt werden. In gewissen Fällen können die Gemeindebehörden – wie in Preußen – Ausnahmebestimmungen erlassen. Die Verfügung des Ernährungsministeriums vom 9. Dezember 1920 gibt aber klar und eindeutig an, wer auf uneingefriedeten Grundstücken fangen darf und unter welchen Bedingungen. Angebote zu Verkauf und Ankauf von unseren Fellen sind dort ebenfalls verboten. Wer sich nicht daran hält, kann mit Gefängnis bis zu einem Jahr und mit verhältnismäßig hoher Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen belegt werden. Eine Einschränkung hat Württemberg allerdings vorgenommen. Das für die Angelegenheiten der Landwirtschaft zuständige Ministerium kann die einzelnen Bestimmungen für das ganze Staatsgebiet oder Teile davon auf bestimmte oder unbestimmte Zeit außer Kraft setzen. Ganz ähnlich lautet das entsprechende Schutzgesetz in Holland.
[338]
Und was haben Sie in Sachsen gefordert? War es nicht dasselbe?
Ich grub mich also nach Schlesien hinaus und hatte Ruhe.
1921 schrieb ich Ihnen: »Es ist uns unbeabsichtigt Hilfe von anderer Seite gekommen. Frau Mode, das wetterwendische Weib, hat uns ihre Gunst wieder entzogen. Das ist unser Glück. Frau Mode hat Euch Menschen alle am Bändel. (Heute würde ich vielleicht schreiben »am Narrenseil«.) Hoffentlich beehrt sie uns recht lange mit ihrer Geringschätzung. Dann werden wir auch Ruhe haben. Wen sie unter uns freien Geschöpfen mit ihrer Gunst beglückte, dem brachte sie den Untergang.« Im neuen Brehm, der vielleicht bei gewissen Leuten mehr zieht als der alte, steht es Schwarz auf Weiß im 10. Bande Seite 320: Nach einer Auskunft, die von einer hervorragenden, an den Zentralen des Pelzhandels in Leipzig und London domizilierenden Rauchwarenfirma herrührt, ist die Mode des Maulwurfpelztragens im entschiedenen Rückgange begriffen und dürfte in absehbarer Zeit ganz verschwinden. Zur Zeit (Juni 1904) ist das Angebot auf dem Weltmarkt in London zirka eine Million Felle jährlich, wovon der deutsche Anteil etwa zwanzig Prozent betragen mag. Die Verfasser vom neuen Brehm schreiben hinzu: »Heute sind die kleinen Samtfellchen des Maulwurfes aus der Pelzkonfektion längst wieder verschwunden«. Leider haben sich diese große Pelzfirma und die Herren Verfasser vom Brehm gründlich getäuscht. Oder sollte ihnen 1920 nicht bekannt geworden sein, daß zum Beispiel zu einem Umhang für eine eitle, gedankenlose Frau, nein (das wäre Verletzung der Frau und Mutter), für ein eitles, gedankenloses menschliches Wesen etwa dreihundert Maulwurfsfelle und vierundsechzig Felle des grauen sibirischen Eichhörnchens verwendet und sechshundertfünfundsiebzig Dollar (1920) dafür verlangt und auch gezahlt worden sind? An dieses eine Beispiel ließen sich leicht weitere, ganz ähnliche anfügen. Schon 1904 hatte der Verband fortschrittlicher Frauenvereine beim Reichskanzler eine Eingabe abgegeben, in der gefordert wurde, einen vermehrten Schutz unserer Sippe herbeizuführen (wir waren schon um 1890 einmal in Mode gekommen), den Maulwurffang und sogar das Tragen von Maulwurfspelzen unter Strafe zu stellen. Das war 1904. Und 1920, 1921!!! Wo bleibt Euer vielgerühmter Fortschritt, der innere Fortschritt?
Ich weiß auch, daß jemand von Euch gesagt hat: Diejenigen, die in unserem Klima wirklich einen Pelz brauchen, sind die, die als Fahrzeugführer zu tun haben. Alle anderen – fast ohne Ausnahme – tragen ihn als Modestück. Aber eins haben uns unsere Vertrauensleute doch noch nicht gemeldet, daß ein angestellter Fahrzeugführer einen Pelz aus unseren Fellen getragen hätte.
Doch zurück zu meiner Anzeige. Was bringt mich darauf? Ich habe von verschiedenen Seiten vernommen, daß Euch die Maikäfer Sorgen bereiten. Die Biologische Reichsanstalt versendet seit einigen Jahren Maikäfermerkblätter. Nach der ganzen Arbeitsweise dieser Anstalt kann ich nicht annehmen, daß sie das nur tut, um etwa die Verbreitungsbezirke vom gewöhnlichen Maikäfer und vom Roßkastanien-Maikäfer klarzulegen. Das Wort Maikäferjahre wird oft genannt.
Man versucht die Zusammenhänge aufzudecken, die jedes Lebewesen als Glied einer geschlossenen Kette erkennen lassen. Man zeigt, wie eine Veränderung an irgendeiner Stelle der Kette zwingend auf alle anderen Glieder einwirken muß. Da taucht auch die Rede auf von den Maikäfern, die Euch Menschen die Milch wegtrinken. Das ist närrisch, aber leider wahr. Überlegt es Euch einmal. Wenn jemand sagte: Maikäfer, die Euch die Kartoffeln wegfressen, so hätte der auch recht.
Im schweizerischen Rhonetale soll eine Gemeinde einmal versucht haben festzustellen, ob es wirklich an dem sei, daß Engerlinge den Grasnutzen merklich schmälern und dadurch die Futtermenge, die Milchviehhaltung und den Milchertrag merklich mindern könnten. Das Ergebnis ist wohl so gewesen, daß auf einen Hektar engerlingsfreier Wiese etwa zwanzig Zentner Heu mehr geerntet worden sind als auf den Wiesen, die engerlingsreich waren. Verbürgen kann ich mich für diese Angaben nicht, aber ein gut Teil Wahrheit steckt dahinter. Hätte man statt des Wiesenlandes Kartoffelland zu diesen Untersuchungen[339] benutzt, so wären sicher ähnliche Ergebnisse zutage getreten. Jetzt werden Mittel gesucht, die den Engerlingsschaden mindern und damit die Erträgnisse der Ländereien unter sonst gleichen Bedingungen heben sollen. Aber keins wird darunter sein, das ohne Opfer an Zeit und Geld anzuwenden wäre.
Was haben aber wir Mulle damit zu tun? Daß wir Engerlinge fressen, das ist wohl bekannt. Herr Wiesenbaumeister Bernatz hat ja nun gefunden, daß wir nur zweimal im Jahre Engerlinge fräßen, hat das auch mit seinen Erfahrungen belegt. Das eine Mal wäre es im Frühjahre, wenn die Engerlinge aus den frostfreien Schichten zu den Graswurzeln, Kartoffeln usw. emporstiegen. Das andere Mal wäre dann, wenn sie im Herbste wieder zur Tiefe gingen. Dabei müßten sie unser Röhrennetz schneiden und fielen uns zur Beute. Zu anderen Zeiten erwischten wir keine. Unsere Gänge seien im Sommer unter den Engerlingen, im Winter über ihnen. Ich halte dem entgegen: Es haben etliche von Euch Versuche mit gefangenen Brüdern von mir angestellt, ob wir unsere Beute auf gewisse Entfernungen hin, durch Erdschichten hindurch usw. auch zu wittern vermöchten. Die Versuche haben Euch gezeigt, daß wir das können. Und unser Jungvolk fährt zumeist dicht unter der Erdoberfläche dahin. Da muß mancher Engerling gewahr werden, daß er nicht bloß im Frühjahr und im Herbste sich vor uns sichern möchte.
Aber mag daran sein, was will. Jeder Engerling, der von uns gefressen wird, bedeutet für Euch Gewinn an Graswuchs, an Kartoffelwuchs, an Futter, an Kartoffeln, an Milch, an Fleisch. Aus den Engerlingen werden Käfer. Auch diese fressen. Jeder Fraß am Baume mindert in entsprechendem Maße den Ertrag an allem, was der Baum bietet. Schwingt Euch einmal zu den Gedankengängen eines Leberecht Hühnchen auf, der sich ausmalt, was er alles verzehrt, wenn er ein einziges Hühnerei genießt: einen ganzen Hühnerpark. Wendet das auf uns an. Was verzehren wir alles, wenn wir einen einzigen Engerling auffressen! Liegt auch eine starke Übertreibung darin, so ist eine solche Betrachtung doch sehr lehrreich und bedeutsam. Was ich hier auf den Engerling bezogen habe, das könnt Ihr auch auf jeden anderen tierischen, innerirdischen Bewohner Eurer Grundstücke anwenden, den wir zu überwinden vermögen.
Ich gehe noch weiter und schlage vor: Nehmt zwei Stück gleichwertiges Land, zwei Wiesen oder zwei Stück Kartoffelland. Das eine säubert von uns; auf dem andern laßt uns in Ruhe. Prüft von beiden die Erträge. Setzt bei der Wiese ruhig in Rechnung, daß Ihr wegen unserer Hügel die Sense vielleicht etwas höher einsetzen müßt, daß daher höhere Grasstoppeln stehen bleiben, als unbedingt nötig wäre. Ich habe die Zuversicht, daß wir uns trotz allem nicht als so schlimme Gäste erweisen werden, als die wir von verschiedenen Seiten her immer hingestellt werden. Daß wir ihrer auf einem Stück nicht zuviel werden, dafür sorgen wir schon selbst. Wir haben eine große Freßlust. Auf einem Stück, auf dem einer von uns gerade satt wird, da duldet er keine weiteren Mitfresser. Einer muß weichen; da gibt es kein Erbarmen.
Ich glaube, meine Anzeige wird jetzt deutlich. Für uns Mulle allein will ich auch nicht sprechen. Ich will nur immer und immer betonen: Ihr Menschen, stört nicht ohne dringende Not das Gleichgewicht in der Natur! Habt Ihr Eingriffe in den Gleichgewichtszustand vor, dann fragt Euch ernstlich: Was für unmittelbare Folgen wird unser Eingriff haben? Aber seid damit noch nicht zufrieden, sondern stellt Euch die viel schwerere Frage: Was für mittelbare, weitgehende Folgen können aus diesem Eingriff erwachsen? Bedenkt dabei, daß diese mittelbaren Folgen Nachteile zu bringen vermögen, die den unmittelbaren Nutzen zunichte machen können. Ein augenblicklicher, vielleicht nur persönlicher Gewinn kann ausschlagen zum dauernden Schaden, den meist die Allgemeinheit zu tragen hat.
Darum will ich zum Schlusse Ihnen noch ein weiteres Bedenken, das mich beunruhigt, vorbringen: Die Kiefernwaldungen werden in gewissen Gegenden von einem Nachtschmetterling, einer sogenannten Eule, schwer heimgesucht. Die ausgedehnten Bestände sind dem Untergange nahe. Einmal die Nonne, dann diese Eule! Ist diese Massenhaftigkeit[340] des Auftretens dieser zwei Waldverderber nicht vielleicht auch eine mittelbare, weittragende Folge einer Gleichgewichtsstörung im Walde? Es wird doch jetzt so viel geredet und geschrieben vom Mischwald, vom Dauerwald. Nun sucht Ihr nach Abwehrmitteln und wollt es jetzt mit einem starken Gift versuchen, das Flieger über den befallenen Waldungen von ihren Flugzeugen aus abblasen sollen. Ich weiß nicht, von mir aus gesehen – ich betrachte die Dinge nur aus der Maulwurfperspektive, nicht von Eurer erhabenen Warte aus – scheint das wieder eine Gleichgewichtsstörung zu werden. Dieser Eule gegenüber wird dieses Mittel wahrscheinlich einen augenblicklichen, vielleicht auch einen auf gewisse Zeit anhaltenden Erfolg bringen. Ich denke aber an die mittelbaren Wirkungen, die nicht heute, nicht morgen in die Erscheinung zu treten brauchen, aber sicher einmal zu spüren sein werden. Wird nur der Schmetterling vernichtet werden? Wird der Gifttod nicht auch andere Lebewesen raffen, auch solche, die er nicht treffen sollte?
Dies wäre von Ihnen und denen, die dem Heimatschutz und damit dem Naturschutz nahestehen und ein Wort dazu zu sagen vermögen, wohl zu bedenken. »Zu spät« ist ein furchtbares Wort. Sorgen Sie mit dafür, daß dieses Wort verschwinden, daß die Tragödienreihe aus Tier- und Pflanzenreich nicht immer neue Fortsetzungen finden möge, die Reihe, die unter der Überschrift steht: »Zu spät« durch menschliche Verblendung!
Damit will ich schließen. Ich sinniere jetzt über Dinge, die mich eigentlich gar nichts angehen. Früher lebte ich, wie mir schien, mein Leben leichter. Da dachte ich mehr an mich und weniger an die anderen. Jetzt muß ich immer mehr an die anderen denken und weniger an mich. Wenn solche Gedankengänge ein Maulwurfshirn erobern können, sollte nicht auch jedes Menschenhirn davon erfüllt sein müssen! Niemand ist für sich da. Jedes ist für alle und alle sind für jedes da. Dieses Umdenken in meinem Maulwurfshirn kann nur meine Bekanntschaft mit Ihren Bestrebungen bewirkt haben. Möchte es jedem so gehen!
Erdmut Sammetwühler, Ehrenobermullrich s. c. (= senectutis causa).
Postskriptum: Ich glaube, es gehört sich für einen richtigen Briefschreiber, daß er ein Postskriptum fertig bringt. Darum füge ich auch eins an. Am 22. August 1925 hat in der Meißner Landwirtschaftlichen Zeitung gestanden: Auf dem Acker beginnt jetzt der Kampf gegen die Getreideschädiger. Die schlimmsten unter ihnen, die Erdraupen, Drahtwürmer und Engerlinge, kann man überhaupt nur fassen, wenn man ihnen einzeln ans Leben geht ... Es gibt keinen größeren Vertilger dieser »Würmer« als den Maulwurf. Ihn sollte man durchaus schonen. Schon heute gibt es eine Anzahl Praktiker, welche die Zunahme der Drahtwurmplage in Zusammenhang bringen mit der schonungslosen Jagd, die man während und nach dem Kriege gegen den Maulwurf geführt hat. (Karl Schöpke, Jessen, Bez. Halle.) So ein Bericht tut wohl. Sollte unsere Maulwurfsdämmerung in graue Fernen rücken, sollte es vielleicht anderswo in anderer Art anfangen zu dämmern?! Hoffentlich! Glück zu!
D. O.

[341]
Von Rud. Zimmermann, Dresden
Mit Abbildungen nach Naturaufnahmen von E. Schwarze und dem Verfasser
Von den Vogelarten unserer Heimat, die mich in den letzten Jahren besonders gefesselt haben, steht die Lachmöwe mit an erster Stelle. Häufige Besuche der volkreichen, zu den prächtigsten Naturdenkmälern Sachsens zählenden Kolonie auf dem Freitelsdorfer Vierteich (nördlich Radeburg) in den Jahren nach dem Kriege, denen sich dann kaum weniger zahlreich solche auch anderer Siedlungen unseres Vogels vorwiegend in den Grenzgebieten der sächsisch-preußischen Oberlausitz anschlossen, führten ganz zwangsläufig zu einer Beschäftigung auch mit der Geschichte dieser Kolonien und zu Untersuchungen über den Bestand unseres Vogels einst und jetzt. Obwohl die Ergebnisse dieser Untersuchungen noch ihrer endgültigen Auswertung harren, sei es mir doch bereits heute hier gestattet, ihnen einiges vorwegzunehmen und den Lesern der Heimatschutzmitteilungen einiges über unseren Vogel und sein Vorkommen in unserem Vaterlande zu berichten.
Die Brutkolonien der Lachmöwe in Sachsen sind durchweg jüngeren Ursprungs. Wir wissen ja, daß unser Land größere natürliche, stehende Gewässer nicht besitzt und daß die heute besonders in den Flachlandschaften östlich der Elbe so zahlreichen ausgedehnten Teiche sämtlich künstlich angelegte Stauteiche sind, deren erste Anfänge zwar in die Zeit nach der Besiedlung des Landes und seiner Urbarmachung durch die Deutschen fallen, die in ihrer Mehrzahl aber in noch späteren Jahrhunderten entstanden sind. Durch ihre Anlage erst wurde der Lachmöwe die Möglichkeit zur Ansiedlung und zur Gründung von Brutkolonien geschaffen. Nun ist es allerdings nicht ausgeschlossen, daß der Vogel vor dem Vorhandensein von Teichen bereits im Bereiche der Elbe, deren Lauf ehedem ja weite Altwässer und dergleichen begleitet haben mögen, Heimatsrechte im Lande besessen haben kann, doch sind wir für eine derartige Annahme ausschließlich auf Vermutungen, nicht aber auch auf gesicherte Beweise angewiesen. Das älteste sächsische Vogelverzeichnis, das den meißnischen Arzt und Naturforscher Kentmann (nicht aber den meißnischen Rektor Fabricius, wie Bernh. Hoffmann, Mitt. Sächs. Heimatsch. 12, 1923, S. 41, irrtümlich angibt) zum Verfasser hat und das die um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts bei Meißen an und auf der Elbe vorgekommenen Vögel aufzählt, nennt auch eine Anzahl »Miben« (= Möwen). Doch lassen sie sich mit Sicherheit auf ihre Art nicht feststellen (der Hoffmannsche Versuch einer Namenserklärung ist in vielem zu gezwungen, wennschon die Lachmöwe bestimmt mit unter den aufgezählten Vögeln sich befinden dürfte) und außerdem sagt es uns leider gar nichts über die Art des Vorkommens selbst. Es ist also, selbst wenn wir dabei außer acht lassen, daß es bereits in eine verhältnismäßig späte Zeit fällt, für unsere Frage ohne Wert.
[342]

Die am frühesten im Schrifttum erwähnte sächsische Lachmöwenkolonie ist die heute allerdings nicht mehr bestehende auf dem Dippelsdorfer Teich bei Moritzburg gewesen; über sie berichtete 1840 der besonders um die sächsische Säugetierforschung verdiente A. Dehne an Christian Ludwig Brehm, daß sie fünfhundert Brutpaare umfasse. 1893 schätzte sie F. Helm, nachdem sie, da der Dippelsdorfer Teich von 1864 bis 1876 trocken gelegen und landwirtschaftlichen Zwecken gedient hatte, zeitweise erloschen gewesen sein muß, wiederum auf etwa fünfhundert Paare, und 1906 noch trafen der verstorbene Mayhoff und R. Schelcher einen Bestand an, »der der früheren Herrlichkeit nicht allzuviel nachgeben mochte.« In den folgenden Jahren aber nahm die Zahl der Vögel rasch ab, bis in den letzten Kriegsjahren die Kolonie gänzlich erlosch. Zeitlich mit dem Eingehen der Dippelsdorfer Kolonie fällt wohl auch das Eingehen einer kleineren Siedlung auf dem Moritzburger Frauenteich zusammen, deren Stärke 1910 Mayhoff und Schelcher auf vierzig bis fünfzig Paare bezifferten. Das Erlöschen der Dippelsdorfer Kolonie führte zur Entstehung einer anderen oder, wenn diese (in dann aber kleinerem Umfange) schon bestanden haben sollte, zu deren Aufblühen, nämlich der auf dem Freitelsdorfer Vierteich, der heute bedeutendsten Sachsens. Hoffmann schätzte 1916 ihre Stärke auf eintausendfünfhundert Paare und mit eintausend Paaren bezifferte sie auch Mayhoff, eine Zahl, die auch ich auf Grund meiner zahlreichen Besuche der Kolonie während der Jahre 1920 bis 1924 für die der Wirklichkeit am nächsten kommende halten möchte. Für 1925 allerdings melden[343] Beobachter – ich selbst konnte die Kolonie in diesem Jahre leider nicht besuchen – einen Rückgang ihres Bestandes. Dafür jedoch hat eine andere Kolonie, die im Schrifttum früh schon genannt wird, aber in den Jahren nach dem Kriege sehr zusammengeschrumpft war und nur noch höchstens fünfzig oder etwas mehr Paare umfaßte, einen neuen Aufschwung genommen, nämlich die auf dem Adelsdorfer Spitalteich. Ihre ersten Erwähnungen fallen in das Ende der siebziger und in die erste Hälfte der achtziger Jahre des verflossenen Jahrhunderts. Aus dieser Zeit liegen auch Schätzungen vor, die ihre Stärke auf eintausend Paare beziffern. Zeitweilig splitterten Teile von ihr ab und führten zur Entstehung kleinerer Kolonien auf benachbarten Teichen, und später erlosch sie sogar gänzlich. Um 1900 hat sie bestimmt nicht mehr bestanden, und erst nach der Jahrhundertwende besiedelte unser Vogel den Teich von neuem. Bei einem Besuche der Kolonie Ende Mai dieses Jahres, wobei ich dank dem liebenswürdigen Entgegenkommen des Bewirtschafters des Teiches die Kolonie in ihrem gesamten Umfange mit dem Boote abfahren konnte, bot sie sich in einer Schönheit und einer Stärke dar, die der Freitelsdorfer Kolonie nicht oder nur um ein Geringes nachstand. Es ist sehr wahrscheinlich, daß die Entstehung der ersten Kolonie auf dem Adelsdorfer Spitalteich eine Folge des Erlöschens der Dippelsdorfer Kolonie in den sechziger Jahren des verflossenen Jahrhunderts gewesen ist; die dort zum Abwandern gezwungenen Vögel ließen sich hier nieder.

Eine ebenfalls größere Kolonie beherbergte lange Zeit auch der Grüngräbchener Lugteich. Ihr Erlöschen fällt noch in die Zeit vor dem Krieg,[344] doch siedelten sich 1922 von neuem gegen fünfzig Paare auf dem Teiche an. Im darauffolgenden Jahre allerdings kehrte nur eine verschwindend kleine Anzahl wieder zurück, und 1924 waren es nur noch ganze zwei Paare, die auf dem Teiche brüteten. Im nördlich angrenzenden preußischen Gebiet bestanden eine etwas größere (einige hundert Paare umfassende?) Kolonie bei Niemtsch und eine kleine bei Kroppen. Die erstere erlosch 1910 infolge der Entwässerung der Teiche durch den Bergwerksbetrieb, während ich über die zweite, anscheinend ebenfalls nicht mehr bestehende, zuverlässige Nachrichten bisher nicht erlangen konnte. Außer diesen beiden, im Schrifttum bereits bekannten Siedlungen scheinen hier und da aber auch noch einzelne kleinere Kolonien vorhanden zu sein; sie entgehen dem Beobachter meistens, weil sie einem dauernden Wechsel unterworfen sind, hier erlöschen und dort wieder neu aufleben. So stellte z. B. 1924 E. Dittmann, Dresden, eine kleine Siedlung unseres Vogels auf dem Sorgeteich bei Guteborn fest.
Weiter östlich sind es besonders die Gegend von Königswartha und die sich dieser im Norden anschließenden Landschaften der preußischen Oberlausitz, die von jeher volkreiche Brutkolonien unseres Vogels beherbergt haben und sie auch heute noch beherbergen. Bernhardt Hantzsch erwähnt 1903 als noch auf sächsischem Gebiet gelegen eine kleinere, etwa zweihundert Paare umfassende, anscheinend aber nicht lange bestehende und heute nicht mehr vorhandene Kolonie auf dem Commerauer Mühlteich; ich lernte weitere auf den Caßlauer Wiesenteichen und dem Caminauer Altteich kennen, die aber beide 1924 infolge vorgekommener Störungen aufgegeben wurden und von denen die auf den Caßlauer Wiesenteichen in diesem Jahre von mindestens zweihundert Paaren von neuem besiedelt, aber leider ein Opfer von Krähen wurde, die sie fast restlos plünderten. 1924 entstand eine kleine, nur einige wenige Paare umfassende Kolonie auf dem Holschaer Großteich (begründet wohl von Vögeln, die von den Caßlauer Wiesenteichen abgewandert waren), die aber in diesem Jahre meines Wissens nicht wieder besiedelt worden ist.
Die größten Kolonien der Gegend liegen jedoch dicht jenseits der Landesgrenze auf preußischem Gebiet. Es sind die von Koblenz und Klösterlich-Neudorf (bei Wittichenau). Stolz nennt 1911 die bereits 1903 Bernhardt Hantzsch bekannt gewesene Koblenzer Kolonie eine »kleine Siedlung«. Sie muß aber dann sehr schnell volkreicher geworden sein, ging um das Kriegsende aber wieder zurück und stieg danach von neuem langsam an; 1924 konnte ich auf Grund wiederholter Besuche ihren Bestand auf mindestens sechshundert Paare einschätzen. 1925 bot sie sich bei meinem ersten Besuch am 20. Mai viel vogelärmer als im vorhergegangenen Jahre dar, und bei einem weiteren am 30. Mai stellte sie sich als fast restlos vernichtet dar: sie war ein Opfer rücksichtslosester Eierräubereien durch Unbefugte (wohl durch die Belegschaft der nahen Kohlengrube Werminghoff) geworden. Die Neudorfer Kolonie war und ist auch heute noch eine der größeren; ihr Bestand dürfte zeitweilig an tausend (und vielleicht noch mehr) Brutpaare herangekommen sein. Auch sie ging in den letzten Jahren zurück (in dem Maße, wie die Koblenzer[345] Kolonie volkreicher wurde?), nahm aber dann in diesem Jahre wieder (zum Teil wohl durch Zuzug der von den Koblenzer Teichen abgewanderten Vögel) einen neuen Aufschwung und dürfte zuletzt gegen fünfhundert (oder auch etwas mehr) Paare umfaßt haben. Neben diesen größeren Kolonien werden im Schrifttum auch noch einzelne, meist nur wenige Paare umfassende kleinere Kolonien erwähnt, die aber, wie wir dies ja auch schon in anderen Fällen sahen, nie von langem Bestand und einem dauernden Wechsel unterworfen gewesen sind; sie immer mit Sicherheit zu erfassen und zu verzeichnen, ist in dem ausgedehnten, ja so teichreichen Gebiete für den einzelnen Beobachter jedoch nicht leicht.
Im äußersten Osten Sachsens bestanden schließlich früher noch zwei Kolonien bei Großhennersdorf und Burkersdorf, die um 1860 sehr volkreich gewesen sein sollen, später aber abnahmen, und – nachdem 1887 die Nester durch ein Hochwasser zerstört worden waren – 1890 gänzlich erloschen. Auf angrenzendem schlesischem Gebiet endlich begegnen wir im Kreise Görlitz noch drei weiteren Kolonien, nämlich auf dem Sohrteich bei Görlitz, bei Ullersdorf und bei den Spreer Heidehäusern. Die erstere ist seit mehr als hundert Jahren bekannt gewesen, sie soll um 1820 »Hunderte von Paaren« umfaßt haben, ging aber dann in den Jahren von 1910 bis 1913 ein. Die zu Ullersdorf bezeichnete William Baer 1898 als »womöglich noch stärker« als die auf dem Sohrteiche, doch traf auch sie das Schicksal der letzteren, sie erlosch 1920. Dagegen hat aber die, von mir 1923 besuchte, der Spreer Heidehäuser in den letzten Jahren stark gewonnen, Pax bezifferte 1924 ihren Bestand mit sechshundert Paaren eher zu niedrig, als zu hoch.
Wenden wir uns nun kurz noch dem Vorkommen des Vogels auch in Westsachsen zu, so müssen wir feststellen, daß dieser Teil des Landes augenblicklich keine einzige Kolonie mehr aufweist und daß die früher hier vorhanden gewesenen sich niemals auch nur annähernd mit den ostelbischen messen konnten. Eine kleine, nur dreißig bis vierzig Paare umfassende Siedlung bestand 1873 (und nur in diesem Jahre?) auf dem Burkartshainer Teich bei Wurzen, eine andere wird für die achtziger Jahre vom Müncherteiche bei Grimma genannt. Eine ebenfalls nur vorübergehende kleinere, vielleicht bis oder etwas über hundert Paare umfassende Kolonie verzeichnet weiter Hennicke für den Anfang der neunziger Jahre für die Rohrbacher Teiche. Seit Mitte der achtziger Jahre wird ferner das Brüten unseres Vogels von den Frohburg-Eschefelder Teichen erwähnt; die ebenfalls niemals groß gewesene Kolonie erlosch um 1913, obgleich auch in späteren Jahren ab und zu hier nochmals einige Paare gebrütet haben mögen. Die Vögel scheinen sich nach den nahen, auf altenburgischem Gebiete gelegenen Haselbacher Teichen gewendet zu haben, die als Niststätte von Lachmöwen 1889 erstmals erwähnt werden und, mit dazwischen gelegenen Pausen, noch bis in die letzten Jahre einzelnen Paaren des Vogels Nistgelegenheit geboten haben. Schließlich gedenkt auch Richard Heyder des Brutvorkommens weniger Paare während der Jahre 1912 bis 1914 auf dem Großhartmannsdorfer Teich. –
[346]

Unsere vorstehenden, kurzen Untersuchungen über die Lachmöwensiedlungen unserer Heimat lassen dabei ganz von selbst die Frage entstehen: »Wie verhält es sich mit dem zahlenmäßigen Bestand unseres Vogels, ist er sich gleich geblieben oder hat er, wie dies so oft behauptet worden ist, und wie ich dies auch selbst – ich betone dies ganz besonders – bisher angenommen habe, eine wesentliche Abnahme erfahren?« Eine alle Zweifel ausschließende Beantwortung derselben ist allerdings nicht ganz leicht, ja, vielleicht überhaupt nicht möglich. Denn uns fehlen dazu aus der Vergangenheit die notwendigen Unterlagen, Untersuchungen und Aufzeichnungen sowohl über die Zahl der ehemals vorhandenen Kolonien – die Zahl der aus dem ostelbischen Gebiet aus der Gegenwart bekannten z. B. ist größer als diejenige der in gewissen Zeiten im Schrifttum der Vergangenheit erwähnten – ebenso wie auch sorgfältige Schätzungen ihres Vogelbestandes. Die letzteren sind fast immer ganz allgemein in den meistens auch heute noch gebrauchten, nichts oder nur wenig sagenden Ausdrücken »einige hundert Paare« oder bei stärkeren Kolonien »tausend Paare,« »über tausend Paare« usw. gehalten. Wenn man nun aber die auf uns überkommenen wenig exakten Angaben etwas kritisch einzuwerten vermag und nie die einzelne Kolonie an sich betrachtet, sondern dabei das Gesamtvorkommen des Vogels in dem unseren Untersuchungen zugrunde liegenden Gebiete im Auge behält, wenn man ferner aus den Verhältnissen der Gegenwart unvoreingenommene Schlüsse zu ziehen[347] imstande ist, und schließlich die Kolonien selbst auch kennt und den unseren Vögeln im Gebiete zur Verfügung stehenden Lebensraum berücksichtigt, so kommt man zu dem Schluß, daß eine wirklich erhebliche Abnahme im Bestand der Lachmöwe in unserem Gebiete sich nicht nachweisen läßt und daß eine solche Abnahme auch gar nicht wahrscheinlich ist. Wir sehen zwar Kolonien verschwinden, an ihrer Stelle aber auch immer wieder neue entstehen oder bereits vorhandene volkreicher werden. Erinnert sei hier nur an das erste Erlöschen der Dippelsdorfer Kolonie in den sechziger Jahren, an das sich, wenn meine Nachforschungen an Ort und Stelle nicht trügen, höchst wahrscheinlich die Entstehung der Adelsdorfer Kolonie knüpft, erinnert an das Eingehen auch der späteren Dippelsdorfer Kolonie, das die Entstehung oder zum mindesten ein gewaltiges Aufblühen der heute so großen und wirklich prächtigen Freitelsdorfer Kolonie zur Folge hatte und deren wahrscheinliche (immerhin dann aber nur geringere) Abnahme in diesem Jahre mit einem kaum geahnten Anwachsen der fast zur Bedeutungslosigkeit herabgesunken gewesenen Adelsdorfer Kolonie verknüpft ist. Die oben erwähnte Abnahme auch der Neudorfer Kolonie in den letzten Jahren spiegelt sich wahrscheinlich in der gleichzeitigen Zunahme der Koblenzer Kolonie wieder, das Eingehen der Kolonien auf den Caßlauer Wiesen- und dem Caminauer Altteich 1924 drückt sich wiederum in der Stärke der Koblenzer Kolonie im gleichen Jahre aus, die die des vorhergegangenen um ein ganz erhebliches[348] übertraf, und die Vernichtung der Koblenzer Kolonie in diesem Jahre hatte, wie sich von den im Gebiete regelmäßig anwesenden Beobachter leicht verfolgen ließ, die Wiederbesiedlung der Caßlauer Wiesenteiche und eine deutlich zum Ausdruck kommende Bestandszunahme der Neudorfer Kolonie zur Folge. – Man hat bisher nur immer das Verschwinden einer Kolonie als Verlust gebucht, aber selten auch die Entstehung neuer oder das Aufblühen bereits bestehender auf der Gewinnseite eingetragen.

Die Lachmöwe hat oft etwas zigeunerhaftes an sich; sie liebt den Wechsel, der sich besonders im Entstehen und Wiederverschwinden der kleineren Kolonien ausdrückt. Aber auch die Art der Teichbewirtschaftung ist von großem Einfluß auf die einzelnen Kolonien, ihren zeitlichen Bestand und ihre Stärke; das Eingehen der Dippelsdorfer Kolonie gegen Kriegsende z. B. scheint mit der durch den Krieg bedingten größeren Rohrnutzung in unmittelbarem Zusammenhang zu stehen. Daß schließlich auch wilde Eierräubereien, wie wir sie in dem Koblenzer Beispiel kennen lernten, Kolonien gefährden können und gefährden müssen, bedarf wohl kaum eines besonderen Hinweises, dies zeigt uns deutlich ja das eben erwähnte Beispiel. In diesem Falle haben sich die Schädigungen lediglich örtlich ausgewirkt: sie veranlaßten die von den Plünderungen betroffenen Vögel lediglich zur Abwanderung nach Teichgebieten in der unmittelbaren Nachbarschaft, würden aber wohl bestimmt das Verschwinden der Vögel im Gebiet überhaupt zur Folge gehabt haben, wenn dieses infolge seines Teichreichtums ihnen eben nicht die Möglichkeit der Ansiedlung an anderen, weniger gefährdeten Stellen geboten hätte. Die Vögel würden und müßten gänzlich verschwinden, wenn ähnliche rücksichtslose Nestplünderungen wie sie 1925 in fast ohne weiteres Beispiel dastehender Weise die Koblenzer Kolonie betroffen haben, auch die übrigen treffen würde. Hoffen wir daher, daß dieser Fall trotz vieler Ansätze dazu (die Freitelsdorfer Kolonie z. B. leidet ebenfalls stark unter Eierräubereien durch Unbefugte) niemals eintreten und daß es uns allmählich gelingen möchte, die heute eingerissene, aus einem falschen Freiheitsbegriff entstandene Zügellosigkeit einzudämmen und die Massen wieder zur Achtung der heimatlichen Landschaft und ihrer hohen Werte zu erziehen!
Unter diesem Titel sind zwölf überaus reizvolle farbige Bilder von dem im Jahre 1917 verstorbenen Herrn Geh. Postrat Karl Thieme in Dresden aus Anlaß des Sachsentages im Juli 1914 erstmalig herausgegeben worden. Den Druck dieser schönen Bilder, deren Originale zum größten Teil von dem im Jahre 1922 im hochbetagten Alter verstorbenen Hofrat und Kustos der Gemäldegalerie[349] Gustav Otto Müller stammen, hat die Lehmannsche Buchdruckerei in Dresden in vorzüglicher Weise ausgeführt[2].
Die jeder Serie beigelegten Erläuterungen machen diese Bilder jedem Heimatfreund besonders wertvoll.
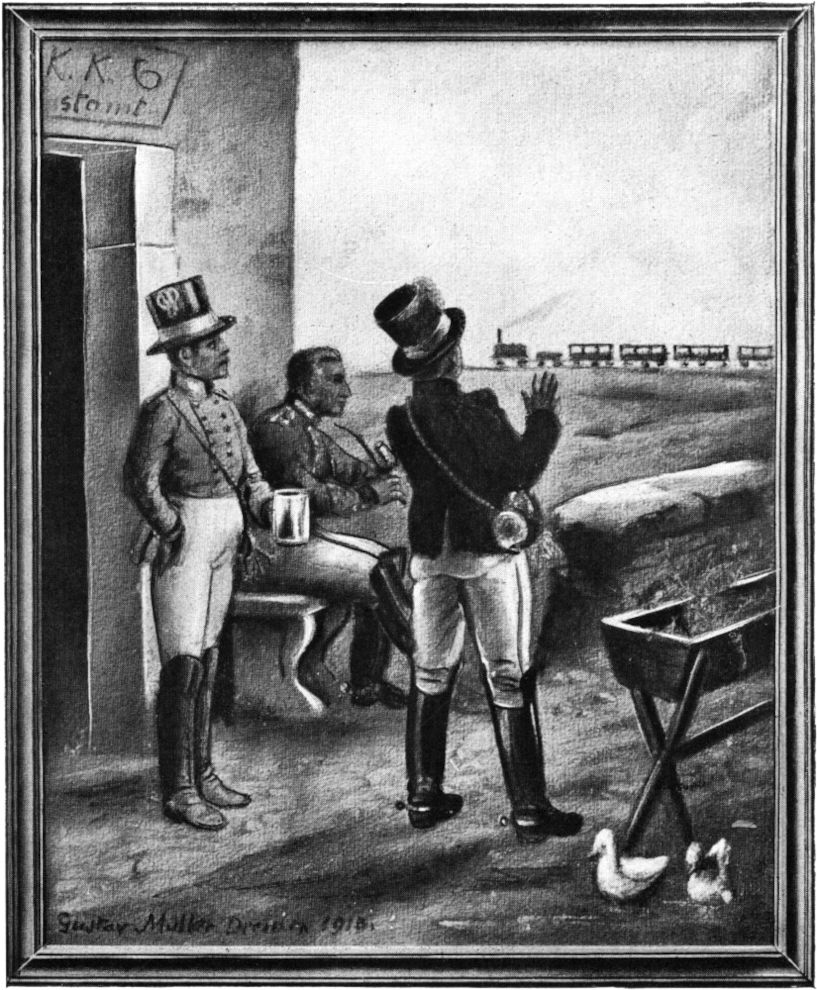
Wir bringen hier eine Wiedergabe des zwölften Bildes, das vom genannten Herausgeber in sinniger Weise mit den Worten »Das Lied ist aus« bezeichnet ist.
[350]
Der weltbekannte, im Jahre 1793 eingerichtete und nach dem Kaiser Franz I. benannte Kurort Franzensbad, von dessen »Sauerbrunnen bei Eger« wir seit 1542 einen gedruckten Nachweis besitzen, dessen Bäder aber erst im 17. Jahrhundert benutzt wurden, hatte bis 1865 noch keine Eisenbahn.
Alljährlich strömten viele Hunderte von Patienten den kräftigen Quellen von Franzensbad zu. Nachdem die letzten Stationen der Sächsischen und Bayrischen Bahnlinien von den Reisenden verlassen worden waren, benutzten sie den schnellen Eilpostwagen oder die teure Extrapost, um ihr Ziel zu erreichen. Die meisten Kurgäste konnten sich diese Mehrausgabe schon leisten und erfreuten oft genug den schmucken Postillion, der unterwegs seine besten Stücke blies, mit einem Extratrinkgeld.
Da gab es bei dem Kaiserlich-Königlichen Postamt zu Franzensbad ein buntes Gedränge von Österreichischen, Bayrischen und Sächsischen Postillionen, die in guter Kameradschaft miteinander lebten und sich gern ein gutes Schöppchen gönnten. Auf unserem Bilde erblicken wir drei solche brave Ritter vom steifen Stiefel. Ach, in den Becher ihrer Daseinsfreude fällt ein bitterer Tropfen banger Beklemmung, als sie den ersten Wagenzug auf der neuen Eisenbahn heranbrausen sehen. So viele Passagiere schleppt das eiserne Ungetüm heran, so viel »honorige« Passagiere, die kaum in zwanzig Extrapostkutschen Platz hätten. Wo bleiben wir armen Postillione? ist wohl ihre sorgenvolle Frage. Der lebhafte Österreicher fuchtelt grimmig mit den Händen, als möchte er am liebsten die heimtückische, fauchende Lokomotive von den Schienen herunterstoßen, der betrübte Sachse vergißt ganz und gar den tröstlichen Schoppen, den er in der Linken hält. Das treffliche österreichische Bier kommt ihm heute gallenbitter vor. Am meisten erregt unsere Teilnahme der brave alte Bayer, der in seinem einfachen blauen Stallkamisol auf dem Bänkchen vor dem Posthause sitzt. Hätte er, wie die beiden anderen Kameraden, auch seine Galauniform an, so könnten wir seine schmucke Erscheinung bewundern, denn die bayrische Postverwaltung hat in der geschmackvollen Ausstaffierung ihrer Postillione immer etwas los gehabt.
Unser ergrauter bayrischer »Schwager« schaut auf die gewaltige Rauchsäule der Lokomotive, indes seiner Pfeife kein Wölkchen mehr entsteigt. Vielleicht denkt er:
Und inzwischen ist der Postillion vergangen.
Wenn auch der Name »Postillion« geblieben, es steckt in diesem Wortgehäuse doch weiter nichts mehr, als ein uniformierter Rollkutscher oder ein Kraftwagenführer, der bloß noch Briefe und Pakete zu karren hat. Mit dem alten Postillionsgeschlecht ist auch das Posthorn vergangen. Wer weiß denn noch etwas von dem poesievollen Klang des Posthorns, wenn es von der stillen[351] Landstraße her seine Zaubertöne über schlafende Dörfer und Städtlein ergoß? Aber in ungezählten Widmungen ist von Poeten und Musikern den Tagen der Romantik des Postillions und seines Zauberhörnleins doch ein dauerndes Denkmal gesetzt worden, und wie das vorstehende Bild, so bleiben auch die übrigen der zwölf farbigen Bilder ein freundliches Andenken an die Tage unserer Groß- und Urgroßväter.
Fußnote:
[2] Anmerkung: Diese zwölf farbigen Bilder sind soeben in zweiter Auflage erschienen und in allen Papierläden und durch Georg Rennert in Dresden-A. 26, Postfach zu haben. Auch als Geschenk sehr geeignet kostet die Reihe mit zwölf Bildern nur Mark 1.20 und die Prachtausgabe 3.— Mark.
»Der braucht die weite Welt nicht, der in einem bescheidenen Tale glücklich zu sein versteht. Merke das, Kind!«
»Betrachte denkend und fühlend deine Heimatstadt! Von den niedrigen Häusern in unebenen Gassen weht der Hauch langer Jahrhunderte. Der Schauer des Vergänglichen faßt dich an, aber ebenso hörst du wohl die fröhliche Melodie gewesener Zeiten. Manche Pforte, manch verwittertes Gemäuer ist ein Erinnerungsmal, das ohne Schrift viel Wundersames erzählt. Die Geschichte setzt so selbst ihre Grabsteine. – Der Rathausturm ist ein Wächter, der mit seinem Zyklopenauge groß über die Stadt schaut. Unbeirrbar und ewig wie die Zeit. Die Blumen aber, die jetzt die Fenster des Rathauses bunt bekränzen, die werden dir, wenn du einst in der Ferne weilst, kaum aus dem Sinn kommen.«
»Und was deine Vorfahren vor dir gedacht und geehrt, schmähe es nicht! Alles Vergangene ist heilig. Worüber du heute achtlos hinweggehst, das wird dir einst als ein Stück Heimat mahnend heraufsteigen. Unser Geist führt vorwärts. Aber alles, was da war, gleicht einem alten vergilbten Blatte, worauf die Träne einer vereinsamten Mutter fiel.«
»Schau dir die Brücke an, die deinen Heimatfluß überwölbt! Was wandert nicht alles darüber! Der Schritt der Menschen ist bald hart und zornig, bald fröhlich-beeilt, bald auch grausam-beschwert von einem heimlichen Leide. – Wer weiß, wie du einmal hinauswandern wirst – über die alte Brücke deiner Heimat?«
»Draußen, als einen stillen, erhebenden Platz, findest du den Garten der Kreuze. Kaum ein Friedhof liegt so schön, wie der deiner Heimatstadt. Wenn du den breiten Weg aufwärts gehst, durch viele Blumen, die den Gedanken an das Leben wachzuhalten suchen, dann ruht ein vergessener Hügel vor dir: ein Muttergrab, ein heilig Grab! So sprach ein Dichter. Ich sehe, wie du dir nach dem Herzen greifst, ich weiß, welch ernster Schwur sich in deiner Brust losringt, und ich weiß auch, wem der gilt.«
»Wenn der Mai uns seine ersten Morgen schenkt, und du willst seinen zarten Duft erhaschen, gehe in den Wald deiner Heimat. Über dir rauschen die Fichten, weiße Birken stehen verschämt dazwischen, und die tiefe Feier ringsum! Du empfindest den Rhythmus aller Wesen um dich, der Pflanzen und der Tiere, du atmest ihn mit, fühlst dich in den großen Kreis der Schöpfung[352] eingeschlossen als ein bedeutungsvolles, lebensfrohes Glied. Ist’s nicht, als seien die Bäume deine Brüder und die lieben Blumen deine Schwestern?«
»Im Frühling klingt’s aus den Bäumen. Es sind der Stimmen unzählige, die lobsingen. Dir gelingt es vielleicht, an ein Rotkehlchen heranzukommen, wenn es auf einem knospenden Strauchwerke sitzt. Zwei Schritte von ihm. Und es singt und jubelt immerfort. Tiefdunkel glänzen die kleinen Augen, klug und rein, die rote Brust hebt sich hastig ungezählte Male. Fühlst du, wie froh alle Schöpfung ist? Lerne froh sein von ihm!«
»Mache das Herz dir frei, mühefrei! Auf den Bergen wehen mit der reineren Luft bessere Gedanken um dich. – Stelle dich auf einen nahen Berg, sieh, wie der Sonne versinkender Ball seine letzte Glut das Heimattal entlangwirft. Und du fühlst auf einmal deinen Heimatfluß als lebendes Wesen, das wie ein müder Wanderer sich der Sonne nachschleppt. – Abend, Feierabend. Fern ist ein Kirchlein vom letzten Strahl beleuchtet, es scheint aus einem Bilderbogen herausgeschnitten. Vor dir thront ein zerrissener Fels, stolz und breit, wie eine sagenhafte Burg. Aus einer Buche Geäst weint die Drossel ein Lied. Die Sonne sehnt sich zurück. Hab’ du auch Sehnsucht zur Sonne!«
»Suche dir, schaffe dir in deiner Heimat einen Lieblingsort. Dort bettest du dich mit deinen Gedanken vor dem Lärm des Tages und der Welt. Dort bist du eine stille Weile lang mit dem Geistesleben, das durch die Natur rauscht, verwachsen. – Lerne auch hier! Das Blühen und Werden der Natur ist Äußerung der Kraft. Nur wer Kraft entwickelt, lebt! Nur wer Kraft entwickelt, hat Anspruch an das Leben! Nur wer Kraft entwickelt, hinterläßt Spuren seiner Persönlichkeit und hat darum nicht umsonst gerungen! Alle anderen sind Schwächlinge. – Doch sieh noch einmal das liebe Tal! Drüben die weiten Fichtenwälder. Ein Streifen dunkler Kiefern läuft zum Tal herunter, so daß es dem Rückgrat eines ungeheuren Urwelttieres gleicht. Sieh noch einmal um dich! Ach, vielleicht vergraben sich deine heißen Hände in die frisch aufgeworfene Erde, du drückst eine feuchte Scholle, die Frische der Erde durchrieselt deinen Körper, Kraft der Erde durchflutet dich, du fühlst und erkennst es: Heimat!«
»Wenn du aus der Heimat auch gehst, nimm sie im Herzen mit! Auch die Heimat ist deine Mutter. Und wer wollte seine Mutter vergessen?«
Emil Vogel.
J. Hottenroth, Gersdorf, Bez. Chemnitz
Ende Juni 1925 stieß man im oberen Teile der Stadt Ölsnitz i. E. beim Abtreiben einer Böschung auf ein sehr umfangreiches Lager von altertümlichen Tongefäßen und kleinen Glasflaschen. Trotz der erstaunlich großen Menge der Gefäße kamen eigentlich nur zwei Typen zum Vorschein, und zwar dickbäuchige Tonflaschen mit dünnem, oben weit ausladendem Halse und kleiner Standfläche[353] und dann kleine Näpfchen von eineinhalb bis vier Zentimeter Höhe. Alle Tonwaren waren glasiert und auf der Drehscheibe hergestellt. Die kleinen Glasfläschchen bestanden aus einem dünnwandigen, in allen Regenbogenfarben schillernden Glase. Der Boden war kegelförmig weit nach innen gestülpt.
Der Fund erregte das größte Aufsehen, und an ihn knüpften sich bald die gewagtesten Vermutungen. Die einen sahen in ihm vorgeschichtliche Töpferei, die anderen Arzneiflaschen aus irgendeiner Pestzeit. Diese seien, um die fürchterliche Seuche zu bannen, an der Fundstelle vergraben worden. Ein besonders phantasiebegabter Erforscher heimischer Geschichte schrieb allen Ernstes im Heimatblatte, daß die beiliegenden kleinen Näpfchen slawische Tränenkrüglein seien. Die Wenden hätten noch keine Taschentücher besessen und hätten infolgedessen bei Trauerfällen die Näpfchen an die Augen gehalten, um die Tränen aufzusammeln.
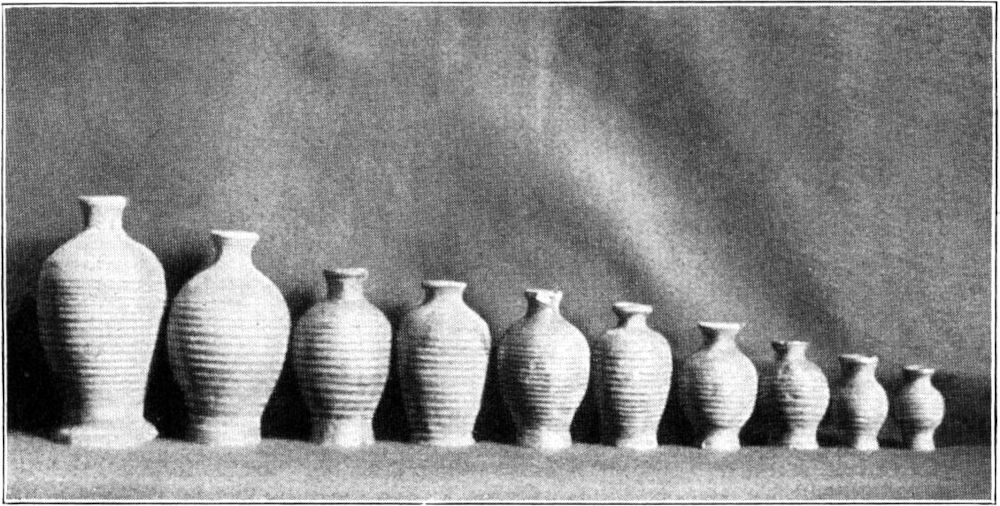
Mir war der Fund zu wichtig, um ihn auf solch kindliche Weise erklären zu lassen. Er ist doch vor allem dazu angetan, das Dunkel, das noch über der Keramik verschiedener geschichtlicher Zeiten schwebt, etwas aufzuhellen.
Es galt deshalb zunächst genau die Zeit festzustellen, in der die Flaschen und Töpfchen entstanden sein könnten. Daß sie nicht prähistorisch sind, war ohne weiteres klar. Mir war, als Laien auf diesem Gebiete, eine unbedingt sichere Datierung nicht möglich, meiner Schätzung nach mochten die Fundstücke ungefähr dem sechzehnten oder siebzehnten Jahrhundert angehören. Mit einer unsicheren Schätzung war mir aber nicht gedient. Ich suchte deshalb zunächst Hilfe im Museum für Volkskunde in Dresden, dessen keramische Schätze ich eingehend studierte. Es fanden sich aber keine analogen Stücke darunter, was ja auch nicht zu verwundern ist, da die volkskundlichen Gegenstände meist nicht über hundert Jahre alt sind.
Nun sandte ich Belegstücke an Dr. Bierbaum, dem Kustos des vorgeschichtlichen Museums in Dresden. Dieser schrieb mir: »Die von Ihnen vorgenommene zeitliche Bestimmung (sechzehntes bez. siebzehntes Jahrhundert), halte auch ich für richtig. Freilich könnten die Scherben und Gläser auch noch jünger[354] sein. Für eine genaue Datierung fehlen leider alle Vergleichsfunde.« Ganz ähnlich äußert sich Dr. Zimmermann, der erste Direktor des Germanischen Nationalmuseums zu Nürnberg: »Die uns zugesandten Muster möchten wir nicht vor das siebzehnte Jahrhundert zurückdatieren.«
Wie sich später herausstellte, haben beide Herren vollständig recht.
Es fragt sich nun, welche Bewandtnis es eigentlich mit den Funden hat. Zunächst ist doch die Annahme sehr naheliegend, daß am Fundorte vor Zeiten eine Töpferei gestanden haben könnte. Daß hier nur zwei bestimmte Gefäßformen vorkommen, steht dieser Ansicht nicht entgegen. Es gibt ja heute noch Töpfereien, die sich auf ganz bestimmte Erzeugnisse (Blumentöpfe usw.) einstellen. Im Germanischen Museum war man der Meinung, es handle sich hier möglicherweise um das Brüchlingslager einer Krugbäckerei. Wenn das so wäre, so fehlt immer noch eine Erklärung für das Vorkommen der Tausende von kleinen Glasflaschen am Fundorte. Es ist doch nicht anzunehmen, daß eine Töpferei zugleich Glashütte war. Zudem hat sich aus den Ölsnitzer Kaufbüchern und Akten ergeben, daß dort nie eine Töpferei vorhanden war.
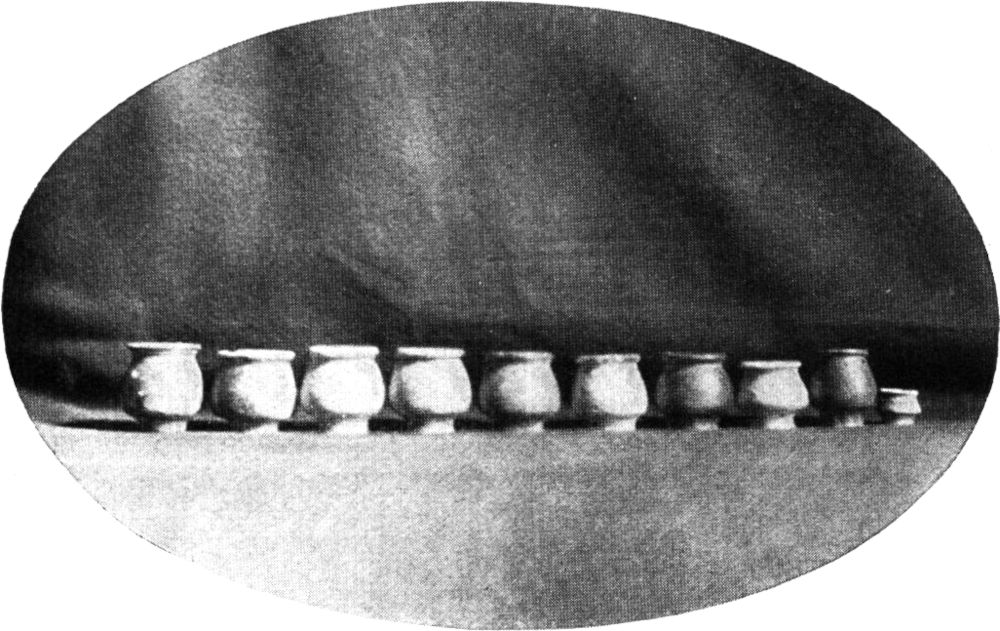
Die kleinen Näpfchen, die ungemein zahlreich neben den Ton- und Glasflaschen lagen, brachten mich auf eine andere Lösung des Rätsels. Diese Näpfe gleichen nämlich vollständig den Töpfen, die Ende des vorigen Jahrhunderts von den »Königseern« mit Salben gefüllt feilgeboten wurden. Ich sprach deshalb im »Ölsnitzer Volksboten« die Vermutung aus, daß an der Fundstelle in früheren Zeiten vielleicht eine Art Laboratorium für Arzneimittel gestanden haben könnte. Die hier hergestellten Tinkturen und Essenzen kamen in die Ton- bzw. Glasflaschen, die Salben in die Näpfe. Mit dieser Annahme wäre ja auch zwangslos eine Erklärung für die auffälligen Größenunterschiede der Tonflaschen gegeben. (Vier bis vierundzwanzig Zentimeter Höhe.) Man sorgte eben für Groß- und Kleinabnehmer. Die Fundstelle wäre dann ein trefflicher Beleg für die Verse, die Hartmann Schopper 1568 den Apothekern als Charakteristikum beigegeben hat:
[355]
Meine Ansicht ist aber mit spöttischem Lächeln aufgenommen und als ganz unmöglich hingestellt worden. Und doch hat sie sich voll und ganz bewahrheitet. Kantor Junghannß, der verdienstvolle Erforscher der Ölsnitzer Geschichte hat aus seiner Chronik von Ölsnitz i. E. folgendes festgestellt: An der Fundstelle stand früher ein Grünhainisches Gut, dessen ältester nachweisbarer Besitzer Andreas Preßler hieß. 1696 besaß es Georg Görner, der es 1723 seinem Sohne Augustin Görner überließ. Augustin Görner war ein berühmter Kräuterarzt. Er hat in Ölsnitz von 1723 bis 1743 seine Praxis ausgeübt. Zur Verabreichung seiner Tinkturen und Salben benutzte er Flaschen und Näpfchen, die er vielleicht in einem besonderen Raume seines Gehöftes aufbewahrte. Die aufgefundenen Gefäße müssen in den Jahren 1723 bis 1743 entstanden sein. 1854 wurde das Bauerngut vom Fürst von Waldenburg angekauft und die Gebäude abgebrochen. Dabei ist wahrscheinlich der Vorratsraum für die Gefäße verschüttet worden.
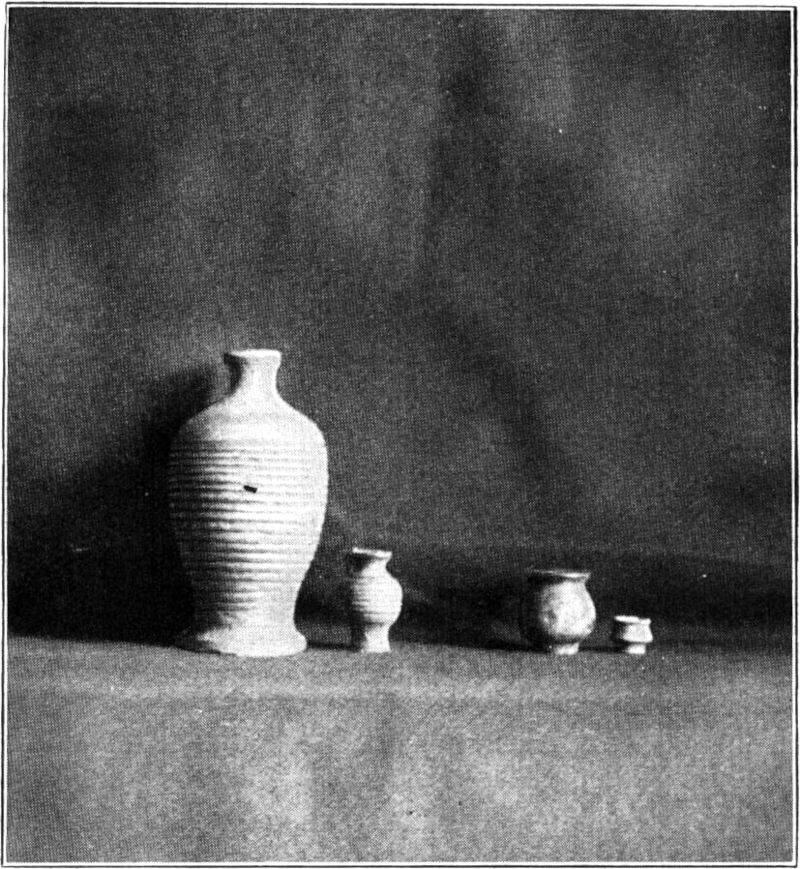
Bestätigt wird diese Feststellung noch durch einen alten Ölsnitzer, der in seinem Heimatblatte Erinnerungen an das Görnersche, später Junghannß Gut, veröffentlichte. Seine Großmutter habe ihm erzählt, daß hier vor alten Zeiten eine Spezerei betrieben worden wäre, in der gute Salben, Arzneien und Tinkturen für Menschen und Tiere hergestellt und in das Gebirge überallhin verkauft wurden.
Die Ölsnitzer Gefäßfunde wären hiermit vollständig geklärt. Ihre Bedeutung geht weit über das örtliche Interesse hinaus. So hat man z. B. 1910 beim Straßenbau nach der Pappfabrik Steinbach (Blatt 139, Annaberg)[356] in Abteilung 45 ein den Ölsnitzer Tonflaschen völlig gleiches Gefäß von zehn Zentimeter Höhe, vierzig Zentimeter tief unter einem Granitblock aufgefunden. Die Deutung dieses Fundes, die bisher nicht möglich war, macht nun keine Schwierigkeiten mehr. Es handelt sich eben um eine Ölsnitzer Arzneiflasche, die aus irgendeinem Grunde im Walde verborgen und nicht wieder abgeholt worden ist. Es ist möglich, daß auch schon anderswo solche Funde gemacht wurden oder noch gemacht werden. Die Ölsnitzer Fundstücke werden auch dann klärend wirken können.
Gewidmet seinem lieben Freunde,
dem guten Jäger Forstmeister i. R. Paul Schneider
von Bernhard, Tharandt
Wald und Wild. Schon dem ähnlichen Klange beider Worte nach möchte man annehmen, daß Wald und Wild zusammengehören. Das Wild ist an den Wald nicht unbedingt gebunden. Wild ist in den Eiswüsten des hohen Nordens, in den Steppen von Asien, Afrika und Amerika vorhanden, ist in den Feldern und im Wasser heimisch. Dagegen ist der Ur- und Naturwald wohl nicht ohne Wild denkbar. In ihm hält das Raubwild das Wild, das sich von Pflanzenstoffen nährt, und dadurch bei Überhandnahme dem Walde schaden könnte, kurz. Es hält aber auch gleichzeitig den Stand dieses vom menschlichen Gesichtspunkt aus als Nutzwild zu bezeichnenden Wildes hoch, weil es Auslese trifft, alle schwachen und kranken Stücke des Nutzwildes vernichtet und nur die besten und schönsten Stücke zurückläßt, die dank ihrer hervorragenden Eigenschaften in der Lage sind, sich den Fängen des Raubwildes dauernd zu entziehen. Anders im Kunstwald, im Forste, im Walde der Gegenwart, im Walde unserer Gegenden. Seine Gaben muß der Mensch versuchen, sich nutz- und dienstbar zu machen, das Holz zu gewerblichen Zwecken, das Wild zur Volksernährung und nicht zuletzt zum menschlichen Vergnügen, zur Ausübung der Jagd. Das Raubwild im Nutzwalde hält der Mensch kurz, damit das Nutzwild sich ungehindert vermehren kann, so kurz, daß z. B. der Heimatschutz in Sachsen zugunsten verschiedener Raubwildarten hat eingreifen müssen, um sie aus unseren sächsischen Wäldern nicht ganz verschwinden zu lassen. Ich erinnere nur an den Baummarder, an den Uhu, an den Hühnerhabicht u. a. Dieser Schutz bekommt dem Nutzwilde aber nur dann gut, es entartet nur dann nicht, wenn der Jäger, der das Jagdrevier bejagt, wirklich Weidmann ist, nicht nur Schießer, sondern auch Heger. Wenn er beim Abschuß Zuchtwahl übt, alle edlen der Fortpflanzung würdigen Tiere erhält, alle der Fortpflanzung unwürdigen, schwächlichen und kranken Stücken aber der Kugel verfallen läßt, und wenn er dafür sorgt, daß dem Wilde auch jederzeit die zur vollkommenen Entwicklung nötige Äsung geboten wird. Diese Äsung aber immer rechtzeitig und vollwertig in unserem jetzigen Nutzwald zur Verfügung zu stellen, ist schwierig. Sehen wir uns unseren[357] Wald in Sachsen an, meist besteht er aus dicht geschlossenen reinen Nadelholzbeständen. Der Boden ist bedeckt mit reiner Nadelstreu, kein Sonnenstrahl dringt zu Boden, kein Gräschen kann fern von der Sonne im dicken Nadelpolster gedeihen. Aus den Jungbeständen aber, die sich noch nicht geschlossen haben, in denen Sonne und Regen noch zum Boden können und wo noch Gras und saftige Kräuter sprießen, wird das Gras als Futter für das Vieh oder als Einstreu in die Ställe oder der Verdämmung der jungen Holzpflanzen wegen ausgeschnitten und verkauft, vielfach ohne Rücksicht darauf, daß mit der dauernden oder wenigstens häufigen Entnahme des Grases dem Boden Kraft entzogen wird. Auch die Laubhölzer, deren Blätter, namentlich im jugendlichen Zustande, unser Wild so gern äst, sind durch unsere Wirtschaft aus unserem Walde verdrängt worden. Ebenso ist die Mast von Eicheln und Buchen im dichten Stande des Kunstwaldes geringer, als beim raumen Stande des Naturwaldes. Wo soll da das Wild in unserem Walde die nötige Äsung hernehmen? Vernichtung des Raubwilds, Veränderung des natürlichen Zustandes des Waldes fordern, wenn das Nutzwild erhalten bleiben, gehegt werden soll, unbedingt sachgemäße Fütterung – neben weidgerechtem Abschuß –, vor allem aber dann, wenn das Wild, womöglich noch durch ein Gatter um den Wald am Austritt auf die Felder verhindert wird, sei es zum Schutze für die Felder, sei es zum Schutze seiner selbst vor den benachbarten Jagdeigentümern. Solche Fütterung aber kostet Geld, das uns mangelt, und entzieht unserem Volke außerdem mittelbar oder unmittelbar noch Nahrungsmittel, die wir so wie so schon zur Befriedigung des Bedarfs teilweise aus dem Auslande einführen müssen. Mit dem Mangel an Äsung, vor allem mit dem Mangel an Lieblingsäsung und an Abwechslung bei der Äsung gewöhnt sich das Wild aber auch Untugenden an, mit denen es dem Walde stark schadet. Im Kampfe gegen diesen Schaden kommt der Forstmann in Widerstreit mit dem Jäger. Der Forstmann sucht seinen Wald, der Jäger sein Wild zu schützen. Der Forstmann ist verpflichtet, aus seinem Walde bei möglichst sparsamen Aufwand an Kapital und Arbeit in möglichst kurzer Zeit dauernd möglichst hohe Werte herauszuwirtschaften. Dies Ziel zu erreichen, hindern ihn die Untugenden des Wildes im Walde, die sich besonders durch Schälen und Verbeißen der Holzpflanzen äußern. Das Wild schält dreißig bis vierzig Jahre alte glatte Fichtenstangen in Reichhöhe seines Geäses und den dritten Trieb von der Spitze her etwa zehn Jahre alter Kiefernjungwüchse. Die Schälstellen der Fichten verharzen und überwallen zwar wieder und der Baum selbst bleibt erhalten, aber er wird im Innern faul und im Ganzen wertlos, mindestens wird sein Wert stark vermindert. Bei den Kiefern stirbt der Baumteil oberhalb des geschälten Triebes meist ab und die Kiefer muß durch Aufrichten eines Seitentriebes einen neuen Schaft bilden, der natürlich nie so grade wie der ursprüngliche Schaft wird, sondern an der Abzweigung vom ursprünglichen Stamme stets eine Krümmung aufweist. Durch diese Krümmung wird der Stamm entwertet. Durch Verbeißen werden die jungen Pflanzen zum Teil ganz vernichtet, zum Teil so stark an der Bildung eines guten Schaftes behindert, daß ihre Entwicklung erheblich[358] verzögert und ihre Erzeugung von Nutzholz wesentlich beeinträchtigt werden. Als Mittel zur Bekämpfung dieser Schäden am Walde durch das Wild stehen dem Forstmann zur Verfügung: Schutz der einzelnen Pflanzen durch Verwittern mit übelriechenden Klebmitteln und Umstecken mit Reisig oder Einzäunen der jungen Bestände, um das Wild am Zutritt zu den zu schützenden Waldteilen überhaupt zu hindern. Letztere Maßnahme beschränkt die Äsungsmöglichkeit des Wildes stark. All diese Maßnahmen kosten auch viel Geld. An Geld aber mangelt es uns jetzt in Deutschland. Wenn der Forstmann kein Geld aufwenden darf, für Mittel zum Schutze seines Waldes vor Schäden durch das Wild, wenn er keine Mittel bewilligt erhält, sein Wild im Kunstwalde reichlich und gut zu füttern, so bleibt ihm nichts anderes zu tun übrig, als die Zahl des Wildes in seinem Walde so weit zu beschränken, daß die in seinem Walde vorhandene spärliche Äsung zur Ernährung seines Wildstandes völlig ausreicht und der Schaden, den das Wild dem Walde zufügt, nicht mehr so stark wie bisher in die Augen fällt. Diese Maßnahmen sind um so nötiger zu einer Zeit, in der die Forstleute, wie gegenwärtig in Sachsen, bestrebt sind, dem reinen Nadelwalde wieder Laubholz einzufügen und in der jede junge Laubholzpflanze aber vom Wilde – vom Hasen bis zum Hirsch – als willkommene Abwechslung in der einförmigen Äsung des eintönigen Kulturwaldes betrachtet und vernichtet wird. So entsteht in unserer armen und dadurch nüchternen Zeit die Frage, wird der Schaden, den das Wild dem Kulturwald zufügt und der in Sachsen sich nach Millionen beziffert, aufgewogen durch die Rente, die die Jagd abwirft. Und hier setzt der Heimatschutz ein, mit der Antwort, bei der Verdrängung des Wildes aus dem Walde handelt es sich nicht nur um materielle, sondern auch um ideelle Güter; denn das Wild belebt den Wald, sein Anblick im Walde fördert das Waldbild und jede Verschönerung des Waldbildes wirkt erhebend auf das menschliche Gemüt. Die Hebung des Waldbildes durch Wild ist nur möglich, wenn es sich wirklich um »Wild«, um freies, edles, in Form und Bewegung schönes Wild handelt. Wild im Gatter, im Tierpark, überhegtes Wild, das auf Äsung aus Menschenhand wartet, ist kein Wild mehr, dessen Schutz sich der Landesverein Sächsischer Heimatschutz zum Ziel setzen darf und kann. Nicht jedem laut daherpolternden, singenden Wandervogel muß es vergönnt sein, draußen im Walde »viel Wild« zu sehen und womöglich gar ein Rehkitz in der Wiese zu finden, und anstatt es ruhig an seinem Platze zu belassen, es zum nächsten Forsthause zu tragen. Nein, nur der echte und wahre Naturfreund, der mit heiligem Schauer das Leben der Natur betrachtet, soll auf seinen stillen Morgen- und Abendgängen hier und da ein stolzes Stück Wild in freier Wildbahn über den Weg ziehen oder auf der Waldwiese am Bestandsrande äsen und den Kopf zur Sicherung aufwerfen sehen. Und so deckt sich auch meiner Ansicht nach das Ziel des Heimatschutzes gegenwärtig mit dem Ziel des Forstmanns und Jägers in unserem Kunstwalde: kräftiges, gesundes und edles Wild in der Zahl bis zu besseren Zeiten durchzuhalten, in der es unser Wald auch wirklich ernähren kann. Nur der wirkliche Naturfreund, nur der echte Heimatschutzmann werden von diesem Wild aber hier und da noch[359] ein Stück zu Gesicht bekommen und sich an seiner Schönheit erfreuen, ebenso wie es der Weidmann tut, dem es darauf ankommt, nicht zu schießen, sondern sich mit den Gewohnheiten seines Wildes so vertraut zu machen und sich selbst so zu beherrschen, daß er trotz Unterlegenheit an Sehkraft und Gehör und trotz des Mangels des beim Wilde so stark ausgeprägten Geruchsinns stets der Überlegene bleibt. Die Freude am jagdlichen Erfolge steigt beim Jäger mit der Schwierigkeit, den Erfolg zu erringen. Auch beim Naturfreund wird sich die Freude, »Wild« zu Gesicht zu bekommen, mit der Seltenheit und Schönheit des Anblickes nur erhöhen.
Von Otto Eduard Schmidt
Aufnahmen des Heimatschutzes
Der Gedanke, der Gesamtheit unserer im Weltkrieg Gefallenen unter Beteiligung des ganzen Volkes von Reichs wegen ein würdiges Denkmal zu weihen, lebt immer von neuem auf und ist trotz des für uns ungünstigen Ausganges des Krieges unabweisbar. Denn in welcher anderen Zeit hätte wohl das deutsche Volk, in Sonderheit seine Frontkämpfer, ein größeres, ergreifenderes und wirkungsvolleres Heldentum an den Tag gelegt? Aber unser Schicksal und unsere Lage ist derart, daß sie uns nicht zu einem stolzen und prunkvollen Neubau hindrängt. Aus dieser Empfindung heraus ist der Plan entstanden, eine unserer altberühmten Burgen zum Reichsdenkmal der Gefallenen zu weihen. Zu den Burgen und Schlössern, die dafür in Betracht kommen, ja sogar zu einer schon getroffenen engeren Auswahl unter denselben gehört auch unsere sächsische Augustusburg, und ein durch seine Vaterlands- und Heimatsliebe wohlbekannter Mann, Geheimrat Meinel auf Tannenbergstal in Sachsen, hat soeben in einer an den Reichsminister des Innern gerichteten Eingabe diesen Plan mit warmen Worten empfohlen. So wird er binnen kurzem die Öffentlichkeit beschäftigen. Deshalb hat mich der Vorstand des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz ersucht, in den »Mitteilungen« von den mir naheliegenden landeskundlichen und geschichtlichen Gesichtspunkten aus über das genannte Schloß und die darauf sich erstreckenden Pläne zu berichten.


Die Augustusburg, 1568 bis 1572 erbaut, ist die Nachfolgerin der mittelalterlichen Burg Schellenberg. Diese lag, ebenso wie das heutige Schloß, auf der gewaltigen, rechts von der Zschopau, links von der Flöha umspülten Porphyrplatte, die wie ein gewaltiger Eckturm den Nordrand des eigentlichen Erzgebirges und zugleich den Punkt bezeichnet, in dem sich das westliche von dem östlichen Gebirge scheidet. Das Flöhatal gilt als die Grenze der beiden Gebiete. Diese Porphyrplatte schiebt sich von Öderan (d. h. »Ort bei den[362] Edern« = Zäunen, Grenzen) südwärts in den ungeheuren Grenzwald vor, der in alter Zeit als ein unbewohntes Puffergebiet zwischen der Mark Meißen und dem Herzogtum Böhmen lag. Dieser Grenzwald war kaiserlich, ebenso der hier hindurchführende Paß von Öderan über Zöblitz und Sebastiansberg nach Komotau oder von Chemnitz über Zschopau-Wolkenstein nach Preßnitz und ins Egertal. Der Eingang zu beiden Straßen, die zu den wichtigsten Verbindungsgliedern zwischen Nord- und Süddeutschland gehörten, wurde von der Burg Schellenberg beherrscht. Deshalb waren die ritterlichen Herren von Schellenberg, denen auch die Burgen Rauenstein an der Flöha und Lauterstein bei Zöblitz als südlich vorgeschobene Posten gehörten, nicht Vasallen der Meißner Markgrafen, sondern standen als edelfreie Ritter unmittelbar unter dem Kaiser. Erst als die kaiserliche Gewalt zertrümmert und das reichsunmittelbare Geschlecht der Schellenberg wegen eines Frevels, den es gegen das Kloster Altzella verübt hatte, geächtet war (1323), kam der wichtige Porphyrfelsen mit seiner Burg in den Besitz der Wettiner (5. April 1324), und nach der Leipziger Teilung (1485) in den Besitz der Albertinischen Herzöge von Sachsen. In der Zeit, wo sich der Schmalkaldische Krieg vorbereitete, hat sich in der Burg Schellenberg eine denkwürdige Szene zugetragen. Der Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen, in Sorge um die Zukunft seines vom Kaiser Karl V. mit Ächtung bedrohten Hauses, besuchte dort im Jahre 1545 zur Zeit der Hirschbrunft seinen Vetter Herzog Moritz und suchte im Vertrauen auf seine eigene Trunkfestigkeit dem in diesem Punkte schwächeren Moritz beim nächtlichen Gelage seine politischen Geheimnisse zu entlocken. Aber Moritz verriet sich nicht, nur wäre er bei der Heimreise nach Dresden an den Folgen des schweren Trunks fast gestorben. In der Tat wurde das Jahr 1547 das Schicksalsjahr der Ernestiner: sie verloren den größten Teil ihrer Länder an die Albertiner, aber es wurde auch das Schicksalsjahr der Burg Schellenberg: sie brannte im Jahre 1547 durch Blitzschlag ab. Zwanzig Jahre lang lag nun die Burg in Schutt und Asche. Da faßte Kurfürst August im April 1567 voll Siegesfreude über die Eroberung der Feste Grimmenstein zu Gotha den Plan, »weil solches des Hauses Sachsen ältesten Schlösser eines, aus erforderter Notdurft, auch zur Zierde des Landes alle solches Schlosses alte Gebäude abtragen zu lassen und zu verordnen, daß an der Stelle ein neues Schloß gebaut werde.« Er gewann dafür als Baumeister den Leipziger Bürgermeister Hieronymus Lotter, der elf Jahre zuvor mit unerhörter Geschwindigkeit den reizvollen Hallen- und Giebelbau des Leipziger Rathauses geschaffen hatte, und dieser an der Schwelle der Siebzig stehende Mann brachte wirklich in vierjährigem, heißem Bemühen den umfangreichen Schloßbau zustande (1568 bis 1572), die letzte Vollendung aber wurde, weil Lotter unverdientermaßen bei dem ungeduldigen Bauherrn in Ungnade gefallen war, dem italienischen Grafen Rochus zu Lynar anvertraut. Außer der Vorburg mit dem gewaltigen äußeren und inneren Tor und der hochgelegten steinernen Auffahrt zeigte das Schloß vier wuchtige, breit dastehende Ecktürme, die durch meist dreistöckige Flügel untereinander zu einem großen Rechtecke verbunden sind. Sie enthielten in reicher Fülle die Säle und Gemächer[366] für einen groß zugeschnittenen fürstlichen Hofhalt. Der Außenbau ist in schlichten, aber markigen Formen gehalten, die Innenräume waren vom Hofmaler Heinrich Göding nach den Angaben des Kurfürsten mit sinnvoller Malerei ausgeschmückt von teils lehrhafter, teils humorvoll-satirischer Art. So war in der »Turteltaubenstube«, wo sich die Hoffräuleins aufzuhalten pflegten, die Kurfürstin Anna über der Tür gemalt, wie sie mit strengem Blick darüber wacht, daß ja nichts Anstößiges geschieht, und neben ihr stand ein Fräulein, das den Pferdefuß, der als Strafe für Verstöße gegen den Anstand verwendet wurde, auf der Schulter trug. Weit berühmt waren die Bilder des »Hasenhauses«, in denen Göding, den Schlußgedanken des »Mümmelmann« von Hermann Löns vorwegnehmend, die Hasen als die eigentlichen Herren der Erde in der Ausübung aller menschlichen Geschäfte, auch als Staatsmänner und Kriegsleute dargestellt hatte, doch so, daß sie zuletzt wieder den Menschen unterliegen und wie einst in Pfannen und an Bratspießen ihr unrühmliches Ende finden.


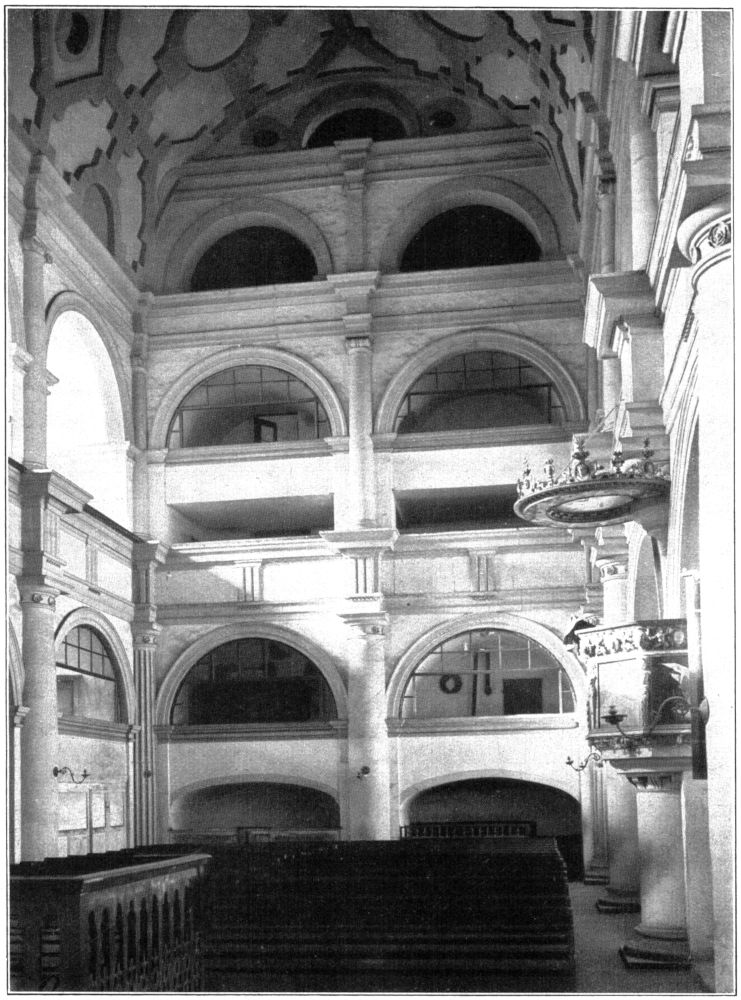
Ganz eigenartig ist die von dem Niederländer Erhard van der Meer geschaffene Schloßkirche. Sie entspricht als rechteckige Saalkirche durchaus den Anforderungen einer Predigtkirche. Über dem Schiff erheben sich die unten von steinernen Bögen und toskanischen Säulen, oben von jonischen Säulen getragenen Emporen, die von einer Decke überwölbt werden, bei der das gotische Rippenwerk durch ein der Kassettendecke sich näherndes System aus rotem Rochlitzer Stein ersetzt ist. Das Altarbild, ein Werk des jüngeren Cranach, zeigt unter dem Gekreuzigten den Kurfürsten mit acht Söhnen und die Kurfürstin mit sechs Töchtern. Es ist zugleich ein Totenmal: denn nur zwei von den Söhnen sind durch Medaillen an der Halskette und nur zwei von den Töchtern sind durch Kränze als noch lebend bezeichnet. Im Hintergrunde des Bildes sehen wir rechts die ehemalige Burg Schellenberg und links die Annaburg (in der jetzigen preußischen Provinz Sachsen). Kurfürst August war bei manchen Bedenken, die man gegen seinen Charakter erheben darf, ein ausgezeichneter Organisator der Volkswirtschaft und vor allem ein großer Lebenskünstler. Als Lotter wegen der starken Wirkung von Wind und Wetter auf der ganz frei gelegenen Höhe die Maße für die Fenster des Schlosses etwas klein genommen hatte, befahl ihm der Kurfürst in einem Briefe, sie größer zu machen, weil »in gewelben, tie (die) nicht genugksamb Wetter und Licht haben, ganz verdrießlich und langweilig zu wohnen« sei. Deshalb hatte der Kurfürst auch, die Gunst der Lage benutzend, angeordnet, daß der ganze Bau in der Höhe des dritten Stockes von einer breiten Galerie umzogen werde, die nach allen Himmelsgegenden hin freie Aussicht gestatte. Von dieser Galerie zeigte er im Jahre 1575 das vollendete Werk dem ihm gesinnungsverwandten Kaiser Maximilian II. und genoß mit ihm die herrliche Aussicht namentlich nach Süden in die wildreichen Bach- und Flußtäler und hinüber bis zur Kammlinie des Erzgebirges, die das entzückte Auge hier vom Keilberg im Westen bis zum Geising im Osten beherrscht. Von besonderen Merkwürdigkeiten erwähne ich noch die uralte sieben Meter im Umfang haltende, aber nur zwei Meter dreißig[367] Zentimeter hohe Linde, die mit der Krone in die Erde gepflanzt sein soll und sich so breit verästelt, daß sie von einem Balkengerüst gestützt wird, und den vom Freiberger Bergmeister Martin Planer in siebenjähriger Arbeit fast durch den ganzen Porphyrmantel des Berges einhundertundsiebzig Meter tief gesprengten Brunnen, für dessen Betrieb ein besonderes Göpelwerk vorhanden war.

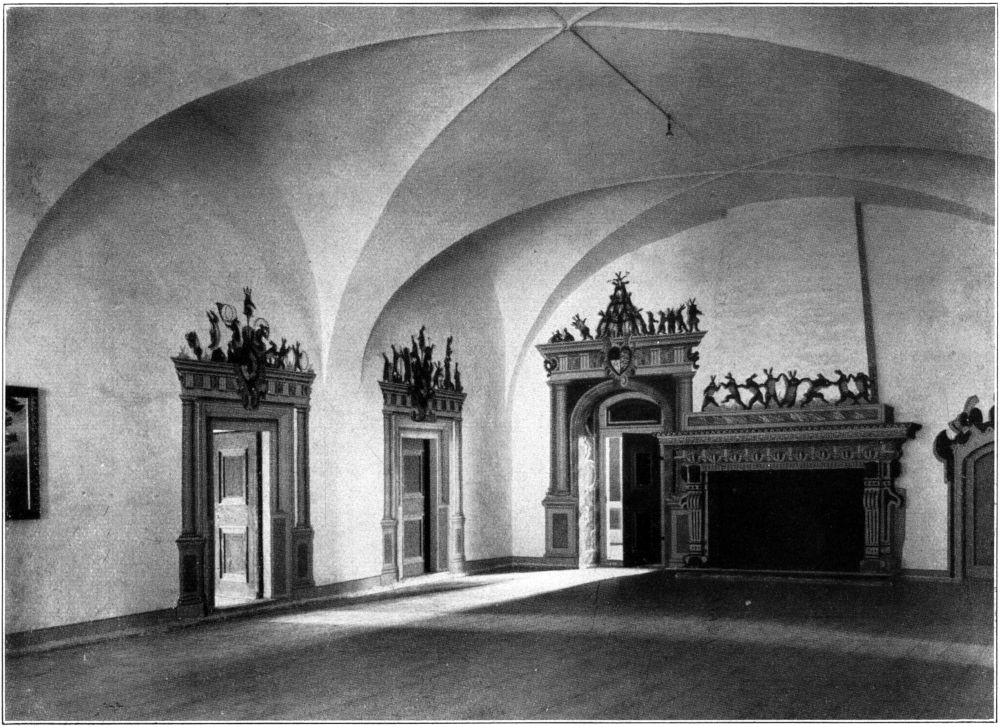
Leider ist von der ursprünglichen Schönheit der Augustusburg im Laufe der Jahrhunderte durch widrige Schicksale und Vernachlässigung viel abgebröckelt. Die Malerei ist an den meisten Stellen verblaßt, die aussichtsreichen Galerien und die sie überragenden Giebel und Dachgeschosse sind 1798 wegen Baufälligkeit abgebrochen worden. Dagegen ist die Kirche, abgesehen von einem, die alte feine Farbenstimmung störenden inneren Anstrich, völlig unversehrt erhalten, ebenso das gewaltige Mauerwerk der Türme und des ersten und zweiten Stockwerkes, auch ist das Schloß noch jetzt in allen Teilen bewohnbar. Einige Räume sind dem Erzgebirgs-Verkehrs-Museum zugewiesen, andere sind von Beamten und Behörden eingenommen, andere stehen leer, im Erdgeschoß herrscht ein lebhafter Gastwirtschaftsbetrieb. Denn Schloß Augustusburg ist schon jetzt zu allen Jahreszeiten das Ziel von Tausenden von Wanderern, die aus der näheren und weiteren Umgebung dort zusammenströmen.


Aber – und nun kommen wir zur Hauptfrage – ist es denn geeignet, eine würdige Erinnerungsstätte an unsere Toten aus dem Weltkriege zu werden? Ich kann diese Frage nur bejahen. Denn hier vereinigen sich alle Erfordernisse der Natur und Lage, der Geschichte und Kunst zu einer nur an wenigen Punkten in gleichem Maße wiederkehrenden Harmonie. Die riesige Porphyrplatte (zweihundertundzwanzig Meter über die Umgebung emporragend) ist auch ohne das darauf ruhende Schloß ein bedeutendes Denkmal der Natur, eine Art von natürlichen Aussichtssöller für das Mittelstück des deutschen Mittelgebirges, und die darauf errichtete Burg war gleich von Anfang an ein Stück steingewordener Fürsorge der lebendigen Reichsgewalt, eine Warte des nord- und süddeutschen Verkehrs in der großen Zeit der Kreuz- und Römerzüge und dann eine weithinleuchtende Stätte landesfürstlicher Wirtschaftlichkeit. Aber auch ohne alle diese geschichtlichen Erinnerungen eignet sich Schloß Augustusburg zum Reichsdenkmal der Gefallenen durch die ganze würdige und großzügige Art des Bauwerks, durch seine schöne Lage und leichte Erreichbarkeit. Hier brauchen nicht ungezählte Millionen in einen ungewissen Baugrund versenkt zu werden: das Schloß thront auf seinem Porphyrfelsen wie ein Bau für die Ewigkeit, das vorhandene Mauerwerk ist stark und tragfähig. Es kommt nur darauf an, das Schloß in seiner ursprünglichen Höhe wieder herzustellen, d. h. das abgebrochene dritte Stockwerk, von dem es gut beglaubigte Abbildungen gibt, in seiner alten Höhe und Schönheit wieder aufzubauen und mit der nach allen Himmelsrichtungen ausschauenden Galerie zu umziehen. Diese bietet dann Raum, daß an Sonn- und Festtagen Hunderte von Menschen gleichzeitig den entzückenden Ausblick in die nahen Wald- und Flußtäler, über[373] die reich angebaute Landschaft, die deutschen Ackerbau und deutsche Industrie vermählt, und hinüber auf die stille Kammlinie des Gebirges genießen und dabei an ihre gefallenen Lieben und an die Zukunft des deutschen Volkes denken können. Alle Wohnungen, Amtszimmer und der Gastwirtschaftsbetrieb müßten natürlich aus dem Schlosse verschwinden; dann würden seine Säle und Zimmer dazu ausreichen, für die Toten jeden Armeekorps und jedes Geschwaders unserer Marine einen besonderen Erinnerungsraum zu schaffen! Die Kirche wird der natürliche Ort werden für Gedenkfeiern der Vereinigungen ehemaliger Frontkämpfer; ein gewaltiger Felsblock im Hofe oder im Schloßgarten würde die lapidare Weiheinschrift für das Ganze enthalten. Die ganze Umgebung des Schlosses müßte durch Haine mit deutschen Laub- und Nadelbäumen und Zypressen auf die im Schlosse herrschende Stimmung vorbereiten, ebenso die aus der Ebene und aus den Waldtälern zum Schlosse führenden Wege und Straßen. Und wie leicht ist dieses in der Mitte Sachsens, im innersten Herzen des Reiches gelegene Denkmal auch von den Rändern der deutschen Erde zu erreichen! Es ist schon jetzt mit der großen Verkehrslinie München–Hof–Dresden–Breslau von der Station Flöha aus durch die Zschopautalbahn und eine Drahtseilbahn verbunden. So führt also die Linie Hof–Chemnitz den süddeutschen, die Linie Leipzig–Chemnitz den westdeutschen, die Linie Berlin–Chemnitz den nord- und nordostdeutschen, die Linie Breslau–Dresden den ostdeutschen Verkehr heran, und bei ganz großen nationalen Feiern gestattet die Nähe der Großstädte Dresden, Leipzig und Chemnitz, auch sehr große Volksmassen unterzubringen. Schon jetzt sieht jeder, der von Hof oder Zwickau nach Dresden und Breslau fährt, die eigenartige Umrißlinie des Schlosses Augustusburg am Horizont auftauchen und wieder verschwinden und wieder auftauchen. Um wieviel mehr wird das der Fall sein, wenn der Bau in seiner alten Höhe wieder hergestellt ist und wenn seine ganz besondere Bestimmung und Weihe die Blicke aller Mitreisenden in ganz anderem Maße und mit viel tieferer innerer Teilnahme darauf hinlenken.

Von Dr.-Ing. Hugo Koch, Nerchau-Leipzig
Aufnahmen von Walther Möbius, Dresden
Großsedlitz, einst das schönste und charaktervollste Gartenkunstwerk der Zeit Augusts des Starken, ist heute ein vergessenes Paradies, der Gefahr des Verfalles preisgegeben. Nur schneller Eingriff und gründliche Arbeit vermag das Gartenkunstwerk lebendig zu erhalten, das zu den schönsten Werken der Barockzeit zählt und zweifellos in der Kunstgeschichte des Gartens eine bedeutende Stellung einnimmt. Möchte die kurze Besprechung dieses seltenen Gartenbauwerkes die verantwortlichen Stellen auf seine Bedeutung aufmerksam[374] machen und die daraus sich ergebende Verpflichtung zur Erhaltung dieses Kunstbesitzes wecken.
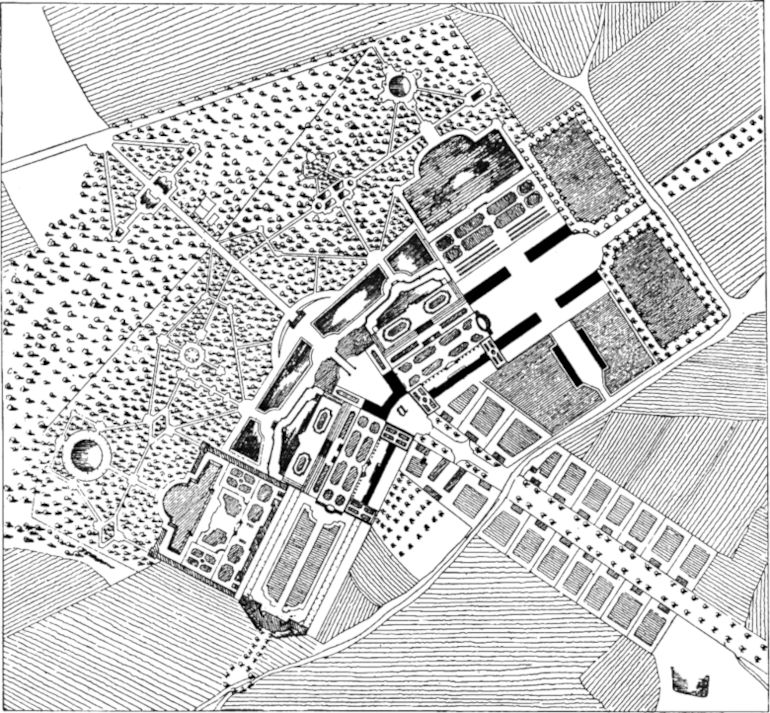
Mit August dem Starken war für Sachsen eine Zeit größter fürstlicher Prachtentfaltung gekommen. Sie blieb nicht stecken in vergänglichen Hoffesten und Prunkschaustellungen, sondern zeitigte durch prächtige Schöpfungen der Architektur und Gartenkunst dauernde Kunstwerte, denen heute noch Dresden, die fürstliche Residenz, ihre Bedeutung verdankt. Der König ging als erster Bauherr voran, ihm folgten im Wettstreit seine Getreuen, als einer der bedeutendsten unter ihnen Graf Wackerbarth, – der Begründer von Großsedlitz.
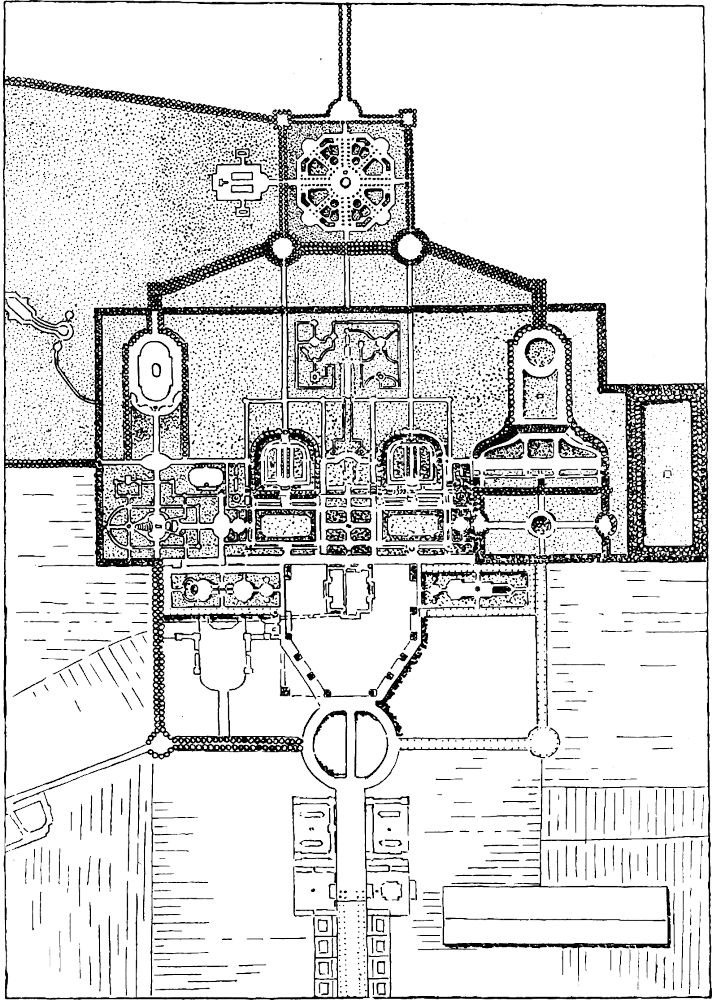
In der Geschichte des sächsischen Gartens hat sein Name einen guten Klang, gehen doch neben Großsedlitz noch andere beachtliche Gartenkunstwerke – Wackerbarths Ruhe in der Lößnitz und die großzügige Gartenplanung am Schlosse zu Zabeltitz – auf seine Initiative zurück. Sein bevorzugter Architekt war Knöfel. Johann Christoph Knöfel, oder Knöffel, wurde 1686 zu Dresden geboren – 1722 wurde er Landbaumeister – 1728 Oberlandbaumeister. Im Schaffen Augusts des Starken tritt er noch wenig hervor. Unter August II. arbeitete er viel für den allmächtigen Minister des Königs, Brühl. Der Brühlsche Garten zu Dresden, die große Gartenanlage zu Pforthen gehen auf ihn zurück. Er war noch verhältnismäßig jung an Jahren, als ihn Wackerbarth mit der Großsedlitzer Planung betraute. Wenn wir dies nur vermuten und über die Künstler, die in Großsedlitz tätig waren, nur wenig Bestimmtes wissen, so liegt es daran, daß die einzigen Zeugen, die Entwürfe, Zeichnungen und Rechnungen bei dem Brand seines Wohnhauses, des Gouvernementsgebäudes zu Dresden am 19. Januar 1728 verloren gingen.
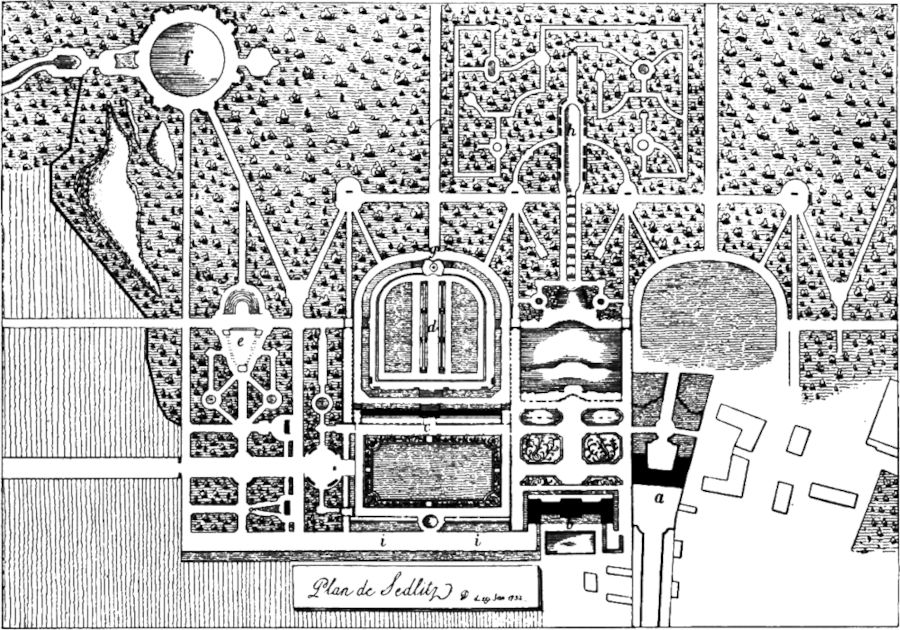
Großsedlitz, in Verbindung mit dem kaum eine Viertelstunde nordwestlich gelegenen Dorfe Kleinsedlitz, war ehedem ein schriftsässiges Rittergut. Eine große Feuersbrunst am 23. August 1715 (vgl. »Geschichte des Königlichen Schlosses und Gartens und Erklärung der Statuen des Parkes« von G. A. Abendroth. Zweite Auflage 1881) mag die Veranlassung gegeben haben, daß Heinrich Gottlob von Wolffersdorff am 21. Juli 1719 das Rittergut Groß- und Kleinsedlitz für zwanzigtausend Gulden an den Grafen von Wackerbarth verkaufte. Nun begann ein umfassendes Planen und eine rege Bautätigkeit. Bereits am 29. September 1719 wurde vier Einwohnern zu Kleinsedlitz durch den Beauftragten des Grafen, den Oberkommissarius Hofrat Matthäus Gärtner, eröffnet, »daß Se. Exzellenz auf’m Erlichtberge sich ein Gebäude aufzuführen Willens sei, wozu er ihre daselbst gelegenen dreieinviertel Acker zweiundzwanzig Ruthen nötig habe«. Gleichzeitig wurde die Planung von Großsedlitz in Angriff genommen, denn am 6. Oktober 1719 meldete der Hofrat Gärtner dem Gerichtsverwalter Barth, »daß er Dienstag, den 11. Oktober, früh in Großsedlitz eintreffen werde, um denen, so zu dem zu erbauenden Palais Land abgetreten, dafür Felder auf dem Kleinsedlitzer Berge abzustecken und mit Pflöcken zu berammen«. Beide Planungen für Klein- und Großsedlitz standen miteinander in Beziehung. Wie immer das Bestreben jener Tage dahin ging, die ganze Umgebung in die Komposition einzubeziehen, war das[375] auf dem Erlichtberge in Kleinsedlitz geplante Schloß mit Garten, Terrassen und reichen Kaskadenanlagen, für welche das abschüssige Gelände nach dem Elbtale zu sehr glücklich benutzt werden sollte, ausersehen, mit der Planung für Großsedlitz auch den Blick auf Dresden und das westliche Elbtal zu erschließen. Die beiden großen Anlagen sollten durch zwei Lindenalleen verbunden werden. Durch Aufgabe des Projektes auf dem Erlichtberge kam hiervon nur ein Teil zur Ausführung. Alle Mittel wurden auf die Großsedlitzer Anlage verwandt.
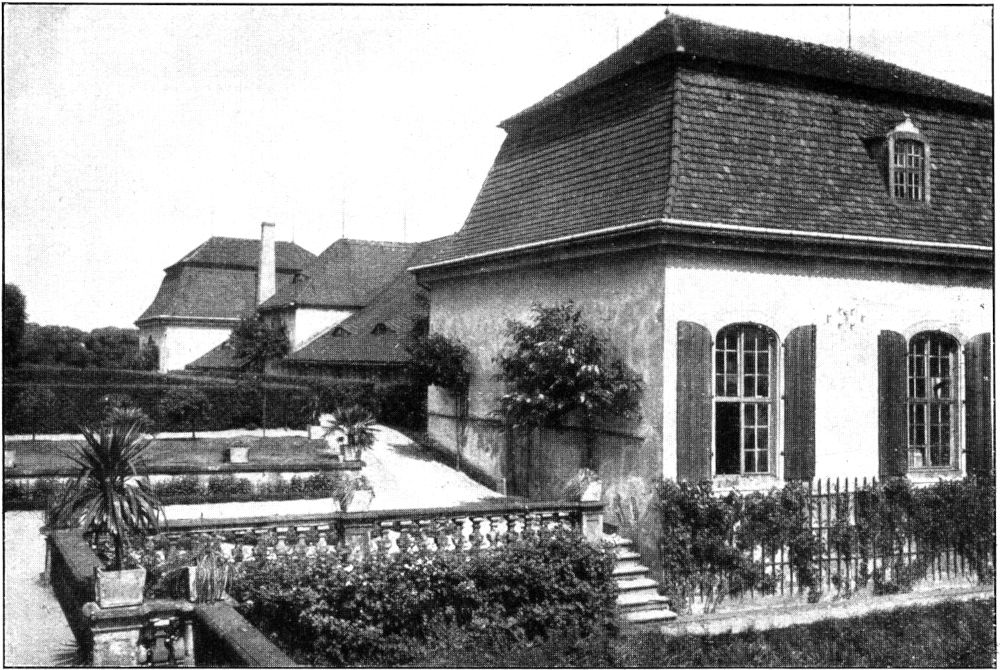
Wir sind von der Planung unterrichtet durch den Entwurf, der sich in der Kartensammlung der Staatsbibliothek in Dresden erhalten hat mit der Bezeichnung: »Projet du Château et Jardin de Sedlitz près de la ville de Dresde au Comte de Wackerbarth,« ohne Namen des Verfertigers (Abbildung 1). Er dürfte auf Knöfel zurückzuführen sein.
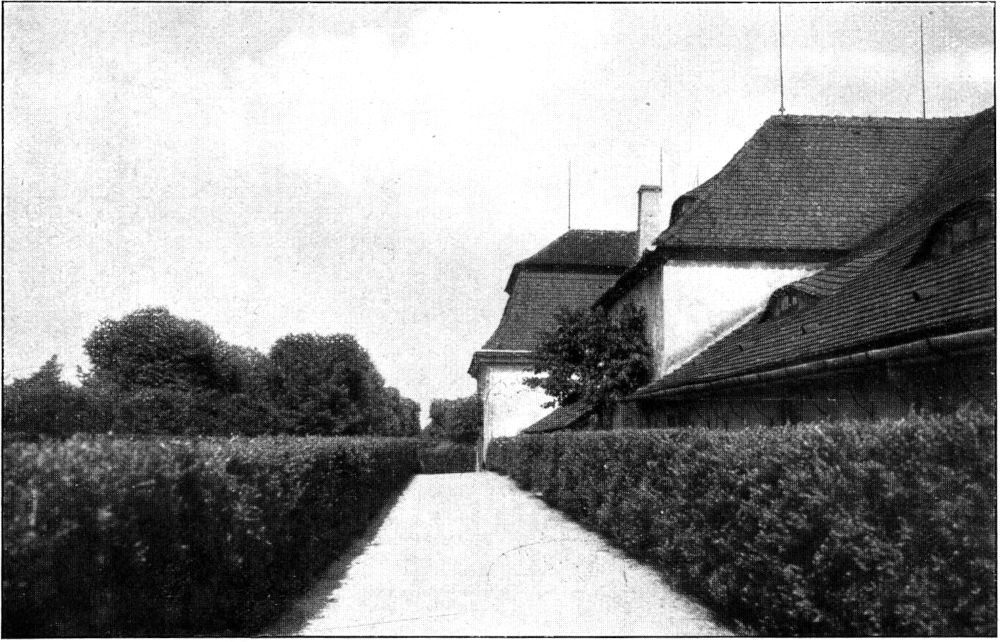
Der Schöpfer der Planung machte sich eine Taleinsenkung des Geländes in geistreicher Weise zunutze. Das Schloß mit zwei weit vorspringenden Flügelbauten und die zu beiden Seiten im stumpfen Winkel symmetrisch sich anfügenden Orangeriegebäude bilden als beherrschende Baugruppe den Zielpunkt der Anlage. In den Achsen der drei Gebäude führen Terrassen und reiche Wasseranlagen zur Taleinsenkung hinab, während das ansteigende Gelände gegenüber als Waldstatt, durchschnitten von Schneisen, ausgebildet ist. An diesen beherrschenden Mitteltrakt schließt rechts und links je eine weitere Anlage an. Wirtschaftsgebäude, Orangerie und Pavillonbauten dienen als Dominanten der dem Gelände wiederum gut angepaßten Gartenanlagen. Auch hier setzen weit in die Landschaft fortgeführte Alleen das Schloß mit der weiteren Umgebung in Beziehung.
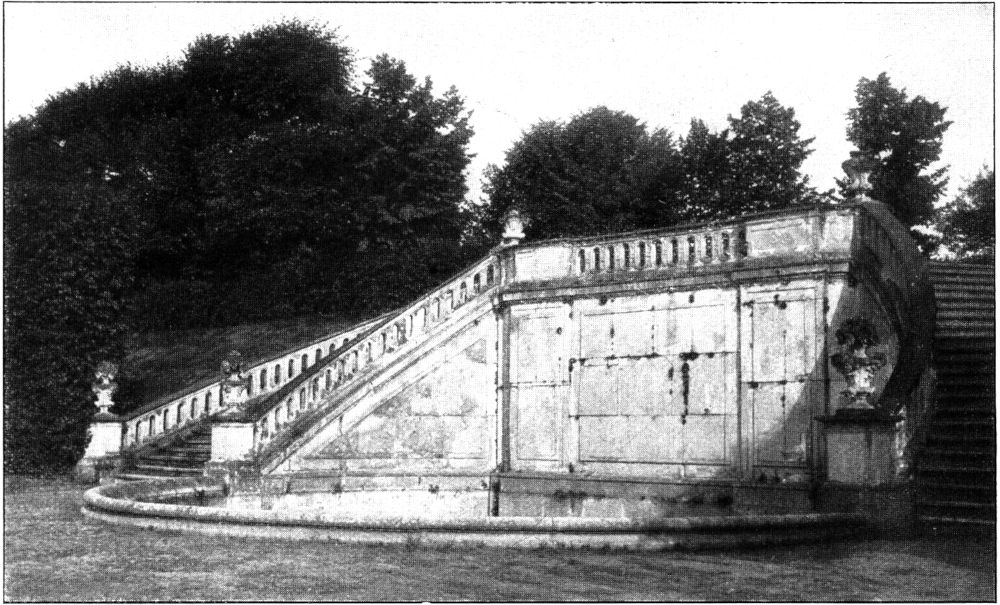
Schloß und Orangeriegebäude kamen zuerst zur Ausführung. Doch schon im Januar 1723 ging das Besitztum an den König über mit der Bestimmung, daß Graf Wackerbarth über den eingetretenen Besitzwechsel Stillschweigen zu beobachten und die Vollendung der gesamten Anlage in seinem eigenen Namen, aber nach Angaben und auf Kosten des Königs, auszuführen hatte. Die Geheimhaltung des Kaufes dauerte bis 1726, in welchem Jahre die öffentliche Übergabe an den König erfolgte. In jene vier Jahre fällt die Herstellung der Gartenanlagen, wie diese in ihrer Grundform noch heute erhalten sind.
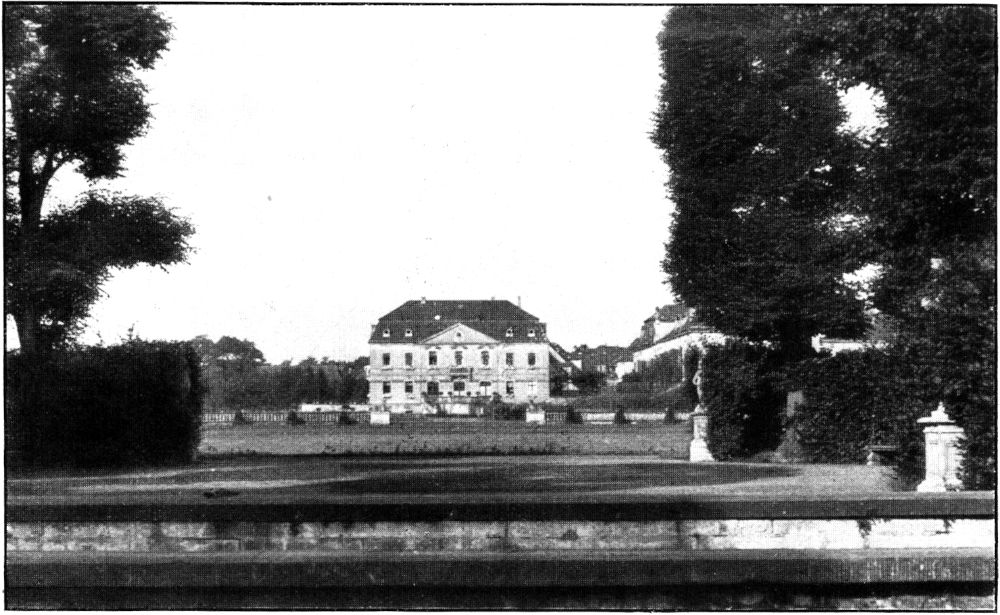
Was tat nun der König? Ihm konnte bei seinen königlichen Bedürfnissen das von Wackerbarth erbaute bescheidene Schlößchen nicht genügen. Er erkannte wohl auch mit seinem sicheren, künstlerischen Blick, daß das Schloß in seiner Anlage wenig glücklich in den Raum komponiert war, daß es bei seinen bescheidenen Abmessungen, es bestand nur aus Erdgeschoß und einem Stockwerk, nicht vermochte, der weitausgedehnten Anlage den beherrschenden Mittelpunkt zu geben. So ging er ans Um- und Neuplanen, und es ist naheliegend, daß er dazu die Künstler heranzog, mit denen er seine sonstigen Baupläne durchführte. – Pöppelmann, den bewährten Zwingerbaumeister und Zacharias Longuelune. Letzterer war 1664 in Paris geboren und herangebildet, gehörte zu dem Kreis von Künstlern, welcher sich am Hofe König Friedrichs I. von Preußen versammelt hatte und trat nach des Königs Tod 1703 in sächsische Dienste. Mit Longuelune fand[376] in Sachsens Gartenkunst der großzügige Stil Lenôtres, des berühmten Schöpfers der Versailler Gartenanlagen, Eingang, und man darf wohl mit Sicherheit annehmen, daß ihm der Hauptanteil an der nunmehr vom König zur Durchführung gebrachten Großsedlitzer Gartenschöpfung gebührt, während Einzelteile der architektonisch-plastischen Arbeiten auf die Meisterhand Pöppelmanns zurückzuführen sind. Auch urkundlich ist bestätigt, daß Pöppelmann bei der Sedlitzer Planung tätig gewesen ist.
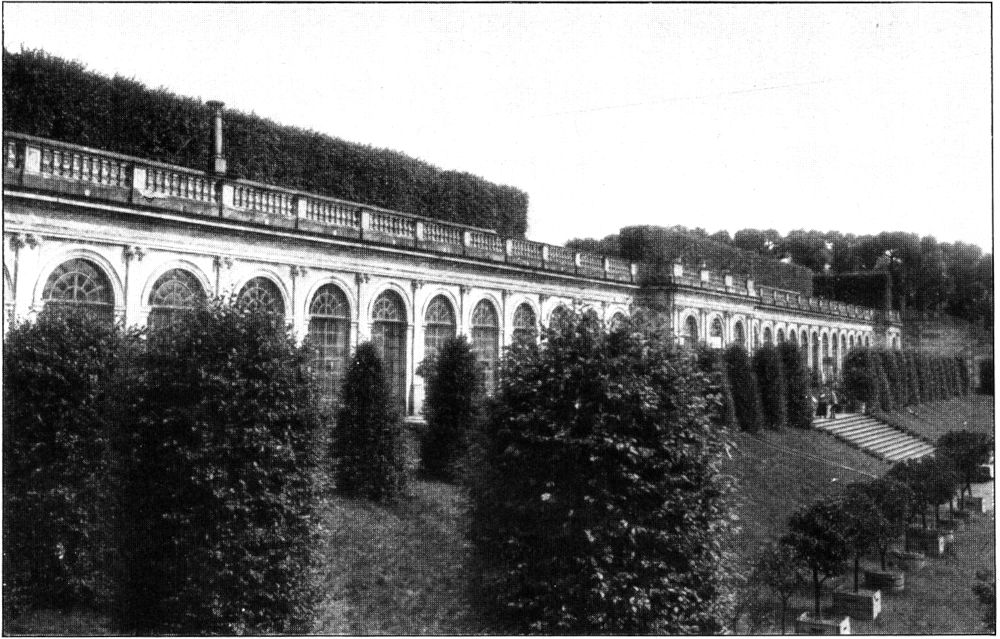
Nachdem der König es aufgegeben hatte, die Zwingeranlagen zu vollenden, wendete er sich mit großem Eifer der Sedlitzer Anlage zu. In der Sammlung für Baukunst an der Technischen Hochschule in Dresden und anderen Sammelstätten finden sich noch heute eine Reihe von Plänen, die des Königs korrigierenden Stift zeigen. Was letzten Endes das Ziel seiner Pläne war, zeigt ein Originalplan im ehemaligen Königlichen Oberhofmarschallamt in Dresden. (Abbildung 2.)
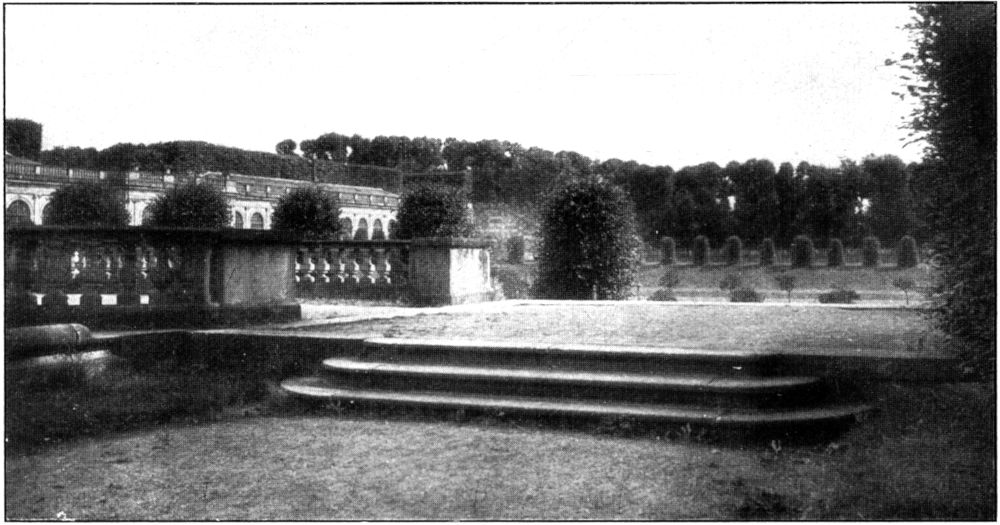
Das Schloß wird ganz ausgeschieden aus der Planung, die Hauptachse der Gartenanlage auf das von Knöfel erbaute Orangeriehaus verlegt und an dessen Stelle ein großer Schloßbau geplant. Diese Achse wird im Garten zur beherrschenden erhoben durch reiche Kaskadenanlagen, die sich die Taleinsenkung des Geländes zunutze machen. Zu beiden Seiten sollte in der Tiefe, symmetrisch zur Hauptachse, je ein Orangerieparterre mit Orangeriehaus liegen, von denen nur das linke zur Ausführung kam. In ihrer Mittelachse führen aufsteigende heckenbegrenzte Wege zu einem quadratischen Platze, der, dem Schloß gegenüberliegend, als Abschluß der den Wald durchschneidenden Kaskade geplant war. In seiner Mitte liegt ein großes Wasserbecken. Ein Parterre von achteckiger Form, mit Pavillonbauten an den Eckpunkten, umschließt es. Eine lange Allee in der Achse des Schlosses führt den Blick in die weite Landschaft, und weitere zwei- und vierreihige Alleen stellen die Verbindung mit der übrigen Gartenplanung her; denn seitlich der Orangerieparterre schließen weitere Anlagen an, die als Waldstätten durchgebildet sind und im Geiste der Zeit Stätten gesellschaftlichen Lebens, Stätten des Spiels, lauschige Plätze und ruhige Wasserbecken bergen.

Damit war eine Planung geschaffen, die durchaus den Anforderungen eines glänzenden Hofes in einer prachtliebenden Zeit entsprach. In ihrem architektonischen Aufbau wie in der Einzeldurchbildung stellt sie ein Meisterwerk dar, dessen einzigartige Wirkung wir uns wohl vorzustellen vermögen, wenn wir die auf uns überkommene Anlage im Geiste entsprechend ergänzen. Denn leider reichten die Mittel des Königs nicht zur völligen Durchführung des Planes. Von dem gesamten Entwurf kam nur der östliche Teil, und auch dieser nur teilweise zur Ausführung.
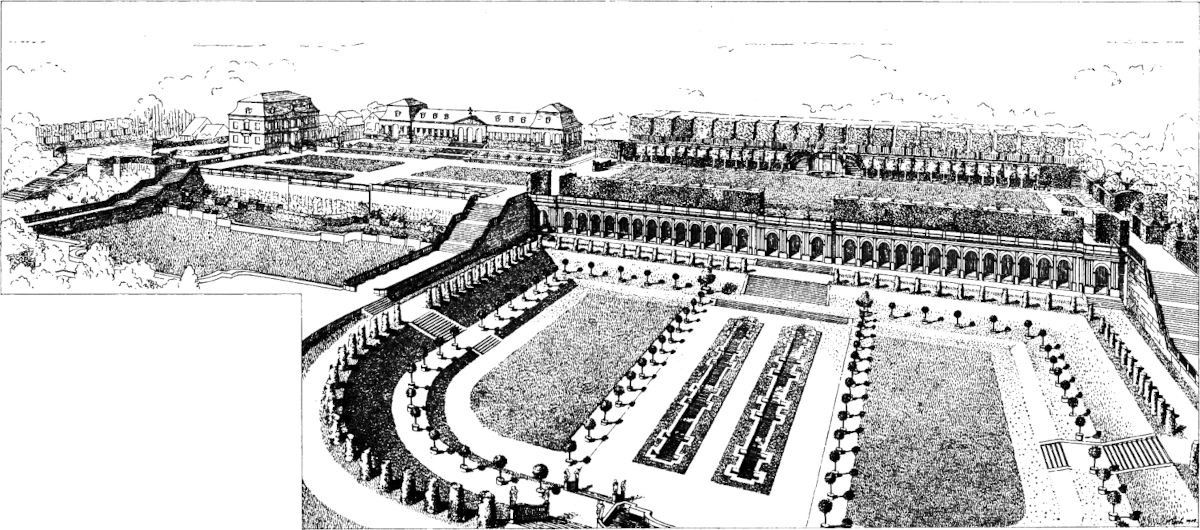
Ein Originalplan der Staatsbibliothek in Dresden, bezeichnet: »Plan de Sedlitz 29. Januar 1732«, gibt den Zustand der Schöpfung wieder, wie sie gegen Ende der Regierungszeit Augusts des Starken geplant war und wie sie nahezu auf uns überkommen ist. (Abbildung 3.) Denn nach dem Tode des kunstsinnigen Königs (1733) erlosch das Interesse für Großsedlitz. Sein Sohn[377] und Nachfolger August II. führte den großzügigen Plan seines Vaters nicht weiter, wenn er auch hier oft sein Hoflager aufschlug und die Ordensfeste in alter Pracht mit wenigen Unterbrechungen jährlich am 3. August hier feierte. Noch 1756, während Friedrich der Große schon seine Zurüstungen zum Einmarsch in Sachsen vorbereitete, hielt er unter Lust und Jubel ein Ordensschießen ab. Niemand ahnte wohl damals, daß anstatt der lustigen Fanfaren beim Ordensfest schon wenige Wochen danach die Kriegstrompete hier erschallen würde, daß die friedlichen Räume und die Wasserkünste zerstört, die kupferne Bedachung des großen Orangeriehauses herabgerissen und in die feindlichen Arsenale gesendet, die Statuen aber fast ohne Ausnahme verstümmelt sein würden, wie uns Abendroth berichtet. Neue Kriegsstürme um 1813, in welchen der Garten selbst zum Schauplatze von Kämpfen wurde, schlugen weitere Wunden.

Erst unter König Friedrich August II. (1836 bis 1854) und seinem Nachfolger ging man an den Wiederaufbau. Zunächst wurde ein Teil der Statuen, die neunzig Jahre verstümmelt und grau mit Moos und Flechten überwachsen auf ihren Postamenten gestanden, in alter Weise hergestellt, ein Umbau der großen Freitreppen am Orangerieparterre vorgenommen und die Orangeriehäuser[379] erneuert. Das 1813 zerstörte Schloß wurde in den Jahren 1872 bis 1874 nur etwa in ein Drittel der alten Größe wieder aufgebaut. War es schon vorher zu bescheiden in seinen Abmessungen, um der großzügigen Gartenplanung einen wirkungsvollen Abschluß zu geben, so steht es nunmehr als ein bescheidener Bau ohne rechte Beziehung ziemlich verloren in der Gesamtanlage. Und endlich wurde aus mangelnden Mitteln auf die Wiederherstellung der Wasserkünste verzichtet und damit der Anlage ein Hauptreiz genommen. Wenn wir auch annehmen müssen, daß die früheren Wassermengen nicht eben bedeutende waren, so dürften sie doch genügt haben, um die gewollte Wirkung einigermaßen zu erreichen. Die wenigen durch eine neue Leitung heute mit Wasser gespeisten Becken können nicht als Ersatz gelten. Wenn trotzdem der Garten von Großsedlitz auch heute noch eine tiefe Wirkung ausübt, so vermag man zu erkennen, welch bedeutsames Kunstwerk hier entstehen sollte, dessen heutige Gestalt wir nunmehr durch einen Rundgang kennenlernen wollen.
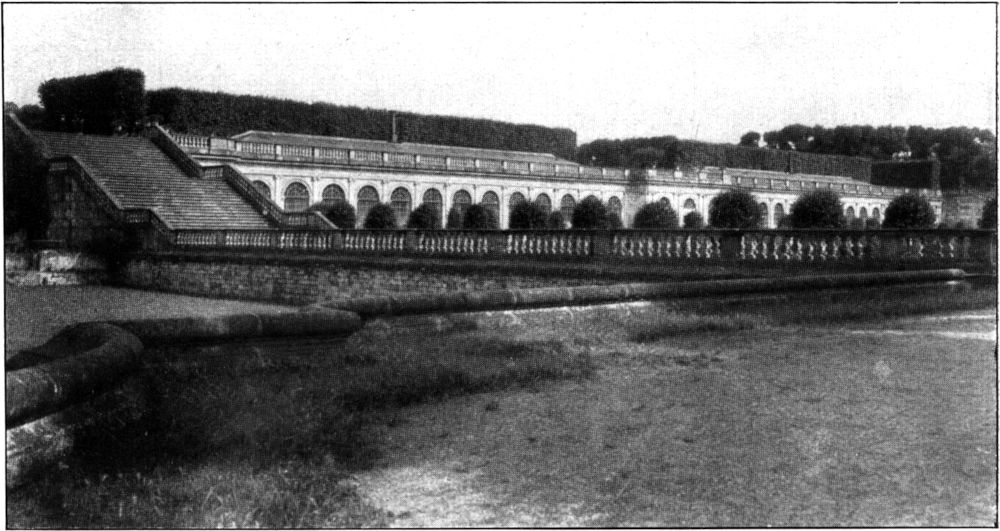
Wir betreten heute den berühmten alten Garten durch die Gärtnerwohnung hinter dem Knöfelschen Orangeriebau und befinden uns hier auf der oberen Terrasse, auf welcher in der Planung Augusts des Starken (Abbildung 2) die Schloßbauten entstehen sollten. Hier erschließt sich ein reizvoller Blick auf die Rückseite des Knöfelschen Orangeriebaues. (Abbildung 4 und 5.) Beschnittene Hecken säumen die Wege und umschlossen einst ein großes Wasserbecken (Abbildung 3) von dem die Speisung einiger Wasserkünste erfolgte. Heute ist die Fläche zu Frühbeetanlagen ausgenutzt. In der Mittelachse führt eine breite, im Schnitt gehaltene Allee (i i auf Abb. 3) auf der oberen Terrasse entlang,[381] mit steinernen Ruhebänken zu beiden Seiten. In der Mitte öffnet sich eine freie Aussicht auf den tiefer liegenden Garten. Wir stehen oberhalb eines runden Wasserbeckens, aus welchem ehemals drei glitzernde Wasserstrahlen emporstiegen. Feingeschwungene Freitreppen vermitteln den Höhenunterschied von etwa vier Meter. Die Balustraden zieren große Vasen mit Reliefporträts in feiner Sandsteinarbeit. (Abb. 6.) Wir gelangen hinab in ein großes Parterre, einem ebenen Wiesenplan, der ehemals durch eine reich verzierte Borde eingefaßt war. Nach einem Plane in der Sammlung für Baukunst sollten an den Längswänden, die durch Heckenwände oder Gitterwerk gebildet waren, zwischen Ruheplätzen in halbkreisförmigen Nischen je fünf Wasserkünste, insgesamt zwanzig, das Bild beleben. Heute sind nur noch die begrenzenden Heckenwände vorhanden und trotz aller Einfachheit ergibt sich auch heute noch durch die fein abgewogenen Raumverhältnisse ein starker Eindruck. Rechts, nach dem Schlosse zu, ist das Parterre durch eine Steinbalustrade abgeschlossen. Zwei steinerne Sphinxe bewachen den Eingang, während nach links Waldstätten anschließen. Wir gelangen hier zunächst in ein großes Rundteil von etwa achtundzwanzig Meter im Durchmesser, wo vier Statuen, die Allegorie des Ackerbaues, der Fischerei, die Siegesgöttin Viktoria und die Hygiea wirkungsvolle Aufstellung gefunden haben. In den anschließenden Waldstätten war eine Kegelbahn untergebracht und ein Naturtheater geplant, was jedoch heute nicht mehr vorhanden ist und wohl überhaupt nicht zur Ausführung kam. Die Längsachse des großen Wiesenparterres findet nach links ihren Abschluß durch ein sogenanntes »Aha«. Die Einfriedigungsmauer ist hier unterbrochen[382] und der Abschluß durch einen gemauerten Graben ersetzt, damit der Blick ins Weite geführt wird. Im Vordergrund auf Abbildung 7 ist das Aha zu erkennen und zeigt das Bild den Blick von hier nach dem Schlosse zu.
Wir kehren nach dem Wiesenparterre zurück und treten auf einen der drei bastionartigen Austritte oberhalb des durch Longuelune geschaffenen Orangeriegebäudes. Hier bietet sich ein köstliches Bild. (Abb. 8 und 9.) In der Tiefe breitet sich das Orangerieparterre aus, dessen ursprüngliche Gestalt in einem Originalplan in der Sammlung für Baukunst ersichtlich und in meiner »Sächsischen Gartenkunst« wiedergegeben ist. Den Mittelweg flankieren zu beiden Seiten lange schmale Wasserbecken, in denen einst je neun kleine Fontainen sprangen. Auf den Wegen, die den vertieften Rasenplatz umgeben, stehen noch heute eine große Anzahl Orangeriebäume. Ehemals war die Orangerie dieses Gartens sehr berühmt. Iccander berichtet »von dem Hoch-Reichs-Gräflichen Wackerbarthischen Garten zu Sedlitz, der seinesgleichen weit und breit in Deutschland nicht haben wird, daß der fleißige orientalische Kunst- und Lustgärtner Herr Meyer mehr als zwanzigtausend rare Indianische und andere ausländische Gewächse konservieret und man zwei amerikanische Aloen siehet, die wohl in kurzer Zeit zur Blüte getrieben werden dürften«. Am etwas erhöhten äußeren Rand des Parterres stehen stumpfe, kegelförmig verschnittene Buchen, so weit gesetzt, daß der Durchblick noch frei, aber in der Perspektive das Bild geschlossen erscheint, und der Blick auf die Mittelgruppe, die sogenannte »stille Musik«, gelenkt wird (Abb. 10), ein Meisterwerk Pöppelmannscher Gestaltungskraft. Zu beiden Seiten eines Wasserbeckens führen geschwungene Treppen[384] hinauf zum oberen Parterrerundgang. Zwölf kleinere Figuren von ungemein reizvoller Wirkung zieren die Treppenbalustraden. Darstellungen musizierender Tritonen haben ihr den Namen »stille Musik« gegeben – mit vollem Recht. In der Mitte des Wasserbeckens sprang einst eine Fontäne, die den Blick weiter hinaufführte in die freie Landschaft, denn eine Allee durchschneidet die hohe noch unter Schnitt gehaltene Waldstatt, die das Parterre bogenförmig abschließt. Zu den hohen dunklen Heckenwänden stehen die weißen Statuen in ihrer bewegten Haltung in wirkungsvollem Gegensatz. Wenn Großsedlitz weiter nichts böte, als dieses in Abmessungen und räumlicher Gestaltung wundervoll gelungene Orangerieparterre, so genügte es allein schon, um diese Gartenschöpfung als eine der bedeutendsten aller Zeiten zu bezeichnen. Daraus ist zu ermessen, daß diese Anlage unbedingt vor weiterem Verfall geschützt werden muß. Vor allem bedürfen die in ihren Abmessungen so trefflich gelungenen Treppenanlagen zu beiden Seiten des Parterres wie auch die »stille Musik« dringend einer gründlichen Ausbesserung. Die vor dem Orangeriehaus heute aufgeschlagene Freilichtbühne stört durch ihre Stuhlreihen den großen Eindruck und würde besser in einem abgeschiedeneren Teil des Parkes untergebracht werden.
Wir benutzen nun die großen Freitreppen, um vom oberen Wiesenparterre nach der »stillen Musik« zu gelangen und von hier aus das gegenüberliegende Parkbild zu genießen. (Abb. 11 bis 13.) Mit großem Geschick ist der Höhenunterschied zwischen dem oberen Wiesenparterre und dem[387] tieferen Orangerieparterre zur Anlage des Orangeriehauses benutzt. Es wurde im Jahre 1862 neu aufgeführt, auch mit Wasserleitung versehen und öffnet sich in weiten Bogen nach dem Garten zu, so recht geeignet, in heißer Sommerszeit schattigen Wandelgang zu bieten. Der Entwurf Longuelunes hierfür ist noch erhalten, aus dem ersichtlich ist, daß statt der Rundbogenfenster früher Flachbogenfenster gewählt waren. Die große Horizontale des Baues wird unterstrichen durch hohe beschnittene Heckenwände, hinter denen die kubisch beschnittenen Alleen der höher liegenden Gartenteile sichtbar werden.
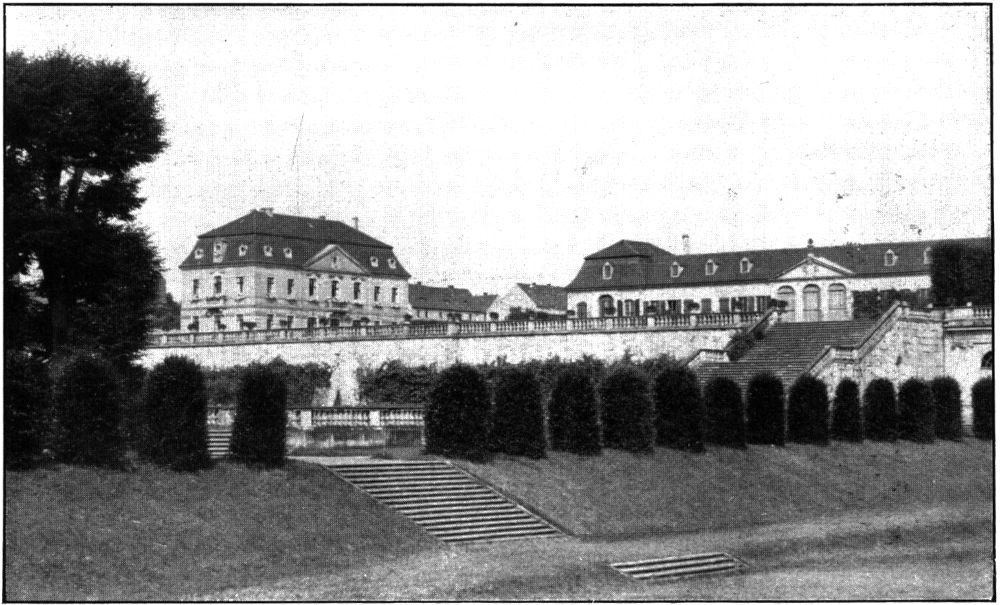
Wenden wir den Blick weiter westlich, so erscheint ein noch malerischeres Bild. Den oberen Abschluß, auf schmaler Terrasse, bildet das alte Gewächshaus, von Knöfel erbaut, einfach in den Formen, doch im Umriß fein abgestimmt. (Abb. 14.) An dieser Stelle war in der erweiterten Planung von August dem Starken der große Schloßbau geplant und daher diese Achse als Hauptperspektive besonders reich ausgebildet worden. Wenige Stufen führen vom Orangeriebau Knöfels zu dem vorliegenden großen Hauptparterre hinab, in vier Felder gegliedert, von denen die hinteren zwei nach Art der Teppichbeete ehemals reich geziert waren. Heute haben hier die Arzneipflanzen-Siedlungen der Hofapotheke ihren Platz gefunden. Störend wirken die vielen großen Namentafeln, die etwas kleiner auch ihren Zweck erreichen und nicht so unangenehm auffallen würden, wie überhaupt hier in der Kriegszeit angepflanzte Nutzsträucher und dergleichen endlich beseitigt und gepflegte Anlagen geschaffen werden sollten. Vor den ehemaligen zwei großen Teppichbeeten liegen zwei große Wasserbecken, deren Brunnen heute nicht mehr springen.[388] (Abb. 15.) Eine Steinbalustrade als Bekrönung der hohen Futtermauer schließt dies Parterre gegen den tiefer liegenden Garten ab, zu welchem reich gegliederte Kaskadenbecken hinabführten, heute noch erkenntlich an den großen Vasen, die als Wasserbecken gedacht waren. (Abb. 16.) Aus vorhandenen Plänen geht hervor, daß auf der ersten Kaskadenmauer beiderseits je vier Springbrunnen angeordnet waren, während die Mitte eine größere Fontäne beherrscht. Auf dem nächst niederen Absatz werden die Wasserkünste kleiner, je zwei bescheidenere Strahlen treten an Stelle des großen, und plätschernd sollte sich wohl das flüssige Element in das große unterste Becken ergießen. Gegenüber aber rauschte von der waldigen Höhe aus einem engen, von Statuen umgebenen Becken das Wasser in zahlreichen schmäleren Fällen in Form einer Kaskade herab. Es sammelte sich im untersten großen Becken, welches zwei treffliche Statuen schmücken. Mit feinem künstlerischen Gefühl wußte der entwerfende Künstler die Wirkung durch die seitlich im Waldesdunkel liegenden Fontänenbecken zu heben, deren ehemals springende Wasser im stimmungsvollen Akkord zur Wassertreppe traten. (Abb. 17.) Durch diesen pyramidenförmigen Aufbau, diese allmähliche Steigerung ist ein Gesamtbild geschaffen worden, wie es reizender kaum gedacht werden kann. Nicht wenig tragen die acht trefflichen Doppelstatuen in ihrer fein bewegten Umrißlinie zur Wirkung des Gesamteindruckes bei. Weiter müssen wir uns zur Vollständigkeit des Bildes die seitlichen Treppen der Kaskade von einer lustwandelnden Hofgesellschaft belebt denken. Sie steigen die Stufen gemessenen graziösen Schrittes empor, um am Ende der Allee im gegenseitigen Austausch die herrliche Aussicht auf die von ferne[389] winkenden Zinnen von Pirna und die malerisch im Nebel verhüllten Berge der Sächsischen Schweiz genießen zu können. In trautem Zwiegespräch kehren sie zurück und verlieren sich in den weiten Räumen des Gartens.

Wir wenden uns mit ihnen zu den schattigen Ruheplätzen, welche zu beiden Seiten der Kaskade in einer Geraden angelegt sind. Ganz links erfreut unser Auge die kräftige Gestalt des farnesischen Herkules (Abb. 18), während bei der Kaskade Cybele, die Göttin der Erde, und Juno, die Himmelskönigin, wohl die beste Statue des Gartens, unseren Blick fesseln. Steinerne Ruhebänke laden ein zu näherer Betrachtung.
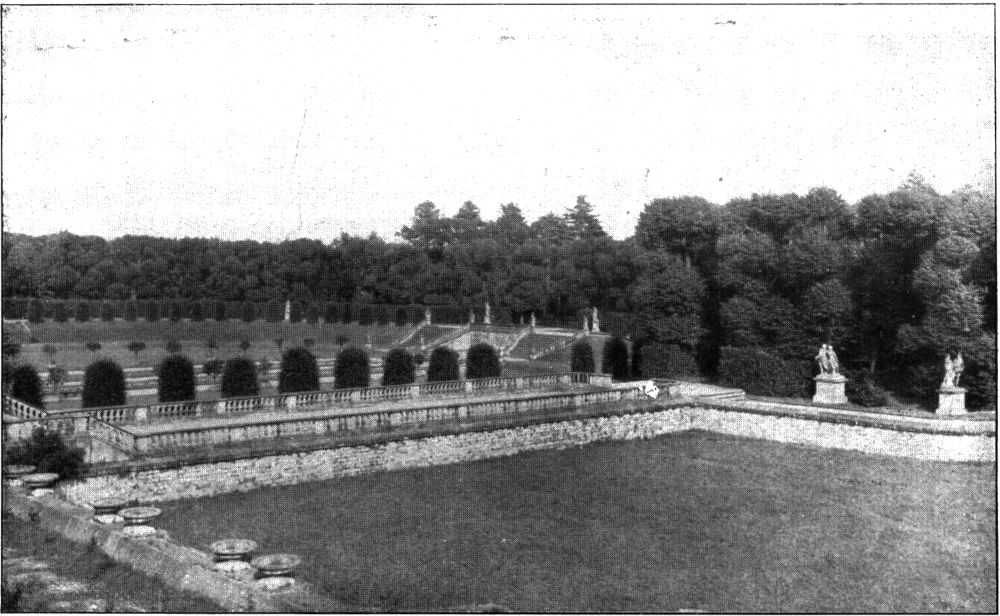
Nicht alle Statuen des Gartens besitzen höheren Kunstwert, aber durch ihre meisterhafte Aufstellung geben sie dem Garten reiches Leben. (Abb. 19 und 20.) In der Aufstellung der Plastiken hatte man von Frankreich gelernt. Überall setzt der Künstler seine Statuen gegen den dunklen Hintergrund der Hecken, überall sieht man sich in Gesellschaft der alten Götter, nur sind diese aus den hellen reinen Höhen des Olymps herabgestiegen in die Sphäre der Kulissen und haben vielfach Gestalt und Ausdruck bekannter Mitglieder des Hofes angenommen. Sie gaben so reichen Stoff zur Belehrung und Belustigung. Die später angebrachten Namentafeln aus Blech sollte man bei einer Instandsetzung, die in vielen Fällen dringend nötig ist, beseitigen.
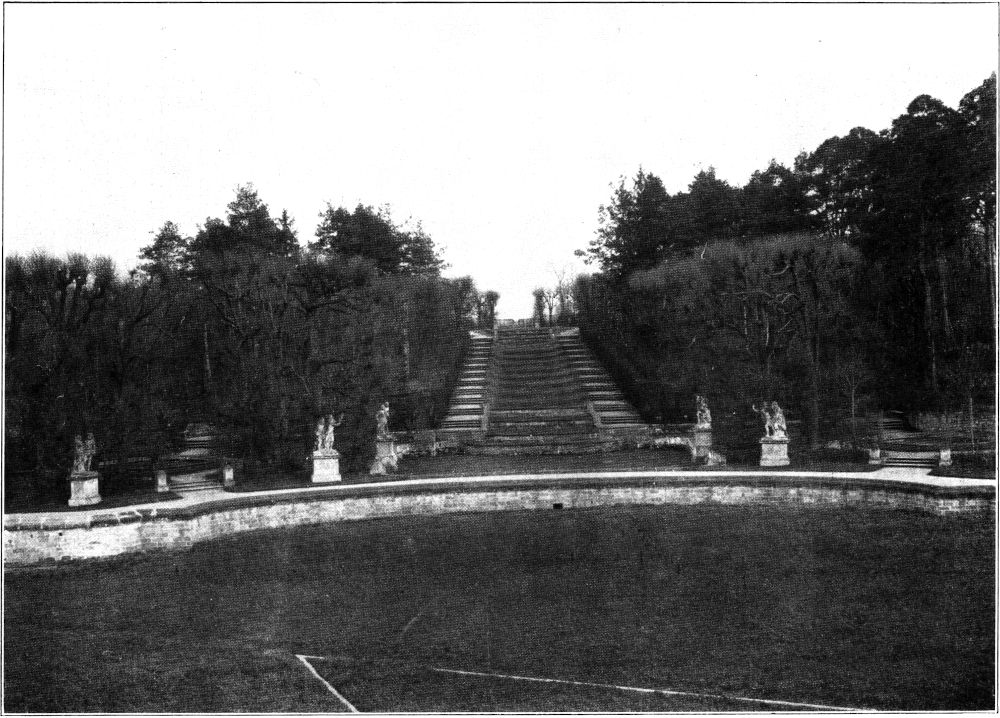
Wir aber lenken nun unsere Schritte weiter westlich nach der großen Allee, welche die Achse des ehemaligen Schlosses aufnimmt und in die Weite führt. Dieser Teil der Planung ist in den Anfängen stecken geblieben. Nach der unter August dem Starken vorgenommenen Umplanung sollte hier ein zweites[392] Orangerieparterre entstehen, was aber aus Mangel an Mitteln nicht zur Ausführung kam.

So ist Großsedlitz ein Torso geblieben. Ihm fehlt der bestimmende Schloßbau, der die reiche malerische Gartenanlage zur Einheit zusammenschließt. Was aber in seinen Einzelteilen geschaffen worden ist, gehört zu dem Schönsten und Reifsten, was die Gartenkunst je hervorgebracht hat. Hier ist die Verfolgung des Zieles gelungen, das der bekannte Gartentheoretiker Daviler dahin bezeichnet, daß die größte Kunst bei der Anlage von Gärten in der Benutzung der Vorteile und Fehler des Grundstücks bestehe bei geringster Veränderung der Bodenlage. Die auf jene verwendeten Kosten seien doppelt mißliche,[393] weil man den Erfolg nach Vollendung der Arbeit nicht sehe. So ist es in Großsedlitz gelungen, durch Benutzung vorhandener Bodengestaltung ein Gartenkunstwerk zu schaffen, dessen höchste Werte in den wundervollen Raumgestaltungen seiner Einzelteile liegen. Es ist auf dem Gebiete der Gartenkunst – etwa wie der Zwinger als Architekturschöpfung – ein einzigartiges Werk.

Ich sah Großsedlitz nach Jahren wieder, an einem sonnigen Herbsttage in einer wunderbaren Herbststimmung. Der Eindruck war stärker denn je. Etwas ging wohl auf Kosten der prächtigen Herbstfärbung, andererseits fehlte jedweder blühende Blumenflor und auch der Schmuck der bereits eingewinterten Orangenbäume. Ganz klar und einfach trat darum die Struktur dieses[394] einzigartigen Gartens zu Tage, allein das Raumkunstwerk von Großsedlitz sprach und wirkte – wirkte tiefer noch als je.
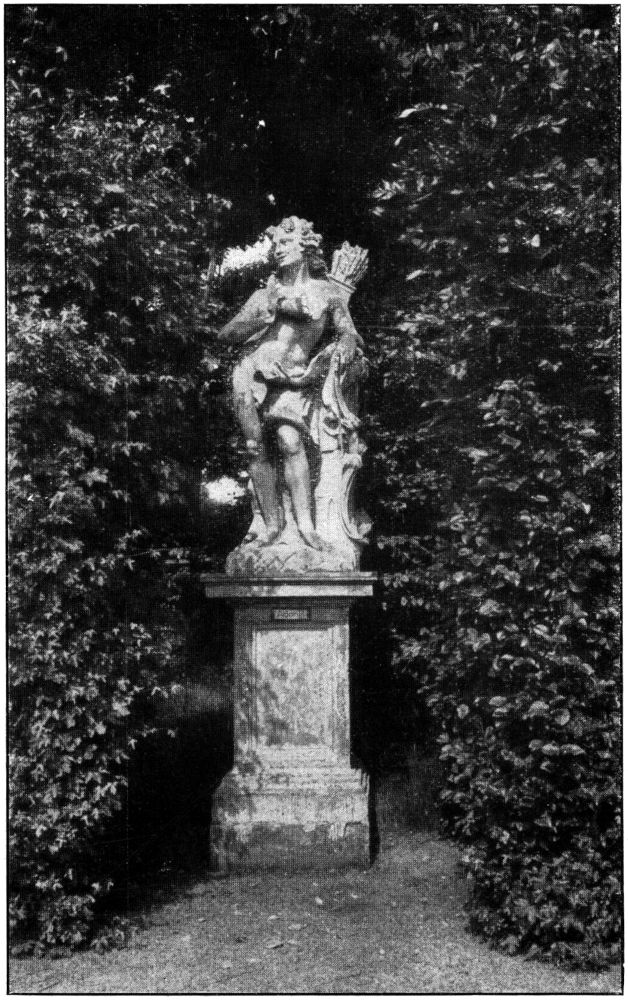
Das ist wirklich Großes, was sich so behaupten kann, ohne jedwede schmückende Zutat, was noch eine unvergängliche Wirkung ausübt – im Sterben –. Ja, vom Sterben dieser einzigartigen Schöpfung raunte es in den Wipfeln und in den Hecken und auf dem Rasen und in dem Gestein. Wie lange noch werd’ ich dem Schicksal trotzen, das mich verstoßen, vergessen –, vergessen im Weichbild einer Großstadt, in einer Zeit, wo man den Wert von Grünflächen für die Volksgesundheit erkannt hat, von einer Stadt, die noch heute vom Ruhm der Werke zehrt, deren Meister auch mich erschufen – mich als ein einzigartiges Werk in der ganzen Geschichte der Gartenkunst, unberührt vom Geist der Sentimentalität und Romantik, dem so manche Anlage der Barockzeit zum Opfer fiel, der auch mich wohl erfaßt hätte, wenn ich nicht von jeher als Stiefkind behandelt worden wäre, das weit draußen vor den Toren von Dresden der Vergessenheit anheim fiel. Aber noch sträube ich mich mit aller Kraft gegen das Sterben. Unsere Wurzeln sind gesund, versicherten die Hecken und die Waldstätten. Etwas mehr Pflege, und wir werden es euch danken durch frischeres Grünen und Blühen. – Verschließt meine Risse und Wunden, die mir das Alter schlug, und ich bleibe fest gefügt, flehte das Gestein, die Balustraden, die Mauern. – Die Götter des Olymp aber baten um ihr Leben, sie würden dann auch Jahrzehnte und Jahrhunderte weiter unermüdlich erzählen von dem Einst, dem Geist ihrer Schöpfer und dem lebensprühenden gesellschaftlichen Bild, das sich in diesem Garten entfaltete.
Selbst die Sphinxe auf der oberen Terrasse, die scheinbar teilnahmlos mit undurchdringlichem Ausdruck zugehört hatten, ließen sich nun anklagend vernehmen. Stolz sei das heutige Geschlecht auf seine Kultur. Stolz der Staat auf seinen Kunstbesitz, den er im wesentlichen dem abgedankten Königshaus verdanke. Nun habe er auch von Großsedlitz Besitz ergriffen für die Volksgemeinschaft, ohne aber das Mahnwort: »Besitz verpflichtet« zu beherzigen. Und wo gelte das mehr als beim Staate, der der Volksgemeinschaft verantwortlich sei für die ihm anvertrauten kulturellen Güter.
So und ähnlich klang’s und rauschte es in diesem wundervollen Gartenbauwerk an jenem sonnigen Herbsttag. Möchte das Klagen, Flehen und Mahnen auch an die Stellen dringen, denen die Verantwortung und Pflege für diesen einzigartigen Kunstbesitz obliegt. Denn selbst bei ganz nüchterner Betrachtung und Erwägung wird man dann erkennen, daß sofortige Hilfe not tut. Wohl wird in heutiger Zeit auch der begeisterte Kunstfreund nicht fordern, daß große Summen bewilligt werden, um Großsedlitz im einstigen Glanze erstrahlen zu lassen. Das mag einer besseren Zeit vorbehalten bleiben. Zum anderen wird es aber auch niemand verantworten können, hier ein Werk sterben zu lassen, das einzig in seiner Art und mit verhältnismäßig bescheidenen Mitteln zu pflegen und damit noch Jahrhunderte hindurch zu erhalten ist. Wo ein Wille, da ein Weg. Wenn es wirklich nicht durchführbar[395] sein sollte, aus laufenden Etatmitteln Beträge von der Regierung bzw. dem Landtag zu erhalten, so müßte doch zum mindesten der Staat als großindustrieller Unternehmer die moralische Pflicht in sich fühlen, hier helfend einzuspringen. Den sächsischen Werken, die zur Förderung ihrer wirtschaftlichen Betriebe geradezu vernichtend in das Bild der Heimat eingreifen, müßte es eine Ehrensache sein, auf der anderen Seite etwas für die Erhaltung wertvoller Denkmäler der Heimat zu tun. Wenn wir schätzen, daß schon ein Betrag von etwa fünf- bis zehntausend Mark auf einige Jahre ausreichen würde, um die Großsedlitzer Anlage wieder lebensfähig herzustellen, dann sollte man doch wirklich nicht zögern, das Opfer zu bringen, und aus den wirtschaftlichen Betrieben des Staates die Mittel zur Verfügung stellen. Ein einzigartiges Gartenbauwerk, das zweifellos zu den reifsten Schöpfungen der Gartenkunst aller Zeiten gehört, gilt es vor dem Verfall zu retten!
Von Gertraud Enderlein
Man denkt zunächst – weil das jetzt so in der Luft liegt – die Krippe sei die Hauptsache. Die Weihnachtskrippe, wie sie sich in einer kernhaft volkstümlichen Schnitzerei, aus alten Holzschnittvorbildern hervorgewachsen, mit einer nonnenhaften Maria, anbetenden Rittern, Mönchen und Bauern im Schaufenster der Gemeinnützigen Verkaufsstelle auf der Schießgasse aufbaut. Tritt man aber ein – und es ist ohne Kaufzwang erlaubt und erwünscht, alle diese lieblichen Erzeugnisse sächsischer Volks- und Kleinkunst zu beschauen – so erkennt man: hier leuchtet in Regalen und Glasvitrinen, auf der Ladentafel und den Verkaufstischen solch eine Fülle des Köstlichen, daß man das »Spieglein an der Wand« um das Schönste befragen möchte, weil man sich selber keinen Rat weiß. Man hatte nämlich im stillen gemeint, einmal müsse der ständig Neues spendende Born versiegen. Aber nun sieht man staunend: unerschöpflich sind die Quellen der Heimatkunst ...
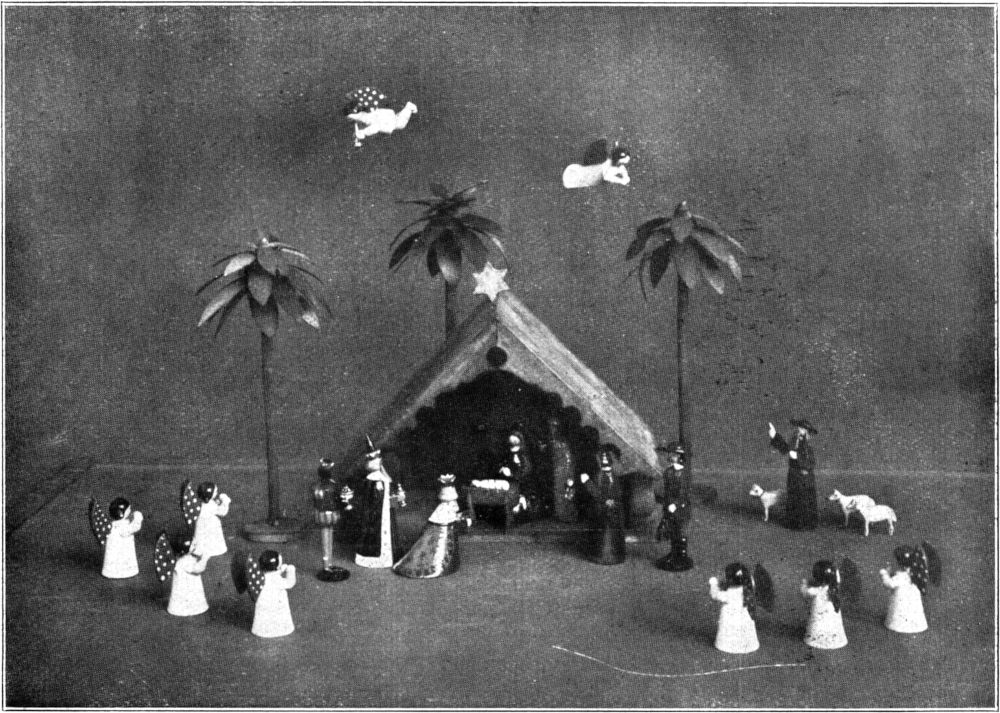
Natürlich bleibt man zunächst am Weihnachtlichen hängen. Die erzgebirgischen Lichterkränze! Aus der Deckenwölbung schweben sie herab, und auf dem weißen Rund des Holzrings ziehen schwarzröckige, silhouettenfeine Bergleute in ernster Reihe auf, oder das Heimatschutzengelchen, das mit seinem steif stehenden weißen Kleidlein und den runden Apfelbäckchen schon unsere Feldgrauen einst glücklich gemacht, müht sich im Kreis seiner Schwestern, die Lichtertüllen festzuhalten. Aber da ist ein ergreifendes, Neues und doch Urältestes hinzugekommen. Die »Bergspinnen«, die wundervollen, volksliedinnigen Weihnachtshängeleuchter, wie sie in unserem Volkskunstmuseum soviel Weihe und Heimeligkeit verstreuen, regen nun auch hier, vom Luftzug der etwa zufallenden Tür berührt, ihre vergoldeten hölzernen Glöckchenbehänge. Und nun kann man schon gar nicht anders, man muß erst einmal die erzgebirgische Spielzeugecke aufsuchen, weil das ja auch so etwas Ur-Weihnachtliches ist. Wie[396] zu einer Bescherung reiht sich’s auf, farbkräftig und bodenständig, jeglicher schematischen Gleichförmigkeit entkleidet, persönlich durchfühlt bis ins kleinste. Hier hat Direktor Seifert in Seiffen seines Amtes gewaltet, naives Bauernkönnen künstlerisch beeinflussend, hat die Gänseliesel und die Schweinefamilie so lebenstrotzend und formenschlicht dabei gestalten helfen, daß auch die Großen sich am liebsten solch eine erheiternde Spielschachtel für die dunklen Winterwochen mit heimnehmen möchten. Es ist auch eine Puppenstube vorhanden; die hält sich aber ein wenig abseits, weil sie in aller kleinbürgerlichen Einfachheit zu kostbar ist mit ihren bemalten Möbelchen, ihren festen Stuhl- und Sofabezügen, den handgedrehten Schüsselchen in der angrenzenden Küche, – dieses winzige Abbild biedermeierlichen Behagens. Und es gibt fröhliche Hampelmänner und eine ganz urwüchsige Art Menschlein aus Stoff und Holz, die der Dresdner Kunstgewerbler W. Seifert geschaffen und die höchst putzig, eine drollige Charakterpuppensippschaft, auf festen Holzschuhen durchs Leben steigen. Ein Motiv, das die Leipzigerin Mußmann noch mehr ins Karikistische hineingesteigert hat. Und seltsame hölzerne Märchenvögel, von allerkleinsten Händchen leicht durchs Zimmer zu führen, auch von Seiferts Gnaden, heben den Kopf mit den listigen Augen und dem mächtigen Schnabel aus dem gedrungenen Leib; man würde sich keinen Augenblick verwundern, wenn die[399] derbe Hülle sänke und ein schöner Königssohn den Flügeln dieses Fabelwesens entstiege.

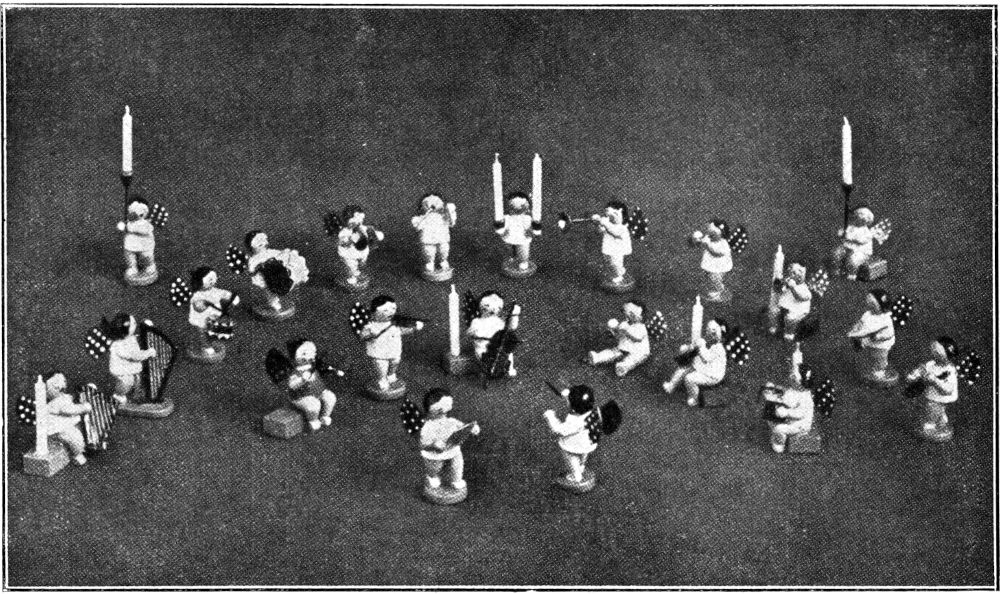
Nein, die großen Leute brauchen sich durchaus keinen Hühnerhof, keins dieser dauerhaften Eisenbahnzüglein mit Personenwagen und Kipploris mit heimzunehmen. Der gute Geist des Heimatschutzes bedenkt auch sie mit allerlei Nützlichem und Freundlichem aus den Handwerksstuben des Sachsenlandes. Da sind die Grünhainichener Spankörbe, mit gut verteilter Blumenornamentik bemalt, die Spanschachteln, auf denen wie auf den stämmigen Holztruhen ganze phantastische und doch mit allen Wurzelfasern im Heimatlichen wurzelnde Blumenwiesen erblühen. Gedrechselte Schalen und Dosen – wie hier die Wirkung des erlesenen Materials durch sorgfältigste Behandlung gesteigert ist! – bieten sich für Schreib- und Nähtisch als schmückende, zweckvolle Vervollständigung an, und die »Blaubeerenkinder«, die eigentlich ins Lager der Reiseandenken gehören und als solche jetzt ausgeführt werden dürfen, betteln geradezu um ein Plätzchen im Glasschrank daheim. Zum Holz aber gesellt sich der andere Stoff, darauf fast alles Kunstschaffen im Heimatschutz gegründet ist: die gebrannte Erde, der Ton. Die junge Hausfrau streichelt mit den Augen all die festen farbenmunteren Tassen und Kannen, die liebevoll entworfenen Lausitzer und Frohburger Ziergefäße mit den flammenden Herzen und den holden Röslein unter der blanken Glasur, schmückt schon in Gedanken den Tannenbaum mit dem zierlichen tönernen Behang, darin die Zeichen des Tierkreises so kindlich-einprägsam festgehalten sind, und stellt wohl auch schon solch einen vergnüglichen Kohrener Tonvogel, den der Künstler in irgendeiner charakteristischen Bewegung in die Form gebannt, für das Allerkleinste darunter.
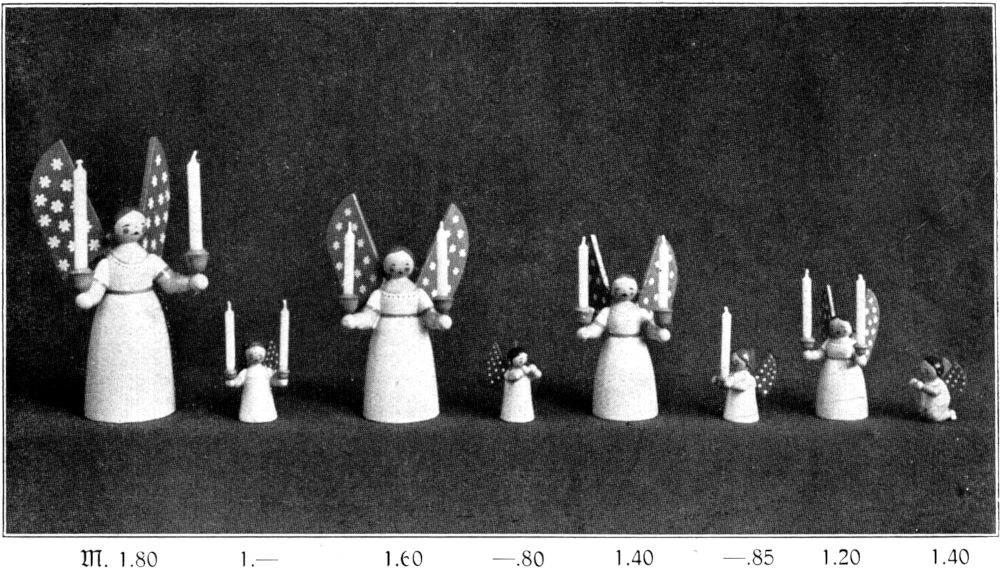
Es ist eine unendliche Weihnachtsfreude, zwischen den Schätzen der Gemeinnützigen Verkaufsstelle einherzustreifen und sich dies und jenes als eine liebe Gabe oder einen ehrlichen treuen Hauskameraden für durchaus nicht überhohen Preis mitzunehmen. Man wandelt wie auf einem schönen Stern und steht doch mitten im Irdischen. Und aus allen Ecken hört man Weihnachtslieder.

Cornelius Gurlitt, August der Starke. Zwei Bände. Im Sibyllen-Verlag, Dresden 1924.
Ein stattliches, gut ausgestattetes, mit reichem Bilderschmuck versehenes Werk von zwei Bänden mit insgesamt 872 Seiten Text liegt vor uns. Es ist also dem Verfasser für den großen Gegenstand, den er behandelt, auch der nötige Raum von der Verlagsanstalt bewilligt worden, um nicht nur das eigentliche Leben und Wesen seines Helden, sondern auch die wirtschaftlichen, staatlichen, geistigen und religiösen Zustände des ganzen Zeitalters ausführlich darzustellen. Und daß der Verfasser in alle diese Verhältnisse hineinleuchtet, zeigt schon die ins einzelne gehende Gliederung des Stoffes. Der erste Band enthält die fünf großen Abschnitte: 1. Der Prinz. 2. Fürstenrecht. 3. Der König. 4. Das Volk. 5. Der Staat; und dieser 5. Abschnitt z. B. gliedert sich wieder in die Kapitel: Regierung und Hof. Die Stände. Steuern. Geld. Geldgeschäft. Gewerbepolitik. Die öffentliche Meinung. Der zweite Band enthält die drei Abschnitte: 6. Die Kirche. 7. Industrie und Handel. 8. Die Kunst. In diesen Abschnitten und Kapiteln wird eine erstaunliche Fülle von Stoff vor uns ausgebreitet, so daß man dem Verfasser wegen seines Fleißes und seiner Belesenheit die Bewunderung[400] nicht versagen kann. Freilich ist man verhältnismäßig selten in der Lage, die Herkunft und Zuverlässigkeit des Stoffes zu prüfen, da die Quellenangaben meist fehlen. Gurlitt sagt darüber im Vorwort: »Es schien mir dabei nötig, alle fachwissenschaftliche Belastung von dem Buche fern zu halten, um es nicht allzusehr auszudehnen.« Aus diesem Grunde hat Gurlitt seine Quellen in dem »zeitgenössischen Schrifttum« gesucht, das ihm die Sächsische Landesbibliothek in ausgiebigstem Maße zur Verfügung stellte, nicht aber in einem ausgedehnten Studium des noch ungedruckten in den Archiven ruhenden Stoffes. Trotzdem ist nicht zu verkennen, daß unser Wissen über August den Starken durch Gurlitts Buch erweitert worden ist, da er aus der Geschichte der Technik und der Künste – Gebiete, mit denen Gurlitt ganz besonders vertraut ist –, vieles zur Beurteilung Augusts des Starken heranzieht, was man in den bisher über diesen Fürsten geschriebenen Büchern nicht liest. Mit Recht weist er immer wieder (z. B. II, 158) darauf hin, daß »der Zug, durch Wissenschaft die Erfolge des Gewerbes zu heben« zwar schon vor August dem Starken in der sächsischen Kultur bemerkbar ist, aber gerade durch August den Starken und seine Verbindung mit Männern wie Leibniz und Tschirnhausen sehr stark entwickelt worden ist.
Bei der Fülle des Gebotenen hat sich da und dort auch ein Fehler eingeschlichen. So ist z. B. Hans Ernst von Knoch (I, 20 f.), der Erzieher Augusts, nicht erst gegen das Ende seiner Laufbahn geadelt worden, sondern entstammte einer altadeligen Familie aus dem Anhaltischen, auch war die Habsburgerin Maria Josefa, die Schwiegertochter Augusts, nicht »die erste Frau« aus kaiserlichem Hause in der Stammrolle der Wettiner (I, 12g) und die Academia Leopoldina naturae curiosorum (II, 147) hat nichts mit »Merkwürdigkeiten« zu tun. Man kann auch nicht allen von Gurlitt ausgesprochenen Urteilen beipflichten. Ob dem Prinzen August zu der Zeit, als er sich zur »großen Tour« anschickte, das Prädikat »im Auftreten schüchtern« zukam, kann man bezweifeln. Schilderte sich doch August selbst (I, 18) »als einen frischen Jungen, der nichts achtete« und stellte doch auch Liselotte v. d. Pfalz fest (I, 27), er habe »mehr Vivazität als sein Bruder.« Ganz verfehlt ist es, wenn Gurlitt (I, 126) Augusts Übertritt zum Katholizismus mit der Haltung des Herzogs Moritz im Schmalkaldischen Kriege auf eine Stufe stellt. Moritz hat nie daran gedacht überzutreten, er war in einer schweren Notlage eine kurze Zeit Bundesgenosse Karls V., wurde aber bald darauf der Retter des Protestantismus und eines unabhängigen Deutschlands. Auch die großen politischen Probleme, die August den Starken beschäftigten, sind nicht klar genug formuliert und leiden an einer gewissen Unsicherheit des Urteils, die sich da und dort in einem die Wirkung beeinträchtigenden Hinundher der Darstellung bekundet. Am höchsten nach Inhalt und Form sind die Kapitel zu bewerten, die über die wirtschaftlichen, gewerblichen und künstlerischen Verhältnisse des Zeitalters Augusts des Starken berichten. Hier kommt die einzigartige Erfahrung, die Gurlitt durch mehr als ein Menschenalter an Denkmalspflege und an Studium der Bau- und Kunstgeschichte Sachsens hinter sich hat, glänzend zur Erscheinung. Alles in allem ist Gurlitts Werk eine sehr beachtliche Leistung. Es ist nicht die Geschichte Augusts des Starken, auf die wir schon längst warten, die aber ohne gründliche und umfassende Archivstudien nicht geschrieben werden kann, wohl aber ist es ein unser Gesamtwissen über August den Starken vermehrendes und auf eine breitere Basis stellendes Werk und zugleich ist es ein Denkmal der Universalität des Strebens, zu dem sich sein Verfasser in einem überaus tätigen und erfolgreichen Leben durchgearbeitet hat.
Otto Eduard Schmidt
Für die Schriftleitung des Textes verantwortlich: Werner Schmidt – Druck: Lehmannsche Buchdruckerei
Klischees von Römmler & Jonas, sämtlich in Dresden – Photographische Platten »Sigurd« und »Satrap«, photographische,
sowie kinematographische Aufnahme- und Wiedergabeapparate »Ernemann«
Sächsischer Bauern-Kalender 1926. Herausgegeben von der Landwirtschaftskammer für Sachsen. Bearbeitet von Dr. Horst Höfer, Meißen, Bildschmuck von A. Weßner-Collenberg. Preis 3 M. Zu haben im Heimatschutz, Dresden-A., Schießgasse 24.
Zum fünften Male nimmt der stattliche Bauern-Kalender seinen Weg hinaus in das sächsische Land. Was er bei seinem erstmaligen Erscheinen versprach, hat er treulich gehalten; er ist ein Kulturwerk geworden, auf das wir Sachsen stolz sein können. Der künstlerisch vollendet ausgestattete Kalender ist als Pionier des guten Geschmacks in das Bauernhaus gezogen, wo er vielfach der bevorzugte Lesestoff des Jahres ist, und hat dort die ärmlichen, ja oft erbärmlichen Kalendermachwerke früherer Zeit verdrängt und den Sinn für das Gute und Schöne geweckt. Aber nicht nur das! Der Bauern-Kalender ist auch ein treuer Pfleger des Schollenbewußtseins und der Heimatliebe. In jedem der vielen prächtigen Bilder von der Meisterhand A. Weßner-Collenbergs spiegelt sichs wieder: Wie schön ist doch unser liebes Sachsenland! Und aus jedem der zahlreichen, belehrenden und unterhaltenden Aufsätze klingts hervor: Wie reich ist unser Bauernland und wie kraftvoll und stark ist noch unser Bauernstand, der Urquell unserer Volkskraft. Nicht nur der Landmann wird seine Freude an dem prächtigen Kalenderbuche haben, jeder Freund des ländlichen Sachsens – und wer wäre das nicht! – wird sich mit hohem Genuß hinein vertiefen. Daß die Auswahl des Stoffes und die ganze Zusammenstellung und Ausstattung des Kalenders nichts zu wünschen übrig lassen, war nach dem, was die früheren Jahrgänge geboten haben, nicht anders zu erwarten.
Klengel.
Weicher, Dr. G. und Wiese, A. Die Augen auf! Heimatbücher für die weitere Umgebung von Dresden. Band I: Gesteine und Landschaft. Leipzig, F. Hirt & Sohn. 1926. M. 4.50. Zu beziehen vom Heimatschutz, Dresden-A., Schießgasse 24.
Ein feiner geographischer Beobachter und ein tüchtiger Photograph (Studienräte an einer Dresdner Oberrealschule) haben sich zusammengefunden, um die Heimatlandschaft wissenschaftlich zu analysieren und dem denkenden Wanderer durch Bild und kurze Beschreibung die Augen zu öffnen – zunächst für die Zusammenhänge zwischen Erdgeschichte und Landschaftsform. »Erdgeschichtliche Urkunden« haben wir einmal in den Heimatschutzvorträgen das genannt, was hier geboten wird. Die Auswahl der Bilder, ihre photographische Qualität und die technische Wiedergabe sind gleich lobenswert. Der Text ist sehr geschickt dem Raum angepaßt, kurz und klar. Die ganze Aufmachung des Quartbandes ist im besten Sinne »friedensmäßig« – eine schöne Gabe für den Weihnachtstisch!
Dr. P. Wagner.
Ein deutsches Weihnachtsspiel:
»Im Stall zu Bethlehem«
In vier Aufzügen mit Text, Buntfiguren und Anleitung zum Bühnenbau bearbeitet von M. Brethfeld und Th. Göhl
Verlag: Landesverein Sächsischer Heimatschutz,
Dresden-A., Schießgasse 24
Preis M. 2.—
Bestellkarte in diesem Heft
Infolge Arbeitsüberhäufung durch die mit sehr schönem Erfolg abgeschlossene Geldlotterie unseres Vereins, bei der unsere Mitglieder in dankenswerter Weise mithalfen, ist es uns nicht möglich, in diesem Jahre noch weitere Nummern unserer Mitteilungen erscheinen zu lassen. Wir holen aber das fehlende Heft im nächsten Jahre bestimmt nach.
Besucht das Landesmuseum für Sächsische Volkskunst im Weihnachtsschmuck!
Dresden-N., Asterstraße 1 (beim Zirkus)
Gesänge, weihnachtliche Darbietungen von Kindern, Schülern und Schülerinnen, Kurrendensängern, Vereinen und Einzel-Sänger und -Sängerinnen
Vom 17. Dezember 1925 bis mit 3. Januar 1926,
wochentags 9–2 Uhr, Sonntags 11–1 Uhr,
alle Nachmittage 5–7 Uhr
Außerdem noch drei Abendfeiern: Sonntag, den 20. Dezember und 27. Dezember und Mittwoch, den 30. Dezember 8–10 Uhr
Donnerstag, den 24. Dezember und Donnerstag,
den 31. Dezember nachmittags geschlossen
Die Eröffnung
findet Donnerstag, den 17. Dezember, 5 Uhr,
mit einigen Christspielszenen statt
Lehmannsche Buchdruckerei, Dresden-N.
Weitere Anmerkungen zur Transkription
Offensichtliche Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Die Darstellung der Ellipsen wurde vereinheitlicht.
Die Bandnumerierung auf S. 321 weicht vom Titel ab, da ursprünglich ein weiterer Band geplant war (s. letzte Seiten).